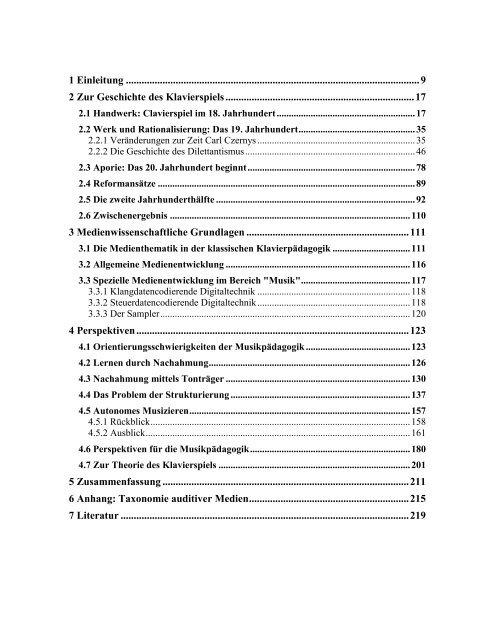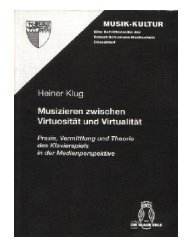1. Einleitung - Heiner Klug
1. Einleitung - Heiner Klug
1. Einleitung - Heiner Klug
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1 <strong>Einleitung</strong> ................................................................................................................ 9<br />
2 Zur Geschichte des Klavierspiels ........................................................................ 17<br />
2.1 Handwerk: Clavierspiel im 18. Jahrhundert ......................................................... 17<br />
2.2 Werk und Rationalisierung: Das 19. Jahrhundert ................................................ 35<br />
2.2.1 Veränderungen zur Zeit Carl Czernys ................................................................. 35<br />
2.2.2 Die Geschichte des Dilettantismus ...................................................................... 46<br />
2.3 Aporie: Das 20. Jahrhundert beginnt ..................................................................... 78<br />
2.4 Reformansätze .......................................................................................................... 89<br />
2.5 Die zweite Jahrhunderthälfte .................................................................................. 92<br />
2.6 Zwischenergebnis ................................................................................................... 110<br />
3 Medienwissenschaftliche Grundlagen .............................................................. 111<br />
3.1 Die Medienthematik in der klassischen Klavierpädagogik ................................ 111<br />
3.2 Allgemeine Medienentwicklung ............................................................................ 116<br />
3.3 Spezielle Medienentwicklung im Bereich "Musik" ............................................. 117<br />
3.3.1 Klangdatencodierende Digitaltechnik ............................................................... 118<br />
3.3.2 Steuerdatencodierende Digitaltechnik ............................................................... 118<br />
3.3.3 Der Sampler ....................................................................................................... 120<br />
4 Perspektiven ........................................................................................................ 123<br />
4.1 Orientierungsschwierigkeiten der Musikpädagogik ........................................... 123<br />
4.2 Lernen durch Nachahmung ................................................................................... 126<br />
4.3 Nachahmung mittels Tonträger ............................................................................ 130<br />
4.4 Das Problem der Strukturierung .......................................................................... 137<br />
4.5 Autonomes Musizieren ........................................................................................... 157<br />
4.5.1 Rückblick ........................................................................................................... 158<br />
4.5.2 Ausblick ............................................................................................................. 161<br />
4.6 Perspektiven für die Musikpädagogik .................................................................. 180<br />
4.7 Zur Theorie des Klavierspiels ............................................................................... 201<br />
5 Zusammenfassung .............................................................................................. 211<br />
6 Anhang: Taxonomie auditiver Medien ............................................................. 215<br />
7 Literatur .............................................................................................................. 219
1 <strong>Einleitung</strong><br />
Die beiden Begriffe Klavier und Medien rufen in der Regel recht unterschiedliche<br />
Assoziationen hervor. Auf der einen Seite lässt der Begriff Klavier an klassische<br />
Musikkultur denken, die heute leider nur von einer Minderheit gepflegt wird. Auf<br />
der anderen Seite drängt sich beim Begriff Medien die moderne Mediengesellschaft<br />
ins Bewusstsein. Diese ist assoziiert mit einer Beschleunigung der Lebenswelt, einer<br />
oft beklagten Neigung zur Oberflächlichkeit und Kommerzialisierung und nicht zuletzt<br />
dem drohenden Verlust von künstlerischem Erleben in Form einer sich auf allen<br />
Kanälen ausbreitenden Pop-Kultur.<br />
In Diskussionen um die Bedeutung von Musikerziehung wird dieser Gegensatz häufig<br />
zum Thema. Musikerziehung versteht sich als bedeutsamer, aber auch gefährdeter<br />
Gegenpol zur modernen Medienkultur. Als Indiz für eine solche Gefährdung dieses<br />
musikalischen Gegenpols könnte etwa die Tatsache gewertet werden, dass heute<br />
kein Schulfach außer Religion bei deutschen Mittel- und Oberstufenschülern unbeliebter<br />
ist. Aktuelle Rückzugstendenzen des Faches Musik aus der Schule mögen<br />
also aus Sicht der Schüler als glückliche Fügung erscheinen (Abbildung 1, S. 10).<br />
Aber auch die Musikschul- und Instrumentalpädagogik, um die es uns gehen soll<br />
(und die im Folgenden auch als Musikpädagogik bzw. Musikerziehung bezeichnet<br />
wird), befindet sich in einer schwierigen Situation. Ein besonderer Interessenkonflikt<br />
zwischen Musikerziehung und Medieneinflüssen wird häufig artikuliert. Die<br />
Düsseldorfer Oberbürgermeisterin MARLIES SMEETS formuliert in ihrem Grußwort<br />
zur Festschrift einer Musikschule den Interessenkonflikt zwischen Medieneinfluss<br />
und musikalischer Aktivität, gemeint ist das instrumentale Spiel, folgendermaßen:<br />
"Gerade in der heutigen Zeit, in der die Medien zum passiven Musikkonsum<br />
verleiten, sind eigene musikalische Aktivitäten von besonderer Bedeutung."<br />
(SMEETS 1996, 5)<br />
Auch REINHART VON GUTZEIT als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Musikschulen<br />
sieht in seinem Beitrag zur selben Festschrift in der zunehmenden Verbreitung<br />
elektronischer Medien ein Faktum, das musikpädagogische Arbeit erschwert:<br />
"Unsere Arbeit – das ist eine Binsenweisheit – wird nicht gerade einfacher,<br />
denn die Hindernisse, die es zu bewältigen gibt, sind enorm:<br />
Die Alltagswelt der elektronischen Medien, die Tendenz zum Schnuppern und<br />
zum raschen fast-food-Erfolg, die Leere in den kommunalen Kassen." (V.<br />
GUTZEIT 1996a, 15)<br />
9
Abb. 1: Frankfurter Rundschau, 2<strong>1.</strong> Juli 1999.<br />
10
Dass die Musikerziehung um ihren Standort ringt, ja dass die musikalische Bildung<br />
sogar "im Ganzen" gefährdet sei, geht auch aus dem Memorandum zur Ausbildung<br />
für musikpädagogische Berufe des Deutschen Musikrats vom 12. Februar 2000 hervor.<br />
Dort wird vor dem Totalverlust musikalischer Bildung gewarnt, wobei unter<br />
den gefährdenden Faktoren ebenfalls die Medien genannt werden:<br />
"Der Deutsche Musikrat stellt mit Sorge fest, dass sich die gesellschaftliche<br />
Musikpraxis sowie das musikalische Lernen auf allen Ebenen einerseits und<br />
die Ausbildung für die musikpädagogischen Berufe andererseits in hohem<br />
Maße auseinander entwickelt haben. Eine Neubestimmung dieses Verhältnisses<br />
und Konsequenzen für die Ausbildungsinstitutionen sind unabweisbar, soll<br />
nicht die musikalische Bildung im Ganzen gefährdet sein. Die heutigen Ausbildungskonzepte<br />
verlängern immer noch einseitig Grundvorstellungen des 19.<br />
Jahrhunderts und reichen angesichts des gesellschaftlichen und kulturellen<br />
Wandels nicht mehr hin. Die Sorge ist vor allem bedingt durch:<br />
� den im Zuge der Globalisierung ökonomischer und kultureller Prozesse beschleunigten<br />
Wandlung der individuellen und sozialen Realität von Kindern<br />
und Jugendlichen<br />
� die gravierend veränderte ökonomische und soziale Situation der Studierenden<br />
und ihre beruflichen Aussichten<br />
� die mediengeprägte Kulturlandschaft, die wesentliche Veränderungen des<br />
musikalisch-ästhetischen Handelns der Menschen zur Folge hat<br />
� den Widerspruch zwischen dem hohen Bedarf an musikalischem Lernen<br />
auf der einen und der ökonomischen Einengung musikalischen Lernens auf<br />
der anderen Seite<br />
� den beschleunigten Wandel schulischer und außerschulischer Bildungsinstitutionen<br />
und der von ihnen vertretenen Ziele und Inhalte.<br />
Aus dem Gesagten folgt, dass die Ausbildungskonzepte für musikpädagogische<br />
Berufe dringend der Revision bedürfen. [...]" (DEUTSCHER MUSIKRAT<br />
2001)<br />
Aber inwiefern divergieren Musikkultur und Mediengesellschaft und wie begründet<br />
sich dieser Konflikt? In der Tat beruht zwar die Musikpädagogik, wie vom Deutschen<br />
Musikrat artikuliert, auf Grundvorstellungen des des 19. Jahrhunderts. Aber<br />
hat sie sich nicht weiterentwickelt und neue, aktuelle und überzeugende Konzepte<br />
entworfen? Kann sie mit äußeren Veränderungen nicht Schritt halten? Welchen Stellenwert<br />
kann das Musizieren in der Mediengesellschaft haben? In welche Richtung<br />
muss die Revision der musikpädagogischen Berufe sich bewegen? Am Beispiel des<br />
Klavierspiels soll diesen Fragenkomplex nachgegangen werden. Eine zentrale Frage<br />
11
wird dabei sein, welchen Einfluss Medien auf den Umgang mit Musik und das Musizieren<br />
haben. Es wird sich zeigen, dass dieser Einfluss fundamental ist.<br />
Dieser Versuch, die aktuelle musikkulturelle Situation vor dem Hintergrund der<br />
Medienentwicklung zu beurteilen, erfordert zunächst einen Blick zurück. Im historischen<br />
Teil (Kapitel 2) wird die Entwicklung des Klavierspiels und die seiner Vermittlung<br />
in den letzten etwa drei Jahrhunderten beleuchtet. Besonderes Augenmerk<br />
wird dabei auf die Rolle zunächst vorwiegend schriftlicher Medien gerichtet. Kapitel<br />
3 ist den medienwissenschaftlichen Grundlagen, insbesondere den technologischen<br />
Voraussetzungen der aktuellen Entwicklung neuer Medien- und Musiktechnologie<br />
gewidmet. Kapitel 4 soll die bis dahin geklärten Zusammenhänge zusammenführen<br />
und eine Einschätzung der aktuellen Situation versuchen, die auch einen Ausblick in<br />
die Zukunft erlaubt.<br />
12
Vorbemerkung zum Sprachgebrauch<br />
Im Zuge kultureller Veränderungen wandelt sich auch der Sprachgebrauch. Einige<br />
Begriffe werden deshalb gelegentlich in Bedeutungen bemüht werden, die vom heutigen<br />
Usus abweichen. Da diese Veränderungen aufschlussreiche Zeugnisse historischer<br />
Prozesse sind und zu einer differenzierteren Beurteilung beitragen können,<br />
sollen sie nicht verwischt werden. Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen,<br />
seien bereits hier die wichtigsten dieser Begriffe unter Anführung jener Passagen im<br />
Text genannt, an denen ihre Bedeutungsänderungen klärend behandelt werden. Bei<br />
Unklarheiten wären die entsprechenden Passagen zu konsultieren. Diese Bedeutungsänderungen<br />
sind direkt an jene kulturellen Veränderungen geknüpft, die unser<br />
Thema bestimmen, verweisen also in die Sache selbst.<br />
<strong>1.</strong> Der Begriff Klavier geht aus clavis (lat. Schlüssel) hervor und bezeichnet ursprünglich<br />
jedes Musikinstrument, bei dem die Tonerzeugung durch einen "Schlüsselimpuls"<br />
ausgelöst werden kann. Ursprünglich mit "C" geschrieben, subsumiert<br />
der Begriff Clavierspiel jegliches Musizieren mit Instrumenten, die auf "Knopfdruck"<br />
Klänge erzeugen, sei es etwa Orgel oder Cembalo (vgl. S. 24). Anzahl und<br />
Anordnung der klangerzeugenden Tasten wiesen in verschiedenen Stadien der Musikgeschichte<br />
unterschiedliche Ausprägungen auf. Erst mit dem Siegeszug des Pianoforte<br />
vor etwa zweihundert Jahren entstand der Begriff des Klavierspiels in seinem<br />
engeren Sinn, nun in der Regel mit "K" geschrieben. Es wird bei der Untersuchung<br />
aktueller Medienphänomene nützlich sein, die Herkunft dieses Begriffes und<br />
seine ursprüngliche Bedeutung nicht aus den Augen zu verlieren.<br />
2. Die Bezeichnung Klavierschule für ein gedrucktes didaktisches Werk führt gelegentlich<br />
zu Irritationen. Die Verwendung der Bezeichnung Schule, die heute zunächst<br />
mit einer Institution in Verbindung gebracht wird, für ein Printmedium geht<br />
auf DANIEL GOTTLOB TÜRK zurück. Er veröffentlichte seine Schule im Sinne einer<br />
Lehre – in dieser Bedeutung ist der Begriff auch heute noch gelegentlich, beispielsweise<br />
in der Bezeichnung "Leipziger Schule" vs. "Berliner Schule" geläufig – im<br />
Jahre 1789 unter dem Titel "Klavierschule".<br />
Wie in Abschnitt 2.1 (S. 23f.) näher ausgeführt wird, wechselte dieser Begriff darüber<br />
hinaus im Verlauf des 19. Jahrhunderts insofern noch einmal grundlegend seine<br />
Bedeutung, als der Charakter des Printmediums sich von einer in Worte gefassten<br />
Anleitung (wie noch bei TÜRK oder CARL PHILIPP EMANUEL BACH) in eine Sammlung<br />
didaktisch aufbereiteter und in progressiver Schwierigkeit angeordneter Spiel-<br />
13
stücke verwandelte. Erst dadurch wurde die Klavierschule zum Unterrichtsmedium<br />
in jener Bedeutung, die sie noch heute besitzt.<br />
3. Der Begriff des Dilettantismus oder Dilettanten ist heute generell wertnegativ besetzt.<br />
Dass dies ursprünglich anders war und warum sich die Bedeutung von einer<br />
wohlwollenden Bezeichnung für einen Amateur, dessen Leistung durchaus nicht der<br />
eines Profis, d. h. Virtuosen nachstehen musste, ins Negative verwandelt hat, wird<br />
insbesondere in Abschnitt 2.2.2 erörtert. Taucht der Begriff Dilettant bzw. Dilettantismus<br />
auf, ist dieser Zusammenhang zu berücksichtigen.<br />
4. Auch der Begriff der Virtuosität ruft heute in gewissen Kreisen zwiespältige Assoziationen<br />
hervor. Die ursprüngliche, positiv bewertete Bedeutung für professionelle<br />
Könnerschaft auf der Grundlage umfassender musikalischer Fähigkeiten gerät<br />
dort zur Bezeichnung für manuell geschicktes und schnelles, aber oberflächliches<br />
Instrumentalspiel. So wird Virtuosität beispielsweise von OTTO FRIEDRICH<br />
BOLLNOW (1991, 51) mit den Attributen "leer" und "seelenlos" versehen. In dieser<br />
Arbeit soll der Begriff Virtuosität aus Gründen der Eindeutigkeit aber durchweg im<br />
ursprünglichen Sinn (vgl. SCHLEUNING 1984, 64f.) als positiv und vorbildhaft für<br />
musikalische Betätigung, die weit über oberflächliche Fingertechnik hinausweist,<br />
begriffen werden. Die Beschäftigung mit der Frage, warum die Bedeutung von Virtuosität<br />
und Dilettantismus im Lauf der vergangenen gut einhundert Jahre solchen<br />
Wandel erlitten hat, vermittelt aufschlussreichen Einblick in musikkulturelle Veränderungen<br />
in diesem Zeitraum und führt direkt in den Kern der Thematik. Näher eingegangen<br />
wird auf diese Zusammenhänge auf S. 154f.<br />
5. Eine ähnliche Dichotomie der inneren versus äußeren Perspektive wie beim Begriff<br />
der Virtuosität taucht im Zusammenhang mit dem Begriff musikalischer Aktivität<br />
auf, wie er bereits in der Äußerung der Düsseldorfer Oberbürgermeisterin<br />
MARLIES SMEETS in dem Gegensatz aktives Musizieren – passiver Konsum gefallen<br />
ist. Bei der Bewertung des Begriffspaares aktiv – passiv ist insofern Vorsicht angebracht,<br />
als musikalische Aktivität nicht automatisch gleichbedeutend sein muss mit<br />
sichtbarer körperlicher Bewegung. Dass musikalische Aktivität durchaus auch komplementär<br />
zu körperlicher Bewegung betrachtet werden kann, wird auf S. 154 deutlich.<br />
6. In Abschnitt 4.6 auf S. 201ff. wird ausführlich der Begriff digital in seiner umfassenden<br />
Bedeutung diskutiert, die dem konventionell technischen, von der Elektro-<br />
14
nikindustrie häufig als Verkaufsargument genutzten Verständnis scheinbar zuwiderläuft<br />
und zu Missverständnissen führen könnte.<br />
7. Der Begriff der Normalisierung bestimmter Kulturtechniken im Zuge der Medienentwicklung<br />
mag möglicherweise diffus erscheinen. Da sich dieser Begriff aber<br />
gut eignet, um den Vorgang zu beschreiben, dass Musikpräsenz vom Besonderen,<br />
weil Seltenen, durch Verbreitung zur Normalität wird, soll auf ihn nicht verzichtet<br />
werden. In ähnlichem Sinne, wie es die historische Durchsetzung der Printmedien<br />
möglich gemacht hat, dass Alphabetismus heute in unserer Kultur als normal gilt,<br />
kann der Begriff der Normalisierung hilfreich sein beim Versuch, die Auswirkungen<br />
elektroakustischer Medien auf den Umgang mit Musik zu beleuchten. Auch<br />
RAINALD MERKERT (1992, 11) bedient sich dieses Begriffs, um die dritte Phase der<br />
Rezeption jeweils neuer Medien durch die "Gebildeten" einer Zeit zu beschreiben.<br />
Die ersten beiden Stadien beschreibt er als Irritation bzw. Vereinnahmung. Bezüglich<br />
der Rezeption interaktiver Medien scheinen wir uns in dieser Terminologie gegenwärtig<br />
am Ende des ersten Stadiums, also des Stadiums der Irritation und am<br />
Beginn der Vereinnahmung zu befinden.<br />
8. Schließlich sei noch erwähnt, dass mit Medien nicht etwa nur elektronische Massenmedien<br />
gemeint sind, wiewohl die gegenwärtige Zuspitzung der Mediendiskussion<br />
eine solche Fokussierung nahelegen würde. Eine derartige Einschränkung des<br />
Begriffs Medium würde in die Irre führen, weil sie wichtige Arten von Informationsträgern<br />
– insbesondere Printmedien und interaktive Medien – ausgrenzt. Eine solche<br />
Einengung würde auch eine Untersuchung medienrelevanter Fragen unter Berücksichtigung<br />
vergangener Epochen unmöglich machen. Wie sich des weiteren vor allem<br />
in Kapitel 3 herausstellen wird, nähern sich auch die Begriffe Musiktechnologie<br />
und Medientechnologie im Zuge der zu beschreibenden Entwicklung an, so dass<br />
künftig auch hier nicht mehr scharf getrennt werden kann. Computer werden beispielsweise<br />
bereits heute genutzt zur Klangerzeugung (als Musikinstrument), zur<br />
Musikproduktion (als virtuelles Tonstudio), aber auch zur Verbreitung und Veröffentlichung.<br />
15
2 Zur Geschichte des Klavierspiels<br />
Zum Verständnis der zu behandelnden Phänomene gegenwärtiger Musikkultur ist<br />
zunächst ein Blick auf ihre Vorgeschichte erforderlich. Im ersten Teil wird deshalb<br />
ein Abriss zur Geschichte des Klavierspiels und -unterrichts gegeben. Dabei sollen<br />
entscheidende Veränderungen herausgearbeitet werden, denen Theorie und Praxis<br />
der Musikausübung und -vermittlung innerhalb der letzten etwa drei Jahrhunderte<br />
unterworfen waren. Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei dem Einfluss von Medientechnologie<br />
auf diese Veränderungen gewidmet. Dies betrifft für die Vergangenheit<br />
vorwiegend schriftliche Medien. Der Schritt zur Betrachtung neuerer, insbesondere<br />
audiovisueller Medien soll im zweiten Teil getan werden.<br />
2.1 Handwerk: Clavierspiel im 18. Jahrhundert<br />
Die Bedingungen der Musikausübung im 18. Jahrhundert sind geprägt von professioneller<br />
Handwerklichkeit und der Personalunion von schaffendem und ausübendem<br />
Künstler. Eine nur gering ausgeprägte Arbeitsteilung erforderte eine vielseitige<br />
musikalische Ausbildung. Diese erfolgte, ähnlich wie in anderen Handwerksberufen,<br />
in der Regel innerhalb von Familientraditionen in einer Ausbildungssituation, die<br />
weitgehend dem Verhältnis zwischen Meister und Lehrling entsprach.<br />
Dabei bestand sehr enger persönlicher Kontakt zwischen Meister und Auszubildendem<br />
auf der Grundlage täglicher Anwesenheit des Eleven in der "Werkstatt". Auch<br />
war es nicht unüblich, dass ein Schüler, selbst wenn er nicht der eigenen Familie<br />
entstammte, im Haus des Meisters wohnte (vgl. GELLRICH 1992, 9). Aus einem<br />
Brief vom 30. April 1712 des BACH-Schülers PHILIPP DAVID KRÄUTER an das<br />
Scholarchat Augsburg geht hervor, wie intensiv der Lehrer-Schüler-Kontakt und wie<br />
vielseitig die Ausbildung bei JOHANN SEBASTIAN BACH war. Herausragende Bedeutung<br />
genoss dabei die Unterweisung in Kompositionslehre und Klavierspiel; aber<br />
auch andere Instrumente wurden in den Unterricht einbezogen:<br />
"[...] er ist ein vortrefflicher, dabey auch sehr getreuer Mann sowohl in der<br />
Composition und Clavier, als auch in anderen Instrumenten, gibt mir den Tag<br />
gewiß 6 Stund Information, die ich dann absonderlich zur Composition und<br />
Clavier, auch bißweilen zu anderer Instrumenten exercirung hoch vonnöthen<br />
habe." (KRÄUTER 1712)<br />
17
Dieser enge Kontakt ermöglichte dem Schüler, den Meister ständig zu beobachten<br />
und dabei in einer Art von "learning by doing", ähnlich der Lehrsituation in anderen<br />
Handwerksberufen, zu versuchen, das Vorbild des Ausbilders zu imitieren.<br />
Die tägliche Arbeit in Form der Erfüllung der geforderten Aufgaben, die im Wesentlichen<br />
von der Unterhaltung eines Dienstherrn geprägt waren und zu diesem Zweck<br />
die regelmäßige Produktion klanglich verwertbaren Materials und dessen Ausführung<br />
beinhalteten, bildete den Rahmen für die Betätigung in der Werkstatt. THOMAS<br />
NIPPERDEY fasst die Situation der künstlerischen Berufe zu jener Zeit in seinem historisch-soziologischen<br />
Werk Wie das Bürgertum die Moderne fand wie folgt zusammen:<br />
18<br />
"Bildende Künstler und Musiker lebten in festen Familien- und Handwerkstraditionen,<br />
sie hatten ihren festen Platz in der Gesellschaft, ihre<br />
zugeschriebene Rolle, sie erfüllten Aufträge, und sie konnten sich, zunächst<br />
einmal, an feste Regeln halten." (NIPPERDEY 1988, 10)<br />
Auch die Aufgaben des Schülers richteten sich in dieser Situation weitgehend nach<br />
den Erfordernissen des Werkstattbetriebes. Der Lehrling hatte dem Meister in<br />
vielfacher Hinsicht zu assistieren; dafür wurden ihm je nach didaktischem Geschick<br />
des Ausbilders mehr oder minder gut zu lösende und instruktive Aufgaben gestellt.<br />
Eine typische Aufgabe, durch die sich ein Schüler nützlich erweisen konnte, war<br />
etwa das handschriftliche Kopieren von Notentexten, sowohl von des Meisters Hand<br />
mit dem Ziel der Verbreitung oder Aufführung, als auch von fremden Quellen mit<br />
dem Ziel, sie in eigenen Besitz zu bringen.<br />
Die Zeit gegenseitigen Kontakts stellte in dieser Ausbildungssituation gegenüber<br />
heute ein weniger knappes Gut dar. Deshalb bestand Bedarf an Unterrichtsmedien,<br />
um etwa dem Schüler selbstständiges häusliches Üben zu ermöglichen, nur in relativ<br />
geringem Maß. Rar waren statt dessen Drucksachen, so dass sich ein wesentlicher<br />
Teil der Übermittlung auf der Grundlage mündlicher Überlieferung und handgeschriebener<br />
Medien vollziehen musste. Diese handschriftliche Vervielfältigung war<br />
aber zeitaufwändig und vollzog sich im Gegensatz zum Druck nicht multiplikativ,<br />
sondern additiv.<br />
Dem aus heutiger Sicht möglicherweise zu beneidenden Vorteil des intensiven<br />
Kontakts zwischen Lehrmeister und Schüler stand damit ein schwerwiegender<br />
Nachteil gegenüber: Musik anderer Komponisten war oft nur schwer zugänglich und<br />
keineswegs jederzeit verfügbar. DANIEL GOTTLOB TÜRK weist z.B. in seiner Klavierschule<br />
darauf hin, dass
"[...] die Lehrer an kleinen Orten, und vorzüglich auf dem Lande, nicht immer<br />
Gelegenheit haben, die zum Unterrichten bequemen Stücke kennen zu lernen<br />
[...]." (TÜRK 1789/1962, 15)<br />
Andererseits erleichterte diese Mediensituation einem Lehrmeister, eigene Schwächen<br />
zu kaschieren, indem er den Vergleich mit Konkurrenten mied. So konnte sich<br />
Musikunterricht mancherorts in einer Art "kultureller Inzucht" vollziehen. Da für<br />
jeden Meister eigenes Komponieren wichtiger Bestandteil seiner Tätigkeit und<br />
Grundlage seiner Stellung war, war es auch eine Frage seiner Beschränkung und<br />
Eitelkeit, ob er den medialen Zugang des Schülers zu fremden Werken zu fördern<br />
oder zu verhindern suchte. CARL PHILIPP EMANUEL BACH beklagt diesbezüglich in<br />
seinem Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen die Tendenz, Unterricht<br />
unter ausschließlicher Verwendung eigener Produkte zu gestalten:<br />
"Jeder Lehr-Meister bey nahe dringt seinen Schülern seine eigenen Arbeiten<br />
auf [...]. Dahero werden den Lehrlingen andere gute Clavier-Sachen, woraus<br />
sie etwas lernen könten, unter dem Vorwande, als ob sie zu alt oder zu schwer<br />
wären, vorenthalten." (BACH 1753/1994, 2f.)<br />
Auch DANIEL GOTTLOB TÜRK hebt die Bedeutung verschiedenartiger Vorbilder für<br />
eine qualifizierte Ausbildung hervor. Er hält es für unverzichtbar, in der Ausbildung<br />
einen möglichst breiten Horizont zu gewinnen und die Unterweisung nicht auf den<br />
eigenen Kompositionsstil zu beschränken:<br />
"Man muß daher dem Scholaren durch die Abwechslung nützlich zu werden<br />
suchen; denn die Mannigfaltigkeit gewährt überhaupt mehrere Vortheile. Sie<br />
unterhält, vergnügt mehr, giebt Anlass zu nützlichen Regeln, Vergleichungen,<br />
Anwendungen; [...] folglich sorgen diejenigen Lehrer, welche beym<br />
Unterrichten blos ihre eigenen Kompositionen spielen lassen [...] nicht gut für<br />
ihre Schüler." (TÜRK 1789/1962, 18)<br />
Diese Beispiele vermitteln einen ersten Eindruck von der engen Verknüpfung von<br />
Unterrichtspraxis und Medienwirklichkeit: In der modernen Musikpädagogik ermöglichte<br />
unter anderem die einfachere Verfügbarkeit von Musikalien eine radikale<br />
Umkehr des Nutzungsverhältnisses von eigen- zu fremd produzierten Kompositionen<br />
im Unterricht.<br />
Waren aber Fremdkompositionen, sei es gedruckt oder handschriftlich kopiert, damals<br />
verfügbar, war der Umgang mit ihnen noch keineswegs frei von Unwägbarkeiten.<br />
Nie konnte davon ausgegangen werden, dass die vorliegenden Medien fehlerfrei<br />
waren. Eine fachkundige Prüfung war zwangsläufig mit jedem Abschreiben<br />
19
und – nota bene – Spielen verbunden. Dies betraf sowohl das Spiel aus einem "bald<br />
gar nicht und bald sehr falsch bezieferten Basse", wie C. PH. E. BACH eine damals<br />
gängige Schwierigkeit bezeichnete (s. u. S. 23), als auch aus schlecht gesetzten Noten,<br />
wofür DANIEL GOTTLOB TÜRK in seiner Klavierschule folgendes Beispiel liefert:<br />
Abb. 2: TÜRK 1789/1962, S. 157.<br />
Für das Musizieren und Abschreiben war eine intensive Beschäftigung mit der Vorlage<br />
also unabdingbar, sowohl die Korrektur als auch die Ergänzung der Notentexte<br />
betreffend. Da sich die Unwägbarkeiten der Wiedergabe aber nicht nur wie hier auf<br />
schlecht gesetzte oder verzerrte Notentexte, sondern vor allem auch auf schlicht<br />
falsch abgeschriebene Noten bezogen, war die Kenntnis der Regeln der Musikherstellung<br />
für einen Spieler, der notierte Musik richtig wiedergeben wollte, unabdingbar<br />
erforderlich. 1<br />
Fremde Notentexte erfüllten unter diesen Voraussetzungen immer auch eine Funktion<br />
als Beispiele und Vorbilder für die eigene Komposition. Die geforderte kritische<br />
Bewertung komponierter Vorlagen beruhte auf einem grundlegend anderen Verhältnis<br />
zwischen ausführendem Musiker und auszuführender Musik, als es sich im Ver-<br />
1 Die Notwendigkeit zur Ergänzung bezog sich nicht nur auf offensichtliche Fehler oder versehentlich<br />
Weggelassenes, sondern auch auf nicht oder nur schwer druck- oder notierbare Inhalte. Generalbassnotation<br />
oder Manieren sind typische Beispiele für solche Abkürzungen, deren Code<br />
vom Ausführenden der Barockzeit selbstverständlich beherrscht werden musste (vgl. GELLRICH<br />
1992, 18).<br />
20
lauf des 19. Jahrhunderts anhand der Interpretation von gedruckten Werken 2 entwickelte.<br />
Stücke anderer Komponisten waren zunächst "Gedancken" von Kollegen,<br />
mit denen genauso frei hantiert werden konnte wie mit eigenen. Es war üblich,<br />
Stücke anderer Komponisten beim Vortrag zu verändern, sei es, indem man sie erschwerte<br />
(vgl. GELLRICH 1992, 132 u. 143) oder erleichterte, wie es C. PH. E. BACH<br />
im folgenden empfiehlt:<br />
"Seine Fähigkeit und Disposition kan man an den geschwindesten und<br />
schwersten Passagen abmessen, damit man sich nicht übertreibe und hernach<br />
stecken bleibe. Diejenigen Gänge, welche zuhause mit Mühe und sogar nur<br />
dann und wann glücken, muß man öffentlich weglassen." (BACH 1753/1994,<br />
121)<br />
Nicht die möglichst vollständige und originalgetreue Wiedergabe als absolut erachteter<br />
Werke stand hierbei im Mittelpunkt der Bemühungen, sondern die bestmögliche<br />
Unterhaltung des Publikums in der jeweiligen Situation. Dabei war es<br />
nicht ungewöhnlich, wenn sich das aktuelle Arrangement des Stückes und der Verlauf<br />
der Darbietung erst während des Vortrags aus den Umgebungsbedingungen<br />
(z.B. Zustand von Klavier und Raum, Reaktion der Zuhörer) entwickelte (vgl. TÜRK<br />
1789, 313).<br />
Noch FRANZ LISZT bereitete es in den 1830er Jahren großen Spaß, sowohl privat als<br />
auch öffentlich fremde Werke nach Belieben auf sich zuzuschneiden:<br />
"Kennen Sie die Mazurkas von Chopin, die Mme. Freppa gewidmet sind? Sie<br />
sind wunderbar; ich mache eine riesige Menge von Kadenzen und Tremolos."<br />
(Liszt an Marie d'Agoult, 1834, zit. nach MOLSEN 1982, 105)<br />
"Um diesen Brief zu vervollständigen, muß ich Ihnen noch sagen, daß ich gestern<br />
nach meinem Konzert im 'Concert spirituel' das C-Moll-Konzert von<br />
Beethoven gespielt habe, welches ich nicht kannte und das ich 24 Stunden gelernt<br />
habe (mit improvisiertem Orgelpunkt), mit dem unerhörtesten Erfolg."<br />
(Liszt an Marie d'Agoult, 1839, zit. nach MOLSEN 1982, 146)<br />
2 Die Drucklegung begründete in ihrer Unveränderbarkeit spätestens seit Beethoven das Musikwerk<br />
und definierte es geradezu. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass das Opus und<br />
seine Nummerierung in der Regel die Chronologie der Drucklegung beschreibt – ein Problem für<br />
die Musikgeschichtsschreibung, die sich statt dessen stets um eine Nummerierung bemühte, die<br />
in ihrer Ordnung der Entstehungsabfolge der Kompositionen entspricht.<br />
21
Auch aus dem folgenden Ausschnitt eines Briefes von FRIEDRICH WIECK an seine<br />
Frau geht die noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in fachkundigen Kreisen<br />
gepflegte Autonomie des Ausführenden gegenüber dem ausgeführten Werk hervor:<br />
22<br />
"Eben schickt Banck aus Rudolstadt die neuesten Etüden von Henselt. [...] In<br />
diesen Etüden ist aber nichts Neues mehr u. nur Eine davon wird Clara zum<br />
Studieren wählen, aber einiges daran verändern, was zu monoton." (FRIEDRICH<br />
WIECK an CLEMENTINE WIECK aus Wien, 3. April 1838, abgedruckt in WIECK<br />
1968, 96)<br />
Allerdings hatte bereits achtzig Jahre früher CARL PHILIPP EMANUEL BACH davor<br />
gewarnt, Vorlagen durch Veränderung etwa zu verschlechtern. So dürfen seiner<br />
Meinung nach zwar Bassfiguren abgeändert werden, die zu Grunde liegende Harmonie<br />
muss jedoch erhalten bleiben:<br />
"Alle Veränderungen müssen dem Affeckt des Stückes gemäß seyn. Sie müssen<br />
allezeit, wo nicht besser, doch wenigstens eben so gut wie das Original<br />
seyn. Simple Gedancken werden zuweilen sehr wohl bunt verändert und umgekehrt.<br />
[...] Bey Clavier=Sachen kan zu gleich der Baß in der Veränderung<br />
anders seyn, als er war, indessen muß die Harmonie dieselbe bleiben. Überhaupt<br />
muß man, ohngeacht der vielen Veränderungen, welche gar sehr Mode<br />
sind, es allezeit so einrichten, daß die Grundliniamenten des Stückes, welche<br />
den Affect des Stückes zu erkennen geben, dennoch hervor leuchten." (BACH<br />
1753/1994, 132f.)<br />
Das Urteil über Gelingen oder Misslingen dieser Bemühungen fiel letztendlich dem<br />
Publikum zu. Ziel des Musizierens war deshalb immer die Weckung und Erhaltung<br />
der Aufmerksamkeit der Zuhörer durch geschmackvolle Abwechslung:<br />
"Diesem ohngeachtet stehet es jedem, wer die Geschicklichkeit besitzet, frey,<br />
ausser unsern Manieren weitläufigere einzumischen. [...] Wer hierinnen das<br />
nöthige in Obacht nimmt, den kan man für vollkommen paßiren lassen, weil er<br />
[...] die Aufmercksamkeit seiner Zuhörer durch eine beständige Veränderung<br />
vorzüglich aufzumuntern und zu unterhalten weiß." (BACH 1753/1994, 53f.)<br />
Diese publikumsorientierte Perspektive, die die spontane Veränderung, die Reaktion<br />
des Künstlers auf die jeweilige Situation und die Unterhaltung des Publikums als<br />
ihre Hauptaufgaben begreift, fasst GRETE WEHMEYER in ihrem Buch Carl Czerny<br />
oder die Einzelhaft am Klavier folgendermaßen zusammen:
"Hier spielt das Werk die untergeordnete, die Beziehung zwischen Spieler und<br />
Zuhörer die Hauptrolle. Das kann auch der Fall sein bei Improvisationen und<br />
freien Fantasien. Musik ist dann ausschließlich Kommunikation." (WEHMEYER<br />
1983, 116)<br />
Diese von kommunikativen Elementen zwischen Musiker und Publikum bestimmte<br />
Kunstausübung schlug sich auch in den Lehrwerken jener Zeit nieder. Einen Einblick<br />
in die Praxis von Klavierspiel und Klavierunterricht des 18. Jahrhunderts geben<br />
neben den bereits zitierten Werken von CARL PHILIPP EMANUEL BACH<br />
(1753/1762) und DANIEL GOTTLOB TÜRK (1789) die Klavierschulen Anleitung zum<br />
Clavierspielen von FRIEDRICH WILHELM MARPURG (1762/1765) und Musicus theoretico-practicus<br />
(1749) von PHILIPP CHRISTOPH HARTUNG. Obwohl die identische<br />
Bezeichnung eine Verwechslung nahelegt, handelt sich bei diesen Schulen keineswegs<br />
wie heute um Kompendien aus einfachen, im Schwierigkeitsgrad sukzessiv<br />
ansteigenden Spielstücken für Anfänger, sondern um vorwiegend aus verbalem Text<br />
bestehende Werke, die eine Einführung in die Probleme des Klavierspiels in theoretischer<br />
Form bis zum höchsten künstlerischen Niveau geben und diese teilweise<br />
durch Notenbeispiele ergänzen. Notenbeispiele wurden dabei bis um 1780 aus Mangel<br />
an kombinierten drucktechnischen Möglichkeiten meist auf getrennten Platten<br />
hergestellt und als Anhang angefügt.<br />
In der Vorrede zu seiner Klavierschule, dem bereits zitierten Versuch über die<br />
wahre Art das Clavier zu spielen, stellt CARL PHILIPP EMANUEL BACH zunächst<br />
seine Anforderungen an den Klavierspieler klar. Neben der Fähigkeit zur Wiedergabe<br />
vorgelegter Notentexte verlangt er Folgendes:<br />
"Man verlanget noch überdies, daß ein Clavierspieler Fantasien von allerley<br />
Art machen soll; daß er einen aufgegebenen Satz nach den strengsten Regeln<br />
der Harmonie und der Melodie aus dem Stegereif durcharbeiten, aus allen Tönen<br />
mit gleicher Leichtigkeit spielen, ein Ton in den anderen im Augenblick<br />
ohne Fehler übersetzen, alles ohne Unterschied vom Blatte weg spielen soll, es<br />
mag für seyn Instrument eigentlich gesetzt sein oder nicht; daß er die Wissenschaft<br />
des Generalbasses in seiner völligen Gewalt haben, selbigen mit Unterschied,<br />
oft mit Verläugnung, bald mit vielen, bald mit wenigen Stimmen, bald<br />
nach der Strenge der Harmonie, bald galant, bald nach einem wenig oder zu<br />
viel, bald gar nicht und bald sehr falsch bezieferten Basse spielen soll; daß er<br />
diesen Generalbaß manchmahl aus Partituren mit vielen Linien, bey unbezieferten,<br />
oder ofte gar pausirenden Bässen, wenn nemlich eine von den andern<br />
Stimmen zum Grunde der Harmonie dienet, ziehen und dadurch die Zusammenstimmung<br />
verstärken soll, und wer weiß alle Forderungen mehr." (BACH<br />
1753/1994, Vorrede, 1f.)<br />
23
PHILIPP CHRISTOPH HARTUNG fasst seine Anforderungen in Form eines resümierenden<br />
Gedichtes in seiner Klavierschule, dem Musicus theoretico-practicus, zusammen<br />
und gibt dabei ebenfalls aufschlussreichen Einblick in den nicht minder umfangreichen<br />
Fundus an Fähigkeiten, den er erhofft, vermittelt zu haben. Neben weitgehenden<br />
Übereinstimmungen mit CARL PHILIPP EMANUEL BACH geht hieraus unter<br />
anderem die selbstverständliche Einordnung auch des Orgelspiels unter die "Clavier-<br />
Kunst" hervor:<br />
24<br />
"Mein Freund! mit was vor Kunst und Vortheil spielest du?<br />
Gehts auf der Orgel auch recht leicht und hurtig zu?<br />
Hier will ich dir ein Stück, das schwer gesetzt ist, reichen;<br />
Es steht im Cis: nun komm und spiels aus allen Zeichen.<br />
Jetzt liegt das Stück verkehrt; jetzt liegt es in der Quer:<br />
Wohlan! schlags gleich behend, aus allen Thonen her.<br />
Ich spiele dir darzu: nicht vorn; nein, weiter hinten.<br />
Ist dein Gehör recht gut; so wirst du mich schon finden.<br />
Nun variire mir diß Stück recht schön und reich:<br />
Nimm selbst die Partitur; und spiel und sing zugleich.<br />
Doch wirst du deine Stimm jetzt transponiren müssen:<br />
Und das was unten steht, das trittst du mit den Füssen.<br />
Jetzt zeig, was deine Kunst im General-Bass sey.<br />
Dort sind die Zeichen schwehr, hier stehn sie nicht darbey.<br />
Du wirst vielleicht diß Ding mit Melodien zieren;<br />
Und deine linke Hand wird künstlich variiren.<br />
Du mußt zu gleicher Zeit der Tenoriste seyn:<br />
Und aus der Partitur hilf auch den andern ein.<br />
Jetzt muß ich deine Kunst im Fantasiren sehen;<br />
Und ob du meistens pflegst auf Fugen-Art zu gehen.<br />
Nebst diesem suche ich die schönste Melodie<br />
In aller Thonen-Art bey deiner Fantasie.<br />
Wird auch die Leidenschafft, nach dem du wilt, entstehen!<br />
Gehts glücklich, wann du wilt in fremde Thone gehen?<br />
Bezeugst du im Choral Vernunft und Hurtigkeit?<br />
Ist deine Fantasie zu allem Tact bereit?<br />
Vermagst du aus dem Kopf mit uns zu musiciren,<br />
Und doch mit andern auch darbey zu discuriren?<br />
Du bist recht brav, mein Freund! Nun spiel zu guter letzt<br />
Ein Kunst-Stück, das du selbst erfunden und gesetzt."<br />
(HARTUNG 1749/1977, II, 16)
Beide Beispiele zeigen einen aus heutiger Sicht in seiner Vielfalt erstaunlichen Forderungskatalog.<br />
Dabei fällt auf, wie sehr insbesondere Fähigkeiten der Flexibilität<br />
und Spontaneität mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Entsprechend diesen vielfältigen<br />
Aufgaben beschäftigen sich die Klavierschulen des 18. Jahrhunderts wesentlich<br />
auch mit Herstellung und Arrangement von Musik für das Tasteninstrument. C.<br />
PH. E. BACHS zweiter Teil des Versuchs über die wahre Art das Clavier zu spielen,<br />
der übrigens deutlich umfangreicher ausfällt als der erste, ist den Tonsatz- und Generalbassregeln<br />
gewidmet. Auch dies belegt den hohen Stellenwert, den C. PH. E.<br />
BACH eigenkreativen Aspekten bei der Kunst des Klavierspiels beimaß.<br />
Alle Quellen jener Zeit belegen auch eine reiche Improvisationskultur. Dieser Sachverhalt<br />
kann nicht überraschen, ergibt sich doch die Praxis der Improvisation und<br />
freien Fantasie automatisch aus einer Verbindung von Fähigkeiten der Herstellung<br />
und der Darbietung. Improvisation ist simultane Erfindung und Ausführung musikalischer<br />
Gedanken, oder, wie es CARL PHILIPP EMANUEL BACH am Beispiel des<br />
spontanen Kadenzspiels formuliert:<br />
"Die verzierten Cadenzen sind gleichsam eine Composition aus dem Stegereif."<br />
(BACH 1753/1994, 131)<br />
Nur ein Bruchteil der im 18. und frühen 19. Jahrhundert hervorgebrachten Klaviermusik<br />
dürfte notiert, geschweige denn auf schriftlicher Grundlage überliefert worden<br />
sein.<br />
Auch für LUDWIG VAN BEETHOVEN war die Improvisation eine essentielle Art der<br />
musikalischen Betätigung, die seine Leistung bei der Interpretation eigener Werke,<br />
zeitgenössischen Berichten zufolge, deutlich überragt haben soll. Aus heutiger Sicht,<br />
da BEETHOVEN aufgrund bekannter Medienkonstellation nur noch als Komponist<br />
Bedeutung behalten hat, eine möglicherweise überraschende Tatsache. CARL<br />
CZERNY berichtet in seinen Erinnerungen mehrfach, dass das Phantasieren für<br />
BEETHOVEN tägliche Praxis war (vgl. CZERNY 1968, 12, 24) und dass seine öffentlichen<br />
Improvisationen meist bleibenderen Eindruck hinterlassen haben als die Wiedergabe<br />
seiner eigenen Kompositionen (vgl. LANDON 1994, 183). Eine Improvisation<br />
durfte aber auf keinen Fall vorher einstudiert sein (vgl. TÜRK 1789, 313). Dies<br />
wurde üblicherweise einfach dadurch überprüft, dass dem Virtuosen ein Thema aufgegeben<br />
wurde, über das er spontan zu fantasieren hatte. So war WOLFGANG<br />
AMADEUS MOZART erst von den Fähigkeiten des jungen BEETHOVEN überzeugt,<br />
nachdem er sich auf diese Weise vergewissert hatte, dass sein Vortrag nicht "eingelernt"<br />
sei:<br />
25
26<br />
"Als Knabe wurde er zu Mozart geführt, der ihn spielen ließ, worauf er fantasierte.<br />
'Das ist recht hübsch', sagte Mozart, 'aber eingelernt'. Gekränkt bat sich<br />
Beethoven ein Thema aus und fantasierte so, daß Mozart zu einigen Freunden<br />
sagte: 'Auf den gebt acht, der wird euch noch was erzählen'." (zit. nach<br />
LANDON 1994, 36)<br />
Auch der Pianist und Komponist Abbé JOSEPH GELINEK beurteilte MOZART und<br />
BEETHOVEN nicht primär anhand ihrer schriftlich festgehaltenen Kompositionen,<br />
sondern anhand ihrer Fähigkeit zur Improvisation. Er berichtet über eine Begegnung<br />
mit BEETHOVEN:<br />
"In dem jungen Menschen steckt der Satan. Nie habe ich so spielen gehört! Er<br />
phantasierte auf ein von mir gegebenes Thema, wie ich selbst Mozart nie<br />
phantasieren gehört habe." (CZERNY 1968, 9)<br />
Improvisationen gehörten zur Vortragspraxis aller Pianisten, wie auch FRÉDÉRIC<br />
CHOPIN (vgl. MOLSEN 1982, 122), FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (vgl. HILLER<br />
1874, 4) und FRANZ LISZT (vgl. WÖRNER 1993, 641). Entsprechend spielten Anleitungen<br />
zur freien Fantasie bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in den<br />
Klavierschulen eine bedeutende Rolle. So lautet das einundvierzigste Kapitel im<br />
zweiten Band von C. PH. E. BACHS Versuch über die wahre Art das Clavier zu<br />
spielen "Von der freyen Fantasie". Carl CZERNY veröffentlichte als eines der letzten<br />
Improvisationslehrwerke des 19. Jahrhunderts im Jahr 1829 die Systematische Anleitung<br />
zum Fantasieren auf dem Pianoforte als opus 200. Im täglichen Unterricht<br />
hatte die Improvisation ihren festen Platz (vgl. CZERNY 1968, 28).<br />
Im Geist des spontanen Musizierens war es auch Usus, jeden Vortrag durch ein kurzes<br />
Vorspiel einzuleiten. Publikum und Pianist wurden so auf den Charakter der<br />
nachfolgenden Komposition und auf die örtlichen Gegebenheiten von Raumakustik<br />
und Instrument eingestimmt. MARTIN GELLRICH zitiert diesbezüglich die folgende<br />
Bemerkung 3 aus dem Jahr 1851:<br />
"In der That gibt es nichts jämmerlicheres als eine Person, die sich ans Klavier<br />
setzt und sogleich ein Musikstück zu spielen beginnt, ohne vorher, wenn auch<br />
nicht ein Präludium, so doch wenigstens einige Accorde gemacht zu haben, die<br />
den Zuhörern anzeigen, in welcher Tonart das Stück geschrieben ist, das man<br />
zu spielen gedenkt, um sie dadurch zur nöthigen Aufmerksamkeit aufzufordern."<br />
(zit. nach GELLRICH 1992, 128)<br />
3 A. d. Kontzki: L´indispensable du Pianiste, op. 100, Leipzig 1851, S. 66.
Die Fähigkeit zu präludieren war entsprechend von Beginn des Klavierunterrichts<br />
wichtiges Ausbildungsziel. CARL CZERNY forderte demgemäß:<br />
"Selbst der Anfänger kann und muss bereits in den ersten Monathen dazu angehalten<br />
werden, vor jedem Tonstück ein kleines Vorspiel auszuführen [...]."<br />
(CZERNY 1839, Bd. 3, 84)<br />
Die vor der Abspaltung der Interpretation von der Komposition übliche Praxis, die<br />
Qualitäten eines Künstlers weniger in der Perfektion der Ausführung, sondern in der<br />
Spontaneität und Fähigkeit zur Ausgestaltung einer konkreten Situation zu messen,<br />
spiegelt sich in einem von dem heutigen grundlegend abweichenden Verhältnis zwischen<br />
vorbereitender Übung von Vortragsstücken einerseits und praktischer Ausübung<br />
der Kunst andererseits wider. Vortragsstücke wurden nicht separat einstudiert,<br />
sondern ihre Ausführung erfolgte aus dem Geist der Improvisation weitgehend<br />
ohne spezifische Übung. Die Beherrschung der Klavierkunst gewährleistete vielmehr<br />
generell die Fähigkeit zur Verklanglichung von Musik, die Wiedergabe von<br />
Kompositionen eingeschlossen. So betonte FRÉDÉRIC CHOPIN in einem von<br />
FRIEDRICH NIECKS überlieferten Gespräch mit dem Kritiker WILHELM VON LENZ,<br />
dass seine Vorbereitung auf ein Konzert keineswegs in der Übung seiner Kompositionen<br />
bestand:<br />
"'Studiren Sie, wenn der Concerttag kommt?' fragte ihn Lenz. 'Es ist eine<br />
schreckliche Zeit für mich', war Chopin's Antwort. 'Ich liebe nicht die Öffentlichkeit,<br />
aber es gehört zu meiner Stellung. Vierzehn Tage schließe ich mich<br />
ein und spiele Bach. Das ist meine Vorbereitung, ich übe nicht meine Compositionen.'"<br />
(NIECKS 1890, Bd. 2, 87)<br />
Eine ähnliche Einstellung zum Üben von Werken geht auch aus der folgenden Bemerkung<br />
von FRANZ LISZT über ADOLF HENSELT hervor, von der FRIEDRICH WIECK<br />
in einem Brief berichtet:<br />
"Daß Henselt seine Kompositionen jahrelang üben kann, zeige, meinte er,<br />
durchaus ein sehr beschränktes Talent an." (FRIEDRICH WIECK an CLEMENTINE<br />
WIECK, 5. März 1838 4, abgedruckt in WIECK 1968, 93)<br />
Eine solche Musikpraxis wirkte sich zwangsläufig auch auf den Unterricht aus. In<br />
jener Zeit, in der der Vortrag vorproduzierter Werke noch nicht Hauptziel der Ausbildung<br />
war, und als noch keine gedruckte Standardliteratur existierte, die dem<br />
4 Als Datum des Briefs ist der 5. März 1832 angegeben, offensichtlich ein Druckfehler.<br />
27
Publikum bekannt gewesen wäre und deren korrekte Ausführung beim Vortrag hätte<br />
überprüft werden können, spielte die Perfektion der Wiedergabe auch in der Ausbildung<br />
nicht die entscheidende Rolle. So sah DANIEL GOTTLOB TÜRK für den Klavierunterricht<br />
in der Beschäftigung mit einem Stück über längere Zeit keinen Sinn:<br />
28<br />
"Ein anderer Fehler wird sehr oft dadurch begangen, daß man den Anfänger<br />
die Stücke so lange spielen läßt, bis er sie auswendig kann [...]. Besser ist es<br />
daher, wenn man ihn das aufgegebene Tonstück nur so lange üben läßt, bis er<br />
es in einer sehr mäßigen Bewegung zusammenhängend spielen kann." (TÜRK<br />
1789/1962, 18)<br />
Die folgende Äußerung CARL CZERNYS in seiner Pianoforte-Schule zielt in eine<br />
ähnliche Richtung:<br />
"Manche Lehrer haben den Grundsatz, dem Schüler so lange ein Stück einstudieren<br />
zu wollen, bis es ganz vollkommen gehe [...]. Die auf die [...] Art unterrichteten<br />
Schüler können wohl ein mühsam eingelerntes Stückchen zuletzt vor<br />
Zuhörern spielen, und damit einigen Beifall gewinnen; aber außerdem wissen<br />
sie fast gar nichts." (CZERNY 1839, Bd.1, zit. nach WEHMEYER 1983, 215)<br />
Erstaunlich aus Sicht der heutigen Klavierpädagogik, in welcher das Ideal der perfekten<br />
Wiedergabe in jedem Stadium der Ausbildung für einen optimalen Lernerfolg<br />
als unverzichtbar gilt, ist die Tatsache, dass ein solches Vorgehen nicht als inakkurat<br />
und damit als mangelhaft angesehen wurde. Das Gegenteil war der Fall. Die Klärung<br />
dieses scheinbaren Widerspruchs gelang MARTIN GELLRICH (1992). Er beschrieb<br />
die dieser Praxis zugrunde liegende und von der heutigen Situation grundlegend<br />
verschiedene Vermittlungsform aus dem Geist der Einheit von Erfindung und<br />
Ausführung. GELLRICH zeigte, dass ein wesentlicher Teil der Übezeit am Klavier<br />
mit dem Erlernen musiksprachlicher Elemente, mit Passagenübungen und, wie er es<br />
nennt, "Sätzchen-Spiel" zugebracht wurde. Beide Arten bezeichnet er als integrierte<br />
"technisch-musikalische Übungen". Das Erlernen des Instrumentalspiels vollzog<br />
sich dabei auf der Grundlage der musikstrukturellen Bestandteile, aus denen die<br />
Kompositionen hergestellt waren. Das Beherrschen dieser Bestandteile garantierte<br />
auch die Fähigkeit, aus diesen Bestandteilen erstellte Werke auszuführen. Komposition<br />
und Spiel waren in der Improvisation miteinander verknüpft.<br />
GELLRICH hebt besonders die ursprüngliche Einheit von musikalisch-improvisatorischem<br />
Lernen und technischer Übung hervor. Der Schüler hatte weniger vorgegebene<br />
Übungen nachzuspielen, sondern entsprechend dem Stil der Zeit Floskeln
selbst zu erfinden und neu zu kombinieren. Anstatt einzelne Stücke zu üben, wurde<br />
der musikalische "Wortschatz" praktiziert, aus dem die Stücke aufgebaut waren:<br />
"Die Passagenübung füllte nach Czernys Aussage die Hälfte der Übezeit aus.<br />
Die restliche Zeit wurde der Sätzchen-, der Etüden-, der Improvisationsübung,<br />
dem Blattspiel und eben dem Einstudieren von Vortragsstücken gewidmet."<br />
(GELLRICH 1992, 131)<br />
Eine Passage stellt eine bestimmte Tonverbindung als Grundlage für einen gewissen<br />
Kompositionsstil dar, und die Summe der bekannten Passagen eine Art musikalischen<br />
"Grundwortschatz". Dieser wurde variiert und kombiniert, so dass musikalische<br />
Floskeln und Sequenzen entstanden. Zur Illustration sei eine typische Passage<br />
aus dem Lehrbuch von PHILIPP CHRISTOPH HARTUNG angeführt:<br />
29
Abb. 3: HARTUNG (1749/1977), Anhang, <strong>1.</strong><br />
Verschiedene Möglichkeiten, Passagen im Stil BEETHOVENS zu erfinden und zu<br />
variieren, demonstriert CARL CZERNY in seiner Anleitung zum Fantasieren auf dem<br />
Pianoforte:<br />
30
Abb. 4: CARL CZERNY: op. 200, S. 6.<br />
31
Abb. 5: CARL CZERNY: op. 200, S. 7.<br />
32
War ein ausreichender Grundstock an Passagen gelernt, konnten darauf aufbauend<br />
kleine Formen geschaffen werden, von MARTIN GELLRICH als "Sätzchen" bezeichnet.<br />
Typische Beispiele für solche Kleinformen, die sowohl technische als auch musikalische<br />
Lernziele miteinander verbanden, stellen die 160 achttaktigen Übungen<br />
op. 821 von CARL CZERNY dar:<br />
Abb. 6: CARL CZERNY: op. 82<strong>1.</strong> 10.<br />
33
Abb. 7: CARL CZERNY: op. 82<strong>1.</strong> 2<strong>1.</strong><br />
Beherrschte ein Schüler auch die Bildung solcher Kleinformen, konnte die Herstellung<br />
umfangreicherer Stücke angegangen werden. Die integrale Verbindung von<br />
technischem Training und Übung in der Herstellung eigener Musik führte nach<br />
MARTIN GELLRICH dazu, dass<br />
34<br />
"[...] Musik im 18. Jahrhundert ähnlich wie eine Muttersprache angeeignet<br />
wurde, nämlich durch das Spielen musikalischer Sätze. Im Sätzchen-Spiel<br />
lernte das Kind mit Sequenz und Kadenz umzugehen. Es lernte ferner den Gebrauch<br />
der musikalischen Syntax und Grammatik und übte sich schließlich<br />
auch im Darstellen bzw. Ausdrücken von Affekten und Charakteren. Nimmt<br />
man noch das Generalbaßspiel hinzu, so wurden dem Schüler schon in den ersten<br />
Lehrjahren alle Werkzeuge in die Hand gegeben, um eigenhändig Musikstücke<br />
herstellen zu können." (GELLRICH 1992, 13)<br />
Das Üben von Passagen verfolgte also keineswegs nur technische Zwecke, sondern<br />
schuf auch die stilistische, kompositorische und improvisatorische Grundlage des<br />
Musizierens.<br />
Die Wiedergabe von Kompositionen stellte in diesem Zusammenhang nur einen<br />
kleinen Teil der Klavierpraxis dar, nicht zu vergleichen mit der dominierenden Rolle<br />
der Interpretation fremder Werke seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als<br />
das Récital zur bestimmenden Ausführungsform von solistischer Klaviermusik<br />
wurde.
2.2 Werk und Rationalisierung: Das 19. Jahrhundert<br />
2.2.1 Veränderungen zur Zeit Carl Czernys<br />
Ein erster Hinweis auf einen Wertewandel weg von spontanen Äußerungsformen<br />
und die Voraussetzung für neue Unterrichtsmethoden findet sich in einer Fußnote<br />
zur vierten Auflage von C. PH. E. BACHS Versuch über die wahre Art das Clavier zu<br />
spielen aus dem Jahr 1787. Hier relativiert C. PH. E. BACH seine bereits zitierte Aussage<br />
aus der ersten Auflage, dass Veränderungen an Stücken immer dann zu billigen<br />
seien, wenn sie besser oder zumindest genauso gut seien wie das Original. In der<br />
Ergänzung betont er die Bedeutung der schriftlich fixierten Komposition an sich und<br />
mahnt bei Veränderung zur Vorsicht:<br />
"Denn man wählt bey der Verfertigung des Stückes, unter andern Gedanken,<br />
oft mit Fleiß denjenigen, welchen man hingeschrieben hat und deswegen für<br />
den besten in dieser Art hält, ohngeacht einem die Veränderungen dieses Gedanken,<br />
welche mancher Ausführer anbringt und dadurch dem Stücke viel<br />
Ehre anzuthun glaubt, zugleich der Erfindung desselben mit beygefallen sind."<br />
(BACH 1994, 14*)<br />
CARL CZERNY (1791-1857) schildert in seinen Erinnerungen ein Erlebnis mit<br />
LUDWIG VAN BEETHOVEN, das sich etwa 25 Jahre nach Erscheinen des eben zitierten<br />
BACHschen Textes zutrug. Hier spitzt sich der Konflikt zwischen Komponist und<br />
Pianist zu, aus dem der Komponist und damit indirekt das schriftliche Medium<br />
schließlich als Sieger hervorging:<br />
"Als ich z.B. einst (um 1812) in Schuppanzighs Musik das Quintett mit Blasinstrumenten<br />
vortrug, erlaubte ich mir im jugendlichen Leichtsinn manche Änderungen,<br />
–Erschwerung der Passagen, Benützung der höheren Oktave etc.–<br />
Beethoven warf es mir mit Recht [...] mit Strenge vor. Den anderen Tag erhielt<br />
ich von ihm folgenden Brief, den ich hier genau nach dem mir vorliegenden<br />
Originale abschreibe.<br />
'Lieber Czerny!<br />
Heute kann ich Sie nicht sehen, morgen werde ich selbst zu Ihnen kommen,<br />
um mit Ihnen zu sprechen. Ich platzte gestern so heraus, es war mir sehr leid,<br />
als es geschehen war, allein das müssen Sie einem Autor verzeihen, der sein<br />
Werk lieber gehört hätte, gerade, wie es geschrieben, so schön Sie auch übrigens<br />
spielten [...].'<br />
35
36<br />
Dieser Brief hat mich mehr als alles andere von der Sucht geheilt, beim Vortrag<br />
seiner Werke mir irgendeine Änderung zu erlauben, und ich wünsche, daß<br />
er auf alle Pianisten von gleichem Einfluß wäre." (CZERNY 1968, 34f.)<br />
Damit fordert die gestiegene Bedeutung der schriftlich definierten Komposition ihren<br />
Tribut: Solche Schwierigkeiten zeugen von der Etablierung des Musikwerks als<br />
Wert an sich und korrespondieren mit der allmählich sich vollziehenden Aufgabenteilung<br />
in Komponist und Interpret. Die originalgetreue und möglichst genau den<br />
Vorstellungen des Komponisten entsprechende Interpretation setzte sich im weiteren<br />
Verlauf des 19. Jahrhunderts als Ziel des Instrumentalspiels durch.<br />
Während früher der Zweck einer Komposition bereits erfüllt sein konnte, wenn das<br />
Stück ein einziges Mal durch den Autor aufgeführt wurde und schriftliche Verbreitung<br />
vielfach aus instruktiven Beweggründen erfolgte, wurde nun das Verlegen und<br />
der Verkauf von Musikwerken in schriftlicher Form zum wirtschaftlichen Prinzip<br />
und die maximale Verbreitung von Noten mit dem Ziel ihrer Wiedergabe zum<br />
Zweck von Komposition. Je weitflächiger aber die Verteilung von Musikwerken<br />
erfolgte, desto weniger konnten mündlich überlieferte Ergänzungen, aufführungspraktische<br />
Regeln und die Kenntnis stilistischer Besonderheiten bei den Lesern<br />
der Notentexte vorausgesetzt werden. Als Folge dieses Verteilungsprinzips wurde es<br />
für die Komponisten immer wichtiger, ihre Gedanken möglichst detailliert und unmissverständlich<br />
zu codieren. Im Bestreben, auch Tempovorstellungen zu objektivieren,<br />
war auch die Erfindung des MÄLZELschen Metronoms (die Patentanmeldung<br />
erfolgte im Jahr 1816) und seine Anwendung durch LUDWIG VAN BEETHOVEN in<br />
jener Phase nur konsequent.<br />
Medientechnologische Voraussetzungen für die massenhafte Herstellung und Verteilung<br />
von Drucksachen im 19. Jahrhundert, für den Notenverkauf als indirekte<br />
Existenzgrundlage der Komponisten und für die Etablierung des Musikwerks waren<br />
entscheidende Fortschritte auf dem Gebiet der Drucktechnik, insbesondere die Erfindung<br />
der Lithographie durch ALOIS SENEFELDER im Jahr 1797.<br />
Die Qualität der im 19. Jahrhundert veröffentlichten Notenausgaben verbesserte sich<br />
ständig, die Drucksachen wurden immer detaillierter und übernahmen die Rolle von<br />
Normen, die von den Ausführenden erfüllt werden mussten. Von der Richtigkeit des<br />
Druckerzeugnisses musste nun im Gegensatz zu früher, auch aufgrund der großen<br />
Sorgfalt, mit der die meisten Komponisten und Verleger die Herstellung der Vorlagen<br />
überwachten, ausgegangen werden. Je mehr dabei die Originalität und Einmaligkeit<br />
des Kunstwerks den in früherer Zeit herrschenden "vom Regelwerk abhängigen<br />
Gruppengeschmack" (WÖRNER 1993, 281) ablöste, desto weniger war Veränderung<br />
und kritische Prüfung des Notentextes, ob er denn mit den Regeln der Tonset-
zung im Einklang stehe oder eventuell der Korrektur bedürftige Fehler enthalte,<br />
durch den Ausführenden notwendig oder einsichtig, ja nicht einmal mehr statthaft.<br />
Eine Veränderung des Notentextes beim Vortrag geriet zunehmend in den Ruch einer<br />
Respektlosigkeit gegenüber dem Komponisten und seinem Werk. Folglich<br />
wurde das uneingeschränkte Meistern aller Noten und Ausführungsanweisungen der<br />
Vorlage und die Bewältigung ihrer technischen Schwierigkeiten zur neuen Aufgabe<br />
und Meßlatte für die Qualität ausübender Musiker.<br />
Auch für die Musikerziehung boten die modernen drucktechnologischen Möglichkeiten<br />
neue Perspektiven. Die Bedeutung dieser Neuerungen für den Klavierunterricht<br />
lässt sich ermessen beim Vergleich des zeitlichen Aufwands für die Unterweisung<br />
eines Schülers vor etwa 1800 mit der Situation danach. Bis dahin war es noch<br />
Usus gewesen, einen Schüler fast täglich zu unterrichten, wie etwa bei DANIEL<br />
GOTTLOB TÜRK:<br />
"Wer das Klavier zum Vergnügen spielen lernt, der hat genug gethan, wenn er<br />
täglich zwey Stunden darauf verwendet; anfangs wöchentlich etwa vier, wenn<br />
es seyn kann sechs, und in der Folge zwey bis vier Stunden Unterricht mit eingerechnet:<br />
wer aber das Klavierspielen zu seinem Hauptgeschäfte machen will,<br />
für den sind täglich drey bis vier Stunden Uebung kaum hinreichend, und außer<br />
diesen ist wenigstens noch Eine [sic] Lectionsstunde nöthig." (TÜRK 1789,<br />
11)<br />
Auch LUDWIG VAN BEETHOVEN hielt einen nur "einige Male" pro Woche statt findenden<br />
Unterricht für unzureichend. Er äußerte sich gegenüber dem Freiherrn<br />
KÜBECK VON KÜBAU mit der Bitte, dieser möge ihm wegen seiner knappen Zeit bei<br />
der Betreuung einer Schülerin assistieren:<br />
"Ich unterrichte eine junge Person einige Male in der Woche. Öfter kann ich<br />
nicht und das ist unzureichend, um sie weiter zu bringen." (zit. nach LANDON<br />
1994, 52)<br />
Dass BEETHOVEN davon ausging, der Lehrer-Schüler-Kontakt habe täglich zu erfolgen,<br />
geht aus dem weiteren Verlauf des Textes unzweifelhaft hervor. KÜBECK VON<br />
KÜBAU übernahm daraufhin BEETHOVENS Assistenz im Unterricht dieser jungen<br />
Person und unterrichtete sie<br />
"[...] täglich von 5 bis 6 Uhr abends." (zit. nach LANDON 1994, 52)<br />
37
Zu Beginn des Unterrichts war eine Betätigung des Instruments oft ausschließlich in<br />
Gegenwart des Lehrers erwünscht. FRIEDRICH WILHELM MARPURG beispielsweise<br />
empfahl, selbstständiges Üben des Schülers im Anfangsunterricht völlig zu unterbinden:<br />
38<br />
"In den ersten Stunden der Unterweisung ist es gar nicht rathsam, junge Personen<br />
in Abwesenheit des Meisters zur Ueberstudirung ihrer Lection anzuhalten.<br />
Sie sind zu flüchtig, als daß sie ihre Hände in der ihnen vorgeschriebenen Lage<br />
zu erhalten, sich die Mühe geben sollten. [...] Sie können durch eine üble<br />
Wiederholung in einem Augenblicke niederreissen, was ein geschickter Meister<br />
in einer Zeit von drey Viertheilstunden mit Sorgfalt gebauet hat."<br />
(MARPURG 1762, 6)<br />
Auch FRANÇOIS COUPERIN hatte sich in diesem Sinn geäußert. Er empfahl dem Lehrer,<br />
das Klavier abzuschließen und den Schlüssel mitzunehmen. Teile der Texte von<br />
MARPURG und COUPERIN ähneln sich übrigens derart, dass der Eindruck entstehen<br />
könnte, MARPURG habe bei COUPERIN abgeschrieben:<br />
"Es ist in der ersten Unterrichtszeit besser, die Kinder nicht in Abwesenheit<br />
des Lehrers üben zu lassen. [...] Ich nehme deshalb während des Anfangsunterrichts<br />
der Kinder aus Vorsicht den Schlüssel des Instruments, auf dem ich sie<br />
unterweise, mit, damit sie in meiner Abwesenheit nicht in einem Augenblicke<br />
verderben können, was ich in aller Sorgfalt ihnen in 3/4 Stunden beigebracht<br />
habe." (COUPERIN 1717/1933, 12)<br />
Für die Praxis des Klavierunterrichts bot die Entwicklung neuer Arten von Klavierschulen<br />
entscheidende Rationalisierungsmöglichkeiten. Aufgrund im Verlauf des<br />
19. Jahrhunderts in erhöhter Menge und Qualität zur Verfügung stehender Drucksachen<br />
mussten Lehrer nicht mehr selbst komponieren können, noch musste (oder<br />
konnte) es der Schüler bei einem solchen Lehrer lernen. Der Notendruck wurde präziser<br />
und ausführlicher, so dass die auf S. 20 erwähnten kognitiven Leistungen beim<br />
Notenspiel, das Anbringen von Korrekturen und das Entschlüsseln von Kürzeln, an<br />
Bedeutung verloren. Es war nicht mehr erforderlich, die vorliegenden Notentexte<br />
musikstrukturell nachzuvollziehen. Im Vertrauen auf Richtigkeit und Vollständigkeit<br />
des Textes konnte nun Note für Note wiedergegeben werden.<br />
Auf dieser Grundlage etablierte sich, veränderten gesellschaftlichen Bedingungen<br />
Rechnung tragend, ein zunehmend breitenorientierter Klavierunterricht. Der zeitliche<br />
Aufwand pro Schüler konnte reduziert werden, und ein Großteil des Lernens<br />
fand nun selbstständig anhand gedruckter Publikationen statt. Eine Reduktion des<br />
Unterrichtsaufwandes von etwa einer Stunde täglich (TÜRK, BEETHOVEN, vgl. S. 37)
auf eine Stunde wöchentlich (professionelle Ausbildung vor etwa 100 Jahren wie<br />
heute) entspricht einer Rationalisierung um etwa den Faktor sechs; nimmt man die<br />
Äußerung von PHILIPP DAVID KRÄUTER über die Unterweisung bei J. S. BACH (vgl.<br />
S. 17) wörtlich, ergibt sich sogar eine Rationalisierung um den Faktor fünfzig!<br />
CARL CZERNY nutzte als einer der Ersten die neuen technologischen Möglichkeiten<br />
intensiv. Er begann, bändeweise Passagen und Sätzchen zu fixieren, um einerseits<br />
im eigenen Unterricht schnell darauf zugreifen zu können, aber auch, um sie der<br />
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das umfangreiche Etüden-Schaffen CARL<br />
CZERNYS steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den neuen drucktechnischen<br />
Möglichkeiten, die in mehrfacher Hinsicht eine neue Dimension der Musikvermittlung<br />
versprachen. War bis dahin der persönliche Kontakt zu einem Lehrmeister die<br />
einzige Möglichkeit gewesen, sich in die Geheimnisse der Virtuosität einweisen zu<br />
lassen, so erschien es nun als völlig neue Chance, durch den Erwerb z.B.<br />
CZERNYscher Studienwerke sich diesen Einblick selbstständig zu verschaffen. 5 Der<br />
besondere Ruf CZERNYS als Schüler BEETHOVENS und Lehrer LISZTS tat ein Übriges,<br />
dass die Verleger ihm seine Etüdensammlungen gleichsam aus den Händen rissen<br />
(vgl. CZERNY 1968, 26f.). Man kann es CARL CZERNY nicht verübeln, dass er<br />
dieser unersättlichen Nachfrage (vgl. JANSEN 1991, 67) durch Produktion immer<br />
neuer Bände von Etüden nachkam und sich auf diese Weise eine materielle Grundlage<br />
schuf, die es ihm ermöglichte, seine Unterrichtstätigkeit zu reduzieren und<br />
letztlich ganz aufzugeben. 6<br />
Die Drucklegung von musikalisch-technischen Beispielen in Form von Sätzchen<br />
und Etüden hatte allerdings folgenschwere Konsequenzen: Sie machte die musiksprachlichen<br />
Bestandteile des damals aktuellen Stils, wie sie auf S. 28ff. dargestellt<br />
und bis dahin als lebendige Musiksprache und veränderliche Beispiele weitgehend<br />
mündlich tradiert worden waren, vermeintlich zu feststehenden Werken. Die Käufer<br />
CZERNYscher Etüden nutzten die Übungsstücke jedenfalls nicht mehr als musiksprachliche<br />
Muster und Anregung zum Selbsterfinden, sondern als feststehende<br />
Kompositionen, mit denen sie genauso streng verfuhren wie etwa mit dem Notentext<br />
5 Sogar der Selbstunterricht anhand gedruckter Medien schien nun möglich zu werden. ADOLPH<br />
KULLAK berichtet diesbezüglich in seiner Ästhetik des Klavierspiels über die Klavierschule von<br />
J. P. MILCHMEYER aus dem Jahr 1797. Diese erhob den Anspruch, eine Anleitung zu geben, "[...]<br />
wie man das Pianoforte [...] ohne Meister spielen lernen könne." (KULLAK 1861/1916, 70).<br />
6 CZERNY berichtet in seinen Erinnerungen über seine exzessive Unterrichtstätigkeit aus dem Jahr<br />
1816: "Damals gab ich in der Regel elf bis zwölf Lektionen täglich, von acht Uhr früh bis acht<br />
Uhr abends, und unterrichtete bei dem höchsten Adel und in den ersten Familien Wiens. Diese<br />
einträgliche, aber auch höchst anstrengende und meine Gesundheit in Anspruch nehmende Beschäftigung<br />
dauerte durch mehr als zwanzig Jahre bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Unterrichtgeben<br />
(1836) gänzlich aufgab." (CZERNY 1968, 25)<br />
39
einer Sonate BEETHOVENS. Schließlich war inzwischen das Meistern vorgegebener<br />
Schwierigkeiten und die Bewältigung aller vom Komponisten notierten Vorgaben<br />
zum Ziel der Musikausübung geworden.<br />
Durch die Drucklegung geriet jedenfalls der ursprüngliche Zweck der Übungen aus<br />
dem Passagen- und Sätzchen-Spiel als technische und musikalische Beispiele in den<br />
Hintergrund. Vielfalt und Menge der produzierten Etüden machte die eigene Erfindung<br />
durch Variation und Improvisation auf der Grundlage von musiksprachlichen<br />
Elementen überflüssig: Alle Eventualitäten pianistischer Bewegungsausführung<br />
(diese wird nun unter der Bezeichnung "Technik" erstmals zum getrennt ausgewiesenen<br />
Problem!) wurden von CZERNY bedient. Auch die zunehmende Trennung der<br />
Ausführung von der Komposition und damit die Verlagerung des Interesses auf Interpretation<br />
als vordringliches Ziel des Klavierunterrichts führte dazu, dass Komposition<br />
und Improvisation zunehmend aus dem Blickfeld musikalischer Ausbildung<br />
und Betätigung gerieten.<br />
Wo aber die Interpretation von Komposition und Improvisation getrennt war, dort<br />
vollzog sich die Spaltung in "technische" und "musikalische" Aspekte des Musizierens.<br />
Beherrschung pianistischer "Technik" wurde zur Voraussetzung für musikalische<br />
Ausdrucksfähigkeit und das Spiel von Übungsstücken zur Schaffung dieser<br />
Voraussetzung unverzichtbarer Bestandteil des Klavier-Übens.<br />
Aus der Sicht ihrer Entstehungsgeschichte stellt damit das Schicksal der Etüden<br />
CARL CZERNYS ein typisches Beispiel für eine fehlgeleitete Medienanwendung dar,<br />
und für den Autor wurde der schnelle Erfolg seiner Produkte zum Stigma, das ihm<br />
bis heute anhaftet. CZERNY selbst bedauerte gegen Ende seines Lebens, den Wünschen<br />
der Verleger nach immer neuen Etüden zu oft nachgekommen zu sein, verblasste<br />
doch sein umfangreiches Werk von über 800 Opera vor dem Erfolg seiner<br />
"nur" ca. 70 Etüdenbände. Kurz vor seinem Tod schrieb er diesbezüglich an den<br />
Verleger ANDRÉ:<br />
40<br />
"Geehrter Herr und Freund,<br />
Schon vor ungefähr 8 Jahren hatte ich Herrn Schlesinger eine von ihm bestellte<br />
Sammlung von Etüden jeder Gattung zugesagt und er dieselbe auch nach und<br />
nach im Laufe der Jahre erhalten. [...] Auch schrieb ich Ihnen, wie schwer es<br />
ist, in dieser beschränkten Form etwas neues und hübsches zu finden, und wie<br />
höchst zuwider mir dieses Fabrizieren von solchen Kindereyen ist, da dergleichen<br />
für meinen Künstlerberuf sehr nachtheilig seyn kann. Durch ernste Compositionen,<br />
denen ich jetzt seit Jahren meine Zeit widme /: Quartette, Sinfonien,<br />
Kirchenwerke etc. :/ hoffe ich, wenn mir Gott noch so langes Leben<br />
schenkt, diesen Fehler wieder zu verbessern, den ich immer nur aus Gefälligkeit<br />
gegen die Herrn Verleger beging, und der auch schuld ist, daß das Ausland
sich mit dem bloßen Nachdruck dieser Kleinigkeiten begnügt." (zit. nach<br />
WEHMEYER 1983, 83f.)<br />
Mit der Trennung der Ausführung von der Produktion im Verlauf des 19. Jahrhunderts<br />
entstand eine veränderte Arbeitshaltung: Der Sinn der Übung als Selbstzweck<br />
wurde ersetzt durch den neuen der vorbereitenden Übung. Damit vollzog sich ein<br />
grundlegender Bedeutungswandel des Begriffs Üben. 7 Im 18. Jahrhundert hatte die<br />
Clavierübung noch für die gesamte Ausübung der Kunst am Instrument gestanden.<br />
Im Geist jener Zeit, die noch nicht trennte zwischen einem musikalischen Gedanken<br />
und seiner Ausführung, wäre es sinnlos erschienen, technische Probleme der Ausführung<br />
separat zu betrachten: Hier waren die Begriffe Üben und Ausüben noch<br />
Synonyme: Übung war jede Beschäftigung mit dem Instrument, jedes Spiel, unabhängig<br />
vom Niveau: vom Anfänger bis zum Meister, der Vortrag inbegriffen.<br />
ISABELLA AMSTER wies in einem Aufsatz über die Klavierübung im Alltag des Musizierens<br />
auf die Allgemeingültigkeit des Begriffes Clavierübung hin, die sich auch<br />
lexikologisch untermauern lässt:<br />
"Daher sucht man auch vergebens in den Lexica und theoretischen Schriften<br />
allgemeinen oder klavierpädagogischen Charakters dieser Zeit nach einer genauen<br />
Definition von 'Klavierübung'. Sie ist keine bestimmte Form, umfaßt<br />
vielmehr alle in der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts üblichen Formgattungen:<br />
Suiten, Fugen, Ricercare, Chaconne, Variationen, Sonaten usw. Da diese Formen<br />
den Umkreis des täglichen Musizierens ausmachten, so war eben jedes<br />
Musizieren am Klavier eine Klavier-Übung. Solche 'Übungen' bildeten also<br />
nicht eine Vorbereitung für einen außerhalb des täglichen häuslichen Musizierens<br />
liegenden Zweck repräsentativer Art (wie Vortrag im Konzertsaal), sondern<br />
waren Stoff für eine allgemein-musikalische Betätigung des Spielers mit<br />
besonderer sachgemäßer Berücksichtigung seines Instrumentes." (AMSTER<br />
1930, 173f.)<br />
Als Beispiel für eine solche Übung im ursprünglichen Sinn sei die Clavier-Übung,<br />
IV. Teil von JOHANN SEBASTIAN BACH angeführt, bekannt als Goldberg-Variationen:<br />
7 Eine grundlegende Abhandlung zum Begriff des (nicht nur musikalischen) Übens liegt von OTTO<br />
FRIEDRICH BOLLNOW (1991) vor.<br />
41
Abb. 8: Titelblatt der Erstausgabe der Clavier-Übung, IV. Teil (Goldberg-Variationen)<br />
von JOHANN SEBASTIAN BACH.<br />
Am Beispiel des Wohltemperierten Klaviers formuliert ISABELLA AMSTER diese<br />
Einheit von Denken und Spielen folgendermaßen:<br />
42<br />
"Das Technische erscheint hier in einer musikalischen, geschlossenen Form,<br />
technische Prinzipien und musikalische Gestaltung fallen zusammen."<br />
(AMSTER 1930, 173)<br />
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts vollzog sich die Spaltung der Clavier-Übung in<br />
Technik und Interpretation. Damit gewann der Begriff Üben eine neue Bedeutung<br />
im Sinne vorbereitender Übung. Im Geist des 18. Jahrhunderts würde das Sprichwort<br />
"Übung macht den Meister" etwa bedeuten: "Ständige Betätigung in der<br />
Kunstausübung und Beschäftigung mit der Musik ergibt kontinuierliche Verbesserung<br />
durch Lernen." In der neuen Bedeutung des 19. Jahrhunderts bekommt das
Wort jenen negativen Beigeschmack, den es vielfach noch heute besitzt, wenn etwa<br />
unter Musikern der Satz fällt: "Ich muss üben." "Übung macht den Meister" bedeutet<br />
nun: "Fleiß und Entbehrungen liegen auf dem Weg zur Meisterschaft."<br />
Aus den beiden Klassen musikbezogener Medien des 18. Jahrhunderts, Clavierschule<br />
als theoretische Abhandlung in verbaler Form und Clavierübung in Notenform,<br />
wurden vier: Aus den Clavierschulen des 18. Jahrhunderts ging einerseits die<br />
so genannte Praktikerliteratur 8 hervor, die theoretische Betrachtungen über das Klavierspiel<br />
beinhaltet und sich mit der künstlerischen und technischen Problemlösung<br />
der Interpretation befasst. Sie besteht vorwiegend aus verbalem Text und spielt bis<br />
heute in der Ausbildung von Instrumentalpädagogen eine wichtige Rolle. Der Terminus<br />
Klavierschule andererseits wurde im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts<br />
mit völlig neuem Inhalt gefüllt und bezeichnet seitdem ein Unterrichtsmedium, das<br />
sukzessive im Schwierigkeitsgrad ansteigende Spielstücke für Anfänger enthält.<br />
Die Clavierübung als Sammelbegriff für die ausübende Praxis des 18. Jahrhunderts<br />
spaltete sich auf in Werke, deren Interpretation Ziel aller Bemühungen wurde und<br />
hierauf vorbereitende Übungen (vgl. AMSTER 1930, 174). Dabei entstand eine neue<br />
musikalische Gattung: die Etüde (vgl. AUGUSTINI 1986). Deren erste Exemplare<br />
erschienen im Jahr 1804 in Form der Études pour le pianoforte en 42 exercices...<br />
von JOHANN BAPTIST CRAMER. Beispielhaft für die neue Bedeutung der vorbereitenden<br />
Übung bzw. Etüde sei hier der Artikel Essercizi aus Dizionario e Bibliografia<br />
della Musica, erschienen in Mailand 1826, zitiert, den ISABELLA AMSTER folgendermaßen<br />
übersetzte:<br />
"Es sind Musikstücke, komponiert für eine technische Schwierigkeit der<br />
Stimme, für eine besondere und schwierige Art, das Instrument zu spielen,<br />
welche sich auf alle Stufen der Tonleiter und auf alle Lagen erstreckt... Da die<br />
Übungen nur zum Studium im Zimmer bestimmt sind, um den Schüler mit den<br />
Schwierigkeiten aller Art in den Arbeiten berühmter Komponisten vertraut zu<br />
machen, so gebe man sich keine Mühe, sie angenehm fürs Ohr zu machen<br />
[...]." (AMSTER 1930, 174)<br />
Der Hinweis auf die sekundäre Rolle des Ohres bei einer musikbezogenen Tätigkeit<br />
wäre noch wenige Jahrzehnte zuvor als absurd abgetan worden und kennzeichnet<br />
einen entscheidenden Wandel der Kommunikationsebene: die Abkehr von der Unterhaltungsfunktion<br />
des Musikers (vgl. WÖRNER 1993, 454), von dem Primat der<br />
"Ergötzung" des Publikums unter alleiniger Referenz des Klangeindrucks und statt<br />
dessen die Hinwendung zur Betrachtung spieltechnischer Probleme bei der Übertra-<br />
8 Zum Begriff vgl. SCHMIDT-BRUNNER (1982, 15).<br />
43
gung von Notentexten auf die Klaviatur. Damit verlagerte sich die primäre Kommunikationsebene<br />
von der Dimension Musiker - Publikum in die Richtung Musiker -<br />
Instrument oder (im günstigeren Fall) Musiker - Werk bzw. Musiker - Geist des<br />
Komponisten. Die Berücksichtigung aller im Notentext vorgegebenen Vorschriften<br />
kann dabei unter ungünstigen Umständen bei der Wiedergabe von Werken die Aufmerksamkeit<br />
des Ausführenden derart absorbieren, dass das Klangergebnis auch bei<br />
der Interpretation sekundär wird. Obwohl seine Produkte zunehmend zu Opfern einer<br />
derartigen Behandlung wurden, muss betont werden, dass für CARL CZERNY<br />
selbst der erste Rang der Klanggestaltung nicht in Frage stand:<br />
44<br />
"Das wichtigste Mittel, um auch solche Passagen angenehm zu machen, die<br />
hart, überladen, misstönend scheinen, ist: die Schönheit des Tons: [...] Es ist<br />
damit so, wie im Sprechen, wo eine rauhe polternde Stimme auch den besonnensten<br />
Ausdruck beleidigend machen kann, während dagegen die bescheidene,<br />
ruhig sanfte Aussprache selbst jene Worte mildern kann, die sonst verletzend<br />
sein würden" (CZERNY 1839, Bd.3, 53f., zit. nach GELLRICH 1992, 135)<br />
Die Verlagerung des Interesses auf die originalgetreue Bewältigung von Musikwerken<br />
in Form von Notentexten steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Etablierung<br />
der Klassik. Das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewachsene historische<br />
Bewusstsein (vgl. RICHTER 1997, 79) hatte, wie THOMAS NIPPERDEY betont,<br />
auch Auswirkungen auf die Künste:<br />
"Als die Künste bürgerlich wurden, ist die Bildung dieser Bürger gleichzeitig<br />
historisch geworden, und diese Historisierung greift auch auf die Künste aus.<br />
Vergangene Kunst wird in bisher noch nie dagewesener Weise neben der gegenwärtigen<br />
Kunst präsent, gleichberechtigt oder gar übermächtig."<br />
(NIPPERDEY 1988, 38)<br />
Damit gewann Komposition zunehmend den Anspruch, bleibende Werke zu schaffen.<br />
Die neue Aufmerksamkeit, mit der nun im Sinne dieses überzeitlichen Anspruchs<br />
auch Werke der Vergangenheit bedacht wurden, manifestiert sich in der<br />
Wiederentdeckung der Kompositionen JOHANN SEBASTIAN BACHS, symbolisiert<br />
durch die Wiederaufführung der Matthäus-Passion durch FELIX MENDELSSOHN-<br />
BARTHOLDY im Jahr 1829. Die Sammlung bedeutender Werke der Vergangenheit<br />
ergibt den Begriff der Klassik. Aus der Tatsache, dass dieser Begriff heute zwei verschiedene<br />
Bedeutungen, eine engere und eine weitere besitzt, lässt sich rekonstruieren,<br />
dass er nach dem Ende der klassischen Epoche im engeren Sinn entstanden sein
muss – eben als beide Bedeutungen noch vereint waren. 9 Die Tatsache, dass der<br />
weitere Begriff der Klassik bis heute den gesamten Komplex der "E-Musik" umfasst<br />
(jedenfalls ist es nicht unüblich, beispielsweise ein Werk STRAWINSKYS als klassische<br />
Musik zu bezeichnen), deutet darauf hin, dass mit der Etablierung der Klassik<br />
am Ende der klassischen Epoche im engeren Sinn gleichzeitig mit einer neuen Musikauffassung<br />
eine neue Musikgattung geschaffen wurde. Zu deren Charakteristika<br />
gehört der Anspruch, sich in überzeitlicher Perspektive mit den zu Klassikern verdichteten<br />
Kunstgrößen der Vergangenheit zu messen. In der Praxis dieser "ernsten<br />
Musik" (vgl. WÖRNER 1993, 454) gerieten "unterhaltende" Elemente in den Hintergrund,<br />
und die Musikausübung wurde allmählich zu einem transzendenten Akt der<br />
Kommunikation des Interpreten mit dem Geist des Komponisten, dem die Zuhörer<br />
im zum "Kunsttempel" gewordenen Konzertsaal schweigend beiwohnen durften.<br />
THOMAS NIPPERDEY bemerkt zu diesem Prozess der Mystifizierung der Kunst in<br />
jener Epoche:<br />
"Die Künstler sind Heilige und Märtyrer, sind wie Beethoven (im späten 19.<br />
Jahrhundert) Prometheus und Prophet, Verkünder des heroischen Evangeliums<br />
von Leid und Überwindung. Die Sprache des Quasi-Religiösen ist im Nachhinein<br />
oft fremd und mit ihrem schwülstigen Pathos oft unerträglich [...].<br />
Philosophisch gesprochen: Kunst transzendiert die Welt und ist insofern ein<br />
Stück Transzendenz. [...] Kunst hat es mit der Wahrheit zu tun, sie präsentiert<br />
Wahrheit und Sinn im Symbol für das Gefühl, sie vermittelt noch – das Ganze.<br />
[...] Der Künstler triumphiert gegenüber dem Konkurrenten, der Anspruch auf<br />
das Erbe der Religion erhebt, dem Wissenschaftler, weil er nicht der reinen<br />
Intellektualität verschrieben ist und vor allem nicht der Spezialisierung durch<br />
Fachleute." (NIPPERDEY 1988, 25f.)<br />
Die Kunstausübung verlor als Folge der Historisierung ihre Unbefangenheit, wurde<br />
gleichsam "erwachsen" und damit erstmals "problematisch". Indem nämlich "das<br />
Klassische [...] auf den Sockel gestellt" wird "oder in die Vitrine" (NIPPERDEY 1988,<br />
53), kann Musikausübung zum Problem werden:<br />
"Umgang mit Kunst steht im Schatten der Vergangenheit und ist schon dadurch<br />
pluralisiert. Damit rückt aber auch die gegenwärtige Kunst und der Umgang<br />
mit ihr in eben diesen langen Schatten der Vergangenheit. Das Verhältnis<br />
zur Tradition, ihrer Macht und Übermacht, wird zum existentiellen Problem."<br />
(NIPPERDEY 1988, 39)<br />
9 Dieser Zusammenhang bestätigt sich bei der Betrachtung der auf S. 53f zitierten Bemerkung<br />
ANTON SCHINDLERS zur "classischen" Epoche in seiner zwischen 1835 und 1840 in Aachen entstandenen<br />
Beethoven-Biographie.<br />
45
Diese Problematisierung schuf die Grundlage für den Siegeszug der Instrumentalpädagogik.<br />
Letztere bot ihre Dienstleistung als Schlüssel zur Lösung dieser Probleme<br />
an und profitierte so von der Verlagerung auf die kunstreligiöse, fast "esoterische"<br />
in jedem Fall aber scheinbar nur für "Eingeweihte" zugängliche Ebene. Bis<br />
heute bezieht die Instrumentalpädagogik aus dem Exklusivanspruch auf diese<br />
"Weihe" ihr Existenzrecht. Dies – und die Abkehr von der Kommunikation mit dem<br />
Publikum als oberster Instanz allen Musizierens – ermöglichte in Verbindung mit<br />
der Entmündigung des Ohrs allerdings auch die Erfolgsgeschichte des Dilettantismus.<br />
2.2.2 Die Geschichte des Dilettantismus<br />
Im 19. Jahrhundert wurde das Klavierspiel enorm populär (vgl. BALLSTAEDT &<br />
WIDMAIER 1989). Die neuen medialen Möglichkeiten, aber auch verbesserte Herstellungsverfahren<br />
im Instrumentenbau, die das Klavier erschwinglich machten (vgl.<br />
WEBER 1921/1972, 76), trugen dazu bei, dass dieses zum beliebtesten Musikinstrument<br />
des 19. Jahrhunderts wurde; eine Erfolgsgeschichte, die bis in die Gegenwart<br />
ausstrahlt. JOHANNES JANSEN bemerkt dazu:<br />
46<br />
"Das einstige Luxusgut, ein Spielzeug der Reichen, war erschwinglich geworden.<br />
Bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte es zum festen Inventar<br />
eines 'besseren' Hauses. Durch das Klavier nahm das Bürgertum in einer nie<br />
dagewesenen Breite an der Musikentwicklung teil. Aber Klavierspielen gehörte<br />
nicht nur zum guten Ton, es wurde zur Leidenschaft – und die Pianomanie<br />
zur Begleiterscheinung der industriellen Revolution." (JANSEN 1991, 67)<br />
Dass dieser Aufschwung die gesamte westliche Welt erfasste, davon zeugen unter<br />
anderem die Produktions- und Verkaufszahlen für Klaviere in verschiedenen Regionen.<br />
FOLKE AUGUSTINI nennt die folgenden Herstellungszahlen der Klavier-Fabriken<br />
in England, den Vereinigten Staaten und Deutschland:<br />
"1802 fabrizierte Broadwood in England 400 Klaviere, 1825 bereits <strong>1.</strong>500 Instrumente<br />
pro Jahr. In den Vereinigten Staaten bestanden 1860 vier große Klavierbauwerke<br />
[...] mit einer gemeinsamen Jahresproduktion von etwa 15.000<br />
bis 20.000 Klavieren pro Jahr. 1889 bauten in Deutschland circa 380 Firmen<br />
ungefähr 70.000 Instrumente." (AUGUSTINI 1986, 56)
Aus dem weiteren Verlauf der Arbeit von AUGUSTINI (1986, 56) geht eine zusätzliche<br />
Vervielfachung der Produktion auf 170.000 Instrumente allein in Deutschland<br />
im Jahr 1905 hervor. Um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert war schließlich,<br />
wie OSCAR BIE in seinem Buch Das Klavier und seine Meister bemerkt, eine klavierlose<br />
Wohnung kaum noch vorstellbar:<br />
"Das Klavier ist ein Lebensfaktor geworden. Diejenigen, welche nicht Klavier<br />
spielen, stehen heute ausserhalb einer grossen Gemeinschaft, die dies Hausmittel<br />
der Musik kultiviert. In klavierlosen Wohnungen scheint eine fremde<br />
Atmosphäre zu sein." (BIE 1901, 280f.)<br />
Diese beeindruckende Erfolgsgeschichte des Klavierspiels im Verlauf des 19. Jahrhunderts<br />
wurde begünstigt durch mehrere Faktoren.<br />
Das Klavier in Verbindung mit dem Print-Medium bot erstmals in der Geschichte<br />
eine mit relativ geringem Aufwand praktizierbare Möglichkeit der häuslichen Wiedergabe<br />
komplexerer Arten von Musik durch eine Einzelperson. Vor der Erfindung<br />
von mechanischer Tonaufzeichnung (im Jahr 1887) und Rundfunk (in den zwanziger<br />
Jahren des 20. Jahrhunderts) war Hausmusik die einzige Möglichkeit des Musikkonsums<br />
im bürgerlichen Heim. Das Klavier hatte dank konstruktiver Verbesserungen<br />
eine ausreichende Stabilität und großes klangliches Volumen erreicht. So<br />
wurden mit der Erfindung der doppelten Auslösung durch die Brüder Erard und deren<br />
Patentierung im Jahre 1821, mit der Einführung des gusseisernen Rahmens zur<br />
Stabilisierung der erhöhten Saitenspannung, der Kreuzbesaitung und der Befilzung<br />
der Hämmer entscheidende Verbesserungen geschaffen, bis sich in der zweiten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Entwicklung des Klaviers in die Form, die noch<br />
heute besteht, weitgehend vollzog (vgl. PALMIERI 1989, 245ff.). Der Wunsch, Instrumentalmusik<br />
zu hören, dessen Erfüllung bis dahin einen aufwändigen Konzertbesuch,<br />
zumindest aber (bei kammermusikalischer Hausmusik) ein entsprechendes<br />
Ensemble erforderlich gemacht hatte, ließ sich nun leichter erfüllen. Auch um<br />
Werke der Symphonik kennenzulernen, war das Klavier, insbesondere beim vierhändigen<br />
Spiel, durchaus geeignet. Wie sehr die Verklanglichung auch von Werken,<br />
die eigentlich für Orchester oder Kammermusikensembles komponiert waren, vor<br />
Erfindung der Schallaufzeichnung zu den Aufgaben des Klaviers gehörte, lässt sich<br />
unter anderem der großen Zahl von Klavierauszügen entnehmen, die im 19. Jahrhundert<br />
den Markt überschwemmten.<br />
Ein weiterer Faktor, der die Verbreitung des Klavierspiels begünstigte, liegt im besonderen<br />
Ansehen des Virtuosentums begründet. Das transzendente Image von<br />
Kunst und die Rolle der Virtuosen als Idole lösten eine Welle der Begeisterung für<br />
das Klavierspiel aus. Das aktive Klavierspiel barg für viele ehrgeizige jungen Men-<br />
47
schen des 19. Jahrhunderts die Hoffnung, vielleicht irgendwann selbst einmal zu<br />
Virtuosen zu werden und damit die eigene Existenz zu transzendieren. War das 18.<br />
Jahrhundert noch geprägt von einer festen Weltordnung und der gesellschaftliche<br />
Stand in jener Zeit noch weitgehend unverrückbar gewesen, so bot das 19. Jahrhundert<br />
erstmals die Möglichkeit sozialen Aufstiegs für breitere Bevölkerungskreise<br />
und damit die Versuchung, durch eigene Leistung einen Hauch göttlicher Aura zu<br />
erlangen. Nachdem die Standesschranken gefallen waren, schien der Traum in greifbarer<br />
Nähe, durch eigene Leistung auf dem Instrument gesellschaftliche und materielle<br />
Schranken zu sprengen, wie es PAGANINI und LISZT vorgemacht hatten. Ein besonderer<br />
Reiz ergab sich im Kontext der angestrebten Transzendenz aus dem bis<br />
heute ungebrochenen Spannungsverhältnis zwischen Veranlagung und Fleiß. Die<br />
Stellung der Virtuosen reichte in eine quasi überirdische Sphäre hinein, die bis dahin<br />
nur qua Geburt erreichbar gewesen war. War nicht dieser Zustand der Transzendenz<br />
im Bereich der Musik insgeheim doch durch hervorragenden Einsatz zu erreichen?<br />
Oder bedurfte es erst des Fleißes, um eine möglicherweise angeborene Begabung<br />
wirksam werden zu lassen? Gerade weil musikalische Begabung im Bild des fortgeschrittenen<br />
19. Jahrhunderts von einer besonderen genetischen Prädestination, ja in<br />
ihrer Transzendenz geradezu von neuem Adel zu zeugen schien, war es besonders<br />
reizvoll, seine eigenen Möglichkeiten und damit insgeheim seine eigene Auserwähltheit<br />
durch intensive Betätigung am Klavier auszutesten.<br />
Dass das Klavier bei diesen Bemühungen vor anderen Instrumenten bevorzugt<br />
wurde, resultiert auch aus seiner maschinellen Machart. Es entspricht dem Zeitgeist<br />
der industriellen Revolution, indem es durch konstruktiven Aufwand den Geist der<br />
Rationalisierung, welcher in Gestalt allgegenwärtiger Technifizierung das Leben<br />
bereits erheblich erleichtert hatte, auch auf das Musizieren anwendbar machte. Die<br />
Möglichkeit der Wiedergabe einer Symphonie durch eine einzige Person, die dank<br />
des zudem vorab geleisteten Arrangements nicht mehr im Partiturspiel ausgebildet<br />
zu sein brauchte, kann in diesem Zusammenhang (trotz unbestreitbarer Abstriche im<br />
klanglichen Bereich) als wesentlicher Rationalisierungserfolg gewertet werden.<br />
FOLKE AUGUSTINI macht auf das typische Leistungsdenken jener Zeit aufmerksam,<br />
aus dem heraus Virtuosentum angestrebt wurde, und stellt den Zusammenhang zur<br />
Rezeption der Werke CARL CZERNYS im Geist der Industrialisierung her:<br />
48<br />
"So wirkten die vielen Pianisten als Vorbilder für die große Menge der Laien,<br />
die sich nun ihrerseits auch musikalisch betätigen wollten. Daß es möglich ist,<br />
auch ohne Genialität und überragende Begabung einige Fertigkeit auf dem<br />
Klavier zu erlangen, hatte Carl Czerny gezeigt. [...] Dazu kommt dann noch die<br />
Tatsache, daß das Klavier aufgrund seiner überwiegend technischen Konzeption<br />
für Laien leichter zugänglich ist als Instrumente, deren Töne nicht durch
einen ausgebildeten Stimmer vorgegeben sind, wie die Streich- und Blasinstrumente,<br />
bei denen das Gehör eine große Rolle spielt; und hatte denn nicht<br />
auch Arbeit zu den Fortschritten und Errungenschaften des täglichen Lebens<br />
geführt?" (AUGUSTINI 1986, 57)<br />
Eine umfassende musikalische Ausbildung, wie sie zu Zeiten der Einheit von Komposition<br />
und Ausführung die Norm gewesen war, schien in diesem Streben nicht<br />
erforderlich, ja unter der Prämisse eines möglichst rationellen Lernens sogar eher<br />
hinderlich, denn die vorzutragenden Werke lagen in Form von Notentexten bereits<br />
fest. Im Geist der Rationalisierung war es nur konsequent, die Quantität und Geschwindigkeit<br />
der zu leistenden Tastenbewegungen durch körperliches Training bis<br />
zur Virtuosität zu steigern zu suchen.<br />
Im Bemühen, das inzwischen als einzig erstrebenswert erachtete Ziel der Interpretation<br />
von Meisterwerken zu erreichen, musste CZERNY missverstanden werden. Es<br />
musste nun als Zeitverschwendung erscheinen, beim Üben weiterhin durch Passagen-<br />
und Sätzchen-Spiel eigene musikalische "Gedanken" zu entwickeln. Die bereits<br />
vollbrachte Vorleistung CARL CZERNYS wurde, ähnlich wie die konstruktiven Vorleistungen<br />
der Klavierbauer mit dem Ziel einer möglichst einfach bedienbaren und<br />
trotzdem variablen Tonerzeugung, zu diesem Zweck gern in Anspruch genommen.<br />
Die Kosten für die Notenbände mit seinen Etüden schienen durch den Mehrwert rationelleren<br />
Übens und dadurch schnelleren Fortkommens mehr als ausgeglichen zu<br />
werden. Diesem Missverständnis erlag auch ADOLPH KULLAK in seiner Ästhetik des<br />
Klavierspiels, einem typischen und dem wohl bedeutendsten Beispiel für Praktikerliteratur<br />
des 19. Jahrhunderts. Er propagiert das zielgerichtete Studium anhand<br />
CZERNYscher Werke und erklärt die hohe Beliebtheit CZERNYS in der zweiten Jahrhunderthälfte:<br />
"Das Czernysche Prinzip bestand darin, in den Etüden den Geist möglichst<br />
wenig auf irgendeinen tieferen Inhalt abzuleiten, es sollte die Mechanik ausschliesslich<br />
im Vordergrunde des Interesses bleiben; dieser für das Praktische<br />
sehr ergiebige Standpunkt hat denn auch manchen Werken eine unbedingte<br />
Popularität eingetragen." (KULLAK 1876/1994, 96)<br />
In der Auflage von 1916, die von WALTER NIEMANN bearbeitet wurde, sind Ergänzungen<br />
zu finden, die die Formulierungen KULLAKS noch verschärfen. So lautet das<br />
letzte Zitat in der Auflage von 1916 (die Ergänzung ist kursiv gedruckt):<br />
"Das Czernysche Prinzip bestand darin, in den Etüden den Geist möglichst<br />
wenig auf irgendeinen tieferen Inhalt abzuleiten, durch Hinwegräumen von<br />
allem nur irgendwie geistig Erschwerendem zu flüssigem, raschen Spielen ge-<br />
49
50<br />
radezu zu zwingen; es sollte die Mechanik ausschliesslich im Vordergrunde<br />
des Interesses bleiben; dieser für das Praktische sehr ergiebige Standpunkt hat<br />
denn auch manchen Werken eine unbedingte Popularität eingetragen."<br />
(KULLAK 1861/1916, 98)<br />
Noch schärfer formuliert KULLAK sein reduziertes Verständnis CZERNYS, wo er die<br />
ältere Methode HUMMELS kritisiert und diese der seiner Meinung nach besseren,<br />
weil rationelleren Methode CZERNYS gegenüberstellt. Das dabei von ihm benutzte<br />
Attribut "geistabtötend" wird nicht etwa als Nachteil gesehen, denn es geht seiner<br />
Auffassung nach ja nun beim Klavierspiel nur noch um Ausführung, nicht mehr um<br />
inhaltliches Schaffen:<br />
"Nur fehlt es Hummel noch an der praktischen Einsicht der Czerny'schen<br />
Lehrmethode, die auf kürzerem Wege die Mechanik zu bilden weiß, und in<br />
dieser Beziehung den ganzen neueren Fortschritt begründet hat. Hummel ist<br />
noch nicht Mechaniker genug, die Handbildung ist bei ihm noch nicht ein Erzeugnis<br />
rein technischer Arbeit geworden, aus welcher sie durch die zwar<br />
geistabtödtenden, aber schnell wirkenden [Hervorhebung von mir, H.K.] Mittel<br />
späterer Methodik als ein vollkommener Mechanismus hervorging."<br />
(KULLAK 1876/1994, 78)<br />
Aufgabe des ausführenden Musikers ist es damit, sichtbare mechanische Arbeit bei<br />
der Ausführung des Notentextes zu leisten. ADOLPH KULLAK schließt zwar, wie<br />
zumindest der Titel Ästhetik des Klavierspiels nahelegt, die musikalische Intention<br />
nicht aus, doch seine folgende Bemerkung lässt keine Zweifel darüber offen, dass<br />
für ihn die entscheidende Anforderung beim Klavierspiel auf einem anderen Gebiet<br />
liegt:<br />
"Die Mechanik ist die erste und unerlässlichste Bedingung des Klavierspieles.<br />
[...] Die Mechanik muss vollkommen sein; so wenig das geschickteste rhetorische<br />
Genie den Redner macht, wofern die Zunge stottert, schwerfällig, oder<br />
wohl gar der Sprache unmächtig ist, ebenso wenig macht das ausserordentlichste<br />
Verständnis aller Kompositionen oder die üppigste Fantasie den Klavierspieler,<br />
wenn es der Mechanik gebricht." (KULLAK 1876/1994, 122)<br />
Bemerkenswert und typisch für das Denken in der zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
ist dabei, dass KULLAK in der naheliegenden und häufig strapazierten Analogie<br />
Redner – Musiker die Redekunst primär an der mechanischen Beweglichkeit der<br />
Zunge festmacht. Stottern ist für ihn also ein mechanisches und kein psychologisches<br />
Problem!
Improvisation und Komposition haben dabei keinen Platz mehr in pianistischer<br />
Ausbildung und Betätigung:<br />
"Das Klavierspiel ist reproduzierende Kunst. Die Improvisation und Komposition<br />
auf dem Pianoforte unterliegen Regeln, welche in allgemeinere Gebiete<br />
des musikalisch Schönen hineinreichen."<br />
(KULLAK 1876/1994, 117)<br />
Auch hier präzisiert die Auflage von 1916 durch eine Ergänzung. Die Rede ist von<br />
der Ästhetik des Klavierspiels:<br />
"Ihr spezieller Kreis ist die Reproduktion dessen, was in einer ursprünglichen<br />
Tätigkeit der künstlerischen Kraft bereits voraus geschaffen ist." (KULLAK<br />
1916, 135f.)<br />
Die Idee der Rationalisierung forderte die Abtrennung alles Überflüssigen und die<br />
Konzentration auf das Wesentliche. Auch die zeitgenössischen Pianisten lieferten in<br />
ihrer Übepraxis Beispiele, die diese Trennung versinnbildlichen. OSCAR BIE berichtet<br />
diesbezüglich, wie EUGEN D'ALBERT<br />
"[...] sich mechanisch in Skalen übt, während er gleichzeitig neue Noten liest,<br />
oder wie Henselt Bach spielt, während er die Bibel liest [...]." (BIE 1901, 281)<br />
Als Folge der Beschränkung auf die Wiedergabe konnte jeder durch Vermittlung<br />
ausreichender Kenntnisse im Notenlesen und im Umgang mit der Klaviatur das Klavierspiel<br />
erlernen. Die so möglich gewordene Verbreitung des Musizierens auf der<br />
Grundlage von Liebhaberei begründete den Dilettantismus, dessen erste Vorboten<br />
sich bereits vor der Wende zum 19. Jahrhundert ankündigten (vgl. AMSTER 1930,<br />
174). Der Begriff Dilettant beinhaltete zunächst aber, ähnlich wie heute im Begriffspaar<br />
Profi – Amateur, keinerlei negativen Beigeschmack. So war es durchaus<br />
üblich, Dilettanten mit positiven Attributen zu versehen. Auch ADOLPH KULLAK<br />
berichtet noch von einem "vortrefflichen Dilettanten" (1916, 74). Die Abwertung<br />
des Dilettantismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts geht einher mit dem Scheitern<br />
der Bemühungen, auf dem Weg der Rationalisierung Virtuosität zu erreichen. Diese<br />
ungeeigneten Versuche in "Pseudo-Virtuosentum" wurden allmählich zum typischen<br />
Wesenszug von Dilettantismus und gaben diesen schließlich der Lächerlichkeit<br />
preis. In der folgenden Bemerkung aus dem Gründungsjahrgang 1878 der Zeitschrift<br />
Der Klavier-Lehrer deutet sich bereits ein Umkippen der Bedeutung von Dilettantismus<br />
ins Negative an:<br />
51
52<br />
"Da nun Jeder sich für befähigt hält, auf dem Pianoforte, diesem so leicht zugänglichen<br />
Instrumente, wenn nicht wie ein durchgebildeter Musiker, so doch<br />
mit einer gewissen künstlerischen Auffassung Werke unserer Tondichter wiederzugeben,<br />
so wird uns die fast epidemische Verbreitung des Klavierspiels<br />
erklärlich. Dem Umstande allein also, dass in der Musik der das Kunstwerk<br />
Ausführende nicht mit zum Handwerk zählt, sondern einen höheren Rang einnimmt<br />
wie in den bildenden Künsten, verdankt die Tonkunst im Felde der Reproduktion<br />
so viele berufene und unberufene Jünger; aus gleichem Grunde<br />
macht sich in keiner Kunst der Dilettantismus so breit, als in ihr.<br />
In keiner anderen Kunst auch ist der Lehrstand so stark vertreten, als in der<br />
Musik, da aber auch hier wieder dieselben Ursachen wirken, so wird auch in<br />
keinem zweiten Kunstgebiete von Lehrern so viel gesündigt, wie im musikalischen<br />
Felde. Klavierlehrer oder Klavierlehrerin glaubt heut zu Tage Jeder werden<br />
zu können, der mit oder ohne Talent einen gewissen Grad von Fingerfertigkeit<br />
sich erworben hat." (NAUMANN 1878, 105)<br />
Dass jene Rationalisierungsstrategien, die sich im Wirtschaftsleben als durchschlagend<br />
erfolgreich erwiesen hatten, auf dem Gebiet künstlerischer Betätigung ungeeignet<br />
sein könnten, hätte zu jener Zeit zwar vielleicht erahnt werden können, konkretisierte<br />
sich aber erst nach dem Zusammenbruch dieser positivistischen Denkweise<br />
um die Wende zum 20. Jahrhundert (vgl. Abschnitt 2.3). So verbreitete sich<br />
das Klavierspiel auf der Grundlage zumeist unreflektierter Nutzung gedruckter Medien<br />
unter Konzentration der Aufmerksamkeit auf die Bewegungsausführung. Hierdurch<br />
vergrößerte sich die Kluft zwischen Virtuosentum und Dilettantismus weiter<br />
(vgl. GELLRICH 1992, 44). Aus Sicht der älteren Handwerkstradition musste es in<br />
diesem Zusammenhang auch seltsam erscheinen, wenn die Praxis des Klavierspiels<br />
nun aus der ausschließlichen Wiedergabe von Stücken bestand, die selbst herzustellen<br />
die Ausführenden nicht im Entferntesten mehr in der Lage gewesen wären.<br />
Wenn dann noch – was sich im Laufe des Jahrhunderts zunehmend durchsetzte –<br />
auswendig gespielt und damit der Eindruck erweckt wurde, der Interpret gebe sich<br />
spontaner Eingebung hin, war, wie es GRETE WEHMEYER nennt, das "Talmi" perfekt:<br />
"Das 'Als ob', das Talmi, war perfekt: seit Czerny setzen die Instrumentalisten<br />
alles daran, des Virtuosenglanzes eines Liszt, eines Paganini, eines Thalberg<br />
teilhaftig zu werden. Sie 'arbeiten', schuften, werden von den Konservatorien<br />
trainiert, bis sie – oft – wie 'dressierte Pudel' sind; und dann verleugnet man<br />
das alles und versucht den Anschein von 'freier Improvisation' zu erwecken –<br />
wie Paganini oder Liszt." (WEHMEYER 1983, 180)
Bei derartigem Auswendigspiel handelte es sich keineswegs mehr um Musizieren im<br />
umfassenden Sinn, wie es von den alten Virtuosen noch aufgrund erworbener musikalisch-struktureller<br />
und auditiver Fähigkeiten praktiziert wurde, sondern um die<br />
Wiedergabe von Fall zu Fall und "Takt für Takt mit eisernem Willen" (WEHMEYER<br />
1983, 180) mühsam eingepaukter Notentexte. Dass aber die Grundlage der Virtuosität<br />
immer weniger vorhanden war, zeigt nicht zuletzt das vielfache Scheitern von<br />
Vortragsbemühungen, wenn anstatt von Souveränität und Freiheit dem Publikum<br />
der Eindruck von Nervosität und Unsicherheit im Behalten des Notentextes vermittelt<br />
wurde: Erscheinungen, die den Dilettantismus schließlich der Lächerlichkeit<br />
preisgaben.<br />
Was ANTON SCHINDLER in seiner BEETHOVEN-Biographie bezüglich der Medienanwendung<br />
für die Vermittlung der Kompositionslehre beklagt, ist ohne Einschränkung<br />
auch auf die Unterweisung im Klavierspiel übertragbar:<br />
"Die jetzige Generation der Componisten ersieht aus Vorstehendem, auf welchem<br />
Wege die Componisten der früheren Epoche, welche von der Kunstgeschichte<br />
die 'classische' genannt wird, die Kenntnis des naturgemäßen Gebrauches<br />
aller Instrumente übernommen hat, nämlich auf dem der m ü n d l i -<br />
c h e n U e b e r l i e f e r u n g , den man den practisch-empirischen nennt.<br />
Dies war der Weg, auf dem die sogenannte 'Kunst zu instrumentiren', das<br />
Kunst- H a n d w e r k überhaupt, wohl zwei Jahrhunderte hindurch gelehrt<br />
worden, wie es in allen andern schönen Künsten der Fall gewesen, uns bis zu<br />
diesem Tage noch ist. Sollte die Frage entstehen, welcher Weg wohl zu Erreichung<br />
solcher Kunstgeschicklichkeit der sichere und zweckmäßigere sey, der<br />
frühere, practisch-empirische, oder der nunmehr eingeschlagene vermittelst<br />
gedruckter Methoden [Hervorhebung von mir, H.K.], welche sich bis zu sclavischer<br />
Nachahmung gegebener Musterbeispiele, somit bis zur Schablone, verstiegen<br />
haben, um die Erfindungsgabe des Kunstjüngers im Keime schon,<br />
wenn nicht ganz zu tödten so doch sicher und gewiß nicht zu kräftigen, vielmehr<br />
träge zu machen; wir wiederholen, sollte eine derartige Frage gestellt<br />
werden, so entscheiden wir uns unbedingt für den Weg, den unsere Altvordern<br />
gegangen, weil er im analogen Verhältniß zu dem in andern Künsten steht, vor<br />
allem, weil er den Kunstjünger zu Selbstdenken auffordert und ihm die Sache<br />
nicht so leicht macht, als es vermittelst der bestehenden Methoden geschieht.<br />
Daß jener Weg nothwendig ein gedehnterer seyn müsse, als der moderne,<br />
macht ihn auch noch vorzuziehen, weil er dem Lernenden zu naturgemäßer<br />
Entwicklung aller intellectuellen Kräfte Zeit gelassen und keinerlei Sprünge<br />
gethan werden können." (SCHINDLER 1871/1970, Bd.1, 35f.)<br />
Die eigene Erfindung ging in der Praxis des Klavierspiels – auch in der Absicht der<br />
Vermeidung jenes "gedehnteren Weges" – bis zur Wende zum 20. Jahrhundert fast<br />
53
vollständig verloren, und die dem zu Grunde liegenden Missverständnisse wirken<br />
bis in die Gegenwart fort. Noch heute sind Noten-Ausgaben der Etüden CZERNYS<br />
beliebte Unterrichtsmedien, wobei ihre Behandlung kaum anders erfolgt als vor 100<br />
Jahren. Indiz für das unverändert bestehende Problem der Trennung von Denken<br />
und Spielen ist die widersprüchliche Praxis, CZERNYS Kompositionen einerseits abschätzig<br />
zu beurteilen, andererseits aber den Schülern als notwendiges Übel zur<br />
Technik-Schulung aufzubürden. Der Geist von Fleiß und Entbehrungen, von (oft<br />
nicht endenden) Durststrecken zur Schaffung vermeintlicher Voraussetzungen zum<br />
Musizieren hat sich im Klavierunterricht vielfach bis heute erhalten (vgl. S. 144).<br />
ULRICH MAHLERT verglich in einem Vortrag beim EPTA 10-Jahreskongreß 1995 die<br />
Czerny-Rezeption vor 100 Jahren mit der heutigen. Dabei zeigte er, wie wenig sich<br />
die Anwendung Czernyscher Studienwerke im Klavierunterricht seitdem geändert<br />
hat. MAHLERT zitiert zunächst einen Text EDUARD HANSLICKS aus dem Jahr 1892:<br />
54<br />
"'Man spricht selten mehr von Czerny, und wenn es geschieht, mit einer Art<br />
Herablassung. Und doch spielen in diesem Augenblick hunderte von Schülern<br />
seine Etüden und arbeiten hunderte von Lehrern, die alle in ihrer Jugend aus<br />
Czernyschen Heften gelernt haben. So wirkt er als unentbehrlicher und unübertroffener<br />
Klavierpädagoge, als musikalischer Ober-Schullehrer noch heute<br />
fort und wird weit ins kommende Jahrhundert hinüberwirken.'(HANSLICK<br />
1892, S. 32) 11<br />
Diese Prognose des Wiener Musikkritikers und -gelehrten Eduard Hanslick aus<br />
dem Jahre 1891 aus Anlaß von Czernys 100. Geburtstag hat sich durchweg bis<br />
heute bewahrheitet. Auch 100 Jahre später noch bestehen viele Vorurteile gegenüber<br />
Carl Czerny (1791-1857), und gleichzeitig werden nach wie vor seine<br />
klavierpädagogisch bewährten Etüden als offenbar unverzichtbares pianistisches<br />
Unterrichtsmaterial gelehrt und geübt." (MAHLERT 1995, 126)<br />
Als Folge der Trennung von Geist und Technik nahm CZERNYS Ruf irreparablen<br />
Schaden. Die Macht des gedruckten Mediums, das allein durch seine Existenz den<br />
vorliegenden Text als zu erfüllende Norm installiert, scheint nahezu unbezwingbar:<br />
das Medium hat sich verselbständigt.<br />
Das Lernen mit Hilfe schriftlicher Medien ermöglichte andererseits eine rasche Verbreitung<br />
von Musik, wie sie anders nicht denkbar gewesen wäre. Mit nur wenig<br />
Übertreibung kann man sagen, dass ein entscheidender Vorteil des Klavierspiels<br />
gegenüber anderen Arten des Musizierens und damit ein Garant für seine Verbrei-<br />
10 EPTA: European Piano Teachers Association<br />
11 EDUARD HANSLICK: Karl Czerny. (Zu seinem 100. Geburtstage 189<strong>1.</strong>) in: ders., Aus dem Tagebuch<br />
eines Musikers (Der 'Modernen Oper' VI. Theil). Kritiken und Schilderungen, Berlin 1892,<br />
S. 32-40.
tung in den Wohnzimmern des 19. Jahrhunderts auf der Tatsache beruht, dass es so<br />
gut wie überhaupt keiner musikalischen Fähigkeiten bedurfte. Mittels der neuen<br />
Lehrmethoden konnte die Wiedergabe vorgefertigter Arrangements jedem beigebracht<br />
werden, der die erforderliche Akribie und Geduld aufbrachte, diese zu entschlüsseln:<br />
12 Tugenden, die speziell dem weiblichen Geschlecht anerzogen waren,<br />
was dazu führte, dass das Klavierspiel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu<br />
einem Hauptbetätigungsfeld der Damenwelt wurde. Viele dieser Damen nutzten die<br />
Chance, aus dem Klavier-Boom als Lehrerinnen Kapital zu schlagen, womit der Beruf<br />
der Instrumentallehrerin zu einem der ersten Frauenberufe und, in einer Art<br />
"Kunstpriestertum", zu einer Alternative zur Ehe wurde:<br />
Abb. 9: Der Klavier-Lehrer, 27. Jg. (1904), Heft 16, S. 240.<br />
Die alte virtuose Tradition des eigenschöpferischen Passagen- und Sätzchen-Spiels<br />
musste schon allein aufgrund der Tatsache ins Hintertreffen geraten, dass die starke<br />
Nachfrage nach Klavierunterricht von umfassend nach alter Schule ausgebildeten<br />
Lehrern allein quantitativ nie hätte bewältigt werden können (vgl. DE VRIES 1996,<br />
28). Unter Berücksichtigung des erforderlichen Zeitaufwands für Unterricht (vgl. S.<br />
12 Im zwanzigsten Jahrhundert weiter perfektioniert durch eingedruckte Fingersätze.<br />
55
39) hätte bei mündlicher Vermittlung die Schere zwischen Angebot und Nachfrage<br />
immer weiter auseinander gehen müssen. Mittels gedruckter Medien war nun aber<br />
eine schnelle Verbreitung möglich. Dass die großen Vorbilder des virtuosen Konzertierens,<br />
verkörpert beispielsweise durch CLARA SCHUMANN, sich inzwischen auf<br />
die ausschließliche Interpretation von Werken klassischer Musik verlegt hatten, kam<br />
den neuen Klavierlehrerinnen und ihrer Vermittlungsmethode sehr gelegen, schienen<br />
diese Veränderungen im Konzertleben doch scheinbar die neue Lehrmethode zu<br />
bestätigen, die dem Vorbild des großen Virtuosen direkt durch Reproduktion und<br />
ohne Umwege über scheinbar unnötigen musikalischen Ballast näherzukommen<br />
suchte. Erschwerend kam hinzu, dass die Praxis der Improvisation, die sowohl für<br />
CLARA WIECK als auch FRANZ LISZT noch unverzichtbare Grundlage und Mittelpunkt<br />
der musikalischen Ausbildung gewesen war, als Folge der "Virtuosenjubeljahre"<br />
zwischen 1830 und 1850 massiv in Verruf geraten war. Neben den wirklich<br />
fähigen Improvisatoren und Virtuosen erschienen in jener Zeit nämlich vermehrt<br />
"Pseudo-Virtuosen" auf der Bildfläche, die auf unqualifizierte Weise versuchten, es<br />
den Könnern gleichzutun. Sie nahmen sich größte Freiheiten beim Spiel und meinten,<br />
wenn sie nur ihrer spontanen Eingebung nachgäben, müsse sich eine ähnliche<br />
Wirkung auf das Publikum einstellen wie bei den Großen. Dies führte zu einer Willkür<br />
beim Vortrag, und damit, wie FRIEDRICH WIECK berichtet, zu lächerlichen Ergebnissen.<br />
WIECK beweist parodistisches Talent, wo er diese geschmacklose Willkür<br />
am Beispiel des Pianisten "Forte" karikiert:<br />
56<br />
"Forte macht mehrere gefährliche Läufer hinauf und hinunter und viele Octavenpassagen<br />
fortissimo mit aufgehobenem Pedal – und verbindet damit sogleich<br />
– ohne abzusetzen – die Mazurka, die presto angefangen wird. Von Tact<br />
und Rhythmus war nichts zu hören, aber wohl von immerwährendem rubato<br />
und unmusikalischen Rückungen. Einige Noten wurden ziemlich undeutlich pp<br />
gesäuselt und sehr verschleppt gespielt, andere plötzlich sehr schnell, überstark<br />
und hastig angeschlagen, so dass die Saiten klirrten und der letzte B-dur-<br />
Accord einer Saite das Leben kostete." (WIECK 1853, 101)<br />
Kurz darauf geht das Konzert folgendermaßen weiter. Insbesondere der Widerspruch<br />
zwischen mangelnden Fähigkeiten und "Selbstgenügsamkeit" – heute würde<br />
man sagen "Starallüren" – reizt dabei zur Karikatur: 13<br />
13 Neben dieser Karikatur in Textform sei auf den folgenden Seiten die ebenso ironische Bildfolge<br />
Der Virtuos von WILHELM BUSCH aus dem Jahr 1865 angeführt. Sie illustriert die Gebärden der<br />
Virtuosen jener Zeit ebenfalls eindrucksvoll.
Abb. 10: WILHELM BUSCH: Der Virtuos, aus: Üben & Musizieren, 3/1996, S. 10.<br />
57
Abb. 11: WILHELM BUSCH: Der Virtuos, aus: Üben & Musizieren, 3/1996, S. 1<strong>1.</strong><br />
58
"Forte durchwühlt mehrere fremdartige Accorde in höchster Schnelligkeit mit<br />
aufgehobenem Pedal und geht, ohne abzusetzen, zur Fis-moll-Mazurka über.<br />
Er accentuirt heftig, einen Tact zieht er auseinander und schenkt ihm zwei<br />
Viertel mehr, dem anderen nimmt er ein Viertel weg, und so fährt er fort, bis er<br />
mit grosser Selbstgenügsamkeit schliesst und nach einigen verzweifelnden und<br />
verminderten Septimenaccorden sogleich das 'Ständchen von Schubert' (D-<br />
Moll) nach der Transscription von Liszt damit verbindet. – Es entsteht, während<br />
die zweite Saite auf dem zweigestrichenen B auch gesprungen und Klirren<br />
verursacht, ein heimliches Flüstern, von wem das Stück wohl sein könne,<br />
[...] bis endlich [...] Forte – mit der 'Verschiebung' schliesst, die er bereits<br />
schon vielmals in seiner Begeisterung angewendet." (WIECK 1853, 101f.)<br />
Anschließend lässt WIECK den Möchtegern-Virtuosen "Forte" seine zweifelhafte<br />
Kunstauffassung folgendermaßen erläutern:<br />
"Man muss bei solchen Schönheiten sich ganz seiner Eingebung und Empfindung<br />
überlassen. Ein anderes Mal mache ich drei Tacte daraus, wie eben der<br />
Genius und die Begeisterung in mir winken und wirken. Das nennt man: 'ästhetische<br />
Überraschung.' Henselt, Moscheles, Thalberg, Clara tragen freilich<br />
nicht so vor – dafür können sie aber auch keine Effecte und keine Reisen mehr<br />
machen." (WIECK 1853, 102)<br />
In Anbetracht dieser Willkür ist es nicht verwunderlich, dass sich eine Gegenbewegung<br />
formierte, die sich schließlich durchgesetzt hat. Sie legte Wert auf die originalgetreue<br />
Wiedergabe des Notentexts und verlangte vom Interpreten, dem Kunstwerk<br />
mit angemessenem Respekt entgegenzutreten. Auch FRIEDRICH WIECK forderte diesen<br />
Respekt, der den "Clavierfurien" fehlte, in Form angemessener "Pietät":<br />
"Man spielte sie auf moderne Weise, d. h. brillanter, bravourmässiger, im<br />
schnelleren Tempo, leidenschaftlicher und heftiger accentuirt, mit einem<br />
Worte: 'modern concertmässig' und versündigte sich somit gegen die, diesen<br />
Meisterwerken schuldige Pietät." (WIECK 1853, 105)<br />
Dabei wird deutlich, wie sehr sich der Wandel vom Kunsthandwerk zur Werktreue<br />
in der Biographie FRIEDRICH WIECKS – vielleicht noch deutlicher in der seiner<br />
Tochter CLARA (vgl. DE VRIES 1996) – widerspiegelt. Er, der bei der Ausbildung<br />
seiner Töchter und Schüler noch wesentlich auf vielseitige, im umfassenden Sinn<br />
virtuose Ausbildung in Form von Improvisation, Komposition und Interpretation<br />
59
Wert gelegt hatte, 14 muss sich nun gegen – scheinbar – aus jenen Ausbildungsmethoden<br />
hervorgegangene Auswüchse wenden. Wie sehr WIECK aber als Verfechter<br />
von Kunst und Geschmack auf verlorenem Posten steht und gleichsam an zwei<br />
Fronten gleichzeitig kämpft, zeigt die Tatsache, dass auf der Gegenseite bereits die<br />
Auswüchse des anderen Extrems, nämlich des stupiden Abspielens von Noten, ihre<br />
Schatten vorauswerfen:<br />
60<br />
"Ueberall begegnet man, namentlich in der jüngsten Generation, dem Dutzendspiel,<br />
d.h. es spielt einer wie der andere, weder stümperhaft noch meisterhaft,<br />
weder musikalisch noch unmusikalisch – aber brav und hausbacken, die Noten<br />
im Tact, was freilich immer noch besser ist als die Zukunftsdrescherei."<br />
(WIECK 1853, 116)<br />
Indem sich WIECK im Zweifel für das langweilige "Dutzendspiel" entscheidet, wird<br />
klar, wie groß die Verfehlungen des Pseudo-Virtuosentums gewesen sein müssen. In<br />
der Tradition dieser Gegenbewegung steht bis heute die Pflege des hohen Stellenwerts<br />
originalgetreuer Interpretation von Meisterwerken im klassischen Instrumentalspiel,<br />
wohingegen spontane Äußerungsweisen häufig verachtet und gemieden<br />
werden. "Vorteil" dieser Tradition für die Zunft der Instrumentalpädagogen und damit<br />
mitursächlich für die Dauerhaftigkeit der "soliden Ausbildung" auf der Grundlage<br />
technischer Schulung auch in der Unterrichtspraxis des 20. Jahrhunderts: Indem<br />
der Notentext zum Maß allen Musizierens wird, lassen sich eingeschränkte Fähigkeiten<br />
von Lehrern ideal kaschieren. So kann der Lehrer dozierend und erläuternd<br />
anstatt musizierend auftreten, was sowohl der Bequemlichkeit seines Unterrichtsstils<br />
als auch der Pflege seiner Aura im Geist der Exegese von Kunstwerken förderlich<br />
ist. Der dieser Tradition entstammende Widerspruch zwischen Musizieren und Dozieren<br />
– einerseits Interpretation als höchste musikalische Äußerungsform zu werten,<br />
die auf der anderen Seite aber mit dilettantischen Lehrmethoden erreicht werden<br />
soll – brachte dem Beruf des Klavierlehrers allerdings bereits in der zweiten Hälfte<br />
des 19. Jahrhunderts ein durchaus ambivalentes Ansehen ein.<br />
FRIEDRICH WIECK, der sich als Vertreter der alten Schule sah und solche Tendenzen<br />
konsequent bekämpfte, karikiert die Vorgehensweise einer solchen entbehrungsreichen<br />
"soliden" Ausbildung anhand schriftlicher Medien, wo jede Bewegung bis hin<br />
zum Fingersatz (bis heute übrigens gängige Praxis) vom Lehrer vorgeschrieben<br />
wird, in Form des fiktiven Lehrers "Büffel". Ein Schüler dieses Lehrers berichtet:<br />
14 Dies zeigt sich unter anderem in WIECKS Vademecum für den ersten Pianoforte-Unterricht. Vgl.<br />
diesbezüglich DE VRIES (1996, 125).
"Herr Büffel geht ganz solid [Hervorhebung von mir, H.K.]: erst muss ich den<br />
Gradus ad Parnassum noch ganz durchackern, dann erst will er ein Concert von<br />
Beethoven mit mir vornehmen und die gehörige Applicatur darüber schreiben.<br />
Das werde ich dann ö f f e n t l i c h spielen und dann – hat er und die Tante<br />
gesagt – w e r d e i c h A l l e s t o d t m a c h e n . " (WIECK 1853, 10)<br />
Die alte virtuose Tradition in der Einheit von Produktion und Wiedergabe war um<br />
die Jahrhundertwende endgültig gebrochen, und die Praxis der Improvisation verschwand<br />
fast völlig aus dem Konzertleben, wie OSCAR BIE berichtet:<br />
"Auch unsere Ersten haben aufgehört im Konzert zu improvisieren, nur 'Konzertkomiker'<br />
besorgen es noch. Und von einer privaten bezaubernden Improvisationskunst,<br />
wie man sie von Beethoven und Liszt kannte, hört man heute<br />
weniger. Die Konzerte gehören grösstenteils der Vorführung bekannter Werke,<br />
die sich oft – wie Beethovens Es-dur-Konzert – bis zur Übersättigung wiederholen.<br />
Es wird gelehrt, es wird vorgespielt, aber es kocht nirgends vom Drange<br />
des Schaffens. Das Klavierspiel ist ein Weltberuf bis in die äussersten Peripherien<br />
des Dilettantismus, der keinen Accord zusammen anschlagen und keine<br />
Noten punktieren kann." (BIE 1901, 282)<br />
Nun gewannen in der Instrumentalpädagogik selbst ernannte Priester des Geschmacks,<br />
wie sie HUGO RIEMANN im Titel eines Aufsatzes aus dem Jahr 1895 ironisch<br />
bezeichnete, die Oberhand. Vordergründig aus Pietät gegenüber Komponist<br />
und Werk, in Wirklichkeit aber oft, um mangelnde musikalische Autorität der Lehrer<br />
zu kaschieren, entstand in dieser Phase das bis heute von Anbeginn des Unterrichts<br />
gültige Ausbildungsziel, möglichst bald und möglichst korrekt notierte Übungen<br />
und Stücke wiederzugeben. Viele Klavierlehrer waren dabei mangels musikalischer<br />
Kenntnisse völlig von Unterrichtsmedien abhängig. Die korrekte Bewältigung<br />
der Klavierschule geriet nun in den Mittelpunkt der Bemühungen und damit die<br />
Kriterien richtig und falsch bei deren Ausführung. Die Tradition der Demut gegenüber<br />
Werk und Komponist übertrug sich auf die einfachsten Lernstücke und begünstigte<br />
die Tendenz, das gedruckte Medium als oberste Instanz zu betrachten, die<br />
nicht nur nicht hinterfragt, sondern bei dieser Art der Ausbildung auch nicht mehr<br />
verstanden werden musste. HUGO RIEMANN klagt:<br />
"Der Unterricht eines älteren Orchestermusikers ist auf alle Fälle dem einer<br />
selbst ohne rhythmisches Gefühl und ohne harmonisches Verständnis fehlerhaft<br />
dilettierenden Dame vorzuziehen. Die selbst nur halbgebildeten Lehrerinnen<br />
sind hinsichtlich der Lehrmethode völlig unselbständig und genötigt, sich<br />
an eine sogenannte 'Klavierschule' [Hervorhebung von mir, H.K.] anzuklammern;<br />
[...] unfähig, eine verständige Auswahl des darin gebotenen Materials zu<br />
61
62<br />
treffen und je nach der Anlage des Schülers Sprünge zu machen, lassen sie<br />
denselben sich durch den ganzen Ballast meist sehr mittelmäßig gesetzter Musik<br />
durcharbeiten. Des Schülers Lust zur Musik erlahmt bei diesem pedantischen<br />
Einerlei gar bald, und er kommt nur langsam vorwärts. So vergehen<br />
Jahre, die Klavierschule ist noch immer nicht absolviert, und außer einigen<br />
Salonstücken 'zum Vorspielen' lernt der Ärmste nichts kennen." (RIEMANN<br />
1895/1967, 36)<br />
Die von GRETE WEHMEYER plastisch dargestellten weiblichen Tugenden, die auf die<br />
Vermittlung des Instrumentalspiels prägenden Einfluss hatten, taten ein Übriges,<br />
dass sich die musikalischen "Aktivitäten", quasi als Belohnung für die erduldeten<br />
Entbehrungen der "soliden Ausbildung" (vgl. S. 61), auf diese wenigen "Vorspielstücke"<br />
beschränkten. Diese Klavierlehrerinnen hatten, wie GRETE WEHMEYER<br />
schreibt,<br />
"[...] Fleiß, Ordnung, Sauberkeit, asketische Selbstverleugnung geübt. Was<br />
konnten sie, die selber keine Klavierspielerinnen geworden waren, anderes<br />
vermitteln als ein sehr domestiziertes Virtuosentum, das mehr mit penibler<br />
Haushaltführung zu tun hatte als mit Kunst.<br />
So kam sie zustande, die Klavierlehrerin, streng und etwas säuerlich, vom Leben<br />
enttäuscht, die sich wahrscheinlich strikt an Czernys oder eines anderen<br />
Anweisung hielt, eine Übung 10-, 12-, 20- oder 30 mal zu wiederholen. Zucht<br />
und Ordnung herrschte dort. Die Frauen, an ihre Reservat-Kultur gewöhnt,<br />
hatten sicher auch großen Anteil an dem Rückzug aus dem Aktuellen, den die<br />
Pianistik und die Klavierpädagogik antraten. Sie verhielten sich ihrer zeitgenössischen<br />
Musik gegenüber nicht abenteuerlustig oder experimentierfreudig.<br />
Was Wunder, daß nach einigen Jahrzehnten die zeitgenössische Musik ganz<br />
aus dem Klavierunterricht verschwand. Die Klavierlehrerinnen haben es –<br />
ohne Schuld – auf dem Gewissen, daß das Klavierspielen eine so enge, frigide,<br />
ängstliche Angelegenheit werden konnte. Sie sind der Umschlaghafen oder die<br />
Nahtstelle zwischen bürgerlicher Lebensansicht und Kunst." (WEHMEYER<br />
1983, 114f.<br />
Die Vermittlung des Klavierspiels geriet dabei, wie HUGO RIEMANN meinte, insgesamt<br />
in beklagenswerten Zustand:<br />
"Wer erteilt heute nicht Musikunterricht? Jeder Orchestermusiker vom Kapellmeister<br />
an bis herunter zum Posaunenbläser und Paukenschläger der untergeordnetsten<br />
Gartenkapelle giebt Privatstunden, und zwar nicht für sein Instrument,<br />
sondern für das moderne Allerweltsinstrument, das Klavier. Das<br />
Klavier ist eine wirkliche Landplage geworden. Der schlimme Umstand, daß<br />
man, um Klavier zu spielen, wenig oder gar kein musikalisches Gehör zu ha-
en braucht, weil die Töne fix und fertig daliegen und nicht gebildet zu werden<br />
brauchen, verschuldet es, daß 'ein bisschen Klimpern' heute schon zur notwendigen<br />
Erziehung der Bauernmädchen gehört, und daß jeder Klavierunterricht<br />
erteilen kann, der die Beziehung der Notenzeichen zu den Klaviertasten begriffen<br />
hat. Beamten- und Offizierswitwen oder -töchter, die sich genieren, Verkäuferinnen<br />
zu werden oder ein Putzgeschäft anzufangen, geben zu billigen<br />
und billigsten Preisen Klavierstunden, lediglich darauf hin, daß sie selber früher<br />
'zu ihrem Vergnügen' etwas Unterricht auf dem Instrumente erhalten haben.<br />
Wie das ausfällt, mag man sich denken. Dem Verfasser dieser Zeilen<br />
wurden Schüler zugeführt, die nach zweijährigem Unterricht bei 'einer Dame'<br />
noch nicht einmal unterscheiden konnten, ob's 'hinauf oder herunter ging' und<br />
keine Note kannten, obgleich sie einiges Talent hatten." (RIEMANN 1895/1967,<br />
34f.)<br />
Die Mischung aus den Idealen Disziplin und Ordnung einerseits und der Transzendenz<br />
von Virtuosität andererseits, die mit ersteren Mitteln vergeblich zu erreichen<br />
versucht wird, führt zu musikalischer "Pseudo-Aktivität", basierend auf akkuratem<br />
Notenspiel, verbrämt mit dem Ideal der "soliden Ausbildung". Das Vertrauen<br />
in die Beteuerungen der Pädagogen, die anstatt musikalischer Fähigkeiten hauptsächlich<br />
Notenlesen und Fingersätze vermittelten, je konsequenter die technischen<br />
Grundlagen gelegt würden, desto einfacher habe man es später, wurde untermauert<br />
durch das Leistungsdenken des industriellen Zeitalters und führte zu einer Verdrängung<br />
musikalischer Lerninhalte aus weiten Bereichen des Klavierunterrichts.<br />
Aus diesem Geist wurde die Tendenz genährt, die Lösung technischer Probleme,<br />
trotz ungeeigneter Mittel, anstatt in qualitativen Sensibilisierungsprozessen in quantitativen<br />
Steigerungen eben dieser Mittel zu suchen. Aus psychologischer Sicht<br />
könnte man einem solchen Verhalten sucht-ähnlichem Charakter zuschreiben. Wie<br />
bei allen derartigen Verhaltensweisen führt jede Steigerung der Mittel weiter vom<br />
eigentlichen Ziel weg. Und ebenso gibt es immer jemanden, der für Nachschub sorgt<br />
und daran verdient, in diesem Fall am Verkauf von Notenmaterial, wie JOHANNES<br />
JANSEN am Beispiel von CZERNYS Etüden schildert:<br />
"Wer sie kaufte, war noch kein gemachter Pianist, aber die Hoffnung, es zu<br />
werden, steckte in jedem Band, der da über die Ladentische ging. Doch mit der<br />
wachsenden Zahl aufstrebender Talente, die sich seiner Systematik anvertrauten,<br />
wuchs auch die Zahl ihrer Opfer, zumal in der Generation der Enkel- und<br />
Enkel-Enkel-Schüler: Czernygeprüft, aber total frustriert endet noch heute<br />
manche hoffnungsvoll begonnene Karriere, denn die 'klassische' Klavierpädagogik,<br />
die sich auf ihn als ihren Urheber beruft, hat sich von den Intentionen<br />
Czernys meilenweit entfernt." (JANSEN 1991, 69)<br />
63
Die Nachfrage nach gedruckten Werken war jedenfalls riesig und schuf einen neuen<br />
Industriezweig:<br />
64<br />
"Das Bedürfnis nach entsprechendem Notenmaterial war ungeheuerlich, und<br />
die Verleger beeilten sich, durch Modernisierung des Druckwesens – und die<br />
Komponisten durch eine Massenproduktion – die Nachfrage der inflationär ansteigenden<br />
Klavierspielerschar zu befriedigen." (AUGUSTINI 1986, 58)<br />
Am Ende des Versuchs, den Erfolg durch ständig steigende Dosierung ungeeigneter<br />
Mittel zu erzwingen, standen immer öfter körperliche Erkrankungen. CLAUDIA DE<br />
VRIES berichtet in ihrer Arbeit über CLARA SCHUMANN aus den achtziger Jahren des<br />
19. Jahrhunderts von einem<br />
"[...] epidemisch sich verbreitenden Übel des Armleidens."<br />
(DE VRIES 1996, 39)<br />
Das unentwegte, stereotype Absolvieren immer der gleichen Bewegungen anhand<br />
immer der gleichen Stücke mit immer dem gleichen Fingersatz führte insbesondere<br />
bei Studierenden an den in der zweiten Jahrhunderthälfte zahlreich gegründeten<br />
Konservatorien regelmäßig zu körperlicher Überlastung. Hier, wo sich eigentlich die<br />
Ausbildung professioneller Musiker vollziehen sollte, wurde mit derselben Einseitigkeit<br />
an der Einstudierung von Werken gearbeitet, wie sie sich im Anfangsunterricht<br />
anhand von Klavierschulen etabliert hatte – und damit in Wirklichkeit dilettantische<br />
Unterrichtspraxis auf höherer Ebene fortgeführt. Dass auch in dieser vermeintlich<br />
professionellen Ausbildung vom ursprünglichen Virtuosentum nicht mehr<br />
viel vorhanden war, verdeutlicht HUGO RIEMANN anhand der folgenden Beschreibung<br />
eines Absolventen eines Konservatoriums. RIEMANN berichtet von physischer<br />
Selbstzerstörung durch "Fingerkrampf" als Folge einseitigen Übens, wenn musikalische<br />
Fähigkeiten (wie in der Regel übrigens noch heute) fast ausschließlich praktisch<br />
anhand von Literatur- und Etüdenspiel "eingepaukt" werden:<br />
"Ein junger Mann, der vor Jahren eine solche Anstalt verließ und als Klaviervirtuose<br />
in die Öffentlichkeit trat, hatte ein Repertoire von einem Mozartschen,<br />
einem Beethovenschen und einem Schumannschen Konzerte, war aber außerstande,<br />
ein mittelmäßig schweres Stück erträglich abzuspielen, das nicht auf<br />
seinem Repertoire stand, da er jene Konzerte nur durch jahrelanges mühsames<br />
Einpauken hatte bewältigen lernen, während sein übriges musikalisches Fassungsvermögen<br />
[Hervorhebung von mir, H.K.] keine entsprechende Fortentwicklung<br />
genommen hatte. Dass den jungen in der Ausbildung begriffenen<br />
Virtuosen und Virtuosinnen für längere Zeit das Spielen gänzlich untersagt
werden muss, weil sie sich entweder den Fingerkrampf angespielt oder das<br />
Nervensystem überreizt haben, ist eine ganz gewöhnliche Erscheinung. Dergleichen<br />
würde nicht möglich sein, wenn nicht die Musikschüler ein Übermaß<br />
von Zeit auf das praktische Spiel verwendeten, natürlich auf Kosten aller anderweitigen<br />
Studien; solange sie auf der Anstalt sind, geben sie sich nur allzugerne<br />
dem Wahne hin, wirkliche Virtuosen werden zu können [...]." (RIEMANN<br />
1895/1967, 11)<br />
Diese Kritik an Mängeln in der Bildung des "musikalischen Fassungsvermögens"<br />
korreliert mit der bereits auf S. 28 zitierten Bemerkung CARL CZERNYS über die<br />
Nachteile einer Übeweise, die sich anhand der möglichst fehlerfreien Wiedergabe<br />
einiger weniger Werke vollzieht. Letztere Praxis hatte sich zwar in der institutionalisierten<br />
Ausbildung der zweiten Jahrhunderthälfte unwiderruflich durchgesetzt, jedoch<br />
gab es Bestrebungen, das musikalische Fassungsvermögen der Studierenden<br />
durch begleitenden Unterricht in "Musiktheorie" zu verbessern. So wurden an vielen<br />
Konservatorien kompositorische Elemente in den Fächerkanon aufgenommen – allerdings<br />
nicht, damit die Studierenden selbst komponieren lernten, sondern ausschließlich,<br />
um ihnen die Machart der zu interpretierenden Werke näherzubringen.<br />
Die Bezeichnung Musiktheorie verdeutlicht, dass es sich nicht um praktisch anwendbare<br />
Kompositionslehre handeln sollte, sondern dass theoretisches Verständnis<br />
der Klassiker entscheidendes Lernziel war. 15<br />
Der Verzicht auf schöpferisches bzw. anspruchsvolles Musizieren oder Komponieren<br />
im "Theorieunterricht" deutet, wie schon letzterer Begriff selbst, darauf hin, dass<br />
hierdurch die Trennung von Erfinden und Spielen nicht aufgehoben werden sollte.<br />
15 Die Trennung in Musiktheorie und Musikpraxis birgt allerdings Diskussionsstoff und aus Sicht<br />
des schöpferischen Musizierens konnte bereits für ARNOLD SCHÖNBERG Tonsatz keine "Theorie"<br />
sein. Eine solche Beschränkung auf die Betrachtung war für ihn nur schwer nachvollziehbar. Er<br />
schreibt in seiner Harmonielehre:<br />
"Wenn einer musikalische Komposition unterrichtet, wird er Theorielehrer genannt; wenn er aber<br />
ein Buch über Harmonielehre geschrieben hat, heißt er gar Theoretiker. Aber einem Tischler, der<br />
ja auch seinem Lehrbuben das Handwerk beizubringen hat, wird es nicht einfallen, sich für einen<br />
Theorielehrer auszugeben. Er nennt sich eventuell Tischlermeister, das ist aber mehr eine Standesbezeichnung<br />
als ein Titel. Keinesfalls hält er sich für so was wie einen Gelehrten, obwohl er<br />
schließlich auch sein Handwerk versteht. Wenn da ein Unterschied ist, kann er nur darin bestehen,<br />
dass die musikalische Technik 'theoretischer' ist als die tischlerische. Das ist nicht leicht einzusehen."<br />
(zit. nach HAEFELI 1999, 47).<br />
Bereits hier sei auf die einschneidenden Veränderungen hingewiesen, die diesbezüglich von der<br />
gegenwärtigen Medienentwicklung ausgehen. Mit dem direkten Zugriff auf klangliche Strukturen<br />
ohne visuelle Zwischenschritte wird der Begriff "Theorie" (griech. ������: betrachten) relativiert.<br />
Bezüglich dieser aktuellen Entwicklung vgl. insbesondere Abschnitt 4.5.<br />
65
Auch verwertbare improvisatorische Fähigkeiten wurden hier kaum vermittelt – dies<br />
war ebenso wenig beabsichtigt. Auch die Tatsache, dass derartige Lerninhalte in der<br />
Regel nicht von Beginn der musikalischen Ausbildung an, sondern erst mit Erreichen<br />
der Oberstufen Bedeutung erlangten, trug und trägt zur peripheren Bedeutung<br />
des eigenen Schaffens in der Musikausbildung bei.<br />
Die Aufgabenbeschränkung des Musikschülers auf die Wiedergabe besteht in der<br />
Regel bis heute, und das, was MARTIN GELLRICH das verloren gegangene "Herzstück"<br />
musikalischer Ausbildung nennt, war durch Einführung des Theorie-Unterrichts<br />
nicht wiederzugewinnen:<br />
66<br />
"Als sich etwa um die Jahrhundertmitte die Kunst des Klavierspiels zur Interpretationskunst<br />
wandelte, verlor das Sätzchen-Spiel bald an Bedeutung. Es<br />
hatte im Rahmen der Interpretationskunst keine Bedeutung mehr. Der Funktionsverlust<br />
hatte weitreichende Folgen, unter denen wir noch heute zu leiden<br />
haben. Mit dem Sätzchen-Spiel wurde das muttersprachliche Musiklernen sozusagen<br />
seines Herzstücks beraubt. Die verschiedenen Teile der Instrumentalübung<br />
waren nämlich [...] ursprünglich alle über das Sätzchen-Spiel miteinander<br />
verbunden. Weil das Kernstück herausgebrochen wurde, zerfiel die Instrumentalübung<br />
in ihre Bestandteile. Die Passagenübung, das Variations- und<br />
Etüdenspiel, sowie die Übung von Vortragsstücken, standen nun beziehungslos<br />
nebeneinander." (GELLRICH 1992, 81)<br />
Entscheidender Grund für den von MARTIN GELLRICH erwähnten Zerfall der ganzheitlich-komplexen<br />
Musikausbildung in Einzelteile waren die Auswirkungen der<br />
schriftlichen Medienkultur in der Musikvermittlung auf Grundlage des gedruckten<br />
Werkes als opus perfectum und damit die Trennung des Wiedergabe-Vorgangs vom<br />
Schaffensprozess. Die folgende Kritik HUGO RIEMANNS, in der er die Schuld für<br />
diese Einengung der musikalischen Ausbildung ausschließlich in der Institution des<br />
Konservatoriums sucht, scheint vor diesem Hintergrund zu einfach und lässt tiefer<br />
liegende Ursachen außer Acht:<br />
"Die heute fast allgemeine ausschließliche Dressur auf praktische Musikübung<br />
ist eine traurige Errungenschaft der neuesten Zeit, und sie ist lediglich auf die<br />
Einrichtung der Konservatorien zurückzuführen." (RIEMANN 1895/1967, 24)<br />
Sicherlich zeigen sich Mängel einseitiger Bemühungen am deutlichsten dort, wo<br />
professionelle und damit ernsthafteste Bemühungen scheitern. Allerdings existieren,<br />
wie gezeigt wurde, vielfältige Ursachen dieses Phänomens im komplexen Beziehungsgefüge<br />
zwischen gesellschaftlicher Situation und Vermittlungsform.
Der Begriff des Dilettantismus gewann gegen Ende des 19. Jahrhunderts allerdings<br />
unwiderruflich jenen abschätzigen Unterton, der ihm noch heute anhaftet. HUGO<br />
RIEMANN berichtet im Jahr 1895 von einem "jetzt verrufenen Sinn" dieses Begriffes:<br />
"Es wird aber [...] eine Generation groß gezogen, welcher ganz verkehrte Begriffe<br />
von der Kunst durch den Lehrer überliefert sind und welche daher von<br />
einem einseitig bornierten Standpunkte aus Künstler und Kunstwerke beurteilt,<br />
eine Generation von Dilettanten in dem jetzt verrufenen Sinn des Wortes [Hervorhebung<br />
von mir, H.K.] [...], d. h. Leute, die ein bißchen musizieren, aber<br />
schlecht und ohne Verständnis für poetische Intentionen und höhere Flüge des<br />
musikalischen Genies." (RIEMANN 1895/1967, 38f.)<br />
Weder die Schließung der Konservatorien, wie sie RIEMANN möglicherweise gefallen<br />
hätte, noch der Versuch einer ganzheitlicheren Musikvermittlung standen allerdings<br />
als Konsequenzen ernsthaft zur Debatte. Die grassierenden physischen Schäden<br />
durch Instrumentalspiel lenkten den Blick in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
statt dessen zunehmend auf ein Gebiet, dessen Erfolge in Wirtschaft und<br />
Industrie den Schluss nahelegten, seine Errungenschaften auch auf das reproduzierende<br />
Musizieren nutzbringend anzuwenden: die Naturwissenschaft.<br />
In der Ahnung, dass es vielleicht doch qualitative und nicht nur in der Quantität des<br />
Übens begründete Unterschiede bei der Erlangung von Virtuosität gäbe, wurde nun<br />
das Geheimnis des Klavierspiels mit rationalen Methoden zu entschlüsseln versucht.<br />
1879 erschien in der Zeitschrift Der Klavier-Lehrer ein Artikel mit dem Titel Ueber<br />
die gesundheitsschädlichen Folgen des Uebens, von einer gewissen HULDA<br />
TUGENDREICH, in dem die Betrachtung des Klavierspiels aus naturwissenschaftlicher<br />
Sicht als pädagogische Perspektive und als Mittel gegen Spielerkrankungen<br />
propagiert wird:<br />
"Ich glaube, dass, wenn die Kunst des Klavier-, Violin- und Orgelspiel-Unterrichts<br />
als Wissenschaft vom physikalischen Standpunkt aus betrachtet würde,<br />
wie es Kullak und Ward Jackson aus London verlangen, so würde sich das<br />
Leiden weniger häufig als jetzt zeigen und den Lernenden würde ihre Aufgabe<br />
sehr erleichtert werden." (TUGENDREICH 1879, 109)<br />
1878, im Gründungsjahr genannter Zeitschrift, veröffentlichte GUSTAV STOEWE den<br />
Aufsatz Ueber die Wichtigkeit des Studiums der Anatomie für Klavierspieler vom<br />
Fach. Darin äußert er ebenfalls die Hoffnung, dass anatomische Betrachtungen die<br />
in einer Sackgasse befindliche Entwicklung des Klavierspiels voranbringen könnten:<br />
67
68<br />
"Während in den letzten Jahrzehnten fast auf allen Gebieten der Musik neue<br />
Erscheinungen aufgetreten sind, welche es vermocht haben, reformatorisch in<br />
dieselbe einzugreifen – ich nenne nur die musikalische Komposition und die<br />
Theorie der Musik – [...], so müssen wir Pianisten uns wohl gestehen, dass auf<br />
dem Gebiete der Technik des Klavierspiels seit Langem ein Stillstand eingetreten<br />
ist. [...]. Der Grund dieser Erscheinung liegt meines Erachtens darin,<br />
dass es an einem neuen Standpunkte fehlte, an einem ganz neuen Gesichtskreise,<br />
von welchem aus man sich der heutigen Technik gleichsam fremd gegenüber<br />
zu stellen und sie in ihren Einzelheiten kritisch zu betrachten vermochte.<br />
Ein solcher Standpunkt nun könnte durch die A n a t o m i e genommen<br />
werden.<br />
[...] Hat sich doch die Technik selbst gleichsam unbewusst aus den physiologischen<br />
Gesetzen heraus entwickelt, warum sollte die Anatomie, welche<br />
selbst im Laufe der Jahre so ungeheure Fortschritte gemacht hat, nicht einmal<br />
kontrolliren dürfen, ob nicht etwa Mancherlei in der Spiel- oder Lehrmethode<br />
mit den Forschungen der Wissenschaft im Widerspruch steht, warum<br />
sollte sie nicht sogar reformatorisch in dieselbe eingreifen dürfen?" (STOEWE<br />
1878, 238f.)<br />
Als Konsequenz dieser mechanistischen Betrachtungsweise gewannen in jener Zeit<br />
gymnastische Hilfsmittel zum Training der Hand oder zur Haltungskorrektur beim<br />
Klavierspiel an Bedeutung. 16 So wurden zur vorbereitenden Kräftigung der Fingermuskulatur<br />
folgende Geräte angepriesen:<br />
16 Bereits in der ersten Jahrhunderthälfte waren die ersten mechanischen Hilfsmittel zum Klavierspiel<br />
wie z.B. der Logier'sche Chiroplast (vgl. DE VRIES 1996, 119), der Kalkbrennersche Handleiter<br />
(vgl. DE VRIES 1996, 120) oder das Herz'sche Dactylion (vgl. BALLSTAEDT & WIDMAIER<br />
1989, Anhang, Abb.5) auf dem Markt erschienen. Aber erst in der zweiten Jahrhunderthälfte fanden<br />
diese Entwicklungen gewisse Verbreitung. So warb im Jahre 1880 das "Berliner Seminar zur<br />
Ausbildung von Klavier-Lehrern und Lehrerinnen" mit folgendem Text in einer Anzeige der<br />
Zeitschrift Der Klavier-Lehrer um Schüler, in dem das ganze Arsenal an Hilfsmitteln präsentiert<br />
wird:<br />
"Meine Anstalt ist ausgerüstet mit den bewährtesten mechanischen Hilfsmitteln, welche in neuerer<br />
Zeit zur Beförderung der leichteren Beweglichkeit der Finger, der richtigen Lage des Armes<br />
und der Hand, der ruhigen und graden Körperhaltung am Klavier und des sicheren, taktmässigen<br />
Spieles erfunden worden sind. Es sind im Gebrauch die Handhalter von Lenz, Spengler und Bohrer,<br />
Seebers Fingerbildner, der Rumpf'sche Gradhalter, die Metronome von Decher und Mustroph<br />
und Gley's Taktuhr." (Der Klavier-Lehrer, 3.Jg. (1880), S. 51)
Abb. 12: Der Klavier-Lehrer, 20. Jg. (1897), S. 275.<br />
Um die Finger-Krümmung in den richtigen Winkel zu bringen, wurde folgendes<br />
Hilfsmittel eingesetzt: Ein Ring verhindert, dass die Finger zu flach gehalten werden:<br />
69
Abb. 13: Seebers Fingerbildner, in: Der Klavier-Lehrer, 3. Jg. (1880), S. 57.<br />
Gegen jedwede Bewegung des Handgelenks war der "Lenz'sche Finger-, Hand-, und<br />
Handgelenkleiter" gedacht:<br />
Abb. 14: Lenz'scher Handleiter. Aus: Der Klavier-Lehrer, <strong>1.</strong> Jg. (1878), S. 256a.<br />
70
Zur guten Körperhaltung sollte "Frau Henriette Rumpf's Vorrichtung zur Regelung<br />
der Körperhaltung beim Klavierspiel. (Patent.)" beitragen:<br />
Abb. 15: "Rumpf's Gradhalter" in: Der Klavier-Lehrer, 2. Jg. (1879), S. 285.<br />
Dabei wird das Kinn in den Halter mit der Bezeichnung "a" gelegt, damit der Kopf<br />
nicht mehr bewegt werden kann. Der Rest des Mechanismus wird um den Körper<br />
geschnallt. Die Rezension lobte das Instrument in höchsten Tönen. So könnten nach<br />
Meinung des Rezensenten bei Anwendung dieses Gerätes Jahre der Ausbildung gespart<br />
werden:<br />
"Man erzielt durch die Vorrichtung die Hauptsache beim Klavierspiel: die absolute<br />
ruhige Haltung und ein ruhiges Weiterlesen der Noten [Hervorhebung<br />
von mir, H.K.], vermeidet das Notenverlieren und das unruhige Suchen nach<br />
Tasten und Noten, glättet das holperige Spielen, und zwar Alles in kürzester<br />
Zeit, während sonst Jahre dazu gehören, und dennoch in vielen Fällen ein ruhiges<br />
Spielen gar nicht erreicht wird.–<br />
Der oben beschriebene Rumpf'sche Gradhalter hat sich bei verschiedenen Versuchen,<br />
die ich mit demselben angestellt habe, als so zweckmässig für die Regelung<br />
der Körperhaltung am Klavier erwiesen, dass ich ihn der wärmsten<br />
Empfehlung werth erachte und ihn Solchen, deren schlechte Körperhaltung<br />
ihre Gesundheit sowohl als auch ihre Fortschritte im Klavierspiel beeinträchtigt,<br />
nicht dringend genug zur Anschaffung empfehlen kann." (BRESLAUR<br />
1879, 285)<br />
Interessante Rückschlüsse lassen sich aus diesem Beispiel in mehrfacher Hinsicht<br />
ziehen. Einerseits wird plastisch ein Klavierspiel-Ideal der damaligen Zeit vor Augen<br />
geführt. Im Gegensatz zur Praxis vieler Virtuosen, die sich in unbändigen Posen<br />
am Klavier produziert hatten, wird hier im Geist der Entsagung die absolut ruhige<br />
71
Körperhaltung bei stetem Blick in die Noten propagiert. Ohne zu übertreiben kann<br />
man hier von einem maschinellen Reproduktionsideal sprechen, dessen Sinn in einer<br />
visuellen 1:1 Wiedergabe der Noten besteht, ähnlich wie ein Plattenspieler oder ein<br />
CD-Player die Informationen einer Platte abtastet. Nicht umsonst geht die Verbreitung<br />
der Schallaufzeichnung zu Beginn des 20. Jahrhunderts einher mit deutlichem<br />
Bedeutungsverlust des Klavierspiels (vgl. S. 76). Die zahlreichen Bearbeitungen von<br />
Symphonien und anderen Werken der Musikliteratur für Klavier zwei- oder vierhändig<br />
aus dem 19. Jahrhundert können aus dieser Perspektive durchaus als erster<br />
Schritt auf dem Weg zur Omnipräsenz von Musik mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln<br />
gesehen werden, deren Höhepunkt in den heutigen Möglichkeiten der<br />
Schallaufnahme- und -wiedergabe-Technik erreicht zu sein scheint. Das Klavier<br />
übernimmt in diesem Fall keine originär musikalische Funktion als Instrument, sondern<br />
eine Rolle als Medium, bei dessen Benutzung nicht eigentlich die Interessen<br />
des Musizierenden im Vordergrund stehen, sondern die seines sozialen Umfeldes.<br />
Darüber hinaus zeigt die Rezension zum Rumpf'schen Gradhalter die typische rational-kausale<br />
Denkweise jener Zeit:<br />
Als Probleme werden genannt:<br />
� Beeinträchtigung der Gesundheit durch Klavierspiel<br />
� Mangelnde Fortschritte.<br />
Als Ursache wird vermutet:<br />
Schlechte Körperhaltung.<br />
Daraus folgt der Schluss:<br />
Abhilfe schaffen Hilfsmittel zur Korrektur der Körperhaltung.<br />
Diese lineare Denkweise geht einher mit der Tendenz, komplexe Vorgänge durch<br />
Auflösen in kleinste Bestandteile verstehen zu wollen. Wenn ADOLPH KULLAK im<br />
folgenden die Finger-Bewegung beim Klavierspiel zu erklären versucht und dabei<br />
vom Ganzen und seinen Teilen spricht, ist auch hier unschwer eine reduktionistische<br />
Weltsicht erkennbar:<br />
72<br />
"Der Anschlag besteht aus Aufheben, Niederfallen und Andrücken. Jeder dieser<br />
Faktoren muß für sich geübt werden. Ein vollkommenes Ganze [sic] ist nur<br />
durch Vollkommenheit seiner Theile erreichbar. – Das Aufheben kann [...] in<br />
erschwerender Anforderung so hoch als möglich gesteigert werden. Oft ist das<br />
Hochhalten der Finger schon eine treffliche Uebung, und ist dieselbe vorzüglich<br />
auf den vierten und fünften Finger zu erstrecken." (KULLAK 1876/1994,<br />
139)<br />
Die Tendenz zum Zerlegen in kleinste Bestandteile ist auch in Klavierschulen zu<br />
beobachten. So erscheint am Anfang der Bisping-Klavierschule aus dem Jahr 1900,
nachdem das System der Notenschrift auf der ersten Seite abgehandelt ist, auf der<br />
darauf folgenden Seite die folgende Lektion:<br />
Abb. 16: BISPING (1900, S. 4).<br />
Auffällig ist dabei der (nicht vorhandene) musikalische Gehalt. Die Melodieführung<br />
kann durchaus als unsinnig bezeichnet werden: Die Elemente der Musik werden<br />
schon zu Beginn des Lernens abgetrennt. Dieser Ansatz zeigt den Versuch, Musik<br />
durch Systematisierung und Atomisierung zu vermitteln. Auch hier schlägt der Geist<br />
der "soliden Ausbildung" (S. 61) durch, bei der zuerst durch Schweiß und Tränen<br />
eine technische Grundlage gelegt werden muss, bevor daran gedacht werden kann,<br />
zu musizieren.<br />
Als Elemente des Klavierspiels lassen sich bei BISPING ausmachen:<br />
<strong>1.</strong> Lesen der Noten<br />
2. Zählen des Metrums<br />
3. Beachten der Fingersätze<br />
4. Trennen der Hände (einzeln üben)<br />
5. Heben und Senken der Finger.<br />
Als sechster Punkt sei hinzugefügt, dass auch hier nicht auf die Hände, sondern nur<br />
auf die Noten geblickt werden darf, denn zwei Seiten weiter findet sich folgende<br />
Bemerkung:<br />
"Anfänger im Klavierspiel haben vielfach die Angewohnheit, auswendig zu<br />
spielen, d. h. anstatt auf die Noten, auf die Tasten zu sehen. Der Lehrer suche<br />
dem dadurch rechtzeitig vorzubeugen, dass er die Hände des Schülers mit einem<br />
Stück Papier bedeckt. Leicht und schnell gewöhnt sich alsdann der Schüler<br />
daran, auf die Noten zu sehen." (BISPING 1900, 6)<br />
73
Auch rhythmische Elemente wurden nun abgetrennt und separat zu vermitteln versucht.<br />
Das Ausrufen der Zählzeiten im angeführten Notenbeispiel von BISPING, jede<br />
Zahl mit Ausrufezeichen versehen, zeugt davon. Aus der Clavierübung (im ursprünglichen<br />
Sinn, vgl. S. 41) ist ein Exerzieren geworden und das Studierzimmer<br />
zum geschlossenen Exerzierplatz.<br />
Im Trend lag es nun auch, dass mechanische Hilfsmittel erfunden wurden, um<br />
Rhythmik separat zu vermitteln. Als Gerät, mit dessen Hilfe die Schüler nun Taktfestigkeit<br />
lernen sollten, sei "Gley's Taktuhr" genannt. Im Jahr 1880 erschien ein<br />
Artikel in Der Klavier-Lehrer über die Taktuhr, die dort folgendermaßen abgebildet<br />
ist:<br />
Abb. 17: Die Taktuhr, in: Der Klavier-Lehrer, 3. Jg. (1880), S. 117.<br />
Im begleitenden Text, der offensichtlich vom Erfinder selbst verfasst wurde, heißt<br />
es:<br />
74<br />
"Man lasse den Takt durch Aufklopfen mit einem Stabe und Zählen nachbilden<br />
und achte genau darauf, dass der Schüler die Note durch Liegenlassen, und die<br />
Pause durch Aufheben des Stabes genau wiedergebe, was eben beim Lernen<br />
nach der Taktuhr sehr leicht ist, weil der, die geometrischen Figuren durchlau-
fende Zeiger, den Eintritt der Note wie Pause, dem Auge darstellt." (GLEY<br />
1880, 117)<br />
Eher beiläufig zeigt sich auch an der Wortwahl GLEYS im letzten Satz der Wandel<br />
hin zur Präferenz des visuellen Sinneskanals.<br />
Wie sehr sich das moderne Klavierspiel zu diesem Zeitpunkt bereits von der umfassenden<br />
älteren Schule, wie sie z.B. FRIEDRICH WIECK noch verkörperte, entfernt<br />
hatte, lässt sich auch ermessen, wenn man die BISPINGsche bzw. GLEYsche Methode<br />
mit WIECKschen Äußerungen vergleicht. Dabei zeigt sich, dass sich fast alle pädagogischen<br />
Grundsätze innerhalb der fünfzig Jahre, die zwischen beiden Veröffentlichungen<br />
lagen, in ihr Gegenteil verkehrt haben! FRIEDRICH WIECK zählte nämlich<br />
in Clavier und Gesang folgende "Clavierregeln" auf, die er in der Klavierpädagogik<br />
für überwunden hielt:<br />
"'Du sollst nicht auswendig spielen, sondern auf die Noten sehen, sonst lernst<br />
du nicht vom Blatt lesen.<br />
Du musst kein Stück spielen, was nicht gehörig beziffert ist, damit du dir keine<br />
falsche Fingersetzung angewöhnst.<br />
Du darfst nicht auf die Tasten sehen bei springenden Tönen und Accorden,<br />
weil das von den Noten abzieht.<br />
Du musst hübsch beim Spiel zählen lernen, damit du immer streng im Tact<br />
bleibst.'<br />
Um auch einmal dem Geist der Zeit Rechnung zu tragen: 'solche und ähnliche<br />
Dinge gehören zu meinen w i r k l i c h ü b e r w u n d e n e n Standpunkten;'<br />
[kursive Hervorhebung von mir, H.K.] – ich wünsche, dass die Zukunftsmusiker<br />
ihre Standpunkte auch so glücklich überwinden mögen – nicht durch hohle<br />
Floskeln und Phrasen und durch leeres Strohdreschen – sondern durch 'praktische<br />
erfolgreiche Wirksamkeit und Streben nach dem Besseren.'" (WIECK<br />
1853, 70)<br />
Zum Zählen hatte sich übrigens auch CARL CZERNY noch folgendermaßen geäußert:<br />
"Es ist nicht sehr vorteilhaft, wenn man den Schüler zum Lautzählen oder gar<br />
zum Taktschlagen mit dem Fusse anhalten will." (zit. nach WEHMEYER 1983,<br />
216)<br />
Unter dem maßgeblichen Einfluss gedruckter Medien waren kreative oder emanzipatorische<br />
Elemente ins Hintertreffen geraten. Bei der praktischen Musikausübung<br />
ging es nicht mehr um produktives, sondern um reproduktives Tun, bei dem zwar<br />
das eigentliche künstlerische Ziel, die anspruchsvolle Interpretation, immer angestrebt<br />
blieb, allerdings vor lauter Entbehrungen im Sinn der "soliden Ausbildung" in<br />
75
die fernere Zukunft verschoben wurde. Diese Tradition kann bis zur bedingungslosen<br />
Unterwerfung des ausübenden Musikers unter den Notentext führen, die für<br />
CHRISTIAN KADEN sogar gleichbedeutend ist mit einer Aufhebung der Arbeitsteilung<br />
zwischen Komponist und Interpret. Der ausführende Musiker gerät zum Medium:<br />
76<br />
"Damit jedoch ist, in einem zentralen semantischen Bereich von Musik, die<br />
Aufhebung der Arbeitsteilung zwischen Komponist und Interpret postuliert.<br />
Der Interpret hat – bis heute ist diese Norm geläufig – nichts Eigenes zu geben,<br />
sondern vorgefertigtes Vorgefühltes, emotionale Opera perfecta nachzufühlen<br />
und weiterzureichen." (KADEN 1993, 145)<br />
In diesem Zusammenhang deutet auch die Tatsache, dass sich das Klavierspiel in<br />
direkter Konkurrenz mit der elektromechanischen Tonaufzeichnung befand, darauf<br />
hin, dass die Ideale des Klavierspiels eher auf informellem Gebiet lagen. Mit der<br />
Verbreitung elektroakustischer Medien zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlor das<br />
Klavierspiel jedenfalls erheblich an Attraktivität. ANDREAS BALLSTAEDT und<br />
TOBIAS WIDMAIER berichten:<br />
"Produktion und Absatz von Klavieren gerieten spätestens mit Einführung des<br />
Radios – die Zahl der Rundfunkteilnehmer nahm Mitte der 1920er Jahre<br />
sprunghaft zu – in eine schwere Krise. Während Musik in den Wohnungen des<br />
Besitz- und Bildungsbürgertums – zum privaten Vergnügen oder zur Unterhaltung<br />
von Gästen – bislang nur dann erklungen war, wenn eines oder mehrere<br />
Familienmitglieder über eine gewisse Fertigkeit im Instrumentalspiel oder<br />
Gesang verfügten, ließ sich mit Hilfe der technischen Musikmittler der<br />
Wunsch nach Musik in den eigenen vier Wänden auf eine völlig neue und bequeme<br />
Weise befriedigen. Innerhalb einer Generation, etwa zwischen Mitte der<br />
1890er und 1920er Jahre, vollzog sich im häuslichen Musikleben Schritt für<br />
Schritt ein grundlegender Wandel, der von einigen Zeitgenossen bitter beklagt<br />
wurde: 'Jetzt spielt unser Volk nicht mehr ein Instrument, jetzt dreht es die<br />
Kurbel und hört zu. Aus der Aktivität wird es in die Passivität gedrängt, was<br />
wohl als das schlimmste Zeichen des musikalischen Niedergangs angesehen<br />
werden darf.' 17" (BALLSTAEDT & WIDMAIER 1989, 352)<br />
Die von BALLSTAEDT & WIDMAIER zitierte Äußerung aus dem Jahr 1912, in der der<br />
kulturelle Niedergang durch Verlust aktiver Musikausübung beklagt wird, muss vor<br />
dem geschilderten Hintergrund hinterfragt werden. Klavierspiel unter den beschrie-<br />
17 FUHLBRÜGGE: Der Kampf gegen den musikalischen Schund, in: Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung<br />
LXIV, 1912, S. 474.
enen Voraussetzungen beinhaltet zwar unzweifelhaft einen höheren feinmotorischen<br />
Aufwand als das Drehen der Kurbel eines Grammophons; allerdings muss<br />
kritisch gefragt werden, in welchen Teilbereichen die dabei geleistete musikalische<br />
Aktivität die des Schallplatten-Abspielens wesentlich übersteigt. Aus dieser Sicht<br />
muss der "musikalische Niedergang", den die Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung<br />
beklagte, relativiert werden. Der "musikalische Niedergang", wenn man bei diesem<br />
Ausdruck bleiben will, hatte bereits im Vorfeld stattgefunden, als nämlich aufgrund<br />
beschränkter medialer Möglichkeiten das Musizieren unter den maßgeblichen Einfluss<br />
des Auges geriet. Andererseits kann man die massive Erhöhung der Musikpräsenz<br />
in den Wohnzimmern des 19. Jahrhunderts als begrüßenswerten Zwischenschritt<br />
im Prozess der Verbreitung und Vermittlung von Musik werten.<br />
Die Popularisierung des Klavierspiels im 19. Jahrhundert hatte zwar ursprüngliche<br />
("virtuose") musikalische Fähigkeiten nicht grundsätzlich weitertragen können. Das<br />
Phänomen des Dilettantismus kann aber als Ausgangsbasis für weiterführende gesellschaftlich-musikalische<br />
Entwicklungen betrachtet werden, die im Zuge fortschreitender<br />
Medienentwicklung auch wiederum auditives Musizieren breiteren Bevölkerungskreisen<br />
nahe bringen könnten.<br />
Heute wird das Klavierspiel in der Regel noch in der Tradition des 19. Jahrhunderts<br />
vermittelt. Erst in jüngster Zeit und durch neueste Medientechnologie eröffnen sich<br />
Möglichkeiten, die durch Verbreitung elektronischer Wiedergabemedien enorm gestiegene<br />
Präsenz von Musik zu Konsum und Berieselung durch musikstrukturelle<br />
Lernprozesse zu ergänzen. Dazu später mehr.<br />
77
2.3 Aporie: Das 20. Jahrhundert beginnt<br />
Um die Jahrhundertwende setzte ein deutlicher Umschwung bei der Suche nach den<br />
Geheimnissen der Virtuosität ein. Die mechanischen Hilfsmittel, die zur Förderung<br />
der Beweglichkeit und Kraft der Finger geschaffen worden waren, verschwanden<br />
schlagartig aus der Fachpresse. Nun richtete sich alle Aufmerksamkeit auf neue, als<br />
revolutionär erachtete Ansätze, die die Ausnutzung von Schwung- und Gewichtskräften<br />
beim Klavierspiel propagierten.<br />
Versuche, das Klavierspiel durch Steigerung des Fingertrainings zu erlernen, waren<br />
zu diesem Zeitpunkt, nach insgesamt mehr als fünfzigjährigen Versuchen, endgültig<br />
diskreditiert. Unter anderem gesundheitsschädigende Folgen des Übens machten<br />
diesen Schluss unumgänglich.<br />
In der Folge schlugen die Bestrebungen scheinbar in das Gegenteil um, blieben aber<br />
im Kern noch immer mechanistisch bestimmt: Nun wurde versucht, die Finger als<br />
Kraftquelle mehr ganzheitlichen Spielbewegungen unterzuordnen. Begriffe wie<br />
"Fall", "Gewicht" und "Schwung" wurden bedeutsam. Typische Vertreter dieser<br />
neuen Richtung waren LUDWIG DEPPE, seine Schülerin ELISABETH CALAND, TONY<br />
BANDMANN und RUDOLF MARIA BREITHAUPT.<br />
In einem Artikel über Ludwig Deppe in seiner Methode des Klavierunterrichts aus<br />
dem Jahr 1900 wird dieser Umschwung deutlich. Mit "gewöhnliche Spielart" ist dabei<br />
das traditionelle Fingerspiel mit relativ ruhig gehaltener Hand gemeint:<br />
78<br />
"Die Hand darf deshalb nicht überbürdet werden, wie es bei der gewöhnlichen<br />
Spielart so häufig geschieht, wo man von den einzelnen Fingern Kraftleistungen<br />
verlangt, für die sie von der Natur nicht beanlagt sind. Demnach also muss<br />
die Hand von dem Arm getragen, entlastet werden. In schöner runder Linie<br />
hebt der Arm die Hand mit erhobenem Pulse über die Klaviatur, um sie dann<br />
durch den ' b e h e r r s c h t e n f r e i e n F a l l ' in die Tasten zu senken, wo<br />
die Finger die Töne beseelt zu Gehör bringen." (Der Klavier-Lehrer, 23. Jg.<br />
(1900), 154)<br />
Dadurch, dass die Aufmerksamkeit nun auf größere Teile des Körpers gerichtet<br />
wurde, komplizierte sich die Betrachtung der Klaviertechnik wesentlich. Die Vielfalt<br />
der Lehren und verschiedenen klavierpädagogischen Ausrichtungen nahm erheblich<br />
zu. Viele Übungen, die nun von diversen Lehrern erfunden wurden, um die<br />
vermeintlichen Geheimnisse des Klavierspiels zu vermitteln, muten an wie esoterische<br />
Meditationsübungen. Um das besagte Ziel des "leichten Armes" zu erreichen,<br />
empfiehlt z.B. ELISABETH CALAND folgende Übung, umschrieben mit dem geheimnisvollen<br />
Begriff "Schulterblattsenkung":
"Als erste Uebung sei Folgendes mit grösster Aufmerksamkeit auszuführen:<br />
um des Gefühls uns bewusst zu werden, wie man die Hand, durch den Arm<br />
vom Rücken getragen, leicht machen kann, hebe man die Arme, von den<br />
Schultern aus, leicht nach vorne, ohne jedoch die Schultern selbst hinaufzuziehen.<br />
Man lenke seine volle Aufmerksamkeit auf die Muskeln der Schultern<br />
und des Rückens während dieser Uebung; des intensiven Gefühls, dass die<br />
Arme vom Rücken aus getragen und festgehalten werden, muss man sich voll<br />
bewusst bleiben, indem man die Arme langsam auf die Tasten niedersinken<br />
lässt." (CALAND 1897, 9f. und CALAND 1905, 34)<br />
Während für ELISABETH CALAND die Leichtigkeit des Armes entscheidend ist,<br />
spricht sich z.B. eine Zeitgenossin, TONY BANDMANN, zwar grundsätzlich ebenso<br />
für die Ausnutzung von Armbewegungen aus, kommt aber zu dem Schluss, dass das<br />
Gewicht in der Schwere des Armes und der Hand zur Geltung kommen muss:<br />
"Fall und Schwung setzen ein Gewicht voraus, umsomehr, sobald sie eine<br />
Kraftleistung zum Endzweck haben. Dieses Gewicht ist vorhanden in der<br />
Schwere des Armes, der Hand und der Finger." (BANDMANN 1903, 178)<br />
Eine beinahe euphorische Aufbruchsstimmung in der Diskussion neuer Methoden<br />
um die Jahrhundertwende vermittelt (trotz häufig diametral auseinanderführender<br />
Theorien) vielfach den Eindruck, als ob die endgültige Entschlüsselung der Geheimnisse<br />
des Klavierspiels kurz bevorgestanden hätte. Jeder Autor für sich versucht<br />
den Eindruck zu vermitteln, dem entscheidenden Hindernis, das dem Erreichen allgemeiner<br />
Virtuosität noch entgegensteht, auf der Spur zu sein. Gemeinsamkeit der<br />
in alle Richtungen divergierenden Klavierlehren jener Zeit ist allerdings die Tatsache,<br />
dass kaum mehr jemand wagte, sich für das scheinbar überholte Fingerspiel<br />
auszusprechen.<br />
Rückendeckung erhielten diese Tendenzen gegen die Fingertechnik durch Untersuchungen<br />
mit wissenschaftlichem Anspruch durch OSKAR RAIF, Professor an der<br />
"Berliner K. Hochschule für Musik", veröffentlicht im Jahr 1901 in den von Carl<br />
Stumpf herausgegebenen Beiträgen zur Akustik und Musikwissenschaft.<br />
Hier versucht RAIF empirisch zu beweisen, dass beim Klavierspiel keine Fingerbewegungen<br />
vonnöten sind, die die physische Leistungsfähigkeit des durchschnittlichen,<br />
ungeübten Menschen übersteigen. Er ließ verschiedene Testpersonen möglichst<br />
schnelle Hin-und-Her-Bewegungen mit verschiedenen Fingern machen und<br />
kam zu folgendem Schluss:<br />
79
80<br />
"Die Annahme, daß der Claviervirtuose einer über das vorhandene normale<br />
Maß gesteigerten Beweglichkeit der einzelnen Finger bedarf, erweist sich bei<br />
eingehender Beobachtung als irrthümlich.<br />
Zahlreiche Versuche mit Personen aus allen Ständen und Berufsclassen haben<br />
mir ergeben, daß wir in einer Secunde durchschnittlich 5 bis 6 Anschlagsbewegungen<br />
mit dem zweiten und dritten Finger, und nur 4 bis 5 mit den übrigen<br />
Fingern hervorbringen können.<br />
Im Allgemeinen haben Gebildete wohl eine größere Fingerbeweglichkeit als<br />
Personen niederer Stände, keineswegs aber Clavierspieler eine größere Beweglichkeit<br />
als Nichtclavierspieler.<br />
Unter den letzteren konnten einige mit Leichtigkeit 7 Anschlagsbewegungen in<br />
einer Secunde hervorbringen, während eine ganze Reihe guter Clavierspieler<br />
es im gleichen Zeitraume nur auf 5 Bewegungen brachte." (RAIF 1901, 352)<br />
Im Kontext des Scheiterns der traditionellen Fingermethode schienen RAIFS Erkenntnisse<br />
völlig mit den neuen Erfahrungen beim Klavierspiel im Einklang zu stehen.<br />
Seine Forschungsergebnisse schienen die Erkenntnis zu untermauern, die ohnehin<br />
in der Luft lag: Das Geheimnis des Klavierspiels muss auf einer anderen Ebene<br />
zu finden sein als auf der der Fingerbeweglichkeit oder -kraft. Man tendierte damals<br />
dazu, zu glauben, dass Lockerheit und Spiel mit Handgelenkbewegungen die Lösung<br />
bringen könnten. In der Folge wurde es deshalb häufig als überflüssig erachtet,<br />
der Ausbildung der Finger beim Klavierspiel besondere Aufmerksamkeit zukommen<br />
zu lassen. Obwohl RAIFS Untersuchungen lediglich die Geschwindigkeit des isolierten<br />
Hin-und-her-Bewegens eines einzelnen Fingers betrafen, leisteten sie doch<br />
der Meinung Vorschub, die Beweglichkeit der Finger sei von vornherein bei jedem<br />
Menschen ausreichend für das Klavierspiel. 18<br />
Auch das Ausbildungsziel, die Finger zum Zweck des Klavierspiels zu kräftigen,<br />
geriet in Frage. So äußerte TONY BANDMANN die Überzeugung, man müsse und<br />
könne die einzelnen Finger gar nicht trainieren:<br />
"Aber – wenn Oskar Raif nachgewiesen hat, dass es eine Täuschung sei, zu<br />
glauben, man müsse normale Finger erst gelenkig machen, damit sie die nötige<br />
S c h n e l l i g k e i t der Bewegung erreichten, – so möchte ich behaupten, es<br />
ist eine ebensolche Täuschung, wenn man glaubt, durch Uebung der einzelnen<br />
Finger deren K r a f t nennenswert zu beeinflussen." (BANDMANN 1903, 178)<br />
18 Die Untersuchungen RAIFs zeigen einen typischen Fall von "Zeitgeist-Wissenschaft". Vor dem<br />
historischen Hintergrund des Scheiterns der Ausbildung am Klavier durch Fingertechnik mussten<br />
die Untersuchungen RAIFs zu diesem Ergebnis führen. Das erwünschte Ergebnis bedingt dabei<br />
Fragestellung und Versuchsanordnung.
Erstmals wird hier im Zusammenhang von subjektiven Erfahrungen beim Klavierspiel<br />
von "Täuschung" gesprochen. Die Wissenschaft wird nun in ihrem von der<br />
unmittelbaren menschlichen Erfahrung abweichenden Zugang zur neuen Hoffnungsträgerin<br />
der Klavierpädagogik. Bei Diskrepanzen zwischen der eigenen subjektiven<br />
Wahrnehmung und wissenschaftlichen Erkenntnissen wird nun im Zweifel<br />
der Wissenschaft vertraut. Vor dem Hintergrund des Scheiterns vorangegangener<br />
Bemühungen, das Geheimnis des Klavierspiels zu entschlüsseln, kann diese Wendung<br />
nicht verwundern. Sämtlichen überkommenen und aus subjektiven Erfahrungen<br />
der ausübenden Instrumentalisten entstandenen Grundlagen, die bisher für das<br />
Spiel gegolten hatten – insbesondere symbolisiert durch die Tradition des isolierten<br />
Fingerspiels –, wurde nun aus gutem Grund mit Misstrauen begegnet.<br />
Im Gegensatz zu den ersten physiologisch orientierten Ansätzen zwanzig Jahre zuvor<br />
(z.B. von GUSTAV STOEWE, vgl. S. 68) wird die Wissenschaft nun nicht mehr<br />
nur als Mittel zur Unterstützung der Klavierpädagogik gesehen, sondern geradezu<br />
als Rettungs-Anker, um grundsätzliche Widersprüche zu klären. Dass die Lösung<br />
der Geheimnisse nur im Bereich der Bewegungsführung des Armes liegen könne,<br />
dieser Irrtum war um 1900 gängige Meinung; welchen anderen Schluss hätten die<br />
gemachten Erfahrungen auch zugelassen?<br />
Die Tendenz, Probleme des Klavierspiels mit wissenschaftlichen Hilfsmitteln in den<br />
Griff bekommen zu wollen, erreichte um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert<br />
ihren Höhepunkt. Die gängigen Methoden, Virtuosität zu vermitteln, hatten zum<br />
Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend versagt. Statt Virtuosen verließen hauptsächlich<br />
Dilettanten die Konservatorien. Die Wissenschaft avancierte zur Hoffnungsträgerin,<br />
diesem Mangel abzuhelfen. Von ihr wurden konkrete Hilfen für die Praxis<br />
erwartet, so auch von einem gewissen DR. HERTER, der sich 1905 in der Zeitschrift<br />
Der Klavier-Lehrer folgendermaßen äußert:<br />
"Indes ist doch eine wissenschaftliche Untersuchung der Körperbewegungen<br />
nicht nur, wie jeder Einblick in die Werkstatt der Natur, von allgemeinem Interesse,<br />
sondern auch von bestimmtem praktischen Wert für denjenigen, welcher<br />
eine schwierige Bewegungstechnik, wie sie das Klavierspiel darstellt, beherrschen<br />
will. Was dagegen zu sprechen scheint, sind eben nur Scheingründe.<br />
Gewiss erlernt auch der Naturmensch vieles unbewusst aus sich heraus oder<br />
durch Nachahmung Anderer, aber wie unvollkommen und oft auf welchen<br />
Umwegen!" (HERTER 1905, 85)<br />
Derartiges Vertrauen in die Wissenschaft währte allerdings nicht lange. Anstatt<br />
nämlich endlich die drängenden Fragen zu beantworten, lieferte sie im Jahr 1905 ein<br />
81
erstes handfestes Ergebnis, aber eines, das alle Hoffnungen auf praktische Verwertbarkeit<br />
schlagartig zunichte machte.<br />
EUGEN TETZEL zeigte 1905 in seinem Buch Das Problem der Modernen Klaviertechnik,<br />
dass das künstlerische Erleben beim Klavierspiel aus wissenschaftlicher<br />
Sicht in der Tat auf groben Täuschungen beruhen muss. Dieses Werk besiegelte die<br />
Abspaltung der Praxis des Klavierspiels von der Wissenschaft. TETZEL bewies<br />
darin, dass sich der gesamte klangliche Darstellungsbereich des Klaviers auf die<br />
Frage reduzieren lässt, wann und mit welcher Geschwindigkeit die Tasten bzw.<br />
Hämmer bewegt werden. Subjektiv empfundene Kategorien wie z.B. Klangfarbe<br />
oder Schönheit des Tons sind nach TETZEL beim Klavier ausschließlich durch Veränderungen<br />
der Lautstärken zu erzielen:<br />
82<br />
"Daraus ergibt sich mit unbedingter Sicherheit die für das Klavierspiel grundlegende<br />
Erkenntnistatsache: Der Klavierton an sich hat bei gleicher Tonstärke<br />
auch gleiche Klangfarbe. Die Klangfarbe ist also bei gleicher Tonstärke nicht<br />
durch die Anschlagsart des Spielers zu beeinflussen." (TETZEL 1912, 13)<br />
Die Konsequenzen beschreibt CARL ADOLPH MARTIENSSEN in seinem Buch<br />
Schöpferischer Klavierunterricht:<br />
"Folglich kann der Klavierton auch nur in einer einzigen Weise verändert werden:<br />
er kann je nach der größeren oder geringeren Endgeschwindigkeit des<br />
Hammerfluges entweder lauter oder leiser sein, und nur parallel mit der Tonstärke<br />
kann sich seine Klangfarbe verändern, – eine andere Veränderung, etwa<br />
bei gleicher Tonstärke nach Belieben weicher oder härter zu spielen, ist unmöglich."<br />
(MARTIENSSEN 1957, 26)<br />
Diese Erkenntnisse waren derart befremdlich, dass sich TETZEL einiger der damals<br />
berühmtesten Physiker rückversichern musste. Er gab Gutachten bei Geheimrat<br />
Prof. Dr. RUBENS, Direktor des physikalischen Instituts Berlin, Geheimrat Prof. Dr.<br />
MAX PLANCK, Direktor des Instituts für theoretische Physik an der Königlichen<br />
Universität zu Berlin und später Nobelpreisträger, und Geheimrat Prof. Dr. KRIGAR-<br />
MENZEL, Dozent der Physik, ebenfalls an der Königlichen Universität zu Berlin, in<br />
Auftrag. Sie bestätigten einhellig die Erkenntnisse TETZELS. MAX PLANCK schreibt:<br />
"Eine Beeinflussung der Klangfarbe einer Saite durch die Art des Anschlags<br />
kann, sofern der Hammer frei gegen die Saite fliegt, nur durch eine verschiedene<br />
Geschwindigkeit des Hammers, also durch verschiedene Tonstärke bewirkt<br />
werden." (TETZEL 1912, 172)
Diese Erkenntnis steht in derart eklatantem Widerspruch zu der Erfahrungswelt des<br />
Musikers, dass mit dieser Veröffentlichung jede Verbindung zwischen künstlerischer<br />
und wissenschaftlicher Sicht des Klavierspiels verloren war. Auch die physiologisch<br />
orientierte Klaviermethodik, wie sie OSKAR RAIF, LUDWIG DEPPE oder<br />
ELISABETH CALAND begründet hatten, obschon ursprünglich mit teilweise wissenschaftlichem<br />
Anspruch, konnte mit diesen Erkenntnissen nicht mehr vereinbart werden.<br />
Es gelang in der Praxis auch nicht, das subjektive Spielgefühl, wie es<br />
ELISABETH CALAND z.B. anhand der Schultern zu erklären versucht hatte, zu diesen<br />
physikalischen Tatsachen in Beziehung zu setzen. Die Klavierpädagogik war zum<br />
Rückzug in die Irrationalität verdammt, und die Erkenntnisse EUGEN TETZELS werden<br />
im Klavierunterricht in der Regel ignoriert.<br />
Diese Widersprüche zeigen krisenhafte Züge, wie sie zu Beginn des zwanzigsten<br />
Jahrhunderts auf vielen Gebieten zu Tage traten. In der Klavierpädagogik ließ die<br />
grundlegende Verunsicherung die Suche nach dem richtigen Weg zu einem Pendeln<br />
zwischen Extremen werden – um dann schließlich in Ratlosigkeit zu enden. Sollte<br />
den eigenen Gefühlen und damit dem Unmittelbaren oder aber den sekundären<br />
Systemen, wie sie die Wissenschaft zur Verfügung stellte, vertraut werden? Die von<br />
THOMAS NIPPERDEY aus gesellschaftlicher Sicht diagnostizierte "Modernitätskrise"<br />
lässt sich anhand der Entwicklung des Klavierspiels zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
gut nachvollziehen:<br />
"Die einfache sieghafte Selbstgewißheit bürgerlicher Pragmatiker, der auf<br />
Wissenschaft, Technik und Wirtschaft, auf Arbeit und Moral gegründete Fortschrittsglaube,<br />
vom politischen Credo des Liberalismus, des Nationalismus,<br />
des Imperialismus überwölbt, geriet auch im normalen, praktischen Bürgertum<br />
außer Kurs, ja wurde unmöglich. Nicht nur das – nostalgische – Gefühl für die<br />
Kosten der Modernisierung (etwa Heimat-, Geborgenheits- und Traditionsverluste)<br />
und Entfremdungen – das war ja schon seit der Romantik ständiger<br />
Kontrapunkt der Gebildeten gewesen – , sondern die spezifische Zuspitzung<br />
zum Krisengefühl, darauf kam es an. Nicht mehr Konservative und Traditionalisten<br />
waren davon erfaßt, sondern eigentlich alle, das Unbehagen in und an<br />
der modernen Kultur wurde zu einer Signatur der Gegenwart.<br />
Die Welt ist technischer, wissenschaftlicher, rationaler geworden, entzauberter<br />
auch: rechenhafter und bürokratischer, kälter und abstrakter. Nicht nur das<br />
Vertraute schwindet, der Rückhalt an der Tradition, sondern auch das Freie<br />
und Unmittelbare. Die Reflexivität zerstört alle Unmittelbarkeiten. Sekundäre<br />
Systeme gewinnen Macht über den Menschen, Rollenteilungen und Rollenzwänge.<br />
Die primären Erfahrungen werden von sekundären Erfahrungen<br />
überlagert." (NIPPERDEY 1988, 82f.)<br />
83
Hierbei vollzog sich eine geistesgeschichtlich entscheidende Entwicklung. Der<br />
Glaube an die Allmächtigkeit von Wissenschaft und Technik, kaum gewonnen,<br />
wurde um die Wende zum 20. Jahrhundert massiv erschüttert. Der menschliche<br />
Geist verlor die Kontrolle über sich 19 und seine Umgebung. Die Verbindung<br />
zwischen Wissenschaft und allen Gebieten der Kunst war spätestens zu diesem<br />
Zeitpunkt nicht mehr aufrecht zu erhalten.<br />
Der Kunsthistoriker CLAUS BAUMANN zeigt, dass auch in der Bildenden Kunst die<br />
ehemals parallele Entwicklung von Kunst und Wissenschaft zu Beginn des zwanzigsten<br />
Jahrhunderts von Auflösungserscheinungen gekennzeichnet ist:<br />
84<br />
"In Bezug auf den gemeinsamen RAUMZEIT-Nenner verläuft die Entwicklung<br />
der Kunst von der Renaissance an nicht zunehmend konträr zur Entwicklung<br />
der Naturwissenschaften, sondern parallel. Und dies so konsequent, daß,<br />
setzt man von der Renaissance an bis heute einen Entwicklungsprozeß von der<br />
umfassenden zur kleinstmöglichen Aussage voraus, dann beide, Naturwissenschaft<br />
und Kunst, fast exakt zur gleichen Zeit bei den ihnen möglichen kleinsten<br />
Aussagen, Raum und Zeit betreffend, anlangten: 1912 Malewitsch mit<br />
dem 'Schwarzen Quadrat' und 1916 Einstein mit der Formel 'E=mc 2';"<br />
(BAUMANN 1994, 15)<br />
Widersprüche zwischen Subjekt und Objekt, die zu jener Zeit deutlich wie nie zuvor<br />
zu Tage treten, werden am Beispiel des Klavierspiels ebenso evident wie z.B. in der<br />
Bildenden Kunst oder den Wissenschaften. Die Erkenntnisse TETZELS führen die<br />
Entwicklung des Klavierspiels an jenen "Nullpunkt", der für die Physik durch<br />
ALBERT EINSTEINS Spezielle Relativitätstheorie im Jahr 1905 und für die Komposition<br />
durch die erste "atonale" Komposition, die Klavierstücke op. 11 von ARNOLD<br />
SCHÖNBERG im Jahr 1909 markiert wird.<br />
In dieser Phase trennen sich Kunst und Wissenschaft endgültig. Die Erklärbarkeit<br />
künstlerischer Phänomene wird nun prinzipiell negiert. HELGA DE LA MOTTE-<br />
HABER befasst sich in ihrer Musikpsychologie mit der Rezeption des Buches Die<br />
Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der<br />
Musik von HERMANN VON HELMHOLTZ aus dem Jahr 1863. Hier glaubt sie, das Jahr<br />
1913 als entscheidenden Wendepunkt auszumachen: 20<br />
19 Insbesondere durch das Wirken SIGMUND FREUDs.<br />
20 HELGA DE LA MOTTE-HABER leitet diese erstaunlich präzise Festlegung auf das Jahr 1913 möglicherweise<br />
aus der Tatsache ab, dass die HELMHOLTZsche Lehre in jenem Jahr ihre sechste und<br />
letzte Auflage erfuhr (vgl. RECHENBERG 1994, 463).
"Das Buch von Helmholtz ist im Zusammenhang mit jenen Versuchen zu verstehen<br />
[...], die Naturgesetzlichkeiten für den Bereich der Kunst aufweisen<br />
wollten. Daß das Jahr 1913 eine Zäsur in der Geschichte der Rezeption seiner<br />
Gedanken bedeutet, hängt nur mittelbar mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges<br />
zusammen, sondern vielmehr damit, daß das Interesse an solchen Bemühungen<br />
erlahmte; die rasche Entwicklung der Musik demonstrierte zu deutlich,<br />
daß Aussagen, die auf den gleichen Fundamenten wie jene der Naturwissenschaften<br />
basierten, für die Musik nicht zu erstellen sind." (DE LA MOTTE-<br />
HABER 1984, 62)<br />
Die Dramatik dieser Situation für die Klavierpädagogik besteht darin, dass erst kurz<br />
vor der Jahrhundertwende das ältere System des exzessiven Fingerspiels unter dem<br />
Druck grassierender Erkrankungen zusammengebrochen war. Nun endet auch der<br />
wissenschaftliche Versuch, die Geheimnisse der Virtuosität zu entschlüsseln, quasi<br />
als letzte Hoffnung, das Klavierspiel doch noch versteh- und damit schlüssig lehrbar<br />
zu machen, ergebnislos.<br />
Deutlich geht sowohl die vorläufige Euphorie zu Beginn des 20. Jahrhunderts als<br />
auch deren anschließender Zusammenbruch aus dem Vorwort von WALTER<br />
NIEMANN zur sechsten Auflage von ADOLPH KULLAKS Ästhetik des Klavierspiels<br />
hervor. Selten musste ein Herausgeber eine Auflage eines Buches derart revidieren.<br />
Im Jahr 1916 distanziert sich NIEMANN radikal von seinen eigenen Einschätzungen<br />
aus dem Jahr 1906. Die "neue" Methode des Klavierspiels unter Berücksichtigung<br />
physiologischer Erkenntnisse scheint, wie der folgende Ausschnitt aus NIEMANNS<br />
Vorwort deutlich macht, völlig versagt zu haben:<br />
"Als die vierte Auflage 1906 erschien, stand die moderne, psycho-physiologische<br />
Methodik des Klavierspiels der Deppe-Caland-Lehre, des Breithauptschen<br />
Arm- und Gewichtsspiels, der Clark-, Jaell-, Leschetizky-Methoden<br />
usw. im Vordergrund eines geradezu sensationellen Interesses. Entzückt ob der<br />
berauschenden Entdeckungen der wahren Kraftquellen des Klavierspiels,<br />
schüttete man das Kind mit dem Bade aus und verurteilte alles, was methodisch<br />
auf älterem, physiologisch nicht urbar gemachtem Boden stand, in<br />
Bausch und Bogen. Ich [...] gab [...] meiner damaligen Neuausgabe vielfach<br />
ein fremdes und manchem in der scheinbar einseitigen Parteinahme für die<br />
moderne Methodik mit Recht sehr unerwünschtes Gesicht.<br />
Die neun Jahre haben mich immer mehr überzeugt, dass, da ich die moderne,<br />
einseitig physiologisch aufgebaute Klaviermethodik als Extrem der Revolution<br />
gegenüber dem Extrem der Reaktion der älteren Methodik als eine notwendige,<br />
aber vorübergehende Erscheinung ansehe, diese Pflicht ihrer Einarbeitung in<br />
die ältere Methodik nicht mehr vorliegt." (KULLAK 1861/1916, XIIf.)<br />
85
Indem NIEMANN nun die neuen Wege verwirft, vollzieht er gezwungenermaßen einen<br />
Rückschritt zu eigentlich bereits gescheiterten Methoden der Vergangenheit.<br />
Die Hoffnungen auf eine theoretische Lösung der Geheimnisse der Virtuosität<br />
rückten jedenfalls in weite Ferne.<br />
Für das transzendente Image des Virtuosen und zu einem gewissen Grad auch des<br />
Lehrers war diese Krise andererseits durchaus förderlich. Wenn es nicht möglich ist,<br />
die Fähigkeit zum Musizieren entsprechend zu vermitteln, muss die Ursache für das<br />
Können wohl in der Begabung liegen. Diese scheinbar genetisch verursachte Ausnahmestellung<br />
des Künstlers erhöht seine Attraktivität. Die aus dem 19. Jahrhundert<br />
überkommene Aura des Künstlers erhielt durch das Scheitern der rationalen Methoden<br />
zusätzliche Bestätigung. Wenn die Virtuosität mit "irdischen" Mitteln nicht zu<br />
erklären ist, muss es sich folglich um eine Art übermenschliche Fähigkeit handeln.<br />
So nimmt der Künstler in der Gesellschaft einen Teil der Rolle des Adligen aus früheren<br />
Zeiten ein: Es liegt aus dieser Perspektive eine Auserwähltheit von Geburt<br />
vor, die den Künstler in eine Position zwischen Diesseits und Transzendenz erhebt.<br />
Eine seltsame Aura von Mystik und Esoterik lag in den Unterrichtszimmern, wo der<br />
Geist der Musik mit schmuckvollen Metaphern zu vermitteln versucht wurde. Wunderliche<br />
Äußerungen wie die folgende finden sich durchaus noch in der sechsten<br />
Auflage von 1916 von ADOLPH KULLAKS Ästhetik des Klavierspiels:<br />
86<br />
"Bald ist es das zarte Streicheln der Fingerspitze, bald die ihre Beute durchbohren<br />
wollende Hand. Einmal falten sich die Finger enggeschlossen wie eine<br />
Masse zusammen, ein andermal fahren sie im Tarantellauf, spinnenartig gespreizt<br />
daher, dann wieder stehen ein oder mehrere Finger fest wie eingewurzelt<br />
auf einer Stelle, und andere weben geheimnisvolle Figuren, dann springt<br />
geschossartig, oder wie der Löwe auf seine Beute sich wirft, die Hand von einem<br />
Punkt nach einem entfernten." (KULLAK 1861/1916, 250f.)<br />
Der didaktische Wert solcher Aussagen ist allerdings zumindest ebenso zweifelhaft<br />
wie beispielsweise die bereits zitierte, eher der rationalen Welt entnommene Äußerung<br />
von ELISABETH CALAND bezüglich der Frage, wie sich die Schulter beim Spiel<br />
anzufühlen habe. Der Unterricht wird so zu einem Versuch, das Nichtwissen um die<br />
Zusammenhänge hinter einer sagenumwobenen Sprache zu verbergen. Der angenehme<br />
Nebeneffekt für den Lehrer: Sollte der Unterricht keinen Erfolg zeitigen,<br />
verbietet seine Aura Zweifel an seiner Didaktik. Die Ursache für den Misserfolg<br />
wird dann mit mangelnder Begabung des Schülers erklärt. Die fragwürdige Unterscheidung<br />
in musikalische und unmusikalische Menschen erfuhr hierdurch ihre<br />
scheinbare Bestätigung. Der Schüler taugt nicht zum Künstler, er muss "Mensch"<br />
bleiben.
Der Rückzug der Klavierpädagogik ins Irrationale in den Jahren um 1910 vollzog<br />
sich mit einem kräftigen Pendelschlag. Endlich hatte das Klavierspiel wieder ein<br />
eigenes Existenzrecht auszufüllen, das ausschließlich im emotionalen Bereich gesucht<br />
und mit poetischen Assoziationen ausgefüllt wurde. Von dieser Wendung<br />
zeugt das 1911 zum ersten Mal erschienene Büchlein Von der Poesie des Klavierspiels<br />
von JOSEPH PEMBAUR D. J. Hier werden poetische, die Fantasie beflügelnde<br />
Anregungen gegeben – insbesondere, um den geistigen Hintergrund für die zu interpretierenden<br />
Werke zu schaffen und mit Gestaltungskraft zu füllen. Es wird nun, da<br />
schon kein rationales Gegenstück zur Musik vorhanden zu sein scheint, das Gefühl<br />
als Äquivalent bemüht. Auch das Vokabular PEMBAURS vermittelt eine poetische<br />
Stimmung, so werden beispielsweise Vergleiche mit Gedichten RILKES angestellt<br />
(vgl. PEMBAUR 1917, 11). PEMBAUR empfiehlt zum Studium des Klavierspiels insbesondere<br />
Begleitungen von Melodramen und Liedern und begründet dies wie folgt:<br />
"Abgesehen davon, daß diese Werke uns mit den bedeutendsten Dichtern bekannt<br />
machen, deren Beziehungen, wie die der Maler und anderer Künstler zu<br />
den Komponisten, seien sie nun durch ihre Gedichte und Bilder oder durch ihr<br />
Leben geknüpft, viel zu wenig beachtet werden, zeigen sie uns, wie man ganz<br />
bestimmte Gefühle in Tönen zum Ausdrucke bringt, und wir lernen dadurch<br />
wieder in der sogenannten absoluten Musik bestimmte Tongruppen in die entsprechenden<br />
Gefühle umzudeuten." (PEMBAUR 1917, 37)<br />
Ein Beispiel für diese direkte Umdeutung in Gefühle, wie sie PEMBAUR vorschlägt,<br />
sei zur Verdeutlichung angefügt:<br />
87
Abb. 18: PEMBAUR 1917, S. 8.<br />
Charakteristisch für die Auffassung PEMBAURS ist die von romantischen Vorstellungen<br />
geprägte Ansicht, dass allein das Gefühl die Transzendenz des Kunstwerks zu<br />
erschließen vermag. Hinzu kommen Elemente der Affektenlehre, indem bestimmten<br />
Spielfiguren bestimmte Gemütszustände zugeordnet werden.<br />
Die Zeitschrift Der Klavier-Lehrer erschien im Jahr 1910 zum letzten Mal, nachdem<br />
es nun im Zustand allgemeiner Ratlosigkeit offenbar keine Geheimnisse gab, deren<br />
Diskussion nutzbringend erschienen wäre. Die Integration dieser Zeitschrift in die<br />
Musikpädagogischen Blätter ist Indiz dafür, dass das Musizieren nun weniger in-<br />
88
strumentenspezifisch und damit weniger äußerlich betrachtet wurde. Das Klavierspiel<br />
insgesamt verlor in jener Zeit erheblich an Faszination, wesentlich mitverursacht<br />
durch die Verbreitung akustischer Wiedergabemedien (vgl. S. 76 und<br />
BALLSTAEDT & WIDMAIER 1989, 351-364).<br />
2.4 Reformansätze<br />
Das Problem des dilettantischen Klavierspiels wurde regelmäßig von den Autoren<br />
der Praktikerliteratur artikuliert. EUGEN SCHMITZ z.B. wies im Jahr 1919 in der<br />
<strong>Einleitung</strong> zu seinem Buch Klavier, Klaviermusik und Klavierspiel auf die Gefahr<br />
hin, die besteht, wenn auf einem Instrument, auf dem die Tonhöhen konstruktionsbedingt<br />
festliegen und durch einfaches Drücken einer Taste zum Erklingen gebracht<br />
werden können, vorgefertigte Noten gespielt werden. Zunächst begrüßt er aber, dass<br />
"[...] das Klavier im Laufe der Zeit insbesondere das beliebteste Hausinstrument<br />
geworden ist, das heute im Fürstenpalast wie im bescheidenen Bürgerhaus<br />
seinen festen, unbestrittenen Platz gefunden hat.<br />
Freilich hat diese gemeinverbreitete Pflege des Klavierspiels auch ihre<br />
S c h a t t e n s e i t e n . Das Klavier ist das einzige Instrument, das den Ton<br />
fertig hergibt. Keine Nachprüfung, etwa mit Hilfe des Gehörs, ist nötig oder<br />
möglich. Mit rein mechanischer Fingertechnik läßt sich verhältnismäßig viel<br />
erreichen. Ein Musizieren, das seinen Anfang und sein Ende im Klavierspielen<br />
findet, verfällt darum nur zu leicht jener Gedankenlosigkeit und<br />
O b e r f l ä c h l i c h k e i t , die leider für das Dilettantentum von heute zum<br />
beschämenden Kennzeichen zu werden droht. Soll darum das moderne häusliche<br />
Klavierspiel wirklich kulturelle Bedeutung gewinnen, so müssen sich nicht<br />
nur die Finger, sondern auch Geist und Herz daran beteiligen. Zunächst muß<br />
ein tieferes Eindringen in Wesen und Technik der Musik, als es das Instrument<br />
allein zu vermitteln vermag, angestrebt werden durch Schulung des Gehörs,<br />
durch Studium wenigstens der Elemente der musikalischen Grammatik [...]."<br />
(SCHMITZ 1919, 1f.)<br />
Ähnliche Bedenken waren von Vordenkern wie z.B. HUGO RIEMANN seit der zweiten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts regelmäßig geäußert worden und waren Anlass für<br />
Versuche, durch Einführung von Musiktheorie in den Fächerkanon an Konservatorien<br />
die aufgetretenen Mängel zu kompensieren. Das erkannte Grundübel aber,<br />
nämlich das Spiel ohne hinreichende Beteiligung des Gehörs, war mit der Einführung<br />
der Musiktheorie offensichtlich nicht grundsätzlich gebannt, dies belegen<br />
89
EUGEN SCHMITZ’ Äußerungen aus einer Zeit, in der die Musiktheorie in aller Regel<br />
bereits Bestandteil höherer musikalischer Ausbildung war.<br />
Einen weiteren Ansatz im Kampf gegen den Dilettantismus stellt die durch LEO<br />
KESTENBERG initiierte Einführung der Staatlichen Musiklehrerprüfung im Jahr 1925<br />
dar (vgl. ECKSTAEDT 1996, 63). Durch eine zentral geregelte Abschlussprüfung<br />
sollte ein einheitlicher Qualitätsmaßstab für die Instrumentallehrer-Ausbildung geschaffen<br />
werden. Die Inhalte dieser Prüfung zeigen Bestrebungen, durch entsprechende<br />
Anforderungen in den begleitenden Fächern Musikgeschichte und Musiktheorie<br />
eine umfassende musikalische Bildung von Instrumentallehrern zu gewährleisten.<br />
Hierbei blieben die praktischen Ausbildungsinhalte am Instrument auf den<br />
reproduktiv-interpretatorischen Bereich beschränkt.<br />
Dagegen zeigt das 1930 in der Musikpädagogischen Bibliothek als Band 4 erschienene<br />
Buch Klavierpädagogik von FRIEDA LOBENSTEIN einen über die Anforderungen<br />
der Staatlichen Musiklehrerprüfung hinausweisenden Ansatz. Klavierpädagogik<br />
wird von ihr nicht auf Aspekte des Instruments beschränkt, sondern als Teil einer<br />
umfassenden Musikerziehung gesehen. LOBENSTEIN grenzt sich bewusst ab von einem<br />
auf solistische Leistungen abgerichteten, vordergründig-technischen Klavierspiel:<br />
90<br />
"Dieses Buch wurde 'Klavierpädagogik' betitelt. Hiermit soll ausgedrückt werden:<br />
es ist nicht nur eine Klaviermethodik oder eine Techniklehre, es stellt also<br />
nicht einen Lehrgang lediglich für das Klavierspiel auf. Klavierpädagogik<br />
heißt: Musikerziehung unter wesentlicher Einbeziehung des Klavierspiels.<br />
Hierdurch grenzt sich diese Arbeit bewußt ab von einer Unterweisung für die<br />
Beherrschung des Klaviers nur als eines Soloinstruments. Es soll so den Richtlinien<br />
entsprochen sein, wie sie der Herausgeber in seiner prinzipiellen <strong>Einleitung</strong><br />
zur 'Musikpädagogischen Bibliothek' vorgezeichnet hat. Denn auch diese<br />
'Klavierpädagogik' hat als leitenden Gedanken, einen Beitrag für die Musikpädagogik<br />
als Ganzheit zu liefern, das instrumentale Spiel – in diesem Fall das<br />
Klavierspiel – einzuordnen in diese Ganzheit." (LOBENSTEIN 1931/1960, 3)<br />
Als entscheidender Sinneskanal des Musizierens wird von ihr das Gehör genannt:<br />
"Als der diese musikalischen Grundstrukturen aufnehmende Sinn wurde das<br />
Gehör einem besonderen, planmäßigen Bildungsprozeß zugeführt, und so<br />
wurde die Gehörbildung zu einer zentralen Aufgabe der Musikerziehung."<br />
(LOBENSTEIN 1931/1960, 3)<br />
FRIEDA LOBENSTEIN legt besonderen Wert auf die zentrale Funktion der Improvisation<br />
als im musikalischen Kontext praktizierte (und nicht, wie in Musiktheorie üb-
lich, aus dem musikalischen Zusammenhang gelöste) Gehörbildung und Mittel für<br />
die Ausbildung des Klangvorstellungsvermögens:<br />
"Die schöpferischen Kräfte sollen zur Betätigung entfaltet werden auf dem<br />
Gebiet der Improvisation, und die Improvisation trat in den Vordergrund, weil<br />
in ihr eben der Anteil der schöpferischen Selbsttätigkeit und einer aus Eigenstem<br />
fließenden Erarbeitung der Stoffgebiete entscheidendste Bedeutung hat.<br />
Die Fähigkeit, alle diese Bewegungsvorgänge zu erkennen, die Bereitschaft für<br />
die Improvisation sind nur zu erzielen, wenn das musikalische Gehör genügend<br />
gebildet wird, um mit einer klaren, sicheren Klangvorstellung alle musikalische<br />
Betätigung zu leiten." (LOBENSTEIN 1931/1960, 4)<br />
Die Reformideen FRIEDA LOBENSTEINS konnten sich in der Praxis allerdings nicht<br />
durchsetzen. Einerseits hatte Improvisation immer noch mit dem Ruf der niederen<br />
Kunst zu kämpfen, was neben den lächerlichen Versuchen in "Pseudo-Virtuosentum"<br />
des 19. Jahrhunderts (vgl. S. 56f.) auch in der Erscheinung gründet, dass<br />
Improvisation fester Bestandteil der Unterhaltungsmusik blieb und somit von der<br />
auf schriftliche Medien sich stützenden Interpretationspädagogik als typisches Unterscheidungsmerkmal<br />
zwischen niederer und hoher Kunst herangezogen werden<br />
konnte. Die improvisatorische Tradition in der Ausübung klassischer Musik war<br />
spätestens seit der Jahrhundertwende verloren, so dass diese Fähigkeit, da in der Regel<br />
nicht mehr vorhanden, auch nicht mehr vermittelt werden konnte. Die anhaltende<br />
Beschränkung auf die Wiedergabe gedruckter Werke blieb übrigens auch Garant<br />
dafür, dass restriktiver Unterricht weiterhin möglich und damit Dilettantismus<br />
unter Klavierlehrern schwer zu entlarven blieb. Damit tragen auch Interessen der<br />
Selbstbehauptung der Zunft – bis in die Gegenwart (vgl. S. 134) – zu einem ausgeprägten<br />
Beharrungsvermögen tradierter Unterrichtsformen bei. 21<br />
21 In Deutschland hat insbesondere auch die politische Entwicklung in den 30er Jahren dazu beigetragen,<br />
ganzheitliche Ansätze im Keim zu ersticken. So konnte FRIEDA LOBENSTEIN nur bis 1933<br />
Leiterin des Musiklehrerseminars an der Staatlichen Hochschule für Musik in Berlin bleiben und<br />
musste 1939 nach Brasilien auswandern. Diese geistig-politische Entwicklung ist als entscheidend<br />
auch für die Stagnation der Musikerziehung in Deutschland in jener Zeit zu werten. So bedient<br />
das Vorwort ADOLF HITLERS in einem Prospekt des Robert-Schumann-Konservatoriums<br />
der Stadt Düsseldorf aus dem Jahre 1939 alle Klischees von der Trennung in "von Gott begnadete"<br />
Genialität und "technisches Können" als Voraussetzung zu musikalischer Äußerung, die<br />
mit Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich hätten überwunden sein sollen:<br />
"Wer von der Größe der Schönheit oder dem Schmerz, dem Leid einer Zeit und seines Volkes<br />
durchdrungen oder überwältigt wird, kann, wenn er von Gott begnadet ist, auch in Tönen sein Inneres<br />
erschließen. Das technische Können ist wie immer die äußere notwendige Voraussetzung<br />
für die Offenbarung der inneren Veranlagung." (HITLER 1939).<br />
91
2.5 Die zweite Jahrhunderthälfte<br />
Die Rolle des Gehörs und des Klangvorstellungsvermögens als zentrale Instanzen<br />
musikalischer Betätigung wird in allen ernst zu nehmenden Klavierdidaktiken des<br />
20. Jahrhunderts ausdrücklich hervorgehoben. Andererseits beschränken sich fast<br />
alle Autoren auf Aspekte des Interpretierens von Notentexten. Aus dieser Tatsache<br />
ergibt sich erheblicher Diskussionsbedarf.<br />
In ihrem 1929 in Deutschland erschienenen und in der Instrumentalpädagogik immer<br />
noch aktuellen Buch Der lebendige Klavierunterricht legt etwa MARGIT VARRÓ<br />
Wert auf die Feststellung, dass es sich auch bei ihrer Didaktik nicht um technisch<br />
orientierten Drill, sondern um eine ganzheitliche Erziehung zur Musik handele.<br />
Auch sie widmet der Ausbildung des Gehörs besondere Aufmerksamkeit:<br />
92<br />
"Der Klavierunterricht ist, wie jede Unterweisung im instrumentalen Spiel, in<br />
erster Linie als Musikunterricht aufzufassen. Er entspricht diesem Zweck nicht,<br />
wenn sich der Lehrer darauf beschränkt, dem Schüler das Notenlesen beizubringen,<br />
sowie die manuelle Fertigkeit, deren er bedarf, um die den Noten entsprechenden<br />
Tasten kunstgerecht anzuschlagen. Der Klavierunterricht kann<br />
nur dann als Musikunterricht angesprochen werden, wenn die Entwicklung der<br />
technischen Fertigkeit Hand in Hand geht mit der Ausbildung des Gehörs und<br />
der Erziehung des musikalischen Verständnisses. – Dies klingt selbstverständlich,<br />
ist es aber nicht. – Es ist so viel gesündigt worden durch den seelenlosen<br />
technischen Drill, der zahllosen jugendlichen Musikliebhabern das Wesen der<br />
Musik verschleiert, entstellt und verleidet hat, daß es an der Zeit ist, als erste<br />
Hauptregel den Satz aufzustellen: das Kind muß alles verstehen, was es spielt,<br />
besser gesagt, es muß bereits richtig musikalisch aufgefaßt haben, was es am<br />
Instrument doch nur wiedergeben soll. Sonst wird Klavier gespielt, aber nicht<br />
musiziert.<br />
Für die Musikerziehung könnte man mit wenig Spitzfindigkeit aus dieser Äußerung schließen,<br />
dass musikalische Ausbildung sinnvollerweise darin bestehen müsse, ausschließlich technische<br />
Lehrinhalte zu vermitteln, da musikalische Fähigkeiten, weil angeboren, nicht bildbar seien.<br />
Der Glaube an den menschlichen Willen als Garant für Erfolg, der das ausgehende 19. Jahrhundert<br />
geprägt hatte und der sich in der Klavierpädagogik in den mechanischen Übehilfen spiegelt,<br />
die technokratische Hybris, die eigentlich spätestens mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hätte<br />
bewältigt sein müssen, wurde im Hitlerdeutschland geradezu verzweifelt wieder heraufbeschworen.<br />
Dass es sich hierbei auch und gerade auf dem Gebiet der Kunst um eine ungeeignete Strategie<br />
handeln muss, hätte eigentlich auch das Scheitern einseitiger Bemühungen in der Vermittlung<br />
des Klavierspiels der zweiten Hälfte des vorangegangenen Jahrhunderts gelehrt haben müssen.<br />
So gesehen kann der geistige Hintergrund des Nationalsozialismus als (hoffentlich letzter) vergeblicher<br />
Versuch betrachtet werden, die auf S. 83 erwähnte Modernitätskrise ungeschehen zu<br />
machen und als zu komplex erachtete Weltbilder durch konkretere, damit aber unzulässig vereinfachte<br />
zu ersetzen.
Abweichend von der gewohnten Unterrichtspraxis [Hervorhebung von mir,<br />
H.K.] fällt der hier dargestellten Methode der Entwicklung des Gehörs eine<br />
zentrale Rolle zu." (VARRÓ 1929, 7f.)<br />
Besonders aufschlussreich ist dabei, dass MARGIT VARRÓ die zentrale Bedeutung<br />
des Gehörs in ihrer Methode als "abweichend von der gewohnten Unterrichtspraxis"<br />
bezeichnet. In ähnlicher Weise sieht auch KARL LEIMER in seinem Buch Modernes<br />
Klavierspiel nach Leimer-Gieseking die Bedeutung des Gehörs bei seiner Methode<br />
als Ausnahme:<br />
"Der Hauptunterschied meiner Unterrichtsweise gegenüber anderen [Hervorhebung<br />
von mir, H.K.] und eine der wichtigsten Grundlagen meines Systems<br />
ist die Trainierung des Ohres. Die meisten Klavierspieler hören sich selbst garnicht<br />
[sic] richtig!" (LEIMER 1931, 11)<br />
Wo immer in der Praktikerliteratur des 20. Jahrhunderts das Primat des Ohrs beim<br />
Musizieren hervorgehoben wird, wird meist gleichzeitig betont, dass es sich dabei<br />
um eine positive Ausnahme und besondere Errungenschaft der Methode des jeweiligen<br />
Autors handele.<br />
Auch CZESLAW MAREK setzt sich in seiner Lehre des Klavierspiels mit dem zentralen<br />
Problem der Ausbildung des Gehörs auseinander. MAREK stellt dabei eine Hierarchie<br />
von musikalischen Fähigkeiten auf, deren Reihenfolge weder beim Musizieren<br />
noch beim Lernen verändert werden darf:<br />
<strong>1.</strong> Klangvorstellungsvermögen<br />
2. Klanggestaltungskraft<br />
3. Klangdarstellungsfähigkeit (=Technik)<br />
Aus dieser Hierarchie ergibt sich für MAREK, dass Technik nur auf der Grundlage<br />
einer Klangvorstellung erworben werden kann:<br />
"Der Musizierende muß befähigt werden, alles, was er spielt, oder singt, innerlich<br />
zu hören, und zwar ehe er es spielt oder singt. Jedes anders geartete 'Musizieren'<br />
ist inhaltlos und daher zwecklos. Wollte ein Musiklehrer seinen Instrumental-<br />
oder Vokalunterricht mit der Förderung der Klanggestaltungskraft<br />
oder gar Technik beginnen, ohne auf den noch unentwickelten Zustand des<br />
Klangvorstellungsvermögens seines Schülers Rücksicht zu nehmen, so wären<br />
seine Bemühungen unzweckmäßig. Die Anweisungen und Anregungen, welche<br />
zur Steigerung des Ausdruckswillens und zur Differenzierung der musikalischen<br />
Gestaltung führen, können, ähnlich wie der Lehrgang der Technik, erst<br />
dann ihren Zweck erfüllen, wenn der Stoff des Musizierens, also die Melodie,<br />
93
94<br />
der Rhythmus und die Harmonie der zu erlernenden Musikstücke, im Klangvorstellungsvermögen<br />
des Musikschülers lebt bzw. durch Vermittlung des<br />
Klangvorstellungsvermögens zu seinem 'inneren Inhalt' geworden ist. Diese<br />
Forderung gilt für alle Unterrichtsstufen, ganz besonders ist sie aber für den<br />
Anfängerunterricht wichtig." (MAREK 1986, 36f.)<br />
Eine ähnliche Meinung vertritt auch CARL ADOLPH MARTIENSSEN. Er setzt sich in<br />
seinem Standardwerk Schöpferischer Klavierunterricht ebenfalls ausführlich mit<br />
dem Problem der Ausbildung des Gehörs auseinander. MARTIENSSEN demonstriert<br />
am Beispiel des jungen W. A. MOZART den von ihm (MARTIENSSEN) so genannten<br />
Wunderkindkomplex. Daran versucht er zu verdeutlichen, wie MOZART als kleines<br />
Kind an die Musik herangeführt wurde. Dieses Muster, dieser "Komplex", dient ihm<br />
als Idealbild musikalischen Lernens, an dem sich seiner Meinung nach jeder Musikunterricht<br />
orientieren muss. MARTIENSSEN zitiert einen Brief des salzburgischen<br />
Hoftrompeters SCHACHTNER an MOZARTs Schwester mit der Schilderung, wie<br />
MOZART zum ersten Mal in einem Streichquartett die zweite Geige spielte, ohne<br />
dieses Instrument jemals erlernt zu haben. Seine höchst konkrete Klangvorstellung<br />
suchte und fand von selbst die richtigen Töne auf dem Griffbrett, wenn auch zunächst<br />
"[...] mit lauter unrechten und unregelmäßigen Applicaturen [...]."<br />
(MARTIENSSEN 1957, 3)<br />
MARTIENSSEN beschreibt auch, wie Wolfgang seine ersten Erfahrungen am Klavier<br />
sammelte:<br />
"Über die Erlernung des Klavierspiels berichtet Schlichtegrolls Nekrolog nach<br />
Mitteilungen der Schwester:<br />
'Die Tochter (die Schwester W.A. Mozarts) zeigte ein so entscheidendes Talent<br />
zur Musik, daß der Vater früh mit ihr den Unterricht im Klavier begann, dies<br />
machte auf den etwa dreijährigen Knaben einen großen Eindruck; er setzte sich<br />
auch ans Klavier und konnte sich dort lange mit dem Zusammensuchen von<br />
Terzen unterhalten, die er unter Freudenbezeugungen über seinen Fund zusammen<br />
anschlug; auch behielt er hervortretende Stellen der Musikstücke, die<br />
er hörte, im Gedächtnis. Im vierten Jahre seines Alters fing der Vater gleichsam<br />
spielend an, ihn einige Menuette und andere Stücke auf dem Klavier zu<br />
lehren; in kurzer Zeit konnte er sie mit der vollkommensten Sauberkeit und mit<br />
dem festesten Takte spielen. Bald regte sich in ihm der eigene Schaffenstrieb,<br />
im fünften Jahre komponierte er kleine Stücke, die er seinem Vater vorspielte<br />
und von diesem zu Papier bringen ließ.'" (MARTIENSSEN 1957, 2)
Wolfgang konnte zu dieser Zeit noch keine Noten lesen. 22 MARTIENSSEN zieht folgende<br />
Schlussfolgerungen:<br />
"Was ist nun das Wichtige an diesen Berichten? Das psychologisch und pädagogisch<br />
Wichtigste ist, daß bei dieser musikalischen Frühentwicklung nicht<br />
das intellektuelle Lernen, sondern der Sinn, der Gehörssinn, der Klangsinn, im<br />
spielenden Sichbetätigen das primum agens ist. Die Grundlage gibt das von<br />
Musik erfüllte Haus. Klänge und Melodien speichern sich im Gehirn auf. [...]<br />
Suchend, und das ist das Wichtige, mit dem Gehörssinn suchend geht der<br />
Dreijährige ans Klavier und kann sich nicht genug tun in den neuen Entdeckungen,<br />
die er hier macht." (MARTIENSSEN 1957, 3)<br />
Auch nach MARTIENSSENS Meinung stellt ein solches Musizieren unter der Führung<br />
des Gehörs in der Wirklichkeit der Musikpädagogik die Ausnahme dar. Ebenso wie<br />
CZESLAW MAREK das Bilden der Klangvorstellung vor Wiedergabe von Noten keineswegs<br />
für selbstverständlich hält und wie KARL LEIMER und MARGIT VARRÓ sich<br />
in ihrer vom Ohr gesteuerten Lehrmethode als Ausnahme sehen: – ebenso bezeichnet<br />
auch CARL ADOLPH MARTIENSSEN dieses vom Klangvorstellungsvermögen ausgehende<br />
Musiklernen als seltene positive Ausnahme. Als Normalfall im üblichen<br />
Klavierunterricht und gleichzeitig Negativbeispiel stellt MARTIENSSEN (1957, 8)<br />
22 Auch der Lernweg CLARA WIECKS zeigt eine eindeutige Priorität in der Ausbildung des Auditiven<br />
vor dem Visuellen. Sie spielte erst jahrelang nach Gehör, bevor sie Noten lernte. MARTIN<br />
GELLRICH berichtet:<br />
"Sie begann erst zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr, einzelne Worte zu sprechen,<br />
wohl u. a. deshalb, weil sie in ihrer Kindheit einer 'wenig sprachseligen Magd' überlassen war.<br />
Klavierspielen hörte sie jedoch sehr viel und bildete dadurch schneller ein Gehör für musikalische<br />
Töne als für Sprache aus. Im vierten Lebensjahr begann sie unter Anleitung ihrer Mutter,<br />
auf dem Klavier einige Übungen bei stillstehender Hand im Fünftonraum und außerdem leichte<br />
Begleitungen nach dem Gehör zu Tänzen zu spielen. Die Doppelgleisigkeit der Lernmethode:<br />
Passagenübungen und Spiel nach dem Gehör, wurde von ihrem Vater F. Wieck fortgeführt, bei<br />
dem sie ab dem fünften Lebensjahr Unterricht hatte. 'Sie lernte zunächst stufenweise alle Tonleitern<br />
in Dur und Moll rasch nach einander mit beiden Händen zusammen, sowie Dreiklänge in jeder<br />
Lage und aus allen Tonarten. Zugleich ließ sie der Vater nach dem Gehör eine Menge eigens<br />
für sie geschriebener kleiner Stücke einüben' (LITZMANN 1906, 6). Clara lernte gleichzeitig Klavierspielen<br />
und Sprechen. Ähnlich wie das Gefühl für den Sprachrhythmus beim Muttersprachenerwerb<br />
über das Nachahmen angeeignet wird, bildete Clara durch Imitation ihres Vaters<br />
ziemlich rasch ein sicheres Taktgefühl aus. Die Berechnung der Takteinteilung lernte sie erst mit<br />
acht Jahren, zugleich mit dem Bruchrechnen in der Schule, in einem Alter, in dem sie immerhin<br />
bereits Hummels Konzert op. 73 bewältigte. Ähnlich wie das Lesen beim Muttersprachenerwerb,<br />
spielte auch das Notenlesen bei Claras Musiklernen zunächst keine Rolle. Sie lernte das Notenlesen<br />
über das Schreiben und begann erst im ausgehenden sechsten Lebensjahr mit dem Spiel nach<br />
Noten. Dank dieser Unterrichtsmethode lernte Clara schon sehr früh neben dem Spiel nach Noten<br />
auch zu improvisieren und zu komponieren." (GELLRICH 1992, 78)<br />
95
statt dessen ein Modell vor, bei dem die Bewegungsausführung rein visuell vom<br />
Notenbild motiviert ist (siehe S. 99).<br />
Sollte ein solches Musizieren in der Tat heute noch der Normalfall sein, und sollten<br />
die zuletzt zitierten Äußerungen der Praktiker zutreffen, beruhte der gängige, von<br />
visuellen Medien geprägte Klavierunterricht in der Regel, wie es CZESLAW MAREK<br />
bereits auf Seite 93 formuliert hatte, auf "inhalts- und zwecklosem 'Musizieren'",<br />
wobei der Begriff "Musizieren" dann zu Recht in Anführungszeichen erscheinen<br />
würde.<br />
Wie schwierig eine aktive Mitwirkung des Gehörs bei einem solchen Musikunterricht<br />
offensichtlich ist, geht unter anderem aus der Komplexität und Diffusität der<br />
einzelnen methodischen Ansätze hervor, mittels derer die Autoren der Klavierpädagogik<br />
dilettantisches, visuell-motorisches Spiel zu bekämpfen suchen. Auch die<br />
Tatsache, dass sich die Autoren, wie im folgenden gezeigt werden soll, im Lösungsansatz<br />
teils erheblich widersprechen, deutet auf grundsätzliche Schwierigkeiten.<br />
MARGIT VARRÓ stellt die folgende Forderung auf:<br />
96<br />
"Die Noten sind nur als die Symbole bereits vorhandener Tonvorstellungen<br />
einzuführen [...]." (VARRÓ 1929, 40)<br />
Zu diesem Zweck stellt sie eine Methode in fünf "Graden" vor, wie ihrer Meinung<br />
nach richtiges Musiklernen erreicht werden kann. Diese Methode stützt sich stark<br />
auf das Singen. Prinzipiell muss ein Ton immer vorher gesungen werden, bevor er<br />
gespielt wird. Die Tonvorstellung wird erst Schritt für Schritt auf die Tastatur übertragen:<br />
"Erster Grad.<br />
Hören – Nachsingen. (Rein gehörsmäßiges Memorieren mit Ausschluß visueller<br />
und motorischer Vorstellungen.)<br />
[...]<br />
Zweiter Grad.<br />
Hören – Nachsingen – Spielen. (Gehörsmäßiges und motorisches Memorieren;<br />
visuelle Vorstellungen in Verbindung mit der Klaviatur.)<br />
[...]<br />
Dritter Grad.<br />
Vomblattsingen – Klavierspielen. (Visuell-auditiv-motorisches Memorieren.)<br />
[...]<br />
Vierter Grad.<br />
Notenlesen – Tonvorstellung – Klavierspiel.<br />
[...]
Fünfter Grad.<br />
Notenlesen – Memorieren in der Vorstellung – Klavierspiel ohne Noten."<br />
(VARRÓ 1929, 40ff.)<br />
Die Methode von VARRÓ musste stark gekürzt wiedergegeben werden. Es handelt<br />
sich um einen Exzerpt aus 14 Seiten. Der Umfang der Originaldarstellung deutet auf<br />
die Komplexität der Methode und die hohe Bedeutung hin, die die Autorin dieser<br />
Problematik beimisst. Dass die von MARGIT VARRÓ bearbeiteten Probleme bis heute<br />
akut sind, geht auch aus der Tatsache hervor, dass noch im Jahr 1998 ein EPTA-<br />
Kongress eigens zu dieser Thematik stattfand (vgl. FREY-SAMLOWSKY 1998).<br />
Auch von CZESLAW MAREK (1986, 37f.) wird ausdrücklich das Singen, unter anderem<br />
in Form von Solmisation, als unverzichtbares Hilfsmittel und Zwischenstufe<br />
propagiert.<br />
Mit Nachdruck spricht sich allerdings CARL ADOLPH MARTIENSSEN gegen die, wie<br />
er sie bezeichnet, "Gehör-Sing-Schulung" aus:<br />
"Es wird immer angenommen, daß der Gesangskomplex des schöpferischen<br />
Klangwillens auf den Instrumentalkomplex rein automatisch fördernd einwirke.<br />
D i e s e A n n a h m e a b e r i s t e i n I r r t u m . " (MARTIENSSEN<br />
1957, 103)<br />
Seiner Meinung nach kann das Problem, im Klavierunterricht die Klangvorstellung<br />
des Schülers zu fördern, durch Singen nicht gelöst werden. Er ist statt dessen der<br />
Überzeugung, dass<br />
weil es<br />
"[...] die beste Gehör-Sing-Schulung einer s c h l a f m ü t z i g - l a n d l ä u -<br />
f i g e n Klavierpädagogik n i c h t auf die Beine helfen kann [...]"<br />
(MARTIENSSEN 1957, 106),<br />
"[...] zwei verschiedene Leitungswege sind, die von seinem Klang-Kraftzentrum<br />
gespeist werden; und eine strenge Prüfung wird stets ergeben, daß entweder<br />
das Singen im Mittelpunkt des schöpferischen Klangwillens stand oder das<br />
Spielen – oder daß meistens beides nur halbe Intensität hatte. Man mache sich<br />
dieses Denkexperiment nicht zu leicht und prüfe objektiv! Und mit solchen<br />
sehr schwierigen Doppelkomplexen sollte der normale Klavierunterricht beginnen?"<br />
(MARTIENSSEN 1957, 107)<br />
97
Der Konflikt zwischen Gegnern und Befürwortern des Singens als Vorstufe instrumentalen<br />
Musizierens kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Auch die Bedeutung<br />
von Solmisation kann hier nur angedeutet werden. Ziel der ausführlichen<br />
Darstellung war aber, zu zeigen, wie schwierig es im Klavierunterricht zu sein<br />
scheint, das Klangvorstellungsvermögen auszubilden. Auch wenn alle methodischen<br />
Zwischenstufen, wie von MARGIT VARRÓ vorgeschlagen, Anwendung gefunden<br />
haben sollten, bleibt nichtsdestoweniger als Anschlußproblem die bange Frage, ob<br />
das gerade geweckte Klangvorstellungsvermögen sich beim Notenspiel nicht bald<br />
etwa wieder in das eben überwundene Schattendasein zurückziehen könnte. Dabei<br />
bleibt auch die Kontrolle dieser Vorgänge durch den Lehrer ein grundsätzliches<br />
Problem, das MARGIT VARRÓ folgendermaßen formuliert:<br />
98<br />
"Die Überwachung dessen, ob das innere Gehör des Schülers beim Notenspielen<br />
mitwirkt oder nicht, ist eine mißliche Sache." (VARRÓ 1929, 46)<br />
Auch die Motorik könnte nämlich beim reproduktiven Spiel stereotyp eingeübter<br />
Stücke theoretisch eine fehlerlose Wiedergabe gewährleisten. Häufig scheitert eine<br />
solche Spielweise allerdings, wenn die stereotype Motorik unter Einwirkung von<br />
Nervosität oder äußeren Störungen destabilisiert wird.<br />
Eine Deutung dieses offensichtlichen Kernproblems der Musikerziehung ist erstaunlich<br />
einfach, wenn man sich die anthropologischen Grundlagen der betrachteten<br />
Vorgänge vergegenwärtigt, wie sie der Medienwissenschaftler und Pädagoge<br />
RAINALD MERKERT in seinem Aufsatz Zur Anthropologie des Hörens benennt. Er<br />
beschäftigt sich dort mit dem Verhältnis des menschlichen Hörens zu anderen<br />
Wahrnehmungsarten im Allgemeinen:<br />
"Für Psychologen ist ebenso wie für Pädagogen und Anthropologen unbestritten,<br />
daß alle Weltorientierung auf dem menschlichen Tast-Bewegungs-System<br />
beruht und daß Tastsinn und Gesichtssinn einander zugeordnet sind, beide einen<br />
Sinneskreis bilden. Das Zusammenspiel von Hand und Auge macht es<br />
möglich, daß wir die im Hantieren mit den Dingen einmal begriffenen Eigenschaften<br />
und Umgangsqualitäten ihnen später auch ansehen können."<br />
(MERKERT 1988, 759)<br />
Zur Verknüpfung von Gehörsinn und Tastsinn beim Musizieren unter Nutzung visueller<br />
Medien wäre damit, wie sich aus MERKERTS Bemerkung unzweifelhaft schließen<br />
lässt, eine gewisse Überwindung von der Natur präferierter Strukturen erforderlich.<br />
Eine Musikpädagogik, die sich aber vorwiegend auf schriftliche Medien und<br />
damit auf den visuell-haptischen Sinneskreis stützt, festigt demnach ohnehin begün-
stigte Verknüpfungen unter Umgehung des Gehörsinnes und kann so in der Regel 23<br />
nicht zu schöpferischem Musizieren führen. CARL ADOLPH MARTIENSSEN stellte die<br />
psychischen Vorgänge beim durchschnittlichen Klavierspiel, wie er sie sich vorstellte,<br />
dem Ideal des "Wunderkindkomplexes" schematisch folgendermaßen gegenüber.<br />
Dabei stellen die beiden ersten Schemata den Idealfall vor und nach dem Notenlernen<br />
dar. Das dritte Schema steht für durchschnittlichen Musikunterricht als<br />
Negativbeispiel:<br />
Abb. 19: Spielfunktion vor dem Notenlernen (nach MARTIENSSEN 1957, S. 5).<br />
Abb. 20: Verhältnis der Sphären beim Wunderkindkomplex, also beim richtig<br />
ausgebildeten Spieler, nach dem Lernen der Noten (nach MARTIENSSEN 1957, S. 7).<br />
23 Diese Konstellation begünstigt damit die Ausnahmestellung "musikalischer Begabung" in von<br />
Schriftlichkeit beherrschter Kultur.<br />
99
Abb. 21: Verhältnis der Sphären beim durchschnittlich ausgebildeten Spieler (nach<br />
MARTIENSSEN 1957, S. 7).<br />
Obwohl die Fragwürdigkeit schriftlicher Vermittlung in der musikpädagogischen<br />
Diskussion des 20. Jahrhunderts, wie gezeigt wurde, erkannt und regelmäßig thematisiert<br />
wurde, ist die Herrschaft der visuellen Methode in der Musikerziehung bislang<br />
ungebrochen. Dieser Widerspruch, einerseits für den Gehörsinn die unzweifelhafte<br />
Führung beim Musizieren zu reklamieren, ihn andererseits aber in der Praxis<br />
nicht hinreichend bedienen zu können, findet seine Fortsetzung in den Äußerungen<br />
der Praktiker zum Thema "Technik". Auch hier besteht zunächst einhellige Übereinstimmung<br />
der Autoren in der Ansicht, dass Spieltechnik keine äußerlich-mechanische<br />
Angelegenheit sei, wie sie noch Ende des 19. Jahrhunderts gesehen wurde,<br />
sondern Teil einer vom Ohr dominierten Ganzheit. Folglich beruhen auch spieltechnische<br />
Probleme nach Meinung aller maßgeblichen Autoren vorwiegend auf unzureichend<br />
ausgebildetem Klangvorstellungsvermögen. Es kann, wie im folgenden<br />
gezeigt werden soll, als gängige Lehrmeinung angesehen werden, dass Technik essenziell<br />
mehr ist als das, was von außen, etwa in Form von Fingerbewegungen,<br />
wahrgenommen werden kann, vielmehr wesentlich auf psychischen Vorgängen beruht.<br />
So betont KARL LEIMER in seinem Buch Modernes Klavierspiel nach Leimer-<br />
Gieseking, dass die Konzentration auf das Klangergebnis die beste technische<br />
Schulung sei:<br />
100<br />
"Das ununterbrochene Hinhören auf die gespielten Töne, die Kontrolle über<br />
die exakte Ausführung: das ist der Weg, der schnell und sicher zur ausgefeiltesten<br />
Technik führen muß. Die Finger sind Diener des Kopfes; was ihnen der<br />
Kopf befiehlt, führen sie aus. Ist sich also der Kopf durch ein gut geschultes<br />
Ohr über die Ausführung klar, so wird der Finger dieselbe wiedergeben. Auch<br />
die schwierigsten technischen Probleme werden in diesem Fall von den Fingern<br />
in ganz kurzer Zeit, manchmal direkt oder in wenigen Minuten, gelöst<br />
[...]." (LEIMER 1931, 18)
An anderer Stelle fasst er diese ganzheitliche Auffassung folgendermaßen zusammen:<br />
"Technik ist ein Produkt der Geistesarbeit!" (LEIMER 1931, 6)<br />
Im selben Geist wie KARL LEIMER versucht JOZSEF GAT in seinem Buch Die Technik<br />
des Klavierspiels die häufig irrtümlich als Hauptproblem angesehene Schnelligkeit<br />
des Spiels zu entmystifizieren:<br />
"Diese Jagd nach Schnelligkeit ist überhaupt nicht begründet. Unsere Muskeln<br />
und Nerven sind auch ohne besonderes Üben zu außerordentlich schneller Arbeit<br />
befähigt, zu viel schnellerer Arbeit, als sie selbst der größte Klaviervirtuose<br />
braucht. Die Aufgabe besteht nur darin, diese Schnelligkeit anwendbar<br />
zu machen [...]. Hier muß allerdings immer wieder betont werden, daß die<br />
wichtigste Voraussetzung für die Schnelligkeit des Spiels die Schnelligkeit der<br />
musikalischen Vorstellung ist." (GAT 1965, 102)<br />
Auch GÜNTHER PHILIPP betont in seinem 1984 in der DDR erschienenen Buch Klavier,<br />
Klavierspiel, Improvisation die Bedeutung der Klangvorstellung für die Bildung<br />
von Technik:<br />
"Wenn wir kein einwandfreies Spiel erreichen, kann der Fehler auch im ersten<br />
Punkt unserer Übersicht liegen: in unklarer oder fehlender Klangvorstellung,<br />
die oft auf mangelhafter Bedeutungserfassung des Werkes beruht. Das fängt<br />
beim verständnislosen Lesen des Notenbildes an und geht bis zu dürftigen<br />
klanglichen Erinnerungsbildern. Deshalb sind theoretisches Verstehen, Ausbildung<br />
des Klangbewußtseins und des Formgefühls sowie reichliches b e -<br />
wußtes Hören von Musik so außerordentlich wichtig für die pianistische<br />
Ausbildung. [...] Ich hoffe, es ist spätestens an dieser Stelle deutlich geworden,<br />
daß der Schwerpunkt des Übens und Unterrichtens in der geistigen Vorbereitung<br />
auf das Spiel zu suchen ist." (PHILIPP 1984, 88)<br />
Nach RENATE KLÖPPEL sind Leistungsgrenzen eher durch geistiges Üben anstatt<br />
Fingerübungen zu überwinden:<br />
"Üben vollzieht sich vor allem im Kopf und weniger in den Fingern."<br />
(KLÖPPEL 1993, 17)<br />
KURT SCHUBERT schreibt in seinem Büchlein Die Technik des Klavierspiels:<br />
101
102<br />
"Umso reicher und charakteristischer werden die den Klang erregenden Spielbewegungen<br />
ausfallen, je reicher und phantasievoller die Vorstellungswelt belebt<br />
ist, aus der der reale Klang geboren werden soll, und je intensiver der<br />
Klangwille ist, der den Spieler beseelt." (SCHUBERT 1954, 8)<br />
JOZSEF GAT betont die Gefahr motorischen Musizierens mit der Trennung der Bewegung<br />
von der Klangvorstellung:<br />
"Unter dem Vorwande der Entwicklung der Schnelligkeit trennen sich ihre<br />
Bewegungen von ihrer musikalischen Vorstellung und verhindern so, daß ihre<br />
Technik tatsächlich im Dienst der Musik steht." (GAT 1965, 102)<br />
Zur Bekämpfung dieses Grundübels und zur Wiedergewinnung des verlorengegangenen<br />
"Herzstücks" des Musizierens wird in jüngerer Zeit vermehrt die (Wieder-)<br />
Einführung von Improvisation in den Instrumentalunterricht gefordert. Dies erfolgt<br />
gemäß der Annahme, dass beim Improvisieren, anders als beim reproduzierenden<br />
Spiel, die eigene Klangvorstellung unabdingbare Voraussetzung zur Tonerzeugung<br />
ist. In den Jahrgängen 1995 und 1996 der Zeitschrift Üben & Musizieren erschienen<br />
insgesamt sechs Aufsätze, die sich mit dem Thema Improvisation 24 befassen, 1999<br />
wurde diesem Thema gar ein ganzes Heft gewidmet 25. Damit ist dieses Themengebiet<br />
eines der meistdiskutierten. In diesen Veröffentlichungen werden Hoffnungen<br />
artikuliert, improvisatorischer Instrumentalunterricht könne entscheidende Defizite<br />
der herkömmlichen Methoden kompensieren. Sämtliche, insbesondere bislang defizitäre<br />
musikalische Lernziele tauchen auf, wenn es darum geht, Argumente für Improvisation<br />
zu finden. WOLFGANG BRUNNER setzt in seinem Aufsatz Improvisieren<br />
wozu? große Hoffnungen in improvisatorisches Musiklernen:<br />
"Es liegt noch ein großes und lohnendes Aufgabenfeld für die Instrumental-<br />
Musikpädagogik vor uns, das bisher viel zu wenig angegangen wurde."<br />
(BRUNNER 1996, 35)<br />
Auch ANSELM ERNST nennt in seinem Buch Lehren und Lernen im Instrumentalunterricht<br />
den folgenden umfangreichen Themenkomplex:<br />
"Improvisation ist – zumindest im Unterricht mit Kindern – ein Lernfeld, dessen<br />
psychologische und methodologische Bedeutung kaum überschätzt werden<br />
24 BIESENBENDER (1995), PHILIPP (1995), BRUNNER (1995), WIEDEMANN (1996), BRUNNER<br />
(1996), CHMEL (1996).<br />
25 Heft 2.
kann. [...] Und was das Improvisieren methodisch bereithält – als Lernmethode<br />
für Technik, Musiktheorie, Ausdrucksschulung und Zusammenspiel –, ist noch<br />
nicht annähernd ausgeschöpft." (ERNST 1991, 50)<br />
GÜNTHER PHILIPP weist folgendermaßen auf positive Transfereffekte der Improvisation<br />
auf wesentliche musikalische Ausbildungsziele hin:<br />
"Improvisation fördert Interpretation und Musikverständnis, Musikverständnis<br />
fördert Interpretation und Improvisation, ständige ausschließliche Interpretation<br />
'genau nach Vorschrift' führt zur künstlerischen und persönlichen Verarmung."<br />
(PHILIPP 1984, 406)<br />
Dass als Folge rein reproduktiver Ausbildung eine solche Verarmung nicht nur bei<br />
Pianisten zu beobachten sei, sondern auch bei Streichern, obwohl diese aufgrund<br />
aufwändigerer Tonerzeugung eine exaktere Klangvorstellung beim Spiel zu benötigen<br />
scheinen, beklagt der Frankfurter Celloprofessor GERHARD MANTEL. Er hält<br />
Improvisation für notwendig auch in der Ausbildung klassischer Musiker, die seiner<br />
Meinung nach sonst auch bei der Interpretation erhebliche Defizite hätten:<br />
"Warum soll eigentlich ein Kind nicht improvisieren? Nur weil der Lehrer es<br />
nicht kann? In einem Symposium über Gruppenunterricht wurde vor kurzem<br />
von einem offenbar unfähigen Klavierlehrer höhnisch vom 'improvisierenden<br />
Klavierlehrer' gesprochen! Gerade das Kind hat auf diesem Gebiet viel weniger<br />
Hemmungen als die meisten Erwachsenen. Beim Improvisieren kann man<br />
ja gerade in Bezug auf den Text, dessen Kritik sonst immer im Vordergrund<br />
steht, nichts falsch machen. Die damit gewonnene Freiheit schlägt sich fast<br />
immer als großer Gewinn bei allem nieder, was mit Tonqualität zu tun hat:<br />
Strichverlaufskurve, Dynamik, Farbe – alles erscheint freier als bei der 'möglichst<br />
richtigen' Umsetzung von vorgegebenen gedruckten Noten.<br />
Beim Improvisieren werden außerdem Intervalle mit Bewegungen in Beziehung<br />
gebracht, statt mit gedruckten Symbolen; ganz spielerisch werden so auf<br />
diesem wichtigen Sektor bedeutende Fortschritte möglich. Was wird hier nicht<br />
alles versäumt! Bei meinen letzten Aufnahmeprüfungen waren zehn von zwölf<br />
Hauptfachkandidaten, die mit schweren Werken der Celloliteratur anrückten,<br />
nicht in der Lage, ein Kinderlied, das alle kannten (Alle Vögel sind schon da),<br />
in Es-Dur auf dem Cello fehlerfrei zu spielen, wobei weder an Tonschönheit<br />
noch an Intonation irgendwelche Anforderungen gestellt waren. Warum sollen<br />
all die Parameter, die sozusagen frei verfügbar sind für Fortschritte, dem Umstand<br />
geopfert werden, daß ein Schüler bei der Erfassung eines gedruckten<br />
Textes vielleicht noch Schwierigkeiten hat? Er wird auch die Texterfassung eines<br />
Tages lernen, allerdings dann auf dem Niveau des flexiblen, freien Spiels<br />
statt auf dem einer dürren Pflichterfüllung Ton für Ton." (MANTEL 1994, 17)<br />
103
HERBERT WIEDEMANN setzt sich in seinem Aufsatz Improvisierendes Lernen als<br />
Weg zum Life-Time-Spielen mit dem Problem auseinander, dass viele Erwachsene<br />
im Nachhinein vom Instrumentalunterricht deshalb enttäuscht sind, weil sie keinen<br />
Zugang vermittelt bekamen, der ihnen die dauerhafte Fähigkeit zum Musizieren geschaffen<br />
hätte. Wie der Titel bereits verrät, sieht HERBERT WIEDEMANN in der Improvisation<br />
auch hierfür einen Lösungsansatz:<br />
104<br />
"In einer Befragung, welche Erwartungen sie an einen geglückten [...] Instrumentalunterricht<br />
hatten, bestand im Wesentlichen Einmütigkeit über drei<br />
Bereiche:<br />
<strong>1.</strong> Das Instrumentalspiel sollte dazu führen, sich selbst musikalisch ausdrücken<br />
zu können.<br />
2. Das Instrumentalspiel soll dazu dienen, 'klassische Musik' intensiver zu erfahren<br />
und zu erleben.<br />
3. Das Instrumentalspiel sollte Medium sein, sich seine Hörwelt tätig aneignen<br />
zu können.<br />
Die Unterrichtspraxis zeigt, daß sich diese drei Lernbereiche nicht durch mechanische<br />
Einübung eines Notentextes einlösen lassen. Ein Klavierspiel, das<br />
vorwiegend von der Auge-Hand-Koordination getragen wird, führt dazu, daß<br />
die Schüler/innen nur greifen, ohne zu begreifen. Das Ohr hat dabei nur noch<br />
die Funktion, zwischen falsch und richtig zu unterscheiden. Ein Unterricht, der<br />
die Umsetzung der drei oben genannten Bereiche anstrebt, muß Gelegenheit<br />
bieten, daß sich die Lernenden Musik am Klavier hörend bzw. horchend und<br />
begreifend erschließen. Nur auf diese Weise wird die innere Klangvorstellung<br />
entwickelt und das Begreifen von Sinnzusammenhängen gefördert: Beide<br />
Lernfelder bilden unumgängliche Voraussetzungen dafür, daß sich Lernende<br />
musikalisch selbst ausdrücken, Stücke nach Gehör spielen und komponierte<br />
Stücke eigenständig gestalten und interpretieren können. [...]<br />
Als methodischer Weg, diese drei Lernziele in der Unterrichtspraxis einzulösen,<br />
bietet sich das Improvisierende Lernen an. Dabei bildet nicht eine notierte<br />
Komposition und deren Gestaltung bzw. Interpretation am Instrument den Fokus<br />
des Klavierspiels, sondern gestaltungsoffene, melodische, harmonische<br />
und rhythmische Strukturen. Sie werden anhand von Vorspielen und Imitieren<br />
– durch Horchen und Hören – und anhand von Zeigen und Erklären – durch<br />
Greifen und Begreifen – vermittelt." (WIEDEMANN 1996, 13f.)<br />
Sollten solche Inhalte von Vorspielen, Horchen und Imitieren wieder zu grundlegenden<br />
Bestandteilen des Instrumentalunterrichts werden, rückten in der Tat Klangvorstellungsvermögen<br />
und Gehör und damit die Einheit aus Erfinden und Ausführen,<br />
von Denken und Spielen (so der Titel einer Veröffentlichung: UHDE & WIE-<br />
LAND 1989) wieder in den Mittelpunkt musikalischen Tuns.
Eine praktische Realisierung unter gegebenen Unterrichtsbedingungen wirft aber<br />
grundsätzliche Fragen auf. Nicht nur der persönliche Kontakt zwischen Schüler und<br />
Lehrer ist heute unmöglich wieder auszubauen, wie es erforderlich wäre, um die geforderten<br />
Inhalte etwa durch täglichen Unterricht wie im 17. und 18. Jahrhundert<br />
(vgl. Abschnitt 2.1) zu vermitteln. Auch der Verlust der Fähigkeit des Improvisierens<br />
in der klassischen Musiktradition stellt keine günstige Voraussetzung dar. 26<br />
Darüber hinaus scheint es, als sei, wenn allenthalben der Modebegriff "Improvisation"<br />
als Allheilmittel zur Bekämpfung bekannter Defizite beschworen wird, in<br />
Wirklichkeit der Oberbegriff gemeint: das Spiel nach dem Gehör. Und dieses kann<br />
keineswegs automatisch auf den Teilbereich der Improvisation reduziert werden,<br />
sondern beinhaltet – insbesondere in der Lernphase – die auditive Nachahmung. So<br />
kann es nicht verwundern, dass die erwähnte Flut von Veröffentlichungen zum<br />
Thema Improvisation bislang weitgehend im luftleeren Raum stattfand und kaum<br />
Auswirkungen auf die Unterrichtspraxis hatte.<br />
In jüngerer Zeit wurde aber der grundsätzliche Zusammenhang zwischen einseitiger<br />
Medienorientierung und improvisatorischem Defizit erstmals in einer musikpädagogischen<br />
Zeitschrift thematisiert. So schrieb ULRICH MAHLERT im Vorwort zum Themenheft<br />
Improvisation von Üben und Musizieren im April 1999:<br />
"Kein Zweifel: Wer heute improvisieren lernen will, der findet durchaus ein<br />
vielfältiges didaktisches Material vor. [...] Seit drei Jahrzehnten ist das Lernfeld<br />
Improvisation von der schreibenden Zunft gründlichst beackert worden.<br />
Aber offenbar reicht das nicht, führt die Publikation immer neuer Lehrwerke<br />
nicht zum gewünschten Erfolg, vermögen diese nicht zu halten, was sie in bester<br />
Absicht versprechen. [...] Dabei empfinden manche Lehrkräfte durchaus<br />
einen Nachholbedarf und versuchen, sich über Lehrwerke weiterzubilden.<br />
Aber oft genug gelangen sie dabei vor allem zu der frustrierenden Einsicht,<br />
dass das 'Spielen ohne Noten' nur schwer ausschließlich über Noten und<br />
Worttexte zu erlernen ist. Es bedarf zumindest einer Ergänzung durch Fortbildungsveranstaltungen,<br />
die inzwischen glücklicherweise keine Seltenheit mehr<br />
sind. (MAHLERT 1999, 1)<br />
Grundsätzliche Fragen des Verhältnisses von visueller zu auditiver Informationsdarbietung<br />
– und damit zwangsläufig der Medienperspektive – werden damit aufgeworfen.<br />
Soll der primäre Sinneskanal bei der Vermittlung des Musizierens vom Auge<br />
auf das Ohr übergehen, so müsste eigentlich das schriftliche Medium an Einfluss in<br />
26 Die beiden Begriffe Klassik und Improvisation bilden von vorn herein ein Gegensatzpaar. Eines<br />
der konstituierenden Elemente des Klassikbegriffs liegt in der Suche nach bleibenden Werten;<br />
dagegen beruht Improvisation auf der Gegenwartsperspektive (wörtlich: "unvorhergesehen").<br />
105
der Musikerziehung abgeben und interaktive, insbesondere auditive Medien an Gewicht<br />
gewinnen.<br />
Eine solche Verlagerung des Schwerpunkts hätte allerdings weit reichende Auswirkungen,<br />
insbesondere auf die Anforderungen an Musikpädagogen. Fortbildungsveranstaltungen,<br />
wie von ULRICH MAHLERT erwähnt, können nur ein Anfang sein. In<br />
letzter Konsequenz würde die geforderte Wiedereinführung der Improvisation neben<br />
dem Wechsel vom visuellen zum auditiven Sinneskanal auch eine Neuordnung der<br />
Musiklehrerausbildung erfordern. Denn schon die vielfach geforderte Improvisation<br />
kann nicht die geforderte Bedeutung gewinnen, solange die seit der Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts getrennten Aufgabengebiete Komposition und Interpretation kategorisch<br />
weiterbestehen und die Musiklehrerausbildung sich auf den zweitgenannten<br />
Teilbereich konzentriert. Jeder, der nicht nur sehr oberflächlich improvisieren will,<br />
muss sich auch mit Kompositionslehre befassen, in täglicher schöpferischer Praxis<br />
und weit über die bestehenden "theoretischen" Lehrinhalte in Tonsatz (vgl. S. 65)<br />
hinaus. Was bei den zitierten Fürsprechern unter dem Stichwort Improvisation firmiert,<br />
muss nämlich – nur so können die erhofften Effekte erzielt werden – letztlich<br />
gleichgesetzt werden mit einer viel umfassenderen musikalischen Ausbildung des<br />
Ohrs im Sinne der verlorengegangenen Virtuosität im weiten Sinn, wie sie in Kapitel<br />
2.1 dargestellt wurde.<br />
Die Tatsache, dass Improvisation nichts Willkürliches ist und nicht losgelöst von<br />
Komposition betrieben werden kann, wurde bereits angedeutet, ist heute aber,<br />
ebenso wie die Praxis der Improvisation selbst, vielfach in Vergessenheit geraten<br />
und muss deshalb nachdrücklich betont werden. Bedeutende Musiker bieten sich als<br />
Zeugen für diese enge Verschränkung von Improvisation und Komposition an. Wie<br />
bereits in Abschnitt 2.1 erwähnt, bezeichnet C. PH. E. BACH das improvisatorische<br />
Verzieren von Kadenzen als<br />
106<br />
"[...] eine Composition aus dem Stegereif." (BACH 1753/1994, 131)<br />
Auch ARNOLD SCHÖNBERG kann zur Richtigstellung bemüht werden. Komposition<br />
und Improvisation unterscheiden sich nach seiner Aussage nur durch den Zeitfaktor.<br />
Er bezeichnet eine Komposition als<br />
"[...] verlangsamte Improvisation." (zit. nach BIESENBENDER 1995, 8)<br />
Ähnlich äußert sich der amerikanische Jazz-Pianist KEITH JARRETT:<br />
"'Ich habe', sagte Jarrett einmal, 'eigentlich nie einen so großen Unterschied gesehen<br />
zwischen dem, was ich improvisiere und dem, was ich komponiere. Im-
provisation ist doch einfach ein beschleunigter Prozeß der [sic] Komponierens,<br />
der keinerlei nachträgliche Korrekturen oder Änderungen oder Auslassungen<br />
erlaubt [...].'" (RÜEDI 1985, 196)<br />
FERRUCCIO BUSONI meinte gar, dass die schriftliche Notation nichts anderes sei als<br />
ein Notbehelf, um Improvisation festzuhalten:<br />
"Die Notation, die Aufschreibung, von Musikstücken ist zuerst ein ingeniöser<br />
Behelf, eine Improvisation festzuhalten, um sie wiedererstehen zu lassen."<br />
(BUSONI 1917, 20)<br />
Der Kompositionsvorgang unterscheidet sich von Improvisation demnach hauptsächlich<br />
in der Loslösung vom Zeitfaktor und gewinnt somit, wie CHRISTIAN<br />
KADEN betont, einen Freiheitsgrad hinzu:<br />
"Daß der Improvisator ungebundener hantiere als der Komponist, steht nicht<br />
fest; man kann sogar der entgegengesetzten Auffassung huldigen und der<br />
kompositorischen Entscheidungsfindung einen sprunghaften Freiheitszuwachs<br />
bescheinigen." (KADEN 1993, 47)<br />
Wer fantasiert, befasst sich implizit mit Komposition. Und wer improvisieren kann,<br />
ist im Prinzip Komponist – bis ins 19. Jahrhundert hinein eine solche Selbstverständlichkeit,<br />
dass die folgende Bemerkung FRIEDRICH WIECKS aus einem Brief an<br />
seine Frau nicht der geringsten Erläuterung bedurfte:<br />
"Gestern hat Klara vor den allerfeinsten Kennern Dresdens gespielt [...]. – Daß<br />
sie komponieren könnte, wollte aber niemand glauben, weil es bei Frauenzimmern<br />
von dem Alter noch niemals dagewesen. Als sie aber über ein aufgegebenes<br />
Thema phantasiert hatte, so war alles außer sich." (FRIEDRICH WIECK:<br />
Brief an CLEMENTINE WIECK vom 19. März 1830, in WIECK 1968, 27)<br />
Diese Zusammenhänge sind für viele Musikpädagogen der Gegenwart allerdings nur<br />
sehr schwer nachvollziehbar. Die einseitige Ausrichtung auf schriftliche Informationsträger<br />
und damit auf die Reproduktion hat dazu geführt, dass heute in der<br />
Instrumentalpädagogik in der Regel entgegengesetzte Ansichten vorherrschen. Im<br />
Gegensatz zu den zitierten Musikern wird nämlich von Musikpädagogen vielfach<br />
die umgekehrte Hierarchie vertreten, die CHRISTIAN KADEN folgendermaßen<br />
charakterisiert:<br />
107
108<br />
"Durchaus zum guten Ton gehört es bereits, Improvisation zwar als Grund-<br />
und Elementarprinzip musikalischer Gestaltgebung anzuerkennen, zugleich jedoch<br />
zum bloßen Negativ abzuwerten: zum Gegenbild von Komposition. Sie<br />
[...] stelle [...] sozusagen Komposition eines niederen Grades dar, noch ohne<br />
schriftliche Fixierung vor allem, auf 'entwicklungsgeschichtlich frühe[r]<br />
Stufe'." (KADEN 1993, 47)<br />
Diese Umkehrung von Werten entspringt direkt den Verirrungen der Virtuosenjubeljahre<br />
des 19. Jahrhunderts (vgl. S. 56) in Verbindung mit einer Monokultur der<br />
Schriftlichkeit und fiel im Umfeld damaliger weiblicher Erziehungsideale auf<br />
fruchtbaren Boden. In dieser Tradition wird sie bis heute weitergetragen. Wie fremd<br />
Improvisation, Komposition und ganzheitliche Ansätze, die zur Wiedererlangung<br />
des verlorengegangenen "Herzstücks" des Musizierens aber unabdingbar erforderlich<br />
wären, auch im vergangenen Jahrzehnt noch gerade in der Musikpädagogik zu<br />
sein schienen, verdeutlicht auch ein Blick auf den Bericht der Neuen Musik-Zeitung<br />
vom EPTA-Jahreskongreß 1994 über den Vortrag des US-amerikanischen Pianisten<br />
und Klavierpädagogen SEYMOUR BERNSTEIN. Den Formulierungen der Berichterstatterin<br />
ist deutlich spürbar ein gewisses Unbehagen bei der Zusammenfassung seiner<br />
Gedanken zu entnehmen:<br />
"Mit Spannung wurde der Vortrag von Seymour Bernstein 'With your own two<br />
hands: Lecture-master Class' [sic] erwartet. Mit viel Humor stellte Bernstein –<br />
Pianist, Lehrer, Komponist – sein 1993 in der Übersetzung von Gerhard<br />
Schroth erschienenes Werk 'Mit eigenen Händen' dem Publikum vor.<br />
[...] Als zweiten Schwerpunkt äußerte er, es müsse die Kreativität des Schülers<br />
als ein wesentlicher Unterrichtsschwerpunkt zu beachten sein, und demzufolge<br />
müsse der Lehrer einsehen, daß Improvisation und sogar eigene Kompositionen<br />
für jeden Schüler und Studenten ein 'Muß' seien." (FREY-SAMLOWSKI<br />
1994, 14)<br />
Insbesondere das Wörtchen "sogar" markiert die in Frage stehende, in der Musikpädagogik<br />
aber verbreitete Hierarchie zwischen Komposition und Improvisation.<br />
Auch das Verb "einsehen" deutet zumindest auf unterstellten Widerwillen unter<br />
Pädagogen. Aber auch wenn er es "einsieht": wie soll der Lehrer etwas vermitteln,<br />
das er selbst nicht gelernt hat?<br />
So lange Irrtümer über das Verhältnis von Improvisation und Komposition weiter<br />
bestehen, birgt auch ein Improvisationskonzert auf der Tagung eines Klavierlehrerverbandes<br />
einige Brisanz. Im Wissen, mit einem solchen Konzert an den Grundfesten<br />
hundertjähriger Unterrichtstradition zu rütteln, sah sich GÜNTHER PHILIPP<br />
genötigt, in der unteren Hälfte des Programmzettels seines Improvisationsabends auf
einer EPTA-Tagung am <strong>1.</strong> November 1996 die folgende Erklärung abdrucken zu<br />
lassen:<br />
"Die Improvisation wurde in ihrer künstlerischen und pädagogischen Bedeutung<br />
erst in unserer Zeit voll erkannt als ein eigenständiges Schaffensgebiet.<br />
Sie kann neue Musik hervorbringen, die in ihrer hohen Komplexität, Zufallsbedingtheit<br />
und Reaktionsnotwendigkeit so niemals komponiert (notiert) werden<br />
könnte. Das Risiko des unabgesicherten virtuosen Spiels, das Wagnis des<br />
(im Detail oder insgesamt) nicht festgelegten Ablaufs und völlig offenen<br />
Klangprozesses, die ästhetische Balance zwischen Chaos und Ordnung und die<br />
unerläßlichen blitzschnellen Entscheidungsprozesse ohne Korrekturmöglichkeit<br />
– all das sind Schwierigkeiten, die zugleich den besonderen Reiz der Improvisation<br />
bedingen. Der Hörer wird unmittelbarer Zeuge eines schöpferischen<br />
Geschehens. Die Spannweite reicht vom frei unbewußten Selbstausdruck<br />
(Emotionsverlauf) bis hin zu geistig disziplinierter konzentrativer Durchsetzung<br />
eines immanenten Spielkonzepts und Formkalküls." (EPTA-Dokumentation<br />
1996, 74)<br />
Aus jedem Satz dieser Erklärung spricht ein tiefes Bedürfnis nach Rechtfertigung<br />
und Richtigstellung. Dass aber derartige Erklärungen auf einer musikpädagogischen<br />
Verbandstagung heute erforderlich sind, belegt das Vorhandensein von fundamentalen,<br />
auf der Schriftlichkeit der Unterrichtstradition sich gründenden Missverständnissen.<br />
Ein Zurechtrücken dieser Missverständnisse erschüttert aber wiederum die<br />
Grundfeste der "soliden Ausbildung" (vgl. S. 61), stellt es doch die Vorherrschaft<br />
der visuell-reproduzierenden Unterrichtsmethode in Frage.<br />
Wenn also allenthalben improvisierendes Lernen gefordert wird, um bekannte und<br />
benannte Defizite der Musikpädagogik auszugleichen, wäre damit zwangsläufig ein<br />
Richtungswechsel verbunden hin zu einer im ursprünglichen Sinn virtuosen Musikpädagogik<br />
unter Wiedergewinnung des "Herzstücks" (S. 66) des Musizierens. Dieser<br />
Richtungswechsel erfordert aber einen Wechsel der Medienperspektive. Die<br />
Vorherrschaft der reproduzierenden Schriftlichkeit in der Musikerziehung ist mit<br />
diesem ganzheitlichen Ansatz kaum vereinbar. Die visuell geprägte Weltsicht des<br />
19. Jahrhunderts, welche die westliche Instrumentalpädagogik bis heute dominiert,<br />
wäre auch auf der Medienebene wieder zu ersetzen, zumindest aber zu ergänzen<br />
durch diejenige, die ursprünglich jedes musikalische Tun bestimmt und die in allen<br />
weniger von Schriftlichkeit geprägten Kulturen nie in Gefahr war: die Führungsrolle<br />
der Klanglichkeit, auch was den Medienkanal betrifft.<br />
Keine der einmaligen Errungenschaften der abendländischen Musikkultur, weder die<br />
Möglichkeit der kompositorischen Festlegung und Überlieferung noch die Mehrstimmigkeit<br />
wären ohne die schriftliche Codierung möglich gewesen. Eine gewisse<br />
109
Elitebildung und Abspaltung von "plebejischen Traditionen" (KADEN 1993, 185),<br />
auch in Form des beschriebenen Dilettantismus, war aber unvermeidbare Folge dieses<br />
medialen Zwischenschritts auf der Suche nach einer Verbreitung aktiven Musizierens<br />
in der Gesellschaft. Inzwischen bieten neue Medien, die den Umgang mit<br />
musikalischer Komplexität erstmals mit dem direkten Zugriff auf klangliche Strukturen<br />
verbinden, zukunftsweisende Perspektiven.<br />
2.6 Zwischenergebnis<br />
Schon lange ist die Musikpraxis entscheidend von Medien geprägt. Insbesondere der<br />
Übergang von der professionellen, handwerklichen Musizierpraxis vor 1800 zum<br />
ausgebreiteten Dilettantismus des 19. Und 20. Jahrhunderts wäre ohne einschneidende<br />
medientechnologische Veränderungen nicht möglich gewesen. Erst lithographische<br />
Druckverfahren ermöglichten die Verbreitung des Klavierspiels im 19.<br />
Jahrhundert als Massenphänomen. Bereits hier zeigen sich enorme Rationalisierungseffekte<br />
bei der Vermittlung. Damit verbunden ist aber auch eine Tendenz zum<br />
oberflächlichen Umgang mit musikalischen Strukturen. Die Funktion des Klaviers<br />
als Wiedergabemedium im Wohnzimmer des 19. Jahrhunderts verlangte zunächst<br />
nur Reproduktion möglichst präziser Drucksachen. Die mit diesem oberflächlichen<br />
Umgang verbundene Abwertung des Dilettantismus zum Negativum gegen Ende des<br />
19. Jahrhunderts steht mit einer dominierenden visuellen Mediensphäre gegenüber<br />
der (nicht vorhandenen) auditiven in direktem Zusammenhang.<br />
Auf der anderen Seite prägte sich auf dieser medialen Grundlage eine dezidierte Interpretationskultur<br />
heraus, die vor zweihundert Jahren noch unvorstellbar war.<br />
Gleichzeitig ging die Verbindung zwischen Erfinden und Ausführen verloren, die<br />
Arbeitsteilung in Komposition und Interpretation vollzog sich, auch dies ein Resultat<br />
medialer Veränderungen. Damit verlor auch Improvisation ihre Grundlage. Das<br />
klassische Musizieren ist bis heute stark medial geprägt, und die Abhängigkeit von<br />
Noten ist in der traditionellen Ausbildung maximal.<br />
Bemühungen der modernen Musikpädagogik, diese Abhängigkeit zu mindern,<br />
scheitern häufig an dieser fest verwurzelten Medienbindung, die bislang kaum in<br />
Frage gestellt wurde, aber auch an mangelnden Alternativen. Doch welche Bedeutung<br />
kommt der aktuellen digitalen Medienrevolution in diesem Zusammenhang zu?<br />
110
3 Medienwissenschaftliche Grundlagen<br />
Entscheidende Veränderungen der Medientechnologie vollziehen sich gegenwärtig<br />
nicht mehr auf dem Gebiet der Drucktechnik, sondern der elektronischen Medien.<br />
Im Anschluss an den historischen Teil, in dem den schriftlichen Medien besondere<br />
Aufmerksamkeit gewidmet wurde, soll in diesem Abschnitt die Entwicklung audiovisueller<br />
Medien aufgegriffen werden.<br />
3.1 Die Medienthematik in der klassischen Klavierpädagogik<br />
In der musikpädagogischen Literatur ist das Thema Medien bislang unterrepräsentiert,<br />
in den meisten Werken der klavierpädagogischen Literatur bleibt es ausgespart.<br />
Dies entspricht der Tatsache, dass die technische Entwicklung auditiver Medien erst<br />
mit dem zwanzigsten Jahrhundert begann. Während der Gebrauch von schriftlichen<br />
Medien in Notenform derart selbstverständlich ist, dass er nie gesondert thematisiert,<br />
ja meist nicht einmal als solcher erkannt wird, nehmen andere Arten von Medien<br />
einen marginalen Raum in der Literatur ein. Im folgenden sollen die seltenen Äußerungen<br />
von Klavierpädagogen zum Thema Medien weitgehend unkommentiert zusammengefasst<br />
werden, um die Bandbreite aufzuzeigen, in welcher sich die Meinungen<br />
bewegen. Dabei lassen sich folgende Themenbereiche unterscheiden:<br />
� Hören von Aufnahmen bedeutender Interpreten<br />
Der größte Teil der seltenen Fälle, in denen in der klavierpädagogischen Literatur<br />
auf auditive Medien Bezug genommen wird, betrifft die Möglichkeit, durch das Hören<br />
von Aufnahmen sich mit Interpretationen unterschiedlicher Pianisten vertraut zu<br />
machen. Von den meisten Autoren wird es als entscheidende Chance der elektrischen<br />
Schallaufzeichnung erachtet, berühmte Interpreten auch außerhalb des Konzertsaals<br />
zu hören. Bereits in der Frühzeit der elektromechanischen Schallaufzeichnung,<br />
gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts, wurde dieser damals noch weit in die<br />
Zukunft weisende Aspekt in einem Artikel von HEINRICH DESSAUER in der Zeitschrift<br />
Der Klavier-Lehrer aufgegriffen:<br />
"Durch den Phonographen wäre es nun möglich, jungen Musiklehrern und<br />
Konzertspielern die Leistungen der ausübenden Tonkünstler der ganzen Welt<br />
111
112<br />
zugänglich zu machen. Wir müssten in die innerste Werkstatt des Meisters in<br />
dessen Lehrstube wandern!" (DESSAUER 1892, 264)<br />
Auch HEINRICH NEUHAUS hält in seinem um die Mitte des 20. Jahrhunderts verfassten<br />
Buch Die Kunst des Klavierspiels die Tatsache, dass nun jedermann freien<br />
Zugang zu vorbildlichen Interpretationen hat, für einen bedeutsamen Fortschritt. Er<br />
vertritt darüber hinaus die revolutionäre Ansicht, dass sogar der Unterricht an Konservatorien<br />
vom Plattenhören verdrängt werden könnte:<br />
"Für talentierte und fortgeschrittene Pianisten sind Plattenaufnahmen augenblicklich<br />
wahrscheinlich das beste erzieherische Mittel. Auf Platten ist so viel<br />
Vortreffliches und Wunderbares bewahrt, daß sie mir manchmal den sündhaften<br />
Gedanken suggerieren, als sei die Zeit nicht mehr fern, wo der Unterricht<br />
fortgeschrittener Pianisten der höheren Kurse des Konservatoriums oder in der<br />
Aspirantur durch individuelle Pädagogen ganz von selbst aussterben wird und<br />
diese den Platten Platz machen." (NEUHAUS 1967, 192)<br />
JAKOW MILSTEIN, wie NEUHAUS russischer Pianist, äußert sich ähnlich euphorisch.<br />
Auch er spricht davon, dass die Rolle der Schallplatte beim Lernvorgang eines Tages<br />
die Bedeutung des persönlichen Lehrers überragen könnte:<br />
"Es besteht kein Zweifel, daß [...] sich die Diskrepanz zwischen dem Ersatz<br />
(der die mechanische Aufzeichnung letztendlich doch irgendwie immer bleiben<br />
muß) und dem vollwertigen Naturprodukt (also der lebendigen Musik) unvermeidlich<br />
immer mehr ausgleichen wird. Manche nehmen sogar an, daß die<br />
'Konserven' mit der Zeit alle Eigenschaften einer 'natürlichen Nahrung' annehmen<br />
werden.<br />
Besonders wertvoll sind die Aufzeichnungen vom Vortrag großer, vielerfahrener<br />
Künstler. [...] Man spricht sogar davon, daß das Hören von Schallplatten in<br />
unserer Zeit mitunter wichtiger sei als die Stunden beim eigenen Lehrer."<br />
(MILSTEIN 1976, 183f.)<br />
� Eigene Aufnahme und Wiedergabe<br />
Neben der Schallplatte als Wiedergabemedium empfiehlt ANDOR FOLDES in seinem<br />
Buch Wege zum Klavier auch, das eigene Spiel aufzunehmen, um sich eine Vorstellung<br />
von der Wirkung der eigenen Interpretation zu machen. Er äußert dabei die<br />
Überzeugung, dass das bewusste Hören gesondertes Lernziel sein müsse. Zunächst
stellt er deshalb den Zusammenhang zur verbreitet mangelhaften Beachtung des Gehörsinnes<br />
her:<br />
"Wenn ich sagte, das Musiklesen sei der erste Schritt auf dem Weg zu gutem<br />
Klavierspiel, so muß ich nun hinzufügen, daß Musikhören – das eigene Spiel<br />
sowohl wie das Musizieren anderer – ein ebenso wichtiger Bestandteil der<br />
Ausbildung jedes jungen Musikers ist. Viele Studierende beschäftigen sich<br />
stundenlang damit, an ihrem Instrument fieberhaft schwierige Stellen zu üben.<br />
Oft laufen diese Anstrengungen auf wenig mehr als das Bewegen der Finger<br />
auf den Tasten hinaus. Die auf diese Weise am Klavier verbrachte Zeit wird<br />
nicht die gewünschten Ergebnisse bringen, wenn diese jungen Pianisten nicht<br />
die Fähigkeit zu gewissenhaftem Hören erlangt haben. Natürlich ist es doppelt<br />
schwer, auf das eigene Spiel zu hören. Das Spielen an sich nimmt einen stark<br />
in Anspruch, und gleichzeitiges Spielen und Hören erfordert eine große Konzentration.<br />
Andererseits wird durch den Prozeß des Hörens Energie absorbiert,<br />
deren Fehlen dann die Exaktheit der Ausführung beeinträchtigt.<br />
Man erlernt die Kunst des Hörens eher, wenn man sich zunächst auf die von<br />
anderen gespielte Musik konzentriert anstatt auf die selbst produzierte. Man<br />
wird erst dann imstande sein, gleichzeitig zu spielen und zu hören, wenn man<br />
gelernt hat, mit offenen Ohren das Musizieren anderer anzuhören. [...]<br />
Schallplatten sind eine ausgezeichnete Quelle musikalischer Unterweisung und<br />
können den jungen Musikern gar nicht warm genug empfohlen werden. Der<br />
Studierende kann ungeheuer viel lernen, wenn er zunächst unter bestmöglichen<br />
Bedingungen gespielte Konzerte reifer Künstler anhört und dann später sein<br />
eigenes Spiel anhand von Platten – die jedes private Tonstudio aufnimmt –<br />
überprüft." (FOLDES 1990, 20ff.)<br />
Als dieser Text um die Mitte des 20. Jahrhunderts entstand, war es noch schwierig,<br />
eigenhändig Aufnahmen durchzuführen, deshalb die Erwähnung von Tonstudios.<br />
Heute hat sich diese Situation grundlegend geändert: Eigene CD-Produktionen sind<br />
an der Tagesordnung.<br />
Auch der Kölner Pianist HELMUT WEINREBE plädiert für eigene Aufnahmen, zumindest<br />
für sehr fortgeschrittene Schüler:<br />
"Für den Klavierpädagogen und den sehr weit fortgeschrittenen Schüler ist die<br />
Möglichkeit, erübte Werke auf Tonband oder Kassette zu spielen, im Unterricht<br />
nicht mehr hinwegzudenken." (WEINREBE 1994, 125)<br />
Für weniger weit fortgeschrittene Schüler rät er allerdings von der Aufzeichnung des<br />
eigenen Spiels ab:<br />
113
114<br />
"So sehr Tonbandaufnahmen von Kindern im Klavierspiel quasi zum Familienalbum<br />
gehören, spürt der selbstkritische Schüler durch die Perfektion des<br />
Mediums einen Anspruch, dem er noch nicht gewachsen ist." (WEINREBE<br />
1994, 125)<br />
� Hören von Lehrstücken<br />
Die auditive Vermittlung von Lehrstücken spielt bislang nur bei der Suzuki-Methode<br />
eine zentrale Rolle. Das Hören der Tonträger wird hier als weitaus wichtiger eingeschätzt<br />
als die eigene Arbeit am Instrument! Deshalb kommen hier auditive Medien<br />
schon im Unterstufenunterricht zum praktischen Einsatz:<br />
"Auf das tägliche Hören der Schallplatten muß immer wieder hingewiesen<br />
werden. Die Suzuki-Erziehung basiert auf Nachahmung und Wiederholung<br />
[...]. Das Hören der Musikbeispiele ist doppelt so wichtig wie das Üben, betont<br />
Dr. Suzuki. Viele Dinge, das sollten Eltern einsehen, werden durch das Hören<br />
vermittelt:<br />
a) Tonfolgen<br />
b) Formgefühl<br />
c) Harmonische Zusammenhänge<br />
d) Gedächtnisschulung<br />
e) Auffassen neuer Melodien<br />
f) Schulung des musikalischen Ausdrucks."<br />
(BIGLER / LLOYD-WATTS 1984, 24)<br />
Diese Art nachahmenden Lernens stößt insbesondere im europäischen Kulturkreis<br />
vielfach auf Skepsis, weil die Suzuki-Methode mit "Dressur" von kindlichen Großgruppen<br />
assoziiert wird (vgl. V. GUTZEIT 1998).<br />
� Aufnahme von Unterrichtsstunden<br />
HEINRICH NEUHAUS propagiert auch die elektroakustische Aufnahme und Verbreitung<br />
von Unterrichtsstunden. Auf diese Weise könnten seiner Meinung nach Entfernungen<br />
leichter überwunden werden und auch die Provinz in den Genuss vorbildlichen<br />
Unterrichts kommen, ein Problem, das in der geographischen Situation der<br />
Sowjetunion, in der NEUHAUS wirkte, besonderer Aufmerksamkeit bedurfte:
"Man wird Tonbandaufnahmen von wirklichen Unterrichtsstunden sogenannter<br />
'führender Meister' und selbstverständlich auch anderer anfertigen, sie vervielfältigen<br />
und an die Musikschulen, Lehranstalten und Konservatorien der verschiedenen<br />
Städte verschicken, wie man das mit Filmen tut. Ich hoffe, daß man<br />
bald dazu kommt. Der Nutzen wäre gewaltig." (NEUHAUS 1967, 123f.)<br />
Lassen solche Thesen im Zeitalter von Datenfernübertragung und Internet hellhörig<br />
werden, so erweist sich die Fortschrittlichkeit im Denken HEINRICH NEUHAUS' auch<br />
in der folgenden Äußerung. Dort entwarf er, lange vor der Etablierung multimedialer<br />
Technologien, zumindest theoretisch eines der ersten Multimedia-Pakete der<br />
Klavierpädagogik: ein Buch in Kombination mit Schallplatten:<br />
"Ich bin überzeugt, daß in naher Zukunft Bücher, die dem meinen ähnlich sind,<br />
nur unter Beifügung klanglicher Aufzeichnungen erscheinen werden, denn nur<br />
diese können eine vollständige und klare Vorstellung vermitteln." (NEUHAUS<br />
1967, 193)<br />
In den immerhin bereits über 30 Jahren seit Veröffentlichung der Kunst des Klavierspiels<br />
in Deutschland haben sich die Vorhersagen NEUHAUS' in der Praxis allerdings<br />
zumindest für die klassische Instrumentalpädagogik nicht bewahrheitet. Der Frage,<br />
warum solche modernen Medienansätze nur schwer Eingang in die kulturelle Realität<br />
finden, wird auf S. 134ff. nachgegangen.<br />
Ebenfalls sehr selten kommt in der klavierpädagogischen Praxis die im folgenden<br />
von GÜNTER REINHOLD geschilderte, völlig neue Art der Tonaufzeichnung zum<br />
Einsatz:<br />
"Wesentliche Erkenntnisse kann man auch durch eine Neuentwicklung, den<br />
Bösendorfer-Computerflügel gewinnen, einen ganz normalen Flügel, in den<br />
eine Zusatzeinrichtung zur elektronischen Speicherung eingebaut ist, die eine<br />
absolute Identität von Aufnahme und Wiedergabe garantiert. Bezogen auf die<br />
beim Flügel intendierte Klangrichtung sitzt ein Pianist seitlich am Instrument;<br />
bei der Wiedergabe kann man aus dem Saal, also aus der Position des Publikums<br />
das eigene Spiel beurteilen. Die Verlangsamung der Spielgeschwindigkeit<br />
erlaubt eine höhere Kontrolle der Genauigkeit und darüber, inwieweit<br />
kleinste Abweichungen hiervon ausdrucksmäßige Wirkungen beinhalten. Auch<br />
werden bei liegendem Pedal im Originaltempo verschwimmende Anschläge<br />
durch Verlangsamung hörbar [...]. Ausdrucksmäßige Maßnahmen lassen sich<br />
genau untersuchen." (REINHOLD 1996, 32f.)<br />
Um die zitierten Äußerungen einordnen zu können, müssen zunächst grundsätzliche<br />
Merkmale der zur Sprache gebrachten Arten von Medien und Musikinstrumenten<br />
115
herausgearbeitet werden. Eine genaue Systematik der unterschiedlichen Technologien<br />
findet sich im Anhang. Visuelle Medien, Film- und Videoaufzeichnung, werden<br />
dabei ausgespart. In der Praktikerliteratur (vgl. WEINREBE 1994, 126, REINHOLD<br />
1996, 32, MARTIENSSEN 1957, 199, WERNER 1993, 47) nimmt dieses Feld nur einen<br />
äußerst geringen Raum ein.<br />
3.2 Allgemeine Medienentwicklung<br />
WOLFGANG MANZ (1991, 49) erwähnt in seiner Übersicht über die Unterrichtsmedien<br />
vier Kategorien von technischen Neuerungen nach der Erfindung des Buchdrucks:<br />
116<br />
<strong>1.</strong> Fotografie und Reproduktion<br />
2. Audio- und Videoaufnahme<br />
3. Elektronische Datenverarbeitung<br />
4. Datenfernübertragung<br />
Die aktuelle Entwicklung zeigt als Folge sich durchsetzender Digitaltechnik eine<br />
Auflösung der Grenzen zwischen diesen Medienkategorien und eine Integration in<br />
der elektronischen Datenverarbeitung. Die analoge Ton- und Bildtechnik, die das<br />
20. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt hat, wird damit weitgehend überflüssig:<br />
Analoge audiovisuelle (AV-) Medien werden gegenwärtig von digitalen Medien<br />
verdrängt, von einer Technologie, deren scheinbar unaufhaltsamer Siegeszug auf<br />
eine gerade erst fünfzigjährige Geschichte zurückblickt. Die technische Entwicklung<br />
hat in den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die digitale Verarbeitung<br />
von Audiosignalen mit einem Datenfluss von ca. 1 Megabit 27 pro Sekunde und in<br />
den neunziger Jahren die digitale Verarbeitung bewegter Bilder mit einem um Größenordnungen<br />
höheren Datenfluss (je nach erforderlicher Qualität und Codierungsart<br />
bis zu 200 Megabit pro Sekunde) möglich gemacht (vgl. REIMERS 1994). Damit<br />
kann ein Datenverbund aus Bild-, Ton- und Textverarbeitung realisiert werden, der<br />
üblicherweise als multimedial bezeichnet wird, obwohl der Begriff monomedial<br />
wohl treffender wäre. Unter dem Begriff neue Medien werden inzwischen gewöhnlich<br />
eben diese Medien subsumiert, die Informationen in digitaler Form speichern,<br />
27 Ein bit ("binary digit") ist die kleinste Informationseinheit. Davon zu unterscheiden ist die Einheit<br />
"byte". Sie besteht aus acht bit. Diese Informationsmenge wird benötigt, um ein Zeichen,<br />
z.B. einen Buchstaben, aus einer Menge von 256 Elementen zu codieren. Speicherkapazitäten<br />
werden in der Regel in byte gemessen.
eproduzieren und übermitteln. Alle digitalen Medien bedienen sich der Technologie<br />
der elektronischen Datenverarbeitung, unabhängig davon, ob es sich um klangerzeugende,<br />
speichernde oder übermittelnde Geräte handelt. Die Tatsache, dass alle<br />
Arten digitaler Information von ein und demselben Rechner verarbeitet werden können,<br />
hat zur Folge, dass dieses Medium bei entsprechender Kapazität gleichzeitig<br />
Informationen speichern, kombinieren, übermitteln und entgegennehmen kann: es<br />
wird interaktiv. Was im Jahr 1992 in einem Computer-Anwenderbuch zur Definition<br />
von Multimedialität noch in die Zukunft projiziert wurde, ist inzwischen weitgehend<br />
Realität geworden:<br />
"Die herkömmlichen Massenmedien wie Fernsehen, Radio, Video, Film und<br />
Zeitung sind für den Empfänger ein einziger Monolog: Er kann ihn auf sich<br />
wirken lassen, sich berieseln lassen oder das Programm wechseln oder ausschalten.<br />
Unmittelbares Gestalten oder Verändern der Massenmedien liegt<br />
nicht im Bereich der Möglichkeiten des Empfängers. Seine Rolle ist die des<br />
Empfängers, und zwar immer. [...]<br />
Multimedia soll die herkömmlichen Massenmedien und Kommunikationsdienste<br />
in die interaktive Welt der Computer integrieren. Der Computer soll Kommunikationsmittel<br />
werden, ein Gerät, das alle Eigenschaften in sich vereint:<br />
Telefon, Computer, Fernseher, mit Sprach- und Gesten-Eingabe, Bildtelefon<br />
und ISDN-Anschluss. Das wäre ein Medium für alles, 'the medium to end all<br />
media' [...]." (FISCHER/KLUG 1992, 581)<br />
Hinzu kommt heute, dass auch die elektronische Klangerzeugung und -bearbeitung<br />
und damit die Musikproduktion im gleichen Gerät wie die Speicherung vollzogen<br />
werden kann. Das Medium wird damit auch zum Musikinstrument. Beide Kategorien<br />
sind nicht mehr eindeutig zu trennen. Näheres dazu in Abschnitt 3.3.3.<br />
3.3 Spezielle Medienentwicklung im Bereich Musik<br />
Grundsätzlich wird die technologische Entwicklung unmittelbaren Zugriff und sofortige<br />
Vervielfältigbarkeit klanglicher Informationen ermöglichen. Was der Foto-<br />
oder auch der Fernkopierer (Telefax) für die Vervielfältigung von Schrift leistet,<br />
wird auch auf Musik anwendbar: Eine Vervielfältigung, Bearbeitung und Übermittlung<br />
erfordert nicht mehr die Zeit der Erstellung der Information (der Übergang von<br />
der Abschrift zum Druck im 18. Jahrhundert bezeichnet auf dem Gebiet der schriftlichen<br />
Musikbearbeitung eine vergleichbare Zäsur, vgl. S. 18), sondern wird in<br />
praktisch unbegrenzt kleinen Zeiträumen erfolgen können. In Verbindung mit Fort-<br />
117
schritten auf dem Gebiet der Datenfernübertragung folgt hieraus, dass jede Art von<br />
(im musikalischen Kontext natürlich vorwiegend auditiver) Information in beliebig<br />
kurzer Zeit an jedem beliebigen Ort verfügbar sein wird.<br />
3.3.1 Klangdatencodierende Digitaltechnik<br />
Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Möglichkeiten der Speicherung von Musik<br />
können zwei Arten der digitalen Verarbeitung unterschieden werden.<br />
In der klangdatencodierenden digitalen Audiotechnik, wie sie in den verbreiteten<br />
Arten von Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräten (z.B. CD) zum Einsatz kommt,<br />
erfolgt nach elektroakustischer Wandlung mittels Mikrofonen (dies zunächst wie bei<br />
der analogen Tonaufnahme) nicht die unmittelbare Speicherung der analogen Wellenform,<br />
wie es bei der Analogtechnik Prinzip ist. Die Gestalt dieses nur vorläufig<br />
analogen elektrischen Signals wird statt dessen abgetastet und die ermittelten Abtastwerte<br />
als diskrete (digitale) Werte gespeichert. Die Qualität der Aufzeichnung<br />
hängt dabei unmittelbar von der Genauigkeit der Abtastung ab. Je höher diese Genauigkeit<br />
ist, desto mehr Daten fallen an und müssen verarbeitet werden. Die<br />
Schnelligkeit der verfügbaren Mikroprozessoren erlaubt bereits heute bei der Audioaufzeichnung<br />
eine eindeutige qualitative Überlegenheit von Digital- gegenüber<br />
Analogtechnik.<br />
Auditive und visuelle Information wird, wie es sich gegenwärtig bei der Aufnahme<br />
und Wiedergabe auf Festplatten und flüchtigem Speicher bereits andeutet, zunehmend<br />
unabhängig vom Zeitfaktor und damit entmaterialisiert und entlinearisiert.<br />
Alle aus der Textverarbeitung bekannten Bearbeitungsmöglichkeiten – Kopieren,<br />
Schneiden, Einfügen, Wiederholen, in Grenzen auch schnellere oder langsamere<br />
Wiedergabe – werden auch bei AV-Medien möglich.<br />
3.3.2 Steuerdatencodierende Digitaltechnik<br />
Neben der klangdatencodierenden digitalen Audiotechnik hat eine zweite Art der<br />
digitalen Aufzeichnung von Musik Bedeutung gewonnen, bei der die zuletzt erwähnten<br />
Manipulationsmöglichkeiten wesentlich umfangreicher sind. Hierbei werden<br />
unmittelbar die Erzeugungsparameter der Musik festgehalten. Einfach ausgedrückt:<br />
es wird registriert, wann welcher Ton auf einem Instrument mit welcher Dynamik<br />
gespielt wurde; die Aufstellung von Mikrofonen entfällt. Hier wird nicht nach<br />
akustischen, sondern musikalischen Parametern codiert: Registriert werden insbe-<br />
118
sondere Zeitpunkt, Dauer und Lautstärke von Klangereignissen. Über die Klangfarbe<br />
sind weitere Übereinkünfte notwendig.<br />
Aufwändige Beispiele für diese Technologie sind der selbstspielende Bösendorfer<br />
Computerflügel SE oder das Yamaha Disclavier. Bei der Wiedergabe bewegt sich<br />
unter jeder Taste ein Linearmotor, der wiederum vom Computer mit den gespeicherten<br />
Daten gespeist wird und die Taste entsprechend beschleunigt. Dies entspricht<br />
dem selben Prinzip, wie es bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in selbstspielenden<br />
Klavieren (z. B. Welte Mignon) angewandt wurde, allerdings in weit präziserer<br />
Ausprägung. Mit den mittels Abnahme von Tastenbewegungen gewonnenen<br />
Steuerdaten können aber, wie es in der Regel bei der Produktion von Popularmusik<br />
Anwendung findet (und wesentlich preiswerter als mit selbstspielenden Klavieren zu<br />
realisieren ist), auch synthetische Klangerzeuger angesteuert werden.<br />
Mit dieser Technologie ist die Aufzeichnung von Musik nur möglich, wenn ihre Erzeugungsparameter<br />
erfasst werden können. Gut gelingt dies bei einem Tasteninstrument,<br />
bei dem es nach TETZEL (vgl. S. 82f.) ausreicht, zusätzlich zum Pedal<br />
Zeitpunkt und Stärke der jeweiligen Tasten- bzw. Hammerbewegungen zu<br />
speichern, um eine eindeutige Codierung zu gewährleisten. Für unterschiedliche<br />
Arten von Instrumenten, von Zupf- bis hin zu Blasinstrumenten existieren<br />
Applikationen, die die Registrierung von Steuerdaten ermöglichen. Vorteile der<br />
steuerdatenbezogenen Aufzeichnung liegen in der Flexibilität und der Vielfalt<br />
musikalischer Bearbeitungsmöglichkeiten. Das Tempo ist frei manipulierbar und<br />
jedes Instrument eines beliebig komplexen Arrangements kann einzeln behandelt,<br />
verändert oder aus dem Gesamtklang ausgeblendet werden. Auf diese Weise<br />
codierte Musik kann auch beliebig in andere Tonarten transponiert werden.<br />
Das Verfahren der Aufzeichnung spielbezogener Daten wird als sequencing (engl.)<br />
bezeichnet. Das hierbei erforderliche Datenprotokoll wurde im Jahr 1983 von Musikinstrumentenherstellern<br />
in der MIDI-Spezifikation 28 festgelegt, auf deren Grundlage<br />
Aufnahmegeräte und Klangerzeuger aller Hersteller sich miteinander verbinden<br />
lassen.<br />
Während die klangdatencodierende Art der Aufzeichnung in der Tradition der Wiedergabemedien<br />
steht, entstammt die steuerdatencodierende Aufzeichnungsart der<br />
Tradition der Musikinstrumente. Die Tatsache, dass hier beliebig bearbeitbare musikalische<br />
Parameter codiert werden, macht diese Aufzeichnungsart auch für die Musikpädagogik<br />
interessant. In den Bereichen Transkription, Komposition, Notation,<br />
Gehörbildung ist eine multisensurale Verbindung von Schriftlichkeit und Klang mit<br />
28 MIDI: Abkürzung für Musical Instruments Digital Interface.<br />
119
dieser Technologie möglich, die bislang im Musikunterricht noch wenig genutzt<br />
wird.<br />
3.3.3 Der Sampler<br />
Der Sampler entstammt ursprünglich ebenfalls der Tradition der steuerdatencodierenden<br />
Musikinstrumente. Er besteht aus flüchtigem RAM-Speicher, von dem<br />
Klangdaten aufgenommen ("gesampelt") und wiedergegeben werden können. Er<br />
wurde geschaffen, um, per MIDI angesteuert, möglichst originalgetreu Klänge zu<br />
produzieren, die per Mikrofon in ihm aufgezeichnet und gespeichert wurden. Auf<br />
diese Weise wurden auch natürliche Instrumentalklänge in der elektronischen Musik<br />
zugänglich, ähnlich wie es auf elektromagnetische Weise bereits im Mellotron verwirklicht<br />
wurde. Ursprünglich war der zur Verfügung stehende Speicher allerdings<br />
sehr knapp und teuer, so dass nur sehr kurze Klangschnipsel abrufbereit sein konnten.<br />
Damit befand sich die Funktion des Samplers noch eindeutig in der Tradition<br />
der Klangerzeuger, also der Musikinstrumente. Je länger aber die gespeicherten<br />
Klänge wurden, desto mehr näherte sich die Funktion des Samplers der eines Wiedergabemediums<br />
an. Ein Tastendruck genügt in diesem Fall, um eine längere Sequenz<br />
erklingen zu lassen. Die Taste des Tasteninstruments wird damit zum Startknopf<br />
eines Wiedergabemediums. Inzwischen werden in Form von MP3-Playern<br />
auch reine Wiedergabegeräte angeboten, die keine beweglichen Speichermedien<br />
mehr enthalten.<br />
Eine zwangsläufige Folge der Vergrößerung von Rechnerkapazitäten ist also die<br />
Vermischung von steuerdatencodierender und klangdatencodierender Sphäre. Damit<br />
verschmelzen die bislang getrennten Funktionen von Musikinstrument und Wiedergabemedium.<br />
Das rein quantitative Phänomen der größeren Leistungsfähigkeit von<br />
Rechnern führt also in Form des Samplers zu der neuen Qualität der Verschmelzung<br />
von Musikinstrument und Medium.<br />
Der Sampler vereint die Eigenschaften klangdatencodierender und steuerdatencodierender<br />
Technologien und verkörpert damit die Verschmelzung von Musikinstrument<br />
und Medium.<br />
Da ein Sampler im Prinzip nichts anderes ist als ein Computer, bedeutet dies auch:<br />
Computer können behandelt werden wie Musikinstrumente und sind dann Musikinstrumente.<br />
120
Damit setzt sich konsequent eine technologische Entwicklung fort, die seit Jahrtausenden<br />
darin besteht, Mittel zur Klangerzeugung zu finden, die die menschliche<br />
Stimme transzendieren oder ergänzen. Der Computer (oder das digitale Medium, der<br />
Synthesizer oder wie man es nennen mag) steht in dieser Tradition und damit in keiner<br />
anderen als alle anderen Musikinstrumente, sei es die Violine oder die Orgel.<br />
Die bedeutsamen Auswirkungen dieser Tatsache auf die Musikkultur werden in Abschnitt<br />
4.5 näher erörtert. Der Gelehrtenstreit um einen Laptop oder ein Musikinstrument<br />
für jeden Schüler könnte unter dieser Voraussetzung eine Akzentverschiebung<br />
erfahren. Immer bedeutsamer wird jedenfalls die Frage werden, wie<br />
Computer bzw. digitale Medien sinnvoll für gute musikalische Bildung genutzt<br />
werden können.<br />
Solche Fragen mögen heute noch theoretisch erscheinen, werden aber sehr schnell<br />
auch praktische Relevanz gewinnen. Während in der Praxis die Klangerzeugung<br />
akustischer Musikinstrumente in der Hand von Interpreten der elektronischen<br />
Klangerzeugung heute noch uneinholbar überlegen erscheint, sieht die Theorie anders<br />
aus. Die elektronische Klangerzeugung ist der Klangerzeugung akustischer Instrumente<br />
äquivalent und kann grundsätzlich gleichwertige Klänge erzeugen. Damit<br />
liegen entscheidende Fragen der Zukunft nicht in der Entscheidung zwischen akustischer<br />
oder elektrischer Tonerzeugung, sondern – neben dem Problem der Übertragung<br />
der Schallwellen an das menschliche Ohr – in der Gestaltung von Schnittstellen<br />
zwischen Musiker und Instrument. Elektronische Klangerzeugung ist dabei übrigens,<br />
wie nicht nur das Trautonium bezeugt, keineswegs zwangsläufig an eine<br />
Tastatur als Schnittstelle gebunden. In letzter Konsequenz wird damit der Begriff<br />
"Clavierspiel" auch in seiner erweiterten Bedeutung in traditionellen Schreibweise,<br />
die noch das Musizieren auf allen Tasteninstrumenten umfasst, zu eng. Fragen der<br />
Klangerzeugung werden auch auf S. 177 ff. erörtert. Eine systematische Aufstellung<br />
auditiver Medien findet sich im Anhang.<br />
121
122
4 Perspektiven<br />
4.1 Orientierungsschwierigkeiten der Musikpädagogik<br />
Während auf dem Gebiet der Allgemeinen Didaktik bereits seit mehreren Jahrzehnten<br />
eine eigene mediendidaktische Tradition besteht, scheinen, wie in Abschnitt 3.1<br />
gezeigt wurde, in der Musik- und dabei besonders der Instrumentalpädagogik Ansätze<br />
zur Aufarbeitung der medientechnologischen Entwicklung rudimentär. Eine<br />
Ursache hierfür ist die Dominanz der Interpretation in der Ausbildung am Instrument,<br />
womit automatisch das schriftliche Medium als Vorlage des Musizierens im<br />
Mittelpunkt bleibt. Wird diese Tradition nicht hinterfragt, stellt sich die Medienfrage<br />
nicht.<br />
Eine weitere Ursache für die geringe Aufmerksamkeit, die mediendidaktische Tendenzen<br />
der Allgemeinen Pädagogik in der Musikpädagogik finden, ist die von<br />
künstlerischen Vorstellungen beherrschte Sonderrolle der Musikpädagogik im Fächerkanon<br />
und die damit verbundene Überzeugung, dass Erkenntnisse der Allgemeinen<br />
Didaktik auf die Musikdidaktik nur sehr begrenzt übertragbar sind. Von<br />
Vertretern der Musikpädagogik wird wiederholt beteuert, dass musikalische Lernprozesse<br />
weniger in allgemein-didaktischen Kategorien fassbar seien, sondern, wie<br />
beispielsweise die Musikpädagogin URSULA DITZIG-ENGELHARDT feststellt,<br />
"[...] daß Musiklernen oft eigenen Gesetzmäßigkeiten gehorcht." (DITZIG-<br />
ENGELHARDT 1987, 383)<br />
Das Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Pädagogik und Musikpädagogik befindet<br />
sich deshalb in einem besonderen Spannungsverhältnis. Die Musikpädagogik<br />
bemüht sich zwar seit einigen Jahrzehnten, ihrem selbstgestellten wissenschaftlichen<br />
Anspruch zu genügen, muss aber zugeben, dass gültige wissenschaftliche Kriterien<br />
bislang nicht vorliegen. CHRISTOPH-HELLMUTH MAHLING bemerkt zur Suche der<br />
Musikpädagogik nach einem eigenen wissenschaftlichen Standort:<br />
"Die Bemühungen, Musikpädagogik als eine autonome Wissenschaft zwischen<br />
Musikwissenschaft und Erziehungswissenschaft zu etablieren, sind durch zahlreiche<br />
Versuche gekennzeichnet, Standort, Selbstverständnis und Aufgabenbereich<br />
zu klären. Ein überzeugendes und allgemein anerkanntes Ergebnis steht<br />
hier einstweilen noch aus. Nicht zuletzt darin scheint aber auch der derzeitige<br />
Konzeptpluralismus begründet, der seinerseits wiederum im Autonomiestreben<br />
der Musikpädagogik eine Art Selbstbehinderung darstellt." (MAHLING 1978,<br />
64)<br />
123
Auch SIGRID ABEL-STRUTH führt die mangelnde wissenschaftliche Grundlegung der<br />
Musikpädagogik im folgenden auf die Verschiedenartigkeit der in der Musikpädagogik<br />
existierenden didaktischen Ansätze zurück:<br />
124<br />
"In der Unterschiedlichkeit der wissenschaftlichen Herkunft musikpädagogischer<br />
Forschungsansätze mit ihren gelegentlich konkurrierenden methodischen<br />
Tendenzen sind wohl entscheidende Ursachen dafür zu suchen, daß der pädagogische<br />
Umgang mit Musik so schwer zu wissenschaftlicher Grundlegung<br />
findet." (ABEL-STRUTH 1985, 70)<br />
Musikdidaktiken beruhen auf Traditionen und sind deshalb nur innerhalb relativ<br />
großer Zeiträume beeinflussbar. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse fließen aufgrund<br />
der in Frage stehenden Gültigkeit für musikalische Lernprozesse, wenn überhaupt,<br />
nur verzögert in die Musikdidaktik ein und können dann erst nach Generationen<br />
der Erprobung traditionell "bewährte" oder "festgefahrene" (je nach Blickwinkel)<br />
Strukturen infrage stellen. Objektivierte Verfahren zur Verifizierung von Lernfortschritten<br />
stehen nicht zur Verfügung.<br />
Die Art und Weise, in der gegenwärtig Studierende der Instrumentalpädagogik ausgebildet<br />
werden, unterscheidet sich deshalb, wie die Neue Musikzeitung unter nur<br />
leichter Übertreibung meldet, kaum von der vor hundert Jahren:<br />
"Wenn man Lehrproben von Hochschulabsolventen hört und sieht, hat man<br />
häufig den Eindruck, daß da der gleiche Unterricht abläuft, wie er vor 25, 50<br />
oder 75 Jahren gehalten wurde. Man könnte meinen, im Instrumentalunterricht<br />
sei die Zeit in den letzten 100 Jahren stehengeblieben. Nichts zu spüren davon,<br />
daß die Kinder und Jugendlichen heute anders sind als vor 50 oder noch vor 20<br />
Jahren. Nichts zu spüren vom Einfluß pädagogischer Forschung und Erkenntnis<br />
aus dem Anfang und der Mitte unseres 20. Jahrhunderts, geschweige denn<br />
neuester Erkenntnisse." (KORWARD 1993, 17f.)<br />
Bemühungen einer Musikpädagogik mit wissenschaftlichem Anspruch, dieser vermeintlichen<br />
Stagnation zu begegnen, haben allerdings nur selten Erfolg. Auf der<br />
Grundlage einer immer wieder beteuerten Sonderrolle und der damit verbundenen<br />
besonderen Komplexität musikalischer Lernvorgänge bemüht sie sich zwar, eigene<br />
Methoden zu entwickeln, die den selbstgestellten wissenschaftlichen Ansprüchen<br />
genügen. Die nach wie vor bestehende Methodenunsicherheit zeigt aber, dass "wissenschaftliche<br />
Grundlegung" (ABEL-STRUTH, s. o.) immer noch weit entfernt zu sein<br />
scheint; und schließlich muss die wissenschaftliche Musikpädagogik auch ihre prinzipielle<br />
Ohnmacht eingestehen, verbindliche Antworten zu geben. So berichtet
URSULA DITZIG-ENGELHARDT über Versuche, Erkenntnisse aus der Allgemeinen<br />
Pädagogik auf die Musikpädagogik zu übertragen und diesbezügliche Einwände<br />
SIGRID ABEL-STRUTHS:<br />
"Zur Aufschlüsselung von Lernprozessen in einzelne aufeinanderfolgende Stufen<br />
wurden Taxonomien entwickelt, durch die eine systematische Darstellung<br />
des kognitiven, des emotionellen und des psychomotorischen Verhaltensbereichs<br />
angestrebt wurde. Die Übertragung allgemeiner Lerntheorien auf das<br />
Musiklernen wird den hochkomplexen Vorgängen musikalischer Wahrnehmung,<br />
musikalischen Verstehens und Agierens jedoch nur bedingt gerecht. So<br />
warnt Sigrid Abel-Struth [...]: 'Kein Verfahren ist in der Lage, Ziele musikalischen<br />
Lernens umfassend oder auch nur zureichend auf wissenschaftliche<br />
Weise zu bestimmen oder logisch zu deduzieren.' [...]<br />
Die spezifischen Strukturen des Faches Musik machen eine eigens dafür entwickelte<br />
Taxonomie erforderlich." (DITZIG-ENGELHARDT 1987, 420f.)<br />
Indem URSULA DITZIG-ENGELHARDT als Vertreterin einer Musikpädagogik mit wissenschaftlichem<br />
Anspruch die Eignung der Wissenschaft negiert, musikpädagogische<br />
Fragestellungen abschließend zu beantworten, ja die Methode der logischen<br />
Deduktion für die Musikpädagogik als letztendlich ungeeignet bezeichnet, stellt sie<br />
implizit die Eignung wissenschaftlicher Herangehensweisen beim Versuch der Erstellung<br />
der von ihr selbst geforderten Taxonomie in Frage.<br />
Die Wissenschaftlichkeit in der Musikpädagogik scheint also vorwiegend damit beschäftigt<br />
zu sein, einen eigenen Standort zu suchen. Konkrete Hilfen für den Instrumentalunterricht<br />
scheinen aus dieser Richtung kaum zu erwarten. HERBERT<br />
WIEDEMANN beschreibt in seinem Buch Klavierspiel und das rechte Gehirn diese<br />
Situation und die vergebliche Suche nach lerntheoretisch fundierter Perfektionierung<br />
der Musikdidaktik am Beispiel des Klavierunterrichts:<br />
"Wenn Begriffe wie 'intuitive Erkenntnis', 'seelische Kraft' und 'intellektuelles<br />
Erfassen' oder gar 'Inspiration' sich nicht anhand lerntheoretischer Parameter<br />
definieren, abgrenzen oder operationalisieren lassen, ist es nicht möglich, didaktische<br />
Konzepte auf solche Lernziele hin zu entwickeln. Vielleicht ist dies<br />
mit ein Grund dafür, daß viele Werke der Klaviermethodik und viele Klavierschulen<br />
trotz ihres Anspruchs, zu einem Klavierspiel als 'seelisch-geistige' Tätigkeit<br />
hinzuführen, letztlich eben nur Anleitung zur Technik des Klavierspiels<br />
sind." (WIEDEMANN 1990, 12)<br />
Es scheint, als hätten rationale Versuche, das Phänomen des Musizierens zu fassen,<br />
erhebliche Schwierigkeiten mit der Komplexität des Sujets.<br />
125
4.2 Lernen durch Nachahmung<br />
Der symptomatischen Unsicherheit der Verfasser von pädagogischer oder wissenschaftlicher<br />
Literatur bezüglich musikalischer Lernvorgänge steht eine bemerkenswert<br />
einheitliche und stabile, aber auch verblüffend unkomplizierte Position entgegen,<br />
wenn sich bedeutende Musiker zu diesem Komplex äußern. Einige Beispiele<br />
hierfür sollen im folgenden gegeben werden.<br />
In den Kritischen Büchern der Davidsbündler äußert sich ROBERT SCHUMANN beispielsweise<br />
unter anderem über die Studien für das Pianoforte von J. N. Hummel.<br />
Dort schreibt er über die grundlegenden Fragen der Musikdidaktik: 29<br />
126<br />
"Methode, Schulmanier bringen wohl rascher vorwärts, aber einseitig, kleinlich.<br />
Ach! wie versündigt ihr euch, Lehrer! Mit eurem Logierwesen 30 zieht Ihr<br />
die Knospen gewaltsam aus der Scheide! Wie Falkeniere rupft ihr euren Schülern<br />
die Federn aus, damit sie nicht zu hoch fliegen [...] – Wegweiser solltet ihr<br />
sein, die ihr die Straße wohl anzeigen, aber nicht überall selbst mitlaufen<br />
sollt!" (SCHUMANN 1982, 10)<br />
RICHARD WAGNER betont in seiner Schrift Mitteilung an meine Freunde aus dem<br />
Jahr 1851, dass er sich glücklich schätze, in seiner Jugend nicht zu viel durch erzieherische<br />
Methoden beeinträchtigt worden zu sein. So konnte er "die Kunst selbst" zu<br />
seinem Erzieher machen. Wenn nur die Motivation und die Möglichkeit der Auseinandersetzung<br />
mit der Kunst vorhanden sei, könne seiner Meinung nach jeder zu einem<br />
Künstler, er verwendet den Begriff "Genie", werden.<br />
"Die eine verschmähte Gabe: 'der nie zufried'ne Geist, der stets auf Neues<br />
sinnt', bietet uns allen bei unserer Geburt die jugendliche Norn an, und durch<br />
sie allein könnten wir einst alle 'Genies' werden*; jetzt, in unserer erziehungssüchtigen<br />
Welt, führt nur noch der Zufall uns diese Gabe zu, – der Zufall, nicht<br />
erzogen zu werden. Vor der Abwehr eines Vaters, der an meiner Wiege starb,<br />
sicher, schlüpfte vielleicht die so oft verjagte Norn an meine Wiege, und verlieh<br />
mir ihre Gabe, die mich Zuchtlosen nie verließ, und, in voller Anarchie,<br />
das Leben, die Kunst, und mich selbst zu meinem einzigen Erzieher machte."<br />
(WAGNER 1983, 221f.)<br />
29 Einen Teil der Belege verdanke ich MARTIN GELLRICH (1992, 59f.).<br />
30 LOGIER hieß der Erfinder des "Chiroplasten", einer Vorrichtung, welche die Handhaltung beim<br />
Klavierspiel regelt.
Die durch Stern markierte, den Text begleitende Fußnote illustriert den Konflikt<br />
zwischen Kunstausübung und ihrer Pädagogik. Ein Vertreter der Zunft der Musikerzieher<br />
musste diese Bemerkung als "Zumutung" für seinen Stand zurückweisen:<br />
"* Über diese Behauptung ärgerte sich, seinerzeit, der Kölnische Professor<br />
Bischoff; er hielt sie für eine ungebührliche Zumutung an sich und seine<br />
Freunde." (WAGNER 1983, 221)<br />
Auch ARNOLD SCHÖNBERG, der sich intensiv als Musikpädagoge betätigte, macht<br />
sich Gedanken über das Verhältnis von Kunst und Pädagogik. Was WAGNER "Norn"<br />
genannt hat, nennt SCHÖNBERG "Neigung". Und was WAGNER das Lernen an der<br />
Kunst selbst genannt hat, nennt SCHÖNBERG "Nachahmung". Er kritisiert dabei die<br />
verbreitete Vorgehensweise der Pädagogik, Lehrziele zu definieren und Methodiken<br />
aufzustellen, die doch in Wirklichkeit das eigentliche Ziel, die Erziehung zur Kunst,<br />
verfehlten. Er führt die Verbreitung des Dilettantismus unmittelbar auf diese Vorgehensweise<br />
zurück. Seiner Überzeugung nach gibt es in der Kunst nur eine adäquate<br />
Lernweise, und zwar die der Nachahmung von Vorbildern:<br />
"Gab es früher Dilettanten, die sich vom Künstler nicht im Können unterschieden,<br />
sondern nur dadurch, daß sie nicht Broterwerb durch Kunsttätigkeit bezweckten,<br />
so gibt es heute allzu viel Künstler, die sich vom Dilettanten nicht<br />
im Können, wohl aber dadurch unterscheiden, daß sie ausschließlich auf Broterwerb<br />
ausgehen, der fähige Dilettant aber ist verhältnismäßig selten geworden.<br />
Eine Hauptursache dieser Erscheinung ist die Pädagogik. Sie verlangt von beiden,<br />
vom Künstler wie vom Dilettanten zu viel und zu wenig: das Lehrziel. [...]<br />
In der Kunst gibt es nur einen wahrhaften Lehrmeister: die Neigung. Und der<br />
hat nur einen brauchbaren Gehilfen: die Nachahmung." (SCHÖNBERG 1964,<br />
42f.)<br />
Die besondere Bedeutung des Vorbilds im Unterricht bei JOHANN SEBASTIAN BACH<br />
hebt MONIKA HEINRICH hervor:<br />
"Ein wesentlicher Grundsatz, auf welchem Bachs Unterricht aufgebaut war,<br />
lautete: Lernen am Vorbild. Bach vertrat die Ansicht, daß durch Nachahmung<br />
von Qualitätvollem der Geschmack auf beste Weise gebildet werden könnte –<br />
ein Prinzip, nach dem er selbst gelernt hatte." (HEINRICH 1996, 6)<br />
Aus der Sicht der genannten Künstler lässt sich insgesamt eine Parteinahme zu Gunsten<br />
des Lernens durch Nachahmung von Vorbildern feststellen. Aufnahme und<br />
127
Verarbeitung von Klangeindrücken spielen dabei die entscheidende Rolle. Die<br />
Instrumentalpädagogik scheint diese Methode momentan neu zu entdecken. Auf<br />
dem 4. Symposium des Instituts für Begabungsforschung und Begabtenfördering in<br />
der Musik thematisierte jedenfalls ULRICH MAHLERT diesen Bereich,<br />
128<br />
"[...] indem er auf das Lernen durch Nachahmen einging. Dieses Nachahmen,<br />
das in der Pädagogik oft geringschätzig als 'Papageienmethode' abqualifiziert<br />
wird, sei so selbstverständlich, dass es anscheinend nicht reflektiert werden<br />
müsse. Dabei seien wichtige Fragen rund um das Nachahmungslernen für den<br />
Unterricht besonders relevant. Die Frage, inwieweit man SchülerInnen durch<br />
ein Vorspielen in ihrer interpretatorischen Freiheit determiniert, ist nur eine<br />
von denen, die in diesem Themenkomplex virulent sind." (KOCH 1998, 31)<br />
Unabdingbare Voraussetzung für die Nachahmung ist allerdings das Vorhandensein<br />
geeigneter Vorbilder. Bei der Betrachtung von Werdegängen von Musikern stößt<br />
man regelmäßig auf Phänomene des Lernens durch Nachahmung, die von außen<br />
betrachtet als nahezu autodidaktisch erscheinen. Dieses vollzieht sich im Idealfall in<br />
Form direkter auditiver Verarbeitung nicht zu komplexer und häufig wiederholter<br />
klanglicher Strukturen, die auf die Notation entweder verzichtet oder sie nur als sekundäres<br />
Hilfsmittel nutzt. Für den russischen Pianisten JEWGENIJ KISSIN z.B. war<br />
die ältere Schwester Vorbild für seine Beschäftigung mit dem Klavier in frühester<br />
Kindheit:<br />
"Als die ältere Schwester bei Frau Mama mit regelmäßigem Unterricht begann,<br />
spielte der Bruder ihr alles nach. Noten kannte er nicht." (Der Spiegel 29/1994,<br />
144)<br />
Ähnliche Umgebungsbedingungen lagen im Elternhaus der israelischen Pianistin<br />
EDITH KRAUS vor:<br />
"Meine um sieben Jahre ältere Schwester hatte Klavierunterricht und ich<br />
spielte immer alle ihre Stücke aus dem Gehör nach." (HAUFE 1999, 31)<br />
Auch der Keyboarder DAVE GREENSLADE, Mitglied der Popgruppe Colosseum, erinnert<br />
sich an seine ersten Gehversuche am Klavier:<br />
"Ich hatte keine Notenbücher, ich suchte mir einfach bestimmte Akkorde auf<br />
den Tasten und spielte aus dem Kopf. Mein Vater zeigte mir kleine Melodien,<br />
und ich versuchte sie nachzuspielen." (Keyboards 3/1995, 40)
Eine entscheidende Schwierigkeit bei dieser Art zu lernen, die Flüchtigkeit der zu<br />
imitierenden Klänge, stellt allerdings hohe Anforderungen an die musikalische Auffassungsgabe<br />
des Lernenden und sein Gedächtnis für musikalische Gestalten. Als<br />
vorteilhaft gegenüber dieser Flüchtigkeit der Musik wirkte sich in der Vergangenheit<br />
häufig eine zufällige Konstellation aus, wie sie nicht nur bei JEWGENIJ KISSIN und<br />
EDITH KRAUS, sondern auch vielen anderen Fällen vorlag: Sie begünstigte die Möglichkeit<br />
der Nachahmung bereits in frühester Kindheit, wenn eine ältere Schwester<br />
oder ein älterer Bruder das Klavierspiel erlernte und bestimmte Passagen ausreichender<br />
Einfachheit so oft wiederholte, dass dies die aktive Aufnahme und Nachahmung<br />
durch den Jüngeren ermöglichte. JOHANN GROLLE erwähnt in einem Spiegel-Artikel<br />
die Geschichte eines amerikanischen Sklavenjungen Mitte des 19. Jahrhunderts,<br />
der zur Überraschung seines Herrn die von den Töchtern des Hauses geübten<br />
Werke ebenfalls gelernt hatte. Der Hausherr hörte abends in seinem Salon<br />
Musik und entdeckte den Sklaven am Klavier:<br />
"In der Dunkelheit saß dort der vierjährige Tom über das Piano gebeugt. Fast<br />
fehlerfrei spielte er, was er während der Klavierstunden der Töchter seines<br />
Herrn gehört hatte." (GROLLE 1997, 142)<br />
Der ältere Bruder war ebenfalls Vorbild für den französischen Pianisten ALAIN<br />
PLANÈS, der im Alter von vier Jahren selbstständig mit dem Klavierspiel begann:<br />
"Nach den Unterrichtsstunden ging ich regelmäßig zum Klavier und spielte das<br />
nach, was ich beim Unterricht meines Bruders gehört hatte." (DÜRER 2001, 19)<br />
Auch im Falle WOLFGANG AMADEUS MOZARTS trug die ältere Klavier spielende<br />
Schwester möglicherweise die entscheidenden klanglichen Anregungen bei, die der<br />
junge Wolfgang noch vor Beginn der Ausbildung durch seinen Vater für seine auditive<br />
Sensibilisierung nutzen konnte, so dass er bereits von klein auf in der Lage war,<br />
musikalische Gestalten zu erkennen und selbst anzuwenden. Diese intensive Gehörbildung<br />
gipfelte schließlich in der weithin als genial betrachteten Leistung, als<br />
MOZART im Alter von 14 Jahren das Miserere von GREGORIO ALLEGRI nach<br />
zweimaligem Hören notierte:<br />
"Als Kind von 6 Jahren war Mozart fähig, alle Töne und Akkorde nach dem<br />
Gehör niederzuschreiben; bekannt ist seine erstaunliche Leistung als 14jähriger<br />
Knabe, als er in Rom das Miserere von Allegri nach 2maligem Hören aus dem<br />
Gedächtnis niederschrieb." (BENDA 1898, 335)<br />
129
Es ist müßig, zu fragen, ob MOZART diese Leistung auch hätte vollbringen können,<br />
wenn er nur eine einzige Gelegenheit gehabt hätte, das Stück zu hören. Unstrittig ist<br />
aber, dass die Möglichkeit der Wiederholung eine Erleichterung für das Erkennen<br />
und Behalten musikalischer Gestalten darstellt, nicht nur für Ausnahmeerscheinungen<br />
wie MOZART, sondern generell.<br />
Die maßgebliche Vorbildfunktion älterer musizierender Geschwister kann nicht<br />
endgültig bewiesen werden. Es deutet aber Vieles darauf hin, dass die von ihnen<br />
dargebotenen und ständig wiederholten klanglichen Strukturen entscheidend waren<br />
für das Lernen der Jüngeren.<br />
Eine ähnliche Funktion können inzwischen Medien erfüllen. Da diese im Gegensatz<br />
zu lebenden Vorbildern wesentlich einfacher manipulierbar sind, spielen sie eine<br />
immer bedeutendere Rolle bei musikalischen Lernvorgängen.<br />
4.3 Nachahmung mittels Tonträger<br />
Weitgehend unbemerkt von der etablierten Musikpädagogik und außerhalb des klassischen<br />
Instrumentalunterrichts hat sich im zwanzigsten Jahrhundert eine eigene<br />
Lernkultur anhand von Tonträgern entwickelt, die sich die beliebige Wiederholbarkeit<br />
der Darbietung mittels Schallplatten bzw. Tonbändern zu Nutze macht, um die<br />
naturgegebene Flüchtigkeit der Musik zu überwinden. Eine solche mediale Vermittlung<br />
ist für Lernen und Ausübung bestimmter Musikstile bereits prägend geworden.<br />
Der Jazz-Pianist WOLFGANG DAUNER berichtet z.B. über sich und seine<br />
Musiker-Kollegen, wie die Schallplatte für sie zum entscheidenden Lern-Medium<br />
wurde:<br />
130<br />
"Die meisten von uns waren Autodidakten. Das heißt, ich habe zwar ganz klassisch<br />
Klavier gelernt, aber von Jazz hat mir niemand was gesagt, ich habe mir<br />
alles aus den Platten rausgeschrieben!" (Keyboards 1/1995, 26)<br />
Auch CHICK COREA bezeichnet im folgenden Ausschnitt aus einem Interview diejenigen<br />
Musiker als seine Lehrer, deren Schallplatten er hörte:<br />
"Später [...] waren in erster Linie Musiker meine Lehrer, denen ich auf Schallplatte<br />
zuhörte. Man sollte diese Phase in der musikalischen Entwicklung nicht<br />
unterschätzen. Aufnahmen kann man immer und immer wieder anhören und<br />
dabei analysieren." (Keyboards 7/1986, 23)
Auch der Pianist und Dirigent ANDRÉ PREVIN betätigte sich im Jazz. Seine Methode,<br />
diesen Stil zu lernen, war ebenfalls vom Medium Schallplatte bestimmt, wie<br />
aus dem Kommentar zu seiner CD André Previn's Trio Jazz: King Size hervorgeht.<br />
Sein pianistisches Vorbild war ART TATUM. Das Medium ermöglichte PREVIN, ohne<br />
persönlichen Kontakt zu diesem von TATUM zu lernen:<br />
"Hearing Art Tatum's record Sweet Lorraine on the radio intrigued him, not so<br />
much from a jazz viewpoint, but in wonder that 'someone could use that much<br />
imagination and technique whithin a thirty-two bar framework.' Previn bought<br />
Tatum records, transcribed some on paper ('it's like copying out a Mahler<br />
score') and for some time – he was about fourteen – his ambition was 'to play<br />
even longer runs than Tatum'." (HENTOFF 1959)<br />
Der Jazz-Pianist MICHEL PETRUCCIANI hat seinen eigenen Stil ebenfalls auf der<br />
Grundlage von Nachahmung und Transkription entwickelt:<br />
"Jazz ist sehr autodidaktisch. Man muß die Menschen kopieren, die man verehrt.<br />
Ich habe alle Oscar-Peterson-Soli kopiert und von der Platte notiert. Alle,<br />
die ich liebe, Bill Evans, Errol Garner, Art Tatum... ich habe sie alle studiert<br />
und dann langsam meine eigene Stimme gefunden."<br />
(Rheinische Post, 2.2.1998)<br />
Der Kino-Organist HORST SCHIMMELPFENNIG, der in den zwanziger Jahren das<br />
Glück hatte, durch seinen Bruder, Musiker auf einem Ozeandampfer, Zugang zu<br />
Schallplatten aus den USA zu bekommen, schildert seinen Zugang zur Musik geradezu<br />
als Lehrstück auditiven Lernens:<br />
"Der Klang dieser Orgel hat mich fasziniert, infiziert, möchte ich sagen. Ich<br />
habe mir diese alten Schellackplatten so oft alleine am Klavier vorgespielt,<br />
mitgespielt, zusammen gespielt, in der gleichen Tonart, so daß ich die Melodie<br />
und Harmoniebegleitung erfaßte und bis zum heutigen Tag nicht vergessen<br />
konnte. Ich habe gar nicht gewußt, daß es für mich als Junge damals ein unerhörtes<br />
Musikdiktat war; das Gehör wurde geschult, das Erinnerungsvermögen<br />
und der Sinn für Klang. So kam ich zur Musik." (SCHMIDT 1987, 345)<br />
Notentext erfüllt in diesen Fällen nur die Funktion eines Hilfsmittels und damit Sekundärmediums,<br />
mit dem die primäre klangliche Anregung, die zur selbstständigen<br />
Anfertigung der Partitur führte, untrennbar verbunden ist. Ähnlich wie vor Etablierung<br />
der Klassik im 19. Jahrhundert (vgl. S. 44) erfüllt er hier weniger die Rolle einer<br />
absoluten Referenz, sondern dient mehr als Gedächtnisstütze zum Zweck der<br />
131
Reaktivierung ursprünglicher klanglicher Vorstellungen (vgl. SCHLÄBITZ 1997b,<br />
19).<br />
Lernprozesse mittels auditiver Medien sind für jüngere Musikstile, insbesondere des<br />
populären Bereichs, typisch. Gegenüber klassischem Instrumentalunterricht besteht<br />
hier ein grundlegend anderer Medienansatz. Die Akzeptanz moderner Kommunikationsmedien<br />
durch die Musiker dieser Stile ist sehr hoch, und ihre Anwendung erfolgt<br />
im Gegensatz zur klassischen Musikerziehung mit großer Selbstverständlichkeit.<br />
Wie aus der folgenden, von JOSEF ZAWINUL berichteten Anekdote hervorgeht,<br />
wurde die Möglichkeit der Tonaufzeichung von Jazz-Musikern sehr früh aufgegriffen.<br />
So war bereits im Jahr 1963 für den Jazz-Saxophonisten BEN WEBSTER das<br />
Tonbandgerät entscheidende Übungshilfe. ZAWINUL stellte WEBSTER damals während<br />
seiner Abwesenheit seine New-Yorker Wohnung zur Verfügung – für ihn keine<br />
ganz uneigennützige Tat, denn so bekam er als junger Europäer die Gelegenheit, im<br />
persönlichen Kontakt mit seinen Vorbildern zu spielen und mit ihnen interagierend<br />
zu lernen:<br />
132<br />
"Und wie ich zurückgekommen bin, hat der dort mit seinem Tape-Recorder<br />
gehaust – aber sehr ordentlich! – und hat da geübt. Und der Coleman Hawkins<br />
ist immer vorbeigekommen, und sie haben gespielt. So hab' ich ihn dort wohnen<br />
lassen, denn es war ja groß genug, und hab' vier Monate mit diesen zwei<br />
Alten gespielt und gelernt und gelernt." (Keyboards 7/1996, 38)<br />
Die Möglichkeit einer auf klanglicher Nachahmung beruhenden Lernkultur existiert<br />
damit bereits nicht mehr nur auf der Grundlage des lebendigen Kontakts mit einem<br />
leibhaftigen Lehrer als Vorbild, wie es von Musikern gefordert wurde (vgl. S. 126<br />
ff.), sondern auch über mediale Vermittlung klingender Informationen und gewinnt<br />
dadurch, nachdem sie in über hundert Jahren schriftlicher Musikerziehung in den<br />
Hintergrund geraten war, erneut an Bedeutung. Der amerikanische Jazz-Pädagoge<br />
JAMEY AEBERSOLD bezeichnet in seinem Lehrwerk Ein neuer Weg zur Jazz-Improvisation<br />
die Imitation mittels Tonträger als Standard-Lernmethode der meisten<br />
Jazzmusiker:<br />
"Ich empfehle, auch mit normalen Jazzaufnahmen mitzuspielen. [...] Das ist<br />
ausgezeichnetes Hörtraining. Die meisten Jazzmusiker der letzten Jahrzehnte<br />
haben auf diese Art zu spielen gelernt." (AEBERSOLD 1996, 35)<br />
Die Beherrschung der Notenschrift ist damit nicht mehr zwingend Grundvoraussetzung<br />
zum Musizieren. Der Bedeutungsverlust der Notation mündet sogar schon vielfach<br />
in einen vollständigen Verzicht. Zu den bedeutenden Musikern, die in der Zeit
der aufkommenden elektroakustischen Medien völlig ohne Notenkenntnisse<br />
Weltruhm erlangt haben, gehören z.B. der Jazz-Pianist ART TATUM, der Komponist<br />
IRVING BERLIN, JOHN LENNON, PAUL MCCARTNEY und LUCIANO PAVAROTTI.<br />
Immer häufiger finden sich auch unter klassischen Musikern Beispiele für Lernprozesse<br />
mittels auditiver Medien. Eine bemerkenswerte Lernbiographie schildert diesbezüglich<br />
der Londoner Klavierpädagoge PETER FEUCHTWANGER aus seiner Jugend<br />
im amerikanischen Exil:<br />
"Da ich als Kind wegen meiner unbefriedigenden Leistungen in der Schule<br />
keinen Klavierunterricht haben durfte und wir nach der Emigration auch kein<br />
Klavier zuhause hatten, schwänzte ich oft die Schule, ging statt dessen zu einer<br />
Nachbarin (einer alten Dame aus München) und spielte all das auf dem Klavier,<br />
was ich auf meinen und ihren Schallplatten gehört hatte. So spielte ich<br />
sämtliche Chopin-Etüden (nach Aufnahmen von Cortot und Backhaus), fast<br />
alle Beethoven-Sonaten nach Platten von Schnabel und viele andere Klavierstücke<br />
nach. Da unser Plattenspieler und auch der der alten Nachbarin zu<br />
schnell lief und ich ein absolutes Gehör hatte, spielte ich alle diese Werke einen<br />
Halbton zu hoch. Als ich die Werke darauf in Konzerten in der richtigen<br />
Tonart hörte, transponierte ich sie sofort einen halben Ton tiefer ohne jegliche<br />
Schwierigkeiten. Dadurch lernte ich auch die natürlichste Art zu transponieren,<br />
worauf ich auch bei meinen Schülern großen Wert lege. Ich muß noch hinzufügen,<br />
daß ich keine Noten lesen konnte." (FEUCHTWANGER 1996, 18)<br />
Auch die Pianistin IDIL BIRET war mittels Schallplatten in der Lage, ein Klavierkonzert<br />
von JOHANNES BRAHMS zu spielen, obwohl ihr der Zugriff auf Noten von Lehrer<br />
und Eltern verweigert wurde.<br />
"Ich habe das zweite Klavierkonzert mit Toscanini und Horowitz auf Schallplatte<br />
gehört. Meine Eltern hatten das für mich gekauft. Und ich spielte das<br />
ganze Konzert auswendig von der Schallplatte. Ich machte mir sogar meinen<br />
eigenen Klavierauszug." (BUSLAU 1997, 9f.)<br />
Solche Lernvorgänge mittels Tonaufzeichnungsmedien sind bislang Ausnahmen und<br />
vollziehen sich meist außerhalb des Unterrichts oder gar im Konflikt mit dem Lehrer.<br />
Für die polnische Pianistin EWA KUPIEC stand sogar der Verbleib an der Musikschule<br />
in Frage. Sie berichtet über ihre Zeit am Lyzeum in Katowice:<br />
"Diese Jahre, zwischen 12 und 15, waren wahrscheinlich die intensivsten überhaupt.<br />
Denn ich konnte keine Noten schreiben, konnte ja aber perfekt nach<br />
dem Gehör spielen. Als ich dann 15 war, hatte man sich entschieden, daß ich<br />
weiter auf dieser Schule bleiben kann." (DÜRER 1998, 10)<br />
133
Die hier geschilderten Lernwege erinnern an den kindlichen Spracherwerb und verkörpern<br />
theoretisch in idealer Weise das Vorbild des MARTIENSSENSCHEN "Wunderkindkomplexes"<br />
(vgl. S. 94). Sie müßten demgemäß eigentlich als beispielhaft<br />
für Musiklernen angesehen werden. Allerdings führen in der Praxis bereits zaghafte<br />
Versuche, die tradierte Monokultur schriftlicher Vermittlung vorsichtig durch Tonträger<br />
auch nur zu ergänzen, in Fachkreisen der Instrumentalpädagogik zu erheblichen<br />
Irritationen. So sieht sich beispielsweise der Klavierpädagoge und Journalist<br />
STEFAN DETTLINGER einer "verkehrten Welt" gegenüber. Die Tatsache, dass nun<br />
erstmals klangliche Vorbilder in multimedialer Kombination (Klaviernotenausgaben<br />
mit CD, Peters Young Classics Edition) präsent sind, wird von ihm als Gefahr in<br />
mehrfacher Hinsicht gesehen:<br />
134<br />
"Denn schließlich, verkehrte Welt hin oder her, gewinnt bei den Jugendlichen<br />
auch vor allem das Achtung und Wichtigkeit, was auf CD gepreßt wurde und<br />
dadurch bequem abrufbar ist. Der Reiz liegt dann aber in der Befriedigung einer<br />
Art Nachahmungstrieb, in einer frugalen Imitation. Daß damit ein latenter<br />
Verlust an Interpretationsfreiheit einhergehen könnte, ein kreatives Suchen<br />
durch geistloses, mechanisches Funktionieren ersetzt, steht auf einem anderen<br />
Blatt geschrieben. Denn gerade junge Menschen bekommen sehr schnell eine<br />
feste Vorstellung von den Dingen und sind der Gefahr einer Geschmacksnormierung<br />
ausgeliefert. So könnten sich in den Köpfen rasant starre Interpretationsmuster<br />
festsetzen, die vom Klavierlehrer dann in schweißtreibender Arbeit<br />
wieder hinauskatapultiert werden müßten.<br />
Zweifellos manipuliert die beigelegte CD aber auch das Vorspielverhalten des<br />
Klavierlehrers im Unterricht. Für ihn könnte sich, angenommen derartige Editionen<br />
gewännen Hegemonie über die einfachen Notenheftchen, einiges ändern.<br />
Er könnte sich etwa beim Vorspiel in der Stunde, um dem Vergleich mit<br />
der makellosen Peters-CD standhalten zu können, plötzlich einem Perfektionszwang<br />
ausgeliefert fühlen, der ihn zum Üben vor der Stunde zwingt."<br />
(DETTLINGER 1998, 60)<br />
Es sei unbestritten, dass in fortgeschrittenem Ausbildungsstadium zum Interpreten<br />
die Auseinandersetzung mit schriftlichen Quellen entscheidend ist. Auch ist die CD<br />
sicherlich kein ideales Lernmedium. Eine generelle Ablehnung auch unterstützender<br />
Funktionen auditiver Medien beim Musiklernen könnte aber entscheidende Chancen<br />
verschenken. Erstens widerspricht eine solche Ablehnung den Äußerungen aller in<br />
Abschnitt 4.2 zitierten Musiker zum Primat des klingenden Vorbilds, zweitens liegen<br />
inzwischen genügend unterschiedliche Interpretationen von Werken auf Tonträgern<br />
vor, so dass der Lehrer wie bei der Wahl von Notenausgaben für den Schüler
auch hier eine Vorauswahl geeigneter Interpretationen treffen könnte, drittens stellt<br />
das allenthalben geforderte Vorspiel durch den Lehrer eine ebensolche Vorbeeinflussung<br />
des Schülers dar, viertens ist es für viele Schüler eine Überforderung, sich<br />
ohne klingendes Vorbild eine eigene Vorstellung aus dem Text zu bilden und fünftens<br />
sollte sich jeder Klavierschüler glücklich schätzen, sollte er auch nur annähernd<br />
in der Lage sein, eine ihn ansprechende, auf Tonträger vorliegende Interpretation<br />
nachzuahmen. Möglicherweise entscheidende und entlarvende Beweggründe für<br />
vielfache Skepsis dem Medium gegenüber offenbaren sich dem Leser schließlich im<br />
letzten Absatz des Zitats von DETTLINGER: Dem Schüler, der dem ungeübtem Vortrag<br />
durch den Lehrer bisher keine wesentlich differenzierteren Klangerfahrungen<br />
entgegenzusetzen hatte, soll kein Anlass gegeben werden, an dessen Vorbild zu<br />
zweifeln. So verkehrt sich das Argument, den Schüler vor schlechten Vorbildern<br />
bewahren zu müssen, ins Gegenteil: Die Ablehnung des neuen Mediums stellt einen<br />
Versuch zur Abwehr von Konkurrenz dar. Viele Instrumentalpädagogen befürchten<br />
(möglicherweise zu Recht) durch Medieneinfluss klingender Information eine Gefahr<br />
für den eigenen Unterrichtsstil und damit einen ähnlichen Macht- und Autoritätsverlust<br />
des vorgeblich eingeweihten (vgl. S. 46), in Wirklichkeit aber in seinen<br />
Möglichkeiten beschränkten Lehrers, der auch im Zuge der Verbreitung von<br />
Büchern bereits vor Jahrhunderten das Ende der Ausnahmestellung des Schriftkundigen<br />
besiegelte. NORBERT SCHLÄBITZ schreibt dazu in seinem Buch Der<br />
diskrete Charme der Neuen Medien:<br />
"Es hat immer wieder Bestrebungen gegeben, nur bestimmte Effekte zuzulassen<br />
und zu nutzen, andere aber explizit auszugrenzen. Blieb mit der Schrift<br />
Wissen noch weitgehend ein Arkanum, da dessen Verwaltung einigen wenigen<br />
oblag, welche zugleich auch darüber bestimmten, was an neuem Gedankengut<br />
für schriftwürdig befunden wurde, so wurde mit dem Buchdruck Wissen vervielfältigbar<br />
und für jeden zugänglich. Damit einher ging aber Machtverlust,<br />
denn mit der Anzahl der Lesenden stieg die Anzahl der Interpretationen, welche<br />
zudem in gedruckter Form ihre eigenen Kreise ziehen konnten. Auf eine<br />
kanonisierte Denkrichtung wie zur Zeit der Manuskriptkultur zu zwingen, als<br />
Schriftgelehrte (meist aus kirchlichen Kreisen) das Geschriebene vortrugen<br />
und zugleich die 'richtige' Lesart an die Hand gaben, war fortan schwierig."<br />
(SCHLÄBITZ 1995, 75)<br />
Ähnlich schwierig wird es künftig sein, Schüler vor unterschiedlichsten medial vermittelten<br />
auditiven Eindrücken zu "schützen".<br />
Bereits zu Zeiten C. PH. E. BACHS vollzog sich ein ähnliches Rückzugsgefecht mit<br />
dem Versuch der Ausgrenzung fremder Kompositionen aus dem Unterricht. Damals<br />
wurde als Vorwand, vom Schüler fremde Kompositionen fernzuhalten, unter ande-<br />
135
em das Argument genannt, diese seien zu alt oder zu schwer (siehe S. 19). Ähnlich<br />
scheint heute das gelegentlich geäußerte Argument, auditives Lernen sei zu schwierig,<br />
häufig eine Übertragung der eigenen Beschränkung visuell erzogener Lehrer auf<br />
ihre Schüler darzustellen. Die Äußerung DETTLINGERS beweist aus dieser Sicht<br />
nichts anderes als die Unvereinbarkeit von auditivem Zugang und Dilettantismus,<br />
wiewohl sich auch der Dilettantismus im 19. Jahrhundert in enger Kopplung an die<br />
Entwicklung der Schriftlichkeit verbreitet hatte (vgl. Abschnitt 2.2.2).<br />
Insbesondere die zunehmende Flexibilisierung in der Handhabung auditiver Medien<br />
wird aber Lernvorgänge über das Ohr weiter erleichtern und auditives Lernen anhand<br />
musikalischen Materials beliebig wählbarer Komplexität ermöglichen, so dass<br />
derartige Lernvorgänge auf dem individuellen Niveau eines jeden Schülers möglich<br />
werden. Versuche, solche Medieneinflüsse dauerhaft aus dem Musikunterricht fernzuhalten,<br />
werden misslingen. NORBERT SCHLÄBITZ vergleicht mit der bereits vollzogenen<br />
Medienrevolution des Buchdrucks:<br />
136<br />
"Dabei sind, wie die Geschichte des Buchdrucks beispielhaft zeigt, Versuche<br />
der medialen Botschaft entgegenzuarbeiten von Seiten Interessierter schlicht<br />
zum Scheitern verurteilt." (SCHLÄBITZ 1997a, 23)<br />
Schallplatten und Tonbänder waren nur in begrenztem Umfang in der Lage, musikalische<br />
Lernvorgänge, insbesondere komplexerer Arten von Musik, zu unterstützen.<br />
Für das auditive Lernen stellen alle Medien der gegenwärtig zu Ende gehenden<br />
"Frühzeit" der Elektroakustik (z.B. Schallplatten und Tonbänder) aufgrund beliebiger<br />
Wiederholbarkeit zwar eine wesentliche Erleichterung dar, indem sie die ursprüngliche<br />
Flüchtigkeit der Musik aufheben. Nachahmendes Lernen mit Hilfe dieser<br />
Medien wird jedoch erschwert durch umständliche Handhabung. Ein solches<br />
Medium, ausschließlich zur Wiedergabe ganzer Werke konzipiert, bietet kaum didaktisch<br />
verwertbare Eigenschaften. Sollten sich beim Lernvorgang Schwierigkeiten<br />
ergeben, ist die Fokussierung eines kleinen Ausschnittes mittels exakter Wiederholung<br />
dieses Teils z.B. ebenso wenig möglich wie die Veränderung der Wiedergabegeschwindigkeit<br />
ohne gleichzeitige Veränderung der Tonhöhe. Deshalb eignen sich<br />
diese Medien nur bedingt für musikdidaktische Zwecke. Wie aus Kapitel 3 hervorging,<br />
entstehen aber neue Möglichkeiten, die diese Einschränkungen aufheben.<br />
Wenn die Medienentwicklung künftig Mittel zur Verfügung stellt, die es jedermann<br />
ermöglichen, auditiv entsprechend seinen Fähigkeiten zu lernen, könnte die Ausnahmestellung<br />
musikalischer Begabung in unserer Gesellschaft (s. u. S. 140f.) revidiert<br />
werden. Als entscheidend wird sich dabei die Qualität neuer Medien erweisen,<br />
Information beliebig zeitflexibel und multimedial zu strukturieren. Dies bedeutet,
dass die Informationsübermittlung auditiv-visuell für jeden Schüler individuell gestaltbar<br />
ist. Schwächen im Notenlesen sind damit ebenso zu bekämpfen wie die<br />
heute noch sehr verbreitete Unfähigkeit zur Transposition oder auditiven Nachahmung.<br />
Doch handelt es sich bei den beschrieben Lernprozessen von Musikern anhand auditiver<br />
Medien nicht vielleicht doch um Ausnahmen aufgrund außergewöhnlicher<br />
genetischer Voraussetzungen, also angeborener Begabung? Im nächsten Abschnitt<br />
soll die gegenteilige Ansicht untermauert werden, nämlich dass entscheidende Faktoren<br />
des Umgangs mit Musik durch die mediale Strukturierung der zu lernenden<br />
Informationen bestimmt sind und damit gesteuert werden können. Die Darbietung<br />
dieser Information gerät damit zur musikpädagogischen Kernfrage im Informationszeitalter.<br />
4.4 Das Problem der Strukturierung<br />
Notentexte in ihrer tradierten Form verleiten dazu, Einzelereignisse wahrzunehmen,<br />
anstatt diese Ereignisse miteinander in Beziehung zu setzen und erschweren auf<br />
diese Weise das Verständnis musikalischer Strukturen. Die Fortschritte nach Noten<br />
lernender Schüler beschränken sich weitgehend auf das lineare Entschlüsseln von<br />
Texten zunehmender Komplexität. Dieses Manko beklagt der Frankfurter Cellist<br />
und Professor GERHARD MANTEL in seinem Aufsatz Strategien des Unterrichts.<br />
Seine folgende Äußerung handelt von der Progression von Lehrwerken für Streicher;<br />
sie ist aber auf alle pädagogischen Notenausgaben, unabhängig vom Instrument,<br />
übertragbar; für Klavier gelten sie umso mehr, als hier die Komplexität der<br />
Texte im Allgemeinen einen deutlich höheren Grad aufweist als bei Streichern. Die<br />
Rede ist von gedruckten Lehrwerken für den Unterricht am Streichinstrument:<br />
"Sie bemühen sich zwar in den angebotenen Texten durchaus sinnvoll, vom<br />
Leichten zum Schwierigeren fortzuschreiten. Die Schwierigkeit bezieht sich<br />
aber ausschließlich auf die Komplexität von Texten, also nur auf einen einzigen<br />
der vielen beim Unterricht relevanten Parameter. Am Text wird gelernt,<br />
das 'Richtige' vom 'Falschen' zu unterscheiden, eine letzten Endes unkünstlerische<br />
Dichotomie;" (MANTEL 1994, 17)<br />
Der musikalische Notencode beruht auf kleinsten Einheiten, wobei die Fähigkeit zu<br />
deren Erfassung und Unterscheidung vielfach irrtümlich als entscheidende Grundlage<br />
musikalischer Bildung und als hinreichende Voraussetzung für die Fähigkeit<br />
137
zur Interpretation betrachtet wird. 31 Dieser Irrtum beruht auf der Missachtung der<br />
Tatsache, dass das schriftliche Medium die aus diesen kleinsten Einheiten gebildeten<br />
größeren musikalischen Strukturen dem Lernenden aufgrund seiner Linearität nicht<br />
zwangsläufig vermittelt, sondern tendenziell eher vorenthält. Der Musikpsychologe<br />
JOHN A. SLOBODA weist auf die sinngebende Bedeutung solcher größerer musikalischer<br />
Einheiten hin, die sich weit über den vordergründigen Notentext hinaus erstrecken.<br />
Er verwendet dafür den Begriff der semantischen Makrostruktur, der im<br />
weiteren Verlauf eine wichtige Rolle spielen wird:<br />
138<br />
"Eine lernpsychologisch sinnvolle Gestaltung von Notentextausgaben durch<br />
die einschlägigen Musikverlage fehlt bislang. [...] Neuere Untersuchungen zur<br />
Textverarbeitung [...], die auch auf den musikalischen Bereich anwendbar erscheinen,<br />
belegen anschaulich die Notwendigkeit angemessener Darstellungsstrukturen.<br />
Erst wenn Informationen zur semantischen Makrostruktur verdichtet<br />
werden, ist ein signifikanter Behaltenszuwachs gewährleistet." (SLOBODA<br />
1993, 554)<br />
Auch der Lübecker Pädagoge WILFRIED RIBKE verwendet in seinem Artikel zum<br />
Thema Üben im Handbuch der Musikpsychologie diesen Begriff der Makrostruktur,<br />
deren Erfassung er als entscheidend für sinnvolles Üben erachtet. Auch RIBKE sieht<br />
die mangelnde Vermittlung solcher Makrostrukturen beim Lernen nach Noten als<br />
entscheidendes Defizit:<br />
"Die Integration und Koordination von Noten- und Bewegungsbild (visuelle<br />
Ebene) mit der jeweiligen Klang- und Bewegungsvorstellung (auditiv-kinästhetische<br />
Ebene) sowie deren Repräsentation durch entsprechende Kategorien,<br />
Ausdrucksempfindungen und interpretatorische Konzepte zählen zu den<br />
Hauptaufgaben des Übens, die unterschiedliche Gedächtnisleistungen beanspruchen.<br />
Die weitverbreitete Angewohnheit, selbst einfache Tongruppen mit<br />
ständigem Blickkontakt zum Notentext zu üben, verhindert nicht nur die intensive<br />
Wahrnehmung, Vorstellung und Einspeicherung der genannten Repräsentationsebenen,<br />
sondern ist auch eine der Hauptursachen für fehlerhaftes<br />
Spiel. Auswendiges Üben zumindest in Teilbereichen ist deshalb eine grundle-<br />
31 Um das Problem dieser unkünstlerischen Dichotomie anschaulich zu machen, könnte man die<br />
von MANTEL beschriebene Musikerziehung nach Noten vergleichen mit einer Lehrmethode der<br />
Bildenden Kunst, in der bis zur höchsten Komplexität immer schwierigere Umrisse mit bestimmten,<br />
vorgegebenen Farben ausgemalt werden müssen. Solche Methoden finden sich beispielsweise<br />
in Malbüchern, die unter dem Begriff "Malen nach Zahlen" geführt werden. Ähnlich<br />
wie beim linearen Notenspiel vermitteln sich hier künstlerische Strukturen, wenn überhaupt, eher<br />
zufällig.
gende Voraussetzung für den Aufbau musikalischer Makrostrukturen, die erst<br />
zu einer angemessenen Klangvorstellung führen." (RIBKE 1993, 555)<br />
Entscheidende Probleme des verbreiteten Musikunterrichts können auf eine defizitäre<br />
Vermittlung solcher Makrostrukturen beim visuellen Lernen zurückgeführt<br />
werden. Dieses Phänomen stellt ein wesentliches Manko auch speziell des Klavierunterrichts<br />
spätestens seit seiner Institutionalisierung in Konservatorien und die<br />
Beschränkung der Ausbildung auf die Reproduktion in der zweiten Hälfte des 19.<br />
Jahrhunderts dar. Die bereits u. a. von HUGO RIEMANN (vgl. S. 61) und ARNOLD<br />
SCHÖNBERG (vgl. S. 127) beklagte Ausbreitung des Dilettantismus als vermeintliches<br />
Musikertum in der Tradition des fortgeschrittenen 19. Jahrhunderts steht in<br />
ursächlichem Zusammenhang mit der weitgehenden Beschränkung des Instrumentalunterrichts<br />
auf die Wiedergabe von Notentexten.<br />
Noch härter als HUGO RIEMANN und ARNOLD SCHÖNBERG ging im Jahr 1921 der<br />
Dirigent und Musikpädagoge HEINRICH JACOBY mit der defizitären Praxis des<br />
landläufigen Instrumentalunterrichts ins Gericht und artikulierte als einer der ersten<br />
einen ursächlichen Zusammenhang zwischen grundsätzlichen Problemen der Musikpädagogik<br />
und ihrer Methode der schriftlichen Vermittlung. In der folgenden<br />
Kritik am üblichen Klavierunterricht aus seinem Aufsatz Jenseits von Musikalisch<br />
und Unmusikalisch finden sich Begriffe wie "Dilettanten", "Musikerproletariat" und<br />
"Konservatorien" im folgenden Zusammenhang:<br />
"Der Musikunterricht, wie er heute meistens verläuft, ist geradezu ein Schulbeispiel<br />
dafür, wie Erziehung nicht sein soll. Wenn sich die Richtigkeit eines<br />
Weges daran erkennen läßt, daß er zum Ziel führt, so zeigen die unzulänglichen<br />
Leistungen der meisten Dilettanten, [...] vor allem aber das halbgebildete<br />
Musikerproletariat, dem unsere Konservatorien alljährlich neuen Zustrom<br />
bringen, deutlicher als alle theoretischen Überlegungen und Untersuchungen,<br />
daß der bisherige Weg nicht einmal für besonders 'Musikalische' der richtige<br />
sein kann.<br />
Am greifbarsten treten seine Mängel beim Instrumentalunterricht zutage und<br />
da wieder am deutlichsten bei dem unglücklicherweise am weitesten verbreiteten<br />
Klavierspiel: Mit seltenen rühmlichen Ausnahmen beginnt man den Unterricht<br />
mit der Benennung der Noten." (JACOBY 1995, 16)<br />
Aus einer deskriptiven Notation, die ursprünglich dazu geschaffen war, flüchtige<br />
musikalische Gedanken festzuhalten, sei nach JACOBY eine präskriptive Notation<br />
geworden, seien Noten geworden, die<br />
139
140<br />
"[...] die Musik diktieren – uns Grundlage und Vorbild für alles Musizieren liefern.<br />
[...] Vom ursprünglich spontanen musikalischen Ausdruck ist schließlich<br />
nichts übrig geblieben als die Gewohnheit, sobald man musizieren will, Musik<br />
nach diesen Noten zu 'machen', d. h. Noten, die irgendein anderer zusammengesetzt<br />
– komponiert – hat, meist noch ein anderer 'herausgegeben' und interpretiert<br />
hat, möglichst genau nach Vorschrift zum Klingen zu bringen."<br />
(JACOBY 1995, 41f.)<br />
JACOBY gibt der Tradition der Musikpädagogik die Hauptschuld an dieser Situation,<br />
denn einerseits machten die ausbildenden Instanzen sich und ihre Schüler zu Sklaven<br />
der Notentexte, andererseits gäben sie aber ihrer eigenen Tätigkeit den Anstrich<br />
von etwas Besonderem, eben Künstlerischem, und damit nicht für jedermann Zugänglichem,<br />
wodurch Kritik an ihrer Didaktik unmöglich würde. Dadurch bekäme<br />
die "Exegese" von Notentexten, welche die genannten Berufsgruppen als ihre<br />
Hauptaufgabe begriffen, so JACOBY, eine beinahe mystische Dimension, deren<br />
Sphären nur einer Minderheit, nämlich den besonders "Begabten" offenstünden. Er<br />
fährt fort:<br />
"Durch die Entwicklung und Verbreitung dieses Verfahrens bildet sich dann<br />
eine Kaste, die die Bewahrung und Überlieferung der Begriffe und der zu leeren<br />
Formeln gewordenen Symbole in die Hand nimmt, die weitere Komplizierung<br />
der Gehäuse berufsmäßig betreibt, den Notenhaufen hütet und vergrößert,<br />
– und die Handhabung der Instrumente lehrt, mit deren Hilfe man 'Noten zum<br />
Klingen bringen kann', und die alles tut, den Nimbus zu verbreiten und aufrecht<br />
zu erhalten, daß sie etwas 'Besonderes', etwas nur 'Auserwählten', 'Begabten'<br />
Zugängliches hege und pflege." (JACOBY 1995, 42)<br />
So radikal diese Einschätzung möglicherweise erscheinen mag, bietet sie doch eine<br />
Erklärung für ein Spezifikum unserer westlichen Musikkultur: die Einteilung in<br />
viele musikalisch "unbegabte" Durchschnittsmenschen und wenige besonders "Begabte".<br />
Diese Ausnahmestellung der Begabung behindert die musikalische Entfaltungsmöglichkeit<br />
des folglich als unmusikalisch erachteten Großteils der Gesellschaft,<br />
wie auch JOHN A. SLOBODA in einem Aufsatz aus dem Jahr 1993 betont. Er<br />
vergleicht darin die gegenwärtige Situation in der westlichen Welt mit anderen<br />
Kulturkreisen der Erde und hält es für<br />
"[...] wichtig aufzuzeigen, daß neben der westlich-europäischen Musikkultur<br />
eine Vielzahl traditioneller Musikkulturen existieren, in denen musikalische<br />
Leistungen in der Bevölkerung viel verbreiteter sind als bei uns. In diesen<br />
Kulturen ist Musik oft viel tiefer im ganzen Leben und in der Arbeit der Gesellschaft<br />
verwurzelt [...]. Auf lange Sicht mag es sich herausstellen, daß die
moderne westliche Gesellschaft als ungewöhnlich bezeichnet werden muß,<br />
weil sie die musikalische Entwicklung bei nahezu allen Menschen bis auf eine<br />
kleine Minderheit behindert." (SLOBODA 1993, 576)<br />
Betrachtet man Musik aber als anthropologisch begründetes Phänomen, so kann es<br />
nicht als Normalzustand akzeptiert werden, wenn musikalische Betätigung einer gesellschaftlichen<br />
Minderheit vorbehalten bleibt. Allerdings wäre es zu einfach, die<br />
Fachkreise der etablierten Musikpädagogik der mutwilligen Erzeugung von Unmusikalität<br />
wider besseres Wissen zu bezichtigen. Eine entscheidende Ursache für die<br />
vorliegende Problematik stellt vielmehr die beschriebene Rolle der Schriftlichkeit in<br />
der europäischen Musikkultur dar und liegt in den damit verbundenen Schwierigkeiten<br />
begründet, die Praxis des Musizierens mit der Speicherung musikalischer Information<br />
strukturell zu verbinden.<br />
Die Trennung zwischen einerseits praktischem Musizieren und andererseits der Codierung<br />
von Musik mit Hilfe schriftlicher Medien erzeugt Interferenzen, die zu<br />
überwinden nur eine Minderheit, eben die Gruppe der besonders "Begabten", in der<br />
Lage zu sein scheint. Der musikalische Notencode ist über Jahrhunderte entstanden,<br />
und sein Verständnis erfordert Einsichten in musikalische Strukturen, die in der Regel<br />
noch nicht vorhanden sein können, wenn mit Musikunterricht auf schriftlicher<br />
Grundlage begonnen wird; eine Erkenntnis, der FRIEDRICH WIECKS Alter Ego in<br />
Gestalt des Lehrers Das in seinem Unterricht folgendermaßen Rechnung trägt, was<br />
allerdings in einer Zeit vor Erfindung auditiver Medien zwangsläufig an sehr zeitintensiven<br />
persönlichen Kontakt mit dem Lehrer gekoppelt war (vgl. Kap. 2.1):<br />
"Ich habe also meine Schüler musikalisch und fast zu fertigen, guten Clavierspielern<br />
gebildet, ehe sie eine Note lernten;" (WIECK 1853, 6)<br />
Für den Schüler muss die historisch gewachsene schriftliche Codierung in Einzeltönen<br />
oft willkürlich und undurchsichtig erscheinen, worauf auch der Schweizer Mathematiker<br />
und Musiker GUERINO MAZZOLA in seinem Buch Geometrie der Töne<br />
hinweist, indem er die elitäre Trennung in wenige Musikalische und viele Unmusikalische<br />
wesentlich auf die aus Schülersicht arbiträre Struktur des schriftlichen Zeichencodes<br />
zurückführt:<br />
"Die überwiegend unmotivierte Zeichenstruktur des musikalischen Notencodes<br />
ist [...] ein Grund für die Elitebildung in unserer Musikkultur." (MAZZOLA<br />
1990, 9)<br />
141
Im Zuge der Trennung von Komposition und Interpretation und der damit verbundenen<br />
Verselbständigung des Musikwerks und seiner Verbreitung und Aufführung<br />
losgelöst vom Komponisten übernahmen Notentexte notwendig eine Funktion als<br />
Primärmedien, die ihnen ursprünglich nicht zu eigen war. Sie mussten intersubjektiv<br />
verstehbar sein und die Vorstellungen des Komponisten möglichst unmissverständlich<br />
vermitteln (vgl. KNOLLE & WEIDENFELD 1998, 52). Da eine Partitur aber immer<br />
nur einen kleinen Teil der zu überliefernden Gedanken des Autors enthalten kann 32,<br />
besteht beim Studium des Notentextes durch Rezipienten, deren musikalische Bildung<br />
sich auf einem anderen Niveau befindet oder in vom Komponisten abweichendem<br />
kulturellem Kontext erfolgte, generell die Gefahr der Fehlinterpretation. Nahe<br />
liegende und konsequente Gegenmaßnahme der Komponisten gegen diese Erscheinung<br />
war eine zunehmende Verfeinerung und Komplizierung der Notation – mit<br />
dem aus pädagogischer Sicht fragwürdigen Resultat weiter steigender visueller Vereinnahmung<br />
des Spielers.<br />
Eine zunehmende Verfeinerung von Notationsweisen muss also nicht zwangsläufig<br />
zum besseren Verständnis von Werken führen und kann nicht darüber hinweg täuschen,<br />
dass die Schrift im musikalischen Zusammenhang immer nur eine sekundäre<br />
Funktion unter der Voraussetzung einer primären Klangerfahrung erfüllen kann.<br />
Wesentliche der in Kapitel 2 geschilderten Schwierigkeiten und Missverständnisse<br />
der klassischen Musikerziehung können auf eine Überschätzung des Notentextes als<br />
Primärmedium im pädagogischen Kontext zurückgeführt werden.<br />
Dass es sich beim Phänomen der Spaltung in viele unmusikalische und wenige musikalische<br />
Menschen nicht um einen akzeptablen Zustand handeln kann, darauf<br />
deuten neben den interkulturellen Vergleichen von JOHN A. SLOBODA auch Beobachtungen<br />
innerhalb der westlichen Kultur hin. HEINRICH JACOBY beobachtete einen<br />
scheinbar paradoxen Zusammenhang: gerade unter den scheinbar "Unmusikalischen"<br />
glaubt er wider Erwarten einen besonders hohen Anteil von Menschen ausmachen<br />
zu können, die eine ausgeprägte emotionale Affinität zur Musik haben:<br />
32 In dem US-amerikanischen musikpädagogischen Werk Der Mozart in uns wird beispielsweise<br />
davon ausgegangen, dass der Notentext nur etwa ein Zehntel aller musikrelevanten Phänomene<br />
codieren kann:<br />
"Das bedruckte Notenblatt spiegelt nur einen kleinen Teil der Musik wider (vielleicht 10 %)."<br />
(GREEN / GALLWEY 1993, 61)<br />
Eine so exakte Bestimmung scheint zwar übertrieben, verdeutlicht aber die Problematik: Übersteigt<br />
die Komplexität eines Notentextes das musikalische Fassungsvermögen des "Interpreten",<br />
ist eine oberflächliche Wahrnehmung unter Auslassung großer Teile der eigentlichen musikalischen<br />
Zusammenhänge die zwangsläufige Folge. Die Aufmerksamkeit des Ausführenden verlagert<br />
sich hierbei weg vom eigentlich notwendigen transmediellen Aspekt, der in einer Art ganzheitlicher<br />
Wahrnehmung zunächst geistig das Klangerlebnis wiederaufleben lässt, bevor er es erklingen<br />
lässt, hin zum visuell-motorischen.<br />
142
"Merkwürdig und bezeichnend ist es [...], daß man unter diesen 'Unmusikalischen'<br />
auffallend viele Menschen trifft, die Musik leidenschaftlich lieben und<br />
so ein ausgesprochenes Gefühlsleben haben, daß man annehmen sollte, der<br />
musikalische Ausdruck entspräche ihrem Wesen am ehesten." (JACOBY 1995,<br />
14)<br />
Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Pervertierung der Kategorien "musikalisch"<br />
und "unmusikalisch" bei schriftlicher Musikvermittlung liefert die Erzählung Der<br />
Musikfeind aus der Kreisleriana von E. T. A. HOFFMANN. Er beschreibt dort aus der<br />
Sicht eines Kindes, wie dessen musikalische Neigungen durch die musikpädagogischen<br />
Bemühungen seiner visuell orientierten Umgebung zunichte gemacht werden.<br />
Höhepunkt dieser Vernichtung von Musikalität in Gestalt von Klavierunterricht ist<br />
der Vortrag eines Scherzos, das der Erzähler aufgrund seines auditiven Zugangs versehentlich<br />
nach F-dur transponiert anstatt im notierten E-dur vorgetragen hatte:<br />
"Ich setzte mich [...] an den Flügel und hämmerte meine Stückchen frisch darauf<br />
los, und mein Vater rief einmal über das andere: 'Das hätte ich nicht gedacht!'<br />
– Als das Scherzo zu Ende war, sagte der Kantor [sein Klavierlehrer,<br />
H.K.] ganz freundlich: 'Das war die schwere Tonart E-dur!' und mein Vater<br />
wandte sich zu einem Freunde, sprechend: 'Sehen Sie, wie fertig der Junge das<br />
schwere E-dur handhabt!' – 'Erlauben Sie, Verehrtester', erwiderte dieser, 'das<br />
war ja F-dur.' – 'Mitnichten, mitnichten!' sagte der Vater. 'Ei ja doch', versetzte<br />
der Freund: 'wir wollen es gleich sehen.' Beide traten an den Flügel. 'Sehen<br />
Sie', rief mein Vater triumphierend, indem er auf die vier Kreuze wies. 'Und<br />
doch hat der Kleine F-dur gespielt', sagte der Freund. – Ich sollte das Stück<br />
wiederholen. Ich tat es ganz unbefangen, indem es mir nicht einmal recht<br />
deutlich war, worüber sie so ernstlich stritten. Mein Vater sah in die Tasten;<br />
kaum hatte ich aber einige Töne gegriffen, als mir des Vaters Hand um die Ohren<br />
sauste. 'Vertrackter, dummer Junge!' schrie er im höchsten Zorn. Weinend<br />
und schreiend lief ich davon, und nun war es mit meinen musikalischen Unterricht<br />
auf immer aus." (HOFFMANN 1983, 99)<br />
Ein von schriftlichen Medien dominierter Musikunterricht tendiert also dazu, kreative<br />
und originär musikalische Kategorien, die sich vorwiegend dem Gehörsinn<br />
vermitteln, zu benachteiligen zu Gunsten normativer und restriktiver Lernformen.<br />
Daran konnte sich aufgrund der im Musikunterricht unveränderten Mediensituation<br />
trotz allgemeiner Fortschritte der Pädagogik seit E. T. A. HOFFMANN bis heute<br />
nichts Grundsätzliches ändern. Ein Beispiel aus der Gegenwart beschreibt der folgende<br />
Ausschnitt aus einem Interview mit einer etwa 20-jährigen Studentin aus dem<br />
Jahr 1996. Er liefert aufschlussreiche Einblicke in die Diskrepanz zwischen musika-<br />
143
lischen Bedürfnissen der Schülerin und dem ihr noch in jüngster Zeit zuteil gewordenen<br />
Klavierunterricht. Aus ihrer folgenden Äußerung geht deutlich der Widerspruch<br />
zwischen dem starken Bedürfnis, selbst zu musizieren, und der erlittenen<br />
Unterrichtsrealität hervor. Das Interview wurde zu allgemein musikalischen Themen<br />
geführt, das Klavierspiel wurde dabei zufällig angeschnitten, als die Bedeutung von<br />
Musik für das Leben der Studentin zur Sprache kam. Sie antwortete wie folgt:<br />
144<br />
"Ziemlich hohe Bedeutung, macht einen ziemlich großen Teil meines Lebens<br />
aus, würde ich sagen."<br />
Bei der Beantwortung der Zwischenfrage:<br />
"Machst du selber Musik?"<br />
kommt die Interviewpartnerin nach einigem Zögern auf den ihr zuteil gewordenen<br />
Klavierunterricht zu sprechen:<br />
"Nein, kann ich leider nicht, also Klavier nur, aber... [Ende des Satzes]"<br />
(Tonbandprotokoll)<br />
Der ihr zuteil gewordene Klavierunterricht konnte die Bedürfnisse der Interviewpartnerin<br />
nach musikalischer Betätigung offensichtlich nicht befriedigen. Bezeichnenderweise<br />
– und bei reiner Reproduktion, wie im traditionellen Unterricht<br />
üblich, genau genommen mit Recht – wird Klavierunterricht von ihr nicht einmal als<br />
Tätigkeit des "Musikmachens" eingestuft. Nach wie vor bestehende grundsätzliche<br />
Probleme dieser Art schildert auch ein Buch eigens zu dieser Thematik: "...mit Klavierspiel<br />
hab' ich dann aufgehört" (ECKSTAEDT 1996).<br />
Die schriftliche Musikvermittlung kann musikalische Bedürfnisse der Schüler offenbar<br />
nur zu einem Teil befriedigen. Ein Unterricht mit Schülern, die sich weniger<br />
restriktiven Lehrumfeldern unterzuordnen bereit sind und eigene Kreativität entfalten<br />
wollen (eigentlich Grundvoraussetzung jeder künstlerischen Betätigung!), ist<br />
unter solchen Voraussetzungen oft zum Scheitern verurteilt. HERBERT WIEDEMANN<br />
befragte ehemalige Klavierschüler nach den Gründen für vollzogenen Unterrichtsabbruch<br />
und fasst das Ergebnis in der lapidaren Formulierung zusammen:<br />
"In einer Befragung, die sich auf Klavierspieler/innen beschränkte, wurde aber<br />
auch vielfach beklagt, daß die Inhalte des Klavierunterrichts und die Art der<br />
Vermittlung zum Abbruch geführt hätten." (WIEDEMANN 1996, 13)
In einer Kunstauffassung, bei der unter der erdrückenden Last der zu meisternden<br />
Notenkonglomerate die Kreativität der eigenen künstlerischen Äußerung verloren<br />
geht, lebt eine Geisteshaltung fort, die in der Tradition weiblicher Tugenden des 19.<br />
Jahrhunderts auf fruchtbaren Boden fiel und bis heute erstaunliche Langlebigkeit<br />
bewiesen hat (vgl. Abschnitt 2.2.2). Diese Tradition gipfelt im noch immer vorhandenen<br />
Ruf des Klavierunterrichts als Inbegriff von Lustfeindlichkeit, gleichzeitig<br />
aber auch geeignetem Mittel tugendhafter Erziehung zu Disziplin und Ordnung. Wie<br />
bereits im Jahr 1900 in der Zeitschrift Der Klavier-Lehrer das Klavier als "Marterinstrument"<br />
(23. Jg., S. 341) tituliert wurde, wird es noch immer verbreitet mit<br />
"Schweiß und Tränen" (BECKER 1996, 56) assoziiert.<br />
Solche anti-emanzipatorischen Tendenzen werden auch heute noch genährt durch<br />
gedruckte Klavierschulen. Aufgrund ihrer linearen und visuellen Struktur sind diese<br />
nicht gut geeignet, musikalisch-kommunikative Lerninhalte zu vermitteln und fördern<br />
statt dessen dressurähnliche Lernformen. Dieses Verfahren beinhaltet auf mindestens<br />
zwei Ebenen die Gefahr, dass künstliche Distanzen zwischen dem eigentlich<br />
angestrebten Klangerlebnis und den geforderten Lerninhalten aufgebaut werden:<br />
Zum einen werden Progressionen meist nach motorischem, nicht aber nach musikstrukturellem<br />
Schwierigkeitsgrad strukturiert. Der erwünschte Grad motorischer<br />
oder visueller Komplexität des zu erlernenden Materials führt dadurch oft zu musikalisch<br />
sinnlosen Strukturen, die dem Schüler die logischen (und damit auch historischen)<br />
Voraussetzungen musikalischer Notation vorenthalten. Im Interesse einer<br />
Förderung der Fähigkeit, Versetzungszeichen zu lesen, gerät beispielsweise das folgende<br />
Stück aus dem ersten Band der Klavierschule Wir musizieren am Klavier von<br />
JOHN W. SCHAUM zu einem Musterbeispiel für eine musikstrukturell irritierende<br />
Notationswese, voller verminderter und übermäßiger Intervalle, die musikalisch<br />
sinnentstellend wirken. Nach wenigen Wochen Unterricht muss hier innerhalb von<br />
acht Takten drei Mal das tonale Bezugssystem gewechselt werden:<br />
145
Abb. 22: JOHN W. SCHAUM: Wir musizieren am Klavier, Bd. <strong>1.</strong><br />
Zum anderen werden die Bedürfnisse nach emotionalem Umgang und kreativer Betätigung<br />
mit musikalischem Material häufig nicht befriedigt, da die visuelle Vermittlung<br />
in Form linearen Notenspiels auf vorwiegend rational-reflektierender<br />
Ebene abläuft. HEINRICH JACOBY bemerkt dazu:<br />
146<br />
"Beim üblichen Musikunterricht [...] werden diese 'unmusikalischen' Menschen<br />
höchstens Objekt einer intellektuell-manuellen Dressur, wozu meistens<br />
das Klavier herhalten muß als das Instrument, für dessen Behandlung man, wie<br />
allgemein geglaubt wird, am wenigsten 'musikalisch' zu sein braucht."<br />
(JACOBY 1995, 14)
Insgesamt entsteht der Eindruck, als ob der verbreitete, visuell orientierte Zugang<br />
zur Musik sich auf kognitiv-intellektuelle Leistungen stütze, die in der westlichen<br />
Gesellschaft dominant geworden sind, die sich aber mit aktivem musikalischem Tun<br />
nur schwer vereinbaren lassen. Dabei werden Schüler mit überdurchschnittlicher<br />
rationaler Intelligenz einerseits zunächst bevorzugt, während Schüler mit geringerem<br />
Abstraktionsvermögen benachteiligt werden. Andererseits besteht aber auch für<br />
die zunächst bevorzugte Gruppe die Gefahr der zu starken visuellen Orientierung in<br />
Verbindung mit der Vernachlässigung auditiver und ganzheitlich-musikalischer Fähigkeiten<br />
aufgrund der einseitigen Förderung ihres ohnehin bereits stärker ausgeprägten<br />
rational-abstrahierenden Denkvermögens und damit der Ausbildung eines<br />
typischen musikalischen Dilettantismus, wie er in Abschnitt 2.2.2 beschrieben<br />
wurde. Für diese (nach üblichen Kriterien "begabte") Gruppe gelten die besonderen<br />
Gefahren des visuell geprägten Spiels, die in Abschnitt 2.4 ausführlich diskutiert<br />
wurden, während die andere, erfahrungsgemäß weitaus größere Gruppe in der Regel<br />
schon früh als "unmusikalisch" aus dem Instrumentalunterricht entlassen wird und in<br />
der Folge – zumindest bislang – dazu verurteilt ist, ihre in der Regel überaus bedeutsamen<br />
musikalischen Bedürfnisse durch den Konsum von Tonträgern und Massenmedien<br />
zu befriedigen.<br />
Die in Abschnitt 2.4 dargelegten, teilweise äußerst aufwändigen Konzepte der Musikpädagogen,<br />
die Nachteile visuellen Musiklernens abzumildern (vgl. S. 96f.), untermauern<br />
den zwiespältigen Eindruck eines von schriftlichen Medien dominierten<br />
Unterrichts. Keiner der Autoren, die sich dort mit diesen Problemen beschäftigten,<br />
stellte aber das schriftliche Medium grundsätzlich in Frage.<br />
Nichtsdestotrotz verliert die geschilderte Diskrepanz zwischen Inhalten des Instrumentalunterrichts<br />
und Bedürfnissen von Schülern mit der fortschreitenden Medienentwicklung<br />
ihre Zwangsläufigkeit: Musikpädagogik verliert den Zwang zur<br />
Beschränkung auf schriftliche Unterrichtsmedien, die dem Schüler häufig wichtige<br />
Teile auditiver und musikalischer Erfahrungen vorenthalten.<br />
Die Praxis heutiger "U-Musik" zeigt aufgrund ihres geringeren Alters und geringerer<br />
Traditionsorientierung eine modernere Ausrichtung. Hier stellt der Tonträger das<br />
primäre und die Notation das sekundäre Medium dar. 33 Diese Re-Etablierung des<br />
33 Die Tatsache, dass schriftliche Notation kein Primärmedium für diese Musikstile darstellt, bedingt<br />
auch die Fragwürdigkeit der Vermittlung von Popularmusik im Unterricht mittels Notentexten,<br />
denn Transkriptionen werden dem Charakter dieses Stils in der Regel nicht gerecht. Es<br />
handelt sich um ein Missverständnis, wenn Klavierlehrer dem Wunsch des Schülers, im Unterricht<br />
auch Popmusik zu spielen, widerwillig nachkommen, indem (oft unter Schwierigkeiten)<br />
147
Klangereignisses als Primärreferenz markiert, wenn auch bislang von der Musikwissenschaft<br />
kaum registriert, einen entscheidenden Schritt musikkultureller Entwicklung:<br />
jüngere Musikstile, die nach der Verbreitung elektroakustischer Aufzeichnungsmedien<br />
entstanden sind, werden zunehmend von diesen geprägt, wobei die<br />
schriftliche Codierung ihre dominierende Rolle weitestgehend verliert. Damit vollzieht<br />
sich allmählich die Korrektur einer Schieflage, die über Jahrhunderte aufgrund<br />
eines einseitigen Vorsprungs von Drucktechnologien gegenüber der Elektroakustik<br />
entstanden war. Diese Korrektur vollzieht sich allerdings nur langsam, und in der<br />
öffentlichen Meinung sind Vorstellungen vom Musizieren in der Regel noch immer<br />
stark von traditionellen Kategorien der Schriftlichkeit geprägt. So wird z.B. im folgenden<br />
Ausschnitt aus einem Artikel der Bild-Zeitung als Spiegelbild der öffentlichen<br />
Meinung die Gedächtnisleistung des auswendig spielenden Pianisten DAVID<br />
HELFGOTT als linearer Vorgang fehlinterpretiert. Dort wird zunächst Helfgotts Lehrer<br />
PETER FEUCHTWANGER zu dessen Gedächtnisleistungen beim Auswendigspiel<br />
befragt; anschließend kommentiert die Bild-Zeitung:<br />
148<br />
"Das sind Abermillionen von Noten." (Bild, 24.5.1997)<br />
Eine solche Äußerungsweise drückt ein von Vorstellungen der Schriftlichkeit beherrschtes<br />
Denken aus, das um die sinngebende Funktion musikalischer<br />
Makrostrukturen nicht weiß – (ähnlich abwegig wäre es, die Leistung eines Schauspielers<br />
nach der Anzahl der auswendig gelernten Buchstaben zu bewerten). Auch<br />
trägt eine solche verständnislose Bewunderung dazu bei, die Kluft zwischen Musiker<br />
und Gesellschaft und damit die Ausnahmeerscheinung "musikalischer Begabung"<br />
zu vertiefen.<br />
Noch heute bezeichnen sich große Teile der Bevölkerung selbst als "unmusikalisch",<br />
ohne dass dies als ehrenrührig aufgefasst würde – wobei sich diese Selbsteinschätzung<br />
bezeichnenderweise wiederum auf visuelle Kategorien gründet. Musikalität<br />
wird nämlich in der Regel mit der hierfür vermeintlich entscheidenden Fähigkeit des<br />
Notenlesens gleichgesetzt. Auch im folgenden Pressebericht über die nationale Vorentscheidung<br />
zum Eurovisions-Schlager-Grand Prix 2001 werden visuelle und auditive<br />
Ebene vermischt:<br />
"Zlatko, der Mann, der aus dem "Big Brother"-Container kam, erging es kaum<br />
besser - obwohl er noch getönt hatte, er sei sich '99,9 Prozent' sicher, das<br />
Ticket für Kopenhagen zu gewinnen. Dass der mazedonisch-stämmige<br />
Noten fragwürdiger Qualität und Herkunft des gewünschten Stückes besorgt und dann in bester<br />
Tradition der Werktreue Ton für Ton wiedergegeben werden.
Schwabe noch nicht einmal Noten lesen kann ('Bin ein Naturtalent'), konnte<br />
man bei seiner Ballermann-kompatiblen Hymne 'Einer für alle' allerdings<br />
ziemlich deutlich hören." (RP-Online 2001)<br />
Notenlesen und Musizieren stehen aber in keinerlei zwingendem Zusammenhang.<br />
Bei LUCIANO PAVAROTTI hört man eben nicht, dass auch er die Notenschrift nicht<br />
beherrscht. Diese Irrtümer belegen, wie auch die erfolgreich verlaufene Normalisierung<br />
des Alphabetismus der letzten Jahrhunderte, den prägenden Einfluss schriftlicher<br />
Medien auf unsere Kultur. Ebenso wie sich auf der Skala begabt – normal –<br />
behindert die Voraussetzung für das Beherrschen von Lesen und Schreiben im Zuge<br />
der Verbreitung schriftlicher Medien nach rechts verschoben hat, könnten aber neue<br />
mediale Möglichkeiten des Umgangs mit akustischen Strukturen wieder zu einer<br />
gesellschaftlichen Normalisierung von Musikalität führen.<br />
Die für fundiertes Musiklernen erforderliche Ausprägung geeigneter semantischer<br />
Makrostrukturen vollzieht sich, wie jedes Lernen komplexer Fähigkeiten, infolge<br />
der Begrenztheit menschlicher Informationsverarbeitungskapazität in Form der Bildung<br />
größerer Sinneinheiten. Von Psychologen wird dieser Vorgang als Chunking<br />
(vgl. SPADA 1992, 144ff.) bezeichnet. Gut verständlich werden diese Vorgänge im<br />
folgenden Ausschnitt aus einem populärwissenschaftlichen Artikel des Spiegel über<br />
das Duell zwischen dem menschlichen Gehirn des Gari Kasparow und dem Computerhirn<br />
"Deep Blue" im Jahr 1997 zusammengefasst. Die hierbei beschriebenen<br />
Prozesse gelten für jede Art des Lernens, auch für das Erlernen eines Musikinstruments:<br />
"'Chunking' ist der Begriff, mit dem die Psychologen diesen Prozeß bezeichnen:<br />
Viele einzelne geistige Operationen werden zu Makrooperationen<br />
('Chunks') zusammengefaßt, die dann als Ganzes im Gedächtnis abrufbar sind.<br />
Genau zehn Jahre dauere es, so haben die Psychologen errechnet, bis im Hirn<br />
jene rund 100 000 Wissens-Chunks verschaltet sind, die nötig sind für Spitzenleistungen<br />
auf einem Spezialgebiet.<br />
Dann ist der Experte fähig, ein komplexes Problem in wenigen Makroschritten<br />
zu lösen. Die Gedanken des Laien hingegen verheddern sich in unzähligen<br />
Einzelschritten.<br />
Selbst menschliche Blitzrechner, die innerhalb weniger Sekunden die Wurzeln<br />
100stelliger Zahlen ziehen können, vollführen nicht mehr Rechnungen pro Sekunde<br />
als ein durchschnittlicher Abiturient. Vielmehr jonglieren sie mit vorgefertigten<br />
Zahlenpaketen, die sie in jahrelangem Programmtraining gebündelt<br />
haben und nun als Ganzes abrufen.<br />
Nicht anders ist es bei Schachspielern. Eindrucksvoll belegte dies ein einfaches<br />
Experiment: Die Forscher zeigten Großmeistern fünf Sekunden lang eine komplizierte<br />
Stellung aus einer Turnierpartie.<br />
149
150<br />
In fast allen Fällen erinnerten sich die Schach-Cracks anschließend an die Position<br />
sämtlicher Figuren. Laien hingegen konnten selten mehr als sechs oder<br />
sieben richtig auf dem Brett plazieren.<br />
Doch der Vorsprung der Profis schmolz dahin, als sie mit einer willkürlichen<br />
Verteilung von Figuren auf dem Brett konfrontiert wurden. Der Möglichkeit<br />
beraubt, die Bauernstellung, den Königsflügel oder die offenen Linien als<br />
Ganzes zu erfassen und so das Spiel in wenige Chunks zu zergliedern, schnitten<br />
sie bei den Gedächtnistests kaum besser ab als ein Schach-Anfänger."<br />
(GROLLE & SCRIBA 1997, 218)<br />
Ohne einen sinngebenden Zusammenhang kann es keine qualifizierte Gedächtnis-<br />
oder Verstehensleistung geben, gleich auf welchem Gebiet menschlicher Expertise.<br />
Für die Musik wird dieser Sachverhalt von JOHN A. SLOBODA folgendermaßen formuliert:<br />
"Es ließ sich jedoch experimentell zeigen, daß Musiker gegenüber Laien nicht<br />
besser abschneiden, wenn es darum geht, willkürlich oder zufällig hergestellte<br />
Klangereignisse zu reproduzieren. Effektives Gedächtnis beinhaltet, daß Muster<br />
und Strukturen wiedererkannt oder langfristig gespeichert werden – Prozesse,<br />
die sich verbessern, je mehr über die in der Musik zu erwartenden<br />
Strukturen gelernt wurde. Diese Lernprozesse werden vielfach nicht offen und<br />
bewußt vollzogen. Kinder lernen z.B. überwiegend durch die Beschäftigung<br />
mit der Musik ihrer Kultur und nicht durch explizite Instruktion über die theoretische<br />
Struktur die Grammatik der Musik." (SLOBODA 1993, 566)<br />
Die hier geforderte lebendige Beschäftigung mit Musik kann aber nur zu tragfähigen<br />
semantischen Strukturen führen, wenn diese auch in größeren Sinneinheiten praktiziert<br />
werden. Anders wäre beispielsweise kein sicheres Auswendigspiel möglich,<br />
denn ohne die Schaffung sinnvoller Makrostrukturen wäre es in der Tat unumgänglich,<br />
wie die Bild-Zeitung verlauten ließ (vgl. S. 148), sich wenn nicht "Millionen",<br />
so doch Tausende von Noten einzeln zu merken.<br />
Aber auch sicheres Blattspiel ist unter Verzicht auf solche Strukturen aus größeren<br />
Sinneinheiten nicht möglich. Vermutungen von CHRISTA NAUCK-BÖRNER aus dem<br />
Jahr 1987 zur Wahrnehmung beim Blattspiel, dass von schwachen Blattspielern –<br />
man könnte sie auch als typische "Dilettanten" bezeichnen –<br />
"[...] musikalische Notation wahrgenommen wird ohne Rückgriff auf Kenntnisse<br />
über Strukturen und Redundanz im Notentext" (NAUCK-BÖRNER 1987,<br />
31),
werden durch neuere Untersuchungen bestätigt. Neurowissenschaftler an der University<br />
of Sussex unter Leitung von Prof. MIKE LAND und Mitarbeit von SOPHIE<br />
FURNEAUX haben sich, unter anderem durch Auswertung von Videoaufzeichnungen,<br />
mit den Vorgängen beim Blattspiel beschäftigt. Beim guten Blattspiel handelt es<br />
sich demnach, wie der New Scientist berichtet, um das Ergebnis der folgenden erfolgreichen<br />
Lernstrategie:<br />
"Strategy, not speed, explains why some professional musicians can sight-read<br />
music the first time they pick up an unknown piece. According to researches at<br />
the University of Sussex´s Centre for Neuroscience, professionals do not interpret<br />
the musical notes any faster, they are just more efficient at reading the<br />
notes. [...] To test what the differences really were, researchers used a video<br />
camera to monitor the movements of the pianists' eyes on the sheet of music.<br />
[...] The result was a smooth progression of their eyes through the music without<br />
prolonged concentration on any one note. Land says this is the ideal<br />
strategy a pianist should use if they are already familiar with the score. But the<br />
professional had played the piece cold. [...] The biggest pitfall for beginners<br />
seems to be dwelling on their mistakes. In the study a novice's eyes would not<br />
only drift back a beat or two to notes they had misplayed, but would also, for<br />
instance, jump back several bars to check the key signature, which is inscribed<br />
at the beginning of each line of music. 'My guess is that the cause of many<br />
mistakes is quite often associated with looking back at previous mistakes,' says<br />
Furneaux.<br />
Furneaux was also surprised at some of the aspects of the professionals' performance.<br />
Beginners are always told not to look at the keyboard while playing,<br />
but the video camera revealed that the professionals occasionally glanced<br />
down." (HAMER 1997, 20)<br />
Abgesehen von der nebenbei vermittelten Information, dass im Jahr 1997 offensichtlich<br />
immer noch als vorbildhaft betrachtet wird, was bereits FRIEDRICH WIECK<br />
für überwunden gehalten hatte (vgl. S. 75), nämlich dass nur auf die Noten geblickt<br />
werden darf (vgl. S. 73) ergibt sich als Konsequenz die zunächst möglicherweise<br />
überraschende Erkenntnis, dass die neuronalen Abläufe bei richtigem Blattspiel und<br />
Auswendigspiel sich stark ähneln. In beiden Fällen geht es um das Erkennen bzw.<br />
Behalten verinnerlichter musikalischer Strukturen. Noch delikater ist die aus dem<br />
Zusammenhang zwangsläufig zu folgernde Erkenntnis: dass nämlich Notenspiel Ton<br />
für Ton, wie es üblicherweise den Hauptbestandteil von Klavierunterricht bildet, in<br />
der Regel weder die Fähigkeit guten Auswendigspiels, noch – nota bene – die Fähigkeit<br />
zu adäquatem Blattspiel hervorbringen kann, denn Notentexte sind, wie auf<br />
S. 138f. dargelegt wurde, für sich kaum in der Lage, die erforderlichen musikalischen<br />
Strukturen zu vermitteln.<br />
151
Beim breiter angelegten (also im ursprünglichen Sinne "virtuosen") Lernen unter<br />
primärer Beteiligung des Ohrs bzw. praktischer Anwendung musikalischer Makrostrukturen<br />
und der dabei vermittelten Fähigkeit zur Redundanz- und Irrelevanzreduktion<br />
und damit zum Unterscheiden des Wichtigen vom Unwichtigen im Notentext<br />
wächst dagegen die Fähigkeit zu spielen, auch wenn die Noten Fehler,<br />
Lücken oder Unklarheiten aufweisen, indem fehlende Informationen sinngemäß ergänzt<br />
werden können (vgl. S. 20). Vor diesem Hintergrund verwundern scheinbar<br />
übermenschliche Leistungen von Virtuosen weniger, wie etwa die folgende der jungen<br />
CLARA WIECK, über die ihr Vater berichtet. FRIEDRICH WIECK schreibt in einem<br />
Brief an seine Frau voller Stolz, wie CLARA ein ihr unbekanntes handgeschriebenes<br />
Stück des Prager Komponisten VACLAV JAN TOMASCHEK vom Blatt spielte:<br />
152<br />
"Sie spielte [...] gestern Abend ein Allegro di Bravura (ein neues Manuskript<br />
von ihm u. schlecht geschrieben) – nun, sie spielte es ihm vom Blatt." (FRIED-<br />
RICH WIECK an CLEMENTINE WIECK, 2. 1<strong>1.</strong> 1837, abgedruckt in WIECK 1968,<br />
72)<br />
Es ergibt sich der scheinbar paradoxe Schluss, dass die Dominanz "guter" Notenausgaben<br />
die musikalische Ausbildung am Instrument, auch die Fähigkeit zum<br />
Blattspiel, eher zu behindern als zu fördern scheint. Die Ursache hierfür liegt in der<br />
einseitigen Struktur des Mediums, das dem Spieler eigene musikalisch-strukturelle<br />
Leistungen umso mehr abnimmt, je besser die Notenqualität ist. Wahrscheinliche<br />
Folge dieser scheinbaren Leichtigkeit beim Lernen ist allerdings die defizitäre Ausbildung<br />
musikstruktureller und auditiver Kompetenz. Im Zuge weiteren Fortschreitens<br />
im Unterricht müssen bei diesem Lernweg mit zunehmender Komplexität der<br />
Notentexte immer mehr Informationen linear verarbeitet werden, was die Aufmerksamkeit<br />
des Spielers voll beansprucht und damit unter anderem der Kontrolle des<br />
Klangergebnisses entzieht. Vor diesem Hintergrund wird auch die folgende, zunächst<br />
unlogisch erscheinende Bemerkung MARTIN GELLRICHS verständlich, der vor<br />
den Gefahren des Unterrichts nach Noten, speziell im Anfangsunterricht, wie folgt<br />
warnt:<br />
"Der zu frühe und unvermittelte Beginn nach Noten führt dazu, daß viele [...]<br />
die Fähigkeit des Spiels nach Noten nur in defizitärer Form ausbilden. Ein<br />
Kardinalproblem ist zweifellos das Fehlen der inneren Tonvorstellung. Aufgrund<br />
der Schwierigkeit des Spiels nach Noten beschränken sich Schüler oft<br />
nur darauf, gelesene Noten bzw. Fingersätze in Griffe umzusetzen."<br />
(GELLRICH 1996, 10)
Die Erkenntnis, dass sowohl beim Blatt- als auch beim Auswendigspiel ähnliche<br />
Strukturerkennungsprozesse erforderlich sind, mag überraschen, ist aber geeignet,<br />
verbreitete Irrtümer aufzuklären. So kann professionelles Blattspiel grundsätzlich<br />
daran erkannt werden, dass der "Virtuose" die Struktur erkennt und größere Sinnzusammenhänge<br />
herstellt, während der "Dilettant" gewohnt ist, Note für Note zu lesen.<br />
Letzterem wird in Anbetracht der Anzahl der zu merkenden Noten das Auswendiglernen<br />
beinahe unmöglich gemacht, während ersterer automatisch lernt, je öfter er<br />
das Stück liest. WOLFGANG BRUNNER beschreibt das Ineinandergreifen unterschiedlicher<br />
musikalischer Fähigkeiten zu einem musikstrukturellen Ganzen bei<br />
vorbildlichem Lernen, mit besonderem Augenmerk auf die Improvisation, folgendermaßen:<br />
"Beim Vortrag schriftlich 'festgelegter' Stücke passieren jedem Musiker Töne,<br />
die er nicht beabsichtigt hat. Ein improvisatorisch gewandter Spieler wird sofort<br />
versuchen, diese 'Verspieler' in den vorhergegangenen und nachfolgenden<br />
Ablauf so einzufügen, daß die geänderte Struktur sinnvoll und gewollt erscheint.<br />
Besonders beim Spiel vor Publikum hat ein Musiker normalerweise<br />
den Ehrgeiz, perfekt zu sein und keine 'falschen' Töne zu produzieren. Die Improvisation<br />
wird notwendig zur Tarnung dessen, was nicht vorhanden sein<br />
darf. Ebenso sind Gedächtnislücken zu überbrücken.<br />
Ein ähnlicher Vorgang geschieht manchmal beim Blattspielen. Ein Musiker,<br />
dessen Blattspielbegabung nicht vorrangig darin liegt, optisch sehr viele Einzelheiten<br />
auf einmal erkennen zu können, sondern der eher mit Hilfe einer<br />
schnellen Einfühlungsgabe in den Stil und musikalischen Zusammenhang eines<br />
Werkes – sozusagen 'ganzheitlich' – blattspielt, wird Details oft übersehen,<br />
dank seines improvisatorischen Könnens aber trotzdem eine Wirkung erzielen,<br />
die der des 'Originals' nahekommt." (BRUNNER 1996, 32f.)<br />
Wurden entsprechende Makrostrukturen vom Schüler erworben, so ergänzen sich<br />
diese mit motorischen und kognitiven Behaltensstrategien zu Gunsten größerer Sicherheit<br />
und Flexibilität beim Spiel. Im Gegensatz zum stereotypen Einüben von<br />
Stücken anhand vorwiegend motorischer Strukturen entsteht auf diese Weise eine<br />
musikalische Flexibilität, die sich mehr auf die Relativität musikalischer Zusammenhänge<br />
stützt als auf absolute Werte einzelner Töne. Nur so kann übrigens auch<br />
die Fähigkeit zur Transposition entstehen, die im Zuge der "geistigen Digitalisierung"<br />
(vgl. S. 201f.) in der Musikpädagogik weitgehend verloren gegangen ist.<br />
Wahrscheinlich besteht in bestimmten Lernphasen sogar ein komplementäres Verhältnis<br />
zwischen motorischem und musikalischem Lernen. Für die israelische Pianistin<br />
EDITH KRAUS führte gar ein Aufenthalt im deutschen Konzentrationslager mit<br />
erschwertem Zugang zum Klavier dazu, dass sie einige Stücke besonders gut be-<br />
153
herrscht: nämlich diejenigen, die sie nicht motorisch, sondern quasi virtuell gelernt<br />
hat. Sie berichtet in einem Interview:<br />
154<br />
"Heißt das, daß Ihnen ein zweistündiges Übepensum ausreichte, um täglich<br />
konzertieren zu können?"<br />
"Ich habe auch vieles 'zu Hause' im Kopf ohne Klavier gelernt. 'Zu Hause'<br />
kann man nicht sagen, aber auf meiner Lagerstatt oder auf einer Bank im Hof.<br />
Diese Stücke sitzen am besten, da sie nicht mechanisch gelernt wurden."<br />
(HAUFE 1999, 31)<br />
Die verbreitete Ansicht, die Fähigkeit zur Interpretation von Meisterwerken als<br />
oberstes Ziel der musikalischen Ausbildung könne durch zielgerichtetes und rationalisiertes<br />
Training eben der Wiedergabe einzelner Stücke erreicht werden, erweist<br />
sich als zwar nahe liegender, aber fundamentaler Irrtum.<br />
Die Abspaltung der Interpretation von der Komposition und die Trennung der Ausführung<br />
des musikalischen Gedankens von seiner Erzeugung im Verlauf des 19.<br />
Jahrhunderts führte zu einer Verlagerung der Aufmerksamkeit weg vom Erwerb musikstruktureller<br />
und auditiver Kompetenz hin zur Lösung motorischer Probleme bei<br />
der Wiedergabe. Gleichzeitig verschob sich die Bedeutung von Virtuosität auf ihre<br />
von außen sichtbaren Bestandteile und führte damit zu einer Einengung des Begriffes<br />
auf vorwiegend motorische Könnerschaft. Als Folge dieser eingeschränkten<br />
Sichtweise konzentriert sich die Instrumentalpädagogik bis heute – in bester Absicht<br />
– darauf, möglichst früh motorische Grundlagen als scheinbar optimale Voraussetzung<br />
für den Erwerb von Virtuosität zu legen. In dem Wunsch, auf kürzestem und<br />
schnellstem Weg Virtuosität zu erlangen, wird so in Wirklichkeit aber Dilettantismus<br />
praktiziert.<br />
Auch HEINRICH JACOBY wandte sich grundsätzlich gegen den von klein auf üblichen<br />
Drill, mit dem Schüler vermeintlich auf Virtuosentum vorbereitet werden.<br />
Noch kompromissloser als z.B. CARL ADOLPH MARTIENSSEN oder KARL LEIMER<br />
vertritt er den Ansatz, dass sich motorische Probleme nur unter ganzheitlicher Betrachtung<br />
lösen lassen:<br />
"Die Ansicht, daß Kinder nicht frühzeitig genug mit 'Üben' anfangen können,<br />
gehört zu den vielen, anscheinend unausrottbaren Denkgewohnheiten, die keiner<br />
näheren psychologischen und physiologischen Betrachtung standhalten.<br />
Man braucht nur den üblichen Entwicklungsgang und die späteren, in keinem<br />
Verhältnis zur aufgewendeten Zeit und Kraft stehenden, meist kläglichen Leistungen<br />
von Kindern mit früh gedrillten Händen zu verfolgen, um zu sehen,<br />
daß in den meisten Fällen das Gegenteil des Erwarteten, nämlich Verbildung,
erreicht wird. Sechsjährige Wunderkinder haben auch nicht sechs Jahre lang<br />
täglich ihre vier bis acht Stunden üben können, um die erstaunlichen virtuosen<br />
Leistungen zu erzielen, die wir von ihnen zu hören bekommen. Man wird sagen:<br />
Das sind eben 'Wunder'kinder, und wir haben es mit 'Durchschnitts'kindern<br />
zu tun. Aber wer ahnt denn auch nur, wie viele Kinder täglich vom Wunder,<br />
das in ihnen ruht, durch die übliche Schulung zum Durchschnitt herunter<br />
erzogen werden? Gingen wir andere Wege, würde uns sicher manche Leistung<br />
nicht mehr als Wunder erscheinen, bei der das heute der Fall ist. Über das<br />
Üben als Arbeitsmethode – nicht nur bei der Musik – wäre in diesem Zusammenhang<br />
noch mancherlei zu sagen; das würde aber zu weit von unserem<br />
Thema abführen. Ich muß mich deshalb darauf beschränken, daran zu erinnern,<br />
wie viel leichter die ausführenden Organe einer einzigen intensiven Vorstellung<br />
gehorchen als noch so exakten und häufig wiederholten 'geübten' Reflexionen<br />
und von außen kommenden Befehlen. Ich habe im Verlaufe von fast 10<br />
Jahren, während deren ich im Sinne dieser Ausführungen zu arbeiten versuchte,<br />
erfahren, daß mit jedem Jahre, in dem ich die Entwicklung des Klangempfindungs-,<br />
Klangerinnerungsvermögens konsequenter allem Technischen<br />
vorausgehen ließ und das Erarbeiten lückenloser durchführte, die Schüler für<br />
die Erreichung der gleichen Ziele weniger Zeit brauchten." (JACOBY 1995, 23)<br />
Es ist bemerkenswert, wie scheinbar zwangsläufig die Diskussion der grundsätzlichen<br />
Probleme abendländischer Musikerziehung immer wieder in den Ruf nach adäquater<br />
Beteiligung des Gehörs mündet. Die bereits in Abschnitt 2.4 gewonnene<br />
Erkenntnis, dass nur unter zentraler Berücksichtigung des Klangempfindens letztlich<br />
der Schlüssel zu musikalischer Aktivität gefunden werden kann, ergibt sich nunmehr<br />
auch aus Betrachtungen zur Motorik. Dabei scheint es, als ob Begriffe wie<br />
"Klangempfinden" bei HEINRICH JACOBY bzw. "Klangwille" bei CARL ADOLPH<br />
MARTIENSSEN einerseits und der Begriff der "semantischen Makrostruktur" der Musikpsychologen<br />
andererseits nahezu synonym gebraucht würden.<br />
Als Konsequenz ergibt sich die eigentlich triviale Erkenntnis, dass die Bildung semantischer<br />
Makrostrukturen in der Musik essenziell an Eindrücke durch das Ohr als<br />
primären Sinneskanal gebunden sein muss. Dass eine solche Trivialität, nämlich die<br />
der primären Rolle des Ohrs in der akustischen Disziplin Musik, aufwändig untermauert<br />
werden muss, belegt den Grad der Pervertierung musikbezogener Vorgänge<br />
in unserer Kultur durch die Dominanz der Sehsphäre bei ihrer Vermittlung, die wiederum<br />
unlösbar verknüpft ist mit der die einseitigen Fortentwicklung schriftlicher<br />
Medien in der Vergangenheit. Auch die Tatsache, dass das Fach Gehörbildung nicht<br />
implizit an musikalisches Lernen gebunden zu sein scheint, sondern statt dessen an<br />
Hochschulen (also erst in der Schlussphase der musikalischen Ausbildung) als separates<br />
musikalisches Fach kompensatorisch vermittelt werden muss (und zudem dort<br />
155
häufig unter "Theorie" eingeordnet wird), ist ein Indiz für diese Pervertierung.<br />
Instrumentalpädagogik der Interpretation findet also in einer visuell geprägten Medienwelt<br />
in ihrer hohen Spezialisierung vielfach ohne Fundament statt, eben ohne<br />
auf grundlegende musikalische Fähigkeiten bauen oder sie vermitteln zu können.<br />
VOLKER BENDIG nennt dies in einem Aufsatz die<br />
156<br />
"[...] Diskrepanz zwischen instrumentaler Virtuosität und gehörmäßigem<br />
Bankrott." (BENDIG 2001, 60)<br />
Die in Abschnitt 2.5 dargestellte und inzwischen kaum mehr überhörbare Forderung<br />
nach "improvisatorischem Lernen" im Musikunterricht ist Zeichen eines immer<br />
deutlicher artikulierten Unbehagens über grundsätzliche Defizite. Dies ist einerseits<br />
konsequent, gilt doch Improvisation als eine Art des Musizierens, bei der die<br />
Hörsphäre kaum verzicht- oder vernachlässigbar erscheint. Allerdings muss betont<br />
werden, dass Improvisation nicht, wie die aktuelle Diskussion suggerieren mag, die<br />
einzige oder gar bedeutendste Art des Musiklernens unter primärer Beteiligung des<br />
Gehörs ist. Auch die auditive Imitation (vgl. Abschnitt 4.2) gehört in diese Kategorie.<br />
Die äußeren Bedingungen des Instrumentalunterrichts mit der pro Schüler zur<br />
Verfügung stehenden Zeit, hervorgegangen aus der Rationalisierung des Unterrichts<br />
in der CZERNY-Nachfolge (vgl. Abschnitt 2.2.1) und die bisherige Mediensituation<br />
boten, neben dem eingeschränkten Ausbildungsstand von Musikpädagogen (vgl.<br />
Abschnitt 2.3), bislang allerdings kaum Handhabe zur Realisierung derartiger Unterrichtsformen<br />
– trotz der Mode, in der sich das Stichwort Improvisation seit einiger<br />
Zeit befindet.<br />
Sollte diese nicht eben schmeichelhafte Analyse der musikpädagogischen Situation<br />
in Teilen zutreffen, wäre als nächstes zu fragen, welche Möglichkeiten der positiven<br />
Einflussnahme die Medienentwicklung bietet. Da interaktive Medien in der Instrumentalpädagogik<br />
noch kaum Einzug gehalten haben, erfolgt die Analyse bereits bestehender<br />
Musizierformen mittels dieser Medien an der gegenwärtig explodierenden<br />
Kultur autonomen Musizierens außerhalb von institutionellem Musikunterricht. Eine<br />
Betrachtung dieser Vorgänge kann für die Musikpädagogik wertvolle Anregungen<br />
liefern.
4.5 Autonomes Musizieren<br />
"Nach dreitausendjähriger, durch Techniken des Zerlegens und der Mechanisierung<br />
bedingter Explosion erlebt die westliche Welt eine Implosion. In den<br />
Jahrhunderten der Mechanisierung hatten wir unseren Körper in den Raum<br />
hinaus ausgeweitet. Heute, nach mehr als einem Jahrhundert der Technik der<br />
Elektrizität, haben wir sogar das Zentralnervensystem zu einem weltumspannenden<br />
Netz ausgeweitet und damit, soweit es unseren Planeten betrifft, Raum<br />
und Zeit aufgehoben. [...]<br />
Ist es nicht klar, daß im selben Augenblick, in dem das Aufeinanderfolgen der<br />
Gleichzeitigkeit weicht, wir uns in der Welt der Struktur und Gestalt befinden?<br />
[...] Die Aufmerksamkeit gilt nicht mehr speziellen Teilaspekten, sondern<br />
wendet sich der Gesamtwirklichkeit zu, und wir können jetzt ganz natürlich<br />
sagen, 'das Medium ist die Botschaft'." (MCLUHAN 1995, 15, 30)<br />
Diese Worte des kanadischen Medientheoretikers MARSHALL MCLUHAN wurden<br />
bereits im Jahr 1964 erstmals veröffentlicht, erlangten aber erst später unter dem<br />
Einfluss akuter medientechnologischer Veränderungen breitere Aufmerksamkeit.<br />
Obwohl außerhalb eines musikalischen Zusammenhangs verfasst, gewinnen sie<br />
gerade hier an Bedeutung, erweist sich doch die mediale Strukturierung bei der<br />
Vermittlung von Musik als Kernfrage (vgl. Abschnitt 4.4).<br />
Bezogen auf die Musik hat GLENN GOULD, wie MCLUHAN Kanadier und mit dessen<br />
Gedanken vertraut, im Jahr 1966 in seinem Aufsatz Die Zukunftsaussichten der<br />
Tonaufzeichnung (The Prospects of Recording) eine Vision entworfen, die ebenfalls<br />
das Medienumfeld des Einzelnen zum Inhalt hat und die er unter anderem folgendermaßen<br />
beschreibt:<br />
"Das Herumspielen an Knöpfen ist in seiner begrenzten Weise ein interpretativer<br />
Akt. Vor vierzig Jahren konnte der Hörer einen Schalter betätigen, auf dem<br />
»Ein« und »Aus« geschrieben stand, und mit einem Gerät, das auf dem neuesten<br />
Stand war, vielleicht ein wenig die Lautstärke regeln. Heute erfordert die<br />
Vielfalt der Bedienungselemente, die ihm zur Verfügung gestellt werden, analytisches<br />
Urteilsvermögen. Und diese Bedienungselemente sind nur primitive<br />
Regelvorrichtungen verglichen mit jenen Möglichkeiten der Teilhabe, deren<br />
der Hörer sich erfreuen wird, sobald gebräuchliche Labortechniken von Abspielgeräten<br />
zum Hausgebrauch übernommen worden sind." (GOULD 1987,<br />
152)<br />
GLENN GOULD postulierte damit im Prinzip die Emanzipation des Musikkonsumenten.<br />
Er war davon überzeugt, dass die Medienentwicklung eines Tages die Trennung<br />
157
zwischen Musiker und Hörer auflösen würde. OTTO FRIEDRICH bezeichnet diese<br />
Vision in seiner Gould-Biographie als das Ende musikalischer Passivität und die<br />
Befreiung des Hörers:<br />
158<br />
"Der Höhepunkt dieser technischen Revolution in der Musik, so glaubte er,<br />
wäre die Befreiung des Hörers oder vielmehr die Umwandlung des Hörers von<br />
einem passiven zu einem aktiven Teilnehmer." (FRIEDRICH 1994, 154)<br />
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren solche Gedanken ihrer Zeit weit voraus.<br />
Die gegenwärtig sich vollziehenden technischen Veränderungen leisten aber die<br />
Loslösung der Informationsdarbietung vom linearen Medium (vgl. S. 118). Der<br />
Umgang mit Musik wird durch diese Befreiung von medialen Fesseln auch aus der<br />
Sicht des Konsumenten einschneidende Veränderungen erfahren, die die Visionen<br />
GOULDS und MCLUHANS in die Nähe der Realität rücken.<br />
4.5.1 Rückblick<br />
Vor der Erfindung der technischen Schallaufzeichnung bzw. -übermittlung waren<br />
die Möglichkeiten des Einzelnen im Umgang mit Musik sehr begrenzt. Sie<br />
beschränkten sich prinzipiell auf die beiden Möglichkeiten, entweder selbst ein<br />
Instrument zu spielen (oder zu singen), oder dem Spiel einer anderen Person<br />
zuzuhören. Dabei beschränkte sich die Einflussnahme eines Musikkonsumenten<br />
beim Hören von Musik im Prinzip auf die beiden Alternativen, entweder einem<br />
Vortrag beizuwohnen 34 oder diesen nicht zu besuchen.<br />
Das 20. Jahrhundert bietet im Zuge der Nutzbarmachung der Elektroakustik zunächst<br />
die Überwindung von Distanzen durch das Radio und die Überwindung der<br />
Flüchtigkeit von Musik durch die Schallaufzeichnung. Das Radio bot zwar bald neben<br />
der Ortsunabhängigkeit nicht mehr nur die Wahlmöglichkeit zwischen "Ein"<br />
und "Aus", sondern darüber hinaus die simultane Auswahl zwischen mehreren Programmen<br />
auf unterschiedlichen modulierten Frequenzen. Die Möglichkeiten des<br />
Grammophons bzw. Plattenspielers gehen unter dem Aspekt der Einflussnahme des<br />
Hörers aber weit über die des Radios hinaus: in Abhängigkeit von der zur Verfügung<br />
stehenden Software (in diesem Fall in linearer, analoger Form einer Rille, ge-<br />
34 ...und dabei als einzige Möglichkeit der Steuerung durch Zuruf möglicherweise ein "da capo" zu<br />
erreichen oder einen Repertoirewunsch zu äußern.
speichert auf Schallplatten) bietet die Schallaufzeichnung freie Programmzusammenstellung<br />
bei beliebiger Wiederholbarkeit. 35<br />
Diese Art der Beeinflussung musikalischer Abläufe durch den Hörer mittels Programmwahl<br />
in einem Radio oder Auswahl von Schallplatten erfolgt, indem Entscheidungen<br />
in der Regel im Minuten- oder Stundenabstand getroffen werden, also<br />
(im Gegensatz zum Spiel eines Musikinstruments, bei dem jeder Ton einzeln produziert<br />
werden muss) vergleichsweise selten. Im Gegensatz zur ursprünglichen, äußerst<br />
beschränkten Beeinflussbarkeit vorelektrischer Zeit gewährt die Elektroakustik<br />
aber bereits hier eine deutliche Differenzierung des Zugriffs. Dieser aus heutiger<br />
Sicht wiederum sehr beschränkte Differenzierungsgrad per Einflussnahme auf Radiosender<br />
oder Plattenspieler war bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts aber<br />
Stand der Technik und begrenzte die Möglichkeiten der Gestaltung ihrer musikalischen<br />
Umgebung all derer, die kein Musikinstrument erlernen konnten oder wollten.<br />
Befand sich also bis vor kurzem auf der einen Seite im Umgang mit Musik die sogenannte<br />
"passive" Beschäftigung wie das Hören von Radio oder Platten, das sich in<br />
der Darbietungsform nur in musikalisch sehr groben Parametern – also dem Auswählen<br />
ganzer Stücke – beeinflussen ließ, so stand auf der anderen Seite das Musizieren,<br />
z.B. das Klavierspiel, das auf der Codierung und damit Beeinflussbarkeit<br />
kleinster Einheiten in Form von Noten bzw. der Gestaltung einzelner Töne basierte.<br />
Die Durchlässigkeit vom konsumierenden zum praktizierenden Umgang mit Musik<br />
– als theoretisch denkbarer autodidaktischer Übergang vom Musikkonsument zum<br />
Musiker – war damit allein aufgrund einer großen Distanz zwischen gröbster und<br />
feinster musikalischer Strukturierung und der inkompatiblen Codierungsarten gering:<br />
es war deshalb in der Regel auch für einen Schüler mit Vorkenntnissen nur<br />
schwer möglich, Instrumentalspiel mit Hilfe elektroakustischer Medien zu lernen.<br />
Die inzwischen absehbare Möglichkeit der beliebigen Strukturierbarkeit von Information<br />
wird diese Distanzen insofern auflösen, als verschiedene beliebig grob oder<br />
fein strukturierte Möglichkeiten des Umgangs mit Musik entstehen werden, zwischen<br />
denen eine kleinschrittigere Durchlässigkeit von einer zur anderen möglich<br />
wird. Deutliche Anzeichen einer solchen Ausdifferenzierung existieren bereits –<br />
ähnlich wie bei den Umgangsformen mit Musik auf der Seite der relativ groben Parameter<br />
(Radioprogramm wählen, Schallplatte auflegen) – auch auf der gegenüberliegenden<br />
Seite, der Einflussnahme in feineren Einheiten, also dem so genannten<br />
"aktiven" Musizieren. Hier sind inzwischen neuere Möglichkeiten der Behandlung<br />
von musikalischen Strukturen entstanden, die Zwischenstufen zwischen den bislang<br />
35 Erst die aktuelle Entwicklung der Online-Technologien (Internet) entmaterialisiert diese Software<br />
völlig, wodurch Orts- und Zeitunabhängigkeit perfektioniert werden und eine neue Qualität der<br />
Gleichzeitigkeit schaffen.<br />
159
gegebenen Möglichkeiten darstellen und damit die Unterschiede zwischen den beiden<br />
Extremen, dem "konsumierenden", "passiven" Umgang mit Musik und dem<br />
"aktiven Musizieren", nivellieren. 36 Ein Beispiel hierfür stellt das seit wenigen Jahrzehnten<br />
sich entwickelnde Spiel am elektronischen Keyboard dar. Einerseits betätigt<br />
sich der Spieler hierbei in kleinsten Elementen auf der Ebene einzelner Töne, indem<br />
er die Melodie selber spielt. Andererseits wird er vom Medium entlastet, das es ihm<br />
ermöglicht, Harmonie und Rhythmus in größeren Einheiten zu steuern. Die Aktivität<br />
des Musizierenden bei der Melodiegestaltung ist hierbei vergleichbar mit der beim<br />
Klavierspiel, was in der Regel die Ausbildung von Notenkenntnissen erfordert, während<br />
auf rhythmischem und harmonischem Gebiet eine stärkere Autonomie des Instruments<br />
und damit eine Entlastung bei gleichzeitig reduzierter Einflussmöglichkeit<br />
des Spielers besteht.<br />
Um die graduellen Unterschiede musikalischer Aktivität zwischen den verschiedenen<br />
Arten des Musizierens zu beschreiben, könnte ihre unterschiedliche Komplexität<br />
durch Zeitgrößen zu beschreiben versucht werden, innerhalb derer vom Musiker<br />
(bzw. Musikkonsumenten) Entscheidungen getroffen werden können bzw. müssen,<br />
um den Ablauf der musikalischen Darbietung zu beeinflussen. Je kleiner die betreffenden<br />
Zeiteinheiten sind, desto größere Aktivität wird dem Ausübenden abverlangt.<br />
Die Frequenz solcher Entscheidungen ist beim virtuosen Klavierspiel idealer Weise<br />
sehr hoch und der Abstand zwischen zwei zu beeinflussenden Ereignissen reicht in<br />
den Bereich von Sekundenbruchteilen. Beim Keyboardspiel liegen bezüglich der<br />
Melodiegestaltung diese Zeiteinheiten in ähnlicher Größenordnung wie beim Klavierspiel,<br />
während Entscheidungen über den harmonischen Ablauf vom Spieler etwa<br />
taktweise und über den rhythmischen Ablauf oft nur einmal pro Stück nötig werden.<br />
Auf der gegenüber liegenden Seite, die gewöhnlich als "passiver" Musikkonsum<br />
bezeichnet wird, obwohl auch hier aktive Entscheidungen der musikalischen Gestaltung<br />
gefällt werden, bewegen sich die Zeiträume, innerhalb derer solche Entscheidungen<br />
fällig werden, zwischen quasi unendlich, falls immer dasselbe Radio-<br />
36 Indem die Begriffe "aktiv" und "passiv" in Anführungszeichen stehen, soll der Tatsache Rechnung<br />
getragen werden, dass die traditionelle Anwendung dieser Begriffe eine Polarisierung suggeriert,<br />
die hier nicht vertreten wird. Jede Beschäftigung mit und Rezeption von Musik erfordert<br />
eine geistige Aktivität, die sich allerdings in ihrer Art unterscheidet. GUERINO MAZZOLA schreibt<br />
zur Frage von Aktivität bei musikalischer Wahrnehmung:<br />
"Aesthesis ist mit der wahrnehmenden Bewertung des Werks durch den Hörer befaßt. Diese Aktivität<br />
besteht in einem Für-wahr-Nehmen von Werksmerkmalen in Funktion der individuell variablen<br />
Position des Hörers. Diese interpretatorische Bewertung aus einer bestimmten Perspektive<br />
heraus ist nicht weniger aktiv als diejenige des Schöpfers – und dies nicht nur im Fall des Instrumentalinterpreten,<br />
sondern ganz generell." (MAZZOLA 1990, 6)<br />
Es gibt keine eindeutig definierbare Grenze zwischen "aktiver" und "passiver" Musikbeschäftigung.<br />
160
programm gehört wird (es wäre zu diskutieren, ob es sich hierbei möglicherweise in<br />
der Tat um eine völlig passive Art des Umgangs mit Musik handelt), Stunden beim<br />
Abspielen von CD-Alben und wenigen Minuten bei der Auswahl von Einzelstücken,<br />
wie es beispielsweise der traditionellen Tätigkeit des Disk-Jockeys entspricht.<br />
4.5.2 Ausblick<br />
Die Medienentwicklung wird künftig unbegrenzt viele weitere Ausformungen musikbezogener<br />
Tätigkeit zwischen bereits existierenden Zwischenformen (z.B. Keyboardspiel,<br />
Tätigkeit des Diskjockeys) und den geschilderten Extremen der ganz<br />
grob (Radio hören) oder ganz fein (Klavierspiel) strukturierten Tätigkeiten hervorbringen,<br />
mit der Folge einer Individualisierung des Umgangs mit Musik und damit<br />
in der Tat, wie von GLENN GOULD beschrieben, einer Emanzipation des Musikkonsumenten.<br />
37 Dabei wird die Vielfalt der musikalischen Codierungs- und Strukturierungsmöglichkeiten<br />
die Grenzen zwischen Musikkonsum und Musizieren verwischen<br />
und durchlässig machen. Die Komplexität der musikalischen Strukturierung<br />
wird beliebig dem musikalischen Niveau des Konsumenten bzw. Spielers bzw.<br />
Schülers – diese Begriffe werden nun synonym! – angepasst werden können. Da die<br />
Schritte zwischen den unterschiedlichen Komplexitätsgraden im musikalischen Umgang<br />
annähernd beliebig minimierbar sein werden, wird jede musikalische Betätigung,<br />
sofern sie mit einer Erhöhung des jeweiligen Komplexitätsniveaus geistigmusikstruktureller<br />
Verarbeitung einhergeht, zum Lernvorgang.<br />
Die bislang strikte Trennung zwischen Musizieren und Musikhören bzw. zwischen<br />
"aktivem" und "passivem" Umgang mit Musik kann sich damit auflösen. Der Unterschied<br />
zwischen aktivem und passivem Umgang mit Musik wird nicht mehr scheinbar<br />
zwischen Schallplattenkonsument und Musikschüler verlaufen, sondern passiverer<br />
wird sich von aktiverem Umgang darin unterscheiden, dass Möglichkeiten des<br />
Wechsels des Verarbeitungsniveaus hin zu einer differenzierteren (höherfrequent<br />
37 Ein kurioses Beispiel für den fließenden Übergang zwischen zwei Arten des Musikertums konstituiert<br />
sich momentan in Form der Tätigkeit des "Alleinunterhalters". Während ein Alleinunterhalter<br />
traditionell ein Keyboardspieler ist, der sich der Unterstützung hauptsächlich rhythmischer<br />
Fähigkeiten dieses Instrumentes bedient, sind in jüngerer Zeit vermehrt "Alleinunterhalter" zu<br />
beobachten, die das Keyboard mehr und mehr als Attrappe einsetzen, in Wirklichkeit aber hauptsächlich<br />
vorprogrammierte MIDI-Files wiedergeben und damit in Wirklichkeit eine Tätigkeit<br />
ausüben, die mit "Diskjockey" besser umschrieben wäre. Wichtig erscheint aber, darauf hinzuweisen,<br />
dass ein solcher "Betrug" umso weniger eine unmoralische Tat darstellt, je besser das<br />
Ziel der guten Unterhaltung des Publikums erreicht wird (vgl. auch die Diskussion um die Unterschiede<br />
zwischen werk- und publikumszentrierten Perspektiven auf S. 191f.).<br />
161
aktive Entscheidungen abverlangenden) Umgangsform nicht genutzt werden. Auch<br />
oberflächliches, auf die Wiedergabe beschränktes Spiel nach Noten am Klavier, wie<br />
es aus dem Klavierunterricht des 19. Jahrhunderts überliefert ist, müsste mangels<br />
Möglichkeit, die Ebene der musikalischen Struktur zu wechseln, aus dieser Sicht als<br />
eher passiv angesehen werden.<br />
Greift der Hörer aber aktiv in die Strukturen der Musik ein und gestaltet er somit<br />
autonom, so wird er zum Komponisten. Diese Möglichkeit hatte bereits GLENN<br />
GOULD als Konsequenz der Medienentwicklung vorausgesagt und für so zwingend<br />
gehalten, dass er jede Gegenrede als "tollkühn" bezeichnet hätte:<br />
162<br />
"Es wäre in der Tat tollkühn, von vorn herein die Idee abzutun, dass der Hörer<br />
letzten Endes sein eigener Komponist werden kann." (GOULD 1987, 151)<br />
In seinem Aufsatz The Prospects of Recording vertritt GOULD des Weiteren die<br />
These, dass der Umgang mit Musik als Konsequenz der Medienentwicklung die<br />
Aura des Besonderen verlieren würde und, ähnlich wie das Schreiben im Zuge der<br />
Entwicklung schriftlicher Medien, zu einer Standardkulturtechnik werden könnte:<br />
Musikalische Betätigung wäre nicht mehr a priori als künstlerisch zu begreifen:<br />
"Tatsächlich wird diese ganze Frage der Individualität in der kreativen Situation<br />
– in dem Prozeß, durch welchen der kreative Akt aus individuellen Meinungen<br />
resultiert, diese absorbiert und verwandelt – einer radikalen Revision<br />
unterworfen werden.<br />
Ich glaube, die Tatsache, daß Musik eine so umfassende Rolle in der Regulierung<br />
unserer Umwelt spielt, deutet daraufhin [sic], daß sie schließlich eine<br />
ebenso unmittelbare, nützliche und unfeierliche Rolle übernehmen wird wie<br />
die, die Sprache jetzt in unserer täglichen Lebensführung spielt. Damit Musik<br />
eine vergleichbare Vertrautheit erlangt, müssen die Implikationen ihrer Stile,<br />
ihre Gewohnheiten, ihre Manierismen, ihre Tricks, ihre üblichen Kunstgriffe,<br />
ihre statistisch häufigsten Vorkommnisse – mit anderen Worten, ihre Klischees<br />
– vertraut sein und von jedermann erkannt werden. Ein massenhaftes Erkennen<br />
der Klischeequotienten eines Vokabulars muß nicht bedeuten, daß wir mit den<br />
Banalitäten dieser Klischees vollgestopft werden. Wir achten große Werke der<br />
Literatur nicht geringer, weil wir als gewöhnliche Menschen die Sprache sprechen,<br />
in der sie zufälligerweise geschrieben sind. Die Tatsache, daß so vieles<br />
von unserer täglichen Konversation den langweiligen Vertraulichkeiten üblicher<br />
Höflichkeit gilt, den obligatorischen Bemerkungen über das Wetter, um<br />
ein Gespräch einzuleiten, und so weiter, trübt nicht für einen Moment unseren<br />
Sinn für die potentiellen Schönheiten der Sprache, die wir gebrauchen. Im Gegenteil,<br />
sie schärft ihn. Sie gibt uns einen Hintergrund, vor dem sich der Vordergrund,<br />
der der Standort des imaginativen Künstlers ist, um so besser abhe-
en kann. Meiner Ansicht nach wird im Zeitalter der Elektronik die Kunst der<br />
Musik zu einem viel brauchbareren Bestandteil unseres Lebens werden, viel<br />
weniger nur ein Ornament an ihm sein und es folglich viel tiefgreifender<br />
verändern.<br />
Wenn diese Veränderungen tiefgreifend genug sind, könnten wir schließlich<br />
genötigt sein, die Terminologie, mit der wir unsere Gedanken über Kunst zum<br />
Ausdruck bringen, neu zu definieren. Tatsächlich kann es zunehmend unpassender<br />
werden, auf die Beschreibung von Umweltsituationen das Wort 'Kunst'<br />
selbst anzuwenden – ein Wort, das, wie ehrwürdig und geehrt auch immer,<br />
zwangsläufig mit ungenauen, wenn nicht in der Tat obsoleten Nebenbedeutungen<br />
erfüllt ist." (GOULD 1987, 159)<br />
GOULDS Hinweis auf die zu erwartende Vertrautheit mit Klischees meint nichts anderes<br />
als die Vertrautheit mit der musikalischen Sprachstruktur, oder, wie es an anderer<br />
Stelle von Musikpsychologen formuliert wurde, mit den semantischen Makrostrukturen<br />
des jeweiligen Musikstils. Auch die gegenwärtige Omnipräsenz musikalischer<br />
Klischees in Form von Berieselung muss nicht im Widerspruch stehen zur<br />
Emanzipation des Musikhörers, im Gegenteil: Projiziert man die einschneidenden<br />
Auswirkungen der Entwicklung reiner Wiedergabetechnologien auf die Präsenz von<br />
Klangtapeten in die Zukunft unter Berücksichtigung neuer Entwicklungsmöglichkeiten<br />
auf dem Gebiet des interaktiven Umgangs mit musikalischen Strukturen,<br />
bietet die heute allgegenwärtige Berieselung nur eine vage Vorahnung davon, in<br />
welcher Breite als Folge der Realisierung geeigneter medialer Möglichkeiten musikalische<br />
Aktivität möglich sein wird.<br />
Bereits HEINRICH JACOBY erachtete es als erstrebenswert, die prinzipielle Verknüpfung<br />
von Musizieren und Kunst aufzubrechen. Er sah in dieser Verbindung ein kulturell<br />
hemmendes Phänomen, welches natürliche und unverkrampfte musikalische<br />
Aktivität erschwert. JACOBY wies darauf hin, dass im Zusammenhang mit der angestrebten<br />
Normalisierung des Umgangs mit musikalischer Syntax auch die Lernvorgänge<br />
einen natürlicheren, "muttersprachlichen" Ansatz gewinnen würden. Indem<br />
musikalische Betätigung ihre künstliche Überhöhung verlöre, würde nach seiner<br />
Einschätzung auch das Phänomen der "Unmusikalität" hinfällig:<br />
"Dieser Hinweis auf die Muttersprache zeigt vielleicht am deutlichsten, in welchem<br />
Sinne wir unsere Einstellung den anderen Ausdrucksgebieten gegenüber<br />
revidieren sollten und wie irreführend es wirkt, wenn wir bei Fragen, die Ausdrucksgebiete<br />
betreffen, ohne weiteres den Begriff Kunst verwenden. Auch bei<br />
der Musik müssen wir vermeiden, zuerst an Kunst oder Kunstwerke zu denken<br />
oder gar an das, was heute als eine gesellschaftliche Angelegenheit in unseren<br />
Theatern und Konzertsälen vor sich geht. Wir haben es in erster Linie mit dem<br />
163
164<br />
lebendigen, elementaren Ausdrucksmittel zu tun, durch das sich äußern zu<br />
können jedem aus den Gegebenheiten der menschlichen Natur heraus möglich<br />
und gemäß ist. [...] In diesem Zusammenhange wird die Behauptung 'Jeder<br />
Mensch ist musikalisch' nicht mehr so paradox erscheinen, wie sie manchem<br />
sonst im ersten Augenblick klingen könnte. Dahin zu gelangen, daß diese Behauptung<br />
mehr als theoretische Bedeutung erhält, – daß viel mehr Menschen<br />
als bisher zu einer Entfaltung der eigenen musikalischen Äußerungs-Fähigkeit<br />
kommen, ist vom Standort der Erziehung aus zunächst wichtiger als die mehr<br />
oder weniger erfolgreiche reproduktive Auseinandersetzung mit dem in Laufe<br />
von Jahrhunderten aufgehäuften Schatz von Kulturgütern, von Werken großer<br />
Meister, der durch Aufführungen erst wieder lebendig gemacht werden muß.<br />
Selbstverständlich hat auch die musikalische Literatur ihre bedeutsame Rolle<br />
in der Erziehung zu spielen, aber nicht, indem man, wie jetzt [1921, H.K.]<br />
noch meistens, unreife Kinder dazu dressiert, Kunstschöpfungen aus einer<br />
Ausdruckswelt, deren Sprache sie weder zu verstehen noch zu sprechen vermögen,<br />
nachzuplappern. Erst wenn Musik bereits eigenes, lebendiges Äußerungsmittel<br />
geworden ist, dürfte an eine Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk<br />
gedacht werden, die dann intensiver und lebensvoller vor sich gehen<br />
wird, als es bei denen zu erwarten ist, die nie anders als aus dem Notenbuch zu<br />
musizieren gelernt haben. Der Kreis derer, die auf eine solche Weise teil an einer<br />
lebendigen musikalischen Kultur haben können und die erst durch ihre<br />
Existenz das Vorhandensein einer solchen Kultur bezeugen, wird bedeutend<br />
größer sein, als man heute anzunehmen geneigt ist. [...]<br />
Wenn es gelingt, [...] den Nachweis zu erbringen, daß vieles, was heute als<br />
Reservat des 'Künstlers' oder 'Fach'-musikers gilt, auf einem geeigneten Weg<br />
der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden kann, so kommt dadurch die<br />
Kunst nicht in Gefahr. Im Gegenteil! Es wird jene, die Bedeutung des Kunstbegriffs<br />
entwertende Oberflächlichkeit verschwinden, mit der man oft eine<br />
vielen mögliche, an sich selbstverständliche Beziehung zu Ausdrucksmitteln<br />
wegen ihrer verhältnismäßigen Seltenheit als 'Kunst'-Leistung bewertet".<br />
(JACOBY 1995, 12f.)<br />
Für GLENN GOULD resultiert aus einer solchen Normalisierung des Umgangs mit<br />
Musik neben der Auflösung der Standesschranken zwischen musizierenden und<br />
konsumierenden Bevölkerungsteilen auch eine Aufgabenvermischung unter all denen,<br />
die sich mit Musik beschäftigen:<br />
"Indem dieses Medium sich entwickelt, indem es verfügbar wird für Situationen,<br />
in denen ganz zurecht die freie Beteiligung des Hörers ermutigt wird,<br />
werden jene ehrwürdigen Unterscheidungen in der Klassenstruktur innerhalb<br />
der musikalischen Hierarchie – Unterscheidungen, die Komponist, ausführende<br />
Künstler und Interpreten voneinander getrennt haben – aus der Mode kommen."<br />
(GOULD 1987, 158)
Diese Auflösung der kategorischen Trennung in Menschen, die Musik herstellen<br />
und andere, die sie konsumieren, wird durch ein neues Medium symbolisiert, das<br />
sich seit etwa einem Jahrzehnt entwickelt und das die Eigenschaften von Musikinstrument<br />
und Wiedergabemedium in sich vereint: den Sampler (vgl. Abschnitt<br />
3.3.3). Dieser kann einerseits über ein Keyboard oder MIDI-Befehle gesteuert werden,<br />
was zunächst auf eine Funktion als Musikinstrument hindeutet. Wird der<br />
Sampler aber dazu veranlasst, ein längeres Klangereignis wiederzugeben, übernimmt<br />
er die Funktion eines Wiedergabemediums. Dabei unterscheiden sich die<br />
beiden Qualitäten Musikinstrument und Wiedergabemedium ausschließlich quantitativ<br />
durch die Länge der wiedergegebenen Samples, was nichts anderes bedeutet als<br />
eine Verschmelzung der beiden genannten Qualitäten und damit eine Entgrenzung<br />
der bislang streng getrennten Tätigkeiten "Musikkonsum" und "Musizieren": Es<br />
lässt sich keine klare Grenze mehr definieren, ab welcher Länge der aufgenommenen<br />
Samples es sich nicht mehr um ein Musikinstrument, sondern um ein Wiedergabemedium<br />
handelt. Der Sampler bildet damit auch das Bindeglied zwischen (von<br />
den Triggerimpulsen her betrachtet) steuerdatencodierender und (aus der Sicht der<br />
Samples) klangdatencodierender Aufzeichnung.<br />
Einen Einblick in die Praxis des Samplings bietet ein Interview mit DJ Shadow,<br />
veröffentlicht im Dezember 1997 in der Zeitschrift Keyboards. DJ Shadow produziert<br />
CDs, bei deren Aufnahme kein einziges (weder akustisches noch elektronisches!)<br />
Musikinstrument zum Einsatz kommt. 38 Er berichtet von seinem spontanen<br />
Entschluss, mit dem Sampler Musik zu komponieren. Zwischen Entscheidung und<br />
Realisierung lagen dabei weder Kurse in Musiktheorie noch Etüden; die Elektronik<br />
ermöglichte es ihm, seine musikalischen Gedanken auszuprobieren und direkt in die<br />
Tat umzusetzen:<br />
"Ich habe mir seit 1983 Hip-Hop-Sachen gekauft. Der eigentliche Einfluß aber<br />
kam von meinem Vater, der Platten wie Isaac Hayes' Hot Buttered Soul, Sachen<br />
von Three Dog Night und so was gehört hat. Und was ich nie vergessen<br />
werde, war mein erstes Public-Enemy-Konzert in Oakland. Ihr Album Takes a<br />
Nation of Millions kam raus, und da hatten sie einen der Songs von Hot<br />
Buttered Soul gesampelt und in Black Steel in the Hour of Chaos benutzt. Damit<br />
konnte ich also gleich was anfangen, und ich erinnere mich noch, daß ich<br />
gedacht habe: 'Mein Gott, genau das könnte ich machen.'" (RULE 1997, 16f.)<br />
38 In der Beilage zur CD "Entroducing" (Marlboro Music 00088332) heißt es: "This album consists<br />
entirely of samples. No live instruments, drum machines or keyboards were used."<br />
165
Unbemerkt von weiten Teilen der Musikwissenschaft haben sich die DJs in den<br />
letzten Jahren zu Musikern entwickelt und neue Tätigkeitsfelder erobert, die weit<br />
über ihre ursprüngliche Aufgabe, Schallplatten aufzulegen, hinausgehen. Dabei hat<br />
sich unter maßgeblicher Nutzung des Samplers das "Mixen" auf immer kleinere musikalische<br />
Einheiten ausgedehnt. Die DJs verkörpern die Durchlässigkeit vom Musikkonsumenten<br />
zum Musiker und sind dabei zu einer neuen Art von "Componisten"<br />
im eigentlichen Wortsinn geworden. Für die Stile des Hip-Hop etwa ist die Verschmelzung<br />
von Musikkonsument und Musiker auf diese Weise bereits Realität.<br />
Auch ULF PORSCHARDT, Verfasser der Arbeit DJ-Culture, dem wegweisenden musikwissenschaftlichen<br />
Beitrag zur Emanzipation des Diskjockeys, sieht davon einschneidende<br />
gesellschaftliche Veränderungen ausgehen:<br />
166<br />
"Wie die Künstler im Mittelalter waren die DJs zunächst als Handwerker definiert.<br />
Den DJ als Star und 'Autor' gibt es – von einigen Ausnahmen abgesehen<br />
– erst seit kurzem. Doch der DJ-Culture gehört die Zukunft der Popmusik. Neil<br />
Tennant von den Pet Shop Boys ist sich ganz sicher: 'Auf Dauer sind zwei<br />
Plattenspieler und ein Mischpult aufregender als fünf Gitarrensaiten.'<br />
Der DJ stellt den herkömmlichen Künstlerbegriff in Frage, sprengt ihn und<br />
wird ihn in renovierter Form re-etablieren." (POSCHARDT 1995, 15)<br />
Eine Technik des Zusammensetzens ("Komponierens") im allerweitesten Sinn stellt<br />
zwar auch die traditionelle Tätigkeit des Diskjockeys dar, indem Tonträger seriell<br />
aneinandergereiht werden. Seit DJs aber begannen, mit den Schallplatten freier zu<br />
hantieren und, zunächst noch anhand von Vinyl-Schallplatten 39 und dann durch<br />
39 Noch heute spielen Vinyl-Schallplatten in der DJ-Szene insbesondere im Live-Betrieb aufgrund<br />
der physischen Zugriffsmöglichkeiten eine bedeutende Rolle. Einen Einblick in diese Tätigkeit<br />
bietet der Artikel "Die Musik gibt mir Kraft: Aus dem Alltag eines DJ", erschienen im Februar<br />
1997 in der Jugendbeilage "Cocktail" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung:<br />
"Der 23jährige besitzt eine Gitarre und einen Bass – seine wichtigsten 'Instrumente' sind jedoch<br />
zwei Plattenspieler, ein Mischpult und mehrere Hundert Vinylplatten. Mit denen kann er 'genauso<br />
Musik komponieren wie mit anderen Instrumenten auch'. Dabei geht er von dem Groove<br />
der zuerst aufgelegten Platte aus und baut den Beat der zweiten Platte in diesen Groove ein, die<br />
Übereinstimmung der beiden Beats überprüft er per Kopfhörer. Falls nötig, wird die Geschwindigkeit<br />
des zweiten Plattentellers elektronisch oder per Hand nachgeregelt, um danach den Sound<br />
der beiden Platten mit dem Mischpult übereinander zu spielen. Bei der Kombination von zwei<br />
Stücken können so immer wieder neue Werke entstehen, die einen fortlaufenden Rhythmus haben."<br />
(SCHOCHARDT 1997)<br />
Ein grundsätzlicher Wertewandel deutet sich hier in Form neuer Bedeutungen mehrerer musikalischer<br />
Fachtermini an: so sind die Begriffe "Instrument", "Komponieren" oder "Werk" in einer<br />
gegenüber dem traditionell üblichen Sinn deutlich ausgeweiteten Bedeutung verwendet.<br />
BERND ENDERS meint diese Tätigkeit des Live-Mixens, wenn er konstatiert:
Sampling, die Klangmanipulation auf immer kleinere Einheiten zu erweitern, gewinnt<br />
diese Art des "Komponierens" eine neue Qualität. Die Möglichkeit der digitalen<br />
Klangspeicherung und die damit verbundenen Möglichkeiten des Samplings<br />
bieten entscheidende Verfeinerungsmöglichkeiten über die Manipulation von analogen<br />
Vinyl-Schallplatten hinaus: das Sampling erlaubt die beliebige Genauigkeit des<br />
Zugriffs, was es den DJs ermöglicht, auch auf dem Gebiet der Musikproduktion tätig<br />
zu werden und eigene Werke aus "gesampeltem" Material herzustellen. Aus einem<br />
Interview mit dem britischen Drum 'n' Bass-Musiker RUPERT PARKES ("Photek")<br />
geht deutlich diese Möglichkeit des Musizierens hervor, die insbesondere den Bereich<br />
zwischen Instrumentalspiel und Komposition entscheidend erweitert:<br />
"Als ich 15, 16 Jahre alt war, begann ich, Tenorsaxophon zu spielen. Wie<br />
schon gesagt, war ich von John Coltranes Musik mehr als begeistert und habe<br />
Unterricht genommen. Natürlich habe ich in erster Linie versucht, meine Lieblingslieder<br />
nachzuspielen usw. Auf diese Weise habe ich schon eine Menge<br />
über Musik gelernt, aber etwa 1 1/2 Jahre später habe ich dann doch begriffen,<br />
daß ich eigentlich nicht ein bestimmtes Instrument spielen möchte, sondern<br />
vielmehr Schallplatten machen wollte. Nehmen wir doch die Musik von John<br />
Coltrane: in so einem Stück arbeiten Saxophon, Kontrabaß und Schlagzeug zusammen.<br />
Mit meinen Saxophon-Kenntnissen war ich in der Lage diese Melodie<br />
nachzuspielen, die den Wiedererkennungswert ausmacht, aber das Geheimnis<br />
dieser Songs lag vielmehr in dem gekonnten Zusammenspiel aller Instrumente.<br />
Die Konsequenz: Ich verkaufte das Saxophon und holte mir stattdessen<br />
von Roland die W-30 Workstation. Das war nichts besonderes: eine<br />
Tastatur mit einem 15-Sekunden Sampler und integriertem Sequenzer: Damit<br />
fing ich an, herumzuexperimentieren, kleine HipHop und Techno Trax zu<br />
skizzieren." (VENUS 23 1996, 73)<br />
Dabei kann das musikalische Material bis in kleinste Details den künstlerischen<br />
Vorstellungen angepasst werden. Aus Tausenden von gesampelten Klängen, die<br />
teilweise nur den Bruchteil einer Sekunde dauern, werden z.B. von DJ Shadow neue<br />
Stücke hergestellt:<br />
"Die Diskjockeys, oder besser: die DJs sind die neuen Live-Musiker. Sie erstaunen durch ein<br />
virtuoses Musizieren mit Schallplatten, indem sie die rotierende Scheibe in verschiedenster<br />
Weise manipulieren, durch Scratching, d. i. ein drehzahlvariierendes Wischen über die Platte zur<br />
Generierung neuartiger Klanggeräusche, die einem laufenden Loop zugemischt werden, weiter<br />
durch geschickte Anpassung der Drehzahl und Synchronisierung zweier gleichzeitig laufender<br />
Platten und blitzschnelles, rhythmisch absolut timing-gerechtes Umschalten mit dem Mixer von<br />
einem Track auf einen anderen etc." (ENDERS 1995, 65)<br />
Im Zuge der Weiterentwicklung der Digitaltechnik werden aber möglicherweise auch im DJ-Betrieb<br />
die analogen Vinyl-Schallplatten an Bedeutung verlieren.<br />
167
168<br />
"Die meisten Breaks aus dem Album bestehen aus neun Chops, also Sample-<br />
Stückchen, manchmal sind es auch mehr. Anders gesagt, wenn der Break etwa<br />
so geht [singt: bum, bum, gat...gat, da-bum, gat], dann klingt das zu primitiv<br />
und old-fashioned für mich, wenn ich es einfach loope. Also sample ich den<br />
ersten Bassdrumschlag, dann die Snare, dann die HiHat, dann die nächste<br />
Snare und so weiter. So kann ich den Beat von der Platte für ein paar Takte<br />
lang so rekonstruieren, wie er im Original war, ich kann aber auch später etwas<br />
ganz anderes daraus machen.Eine Supersache, die ich auf der MPC [Sampler,<br />
H.K.] rausgefunden habe, ist die Fade-Funktion. Ich mag es nicht, wenn meine<br />
Beats, die ja aus gesampelten Stückchen bestehen, so zerstückelt klingen, wie<br />
sie es ja tatsächlich sind. Wenn ich eine Loop mache [...], dann besteht die<br />
Schwierigkeit darin, daß sie klingt wie eine Loop aus einzelnen Stückchen<br />
oder eine Loop, die es vorher nicht gab. Also sagen wir mal, du hast Schnipsel<br />
von einer Loop gesampelt, und möchtest nicht, daß es irgendwie zerhackt<br />
klingt. Du möchtest nicht, daß man hört, wie der Decay von der Snare abgeschnitten<br />
wird oder so etwas, oder dass keine Ambience auf der Kickdrum ist.<br />
Dann gebe ich ihr diese Ambience. Manchmal sample ich einfach Luft von der<br />
Platte und leg sie drüber. Und hier kommt die fade-Funktion ins Spiel. Wenn<br />
ich Luft sample, und das klingt dann wie [singt: tschhhhhhh], dann wird<br />
daraus, wenn du es einfadest, [singt: wwhhschhhhhh]. Und wenn du das jetzt<br />
dauernd wiederholst, dann erzeugt das eine unglaubliche Weichheit, und du<br />
hast absolut keine leeren Stellen mehr. Man sollte das natürlich nur machen,<br />
wenn es nötig ist. Es kann sein, daß das nur einmal in einer zweitaktigen Loop<br />
der Fall ist. Auch wenn der Drummer irgendwas gespielt hat, was dir nicht gefällt,<br />
oder du hast einen Knackser auf der Platte, der dich zwingt, einen Sound<br />
früher abzuschneiden, als du eigentlich möchtest, kannst du die Luft einfliegen,<br />
um die leere Stelle zu füllen.<br />
Wenn das Drumpattern sehr komplex klingt, dann soll das auch so sein. Ich<br />
möchte, daß die Leute hören, wie viel Zeit ich mir für jedes Detail des Samples<br />
nehme. Ich betrachte den Sampler genauso wie andere Leute ihre Gitarre oder<br />
ihr Schlagzeug sehen. Ich möchte der Beste auf diesem Instrument sein."<br />
(RULE 1997, 20)<br />
Der Vergleich mit Gitarre oder Schlagzeug ist aus musikstruktureller Sicht durchaus<br />
berechtigt, sind doch die hierbei verarbeiteten musikalischen Einheiten vergleichbar<br />
mit der strukturellen Feingliedrigkeit schriftlicher Codierung in Noten. Ein Unterschied<br />
zum traditionellen Instrumentalspiel liegt aber neben der Verschmelzung von<br />
Instrument und Medium in der Flexibilität der Verarbeitung, die nicht wie ein Notentext<br />
zwangsläufig auf diese kleinsten Einheiten reduziert, sondern beliebig grobe<br />
oder feine und damit jederzeit sinnvolle (im Sinne der semantischen Makrostruktur)<br />
Strukturierung zuläßt. Gleichzeitig steht das auditive Signal im Mittelpunkt der mu-
sikalischen Betätigung. Den einzig sichtbaren Unterschied zwischen U- und E- Musikwerken<br />
scheint diesbezüglich noch das Vorhandensein einer Partitur darzustellen.<br />
Aber auch dieser Unterschied geht verloren, indem Autodidakten nachträglich<br />
grafische Partituren erstellen. Ein Beispiel hierfür ist ERIK M, über den die Neue<br />
Musikzeitung berichtet:<br />
"Erik M wurde 1970 in der Nähe von Mühlhausen geboren und absolvierte<br />
keinerlei musikalische oder akademische Ausbildung. [...] Heute besteht sein<br />
Equipment aus allen möglichen Geräten, Hi-Fi-Komponenten wie Minidisc<br />
und CD-Player, aber auch Lo-Fi-Geräte wie tragbare Plattenspieler aus den<br />
60er und 70er-Jahren. In unterschiedlichen Zusammenstellungen benutzt der<br />
Musiker diese Geräte als Instrumente, zum Beispiel eine Gruppe aus vier Plattenspielern,<br />
Minidisc- und CD-Playern oder eine um einen Sampler ergänzte<br />
Kombination. [...] In anderen Stücken greift Erik M auf andere Verfahren zurück:<br />
Collagieren, Samplen, Klangsynthese und -bearbeitung per Computer,<br />
alles Arbeitsweisen und Kompositionstechniken der avancierten, zeitgenössischen<br />
Musik, im Besonderen der elektronischen Musik und der musique concrète.<br />
Genau wie diese verwendet Erik M Technologie, Geräte vom Plattenspieler<br />
bis zum Computer und Tonmaterial von Umweltaufnahmen über Tonkonserven<br />
bis hin zu synthetisiertem Klang. Schließlich hat er eine Notation<br />
für seine Musik entwickelt. Er schreibt grafische Partituren, die die Struktur<br />
seiner Stücke [...] auf einer Zeitachse präzise verzeichnen. Mit diesen Partituren<br />
kann jeder, der die Geräte und Tonträger besitzt, das jeweilige Stück nachspielen.<br />
Daneben verwendet Erik M sein Instrumentatium zum freien Improvisieren."<br />
(EHRLER 2001, 5)<br />
Diese Entgrenzung von Musikkonsum und Musizieren durch die Verschmelzung<br />
von Medium und Musikinstrument besitzt das Potenzial einer breiten gesellschaftlichen<br />
Entwicklung. Die Software-Industrie trägt ihren Anteil dazu bei, indem sie<br />
Produkte auf den Markt bringt, die es jedermann ermöglichen sollen, unter einer einfachen<br />
Benutzeroberfläche eigene kompositorische Experimente nach DJ-Art zu<br />
vollziehen. Dabei stehen häufig zunächst in einer Art Baukastensystem verschiedene<br />
Klänge, Rhythmen, usw. zur Verfügung, die graphisch angeordnet und beliebig<br />
kombiniert werden können. Beispielsweise bemüht sich die Softwarefirma Systhema<br />
mit ihrem Programm Soundtoys um neue Darstellungsformen von musikalischen<br />
Strukturen, wie RODERICH ROMAN TYLSKI in der Jugendbeilage Cocktail der<br />
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 4. April 1997 berichtet:<br />
"Wer andere Menschen mit seinen musikalischen Ergüssen nicht unnötig quälen<br />
wollte, mußte bis vor wenigen Jahren zumindest ein Instrument beherrschen.<br />
Und wer sich sogar an Musik mit dem Computer heranwagte, stand vor<br />
169
170<br />
einem viel größeren Problem: Er mußte Bücher wälzen und die Programmierung<br />
der Software pauken. Dank Multimedia sind heute diese Hemmnisse gefallen.<br />
Ein Programm wie 'Soundtoys' macht es leicht, selbst zu komponieren,<br />
aufzunehmen und zu reproduzieren. [...] Die Synthesizer-Sounds, Rhythmen<br />
und Effekte lassen sich zu immer neuen Melodien und Sequenzen kombinieren."<br />
(TYLSKI 1997, 3)<br />
Die Zeitschrift Keyboards berichtet über ein Konkurrenzprodukt der Firma Arboretum:<br />
"Neu im Arboretum-Programm ist auch das Programm MetaSynth. Bei der für<br />
Macintosh PowerPC erhältlichen Software handelt es sich um ein Sound-Design-<br />
und Kompositions-Werkzeug, das komplett grafik-orientiert arbeitet und<br />
vor allem auch 'Nicht-Musikern' helfen soll, neue Klangwelten zu erschließen.<br />
(Keyboards 12/1997, 13)<br />
Die zunehmende Verbreitung solcher Software trägt einem verbreiteten Bedürfnis<br />
nach eigenkreativem Umgang mit Musik auch auf dieser gegenüber der reinen Wiedergabe<br />
von Tonträgern deutlich differenzierteren strukturellen Ebene Rechnung. Im<br />
Gegensatz zur Tätigkeit der DJs, die frei mit beliebigen Samples hantieren, weist<br />
diese Software zwar teilweise noch eingeschränkte Möglichkeiten auf. Prinzipiell<br />
schafft die Technologie der Implementierung eines Software-Samplers im Heimcomputer<br />
aber die grundlegend neue Situation, dass jeder mit einem Computer ausgestattete<br />
Haushalt technisch in die Lage nahezu unbegrenzten Musikproduktionspotenzials<br />
versetzt wird. Je nach dem musikalischen Bildungshorizont der Anwender<br />
mögen mit Hilfe solcher Softwareprodukte zwar in Mengen undifferenzierte<br />
Erzeugnisse entstehen. Grundsätzlich erweitert diese Technologie aber die Möglichkeit<br />
des Umgangs mit musikalischem Material für weite Bevölkerungskreise fundamental.<br />
Bei der Bewertung dieser Phänomene darf nicht der Fehler einer Vermischung<br />
grundsätzlicher Möglichkeiten einer Technologie mit bereits vorliegenden künstlerischen<br />
Ergebnissen gemacht werden. Die Tatsache, dass es sich aus der Sicht von<br />
Musikpädagogik und Musikwissenschaft hierbei möglicherweise um Erzeugnisse<br />
von niedrigstem Niveau handeln mag, ändert nichts am zukunftsweisenden Potenzial<br />
der Technologie, war doch die Verwirklichung musikalischer Bedürfnisse des Einzelnen<br />
bislang entweder von Massenmedien abhängig und trug dadurch deutliche<br />
Züge verordneten Konsums oder war an den nur für eine Minderheit realisierbaren<br />
Besuch einer Musikschule gebunden. Für den Großteil der Bevölkerung, dessen<br />
Möglichkeiten sich bislang darauf beschränkten, ein Radioprogramm aus vielleicht
einem Dutzend Möglichkeiten auszuwählen oder ein Musikprogramm aus Tonträgern<br />
zusammenzustellen, wird erstmals das Experimentieren auf der Grundlage musikalischer<br />
Strukturen möglich. Bedeutsam ist hierbei auch die Aussicht, dass durch<br />
die flexible Strukturierung Wechsel von einer Stufe niedriger Komplexität des Musizierens<br />
zu einer Stufe höherer Komplexität ermöglicht wird und damit jedes Hantieren<br />
mit entsprechendem Material zum Lernvorgang werden kann.<br />
So "popularistisch" solche Ansätze zunächst auch erscheinen mögen, so sehr müssen<br />
sie ernstgenommen werden, sind sie doch darüber hinaus in der Lage, erkannte Defizite<br />
der traditionellen Musikpädagogik auszugleichen: Gegenüber herkömmlichem<br />
Instrumentalunterricht ist ein flexibler und jedermann zugänglicher Umgang mit<br />
klanglichem Material auf einer seinem musikalischen "Fassungsvermögen" (H.<br />
RIEMANN, vgl. S. 64) angepassten strukturellen Ebene möglich. Der Lernvorgang<br />
vollzieht sich in direktem, experimentellem Kontakt zum Klang ohne restriktive<br />
oder separierende Faktoren. Der Umweg über das visuelle Medium kann (zunächst)<br />
vermieden werden. Im Gegensatz zur traditionell schriftlich orientierten Musikpädagogik<br />
kommen hier erstmals in der Geschichte der Musikerziehung musikalische<br />
Hör- und Äußerungsmöglichkeiten breiter gesellschaftlicher Kreise auf ein und derselben<br />
musikalisch-strukturellen Ebene zur Deckung.<br />
Auf dem Gebiet der Musik könnte ein vergleichbarer Prozess in Gang kommen mit<br />
dem der Alphabetisierung im Zuge der Verbreitung schriftlicher Medien. Als die<br />
Beherrschung der Schrift von der Ausnahmeerscheinung zur Normalität wurde, verschwand<br />
die künstlerische Aura des Schriftkundigen. Dass sich im bisherigen Verlauf<br />
der Geschichte der Elektrizität trotz explosionsartiger Zunahme der Musikpräsenz<br />
durch Massenmedien musikalische Fähigkeiten in der Gesellschaft aber nicht<br />
signifikant verbessert zu haben scheinen und die musikalischen Äußerungsformen<br />
großer Teile der Gesellschaft sich darauf beschränken, konsumierend einer – allerdings<br />
riesigen – Musikindustrie zu huldigen, mag neben der Kürze der seither verstrichenen<br />
Zeit an der Struktur traditioneller Medien, genauer gesagt, an der mangelnden<br />
Durchlässigkeit zwischen bislang zur Verfügung stehenden Möglichkeiten<br />
der Behandlung von musikalischem Material liegen, wie sie als entweder sehr grob<br />
oder sehr fein beschrieben wurden (vgl. Abschnitt 4.5.1). Die folgende Vision<br />
ARNOLD SCHÖNBERGS zur gesellschaftlich-musikalischen Entwicklung kann erst<br />
Realität werden, wenn multimediale Einrichtungen flexible Kombinationen und<br />
Durchlässigkeiten zwischen den von ihm genannten Möglichkeiten des Lesens, des<br />
Spielens und des Hörens von Musik zur Verfügung stellen; Multimedialität ermöglicht<br />
dabei die Betonung des folgenden Satzes auf dem Wörtchen "und":<br />
171
172<br />
"Die musikalische Bildung würde schneller um sich greifen, wenn die Leute<br />
mehr Musik läsen, spielten und hörten, als es heute [1939, H.K.] geschieht."<br />
(SCHÖNBERG 1992, 141)<br />
Die junge steuerdatencodierende Aufzeichnungsart bietet neue Möglichkeiten der<br />
Verbindung von schriftlicher und auditiver Codierung auch klassischer Musik. Diese<br />
Technologie schafft die Voraussetzung dafür, dass auch die Schriftlichkeit von Musik<br />
vom musikkulturellen Normalisierungsvorgang nicht ausgeschlossen bleiben<br />
muss. Es existieren vielfältige Softwarelösungen in Form sogenannter Sequencer<br />
(vgl. S. 119), die in der Lage sind, die Daten einer mit einer Tastatur gespielten Musik<br />
zu speichern und in Notenform zu drucken – was der Göttinger Ökonomieprofessor<br />
JOHANN BECKMANN etwas voreilig bereits im Jahr 1786 für möglich gehalten<br />
hatte. BECKMANN berichtete in seinen Beyträgen zur Geschichte der Erfindungen<br />
von der Erfindung des "Melographen", einer Maschine, die die Tastenbewegung<br />
eines Klaviers in Notenschrift umsetzt:<br />
"Des Hrn. Ungers eigene Beschreibung seiner Erfindung ist im Jahre 1774 zu<br />
Braunschweig [...] unter folgendem Titel einzeln gedruckt worden: Entwurf einer<br />
Maschine, wodurch alles, was auf dem Clavier gespielet wird, sich von<br />
selber in Noten setzt;" (BECKMANN 1786, Bd.1, 30)<br />
Heute können gespielte Sequenzen beliebig, auch in Notenform, dargestellt oder<br />
umgekehrt mittels Scanner Notenblätter in MIDI-Dateien umgewandelt werden; als<br />
MIDI-Datei vorliegende Musik kann in Notenform gedruckt, am Bildschirm angezeigt,<br />
verändert oder in ausgedruckter Form vom Blatt gespielt werden. Die steuerdatencodierende<br />
Musikaufzeichnung (vgl. 3.3.2) verbindet dabei visuelle und auditive<br />
Codierungsformen, vereint Eigenschaften von Primär- und Sekundärmedium<br />
und schafft die Möglichkeit multimedialer Darstellung. Ein Beispiel für eine solche<br />
multimediale Darstellung liefert die Schott Digital Music Library, wo auditive und<br />
visuelle Information simultan präsentiert wird:
Abb. 23: Schott Digital Music Library: JOHANN SEBASTIAN BACH: Klavierwerke.<br />
Anhand von mittels Steuerdatencodierung gespeicherter Musik ist auch eine Kommunikation<br />
zwischen Musikern möglich, die unterschiedliche Herangehensweisen<br />
an Musik pflegen. Beim Austausch von MIDI-Dateien steht es jedem Musiker frei,<br />
die ihm angemessene Darstellungsform, ob auditiv oder visuell, in Tabulatur- oder<br />
Notenform, zur Bearbeitung zu wählen. Auch für Menschen, die die Notenschrift<br />
nicht beherrschen, wird auf diese Weise das Komponieren von Werken größeren<br />
Umfangs und größerer Besetzung möglich. Seine 1997 uraufgeführte Sinfonie Standing<br />
Stone etwa hat PAUL MCCARTNEY, wie die Westdeutsche Zeitung berichtet,<br />
mit Keyboard und Computer komponiert:<br />
173
174<br />
"McCartney, der Noten weder lesen noch schreiben kann, hatte das Stück mit<br />
Hilfe eines Computers komponiert und es sich dann von einem Beraterteam<br />
orchestrieren lassen.<br />
Musik von Grund auf zu lernen, sei ihm versagt geblieben, berichtet er."<br />
(Westdeutsche Zeitung, 16.10.1997)<br />
In MCCARTNEYs Bedauern über die ihm entgangene musikalische Ausbildung<br />
schwingt der für die westliche Musikkultur typische Minderwertigkeitskomplex des<br />
musikalischen "Analphabeten" mit. Dass diese gängige Verknüpfung von Musikalität<br />
und Beherrschung der Notenschrift aber in die Irre führt, wurde bereits auf S. 148<br />
angedeutet. Wenn nun der deutsche Massenkomponist von Schlagermusik, RALPH<br />
SIEGEL, nach seiner Niederlage gegen ALF IGEL alias STEFAN RAAB in der<br />
deutschen Vorauswahl zum Grand Prix de la Chanson 1998 versucht, seinen<br />
Kontrahenten durch Verbreitung der folgenden Information abzuqualifizieren:<br />
"[...] der müsse 'seine Song-Ideen auf ein Diktiergerät singen, weil er keine<br />
Noten schreiben kann'." (WAZ, 24.4.1998),<br />
so symbolisiert dies das Rückzugsgefecht der unterlegenen visuellen gegen die gestärkte<br />
auditive Herangehensweise an Komposition. Eine solche Äußerung wird<br />
nicht mehr lange geeignet sein, musikalische Kompetenz eines Konkurrenten zu<br />
diskreditieren – wird doch nun die folgende Vision des 1977 verstorbenen Dirigenten<br />
LEOPOLD STOKOWSKI Realität:<br />
"One can see coming ahead a time when a musician who is a creator can create<br />
directly into tone, not into paper:" (zit. nach UNGEHEUER 1992, 84)<br />
Dies ist die Emanzipation des Kompositionsvorgangs vom schriftlichen Medium.<br />
In der Folge dieser Loslösung des musikalischen Schaffensprozesses von der<br />
Schriftlichkeit vermischen sich auch Improvisation und Komposition. Jede Improvisation<br />
auf einem MIDI-fähigen Musikinstrument kann gedruckt oder auf Tonträger<br />
veröffentlicht und damit zum "Werk" werden. Der geringe Speicherbedarf von steuerdatencodierter<br />
Musik trägt dazu bei, dass z.B. im Internet solch ein Werk bereits<br />
heute in beliebigem Umfang und praktisch ohne Kosten veröffentlicht werden kann.<br />
Auch diese Auflösung medialer Hemmnisse trägt zur Entmystifizierung und Popularisierung<br />
der Tätigkeit des Komponierens bei. JOSEPH HAYDN brauchte noch mindestens<br />
das Blatt Papier, den Verleger, den Notensetzer, den Druckstock und die Postkutsche,<br />
um aus seinen allmorgendlichen Improvisationen Kompositionen von ge-
wissem Verbreitungsgrad werden zu lassen. Jeden Morgen nach dem Frühstück<br />
nämlich, so berichtet sein Biograph ALBERT CHRISTOPH DIES,<br />
"[...] setzte er sich ans Klavier und phantasierte so lange, bis er zu seiner Absicht<br />
dienende Gedanken fand, die er sogleich zu Papier brachte. So entstanden<br />
die ersten Skizzen von seinen Kompositionen." (DIES 1962, 209f.)<br />
Unter heutigen Bedingungen hätte HAYDNS Kompositionsweise vielleicht so ausgesehen,<br />
wie JOE ZAWINUL bei der Produktion seiner CD Stories from the Danube<br />
Mitte der neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts vorgegangen ist. Er gibt<br />
über seine Art, Musik zu schreiben (!) in einem Interview der Zeitschrift Keyboards<br />
Auskunft:<br />
"Ich schreib ja anders als die trainierten Komponisten, ich hab' das nie gelernt."<br />
"Sie improvisieren alle ihre Stücke..."<br />
"Ja, ich improvisiere alles. Ich hab' auch bei diesem Stück alles improvisiert<br />
und dann orchestriert."<br />
"An einem Keyboard oder an einem Piano?"<br />
"Nur an Keyboards."<br />
"Dann sicher gleich mit dem Gesamtklang des Orchesters im Kopf?"<br />
"Ja, denn Keyboards klingen ja wie ein Orchester, das ist ihr Vorteil. Es war<br />
sehr einfach, ich hab' zwei, drei Tage improvisiert und viel mehr, als man jetzt<br />
hört. Ich hab dann einfach den Computer aufgedreht. Es erlaubt einem, wie auf<br />
einem Tape zu improvisieren, aber man kann alles ausdrucken und sieht sofort,<br />
wie es gespielt wird. Und mit der Information vom Druck und dem, was ich<br />
selbst runtergeschrieben hab' vom Tape, ist es einfach zu orchestrieren."<br />
(Keyboards 7/1996, 30)<br />
Die Tatsache, dass ein weltberühmter Musiker wie JOE ZAWINUL, der einen guten<br />
Teil seines Lebensunterhalts wahrscheinlich aus Tantiemen bestreiten kann,<br />
beteuert, er habe nie komponieren gelernt, mag vielleicht als Koketterie aufgefasst<br />
werden. Sie verdeutlicht darüber hinaus aber die tiefgreifenden Veränderungen, die<br />
der Umgang mit Musik durch neue Technologien erfährt: Die Möglichkeit des<br />
175
klanglichen Experiments eröffnet, wie bereits GLENN GOULD vorausgesehen hatte,<br />
in der Tat jedermann die Möglichkeit der Komposition.<br />
Wie aber jedes mit Hilfe elektroakustischer Medien aufgezeichnete Klangexperiment<br />
zur Komposition wird, wird auch jede Komposition, die mit Computerhilfe<br />
und nicht mit Bleistift und Papier entsteht, zum Klangexperiment. Die Komposition<br />
gewinnt damit auch "improvisatorische" Aspekte, indem Kompositionen bereits<br />
während ihres Entstehungsprozesses der Überprüfung unterzogen werden können.<br />
Der Schweizer Komponist RAINER BOESCH pflegt die so entstehenden Möglichkeiten<br />
als "Malen mit Musik" zu bezeichnen. Seiner Meinung nach fällt ein entscheidender<br />
Grund für das Phänomen, dass es wesentlich mehr Amateur-Maler als Amateur-Komponisten<br />
gibt. Eines Tages könnte dieses "Malen mit Musik" so selbstverständlich<br />
sein wie das Malen von Bildern mit Farbe und Papier. Was von den Pionieren<br />
der elektronischen Musik der 50er Jahre mit Magnettonband, Schere und<br />
Mischpult vorgemacht worden war, findet nun mit der Entlinearisierung der Tonaufzeichnung<br />
durch Computer, Festplatte und Sampler Einzug in die Kinderzimmer.<br />
Der Komponist und Pädagoge DAVID GRAHAM vergleicht diesbezüglich in einem<br />
Interview zunächst bisherige Formen des Kunst- und Musikunterrichts an<br />
allgemeinbildenden Schulen:<br />
176<br />
"Ich habe gemerkt, auch weil ich immer in Schulen gearbeitet habe, daß alle<br />
Kunstrichtungen kreativ unterrichtet werden, nur die Musik nicht. Das heißt,<br />
wenn man Kunst lernt in der Schule, dann studiert man nicht Rubens oder Picasso,<br />
sondern man malt direkt Bilder – schon im Kindergarten. Mit Musik<br />
macht man das ganz anders. Maximal übt man Mozart, was auch wichtig ist...<br />
die kreative und schöpferische Seite wird aber völlig übergangen." (BERHEIDE<br />
1998, 80)<br />
Auf die folgende Frage eines Schülers<br />
"Wie erklärst du dir, daß es im Unterschied, beispielsweise zum eigenständigen<br />
Malen in Kunstunterricht, im Musikunterricht keine ähnliche Unterrichtsweise<br />
gibt?" (BERHEIDE 1998, 80)<br />
antwortet Graham mit dem folgenden Hinweis auf die Medienproblematik:<br />
"Dafür gibt es für mich vor allem einen Grund: die Musik ist für die breite<br />
Masse immer ein Geheimnis geblieben – aufgrund dieser 'Zwischensprache',<br />
der Notenschrift. Sie ist wie eine Mauer, obwohl sie leicht zu erlernen ist.<br />
Beim Malen ist es etwas ganz anderes: Man hat einen Gedanken und malt einen<br />
Strich. Das ist ganz einfach und funktioniert – ohne Zwischenschritte. Man
sieht sofort was richtig und was falsch ist. Bei der Musik braucht man dagegen<br />
sogar noch Interpreten, die die Noten spielen können. Wer nicht ein bißchen<br />
auf dem Klavier improvisieren kann, hat grundsätzlich einige Probleme. Das<br />
hat dazu geführt, dass Musik immer eine elitäre Kunst gewesen ist."<br />
(BERHEIDE 1998, 80)<br />
Wenn sich aber ein Komponist sofort hörend mit dem Klang der von ihm geschaffenen<br />
Musik auseinander setzen kann, entsteht die Möglichkeit, die Dauer von Lernzyklen<br />
von angehenden Komponisten, den Klang der von ihnen erzeugten "Partituren"<br />
betreffend, zu minimieren. Ähnlich wie der Maler vor der Staffelei direkt das<br />
Ergebnis seines Tuns kontrollieren kann, indem er einige Schritte zurückgeht, wird<br />
es für den Komponisten möglich, seine Lernzyklen von mehreren Jahren, die nicht<br />
nur GUSTAV MAHLER teilweise auf die klangliche Realisierung seiner Symphonien<br />
warten musste, um Größenordnungen zu reduzieren, indem er die geschaffene Partitur<br />
vom elektronischen Medium erklingen lässt. Im Zuge der Medienentwicklung<br />
rückt auch die folgende Vision von HANS WERNER HENZE in den Bereich des Möglichen,<br />
nämlich dass<br />
"[...] in meinen Augen und nach meiner Erfahrung das Komponieren von Musik<br />
lehrbar und erlernbar ist – in der Schule! Gerade so wie man es mit dem<br />
Zeichnen oder Malen oder dem deutschen Aufsatz zu tun pflegt." (HENZE<br />
1998)<br />
Kein synthetischer Klangerzeuger war zwar bislang in der Lage, die klanglichen<br />
Möglichkeiten eines Streich- oder Blasinstrumentes in der Hand eines Musikers in<br />
allen Nuancen zu simulieren. Gegenüber dem herkömmlichen Partiturspiel mit in<br />
der Regel nicht mehr als zehn Fingern bietet die synthetische Klangerzeugung für<br />
die Überprüfung von Kompositionen aber bereits heute einen deutlichen Fortschritt.<br />
Auch verkennen Kritiker, die grundsätzlich die klangliche Unterlegenheit elektrischer<br />
Klangerzeugung gegenüber akustischen Instrumenten postulieren, die Tatsache,<br />
dass in der Geschichte des Baus akustischer Instrumente bereits Jahrhunderte<br />
verstrichen sind, während die elektrische Klangerzeugung noch immer im Entstehen<br />
begriffen ist. Wie etwa die Entwicklung des Klaviers Jahrhunderte der künstlerischen<br />
Auseinandersetzung zur Folge hatte, verspricht die Entwicklung neuer Musiktechnologien<br />
für die Zukunft ähnlich bereichernde Aussichten für das Gebiet der<br />
elektronischen Klangerzeugung. BERND ENDERS und CHRISTOPH ROCHOLL mahnen<br />
hier zur Geduld:<br />
177
178<br />
"Und hier müssen wir geduldig sein und abwarten, bis das elektronische Instrument<br />
den künstlerischen Kinderschuhen entwachsen ist. Als das Hammerklavier<br />
erfunden wurde, währte es eine geraume Zeit, bevor Komponisten und<br />
Pianisten wie Chopin, Bartók oder Chick Corea bewiesen, welche musikalische<br />
Vielfalt diesem Instrument entlockt werden kann. In einer Zeit rasanter<br />
technischer Entwicklungen ist ein Instrument schneller konstruiert und fabriziert<br />
als musiziert. Man muß den Musikern wohl noch ein wenig Zeit lassen,<br />
bevor ästhetische Urteile angebracht sind." (ENDERS & ROCHOLL 1992, 113)<br />
Es wird auch noch geraume Zeit dauern, bis sich eine angemessene Spieltechnik auf<br />
dem Synthesizer entwickelt haben wird. Die willkürliche Adaptation der Klaviertastatur<br />
für die synthetische Klangerzeugung provoziert eine klavierähnliche Spielweise,<br />
die häufig musikalischer und klanglicher Rechtfertigung entbehrt. Statt dessen<br />
erfordert die besondere Klangqualität des Synthesizers eine eigene Spielweise,<br />
oder besser: so viele verschiedene Spielweisen, wie das Instrument Klänge herzustellen<br />
in der Lage ist. Auf diesen Sachverhalt macht JOE ZAWINUL, Pionier des<br />
Synthesizerspiels, im folgenden aufmerksam:<br />
"Es ist ein junges Instrument, und es gibt bis heut' fast keinen, der es spielen<br />
kann. Aber das wird kommen. Aber wenn man's spielt, dieses Instrument, dann<br />
erschießen einen die Kritiker immer mit der einen, und mit der anderen schreiben<br />
sie, daß das ja nicht wertvoll ist. Aber dös is immer a Blödsinn! Diese Musik<br />
ist genauso wertvoll wie eine andere, nur sie ist halt noch nicht so gut gespielt."<br />
(Keyboards 7/1996, 39)<br />
Das Klavier, als Spezialfall eines Keyboards mit nur einem bestimmten Klang betrachtet,<br />
verlangt im Gegensatz zum Synthesizer entsprechend nur eine dezidierte<br />
Spieltechnik. Trotz dieser Einschränkung war es in der Lage, die Kreativität vieler<br />
Musikergenerationen herauszufordern. Das Klavier, betrachtet man es als einen Versuch,<br />
einen möglichst reichhaltigen Klang mit möglichst einfacher Tonerzeugung,<br />
nämlich dem Druck auf "claves" zu erzielen, lässt sich in die Kategorie steuerdatencodierender<br />
Medien nahtlos einordnen und stellt aus dieser Sicht – wie übrigens<br />
auch die Orgel – nichts anderes dar als einen Sampler bzw. Synthesizer mit sehr<br />
spezialisierten Möglichkeiten, allerdings in nicht elektrischer Form. In Anbetracht<br />
der reichhaltigen musikalischen Ergebnisse, die das Klavier trotz dieser eingeschränkten<br />
Möglichkeiten hervorzubringen in der Lage ist, müssen künstlerische<br />
Möglichkeiten und Herausforderung der elektronischen Klangerzeugung nahezu<br />
unbegrenzt erscheinen.<br />
Möglichkeiten des Experiments mit Klängen, die in der Vergangenheit nur einigen<br />
wenigen Musikern gegeben waren, werden Allgemeingut. JOSEPH HAYDN, einer der
wenigen Glücklichen, die über diese Möglichkeit des Klangexperiments bereits vor<br />
Jahrhunderten verfügten, berichtet von den enormen Vorteilen, die sich ihm als<br />
Hofkapellmeister boten:<br />
"Ich konnte als Chef eines Orchesters Experimente machen, beobachten, was<br />
den Eindruck hervorbringt und was ihn schwächt, also verbessern, zusetzen,<br />
wegschneiden, wagen. [...] Das Ohr, versteht sich ein gebildetes, muß entscheiden<br />
und ich halte mich für befugt wie irgendeiner, hierin Gesetze zu geben."<br />
(zit. nach HAEFELI 1999, 47)<br />
Interaktive Medien relativieren die Kultur der medialen One-Way-Kommunikation,<br />
die über Jahrhunderte für unsere Gesellschaft wesenstypisch geworden ist. Damit<br />
treten interagierende und demokratischere Lebens- und Wahrnehmungsweisen in<br />
Konkurrenz zur Frontalsituation, wie sie das 19. Jahrhundert überdauert hat und<br />
heute noch typischerweise das Klassenzimmer, den Konzertsaal oder den Fernsehplatz<br />
charakterisiert. Eine relativ neue Möglichkeit stellt diesbezüglich die Internet-<br />
Plattform RocketNetwork dar, auf der ortsunabhängig gemeinsam musiziert werden<br />
kann.<br />
In dem Maße, in dem die Möglichkeiten autodidaktischen Umgangs mit musikalischen<br />
Strukturen wachsen, werden sich auch die Anforderungen an die Ausbildung<br />
von Musikpädagogen verändern. Von der Musiklehrerausbildung wird in Zukunft<br />
vermehrt die Vermittlung von Medien- und Technologiekompetenz gefordert werden,<br />
soll ein weiteres Auseinanderdriften von musikpädagogischem Anspruch und<br />
gesellschaftlicher Wirklichkeit verhindert werden.<br />
Diese Veränderungen müssen keinesfalls im Widerspruch stehen zu interpretierendem<br />
Musizieren anhand klassischer Literatur, im Gegenteil: letztere Fähigkeit kann<br />
fundierter erworben werden, wenn auch musikstrukturelle, auditive und eigenkreative<br />
Inhalte vermittelt werden, die, jenseits von Fragen elektrischer oder akustischer<br />
Tonerzeugung, weit über die bislang praktizierten Unterrichtsinhalte hinausgehen.<br />
179
4.6 Perspektiven für die Musikpädagogik<br />
Wie in Abschnitt 2.4 dargelegt, birgt die traditionell bevorzugte visuelle Musikvermittlung,<br />
die durch Fortschritte auf dem Gebiet der Drucktechnologien seit mindestens<br />
zweihundert Jahren überproportional Vorschub bekommen hat, für die Musikpädagogik<br />
Probleme. Bedingt durch einseitige Medienentwicklung entstand eine<br />
Schieflage zu Gunsten visuell-linearer Lernformen mit der Konsequenz der Abspaltung<br />
der Instrumentalausübung vom musikalischen Schaffensprozess, der Musikpädagogik<br />
von Teilen der gesellschaftlichen Wirklichkeit und des Selbstbilds<br />
vieler Instrumentalisten von den eigenen musikalischen Fähigkeiten, was u.a. in der<br />
Abwertung des Dilettantismus seinen sprachlichen Niederschlag fand.<br />
Dass die Problematik der visuellen Vermittlung in der musikpädagogischen Literatur<br />
bereits thematisiert, wenn auch noch nicht konsequent zu Ende verfolgt ist,<br />
wurde ebenfalls ausgeführt. Ebenso wurde der Widerspruch formuliert zwischen<br />
erkannten Problemen auf der einen Seite und einem Mangel an Lösungsansätzen<br />
andererseits.<br />
In Abschnitt 4.5 wurden die Möglichkeiten dargestellt, die neue Technologien für<br />
den autonomen bzw. autodidaktischen Umgang mit Musik bieten. Anzeichen einer<br />
radikalen, die etablierte Musikpädagogik konterkarierenden Entwicklung wurden<br />
registriert. Dabei wurde deutlich, dass eine neue für jedermann zugängliche Musizierweise<br />
im Entstehen begriffen ist, die erstmals ohne Umweg über das schriftliche<br />
Medium komplexe Musik zu strukturieren, herzustellen und zu vermitteln vermag.<br />
In der etablierten Musikpädagogik macht sich in Anbetracht dieser Umbruchsituation,<br />
zusätzlich belastet durch die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Musikschulen<br />
und den damit in Verbindung stehenden Rationalisierungsdruck, vielfach<br />
Ratlosigkeit breit. Immer weitere zeitliche Einschränkungen des Schüler-Lehrer-<br />
Kontaktes durch vermehrten Einsatz schriftlicher Medien lassen einen erfolgreich<br />
verlaufenden Instrumentalunterricht noch unwahrscheinlicher werden. Unter dieser<br />
Prämisse veröffentlichte MARTIN GELLRICH in der Zeitschrift Üben & Musizieren<br />
im Jahr 1996 den Aufsatz Instrumentalausbildung an Musikschulen – ein Haus ohne<br />
solides Fundament, in dem er die folgende ernüchternde Bilanz zieht:<br />
180<br />
"So bleibt für Lehrerinnen und Lehrer nur der Ausweg übrig, den alten, ineffektiven<br />
Weg des Erlernens des Spiels nach Noten mittels der Methode des<br />
mechanischen Greifens unter verschlechterten Bedingungen weiterzuführen."<br />
(GELLRICH 1996, 12)
Auch aus dieser Sicht scheint eine intensivere Beschäftigung mit der aktuellen Medienentwicklung<br />
unumgänglich.<br />
Das Verhältnis von visueller zu auditiver Wahrnehmung wird gegenwärtig vielfach<br />
grundsätzlich diskutiert. Die Dominanz des Auges gegenüber dem Ohr in unserer<br />
Kultur wird von gewissen Kreisen allgemein für technokratisches Denken und damit<br />
für viele Schwierigkeiten der gegenwärtigen gesamtgesellschaftlichen Situation bis<br />
hin zu ökologisch-ökonomischen Problemen verantwortlich gemacht. Als Konsequenz<br />
wird vielfach eine neue Hörkultur gefordert; in der Annahme, dass eine adäquate<br />
Berücksichtigung des in unserer Gesellschaft als benachteiligt angesehenen<br />
Ohres der postulierten Eindimensionalität des Denkens einen ganzheitlichen Ansatz<br />
entgegenstellen könne. Als Vertreter dieser Richtung hat sich JOACHIM ERNST<br />
BERENDT profiliert. In einer Vielzahl von Veröffentlichungen propagiert er eine<br />
Hinwendung weg von der seiner Meinung nach "aggressiven Sehkultur", hin zu einer<br />
"sanften" Kultur des Hörens; so auch in seinem Buch Nada Brahma – die Welt<br />
ist Klang:<br />
"Der Neue Mensch wird ein hörender Mensch sein – oder er wird nicht sein. Er<br />
wird in einem Maße Klänge wahrnehmen, von dem wir uns heute noch keine<br />
Vorstellung machen können. [...]<br />
Die tiefere Veränderung unseres Bewußtseins (und das ist wohl unbestritten:<br />
wir brauchen ein neues Bewußtsein, eine andere Wahrnehmung von Welt) ...<br />
die tiefere Veränderung wird dadurch ausgelöst, daß wir uns endlich das Ohr<br />
und das Hören in dem Maße erschließen, in dem das Auge und das Sehen ohnehin<br />
in unserer Kultur erschlossen sind." (BERENDT 1985, 16)<br />
Auch wenn BERENDTs Thesen durchaus nicht unumstritten sind, verdeutlichen sie<br />
eine gegenwärtig verbreitete Tendenz: die Suche nach einer Stärkung der in Konkurrenz<br />
zum Sehen ins Hintertreffen geratenen Hörkultur. Auch MARSHALL MCLUHAN<br />
polarisiert das grundsätzliche Verhältnis zwischen sehender und hörender Wahrnehmung.<br />
Er postuliert in seinem Buch Understanding media – die magischen Kanäle<br />
gar eine "Entscheidungsschlacht" zwischen Auge und Ohr:<br />
"Wir erleben die Entscheidungsschlacht zwischen Sehen und Hören, zwischen<br />
der schriftlichen und mündlichen Form der Wahrnehmung." (MCLUHAN 1995,<br />
34)<br />
MCLUHAN vertritt die bemerkenswerte Überzeugung, dass sich im Zuge der Medienentwicklung<br />
das Ohr in diesem Kampf durchsetzen wird, bzw., wie er im Fol-<br />
181
genden betont, sich möglicherweise sogar bereits durchgesetzt hat. Daraus folgt für<br />
ihn eine neue Kultur der Gleichzeitigkeit, der Abkehr vom linearen Denken:<br />
182<br />
"Wir leben in einer brandneuen Welt der Gleichzeitigkeit. Die 'Zeit' hat aufgehört,<br />
der 'Raum' ist dahingeschwunden. Wir leben heute in einem globalen<br />
Dorf ... in einem gleichzeitigen Happening. Wir leben wieder im Hörraum. Wir<br />
haben wiederum damit begonnen, Urahnungen, Stammesgefühlen Gestalt zu<br />
geben, von denen uns einige Jahrhunderte des Alphabetismus getrennt hatten."<br />
(MCLUHAN 1984, 63)<br />
Die autonomen Musizierformen, wie sie in Abschnitt 4.5.2 beschrieben wurden, sind<br />
zwar zum großen Teil erst nach MCLUHANS Tod im Jahr 1980 entstanden, scheinen<br />
aber seine Einschätzung, die von ihm nicht speziell auf musikalische Aspekte hin<br />
formuliert wurde, gerade für die Musikkultur zu bestätigen. Auch die rhythmisch<br />
geprägten Musikstile der Jugendkultur erinnern an Urahnungen und Stammesgefühle,<br />
die aus unserer Zivilisation verschwunden gewesen zu sein schienen und fügen<br />
der europäischen Musikkultur das rhythmische Element als wesentliches Gestaltungsmittel<br />
hinzu. Der Widerspruch zwischen einerseits vielfachem Scheitern<br />
visuell geprägter Musikpädagogik und andererseits massenhaftem Konsum von<br />
Popmusik könnte ebenfalls als Indiz für den von MCLUHAN postulierten Sieg des<br />
Ohrs gewertet werden.<br />
Auch in der Musikerziehung ist diese Polarisierung zu beobachten. Hier wird der<br />
"Kampf zwischen Auge und Ohr" vordergründig zwischen den Musikstilen ausgetragen.<br />
Vertreter der einen Seite, der klassischen Musikkultur, halten der Gegenseite<br />
dabei häufig mangelnde geistige Durchdringung, mangelnde Sensibilität und Oberflächlichkeit,<br />
kurz: mangelnden künstlerischen Anspruch vor. Diese Richtung vertritt<br />
beispielsweise der rheinische Klavierpädagoge PETER PAUL WERNER in seiner<br />
Neuen Methodik und Didaktik am Klavier. WERNER polarisiert zwischen Klavier<br />
und Keyboard, indem er dem Keyboard jegliche künstlerische Potenz abspricht und<br />
gleichzeitig grundsätzlich bezweifelt, dass auf dem Keyboard erlernte Fähigkeiten<br />
auf das Klavierspiel übertragen werden können:<br />
"Da das Keyboard selbst keine Verbindung zum Kunstinstrument aufweist,<br />
kann es ebenso wenig zu ihm hinführen!<br />
Als mechanische Klopftastatur, die mit rhythmischer Bearbeitung schnell hörbare<br />
Erfolge gewährleistet, deren statische Töne auf musikalische Forderungen<br />
mangels Tonmodifikation verzichten müssen, ist es nur zum rhythmischen<br />
Sound der Popmusik prädestiniert. Somit zur Oberflächlichkeit statt zur Meditation<br />
vorprogrammiert, ist es zur künstlerischen Aussage unfähig." (WERNER<br />
1993, 23)
Umgekehrt kritisieren Vertreter von Improvisations- und Jazzpädagogik die klassische<br />
Musikerziehung, indem sie sich auf Kulturen berufen, wo ursprünglichere und<br />
spontanere Musizierformen erhalten geblieben sind. VOLKER BIESENBENDER als<br />
Vertreter dieser Richtung führt beispielsweise in seinem Buch Von der unerträglichen<br />
Leichtigkeit des Instrumentalspiels den afrikanischen Musiker PAPA OYEAH<br />
MAKENZIE als Zeugen an, um den Vorwurf eines seiner Meinung nach grundsätzlich<br />
falschen Ansatzes in der klassischen Musikerziehung zu untermauern:<br />
"Ich glaube, ihr lernt alle die Musik verkehrt herum – von den Fingern in die<br />
Ohren, statt von den Ohren in die Finger. Das ist, als ob man Tricks lernt, um<br />
das Leben zu imitieren." (BIESENBENDER 1992, 38)<br />
JAMEY AEBERSOLD als Vertreter der US-amerikanischen Jazzpädagogik hält rein<br />
reproduzierenden Instrumentalunterricht gar für eine Art Betrug an den Schülern. Er<br />
verlangt von jedem Musikunterricht die Vermittlung von Fähigkeiten, eigene Musik<br />
herzustellen und fordert deshalb in Form eines Appells an einen fiktiven Musiklehrer:<br />
"Vor allem aber vergiß nicht, mir zu zeigen, wie ich meine eigene Musik machen<br />
kann. Denn erst dann wird die Musik zu einem Teil meiner selbst.<br />
Es wird Zeit, daß die Pädagogen in der Musikerziehung die Notwendigkeit erkennen,<br />
Phantasie und Kreativität in ihren Unterricht einfließen zu lassen. Das<br />
gilt sowohl für die Musikschulen als auch für den Privatunterricht. Wir haben<br />
die Musikschüler und -studenten lange genug über's Ohr gehauen."<br />
(AEBERSOLD 1996, 74)<br />
Diese Frontenbildungen und gegenseitigen Ressentiments beruhen nicht unwesentlich<br />
auf diametral entgegengesetzten und bislang unvereinbaren Medienzugängen.<br />
Während die klassische Musikerziehung aus gezeigten medienhistorischen Gründen<br />
die visuelle Vermittlungsform über das Printmedium vertritt, vollzieht sich, wie<br />
HEINER GEMBRIS unter Bezugnahme auf eine Arbeit von GÜNTHER KLEINEN bemerkt,<br />
das Lernen in der "U-Musik" genau umgekehrt:<br />
"Verläuft das Erarbeiten und Erlernen von Musik auf dem Gebiet der klassischen<br />
Kunstmusik 'in der Regel über die Noten und eher über intellektuelle<br />
Operationen', vollzieht sich musikalisches Lernen im Bereich der Popmusik 'in<br />
erster Linie über das Hören und im affektbetonten Zugriff'." (GEMBRIS 1987,<br />
130)<br />
183
Diese gegenseitigen Ressentiments sind aufgrund der bisherigen Inkompatibilität der<br />
unterschiedlichen Zugangsweisen nur zu verständlich – führen doch Schwächen der<br />
Popmusiker im Notenspiel einerseits und der "E-Musiker" bei spontanen und improvisatorischen<br />
Musizierformen andererseits häufig zu Berührungsängsten bis hin zu<br />
Minderwertigkeitsgefühlen, die eine musikalische Kommunikation mit Vertretern<br />
der jeweils anderen Seite erschweren oder gar unmöglich machen. Stichhaltige Argumente<br />
für eine Polarisierung oder Unvereinbarkeit der beiden Richtungen lassen<br />
sich aber aus musikstruktureller Sicht kaum finden, denn klassische Musik und populäre<br />
Stile der Gegenwart fußen musikstilistisch weitgehend auf identischen<br />
Grundstrukturen und sind trotz aller Unterschiedlichkeit der Einflüsse, z.B. afroamerikanischer<br />
Rhythmik auf die Jazz- und Popmusik, in weiten Teilen eng verwandt<br />
(vgl. WIEDEMANN 1992). 40<br />
Multimediale Verbindungen von visuellen und auditiven Medien versprechen in diesem<br />
Zusammenhang die Aussicht, einen vielschichtigen musikalischen Bildungsprozess<br />
zu ermöglichen, der auch diese Spaltung relativieren könnte. Gerade die in<br />
Abschnitt 4.5.2 beschriebene neue mediale Durchlässigkeit zwischen verschiedenen<br />
Komplexitätsgraden der Verarbeitung von Musik könnte künftig einen wichtigen<br />
Beitrag zur Hebung des musikalischen Verständnisniveaus gegenüber verschiedensten,<br />
auch komplexen Arten von Musik leisten. Multimediale und interaktive Darstellungsformen<br />
wären auch dazu geeignet, synästhetische Wahrnehmungen zu<br />
schaffen, um den von RAINALD MERKERT beschriebenen Sinneskreis zwischen<br />
Auge und Hand (vgl. S. 98) zu durchbrechen und für das Musiklernen geeignetere<br />
Synästhesien anzubieten.<br />
Allerdings sind bislang in der Praxis der Musikdidaktik realisierte Ergebnisse meist<br />
ernüchternd. Ein Beispiel für eine Software, bei der multimediale Möglichkeiten des<br />
Computers nicht wirksam genutzt werden, sei am Miracle Piano Teaching System<br />
gezeigt. Dieses stellt ein typisches Beispiel für die unreflektierte Übertragung überkommener<br />
Denkstrukturen aus dem Umgang mit bereits länger bekannten Medien<br />
dar: die traditionellen visuell geprägten Kriterien des Klavierlernens Noten richtig<br />
lesen – Taste korrekt drücken finden sich bei diesem System unverändert wieder. Im<br />
zugehörigen Handbuch wird auf den zwar modernen Ansatz des differenzierten<br />
Fehlerfeedbacks hingewiesen. Betrachtet man aber die Liste der dabei möglichen<br />
Fehler, so wird deutlich, dass die (an sich bereits unkünstlerischen) Kriterien richtig<br />
– falsch genau nach solchen Gesichtspunkten geordnet werden, die sich im Laufe<br />
der Entwicklung des Klavierspiels anhand der visuellen Vermittlung von Musik ge-<br />
40 Auch die Tatsache, dass unablässig Themen klassischer Musikliteratur in Popstücken reanimiert<br />
werden, zeugt von der Kompatibilität beider Stile.<br />
184
ildet hatten und bis heute eine Bürde der klavierpädagogischen Tradition darstellen:<br />
"Wenn ein Stück nicht richtig gespielt wird, sagt das Programm nicht nur lakonisch:<br />
'Du hast da ein paarmal daneben gegriffen'. Ein intelligentes Lernsystem<br />
wie Miracle versucht vielmehr festzustellen, warum ein gewisser Fehler<br />
auftaucht, um dann entsprechende Lösungsvorschläge bieten zu können.<br />
Das Miracle stuft jeden Fehler in eine von 200 möglichen Fehlerkategorien<br />
ein. Diese 200 Standardfehler sind wiederum in 41 Haupt-Kategorien unterteilt.<br />
Nachfolgend einige häufige Fehler:<br />
• Übersehen eines Vorzeichens<br />
• Zu langes Halten einer Note<br />
• Zu schnelles Spielen von Noten<br />
• Fehlerhafte Auslegung eines Vorzeichens<br />
• Übersehen einer Pause<br />
• Zu kurzes Halten einer punktierten Note<br />
• Falscher Finger<br />
• Treffen des Zwischenraums zwischen zwei Tasten"<br />
(The Miracle Piano Teaching System (Klavierlernsystem) Benutzerhandbuch<br />
© 1990, 1991 The Software Toolworks, Inc., S. 22)<br />
Es scheint, als würden von einem solchen System, das sich auf tradierte visuelle<br />
Kriterien stützt, die Möglichkeiten des neuen Mediums kaum genutzt – möglicherweise<br />
sogar schlechter als beim üblichen Keyboardunterricht, wo in Teilen zwar<br />
weniger motorische Fertigkeiten, dafür aber musikalische Strukturen vermittelt werden<br />
(vgl. Abschnitt 4.5.1). Die Dominanz der Tradition führt hier also dazu, dass<br />
alte Denkmuster zunächst – ungeachtet seiner anders gearteten Möglichkeiten – auf<br />
das neue Medium übertragen werden: ein Phänomen, das für die erste Phase der Erschließung<br />
einer neuen Medienrealität geradzu typisch ist (vgl. MERKERT 1992, 8f.).<br />
Ein Grund für derart mangelhafte Verwertung neuer Technologien liegt auch an dem<br />
relativ geringen Interesse aus Kreisen der Musikpädagogik an solchen Entwicklungen.<br />
So bleiben Medienkonzeptionen vielfach fachfremden Software-Ingenieuren<br />
überlassen – mit den entsprechenden Ergebnissen. Um diese Situation zu verbessern,<br />
wäre es nach Meinung des Hannoveraner Musikwissenschaftlers REINHARD KOPIEZ<br />
"[...] notwendig, daß in der Musikpädagogik und der Musikwissenschaft eine<br />
Diskussion beginnt, die existierende multimediale Vermittlungskonzepte aufgreift<br />
bzw. alternative Entwürfe erarbeitet. Momentan wird dieses Feld weitgehend<br />
den Ingenieuren überlassen – entsprechend kompliziert und benutzerunfreundlich<br />
sind die meisten Programme. Weitere Forderungen wären an<br />
die Ausbildung von Musikpädagogen und -wissenschaftlern zu stellen, sich<br />
185
186<br />
den neuen Medien zu öffnen, doch die Ausbildungssituation ist ernüchternd.<br />
(KOPIEZ 1996, 26)<br />
Eine intensive Beschäftigung mit Phänomenen der Medienentwicklung wird aber<br />
auch für Vertreter der Musikerziehung künftig unerlässlich sein, um den gebotenen<br />
Möglichkeiten nutzbringende Lösungen abzugewinnen.<br />
Endziel und anzustrebendes Ideal einer multimedialen und polyästhetischen Ausbildung<br />
wäre die untrennbare Verbindung von visueller und auditiver Wahrnehmungssphäre,<br />
so dass musikalische Partituren, wie bei sprachlichen Texten inzwischen<br />
selbstverständlich, stumm gelesen werden können. Dieses Ausbildungsideal<br />
hat ROBERT SCHUMANN in seinen Haus- und Lebensregeln folgendermaßen formuliert:<br />
"Du mußt es soweit bringen, dass du eine Musik auf dem Papier verstehst."<br />
(SCHUMANN 1984, 183)<br />
ARNOLD SCHÖNBERG verlangt diese Fähigkeit auch von Tonmeistern, über deren<br />
Ausbildung er sich wie folgt äußert:<br />
"Der Student müßte fähig werden, sich im Kopf ein Bild davon zu machen,<br />
wie die Musik, vollendet gespielt, klingen soll. [...] Das bloße Lesen der Partitur<br />
muß genügen." (SCHÖNBERG 1958, 252)<br />
Bis dato ist diese Fähigkeit zum Lesen von Musik aber noch die Ausnahme, wie<br />
RAINALD MERKERT in seinem Aufsatz Zur Anthropologie des Hörens feststellt:<br />
"Nicht von ungefähr jedoch gibt es im Bereich der Musik ungleich mehr Analphabeten<br />
als in dem der Schrift, und nur wenige Menschen sind in der Lage,<br />
Notenschrift direkt bzw. 'leise' zu lesen, also ohne das Ohr zu Hilfe zu nehmen."<br />
(MERKERT 1988, 761)<br />
Wie der Vergleich mit den kulturellen Folgen der Verschriftlichung von Sprache<br />
nahelegt, erscheint es aber zumindest denkbar, dass die beschriebenen Merkmale<br />
künftiger Medienentwicklung Hilfsmittel zur Verfügung stellen könnten, auch die<br />
Verschriftlichung von Musik breiteren Bevölkerungskreisen nahezubringen. Auf<br />
dem Gebiet sprachlicher Texte hat sich das Lesen dank der Verbreitung schriftlicher<br />
Medien in den letzten Jahrhunderten von einer nur für Eingeweihte zugänglichen<br />
Kunst zu einer Standardkulturtechnik entwickelt. Die Fähigkeit zum stummen Lesen<br />
war dabei, wie RAINALD MERKERT erläutert, auch im Zusammenhang mit verbalem
Text keineswegs immer selbstverständlich. Die ursprünglich rein auditive Kommunikationsform<br />
des Sprechens wurde nämlich durch ihre Verschriftlichung so verfremdet,<br />
dass sie beim Lesen durch lautes Mitsprechen zunächst wieder in akustische<br />
Signale übersetzt werden musste, um vom Leser verstanden zu werden:<br />
"In unserer Welt dominiert das Auge. Wir haben es sogar fertiggebracht,<br />
menschheitsgeschichtlich gesehen erst in allerjüngster Zeit, dem Ohr streitig zu<br />
machen, was seit Entstehung der Menschheit ihm zugeordnet war, nämlich die<br />
Sprache. Wir haben selbst die Sprache visualisiert, in Gestalt der Schrift, haben<br />
sie damit dem Auge zugänglich gemacht. Es ist dies gewissermaßen der Gipfel<br />
der Unnatur, oder positiv formuliert, es ist eine Spitzenleistung menschlicher<br />
Plastizität, als solche zugleich wesentliches Fundament von Überlieferung und<br />
Kultur. Im 6. Buch der Confessiones schreibt Augustinus über den Bischof<br />
Ambrosius: 'Wenn er aber las, so glitten die Augen über die Blätter, Stimme<br />
und Zunge aber ruhten.' Es war damals offenbar höchst ungewöhnlich, daß jemand<br />
leise lesen konnte. Noch heute pflegen die Schulanfänger, wenn sie lesen<br />
lernen, zunächst laut zu lesen, sie geben also die visualisierte Sprache zunächst<br />
an das Ohr bzw. in den Sprech-Hör-Kreislauf zurück; nur so offenbar kann<br />
man überhaupt lesen lernen." (MERKERT 1988, 760)<br />
Bezüglich der Visualisierung und des stummen Lesens von Musik befindet sich die<br />
kulturelle Entwicklung gegenwärtig noch auf einer ähnlich archaischen Stufe wie<br />
zur Zeit des AUGUSTINUS bezogen auf das Lesen von verbalem Text: Die<br />
Verklanglichung ist in aller Regel noch erforderlich, um sich den Inhalt einer<br />
Partitur zu vergegenwärtigen. Betrachtet man aber die von RAINALD MERKERT zu<br />
Recht hervorgehobene "Spitzenleistung menschlicher Plastizität" bei der<br />
Verschriftlichnung von Sprache, die in menschheitsgeschichtlich kürzester Zeit vom<br />
Undenkbaren zum Allgemeingut geworden ist, so kann es nicht abwegig erscheinen,<br />
von der aktuellen Medienentwicklung künftig weit reichende Auswirkungen auf die<br />
Verbreitung des Umgangs mit Musik zu erwarten.<br />
HEINRICH JACOBY bemüht ebenfalls den Vergleich mit der Alphabetisierung und<br />
weist auf eine potentielle Verschiebung der Verhältnisse zwischen musikalisch "Begabt"<br />
und "Unbegabt" als Resultat der Verwandlung einer nur wenigen zugänglichen<br />
"Kunst" in eine verbreitete Kulturtechnik hin. Er vergleicht im folgenden die in unserer<br />
Gesellschaft verbreitete "Unmusikalität" (vgl. S. 140) mit der mittelalterlichen<br />
Situation in Bezug auf das Lesen und Schreiben. Für JACOBY sind dabei die Grenzen<br />
und Übergänge zwischen "begabt", "normal", "unbegabt" und "behindert" durchaus<br />
veränderbar:<br />
187
188<br />
"In welchem Maße durch veränderte Fragestellung und Zielsetzung und dem<br />
sich daraus ergebenden anderen Weg sich das Verhältnis zwischen den scheinbar<br />
besonders Veranlagten und den Übrigen verschieben kann, in welchem<br />
Maße sich dann auch der gewohnte Zeitaufwand für das Erarbeiten der Ausdrucksmittel<br />
verringern kann, sei durch einen Hinweis auf das Schreiben angedeutet<br />
[...]. Vor wenigen hundert Jahren galt es noch als eine große Kunst, deren<br />
Erlernung mancher ein halbes Leben widmete, und heute kann fließendes<br />
Schreiben [...] von jedem Kinde in wenigen Monaten erarbeitet werden."<br />
(JACOBY 1995, 13)<br />
In der Gegenwart, in der Lesen und Schreiben Standardkulturtechniken geworden<br />
sind, gilt ein dieser Fähigkeiten Unkundiger bereits als "behindert". – Dass auch auf<br />
dem Gebiet der Musik vermeintliche "Begabungen" wesentlich von Medienkonstellationen<br />
verursacht sein können, auf diesen Sachverhalt macht RENATE KLÖPPEL in<br />
ihrem Buch Die Kunst des Musizierens aufmerksam:<br />
"In diesem Zusammenhang muß auch die Bedeutung der Begabung relativiert<br />
werden: Je einseitiger der Unterricht oder ein Übeverhalten ist, um so stärker<br />
fallen fehlende oder bestehende Begabungen ins Gewicht: Eine spontan gefundene<br />
Übestrategie basiert zumeist auf den angelegten oder sehr früh erworbenen<br />
Fähigkeitsschwerpunkten, wodurch scheinbare oder tatsächliche Begabungen<br />
weiter ausgebaut und gefördert werden, während andere Bereiche vernachlässigt<br />
werden und schließlich als 'fehlende Begabungen' in Erscheinung<br />
treten. Augenfällig ist dies unter anderem bei der vorhandenen oder fehlenden<br />
'Begabung' zum Vom-Blatt-Spiel beziehungsweise zum Spiel nach dem Gehör,<br />
deren Entwicklung sich oft bis zur bevorzugten Unterrichtsmethode des ersten<br />
Lehrers zurückverfolgen läßt." (KLÖPPEL 1993, 17)<br />
In Anbetracht der Dominanz visueller Medien in der westlichen Instrumentalpädagogik<br />
kann die Verbreitung von Unmusikalität, oder anders ausgedrückt, die<br />
Unfähigkeit zum adäquaten Gebrauch des Gehörs beim Musizieren, nicht verwundern.<br />
Multimediale und interaktive Medien bieten dagegen aufgrund totaler Flexibilität<br />
alle Möglichkeiten, die u. a. von RENATE KLÖPPEL angesprochenen Einseitigkeiten<br />
zu kompensieren.<br />
Bereits seit mehreren Jahrzehnten verbreitet sich multimediales Lernen stetig – allerdings<br />
fast ausschließlich außerhalb des Musikunterrichts. Der französische Filmkomponist<br />
ERIC SERRA beispielsweise hätte zur Zeit MOZARTS keine Chance<br />
gehabt, den Beruf des Komponisten zu erlernen. In der zweiten Hälfte des 20.<br />
Jahrhunderts war es ihm aber bereits möglich, sein eigenes "Multimediapaket" zum<br />
Zweck autodidaktischen Lernens zusammenzustellen. Nachdem SERRA in einem<br />
Interview der Zeitschrift Keyboards zunächst den Ausgangspunkt seiner
musikalischen Entwicklung geschildert hat, die ähnlich den in Abschnitt 4.3<br />
erwähnten Musikerbiographien anhand von Schallplatten erfolgte, nennt er einen<br />
multimedialen Mix aus gedrucktem Medium und Tonträger als sein persönliches<br />
Rezept, sich die Fähigkeit des Komponierens anzueignen und die schriftliche<br />
Codierung von Musik zu erlernen:<br />
"Zwei, drei Jahre lang habe ich mir intensiv Orchestermusik angehört und dazu<br />
Partituren studiert." (Keyboards 3/1996, 90)<br />
Das auditive Medium verschaffte ihm dabei gegenüber "tonträgerlosen" Generationen<br />
den entscheidenden Vorteil der beliebigen Wiederholbarkeit.<br />
In welch hohem Ausmaß die unendlich vielfältigen Nuancen der in Abschnitt 4.5.2<br />
erörterten Medienentwicklung künftig Einfluss auf die Musikkultur nehmen könnten,<br />
lässt sich möglicherweise erahnen, wenn man sich die Auswirkungen der bereits<br />
vollzogenen, im Vergleich mit künftigen Medienentwicklungen (im wahrsten Sinn<br />
des Wortes) eindimensionalen Entwicklungsgeschichte von Tonband und Schallplatte<br />
auf die Musikkultur vergegenwärtigt. Das musikalische Ausbildungsniveau ist<br />
in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen (vgl. V. GUTZEIT 1996b, 5).<br />
Vielleicht besteht bereits hier ein indirekter Zusammenhang mit der rasanten<br />
Verbreitung und inzwischen nahezu ständigen Verfügbarkeit klanglicher Vorbilder<br />
auf Tonträgern. In einer jener Disziplinen jedenfalls, in denen auditive Medien die<br />
Hauptrolle in der Überlieferung übernommen haben, nämlich im Jazz, konnte sich<br />
im Lauf des 20. Jahrhunderts eine eigene Tradition auf der Grundlage von Tonträgern<br />
entwickeln, die deutliche Merkmale ursprünglicher Virtuosität trägt. Einige<br />
Beispiele neuer Lernformen aus der Biographie von Musikern anhand dieser analogen<br />
Tonträger wurden bereits auf S. 130 ff. erwähnt. Während auf klassischem Gebiet<br />
auf diese Weise lernende Schüler noch als Exoten gelten und sich im institutionalisierten<br />
Ausbildungssystem schwer behaupten können (vgl. S. 133), hat diese<br />
Lernmethode im Jazz die Führungsrolle übernommen. Vergleicht man die so entstandene<br />
Musikkultur mit alter Musizierpraxis des Barock, so fällt eine erstaunliche<br />
Verwandtschaft auf. Bei diesem Vergleich drängt sich sogar der Eindruck auf, als<br />
stelle die visuell-restriktive Vermittlungsform von Musik, wie sie sich in der<br />
CZERNY-Nachfolge etabliert und im Klavierunterricht bis heute bewahrt hat, nur<br />
eine sehr spezielle Episode kultureller Entwicklung dar, die gerade dabei sein<br />
könnte, durch die Medienentwicklung überwunden zu werden:<br />
189
� Die Bedeutung der auditiven Nachahmung<br />
Bestimmend für das Lernen sowohl in der Zeit vor etwa 1800 als auch in der heutigen<br />
"U-Musik" ist der auditive, improvisatorisch-imitatorische Zugang. Dieses Prinzip<br />
wurde früher durch beinahe täglichen Unterricht gewährleistet und ist heute wesentlich<br />
von Tonträgern geprägt. Manche Jazzmusiker nutzten z.B. in Anwendung<br />
dieser Tonträger eine bestimmte – allerdings im Gegensatz zu neuesten Möglichkeiten<br />
der Beeinflussung akustischer Strukturen wiederum sehr eingeschränkte –<br />
Funktion von Tonbandgeräten, die Wiedergabe zu manipulieren, indem sie die Abspielgeschwindigkeit<br />
halbierten, um die für sie vorbildhafte Musik detaillierter<br />
wahrnehmen zu können. Die Wiedergabe erfolgt mit Hilfe traditioneller analoger<br />
Tonträger bei halber Wiedergabegeschwindigkeit zwangsläufig eine Oktave tiefer.<br />
Der Schlagzeuger GÜNTER SOMMER berichtet von einem geradezu schlechten Gewissen,<br />
das er bei einer solchen Manipulation des Mediums verspürte:<br />
190<br />
"Ich habe angefangen, Blakey auf dem Tonband abzuhören und in halber Geschwindigkeit<br />
zu analysieren und kam mir bald wie ein Dieb vor." (PILZ 1996,<br />
29)<br />
Wäre Günter Sommer aber Schüler von C. PH. E. BACH gewesen, so wäre ihm sein<br />
schlechtes Gewissen möglicherweise erspart geblieben, denn BACH hielt eine solche<br />
Art von krimineller Energie zu Gunsten imitatorischen Musiklernens geradezu für<br />
notwendig. Er schreibt in der Vorrede zu seinem Versuch über die wahre Art das<br />
Clavier zu spielen:<br />
"Das Abhören, eine Art erlaubten Diebstahls, aber ist in der Musick desto<br />
nothwendiger, da [...] viele Sachen aufstossen, die man kaum weisen, geschweige<br />
schreiben kan, und die man also vom blossen Hören erlernen muß."<br />
(BACH 1753/1994, Vorrede)
� Vortrag und Interpretation<br />
Ähnlich wie in der Zeit der frühen Virtuosen steht beim Jazzvortrag nicht eine<br />
werkzentrierte, sondern eine publikumsorientierte Perspektive im Vordergrund. Der<br />
Musiker hat seine Spielweise durch ständige Veränderung an die aktuelle Situation<br />
anzupassen, um das Interesse des Publikums zu wecken und zu erhalten. Die folgende<br />
Bemerkung von JAMEY AEBERSOLD beschreibt nichts anderes als diese kommunikative<br />
Musikauffassung der Barockzeit (vgl. S. 23):<br />
"Abwechslung ist vorrangig. Übertreiben Sie aber nicht. Wecken Sie das Interesse<br />
des Zuhörers." (AEBERSOLD 1996, 30)<br />
Im Vordergrund steht dabei weniger die detailgetreue Umsetzung eines Notentextes<br />
als vielmehr die künstlerische Ausgestaltung der aktuellen Situation. Die Verantwortung<br />
des Vortragenden gegenüber dem Publikum lässt dabei die von CHRISTIAN<br />
KADEN postulierte Aufhebung der Arbeitsteilung zwischen Komponist und Interpret<br />
(vgl. S. 76) nicht zu. Bei JAMEY AEBERSOLD findet sich ein Zitat des Jazzmusikers<br />
JOE HENDERSON, die seine Auffassung vom Verhältnis zwischen Vortragendem und<br />
Komponist beschreibt:<br />
"Ich habe immer versucht, die Melodien besser wiederzugeben als die Komponisten,<br />
die sie schrieben. Ich habe immer versucht, dabei etwas zu erfinden,<br />
was nicht einmal ihnen selbst eingefallen wäre. Für mich besteht die wahre<br />
Herausforderung darin, nicht die Absichten des Komponisten zu ändern, sondern<br />
mit den Parametern des Komponisten kreativ, phantasie- und bedeutungsvoll<br />
umzugehen." (AEBERSOLD 1996, 60)<br />
Auch diese Auffassung gleicht der von CARL PHILIPP EMANUEL BACH, wie er sie<br />
noch in der ersten Auflage seines Versuchs über die wahre Art das Clavier zu spielen<br />
vertreten hatte. C. PH. E. BACH wurde diesbezüglich bereits zitiert, die entsprechende<br />
Passage soll hier zu Zwecken des direkten Vergleichs ausnahmsweise nochmals<br />
angeführt werden:<br />
"Alle Veränderungen müssen dem Affeckt des Stückes gemäß seyn. Sie müssen<br />
allezeit, wo nicht besser, doch wenigstens eben so gut, als das Original<br />
seyn." (BACH 1753/1994, 132)<br />
Die Absolutheit des schriftlich definierten Werks lässt einen solchen Umgang mit<br />
Komposition heute in der Regel nicht mehr zu, und jedem Schüler würde es als An-<br />
191
maßung und mangelnde Pietät (vgl. S. 59) ausgelegt, wagte er einen ähnlich selbstbewussten<br />
Einsatz seines eigenen Ohrs wie JORGE BOLET, über dessen Umgang mit<br />
den Werken LISZTS der Pianist FRIEDRICH HÖRICKE berichtet:<br />
192<br />
"Er setzte die Sachen um, baute Akkorde um, schichtete die Sachen ganz anders<br />
und sagte dann: Denn so und so klingt das einfach nicht." (DÜRER 1999,<br />
46)<br />
� Der musikalische Gedanke und seine Ausführung<br />
Die kreative Verbindung des musikalischen Gedankens mit seiner Ausführung bedingte<br />
in der Zeit bis um 1800 eine Lern- und Übeweise, die von MARTIN GELLRICH<br />
als "Passagen- und Sätzchen-Spiel" bezeichnet wurde (vgl. Abschnitt 2.1). Dabei<br />
eignet sich der Schüler durch Variation bestehender Figuren und Entwicklung eigener<br />
musikalischer Gedanken das erforderliche musiksprachliche Material an. Rein<br />
motorisch motiviertes Musizieren ist auf diese Weise kaum möglich; das Spiel ist<br />
untrennbar verbunden mit der Klangvorstellung des ausführenden Musikers. Die<br />
folgende Äußerung von JAMEY AEBERSOLD beschreibt nichts anderes als diese alte<br />
Lernmethode:<br />
"Jazzmusiker haben die Musik zunächst im Kopf, dann arbeiten und üben sie,<br />
bis sie diese Ideen auf ihren Instrumenten spielen können. Grundlage dafür<br />
bildet das Beherrschen der Fingersätze und der Tonleitern und Akkorde (Arpeggien)<br />
der jeweiligen Harmonien." (AEBERSOLD 1996, 4)<br />
Auch der Begriff des musikalischen "Gedanckens", der in den Lehrwerken des 18.<br />
Jahrhunderts noch eine zentrale Rolle spielte (vgl. z.B. S. 22: C. PH. E. BACH) und in<br />
den letzten 150 Jahren im Zuge der Beschränkung auf die Reproduktion aus der<br />
Musikdidaktik verschwunden ist (vgl. S. 49), gewinnt in der Jazzpädagogik wieder<br />
an Bedeutung (vgl. AEBERSOLD 1996, 27).<br />
� Improvisation, Komposition und Begabung<br />
Wenn eigene musikalische Gedanken realisiert werden, entsteht implizit auch die<br />
Fähigkeit zu Improvisation und Komposition (vgl. Abschnitt 2.5). Diese Fähigkeiten
waren ursprünglich Ziel jeden Musikunterrichts und bedurften keiner besonderen<br />
Begabung. CARL CZERNY äußerte sich folgendermaßen:<br />
"Ich bin überzeugt, dass Jedermann, der im Spielen eine mehr als mittelmässige<br />
Stufe erreicht hat, auch der Kunst des Improvisierens, wenigstens bis<br />
zu einem gewissen Grade, nicht unfähig ist. Aber hierzu gehört auch, dass man<br />
bey Zeiten sich darin zu üben anfange, (was leider die meisten Spieler versäumen,)<br />
und dass man unverdrossen die sich stets vermehrende Erfahrung, welche<br />
man durch das Einstudieren zahlreicher fremder Compositionen gewinnt,<br />
auch auf das eigene Fantasieren anzuwenden lerne." (CZERNY 1988, 79)<br />
Eine ähnliche Haltung vertritt JAMEY AEBERSOLD:<br />
"Jeder kann improvisieren. Das war schon immer die natürlichste Art, Musik<br />
zu machen. Es ist eine Technik, die wir entweder vergessen haben oder für die<br />
wir uns nicht gut genug halten." (AEBERSOLD 1996, 6)<br />
Gleiches gilt für die Komposition. Wenn improvisatorische Techniken vermittelt<br />
werden, wird auch die folgende Forderung von HANS WERNER HENZE bezüglich<br />
der Fähigkeit der Komposition nicht mehr so abwegig klingen, wie dies aus Sicht<br />
der heutigen Musikpädagogik (vgl. S. 108) noch erscheinen mag:<br />
"Jeder Mensch, der sich mit Musik beschäftigt, sollte eigentlich auch komponieren<br />
können." (HENZE 1997)<br />
Improvisations- und Kompositionsfähigkeiten sind untrennbare Bestandteile des<br />
Musizierens sowohl für einen Musiker des Barockzeitalters als auch für einen modernen<br />
Jazzmusiker. Die Tatsache, dass in beiden Stilen nicht kategorisch zwischen<br />
Komponisten und Interpreten unterschieden wird, zeugt von dieser Einheit. Auch die<br />
Kunst des Präludierens (vgl. S. 27) findet sich in der Musizierpraxis des Jazz wieder.<br />
� Die Bedeutung schriftlicher Lehrwerke<br />
Im multimedialen Kontext gewinnt das schriftliche Lehrwerk eine Bedeutung zurück,<br />
die ihm bereits in der Zeit vor etwa 1800 zugemessen war. Vergleicht man<br />
aktuelle Lehrwerke des Jazz mit Clavierschulen des 18. Jahrhunderts, zeigen sich<br />
verblüffende Übereinstimmungen. In den Jazz-Klavierschulen lebt die alte Form von<br />
Handwerkslehren wieder auf, wie sie als grundlegend verschieden von heutigen<br />
klassischen Klavierschulen charakterisiert wurde (vgl. S. 23). Die Autoren der Jazz-<br />
193
Schulen konzipieren, wie die Verfasser der Clavierschulen des Barock, das schriftliche<br />
Medium hauptsächlich als Harmonie- Melodie- und Rhythmuslehre; Notenbeispiele<br />
haben hier vorwiegend ergänzende und illustrierende Funktion. Dabei ist es<br />
wie in den älteren Clavierschulen nicht vorgesehen, dass sich der Schüler auf die<br />
abgedruckten Beispiele beschränkt, sondern diese als Ausgangspunkt für eigene<br />
Weiterentwicklungen betrachtet. Zusätzlich stützen sich die modernen Lehrwerke<br />
des Jazz inzwischen auf Tonträger. Das schriftliche Medium zieht sich auf eine<br />
Rolle als Sekundärmedium zurück:<br />
194<br />
"Sie lernen Stücke vor allem, wenn Sie selber von Aufnahmen transkribieren.<br />
Mit zunehmender Fähigkeit sollte dies Ihre hauptsächliche Quelle werden."<br />
(LEVINE 1992, 8)<br />
Diese Lehrwerke sind, ebenso wie die alten Clavierschulen, nicht nach motorischer,<br />
sondern nach musikstruktureller Komplexität geordnet.<br />
� Die Bedeutung von Kurzschreibweisen<br />
Die primäre Rolle auditiver Medien führt dazu, dass Kompositionen in der Regel<br />
nicht mehr extrem detailliert schriftlich fixiert werden. Deshalb kommt die Notation<br />
im Jazz meist mit einer Kurzschrift aus. Die "Leadsheets", die im Wesentlichen aus<br />
der ausnotierten Melodie und darübergeschriebenen Harmoniesymbolen bestehen,<br />
zeigen in der Angabe von Rhythmik, Harmonik und Melodie eine ähnliche Kurzschreibweise<br />
wie die Generalbassnotation. Dabei liegen Funktionen der Akkorde<br />
zwar fest, aber die Gestaltung der Feinstruktur (das "Voicing") liegt in der Verantwortung<br />
des Ausführenden und wird von ihm an den Gesamtklang, das angetroffene<br />
Instrument und die akustischen Umgebungsverhältnisse angepasst. Im Vorwort des<br />
Real Book III wird ausdrücklich betont, dass die angegebenen Akkordsymbole nicht<br />
buchstäblich, sondern unter der Voraussetzung guten Geschmacks sinngemäß zu<br />
verstehen sind:<br />
"It should be understood by the user that 7th chords may be enhanced harmonically<br />
by the addition of upper extensions. The only limit to this would be<br />
good taste. [...] You will also notice the absence of turn-around chords. It is assumed<br />
that you can figure out them yourself." (The Real Book III, Vorwort)
Das Spiel im Jazz-Ensemble lässt den Pianisten eine ähnliche Rolle einnehmen, die<br />
der "Accompagnist" beim Generalbassspiel innehatte. CARL PHILIPP EMANUEL<br />
BACH beschrieb sie folgendermaßen:<br />
"Es ist ein Irrthum wenn man glaubt, daß sich die Regeln des guten Vortrags<br />
blos auf die Ausführung der Handsachen erstrecken. [...] Wir haben uns darüber<br />
schon [...] erkläret, und von einem Accompagnisten gefordert, daß er jedem<br />
Stücke, welches er begleitet, die ihm zukommende Harmonie mit dem<br />
rechten Vortrage in der gehörigen Stärke und Weite gleichsam anpassen soll."<br />
(BACH 1762/1994, 242)<br />
� Die Bedeutung der Übung<br />
Die aus Sicht der heutigen klassischen Musikpädagogik befremdliche Tatsache, dass<br />
die Virtuosen der alten Schule, wie etwa BEETHOVEN, CHOPIN (vgl. S. 27) oder<br />
LISZT (vgl. S. 27) ihre vorzutragenden Werke nicht explizit übten, findet sich in der<br />
Praxis des Jazz wieder. Für den Journalisten, der das folgende Interview mit LES<br />
MCCANN führte, scheint die hier praktizierte Einheit von Üben und Ausüben so unverständlich,<br />
dass er den Befragten durch sein wiederholtes Fragen nach seinem<br />
Übegeheimnis zu einer ungehaltenen Reaktion und zur Umkehrung der Interviewsituation<br />
provozierte:<br />
"[...] viele können nur eins und ich kann eben sehr gut hören.<br />
So übten Sie nicht jahrelang jeden Tag mehrere Stunden oder so?<br />
Oh nein, ich spielte jeden Tag, das war meine Übung...<br />
...auch mit speziellen Lektionen etc.?<br />
Ja manchmal, aber alles was ich entwickelte, war ich selbst.<br />
Keine klassische Ausbildung?<br />
Nein.<br />
So begannen Sie mit Gospel oder etwa direkt mit dem Jazz?<br />
195
196<br />
Ich fing mit einer Note an und eines Tages waren es zwei Noten und wieder an<br />
einem anderen Tag waren es drei Noten. Es ist alles Entfaltung und Entwicklung.<br />
Wie haben Sie schreiben gelernt?<br />
In der Schule.<br />
Ja, aber wie haben Sie es gelernt?<br />
Durch versuchen.<br />
Ja, das ist dasselbe. Kein Unterschied in allem. Ich hasse diese Art von Fragen."<br />
(EBERT 1998, 31)<br />
Insgesamt lassen sich nach der Gegenüberstellung der Lernmethoden von frühem<br />
Virtuosentum und Jazz frappierende Ähnlichkeiten feststellen. Die angeführten Beispiele<br />
belegen bereits heute gewichtige Auswirkungen der analogen elektroakustischen<br />
Tonaufzeichnung auf die Kultur des Musizierens. Damit verdankt eine in<br />
weitaus vielfältigeren Freiheitsgraden sich vollziehende und damit (im ursprünglichen<br />
Sinn) "virtuosere" Praxis als die der traditionellen, klassisch ausgerichteten<br />
Instrumentalpädagogik ihre Entstehung nicht unwesentlich der Medienentwicklung.<br />
Von künftigen digitalen, im Vergleich zur Geschichte von Schallplatte und Tonband<br />
um Größenordnungen vielschichtigeren medialen Entwicklungen könnten entsprechend<br />
noch einschneidendere Auswirkungen auf die Musikkultur in dieser Richtung<br />
erwartet werden.<br />
Damit deutet sich nichts anderes an als eine Revolution: Eine Laien- oder Subkultur<br />
bekommt mit Medienhilfe alle Handhabe zu Virtuosität und Professionalität, während<br />
klassisch ausgerichtete institutionalisierte Musikausbildung ihr auf der Kenntnis<br />
von schriftlicher Codierung sich gründendes Monopol zu Musikerziehung verliert<br />
(vgl. Kap. 4.5). Durch die Relativierung des Werkbegriffs, der sich gegenwärtig<br />
insbesondere in der Diskussion um das Sampling artikuliert und mit der allgemeinen<br />
Verfüg- und Manipulierbarkeit klanglicher Strukturen einhergeht, scheint sich Musik<br />
in einer Klangkunst zu verflüssigen. Zusätzlich Vorschub erhält diese Tendenz<br />
durch neue Online-Technologien, insbesondere das Internet. Damit verschmelzen<br />
nicht nur Musikübermittlung und Musikspeicherung. Auch Klangerzeugung, die<br />
traditionelle Aufgabe von Musikinstrumenten, kann vom Digitalrechner übernommen<br />
werden. Dabei nähern sich auch die Disziplinen Komposition und Arrangement<br />
und damit die Sphären von Musikerfindung, Musikausführung und Musikproduktion<br />
an. Allerdings wächst damit beim genaueren Hinsehen nur zusammen, was zusammengehört.<br />
Auch die Aufführungspraxis ist davon nicht zu trennen.
Musikpädagogik und Musikwissenschaft werden sich der veränderten Mediensituation<br />
stellen müssen. In den Mittelpunkt von Musizieren rückt zunehmend die auditive<br />
Information. Musikunterricht wird sich in Anbetracht veränderter Bedingungen<br />
künftig nicht mehr auf die Interpretation beschränken, sondern zunehmend auf die<br />
Vermittlung eigenkreativer musikalischer Fertigkeiten unter Einbeziehung aller medialen<br />
und sozialen Möglichkeiten ausdehnen.<br />
Ob sie es zugibt oder nicht: die Musikpädagogik registriert – wenn auch vielleicht<br />
noch unterschwellig – diese Veränderungen, die ihr Tätigkeitsfeld bereits heute erheblich<br />
tangieren. Das scheinbar paradoxe Phänomen, dass sich die Aufarbeitung<br />
der Medienentwicklung gerade in den Musikdisziplinen und damit auf den Gebieten,<br />
die sich originär mit akustischen Erscheinungen befassen und dadurch besonders<br />
von neuen Medien und Multimedialität profitieren könnten, gegenüber anderen Fächern<br />
im Rückstand befindet, resultiert nicht zuletzt aus der begründeten Furcht der<br />
Zunft vor dem Verlust ihrer marktbeherrschenden Stellung, der in ihrem jetzigen,<br />
auf Umgebungsbedingungen des 19. Jahrhunderts beruhenden Zustand mit der<br />
Überwindung der Schriftlichkeit in der Musikvermittlung zwangsläufig verbunden<br />
wäre.<br />
Die von Musikwissenschaftlern und Musiklehrern meist defensiv geführte Diskussion<br />
um die Rolle neuer Medien zeigt eine tiefgreifende Verunsicherung. Häufig<br />
geäußerte Befürchtungen, die Maschine löse eines Tages den Menschen als musikausübendes<br />
Wesen ab, sind vielleicht auch Ausdruck der unterschwelligen<br />
Ahnung, dass durch die technologische Entwicklung jede Form von Dilettantismus<br />
obsolet werden könnte. Diese Angst davor, ob der musizierende Mensch nicht doch<br />
irgendwann durch die Maschine ersetzt werden könnte, zeugt damit auch von<br />
unbegründeten Zweifeln an einer der Grundbedingungen von Musik überhaupt: der<br />
Funktion von Musik als menschlicher Kommunikationsform. Diese Zweifel werden<br />
allerdings genährt durch stereotype Tendenzen insbesondere des solistischen<br />
Unterrichts- und Wettbewerbswesens in der Praxis heutigen Instrumentalspiels. 41<br />
Indem Musikautomaten die menschliche Kreativität herausfordern, helfen sie aber<br />
letztendlich, den Blick zu schärfen für das kommunikative Moment des Musizierens<br />
als genuin menschliche Äußerungsform. Es erscheint unumgänglich, diese Heraus-<br />
41 Ein Bild von derartigen Merkmalen zeichnet die folgende, in einem Bericht über das 4. Symposium<br />
des "Instituts für Begabungsforschung und Begabtenförderung in der Musik" zitierte Äußerung<br />
eines unumstrittenen Fachmanns für Klavierwettbewerbe, Prof. Karl-Heinz Kämmerling:<br />
"Karl-Heinz Kämmerling veranschaulichte [...], daß nicht nur [!] Tastenakrobatik und Muskelkraft<br />
bei der Interpretation gefragt sind, sondern daß eine neue 'Innerlichkeit und Innigkeit' in die<br />
klassische Musik Einzug halten müsse [!]. Auch [!] damit könne [!] man bei international renommierten<br />
Wettbewerben Erfolg haben." (KOCH 1998, 31)<br />
197
forderung im Vertrauen auf die Unantastbarkeit des Subjekts und seiner ästhetischen<br />
Empfindung anzunehmen, auch unter Einbeziehung neuer Medien. Ebenso wenig<br />
wie die Verbreitung von Tonträgern den Konzertbetrieb überflüssig machen konnte,<br />
wird ein theoretisch denkbarer synthetischer Interpret oder Komponist das Ende des<br />
kreativen Musikertums besiegeln. Wo künstlerische Leistung allerdings wesentlich<br />
in den Kategorien von Geschwindigkeit und Exaktheit von Bewegungen gemessen<br />
wird, bestehen Befürchtungen und Ängste zu Recht: Auf diesem Gebiet der "Virtuosität"<br />
in ihrer eingeschränkten Bedeutung (vgl. S. 154) muss sich der Mensch der<br />
Maschine bereits heute geschlagen geben.<br />
Als Folge der Medienentwicklung wird sich auch die fragwürdige Dichotomie zwischen<br />
aktiver Musikausübung und passivem Musikkonsum auflösen oder zumindest<br />
ihr diskriminierendes Moment verlieren. Statt dessen rückt wieder die gegenwärtig<br />
vielfach unterrepräsentierte Fähigkeit zur Reaktion in den Mittelpunkt des Interesses,<br />
die, wie MARSHALL MCLUHAN meint, im Zuge der Alphabetisierung weitgehend<br />
verlorengegangen ist. Für MCLUHAN ergibt sich diese Konsequenz aus einem<br />
Wechsel der Medienperspektive. An seine bereits zitierte Bemerkung über die<br />
Rückeroberung des Hörraumes<br />
198<br />
"Wir leben wieder im Hörraum. Wir haben wiederum damit begonnen, Urahnungen,<br />
Stammesgefühlen Gestalt zu geben, von denen uns einige Jahrhunderte<br />
des Alphabetismus getrennt hatten." (MCLUHAN 1984, 63)<br />
schließt deshalb der Hinweis auf die Verlagerung des Schwerpunkts der Aufmerksamkeit<br />
von der Aktion zur Reaktion an:<br />
"Wir sehen uns jetzt genötigt, unsere größte Aufmerksamkeit nicht mehr Aktionen,<br />
sondern Reaktionen zuzuwenden." (MCLUHAN 1984, 63)<br />
Wie sehr das schriftliche Medium den Sinn für die für das Musizieren essentiellen<br />
Parameter Reaktion und Interaktion beeinträchtigen kann, wird auch aus der Tatsache<br />
ersichtlich, dass diese auch von einflussreichen Musikern erst allmählich wiederentdeckt<br />
werden müssen. Diese Reaktionsfähigkeit war selbst für SERGIU<br />
CELIBIDACHE, einen bedeutenden Vertreter der Musikkultur des 20. Jahrhunderts, in<br />
seiner musikalischen Ausbildung keineswegs eine Selbstverständlichkeit, erforderte<br />
die Einsicht in die Notwendigkeit interaktiven Musizierens doch den Perspektivwechsel<br />
vom Denken in absoluten Parametern, das die Partitur nahelegt, hin zur reaktiven<br />
Präferenz des Ohres:
"Also was habe ich von Furtwängler gelernt? Der eine Gedanke, der mir alle<br />
Türen für mein ganzes Leben und für meine Untersuchung geöffnet hat, dieser<br />
eine Satz, als der junge Celibidache ihn gefragt hat: 'Meister, wie geht dieser<br />
Übergang in dieser Bruckner-Symphonie von dem da, wie macht man das, wie<br />
schnell und was schlagen Sie da?' sagte er:<br />
'Wieso, wie schnell? Je nachdem, wie es klingt! Klingt es weich und tief und<br />
überall gleich, werde ich breiter. Klingt es trocken und flüchtig, muss ich<br />
schneller werden.'<br />
Das heißt, er ist auf das Hören eingestellt, auf das, was tatsächlich rauskommt,<br />
was tatsächlich mitspielt. Nicht auf eine Theorie. [MM=] 92, was ist 92 in der<br />
Berliner Philharmonie, was ist 92 in der Münchner Philharmonie und was sind<br />
92 im Musikverein in Wien? Eine Idiotie!" (Videoprotokoll)<br />
Die Überwindung des Metronoms, die CELIBIDACHE hier andeutet, besitzt Symbolcharakter<br />
für die Überwindung des Denkens in linear-absoluten Kategorien, das<br />
die klassische Musikkultur seit ihrer Begründung in den Jahrzehnten nach 1800<br />
(nicht zufällig gleichzeitig mit der Erfindung des Metronoms) auszeichnet. Die Forderung<br />
nach Improvisation im Musikunterricht (vgl. Abschnitt 2.5) zielt in eine<br />
ähnliche Richtung, war aber bislang in der Praxis der Musikerziehung mit traditionellen<br />
Medien kaum realisierbar (vgl. S. 180). Ein Wechsel des Mediums musikalischer<br />
Ausbildung vom Notenblatt zu einer Art interaktivem "Werkzeug für das Ohr"<br />
(vgl. FLENDER & HEUGER 1998, 446) jedoch stellt, indem das Ohr wieder in den<br />
Mittelpunkt der Wahrnehmung rückt, einen wichtigen Zwischenschritt dar auf dem<br />
Weg zur (Wieder-) Erlangung auch der Fähigkeit zu musiksprachlicher Kommunikation.<br />
Wenn interaktive Medien eines Tages nicht nur Grundregeln des Tonsatzes und andere<br />
handwerkliche Grundlagen vermitteln, sondern grundsätzlich stärker zur musikalischen<br />
Bildung genutzt werden, gewinnt die Handwerklichkeit in der Musik wieder<br />
an Gewicht, und die Sphäre der eigentlichen Kunstausübung verschiebt sich innerhalb<br />
der Komposition auf dasjenige Gebiet, wo aussagekräftige ästhetische Mitteilungen<br />
gemacht werden. Die Grenze zwischen Handwerk und Kunst (und damit<br />
zwischen "Normalität" und "Künstlichkeit") würde dann ungefähr dort zu liegen<br />
kommen, wo von den handwerklichen Grundlagen des Tonsatzes zu authentischen<br />
musikalischen Äußerungen übergegangen wird. Damit wäre, wie es sich in der Praxis<br />
bereits abzeichnet (vgl. Abschnitt 4.5.2), der Zwang zur Kunstproduktion vom<br />
Musik Ausübenden genommen und gleichzeitig zumindest ein Teil des "Schattens<br />
der Vergangenheit" (THOMAS NIPPERDEY, vgl. S. 45), der seit der "Erfindung" der<br />
Klassik (vgl. S. 44f.) die Musikausübung zu einer ziemlich "künstlichen" Sache werden<br />
ließ, zu überwinden.<br />
199
Der Gewinn kommunikativer Elemente unter Zurückdrängung der künstlerischen<br />
Überhöhung musikalischen Tuns in Verbindung mit dem direkten medialen Zugriff<br />
auf musikalische Strukturen könnte Auswirkungen haben, wie sie sich schon<br />
HEINRICH JACOBY von einem alternativen Musikunterricht gewünscht hatte. Das<br />
Phänomen der "Unmusikalität" würde nämlich seiner Meinung nach seine Existenzgrundlage<br />
verlieren, wenn erst ein natürlicheres und damit weniger künstliches Verhältnis<br />
zur Musik zurückgewonnen ist:<br />
200<br />
"Die praktische Erfahrung zeigt immer wieder, daß eine Entwicklung, die psychologisch<br />
und methodisch anders als im üblichen Musikunterricht eingeleitet<br />
wird, die Äußerungs- und 'Aufnahme'-Fähigkeiten der 'Unmusikalischen' verhältnismäßig<br />
leicht fördert, und zwar oft so weit, daß sie in manchem den nicht<br />
auf einem solchen Weg gebildeten 'Musikalischen' sogar überlegen werden.<br />
Wie wichtig diese überraschend gewonnene Möglichkeit der musikalischen<br />
Äußerung für die gesamte Entwicklung des einzelnen Menschen werden kann,<br />
was das Erwachen des Vertrauens zur eigenen Äußerungsfähigkeit und zu deren<br />
Entfaltungsmöglichkeit für die Entwicklung des Selbstvertrauens bedeutet,<br />
vermag der Unbeteiligte kaum zu ermessen.<br />
Eine Berechtigung für die bisher übliche Scheidung in 'Musikalische' und<br />
'Unmusikalische' kann es nicht mehr geben, wenn der Beweis erbracht worden<br />
ist, daß die Hemmungen, die den Menschen unmusikalisch erscheinen lassen,<br />
überwunden werden können." (JACOBY 1995, 15f.)<br />
Der autodidaktischen Betätigung mit Digitalmedien (vgl. Abschnitt 4.5.2) ist es bereits<br />
heute zu danken, dass Menschen zu professionellen Musikern (und damit im<br />
allerursprünglichsten Sinne: "Virtuosen") wurden, die nach herkömmlichen Bewertungsmaßstäben<br />
weder als "musikalisch" bezeichnet worden wären, noch einen herkömmlichen<br />
Instrumentalunterricht erfolgreich absolviert hätten. Auch die Integration<br />
aus Wiedergabemedium und Musikinstrument in Form des Samplers trägt dazu<br />
bei, dass sich Wiedergabe, Improvisation und Komposition vermischen, ihre künstliche<br />
Aura verlieren und das praktische Musizieren sich in verschiedenste Facetten<br />
aufgliedert, die je nach medialem Hilfsmittel und Niveau des Schaffenden von einfacherer<br />
Synthese mit Hilfe spezieller Software am Computer über das Sampling<br />
und das Keyboardspiel bis hin zur traditionellen Schaffung von Notentexten für Ensembles<br />
herkömmlicher Musikinstrumente reichen. Aus pädagogischer Sicht besonders<br />
bedeutsam ist dabei die in Abschnitt 4.5.2 geschilderte Durchlässigkeit zwischen<br />
unterschiedlichen musikalischen Komplexitätsgraden. Damit bekommt auch<br />
eine Forderung Substanz, die von fortschrittlichen Musikpädagogen immer öfter<br />
vorgebracht wird: dass die traditionelle Interpretationspädagogik dringend der Revi-
sion und vor allem Ergänzung bedarf. Der US-amerikanische Pianist SEYMOUR<br />
BERNSTEIN formuliert diese Forderung folgendermaßen:<br />
"Heutzutage wird einseitig reproduktive Fertigkeit gefördert und, sozusagen<br />
zum Ausgleich, das Wort 'schöpferisch' unkritisch auf die Interpretationskunst<br />
angewandt. Wir müssen Kreativität als wesentliches Element musikalischer<br />
Erziehung begreifen! Sie wissen, es war Bach, der in der Vorbemerkung zu<br />
seinen Inventionen sagte: Ich schreibe diese Stücke, um Grundlagen des Komponierens<br />
zu vermitteln, ich gebe ein Beispiel. Wir sind von diesem Weg abgekommen."<br />
(WIDMAIER 2001, 42)<br />
Musikalische Kreativität kann sich heute auf neue Technologien und Multimedialität<br />
stützen, sowohl in Musikpraxis als auch Musikerziehung. Die Erforschung und<br />
Anwendung neuer Technologien muss ein wesentlicher Bestandteil der vom<br />
Deutschen Musikrat geforderten Revision der musikpädagogischen Berufe sein.<br />
4.7 Zur Theorie des Klavierspiels<br />
Aus den im Entstehen begriffenen multimedialen Möglichkeiten erwächst in Form<br />
des interaktiven "Werkzeugs für das Ohr" eine neue, beliebig formbare Schnittstelle<br />
zwischen Mensch und Musik. Solange Musikunterricht sich zwangsläufig vorwiegend<br />
auf den einseitigen Sinneskreis Auge-Hand stützen musste, wie ihn unter anderem<br />
CARL ADOLPH MARTIENSSEN (vgl. S. 100) und RAINALD MERKERT (vgl. S. 98)<br />
verdeutlicht haben, konnte von einem den Strukturen des Materials gemäßen, also<br />
analogen Umgang mit Musik nicht die Rede sein.<br />
In der elektrischen Digitalisierung wendet sich nun paradoxerweise eine Jahrhunderte,<br />
wenn nicht Jahrtausende währende Tendenz der geistigen Digitalisierung und<br />
damit "Ent-Analogisierung" zurück in einen Prozess der Analogisierung des Verhältnisses<br />
zwischen Musiker und Musikinstrument. Dieser Sachverhalt begründet<br />
sich wie folgt:<br />
Die Einteilung der Musik in Einzeltöne, die Verabsolutierung der Höhen dieser<br />
Töne und ihre Repräsentation durch bestimmte Griffe auf Musikinstrumenten und<br />
die Finger der Guidonischen Hand bis hin zur Notenschrift und die Mensurierung<br />
der Einsatzzeiten dieser Töne können als eine Rasterung ursprünglich analoger<br />
Kontinua musikalischen Rohmaterials und damit als Prozess der Digitalisierung<br />
aufgefasst werden (vgl. FRICKE 1998). Bereits die sprachliche Herkunft des Begriffes<br />
"digital" verweist auf den Wandel von "analogem" Musizieren unter Verwen-<br />
201
dung der menschlichen Stimme und kontinuierlichen Klangparametern hin zu einem<br />
Musizieren unter Zuhilfenahme der Finger (lat. digitus).<br />
Die Selektion bestimmter Elemente musikalischen Materials aus einem unendlichen<br />
Vorrat im Zuge dieser Digitalisierung in Verbindung mit der Schaffung von Notationstechniken<br />
machte eine dauerhafte Überlieferung in der vorelektrischen Zeit erst<br />
möglich (vgl. KADEN 1993, 75), beeinflusste andererseits aber auch den Gehalt der<br />
Musik, indem sie leichter notierbare Parameter bevorzugte und die Musiktradition<br />
auf schriftlich fixierbare Strukturelemente wenn nicht reduzierte, so doch<br />
konzentrierte.<br />
Nur im Geist dieses "digitalen" Denkens aus der Perspektive der Finger bzw. der<br />
Einzeltöne kann die folgende Verhaltensweise von LEOS JANACEK als vermeintlich<br />
inkonsequent gedeutet werden. Der Pianist RUDOLF FIRKUSNY, der als Kind persönlich<br />
von JANACEK ausgebildet worden war, berichtet, wie JANACEK seine eigenen<br />
Werke unterrichtete:<br />
202<br />
"Natürlich spielte ich mit ihm auch die meisten seiner Klavierwerke. Und hier<br />
war Janacek bezeichnenderweise inkonsequent: Oft änderte er – wohl aus seiner<br />
impulsiven Natur heraus – die gedruckte Vorlage ab." (FIRKUSNY 1997, 9)<br />
Wechselt die Perspektive aber von der durch das gedruckte Medium suggerierten<br />
Unabänderlichkeit des Geschaffenen in die Gegenwart und die Welt des Klangs, so<br />
wirken sich vielfältige Variablen wie der Zustand des Klaviers und des Raumes,<br />
aber auch der subjektiven Befindlichkeit des Ausführenden in Relation zum Auditorium<br />
auch auf die Feinstruktur des Werks aus. Dann wäre das Verhalten JANACEKS<br />
keineswegs mehr als inkonsequent zu begreifen. Allerdings bleibt die Frage nach der<br />
Gültigkeit der auf diese Weise wiederum schriftlich definierten Änderung: sie ist<br />
natürlich genauso begrenzt wie der ursprüngliche Text.<br />
Auch am Beispiel der authentischen Ausführung von Trillern soll das Phänomen der<br />
"geistigen Digitalisierung" verdeutlicht werden. Die akademische Diskussion um die<br />
exakte Ausführung barocker Manieren verstellt leicht den Blick für das Wesentliche,<br />
den intendierten Klangeffekt, der möglicherweise auf modernen Instrumenten auf<br />
abweichende Art zu erzielen wäre. So schreibt CARL PHILIPP EMANUEL BACH in<br />
seinem Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, dass Verzierungen am<br />
Klavier häufig allein die Funktion haben, zu schnell abklingende Töne länger erscheinen<br />
zu lassen. Die Ausführung ist dadurch vom individuellen Klanggehalt des<br />
jeweiligen Instrumentes und der Raumakustik nicht zu trennen:<br />
"Es müssen aber alle diese Manieren rund und dergestalt vorgetragen werden,<br />
daß man glauben sollte, man höre blosse simple Noten. Es gehört hierzu eine
Freiheit, die alles sclavische und maschinenmäßige ausschliesset. Aus der<br />
Seele muß man spielen, und nicht wie ein abgerichteter Vogel." (BACH<br />
1753/1994, 119)<br />
In Musikpädagogik und Musikwissenschaft folgte aber der Geschichte der schriftlichen<br />
Überlieferung von Musik ein Prozess "mentaler Digitalisierung", der sich am<br />
sinnfälligsten in dem Phänomen der diskriminierenden Dichotomie "entweder –<br />
oder" bzw. "0" – "1" in Form der in der Musikpädagogik dominierenden Entscheidungskriterien<br />
"falsch" – "richtig" äußert.<br />
Die Beschränkung auf die zwölf Töne der gleichschwebend temperierten Skala unter<br />
Bezugnahme auf einen genormten Kammerton hat die Digitalisierung der abendländischen<br />
Musik auf die Spitze getrieben. Die Serielle Musik stellt in diesem Zusammenhang<br />
den Höhepunkt des selben Missverständnisses dar, das bereits die Erkenntnisse<br />
EUGEN TETZELS als vermeintlich abwegig erscheinen ließ: das aus der<br />
Perspektive des "digitalen Denkens" entstandene Missverständnis, den Sinn musikalischer<br />
Struktur in absoluten Tonparametern und nicht in der Relativität der Tonbeziehungen<br />
zu suchen.<br />
Nur wenige Jahrzehnte, nachdem also die Serielle Musik die geistig-strukturelle Digitalisierung<br />
in der Musik ad absurdum geführt hat, schafft nun (paradoxerweise) die<br />
elektrische Digitaltechnik die Möglichkeit, dass die Relativität in der Musik eine<br />
Bedeutung zurückgewinnt, die im Verlauf des Übergangs von der Sanglichkeit zur<br />
"Digitalisierung" der Musikausübung kontinuierlich ins Hintertreffen geraten war.<br />
Die Re-Analogisierung durch elektrische Digitaltechnik ent-digitalisiert musikalisches<br />
Material, indem sie das Raster der beeinflussbaren Gestaltungsparameter unendlich<br />
verfeinert und dadurch die verlorengegangenen Zwischenräume bis zum<br />
Klangkontinuum zurückerobert. Alle Klangbeeinflussungsmöglichkeiten, nicht nur,<br />
aber auch die der menschlichen Stimme, werden damit erstmals der Instrumentalmusik<br />
zugänglich. Das elektronisch komponierte Werk scheint zwar zunächst noch<br />
absoluter definiert als der Notentext. Dies gilt allerdings nur, solange die Interaktivität<br />
des Mediums ausgeklammert bleibt. Bescheidene Vorboten dieser Beeinflussungsmöglichkeiten<br />
finden sich seit Jahrzehnten beispielsweise in Form von Equalizern<br />
an jeder heimischen Stereoanlage.<br />
Die künftige Technikentwicklung wird zwar langfristig die Möglichkeiten differenzierter<br />
Klanggestaltung vervielfachen; eine etwaige Hoffnung auf eine Eroberung<br />
neuer oder tieferer musikalischer Erlebnissphären durch diese Technologie scheint<br />
aber illusorisch. Dies ergibt sich aus dem psychologischen Phänomen der "Unschärfe"<br />
menschlicher Wahrnehmung in Verbindung mit der aktivischen Rolle des<br />
Perzeptiven, wodurch es überhaupt erst möglich wird, auf einem Instrument wie<br />
203
dem Klavier Musik wiederzugeben, die vom menschlichen Hörer als ihm analoge<br />
Musik verstanden werden kann. Denn das hochtechnisierte Klavier stellt, ähnlich<br />
wie alle anderen (nicht elektronischen) Tasteninstrumente, deren Tonerzeugung auf<br />
komplexen Mechaniken beruht, den Inbegriff eines grob rasternden und damit "digitalen"<br />
Instrumentes dar, reduziert es doch tonliche Gestaltungsmöglichkeiten auf<br />
ein Minimum: es bietet weder Beeinflussbarkeit der Tonhöhen, noch der Klangfarbe<br />
getrennt von der Lautstärke, und (abgesehen vom nur pauschal und damit recht<br />
undifferenziert einsetzbaren Pedal) keine Möglichkeit der Beeinflussung des<br />
Tonverlaufs nach seiner Auslösung. Beim Hören von Klaviermusik bleibt es damit<br />
der Aktivität des Rezipienten überlassen, die dargebotenen Einzeltöne bei gutem<br />
Vortrag dennoch miteinander in Beziehung zu setzen und als dem Hörer analogen<br />
Vorgang zu interpretieren, wobei das Ohr quasi die Rolle eines Digital-Analog-<br />
Wandlers übernimmt. Ähnlich wie eine D-A-Wandlung in der Audiotechnik auf die<br />
glättende Funktion eines Tiefpassfilters nicht verzichten kann, scheint die<br />
menschliche Wahrnehmung nur zu funktionieren, weil sie in der Lage ist, "Kanten"<br />
von Einzelereignissen zu glätten, indem sie diese in Beziehung setzt und dabei,<br />
ähnlich der Betrachtung eines gerasterten Fotos oder pointillistisch erzeugten<br />
Gemäldes, ein eigenes Bild von Welt erzeugt. Auch die physikalische Tatsache, dass<br />
in der auf der gleichschwebend temperierten Stimmung beruhenden neueren<br />
abendländischen Musikpraxis am mechanischen Tasteninstrument nur zwölf<br />
unterschiedliche Tonhöhen pro Oktave existieren, wird durch die menschliche<br />
Wahrnehmung transformiert und dabei subjektiv in eine für den Zusammenhang und<br />
dessen Verständnis entscheidende Vielfalt enharmonisch unterschiedlich erlebbarer<br />
Töne verwandelt (vgl. ENDERS 1981, 19f.).<br />
Das nicht enden wollende Missverständnis um die Erkenntnisse EUGEN TETZELS<br />
kann wie das Phänomen der Seriellen Musik als Resultat der Fixierung auf das Einzelereignis<br />
im Zuge "mentaler Digitalisierung" und damit als Resultat des Verlustes<br />
der Perspektive der Relativität zwischen musikalischen Ereignissen in der Ton-Ton-<br />
Beziehung aufgefasst werden. Akzeptiert man aber, dass jeder Wahrnehmungsprozess<br />
einen aktiven Vorgang darstellt, der weder vom Subjekt noch vom Medium zu<br />
trennen und auf eine gewisse Unschärfe geradezu angewiesen ist, lassen sich die<br />
scheinbar unvereinbaren Sichtweisen von Kunst und Physik durchaus verbinden.<br />
Wie schwer es aber noch heute zu sein scheint, zu akzeptieren, dass die menschliche<br />
Wahrnehmung subjektiv und unabdingbar an die relativierende Struktur der<br />
menschlichen Psyche gebunden ist, ja durch die Unschärfe der Wahrnehmung und<br />
die dadurch notwendige Eigensynthese ein künstlerisches Erleben, insbesondere von<br />
Klaviermusik, erst möglich wird, zeigen vor nicht allzu langer Zeit (1997) veröffentlichte<br />
Ergebnisse von Forschungen an der Musikhochschule Trossingen unter<br />
204
Leitung des Pianisten WOLFGANG WAGENHÄUSER mit dem Ziel der Widerlegung<br />
EUGEN TETZELS. WAGENHÄUSER hält offenbar eine Diskrepanz zwischen physikalischer<br />
und künstlerischer Realität für unerträglich und bemüht sich deshalb, seine<br />
berechtigte künstlerische Sichtweise mit ungeeigneten Mitteln der objektiven<br />
Wissenschaft zu festigen. Zur Untermauerung seiner These von der Unrichtigkeit<br />
der Erkenntnisse TETZELS führte er aus Forschungsmitteln des Landes Baden-<br />
Württemberg finanzierte Untersuchungen mit dem fragwürdigen Ergebnis durch,<br />
dass es doch möglich sei, Klangfarbenbeeinflussungen beim Klavier unabhängig<br />
von der Lautstärke zu realisieren (vgl. WAGENHÄUSER & REUTER 1997). Hätte<br />
WAGENHÄUSER gegenteilige Ergebnisse erzielt, wäre er möglicherweise seines<br />
Seelenfriedens als Pianist verlustig gegangen, müsste er doch dann glauben, ein<br />
Psychopath zu sein: jedenfalls interpretiert er Unterschiede zwischen subjektiver<br />
und objektiver Weltsicht bereits in der <strong>Einleitung</strong> seiner Studie als pathologisches<br />
Phänomen:<br />
"Unter Kollegen findet man im Nu Konsens darüber, wie verblüffend unterschiedlich<br />
dasselbe Instrument bei verschiedenen Spielern klingt. Und dennoch<br />
akzeptieren alle die Behauptung der Akustiker, daß ebendies nicht möglich sei.<br />
So war es mir zunächst schlichtweg ein Anliegen, nachzuprüfen, inwieweit<br />
Pianisten Psychopathen sind." (WAGENHÄUSER & REUTER 1997, 6)<br />
Während sich die Naturwissenschaft mit Diskrepanzen zwischen Wahrnehmung und<br />
Messung abgefunden hat und die Bedeutung von Relativitäten anerkennt, sollten<br />
derartige Einsichten gerade in der Kunst ebenfalls nicht weiter bekämpft werden.<br />
Das Phänomen, dass gerade auf dem Gebiet der Pianistik pädagogische Denkansätze<br />
auf Simplifikationen beruhen und die spätestens seit EINSTEIN auch von der Naturwissenschaft<br />
anerkannte Bedeutung von Relativitäten negieren, untermauert die in<br />
Abschnitt 4.1 diagnostizierten Orientierungsschwierigkeiten der Musikpädagogik.<br />
Die ästhetische Bedeutung eines Signals lässt sich nie aus dem Signal selber begründen,<br />
sondern wird vom Subjekt aktiv aus dem Zusammenhang erzeugt. Bei der<br />
Wahrnehmung von Klaviermusik betrifft dieser Zusammenhang wesentlich die Relationen<br />
der Einzellautstärken, aus deren Kombination der Hörer eine etwaige ästhetische<br />
Information zweifelsfrei rückschließen kann. Dieser Zusammenhang bestätigt<br />
sich auch bei informationstheoretischer Betrachtung. So äußert sich<br />
JOHANNES PETERS in seinem 1967 erschienenen Grundlagenwerk zur Informationstheorie<br />
auch zu Fragen der Übermittlung ästhetischer Informationen:<br />
"Man kann auch der Frage der Übertragung von künstlerischem Empfinden<br />
durch einen technischen Nachrichtenkanal nicht ausweichen. Auch wenn die<br />
205
206<br />
Fragen des Zusammenhanges zwischen dem künstlerischen Empfinden des Erzeugers<br />
eines Kunstwerkes und der technischen Gestaltung sowie der Rückübersetzung<br />
des Kunstwerkes in Empfinden beim Betrachter noch weit von einer<br />
befriedigenden Antwort entfernt sind, gibt es keinen transphysikalischen<br />
Kanal für künstlerisches Empfinden. Eine technisch perfekte Reproduktion eines<br />
Kunstwerkes löst beim subjektiv nicht beeinflußten Beobachter dasselbe<br />
Empfinden aus wie das Original, wenn diese Voraussetzung durch eine entsprechende<br />
Anlage des Versuches erfüllt ist." (PETERS 1967, 154f.)<br />
Die hierbei unabdingbar aktive Rolle des Rezipienten betrifft eben auch stark "verstümmelte"<br />
musikalische Informationen, wie sie beispielsweise beim Klavierspiel<br />
vorliegen. Es ist bemerkenswert und liefert ein weiteres Indiz für das besondere<br />
Spannungsverhältnis zwischen dem Phänomen des Klavierspiels und wissenschaftlichem<br />
Weltbild, dass JOHANNES PETERS in diesem mathematisch angelegten Werk<br />
einen Exkurs einfügt, in dem er das Klavierspiel als Beispiel bemüht, um den Gegensatz<br />
zwischen rationalem und künstlerischem Weltbild zu charakterisieren. Den<br />
eben zitierten Ausschnitt begleitet nämlich die folgende Fußnote:<br />
"Die entgegenstehenden Urteile von Künstlern beruhen stets auf subjektiven<br />
Behauptungen, nicht auf Schlußfolgerungen aus objektiv gesicherten Versuchsergebnissen.<br />
Statt der Überlegungen findet der Leser Appelle an das<br />
Emotionale in ihm vor, denen er leicht ohne inneren Widerspruch erliegt. Ein<br />
Beispiel für viele:<br />
BESELE, H. v.: Das Klavierspiel, 16. Kassel: Bärenreiter-Verlag 1965:<br />
»Physikalische Fragen können hier nicht behandelt werden, jedoch muß zu der<br />
Behauptung E. TETZELS, die Klangfärbung sei auf dem Klavier durch Anschlagsart<br />
nicht zu beeinflussen, es gäbe nur Unterschiede in der Tonstärke,<br />
Stellung genommen werden... Es gab immer große Künstler, unter deren Händen<br />
das Klavier zu singen vermochte... Und MIKULI berichtet über das Spiel<br />
seines Lehrers CHOPIN: ›Unter seinen Händen brauchte das Klavier weder die<br />
Violine um ihren Bogen, noch die Blasinstrumente um den lebendigen Atem<br />
zu beneiden. So wunderbar verschmolzen die Töne im schönsten Gesang.‹<br />
Glücklicherweise gibt es in der Kunst Geheimnisse, die zu lüften kein Sterblicher<br />
vermag.«" (PETERS 1967, 155)<br />
Der ästhetische Gehalt von Klaviermusik, dem hier in der Begeisterung über das<br />
rational nur schwer begründbare "Verschmelzen der Töne" im Spiel FRÉDÉRIC<br />
CHOPINS Ausdruck verliehen wird, muss sich unzweifelhaft aus den relativen Beziehungen<br />
zwischen den Einzeltönen ergeben. Die Tatsache dass Klaviermusik überhaupt<br />
funktioniert, spätestens aber die Existenz und Funktionsfähigkeit selbstspielender<br />
Klaviere führt letztlich den Beweis für die Richtigkeit der Erkenntnisse
EUGEN TETZELS und die relativierende Unschärfe menschlicher Wahrnehmung. Es<br />
kristallisiert sich am Phänomen des Klavierspiels als besonders interessantes<br />
Merkmal der menschlichen Psyche heraus, dass diese die aufgenommenen Reize<br />
transformiert. Damit löst sich der scheinbar unvereinbare Gegensatz zwischen<br />
wissenschaftlich-objektiver und subjektiv-künstlerischer Sichtweise in einer Art<br />
"psychologischer Relativitätstheorie" auf: Die menschliche Psyche erweist sich bei<br />
der Wahrnehmung von Klavierspiel besonders eindrücklich als entscheidende<br />
Vermittlerin zwischen den unterschiedlichen Realitäten.<br />
So lange die Relativität der Realitäten nicht anerkannt ist, kann die Moderne (vgl. S.<br />
83) nicht bewältigt sein. Bei dieser schwierigen Aufgabe bietet das Klavierspiel nun<br />
eine erstaunliche und wohl einmalige Schnittstelle zwischen Kunst und<br />
Wissenschaft, zwischen Mensch und Maschine, zwischen Geist und Welt, zwischen<br />
Ratio und Intuition, zwischen Körper und Seele und zwischen Analytik und<br />
Ganzheit, die interessante Fragestellungen aus unterschiedlichen Wissensgebieten<br />
zuläßt. In Form des Computerflügels existiert diese Schnittstelle bereits.<br />
Im Zuge der Bewältigung der Moderne wird sich unser Weltbild wohl von einem<br />
idealen, technokratischen zu einem künstlerischen wandeln müssen. Naturwissenschaft<br />
und Kunst scheinen sich heute, im Zustand nahezu maximaler Inkompatibilität,<br />
die sich besonders eindrücklich auch am Phänomen des Klavierspiels manifestiert,<br />
jedenfalls wieder aufeinander zu zu bewegen. Die Naturwissenschaft hat<br />
sich von Ansprüchen der absoluten Exaktheit verabschiedet. Der Chemie-Nobelpreisträger<br />
ILYA PRIPOGINE vertritt die Meinung,<br />
"[...] wir werden die Vorstellung von der Welt als einer Maschine verlassen<br />
müssen, um zurückzukehren zu dem alten griechischen Paradigma von der<br />
Welt als einem Kunstwerk." (DAUCHER 1994, 23)<br />
An den Kunstwissenschaften ist es nun, "Digitalitäten" ebenfalls aufzugeben und<br />
sich von überholten Absolutheitsansprüchen zu lösen. Die Bedeutung der musikalischen<br />
Kunstausübung, deren Kontakt zur Naturwissenschaft im 20. Jahrhundert völlig<br />
zusammengebrochen ist und die sich im Dickicht zwischen virtuosen und transzendenten<br />
Ansprüchen einerseits und linearem Denken andererseits verstrickt hat,<br />
könnte davon profitieren.<br />
Unter Berücksichtigung des bis heute unbewältigten Scheiterns des "musikpädagogischen<br />
Positivismus" (vgl. Abschnitt 2.3), der bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts<br />
hervortrat, aber noch heute weite Teile der Musikpädagogik beherrscht, erweist<br />
sich das Musizieren als Musterbeispiel für die Notwendigkeit der Überwindung linearen<br />
Denkens. Hier zeigt sich am deutlichsten, was auch in anderen Disziplinen<br />
207
immer klarer zu Tage tritt: dass die von schriftlichen Kategorien dominierte Denkweise<br />
unserer Kultur nur eine von vielen und vor allem nicht die allenthalben geeignetste<br />
Weltsicht liefern kann.<br />
Ein Bildungssystem, das sich vorwiegend auf eine bestimmte Medienart stützt, erzeugt<br />
aber zwangsläufig eine von diesen Medien geprägte Wahrnehmung. Die Auswirkungen<br />
dieses Bildungssystems auf das Denken beschreibt HANS DAUCHER in<br />
einem Aufsatz zur Tagung Naturwissenschaft und Kunst, Kunst und Naturwissenschaft<br />
folgendermaßen:<br />
208<br />
"Nun ist unser Bildungssystem nahezu ausschließlich verbal orientiert. Diese<br />
Einseitigkeit zeigt Folgen, die kaum reflektiert werden.<br />
Die Art zu denken, wie das Kind denkt, wird durch unser Schulsystem radikal<br />
verändert. Verändert wird dadurch unsere Welt, mit positiven und negativen<br />
Folgen." (DAUCHER 1994, 21)<br />
Das Scheitern dieses Denkens in der Musik zwingt die Musikpädagogik zur Suche<br />
nach Alternativen. Musizieren bzw. Musiklernen könnte damit einen Präzedenzfall<br />
für die Pädagogik liefern, die auch Auswirkungen auf andere Bereiche des Bildungssystems<br />
haben könnte. Die besondere Bedeutung der Musik im gegenwärtigen<br />
kulturellen und pädagogischen Kontext liegt darin, dass sich hier vielleicht am deutlichsten<br />
die Unzulänglichkeit linearer Denktradition offenbart und gleichzeitig (z.B.<br />
im Phänomen der Virtuosität) noch Einblicke in alternative Daseinsformen existieren,<br />
die in anderen Disziplinen noch wesentlich stärker verschüttet sind.<br />
Der Medizin-Nobelpreisträger ROGER SPERRY unterscheidet zwei grundsätzlich unterschiedliche<br />
Arten des Denkens. Die erste, lineare, linkshemisphärische (unter<br />
Dominanz der linken Gehirnhälfte, vgl. MERKERT 1992, 21), die heute als derart<br />
gängig angesehen wird, dass in der pädagogischen Psychologie die linke Gehirnhälfte<br />
häufig synonym als "dominante Gehirnhälfte" bezeichnet wird, und eine<br />
zweite, deren Rolle in unserer Kultur in den Hintergrund getreten ist. HANS<br />
DAUCHER fasst diese beiden von ROGER SPERRY beschriebenen Denkweisen wie<br />
folgt zusammen:<br />
"Roger Sperry, Nobelpreisträger von 1981, zeigte, daß wir im wesentlichen<br />
über zwei neuronal verschiedene Formen der Vergegenwärtigung von Welt<br />
verfügen, über begrifflich-abstraktes Denken, das uns durch die präzise Etikettierung<br />
von Erlebniseinheiten zu analytischem Denken befähigt, uns befähigt,<br />
lineare, logische, kausale Denkketten zu bilden, und über die Fähigkeit, in Bildern,<br />
in umfassenden, hochkomplexen Zusammenhängen zu denken. Roger<br />
Sperry war der erste, der vom Standort des Hirnforschers darauf hinwies, wie
einseitig sich unsere Erziehungssysteme gleichsam nur an die eine Hälfte unseres<br />
Gehirns wenden.<br />
Die mittelalterliche Mnemotechnik, die lange Zeit wissenschaftlich unbeachtet<br />
blieb, befähigt mit Hilfe der großen Kapazität des Bildgedächtnisspeichers zu<br />
schier unglaublichen Leistungen. [...] Offenbar wird unsere neuronale Kapazität<br />
dadurch besser genützt und befähigt, in hochkomplexen Ganzheiten zu denken."<br />
(DAUCHER 1994, 23)<br />
Bezüglich der Problematik virtuosen und dilettantischen Musizierens in der erörterten<br />
Terminologie könnte es sich erweisen, dass die von HANS DAUCHER zuerst genannte<br />
Denkweise auf dilettantisches und die letztere auf das im ganzheitlichen Sinn<br />
virtuose Musizieren bezogen werden kann. Es deutet vieles darauf hin, dass virtuoses<br />
Musizieren sich auf grundsätzlich andere psychische Vorgänge stützt als die<br />
vom heutigen Bildungssystem geforderten und geförderten. Insbesondere im gängigen<br />
Instrumentalunterricht provoziert monomediale Orientierung die Ausnahme von<br />
"Musikalität". Eine im wahrsten Sinne des Wortes "ganzheitlichere" neuronale Verarbeitung<br />
beim virtuosen Musizieren im Vergleich zu anderen Tätigkeiten kann inzwischen<br />
jedenfalls als physiologisch erwiesen gelten: Bei Messungen mit Hilfe<br />
neuer Methoden der medizinischen Diagnostik erwies sich, dass bei hervorragenden<br />
Musikern das Corpus Callosum ("CC"), jener Balken, der die beiden Gehirnhälften<br />
verbindet, signifikant stärker ausgebildet ist als bei Vergleichspersonen. Ein internationales<br />
Forscherteam berichtet in der Zeitschrift Neuropsychologia über seine<br />
Forschungsergebnisse, deren Tragweite für das Verständnis von Musizieren, aber<br />
auch von neuroembryologischen Vorgängen noch nicht annähernd abgesehen werden<br />
kann:<br />
"Our analyses revealed that the anterior half of the CC was significantly larger<br />
in musicians. [...] Since anatomic studies have provided evidence for a positive<br />
correlation between midsagittal callosal size and the number of fibers crossing<br />
through the CC, these data indicate a difference in interhemispheric communication<br />
[...]." (SCHLAUG et al. 1995, 1047)<br />
Beim Versuch, in der Praxis des Musizierens ganzheitlicheren Ansprüchen gerecht<br />
zu werden und vernachlässigte interaktive Fähigkeiten wiederzubeleben, darf die<br />
Medienfrage nicht ausgeklammert werden. Nur durch Rückgewinnung einer ausgeglichenen<br />
Symbiose aus Hören und Sehen im eigenschöpferischen Musizieren kann<br />
auch die nach wie vor zu Recht zentrale musikalische Teildisziplin der Interpretation<br />
von Werken letztendlich den ihr zustehenden Stellenwert gewinnen, nämlich als<br />
Ziel musikalischer Eigenkreativität. Und nur unter zentraler Berücksichtigung musikstruktureller<br />
und eigenschöpferischer Fähigkeiten kann Musizieren letztlich dem<br />
209
Anspruch von JÜRGEN UHDE und RENATE WIELAND gerecht werden, die von jedem<br />
guten Interpreten fordern, er müsse während des Spiels<br />
210<br />
"[...] das Stück gleichsam mitkomponieren." (UHDE & WIELAND 1989, 176)<br />
Im Zuge der gegenwärtigen Entwicklung auf dem Gebiet der Medien- und<br />
Musiktechnologie hat die Überwindung der Diskrepanz zwischen Produktion und<br />
Reproduktion in der Musikkultur von selbst begonnen. Die Entwicklungen auf dem<br />
Gebiet der populären elektrisch erzeugten Musik tragen Anzeichen der geforderten<br />
Auflösung der Blockade musikalisch-struktureller Betätigung. Da es sich hierbei<br />
aber um die erste Gelegenheit in der Geschichte handelt, ohrbezogen unter Mithilfe<br />
von Medien mit komplexeren musikalischen Strukturen zu hantieren, beginnt die<br />
Beschäftigung mit musikalischen Sprachelementen zwangsläufig auf niedriger<br />
Stufe, was gelegentlich zu der irrigen Ansicht verleitet, in der Medienentwicklung<br />
die Ursache für kulturellen Verfall zu sehen. Ursache und Wirkung dürfen aber nicht<br />
verwechselt werden: In diesem scheinbaren Verfall manifestiert sich nur ein den<br />
bisherigen medialen Möglichkeiten und den damit verbundenen<br />
Wahrnehmungsstrategien entsprechendes archaisches musikalisches Entwicklungsniveau<br />
der westlichen Gesellschaft, dessen Zustand bisher nur durch den<br />
Spagat zwischen Transzendenz und Dilettantismus einigermaßen erfolgreich zu verschleiern<br />
war.<br />
Die Geschichte der europäischen Musik liefert schließlich ein eindrucksvolles Beispiel<br />
für die von MARSHALL MCLUHAN geprägte und häufig kolportierte, aber selten<br />
verstandene These The media is the message – Das Medium ist die Botschaft: Die<br />
Botschaft des schriftlichen Mediums in der Musik(-erziehung) ist die Geschichte des<br />
Dilettantismus, was zunächst nichts anderes meint als eine begrüßenswerte Verbreitung<br />
von Musik in der bürgerlichen Lebenswelt.<br />
Doch die nächste Etappe wirft bereits ihre Schatten voraus: Die Botschaft des digitalen<br />
Mediums wird eine starke Verbreitung des Umgangs mit klanglichen Strukturen<br />
sein.<br />
Um nicht von der Wirklichkeit dieser Phänomene überrollt zu werden, wird es für<br />
Musikpädagogik und Musikwissenschaft notwendig sein, sich den neuen Möglichkeiten<br />
zu öffnen in Richtung einer Praxis, wie sie sich im autonomen Umgang<br />
mit Musik unter selbstverständlicher und spielerischer Anwendung neuer Medien<br />
bereits lebendig vollzieht.
5 Zusammenfassung<br />
Die westliche Kunstmusik ist bis heute entscheidend geprägt von der schriftlichen<br />
Überlieferung. Die einzig relevante Möglichkeit, Musik zu speichern, bot bis Ende<br />
des 19. Jahrhunderts das schriftliche Medium. Noch heute stellen Notentext und<br />
Partitur in Musikwissenschaft und Musikpädagogik die meistgenutzte Medienform<br />
dar. In der Musikpraxis entstand auf dieser Grundlage in den letzten beiden Jahrhunderten<br />
eine ausgeprägte Interpretationskultur. An dieser orientiert sich eine Musikpädagogik,<br />
die sich seit etwa zweihundert Jahren eine stark verbesserte Drucktechnologie<br />
zu Nutze machte und sich damit von der weitgehend persönlichen und<br />
mündlichen auf die rationellere schriftliche Vermittlung verlegen konnte. Nur dank<br />
dieser intensiven Medienunterstützung war die vollzogene Verbreitung des Instrumentalspiels,<br />
also des heute so genannten aktiven Musizierens, möglich.<br />
Wird aber persönlicher Kontakt im musikdidaktischen Kontext, wie hier geschehen,<br />
in wesentlichem Umfang durch Medien ersetzt, sind damit auch Nebenwirkungen<br />
verbunden. Eine sicherlich zunächst nicht beabsichtigte Folge der Nutzung schriftlicher<br />
Medien in der Ausbildung war die für die abendländische Musikerziehung bis<br />
heute wesenstypische Vorherrschaft visueller und motorischer Kriterien beim Lernen.<br />
Dadurch akzentuierte Distanzen zum ursprünglichen Motiv allen Musizierens,<br />
nämlich dem Klangerlebnis, stellen bis heute ein Grundproblem für die Musikpädagogik<br />
dar.<br />
Oberflächlich betrachtet scheint die immer weiter anwachsende Medienflut die Tendenz<br />
zum Konsum und Distanzen zum kreativen Umgang mit Musik zusätzlich zu<br />
vergrößern. Multimediale Technologie bietet aber andererseits in ihrem neuen auditiven,<br />
interaktiven und strukturierbaren Bestandteil auch dringend benötigte Möglichkeiten,<br />
die bereits eingehend erörterte und allenthalben kritisierte Einseitigkeit<br />
visuellen Musiklernens auszugleichen. Diese Möglichkeiten gilt es zu nutzen.<br />
Im Zuge der elektrischen Digitalisierung wird das schriftliche Moment zum Bestandteil<br />
des Gesamtmediums. Gleichzeitig verliert die Schriftlichkeit ihre exklusive<br />
Bedeutung als entscheidende Voraussetzung zum anspruchsvollen Musizieren in<br />
historischer Dimension. Die Integration auditiver und visueller Codierung im digitalen<br />
"Universalmedium", dem Rechner, wird die Bedingungen des Musizierens<br />
grundlegend verändern. Diese Veränderungen betreffen alle Bereiche von Komposition<br />
über Musikproduktion, Interpretation, Improvisation bis zum Musikhören, so<br />
dass die gegenwärtigen Bedeutungsgrenzen dieser Begriffe bald überholt sein<br />
könnten.<br />
Die Richtung dieser Veränderungen wird von folgenden Eckpunkten bestimmt:<br />
211
� Visuelle und auditve Musikcodierung werden kombinierbar, das Medium interaktiv.<br />
Steuerdatencodierung verbindet Primär- und Sekundärmedium, klangliche<br />
Information und Notentext.<br />
� Der direkte Zugriff auf akustische Strukturen erlaubt anspruchsvolles Musizieren<br />
ohne die diskriminierende Zwischenstufe der Notenschrift. Dies ermöglicht eine<br />
wachsende Bedeutung musikalisch-spielerischen Lernens. Grenzen zwischen<br />
Musikkonsum und "aktivem" Musizieren verschwimmen.<br />
� Die Trennung in Komposition und Interpretation löst sich wieder auf,<br />
Improvisation und Komposition nähern sich wieder an.<br />
� Das typische Merkmal aller Clavierinstrumente, die Auslösung von Klangereignissen<br />
durch Triggerimpulse im Betätigen von Tasten, findet seine konsequente<br />
Fortsetzung in der Musikelektronik. Die Technologie der steuerdatencodierenden<br />
Digitaltechnik macht diese Art des Musizierens speicher- und reproduzierbar.<br />
� Der Sampler als Weiterentwicklung dieser Idee vereinigt Musikinstrument und<br />
Wiedergabemedium. Die beiden Funktionen Tonerzeugung und Speicherung verschmelzen.<br />
� Es handelt sich dabei um eine Konsequenz der anthropologischen Grundtendenz,<br />
die menschliche Stimme als musikerzeugendes Organ durch technische Hilfsmittel,<br />
Instrumente zu ergänzen und Musik ihrer Flüchtigkeit zu entreißen. Die Art<br />
der Klangerzeugung ist theoretisch sekundär und wird dies eines Tages auch<br />
praktisch, ohne einen Qualitätsverlust zu implizieren.<br />
� Grundsätzlich besteht keinerlei Widerspruch zwischen Medientechnologie und<br />
musikalischer Aktivität, im Gegenteil: Es gibt keinen Grund mehr, aktives Musizieren<br />
mit dem zu kurz greifenden Phänomen des klassischen Instrumentalspiels<br />
zu identifizieren. In den Blickpunkt geraten statt dessen wieder die hierzu erforderlichen<br />
geistigen Voraussetzungen, nämlich das Verständnis musikalischer<br />
Strukturen.<br />
� Jede Art der Information steht an jedem Ort praktisch gleichzeitig zur Verfügung.<br />
Damit werden traditionelle Möglichkeiten des Miteinander-Musizierens durch<br />
neue Möglichkeiten ergänzt.<br />
� Die dem 19. Jahrhundert entstammende Rolle des Klaviers als häusliches Wiedergabemedium<br />
muss vor dem Hintergrund der Verbreitung elektronischer Wiedergabemedien<br />
endgültig revidiert werden. Statt dessen wird das "Clavier" (im<br />
weitesten Sinn von Keyboard – die Computertastatur eingeschlossen) seine traditionell<br />
bedeutsame Funktion als Werkzeug des Musikschaffenden ausbauen bzw.<br />
wiedergewinnen. Weitere Schnittstellen und Bedienungsoberflächen zwischen<br />
Mensch und Musikinstrument werden entstehen.<br />
212
� Das reproduktive Instrumentalspiel, gegenwärtig anerkannteste und verbreitetste<br />
Möglichkeit "aktiver" Musikausübung, wird ergänzt um andere Formen des<br />
Musizierens. Bereits heute beginnen produktive, reproduktive und konsumierende<br />
Sphären des Musizierens zu verschmelzen. Eine Herausforderung an die<br />
Musikpädagogik stellt es dar, die entstehenden Zwischenformen zu integrieren.<br />
Die eingangs zitierte Sorge des Deutschen Musikrats um die musikalische Bildung<br />
ist unter dem Medienaspekt auch Spiegelbild von Kompatibilitätsproblemen zwischen<br />
den im 20. Jahrhundert noch weitgehend unverknüpft nebeneinander bestehenden<br />
Mediensphären Klang und Schrift, d. i. Tonträger und Printmedium. Die besonderen<br />
Unsicherheiten von Musikwissenschaft und Musikpädagogik in der Rezeption<br />
neuer Medien sind heute auch Ausdruck der Tatsache, dass mit der Infragestellung<br />
der Führungsrolle von Schriftlichkeit die genannten Disziplinen in ihren<br />
Grundlagen angetastet scheinen – sind doch Musikwissenschaft und Musikpädagogik<br />
selbst unmittelbar aus der schriftlichen Tradition des 19. Jahrhunderts hervorgegangen.<br />
Diese Disziplinen der akustischen Kunst gewinnen aber durch audivisuelle<br />
Medien neue Betätigungsfelder. Die Nutzung neuer Möglichkeiten, begünstigt durch<br />
mediale Interaktivität, erscheint gerade für die Musikerziehung auch deshalb angeraten,<br />
da sich Hinweise verdichten, dass schriftliche Medien allein strukturell bedingt<br />
ungeeignet sein könnten, Fähigkeiten zum aktiven bzw. reaktiven, unter Umständen<br />
sogar zum reproduzierenden Musizieren zu fördern. Sollte sich dieser Verdacht<br />
auch nur teilweise bestätigen, müsste das typische "Begabungsproblem" der<br />
abendländischen Musikerziehung als Medienproblem aufgefasst und entsprechend<br />
auch aus der Medienperspektive angegangen werden. Die folgende Forderung<br />
müsste dann eine Basis künftiger Musikerziehung bilden und der Revision musikpädagogischer<br />
Berufe zu Grunde gelegt werden:<br />
Musiklernen bedarf grundsätzlich multimedialer Vermittlung ebenso essenziell, wie<br />
der Vorgang des Musizierens selbst multisensural, komplex und ganzheitlich strukturiert<br />
ist. Dabei gebührt dem Gehör und damit dem auditiven Medienaspekt die<br />
Priorität. Mediale Interaktivität und Multimedialität bieten hierzu die technischen<br />
Voraussetzungen.<br />
Unter der Maßgabe, dass auch die Fertigkeit des Instrumentalspiels von vielfältigen<br />
und intensiven Klangerfahrungen entscheidend profitiert, könnte eine intensivierte<br />
Musikerziehung auf der Grundlage neuer Medien- und Musiktechnologie auch für<br />
die Instrumentalpädagogik künftig eine Grundlage bilden. Instrumentalpädagogik<br />
und Schulmusikerziehung könnten dann vielleicht auf einem gemeinsamen Funda-<br />
213
ment aufbauen und wären entsprechend grundständig eines Tages möglicherweise<br />
nicht mehr zu trennen.<br />
214
6 Anhang: Taxonomie auditiver Medien (zu Kap. 3.3)<br />
Klangdatencodierende und steuerdatencodierende Medien sind im Folgenden<br />
anhand von drei Parametern geordnet.<br />
Die drei Parameter unterscheiden sich in der Art,<br />
a) was gespeichert wird, Klangdaten (0) oder Steuerdaten (1),<br />
b) (in der Art) der Klangerzeugung, also ob ein Instrument (0) oder ein Lautsprecher<br />
(1) die Luft in Schwingung versetzt und<br />
c) wie gespeichert wird, analog (0) oder digital (1).<br />
Diese drei Gruppen lassen sich beliebig kombinieren. Die erste Ziffer steht für den<br />
Parameter a, die zweite für den Parameter b und die dritte für c.<br />
Beispiel:<br />
Die Kombination 010 bezeichnet ein Medium mit analoger Speicherung der<br />
Klangdaten und Wiedergabe über Lautsprecher. In diese Kategorie fallen beispielsweise<br />
traditionelle Plattenspieler oder Tonbandgeräte.<br />
Die technische Realisierung der Aufzeichnung im Einzelnen (magnetische oder optische<br />
Verfahren etc.) ist dabei sekundär und wird hier ausgeklammert, da prinzipiell<br />
alle Möglichkeiten bestehen, diese aber keine entscheidenden Auswirkungen auf die<br />
Anwendung haben.<br />
Systematik:<br />
000<br />
Einziges Beispiel für ein Medium mit analoger Aufzeichnung der Klangdaten<br />
und Wiedergabe über ein reales Instrument ist das von der Firma Schimmel patentierte<br />
Audioforte-System, wenn als Tonquelle ein analoges Medium, z.B. ein<br />
Tonband zum Einsatz kommt. Hierbei wird über einen Elektromagneten bei Wiedergabe<br />
der Resonanzboden des Klaviers in Schwingung versetzt, also quasi als<br />
Lautsprechermembran genutzt. Bislang hat sich das Audioforte-System nicht durchsetzen<br />
können. Aufnahme ist mit diesem System bisher nicht möglich.<br />
215
001<br />
Digitale Aufzeichnung der Klangdaten bei Wiedergabe über ein Instrument<br />
entspricht der Ziffer 000 (Audioforte-System) mit dem Unterschied, dass als Aufzeichnungsmedium<br />
ein digitales Gerät wie z.B. CD oder DAT (digitale Tonbandcassette)<br />
verwendet wird. Das Audioforte-System an sich ist nicht an eine bestimmte<br />
Speicherung (analog oder digital) gebunden.<br />
010<br />
Die analoge Aufzeichnung der Klangdaten bei Wiedergabe über Lautsprecher<br />
trifft auf alle traditionellen Analog-Medien zu. Dies wären z.B. Plattenspieler,<br />
Grammophon, Wachswalze, Tonbandgerät und analoger Cassettenrecorder.<br />
011<br />
Hier werden die Klangdaten digital aufgezeichnet, die Wiedergabe erfolgt über<br />
Lautsprecher. Dies gilt für CD, DAT, Harddiscrecording oder Mini-Disc. 42 Während<br />
bei CD und DAT alle anfallenden Daten aufgezeichnet werden, was zu einem<br />
Datenfluss von ca. 1 Mbit/s führt, wird bei Mini-Disc und teilweise bei Harddisc-<br />
Recording versucht, durch psychoakustisch bedingte Datenreduktion den Datenfluss<br />
etwa um eine Größenordnung zu reduzieren. Eine Veränderung der Wiedergabegeschwindigkeit,<br />
die bei analoger Aufzeichnung zwangsläufig mit einer Tonhöhenveränderung<br />
einhergeht, ist beim Harddiscrecording durch aufwändige Rechenprozesse<br />
in Grenzen auch bei gleichbleibender Tonhöhe möglich. Werden keine beweglichen<br />
Teile zur Speicherung benutzt, sondern die Klangdaten aus flüchtigem Speicher<br />
(RAM) wiedergegeben, spricht man traditionell von einem Sampler. In MP3-<br />
Playern kommen ebenfalls flüchtige Speicher zum Einsatz.<br />
100<br />
Während die bisher beschriebenen Medien prinzipiell relativ unflexibel in der Wiedergabegeschwindigkeit<br />
sind, ist es für die folgenden problemlos möglich, eine Aufzeichnung<br />
ohne Veränderung der Tonhöhe in beliebiger Geschwindigkeit wiederzugeben.<br />
Anstatt wie oben die Wellenform, also die Summe des akustischen Ereignisses,<br />
per Mikrofon aufzunehmen (vgl. Abschnitt 3.3.1), werden hier Steuerdaten aufgezeichnet<br />
(vgl. Abschnitt 3.3.2). Die Welle wird erst während der Wiedergabe neu<br />
42 CD: Compact Disc, digitale Schallplatte, optisches Aufzeichnungsverfahren.<br />
DAT: Digital Audio Tape, digitaler Cassettenrecorder, magnetisches Verfahren.<br />
Harddisc-Recording: Aufnahme auf Computer-Festplatte, magnetisches Verfahren.<br />
Mini-Disc: Aufnahme auf diskettenartigen Tonträger, magnetisches Verfahren mit Datenreduktion.<br />
216
erzeugt und muss während des Aufnahmevorgangs nicht gespeichert werden, da sie<br />
im Wiedergabegerät für jeden einzelnen zu spielenden Ton enthalten ist, wie im Fall<br />
eines akustischen Musikinstruments. Dabei ergibt sich bei Übertragung von Steuerdaten<br />
die Notwendigkeit, Übereinkunft über die Beschaffenheit der zu erzeugenden<br />
Welle, also über den Klang des erwünschten Instrumentes zu treffen.<br />
Als Beispiel für die Kategorie 100, also analoge Aufzeichnung von Steuerdaten<br />
bei Wiedergabe über das Instrument kann das 1904 erstmals vorgestellte<br />
Welte-Mignon-Reproduktions-Piano gelten. Zumindest kontinuierliche Dynamikveränderungen<br />
sind hier nicht digital codiert. Leider ist die Stanz- und damit Aufnahmetechnik<br />
von der Firma Welte so gut geheimgehalten worden, dass sie heute<br />
als verloren gilt.<br />
101<br />
Die digitale Speicherung der Steuerdaten bei Wiedergabe über das Instrument<br />
findet bei allen modernen selbstspielenden Klavieren Anwendung, wie zum<br />
Beispiel Bösendorfer Computerflügel SE oder Yamaha Disclavier. Die Tasten und<br />
Hämmer werden bei Wiedergabe elektromagnetisch in Bewegung gesetzt.<br />
110<br />
Eine Anwendungsmöglichkeit, bei der analog aufgezeichnete Steuerdaten über<br />
Lautsprecher wiedergegeben werden, ist nicht bekannt.<br />
111<br />
Die letzte Kategorie beinhaltet die traditionelle Domäne der MIDI-Technik, nämlich<br />
die digitale Speicherung der Steuerdaten bei elektroakustischer Wiedergabe<br />
(über Lautsprecher) und synthetischer Klangerzeugung, wie sie insbesondere in<br />
der Popmusikproduktion verbreitet Anwendung findet. Aus Sicht der Steuerung fällt<br />
der Sampler, der bereits in die Kategorie 011 eingeordnet wurde, auch in diese Kategorie,<br />
denn er kann über MIDI-Befehle getriggert und damit angewiesen werden,<br />
die gespeicherten Klangdaten wiederzugeben.<br />
Der Sampler vereint die Eigenschaften klangdatencodierender und steuerdatencodierender<br />
Technologien und verkörpert damit die Verschmelzung von Musikinstrument<br />
und Aufzeichnungsmedium (siehe Abschnitt 3.3.3).<br />
217
218
7 Literatur<br />
Anonym: The Miracle Piano Teaching System (Klavierlernsystem), Benutzerhandbuch<br />
© 1990, 1991 The Software Toolworks, Inc.<br />
Anonym: The Real Book III.<br />
Abel-Struth, Sigrid: Grundriß der Musikpädagogik, Mainz 1985.<br />
Aebersold, Jamey: Ein neuer Weg zur Jazz Improvisation, Bd. 1, Buch und Tonträger,<br />
o.O. (= Rottenburg): Advance Music 61996.<br />
Amster, Isabella: Klavierübung im Alltag des Musizierens; In: Musik und Gesellschaft,<br />
Heft 6/1930, S. 172-176.<br />
Augustini, Folke: Die Klavieretüde im 19. Jahrhundert: Studien zu ihrer Entwicklung<br />
und Bedeutung, Duisburg 1986.<br />
Bach, Carl Philipp Emanuel: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen,<br />
Berlin 1753 (Teil I), 1762 (Teil II), Reprint Kassel 1994.<br />
Ballstaedt, Andreas & Widmaier, Tobias: Salonmusik: Zur Geschichte und Funktion<br />
einer bürgerlichen Musikpraxis (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft,<br />
Bd. XXVIII), Stuttgart 1989.<br />
Bandmann, Tony: Tonbildung und Technik auf dem Klavier, in: Der Klavier-Lehrer,<br />
26. Jg. (1903), S. 177-178, S. 197-199 und S. 212-214.<br />
Baumann, Claus: Thesen für eine erweiterte Kunstbetrachtung, in: Naturwissenschaft<br />
und Kunst, Kunst und Naturwissenschaft: Katalog zum gleichnamigen<br />
Symposium vom <strong>1.</strong> bis 3. Dezember 1994 an der Universität Leipzig, herausgegeben<br />
von der Kustodie der Universität Leipzig, S. 14-17.<br />
Becker, Tom: Musikschulen: Lernen, lernen, lernen; in: Tastenwelt, Heft 4/1996, S.<br />
56-67.<br />
Beckmann, Johann: Beyträge zur Geschichte der Erfindungen, Leipzig 21786.<br />
Benda, A.: Das Musik-Diktat und seine Bedeutung für den Musik-Unterricht, in: Der<br />
Klavier-Lehrer, 2<strong>1.</strong> Jg. (1898), S. 333-335.<br />
Bendig, Volker: Abschlussprüfung Gehörbildung im Internet, in: Üben & Musizieren,<br />
18. Jg. (2001), S. 60-63.<br />
Berendt, Joachim Ernst: Nada Brahma: die Welt ist Klang, Reinbek 1985.<br />
Berheide, Hauke: Hauke Berheide interviewt David P. Graham, in: EPTA Dokumentation<br />
1997, Köln 1998, S. 80-8<strong>1.</strong><br />
Besele, Hans von: Das Klavierspiel, Kassel 1955.<br />
Bie, Oscar: Das Klavier und seine Meister, München 2190<strong>1.</strong><br />
Biesenbender, Volker: Von der unerträglichen Leichtigkeit des Instrumentalspiels,<br />
Aarau 1992.<br />
219
Biesenbender, Volker: Wie viel "Kreatur" braucht's eigentlich zum Kreativsein? In:<br />
Üben & Musizieren, 12. Jg. (1995), Heft 3, S. 6-13.<br />
Bigler, Carole L. & Lloyd-Watts, Valery: Die Suzuki-Klavier-Methode, Regensburg<br />
1984.<br />
Bimberg, Guido & Bimberg, Siegfried: Musikwissenschaft und Musikpädagogik:<br />
Perspektiven für das 2<strong>1.</strong> Jahrhundert (= Musikwissenschaft / Musikpädagogik<br />
in der Blauen Eule, Bd. 33), Essen 1997.<br />
Bisping, Ernst: Bisping Klavierschule, Köln 1900.<br />
Bollnow, Otto Friedrich: Vom Geist des Übens, Stäfa 3199<strong>1.</strong><br />
Breithaupt, Rudolf Maria: Die natürliche Klaviertechnik, Leipzig 1905/1912.<br />
Breslaur, Emil: Frau Henriette Rumpf's "Vorrichtung zur Regelung der Körperhaltung<br />
beim Klavierspiel". (Patent.), in: Der Klavier-Lehrer, 2. Jg. (1879), S.<br />
285.<br />
Bruhn, Herbert & Oerter, Rolf & Rösing, Helmut: (Hg.): Musikpsychologie, Reinbek<br />
1993.<br />
Brunner, Wolfgang: Spontaneität im Musizieren, Chancen, Probleme und Wege der<br />
Instrumentalpädagogik, in: Üben & Musizieren, 12. Jg. 3/1995, S. 15-2<strong>1.</strong><br />
Brunner, Wolfgang: Improvisieren – wozu? Zur instrumentaldidaktischen Relevanz<br />
historischer Improvisationsfunktionen, in: Üben & Musizieren, 13. Jg. 4/1996,<br />
S. 29-37.<br />
Busch, Wilhelm: Der Virtuos: Beilage zum XLIII. Band der "Fliegenden Blätter",<br />
1865, nach: Üben & Musizieren, 13. Jg. (1996), Heft 3, S. 10-1<strong>1.</strong><br />
Buslau, Oliver: Von Brahms und dem Klavier: Ein Interview mit der Pianistin Idil<br />
Biret über Brahms und Gesamteinspielungen, in: Piano News, <strong>1.</strong> Jg. (1997),<br />
Heft 2, S. 8-13.<br />
Busoni, Ferruccio: Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, Leipzig 1917.<br />
Caland, Elisabeth: Die Deppesche Lehre des Klavierspiels, Stuttgart 1897.<br />
Caland, Elisabeth: Die Ausnützung der Kraftquellen beim Klavierspiel, Stuttgart<br />
1905.<br />
Chmel, Bruno: Flamenco und Barockmusik, Überlegungen zur Musizier- und Unterrichtspraxis,<br />
in: Üben & Musizieren, 13. Jg. (1996), Heft 4, S. 24-29.<br />
Couperin, François: L'art de toucher le Clavecin, Reprint Wiesbaden 1933 (<strong>1.</strong> Aufl.<br />
1717).<br />
Czerny, Carl: Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte, op.<br />
200, Wien 1829, Faks. Nachdruck Wiesbaden 1993.<br />
Czerny, Carl: Vollständig theoretisch-practische Pianoforte-Schule von dem ersten<br />
Anfange bis zur höchsten Ausbildung fortschreitend, und mit allen nöthigen, zu<br />
220
diesem Zwecke eigens componierten zahlreichen Beyspielen, op.500, 4 Teile,<br />
Wien 1839, Nachdruck Wiesbaden 199<strong>1.</strong><br />
Czerny, Carl: Erinnerungen aus meinem Leben, herausgegeben und mit Anmerkungen<br />
versehen von Walter Kolneder (= Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen,<br />
Bd. 46), Strasbourg - Baden-Baden 1968.<br />
Czerny, Carl: Briefe über den Unterricht auf dem Pianoforte vom Anfange bis zur<br />
Ausbildung als Anhang zu jeder Clavierschule, Wien (o. J.): Diabelli und<br />
Comp., Reprint: Straubenhardt 1988.<br />
Daucher, Hans: In Bildern denken, in: Naturwissenschaft und Kunst, Kunst und Naturwissenschaft,<br />
Katalog zum gleichnamigen Symposium vom <strong>1.</strong> bis 3. Dezember<br />
1994 an der Universität Leipzig, herausgegeben von der Kustodie der<br />
Universität Leipzig, S. 20-23.<br />
Dessauer, Heinrich: Der Phonograph und das Grammophon in ihrer Bedeutung für<br />
die Musikpädagogik, in: Der Klavier-Lehrer, 15. Jg. (1892), S. 264.<br />
Dettlinger, Stefan: Vorgefertigte Spieleindrücke? Die Edition-Peters-Reihe Young<br />
Classic Edition, in: Piano News, 2. Jg. (1998), Heft 2, S. 60.<br />
Deutscher Musikrat: Revision dringend nötig: Memorandum zur Ausbildung für musikpädagogische<br />
Berufe, in: Üben und Musizieren, 18. Jg. (2001), S. 50-53.<br />
Dies, Albert Christoph: Biographische Nachrichten von Joseph Haydn, 21962.<br />
Ditzig-Engelhardt, Ursula: Lerntheorien und ihr Einfluss auf die Musikpädagogik,<br />
in: Helga de la Motte-Haber, (Hg.): Handbuch der Musikpädagogik, Bd. 4:<br />
Psychologische Grundlagen des Musiklernens, Kassel 1987.<br />
Dürer, Carsten: Ewa Kupiec: Ein besserer Mensch durch das Klavierspiel, Interview<br />
in: PianoNews, 2. Jg. (1998), Heft 1, S. 10-15.<br />
Dürer, Carsten: Die Musik im Sinne des 19. Jahrhunderts neu verpacken, ein Gespräch<br />
mit Friedrich Höricke, in: PianoNews, 3. Jg (1999), Heft 3, S. 44-48.<br />
Dürer, Carsten: Aus Frankreich in die USA und zurück, ein Gespräch mit dem<br />
französischen Pianisten Alain Planès, in: PianoNews, 5. Jg (2001), Heft 3, S.<br />
18-23.<br />
Ebert, Andreas: What you hear is the whole package: ein Treffen mit Les McCann,<br />
in: PianoNews 1/1998, S. 30-33.<br />
Ebert, Dietrich: Atmung beim Klavierspielen, einem Sonderfall rhythmischer Bewegungen,<br />
in: Therapiewoche 15, 46. Jg. (1996), S. 800-805.<br />
Eckstaedt, Carsten: "... mit Klavier hab' ich dann aufgehört", Bochum 1996.<br />
Ehrler, Hanno: ...explose comme un virus..., in: nmz, 50. Jg. (2001), S. 5<br />
Enders, Bernd: Studien zur Durchhörbarkeit und Intonationsbeurteilung von Akkorden<br />
(= Kölner Beiträge zur Musikforschung 115, Akustische Reihe Band 8),<br />
Regensburg 198<strong>1.</strong><br />
221
Enders, Bernd & Rocholl, Christoph: Musik und Neue Technologien: Instrumentalmusik<br />
im Zeichen der Elektronik, in: Bernd Hoffmann, Winfried Pape und Helmut<br />
Rösing (Hg.): Rock / Pop / Jazz im musikwissenschaftlichen Diskurs, Arbeitskreis<br />
Studium populärer Musik e. V. (ASPM), Hamburg 1992, S. 95-113.<br />
Enders, Bernd: Gedanken zum Thema und Konzept, in: ders. (Hg.): Neue Musiktechnologie,<br />
Mainz 1993, S. 7-12.<br />
Enders, Bernd: Der Einfluss moderner Musiktechnologien auf die Produktion von<br />
Popularmusik, in: Markus Heuger & Matthias Prell (Hg.): Popmusic: Yesterday<br />
• today • tomorrow (= Forum Musik Wissenschaft, Bd. 1), Regensburg<br />
1995, S. 47 - 7<strong>1.</strong><br />
EPTA-Dokumentation 1996, herausgegeben von der European Piano Teachers<br />
Association.<br />
Ernst, Anselm: Lehren und Lernen im Instrumentalunterricht, Mainz 199<strong>1.</strong><br />
Feuchtwanger, Peter: Technische Übungen als Vorbereitung zur musikalischen Gestaltung,<br />
in: EPTA-Dokumentation 1996, S. 18-20.<br />
Firkusny, Rudolf: Rudolf Firkusny über Janacek, in: Beilage zur CD DG 449 764-2:<br />
Leos Janacek: Klavierwerke, Hamburg 1997.<br />
Fischer, Hans Conrad: Johann Sebiastian Bach: Sein Leben in Bildern und Dokumenten,<br />
Stuttgart 1985.<br />
Fischer, Peter & <strong>Klug</strong>, Boris: Das große System-7-Buch, Düsseldorf 1992.<br />
Flender, Christine & Heuger, Markus: Digitalisierung der Medien – Digitalisierung<br />
der Musikästhetik: Bericht über die Podiumsdiskussion, in: Bernd Enders &<br />
Niels Knolle: KlangArt-Kongress 1995, Osnabrück 1998, S. 435-448.<br />
Foldes, Andor: Wege zum Klavier, Frankfurt/M. 1990.<br />
Frey-Samlowski, Ruth-Iris: Große Medien spielen auf anderen Tasten, in: nmz, 43.<br />
Jg. (1994), H. 6 (Dezember/Januar).<br />
Frey-Samlowsky, Ruth-Iris: Von Etüden und Übungen – Zwischen Czerny und<br />
Cortot: EPTA-Jahreskongreß 1995, in: Üben & Musizieren, 13. Jg (1996), H.<br />
2, S. 37-38.<br />
Frey-Samlowsky, Ruth-Iris: Pionierarbeit mit Zukunftsperspektive: Margit Varrós<br />
Klavierpädagogik als Thema beim EPTA-Kongress in Gödöllö/Ungarn, in:<br />
nmz, 47. Jg. (1998), H. 10, S. 20.<br />
Fricke, Jobst: Musik: Analog – digital – analog, in: Enders, Bernd & Knolle, Niels<br />
(Hg.): Klangart-Kongress 1995 (= Musik und Neue Technologie 1), Osnabrück<br />
1998, S. 15-27.<br />
Friedrich, Otto: Glenn Gould, Reinbek 1994.<br />
Gat, Jozsef: Die Technik des Klavierspiels, Kassel 1965.<br />
Gellrich, Martin: Üben mit Lis(z)t, Frauenfeld 1992.<br />
222
Gellrich, Martin: Instrumentalausbildung an Musikschulen – ein Haus ohne solides<br />
Fundament, in: Üben & Musizieren, 13. Jg., 1996, Heft 6, S. 8-14.<br />
Gembris, <strong>Heiner</strong>: Musikalische Fähigkeiten und ihre Entwicklung, in:Helga de la<br />
Motte-Haber (Hg.): Handbuch der Musikpädagogik, Bd. 4: Psychologische<br />
Grundlagen des Musiklernens, Kassel 1987.<br />
Gley: Die Taktuhr, in: Der Klavier-Lehrer, 3. Jg., 1880, S. 116-117.<br />
Gould, Glenn: Vom Konzertsaal zum Tonstudio, Schriften zur Musik II, München<br />
1987.<br />
Gould, Glenn: Von Bach bis Boulez, Schriften zur Musik I, (= Serie Musik Piper<br />
Schott, Bd. 8261), München 1992.<br />
Green, Barry & Gallwey, W.Timothy: Der Mozart in uns oder eine Anleitung zum<br />
Musizieren, Frauenfeld 1993.<br />
Grolle, Johann: Feuerwerk der Noten, in: Der Spiegel, 1997, Heft 30, S. 140-142.<br />
Grolle, Johann & Scriba, Jürgen: Duell der Superhirne, in: Der Spiegel, 1997, Heft<br />
18, S. 212-218.<br />
Gutzeit, Reinhart von: (1996a) Verklärte Erinnerungen eines Ehemaligen, in: Festschrift:<br />
40 Jahre Clara-Schumann-Musikschule, Düsseldorf 1996, S. 14-15.<br />
Gutzeit, Reinhart von: (1996b) Ich kenne keine Wunderkinder. Igor Ozim im Gespräch,<br />
in: Üben & Musizieren, 13. Jg. (1996), Heft 1, S. 3-6.<br />
Gutzeit, Reinhart von: Wie musikalisches Lernen gelingt, in: Üben & Musizieren,<br />
15. Jg. (1998), Heft 5, S. <strong>1.</strong><br />
Haefeli, Anton: Gefühl versus Handwerk oder: Ist Komponieren lernbar? Geschichtliche<br />
Überlegungen zum Begriff des künstlerischen Schaffens, in: nmz,<br />
48. Jg. (1999), Heft 4, S. 45-48.<br />
Halsband, Ulrike, Binkofski, Ferdinand & Camp, Max: The Role of the Perception<br />
of Rhythmic Grouping in Musical Performance: Evidence from Motor-Skill<br />
Development in Piano Playing, in: Music Perception, Vol. 11, Spring 1994, S.<br />
265-288.<br />
Hamer, Mick: Professionals know the score, in: The New Scientist, Vol. 153, No.<br />
2069 (February 15, 1997), S. 20.<br />
Hartung (alias Humano), Philipp Christoph: Musicus theoretico-practicus, Nürnberg<br />
1749, Reprint Leipzig 1977.<br />
Haufe, Friederike: Es gibt kein absolutes Urteil über einen Musiker, in: Üben &<br />
Musizieren, 16. Jg (1999), Heft 3 (Mai/Juni), S. 30-32.<br />
Heinrich, Monika: Johann Sebastian Bach – "Schulmann" oder Privatmusiklehrer?<br />
in: Üben & Musizieren, 13. Jg. (1996), Heft 2 (März/April), S. 3-8.<br />
Helmholtz, Hermann von: Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische<br />
Grundlage für die Theorie der Musik, Braunschweig 21877.<br />
223
Hemker, Thomas & Müllensiefen, Daniel (Hg.): Medien – Musik – Mensch: Neue<br />
Medien und Musikwissenschaft, Hamburg 1997.<br />
Hentoff, Nat: André Previn's Trio Jazz: King Size, Begleittext zu: Contemporary<br />
Records S 7570, Berkeley 1959.<br />
Henze, Hans Werner: Information zum Nordkolleg Rendsburg, 2.8. - 4.8. 1997, Broschüre.<br />
Henze, Hans Werner: Komponieren in der Schule, in: Nova, Herbst 1998, Katalog<br />
des Schott Verlags, Mainz, S. 30.<br />
Herter, G.: Ueber die Mechanik der dem Klavierspiel dienenden Bewegungen, in:<br />
Der Klavier-Lehrer, 28. Jg. (1905), S. 85-87.<br />
Hiller, Ferdinand: Felix Mendelssohn-Bartholdy: Briefe und Erinnerungen, Köln<br />
1874.<br />
Hitler, Adolf: Vorwort, in: Das Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Düsseldorf,<br />
Prospekt, 1939.<br />
Hoffmann, E.T.A.: Kreisleriana, Stuttgart 1983.<br />
Jacoby, Heinrich: Musik: Gespräche, Versuche 1954; herausgegeben von Sophie<br />
Ludwig, Hamburg 1986.<br />
Jacoby, Heinrich: Jeneits von "Begabt" und "Unbegabt". Zweckmäßige Fragestellung<br />
und zweckmäßiges Verhalten – Schlüssel für die Entfaltung des Menschen,<br />
herausgegeben von Sophie Ludwig, Hamburg 51994.<br />
Jacoby, Heinrich: Jenseits von "Musikalisch" und "Unmusikalisch". Die Befreiung<br />
der schöpferischen Kräfte dargestellt am Beispiele der Musik, Hamburg 21995.<br />
Jansen, Johannes: Der patentierte Pianist: Gedanken zum 200. Geburtstag von Carl<br />
Czerny, in: Pianoforte, <strong>1.</strong> Jg, 1991, Heft 2, S. 66-69.<br />
Kaden, Christian: Des Lebens wilder Kreis: Musik im Zivilisationsprozeß, Kassel<br />
1993.<br />
Keller, Hermann: Die Klavierwerke Bachs (= Ed. Peters 4571), Leipzig o.J.<br />
Klöppel, Renate: Die Kunst des Musizierens, von den physiologischen und psychologischen<br />
Grundlagen zur Praxis, Mainz 1993.<br />
Knolle, Niels & Axel Weidenfeld: "Unplugged" – Stationen der Produktion, Distribution<br />
und Rezeption von Musik unter dem Einfluß von Technik, in: Enders,<br />
Bernd & Knolle, Niels (Hg.): Klangart-Kongress 1995 (= Musik und Neue<br />
Technologie 1), Osnabrück 1998, S. 49-70.<br />
Koch, Martin: Greifen und Begreifen: 4. Symposium des Instituts für Begabungsforschung<br />
und Begabtenförderung in der Musik (IBFF), in: Üben & Musizieren,<br />
15. Jg. (1998), Heft 2, S. 31-32.<br />
Kontzki, A.: L´insispensable du Pianiste, op. 100, Leipzig 185<strong>1.</strong><br />
224
Kopiez, Reinhard: Mensch-Musik-Maschine: Neue Informationstechnologien und<br />
ihre Bedeutung für Musikvermittlung und Musikwissenschaft, in: musica, 50.<br />
Jg (1996), Heft 1, S. 20-26.<br />
Korward, Hansjörg: Wer lehrt die Lehrer das Lehren? in: nmz, 42. Jg (1993), S. 17-<br />
18.<br />
Kräuter, Philipp David: Brief an das Scholarchat Augsburg vom 30.4.1712, in:<br />
Bach-Dokumente, Band 3: Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian<br />
Bachs 1750-1800, Kassel / Leipzig u. a. 1972, Nr. 53b, S. 649.<br />
Kuhnau, Johann: Neue Clavierübung, bestehend aus 7 Partiten aus dem Ut, Re,Mi,<br />
oder Tertia majore eines jedweden Toni etc. Allen Liebhabern zu sonderbahrer<br />
Annehmlichkeit aufgesetzt und verleget, Leipzig 1689/1692.<br />
Kullak, Adolph: Die Ästhetik des Klavierspiels, 21876, umgearbeitete Auflage herausgegeben<br />
von Hans Bischoff, Reprint, neu herausgegeben von Martin Gellrich,<br />
Regensburg 1994 (<strong>1.</strong> Aufl.: 1861).<br />
Kullak, Adolph: Die Ästhetik des Klavierspiels, Leipzig 61916, herausgegeben von<br />
Walter Niemann (<strong>1.</strong> Aufl.: 1861).<br />
Landon, H. C. Robbins Ludwig van Beethoven in Zeugnissen der Zeit, Stuttgart<br />
1994.<br />
Leimer, Karl: Modernes Klavierspiel nach Leimer-Gieseking, Leipzig 193<strong>1.</strong><br />
Levine, Mark: Das Jazz Piano Buch, o.O. (= Rottenburg): Advance Music, 1992.<br />
Litzmann, Berthold: Clara Schumann; Ein Künstlerleben nach Tagebüchern und<br />
Briefen; Erster Band: Mädchenjahre, 1819-1840, Leipzig 31906.<br />
Lobenstein, Frieda: Klavierpädagogik (= Musikpädagogische Bibliothek, Bd. 4),<br />
Heidelberg 21960 (<strong>1.</strong> Aufl.: 1931).<br />
Maass, Georg (Hg.): Musiklernen und Neue (Unterrichts-) Technologien (= Musikpädagogische<br />
Forschung, Band 16), Essen 1995.<br />
Maeckel, O.v.: Das organische Klavierspiel, Iserlohn 1938.<br />
Mahlert, Ulrich: Spielen ohne Noten, in: Üben & Musizieren, 16. Jg. (1999), Heft 2,<br />
S. <strong>1.</strong><br />
Mahlert, Ulrich: Carl Czernys "Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem<br />
Pianoforte" (1829) – Ein Quellenwerk zur Geschichte der Klavierimprovisation,<br />
in: EPTA-Dokumentation 1995, S. 126-137.<br />
Mahling, Christoph-Hellmut: Musikwissenschaft und Musikpädagogik. – Unüberwindbare<br />
Gegensätze? In: Walter Gieseler & Rudolf Klinkhammer (Hg.): Forschung<br />
in der Musikerziehung 1978, Dokumentation einer Wissenschaftlichen<br />
Tagung der Bundesfachgruppe Musikpädagogik vom 29. 9. bis 2. 10. 1977 in<br />
der Justus-Liebig-Universität Gießen, Mainz 1978, S. 63-67.<br />
225
Mantel, Gerhard: Strategien des Unterrichts, in: Üben & Musizieren, 1<strong>1.</strong> Jg. (1994),<br />
H. 4, S. 14-17.<br />
Manz, Wolfgang: Medieneinsatz und Medienerziehung – ihre Bedeutung für die Bildungsarbeit<br />
–, in: Fakultätsausschuß Medienwissenschaft der Heinrich-Heine-<br />
Universität Düsseldorf (Hg.): H.H. Medien: Medienwissenschaftliche Beiträge<br />
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Heft 1, 1991, S. 42-60.<br />
Marek, Czeslaw: Lehre des Klavierspiels, Zürich 31986.<br />
Marpurg, Friedrich Wilhelm: Die Kunst das Clavier zu spielen, Berlin 1762 (Reprint:<br />
Hildesheim 1969).<br />
Marpurg, Friedrich Wilhelm: Anleitung zum Clavierspielen, Berlin 1765 (Reprint:<br />
Hildesheim 1970).<br />
Martienssen, Carl Adolph: Schöpferischer Klavierunterricht, Leipzig 21957.<br />
Mazzola, Guerino: Geometrie der Töne: Elemente der Mathematischen Musiktheorie,<br />
Basel/Boston/Berlin, 1990.<br />
McLuhan, Marshall & Quentin Fiore: Das Medium ist Massage, Frankfurt / Berlin /<br />
Wien 1984.<br />
McLuhan, Marshall: Die magischen Kanäle: Understanding Media, Dresden / Basel<br />
21995.<br />
Merkert, Rainald: Zur Anthropologie des Hörens, in: Stimmen der Zeit, Bd. 206,<br />
Freiburg 1988, S. 759-770.<br />
Merkert, Rainald: Medien und Erziehung, Darmstadt 1992.<br />
Milstein, Jakow: Über Tendenzen in der Entwicklung der Interpretationskunst, der<br />
Interpretationskritik und der Erziehung des Interpreten, in: H. Sahling, (Hg.):<br />
Notate zur Pianistik, Leipzig 1976, S. 170-205.<br />
Molsen, Uli: Die Geschichte des Klavierspiels in historischen Zitaten, Balingen<br />
1982.<br />
Motte-Haber, Helga de la: Musikpsychologie, Laaber 1984.<br />
Motte-Haber, Helga de la: Was bewirkt musikpädagogische Forschung? In: Christa<br />
Nauck-Börner (Hg.): Musikpädagogik zwischen Traditionen und Medienzukunft<br />
(= Musikpädagogische Forschung Bd.9), Laaber 1988 S. 251-254.<br />
Müller-Römer, F.: Digitales Fernsehen – Auswirkungen auf die Medienlandschaft,<br />
in: Fernseh- und Kinotechnik, 48. Jg., Heidelberg 6/1994, S. 291-302.<br />
Nägeli, Hans Georg: Vorlesungen über Musik mit Berücksichtigung der Dilettanten,<br />
Stuttgart und Tübingen, 1826.<br />
Nauck-Börner, Christa: Wahrnehmung und Gedächtnis, in: Helga de la Motte-Haber:<br />
Handbuch der Musikpädagogik, Band 4: Psychologische Grundlagen des<br />
Musiklernens, Kassel 1987.<br />
226
Naumann, Emil: Klavierspielern und Klavierlehrern zur Beherzigung, in: Der Klavier-Lehrer,<br />
<strong>1.</strong> Jg. (1878), S. 105-107.<br />
Neuhaus, Heinrich: Die Kunst des Klavierspiels, o.O. (= Köln): Hans Gerig, 1967.<br />
Niecks, Friedrich: Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker, 2 Bde., Leipzig<br />
1890.<br />
Nipperdey, Thomas: Wie das Bürgertum die Moderne fand, Berlin 1988.<br />
Palmieri, Robert: Piano Information Guide. New York, London 1989.<br />
Pembaur d. J., Joseph: Von der Poesie des Klavierspiels, Köln 71917.<br />
Peters, Johannes: Einführung in die allgemeine Informationstheorie, Berlin-Heidelberg-New<br />
York 1967.<br />
Philipp, Günter: Klavier Klavierspiel Improvisation, Leipzig 1984.<br />
Philipp, Günter: Das Improvisatorische in Musik und Malerei, in: Üben & Musizieren,<br />
12. Jg. (1995), Heft 4, S. 14-17.<br />
Piltz, Albrecht: Sorry, but this just isn't music: Interview mit Coldcut, in: Keyboards<br />
1/1998, S. 24-38.<br />
Pilz, Michael: Ich habe den Bauch voller Musik, Interview mit dem Schlagzeuger<br />
Günter Sommer, in: Üben & Musizieren, 13. Jg. (1996), Heft 6, S. 28-32.<br />
Poschardt, Ulf: DJ Culture, Hamburg 1995.<br />
Raif, Oskar: Ueber Fingerfertigkeit beim Clavierspiel, in: Carl Stumpf (Hg.): Beiträge<br />
zur Akustik und Musikwissenschaft, Jg. XXIV, Heft 3, S. 352-355, Leipzig<br />
190<strong>1.</strong><br />
Raue, Hermann: Klassische und elektronische Tasteninstrumente: Konkurrenz oder<br />
Koexistenz? In: Günther Batel: Handbuch der Tasteninstrumente und ihrer Musik,<br />
Braunschweig 1986, S. 189-193.<br />
Rechenberg, Helmut: Der intellektuelle Gigant der Naturwissenschaften. Zum hundertsten<br />
Todestag von Hermann von Helmholtz, in: Naturwissenschaftliche<br />
Rundschau, 47. Jg. (1994), Heft 12, S. 460-466.<br />
Reimers, U.: Digitales Fernsehen für Europa. In: Fernseh- und Kinotechnik, 48. Jg.<br />
(1994), H. 10, S. 517-520.<br />
Reinhold, Günter: Alfred Cortot als Pädagoge: ein Nachtrag, in: EPTA-Dokumentation<br />
1996, S. 28-35.<br />
Ribke, Wilfried: Üben, in: Herbert Bruhn, Rolf Oerter & Helmut Rösing (Hg.): Musikpsychologie<br />
(= Rowohlts Enzyklopädie Bd. 526) , Reinbek 1993, S. 546 -<br />
558.<br />
Richter, Klaus Peter: So viel Musik war nie: von Mozart zum digitalen Sound, München<br />
1997.<br />
Riemann, Hugo: Handbuch des Klavierspiels, Berlin 61920.<br />
227
Riemann, Hugo: Präludien und Studien, Hildesheim 1967, Reprografischer Nachdruck<br />
der Ausgabe Leipzig 1895.<br />
RP-Online: http://rp-online.de/news/boulevard/2001-0302/grand_prix_ende.html.<br />
URL vom 03.03.200<strong>1.</strong><br />
Rüedi, Peter: Keith Jarrett: Die Augen des Herzens, in: Siegfried Schmidt-Joos<br />
(Hg.): Idole (5): Nur der Himmel ist Grenze, Frankfurt / Berlin / Wien (Ullstein<br />
Taschenbuch) 1985, S. 155-212.<br />
Rule, Greg: DJ Shadow, in: Keyboards, 12/1997, S. 16-24.<br />
Scharwenka, Xaver: Methodik des Klavierspiels (= Handbücher der Musiklehre,<br />
Bd.III), Leipzig 31919.<br />
Schindler, Anton: Biographie von Ludwig van Beethoven, 2 Bde., Münster 51871,<br />
Reprint Hildesheim 1970.<br />
Schläbitz, Norbert (1995): Diskret und Vertraulich: Kommunikation mit Neuer Musiktechnologie,<br />
in: Georg Maas (Hg.): Musiklernen und Neue (Unterrichts-)<br />
Technologien (= Musikpädagogische Forschung, Bd. 16), Essen 1995, S. 69-<br />
95.<br />
Schläbitz, Norbert (1997a): Der diskrete Charme der Neuen Medien: Digitale Musik<br />
im medientheoretischen Kontext und deren musikpädagogische Wertung<br />
(= Forum Musikpädagogik, Bd. 26), Augsburg 1997.<br />
Schläbitz, Norbert (1997b): Medien–Musik–Mensch, in: Thomas Hemker & Daniel<br />
Müllensiefen: Medien–Musik–Mensch: Neue Medien und Musikwissenschaft,<br />
Hamburg 1997, S. 11-37.<br />
Schlaug, Gottfried / Jäncke, Lutz / Huang, Yanxiong / Staiger, Jochen F. / Steinmetz,<br />
Helmuth: Increased Corpus Callosum in Musicians, in: Neuropsychologia,<br />
Vol. 33 (1995), No.8, S. 1047-1055.<br />
Schleuning, Peter: Das 18. Jahrhundert: Der Bürger erhebt sich, Reinbek 1984.<br />
Schmidt, Hans-Christian: Liebe, Lust und Leid mit Händen und Füßen: der Kino-<br />
Organist Horst Schimmelpfennig, in: Sabine Schutte (Hg.): Ich will aber gerade<br />
vom Leben singen, Reinbek 1987, S. 343-364.<br />
Schmidt-Brunner, Wolfgang: Methode-Technik und/oder Konzept? Ein einführendes<br />
Vorwort zum Problemkreis, in: ders. (Hg.): Methoden des Musikunterrichts,<br />
Mainz 1982, S. 14-29.<br />
Schmitz, Eugen: Klavier, Klaviermusik und Klavierspiel, Leipzig 1919.<br />
Schneider, Norbert J.: Musik und Mensch, Baustein für eine Anthropologie der Musik,<br />
in: musica, Kassel 1/1995, S. 2-9.<br />
Schönberg, Arnold: Ausgewählte Briefe, ausgewählt und herausgegeben von Erwin<br />
Stein, Mainz 1958.<br />
228
Schönberg, Arnold: Schöpferische Konfessionen, ausgewählt und herausgegeben<br />
von Willi Reich, Zürich 1964.<br />
Schönberg, Arnold: Schulung des Ohrs durch Komponieren, in: ders.: Stil und Gedanke,<br />
Frankfurt 1992, S. 140-146.<br />
Schochardt, Kai: "Die Musik gibt mir Kraft": Aus dem Alltag eines DJ, in: Cocktail,<br />
Verlagsbeilage zur Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, 28.2.1997.<br />
Schubert, Kurt: Die Technik des Klavierspiels aus dem Geiste des musikalischen<br />
Kunstwerks (= Sammlung Göschen Band 1045), Berlin 1954.<br />
Schumann, Robert: Schriften über Musik und Musiker, Stuttgart 1982<br />
Schumann, Robert: Musikalische Haus- und Lebensregeln, in: Klaus Stadler (Hg.):<br />
Lust an der Musik (= Serie Musik Piper Schott, Bd. 8250), München 1984, S.<br />
183-184.<br />
Sloboda, John A.: Begabung und Hochbegabung, in: Herbert Bruhn & Rolf Oerter<br />
& Helmut Rösing (Hg.): Musikpsychologie (= Rowohlts Enzyklopädie Bd.<br />
526), Reinbek 1993, S. 565 - 578.<br />
Smeets, Marlies: Grußwort, in: Festschrift: 40 Jahre Clara-Schumann-Musikschule,<br />
Düsseldorf 1996, S. 5.<br />
Spada, Hans (Hg.): Lehrbuch allgemeine Psychologie, Bern 1992.<br />
Stange-Elbe, Joachim: Computerunterstützte Musikanalyse und Interpretation mit<br />
der Software RUBATO,<br />
http://bird.musik.uni-osnabrueck.de/MaMuTh/PC/index.html.<br />
(URL v. 12.<strong>1.</strong>1999)<br />
Stoewe, Gustav: Ueber die Wichtigkeit des Studiums der Anatomie für Klavierspieler<br />
vom Fach, in: Der Klavier-Lehrer, <strong>1.</strong> Jg., 1878, S. 238-24<strong>1.</strong><br />
Tetzel, Eugen: Das Problem der modernen Klaviertechnik, Leipzig 21912 (erste<br />
Auflage: 1905).<br />
Türk, Daniel Gottlob: Klavierschule, Leipzig und Halle 1789 (Reprint: Kassel<br />
1962).<br />
Tugendreich, Hulda: Ueber die gesundheitsschädlichen Folgen des unrichtigen Uebens,<br />
in: Der Klavier-Lehrer, <strong>1.</strong> Jg. (1878) S. 109-110.<br />
Tylski, Roderich Roman: Musik für die Massen: Jeder kann mit dem Programm<br />
"Soundtoys" zum Komponisten werden, in: Cocktail: Verlagsbeilage zur Westdeutschen<br />
Allgemeinen Zeitung 4.4.1997, S. 3.<br />
Uhde, Jürgen & Wieland, Renate: Denken und Spielen; Studien zu einer Theorie der<br />
musikalischen Darstellung, Kassel 1989.<br />
Ungeheuer, Elena: Wie die elektronische Musik "erfunden" wurde; Quellenstudie zu<br />
Werner Meyer-Epplers Entwurf zwischen 1949 und 1953, Mainz 1992.<br />
Varró, Margit: Der lebendige Klavierunterricht, Hamburg 1929.<br />
229
Venus 23: Einmal Rupert und zurück: Photek, in: Raveline 07/1996, S. 72-74.<br />
de Vries, Claudia: Die Pianistin Clara Wieck-Schumann: Interpretation im Spannungsfeld<br />
von Tradition und Individualität (= Schumann Forschungen 5),<br />
Mainz 1996.<br />
Wagenhäuser, Wolfgang & Reuter, Michael: Spielen wie Horowitz? Trossingen -<br />
Berlin 1997.<br />
Wagner, Richard: Eine Mitteilung an meine Freunde, in: Ders.: Dichtungen und<br />
Schriften, herausgegeben von Dieter Borchmeyer, Bd. 6, Frankfurt am Main<br />
1983, S. 199 - 325.<br />
Weber, Max: Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik, Tübingen<br />
1972 (<strong>1.</strong> Aufl.: 1921).<br />
Wehmeyer, Grete: Carl Czerny und die Einzelhaft am Klavier, Kassel 1983.<br />
Weinrebe, Helmut: Wegweiser zum künstlerischen Klavierspiel, Köln-Rodenkirchen<br />
1994.<br />
Werner, Peter Paul: Neue Methodik und Didaktik am Klavier, Wilhelmshaven 1993.<br />
Widmaier, Martin: Ich weiß, dass ich viel anzubieten habe: im Gespräch mit Seymour<br />
Bernstein, in: Üben und Musizieren, 18. Jg. (2001), S. 40-42.<br />
Wieck, Friedrich: Clavier und Gesang: Didaktisches und Polemisches, Leipzig<br />
1853.<br />
Wieck, Friedrich: Briefe aus den Jahren 1830-1838, eingeleitet und herausgegeben<br />
von Käthe Walch-Schumann (= Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte,<br />
Heft 74), Köln 1968.<br />
Wiedemann, Herbert: Klavierspiel und das rechte Gehirn, (= Perspektiven zur Musikpädagogik<br />
und Musikwissenschaft, Bd. 9), Regensburg 31990 (<strong>1.</strong> Auflage:<br />
1985).<br />
Wiedemann, Herbert: Klavier, Improvisation, Klang, Regensburg 1992.<br />
Wiedemann, Herbert: Improvisierendes Lernen als Weg zum Life-Time-Spielen, in:<br />
Üben & Musizieren, 13. Jg (1996), H. 2, S. 13-17.<br />
Wörner, Karl H.: Geschichte der Musik, Göttingen 81993.<br />
230