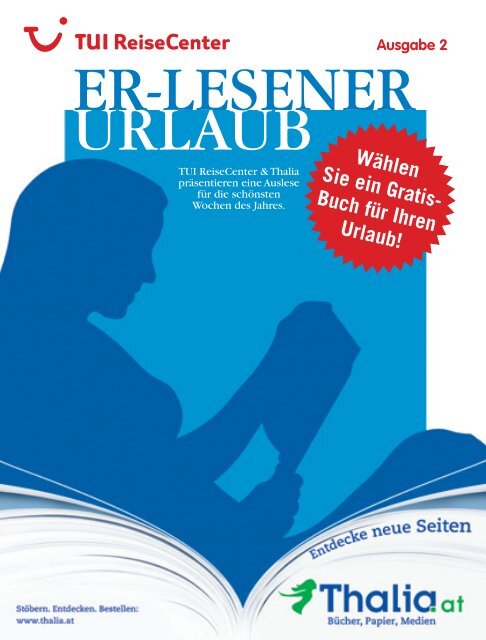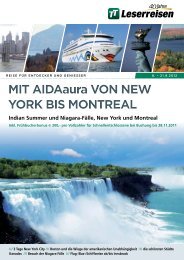Ausgabe 2 - TUI ReiseCenter
Ausgabe 2 - TUI ReiseCenter
Ausgabe 2 - TUI ReiseCenter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Ausgabe</strong> 2
(Ent)Spannung,<br />
wie sie im<br />
Buche steht
Die kostenlose<br />
Urlaubslektüre von<br />
<strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong><br />
und Thalia speziell<br />
für Sie.<br />
Willkommen in der World of <strong>TUI</strong>, wo Ihnen die weite Welt des<br />
Reisens offen steht. Mit über 90 Standorten in ganz Österreich ist<br />
das <strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong> immer eine nahe liegende Adresse für Ihren<br />
Traumurlaub. Ob klassische Pauschalreise oder Linienflug, ob<br />
Studien- oder Busreise, ob Kreuzfahrt oder Individualreise – wo<br />
immer Sie das bekannte Lächeln der World of <strong>TUI</strong> sehen, lacht Ihnen<br />
Urlaubsfreude entgegen. Denn mit Ihrem <strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong> verfügen<br />
Sie über seriöse und sichere<br />
Veranstalterpartner wie <strong>TUI</strong>,<br />
Gulet, Delphin, Magic Life,<br />
1-2-Fly, Terra Reisen,<br />
Neckermann, Dertour und<br />
viele mehr.<br />
Die Reiseprofis in Ihrem <strong>TUI</strong><br />
<strong>ReiseCenter</strong> denken nur an<br />
Ihren Urlaub – und dabei wird<br />
wirklich an alles gedacht. Sogar<br />
an Ihre Urlaubslektüre.<br />
In diesem Buch finden Sie Leseproben von 12 aktuellen Bestseller-<br />
Neuerscheinungen und 24 Klassikern im Taschenbuchformat aus<br />
dem umfassenden Thalia Sortiment.<br />
„Lesen Sie Ihr Lieblingsbuch heraus“ und kreuzen Sie es auf Ihrem<br />
<strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong> Buchscheck an, den Sie bei der Buchung Ihres<br />
Traumurlaubs erhalten haben. Den ausgefüllten Buchscheck bis 4<br />
Wochen vor Ihrem Reisetermin einfach per Post oder Fax einsenden<br />
– oder direkt in Ihrem <strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong> abgeben. Sie erhalten dann<br />
rechtzeitig vor Ihrer Abreise ein Gratis-Exemplar des ausgewählten<br />
Buches als Reisebegleitung für Ihren Urlaub.<br />
Gute Erholung und viel Entspannung mit der Lektüre Ihrer Wahl<br />
wünscht Ihnen<br />
Ihr <strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong>
Lust auf Urlaub!<br />
Mit Ihrem<br />
<strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong><br />
liegen Sie immer<br />
richtig.<br />
www.tui-reisecenter.at
Entdecken Sie neue Seiten des Urlaubs.<br />
Die schönsten Wochen des Jahres liegen vor Ihnen. Und damit wächst die Vorfreude<br />
auf unbeschwerte Urlaubsentspannung. Zu den schönsten Urlaubsvorbereitungen<br />
zählt auf jeden Fall ein Besuch bei Thalia, Österreichs größter Erlebnisbuchhandlung.<br />
Bücher sind ideale Urlaubsbegleiter.<br />
Bei Thalia findet jede Lesergeneration ihre ganz persönliche Lieblingslektüre: Ob<br />
aktuelle Bestseller oder zeitlose Klassiker, ob Spannung oder Entspannung, ob<br />
Heiteres oder Besinnliches, ob Wissen oder Information, ob ferne Länder oder<br />
fremde Sprachen – Thalia bietet Leseerlebnisse für die ganze Familie. Und mehr,<br />
denn neben den gedruckten Seiten wartet auch ein vielseitiges Medienangebot auf<br />
Sie: Von Hörbüchern über Musik-CDs und DVD-Filme bis zu Games und Software ist<br />
für jeden Geschmack das Richtige dabei. Zur unvergleichlichen Auswahl genießen Sie<br />
stets kompetente Beratung und zuverlässige Serviceleistungen.<br />
Ein Service besonderer Art halten Sie gerade in den Händen: Die vorliegende Ausle-<br />
se für Ihre Urlaubslektüre umfasst einen aktuellen Auszug aus dem umfangreichen<br />
Thalia Leseprogramm. Tauchen Sie ein in die Welt von Büchern, Medien und mehr.<br />
Besuchen Sie Ihre Thalia Buchhandlung oder entdecken Sie neue Seiten auf www.<br />
thalia.at.<br />
Wie immer Ihre Reiseziele auch aussehen mögen – Ihr Team bei Thalia<br />
wünscht Ihnen schon heute Urlaubsfreuden, wie sie im Buche stehen!
8<br />
Taschenbuch Klassiker<br />
Friedrich Torberg - Die Tante Jolesch ............................ 98<br />
Heimito von Doderer - Die Merowinger ....................... 98<br />
Heimito von Doderer - Ein Mord den jeder begeht ....... 99<br />
Joseph Roth - Radetzkymarsch ...................................... 99<br />
Leo N. Tolstoi - Anna Karenina ................................... 100<br />
Umberto Eco - Der Name der Rose ............................. 100<br />
Jane Austen - Stolz und Vorurteil................................. 101<br />
Fjodor M. Dostojewski - Die Brüder Karamasow ........ 101<br />
Jules Verne- Reise zum Mittelpunkt der Erde .............. 102<br />
Jules Verne - In 80 Tagen um die Welt ......................... 102<br />
John Steinbeck - Straße der Ölsardinen ....................... 103<br />
Jack London - Wolfsblut ............................................. 103<br />
Miguel de Cervantes Saavedra - Don Quijote .............. 104<br />
Herbert G. Wells - Die Zeitmaschine .......................... 104<br />
�omas E. Lawrence - Die sieben Säulen der Weisheit 105<br />
Johann W. von Goethe - Italienische Reise .................. 105<br />
�omas Mann - Tod in Venedig .................................. 106<br />
�omas Mann - Zauberberg ........................................ 106<br />
Charles Dickens - David Copperfield .......................... 107<br />
Charles Dickens - Oliver Twist .................................... 107<br />
Edgar Allan Poe - Grusel- u. Schauergeschichten ......... 108<br />
Daniel Defoe - Robinson Crusoe ................................. 108<br />
Homer - Odyssee ........................................................ 109<br />
Hape Kerkeling - Ich bin dann mal weg ...................... 109
Leseproben Neuerscheinungen<br />
Marieke van der Pol - Brautflug ..................................... 10<br />
Jeffery Deaver - Der Täuscher ........................................ 18<br />
Fred Vargas - Der verbotene Ort .................................... 25<br />
Sandra Gulland - Die Sonne des Königs ........................ 31<br />
Jan Winter - Erzähl mir von den weissen Blüten ............ 38<br />
Ann Cleeve - Im kalten Licht des Frühlings ................... 46<br />
Oliver Bottini - Jäger der Nacht .................................... 54<br />
Kate Saunders - Liebe macht lustig ................................ 61<br />
Melanie Rose - Mein Tag ist Deine Nacht ..................... 68<br />
Val McDermid - Nacht unter Tag .................................. 75<br />
Arne Dahl - Totenmesse ................................................ 81<br />
David Gilmour - Unser allerbestes Jahr ......................... 91<br />
9
Marieke van der Pol<br />
Brautflug<br />
Roman<br />
ISBN 3-8105-1580-9<br />
© Krüger Verlag<br />
10<br />
Marieke van der Pol machte eine Schauspielausbildung<br />
und arbeitete viele Jahre für �eater und Film. Dann<br />
wechselte sie die Seiten und ist heute eine der be-<br />
kanntesten Drehbuchautorinnen der Niederlande. Für<br />
ihr Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. für<br />
ihr Drehbuch zum Oscar-nominierten Film ›Die Zwil-<br />
linge‹. ›Brautflug‹ ist Marieke van der Pols Romande-<br />
büt, das in viele Sprachen übersetzt und mit Rutger<br />
Hauer fürs Kino verfilmt wurde. Die Autorin lebt in<br />
Amsterdam und schreibt an ihrem zweiten Roman.
So sah es also aus, ihr Schiff, ihre Arche. Die silbergraue Kabine mit den<br />
gebogenen Wänden, der Teppich im Durchgang in beruhigendem Blau, links<br />
drei Sitze und rechts zwei, bis tief ins Heck hinein. Willkommen an Bord. Zwei<br />
Stewards und eine Stewardess, die Uniform in der gleichen beruhigenden Farbe,<br />
nahmen ihre Jacken in Empfang und verstauten sie schnell und effizient im<br />
Garderobenraum im hinteren Teil des Flugzeugs. Sie wiesen den Passagieren ihre<br />
Plätze an, eine gut vorbereitete Operation. Das spendete allgemein Vertrauen,<br />
und innerhalb von zehn Minuten saßen alle. Natürlich waren die Plätze auf<br />
die jeweiligen Namen, vielleicht sogar auf ihr individuelles Gewicht ausgestellt,<br />
doch für den jungen Mann, der Frank hieß, galten anscheinend andere Regeln.<br />
Er leitete Ada mit festem Griff zu zwei Sitzen irgendwo in der Mitte, als wäre<br />
es genauso gedacht. Esther und Marjorie ließen sich ohne Zögern hinter ihnen<br />
auf die Sitze fallen. Ada wusste genau, dass sie das dieses Jungen wegen taten, als<br />
wollten sie ihn nicht loslassen, jetzt, wo sie ihn einmal entdeckt hatten. Es war<br />
ein ziemliches Hin und Her, einige Passagiere mussten ein Stück weiter nach vorn<br />
oder hinten rücken, doch es war alles kein Problem, denn alle waren zu aufgeregt,<br />
um irgendwelche Schwierigkeiten zu machen. Die Journalisten waren direkt bis<br />
zum Heck durchgelaufen und klappten dort die Tischchen für ihre Schreibmaschinen<br />
aus.<br />
Das Handgepäck lag über ihren Köpfen in den Netzen, die Erfolgskoffer<br />
mussten unter den Sitzen verstaut werden. Marjorie machte ihren auf, um den<br />
Schleier ordentlich hineinzufalten. Ada, die nicht so recht wusste, wie sie sich<br />
mit dem Unbekannten an ihrer Seite verhalten sollte, setzte sich und drehte sich<br />
sofort nach hinten um. Die Reisende, die hier so lässig über der Lehne hängt, das<br />
bin ich. Marjorie lachte ihr zu. »Schön, nicht?«<br />
Es war eigentlich keine Frage, aber sie nickte trotzdem.<br />
»Der Geschmack der Neuseeländer scheint ziemlich konservativ zu sein«, sagte<br />
Esther und ließ den Brautschleier ihrer Nachbarin prüfend durch die Finger gleiten,<br />
»davon werde ich profitieren.« Das Urteil in ihren Augen war Ada nicht entgangen.<br />
Noch nie zuvor hatte sie so eine Frau aus solcher Nähe heraus betrachtet.<br />
Marjorie faltete und stopfte so lange, bis die Meter weggleitenden Tülls ihr<br />
11
gehorchten. Und Esther würde davon profitieren, von diesem konservativen Geschmack.<br />
Die langen, schwarzen Wimpern hoben und senkten sich kühl, blinzeln<br />
konnte man das nicht nennen. »Ich bin Modeschöpferin.«<br />
In dem Kupferstich mit dem Totenkopf pudert die Frau sich zum letzten Mal<br />
die Nase, erhebt sich schwebend von ihrem Schemel, schlägt die weiten Falten<br />
ihres Abendkleides anmutig zurück und trippelt zum Schauspielhaus, nirgendwo<br />
ein Schädel zu sehen.<br />
12<br />
»Heiratest du?«, fragte Marjorie.<br />
»Das habe ich vor.«<br />
»Und dann auch noch Kinder bekommen?«<br />
Esther schob den letzten Rest widerspenstigen Tülls von sich, ihre Armreifen<br />
klimperten heftig. »Vielleicht werde ich selber Stoffe entwerfen«, sagte sie.<br />
»Let me be by myself in the evenin’ breeze …«<br />
Es wurden Zeitungen und Kaugummipäckchen verteilt. Ein Steward lief nach<br />
vorne. »Guten Tag, meine Damen und Herren … ich weiß nicht, ob meine Stimme<br />
bis ins Heck zu hören ist, jedenfalls heiße ich Sie im Namen der Besatzung<br />
herzlich willkommen an Bord …« Das Kabinenpersonal arbeitete auf Hochtouren,<br />
wie eine gut geölte Maschine, sie mussten ihrem Namen alle Ehre machen,<br />
das Kaugummi trug seinen Teil dazu bei, verstehen tat Ada das allerdings nicht.<br />
Ihr neuer Bekannter wusste Bescheid.<br />
»Für die Ohren, beim Starten.«<br />
Ada starrte verlegen auf das Päckchen und versuchte sich vorzustellen, wie das<br />
ging.<br />
»Stimmt was nicht?«<br />
Sie hasste ihre eigene Unwissenheit.
»Muss man erst darauf kauen?«<br />
Er sah sie weiter an, seine Augen blitzten vergnügt auf.<br />
»Ja.«<br />
Das Einzige, was sie tun konnte, war, darauf zu achten, was die anderen taten.<br />
Sie drehte sich zum Fenster, sah den Herzog von Gloucester vor dem Kalkstrich<br />
stehen, und zeigte nach draußen, erleichtert, sieh nur.<br />
Frank beugte sich über sie herüber, sie hielt den Atem an. Er hatte ein scharfes,<br />
irgendwie arrogantes Profil, mit einer Nase, die man nicht wirklich als Hakennase<br />
bezeichnen konnte, die aber durchaus respekteinflößend wirkte. Ein Herrschergesicht.<br />
Auch andere hatten den Herzog entdeckt. Jeder versuchte, durch die kleinen<br />
Fenster hindurch das Geschehen zu verfolgen. Sie drückten sich die Nasen am<br />
Glas platt. Marjorie tippte sie an, ob sie eigentlich wussten, dass er ein Onkel von<br />
Königin Elizabeth war? Das würde auch ihre Königin werden. Die Stewardess<br />
lief zu der offenen Tür, winkte den Fotografen zum letzten Mal, schloss dann die<br />
schwere Tür und verriegelte sie. Sie waren allein.<br />
In der Kabine leuchteten die Deckenlichter auf.<br />
Ein Ruck ging durch das Flugzeug und erschütterte die Reihen – der Fliegende<br />
Holländer rollte schwerfällig zur Startlinie. Die drei Konkurrenten der Handicapklasse<br />
würden mit fünf Minuten Abstand voneinander aufsteigen, sie waren<br />
als Erste an der Reihe. Wieder winkten die Wegfliegenden, diesmal hinter den<br />
kleinen Fenstern. Ada nicht, sie hatte genug vom ziellosen Winken, und Frank<br />
tat es auch nicht.<br />
An der Kalklinie blieb das Flugzeug stehen, einen Moment lang neigten sich<br />
alle vornüber, sie hingen in ihren Gurten. Draußen erhob der Herzog seine grüne<br />
Flagge. Eine eigenartige, gespannte Stille erfüllte die Kabine. Dann schwoll das<br />
Geräusch der Motoren dumpf und dunkel an. Ada schloss die Augen. Vater unser<br />
im Himmel. Die Stewardess setzte sich als Letzte und schnallte sich schnell an.<br />
Sie zeigte den Leuten, die in der Nähe saßen, ihre Armbanduhr. »Noch siebzig<br />
13
Sekunden.« Ada wimmerte leise, und Frank ergriff ihre Hand, aber da sich das<br />
nicht gehörte, zog sie sie vorsichtig zurück. Dabei überkam sie allerdings das<br />
Gefühl, dass sich dies ebenso wenig gehörte. Glücklicherweise schauten alle nur<br />
auf den Herzog.<br />
14<br />
Ein Moment äußerster Spannung folgte, dann wurde die Flagge gesenkt.<br />
»Gas geben«, sagte Frank.<br />
Mit einem kräftigen Ruck stoben sie über die Startlinie, vorbei an den Männern<br />
mit den Walkie-Talkies, die Startbahn entlang. Als sie in ihrem Sitz nach hinten<br />
gedrückt wurde, spürte sie nun zum zweiten Mal die Gewalt, während ihr das<br />
Herz in der Brust raste. Vater unser im Himmel. Unter dem Flugzeug knallte und<br />
wummerte es.<br />
»Wir sind in der Luft«, rief die Stewardess, »fünfundzwanzig Sekunden nach<br />
dem Start, und wir sind in der Luft! Noch nicht mal auf der Hälfte der Startbahn!«<br />
Das Flugzeug neigte sich zur Seite, wackelte, sank und stieg, dasselbe<br />
grässliche Gefühl im Magen wie gestern.<br />
»Zehntausend Pferde galoppieren uns in die Luft«, bemerkte Frank.<br />
Aber Hufe müssen doch Funken sprühen. Sie sah Getrappel im luftleeren<br />
Raum, ein senkrechter Fall nach unten, ein blutiger Berg aus gebrochenen<br />
Knochen und zertrümmerten Schädeln, aus denen Hirn herausgespritzt ist. Dein<br />
Wille geschehe. Sie krallte sich an die Sitzlehne und richtete ihren Blick auf den<br />
Teil des Flügels, den sie sehen konnte. Sie hingen schief. Das ging nicht gut. Dass<br />
der Mensch fliegen könnte, war ein hochmütiger Irrtum. Vergib uns.<br />
Über dem Gebrüll der Motoren erklang Gesang aus Mädchenmündern. »Hup,<br />
Holland, hup, lasst den Löwen nicht im Regen stehen.« Fröhliche Seelen hatten<br />
eine Fassung für besondere Gelegenheiten gedichtet: Auf dem Fußballplatz<br />
feierten sie keine herausragenden Erfolge, doch hoch in der Luft würde Holland<br />
vielleicht Champion werden können. Von hinten ertönte ein heiseres Lachen.<br />
»Was für ein schlichtes Lied.«<br />
Frank grinste. Marjorie sang aus voller Kehle mit. Niemand schien etwas zu
merken. Wir fallen herunter, wollte sie schreien, aber ihre Kiefer wollten sich<br />
nicht bewegen. In einem Angstkrampf saß sie in ihren Sitz geklebt und fühlte,<br />
wie das Flugzeug machtlos vibrierend um seine letzten Momente in der Luft<br />
kämpfte.<br />
»Was ist los?«<br />
Sie konnte ihn nicht ansehen, denn dann würde sie ihren Blick von dem Flügel<br />
lösen müssen.<br />
»Hast du Angst?«<br />
Mit einer winzigen Geste zeigte sie nach draußen.<br />
»Wir fliegen eine Kurve, das ist alles.« Er sah sie weiter an. Das Flugzeug kippte,<br />
richtete sich wieder auf und kippte wieder. »Es passiert nichts. Du musst dich<br />
entspannen, dann macht es Spaß. Wie auf dem Jahrmarkt.« Sie starb, und in der<br />
Ferne schrie jemand etwas von Jahrmarkt.<br />
»Denkst du, dass wir abstürzen, wenn du redest?«<br />
Das Reißen von Papier, er packte das Kaugummi aus. »Wenn du Probleme<br />
mit dem Luftdruck hast, musst du kauen. Bitte schön.« Er hielt ihr etwas vor<br />
den Mund. Sie schüttelte den Kopf, sie konnte nicht, nicht jetzt. Er lachte und<br />
steckte es sich selbst in den Mund.<br />
»Na, dann nicht …«<br />
Seine Hand glitt ruhig über die ihre hinweg, die sich wie eine Kralle um die<br />
Lehne geklammert hatte. Ada spürte die angenehme, trockene Wärme.<br />
»Konzentrier du dich nur, dann bleiben wir wenigstens in der Luft.«<br />
Behutsam bewegte sie die Augen in seine Richtung. Er klopfte ihr freundlich<br />
auf die Hand.<br />
»Ich hoffe, dass du bis Christchurch durchhältst.«<br />
Inzwischen sangen immer mehr Leute mit, die Stimmung wurde ausgelassener.<br />
Frank stimmte fröhlich ein, bellend und kauend. Ab und zu nickte er ihr<br />
aufmunternd zu.<br />
15
Ada löste die Hand, mit der sie die Lehne umfasste, ein wenig und dachte<br />
nach. Aber das Flugzeug rumpelte und stieß durch die Wolkenschicht, und das<br />
machte das Nachdenken nicht gerade einfacher. Erst als die letzten Wolkenfetzen<br />
wie Schaum am Rumpf abgeglitten waren und sie in eine bildschöne, neue Welt<br />
hineinflogen, das Flugzeug scheinbar zur Ruhe gekommen war und die Kabine in<br />
blendendes, weißes Sonnenlicht gebadet wurde, erst dann ging ein Seufzer durch<br />
Adas Körper. Sie beendete ihr Gebet, entspannte die Finger, schloss die Augen<br />
und ließ die Sonne über ihr Gesicht gleiten.<br />
Irgendetwas hatte es mit diesem Unbekannten auf sich. Keine halbe Stunde später<br />
– inzwischen flogen sie mit Dauergeschwindigkeit und schienen schon zwei<br />
Minuten vor ihrem eigenen Zeitplan zu liegen – hing Esther an seiner Sitzlehne<br />
auf dem Gang und Marjorie steckte ununterbrochen ihren Kopf zwischen ihren<br />
Sitzen hindurch. Ada saß nun wieder wie festgeklebt auf ihrem Sitz, denn sie hatte<br />
entdeckt, dass zwischen einigen Paneelen Licht hindurchdrang, und außerdem<br />
kräuselte sich hier und da eine dünne Schliere Rauch oder Nebel in die Kabine.<br />
Das Geräusch der Motoren blieb dumpf und bedrohlich, und manchmal heulten<br />
sie ohne ersichtlichen Grund auf. Alles in der Kabine vibrierte. Sie machte sich<br />
große Sorgen deswegen und klammerte sich am Lächeln auf dem Gesicht der<br />
Stewardess fest. Das Gewirr und Gesumm um den jungen Mann entging ihr<br />
jedoch nicht.<br />
16<br />
Marjorie zog ein Foto ihres Verlobten hervor.<br />
»Er heißt Hans. Hans Doorman. Hübsch, nicht wahr? Er ist schon zwei Jahre<br />
dort, und jede Woche schreibt er einen Brief. Er hat sehr schöne Hände. Er arbeitet<br />
als Zimmermann, dabei hat er eigentlich studiert!«<br />
Ada versuchte, sich die Hände von Derk ins Gedächtnis zu rufen. Sie hatte sie<br />
auf ihrem Körper gespürt, die verzweifelten Hände eines Ertrinkenden.<br />
»Er musste unterschreiben, dass er zwei Jahre lang als Gelegenheitsarbeiter<br />
einspringt, wo er gerade gebraucht wird, sonst hätte er keinen Zuschuss bekommen.«
Frank reichte ihr das Foto weiter. Es zeigte einen Jüngling in Knickerbockern<br />
auf einer Düne, der sinnend in die Ferne sah. »Bei mir ist es genauso. Ich habe<br />
auch einen Vertrag. Plan-Auswanderer, haben sie das genannt. Ich muss auch erst<br />
einmal abwarten. Ich bin ein Standard-Emigrant.« Esther beugte sich zu ihm herüber<br />
und sagte mit heiserer Stimme, dass er gar nicht danach aussähe. Sie nahm<br />
das Foto von Ada, würdigte es aber keines Blickes.<br />
»Ich will nicht einfach irgendeinen Job machen«, sagte Marjorie. »Ich bin diplomierte<br />
Krankenschwester, das ist schließlich schon was.« Sie schnaubte entrüstet.<br />
»To be honest, ich will überhaupt nicht arbeiten, ich will heiraten … und sobald<br />
wir ein Haus haben, bekommen wir Kinder.«<br />
17
Jeffery Deaver<br />
Der Täuscher<br />
Roman<br />
ISBN 3-7645-0296-7<br />
© Blanvalet Verlag<br />
18<br />
Jeffery Deaver, laut �e Times „der beste Autor<br />
psychologischer �riller weltweit“, hat sich nach<br />
dem ersten großen Erfolg als Schriftsteller aus seinem<br />
Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun<br />
abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine<br />
Bücher wurden bislang in 150 Länder verkauft, in 25<br />
Sprachen übersetzt und haben ihm bereits zahlreiche<br />
renommierte Auszeichnungen eingetragen. Die Ver-<br />
filmung seines Romans „Die Assistentin“ unter dem<br />
Titel „Der Knochenjäger“ (mit Denzel Washington<br />
und Angelina Jolie in den Hauptrollen) war weltweit<br />
ein sensationeller Kinoerfolg und hat dem faszinie-<br />
renden Ermittler- und Liebespaar Lincoln Rhyme und<br />
Amelia Sachs eine riesige Fangemeinde erobert.
Irgendetwas stimmte nicht ganz, aber sie konnte es nicht genau benennen.<br />
Wie ein Schmerz, der irgendwo in deinem Körper vage wieder aufflackert.<br />
Oder ein Mann, der auf dem Heimweg hinter dir geht … Etwa derselbe Kerl,<br />
der in der U-Bahn ständig zu dir herübergeschaut hat?<br />
Oder ein dunkler Punkt, der sich deinem Bett nähert und plötzlich verschwunden<br />
ist. Eine giftige Spinne?<br />
Doch dann sah der Besucher, der auf ihrem Wohnzimmersofa saß, sie lächelnd<br />
an, und Alice Sanderson vergaß ihre Sorge – falls man das überhaupt als eine<br />
Sorge hätte bezeichnen können. Arthur war nicht nur intelligent und ziemlich<br />
durchtrainiert. Er hatte vor allem ein großartiges Lächeln.<br />
»Wie wär’s mit einem Glas Wein?«, fragte sie und ging in die kleine Küche.<br />
»Gern. Was immer du gerade im Haus hast.«<br />
»Das macht echt Spaß – mitten in der Woche die Arbeit zu schwänzen. Man<br />
sollte meinen, wir seien zu alt für so was. Aber es gefällt mir.«<br />
»Born to be wild«, scherzte er.<br />
Das offene Fenster gab den Blick auf die Sandsteingebäude der anderen Straßenseite<br />
frei, manche davon mit Anstrich, andere naturbelassen. Auch ein Teil der<br />
Skyline Manhattans war zu sehen und ragte in den Dunst des schönen Frühlingstages<br />
auf. Ein Luftzug – recht frisch für New Yorker Verhältnisse – trug den Duft<br />
von Knoblauch und Oregano herein. Das kam von dem italienischen Restaurant<br />
ein paar Häuser weiter. Es war ihrer beider Lieblingsküche – eine der vielen<br />
Gemeinsamkeiten, die sie festgestellt hatten, seit sie sich vor einigen Wochen bei<br />
einer Weinprobe in SoHo begegnet waren. Alice hatte Ende April zusammen<br />
mit etwa vierzig anderen Leuten den Ausführungen eines Sommeliers über die<br />
Weine Europas gelauscht, als eine Männerstimme sich nach einem bestimmten<br />
spanischen Rotwein erkundigte.<br />
Sie hatte unwillkürlich leise aufgelacht, denn zufälligerweise besaß sie einen<br />
Karton genau dieses Weines (nun ja, inzwischen war der Inhalt nicht mehr ganz<br />
vollständig). Das Weingut war eher unbekannt, und es mochte sich nicht um<br />
19
den besten Rioja aller Zeiten handeln, aber für Alice waren schöne Erinnerungen<br />
damit verbunden. Während eines einwöchigen Spanienaufenthaltes hatten sie<br />
und ihr französischer Geliebter nämlich jede Menge davon getrunken – eine perfekte<br />
Liaison, genau das Richtige für eine Frau Ende zwanzig, die sich kurz zuvor<br />
von ihrem Freund getrennt hatte. Die Urlaubsromanze verlief leidenschaftlich,<br />
intensiv und natürlich ohne die Gefahr einer längerfristigen Bindung, was sie nur<br />
umso besser machte.<br />
Bei der Weinprobe hatte Alice sich vorgebeugt, um einen Blick auf den Fragesteller<br />
zu werfen: ein durchschnittlich aussehender Mann in Anzug und Krawatte.<br />
Nach einigen Gläsern der vorgestellten Weinkollektion war sie etwas mutiger<br />
geworden, hatte mit ihrem Häppchenteller in der Hand den Raum durchquert<br />
und sich bei dem Fremden nach dem Grund für sein Interesse an dem besagten<br />
Rioja erkundigt.<br />
Er erzählte ihr von einer Spanienreise, die er ein paar Jahre zuvor mit einer<br />
Exfreundin unternommen und dabei Gefallen an dem Wein gefunden hatte. Sie<br />
nahmen an einem Tisch Platz und unterhielten sich eine Weile. Wie sich herausstellte,<br />
schien Arthur das gleiche Essen und dieselben Sportarten zu mögen wie<br />
Alice. Sie gingen beide joggen und brachten jeden Morgen eine Stunde in einem<br />
überteuerten Fitnesscenter zu. »Aber ich trage dabei bloß schlichte Shorts und<br />
ein einfaches T-Shirt vom Wühltisch«, sagte er. »Nicht so einen Designermüll …«<br />
Dann wurde er rot, weil er merkte, dass er Alice womöglich beleidigt hatte.<br />
Doch sie lachte nur, denn sie selbst hielt es mit ihren Sportsachen genauso (und<br />
kaufte diese meistens in einem Billigladen in Jersey, wenn sie ihre Eltern besuchte).<br />
Allerdings widerstand sie dem Impuls, Arthur sogleich davon zu erzählen; sie<br />
wollte schließlich nicht übereifrig wirken. Und so spielten sie das beliebte Kennenlernspiel<br />
der Großstadtsingles: Was wir zwei gemeinsam haben. Sie vergaben<br />
Noten an Restaurants, verglichen Episoden einer bekannten Sitcom und klagten<br />
über ihre Psychotherapeuten.<br />
Es folgte eine Verabredung, dann noch eine. Art war witzig und aufmerksam.<br />
Ein wenig formell und bisweilen schüchtern und zurückhaltend, aber das führte<br />
Alice auf die – wie er es nannte – »höllische Trennung« von seiner langjährigen<br />
20
Freundin aus der Modebranche zurück. Und auf seine enorme Arbeitsbelastung<br />
– ty pisch für einen Geschäftsmann in Manhattan. Er hatte nur wenig Freizeit.<br />
Würde etwas aus ihnen beiden werden?<br />
Noch war nichts Ernstes zwischen ihnen gelaufen. Aber es gab weitaus unangenehmere<br />
Menschen, mit denen man seine Zeit verbringen konnte. Und als<br />
sie sich beim letzten Treffen geküsst hatten, hatte Alice dieses sanfte Kribbeln<br />
gespürt, das ihr mitteilte, dass die Chemie stimmte. Der heutige Abend würde<br />
ihr eventuell genaueren Aufschluss darüber geben. Ihr war nicht entgangen, dass<br />
Arthur immer wieder – insgeheim, wie er glaubte – das enge rosafarbene Kleid<br />
musterte, das sie sich extra für diese Verabredung gekauft hatte. Für den Fall, dass<br />
es nicht beim Küssen bleiben würde, hatte Alice im Schlafzimmer zudem einige<br />
Vorkehrungen getroffen.<br />
Dann meldete sich plötzlich wieder diese leichte Verunsicherung, die Sorge<br />
wegen der Spinne.<br />
Was war denn nur los?<br />
Alice nahm an, es müsse sich wohl um einen Rest des Unbe ha gens handeln,<br />
das sie empfunden hatte, als ihr früher an jenem Tag ein Paket zugestellt worden<br />
war, von einem Mann mit kahl geschorenem Kopf und buschigen Augenbrauen,<br />
der nach Zigaretten roch und mit starkem osteuropäischen Akzent sprach. Während<br />
sie den Empfang quittierte, hatte der Kerl sie von oben bis unten anzüglich<br />
begafft und dann um ein Glas Wasser gebeten. Widerwillig hatte sie ihm aus der<br />
Küche etwas zu trinken geholt und ihn bei ihrer Rückkehr mitten im Wohnzimmer<br />
vorgefunden, wo er ihre Stereoanlage anstarrte.<br />
Sie hatte gesagt, sie erwarte Besuch, und er war mit finsterer Miene gegangen,<br />
als sei er beleidigt. Daraufhin hatte Alice aus dem Fenster gesehen und fast zehn<br />
Minuten warten müssen, bis der Mann unten zum Vorschein kam, in den in<br />
zweiter Reihe geparkten Lieferwagen stieg und wegfuhr.<br />
Was hatte er die ganze Zeit in dem Apartmentgebäude gemacht? Die Sicherheitsvorkehrungen<br />
ausgekundschaftet …?<br />
21
22<br />
»Hallo, Erde an Alice …«<br />
»Entschuldige.« Sie lachte, ging zum Sofa und setzte sich neben Arthur. Ihre<br />
Knie berührten einander. Die Gedanken an den Paket-boten verschwanden. Alice<br />
und Arthur nahmen ihre Gläser und stießen an, diese zwei Menschen, die auf<br />
vielen wichtigen Gebieten harmonierten – Politik (sie spendeten nahezu den gleichen<br />
Be trag an die Demokratische Partei und zusätzlich etwas für die Wahlkampagnen),<br />
Filme, Essen, Reisen. Sie waren beide nicht praktizierende Protestanten.<br />
Als ihre Knie einander erneut berührten, rieb Arthur sein Bein verführerisch an<br />
ihrem. Dann lächelte er und fragte: »Übrigens, was ist mit diesem Gemälde, dem<br />
Prescott? Hast du es bekommen?«<br />
Sie nickte mit leuchtenden Augen. »Jawohl, ich bin jetzt stolze Besitzerin eines<br />
Harvey Prescott.«<br />
Nach New Yorker Begriffen war Alice Sanderson keine reiche Frau, aber sie<br />
hatte ihr Geld gut investiert und frönte einer großen Leidenschaft. Prescott, ein<br />
Maler aus Oregon, dessen Karriere sie lange verfolgt hatte, war auf fotorealistische<br />
Familienbilder spezialisiert gewesen – nicht von echten Leuten, sondern von<br />
ausgedachten Personen. Manche der Werke fielen eher traditionell aus, andere<br />
weniger – sie zeigten Alleinerziehende, Eltern von unterschiedlicher Hautfarbe<br />
oder homosexuelle Paare. Was sich von Prescott überhaupt noch auf dem Markt<br />
befand, war für Alice meistens viel zu teuer, aber sie stand auf den Mailinglisten<br />
der Galerien, die gelegentlich neue Angebote hereinbekamen. Letzten Monat<br />
hatte sie aus dem Westen der USA die Nachricht erreicht, demnächst könne<br />
für einen Preis von hundertfünfzigtausend Dollar ein kleines frühes Ölgemälde<br />
erhältlich sein. Der Eigentümer entschied sich tatsächlich für den Verkauf, und<br />
Alice machte einen Teil ihrer Anlagen zu Geld, um die Summe aufzubringen.<br />
Das war die Lieferung, die sie heute erhalten hatte. Doch der Gedanke an den<br />
Zusteller ließ die Freude über den Neuerwerb schlagartig wieder verblassen. Sie<br />
erinnerte sich an den Geruch des Mannes, an seine lüsternen Blicke. Alice stand<br />
auf und ging zum Fenster, als wolle sie die Vorhänge ein Stück weiter aufziehen.<br />
Dabei sah sie nach draußen. Keine Lieferwagen, keine Glatzköpfe, die an der
Straßenecke standen und zu ihrer Wohnung he raufstarrten. Sie überlegte, ob sie<br />
das Fenster schließen und verriegeln sollte, aber das würde gewiss etwas eigenartig<br />
wirken und eine Erklärung erfordern.<br />
Sie kehrte zu Arthur zurück, wies auf die Zimmerwände und erzählte ihm, sie<br />
sei sich nicht sicher, wo in ihrem kleinen Apartment sie das Gemälde aufhängen<br />
solle. Vor ihrem inneren Auge lief ein kurzer Film ab: Arthur blieb eines Samstags<br />
über Nacht und half ihr am Sonntag nach dem Brunch dabei, den perfekten<br />
Platz für das Bild zu finden.<br />
»Möchtest du es mal sehen?«, fragte sie fröhlich und voller Stolz.<br />
»Unbedingt.«<br />
Sie standen auf, und Alice ging voran zum Schlafzimmer. Ihr war so, als würde<br />
sie draußen auf dem Hausflur Schritte hören. Die anderen Mieter hätten um<br />
diese Tageszeit eigentlich bei der Ar beit sein müssen.<br />
War das etwa der Paketbote?<br />
Nun ja, wenigstens war sie nicht allein.<br />
Sie erreichten die Schlafzimmertür.<br />
In diesem Moment biss die Giftspinne zu.<br />
Alice war urplötzlich klar, was sie die ganze Zeit gestört hatte, und es hatte<br />
nichts mit dem Paketzusteller zu tun gehabt. Nein, es ging um Arthur. Er hatte<br />
sie gestern gefragt, wann der Prescott eintreffen würde.<br />
Zuvor hatte sie ihm zwar erzählt, dass sie sich ein Gemälde kaufen wolle, aber<br />
den Namen des Künstlers hatte sie nie erwähnt. Sie hielt an der Schlafzimmertür<br />
inne. Ihre Hände wurden feucht. Falls er von selbst etwas über das Bild herausgefunden<br />
hatte, dann vielleicht auch über andere Aspekte ihres Lebens. Was war,<br />
falls die vielen Gemeinsamkeiten gelogen wären? Falls er schon vorher gewusst<br />
hätte, dass sie diesen spanischen Wein mochte? Falls er nur deswegen bei der<br />
Weinprobe aufgetaucht wäre, weil er sich an sie heranmachen wollte? All die<br />
Restaurants, die sie beide kannten, die Reisen, die Fernsehserien …<br />
23
Mein Gott, und jetzt führte sie einen Mann, den sie erst seit ein paar Wochen<br />
kannte, in ihr Schlafzimmer. Völlig schutzlos …<br />
24<br />
Das Atmen fiel ihr schwer … Sie zitterte.<br />
»Oh, das Bild«, flüsterte er und schaute an ihr vorbei. »Wie wunderbar.«<br />
Als sie seine ruhige, wohltönende Stimme hörte, lachte Alice innerlich auf. Bist<br />
du von allen guten Geistern verlassen? Sie musste Arthur irgendwann Prescotts<br />
Namen genannt haben. Ihre Verunsicherung schob sie beiseite. Beruhige dich.<br />
Du lebst schon zu lange allein. Denk an sein Lächeln, seine Witze. Er tickt so wie<br />
du.<br />
Bleib locker.<br />
Ein leises Lachen. Alice musterte das sechzig mal sechzig Zentimeter große<br />
Ölgemälde, die gedämpften Farben: ein halbes Dutzend Leute an einem Esstisch,<br />
die den Betrachter ansahen, einige belustigt, andere nachdenklich oder besorgt.<br />
»Unglaublich«, sagte er.<br />
»Der Bildaufbau ist großartig. Aber am besten hat Prescott die verschiedenen<br />
Gesichtsausdrücke eingefangen. Meinst du nicht auch?« Alice wandte sich zu ihm<br />
um.<br />
Ihr Lächeln erstarb. »Was ist denn, Arthur? Was machst du da?« Er hatte sich<br />
beigefarbene Stoffhandschuhe übergestreift und griff soeben in die Tasche. Und<br />
dann sah Alice ihm in die Augen, die sich in dunkle kleine Punkte unter finsteren<br />
Brauen verwandelt hatten, in einem Gesicht, das sie kaum wiedererkannte.
Fred Vargas<br />
Der Verbotene Ort<br />
Roman<br />
ISBN 3-351-03256-0<br />
© Aufbau Verlag<br />
Fred Vargas, geb. 1957, ist die bedeutendste franzö-<br />
sische Kriminalautorin und eine Schriftstellerin von<br />
Weltrang; sie wird heute in über 40 Sprachen übersetzt.<br />
Alle ihre Romane liegen bei Aufbau in Übersetzung<br />
vor. Deutscher Krimipreis 2004 für »Fliehe weit und<br />
schnell«.<br />
„FRED VARGAS ist die beste Kriminalschriftstellerin<br />
in Frankreich“, urteilt Die Zeit. „Es gibt eine Magie<br />
Vargas“, schreibt Le Monde. Und sie heißt: litera-<br />
rische Phantasie, poetische Intelligenz, Humor und<br />
sprühende Dialoge. Heute werden ihre Romane in 30<br />
Sprachen übersetzt.<br />
25
Kommissar Adamsberg verstand es, Hemden zu bügeln, seine Mutter hatte ihm<br />
beigebracht, wie man die Schulterpasse ausstrich und den Stoff um die Knöpfe<br />
herum glättete. Er zog den Stecker des Bügeleisens, legte die Kleidungsstücke in<br />
den Koffer. Er hatte sich rasiert, gekämmt, er würde nach London reisen, daran<br />
führte kein Weg mehr vorbei. Er nahm seinen Stuhl und schob ihn in das<br />
sonnenbeschienene Viereck der Küche. Der Raum öffnete sich nach drei Seiten,<br />
und so verbrachte er seine Zeit damit, seinen Stuhl je nach dem einfallenden<br />
Licht um den runden Tisch herum zu bewegen, gleich der Eidechse, die um den<br />
Fels wandert. Adamsberg stellte seine Schale mit Kaffee Richtung Osten und setzte<br />
sich mit dem Rücken zur Wärme. Er wäre ja einverstanden, nach London zu<br />
fahren, um sich die Stadt anzusehen, zu riechen, ob die �emse den gleichen<br />
modrigen Geruch nasser Wäsche hatte wie die Seine, zu hören, wie die Möwen<br />
schrien. Schon möglich, dass die Möwen auf Englisch anders schrien als auf<br />
Französisch. Aber man würde ihm nicht die Zeit dazu lassen. Drei Tage<br />
Kolloquium, zehn Vorträge pro Sitzung, sechs Debatten, ein Empfang im<br />
Innenministerium. Über hundert hochrangige Polizisten würden sich in der<br />
großen hall drängen, nichts als Polizisten aus dreiundzwanzig Ländern, die<br />
zusammenkamen, um das große Europa der Polizei zu optimieren, genauer noch,<br />
um»die Regelung der Migrationsströme zu harmonisieren«. So lautete das �ema<br />
des Kolloquiums. Als Leiter der Pariser Brigade criminelle musste Adamsberg<br />
sich dort blicken lassen, aber das kümmerte ihn wenig. Seine Teilnahme würde<br />
flüchtig sein, nahezu ätherisch, einerseits aufgrund seiner Abneigung gegen das<br />
Regelnvon Strömen, andererseits, weil er nie auch nur ein einziges Wort Englisch<br />
im Gedächtnis behalten hatte. Er trank ruhig seinen Kaffee aus, während er die<br />
Nachricht überflog, die ihm Commandant Danglard gerade schickte. »Treffen<br />
uns in 1 Std 20 Min in der Abfertigungshalle. Verfluchter Tunnel. Habe<br />
passendes Jackett für Sie eingesteckt, mit Kraw. «Adamsberg strich mit dem<br />
Daumen über das Display seines Handys und löschte die Angst seines Stellvertreters,<br />
so wie man den Staub von einem Möbelstück wischt. Danglard war wenig<br />
geschaffen fürs Laufen, fürs Rennen, schon gar nicht fürs Reisen. Den Ärmelkanal<br />
im Tunnel zu durchqueren schreckte ihn ebenso wie ihn zu überfliegen.<br />
Dennoch hätte er niemandem seinen Platz abgetreten. Seit dreißig Jahren schwor<br />
26
der Commandant auf die Eleganz der englischen Kleidermode, er setzte darauf,<br />
um seinen natürlichen Mangel an Erscheinung zu kompensieren. Von dieser<br />
lebenswichtigen Option inspiriert, hatte er seine Dankbarkeit auf das übrige<br />
Vereinigte Königreich ausgedehnt und war zum Typus des anglophilen Franzosen<br />
schlechthin geworden, der die Liebenswürdigkeit der Manieren, das Taktgefühl<br />
der Engländer und ihren diskreten Humor bewunderte. Außer in Augenblicken,<br />
in denen er jede Zurückhaltung fahrenließ, worin der anglophile Franzose sich<br />
vom wahren Engländer unterscheidet. So freute ihn die Aussicht auf einen<br />
Aufenthalt in London, mit Migrationsströmen oder ohne. Blieb nur noch das<br />
Hindernis dieses verfluchten Tunnels zu überwinden, durch den er zum ersten<br />
Mal fuhr. Adamsberg spülte seine Kaffeeschale aus, nahm seinen Koffer, wobei er<br />
sich fragte, was für ein Jackett mit was für einer Kraw Commandant Danglard<br />
für ihn ausgesucht haben mochte. Da schlug sein Nachbar, der alte Lucio, mit<br />
seiner schweren Faust an die verglaste Eingangstür, dass sie erzitterte. Der<br />
Spanienkrieg hatte ihm seinen linken Arm genommen, als er neun Jahre alt war,<br />
und es schien, als sei der rechte dementsprechend stärker geworden, um in sich<br />
allein die Spannweite und Kraft von zwei Händen zu vereinen. Das Gesicht an<br />
die Scheiben gepresst, sah er mit gebieterischem Blick zu Adamsberg herein.<br />
»Komm mal rüber«, brummte er im Ton eines Befehls. »Sie kriegt sie nicht allein<br />
raus, ich brauch deine Hilfe.« Adamsberg stellte seinen Koffer nach draußen in<br />
den verwilderten kleinen Garten, den er sich mit dem alten Spanier teilte. »Ich<br />
muss für drei Tage nach London, Lucio. Ich helfe dir, wenn ich zurück bin.« »Zu<br />
spät«, polterte der Alte. »Komm rüber.« Und wenn Lucio polterte, mit seinen<br />
rollenden »r« in der Stimme, erzeugte er ein so dumpfes Geräusch, dass es<br />
Adamsberg schien, als käme der Ton direkt aus der Erde. Er nahm seinen Koffer<br />
in die Hand, in Gedanken schon an der Gare du Nord. »Was kriegst du nicht<br />
raus?«, sagte er abwesend und verschloss seine Tür. »Die Katze, die im Schuppen<br />
lebt. Du wusstest doch, dass sie Junge kriegt, oder?« »Ich wusste nicht, dass im<br />
Schuppen eine Katze lebt, und es ist mir auch vollkommen egal.« »Dann weißt<br />
du’s jetzt. Und es wird dir nicht egal sein, hombre. Sie hat bis jetzt erst drei<br />
rausgebracht. Eins ist tot, und zwei weitere stecken fest, ich kann ihre Köpfe<br />
spüren. Ich werde massieren und dabei sanft schieben, und du ziehst raus. Aber<br />
27
pass auf, fass nicht wie ein Schlächter zu, wenn du sie holst. So ein Kätzchen, das<br />
zerbricht dir unter den Fingern wie Keks.« Finster und mit dringlichem<br />
Ausdruck stand Lucio da und kratzte seinen fehlenden Arm, indem er die Finger<br />
im Leeren bewegte. Er hatte oft erklärt, dass er damals, als er seinen Arm verlor,<br />
dort einen Spinnenbiss hatte und gerade dabei war, ihn zu kratzen. Aus diesem<br />
Grund juckte der Biss ihn noch nach neunundsechzig Jahren, weil er mit dem<br />
Kratzen nicht fertig gewesen war, es nicht gründlich hatte machen, nicht hatte<br />
vollenden können. Das war die neurologische Erklärung, die seine Mutter ihm<br />
geliefert hatte, sie war für Lucio mit der Zeit zur Philosophie schlechthin<br />
geworden und ließ sich auf jede Situation und jedes Gefühl anwenden. Man<br />
muss bis ans Ende gehen, oder gar nicht erst anfangen. Den Kelch bis zur Neige<br />
leeren, auch in der Liebe. Wenn also eine lebenswichtige Handlung ihn intensiv<br />
beschäftigte, kratzte Lucio seinen unterbrochenen Spinnenbiss. »Lucio«, sagte<br />
Adamsberg etwas entschiedener, indem er den kleinen Garten durchquerte, »in<br />
eineinviertel Stunden geht mein Zug, mein Stellvertreter steht an der Gare du<br />
Nord und verzehrt sich vor Ungeduld, und ich werde jetzt nicht den Geburtshelfer<br />
bei deinem Katzenvieh spielen, während in London hundert Spitzenpolizisten<br />
auf mich warten. Sieh zu, wie du klarkommst, am Sonntag erzählst du mir dann<br />
alles.« »Und wie willst du, dass ich hiermit klarkomme?«, schrie der Alte und hob<br />
seinen Armstumpf. Lucio hielt Adamsberg mit seiner mächtigen Hand auf und<br />
reckte sein vorgeworfenes Kinn, das nach Meinung von Commandant Danglard<br />
eines Velázquez’ würdig gewesen wäre. Der Alte sah nicht mehr scharf genug, um<br />
sich korrekt zu rasieren, und manche Stoppeln entkamen seiner Klinge. Weiß<br />
und hart stachen sie hier und da aus seinem Gesicht und bildeten so etwas wie<br />
eine Dekoration aus silbrigen Dornen, die in der Sonne glänzten. Manchmal<br />
kriegte Lucio eine von ihnen zu fassen, klemmte sie resolut zwischen zwei<br />
Fingernägel und zog daran, als wenn er eine Zecke ausreißen würde. Und er gab<br />
nicht auf, bevor er sie nicht hatte, gemäß der Spinnenbiss-Philosophie. »Du<br />
kommst mit mir.« »Lass mich in Ruhe, Lucio.« »Du hast gar keine Wahl,<br />
hombre«, sagte Lucio düster. »Das kreuzt deinen Weg, du musst es wahrnehmen.<br />
Oder es wird dich dein Leben lang jucken. Es kostet dich ganze zehn Minuten.«<br />
»Auch mein Zug kreuzt meinen Weg.« »Der kreuzt hinterher.« Adamsberg ließ<br />
28
seinen Koffer los und verfluchte seine Ohnmacht, während er Lucio zum<br />
Schuppen folgte. Ein klebriges, blutbeschmiertes Köpfchen zeigte sich zwischen<br />
den Hinterpfoten des Tieres. Unter den Anweisungen des alten Spaniers nahm er<br />
es behutsam in seine Hand, während Lucio mit professionellem Griff auf den<br />
Bauch drückte. Die Katze miaute fürchterlich. »Zieh noch ein bisschen stärker,<br />
hombre, fass es unter den Pfoten und zieh! Entschlossen, aber sanft, und drück<br />
nicht den Schädel zusammen. Mit deiner anderen Hand kraul der Mutter die<br />
Stirn, sie ist in Panik.« »Lucio, wenn ich jemandem die Stirn kraule, schläft er<br />
ein.« »Joder! Zieh, verdammt!« Sechs Minuten später legte Adamsberg zwei kleine<br />
rote, piepsende Ratten neben zwei andere auf eine alte Decke. Lucio schnitt<br />
ihnen die Nabelschnur durch und legte sie nacheinander an die Zitzen. Er warf<br />
einen besorgten Blick auf das klagende Muttertier. »Wie war das mit deinen<br />
Händen? Womit bringst du die Leute in Schlaf?« Adamsberg schüttelte bedauernd<br />
den Kopf. »Ich weiß es nicht. Wenn ich ihnen die Hand auf den Kopf lege,<br />
schlafen sie ein. Das ist alles.« »So machst du es mit deinem Kind?« »Ja. Es<br />
kommt auch vor, dass die Leute einschlafen, während ich mit ihnen rede. Ich<br />
habe schon Verdächtige während eines Verhörs eingeschläfert.« »Dann mach das<br />
mit der Mutter. Apúrate! Mach, dass sie einschläft.« »Großer Gott, Lucio, kriegst<br />
du das nicht in deinen Schädel rein, dass ich zum Zug muss?« »Wir müssen die<br />
Mutter beruhigen.« Adamsberg war die Katze egal, nicht aber der schwarze Blick,<br />
den der Alte ihm zuwarf. So streichelte er den – unglaublich weichen – Kopf der<br />
Katze, denn in der Tat, er hatte keine Wahl. Das Hecheln des Tieres kam zur<br />
Ruhe, während Adamsbergs Finger wie Kugeln von seinem Mäulchen zu seinen<br />
Ohren rollten. Lucio wiegte anerkennend den Kopf. »Sie schläft, hombre.«<br />
Adamsberg löste langsam seine Hand, wischte sie im feuchten Gras ab und<br />
entfernte sich im Rückwärtsgang. Während er über den Bahnsteig der Gare du<br />
Nord lief, fühlte er, wie das Zeug zwischen seinen Fingern und unter den Nägeln<br />
hart wurde. Er hatte zwanzig Minuten Verspätung, Danglard kam mit eiligen<br />
Schritten auf ihn zu. Man hatte immer den Eindruck, dass Danglards Beine, die<br />
schlecht konstruiert waren, von den Knien abwärts in ihre Einzelteile zerfallen<br />
würden, wenn er zu rennen versuchte. Adamsberg hob die Hand, um seiner Eile<br />
wie auch seinen Vorwürfen Einhalt zu gebieten. »Ich weiß«, sagte er. »Etwas hat<br />
29
meinen Weg gekreuzt, und ich musste zufassen, sonst hätte ich mich mein Leben<br />
lang kratzen müssen.« Danglard war an Adamsbergs unverständliche Bemerkungen<br />
schon so gewöhnt, dass er sich selten die Mühe machte, Fragen zu stellen.<br />
Wie viele andere in der Brigade beachtete er sie kaum noch, wusste er doch<br />
zwischen Interessantem und Unwichtigem zu unterscheiden. Außer Atem wies er<br />
auf die Abfertigungshalle und machte kehrt. Während Adamsberg ihm in aller<br />
Gelassenheit folgte, versuchte er sich an die Farbe der Katze zu erinnern. Weiß<br />
mit grauen Flecken? Mit roten Flecken?<br />
30
Sandra Gulland<br />
Die Sonne des Königs<br />
Historischer Roman<br />
ISBN 3-8105-0878-0<br />
© Krüger Verlag<br />
Sandra Gulland wuchs im kalifornischen Berkeley<br />
auf, wo sie auch studierte. 1970 ging sie nach Kanada<br />
und arbeitete als Lehrerin und Lektorin. Heute lebt<br />
sie in Killaloe, Ontario und San Miguel de Allende<br />
in Mexiko. Sandra Gulland ist verheiratet und hat<br />
zwei erwachsene Töchter. Mit ihrer Romantrilogie um<br />
Joséphine hat sich Sandra Gulland bereits längst ihren<br />
Platz unter den großen Autoren historischer Romane<br />
gesichert. Die Sonne des Königs ist ihr neuer Roman.<br />
31
Eine Roma-Frau in einem flatternden karmesinroten Kleid rauscht vorbei. Sie<br />
steht kerzengerade auf dem Rücken eines galoppierenden Pferdes. Ihr Kopfschmuck<br />
aus Truthahnfedern zittert in der brennenden Sommersonne.<br />
»Die wilde Frau!«, verkündet der Schausteller und schwenkt seinen schwarzen<br />
Hut.<br />
Die Menge jubelt, als das schäumende Pferd seinen Schritt beschleunigt. Es<br />
schüttelt seinen großen Kopf, Schweiß- und Speicheltropfen fliegen umher,<br />
wehender Schweif, donnernde Hufe im Staub.<br />
Die wilde Frau streckt die Arme aus. Ihre zarten Röcke bauschen sich hinter<br />
ihr auf. Langsam erhebt sie die Arme zum wolkenlosen Himmel und stößt einen<br />
gellenden Kriegsschrei aus.<br />
Ein blasses Mädchen – kaum groß genug, um über die Absperrung hinwegzublicken<br />
– schaut wie gebannt zu. In ihrer Phantasie streckt sie selbst ihre dünnen<br />
Arme aus, die Füße fest auf dem breiten Rücken eines Pferdes.<br />
32<br />
Hingerissen presst sie die Hände an die Wangen. Oh, der Wind!<br />
Man schrieb das Jahr 1650, das achte Herrschaftsjahr des jungen Königs Louis<br />
XIV – eine Zeit von Hungersnot, Pest und Krieg. In den Weilern, Höhlen und<br />
Wäldern fern der Städte starben die Menschen. Landauf, landab regierte die<br />
Gewalt. Das Mädchen war gerade sechs Jahre alt geworden.<br />
Sie war klein für ihr Alter und wurde oft für eine Vierjährige gehalten – jedenfalls<br />
bis sie den Mund zum Reden öffnete. Ihr Ausdruck war von einer<br />
selbstverständlichen Reife, durch die sie ihrem Alter weit voraus schien. Sie trug<br />
eine eng anliegende, mit Bändern unter dem Kinn befestigte Kappe, und ihre<br />
flachsfarbenen Haare fielen ihr bis hinunter zur Taille. Ihr Kleid aus grauem Serge<br />
wurde von einer Kette verschönert, die sie selbst aus Igelzähnen gefertigt hatte.<br />
»Koboldkind«, so nannten die Leute sie manchmal, wegen ihrer kleinen Gestalt,<br />
ihrer zarten weißen Haut, den blonden Haaren und dem beunruhigenden Blick.<br />
Das Mädchen ließ die wilde Frau nicht aus den Augen, als diese von dem Pferd
hinuntersprang und sich mit einem Schwenk ihrer Federkrone verbeugte. Ohne<br />
die Jongleure, den Clown auf Stelzen, den Purzelbäume schlagenden Zwerg oder<br />
den Bauern mit der luftgefüllten Schweinsblase an einer Schnur auch nur eines<br />
Blickes zu würdigen, umrundete sie das Gelände und lief zu dem Wagenplatz<br />
jenseits des Hügels. Dort fand sie die wilde Frau, die gerade einen Ledereimer<br />
voller Wasser über ihr wirres Haar goss. Die Blechspangen ihres Kleides blitzten<br />
in der Sonne.<br />
»Potzblitz, ist das heiß!«, fluchte die Frau. Ihr Pferd, ein Schecke mit rosafarbenen<br />
Augenlidern, stand ein paar Schritte entfernt, angebunden an einen Ochsenkarren.<br />
»Was willst du, Engelchen?«, fragte die Akrobatin durch ihre tropfenden<br />
Strähnen hindurch.<br />
»Ich möchte reiten können wie Ihr«, antwortete das Mädchen. »Im Stehen.«<br />
»So, das möchtest du also«, sagte die Frau und rieb sich das Gesicht mit den<br />
Händen ab.<br />
»Ja. Ich bin eine Pferdenärrin«, erklärte das Mädchen nüchtern. »Sagt mein<br />
Vater.«<br />
Die Frau lachte. »Und wo ist dein Vater, wenn man fragen darf?«<br />
Das Pferd scharrte mit den Hufen und wirbelte Staubwolken auf. Die Frau<br />
ruckte an seinem ausgefransten Führstrick und sagte etwas in einer fremden Sprache.<br />
Das Pferd hob seinen hässlichen Kopf, wieherte und erhielt gleich darauf<br />
eine vielstimmige Antwort.<br />
Pferde.<br />
»Sie stehen hinten auf der Weide«, sagte die Frau und ermunterte das Kind,<br />
dorthin zu gehen.<br />
Das Mädchen schlängelte sich zwischen den Wagen und Zelten hindurch bis zu<br />
einer Weide, auf der vier Zugpferde, ein Esel und ein geschecktes Pony grasten.<br />
Eine angebundene ältere Stute mit einer Glocke um den Hals hob den Kopf, als<br />
das Kind sich näherte, fuhr dann aber fort, an den schimmeligen Kleiebrotlaiben<br />
zu fressen, die man den Tieren auf einen Haufen hingeworden hatte. Der Som-<br />
33
mer war trocken gewesen, und das Gras wurde knapp.<br />
Und da entdeckte das Mädchen das Pferd, das weiter hinten im Wald angebunden<br />
war – ein junger Hengst, so erriet sie anhand seines stolzen Gehabes. Eine<br />
Absperrung trennte ihn von den anderen Pferden, und eines seiner Vorderbeine<br />
war mit einem Lederriemen hochgebunden.<br />
Es war ein Schimmel, ein großes Tier. Worte aus der Bibel kamen ihr in den<br />
Sinn: Und ich sah den Himmel aufgehen, und siehe: ein weißes Pferd. Sein Hals<br />
war lang und am Kopfansatz schmal. Seine gespitzten Ohren waren klein und<br />
wohlgeformt, seine Nüstern weit gebläht. Seine Augen schauten ihr mitten ins<br />
Herz. Halleluja!<br />
Sie dachte an die Geschichten, die ihr Vater ihr erzählt hatte – Geschichten von<br />
Neptun, der seine Schimmel der Sonne geopfert hatte, Geschichten von Pegasus,<br />
dem geflügelten Pferd. Huldige ihm, der auf Wolken reitet. Sie dachte an den<br />
König, einen Jungen, kaum älter als sie selbst, der die Aufstände in Paris beendet<br />
hatte, indem er auf einem Schimmel in das Kampfgetümmel hineingeritten war.<br />
Und der ihn reitet, von dem heißt es: Treu und wahrhaftig, und er richtet und<br />
streitet mit Gerechtigkeit.<br />
34<br />
Sie kannte dieses Pferd: Es war das Pferd aus ihren Träumen.<br />
Sie bahnte sich einen Weg über die Lichtung. »Ho, mein Junge«, sagte sie und<br />
streckte die Hand aus.<br />
Der Hengst legte die Ohren an.<br />
Laurent de la Vallière lenkte seinen quietschenden Wagen auf das steinige Feld,<br />
ließ sich vom Kutschbock gleiten und reckte sich, eine Hand auf den unteren<br />
Rücken gelegt. Sein Armeehut war mit Federn geschmückt, aber fleckig, und er<br />
trug ein rissiges Lederwams mit geflickten Wollärmeln, die an der Schulterpartie<br />
verschnürt waren. Seine gesteppten Kniebundhosen und die ausgeleierte Pumphose<br />
darüber, seit über einem halben Jahrhundert aus der Mode, waren ebenfalls<br />
an vielen Stellen geflickt und gestopft. Mit seinen Stiefeln und Sporen und dem
umgegürteten Schwert glich er einem Offizier der Kavallerie, der schon bessere<br />
Zeiten gesehen hatte.<br />
Er band das Kutschpferd, eine Stute, an einer verkümmerten Eiche fest und<br />
ging auf die Gruppe von Leuten zu, die sich auf dem Feld versammelt hatte. Wo<br />
der Weg endete, saß eine korpulente Roma-Frau auf einem Baumstumpf – die<br />
Wächterin, wie er annahm. Nicht alle Zigeuner waren Vagabunden, aber die<br />
meisten durchaus zwielichtige Gestalten. Er tastete unter seinem Lederwams nach<br />
dem Rosenkranz, den er am Herzen trug, eine Schnur mit einfachen Holzperlen,<br />
die einst die heilige �eresia von Avila berührt hatte. O Gott, vertreibe<br />
alle unheilvollen Gedanken aus meinem Herzen und erquicke mich mit froher<br />
Hoffnung. Amen.<br />
»Monsieur de la Vallière«, stellte er sich vor und tippte an seinen Hut. Er war<br />
sehr angesehen in dieser Gegend, und man schätzte ihn wegen seiner Heilkunst<br />
und seiner Mildtätigkeit, aber die Roma waren ein fahrendes Volk, sie kannten<br />
ihn höchstwahrscheinlich nicht. »Ich suche ein kleines Mädchen«, erklärte er.<br />
Ein plötzlicher Windstoß trug ihm Uringeruch zu. »Ein Mädchen, sagt Ihr?«,<br />
fragte die Frau grinsend, ihr lückenhaftes Gebiss entblößend.<br />
»Ja, meine Tochter.« Mit einer Hand gab Laurent dabei die Größe an.<br />
»Blond, mit einer Zahnlücke im Oberkiefer?«<br />
»Also ist sie hier!« Gepriesen seist du, o Herr! Er hatte bereits den ganzen Nachmittag<br />
nach ihr gesucht. Nachdem sie im Haus nirgendwo zu finden gewesen<br />
war, hatte er in der Scheune, im Taubenschlag, in der Kornkammer, der Molkerei<br />
und sogar im Hühnerstall nachgesehen. Er hatte den Wald und die Felder dahinter<br />
durchkämmt und ängstlich das Flussufer abgeschritten, bis er schließlich die<br />
Stute angespannt hatte und in die Stadt gefahren war. Beim Stoffhändler in Reugny<br />
erfuhr er schließlich von den Roma mit ihren dressierten Ponys. Das Mädchen<br />
war verrückt nach Pferden.<br />
»Sie ist auf der Weide ganz hinten – bei Diablo«, fügte die Frau mit einem<br />
kehligen Lachen hinzu.<br />
35
Der Teufel? Laurent bekreuzigte sich und machte sich auf den Weg über den<br />
Hügel und zwischen den Planwagen hindurch bis zu dem dahinter liegenden<br />
Feld. Dort sah er seine Tochter. Sie kauerte im Staub.<br />
36<br />
»Petite!«, rief er. Sie war von kräftigen Pferden umringt.<br />
»Vater?« Sie stand auf. »Sieh mal!«, sagte sie, als sie sich ihm näherte, und zeigte<br />
auf einen Schimmel am Waldrand.<br />
»Wo bist du bloß gewesen?« Furcht übermannte ihn, jetzt, wo er sie in Sicherheit<br />
wusste. »Du hättest …« Überall machten Vagabunden die Gegend unsicher.<br />
Noch in der Woche zuvor waren zwei Pilger auf dem Weg nach Tours ermordet<br />
worden.<br />
Er beugte sich zu seiner Tochter hinunter und nahm ihre Hand. O Gott, ich<br />
danke dir von ganzem Herzen für die Gnade, die du mir geschenkt hast. Amen.<br />
Ihre blassen Wangen waren gerötet. »Kleines, du darfst nicht einfach so weglaufen.«<br />
Sie war ein impulsives, gefühlvolles Kind, aufrichtig und unabhängig,<br />
jungenhaft in ihrem Wesen. Eigenschaften, die seine Frau ganz und gar nicht<br />
schätzte. Sie ließ bei dem Mädchen Strenge walten und zwang sie, stundenlang<br />
am Spinnrad zu sitzen. Doch was konnte er schon dagegen tun? Die Erziehung<br />
einer Tochter war Aufgabe der Frau.<br />
»Ich werde im Stehen auf einem galoppierenden Pferd reiten«, lispelte Petite<br />
durch ihre Zahnlücke. Sie streckte die Arme aus und ihre weit auseinander stehenden<br />
blauen Augen leuchteten.<br />
Laurent fragte sich, ob der Heilige Geist aus ihr sprach oder gar der Teufel?<br />
Man konnte die beiden leicht verwechseln.<br />
»Wie die wilde Frau«, erklärte sie.<br />
Die blühende Phantasie des Mädchens bereitete ihnen Sorge. Im Frühjahr hatte<br />
sie hinten in der Scheune aus Steinen einen einfachen Pferch gebaut, den sie als<br />
ihr »Kloster« bezeichnete. Darin hatte sie verletzte Tiere gesund gepflegt, zuletzt<br />
einen Feuersalamander und einen Hühnerhabicht.<br />
»Die haben versprochen, es mir beizubringen.«
»Komm, lass uns gehen«, sagte Laurent und nahm seine Tochter an der Hand.<br />
»Ich habe Brötchen im Wagen.« Vorausgesetzt, die Roma hatten sie nicht gestohlen.<br />
»Aber was ist mit Diablo?«, fragte Petite und blickte sich nach dem Hengst um.<br />
»Er gehört diesen Leuten hier.«<br />
»Sie haben gesagt, sie würden ihn billig verkaufen.«<br />
»Nächste Woche fahren wir zum Pferdemarkt nach Tours«, versprach er. »Dort<br />
kaufen wir dir ein Pony, wie du es dir immer gewünscht hast.« Tatsächlich ritt das<br />
Mädchen auf allem, was vier Beine hatte. Im Jahr zuvor hatte sie einem Kalb das<br />
Springen beigebracht.<br />
»Du hast gesagt, die Pferde, die auf dem Markt verkauft würden, wären kreuzlahm.<br />
Du hast gesagt, das wären alles klapprige Mähren.«<br />
»Stimmt, es ist kein gutes Jahr für Pferde.« Durch den endlosen Krieg mit<br />
Spanien und die ewigen Aufstände waren akzeptable Reittiere schwer zu finden.<br />
Praktisch jeder Vierbeiner war von irgendeiner Armee konfisziert worden. Außerdem<br />
wurde die natürliche Aversion der Leute gegen den Verzehr von Pferdefleisch<br />
in Zeiten einer Hungersnot außer Kraft gesetzt. »Aber Hoffnung gibt es immer.<br />
Lass uns beten, und der liebe Gott wird uns helfen, ein Pferd für dich zu finden.«<br />
»Ich habe für dieses Pferd gebetet«, erklärte Petite. Der Hengst stand immer<br />
noch reglos wie eine Statue da und ließ sie nicht aus den Augen. »Ich habe für<br />
diesen Schimmel gebetet.«<br />
Laurent blieb stehen und dachte nach. Er konnte einen Hengst gebrauchen,<br />
und seine Tochter hatte einen untrüglichen Blick für Pferde. Die Beine des<br />
Hengstes waren gerade, seine Schultern lang. Sein Kopf war schmal wie der eines<br />
Widders: einfach perfekt. Obwohl das Tier mager war, besaß es eine breite Brust.<br />
Pferde mit dieser seltenen, milchweißen Färbung, seien, so hieß es, wie Wasser:<br />
temperamentvoll und dennoch sanft. Einmal gestriegelt und gebürstet, wäre er<br />
ein prachtvolles Tier, zweifellos.<br />
»Wie viel wollen sie für ihn haben, hast du gesagt?«<br />
37
Jan Winter<br />
Erzähl mir von den<br />
weissen Blüten<br />
Roman<br />
ISBN 3-547-71150-9<br />
© Verlag Marion von Schröder<br />
38<br />
Jan Winter, 1961 in Hamburg geboren, entdeckte früh<br />
das Unterwegssein als seine Berufung. Nach ausführ-<br />
licher Erkundung Europas und Nordafrikas bereiste er<br />
fünf Jahre lang verschiedene Länder in Asien. Seinen<br />
Roman schrieb er auf Bali und Malaysia, wo er sich<br />
fast zwei Jahre lang das Haus mit einer chinesischen<br />
Familie teilte. Wenn er nicht gerade reist, lebt Jan<br />
Winter mit seiner Frau in Hamburg.
Die Wärme und Weichheit der tropischen Nächte hatten auch nach Jahren<br />
ihren Reiz nicht verloren. Schon wenige Schritte vom Haus entfernt ließ der<br />
Lärm der Party nach und wich dem Zirpen der Insekten, den Rufen streitender<br />
Eidechsen und anderer Kleintiere, die in der Dunkelheit des Gartens unterwegs<br />
waren.<br />
Unter einem knorrigen Frangipanibaum saß Chee Wahs Frau mit einem Mann<br />
an einem Tisch, auf dem drei Kerzen standen; um sie herum lag alles in tiefer<br />
Dunkelheit. Der Anblick erinnerte Julie an zwei glückliche Menschen auf einer<br />
winzigen Insel mitten im Ozean. Als die alte Frau ihnen zuwinkte, drehte auch<br />
der Mann seinen Kopf in ihre Richtung und erhob sich zur Begrüßung. Der<br />
große, sehr schlanke Europäer trug einen Leinenanzug und hielt eine weiße Blüte<br />
in der linken Hand.<br />
»Das ist Paul, ein alter Freund unserer Familie. Harry und Julie«, stellte Chee<br />
Wahs Frau sie einander vor.<br />
Julie ergriff die Hand des Mannes.<br />
»Schön, Sie kennenzulernen«, sagte sie.<br />
»Die Freude ist auf meiner Seite.«<br />
Er sah sie an, und mehrere Sekunden vergingen, ohne dass sie sich rühren oder<br />
etwas sagen konnte. Obwohl die beinahe unverschämte Intensität seines Blicks<br />
Julie einschüchterte, fiel es ihr schwer, sich von seinen strahlend blauen Augen<br />
loszureißen und ihre Aufmerksamkeit dem Rest seines Gesichts zuzuwenden.<br />
Paul war älter als sie, bestimmt über vierzig. Um seine ungewöhnlichen Augen<br />
herum hatten sich zahllose kleine Fältchen eingenistet, und von der Nase liefen<br />
zwei scharfe Furchen schräg an den Mundwinkeln vorbei. Mitten in der Betrachtung<br />
seines Mundes bemerkte Julie erschrocken, dass sie immer noch seine Hand<br />
hielt, und ließ sie hastig los.<br />
»Habt ihr schon gegessen, Kinder?«, fragte Chee Wahs Frau in die Stille.<br />
»Meine Eltern erwarten uns zum Abendessen«, sagte Harry.<br />
»Wenn das so ist, könntest du ein paar Bücher mitnehmen? Deine Mutter hatte<br />
39
sie mir geliehen.«<br />
40<br />
»Selbstverständlich, kein Problem.«<br />
»Dann lass uns ins Haus gehen, damit ich sie dir geben kann. Leistest du Paul<br />
solange Gesellschaft, Julie?«<br />
»Sehr gern.«<br />
»Setzen Sie sich doch«, sagte Paul, als die beiden gegangen waren, und wies auf<br />
den frei gewordenen Stuhl. Julie strich ihren Qipao glatt und folgte seiner Aufforderung.<br />
Seine Stimme war tief und beruhigend.<br />
»Mögen Sie Frangipani?«, fragte sie mit einem Blick auf die Blüte in seiner<br />
Hand.<br />
»Es ist meine Lieblingsblüte.«<br />
»Was ist so besonders daran?«<br />
»Das Weiß der Frangipani ist rein und kühl. Alles Hässliche gleitet daran ab«,<br />
sagte er bedächtig, jedes Wort genau abwägend. »Außerdem liebe ich den verführerischen<br />
Duft: intensiv, zugleich durchdringend und zart.«<br />
»Haben Sie schon einmal Schneelotus gesehen?«<br />
»Ich glaube nicht. Wie sieht er aus?«<br />
»Ein Kranz aus weißen Blättern um ein tiefrotes Herz.«<br />
Er betrachtete ihr Gesicht, und Julie erinnerte sich an ihren Anblick im Spiegel:<br />
ihre weiße Haut und der auffallend rot geschminkte Mund. Sie war Paul dankbar,<br />
als er das �ema wechselte.<br />
»Wie nennt man diese Art von Kleid? Ich wusste es, habe es aber vergessen.«<br />
»Auf Chinesisch heißt es Qipao oder Cheongsam.«<br />
»Richtig. Es steht Ihnen ganz ausgezeichnet, auch die Farbe. Ein Blau für die<br />
Nacht.«<br />
Obwohl der Mann Julie verunsicherte, gefiel ihr die Art, wie er sie ansah. Auf<br />
einmal kam es ihr so vor, als hätte sie diesen Fremden schon einmal gesehen.
»Leben Sie in Penang?«, wollte sie wissen.<br />
»Nein. Ich komme gelegentlich hierher, weil Penang eine meiner Lieblingsstädte<br />
ist und ich einige Bekannte hier habe. Natürlich auch wegen des guten Essens«,<br />
fügte er hinzu.<br />
»Und wo leben Sie?«<br />
Ȇberall und nirgends. Ich habe ein kleines Haus in Indonesien, aber die meiste<br />
Zeit bin ich beruflich unterwegs. Es macht mir nichts aus, weil ich gern reise und<br />
zu den Menschen gehöre, die sich in Hotels wohl fühlen. Hier in Penang wohne<br />
ich immer im Cathay. Kennen Sie es?«<br />
»Der alte weiße Bau in der Lebuh Leith?«<br />
»Genau. Ich mag die Atmosphäre und den abgewohnten Charme.«<br />
Wieder entstand eine Pause im Gespräch. Julie legte den Kopf zurück und<br />
lauschte dem Quaken der Frösche. Sie war sich bewusst, dass Paul sie beobachtete,<br />
aber es war ihr nicht unangenehm. Als sie wieder zu ihm sah, trafen sich<br />
ihre Augen. Sie hielt seinem Blick stand, bis es ihr zu viel wurde und sie sich mit<br />
einem leichten Schwindelgefühl abwandte.<br />
»Wie lange bleiben Sie in Penang?«, fragte sie.<br />
»Noch drei oder vier Tage, denke ich.«<br />
»Sind Sie allein hier?«<br />
Sobald sie die Zweideutigkeit ihrer Frage erkannte, schoss Julie das Blut in die<br />
Wangen. Sie war ihr einfach so herausgerutscht. Paul blinzelte.<br />
»Ja, ich bin allein.«<br />
Er strich mit der Hand über seine kurzgeschnittenen, zum großen Teil bereits<br />
ergrauten Haare und kratzte sich am Ohr, was Julie als ersten Anflug von<br />
Nervosität wertete. Bisher hatte er einen ausgesprochen selbstsicheren Eindruck<br />
gemacht.<br />
»Darf ich Sie etwas fragen?«<br />
41
42<br />
»Ja.«<br />
»Ist Julie Ihr richtiger Name?«<br />
»Alle nennen mich so, also ist es wohl mein richtiger Name.«<br />
Sie griff in ihre Handtasche und zog ein Paket Filterzigaretten heraus. Paul riss<br />
ein Streichholz an, um ihr Feuer zu geben. Er schützte die Flamme mit beiden<br />
Händen und berührte dabei ihre Finger. Als der Tabak aufglühte, blies er das<br />
Streichholz aus und warf es in den Aschenbecher.<br />
»Ihre Hände …«, begann er, brach dann aber ab.<br />
»Was ist mit meinen Händen?«<br />
»Ach, nichts. Ich bin ein bisschen durcheinander.«<br />
Er zündete sich ebenfalls eine Zigarette an. Die Kretek, eine indonesische Nelkenzigarette,<br />
verströmte ein schweres, süßliches Aroma. Julie hatte den Eindruck,<br />
dass Paul einiges von seiner Gelassenheit verloren hatte, und das schmeichelte ihr.<br />
Sie hörte Stimmen hinter sich: Madame Tan kehrte mit Harry aus dem Haus<br />
zurück. Er hielt zwei Bücher in der Hand und war sichtlich schlecht gelaunt.<br />
»Können wir endlich los? Wir werden erwartet«, sagte er.<br />
»Ich würde gern noch zu Ende rauchen«, entgegnete sie kühl.<br />
Chee Wahs Frau blickte zu Paul, und ihre Mundwinkel zuckten amüsiert, als sie<br />
bemerkte, dass er seine Augen nicht von Julie lassen konnte.<br />
»Ich gehe wieder ins Haus, man vermisst mich sicher schon. Paul, wir sehen uns<br />
später.«<br />
Er nickte ihr zu und wandte sich dann an Harry.<br />
»Setzen Sie sich doch, da steht noch ein Stuhl.«<br />
»Danke, ich stehe lieber.«<br />
»Na gut, gehen wir also«, sagte Julie und warf die halbgerauchte Zigarette<br />
verärgert auf den Rasen. Harry wartete. Als sie trotz ihrer Ankündigung keine<br />
Anstalten machte, sich zu erheben, verschwand er wortlos in der Dunkelheit.
»Es tut mir leid, Paul.«<br />
»Mir auch.«<br />
Wieder sah er sie aufmerksam an, als wollte er sich jede Einzelheit ihres Gesichts<br />
einprägen. Julie erwiderte seinen Blick, bis sie sich schließlich einen Ruck<br />
gab und aufstand.<br />
»Es war schön, Sie kennenzulernen.«<br />
»Passen Sie gut auf sich auf.«<br />
Julie ging in Richtung des Hauses davon. Sie war erst wenige Schritte weit<br />
gekommen, als er ihren Namen rief. Gespannt drehte sie sich um. Würde er sie<br />
um ein Wiedersehen bitten?<br />
»Was ich vorhin sagen wollte …«, begann er zögerlich. »Ich habe in meinem<br />
ganzen Leben keine so schönen Hände gesehen wie Ihre.«<br />
Wie er so allein im Licht der Kerzen stand, glich er einem Jungen, den man bei<br />
einem Streich ertappt hatte. Sein Kompliment war ehrlich gemeint, ohne jede<br />
Berechnung. Julie lächelte.<br />
»Wirklich?«<br />
»Ja. Sie sind wie weiße Blüten. Wie Frangipani.«<br />
»Danke.«<br />
Als sie weiterging, stieß sie fast mit Harry zusammen. Er hatte im Dunkeln auf<br />
sie gewartet und jedes Wort gehört.<br />
Er schwieg, bis sie sein Auto erreichten, dann platzte sein Ärger<br />
aus ihm heraus.<br />
»Was sollte das?«<br />
»Wovon sprichst du?«<br />
»Stell dich nicht dumm. Die schönsten Hände der Welt. Wie weiße Blüten«,<br />
äffte er Paul nach. »Was für ein Schwachsinn.«<br />
43
Unwillkürlich betrachtete sie ihre Hände: schlank und glatt, mit langen Fingern<br />
und schmalen Knöcheln. Die Nägel waren kurz geschnitten und gepflegt. Sie<br />
hatte nie darüber nachgedacht, aber es waren tatsächlich schöne Hände. Als Julie<br />
aufsah, stellte sie fest, dass Harry sie ungeduldig musterte.<br />
44<br />
»Was willst du hören?«<br />
»Warum du dich so aufführst. Hast du nicht gemerkt, wie er dich angeglotzt<br />
hat? Wie ein halbverhungerter Tiger, der seine Beute vor Augen hat.«<br />
»Eben nicht. Genau so hat er mich nicht angesehen.«<br />
»Ich bin doch nicht blind!«<br />
»Denkst du, ich wüsste nicht, wie es ist, wenn man angegafft wird? Wenn mir<br />
Männer auf die Brüste starren und ich in ihren Augen lesen kann, welche schmierigen<br />
Gedanken ihnen durch den Kopf gehen? Wenn irgendwelche Jugendlichen<br />
im Vorbeigehen meinen Hintern kommentieren? Ich kann es nicht ausstehen,<br />
doch das eben war anders, voller Respekt.«<br />
Sie brach ab, weil sie begriff, dass der Eifer, mit dem sie Paul verteidigte, die<br />
Situation nicht entspannen würde.<br />
»Respektiere ich dich etwa nicht?«, fragte er, offenbar um Ruhe bemüht, aber<br />
die fahrigen Bewegungen seiner Hände verrieten seine Anspannung.<br />
»Doch, das tust du«, räumte sie ein.<br />
»Warum bist du dann so abweisend zu mir? Erst flirtest du mit diesem braungebrannten<br />
Lackaffen, und dem Mat Salleh hättest du dich am liebsten gleich auf<br />
den Schoß gesetzt.«<br />
»Bitte, Harry. Was soll das?«<br />
»Ich fand ihn unsympathisch, das ist alles. Was hat er, das mir fehlt?«<br />
»Warum bist du eifersüchtig? Wir sind kein Liebespaar. Du bist mein Freund,<br />
und ich war immer offen und fair zu dir. Du hast kein Recht, mir Vorwürfe zu<br />
machen.«<br />
»Habe ich nicht alles für dich getan? Wie eine Prinzessin habe ich dich behan-
delt. Was verlangst du noch?«, brach es aus ihm heraus.<br />
»Hör bitte auf. Es reicht.«<br />
»Wenn ich dich nur küssen will, drehst du den Kopf weg. Bin ich nicht gut<br />
genug für dich? Für wen hältst du dich eigentlich, Julie Lin?«<br />
»Halt endlich den Mund. Das ist jämmerlich.«<br />
»Klar, das willst du natürlich nicht hören. Bei mir spielst du die Unberührbare,<br />
aber für diesen Kerl würdest du wie eine billige Schlampe sofort die Beine breit<br />
machen.«<br />
Julie schlug ihm mit aller Kraft ins Gesicht.<br />
»So spricht niemand mit mir! Verstehst du? Niemand!«<br />
Ihre Stimme zitterte vor Wut. Harry sah sie betroffen an und hielt sich die<br />
Wange.<br />
»Verzeih mir, ich habe es nicht so gemeint.«<br />
Als sie nichts erwiderte, sondern ihn nur kalt anfunkelte, drehte er sich hastig<br />
um und stieg ins Auto. Sekunden später fuhr er mit quietschenden Reifen davon.<br />
Es machte Julie nichts aus, dass er sie allein auf der menschenleeren Straße<br />
stehenließ. Nach diesem Streit hätte sie sich ohnehin nicht von ihm nach Hause<br />
fahren lassen. Dennoch fühlte sie sich elend: Es schmerzte Julie, dass sie einen<br />
Freund verloren hatte, und noch schlimmer war die Konfusion, in die ihre Begegnung<br />
mit Paul sie gestürzt hatte. Sie merkte, wie ihr die Tränen kamen.<br />
Nach einigen Minuten zog sie ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und<br />
trocknete sich die Augen. Ihre Absätze klackten scharf auf dem Pflaster, als sie<br />
entschlossenen Schrittes zu Chee Wahs Villa zurückging.<br />
45
Ann Cleeves<br />
Im kalten Licht des Frühlings<br />
Kriminalroman<br />
ISBN 3-8052-0876-6<br />
© Wunderlich<br />
46<br />
Ann Cleeves, geboren 1954 in Herefordshire, hielt sich<br />
zunächst mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Bei ihrem<br />
Job als Köchin einer Vogelwarte auf Fair Isle lernte<br />
sie ihren späteren Ehemann und Ornithologen Tim<br />
kennen. Kurz nach der Hochzeit lebte sie mit ihm als<br />
einzige Bewohner auf einer kleinen Insel namens Hil-<br />
bre, wo er als Vogelwächter arbeitete und sie mit dem<br />
Schreiben begann. Heute lebt sie mit ihrer Familie in<br />
West Yorkshire und ist Mitglied des «Murder Squad»,<br />
eines illustren Krimi-Zirkels. Im Jahre 2006 erhielt<br />
sie für «Die Nacht der Raben» die weltweit wichtigste<br />
Auszeichnung der Kriminal-Literatur, den Duncan<br />
Lawrie Dagger Award der britischen Crime Writers‘<br />
Association.
Kapitel 5<br />
Sandy Wilson überquerte das Feld mit zögernden Schritten. Vor ein paar Wochen<br />
war der Schädel gefunden worden, und es war eine dieser dichten schwarzen<br />
Nächte, die im Frühling so oft vorkamen. Nicht kalt, aber über der Insel hing<br />
eine tiefe Wolkendecke, aus der es unablässig nieselte und die den Mond und die<br />
Sterne verdeckte, sie verschluckte sogar das Licht aus den Fenstern der Häuser<br />
hinter ihm. Er hatte keine Taschenlampe, aber die brauchte er auch nicht. Er war<br />
hier aufgewachsen. Auf einer Insel, die gut elf Kilometer lang und knapp fünf Kilometer<br />
breit war, kannte man mit zehn Jahren jeden einzelnen Quadratzentimeter.<br />
Diese innere Landkarte trug man bei sich, selbst wenn man fortging. Sandy<br />
lebte jetzt in der Stadt, in Lerwick, aber man hätte ihn irgendwo auf Whalsay mit<br />
verbundenen Augen absetzen können – nach ein paar Minuten wüsste er, wo er<br />
sich befand, einfach an der Art, wie sich der Boden unter seinen Füßen hob und<br />
senkte.<br />
Er wusste, dass er zu viel getrunken hatte, beglückwünschte sich jedoch selbst<br />
dazu, dass er das Pier House Hotel noch rechtzeitig verlassen hatte. Seine Mutter<br />
war sicher aufgeblieben, um auf ihn zu warten. Noch ein paar Drinks, dann<br />
wäre er völlig besoffen gewesen. Und dann hätte er die alte Leier über Selbstbeherrschung<br />
zu hören bekommen und über Michael, seinen Bruder, der das<br />
Saufen aufgegeben hatte. Sandy überlegte, ob er auf dem Weg vielleicht bei seiner<br />
Großmutter vorbeischauen sollte, sie würde ihm eine Tasse starken schwarzen<br />
Kaffee machen, sodass er nüchtern zu Hause ankommen würde. Sie hatte ihn<br />
Anfang der Woche angerufen und ihn gebeten, doch mal in Setter vorbeizukommen,<br />
wenn er wieder auf Whalsay wäre. Mima störte sich nie daran, wenn er ein<br />
bisschen Schlagseite hatte. Sie selbst hatte ihm eines Morgens sein erstes Gläschen<br />
eingeschenkt, bevor er sich auf den Weg zur Schule machte. Es war ein frostiger<br />
Tag, und sie hatte gemeint, der Whisky wäre gut gegen die Kälte. Er hatte geprustet<br />
und sich verschluckt, als ob es die schlimmste Medizin wäre, aber seither<br />
hatte er Geschmack daran gefunden. Mima war wohl schon mit dem Geschmack<br />
daran auf die Welt gekommen, auch wenn man ihr die Wirkung nie anmerkte.<br />
Er hatte sie noch nie betrunken gesehen.<br />
47
Das Feld fiel sanft zu dem Fahrweg ab, der zu Mimas kleinem Bauernhof<br />
führte. Plötzlich hörte er einen Schuss. Der Lärm schreckte ihn kurz auf, aber<br />
er machte sich weiter keine Gedanken. Sicher war Ronald mit seiner großen<br />
Taschenlampe auf Kaninchenjagd. Er hatte davon gesprochen, als Sandy sich das<br />
Baby angesehen hatte, und es war eine gute Nacht dafür. Im blendenden Licht<br />
der Lampe blieben die Kaninchen reglos wie Statuen sitzen, als warteten sie nur<br />
darauf, abgeschossen zu werden. Es war illegal, aber auf den Inseln herrschte eine<br />
solche Kaninchenplage, dass sich niemand darum scherte. Ronald war Sandys<br />
Cousin. Gewissermaßen. Sandy fing an, über den genauen Verwandtschaftsgrad<br />
nachzudenken, aber sein Familienstammbaum war kompliziert, und er war<br />
betrunken, also verlor er den Überblick und gab es auf. Auf dem restlichen Weg<br />
nach Setter war immer mal wieder das Geräusch einer Schrotflinte zu hören.<br />
Die Straße machte eine Biegung, und wie erwartet sah Sandy noch Licht in<br />
Mimas Küchenfenster. Ihr Haus lag in den Hang gebettet, sodass man es erst entdeckte,<br />
wenn man schon fast da war. Vielen Inselbewohnern war es ganz recht,<br />
dass es so vor Blicken verborgen war, denn es war ein ziemlich schäbiger Hof, der<br />
Garten von Unkraut überwuchert, die Fensterrahmen unlackiert und halb verrottet.<br />
Evelyn, Sandys Mutter, schämte sich entsetzlich für den Zustand von Mimas<br />
Hof und lag seinem Vater deswegen regelmäßig in den Ohren. «Kannst du nicht<br />
mal hingehen und das Haus für sie in Schuss bringen?» Aber Mima wollte davon<br />
nichts hören. «Das wird mich noch überleben», sagte sie gleichmütig. «Mir gefällt<br />
es so, wie es ist. Mit dir auf dem Hof, das wäre mir zu viel Getue.» Und da Joseph<br />
mehr auf seine Mutter als auf seine Frau hörte, behielt Mima ihre Ruhe.<br />
Setter war der geschützteste Hof auf der Insel. Der Archäologe, der letztes Jahr<br />
von einer Universität im Süden hergekommen war, sagte, auf diesem Land hätten<br />
schon seit Jahrtausenden Menschen gesiedelt. Er hatte gefragt, ob sie vielleicht<br />
auf einem Feld nahe beim Haus ein paar Gruben ausheben dürften. Ein Projekt<br />
für eine Doktorandin, hatte er erklärt. Eine seiner Studentinnen glaubte, dass es<br />
auf diesem Gelände eine Kaufmannssiedlung gegeben habe. Sie würden anschließend<br />
genau den Zustand wiederherstellen, in dem sie das Gelände vorgefunden<br />
hatten. Sandy nahm an, dass Mima es ihnen so oder so erlaubt hätte. Der<br />
48
Professor gefiel ihr. «Er ist ein gutaussehender Mann», hatte sie Sandy erzählt, mit<br />
funkelnden Augen. Da hatte er geahnt, wie sie als junges Mädchen gewesen sein<br />
musste. Draufgängerisch. Keck. Kein Wunder, dass die anderen Frauen auf der<br />
Insel sie mit Argwohn betrachteten.<br />
Von dem Feld neben der Straße drang ein Geräusch her-über. Diesmal kein<br />
Schuss, sondern ein paar gedämpfte Laute, eine Art Reißen, dann Fußgetrappel.<br />
Sandy drehte sich um und sah die Silhouette einer Kuh nur wenige Schritte<br />
entfernt. Mima war der einzige Mensch auf der ganzen Insel, der noch von Hand<br />
molk. Die anderen hatten schon vor Jahrzehnten damit aufgehört, weil es zu viel<br />
Mühe machte und die Hygienevorschriften es einem untersagten, die Milch zu<br />
verkaufen. Aber es gab Leute, die die Rohmilch nach wie vor lieber mochten und<br />
Mimas Dach reparierten oder ihr eine Flasche Whisky zusteckten, wenn sie im<br />
Tausch dafür jeden Morgen einen Krug der gelben Flüssigkeit bekamen. Sandy<br />
war sich nicht sicher, ob sie auch so scharf darauf gewesen wären, wenn sie Mima<br />
mal beim Melken gesehen hätten. Als er sie das letzte Mal dabei beobachtet hatte,<br />
hatte sie sich die Nase mit demselben schmuddeligen Geschirrtuch geputzt, mit<br />
dem sie anschließend das Euter abwischte. Soweit er wusste, war davon aber auch<br />
noch niemand krank geworden. Er selbst war mit dem Zeug großgeworden, und<br />
es hatte ihm nicht geschadet. Sogar seine pingelige Mutter schöpfte den Rahm<br />
aus der Kanne und goss ihn sich als besondere Leckerei auf ihren Porridge.<br />
Er schob die Küchentür auf und rechnete damit, Mima in ihrem Sessel am<br />
Ofenherd anzutreffen, die Katze auf dem Schoß, ein leeres Glas neben sich,<br />
während im Fernseher irgendein brutaler Film lief. Früh schlafen zu gehen war<br />
nie ihre Sache gewesen, sie schien überhaupt kaum Schlaf zu brauchen, und sie<br />
hegte eine Vorliebe für Gewaltszenen. Sie war die Einzige in seiner Familie, der<br />
seine Berufswahl gefallen hatte. «So was», hatte sie gesagt, «ein Polizist!» Der<br />
verträumte Ausdruck in ihren Augen verriet ihm, dass sie ohne jeden Zweifel an<br />
New York, an Schießereien und rasante Verfolgungsjagden dachte. Sie war nie<br />
weiter gekommen als zu einer Beerdigung nach Aberdeen, ihre einzige Fahrt in<br />
Richtung Süden. Ihre Bilder von der Welt stammten aus dem Fernsehen. Die<br />
Polizeiarbeit auf Shetland hatte damit nicht sehr viel zu tun, aber sie hörte sich<br />
49
trotzdem gern seine Geschichten an, und er übertrieb dann ein kleines bisschen,<br />
weil es sie so glücklich machte.<br />
Der Fernseher lief auf voller Lautstärke. Mima wurde allmählich taub, auch<br />
wenn sie es nicht zugab. Aber die Katze lag allein im Sessel. Das große schwarze<br />
Tier war zu jedem außer seiner Besitzerin bösartig, eine Hexenkatze, hatte seine<br />
Mutter mal gesagt. Sandy drehte den Ton herunter, öffnete die Tür zu den übrigen<br />
Räumen und rief laut nach seiner Großmutter. «Mima! Ich bin’s!» Er wusste,<br />
dass sie nicht schlief. Niemals hätte sie das Licht und den Fernseher angelassen,<br />
außerdem teilte die Katze nicht nur den Sessel, sondern auch das Bett mit ihr.<br />
Mimas Mann war auf See verunglückt, als sie noch jung war. Gerüchteweise hieß<br />
es, sie hätte es als junge Witwe ganz schön bunt getrieben, aber seit er sie kannte,<br />
lebte sie allein.<br />
Keine Antwort. Er fühlte sich plötzlich sehr viel weniger betrunken und ging<br />
weiter ins Haus hinein. Vom Flur gingen drei Türen zu den dahinterliegenden<br />
Zimmern ab. Er konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor Mimas Schlafzimmer<br />
betreten zu haben. Sie war nie krank gewesen. Der quadratische Raum wurde fast<br />
ganz von einem wuchtigen Kleiderschrank aus dunklem Holz ausgefüllt und von<br />
einem Bett, das so hoch war, dass er sich fragte, wie Mima ohne einen Schemel<br />
überhaupt hineinkam. Auf dem Boden lag das gleiche dicke braune Linoleum<br />
wie in der Küche, darauf ein Schaffell als Bettvorleger, ehemals weiß, jetzt grau<br />
und ziemlich verfilzt. Die Vorhänge, ausgeblichen und schäbig, cremefarben mit<br />
einem Muster aus kleinen Rosen, waren nicht zugezogen. Auf dem Fensterbrett<br />
stand ein Foto von Mimas Mann. Er hatte einen dichten roten Bart, sehr blaue<br />
Augen, trug Ölzeug und Stiefel und erinnerte Sandy an seinen Vater. Das Bett<br />
war gemacht und mit einem Quilt aus gehäkelten Rechtecken bedeckt. Von<br />
Mima keine Spur.<br />
Das Badezimmer war nachträglich an der Rückseite des Hauses angebaut worden,<br />
allerdings befand es sich dort schon, seit Sandy denken konnte. Badewanne<br />
und Spülbecken waren in einem unsäglichen Blau, aber auch hier bestand der<br />
Boden aus braunem Linoleum, teilweise von einem leuchtend blauen Hochflorteppich<br />
bedeckt. Es roch feucht und nach nassen Handtüchern. Eine riesige<br />
50
Spinne krabbelte um den Abfluss herum. Abgesehen davon war der Raum leer.<br />
Sandy bemühte sich, rational zu denken. Aus seinen eigenen Ermittlungen<br />
wusste er, dass die Angehörigen immer unnötig in Panik gerieten, wenn jemand<br />
vermisst wurde. Er hatte sich oft über die ängstlichen Eltern oder Partner lustig<br />
gemacht, sobald er das Telefon aufgelegt hatte. Aber jetzt traf ihn schlagartig und<br />
unerwartet die Ungewissheit. Mima ging nie so spät aus dem Haus, nicht in letzter<br />
Zeit, außer wenn es ein Familientreffen bei seinen Eltern gab oder ein großes<br />
Inselereignis wie eine Hochzeit, und dann hätte jemand sie im Auto mitgenommen,<br />
und er wüsste davon. Sie hatte keine richtigen Freunde. Die meisten Leute<br />
auf Whalsay fürchteten sich etwas vor ihr. Er merkte, wie seine Gedankengänge<br />
entgleisten, und bemühte sich, ruhig zu bleiben. Was würde Jimmy Perez in<br />
dieser Situation tun?<br />
Mima sperrte abends immer ihre Hühner in den Stall. Vielleicht war sie hinausgegangen,<br />
gestolpert und gestürzt. Die Archäologen hatten auf einem Gelände<br />
nicht weit vom Haus ihre Gruben ausgehoben. Sie war nicht mehr die Jüngste,<br />
und möglicherweise merkte sie den Alkohol inzwischen doch. Auf dem abschüssigen<br />
Weg konnte sie leicht den Halt verloren haben.<br />
Sandy ging zurück in die Küche und nahm eine Taschenlampe aus der Schublade<br />
unter dem Tisch. Sie lag dort seit der Zeit, als jedes Haus seinen eigenen<br />
Generator hatte, der nur für ein paar Stunden am Abend lief. Draußen spürte er<br />
die Kälte, den Dunst und den Nieselregen, schneidend nach der Ofenwärme im<br />
Haus. Es musste jetzt fast Mitternacht sein. Seine Mutter würde sich inzwischen<br />
fragen, wo er steckte. Er ging um das Haus herum zum Stall. Als sich seine Augen<br />
an die Dunkelheit gewöhnt hatten, reichte ihm das Licht, das aus dem Haus<br />
drang, zur Orientierung. Noch brauchte er die Taschenlampe nicht. Er hatte<br />
das Licht im Badezimmer angelassen, und das Fenster ging nach hinten hinaus.<br />
Die Hühner waren bereits eingesperrt. Er überprüfte den Riegel am hölzernen<br />
Hühnerstall und hörte, wie sie sich drinnen regten.<br />
Am Morgen war das Wetter schön gewesen, und Mima hatte Wäsche gemacht.<br />
Die Wäscheleine war vom Haus in Richtung der Grabungsstätte gespannt. An<br />
der Nylonschnur hingen noch Handtücher und ein Laken. Sie baumelten leblos<br />
51
und schwer, wie die Segel eines Bootes bei Flaute. Die anderen Frauen auf der<br />
Insel nahmen die Wäsche ab, sobald das Wetter trüber wurde, aber Mima sparte<br />
sich die Mühe wahrscheinlich, wenn sie gerade beim Tee saß oder ein Buch las.<br />
Es war diese Unbekümmertheit, die manche ihrer Nachbarn so ärgerte. Was fiel<br />
ihr ein, sich nicht darum zu scheren, was die Leute von ihr dachten? Wie konnte<br />
sie nur einen so schlampigen Haushalt führen?<br />
Sandy ging an der Wäsche vorbei zu der Stelle, wo die Studentinnen gearbeitet<br />
hatten. Ein paar Stangen, zwischen denen Schnur gespannt war, um die<br />
Grabungsfläche zu markieren oder zu vermessen. Ein Windschutz aus blauer<br />
Plastikplane über einem Metallgestänge. Ein Haufen ausgestochener Grasnarbe,<br />
ordentlich aufgeschichtet, ein weiterer mit Erdaushub. Zwei Gruben im rechten<br />
Winkel zueinander. Er leuchtete mit der Taschenlampe hinein, aber bis auf ein<br />
paar Wasserpfützen waren sie leer. Ihm ging durch den Kopf, dass das Ganze<br />
aussah wie ein Tatort in einem der Filme, die seine Großmutter so gerne sah.<br />
«Mima!», rief er. Seine Stimme klang sehr dünn und hoch. Sie war ihm selbst<br />
fremd.<br />
Er beschloss, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen, schaltete die Taschenlampe<br />
aus und machte sich auf den Weg zurück zum Haus. Von dort konnte er in Utra<br />
anrufen. Sicher wusste seine Mutter, wo Mima war; ihr entging nichts, was auf<br />
Whalsay geschah. Dann sah er, dass ein Mantel von der Wäscheleine gefallen war<br />
und zusammengeknittert im Gras lag. Er erkannte einen der Regenmäntel der<br />
Studentinnen und nahm an, Mima hätte ihnen angeboten, ihre verschlammten<br />
Sachen zu waschen. Erst wollte Sandy ihn liegen lassen – musste er nicht ohnehin<br />
erneut in die Waschmaschine? Aber dann bückte er sich doch danach, um ihn ins<br />
Haus zu bringen.<br />
Da lag nicht nur ein Mantel. Da lag seine Großmutter, die in der gelben Jacke<br />
sehr klein aussah. Sie war kaum größer als eine Puppe, mit Armen und Beinen<br />
wie Stöckchen. Sandy berührte ihr Gesicht, das kalt und glatt wie Wachs war,<br />
tastete nach dem Puls. Er wusste, er sollte den Arzt rufen, konnte sich aber<br />
nicht von der Stelle rühren. Der Schock lähmte ihn, und er brauchte Zeit für<br />
die Erkenntnis, dass Mima tot war. Er blickte auf ihr Gesicht hinunter, das sich<br />
52
kreideweiß vom schlammigen Boden abhob. Das ist nicht Mima, dachte er. Das<br />
kann nicht sein. Es ist irgendein schrecklicher Irrtum. Aber natürlich war es seine<br />
Großmutter; er sah das schlechtsitzende Gebiss und das zerzauste weiße Haar,<br />
und ihm wurde übel. Mit einem Schlag war er ganz und gar nüchtern. Doch er<br />
traute seinem Urteil nicht. Er war Sandy Wilson, der immer alles falsch machte.<br />
Vielleicht hatte er nicht richtig nach dem Puls getastet, und in Wirklichkeit<br />
atmete sie, lebte.<br />
Er hob sie auf die Arme, um sie ins Haus zu tragen, denn er brachte es nicht<br />
über sich, sie hier draußen in der Kälte zu lassen. Erst als er mit ihr in die Küche<br />
trat, sah er die Wunde an ihrem Bauch und das Blut.<br />
53
Oliver Bottini<br />
Jäger der Nacht<br />
Kriminalroman<br />
ISBN 3-5021-1018-2<br />
© Scherz<br />
54<br />
Oliver Bottini, in Nürnberg geboren, studierte in<br />
München Neuere deutsche Literatur, Italianistik und<br />
Markt- und Werbepsychologie. Er erhielt für seine<br />
beiden Kriminalromane »Mord im Zeichen des Zen«<br />
und »Im Sommer der Mörder« jeweils den Deutschen<br />
Krimi Preis. Beide Romane standen monatelang auf<br />
der KrimiWelt-Bestenliste und wurden in mehrere<br />
Sprachen übersetzt. 2007 wurde er für den Friedrich-<br />
Glauser-Preis in der Sparte Roman nominiert. Sein<br />
dritter Roman, »Im Auftrag der Väter«, stand 2007<br />
auf der Shortlist des Münchener Tukan-Preises. Oliver<br />
Bottini lebt in Berlin.<br />
Im Internet: www.bottini.de
Prolog<br />
Ein blick auf das dunkle, lautlose Wasser des Rheins, und alles war für einen<br />
Moment vergessen. Der Hass, die Schmerzen, die Angst.<br />
Eddie ließ das Fahrrad ins Gras fallen, stieg zum Wasser hinunter, setzte sich.<br />
Wenn der Rhein nicht wäre. Trug alles weg für ein paar Minuten. Nur die Gedanken<br />
blieben. Die Gedanken und das Herzklopfen.<br />
Den Vater töten.<br />
Er zündete sich eine Zigarette an, streckte die Beine aus, hängte die Füße in den<br />
Fluss. Die Nikes sogen sich voll. Von unten kroch es kühl die Beine hoch.<br />
Wenn ihn der Hass und die Gedanken zu übermannen drohten, ging er nachts<br />
ins Wasser und schwamm. In Deutschland rein, in Frankreich raus. Erst der<br />
Altrhein, dann über die Insel, dann der Große Elsässische Kanal. Der Kanal<br />
war gefährlich. Einhundertfünfzig Meter Dunkelheit und Kälte, quer durch die<br />
Fahrrinnen, zwischen Lastkähnen, Fischerbooten, Sportbooten hindurch, und<br />
das bei starker Strömung. Manchmal hörte er eine wütende Stimme von einem<br />
der Schiffe, doch meistens sah ihn niemand. Am anderen Ufer blieb er liegen, bis<br />
er wieder zu Kräften gekommen war. Dann schwamm er zurück. So wurde er den<br />
Hass und die Gedanken los.<br />
Im Winter, wenn das Wasser zu kalt war, rannte er.<br />
Er füllte die Lungen mit Rauch, ließ den Blick wandern. Der Wald gegenüber<br />
im Sonnenlicht, flussabwärts am deutschen Ufer die Bootsanlegestelle, dann ging<br />
es in einer leichten Linkskurve hoch nach Breisach. Flussaufwärts ein weißer<br />
Fleck am Ufer, Dennis, der sich in jeder freien Minute in die Sonne legte und<br />
doch immer weiß blieb wie Mozzarella. Der kaum etwas aß und doch immer fett<br />
blieb wie eine Qualle.<br />
Ein weißer, schwabbliger Arm hob sich. Eddie winkte zurück. Als er eine<br />
Männerstimme hörte, hielt er den Atem an. Eine Frau lachte. Das Geräusch von<br />
Fahrradreifen auf dem Weg über ihm. Dann war es wieder ruhig.<br />
Er schnippte die Zigarette von sich, ließ sich zurücksinken und dachte darüber<br />
55
nach, wie das Leben ohne seinen Vater wäre.<br />
56<br />
»Eddie.«<br />
Er öffnete die Augen und fuhr hoch. Sein Herz raste, und er spürte, dass er die<br />
Muskeln angespannt hatte.<br />
Aber es war nur Dennis, eine gelbe Tüte in der einen, das Fahrrad an der anderen<br />
Hand. Vorsichtig ließ er das Rad ins Gras gleiten und kam die zwei Meter<br />
herunter. »Ich hab Bier, wenn du willst.«<br />
Eddie nickte, und Dennis nahm eine Flasche Ganter aus der Tüte und öffnete<br />
sie.<br />
Die Flasche war kühl und nass. Während er trank, dachte er, dass auch Dennis’<br />
Stimme irgendwie weiß und fett war.<br />
Rülpsend setzte sich Dennis neben ihn. Er rülpste und furzte alle paar Minuten.<br />
Eddie hatte den Eindruck, dass er es tat, weil er so weiß und so fett war. Dass er<br />
sich dachte: Wenn schon hässlich, dann richtig.<br />
Eddie störte sich nicht daran. Er schwamm nachts durch den Rhein, Dennis<br />
rülpste und furzte. Irgendwas musste man tun.<br />
Dennis furzte. »Du blutest.«<br />
Eddie berührte die Wunde an seiner linken Wange. Im Schlaf aufgekratzt. Jetzt<br />
tat es auch wieder weh. Er hielt die blutverschmierte Hand vor sich, und sie<br />
betrachteten sie eine Weile.<br />
»Krass«, sagte Dennis. »Meins ist viel heller.«<br />
»Weiß?«<br />
Sie grinsten. Eddie beugte sich vor und tauchte die Hand ins Wasser. Der Rhein<br />
wusch das Blut fort.<br />
Er drehte den Kopf, und ihre Blicke begegneten sich.<br />
Sie sprachen nicht darüber, und doch schien Dennis zu ahnen, wie die Wunde<br />
entstanden war. Weshalb Eddie auch im Sommer nie kurze Hosen oder kurzärm-
lige T-Shirts trug.<br />
Eddie dachte, dass er ihn mochte, obwohl er keine Ahnung hatte, weshalb.<br />
Vielleicht weil Dennis keine Fragen stellte. Oder weil er pausenlos rülpste und<br />
furzte. Oder weil sie fast so etwas wie Brüder waren. Sein Vater fickte die Mutter<br />
von Dennis.<br />
Die Mutter ging nie in die Sonne und aß für drei und war genauso weiß und<br />
fett wie Dennis. Wie Dennis’ Vater aussah, wusste niemand. Nicht einmal seine<br />
Mutter, behauptete Dennis. Ich bin von hinten gemacht worden, sagte er, als<br />
würde das alles erklären. Die weiße Haut, das Fett, die schlechten Noten in der<br />
Schule, und warum das Leben beschissen war.<br />
Eddie wandte sich ab und wusch sich das Blut von der Wange.<br />
»Du kannst das Spiel heute Abend bei mir anschauen, wenn du willst«, sagte<br />
Dennis.<br />
Das zweite Halbfinale. Mexiko gegen Argentinien in Dolby Digital, ein Plasmabildschirm,<br />
der die halbe Wohnzimmerwand einnahm. Viele Männer fickten<br />
Dennis’ Mutter, und manche ließen Geld da.<br />
»Okay.«<br />
Eddie starrte auf sein verzerrtes Spiegelbild im Wasser, und sein Herz begann<br />
wieder zu rasen. Gestern das erste Halbfinale. Die Deutschen hatten gut gespielt,<br />
aber die Brasilianer hatten gewonnen. Mit dem Schlusspfiff war sein Vater aufgesprungen<br />
und hatte zugeschlagen.<br />
»Mama macht Gulasch.«<br />
»Okay.«<br />
Eddie setzte sich zurück, nahm einen Schluck Ganter, und für einen Moment<br />
war er beinahe zufrieden. Fußball schauen, Bier trinken, rauchen und aus riesigen<br />
Suppentellern Gulasch essen. Später würde er wieder herkommen und zusehen,<br />
wie es Nacht wurde, und dann würde er durch den Fluss ans französische Ufer<br />
schwimmen.<br />
57
Eine Weile saßen sie da, beobachteten vereinzelte Kanufahrer auf dem Wasser,<br />
sagten nichts. Der Moment der Zufriedenheit war verflogen. Die Wunde brannte,<br />
und der Hass war wieder da. Das Tor von Adriano. Die Wut seines Vaters, der<br />
teilnahmslose Blick seiner Mutter.<br />
Heute Morgen erst die üblichen Knüffe, Schubsereien, Drohungen. Dann<br />
hatte sein Vater zu lachen begonnen, was hat’n der im Gesicht, ist der aus’m Bett<br />
gefallen? Seine Mutter hatte gesagt: Lach doch, Eddie, ist doch lustig, und sein<br />
Vater hatte gesagt: Schau dir dem seine Schmollfresse an, und nicht aufgehört<br />
zu lachen. Eddie war zur Tür gegangen, hatte sich umgedreht und gesagt: Eines<br />
Tages kill ich dich. Da hatte sein Vater nicht mehr gelacht.<br />
58<br />
»Ich fahr dann«, sagte Dennis.<br />
Eddie nickte.<br />
»Kommst du mit in den Ort?«<br />
»Ich bleib noch.«<br />
»Wenn du willst, lass ich dir ein Bier da.«<br />
»Okay. Hast du Zigaretten?«<br />
Dennis öffnete ein weiteres Ganter. »Sind alle«, sagte er. Sein Blick war merkwürdig,<br />
und Eddie fragte sich, was er dachte.<br />
»Du kannst mit zu mir kommen, wenn du willst.«<br />
Eddie schüttelte den Kopf.<br />
»Dann bis später.«<br />
»Okay.«<br />
Er hörte, wie Dennis oben am Weg auf das Rad stieg. Ein Furz, ein Rülpser, ein<br />
Quietschen, dann entfernten sich die Geräusche. Er hob das Bier an die Lippen,<br />
schloss die Augen, trank. Er wusste jetzt, was Dennis gedacht hatte, und er hasste<br />
ihn dafür. Dennis hatte Mitleid gehabt, und Mitleid hatte man nur mit den<br />
Schwachen.
Sein Vater schien auf ihn zu warten. Er saß im schmalen Vorgarten auf einem<br />
Stuhl, eine Bierflasche in Reichweite, den schwarzen Cowboyhut tief ins Gesicht<br />
gezogen. Er saß so, dass Eddie nicht ins Haus kommen würde, ohne ihn zu<br />
berühren.<br />
Dann hörte Eddie Schnarchgeräusche, und er dachte, dass er Glück hatte.<br />
Er ging am Zaun entlang um das Haus herum, bis er den faustgroßen, fast<br />
runden Stein fand, den er vor Monaten hierher gelegt hatte. Er wischte die Erde<br />
ab, rieb den Stein an seiner Hose sauber, damit er ihm nicht aus der Hand gleiten<br />
würde. Den Stein in der Rechten, ging er zum Gartentor zurück. Der Stein fühlte<br />
sich kühl und beruhigend an, so kühl und beruhigend wie das Wasser des Rheins.<br />
Er dachte, dass der Stein genau wie der Rhein für ihn gemacht war.<br />
Am Gartentor blieb er stehen und musterte seinen Vater. Er trug Shorts und<br />
Unterhemd, sodass die muskulösen Arme und Beine zu sehen waren. Eddie<br />
presste die Finger um den Stein. Wichtig war nur, beim ersten Mal so fest wie<br />
möglich zuzuschlagen. Dann würde er es schon schaffen, selbst wenn sein Vater<br />
danach versuchen würde, sich zu wehren.<br />
Eine Bewegung an einem der Fenster im ersten Stock ließ ihn aufblicken. Der<br />
weiße Vorhang war zugezogen, doch er sah den Schatten seiner Mutter dahinter.<br />
Sie stand reglos da, das Gesicht in seine Richtung gewandt. Dann hob sie eine<br />
Hand und krallte sie in den Vorhang. Dann stand sie wieder reglos da.<br />
Eddie machte ein paar Schritte auf seinen Vater zu. Sein Herz raste, und der<br />
Hass pochte in seinem Kopf. Erneut blieb er stehen und schaute zu seiner Mutter<br />
hoch. Dort, wo ihre Hand den Vorhang hielt, war der Stoff verdreht.<br />
Sein Vater gab im Schlaf ein leises, tiefes Schweinegrunzen von sich, und Eddie<br />
wandte sich ihm wieder zu. Er dachte, dass sein Vater so sterben würde, wie es zu<br />
ihm passte. Grunzend wie ein Schwein.<br />
Er ging weiter. Wieder hörte er das Grunzen, doch dann begriff er, dass sein<br />
Vater erwacht war und dass er nicht im Schlaf grunzte, sondern weil er die Augen<br />
geöffnet und den Stein gesehen hatte. In diesem Moment hob er den Kopf leicht,<br />
und Eddie konnte seine Augen unter der Hutkrempe sehen. Erwartungsvoll und<br />
59
voller Verachtung blickten sie ihn an. Komm, sagten sie. Versuch es.<br />
Eddie blieb stehen. Plötzlich wusste er, dass sein Vater genau wie er auf die<br />
richtige Gelegenheit gewartet hatte.<br />
Jetzt war sie da. Endlich, sagten die Augen, und Eddie dachte, dass er verloren<br />
und dass sein Vater gewonnen hatte. Alles war entschieden, ohne dass er etwas<br />
hatte tun können, das die Dinge entschied. Wie so oft war sein Vater zu stark<br />
und er zu schwach.<br />
60<br />
Sein Vater lächelte und sah sehr zufrieden aus.<br />
Eddie hob den Stein, holte aus und schleuderte ihn in Richtung seines Vaters.<br />
Aber der Stein verfehlte ihn um einen Meter. Als er gegen die Hauswand krachte,<br />
sprang sein Vater auf, und Eddie drehte sich um und rannte.<br />
Sein Vater folgte ihm nicht. Minutenlang stand Eddie am anderen Ende des<br />
Ortes im Schatten eines Baumes. Sein Herz raste, der Hass war da und noch<br />
mehr Angst. Doch sein Vater kam nicht. Warum auch, dachte er. Sein Vater musste<br />
nur abwarten, ob er es wagen würde, nach Hause zurückzukehren.<br />
Einen Augenblick lang überlegte er, was er jetzt machen sollte. Er hatte kein<br />
Geld, keine Kleidung. Um fortzugehen, musste er nach Hause. Aber er konnte<br />
nicht mehr nach Hause.<br />
Er verdrängte die Gedanken und folgte der Straße in Richtung Ortsmitte, um<br />
sein Fahrrad zu holen, das er vorhin am Taubenturm abgestellt hatte. Der Rhein<br />
würde Antworten haben.<br />
Als er das Schloss aufsperrte, spielte sein Handy die ersten Takte von »Candy<br />
Shop« von 50 Cent.<br />
Dennis.<br />
»Ich muss dir was zeigen«, sagte er, und seine Stimme klang nicht mehr weiß<br />
und fett, sondern geheimnisvoll.
Kate Saunders<br />
Liebe macht lustig<br />
Roman<br />
ISBN 3-8105-1935-9<br />
© Krüger Verlag<br />
Kate Saunders verlor als Teenager ihr Herz ans �eater,<br />
wo sie aber lieber hinter als auf der Bühne stand. Als<br />
Journalistin schrieb sie u. a. für die »Sunday Times«<br />
und »Cosmopolitan« und arbeitete für das Radio. Sie<br />
ist begeisterte Londonerin und lebt dort mit ihrem<br />
Sohn.<br />
61
Clare hatte diesen Anruf nicht erwartet. Sie wusste sofort, dass es Alarmstufe<br />
eins bedeutete. Charlie flüsterte hastig, während im Hintergrund ziemlich laut<br />
Wagner lief.<br />
»Mein Liebling – etwas Furchtbares – das muss jetzt schnell gehen, ich bin zu<br />
Hause im Arbeitszimmer. Es hat sich eine kleine Katastrophe ereignet.«<br />
»Katastrophe?« Clare nahm die Fernbedienung vom Fernseher, um das biblische<br />
Monumentaldrama stumm zu schalten, das sie sich angesehen hatte, während<br />
ihre Fußnägel trockneten. »Was ist passiert?«<br />
62<br />
»Beth hat alles herausgefunden.«<br />
»Oh.« Clares Magen drehte sich um. Ihr wurde übel.<br />
»Es ist nicht deine Schuld, aber du hast es jemandem bei deiner Krankenhaus-<br />
Komitee-Sache erzählt.«<br />
»Ich habe es jemandem erzählt?« Das war so lächerlich, dass es eigentlich keine<br />
ernste Antwort verdiente. »Glaubst du, dass wir uns damit unsere Zeit vertreiben?<br />
Uns über unsere Liebesleben zu unterhalten?<br />
Charlie murmelte: »Du hast einer neugierigen alten Tratschtante mit dem<br />
Namen Lizzie Parr erzählt, dass du ins Château Cornu fährst.«<br />
»Oh, ist das etwa die Frau vom Chefarzt? Vielleicht habe ich es am Ende eines<br />
Meetings erwähnt.«<br />
»Nun ja, sie ist eine Freundin von Beth. Sie hat herausposaunt, dass du in dasselbe<br />
Hotel fährst wie ich. Ich habe nichts zugegeben, aber Beth hat offensichtlich<br />
zwei und zwei zusammengezählt.«<br />
»Oh.«<br />
Er stöhnte leicht. Im Hintergrund schrien die Rheintöchter. »Sie ist wirklich<br />
aufgebracht und richtig wütend – sie hat mir vorgeworfen, die Mädchen zu<br />
betrügen und alles zu untergraben, was wir uns aufgebaut haben.«<br />
Clare wurde ungeduldig. Die Details seiner Vorort-Familien-Dramen waren für<br />
sie absolut uninteressant, es sei denn, sie führten dazu, dass er seine Frau verließe
– was sie natürlich nie taten. Charlie hatte ihr schon mehrere Male gesagt, dass<br />
er Beth nicht verlassen könne, bevor die Mädchen nicht das College absolviert<br />
hätten.<br />
»Also«, sagte sie, »werde ich wohl alleine fahren. Ich sollte besser ein paar gute<br />
Bücher mitnehmen.«<br />
Sie war enttäuscht, fand sich aber damit ab. Verheiratete Männer zu lieben hieß,<br />
plötzliche Absagen mit einer gewissen Haltung hinzunehmen.<br />
»Na ja«, sagte Charlie. »Nicht ganz.«<br />
»Bitte?«<br />
»Du wirst mich hassen, aber ich muss es tun, ich habe keine andere Wahl. Beth<br />
hat entschieden, dass sie mitkommt.«<br />
»Was?«<br />
»Und sie bringt die Kinder mit. Es tut mir so leid, wenn du nur wüsstest, wie<br />
leid es mir tut, während ich dich anbete, während ich deinen Körper und deinen<br />
Geist will – aber selbstverständlich zahle ich dir die Hälfte des Zimmerpreises<br />
zurück.«<br />
»Was redest du denn da?« Clare bebte vor Wut. »Warum solltest du denn das<br />
Zimmer behalten?«<br />
»Nun, weil ich es mit Beth teilen werde.«<br />
»Willst du damit sagen, du lässt es zu, dass deine Frau mir meinen Urlaub<br />
wegnimmt?«<br />
»Clare, Süße …«<br />
»Meinen Urlaub, den ich schon seit Wochen plane? Verpiss dich! Es ist nicht<br />
dein Hotel, im Übrigen habe ich es entdeckt, und du kannst mich davon nicht<br />
fernhalten.«<br />
»Komm schon, Clare! Ich werde mit meiner verdammten Familie dort sein.«<br />
»Oh, mach dir keine Sorgen. Ich werde mir ein anderes Zimmer buchen. Ich<br />
63
werde unsichtbar sein. Du wirst nicht einmal mitbekommen, dass ich da bin.«<br />
Sie legte einfach auf, und das hatte sie noch nie getan. Der Ärger fiel von ihr ab,<br />
und sie begann zu schluchzen. Es passierte wieder. Sie wusste nur zu gut, was jetzt<br />
kommen würde. Diese Art von Liebesbeziehung zerfällt zu Staub, wenn sie erst<br />
einmal der Lufteinwirkung ausgesetzt ist. Charlie wäre vor die Wahl gestellt, und<br />
dann entschied er sich bestimmt für seine spießige verheiratete Jungfrau. Clare<br />
müsste aus seinem Leben verschwinden und nichts als Reue und Schuldgefühle<br />
zurücklassen – keinen Gold-, sondern einen Trauerring.<br />
Sie war nicht böse auf ihn. Sie war noch nicht einmal böse auf Beth. Sie war<br />
böse auf sich selbst, weil sie ihr eigenes Leben so wenig im Griff hatte. In solchen<br />
Phasen musste Clare wohl oder übel zugeben, dass sie wusste, warum sie mit dreiunddreißig<br />
Jahren alleine war. Sie war süchtig nach der heimlichen Ekstase, dem<br />
schmerzlichen Verlangen und der unglaublichen sexuellen Erregung, die Affären<br />
mit verheirateten Männern mit sich brachten.<br />
Und weil sie wusste, dass sie kein Mitleid verdient hatte, tat es nur noch mehr<br />
weh. Ihre Mutter, die Sprichwörter sehr gemocht hatte, hätte gesagt, wer mit dem<br />
Feuer spielt, kommt darin um. Wenn ihr Herz bräche, wäre das ganz allein ihre<br />
Schuld.<br />
Clare ahnte seit dem Tag, an dem sie in dem großen Architekturbüro in Clerkenwell<br />
angefangen hatte, dass sie wahrscheinlich auf alle Gesellschafter abfahren<br />
würde. Sie wusste nur zu gut, dass sie die fatale Neigung hatte, männliche Autoritätspersonen<br />
anzuhimmeln. Das hatte sie in den bitteren Nachwehen der Affäre<br />
mit Patrick, ihrer ersten großen Liebe, herausgefunden.<br />
Sie hatte Charlie gesehen, wie er sich über den Schreibtisch lehnte und telefonierte.<br />
Er hatte kurz aufgeblickt, ihre Hand geschüttelt, und ihr Herz begann wie<br />
wild zu klopfen – diese dunklen Augen mit dem verschleierten Blick, die grauen<br />
Strähnen in seinem dicken schwarzen Haar. Er hatte etwas von Harrison Ford,<br />
eine Spur von Connery, einen Anflug von Gary Cooper in ›Zwölf Uhr mittags‹.<br />
Es hatte sie augenblicklich erwischt.<br />
Charlie war zweiundfünfzig. Über der Spüle in der Büroküche hing ein altes<br />
64
Foto von der Überraschungsparty zu seinem fünfzigsten Geburtstag. Er stand in<br />
der Mitte einer Gruppe, und sein grinsendes Gesicht drückte blankes Entsetzen<br />
aus. Fünfzig zu werden, das wusste Clare aus gutem Grund, war oft ein traumatisches<br />
Erlebnis für den grauhaarigen Alphamann.<br />
Der Sex mit Charlie war phantastisch, unglaublich. Aber natürlich war da noch<br />
mehr. Er war einfühlsam, galant und romantisch. Nach ihrer ersten Umarmung<br />
hatte Charlie sie zum Abendessen ausgeführt und ihr eine weiße Rose mitgebracht.<br />
Clare hatte sich nichts daraus gemacht, dass das düstere italienische<br />
Restaurant im Büro »Affärino’s« genannt wurde. Dieses erste Zusammentreffen<br />
hatte nichts Schmutziges oder Heimliches. Sie hatten sich angeregt unterhalten.<br />
Sie hatte sich dabei ertappt, ihm alle möglichen Dinge von ihren lustigen alten<br />
Eltern zu erzählen, die beide Landärzte gewesen waren, und von ihrer einsamen<br />
Lincolnshire-Kindheit. Diese Dinge waren alle unglaublich persönlich. Normalerweise<br />
war Clare eher zurückhaltend, was ihre Herkunft betraf, und zögerte<br />
eher, sie vor Leuten auszubreiten, die sie möglicherweise nicht verstanden, aber<br />
Charlie hatte einfach genau die richtigen Fragen gestellt. Und er hörte ihr mit<br />
großem Interesse zu. Sie hatte in diesen besonderen Ferien geplant, ihm von<br />
Patrick zu erzählen.<br />
Sie weinte eine halbe Stunde. Im Fernsehen bewegte Deborah Kerr stumm ihre<br />
Lippen in einer Toga aus violettem Chiffon.<br />
Clare konnte Charlie nicht zurückrufen, um ihm zu sagen, dass es ihr leidtat.<br />
Sie durfte ihn nicht anrufen. Es tat ihr sowieso nicht leid. Wie konnte er es<br />
wagen? Sie hatte diesen Urlaub – ihre ehebrecherischen Flitterwochen – mit solch<br />
liebevoller Sorgfalt geplant.<br />
Sie hatte das Château Cornu in einem Design-Magazin, das ans Büro geliefert<br />
wurde, entdeckt. Beim Durchblättern fiel ihr Blick auf ein atemberaubendes<br />
Foto. Es zeigte ein kleines Schloss mitten in einem Garten zwischen Lavendel,<br />
Rosen und Reihen von Geranien unter dem südlichen Himmel. Der älteste Teil<br />
des Schlosses war ein massiger Bau aus grauem Stein mit schmalen, tiefliegenden<br />
Fenstern hinter Eisengittern. Daran schloss sich ein traditionelles, weinumranktes<br />
französisches Manoir mit Verandafenstern an. Hinter dem neueren Flügel des<br />
65
Hauses war ein Teil des Swimmingpools zu sehen. Unter dem Foto stand ein<br />
kurzer Artikel. Clare überflog ihn schnell. Château Cornu war im 11. Jahrhundert<br />
zum Schutz vor den räuberischen Engländern gebaut worden. Der Rest war<br />
im 17. Jahrhundert hinzugefügt worden. In den frühen Zwanzigerjahren hat<br />
eine entschlossene amerikanische Lady mit einem großen Interesse an Kunst und<br />
Geschichte es erworben. Mrs Rushing hatte das Schloss restauriert und es in die<br />
Pension Cornu umgewandelt. Auf der zweiten Seite war ein Schwarz-Weiß-Foto<br />
von E. M. Forster, ein paar Mitgliedern der Bloomsbury Group und Angehörigen<br />
der Cunard-Familie abgebildet, die in weißen Klamotten auf einer großen, mit<br />
Kies bedeckten Terrasse saßen und ihre berühmten, alten Augen vor der Sonne<br />
schützten.<br />
Mrs. Rushings Hotel war vor dem Zweiten Weltkrieg geschlossen worden. Im<br />
Laufe der Jahre war es extrem baufällig, ja beinahe gefährlich geworden. Ein britisches<br />
Paar hatte diesen Ort letztes Jahr gekauft, mit dem Ziel, ihn in ein feines<br />
Hotel zu verwandeln. Das war alles, was Clare wissen musste. Sie hatte einen<br />
Zettel hineingelegt und das Magazin auf Charlies Schreibtisch gelegt. Er hatte<br />
ihnen auftragsgemäß ein luxuriöses Zimmer gebucht und seiner Frau erzählt, dass<br />
er alleine fahren würde, um den Akku aufzuladen. (Clare war erstaunt über Beths<br />
Leichtgläubigkeit – seit wann lädt ein Mann seinen Akku in einem Hotel auf, das<br />
so wahnsinnig schön ist, dass es fast schon unanständig ist?)<br />
Clare ging in ihre kleine Küche. Sie putzte sich die Nase mit einem Geschirrtuch<br />
und brühte einen Tee auf. Mach es jetzt, sagte sie zu sich selbst, bevor du<br />
dich noch umentschließt. Sie wählte die Nummer des Château Cornu. Sie ließ es<br />
lange klingeln. Endlich hob ein Mann mit einem vornehmen britischen Akzent<br />
ab. Er klang atemlos, und im Hintergrund hörte man so eine Art klappernde<br />
Unruhe. Clare musste mehrmals erklären, was sie wollte.<br />
»Oje«, sagte er schwach. »Ich fürchte, ich habe nur noch ein einziges Zimmer<br />
übrig. Es ist sehr klein, und es hat nur eine Dusche und keine Badewanne. Und<br />
um ehrlich zu sein, ist es nicht richtig fertig.«<br />
»Wie bitte?«<br />
66
»Es ist noch nicht komplett eingerichtet, verstehen Sie?«<br />
»Das macht nichts«, antwortete Clare.<br />
»Um die Wahrheit zu sagen«, fügte er hinzu, »wir haben gerade erst eröffnet.«<br />
»Bitte?«<br />
»Das Hotel. Wir haben bis jetzt noch keine Gäste gehabt.«<br />
Clare hörte ein Krachen, gefolgt von jemandem, der »Scheiße!« rief.<br />
»Aber«, sagte der Mann bestimmt, »einige Kinderkrankheiten ergeben sich ja<br />
zwangsläufig. Haben Sie schon einen Flug gebucht?«<br />
»Ja. Ich werde morgen Nachmittag in Toulouse am Flughafen ankommen. Um<br />
vier, glaube ich.«<br />
»Oh, gut. Dann können Sie mit in den Bus. Ich werde bei der Ankunft ein<br />
Schild hochhalten. Mein Name ist Jamie MacDuff.«<br />
»Sehr erfreut«, sagte Clare.<br />
»Scheiße!«, schrie die Phantomstimme im Hintergrund.<br />
»Dann bis morgen«, sagte Jamie MacDuff.<br />
Clare legte den Hörer auf und ließ sich von der Einsamkeit ihrer Wohnung<br />
überwältigen. Sie hatte keinerlei Zweifel daran, dass es ein wahnsinniger Akt<br />
war, mit ihrem Liebhaber und seiner Familie in den Urlaub zu fahren. Das war<br />
ihr egal. Sie war es leid, die Regeln des Ehebruchs einzuhalten – die kurzen Telefongespräche<br />
über Handy von seltsamen Orten, die diskreten Restaurants, die<br />
heimlichen Nächte und die plötzlich überflüssigen �eaterkarten.<br />
Dieses Mal war es anders. Wenn Charlie der Mann war, den sie liebte, dann<br />
musste sie auch bereit sein, um ihn zu kämpfen.<br />
67
Melanie Rose<br />
Mein Tag ist Deine Nacht<br />
Roman<br />
ISBN 3-426-66364-3<br />
© Droemer/Knaur<br />
68<br />
Melanie Rose lebt in Surrey und hat schon als Teena-<br />
ger Kurzgeschichten für Zeitschriften und Magazine<br />
geschrieben. Schon damals beschäftigte sie immer<br />
wieder die Frage: „Was wäre, wenn …?“ Die Autorin<br />
hat zunächst als Kinderkrankenschwester und Spiel-<br />
therapeutin gearbeitet, bevor sie mit ihrem Mann eine<br />
Familie gründete, zwei Söhne bekam und zwei weitere<br />
Kinder adoptierte. „Mein Tag ist deine Nacht“ ist ihr<br />
erster Roman.
Prolog<br />
Ausgelassen zog mich Frankie über den staubigen Parkplatz auf den kurzgeschnittenen<br />
Rasen der Downs, dem alljährlichen Schauplatz des Epsom-Derbys,<br />
wo ich stehen blieb und die Herbstluft einatmete, froh darüber, endlich draußen<br />
zu sein: fort von den Autoabgasen der nahe gelegenen Straße und der Enge<br />
meiner kleinen Wohnung. Ich bückte mich, um meine dreijährige Terrierhündin<br />
von der Leine los zu lassen, und als ich mich wieder aufrichtete, flitzte sie bereits<br />
übermütig davon. Lächelnd wünschte ich mir, ich könnte mit ebensolcher Hingabe<br />
hinter ihr herrennen.<br />
Stattdessen gab ich mich mit einem flotten Tempo zufrieden, holte sie schließlich<br />
ein, und gemeinsam setzten wir den vertrauten Weg auf den Epsom Downs<br />
fort, Frankie im geschäftigen Trippelschritt vorneweg. Ich ließ meine Gedanken<br />
schweifen und spürte, wie der Druck der vergangenen Woche von mir abfiel und<br />
ich mich entspannte.<br />
Als wir eine kleine Anhöhe erklommen, verschwand die Sonne hinter einer<br />
Wolke, und mit einem Mal herrschte -völlige Windstille. Das verdorrte Gras und<br />
die fernen Bäume, einen Augenblick zuvor in der frühen Nachmittagssonne noch<br />
in satten Herbsttönen leuchtend, hatten einen unheimlichen gelblichen Farbton<br />
angenommen. Schaudernd zog ich meinen Schaffellmantel fester um mich und<br />
beschleunigte den Schritt.<br />
Frankie hatte ein paar kleine Bäume ins Visier genommen, und ich fluchte leise<br />
vor mich hin, hoffte, sie würde nicht gerade jetzt verschwinden, wo ich mich auf<br />
den langen Rückweg zum Auto begeben wollte. Auf einmal wurde es kalt, und<br />
der Himmel färbte sich lila und schwarz wie eine überreife Pflaume. Die Landschaft<br />
schien in eine unnatürliche Stille getaucht. Beklommen bemerkte ich, dass<br />
selbst die Vögel zu singen aufgehört hatten.<br />
Ein tiefes Grollen hallte über die fernen Anhöhen wider, und ein paar Sekunden<br />
darauf kam Frankie panisch zurückgestürmt und bewegte ihre Hinterbeine dabei<br />
derart schnell, dass es fast aussah, als stünden sie unter ihrer Schnauze hervor. Sie<br />
prallte gegen meine Schienbeine und winselte.<br />
69
Ich nahm sie hoch und drückte sie an mich, ohne mich darum zu kümmern,<br />
dass sie mir mit ihren Pfoten den Mantel schmutzig machte. Ihr warmer, lebendiger<br />
Körper und ihr Hundeatem auf meinem Gesicht gaben mir die Gewissheit,<br />
nicht versehentlich in die Stille eines Landschaftsgemäldes getreten zu sein.<br />
Voller Ehrfurcht betrachtete ich die beängstigende Schönheit des Schauspiels<br />
um mich herum. Das eigenartige Licht hatte die herbstlichen Bäume auf der<br />
weit entfernten Hügelkuppe bemalt und ihre Wipfel in Gold getaucht, und doch<br />
zeigte sich der Himmel mit jedem Augenblick dunkler und unheilvoller.<br />
Und dann setzte der Wind mit einer derartigen Wucht ein, dass ich unter dem<br />
Angriff zurücktaumelte. Er fegte mein schulterlanges braunes Haar nach hinten<br />
und umklammerte mit seiner kalten Hand mein Gesicht, so dass ich nach Luft<br />
schnappte. Frankie wand sich in meinen Armen, aber ich wollte sie nicht absetzen,<br />
da ich befürchtete, sie würde dann in ihrer Angst das Weite suchen.<br />
Ich befestigte das Ende der Hundeleine unter Mühen an ihrem karierten<br />
Halsband. Gerade wollte ich sie auf den Boden setzen, als ein schwarzer Labrador<br />
auf uns zugeschossen kam. Er hatte uns fast erreicht, als der erste Blitzstrahl den<br />
Himmel zerriss. Sekunden darauf folgte der Donnerschlag, und die beiden Hunde<br />
drückten sich an meine Beine, ohne sich mit den üblichen Schnüffelformalitäten<br />
abzugeben. Ich kauerte mich zu ihnen, da ich einmal gehört hatte, Blitze<br />
schlügen immer in den höchsten Punkt ein. Der wollte ich nicht sein.<br />
Wir drängten uns noch immer mit gesenkten Köpfen aneinander, wobei ich die<br />
Arme beschützend um die Hunde gelegt hatte, als mir jemand auf die Schulter<br />
tippte. Ich riss den Kopf hoch und sah einen Mann über uns stehen, in dessen<br />
Hand eine Hundeleine baumelte.<br />
70<br />
»Alles in Ordnung?«, rief er mir über das Windgetöse hinweg zu.<br />
Vor Verlegenheit stieg mir die Röte ins Gesicht. Ich rappelte mich hoch und<br />
blickte unvermittelt in seine blauen Augen. Nachdem ich tief Luft geholt hatte,<br />
versuchte ich meinen aufflatternden Mantel zu schließen und gleichzeitig trotz<br />
der schweren Böen und Frankies beharrlichem Zerren nicht das Gleichgewicht zu<br />
verlieren.
Ein zweiter Blitzstrahl knisterte über uns, und wir zuckten beide unwillkürlich<br />
zusammen. Gedanken wirbelten durch meinen Kopf, unter anderem die Frage,<br />
wieso ich dem Traum einer jeden Frau genau dann begegnen musste, wenn ich<br />
mich – mitten in einem Gewittersturm in den Downs – mit zwei verdreckten<br />
Hunden zusammendrängte?<br />
»Ist das Ihrer?«, brüllte ich und blickte auf den schwarzen Labrador, der nun<br />
verzückt um den Mann, der wohl Anfang dreißig sein musste, herumsprang.<br />
»Ja, sie ist mir weggelaufen. Danke, dass Sie sie aufgehalten haben.«<br />
Er schien seinen Weg nur ungern fortsetzen zu wollen, und ich überlegte<br />
krampfhaft, wie ich die Unterhaltung in Gang halten konnte, bekam den Mund<br />
aber einfach nicht auf. Hilflos sah ich zu, wie er seinen Hund an die Leine nahm,<br />
mich dankbar anlächelte und sich zum Gehen wandte.<br />
Das wär’s gewesen, ganz bestimmt, hätte es nicht wieder zu regnen begonnen:<br />
Riesige, schimmernde Tropfen, die wie kleine Kanonenkugeln niederprasselten<br />
und da, wo sie auf die trockene Erde fielen, dunkle Flecken bildeten. Der Unbekannte<br />
drehte sich um, schlug seinen Jackenkragen hoch und kam, den Kopf<br />
gegen den Gewitterregen gesenkt, zu mir zurück. Der Regenguss nahm nun an<br />
Heftigkeit zu, bis wir in keine Richtung mehr weiter als über eine Armeslänge<br />
hinaus blicken konnten. Es war, als stünde man unter einem Wasserfall.<br />
Wir blickten einander an, dieser Fremde und ich, und brachen in Gelächter aus.<br />
Er hatte ein bezauberndes Lachen, tief und kehlig, und obwohl ihm das kurze<br />
Haar am Kopf klebte und Wasser von der Nasenspitze tropfte, wusste ich auf der<br />
Stelle, dass er jemand Besonderes war.<br />
»Mein Wagen steht da drüben«, schrie er und deutete vage in eine Richtung.<br />
»Da wären wir im Trockenen. Laufen wir hin?«<br />
Ich nickte, und zu meiner großen Freude nahm er meine kalte, nasse Hand in<br />
seine und zog mich mit sich, die beiden Hunde mit eingezogenen Schwänzen im<br />
Gefolge.<br />
Ich konnte spüren, wie das Blut in meinen Adern pulsierte, und meine mit<br />
71
seinen verschlungenen Finger kribbelten in einer Art Ekstase, die dem Schmerz<br />
nicht unähnlich war.<br />
Fast hatten wir den Parkplatz erreicht, als erneut ein Blitz aufzuckte und die<br />
Wagenreihen im Nebel vor uns beleuchtete. Die Regentropfen schufen einen<br />
dunstigen aufwärtsstrebenden Sprühnebel, der auf seine Weise schön war, allerdings<br />
nicht so schön wie das Zusammengehörigkeitsgefühl, das ich gegenüber<br />
diesem Mann empfand, dessen tropfende Finger mir Löcher in die Handflächen<br />
brannten. Zwischen uns beiden knisterte es, wie ich es noch nie erlebt hatte und<br />
nicht einmal ansatzweise in Worte zu fassen vermochte.<br />
Der Regen trommelte auf unsere Rücken, stieß uns voran, unsere Schritte<br />
stampften in vollkommenem Gleichklang, und als wir uns atemlos dem Wagen<br />
näherten, blickte mir der attraktive Unbekannte in die Augen, und mich überlief<br />
ein Schauer der Erregung. Er ließ meine Hand einen Augenblick los, um den<br />
Autoschlüssel aus seiner Tasche zu holen, und in diesem Bruchteil einer Sekunde<br />
erhellte sich der Himmel mit einem krachenden Donnern. Wie in einer heftigen<br />
Explosion drang ein Blitzstrahl in meinen Körper.<br />
Als hätte jemand einen riesigen Schalter betätigt, verschwand die zuvor verspürte<br />
Euphorie. In der Schulter durchfuhr mich ein brennender Schmerz. Hingerissen<br />
beobachtete ich, wie sich die Augen des Fremden vor Entsetzen weiteten.<br />
Ich konnte den unerträglichen Gestank verbrannten Fleisches riechen und wusste<br />
unwillkürlich, dass es meines war. Einen kurzen Moment lang vermeinte ich,<br />
über mir zu schweben, mein irdischer Körper umflutet von einer roten Aura. Ich<br />
erschauerte ich, sank auf den nassen Boden, und dann war da nur noch Schwärze.<br />
Nichts.<br />
72
Kapitel 1<br />
Was für ein unheimlicher Traum. Ich schmiegte mich tiefer in mein Kissen und<br />
wollte zurück in den Schlaf finden und die Gefühle wieder einfangen, die ich für<br />
den gutaussehenden Unbekannten empfunden hatte. Ein fremdartiger Geruch<br />
weckte mich jedoch, zerrte an meinem Bewusstsein. Verschlafen schlug ich ein<br />
Auge auf und drehte mich zu meinem Wecker um. Er war nicht da. Stattdessen<br />
stand dort ein Resopal-Nachtkasten mit einem Wasserkrug aus Plastik und einem<br />
Becher mit Strohhalm darauf.<br />
Mühsam stützte ich mich auf einen Ellbogen und entdeckte dabei, dass auf<br />
meinem linken Handrücken mittels Heftpflaster eine Nadel befestigt war. Sie<br />
schien mit einem durchsichtigen Beutel verbunden, der eine Flüssigkeit enthielt,<br />
die über einen dünnen Schlauch in meine Adern tropfte. Ich starrte ihn ein paar<br />
Sekunden an und blickte mich dann in dem kleinen, fensterlosen Raum um, an<br />
dessen Wand sich mehrere rhythmisch piepsende Monitore befanden. Als ich mit<br />
den Händen über das gestärkte weiße Krankenhausgewand fuhr, in dem ich mich<br />
wiederfand, entdeckte ich die klebrigen Elektroden der Monitore – sie waren an<br />
meinem Brustkorb angebracht.<br />
Ich setzte mich kerzengerade auf und verfluchte mich umgehend dafür, da<br />
mich in Rücken und Schulter ein stechender Schmerz durchzuckte. Behutsam<br />
befühlte ich das hauchdünne Material auf meinem Nacken und über meiner<br />
linken Schulter. Verband. Ich dachte an den Blitzschlag zurück. Es war also gar<br />
kein Traum gewesen! Einen Augenblick saß ich reglos da und bemühte mich, die<br />
Geschehnisse noch einmal Revue passieren zu lassen: das Unwetter, der gutaussehende<br />
Fremde, die beiden Hunde, die sich hinter dem Auto versteckt hatten, der<br />
Regen, der erbarmungslos niedergegangen war. Und was war mit Frankie? Wer<br />
kümmerte sich jetzt um sie?<br />
Ich wohnte allein in meiner Souterrainwohnung am Stadtrand von Epsom.<br />
Meine Eltern lebten Meilen entfernt, lebendig begraben in einem ruhigen Nest<br />
in Somerset – einem Dorf, das aus einer Handvoll Cottages, einem Pub und<br />
einer Kombination aus Postamt und Gemischtwarenhandlung bestand – die Art<br />
von Ort, die man durchfahren konnte, ohne ihn überhaupt wahrzunehmen.<br />
73
Niemand käme auf die Idee, meine Eltern davon zu unterrichten, dass ich verletzt<br />
oder dass Frankie irgendwo allein war.<br />
Ich berührte meinen Kopf, der empfindlich schmerzte, und ver-suchte mich<br />
zu erinnern, ob ich bei dem Spaziergang irgendwelche Ausweispapiere dabeigehabt<br />
hatte. Meine Handtasche war im Auto gewesen, das an einer anderen Stelle<br />
geparkt war als das des Fremden. In meinen Manteltaschen hatten sich -lediglich<br />
ein paar Papiertaschentücher und ein Hundekeks befunden. Nicht viel, um Hinweise<br />
auf meine Identität zu geben.<br />
Als ich mich in dem weiß gestrichenen Raum umsah, blieb mein Blick an einer<br />
Grußkarte hängen, die durch den Wasserkrug auf dem Nachtschrank zum Teil<br />
verdeckt wurde. Eine Kinderzeichnung von einer Frau befand sich darauf, umgeben<br />
von kleinen Kindern, die Köpfe auf den Strichkörpern unverhältnismäßig<br />
groß, das hellblaue Haar stand ihr zu Berge.<br />
74<br />
Ich schlug die Karte auf und las, was hineingekrakelt worden war.<br />
»Liebe Mami. Hoffentlich geht’s Dir bald wieder besser. Alles Liebe von Sophie,<br />
Nicole, Toby und Teddy. XXXX.«<br />
Ich fragte mich, wie sauber das Zimmer sein mochte, wenn man die Sachen<br />
meiner Vorgängerin noch nicht weggeräumt hatte, und hatte die Karte gerade<br />
wieder auf den Nachttisch gestellt, als die Tür aufging und eine Krankenschwester<br />
mit einem Krankenblatt hereinkam. Als sie sah, dass ich wach war, lächelte<br />
sie.
Val McDermid<br />
Nacht unter Tag<br />
Roman<br />
ISBN 3-426-19844-4<br />
© Droemer/Knaur<br />
Val McDermid wurde 1955 in Kirkcaldy im schot-<br />
tischen Fife geboren und wuchs dort in einer Bergar-<br />
beiterfamilie auf. Nach der Schulzeit studierte sie Eng-<br />
lisch in Oxford. Nach Jahren als Literaturdozentin und<br />
als Journalistin bei namhaften Zeitungen lebt sie heute<br />
als freie Autorin in Manchester und in einem kleinen<br />
Dorf an der englischen Nordseeküste. Sie gilt als eine<br />
der interessantesten Autorinnen im Spannungsgenre<br />
und ist außerdem als Krimikritikerin der BBC, der<br />
„Times“, des „Express“ und der Krimi-Website Tangled<br />
Web sowie als Jurymitglied mehrerer Krimipreise<br />
eine zentrale Figur in der britischen Krimiszene. Ihre<br />
Kriminalromane und �riller sind weltweit in mehr<br />
als 25 Sprachen übersetzt.<br />
75
76<br />
Mittwoch, 27. Juni 2007,<br />
Glenrothes<br />
Die junge Frau schritt durch den Empfangsbereich, und das rhythmische<br />
Klacken ihrer niedrigen Absätze auf dem Kunststoffboden wurde vom Geräusch<br />
der vielen anderen vorbeieilenden Füße übertönt. Sie sah aus wie jemand, der<br />
eine wichtige Mission hat, dachte der Beamte in Zivil, als sie auf seinen Schreibtisch<br />
zukam. Aber eigentlich war das ja bei den meisten so. Die ganzen Poster an<br />
den Wänden, auf denen Hinweise zur Verbrechensverhütung und allerlei weitere<br />
Informationen standen, erreichten diese Leute nie, wenn sie in wilder Entschlossenheit<br />
auf ihn zuschritten.<br />
Sie steuerte ihn mit fest aufeinandergepressten Lippen an. Sieht nicht schlecht<br />
aus, dachte er. Aber wie bei vielen der Frauen, die sich hier einfanden, war ihr<br />
Äußeres auch nicht gerade spitzenmäßig. Ein bisschen mehr Make-up wäre angebracht<br />
gewesen, um ihre leuchtend blauen Augen stärker zu betonen; und auch<br />
etwas Kleidsameres als Jeans und ein Kapuzenpullover. Dave Cruickshank setzte<br />
sein gewohntes professionelles Lächeln auf. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.<br />
Die Frau schob den Kopf leicht zurück, als wolle sie sich verteidigen. »Ich<br />
möchte jemanden als vermisst melden.«<br />
Dave versuchte, sich seine Müdigkeit und Gereiztheit nicht anmerken zu lassen.<br />
Wenn nicht bitterböse Nachbarn, dann waren es sogenannte Vermisste. Die Frau<br />
war für ein verschwundenes Kleinkind zu gelassen und für einen weggelaufenen<br />
Teenager zu jung. Bestimmt ging es um einen Streit mit ihrem Freund. Oder um<br />
einen senilen Opa, der ausgebrochen war. Also eine verflixte Zeitverschwendung<br />
– wie üblich. Er zog einen Block mit Formularen über den Schaltertisch zu sich<br />
heran, bis er akkurat und gerade vor ihm lag, und griff nach einem Füller. Aber<br />
er nahm dessen Kappe noch nicht ab. Es gab eine Schlüsselfrage, die beantwortet<br />
werden musste, bevor er Einzelheiten notieren würde. »Und wie lange ist diese<br />
Person schon verschwunden?«<br />
»Zweiundzwanzig Jahre und sechs Monate. Genau genommen seit Freitag, dem<br />
vierzehnten Dezember 1984.« Sie streckte das Kinn vor, und Entrüstung verdü-
sterte ihre Gesichtszüge. »Ist das lang genug, um es ernst nehmen zu können?«<br />
[…]<br />
Detective Inspector Karen Pirie führte die Frau einen Seitenkorridor entlang<br />
zu einem kleinen Zimmer. Ein hohes Fenster ging auf den Parkplatz und auf<br />
den Golfplatz hinaus mit seinem gleichmäßig künstlichen Grün in der Ferne.<br />
Vier mit dem grauen Tweed der Ämter bezogene Polsterstühle standen um einen<br />
runden Tisch, dessen helles Kirschbaumholz zwar poliert war, aber nur stumpf<br />
glänzte. Der einzige Hinweis auf den Zweck dieses Raums ergab sich aus der<br />
Reihe gerahmter Fotos an der Wand, alles Bilder von Polizisten im Einsatz. Jedes<br />
Mal, wenn sie das Zimmer nutzte, fragte sich Karen, warum die oberen Etagen<br />
nur Bilder ausgewählt hatten, die in den Medien meistens dann veröffentlicht<br />
wurden, wenn etwas sehr Schlimmes passiert war.<br />
Die Frau sah sich unsicher um, während Karen einen Stuhl herauszog und ihr<br />
ein Zeichen machte, Platz zu nehmen. »Im Fernsehen ist das anders«, sagte sie.<br />
»Nicht vieles im Polizeibezirk von Fife ist wie im Fernsehen«, entgegnete Karen<br />
und setzte sich in einem Winkel von neunzig Grad, nicht der Frau direkt gegenüber.<br />
Eine weniger herausfordernde Position brachte bei einer Zeugenbefragung<br />
gewöhnlich mehr.<br />
»Wo sind die Tonbandgeräte?« Die Frau ließ sich nieder, zog aber ihren Stuhl<br />
nicht näher an den Tisch heran und hielt ihre Tasche auf dem Schoß fest.<br />
Karen lächelte. »Sie verwechseln eine Zeugenbefragung mit dem Verhör eines<br />
Verdächtigen. Sie sind ja hier, um eine Meldung zu machen, nicht um wegen<br />
eines Verbrechens befragt zu werden. Sie dürfen also auf einem bequemen Stuhl<br />
sitzen und aus dem Fenster schauen.« Sie schlug ihren Block auf. »Ich glaube, Sie<br />
wollten jemanden als vermisst melden?«<br />
»Das stimmt. Sein Name ist …«<br />
»Einen Moment. Ich muss ein bisschen weiter vorn anfangen. Zunächst mal,<br />
wie heißen Sie?«<br />
»Michelle Gibson. So heiße ich, seit ich verheiratet bin. Mein Mädchenname ist<br />
77
Prentice. Aber alle nennen mich Misha.«<br />
78<br />
»Gut, Misha. Ich brauche auch Ihre Adresse und Telefonnummer.«<br />
Misha ratterte alle Angaben herunter. »Das ist die Adresse meiner Mutter. Ich<br />
mache das sozusagen in ihrem Auftrag, wissen Sie?«<br />
Karen kannte den Namen des Dorfes, aber nicht den der Straße. Es hatte sich<br />
aus einem der kleinen Weiler entwickelt, die der dortige Grundbesitzer für seine<br />
Bergleute zu einer Zeit gebaut hatte, als ihm die Arbeiter noch genauso gehörten<br />
wie die Gruben selbst. Und es wurde schließlich zu einer Schlafstadt für Fremde,<br />
die weder eine Verbindung zu dem Ort noch zu seiner Vergangenheit hatten.<br />
»Trotzdem brauche ich auch die Angaben zu Ihrer Person«, erklärte sie.<br />
Misha runzelte leicht die Stirn, dann gab sie eine Adresse in Edinburgh an. Karen<br />
sagte die Anschrift nichts; obwohl sie nur dreißig Meilen von der Hauptstadt<br />
entfernt wohnte, waren ihre Kenntnisse der sozialen Gegebenheiten dort von provinzieller<br />
Unzulänglichkeit. »Und Sie möchten jemanden als vermisst melden«,<br />
fuhr sie fort.<br />
Misha zog scharf die Luft ein und nickte. »Meinen Vater. Mick Prentice. Also<br />
eigentlich Michael, genau genommen.«<br />
»Und wann ist Ihr Vater verschwunden?« Jetzt könnte es interessant werden,<br />
dachte Karen. Sollte es überhaupt jemals interessant werden.<br />
»Wie ich dem Mann unten schon sagte, vor zweiundzwanzig Jahren und sechs<br />
Monaten. Am Freitag, dem vierzehnten Dezember 1984, haben wir ihn zum<br />
letzten Mal gesehen.« Misha Gibson zog die Augenbrauen zusammen und blickte<br />
störrisch und finster drein.<br />
»Das ist eine ziemlich lange Zeit, um jemanden dann erst vermisst zu melden«,<br />
bemerkte Karen.<br />
Misha seufzte und wandte den Kopf, um aus dem Fenster zu sehen. »Wir glaubten<br />
nicht, dass er verschwunden war. Nicht direkt.«<br />
»Ich kann Ihnen nicht folgen. Was meinen Sie mit ›nicht direkt‹?«
Misha drehte sich um und hielt Karens beharrlichem Blick stand. »Hört sich so<br />
an, als seien Sie aus der Gegend hier.«<br />
Karen fragte sich, worauf das hinauslaufen würde, und erwiderte: »Ich bin in<br />
Methil aufgewachsen.«<br />
»Also, nichts für ungut, aber Sie sind alt genug, um sich zu erinnern, was 1984<br />
los war.«<br />
»Der Streik der Bergleute?«<br />
Misha nickte. Ihr Kinn war weiterhin vorgeschoben, und sie starrte sie trotzig<br />
an. »Ich bin in Newton of Wemyss aufgewachsen. Mein Vater war Bergmann.<br />
Vor dem Streik arbeitete er unten in der Lady Charlotte. Sie werden sich erinnern,<br />
was die Leute in dieser Gegend damals sagten: Niemand sei streitbarer<br />
als die Kumpel von Lady Charlotte. Trotzdem verschwand in einer Nacht im<br />
Dezember nach neun Monaten Streik ein halbes Dutzend von ihnen. Na ja, ich<br />
sage, sie verschwanden, aber alle kannten die Wahrheit. Nämlich dass sie nach<br />
Nottingham zu den Streikbrechern gingen.« Ihr Gesicht verzog sich krampfhaft,<br />
als kämpfe sie gegen einen körperlichen Schmerz an. »Bei fünf von ihnen war<br />
niemand allzu überrascht, dass sie den Streik unterliefen. Aber meine Mum<br />
erzählt, alle seien fassungslos gewesen, dass mein Dad sich ihnen anschloss. Sie<br />
selbst auch.« Sie sah Karen flehentlich an. »Ich war zu klein, um mich erinnern<br />
zu können. Aber alle sagen, er war durch und durch Gewerkschaftsmann. Der<br />
Letzte, von dem man erwartet hätte, dass er zum Streikbrecher werden könnte.«<br />
Sie schüttelte den Kopf. »Trotzdem, was sollte sie sonst denken?«<br />
Karen verstand nur zu gut, was ein solcher Treuebruch für Misha und ihre<br />
Mutter bedeutet haben musste. In dem radikalen Kohlegebiet Fife gab es nur<br />
Sympathie für diejenigen, die durchhielten. Mick Prentice’ Verhalten hatte seine<br />
Familie bestimmt sofort zu Parias gemacht. »Es war für Ihre Mutter bestimmt<br />
nicht leicht«, sagte sie.<br />
»In einer Hinsicht war es total einfach«, entgegnete Misha bitter. »Was meine<br />
Mutter betraf, war’s das. Für sie war er tot. Sie wollte nichts mehr mit ihm zu<br />
tun haben. Er schickte Geld, aber sie spendete es dem Unterstützungsfonds für<br />
79
Notfälle. Später, als der Streik vorbei war, gab sie es dem Wohlfahrtsverband für<br />
Bergarbeiter. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem der Name meines<br />
Vaters nie erwähnt wurde.«<br />
Karen spürte einen Kloß im Hals, ein Gefühl zwischen Anteilnahme und Mitleid.<br />
»Er hat sich nie gemeldet?«<br />
»Nur sein Geld kam. Immer in gebrauchten Scheinen. Immer mit einem Nottinghamer<br />
Poststempel.«<br />
»Misha, ich hoffe, es klingt nicht herzlos, aber für mich hört es sich nicht so<br />
an, als sei Ihr Vater verschollen.« Karen bemühte sich, ihre Stimme so sanft wie<br />
möglich klingen zu lassen.<br />
»Das dachte ich auch nicht. Bis ich ihn suchen ging. Glauben Sie mir, Inspector.<br />
Er ist nicht dort, wo er sein sollte. Er war nie dort. Und es ist absolut nötig,<br />
ihn ausfindig zu machen.«<br />
Die schiere Verzweiflung in Mishas Stimme überraschte Karen. Sie erschien ihr<br />
interessanter als Mick Prentice’ Aufenthaltsort. »Wieso?«, fragte sie.<br />
80
Arne Dahl<br />
Totenmesse<br />
Kriminalroman<br />
ISBN 3-492-05018-2<br />
© Piper<br />
Arne Dahl ist das Pseudonym des 1963 geborenen<br />
schwedischen Schriftstellers Jan Arnald. Der promo-<br />
vierte Literaturwissenschaftler war Herausgeber der<br />
Zeitschriften Artes und Aiolos und schreibt als Kritiker<br />
für Göteborgs-Posten. Arnald war auch Herausgeber<br />
einer Literaturzeitschrift der Schwedischen Akademie,<br />
die alljährlich den Nobelpreis vergibt.<br />
In den letzten Jahren bescherten ihm seine Kriminal-<br />
romane um die Kommissare Paul Hjelm und Kerstin<br />
Holm Millionen Leser weltweit. »Totenmesse« ist nach<br />
»Ungeschoren« der siebte Fall für das Stockholmer A-<br />
Team, die Sondereinheit für internationale Verbrechen.<br />
Die Verfilmung ist bereits nach Deutschland verkauft.<br />
Arne Dahl erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter<br />
zweimal den Deutschen Krimipreis: 2005 für »Falsche<br />
Opfer« und 2006 für »Tiefer Schmerz«.<br />
Weitere Informationen zum Autor: www.arnedahl.net<br />
und www.piper.de<br />
81
82<br />
Staffagefigur. Ein seltsames Wort.<br />
Kapitel 4<br />
Es kommt aus dem Deutschen und wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
ins Schwedische übernommen. Es bezog sich damals auf etwas sehr Spezifisches,<br />
nämlich auf die Barockmalerei. ›Staffage‹ sind kleinere Nebenfiguren in<br />
einem Landschaftsbild, die die künstlerische Darstellung beleben sollen.<br />
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Wort ›Staffagefigur‹ von ›Staffage‹<br />
losgelöst und in übertragener Bedeutung für eine Person benutzt, die – in welchem<br />
Zusammenhang auch immer – eine untergeordnete Rolle spielt.<br />
Das Wort hatte sich in ihr festgesetzt, sie hatte das Gefühl, zur Existenz einer<br />
Staffagefigur verdammt zu sein.<br />
Aber Cilla Hjelm hatte es satt, sie hatte es gründlich satt, eine Nebenfigur zu<br />
sein, untergeordnet, ohne eigene Persönlichkeit.<br />
Es hatte irgendwann in der Zeit begonnen, als die Kinder geboren wurden,<br />
Danne und Tova, vor fast zwanzig Jahren. Eine Art von Selbstverleugnung. Alle<br />
außer ihr im Mittelpunkt. Als ihr Mann Paul bei der Polizei Karriere machte<br />
und sie versuchte, verlorenen Boden zurückzugewinnen und der Mensch zu<br />
werden, der sie im Innersten war, musste etwas schief gelaufen sein. Sie hatte<br />
versucht, wieder die zu werden, die sie vor zwanzig Jahren gewesen war, und<br />
das war natürlich unmöglich. Es kam zu einem Konflikt, dessen Ergebnis eine<br />
große existenzielle Verwirrung war.<br />
Eines wusste sie auf jeden Fall: Von jetzt an würden sie selbst und ihre Wünsche<br />
im Mittelpunkt stehen. Nur was waren ihre Wünsche? Die Entfremdung<br />
zwischen ihr und<br />
Paul wurde immer größer. Er war so aufdringlich in seinem Wunsch nach Intimität,<br />
sie fühlte sich bedrängt, er ließ ihr keinen Raum zum Atmen. Schließlich<br />
bekam sie keine Luft mehr. Kontakte zu anderen Menschen wurden wichtiger<br />
als der zum Ehemann, und um etwas rekonstruieren zu können, musste sie<br />
alles verwerfen, was irgendwie Pauls Sphäre zugerechnet werden konnte. Und
die Sexualität gehörte zu seiner Sphäre. Sie musste sich verweigern, um sich<br />
nicht ganz zu verlieren.<br />
Paul Hjelm kam mit dem ihm aufgezwungenen Zölibat nicht zurecht. Plötzlich<br />
war er einfach verschwunden, hatte seine Siebensachen gepackt und war<br />
gegangen.<br />
In der Tiefe ihres Herzens fühlte sie sich verraten.<br />
Fast ein Jahr war inzwischen vergangen.<br />
Ganz schuldlos war sie selbst wohl auch nicht.<br />
Das war eine neue und nicht ungeteilt angenehme Einsicht.<br />
Es war einfacher, wenn er an allem schuld war.<br />
Cilla Hjelm hatte eine neue Arbeit gefunden und war jetzt Abteilungsleiterin<br />
in einer Klinik für plastische Chirurgie im Sophiaheim im Stockholmer Stadtteil<br />
Östermalm. Ein ruhigerer Job – denn war sie nicht einfach ausgebrannt<br />
gewesen?<br />
Sie hatte die Ambulanz und die ständigen Überstunden hinter sich gelassen,<br />
ihr Lohn war höher, das Tempo ruhiger, die Stimmung angenehmer – aber war<br />
sie zuvor wenigstens ein kleines bisschen Florence Nightingale gewesen, mit einem<br />
hauchzarten Anstrich von Idealismus, so war sie jetzt eine krasse Realistin.<br />
Entwicklung? Na ja. Zumindest Überleben.<br />
Es war Donnerstagvormittag, und sie schlenderte auf dem Weg zur Arbeit die<br />
Skeppargata hinauf. Es war einer ihrer beiden späten Arbeitstage; sie arbeitete<br />
Teilzeit und kam gut damit zurecht. Auf dem Weg vom U-Bahn-Aufgang am<br />
Östermalmstorg zum Sophiaheim am Valhallaväg wollte sie noch in die Bank<br />
und die Reste einiger abstürzender Fonds retten. Das Reihenhaus in Norsborg<br />
war bezahlt, ihre Lebenshaltungskosten waren niedrig. Sie hatte es nicht über<br />
sich gebracht, den Kontakt zum anderen Geschlecht wieder herzustellen. Sie<br />
fragte sich, ob sie je wieder Lust auf Sex haben würde.<br />
Aber sie hatte ja Tova. Zumindest manchmal. Und morgen hatte sie Geburts-<br />
83
tag, die Kleine. Achtzehn. Volljährig. Die meisten Teenagerkrisen waren überstanden.<br />
Cilla drückte das blaue Paket an sich. Gewagt, einer Achtzehnjährigen<br />
ein Kleid zu kaufen. Ein leichtes, dünnes Sommerkleid. Tova entwickelte sich<br />
zu einer richtig gut aussehenden Frau, das musste die Mutter einräumen, und<br />
gerade deshalb mussten die Ambitionen, ständig in die Welt hinauszuziehen,<br />
gebremst werden. Da war Paul wie üblich viel zu tolerant.<br />
84<br />
Paul, ja, Paul ...<br />
Hätten wir unsere Verschiedenheiten nicht für uns statt gegen uns sprechen<br />
lassen können? All die bitteren Worte. Die verbalen Misshandlungen. Seine<br />
wohlgesetzten Bosheiten.<br />
Und all ihre Neins ... Nein als Lösung für alles. Nein als das Passwort der<br />
Identität.<br />
Sie bog aus der Skeppargata in den Karlaväg ein, betrat die Bankfiliale und<br />
zog eine Nummer. Fünf waren vor ihr. Es würde nicht länger als zehn Minuten<br />
dauern, eine Viertelstunde, wenn es hoch kam. Zwei geöffnete Schalter. Und<br />
tatsächlich saßen fünf Personen auf den Sofas der gediegenen klimatisierten<br />
Östermalmsbank. Es fehlte nur noch ein wenig dezente Stimmungsmusik.<br />
Wie in der Abteilung für plastische Chirurgie.<br />
Ihre Gedanken machten sich selbstständig. Warum? Weil ihre Tochter morgen<br />
volljährig wurde? Weil es gewissermaßen ihr letzter Tag als Mutter war?<br />
Aber war das nicht ausschließlich ihr eigener Fehler? Sie hatte Paul zum Sündenbock<br />
erkoren, hatte beschlossen, alles Ungute in ihrem Leben ihm anzulasten.<br />
Sie wollte nichts als arbeiten, schlafen und mit Freundinnen verkehren,<br />
die besser lebten als sie selbst und an deren Leben sie Anteil nehmen konnte.<br />
Alle anderen hatten es sowieso besser.<br />
Die roten Leuchtdioden blätterten zur nächsten Nummer vor, jetzt warteten<br />
nur noch vier auf den Sofas, und zwei standen an den Schaltern und ließen sich<br />
viel Zeit.<br />
Sie dachte an Pauls affektierte Argumentation. Was passiert mit der weibli-
chen Sexualität, wenn die Frau beschließt, keine Kinder mehr zu bekommen?<br />
Sie – ermüdet.<br />
Wenn das Geheimnisvolle verschwunden ist, ermüdet die Frau. Und wenn die<br />
Kinder geboren sind, auch. Die weibliche Sexualität existiert nur angesichts des<br />
Unbekannten. Unbekannter Mann, unbekannte Kinder. Sie hatte das natürlich<br />
abgestritten. Männlicher Chauvinismus, ganz einfach.<br />
Seine Worte: »Ich kenne keine einzige länger andauernde Beziehung, in der<br />
der Mann nicht irgendwann sexuell frustriert gewesen ist.«<br />
Es war ein Geschlechterkrieg.<br />
Aber im Nachhinein musste sie sich eingestehen, dass sie ihre eigene Sexualität<br />
nicht richtig verstand. Es war so unglaublich kompliziert. Jede Erfahrung<br />
war wie ein Strang in einem Netz aus Hindernissen, Kindheit, Pubertät,<br />
Erwachsensein, Elternschaft. Für ihn war es so verdammt einfach. Er wurde<br />
geil, ganz klar.<br />
Sigmund Freud widmete Jahrzehnte dem Bemühen, die weibliche Sexualität<br />
zu verstehen. Gegen Ende seines Lebens entrang sich ihm in einem Gespräch<br />
mit Marie Bonaparte die Frage: ›Was will das Weib?‹ Er hatte nichts verstanden.<br />
Aber er war ja auch ein alter Chauvi.<br />
Cilla griff nach ihrem Handy. Es war das denkbar jüngste Modell, komplett<br />
mit Kamera und Zoom. Sie blätterte im Adressbuch und stieß auf Paul. Wie<br />
durch Zufall. Seine Nummer bei der Arbeit, die neue Nummer bei der Sektion<br />
für Interne Ermittlungen; die Nummer seiner Wohnung auf Messer-Söder; ein<br />
Diensthandy und ein privates Handy.<br />
Warum hatte sie vier Nummern von ihrem Exmann?<br />
Und warum trug sie immer noch den Nachnamen Hjelm?<br />
Es machte wieder Pling im Schalterraum. Noch drei Personen vor ihr.<br />
Auf ihrem Handy, oberhalb von Paul Hjelms Diensthandynummer, zeigte die<br />
Uhr 10.39. Nein, sie sprang gerade um.<br />
85
86<br />
Auf 10.40 Uhr.<br />
Was dann geschah, wollte nicht in sie hinein. Es kam ihr die ganze Zeit nicht<br />
wirklich vor.<br />
Die zwei maskierten Männer. Die harten Worte auf Englisch. Die Tatsache,<br />
dass sie auf den Marmorfußboden gepresst dalag. Die Plastikpakete, die an die<br />
Wände geklebt wurden. Das Brüllen der Maschinenpistolen. Das zersplitterte<br />
Glas.<br />
Aha, fuhr es ihr durch den Kopf. Deshalb waren die Gedanken so schnell<br />
abgerollt. Weil ich sterben soll.<br />
Und Cilla Hjelm war keine Staffagefigur mehr.<br />
Kapitel 6<br />
Niklas Grundström war Chef der Sektion für Interne Ermittlungen. Er war<br />
jetzt seit einem guten Jahr Paul Hjelms Chef, Paul Hjelms einziger Chef.<br />
»Nur damit du es weißt«, sagte er.<br />
Das bedeutete immer viel, viel mehr. Beispielsweise: ›Sei gefasst auf polizeiliche<br />
Fehltritte.‹ Oder: ›Wir müssen jetzt jede Sekunde ausrücken.‹ Oder sogar:<br />
›Hoffentlich hast du dir am Wochenende nichts vorgenommen.‹<br />
»Die A-Gruppe also?«, fragte Paul Hjelm, der sich an seinem wohlproportionierten<br />
Schreibtisch im Polizeipräsidium auf Kungsholmen wohlfühlte.<br />
Doch, wohlfühlte.<br />
Unverschämt wohl, wie kleingeistige Missgunst es formulieren würde.<br />
Nicht einmal die Tatsache, dass die A-Gruppe wieder einmal in etwas verwickelt<br />
war, was die Sektion für Interne Ermittlungen tangierte, konnte seinem<br />
Wohlbefinden Abbruch tun. Erst waren es seine Kontroversen und Konflikte<br />
mit dem besten Kumpel Jorge Chavez letztes Jahr zu Mittsommer gewesen.<br />
Dann, erst vor Kurzem, Lena Lindbergs ungewöhnlich grobe Misshandlung<br />
eines nordfinnischen Zuhälters. Die er, gegen alle Vernunft und gegen alle
Gesetze, hatte unter den Tisch fallen lassen. Nach einem Gespräch.<br />
»Nicht direkt«, sagte Niklas Grundström und beugte sich über Hjelms<br />
Schreibtisch.<br />
Paul Hjelm betrachtete ihn. Diese blonde, gesunde, gepflegte Straffheit, die<br />
er einst verachtet hatte, für die er aber inzwischen großen, wenn auch distanzierten<br />
Respekt empfand. Sie trugen an einer unaufgearbeiteten gemeinsamen<br />
Vergangenheit, die wie das unreinste Eisenerz angereichert werden musste, um<br />
glänzen zu können. »Nicht direkt?«, fragte Paul Hjelm misstrauisch.<br />
Grundström setzte sein kleines Grinsen auf und legte sich die Worte zurecht.<br />
Eines nach dem anderen, bis die Formulierung perfekt geschliffen war.<br />
Grundström & Hjelm waren mittlerweile ein respektiertes – und zeitweilig<br />
gefürchtetes – Warenzeichen innerhalb der Polizei. Die ›Internabteilung‹, diese<br />
Schreckensbezeichnung, hatte einen ganz anderen Klang bekommen. Einerseits<br />
war die Gefahr für einen Polizisten, dass ihm Unrecht widerfuhr, stark<br />
vermindert worden, anderseits hatte die Gefahr, dass er rechtmäßig belangt<br />
wurde, erheblich zugenommen. Polizeiintendent Niklas Grundström war Chef<br />
der Gesamtsektion für Interne Ermittlungen, während Kommissar Paul Hjelm<br />
der Stockholmsektion vorstand.<br />
Und Hjelm musste einräumen, dass sie sehr gut zusammenarbeiteten, mit<br />
wenigen Worten und ohne unnötige Diskussionen. Das Gegenteil von seiner<br />
früheren Zusammenarbeit mit Kerstin Holm und Jorge Chavez. Dort hatte es<br />
viele unnötige Diskussionen gegeben.<br />
»In erster Linie ist es die NE«, sagte Grundström.<br />
Niklas Grundström. Verheiratet mit Elsa, einer tiefschwarzen Frau aus Orsa,<br />
die am Moderna Museet für Pressearbeit zuständig war und ein singendes<br />
Dalarna-Schwedisch sprach. Und Vater eines ganzen Schwarms kleiner brauner<br />
Kinder. Hjelm hätte nicht sagen können, wie viele es eigentlich waren. Das ließ<br />
Rückschlüsse auf ihre Beziehung zu. Dachte er. Heiter.<br />
»Was hat die A-Gruppe mit der Nationalen Einsatztruppe zu tun?«, fragte er.<br />
87
Am schlimmsten war, dass Grundström sich mit Hjelms altem Boss Jan-Olov<br />
Hultin angefreundet hatte, dem Gründer der A-Gruppe. Hjelm traf ihn sehr<br />
selten draußen in Norrviken in Sollentuna, nördlich von Stockholm. Doch<br />
Grundström war oft da. Und das Ehepaar Hultin war oft zu Besuch bei der<br />
Familie Grundström in der viel zu kleinen Wohnung in Fredhäll.<br />
»Nicht das Geringste«, sagte Grundström. »Panik in der Einsatzleitung, würde<br />
ich tippen.«<br />
Die beiden teilten das Misstrauen in die Polizeiführung. In der fast kein<br />
Polizist zu finden war.<br />
88<br />
»Waldemar Mörner«, sagte Paul Hjelm.<br />
Er brachte Grundström inzwischen ziemlich oft zum Lachen. Vielleicht war<br />
das ein Schritt in die richtige Richtung. Und die erwähnte Wortkonstellation<br />
war ein bombensicherer Schlüssel zu Grundströms hellem Jungenlachen.<br />
So auch diesmal.<br />
»Ich glaube, sie haben die A-Gruppe einfach hinzugezogen, damit sie für sie<br />
denkt«, sagte Grundström.<br />
»Zum Sprengstoff«, sagte Hjelm.<br />
»Sie haben eine Einsatzzentrale auf der anderen Seite von Karlavägen eingerichtet.«<br />
»Mörner und Kerstin?«<br />
»Nur damit du es weißt«, wiederholte Grundström und verschwand.<br />
Wie er immer verschwand. Mit einem Augenzwinkern.<br />
Hjelm stand auf und ging zu seiner Stereoanlage. Es fiel ihm schwer, sich<br />
daran zu gewöhnen, dass Stereoanlagen kaum noch sichtbar waren. Und sogar<br />
die Lautsprecher waren klein. Aber Klang hatten sie. Mozarts Requiem, wie<br />
immer in voller Lautstärke, woraufhin die ersten Male seine Sekretärin – er vergaß<br />
immer, dass er eine Sekretärin hatte – in Panik hereingestürzt war. Sogar<br />
die Fernbedienung hatte Miniformat. Er hielt sie jetzt so in der Hand, dass sie
vollkommen unsichtbar war, und legte den Zeigefinger auf die Stopptaste. Er<br />
würde die Musik im Bruchteil einer Sekunde ausschalten können, falls jemand<br />
ins Zimmer stürmte. Es war keine gute Situation für eine Totenmesse.<br />
Da halb Östermalm drauf und dran war, in die Luft gejagt zu werden.<br />
Und der Irak in Flammen stand.<br />
Das war das Zweischneidige an seiner neuen Lebenssituation. Von außen betrachtet<br />
war er ein einsamer Mensch. Seit der Scheidung hatte er ein paar kurze<br />
Liebschaften hinter sich, und im Grunde fehlte ihm der Wille, sich aufs Neue<br />
zu binden. Er fragte sich, warum. Allerdings fragte er sich das heiter. Er fühlte<br />
sich in letzter Zeit bemerkenswert obenauf – solange er nicht an seine frühere<br />
Frau dachte und an alles, was sich zwischen ihnen abgespielt hatte. Er wollte es<br />
einfach vergessen, aus seinem Bewusstsein streichen. Die Gewaltspirale in der<br />
Gesellschaft drehte sich weiter, die globale Gleichmacherei walzte weiter alles<br />
platt, die polizeiliche Arbeit wurde immer härter und die soziale Ausgrenzung<br />
immer rücksichtsloser. Aber nichts konnte ihn, der so leicht deprimiert war, in<br />
schlechte Stimmung versetzen. Außerdem wurde sein jüngstes Kind morgen<br />
volljährig. Klein-Tova.<br />
Fühlte er sich also wohl als Geschiedener?<br />
Eigentlich nicht. Natürlich fehlte ihm jemand an seiner Seite, jetzt, wo die<br />
Freiheit praktisch in Reichweite lag. Er vermisste die tägliche Berührung, aber<br />
er konnte es sich erlauben, zufrieden zu sein.<br />
Das beste Verhältnis, eigentlich das einzig dauerhafte seit seiner Scheidung,<br />
hatte er mit Christina gehabt. Sie hatten sich um Mittsommer im vorigen Jahr<br />
getroffen und einen wunderbaren Sommer verlebt. Und ganz plötzlich hatte<br />
sie die Beziehung beendet. Sie sei nicht in der Lage, erklärte sie, sich nach ihrer<br />
Scheidung wieder zu binden, und so war auch er verlassen worden.<br />
Das Gesicht, das er vor sich sehen wollte, war Christinas.<br />
Das Gesicht, welches er sah, war Cillas.<br />
Er würde es nie begreifen.<br />
89
Er verschränkte die Hände im Nacken, lehnte sich zurück und ließ die Kraft<br />
des Requiems den Raum erfüllen.<br />
90<br />
Das überirdische Dröhnen der Totenmesse.<br />
Und mittendrin eine ganz kleine Störung.<br />
Er hörte sie erst im Nachhinein, als hätte etwas Unbekanntes das vertraute<br />
Ganzheitserlebnis verändert. Zwei kleine Piepsignale. Er öffnete die oberste<br />
linke Schreibtischschublade. Da lag das Diensthandy. Normalerweise rief ihn<br />
dort nur Niklas Grundström an.<br />
Er hatte eine SMS bekommen. Und nicht von Grundström, sondern von einer<br />
unbekannten Nummer. Er klickte die Nachricht aufs Display. Mozarts mächtiger<br />
Klangteppich hallte im Hintergrund.<br />
Die Totenmesse.<br />
Auf dem Display stand: ›Hilfe Geisel Cilla‹.<br />
Er blickte auf die Nachricht. Es dauerte einen Moment, bis er sie verstand.<br />
Dann brach seine Vergangenheit über ihm zusammen und begrub ihn.
David Gilmour<br />
Unser allerbestes Jahr<br />
Roman<br />
ISBN 3-10-027819-4<br />
© S. Fischer Verlag<br />
David Gilmour, Jahrgang 1949, lebt in Toronto, Kana-<br />
da, und ist Buchautor, Fernsehmoderator, Journalist<br />
und Filmkritiker. Er wurde mit vielen Literaturpreisen<br />
ausgezeichnet, etwa mit dem renommierten Governor<br />
General´s Award. Sein 16-jähriger Sohn Jesse schmiss<br />
die Schule und schaute sich mit seinem Vater zusam-<br />
men Filme an. Wie es mit Jesse weiterging, kann man<br />
in ›Unser allerbestes Jahr‹ nachlesen. Es ist David<br />
Gilmours erstes Buch in deutscher Übersetzung und<br />
war in Kanada ein Bestseller.<br />
91
Als ich neulich an einer roten Ampel halten musste, sah ich meinen Sohn aus<br />
dem Kino kommen. Er war mit seiner Freundin zusammen. Sie hielt ihn am Jakkenärmel<br />
fest, ganz vorne und nur mit den Fingerspitzen, und flüsterte ihm etwas<br />
ins Ohr. Ich konnte nicht herausfinden, welchen Film sie gerade gesehen hatten ;<br />
die Markise war von einem blühenden Baum verdeckt ;, aber mich überkam eine<br />
tiefe Wehmut, weil ich an die drei Jahre denken musste, die er und ich, nur wir<br />
zwei, damit verbracht hatten, Filme zu sehen, auf der Veranda zu sitzen und zu<br />
reden. Eine magische Zeit, wie man sie als Vater so spät im Leben eines Heranwachsenden<br />
normalerweise nicht mitbekommt. Inzwischen sehe ich ihn nicht<br />
mehr so oft wie früher (so soll es ja auch sein), aber es waren wunderbare Jahre.<br />
Ein Glücksfall, für uns beide.<br />
Als Kind dachte ich, es gibt einen Ort, wohin böse Jungs geschickt werden,<br />
wenn sie die Schule schmeißen. Dieser Ort befand sich irgendwo am Ende der<br />
Welt, so ähnlich wie der berühmte Elefantenfriedhof, nur war er eben voll mit<br />
weißen Knöchelchen von kleinen Jungen. Garantiert habe ich deswegen bis<br />
heute diesen Albtraum, dass ich für eine Physikarbeit lernen muss, ich blättere in<br />
meinem Buch, Vektoren, Parabeln, und mit jeder Seite wächst die Panik ; weil ich<br />
die ganzen Sachen noch nie im Leben gesehen habe!<br />
Fünfunddreißig Jahre später. Als die Noten meines Sohnes in der neunten<br />
Klasse zu wackeln anfingen und in der zehnten endgültig kippten, packte mich<br />
eine Art Doppelhorror, erstens wegen der konkreten Situation, mit der ich konfrontiert<br />
war, und zweitens wegen dieses Angstgefühls von früher, das in meinem<br />
Körper immer noch hellwach herumtobte. Ich tauschte mit meiner Exfrau die<br />
Wohnung (»Er muss mit einem Mann zusammenwohnen«, sagte sie). Ich zog<br />
in ihr Haus, sie in meinen Loft, der zu klein war, um einen einsneunzig großen,<br />
schwerfüßigen Jugendlichen Vollzeit zu beherbergen. Auf diese Weise, so dachte<br />
ich insgeheim, konnte ich an ihrer Stelle für ihn die Hausaufgaben machen.<br />
Aber es half nichts. Auf meine allabendliche Frage: »Hast du keine Hausaufgaben?«,<br />
antwortete mein Sohn Jesse immer mit einem fröhlichen: »Nein, überhaupt<br />
keine!«. Als er dann im Sommer eine Woche bei seiner Mutter verbrachte,<br />
fand ich hundert verschiedene Hausaufgabenblätter, die er in seinem Zimmer an<br />
92
allen nur denkbaren Stellen versteckt hatte. Mit einem Wort: Die Schule machte<br />
ihn zum Lügner, zu einem unzuverlässigen Kandidaten.<br />
Wir schickten ihn auf eine Privatschule; an manchen Vormittagen rief uns eine<br />
irritierte Sekretärin an: »Wo steckt er?«. Später erschien mein schlaksiger Sohn<br />
dann irgendwann auf der Veranda. Wo war er gewesen? Vermutlich bei einem<br />
Rap-Wettbewerb in einer Shopping Mall in den Suburbs oder auch bei etwas<br />
weniger Erfreulichem. Auf jeden Fall nicht in der Schule. Wir machten ihm<br />
die Hölle heiß, er entschuldigte sich feierlich, war ein paar Tage brav, und dann<br />
ging‘s wieder von vorne los.<br />
Er war ein sanfter, umgänglicher Junge, aber sehr stolz und völlig außerstande,<br />
etwas zu tun, was ihn nicht interessierte, selbst wenn ihm die Konsequenzen<br />
Angst machten. Sie machten ihm sogar große Angst. Er bekam miserable Noten,<br />
nur die Kommentare waren positiv. Er war beliebt, die Leute mochten ihn, sogar<br />
die Polizisten, die ihn verhafteten, weil er die Mauern seiner ehemaligen Grundschule<br />
mit Graffiti besprühte (ein paar Nachbarn erkannten ihn, ungläubig,<br />
fassungslos). Als der Beamte ihn zu Hause ablieferte, sagte er: »Ich würde mir an<br />
deiner Stelle keine Hoffnungen auf eine kriminelle Karriere machen, Jesse. Dafür<br />
hast du einfach nicht das Zeug.«<br />
Als ich eines Nachmittags mit ihm Latein lernte, merkte ich, dass er kein Heft<br />
hatte, keine Notizen, kein Lateinbuch, nichts, nur einen zerknitterten Zettel mit<br />
ein paar Sätzen über die römischen Konsuln. Diese Seite sollte er übersetzen.<br />
Ich erinnere mich noch genau, wie er mir mit gesenktem Kopf am Küchentisch<br />
gegenübersaß, ein Junge mit einem blassen, gegen jede Sonnenbräune immunen<br />
Gesicht, auf dem sich die kleinste Erregung überdeutlich spiegelte. Es war<br />
Sonntag, dieser Tag, den man als Jugendlicher hasst: Das Wochenende so gut wie<br />
vorüber, die Hausaufgaben nicht gemacht, die Stadt so grau wie der Ozean an<br />
einem Tag ohne Sonne. Feuchtes Laub auf der Straße, und im Nebel lauert schon<br />
der Montag.<br />
Nach einer Weile fragte ich: »Wo sind deine Aufzeichnungen, Jesse?«<br />
»Ich hab sie in der Schule gelassen.«<br />
93
Er war sprachbegabt, begriff die innere Logik von Sprachen, hatte das Gehör<br />
eines Schauspielers, die Übersetzung hätte ein Kinderspiel für ihn sein müssen,<br />
aber man brauchte ihm nur zuzusehen, wie er in seinem Lexikon blätterte, um zu<br />
wissen, dass er keine Ahnung hatte.<br />
Ich sagte: »Ich verstehe nicht, wieso du deine Notizen nicht mit nach Hause<br />
genommen hast. So ist alles viel schwieriger.«<br />
Er hörte den ungeduldigen Unterton in meiner Stimme; ich machte ihn nervös,<br />
was wiederum bei mir Unbehagen auslöste. Er hatte Angst vor mir. Das konnte<br />
ich nicht leiden. Ich wusste nie, ob es ein Vater-Sohn-Ding war oder ob ich, ganz<br />
speziell ich mit meiner Reizbarkeit, meiner generellen Ungeduld, diese Reaktion<br />
verursachte. »Na, egal«, sagte ich. »Spaß macht es trotzdem. Ich liebe Latein.«<br />
»Ehrlich?«, fragte er eifrig (alles war okay, solange es nur von den fehlenden<br />
Notizen ablenkte). Ich schaute ihm eine Weile zu, wie er arbeitete, die Finger mit<br />
den Nikotinflecken um den Stift gekrampft. Seine schlechte Handschrift.<br />
94<br />
»Wie raubt man eigentlich eine Sabinerin, Dad?«, fragte er.<br />
»Erklär ich dir später.«<br />
Pause. »Ist _cassis¬ ein Verb?«<br />
So ging es immer weiter, die spätnachmittäglichen Schatten krochen über die<br />
Küchenfliesen. Die Bleistiftspitze hüpfte auf der Tischfläche. Nach einer Weile<br />
merkte ich, dass etwas brummte. Woher kam dieses Geräusch? Von ihm? Was<br />
sollte das? Ich musterte ihn aufmerksam. Es war ein Ausdruck von Langeweile, ja,<br />
aber einer ganz besonderen Form von Langeweile, es war die physisch spürbare<br />
Überzeugung, dass die gestellte Aufgabe absolut irrelevant war. Und merkwürdigerweise<br />
hatte ich ein paar Sekunden lang das Gefühl, als würde sich das alles in<br />
meinem eigenen Körper abspielen.<br />
Ach, dachte ich, so erlebt er also die Schule. Dagegen kommt keiner an. Und<br />
plötzlich ; es war so eindeutig wie das Geräusch einer splitternden Fensterscheibe<br />
; begriff ich, dass wir den Schulkampf verloren hatten.<br />
Und im selben Moment wusste ich ; ich wusste es mit jeder Faser meines Kör-
pers ;, dass ich auch ihn verlieren würde, dass er eines Tages vom Tisch aufstehen<br />
und sagen würde: »Du willst wissen, wo meine Notizen sind? Ich werd‘s dir<br />
sagen. Ich hab sie mir in den Arsch gesteckt. Und wenn du mich nicht augenblicklich<br />
in Ruhe lässt, stecke ich sie dir genau dahin.« Und weg wäre er, peng,<br />
Schluss, Tür zu.<br />
»Jesse«, sagte ich leise. Er wusste, dass ich ihn beobachtete, und das beunruhigte<br />
ihn, weil er ahnte, gleich würde er Schwierigkeiten bekommen (mal wieder), und<br />
diese hektische Aktivität, dieses Geblättere, vor und zurück, vor und zurück, war<br />
ein Versuch, die Zurechtweisungen im Vorfeld abzuschmettern.<br />
»Jesse, leg mal kurz den Stift weg. Hör auf zu schreiben, bitte.«<br />
»Was ist?«, fragte er. Er ist so blass, dachte ich. Die Zigaretten saugen noch die<br />
ganze Lebenskraft aus ihm heraus.<br />
Ich sagte: »Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Ich möchte, dass du dir<br />
überlegst, ob du in die Schule gehen willst oder nicht.«<br />
»Dad, die Notizen sind in meinem ;«<br />
»Vergiss die Notizen. Ich möchte, dass du dir überlegst, ob du grundsätzlich<br />
noch länger in die Schule gehen willst oder nicht.«<br />
»Warum?«<br />
Ich merkte, wie mein Herz anfing, schneller zu schlagen, das Blut stieg mir ins<br />
Gesicht. Das war eine Situation, in der ich mich noch nie befunden hatte, nicht<br />
einmal in meiner Vorstellung. »Weil es okay ist, wenn du nicht mehr willst.«<br />
»Was ist okay?«<br />
Sag‘s doch. Spuck es aus.<br />
»Wenn du nicht mehr in die Schule willst, brauchst du nicht mehr zu gehen.«<br />
Er räusperte sich. »Du erlaubst mir, dass ich mit der Schule aufhöre?«<br />
»Wenn du das möchtest. Aber überleg dir‘s ein paar Tage. Es ist eine wich ;«<br />
Er sprang auf. Er sprang immer auf, wenn ihn etwas bewegte, seine langen<br />
95
Gliedmaßen hielten dann nicht länger still. Er beugte sich über den Tisch und<br />
senkte die Stimme, als hätte er Angst, jemand könnte mithören: »Ich muss mir<br />
das nicht überlegen.«<br />
96<br />
»Tu‘s trotzdem. Ich bestehe darauf.«<br />
Später am selben Abend trank ich mir mit ein paar Glas Wein Mut an und<br />
wählte die Nummer seiner Mutter in meiner Wohnung (ein Loft in einer alten<br />
Bonbonfabrik), um ihr die Neuigkeit mitzuteilen. Sie ist eine dünne, hübsche<br />
Schauspielerin und überhaupt der liebste Mensch, den ich kenne. Eine Schauspielerin<br />
ohne Schauspielerallüren, könnte man sagen. Aber andererseits ist sie<br />
eine Schwarzmalerin der schlimmsten Sorte, und schon nach ein paar Sekunden<br />
sah sie Jesse in Los Angeles in einem Pappkarton wohnen.<br />
»Glaubst du, das ist so, weil er zu wenig Selbstbewusstsein hat?«, fragte Maggie.<br />
»Nein«, sagte ich. »Ich glaube, es ist so, weil er die Schule hasst.«<br />
»Aber irgendwas stimmt doch nicht mit ihm, wenn er die Schule hasst.«<br />
»Ich habe die Schule auch gehasst«, sagte ich.<br />
»Vielleicht kommt es ja daher.« Wir redeten noch eine Weile, bis sie schließlich<br />
in Tränen ausbrach und ich mit eiligen Verallgemeinerungen daherkam, auf die<br />
Che Guevara stolz gewesen wäre.<br />
»Dann muss er sich eben einen Job suchen«, sagte Maggie.<br />
»Hat es einen Sinn, deiner Meinung nach, wenn man eine Tätigkeit, die man<br />
ablehnt, gegen eine andere austauscht?«<br />
»Was soll er denn sonst machen?«<br />
»Keine Ahnung.«<br />
»Vielleicht kann er ja irgendwo ehrenamtlich arbeiten«, schniefte sie.<br />
Ich wachte mitten in der Nacht auf. Tina, meine Frau, drehte sich im Schlaf<br />
auf die andere Seite. Ich trat ans Fenster. Der Mond hing ungewöhnlich tief am<br />
Himmel, er hatte sich verirrt und wartete darauf, dass man ihn abholte und nach<br />
Hause brachte. Was ist, wenn ich mich irre?, dachte ich. Was ist, wenn ich auf
Kosten meines Sohnes cool bin und ihm erlaube, sein Leben zu ruinieren?<br />
Es stimmt ; er muss etwas tun. Aber was? Wozu kann ich ihn motivieren, ohne<br />
das Schuldebakel zu wiederholen? Er liest nicht, er hasst Sport. Was macht er<br />
gern? Er sieht gern Filme. Ich auch. Mit Ende dreißig war ich sogar ein paar Jahre<br />
lang ein ziemlich geistreicher Filmkritiker für eine Fernsehsendung. Hilft uns das<br />
irgendwie weiter?<br />
Drei Tage später trafen wir uns zum Essen im Le Paradis, einem französischen<br />
Restaurant mit weißen Tischdecken und schwerem Besteck. Jesse wartete draußen<br />
auf mich. Er hockte auf der Steinballustrade und rauchte eine Zigarette, weil<br />
er nicht gern allein in einem Restaurant saß. Da fühlte er sich unwohl, weil er<br />
dachte, dass jeder ihn für einen Versager ohne Freunde hielt.<br />
Ich umarmte ihn. Man spürte die Kraft in seinem jungen Körper, die Vitalität.<br />
»Wir bestellen den Wein, und dann reden wir.«<br />
Wir gingen hinein. Begrüßung per Handschlag. Rituale der Erwachsenen, die<br />
ihm schmeichelten. Sogar ein Scherz zwischen ihm und dem Bartender über<br />
John-Boy aus der Serie Die Waltons. Wir schwiegen beide, während wir auf<br />
den Kellner warteten. Auf unserer Agenda stand ein wichtiges �ema, da gab es<br />
vorher nichts zu sagen.<br />
97
Friedrich Torberg<br />
Die Tante Jolesch<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4230-1266-9<br />
© dtv<br />
Heimito von Doderer<br />
Die Merowinger oder<br />
Die totale Familie<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-1308-3<br />
© dtv<br />
98<br />
Friedrich Torberg war wohl einer der letzten, der aus eigener<br />
Erinnerung die Atmosphäre des ehemals habsburgischen<br />
Kulturkreises und die Welt der Boheme in Budapest, Prag<br />
und Wien so intensiv zu beschwören vermochte. Franz<br />
Molnár, Egon Erwin Kisch, Anton Kuh, Egon Friedell<br />
und Alfred Polgar - hier werden sie alle wieder lebendig.<br />
Aber mehr noch kommen die Unbekannten zu Wort: der<br />
zerstreute Religionslehrer Grün, der geistreiche Rechtsanwalt<br />
Sperber, die Redakteure des legendären ‚Prager Tagblatts‘<br />
und natürlich die Tante Jolesch, die den Lauf der Welt auf<br />
ihre Weise kommentierte.<br />
Familie? Dieser Mann ist sich selbst genug. Freiherr<br />
Childerich von Bartenbuch gelingt es, durch Heiraten sein<br />
eigener Großvater, Vater, Schwiegervater und Schwiegersohn,<br />
Schwager, Onkel und Neffe zu werden. - Abenteuer,<br />
Analysen und Anregungen für Nachahmer: in diesem Buch.<br />
Aberwitzig!
Heimito von Doderer<br />
Ein Mord den jeder begeht<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-0083-0<br />
© dtv<br />
Joseph Roth<br />
Radetzkymarsch<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-2477-5<br />
© dtv<br />
Und längst auf der Hochzeitsreise war es, zu Bologna, daß er,<br />
nun eigentlich ganz erstmalig, die Beziehung und Ähnlichkeit<br />
entdeckte, die zwischen Marianne und Louison bestand.<br />
Er traf ihn wie ein Pfeil. Der Lebensroman eines jungen<br />
Mannes, der in den Wirren eines ungewöhnlichen Schicksals<br />
schließlich zur Wahrheit und zu sich selbst findet.<br />
In der Schlacht bei Solferino im Jahre 1859 rettet der slowenische<br />
Infantrieleutnant Joseph Trotta dem österreichischen<br />
Kaiser Franz Joseph I. das Leben. Er wird dafür geadelt und<br />
mit Orden ausgezeichnet und verläßt unwiderruflich den<br />
Weg seiner bäuerlichen Vorfahren. So beginnt die Geschichte<br />
der Familie von Trotta in einer Zeit, in der die Herrschaft<br />
der Habsburger noch einmal eine glorreiche Blüte erlebt.<br />
Der Kaiser ist mächtig, das Reich ist groß, die bestehende<br />
Ordnung der Welt scheint unvergänglich. Und doch wird<br />
hinter diesem Glanz eine Müdigkeit fühlbar, eine Erstarrung,<br />
eine Ahnung von Verfall und Auflösung. Von der knorrigen<br />
Stärke des „Helden von Solferino“ ist bei seinem weichen<br />
und feinfühligen Enkel Carl Joseph von Trotta nichts<br />
übriggeblieben. Er erkennt, daß neue Kräfte die Zukunft bestimmen<br />
werden, aber er kann nicht selbst daran teilnehmen.<br />
Im Aufstieg und Verfall einer Familie spiegeln sich die letzten<br />
Jahrzehnte der Donaumonarchie. ‚Radetzkymarsch‘ gilt als<br />
das Hauptwerks des großen Epikers Joseph Roth.<br />
99
Leo N. Tolstoi<br />
Anna Karenina<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-2494-2<br />
© dtv<br />
Umberto Eco<br />
Der Name der Rose<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-0551-4<br />
© dtv<br />
100<br />
Die frostige Vornehmheit und gefühllose Engherzigkeit ihres<br />
Gatten treibt die schöne und sensible Anna Karenina in die<br />
Arme des jungen Grafen Wronskij. Ihre gemeinsame Flucht<br />
aus der Enge gesellschaftlicher und religiöser Konventionenendet<br />
in einer Sackgasse: Anna Karenina geht in den Freitod,<br />
nachdem sich ihre Liebe in Eifersucht und Haß verkehrt hat.<br />
Der Heldin, die in ihremStreben nach dem absoluten und<br />
damit unerreichbaren Glück scheitern muß, steht antithetisch<br />
der junge, grüblerische Gutsbesitzer Lewin gegenüber,<br />
der sich aus der Moskauer Gesellschaft zu einem bescheidenen<br />
Glück in der Harmonie eines tätigen Landlebens<br />
zurückzieht. Mit großem psychologischenGespür, scharfem<br />
Beobachtungssinn und einer meisterhaften Beherrschung der<br />
darstellerischen Mittel schuf Tolstoi ein Werk, das �omas<br />
Mann zurecht als‚ den größten Gesellschaftsroman der Weltliteratur‘<br />
bezeichnet hat.<br />
Daß er in den Mauern der prächtigen Benediktinerabtei<br />
an den Hängen des Apennin das Echo eines verschollenen<br />
Lachens hören würde, das hell und klassisch herüberklingt<br />
aus der Antike, damit hat der englische Franziskanermönch<br />
William von Baskerville nicht gerechnet. Zusammen mit Adson<br />
von Melk, seinem etwas tumben, jugendlichen Adlatus,<br />
ist er in einer höchst delikaten politischen Mission unterwegs.<br />
Doch in den sieben Tagen ihres Aufenthalts werden die<br />
beiden mit kriminellen Ereignissen und drastischen Versuchungen<br />
konfrontiert: Ein Mönch ist im Schweineblutbottich<br />
ertrunken, ein anderer aus dem Fenster gesprungen, ein<br />
dritter wird tot im Badehaus gefunden. Aber nicht umsonst<br />
stand William lange Jahre im Dienste der heiligen Inquisition.<br />
Das Untersuchungsfieber packt ihn. Er sammelt Indizien,<br />
entziffert magische Zeichen, entschlüsselt Manuskripte und<br />
dringt immer tiefer in ein geheimnisvolles Labyrinth vor,<br />
über das der blinde Seher Jorge von Burgos wacht ...
Jane Austen<br />
Stolz und Vorurteil<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-2350-1<br />
© dtv<br />
Fjodor M. Dostojewski<br />
Die Brüder Karamasow<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-2410-2<br />
© dtv<br />
Stolz und Vorurteil - damit haben alle in Jane Austens<br />
populärstem Roman zu kämpfen. Um aristokratischen und<br />
bürgerlichen Dünkel dreht sich ein wild wirbelndes Heiratskarussell,<br />
das schließlich beim Happy End zum Stehen<br />
kommt. Witz und Ironie prägen die Dialoge dieses 1813<br />
erstmals erschienenen Buches.<br />
Ein Roman in vier Teilen, erschienen 1879/80, ein Jahr vor<br />
dem Tod seines Autors. Wiederum als Kriminalgeschichte<br />
angelegt - diesmal jedoch bleibt der Täter für den Leser bis<br />
zum Schluss unbekannt - erzählt Dostojewskij die Geschichte<br />
der drei Brüder Karamasow, die als Erwachsene in ihr<br />
Elternhaus zurückkehren, wo sie ihrem Vater als einem alten<br />
lüsternen Trunkenbold begegnen. Ihre Verachtung für den<br />
Vater ist so groß, dass sie seinen Tod herbeiwünschen. Als<br />
er dann wirklich ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht,<br />
ein Vatermörder zu sein, auf den ältesten der Brüder,<br />
Dimitrij. Er wird schuldig gesprochen und zu Zwangsarbeit<br />
in Sibirien verurteilt. Alle wissen jedoch: Ein anderer hat den<br />
greisen Unhold ermordet, und trotzdem nehmen die Brüder<br />
die Schuld auf sich ...<br />
101
Jules Verne<br />
Reise zum Mittelpunkt<br />
der Erde<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-3575-7<br />
© dtv<br />
Jules Verne<br />
In 80 Tagen um die Welt<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-3545-0<br />
© dtv<br />
102<br />
»Steig hinab in den Krater des Sneffels Jökull und du wirst<br />
zum Mittelpunkt der Erde gelangen.« Der Traum eines jeden<br />
Professors: die sensationelle Entdeckung - und ewiger Ruhm!<br />
Ein rätselhaftes Runendokument scheint Professor Lidenbrock<br />
genau dies zu eröffnen, woraufhin er sich mit seinem<br />
Neffen und einem isländischen Führer auf eine phantastische<br />
Reise in die Unterwelt begibt. Was ihn dort erwartet, übersteigt<br />
jede Vorstellung. Und auch für den gelehrtesten Geologen<br />
der Welt steckt die Erde noch voller Überraschungen!<br />
Ein Klassiker der phantastischen Literatur und der zweite<br />
Band der Jules Verne-Reihe lädt ein zu einer spannenden<br />
Expedition zu den Ursprüngen der Erdgeschichte.<br />
Top! Die Wette gilt: In 80 Tagen will Phileas Fogg die Erde<br />
umrunden, setzt darauf die Hälfte seines Vermögens und<br />
macht sich mit Jean Passepartout auf den Weg. Europa,<br />
Asien, Nordamerika, per Eisenbahn, Schiff, Elefant oder<br />
Schlitten - in atemberaubender Ruhe lässt der elegante junge<br />
Herr Landschaften und Städte und Abenteuer an sich vorbeiziehen,<br />
bis ihm am Ende die Zeit doch beinahe ausgeht.<br />
Jules Vernes populärster Roman in einer neuen Übersetzung,<br />
prachtvoll illustriert und mit einem ausführlichen Anhang<br />
bildet den Auftakt einer neuen Verne-Edition im Klassik-<br />
Programm des dtv.
John Steinbeck<br />
Straße der Ölsardinen<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-0625-2<br />
© dtv<br />
Jack London<br />
Wolfsblut<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4230-1298-0<br />
© dtv<br />
Gelegenheitsarbeiter, Taugenichtse, Dirnen und Sonderlinge<br />
bevölkern die Cannery Row im kalifornischen Fischerstädtchen<br />
Monterey. Sie leben in alten Lagerhallen wie Mack und<br />
seine vier Kumpane, denen jede geregelte Arbeit verhasst ist;<br />
sie hausen in ausrangierten Dampfkesseln und verrosteten<br />
Röhren auf dem leeren Platz, der alles andere als leer ist oder<br />
wie Henri, der Maler, in einem Boot Marke Eigenbau, an<br />
dem er seit zwanzig Jahren herumbastelt und in dem es keine<br />
seiner Frauen und Freundinnen lange aushält. Sie treffen sich<br />
im unerschöpflichen Kramladen des Chinesen Lee Chong,<br />
um auf Pump einzukaufen, in den Kneipen rund um die<br />
Fischkonservenfabriken, in Doras Etablissement und im Laboratorium<br />
des einsiedlerisch lebenden Meeresbiologen Doc,<br />
den sie eines Tages mit einer grandiosen Party überraschen.<br />
Und das alles spielt sich unter den misstrauischen Blicken der<br />
ordentlichen Bürger von Monterey ab ... So komisch, leicht<br />
und nostalgisch ist diese Prosa, dass man beinahe vergessen<br />
könnte, dass es sich um Weltliteratur handelt.<br />
Geboren in der Wildnis des Nordens, als Jungtier von<br />
Indianern gefangen und zum Schlittenhund abgerichtet, für<br />
Schnaps an einen skrupellosen Menschen verkauft, der ihn<br />
zur Belustigung von Neugierigen in einem Käfig zur Schau<br />
stellt und zu seiner eigenen Bereicherung gegen Hunde und<br />
Wölfe kämpfen läßt, im letzten Augenblick vor dem sicheren<br />
Tod gerettet und schließlich ergebener Diener seines neuen<br />
Herrn: das ist der Lebenslauf von Wolfsblut. Früh lernt<br />
Wolfsblut eine Reihe von Gesetzen zu beachten und sich<br />
gegen seine feindliche Umgebung zu behaupten. Doch eines<br />
Tages macht der junge Wolf eine Entdeckung: er sieht zum<br />
erstenmal Menschen und fühlt instinktiv, daß er sich ihnen<br />
unterwerfen muß.<br />
103
Miguel de Cervantes<br />
Don Quijote<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-2351-8<br />
© dtv<br />
Herbert G. Wells<br />
Die Zeitmaschine<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-2234-4<br />
© dtv<br />
104<br />
Miguel de Cervantes Saavedra hat eine Figur geschaffen, die<br />
sprichwörtlich geworden ist für den Kampf des Idealisten<br />
gegen die Windmühlen der Realität: Don Quijote. Der arme<br />
Ritter und sein Diener Sancho Pansa haben den Kampf<br />
gegen das Vergessen gewonnen: Der Roman zählt seit 1605<br />
zu den größten Werken der Weltliteratur. Die Erfolgsausgabe<br />
mit den kongenialen Illustrationen Grandvilles von 1848<br />
erscheint zu Cervantes‘ 450. Geburtstag in neuer Ausstattung.<br />
Prämiert 2002 vom Osloer Nobelinstitut als „Das beste<br />
Buch der Welt“.<br />
>Die Zeitmaschine
�omas E. Lawrence<br />
Die sieben Säulen<br />
der Weisheit<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4230-1456-4<br />
© dtv<br />
Johann W. von Goethe<br />
Italienische Reise<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-4231-2402-7<br />
© dtv<br />
T. E. Lawrence, der legendäre ‚Lawrence von Arabien‘, war<br />
ursprünglich Archäologe und Sprachforscher. Im Ersten<br />
Weltkrieg trat er als britischer Agent in den Dienst des Arab<br />
Bureau in Kairo; 1916 knüpfte er Kontakte zum Emir von<br />
Mekka und organisierte, unterstützt von dessen Sohn Faisal,<br />
den von England geschürten Aufstand der Araber gegen die<br />
Türkenherrschaft - mit großem Erfolg dank der neuartigen<br />
Guerillataktik. Lawrence, der sich bei seinem Auftrag<br />
zunehmend mit dem arabischen Freiheitsideal identifiziert,<br />
wird dabei selbst zu einem Sohn der Wüste, der Burnus und<br />
Krummsäbel trägt, die Gewohnheiten der Wüstenbewohner<br />
annimmt und der wie sie das mörderische Klima, die Qualen<br />
des Durstes, der Entbehrung sowie die Strapazen der endlosen<br />
Kamelritte zu ertragen versteht. Sein packender, aus der Sicht<br />
des aktiven Partisanenkämpfers geschriebener Bericht über<br />
den Aufstand in der Wüste erschöpft sich jedoch nicht in der<br />
Darstellung der militärischen Ereignisse, sondern er beschreibt<br />
zugleich eingehend Bräuche und Mentalität der Wüstenvölker<br />
und die bizarren Eigenartigkeiten des Lebensraumes.<br />
Früh drei Uhr stahl ich mich aus Karlsbad, weil man<br />
mich sonst nicht fortgelassen hätte. Man schreibt den 3.<br />
September 1786. Nur mit Mantelsack und Dachsranzen<br />
ausgerüstet, verwirklicht Goethe den seit seiner Kindheit<br />
gehegten Wunsch, selber das Land zu betreten, das er schon<br />
aus den Beschreibungen seines Vaters kannte. Er bricht nach<br />
Italien auf, als die Problematik seiner Weimarer Existenz zur<br />
lebensbedrohlichen Krise geworden war - die Unmöglichkeit,<br />
gleichzeitig dem öffentlichen Amt und der dichterischen<br />
Berufung zu leben; dazu die Anssichtslosigkeit seiner Liebe<br />
zu Charlotte von Stein.<br />
105
�omas Mann<br />
Der Tod in Venedig<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-596-90027-5<br />
© Fischer Klassik<br />
�omas Mann<br />
Zauberberg<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-596-90124-1<br />
© Fischer Klassik<br />
106<br />
�omas Manns Erzählungen sind vor allem eines: großartige<br />
und abgründige Liebesgeschichten. Der alternde Gustav<br />
Aschenbach zum Beispiel, den es nach Venedig treibt,<br />
verliebt sich an der schwülen Lagune hoffnungslos in den<br />
jungen Tadzio und bringt es auch dann nicht über sich, die<br />
Stadt zu verlassen, als die Cholera ausbricht … Luchino<br />
Visconti hat die Melancholie und Sinnlichkeit des ›Tod in<br />
Venedig‹ kongenial verfilmt, Benjamin Britten hat sie vertont,<br />
und John Neumeier hat sie sogar getanzt.<br />
Ein epochaler Roman, ein Roman, der aufs Ganze geht und<br />
es wagt, die eigene Zeit in Gedanken und große epische<br />
Zusammenhänge zu fassen – was heute vor allem von amerikanischen<br />
Autoren wie Richard Powers oder Philip Roth<br />
geleistet wird, haben die Autoren der Klassischen Moderne<br />
schon lange vorher durchgespielt. Wie klug und vergnüglich<br />
diese Autoren erzählen konnten, sieht man am Vorbild aller<br />
Epochen-Romane: an �omas Manns berühmtem ›Zauberberg‹,<br />
in dem ein Davoser Lungensanatorium zur großen<br />
Weltbühne wird.
Charles Dickens<br />
David Copperfield<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-596-90009-1<br />
© Fischer Klassik<br />
Charles Dickens<br />
Oliver Twist<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-596-90042-8<br />
© Fischer Klassik<br />
Das England der beginnenden Industrialisierung: harsche<br />
Erziehungseinrichtungen, Schuldnergefängnisse. Es schlägt<br />
Mitternacht an einem Freitag, da mischt sich unter die Glockenschläge<br />
der Schrei des Neugeborenen David Copperfield.<br />
Kein gutes Omen. Doch Charles Dickens versteht es, mit<br />
überbordendem Realismus und scharfer Zunge, mit Gefühl<br />
und Witz, nicht nur den Leidensweg des Jungen zu schildern,<br />
sondern ein buntes Regiment an Figuren vorzuführen, die<br />
in ihrer Verbohrtheit oder Herzensgüte noch lange lebendig<br />
bleiben, nachdem man das Buch zugeschlagen hat.<br />
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der<br />
Redaktion der<br />
Schurken, schmieriges Elend, ein hilfloses, unterdrücktes<br />
Waisenkind. Dutzende Film- und Fernsehadaptionen hat<br />
Dickens’ Roman inspiriert. Einst wühlte das krasse Porträt<br />
des jüdischen Schurken Fagin die Gemüter auf. Heute stört<br />
sich Roman Polanski an der Hoffnung, dass das Gute im<br />
Menschen über die Ungerechtigkeit triumphieren kann.<br />
Dickens’ ›Oliver Twist‹ lebt weiter, weil er eine existenzielle<br />
Spannung gestaltet: der Einzelne gegen die Gesellschaft.<br />
107
Edgar Allan Poe<br />
Grusel- u. Schauergeschichten<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-596-90134-0<br />
© Fischer Klassik<br />
Daniel Defoe<br />
Robinson Crusoe<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-596-90052-7<br />
© Fischer Klassik<br />
108<br />
Dunkel und gespenstisch sind Edgar Allan Poes schaurige<br />
Geschichten, die ganz ohne das übliche Repertoire des<br />
Schaurigen, ohne Geister und Gespenster, auskommen. Die<br />
Menschen selbst sind es, die sich in Angst und Schrecken<br />
versetzen: In der königlichen Spaßgesellschaft muss ein<br />
verkrüppelter Zwerg, seiner physischen Deformation wegen als<br />
›Hopp-Frosch‹ verlacht, das Entertainment auf Kosten seiner<br />
eigenen Würde gewährleisten. Systematisch erniedrigt, wächst<br />
in ihm ein unbändiger Rachedurst heran. Er treibt seinen<br />
Beruf auf die Spitze und erlaubt sich einen tödlichen Spaß …<br />
Eine einsame Insel in der Südsee, Kannibalen und ein<br />
Freund namens Freitag. ›Robinson Crusoe‹ ist einer der<br />
bekanntesten Abenteuerromane aller Zeiten, und Filme<br />
wie ›Castaway‹, Gameshows wie ›Survivor‹ oder Fernsehserien<br />
wie ›Lost‹ speisen sich aus dieser faszinierenden Welt,<br />
ihrer Romantik und ihrem Schauer: Robinson kämpft sich<br />
mit Pfiff und einer ordentlichen Portion Mut durch seine<br />
exotische Umwelt. Und lernt nichts weniger, als auf eigenen<br />
Füßen zu stehen.
Homer<br />
Odysee<br />
Roman<br />
ISBN 978-3-596-90019-0<br />
© Fischer Klassik<br />
Hape Kerkeling<br />
Ich bin dann mal weg<br />
ISBN: 978-3-492-25175-7<br />
© Piper<br />
Das Epos von König Odysseus ist zu einem Urmythos der<br />
abendländischen Kultur geworden. Odysseus kann durch<br />
seine Beharrlichkeit und seinen Einfallsreichtum von seiner<br />
verworrenen Reise heimkehren. Die imaginative Kraft, die<br />
heldenhafte Größe dieser über 2500 Jahre alten Geschichte<br />
besticht noch heute mit ihrer bilderreichen Schönheit und<br />
inspiriert mit ihrem Schatz an irrwitzigen Geschichten so<br />
skurrile Verfilmungen wie die Mississippi-Odyssee ›O Brother,<br />
Where Art �ou‹ der Kultregisseurbrüder Coen.<br />
Hape Kerkeling, Deutschlands vielseitigster TV-Entertainer,<br />
lief zu Fuß zum Grab des heiligen Jakob - über 600<br />
Kilometer durch Spanien bis nach Santiago de Compostela<br />
- und erlebte die reinigende Kraft der Pilgerreise. Ein außergewöhnliches<br />
Buch voller Witz, Weisheit und Wärme, ein<br />
ehrlicher Bericht über die Suche nach Gott und sich selbst<br />
und den unschätzbaren Wert des Wanderns.<br />
109
Impressum:<br />
Herausgegeben von: <strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong> eine Marke der <strong>TUI</strong> Austria Holding GmbH, Heiligenstädter<br />
Straße 31, 1190 Wien · In Kooperation mit �alia Buch & Medien GmbH, 4020 Linz · Für den Inhalt<br />
verantwortlich: Manfred Fussek und Birgit Schott · Konzept, Gestaltung, Satz: Freund Werbeagentur<br />
GmbH, 4020 Linz · Druck: Druckerei Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn
Bücher, Papier, Medien<br />
Urlaub hat viele schöne Seiten<br />
Es freut uns, dass Sie Ihre wertvolle<br />
Freizeit dem <strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong><br />
anvertrauen und wir wünschen<br />
Ihnen schon heute einen schönen,<br />
erholsamen Urlaub. Als kleines<br />
Dankeschön für Ihre Reisebuchung<br />
soll Ihnen dieses Buch einen<br />
Vorgeschmack auf die Urlaubszeit<br />
als Lesezeit vermitteln. Gemeinsam<br />
mit Thalia, Österreichs größter<br />
Qualitätsbuchhandlung, präsentieren<br />
wir Ihnen darin Leseproben aus<br />
12 Bestseller-Neuerscheinungen<br />
und 24 Taschenbuch Klassikern<br />
des aktuellen Thalia-Programms.<br />
Lesen Sie sich ein und wählen Sie<br />
Ihr Lieblingsbuch als Lektüre für<br />
den bevorstehenden Urlaub aus.<br />
Ihr <strong>TUI</strong> <strong>ReiseCenter</strong> und Thalia<br />
machen es Ihnen dann gerne zum<br />
Geschenk.