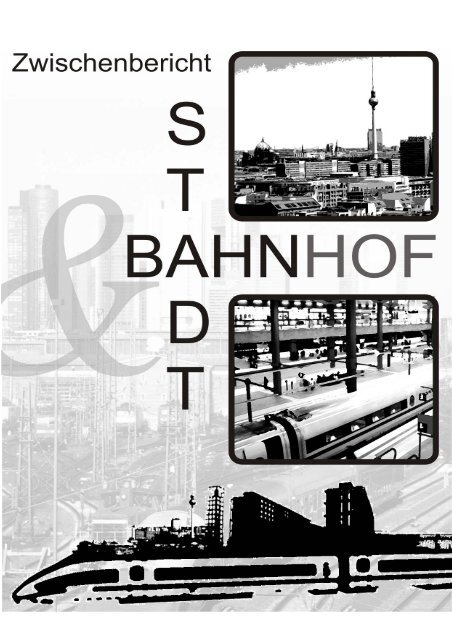Zwischenbericht (pdf, 8 MB) - Stadt und Bahnhof
Zwischenbericht (pdf, 8 MB) - Stadt und Bahnhof
Zwischenbericht (pdf, 8 MB) - Stadt und Bahnhof
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Technische Universität Berlin, Fakultät VI<br />
Institut für <strong>Stadt</strong>- <strong>und</strong> Regionalplanung<br />
Fachgebiet <strong>Stadt</strong>- <strong>und</strong> Regionalökonomie<br />
Hardenbergstraße 40a<br />
10623 Berlin<br />
<strong>Zwischenbericht</strong><br />
Studienprojekt im Hauptstudium: <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong><br />
Internetseite: www.stadt<strong>und</strong>bahnhof.de<br />
Projektleitung: Prof. Dr. Dietrich Henckel<br />
Projektteilnehmer: Ceren Çakir, Stephan Gubi, Harald Horster, Armand Kokotkiewicz,<br />
Josiane Meier, Sirko Mill, Alexander Petau, André Przesang, Paul Salomon, Natalia Schmidt,<br />
Agnieszka Szpatowicz, Evelyn Westphal, Marco Witte, Qi Xie, Zhou Ye<br />
Juli 2007, Berlin<br />
1
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort ....................................................................................................... 5<br />
Einleitung .................................................................................................... 6<br />
Gr<strong>und</strong>lagen .................................................................................................. 9<br />
1. Ökonomie der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> ................................................... 12<br />
1.1 Einleitung .................................................................................... 12<br />
1.2 Gr<strong>und</strong>lagen ................................................................................. 13<br />
1.3 Der <strong>Bahnhof</strong> als Immobilie ............................................................. 14<br />
1.3.1 Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen ............................................................. 14<br />
1.3.2 Abgrenzung <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> Empfangshalle .................................... 15<br />
1.3.3 Der <strong>Bahnhof</strong> als immobilienwirtschaftliches Objekt ....................... 16<br />
1.4 Übergang vom Beförderungszentrum zum Einkaufszentrum ............... 23<br />
1.4.1 Erlebnisfaktor <strong>Bahnhof</strong> ............................................................. 27<br />
1.4.2 Einkaufscenter im <strong>Bahnhof</strong> ....................................................... 28<br />
1.5 Exkurse ...................................................................................... 32<br />
1.5.1 Vergleich von <strong>Bahnhof</strong>, Flughafen <strong>und</strong> Hafen ............................... 32<br />
1.5.2 Englands Bahnhöfe <strong>und</strong> deren Entwicklung seit der Privatisierung der<br />
Englischen Bahn ..................................................................................... 34<br />
1.6 Fazit ........................................................................................... 37<br />
2. Ökonomische Gr<strong>und</strong>lagen des Bahnbetriebs ..................................... 38<br />
2.1 Gr<strong>und</strong>lagen der Gleis- <strong>und</strong> Bahnsteiganlagenplanung ........................ 38<br />
2.1.1 Rechtsgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Richtlinien für die Konzeption von Gleisen <strong>und</strong><br />
Bahnsteigen ........................................................................... 39<br />
2.1.2 Technische Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Merkmale von Gleisen ...................... 41<br />
2.1.3 Technische Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Merkmale von Bahnsteigen ................ 44<br />
2.1.4 Fazit Gleis- <strong>und</strong> Bahnsteiganlagen ............................................. 48<br />
2.2 Zugverkehr ................................................................................. 49<br />
2.2.1 Verbindungen der Bahnhöfe der Kategorie 1 ............................... 52<br />
2.2.2 Verbindungsanalyse ................................................................ 52<br />
2.2.3 Fazit Zugverkehr ..................................................................... 61<br />
2.3 Umgang mit Wettbewerbern .......................................................... 62<br />
2.3.1 Trassenpreissystem ................................................................. 62<br />
2.3.2 Stationspreissystem ................................................................ 69<br />
2.3.3 Fazit Umgang mit den Wettbewerbern ........................................ 78<br />
2.4 Exkurs: Ökologie im <strong>Bahnhof</strong>betrieb ............................................... 79<br />
2.4.1 Ökologische Aspekte im <strong>Bahnhof</strong>betrieb ..................................... 79<br />
2.4.2 Fazit Ökologie im <strong>Bahnhof</strong>betrieb .............................................. 80<br />
3. Ökonomie <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong> ......................................................... 81<br />
3.1 Ökonomische Faktoren in der Beziehung zwischen <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong> . 81<br />
3.1.1 Bahnhöfe als Arbeitgeber ......................................................... 81<br />
3.1.2 Bahnhöfe als Kristallisationskerne für Funktionen ......................... 83<br />
3.1.3 Bahnhöfe als Netzknoten .......................................................... 90<br />
3.1.4 Finanzielle Mittel der Städte für einen <strong>Bahnhof</strong>, oder alles<br />
B<strong>und</strong>esgelder? ........................................................................ 91<br />
3.1.5 <strong>Bahnhof</strong> als Wirtschaftsmotor eines <strong>Stadt</strong>teils oder sogar einer<br />
ganzen <strong>Stadt</strong>? ........................................................................ 92<br />
2
3.1.6 Standortmarketing der <strong>Stadt</strong> im Bezug auf Bahnhöfe ................... 92<br />
3.2 Derzeitige Entwicklungen............................................................... 97<br />
3.2.1 Bahnhöfe als Visitenkarten bzw. Imageträger der <strong>Stadt</strong> ................ 97<br />
3.2.2 Bahnhöfe als Einzelhandels- <strong>und</strong> Dienstleistungszentren ............. 100<br />
3.2.3 Bahnhöfe als Event- <strong>und</strong> Erlebnisstätten ................................... 101<br />
3.3 Fazit ......................................................................................... 102<br />
4. <strong>Bahnhof</strong>sumfeld ......................................................................... 104<br />
4.1 Eigenschaften <strong>und</strong> Definition des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds ......................... 105<br />
4.2 Historische Entwicklung ............................................................... 112<br />
4.2.1 Die Anfänge: Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts .................................. 113<br />
4.2.2 Konsolidierung: Ab Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts .......................... 114<br />
4.2.3 Wandel: Um den Zweiten Weltkrieg ......................................... 116<br />
4.2.4 Bedeutungsverlust: Die 1950er bis 70er Jahre .......................... 117<br />
4.2.5 Wiederentdeckung <strong>und</strong> der Wunsch nach dem großen Wurf: 1980er<br />
<strong>und</strong> 90er Jahre ..................................................................... 119<br />
4.3 Gegenwärtige Aspekte der <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung ................... 120<br />
4.3.1 Überlokale Rahmenbedingungen ............................................. 122<br />
4.3.2 Rahmenbedingungen, Akteure <strong>und</strong> Prozesse ............................. 124<br />
4.3.3 Entwicklungschancen <strong>und</strong> Konsequenzen im lokalen Kontext ....... 132<br />
4.3.4 Nutzungsstruktur .................................................................. 134<br />
4.3.5 Ökonomische Aspekte ............................................................ 139<br />
4.3.6 Soziale Aspekte .................................................................... 144<br />
4.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Ausblick ................................................... 146<br />
5. Verhältnis <strong>Stadt</strong> – <strong>Bahnhof</strong> .......................................................... 148<br />
5.1 <strong>Bahnhof</strong>sflächen aus der Sicht der <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>planung ...<br />
............................................................................................... 148<br />
5.2 Entwicklungsmöglichkeiten für <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Quartier ........................... 150<br />
5.2.1 <strong>Bahnhof</strong>sneubau ................................................................... 150<br />
5.2.2 <strong>Bahnhof</strong>sschließung – Beispiel Ehemaliger Solingen Hauptbahnhof ....<br />
.......................................................................................... 157<br />
5.2.3 <strong>Bahnhof</strong>sumbau – Stuttgart Hauptbahnhof ............................... 159<br />
5.2.4 <strong>Bahnhof</strong>sverlegung- Beispiel <strong>Bahnhof</strong> Bozen ............................. 162<br />
5.3 Umgang mit brachgefallenen Bahnflächen ...................................... 164<br />
5.4 Fazit ......................................................................................... 168<br />
6. Architektur <strong>und</strong> räumliche Zusammenhänge der Bahnhöfe ............... 169<br />
6.1 Die Entwicklung der <strong>Bahnhof</strong>sarchitektur ....................................... 169<br />
6.2 Schienengestützte Siedlungsentwicklung ....................................... 171<br />
6.2.1 Gründe für die Orientierung zur schienengestützten<br />
Siedlungsentwicklung ............................................................ 173<br />
6.2.2 Definition „Schienengeb<strong>und</strong>ene Siedlungsentwicklung“ ............... 174<br />
6.2.3 Ziele ................................................................................... 174<br />
6.2.4 Umsetzung ........................................................................... 175<br />
6.2.5 Förderung der schienengestützten Siedlungsentwicklung in<br />
Deutschland ......................................................................... 184<br />
6.2.6 Schienengestütze Siedlungsentwicklung in anderen Ländern ....... 186<br />
6.3 Städtebauliche Zusammenhänge .................................................. 189<br />
6.3.1 Städtebauliche Funktionen von Bahnhöfen ................................ 189<br />
6.3.2 Gewichtete Anordnung der Verkehrsnutzungen ......................... 190<br />
3
6.4 Luftbildanalyse von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern ......................................... 192<br />
6.4.1 Einleitung <strong>und</strong> Vorgehensweise ............................................... 192<br />
6.4.2 Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Kriterien der Luftbildanalyse ............................ 193<br />
6.4.3 Ergebnisse der Luftbildanalyse ................................................ 195<br />
6.4.4 Analyse <strong>und</strong> Klassifizierung .................................................... 199<br />
6.4.5 Sonderfälle von Bahnhöfen ..................................................... 207<br />
6.5 Fazit ......................................................................................... 211<br />
7. Rolle des <strong>Bahnhof</strong>s ..................................................................... 213<br />
7.1 Image der Bahnhöfe ................................................................... 213<br />
7.1.1 Eisenbahnimperien ................................................................ 213<br />
7.1.2 Bedeutungsverlust von der Bahnhöfe als „Zentrum der Welt” ...... 215<br />
7.1.3 Renaissance der Bahnhöfe ...................................................... 218<br />
7.1.4 Fazit.................................................................................... 219<br />
7.2 <strong>Bahnhof</strong> in der Kunst .................................................................. 219<br />
8. Internationale Bahnhöfe im Vergleich ............................................ 226<br />
8.1 Eisenbahn in Japan ..................................................................... 226<br />
8.1.1 Shibuya-Station .................................................................... 228<br />
8.1.2 Shinjuku-Station ................................................................... 229<br />
8.1.3 Tokio Hauptbahnhof .............................................................. 230<br />
8.2 Eisenbahn in England .................................................................. 231<br />
8.3 Eisenbahn in Frankreich .............................................................. 233<br />
8.3.1 Euralille, Lille ........................................................................ 235<br />
Quellen: ................................................................................................... 239<br />
Tabellenverzeichnis: ................................................................................... 253<br />
Abbildungsverzeichnis: ............................................................................... 254<br />
4
Vorwort<br />
Der spektakuläre Neubau des Berliner Hauptbahnhofes <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Verlagerung von Funktionen im <strong>Stadt</strong>gebiet war Anlass sich mit dem Verhältnis von <strong>Stadt</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong> auseinanderzusetzen. Denn nicht nur in Berlin, sondern in vielen Städten<br />
Deutschlands, Europas <strong>und</strong> der Welt befinden sich die Struktur des Eisenbahnnetzes <strong>und</strong> die<br />
Rolle der Bahnhöfe in einem weit reichenden Wandel. Dabei geht es aber nicht nur um die<br />
veränderte Rolle der Bahnhöfe selbst, ihren Wandel zu funktionsintegrierten Großstrukturen,<br />
sondern auch um die Rolle der Bahnhöfe für die <strong>Stadt</strong>entwicklung, die Folgen des<br />
Funktionswandels der Bahnhöfe für die Städte.<br />
Im Rahmen des Studienprojektes „<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>“ im Studienjahr 2007/08 am Institut<br />
für <strong>Stadt</strong>- <strong>und</strong> Regionalplanung der TU Berlin wurde daher im SS 2007 eine umfangreiche<br />
Analyse der geschichtlichen Entwicklung der Bahnhöfe <strong>und</strong> ihrer Veränderung, der Rolle des<br />
<strong>Bahnhof</strong>s als Immobilie, der Einflüsse der Bahnreform, des Verhältnisses zwischen <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Bahnhof</strong>, des Images von Bahnhöfen, der Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern<br />
durchgeführt.<br />
Diese Untersuchung bietet die Gr<strong>und</strong>lage für eine empirische Untersuchung der Folgen der<br />
Verlagerung der Hauptbahnhofsfunktionen in Berlin, die für das WS 2007/08 vorgesehen ist.<br />
Bei der Gr<strong>und</strong>lagenuntersuchung wurde die Projektgruppe von zahlreichen Personen<br />
unterstützt. Herr Eglit von der Deutschen Bahn AG hielt einen Vortrag über die Struktur der<br />
Bahn <strong>und</strong> die immobilienwirtschaftlichen Konzepte. Im Rahmen einer Exkursion nach Leipzig<br />
wurden das Projekt des Umbaus des Leipziger Hauptbahnhofs <strong>und</strong> die Entwicklungen im<br />
Umfeld aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Herr Beck vom ECE-Centermanagement<br />
der „Promenaden“ im Hauptbahnhof stellte das Konzept des Unternehmens <strong>und</strong> die Spezifika<br />
des Projektes im Leipziger Hauptbahnhof vor. Herr Wolff vom <strong>Stadt</strong>planungsamt der <strong>Stadt</strong><br />
führte in die städtische Planung zum <strong>Bahnhof</strong>sumfeld am Hauptbahnhof <strong>und</strong> an anderen<br />
(ehemaligen) Bahnhöfen der <strong>Stadt</strong> ein. Herr Hahn von der IHK Leipzig gaben einen Einblick<br />
in die Positionen der IHK zur <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung (<strong>und</strong> darüber hinaus) in Leipzig. Allen<br />
Personen sei an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, uns an ihrem Know-how<br />
teilhaben zu lassen <strong>und</strong> sich unseren kritischen Fragen zu stellen, gedankt.<br />
Dietrich Henckel<br />
Berlin 13.07.07<br />
5
Einleitung<br />
Bahnhöfe prägen seit mehr als 150 Jahren das <strong>Stadt</strong>bild. Insbesondere in Großstädten<br />
lassen sich monumentale Bauwerke bew<strong>und</strong>ern, denen zuweilen die Bezeichnungen „Tor zur<br />
<strong>Stadt</strong>“ oder sogar „Tor zur Welt“ beigemessen wurden <strong>und</strong> werden 1 . Architektur,<br />
Kunstepochen, Zeitgeist – all dies spiegelt sich in einer Vielzahl von <strong>Bahnhof</strong>s-Bauwerken<br />
wieder. Dabei ist die <strong>Stadt</strong> in der Regel um den <strong>Bahnhof</strong> herum gewachsen. Dort wo sich<br />
heute Bahnhöfe befinden, befanden sich einst dünn besiedelte, oft landwirtschaftlich<br />
genutzte Gebiete im näheren Umfeld der Städte. Die Verortung der Bahnhöfe vor den<br />
<strong>Stadt</strong>grenzen hatte einen enormen Einfluss auf die damalige <strong>Stadt</strong>entwicklung. Die <strong>Stadt</strong><br />
wuchs stärker um den <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> an den Gleisen anstatt um das ursprüngliche Zentrum<br />
der <strong>Stadt</strong>. So entstand neben dem schon vorhandenen <strong>Stadt</strong>zentrum im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld ein<br />
neuer <strong>Stadt</strong>kern. Viele der Bahnhöfe sind Kopfbahnhöfe, da man sie so dicht wie möglich an<br />
die <strong>Stadt</strong> heranbaute, die Gleise aber nicht durch die <strong>Stadt</strong> fortführte. Ein Umstand den man<br />
in letzter Zeit – insbesondere zum Ausdruck gebracht durch die Projekte21 – zu ändern<br />
versucht. <strong>Stadt</strong>bahnhöfe, die zuvor in den verschiedenen Himmelsrichtungen als einzelne<br />
Kopfbahnhöfe situiert waren, werden durch kostspielige Vorhaben miteinander verb<strong>und</strong>en,<br />
um die Effektivität der Eisenbahn <strong>und</strong> der Bahnhöfe in den jeweiligen Städten zu steigern.<br />
Galt die Eisenbahn ab Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts zusammen mit der Schwerindustrie <strong>und</strong><br />
dem Maschinenbau als Tempogeber für die Industrialisierung Deutschlands <strong>und</strong> den Ausbau<br />
der Städte 2 <strong>und</strong> demzufolge auch der Bahnhöfe, wurden der Eisenbahn insbesondere in den<br />
so genannten „goldenen 1960er“ Jahren Grenzen aufgezeigt. Als nicht konkurrenzfähiges<br />
Verkehrsmittel unterlag die Eisenbahn dem Auto <strong>und</strong> dem motorisierten Individualverkehr.<br />
Die „verkehrsgerechte <strong>Stadt</strong>“ – ein Leitbild der damaligen <strong>Stadt</strong>planung – fokussierte die<br />
Bedürfnisse der <strong>Stadt</strong>- <strong>und</strong> Infrastrukturplanung weniger auf Bahnhöfe als auf große<br />
Parkhäuser.<br />
Unbeachtet von der <strong>Stadt</strong>planung <strong>und</strong> Politik wurden die Bahnhöfe von der Gesellschaft zu<br />
„Un-Orten“ degradiert <strong>und</strong> zogen in Folge der öffentlichen Missachtung insbesondere in dem<br />
Gebiet „hinter“ dem <strong>Bahnhof</strong> (auf der Rückseite – nicht dem <strong>Stadt</strong>zentrum zugewandt) das<br />
Rotlicht- <strong>und</strong> Drogenmilieu an.<br />
Nicht nur die Ölkrise in den 1970er Jahren, sondern auch ein gewandeltes<br />
Planungsverständnis ließen den <strong>Bahnhof</strong> wieder vermehrt in den Fokus planerischer<br />
Aktivitäten rücken. Die <strong>Stadt</strong> sollte <strong>und</strong> soll nun „nachhaltig“ <strong>und</strong> „ökologisch“ sein. Die<br />
Eisenbahn trat nach langer Zeit wieder ins Interesse der Öffentlichkeit: Die sogenannte<br />
„Renaissance der Bahnhöfe“ begann. Die Bahn wurde als Verkehrsmittel wieder zunehmend<br />
1<br />
http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/27.05.2006/2557461.asp (2007): Der Tagesspiegel (27.05.2006),<br />
Berlins gläsernes Tor zur Welt (Zugriff: 16.05.2007).<br />
2<br />
http://www.muenchen.de/<strong>Stadt</strong>leben/Specials/Kulturgeschichtspfade/neuhausen_nymphenburg/querschnitt/144<br />
168/quer_eisenbahn.html (2007): KulturGeschichtsPfade: Eisenbahn/Industrialisierung. <strong>Stadt</strong> München. (Letzter<br />
Zugriff: 05.07.2007).<br />
6
akzeptiert. Die Politik <strong>und</strong> die Deutsche Bahn AG ergriffen Maßnahmen zum Ausbau der<br />
Netze <strong>und</strong> Bahnhöfe.<br />
Die Privatisierung der Deutschen Bahn AG über die 1994 begonnene Bahnreform verpflichtet<br />
zu Rentabilität. Seitdem wurden „455 Strecken“ stillgelegt <strong>und</strong> das Streckennetz wurde von<br />
„42.800 auf 34.200 Kilometer gekürzt“ 3 . Dies hat unweigerlich Auswirkungen auf die<br />
Infrastrukturversorgung, insbesondere im eher ländlichen Raum, gibt aber auch<br />
privatwirtschaftlichen Investoren die Möglichkeit auf stillgelegten Strecken den Betrieb zu<br />
übernehmen <strong>und</strong> diese Strecken zu bewirtschaften. In Bezug auf den<br />
Betrachtungszusammenhang „<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>“ ist diese Entwicklung jedoch zunächst ein<br />
anderes Thema <strong>und</strong> nicht von vorrangiger Bedeutung.<br />
Wo die Deutsche Bahn AG auf der einen Seite spart, investiert sie auf der anderen. Die Top-<br />
Bahnhöfe Deutschlands sollen sich an Flughäfen messen: In Ausstattung, Funktionalität,<br />
Erreichbarkeit <strong>und</strong> Bedeutung. Dies ist einer der Umstände, der die Funktionsanreicherungen<br />
der Bahnhöfe insbesondere im Bereich des Einzelhandels- <strong>und</strong> Dienstleistungssektors<br />
verstärkt. Die Deutsche Bahn AG stellt sich der Konkurrenz der so genannten „Billig-Flieger“<br />
<strong>und</strong> versucht, mit Preisnachlässen <strong>und</strong> Spezialpreisen die Menschen an die Bahn zu binden.<br />
Auch mit der Einrichtung von Hochgeschwindigkeitsstrecken wie beispielsweise zwischen<br />
Frankfurt <strong>und</strong> Paris stellt sich die Bahn oftmals als klare <strong>und</strong> vor allem ökologischere<br />
Alternative zum Flugzeug dar4.<br />
Egal ob Kopf- oder Durchgangsbahnhof, historisches Bauwerk oder neu errichteter<br />
Verkehrsknotenpunkt; was den <strong>Bahnhof</strong> seit den Anfängen der Eisenbahn prägt, sind die<br />
Menschen, die ihn nutzen. „Ein <strong>Bahnhof</strong> ohne Menschen ist wie ein Gesicht ohne Züge.“5 4,1<br />
Milliarden Menschen sind laut der Deutsche Bahn AG jährlich in Deutschlands Bahnhöfen<br />
unterwegs6. Davon sind viele Menschen nicht wegen der Eisenbahn, sondern wegen der<br />
Einkaufsmöglichkeiten oder anderen Dienstleistungen im <strong>Bahnhof</strong>. Dies wiederum kann<br />
unter Umständen Einflüsse auf die <strong>Stadt</strong>entwicklungsplanung haben. So stehen großräumige<br />
Einzelhandelsflächen möglicherweise in direkter Konkurrenz zum innerstädtischen<br />
Einzelhandelsangebot oder anderen Einkaufszentren.<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> hat sich über viele Jahre gewandelt <strong>und</strong> wandelt sich weiter. Die <strong>Stadt</strong> war <strong>und</strong><br />
ist mit dem <strong>Bahnhof</strong> nicht nur territorial verb<strong>und</strong>en. <strong>Stadt</strong>entwicklungen <strong>und</strong><br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungsprogramme sowie Leitbilder haben meist auch Folgen für den <strong>Bahnhof</strong><br />
impliziert, beziehungsweise die in Folge der <strong>Bahnhof</strong>svernachlässigung aufgetretenen<br />
sozialen Brennpunkte wurden wiederum Thema der <strong>Stadt</strong>entwicklungsplanung.<br />
3<br />
http://www.sciencegarden.de/berichte/200612/bahnreform/bahnreform.php (Januar 2007): Sciencegarden /<br />
Magazin für junge Forschung, Dieser Zug endet dort… (Letzter Zugriff: 14.07.2007)<br />
4<br />
http://www.focus.de/reisen/urlaubstipps/bahn_aid_56994.html (2007): Focus Online (22.05.2007),<br />
Hochgeschwindigkeitszüge: Konkurrenz für Billigflieger. (Letzter Zugriff: 14.07.2007)<br />
5<br />
Werner Mitsch, (*1936), deutscher Aphoristiker<br />
6<br />
DB Station & Service AG Marketing (ohne Jahresangabe): Geschäfte 1. Klasse Top-Gewerbeflächen in<br />
Deutschlands Bahnhöfen, Seite 5.<br />
7
Dieser <strong>Zwischenbericht</strong> dient nicht nur zur Einordnung der Geschichte der Bahnhöfe, der<br />
Rolle der Bahnhöfe oder der Entwicklungen im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld. Behandelt werden auch das<br />
Verhältnis <strong>und</strong> die ökonomischen Faktoren der Beziehung zwischen <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>. Es<br />
wird hinterfragt was man heutzutage unter der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> versteht <strong>und</strong> wie ein<br />
moderner Großbahnhof betrieben wird. Ein „Blick über den Tellerrand“ verdeutlicht an<br />
Beispielen das zum Teil andere Verständnis eines <strong>Bahnhof</strong>s im internationalen Kontext.<br />
Wir wünschen interessante Entdeckungen <strong>und</strong> aufschlussreiche Erfahrungen bei der Lektüre.<br />
8
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
� Definition des Begriffes <strong>Bahnhof</strong><br />
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter dem Begriff <strong>Bahnhof</strong> eine Empfangshalle<br />
mitsamt den dazugehörigen Bahnsteigen verstanden, an denen Reisende ankommen,<br />
abfahren oder umsteigen. Doch rein rechtlich gesehen ist der Begriff <strong>Bahnhof</strong> viel<br />
umfassender. Demnach sind Bahnhöfe „Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge<br />
beginnen, enden, ausweichen oder wenden dürfen. Als Grenze zwischen den Bahnhöfen <strong>und</strong><br />
der freien Strecke gelten im Allgemeinen die Einfahrsignale oder Trapeztafeln, sonst die<br />
Einfahrweichen“ (§ 4 Abs. 2 EBO 7 ). Doch dabei stellt sich schon die erste Frage: Was sind<br />
Bahnanlagen? Auch dafür hält das Gesetz eine Definition bereit, nach der Bahnanlagen „alle<br />
Gr<strong>und</strong>stücke, Bauwerke <strong>und</strong> sonstigen Einrichtungen einer Eisenbahn (sind), die unter<br />
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder<br />
Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind. Dazu gehören auch Nebenbetriebsanlagen<br />
sowie sonstige Anlagen einer Eisenbahn, die das Be- <strong>und</strong> Entladen sowie den Zu- <strong>und</strong><br />
Abgang ermöglichen oder fördern. Es gibt Bahnanlagen der Bahnhöfe, der freien Strecke <strong>und</strong><br />
sonstige Bahnanlagen. Fahrzeuge gehören nicht zu den Bahnanlagen.“ (§ 4 Abs. 1 EBO)<br />
� <strong>Bahnhof</strong>sarten<br />
Bahnhöfe lassen sich zudem auch nach der baulichen Anordnung der Gleis- <strong>und</strong> sonstigen<br />
Anlagen sowie nach ihrer Funktion in verschiedene <strong>Bahnhof</strong>sarten gliedern. Zur besseren<br />
Veranschaulichung werden die verschiedenen Arten in der nachfolgenden Tabelle erläutert.<br />
7 Eisenbahn- Bau- <strong>und</strong> Betriebsordnung<br />
9
Tabelle 1: <strong>Bahnhof</strong>sarten nach baulicher Anordnung der Gleis- <strong>und</strong> sonstigen<br />
Anlagen <strong>und</strong> nach Funktion<br />
<strong>Bahnhof</strong>sart Erläuterung Beispiele<br />
<strong>Bahnhof</strong>sarten nach baulicher Anordnung der Gleis- <strong>und</strong> sonstigen Anlagen<br />
Durchgangsbahnhof - häufigste <strong>Bahnhof</strong>sbauart Hauptbahnhöfe in Köln,<br />
- ein oder mehrere Hauptgleise Hannover, Darmstadt,<br />
durchlaufen das <strong>Bahnhof</strong>sgelände<br />
Augsburg, Bern, Innsbruck<br />
- Empfangsgebäude meist seitlich<br />
zum Gleisfeld<br />
- Sonderform: Reiterbahnhof, bei<br />
dem das Empfangsgebäude quer<br />
über den Gleisen liegt<br />
Hamburg, Kassel-<br />
Wilhelmshöhe<br />
- Sonderform: Inselbahnhof, bei<br />
dem das Empfangsgebäude<br />
zwischen den Gleisen liegt<br />
Halle (Saale)<br />
Kopfbahnhof oder - älteste <strong>Bahnhof</strong>sbauart<br />
Hauptbahnhöfe in Leipzig,<br />
Sackbahnhof<br />
- Endpunkt von einer oder<br />
München, Stuttgart, Zürich,<br />
mehreren Eisenbahnstrecken Frankfurt am Main<br />
Wien Westbahnhof<br />
Kreuzungsbahnhof - Kreuzung verschiedener<br />
Strecken an einem Punkt<br />
Berliner Hauptbahnhof<br />
- Sonderform: Turmbahnhof, an<br />
dem sich die Strecken<br />
kreuzungsfrei kreuzen<br />
Trennungsbahnhof - an einer Streckenabzweigung Gießen Hbf.<br />
- Sonderform: Keilbahnhof, bei<br />
dem das Empfangsgebäude<br />
zwischen der durchgehenden<br />
Strecke <strong>und</strong> dem abzweigenden<br />
Ast liegt<br />
Berührungsbahnhof - seltener <strong>Bahnhof</strong>styp<br />
Hauptbahnhöfe in Mühlheim<br />
- zwei nicht miteinander<br />
verb<strong>und</strong>ene Strecken laufen<br />
durch<br />
(Ruhr), Locarno<br />
Anschlussbahnhof - Ausgangs- bzw. Endpunkte der<br />
von Hauptstrecken<br />
abzweigenden Anschlussbahnen<br />
<strong>Bahnhof</strong>sarten nach Funktionen<br />
Personenbahnhof Sonderformen: Flughafenbahnhöfe, Berlin-Schönefeld, Frankfurt<br />
Messebahnhöfe, Abstellbahnhöfe, am Main-Flughafen,<br />
Postbahnhöfe<br />
Hannover Messe<br />
Güterbahnhof Sonderformen: Containerbahnhöfe, Ludwigshafen-BASF,<br />
nichtöffentliche Werks- oder<br />
Industriebahnhöfe, Zechenbahnhöfe,<br />
Hafenbahnhöfe, Rangierbahnhöfe<br />
Maschen bei Hamburg<br />
Verbindung aus Betriebsbahnhöfe, Grenzbahnhöfe, Frankfurt (Oder),<br />
Personen- <strong>und</strong><br />
Güterbahnhof<br />
Fährbahnhöfe, Spurwechselbahnhöfe<br />
Quelle: http://www.mikrooekonomie.de/<strong>Bahnhof</strong>.html Zugriff 06.07.2007 18.30 Uhr<br />
10
� Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen zu den Zuständigkeiten an Bahnhöfen<br />
Im Gr<strong>und</strong>gesetz der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland ist im Artikel 87e geregelt, dass der<br />
Eisenbahnverkehr für Eisenbahnen des B<strong>und</strong>es in b<strong>und</strong>eseigener Verwaltung geführt wird:<br />
„Der B<strong>und</strong> nimmt die über den Bereich der Eisenbahnen des B<strong>und</strong>es hinausgehenden<br />
Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr, die ihm durch B<strong>und</strong>esgesetz übertragen<br />
werden. Demnach werden Eisenbahnen des B<strong>und</strong>es als Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher<br />
Form geführt. Diese stehen im Eigentum des B<strong>und</strong>es, soweit die Tätigkeit des<br />
Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unterhaltung <strong>und</strong> das Betreiben von Schienenwegen<br />
umfasst.“ (Artikel 87e Abs. 2-3 GG)<br />
Durch die am 1. Januar 1994 eingeleitete Bahnreform wurden die ehemaligen<br />
Sondervermögen des B<strong>und</strong>es, die Deutsche B<strong>und</strong>esbahn <strong>und</strong> die Deutsche Reichsbahn in<br />
einen unternehmerischen <strong>und</strong> einen hoheitlichen Bereich geteilt. Seither untersteht der<br />
unternehmerische Bereich der Deutschen Bahn AG, während der hoheitliche Bereich, also die<br />
Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung, auf das neu eingerichtete Eisenbahn-<br />
B<strong>und</strong>esamt übertragen wurden. Das Eisenbahn-B<strong>und</strong>esamt ist dem B<strong>und</strong>esministerium für<br />
Verkehr, Bau- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung unterstellt. Es hat seine Zentrale in Bonn <strong>und</strong> ist<br />
Aufsichts- <strong>und</strong> Genehmigungsbehörde für die Eisenbahnen des B<strong>und</strong>es, für<br />
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland für das Gebiet der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland, für die nichtb<strong>und</strong>eseigenen Eisenbahnen im Auftrag von 13 der 16<br />
B<strong>und</strong>esländer sowie für Magnetschwebebahnen. 8<br />
Gemäß § 3 Abs. 1 BEVVG hat das Eisenbahn-B<strong>und</strong>esamt folgende Aufgaben 9 :<br />
1. die Planfeststellung für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des B<strong>und</strong>es,<br />
2. die Eisenbahnaufsicht,<br />
3. die Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des B<strong>und</strong>es,<br />
4. die Erteilung <strong>und</strong> den Widerruf einer Betriebsgenehmigung,<br />
5. die Ausübung hoheitlicher Befugnisse sowie von Aufsichts- <strong>und</strong> Mitwirkungsrechten nach<br />
Maßgabe anderer Gesetze <strong>und</strong> Verordnungen,<br />
6. die Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Vereinbarungen gemäß § 9 des<br />
B<strong>und</strong>esschienenwegeausbaugesetzes,<br />
7. die fachliche Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb,<br />
8. die Bewilligung von B<strong>und</strong>esmitteln zur Förderung des Schienenverkehrs <strong>und</strong> zur<br />
Förderung der Kombination des Schienenverkehrs mit anderen Verkehrsarten.<br />
8 http://www.eisenbahn-b<strong>und</strong>esamt.de/eba/vorwort.htm Zugriff 06.07.2007 18.30 Uhr<br />
9 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des B<strong>und</strong>es (B<strong>und</strong>eseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz)<br />
11
1. Ökonomie der Immobilie <strong>Bahnhof</strong><br />
1.1 Einleitung<br />
Eines steht fest: Ein Tag hat 24 St<strong>und</strong>en. Die Einteilung eines Tages ist individuell gestaltbar<br />
– oft treffen aber Interessen aufeinander <strong>und</strong> führen zu Zeitkonflikten <strong>und</strong> sei es nur bei der<br />
Einteilung der individuellen Zeit. „Die wahre Lebenskunst liegt darin, gleichzeitig hier <strong>und</strong> da<br />
zu sein“ 10 . Transiträume – Flughäfen, Bahnhöfe <strong>und</strong> im gewissen Maße Häfen – sind die<br />
Vorreiter einer 24/7-Gesellschaft. Also einer Gesellschaft, die theoretisch gesehen nicht<br />
schläft. Der nicht enden wollende Strom von potentiellen K<strong>und</strong>en innerhalb der international<br />
bedeutenden Flughäfen <strong>und</strong> Bahnhöfe führte zu einer Funktionsanreicherung. Schon lange<br />
sind sie nicht „nur“ Verkehrsknotenpunkte. Einkaufen <strong>und</strong> Erleben prägen die neue<br />
Generation von Flughäfen <strong>und</strong> Bahnhöfen.<br />
Den <strong>Bahnhof</strong> benötigt man nicht mehr nur zum Fahren an sich, sondern für das alltägliche<br />
Nebenher. Es sind die Dinge, die man ohne viel Zeitverlust nach oder vor dem Betreten<br />
eines Zuges erledigen kann. Schnell einen Anzug zur Reinigung abgeben, die vergessene<br />
Flasche Wasser kaufen, den Kaffeefleck (durch das hastige Trinken am <strong>Bahnhof</strong>) auf dem<br />
Hemd durch den Erwerb eines neuen Hemdes „ungeschehen“ machen. Der <strong>Bahnhof</strong> ist<br />
mittlerweile – wohl auch wegen seiner meist innerstädtischen Lage <strong>und</strong> den auf einen Ort<br />
komprimierten Menschenfluss – Einkaufsmall <strong>und</strong> Erlebniswelt <strong>und</strong> wird nicht nur von<br />
Bahnreisenden frequentiert (siehe dazu Kapitel 1.4 / Abb. 3).<br />
Die Deutsche Bahn AG, die größtenteils Eigener (über die Tochtergesellschaft: Station &<br />
Service) der bedeutenden Bahnhöfe Deutschlands ist, hat sich das Konzept des Einkaufs am<br />
<strong>Bahnhof</strong> schon seit geraumer Zeit zu Nutze gemacht. Der <strong>Bahnhof</strong> – respektive die<br />
Empfanghalle – wurde vom Wartesaal zur Einkaufsmall transformiert.<br />
Abb. 1: Vermietungsbroschüre der DB Station & Service AG<br />
Quelle: DB Station & Service AG Marketing 11<br />
10<br />
Krau, Ingrid & Romero Andreas (1998): Bahnhöfe als Einkaufs- <strong>und</strong> Dienstleistungszentren. In: Informationen zur<br />
Raumentwicklung , Heft 2/3 1998, S. 115.<br />
11<br />
DB Station & Service AG Marketing (ohne Jahresangabe): Geschäfte 1. Klasse - Top-Gewerbeflächen in<br />
Deutschlands Bahnhöfen.<br />
12
Das nebenstehende Bild ist dem Titelblatt der Vermietungsbroschüre der DB Station &<br />
Service AG entnommen. Treffender kann man die aktuelle Situation <strong>und</strong> die Hoffnungen der<br />
Deutschen Bahn an die überregional bedeutenden Bahnhöfe Deutschlands nicht beschreiben.<br />
Der Anspruch sind florierende Bahnhöfe!<br />
4,1 Milliarden Menschen sind laut der Deutschen Bahn jährlich in Deutschlands Bahnhöfen<br />
unterwegs. Allein auf dem neuen Berliner Hauptbahnhof – Lehrter <strong>Bahnhof</strong> werden täglich<br />
r<strong>und</strong> 300.000 potenzielle K<strong>und</strong>en verkehren 12 . Der Tag hat immer noch 24 St<strong>und</strong>en – doch<br />
der <strong>Bahnhof</strong> schläft nie.<br />
1.2 Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Ziel der Auseinandersetzung mit der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> ist es zum einen zu klären, was die<br />
Immobilie <strong>Bahnhof</strong> ist <strong>und</strong> zum anderen, wie sie sich im Laufe der Geschichte gewandelt<br />
hat.<br />
Es stellt jedoch eine gewisse Schwierigkeit dar, einen <strong>Bahnhof</strong> aus immobilienwirtschaftlicher<br />
Sicht einzuordnen. Zu mächtig <strong>und</strong> zu <strong>und</strong>urchsichtig sind die einzelnen (voneinander oft<br />
unabhängigen) Bauten, die einen <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> dessen Betrieb ermöglichen. Von<br />
Streckennetzen, die zu einem <strong>Bahnhof</strong> führen müssen, über Gleisanlagen im <strong>Bahnhof</strong> selbst,<br />
bis hin zu K<strong>und</strong>entoiletten oder Einkaufszentren reicht das Spektrum von<br />
betriebsnotwendigen Einrichtungen <strong>und</strong> deren, die man als erweiternd <strong>und</strong><br />
funktionsanreichernd bezeichnen muss.<br />
Die Renaissance der Bahnhöfe Anfang der 1990er Jahren 13 war nicht nur ein Indiz für das<br />
wieder gewonnene Potential der Bahn, sondern führte dazu, „dass auch wohlhabende<br />
Personen in großen Mengen durch zentral in der <strong>Stadt</strong> liegende Gebäude strömten“ 14 . Die<br />
Transformation der deutschen Bahnhöfe begann mit deren Renaissance <strong>und</strong> neuen<br />
Marketingstrategien der Deutschen Bahn. Diese zielten <strong>und</strong> zielen darauf ab, „die<br />
Besonderheit des Ortes durch neue Funktionen zu ergänzen <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>legend zu<br />
verändern“ 15 . Der <strong>Bahnhof</strong> ist zuweilen Beförderungszentrum, Einkaufsmall <strong>und</strong> stellt früher<br />
wie heute das „Tor zur Welt“ 16 dar.<br />
12<br />
ebenda, S. 5.<br />
13<br />
http://www.gradnet.de/papers/pomo2.papers/wucherpfennig00.htm (2007): Wucherpfennig. Architektur,<br />
Atmosphäre, Diskurs<br />
Zur Ästhetisierung eines städtischen Raumes im Zuge der “Renaissance der Bahnhöfe. (Letzter Zugriff:<br />
21.07.2007)<br />
14<br />
Schürmann, Carsten & Spiekermann, Klaus (1999): Dortm<strong>und</strong> Hauptbahnhof wird Verkehrsmagnet. In: Institut<br />
für Raumplanung Dortm<strong>und</strong>, Arbeitspapier 169, Die Überbauung des Dortm<strong>und</strong>er Hauptbahnhofs –<br />
Raumplanerische Beiträge zu einem Großprojekt, S. 81. Online unter: http://www.raumplanung.unidortm<strong>und</strong>.de/irpud/pro/ufo/schu_spi.<strong>pdf</strong>.<br />
(Letzter Zugriff: 21. Juni 2007)<br />
15<br />
Krau, Ingrid & Romero Andreas (1998): Bahnhöfe als Einkaufs- <strong>und</strong> Dienstleistungszentren. In: Informationen<br />
zur Raumentwicklung , Heft 2/3 1998, S. 116.<br />
16<br />
http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/27.05.2006/2557461.asp: Der Tagesspiegel (27.05.2006), Berlins<br />
gläsernes Tor zur Welt. (Letzter Zugriff: 16.05.2007)<br />
13
Diese Betrachtungsweise macht es unausweichlich im Zusammenhang der Ökonomie der<br />
Immobilie <strong>Bahnhof</strong> bestimmte, gr<strong>und</strong>legende Aspekte zu klären. Einerseits ist die Klärung<br />
des Begriffs „<strong>Bahnhof</strong>“ aus der Sicht der Immobilie von großer Bedeutung. Aktuelle<br />
<strong>Bahnhof</strong>sbauprojekte wie Stuttgart21 oder der Berliner Hauptbahnhof kosten Milliarden<br />
Euro. Dabei stellt sich die Frage, ab wo die Immobilie des <strong>Bahnhof</strong>s von anderen Bauten wie<br />
zum Beispiel dem Schienennetz getrennt werden kann. Andererseits muss betrachtet<br />
werden, inwieweit eine herkömmliche Renditeberechnung für eine Gewerbeimmobilie mit der<br />
Wirtschaftlichkeitsberechnung eines <strong>Bahnhof</strong>s konform ist.<br />
1.3 Der <strong>Bahnhof</strong> als Immobilie<br />
1.3.1 Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Die rechtlichen Gr<strong>und</strong>lagen bei der Bestimmung der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> ergeben sich aus<br />
zwei verschiedenen Gesetzen. Zum einen bildet das Allgemeine Eisenbahn Gesetz (AEG) die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen für die Bestimmung von Bahnhöfen, zum anderen wird in der Eisenbahn Bau<strong>und</strong><br />
Betriebsordnung (EBO) eine wesentlich differenzierte <strong>und</strong> genauere definitorische<br />
Begriffsbestimmung vollzogen.<br />
Im AEG wird in Paragraph (§) 2 eine recht allgemeine Begriffsbestimmung vorgenommen,<br />
nach der sich aus Absatz 3c ergibt, dass zu Serviceeinrichtungen folgende Einrichtungen zu<br />
zählen sind:<br />
1. Einrichtungen für die Brennstoffaufnahme,<br />
2. Personenbahnhöfe, deren Gebäude <strong>und</strong> sonstige Einrichtungen,<br />
3. Güterbahnhöfe <strong>und</strong> -terminals,<br />
4. Rangierbahnhöfe,<br />
5. Zugbildungseinrichtungen,<br />
6. Abstellgleise,<br />
7. Wartungseinrichtungen <strong>und</strong> andere technische Einrichtungen <strong>und</strong><br />
8. Häfen.<br />
Allerdings ist durch diese Definition keine ausreichende Klärung der Frage, was <strong>Bahnhof</strong> ist,<br />
gegeben. Im EBO wird wesentlich detaillierter auf die Begriffsbestimmung eingegangen. § 4<br />
befasst sich mit der Definition verschiedenster Bahnanlagen.<br />
Demnach ergibt sich aus § 4 EBO Absatz 1, dass Bahnanlagen, alle Gr<strong>und</strong>stücke, Bauwerke<br />
<strong>und</strong> sonstigen Einrichtungen einer Eisenbahn, die unter Berücksichtigung der örtlichen<br />
14
Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene<br />
erforderlich sind, umfassen. Weiterhin führt Absatz 1 aus, dass auch Nebenbetriebsanlagen<br />
sowie sonstige Anlagen einer Eisenbahn, die das Be- <strong>und</strong> Entladen sowie den Zu- <strong>und</strong><br />
Abgang ermöglichen oder fördern, dazugehören. Außerdem wird klargestellt, dass es<br />
Bahnanlagen der Bahnhöfe, der freien Strecke <strong>und</strong> sonstige Bahnanlagen gibt. Die<br />
Fahrzeuge gehören nicht zu den Bahnanlagen. In Absatz 2 § 4 EBO wird die Bahnanlage der<br />
Bahnhöfe genau definiert. Hier heißt es: Bahnhöfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer<br />
Weiche, wo Züge beginnen, enden, ausweichen oder wenden dürfen. Als Grenze zwischen<br />
den Bahnhöfen <strong>und</strong> der freien Strecke gelten im Allgemeinen die Einfahrsignale oder<br />
Trapeztafeln, sonst die Einfahrweichen.<br />
Aus § 4 Absatz 2 ergibt sich demnach, dass unter <strong>Bahnhof</strong> eine Bahnanlage mit mindestens<br />
einer Weiche zu verstehen ist. Als Grenze des <strong>Bahnhof</strong>s hin zur Bahnstrecke, die auch eine<br />
Bahnanlage ist, werden die Einfahrtssignale oder Trapeztafeln genannt. Allerdings kann auch<br />
die Einfahrweiche als Grenze betrachtet werden. Wichtig ist noch darauf hinzuweisen, dass<br />
auch Haltepunkte nach § 4 Absatz 8 wie Bahnhöfe erscheinen können, da Haltepunkte<br />
Bahnanlagen ohne Weichen sind, wo Züge planmäßig halten, beginnen oder enden dürfen.<br />
Die Unterscheidung ergibt sich also aus dem Vorhandensein von mindestens einer Weiche,<br />
ansonsten handelt es sich „nur“ um einen Haltepunkt <strong>und</strong> keinen <strong>Bahnhof</strong> im Sinne der<br />
rechtlichen Definition.<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> aus rechtsdefinitorischer Sicht gesehen beinhaltet nicht nur das<br />
Empfangsgebäude, sondern u. a. auch die Gleisanlagen <strong>und</strong> Betriebsanlagen. Hier kann eine<br />
Trennung zwischen betriebsnotwendigen <strong>und</strong> nicht betriebsnotwendigen Gebäuden vollzogen<br />
werden. Im Bezug zur Immobilie <strong>Bahnhof</strong> wird deutlich, dass diese nur die Empfangshalle<br />
umfasst (die nicht betriebsnotwendig ist), welche allerdings Nebenanlagen <strong>und</strong> –bauten<br />
aufweisen kann. Dementsprechend definiert sich die Immobilie <strong>Bahnhof</strong> über die<br />
Empfangshalle <strong>und</strong> deren im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Nebengebäude.<br />
1.3.2 Abgrenzung <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> Empfangshalle<br />
Die definitorische Bestimmung der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> kann nicht ausschließlich über die<br />
geltenden Rechte vollzogen werden. Eine weitere, ebenso wichtige Komponente stellt bei der<br />
Eingrenzung der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> die ökonomische Sichtweise <strong>und</strong> damit eine andere<br />
Herangehensweise dar.<br />
Dabei ist aus ökonomischer Sicht eine Trennung von <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> Empfangshalle nötig.<br />
Diese Trennung <strong>und</strong> Konzentration auf den Untersuchungsgegenstand Empfangshalle lässt<br />
sich damit begründen, dass zum einen die Wirtschaftlichkeit der Dienstleistung der Bahn im<br />
Sinne eines Infrastrukturunternehmens bzw. Infrastrukturdienstleisters <strong>und</strong><br />
Personenbeförderers nicht von der Empfangshalle abhängt, oder besser gesagt nur durch<br />
diese verändert <strong>und</strong> möglicherweise aufgewertet wird. Wie auch die EBO in § 4 rechtlich<br />
definiert, ist ein <strong>Bahnhof</strong> eine Haltestelle der Bahn mit mindestens einer Weiche. Es ist<br />
15
keinerlei Bezugnahme auf die Empfangshalle sowohl in der EBO als auch im AEG vorhanden.<br />
Eine Empfangshalle ist – überspitzt formuliert – für den Bahnbetrieb nicht notwendig, da der<br />
reine Bahnbetrieb schließlich auf Gleisanlagen läuft <strong>und</strong> zum Betreten der Bahn ein einfacher<br />
Bahnsteig genügen würde.<br />
Weitere Gründe für die Einteilung des Betrachtungsgegenstandes, bei einer ökonomischen<br />
Betrachtung unter der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> nur die Empfangshalle zu verstehen, ergeben sich<br />
daraus, dass ebenfalls bei der Förderung von Neubauten im Bereich der Bahn nur<br />
infrastrukturelle Maßnahmen begünstigt werden. Wie auch am Beispiel des Leipziger<br />
Hauptbahnhofs <strong>und</strong> dessen Umbaumaßnahmen bezüglich des City Tunnel Projekts 17<br />
verdeutlicht werden kann, sind die Fördermaßnahmen der EU, die aus dem Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung stammen, <strong>und</strong> weitere Förderungsgelder für den Ausbau der<br />
Infrastruktur gedacht, wie z.B. Gelder aus dem B<strong>und</strong>esschienenwegeausbaugesetz oder aus<br />
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Differenziert müssen hier die Förderungen<br />
(Subvention durch EU, B<strong>und</strong>, Länder oder Kommunen) beim <strong>Bahnhof</strong>sbau betrachten.<br />
Während es bei einem Gesamtbahnhof unterschiedliche Möglichkeiten gibt, einen <strong>Bahnhof</strong><br />
unter Hilfe von Subventionen zu finanzieren, ist die Empfangshalle (zumindest bei den Top-<br />
Bahnhöfen) ein privatwirtschaftliches Renditeobjekt, da sie als nicht bahnbetriebsnotwendig<br />
einzuordnen ist.<br />
Stationspreise, die die Deutsche Bahn AG für die Benutzung des <strong>Bahnhof</strong>s erhebt 18 werden<br />
unterdessen nicht für den Betrieb der Empfangshalle verwendet, sondern sie finanzieren die<br />
Unterhalts- <strong>und</strong> Nutzungskosten der betriebsnotwendigen Flächen am <strong>Bahnhof</strong> (siehe dazu<br />
auch Kapitel 2.3.2 / Stationspreissystem). Definiert man also die Immobilie <strong>Bahnhof</strong>,<br />
umfasst diese ausschließlich das Empfangsgebäude (bzw. den durch die Empfangshalle<br />
überbauten Bereich). Die durch diese Definition bestehende Abgrenzung der Empfangshalle<br />
von den bahnbetriebsnotwendigen Flächen, die sich im <strong>Bahnhof</strong> befinden, wird durch die<br />
Abgrenzung zum <strong>Bahnhof</strong>sumfeld <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>svorplatz abger<strong>und</strong>et (siehe dazu Kapitel 4.1<br />
/ Eigenschaften <strong>und</strong> Definition des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds).<br />
1.3.3 Der <strong>Bahnhof</strong> als immobilienwirtschaftliches Objekt<br />
Das Ziel bei der Investition in Gewerbeimmobilien ist in der Regel eine möglichst hohe<br />
Rendite zu erwirtschaften. Unter Rendite ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der<br />
Ertrag, der insgesamt aus einer Investition erzielt wird, zu verstehen. Im Immobilienbereich<br />
ist dies stets langfristig zu sehen. Steuerliche Aspekte spielen eine große Rolle, zudem hängt<br />
17<br />
Vgl. : http://www.citytunnelleipzig.de/, die EU übernimmt Kosten durch EFRE, den Fonds für regionale<br />
Entwicklung.<br />
18<br />
http://die.bahn.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/stationspreise/stationspre<br />
ise.html: DB AG. Transparent, übersichtlich <strong>und</strong> stabil. Das neue Stationspreissystem. (Letzter Zugriff:<br />
16.05.2007)<br />
16
die Rendite in starkem Maße von den sich häufig ändernden <strong>und</strong> auf aktuellen Entwicklungen<br />
beruhenden Marktgegebenheiten ab. 19<br />
Insgesamt wird also versucht, die Investitionssumme schnellstmöglich zu tilgen <strong>und</strong><br />
anschließend Gewinne zu erzielen. Dabei gibt es unterschiedliche Gründe in eine<br />
Gewerbeimmobilie <strong>und</strong> deren Erbauung zu investieren. Auf der einen Seite steht das genau<br />
definierte Vorhaben eines zukünftigen Mieters, der eine Gewerbeimmobilie nach seinen<br />
Vorstellungen plant oder planen lässt. Auf der anderen Seite steht ein Investor, der den<br />
Markt beobachtet, anhand der gesammelten Erkenntnisse eine Immobilie errichtet <strong>und</strong> über<br />
gezieltes Marketing Mieter akquiriert.<br />
In beiden Fällen ist es meist ein Projektentwickler, der von einem Vorhabenträger mit der<br />
Entwicklung, in der Regel auch der Erstellung, der Immobilie beauftragt wird. 20<br />
Der Gewerbeimmobilienmarkt kann unter anderem in die Teilbereiche: Büroimmobilie, Hotel<br />
<strong>und</strong> Gastronomie, Einzelhandel, Logistikimmobilie oder Produktionsimmobilie gegliedert<br />
werden. 21<br />
� Die Immobilie Großbahnhof<br />
Schon im frühen 19. Jahrh<strong>und</strong>ert waren Buchhandlungen in Bahnhöfen keine Seltenheit. 22 In<br />
Folge dessen wurde der <strong>Bahnhof</strong> immer mehr mit Funktionen belegt, die im eigentlichen<br />
Verständnis bahn- <strong>und</strong> bahnhofsfremd sind. Eine Funktionsdurchmischung fand statt. Heute<br />
sind Großbahnhöfe mehr als nur ein Verkehrsknotenpunkt. Sie vereinen in der Regel<br />
Geschäfte, Gastronomien oder Freizeitangebote unter einem Dach. In einigen Fällen kann<br />
man den <strong>Bahnhof</strong> als Einkaufscenter oder Shoppingmall betiteln, ohne ihm die seinerseits<br />
ursprünglich zugedachte Funktion abwerten zu wollen. Augenscheinlich werden außerdem<br />
Büroflächen ebenso wie Hotelgebäude mit dem <strong>Bahnhof</strong> verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> in ihn integriert.<br />
Der Großbahnhof lässt sich somit nicht in einem Teilbereich des Immobilienmarktes<br />
lokalisieren, sondern verbindet mehrere verschiedene dem Immobilienmarkt zuzuordnende<br />
Immobilienarten. Dabei überwiegt die Funktion einer Logistikimmobilie. Der Begriff der<br />
Logistikimmobilie ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht nur auf Güter- <strong>und</strong><br />
Warentransport bezogen, sondern beinhaltet zudem den Aspekt der Beförderung von<br />
Menschen. Die Bahn dient als Beförderungsdienstleister, der Personen mittels logistischer<br />
Planung expediert. Ihr angegliedert werden die Funktionen: Hotel <strong>und</strong> Gastronomie,<br />
Büroimmobilie <strong>und</strong> Einzelhandel. Dabei können die Grenzen an einigen Stellen ineinander<br />
verschwimmen. Daraus folgt, dass eine eindeutige Eingrenzung der Empfangshalle<br />
(Immobilie <strong>Bahnhof</strong>) mitunter schwierig ist. In den meisten Fällen von Großbahnhöfen<br />
handelt es ich um einen Gebäudekomplex, der mehrere Arten von Immobilien vereint.<br />
19<br />
Gehards H. & Keller H. (1990): Baufinanzierung von A bis Z, 2. Auflage, Betriebswirtschaftlicher Verlag.<br />
Wiesbaden. S. 23.<br />
20<br />
Brauer, Kerry-U (2003): Gr<strong>und</strong>lagen der Immobilienwirtschaft. 4. Auflage. Gabler Verlag. Leipzig. S. 23.<br />
21<br />
Ebenda. S. 17.<br />
22<br />
Schivelbusch, Wolfgang (2000): Die Geschichte der Eisenbahnreise. 3. Auflage. Fischer Verlag. Frankfurt. S. 125.<br />
17
Verfolgt man aktuelle Pressemeldungen, stößt man regelmäßig auf Berichte über<br />
Großbahnhöfe <strong>und</strong> deren Bauvorhaben. Die Kosten für Neubauten oder Umbauten sind in<br />
der Regel sehr hoch. Hier muss jedoch nochmals betont werden, dass die Immobilie <strong>Bahnhof</strong><br />
nur die Empfangshalle (<strong>und</strong> etwaige Sonderbauten wie Hotels, etc.) verkörpert.<br />
Gleisanlagen, Bahnsteige <strong>und</strong> ähnliches können nicht zur Immobilie des <strong>Bahnhof</strong>es gezählt<br />
werden. Dies ist zum einen rechtlich zu begründen (siehe Kapitel 1.3.2) – zum anderen rein<br />
ökonomisch. Der Bahnbetrieb könnte auch ohne eine große Empfangshalle funktionieren. Die<br />
Empfangshalle (<strong>und</strong> damit das, was wir heute als <strong>Bahnhof</strong> verstehen) ist „nur“ eine<br />
Funktionsanreicherung. Diese Funktionsanreicherung <strong>und</strong> ihre weitreichenden Folgen haben<br />
parallel zu einer Anreicherung <strong>und</strong> Aufwertung der Bahnhöfe geführt, auch wenn die<br />
eigentliche Funktionsanreicherung fast immer in der Empfangshalle stattgef<strong>und</strong>en hat <strong>und</strong><br />
davon auch zukünftig auszugehen ist. Diese Thematik der Anreicherung wird im Kapitel 4<br />
näher beschrieben.<br />
� Infrastruktur <strong>und</strong> Standort<br />
Im Vergleich zu herkömmlichen Gewerbeimmobilien stellt sich die Frage des Standortes im<br />
Bezug auf eine <strong>Bahnhof</strong>simmobilie in einer anderen Art <strong>und</strong> Weise. Die Vorraussetzungen<br />
sind hier zwar relativ ähnlich. Es wird ein optimaler <strong>und</strong> passender Standort im Sinne des<br />
Investors oder Auftraggebers gesucht, der sich meist an den weichen Standortfaktoren<br />
orientiert 23 . Hier sind es vor allem Faktoren wie standortabhängiges Wirtschaftsklima <strong>und</strong><br />
Image der Region sowie Konkurrenz bzw. Fühlungsvorteile (Agglomerationen) in<br />
unmittelbarer Nähe, die von Bedeutung sind. Darüber hinaus haben harte Standortfaktoren<br />
(wie die infrastrukturelle Einbindung) nach wie vor einen erheblichen Anteil an der<br />
Standortbestimmung. Gerade im Bezug auf die Infrastruktur ist der <strong>Bahnhof</strong> jedoch etwas<br />
Besonderes. Er ist in der Regel schon an ein bestehendes Schienennetz geb<strong>und</strong>en.<br />
Offenk<strong>und</strong>ig sind bei Großprojekten teilweise Neuplanungen möglich oder unumgänglich,<br />
jedoch stellen diese Projekte eine Besonderheit dar, auf die hier nicht weiter eingegangen<br />
werden soll. Hierbei stellen Knotenpunkte <strong>und</strong> viel befahrene Strecken <strong>und</strong> vor allem<br />
Standorte mit einem großen Einzugsgebiet die optimale Gr<strong>und</strong>lage für einen Großbahnhof<br />
dar. Knotenpunkte erscheinen deshalb als besonders attraktiv, da sie häufig als<br />
Umsteigebahnhof fungieren <strong>und</strong> sich deshalb Menschen in diesen Bahnhöfen zumindest für<br />
die Zeit des Umsteigens aufhalten. Da in der Regel ein Anschlusszug mit leichter<br />
Zeitverzögerung weiter fährt, bietet sich so den Menschen die Gelegenheit, im <strong>Bahnhof</strong><br />
umherzugehen <strong>und</strong> gegebenenfalls Einkäufe zu tätigen. Der Aspekt der Nutzergruppen,<br />
welcher die Nutzer eines <strong>Bahnhof</strong>s beschreibt, wird im Kapitel 4 gesondert behandelt.<br />
Eine ausgeprägte (auf der Bahn basierende) Infrastruktur garantiert einen kontinuierlichen<br />
Menschenstrom. Dies hat sicherlich einen großen Anteil an den Funktionsanreicherungen des<br />
23 http://www.stuttgarter-zeitung.de/<strong>pdf</strong>/sonderthemen/immostandort.<strong>pdf</strong> (2007): Anzeigensonderveröffentlichung<br />
- Der Immobilienstandort Stuttgart. Stuttgarter Zeitung. (Letzter Zugriff: 21.05.2007)<br />
18
<strong>Bahnhof</strong>s, wie sie durch die Renaissance der Bahnhöfe in den 1990er Jahren 24 , ausgedrückt<br />
durch Mall-Funktionen, hervortrat.<br />
Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung (Renditeberechnung), die jedem Bauvorhaben einer<br />
Gewerbeimmobilie vorgeschaltet sein sollte, stellt der Aspekt Infrastruktur einen ganz<br />
besonderen <strong>und</strong> schwer messbaren Faktor für die Immobilie <strong>Bahnhof</strong> dar. Wie schon zuvor<br />
argumentiert, kann ein <strong>Bahnhof</strong> auch ohne Geschäfte <strong>und</strong> Gastronomie seine Funktion als<br />
Verkehrsknotenpunkt erfüllen <strong>und</strong> die Anbindung an regionale <strong>und</strong> überregionale<br />
Verkehrsnetze stellt sich auf Gr<strong>und</strong> der infrastrukturellen Bedeutsamkeit eines <strong>Bahnhof</strong>s in<br />
der Regel als gegeben dar. Dies ist für den Investor des <strong>Bahnhof</strong>s eine Kosten sparende<br />
Position bei den zu erwartenden Investitionskosten. Es kann Infrastruktur mitgenutzt<br />
werden, die für den Betrieb des <strong>Bahnhof</strong>s benötigt wird. Eine Erschließung der Immobilie<br />
<strong>Bahnhof</strong> erfolgt demnach in der Regel nur über Fußwege zu den ohnehin vorhandenen<br />
verkehrlichen Angeboten. Dies wird bei der Beurteilung einer Immobilie, in diesem<br />
speziellen Fall einem <strong>Bahnhof</strong>, dazu führen, dass er bei einer Analyse der Immobilie im<br />
Bereich der Anbindung positiv abschneiden wird. Unter einer Immobilienanalyse wird eine<br />
Prüfung verstanden, die nach festgelegten Kriterien zur Ermittlung eines zeitpunktbezogenen<br />
Verkehrs- oder Beleihungswertes verfährt. Gr<strong>und</strong>lage dabei sind der aktuelle<br />
Gebäudezustand, Lage <strong>und</strong> Beschaffenheit des Gr<strong>und</strong>stücks <strong>und</strong> die nachhaltig erzielbaren<br />
Erträge sowie die Drittanwendbarkeit. 25 Eben diese angesprochene Lage der Bahnhöfe wirkt<br />
sich so vorteilhaft auf die Renditeberechnungen aus <strong>und</strong> bildet eine wichtige Gr<strong>und</strong>lage des<br />
Standorts <strong>Bahnhof</strong>.<br />
Erschließungsmaßnahmen, die die Renditeberechnung meist negativ belasten, können bei<br />
einem <strong>Bahnhof</strong>sbau nur schwer zugeordnet werden.<br />
� Verpachtungsvorteile <strong>und</strong> nachteilige Auswirkungen aus Sicht der Deutschen<br />
Bahn AG<br />
Die Deutsche Bahn AG verpachtet teilweise ihre Bahnhöfe an private Unternehmen, die<br />
wiederum versuchen, den gemieteten <strong>Bahnhof</strong> gewinnbringend zu vermarkten <strong>und</strong><br />
letztendlich durch Untermieter zu besetzten. Dies wird vor allem im Bereich der kleineren<br />
Bahnhöfe getan, um diese nicht unterhalten zu müssen. Sie bringen weniger Gewinn als<br />
einer der Top Bahnhöfe. Eine Ausnahme bildet hier der Hauptbahnhof Leipzigs, dessen<br />
Umbau bis zur Fertigstellung 1997 circa 400 Mio. DM (≈ 205 Mio. Euro) kostete. 26 Die<br />
Finanzierung teilten sich zum einen Fondsanleger der Deutschen Bank <strong>und</strong> die ECE-Gruppe .27<br />
24<br />
http://www.baufachinformation.de/zeitschriftenartikel.jsp?z=06019018865 (2005): Von Kathedralen des<br />
Verkehrs zu Einkaufszentren mit Gleisanschluss – Bahnhöfe. Frauenhofer Informationszentrum für Raum <strong>und</strong><br />
Bau. (Letzter Zugriff: 21.05.2007)<br />
25<br />
Gehards H. & Keller H. (1990): Baufinanzierung von A bis Z. 2. Auflage. Betriebswirtschaftlicher Verlag. S. 13.<br />
26<br />
Birenheide Almut & Legarno Aldo (2005): Stätten der Moderne, Reisefüherer durch Bahnhöfe, Shopping Malls,<br />
Disneyland Paris. VS Verlag für Sozialwissenschaft. Wiesbaden. S. 63.<br />
27<br />
Die ECE ist als Projektentwickler nicht nur mit dem Projektmanagement sondern auch mit der Projektkonzeption<br />
<strong>und</strong> dem Betrieb der errichteten Gebäude befasst.<br />
19
28<br />
Dabei wurde der Hauptbahnhof – bis auf die Gleisanlagen – für 70 Jahre per Erbbaurecht<br />
an die ECE verpachtet. Bei anderen Top Bahnhöfen ist die Sachlage in der Regel etwas<br />
differenzierter zu betrachten, da diese wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich den<br />
größten Anteil am Vermietungsumsatz der Deutschen Bahn haben. 172 der bedeutenden<br />
Bahnhöfe erwirtschaften immerhin 75 % des Umsatzes der wirtschaftskräftigsten 591<br />
Bahnhöfe. Dem entsprechend ist die Deutsche Bahn AG an diesen Bahnhöfen wesentlich<br />
stärker interessiert <strong>und</strong> versucht, diese größtenteils selbst zu entwickeln <strong>und</strong> zu vermarkten,<br />
um die Gewinne als Betreiber der Bahnhöfe einzunehmen 29 . Doch auch bei dieser Kategorie<br />
der Bahnhöfe gibt es Ausnahmen, wie z.B. den Leipziger, Hannoverschen <strong>und</strong> Kölner<br />
<strong>Bahnhof</strong>, die beide von der ECE betrieben werden. Im Falle des Leipziger <strong>Bahnhof</strong>s war die<br />
ECE sogar durch die Mithilfe der Deutschen Bank, welche als Fondanleger fungierte, 30 mit<br />
dem Neubau des <strong>Bahnhof</strong>s beauftragt <strong>und</strong> für Planung sowie Umsetzung zuständig 31 .<br />
Abb. 2: Vermietungsumsätze der Bahnhöfe der Deutschen Bahn AG 2006<br />
Quelle:<br />
www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/immobilien/vermietung__verkauf/vermietung__verkauf.html<br />
Die Vorteile für die Deutsche Bahn AG liegen vor allem darin, dass sie keine Investition<br />
tätigen muss <strong>und</strong> die Sanierung bzw. die Instandhaltungsaufgabe an den Pächter des<br />
<strong>Bahnhof</strong>s abgetreten werden kann, wenn dazu eine vertragliche Einigung gef<strong>und</strong>en wurde.<br />
Dabei wirkt sich positiv aus, dass der Pächter ein großes Eigeninteresse an einem vorteilhaft<br />
28 Birenheide Almut & Legarno Aldo (2005): Stätten der Moderne, Reiseführer durch Bahnhöfe, Shopping Malls,<br />
Disneyland Paris. VS Verlag für Sozialwissenschaft. Wiesbaden. S. 63.<br />
29 http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/immobilien/vermietung__verkauf/vermietung__verkauf.html, die DB<br />
schildert die Vorteile für ihre Mieter <strong>und</strong> geht auf die Vermarktung ein.<br />
30 Eglit, J. (DB AG) (2007): Präsentation der DB AG im Projekt „<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>“ am 24.05.2007<br />
31 ECE, eine Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, gegründet 1965, mit folgenden Geschäftsbereichen:<br />
Entwicklung, Realisierung, Vermietung <strong>und</strong> Langzeit-Management sowie Investition, international tätiges<br />
Unternehmen, Gespräch mit Herrn Beck, ECE, am 31.5.2007 in Leipzig.<br />
20
geprägten <strong>Bahnhof</strong> hat, da dies für ihn in engem Zusammenhang mit den zu erwartenden<br />
<strong>und</strong> reellen Renditen aus den Mieteinnahmen steht. Ein in „strahlendem Glanz“ stehender<br />
<strong>Bahnhof</strong> wird wesentlich mehr Besucher anlocken <strong>und</strong> Fahrgäste zum Verweilen einladen<br />
<strong>und</strong> damit gleichzeitig zum Einkaufen motivieren als ein verfallener <strong>und</strong> trostloser <strong>Bahnhof</strong>.<br />
Zusätzlich können Fahrgastgewinne für die Bahn entstehen, wenn Besucher des <strong>Bahnhof</strong>s<br />
oder des Einkaufszentrums im <strong>Bahnhof</strong> mit der Bahn anreisen. Diesen Vorteil durch einen<br />
gepflegten <strong>Bahnhof</strong> kann die Deutsche Bahn AG als positiven Nebeneffekt durch die<br />
Verpachtung von Bahnhöfen erreichen, ohne dass sie diesen bezahlen muss. Denn die<br />
Mehreinnahmen durch gestiegene Fahrgastaufkommen fließen in die Kassen der Deutschen<br />
Bahn AG. Eine klare Zuordnung, ob es sich um einen „herkömmlichen“ Fahrgast handelt<br />
oder um einen eigens wegen des gepflegten <strong>und</strong> attraktiven <strong>Bahnhof</strong>s angereisten Besucher<br />
handelt, kann nicht global vorgenommen werden.<br />
Allerdings ist auch auf die Negativwirkungen, die auf die Deutsche Bahn AG zurückfallen,<br />
einzugehen. Denn die Mieteinnahmen, die der Pächter erwirtschaftet, hätten der Deutschen<br />
Bahn AG zufließen können, wenn sie eine Vermarktung <strong>und</strong> Vermietung eigenständig<br />
betrieben hätte. Diese Einnahmen sind in einer sehr hohen Größenordnung zu verorten,<br />
sodass der Deutschen Bahn AG durch die Verpachtung des <strong>Bahnhof</strong>s an einen<br />
<strong>Bahnhof</strong>sbetreiber enorme Einnahmemöglichkeiten entgehen. Zudem ist bei diesem<br />
nachteiligen Aspekt der Untersuchung der Verpachtungswirtschaft im Bezug zum <strong>Bahnhof</strong><br />
ebenfalls die zukünftige Entwicklung zu berücksichtigen. Bei weiter steigenden Preisen für<br />
Rohstoffe, weiter steigenden Steuern für Benzin <strong>und</strong> die Entwicklung der Umweltpolitik kann<br />
man hypothetisch von steigenden Fahrgastzahlen der Bahn ausgehen32. Diese Annahme hat<br />
sich über die letzten Jahrzehnte als realistisch erwiesen. Wenn dieser Trend anhält, wovon<br />
nach heutigem Kenntnisstand auszugehen ist, werden dementsprechend mehr Fahrgäste<br />
auch eine höhere Frequentierung der einzelnen Bahnhöfe zur Folge haben. Dies wiederum<br />
wird den dort angesiedelten Geschäften möglicherweise höhere Umsätze ermöglichen. Falls<br />
dies der Fall sein wird, werden die Pächter der Bahnhöfe ebenso mit steigenden Einnahmen<br />
rechnen können, da sie teilweise, wie z.B. die ECE im Leipziger Hauptbahnhof, an den<br />
Gewinnen, die die Einzelhandelsgeschäfte in ihrerseits vom <strong>Bahnhof</strong>spächter gemieteten<br />
Gewerbefläche erwirtschaften, beteiligt werden. Schlussfolgernd lässt sich daraus schließen,<br />
dass durch die Verpachtung der Bahnhöfe an Dritte durch die Deutsche Bahn AG<br />
möglicherweise nicht der Aspekt dieser Entwicklung berücksichtigt wurde, da die<br />
Einnahmequellen sich durchaus verbessern können <strong>und</strong> die Einnahmen steigen könnten. Die<br />
Deutsche Bahn AG erhält aber im Zweifelsfall einer wirtschaftlich negativen Entwicklung der<br />
Mieteinnahmen eine garantierte Pachtzahlung, die dann als positiv gewertet werden muss.<br />
Des Weiteren müssen Sanierungsmaßen, die die bahnbetriebsnotwendigen Flächen, also alle<br />
Flächen, die nach Verpachtung des <strong>Bahnhof</strong>s noch in der Hand der Bahn sind, aus den durch<br />
die Fahrpreise erwirtschafteten Geldern bezahlt werden. Unter diesen<br />
Sanierungsmaßnahmen sind auch Instandhaltungskosten, die die Kosten bezeichnen, welche<br />
32 http://de.biz.yahoo.com/15052007/336/deutsche-bahn-verzeichnet-starken-zuwachs-fahrgastzahlen.html<br />
(2007): DB verzeichnet starken Zuwachs an Fahrgastzahlen. Yahoo.biz. (Letzter Zugriff: 29.07.2007)<br />
21
zur Deckung des anfallenden Erhaltungsaufwandes, nicht zur Modernisierung anfallen. Sie<br />
entstehen durch die Beseitigung der durch Abnutzung, Alterung <strong>und</strong> Witterungseinwirkungen<br />
entstandenen baulichen Mängel 33 . Dies wiederum wirkt sich möglicherweise nachteilig auf<br />
die Preisbildung der Fahrpreise der Bahn aus. Letztlich kann auch als Nachteil für die Bahn<br />
aufgegriffen werden, dass es möglicherweise zu Kompetenzstreitigkeiten kommen kann.<br />
Wenn innerhalb der vertraglichen Regelungen Missstände auftreten, sind diese nur schwer<br />
behebbar <strong>und</strong> können zu Ärgernissen auf beiden Seiten der Vertragspartner führen. 34<br />
Letztendlich werden im schlimmsten Fall diese nachteiligen Auswirkungen indirekten Einfluss<br />
bzw. indirekte Auswirkungen auf den K<strong>und</strong>en haben, wie es auch im englischen<br />
Bahnprivatisierungsprozess die Folge war. Vergleich dazu Kapitel 4.4.<br />
Tabelle 2: Gegenüberstellung von Vor- <strong>und</strong> Nachteilen der Vermietung aus Sicht der<br />
Deutschen Bahn AG<br />
Verpachtungsvorteil Verpachtungsnachteil<br />
Einnahmen Werden wahrscheinlich<br />
vom Pächter für<br />
Positivdarstellung des<br />
<strong>Bahnhof</strong>s genutzt<br />
Sanierungsmaßnahmen Müssen vom Pächter<br />
durchgeführt werden<br />
Zukünftige Entwicklung Pächter verfolgt<br />
Quelle: Eigene Darstellung<br />
Marktgeschehen <strong>und</strong><br />
richtet <strong>Bahnhof</strong> daran<br />
aus<br />
� Renditeberechnung der Empfangshalle eines <strong>Bahnhof</strong>s<br />
22<br />
Einnahmen gehen der<br />
Bahn verloren;<br />
Auswirkungen<br />
möglicherweise auf<br />
Fahrpreise<br />
Abstimmungsprobleme<br />
Die Bahn hat weniger<br />
Einflussmöglichkeiten;<br />
Mögliche Positive Effekte<br />
in der Zukunft ohne<br />
Bahnbeteiligung<br />
Die Renditeberechnung der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> erfolgt ähnlich wie bei anderen<br />
Gewerbeimmobilien. Neben den Bau- oder Umbaukosten sind es vor allem der Unterhalt, die<br />
Instandhaltung <strong>und</strong> das Immobilienmarketing, die die Kosten für den Bau- oder Umbau einer<br />
33<br />
siehe dazu : Gehards H. & Keller H. (1990): Baufinanzierung von A bis Z. 2. Auflage. Betriebswirtschaftlicher<br />
Verlag. 1990.<br />
34<br />
http://homepage.univie.ac.at/peter.weichhart/LVs/Seminare/AktFRegent0203/<br />
Ref4<strong>Bahnhof</strong>sprojekte.<strong>pdf</strong> (2002): <strong>Bahnhof</strong>sprojekte. S. 16.
Immobilie bestimmen. Einnahmen bzw. Zuflüsse bringen Nettokaltmieten, Einnahmen aus<br />
Steuerrückflüssen oder Einnahmen aus Zuschüssen. 35<br />
Die Immobilie <strong>Bahnhof</strong> ist nach den definitorischen Gesichtspunkten <strong>und</strong> im hier<br />
verwendeten Verständnis die Empfangshalle. Diese wird in der Regel nicht von der EU, dem<br />
B<strong>und</strong>, den Ländern oder der Kommune – im Gegensatz zu den betriebsnotwenigen<br />
Trassensystemen <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>sbauten (beispielsweise Bahnsteige), u. ä. - gefördert 36 .<br />
Eine Renditeberechnung kann in jedem Fall für die Empfangshalle gebildet werden. Hier sind<br />
Kaufpreise für das Gr<strong>und</strong>stück (Erwerb meist von bahneigenen Unternehmen zu<br />
Marktpreisen), Gr<strong>und</strong>erwerbsteuer, Notar- <strong>und</strong> Amtsgerichtgebühren, Gutachten <strong>und</strong><br />
Studien, nicht umlagefähige Betriebskosten <strong>und</strong> Aufwendungen für die Modernisierung oder<br />
Umnutzung klar definierbare oder prognostizierbare Größen. Die Seite der Einnahmen ist<br />
dementsprechend durch Mieten gedeckt. Die Top-Bahnhöfe der Deutschen Bahn sind<br />
momentan nicht durch Leerstände im unverträglichen Maße auffällig.<br />
Über Mietpreise kann an dieser Stelle leider keine Einordnung erfolgen, da die Betreiber <strong>und</strong><br />
Centermanagements der jeweiligen Bahnhöfe <strong>und</strong> Empfangshallen, diese nicht öffentlich<br />
preisgeben. „In Nürnberg sind je nach Lage der Ladenfläche zwischen 10 <strong>und</strong> 150 € Miete<br />
pro Quadratmeter zu berappen.“ 37 In einigen Fällen sind die Investoren direkt an den<br />
Erfolgen der Mieter beteiligt – bei steigendem Umsatz der Mieter wird eine höhere<br />
Mietprovision verlangt. 38<br />
1.4 Übergang vom Beförderungszentrum zum Einkaufszentrum<br />
Der Begriff Beförderungszentrum kann unterschiedlich eingeordnet werden. Die<br />
Begrifflichkeit des Beförderungszentrums kann darüber hinaus sehr subjektiv ausgelegt<br />
werden. An dieser Stelle soll versucht werden, eine möglichst objektive Einordnung<br />
vorzunehmen, um das Beförderungszentrum zu definieren. Darauf aufbauend soll die sich in<br />
den letzten Jahren immer deutlicher abzeichnende Entwicklung aufgezeigt werden, bei der<br />
sich speziell in Bahnhöfen ein Wandel vom reinen Beförderungszentrum zu einem<br />
Einkaufszentrum vollzogen hat. Diese Transformation wird in der Literatur oftmals mit dem<br />
prägenden Satz vom „Einkaufscenter mit Gleisanschluss“ 39 beschrieben.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich unterscheidet man bei der Beschreibung eines Beförderungszentrums nach<br />
Klassen, die sich durch die Größe <strong>und</strong> Bedeutsamkeit bilden. Ein Bushaltepunkt oder auch<br />
ein S-Bahnhalt sind Beförderungspunkte. Dabei ist ersichtlich, dass es sich keineswegs um<br />
35<br />
Brauer, Kerry-U (2003): Gr<strong>und</strong>lagen der Immobilienwirtschaft. 4. Auflage. Gabler Verlag. Leipzig. S. 376.<br />
36<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/<br />
bahnhofsagentur/bahnhofs__agentur.html (2007): <strong>Bahnhof</strong>sagentur DB. (Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
37<br />
http://www.bayerischestaatszeitung.de/index.jsp?MenuID=33&year=2006&ausgabeID=261&rubrikID=<br />
2&artikelID=3188 (2006): Wirtschaftsfaktor Hauptbahnhof. Bayrische Staatszeitung. (Letzter Zugriff:<br />
20.07.2007)<br />
38<br />
Expertengespräch mit ECE in Leipzig<br />
39<br />
http://www.welt.de/print-wams/article142455/Abschied_vom_<strong>Bahnhof</strong>_Zoo.html (2006): Abschied vom <strong>Bahnhof</strong><br />
Zoo. Die Welt. (Letzter Zugriff: 13.07.2007)<br />
23
ein Zentrum wie es im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, handelt. Der Begriff<br />
Zentrum stammt aus dem lateinischen „centrum“, was „Achspunkt“ bedeutet, oder auch aus<br />
dem griechischen von „kentron“ „Dorn“ 40 . Die Frage, ob es sich um ein Zentrum handelt<br />
oder nicht, hängt elementar mit der Größe <strong>und</strong> Bedeutsamkeit des möglichen Zentrums<br />
zusammen. Darüber hinaus – wie es sich auch aus dem Wortstamm ableiten lässt – ist ein<br />
Beförderungspunkt oder –zentrum auch durch geographische Gegebenheiten, wie sie z. B.<br />
einen Achspunkt oder eine zentrale Lage innerhalb eines Gefüges oder einer Fläche geprägt.<br />
Bei einem Beförderungszentrum muss es sich daraus resultierend um einen Punkt, von dem<br />
Beförderungsmöglichkeiten ausgehen (<strong>und</strong> ankommen), <strong>und</strong> um Ort mit einer zentralen<br />
Funktion handeln. Diese Zuordnung eines Beförderungszentrums an einen Ort mit zentralen<br />
Funktionen würde dem in der Raumplanung bekannten System der zentralen Orte nach<br />
Walter Christaller ähneln. Sein theoretischer Ansatz beruhte auf einer Annahme von<br />
idealtypischen, homogenen Räumen, welche eine Struktur zentraler Orte mit<br />
unterschiedlichen Hierarchiestufen aufweisen. Zentrale Orte höherer Hierarchien weisen<br />
dabei den untergeordneten Städten gegenüber raumbedeutsame Funktionen auf, die in den<br />
hierarchisch niederen Städten/Gemeinden nicht vorhanden sind. Zwar findet das System in<br />
der ursprünglichen Weise keine Verwendung mehr in der Raumplanung, doch lässt sich<br />
leicht ein Vergleich der Anbindung an den Fernverkehr durch Bahnanschluss von Städten<br />
ziehen, wenn dieser auch nicht ganz dem theoretischen Ansatz entspricht (siehe dazu<br />
Kapitel 5.2.1 <strong>Bahnhof</strong>sneubau / Montabaur <strong>und</strong> Limburg). 41 Aus der Gleichzeitigkeit von<br />
Beförderungsmöglichkeiten <strong>und</strong> Zentralität des Ortes ergibt sich das Beförderungszentrum,<br />
unter dem im Allgemeinen größere Bahnhöfe, Flughäfen, möglicherweise auch<br />
Schiffsanlegestellen (Häfen) verstanden werden. Sicherlich ist im Verständnis des<br />
Beförderungszentrums eine Abstufung nach der Bedeutsamkeit <strong>und</strong>/oder der Größe möglich<br />
<strong>und</strong> notwendig. Die Gestaltung dieser Abstufungen kann nach verschiedenen Indikatoren,<br />
wie z. B. Fahrgastaufkommen als Indikator für die Größe des Beförderungszentrums oder<br />
Anbindung an internationale Verkehrsinfrastrukturen als Indikator für die Bedeutsamkeit<br />
vorgenommen werden. Nach der Reflexion, was <strong>und</strong> wodurch sich ein Beförderungszentrum<br />
auszeichnet, soll vor allem am Beispiel der Bahnhöfe, von denen die der <strong>Bahnhof</strong>skategorie<br />
1 (Deutschlands Top-Bahnhöfe) auf jeden Fall zu einem Beförderungszentrum hinzuzählen,<br />
dargestellt werden, wie sich ein Wandel <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>en eine Funktionsanreicherung<br />
vollzog.<br />
So ist sich die Deutsche Bahn AG der Funktionsverschiebung vom reinen<br />
Beförderungszentrum hin zum Einkaufszentrum bewusst <strong>und</strong> fördert diese nachhaltig.<br />
Diesen Sachverhalt kann man damit begründen, dass die Deutsche Bahn AG in eigenen<br />
Informationsbroschüren damit wirbt, den Standort <strong>Bahnhof</strong> für den Einzelhandel auszubauen<br />
<strong>und</strong> zu fördern. In einer Vermietungsbroschüre heißt es, dass durch getätigte „Investitionen<br />
in den Neu- <strong>und</strong> Ausbau der Empfangsgebäude“ in letzter Zeit zahlreiche Bahnhöfe „zu<br />
40<br />
http://www.dwds.de/?woerterbuch=1&corpus=1&kompakt=1&last_corpus=DWDS&qu=Zentrum (2007): Berlin-<br />
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache des 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts. (Letzter Zugriff: 10.07.2007)<br />
41<br />
http://www.wiebel.de/<strong>pdf</strong>/christaller.<strong>pdf</strong> (2001): Wiebel, Dirk. Christallers<br />
Theorie der Zentralen Orte. (Letzter Zugriff: 29.07.2007)<br />
24
einem Einkaufstreffpunkt erster Klasse geworden“ 42 sind. Weiter nennt die Deutsche Bahn<br />
AG in ihren Veröffentlichungen Zahlen betreffend dem Umsatz <strong>und</strong> der zur Verfügung<br />
stehenden Flächen, für die mittels eines Online- Marktplatzes eine Verkaufsplattform<br />
besteht.<br />
Um den möglichen Interessenten den Standort <strong>Bahnhof</strong> (genau genommen die Flächen der<br />
Empfangshalle) möglichst lukrativ <strong>und</strong> profitabel erscheinen zu lassen, wird auf verschiedene<br />
Aspekt Bezug genommen. Unter anderem, dass Reisen bzw. der ÖPNV, der häufig in enger<br />
Verbindung mit dem <strong>Bahnhof</strong> steht, nicht den in der Wirtschaft vorherrschenden<br />
konjunkturellen Schwankungen unterworfen sei. Somit wird suggeriert, dass der <strong>Bahnhof</strong> als<br />
Gewerbefläche einen ausgezeichneten <strong>und</strong> durch die Funktionsanbindung an den <strong>Bahnhof</strong><br />
äußerst stabilen wirtschaftlichen Standort darstellt. Die Deutsche Bahn AG hat hier<br />
verschiedene Nutzergruppen der Empfangshalle analysiert <strong>und</strong> bewertet. Dementsprechend<br />
kategorisiert sie die Nutzer der Bahn in sechs verschiedene Typen, für die sowohl eine<br />
anzunehmende Frequenz aufgeführt wird wie auch die Aufenthaltsdauer im <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong><br />
schließlich der zu erwartende Bedarf (an Konsumgütern).<br />
Tabelle 3: Nutzer- Bedarfs- Analyse der Deutschen Bahn AG<br />
Quelle: http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/vermietungsbroschuere__<br />
bahnhoefe.<strong>pdf</strong> (2007)<br />
42<br />
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/vermietungsbroschuere__bahnhoefe.<strong>pdf</strong><br />
Vermietungsbroschüre. DB Station & Service AG. S. 5.<br />
(2007):<br />
25
Unter Frequenz ist hier zu verstehen, wie oft sich eine Person aus einer bestimmten Gruppe<br />
vorrausichtlich in einem <strong>Bahnhof</strong> aufhält. Dies schwankt von ca. zwei Mal im Monat bis hin<br />
zu mindestens drei Mal die Woche. Daraus resultieren die unterschiedlichen<br />
Bedarfsansprüche der Nutzer in der oben aufgeführten Grafik.<br />
Weiterhin ist bei der Betrachtung der Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>s hin von einem<br />
Beförderungszentrum zu einem Einkaufszentrum ein weiterer Aspekt zu beachten, der die<br />
Angebote innerhalb der Empfangshalle betrifft. Hier wurden historisch betrachtet zuerst in<br />
kleinen Kiosken Zeitungen verkauft, die allmählich ihr Angebot aufstockten. Heute zielen die<br />
Angebotsstruktur <strong>und</strong> Angebotsmerkmale auf andere Gruppen bzw. Nutzer. Die wenigsten in<br />
Bahnhöfen etablierten Angebotssegmente haben mit den ursprünglichen Angeboten (bis in<br />
die frühen 1990er Jahre) noch etwas gemeinsam. Dies hängt zum einen mit der<br />
Magnetwirkung <strong>und</strong> der in der Regel zentralen Lage des <strong>Bahnhof</strong>s in der <strong>Stadt</strong> zusammen.<br />
Anderseits wurde der <strong>Bahnhof</strong> auch für nicht Bahnreisende interessant, da sich die Qualität<br />
(bezogen auf Sauberkeit, Einkaufsvielfalt <strong>und</strong> Architektur) der Bahnhöfe in den letzten<br />
Jahren positiv gewandelt hat 43 44 . Der Fahrgast der Bahn soll hier ebenso an das Einkaufen in<br />
Bahnhöfen „gewöhnt“ werden, wie K<strong>und</strong>en, die den <strong>Bahnhof</strong> nicht zum Reisen aufsuchen.<br />
Dies bietet dem Reisenden die Möglichkeit einzukaufen <strong>und</strong> den ansässigen Geschäften<br />
verhilft dies zu steigenden Umsätzen. 45 Auch die Ladenschlussdebatte war für die Bahnhöfe<br />
lange Zeit irrelevant, da sie durch ihren Sonderstatus verlängert Öffnen durften. Die<br />
Ausdehnung der Öffnungszeiten seit circa einem Jahr hat an vielen Orten bereits die<br />
Wirksamkeit verloren <strong>und</strong> bestimmte Geschäfte, wie z. B. in Berlin, schließen wieder<br />
früher. 46<br />
Wie bereits in Kapitel 1.3.2 angemerkt, liegen hier vor allem die Vorteile der so genannten<br />
Knotenpunkte. Eine Umsteigesituation eines Fahrgastes ist in der Regel mit einer zumindest<br />
für einen „kleinen“ Einkauf verb<strong>und</strong>enen Wartezeit im <strong>Bahnhof</strong> des Knotenpunktes<br />
verb<strong>und</strong>en. Eben diesen durch zeitlich bedingte Abläufe hervorgerufenen Vorteil machen sich<br />
die Geschäfte <strong>und</strong> die Vermarkter eines <strong>Bahnhof</strong>s zu Nutze.<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> ist also nicht mehr nur Anlaufstelle für bahnreisende Konsumenten. Auch<br />
andere Nutzergruppen besuchen den <strong>Bahnhof</strong>. Dies verdeutlicht folgendes Schaubild:<br />
43<br />
http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/nord/hannover__hbf/bahnhofsteam/bahnhofsteam.html (2007):<br />
Mitarbeiter sorgen für Service, Sicherheit <strong>und</strong> Sauberkeit im <strong>Bahnhof</strong>. DB AG. Letzter Zugriff: 28.07.2007<br />
44<br />
Schürmann, Carsten & Spiekermann, Klaus (1999): Dortm<strong>und</strong> Hauptbahnhof wird Verkehrsmagnet. In: Institut<br />
für Raumplanung Dortm<strong>und</strong>, Arbeitspapier 169, Die Überbauung des Dortm<strong>und</strong>er Hauptbahnhofs –<br />
Raumplanerische Beiträge zu einem Großprojekt, S. 81. Online unter: http://www.raumplanung.unidortm<strong>und</strong>.de/irpud/pro/ufo/schu_spi.<strong>pdf</strong><br />
(Zugriff: 21. Juni 2007).<br />
45<br />
Korn, Juliane (2006): Transiträume als Orte des Konsums - eine Analyse des Standorttyps unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Bahnhöfe. Dissertation. Humboldt-Universität. Berlin.<br />
46<br />
http://www.morgenpost.de/content/2007/02/08/berlin/881803.html (28.02.2007): Viele Geschäfte schließen<br />
schon um 20 Uhr - Ladenschluss: Seit Beginn des Jahres kehrt der Einzelhandel zu den alten Öffnungszeiten<br />
zurück. (Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
26
Abb. 3:<br />
Personennbezeichn<br />
nungen in einem Bah<br />
Quelle: Korn, K Julianee<br />
(2006)<br />
1.4.1 EErlebnisfaktor<br />
Bahnnhof<br />
Die Deuutsche<br />
Bahn<br />
AG selbsst<br />
wirbt mit<br />
„die erffolgreiche<br />
S<strong>Stadt</strong>entwic<br />
cklung“<br />
der Bahhnhof<br />
die ihhm<br />
zugeda<br />
Bahn AG<br />
die Bahnnhofsagentu<br />
Strategien<br />
bezüglich<br />
des Ba<br />
soll. Daabei<br />
wird sseitens<br />
der<br />
Bahnhoof<br />
häufig alss<br />
„Visitenka<br />
Visitenkkarten<br />
bzww.<br />
Imageträ<br />
AG an, den Bahnhhof<br />
aus eige<br />
wird unnter<br />
verschiiedenen<br />
As<br />
finden ssollen,<br />
auchh<br />
das Empf<br />
48 t der Beschhreibung<br />
dees<br />
<strong>Bahnhof</strong>fs<br />
als ein In ndikator fü<br />
. Sie S stellt inn<br />
Ihren Brooschüren<br />
MMöglichkeiteen<br />
dar, wie<br />
achte Funkttion<br />
erfüllen<br />
kann. Weeiterhin<br />
beschreibt<br />
die<br />
Deutsche<br />
ur als einenn<br />
Dienstleisster,<br />
der füür<br />
die Umseetzung<br />
von n Ideen <strong>und</strong><br />
hnhofs eine e kompetente<br />
<strong>und</strong> prrofessionelle<br />
Assistenzz<br />
darstellen<br />
r Deutscheen<br />
Bahn AGG<br />
darauf aaufmerksamm<br />
gemachtt,<br />
dass de<br />
arte für Staadt<br />
<strong>und</strong> Bahn“<br />
(siehe dazu Kapittel<br />
3.2.1 Ba ahnhöfe als<br />
äger der Sttadt)<br />
gesehhen<br />
wird. DDaher<br />
strebbt<br />
die Deutsche<br />
Bahn<br />
ener Sicht aus einer gganzheitlichhen<br />
Perspeektive<br />
zu seehen<br />
pekten, die e bei der gaanzheitlicheen<br />
Betrachttung<br />
Berüc<br />
fangsgebäuude<br />
als gesoonderter<br />
Annhaltspunktt<br />
genannt.<br />
49 r<br />
e<br />
e<br />
d<br />
n<br />
r<br />
s<br />
n<br />
. Hier<br />
ksichtigungg<br />
In letztter<br />
Zeit wurde<br />
der Aspekt,<br />
mit ddem<br />
ein Baahnhof<br />
erlebt<br />
werden kann, aber<br />
zusätzlichh<br />
erweitert.<br />
Es setzte<br />
sich ein Trend durrch,<br />
Bahnhöfe<br />
für Kunstaktionenn,<br />
Ausstellu ungen oder<br />
47<br />
Korn, JJuliane<br />
(2006):<br />
Transiträum me als Orte des d Konsums - eine Anallyse<br />
des Stanndorttyps<br />
unter<br />
besonderer<br />
Berückksichtigung<br />
deer<br />
Bahnhöfe. DDissertation.<br />
HHumboldt-Universität.<br />
Berlin.<br />
S. 124.<br />
48<br />
http://wwww.db.de/siite/bahn/de/ggeschaefte/infr<br />
rastruktur__schiene/personnenbahnhoefee/<br />
bahnhofsagentur/bahnnhofs__agentuur.html<br />
(2007):<br />
<strong>Bahnhof</strong>saggentur<br />
DB. (Leetzter<br />
Zugriff: : 12.07.2007) )<br />
49<br />
Siehe ddazu:<br />
Produkttkatalog:<br />
Das Serviceangebbot<br />
in Deutschlands<br />
Personeenbahnhöfen,<br />
http:// /www.db.de/ssite/shared/dee/dateianhaennge/infomaterial/sonstige/pproduktkatalogg.<strong>pdf</strong><br />
27<br />
hnhof 47
auch als Filmkulisse zu nutzen. Hier werden natürliche Begebenheiten des <strong>Bahnhof</strong>s in<br />
Einklang mit dem jeweiligen Event gebracht, welches veranstaltet werden sollte. Zum<br />
Beispiel fand im U-<strong>Bahnhof</strong> am Potsdamer Platz eine Schwarzlicht- Ausstellung statt, die sich<br />
die in einem U- <strong>Bahnhof</strong>, wenn er nicht künstlich beleuchtet wird, vorherrschende Dunkelheit<br />
zu nutze machte 50 . Die Organisation dieser Events wird teilweise bereits als ein eigenes<br />
Marktfeld angesehen <strong>und</strong> vermarktet sowie durch eigens dafür gegründete Unternehmen<br />
betrieben. Gesellschaften, die ehemals Infrastrukturanbieter <strong>und</strong> Personenbeförderer waren,<br />
haben diesen Markt entdeckt <strong>und</strong> promoten ihn entsprechend 51 .<br />
1.4.2 Einkaufscenter im <strong>Bahnhof</strong><br />
Seit der Renaissance der Bahnhöfe der 1990er Jahre gibt es in jedem Top-<strong>Bahnhof</strong> der<br />
Deutschen Bahn die Möglichkeit, ähnlich wie in einem Einkaufscenter, einzukaufen. Dabei<br />
wurden im Vorfeld Kernzeile <strong>und</strong> Maßnahmen erstellt, die die Bahnhöfe stärken sollten <strong>und</strong><br />
letztendlich die Renaissance bedingt haben. Ein Kernziel war der Ausbau der „Bahnhöfe zu<br />
attraktiven Einzelhandels- <strong>und</strong> Dienstleistungsstandorten, […] die das städtische Angebot<br />
ergänzen“. 52<br />
Dies impliziert eine Art von Sanktion <strong>und</strong> Restriktion, dass die Größe des<br />
Einzelhandelscenters im <strong>Bahnhof</strong> sich in das städtische Angebot von Einkaufscentern<br />
einfügen muss. Hier muss man jedoch von Ausnahmen sprechen, wenn innerstädtische<br />
Angebote als nicht ausreichend bewertet werden können.<br />
50<br />
http://www.morgenpost.de/content/2005/10/02/berlin/783242.html (2005): Schwarzlicht-Kunst ganz bunt im<br />
U3-Event-<strong>Bahnhof</strong> am Potsdamer Platz. Berliner Morgenpost. (Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
51<br />
http://www.oebb-immobilien.at/vip8/immo/de/Film_<strong>und</strong>_Event/index.jsp (2007): ÖBB Immobilien. (Letzter<br />
Zugriff: 21.06.2007)<br />
52<br />
Korn, Juliane (2006): Transiträume als Orte des Konsums - eine Analyse des Standorttyps unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Bahnhöfe. Dissertation. Humboldt-Universität. Berlin. S. 163.<br />
28
Tabelle 4: Ladenfläche in den Top-Bahnhöfen der Deutschen Bahn<br />
<strong>Bahnhof</strong>sname Ladenfläche (Vermietungsfläche) in m²<br />
Leipzig Hauptbahnhof 30000<br />
München Hauptbahnhof 29000<br />
Stuttgart Hauptbahnhof 25000<br />
Dresden Hauptbahnhof 22453<br />
Nürnberg Hauptbahnhof 20214<br />
Berlin Hauptbahnhof 15000<br />
Karlsruhe Hauptbahnhof 14000<br />
Hannover Hauptbahnhof 13060<br />
Berlin Ostbahnhof 12000<br />
Köln Hauptbahnhof 11500<br />
Dortm<strong>und</strong> Hauptbahnhof 9928<br />
Düsseldorf Hauptbahnhof 9693<br />
Essen Hauptbahnhof 9369<br />
Frankfurt (Main) Hauptbahnhof 9000<br />
Mannheim Hauptbahnhof 8936<br />
Hamburg Hauptbahnhof 8900<br />
Bremen Hauptbahnhof 5000<br />
Berlin Südkreuz 5000<br />
Mainz Hauptbahnhof 3800<br />
Frankfurt (Main) Flughafen<br />
Fernbahnhof<br />
Quelle: eigene Darstellung 53<br />
53 Alle Zahlen von: http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/start.html: DB AG<br />
29
Leipzig, München, Stuttgart, Dresden <strong>und</strong> Nürnberg bilden eine Art Spitzengruppe, wenn die<br />
Ladenfläche in Quadratmetern (m²) des jeweiligen <strong>Bahnhof</strong>s betrachtet wird. Hier<br />
erscheinen die Flächen der Einkaufscenter zu groß, als das man sie als das städtische<br />
Angebot ergänzend einordnen könnte.<br />
� Beispiel Leipzig<br />
Nach der Wende waren es private Investoren, die die Einzelhandelsstrukturen Leipzigs<br />
nachhaltig beeinflussten. Das Bauen „auf der grünen Wiese“ (also außerhalb der <strong>Stadt</strong>) lag<br />
für die Entwickler von Einkaufszentren sehr nahe. Hier waren die Gr<strong>und</strong>stückspreise im<br />
Gegensatz zur <strong>Stadt</strong> günstig <strong>und</strong> die Eigentumsverhältnisse überschaubar. 54 Zudem wurde<br />
diese Art des Errichtens seitens der baurechtlichen Gegebenheiten nicht oder nur<br />
unzureichend eingeschränkt.<br />
R<strong>und</strong> um Leipzig entstanden bis 1995 sechs Einkaufszentren mit etwa 255.000 m²<br />
Verkaufsfläche – das doppelte der Leipziger Innenstadt. 55 In Leipzig hatte man schon bald<br />
die Gefahr, die für den städtischen Einzelhandel bestand erkannt, <strong>und</strong> lehnte großflächigen<br />
Einzelhandel ab. Die Investoren wichen jedoch immer weiter in das Umland Leipzigs, in dem<br />
Leipzig keine Planungshoheit besaß, aus. Daraufhin änderte die <strong>Stadt</strong> ihre Strategie <strong>und</strong><br />
integrierte auch großflächige Vorhaben innerhalb von Leipzig.<br />
Tabelle 5: Auflistung großer Einzelhandelszentren in/um Leipzig<br />
Name: Größe in m²: Geschäfte:<br />
Allee-Center Leipzig 70.000 115<br />
Halle Center 53.000 57<br />
Nova Eventis 76.000 220<br />
Löwen Center 39.000 30<br />
Leipzig Hauptbahnhof 30.000 140<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Bei der (Um-)Planung des Leipziger Hauptbahnhofs haben sich Bedenken ein 30.000 m²<br />
großes integriertes Einkaufscenter könnte auch die letzten K<strong>und</strong>en aus der Innenstadt<br />
locken nicht bewahrheitet – auch da kein Vollwarenhaus integriert wurde. „Der<br />
Hauptbahnhof zieht neue Käuferschichten an – nicht nur aus der Region“. 56<br />
54<br />
Gormsen, Niels & Kühne Armin (2002): Leipzig. Den Wandel Zeigen. Verlag Edition Leipzig. 2000. 5. Auflage.<br />
Leipzig. S. 19.<br />
55<br />
Ebenda, S. 21.<br />
56<br />
Ebenda, S. 28.<br />
30
Abb. 4: Darstellung der Einzelhandelszentren in/um Leipzig<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
� Beispiel Frankfurt am Main<br />
Bei der Betrachtung der Ansiedlungspunkte des großflächigen Einzelhandels um Frankfurt<br />
am Main herum wird im Gegensatz zu Leipzig deutlich, dass sich die Einzelhandelszentren<br />
vor allem im direkten Umgebungsbereich zu Frankfurt angelagert haben. Diese leicht<br />
gegenteilige Entwicklung im Verhältnis zu Leipzig ist zum einen mit der sehr speziellen Art<br />
<strong>und</strong> Weise, wie nach der Wende versucht wurde, Einzelhandel in den neuen B<strong>und</strong>esländern<br />
anzusiedeln, zu erklären. Zum anderen kann man diesen Sachverhalt mit einer<br />
möglicherweise erhöhten Konzentrationswirkung erklären, die von Frankfurt ausgeht. Dies<br />
würde die relative Konzentration der Einzelhandelszentren um Frankfurt erklären, von denen<br />
keines weiter als maximal 10 km außerhalb der <strong>Stadt</strong> liegt. Außerdem müssen sich die<br />
Einzelhandelsunternehmen nach der ansässigen Kaufkraft richten, welche konzentriert im<br />
engeren Einzugsraum um Frankfurt angesiedelt ist.<br />
Es ist aber zusätzlich anzumerken, dass der <strong>Bahnhof</strong> in Frankfurt nicht annähernd die<br />
Verkaufsfläche des Leipziger Hauptbahnhofes erreicht. Er verfügt lediglich über 9.000 m²,<br />
die zur Vermietung stehen <strong>und</strong> kann dementsprechend keine wirkliche Konkurrenz zu den<br />
umliegenden großflächigen Einzelhandelszentren sein. Diese verfügen über wesentlich mehr<br />
31<br />
Kartengr<strong>und</strong>lage:<br />
Google Maps
Verkaufsfläche, z.B. das Nord- West- Zentrum mit 10-mal so viel Ladenfläche, <strong>und</strong> daher<br />
über wesentlich breitere Produktpaletten sowie ein breiter gefächertes Angebotsspektrum.<br />
Tabelle 6: Auflistung großer Einzelhandelszentren in/um Frankfurt<br />
Name Größe in m²: Geschäfte:<br />
Nord-West-Zentrum 90.000 150<br />
Main-Taunus-Zentrum 79.000 Ca. 100<br />
Ilsenburg-Zentrum 38.500 k. A.<br />
Hessen-Center 36.000 115<br />
Zeilgalerie 11.500 Ca. 50<br />
Frankfurt (Main) Hbf 9.000 70<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
1.5 Exkurse<br />
Gut geeignet scheint bei der Betrachtung der Immobilie <strong>Bahnhof</strong> der Exkurs <strong>und</strong> Vergleich<br />
zu Flughäfen <strong>und</strong> Häfen. Darüber hinaus beschäftigt sich ein weiterer Exkurs mit den Folgen<br />
der Bahnprivatisierung in England für die Bahnhöfe, um aufzuzeigen, wie wichtig <strong>und</strong><br />
lohnenswert der Betrieb von Top-Bahnhöfen für eine (zwar im Sinne einer Aktiengesellschaft<br />
privatwirtschaftlichen – durch den überwiegenden Aktienbesitz der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland aber staatlich geprägte) Bahngesellschaft ist.<br />
1.5.1 Vergleich von <strong>Bahnhof</strong>, Flughafen <strong>und</strong> Hafen<br />
Bei den Verkehrsknotenpunkten <strong>Bahnhof</strong>, Flughafen <strong>und</strong> teilweise auch den großen Häfen<br />
spricht man häufig von Transiträumen. Darunter sind in der Regel Räume zu verstehen, die<br />
der Beförderung dienen <strong>und</strong> zur Überbrückung von großen Distanzen dienen. Gleichzeitig<br />
werden an Transiträumen zeitliche Dimensionen überbrückt, z.B. wenn man ein Flugzeug<br />
besteigt <strong>und</strong> in einer anderen Zeitzone landet. 57<br />
Der Vergleich von Bahnhöfen <strong>und</strong> Flughäfen bietet sich allein schon wegen der von der<br />
Deutschen Bahn AG angestrebten Benchmarktauglichkeit ihrer „Kategorie 1“-Bahnhöfe mit<br />
internationalen Großflughäfen an 58 .<br />
57 Korn, Juliane (2006): Transiträume als Orte des Konsums - eine Analyse des Standorttyps unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Bahnhöfe. Dissertation. Humboldt-Universität. Berlin. Abschnitt 5-8.<br />
58 Siehe Abb. XXX<br />
32
Abb. 5: Bahnhöfe der Kategorie 1 haben Flughäfen zum Benchmark<br />
Quelle: Eglit, J. (Deutsche Bahn AG) (2007): Präsentation der Deutsche Bahn AG im Projekt „<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Bahnhof</strong>“ am 24.05.2007<br />
Bei Flughäfen von größerer Ordnung lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit zu den Top-<br />
Bahnhöfen feststellen. Denn auch in Flughäfen haben sich über die Jahre<br />
Einzelhandelsgeschäfte im Bereich der „Empfangshalle“ angesiedelt. Sicherlich kann man<br />
hier unter Empfangshalle nicht dieselbe Immobilienart wie beim <strong>Bahnhof</strong> verstehen, doch<br />
auch beim Flughafen gehen die Gebäudegröße <strong>und</strong> die Gebäude als Bauwerk selbst, welche<br />
zum eigentlichen Flugverkehrsbetrieb notwendig wären <strong>und</strong> welche real existent sind,<br />
auseinander. Dies hängt mit der sich bei Flughäfen ebenfalls vollzogenen<br />
Funktionsanreicherung zusammen. Jedoch wird eine derartige Vermarktung, wie sie bei<br />
Bahnhöfen stattfindet, nicht konstruiert. Dies ergibt sich sicherlich aus der Eigenart des<br />
Flughafens, der in der Regel schwerer zu erreichen ist als ein <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> der daher nicht<br />
als ein Einkaufszentrum Personen anlocken würde. Zudem gelten Flughäfen als teuer, was<br />
den Einkauf angeht. Zwar hat auch der <strong>Bahnhof</strong> mit diesem Vorurteil zu kämpfen,<br />
überwindet diese Hürde bei der Gewinnung von K<strong>und</strong>en aber deutlich leichter. Studien<br />
haben jedoch belegt, dass ein Teuerungsfaktor von im <strong>Bahnhof</strong> gekauften Artikeln nicht<br />
unbedingt vorliegt. 59 Gerade im Bekleidungsmarkenbereich setzen große Modemarken, wie<br />
in ihren Geschäften außerhalb der Bahnhöfe, auf ein einheitliches Preissystem.<br />
Beim Flughafen überwiegt die Funktion der Beförderung. Eine Anreicherung verhilft vor<br />
allem Flughäfen, welche nicht über Passagierzahlen ihre Gewinne erzielen, durch die sich<br />
59<br />
http://www.wdr.de/tv/service/geld/inhalt/20050616/b_2.phtml (2005): Sonntagseinkauf im Hauptbahnhof –<br />
Teure Supermärkte? WDR. (Letzter Zugriff: 26.06.2007)<br />
33
zusätzlich bietenden Einnahmequellen Einkünfte zu erlangen 60 . Flughäfen <strong>und</strong> Bahnhöfe sind<br />
vor allem auf Gr<strong>und</strong> ihres hohen Menschenaufkommens für die Ansiedlung von Einzelhandel<br />
prädestiniert. Der Vorteil des Flughafens ist es, dass es sich in den meisten Fällen um einen<br />
Flughafen mit internationaler Anbindung handelt, was es ermöglicht, sich nicht nur an<br />
einheimischen Produktpaletten zu orientieren sondern ebenfalls eine internationale<br />
Angebotsstruktur zu verwirklichen – diese wird dann zusätzlich von „einheimischen“ Käufern<br />
genutzt, die genau diese Produkte woanders nicht bekommen können. Es entsteht ein<br />
gewisse auf die Nutzer zugeschnittene Spezialisierung des Angebotssegments.<br />
Der Vergleich von Bahnhöfen zu Häfen ist vor allem auf Gr<strong>und</strong> der unterschiedlichen<br />
Entwicklung der Transportmittel differenziert zu betrachten. Zu unterschiedlich ist die<br />
Ausrichtung der beiden Infrastrukturen auf das Beförderungsgut. Bei der Bahn bildet die<br />
Personenbeförderung das Hauptsegment des Geschäftes. In der Schifffahrt sind es meist<br />
Güter, die transportiert werden. Hier ist selbstverständlich kein Zuwachs durch anderweitige<br />
Funktionen vorhanden. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass die meisten großen Häfen<br />
für Transporte von Gütern genutzt werden <strong>und</strong> nur wenig zivile Schifffahrt betrieben wird.<br />
Zum anderem ergibt es sich aber auch durch die territorial sehr eingeschränkte Lage der<br />
Häfen. Ein Großteil der Häfen liegt in unmittelbarer Nähe zum Meer <strong>und</strong> hat demnach eine<br />
weniger gute Anbindung als ein <strong>Bahnhof</strong> der meist im Zentrum einer <strong>Stadt</strong> liegt, welche<br />
wiederum verschiedenste Anbindungsverknüpfungen aufweist. Ein weiterer Aspekt der dazu<br />
beigetragen hat, dass Häfen wesentlich weniger attraktiv für eine Ansiedlung von Geschäften<br />
sind, ist das Faktum, dass zivile Schifffahrt historisch gesehen immer mehr an Bedeutung<br />
verloren hat. Dies hängt mit der gegenläufigen Entwicklung der Bahnen <strong>und</strong> Flugzeuge<br />
zusammen, da die Geschwindigkeit, mit der ein Flugzeug oder eine Bahn eine gewisse<br />
Strecke überbrücken kann wesentlich höher ist, als die eines Schiffes. Eben diese<br />
notwendige Zeit zur Überbrückung von Wegen wird in der heutigen Gesellschaft versucht zu<br />
minimieren, wie es auch schon in der Einleitung dieses Abschnitts des <strong>Zwischenbericht</strong>es<br />
angeklungen ist. Zum anderen hängt dies generell damit zusammen, dass nur wenige<br />
Bereiche der Kontinente durch Schiffe erreichbar sind, wie es auch schon bei der Lage der<br />
Häfen angesprochen wurde. Zu wenig Punkte sind mit dem Schiff erreichbar, als dass sich<br />
die Schifffahrt hätte durchsetzten können bei der Beförderung von Personen. Hier liegen die<br />
deutlich erkennbaren Vorteile bei der Bahn <strong>und</strong> des Flugzeugs. Diese Gründe haben in ihrer<br />
Gesamtheit dazu geführt, dass Häfen weniger weit (im Bezug auf Einzelhandel <strong>und</strong><br />
Funktionsanreicherungen) ausgebaut sind.<br />
1.5.2 Englands Bahnhöfe <strong>und</strong> deren Entwicklung seit der Privatisierung der<br />
Englischen Bahn<br />
England ist ein Negativbeispiel, wenn es um die Privatisierung der staatlichen<br />
Eisenbahngesellschaft geht. An der Entwicklung, die durch die Privatisierung der Englischen<br />
60 Korn, Juliane (2006): Transiträume als Orte des Konsums - eine Analyse des Standorttyps unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Bahnhöfe. Dissertation. Humboldt-Universität. Berlin. S. 16.<br />
34
Eisenbahn <strong>und</strong> der Folgen entstand, kann man die Bedeutung der Großbahnhöfe innerhalb<br />
eines Schienennetzes noch weiter verdeutlichen. Die Bahn wurde privatisiert, um sie<br />
konkurrenzfähig zu machen <strong>und</strong> den Staatshaushalt (auf Gr<strong>und</strong> der wegfallenden<br />
Subventionen) zu entlasten. Mittlerweile kostet es England Milliarden, die englische Bahn<br />
<strong>und</strong> deren System aufrecht zu erhalten 61 .<br />
Das englische Schienennetz ist das älteste der Welt 62 ; es umfasst fast 17.000 km 63 (D:<br />
38.000 km 64 ). 1992 wurde der Gesetzentwurf zur Privatisierung der British Rail vorgelegt.<br />
"Railtrack" wurde der Teil genannt, der für die Unterhaltung der Infrastruktur (Schienen,<br />
Signalanlagen, etc.) zuständig war. Im selben Jahr warnten Experten vor finanziellen Lasten,<br />
denen die jungen Unternehmen, die den Bahnbetrieb aufrechterhalten sollten, nicht<br />
gewachsen sein würden. „Railtrack [betrieb] als Monopolist die r<strong>und</strong> 37.000 Kilometer des<br />
Schienennetzes, 2.500 Bahnhöfe sowie Brücken <strong>und</strong> Signalanlagen.“ 65<br />
Insgesamt sind 106 Gesellschaften aus der British Rail entstanden, 25 davon für den<br />
Personenverkehr, 2 für den Güterverkehr, der Rest für die Instandhaltungsarbeiten. Ein<br />
unübersichtliches Netz aus direkten Unternehmern <strong>und</strong> Subunternehmern sowie<br />
Subsubunternehmern usw. entstand.<br />
Der „Erfolg“ jedoch gab Railtrack Recht. 1997 wurde der Börsengang vorbereitet, da das<br />
Unternehmen stolze Gewinne verbuchte. Diese resultierten aber aus der chronischen<br />
Vernachlässigung der Pflege <strong>und</strong> Instandhaltung des Schienennetzes <strong>und</strong> der Bahnhöfe seit<br />
1992. In Folge dessen gab es im Jahr des Börsenganges 1997 den ersten Zusammenstoß<br />
zweier Bahnen in Southall mit 7 Toten <strong>und</strong> 150 Verletzten. 66<br />
Das Ergebnis der Railtrack 1999 war aus ökonomischer Sicht jedoch atemberaubend:<br />
- Ein drittel mehr Passagiere,<br />
- 1.500 neue Züge,<br />
- 50% mehr Umsatz im Personenverkehr,<br />
- Subventionierungen durch den Staat sind von 41% auf 29% zurückgegangen.<br />
- Der Aktienkurs von Railtrack stieg auf bis zu 350% des Anfangkurses.<br />
61<br />
http://www.gerhardfrey.de/-/Russell_Hollowood.html (2006): Die traurige Geschichte der Privatisierung der<br />
britischen Bahn. (Letzter Zugriff: 18.07.2007)<br />
62<br />
http://www.mybritishrail.de/tanfieldrailway.htm (2007): Tanfield Railway. (Letzter Zugriff: 22.07.2007)<br />
63<br />
home.12move.nl/sh829487/engelandk<strong>und</strong>e/vk.htm (2007). (Letzter Zugriff: 28.07.2007)<br />
64<br />
Muncke, Martin (2004): Ingenierbauwerke bei der Deutschen Bahn AG, Anforderungen <strong>und</strong> Gestaltung. In:<br />
Umrisse, Zeitschrift für Baukultur. Ausgabe 2 2004. S. 8<br />
65<br />
http://www5.in.tum.de/lehre/seminare/semsoft/unterlagen_02/eisenbahn/website/privatisierung.html (kein<br />
Datum): Die Privatisierung der Eisenbahn in England. (Letzter Zugriff: 28.07.2007)<br />
66<br />
http://www.gerhardfrey.de/-/Russell_Hollowood.html (2006): Die traurige Geschichte der Privatisierung der<br />
britischen Bahn. (Letzter Zugriff: 18.07.2007)<br />
35
- Gleichzeitig waren 1850 verschiedene dringend sanierungsbedürftige Stellen des<br />
Gleisnetzes bekannt. Railtrack investiert nicht in die Modernisierung. 67<br />
Drei weitere verheerende Unfälle in den Jahren 1999 – 2001 mit 74 Toten <strong>und</strong> h<strong>und</strong>erten<br />
Verletzten machte den Privatisierungsexkurs untragbar. Der Aktienkurs von Railtrack viel ins<br />
Bodenlose. England musste mit einem Hilfsplan über 60 Milliarden Pf<strong>und</strong> zur<br />
Aufrechterhaltung <strong>und</strong> Instandsetzung des Bahnbetriebes eingreifen. Die Sanierungen<br />
führten zu sehr vielen Verspätungen. Deswegen <strong>und</strong> wegen der Unfälle kamen zudem den<br />
Verkehrsgesellschaften die K<strong>und</strong>en abhanden. Öffentlich wird zunehmend über mangelnde<br />
Hygiene an Bord, veralterte Technik, komplizierte Tarifsysteme, chaotische Fahrpläne <strong>und</strong><br />
Fehlauskünfte geklagt. 68 2002 meldet Railtrack Konkurs an <strong>und</strong> die öffentlich- rechtliche <strong>und</strong><br />
explizit nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Gesellschaft Network Rail übernahm die<br />
Verantwortung über die technischen Anlagen. Die Bahnhöfe wurden an unterschiedliche<br />
Investoren (zum größten Teil die privatwirtschaftlichen 25 Eisenbahnbetreiber) verkauft. Auf<br />
Staatsdrängen übernahm Network Rail die Verantwortung <strong>und</strong> den Betrieb der größten<br />
Bahnhöfe in England (z. B. alle Londoner Fernbahnhöfe, Manchester, etc.). 69<br />
Die Großbahnhöfe Englands wurden jahrelang vernachlässigt. Daraus resultierte akuter<br />
Handlungsbedarf, insbesondere um die Bahn <strong>und</strong> die Bahnhöfe wieder in einem positiven<br />
Licht erscheinen zu lassen. „Network Rail has announced ambitious plans to launch a multibillion<br />
po<strong>und</strong>, ten-year modernisation programme for its stations. We have identified the<br />
need for up to £4 billion of additional private-partner investment in stations across the<br />
network and are now looking for partners with the expertise to help progress the first<br />
tranche of stations to be redeveloped <strong>und</strong>er these joint-venture schemes“ 70 .<br />
Nicht nur unter der Prämisse einer durch die Deutsche Bahn AG <strong>und</strong> durch den<br />
B<strong>und</strong>esminister für Verkehr, Bau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung Wolfgang Tiefensee forcierten<br />
Privatisierung des Schienenetzes ist die Thematik auch für die deutschen Bahnhöfe<br />
brisant 71 . Zwar gibt es seitens der Bahn keinerlei Pläne, auch die Bahnhöfe an einen<br />
Investor abzugeben – sollte es jedoch so weit kommen, droht einer Immobilie wie dem<br />
<strong>Bahnhof</strong> immer die „Herunterwirtschaftung“ auf Gr<strong>und</strong> des Anspruchs an Rentabilität. In<br />
Deutschland ist hier aber noch eine differenzierte Betrachtung notwendig, da im Gegensatz<br />
zur Ausgangslage in England die Empfangshallen der Topbahnhöfe privatwirtschaftlich (von<br />
Centermanagements oder der Bahn-Tochtergesellschaft DB Station & Service AG) geführt<br />
werden.<br />
67<br />
http://www.attac.de/privatisierung/privatisierungswahn/railtrack.html (2007). Die Welt im Privatisierungswahn.<br />
(Letzter Zugriff: 07.07.2007)<br />
68<br />
http://www.gerhardfrey.de/-/Russell_Hollowood.html (2006): Die traurige Geschichte der Privatisierung der<br />
britischen Bahn. (Letzter Zugriff: 18.07.2007)<br />
69<br />
http://www.3sat.de/nano/bstuecke/97592/index.html (2006): Bahnprivatisierung in England ein schlimmer<br />
Misserfolg. (Letzter Zugriff: 21.07.2007)<br />
70<br />
http://www.networkrail.co.uk/aspx/1584.aspx (2007): Network Rail Station Development. (Letzter Zugriff:<br />
24.06.2007)<br />
71<br />
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/;art271,2006708 (2007): Neue Hürden für die Bahnprivatisierung. Der<br />
Tagesspiegel.10.04.2007. (Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
36
1.6 Fazit<br />
Die Immobilie <strong>Bahnhof</strong> umschreibt die Empfangshalle, die sich in den letzen Jahrzehnten<br />
stark zu einer Erlebnis- bzw. Einkaufswelt insbesondere in den deutschen Großbahnhöfen<br />
entwickelt hat. Dabei wurde diese Entwicklung von der Deutschen Bahn forciert <strong>und</strong> konnte<br />
über Kriterien <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>voraussetzungen, die 1994 über die Anforderung an die<br />
Renaissance der Bahnhöfe gestellt wurden, erreicht werden.<br />
Die Top-Bahnhöfe stellen nicht nur eine wichtige Einnahmequelle für die Deutsche Bahn AG<br />
dar, sie sind auch Prestigeobjekte einer neuen Baukultur. Insbesondere der Lehrter (Haupt-)<br />
<strong>Bahnhof</strong> in Berlin, der uns im zweiten Projektsemester als Forschungsgegenstand zugr<strong>und</strong>e<br />
liegen wird, ist hierfür ein Beispiel.<br />
Für die Bahn ist der Betrieb von Empfangshallen äußerst lohnenswert. Für den Besucher<br />
oder Nutzer des <strong>Bahnhof</strong>s eine interessante Alternative zu innerstädtischen <strong>und</strong><br />
anderweitigen Einkaufsangeboten. Für viele Menschen hat die Bahn etwas Atemberaubendes<br />
– die „Faszination Bahn“ trifft im <strong>Bahnhof</strong> auf die Möglichkeit des Einkaufens. Ein Umstand<br />
der Konsum im <strong>Bahnhof</strong> noch interessanter macht. Auch die – per Test durchgeführte –<br />
Feststellung, dass das Einkaufen im <strong>Bahnhof</strong> nicht einem Teuerungsfaktor unterlegen ist,<br />
unterstreicht die Konkurrenzfähigkeit der Einkaufscentern in Bahnhöfen. Hier müsste die<br />
Bahn (oder der Betreiber der Einkaufscenter in Bahnhöfen) für Aufklärung sorgen, um noch<br />
mehr K<strong>und</strong>en anzulocken.<br />
37
2. Ökonomische Gr<strong>und</strong>lagen des Bahnbetriebs<br />
Bahnhöfe werden als erstes mit ihrem ursprünglichsten Zweck verb<strong>und</strong>en: Dem<br />
Verkehrspunkt. Sie sind Orte des Ein- <strong>und</strong> Aussteigens aus dem Zug <strong>und</strong> Projektionsfläche<br />
so mancher Phantasien: Viele verbinden mit dem Ausfahren des Zuges Sehnsüchte;<br />
Sehnsüchte von der großen weiten Welt, Heimweh, Fernweh, Freiheit, Aufbruch in das<br />
Unbekannte. Dabei spielt immer das unmittelbare, das Verkehrsmittel Zug eine große Rolle.<br />
Die Kraft der Dampflokomotiven, deren Pfeifen, Zischen <strong>und</strong> Dampfen waren einst der<br />
Inbegriff technischen Fortschritts. Und auch wenn der Dampf Diesel- <strong>und</strong> Elektromotoren<br />
weichen musste, vermögen auch heute noch die schnellen weißen Züge nicht nur<br />
Kinderherzen in Wallung zu bringen.<br />
Für die Eisenbahnunternehmen waren die Anlage geeigneter Ein- <strong>und</strong> Ausstiegshilfen, die<br />
sinnvolle Anordnung aller verkehrstechnisch notwendiger Anlagen für den Eisenbahnbetrieb<br />
wichtig. Im Laufe der Zeit änderten sich die Art der Züge, die Ansprüche der Reisenden, die<br />
Anzahl <strong>und</strong> Ziele der Verbindungen <strong>und</strong> die Geschwindigkeiten - der <strong>Bahnhof</strong> musste sich<br />
allen diesen Veränderungen stets anpassen. Um diesen verkehrstechnischen Bereich des<br />
Eisenbahn im <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> zwischen den Bahnhöfen geht es im folgenden Kapitel.<br />
Hier werden die aktuell geltenden Vorschriften für die Anlage der Gleise <strong>und</strong> Bahnsteige<br />
beleuchtet. Diese bilden die Gr<strong>und</strong>lage eines jeden Eisenbahnbetriebs. Es folgt eine<br />
Betrachtung des Verkehrsmittels Zug – es werden exemplarisch die Zugverbindungen der<br />
bedeutendsten deutschen Bahnhöfe geprüft. Damit sollen die zwei Säulen des<br />
Verkehrssystems Eisenbahn, Fahrwege <strong>und</strong> Zugverbindungen, vorgestellt <strong>und</strong> analysiert<br />
werden. Es folgt eine Darstellung des Preissystems der Deutschen Bahn AG für ihre<br />
Stationen <strong>und</strong> Trassen im Hinblick auf den Umgang mit Wettbewerbern. Ein kurzer Blick auf<br />
ökologische Aspekte des Bahnbetriebs bei der Deutschen Bahn AG r<strong>und</strong>et das Kapitel ab.<br />
2.1 Gr<strong>und</strong>lagen der Gleis- <strong>und</strong> Bahnsteiganlagenplanung<br />
Gleise <strong>und</strong> Bahnsteige stellen eine gr<strong>und</strong>legende Notwendigkeit für den reibungslosen<br />
Betrieb eines Personenbahnhofs dar. Für Konzeption, Planung <strong>und</strong> Realisierung solch<br />
bahntechnischer Anlagen bedarf es einheitlicher Normen <strong>und</strong> rechtlicher Gr<strong>und</strong>lagen, damit<br />
im späteren Betriebsablauf die Sicherheit des Bahnbetriebes <strong>und</strong> der darin tätigen Personen<br />
stets gewährleistet ist. Die übergeordnete Rahmenbedingung für die Errichtung<br />
bahntechnischer Anlagen stellt der so genannte Planfeststellungsbeschluss dar, welcher im<br />
§ 18ff. des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) in der Fassung vom 27. Dezember 1993<br />
festgesetzt ist. Diese Form des Beschlusses ist rechtlich nach den §§ 72 bis 78 des<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) geregelt. 72 Im Folgenden sollen nun die rechtlichen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> technischen Merkmale für die Errichtung von Gleisen <strong>und</strong> Bahnsteigen<br />
betrachtet werden.<br />
72 http://www.wedebruch.de/gesetze/gr<strong>und</strong>lagen/aeg_200612zwei.htm#para15, Zugriff 27.06.07.<br />
38
2.1.1 Rechtsgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Richtlinien für die Konzeption von Gleisen <strong>und</strong><br />
Bahnsteigen<br />
� Die Eisenbahnbau- <strong>und</strong> Betriebsordnung (EBO)<br />
Die EBO trat am 12. Mai 1967 rechtlich in Kraft <strong>und</strong> wurde im Laufe der letzten vier<br />
Jahrzehnte mehrfach novelliert <strong>und</strong> an neue technische Standards angepasst. 73 Sie<br />
beinhaltet Mindestanforderungen <strong>und</strong> Grenzwerte für die Planung <strong>und</strong> Realisierung von<br />
Bahn- <strong>und</strong> Gleisanlagen.<br />
Der besonders wichtige Abschnitt 2 definiert im § 4 gr<strong>und</strong>legende bahntechnische Begriffe,<br />
die für den Bahnbetrieb vonnöten sind (siehe dazu Kapitel 1.3.1 Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen).<br />
Anschließend werden verbindliche Größen von Spurweite (§ 5), Gleisbogen (§ 6) <strong>und</strong><br />
Gleisneigung (§ 7) für das deutsche Schienennetz festgesetzt. Die Belastbarkeit des<br />
Bahnkörpers (§ 8), der Regellichtraum (§ 9) <strong>und</strong> der Gleisabstand (§ 10) r<strong>und</strong>en die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Gleisanlagen ab. Später werden hieraus die wichtigsten Punkte in den<br />
technischen Gr<strong>und</strong>lagen näher beleuchtet.<br />
� Die Modulfamilie 813<br />
Die bereits vorgestellte EBO regelt die Kennzahlen für die Konzeption <strong>und</strong> Realisierung von<br />
Gleisanlagen. Da in dieser Betriebsordnung allerdings keinerlei Festsetzungen bezüglich der<br />
Bahnsteiganlagen <strong>und</strong> deren Zuwegungen enthalten sind, muss dies durch Richtlinien <strong>und</strong><br />
Normen anderer Gr<strong>und</strong>lagen erfolgen. Die DB Station & Service AG ist für den Bau <strong>und</strong><br />
Betrieb der Verkehrsstationen innerhalb deutscher Bahnhöfe zuständig. Dazu gehören die<br />
Bahnsteige, Zuwegungen <strong>und</strong> Empfangsgebäude. Um die Infrastruktur an Bahnhöfen nach<br />
vergleichbar hohen Maßstäben entsprechend der EBO gestalten zu können, existieren<br />
technische Regelwerke, die von der höchsten Bauaufsichtsbehörde für<br />
Eisenbahnbetriebsanlagen auf B<strong>und</strong>esebene eingeführt wurden, dem Eisenbahnb<strong>und</strong>esamt<br />
(EBA). 74<br />
73<br />
http://www.wedebruch.de/gesetze/betrieb/ebo1.htm, Zugriff 27.06.07.<br />
74<br />
DB Station&Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong> Entwicklung von Bahnhöfen,<br />
S. 35.<br />
39
Die Tabelle unten zeigt einen Ausschnitt aus den technischen Regelwerken der Deutschen<br />
Bahn AG <strong>und</strong> stellt in der Übersicht die so genannte „Modulfamilie 813“ dar. Auf Gr<strong>und</strong>lage<br />
dieser Modulfamilie kann eine b<strong>und</strong>esweit einheitliche Planung <strong>und</strong> Realisierung neuer<br />
Verkehrsstationen <strong>und</strong> Bahnhöfe erfolgen. Bei der Gr<strong>und</strong>instandsetzung von Bahnsteigen<br />
<strong>und</strong> deren Zuwegungen an bereits bestehenden Bahnhöfen <strong>und</strong> Stationen kommt diese<br />
Modulfamilie ebenfalls zum Einsatz. Damit kann eine optische <strong>und</strong> technische Angleichung<br />
der veralteten Infrastruktur an die aktuellen Erfordernisse der Wiedererkennbarkeit <strong>und</strong><br />
Barrierefreiheit sichergestellt werden. Die genauen Inhalte der einzelnen Module bleiben an<br />
dieser Stelle ausgespart, da es zum einen den Rahmen sprengen würde <strong>und</strong> es sich zum<br />
anderen um interne Richtlinien des technischen Regelwerks der Deutschen Bahn AG handelt.<br />
Tabelle 7: Übersicht der Modulfamilie 813 des technischen Regelwerks der<br />
Deutschen Bahn AG<br />
Quelle: eigene Darstellung, Gr<strong>und</strong>lage: http://www.westbahn.de/bahn/dv_titel/dv_dbn/dv_dbnmitgelt/dv_dbn-mitgelt.html,<br />
Zugriff 03.07.07<br />
40
2.1.2 Technische Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Merkmale von Gleisen<br />
� Gleiskategorien<br />
Um die technischen Spezifika von Gleisen erläutern zu können, bedarf es zunächst einer<br />
Kategorisierung der für einen <strong>Bahnhof</strong> relevanten Gleise <strong>und</strong> Gleisteile. Im folgenden<br />
Abschnitt sind die Arten von Gleisen mit einer kurzen Erläuterung aufgelistet:<br />
- Hauptgleise – sind solche Gleise, die regelmäßig im Zugbetrieb befahren<br />
werden. Dazu gehören Hauptgleise der freien Strecke, Hauptgleise in Bahnhöfen<br />
<strong>und</strong> durch Bahnhöfe hindurchführende Hauptgleise.<br />
- Nebengleise – sind solche Gleise, die von Hauptgleisen abzweigen <strong>und</strong> nicht<br />
regelmäßig im Zugbetrieb befahren werden. Sie dienen zur Abstellung <strong>und</strong><br />
Bereitstellung von Zügen.<br />
- Weichen – sind Abzweigstellen innerhalb der Gleisanlagen, die den Wechsel von<br />
einem auf ein anderes Gleis ermöglichen. Im <strong>Bahnhof</strong> dienen sie dem<br />
wechselseitigen Benutzen von Bahnsteiggleisen durch Personenzüge <strong>und</strong><br />
darüber hinaus dem Kreuzen <strong>und</strong> Überholen von Zügen. 75<br />
� Gleiselemente<br />
Damit ein reibungsloser Betriebsablauf im Bahnbetrieb gewährleistet ist, muss das Gleis auf<br />
dem die Züge verkehren, eine verkehrssichere Einheit bilden <strong>und</strong> unterschiedlichsten<br />
Belastungen standhalten. Das standardisierte Gleis setzt sich aus folgenden drei Elementen<br />
zusammen:<br />
- Schienen,<br />
- Schwellen <strong>und</strong><br />
- Kleineisen.<br />
Die Abbildung unten verdeutlicht den Aufbau eines Gleises. Die Beton- oder Holzschwelle<br />
dient den beiden Schienen als F<strong>und</strong>ament <strong>und</strong> muss drei wichtige Aufgaben erfüllen: Zum<br />
einen überträgt sie die vertikalen <strong>und</strong> horizontalen Kräfte der auf dem Gleis verkehrenden<br />
Züge in das darunter liegende Schotterbett. Zum anderen gewährleistet sie die Spurhaltung<br />
<strong>und</strong> Standfestigkeit der Schienen. Schlussendlich sorgt sie für die Lagesicherung des<br />
gesamten Gleises gegenüber äußeren mechanischen Belastungen. 76<br />
75 http://www.gleisbau-welt.de/site/gleisbau/einteilung.htm, Zugriff 02.07.07.<br />
76 http://www.gleisbau-welt.de/site/gleisbau/gleisbau.htm, Zugriff 02.07.07.<br />
41
Die Schienen stellen das wichtigste Element des gesamten Gleises dar. Sie dienen den<br />
darauf verkehrenden Zügen unmittelbar als Lauffläche <strong>und</strong> haben die gesamten<br />
Verkehrslasten zu tragen. Dementsprechend hochwertig müssen sie gefertigt sein, um über<br />
Jahrzehnte hinweg einen reibungslosen Betriebsablauf sicherstellen zu können. 77<br />
Abb. 6: Aufbau des Gleises<br />
Quelle: Matthews, Volker (1998): Bahnbau,<br />
4. Auflage, Teubner-Verlag, Leipzig, S. 160<br />
Das letzte Element des Verb<strong>und</strong>es Gleis stellen<br />
die so genannten Kleineisen dar. Diese sind in<br />
der Abbildung 6 als Schwellenschraube,<br />
Spannklemme <strong>und</strong> Winkelführungsplatte<br />
bezeichnet. In ihrer Gesamtheit erfüllen sie<br />
einen essentiellen Zweck: Sie verbinden die<br />
Schiene mit der darunter liegenden Schwelle.<br />
Allerdings müssen die Kleineisen speziellen<br />
Anforderungen gerecht werden, denn eine<br />
schlichte Befestigung zwischen Schiene <strong>und</strong><br />
Schwelle reicht nicht aus. Wichtig dabei ist,<br />
dass eine feste Verbindung hergestellt wird,<br />
die dennoch einen gewissen Grad an Elastizität<br />
aufweist. Aufgr<strong>und</strong> von äußeren Einflüssen,<br />
wie zum Beispiel Temperaturschwankungen,<br />
kommt es zu Längenänderungen oder<br />
Verformungen der Schiene, die wiederum eine<br />
Nachgiebigkeit der Kleineisen erfordern.<br />
Über diese Eigenschaft hinaus müssen die Kleineisen unter allen Umständen die exakte<br />
Spurweite der Gleise aufrechterhalten.<br />
Die Spurweite deutscher Gleise liegt nach § 5 EBO bei 1.435 mm. Darauf abgestimmt sind<br />
die Radachsen der Züge. Abweichungen der Spurweite vom Regelmaß sind nur im<br />
Millimeterbereich zulässig, damit der sichere Bahnbetrieb jederzeit gewährleistet ist.<br />
Abschließend müssen die Kleineisen leicht zu handhaben <strong>und</strong> zu lösen sein, um ohne großen<br />
Aufwand einen zügigen Wechsel der Schienen zu ermöglichen. 78<br />
� Der Bahnkörper<br />
Der gesamte Bahnkörper gliedert sich in zwei wesentliche Abschnitte:<br />
77 http://www.gleisbau-welt.de/site/gleisbau/einzelteile.htm, Zugriff 02.07.07.<br />
78 http://www.gleisbau-welt.de/site/gleisbau/gleisbau.htm, Zugriff 02.07.07.<br />
42
Oberbau <strong>und</strong> Unterbau<br />
Die Abbildung zeigt den Aufbau des Körpers mit seinen wesentlichen Elementen. Zum<br />
Oberbau gehört der gesamte Gleiskörper (Schwellen, Kleineisen <strong>und</strong> Schienen), die daran<br />
anschließende Bettungsschicht; meist aus Schotter bestehend (bei der so genannten festen<br />
Fahrbahn besteht diese nicht aus Schotter sondern aus einer festen Betonschicht) <strong>und</strong> im<br />
Abschluss die Planumsschutzschicht.<br />
Abb. 7: Querschnitt durch den Bahnkörper<br />
Quelle: Matthews, Volker (1998): Bahnbau, 4. Auflage,<br />
Teubner-Verlag, Leipzig, S. 137<br />
43<br />
Letztere ist eine spezielle<br />
Dichtungsschicht, die aus einem<br />
wasser<strong>und</strong>urchlässigen<br />
Mineralstoffgemisch besteht. Sie<br />
dient der Abführung des Wassers bei<br />
Regen <strong>und</strong> Nässe. Wie in der<br />
Abbildung 7 ersichtlich, ist der<br />
Oberbau leicht konisch ausgeführt.<br />
Der anfallende Regen sammelt sich<br />
im Schotter der Bettungsschicht <strong>und</strong><br />
wird durch seine grobe Körnung<br />
zügig in den Untergr<strong>und</strong> abgeführt.<br />
Das dort ankommende Wasser trifft<br />
auf die Planumsschutzschicht <strong>und</strong><br />
wird durch die spezielle Form in die<br />
seitlich neben dem Bahnkörper<br />
eingerichteten Entwässerungsgräben<br />
abgeführt.<br />
Diese Art der Entwässerung ist nötig, um auch bei widrigen Wetterverhältnissen stets die<br />
Standsicherheit des Bahnkörpers gewährleisten zu können. 79<br />
Die bereits erwähnte Bettungsschicht dient dem Gleiskörper als feste <strong>und</strong> unverrückbare<br />
Unterlage. Horizontale <strong>und</strong> vertikale Kräfte, die durch die auf dem Gleiskörper verkehrenden<br />
Züge verursacht werden, sollen mittels dieser Schicht in den Untergr<strong>und</strong> abgeleitet werden.<br />
Damit die Bettung ein zügiges Abführen des Regenwassers in den Untergr<strong>und</strong> ermöglichen<br />
kann, muss sie aus festem, wetterbeständigem Hartgestein mit scharfen <strong>und</strong><br />
unregelmäßigen Kanten bestehen. Dadurch entstehen in der Schicht Hohlräume, die<br />
79 Matthews, Volker (1998): Bahnbau, 4. Auflage, Teubner-Verlag, Leipzig, S. 143-146.
anfallendes Wasser schnell ableiten <strong>und</strong> eine Verdunstung beschleunigen. 80 Der zweite<br />
Abschnitt des Bahnkörpers entfällt auf den Unterbau. Dieser kann sowohl künstlich als auch<br />
natürlich ausgeführt sein <strong>und</strong> verbindet den Oberbau mit dem Untergr<strong>und</strong>.<br />
Der Unterbau ist generell durch bautechnische Maßnahmen geformt. Dies kann zum einen<br />
mit den vorhandenen Erdmaterialien vor Ort erfolgen, indem Einschnitte oder Dämme<br />
eingerichtet werden. Zum anderen können dafür künstliche Baustoffe verwendet werden, um<br />
daraus Brücken, Stützmauern oder Tunnel zu errichten. Ein letztes wichtiges Element des<br />
Unterbaus stellen die Entwässerungsanlagen dar. In der Regel sind diese als Bahngräben<br />
entlang der Strecke ausgeführt. Im Bereich von Bahnhöfen bedarf es dabei allerdings der so<br />
genannten Tiefenentwässerung, da aufgr<strong>und</strong> der Anlage von Bahnsteigen in der Regel kein<br />
Platz für Entwässerungsgräben vorhanden ist. Die Tiefenentwässerung besteht aus<br />
geschlossenen, unterirdischen Entwässerungsanlagen, die neben dem anfallenden<br />
Regenwasser auch Sicker- <strong>und</strong> Schichtwasser aufnehmen <strong>und</strong> ableiten sollen. 81<br />
2.1.3 Technische Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Merkmale von Bahnsteigen<br />
Bahnsteige sind ein essentielles Element eines <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> dienen im weiteren Sinn der<br />
Abfertigung von Personenzügen. Im engeren Sinn stellen sie die Gr<strong>und</strong>lage für das<br />
bedarfsgerechte Ein- <strong>und</strong> Aussteigen der Fahrgäste im <strong>Bahnhof</strong> dar. Für die Bewirtschaftung<br />
deutscher Bahnhöfe ist in Deutschland allein die DB Station & Service AG zuständig. Als<br />
Monopolist ist sie rechtlich dazu verpflichtet, technische Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Normen für die<br />
Anlage von Bahnsteigen einzuhalten. Diese werden, wie bereits unter Punkt 2.3.1 erwähnt,<br />
von dem EBA aufgestellt. Für die Kategorisierung von Bahnsteigen ist allerdings die DB<br />
Station & Service AG selbst zuständig.<br />
� Bahnsteigkategorien<br />
Die Kriterien der Kategorisierung von Bahnsteigen richten sich nach der im<br />
Stationspreissystem vorgestellten <strong>Bahnhof</strong>skategorisierung. Passend zu jeder<br />
<strong>Bahnhof</strong>skategorie gibt es eine zugeschnittene Art von Bahnsteig, die den jeweiligen<br />
Anforderungen vor Ort gerecht werden soll. Tabelle 8 zeigt übersichtlich die<br />
Bahnsteigkategorien.<br />
Die Bahnsteige der Kategorie 1 entsprechen den höchsten Anforderungen an Oberflächenqualität<br />
<strong>und</strong> Ausstattung. Mit einer Länge von über 400 Metern sind sie in der Lage,<br />
jegliche Arten von Zuggattungen aufzunehmen: Angefangen bei kurzen<br />
Regionaltriebfahrzeugen über durchschnittlich lange Regionalexpresszüge (ca. 125 m) bis<br />
hin zu 16 Wageneinheiten langen ICE-Fernverkehrszügen (ca. 410 m). In der<br />
Kategorisierung sinkt der Grad der Ausstattung eines Bahnsteigs mit fallender Kategorie<br />
immer weiter ab. Zwar ist das Maß der Oberflächenqualität der Bahnsteige durch das<br />
80 Matthews, Volker (1998): Bahnbau, 4. Auflage, Teubner-Verlag, Leipzig, S. 162.<br />
81 Matthews, Volker (1998): Bahnbau, 4. Auflage, Teubner-Verlag, Leipzig, S. 139-146.<br />
44
technische Regelwerk der Deutschen Bahn AG festgesetzt, doch von Seiten der Station &<br />
Service AG ist bei einem Kategorie-1-Bahnsteig von Komfortqualität die Rede, wohingegen<br />
ein Kategorie-6-Bahnsteig jedoch nur noch die Minimalqualität zugesprochen bekommt.<br />
Solch ein Bahnsteig weist nur noch eine Länge von 60 Metern auf, da dieser ausschließlich<br />
von kurzen Regionaltriebfahrzeugen bedient wird. Ein Bahnsteigdach ist hierfür nicht mehr<br />
vorgesehen, da die niedrige Fahrgastfrequenz eine solche Installation finanziell nicht<br />
rechtfertigen würde. Alle Kategorien zwischen 1 <strong>und</strong> 6 bewegen sich im Mittelfeld bezüglich<br />
der Klasse <strong>und</strong> Länge <strong>und</strong> werden den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst. Eines<br />
haben alle Bahnsteigkategorien gemein: Laut Regelwerk der Deutschen Bahn AG haben sie<br />
eine Normhöhe von 76 cm ab Schienenoberkante aufzuweisen. Abweichungen davon hängen<br />
von speziellen Bestellungen der EVU oder Aufgabenträgern ab, welche diese Stationen<br />
anfahren oder bedienen. 82<br />
Tabelle 8: Kategorisierung von Bahnsteigen nach DB Station & Service AG<br />
Quelle: DB Station & Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong><br />
Entwicklung von Bahnhöfen, S. 12-13<br />
Aufgr<strong>und</strong> der verschiedenen Bauarten von Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller sind die<br />
Einstiegshöhen gegenüber der Bahnsteigkante allerdings nicht immer niveaugleich, obwohl<br />
sich die Fahrzeughersteller nach einheitlichen Fahrzeugrichtlinien zu richten haben. Mitunter<br />
liegt der Niveauunterschied allerdings auch in der Historie begründet. So sind veraltete<br />
Bahnsteige oftmals wesentlich niedriger als die Einstiegshöhen der neueren Fahrzeuge. An<br />
größeren Bahnhöfen mit erfolgter Sanierung oder einem Neubau der Bahnsteige ist mit den<br />
benannten 76 cm Bahnsteighöhe ein Mittelmaß festgesetzt worden, da neuere Fahrzeuge<br />
einen Niederflureinstieg besitzen (um an alten <strong>und</strong> neuen Bahnsteigen gleichermaßen das<br />
Ein- <strong>und</strong> Aussteigen zu vereinfachen) <strong>und</strong> ältere Wagen noch den bekannten <strong>und</strong> wesentlich<br />
höheren Tritt als Einstieg aufweisen.<br />
� Bahnsteigelemente<br />
Die Bahnsteiganlagen an deutschen Bahnhöfen weisen neben den Gr<strong>und</strong>elementen eine<br />
Vielzahl an weiteren Ausstattungsmerkmalen auf. In Tabelle 9 sind die Elemente in Bezug<br />
auf die jeweilige Kategorie dargestellt.<br />
82<br />
DB Station&Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong> Entwicklung von Bahnhöfen,<br />
S. 12-13.<br />
45
Einige Ausstattungselemente können auf den ersten Blick durch ihren Titel nicht eindeutig<br />
verifiziert werden <strong>und</strong> bedürfen einer Erläuterung: Unter der so genannten Einstiegshilfe ist<br />
eine Hubbühne oder Rampe für Rollstuhlfahrer zu verstehen. Diese ist laut der Matrix nur an<br />
Bahnhöfen/Bahnsteigen der ersten zwei Kategorien vorzufinden. Zur Bedienung der<br />
Bühne/Rampe ist fachk<strong>und</strong>iges Personal vonnöten, welches in der Regel nur in diesen<br />
Kategorien auf dem Bahnsteig eingesetzt wird. Eine Besonderheit stellen die Kategorie-4-<br />
Stationen in Großstädten/Ballungsräumen dar. An diesen Stationen befindet sich meist<br />
ebenfalls eine kleine ausklappbare Rampe, welche durch die Triebfahrzeugführer des Zuges<br />
im Falle des Zustiegs von Rollstuhlfahrern eingesetzt wird. 83<br />
Der Begriff der Low-Cost-Anzeige (Billiganzeige) ist relativ neu <strong>und</strong> definiert im Gegensatz<br />
zum Zuganzeiger eine stark vereinfachte Form der Anzeige. Diese wird nur aktiviert, wenn<br />
ein Informationsbedarf für die Reisenden vor Ort gegeben ist. Ein Informationsbedarf ist<br />
gegeben, wenn es zu etwaigen Zugverspätungen von mehr als fünf Minuten, Gleiswechseln<br />
oder gar Zugausfällen kommt. Eine generelle Anzeige von Fahrplandaten erfolgt hierüber<br />
nicht. Die Installation dieser Anzeige ist seit Januar 2007 bei Stationsneubauten oder<br />
gr<strong>und</strong>legenden Umbauten obligatorisch, allerdings nur, wenn an einer Station der Kategorien<br />
4 bis 6 ein gerechtfertigter Bedarf besteht. 84<br />
Tabelle 9: Matrix der Ausstattungsmerkmale eines Bahnsteigs je Kategorie<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Gr<strong>und</strong>lage: DB Station & Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong><br />
Entwicklung von Bahnhöfen, S. 12-24<br />
Die Installation von Kameraüberwachung ist ebenfalls ein relativ neues Element <strong>und</strong> erfolgt<br />
nur bei Bahnhöfen der Kategorien 1 <strong>und</strong> 2. Bei Neubauten ist diese obligatorisch, doch bei<br />
bereits bestehenden Bahnsteiganlagen erfolgt sie nur im Zuge von<br />
Modernisierungsmaßnahmen. Bei Bahnhöfen der Kategorien 3 <strong>und</strong> 4 kann eine Kamera-<br />
83<br />
DB Station&Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong> Entwicklung von Bahnhöfen,<br />
S. 14.<br />
84<br />
DB Station&Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong> Entwicklung von Bahnhöfen,<br />
S. 17.<br />
46
überwachung ebenfalls erfolgen, wenn es sich dabei um Tunnelbahnhöfe oder stark<br />
frequentierte Stationen handelt. 85<br />
� Der Bahnsteigkörper<br />
Die folgende Abbildung zeigt den Querschnitt eines standardisierten Kategorie-1-<strong>Bahnhof</strong>s.<br />
Der Bahnsteigkörper ist in vier Abschnitte unterteilt:<br />
- F<strong>und</strong>ament,<br />
- Bahnsteig,<br />
- Überdachung <strong>und</strong><br />
- Ausstattungselemente.<br />
Diese Gliederung bezieht sich auf höher kategorisierte Bahnsteigkörper. Bei einem<br />
Kategorie-6-Bahnsteigkörper fehlt die Überdachung <strong>und</strong> wird im Bereich der<br />
Ausstattungselemente durch Wetterschutzhäuser repräsentiert. Das F<strong>und</strong>ament wird in der<br />
Regel aus Betonguss gefertigt, auf dem dann der Bahnsteigrohbau erfolgt oder vorgefertigte<br />
Bahnsteigmodule installiert werden. Das Hauptauswahlkriterium für die Entscheidung<br />
zwischen modularer <strong>und</strong> konventioneller Bauweise stellt der Wirtschaftlichkeitsvergleich dar.<br />
In Einzelfällen wird vor Ort entschieden, welche Bauweise wirtschaftlicher ist. In der Regel<br />
wird aber die modulare Bauweise bevorzugt.<br />
Abb. 8: Querschnitt durch den Bahnsteigkörper<br />
Quelle: DB Station & Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong><br />
Entwicklung von Bahnhöfen, Faltblatt im Anhang<br />
85<br />
DB Station&Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong> Entwicklung von Bahnhöfen,<br />
S. 23.<br />
47
Die Installation eines neuen Bahnsteigdaches ist immer gegenüber dem Versuch des Erhalts<br />
vorhandener Dächer zurückzustellen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird generell nur äußerst<br />
selten die gesamte Bahnsteiglänge überdacht.<br />
Im Falle des Berliner Hauptbahnhofs ist die wegen Terminschwierigkeiten nur teilweise<br />
erfolgte Überdachung der Bahnsteige besonders prekär zutage getreten. An den<br />
unüberdachten Bereichen des Bahnsteiges ist eine Ergänzung durch Wetterschutzhäuser<br />
möglich <strong>und</strong> wird in der Regel an größeren Stationen <strong>und</strong> Bahnhöfen vorgenommen. Dies ist<br />
hier allerdings nicht erfolgt, so dass Fahrgäste dem Regen an den unüberdachten<br />
Bahnsteigenden der Fernbahnsteige der <strong>Stadt</strong>bahn schutzlos ausgesetzt sind.<br />
Für die Länge eines zu installierenden Bahnsteigdaches wird die Einsteigeranzahl an<br />
Reisenden zur Spitzenzeit eines Tages mit 1,50 m² multipliziert <strong>und</strong> dann wiederum durch<br />
die maximal mögliche Breite des Daches vor Ort (generell allerdings max. 5 Meter) dividiert.<br />
Nebenstehende Beispielrechnung soll dies verdeutlichen.<br />
Abb. 9: Beispielrechnung<br />
Die Breite des Daches richtet sich gr<strong>und</strong>sätzlich nach der maximalen Breite des Bahnsteigs,<br />
damit das Lichtraumprofil für Bahnfahrzeuge gewährleistet bleibt. 86 Das Lichtraumprofil für<br />
Bahnfahrzeuge wird im § 9 Regellichtraum der EBO geregelt. Es definiert den zu jedem Gleis<br />
gehörenden Freiraum, den Bahnfahrzeuge einschließlich ihrer horizontalen <strong>und</strong> vertikalen<br />
Bewegungen benötigen.<br />
Die Installation der weiteren Ausstattungselemente (<strong>Bahnhof</strong>snamensschilder, Zuganzeiger,<br />
Sitzgelegenheiten etc.) erfolgt nach den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort: Der Länge der<br />
Bahnsteige, Anzahl der Reisenden <strong>und</strong> der vorgestellten Matrix in Bezug auf jede<br />
<strong>Bahnhof</strong>skategorie.<br />
2.1.4 Fazit Gleis- <strong>und</strong> Bahnsteiganlagen<br />
Mit den technischen Regelwerken des AEG <strong>und</strong> der EBO sind allgemeingültige <strong>und</strong><br />
verbindliche Mindestanforderungen <strong>und</strong> Grenzwerte für die Durchführung eines<br />
reibungslosen Bahnbetriebs aufgestellt worden. Ohne diese Betriebsordnungen gäbe es ein<br />
heilloses Durcheinander <strong>und</strong> mit Sicherheit eine Rückkehr zur Kleinstaaterei der staatlichen<br />
86<br />
DB Station&Service AG: Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung <strong>und</strong> Entwicklung von Bahnhöfen,<br />
S. 12-13.<br />
48
Bahnen von einst. Erst diese Gr<strong>und</strong>sätze machten eine Vereinheitlichung <strong>und</strong> damit<br />
Vereinfachung des Bahnbetriebes möglich.<br />
Die Gleis- <strong>und</strong> Bahnsteiganlagen Deutschlands gehören aufgr<strong>und</strong> ihrer strengen Vorgaben<br />
<strong>und</strong> Richtlinien zu den sichersten <strong>und</strong> verlässlichsten weltweit. Allerdings besteht nach wie<br />
vor ein großer Sanierungsbedarf bei den technischen <strong>und</strong> betrieblichen Anlagen der<br />
Deutschen Bahn AG. Das Vermächtnis der beiden ehemaligen Staatsbahnen, B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong><br />
Reichsbahn, wiegt schwer <strong>und</strong> hinterließ zum Teil stark veraltete Anlagen, die erneuert oder<br />
ausgetauscht werden müssen. In den letzten 15 Jahren seit der Bahnreform hat sich im<br />
Bahnbetrieb deutschlandweit viel verändert. Viele Maßnahmen widmeten sich den neuen<br />
B<strong>und</strong>esländern <strong>und</strong> der Modernisierung des dortigen Bahnnetzes. Nun hat sich allerdings das<br />
westdeutsche Netz als zu sehr vernachlässigt herausgestellt, weshalb die Deutsche Bahn AG<br />
nun wieder unter starkem Erneuerungsdruck steht.<br />
Die Regelwerke von Seiten des EBA tragen viel zur Vereinheitlichung <strong>und</strong> Rationalisierung<br />
der Anlagen <strong>und</strong> Abläufe bei <strong>und</strong> unterstützen den Konzern Deutsche Bahn AG auf dem Weg<br />
der Modernisierung. Allerdings bergen diese Normen ein sehr großes<br />
Vereinheitlichungspotential. Viele Bahnhöfe <strong>und</strong> Haltepunkte, vor allem in ländlicheren<br />
Gegenden, haben zum großen Teil ihr individuelles Erscheinungsbild gegenüber dem<br />
Einheitsdesign des Konzerns einbüßen müssen. Alte Bahnhöfe fielen brach <strong>und</strong> nur wenige<br />
Meter weiter wurde ein kleiner bedarfsgerechter Haltepunkt errichtet, der von der nächsten<br />
Station drei Kilometer weiter kaum noch zu unterscheiden ist. In Zeiten des Wettbewerbs<strong>und</strong><br />
Rationalisierungsdrucks scheint der Deutschen Bahn AG allerdings nichts anderes übrig<br />
zu bleiben.<br />
2.2 Zugverkehr<br />
Im Bereich Zugverkehr sollen die Fernverkehrsverbindungen der Deutschen Bahn AG<br />
untersucht werden. Dabei sollen die Verknüpfungen zwischen den bedeutendsten deutschen<br />
Bahnhöfen geprüft werden.<br />
Dazu werden zunächst die wichtigsten Stationen benannt: Das Netz der Deutschen Bahn AG<br />
umfasst r<strong>und</strong> 34.000 Streckenkilometer mit über 5.400 Bahnhöfen. 87 Die Bahnhöfe wurden<br />
alle von der Deutschen Bahn AG - Tochter Station & Service AG klassiert <strong>und</strong> einer von<br />
sechs Kategorien zugeordnet. Die sechs Kategorien gliedern sich von Fernverkehrsknoten<br />
(Kategorie 1) bis zum Nahverkehrshalt (Kategorie 6), näheres dazu in Kapitel 2.3.2.<br />
Ausschlaggebende Kriterien für die Einordnung der Bahnhöfe sind:<br />
- Anzahl der Reisenden, gewichtet zwischen Nah- <strong>und</strong> Fernverkehr (aufgr<strong>und</strong> der<br />
unterschiedlichen Aufenthaltsdauer der Reisenden),<br />
- Anzahl der Zughalte, gewichtet zwischen Nah- <strong>und</strong> Fernverkehr,<br />
87 http://www.db.de/site/bahn/de/unternehmen/konzern/aufeinenblick/aufeinenblick.html, Zugriff 24.06.07.<br />
49
- Verknüpfungsfunktion zwischen Nah- <strong>und</strong> Fernverkehr bzw. innerhalb des Nah<strong>und</strong><br />
Fernverkehrs,<br />
- Präsenz unterschiedlicher Zugprodukte am <strong>Bahnhof</strong> - zum Beispiel Bahnhöfe mit<br />
hoch frequentiertem Regional- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>verkehr,<br />
- örtliche Besonderheiten, wie zum Beispiel besondere touristische Bedeutung,<br />
Einwohnerzahl, Universitäts- oder Kurstadt. 88<br />
Dabei steigt die Anzahl der Bahnhöfe je Kategorie mit abnehmender Bedeutung: So gibt es<br />
nur 20 Kategorie-1-Bahnhöfe, etwa 60 der zweiten Kategorie <strong>und</strong> zirka 3.200 Bahnhöfen der<br />
Kategorie 6. Entsprechend den Kategorien steigen Ausstattungsstandard <strong>und</strong> verkehrliche<br />
Bedeutung. Für die folgende Untersuchung werden nur die 20 Bahnhöfe der Kategorie 1<br />
betrachtet.<br />
Das Ausstattungsniveau der Bahnhöfe der Kategorie 1 soll mit dem internationaler Flughäfen<br />
vergleichbar sein. In repräsentativen Gebäuden, die im Zentrum der Großstädte liegen,<br />
sollen Bahnreisende <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>sbesucher sämtliche Dienstleistungen r<strong>und</strong> um die Bahn<br />
vorfinden, ergänzt durch attraktive Einkaufsmöglichkeiten, wobei dabei auf persönlichen<br />
K<strong>und</strong>enservice großen Wert gelegt wird. Hochwertige Ausstattungsmaterialien sollen für ein<br />
angenehmes Ambiente sorgen. 89<br />
88 http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/<br />
bahnhofskategorien/bahnhofs__kategorien.html, Zugriff 24.06.07.<br />
89 http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/<br />
bahnhofskategorien/bahnhofs__kategorien.html, Zugriff 24.06.07.<br />
50
In diese Gruppe fallen folgende Bahnhöfe:<br />
- Berlin Hauptbahnhof,<br />
- Berlin Ostbahnhof,<br />
- Berlin Südkreuz,<br />
- Bremen Hauptbahnhof,<br />
- Dortm<strong>und</strong> Hauptbahnhof,<br />
- Dresden Hauptbahnhof,<br />
- Düsseldorf Hauptbahnhof,<br />
- Essen Hauptbahnhof,<br />
- Frankfurt<br />
Hauptbahnhof,<br />
(Main)<br />
- Frankfurt (Main) Flughafen,<br />
- Hamburg Hauptbahnhof,<br />
- Hannover Hauptbahnhof,<br />
- Karlsruhe Hauptbahnhof,<br />
- Köln Hauptbahnhof,<br />
- Leipzig Hauptbahnhof,<br />
- Mainz Hauptbahnhof,<br />
- Mannheim Hauptbahnhof,<br />
- München Hauptbahnhof,<br />
- Nürnberg Hauptbahnhof,<br />
- Stuttgart Hauptbahnhof. 90<br />
Abb. 10: Städte mit Kategorie-1-Bahnhöfen<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
90 Eigene Recherche, Datengr<strong>und</strong>lage: <strong>Bahnhof</strong>skategorisierung DB Station & Service AG, Stand 01.01.07.<br />
51
Die Bahnhöfe der Kategorie 1 verteilen sich über das B<strong>und</strong>esgebiet (Abb. 10). Die Länder<br />
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein <strong>und</strong><br />
Thüringen haben keinen entsprechenden <strong>Bahnhof</strong>.<br />
Angenommen wird, dass diese „Aushängeschilder“ der Deutschen Bahn AG als zentrale<br />
Knotenpunkte dienen <strong>und</strong> deshalb alle diese Bahnhöfe in ausreichender Weise miteinander<br />
durch Direktverbindungen im Fernverkehr vernetzt sind. Als ausreichend wird dabei<br />
mindestens eine direkte Fernverkehrsverbindung am Tag angesehen. Für die weiteren<br />
Betrachtungen der Fernverkehrsverbindungen wurden drei Bahnhöfe ausgenommen: Die<br />
Bahnhöfe Berlin Ostbahnhof <strong>und</strong> Berlin Südkreuz werden durch den Berliner Hauptbahnhof<br />
in ihren verkehrlichen Funktionen abgedeckt, entsprechend wird der <strong>Bahnhof</strong> Frankfurt<br />
(Main) Flughafen durch den Frankfurter Hauptbahnhof repräsentiert.<br />
2.2.1 Verbindungen der Bahnhöfe der Kategorie 1<br />
Die Vergleichbarkeit von <strong>Bahnhof</strong>sverbindungen ist aufgr<strong>und</strong> bahneigener Besonderheiten<br />
nicht einfach: So gibt es je Wochentag eine unterschiedliche Anzahl an Verbindungen. An<br />
Ferien-, Feier- <strong>und</strong> Brückentagen ändert sich die Anzahl an verkehrenden Zügen, zu Messen<br />
<strong>und</strong> anderen besonderen Ereignissen können zusätzlich Züge eingesetzt werden. Die kleinste<br />
vergleichbare Einheit ist daher die Woche, am günstigsten eine Woche ohne vorgenannte<br />
Besonderheiten, da diese sonst ein verzerrtes Bild ergeben könnten. Für die Betrachtungen<br />
wurde die Woche vom 18. zum 24. Juni 2007 ausgewählt, da sie solche Eigenheiten nicht<br />
aufweist. Auf Gr<strong>und</strong>lage verschiedener aktueller Informationsmaterialien der Deutschen<br />
Bahn AG (Faltblätter mit Fahrplanauszügen, Städteverbindungsbuch Leipzig, Internetdienst<br />
„Ihr Fahrplan“ 91 ), wurden die Verbindungen für diese Woche gezählt. Es wurden dabei nur<br />
Direktverbindungen gezählt, also ohne jegliche Umstiege <strong>und</strong> nur Fernverkehrsangebote,<br />
wie Intercityexpress (ICE), Intercity (IC), Eurocity (EC), Durchgangszug (D-Zug), Nachtzug<br />
(NZ), Euronachtzug (EN), Citynachtlinie (CNL) <strong>und</strong> der französische<br />
Hochgeschwindigkeitszug TGV, sofern diese die Strecken befahren.<br />
Eventuell stattfindender Regionalzugverkehr sowie Angebote anderer Anbieter wurden nicht<br />
gewertet. Der Direktnahverkehr spielt keine Rolle, da er nur bei geografisch nahe liegenden<br />
Orten vorkommt <strong>und</strong> das Bild stark verzerren würde. Er würde die Vergleichbarkeit<br />
beeinträchtigen. Drittanbieter, auch für Fernverkehr, wurden nicht gezählt, da die<br />
Verbindungen der Deutschen Bahn AG zwischen den Vorzeigebahnhöfen im Mittelpunkt der<br />
Analyse stehen sollen.<br />
91 http://persoenlicherfahrplan.bahn.de/bin/pf/query-p2w.exe/dn?, alle Zugriffe 13.06.07.<br />
52<br />
B Berlin Hbf<br />
HB Bremen Hbf<br />
DO Dortm<strong>und</strong> Hbf<br />
DD Dresden Hbf<br />
D Düsseldorf Hbf
2.2.2 Verbindungsanalyse<br />
Die Ergebnisse der Prüfung der Verbindungen sind in Tabelle 10<br />
dargestellt. Die verwendeten <strong>Bahnhof</strong>skürzel orientieren sich an<br />
den deutschen Kfz-Kennzeichen <strong>und</strong> sind rechts noch einmal<br />
detailliert aufgeführt.<br />
Im Ergebnis der Zählungen bestätigten sich die Annahmen<br />
bezüglich der Verknüpfung aller Bahnhöfe nicht. Es gibt Verbindungen,<br />
die seltener als einmal täglich angefahren werden,<br />
teilweise werden Fernverkehrsdirektverbindungen gar nicht angeboten.<br />
Die Anzahl der Verbindungen zwischen den Städten ist<br />
sehr unterschiedlich <strong>und</strong> liegt zwischen Null <strong>und</strong> 392 (Köln Hbf �<br />
Düsseldorf Hbf). Der durchschnittliche Wert der Verbindungen von <strong>Stadt</strong> zu <strong>Stadt</strong> liegt bei<br />
knapp 107 92 E Essen Hbf<br />
Frankfurt (Main)<br />
F Hbf<br />
HH Hamburg Hbf<br />
H Hannover Hbf<br />
KA Karlsruhe Hbf<br />
K Köln Hbf<br />
L Leipzig Hbf<br />
MZ Mainz Hbf<br />
MA Mannheim Hbf<br />
M München Hbf<br />
N Nürnberg Hbf<br />
S Stuttgart Hbf<br />
.<br />
Tabelle 10: Verbindungsmatrix<br />
von<br />
nach<br />
B HB DO DD D E F HH H KA K L MZ MA M N S<br />
B Z 14 155 55 140 149 115 149 190 62 130 125 3 107 111 109 50<br />
HB 7 Ü 126 0 84 84 63 138 111 27 119 42 111 55 47 48 28<br />
DO 156 129 G 14 352 350 96 128 178 49 345 47 161 118 70 68 57<br />
DD 55 0 14 E 14 14 59 34 1 13 14 118 33 13 7 7 0<br />
D 144 91 380 14 387 136 91 129 35 390 9 125 125 121 80 68<br />
E 143 91 368 14 366 I 53 91 129 28 152 9 119 118 68 33 57<br />
F 112 69 107 61 149 89 N 123 128 168 220 75 142 266 108 165 170<br />
HH 138 128 126 34 90 90 122 255 64 125 90 111 106 98 98 50<br />
H 197 117 185 0 138 136 130 259 D 84 172 95 20 120 106 85 58<br />
KA 58 27 43 13 44 28 156 66 89 E 70 13 23 211 22 44 144<br />
K 123 126 268 14 392 218 208 133 162 64 R 40 182 111 175 120 75<br />
L 116 41 42 122 8 8 79 85 95 13 41 49 14 103 99 1<br />
MZ 4 104 153 20 123 103 132 104 19 24 181 36 W 114 28 56 90<br />
MA 113 48 113 18 126 112 265 114 108 207 127 19 104 O 132 0 217<br />
M 99 47 91 7 136 95 111 102 101 26 163 91 22 138 C 260 189<br />
N 113 42 77 7 95 61 166 103 96 48 108 105 56 0 281 H 49<br />
S 49 28 56 0 68 56 182 57 52 145 69 0 88 212 195 49 E<br />
Quelle: eigene Berechnung<br />
92 Eigene Berechnung.<br />
53
� Lageabhängigkeit<br />
Alle weiteren Berechnungen basieren auf dieser<br />
Verbindungsmatrix.<br />
Die Anzahl der Verbindungen weist einige<br />
Abhängigkeiten auf: Die Verbindungen sind<br />
abhängig von der Lage der <strong>Stadt</strong>, von der Zahl der<br />
sie durchfahrenden Linien <strong>und</strong> von der<br />
Verbindungsrichtung. In den folgenden<br />
Abschnitten wird dies ausführlicher beleuchtet <strong>und</strong><br />
abschließend<br />
dargestellt.<br />
verdeutlichende Ergebnisse<br />
Die 17 Städte mit den Bahnhöfen der Kategorie 1 liegen über das B<strong>und</strong>esgebiet verteilt,<br />
dabei gibt es aber einige Häufungspunkte, Gebiete mit besonders vielen Vorzeigebahnhöfen.<br />
Diese liegen entlang der so genannten Rheinschiene zwischen Ruhrgebiet <strong>und</strong> nördlichem<br />
Baden-Württemberg. Im nördlichen Teil liegen die Bahnhöfe von Dortm<strong>und</strong>, Essen,<br />
Düsseldorf, Köln wie eine Perlenkette aufgereiht in kurzem Abstand hintereinander. Im<br />
südlichen Teil der Rheinschiene liegen die Bahnhöfe von Frankfurt am Main, Mainz,<br />
Mannheim, Karlsruhe <strong>und</strong> Stuttgart. Diese liegen aber nicht linear, sondern polyzentral mit<br />
Mannheim als (geografischem) Zentrum. Alle weiteren Orte bilden eigene Pole.<br />
Durch Summierung aller ankommenden <strong>und</strong> abgehenden Züge kann eine Rangfolge der<br />
Bahnhöfe erstellt werden (Tabelle 11). Die Städte der „<strong>Bahnhof</strong>shäufungspunkte“ bilden<br />
auch die Spitze der Kategorie-1-Bahnhöfe, gemessen an der Anzahl der Verbindungen<br />
untereinander, die peripher gelegenen Orte sind wesentlich weniger stark verknüpft.<br />
54
Tabelle 11: Klassierung nach Verbindungszahl je Woche<br />
<strong>Bahnhof</strong> von nach gesamt<br />
Köln Hbf 2.411 2.426 4.837<br />
Düsseldorf Hbf 2.325 2.325 4.650<br />
Dortm<strong>und</strong> Hbf 2.318 2.304 4.622<br />
Frankfurt (Main) Hbf 2.152 2.073 4.225<br />
Essen Hbf 1.839 1.980 3.819<br />
Hannover Hbf 1.902 1.843 3.745<br />
Mannheim Hbf 1.823 1.828 3.651<br />
Hamburg Hbf 1.725 1.777 3.502<br />
München Hbf 1.678 1.672 3.350<br />
Berlin Hbf 1.664 1.627 3.291<br />
Nürnberg Hbf 1.407 1.321 2.728<br />
Mainz Hbf 1.291 1.349 2.640<br />
Stuttgart Hbf 1.306 1.303 2.609<br />
Bremen Hbf 1.090 1.102 2.192<br />
Karlsruhe Hbf 1.051 1.057 2.108<br />
Leipzig Hbf 916 914 1.830<br />
Dresden Hbf 396 393 789<br />
Quelle: eigene Berechnungen<br />
Die Bahnhöfe der Rheinschiene, insbesondere zwischen Dortm<strong>und</strong> <strong>und</strong> Mannheim, bilden die<br />
Spitze im Vergleich der Summen aller innerkategorialer Verbindungen je Woche (> 3.500).<br />
Hannover, als sehr zentral gelegene <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> die deutschen Großstädte Hamburg, München<br />
<strong>und</strong> Berlin folgen mit mehr als 3.000 Verbindungen je Woche.<br />
Mit Nürnberg, Mainz <strong>und</strong> Stuttgart folgen drei weitere süddeutsche Städte (> 2.500<br />
Verbindungen/Woche).<br />
Die Schlussgruppe bilden die (bahntechnisch) peripher gelegenen Städte Bremen, Karlsruhe<br />
<strong>und</strong> Leipzig (zwischen 1.800 <strong>und</strong> 2.200 Verbindungen/Woche) sowie Dresden. Wobei<br />
Dresden mit 789 Verbindungen einen deutlichen Rückstand auf alle anderen Städte hat.<br />
Die Anzahlen treffen allerdings keine endgültigen Aussagen über den <strong>Bahnhof</strong> als<br />
Fernverkehrsknoten insgesamt, da Verbindungen zu anderen Bahnhöfen, insbesondere im<br />
Ausland, nicht in die Berechnung einflossen. Dennoch kann festgestellt werden, dass nicht<br />
die Größe der <strong>Stadt</strong> der entscheidende Faktor bei der Zugfrequentierung ist, sondern viel<br />
eher die Lage der <strong>Stadt</strong>.<br />
55
� Linienabhängigkeit<br />
Die Anzahl der Fernverkehrslinien, welche einen <strong>Bahnhof</strong> berühren, beeinflussen stark die<br />
Zugzahl <strong>und</strong> möglichen Direktverbindungen von diesem <strong>Bahnhof</strong> aus.<br />
Die Lage der <strong>Stadt</strong> bedingt klar die Anzahl der Linien, welche die <strong>Stadt</strong> anlaufen. So sind<br />
peripher gelegene Städte, wie Bremen, Hamburg <strong>und</strong> Dresden eher Start- <strong>und</strong> Zielpunkte<br />
von Linien, während zentral gelegene Orte, wie Hannover, Frankfurt am Main, Nürnberg<br />
Verknüpfungspunkte verschiedener Fernverkehrslinien sind, <strong>und</strong> daher mehr Verbindungen<br />
ermöglichen.<br />
In der Darstellung des aktuellen ICE-Netzes ist deutlich zu erkennen, dass es eine<br />
Hauptachse vieler parallel verkehrender Linien im Westen der B<strong>und</strong>esrepublik gibt.<br />
Abb. 11: ICE-Netz 2007<br />
Quelle: http://www.bahn.de/p/view/planen/reiseplanung/streckenkarten_fernv.shtml, Zugriff 24.05.07<br />
Die Nord-Süd-Verbindung Dortm<strong>und</strong> (– Essen – Düsseldorf) – Köln – Frankfurt am Main –<br />
Mannheim wird von mehreren Linien angefahren.<br />
Weiterhin gibt es eine zentrale Nord-Süd-Verbindung Hamburg – Hannover – Frankfurt am<br />
Main – Mannheim.<br />
56
Im Osten befindet sich die Nord-Süd-Verbindung Berlin – Leipzig – Nürnberg – München.<br />
Zwischen Nürnberg <strong>und</strong> München ist eine weitere Linienkonzentration. Ost-West-<br />
Verbindungen sind weniger gebündelt. Es bestehen die Verbindungen Berlin – Hamburg,<br />
Berlin – Hannover – Dortm<strong>und</strong> (- Essen – Düsseldorf) – Köln sowie Dresden – Leipzig –<br />
Frankfurt am Main – Mainz. Weitere Linien verteilen sich über das B<strong>und</strong>esgebiet meist als<br />
Verzweigungen aus den oben beschriebenen Hauptachsen.<br />
Im darunter angesiedelten IC-/EC-Netz sind andere Linienhäufungen zu erkennen, aber<br />
nicht in der Stärke des ICE-Netzes. So besteht auch eine starke westliche Nord-Süd-<br />
Verbindung Hamburg – Bremen – Dortm<strong>und</strong> – Köln – Mainz – Mannheim – Stuttgart (–<br />
München).<br />
Abb. 12: EC-/IC-Netz 2007<br />
Quelle: http://www.bahn.de/p/view/planen/reiseplanung/streckenkarten_fernv.shtml, Zugriff 24.05.07<br />
Die zentrale Nord-Süd-Achse bildet die Verbindung Hamburg – Bremen – Hannover –<br />
Nürnberg bzw. München. Die östliche IC-/EC-Nord-Süd-Verbindung entspricht der, des ICE-<br />
Netzes.<br />
Es gibt nur eine ausgeprägte Ost-West-Verbindung: Berlin – Hannover – Dortm<strong>und</strong> – Essen<br />
– Düsseldorf – Köln. Weitere Verbindungen sind, wie im ICE-Netz auch, Verzweigungen aus<br />
den o.g. Linien.<br />
57
Aus der Analyse der Netze ist zu erkennen, dass das Fernverkehrsangebot in den Bahnhöfen<br />
unterschiedliche Ausprägungen in Form von Zuggattungen (ICE bzw. IC/EC) hat. So existiert<br />
ein <strong>Bahnhof</strong> mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an ICE-Verbindungen: Frankfurt<br />
(Main) Hbf. Zudem gibt es Bahnhöfe mit ausgewogen (vielen) ICE-/IC- <strong>und</strong> EC-Anfahrten,<br />
wie Hamburg Hbf, Köln Hbf, Essen Hbf, Düsseldorf Hbf, Dortm<strong>und</strong> Hbf, Hannover Hbf, Berlin<br />
Hbf, Nürnberg Hbf, München Hbf, Mannheim Hbf, Stuttgart Hbf sowie Karlsruhe Hbf.<br />
Außerdem gibt es auf den Bahnhöfen Leipzig Hbf <strong>und</strong> Dresden Hbf einen ausgeglichenen<br />
ICE-/IC-/EC-Anteil, allerdings auf niedrigem Niveau. Hinzu kommen Bahnhöfe mit einem<br />
sehr hohen IC-/EC-Zuganteil, wie Mainz Hbf <strong>und</strong> Bremen Hbf.<br />
Beim Vergleich der vorgenannten Bedingungen mit den Zugverbindungszahlen (Tabelle 11),<br />
kommt man zu dem Schluss, dass in der Regel durch IC-/EC-Linien weniger<br />
Verbindungstakte, als durch ICE-Züge bestehen, also eine ICE-Linie mehr Zugfahrten hat als<br />
IC- bzw. EC-Linien.<br />
� Richtungsabhängigkeit<br />
Die Verbindungsanzahl zwischen den Städten ist auch abhängig von der<br />
Verbindungsrichtung. Bei den meisten Verbindungen stimmt die Anzahl der Züge von A nach<br />
B mit der Anzahl von B nach A (nahezu) überein. Es gibt aber auch eine Reihe von<br />
Verbindungen, bei denen eine Richtung öfter angefahren wird als die Entgegengesetzte. Dies<br />
tritt sowohl bei selten, wie auch bei häufig gefahrenen Verbindungen auf. (Beispiele im<br />
folgenden Abschnitt)<br />
� Einzelergebnisse<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der entscheidende Punkt bei der Anzahl von<br />
Verbindungen zu anderen Bahnhöfen der Kategorie 1, die Lage der <strong>Stadt</strong> ist. So können Orte<br />
„auf dem Weg“ öfter angefahren werden, als abseits gelegene. Dabei spielen die<br />
vorhandenen Gleisverbindungen eine entscheidende Rolle. Deutlich wird dies z.B. beim<br />
Vergleich von Mainz <strong>und</strong> Frankfurt am Main. Beide Orte liegen unweit voneinander entfernt,<br />
ihre Bahnhöfe haben aber unterschiedliche Charakteristika. Frankfurt (Main) Hbf liegt an der<br />
ICE-Neubaustrecke nach Köln <strong>und</strong> besitzt deshalb regen ICE-Verkehr, während der IC- <strong>und</strong><br />
EC-Verkehr eine geringere Bedeutung hat. Ganz im Gegensatz zum <strong>Bahnhof</strong> Mainz Hbf,<br />
welcher an der „Altbaustrecke“ nach Köln liegt, die fast ausschließlich von IC- <strong>und</strong> EC-Zügen<br />
genutzt wird. Für Mainz spielt der ICE-Verkehr deshalb eine geringere Rolle. Und während<br />
Frankfurt (Main) Hbf über 4.200 Verbindungen zu anderen Bahnhöfen, der ersten Kategorie<br />
hat, so hat Mainz Hbf unter 2.700.<br />
a. Anzahl der Direktverbindungen<br />
Es gibt eine Reihe von Verbindungen zwischen den betrachteten Kategorie-1-Bahnhöfen, die<br />
nicht direkt gefahren werden:<br />
58
- Bremen Hbf � Dresden Hbf,<br />
- Dresden Hbf � Stuttgart Hbf,<br />
- Hannover Hbf � Dresden Hbf (in die Gegenrichtung 1 Zug/Woche),<br />
- Stuttgart Hbf � Leipzig Hbf (in die Gegenrichtung 1 Zug/Woche),<br />
- Mannheim Hbf � Nürnberg Hbf.<br />
Die fehlenden Direktverbindungen betreffen dreimal die sächsische Landeshauptstadt<br />
Dresden. Dies ist durch die innerdeutsche Abseitslage, bzw. durch die schlechte<br />
bahntechnische Erschließung zu erklären. Überraschend ist aber die fehlende<br />
Direktverbindung zwischen den großen süddeutschen Städten Mannheim <strong>und</strong> Nürnberg. Hier<br />
könnte sicher das Interesse der Deutschen Bahn AG an den Nord-Süd-Linien eine Rolle <strong>und</strong><br />
deren Konzentration auf München in diesem Raum spielen.<br />
Einige Verbindungen werden durchschnittlich weniger als einmal täglich bedient<br />
(< 7 Verbindungen/Woche). Dies sind die Verbindungen:<br />
- Dresden Hbf � Hannover Hbf,<br />
- Leipzig Hbf � Stuttgart Hbf <strong>und</strong><br />
- Berlin Hbf � Mainz Hbf (3 bzw. 4 Verbindungen/Woche).<br />
Zudem gibt es eine Vielzahl von Verbindungen mit weniger als 14 Verbindungen je Woche,<br />
also durchschnittlich weniger als zwei am Tag.<br />
Der Durchschnitt aller Verbindungsanzahlen liegt bei knapp 107 Verbindungen pro Woche,<br />
also in etwa 15 täglichen Verbindungen. Es gibt aber auch eine Reihe von Verbindungen,<br />
welche durchschnittlich häufiger als einmal stündlich angeboten werden (entspricht mehr als<br />
168 Verbindungen je Woche).<br />
Die meistgefahrenen Strecken sind:<br />
- Köln Hbf � Düsseldorf Hbf (392/390 Verbindungen/Woche),<br />
- Essen Hbf � Düsseldorf Hbf (387/366),<br />
- Düsseldorf Hbf � Dortm<strong>und</strong> Hbf (380/352),<br />
- Essen Hbf � Dortm<strong>und</strong> Hbf (368/350) <strong>und</strong><br />
- Dortm<strong>und</strong> Hbf � Köln Hbf (345/268).<br />
59
Auffallend ist, dass es sich dabei um die nördliche Rheinschiene handelt. In diesem Bereich<br />
sind viele Linien gebündelt <strong>und</strong> erschließen gleich alle Bahnhöfe. Die nächstfolgenden<br />
Verbindungen sind:<br />
- Nürnberg Hbf � München Hbf (281/260 Verbindungen/Woche),<br />
- Frankfurt (Main) Hbf � Mannheim Hbf (266/265),<br />
- Hannover Hbf � Hamburg Hbf (259/255) sowie<br />
- Frankfurt (Main) Hbf � Köln Hbf (220/208).<br />
Zur Orientierung: Der Wert von 252 Zügen/Woche entspricht durchschnittlich<br />
1,5 Zügen/St<strong>und</strong>e, dies bedeutet, dass rein rechnerisch alle 40 Minuten ein Zug diese<br />
Verbindung bedient.<br />
b. Ungleiche Richtungsverteilung<br />
Nur relativ wenige Verbindungen werden gleichzahlig in die eine, wie in die andere Richtung<br />
angeboten, dennoch ist der Unterschied in den meisten Fällen unbedeutend. Bei einigen<br />
Verknüpfungen gibt es aber auffällige Unterschiede in den Richtungsanfahrten. Hier ein<br />
Beispiel:<br />
Die Verbindung Berlin Hbf � Bremen Hbf wird 14mal wöchentlich angeboten, in die<br />
Gegenrichtung fahren nur halb so viele Züge. Weitere Beispiele:<br />
- Dresden Hbf � Mainz Hbf (33mal wöchentlich), Mainz Hbf � Dresden (20),<br />
- Nürnberg Hbf � Essen Hbf (61), Essen Hbf � Nürnberg Hbf (33),<br />
- München Hbf � Dortm<strong>und</strong> Hbf (91), Dortm<strong>und</strong> Hbf � München Hbf (70) <strong>und</strong><br />
- München Hbf � Essen Hbf (95), Essen Hbf � München Hbf (68).<br />
Es gibt im hochzahligen Bereich auch einige deutliche Abweichungen:<br />
- Köln Hbf � Essen Hbf (218mal wöchentlich), Essen Hbf � Köln Hbf (152),<br />
- Dortm<strong>und</strong> Hbf � Köln Hbf (345), Köln Hbf � Dortm<strong>und</strong> Hbf (268) sowie<br />
- Düsseldorf Hbf � Dortm<strong>und</strong> Hbf (380), Dortm<strong>und</strong> Hbf � Düsseldorf Hbf (352).<br />
Auch hier fällt die Dominanz der nördlichen Rheinschiene auf, insbesondere für Essen Hbf<br />
bedeutet dies, dass in der Summe 141 Züge mehr ankommen als abfahren (vgl.<br />
60
Tabelle 11). Bei allen anderen Bahnhöfen halten sich die Summen ungefähr die Waage. Bei<br />
dem in der Aufzählung ebenso auftauchenden <strong>Bahnhof</strong> Köln Hbf gleicht sich die Zahl letztlich<br />
sogar aus, es gibt keine Unterschiede in der Zahl der abfahrenden <strong>und</strong> ankommenden Züge.<br />
2.2.3 Fazit Zugverkehr<br />
Die Analyse der Verbindungen der wichtigsten deutschen Bahnhöfe fand auf Gr<strong>und</strong>lage der<br />
Einteilung der Bahnhöfe durch die Deutsche Bahn AG statt. Dabei wurden die Fernverkehrdirektverbindungen<br />
zwischen 17 der 20 Bahnhöfe der ersten Kategorie anhand einer<br />
ausgewählten Beispielwoche gezählt. Das Ergebnis ist, dass nicht alle untersuchten<br />
Bahnhöfe durch direkt verkehrende Fernverkehrszüge verb<strong>und</strong>en werden. Die Anzahl der<br />
Verbindungen ist sehr unterschiedlich <strong>und</strong> stark abhängig von der Lage der <strong>Stadt</strong> in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik, der Lage der Bahnhöfe an geeigneten Bahntrassen <strong>und</strong> auch von der<br />
Verbindungsrichtung. Alle Ergebnisse werden in Tabelle 12 noch einmal dargestellt.<br />
Tabelle 12: Ergebnisübersicht der Zugverkehrsanalyse<br />
von<br />
nach<br />
B HB DO DD D E F HH H KA K L MZ MA M N S<br />
B Z 14 155 55 140 149 115 149 190 62 130 125 3 107 111 109 50<br />
HB 7 Ü 126 0 84 84 63 138 111 27 119 42 111 55 47 48 28<br />
DO 156 129 G 14 352 350 96 128 178 49 345 47 161 118 70 68 57<br />
DD 55 0 14 E 14 14 59 34 1 13 14 118 33 13 7 7 0<br />
D 144 91 380 14 387 136 91 129 35 390 9 125 125 121 80 68<br />
E 143 91 368 14 366 I 53 91 129 28 152 9 119 118 68 33 57<br />
F 112 69 107 61 149 89 N 123 128 168 220 75 142 266 108 165 170<br />
HH 138 128 126 34 90 90 122 255 64 125 90 111 106 98 98 50<br />
H 197 117 185 0 138 136 130 259 D 84 172 95 20 120 106 85 58<br />
KA 58 27 43 13 44 28 156 66 89 E 70 13 23 211 22 44 144<br />
K 123 126 268 14 392 218 208 133 162 64 R 40 182 111 175 120 75<br />
L 116 41 42 122 8 8 79 85 95 13 41 49 14 103 99 1<br />
MZ 4 104 153 20 123 103 132 104 19 24 181 36 W 114 28 56 90<br />
MA 113 48 113 18 126 112 265 114 108 207 127 19 104 O 132 0 217<br />
M 99 47 91 7 136 95 111 102 101 26 163 91 22 138 C 260 189<br />
N 113 42 77 7 95 61 166 103 96 48 108 105 56 0 281 H 49<br />
S 49 28 56 0 68 56 182 57 52 145 69 0 88 212 195 49 E<br />
kursiv starke unterschiede zwischen den Richtungen<br />
fett keine Fernverkehrdirektverbindung<br />
rot weniger als zwei Verbindung täglich (< 14 Verbindungen/Woche)<br />
grün mehr als eine Verbindung stündlich (> 168 Verbindungen/Woche)<br />
Quelle: eigene Berechnungen<br />
61
2.3 UUmgang<br />
mmit<br />
Wettbeewerbern<br />
Der Ummgang<br />
derr<br />
Deutscheen<br />
Bahn AAG<br />
mit koonkurrierennden<br />
Unternehmen<br />
wird w durchh<br />
Marktöfffnung<br />
zuküünftig<br />
zuneehmen.<br />
In diesem Absschnitt<br />
soll die Transpparenz<br />
der Deutschenn<br />
Bahn AAG<br />
geprüfft<br />
werden.<br />
Dazu wwurden<br />
diee<br />
zwei wwichtigsten<br />
firmenuna abhängigenn<br />
Kostenppunkte<br />
fürr<br />
Eisenbahnunternehmmen,<br />
Trassen-<br />
<strong>und</strong> Stationsprreise<br />
unterrsucht.<br />
Diee<br />
Trassenn<br />
<strong>und</strong> Statiionen<br />
gehöören<br />
mehrhheitlich<br />
demm<br />
Deutschee-Bahn-Konnzern,<br />
spezziell<br />
dessenn<br />
Tochterrunternehmmen<br />
DB Netz<br />
AG <strong>und</strong> DDB<br />
Station & Service AAG.<br />
2.3.1 TTrassenpreeissystemm<br />
Das Traassenpreiss<br />
werden:<br />
Einerseit<br />
Kosten für Bau- u<br />
Systemm<br />
auf N<br />
Unterneehmensziel<br />
Effizienzsteigerung<br />
erfüllt wwerden.<br />
93 system der DB Netz AAG<br />
(TPS) sooll<br />
unterschiedlichen<br />
AAnforderung<br />
gen gerechtt<br />
ts muss deer<br />
mit den Trassen vverb<strong>und</strong>enee<br />
Aufwand bezahlt we erden, alsoo<br />
<strong>und</strong> Instanddhaltungsarbeiten<br />
müüssen<br />
abgeegolten<br />
werrden.<br />
Dabe ei muss dass<br />
achfragefakktoren<br />
reeagieren<br />
können. Außerdem sollen auch diee<br />
e der DB Netz AG, aausgeglicheene<br />
Bilanze en mit maarktüblichen<br />
n Renditen,<br />
gen <strong>und</strong> nachhaltige<br />
Sicherung der Qualittät<br />
der benötigten<br />
In nfrastruktur<br />
DDaher<br />
wurde<br />
ein moduulares<br />
Trasssenpreissysstem<br />
entwicckelt.<br />
Das Traassenpreisssystem<br />
biet tet für alle Eisenbahnnunternehm<br />
Benutzuung<br />
der SStrecken.<br />
DDamit<br />
kommmt<br />
es deer<br />
Forderu<br />
diskriminierungsfrreien<br />
Zuga ang zu ggewähren<br />
<strong>und</strong> so<br />
Trassennpreisrechnner<br />
ist im Innternet<br />
frei<br />
herunterlaadbar.<br />
für alle Eisenbahnnverkehrsunnternehmenn<br />
(EVU) erf<br />
(Abbilduung<br />
13).<br />
94 men gleichee<br />
Bedingungen<br />
für diee<br />
ng durch die EU nach,<br />
einenn<br />
Wettbeweerb<br />
zuzulaassen.<br />
Der<br />
Die<br />
Berechnuung<br />
der Traassenpreisee<br />
folgt auf Gr<strong>und</strong>lage<br />
der<br />
Trassenpreisformeel<br />
Abb. 13 3: Trassennpreisform<br />
mel<br />
Quelle: eigene e Darsttellung<br />
he Bahn AG ( 2007): Das Trassenpreissyystem<br />
der DB Netz AG, Frannkfurt<br />
am Main,<br />
S. 2.<br />
http://www.ddb.de/site/bahhn/de/geschaefte/infrastruktur__schienee/netz/trassenn/software/tra<br />
assenpreisaus-<br />
kunft___tpis.html<br />
93<br />
Deutsc<br />
94<br />
62
Gr<strong>und</strong>lage: Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main<br />
Zur Berechnung der Trassenpreise sind<br />
- nutzungsabhängige,<br />
- leistungsabhängige <strong>und</strong><br />
- sonstige Komponenten bedeutend.<br />
Jede dieser Komponenten beinhaltet Einzelkomponenten. Während die nutzungsabhängigen<br />
Komponenten immer berechnet werden, sind die anderen zwei Kategorien<br />
einzelfallabhängig.<br />
� Nutzungsabhängige Komponenten<br />
Zu den nutzungsabhängigen Komponenten gehören die Streckenkategorie <strong>und</strong> das<br />
Trassenprodukt. Das Produkt dieser beiden Faktoren bildet den Trassengr<strong>und</strong>preis <strong>und</strong> damit<br />
die Basis der Trassenpreisberechnung.<br />
a. Streckenkategorie SK<br />
Die DB Netz AG teilte ihre Fahrwege in zwölf Streckenkategorien ein, wovon drei<br />
ausschließlich Strecken des <strong>Stadt</strong>schnellverkehrs (S-Bahn) sind 95 <strong>und</strong> daher für die weitere<br />
Betrachtung keine Rolle spielen. Die verbleibenden neun Kategorien unterteilen sich in Fern<strong>und</strong><br />
Zulaufstrecken, eine Übersicht bietet Tabelle 13.<br />
Die Gr<strong>und</strong>preise für die Benutzung der Fahrwege der Deutschen Bahn AG unterscheiden sich<br />
stark, wobei für den Preis die zugelassene Höchstgeschwindigkeit ein wichtiger Faktor ist. So<br />
steigen die Preise für die höchsten zwei Kategorien (Fplus <strong>und</strong> F 1) im Vergleich zur<br />
nächstfolgenden Kategorie F 2 überproportional stark an.<br />
95 Deutsche Bahn AG (2007):Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 4.<br />
63
Tabelle 13: Streckenkategorien <strong>und</strong> ihre Merkmale<br />
Streckenkategorie<br />
FP Fernstrecke<br />
Fplus<br />
F1 Fernstrecke<br />
F 1<br />
F2 Fernstrecke<br />
F 2<br />
F3 Fernstrecke<br />
F 3<br />
F4 Fernstrecke<br />
F 4<br />
F5 Fernstrecke<br />
F 5<br />
F6 Fernstrecke<br />
F 6<br />
Z1 Zulaufstrec<br />
ke Z 1<br />
Z2 Zulaufstrec<br />
ke Z 2<br />
Gr<strong>und</strong>preise*<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Höchstgesch<br />
windigkeitsb<br />
ereich<br />
€/Trkm km/h Stück<br />
8,09 281–300 2<br />
Gleisanzahl<br />
verkehrliche Merkmale<br />
64<br />
überdurchschnittliche verkehrliche<br />
Bedeutung; Schnellverkehr<br />
4,12 201–280 2 überwiegend Schnell-, auch Mischverkehr<br />
2,85 161–200 2 überwiegend Schnell-, auch Mischverkehr<br />
2,53 101–160 1-2 Mischbetriebsstrecken<br />
2,42 101–160 2 Vorrangig überregionale schnelle Verkehre<br />
1,86 101–120 1-2<br />
2,18 101–160 1-2<br />
2,26 51–100 1<br />
2,34 bis 50 1<br />
vorrangig überregionale langsame<br />
Verkehre<br />
überwiegend SPNV bzw. Anbindung einer<br />
Region an einen Verdichtungsraum<br />
keine oder einfachste Leit- <strong>und</strong><br />
Sicherungstechnik<br />
Gr<strong>und</strong>lage: Deutsche Bahn AG (2007): Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG (SNB),<br />
Frankfurt am Main, außer *: Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz<br />
AG, Frankfurt am Main<br />
Zwischen der günstigsten Streckenkategorie F 5, welche hauptsächlich für den langsamen<br />
überregionalen Verkehr gedacht ist <strong>und</strong> der Kategorie F 2, die Geschwindigkeiten bis<br />
200 km/h erlaubt, liegt ein Preisunterschied von knapp 1 Euro je Streckenkilometer (1,86<br />
bzw. 2,85 €/Trkm). Zu Kategorie F 1 steigt der Preis um 1,27 Euro je Trassenkilometer,<br />
zwischen den Streckenkategorien F 1 <strong>und</strong> Fplus liegen fast 4 Euro je Kilometer Strecke.
Abb. 14: Trassen <strong>und</strong> ihre Kategorien im Bereich der DB Netz AG Niederlassung<br />
West (Ausschnitt)<br />
Quelle:<br />
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/trasse/trassenpreissystem__streckenkartegorienkarte__west__2007.<strong>pdf</strong>,<br />
Zugriff 30.06.07<br />
b. Trassenproduktfaktor TF<br />
Das Trassenprodukt entspricht der Art des Zuges. Für die Festlegung des Trassenproduktfaktors<br />
wird gr<strong>und</strong>sätzlich zwischen Personen- <strong>und</strong> Güterverkehr unterschieden. Als<br />
weiteres Kriterium ist die Taktung des Verkehrs wichtig: Höchste Priorität erhalten<br />
Expresstrassen, also Strecken für Züge, die schnellstmöglich <strong>und</strong> direkt Ballungszentren<br />
anbinden <strong>und</strong> für grenzüberschreitende Expressverkehre genutzt werden. Im<br />
Personenverkehr folgen die Takttrassen, also in regelmäßigen Abständen befahrene<br />
65
Verbindungen. Ein wichtiges Kriterium ist dabei die Verknüpfung der Takte <strong>und</strong> Anschlüsse<br />
untereinander. Die Standardtrassen sind ungetaktete Verkehre, im Güterverkehr sind die<br />
Standardtrassen über Anschlüsse miteinander verknüpft <strong>und</strong> nur die Ankunftszeit beim<br />
Empfänger von Bedeutung. 96<br />
Lokzüge ermöglichen die Durchführung dispositiver Lok- <strong>und</strong> Triebfahrzeugfahrten. Im<br />
Güterverkehr gibt es noch die Zubringertrasse. Diese Trasse dient zur Überführung<br />
beladener <strong>und</strong> leerer Einzelwagen zwischen Güterverkehrsstellen <strong>und</strong> Zugbildungsanlagen.<br />
Die Trassenlänge für Zubringertrassen ist auf maximal 75 km begrenzt. 97 Eine Übersicht der<br />
unterschiedlichen Trassenproduktfaktoren bietet Tabelle 14.<br />
Tabelle 14: Trassenprodukte <strong>und</strong> ihre Faktoren<br />
Personenverkehr Güterverkehr<br />
Trassenprodukt Faktor Trassenprodukt Faktor<br />
Expresstrasse 1,80 Expresstrasse 1,65<br />
Fernverkehrstakttrasse 1,65 Standardtrasse 1,00<br />
Nahverkehrstakttrasse 1,65 Lokzugtrasse 0,65<br />
Economytrasse 1,00 Zubringertrasse 0,50<br />
Lokzugtrasse 0,65<br />
Quelle: eigene Darstellung,<br />
Gr<strong>und</strong>lage: Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main<br />
� Leistungsabhängige Komponenten<br />
Die leistungsabhängigen Komponenten sollen ein Anreizsystem zur Verringerung von<br />
Störungen <strong>und</strong> zur Optimierung der Leistungsfähigkeit des Netzes darstellen. 98 So werden<br />
Unpünktlichkeit, die längere Beanspruchung der Fahrwege durch bauartbedingt langsame<br />
Fahrzeuge <strong>und</strong> die Nutzung stark ausgelasteter Streckenabschnitte durch Faktoren oder<br />
Zuschläge sanktioniert.<br />
c. Auslastungsfaktor AF<br />
Der Auslastungsfaktor dient als Anreiz zur effizienteren Ausnutzung der<br />
Streckenkapazitäten. Er wird auf besonders stark ausgelasteten Streckenabschnitt erhoben<br />
<strong>und</strong> hat den Wert 1,2. 99 Dieser Faktor wird im Trassenpreisrechner als AK<br />
(Auslastungskategorie) bezeichnet <strong>und</strong> hat die Ausprägungen 1 = stark belastet, aufschlag-<br />
96 Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 6-7.<br />
97 Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 6-7.<br />
98 Ebenda, S. 7.<br />
99 Ebenda, S. 10.<br />
66
pflichtig <strong>und</strong> 2 = normale Belastung, aufschlagfrei. Die Einordnung der Strecken obliegt der<br />
DB Netz AG.<br />
d. Zuschlagfaktor ZF<br />
Der Zuschlagfaktor von 1,5 wird erhoben, wenn bauartbedingt eine Mindestgeschwindigkeit<br />
von 50 km/h nicht erreicht wird. Weil durch die niedrigere Geschwindigkeit die Strecke nicht<br />
so dicht befahren werden kann, entsteht ein erhöhter Kapazitätsbedarf. Sie soll ein Anreiz<br />
zur Erhöhung der Streckenleistungsfähigkeit darstellen. Diese Regelung gilt nicht für<br />
Zulaufstrecken. 100<br />
e. Störungszuschlag SZ<br />
Der Störungszuschlag ist ein Anreizsystem zur Verringerung von Störungen. Es werden<br />
hierbei an dafür eingerichteten Messpunkten nach Deutsche Bahn AG-Richtlinie 420.9001<br />
Verspätungsminuten für jeden Zug vom zuständigen Fahrdienstleiter erfasst. 101<br />
Verspätungsminuten liegen vor, wenn die Fahrzeit zwei oder mehr Minuten vom Fahrplan<br />
abweicht. 102 Je Verspätungsminute wird ein Anreizentgelt von 0,10 € berechnet. 103 Zu den<br />
Minuten wird die Verspätungsursache gespeichert <strong>und</strong> dementsprechend die<br />
Verantwortlichkeit für die Verspätung festgelegt. Dabei gibt es vier<br />
Verantwortlichkeitsbereiche:<br />
- Verantwortung der DB Netz AG als Betreiber der Schienenwege,<br />
- Verantwortung der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) für den<br />
Schienenpersonenverkehr,<br />
- Verantwortung der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) für den<br />
Schienengüterverkehr,<br />
- keine Verantwortlichkeit einer Partei.<br />
Die jeweiligen Verantwortungsbereiche sind festgelegt. Die Verspätungsminuten werden für<br />
jeden Monat gesammelt <strong>und</strong> am Ende des Monats saldiert. Es werden die<br />
Verspätungsminuten zulasten der DB Netz AG mit den Minuten zulasten des EVU verrechnet<br />
<strong>und</strong> das Unternehmen, welches mehr Verspätungsminuten zu verantworten hat, zahlt dem<br />
anderen Unternehmen das sich ergebene leistungsabhängige Anreizentgelt<br />
(Störungszuschlag) im Folgemonat aus. 104<br />
100 Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 10.<br />
101 Deutsche Bahn AG (2007): Das Anreizsystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 6.<br />
102 Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 8.<br />
103 Deutsche Bahn AG (2007): Das Anreizsystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 2.<br />
104 Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 8-10.<br />
67
� Sonstige Komponenten<br />
Unter den sonstigen Komponenten fallen unterschiedliche Entgelte <strong>und</strong> Besonderheiten.<br />
f. Regionalfaktor RF<br />
Regionalfaktoren werden zur Verbesserung der Kostendeckung von Regionalnetzen erhoben.<br />
Dies betrifft Strecken, für die mittelfristig keine tragfähige Kosten-Erlös-Struktur zu erwarten<br />
ist. Die Anwendung des Regionalfaktors erfolgt in der Regel nur für den<br />
Schienenpersonennahverkehr. Er wird durch die DB Netz AG festgelegt <strong>und</strong> ist abhängig<br />
von:<br />
- Zuschüssen <strong>und</strong><br />
- Anzahl der Trassenbestellungen der B<strong>und</strong>esländer.<br />
Bei Änderung einer dieser Faktoren kann der Regionalfaktor angepasst werden. So wird eine<br />
Abbestellung von Strecken oder eine Verringerung der Zuschüsse, das Anheben des<br />
Regionalfaktors zufolge haben. Genauso kann im ungekehrten Fall der Regionalfaktor<br />
gesenkt werden. Es wurden von der DB Netz AG für 40 Regionalnetze Faktoren zwischen<br />
1,05 <strong>und</strong> 1,91 festgelegt. 105<br />
g. Lastkomponente LK<br />
Für den schweren Schienengüterverkehr wird eine Lastkomponente von 0,92 Euro/Trkm<br />
erhoben, wenn das Bruttozuggewicht 3000 t übersteigt. Damit soll der zusätzliche Aufwand<br />
durch erhöhten Verschleiß <strong>und</strong> Kapazitätsverbrauch ausgeglichen werden. 106<br />
h. Angebotsentgelt AE <strong>und</strong> Stornierungsentgelt SG<br />
Die Entgelte werden nur erhoben, wenn eine Trasse nicht genutzt wird.<br />
Das Angebotsentgelt wird für die Bearbeitung von Anträgen auf Zuweisung von Zugtrassen<br />
erhoben, wenn die bestellte Trasse nicht angenommen wird <strong>und</strong> dafür keine berechtigten<br />
Beanstandungsgründe stehen. Es wird ein Bearbeitungsentgelt von 80 Euro je Trasse,<br />
maximal aber dem Nutzungsentgelt der nicht angenommenen Trasse erhoben.<br />
Das Stornierungsentgelt wird fällig, wenn eine Trasse endgültig oder für bestimmte<br />
Verkehrstage abbestellt wird. Die Höhe des Stornierungsentgelts richtet sich nach dem<br />
Zeitpunkt der Abbestellung <strong>und</strong> liegt zwischen dem entsprechenden Angebotsentgelt (mind.<br />
60 Tage vor dem stornierten Verkehrstag) <strong>und</strong> dem vollen Trassenpreis, wenn weniger als<br />
24 St<strong>und</strong>en vor der Abfahrt storniert wird.<br />
i. Weitere Komponenten<br />
105 Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 11.<br />
106 Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main, S. 11.<br />
68
Es gibt eine Reihe weiterer Komponenten, die erhoben werden können, auf die aber nicht<br />
näher eingegangen werden soll:<br />
- Reduzierungsentgelt bei Rahmenverträgen,<br />
- Entgeltminderung bei nicht vertragsmäßigem Zustand der Infrastruktur,<br />
- Entgeltregelung bei kurzfristiger Umleitung aufgr<strong>und</strong> von Baumaßnahmen,<br />
- Entgeltregelung bei Schienenersatz- bzw. Busnotverkehr im Personenverkehr,<br />
- zeitlich begrenzte Entgeltnachlässe zur Förderung der Benutzung von Strecken<br />
mit niedrigem Auslastungsgrad,<br />
- Entgeltregelung bei Angebotstrassen <strong>und</strong><br />
- Entgeltnachlass zur Förderung von Neuverkehren.<br />
Diese Komponenten regeln Sonderfälle <strong>und</strong> Ausnahmesituationen <strong>und</strong> spielen bei der<br />
Trassenpreisberechnung im Regelfall keine Rolle. Die untenstehende Beispielrechnung soll<br />
die gesamte Trassenpreisberechnung ein wenig anschaulicher gestalten.<br />
2.3.2 Stationspreissystem<br />
Das Stationspreissystem (SPS) der DB Station & Service AG setzt sich aus zwei<br />
Komponenten zusammen: Zum einen aus den „Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung<br />
69
der Infrastruktur von Personenbahnhöfen der DB Station & Service AG“ (ABP) <strong>und</strong> zum<br />
anderen aus der dazugehörigen Stationspreisliste. Dieselbe Systematik gilt für das<br />
Stationspreissystem der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH, einer 100%igen Tochter der DB<br />
Station & Service AG, welche b<strong>und</strong>esweit eigenständig Regionalnetze betreibt, auf denen<br />
ausschließlich Regionalverkehr stattfindet. Da in unserer Betrachtung nur<br />
Fernverkehrsknoten (Kategorie-1-Bahnhöfe) von Relevanz sind, <strong>und</strong> die DB RegioNetz<br />
Infrastruktur GmbH in ihren Netzen nur Bahnhöfe der Kategorien 3 bis 6 betreibt, soll eine<br />
Beleuchtung der Regionalnetze nicht erfolgen.<br />
Ähnlich dem Trassenpreissystem dient das SPS der Konsolidierung der Kosten für Bau <strong>und</strong><br />
Instandhaltung der Bahnhöfe einschließlich ihrer Zuwegung <strong>und</strong> Bahnsteiganlagen. Über die<br />
Konsolidierung der Kosten hinaus bezweckt die DB Station & Service AG eine Verfolgung<br />
ihrer Unternehmensziele. Dazu gehören unter anderem Effizienzsteigerungen <strong>und</strong><br />
Gewinnmaximierung.<br />
Die ABP <strong>und</strong> die dazugehörigen Stationspreislisten sind im Internet frei zugänglich. 107<br />
� <strong>Bahnhof</strong>skategorien <strong>und</strong> Stationspreise<br />
Tabelle 15: <strong>Bahnhof</strong>skategorien der DB Station & Service AG<br />
In Tabelle 16 sind die sechs <strong>Bahnhof</strong>skategorien mit der jeweiligen b<strong>und</strong>eslandabhängigen<br />
Stationspreisspanne, der Anzahl der Bahnhöfe b<strong>und</strong>esweit <strong>und</strong> den wichtigsten Merkmalen<br />
dargestellt. Auffällig sind die Stationspreisspannen in den <strong>Bahnhof</strong>skategorien: Es kann<br />
107<br />
<strong>Bahnhof</strong>skategorie<br />
Stationspreisspanne<br />
€/Halt Stück<br />
1 Fernverkehrsknoten 17,05–41,26 20<br />
2 Fernverkehrssystemhalt 6,63–41,20 66<br />
3<br />
Nahverkehrsknoten, ggf.<br />
mit Fernverkehrshalt<br />
4,56–20,44 250<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/stationspreise/stationspr<br />
eise.html<br />
70<br />
Bahnhöfe<br />
verkehrliche Merkmale<br />
- im Zentrum der Großstadt<br />
- höchstes Ausstattungsniveau<br />
- Zustiegspunkt für Fernverkehr<br />
- hohes Ausstattungsniveau<br />
- Hbf’e mittelgroßer Städte<br />
- meist mit Empfangsgebäuden<br />
4<br />
hochfrequentierter<br />
Nahverkehrssystemhalt<br />
1,03–3,07 600<br />
- zumeist in Großstädten<br />
- große Pendleranzahl<br />
5 Nahverkehrssystemhalt 1,68–8,05 1.300<br />
- Bf in kleineren Städten<br />
- größtenteils Pendler<br />
6 Nahverkehrshalt 1,58–4,24 3.200<br />
- in dünn besiedelten Gegenden<br />
- geringe Reisendenzahlen<br />
Quelle: eigene Darstellung, Gr<strong>und</strong>lage: DB Station & Service AG: Ausstattungshandbuch zur<br />
Standardisierung, Planung <strong>und</strong> Entwicklung von Personenbahnhöfen, S. 5-7
vorkommen, dass ein Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in einem B<strong>und</strong>esland für den<br />
Verkehrshalt an einem Fernverkehrssystemhalt (Kategorie 2) wesentlich mehr bezahlen<br />
muss, als für einen Verkehrshalt an einem Fernverkehrsknoten (Kategorie 1) in einem<br />
anderen B<strong>und</strong>esland. Im Folgenden soll versucht werden, diese Disparitäten zu analysieren.<br />
Wie bereits in den Gr<strong>und</strong>lagen des <strong>Bahnhof</strong>betriebs kurz dargestellt wurde, ermittelt die DB<br />
Station & Service AG anhand von fünf Kriterien für jeden <strong>Bahnhof</strong> eine Gr<strong>und</strong>kategorisierungszahl.<br />
Mit Hilfe dieser Zahl wird der jeweilige <strong>Bahnhof</strong> einer der sechs<br />
<strong>Bahnhof</strong>skategorien zugeordnet. Damit wird eine Preisermittlung für jeden <strong>Bahnhof</strong><br />
individuell vermieden, denn die sechs <strong>Bahnhof</strong>skategorien werden mit der Anzahl der<br />
B<strong>und</strong>esländer in Deutschland multipliziert, daraus ergibt sich folgende Formel:<br />
16 B<strong>und</strong>esländer x 6 <strong>Bahnhof</strong>skategorien = 96 Stationspreise 108<br />
Tabelle 16: Stationspreisliste der DB Station & Service AG, nach B<strong>und</strong>esländern<br />
geordnet (alle Angaben in €)<br />
Quelle: eigene Darstellung, Gr<strong>und</strong>lage: DB Station & Service AG: Stationspreisliste 2007<br />
(Stand 01.01.07)<br />
108<br />
http://www-cda2.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/vertraege__agb/abp__station<strong>und</strong>service__20070410 .<strong>pdf</strong>,<br />
S. 29, Zugriff 07.06.07.<br />
71
Eine genauere Betrachtung der Stationspreisliste ergibt jedoch, dass es „nur“ 87<br />
Stationspreise b<strong>und</strong>esweit gibt. In Tabelle 17 ist ersichtlich, in welchen Bereichen die neun<br />
fehlenden Stationspreise zu finden sind: In den beiden größten deutschen Städten, Berlin<br />
<strong>und</strong> Hamburg, existieren keine Kategorie-6-Bahnhöfe, da in diesen Ballungsräumen selbst<br />
kleine Haltepunkte/S-Bahnstationen durch Pendler gut frequentiert werden, <strong>und</strong> diese somit<br />
nicht in die sechste <strong>Bahnhof</strong>skategorie fallen können. In Bremen gibt es keine Kategorie-2-<br />
Bahnhöfe, da nur Bremen Hbf <strong>und</strong> Bremerhaven Hbf als Fernverkehrshalt dienen. Bremen<br />
Hbf fällt dabei in die Kategorie 1 <strong>und</strong> Bremerhaven Hbf in die Kategorie 3. Alle anderen<br />
Bahnhöfe <strong>und</strong> Haltepunkte in diesem B<strong>und</strong>esland sind niedriger kategorisiert <strong>und</strong> dienen<br />
ausschließlich dem Nahverkehr. Das Land Brandenburg weist keinen Kategorie-1-<strong>Bahnhof</strong><br />
auf, da die größten <strong>und</strong> stark frequentierten Knoten, die für das Einzugsgebiet Brandenburgs<br />
zuständig sind, im Ballungsraum Berlin liegen. Ähnlich sieht es in Mecklenburg-Vorpommern<br />
aus, nur mit dem Unterschied, dass sich dort kein vergleichbarer Ballungsraum befindet.<br />
Hinzu kommt hierbei, dass Mecklenburg-Vorpommern das am dünnsten besiedelte<br />
B<strong>und</strong>esland ist. Vier weitere B<strong>und</strong>esländer, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein<br />
<strong>und</strong> Thüringen, besitzen ebenfalls keine Kategorie-1-Bahnhöfe. Auffällig hierbei ist, dass 4<br />
der 6 Länder ohne Kategorie-1-<strong>Bahnhof</strong> neue B<strong>und</strong>esländer sind. Letztendlich liegt die<br />
Begründung für das Fehlen der Kategorie-1-Bahnhöfe in der Einwohnerzahl der genannten<br />
Länder.<br />
� Stationspreisbildung<br />
Es stellt sich die Frage, warum ein EVU in Berlin Hauptbahnhof pro Verkehrshalt mehr als<br />
doppelt so viel zahlen muss im Vergleich zu einem Verkehrshalt in Hamburg Hbf, obwohl<br />
beide Stationen derselben <strong>Bahnhof</strong>skategorie angehören. In Tabelle 18 sind dazu noch<br />
einmal die Stationspreise pro Verkehrshalt für alle 20 Kategorie-1-Bahnhöfe in Deutschland<br />
aufgelistet. Um diese Disparität aufklären zu können, bedarf es einer Betrachtung der<br />
Kostenposten, die durch einen <strong>Bahnhof</strong> entstehen, <strong>und</strong> der Nutzungsfrequenz durch<br />
Zughalte am <strong>Bahnhof</strong>.<br />
Tabelle 17: Stationspreise je Verkehrshalt für die 20 deutschen Kategorie-1-Bahnhöfe,<br />
nach Höhe des Preises sortiert<br />
Quelle: eigene Darstellung, Gr<strong>und</strong>lage: DB Station & Service AG: Stationspreisliste 2007<br />
(Stand 01.01.07)<br />
72
Die DB Station & Service AG nennt folgende sechs Kostenposten als ausschlaggebende<br />
Kriterien, welche in die Berechnung der Stationspreise einfließen:<br />
- Vorhaltung,<br />
- Instandhaltung,<br />
- Personal,<br />
- Material <strong>und</strong> Fremdleistungen,<br />
- Abschreibung (basierend auf Anschaffungs- <strong>und</strong> Herstellungskosten) <strong>und</strong><br />
- sonstiger Aufwand. 109<br />
Neben diesen sechs Kostenpunkten wird für jeden <strong>Bahnhof</strong> eine Nutzungsfrequenz anhand<br />
folgender Kriterien ermittelt:<br />
- Anzahl der Zughalte pro Zugeinheit <strong>und</strong><br />
- Zuglänge je Zugeinheit. 110<br />
Zielkosten<br />
=<br />
kostenorientierter<br />
Stationspreis<br />
Zughalte<br />
Die Zuglänge jeder Zugeinheit wird in zwei verschiedene Größen aufgeteilt: Alle<br />
Zugeinheiten mit einer Länge von bis zu 180 Metern (einschließlich Triebfahrzeug/e)<br />
erhalten den Zuglängenfaktor 1,0. Zugeinheiten mit einer Länge von mehr als 180 Metern<br />
werden mit dem Zuglängenfaktor 2,0 belegt. 111<br />
Die DB Station & Service AG fasst alle Kostenposten der Bahnhöfe eines B<strong>und</strong>eslandes je<br />
<strong>Bahnhof</strong>skategorie zusammen <strong>und</strong> ermittelt daraus einen Gesamtbetrag (Zielkosten).<br />
Ähnlich wird bei der Nutzungsfrequenz (Zughalte) der Bahnhöfe je Kategorie <strong>und</strong><br />
B<strong>und</strong>esland verfahren. Mittels dieser beiden Posten erfolgt nach folgender Formel die<br />
Stationspreisbildung je <strong>Bahnhof</strong>skategorie <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esland:<br />
Bei der Formel ist zu beachten, dass die beiden Elemente Zielkosten <strong>und</strong> Zughalte immer für<br />
die jeweilige <strong>Bahnhof</strong>skategorie <strong>und</strong> das jeweilige B<strong>und</strong>esland ermittelt <strong>und</strong> verrechnet<br />
werden, damit ein kategorie- <strong>und</strong> b<strong>und</strong>eslandscharfer Stationspreis zustande kommen kann.<br />
109<br />
http://www-cda2.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/vertraege__agb/abp__station<strong>und</strong>service__<br />
.<strong>pdf</strong>, S. 28, Zugriff 07.06.07.<br />
20070410<br />
110<br />
http://www-cda2.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/vertraege__agb/abp__station<strong>und</strong>service__<br />
.<strong>pdf</strong>, S. 28, Zugriff 07.06.07.<br />
20070410<br />
111<br />
http://www-cda2.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/vertraege__agb/abp__station<strong>und</strong>service__<br />
.<strong>pdf</strong>, S. 13, Zugriff 07.06.07.<br />
20070410<br />
74
Durch diese Form der Berechnung lässt sich zwar ansatzweise erklären, warum für einen<br />
Verkehrshalt in Hamburg Hbf im Vergleich zu Berlin Hbf ein anderer Stationspreis gezahlt<br />
werden muss, aber dennoch bleibt die Frage bezüglich des gravierenden Preisunterschiedes<br />
offen.<br />
Eine andere mögliche Erklärung ließe sich in den Unterhalts- <strong>und</strong> Abschreibungskosten der<br />
Kategorie-1-Bahnhöfe der B<strong>und</strong>esländer Berlin <strong>und</strong> Hamburg finden. Zum einen besitzt das<br />
B<strong>und</strong>esland Hamburg nur einen Kategorie-1-<strong>Bahnhof</strong>, nämlich seinen Hauptbahnhof. Berlin<br />
hingegen besitzt drei Kategorie-1-Bahnhöfe, die in ihren entstehenden Kosten gedeckt<br />
werden müssen. Zwar relativiert sich der Betrag der Zielkosten wieder dadurch, dass dieser<br />
durch die Zughalte dividiert werden muss, aber die Zughalte werden durch die drei Bahnhöfe<br />
der Kategorie 1 in Berlin nicht automatisch verdreifacht, denn zu ähnlichen Teilen befahren<br />
die Zugeinheiten, die im Berliner Hbf halten, zum einen den Berliner Ostbahnhof <strong>und</strong> zum<br />
anderen Berlin Südkreuz. Demnach wird die Anzahl der Zughalte in Berlin „nur“ verdoppelt,<br />
obwohl in der Gesamtrechnung drei Kategorie-1-Bahnhöfe angefahren werden. Eine<br />
automatische Stationspreisdifferenz zwischen Berlin <strong>und</strong> Hamburg ist also in diesem Fall auf<br />
die besondere Anlage des Eisenbahnnetzes in Berlin zurückzuführen.<br />
Neben diesem Kriterium kann eine weitere Erklärung angeführt werden: Zwei der drei<br />
Berliner Bahnhöfe der Kategorie 1 sind im Jahre 2006 eröffnet worden (Hauptbahnhof <strong>und</strong><br />
Südkreuz). Demnach handelt es sich um neue <strong>Bahnhof</strong>sgroßprojekte, die finanziert werden<br />
müssen. Allein der Berliner Hauptbahnhof schlägt mit Gesamtkosten von mehr als einer<br />
Milliarde Euro zu Buche, von denen ein nicht geringer Teil allein auf die Verkehrsstation der<br />
DB Station & Service AG angerechnet werden muss. Genaue Zahlen liegen dazu leider nicht<br />
vor, aber es kann davon ausgegangen werden, dass hierbei ein gewisser Teil des<br />
Stationspreises auf die Abschreibungskosten des <strong>Bahnhof</strong>s zurückzuführen ist.<br />
� Stationspreisentgelt<br />
Der in der Stationspreisliste aufgeführte Betrag entspricht nicht dem tatsächlichen<br />
Stationsentgelt, welches das EVU für den Verkehrshalt an einem <strong>Bahnhof</strong> an die DB Station<br />
& Service AG zu leisten hat. Das zu zahlende Entgelt ergibt sich aus folgender Formel:<br />
Listenbetrag x Zuglängenfaktor x Anzahl der Halte = Stationspreisentgelt 112<br />
Der bereits erwähnte Zuglängenfaktor findet nun in dieser Formel Anwendung. Weist eine<br />
Zugeinheit inklusive des Triebfahrzeugs eine Länge von weniger oder gleich 180 Metern auf,<br />
so fällt der Zuglängenfaktor nur einfach ins Gewicht. Ist die Zugeinheit länger als 180 Meter,<br />
so fällt der Zuglängenfaktor doppelt ins Gewicht. Allein durch diesen Faktor würde sich also<br />
das Stationsentgelt verdoppeln, wenn es sich um einen langen Zug handelte. Hinzu kommt<br />
die Anzahl der Verkehrshalte. Strebt das EVU mit seiner Zugeinheit nur einen Halt an, so<br />
112 http://www-cda2.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/vertraege__agb/abp__station<strong>und</strong>service__20070410<br />
.<strong>pdf</strong>, S. 13, Zugriff 07.06.07.<br />
75
verbliebe das Stationsentgelt bei dem Listenbetrag. Zur Verdeutlichung folgt nun eine<br />
Proberechnung am Beispiel des Berliner Hauptbahnhofs:<br />
Das EVU (hier X):<br />
besitzt eine Zugeinheit von 160 Metern Länge,<br />
strebt zwei Verkehrshalte pro Tag im Berliner Hbf an,<br />
frequentiert den Hbf täglich (ergibt Anzahl der Verkehrshalte: r<strong>und</strong> 730 im Jahr).<br />
Der Listenstationspreis für den Berliner Hbf liegt bei 41,26 €. Somit ergibt sich folgende<br />
Gleichung:<br />
41,26 € x 1,0 x 730 = 30.119,80 € für ein Fahrplanjahr.<br />
Demnach hat das EVU X für ein Fahrplanjahr für die beiden täglichen Verkehrshalte im<br />
Berliner Hauptbahnhof über 30.000 € zu zahlen. Wäre die Zugeinheit des EVU länger als 180<br />
Meter, so würde sich das zu zahlende Stationsentgelt verdoppeln.<br />
� Ausstattungsmerkmale der Bahnhöfe<br />
Tabelle 19 macht deutlich, nach welchen Standards ein <strong>Bahnhof</strong> der jeweiligen Kategorie<br />
ausgestattet sein sollte, beziehungsweise für was das EVU für den Verkehrshalt an der<br />
Station der jeweiligen Kategorie zu zahlen hat. Kategorie-1-Bahnhöfe, die tendenziell den<br />
höchsten Stationspreis aufweisen, besitzen einen entsprechend hohen Ausstattungsstandard,<br />
einschließlich Servicemitarbeitern <strong>und</strong> Servicepunkt. Prinzipiell sind die<br />
Personalkosten eines Unternehmens die höchsten Kosten <strong>und</strong> schlagen dementsprechend zu<br />
Buche.<br />
Auffallend ist, dass Kategorie-6-Bahnhöfe den Basisleistungen entsprechend nicht über eine<br />
<strong>Bahnhof</strong>suhr, eine Sitzgelegenheit <strong>und</strong> einen Wetterschutz verfügen müssen, um den<br />
Anforderungen gerecht zu werden. Auch an Haltepunkten mit geringen Fahrgastzahlen ist<br />
zumindest eine Sitzgelegenheit <strong>und</strong> ein Wetterschutz bei eventuellen Zugverspätungen oder<br />
widrigen Wetterumständen zu erwarten! Des Weiteren bleibt es unverständlich, dass<br />
Kategorie-4-Bahnhöfe diese drei Merkmale standardmäßig aufweisen <strong>und</strong> mitunter einen<br />
wesentlich geringeren Stationspreis besitzen, als Kategorie-6-Bahnhöfe, denen diese<br />
Ausstattungselemente standardmäßig fehlen.<br />
76
Tabelle 18: Leistungen je <strong>Bahnhof</strong>skategorie gemäß ABP<br />
Quelle: http://www-cda2.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/vertraege__agb/abp__station<br />
<strong>und</strong>service__20070410.<strong>pdf</strong>, S. 30, Zugriff 07.06.07<br />
� Anreizsystem zur Verringerung von Störungen<br />
Die DB Station & Service AG gewährt in verschiedenen Fällen von Störungen einen anteiligen<br />
Nachlass auf den Stationspreis, um sich damit selbst Anreize zu geben, Störungen zu<br />
vermeiden oder schnellstmöglich zu beheben. Im Folgenden soll nur eine grobe Auflistung<br />
der Möglichkeiten erfolgen, welche im Detail den ABP entnommen werden können:<br />
- Teilausfall der Bahnsteig- <strong>und</strong> Zuwegungsbeleuchtung (mind. 30 %) > 10 %,<br />
- Gesamtausfall der Bahnsteigs- <strong>und</strong> Zuwegungsbeleuchtung > 25 %,<br />
- Mängel an Bahnsteigs- <strong>und</strong> Zuwegungsoberflächen > 15 %,<br />
- nicht erfolgte Schneeräumung > 15 %,<br />
- Mängel an Fahrplanaushängen > 10 %,<br />
- gänzliches Fehlen der <strong>Bahnhof</strong>sbezeichnung > 5 %,<br />
77
- technische Mängel an Reisendeninformationssystemen > 15 %. 113<br />
2.3.3 Fazit Umgang mit den Wettbewerbern<br />
Die Preissysteme müssen transparent, nachvollziehbar <strong>und</strong> verkehrsunternehmenunabhängig<br />
sein, damit ein gerechter Wettbewerb stattfinden kann. Die für die Fahrwege<br />
zuständige DB Netz AG darf dabei keine Unterschiede machen <strong>und</strong> soll auf eine<br />
ausgeglichene Bilanz hinarbeiten.<br />
Im Fall des Trassenpreissystems gibt es eine relativ einfache Formel zur Berechnung der<br />
Streckenkilometerpreise. Jede Komponente wird beschrieben <strong>und</strong> deren Notwendigkeit <strong>und</strong><br />
Höhe angegeben. Da diese für alle Anbieter gleich ausfallen, gibt es hierfür keine Möglichkeit<br />
zur Wettbewerbsverzerrung. Einzelkomponenten bzw. Sonderzuschläge sind hingegen<br />
durchaus anfällig für Manipulationen. So liegt die Erhebung des Störungszuschlags einzig in<br />
Händen der DB Netz AG. Dabei kann es zur gezielten Beeinflussung der Daten, z.B. durch<br />
falsche Verspätungsminutenschuldzuweisung, kommen. Dem<br />
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) wird nur das Ergebnis der Saldierung <strong>und</strong> die vom<br />
EVU zu verantwortenden Verspätungsminuten mitgeteilt. Die Beanstandung wird wieder von<br />
der DB Netz AG durchgeführt <strong>und</strong> erst nach nochmaligem Widerspruch durch das EVU steht<br />
der Rechtsweg offen. Dabei sind alle Klärungsstellen abhängig von den erhobenen Daten.<br />
Der Fahrdienstleiter als Erhebender der Daten ist aber Angestellter der DB Netz AG <strong>und</strong><br />
damit nicht unabhängig. Auch die Erhebung des Regionalfaktors liegt allein in der Hand der<br />
DB Netz AG <strong>und</strong> ist nicht immer nachvollziehbar. Alle weiteren Komponenten sind dagegen<br />
nur schwer manipulierbar, da die Einteilung nachvollziehbar <strong>und</strong> nicht veränderbar ist.<br />
Insgesamt ist das Trassenpreissystem ein transparentes, nachvollziehbares System zur<br />
Erhebung von Trassenpreisen. Die Manipulierbarkeit einiger Daten ist zwar gegeben, diese<br />
ist jedoch nur gering in der Gesamtauswirkung. Eine Verbesserung der Transparenz wäre<br />
gegeben, wenn z.B. die Verspätungsminutenzuweisung in Hände unabhängiger Dritter gelegt<br />
würde. Dies wäre aber auch möglich durch Ausgliederung der DB Netz AG aus dem<br />
Deutsche-Bahn-Konzern. Durch Verbleib beim B<strong>und</strong> wären Neutralität <strong>und</strong> Unabhängigkeit<br />
am besten gewährleistet.<br />
Beim Stationspreissystem ist aufgr<strong>und</strong> der Tatsache, dass sich die DB Station & Service AG<br />
als Monopolist in Bezug auf die Unterhaltung der mehr als 5.400 deutschen Bahnhöfe <strong>und</strong><br />
Haltpunkte seine Bedingungen zu deren Nutzung selbst aufstellen kann, keine 100%ige<br />
Transparenz des Systems gewährleistet. Die Ermittlung der einzelnen Kostenpunkte für die<br />
Bewirtschaftung eines <strong>Bahnhof</strong>s (Vorhaltung, Instandhaltung, Personal etc.) obliegen der DB<br />
Station & Service AG <strong>und</strong> können nicht öffentlich eingesehen werden. Auch wenn die ABP<br />
inklusive der dazugehörigen Stationspreislisten einer Prüfung durch die B<strong>und</strong>esnetzagentur<br />
unterliegen, ist eine einwandfreie <strong>und</strong> den Wettbewerbern gegenüber gerechte Durchführung<br />
<strong>und</strong> Abrechnung durch das System nicht verzerrungsfrei gewährleistet. Die Wettbewerber<br />
113 http://www-cda2.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/vertraege__agb/abp__station<strong>und</strong>service__20070410.<strong>pdf</strong>,<br />
S. 14, Zugriff 07.06.07.<br />
78
sind als Zwangsnutzer deutscher Bahnhöfe <strong>und</strong> Haltepunkte auf die ABP der DB Station &<br />
Service AG angewiesen <strong>und</strong> haben keine Möglichkeit der „Infrastrukturwahl“.<br />
Das Stationspreissystem wurde bis vor wenigen Jahren als stationsscharfes Preissystem<br />
geführt. Dabei wurde für jeden <strong>Bahnhof</strong> individuell der zu zahlende Stationspreis ermittelt.<br />
Somit war eine gute Vergleichbarkeit der Bahnhöfe untereinander gewährleistet. Allerdings<br />
bedeutete dies für die DB Station & Service AG einen Mehraufwand an Arbeit, da die<br />
Bahnhöfe schlichtweg nicht kategorisiert <strong>und</strong> damit rationalisiert bearbeitet werden konnten.<br />
Das heutige System arbeitet mit Kategorien <strong>und</strong> schert zum Teil unterschiedliche<br />
Bahnhöfe/Haltepunkte innerhalb einer Kategorie über einen Kamm. Die Vergleichbarkeit<br />
untereinander ist damit nicht mehr einwandfrei gegeben. Dementsprechend ist dieses<br />
System in Sachen Transparenz dahingehend optimierbar, dass es wieder zu einer<br />
stationsscharfen Preisermittlung zurückkehrt. In Zeiten des Rationalisierungs- <strong>und</strong><br />
Wettbewerbsdrucks <strong>und</strong> der bevorstehenden Kapitalprivatisierung des Deutsche Bahn-<br />
Konzerns erscheint eine Rückkehr zu Altbewährtem allerdings fraglich.<br />
2.4 Exkurs: Ökologie im <strong>Bahnhof</strong>betrieb<br />
Zum Abschluss soll ein kurzer Exkurs zum Thema Ökologie im <strong>Bahnhof</strong>betrieb erfolgen.<br />
2.4.1 Ökologische Aspekte im <strong>Bahnhof</strong>betrieb<br />
Historisch bedingt ist es den vorhandenen Bahnhöfen in Deutschland nur schwer möglich<br />
ihren Betrieb aktiv nach ökologischen Gesichtspunkten zu gestalten. Die Anlagen existieren<br />
zum Teil seit Jahrzehnten <strong>und</strong> werden nur nach <strong>und</strong> nach im Zuge von Modernisierungen<br />
umweltschonend <strong>und</strong> umweltgerecht umgestaltet. Anders sieht es dabei für<br />
<strong>Bahnhof</strong>sneubauten aus. Die regenerativen Energieträger, wie Sonne, Wind oder Wasser<br />
spielen in der aktuellen öffentlichen Debatte eine immer weiter reichende Rolle. So wurde im<br />
Jahre 2003 bei der Errichtung des Berliner Hauptbahnhofs die größte Photovoltaikanlage der<br />
Hauptstadt auf dem gläsernen Ost-West-Dach installiert. Auf einer Fläche von r<strong>und</strong><br />
1.700 m² erzeugen 780 Solarmodule jährlich r<strong>und</strong> 160.000 Kilowattst<strong>und</strong>en Strom. Mit<br />
dieser Leistung können 2 % des Strombedarfs des <strong>Bahnhof</strong>s gedeckt werden. 114 Ein weiterer<br />
Aspekt der Ökologie im <strong>Bahnhof</strong>betrieb ist die fachgerechte Trennung des täglich<br />
anfallenden Abfalls. Begonnen wird damit bereits bei dessen Erzeuger, dem Fahrgast: Auf<br />
allen Bahnsteigen der Bahnhöfe befinden sich untergliederte Abfallbehälter, in die bereits der<br />
Reisende seinen Abfall bedarfsgerecht trennen <strong>und</strong> entsorgen kann. Leichtverpackungen,<br />
Glas <strong>und</strong> Papier können bei fachgerechter Trennung wieder dem Stoffkreislauf zugeführt<br />
werden. Die gleichzeitige Umstellung des Angebots im Servicebereich auf<br />
Mehrwegverpackungen hat dazu beigetragen, die Abfallmengen deutlich zu verringern. 115<br />
114<br />
DB Umweltbericht 2005, http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/umweltbericht2005<br />
__download-version.<strong>pdf</strong>, S. 59.<br />
115<br />
DB Umweltbericht 2005, http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/umweltbericht2005<br />
__download-version.<strong>pdf</strong>, S. 97-98.<br />
79
Das Thema der Vegetationskontrolle an Bahndämmen <strong>und</strong> Bahnhöfen wird von der<br />
Öffentlichkeit nach wie vor kritisch betrachtet. Die Deutsche Bahn AG führt an, dass ein<br />
Bewuchs des Gleiskörpers <strong>und</strong> seiner unmittelbaren Umgebung unbedingt zu vermeiden ist,<br />
da es sonst zu Beeinträchtigungen der Bettungsschicht <strong>und</strong> damit zu erhöhten Unterhaltskosten<br />
kommen kann. Um den Pflanzenwuchs im Gleiskörper zu verhindern, werden von der<br />
Deutschen Bahn AG nach wie vor chemische Mittel eingesetzt: Die Herbizide Flumioxazin,<br />
Glyphosat <strong>und</strong> Glyphosat-Trimesium wurden im Jahr 2004 auf mehr als 50 % des<br />
Gleisnetzes zur Unkrautbekämpfung verwendet. In Kooperation mit anderen europäischen<br />
Bahnunternehmen (Schweizerische B<strong>und</strong>esbahnen SBB <strong>und</strong> Österreichische B<strong>und</strong>esbahnen<br />
ÖBB) hat die Deutsche Bahn AG nach möglichen nichtchemischen Alternativen gesucht,<br />
diese aber aus Gründen der Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> begrenzten Wirksamkeit wieder<br />
verworfen. Auf Flächen außerhalb der Gleisanlagen, also auf Bahnsteigen, Zuwegungen<br />
sowie freien Strecken neben dem Gleiskörper werden keine chemischen Mittel eingesetzt,<br />
sondern manuelle Rückschnitte betrieben. 116<br />
2.4.2 Fazit Ökologie im <strong>Bahnhof</strong>betrieb<br />
Das generelle Umdenken hin zu einem nachhaltigeren Umgang mit der Umwelt hat in den<br />
letzten zehn Jahren deutlich an Relevanz gewonnen. Merklich beachtet die Deutsche Bahn<br />
AG Themen wie Klimaschutz <strong>und</strong> ökologische Nachhaltigkeit <strong>und</strong> implementiert sie<br />
schrittweise in den Betrieb. Diese Formen des gerechten Umgangs mit Natur <strong>und</strong> Umwelt<br />
lassen sich allerdings fast ausschließlich im Bahnbetrieb festmachen. Der Betrieb eines<br />
<strong>Bahnhof</strong>s zeigt nur unterschwellig, dass auch dort ökologische Aspekte von Relevanz sind.<br />
Die gesellschaftliche Akzeptanz regenerativer Energiequellen steigt von Jahr zu Jahr <strong>und</strong><br />
findet schrittweise auch im Deutsche Bahn-Konzern Anklang. Die Solarmodule auf dem Dach<br />
des Berliner Hauptbahnhofs oder die Gewinnung von Strom durch bahneigene<br />
Wasserkraftwerke im Süden Deutschlands an Donau <strong>und</strong> Isar machen dies deutlich. 117<br />
Pestizide/Herbizide zur Bekämpfung von Unkräutern im Gleiskörper sind in den Augen der<br />
Deutschen Bahn AG unverzichtbar, doch die Nachbarn, allen voran die Österreichischen<br />
B<strong>und</strong>esbahnen, zeigen, dass es auch anders geht. Sie erprobten vor Jahren den Einsatz<br />
alternativer, nichtchemischer Bekämpfungsmittel, so zum Beispiel Infrarotbestrahlung oder<br />
Heißdampf. Auch wenn diese Alternativen nur einen sehr geringen Wirkungsgrad aufweisen,<br />
zeigen sie doch einen Weg in eine andere Richtung auf – eine Bekämpfung des Unkrautes<br />
ohne chemische Mittel. In Wasserschutzgebieten in Österreich werden diese Mittel<br />
obligatorisch eingesetzt, auch wenn sie höhere Kosten verursachen <strong>und</strong> langwieriger in der<br />
Anwendung sind. 118<br />
116<br />
DB Umweltbericht 2005, http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/umweltbericht2005<br />
__download-version.<strong>pdf</strong>, S. 92.<br />
117<br />
DB Umweltbericht 2005, http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/umweltbericht2005<br />
__download-version.<strong>pdf</strong>, S. 58.<br />
118<br />
http://www.ph-linz.at/LuF/flora/Unkraut.html, Zugriff 27.06.07.<br />
80
3. Ökonomie <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong><br />
Bahnhöfe prägen heute mehr als je zuvor das Erscheinungsbild der Großzahl der deutschen<br />
Städte. Dies liegt zum einen an der meist zentralen Lage der Bahnhöfe, aber auch an den<br />
architektonischen, städtebaulichen, sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Auswirkungen auf das<br />
Umfeld der Bahnhöfe <strong>und</strong> auf die gesamte <strong>Stadt</strong>. Zur Untersuchung der ökonomischen<br />
Auswirkungen <strong>und</strong> Wechselbeziehungen zwischen den Bahnhöfen <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong> werden im<br />
Folgenden verschiedene Fragestellungen untersucht <strong>und</strong> ausgewertet. Angefangen bei den<br />
Bahnhöfen als Arbeitgeber, Kristallisationskerne für Funktionen, Netzknoten <strong>und</strong><br />
Wirtschaftsmotor über die finanziellen Mitteln für Bahnhöfe <strong>und</strong> Standortmarketingansätze<br />
der Städte werden die Bahnhöfe auch nach ihren neuesten Entwicklungen als Einzelhandels<strong>und</strong><br />
Dienstleistungszentren, Visitenkarten der <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Eventstätten hin untersucht.<br />
Abschließend soll die Frage geklärt werden - Was bringen die Bahnhöfe einer <strong>Stadt</strong><br />
wirtschaftlich? – um ein umfassendes Bild der ökonomischen Beziehungen zwischen<br />
Bahnhöfen <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> darzulegen.<br />
3.1 Ökonomische Faktoren in der Beziehung zwischen <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong><br />
3.1.1 Bahnhöfe als Arbeitgeber<br />
Wie eine riesige Maschine viele Einzelteile an unterschiedlichen Stellungen braucht, um in<br />
Betrieb genommen zu werden, bedarf ein <strong>Bahnhof</strong> professioneller Leute, um für seine<br />
Benutzer funktionsfähig zu sein: Auf diese Weise spielt der <strong>Bahnhof</strong> die Rolle des<br />
Arbeitgebers. Die Zahl von Arbeitsplätzen, die ein <strong>Bahnhof</strong> anbietet, hängt unmittelbar ab<br />
von der Dimension des <strong>Bahnhof</strong>s sowie von seiner Größe <strong>und</strong> Fläche, der Besucherfrequenz<br />
usw., während sich die Art der Arbeitsplätze auch entsprechend der verschiedenen<br />
Funktionen ändert, die der <strong>Bahnhof</strong> hat. In der vorgenommenen Analyse wurden die<br />
Arbeitsplätze im <strong>Bahnhof</strong> getrennt nach zwei Arbeitgebergruppen untersucht: Bei der ersten<br />
Gruppe handelt es sich um den Konzern Deutsche Bahn AG mitsamt seiner<br />
Tochterunternehmen; in die zweite Gruppe wurden alle anderen Unternehmen <strong>und</strong><br />
Organisationen, die ebenfalls Arbeitsplätze in Bahnhöfen anbieten, eingeordnet.<br />
Mit r<strong>und</strong> 229.200 Mitarbeitern (Vollzeitpersonen) ist die Deutsche Bahn AG einer der größten<br />
Arbeitgeber in Deutschland. Auf der von der IHK Berlin veröffentlichten Liste der 100<br />
größten Arbeitgeber der Berliner Wirtschaft steht die Deutsche Bahn AG mit 19.400<br />
Beschäftigten seit zwei Jahren unverändert auf dem ersten Platz (Stand: Oktober 2006). 119<br />
Die DB Station & Service AG ist, als Teil des Vorstandsressorts “Infrastruktur <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen“ (VRI) der Deutschen Bahn AG, für den Infrastrukturbetrieb von r<strong>und</strong> 5.400<br />
Bahnhöfen sowie für die kommerzielle Nutzung vorhandener Flächen in r<strong>und</strong> 2.400<br />
119 http://www.berlin.ihk24.de/produktmarken/standortpolitik/analysen_fakten/wirtschaft_in_zahlen/Top-Liste.jsp<br />
(2006): IHK Berlin, Die 100 größten Arbeitgeber der Berliner Wirtschaft. Letzter Zugriff: 24.06.07.<br />
81
<strong>Bahnhof</strong>sgebäuden verantwortlich. 120 Für die r<strong>und</strong> 11 Millionen Menschen, die pro Tag in den<br />
Bahnhöfen unterwegs sind, sorgen allein 3.000 Mitarbeiter in den 3-S-Zentralen (Sicherheit,<br />
Sauberkeit <strong>und</strong> Service), an den ServicePoints <strong>und</strong> auf den Bahnsteigen für die<br />
121<br />
Leistungsfähigkeit der Bahnhöfe.<br />
Dadurch, dass die Bahnhöfe verschiedenartige Dienstleistungen sowie Einkaufs- <strong>und</strong><br />
Freizeitmöglichkeiten anbieten, schließt der Arbeitsplatz <strong>Bahnhof</strong> vielfältige<br />
Beschäftigungstypen ein. In der Stellenbörse der Deutschen Bahn AG werden zahlreiche<br />
Arbeitsplätze, Studienplätze, Ausbildungsplätze, Praktikumsplätze usw. angeboten. Diese<br />
werden unterschieden nach diversen Einsteigsarten, Tätigkeitsbereichen,<br />
Verantwortungsbereichen, B<strong>und</strong>esländern, Zeitdauern sowie nach Bildungsabschlüssen.<br />
Beispielsweise tragen in <strong>und</strong> an einem <strong>Bahnhof</strong> Beschäftigte vom Serviceteamchef über den<br />
Reiseberater bis hin zum Lokführer, Zugbegleiter oder Koch im Mitarbeiterrestaurant zum<br />
funktionierenden Ablauf bei. Wichtig zu betrachten ist ebenfalls, dass man im Unternehmen<br />
nicht nur Arbeitsplätze für Berufserfahrene <strong>und</strong> Absolventen findet, sondern dass auch<br />
andere berufsrelevante Möglichkeiten angeboten werden, etwa für Schüler, Schulabgänger<br />
<strong>und</strong> Studenten. Als Einstiegsmöglichkeiten in das Berufsleben für Schulabgänger gibt es<br />
beispielsweise 16 Ausbildungsberufe, 16 duale Studiengänge <strong>und</strong> eine Hochschulkooperation;<br />
für Studenten werden Praktikumsplätze <strong>und</strong> eine Betreuung über Studienabschlussarbeiten<br />
angeboten.<br />
Der Stuttgarter Hauptbahnhof bietet für insgesamt 1.200 Menschen Arbeitsplätze, davon<br />
sorgen 72 Deutsche Bahn AG-Mitarbeiter für eine saubere <strong>und</strong> sichere Atmosphäre für<br />
Reisende <strong>und</strong> Besucher. 122 Die über 1.000 Nicht-Deutsche Bahn AG-Mitarbeiter arbeiten<br />
hauptsächlich in den Vermietungsbereichen, die kommerziell für Geschäfte, Gastronomie,<br />
Büros, Freizeitzentren usw. genutzt werden. Genaue Zahlenangaben zu den Arbeitsplätzen<br />
in dieser Gruppe sind nicht verfügbar, von den Internetseiten einiger Bahnhöfe <strong>und</strong> auch<br />
durch Interviews konnten aber dennoch ein paar Angaben ermittelt werden, welche die<br />
Situation etwas illustrieren können. Diese sind in Tabelle aufgeführt.<br />
120<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/unternehmen/konzern/gesellschaften/infrastruktur__dienstleistungen/personenb<br />
ahnhoefe/personenbahnhoefe.html (2007): DB Station & Service AG, Firmenprofil. Letzter Zugriff: 24.06.07.<br />
121<br />
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/sonstige/db__station<strong>und</strong>service__kompetenzprofil.<br />
<strong>pdf</strong>: DB Station&Service (2007): Das Kompetenzprofil. Entwicklung, Vermarktung <strong>und</strong> Betrieb von<br />
Personenbahnhöfen. Letzter Zugriff: 24.06.07.<br />
122<br />
http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/sued/stuttgart__hbf/daten__<strong>und</strong>__fakten/daten__<strong>und</strong>__fakten__.htm<br />
l (2007). Letzter Zugriff: 24.06.07.<br />
82
Tabelle 19: Arbeitsplätze in den Bahnhöfe 123<br />
Karlsruhe Hbf 1.000<br />
München Hbf 2.000<br />
Gesamtzahl<br />
Arbeitsplätze<br />
83<br />
Eisenbahner Arbeitsplätze im Shopping-<br />
Center/Business Center<br />
Leipzig Hbf 1.000 1.200 bis 1.500 124<br />
Lille Europabf 900 / 3.000<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
3.1.2 Bahnhöfe als Kristallisationskerne für Funktionen<br />
Im Jahr 1835 begann in Deutschland die Geschichte der Eisenbahn mit der Eröffnung der<br />
ersten Strecke zwischen Nürnberg <strong>und</strong> Fürth. Im Folgenden entstanden Bahnhöfe als neue<br />
Aus- bzw. Eingangstore der Städte <strong>und</strong> wurden entsprechend der jeweiligen <strong>Stadt</strong>struktur<br />
<strong>und</strong> der Entwicklung des zentralen Siedlungskörpers möglichst zentrumsnah errichtet. 125 Der<br />
<strong>Bahnhof</strong>, als ein von Menschen geschaffener Ort, ist einem starken zeitlichen Wandel<br />
unterworfen. Das Erscheinungsbild des <strong>Bahnhof</strong>s kann kontinuierlich mit diesem Wandel<br />
mitwachsen oder auch als Relikt aus früheren Zeiten weiter bestehen. Die Funktionen des<br />
<strong>Bahnhof</strong>s entwickeln sich nach einem ähnlichen Schema. Der Pool an <strong>Bahnhof</strong>sfunktionen<br />
wurde im Laufe der Zeit stark erweitert: Während viele Funktionen gleich blieben 126 , wurden<br />
auch neue Funktionen hinzugefügt.<br />
Zu diesem Punkt werden Abbildungen eines Systemmodells aus einer Semesterarbeit mit<br />
dem Titel „<strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum“ zitiert, welche eine relativ klare Struktur<br />
der <strong>Bahnhof</strong>sfunktionen anhand von drei Hierarchiestufen darstellt <strong>und</strong> eine empfehlende<br />
Stellungnahme formuliert. Die erste Stufe oder Funktionsebene beschreibt die fünf<br />
übergeordneten <strong>Bahnhof</strong>sfunktionen: Mobility Switch Point, Kommerzielle Flächennutzung,<br />
Identität, Raumgliederung <strong>und</strong> Wirtschaftsstandort. Als zweite Stufe beschreibt die<br />
Instrumentenebene die Instrumente, welche zu jeder einzelnen Funktion benötigt werden.<br />
Die dritte Hierarchiestufe sind die Qualitätsmerkmale: In dieser Ebene werden zu jedem<br />
Instrument die jeweiligen Qualitätsmerkmale beschrieben. 127<br />
123<br />
Zahlen von http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/start.html: DB AG<br />
124<br />
Interview mit Herrn Beck von ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG in Leipzig<br />
125<br />
Götz Baumgärtner (2005): Neue <strong>Bahnhof</strong>sprojekte. Nationalatlas B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland – Verkehr <strong>und</strong><br />
Kommunikation. Leibniz- Institut für Länderk<strong>und</strong>e. Leipzig. S. 46.<br />
126<br />
Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit. Eidgenössische<br />
Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 11.<br />
127<br />
Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit. Eidgenössische<br />
Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 9.
Abb. 15: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Mobility Switch Point“<br />
Quelle: Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit.<br />
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 22<br />
Wie die obige Abbildung zeigt, hat der <strong>Bahnhof</strong> aus ursprünglichem oder auch traditionellem<br />
Gesichtspunkt die Funktion als "Mobility Switch Point“. Dieser Begriff beschreibt die Funktion<br />
des <strong>Bahnhof</strong>s als Haltepunkt oder Verkehrsknotenpunkt, an dem die verschiedenen<br />
Verkehrsmittel zusammenkommen. Die Funktion an sich ist die Nutzung des Haltespunktes<br />
(„Point“) als Ein-, Um- <strong>und</strong> Aussteigeplattform („Switch“) zwischen den verschiedenen<br />
Verkehrsmitteln („Mobility“). 128 (Die hier erwähnte verkehrliche Funktion des <strong>Bahnhof</strong>s als<br />
Netzknoten wird im nächsten Kapitel weiter erläutert.) Als systeminterne<br />
„Verkehrsstationen“ mit den Funktionen des Zugangs zum <strong>und</strong> des Abgangs vom<br />
Transportsystem Bahn sowie des Umsteigens, haben Bahnhöfe gleichzeitig die Funktionen<br />
des Fahrplanangebots, des Wartens, der Park- <strong>und</strong> Abstellanlagen, des sich Informieren<strong>und</strong><br />
Beratenlassens, des Verkaufs verkehrsmittelbezogener Produkte, der Versorgung der<br />
Reisenden <strong>und</strong> des Erwerbs von Zugangsberechtigungen („Fahrkarten“) sicherzustellen.<br />
Servicedienste für den Bahnbetrieb wie auch für Bahnk<strong>und</strong>en werden hier organisiert <strong>und</strong><br />
angeboten.<br />
Um den Reisekomfort zu erhöhen <strong>und</strong> auf vorhandene Bedürfnisse zu reagieren, bietet der<br />
<strong>Bahnhof</strong> auch ein kommerzielles Angebot. Immer mehre Leute pendeln <strong>und</strong> wollen ihre<br />
Einkäufe auf dem Heimweg erledigen. Die Entwicklung der letzten Zeit zeigt aber auch, dass<br />
Einkaufs- <strong>und</strong> Dienstleistungsangebote losgelöst von der Reisefunktion genutzt werden,<br />
128<br />
Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit. Eidgenössische<br />
Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 22.<br />
84
eispielsweise von Anwohnern. 129 Damit zeigt sich eine weitere Funktion des <strong>Bahnhof</strong>s in<br />
seiner kommerziellen Flächennutzung. Diese hat stark an Bedeutung gewonnen <strong>und</strong> wird<br />
daher als eigenständige <strong>Bahnhof</strong>sfunktion betrachtet: Bahnhöfe sind mehr als Orte des Ein<strong>und</strong><br />
Aussteigens.<br />
Abb. 16: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Kommerzielle<br />
Flächennutzung“<br />
Quelle: Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit.<br />
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 25<br />
Nach einer groben Analyse der 20 größten Bahnhöfe in Deutschland wird ein deutlicher<br />
Trend moderner Bahnhöfe hin zu Nutzungsüberlagerungen sowie zur Multifunktionalität<br />
erkennbar. Die folgende Tabelle zeigt die Anteile der kommerziellen Flächen für jeden<br />
<strong>Bahnhof</strong>.<br />
Tabelle 20: Anteile der kommerziellen Flächen in den 20 größten Bahnhöfen 130<br />
Bahnhöfe<br />
Berlin Hbf<br />
Berlin Ostbf<br />
Fläche d.<br />
Bahnsteige (m²)<br />
ca.<br />
80.00<br />
0<br />
13.12<br />
6<br />
Fläche Vermietung<br />
(m²)<br />
15.000<br />
Anzahl Geschäfte<br />
& Gastronomie<br />
Gastronomie<br />
k.<br />
A.<br />
85<br />
Geschäfte<br />
B B&P B&W D G L M S T<br />
X X X X X X X X X<br />
12.000 55 X X X X X X X X X<br />
Berlin<br />
Südkreuz<br />
k.A. 5.000 18 X X X X X X<br />
Bremen Hbf. 21.80 5.000 21 X X X X X X X X X<br />
129<br />
Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit. Eidgenössische<br />
Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 25.<br />
130<br />
Alle Zahlen von http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/start.html: DB AG.
Dortm<strong>und</strong> Hbf<br />
Dresden Hbf<br />
Düsseldorf Hbf<br />
Essen Hbf<br />
Frankfurt<br />
(Main) Hbf<br />
Frankfurt<br />
(Main) Flugh<br />
Hamburg Hbf<br />
Hannover Hbf<br />
Karlsruhe Hbf<br />
Köln Hbf<br />
Leipzig Hbf<br />
Mainz Hbf<br />
Mannheim Hbf<br />
München Hbf<br />
Nürnberg Hbf<br />
Stuttgart Hbf<br />
B & P: Bücher <strong>und</strong> Presse<br />
B & W: Beauty <strong>und</strong> Wellness<br />
0<br />
20.20<br />
9<br />
27.46<br />
7<br />
24.92<br />
9<br />
24.79<br />
8<br />
60.87<br />
3<br />
26.58<br />
1<br />
24.41<br />
7<br />
43.79<br />
1<br />
32.99<br />
2<br />
68.78<br />
2<br />
16.90<br />
6<br />
16.89<br />
4<br />
41.07<br />
1<br />
25.32<br />
0<br />
38.00<br />
0<br />
9.928 21 X X X X X X X X<br />
22.453 X X X X X X<br />
9.693 32 X X X X X X X X X<br />
9.369 34 X X X X X X X X X<br />
9.000 70 X X X X X X X X<br />
86<br />
Keine Angabe<br />
8.900 75 X X X X X X X X<br />
13.065 47 X X X X X X X X X<br />
14.000 18 X X X X X X<br />
11.500 71 X X X X X X X X<br />
30.000<br />
D : Dienstleistungen (Post,Infostore, Autovermietung, Friseur...)<br />
G : Ges<strong>und</strong>heit<br />
L : Lebensmittel<br />
M : Mode<br />
S : Sonstige Geschäfte (Tabak, Kiosk...)<br />
T : Technik (Mobilfunk...)<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
14<br />
0<br />
X X X X X X X X X X<br />
3.800 21 X X X X X X X X<br />
8.936 34 X X X X X X X X X<br />
29.000 65 X X X X X X X X X<br />
20.214 55 X X X X X X X X X<br />
25.000 40 X X X X X X X X<br />
Mit 30.000 m² hat der Leipziger Hauptbahnhof die größte Fläche zur Vermietung. Auf dieser<br />
versuchen 140 Geschäfte <strong>und</strong> Gastronomiebetriebe die Einkaufs-, Freizeit- <strong>und</strong><br />
Alltagsbedürfnisse der Reisenden, Pendler <strong>und</strong> Anwohner zu befriedigen. Damit nimmt der<br />
Leipziger Hauptbahnhof auch den ersten Platz unter den 20 analysierten Bahnhöfen ein. Der<br />
Hauptbahnhof Mainz mit einer Fläche von 3.000 m², sowie der <strong>Bahnhof</strong> Berlin-Südkreuz <strong>und</strong><br />
der Karlsruher Hauptbahnhof mit 18 Geschäften/Gastronomieeinrichtungen weisen die<br />
niedrigsten Zahlen auf.<br />
Ebenfalls zu erwähnen ist das Multi-Themen-Center (3do) des Dortm<strong>und</strong>er Hauptbahnhofs.<br />
Obwohl das Projekt schon am 28. Februar 2007 für gescheitert erklärtet wurde, da der<br />
Vertrag mit dem Investor doch nicht zustande gekommen ist, stehen die Ideen dazu noch
symbolisch für den Neubau <strong>und</strong> Umbau der Bahnhöfe in Deutschland. Eine Besonderheit des<br />
Projektes sollte in der Bündelung verschiedenartiger Nutzungen liegen. Damit nahm das<br />
Projekt aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich des Konsumverhaltens auf. Neben der<br />
neuen Verkehrsstation (Ebenen 0 bis 2) beinhaltete die Planung den Bau eines Einkaufs-,<br />
Freizeit- <strong>und</strong> Entertainmentcenters (Ebene 3 bis 5) sowie eines Hotels mit<br />
Geschäftshaus/Konferenzcenter <strong>und</strong> Parkhaus auf dem bestehenden <strong>Bahnhof</strong>sgelände. 131<br />
Das Entertainment-Konzept des 3do sah ein großes, multifunktionales, an eine breit<br />
gefächerte Zielgruppe gerichtetes Angebot vor. Insgesamt waren 1.500 m 2 Shopfläche für<br />
den Reisendenbedarf sowie 6.500 m 2 Büro-, Sozial- <strong>und</strong> Serviceflächen geplant. Die<br />
vorgesehenen öffentlichen Verkehrsflächen in den Tunnel- <strong>und</strong> Verteilerbereichen umfassten<br />
ca. 10.000 m 2 . Hinzu kamen umfangreiche Technik- <strong>und</strong> sonstige Flächen sowie die<br />
nichtöffentlichen Erschließungsflächen. 132<br />
Ob mit größeren oder kleineren kommerziellen Flächen, vielen oder wenigen Geschäften <strong>und</strong><br />
Gastronomiebetrieben: Fast jeder <strong>Bahnhof</strong> ist als Multifunktionszentrum ausgestattet.<br />
Zusammengefasst wurden folgende Nutzungen in Bahnhöfen identifiziert:<br />
- Einkaufszentrum (Einzelhandel, Fachmarkt)<br />
- Dienstleistungszentrum (Post, Infostore, Autovermietung, Friseur etc.)<br />
- Gastronomie<br />
- Entertainment<br />
- Büros<br />
- Konferenzbereich<br />
- Reisezentrum<br />
131 http://www.spiekermann.de/Hochbau/Referenzen/MTC_3do.<strong>pdf</strong>: Spiekermann Beratende Ingenieure: Multi-<br />
Themen-Center 3do – Dortm<strong>und</strong> Hbf. Letzter Zugriff: 12.07.07.<br />
132 ebenda<br />
87
Ein <strong>Bahnhof</strong> ist ein öffentlicher Ort der nur schwer mit anderen öffentlichen Orten<br />
vergleichbar ist. Ihm haftet ein bevölkerungsnahes Image an, etwas was beispielsweise<br />
Flughäfen oder Busbahnhöfe nicht in demselben Masse besitzen. Ein <strong>Bahnhof</strong> dient aufgr<strong>und</strong><br />
seiner meist zentralen Lage als Tor zur <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> bestimmt den ersten Eindruck, den man<br />
bei Anreise mit der Bahn von ihr gewinnt. Er ist an der Schaffung einer Identität des Ortes<br />
maßgeblich mitbeteiligt. 133 (siehe dazu Kapitel 3.2.1 Bahnhöfe als Visitenkarten bzw.<br />
Imageträger der <strong>Stadt</strong>).<br />
Abb. 17: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Identität“<br />
Quelle: Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit.<br />
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 27<br />
Die Analyse der raumgliedernden Funktion des <strong>Bahnhof</strong>s geht von der Frage aus: Was würde<br />
im Raum fehlen, wenn der <strong>Bahnhof</strong> nicht existieren würde? Die Verkehrsrichtung, die<br />
Schneisen <strong>und</strong> Achsen einer <strong>Stadt</strong> sind stark von der Anwesenheit des <strong>Bahnhof</strong>s geprägt.<br />
Die massiven Einschnitte in die <strong>Stadt</strong>struktur durch die Bahnanlagen ersetzen teilweise die<br />
trennende <strong>und</strong> begrenzende Funktion von Flüssen <strong>und</strong> Anhöhen. Aus diesem Gesichtspunkt<br />
wirken <strong>Bahnhof</strong>sflächen <strong>und</strong> Gleisanlagen als raumplanerische Strukturelemente in der<br />
<strong>Stadt</strong>. 134 (siehe dazu Kapitel 6.3).<br />
133<br />
Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit. Eidgenössische<br />
Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 27.<br />
134<br />
ebenda, S. 30<br />
88
Abb. 18: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Raumgliederung“<br />
Quelle: Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit.<br />
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 30<br />
Die Bedeutung der Bahnhöfe für ihr Viertel ist nach von Gerkan (1996) in erster Linie<br />
ökonomischer Art. Die Funktion „Wirtschaftsstandort“ beleuchtet also die ökonomische Seite<br />
des <strong>Bahnhof</strong>s als <strong>Stadt</strong>entwicklungsfaktor. 135 (siehe dazu Kapitel 1.3.3).<br />
Abb. 19: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Wirtschafsstandort“<br />
Quelle: Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit.<br />
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 33<br />
Bahnhöfen selbst dient die Nutzungsüberlagerung dazu, ihren Umsatz zu steigern. Aber auch<br />
die Städte, <strong>und</strong> insbesondere die Innenstädte, bekommen durch die <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung<br />
neue Entwicklungschancen (siehe dazu Kapitel 5.1 <strong>Bahnhof</strong>sflächen aus der Sicht der<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>planung). Einerseits bringt die Einzelhandelsansammlung im<br />
<strong>Bahnhof</strong> bei gleich bleibender Kaufkraft Konkurrenz zum traditionellen Einzelhandel der<br />
Innenstadt, andererseits kann das zusätzliche Angebot zur Steigerung der Attraktivität der<br />
gesamten Innenstadt beitragen <strong>und</strong> zusätzliche Kaufkraft anziehen. Als zentrale<br />
Kommunikations- <strong>und</strong> Dienstleistungszentren, welche das innerstädtische Angebot auch im<br />
Handels- <strong>und</strong> Freizeitbereich ergänzen können, können die Bahnhöfe durch eine Stärkung<br />
der Kernfunktionen auch wesentliche Impulse für eine zukunftsfähige <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
135<br />
Maya Wolfensberger Malo (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum. Semesterarbeit. Eidgenössische<br />
Technische Hochschule Zürich, Zürich. S. 33.<br />
89
setzen. Eine Sicherung <strong>und</strong> Verbesserung der ökonomischen Funktionen der Innenstädte<br />
<strong>und</strong> der Rentabilität von Bahnleistungen beschreiben ein Ziel der Entwicklung von<br />
Bahnhöfen.<br />
3.1.3 Bahnhöfe als Netzknoten<br />
Bahnhöfe sind immer noch – oder sogar wieder verstärkt – Eingänge in die <strong>Stadt</strong>, sowohl für<br />
Tagespendler als auch für Fernreisende. Sie sind umgekehrt auch als Tore zum Umland <strong>und</strong><br />
zur Welt. Sie stellen im Städtischen wie auch im regionalen Gefüge hochwertige Standorte<br />
der Verkehrserschließung durch alle Verkehrsmittel <strong>und</strong> der Verknüpfung der verschiedenen<br />
Verkehrsmittel dar. 136<br />
Seit eineinhalb Jahrh<strong>und</strong>erten sind die Bahnhöfe die Drehpunkte, Kommandozentralen <strong>und</strong><br />
Gelenkstellen eines Eisenbahnimperiums, dessen Entfaltung die Entwicklung vieler Länder<br />
stark beeinflusst hat. 137 Aus verkehrsplanerischer Perspektive kann man den <strong>Bahnhof</strong> als<br />
wichtigsten verkehrslogistischen Verknüpfungspunkt <strong>und</strong> Ort der größten Verkehrsdichte<br />
bezeichnen. 138 Bahnhöfe sind Orte des Wechsels zwischen unterschiedlich strukturierten <strong>und</strong><br />
unterschiedlich schnellen Verkehrssystemen, an denen lokale, regionale <strong>und</strong> überregionale<br />
Züge halten <strong>und</strong> durch fahren. Damit haben Bahnhöfe die höchste absolute<br />
Verkehrsintensität innerhalb von Städten <strong>und</strong> verbinden diese auch miteinander.<br />
Neben dem Nah- <strong>und</strong> Fernverkehr am <strong>Bahnhof</strong> treffen hier ebenfalls die Verkehrswege von<br />
Tram, Bus, motorisiertem Individualverkehr <strong>und</strong> Langsamverkehr zusammen. Damit<br />
übernimmt der <strong>Bahnhof</strong> die Aufgabe, ein „Zugang zur <strong>Stadt</strong>“ zu sein. Ein typisches Beispiel<br />
dafür ist der Berliner Hauptbahnhof mit seinen Anbindungen zu bzw. Angebot an:<br />
- <strong>Stadt</strong>verkehr<br />
- Mietwagen<br />
- Fahrradverkehr<br />
- Taxis<br />
Mit mehreren Verkehrslinien an <strong>und</strong> durch den Berliner Hauptbahnhof macht der öffentliche<br />
Personennahverkehr Bahnfahrer in der <strong>Stadt</strong> mobil <strong>und</strong> bindet den <strong>Bahnhof</strong> gut an andere<br />
<strong>Stadt</strong>teile an. Die S-Bahn Linien 5, 7, 75 <strong>und</strong> 9 auf dem zweiten Obergeschoss bieten eine<br />
Ost-West Verbindung zwischen Ostkreuz <strong>und</strong> Westkreuz. Die geplante neue S-Bahn Linie 21<br />
zwischen Nordring <strong>und</strong> Südring durch den Hauptbahnhof wird in Zukunft eine Nord-Süd-<br />
136<br />
Beckmann, Klaus J. (2002): Personenbahnhöfe als Kristallisationskerne zukunftsfähiger <strong>Stadt</strong>entwicklung.<br />
Eisenbahntechnische R<strong>und</strong>schau 51/2002, S. 369-377. Hestra-Verlag. Hamburg. S. 371.<br />
137<br />
Jean Dethier (1978): Der <strong>Bahnhof</strong>: ein neuer Turmbau zu Babel. In: Die Welt Der Bahnhöfe, Elefanten- Press-<br />
Verlag. Berlin. S. 6.<br />
138<br />
Hatzfeld, Ulrich (1999): Zur städtebaulichen <strong>und</strong> verkehrlichen Funktion der Bahnhöfe. In: Bahnhöfe, Sicherheit,<br />
Service, Aufenthaltsqualität. Institut für Landes- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklungsforschung des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen. Dortm<strong>und</strong>. S. 70.<br />
90
Verbindung herstellen. 139 Auf den Vorplätzen des <strong>Bahnhof</strong>s gibt es viele Reisemöglichkeiten<br />
mit dem Bus: Direkte <strong>und</strong> schnelle Verbindungen zum Flughafen Tegel mit dem Expressbus<br />
TXL; in nördliche Richtung fahren die Buslinien 245 nach Nordbahnhof <strong>und</strong> 120 nach<br />
Frohnau; ein geplantes U-Bahn-Shuttle zwischen dem Hauptbahnhof <strong>und</strong> Brandenburger Tor<br />
als U 55 wird den Hauptbahnhof in südliche Richtung mit dem <strong>Stadt</strong>zentrum verbinden.<br />
Am <strong>Bahnhof</strong> gibt es zusätzlich viele verschiedene Mietwagenangebote. Zusammen mit dem<br />
Fahrradverleih <strong>und</strong> dem Taxiangebot r<strong>und</strong> um den <strong>Bahnhof</strong> ermöglichen diese eine<br />
ungehinderte Anbindung - ohne Beschränkung von Abfahrtszeit <strong>und</strong> Fahrtrichtung - an die<br />
<strong>Stadt</strong>. Auch haben alle diese Angebote die Vorstädte durch den <strong>Bahnhof</strong> an die Kernstadt<br />
angeb<strong>und</strong>en: Damit machen diese Verkehrsmittel den <strong>Bahnhof</strong> ebenso zur Drehscheibe des<br />
ständig zunehmenden Personennahverkehrs wie er es für ein-, um- <strong>und</strong> aussteigende<br />
Fernreisende ist.<br />
3.1.4 Finanzielle Mittel der Städte für einen <strong>Bahnhof</strong>, oder alles B<strong>und</strong>esgelder?<br />
Betrachtet man die rein rechtlichen Bestimmungen für einen <strong>Bahnhof</strong>, so wird schnell<br />
deutlich, dass die <strong>Stadt</strong> als Gemeinde wenig Einfluss auf den Komplex „<strong>Bahnhof</strong>“ mit allen<br />
Betriebsanlagen, die in § 18 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes geregelt sind,<br />
nehmen kann. Schon im Gr<strong>und</strong>gesetz der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland Artikel 87e Abs. 1<br />
wird festgeschrieben, dass „die Eisenbahnverkehrsverwaltung der Eisenbahn des B<strong>und</strong>es (…)<br />
in b<strong>und</strong>eseigener Verwaltung“ geführt wird, wobei Aufgaben auch als Angelegenheiten den<br />
Ländern übertragen werden können. In Hinsicht auf die Ökonomie des <strong>Bahnhof</strong>es werden<br />
„Eisenbahnen des B<strong>und</strong>es (…) als Wirtschaftsunternehmen in privat-rechtlicher Form<br />
geführt. Diese stehen im Eigentum des B<strong>und</strong>es, soweit die Tätigkeit des<br />
Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unterhaltung <strong>und</strong> das Betreiben von Schienenwegen<br />
umfasst. Die Veräußerung von Anteilen des B<strong>und</strong>es an Unternehmen nach Satz 2 erfolgt auf<br />
Gr<strong>und</strong> eines Gesetztes, die Mehrheit der Anteile an diesen Unternehmen verbleibt beim<br />
B<strong>und</strong>. Das Nähere wird durch B<strong>und</strong>esgesetz geregelt.“ (Artikel 87e Abs. 3 GG)<br />
Gibt es demnach keine finanziellen Mittel einer <strong>Stadt</strong> für einen <strong>Bahnhof</strong>, weil alles<br />
B<strong>und</strong>esangelegenheit oder Länderangelegenheit ist? Die <strong>Stadt</strong> beteiligt sich einzig <strong>und</strong> allein<br />
am <strong>Bahnhof</strong>vorplatz <strong>und</strong> an der Entwicklung nicht mehr betriebsnotwendiger, disponibler<br />
Bahnflächen finanziell. 140 (siehe dazu Kapitel 5.3 Umgang mit brachgefallenen Bahnflächen)<br />
Angesichts der rechtlichen Regelungen <strong>und</strong> der Bestätigung in der Exkursion nach Leipzig<br />
kann festgehalten werden, dass die <strong>Stadt</strong> als Gemeinde im ökonomischen Sinne einen eher<br />
geringen Einfluss auf den <strong>Bahnhof</strong> hat.<br />
139<br />
http://www.berliner-verkehrsseiten.de/s-bahn/Strecken/Elektrifizierung/S_21/s_21.html (2006): Planungslinie S<br />
21 (Berlin). Letzter Zugriff: 13.07.07.<br />
140<br />
Interview auf der Exkursion mit Herrn Wolff des <strong>Stadt</strong>planungsamtes Leipzig (Abteilung Süd/Ost)<br />
91
3.1.5 <strong>Bahnhof</strong> als Wirtschaftsmotor eines <strong>Stadt</strong>teils oder sogar einer ganzen<br />
<strong>Stadt</strong>?<br />
Wird der <strong>Bahnhof</strong> als Wirtschaftsstandort betrachtet, taucht oftmals der Begriff<br />
Einzelhandels- <strong>und</strong> Dienstleistungsstandort auf. Da die genaue Betrachtung dieses Begriffes<br />
unter Punkt 4.3.2.2 untersucht werden soll, wird sich hier auf eine allgemeine Betrachtung<br />
des <strong>Bahnhof</strong>es als Wirtschaftsmotor beschränkt. Betrachtet man den Wandel der Bahnhöfe<br />
vom Verkehrsknoten hin zum Versorgungszentrum (siehe auch Kapitel 1.4 Übergang vom<br />
Beförderungszentrum zum Einkaufszentrum), so wird sehr schnell deutlich, dass sich die<br />
Bahnhöfe während der letzten zehn Jahre in ihrer Wirtschaftskraft verstärkt haben. Die<br />
Anreicherung von Funktionen im Einzelhandel <strong>und</strong> im Dienstleistungsbereich hat zum einen<br />
neue Arbeitsplätze geschaffen <strong>und</strong> zum anderen neue K<strong>und</strong>enströme generiert. Wie sich dies<br />
allerdings auf das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld <strong>und</strong> auf die weitere Umgebung ausgewirkt hat, soll unter<br />
Punkt 4.3.2.2 „Bahnhöfe als Einzelhandels- <strong>und</strong> Dienstleistungszentren“ aufgeführt werden.<br />
3.1.6 Standortmarketing der <strong>Stadt</strong> im Bezug auf Bahnhöfe<br />
Für diesen Aufgabenpunkt sind vor allen Dingen die folgenden Fragen wichtig: Gibt es ein<br />
Standortmarketing der <strong>Stadt</strong> im Bezug auf Bahnhöfe? Wenn ja, wie sieht dieses aus? Welche<br />
Kommunikationen <strong>und</strong> Kooperationen zwischen der <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> den Bahnhöfen sind<br />
vorhanden oder anzustreben? Zur Beantwortung dieser drei Fragen wurde versucht, zuerst<br />
Antworten in der Literaturrecherche zu finden, um diese anschließend bei der Exkursion in<br />
Leipzig zu verfestigen.<br />
Der Standort „<strong>Bahnhof</strong>“ wird als solches von Seiten der <strong>Stadt</strong> nicht vermarktet, da er kein<br />
„Eigentum“ der <strong>Stadt</strong> darstellt. Allerdings gibt es Formen der Kommunikation <strong>und</strong><br />
Kooperationen zwischen <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>. Beispiele hierfür wären das <strong>Stadt</strong>marketing <strong>und</strong><br />
das City-Management, wobei das bekannteste Instrument der beiden das <strong>Stadt</strong>marketing<br />
ist. Seit Mitte der 1980er Jahre wird dieses Werkzeug in den Bereichen <strong>Stadt</strong>entwicklung,<br />
Wirtschaftsförderung, Standortwerbung <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit verstärkt eingesetzt, um<br />
neue Impulse für Entwicklungen zu erzeugen. Dabei ist das zentrale Element eines<br />
<strong>Stadt</strong>marketing-Prozesses die Verbesserung der städtischen Kommunikation nach innen <strong>und</strong><br />
nach außen sowie das gemeinsame Entwickeln <strong>und</strong> Umsetzen von Maßnahmen, um damit<br />
eine Kooperationen zwischen den einzelnen Beteiligten zu erzielen. 141 Beim <strong>Stadt</strong>marketing<br />
bilden bestimmte, ineinander greifende Elemente, ein umfassendes Konzept.<br />
Diese Elemente sind nach Grabow <strong>und</strong> Hollbach-Grömig folgende:<br />
- Die <strong>Stadt</strong> wird als Ganzes betrachtet, der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt<br />
nicht ausschließlich auf der Innenstadt.<br />
141 Linke, Hartmut (1999): Bahnhöfe als Einzelhandelsstandort – Entwicklungen, Potentiale <strong>und</strong> Empfehlungen für<br />
eine „Renaissance der Innenstädte“. Diplomarbeit Universität Trier, S. 79<br />
92
- <strong>Stadt</strong>marketing ist ein kooperativer Prozess möglichst vieler Akteure.<br />
- Es sollte eine Dienstleistungsorientierung bzw. eine Verbesserung des<br />
„Produktes <strong>Stadt</strong>“ angestrebt werden.<br />
- Es wird ein breites Themenspektrum aufgegriffen, das sich aus praktisch allen<br />
Elementen der <strong>Stadt</strong>entwicklung zusammensetzt (Wirtschaft, Wohnen, Verkehr,<br />
Soziales etc.). 142<br />
Vor allen Dingen die Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels gegenüber den<br />
„Einzelhandels-Großriesen“ auf der „grünen Wiese“ ist ein Ziel des City-Managements.<br />
Genau wie beim <strong>Stadt</strong>marketing kann die Trägerschaft eines solchen City-Managements<br />
völlig unterschiedlich sein - ausschließlich kommunal, rein privat oder als gemeinsam<br />
getragene Form von <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Privaten. Da der räumliche Wirkungsbereich <strong>und</strong> die<br />
Themenbereiche beim City-Management enger gefasst sind als beim <strong>Stadt</strong>marketing,<br />
erweist sich dieses bei der Revitalisierung der Innenstädte auch als geeigneter. Bezogen auf<br />
die Bahnhöfe ist es erforderlich, dass die Deutsche Bahn AG, der Einzelhandel <strong>und</strong> die<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung ein Verständnis für die Entscheidungsstrukturen <strong>und</strong> Zielvorstellungen der<br />
jeweils anderen Seite finden <strong>und</strong> versuchen, das jeweilige Vorgehen einander anzupassen. 143<br />
Wie sieht ein solches City-Management nun aber in der Praxis aus? Ein Beispiel hierfür wäre<br />
die <strong>Stadt</strong> Leipzig. Vertreter des innerstädtischen Einzelhandels in Leipzig hatten vor der<br />
Eröffnung enorme Einwände gegen die Promenaden am Hauptbahnhof, was sich nicht zuletzt<br />
durch die Frage der Öffnungszeiten zu einem offenen Streit entwickelte. 144 Dies war auch ein<br />
Gr<strong>und</strong> dafür, dass im April 1998, gerade einmal fünf Monate nach der Eröffnung der<br />
„Promenaden am Hauptbahnhof“, der Verein „City Leipzig Management“ gegründet wurde.<br />
In dem Verein wurden die Promenaden mit dem Center-Management ECE von Beginn an als<br />
Mitglied integriert. Außerdem sind ca. 500 weitere Mitglieder, in 10 Mitglieder-Pools (unter<br />
anderem ein Gastronomie-Pool, eine Gruppe der Immobilien-Eigentümer, die City-<br />
Gemeinschaft (Einzelhändler), die Sparkasse, eine Gruppe der Passagen-Betreiber <strong>und</strong><br />
mehr) unterteilt, im Verein aktiv. Neben vereinzelten Projekten wie einer Kinderbetreuung<br />
für Innenstadtbesucher, einer City-Card sowie verschiedenen Events sind vor allen Dingen<br />
Werbekampagnen <strong>und</strong> die Lobby-Arbeit gegenüber der Politik <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
wichtige Aufgaben des Vereins. 145 Nach einer Forschungsarbeit zum Thema „Die<br />
Auswirkungen der Eröffnung des Einkaufscenters „Promenaden am Hauptbahnhof“ auf die<br />
Händler der Leipziger Innenstadt“ aus dem Jahre 1998 bemängelten 68% aller befragten<br />
Einzelhändler der <strong>Stadt</strong> Leipzig die Kooperation mit der <strong>Stadt</strong>verwaltung. Demnach sind<br />
langwierige <strong>und</strong> bürokratische Genehmigungsverfahren sowie eine fehlende allgemeine<br />
142<br />
Grabow, B & B. Hollbach-Grömig (1998): <strong>Stadt</strong>marketing – eine kritische Zwischenbilanz (=DIFU-Beiträge zur<br />
<strong>Stadt</strong>forschung, Bd. 25). Berlin, S. 170ff<br />
143<br />
Linke, Hartmut (1999): Bahnhöfe als Einzelhandelsstandort – Entwicklungen, Potentiale <strong>und</strong> Empfehlungen für<br />
eine „Renaissance der Innenstädte“. Diplomarbeit Universität Trier, S. 80-81<br />
144<br />
Interview auf der Exkursion mit Herrn Hahn der IHK Leipzig<br />
145<br />
Linke, Hartmut (1999): Bahnhöfe als Einzelhandelsstandort – Entwicklungen, Potentiale <strong>und</strong> Empfehlungen für<br />
eine „Renaissance der Innenstädte“. Diplomarbeit Universität Trier, S. 108-109<br />
93
Anlaufstelle für die Einzelhändler in der Leipziger Innenstadt als sehr kritische Punkte<br />
angemerkt worden. Besonders das Fehlen einer „positiven Eigeninitiative“ der <strong>Stadt</strong> wurde<br />
damals stark bemängelt. 146 Im Zuge der Exkursion nach Leipzig konnte teilweise ein Wandel<br />
hin zu mehr Eigeninitiative der <strong>Stadt</strong>verwaltung festgestellt werden.<br />
Eine sehr repräsentative Umfrage von 339 Städten <strong>und</strong> Gemeinden des Deutschen Institutes<br />
für Urbanistik aus dem Jahre 2004 bestätigt ein solches Bild für das gesamte B<strong>und</strong>esgebiet<br />
Deutschland. Hierbei wurde ein Rücklauf von 223 Kommunen deutschlandweit ausgewertet,<br />
was zu folgendem Ergebnis führte. In allen Städten mit über 100.000 Einwohnern ist<br />
<strong>Stadt</strong>marketing in der Umsetzung oder man hat zumindest erste Erfahrungen gesammelt. In<br />
Kommunen mit weniger als 50.000 Einwohnern ist <strong>Stadt</strong>marketing in 72 % in der<br />
Umsetzung, in 9 % wurden Erfahrungen gesammelt. Besonders interessant sind auch die am<br />
häufigsten genannten Federführenden beim <strong>Stadt</strong>marketing der Befragten Kommunen.<br />
Dabei ist der Bürgermeister, der am häufigsten genannte, vor der <strong>Stadt</strong>verwaltung, dem<br />
<strong>Stadt</strong>marketingbüro, Arbeitskreis <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>direktor. Dies ist auch darin begründet, dass die<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung den größten Teil der Finanzierung des <strong>Stadt</strong>marketings trägt. Das Fazit aus<br />
der Umfrage des Deutschen Institutes für Urbanistik ist recht deutlich: Das Instrument des<br />
<strong>Stadt</strong>marketings ist etabliert <strong>und</strong> hat eine inhaltliche <strong>und</strong> räumliche Orientierung auf den<br />
Einzelhandel <strong>und</strong> die Innenstadt erfahren. 147<br />
Eine andere Untersuchung zum Marketing des Standortes <strong>Bahnhof</strong> auf Ebene der <strong>Stadt</strong><br />
stellte eine eigene Analyse der Homepages der Städte mit den zwanzig Bahnhöfen der<br />
Kategorie 1 Deutschlands (<strong>Bahnhof</strong>skategorisierung DB Station & Service AG, Stand<br />
01.01.07.148) dar. Dabei wurden die Homepages der 17 Städte daraufhin untersucht, ob<br />
der <strong>Bahnhof</strong> oder die großen Bahnhöfe der <strong>Stadt</strong> in irgendeiner Weise präsentiert werden<br />
<strong>und</strong>, wenn ja, wie. Zur Veranschaulichung der Ergebnisse der Untersuchung soll die Tabelle<br />
auf der folgenden Seite dienen.<br />
146<br />
Gräve, D., K. Wellner & A. Wicht (1998): die Auswirkungen der Eröffnung des Einkaufscenters „Promenaden am<br />
Hauptbahnhof“ auf die Händler der Leipziger Innenstadt. Unveröffentlichte Forschungsarbeit der Universität<br />
Leipzig, Lehrstuhl Handel <strong>und</strong> Sistribution. Leipzig, S. 15<br />
147 Hollbach-Grömig, Dr. Beate (8. 1. 2007): <strong>Stadt</strong>marketing: Ziele – Aktivitäten – Erfolgsfaktoren, einer<br />
b<strong>und</strong>esweiten Umfrage. Präsentation des Deutschen Institutes für Urbanistik. S. 1-22<br />
148<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/bahnhofskategorien/bahn<br />
hofs__kategorien.html Zugriff: 25.06.2007 19.00 Uhr<br />
94
Tabellee<br />
21: Ergeebnisse<br />
der<br />
Analyse der Homeepages<br />
<strong>Stadt</strong>tlogo<br />
Bahnhö öfe der Auussage<br />
1<br />
Bahnhö öfe der Auussage<br />
2<br />
Bahnhö öfe der Auussage<br />
3<br />
Bahnhö öfe der Auussage<br />
4<br />
LLeipzig<br />
Hbf<br />
DDresden<br />
Hbf<br />
BBerlin<br />
Hbf<br />
BBerlin<br />
Ostbaahnhof<br />
BBerlin<br />
Südkrreuz<br />
MMannheim<br />
HHbf<br />
DDortm<strong>und</strong><br />
HHbf<br />
DDüsseldorf<br />
HHbf<br />
FFrankfurt<br />
(MMain)<br />
Hbf<br />
FFrankfurt<br />
(MMain)<br />
FFlughafen<br />
HHamburg<br />
Hbbf<br />
SStuttgart<br />
Hbbf<br />
HHannover<br />
Hbf<br />
BBremen<br />
Hbff<br />
KKarlsruhe<br />
Hbf<br />
KKöln<br />
Hbf<br />
MMainz<br />
Hbf<br />
Bahnnhöfe<br />
MMünchen<br />
Hbbf<br />
95<br />
Bahnhhofsdarste<br />
ellung<br />
umfangreiche<br />
Darstellungen<br />
in<br />
verschieedenen<br />
Kat tegorien<br />
auf der Homepage e<br />
Zahlreicche<br />
Darstellungen<br />
bei Staddtentwicklung,<br />
Umwelt, , Tourismus s …<br />
Zahlreicche<br />
Links <strong>und</strong><br />
Darstellungen<br />
Mehreree<br />
Darstellun ngen,<br />
Link zu Deutsche Bahn B<br />
AG,<br />
„Bahnhoof<br />
des Jahre es“<br />
Kurze DDarstellung<br />
<strong>und</strong><br />
Link<br />
zur Deutschen<br />
Bah hn AG<br />
mit Staddtplan<br />
wenige Darstellunggen<br />
bei<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung,<br />
Verkehr<br />
<strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>archiv<br />
Kurze DDarstellung,<br />
, Link zu<br />
Deutschhe<br />
Bahn AGG<br />
Kurze DDarstellung<br />
Kurze DDarstellung<br />
Öfters eerwähnt,<br />
un nter<br />
anderemm<br />
bei Shopping<br />
Direktveerlinkung<br />
zu<br />
Deutschhe<br />
Bahn AGG<br />
mit<br />
<strong>Bahnhof</strong>fsplan<br />
Hauptsäächlich<br />
nur Links<br />
zum Verrkehr<br />
Nur Erwwähnung<br />
in<br />
Lokalnachrichten<br />
Hauptsäächlich<br />
Linkks<br />
zum<br />
Verkehrr<br />
Hauptsäächlich<br />
Linkks<br />
zum<br />
Verkehrr
Nürnberg Hbf Hauptsächlich Links zum<br />
Verkehr<br />
Essen Hbf Keine Links zu finden<br />
Quelle: eigene Darstellung auf Gr<strong>und</strong>lage der Homepages der einzelnen Städte (Stand 25.06.07)<br />
Aus der Analyse der Homepages lassen sich folgende Aussagen ableiten:<br />
- Einzig <strong>und</strong> allein Leipzig präsentiert seinen Hauptbahnhof weit reichend <strong>und</strong> in<br />
den verschiedensten Kategorien (<strong>Stadt</strong>spaziergang, Wissenswertes zur <strong>Stadt</strong>,<br />
Geschichte <strong>und</strong> Shopping) auf der Homepage. Zahlreiche Bilder <strong>und</strong> sogar eine<br />
3D-R<strong>und</strong>schau im <strong>Bahnhof</strong> zeigen die starke Identifikation der <strong>Stadt</strong> Leipzig mit<br />
dem Hauptbahnhof <strong>und</strong> mit den „Promenaden am Hauptbahnhof“. Schon bei der<br />
Vorstellung der <strong>Stadt</strong> wird der Hauptbahnhof als sehr wichtig aufgeführt.<br />
- Die Homepages der Städte Dresden, Berlin <strong>und</strong> Mannheim stellen den <strong>Bahnhof</strong><br />
als solches mit Bildern vor <strong>und</strong> zeigen neben den verkehrsrelevanten Links<br />
teilweise auch Entwicklungen <strong>und</strong> Planungen. Allerdings gelangt man erst durch<br />
intensive Suche auf die entsprechenden Seiten.<br />
- Die Homepages der Städte Dortm<strong>und</strong>, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,<br />
Hannover <strong>und</strong> Stuttgart stellen in einem kurzen Link ihre Hauptbahnhöfe vor,<br />
sonstige Links sind meist auf den Verkehr beschränkt <strong>und</strong> ermöglichen<br />
höchstens einen Zugang zur Deutschen Bahn AG-Homepage.<br />
- Die restlichen untersuchten Homepages der Städte Bremen, Karlsruhe, Köln,<br />
Mainz, München <strong>und</strong> Nürnberg haben ihre Hauptbahnhöfe meist nur unter der<br />
Kategorie Verkehr aufgeführt. Auf der Homepage der <strong>Stadt</strong> Essen war sogar<br />
keinerlei Information zum Hauptbahnhof zu finden.<br />
Zusammenfassend lässt sich sehr deutlich erkennen, dass die Bahnhöfe auf den Homepages<br />
mit Ausnahme der <strong>Stadt</strong> Leipzig eher wenig ausführlich <strong>und</strong> detailliert präsentiert werden.<br />
Demnach ist eine Art „Identifikation“ der Städte mit den Bahnhöfen auf den Homepages<br />
nicht zu belegen. Die Bahnhöfe als „Tor zu <strong>Stadt</strong>“ oder sogar „zur Welt“ werden demnach<br />
aus Marketingzwecken der Städte nicht ausreichend ausgeschöpft. Wie schon erwähnt, stellt<br />
sich nur Leipzig als Sonderbeispiel dar, da hier der Hauptbahnhof auf den verschiedensten<br />
Ebenen der Homepage immer wieder aufgeführt wird. Auch die „Promenaden am<br />
Hauptbahnhof“ werden als Shopping-Meile für den Besucher der Homepage präsentiert.<br />
Empfehlenswert wäre in Zukunft eine verbesserte Kommunikation <strong>und</strong> Kooperation zwischen<br />
den Betreibern, Einzelhändlern <strong>und</strong> Managern der Bahnhöfe <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong>verwaltung, um<br />
eine ergebnisorientierte <strong>Stadt</strong>entwicklung voran zu treiben. Das Beispiel City-Management<br />
wird demnach auch in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle einnehmen. Die Betreiber der<br />
Homepages der Städte bzw. die Städte selbst aus Eigeninteresse heraus könnten zudem<br />
96
verstärkte Kooperationen mit der Deutschen Bahn AG bzw. mit anderen relevanten<br />
<strong>Bahnhof</strong>sbetreibern eingehen, um somit den Standort <strong>Bahnhof</strong> interessanter <strong>und</strong> erlebbarer<br />
zu machen.<br />
3.2 Derzeitige Entwicklungen<br />
3.2.1 Bahnhöfe als Visitenkarten bzw. Imageträger der <strong>Stadt</strong><br />
Die geschichtliche Entwicklung der Bahnhöfe in den letzten 150 Jahren zeigt deutliche Auf<strong>und</strong><br />
Abwärtsbewegungen im Ansehen der Bahnhöfe in der Gesellschaft. Besonders nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg machte der enorme Aufstieg des Autos als Hauptverkehrsmittel für den<br />
nach Individualität strebenden Menschen die Bahn zum Massenverkehrsmittel, was auch den<br />
<strong>Bahnhof</strong> als solches <strong>und</strong> dessen Umfeld an Ansehen bzw. Image verlieren ließ. Dies führte<br />
dazu, dass fast nur noch diejenigen mit der Bahn fuhren, die sich kein Auto leisten konnten.<br />
Zeitgleich wurde der <strong>Bahnhof</strong> von mehrspurigen Ringstraßen teilweise von der Innenstadt<br />
abgetrennt, als konkrete Planungen der damaligen <strong>Stadt</strong>entwicklung. Aber nicht nur der<br />
<strong>Bahnhof</strong> an sich sondern auch sein Umfeld litt in dieser Zeit an einem starken Imageverlust.<br />
Bedenkt man, dass um die Wende vom 19. zum 20. Jahrh<strong>und</strong>ert die <strong>Bahnhof</strong>gegenden noch<br />
zu den besten Adressen der <strong>Stadt</strong> gehörten, so hat sich die „Visitenkarte“ in den 50er Jahren<br />
des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts schnell zu einem problembelasteten Gebiet verändert (siehe dazu AG<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld/Kapitel historische Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds). Das fehlende<br />
Interesse der <strong>Stadt</strong>planung an den Bahnhöfen <strong>und</strong> dessen Umfeld bewirkte über Jahrzehnte<br />
eine starke Verschlechterung der <strong>Bahnhof</strong>sumfelder durch die Ansiedlung des<br />
Rotlichtmilieus. Aber auch in architektonischer Weise wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zu<br />
großen Teilen eine Art „Verunstaltung“ betrieben, die nicht zuletzt aus der Geringschätzung<br />
der Bahnhöfe in Politik <strong>und</strong> Planung resultierte. Bei der Erneuerung <strong>und</strong> sogar beim Neubau<br />
von Bahnhöfen in dieser Zeit wurde auf neutrale Rasterfassaden gesetzt, die eher die<br />
Impression eines Kaufhauses oder eines Bürohauses als die eines <strong>Bahnhof</strong>es auslösten. Dies<br />
war allerdings auch der architektonische Ausdruck dieser Zeit (siehe dazu Kapitel 6.1). Dabei<br />
sollten vor allen Dingen Funktionalität, Austauschbarkeit <strong>und</strong> Standardisierung im<br />
Vordergr<strong>und</strong> stehen, unterdessen wurde ein gestalterischer Anspruch geradewegs tabuisiert.<br />
Beispiele dafür sind die Hauptbahnhöfe in München, Saarbrücken, Braunschweig <strong>und</strong><br />
Bochum. Auch im Ausland, besonders in Frankreich, konnte man diese Entwicklung<br />
beobachten. 149<br />
Erste Versuche der Aufwertung der stark imagegeschädigten Bahnhöfe erfolgten in den 70er<br />
Jahren des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts. Dies waren aber keine Überlegungen der Bahn, vielmehr<br />
sollten damit Gebiete um die Bahnhöfe aufgewertet werden <strong>und</strong>/oder <strong>Stadt</strong>teile, die durch<br />
Bahngleise voneinander getrennt waren enger miteinander verb<strong>und</strong>en werden. Ein Beispiel<br />
aus Deutschlands näherem Ausland ist Utrecht. In Utrecht (Niederlande) konnten am<br />
Hauptbahnhof verschiedene, besonders verkehrserzeugende Nutzungen konzentriert<br />
149 Linke, Hartmut (1999): Bahnhöfe als Einzelhandelsstandort – Entwicklungen, Potentiale <strong>und</strong> Empfehlungen für<br />
eine „Renaissance der Innenstädte“. Diplomarbeit Universität Trier, S. 8-9<br />
97
werden. Dadurch ist es gelungen, den <strong>Bahnhof</strong> in der <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> in den<br />
Verkehrskonzepten wieder mehr <strong>und</strong> mehr in eine zentrale Rolle zu bringen. Aber auch in<br />
Deutschland gab es einige Ansätze, die das „Überspringen“ der Gleisanlagen <strong>und</strong> Bahnhöfe<br />
Anfang der 70er Jahre zu einem wichtigen städtebaulichen Thema machten. Beispiele hierfür<br />
wären die Hauptbahnhöfe in Hannover <strong>und</strong> Düsseldorf. 150<br />
Erst in den 80er Jahren des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts setzte nun die eigentliche Aufwertung,<br />
Umgestaltung <strong>und</strong> Kommerzialisierung der Bahnhöfe ein, die eine neue Dimension erreichte.<br />
Zwei bedeutende Gründe sind für diese Entwicklung zu nennen: Zum einen wäre hierzu das<br />
veränderte städtebauliche Leitbild des behutsamen <strong>Stadt</strong>um- <strong>und</strong> Neubaus sowie des<br />
städteverträglichen Verkehrs zu nennen. Dies führte nämlich dazu, dass zu dieser Zeit ein<br />
Umdenken stattfand, welches das Auto als alleiniges Hauptverkehrsmittel in Frage stellte.<br />
Der zweite <strong>und</strong> nicht unwesentliche Gr<strong>und</strong> war die sich immer mehr verschlechternde<br />
wirtschaftliche Lage der Bahn, die ein massives Umsteuern hin zu neuen Einnahmequellen,<br />
mehr K<strong>und</strong>enorientierung <strong>und</strong> Attraktivität erforderte. 151<br />
Mit der Ausstellung der Deutschen Bahn im Jahre 1996 unter dem Titel „Die Renaissance der<br />
Bahnhöfe als städtebaulicher Nukleus“ wurde das Thema der Aufwertung, Umgestaltung <strong>und</strong><br />
Kommerzialisierung der Bahnhöfe auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt.<br />
Insgesamt 25 Bahnhöfe im Zuge der „Projekte21“ sollen durch Umgestaltung oder Neubau<br />
gr<strong>und</strong>legende Maßstäbe setzen. Nach Zitaten der Deutschen Bahn AG sollen die Bahnhöfe<br />
wieder zu "Hallen voll sakraler Majestät werden", zu "Kathedralen der Mobilität <strong>und</strong> des<br />
Verkehrs". Die 25 neuen bzw. neu gestalteten Bahnhöfe sollen "Nukleus" oder "Kern<br />
städtebaulicher Entwicklung" sein. Der Ehemalige Bahnchef Dürr erklärte: "Es geht nicht nur<br />
um Bahnhöfe, mehr noch geht es um <strong>Stadt</strong>entwicklung" <strong>und</strong> "gerade in Deutschland bildet<br />
die Eisenbahn den Motor der <strong>Stadt</strong>entwicklung". 152<br />
Doch wie steht es nun im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert um das Image der Bahnhöfe? Sind sie zu<br />
Visitenkarten der <strong>Stadt</strong> avanciert? Eine Beantwortung dieser Fragen ist derzeit nur sehr<br />
subjektiv möglich, da noch keine empirisch unterstützen Aussagen möglich sind. Nicht alle<br />
der Projekte sind bis zum heutigen Jahr 2007 abgeschlossen <strong>und</strong> lassen damit noch keine<br />
Aussagen zu. Allerdings lassen sich aus den gewählten Beispielen Berlin <strong>und</strong> Leipzig einige<br />
Thesen bilden. Da das Augenmerk dieses Kapitels auf den Auswirkungen auf die <strong>Stadt</strong> liegt,<br />
lässt sich allerdings eines im Voraus sagen: Die Initiative der Deutschen Bahn AG mit der<br />
„Renaissance der Bahnhöfe“ ist vielmehr eine versuchte Aufpolierung des Images der<br />
Deutschen Bahn AG als eine Unterstützung der <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> des <strong>Stadt</strong>images. Doch<br />
stellt sich auch die Frage, ob ein „<strong>Bahnhof</strong>“ dies überhaupt leisten kann. Die einzelnen<br />
Projekte ziehen allerdings verschiedene Entwicklungen weit um den <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> auch<br />
150 ebenda 9-10<br />
151 Korn, Juliane (2006): Transiträume als Orte des Konsums – eine Analyse des Standorttyps unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Bahnhöfe. Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin, S. 61<br />
152 Dürr, Heinz. Die Projekte 21 - Eine Vision für Städte <strong>und</strong> Bahnhöfe. Vortragsmanuskript. [Aus einem Vortrag auf<br />
dem Symposium 'Fokus Stuttgart II' am 19. Juni 1996 in Stuttgart]. Stuttgart, 1996. S. 1.<br />
98
gesamtstädtisch nach sich, die den <strong>Bahnhof</strong> auch durchaus als „Visitenkarte“ für eine <strong>Stadt</strong><br />
fungieren lassen.<br />
Das Beispiel Leipzig zeigt dabei sehr deutlich, dass ein denkmalgeschützter <strong>Bahnhof</strong> nach<br />
einer umfangreichen Umgestaltung <strong>und</strong> einem Umbau zu einem Einzelhandels- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungszentrum eine Imageaufwertung für die gesamte Innenstadt mit sich bringen<br />
kann. Aber auch die enorme Identifikation der Leipziger mit „ihrem“ <strong>Bahnhof</strong> zeigt das<br />
positive Image. Wer heute nach seinen Erinnerungen <strong>und</strong> Eindrücken zu Leipzig gefragt<br />
wird, nennt mit Sicherheit auch den <strong>Bahnhof</strong>. Nicht nur aus verkehrlichen Gründen, sondern<br />
auch architektonisch ist der Leipziger <strong>Bahnhof</strong> ein Prachtstück <strong>und</strong> die Promenaden am<br />
Hauptbahnhof bieten ein Einkaufserlebnis.<br />
Doch wie verhält es sich bei einem kompletten Neubau eines <strong>Bahnhof</strong>es? Diese Frage soll<br />
am Beispiel des neuen Berliner Hauptbahnhofes kurz angerissen werden. Allein schon die<br />
Medienpräsenz dieses gigantischen, in der Zwischenzeit abgeschlossenen, Bauvorhabens hat<br />
gezeigt, dass der <strong>Bahnhof</strong> für Berlin eine Visitenkarte darstellt. Dann vermarktete auch die<br />
überdimensionale Einweihung des <strong>Bahnhof</strong>es mit Feuerwerk <strong>und</strong> Lasershow den <strong>Bahnhof</strong> als<br />
Eventstätte. Wer heute am Berliner Hauptbahnhof ankommt, sieht sofort die Merkmale der<br />
B<strong>und</strong>eshauptstadt: das Regierungsviertel, aus der Ferne den Fernsehturm am<br />
Alexanderplatz <strong>und</strong> teilweise den grünen Tiergarten. „Das Tor zur <strong>Stadt</strong>“ wird wohl noch<br />
einige Zeit brauchen, bis es sich ins Gesamtensemble eingliedert, aber schon heute ist ein<br />
Imagegewinn durch den Hauptbahnhof für Berlin zu spüren. Die Entwicklungen im Umfeld<br />
des neuen Hauptbahnhofes in Berlin sind derzeit noch sehr schleppend zu erkennen, aber<br />
werden dennoch folgen. Inwiefern diese Entwicklungen auch zum Imagegewinn beitragen<br />
werden, ist bis jetzt empirisch nicht auswertbar.<br />
Abschließend soll noch einmal angemerkt werden, dass das Image des <strong>Bahnhof</strong>es in einer<br />
<strong>Stadt</strong> auch von vielfältigen Faktoren abhängt. Die folgende Auflistung ist nur eine Sammlung<br />
<strong>und</strong> stellt bei weitem keinen Anspruch auf Vollständigkeit.<br />
- Lage des <strong>Bahnhof</strong>es innerhalb der <strong>Stadt</strong><br />
- Größe des <strong>Bahnhof</strong>es<br />
- Lobbyarbeit in Politik <strong>und</strong> Verwaltung für den <strong>Bahnhof</strong><br />
- Einbeziehung der Öffentlichkeit in Planungen für den <strong>Bahnhof</strong><br />
- geschichtliche Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>es<br />
- Umfeld des <strong>Bahnhof</strong>es<br />
- <strong>Bahnhof</strong> als Einzelhandels- <strong>und</strong> Dienstleistungsstandort<br />
- <strong>Bahnhof</strong> als Eventstätte<br />
99
3.2.2 Bahnhöfe als Einzelhandels- <strong>und</strong> Dienstleistungszentren<br />
Liest man Zeitungsartikel aus der Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts, so stößt man<br />
auf Überschriften wie: „Langfristig sollen aus den guten alten Bahnhöfen<br />
Dienstleistungszentren werden“ 153 oder „Kaufhäuser mit Gleisanschluss“ 154 , die oftmals auch<br />
mit kritischen Meinungen gespickt sind. Denn die neu entwickelten Einzelhandels- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungszentren in Transiträumen wie Bahnhöfen haben oftmals starke Auswirkungen<br />
auf die <strong>Stadt</strong> (vgl. Kapitel 1 Ökonomie der Immobilie <strong>Bahnhof</strong>).<br />
Ausgehend von den Entwicklungen im Einzelhandel zeigt sich Anfang der 90er Jahre des 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts eine starke Entwicklung hin zu großen Shopping-Centern auf der „grünen<br />
Wiese“. Mit dem Konzept der „Renaissance der Bahnhöfe“ der Deutschen Bahn AG soll nun<br />
aber seit Mitte/Ende der 1990er Jahre genau diesen Entwicklungen entgegen gewirkt<br />
werden, um das nähere Umfeld eines <strong>Bahnhof</strong>es, oder auch größeren Teilen der <strong>Stadt</strong>, zu<br />
revitalisieren. Der starke Wettbewerb des innerstädtischen Einzelhandels zu den Shopping-<br />
Centern auf der „grünen Wiese“ führte zunehmend zu enormen Verlusten von<br />
K<strong>und</strong>enströmen in den Innenstädten, besonders in den neuen B<strong>und</strong>esländern. Die<br />
Rückbesinnung auf die Bahnhöfe als „Tor zur <strong>Stadt</strong>“ <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Entwicklungen haben das Augenmerk als weitere Rahmenbedingungen wieder auf das<br />
<strong>Stadt</strong>innere gelenkt, denn die großen Bahnhöfe der Städte liegen fast ausnahmslos in<br />
unmittelbarer Innenstadtnähe.<br />
Am Beispiel Leipzig lässt sich sehr genau darstellen, welche Folgen die Eröffnung der<br />
Promenaden am Hauptbahnhof auf den Einzelhandel haben. Trotz anfänglicher Skepsis <strong>und</strong><br />
großen Protesten von Seiten der Händler in der Innenstadt, der IHK <strong>und</strong> Bewohnern der<br />
<strong>Stadt</strong> Leipzig, hat sich eine durchaus positive Entwicklung vollzogen. Die stark geschwächte<br />
Innenstadt Leipzigs entwickelte sich nach der Eröffnung der „Promenaden am Hauptbahnhof“<br />
im Bezug auf die Kaufkraft, K<strong>und</strong>enströme <strong>und</strong> Neueröffnungen von Geschäften durchaus<br />
positiv. Vor allem durch das teilweise abweichende Sortiment der „Promenaden am<br />
Hauptbahnhof“ vom innerstädtischen Einzelhandel konnten diese Erfolge verzeichnet<br />
werden. Auch ein verändertes Kaufverhalten der K<strong>und</strong>en als Gr<strong>und</strong> für die innerstädtischen<br />
Gewinne spielt hierbei eine Rolle, denn das Einkaufen auf der „grünen Wiese“ bietet im<br />
Vergleich zur Innenstadt nicht das urbane Flair <strong>und</strong> die abwechslungsreichen Möglichkeiten<br />
vor oder nach dem Shopping. 155 Gefahren von den Bahnhöfen für die Innenstädte als<br />
Einzelhandelsstandorte könnten allerdings dann ausgehen, wenn eine zu ähnliche<br />
Angebotsstruktur vorherrscht <strong>und</strong> damit innerstädtische Händler verdrängt werden. Aus den<br />
Erfahrungen in Leipzig hat sich gezeigt, dass die Promenaden am Hauptbahnhof …<br />
- … zu einer Erhöhung der Zentralität Leipzigs beigetragen haben.<br />
- … neue Innenstadtbesucher rekrutiert haben.<br />
153 Süddeutsche Zeitung (29.03.1997): Wir legen Wert auf einen Branchenmix. Der Immobilien-Markt<br />
154 Skyline (1995): Kaufhäuser mit Gleisanschluss. S. 11<br />
155 Interview bei der Exkursion in Leipzig mit Herrn Beck von ECE <strong>und</strong> Herrn Hahn von der IHK Leipzig<br />
100
- … die 1A-Lagen in Leipzig erweitert haben. 156<br />
Aus dem Beispiel Leipzig wurden anhand einer Untersuchung in der Diplomarbeit von Herrn<br />
Linke verschiedene Empfehlungen aufgeführt, um ein Einzelhandels- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungszentrum im <strong>Bahnhof</strong> nicht als Konkurrenz sondern als Ergänzung <strong>und</strong><br />
Revitalisierung der Innenstädte zu entwickeln. Diese sind vornehmlich auch für das zweite<br />
Projektsemester von hoher Bedeutung.<br />
Auflistung der Handlungsempfehlungen<br />
- Es sollte ein klares Konzept vorliegen, ob die Einzelhandelsflächen im <strong>Bahnhof</strong><br />
der Nahversorgung dienen oder die Zentralität der <strong>Stadt</strong> erhöhen sollen.<br />
- Wird eine Erhöhung der Zentralität angestrebt, sind Verkaufsflächen in der<br />
Größenordnung von 10,000 bis 20,000 m 2 zu empfehlen.<br />
- Eine Erhöhung der Zentralität sollte nicht durch Erweiterung des<br />
Einzugsgebietes, sondern durch Erhöhung der Kaufkraftbindung in den<br />
bestehenden Einzugsbereichen erfolgen.<br />
- <strong>Stadt</strong>verwaltungen sollten die Notwendigkeit von Flächenexpansion des<br />
Einzelhandels<br />
hinarbeiten.<br />
akzeptieren <strong>und</strong> auf die Bereitstellung geeigneter Flächen<br />
- Es ist von großer Wichtigkeit, den <strong>Bahnhof</strong> möglichst optimal an die<br />
bestehenden Einkaufsbereiche der Innenstadt anzubinden, besonders für den<br />
Fußgängerverkehr.<br />
- Die Nutzung bzw. der Branchenmix im <strong>Bahnhof</strong> sollte eine sinnvolle Ergänzung<br />
zum bestehenden Angebot der Innenstadt darstellen.<br />
- Eine Bewahrung des unverwechselbaren Charakters des <strong>Bahnhof</strong>es ist<br />
anzustreben.<br />
Werden diese Empfehlungen bei den weiteren Entwicklungen der Bahnhöfe berücksichtigt,<br />
könnte die „Renaissance der Bahnhöfe“ durchaus ein Auslöser für die „Renaissance der<br />
geschwächten Innenstädte“ darstellen. Genaue Auswirkungen der Einzelhandels- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungszentren im <strong>Bahnhof</strong> sind allerdings empirisch zurzeit wenig belegt.<br />
3.2.3 Bahnhöfe als Event- <strong>und</strong> Erlebnisstätten<br />
Bahnhöfe nehmen als Räume für Ausstellungen, Musikveranstaltungen, Sportevents,<br />
Filmdrehs, Wellness <strong>und</strong> Erlebnisgastronomie mehr <strong>und</strong> mehr an Bedeutung zu. Dies kann<br />
156 Linke, Hartmut (1999): Bahnhöfe als Einzelhandelsstandort – Entwicklungen, Potentiale <strong>und</strong> Empfehlungen für<br />
eine „Renaissance der Innenstädte“. Diplomarbeit Universität Trier, S. 135-144<br />
101
unter anderem auch als Ergänzung zu Angeboten aus der Umgebung oder bei größeren<br />
Aktionen in der ganzen <strong>Stadt</strong> dienen. Einige <strong>Bahnhof</strong>shallen in Deutschland stellen<br />
beispielsweise hervorragende Ausstellungsräume dar, die meist in der <strong>Stadt</strong> nirgends zu<br />
finden sind. Ferner bringen solche Publikumsmagnete auch durch den Fernverkehr neue<br />
Besucher mit in die <strong>Stadt</strong>, die dann anschließend das Angebot in der Innenstadt nutzen.<br />
Dabei ist es förderlich, wenn sich die Events am <strong>Bahnhof</strong> mit der <strong>Stadt</strong> verbinden lassen.<br />
Straßenfeste in Verbindung mit Bahnhöfen, oder auch Ausstellungsreihen in der ganzen<br />
<strong>Stadt</strong> einschließlich des <strong>Bahnhof</strong>es wären nur einige Beispiele. Aber auch die Bahnhöfe als<br />
Orte der Werbung könnten für die <strong>Stadt</strong> interessant sein. Informationen zur <strong>Stadt</strong>,<br />
<strong>Stadt</strong>pläne oder <strong>Stadt</strong>r<strong>und</strong>fahrten könnten direkt am <strong>Bahnhof</strong> angeboten werden, um den<br />
„Ankommenden“ die Entdeckung der <strong>Stadt</strong> zu erleichtern. Das Beispiel Berliner<br />
Hauptbahnhof zeigt auch, dass <strong>Bahnhof</strong>svorplätze optimal für Konzerte <strong>und</strong> Straßenfeste<br />
genutzt werden können, solange diese über eine gewisse Größe verfügen <strong>und</strong> möglichst fern<br />
ab von großen Verkehrsstraßen liegen, beispielsweise wenn <strong>Bahnhof</strong>svorplätze Teile von<br />
Fußgängerzonen sind.<br />
3.3 Fazit<br />
Was bringen die Bahnhöfe einer <strong>Stadt</strong> wirtschaftlich? Aus den Ergebnissen dieses Kapitels<br />
lassen sich einige Aussagen diesbezüglich treffen. Zum einen entwickeln sich die Bahnhöfe<br />
vor allen Dingen in den 17 Städten der Kategorie 1 Bahnhöfe der Deutschen Bahn AG zu<br />
größeren Arbeitgebern, da die Funktionsanreicherung der Bahnhöfe als Einzelhandels- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungsstandorte oder auch als Eventstätten eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten<br />
bietet. Aber auch die sich daraus ergebenden Beziehungen zwischen der <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> den<br />
Bahnhöfen ist von essenzieller Bedeutung. Kommunikation <strong>und</strong> Kooperation ist dabei der<br />
Schlüssel für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten zwischen den Bahnhöfen <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong>.<br />
Ein sich etabliertes Instrument ist dabei das <strong>Stadt</strong>marketing, was zum anderen auch die<br />
Kommunikation unten den Einzelhändlern einer <strong>Stadt</strong> unterstützt. Nur wenn ein <strong>Bahnhof</strong> mit<br />
einer verstärkten Einzelhandelsfunktion keine gefährliche Konkurrenz zur Innenstadt<br />
darstellt (beispielsweise durch ausgewählte Sortimentsabstimmung), ist ein wirtschaftlicher<br />
Nutzen der Bahnhöfe für die <strong>Stadt</strong> erreichbar.<br />
Doch wie verhält es sich, wenn mehrere Bahnhöfe in einer <strong>Stadt</strong> eine Umstrukturierung<br />
erfahren? Wie viel „<strong>Bahnhof</strong>“ verträgt dann eine <strong>Stadt</strong>? Diese Frage konnte in Folge ihrer<br />
enormen Komplexität nicht im ersten Projektsemester beantwortet werden. Allerdings<br />
wurden vertiefende Arbeitspunkte entwickelt, die eine Untersuchung im zweiten<br />
Projektsemester vereinfachen sollen. Besonders auf das Thema des zweiten<br />
Projektsemesters „Der Hauptbahnhof in Berlin <strong>und</strong> seine Auswirkungen auf den <strong>Bahnhof</strong><br />
Zoologischer Garten“ bezogen, sollen die Arbeitspunkte weitere Denkanstöße liefern.<br />
- Welche Einzugsgebiete (Einwohner in der Region, Größe der Region) haben die<br />
einzelnen Bahnhöfe, die <strong>Stadt</strong> oder auch die Region? Wie verteilen sich die<br />
Bahnhöfe innerhalb der <strong>Stadt</strong> in Bezug auf die Einzugsgebiete (Bsp.<br />
sternenförmig, kreisförmig usw.),<br />
102
- Entwicklung eines Benchmarkings zur Sammlung von Best Practise Beispielen<br />
für Bahnhöfe <strong>und</strong> Flughäfen,<br />
- Erarbeitung eines Modells, welches die Fahrgastzahlen, die <strong>Bahnhof</strong>sflächen, die<br />
Größen der Städte <strong>und</strong> der Regionen sowie die Einzugsbereiche der 17 Städte<br />
mit den 20 bedeutendsten Bahnhöfen in Deutschland (<strong>Bahnhof</strong>skategorisierung<br />
DB Station & Service AG, Stand 01.01.07.) zueinander in Beziehung setzt.<br />
103
4. <strong>Bahnhof</strong>sumfeld<br />
Die Hauptfunktion eines <strong>Bahnhof</strong>s ist aus traditioneller Sicht der Transport, er ist ein<br />
Knotenpunkt in einem Transportnetz, verb<strong>und</strong>en mit anderen Bahnhöfen <strong>und</strong> gewährleistet<br />
den Austausch zwischen den Städten <strong>und</strong> Orten in diesem Netz.<br />
Mit dem Ausbau des europäischen Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetzes <strong>und</strong> der damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Raumplanungspolitik gewinnen Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umfelder in den Städten<br />
dieses Verkehrsnetzes stetig neue Funktionen. Heutzutage ist ein <strong>Bahnhof</strong> nicht nur „a place<br />
where trains arrive and depart“, sondern vielmehr “an urban exchange complex”. 157<br />
Bisher ist es eine übliche Situation, dass der <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> viele separate Elemente in seinem<br />
Umfeld nebeneinander stehen: der <strong>Bahnhof</strong>, die U-Bahnstation, die Busstation, der<br />
Taxistand, die Parkplätze, die Informationseinrichtungen, aber auch Elemente wie<br />
Shoppingcenter <strong>und</strong> Büros oder Brachflächen, die nicht unbedingt zu der<br />
Verkehrsinfrastruktur gehören. Einerseits erschweren es die vielfältigen Funktionen <strong>und</strong> ihre<br />
separate räumliche Verteilung, diese Elemente als ein Ganzes zu definieren <strong>und</strong> als ein<br />
integriertes Organ in der <strong>Stadt</strong> zu betrachten. Andererseits wird der <strong>Bahnhof</strong> mit seinem<br />
Umfeld seit den 1980er Jahren neben seinen Transportfunktionen immer mehr als ein Teil<br />
der <strong>Stadt</strong> mit heterogenen Funktionen wahrgenommen 158 <strong>und</strong> ist ein zentraler<br />
Investitionspunkt geworden. Deshalb besteht Anlass, die Eigenschaften verschiedener<br />
Elemente im Umfeld des <strong>Bahnhof</strong>s zu begreifen <strong>und</strong> zu versuchen, diese als Einheit zu<br />
verstehen.<br />
Anschließend gilt es die Frage zu klären, wie „an urban exchange complex“ 159 funktioniert,<br />
also wie sich der <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> sein Umfeld mit den angrenzenden urbanen Funktionen<br />
gegenseitig austauschen können. Dabei sind die neuen Funktionsanreicherungen <strong>und</strong><br />
Entwicklungen im <strong>Bahnhof</strong> (vgl. Kapitel 1.4 <strong>und</strong> Kapitel 3.2) <strong>und</strong> seinem Umfeld besonders<br />
zu beobachten. Anhand verschiedener Aspekte werden die neusten Entwicklungen im<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld im Kapitel 4.3 analysiert, um die Fragen zu beantworten:<br />
- Was sind die Rahmenbedingungen für die Entwicklung im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld?<br />
- Welche Faktoren spielen bei einer <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung eine Rolle?<br />
Welche Faktoren veranlassen eine Entwicklung, welche Faktoren verhindern eine<br />
Entwicklung?<br />
157<br />
Amar, G. (1996): Complexes d´échanges urbains, du concept au project. Les Annales de la Recherche Urbaine,<br />
S. 71 ff. Zitiert aus Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station<br />
Areas. E & FN Spon, London. S. 12.<br />
158<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 36.<br />
159<br />
Amar, G. (1996): Complexes d´échanges urbains, du concept au project. Les Annales de la Recherche Urbaine,<br />
S. 71 ff. Zitiert aus Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station<br />
Areas. E & FN Spon, London. S. 12.<br />
104
- Welche Entwicklungen finden statt? Gibt es eine sektorale Bevorzugung bzw.<br />
eine Nutzungsverschiebung?<br />
- Welche Auswirkungen dieser Entwicklungen können in verschiedenen (sozialen,<br />
ökonomischen) Kontexten betrachtet werden? Gibt es damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Risiken?<br />
4.1 Eigenschaften <strong>und</strong> Definition des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds<br />
Es gibt verschiedene Typen von Bahnhöfen. Bahnhöfe eines gleichen Typs veranlassen<br />
jedoch nicht unbedingt die gleiche Entwicklung in ihren Umfeldern. Begriffe wie<br />
„<strong>Bahnhof</strong>sviertel“ oder „<strong>Bahnhof</strong>squartier“ mögen zwar immer wieder auftauchen, <strong>und</strong><br />
bezeichnen in verschiedenen Städten ähnliche Eigenschaften bzw. Milieus (z. B. das<br />
Zusammentreffen Fremder, der Rotlicht- <strong>und</strong> Drogenszene, die Anhäufung von Randgruppen<br />
etc.) in der Nähe von Bahnhöfen. Aber mit Hilfe dieses vorgeprägten Begriffes kann man auf<br />
keinen Fall das ganze <strong>Bahnhof</strong>sumfeld beschreiben.<br />
In diesem Kontext wird mit dem Begriff „<strong>Bahnhof</strong>sumfeld“ versucht, umfassend<br />
Eigenschaften zu erfassen <strong>und</strong> die heterogenen Funktionen, Probleme <strong>und</strong><br />
Entwicklungspotenziale um die Bahnhöfe zu thematisieren. Bürogebäudekomplexe, kleine<br />
Läden bis hin zu großen Kaufhäusern, Verkehrsflächen, aber auch Hotels, Sportanlagen,<br />
Museen <strong>und</strong> Theater oder brachliegende Flächen <strong>und</strong> ungenutze Immobilien: Die vielfältig<br />
vorhandenen Funktionen in verschiedenen <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern sind immer unterschiedlich.<br />
Wenn noch dazu die Fragen gestellt werden: Was gehört zum <strong>Bahnhof</strong>sumfeld oder wo hört<br />
das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld auf, gibt es meistens keine klare Antwort. Die folgende Diskussion über<br />
diese Fragen orientiert sich weniger auf die Suche nach einer klaren <strong>und</strong> allumfassenden<br />
Definition für den Begriff „<strong>Bahnhof</strong>sumfeld“, sondern intendiert viel mehr, die Komplexität<br />
der Fragestellung zu entziffern <strong>und</strong> ein klareres Bild des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds zu entwickeln.<br />
Zwei Eigenschaften sind bei der Betrachtung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes jedoch immer gegeben:<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> ist der Startpunkt des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes. Die Entstehung oder die<br />
Neuentwicklung eines <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes folgt dem Neubau bzw. der Erneuerung oder auch<br />
dem Verfall eines <strong>Bahnhof</strong>s, d. h. die Veränderung des <strong>Bahnhof</strong>s veranlasst eine<br />
Veränderung seines Umfeldes. Somit kann das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld unmittelbar als<br />
„Einflussbereich des <strong>Bahnhof</strong>s“ definiert werden, d. h. das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld hört dort auf, wo<br />
kein Einfluss von der <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung mehr wahrgenommen werden kann. Anders<br />
formuliert lautet die Definition: Das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld ist der Bereich, wo die<br />
Interaktion zwischen dem <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong> stattfindet.<br />
Mit Hilfe von Beispielen kann dieser erste Definitionsentwurf überprüft werden. Zum Beispiel<br />
wurden in Kassel-Wilhelmshöhe nach erfolgter Neuanbindung an das ICE-Netz durch den<br />
Neubau eines ICE-<strong>Bahnhof</strong>s anstelle eines früher unbedeutenden Vorstadtbahnhofs alle<br />
Bauvorhaben zwischen 1989-1995 in den angrenzenden <strong>Stadt</strong>teilen erhoben <strong>und</strong> evaluiert.<br />
Wenn man die Kenngrößen „Anzahl der Vorhaben“, „Investitionen“ <strong>und</strong> realisierte<br />
105
„Nutzflächen“ relativ zu der Flächengröße des jeweiligen Entfernungsrings darstellt, so ergibt<br />
sich eine eindeutige Stufung (vgl. Abb. 20): „großer Impuls bis 200 m Entfernung, noch<br />
deutlich spürbarer Impuls bis 400 m, nachweisbarer Impuls bis 600 m, danach fast keine<br />
besondere Wahrnehmung mehr.“ 160 Spontan kann nach unserer Definition die Aussage<br />
getroffen werden: Der fußläufig erreichbare 600 m-Radius ist das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld. Aber es<br />
kann noch ein weiteres Phänomen in Kassel beobachtet werden: „Einige wenige Standorte<br />
außerhalb der fußläufigen Erreichbarkeit stellen deutliche Investitionsschwerpunkte dar.<br />
Gemeinsames Merkmal dieser Standorte ist es, dass sie durch leistungsfähige <strong>und</strong> schnelle<br />
Komplementärverkehrsmittel gut an den ICE-<strong>Bahnhof</strong> angeschlossen sind <strong>und</strong> sich die<br />
komplementäre Reisezeit im Vergleich zum vorher beschriebenen Fußweg nur unwesentlich<br />
verlängert.“ 161<br />
Abb. 20: Impuls des Hochgeschwindigkeitsverkehrs (HGV) in Kassel-Wilhelmshöhe<br />
in Abhängigkeit von der Entfernung zum <strong>Bahnhof</strong><br />
Quelle: <strong>Stadt</strong> Kassel, 1995 in: Bartkowiak, 2004<br />
160 Bartkowiak, Jost: <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung für<br />
<strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Frankfurt am<br />
Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlagsgesellschaft. 2004, S. 241.<br />
161 Ebenda, S. 243.<br />
106
Nach der obigen Definition sollten diese entwicklungsbezogenen Standorte außerhalb des<br />
Radius auch zum <strong>Bahnhof</strong>sumfeld gehören, weil ihre Entwicklungen eindeutig von dem<br />
Neubau des ICE-<strong>Bahnhof</strong>s beeinflusst sind. Ähnliche Entwicklungen können auch in Leipzig<br />
beobachtet werden, wo die Einzelhandelsentwicklung der ganzen Innenstadt als Synergie<br />
der Erneuerung des Hauptbahnhofs angesehen werden kann. 162 (Siehe dazu Kapitel 1.4.2 /<br />
Beispiel Leipzig) Jedoch gibt es häufig, bspw. in Leipzig, einige sog. Grauzonen innerhalb des<br />
fußläufigen Radius, die trotz der Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>s entweder weiterhin brachliegen<br />
oder untergenutzt sind. Hier stellt sich die Frage, ob diese auch zum <strong>Bahnhof</strong>sumfeld gezählt<br />
werden können.<br />
An dieser Stelle hat diese Definition schon ihre Grenze erreicht. Einerseits kann begründet<br />
werden, dass diese Grauzonen nicht mehr zum <strong>Bahnhof</strong>sumfeld gehören, weil sie nach der<br />
Erneuerung <strong>und</strong> Funktionsanreicherung des <strong>Bahnhof</strong>s nicht direkt darauf reagiert haben.<br />
Anderseits benötigt es für die Entwicklung solcher Gebiete enorme Investitionsvolumina <strong>und</strong><br />
innovative Entwicklungsideen, weil diese häufig viele Entwicklungsnachteile mit sich tragen,<br />
zum Beispiel:<br />
- Durch die Dichte der Verkehrsanlagen sind sie unsichtbar oder schlecht<br />
begehbar<br />
- komplizierte Eigentumsverhältnisse <strong>und</strong> Interessenskonflikte<br />
- Schlechte Verkehrsanbindung zur Innenstadt etc.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der begrenzten Subventionsmittel bezeichnet die <strong>Stadt</strong> solche Gebiete als<br />
„Geduldsflächen“ 163 , es wird auf neue Entwicklungen aus privater Hand gehofft. Häufig<br />
versucht die <strong>Stadt</strong>, durch z.B. städtebauliche Ideenwettbewerbe das neue Entwicklungsbild<br />
für die privaten Investoren zu schaffen, indem brachliegende Bahnflächen um den <strong>Bahnhof</strong><br />
als Potenziale der <strong>Stadt</strong>entwicklung festgestellt werden. 164 Ferner leistet die <strong>Stadt</strong> die<br />
Bereitstellung von Informationen <strong>und</strong> bietet auch kostenfreie beratende Dienstleistung an.<br />
Nach der neuen Entwicklung des Leipziger <strong>Bahnhof</strong>s finden in den Grauzonen zwar keine<br />
physischen Entwicklungen statt, der Druck <strong>und</strong> die Wünsche einer neuen Entwicklung sind<br />
jedoch verstärkt. Deshalb bleibt die Möglichkeit des Einflusses in einer<br />
Projektvorbereitungsphase nicht völlig aus, <strong>und</strong> die Flächen dürften dann auch als<br />
entwicklungsbezogene Flächen im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld betrachtet werden.<br />
Mit der vorherigen Betrachtung eines Definitionsentwurfs können drei Methoden für die<br />
Identifizierung eines <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes bestimmt werden: 165<br />
162<br />
Expertengespräch mit Herrn Wolff, <strong>Stadt</strong>planungsamt Leipzig am 31.05.2007<br />
163<br />
Expertengespräch mit Herrn Wolff, <strong>Stadt</strong>planungsamt Leipzig am 31.05.2007<br />
164<br />
Vgl. <strong>Stadt</strong> Leipzig, Dezernat <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> Bau (2003): Bahnflächen als Potenziale der <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
(= Beiträge zur <strong>Stadt</strong>entwicklung 39).<br />
165<br />
Vgl. auch Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E &<br />
FN Spon, London. S. 12.<br />
107
1. Der fußläufig erreichbare Radius (vgl. Abbildung 21)<br />
Abb. 21: Identifizierung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes durch einen fußläufig erreichbaren<br />
Radius<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Nach dieser Möglichkeit wird das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld durch einen fußläufig erreichbaren Radius<br />
mit dem <strong>Bahnhof</strong>sgebäude in der Mitte identifiziert. Diese Lösung wird auch von Munck<br />
Mortier bevorzugt, er nimmt dabei einen Radius von 500 m an. 166 Es wird häufig auch eine<br />
Fußlaufzeit von bspw. 10 Minuten angenommen. Diese ideale Abgrenzung könnte zwar die<br />
meisten mit der <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung zusammenhängenden neuen Vorhaben ergreifen,<br />
schließt aber alle Entwicklungen außerhalb des Radius aus. Außerdem ist die räumliche<br />
Verteilung neuer Entwicklungen um den <strong>Bahnhof</strong> eher asymmetrisch, wie z. B in Leipzig: Sie<br />
hängt von der gegebenen <strong>Stadt</strong>struktur (Innenstadt südlich vor dem Kopfbahnhof, <strong>und</strong> von<br />
Gleisen zersplitterte Fläche nördlich hinter dem <strong>Bahnhof</strong>) <strong>und</strong> dem Typ des <strong>Bahnhof</strong>s ab.<br />
166<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 12.<br />
108
2. Die zusammenhängend entwickelten Funktionen (vgl. Abbildung 22)<br />
Abb. 22: Identifizierung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes nach den entwickelten Funktionen<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Hier wird das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld als eine Anhäufung von Funktionselementen verstanden, bei<br />
denen die Anwesenheit des <strong>Bahnhof</strong>s einen wichtigen Standortfaktor darstellt. 167 Im<br />
Vergleich zur vorherigen rein räumlichen Begrenzung wird hier eine sehr sinnvolle<br />
Betrachtungsweise versucht. Das Identifizierungskriterium ermöglicht die Erfassung aller<br />
entwickelten Vorhaben, die mit der <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung zusammenhängen. Die Schwäche<br />
dieser Methode liegt bei der Erkennung potenzieller, noch nicht vorhandener Entwicklungen<br />
<strong>und</strong> Synergieeffekte. Ein absoluter Problempunkt ist, dass in der Realität der<br />
Zusammenhang zwischen der Umfeldentwicklung <strong>und</strong> der <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung häufig nicht<br />
eindeutig zu erklären ist, weil die Bedingungen <strong>und</strong> Motoren für die Entwicklung im<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld in großer Komplexität zusammengeballt sind <strong>und</strong> der <strong>Bahnhof</strong> nur ein<br />
Faktor unter vielen ist. Dies wird im Kapitel 4.3 noch näher betrachtet.<br />
167<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 12.<br />
109
3. Die Fläche mit Entwicklungspotenzial (vgl. Abbildung 23)<br />
Abb. 23: Identifizierung durch Erkennung des Entwicklungspotenzials<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Hier geht es um die Verbesserung der zweiten Methode. Mit dieser Ergänzung werden<br />
insbesondere Brachflächen bzw. ungenutzte Immobilien sowohl mit ihren möglichen neuen<br />
Vorhaben als auch mit ihrer konkreten Größe erfasst, so dass konkrete Entwicklungsgebiete<br />
entstehen. Allerdings besteht hier die große Gefahr, dass die Entwicklungsgebiete nicht in<br />
einem umfassenden Plan organisiert sind. Demzufolge werden die Entwicklungsgebiete nur<br />
getrennt mit der Blickperspektive des jeweiligen Entwicklers behandelt. Ihre möglichen<br />
Konflikte <strong>und</strong> städtebaulichen Missstände könnten nicht ausreichend kontrolliert werden.<br />
Hinzu kommt, dass unter einer wachstumsorientierten <strong>Stadt</strong>entwicklungspolitik sich die<br />
<strong>Stadt</strong> häufig zu Gunsten des Investors entscheidet. Deshalb ist ein umfassender Plan<br />
notwendig.<br />
Nach der Auflistung dieser drei verschiedenen Identifizierungsmethoden, die jeweils mit<br />
offensichtlichen Nachteilen verb<strong>und</strong>en sind, weist die getestete Definition noch zwei<br />
gravierende Lücken auf, die eigentlich zwei rahmensetzende Fragen sind, die bei einer<br />
Definition gestellt werden müssen:<br />
- Was verursacht bzw. beeinflusst die neue Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>s? Und wie<br />
steuert dann die Ursache die Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes? (Kontext in<br />
einem Netzwerk)<br />
- Wohin geht die Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes im Bezug auf die<br />
Entwicklung im gesamtstädtischen Kontext? (Prozess <strong>und</strong> Kontext der<br />
Entwicklung in der <strong>Stadt</strong>)<br />
110
Diese Fragestellungen werden im Kapitel 4.3 näher untersucht. Um aber die Relevanz dieser<br />
Fragestellungen für das Verständnis der <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung zu verdeutlichen,<br />
werden hier zunächst ihre beinhalteten Themenkomplexe illustriert.<br />
Wie in der Einleitung schon erwähnt wird, sind Bahnhöfe keine einzelnen Objekte, sondern<br />
Knotenpunkte in einem Verkehrsnetz. Gleichzeitig steht der <strong>Bahnhof</strong> mit seinem Umfeld<br />
meistens in enger Verbindung zu seinen Nachbargebieten in einer <strong>Stadt</strong>. Sowohl die<br />
Knotenfunktion des <strong>Bahnhof</strong>s im Verkehrsnetz als auch die Interaktion des <strong>Bahnhof</strong>umfeldes<br />
mit der <strong>Stadt</strong> muss deshalb bei der Untersuchung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes beachtet werden.<br />
Mit dem Ausbau des europäischen Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetzes versuchen sich alle<br />
Städte an dieses Netz anzuschließen, um ihre lokalen Ressourcen aufzuwerten <strong>und</strong> zu<br />
vermarkten. Hier ist das Ziel innerhalb der Globalisierungsprozesse ökonomisch<br />
konkurrenzfähig zu bleiben. In Europa führt diese Entwicklung anscheinend zu mehr<br />
sektoraler Spezialisierung der Städte. 168 „Within macro-regions (of which Europe is one),<br />
cities tend to be either nodes of specialized technological and/or financial networks, or<br />
bridgeheads for international capital in a specific regional/world market...For instance, it has<br />
led to the concentration of financial services in Frankfurt, of international insurance<br />
companies in Amsterdam, of modern industry in Stuttgart, of retail and distribution in Lyon,<br />
and of research and development in Grenoble. “ 169 Diese Spezialisierungen werden in der<br />
Großregion Europa kombiniert, diese Kombination führt wiederum zur Entstehung neuer<br />
„urban types“ 170 . „Not all of these urban types are equally relevant to station area<br />
development, but each type has specific implications for the station area(s) it contains, and<br />
this is the point. For instance, most demand-driven station area projects in Europe are<br />
currently to be fo<strong>und</strong> in the category of international finance and service centres. By<br />
contrast, supply-driven projects are often promoted in evolving traditional industrial<br />
complexes, while railway stations may have an important complementary function in both<br />
aerovilles and leisure worlds.” 171 Der Kontext in einem übergeordneten Netzwerk spielt somit<br />
eine große Rolle in der Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes.<br />
Die zweite Fragestellung weist auf, dass die Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes dem<br />
Entwicklungsprozess <strong>und</strong> Entwicklungskontext der <strong>Stadt</strong> unterworfen ist:<br />
- Akteure, also Koalitionen mit unterschiedlichen Interessen <strong>und</strong> Belangen, die in<br />
einem Entwicklungsprozess involviert sind, gestalten gemeinsam den Prozess.<br />
Ihre Belange, Aktivitäten <strong>und</strong> Handlungsinstrumente müssen erklärt werden, um<br />
die Entwicklungsprozesse im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld zu verstehen.<br />
168<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 37.<br />
169<br />
Eigene Übersetzung aus Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway<br />
Station Areas. E & FN Spon, London. S. 37.<br />
170<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 37.<br />
171<br />
Ebenda, S. 38.<br />
111
- Verschiedene Bahnhöfe sind in verschiedenen Lagen in verschiedenen Städten<br />
untergebracht. „Wo in der <strong>Stadt</strong>“ <strong>und</strong> „in welcher <strong>Stadt</strong>“, diese beiden Faktoren<br />
beeinflussen die Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes.<br />
- Die Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes <strong>und</strong> der benachbarten <strong>Stadt</strong>teile<br />
beeinflussen sich gegenseitig. Nur mit einem umfassenden Blick in den<br />
ökonomischen, sozialen <strong>und</strong> nutzungsstrukturellen Kontext können die<br />
wesentlichen Kenntnisse der Interaktion mit der <strong>Stadt</strong> bzw. des „urban<br />
exchange complex“ 172 ausgewertet werden.<br />
Mit den oben aufgeführten Kontexten <strong>und</strong> Prozessen beschäftigt sich das Kapitel 4.3.2 <strong>und</strong><br />
4.3.3, welches einen umfassenden Einblick in aktuelle Entwicklungen im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld<br />
bieten dürfte.<br />
Mit Hilfe dieses Abschnittes wurde die Thematik der Komplexität des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes<br />
eröffnet. Zusammenfassend kann angemerkt werden: Das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld ist ein<br />
unverschlossener <strong>und</strong> asymmetrischer Radius um den <strong>Bahnhof</strong>, der aber durch Einbeziehung<br />
der funktionalen Entwicklung <strong>und</strong> Entwicklungspotenziale durch die <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung<br />
variieren kann. Gleichzeitig wandelt sich die Form <strong>und</strong> Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes<br />
durch Veränderung der Kontextvariablen <strong>und</strong> Prozessvariablen ständig.<br />
Bevor wir uns mit der Analyse der aktuellen <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung beschäftigen, bietet<br />
das nächste Kapitel einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldes.<br />
4.2 Historische Entwicklung<br />
Die Entwicklung von <strong>Bahnhof</strong>, Bahnflächen <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> bzw. <strong>Bahnhof</strong>sumfeld sind ab den<br />
Anfängen um die Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts eng miteinander verknüpft: Die Entwicklung der<br />
Bahnhöfe <strong>und</strong> ihrer Bedeutung spiegelt sich gewissermaßen in der Entwicklung ihrer<br />
Umfelder wieder <strong>und</strong> umgekehrt. Dementsprechend werden <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>sumfeld im<br />
Folgenden in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten betrachtet.<br />
Die geschichtliche Betrachtung beschränkt sich auf die kontinentaleuropäische Entwicklung,<br />
mit Fokus auf größere Städte in Deutschland. Dabei werden im Sinne eines Überblicks nur<br />
die „groben Linien“ nachgezogen, wohl wissend, dass die lokalen Bedingungen in jeder <strong>Stadt</strong><br />
unterschiedlich waren <strong>und</strong> sind. Ein gewisser Grad der Verallgemeinerung kann aber<br />
vorgenommen werden, weil die Entwicklung der großen Bahnhöfe <strong>und</strong> ihrer Umfelder auch<br />
wesentlich von weiteren Rahmenbedingungen <strong>und</strong> Entwicklungen auf nationaler sowie<br />
internationaler Ebene geprägt war <strong>und</strong> ist.<br />
172 Amar, G. (1996): Complexes d´échanges urbains, du concept au project. Les Annales de la Recherche Urbaine,<br />
S. 71 ff. Zitiert aus Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station<br />
Areas. E & FN Spon, London.<br />
112
4.2.1 Die Anfänge: Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Die großen Bahnhöfe wurden in der Regel außerhalb der Städte, in zu dieser Zeit eher<br />
peripheren Lagen errichtet. Die Standortwahl wurde dabei im Wesentlichen durch zwei<br />
Faktoren determiniert: ökonomische <strong>und</strong> verkehrliche. Entscheidend auf der ökonomischen<br />
Seite waren die damaligen Gr<strong>und</strong>stückspreise. In den dicht bebauten, größtenteils noch klar<br />
begrenzten Städten war wenig Freiraum vorhanden <strong>und</strong> die Bodenpreise waren hoch,<br />
während draußen, „vor den Toren der <strong>Stadt</strong>“, große Flächen günstig zu haben waren. Auf<br />
der verkehrlichen Betrachtungsseite waren hingegen die Ziele der optimalen Verkehrslage<br />
sowie der besten Anbindungsmöglichkeiten ausschlaggebend. 173 Die Lage eines <strong>Bahnhof</strong>s zur<br />
<strong>Stadt</strong> wurde also geprägt durch die Überlegungen „je weiter weg, desto günstiger“ <strong>und</strong> „je<br />
näher dran, desto besser angeb<strong>und</strong>en“, sowie durch die Lage der jeweiligen <strong>Stadt</strong> im<br />
Verhältnis zu anderen angeb<strong>und</strong>enen Städten. Somit resultierte aus den Kriterien<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreis <strong>und</strong> Anbindungs- sowie Lagevorteile je nach <strong>Stadt</strong> eine bestimmte Lage<br />
des <strong>Bahnhof</strong>s. Dort, wo sich heute Bahnhöfe samt ihres Umfelds befinden, befanden sich<br />
also vor gut 150 Jahren in der Regel noch dünn besiedelte, oft landwirtschaftlich genutzte<br />
Gebiete im näheren Umfeld der Städte.<br />
Abb. 24: Frankfurt am Main 1873 <strong>und</strong> 1887<br />
Frankfurt/M 1873: Mehrere Bahnhöfe<br />
westlich der noch intakten<br />
Wallanlagen<br />
Quelle: von Gerkan (1996), S. 33<br />
Ab ihrer Errichtung prägten die neuen Bahnhöfe die <strong>Stadt</strong>entwicklung in starkem Ausmaß.<br />
Dies zeigt sich besonders in ihrem Einfluss auf die Ausrichtung des städtischen Wachstums<br />
zum <strong>Bahnhof</strong> hin, was wiederum „oft eine radikale Umgestaltung der <strong>Stadt</strong>struktur“ zur<br />
173 Schivelbusch, Wolfgang (1984): Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum <strong>und</strong> Zeit im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Ullstein Verlag, Frankfurt/M, Berlin, Wien. S. 185f.<br />
113<br />
Frankfurt/M 1887: Neubau des<br />
Hauptbahnhofs, Neuordnung der<br />
ehem. <strong>Bahnhof</strong>sflächen<br />
Quelle: von Gerkan (1996), S. 33
Folge hatte. 174 Der Bau der ersten großen Bahnhöfe <strong>und</strong> deren Einfluss auf die<br />
stadtstrukturelle Entwicklung ist auch mit der Tatsache im Zusammenhang zu sehen, dass in<br />
vielen Städten erst wenig früher die <strong>Stadt</strong>mauern geschliffen worden waren bzw. um diese<br />
Zeit geschliffen wurden (siehe dazu auch Abb. 24 <strong>und</strong> Abb. 25). 175 Bartkowiak schreibt<br />
diesbezüglich gar von einer, durch die Lage des <strong>Bahnhof</strong>s außerhalb des Altstadtkerns,<br />
176<br />
vorprogrammierten „Verdoppelung des Zentrums“.<br />
Als „Brückenköpfe des neuen Verkehrs“ bewirkten sie ebenfalls eine deutliche<br />
Verkehrssteigerung in der gesamten <strong>Stadt</strong> sowie in ihrer Umgebung. Dies veränderte<br />
wiederum den Charakter dieser ehemals eher peripheren Gebiete: Anstelle einer bis dahin<br />
ruhigen <strong>und</strong> grünen Lage finden sich die bisherigen Bewohner des neuen <strong>Bahnhof</strong>sumfelds<br />
innerhalb kurzer Zeit in einer völlig veränderten, stark von Lärm <strong>und</strong> Verkehr<br />
verschiedenster Art geprägten, Situation wieder. 177<br />
4.2.2 Konsolidierung: Ab Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Durch das starke <strong>Stadt</strong>wachstum waren die Bahnhöfe bereits nach wenigen Jahrzehnten im<br />
Zuge der gründerzeitlichen <strong>Stadt</strong>erweiterungen von dicht bebauter <strong>Stadt</strong> umgeben (siehe<br />
dazu auch Abb. 26 <strong>und</strong> Abb. 27). Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Bahnhöfe <strong>und</strong> ihr<br />
Umfeld mehr <strong>und</strong> mehr zu sozialen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Zentren der Städte des<br />
ausgehenden 19. Jahrh<strong>und</strong>erts. 178 Somit kam auch dem <strong>Bahnhof</strong>svorplatz eine große<br />
Bedeutung zu: Er galt als „Visitenkarte eines Ortes“, <strong>und</strong> an der Verbindungsstrasse<br />
zwischen Altstadt <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong> entstanden entsprechende Hotels sowie Wohn- <strong>und</strong><br />
Geschäftshäuser. 179<br />
Die <strong>Bahnhof</strong>sgegenden waren gekennzeichnet durch ein buntes <strong>und</strong> urbanes Milieu, welches<br />
auch Amüsierbetriebe <strong>und</strong> Kabaretts verschiedener Art mit einschloss. Allerdings waren dies<br />
damals noch eher einzelne Elemente eines gemischten <strong>und</strong> durch ein vielseitiges<br />
Geschäftsleben geprägten Ganzen. 180<br />
174<br />
Bärtschi, H.-P. (2005): Bahnhöfe. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter www.dhs.ch/externe/<br />
protect/textes/d/D41756.html<br />
175<br />
Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 13.<br />
176<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 219.<br />
177<br />
Schivelbusch, Wolfgang (1984): Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum <strong>und</strong> Zeit im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Ullstein Verlag, Frankfurt/M, Berlin, Wien. S. 160.<br />
178<br />
Bärtschi, H.-P. (2005): Bahnhöfe. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter www.dhs.ch/externe/<br />
protect/textes/d/D41756.html<br />
179<br />
Bärtschi, H.-P. (2005): Bahnhöfe. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter www.dhs.ch/externe/<br />
protect/textes/d/D41756.html<br />
180<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 223.<br />
114
Abb. 25: Frankfurt am Main 1903 <strong>und</strong> 1936<br />
Frankfurt/M 1903: Geschlossene<br />
<strong>Stadt</strong>struktur um den Hauptbahnhof<br />
Quelle: von Gerkan (1996), S. 33<br />
Es knüpften sich viele Hoffnungen an den neuen <strong>Stadt</strong>teil, die tatsächliche Entwicklung des<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfelds verlief allerdings nicht unbedingt so glänzend wie erwartet: Bald schon<br />
erhielten die direkt an den <strong>Bahnhof</strong> grenzenden Viertel „das Stigma des Industriellen <strong>und</strong><br />
Proletarischen“ <strong>und</strong> gerieten als „<strong>Bahnhof</strong>sgegend“ in Verruf. 181 Dass diese Entwicklung<br />
durchaus nicht erwartet war, zeigt eine Passage in der 1865 erschienenen dritten Auflage<br />
des Eisenbahnhandbuches von Auguste Perdonnet, welche in der ersten Auflage von 1855<br />
noch fehlte: „Man hat lange Zeit fälschlicherweise angenommen, die Bahnhöfe würden für<br />
die Bewohner der Städte zu Anziehungspunkten werden. Ganz im Gegenteil jedoch steht<br />
heute fest, dass man sich eher von diesen lärmenden Zentren fernhält. Die Hotels, die den<br />
Bahnhöfen am benachbartesten sind, gehen in der Regel schlecht.“ 182 Diese zeitgenössische<br />
Beschreibung der Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds steht in deutlichem Kontrast zu<br />
zahlreichen heutigen Darstellungen, wie etwa der Folgenden von Dürr, welche die damalige<br />
Situation weit positiver wiedergibt: „Noch bis weit in dieses Jahrh<strong>und</strong>ert hinein waren die<br />
<strong>Bahnhof</strong>sgebiete die Empfangssalons der Städte <strong>und</strong> begehrte Wohn- <strong>und</strong> Geschäftslagen,<br />
Handels- <strong>und</strong> Kulturzentren.“ 183<br />
Bereits zu dieser Zeit handelte es sich in vielen <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern insgesamt um eine<br />
kontrastreiche Angelegenheit, in der auch deutlich ein „Vorne“ <strong>und</strong> „Hinten“ zu erkennen<br />
181 Schivelbusch, Wolfgang (1984): Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum <strong>und</strong> Zeit im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Ullstein Verlag, Frankfurt/M, Berlin, Wien. S. 152f.<br />
182 Perdonnet, Auguste 1865: Traité élémentaire des chemins de fer. 3. Auflage, Bd. 4, S. 401f. Paris. Zitiert aus<br />
Schivelbusch, Wolfgang (1984): Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum <strong>und</strong> Zeit im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Ullstein Verlag, Frankfurt/M, Berlin, Wien. S. 152f.<br />
183 Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 14.<br />
115<br />
Frankfurt/M 1936: Blick von der<br />
Altstadt in Richtung Hauptbahnhof<br />
Quelle: von Gerkan (1996), S. 34
war: Auf den inzwischen teuren Gr<strong>und</strong>stücken vor dem <strong>Bahnhof</strong> fanden sich vermehrt noble<br />
Geschäftsgebäude <strong>und</strong> Hotels, während sich hinter dem <strong>Bahnhof</strong> Lager-, Gewerbe- <strong>und</strong><br />
Industriebetriebe, vermischt mit hoch verdichteten Arbeiterwohnungen, konzentrierten. 184<br />
Vor allem dort, wo es zu einer Kombination von billigen Gr<strong>und</strong>stückspreisen <strong>und</strong> räumlicher<br />
Nähe zu Bahnanlagen kam – also insbesondere an der <strong>Bahnhof</strong>srückseite bzw. dem Vorplatz<br />
abgewandten Bereiche – hatte das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld ein negatives Image. 185<br />
Der Einfluss der Eisenbahn auf die städtische Entwicklung war also keineswegs ein<br />
uneingeschränkter Segen, sondern hatte durchaus seine Schattenseiten, welche sich vor<br />
allem in weniger repräsentativen <strong>und</strong> durch starke Immissionen beeinträchtigten Lagen<br />
manifestierten. Zu der Situation in England (wo Bahnhöfe allerdings in vielen Fällen in die<br />
bestehende <strong>Stadt</strong> hineingebaut wurden) schrieb Lewis Mumford: „Thus the railroad carried<br />
into the heart of the city not merely noise and soot but the industrial plants and the debased<br />
housing that alone could thrive in the environment it produced.“ 186<br />
In der Zwischenzeit von <strong>Stadt</strong> umbaut hatten die Bahnhöfe <strong>und</strong> Bahntrassen nach wie vor<br />
einen starken Einfluss auf deren Entwicklung – einerseits förderten sie das städtische<br />
Wachstum in bestimmte Richtungen, andererseits wirkten vor allem Bahntrassen stark<br />
trennend. 187 <strong>Stadt</strong>teile dies- <strong>und</strong> jenseits der Gleise entwickelten sich, trotz relativer Nähe<br />
zueinander, häufig sehr unterschiedlich, was sich z.B. in entsprechend anderen<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreisniveaus widerspiegelte.<br />
Mit dem steigenden Verkehrsaufkommen <strong>und</strong> dem Ausbau der Nahverkehrsmittel änderte<br />
sich auch die Qualität des <strong>Bahnhof</strong>svorplatzes: „Seine repräsentative Gestaltung musste<br />
nach <strong>und</strong> nach den Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr weichen, der Platz wurde<br />
daher vielfach zu klein für seine vielfältigen Aufgaben.“ 188<br />
4.2.3 Wandel: Um den Zweiten Weltkrieg<br />
Das Ansehen der Bahnhöfe sank vom Zweiten Weltkrieg an immer mehr. Während des<br />
Krieges galten Bahnhöfe <strong>und</strong> damit auch ihr Umfeld als besonders gefährliche Orte, da sie<br />
als wichtige Transportinfrastruktur oft Ziele von Bombenangriffen waren. Gleichzeitig waren<br />
184<br />
Bärtschi, H.-P. (2005): Bahnhöfe. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter www.dhs.ch/externe/<br />
protect/textes/d/D41756.html<br />
185<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 222.<br />
186<br />
Mumford, Lewis (1961): The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. Harcourt, Brace<br />
& World, Inc., New York. S. 461.<br />
187<br />
Bärtschi, H.-P. (2005): Bahnhöfe. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter www.dhs.ch/externe/<br />
protect/textes/d/D41756.html<br />
188<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 223.<br />
116
die oft stark zerstörten Bahnhöfe „die einzigen Orte, an denen wenigstens der Versuch zur<br />
Versorgung der in Bewegung geratenen Menschenmassen unternommen wurde.“ 189<br />
Nach Ende des Krieges entwickelten sich die Bahnhöfe „zur Anlaufstelle von<br />
Kriegsheimkehrern, Obdachlosen <strong>und</strong> zu Zentren des städtischen Schwarzmarktes.“ 190 Dies<br />
blieb nicht ohne Effekt auf das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld: „Ein wesentlicher Teil des rudimentären<br />
„Wirtschaftslebens“ spielte sich r<strong>und</strong> um die Bahnhöfe ab. In den Jahren nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg waren die Bahnhöfe trotz des meist zerstörten Zustandes auch die wichtigsten<br />
Orte der Ver- <strong>und</strong> Besorgung. Da blühte der Schwarzhandel, der Naturaltausch von<br />
Zigaretten, Kaffee <strong>und</strong> Alkohol gegen Familiensilber <strong>und</strong> über die Flucht gerettete<br />
Erbstücke.“ 191<br />
4.2.4 Bedeutungsverlust: Die 1950er bis 70er Jahre<br />
Ein zentraler Gr<strong>und</strong> für den Bedeutungsverlust der Bahnhöfe, der auch deutlich auf die<br />
<strong>Bahnhof</strong>sviertel ausstrahlte, war die automobilzentrierte Verkehrspolitik der<br />
Wirtschaftsw<strong>und</strong>erjahre: „Der Siegeszug des Autos hat der Bahn aber nicht nur eine<br />
quantitative Niederlage bereitet, sondern vor allem eine gravierende Abwertung im<br />
gesellschaftlichen Status.“ 192 Die Bahn wurde immer mehr zum Transportmittel für<br />
diejenigen, die sich kein eigenes Fahrzeug leisten konnten, <strong>und</strong> somit keine Wahl hatten; für<br />
den motorisierten Teil der Gesellschaft wurden Bahnhöfe zunehmend zu „Un-Orten“.<br />
Entsprechend wurden während den 1950er <strong>und</strong> 60er Jahren zahlreiche Bahnhöfe abgerissen<br />
oder zu reinen Zweckbauten umgestaltet (siehe dazu auch Abb. 28). 193<br />
Während dieser Zeit etablierte sich in vielen <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern Rotlicht <strong>und</strong> Drogenhandel<br />
in hoher Dichte, was wiederum zu weiterem Ansehensverlust führte bzw. dazu, dass immer<br />
mehr Personen sie zu meiden versuchten. 194 Diese Entwicklung war nicht zuletzt auch ein<br />
Ergebnis der damaligen <strong>Stadt</strong>planung, die das ganze Thema <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> Eisenbahn für<br />
überkommen hielt: „Mit der selben Geringschätzigkeit, mit der man der Bahn als<br />
189 Ebenda, S. 223<br />
190 Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 14.<br />
191 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 231.<br />
192 Ebenda, S. 231.<br />
193 Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 14. Und Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im<br />
Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong><br />
<strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang Verlagsgesellschaft, Frankfurt am<br />
Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 231.<br />
194 Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 14.<br />
117
Verkehrsmittel begegnete, behandelte man auch die <strong>Stadt</strong>quartiere r<strong>und</strong> um den<br />
<strong>Bahnhof</strong>.“ 195<br />
Auch am <strong>Bahnhof</strong>svorplatz ging die PKW-zentrierte Entwicklung nicht spurlos vorüber. Im<br />
Bestreben, den <strong>Bahnhof</strong> für „Park and Ride“ gut zugänglich zu machen, wurde der Vorplatz<br />
vielerorts vergrößert <strong>und</strong> – oft in Verbindung mit stark befahrenen Strassen – zu einem<br />
reinen Verkehrsplatz ausgestaltet. 196 Dies wiederum führte zu einer noch stärkeren<br />
Abb. 26: München: alter Hauptbahnhof. (1847-1949) <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>sneubau (ab<br />
1960)<br />
Quelle (beide Abbildungen): Hackelsberger (1996), S. 219<br />
Isolierung des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> zog einen weiteren Verlust an Aufenthaltsqualität im<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld nach sich.<br />
Nach wie vor hatten der <strong>Bahnhof</strong> sowie die Gleisanlagen eine stark trennende Wirkung auf<br />
ihr Umfeld: In vielen Städten waren diejenigen Gebiete, welche sich auf der<br />
<strong>Bahnhof</strong>srückseite befanden, weitgehend von der übrigen <strong>Stadt</strong>entwicklung abgeschnitten.<br />
Um dieser Situation beizukommen, gab es Ende der 1960er Jahre im Zuge von<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumbaumaßnahmen erste Versuche, diese <strong>Stadt</strong>teile mittels Passagen unter den<br />
Gleisanlagen besser anzubinden. Der Erfolg dieser Maßnahmen hielt sich allerdings meist in<br />
deutlichen Grenzen, was vermutlich nicht zuletzt auf die mangelnde Aufenthaltsqualität <strong>und</strong><br />
195 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 223f.<br />
196 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 223f.<br />
118
vandalismusresistente Gestaltung mit niedrigem ästhetischem Anspruch zurückzuführen<br />
ist. 197<br />
4.2.5 Wiederentdeckung <strong>und</strong> der Wunsch nach dem großen Wurf: 1980er <strong>und</strong> 90er<br />
Jahre<br />
Im Kontext eines einsetzenden planerischen Wertewandels hin zur Fußgängerfre<strong>und</strong>lichkeit<br />
<strong>und</strong> zum Ausbau des ÖPNV wuchs ab den 1980er Jahren das Bewusstsein für die Bahnhöfe<br />
<strong>und</strong> ihre Umgebung wieder. Eine neue Sicht auf den <strong>Bahnhof</strong>sbereich begann sich<br />
abzuzeichnen: „Er wurde nicht mehr nur unter verkehrsfunktionalen <strong>und</strong> räumlichgestalterischen<br />
Aspekten neu bewertet, sondern er wurde auch ... als sozialer Ort<br />
wiederentdeckt, der zahlreichen Gruppen als Aufenthalts-, Aktions- <strong>und</strong> Begegnungsraum<br />
dient.“ 198<br />
In den 1980er Jahren entstand ein erstes – in der Zwischenzeit verworfenes – Leitkonzept<br />
der Bahn für die Entwicklung ihrer Bahnhöfe: „Erlebniszentren mit Gleisanschluss“. 199<br />
Im Rahmen des Ausbaus der Hochgeschwindigkeitsnetze entstanden ab den 1990er Jahren<br />
auch einige große Neubauprojekte, bei denen nicht nur der <strong>Bahnhof</strong>, sondern auch sein<br />
Umfeld neu entworfen wurden. Eines der bekanntesten Beispiele hierfür ist Lille, wo neben<br />
dem alten <strong>Bahnhof</strong> (Lille-Flandres) ein komplett neuer Schnellbahnhof (Lille-Europe) samt<br />
zugehörigem neuem <strong>Bahnhof</strong>sumfeld aus einem Guss geschaffen wurde. In diesem Kontext<br />
ist auch der neue Berliner Hauptbahnhof zu nennen, um den ein gebautes Umfeld<br />
weitgehend erst noch entstehen soll.<br />
Im Katalog der Ausstellung „Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert“ von<br />
1996 wurden dann große Bahnhöfe <strong>und</strong> vor allem deren Gleisfelder als „unüberwindliche<br />
Hürden der <strong>Stadt</strong>entwicklung“ gesehen, die ganze Quartiere „zerschneiden“. Daher wurde<br />
auch für „neue Wege eines städteverträglichen Umbaus der Bahnanlagen“ plädiert, wobei die<br />
Deutsche Bahn AG „Städten, die sich entwickeln wollen, wertvolle Gebiete zur Erweiterung<br />
der City anbieten“ könne. 200<br />
Die tragende Idee war dabei, dass im Rahmen so genannter „Projekte21“ in mehreren<br />
Großstädten die Gleise tiefer gelegt <strong>und</strong> Betriebsgelände an den <strong>Stadt</strong>rand verlegt werden<br />
sollten, um eine städtische Entwicklung von bis zu 90% der Bahnflächen zu ermöglichen<br />
197 Ebenda, S. 224. Und von Gerkan, Meinhard (1996): Renaissance der Bahnhöfe als Nukleus des Städtebaus. In:<br />
B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.):<br />
Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 43.<br />
198 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 227.<br />
199 Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 14.<br />
200 Ebenda, S. 13f.<br />
119
Abb. 27: Frankfurt/M: Luftbild <strong>und</strong> städtebaulicher Entwurf für Frankfurt21 (1996)<br />
Quelle: von Gerkan, Marg <strong>und</strong> Partner (1996), S. 165<br />
(siehe dazu beispielsweise Abb. 29). Auf diese Weise könnten dann „in vielen deutschen<br />
Städten die Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umfelder wieder in das innerstädtische Leben integriert<br />
werden“. 201<br />
Durch die Eingliederung der neuen Flächen sollte somit auch eine Revitalisierung des<br />
bestehenden <strong>Bahnhof</strong>sumfelds ermöglicht werden, das unter anderem als „städtischer<br />
Hinterhof“ bezeichnet wurde. Ferner wurde mit der Vision der Schaffung von<br />
multifunktionalen Bahnhöfen, die mitsamt ihrer neuen Geschäftszonen „integrale<br />
Bestandteile der <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> ihres öffentlichen Raumes“ werden sollten, die Hoffnung<br />
verknüpft, „ganze <strong>Stadt</strong>viertel ringsum wiederzubeleben“. 202<br />
Es scheint, dass – auch wenn nicht alle geplanten Projekte in diesem Ausmaß realisiert<br />
werden sollten – doch einiges an gr<strong>und</strong>legender Veränderung auf bestehende<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfelder bereits zukommt bzw. noch zukommen soll. Darauf, wie diese<br />
Veränderungen aussehen <strong>und</strong> welche Auswirkungen sie mit sich bringen könnten, wird im<br />
folgenden Abschnitt eingegangen.<br />
4.3 Gegenwärtige Aspekte der <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung<br />
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung ständig eng mit dem<br />
Bedeutungswandel des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong>entwicklung verb<strong>und</strong>en ist. Gegenwärtig<br />
rückt das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld in den Zentralbereich der Investition vieler Städte. Wie wir aus<br />
der Geschichte erfahren haben, hängen die Entwicklungen von vielen verschiedenen<br />
Faktoren ab <strong>und</strong> es gibt nicht nur den Verkehrsaspekt. Technische Entwicklungen,<br />
201 Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 13f.<br />
202 Ebenda, S. 14f.<br />
120
gesellschaftlicher Wandel <strong>und</strong> eine Menge von externen Effekten bestimmen die<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung mit.<br />
Heutzutage bringt die Globalisierung der Ökonomie noch zusätzlich latente Kräfte, die als<br />
Treiber hinter der Entwicklung stehen. Wie im Kapitel 4.1 schon erwähnt wurde, ist ein<br />
<strong>Bahnhof</strong> mit seinem Umfeld sowohl ein Knotenpunkt in einem übergeordneten Netzwerk, als<br />
auch ein Ort in der <strong>Stadt</strong>. Die Einflussfaktoren sind lokal sowie überregional organisiert. Die<br />
Entwicklung ist deshalb verschiedenen Kontext- <strong>und</strong> Prozessvariablen unterworfen. Noch<br />
einmal verdeutlicht sind die Einflussfaktoren für die <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung wie folgt<br />
organisiert:<br />
- Im überregionalen Kontext: die Rahmenbedingungen für die Entwicklung in<br />
einem übergeordneten Netzwerk<br />
- Im Lokalen Prozess: die Akteure <strong>und</strong> Koalitionen, deren Interessen <strong>und</strong> Belange,<br />
eingesetzte Instrumente <strong>und</strong> wie sie den Prozess gestalten<br />
- Im Lokalen Kontext: Abhängigkeit der Entwicklung von der Lage in der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>und</strong> den Besonderheiten der <strong>Stadt</strong><br />
- Im Austauschprozess mit der Umgebung <strong>und</strong> dem daraus entstandenen neuen<br />
Kontext: viele neue Faktoren werden während der Entwicklung neu produziert,<br />
deren Einflüsse bilden einen neuen sozioökonomischen <strong>und</strong><br />
nutzungsstrukturellen<br />
veranlasst<br />
Kontext, der wiederum spezielle Veränderungen<br />
In diesem Kapitel können viele Einflussfaktoren mit Hilfe selektiver Betrachtung bestimmter<br />
Beispiele verständlich gemacht werden. Ein paar neu entwickelte Projekte können typische<br />
Faktoren mit sich tragen, z. B:<br />
- Hauptbahnhof Leipzig: Eine gravierende Funktionsanreicherung des größten<br />
Kopfbahnhofs in Europa, der direkt an der Innenstadt liegt.<br />
- Hauptbahnhof Frankfurt/Main: Ein Kopfbahnhof im internationalen<br />
Finanzzentrum, der ebenfalls direkt an der Innenstadt liegt, dessen Umfeld eine<br />
traditionelle <strong>Bahnhof</strong>sviertelgeschichte hat <strong>und</strong> gleichzeitig Projektgebiet für<br />
„Soziale <strong>Stadt</strong>“ <strong>und</strong> „Frankfurt 21“ ist.<br />
- Hauptbahnhof Lille: Der neu entwickelte Durchgangsbahnhof mit der<br />
Entwicklung eines neuen <strong>Stadt</strong>teils mit vielen neuen Funktionen.<br />
- Basel SBB/SNCF: Zwei verb<strong>und</strong>ene Kopfbahnhöfe, die mit ihren Umfeldern eine<br />
Zäsur in der <strong>Stadt</strong>struktur darstellen, die durch neue Projekte im<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld in eine bessere Verbindung zur Umgebung gebracht werden<br />
sollten.<br />
121
- <strong>Bahnhof</strong> Kassel-Wilhelmshöhe: Ein neuer Schnellbahnhof der erhebliche<br />
Auswirkungen auf die Entwicklung seiner Umgebung hatte.<br />
Aus der Lektüre wurden Thesen gebildet, nach denen die gegenwärtigen Aspekte der<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung betrachtet werden sollen. Dabei werden die genannten Beispiele<br />
zur schwerpunktmäßigen Betrachtung herangezogen, da diese in vielerlei Hinsicht<br />
komplementär sind, d.h. die aufgeführten Beispielbetrachtungen sind oft für mehr als ein<br />
Thema interessant <strong>und</strong> relevant.<br />
4.3.1 Überlokale Rahmenbedingungen<br />
These 1: Die Kommunen wollen an das Schnellbahnnetz angeb<strong>und</strong>en sein <strong>und</strong> gleichzeitig<br />
den <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> sein Umfeld aufwerten (in Verbindung mit der Hoffnung auf eine<br />
Stärkung der Innenstadt). Auf Initiative von Bahn oder <strong>Stadt</strong> werden daraufhin<br />
Entwicklungsprojekte am <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld angestoßen.<br />
Eine gut ausgebaute Infrastruktur zum schnellen Transport von Personen, Gütern <strong>und</strong><br />
Informationen gilt als ein wesentliches Element eines hoch entwickelten Wirtschaftssystems<br />
<strong>und</strong> als Wohlfahrtsindikator. 203 Die Konkurrenzfähigkeit der Städte ist darauf angewiesen,<br />
sowohl materiell (Transport) als auch immateriell (Information) mit Knotenpunktstädten in<br />
einem Netzwerk verb<strong>und</strong>en zu sein, um die lokalen Ressourcen schnell aufzuwerten <strong>und</strong> zu<br />
vermarkten. Die Netzwerkverbindung im Globalisierungsprozess der Ökonomie führt wie im<br />
Kapitel 4.1 schon erwähnt zu einer sektoralen Spezialisierung der Städte in einer Makro-<br />
Region (Europa). Die daraus resultierenden urbanen Typen beeinflussen spezifisch auch die<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung. 204 Es gibt innerhalb des Netzwerks folgende Entwicklungen, die<br />
als Gr<strong>und</strong>lagen für die Nutzungsmaximierung der gesamten Makro-Region gelten:<br />
- „Komplettierung eines transeuropäischen Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetzes,<br />
- Ausbau des internationalen Flughafenkomplexes,<br />
- räumliche Anbindung durch neue Telekommunikationstechnologie,<br />
- Aufhebung der Grenzen innerhalb Europas <strong>und</strong><br />
- Wettbewerb zwischen Städten <strong>und</strong> Regionen.“ 205<br />
203<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 235.<br />
204<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 37.<br />
205<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 37.<br />
122
Unter diesen Rahmenbedingungen müssen die Städte <strong>und</strong> Regionen gegen<br />
Siedlungsdispersion, Entmischung, unnötiges Verkehrswachstum, Verödung der Innenstädte<br />
<strong>und</strong> soziale Erosion ankämpfen. 206 Die Optimierung der politischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen<br />
Entwicklungsfaktoren sowie das Konkurrenzverhalten bilden einen Kreislauf, der die ganze<br />
Makro-Region in der Weltökonomie konkurrenzfähiger macht. Parallel zum<br />
Konkurrenzverhalten müssen auch gemeinsame Handlungsstrategien zwischen Städten<br />
entwickelt werden. Das Ringen um einen Anschluss an das europäische<br />
Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz <strong>und</strong> gleichzeitig die gemeinsame Entwicklung eines<br />
optimierten Verkehrsnetzes ist u.a. dafür ein Beispiel. Der Konkurrenzkampf führt soweit,<br />
dass z.B. ICE-Stationen in erstaunlicher Lage entstanden sind <strong>und</strong> ein Produkt der<br />
Entwicklungshoffnung werden (vgl. Kapitel 5.2.1 / Beispiel Limburg <strong>und</strong> Montabaur). Der<br />
Gewinner bei dem Kampf um einen Anschluss ans Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz hat<br />
aus der unternehmerischen <strong>und</strong> der stadtentwicklungspolitischen Sicht zwei Vorteile:<br />
Trotz der Entwicklung der Telekommunikationstechnologien ist eine leistungsfähige<br />
Verkehrsanbindung nach wie vor einer der wichtigsten harten Standortfaktoren. Die face-toface<br />
Kommunikation kann in vielen Fällen nicht durch die telekommunikativen Möglichkeiten<br />
ersetzt werden. 207 Und für multinational arbeitende Unternehmen ist gute Erreichbarkeit <strong>und</strong><br />
Zentralität von großer Bedeutung: Ausdehnung des Aktionsradius, günstige<br />
Raumüberwindungskosten, mehr Entwicklungsmöglichkeiten usw.<br />
Der Anschluss an die Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetze <strong>und</strong> die städtebauliche Aufwertung<br />
des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds ist meistens ein sehr großes städtebauliches Ereignis. Solche großen<br />
Ereignisse können zur Produktion der sog. <strong>Stadt</strong>identität <strong>und</strong> zum <strong>Stadt</strong>image beitragen. 208<br />
Somit versuchen die Städte sich im Städtewettbewerb sich besser zu vermarkten.<br />
Ferner sind die meisten Bahnhöfe des Hochgeschwindigkeitsverkehrs die bisherigen<br />
Hauptbahnhöfe der Städte - <strong>und</strong> von ihrem Standort her mehr oder weniger nahe am<br />
<strong>Stadt</strong>kern. Aufgr<strong>und</strong> dessen haben die Städte die Hoffnung, durch Aufwertung <strong>und</strong><br />
Verbesserung der Funktionen <strong>und</strong> städtebaulichen Erscheinungen des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> des<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldes die Innenstädte zu beleben <strong>und</strong> funktional zu stärken. Die Entwicklung<br />
des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes sollte meistens als Impuls <strong>und</strong> Ergänzung zur Innenstadtbelebung<br />
wirken <strong>und</strong> löst Konzentrationswirkungen aus.<br />
Bisher wurde anhand der Rahmenbedingungen im überregionalen Kontext erklärt, wie<br />
wichtig die Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes für die Bedeutung einer <strong>Stadt</strong><br />
im übergeordneten Netzwerk ist. Umgekehrt ist die Entwicklung aber auch eine Anforderung<br />
dieses Netzwerks. Für die <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung reicht jedoch allein die<br />
„Erreichbarkeit“, also der Anschluss ans europäische Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz,<br />
nicht aus. Eine Menge von Entwicklungszielen sind in den städtebaulichen Rahmenplanungen<br />
206 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 240.<br />
207 Ebenda, S. 236-237.<br />
208 Ebenda, S. 5.<br />
123
formuliert worden, wie z.B. die <strong>Bahnhof</strong>21-Projekte in Deutschland. Entwicklungsziele für<br />
das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld sind z. B.:<br />
- Trennende Wirkung der Gleisanlagen aufheben, „Korrektur stadtstrukturell<br />
fehlentwickelter <strong>Stadt</strong>teile“<br />
- „Wiederbelebung“ von <strong>Stadt</strong>vierteln um den <strong>Bahnhof</strong><br />
- Flächensparende <strong>und</strong> verkehrssparsame Standortentwicklung<br />
- Freiraumentwicklung, Entwicklung innerstädtischer Biotopverb<strong>und</strong>e<br />
- Eröffnung neuer Möglichkeiten für die <strong>Stadt</strong>entwicklung: <strong>Bahnhof</strong>sgebiet soll<br />
„integraler Teil der <strong>Stadt</strong>“ werden<br />
- Verbesserung der ökonomischen Funktionen <strong>und</strong> der Konkurrenzfähigkeit der<br />
Innenstädte, inkl. Erhöhung des Werts innerstädtischer Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Die Ziele mögen sehr sinnvoll <strong>und</strong> erfahrungsgemäß sehr richtig definiert sein, bieten aber<br />
keinerlei Antwort für den Entwicklungsprozess <strong>und</strong> beinhalten auch keine Aussage für<br />
Entwicklungsstrategien. Sie sind eher bildhaft. Mit ihnen kann man „sehr schöne Pläne<br />
zeichnen“, um zu illustrieren, wie gut das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld entwickelt werden kann. Das<br />
Fehlen der Fähigkeit, prozesshaft zu denken, ist eine Schwachstelle der Planer <strong>und</strong><br />
Architekten, die heutzutage immer wieder thematisiert wird. 209 Mit Konzepten wie z.B.<br />
„landscape urbanism“ versucht man, neue Theorien für das Entwerfen <strong>und</strong> Planen zu<br />
entwickeln, um dieser Problematik entgegenzuwirken. Warum sind viele Pläne in den<br />
Schubladen geblieben? Weil die <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung nicht automatisch abläuft, wenn<br />
nur Erreichbarkeit geschaffen wird <strong>und</strong> Planungsziele formuliert sind. Beispielsweise sind<br />
nach der Anbindung an die TGV Strecke, die erwünschten <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklungen in<br />
Le Creusot, Vendome <strong>und</strong> Macon gescheitert. 210 Erreichbarkeit ist nicht das<br />
Einzelkriterium 211 , die lokalen Prozessvariablen <strong>und</strong> Kontextvariablen sind genauso<br />
entscheidende Einflussfaktoren.<br />
4.3.2 Rahmenbedingungen, Akteure <strong>und</strong> Prozesse<br />
These 2: Auf Initiative von Bahn oder <strong>Stadt</strong> werden Entwicklungsprojekte am <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong><br />
im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld angestoßen. In deren Rahmen kommt es zunehmend zur Bildung von<br />
Koalitionen bestehend v.a. aus externen Akteuren mit ökonomischen Interessen<br />
209<br />
Vgl. Hight, Christopher (2006): Landscape Urbanism. In: Mostafavi, Mohsen & Najle, Ciro (Hrsg.): A Manual for<br />
the Machinic Landscape. AA Verlag, London<br />
210<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 41.<br />
211<br />
Ebenda, S. 39.<br />
124
(Immobilien-Projektentwickler, Finanzierungs-Institutionen, Unternehmen, Baubranche,<br />
Projektdienstleister). Diese haben einen starken Einfluss auf die Gebietsentwicklung, sind<br />
aber auf die Kooperation mit der Kommune angewiesen.<br />
Eine offene Frage besteht darin, ob – je nach Politik <strong>und</strong> Finanzlage der Kommune – eine<br />
zunehmende Verschiebung der Machtverhältnisse weg von der Kommune hin zu privaten<br />
Akteuren stattfindet.<br />
Bei Entwicklungsprojekten im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld handelt es sich meist um umfangreiche,<br />
langfristige <strong>und</strong> kapitalintensive Unterfangen. Es überrascht daher wenig, dass viele solche<br />
Vorhaben typische Charakteristika von Großprojekten aufweisen <strong>und</strong> etwa eine ganz eigene<br />
Dynamik entwickeln. Dazu gehört auch die Notwendigkeit der Kooperation vielfältiger<br />
öffentlicher <strong>und</strong> privater Akteure, ohne die eine Umsetzung bei den gegenwärtigen<br />
Rahmenbedingungen kaum möglich wäre. Die in solchen Governance-Konstellationen<br />
beteiligten Akteure, aber auch die Rahmenbedingungen der Projektdurchführung (politische<br />
<strong>und</strong> institutionelle Normen <strong>und</strong> Ziele, Planungssysteme) prägen die Art der Durchführung<br />
<strong>und</strong> das Ergebnis des Vorhabens entscheidend mit.<br />
Um gegenwärtige Entwicklungsprozesse im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld besser zu verstehen, wird daher<br />
an dieser Stelle auf verschiedene Aspekte ihrer institutionellen <strong>und</strong> planerischen<br />
Rahmenbedingungen wie auch auf die Art der Akteurskonstellationen eingegangen. Als<br />
Betrachtungsbeispiel werden Euralille <strong>und</strong> der <strong>Bahnhof</strong> Lille-Europe in Lille herangezogen. Es<br />
handelt sich dabei um eine komplexe <strong>und</strong> vielschichtige Angelegenheit. Dies zeigt sich nicht<br />
zuletzt daran, dass Entscheidungsfindungs- wie auch Umsetzungsprozesse im<br />
Zusammenhang mit <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung viel Zeit in Anspruch nehmen: Zeitspannen<br />
von zehn Jahren oder länger sind durchaus üblich 212 .<br />
Nationale Planungssysteme: Aus europäischer Perspektive ist einleuchtend, dass die<br />
verschiedenen nationalen Planungssysteme wie auch die politischen <strong>und</strong> kulturellen<br />
Rahmenbedingungen unterschiedliche Reaktionen auf ähnliche Planungsprobleme (wie etwa<br />
die der <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung) zur Folge haben. Dennoch kann festgestellt werden,<br />
dass es gerade in diesem Bereich auch einige grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten gibt.<br />
So haben Behörden auf verschiedenen Verwaltungsebenen meist einen Anteil bzw.<br />
Interessen an diesen doch oft recht großen <strong>und</strong> bedeutenden Projekten. Daraus schließen<br />
Bertolini <strong>und</strong> Spit, dass gegenüber Entwicklungsvorhaben am <strong>und</strong> um den <strong>Bahnhof</strong> eine<br />
gewissermaßen flexible Gr<strong>und</strong>haltung der Behörden gegeben ist: Der Einfluss der nationalen<br />
Planungssysteme auf derartige Projekte ist zwar vorhanden, aber weniger bezeichnend als<br />
bei anderen Projektarten. 213<br />
212<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 49f.<br />
213<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 51.<br />
125
Bei besonders großen Projekten kann es zu Spannungen kommen, wenn diese zum Teil<br />
außerhalb der Einflussmöglichkeiten der Planungssysteme ablaufen, während sie gleichzeitig<br />
Teil des Planungssystems sind: Daraus wiederum kann sich die etwas schizophrene Situation<br />
ergeben, dass Entwicklungsprojekte durch Teile des Planungssystems einerseits behindert<br />
(z.B. durch nicht erteilte Baugenehmigungen oder sehr lange Planaufstellungsverfahren),<br />
andererseits unterstützt oder mitgetragen werden (z.B. durch Enteignungen). 214<br />
Aus deutscher Perspektive ist in diesem Zusammenhang besonders auf die Konsequenzen<br />
des veränderten Verhältnisses der privatisierten Deutschen Bahn (durch die Reform des<br />
Eisenbahnwesens) <strong>und</strong> den Kommunen hinzuweisen: Es kommen neue rechtliche Probleme<br />
zum Vorschein. Dabei geht es „letztlich um das Verhältnis zwischen kommunaler<br />
215<br />
Planungshoheit <strong>und</strong> privilegierter bahnrechtlicher Fachplanung“. (Für weitere<br />
Informationen siehe Kapitel Gr<strong>und</strong>lagen / Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen zu den Zuständigkeiten an<br />
Bahnhöfen)<br />
Die Kommune hat dabei für wesentliche Bereiche der Entwicklung die Planungshoheit wie<br />
auch die Genehmigungs- <strong>und</strong> Entscheidungsbefugnis (wobei überörtliche Interessen zum Teil<br />
einschränkend auf die kommunale Planungshoheit wirken können). „Auf der Gr<strong>und</strong>lage der<br />
kommunalen Selbstverwaltung <strong>und</strong> der Verpflichtung gegenüber den Bürgern hat die<br />
Kommune deshalb den Auftrag,<br />
- die gesamtstädtische Entwicklung zu steuern,<br />
- den <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> sein Umfeld als integralen Teil der <strong>Stadt</strong>- <strong>und</strong><br />
Verkehrsentwicklung zu verstehen <strong>und</strong><br />
- ein in diesem Sinne ausgewogenes Konzept in Abstimmung mit den Partnern<br />
anzustreben <strong>und</strong> umzusetzen.“ 216<br />
Dabei ist gemäß Bartkowiak festzustellen, dass aufgr<strong>und</strong> des enormen Planungs- <strong>und</strong><br />
Koordinierungsaufwands von Großprojekten „die klassischen Planungsinstrumente mit<br />
neueren Rechtsinstrumenten <strong>und</strong> Verfahrensweisen zur Baulandmobilisierung kombiniert“<br />
werden (siehe dazu auch folgende Grafik). 217 So wird insgesamt eine flexible,<br />
umsetzungsorientierte Planung angestrebt.<br />
214 Ebenda, S. 52f.<br />
215 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 245.<br />
216 Ebenda, S. 347.<br />
217 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 347f.<br />
126
Abb. 28: Planungsinstrumente bei der Standortentwicklung ehemaliger<br />
Bahnverkehrsflächen in Kernstadtbereichen<br />
Quelle: Bartkowiak (2004), S. 348<br />
Neben den oben genannten rechtlichen Problemen entstehen Konflikte zwischen Kommunen<br />
<strong>und</strong> Eigentümern der Bahnliegenschaften vor allem dort, wo unterschiedliche<br />
Interessenslagen bezüglich der zukünftigen Nutzungen bestehen (insbesondere zwischen<br />
planerischen Zielvorstellungen der Kommune einerseits <strong>und</strong> möglichst lukrativen<br />
Investitionszielen der Eigentümer andererseits). 218<br />
Institutionelle Rahmenbedingungen: Die Entwicklung der institutionellen<br />
Rahmenbedingungen in Europa wird gemäß Bertolini <strong>und</strong> Spit vor allem gekennzeichnet<br />
durch Deregulierung, Einschränkungen öffentlicher Ausgaben, eine Verschiebung von<br />
sozialen hin zu ökonomischen <strong>und</strong> (an zweiter Stelle) ökologischen Zielen, Public-Private<br />
Partnerships sowie gleichzeitig stattfindenden Zentralisierungs- <strong>und</strong><br />
Dezentralisierungsprozessen.<br />
219<br />
Von diesen allgemeinen Tendenzen werden<br />
Entwicklungsprojekte im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld zum Teil mehr, zum Teil weniger berührt:<br />
Deregulierungsprozesse kommen hier aufgr<strong>und</strong> des hohen Schadenpotenzials (wie z.B. in<br />
England festgestellt wurde – siehe dazu Kapitel 1.5.2) nur bedingt zum Tragen: Planung <strong>und</strong><br />
Regelungen werden in gewissem Maße immer Teil solcher Projekte bleiben müssen 220 ;<br />
Im Rahmen öffentlicher Sparpolitiken <strong>und</strong> dem verstärkten Fokus auf ökonomische <strong>und</strong><br />
ökologische Ziele werden neue Möglichkeiten für Initiativen von privater Seite eröffnet,<br />
wodurch in vielen Ländern insbesondere Public-Private Partnerships eine bedeutende Rolle<br />
bei der <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung zukommt. Eine Schwierigkeit ist durch die zum Teil<br />
antagonistischen Ziele der Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> der ökologischen Tragfähigkeit gegeben,<br />
218<br />
Ebenda, S. 245.<br />
219<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 53.<br />
220<br />
Ebenda.<br />
127
wobei die ökonomischen Ziele meist als vorrangig gelten <strong>und</strong> die ökologischen Ziele als<br />
Korrektiv zu verstehen sind 221 ;<br />
Aus den gleichzeitigen Zentralisierungs- <strong>und</strong> Dezentralisierungstendenzen ergibt sich für<br />
solche Projekte zum Teil die schwierige Situation, dass von „oben“ Druck für eine schnelle<br />
Umsetzung kommt, während von „unten“ – wo die Kosten der Entwicklung am stärksten zu<br />
spüren sind – eher gebremst wird. 222<br />
Akteure: Auch von den involvierten Akteuren wird der Planungs- <strong>und</strong> Umsetzungsprozess<br />
bei Projekten im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld wesentlich geprägt. In seiner analytischen Betrachtung<br />
unterscheidet Oosten (ähnlich wie Bertolini <strong>und</strong> Spit) zwischen fünf Akteursgruppen<br />
(„Stakeholders“): Bahnunternehmen <strong>und</strong> andere Transportdienstleister, verschiedene<br />
Regierungsebenen, Gr<strong>und</strong>besitzer <strong>und</strong> -entwickler, „Pressure Groups“ (z.B.<br />
Verbraucherorganisationen, Nachbarschaftsorganisationen, Umweltorganisationen), sowie<br />
einzelne Bürger. Er unterscheidet dazu zwischen der Gesamtheit der genannten Akteure<br />
einerseits <strong>und</strong> denjenigen spezifischen Akteuren andererseits, welche direkt am<br />
Erneuerungsprojekt beteiligt sind <strong>und</strong> es finanzieren. Letztere Akteure haben in der Regel<br />
eine Managementfunktion inne oder versuchen zumindest, Kontrolle über das Projekt zu<br />
gewinnen. 223<br />
Die bei Großprojekten häufig anzutreffende Form der Kooperation verschiedenartiger<br />
Akteure aus Privatwirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft mit unterschiedlichen Teilen <strong>und</strong> Ebenen der<br />
öffentlichen Verwaltung wird von Oosten als „Governance Netzwerk“ bezeichnet. Neben dem<br />
„Transportnetzwerk“ einerseits <strong>und</strong> dem „räumlichen Netzwerk“ andererseits wird es als eine<br />
der drei bedeutenden Einflussgrößen auf <strong>Bahnhof</strong>sumfeld-Entwicklungsprojekte gesehen.<br />
Allerdings wird festgestellt, dass es bei derartigen Vorhaben (im Gegensatz etwa zu<br />
Flughafenentwicklungsprojekten) bisher sehr wenig wirklich vernetzte Steuerung gibt – nötig<br />
wäre eine verstärkte <strong>und</strong> verbesserte Kooperation zwischen Akteuren auf verschiedenen<br />
räumlichen Ebenen, von der europäischen bis hin zur kommunalen. 224<br />
Betrachtet man Erfahrungen in Deutschland, so kann auch hier festgestellt werden, dass<br />
die inhaltliche Komplexität <strong>und</strong> die Vielschichtigkeit von Entwicklungsprojekten an<br />
Bahnhöfen <strong>und</strong> im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld „zu einem breiten Spektrum von Beteiligten“ führt.<br />
Zentrale Akteure sind in der Regel die relevanten Abteilungen bzw. Bereiche der Kommunen<br />
<strong>und</strong> der Bahn. Unterstützung erfahren sie von Landes- <strong>und</strong> Regionalverwaltungen sowie von<br />
kommunalen Spitzenverbänden, während das Eisenbahnb<strong>und</strong>esamt die hoheitlichen<br />
Aufsichts- <strong>und</strong> Genehmigungsfunktionen für die Bahnanlagen wahrnimmt. Während die<br />
221<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London, S. 54-56.<br />
222<br />
Ebenda, S. 59.<br />
223<br />
Oosten, Wouter-Jan (2000): Railway stations and a geography of networks. Paper presented at the 6th Annual<br />
Congress of the Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics. Online unter:<br />
www.eur.nl/WebDOC/doc/fsw/fswalg20010507142923.<strong>pdf</strong>. S. 3.<br />
224<br />
Oosten, Wouter-Jan (2000): Railway stations and a geography of networks. Paper presented at the 6th Annual<br />
Congress of the Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics. Online unter:<br />
www.eur.nl/WebDOC/doc/fsw/fswalg20010507142923.<strong>pdf</strong>. S. 5.<br />
128
Gesamtkonzeption meist vorgegeben wird, kommt im Rahmen der darin enthaltenen<br />
Einzelmaßnahmen verschiedenen privaten Akteuren wie Bauherren, professionellen<br />
Projektentwicklern, externen Planungsbüros <strong>und</strong> ausführenden Firmen ebenfalls eine hohe<br />
Bedeutung zu, zumal die Realisierung der Projekte oft von Privatkapital abhängt – <strong>und</strong> somit<br />
auch von Public-Private Partnerships, mit all ihren möglichen Vor- <strong>und</strong> Nachteilen 225 . Für<br />
eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird dadurch auch die Betreuung der „Schnittstelle<br />
zwischen privaten <strong>und</strong> öffentlichen Projektbeteiligten“ immer wichtiger. Von den Städten aus<br />
wird diese Aufgabe oft zur „Chefsache“ erklärt. 226 So wird auch der Prozess der<br />
„Standortentwicklung ... mehr <strong>und</strong> mehr von Anfang an als Dialog zwischen den politisch<br />
Verantwortlichen <strong>und</strong> ihrem Planungsteam auf der einen Seite <strong>und</strong> den Privatinvestoren <strong>und</strong><br />
Projektentwicklern der Immobilienwirtschaft auf der anderen Seite ausgelegt.“ 227<br />
Im Allgemeinen besteht zwischen der Größe eines Projektes, seiner Komplexität <strong>und</strong> der<br />
Anzahl beteiligter Akteure insofern ein Zusammenhang, als dass bei größeren Vorhaben<br />
meist mehr verschiedene Akteure involviert sind. Dadurch steigt das Potenzial für<br />
Interessenskonflikte <strong>und</strong>/oder der Planungsprozess wird verlängert, wodurch wiederum das<br />
Potenzial für Interessenskonflikte steigt. 228<br />
Der Beteiligung Betroffener (Anwohner, Geschäftsinhaber, Bahnk<strong>und</strong>en etc.) wird für den<br />
Erfolg solcher Projekte insgesamt eine hohe Bedeutung zugemessen. Fehlt die öffentliche<br />
Unterstützung, kann dies zur Blockade des Vorhabens führen – wird das Projekt hingegen<br />
von den Betroffenen mitgetragen, so ist dies ein bedeutendes Element für den Erfolg.<br />
Allerdings muss festgestellt werden, dass bei der Restrukturierung <strong>und</strong> Entwicklung von<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldern kaum ganzheitliche Strategien angewandt werden <strong>und</strong> eine wirkliche<br />
Einbeziehung von Anwohnern <strong>und</strong> lokalen Geschäftsleuten eine Seltenheit ist. 229<br />
Beispiel Euralille, <strong>Bahnhof</strong> Lille-Europe: Das Projekt Euralille mitsamt dem neuen<br />
Hochgeschwindigkeitsbahnhof Lille-Europe ist wohl eines der bekanntesten Projekte seiner<br />
Art in Europa. Obwohl es aufgr<strong>und</strong> der immer unterschiedlichen Ausgangs- <strong>und</strong><br />
Rahmenbedingungen kaum zwei gleiche <strong>Bahnhof</strong>s- bzw. Umfeldentwicklungsprozesse geben<br />
kann, handelt es sich bei Lille in zweierlei Hinsicht um ein besonders untypisches Vorhaben:<br />
Das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld wurde zusammen mit dem <strong>Bahnhof</strong> völlig neu geplant <strong>und</strong> errichtet,<br />
<strong>und</strong> die Akteurskonstellationen - sowie der durch sie geprägte Entwicklungsprozess - waren<br />
das Ergebnis einer Vielzahl ganz bestimmter Ereigniskombinationen. Als solch untypisches<br />
Vorhaben von großem Maßstab liefert es in diesem Zusammenhang (wie auch hinsichtlich<br />
der künftigen Analyse des nicht gerade typischen Berliner Hauptbahnhofs) ein sehr<br />
225<br />
Siehe Bartkowiak (2004), S. 354f für eine detaillierte Auflistung.<br />
226<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 346f.<br />
227<br />
Ebenda, S. 353.<br />
228<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 60.<br />
229<br />
Staudacher, Christian (2002): <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> – Standort <strong>und</strong> Lebensgemeinschaft. In: Österreichische<br />
Gesellschaft für Wirtschaftsraumforschung (Hrsg.): Wirtschaftsgeographische Studien, Heft 27/28. Facultas<br />
Verlag, Wien. S. 30f.<br />
129
interessantes Betrachtungsobjekt für die vielfältigen Verflechtungen verschiedener<br />
Handlungsebenen sowie öffentlicher <strong>und</strong> privater Akteure. Im Folgenden wird insbesondere<br />
auf den Projektentwicklungsprozess <strong>und</strong> die maßgeblichen Akteurskonstellationen<br />
eingegangen (für weitere Daten <strong>und</strong> Informationen zu Lille: siehe Kapitel 8.3.1).<br />
„The story of Euralille is at one and the same time that of an extraordinary chain of events<br />
and that of the determination of local élites to profit from emerging opportunities.“ 230 Die<br />
treibende Kraft hinter dem Vorhaben war die <strong>Stadt</strong> Lille, wobei von Anfang an der Person<br />
Pierre Mauroy – zum Teil quasi in „Personalunion“ mit der <strong>Stadt</strong> – eine herausragende<br />
Bedeutung zukam.<br />
Anfang der 1980er Jahre wurde – während der Zeit Mauroys als französischer<br />
Ministerpräsident – der Bau des Kanal-Tunnels zwischen England <strong>und</strong> Frankreich<br />
beschlossen. Wenige Jahre später folgte der Beschluss zwischen Frankreich, Belgien,<br />
Deutschland <strong>und</strong> den Niederlanden zum Ausbau eines nordeuropäischen<br />
Hochgeschwindigkeitsnetzes. Mauroy, der mittlerweile wieder Bürgermeister von Lille war,<br />
übernahm zu dieser Zeit die Führung einer breiten regionalen Interessenskoalition privater<br />
<strong>und</strong> öffentlicher Akteure. Diese Lobby-Gruppe hatte zwei große Ziele: Die Steckenführung<br />
der Hochgeschwindigkeitsverbindung sollte durch die Region Nord-Pas de Calais erfolgen<br />
(anstatt durch die Picardie) <strong>und</strong> sie sollte durch das Zentrum von Lille verlaufen (anstatt,<br />
wie ursprünglich von der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF vorgesehen, außerhalb<br />
der <strong>Stadt</strong>). Beide Ziele wurden erreicht, Zweiteres vor allem durch Kompensationszahlungen<br />
in Höhe von FFR 800 Mio. (ca. € 120 Mio.) durch den Staat, die Region <strong>und</strong> die <strong>Stadt</strong> an die<br />
SNCF. Anfänglicher Widerstand von Kommunen in der Umgebung wurde durch vielfältige<br />
Zusicherungen <strong>und</strong> Kompensationsmaßnahmen gebrochen. 231<br />
Kurz nach der offiziellen Entscheidung für Lille als TGV-Halt 1987 wurde mit Euralille-<br />
Métropole eine Studien-PPP ins Leben gerufen, welche die Machbarkeit eines urbanen<br />
Entwicklungsprojekts im Zusammenhang mit dem neuen <strong>Bahnhof</strong> überprüfen sollte. Direktor<br />
dieser Organisation wurde ein ehemaliger Präsident der Bank Credit Lyonnais <strong>und</strong> guter<br />
Fre<strong>und</strong> von Mauroy, <strong>und</strong> weitere einflussreiche Persönlichkeiten traten ihr bei, ebenso wie<br />
verschiedene Banken, die SNCF <strong>und</strong> die IHK. In der Folge wurde entschieden, dass ein<br />
zweiter <strong>Bahnhof</strong> für die internationalen TGVs entstehen sollte – dies geschah aufgr<strong>und</strong><br />
technischer Überlegungen; das großflächige, ehemals militärisch genutzte Areal dazu wurde<br />
der <strong>Stadt</strong> vom Staat für einen symbolischen Betrag überlassen. Entschieden wurde ferner,<br />
dass zwischen dem alten <strong>und</strong> dem neuen <strong>Bahnhof</strong> ein internationales Geschäftszentrum mit<br />
diversifiziertem Angebot (Büros, Dienstleistungen, Geschäfte, Wohnungen, Kulturangeboten,<br />
öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> Freiräumen) entstehen sollte. Nachdem diese<br />
230<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 73.<br />
231<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 74.<br />
130
Rahmenbedingungen gesetzt waren, wurde 1988 Rem Koolhaas als Gewinner eines<br />
inhaltlichen Wettbewerbs zum Architekten des gesamten Projekts gewählt. 232<br />
Ab dieser Zeit waren vor allem drei in Arbeitsteilung arbeitende Akteure Maßgeblich für die<br />
Entwicklung des Projekts: Der Bürgermeister Mauroy war für politische Kontakte (zu<br />
Institutionen <strong>und</strong> der Bevölkerung) zuständig, der Architekt Koolhaas für die technische<br />
Koordination (v.a. der vielen Berater), <strong>und</strong> der Direktor von Euralille-Métropole für<br />
operationelle Kontakte (zu Investoren, Entwicklern <strong>und</strong> Nutzern). Im Laufe des folgenden<br />
Jahres wurden Investoren für die einzelnen Projektteile gef<strong>und</strong>en sowie das gesamte Projekt<br />
weiter ausgearbeitet <strong>und</strong> (u.a. den Konditionen der Investoren) angepasst. Darauf folgend<br />
wurde das Projekt innerhalb eines Jahres in zwei R<strong>und</strong>en vom <strong>Stadt</strong>rat besprochen <strong>und</strong><br />
anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach einigen Änderungen betreffend der<br />
baulichen Integration des Komplexes wurde anhand von Meinungsumfragen die Zustimmung<br />
der Bevölkerung festgestellt. Insgesamt gab es wenig Widerstand gegen das Vorhaben, <strong>und</strong><br />
die meisten Gegner des Projekts konnten mit der Zeit für das Vorhaben gewonnen<br />
werden. 233<br />
Direkt nach der Zustimmung des Städteverb<strong>und</strong>s zum Projekt wurde die Studien-PPP in eine<br />
Entwicklungs-PPP umgewandelt, die wiederum von Mauroy präsidiert wurde. In ihr<br />
vertretene öffentliche Akteure waren Lille <strong>und</strong> andere Städte der Region, der Städteverb<strong>und</strong>,<br />
die Provinz <strong>und</strong> die Region. Private Investoren waren mehrere regionale, nationale <strong>und</strong><br />
internationale Banken sowie ein Versicherungsunternehmen. Die SNCF <strong>und</strong> die IHK von Lille<br />
waren ebenfalls beteiligt. Für die Planung wurde eine spezielle Entwicklungszone<br />
ausgewiesen, über welche die Entwicklungs-PPP vom Städteverb<strong>und</strong> die Vollmacht erhielt.<br />
Mit dem Bau wurde 1991 begonnen, 1994 wurden der neue <strong>Bahnhof</strong> Lille-Europe, das<br />
Kongresszentrum Lille Grand Palais sowie das gemischt genutzte Centre Euralille eröffnet.<br />
Ein Jahr später erfolgte die Eröffnung der zwei Bürotürme (Credit Lyonnais <strong>und</strong> World Trade<br />
Centre). Durch Schwierigkeiten bei der Finanzierung einzelner Projektelemente wurde die<br />
Umsetzung zum Teil verzögert, wovon die Realisierung der Hauptelemente allerdings nicht<br />
beeinträchtigt war. 234<br />
Insgesamt kann nach Newman <strong>und</strong> Thornley Euralille bezeichnet werden als eine Mischung<br />
mehrerer kleiner, von privaten Investoren finanzierten Projekten, innerhalb eines vom<br />
öffentlichen Sektor definierten Masterplans, koordiniert durch eine nominell gemischte, aber<br />
in Realität durch den öffentlichen Sektor kontrollierte, Managementorganisation. 235<br />
Bemerkenswert am Planungs- <strong>und</strong> Umsetzungsprozess sind auch die Art der Anpassungen<br />
der Dimensionen <strong>und</strong> des Inhalts des Projektes an sich ändernde wirtschaftliche <strong>und</strong><br />
232<br />
Ebenda, S. 75.<br />
233<br />
Ebenda, S. 75f.<br />
234<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 76f <strong>und</strong> 80.<br />
235<br />
Newman, Peter <strong>und</strong> Thornley, Andy (1995): Euralille: ‚Boosterism’ at the Centre of Europe. European Urban and<br />
Regional Studies, 2 (3), S. 242. Eigene Übersetzung aus Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The<br />
Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon, London. S. 81.<br />
131
politische Rahmenbedingungen. Während die Eckpunkte <strong>und</strong> identitätsstiftenden Gebäude<br />
von Anfang an beibehalten wurden, war der Umgang mit der restlichen Umsetzung flexibel:<br />
Das gesamte Programm bestand diesbezüglich aus unabhängigen <strong>und</strong> überschaubaren<br />
Projekten, die von autonomen Entwicklern im Rahmen des Gesamtkonzepts umgesetzt<br />
wurden. 236<br />
4.3.3 Entwicklungschancen <strong>und</strong> Konsequenzen im lokalen Kontext<br />
These 3: Entwicklungsvorhaben im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld bringen sowohl positive als auch<br />
negative Faktoren mit sich. Die Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes kann dabei von<br />
bestimmten Nutzungen dominiert werden.<br />
Seit 2003 besuchen täglich ca. 160.000 Gäste das von ECE betriebene Einkaufszentrum, das<br />
im Hauptbahnhof Leipzigs untergebracht ist, davon nur 30.000 Reisende. 237 Die<br />
Funktionsanreicherung des <strong>Bahnhof</strong>s ist auch ein Impuls bzw. ein Startpunkt für die<br />
Belebung der Einzelhandelsentwicklung der Innenstadt. 238 Die neuen Entwicklungen werden<br />
von den Leipzigern sehr gut angenommen, <strong>und</strong> „der <strong>Bahnhof</strong> hat zur urbanen Struktur<br />
beigetragen,... früher war der <strong>Bahnhof</strong>sbereich eine Zäsur in der <strong>Stadt</strong>, heute ist der<br />
<strong>Bahnhof</strong> mit der Innenstadt zusammengeschmolzen“ 239 .<br />
Stellen wir uns einmal vor, dass der <strong>Bahnhof</strong> an Verkehrsfunktion verlöre, könnte das<br />
Einkaufszentrum dort trotzdem lebensfähig sein, wenn statistisch gesehen nur 18.75% der<br />
Einkaufgäste Bahnpassagiere sind? Würde die Innenstadt noch lebendig bleiben? Eine<br />
Tatsache kann festgestellt werden: die Innenstadtentwicklung ist nicht nur wegen des<br />
Anschlusses ans Schnellbahnnetz zustande gekommen. Sonst wäre z.B. auch im<br />
Freiladebahnhof-Ost, der nordöstlich vom Hauptbahnhof liegt, schon längst eine Entwicklung<br />
zu bemerken (intensive Bemühungen wie Voruntersuchungen für eine städtebauliche<br />
Entwicklungsmaßnahme, Machbarkeitsstudien <strong>und</strong> Rahmenplanungen für eine neue<br />
Entwicklung dieses Gebietes gibt es schon seit 1998 240 ).<br />
Die Standortfaktoren für die Investitionen <strong>und</strong> wirtschaftliche Entwicklung sind im<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld nicht gleichmäßig. Manche Flächen besitzen verschiedene Faktoren, die für<br />
eine neue Entwicklung notwendig sind, während die anderen Flächen sehr negative<br />
Konditionen aufweisen können. Allgemein gesagt, hat ein <strong>Bahnhof</strong>sumfeld einige positive<br />
Standortfaktoren 241 :<br />
- sehr gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr<br />
236<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 84.<br />
237<br />
Expertengespräch mit Herrn Beck, ECE Centermanagement in Leipzig am 31.05.2007<br />
238<br />
Expertengespräch mit Herrn Wolff, <strong>Stadt</strong>planungsamt Leipzig am 31.05.2007<br />
239<br />
Expertengespräch mit Herrn Wolff, <strong>Stadt</strong>planungsamt Leipzig am 31.05.2007<br />
240<br />
<strong>Stadt</strong> Leipzig, Dezernat <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> Bau (2003): Bahnflächen als Potenziale der <strong>Stadt</strong>entwicklung (=<br />
Beiträge zur <strong>Stadt</strong>entwicklung 39). S. 63.<br />
241<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 41.<br />
132
- assoziierter großer Menschenfluss<br />
- (in den meisten Fällen) die Nachbarschaft zum historischen <strong>Stadt</strong>kern<br />
- Unterstützung der Entwicklung durch die <strong>Stadt</strong>politik<br />
Falls die obigen Faktoren vollständig erfüllt werden, sollten die lokale Wirtschaftsentwicklung<br />
<strong>und</strong> die lokalen Koalitionen für die Entwicklung betrachtet werden, z. B.: Wie gut ist die<br />
aktuelle konjunkturelle Entwicklung? Wie gut ist eine Public-Private-Partnership für die<br />
Entwicklung organisiert?<br />
Manche Flächen haben aber viel schlechtere Konditionen für eine neue Entwicklung. Die gute<br />
Erreichbarkeit <strong>und</strong> gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr können auch Nachteile für<br />
manche Flächen bringen. Die benötigten Verkehrsflächen <strong>und</strong> Verkehrsanlagen beschränken<br />
ihre Zugänglichkeit <strong>und</strong> Sichtbarkeit. Einige Flächen haben sehr komplizierte<br />
Eigentumsverhältnisse. Allein die Erklärung der Tiefbauobjekte erschwert <strong>und</strong> verlangsamt<br />
die Vorbereitung der Entwicklung. Diese Splitterung der Zuständigkeit löst in der<br />
Planungsphase häufig Unklarheit <strong>und</strong> Konflikte aus, die Akteure haben dann am Anfang<br />
schon eine schwierige Gr<strong>und</strong>lage für die Zusammenarbeit. Und einige Fläche liegen zwar<br />
auch in der Nähe des historischen <strong>Stadt</strong>kerns, ihr Zugang zum <strong>Stadt</strong>kern kann aber sehr<br />
schlecht sein.<br />
Ferner tauchen auch Nachteile im Entwicklungsprozess auf, die nicht am Anfang stehen. Ein<br />
Hauptproblem bei der <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung sind die hohen Investitionskosten <strong>und</strong><br />
relativ niedrige Einnahmen oder lange plough-back-Phasen. 242 D.h. die Nutzungen mit dem<br />
Charakter „short-term“ <strong>und</strong> „high-return“ 243 werden bevorzugt, was aus unternehmerischer<br />
Sicht eine Entwicklung der Monofunktion ermöglicht. Das Problem wird noch weiter<br />
verschärft, wenn in Folge der Globalisierung der Wirtschaft das<br />
Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetzwerk einigen zentralen Städten in der jeweiligen<br />
räumlichen Verflechtung internationale Bedeutung verleiht, weil in solchen stärkeren<br />
Zentrenstädten dann die im internationalen Bezug bedeutsamen Funktionen bevorzugt<br />
werden, <strong>und</strong> geringerwertige Funktionen wie z.B. öffentliche Dienstleistungen <strong>und</strong><br />
Wohnsiedlungen verlagert werden.<br />
Eine deutlich bevorzugte Nutzung sind Büros. Aus stadtplanerischer Sicht sollte das<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld eine sinnvolle Integration von Bebauung mit gemischten <strong>und</strong> sich<br />
ergänzenden Nutzungen, Freiräumen <strong>und</strong> Verkehrsinfrastruktur sein. Eine dominante<br />
Nutzung wie Büros macht die Integration sehr schwierig. Die Büronutzung ist zwar aus<br />
unternehmerischer Sicht eine rentable Entwicklung, sie erzeugt aber sehr viel individuellen<br />
<strong>und</strong> öffentlichen Verkehr <strong>und</strong> beansprucht eine große Menge von Verkehrs- <strong>und</strong> Parkflächen,<br />
die sehr viele Kosten verursachen <strong>und</strong> häufig Probleme beim Betreiben darstellen. Der<br />
242<br />
Ebenda, S. 41.<br />
243<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 40.<br />
133
verursachte Verkehr konzentriert sich außerdem auf einen bestimmten arbeitszeitbedingten<br />
Zeitraum, was die Verdichtung noch mal verstärkt. Ferner verursacht die Dominanz der<br />
Büronutzung Sicherheitsprobleme. Nach der Arbeitszeit sind die Bürogebäude <strong>und</strong> ihr Umfeld<br />
menschenleer <strong>und</strong> die soziale Kontrolle wird schwächer: dieses Phänomen beängstigt<br />
potenziale Fußgänger <strong>und</strong> Nutzer, 244 wie z.B. das Börsenviertel in Frankfurt a. M. zeigt.<br />
Mit einer Analyse der Nutzungsstruktur soll die Problematik bei den Entwicklungsprozessen<br />
im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld ausführlicher betrachtet werden.<br />
4.3.4 Nutzungsstruktur<br />
These 3a: Auswirkungen auf Nutzungen im Umfeld: Im Zusammenhang mit<br />
Entwicklungsprojekten (direkt) <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ener Bodenpreissteigerung (indirekt) wird<br />
Wohnnutzung zunehmend zugunsten von Büro- <strong>und</strong> Einzelhandelsflächen verdrängt. Es<br />
findet zum Teil eine Entmischung statt.<br />
Während Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude an Bahnhöfen vor einigen Jahren noch fast<br />
ausschließlich im Lichte ihrer Transportfunktionen gesehen wurden, so gelten sie heute<br />
zunehmend als Potenziale für die Erwirtschaftung von Gewinnen. Wie Bertolini <strong>und</strong> Spit an<br />
mehreren europäischen Betrachtungsbeispielen zeigen, führen hohe Entwicklungskosten in<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldern in Verbindung mit eingeschränkter öffentlicher Förderung zu eher<br />
kurzfristigen Investitionsansätzen mit hoher Renditeerwartung: Während Büronutzungen die<br />
meisten Planungen dominieren, gehören insbesondere auch Geschäftsnutzungen zum<br />
Standardrepertoire. 245 Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Oosten: „The development<br />
of railway station areas not only meets requirements or wishes with regard to the transport<br />
network and the urban situation. The exploitation of railway infrastructure almost demands<br />
additional commercial development, it seems.“ 246 Bereits an dieser Stelle zeigt sich der enge<br />
Zusammenhang mit dem Thema der Boden- <strong>und</strong> Mietpreisentwicklung im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld,<br />
auf das im nächsten Abschnitt eingegangen wird.<br />
Nach Bertolini <strong>und</strong> Spit ist diese Entwicklungstendenz auch im Kontext der Globalisierung zu<br />
sehen, wobei ein gleichzeitiger Dekonzentrationsprozess auf überörtlicher Ebene <strong>und</strong> ein<br />
selektiver (Re)Konzentrationsprozess bestimmter Nutzungen in Kerngebieten wie auch in<br />
peripheren Lagen zu beobachten ist. In diesem Sinne konstatieren sie, dass „Dynamic<br />
station areas are among the places where both global connection and local disconnection are<br />
expressed in their most radical forms.“ 247 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch<br />
Bartkowiaks Feststellung, dass viele der geplanten Bauprojekte aus einer internationalen<br />
244<br />
Ebenda, S. 43.<br />
245<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 39f.<br />
246<br />
Oosten, Wouter-Jan (2000): Railway stations and a geography of networks. Paper presented at the 6th Annual<br />
Congress of the Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics. Online unter:<br />
www.eur.nl/WebDOC/doc/fsw/fswalg20010507142923.<strong>pdf</strong>. S. 6.<br />
247<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 38.<br />
134
Betrachtungsperspektive (aufgr<strong>und</strong> der weiter unten beschriebenen Prozesse der<br />
Gr<strong>und</strong>stücksverwertung) „bezogen auf ihre Zielrichtung <strong>und</strong> das damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Verwertungsinteresse, vereinheitlicht werden können. Letztlich bedeutet dies, dass sich das<br />
für Gentrifizierungs-Projekte zu konstruierende baulich-räumliche Ambiente längst<br />
international standardisiert hat.“ 248<br />
Diese Art Entwicklungsprojekte haben tiefgreifende Auswirkungen auf das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld.<br />
Bezug nehmend auf die <strong>Bahnhof</strong>21-Projekte stellt Hoffmann-Axthelm fest: „Die <strong>Stadt</strong><br />
bezahlt faktisch den neuen <strong>Bahnhof</strong>styp mit dem Verlust des klassischen<br />
<strong>Bahnhof</strong>sviertels.“ 249 Dass dies zumindest bei den „21er Projekten“ zum Teil durchaus auch<br />
der Intention entspricht, zeigt sich etwa an den Zielsetzungen von Seiten der Bahn, dass die<br />
City zum <strong>Bahnhof</strong> hin erweitert werden soll bzw. dass „Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umfelder wieder in<br />
das innerstädtische Leben integriert werden“ können. 250 Allerdings steht etwa mit<br />
Stuttgart21 oder München21 die Realisierung einiger der größten <strong>Bahnhof</strong> 21-Projekte noch<br />
aus. Relativierend ist ferner hinzuzufügen, dass viele neu realisierte Um- <strong>und</strong><br />
Ausbaumaßnahmen (u.a. aufgr<strong>und</strong> mittlerweile gedämpfter Erwartungen) deutlich weniger<br />
umfassend sind als in den frühen 1990er Jahren projektiert.<br />
Realisierte bzw. geplante Nutzungsstrukturen ergeben sich gemäß Bartkowiak aus den<br />
hervorragenden innerstädtischen Lagen der Flächenpotenziale in <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern. Dabei<br />
„steht die Tertiärisierung ehemaliger Bahnverkehrsflächen durch einen marktorientierten<br />
Nutzungs-Mix“ im Mittelpunkt. Üblich ist eine Kombination dienstleistungsbezogener<br />
Gewerbeimmobilien (Büro, Shopping-Center, höherwertige Gewerbefläche) mit<br />
kommerziellen Kultur- <strong>und</strong> Freizeitimmobilien (Musicaltheater, Großkino) <strong>und</strong>/oder mit<br />
zielgruppenorientierten Wohnimmobilien zu neuen, multifunktionalen oder gemischtgenutzten<br />
Großimmobilien. Wie genau dieser „Nutzungs-Mix“ zusammengesetzt ist, hängt –<br />
wie im Folgenden zu sehen ist – von der Projektträgerschaft <strong>und</strong> deren konzeptionellen<br />
Ansätzen ab. 251<br />
Bezüglich der Standortentwicklungsziele bei größeren Vorhaben im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld ist aus<br />
Bartkowiaks Betrachtung von Fallbeispielen 252 ersichtlich, dass die Ziele seitens Städtebau<br />
<strong>und</strong> Strukturpolitik an einer „baulich-räumlich differenzierten Neuordnung des jeweiligen<br />
248 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 360.<br />
249 Hoffmann-Axthelm, Dieter (1996): <strong>Stadt</strong>unterfahrung: Zu einer modischen Wendung im Verhältnis von <strong>Stadt</strong><br />
<strong>und</strong> Bahn. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ<br />
(Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S.<br />
230.<br />
250 Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden. S. 13f.<br />
251 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 341.<br />
252 Es handelt sich dabei um fünf Großprojekte an Bahnhöfen <strong>und</strong> in deren Umfeldern der Städte Bremen<br />
(Promotion Park), Essen (Passarea), Frankfurt/Main (Frankfurt 21), Stuttgart (Stuttgart 21) <strong>und</strong> München<br />
(München 21).<br />
135
Gebietes unter den Prämissen einer Innenstadterweiterung oder -ergänzung“ orientiert sind:<br />
„Monostrukturen sollen vermieden, vielfältige Quartiere geschaffen <strong>und</strong> erhalten werden.“<br />
Im Vergleich dazu liegen die Prioritäten der ökonomisch orientierten Projektträger auf einer<br />
„Mischung verschiedener, vorwiegend gewerblicher Nutzungen <strong>und</strong> ihrer Vermarktung“.<br />
Resultat der Vermittlung dieser beiden unterschiedlichen Ausrichtungen war bei den<br />
Fallstudien „eine Planung von Standorten mit hochwertigen tertiären Nutzungen, die in<br />
hoher städtebaulicher Qualität mit Grün- <strong>und</strong> Wohnbereichen kombiniert werden.“ 253<br />
In ihrer Gewichtung betrachtet stellt bei den Fallbeispielen dann auch das Segment der<br />
Gewerbeimmobilien in allen Beispielfällen eindeutig den Schwerpunkt dar, wobei Büroflächen<br />
ausnahmslos die Hauptnutzungsart sind. Während kommerzielle Kultur- <strong>und</strong><br />
Freizeiteinrichtungen als „Frequenzbringer“ integriert werden, spielt die Wohnnutzung eine<br />
vergleichsweise untergeordnete Rolle oder sie ist gar nicht eingeplant. 254<br />
Im Folgenden sollen anhand des Beispiels EuroVille am Basler <strong>Bahnhof</strong> SBB/SNCF einige<br />
Entwicklungstendenzen bezüglich den Veränderungen der Nutzungsstruktur illustriert<br />
werden. Hinzuweisen ist auch auf das Beispiel Euralille am <strong>Bahnhof</strong> Lille-Europe (siehe dazu<br />
oben <strong>und</strong> Kapitel 8.3.1).<br />
Beispiel EuroVille, <strong>Bahnhof</strong> Basel SBB/SNCF: Seit den frühen 1980er Jahren befindet<br />
sich mit dem Projekt EuroVille ein umfassendes Ausbauprojekt direkt am <strong>und</strong> um den<br />
<strong>Bahnhof</strong> Basel SBB/SNCF in Arbeit. Das Projekt umfasst insgesamt 25 Neu- <strong>und</strong><br />
Umbauvorhaben 255 , die auf eine intensivierte Nutzung <strong>und</strong> Aufwertung des Standorts<br />
hinzielen <strong>und</strong> vornehmlich auf Geschäfts- <strong>und</strong> Büronutzungen ausgerichtet sind (siehe dazu<br />
Abb. 31). Übergeordnetes Ziel ist es, „das <strong>Bahnhof</strong>sgebiet als Verkehrsdrehscheibe <strong>und</strong> als<br />
Dienstleistungszentrum für die <strong>Stadt</strong> Basel zu entwickeln“. 256 Dies soll mittels großen,<br />
gestalterisch anspruchsvollen (Büro)Gebäuden geschehen, wobei von den geplanten ca.<br />
175.000 m 2 Bruttogeschossfläche r<strong>und</strong> 90% als Arbeitsfläche, die restlichen 10% als<br />
Wohnfläche ausgewiesen sind. So soll im Laufe der Zeit am <strong>und</strong> um den <strong>Bahnhof</strong> ein neues<br />
Arbeitszentrum mit Platz für ca. 5.500 Beschäftigte entstehen. 257<br />
253 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 338f.<br />
254 Ebenda, S. 341.<br />
255 www.be-active.ch/passerelle: Passerelle Basel SBB. - Zugriff am 26.06.2007<br />
256 Krütli, Pius et al. (2005): <strong>Bahnhof</strong> SBB/SNCF: Treibende Kraft bei der Entwicklung der städtischen Umgebung.<br />
In: Scholz, Roland W. et al. (Hrsg.): Bahnhöfe in der <strong>Stadt</strong> Basel: Nachhaltige <strong>Bahnhof</strong>s- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
in der trinationalen Agglomeration. ETH-UNS Fallstudie 2004. Verlag Rüegger, Zürich, Chur. S. 97.<br />
257 Ebenda, S. 97.<br />
136
Abb. 29: Projekte von EuroVille<br />
Anstoß <strong>und</strong> Motivation für das Projekt EuroVille kamen ursprünglich vom Kanton Basel-<strong>Stadt</strong><br />
wie auch von den Schweizerischen B<strong>und</strong>esbahnen SBB. Die in ihren räumlichen<br />
Wachstumsmöglichkeiten stark beschränkte <strong>Stadt</strong> sah im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld eine der wenigen<br />
Chancen, dem wachsenden Dienstleistungssektor innerhalb der städtischen Grenzen Raum<br />
zu bieten. Auf diese Weise sollten sowohl neue wirtschaftliche Entwicklungen gefördert<br />
werden als auch indirekt der große Druck auf den städtischen Wohnungsmarkt erleichtert<br />
werden. Die SBB wollten ihrerseits im Rahmen des nationalen Bahn 2000-Programms die<br />
Transportkapazität des <strong>Bahnhof</strong>s verdoppeln sowie im Zuge einer verstärkten<br />
Marktorientierung u.a. das Potenzial ihrer innerstädtischen Gr<strong>und</strong>stücke besser ausnutzen.<br />
Mit der Schweizerischen Post PTT <strong>und</strong> dem angrenzenden Kanton Basel-Land kamen zwei<br />
weitere wichtige Partner dazu. 258<br />
Quelle: Krütli et al., S. 97<br />
Die konkreten, das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld direkt betreffenden Zielsetzungen des Projekts EuroVille<br />
beinhalten unter anderem: das <strong>Bahnhof</strong>sgebiet als Arbeits- <strong>und</strong> Wohnviertel zu aktivieren,<br />
das Wachstum des innerstädtischen Geschäftsviertels in Richtung <strong>Bahnhof</strong> zu fördern, den<br />
Konversionsdruck auf Wohngebiete durch den Dienstleistungssektor zu verringern, auf eine<br />
ökologische <strong>Stadt</strong>entwicklung hinzuarbeiten (mittels der Schaffung gut an den öffentlichen<br />
Verkehr angeb<strong>und</strong>ener Büroräume), sowie allgemein eine effizientere Nutzung der Flächen<br />
r<strong>und</strong> um den <strong>Bahnhof</strong> zu ermöglichen. 259 Ferner sollten die an den <strong>Bahnhof</strong> grenzenden<br />
<strong>Stadt</strong>teile besser miteinander verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> der „Hintereingang“ des <strong>Bahnhof</strong>s aufgewertet<br />
werden, um die Möglichkeiten der Gr<strong>und</strong>stücksentwicklung im bislang vom <strong>Stadt</strong>zentrum<br />
weitgehend abgeschnittenen G<strong>und</strong>eldinger Quartier südlich des <strong>Bahnhof</strong>s zu verbessern. 260<br />
258<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 152.<br />
259<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 159.<br />
260<br />
Ebenda, S. 164.<br />
137
Eine zentrale Rolle im Projekt EuroVille kommt somit der neuen Passerelle<br />
(„Fußgängerbrücke“) zu, die als Gleisüberführung im Jahr 2003 als Ersatz für eine frühere<br />
Unterführung eröffnet wurde (siehe Abb. 32). Neben ihrem Hauptzweck, der Erschließung<br />
der Bahnsteige, dient die 24 St<strong>und</strong>en am Tag geöffnete Passerelle auch der besseren<br />
fußläufigen Verbindung zwischen den recht unterschiedlichen <strong>Stadt</strong>gebieten südlich<br />
(„hinten“; dicht besiedeltes Wohnquartier) <strong>und</strong> nördlich („vorne“; Altstadt <strong>und</strong><br />
Geschäftsviertel) des <strong>Bahnhof</strong>s. In der Passerelle befinden sich auch zahlreiche Geschäfte,<br />
womit ihr <strong>und</strong> dem <strong>Bahnhof</strong> selbst zusätzlich eine kommerzielle Funktion zukommen, zumal<br />
nicht nur Bahnk<strong>und</strong>en, sondern auch viele andere Personen das Einkaufsangebot der<br />
Passerelle <strong>und</strong> des <strong>Bahnhof</strong>s nutzen. 261<br />
Abb. 30: Luftbild der Passerelle von Südwesten <strong>und</strong> Passerelle von Innen<br />
Quelle: www.itten-brechbuehl.ch Quelle: www.sengers.ch<br />
Welche Wirkung haben die neue Passerelle <strong>und</strong> die Bürogebäude auf die Entwicklung der<br />
umliegenden <strong>Stadt</strong>teile? Da die Um- <strong>und</strong> Neubaumassnahmen am Basler <strong>Bahnhof</strong> SBB/SNCF<br />
<strong>und</strong> in seiner Umgebung noch nicht vollständig beendet sind, kann diesbezüglich noch kein<br />
abschließendes Urteil gefällt werden. Für das G<strong>und</strong>eldinger Quartier im Süden scheint<br />
insbesondere durch die Passerelle tatsächlich eine wesentlich bessere Anbindung an den<br />
<strong>Bahnhof</strong> sowie die übrige <strong>Stadt</strong> gelungen zu sein; die Auswirkungen des noch zu<br />
vollendenden Gebäudekomplexes Südpark bleiben abzuwarten. Nach Einschätzungen von<br />
Vertretern des „Neutralen Quartiervereins G<strong>und</strong>eldingen“ <strong>und</strong> der „Interessen-Gemeinschaft<br />
G<strong>und</strong>eldinger- <strong>und</strong> Bruderholz-Geschäfte“ wird v.a. durch die Passerelle eine höhere<br />
Besucherzahl <strong>und</strong> damit eine Geschäftsbelebung im Quartier erhofft. Während die<br />
Quartiersgeschäfte gegenüber verlängerten Öffnungszeiten eine ablehnende Haltung<br />
einnehmen, wird beim <strong>Bahnhof</strong> eine andere Ausgangslage <strong>und</strong> damit eher eine<br />
261 Krütli, Pius et al. (2005): <strong>Bahnhof</strong> SBB/SNCF: Treibende Kraft bei der Entwicklung der städtischen Umgebung.<br />
In: Scholz, Roland W. et al. (Hrsg.): Bahnhöfe in der <strong>Stadt</strong> Basel: Nachhaltige <strong>Bahnhof</strong>s- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
in der trinationalen Agglomeration. ETH-UNS Fallstudie 2004. Verlag Rüegger, Zürich, Chur. S. 96.<br />
www.railcity.ch/index_basel.htm: RailCity Basel. - Zugriff am 25.06.2007. www.be-active.ch/ passerelle:<br />
Passerelle Basel SBB. - Zugriff am 26.06.2007<br />
138
Komplementarität gesehen. Als Risiko wird eine mögliche Mietpreissteigerung im Umfeld<br />
betrachtet. 262 Dies könnte allerdings durchaus geschehen: „An important aspect here is the<br />
improvement of connections across the tracks, and the upgrading of the entrance to the<br />
station on the south (non-city) side, in order to open up property development opportunities<br />
in areas until now virtually cut off from the historic centre.“ 263<br />
Für beide Seiten des <strong>Bahnhof</strong>s besteht die Gefahr, dass – im Kontrast zum gesetzten Ziel<br />
der besseren funktionalen <strong>und</strong> räumlichen Verbindung – vor allem nachts durch den<br />
deutlichen Schwerpunkt der Büro- <strong>und</strong> Geschäftsnutzung eine verstärkte Barrierewirkung<br />
zwischen den angrenzenden <strong>Stadt</strong>teilen <strong>und</strong> dem <strong>Bahnhof</strong> zustande kommt. Zur Vermeidung<br />
eines solchen Effekts wird in der ETH-UNS Fallstudie zu Bahnhöfen in der <strong>Stadt</strong> Basel für die<br />
bewusste Schaffung „sozialer Hecken – analog den Hecken im Naturraum, die Lebensräume<br />
vernetzen helfen“ durch einen genügend großen Wohnanteil plädiert. 264 In wiefern ein<br />
solches Ziel auch von den Projektentwicklern <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong> umgesetzt wird, bleibt noch zu<br />
sehen <strong>und</strong> hängt nicht zuletzt von der Entwicklung der ökonomischen Rahmenbedingungen<br />
der einzelnen Projekte ab. Ob die bislang vorgesehenen 10% Wohnfläche in den Büro- <strong>und</strong><br />
Geschäftsgebäuden für eine derartige Vernetzung ausreichen wird, ist allerdings zweifelhaft.<br />
4.3.5 Ökonomische Aspekte<br />
These 3b: Auswirkungen auf ökonomische Aspekte: Im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld kommt es zu einer<br />
selektiven Bodenpreissteigerung. Dies betrifft v.a. sichtbare, gut angeb<strong>und</strong>ene Bereiche<br />
des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds mit klaren Eigentumsverhältnissen. Andere Gebiete werden vorerst<br />
nicht in die Planungen mit einbezogen.<br />
Großprojekte, wie es die meisten großstädtischen Bauvorhaben an Bahnhöfen <strong>und</strong> in deren<br />
Umfeld sind, können (im positiven wie im negativen Sinne) einen erheblichen Einfluss auf<br />
angrenzende Gebiete entfalten. Besonders deutlich <strong>und</strong> nachhaltig spürbar können sich<br />
dabei Boden- bzw. Mietpreiserhöhungen auswirken – ein Effekt, der (zumindest im<br />
Projektgebiet) direkt erzielt wird, da sich insbesondere durch PPPs <strong>und</strong> private Investoren<br />
finanzierte Vorhaben in der Regel auch „rechnen“ sollen.<br />
Um den Kontext dieser Entwicklungen besser zu verstehen, werden zunächst einige<br />
Rahmenbedingungen der Entwicklung innerstädtischer Gr<strong>und</strong>stücksmärkte <strong>und</strong><br />
innerstädtischer Gr<strong>und</strong>stücke wie solchen im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld betrachtet:<br />
Gemäß Bartkowiak findet seit einiger Zeit ein „Formwandel der Gr<strong>und</strong>stücksverwertung“<br />
statt: Er stellt im Allgemeinen sowie konkret anhand der von ihm untersuchten<br />
262<br />
www.be-active.ch/passerelle: Passerelle Basel SBB. - Zugriff am 26.06.2007<br />
263<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 164.<br />
264<br />
Stauffacher, Michael et al. (2005): Bahnhöfe als Schlüssel nachhaltiger Mobilität <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung:<br />
Entwicklungsperspektiven für die <strong>Stadt</strong> Basel <strong>und</strong> die TAB. In: Scholz, Roland W. et al. (Hrsg.): Bahnhöfe in der<br />
<strong>Stadt</strong> Basel: Nachhaltige <strong>Bahnhof</strong>s- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung in der trinationalen Agglomeration. ETH-UNS Fallstudie<br />
2004. Verlag Rüegger, Zürich, Chur. S. 47.<br />
139
Fallbeispiele 265 fest, dass in der städtischen Gr<strong>und</strong>stücksverwertung „Boden als so genanntes<br />
zukünftiges Kapital verwertet“ <strong>und</strong> ausschließlich als Kapitalanlage – vergleichbar mit Aktien<br />
oder Wertpapieren – gehandelt wird. 266 (So hat z.B. auch die Deutsche Bahn<br />
Immobiliengesellschaft DB Immobilie AG die Aufgabe, „Durch effizientes betriebliches<br />
Liegenschaftsmanagement ... den Immobilienbesitz zu veredeln <strong>und</strong><br />
Wertschöpfungspotentiale zu generieren. Die Erlöse fließen dem Mutterkonzern zu <strong>und</strong> sollen<br />
dort die finanziellen Spielräume für Investitionen in das Bahnsystem erhöhen.“ 267 ) Es findet<br />
also ein An- <strong>und</strong> Verkauf von Ansprüchen auf zukünftige Gr<strong>und</strong>rentenerträge statt, wodurch<br />
sich auch die „Preisbildung für Gr<strong>und</strong>stücke ... immer weniger auf das aktuell erzielte<br />
Gr<strong>und</strong>rentenniveau, sondern auf antizipierte, künftig erzielbare Gr<strong>und</strong>renten“ bezieht. 268<br />
Eine zentrale Voraussetzung für diese Entwicklung von Gr<strong>und</strong>eigentum zu finanziellem<br />
Anlageobjekt sieht Bartkowiak (wie auch Krätke) in der Verdrängung traditioneller<br />
Gr<strong>und</strong>eigentümer. So befindet sich seit den 1970er Jahren innerstädtischer Gr<strong>und</strong>besitz<br />
zunehmend „in den Händen von Finanzinstitutionen (Banken, Versicherungen),<br />
Großunternehmen aller Art, <strong>und</strong> spezialisierten Immobilienunternehmen“. 269 Zu dieser<br />
Tendenz trägt sowohl der Druck der derzeitigen stadtentwicklungspolitischen<br />
Rahmenbedingungen auf die Kommunen als auch die Größenordnung <strong>und</strong> Komplexität vieler<br />
Entwicklungsvorhaben (wie auch jener im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld) bei: Der Gr<strong>und</strong>besitz bleibt oder<br />
wechselt in eine Hand. 270<br />
Wird – wie immer häufiger der Fall zu sein scheint – der Boden als reine Kapitalanlage<br />
betrachtet, so verfolgen die Eigentümer das Ziel, das Rentenaufkommen ihrer Gr<strong>und</strong>stücke<br />
möglichst zu maximieren. Mittel zu diesem Zweck ist nach Krätke ein „Umbau der Städte in<br />
Form der Neuschaffung von baulich-räumlichen Arrangements“. Dabei wird insbesondere<br />
versucht, u.a. durch aktives Marketing, im Sinne einer Produktdifferenzierung „privilegierte“<br />
Standorte zu schaffen, um Monopolrenten zu realisieren. Dabei spielt immer auch ein<br />
„spekulatives Moment“ eine Rolle. 271 So heißt es etwa auch zum oben aufgeführten Beispiel<br />
EuroVille in Basel: „The institutional partners are optimistic about the market response. They<br />
see their investment as strategic and long-term. They are not looking for immediate profits,<br />
265 Es handelt sich dabei um fünf Großprojekte an Bahnhöfen <strong>und</strong> in deren Umfeldern der Städte Bremen<br />
(Promotion Park), Essen (Passarea), Frankfurt/Main (Frankfurt 21), Stuttgart (Stuttgart 21) <strong>und</strong> München<br />
(München 21).<br />
266 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 357.<br />
267 Ebenda, S. 265.<br />
268 Krätke, Stefan (1995): <strong>Stadt</strong> – Raum – Ökonomie: Einführung in aktuelle Problemfelder der <strong>Stadt</strong>ökonomie <strong>und</strong><br />
Wirtschaftsgeographie. Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin. S. 222f.<br />
269 Ebenda, S. 223.<br />
270 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 358.<br />
271 Krätke, Stefan (1995): <strong>Stadt</strong> – Raum – Ökonomie: Einführung in aktuelle Problemfelder der <strong>Stadt</strong>ökonomie <strong>und</strong><br />
Wirtschaftsgeographie. Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin. S. 223f, 226.<br />
140
and they are confident in the future performance of the area. The site does not face<br />
competition within the urban region. “ 272<br />
In vielen Städten zeichnet sich durch diese Entwicklung ein zunehmender überlokaler<br />
Einfluss auf den Immobilienmarkt ab, zumal große bauliche Komplexe als bedeutende<br />
Kapitalanlageform in transnationalen Immobilienportfolios aufgenommen werden. 273 So<br />
spielten auch im oben aufgeführten Beispiel Euralille überörtliche <strong>und</strong> internationale<br />
Investoren (insbesondere Banken) eine zentrale Rolle bei der Realisierung verschiedener<br />
Projektelemente.<br />
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Entwicklung von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern?<br />
Aus obigen Prozessen – <strong>und</strong> insbesondere dem Wunsch zur Schaffung eines neuen,<br />
privilegierten Standorts – erklärt sich zum Teil ein allgemeines Problem bei innerstädtischen<br />
Großprojekten, welches auch bei großen Vorhaben im <strong>Bahnhof</strong>sbereich in Vorschein tritt:<br />
„Bahnhöfe sind ... häufig „Inselbetriebe“ <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>soffensiven sind häufig „Insellösungen“<br />
der Bahnverwaltungen mit geringer oder nicht gegebener Integration in die Städte <strong>und</strong><br />
<strong>Stadt</strong>viertel; das gilt auch dort, wo die Bahnverwaltungen mit privaten Investoren<br />
Einkaufszentren errichten (lassen), die dann ohne Integration <strong>und</strong> sogar bewusst in<br />
Konkurrenz <strong>und</strong> gegen die bestehenden Zentrenstrukturen der <strong>Stadt</strong> ausgebaut werden.“ 274<br />
Diese „Inselprojekte“ haben also einerseits einen deutlich spürbaren Einfluss auf ihre direkte<br />
Umgebung (das übrige <strong>Bahnhof</strong>sumfeld), andererseits wird tendenziell auf eine bewusste<br />
Abgrenzung gesetzt. Interessant ist in dieser Hinsicht das Ergebnis einer<br />
Passantenbefragung zum Leipziger Hauptbahnhof, aus der hervorging, dass eine deutliche<br />
Mehrheit positive Assoziationen mit dem <strong>Bahnhof</strong>sumfeld hat – allerdings „ist zu beachten,<br />
dass die Befragten mit <strong>Bahnhof</strong>sumfeld zum größten Teil den <strong>Bahnhof</strong>s(vor)platz gemeint<br />
haben. Dies ergibt sich aus den gegebenen Antworten. Das restliche <strong>Bahnhof</strong>sumfeld wird<br />
kaum wahrgenommen <strong>und</strong> mit diesem auch nicht in Verbindung gebracht.“ 275<br />
In diesem Zusammenhang steht auch, dass durch die Bestrebung der Investoren, ihre<br />
Gr<strong>und</strong>renten zu maximieren, eine räumlich selektive Konzentration von Investitionen<br />
gefördert wird, was wiederum zu einer Entwertung funktionsfähiger Raumstrukturen in<br />
benachteiligten Gebieten führt. 276 Es wäre daher zu erwarten, dass trotz bzw. eben gerade<br />
durch große Investitionsprojekte im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld neben den eigentlichen hochpreisigen<br />
Investitionsflächen auch „Grauzonen“ in weniger sichtbaren Bereichen übrig bleiben, die<br />
272<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway Station Areas. E & FN Spon,<br />
London. S. 162.<br />
273<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 358.<br />
274<br />
Staudacher, Christian (2002): <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> – Standort <strong>und</strong> Lebensgemeinschaft. In: Österreichische<br />
Gesellschaft für Wirtschaftsraumforschung (Hrsg.): Wirtschaftsgeographische Studien, Heft 27/28. Facultas<br />
Verlag, Wien. S. 31.<br />
275<br />
Bayazit, Cem et al. (2002): Filetstücke – ausländische Vorbilder. In: Österreichische Gesellschaft für<br />
Wirtschaftsraumforschung (Hrsg.): Wirtschaftsgeographische Studien, Heft 27/28. Facultas Verlag, Wien. S. 100.<br />
276<br />
Krätke, Stefan (1995): <strong>Stadt</strong> – Raum – Ökonomie: Einführung in aktuelle Problemfelder der <strong>Stadt</strong>ökonomie <strong>und</strong><br />
Wirtschaftsgeographie. Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin. S. 224.<br />
141
sowohl in ihrer Nutzungsstruktur wie auch in ihren Gr<strong>und</strong>stückswerten eher noch abgewertet<br />
werden.<br />
Auf bestehende Nutzungsstrukturen im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld wird bei größeren Um- <strong>und</strong><br />
Anbauprojekten in den meisten Fällen wahrscheinlich wenig Rücksicht genommen: „Die<br />
Behandlung von Gr<strong>und</strong>stücken als reine Finanzanlage bedeutet auch, dass die größeren<br />
Bauprojekte (insbesondere Büro- <strong>und</strong> Geschäftskomplexe) in den metropolitanen Zentren<br />
des Städtesystems häufig nur wenig mit der örtlichen Bedarfslage hinsichtlich bestimmter<br />
Nutzflächen zu tun haben, sondern primär als „gebaute Renditeerwartungen“ anzusehen<br />
sind.“ 277<br />
Ferner scheint sich bezüglich des Nutzungswandels bei Großprojekten im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld<br />
auch in diesem Zusammenhang eine räumlich selektive Konzentration auf Büro- <strong>und</strong><br />
Geschäftsnutzungen zu bestätigen <strong>und</strong> weiter zu erklären, da diese aufgr<strong>und</strong> der erzielbaren<br />
Monopolrenten von Projektentwicklern favorisiert werden. 278<br />
In Anbetracht der oben aufgeführten Punkte überrascht es auch wenig, dass es in der Regel<br />
bisher an ganzheitlichen Strategien zur Restrukturierung <strong>und</strong> Entwicklung von<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldern „als attraktive <strong>und</strong> eigenständige <strong>Stadt</strong>teile <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>zentren“ mangelt.<br />
Lokal ansässige Betriebe <strong>und</strong> die Bevölkerung werden eher selten ernsthaft in die<br />
Entwicklungsprozesse eingeb<strong>und</strong>en. 279<br />
Beispiel <strong>Bahnhof</strong> Kassel-Wilhelmshöhe: Ein interessantes Betrachtungsbeispiel,<br />
zumindest hinsichtlich des Effekts eines neuen Schnellbahnhofs auf die<br />
Gr<strong>und</strong>stückspreisentwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfelds, liefert der 1991 eröffnete <strong>Bahnhof</strong><br />
Kassel-Wilhelmshöhe, da eben diese Wirkung recht detailliert dokumentiert wurde. Der neue<br />
ICE-<strong>Bahnhof</strong> wurde anstelle eines vorherigen, für sein Umfeld wenig bedeutenden,<br />
Vorstadtbahnhofs errichtet. Um äußere Einflüsse herauszufiltern, wurde in der Studie die<br />
Entwicklung der Gesamtstadt jener im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld gegenübergestellt. 280 (Für weitere<br />
Informationen zu diesem Beispiel: Siehe Kapitel 5.2.3)<br />
Ergebnis der Betrachtung des Immobilienmarktes war, dass sich aufgr<strong>und</strong> des Projekts die<br />
Baulandpreise am <strong>Bahnhof</strong> Wilhelmshöhe mehr als verdoppelt haben, während sie in der<br />
Innenstadt im selben Zeitraum in etwa gleich blieben. Ähnlich entwickelten sich auch die<br />
Laden- <strong>und</strong> Büromieten recht unterschiedlich: Während sie am <strong>Bahnhof</strong> tendenziell stiegen<br />
277 Ebenda, S. 223.<br />
278 Siehe dazu z.B. Krätke, Stefan (1995): <strong>Stadt</strong> – Raum – Ökonomie: Einführung in aktuelle Problemfelder der<br />
<strong>Stadt</strong>ökonomie <strong>und</strong> Wirtschaftsgeographie. Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin. S. 223. Und Bartkowiak,<br />
Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung für<br />
<strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 359, 361.<br />
279 Staudacher, Christian (2002): <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> – Standort <strong>und</strong> Lebensgemeinschaft. In: Österreichische<br />
Gesellschaft für Wirtschaftsraumforschung (Hrsg.): Wirtschaftsgeographische Studien, Heft 27/28. Facultas<br />
Verlag, Wien. S. 30f.<br />
280 Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 241.<br />
142
oder auf gleichem Niveau blieben, wiesen sie in der Gesamt- bzw. Innenstadt eine<br />
stagnierende oder fallende Tendenz auf. Aufgr<strong>und</strong> dieser Ergebnisse wurde die These<br />
aufgestellt, dass der Impuls des neuen Hochgeschwindigkeitsbahnhofs nur in seiner Nähe<br />
deutlich zu spüren ist. 281<br />
Um die Stichhaltigkeit dieser These zu überprüfen, wurde eine „Impulsuntersuchung“<br />
durchgeführt, bei der alle Bauvorhaben der Jahre 1989-1995 in <strong>Bahnhof</strong>snahen <strong>Stadt</strong>teilen<br />
erfasst <strong>und</strong> in Abhängigkeit ihrer Luftlinienentfernung zum <strong>Bahnhof</strong> nach verschiedenen<br />
Kenngrößen ausgewertet wurden. Aus der Darstellung der Kenngrößen „Anzahl der<br />
Vorhaben/Fläche“, „Investitionen/Fläche“ sowie realisierte „Nutzfläche/Fläche“ im Verhältnis<br />
zu ihrer jeweiligen Entfernung zum <strong>Bahnhof</strong> ergab sich eine deutliche Stufung (siehe Abb.<br />
20, S. 104): Bis 200 m Entfernung „großer Impuls“, bis 400 m Entfernung „deutlich<br />
spürbarer Impuls“, <strong>und</strong> bis 600 m Entfernung „nachweisbarer Impuls“. In größerer<br />
Entfernung wurde „fast keine besondere Wahrnehmung mehr“ verzeichnet. 282 Was aus der<br />
Literatur leider nicht hervorgeht, ist inwiefern sich im näheren <strong>Bahnhof</strong>sumfeld auch<br />
„Grauzonen“ erhalten oder gebildet haben.<br />
In Kassel-Wilhelmshöhe war ein weiterer Aspekt der Selektivität von Standortentwicklungen<br />
zu beobachten, denn es gab auch einige Standorte außerhalb der fußläufigen Erreichbarkeit,<br />
die sich in Folge ihres besonders guten ÖPNV-Anschlusses an den <strong>Bahnhof</strong> zu<br />
Investitionsschwerpunkten entwickelten: „Die fußläufige Erreichbarkeit wird also sozusagen<br />
künstlich verlängert.“ 283<br />
Obwohl die <strong>Stadt</strong> Kassel gemäß Bartkowiak durch ihre Bauland- <strong>und</strong> Verkehrspolitik „recht<br />
erfolgreich“ versucht hat, „durchgreifende Veränderungen der Wohngebiete im <strong>Stadt</strong>teil<br />
Wilhelmshöhe zu verhindern <strong>und</strong> gleichzeitig die zentrale Funktion des <strong>Bahnhof</strong>s<br />
auszubauen“, wurde festgestellt, dass „die am ICE-<strong>Bahnhof</strong> getätigten Investitionen ... fast<br />
ausschließlich in den Dienstleistungs- <strong>und</strong> Einzelhandelsbereich flossen, dagegen kaum<br />
Wohnungen in unmittelbarer <strong>Bahnhof</strong>snähe realisiert wurden.“ 284<br />
Ähnliche Entwicklungen wie vor einigen Jahren in Kassel scheinen sich in den<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldern der Städte abzuzeichnen, die neuerdings an die Strecke des TGV-Ost<br />
angeb<strong>und</strong>en sind. So berichtete Spiegel Online: „"Der TGV beschert uns einen Schub von<br />
Investitionen", freut sich Jean-Yves Heyer, Direktor der Agentur Reims Champagne<br />
Développement <strong>und</strong> verweist auf 2000 neu geschaffene Arbeitsplätze in drei Jahren. Und der<br />
Trend hält an: In der Nähe des <strong>Bahnhof</strong>s werden zudem 120.000 Quadratmeter Wohnraum<br />
zu Bürofläche umgebaut. ... Nirgendwo ist die Erschließung per schneller Schiene so klar<br />
wahrnehmbar wie bei den Immobilienpreisen, manchmal auch zum Leidwesen den<br />
Anwohner: Zwischen dem Jahr 2000, als die Entscheidung zum Bau der Ost-Verbindung fiel,<br />
<strong>und</strong> 2006 klettern die Mieten; in Straßburg stiegen die Preise von 1439 Euro auf 2392 - eine<br />
281 Ebenda, S. 241.<br />
282 Ebenda, S. 241.<br />
283 Ebenda, S. 241-243.<br />
284 Ebenda, S. 243.<br />
143
Zunahme von gut 66 Prozent. In der Elsass-Metropole wird daher zügig am Ausbau der<br />
Büroflächen gebaut. Im ehemaligen Hafengebiet werden binnen der nächsten fünf Jahre<br />
r<strong>und</strong> 500.000 Quadratmeter gebaut.“ 285<br />
4.3.6 Soziale Aspekte<br />
These 3c: Auswirkungen auf soziale Aspekte: Es findet eine Veränderung der<br />
Nutzerstruktur statt sowie eine Verdrängung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Dies steht<br />
auch im Zusammenhang mit zielgruppenorientiertem Marketing.<br />
Gibt es nach einer Funktionsanreicherung des <strong>Bahnhof</strong>sgebäudes <strong>und</strong> der<br />
Kommerzialisierung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes noch öffentliche Räume? „ Heißt Öffentlichkeit<br />
Zugänglichkeit für jedermann“ oder sind „nur im Prinzip öffentliche Orte jedermann<br />
zugänglich“ 286 ?<br />
„1998 präsentiert die Deutsche-Bahn-Gruppe das 3-S-Programm: Service, Sicherheit <strong>und</strong><br />
Sauberkeit. Und dies soll durch 1000 Mitarbeiter des Tochterunternehmens Bahn Schutz &<br />
Service GmbH <strong>und</strong> 2200 Service-Angestellte der DB Service & Station AG sowie durch<br />
Videoüberwachung geschehen. Herzstück des Programms sind die 64 3-S-Zentralen.<br />
Großbahnhöfe verfügen über eigene Zentralen. Die Videoüberwachung kleinerer Bahnhöfe<br />
erfolgt durch eine nahe liegende Zentrale. Es ist möglich die Verwahrlosten zu entdecken,<br />
sie anzusprechen <strong>und</strong> in letzter Konsequenz aus dem <strong>Bahnhof</strong> zu begleiten, bevor sie sich<br />
längerfristig im <strong>Bahnhof</strong> niederlassen kann.“ 287<br />
Ein <strong>Bahnhof</strong>sumfeld in einer Großstadt wie Frankfurt, die an das europäische<br />
Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz angeschlossen ist <strong>und</strong> direkten Zugang zur Innenstadt<br />
hat, ist gleichzeitig auch Hochpreisgebiet für Boden, Immobilien <strong>und</strong> Mieten. Nur die<br />
hochpreisigen <strong>und</strong> liquiden Nutzer <strong>und</strong> Nutzungen wie Büro-, Dienstleistungs-, Urban<br />
Entertainment- <strong>und</strong> gehobene Einzelhandelsflächen sollen dort angesiedelt werden. Das<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld muss als Investitionsstandort das passende Klima für die entsprechende<br />
Klientel schaffen, öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung wird in diesem Sinne zu einem<br />
Standortfaktor der Investition, der durch die Sicherheitspolitik der Bahn abgesichert werden<br />
soll. Mit den Entwicklungszielen werden auch die gewünschten Nutzergruppen formuliert,<br />
nämlich in Frankfurt z. B. „der Bereich der hochrangigen Dienste“ 288 .<br />
In Frankfurt ist das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld mit langer Tradition <strong>und</strong> den Eigenschaften des<br />
<strong>Bahnhof</strong>sviertels verb<strong>und</strong>en. „Das Leben zeigt sich hier anders als im Inneren der <strong>Stadt</strong>, es<br />
285<br />
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,489489,00.html: Spiegel Online: Simons, Stefan (2007): Neue TGV-<br />
Strecke – Frankreich schrumpft. - Zugriff am 27.06.2007<br />
286<br />
Brunn, Burkhard et al. (1992): Der Hauptbahnhof wird <strong>Stadt</strong>tor. Zum Ende des Automobilzeitalters. Anabas-<br />
Verlag Günter Kämpf KG, Frankfurt a.M. S. 16.<br />
287<br />
Wehrheim, Jan (2002): Die überwachte <strong>Stadt</strong>. Sicherheit, Segregation <strong>und</strong> Ausgrenzung. In: Häußermann,<br />
Harmut et al. (Hrsg.): <strong>Stadt</strong>, Raum <strong>und</strong> Gesellschaft Band 17. Verlag Leske + Budrich, Opladen. S.135.<br />
288<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von Großstadtzentren, deren Bedeutung<br />
für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft. Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang<br />
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. S. 298.<br />
144
ist bunt... man sieht Menschen aller Art durcheinander wimmeln <strong>und</strong> die verschiedensten<br />
Dinge tun. Die <strong>Bahnhof</strong>slandschaft hat sich den Bedürfnissen von „Jedermann“ angepasst<br />
bzw. den Bedürfnissen, die man Jedermann unterstellt.“ 289 Im „unordentlichen“ Milieu<br />
befinden sich auch Lebensressourcen, auf die Obdachlose <strong>und</strong> schwächere Gruppen (Trinker,<br />
Drogenabhängige) angewiesen sind. Ihr Verhalten verunsichert jedoch viele <strong>Stadt</strong>bewohner<br />
<strong>und</strong> steht gegen die Bemühungen der innerstädtischen Einzelhandelsverbände <strong>und</strong><br />
Immobilienmakler. „Vertreter von lokalen Handels, Hotel- <strong>und</strong> Bankenzusammenschlüssen<br />
erklären, ‚Obdachlose seien aber wie Graffitis <strong>und</strong> Taubenkot, kein Anblick, der zur<br />
Steigerung von Attraktivität <strong>und</strong> Kaufkraft beiträgt’. Daher gehören die Obdachlosen<br />
weggeräumt.“ 290 Mit der Sicherheitsstrategie wird versucht, in den kommerzialisierten<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldern ihre Funktionen zu optimieren. Die Erscheinung von Randgruppen stellt<br />
einen Störfaktor für die Nutzer dar. „Öffentliche Sicherheit bedeutet nicht mehr nur den<br />
Schutz von Gr<strong>und</strong>rechten der <strong>Stadt</strong>bewohner, sie ist Voraussetzung dafür, Geschäfte zu<br />
machen, Investitionen zu akquirieren, Touristen anzulocken oder internationale Messen,<br />
Kongresse, Kultur- <strong>und</strong> sonstige Veranstaltungen durchzuführen....“ 291 Die unpassenden<br />
Nutzergruppen werden hier nach dem ökonomischen Ausschlusskriterium verdrängt. Ist der<br />
Einzelne lediglich an einem Ort lokalisiert, ohne über das vom sozialen Raum vorausgesetzt<br />
Kapital zu verfügen, so ist er dort deplaziert.<br />
Gleichfalls gilt das ökonomische Ausschlusskriterium für die zahlschwachen Nutzungen wie<br />
öffentliche Kultur- <strong>und</strong> Freizeiteinrichtungen, soziale Infrastruktur (Kita, Schule,<br />
Sozialstationen usw.), Wohnen (nicht hochrangig) <strong>und</strong> Freiräume. Diese Nutzungen werden<br />
ebenfalls verdrängt. Aber auch Nutzungen, die mit dem unordentlichen Image verb<strong>und</strong>en<br />
sind, sind unerwünscht. So versucht man in Frankfurt a. M., alle Bordellbetriebe aus dem<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld an andere Standorte zu verschieben. Ein Stück traditionelle Geschichte des<br />
<strong>Bahnhof</strong>sviertels würde damit gelöscht.<br />
„Traditionell verläuft das Leben hier provisorisch. Ein Gr<strong>und</strong>, weshalb es dem bürgerlichen<br />
Menschen, der nur dem Festen traut, als unsolid erscheint: einerseits als attraktiv,<br />
anderseits als abstoßend. ... Der Hauptbahnhof produziert ein spezifisches Umfeld, das<br />
demjenigen eines Hafens <strong>und</strong> eines <strong>Stadt</strong>tors ähnelt, die zuvor zerstreut bereits anderswo<br />
existiert haben ... dort, wo das Leben hinein- bzw. hinausströmt, sammeln sich Phänomene,<br />
die der Bürger mit Unwillen zur Kenntnis nimmt.“ 292 Jedoch ist Öffentlichkeit ein Resultat<br />
einer Spannung aus Fremdheit <strong>und</strong> Bekanntheit, Aktivität <strong>und</strong> Müßiggang, zielgerichtetem<br />
293<br />
Verhalten <strong>und</strong> Absichtslosigkeit. Die Öffentlichkeit eines kommerzialisierten<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldes ist also durch die Überwachung <strong>und</strong> den Verdrängungsprozess häufig<br />
beschränkt.<br />
289<br />
Brunn, Burkhard et al. (1992): Der Hauptbahnhof wird <strong>Stadt</strong>tor. Zum Ende des Automobilzeitalters. Anabas-<br />
Verlag Günter Kämpf KG, Frankfurt a.M. S. 64.<br />
290<br />
Terwiesche, Michael, 1997: Innenstädte – eine obdachlosenfreie Zone. Verwaltungsr<strong>und</strong>schau, 12/97 S. 410<br />
291<br />
Jaschke, Hans-Gerd, 1997: Öffentliche Sicherheit im Kulturkonflikt. Frankfurt/Main, New York: Campus Verlag S.<br />
72.<br />
292<br />
Brunn, Burkhard et al. (1992): Der Hauptbahnhof wird <strong>Stadt</strong>tor. Zum Ende des Automobilzeitalters. Anabas-<br />
Verlag Günter Kämpf KG, Frankfurt a.M. S. 16.<br />
293<br />
Feldtkeller, Andreas (1994): Die zweckentfremdete <strong>Stadt</strong>. Wider die Zerstörung des öffentlichen Raumes.<br />
Campus Verlag, New York, Frankfurt a.M.<br />
145
4.4 Zusammenfassung <strong>und</strong> Ausblick<br />
Kennzeichnend für das Forschungsthema sowie für das Studienobjekt <strong>Bahnhof</strong>sumfeld an<br />
sich ist seine Heterogenität <strong>und</strong> Komplexität. Diese zeigt sich unter anderem in der<br />
Schwierigkeit der räumlichen <strong>und</strong> thematischen Abgrenzung: Das gesamte <strong>Bahnhof</strong>sumfeld<br />
ist nicht ein räumlich klar abgrenzbares Gebiet oder eigenständiges Quartier, sondern eher<br />
ein Zusammenwirken bzw. Konglomerat unterschiedlicher, in ihrer Entwicklung wie auch<br />
funktional stärker oder schwächer zusammenhängender <strong>Stadt</strong>teile <strong>und</strong> Einzelflächen.<br />
Entsprechend vielfältig sind die Themen <strong>und</strong> komplexen Zusammenhänge, die sich bei einer<br />
genaueren Betrachtung auftun.<br />
Zumindest teilweise erklären lässt sich diese Heterogenität dadurch, dass das<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld in seiner geschichtlichen Entwicklung wie auch heute noch im<br />
Spannungsfeld zwischen <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung einerseits <strong>und</strong> der gesamtstädtischen<br />
Entwicklung andererseits steht: Beide Faktoren haben ihre jeweils eigenen Logiken <strong>und</strong><br />
Dynamiken, die sich über die Zeit im Umfeld des <strong>Bahnhof</strong>s auswirken <strong>und</strong> abzeichnen.<br />
In jüngerer Zeit lässt sich insbesondere ein Trend hin zur Entwicklung neuer, klar<br />
umrissener Quartiere im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld feststellen, der sowohl in Zusammenhang steht mit<br />
einem Wandel des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> dem Unternehmen Deutsche Bahn AG an sich als auch mit<br />
gegenwärtigen stadtentwicklungspolitischen Zielen <strong>und</strong> Zwängen. Die dargestellten<br />
Entwicklungen in <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern zeigen beispielhaft, wie viele verschiedene Einflüsse<br />
auf die Entwicklung dieser <strong>Stadt</strong>teile einwirken. Der Interaktion <strong>und</strong> Kommunikation<br />
zwischen zahlreichen Akteuren mit meist unterschiedlichen Interessenslagen kommt damit<br />
eine Schlüsselrolle innerhalb solcher Entwicklungsprozesse zu.<br />
Durch politische <strong>und</strong> stadtplanerische Entscheidungen können zwar potenzielle<br />
Entwicklungschancen in ein Konzept gefasst <strong>und</strong> das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld (bzw. ein Teil dessen)<br />
als neuer <strong>Stadt</strong>teil gesehen werden – die tatsächliche Entwicklung hängt jedoch von vielen<br />
Faktoren ab. So kann es durchaus vorkommen, dass die von der Kommune vorgesehenen<br />
Flächennutzungen nicht den Erwartungen bzw. Anforderungen der Investoren entsprechen<br />
<strong>und</strong> ein Kompromiss gef<strong>und</strong>en werden muss. Des Weiteren konzentriert sich das Interesse<br />
der <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> insbesondere der Investoren häufig auf ganz bestimmte Flächen<br />
mit besonders guten Standortfaktoren: In unmittelbarer räumlicher Nähe liegende, aber<br />
strukturell schwächere Gebiete werden dadurch zu „Geduldsflächen“, deren zukünftige<br />
Entwicklung ungewiss ist.<br />
Die Effekte, welche von derartigen, meist großflächigen Umstrukturierungen im<br />
Zusammenhang mit <strong>Bahnhof</strong>saufwertungen ausgehen, sind auch im angrenzenden,<br />
„übrigen“ <strong>Bahnhof</strong>sumfeld zu spüren. Durch die Entwicklung der Gr<strong>und</strong>stückspreise werden<br />
wirtschaftlich schwächere Nutzungen zunehmend zugunsten von insbesondere Büro- <strong>und</strong><br />
Geschäftsräumen verdrängt. Im Zuge der Attraktivitätssteigerung für zahlungskräftige<br />
K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Nutzer findet auch ein zunehmender Ausschluss sozial schwacher<br />
Bevölkerungsgruppen statt.<br />
146
Trotz der zum Teil im Windschatten dieser Entwicklungen stehenden „Geduldsflächen“ kann<br />
eine – insbesondere ökonomische – Aufwertung vieler <strong>Bahnhof</strong>sumfelder verzeichnet<br />
werden, die aber auch mit einem deutlichen Verlust an Heterogenität einhergeht.<br />
Es ist deutlich absehbar, dass sich im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld vieler größerer Städte Deutschlands<br />
in den nächsten Jahren noch einiges entwickeln wird. Damit eröffnen sich auch für die<br />
Forschung weitere <strong>und</strong> neue Fragen, zumal eigenständige Publikationen zum Thema<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld bis anhin nur in geringer Zahl verfügbar sind. Im Folgenden werden daher<br />
einige weiterführende Forschungsfragen formuliert:<br />
- Lassen sich die Akteurskonstellationen in der <strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung<br />
genauer typisieren? Lassen sich Zusammenhänge zwischen der<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldentwicklung <strong>und</strong> der ökonomischen Globalisierung genauer<br />
identifizieren? Welche Abhängigkeiten gibt es diesbezüglich? Welche Vor- bzw.<br />
Nachteile können entstehen, wenn Großinvestoren in den Entwicklungsprozess<br />
involviert sind? Welche Rolle spielt dabei die Privatisierung der Bahn? Wer<br />
kontrolliert welche Akteure <strong>und</strong> Prozesse? Und ist eine Machtverschiebung weg<br />
von der Kommune hin zu Investoren bemerkbar?<br />
- Wie verändern sich unterschiedliche Teile eines bisherigen <strong>Bahnhof</strong>sumfelds<br />
(<strong>Bahnhof</strong>sviertel, Brachflächen, Wohngebiete etc.) im Zuge der zunehmenden<br />
Investitionen im <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> seiner direkten Umgebung bezüglich ihrer<br />
Nutzungen, Personengruppen, Bodenpreisentwicklung, Architektur usw.?<br />
Inwiefern werden direkt Betroffene in die Entwicklungsprozesse aktiv mit<br />
eingeb<strong>und</strong>en?<br />
- Welchen Einfluss haben große Entwicklungsprojekte am <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> in seinem<br />
Umfeld auf die Entwicklung der Innenstadt bzw. Altstadt? Ist die oft anvisierte<br />
funktionale „Vergrößerung der Innenstadt“ um das <strong>Bahnhof</strong>sumfeld wirklich<br />
möglich <strong>und</strong> sinnvoll?<br />
- In Bezug auf den neuen Berliner Hauptbahnhof, dessen Umfeld schon seit<br />
längerer Zeit in der <strong>Stadt</strong>entwicklungspolitik ein Thema ist: Welche Erfolge <strong>und</strong><br />
welche gescheiterten Projekte gibt es schon? Wie kam der Erfolg bzw. das<br />
Scheitern zustande? Wie <strong>und</strong> weshalb haben sich die Rahmenbedingungen mit<br />
der Zeit verändert? Welche Nutzungen <strong>und</strong> Dichten wurden bisher primär<br />
vorgesehen? Haben sich die diesbezüglichen Pläne über die Zeit geändert?<br />
147
5. Verhältnis <strong>Stadt</strong> – <strong>Bahnhof</strong><br />
5.1 <strong>Bahnhof</strong>sflächen aus der Sicht der <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>planung<br />
Das Verhältnis von Bahn <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> war im Laufe der Geschichte immer doppelwertig <strong>und</strong><br />
widersprüchlich. Unbestritten löste die Erfindung <strong>und</strong> rasche Einführung der Eisenbahn im<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert umfangreich gesellschaftliche Veränderungen aus. Die Entwicklung zur<br />
modernen Industriestadt wäre ohne die prägende Funktion der Bahn nicht möglich<br />
gewesen 294 .<br />
Der steigende Güter- <strong>und</strong> Personentransport ließ die Städte immer mehr anwachsen <strong>und</strong> der<br />
Standort der Bahnhöfe bestimmte die Hauptrichtung der <strong>Stadt</strong>erweiterung. Die meisten<br />
deutschen Großbahnhöfe entstanden am Rande der damals noch kleinen Städte 295 . In der<br />
Folge der Urbanisierung des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts wurden Bahnhöfe zum Verkehrsmagneten, sie<br />
bestimmten große Teile des Flächenwachstums in den Städten, so dass ihre abgelegene<br />
Randlage sich bald hin zu den neuen <strong>Stadt</strong>zentren entwickelte.<br />
Diese Potenziale der zentral gelegenen Bahnhöfe wurde lange Zeit nicht genutzt. Die<br />
Bahnhöfe als „Kathedralen der Technik“ 296 , die noch bis in den Anfang des letzten<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts als „Tore zur Welt“ hohes Interesse <strong>und</strong> besondere Gestaltungsanstrengungen<br />
erfahren hatten, verfielen vielfach baulich <strong>und</strong> funktional. 297 Ursachen für die<br />
Funktionsverluste <strong>und</strong> die folgende Abnahme der Attraktivität waren insbesondere auch die<br />
veränderten Strukturen der Verkehrsnachfrage: Wohnstandorte am <strong>Stadt</strong>rand <strong>und</strong> im<br />
<strong>Stadt</strong>umland ohne Bezug zum schienengeb<strong>und</strong>enen ÖPNV – in Verbindung mit einer<br />
drastisch steigenden individuellen Motorisierung. 298<br />
Heute setzen <strong>Stadt</strong>planer <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwickler immer mehr auf die lange Zeit unterschätzten<br />
Potenziale der Bahnhöfe. Sie sind <strong>und</strong> bleiben ein wichtiges Rückgrat für die zukünftige<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> sie prägen sie maßgeblich mit.<br />
In vielen Städten sind in den letzten Jahren infolge des Programms „Renaissance der<br />
Bahnhöfe“ moderne <strong>und</strong> architektonisch anspruchsvolle Bahnhöfe entstanden. Dabei sind die<br />
Bahnhöfe nicht mehr nur Ziel <strong>und</strong> Ausgangspunkt von Reisenden, sondern sie haben sich<br />
294 Töpfer, Klaus, 1997. Vorwort des B<strong>und</strong>esministers für Raumordnung, Bauwesen <strong>und</strong> Städtebau. In: B<strong>und</strong><br />
Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.):<br />
Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg, S. 11.<br />
295 Dürr, Heinz, 1996. Bahn frei für einen neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg, S. 13.<br />
296 Beckmann, Klaus J., 2002: Personenbahnhöfe als Kristallisationskerne zukunftsfähiger <strong>Stadt</strong>entwicklung.<br />
Eisenbahntechnische R<strong>und</strong>schau 51/2002, Hamburg: Hestra-Verlag, S. 369.<br />
297 Ebenda, S. 369.<br />
298 Ebenda, S. 369.<br />
148
mittlerweile zu Orten der Begegnung <strong>und</strong> zur Einkaufsmeilen entwickelt (siehe dazu Kapitel<br />
1.4). 299<br />
Die so genannten „Projekten 21“, die zurzeit deutschlandweit realisiert werden bewirken<br />
durch die unterirdische Gleisführung nicht nur Verbesserung des Verkehrsangebots, sie<br />
schaffen auch Raum für die städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen <strong>und</strong> die<br />
Erweiterung von Grünflächen <strong>und</strong> Parkanlagen. Denn Bahnflächen sind häufig die einzigen<br />
innerstädtischen Areale, die für die Anlage von neuen Grün- <strong>und</strong> Freiraumbereichen zur<br />
Verfügung stehen. Durch die rationalisierte Neunutzung der ehemaligen Bahnareale werden<br />
die Innenstadtflächen nicht nur umweltfre<strong>und</strong>licher gestaltet sondern auch städtebaulich<br />
aufgewertet.<br />
Das hat besondere Bedeutung vor allem deswegen, weil Bahnhöfe <strong>und</strong> Bahnbrachen vielfach<br />
in wertvollen <strong>Stadt</strong>lagen liegen, so dass es sich anbietet, diese in eine integrierte <strong>und</strong><br />
abgestimmte städtebauliche Entwicklung einzubringen. Sie sind es wert, die notwendige<br />
Geduld aufzubringen <strong>und</strong> fachliches <strong>und</strong> persönliches Engagement zu investieren. 300<br />
Natürlich haben die Bahnhöfe als wichtige Verkehrsknoten <strong>und</strong> heute auch als<br />
Kommunikations- <strong>und</strong> Handelszentren Auswirkungen auf die benachbarten Quartiere.<br />
Deswegen müssen bei allen neuen Planungen die Zusammenhänge <strong>und</strong> Verbindungen zu<br />
den benachbarten <strong>Stadt</strong>teilen berücksichtigt <strong>und</strong> genutzt werden. Insbesondere in Bereichen<br />
Einzelhandel <strong>und</strong> Dienstleistungen gibt es einen gewissen Gefahrengrad des Überangebots<br />
<strong>und</strong> Überdeckung der innenstädtischen Funktionen.<br />
Durch eine vernünftige <strong>und</strong> planerisch rationelle Vorgehensweise können <strong>Bahnhof</strong>sstandorte<br />
in der Nachbarschaft zu Innenstädten zu funktionalen, städtebaulichen, gestalterischen <strong>und</strong><br />
verkehrlichen Verbesserungen <strong>und</strong> Aufwertungen der Innenstädte beitragen. Durch die<br />
Umnutzung entbehrlicher Bahnflächen können die <strong>Stadt</strong>zentren attraktiver gestaltet werden.<br />
Bahnhöfe <strong>und</strong> deren Umfelder können somit wesentliche Impulse für eine zukunftsfähige<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung setzen, Kristallisationskerne für eine urbane <strong>Stadt</strong>entwicklung sowie für<br />
die Zentrenfunktion der Städte sein <strong>und</strong> die Konkurrenzfähigkeit der Innenstädte stärken.“<br />
301<br />
Die Innenstadtaufwertung ist eine der vielen Perspektiven <strong>und</strong> Problemlösungen, die die<br />
„Renaissance der Bahnhöfe“ als vorteilhafte Beiträge zur Folge hätte. Das vorrangige Ziel<br />
der Entwicklung von Bahnhöfen – wie auch von Bahnflächen – ist es in erster Linie, die<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung mit der Verkehrsentwicklung zu verknüpfen. Dies bedeutete gleichzeitig:<br />
- eine Stärkung der stadtverträglichen Verkehrsentwicklung („Umweltverb<strong>und</strong>“),<br />
299 Harting, Michael, 2007. Ziele <strong>und</strong> Perspektiven für die Bahn – die Sicht des B<strong>und</strong>es. In: <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Bahn –<br />
Almanach 2006/2007, Wékel, Julian [Hrsg.]: Deutsche Akedemie für Städtebau <strong>und</strong> Landesplanung (DASL),<br />
Berlin, 2007, S. 37.<br />
300 Richard, Jochen, 2007. Bahnflächen als Entwicklungsprozess. In: <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Bahn – Almanach 2006/2007, Wékel,<br />
Julian [Hrsg.]: Deutsche Akedemie für Städtebau <strong>und</strong> Landesplanung (DASL, Berlin, 2007, S. 169.<br />
301 Beckmann, Klaus J., 2002: Personenbahnhöfe als Kristallisationskerne zukunftsfähiger <strong>Stadt</strong>entwicklung.<br />
Eisenbahntechnische R<strong>und</strong>schau 51/2002, S. 369-377. Hamburg: Hestra-Verlag, S. 372.<br />
149
- eine Durchführung <strong>und</strong> Verwirklichung städtebaulicher Ziele<br />
(Funktionsverbesserung, Gestaltung; Innenentwicklung, Überwindung<br />
städtebaulicher Barriere…) <strong>und</strong><br />
- eine Sicherung <strong>und</strong> Verbesserung der ökonomischen Funktionen der<br />
Innenstädte <strong>und</strong> der Rentabilität von Bahnleistungen. 302<br />
Bei den Entscheidungen um Bahnflächenentwicklungen spielen auch politische <strong>und</strong><br />
soziologische Aspekte eine wichtige Rolle. Denn erfolgreiche Projekte gehen immer seltener<br />
auf gute „fachspezifische“ Argumente zurück, sondern vielmehr auf „emotionale“<br />
Zwangspunkte: Ohne die Fußballweltmeisterschaft hätten viele Maßnahmen nicht den<br />
heutigen Stand erreicht. B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesgartenschauen sind gleichfalls überzeugende<br />
Argumente für eine forcierte <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung. Doch auch <strong>Stadt</strong>jubiläen <strong>und</strong> andere<br />
einmalige Ereignisse <strong>und</strong> Großveranstaltungen sind gute Argumente, die vielfach besser die<br />
Notwendigkeit <strong>und</strong> Unabdingbarkeit darstellen als lediglich der Nachweis eines verkehrlichen<br />
Bedarfs oder einer städtebaulichen Notwendigkeit. 303 Große Ereignisse schaffen<br />
Aufbruchsstimmung. Sie stellen den Kristallisationspunkt dar, auf den hin divergierende<br />
Interessen gebündelt werden. Die Festivalisierung der Bahnhöfe wurde in letzter Zeit zu<br />
einem prekären Diskussionspunkt. Insbesondere <strong>Bahnhof</strong>svorplätze erhalten mehr <strong>und</strong> mehr<br />
neue Unterhaltungsfunktionen. Konzerte, Sportveranstaltungen <strong>und</strong> verschiedene Events<br />
werden auf den <strong>Bahnhof</strong>svorplätzen <strong>und</strong> in den <strong>Bahnhof</strong>sgebäuden durchgeführt. Die neu<br />
entdeckte Verfügung über große Entertainmentpotenziale führt in letzter Zeit dazu, dass<br />
Bahnhöfe nicht nur zu den größten Einkaufs- <strong>und</strong> Dienstleistungszentren werden, sondern<br />
sich auch in die so genannten „Urban Entertainment Centren“ umwandeln.<br />
Im nächsten Kapitel wird anhand von vier Beispielen untersucht, welche<br />
Entwicklungsmöglichkeiten sich bieten <strong>und</strong> welche Folgen solche Maßnahmen, wie<br />
<strong>Bahnhof</strong>sneubau, <strong>Bahnhof</strong>sschließung, <strong>Bahnhof</strong>serweiterung <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>sverlagerung auf<br />
die benachbarten <strong>Stadt</strong>teile <strong>und</strong> Städte haben können.<br />
5.2 Entwicklungsmöglichkeiten für <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Quartier<br />
5.2.1 <strong>Bahnhof</strong>sneubau<br />
302 Beckmann, Klaus J., 2002: Personenbahnhöfe als Kristallisationskerne zukunftsfähiger <strong>Stadt</strong>entwicklung.<br />
Eisenbahntechnische R<strong>und</strong>schau 51/2002, S. 369-377. Hamburg: Hestra-Verlag, S. 372.<br />
303 Richard, Jochen, 2007. Bahnflächen als Entwicklungsprozess. In: <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Bahn – Almanach 2006/2007, Wékel,<br />
Julian [Hrsg.]: Deutsche Akedemie für Städtebau <strong>und</strong> Landesplanung (DASL, Berlin, 2007, S. 169.<br />
150
� Beispiel Limburg Süd<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> Limburg Süd liegt in der Nähe der 34.000-Einwohner-Kreisstadt Limburg, beim<br />
Streckenkilometer 110,5 der so genannten Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main.<br />
Abb. 32: Streckenverlauf der ICE–NBS Köln-Rhein/ Main<br />
Quelle: www.hochgeschwindigkeitszuege.com<br />
Die Entstehung der ICE-Bahnhöfe Limburg <strong>und</strong> Montabaur ist außergewöhnlich <strong>und</strong> einmalig<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik. In den betroffenen Regionen, aber auch weit über deren Grenzen<br />
hinaus haben die ICE-Bahnhöfe Montabaur <strong>und</strong> Limburg in den Medien <strong>und</strong> in der<br />
Öffentlichkeit enormes Aufsehen erregt.<br />
Da Rheinland-Pfalz an der Entwicklung eines <strong>Bahnhof</strong>es im Landesgebiet festhielt, entstand<br />
auch seitens des Landes Hessen die Forderung eines <strong>Bahnhof</strong>es an der ICE-Neubaustrecke<br />
Köln-Rhein/Main, der im Umfeld der <strong>Stadt</strong> Limburg erbaut werden sollte. In einer<br />
Vereinbarung von März 1990 stellten die Ministerpräsidenten der beiden Länder sowie der<br />
B<strong>und</strong>esverkehrminister darüber hinaus einvernehmlich fest, „dass ein Halt im Raum Limburg<br />
unverzichtbar“ sei.<br />
151
Drei Varianten wurden im Rahmen der Abstimmungen zwischen dem B<strong>und</strong> <strong>und</strong> den beiden<br />
Ländern im Raum Limburg geprüft. Die erste Variante war die Errichtung eines <strong>Bahnhof</strong>s<br />
Namens Limburg-Staffel, in Verbindung mit einem <strong>Bahnhof</strong> in Montabaur. Der Raum Koblenz<br />
sollte über den <strong>Bahnhof</strong> Montabaur per Pkw angeb<strong>und</strong>en werden. Diese Variante<br />
veranschlagte man 1991 mit ca. 30 Millionen D-Mark.<br />
Abb. 33: Räumliche Lage des ICE-<strong>Bahnhof</strong>s Limburg Süd<br />
Quelle: MÖLLER 1996, S. 22<br />
Die zweite Variante war die Errichtung eines <strong>Bahnhof</strong>s in Limburg-Eschhofen. Zwischen<br />
Lahntalbahn <strong>und</strong> Neubaustrecke wäre dabei von umsteigenden Fahrgästen eine<br />
Höhendifferenz von etwa 40 Metern zu überwinden gewesen. Diese Variante war die beste<br />
Möglichkeit zur Verknüpfung mit dem Straßennetz der Gemeinde sowie für die<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung. Die geschätzten Kosten lagen 1991 bei 90 Millionen D-Mark. Die letzte<br />
Variante war die Erbauung eines <strong>Bahnhof</strong>s zwischen Diez <strong>und</strong> Limburg. Eine Verknüpfung<br />
von Lahntalbahn <strong>und</strong> Neubaustrecke wäre hier mit kurzen Wegen möglich gewesen. Der<br />
Nachteil bei dieser Variante war die notwendige Errichtung einer 1,5 km langen Talbrücke<br />
über die Lahnauen. Die Kosten wurden auf etwa 65 Millionen D-Mark geschätzt.<br />
Für die von der Deutschen Bahn AG bevorzugten mögliche Standorte in Limburg-Staffel <strong>und</strong><br />
Limburg Eschhofen ergab sich nach hydrologischen Bodenerk<strong>und</strong>ungen die Notwendigkeit<br />
von Tunnelbauten, die erhebliche Mehrkosten verursacht hätten. Die Standortalternativen im<br />
benachbarten Diez <strong>und</strong> am Hauptbahnhof Limburg hätten eine optimale Verknüpfung mit<br />
152
dem Regionalbahn- <strong>und</strong> Nahverkehr ermöglicht, erforderten aber ebenfalls hohe<br />
Investitionen <strong>und</strong> bedeuteten gleichzeitig einen hohen Fahrzeitverlust. 304<br />
Am 8. März 1991 sprach sich der Vorstand der B<strong>und</strong>esbahn für die erste Variante aus. Der<br />
Standort bedeutete einen vergleichsweise geringen Aufwand bezüglich der Kosten einer<br />
fehlenden Verknüpfung mit dem Nahverkehr <strong>und</strong> einer eher abseits gelegenen Position;<br />
ferner erforderte sie den Bau des 2,4 km langen Limburger Tunnels durch eine<br />
Wasserschutzzone. Die Station wurde so „auf der grünen Wiese“ etwa 2,5 Kilometer<br />
südöstlich des <strong>Stadt</strong>zentrums der 34.000-Einwohner-<strong>Stadt</strong>, nahe der A3, neu errichtet. Die<br />
Verkehrsprognose ging davon aus, dass 90 Prozent der Bahnreisenden im Vor- <strong>und</strong> Nachlauf<br />
Pkw benutzten würden. Aufgr<strong>und</strong> der Sparpolitik des B<strong>und</strong>es begannen die Bauarbeiten für<br />
den ICE-<strong>Bahnhof</strong> Limburg erst 2001, nachdem die Planungen für den <strong>Bahnhof</strong> reduziert<br />
wurden <strong>und</strong> die <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> das Land Hessen sich zu einer finanziellen Beteiligung an den<br />
Baukosten bereit erklärten. Im November 2003, Monate nach Inbetriebnahme der ICE-<br />
Neubaustrecke Köln-Rhein/Main, wurde das <strong>Bahnhof</strong>sgebäude fertig gestellt.<br />
Abb. 34: <strong>Bahnhof</strong> Limburg Süd<br />
153<br />
Davor wurden nie zwei so kleine <strong>und</strong> dicht<br />
beieinander liegende Orte (Montabaur <strong>und</strong><br />
Limburg liegen ca. 20 Straßenkilometer<br />
voneinander entfernt) an das europäische<br />
Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen.<br />
Montabaur <strong>und</strong> Limburg zählen zu den<br />
wenigen Städten mit maximal 50.000<br />
Einwohnern, die überhaupt einen ICE-<br />
<strong>Bahnhof</strong> besitzen <strong>und</strong> stellen.<br />
Bis 2007 hat die Deutsche Bahn AG dem<br />
Quelle: commons.wikimedia.org<br />
<strong>Bahnhof</strong> Limburg Süd einen<br />
„Bestandsschutz“ eingeräumt: Während dieser Zeit gilt es, deren Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong><br />
positive Effekte für die Regionen zu beweisen. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt laut einer<br />
Vereinbarung mit der Deutschen Bahn AG aus dem Jahr 1993 „die Optimierung des<br />
Betriebsbildes entsprechend der Nutzung“ – erweist sich der ICE-<strong>Bahnhof</strong> Limburg dann als<br />
nicht rentabel, muss damit gerechnet werden, dass dem <strong>Bahnhof</strong> der ICE-Systemhalt<br />
entzogen wird. Inzwischen nutzen etwa 2500 Menschen täglich die Station – für einen ICE-<br />
Halt ein vergleichsweise geringes Fahrgastaufkommen. Zwischen 2003 <strong>und</strong> 2005 nahm die<br />
Zahl der Reisenden nach Bahnangaben um 32 Prozent zu. Der Fortbestand der Station als<br />
ICE-Halt gilt inzwischen als gesichert.<br />
304 Wehner, Oliver (2002): Die Realisierung eines schienengeb<strong>und</strong>enen Großbauvorhabens am Beispiel der<br />
Neubaustrecke Köln-Rhein/Main der Deutschen Bahn AG. (Dissertation, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften,<br />
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a.M.). Frankfurt a.M. S. 187
a. Städtebauliche Integration<br />
Der ICE-<strong>Bahnhof</strong> Limburg ist abseits des <strong>Stadt</strong>zentrums „auf der grünen Wiese“ lokalisiert<br />
<strong>und</strong> befindet sich zwei Kilometer vom Zentrum Limburgs im Lahntal entfernt, auf einem<br />
Hochplateau oberhalb des Flusstals.<br />
Abb. 35: Lage des ICE-<strong>Bahnhof</strong>s Limburg im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Quelle: www.railport.de<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> wird durch die Autobahn A3 <strong>und</strong> die Höhenlage von der Innenstadt<br />
abgeschnitten <strong>und</strong> ist fußläufig oder per Fahrrad bestenfalls noch von einigen kleineren<br />
benachbarten <strong>Stadt</strong>teilen günstig erreichbar (Siehe Abb. 36).<br />
Abb. 36: Blick vom ICE-<strong>Bahnhof</strong> Richtung <strong>Stadt</strong>zentrum<br />
Eine Integration von Schienennah-,<br />
Regional- <strong>und</strong> Fernverkehr wurde am<br />
ICE-<strong>Bahnhof</strong> Limburg versäumt.<br />
Wegen dieses Umstandes wurde ein<br />
Shuttlebusverkehr zwischen dem<br />
Hauptbahnhof <strong>und</strong> dem ICE-<strong>Bahnhof</strong><br />
Limburg initiiert, dessen kostenfreie<br />
Nutzung mit ICE-Fahrschein möglich<br />
ist. Die Fahrt dauert fünf Minuten, der<br />
Fahrplan des Shuttlebusses orientiert sich an den Ankunfts- <strong>und</strong> Abfahrtszeiten der<br />
Hochgeschwindigkeitszüge.<br />
b. Städtebauliche Entwicklung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes<br />
Die <strong>Stadt</strong> Limburg möchte mit der Einrichtung des ICE-<strong>Bahnhof</strong>es die Entwicklung vom so<br />
genannten „Limburg Railport“ initiieren. Der sich unmittelbar an den ICE-<strong>Bahnhof</strong><br />
154
anschließende städtebaulichem Entwicklungsbereich erstreckt sich insgesamt über eine<br />
Fläche von ca. 40 ha, die jedoch in drei Bauabschnitte gegliedert ist. Ein rechtskräftiger<br />
Bebauungsplan existiert bislang nur für den vollständig erschlossenen ersten Bauabschnitt<br />
mit einer Fläche von 20 ha.<br />
Abb. 37: Städtebaulicher Entwicklungsbereich<br />
Quelle: www.railport.com<br />
Das Projekt „Limburg Railport“ wurde auf ein Standortprofil ausgerichtet, das überwiegend<br />
an gewerblichen <strong>und</strong> tertiären Nutzungen orientiert ist, die die Wirtschaftsbranchen<br />
Telekommunikation, Freizeit/Gastronomie, Ges<strong>und</strong>heit sowie den Kongress- <strong>und</strong><br />
Messebetrieb beinhalte. Der zweite Bauabschnitt (ca. 7,5 ha) des Entwicklungsgebietes am<br />
ICE-<strong>Bahnhof</strong> Limburg soll erst dann einer baulichen Nutzung zugeführt werden, wenn 70 %<br />
der Flächen des ersten Abschnittes vermarktet wurden, Abschnitt 3 bietet anschließend die<br />
Option für weiterer Entwicklungen.<br />
� Beispiel Kassel – Wilhelmshöhe<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> Kassel-Wilhelmshöhe ist die Haltestelle für den Eisenbahn-Fernverkehr in der<br />
nordhessischen Großstadt Kassel. Der im westlichen <strong>Stadt</strong>teil Bad Wilhelmshöhe verortete<br />
ICE-Halt ist ein wichtiger <strong>Bahnhof</strong> im deutschen Fernverkehr.<br />
Seit 1849 halten im <strong>Bahnhof</strong> Wilhelmshöhe die Züge. Mit der Eröffnung des letzten<br />
Bauabschnitts zwischen Kassel <strong>und</strong> Guntershausen im Herbst 1849 war die Hauptstadt von<br />
Kurhessen an die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn angeschlossen. Einige Wochen später wurde<br />
das Schienennetz mit dem ersten Teilstück der Main-Weser-Bahn von Kassel bis Wabern<br />
erweitert (Siehe Abb. 39).<br />
155
Abb. 38: Alter <strong>Bahnhof</strong> in Kassel-Wilhelmshöhe<br />
Quelle: www.kassel.de<br />
Im Zweiten Weltkrieg wurde der <strong>Bahnhof</strong> mit seinem Empfangsgebäude ziemlich zerstört,<br />
seitdem hatte er nicht viel Charme. Im Vergleich zum Hauptbahnhof (Baujahr 1856) hatte<br />
Wilhelmshöhe keine bedeutende Rolle inne. Lange Zeit war der <strong>Bahnhof</strong> ein überschaubarer<br />
Haltepunkt ohne große Perspektiven.<br />
Als die Planungen für die Neubaustrecke Hannover-Würzburg Gestalt annahmen, wollte man<br />
möglichst wenige Zwischenhalte für den neuen, schnellen Fernverkehr einrichten. Aber<br />
durch politischen Druck wurden auch Göttingen, Fulda <strong>und</strong> eben Kassel angefahren.<br />
Da die anderen beiden Bahnhöfe Durchgangsbahnhöfe waren, war es relativ<br />
unproblematisch sie zu realisieren. Kassel jedoch hatte einen Kopfbahnhof, es gab drei<br />
Varianten als Lösung. Die erste Variante war die Führung der Neubaustrecke durch Kassel<br />
<strong>und</strong> der Umbau von Kassel Hauptbahnhof in einen Durchgangsbahnhof mittels eines Tunnels<br />
für den Verkehr oder einer Schaffung von zusätzlichen Fernbahnsteigen im Bereich des<br />
Gleisdreiecks (ehem. Betriebswerk). Die Zweite Variante war eine Anbindung von Kassel<br />
Hauptbahnhof an die neue Stracke ohne Umbau des <strong>Bahnhof</strong>s mit einem Halt <strong>und</strong><br />
Fahrtrichtungswechsel durchgehender Züge im Kopfbahnhof. Die letzte Variante war der Bau<br />
eines neuen Durchgangsbahnhofs an der Neubaustrecke <strong>und</strong> keine direkte Anbindung von<br />
Kassel Hauptbahnhof. Als mögliche Standorte des neuen Durchgangsbahnhofs standen KS-<br />
Bettenhausen oder Wilhelmshöhe zur Wahl. 305<br />
305 http://www.achwir.net/sw/bahnhof_wilhelmshoehe.php, Zugriff am 28.06.07<br />
156
Abb. 39: <strong>Bahnhof</strong> Kassel-Wilhelmshöhe<br />
Quelle: www.kassel.de<br />
Im Jahr 1973 wurde der Bau der Strecke Hannover-Würzburg in anderen Abschnitten<br />
angefangen. Erst im Jahr 1979 wurde von der Deutschen B<strong>und</strong>esbahn in einer Ausstellung<br />
zu den Neubauvorhaben in Kassel über die Varianten debattiert. Die Entscheidung war am<br />
13. November 1981 für die dritte Variante gefallen. Der Bau des <strong>Bahnhof</strong>s Kassel-<br />
Wilhelmshöhe begann im gleichen Jahr (Siehe Abb. 40).<br />
Die Eröffnung des neuen <strong>Bahnhof</strong>s erfolgte am 29. Mai 1991, zusammen mit der Übergabe<br />
der gesamten Strecke Hannover–Würzburg <strong>und</strong> dem Beginn des planmäßigen ICE-Verkehrs.<br />
Durch den <strong>Bahnhof</strong>sneubau lag der <strong>Stadt</strong>teil nicht mehr am <strong>Stadt</strong>rand. Der <strong>Stadt</strong>teil hat sich<br />
im Gegenteil zu Limburg Süd positiv entwickelt. Es hat sich in der Nähe des <strong>Bahnhof</strong>es ein<br />
<strong>Stadt</strong>teilzentrum entwickelt. Der <strong>Bahnhof</strong> ist jetzt ein Knotenbahnhof. Damit ist dieses<br />
Projekt ein planerischer Glücksfall.<br />
5.2.2 <strong>Bahnhof</strong>sschließung – Beispiel Ehemaliger Solingen Hauptbahnhof<br />
Solingen erhielt im Jahr 1867 mit dem Kopfbahnhof am Weyersberg seinen Anschluss an das<br />
Eisenbahnnetz. Mit der Eröffnung der Korkenzieherbahn im Jahr 1890 hat sich die<br />
Verkehrsanbindung ziemlich verbessert. Der Endbahnhof Solingen Süd befand sich näher<br />
an der Solinger Innenstadt als die Station in Weyersberg. Die Strecke von Ohligs wurde<br />
daher auch in den Jahren 1896/97 bis zum Südbahnhof verlängert. Mit der Eröffnung<br />
dieser Bahnstrecke Wuppertal-Opladen/Solingen stieg die Verkehrsbedeutung des <strong>Bahnhof</strong>s,<br />
an dem nun auch die Züge der neuen Linie hielten (Siehe Abb.41).<br />
157
Abb. 40: Alter <strong>Bahnhof</strong> Solingen Abb. 41: Solingen Hauptbahnhof im Jahr<br />
1933<br />
Quelle: www.tetti.de<br />
Der Solingen Südbahnhof zeigte sich nach dem Bau der Müngstener Brücke im Jahr 1897<br />
nicht mehr als modern. Die Lage des <strong>Bahnhof</strong>s war zu beengt <strong>und</strong> die kleine Empfangshalle<br />
schien nicht mehr ausreichend zu sein. Daher wurde bereits im Jahr 1898 über eine<br />
Verlegung vom Südbahnhof diskutiert. Jedoch wurde der <strong>Bahnhof</strong> außer kleinen Änderungen<br />
<strong>und</strong> einige Ergänzungsbauten bis zum Jahr 1907 nicht verändert.<br />
im Jahr 1908 wurde mit dem Umbau des Südbahnhofs begonnen. Der Güterbahnhof wurde<br />
erweitert <strong>und</strong> das <strong>Bahnhof</strong>sgebäude erhielt eine größere Empfangshalle. Der Vorplatz wurde<br />
neu gestaltet <strong>und</strong> mit dem Ausbau der <strong>Bahnhof</strong>sstraße wurde die Anbindung zum<br />
<strong>Stadt</strong>zentrum verbessert. Die Bahngleise wurden um 4,4 Meter tiefer gelegt. Der Verkehr<br />
führte mit einer Brücke über die tiefer gelegten Gleise. Am <strong>Bahnhof</strong> entstand zudem eine<br />
Fußgängerüberführung, die bis heute erhalten ist.<br />
Der Südbahnhof ist im Jahr 1910 zum Hauptbahnhof der <strong>Stadt</strong> Solingen geworden <strong>und</strong> hat<br />
damit viele Erwartungen erweckt. Die <strong>Stadt</strong>planer <strong>und</strong> Unternehmer versprachen sich durch<br />
die Ansiedelung von Hotels <strong>und</strong> feinen Geschäften. Doch der Entwicklungsschub ist<br />
ausgeblieben. Mit dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1914 wurden die städtebaulichen<br />
Hoffnungen zerstört. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Hauptbahnhof bei einem<br />
Bombenangriff im November 1944 schwer beschädigt.<br />
Für den Wiederaufbau des Hauptbahnhofes gab es die ersten Pläne bereits im Jahr 1946.<br />
Noch mal wurde die Verlegung des Solinger Hauptbahnhofs in Richtung Zentrum aktuell.<br />
Jedoch hat die Bahn den Vorschlag abgelehnt. Ein anderer Plan wurde im Jahr 1947<br />
vorgeschlagen. In dem Entwurf war ein großer <strong>Bahnhof</strong>splatz mit Parkanlagen, Haltestellen<br />
<strong>und</strong> Parkplätzen vorgesehen. Doch zur Umsetzung kam es erst im Jahr 1954 <strong>und</strong> zwar mit<br />
einem stark abgespeckten Entwurf. Der Bau des neuen Hauptbahnhofs dauerte zwei Jahren.<br />
Der neue <strong>Bahnhof</strong> hatte eine große Pavillonhalle <strong>und</strong> eine 22 Meter hohem Turm (Siehe Abb.<br />
43). Der Turm wurde im Jahr 1978 abgerissen.<br />
158
Abb. 42: Solingen Hauptbahnhof nach dem zweiten Weltkrieg<br />
Quelle: www.solingen-internet.de<br />
159<br />
Nach der Wiedereröffnung hat der<br />
Hauptbahnhof seine Bedeutung<br />
verloren <strong>und</strong> diese Entwicklung hat<br />
sich fortgesetzt. Im Gegenteil ist<br />
der <strong>Bahnhof</strong> in Solingen-Ohlings<br />
wegen seiner Lage,<br />
Verkehrstechnisch wesentlich<br />
bedeutsamer geworden. Ab 1990<br />
wurde der <strong>Bahnhof</strong> Solingen-Ohligs<br />
zur Intercity-Station aufgewertet.<br />
Der Hauptbahnhof hingegen dient<br />
lediglich als Station für eine<br />
regionale Verbindung.<br />
Im Rahmen der Modernisierung der Bahnstrecke sowie der „Regionale 2006“ wurde die<br />
Errichtung zweier Haltepunkte in unmittelbarer Nachbarschaft beschlossen, die die<br />
Verkehrsbeziehungen innerhalb Solingens deutlich verbessern sollten. Wegen der Eröffnung<br />
des Haltepunkts Solingen-Grünewald -westlich des Hauptbahnhofs- am 6. Mai 2006 wurde<br />
der alte Solinger Hauptbahnhof geschlossen. Die Züge hielten nur noch am neuen<br />
Haltepunkt. Der zweite Haltepunkt, Solingen Mitte, der sich östlich des ehemaligen<br />
Hauptbahnhofs befindet, wurde mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2006 eröffnet.<br />
Nach seiner Schließung wird das Gebäude des bisherigen Hauptbahnhofs saniert <strong>und</strong> zur<br />
Regionale 2006 als Forum Produktdesign wiedereröffnet.<br />
5.2.3 <strong>Bahnhof</strong>sumbau – Stuttgart Hauptbahnhof<br />
Das Projekt Stuttgart21 stammt<br />
aus der Diskussion um die<br />
Fortsetzung der Neubaustrecke<br />
Mannheim-Stuttgart eine<br />
"Ausbaustrecke /Neubaustrecke<br />
Plochingen - Günzburg", für deren<br />
Streckenführung noch Varianten<br />
untersucht werden sollten. Im Jahr<br />
1985 wurde diese Überlegung von<br />
der Deutschen Bahn AG im<br />
B<strong>und</strong>esverkehrswegeplan (BVWP)<br />
angekündigt. Die Deutsche Bahn<br />
AG untersuchte die verschiedenen<br />
Möglichkeiten der<br />
Abb. 43: Stuttgart Hauptbahnhof<br />
Quelle: www.stuttgart.de
Streckenführung. Das Problem lag bei der Höchstgeschwindigkeit die auf 120 – 160km/h<br />
begrenzt geblieben wäre. Dies wäre ein "Langsamfahrabschnitt" von 60 km Länge auf einen<br />
Schnellfahrnetz gewesen.<br />
Daher schlug Professor Heimerl von der Universität Stuttgart vor, das gesamte Konzept von<br />
Stuttgart bis Ulm zu erweitern. In diesem Konzept würde der Stuttgarter Hauptbahnhof<br />
durch einen Durchgangsbahnhof in Tieflage für die Strecke Mannheim - Ulm beseitigt. Die<br />
neue Trasse würde weitestgehend mit der Autobahn verbinden. Darüber hinaus wäre eine<br />
Qualitäts- <strong>und</strong> Kapazitätserhöhung in diesem Korridor durch Entmischung von langsamem<br />
Güterverkehr <strong>und</strong> Regionalverkehr einerseits <strong>und</strong> schnellem Reise- <strong>und</strong> schnellem, leichten<br />
Güterverkehr andererseits zu erreichen, der so genannten H-Trasse. Somit wären Kosten<br />
sparendere Trassierungen mit bis zu 35 Promille, wie vom TGV bekannt, möglich gewesen,<br />
wie dies schon bei der damals diskutierten Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main mit 40<br />
Promille gedacht war. Heimerls Ziel war deshalb ein durchgehender<br />
Hochgeschwindigkeitskorridor für schnelle Verkehre bis 300 km/h, vom Ende der<br />
zukünftigen Neubaustrecke Mannheim–Stuttgart bis Augsburg mit Einbeziehung von<br />
Stuttgart Hbf <strong>und</strong> Ulm. Aber anders als die Ingenieure 1986 sah er „noch“ keine Anbindung<br />
des Flughafens vor, dessen S-<strong>Bahnhof</strong> schon eingeplant war (Fertigstellung 1993).<br />
Die zweite Variante war von dem neuen Deutsche Bahn AG-Planer Prof. Krittian. Er<br />
kombinierte die Idee mit dem Fernbahntunnel mit den ursprünglichen Deutsche Bahn AG-<br />
Planungen, der so genannten K-Trasse. Im Dezember 1992 entschied sich der Bahnvorstand<br />
für die autobahnnahe H-Trasse, jedoch ohne den Fernbahntunnel unter dem Hauptbahnhof.<br />
Gleichzeitig wurde angekündigt, dass die Deutsche Bahn AG zusätzlich in Stuttgart einen<br />
neuen Fernbahnhof am Rande des Rosensteinparks untersucht. Aus den Planungen zum<br />
neuen Fernbahnhof Rosenstein blieb die Idee, dass mit dem Freimachen der derzeit von<br />
umfangreichen Gleisanlagen beanspruchten Flächen gleichzeitig eine große Chance für die<br />
städtebauliche Entwicklung der topographisch beengten Kernstadt geboten werden kann.<br />
Hieraus resultierte schließlich das umfassende "Projekt Stuttgart 21".<br />
� Projekt Stuttgart 21<br />
Eine endgültige Entscheidung<br />
über das Projekt Stuttgart21<br />
wurde am 23. Oktober 2006 für<br />
den März 2007 angekündigt. 306<br />
Die B<strong>und</strong>esregierung wollte bis<br />
dahin die Wirtschaftlichkeit<br />
genauer überprüfen. Das Projekt<br />
Stuttgart21 plant eine<br />
Umgestaltung des Bahnknotens<br />
306 Beitrag bei SWR Nachrichten vom 24. Oktober 2006<br />
Abb. 44: Projekt Stuttgart 21<br />
Quelle: www.db.de<br />
160
Stuttgart. Der bisherige Kopfbahnhof soll durch einen unterirdischen <strong>und</strong> um 90° gedrehten<br />
Durchgangsbahnhof ersetzt werden. Der Abstellbahnhof am Rosensteinpark wird auf das<br />
Gelände des bisherigen Rangierbahnhofs Untertürkheim verlegt. Außer die S-Bahn laufen<br />
alle Strecken über den neuen Durchgangsbahnhof in Tieflage. Wie das Prinzip von Trassen<br />
Vorschlag H entsprechend führt die geplante NBS nach Ulm - Augsburg - München vom<br />
Durchgangsbahnhof weiter zur Autobahn mit einer Anbindung des Flughafens.<br />
Ursprünglich waren die Planungen des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes der Anstoß<br />
zum Projekt Stuttgart21. In dieser Planungen war die Rede von eine Gestaltung der<br />
Gleisanlagen <strong>und</strong> Netzanbindungen, die dem Nah- <strong>und</strong> Regionalverkehr in noch stärkerem<br />
Umfang als dem Fernverkehr Verbesserungen bietet, die Anforderungen des Integralen<br />
Taktfahrplans (ITF) erfüllt <strong>und</strong> noch weitergehende Kapazitätsausweitungen ermöglicht.<br />
Abb. 45: Der städtebauliche Rahmenplan von Stuttgart21<br />
Quelle: www.stuttgart21.de<br />
Es gibt zwar wegen der hohen Kosten immer wieder Diskussionen über die Verwirklichung<br />
des Projektes Stuttgart21 aber zusammenfassend ist festzustellen, dass das Konzept<br />
zusammen mit der Neubaustrecke Stuttgart - Ulm eine sehr gute Antwort auf die vielfältigen<br />
Fragen <strong>und</strong> Überlegungen zu einer zukunftsfähigen Gestaltung der Eisenbahninfrastruktur in<br />
der Region Stuttgart darstellt. Es trifft sowohl für den internationalen als auch für den<br />
Regional- <strong>und</strong> Nahverkehr die eingangs erläuterten Forderungen <strong>und</strong> bietet für Stuttgart <strong>und</strong><br />
die Region sowie für ein leistungsfähiges Bahnnetz Vorteile:<br />
- durchgängige Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Halt in der <strong>Stadt</strong><br />
- Erhalt des zentralen Hauptbahnhofs Stuttgart in allen seinen<br />
Verknüpfungsfunktionen als Durchgangsbahnhof,<br />
161
- merkliche Verbesserung des Verkehrsangebots der Bahn mit<br />
Reisezeitverkürzungen sowohl im Fernverkehr als auch im Regional- bzw.<br />
Nahverkehr infolge der Durchbindung der Regionallinien,<br />
- erheblicher Verkehrszuwachs im öffentlichen Verkehr bei gleichzeitiger<br />
Entlastung der Straße <strong>und</strong> entsprechender Verringerung der Umweltbelastung,<br />
- Flughafenanbindung im Fernverkehr mit zusätzlichen verkehrlichen<br />
Verbesserungen im Nah- <strong>und</strong> Regionalverkehr für den Stuttgarter Süden <strong>und</strong><br />
ggf. die neue Messe,<br />
- umfangreiche <strong>und</strong> hochwertige städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten im<br />
Kernbereich der Landeshauptstadt,<br />
- zukunftsgerichtete<br />
Neckarraum,<br />
Impulse für Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft im Mittleren<br />
- zukunftssichere leistungsfähige Bahninfrastruktur als Standortfaktor für <strong>Stadt</strong><br />
<strong>und</strong> Region. 307<br />
5.2.4 <strong>Bahnhof</strong>sverlegung- Beispiel <strong>Bahnhof</strong> Bozen<br />
Abb. 46: <strong>Bahnhof</strong> Bozen<br />
Die städtebauliche Neugestaltung des <strong>Bahnhof</strong>sfeldes<br />
Bozen ist das größte Projekt des <strong>Stadt</strong> Bozen.<br />
Ausgangslage ist die starke Trennwirkung der<br />
Eisenbahnlinie, die Belastung von angrenzenden<br />
Wohngebieten durch Lärmemissionen <strong>und</strong> die geplante<br />
großflächige Tunnelumfahrung des Gütertransitverkehrs.<br />
Durch dieses Projekt wird das Emissionsproblem gelöst<br />
sowie der Güterbahnhof am Hauptbahnhof Bozen<br />
Quelle: www.egm.it<br />
aufgelassen <strong>und</strong> ins 10km südlich von Bozen gelegene<br />
Branzoll verlegt. Der Hauptbahnhof wird zum reinen<br />
Personenbahnhof <strong>und</strong> muss dementsprechend neu gestaltet werden. Dabei werden die vom<br />
bisherigen Güterbahnhof beanspruchten Flächen in zentraler Lage für neue Nutzungen frei.<br />
Im Zuge dieser Umgestaltung soll die Barrierewirkung wegfallen, die frei werdenden Flächen<br />
(etwa 20ha) einer multifunktionellen Nutzung (Geschäfts-, Büro- <strong>und</strong> Wohnnutzung)<br />
zugeführt <strong>und</strong> die Verkehrssysteme für öffentlichen Verkehr <strong>und</strong> Individualverkehr neu<br />
organisiert werden. Dazu wurden 3 Variante untersucht.<br />
307 www.uni-stuttgart.de Zugriff am 28.06.2007<br />
162
Abb. 47: Umverlegung des <strong>Bahnhof</strong>s (3 Varianten)<br />
Quelle: www.egm.it<br />
Erste Variante wäre die Verlegung der Bahnlinie <strong>und</strong> des <strong>Bahnhof</strong>s auf der bestehenden<br />
Trasse unter die Erde. Wegen der topografischen Gegebenheiten, wie der Eisack<br />
untertunnelt werden muss <strong>und</strong> daher die gesamte Strecke sich in Gr<strong>und</strong>wasser befinden<br />
würde, ist die Verwirklichung dieses Variante äußerst schwierig <strong>und</strong> teuer. Aufgr<strong>und</strong> diese<br />
technische Schwierigkeiten wurde diese Variante abgelehnt.<br />
Die zweite Variante wäre die Überbauung mittels einer „Plattform“ <strong>und</strong> Verlängerung der<br />
Bahnlinie. Die neue Bahnlinie verläuft auf der alten Trasse, verlässt diese nach dem<br />
<strong>Bahnhof</strong>, um in einem 2 km langen Tunnel die alte Strecke nördlich von Bozen wieder zu<br />
erreichen. Mit einer Überplattung des <strong>Bahnhof</strong>sareals würde das Problem der Trennwirkung<br />
gelöst. Der Hauptbahnhof würde dabei an der gleichen Stelle bleiben. Das Areal des alten<br />
Güterbahnhofs würde für neue Nutzungen Frei sein.<br />
Die letzte Variante ist die Verlegung des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> des Schienenbündels. Die neue<br />
Trasse verlässt vor dem alten <strong>Bahnhof</strong> die alte Trasse, verläuft südlich davon Richtung<br />
Eisackufer <strong>und</strong> mündet nach dem Bozner Boden wieder in die alte Trasse ein. Ein Teil dieser<br />
Trasse verläuft durch den alten Güterbahnhof, ein Teil durch ein veraltertes Industriegebiet.<br />
Der Hauptbahnhof wird um 500m (Luftlinie) vom heutigen <strong>Bahnhof</strong> entfernt. Große Teile des<br />
alten <strong>Bahnhof</strong>areals sowie des Bozner Bodens werden für neue Nutzungen direkt im<br />
Anschluss an die Altstadt frei. Diese Variante wurde später als „Ferroplan“ genannt.<br />
163
Abb. 48: Neugestaltung des <strong>Bahnhof</strong>sareals<br />
Quelle: www.egm.it<br />
Dieses Variante bekam aufgr<strong>und</strong> des besseren Anschlusses der frei werdenden Flächen an<br />
die Altstadt sowie der besseren Lösbarkeit der neuen Verkehrssysteme den Zuschlag. Zur<br />
weniger zentralen Lage des neuen <strong>Bahnhof</strong>s heißt es in Ferroplan: „Die Frage des nahen<br />
oder weit entfernten <strong>Bahnhof</strong>s hat nur marginale Bedeutung bei diesem großen Projekt der<br />
Neuorganisation des Verkehrs <strong>und</strong> der urbanistischen Umgestaltung.“. Der neue <strong>Bahnhof</strong> soll<br />
etwa 7 m über dem heutigen Niveau entstehen. Die Kosten liegen bei 422 Millionen Euro.<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> in Bozen soll neu gestaltet werden. Darüber sind sich alle einig. Doch während<br />
einige Gruppen den <strong>Bahnhof</strong> nur erneuern wollen, wollen andere den <strong>Bahnhof</strong> aus dem<br />
Zentrum in den Osten von Bozen verlegen. Diskussion darüber seit 20 Jahren<br />
Die Weichen für eine Neugestaltung des Bozner <strong>Bahnhof</strong>sareals sollen endlich gestellt<br />
werden. Bereits seit den 80er Jahren wird über die Notwenigkeit <strong>und</strong> Möglichkeiten einer<br />
Neugestaltung diskutiert <strong>und</strong> immer noch nicht entschieden.<br />
5.3 Umgang mit brachgefallenen Bahnflächen<br />
Wie an den Beispielen gezeigt wurde, entstehen bei den <strong>Bahnhof</strong>sumgestaltungen <strong>und</strong><br />
<strong>Bahnhof</strong>sneubauten diverse Brachflächen, die eine zielorientierte <strong>und</strong> meist aufwendige<br />
Revitalisierung benötigen. Umgang mit diesen Flächen, die trotz ihrer in manchen Fällen<br />
trister Zustände über erhebliche planerische Potenziale verfügen, stellt wichtige Aufgabe der<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>planung dar.<br />
In vielen deutschen Groß- <strong>und</strong> Mittelstädten sind in Folge der seit 1994 durchgeführte<br />
Reform der Bahn mit den damit einhergehenden Modernisierungs- <strong>und</strong><br />
Neustrukturierungsmaßnahmen des Bahnverkehrs umfangreiche Gebäudeanlagen sowie<br />
Gleis- <strong>und</strong> Umschlagflächen in zentrumsnahen sowie peripheren <strong>Stadt</strong>bereichen stillgelegt<br />
164
<strong>und</strong> aufgegeben worden. Diese zumeist größeren <strong>und</strong> zusammenhängenden Areale verfügen<br />
häufig über eine hervorragende verkehrliche Lagegunst, bilden jedoch gleichzeitig eine<br />
negativ wirkende räumlich-funktionale Zäsur im <strong>Stadt</strong>raum. Einer Neuordnung <strong>und</strong><br />
Weiterentwicklung dieser Flächen kommt deshalb sowohl aus stadtentwicklungspolitischen<br />
<strong>und</strong> stadtstrukturell-städtebaulichen Überlegungen <strong>und</strong> Zielvorstellungen der <strong>Stadt</strong> als auch<br />
aus Verwertungsüberlegungen der Gr<strong>und</strong>eigentümer eine besondere planerische wie<br />
wirtschaftliche Bedeutung zu. 308 Dabei werden diese Überlegungen nicht nur auf die großen<br />
Bahnhöfe der Kategorien eins <strong>und</strong> zwei konzentriert. Entsprechende Potenziale weisen auch<br />
kleinere Bahnhöfe in Mittel- <strong>und</strong> Kleinstädten wie aber auch die einfachen Haltepunkte auf.<br />
Zuerst sollten die Bahnflächen, die für eine Revitalisierung relevant sind, klassifiziert <strong>und</strong><br />
systematisiert werden. In erster Linie sind es die <strong>Bahnhof</strong>sgebäuden selbst, die durch ihren<br />
verfallenen Zustand eine Renovierung <strong>und</strong> durch ihre veraltete Baustruktur eine<br />
Modernisierung benötigen. Die zweite Gruppe sind die entbehrlichen Empfangsgebäuden der<br />
Deutschen Bahn AG, die vor dem Verkommen aufbewahrt <strong>und</strong> durch neue attraktive<br />
Nutzungen gefördert werden sollen. Sie befinden sich vielfach in der City um den<br />
Hauptbahnhof <strong>und</strong> führen zu einer städtebaulich unerwünschten Trennwirkung im Zentrum<br />
der <strong>Stadt</strong>. Ungenutzte, inselhafte Flächenareale im Bereich von Bahnhöfen <strong>und</strong> Haltepunkten<br />
sind als weitere charakteristische Erscheinungsformen zu nennen. Die größte <strong>und</strong><br />
komplizierteste Gruppe sind die technischen Bahnbrachen <strong>und</strong> aufgelassenen Gleise. Sie<br />
liegen meist entlang von Bahntrassen <strong>und</strong> können sich über große Flächen des gesamten<br />
<strong>Stadt</strong>gebietes erstrecken.<br />
Häufig befinden sich im Zusammenhang mit den ungenutzten Bahnflächen im Umfeld von<br />
Bahnhöfen weitere Gewerbebrachen. 309<br />
Die Bedeutung von nicht genutzten oder untergenutzten Bahnflächen für die<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung resultiert vor allem aus folgenden Gegebenheiten:<br />
- Bahnflächen verfügen häufig über eine hervorragende Lagegunst in der <strong>Stadt</strong>,<br />
- im innerstädtischen Bereich stellen umnutzungstaugliche Bahnflächen oftmals<br />
die größten zusammenhängenden Entwicklungspotenziale bzw. Flächen einer<br />
möglichen Entwicklung der <strong>Stadt</strong> dar,<br />
- Bahnflächen liegen meist an funktional wichtigen Orten. Durch die vorhandene<br />
Schienetrassen der Bahn <strong>und</strong> die Nähe zu Bahnstationen sind<br />
entwicklungsfähige Flächen in der Regel gut durch den ÖPNV erschlossen,<br />
308<br />
<strong>Stadt</strong> Leipzig, Der Oberbürgermeister, Dezernat <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> Bau, <strong>Stadt</strong>planungsamt (Hrsg.):<br />
Bahnflächen als Potenziale der <strong>Stadt</strong>entwicklung, Leipzig, 2003, S. 2.<br />
309<br />
Renner, Mechthild, 2004: Revitalisierung von Bahnbrachen – zum Sachstand. Informationen zur<br />
Raumentwicklung 9/10.2004, Bonn: BBR, S. 544.<br />
165
- auf der Ebene der Quartiersplanung eignen sich Bahnflächen zur Ergänzung<br />
vorhandener Baustrukturen oder können als Freiraumpotenziale in hoch<br />
verdichteten<br />
wahrnehmen,<br />
städtischen Bereichen wichtige Wohnumfeldfunktionen<br />
- Bahnflächen verfügen teilweise über stadtökologisch wertvolle Potenziale.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der geringen Überbauung fungieren sie nicht selten als bedeutende<br />
Kaltluftschneisen <strong>und</strong> Schneisen der Frischluftzufuhr. 310<br />
Dem zu Folge bildeten sich in Deutschland neue Konzepte bei dem Umgang mit<br />
entbehrlichen Bahnflächen. Dabei wird unterschieden zwischen brachgefallenen oder<br />
mindergenutzten Areale <strong>und</strong> jenen Flächen, die durch eine logistische Optimierung zu<br />
Bauerwartungsland werden.<br />
Wichtig bei der Entscheidung, was mit einer Bahnbrache passieren soll, ist die Frage, „ist<br />
man wirklich sicher, dass die freigewordene Bahnfläche nie mehr für Verkehrszwecke<br />
benötigt wird?“. Ein bedachter Erhalt bestimmter Bahnflächen kann vielleicht<br />
zukunftsweisender sein als eine vorschnelle Vermarktung <strong>und</strong> Umnutzung. Wenn eine<br />
Weiterentwicklung bzw. Umnutzung einer Bahnfläche feststeht <strong>und</strong> die Perspektiven dieser<br />
Entwicklung eingeschätzt werden sollen, müssen insbesondere folgende<br />
Planungsdeterminanten berücksichtigt werden:<br />
- städtebauliche <strong>und</strong> verkehrliche Lagegunst,<br />
- derzeitige Nutzungsstruktur <strong>und</strong> –intensität,<br />
- Bedeutung der Flächen für die <strong>Stadt</strong>entwicklungsplanung. 311<br />
Die Nutzung von nicht mehr bahnbetriebsnotwendigen Flächen <strong>und</strong> die Bemühungen der<br />
Städte <strong>und</strong> Gemeinden um eine funktionale <strong>und</strong> städtebauliche Aufwertung im Umfeld der<br />
Bahnhöfe setzen Impulse für die Stärkung <strong>und</strong> Belebung der Innenstädte. Dabei müssen<br />
Bahnhöfe in die städtischen Standortmuster integriert werden. Die Revitalisierung der<br />
umgebenden <strong>Stadt</strong>bereiche, intensivierte Nutzungen des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> seines Umfelds als<br />
hochwertige Einzelhandels-, Büro-, Freizeit- <strong>und</strong> Wohnstandorte sowie verkehrsfunktionale<br />
Verbesserungen stehen somit in einem engen sich gegenseitig beeinflussenden<br />
Wechselverhältnis. Eine erfolgreiche Entwicklung setzt gleichermaßen kommunale<br />
Entwicklungskonzepte wie bahnseitige Vermarktungs- <strong>und</strong> Aufwertungskonzepte voraus, die<br />
auf- <strong>und</strong> miteinander abgestimmt sind. 312<br />
310 <strong>Stadt</strong> Leipzig, Der Oberbürgermeister, Dezernat <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> Bau, <strong>Stadt</strong>planungsamt (Hrsg.):<br />
Bahnflächen als Potenziale der <strong>Stadt</strong>entwicklung, Leipzig, 2003, S. 8.<br />
311 Ebenda, S. 34.<br />
312 Beckmann, Klaus J., 2002: Personenbahnhöfe als Kristallisationskerne zukunftsfähiger <strong>Stadt</strong>entwicklung.<br />
Eisenbahntechnische R<strong>und</strong>schau 51/2002, S. 369-377. Hamburg: Hestra-Verlag, S. 373.<br />
166
Erfolgreiche Instrumente zur Integration der Bahnhöfe <strong>und</strong> ihrer Umfelder in das<br />
innerstädtische Leben sind die, schon oben erwähnten „Projekte 21“. Durch den Umbau von<br />
Kopfbahnhöfen in tiefer gelegte Durchgangsstationen <strong>und</strong> unterirdische Verlagerung der<br />
Bahngleise können bis zu 90 Prozent 313 der heutigen Bahnflächen den Städten für ihre<br />
Entwicklung zur Verfügung gestellt werden.<br />
In den 1980er Jahren wurde das Konzept erarbeitet, die ungenutzten Bahnhöfe zu<br />
Erlebniszentren mit Gleisanschluss umzubauen, um damit den aufgegebenen Look der<br />
Bahnhöfe als Visitenkarten der Städte wieder ins Leben zu rufen. Doch diese Idee stößt<br />
heute immer mehr auf Misstrauen.<br />
Heute nimmt die Attraktivität der Bahn als schnelles, zuverlässiges <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>liches<br />
Transportmittel immer mehr zu. Die Deutsche Bahn hat heute ganz andere Chancen <strong>und</strong><br />
kann sichere Marktanteile am gesamten Verkehrsaufkommen ausbauen.<br />
Bahnhöfe brauchen sich nicht länger hinter Einkaufs- <strong>und</strong> Freizeitzentren zu verstecken. Sie<br />
müssen klar in ihrer Funktion herausgestellt werden. Ein <strong>Bahnhof</strong> kann erst dann städtische<br />
Funktionen mit Läden, Büros <strong>und</strong> Hotels aufnehmen, wenn er als leistungsfähige<br />
Schnittstelle des Transports <strong>und</strong> als publikumswirksames Reisezentrums akzeptiert wird.<br />
Anders als die isolierten Dienstleistungs- <strong>und</strong> Konsumzentren der großen Flughäfen, die<br />
fernab der Innenstädte zu wahren Ersatzstädten heranwachsen, sollen Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre<br />
Geschäftszonen integrale Bestandteile der <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> ihres öffentlichen Raumes sein.<br />
Multifunktionale Bahnhöfe schaffen es heute sogar ganze <strong>Stadt</strong>viertel ringsherum<br />
wiederzubeleben. 314<br />
In prosperierenden Städten ist es bedeutsam, bestehende räumliche<br />
Wiedernutzungspotenziale im Rahmen der Innenentwicklung als Baulandpotenziale<br />
auszuschöpfen <strong>und</strong> so die Neuinanspruchnahme von Freiräumen bzw. Landschaft für<br />
Siedlungsflächen zu vermeiden. Hier wird es bei der Reaktivierung von Bahnbrachen häufig<br />
entweder um Umbau <strong>und</strong> Umnutzung oder um Rückbau, Neubau <strong>und</strong> Neunutzung gehen.<br />
Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ist zunächst die Strategie des Umbaus <strong>und</strong> der<br />
Umnutzung einzugehen, da die Weiternutzung des Bestandes in der Regel<br />
ressourcenschonender ist als Abbruch <strong>und</strong> Neubau. So werden große Mengen an Bauschutt<br />
<strong>und</strong> verbrauchter Energie für den Abbruch vermieden.<br />
In Städten mit Stagnation bzw. rückläufiger Entwicklung können dagegen auch folgende<br />
Alternativen Anwendung finden:<br />
- diese ehemals genutzte Flächen als Brachen in der <strong>Stadt</strong> zunächst liegen zu<br />
lassen,<br />
313 Dürr, Heinz, 1996. Bahn frei für eine neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg, S. 14-15.<br />
314 Ebenda, 14-15.<br />
167
- sie einer Zwischennutzung zuzuführen oder<br />
- sie der Natur zurückzugeben oder als Kulturlandschaft zu entwickeln.<br />
Zu prüfen bzw. zu vermeiden ist hier immer, ob bzw. dass eine bauliche Wiederverwendung<br />
nicht zur Konkurrenz mit anderen funktionierenden <strong>Stadt</strong>räumen führt <strong>und</strong> hierdurch<br />
letztendlich an anderen innerstädtischen Orten neue Brachen induziert werden. 315<br />
5.4 Fazit<br />
Die Verhältnisse zwischen <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong> haben sich nach der Bahnreform von 1994<br />
drastisch geändert. Hinzu kamen mehrere neue Akteure, die die Entwicklungen der<br />
Bahnflächen <strong>und</strong> somit auch der Städte <strong>und</strong> Gemeinden mit beeinflussten. Die veränderten<br />
Bedingungen wurden erst mehrere Jahre später wahrgenommen <strong>und</strong> sie werden in die<br />
zukunftsorientierten Planungen immer mehr miteinbezogen.<br />
Dass die Entwicklung der innerstädtischen Bahnflächen eine wichtige <strong>und</strong> vorteilhafte<br />
Chance für die Entwicklung der Innenstädte insgesamt ist, die nicht unterschätzt werden<br />
darf, stellt heute vielleicht die bedeutendste Erkenntnis in der <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong><br />
<strong>Stadt</strong>planung. Die Bahnhöfe sollen nicht nur als „Tore zur <strong>Stadt</strong>“ betrachtet werden, sondern<br />
viel mehr als ernsthafte multifunktionale städtische Zonen, die über große<br />
Entwicklungspotenziale verfügen.<br />
315<br />
Renner, Mechthild, 2004: Revitalisierung von Bahnbrachen – zum Sachstand. Informationen zur<br />
Raumentwicklung 9/10.2004, Bonn: BBR, S. 546.<br />
168
6. Architektur <strong>und</strong> räumliche Zusammenhänge der Bahnhöfe<br />
6.1 Die Entwicklung der <strong>Bahnhof</strong>sarchitektur<br />
Die Anfänge der deutschen <strong>Bahnhof</strong>sarchitektur gehen bis in die vierziger Jahre des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts zurück. Die Gestaltung der Bahnhöfe bedeutete für die Architekten eine<br />
neue Herausforderung, da die bisherigen Verkehrsbauten nicht vergleichbar mit den<br />
zukünftigen Bahngebäuden waren. Zugleich gab es in der Baukunst des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
keine einheitliche Formensprache.<br />
Tabelle 22: Zeittafel der Stile der <strong>Bahnhof</strong>sarchitektur<br />
Quelle: Häßler, Michael; „<strong>Bahnhof</strong>sarchitektur im Spiegel zeitgenössischer<br />
Baustilentwicklung“;2006; aus Prof. Dr.-Ing. Richrath, Klaus; Prof. Dipl.- Ing. Ringel,<br />
169
Johannes; Dissertation „<strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> – Untersuchungen zu den Wechselwirkungen<br />
zwischen <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> städtischem Umfeld“; Karlsruhe 2005, S. 51<br />
Dadurch wurde die Entwicklung einer eigenen Architektursprache für die Bahnhöfe<br />
vorantrieben. 316 Der folgende Text geht kurz auf die Baustile der verschiedenen Zeiten<br />
ein, die in der obigen Tabelle zusammenfassend dargestellt sind.<br />
In der Frühzeit bis zum Historismus konnte der Architekt seinen gestalterischen<br />
Gedanken freien Lauf lassen, so dass er in die Bahnhöfe jedwede Elemente der<br />
europäischen Kunstgeschichte integrieren konnte, die dem Bauwerk einen Ausdruck von<br />
Technik, Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Macht verleihen sollten. Trotz dieser vielfältigen<br />
Möglichkeiten der <strong>Bahnhof</strong>sgestaltung manifestierten sich im Verlauf des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts stilistische Gemeinsamkeiten, die schließlich den sich entwickelnden<br />
Historismus ausmachten. Eine wesentliche Rolle für die Architektur des<br />
Empfangsgebäudes spielten elementare, geometrische Formen, eine einfache<br />
Überschaubarkeit der Baumassen <strong>und</strong> der Gr<strong>und</strong>risse sowie die Betonung der Symmetrie<br />
<strong>und</strong> Axialität. Im Gegensatz dazu bestand die Bahnsteighalle nur aus einer simplen<br />
Holzkonstruktion, die die wenigen Gleise überdachen sollten. Die tragenden Säulen des<br />
Daches wurden schon nach wenigen Jahren aus Gusseisen gefertigt, das als modisch <strong>und</strong><br />
modern angesehen wurde. 317<br />
Der späte Historismus kennzeichnete sich vor allem durch verwobene, ineinander<br />
greifende Formen, die die einfache <strong>und</strong> klare Geometrie langsam ablösen sollten. In der<br />
zweiten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts gestalteten sich die Gr<strong>und</strong>risse zunehmend<br />
komplexer <strong>und</strong> es kam zu einer Stärkung asymmetrischer Körper. Mit der Zeit ging der<br />
Historismus in den Eklektizismus über. Während dieser Phase fand die gleichzeitige<br />
Verwendung verschiedener Baustile statt, so dass es den Architekten möglich war<br />
verschiedene Stile anzuwenden. Mit der Zeit stieg auch die Bedeutung der<br />
Bahnsteighallen, die die Entwicklung neuer Baustoffe <strong>und</strong> Bautechnologien vorantrieben.<br />
Es bildete sich eine wahre Blütezeit für die Überdachungshallen heraus, die immer<br />
größere Ausmaße annahmen, so dass in der Folgezeit einige wagemutige<br />
Stahlkonstruktionen hervorgingen, die bald zu mehrschiffigen Hallenstrukturen führten.<br />
Sie waren wiederum bald das Aushängeschild des sich entwickelnden Bahnwesens <strong>und</strong><br />
orientierten sich im zunehmenden Maße an den technischen Belangen wie zum Beispiel<br />
an den wachsenden Gleis- <strong>und</strong> Bahnsteigflächen. 318<br />
Mit Beginn des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts bestanden die meisten deutschen Bahnhöfe bereits, so<br />
dass der <strong>Bahnhof</strong>sbau in Deutschland schon im Historismus <strong>und</strong> Eklektizismus seinen<br />
Höhepunkt gef<strong>und</strong>en hatte. In der anlaufenden Moderne legte man den Schwerpunkt<br />
zunächst in die Einbeziehung der neuen Baustoffe Eisen <strong>und</strong> Stahl. Die Folge jener<br />
Überlegungen war jedoch oftmals, dass die Stahlanteile hinter die Steinfassade gebaut<br />
wurden. Wichtige Gesichtspunkte der neuen Architektursprache der klassischen Moderne<br />
bildeten sich in den zwanziger Jahren des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts heraus. So gewannen die<br />
Reihung, die Wiederholung <strong>und</strong> die Betonung der Horizontalen an Bedeutung in der<br />
316<br />
Häßler, Michael; „<strong>Bahnhof</strong>sarchitektur im Spiegel zeitgenössischer Baustilentwicklung“;2006; aus Prof. Dr.-<br />
Ing. Richrath, Klaus; Prof. Dipl.- Ing. Ringel, Johannes; Dissertation „<strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> – Untersuchungen<br />
zu den Wechselwirkungen zwischen <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> städtischem Umfeld“; Karlsruhe 2005, S. 51 f.<br />
317<br />
Ebenda, S. 52 f.<br />
318<br />
Ebenda, S. 53 f.<br />
170
Architektur der Bahnhöfe. Der Verzicht auf Ornamente spiegelte sich unter anderem in<br />
glatten, weißen Wandflächen wider, die von Fensterbänken durchbrochen wurden.<br />
Kubische Formen, Flachdächer <strong>und</strong> funktionale Gr<strong>und</strong>risse waren weitere Merkmale der<br />
sich durchsetzenden Moderne. Mit dieser Zeit ging jedoch auch das Ansehen der<br />
Bahnsteighallen verloren, so dass überwiegend nur noch kostengünstige<br />
Einzelüberdachungen der Bahnsteige vorgenommen wurden, die zumeist aus Stahl bzw.<br />
Stahlbeton bestanden. 319<br />
Die zahlreichen im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bahnhöfe wurden in den folgenden<br />
Jahrzehnten wieder aufgebaut. Die Architektur dieser nachkriegszeitlichen Bauwerke<br />
orientierte sich zunächst an den in den zwanziger <strong>und</strong> dreißiger Jahren des<br />
20. Jahrh<strong>und</strong>erts entwickelten Gestaltungsformen. Es entstand eine neue Richtung in der<br />
Architektur, die mit reduziertem Materialeinsatz, schlanken Stahlbetonkonstruktionen<br />
<strong>und</strong> zurückhaltenden Pastellfarben auskam. Außerdem setzte man auf große Glasflächen,<br />
die symbolisch mit der Vergangenheit brechen sollten. Doch bereits während der 1960er<br />
Jahre nimmt die Bedeutung des Bahnwesens in Deutschland ab, da durch<br />
infrastrukturelle Maßnahmen der motorisierte Individualverkehr gefördert wurde. In der<br />
<strong>Bahnhof</strong>sarchitektur wurde die einfache Unbeschwertheit der 1950er Jahre durch die<br />
monotone Regelmäßigkeit <strong>und</strong> gestalterische Zurücknahme der sechziger <strong>und</strong> siebziger<br />
Jahre abgelöst. Der Anspruch an die Baukunst der Bahnhöfe stieg erst Ende der achtziger<br />
Jahre wieder an. Es erfolgte vor allem eine Qualifizierung des Inneren der Stationen, die<br />
zunächst mit reichlich Glas <strong>und</strong> Gipskarton ausgestattet wurden. Die Bahn setzte<br />
außerdem auf neue Farben, Baumuster <strong>und</strong> Regelzeichnungen für die<br />
Bahnsteigausstattung. Es erfolgte eine Verbesserung der Überdachungen, der<br />
Wegeleitung <strong>und</strong> der Anzeigetafeln. Jüngste Beispiele in der <strong>Bahnhof</strong>sarchitektur nehmen<br />
unter anderem die Bedeutung der Bahnsteighalle wieder auf <strong>und</strong> lassen kühne<br />
Konstruktionen aus Stahl <strong>und</strong> Glas entstehen, wie es beispielsweise am Berliner<br />
Hauptbahnhof umgesetzt wurde. 320 Eines der aktuellsten Beispiele einer architektonisch<br />
besonders wertvollen Dachkonstruktion ist das 2007 fertig gestellte Membrandach, des<br />
Dresdener Hauptbahnhofes. Das Teflon-Dach ist selbst reinigend <strong>und</strong> besteht aus<br />
Glasfasern, wodurch es äußerst reißfest wird. Der Entwurf entstand nach Plänen des<br />
berühmten Architekten Sir Normen Foster, was die wachsende Bedeutung der<br />
<strong>Bahnhof</strong>sarchitektur unterstreicht. 321<br />
6.2 Schienengestützte Siedlungsentwicklung<br />
In der räumlichen Planung werden die Siedlungsplanung auf der einen Seite <strong>und</strong> die<br />
Verkehrsplanung auf der anderen Seite seit längerem als integrierte Aufgabe verstanden.<br />
Während in der Vergangenheit (bis Anfang der 1980er Jahre) in der Verkehrsplanung das<br />
Hauptaugenmerk auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) - autogerechte <strong>Stadt</strong>gelegt<br />
wurde, konzentriert man sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend auf die<br />
Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Gründe dafür sind<br />
319 Häßler, Michael; „<strong>Bahnhof</strong>sarchitektur im Spiegel zeitgenössischer Baustilentwicklung“;2006; aus Prof. Dr.-<br />
Ing. Richrath, Klaus; Prof. Dipl.- Ing. Ringel, Johannes; Dissertation „<strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> – Untersuchungen<br />
zu den Wechselwirkungen zwischen <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> städtischem Umfeld“; Karlsruhe 2005, S. 54 f.<br />
320 Ebenda, S. 56 f.<br />
321 http://www.das-neue-dresden.de/hauptbahnhof.html, Zugriff am 15.07.2007.<br />
171
allgemein bekannt: Die Jahrzehntelang gleichrangig, ja sogar bevorzugte Stellung des<br />
MIV gegenüber den anderen, weitaus umweltverträglicheren, Verkehrsträgern führte zu<br />
ökonomischen, sozialen <strong>und</strong> vorrangig ökologischen Problemen. Letzteres drückt sich<br />
heute beispielsweise in einem erheblichen Anteil des schädlichen Kohlendioxids in der<br />
Luft <strong>und</strong> durch einen allgemein erhöhten Lärmpegel in den meisten Gebieten aus.<br />
Neben der autogerechten Verkehrsplanung bis Anfang der 1980er Jahre konzentrierte<br />
man sich im Bereich der Siedlungsentwicklung vornehmlich am Leitbild der dezentralen<br />
Siedlungsstruktur. Nach dieser verteilten sich die Infrastruktureinrichtungen auf<br />
zahlreiche Standorte, die Ausweisung von Siedlungen fand im Raum an den<br />
Verkehrsachsen, hauptsächlich aber an denen des Straßenverkehrs statt. Das<br />
Verkehrssystem war stark vernetzt, jedoch nur wenig hierarchisch gegliedert <strong>und</strong><br />
Wohnen <strong>und</strong> Arbeiten fanden an getrennten Orten statt. Letzterer Tatbestand, also die<br />
räumliche Trennung von Wohnen <strong>und</strong> Arbeiten, verstärkte sich darüber hinaus in den<br />
1990er Jahren, aufgr<strong>und</strong> des Wunsches eines großen Teils der Bevölkerung nach einem<br />
eigenen Heim „im Grünen“. Dies ließ insbesondere in den Speckgürteln großer Städte<br />
eine Vielzahl von Siedlungen entstehen, die in ihrer Nutzung sehr einseitig waren. Die<br />
fehlende Nutzungsmischung auf der einen Seite <strong>und</strong> die erhöhte räumliche Distanz<br />
zwischen Wohnort <strong>und</strong> Arbeitsplatz (die meisten Arbeitsplätze sind in größeren Städten<br />
vorhanden) ließen den MIV, trotz des zu der Zeit von der Verkehrsplanung verfolgten<br />
Teilziels, der Förderung des ÖPNV, stark ansteigen.<br />
Mitte der 1990er Jahre erkannte man in der räumlichen Planung das Problem <strong>und</strong><br />
versuchte mit einer Siedlungsentwicklung unter dem Leitbild der Nutzungsmischung <strong>und</strong><br />
der Stärkung der Innenstädte als Wohnort (nahe zum Arbeitsplatz) dem Negativtrend der<br />
Zersiedelung entgegenzuwirken. Gleichzeitig wurde eine verstärkte Durchführung von<br />
Ausweisungen von Siedlungen an den Verkehrsachsen verfolgt, die auch mit dem ÖPNV<br />
erschlossen werden sollten, <strong>und</strong> auch größtenteils wurden. Aufgr<strong>und</strong> von Kürzungen von<br />
öffentlichen Mitteln für den ÖPNV wurde das Befahren vieler Strecken unrentabel <strong>und</strong> die<br />
Verbindungen wurden „kurzerhand“ gestrichen. Insbesondere in ländlich geprägten<br />
Gebieten zeigt sich das heute noch häufig: Es fahren keine Busse <strong>und</strong> Bahnen.<br />
Um der Gefahr der Zunahme der privaten Motorisierung entgegenzuwirken, strebt man<br />
auf Gr<strong>und</strong>lage des raumplanerischen Leitbildes der „dezentralen Konzentration“ <strong>und</strong> der<br />
„<strong>Stadt</strong> der kurzen Wege“ 322 die Ausweisung neuer Wohn- <strong>und</strong> Gewerbegebiete nun<br />
vornehmlich in der Nähe von Haltepunkten der Achsen des<br />
Schienenpersonennahverkehrs an. Diese sollen dabei auch auf längere Zeit rentabel sein.<br />
In jüngerer Vergangenheit hat der Ansatz dann auch erste Umsetzungen <strong>und</strong> eine<br />
Vielzahl von Konkretisierungen in Deutschland <strong>und</strong> anderen Ländern erfahren.<br />
322 Das Leitbild der „<strong>Stadt</strong> der kurzen Wege“ beruht auf den Prinzipien der städtebaulichen Dichte, der<br />
funktionalen <strong>und</strong> sozialen Mischung sowie einer zentralorientierten Standortstruktur (Polyzentralität). Ziel<br />
der Konzeptes ist die Verkehrsvermeidung durch eine Reduzierung der notwendigen Distanzen zur Ausübung<br />
von Aktivitäten <strong>und</strong> eine dadurch ermöglichte Verlagerung auf den Rad- <strong>und</strong> Fußgängerverkehr sowie auf<br />
öffentliche Verkehrsmittel.<br />
172
6.2.1 Gründe für die Orientierung zur schienengestützten Siedlungsentwicklung<br />
Welche Vorteile bietet nun die schienengestützte Siedlungsentwicklung gegenüber den<br />
bisher üblichen verfolgten Siedlungsstrukturkonzepten?<br />
Abb. 49: Siedlungsentwicklung in Gemeinden mit <strong>und</strong> ohne Bahnanschluss<br />
Quelle: The Effects of Land Use and Travel Demand Management Strategies on Commuting<br />
Behaviour, November 1994, Cambridge Systematics<br />
Aus der Schweiz liegen Erfahrungswerte für die Siedlungsentwicklung an<br />
Schienenhaltepunkten in der Vergangenheit vor. Es zeigte sich, dass sich in den Orten,<br />
die über einen Bahnanschluss verfügen, die Einwohnerzahl wesentlich besser entwickelte,<br />
als in denen, die keinen haben. Bei letzteren stagnierte die Zahl der Einwohner <strong>und</strong> war<br />
zum Teil sogar rückläufig, wohingegen in einigen Orten mit einem Schienenhaltepunkt<br />
die Einwohnerzahl beispielsweise das Vierfache des Wertes von 1940 erreichte. 323 Ähnlich<br />
verhält es sich in vielen Fällen auch bei der Entwicklung der örtlichen Wirtschaft.<br />
Weiterhin wird in Orten mit Bahnanschluss, im Vergleich zu denen ohne, das<br />
Verkehrsmittel Bahn als auch der ÖV häufiger als das private PKW genutzt324, was in<br />
den Gebieten selbst zu einem besseren Wohnklima (weniger Verkehrslärm, weniger<br />
Staus, mehr Sicherheit für den ungeb<strong>und</strong>enen Individualverkehr, also Fußgänger-, <strong>und</strong><br />
323 Dieter Apel, Michael Lehmbrock, Tim Pharoa, Jörg Thiemann-Linden; Kompakt, mobil, urban:<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungskonzepte zur Verkehrsvermeidung im internationalen Vergleich; Difu-Beiträge zur<br />
<strong>Stadt</strong>forschung, Band 24; Deutsches Institut für Urbanistik; Anfang 1998.<br />
324 Es wurde beobachtet, dass die Haushalte in einem 1000m Einzugsbereich einen geringeren PKW Bestand<br />
<strong>und</strong> einen signifikant höheren Anteil in der Nutzung des ÖV aufweisen, insbesondere im Berufs- <strong>und</strong><br />
Freizeitverkehr; Quelle: Wolfgang Brinkmann, Andrea Dittrich, Peter Endemann, Guido Müller; Institut für<br />
Landes- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklungsforschung des Landes NRW (ILS); Ministerium für Arbeit, Soziales <strong>und</strong><br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung, Kultur <strong>und</strong> Sport des Landes NRW (Hrsg.); Baulandentwicklung an der Schiene – NRW -<br />
Studie zum Mobilitätsverhalten der Wohnbevölkerung in Gebieten mit <strong>und</strong> ohne Schienenverkehrshaltepunkt;<br />
Dortm<strong>und</strong>, 1999.<br />
173
Fahrradverkehr) <strong>und</strong> zur Entlastung der Umwelt beiträgt. Darüber hinaus ist das<br />
Verkehrsmittel Bahn im Vergleich zum motorisierten Verkehr auf der Straße weitaus<br />
effektiver <strong>und</strong> damit umweltfre<strong>und</strong>licher. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Bahn<br />
als Verkehrsmittel gegenüber dem MIV als Zubringer in Ballungszentren wesentlich<br />
weniger Zeit benötigt <strong>und</strong> dadurch auch Kaufkraft aus der entfernteren Region<br />
erschlossen werden kann. Umgekehrt profitieren die umliegenden Regionen von<br />
ansteigenden Besucherzahlen aus der Innenstadt.<br />
Die ökologischen <strong>und</strong> ökonomischen Vorteile, die die schienengestützte<br />
Siedlungsentwicklung für große Regionen mit sich bringt, führte wie bereits o.g. in der<br />
Raumplanung zu einer zunehmenden Auseinandersetzung mit diesem Thema.<br />
6.2.2 Definition „Schienengeb<strong>und</strong>ene Siedlungsentwicklung“<br />
In Deutschland fehlt bislang eine feststehende allgemeingültige Definition für den Begriff<br />
der „Schienengestützten Siedlungsentwicklung“. Im Rahmen des Projektes „Bahn Ville“,<br />
welches die Voraussetzungen für eine bessere Integration von Schienenverkehrs- <strong>und</strong><br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung auf regionaler Ebene in Deutschland <strong>und</strong> Frankreich im Jahre 2002<br />
untersuchte <strong>und</strong> daraus Handlungsempfehlungen erarbeitete, wurde folgende Definition<br />
vorgeschlagen:<br />
„Schienengestützte Siedlungsentwicklung ist eine aktive Raumordnungspolitik auf<br />
regionaler Ebene, die es sich zum Ziel setzt, die Potentiale eines hochwertigen<br />
Bahnsystems durch eine zeitlich <strong>und</strong> räumlich abgestimmte Standortpolitik zu nutzen <strong>und</strong><br />
zu stärken, Sie umfasst neben strategischen Leitbildern konkrete Maßnahmen <strong>und</strong><br />
Instrumente zur Entwicklung von städtebaulich verdichteten, gemischt genutzten <strong>und</strong> auf<br />
die Bahn ausgerichtete Quartieren an den Haltepunkten <strong>und</strong> Bahnhöfen des SPNV -<br />
Netzes. Über die Stärkung der Bahnsysteme hinaus erwartet man positive Impulse für<br />
die räumliche Entwicklung selbst (ressourcensparende Innenentwicklung, Stärkung der<br />
<strong>Stadt</strong>teilzentren, lebendige Nachbarschaftsquartiere usw.).“ 325<br />
6.2.3 Ziele<br />
Die Ziele der schienengestützten Siedlungsentwicklung sind zum großen Teil aus der<br />
Definition bereits ersichtlich. Übergeordnetes Ziel ist zunächst mit einer integrierten<br />
Planung die Verkehrsentwicklung, wie Verkehrsverminderung bzw. -verlagerung auf<br />
umweltfre<strong>und</strong>liche Verkehrsmittel, mit der nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu<br />
kombinieren. Bestandteil der letztgenannten (nachhaltigen Siedlungsentwicklung) ist<br />
neben der Konzentration neuer Siedlungen entlang von Verkehrsachsen, die<br />
insbesondere vom ÖPNV gut erschlossen sein sollen, vor allem das Erreichen einer<br />
stärkeren Nutzungsmischung <strong>und</strong> höheren Siedlungsdichte.<br />
In der Vereinigung der beiden o.g. Bereiche mit ihren entsprechenden Zielen ergeben<br />
sich die Hauptziele der schienegestützten nachhaltigen Siedlungsentwicklung:<br />
325 Wulfhorst, Gebhard; Kurzbericht des Projektes Bahn Ville – Schienengestützte Siedlungsentwicklung <strong>und</strong><br />
Verkehrsverknüpfung in deutschen <strong>und</strong> französischen Regionen – Inhaltliche Wirkungszusammenhänge,<br />
Rahmenbedingungen auf deutscher <strong>und</strong> französischer Seite, Arbeitspaket 2B; Aachen 2002; S. 12.<br />
174
- Entlastung der Umwelt, aufgr<strong>und</strong> eines Anstiegs des ÖPNV-Anteils am<br />
Gesamtverkehr,<br />
- Entlastung der öffentlichen Haushalte, infolge der besseren Auslastung der<br />
vorhandenen öffentlichen <strong>und</strong> privaten Infrastruktur (wodurch weit weniger<br />
finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen als für Neuinvestitionen), 326<br />
- Entgegenwirken des Prozesses der Landschaftszersiedlung (Leitbild der<br />
"dezentralen Konzentration" mit der Schwerpunktsetzung auf den<br />
6.2.4 Umsetzung<br />
� Allgemeines<br />
Schienenverkehr) 327<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die erfolgreiche Umsetzung der o.g. Ziele der schienengestützten<br />
Siedlungsentwicklung ist die überdurchschnittlich hohe Nutzung der Bahn <strong>und</strong> ihrer<br />
Zubringer des öffentlichen Verkehrs (ÖV) oder des ungeb<strong>und</strong>enen Individualverkehrs<br />
gegenüber dem privaten motorisierten Verkehrsmittel. Aus diesem Sachzusammenhang<br />
heraus stellen sich zunächst folgende Fragen:<br />
Welche Faktoren haben für den Verkehrsmittelnutzer einen Einfluss auf die Wahl der<br />
Bahn? Welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Wahl der Verkehrsmittel zum<br />
<strong>Bahnhof</strong>?<br />
Sind diese Faktoren identifiziert, kann auf dieser Gr<strong>und</strong>lage durch städtebauliche <strong>und</strong><br />
verkehrliche Maßnahmen die Struktur des einzelnen Ortes <strong>und</strong> des <strong>Bahnhof</strong>es, <strong>und</strong> durch<br />
organisatorische <strong>und</strong> verkehrliche Maßnahmen die Siedlungsstruktur der betreffenden<br />
Region so gesteuert werden, dass sich der einzelne Verkehrsteilnehmer vornehmlich<br />
zugunsten der Verkehrsmittel des ÖV´s <strong>und</strong> insbesondere der Bahn entscheidet.<br />
Nachfolgend sollen kurz die Ergebnisse der empirisch durchgeführten Untersuchung des<br />
Projektes „Bahn Ville“ zusammenfassend dargestellt werden, die in diesem<br />
Zusammenhang darüber Aufschluss geben.<br />
326 Dieter Apel, Michael Lehmbrock, Tim Pharoa, Jörg Thiemann-Linden; Kompakt, mobil, urban:<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungskonzepte zur Verkehrsvermeidung im internationalen Vergleich; Difu-Beiträge zur<br />
<strong>Stadt</strong>forschung, Band 24; Deutsches Institut für Urbanistik; Anfang 1998 S. 153.<br />
327 „Eine Zersiedlung der Landschaft ist gegeben, wenn die Freiraumfunktion durch bauliche Tätigkeit in einer<br />
nach Situierung, Intensität (Umfang <strong>und</strong> Maßstab) oder Art übergebührlich gestört (z.B. Landschaftsbild)<br />
oder belastet (z.B. Naturhaushalt) wird. Das ist u.a. der Fall, wenn bauliche Einzelanlagen oder neue<br />
Baugebiete ungeordnet ohne bauliche Konzeption, (in sich) unzusammenhängend, in landschaftlich<br />
bedeutsamer Lage <strong>und</strong>/oder in abgesetzter Lage geplant werden, so dass 1. es sich u.a. um eine<br />
zusammenhanglose Streubebauung ohne Konzentration handelt 2. das Verhältnis zwischen dem Umfang <strong>und</strong><br />
Maßstab (z.B. in Höhe oder Volumen) der bereits vorhandenen Bebauung <strong>und</strong> dem hinzutretenden Vorhaben<br />
unproportional wird, sich also die Planung der vorhandenen Bebauung nicht unterordnet 3. sich funktionale<br />
Spannungen zwischen bestehender Bebauung <strong>und</strong> dem hinzutretenden Vorhaben ergeben 4. der Planung<br />
eine weitreichende oder noch nicht genau übersehbare Vorbildwirkung, für z.B. die Inanspruchnahme von<br />
Flächen an Autobahn Anschlussstellen zukommt 5. der Zugang zur freien Landschaft eingeschränkt wird<br />
<strong>und</strong>/oder 6. es zu einer Bebauung in exponierter Lage - auch bei Anbindung an bebaute Ortsteile- kommt.<br />
Bei Wohnbauten in abgesetzter Lage z.B. handelt es sich regelmäßig um eine Zersiedlung.“; Quelle:<br />
Regionalplan Südostoberbayern; Teil B: Fachliche Festlegungen - Nachhaltige Entwicklung der fachlich<br />
raumbedeutsamen Strukturen ökologisch nachhaltige Entwicklung.<br />
175
Ziel des deutsch-französischen Projektes „Bahn Ville“, das im Zeitraum von Dezember<br />
2001 bis Oktober 2004 durchgeführt wurde, war die Voraussetzungen für eine bessere<br />
Integration von Schienenverkehrs- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung auf regionaler Ebene zu<br />
untersuchen. Dabei standen folgende Fragestellungen im Mittelpunkt:<br />
- Welche Wirkungszusammenhänge bestehen zwischen der Qualität des<br />
regionalen Bahnangebotes, der Gestaltung von Bahnhöfen <strong>und</strong> Stationen,<br />
prozessualen Planungsabläufen <strong>und</strong> verschiedenen Strategien der<br />
Siedlungsentwicklung?<br />
- Welche Faktoren begünstigen eine erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen<br />
<strong>und</strong> welche Erfahrungen liegen bezüglich ihres Zusammenwirkens vor?<br />
Welche Kriterien hingegen wirken sich hemmend auf eine Realisierung aus?<br />
Im Rahmen einer vergleichenden Analyse der Situation in Frankreich <strong>und</strong> in Deutschland<br />
hat das Bahn Ville - Team über einen Zeitraum von 3 Jahren diese Fragestellungen<br />
untersucht <strong>und</strong> die entsprechenden Ergebnisse zusammengetragen. Das Projekt „Bahn<br />
Ville“ bestand aus zwei Projektphasen. In der ersten Phase stand der Austausch über den<br />
aktuellen Kenntnisstand, die Analyse von Best-Practice-Beispielen sowie die Ableitung<br />
von Handlungsempfehlungen im Vordergr<strong>und</strong>. In der zweiten Phase wurden – im Sinne<br />
einer wissenschaftlichen Begleitung – die in Phase 1 gewonnenen Erkenntnisse anhand<br />
von Referenzstrecken in die Praxis umgesetzt.<br />
Das methodische Vorgehen in Phase I bestand zunächst aus der Ermittlung der in beiden<br />
Ländern existierenden Rahmenbedingungen bezüglich technischer, inhaltlicher <strong>und</strong><br />
rechtlich-institutioneller Vorgaben. Anhand der retrospektiven Betrachtung deutscher <strong>und</strong><br />
französischer Best-Practice-Beispiele (Literaturanalyse, Akteursbefragungen) konnten<br />
erste Hinweise auf Wirkungszusammenhänge, Effekte <strong>und</strong> Prozesse abgeleitet werden.<br />
Basierend auf den Arbeitspaketen konnten Hypothesen zu den inhaltlichen <strong>und</strong><br />
prozessualen Wechselwirkungen zwischen Siedlungs- <strong>und</strong> Verkehrsentwicklung<br />
aufgestellt <strong>und</strong> im Rahmen eines Expertenworkshops (März 2003 in Dortm<strong>und</strong>) ergänzt<br />
<strong>und</strong> validiert werden. Darauf aufbauend wurde das Erhebungskonzept für die vertieften<br />
empirischen Untersuchungen in den zuvor festgelegten vier Fallbeispielen (Bodensee-<br />
Oberschwaben-Bahn (BOB), Schienenverkehrsnetz Straßburg, Voreifelbahn (VB � Bonn<br />
nach Euskirchen), die Bahnlinie Nantes - Saint-Nazaire - Le Croisic(MétrOcéane))<br />
entwickelt. Insbesondere die Befragungsergebnisse der Fahrgast- <strong>und</strong><br />
Haushaltsinterviews dienten der Beleuchtung der inhaltlichen Wirkungszusammenhänge<br />
zwischen den Teilbereichen „Bahn“, „Ville“ <strong>und</strong> „Station“. Im weiteren Projektverlauf<br />
wurden die aus den Arbeitspaketen gewonnenen Erkenntnisse – soweit möglich –<br />
generalisiert <strong>und</strong> schematisiert.<br />
Im Oktober 2004 wurden im Rahmen des Abschlussseminars in Bonn (Nordrhein-<br />
Westfalen) die Forschungsergebnisse aus dem Projekt vorgestellt.328<br />
328 Pretsch, Hélène (ISB); Spieshöfer, Alexander (ILS NRW); Puccio, Benjamin (Adeus); Soulas, Claude<br />
(Inrets); Leclercq, Régis (CETE de l’Ouest); Bentayou, Gilles (Certu); Deutsch französisches Projekt Bahn<br />
Ville; 2004; S. 4, 11.<br />
176
In der 3. Kapitel der Arbeit wurden für die schienengestützte Siedlungsentwicklung im<br />
einzelnen folgende Faktoren untersucht:<br />
- - Einfluss auf die Wahl des Verkehrsmittel Bahn,<br />
- - Einfluss auf die Wahl der Verkehrsmittel zum <strong>Bahnhof</strong>,<br />
- - Einfluss sowohl auf die Wahl des Verkehrsmittel zum <strong>Bahnhof</strong> als auch der<br />
Bahn.<br />
� Einflussfaktoren für die Wahl des Verkehrsmittels “Bahn”<br />
a. Siedlungsstruktur<br />
Die Untersuchungen des Projektes „Bahn Ville“ zeigen, dass eine polyzentrisch<br />
ausgerichtete Siedlungsstruktur die meisten Vorteile zur Umsetzung der<br />
schienengestützten Siedlungsentwicklung mit sich bringt <strong>und</strong> damit im Endeffekt die<br />
Wahl des Verkehrsmittels Bahn begünstigen. Im Vergleich zu polarisierten<br />
Siedlungsstrukturen sind in polyzentrischen die Ein- <strong>und</strong> Aussteigerzahlen der Fahrgäste<br />
der Bahn zwischen den jeweiligen Stationen weitaus ausgeglichener. Daraus ergibt sich<br />
ein ausgewogeneres Fahrgastaufkommen entlang der Bahnlinie über einen großen<br />
Zeitraum des Tages verteilt, was wiederum für die Bahn, beispielsweise mit dem Einsatz<br />
eines einheitlichen Fahrzeugtyps <strong>und</strong> als Folge daraus auch für den K<strong>und</strong>en<br />
Einsparpotentiale auf längere Zeit mit sich bringt.<br />
In polarisierten Siedlungsstrukturen lassen sich dagegen unterschiedlich starke<br />
Verkehrsströme erkennen. Dies führt insbesondere auch zur Überlastung des<br />
Straßennetzes. Eine positive Folge dieser eigentlichen Negativ-Situation (zusätzliche<br />
Belastung der Umwelt durch höheren Ausstoß an Abgasen, erhöhter Stress für die<br />
Fahrerinnen <strong>und</strong> Fahrer der Kraftwagen, etc.) ist, dass die Benutzer des MIV, aufgr<strong>und</strong><br />
des erhöhten Zeitaufwands in den Berufszeiten vom Umland zur Kernstadt <strong>und</strong> anders<br />
herum, eher gewillt sind, das Verkehrsmittel Bahn zu nutzen.329 Sie nehmen in den<br />
Situationen im Vergleich zu polyzentrisch ausgerichteten Regionen (dort gibt es auch<br />
solche Phänomene, nur im Vergleich weniger) in ihren Quellorten eine höhere Wegelänge<br />
zum <strong>Bahnhof</strong> in Kauf, um ihr Auto dort abzustellen <strong>und</strong> mit der Bahn weiter zu fahren.<br />
Die damit einhergehende Steigerung des ÖPNV als auch SPNV sollte jedoch nicht darüber<br />
hinwegtäuschen, dass mit der Umsetzung der polarisierten Siedlungsstruktur diesem<br />
Vorteil weitaus mehr gravierendere Nachteile (z.B. hochwertiges Bahnangebot bleibt<br />
überwiegend auf Oberzentren <strong>und</strong> größere Mittelzentren beschränkt, da es nur dort<br />
rentabel ist) gegenüberstehen, die nach dem Konzept der polyzentrischen<br />
Siedlungsstruktur weniger oder geringer vorliegen. Eine Zusammenfassung der Vor- <strong>und</strong><br />
Nachteile einer poly- bzw. monozentrischen Siedlungsstruktur im Hinblick auf das<br />
Bahnangebot <strong>und</strong> die Siedlungsdispersion ist der Tabelle 24 zu entnehmen.<br />
329<br />
Der Umstieg vom MIV auf den ÖPNV erfolgt bei den meisten Nutzern erst, wenn der Zeitaufwand bei den<br />
öffentlichen Verkehrsmitteln deutlich geringer ist.<br />
177
Tabelle 23: Vor- <strong>und</strong> Nachteile einer poly- bzw. monozentrischen<br />
Siedlungsstruktur im Hinblick auf das Bahnangebot <strong>und</strong> die Siedlungsdispersion<br />
Quelle: Hélène Pretsch (ISB), Alexander Spieshöfer (ILS NRW), Benjamin Puccio (Adeus), Claude<br />
Soulas (Inrets), Régis Leclercq (CETE de l’Ouest) <strong>und</strong> Gilles Bentayou (Certu); „Projekt<br />
Bahn Ville“; 2004; S. 37<br />
b. Die Stationsqualität<br />
Bahnstationen werden in vielerlei Texten als das Aushängeschild der Bahn bezeichnet.<br />
Untersuchungen des Projektes „Bahn Ville“ zeigen, dass diese Behauptung nicht<br />
unbegründet ist. Danach bestehen signifikante Zusammenhänge zwischen der<br />
Wahrnehmung des Qualitätsniveaus des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> der Gesamtbewertung des<br />
Bahnsystems. Die Befragten, die ihren <strong>Bahnhof</strong> negativ einschätzten, gaben<br />
verhältnismäßig häufig dem Gesamtsystem Bahn negative Noten. Hierbei spielen<br />
hauptsächlich die Ausstattung <strong>und</strong> der Zustand des <strong>Bahnhof</strong>s eine wesentliche Rolle.<br />
Eine weitere Untersuchung an Bahnhöfen des regionalen Verkehrs in Rheinland-Pfalz <strong>und</strong><br />
Hessen kommt in diesem Zusammenhang auf ein ähnliches Ergebnis. Für Bahnnutzer<br />
nimmt bei den Stationseigenschaften die Sicherheit <strong>und</strong> Sauberkeit die höchste Priorität<br />
ein, gefolgt von den Informationen, dem Fahrkartenverkauf <strong>und</strong> dem optischen Eindruck.<br />
Die geringste Wichtigkeit kommt den Wegen in der Station <strong>und</strong> der Bahnsteigausstattung<br />
zu. 330<br />
330<br />
vgl. Dipl.-Ing. Becker, Josef; Qualitätsbewertung <strong>und</strong> Gestaltung von Stationen des regionalen<br />
Bahnverkehrs; Darmstadt 2005; S. 134, 135.<br />
178
Die Modernisierung von Bahnhöfen ist somit ein wichtiger Bestandteil für eine<br />
erfolgreiche Realisierung der schienengestützten Siedlungsentwicklung.<br />
c. Serviceeinrichtungen am <strong>Bahnhof</strong><br />
Serviceeinrichtungen am <strong>und</strong> im <strong>Bahnhof</strong> sind nach Umfragen der „Bahn Ville“ sowohl für<br />
Bahnk<strong>und</strong>en als auch für Nichtnutzer der Bahn gleichermaßen wichtig. Etwa 30 % der<br />
Geschäftsk<strong>und</strong>en nutzen an den untersuchten Bahnhöfen unabhängig von einer<br />
Bahnfahrt diese Art von Einrichtungen. Die Anzahl der Nichtnutzer hängt dabei<br />
hauptsächlich von der Lage des <strong>Bahnhof</strong>s zur Siedlung <strong>und</strong> vom Warenangebot sowie von<br />
dessen Wichtigkeit zur Befriedigung seiner Bedürfnisse ab. Unterscheidet sich dieses<br />
Warenangebot vom Angebot in den umliegenden Siedlungen ist der Anreiz für einen<br />
Besuch dementsprechend höher. In punkto „Lage des <strong>Bahnhof</strong>s zur Siedlung“ stellt die<br />
folgende Grafik anhand der üblichsten Konfigurationen des Siedlungsschwerpunkts<br />
gegenüber der Bahnlinie dar, welche städtebaulichen <strong>und</strong> kommerziellen Funktionen<br />
Serviceeinrichtungen im Empfangsgebäude bzw. im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld einnehmen<br />
können. 331<br />
Abb. 50: Entwicklungsmöglichkeiten einer Siedlung mit unterschiedlichen<br />
Ausprägungen durch Serviceeinrichtungen an dessen <strong>Bahnhof</strong><br />
Quelle: Hélène Pretsch (ISB), Alexander Spieshöfer (ILS NRW), Benjamin Puccio (Adeus), Claude<br />
Soulas (Inrets), Régis Leclercq (CETE de l’Ouest) <strong>und</strong> Gilles Bentayou (Certu); „Projekt<br />
Bahn Ville“; 2004; S. 46<br />
331 vgl. auch: Hélène Pretsch (ISB), Alexander Spieshöfer (ILS NRW), Benjamin Puccio (Adeus), Claude Soulas<br />
(Inrets), Régis Leclercq (CETE de l’Ouest) <strong>und</strong> Gilles Bentayou (Certu); „Projekt Bahn Ville“; 2004; S. 45.<br />
179
d. Qualität der umliegenden <strong>Bahnhof</strong>sviertel<br />
<strong>Bahnhof</strong>sviertel hatten in der Vergangenheit teils zu Recht teils zu Unrecht den Ruf des<br />
„Verruchten“ <strong>und</strong> der Unsicherheit. Die jahrzehntelang fehlenden Investitionen in die<br />
Bereiche Sicherheit, Sauberkeit <strong>und</strong> Service führten in vielen Beispielen zu einem Verfall<br />
der baulichen Substanz <strong>und</strong> der damit einhergehenden Konzentration von<br />
Personengruppen, die in der Gesellschaft, aufgr<strong>und</strong> der Nichteinhaltung bestimmter<br />
geltender Normen als Minderheiten oder als gefährlich gelten.<br />
Die Rückbesinnung auf das Verkehrsmittel Bahn in der Verkehrspolitik <strong>und</strong> des<br />
Standortes <strong>Bahnhof</strong> als städtebaulich integrierter Teil der <strong>Stadt</strong>, der häufig als ein<br />
„Zugpferd“ für die Entwicklung der jeweiligen <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> ihres Umfeldes nun benannt<br />
wird, führte an zahlreichen Standorten zu einer Aufwertung von Bahnhöfen <strong>und</strong> ihren<br />
umliegenden Gebieten.<br />
In der Untersuchung des Projektes „Bahn Ville“ „gaben 50 % bis 80 % der Befragten<br />
nach der Verbesserung ihrer <strong>Bahnhof</strong>sviertel durch Sanierungsmaßnahmen <strong>und</strong><br />
Verkehrswegekonzepte an, dass dies in den letzten 10 Jahren zu einer deutlichen<br />
Imageverbesserung in diesem Bereich geführt hat.“ 332 Diese hat wiederum positive<br />
Auswirkungen auf die Benutzung der Bahn als Verkehrsmittel.<br />
e. Die Qualität des Bahnangebotes<br />
Für die schienengestützte Siedlungsentwicklung nimmt die Qualität des Bahnangebots die<br />
eigentliche Hauptrolle ein. Sie bildet sozusagen das „Rückgrat“ für die Umsetzung. Was<br />
nützt ein qualitätvoll gestalteter <strong>Bahnhof</strong> zu dem man schnell mit dem ÖV hingelangt,<br />
wenn dort beispielsweise nur zweimal am Tag ein Zug fährt <strong>und</strong> womöglich noch dort hin,<br />
wo man nicht hin will. Schon an diesem kleinen Beispiel erkennt man die Bedeutung der<br />
Qualität des Bahnangebotes, die sich insbesondere aus:<br />
- der optimalen lokalen <strong>und</strong> zeitlichen Verknüpfung der Verkehrsträger am<br />
Quell- <strong>und</strong> Zielort,<br />
- den zu erreichenden Zielen in (möglichst geringer) Zeitdauer,<br />
- den jeweiligen Zeitabständen, in denen der Zug am Tag <strong>und</strong> in der Nacht<br />
fährt (Taktung),<br />
- der Vermittlung von Fahrinformationen (übersichtliche <strong>und</strong> verständliche<br />
Streckenpläne <strong>und</strong> Tarifsysteme, frühes informieren bei etwaigen<br />
Änderungen im Zeit- oder Streckenablauf usw.),<br />
- dem, notwendigen Sicherheitspersonal in den Zügen zu entsprechenden<br />
Zeiten (z.B. in der Nacht, bei bestimmten Veranstaltungen, zu denen<br />
gefährlich eingestufte Personengruppen fahren usw.),<br />
- dem fre<strong>und</strong>lich auftretenden <strong>und</strong> kompetenten Personal,<br />
332 Pretsch, Hélène (ISB); Spieshöfer, Alexander (ILS NRW); Puccio, Benjamin (Adeus); Soulas, Claude<br />
(Inrets); Leclercq, Régis (CETE de l’Ouest); Bentayou, Gilles (Certu); Deutsch französisches Projekt „Bahn<br />
Ville“; 2004; S. 45.<br />
180
- dem Qualitätszustand der Waggons (Sauberkeit, Sicherheit, Übersichtlichkeit,<br />
Ausschilderung usw.),<br />
- dem Geräuschpegel in den Waggons,<br />
- der Sitzqualität der Bestuhlung (z.B. ausreichend Platz zwischen den Sitzen,<br />
qualitätvolle Polsterung, Ergonomie usw.)<br />
- dem Service in der Bahn (z.B. Versorgung mit Getränken <strong>und</strong> kleinen<br />
Snacks),<br />
- <strong>und</strong> anderen Punkten ergibt.<br />
f. Anzahl der Bahnstationen entlang der Bahnlinie<br />
Untersuchungen des Projektes „Bahn Ville“ zeigen, dass mit zusätzlichen Haltepunkten<br />
neue K<strong>und</strong>en für die Bahn gewonnen werden können. So gaben von den befragten Ein<strong>und</strong><br />
Aussteigern an den neuen Haltepunkten 60 % an, dass sie ohne das Vorhandensein<br />
der neuen Station die aktuelle Bahnfahrt nicht getätigt hätten. Daneben werden durch<br />
die Verdichtung der Haltestellenabstände die Anfahrtswege zu den Stationen verkürzt,<br />
wodurch mehr Nutzer zu Fuß oder per Rad zum <strong>Bahnhof</strong> kommen, was die Umwelt<br />
entlastet. Vor einer Umsetzung müssen diese positiven Effekte den sich ebenfalls daraus<br />
ergebenen negativen Auswirkungen entgegengestellt <strong>und</strong> bilanziert werden: Was nützen<br />
viele zusätzliche Haltepunkte auf einer Strecke, wenn sich dadurch die Fahrzeit zu einem<br />
in dieser Region für viele Nutzer wichtiges Ziel so sehr erhöht, dass dies nicht mehr<br />
akzeptabel ist <strong>und</strong> die Nutzer deswegen den MIV bevorzugen? Oder was nützt ein<br />
zusätzlicher Haltepunkt an einer Stelle, für die, aufgr<strong>und</strong> der demografischen<br />
Entwicklung, in der Zukunft sinkende Fahrgastpotentiale zu erwarten sind?<br />
Auch die Finanzierbarkeit der Neubaumaßnahme <strong>und</strong> dessen Unterhaltung spielen hierbei<br />
eine nicht unerhebliche Rolle (Stichpunkt: leere Haushaltskassen). 333<br />
g. Bahnanschluss als Attraktivitätsfaktor bei der Wohnstandortwahl<br />
Ziel der schienengestützten Siedlungsentwicklung ist es, so viele Menschen wie möglich<br />
für das Verkehrsmittel Bahn zu gewinnen. Die Qualität des näheren <strong>Bahnhof</strong>sumfelds ist<br />
ein entscheidender Faktor bei der potentiellen Wohnstandortwahl in dem Gebiet. All zu<br />
große Verkehrsbelastungen mit Lärm <strong>und</strong> Abgasen vertragen sich mit der Nutzung<br />
„Wohnen“ nicht, sodass hier Handlungsstrategien zur Senkung gef<strong>und</strong>en werden müssen.<br />
Eine ist z.B. die Reduzierung des MIV im <strong>Bahnhof</strong>sbereich <strong>und</strong> die Förderung des ÖPNV<br />
als Zubringer zum <strong>Bahnhof</strong>. Weiterhin können immissionsschützende Maßnahmen, wie<br />
Lärmschutzwände oder -wälle, umgesetzt werden. Da insbesondere bei Familien mit<br />
Kindern (<strong>und</strong> Auto) der Bahnanschluss als Kriterium für die Wohnstandortwahl ein<br />
höheres Gewicht einnimmt (als bei anderen Gruppen), ist die Umsetzung der o.g.<br />
beispielhaft genannten Maßnahmen umso wichtiger.<br />
333 Pretsch, Hélène (ISB); Spieshöfer, Alexander (ILS NRW); Puccio, Benjamin (Adeus); Soulas, Claude<br />
(Inrets); Leclercq, Régis (CETE de l’Ouest); Bentayou, Gilles (Certu); Deutsch französisches Projekt „Bahn<br />
Ville“; 2004; S. 44, 45.<br />
181
Die Untersuchungen des Projektes „Bahn Ville“ zeigen auch, dass für die<br />
Wohnstandortwahl entweder in <strong>Bahnhof</strong>snähe oder weit ab vom <strong>Bahnhof</strong> der Besitz eines<br />
eigenen Autos nicht entscheidend ist, sondern eben eher die potentiell konkrete<br />
Nutzungsmöglichkeit der Bahn. Daraus folgt, dass ein entsprechend verfolgtes Marketing<br />
in diesem Bereich also jeden erreichen kann, egal ob Er oder Sie ein Auto besitzt oder<br />
nicht. 334<br />
� Einflussfaktoren für die Wahl des Verkehrsmittels zur Bahn<br />
h. Zentralitätsstufen<br />
Der Zentralitätsgrad der Kommunen korreliert mit den zurückgelegten Wegelängen zum<br />
<strong>Bahnhof</strong>. In Gr<strong>und</strong>-, Unter- <strong>und</strong> kleineren Mittelzentren überwiegt von der <strong>Stadt</strong>struktur<br />
her überwiegend ein hoher Anteil an kurzen Wegen, sodass hier eine gute Erreichbarkeit<br />
zu Fuß <strong>und</strong> per Fahrrad gewährleistet ist. Hier überwiegen denn auch zumeist diese<br />
Verkehrsträger gegenüber anderen. In Oberzentren besteht dagegen ein höherer Anteil<br />
an längeren Wegen zum <strong>Bahnhof</strong>, sodass hier vermehrt der MIV <strong>und</strong> ÖPNV genutzt wird.<br />
Hierbei liegt der Anteil des ÖPNV gegenüber dem MIV weitaus höher, was einerseits<br />
durch die höheren Restriktionen für den MIV auf dem Weg zum <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> am <strong>Bahnhof</strong><br />
<strong>und</strong> andererseits durch ein verhältnismäßig komfortabel ausgebautes <strong>und</strong> bedientes<br />
ÖPNV-Netz zu erklären ist. In den Mittelzentren ist dieser Aspekt nicht oder nur im<br />
geringem Maße gegeben, sodass sich hier genau ein umgekehrtes Bild ergibt. Die<br />
Ursache des hohen MIV-Anteils in Mittelzentren liegt aber auch daran, dass aus den weit<br />
entfernten Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Unterzentren Bahnnutzer mit ihrem private PKW anreisen, um das<br />
attraktivere oder überhaupt nur hier vorhandene Bahnangebot nutzen zu können.<br />
Als Herausforderung ergibt sich damit für die schiengeb<strong>und</strong>ene Siedlungsentwicklung<br />
insbesondere in den Mittelzentren zum einen die Kontrolle der P+R-Nutzung <strong>und</strong> eine<br />
aktiv betriebene Fuß- <strong>und</strong> Radwegegestaltung, <strong>und</strong> zum anderen der Anschluss der<br />
Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Unterzentren mit dem ÖPNV. Letzteres stellt sich in der Realität allerdings<br />
aus Rentabilitätsgründen allzu oft als nicht umsetzbar dar, sodass hier andere Lösungen<br />
gef<strong>und</strong>en werden müssen. So werden teilweise so genannte Bürgerbusse auf<br />
ehrenamtlicher Basis unterstützend eingesetzt. 335<br />
334 Pretsch, Hélène (ISB); Spieshöfer, Alexander (ILS NRW); Puccio, Benjamin (Adeus); Soulas, Claude<br />
(Inrets); Leclercq, Régis (CETE de l’Ouest); Bentayou, Gilles (Certu); Deutsch französisches Projekt „Bahn<br />
Ville“; 2004; S. 40.<br />
335 Pretsch, Hélène (ISB); Spieshöfer, Alexander (ILS NRW); Puccio, Benjamin (Adeus); Soulas, Claude<br />
(Inrets); Leclercq, Régis (CETE de l’Ouest); Bentayou, Gilles (Certu); Deutsch französisches Projekt „Bahn<br />
Ville“; 2004; S. 36.<br />
182
Abb. 51: Bürgerbus zur Befahrung stillgelegter ÖPNV Strecken<br />
Quelle: Verkehrsb<strong>und</strong> Berlin Brandenburg GmbH; Präsentation; „SPNV Fahrplan; ÖPNV<br />
Neuerungen 2006/07“<br />
i. Lage des <strong>Bahnhof</strong>s in der Siedlung<br />
Die Verkehrsmittelwahl zum <strong>Bahnhof</strong> wird beeinflusst durch die Lage des <strong>Bahnhof</strong>s zum<br />
Siedlungsschwerpunkt. Liegt der <strong>Bahnhof</strong> im Siedlungsschwerpunkt, so hat dieser einen<br />
höheren Anteil an Fußgängern als in Siedlungen, wo dieser peripher liegt. Bei letzteren<br />
wird vermehrt der MIV oder ÖPNV zum <strong>Bahnhof</strong> genutzt.<br />
Aus dieser Erkenntnis heraus sollte die Baulandentwicklung am <strong>Bahnhof</strong> möglichst in alle<br />
Richtungen gleichrangig geschehen.<br />
� Gemeinsame Einflussfaktoren für die Wahl des Verkehrsmittels zum<br />
<strong>Bahnhof</strong> als auch der Bahn<br />
Für eine erfolgreiche Umsetzung der schienengestützten Siedlungsentwicklung musste<br />
zunächst geklärt werden, bis zu welcher Entfernung es Sinn macht Siedlungen<br />
auszuweisen, d.h. bis zu welcher Distanz die Bahn als Verkehrsmittel denn auch<br />
vermehrt genutzt wird. Hierfür wurde aus Umfragen an bestehenden Bahnhöfen der<br />
maximale Einzugsbereich für jedes Verkehrsmittel zum <strong>Bahnhof</strong> festgestellt. Es stellte<br />
sich heraus, dass der Zeitaufwand für die Wahl des Verkehrsmittels zum <strong>Bahnhof</strong><br />
entscheidend ist. Für alle Verkehrsmittelzubringer, egal ob Fußgänger, Radfahrer, MIV<br />
oder ÖPNV, stellte sich im Durchschnitt ein maximal akzeptierter Zeitaufwand von 10 bis<br />
15 Minuten heraus 336 . Bei Fußgängern entspricht dies einer Wegelänge von r<strong>und</strong> 1 bis<br />
1,5 km, bei Radfahrern 2 bis 3 km <strong>und</strong> beim MIV <strong>und</strong> ÖPNV je nach Verkehrsaufkommen<br />
einer Entfernung zwischen 4 bis 8 km. Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass die<br />
Baulandentwicklung an der Schiene möglichst in unmittelbarer Nähe der Schienenhalte-<br />
336 80% aller Wege zum <strong>Bahnhof</strong> bleiben unter 15 min beschränkt.<br />
183
punkte vollzogen werden muss, damit das Konzept der schienengestützten<br />
Siedlungsentwicklung Sinn macht.<br />
Insbesondere im Bereich bis zu einem Radius von 1500 Metern stellt sich die Ausweisung<br />
als besonders sinnvoll dar, da hier hauptsächlich die Verkehrsmittel des ungeb<strong>und</strong>enen<br />
Individualverkehrs zur Bahnstation genutzt werden. Es zeigte sich nämlich, dass bei zu<br />
bewältigenden Strecken zum <strong>Bahnhof</strong>, die im Bereich des motorisierten Verkehrs liegen,<br />
also Wegelängen im Durchschnitt ab 2,5 km, hauptsächlich das private KFZ dem ÖPNV in<br />
aller Regel vorgezogen wird. Dieser Fakt stellt sich insbesondere dort dar, wo wenig<br />
Staus oder Reglementierungen am <strong>Bahnhof</strong> (Parkgebühren, geringe Anzahl an<br />
Parkplätzen) zu erwarten sind. Hauptsächlich ist dies in kleineren Städten (kleinere<br />
Mittelzentren <strong>und</strong> Unterzentren) der Fall. Eine Steigerung des ÖPNV zuungunsten des<br />
MIV kann hier durch Restriktionen am <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> seines Umfeldes für den MIV<br />
geschehen. Gleichzeitig sollte dann aber auch der ÖPNV als alternativer Zubringer<br />
gestärkt werden. Dies kann beispielsweise durch spezielle Fahrkartenangebote<br />
geschehen. Im verkehrlichen Bereich kann über die Wegegestaltung der ÖPNV als<br />
Zubringer zum <strong>Bahnhof</strong> gestärkt werden. Eine Streckenplanung die möglichst direkt, <strong>und</strong><br />
weitestgehend unabhängig von Verkehrsbelastungen zu den Berufszeiten ist, wären<br />
Beispiele dafür. Damit kann sich der oben besprochene Einzugsradius (akzeptierte<br />
Zeitdauer von 15 min zum <strong>Bahnhof</strong>) für den ÖPNV auf bis zu 8 km erweitern. 337<br />
6.2.5 Förderung der schienengestützten Siedlungsentwicklung in Deutschland<br />
Durch das Regionalisierungsgesetz von 1996 wurden die Verantwortung <strong>und</strong> damit auch<br />
die Förderung für SPNV auf die B<strong>und</strong>esländer übertragen. Im Folgenden sollen einige<br />
Fördermaßnahmen kurz vorgestellt werden. 338 Im Land Nordrhein-Westfalen wird in den<br />
Förderrichtlinien der <strong>Stadt</strong>erneuerung die Baulandentwicklung an der Schiene durch<br />
verschiedene Möglichkeiten gefördert:<br />
- Förderung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach §§ 165 ff.<br />
BauGB, die der Schaffung von wohn- <strong>und</strong>/oder mischgenutzten Baugebieten<br />
dienen <strong>und</strong> die an den öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere an die<br />
Schiene, angeb<strong>und</strong>en sind,<br />
- Förderung der Entwicklung von Baugebieten mit mehr als 150 geplanten<br />
Wohneinheiten im Einzugsbereich von Haltepunkten an der Schiene,<br />
- Förderung der Mobilisierung <strong>und</strong> Herrichtung von Brachflächen bei<br />
Altstandorten.<br />
Der Inhalt der ersten beiden Punkte dient hauptsächlich dem Ziel, die<br />
Siedlungsentwicklung auf den ÖPNV auszurichten, insbesondere auf den SPNV. Die<br />
Förderung nach dem Inhalt des letzten Punktes verfolgt das Ziel der Nachverdichtung,<br />
337 vgl. auch Pretsch, Hélène (ISB); Spieshöfer, Alexander (ILS NRW); Puccio, Benjamin (Adeus); Soulas,<br />
Claude (Inrets); Leclercq, Régis (CETE de l’Ouest); Bentayou, Gilles (Certu); Deutsch französisches Projekt<br />
„Bahn Ville“; 2004; S. 33ff.<br />
338 Pretsch, Hélène (ISB); Spieshöfer, Alexander (ILS NRW); Puccio, Benjamin (Adeus); Soulas, Claude<br />
(Inrets); Leclercq, Régis (CETE de l’Ouest); Bentayou, Gilles (Certu); Deutsch französisches Projekt „Bahn<br />
Ville“; 2004; S. 53.<br />
184
um eine weitere Zersiedlung zu stoppen. Die Neunutzung von Brachflächen bezieht sich<br />
insbesondere auf Standorte an der Schiene.<br />
Im Land Rheinland-Pfalz wird die schienengestützte Siedlungsentwicklung mit einer<br />
integrierten Verkehrs- <strong>und</strong> Siedlungsentwicklung mit dem Projekt "Umweltbahnhof<br />
Rheinland-Pfalz" 339 seit 1992 verfolgt. Daneben gibt es noch weitere Initiativen auf<br />
Gemeinde- <strong>und</strong> Landesebene sowie in einzelnen Städten. Fördermittel werden hierfür aus<br />
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) <strong>und</strong> der Regionalförderung<br />
bereitgestellt. 340<br />
Nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) fördert das Land Brandenburg<br />
die Kommunen bei Investitionen in die <strong>Bahnhof</strong>sumfelder. 75 Prozent der förderfähigen<br />
Investitionskosten können so übernommen werden. Den Kommunen gelingt es damit,<br />
notwendige Investitionen zu stemmen, die sie allein nicht leisten könnten.<br />
Gefördert werden die Umgestaltung <strong>und</strong> Sanierung von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern, das Anlegen<br />
<strong>und</strong> Erweitern von Parkplatzanlagen <strong>und</strong> Fahrradabstellplätzen <strong>und</strong> moderne<br />
Fahrgastinformationssysteme. Wichtig sind auch ausreichend Parkplätze für Behinderte<br />
<strong>und</strong> barrierefreie Zugänge. 341<br />
Zum Teil werden die Kosten auch von Privaten durch "Public-Private-Partnership" (PPP)<br />
übernommen. 342<br />
Durch die Aufwertung der Bahnhöfe <strong>und</strong> ihren Umfeldern wird direkt ein Beitrag zur<br />
Förderung der schienengestützten Siedlungsentwicklung geleistet. Durch eine höhere<br />
Attraktivität in diesen Bereichen entscheiden sich nachweislich (siehe Ausführungen<br />
„Stationsqualität“, „Qualität der umliegenden <strong>Bahnhof</strong>sviertel“) mehr Nutzer für das<br />
Verkehrsmittel „Bahn“.<br />
In Deutschland wird neben diesen einzelnen Programmen auch auf ein Gesamtkonzept<br />
gesetzt. Hierbei wird nicht jeder einzelne <strong>Bahnhof</strong>sstandort für sich betrachtet, sondern<br />
es wird versucht entlang eine Bahnlinie alle notwendigen Maßnahmen für eine<br />
bestmögliche Umsetzung der schienengestützten Siedlungsentwicklung aufeinander<br />
abgestimmt durchzuführen. Beispiele hierfür sind das EXPO-Projekt Haller-Willem 343 an<br />
339 Die zugr<strong>und</strong>eliegende Idee für das Projekt "Umweltbahnhof Rheinland-Pfalz besteht darin, die<br />
gesellschaftliche Akzeptanz der Bahn zu erhöhen, indem sie als umweltfre<strong>und</strong>liches Verkehrsmittel stärker<br />
herausgestellt wird. Daneben sollen die Flächen von nicht mehr benötigten Bahnanlagen vorrangig entwickelt<br />
werden. In dem Projekt werden die Bahnhöfe Monsheim, Nieder-Lahnstein <strong>und</strong> Grünstadt Bullay an der<br />
Mosel entwickelt. Dafür wurden für alle Standorte städtebauliche Rahmenpläne erarbeitet Quelle: Georg<br />
Speck; Wie schaffen wir attraktive Bahnhöfe?, Das Konzept „Umweltbahnhof Rheinland-Pfalz; in: Bahnhöfe -<br />
Eintrittstor zur <strong>Stadt</strong>, DSSW-Dokumentation; 1996.<br />
340 Barbara Boczek, Wolfgang Christ, Willi Loose, Gero Lücking; Umweltbahnhof Rheinland-Pfalz,<br />
Planungshandbuch; Mediastadt, Büro für <strong>Stadt</strong>kommunikation <strong>und</strong> Öko-Institut, Institut für angewandte<br />
Ökologie im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft <strong>und</strong> Weinbau <strong>und</strong> der<br />
Deutschen Bahn AG; 1997.<br />
341 http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/neuigkeiten/news.php?id=1321 Zugriff: 30.06.2007.<br />
342 Institut für <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> Wohnen des Landes Brandenburg (ISW) im Auftrag des Ministeriums für<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung, Wohnen <strong>und</strong> Verkehr des Landes Brandenburg; Entwicklung von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern -<br />
Investieren in die Zu(g)kunft; Dezember 1995.<br />
343 im Rahmen der EXPO 2000 in Hannover wurden in dem Projekt „Haller-Willem“ der Streckenabschnitt im<br />
Land NRW saniert <strong>und</strong> neue Schienenfahrzeuge eingesetzt. Zudem wurden die dort vorhandenen Bahnhöfe<br />
aufgewertet. Ein attraktives <strong>und</strong> abgestimmtes Betriebsprogramm der Bahn r<strong>und</strong>et die Maßnahmen ab.<br />
Quelle: http://members.aol.com/hallerwillem/.<br />
185
der Strecke Bielefeld – Halle – Dissen - Bad Rothenfelde <strong>und</strong> die Entwicklung von<br />
Bahnhöfen entlang der Köln-Mindener-Eisenbahn in der Emscher-Zone (IBA-Projekte) 344 .<br />
6.2.6 Schienengestütze Siedlungsentwicklung in anderen Ländern<br />
� USA<br />
In den USA stand man Ende der 1980er Jahre in der Raumplanung vor ähnlichen<br />
Problemen wie in Deutschland in den 1990er Jahren. Das Wachstum der Ballungszentren<br />
führte zu einer Zersiedlung in deren Umland („urban sprawl“), mit den entsprechend<br />
negativen Wirkungen. So stiegen die Verkehrsprobleme infolge der längeren Wegeweiten<br />
(z.B. von Wohnhaus im Grünen zur Arbeit in der <strong>Stadt</strong>, vom Wohnhaus im Grünen zu<br />
kulturellen Veranstaltungen in der <strong>Stadt</strong> usw.) stark an. Da das Hauptverkehrsmittel für<br />
die Mehrheit zu dieser Zeit der eigene Pkw darstellte, traten diese Probleme insbesondere<br />
im Straßenverkehr auf. Regelmäßig auftretende Staus, überfüllte Parkplätze an den<br />
Bahnhaltestellen, mit Pkws zugeparkte <strong>Bahnhof</strong>sumfelder, mit Pkw überfüllte Innenstädte<br />
usw. waren üblich. Die daraus erwachsenen negativen Folgen (Stress, Abgase, Lärm) für<br />
die Umwelt <strong>und</strong> für die Lebensqualität der Menschen in den Städten, aber auch in den<br />
Gemeinden, führten im Bereich der Siedlungsentwicklungsplanung zu Überlegungen der<br />
Behebung. 345 Im Jahre 1991 verabschiedete man auf nationaler Ebene ein Gesetz<br />
(Intermodal Surface Transportation Effeciency Act; ISTEA), mit dem die<br />
Siedlungsentwicklung an den Linien des ÖPNV gefördert wird. Die Neuordnung der<br />
Verkehrsplanung wurde mit dem übergeordneten Ziel verfolgt, eine umweltfre<strong>und</strong>liche<br />
<strong>und</strong> nachhaltige Verkehrsabwicklung zu realisieren. Die wichtigsten Bestandteile sind:<br />
- die Metropolitan Planning Organizations (MPO’s) 346 werden verpflichtet, eine<br />
Verkehrsplanung nach festgelegten Bestandteilen durchzuführen,<br />
- MPO´s müssen regelmäßig so genannte Transportverbesserungspläne<br />
(transportation improvement plans � TIP) erarbeiten, die alle Verkehrsmittel<br />
umfassen,<br />
- die von der Federal Transit Administration 347 (FTA) gewährten öffentlichen<br />
Fördermittel werden nun nicht mehr nur wie bisher auf das entsprechende<br />
Verkehrsmittel bezogen, sondern auch für nachhaltige Projekte in der<br />
Verkehrsplanung.<br />
344<br />
Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park (IBA) wurde an der Strecke der Köln-Mindener<br />
Eisenbahn verschiedene <strong>Bahnhof</strong>sprojekte durchgeführt Diese beinhalteten eine Erneuerung der<br />
<strong>Bahnhof</strong>sbereiche an Strecke. Gleichzeitig wurden im Emscherraum zahlreiche Fahrradstationen errichtet, die<br />
eine Wiederbelebung des Verb<strong>und</strong>es aus Fahrrad <strong>und</strong> Bahn hervorrufen sollten. In das Projekt waren die<br />
Bahnhöfe: Kamen <strong>und</strong> Hamm, Oberhausen Hbf, Bottrop Hbf, Essen-Altenessen, Wanne-Eickel Hbf,<br />
Gelsenkirchen Hbf, Herne, Castrop-Rauxel Hbf, Dortm<strong>und</strong>-Mengede, Lünen Hbf mit einbezogen. Quelle:<br />
Dieter Blase; „Die Erneuerung der <strong>Bahnhof</strong>sbereiche an der Köln-Mindener Eisenbahn <strong>und</strong> Fahrradstationen<br />
im Emscherraum“; in: Bahnhöfe - Eintrittstor zur <strong>Stadt</strong>, DSSW-Dokumentation; 1996.<br />
345<br />
vgl. auch http://www.smartergrowth.net/issues/landuse/tod/history.htm Zugriff: 30.06.2007;<br />
www.lgc.org/freepub/land_use/articles/buildcomm/page01.html<br />
www.transitorienteddevelopment.org/ - 31k – Zugriff: 30.06.2007.<br />
346<br />
Organisationen, die für die Verkehrsplanung zuständig sind.<br />
347<br />
B<strong>und</strong>esbehörde für Verkehr.<br />
- 27k - Zugriff: 30.06.2007;<br />
186
Es wurde ein einheitliches Bewertungssystem für Investitionen im Straßenbau <strong>und</strong> dem<br />
öffentlichen Verkehr erarbeitet. Dieses Bewertungssystem berücksichtigt im Gegensatz<br />
zu vorher nun auch die Auswirkungen der Investitionen im sozialen Bereich, im Bereich<br />
der Wirtschaft, Umwelt <strong>und</strong> der Flächennutzung. 348<br />
Auf Gr<strong>und</strong>lage des ISTEA hat die FTA zwei Programme ins Leben gerufen, die die<br />
Baulandentwicklung an den Haltepunkten des öffentlichen Nahverkehrs fördern. Das ist<br />
zum einen das Programm „Building Livable Communities with Transit“ <strong>und</strong> zum anderen<br />
das Programm „Joint development“.<br />
Mit dem „Building Livable Communities with Transit“-Programm werden mit gezielten<br />
Maßnahmen die Verkehrsmittel des ungeb<strong>und</strong>enen Individualverkehrs <strong>und</strong> des ÖPNV<br />
gefördert. Dies geschieht auf der einen Seite mit einer Siedlungsentwicklung, die sich am<br />
öffentlichen Nahverkehr ausrichtet (transit-oriented development), <strong>und</strong> auf der anderen<br />
Seite mit Nahverkehrssystemen, die sich an den Bedürfnissen des jeweiligen Ortes<br />
orientieren (community sensitive transit). Die wichtigsten Elemente des Programms sind:<br />
- Verkehrsmaßnahmen zur Unterstützung des ÖPNV,<br />
- Parkraummanagement,<br />
- Nutzungsmischung bei der Entwicklung von Flächen um die Haltepunkte des<br />
ÖV´s,<br />
- <strong>Bahnhof</strong>serneuerungen mit Verbesserungen der Zugänglichkeit für die<br />
Verkehrsmittel: Fußgänger, Radfahrer <strong>und</strong> ÖPNV.<br />
Die alleinige Umsetzung der Maßnahmen ist jedoch nicht ausreichend, als dass sie<br />
förderungsfähig wäre. Nur wenn gesichert absehbar ist, dass mit dem Maßnahmenpaket<br />
- die Effektivität der Verkehrsmittel des ÖV´s gesteigert wird <strong>und</strong> es einem<br />
Verkehrsprojekt zugeordnet werden kann oder<br />
- eine Entwicklung entlang von Schienenkorridoren erfolgt <strong>und</strong> die Nutzung<br />
der Bahn dadurch erhöht wird, 349<br />
- <strong>und</strong> mit öffentlichen Mitteln gefördert wird.<br />
Mit dem „Joint development“-Programm werden hauptsächlich von<br />
Nahverkehrsunternehmen durchgeführte Entwicklungsmaßnahmen im <strong>Bahnhof</strong>sumfeld<br />
("transit-oriented (joint) developments") gefördert. In der Regel sind die Maßnahmen an<br />
den Bahnhöfen in Oberzentren auf die Entwicklung von Geschäftzentren <strong>und</strong> im Umland<br />
auf die Siedlungsentwicklung an den Schienenhaltepunkten, bezogen. Sind die<br />
Investitionen erfolgreich <strong>und</strong> entstehen Gewinne, stehen diese den Verkehrsunternehmen<br />
frei zur Verfügung. Allerdings werden nur Maßnahmenpakete gefördert, die bestimmte<br />
Bedingungen erfüllen, diese sind:<br />
348<br />
vgl. John W. Polak; Transport Planning and the Legislative Framework: The Example of CAAA and ISTEA in<br />
the United States; Centre for Transport Studies, Imperial College London; Oktober 1997.<br />
349<br />
United States Code (USC), Title 49; Chapter 53 Mass Transportation, Section 5303 Metropolitan planning;<br />
Federal Transit Administration (FTA).<br />
187
- die Maßnahmen müssen räumlich oder funktional im Zusammenhang mit<br />
öffentlichen Verkehrsmitteln stehen,<br />
- die ÖPNV-Nutzung wird dauerhaft erhöht,<br />
- die Förderung geschieht nur in einem Radius um den Haltepunkt von r<strong>und</strong><br />
400 m (entspricht fünf Fußwegminuten). Der Umkreis kann erhöht werden,<br />
wenn die Wege für die Fußgänger, Radfahrer oder den ÖPNV zum Haltepunkt<br />
so gestaltet sind, dass dadurch mehr Verkehrsmittelbenutzer auf die Bahn<br />
umsteigen. 350<br />
Die ("transit-oriented developments"; TOD´s) unterscheiden sich in zwei Kategorien.<br />
Zum einen in die Urban TOD´s <strong>und</strong> zum anderen in die Neighbourhood TOD´s.<br />
Bei ersterem erfolgt eine Entwicklung an den Haltepunkten der <strong>Stadt</strong>bahn,<br />
Schnellbahnlinien <strong>und</strong> Expressbussen. Hauptsachlich wird hier eine Erhöhung der<br />
gewerblichen Nutzungen (Büros, Geschäfte) im unmittelbaren Umfeld der Haltestellen<br />
vorgesehen. Wohnnutzungen sollen sich außen herum anschließen.<br />
Bei den Neighbourhood TOD´s geschieht eine Entwicklung an Haltepunkten der<br />
Zubringerbuslinien zum <strong>Bahnhof</strong>. Hier wird hauptsächlich die Wohnnutzung aber auch<br />
kleine gewerbliche Nutzungen entwickelt.<br />
� Schweiz<br />
In der Schweiz wurde im Jahre 1989 das Programm "Wirtschaftliche<br />
Entwicklungsschwerpunkte" (ESP-Programm) verabschiedet, welches zusätzliche<br />
Arbeitsplätze schaffen <strong>und</strong> eine umweltfre<strong>und</strong>liche Wirtschaftsentwicklung fördern soll.<br />
Die Realisierung dieser Ziele soll durch eine Ansiedelung verkehrsintensiver Nutzungen<br />
an Schienhaltepunkten umgesetzt werden, womit gleichzeitig die Umwelt durch eine<br />
damit einhergehende Reduktion des Verkehrsaufkommens entlastet wird. Das Programm<br />
besteht aus vier Teilen:<br />
- Entlastungsstandorte,<br />
- wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte,<br />
- Wohnstandorte,<br />
- Berner S-Bahn<br />
Auf den Entlastungsstandorten sollen industrielle <strong>und</strong> gewerbliche Nutzungen angesiedelt<br />
werden. Die Verortung geschient hierbei in der Nähe von Schienenhaltepunkten, wo<br />
darüber hinaus auch ein Autobahnanschluss in der Nähe ist. Mit dem Teilprogramm<br />
„wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte“ werden Flächen an den Knotenpunkten des<br />
ÖV´s für Gewerbe- <strong>und</strong> Freizeitnutzungen bereitgestellt. In Bern geschieht dies<br />
beispielsweise an diversen S-Bahn-Haltestellen. Mit dem Teilprogramm „Wohnstandorte“<br />
350 Federal Transit Administration (FTA); Innovative Financing Techniques for American’s Transit Systems;<br />
September 1998; vgl auch http://www.mdot-realestate.org/tod.asp Zugriff: 30.06.2007.<br />
188
soll insbesondere preiswerter Wohnungsbau in verdichteten Siedlungsgebieten mit einem<br />
optimal abgestimmten öffentlichen Verkehrsanschluss realisiert werden. Die<br />
Baulandentwicklung erfolgt in diesem Zusammenhang in einem Radius von 500 m um<br />
den jeweiligen Schienenhaltepunkt. Mit dem Programm „Berner S-Bahn“ soll an den<br />
Schienenhaltepunkten der Berner S-Bahn vornehmlich eine Entwicklung von<br />
Arbeitsplätzen, Wohnen <strong>und</strong> Außenraumgestaltung für Wohnen vollzogen werden.<br />
Daneben ist das Ziel, den MIV zu reduzieren <strong>und</strong> gleichzeitig das öffentliche<br />
Verkehrsangebot auszubauen. 351<br />
Bei allen mit dem Programm geförderten Maßnahmenpaketen erfolgt eine finanzielle <strong>und</strong><br />
zeitliche Abstimmung in der Raum- <strong>und</strong> Verkehrsplanung.<br />
6.3 Städtebauliche Zusammenhänge<br />
6.3.1 Städtebauliche Funktionen von Bahnhöfen<br />
Bahnhöfe nehmen in der jeweiligen <strong>Stadt</strong> viele wichtige Funktionen ein. So stellen<br />
Bahnhöfe eine zentrale verkehrliche Verbindungsfunktion zwischen den<br />
Siedlungseinheiten dar. Sie sind Knotenpunkte für die Verkehrsmittel des ungeb<strong>und</strong>enen<br />
Individualverkehrs (UIV), des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), des<br />
motorisierten Individualverkehrs (MIV) <strong>und</strong> des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).<br />
Des Weiteren haben Bahnhöfe eine regionalökonomische Funktion. Bahnhöfe als<br />
technische Infrastruktur ermöglichen die Arbeitsteilung in <strong>Stadt</strong>netzen <strong>und</strong> zwischen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Land.<br />
In den meisten Fällen befinden sich Bahnhöfe im Zentrum von Städten <strong>und</strong> Dörfern oder<br />
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln so angeb<strong>und</strong>en, dass sie schnell erreichbar sind.<br />
Daher befinden sie sich bei vielen Menschen im täglichen Erfahrungsfeld <strong>und</strong> fungieren<br />
als Orientierungs- <strong>und</strong> Treffpunkte. Daraus ergibt sich für den <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> seiner<br />
unmittelbaren Umgebung eine Mittelpunktsfunktion in der <strong>Stadt</strong>. Darüber hinaus erfüllt<br />
der <strong>Bahnhof</strong> eine Austauschfunktion zwischen Menschen innerhalb der jeweiligen <strong>Stadt</strong><br />
<strong>und</strong> Umgebung mit den Menschen, die als Reisende aus fern gelegenen Regionen<br />
kommen. Daher stellt dieser öffentliche Raum ein Ort dar, an dem die Toleranz für das<br />
„Fremde“ am größten ist.<br />
Bahnhöfe besitzen zudem eine soziale Ausgleichsfunktion. Hier ist die Akzeptanz<br />
gegenüber den Gruppen am höchsten, die aufgr<strong>und</strong> ihrer zumeist persönlichen Probleme<br />
in Abseits der Gesellschaft geraten (Obdachlose, Rauschgiftsüchtige, Alkoholiker, usw.)<br />
sind. Bahnhöfe besitzen zumeist die Funktion des Unverwechselbaren in der örtlichen<br />
Umgebung insbesondere, wenn das <strong>Bahnhof</strong>sgebäude in einer außergewöhnlichen<br />
Architektur erbaut worden ist. Bahnhöfe gelten als weiteres als Orte der Zeitlosigkeit, da<br />
sie fast durchgängig geöffnet sind. 352<br />
351<br />
vgl auch Dieter Apel, Michael Lehmbrock, Tim Pharoa, Jörg Thiemann-Linden; Kompakt, mobil, urban:<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungskonzepte zur Verkehrsvermeidung im internationalen Vergleich; Difu-Beiträge zur<br />
<strong>Stadt</strong>forschung, Band 24; Deutsches Institut für Urbanistik; Anfang 1998; S. 160ff.<br />
352<br />
Institut für Landes- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklungsforschung; Bahnhöfe – Sicherheit, Service, Aufenthaltsqualität;<br />
Dortm<strong>und</strong> 1999; S. 70.<br />
189
6.3.2 Gewichtete Anordnung der Verkehrsnutzungen<br />
Ein wichtiges Ziel einer jeden <strong>Bahnhof</strong>entwicklung ist die Verbesserung der<br />
Verknüpfungspunkte zwischen den einzelnen Verkehrsträgern. Bei der Anordnung der<br />
einzelnen Nutzungen ist im Allgemeinen eine bestimmte Ordnung einzuhalten. Diese<br />
Ordnung orientiert sich zum einen an der Funktion des jeweiligen Verkehrsmittels <strong>und</strong><br />
seinen typisch verb<strong>und</strong>enen Eigenschaften <strong>und</strong> zum anderen an der Verträglichkeit des<br />
jeweiligen Verkehrsmittels mit dem Standort. Beispielsweise sind Fahrradabstellmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Bushaltestellen aufgr<strong>und</strong> ihrer Funktionalität eher auf räumliche Nähe<br />
zum <strong>Bahnhof</strong> bzw. zum Bahnsteigzugang angewiesen als z.B. eine Park & Ride-Anlage<br />
(P&R). In Bezug auf die Verträglichkeit kann z.B. in einem denkmalgeschützten<br />
<strong>Bahnhof</strong>sbereich ein überdimensionierter Parkplatz ausscheiden, da sich das damit<br />
verb<strong>und</strong>ene Verkehrsaufkommen <strong>und</strong> die wiederum daraus resultierenden Maßnahmen<br />
zur Verminderung desjenigen (z.B. Ausbau der Straßen zur Gewährleistung einer<br />
höheren Tragfähigkeit, Schaffung von zusätzlichen Fahrspuren) auf ein unverträgliches<br />
Maß erhöhen würde.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt bei einer umfassenden <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung, dass Fußgänger <strong>und</strong> die<br />
von ihnen benötigten Anlagen im Gestaltungskonzept die höchste Priorität einnehmen<br />
sollten. Schließlich wird jeder <strong>Bahnhof</strong>sbesucher spätestens im Verknüpfungsbereich zum<br />
Fußgänger <strong>und</strong> die Bahnsteige bei Personenbahnhöfen sind ausschließlich Fußgängern<br />
vorbehalten. Aber nicht nur aus funktionalen Gründen ist der Fußgängerverkehr bei<br />
<strong>Bahnhof</strong>sentwicklungsplanungen so hoch gewichtet. Aus ökologischer Sicht ist dieses<br />
Verkehrsmittel das umwelt- <strong>und</strong> siedlungsverträglichste. Aus soziologischer Sicht trägt es<br />
zur Aufrechterhaltung der sozialen Kommunikation <strong>und</strong> zur Wiedergewinnung der<br />
Aufenthaltsqualität im Straßenraum bei, was insbesondere bei kleinen <strong>und</strong> mittelgroßen<br />
Orten mit Bahnhöfen, von hoher Wichtigkeit ist. Als weiteres ist dieses Verkehrsmittel für<br />
große Bevölkerungsteile, denen kein Auto zur Verfügung steht, das<br />
Hauptfortbewegungsmittel, insbesondere im Nahbereich bis zu 1,5 km. 353 Daneben<br />
besitzt diese Verkehrsart auch für den Geldgeber der <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung, also für die<br />
Gemeinde (in den meisten Fällen), für die öffentliche Hand (Fördermittel, die aus<br />
Steuergeldern finanziert werden) <strong>und</strong> die Deutsche Bahn AG Vorteile. Denn dieser<br />
ungeb<strong>und</strong>ene Individualverkehr verursacht im Vergleich zu den anderen Verkehrsarten<br />
die geringsten Kosten, aufgr<strong>und</strong> des einfachsten Infrastruktur- <strong>und</strong> Platzbedarfes.<br />
Die zweitwichtigste Nutzung ist der Fahrradverkehr. Der Radverkehr stellt in den meisten<br />
Fällen eine ideale Ergänzung zu den übrigen Verkehrsmitteln dar. Mit einer entsprechend<br />
fahrradfre<strong>und</strong>lichen Gestaltung (z.B. eigene Fahrradwege, Anschluss der Wege an das<br />
vorhandene Wegenetz, überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten in Bahnsteignähe usw.)<br />
werden insbesondere Fahrgäste in den umliegenden Quartieren bis zu einer Entfernung<br />
von r<strong>und</strong> 3 km animiert auf das umweltfre<strong>und</strong>liche Verkehrsmittel Fahrrad umzusteigen.<br />
Wie auch beim Fußgängerverkehr verursachen die Anlagen dieser Verkehrsart geringere<br />
Kosten als die des ÖPNV oder MIV.<br />
353 Nach der KONTIV Auswertung der Verkehrsmittelwahl nach Entfernungsklassen liegt der Fußverkehr in einer<br />
Entfernung von 0-2km mit 54,5% gefolgt vom PKW Verkehr mit 23,5% <strong>und</strong> Fahrradverkehr mit 16,8% an<br />
der Spitze; Quelle: Beck, Martin; Fahrrad am <strong>Bahnhof</strong>; Beitrag 3.3.4.1in Apel, Holzapfel, Kiepe, Lehmbrock,<br />
Müller; Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung; 1992.<br />
190
Nach dem Fahrradverkehr stellt der ÖPNV die nächst wichtigste, in vielen Fällen auch<br />
gleichgestellte, Prioritätsstufe dar. Jeder <strong>Bahnhof</strong> sollte, wenn möglich, an das regionale<br />
Netz der öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Tram, usw.) angeschlossen sein <strong>und</strong> falls<br />
nicht, wenn möglich, werden. Dadurch wird der Einzugsbereich des <strong>Bahnhof</strong>s um ein<br />
vielfaches erweitert. Hinzu kommt, dass somit Personengruppen den <strong>Bahnhof</strong> erreichen<br />
können, denen es zu Fuß oder mit dem Fahrrad nicht möglich ist. Dies sind z.B. ältere<br />
Personen, Kinder (bis zu einem bestimmten Alter) oder behinderte Mitbürger. Aber auch<br />
im umgekehrten Sinne ist dieses bei (fast) jeder <strong>Bahnhof</strong>sentwicklung zu erreichende<br />
Planungsziel von Bedeutung. Reisende, die am <strong>Bahnhof</strong> mit Gepäck ankommen, können<br />
nur schwer oder gar nicht mit diesem weitere Ziele in der Umgebung erreichen. Der<br />
Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz steigert in diesem Sinne auch den<br />
touristischen Wert <strong>und</strong> damit wiederum den wirtschaftlichen Standort der angrenzenden<br />
Innenstadt oder sonstigen Bereiche. Ein ÖPNV-Anschluss am <strong>Bahnhof</strong> mit entsprechend<br />
auf die Bahn abgestimmten Taktzeiten ist auch die Gr<strong>und</strong>lage für die Stärkung der<br />
Umwelt.<br />
Die auf den ÖPNV folgende Prioritätsstufe sind die vorzusehenden Anlagen für den<br />
Taxiverkehr. Dieser stellt nach dem Fußgänger-, Fahrrad- <strong>und</strong> ÖPN Verkehr das<br />
umweltverträglichste Verkehrsmittel dar. Für den Taxiverkehr sind Vorfahrtmöglichkeiten<br />
als auch Standstreifen in unmittelbarer Nähe zum Ein- bzw. Ausgang des <strong>Bahnhof</strong>s<br />
vorzusehen. Bei kleineren Bahnhöfen, wo sich augenscheinlich eine Taxibeförderung,<br />
aufgr<strong>und</strong> der niedrigen Frequentierung des <strong>Bahnhof</strong>s nicht lohnt (z.B. in ländlichen<br />
Gebieten), sind diese Anlagen natürlich nicht auszubilden. Stattdessen können an der<br />
Stelle Kiss & Ride-Flächen (K&R � Kurzzeitparkflächen) vorgesehen werden.<br />
Die Anordnung der Verkehrsanlagen des motorisierten Individualverkehrs (MIV) ist am<br />
niedrigsten gewichtet. Dies erwächst aus der Tatsache, dass zum einen die<br />
Funktionstüchtigkeit des gesamten <strong>Bahnhof</strong>s hinsichtlich des Verkehrs durch die anderen<br />
o.g. Verkehrsmittel in einem höheren Maße gewährleistet wird <strong>und</strong> zum anderen, dass<br />
aus ökologischer Sicht das Kfz das unverträglichste Fortbewegungsmittel (jedenfalls in<br />
diesem Bereich) darstellt, welches durch einen vorrangig autogerecht gestalteten<br />
<strong>Bahnhof</strong>sbereich nicht mit Nachdruck gefördert werden muss. Dies bedeutet jedoch nicht,<br />
dass eine funktionsgerechte Verknüpfung <strong>und</strong> sonstige mit diesem Verkehrsmittel<br />
zusammenhängenden <strong>und</strong> zu erstellenden Anlagen, wie K&R- <strong>und</strong> P&R-Flächen etwa,<br />
unwichtig wären. Ganz im Gegenteil, letzt genannte Parkflächen für Kfz sind in<br />
verträglicher Zahl bereitzustellen. Hierbei bedeutet verträglich, dass nur eine begrenzte<br />
Zahl an Parkflächen zur Verfügung gestellt werden sollte. Eine ganzheitliche Befriedigung<br />
des an dem Standort aufkommenden Parkplatzbedarfs, der in der Bestandsaufnahme<br />
durch Verkehrszählungen ermittelt werden kann, bedeutet nämlich in den meisten Fällen<br />
die verminderte Nutzung der umweltfre<strong>und</strong>licheren Verkehrsmittel des ungeb<strong>und</strong>enen<br />
Individualverkehrs als auch des ÖPNV. Die Anwendung solcher restriktiven Maßnahmen<br />
(die nicht generell Anwendung finden müssen, sondern von Fall zu Fall entschieden<br />
werden müssen) sollten aber auch gleichzeitig solchen entgegengesetzt werden, die sich<br />
begünstigend auf die Nutzung umweltverträglicherer Zubringersysteme auswirken.<br />
Zielgruppen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die P&R-Nutzer im engsten<br />
Umfeld zum <strong>Bahnhof</strong> (bis 4 km), die durch die Nähe zu diesem, beste Voraussetzungen<br />
zum Umsteigen besitzen. Maßnahmen können gezielte Aufklärungsarbeit, spezielle<br />
Angebote <strong>und</strong> Verbesserung der Umsteigezeiten im Bereich des ÖPNV, als auch der<br />
191
Ausbau der Infrastruktur für den Fußgänger- <strong>und</strong> Fahrradverkehr, mit dem Ziel der<br />
Gesamtreisezeitverkürzung, sein.<br />
Losgelöst von der Gewichtungsskala sind notwendige Verkehrsanlagen zur<br />
Bewirtschaftung <strong>und</strong> Laufenthaltung des <strong>Bahnhof</strong>es bzw. des Schienenverkehrs (z.B.<br />
Anlieferverkehr für gewerbliche Nutzungen im <strong>Bahnhof</strong>sgebäude, Anlagen, die von der<br />
Deutschen Bahn AG für den Betrieb des Schienenverkehrs genutzt werden müssen usw.).<br />
Sie müssen so geplant werden, dass eine reibungslose Nutzung möglich ist. Das<br />
Vorhandensein solcher Anlagen ist aber Fall zu Fall unterschiedlich.<br />
6.4 Luftbildanalyse von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern<br />
6.4.1 Einleitung <strong>und</strong> Vorgehensweise<br />
Schon zur beginnenden Industrialisierung zeichnete sich ab, dass das Bahnwesen schnell<br />
Einfluss auf die <strong>Stadt</strong>entwicklung der jeweiligen Orte nehmen würde. Meist wurden die<br />
Bahnhöfe mit ihren Gleisanlagen an den <strong>Stadt</strong>rand gebaut. Oftmals bildete sich vom<br />
<strong>Bahnhof</strong> rasch eine Achse zur historischen Innenstadt, um die sich kurze Zeit später<br />
ganze <strong>Bahnhof</strong>sviertel entwickelten. 354 Dieses Kapitel greift die beschriebenen<br />
Sachverhalte vertiefend auf <strong>und</strong> beschäftigt sich mit der Analyse der Zusammenhänge<br />
zwischen der baulichen Anlage des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> der ihn umgebenden <strong>Stadt</strong>. Dabei<br />
sollen zum einen das nähere Umfeld sowie die großräumige Umgebung des <strong>Bahnhof</strong>s zur<br />
Klärung der Fragestellung beitragen, welchen Einfluss der <strong>Bahnhof</strong> auf die <strong>Stadt</strong>struktur<br />
hat.<br />
Die besondere Anforderung lag in der Wahl der methodischen Herangehensweise an die<br />
Thematik. Es schien abwegig, die doch sehr visuell geprägten Inhalte in einem eintönigen<br />
Theorieblock abzuhandeln, ohne auf konkrete Beispiele einzugehen. Eine sinnvolle<br />
Lösung ergab sich durch die Verwendung von Luftbildern von Google Earth 2007. Auf<br />
ihnen wird der <strong>Bahnhof</strong> zentriert in einem einheitlichen Maßstab abgebildet. Da es nicht<br />
darum ging, nur das unmittelbare <strong>Bahnhof</strong>sumfeld in die Analyse mit einzubeziehen,<br />
sondern außerdem <strong>und</strong> im Speziellen auch auf die weit reichende <strong>Stadt</strong>struktur Bezug zu<br />
nehmen, wurden jeweils zwei Luftaufnahmen unterschiedlichen Maßstabs gewählt, um<br />
eine umfassende Auswertung vornehmen zu können. Die erste Bildreihe sollte schließlich<br />
einen Bereich darstellen, der von Ost nach West gemessen circa 1,5 Kilometer umfasst.<br />
Für den kleineren der beiden Maßstäbe wurde für die Ost-West-Verbindung eine Länge<br />
von 10,5 Kilometern festgelegt. Im nächsten Schritt ging es um die Wahl der einzelnen<br />
Bahnhöfe. Es wurde beschlossen, sich in der Analyse auf die zwölf einwohnerreichsten,<br />
deutschen Städte <strong>und</strong> deren Hauptbahnhöfe zu beziehen, um letztendlich auch eine<br />
gewisse Vergleichbarkeit erzielen zu können, da die Einwohnerzahl dieser Großstädte<br />
jeweils über eine halbe Million Einwohner beträgt. Folglich wurden Berlin, Hamburg,<br />
München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Dortm<strong>und</strong>, Essen, Düsseldorf, Bremen,<br />
Hannover <strong>und</strong> Leipzig für die Bearbeitung herangezogen. Alle diese Städte besitzen<br />
Bahnhöfe, die die Deutsche Bahn AG in die höchste deutsche <strong>Bahnhof</strong>skategorie<br />
eingeordnet hat.<br />
354 Reulecke, Jürgen, Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, Frankfurt am Main 1985, S. 30 f.<br />
192
Im Fall von Berlin bezieht sich die Analyse noch auf den <strong>Bahnhof</strong> Zoologischer Garten, da<br />
der Berliner Hauptbahnhof aufgr<strong>und</strong> seiner erst kürzlich erfolgten Fertigstellung eine<br />
Sonderstellung erfährt <strong>und</strong> erst zum Ende des Kapitels besprochen wird. Doch auch<br />
ausländische <strong>Bahnhof</strong>sbeispiele werden in die Arbeit mit einbezogen. Gr<strong>und</strong>legend wurde<br />
festgehalten, dass es sich um Großstädte handeln sollte, die den europäischen Rahmen<br />
bewahren <strong>und</strong> die ein mit dem deutschen Bahnwesen vergleichbares Niveau aufweisen.<br />
In diesem Kontext fiel die Wahl auf England <strong>und</strong> Frankreich mit den Städten Birmingham,<br />
Edinburgh <strong>und</strong> Lille. Bei letzterer wird sich die Luftbildanalyse auf den <strong>Bahnhof</strong> Flandres<br />
beziehen, weil sich die städtebauliche Struktur um diesen <strong>Bahnhof</strong> entwickelt hat.<br />
Genauso wie der Hauptbahnhof in Berlin ist auch der <strong>Bahnhof</strong> Gare Lille Europe als<br />
Besonderheit zu betrachten <strong>und</strong> wird deshalb erst später beschrieben.<br />
Mit den gewählten Städten <strong>und</strong> den daraufhin erstellten Luftbildern, wurde die<br />
Quellengr<strong>und</strong>lage für die städtebauliche Analyse der <strong>Bahnhof</strong>sumfelder geschaffen, so<br />
dass die verschiedenen <strong>Bahnhof</strong>sumfelder analysiert werden können. Im Folgenden<br />
werden zuerst Gr<strong>und</strong>lagen der Fernerk<strong>und</strong>ung vorgestellt, woraufhin die Kriterien für die<br />
Luftbildanalyse erstellt werden. Durch sie ist es möglich, die einzelnen <strong>Bahnhof</strong>sumfelder<br />
zu untersuchen, um schließlich Ergebnisse zu erhalten, die zunächst beschrieben <strong>und</strong> in<br />
Form einer Tabelle festgehalten werden. Durch diese Tabelle können Zusammenhänge<br />
nachfolgend gut erklärt <strong>und</strong> verschiedene Typologien von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern<br />
herausgearbeitet werden. Die einzelnen Typen werden anhand von ausgewählten<br />
Musterbeispielen erklärt, die durch farblich markierte Luftbilder der zwei Maßstäbe<br />
veranschaulicht werden. Zusätzlich gibt es daraus entwickelte Strukturmodelle, die die<br />
einzelnen Typen graphisch wiedergeben. Anschließend wird kurz auf die städtebauliche<br />
Situation der besonderen Bahnhöfe eingegangen. Hierzu werden der Hauptbahnhof in<br />
Berlin, der <strong>Bahnhof</strong> Gare Lille Europe <strong>und</strong> der <strong>Bahnhof</strong> Shibuya Station in Tokio<br />
vorgestellt.<br />
Abschließend werden die erarbeiteten Erkenntnisse nochmals zusammenfassend<br />
dargestellt, um letztendlich die Zusammenhänge zwischen dem Städtebau <strong>und</strong> den<br />
Bahnhöfen festzuhalten.<br />
6.4.2 Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Kriterien der Luftbildanalyse<br />
Die Luftbildanalyse kann in das Themengebiet der Fernerk<strong>und</strong>ung eingeordnet werden.<br />
Allgemein beinhaltet dieser Sachbereich die berührungslose Erfassung von<br />
Objektsignaturen an der Erdoberfläche. Bei der Fernerk<strong>und</strong>ung steht vor allem die<br />
Verwendung von klassischen Luftbildern <strong>und</strong> digitalen orthogonalen Fotos im<br />
Vordergr<strong>und</strong>. Unter anderem können hierbei auch Flugzeugscanner- <strong>und</strong><br />
Satellitenaufnahmen eine wesentliche Rolle spielen.<br />
Um in die Analyse einsteigen zu können, sind jedoch einige Dinge zu beachten, die bei<br />
der Interpretation zu Unstimmigkeiten führen könnten. Zum einen stellen Luftbilder stets<br />
leicht verzerrte Aufnahmen dar. Hierbei kann eine Abweichung von bis zu drei Prozent<br />
vom Lot entstehen, da es sich um eine Zentralprojektion handelt, die leichte<br />
Abweichungen hervorrufen kann. Ein Luftbild gibt außerdem immer den augenblicklichen<br />
Zustand des Areals wieder, so dass die Interpretation von Jahres- <strong>und</strong> Tageszeit, der<br />
Witterung <strong>und</strong> der Beleuchtung abhängig ist. Aus der Sicht des Betrachters sind des<br />
193
Weiteren keine Höhenunterschiede, keine Klassifizierungen <strong>und</strong> keine Beschriftungen<br />
erkennbar. Teilweise werden in einer Luftaufnahme am Erdboden befindliche<br />
Gegebenheiten verdeckt, so dass diese Informationen verbogen bleiben. Von<br />
entscheidender Wichtigkeit ist bei der Auswertung die Größe des Maßstabs. Hierbei gilt:<br />
Je größer der Maßstab eines Luftbildes ist, desto mehr Details können wahrgenommen<br />
werden.<br />
Bei einer Interpretation ist die Bearbeitung der Gesichtspunkte „Messen, Beobachtung,<br />
Erkennen, Analysieren <strong>und</strong> Klassifizieren“ zu beachten. 355 Im Fall der zu bearbeitenden<br />
Luftbilder der Bahnhöfe werden diese Kriterien angewandt. Es wurden bereits<br />
verschiedene Maßstäbe gewählt, so dass getreu der Längen <strong>und</strong> Breiten vermessene<br />
Abbildungen vorliegen. Der Prozess der Beobachtung wird hier nicht beschrieben,<br />
dennoch werden die einzelnen Kriterien dargestellt, die Auskunft darüber geben, was<br />
genau auf den Luftaufnahmen betrachtet werden soll. Sobald die Erkenntnisse<br />
gesammelt wurden, sollen sie nachfolgend anhand einer Tabelle dargestellt werden.<br />
Ergänzend dazu wird beschrieben, inwieweit sich Schwierigkeiten beim Erkennen der<br />
einzelnen Kriterienpunkte ergaben. Anschließend werden die in der Tabelle aufgeführten<br />
Ergebnisse der Beobachtung analysiert <strong>und</strong> interpretiert. Eine Klassifizierung wird es<br />
durch die Erstellung von Strukturmodellen geben, so dass die für die Interpretation<br />
notwendigen Schritte allesamt Beachtung finden werden.<br />
In der Beobachtung sollen Kriterien angewendet werden, die es nun zu erfassen gilt. Es<br />
muss klar gemacht werden, was auf jeder Luftaufnahme beobachtet wird, um eine<br />
gewisse Struktur zu bewahren <strong>und</strong> um eine bessere Vergleichbarkeit erzielen zu können,<br />
um schließlich mehr Zusammenhänge zu erkennen. Gr<strong>und</strong>legend sollen städtebauliche<br />
Aspekte vor Augen geführt werden, die sowohl auf die <strong>Stadt</strong> als auch auf den <strong>Bahnhof</strong><br />
<strong>und</strong> seine Anlagen eingehen.<br />
Zunächst wurde die Art des <strong>Bahnhof</strong>s analysiert. Dabei gilt die klare einfache Abgrenzung<br />
zwischen Kopfbahnhof <strong>und</strong> Durchgangsbahnhof. Im zweiten Beobachtungsschritt ging es<br />
um die Bahnsteighalle, die den Gleiskörper am <strong>Bahnhof</strong> selbst überdacht. Hierbei wurde<br />
untersucht, inwiefern die Gleisstränge von einer zusammenhängenden Überdachung<br />
verborgen sind. Ein weiteres wichtiges Merkmal der <strong>Bahnhof</strong>sanlage ist das<br />
Empfangsgebäude. Es wurde untersucht, wo es sich in Bezug zum Gleiskörper befindet<br />
<strong>und</strong> wie es ausgerichtet ist. Ein weiterer Schritt lag in der Betrachtung der<br />
<strong>Bahnhof</strong>vorplätze. Da sich die Bahnhöfe zumeist in der unmittelbaren Nähe zur<br />
Innenstadt befinden, sollten Kenntnisse darüber gewonnen werden, ob der Vorplatz auf<br />
der zum <strong>Stadt</strong>kern gerichteten <strong>Bahnhof</strong>seite liegt, also vor dem <strong>Bahnhof</strong> oder auf der<br />
zum Zentrum abgewandten Seite ruht. Auch der Gleiskörper wurde spezifisch in den<br />
beiden Maßstäben betrachtet. Zum einen war es interessant, wie sich die Trasse in<br />
unmittelbarer <strong>Bahnhof</strong>snähe abhebt <strong>und</strong> zum anderen inwieweit sich der Bahnkörper im<br />
<strong>Stadt</strong>bild abzeichnet <strong>und</strong> damit ein strukturell bedeutsames Element im <strong>Stadt</strong>gefüge<br />
darstellt. Zusätzlich wurde in Erfahrung gebracht, inwiefern sich Achsen<br />
herauskristallisieren, die sich auf den <strong>Bahnhof</strong> beziehen. Führen mehrere Straßen auf die<br />
Anlage des <strong>Bahnhof</strong>s zu, wurde dies festgehalten. Zugleich wurden die in <strong>Bahnhof</strong>snähe<br />
befindlichen breiten Straßen beobachtet. Hierbei wird geklärt, ob der Gleiskörper über-<br />
355<br />
Fliessbach, Gabriele, Skript 10 Kartographie <strong>und</strong> DV-Anwendung, Fernerk<strong>und</strong>ung, Sommersemester 2006,<br />
Graue Literatur des ISR, TU Berlin, S. 1 ff.<br />
194
zw. unterquert wird oder ob die Straßen vollständig um die Trasse geführt werden. Ein<br />
weiteres wichtiges Kriterium ist die Bebauung vor dem <strong>Bahnhof</strong>, die in ihrer Bauweise<br />
<strong>und</strong> in ihrer Tiefe betrachtet wurden. Es stellen sich auch die Fragen, ob eine typische<br />
Blockrandbebauung vorliegt <strong>und</strong> ob die Größe der Innenhöfe vor dem <strong>Bahnhof</strong>s ähnliche<br />
Maße hat. Dabei geht es um das Verhältnis der Größen zueinander <strong>und</strong> nicht um die<br />
Ermittlung bestimmter metrischer Angaben für die verschiedenen Höfe. Nachdem die<br />
städtebaulichen Strukturen vor dem <strong>Bahnhof</strong> erfasst wurden, folgt der direkte Vergleich<br />
mit der Bebauungsstruktur hinter den Bahnanlagen. Es wurde analysiert, ob sich die<br />
bauliche Anordnung gleicht oder ob bzw. inwiefern sich Unterschiede erkennen lassen.<br />
Diese Beobachtungen bezogen sich sowohl auf den großen sowie auf den kleinen Maßstab<br />
der Luftbilder. In den Aufnahmen, in denen die gesamte <strong>Stadt</strong> dargestellt ist, zeigte sich<br />
dabei außerdem, ob sich die Bebauungsdichte zwischen den beiden <strong>Bahnhof</strong>sseiten<br />
unterscheidet.<br />
6.4.3 Ergebnisse der Luftbildanalyse<br />
Bei der Beobachtung der Aufnahmen der Bahnhöfe konnten die Kriterien abermals in<br />
unterschiedliche Kennzeichen aufgespaltet werden. Dieser Abschnitt geht nochmals auf<br />
die jeweiligen Gesichtspunkte ein.<br />
In Bezug auf die <strong>Bahnhof</strong>sart ergaben sich zum einen der Kopfbahnhof <strong>und</strong> zum anderen<br />
der Durchgangsbahnhof. Diese beiden Typen unterschieden sich so gut, dass sie den<br />
Städten schnell zugeordnet werden konnten. Das Erkennen der Überdachung musste<br />
differenzierter betrachtet werden. Es entstanden drei Unterkategorien, die das Ausmaß<br />
der Dachfläche beschreiben. Im Fall des Stuttgarter <strong>Bahnhof</strong>s stellte sich die Dachform<br />
nicht einheitlich dar, sondern eher wie viele eng aneinander liegende<br />
Bahnsteigüberdachungen. Aufgr<strong>und</strong> der Kompaktheit handelt es sich jedoch um ein<br />
vollständiges Dach. Ein interessanter Gesichtspunkt ist die Lage des Empfangsgebäudes<br />
im Bezug zum Gleiskörper. Hier stellte sich heraus, dass die Bauwerke entweder vor den<br />
Gleisen, seitlich derer oder über ihnen liegen oder etwa durch die Bahnsteighallen<br />
verborgen bleiben. Der letztere Fall wurde mit der Kategorie der über dem Gleiskörper<br />
liegenden Gebäude gleichgesetzt, weil in beiden Fällen keine gezielte Hinwendung zu<br />
einer <strong>Bahnhof</strong>sseite erfolgt. Die Gebäude stellen sich in der Anlage des <strong>Bahnhof</strong>s, sofern<br />
sichtbar, als wuchtige Baukörper dar, die meist eine lang gestreckte rechteckige Form<br />
besitzen.<br />
Der <strong>Bahnhof</strong>svorplatz ist ein weiteres städtebauliches Kennzeichen, das es zu<br />
untersuchen galt. Vor allem war die Lage zur Innenstadt wichtig, also vor dem <strong>Bahnhof</strong><br />
<strong>und</strong> damit zur Innenstadt hinwendend oder hinter dem <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> damit von der<br />
<strong>Stadt</strong>mitte abgekehrt. Dabei konnte herausgestellt werden, dass in Hamburg, Köln <strong>und</strong><br />
Essen jeweils zwei Vorplätze zu erkennen sind. Der Vorplatz definierte sich als größere<br />
Ausbuchtung in unmittelbarer Nähe zum <strong>Bahnhof</strong>, der durch Straßen tangiert wird <strong>und</strong> so<br />
eine gewisse Zugänglichkeit erfährt <strong>und</strong> nicht durch bauliche Anlagen verstellt ist. In den<br />
Städten Birmingham <strong>und</strong> Edinburgh gibt es ebenfalls jeweils nur einen Vorplatz, der sich<br />
jedoch hinter dem <strong>Bahnhof</strong> befindet <strong>und</strong> sich somit nicht zur Innenstadt orientiert.<br />
Ein weiteres bauliches Merkmal ist der Gleiskörper, der sowohl in Bezug zur näheren<br />
Umgebung sowie im Zusammenhang mit dem <strong>Stadt</strong>gefüge betrachtet wurde. Am<br />
195
<strong>Bahnhof</strong> selbst gibt es zwei Unterscheidungsformen, einmal den gradlinigen Verlauf der<br />
Gleisstränge <strong>und</strong> zum anderen die anschwellende Variante, die mit der Form eines<br />
eingepackten Bon-Bons verglichen werden kann. Die Bahntrasse zeichnet sich<br />
unterschiedlich stark im <strong>Stadt</strong>bild ab, weshalb eine dreifache Abstufung dieses Kriteriums<br />
vorgenommen wurde. Die praktische Eingrenzung in gering, mittelmäßig <strong>und</strong> stark<br />
gestaltete sich in wenigen Beispielen schwierig, da der Gleiskörper teilweise zwei<br />
unterschiedlichen Abstufungsformen hätte zugeordnet werden können.<br />
Breite Straßen, die in unmittelbarer <strong>Bahnhof</strong>snähe verlaufen, können drei<br />
unterschiedliche Beziehungen zum Gleiskörper aufweisen: Sie führen entweder<br />
vollständig um den <strong>Bahnhof</strong> herum oder über- bzw. unterqueren die Gleisanlagen. In<br />
Hamburg treffen sogar die beiden letzten Punkte gemeinsam zu. Hier führen die großen<br />
Straßen am <strong>Bahnhof</strong> selber über die Gleise. Weiter entfernt verlaufen die Fahrbahnen<br />
unter den sich verjüngenden Gleissträngen durch. Ein weiteres wichtiges Augenmerk ist<br />
auf die Bildung von Achsen zu legen, die auf den <strong>Bahnhof</strong> gerichtet sind. Zum Teil<br />
stechen diese Achsen so deutlich hervor, dass das städtebauliche <strong>Bahnhof</strong>sumfeld nahezu<br />
barocke Strukturen annimmt, wie es sich zum Beispiel bei Hannover darstellt.<br />
Des Weiteren wurde die Bebauung vor dem <strong>Bahnhof</strong> betrachtet. Es traten kaum<br />
Probleme bei der Abgrenzung der einzelnen Gesichtspunkte auf. Ergänzend zur<br />
geschlossenen gibt es teils offene Bauweisen vor den Bahnhöfen. Beispiele hierfür sind in<br />
Berlin Zoologischer Garten <strong>und</strong> in der <strong>Stadt</strong> Stuttgart zu erkennen, in der sich diese<br />
Bebauungsformen auch eher seitlich des Gleiskörpers befinden als vor demselbigen.<br />
Ausnahmefälle sind ebenfalls Gebäude mit einer geringen Gebäudetiefe <strong>und</strong> großen<br />
Innenhöfen. Vereinzelt treten sie in Düsseldorf <strong>und</strong> Hannover zum Vorschein. Unmittelbar<br />
hinter dem <strong>Bahnhof</strong> gibt es im Vergleich zu der vor dem <strong>Bahnhof</strong> befindlichen Bebauung<br />
in einigen Luftbildern Bebauungsformen, die unstrukturiert <strong>und</strong> planlos wirken. Sie<br />
definieren sich oftmals als geschlungene, lang gezogene oder große, wuchtige Baukörper,<br />
die in keiner städtebaulichen Anordnung zueinander stehen. Zwischen diesen Häusern<br />
liegen große, wie Restflächen wirkende, unbebaute Gebiete. Diese deutlichen<br />
strukturellen Bebauungsunterschiede weisen die Städte Dortm<strong>und</strong>, Düsseldorf, Bremen<br />
<strong>und</strong> Hannover auf. Geringe Unterschiede zu den Quartieren vor dem <strong>Bahnhof</strong> sind<br />
gegeben, wenn sich leichte Unterschiede in der Innenhofgröße, in der Gebäudetiefe oder<br />
in der Dichte der Bebauung <strong>und</strong> in der Bauweise ergeben. Andernfalls liegen keine<br />
baulichen Unterschiede vor.<br />
Großräumig weisen manche Städte ebenfalls Entwicklungsunterschiede auf. Hierbei geht<br />
es nicht mehr um einzelne Gebäude, sondern vielmehr um großflächige Gebiete, die<br />
durch ungeordnete Hallenstrukturen <strong>und</strong> unbebaute Flächen auffallen. Schließlich ging es<br />
in der Beobachtung auch um den dichteren Besiedlungsraum <strong>und</strong> seine Verteilung um<br />
den <strong>Bahnhof</strong>. Es konnten zwei unterschiedliche Kriterien erkannt werden. Das erste<br />
Kriterium sieht den dichten Besiedlungsraum größtenteils vor dem <strong>Bahnhof</strong> vor <strong>und</strong> das<br />
zweite geht von einer Gleichverteilung um den Bahnkörper aus.<br />
Bei der Zuordnung der einzelnen Kriterien ergaben sich mehrere Städtegruppen, die die<br />
gleichen Kennzeichen aufweisen <strong>und</strong> in den folgenden fünf Tabellen zusammengefasst<br />
wurden. Die erste Tabelle veranschaulicht die Gemeinsamkeiten aller <strong>Bahnhof</strong>sumfelder.<br />
Unterschiede ergaben sich hingegen zwischen den Kopfbahnhöfen (Tabelle 26) <strong>und</strong> den<br />
196
Durchgangsbahnhöfen. Letzte zeigten wiederum Übereinstimmungen (Tabelle 27) <strong>und</strong><br />
Gegensätze, so dass sich zwei weitere Typen von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern ergaben (Tabelle<br />
28 <strong>und</strong> 29).<br />
Tabelle 24: Gemeinsamkeiten aller <strong>Bahnhof</strong>sumfelder<br />
197<br />
Berlin Zoo<br />
Hamburg<br />
München<br />
Köln<br />
Frankfurt a. M.<br />
Überdachung der Gleise am <strong>Bahnhof</strong>:<br />
vollständig<br />
x x x x x x x x x<br />
Überdachung der Gleise am <strong>Bahnhof</strong>:<br />
teilweise<br />
x x x<br />
Überdachung der Gleise am <strong>Bahnhof</strong>: nicht<br />
vorhanden<br />
x x x<br />
Lage des <strong>Bahnhof</strong>svorplatzes: hinwendend zur<br />
x x x x x x x x x x x x<br />
Innenstadt<br />
x<br />
Achsenbildung der Straßen zum <strong>Bahnhof</strong>:<br />
ausgeprägt vorhanden<br />
x x x x<br />
Achsenbildung der Straßen zum <strong>Bahnhof</strong>:<br />
vorhanden<br />
x x x x x x x x<br />
Achsenbildung der Straßen zum <strong>Bahnhof</strong>:<br />
nicht vorhanden<br />
x x x<br />
Bebauung vor dem <strong>Bahnhof</strong>:<br />
Blockrandbebauung<br />
x x x x x x x x x x x x x x x<br />
Bebauung vor dem <strong>Bahnhof</strong>: geschlossene<br />
Bauweise<br />
x x x x x x x x x x x x x x x<br />
Bebauung vor dem <strong>Bahnhof</strong>: offene Bauweise x x<br />
Bebauung vor dem <strong>Bahnhof</strong>: tiefe Gebäude &<br />
kleine Höfe<br />
x x x x x x x x x x x x x x x<br />
Bebauung vor dem <strong>Bahnhof</strong>: geringe<br />
Gebäudetiefe & große Höfe<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
x x<br />
Tabelle 25: Typ 1 die <strong>Bahnhof</strong>sumfelder der Kopfbahnhöfe<br />
Stuttgart<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
München<br />
Frankfurt a. M.<br />
Essen<br />
Düsseldorf<br />
Stuttgart<br />
Leipzig<br />
Lille Flandres<br />
Art des <strong>Bahnhof</strong>s: Kopfbahnhof x x x x x<br />
Lage des Empfangsgebäudes: vor den Gleisen x x x x x<br />
Form des Gleiskörpers am <strong>Bahnhof</strong>: gradlinig x x x x<br />
Abzeichnung der Bahnanlagen im <strong>Stadt</strong>bild:<br />
stark<br />
Beziehung breiter Straßen zum Gleiskörper:<br />
Umführung<br />
Strukturelle Bebauungsunterschiede hinter<br />
dem <strong>Bahnhof</strong>: keine<br />
Weiträumig stadtstrukturelle Unterschiede<br />
hinter dem <strong>Bahnhof</strong><br />
x x x x x<br />
x x x x x<br />
x x x<br />
x x x x<br />
Bremen<br />
Hannover<br />
Leipzig<br />
Birmingham<br />
Edinburgh<br />
Lille Flandres
Verteilung des weiträumigen dichten<br />
Besiedlungsraumes:<br />
überwiegend vor dem <strong>Bahnhof</strong><br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Tabelle 26: Gemeinsamkeiten aller Durchgangsbahnhöfe<br />
198<br />
Berlin Zoo<br />
Hamburg<br />
x x x x x<br />
Köln<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
Essen<br />
Düsseldorf<br />
Bremen<br />
Hannover<br />
Birmingham<br />
Art des <strong>Bahnhof</strong>s: Durchgangsbahnhof x x x x x x x x x x<br />
Form des Gleiskörpers am <strong>Bahnhof</strong>:<br />
anschwellend<br />
x x x x x x x x x x<br />
Abzeichnung der Bahnanlagen im <strong>Stadt</strong>bild:<br />
mittelmäßig<br />
x x x x x<br />
Abzeichnung der Bahnanlagen im <strong>Stadt</strong>bild:<br />
gering<br />
x x x x x<br />
Beziehung breiter Straßen zum Gleiskörper:<br />
Überquerung<br />
x x x<br />
Beziehung breiter Straßen zum Gleiskörper:<br />
Unterquerung<br />
x x x x x x x x<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Tabelle 27: Typ 2 Durchgangsbahnhöfe mit Strukturunterschieden hinter dem<br />
<strong>Bahnhof</strong><br />
Lage des Empfangsgebäudes: seitlich der<br />
Gleise<br />
Strukturelle Bebauungsunterschiede hinter<br />
dem <strong>Bahnhof</strong>: deutlich<br />
Verteilung des weiträumigen dichten<br />
Besiedlungsraumes:<br />
überwiegend vor dem <strong>Bahnhof</strong><br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
Düsseldorf<br />
Bremen<br />
Hannover<br />
x x x x<br />
x x x x<br />
x x x x<br />
Edinburgh
Tabelle 28: Typ 3 Durchgangsbahnhöfe ohne starke Strukturunterschiede im<br />
Umfeld<br />
Lage des Empfangsgebäudes: über den<br />
Gleisen oder verdeckt<br />
Lage des <strong>Bahnhof</strong>svorplatzes: abkehrend von<br />
der Innenstadt<br />
Strukturelle Bebauungsunterschiede hinter<br />
dem <strong>Bahnhof</strong>: gering<br />
Verteilung des weiträumigen dichten<br />
Besiedlungsraumes:<br />
gleichmäßig um den <strong>Bahnhof</strong><br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
6.4.4 Analyse <strong>und</strong> Klassifizierung<br />
199<br />
Berlin Zoo<br />
Hamburg<br />
Köln<br />
Essen<br />
Birmingham<br />
Edinburgh<br />
x x x x x x<br />
x x x x x<br />
x x x x<br />
x x x x x<br />
Im Folgenden werden die in den Tabellen dargestellten Erkenntnisse aus den Luftbildern<br />
ausgewertet. Dabei wird insbesondere auf die Erläuterung der Klassifizierung in die drei<br />
Typen Wert gelegt.<br />
Die in den Luftbildern analysierten <strong>Bahnhof</strong>sumfelder weisen in städtebaulicher Hinsicht<br />
einige Berührungspunkte auf, die im Folgenden vorgestellt werden (Tabelle 25). Nahezu<br />
alle Bahnhöfe besitzen einen zur Innenstadt gerichteten <strong>Bahnhof</strong>svorplatz. Lediglich die<br />
<strong>Bahnhof</strong>sanlagen der zwei Städte Großbritanniens haben nur einen der Innenstadt<br />
abgewandten <strong>Bahnhof</strong>svorplatz. Die Bahnhöfe haben meist eine Bahnsteighalle, die zum<br />
Teil die gesamten Gleisanlagen überdeckt. Des Weiteren ist auffällig, dass zwölf von<br />
fünfzehn Städten Straßenachsen besitzen, die direkt zum <strong>Bahnhof</strong> führen <strong>und</strong> zum Teil<br />
sehr stark ausgeprägt sind. Im Umfeld der Bahnhöfe verlaufen oftmals mehrere breite<br />
Straßen, die größtenteils unter den Gleissträngen durchgeführt werden. Nur in Hamburg,<br />
Birmingham <strong>und</strong> Edinburgh überqueren Straßentrassen den Bahnkörper. Die Bebauung<br />
vor dem <strong>Bahnhof</strong> gleicht sich sogar in vielerlei Hinsicht. Ausnahmslos in allen Städten<br />
befindet sich auf der zur Innenstadt gerichteten Seite Blockrandbebauung, die sich aus in<br />
die Tiefe orientierten, mit kleinen Innenhöfen ausgestatteten Gebäuden zusammensetzt.<br />
Es liegt stets eine geschlossene Bauweise vor. Wie man der Tabelle 25 entnehmen kann,<br />
gibt es nur in sehr wenigen Städten offene Bauweisen <strong>und</strong> Gebäude mit einer geringen<br />
Tiefe <strong>und</strong> großen Innenhöfen.<br />
� Typ 1 – die <strong>Bahnhof</strong>sumfelder der Kopfbahnhöfe<br />
Den überwiegenden Teil der Beobachtung machen jedoch die Unterschiede zwischen den<br />
Städten aus, da einige Abstufungen in den Kriterien erfasst wurden. Es handelt sich um<br />
die Städte München, Frankfurt am Main, Stuttgart, Leipzig <strong>und</strong> Lille, denen dieselben<br />
Kriterien zugeordnet wurden <strong>und</strong> damit den ersten Typ bilden (Tabelle 26). Das heißt ihre<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfelder ähneln sich so stark, dass sie einer Kategorie angehören. Es fällt ins<br />
Auge, dass es sich bei diesem Typ 1 ausschließlich um Kopfbahnhöfe handelt. Dadurch<br />
entsteht auch der klare Zusammenhang zu den anderen meist vollständig
übereinstimmenden Merkmalen. Das Empfangsgebäude liegt stets vor den Gleisen <strong>und</strong><br />
ist orthogonal zu ihnen ausgerichtet. Um das wuchtige Gebäude führen breite Straßen,<br />
die den Bahnkörper weder über- noch unterqueren, da sie die Möglichkeit nutzen, vor<br />
dem <strong>Bahnhof</strong> zu verlaufen <strong>und</strong> so zur anderen Seite der Gleisstränge führen. Da die Züge<br />
bei dieser <strong>Bahnhof</strong>sart aus derselben Richtung kommen, in die sie wieder abfahren, ist<br />
der Bahnkörper wesentlich breiter <strong>und</strong> hebt sich so immer sehr deutlich aus dem<br />
<strong>Stadt</strong>bild ab. Die Breite der Gleistrasse ändert sich bis zum <strong>Bahnhof</strong> nicht, so dass kein<br />
Anschwellen der Gleisstränge nötig ist. Die einzige Ausnahme ist mit dem<br />
<strong>Bahnhof</strong>sgleisen von München gegeben, die am <strong>Bahnhof</strong> auseinander laufen. Auffällig ist<br />
außerdem, dass sich die Bebauung um den <strong>Bahnhof</strong> herum in den meisten Fällen gleicht.<br />
Bei den Bahnhöfen Leipzig Hauptbahnhof <strong>und</strong> Lille Flandres ergeben sich zwar<br />
Unterschiede in den Strukturen zwischen vor <strong>und</strong> seitlich des <strong>Bahnhof</strong>s, trotzdem kann<br />
man die Auffassung vertreten, dass generell gesehen um Kopfbahnhöfe eine ähnliche<br />
Bebauung herrscht. Dies kann dadurch begründet werden, dass der Bahnkörper der<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung nicht entgegen steht <strong>und</strong> so die Besiedlung gleichsam um den <strong>Bahnhof</strong><br />
erfolgt. Dennoch ist festzustellen, dass es weiträumig hinter dem <strong>Bahnhof</strong> baulich<br />
unstrukturierte Flächen gibt, die sich entlang des breiten Gleiskörpers <strong>und</strong> zwischen den<br />
abzweigenden Gleisen ziehen. Diese Gebiete liegen damit hinter dem <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong><br />
verursachen eine räumliche Diskrepanz, die sich im Luftbild des kleineren Maßstabs gut<br />
abzeichnet. Der Sonderfall ist wiederum Lille Flandres. Da sich die Gleisstränge schon<br />
sehr früh hinter dem <strong>Bahnhof</strong> aufgabeln, geht der Charakter der breiten Trasse schnell<br />
verloren, so dass die Besiedlung hinter den weit auseinander laufenden Schienen nicht<br />
unstrukturiert wirkt. Ein letztes entscheidendes Merkmal, das die Kopfbahnhöfe<br />
aufweisen, ist, dass sich der dichte Siedlungsraum überwiegend vor dem <strong>Bahnhof</strong><br />
befindet. Die gesamte Anlage des <strong>Bahnhof</strong>s ist nämlich zur Innenstadt hin gerichtet, so<br />
dass sich die städtebauliche Entwicklung vor dem <strong>Bahnhof</strong> abspielt. Zusätzlich gibt es im<br />
rückwärtigen Bereich des <strong>Bahnhof</strong>s die zuvor beschriebenen, unstrukturierten Gebiete,<br />
was die Entwicklung außerdem hemmen könnte.<br />
Als Musterbeispiel für den Typ 1 kann Frankfurt am Main gewählt werden. Bei dem<br />
Kopfbahnhof lassen sich die dargestellten Strukturen am besten erkennen. Im gesamten<br />
näheren <strong>Bahnhof</strong>sumfeld befinden sich klare Blockrandstrukturen. Es liegt ausschließlich<br />
geschlossene Bauweise vor. Die Gebäude sind in die Tiefe orientiert <strong>und</strong> haben sehr<br />
kleine Innenhöfe. Der Bahnkörper stellt sich breit <strong>und</strong> gradlinig dar <strong>und</strong> mit einer<br />
<strong>Bahnhof</strong>shalle als großflächige Überdachung. Deutlich zeichnet sich das<br />
Empfangsgebäude mit dem davor befindlichen <strong>Bahnhof</strong>svorplatz ab. Auf die Anlage<br />
führen sechs Straßenachsen zu, die in ihrer Breite variieren. Zusätzlich umführen breite<br />
Verkehrsflächen den <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> verstärken das charakteristische Bild des Typ 1. Der<br />
gegliederte Aufbau wird im Strukturmodell wiedergegeben <strong>und</strong> soll eine<br />
verallgemeinernde Darstellung sein, die auf den Großteil der in Typ 1 liegenden näheren<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfelder angewandt werden kann.<br />
Betrachtet man die Anlagen der Bahn der <strong>Stadt</strong> Frankfurt am Main im <strong>Stadt</strong>gefüge,<br />
lassen sich auch hier die für Typ 1 festgehaltenen Kennzeichen herausfiltern. Ein<br />
wichtiges Augenmerk ist auf den Verlauf der Bahnanlagen Richtung Innenstadt zu legen,<br />
die sich wiederum vor dem <strong>Bahnhof</strong> erstreckt. Stark zeichnen sich auch die großflächigen<br />
Gleisanlagen ab, die zum Teil auch anderen Bahnanlagen zugehörig scheinen. Aufgr<strong>und</strong><br />
dieser Trassenvielfalt heben sich die baulichen Entwicklungsunterschiede hinter dem<br />
200
<strong>Bahnhof</strong> drastisch aus dem Luftbild ab. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in dem<br />
dichten Besiedlungsraum wider, der sich vor dem <strong>Bahnhof</strong> um die Innenstadt erstreckt.<br />
Auch zum Typ 1 wurde ein Strukturmodell erstellt, das die generalisierte Schichtung<br />
wiedergibt <strong>und</strong> für den kleineren Maßstab für Kopfbahnhöfe anwendbar ist.<br />
Abb. 52: Frankfurt am Main Typ 1-nah Abb. 53: Strukturmodell Typ 1-nah<br />
Quelle: Google Earth <strong>und</strong> eigene Darstellung<br />
Abb. 54: Frankfurt am Main Typ 1-fern Abb. 55: Strukturmodell Typ 1-fern<br />
Quelle: Google Earth <strong>und</strong> eigene Darstellung Quelle: eigene Darstellung<br />
201
Nachdem das erste <strong>Bahnhof</strong>sumfeld klassifiziert wurde, geht die Analyse nun zu den<br />
Durchgangsbahnhöfen über. Ein Blick in die obige Tabelle 27 verrät, dass es einige<br />
Gemeinsamkeiten zu verzeichnen gibt. Diese <strong>Bahnhof</strong>sart besitzt im Allgemeinen einen<br />
an der Station anschwellenden Gleiskörper, da die Anzahl der Gleise zunimmt, denen<br />
zusätzlich Bahnsteige zwischengelagert werden, so dass sich die Trasse schließlich<br />
ausweitet. Auch in der Umgebung der Durchgangsbahnhöfe, gibt es sehr breite Straßen.<br />
Sie können die Bahnanlagen jedoch nicht umgehen, da die Schienentrasse eine Schneise<br />
durch die <strong>Stadt</strong> schlägt, die nur unter- bzw. überquert werden kann. Eine Überquerung<br />
der Gleise erfolgt in den meisten Fällen nicht. Lediglich in den Städten Hamburg,<br />
Birmingham <strong>und</strong> Edinburgh führen Straßen über die Trasse. Die dritte Gemeinsamkeit<br />
ergibt sich aus der Betrachtung der im kleinen Maßstab befindlichen Luftbilder. Sie lassen<br />
den Gleiskörper nur sehr schwach erkennen, so dass die einzelnen Gleisstränge teilweise<br />
sogar im <strong>Stadt</strong>gefüge untergehen. Der Gr<strong>und</strong> hierfür liegt zum einen im<br />
Durchgangcharakter der Bahnhöfe. Im Gegensatz zum Kopfbahnhof laufen die<br />
Gleisstränge nicht mehr nur als eine gebündelte Trasse auf den <strong>Bahnhof</strong> zu, sondern<br />
verteilen sich seitlich der Station auf zwei Trassen. Zum anderen gabeln sich die beiden<br />
Strecken meist auch schnell auf, so dass noch schmalere Schienenstränge gebildet<br />
werden, die im kleinen Maßstab kaum mehr wahrnehmbar sind.<br />
� Typ 2 - Durchgangsbahnhöfe mit Strukturunterschieden hinter dem <strong>Bahnhof</strong><br />
Dennoch gibt es zwischen den behandelten Durchgangsbahnhöfen auch einige<br />
Unterschiede, die die Einteilung dieser <strong>Bahnhof</strong>sart in nur eine Kategorie nicht zulassen.<br />
Bei den noch verbliebenen Kriterien kristallisieren sich vielmehr zwei weitere Typen<br />
heraus, die Unterschiede im Zusammenhang mit dem Empfanggebäude, dem<br />
<strong>Bahnhof</strong>svorplatz, dem dichteren Siedlungsraum <strong>und</strong> der Bebauungsstruktur hinter dem<br />
<strong>Bahnhof</strong> aufweisen. Demnach ergibt sich zunächst ein zweiter Typ von<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldern (Tabelle 28). Er ist durch die seitliche Lage des Empfangsgebäudes<br />
gekennzeichnet, vor dem sich der einzige <strong>Bahnhof</strong>svorplatz erstreckt, der sich wiederum<br />
zur Innenstadt hinwendet. Auf der der <strong>Stadt</strong>mitte abgewandten Seite zeichnen sich stets<br />
strukturelle Unterschiede in der Bebauung <strong>und</strong> in der Freiraumgestaltung ab. Besonders<br />
anschaulich wirken diese Entwicklungsunterschiede in den Städten Dortm<strong>und</strong>, Düsseldorf<br />
<strong>und</strong> Bremen. Unmittelbar hinter dem <strong>Bahnhof</strong> lassen sich hier Bebauungsformen<br />
erkennen, die sich durch ihre unterschiedlichen Strukturen von den umliegenden<br />
abheben. Oftmals handelt es sich um größere Gebäude, zwischen denen sich Freiflächen<br />
erstrecken. Hinter dem Bremer <strong>Bahnhof</strong> ist der besondere Fall eines großräumigen,<br />
versiegelten Platzes gegeben, dem sich eine wuchtige Bebauung anschließt. Der Komplex<br />
übertrifft die Größe des <strong>Bahnhof</strong>s um ein Vielfaches. Er kann als charakteristischer<br />
Aufbau des Typs 2 gesehen werden. Auch in Hannover ergeben uneinheitliche Formen,<br />
die in ihrer Ausprägung jedoch nicht so stark hervorstechen. Trotzdem wird das<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeld Hannovers in dieselbe Kategorie aufgenommen, da zum einen das<br />
Empfangsgebäude mit dem Vorplatz seitlich zu den Gleissträngen ausgerichtet ist <strong>und</strong><br />
sich zum anderen auch der dichtere Besiedlungsraum zu größeren Anteilen vor dem<br />
<strong>Bahnhof</strong> befindet. Anhand der im Luftbild zu erkennenden, verschiedenen Färbungen<br />
kann die Dichte der Bebauung abgelesen <strong>und</strong> damit der dichtere Besiedlungsraum<br />
erkannt werden. Dieses Kennzeichen weisen auch die drei anderen Orte auf, so dass sich<br />
die räumliche Diskrepanz auch im weitläufigen <strong>Stadt</strong>bild widerspiegelt. Die vorgestellten<br />
202
Kriterien können im direkten Zusammenhang betrachtet werden. Da sich der <strong>Bahnhof</strong><br />
klar zur Innenstadt orientiert, liegt auch der Schwerpunkt der Entwicklungen auf den<br />
Gebieten vor dem <strong>Bahnhof</strong>. Im rückwärtigen Bereich entstehen hingegen<br />
Entwicklungsunterschiede, die sich in einer schlechteren Wegeführung zum <strong>Bahnhof</strong>, in<br />
einer unstrukturierten Bebauung <strong>und</strong> in einem erhöhen Flächenverbrauch ausdrücken.<br />
Salopp betrachtet könnte man feststellen, dass die baulichen Anordnungen hinter dem<br />
<strong>Bahnhof</strong> umso geordneter wirken, je besser die Zugänglichkeit zur Anlage des <strong>Bahnhof</strong>s<br />
ist. Um die erläuterten Sachverhalte zu veranschaulichen, soll das Umfeld des<br />
Düsseldorfer Hauptbahnhofes vorgestellt werden.<br />
Die Bahnsteige des Durchgangsbahnhofs sind von einer mittelgroßen <strong>Bahnhof</strong>shalle<br />
überdacht, die zum seitlich gelagerten Empfangsgebäude mit dem davor befindlichen<br />
Vorplatz führt. Hinter der aufgeschwollenen Bahntrasse lassen sich deutlich die farblich<br />
markierten uneinheitlichen Bebauungsstrukturen erkennen, die von zahlreichen<br />
Freiflächen durchzogen werden. Vor der Bahnanlage erkennt man die durchgehend<br />
geschlossene Bauweise <strong>und</strong> den typischen Blockrand. In Düsseldorf sind nicht alle auf der<br />
Seite der Innenstadt liegenden Gebäude in die Tiefe orientiert, sondern es bilden sich<br />
auch Häuser ab, die große Innenhöfe haben <strong>und</strong> sich im Luftbild schmaler darstellen.<br />
Abb. 56: Düsseldorf Typ 2-nah Abb. 57: Strukturmodel Typ 2-nah<br />
Quelle: Google Earth <strong>und</strong> eigene Darstellung Quelle: eigene Darstellung<br />
Abb. 58: Düsseldorf Typ 2-fern Abb. 59: Strukturmodel Typ 2-fern<br />
203
Quelle: Google Earth <strong>und</strong> eigene Darstellung Quelle: eigene Darstellung<br />
Fünf breitere Straßen führen achsenähnlich auf den <strong>Bahnhof</strong> zu. Die Verkehrsflächen<br />
unterqueren den Gleiskörper in <strong>Bahnhof</strong>snähe an drei Stellen. Das aus den zutreffenden<br />
Kriterien entwickelte Strukturmodel des unmittelbaren Umfeldes verdeutlicht nochmals<br />
die unterschiedlichen Dichten <strong>und</strong> die Entwicklungsunterschiede zwischen vor <strong>und</strong> hinter<br />
dem <strong>Bahnhof</strong>. Auch die anderen Merkmale des Typ 2 sind im Model vereinfach<br />
dargestellt. Großräumig zeichnen sich die Strecken der Bahn nur sehr leicht ab <strong>und</strong> sind<br />
als dünne Schneisen im <strong>Stadt</strong>bild zu sehen. Kennzeichnend ist außerdem die Aufgabelung<br />
der Gleisstränge kurz hinter dem <strong>Bahnhof</strong> in alle vier Himmelsrichtungen. Das<br />
Empfangsgebäude mit seinem anliegenden Platz richtet sich klar zur nahe liegenden<br />
Kernstadt, die wiederum vom überwiegenden Teil des dichten Besiedlungsraumes<br />
umhüllt wird. Hinter dem <strong>Bahnhof</strong> gibt es nur einen kleinen Anteil der dichteren<br />
Siedlungen, die schon bald in offenere Bauformen übergehen. Das nebenstehende<br />
Gliederungsmodel zeigt diesen Sachverhalt in vereinfachter Form.<br />
� Typ 3 - Durchgangsbahnhöfe ohne starke Strukturunterschiede im Umfeld<br />
Letztlich steht noch der dritte Typ von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern aus (Tabelle 29) <strong>und</strong> soll nun<br />
beschrieben <strong>und</strong> erläutert werden. Das Hauptaugenmerk ist bei dieser Kategorie auf das<br />
Empfangsgebäude <strong>und</strong> den bzw. die <strong>Bahnhof</strong>svorplätze zu legen. Das <strong>Bahnhof</strong>sgebäude<br />
liegt nicht vor dem Gleiskörper, sondern überspannt ihn wie eine Brücke, so dass es sich<br />
quer über den Gleisen befindet, wie es zum Beispiel in Hamburg gegeben ist. In den<br />
meisten Fällen dieses Typs lässt sich das Gebäude in den Luftaufnahmen jedoch nicht<br />
erkennen, so dass in Berlin Zoologischer Garten, Köln, Essen, Birmingham <strong>und</strong> Edinburgh<br />
lediglich die ausgeprägte <strong>Bahnhof</strong>halle erkennbar ist, die sich im Regelfall weitaus größer<br />
darstellt als bei Typ zwei. Unterschiede ergeben sich auch in Bezug auf den<br />
<strong>Bahnhof</strong>svorplatz. Charakteristisch ist, dass es meist einen Vorplatz gibt, der sich auf der<br />
dem Zentrum abgewandten <strong>Bahnhof</strong>sseite befindet. Außerdem gibt es häufig einen<br />
weiteren auf der innerstädtischen Seite. Der Ausnahmefall ist Berlin Zoologischer Garten<br />
mit nur einem klassischen <strong>Bahnhof</strong>svorplatz, der zum westlichen City-Bereich der<br />
Hauptstadt leitet.<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> wurde am 7. Februar 1882 zusammen mit der <strong>Stadt</strong>bahn eröffnet. Erst über<br />
zweieinhalb Jahre später wird der <strong>Bahnhof</strong> für den Fernverkehr freigegeben. Er ist jedoch<br />
nicht der wichtigste <strong>Bahnhof</strong> in Berlin gewesen <strong>und</strong> war 1934 nach der Anzahl der<br />
Fernreisenden nur der fünftgrößte <strong>Bahnhof</strong> in der <strong>Stadt</strong>. Seine Vorrangstellung erhielt er<br />
204
erst im Jahr 1952, als er zum einzigen Fernbahnhof West-Berlins wurde. 356 Es ist<br />
vorstellbar, dass sich der Städtebau nicht vorrangig auf diesen <strong>Bahnhof</strong> ausgerichtet hat,<br />
so dass er heute nur schwer einem Typ zugeordnet werden kann. Dennoch weist er in<br />
der Tabelle überwiegend Kennzeichen des dritten Typs auf, so dass er in diesem Teil des<br />
Textes aufgeführt wird.<br />
Beim Vergleich der Bebauung bei Typ 3 vor <strong>und</strong> hinter dem <strong>Bahnhof</strong> fallen die<br />
strukturellen Unterschiede kaum bis gar nicht ins Gewicht, da hier die Zugänglichkeit zur<br />
Rückseite des <strong>Bahnhof</strong>s gut gewährleistet ist. In den britischen Städten Birmingham <strong>und</strong><br />
Edinburgh gibt es sogar nur einen „Hinterplatz“, da sich der City-Bereich zur anderen<br />
Seite des <strong>Bahnhof</strong>s erstreckt. In den beiden Fällen unterscheidet sich die Bebauung um<br />
die Anlagen der Bahn nicht. In den deutschen Städten dieser Kategorie sind die<br />
rückwärtigen Gebäude teilweise durch größere Innenhöfe <strong>und</strong> geringere Gebäudetiefen<br />
gekennzeichnet, wodurch die Dichte im Verhältnis zum <strong>Stadt</strong>zentrum nicht so stark<br />
ausfällt. Im kleineren Maßstab kann ein weiteres Merkmal des 3. Typs vor Augen geführt<br />
werden, nämlich die relative Gleichverteilung des dichten Besiedlungsraums um den<br />
<strong>Bahnhof</strong>. Da die Haltestation in den vorgestellten Städten beidseitig gut erreichbar ist, ist<br />
es möglich, dass sich auch die <strong>Stadt</strong>entwicklung um den <strong>Bahnhof</strong> gleichmäßig vollziehen<br />
kann. So kann beispielsweise ein auf der dem Zentrum abgewandten Seite der<br />
Bahnanlagen errichteter <strong>Bahnhof</strong>svorplatz die Bildung eines neues städtischen<br />
Schwerpunktes hervorrufen 357 . In Köln liegt die dichtere Siedlungsstruktur jedoch<br />
größtenteils vor dem <strong>Bahnhof</strong>. Aufgr<strong>und</strong> der sich im <strong>Stadt</strong>bild abzeichnenden zwei<br />
Vorplätze, des verdeckten Empfanggebäudes <strong>und</strong> der geringen Entwicklungsunterschiede<br />
zwischen den einzelnen <strong>Bahnhof</strong>sseiten wurde der Kölner Hauptbahnhof in die dritte<br />
Kategorie eingeordnet.<br />
Als Musterbeispiel kann wiederum der Hamburger Hauptbahnhof angesehen werden.<br />
Auch sein <strong>Bahnhof</strong>sumfeld wurde nahe liegend <strong>und</strong> großräumig in den zwei Luftbildern<br />
markiert. Am auffälligsten ist bei diesem Durchgangsbahnhof das quer über dem<br />
Bahnkörper liegende, blau gekennzeichnete Empfangsgebäude, das wie eine Brücke die<br />
beiden Vorplätze verbindet, zwischen denen sich wiederum die wuchtige <strong>Bahnhof</strong>shalle<br />
befindet. Südlich verzweigen sich schnell die Gleisstränge in zwei Richtungen. Zwischen<br />
ihnen entsteht ein Gebiet, das durch diese Verkehrsschneisen von seiner Umgebung<br />
abgekapselt wird. So ist es zu erklären, dass die Bebauung dieser Fläche sehr<br />
unstrukturiert wirkt <strong>und</strong> mit den hinter dem <strong>Bahnhof</strong> liegenden Bereichen des zweiten<br />
Typs verglichen werden kann. Nördlich verjüngt sich die Trasse zu einem sehr schmalen<br />
Gleisbett. Die Straßenverkehrsflächen sind ein weiteres prägendes Merkmal des<br />
<strong>Bahnhof</strong>sumfeldes. Sie überqueren den Bahnkörper an drei Stellen in <strong>Bahnhof</strong>nähe <strong>und</strong><br />
unterqueren ihn zweimal im Bereich der schmaleren Schienentrasse. Die Anordnung der<br />
größeren Straßen wirkt wie ein Netz, das über den <strong>Bahnhof</strong> gelegt wurde <strong>und</strong> die<br />
Bedeutung desselben hervorhebt.<br />
356 Neumann, Peter, Berlins Bahnhöfe, Berlin 2004, S. 107 ff.<br />
357 Recker, Müller, Gesichtspunkte zur Gestaltung von <strong>Bahnhof</strong>svorplätzen, Frankfurt am Main 1961, S. 6.<br />
205
Abb. 60: Hamburg Typ 3-nah Abb. 61: Strukturmodel Typ 3-nah<br />
Quelle: Google Earth <strong>und</strong> eigene Darstellung Quelle: eigene Darstellung<br />
Abb. 62: Hamburg Typ 3-fern Abb. 63: Strukturmodel Typ 3-fern<br />
Quelle: Google Earth <strong>und</strong> eigene Darstellung Quelle: eigene Darstellung<br />
206
Auch in diesem Fall ist die Blockrandbebauung auf der zur Innenstadt gerichteten Seite in<br />
die Tiefe orientiert <strong>und</strong> lässt nur sehr kleine Innenhöfe erkennen. Die durchgehend<br />
geschlossene Bauweise erzeugt eine ausgeprägte städtebauliche Dichte, die jenseits der<br />
Gleise nicht so stark ausfällt. Dennoch halten sich die Entwicklungsunterschiede in einem<br />
geringen Maß, so dass lediglich die Innenhofgröße <strong>und</strong> der Grünanteil auf der anderen<br />
<strong>Bahnhof</strong>sseite zunehmen. Im Strukturmodel ist die leicht abnehmende Dichte durch die<br />
Häuser mit den großen Höfen gekennzeichnet. Großräumig ist festzustellen, dass sich die<br />
Bahnstrecken durch ihre geringe Breite kaum aus dem <strong>Stadt</strong>bild abzeichnen <strong>und</strong> mit<br />
Straßenverkehrsflächen leicht verwechselt werden können. Der dichte Besiedlungsraum<br />
verteilt sich in Hamburg östlich <strong>und</strong> westlich des <strong>Bahnhof</strong>s annähernd gleichmäßig, was<br />
als Charakteristikum für Typ 3 herausgestellt wurde. Südlich bildet der Fluss eine<br />
natürliche Barriere zur Siedlungsentwicklung. Im letzten Schaubild wird vor allem die<br />
nahezu gleichmäßige Besiedlung um den <strong>Bahnhof</strong> dargestellt.<br />
6.4.5 Sonderfälle von Bahnhöfen<br />
Die drei vorgestellten Typen können jedoch nicht auf alle <strong>Bahnhof</strong>sumfelder angewendet<br />
werden. Es gibt einige Sonderfälle von Bahnhöfen, die sich durch ihre Neuheit von den<br />
anderen abheben oder deren städtebauliches Umfeld sich in Aufbau <strong>und</strong> Ausdehnung zu<br />
sehr von dem europäischen Maßstab unterscheidet. Im Folgenden soll deshalb kurz auf<br />
den Berliner Hauptbahnhof, auf den Gare Lille Europe <strong>und</strong> auf die Shibuya Station in<br />
Tokio eingegangen werden.<br />
Auf dem Gelände des heutigen Berliner Hauptbahnhofes befand sich einst der 1871<br />
eingeweihte Kopfbahnhof Lehrter <strong>Bahnhof</strong>. 358 In den Bomberangriffen des Zweiten<br />
Weltkrieges wurde er stark beschädigt. Der später wieder in Betrieb genommene <strong>Bahnhof</strong><br />
verlor durch die Teilung der <strong>Stadt</strong> an Bedeutung, so dass der Schienenverkehr ab 1952<br />
vollständig eingestellt wurde. Nur auf der in Ost-West-Richtung verlaufenden <strong>Stadt</strong>bahn<br />
fuhren die S-Bahnen weiter, die im Bereich des Lehrter <strong>Bahnhof</strong>s an der gleichnamigen<br />
S-Bahn-Station hielten. In der Folge des nahe gelegenen Mauerbaus verlor das Gebiet ab<br />
1961 für die Bahn an Bedeutung, so dass sich das vormals zusammenhängende, nördlich<br />
<strong>und</strong> südlich an die <strong>Stadt</strong>bahn angrenzende Bahngelände in eine öde Landschaft<br />
verwandelte. 359 Erst nach dem Mauerfall wurde die Entwicklung des Berliner Bahnwesens<br />
vorangetrieben, so dass mit dem Berliner Hauptbahnhof der größte Kreuzungsbahnhof<br />
Europas entstand. 360 Aufgr<strong>und</strong> des geschichtlichen Hintergr<strong>und</strong>s ist es verständlich, dass<br />
sich das heutige <strong>Bahnhof</strong>sumfeld als großflächiges, unbebautes Gebiet darstellt, das den<br />
typischen herausgearbeiteten Kriterien widerspricht. Dennoch können einige andere<br />
Kennzeichen auf den oberirdisch verlaufenden Durchgangsbahnhof angewandt werden.<br />
Dadurch lässt sich vielleicht erkennen, in welche Richtung die Entwicklung laufen könnte.<br />
358 http://www.hbfberlin.de/site/berlin__hauptbahnhof/de/geschichte/das__19__jahrh<strong>und</strong>ert/das__19__jahrhun<br />
dert.html, Zugriff am 30.06.2007.<br />
359<br />
http://www.hbfberlin.de/site/berlin__hauptbahnhof/de/geschichte/das__20__jahrh<strong>und</strong>ert/das__20__jahrhun<br />
dert.html, Zugriff am 30.06.2007.<br />
360<br />
http://www.hbfberlin.de/site/berlin__hauptbahnhof/de/geschichte/nach__dem__mauerfall/nach__dem__ma<br />
uerfall.html, Zugriff am 30.06.2007.<br />
207
Abb. 64: Berlin Hauptbahnhof nah Abb. 65: Berlin Hauptbahnhof fern<br />
Quelle: Google Earth 2007 Quelle: Google Earth 2007<br />
Charakteristisch ist die am <strong>Bahnhof</strong> anschwellende Gleistrasse, die von einer großen<br />
Überdachungshalle überspannt <strong>und</strong> von den Straßen unterquert wird. Im <strong>Stadt</strong>bild selber<br />
zeichnet sie sich nur geringfügig ab. Um den <strong>Bahnhof</strong> selber erstrecken sich weite<br />
unbebaute Freiräume, die nur zum Teil begrünt sind. Die entscheidenden Merkmale sind<br />
das quer zu den oberirdischen Gleisen liegende Empfangsgebäude, das sich durch die in<br />
Nord-Süd-Richtung verlaufende Dachkonstruktion abhebt <strong>und</strong> die zwei Vorplätze, die sich<br />
schon leicht in ihren Gr<strong>und</strong>rissen abzeichnen. Demnach könnte der Hauptbahnhof in die<br />
Kategorie 3 eingeordnet werden, so dass eine gleichmäßig gewichtete bauliche<br />
Entwicklung um den <strong>Bahnhof</strong> gut vorstellbar ist.<br />
In der französischen <strong>Stadt</strong> Lille gibt es neben dem bereits vorgestellten <strong>Bahnhof</strong> Flandres<br />
einen zweiten bedeutenden Haltepunkt - den Gare Lille Europe, der nur etwa 400 Meter<br />
von dem historischen Kopfbahnhof entfernt liegt. Der moderne, 1993 fertig gestellte<br />
Durchgangsbahnhof ist ein internationaler Schienenverkehrsknotenpunkt, von dem aus<br />
Strecken unter anderem nach Brüssel, Paris <strong>und</strong> London führen. 361 Da sich die<br />
<strong>Stadt</strong>struktur jedoch nicht auf diesen neuen <strong>Bahnhof</strong> bezieht, können die drei<br />
Klassifizierungen auch in diesem keine Anwendung finden. Trotzdem soll hier kurz die<br />
Anlage des Gare Lille Europe <strong>und</strong> sein unmittelbares städtebauliches Umfeld betrachtet<br />
<strong>und</strong> veranschaulicht werden, um die Sonderstellung des <strong>Bahnhof</strong>s herauszustellen.<br />
361 http://www.directrail.com/eurostar_lille.html, Zugriff am 30.06.2007.<br />
208
Abb. 66: Gare Lille Europe nah Abb. 67: Gare Lille Europe fern<br />
Quelle: Google Earth 2007 Quelle: Google Earth 2007<br />
Zunächst ist es schwierig das Bauwerk im Luftbild klar abzugrenzen, da sich die Station<br />
als ein Gebäudekomplex darstellt <strong>und</strong> es keinen anschwellenden Gleiskörper gibt.<br />
Lediglich die Schienenstränge, die von Straßen überquert werden, verweisen auf die<br />
genaue Lage. Auch der <strong>Bahnhof</strong>svorplatz zeichnet sich nicht deutlich ab, so dass die<br />
Orientierung zu einer <strong>Bahnhof</strong>sseite nur schwer ausgemacht werden kann. Dominant<br />
sticht ein zwischen den beiden Bahnhöfen Lilles befindlicher riesiger Baukörper heraus,<br />
dem sich nördlich <strong>und</strong> südöstlich kleine Parkanlagen anschließen. Die Darstellungen des<br />
Gare Lille Europe zeigen, welche Unterschiede sich zwischen <strong>Bahnhof</strong>sanlage <strong>und</strong> ihrer<br />
Umgebung ergeben können. Dennoch bleibt der <strong>Bahnhof</strong> ein Ausnahmefall, auf den im<br />
Kapitel des internationalen Vergleichs nochmals vertiefender eingegangen wird.<br />
Das letzte in diesem Zusammenhang erläuterte Beispiel soll die Shibuya Station in Tokio<br />
sein. Mit 2,4 Millionen Fahrgästen war sie an normalen Wochentagen im Jahr 2004 der<br />
drittgrößte Pendlerbahnhof Tokios. 362 Ihr städtebauliches Umfeld weicht durch extreme<br />
Formen ebenfalls deutlich von den schon aufzeigten <strong>Bahnhof</strong>sumgebungen ab <strong>und</strong> wird<br />
folgend kurz vorgestellt.<br />
362 http://www.cafepress.com/commutershirts/2003345, Zugriff am 15.07.2007.<br />
209
Abb. 68: Shibuya Station Tokio nah Abb. 69: Shibuya Station Tokio fern<br />
Quelle: Google Earth 2007 Quelle: Google Earth 2007<br />
Shibuya Station kann als Kreuzungsbahnhof bezeichnet werden, der zwei<br />
aneinandergrenzende Überdachungen besitzt, die sich jedoch nur schwer aus den<br />
Luftaufnahmen herauskristallisieren lassen. Der Gr<strong>und</strong> hierfür liegt in der starken<br />
Überbauung, die einen Großteil der Bahnanlage verdeckt. Trotzdem ist der leicht<br />
anschwellende Bahnkörper zwischen den umliegenden Gebäuden ablesbar. Er wird von<br />
mehreren Straßen unter- <strong>und</strong> zum Teil auch überquert. Die in alle Himmelsrichtungen<br />
führenden Gleisstränge sind im kleinen Maßstab kaum wahrnehmbar. Vielmehr zeichnen<br />
sich die breiten Straßenzüge aus dem <strong>Stadt</strong>bild ab, die sich an der Shibuya Station<br />
kreuzen <strong>und</strong> augenscheinlich einen Verkehrsknotenpunkt entstehen lassen. Besonders<br />
sticht jedoch die Bebauung hervor, die nicht in die verschiedenen <strong>Bahnhof</strong>sseiten<br />
unterschieden werden kann, weil der Kreuzungscharakter zum einen vier Bereiche um die<br />
Bahntrasse herausbildet <strong>und</strong> zum anderen die Innenstadt in den Luftbildern nicht<br />
erkennbar ist. Der Haltepunkt ist von einer unvergleichbaren städtebaulichen Dichte<br />
umgeben, die sich aus wuchtigen Baublöcken ohne Innenhöfe zusammensetzt. Ein<br />
eventuelles Empfangsgebäude kann deshalb nicht aus den Bildern herausinterpretiert<br />
werden. Aufgr<strong>und</strong> der baulichen Vielfalt wird der in der Nähe des <strong>Bahnhof</strong>s liegende Platz<br />
nicht als <strong>Bahnhof</strong>svorplatz gesehen, sondern als einfacher öffentlicher Raum im<br />
<strong>Stadt</strong>gefüge. Letztlich lässt der auf einem Gebäudedach befindliche Sportplatz<br />
Rückschlüsse auf die extreme Dichte in der näheren Umgebung zu. Zusammenfassend<br />
kann festgestellt werden, dass die städtebauliche Situation um den <strong>Bahnhof</strong> Shibuya<br />
Station aus der außergewöhnlichen Bevölkerungsdichte Tokios resultiert, die sich im<br />
<strong>Stadt</strong>gebiet aus etwa 13.650 Menschen je Quadratkilometer definiert 363 . Genauere<br />
Informationen über den <strong>Bahnhof</strong> sind im Kapitel des internationalen Vergleichs<br />
dargestellt.<br />
363 http://www.voila-uhren.de/index.php?blog=64&page=1&paged=2, Zugriff am 15.07.2007.<br />
210
6.5 Fazit<br />
In diesem abschließenden Teil soll zusammenfassend dargestellt werden, inwiefern der<br />
Städtebau <strong>und</strong> die Siedlungsstruktur mit der Anlage des <strong>Bahnhof</strong>s zusammenhängen.<br />
Dazu wird nochmals kurz auf die verschiedenen Typen eingegangen. Abschließend sollen<br />
letzte Rückschlüsse gezogen werden, die ein Urteil über die drei Kategorien zulassen<br />
werden.<br />
In der Luftbildanalyse der <strong>Bahnhof</strong>sumfelder hat sich schnell herausgestellt, dass es<br />
einige Zusammenhänge zwischen der <strong>Stadt</strong>struktur <strong>und</strong> den Bahnhöfen gibt. Parallel<br />
konnte jedoch auch vor Augen geführt werden, dass sich die baulichen Anordnungen um<br />
die Bahnanlagen zwischen den verschiedenen Städten im Allgemeinen nicht gleichen.<br />
Gemeinsamkeiten, die sich ergaben, beziehen sich überwiegend auf den Städtebau auf<br />
der zur Innenstadt bezogenen Seite. Dort besteht eine dichte Blockrandbebauung mit<br />
tiefen Gebäuden, die kleine Innenhöfe aufweisen. Es liegt nahezu ausschließlich eine<br />
geschlossene Bauweise vor. Zwischen den Häusern verlaufen auf den <strong>Bahnhof</strong><br />
zuführende Straßen, die sich so als städtebauliche Achsen darstellen <strong>und</strong> in ihrer<br />
Ausprägung variieren können. Weitere gemeinsame Kennzeichen sind ein zum <strong>Stadt</strong>kern<br />
gewandter <strong>Bahnhof</strong>svorplatz <strong>und</strong> die meist vorhandenen Bahnsteigüberdachungen, die<br />
sich jedoch in ihrer Größe unterscheiden.<br />
Die übrigen in den Tabellen aufgeführten Kriterien können nicht auf alle Städte bezogen<br />
werden. Dennoch gibt es Orte, denen dieselben Kennzeichen zugeordnet werden können.<br />
Sie bilden schließlich die verschiedenen Typen, die im Verlauf der Arbeit ausführlich<br />
beschrieben <strong>und</strong> erläutert wurden. Die erste Kategorie beinhaltet die <strong>Bahnhof</strong>sumfelder<br />
der Kopfbahnhöfe. Bei ihnen befindet sich das Empfangsgebäude stets vor der gradlinig<br />
an die Innenstadt herangeführten Bahntrasse, die sich im <strong>Stadt</strong>bild stark abzeichnet <strong>und</strong><br />
am <strong>Bahnhof</strong> von Verkehrsstraßen umführt wird. In der unmittelbaren Umgebung der<br />
Haltepunkte gleicht sich die Bebauung, so dass selten bauliche Unterschiede erkennbar<br />
sind. Weiträumig dahinter sind jedoch baulich unstrukturierte Bereiche festzustellen. Der<br />
dichtere Besiedlungsraum liegt größtenteils vor dem <strong>Bahnhof</strong>. Die Durchgangsbahnhöfe<br />
besitzen einen im <strong>Stadt</strong>gefüge leicht abzeichnenden Bahnkörper, der an der Station<br />
anschwillt. In den meisten Fällen unterqueren die Straßen die Schienenstränge. Diese<br />
<strong>Bahnhof</strong>sart unterscheidet sich jedoch auch in einigen Merkmalen, so dass die Typen 2<br />
<strong>und</strong> 3 herausgebildet wurden. Zum einen gibt es die Durchgangsbahnhöfe mit einem<br />
seitlich zum Bahnsteig liegenden Empfangsgebäude. Der hinter dem <strong>Bahnhof</strong> befindliche<br />
Bereich ist durch eine deutlich unstrukturierte Bebauung gekennzeichnet. Großräumig ist<br />
zu erkennen, dass sich die dichte Besiedlung vor dem <strong>Bahnhof</strong> erstreckt. Im Gegensatz<br />
dazu haben die Durchgangsbahnhöfe mit einem quer über den Gleisen liegenden bzw.<br />
einem verdeckten Empfangsgebäude oftmals einen zweiten <strong>Bahnhof</strong>svorplatz auf der<br />
dem Zentrum abgewandten Seite. Hinter der Station halten sich die<br />
Entwicklungsunterschiede gering. Der Besiedlungsraum verteilt sich etwa gleichmäßig um<br />
den <strong>Bahnhof</strong>.<br />
Während der Analyse <strong>und</strong> Klassifizierung der einzelnen <strong>Bahnhof</strong>sumfelder ließen sich<br />
mehrere Zusammenhänge zwischen dem Städtebau <strong>und</strong> der <strong>Bahnhof</strong>sanlage<br />
interpretieren. Im Allgemeinen konnte abgeleitet werden, dass die städtebauliche<br />
Betonung der hinter dem <strong>Bahnhof</strong> liegenden Flächen die Zugänglichkeit verbessert,<br />
211
wodurch Impulse für eine Entwicklung dieser <strong>Stadt</strong>gebiete entstehen können. Vor dem<br />
<strong>Bahnhof</strong> wiederum kann durch breite Verkehrsachsen die Verbindung zwischen <strong>Bahnhof</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>zentrum gesichert <strong>und</strong> gestärkt werden. Außerdem spiegelt sich die Bedeutung<br />
des <strong>Bahnhof</strong>s in der Dichte der angrenzenden Bebauung wider. In der weiträumigen<br />
Umgebung war zu erkennen, dass sich die dichte Besiedlungsstruktur an der Ausrichtung<br />
des <strong>Bahnhof</strong>s orientiert. Zusätzlich kann diese Strukturierung auch durch die Bahntrasse<br />
beeinflusst werden, die sich zum Teil als klare Barriere im <strong>Stadt</strong>bild abzeichnet <strong>und</strong> durch<br />
die Vielzahl ihrer Gleisstränge Gebiete abkapselt, die in Folge dessen räumliche<br />
Entwicklungsunterschiede aufweisen. Aus diesen Zusammenhängen wird deutlich, dass<br />
die Bahnanlage des dritten Typs am vorteilhaftesten für eine geordnete <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
ist. Durch die Orientierung zu beiden Seiten des <strong>Bahnhof</strong>s können strukturelle<br />
Entwicklungsunterschiede gehemmt werden. Im Gegensatz dazu kann die im Typ 1<br />
beschriebene <strong>Bahnhof</strong>sanlage der städtischen Entwicklung entgegenstehen. Zum einen<br />
fokussiert sie sich durch die einseitig herangeführte Bahntrasse zu sehr auf den<br />
<strong>Stadt</strong>kern <strong>und</strong> zum anderen entstehen starke, das <strong>Stadt</strong>gefüge beeinträchtigende,<br />
Schneisen. Bei Kategorie 2 sind die Entwicklungsunterschiede weniger dramatisch <strong>und</strong><br />
betreffen vor allem die direkt hinter dem <strong>Bahnhof</strong> liegenden Gebiete, so dass die<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung auch hier erschwert werden kann.<br />
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass das komplexe Themenfeld der <strong>Bahnhof</strong>sumfelder<br />
letztlich nicht nur in drei Kategorien gegliedert werden kann. Letztlich ergibt sich<br />
außerdem die Frage, ob die Bahnentwicklung durch die vorgestellten Sonderformen von<br />
Bahnhöfen an einer Weichenstellung in Europa steht.<br />
212
7. Rolle des <strong>Bahnhof</strong>s<br />
7.1 Image der Bahnhöfe<br />
Betreffend des Themas Bahnhöfe gibt es verschiedene Meinungen, welche überwiegend<br />
positiv sind. So wurde beispielsweise behauptet, dass Bahnhöfe „Vulkane des Lebens”<br />
(Malevitsch 364 ) sind. Andere sind davon überzeugt, dass Bahnhöfe „die schönsten Kirchen<br />
der Welt” (Cendrars 365 ) darstellen. Theophile Gautier 366 hat gesagt, Bahnhöfe seien:<br />
„Paläste der modernen Industrie, in denen sich die Religion des Jahrh<strong>und</strong>erts entfaltet:<br />
die Religion der Eisenbahn. Diese Kathedralen der neuen Menschheit sind die Treffpunkte<br />
der Nationen, das Zentrum, in dem alles zusammenfließt; der Kern gigantischer Sterne<br />
mit Strahlen aus Eisen, die sich bis zum Ende der Welt erstrecken“ 367 .<br />
Das Erscheinungsbild der Bahnhöfe hat sich jedoch während den letzten<br />
h<strong>und</strong>ert<strong>und</strong>fünfzig Jahren stark verändert. Die Ursachen dafür sind eng mit der Weltbzw.<br />
Europageschichte verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> hängen vom vergangen, politischen <strong>und</strong><br />
ökonomischen System ab. Deshalb kann man sagen, dass sich auch das Image der<br />
Bahnhöfe während der letzten Jahrh<strong>und</strong>erte stark verändert hat. Diese Änderung dem<br />
Image lässt sich in drei Phasen aufteilen:<br />
1. Phase: Eisenbahnimperiums (ca. 1840 – 1900)<br />
2. Phase: Bedeutungsverlust der Bahnhöfe als „Zentrum der Welt” (1900 – 1970)<br />
3. Phase: Renaissance der Bahnhöfe (1970 – heute)<br />
7.1.1 Eisenbahnimperien<br />
Die erste Phase begann mit der Erfindung der Eisenbahn <strong>und</strong> endete Anfang des 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts. In dieser Zeit wurden Bahnhöfe durch die Bevölkerung als Drehpunkte<br />
eines Eisenbahnimperiums wahrgenommen, dessen Entfaltung die Entwicklung vieler<br />
Länder stark beeinflusst hat. Die Bahnhöfe hatten daher eine wichtige Rolle in der<br />
Entwicklung des Städtebaus <strong>und</strong> beeinflussten die Veränderung bezüglich der<br />
<strong>Stadt</strong>struktur 368 . Bahnhöfe konnten so das Wachstum von Städten beschleunigen, so<br />
dass sie sogar nachhaltig zu der Entstehung von großen Metropolen beitrugen <strong>und</strong><br />
erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von Städten hatten.<br />
In den neuen Eisenbahnländern entstanden immer mehr Städte aufgr<strong>und</strong> der Errichtung<br />
von Bahnhöfen <strong>und</strong> neuen Verkehrswegen.<br />
Nahe den Schienen haben sich im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert auch viele Unternehmen <strong>und</strong> Fabriken,<br />
Werkstätten <strong>und</strong> Lager angesiedelt. Die Folge waren Gewerbezentren innerhalb der<br />
Städte.<br />
364 Kasimir S. Malevitsch (1878 – 1935) russischer Maler<br />
365 Blaise Cendrars (1887 – 1961) schweizer Schriftsteller <strong>und</strong> Abenteurer<br />
366 Theophile Gautier (1811 – 1872) französischer Schriftsteller<br />
367 Dether, Jean (1981): Die Welt der Bahnhöfe, Verlag: Elefanten- Press, Berlin, S. 6<br />
368 Mehr dazu im Kapitel „Luftbildanalyse von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern“<br />
213
Durch die Aufgabe des <strong>Bahnhof</strong>s, eine Flut von Gütern <strong>und</strong> Menschen von <strong>Stadt</strong> zu <strong>Stadt</strong><br />
transportieren zu können, ist er von Anbeginn ein Hauptartikulationspunkt, um den sich<br />
die moderne <strong>Stadt</strong> entfaltet hat. Diese Aufgaben wurden mittels neuer<br />
Konstruktionssysteme realisiert <strong>und</strong> man erbaute sie mit Optimismus <strong>und</strong> Glauben an<br />
den technologischen Fortschritt.<br />
Die Entstehung eines <strong>Bahnhof</strong>es führte meist dazu, dass an Ort <strong>und</strong> Stelle ein neuer<br />
<strong>Stadt</strong>kern erschaffen wurde, welcher seine Umgebung prägte. So modifizierten Bahnhöfe<br />
auch die Anordnung der Vororte, indem sie neue Schwerpunkte schufen <strong>und</strong> bislang<br />
unbekannte Erscheinungen von Modellen des Städtebaus <strong>und</strong> des Wohnungsbaus<br />
auftauchen ließen, die das Leben der Städter nachdrücklich beeinflussten.<br />
Ein Jahrh<strong>und</strong>ert lang war der <strong>Bahnhof</strong> ein Symbol der Rekorde. Immer wieder wurden<br />
Grenzen neu definiert: Die Züge erreichten immer höhere Geschwindigkeiten, die<br />
Ingenieure wetteiferten untereinander, indem sie immer größere <strong>und</strong> gewagtere<br />
Metallkonstruktionen für die <strong>Bahnhof</strong>shallen konstruierten. Durch die Schnelligkeit <strong>und</strong><br />
die (zeitliche) Reduktion der Entfernung fing die Bevölkerung damit an, in einem neuen<br />
Verhältnis zu Raum <strong>und</strong> Zeit zu leben. Arbeiterfamilien überschritten zum ersten Mal ihre<br />
geographischen Grenzen, welche bisher nur von ihrem Wohnort bis zu dem Standort<br />
ihrer Arbeitsstellen, den Fabriken, verliefen <strong>und</strong> verbrachten ihren Urlaub auch an Orten<br />
außerhalb dieser Grenzen.<br />
In den Großstädten entfalten die Bahnhöfe den Größenwahn der modernen Zeiten, den<br />
Kult der technologischen Leistungen. Der <strong>Bahnhof</strong> wurde in dieser Zeit zu einem Tempel<br />
der Technologie <strong>und</strong> drückte die Rituale eines neuen Kultes aus.<br />
Für die westlichen Mächte bedeutete der <strong>Bahnhof</strong> außerdem die Begeisterung für die<br />
Politik des Imperialismus <strong>und</strong> stellte in diesem Jahrh<strong>und</strong>ert ein Hauptmittel für interne<br />
<strong>und</strong> externe Gebietseroberung dar 369 . Er hatte strategische, monumentale <strong>und</strong><br />
symbolische Bedeutung für die politische Logik, welche wiederum seine Existenz<br />
bedingte. Insbesondere bis Anfang des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts wurden die Bahnhöfe mit einem<br />
verwirrenden Übermaß an imperialistischer Vision erbaut, beispielsweise mit<br />
triumphalistischen, drohenden <strong>und</strong> faschistischen Emblemen. Sie dienten der Erinnerung<br />
an die Größe des zeitgenössischen Reiches der westlichen Mächte <strong>und</strong> die Verherrlichung<br />
ihrer physischen Kraft. Die Bahnhöfe dienten als Repräsentationsobjekt.<br />
369 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_kolejowy#Kszta.C5.82towanie_si.C4.99_formy<br />
„<strong>Bahnhof</strong>“, Punkt 3: Architektur der Bahnhöfe<br />
214
Abb. 70: Das Hauptportal des <strong>Bahnhof</strong>s in Helsinki 1904<br />
Für die Öffentlichkeit wurde die Eisenbahn eines der Symbole für Einigkeit, Begegnung<br />
<strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>schaft der Völker.<br />
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts Bahnhöfe für<br />
Architekten <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>planer eines der bevorzugten Mittel wurde, um der <strong>Stadt</strong> das Bild<br />
feierlicher Monumentalität <strong>und</strong> kraftvoller Zentralität aufzuprägen. Bahnhöfe prägten weit<br />
mehr als ein Jahrh<strong>und</strong>ert die Achsen, um die sich die moderne <strong>Stadt</strong> entwickelte. Für die<br />
Öffentlichkeit, obwohl ein Großteil der Öffentlichkeit Angst vor einem zu gewagten<br />
Sprung in die Zukunft <strong>und</strong> der Neuheiten hatte, dienten sie als Symbol der Rekorde <strong>und</strong><br />
drückten das Vertrauen an den technologischen Fortschritt, sowie den Blick in die<br />
Zukunft aus.<br />
7.1.2 Bedeutungsverlust von der Bahnhöfe als „Zentrum der Welt”<br />
Die darauf folgende Phase der Imageentwicklung nimmt den Zeitabschnitt zwischen dem<br />
Anfang des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts bis in die 1970er Jahre ein. In dieser Zeit konnte man das<br />
sinkende Ansehen der Bahnhöfe beobachten.<br />
Schon zu Anfang wurden Bahnhöfe aus strategischen Gründen an der Peripherie der<br />
Städte erbaut. Die Züge konnten nicht den Kern der <strong>Stadt</strong> durchfahren, weil dies eine<br />
Öffnung der Schutzfestung zur Folge gehabt hätte <strong>und</strong> vermieden werden sollte. Das<br />
Militär hat diese neuen Transportmittel schnell als strategischen Punkt erkannt <strong>und</strong> es<br />
wurden zahlreiche Anordnungen angefertigt, die der Organisation <strong>und</strong> Verteidigung der<br />
Bahnhöfe im Kriegsfall vorgeben sollten. Bahnhöfe waren nun nicht mehr Orte der<br />
Begegnung, sondern wurden zu Orten der Kriegsausbrüche. „Die Völker waren nicht<br />
vereint, sondern standen sich als Feinde gegenüber. An den Bahnhöfen sah man die<br />
traurige Masse der Opfer des Krieges, die ihre Todesfahrt in die Konzentrationslager<br />
angefangen haben“ 370 . Die Betrachtungsweise der Bahnhöfe in der Gesellschaft wandelte<br />
sich. Sie wurden nun als Orte angesehen, wo sich Truppen versammeln <strong>und</strong> von wo<br />
Kriegsverfolgte in Konzentrationslager <strong>und</strong> das Militär an die Fronten verteilt wurde.<br />
370 Parissien, Steven (1997), Bahnhöfe der Welt, Sation to station , Verlag: Knesebeck, München, S. 10<br />
215
Im Jahre 1913 wurde von einer gemischten Autorität (Militär <strong>und</strong> Eisenbahngestellte)<br />
eine besondere Regelung der Eisenbahn zu rein strategischen Zwecken entwickelt <strong>und</strong> es<br />
erfolgte eine Enteilung in verschiedene Formen von Bahnhöfen: Hauptbahnhöfe,<br />
Mobilisierungsbahnhöfe, Lagerbahnhöfe, Evakuierungsbahnhöfe <strong>und</strong> Reisebahnhöfe für<br />
Soldaten, die Urlaub machen wollten. Die Hauptbahnhöfe im Krieg von 1914 waren so<br />
etwas wie Nervenzentren.<br />
Während des Zweites Weltkriegs hat sich die Rolle der Bahnhöfe als Operationsfeld <strong>und</strong><br />
als Waffenkraft noch vergrößert. Sie wurden vorzugsweise von den gegnerischen<br />
Truppen aus der Luft bombardiert, um einen wichtigen Teil der Infrastruktur zu<br />
zerstören. Die Bevölkerung fühlte sich daher an den Bahnhöfen unsicher <strong>und</strong> nahm sie<br />
als besonders gefährliche Orte wahr, welche aus diesem Gr<strong>und</strong> von ihnen gemieden<br />
wurden. Nach dem Kriegsende wurden die Bahnhöfe von zwei Nutzergruppen in Anspruch<br />
genommen: Reisende, die den <strong>Bahnhof</strong>steil des Quersteigs (zwischen Durchgangsbereich<br />
<strong>und</strong> dem Bahngleis) einnahmen, <strong>und</strong> Nichtreisende (Kriegsheimkehrer <strong>und</strong> Obdachlose)<br />
welche sich meist in der Eingangshalle <strong>und</strong> in der Übergangszone aufhielten. Es<br />
entstanden meist unbewusste territoriale Verhaltenmuster, welche die Nutzung <strong>und</strong> die<br />
Wahrnehmung der Bahnhöfe beeinflussten. Sie bildeten entweder eine Zuflucht für die<br />
Obdachlosen, Drogensüchtigen <strong>und</strong> Alkoholiker oder wurden als Zentren des<br />
Schwarzmarktes <strong>und</strong> des Vandalismus wahrgenommen371 . Im Gegensatz zu der ersten<br />
Phase, hat sich die Wahrnehmung der Bahnhöfe als der Urheber der <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
gegenüber der zweiten Phase stark verändert. In dieser Zeit wurden Bahnlinien <strong>und</strong><br />
Bahnhöhe als Orte betrachtet, die schlechten Einfluss auf die <strong>Stadt</strong>struktur hatten <strong>und</strong><br />
teilweise Gr<strong>und</strong> dafür waren, dass ganze <strong>Stadt</strong>landschaften verwüstet wurden. Diese<br />
Verwüstungen provozierten Proteste <strong>und</strong> Polemik bei der Bevölkerung <strong>und</strong> machten aus<br />
den Bahnhöfen ein Streitforum für einen „demokratischen Städtebau” 372 . Neben den<br />
politischen Zielen, denen die Bahnhöfe zum Teil dienten oder zum Opfer fielen, waren sie<br />
durch ihre Lage <strong>und</strong> ihre Reichweite die idealen Plätze für Protestäußerungen <strong>und</strong> für die<br />
ideologische Propaganda.<br />
Abb. 710: Ein Vorstadtbahnhof, Sarcelles, Frankreich<br />
371 http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin_Zoologischer_Garten, „Das Bild der <strong>Bahnhof</strong> im 70- 80 Jahren“<br />
372 Parissien, Steven (1997), Bahnhöfe der Welt, Sation to station , Verlag: Knesebeck, München, S. 60<br />
216
Außerdem verloren die Bahnhöfe ihre ursprüngliche Rolle als Treffpunkte. Durch die<br />
monumentalen Fassaden <strong>und</strong> den entfremdenden Formen der Großstadtbahnhöfe,<br />
verwandelten sie sich durch den Pendelverkehr in Umsteigestellen zwischen Arbeitstätten<br />
<strong>und</strong> Wohnung.<br />
Seit den dreißiger Jahren hat dieser hochtrabende Triumphalismus mit der wachsenden<br />
Konkurrenz der anderen Transportmittel auf den Straßen <strong>und</strong> den Luftwegen seine<br />
Existenzberechtigung verloren 373 <strong>und</strong> der <strong>Bahnhof</strong> entwickelte sich rasch zu einem<br />
neutralen Ort zurück. Die daraus entstandenen relativ leeren Räume wurden nun nur<br />
noch von den Bevölkerungsteilen genutzt, die sich kein Auto leisten konnten. Der<br />
Siegeszug des Automobils machte die Eisenbahn überflüssig <strong>und</strong> ein großer Teil der<br />
Reisenden brauchte sie nicht mehr. Zwischen 1936 <strong>und</strong> 1976 wurden viele<br />
Eisenbahnlinien stillgelegt – nicht nur in Deutschland: so wurden beispielsweise 3539<br />
Bahnhöfe der Britischen Nationalen Eisenbahngesellschaft nicht mehr gebraucht. In allen<br />
westlichen Ländern Europas war dieses Phänomen recht häufig zu beobachten. Der<br />
Gr<strong>und</strong> dafür war einerseits, dass viele Verbindungswege ökonomisch nicht mehr rentabel<br />
erschienen, <strong>und</strong> andererseits, weil eine Reorganisation des Eisenbahnnetzes auch eine<br />
neue Fächerung der festen Einrichtung verlangt hätte <strong>und</strong> neukonstruierte Bahnhöfe die<br />
alten von ihren Funktionen befreiten. Hier erschien das Betätigungsfeld für die neuen<br />
Konzeptionen des Wachstum, welche sich durch den Bau zusammenhängender <strong>und</strong><br />
autonomer <strong>Stadt</strong>landschaften auszeichneten. Projekte dieser Art, die im 19. <strong>und</strong> zu<br />
Beginn des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts durch die Urbanisten vorgeschlagen wurden, stießen im<br />
Zeitalter der industriellen Revolution auf einstimmigen Widerspruch. Es wurden die<br />
falschen Beschlüsse gefasst <strong>und</strong> es ergaben sich spekulative, kurzfristige <strong>und</strong> unrentable<br />
Maßnahmen aus ihnen. Daraus folgten die immense Ausdehnung der modernen Städte<br />
<strong>und</strong> die Abtrennung der geschaffenen Vorstädte durch die Eisenbahnlinien. „Anstelle von<br />
ihnen wurden Entscheidungen getroffen, die im Mittelpunkt nur das Interesse einer<br />
Minorität vertreten <strong>und</strong> die Platz für Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Bodenspekulationen gemacht haben.<br />
Spekulationsinteresse in Form von Immobilienprojekten, die sich um die Bahnhöfe herum<br />
ausbreiten, äußert sich immer arroganter <strong>und</strong> brutaler in ihrem sozialen <strong>und</strong><br />
städtebaulichen Kontext. Daraus resultiert auch das Chaos, in dem sich das rasende<br />
Wachstum der völlig zerrissenen <strong>und</strong> unterversorgten Vorstädte vollzogen hat, die von<br />
einem immer weiter entfernten <strong>Stadt</strong>zentrum abhängig waren. Hier zeigt sich die<br />
strukturelle Unfähigkeit der Industriegesellschaft synchron <strong>und</strong> harmonisch zwei<br />
Entwicklungen zu verbinden, die sich eigentlich ergänzen sollten“ 374 .<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bahnhöfe im Laufe der beiden Weltkriege<br />
<strong>und</strong> im Hinblick auf konkurrierende Transportmittel ihr Bild als triumphale Gebäude<br />
verloren. Obwohl sie noch lange Zeit der funktionelle Drehpunkt der Städte geblieben<br />
sind, waren sie <strong>und</strong> ihre Abbildung nicht mehr das Symbol des technologischen<br />
Fortschritts. Im Gegenteil, sie waren der Ausdruck einer gewissen Nostalgie gegenüber<br />
einer fernen, idealisierten Vergangenheit.<br />
373 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_kolejowy<br />
„Der Regreß des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> seines Architektur”<br />
374 Parissien, Steven (1997), Bahnhöfe der Welt, Sation to station , Verlag: Knesebeck, München, S. 99<br />
217
7.1.3 Renaissance der Bahnhöfe<br />
In den 1980ern Jahren fing die neure Ära für die Eisenbahn an – das Wiederaufleben der<br />
Bahnhöfe. Die noch vor einigen Jahren praktizierten Methoden hatten unweigerlich zu<br />
einer Zerstörung der verlassenen Gebäude geführt, um Platz für Immobilienspekulation<br />
zu schaffen. Aber neue Kriterien haben heute diese primäre Logik verdrängt <strong>und</strong> haben<br />
eine neue Denkweise geschaffen. Es stellte sich heraus, dass der <strong>Bahnhof</strong> eines der<br />
wenigen öffentlichen Gebäude war, das aus der industriellen Revolution hervorgegangen<br />
war, die mehrjährige Veränderungen unserer westlichen Gesellschaft zeigt. Deshalb kam<br />
es während der ökonomischen Euphorie der Jahre 1970 bis 1980 zu einem wachsenden<br />
Bewusstsein der bedeutsamen Rolle der Bahnhöfe in der <strong>Stadt</strong>entwicklung. 375<br />
Die großen Bahnhöfe im Herz der europäischen Großstädte wurden wieder zum<br />
Mittelpunkt ehrgeiziger Programme der <strong>Stadt</strong>bilderneuerung. Seit einem Jahrh<strong>und</strong>ert sind<br />
sie ein fester Bestandteil des städtebaulichen Netzwerks <strong>und</strong> die Bahngelände hinter den<br />
Bahnhöfen gelten nun als große Platzreserven, deren Möglichkeiten erst in jüngster Zeit<br />
entdeckt worden sind. Diese Gelände sind eigentlich die einzigen in der <strong>Stadt</strong>, die noch<br />
beachtliche zusammenhängende unbebaute Reserven bilden, die wenig ausgenutzt<br />
wurden <strong>und</strong> meistens öffentliches Eigentum sind. Sie haben fast die letzte Möglichkeit in<br />
der Geschichte des Städtebaus geboten, große Sanierungs- <strong>und</strong> Ausbauoperationen zu<br />
beginnen. Dies vermochte das Gleichgewicht in den Städten wiederzuerlangen <strong>und</strong> das<br />
Absterben der Zentren zu unterbinden.<br />
Durch die neuen Trassen wurden auch viele Dörfer <strong>und</strong> die Vorstädte mit dem<br />
<strong>Stadt</strong>zentrum verb<strong>und</strong>en. In dem <strong>Stadt</strong>bild wurden auch die stillgelegten Bahnhöfe <strong>und</strong><br />
Eisenbahnbauten <strong>und</strong> deren Potential bemerkt. Ihre Berufung zum Gravitationszentrum<br />
des städtischen Raums bestimmt den <strong>Bahnhof</strong> zum neuen Ort der Kommunikation,<br />
großzügig geplant <strong>und</strong> meisterlich ausgeführt boten seine Gebäude <strong>und</strong> Hallen<br />
beachtlichen Raum, der die Massen anzog. Bis heute sind sie zu Museen oder Märkten, zu<br />
Sport- Kultur- oder Handelszentrum, zu Theatern oder botanischen Gärten<br />
umfunktioniert worden.<br />
Im Bewusstsein der Völker hat sich der <strong>Bahnhof</strong> wieder als „Eisenbahndynamo“ gezeigt,<br />
der seit h<strong>und</strong>ertfünfzig Jahren als lebendig gebliebener öffentlicher Raum erscheint.<br />
Die neuen Potentiale der Eisenbahn wurden nicht nur vom Staat erkannt, seit dem<br />
Beginn des 20. Jahrsh<strong>und</strong>erts haben auch die Medien die wachsenden Möglichkeiten<br />
reflektiert, die sich neuerdings den Benutzern dieses neuen – alten - Transportmittels<br />
geboten hat.<br />
Für die Bahnhöfe folgte nun eine neue Ära, die früher nicht bekannt war. Man kann nun<br />
von der „Neuzeit der Bahnhöfe” 376 sprechen. In dem Augenblick, wo in den meisten<br />
Ländern die wichtigste Phase der Modernisierung des Bahnverkehrs <strong>und</strong> eine Erweiterung<br />
des Schienennetzes vorgenommen wurden, erfolgten auch neue Überlegungen für eine<br />
Verbindung von Flugzeug, Straßen <strong>und</strong> Schienen. Die Eisenbahn ist nun nicht mehr nur<br />
375 Parissien, Steven (1997), Bahnhöfe der Welt, Sation to station , Verlag: Knesebeck, München<br />
376 Dether, Jean (1981): Die Welt der Bahnhöfe, Verlag: Elefanten- Press, Berlin, S. 10.<br />
218
ein Transportmittel, sondern sie erscheint, verkörpert durch die Bahnhöfe, als ein<br />
Baustein des globalen Öffentlichen (Fern-)Verkehrs.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die große Fläche an Bahngeländen in den<br />
Städten meist die letzten Reserven an Baugelände darstellen, auf den man noch große<br />
städtebauliche Projekte planen könnte, ohne die Zerstörung von Gebäuden <strong>und</strong> einen zu<br />
enormen Eingriff in die Natur zu verursachen, wenn die Bahngelände nicht (auf Gr<strong>und</strong><br />
der jahrelangen „Missachtung“) Biotop-Status erreicht haben. Diese Gebäude sollen den<br />
neuen Anforderungen gerecht werden, die durch die bestimmte Gruppe der Spezialisten<br />
erarbeitet werden sollen.<br />
7.1.4 Fazit<br />
Beobachtet man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, so kann man leicht feststellen,<br />
dass sich Image der Bahnhöfe im Bewusstsein der Bevölkerung verändert hat <strong>und</strong> sie<br />
wird sich weiter verändern. Der <strong>Bahnhof</strong> hat in den letzten 150 Jahren seiner Existenz<br />
Höhen als auch Tiefen erlebt. Innerhalb dieser Jahre war die Bahn eine<br />
Verbindungsmöglichkeit des Volks, die durch die <strong>Bahnhof</strong>shalle, Regeln, Modelle <strong>und</strong><br />
Standards definiert wurde 377 . Heutzutage soll ein <strong>Bahnhof</strong>sneubau nicht mehr nur der<br />
Image der einzelnen Nationen sondern auch die europäische Image widerspiegeln. „Das<br />
soll nicht durch die Definition der Architekturnormen verlaufen, sondern durch die<br />
Festlegung der Dienstleistungsstandards“ 378 .<br />
Dabei sollen die vielfältigen Lokalinstrumente nicht vernachlässigt werden. Die Bahnhöfe<br />
müssen „zum Mobilitätszentrum sowie zum zentralen Informationspunkt für alle<br />
Verkehrsmittel, die ein gemeinsames Kommunikationsnetz bilden, werden“ 379 . Die<br />
Europäische Kommission betont dabei, „die Bahnhöfe sollen vor allem die mit der<br />
ursprünglichen Rolle verb<strong>und</strong>ene Funktionen erfüllen, <strong>und</strong> zwar mit dem Transport. Die<br />
Bahnhöfe sollen sich eher nicht in anderen Tätigkeitsbereichen engagieren <strong>und</strong> sie sollen<br />
nicht in die Handels- <strong>und</strong> Konsumzentrum verwandelt werden“ 380 . Man muss danach<br />
streben, die Bahnhöfe im gegenwärtigen Bewusstsein der Menschen bzw. der K<strong>und</strong>en<br />
nicht als ein Symbol des Handels sondern als das Bahntransportsymbol da.<br />
7.2 <strong>Bahnhof</strong> in der Kunst<br />
Seit der Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts hat die Bahn eine Fülle von künstlerischen<br />
Expressionen in Dichtung <strong>und</strong> Malerei angeregt. Es hat Gedichte <strong>und</strong> Gemälde über<br />
Geschwindigkeit <strong>und</strong> Macht, Motoren <strong>und</strong> Wagen, Express- <strong>und</strong> Regionalverkehr, Arbeit<br />
<strong>und</strong> Reiseverkehr, Wracks <strong>und</strong> Katastrophen, Reisen <strong>und</strong> Ankünfte, Landschaften <strong>und</strong><br />
Bestimmungsorte gegeben. Bahnstationen wurden in der Kunst völlig verherrlicht <strong>und</strong><br />
gefeiert. Im weiteren Sinne fallen künstlerische Interpretationen von Bahnhöfen in zwei<br />
Gruppen. Die erste Gruppe ist gegenständlich <strong>und</strong> erzählend <strong>und</strong> sieht den <strong>Bahnhof</strong> als<br />
eine Bühne, auf der sich Dramen abspielen. Dies ist gr<strong>und</strong>sätzlich das viktorianische Bild.<br />
377<br />
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:088:0009:01:PL:HTML<br />
Luemut der Europäichen Komitee in der Sache : "Rolle der Bahnhöfe in den Ballungsgebieten <strong>und</strong> in den<br />
Städten der Europäischen Union“.<br />
378<br />
Ebenda.<br />
379<br />
Ebenda.<br />
380<br />
Ebenda.<br />
219
Die zweite Gruppe ist symbolisch <strong>und</strong> atmosphärisch <strong>und</strong> beinhaltet Natur, Essenz <strong>und</strong><br />
Wirkung des <strong>Bahnhof</strong>s. In vielen Fällen ist dies eine nachviktorianische Sicht, das Produkt<br />
des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts. Anfänglich wurde die Illustration der Bahn durch die Arbeit von<br />
Skizzenzeichnern <strong>und</strong> Graveuren eher als von Malern dominiert. Man schätzt, dass etwa<br />
2000 unterschiedliche Bahneindrücke in den zwanzig Jahren nach 1830, hauptsächlich in<br />
Gestalt von Steindrucken veröffentlicht wurden. Etwa 200 von ihnen wurden in Buchform<br />
veröffentlicht. Viele von diesen Kunstwerken wurden direkt von den Bahnunternehmen in<br />
Auftrag gegeben, um ein positives <strong>und</strong> attraktives Bild von Zugreisen zu fördern <strong>und</strong> die<br />
vielen Ängste zu verjagen, die die Leute vor der neuen Art der Fortbewegung hatten.<br />
Ohne Ausnahme betonen diese Eindrücke die von den Bahnbauunternehmern erreichten<br />
Technikw<strong>und</strong>er <strong>und</strong> heben die Symmetrie <strong>und</strong> die formale Ordnung des<br />
Bahnverkehrssystems hervor. Die Bahn wird Teil der Landschaft, ohne sie brutal zu<br />
behandeln, <strong>und</strong> wird als ein Gegenstand von Schönheit gesehen 381 .<br />
Abb. 72: S. Kelper: Liverpool Lime Street<br />
Quelle: http://www.scienceandsociety.co.uk<br />
<strong>Bahnhof</strong>seinrichtungen wurden fast von Anfang an eingeschlossen. I. Shaws Arbeit<br />
schließt eine Zeichnung des <strong>Bahnhof</strong>s: Manchester's Liverpool Road Station ein, in der<br />
unter einem scheunenartigen Dach, fröhliche <strong>und</strong> aufgeregte Passagiere herumlaufen, die<br />
ihr Gepäck greifen. Sie versuchen, den Überblick zu behalten, <strong>und</strong> erwarten die Ankunft<br />
des Zuges. Klassische Eleganz ist der Gr<strong>und</strong>ton von den Gebäuden in dem Bild von T. T.<br />
Bury Bild von London Euston (1837), S. Kelper: Liverpool Lime Street (1836), <strong>und</strong> J. C.<br />
Bourne: Tunbridge Wells-Station (1845). Die reine dominierende Dynamik des<br />
Zugschuppens wird von Tait: Manchester Victoria (1845), <strong>und</strong> von Bourne: GWR-Station,<br />
Bath (1846) <strong>und</strong> seinem herrlichen Steindruck des GWR-Güterbahnhofs, Bristol<br />
Templemeads, hervorgehoben. In dem Bild werden herbstzeitliche Farben thematisiert.<br />
Mit den Farben braun <strong>und</strong> creme betont er die Form <strong>und</strong> die Linie vom Zugschuppendach,<br />
das die Szene, in einer Zusammensetzung einrahmt, die für die Gemälde standardmäßig<br />
werden sollte <strong>und</strong> im Laufe der Jahre fotografiert wurde. Die Symmetrie eines<br />
Technikkonstrukts wird von dem Künstler besungen, der seine reine visuelle Schönheit<br />
darstellt. Die Bahnführer, wie Osbornes London- <strong>und</strong> Birmingham-Bahn-Führer (1840)<br />
<strong>und</strong> George Measoms Illustrated Guide to the Great Western Railway (1852),<br />
381 Richards, MacKenzie, 1986, The railway station: a social history.<br />
220
enthalten eine Fülle von <strong>Bahnhof</strong>sgravuren. Dem Beobachter werden die sich<br />
verändernden Stile von <strong>Bahnhof</strong>sarchitektur näher gebracht 382 .<br />
Von der Mitte des Jahrh<strong>und</strong>erts ist es nicht so viel die Einfachheit von Form <strong>und</strong> Linie als<br />
die Komplexität vom Leben unter den Plattformmarkisen. Die nicht so bekannten<br />
Arbeiten von fünfzehn Steindrucken von der London <strong>und</strong> Nord-West Bahn von A. F. Tait<br />
(1848) schließen Szenen von Aktivitäten der Bahnhöfe Crewe <strong>und</strong> Edgehill ein.<br />
In den Vereinigten Staaten wurde die Eisenbahn als das Symbol für Fortschritt, für<br />
Finanz- <strong>und</strong> Industriemacht <strong>und</strong> nationaler Expansion begrüßt. Sie wurde als<br />
Wahrzeichen der Moderne für Bewegung <strong>und</strong> Macht des Kontinents gesehen. Im<br />
Gegensatz zu Europa bekam die Bahn in Amerika ihren künstlerischen Ausdruck nicht in<br />
ernsten Romanen, Bildern <strong>und</strong> Theaterstücken, sondern in der populären Kultur – in<br />
Melodramen, <strong>und</strong> Jugendfiktionen. In der Kunst war es in Drucken <strong>und</strong><br />
Zeitschriftillustrationen eher als die Malerei, die dazu führte, dass die Bahn <strong>und</strong> der<br />
<strong>Bahnhof</strong> vertraute Blickpunkte wurden. Die Maler konzentrierten sich auf Landschaft <strong>und</strong><br />
Natur, selten auf die Institutionen der modernen Welt. Die anschaulichen Gemälde von<br />
Currier <strong>und</strong> Ives, mit ihren Gr<strong>und</strong>farben <strong>und</strong> mutigen Linien, drücken den Überschwang<br />
des Bahnzeitalters aus. Eine Ausnahme von der allgemeinen Umgehung von der Bahn<br />
durch ernste Malern ist Edward Lamson Henry: The 9.45 Accommodation Stanford<br />
Connecticut (1867). Der Landhausstil-<strong>Bahnhof</strong> dominiert das Zentrum von der Szene -<br />
eine Reihe von Waggons, Wagen <strong>und</strong> Bussen. Die Passagiere haben vor, in den<br />
wartenden Zug einzusteigen. Das Gemälde zeigt die Wichtigkeit der Station, ihre<br />
Gemeinschaftswirkung <strong>und</strong> ihre symbolische Rolle als lokaler Vorposten in einem<br />
Fernkommunikationssystem 383 .<br />
Gegen Ende des Jahrh<strong>und</strong>erts gab es allerdings eine Änderung, die im Interesse einer<br />
kleinen Gruppe der Elite lag. Sie war Teil eines Trends gegen den gesellschaftlichen<br />
Realismus, der eine künstlerische Reflexion des Aufstiegs des Sozialismus war - der<br />
Zunahme an zwischenmenschlichen Beziehungen <strong>und</strong> der Studien über Armut <strong>und</strong><br />
Entbehrung. In den 1870er Jahren arbeitete in Großbritannien eine Gruppe junger Maler<br />
für das illustrierte wöchentliche Papier Die Graphik. Die Künstler waren sozial engagiert<br />
<strong>und</strong> interessierten sich für gesellschaftliche Prozesse. Einer der bemerkenswertesten<br />
Maler von ihnen ist Frank Holl. Einige von seinen Graphiken <strong>und</strong> Zeichnungen wurden in<br />
Malereien umgewandelt. Anfänglich betitelt als "Leaving Home", später in "A Seat in a<br />
Railway Station-Third Class" umbenannt. Es entsteht ein Flair von Melancholie <strong>und</strong><br />
Selbstbeobachtung in der Szene, die in einem düsteren drittklassigen Wartesaal<br />
stattfindet, in dem ein alter Mann auf einer Bank sitzt <strong>und</strong> in Träumereien versunken ist.<br />
Man erkennt eine Frau der Arbeiterklasse, die Abschied von ihrem Soldatenehemann<br />
nimmt <strong>und</strong> eine junge, gut gekleidete, allein stehende Frau mit niedergeschlagenen<br />
Augen 384 .<br />
Maler auf dem europäischen Festland begannen sich mit dem gleichen Thema zu<br />
befassen. Des Spaniers Joaquín Sorolla y Bastida "The Railway Waiting Room" (1895)<br />
zeigt vier junge, schlafende Frauen in einer Ecke in einem einfachen <strong>und</strong> freudlosen<br />
382 Richards, MacKenzie, 1986, The railway station: a social history<br />
383 Załuski, 2006, Dworzec kolejowy w strukturze miasta.<br />
384 Binney, 1984, Great railway station of Europe.<br />
221
Raum. Gegenüber von ihnen befindet sich eine hagere, todmüde, schwarz gekleidete alte<br />
Frau, die ein Gepäckstück anschaut, das am Boden vor der Bank liegt. Das Bild<br />
veranschaulicht die reisende Arbeiterklasse. Ein anderer düsterer Wartesaal wird in Luigi<br />
Selvaticos Morgen-Abfahrt (1899) gezeigt. Das Gemälde enthält zwei Figuren, die<br />
voneinander getrennt in der Leere isoliert sind. Eine Frau, die ihr Gesicht in einem<br />
Taschentuch vergräbt <strong>und</strong> ein Mann, der dem Betrachter seinen Rücken zuwendet. Er<br />
lässt seine Schultern verzweifelt hängen.<br />
In den verschiedenen Stilen wurden überwiegend die Außenansichten der Bahnhöfe<br />
dargestellt. Die romantischen Architekturstile der bedeutenden Bahnhöfe des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts ließen sich ideal visuell dramatisieren. Die anonymen Gemälde, die in der<br />
Mitte des Jahrh<strong>und</strong>erts entstanden, zeigen unter anderem den <strong>Bahnhof</strong> King's Cross<br />
Station in London. Er hat eine starke Ziegelsteinfassade, Doppelfenster <strong>und</strong> einen<br />
zentralen Uhrturm. Ein weiterer <strong>Bahnhof</strong> ist der Gare de I'Est in Paris, der einen<br />
Stirnsäulengang besitzt. Beide zeigen im Zentrum eine große Menge von Taxis, Gepäck<br />
<strong>und</strong> Passagieren. Axel Hermann Haigs Aquarelle von der Victoria zeigt Bombay im Jahre<br />
1878. Das Kunstwerk ist kein Ausdruck von Propaganda. Es zeigt in einer angemessenen<br />
Weise die ehrfürchtige Pracht des großartigen, kunstvollen <strong>Bahnhof</strong>s, vor dem einige<br />
Zugreisende stehen. Der <strong>Bahnhof</strong> wird als orientalischer Tempel abgebildet. Es handelt<br />
sich um eine Dekorativeinstellung für die Anbetung des Gottes - Dampf. Es ist die<br />
späteste Ergänzung zum Pantheon des Subkontinents <strong>und</strong> sollte das Gesicht vom<br />
britischen Indien verändern.<br />
Das bedeutendste Gemälde ist von John O'Connor "St. Pancras Station, seen from<br />
Pentonville Road" (1884). Es zeigt eine Probe der überschwänglichsten Ausdruckskraft<br />
an viktorianischer Architekturvorstellung. Die Leinwand stellt die Gesinnung des<br />
viktorianischen Zeitalters dar. Im Vordergr<strong>und</strong> in der unteren Hälfte der Leinwand sind<br />
die geschäftigen Straßen der bedeutenden Metropole abgebildet. Es ist die Nabe des<br />
mächtigsten Reiches, das die Welt jemals gesehen hat. Zu erkennen sind offene<br />
Pferdebusse, Kinder, H<strong>und</strong>e, Arbeiter - die weltliche, energetische Alltagsrealität.<br />
Jeder Krieg hat seine <strong>Bahnhof</strong>smalerei erzeugt <strong>und</strong> damit einen visuellen Ausdruck von<br />
den Emotionen der Künstler hinterlassen. James Collinsons Return to the Front (1855)<br />
zeigt einen sich aus einem Wagon lehnenden Soldaten, der Abschied von seiner Ehefrau<br />
nimmt. Er wurde zur Krim zurück beordert. Die Garde hinter ihnen schwenkt eine grüne<br />
Fahne. Diese Posen <strong>und</strong> Szenen wurden vielmal wiederholt. George Harcout´s stellte<br />
Goodbye das 3. Bataillon, die Grenadiers Waterloo für den Krieg verlassend dar. Im<br />
Hintergr<strong>und</strong> von winkenden Soldaten werden einige Vignetten hervorgehoben. Im<br />
Zentrum des Bildes befindet sich ein küssendes Paar (?). Ein Vater verabschiedet seinen<br />
Sohn, neben dem eine Mutter mit einem Baby steht. In R. Jack's Return to the Front<br />
(1917) kommen schottische <strong>und</strong> englische Soldaten über den Bahnsteig zurück. Das<br />
Gemälde von William Robert: Soldiers At Train stellt eine ähnliche Szene des II.<br />
Weltkriegs dar, nämlich einen Bahnsteig mit Soldaten <strong>und</strong> Seemännern. Sie rauchen,<br />
trinken aus ihren Tassen Tee <strong>und</strong> essen. Die Gesichter <strong>und</strong> die Uniformen ändern sich,<br />
aber die Emotionen bleiben die gleichen. Die Folge von diesen Szenen ist die tragische<br />
Rückkehr. Eine umfangreiche Zusammenfassung von der Rolle des <strong>Bahnhof</strong>s im Krieg ist<br />
in einem der zwei Gemälde von Helen McKie thematisiert worden - die H<strong>und</strong>ertjahrfeier<br />
von Waterloo Station (1948). Die Leinwände stellen Waterloo gleichzeitig in der Kriegszeit<br />
222
<strong>und</strong> in der Friedenszeit aus der gleichen Perspektive im Jahr 1842 dar. Das<br />
Kriegszeitgemälde veranschaulicht das abgedunkelte <strong>Bahnhof</strong>sdach <strong>und</strong> das Grün der<br />
Südbahn-Lokomotiven. Man kann Soldaten <strong>und</strong> Matrosen sehen. Sie erfüllen ihre Pflicht<br />
<strong>und</strong> warten auf ihren Abschied. Sie treten in verschiedenen Gruppen <strong>und</strong> Kombinationen<br />
zur Abreise an. Henry Marvell Carr: A Railway Terminal (1941) erstellte ein<br />
impressionistisches Bild, auf dem das <strong>Bahnhof</strong>sinnere in der Kriegszeit zu erkennen ist 385 .<br />
In Frankreich sorgte die Station vor allem unter den Impressionisten für Aufregung. Sie<br />
waren Teil einer modernistischen Bewegung in der Kunst, die darauf abzielte, die<br />
Atmosphäre vom gegenwärtigen Tag <strong>und</strong> die Szenen vom Alltag festzuhalten. Seit 1870<br />
waren Stationen ein annehmbares Thema für hohe Kunst.<br />
Abb. 73: Claude Monet: Gare Saint Lazare<br />
Die Impressionisten schätzten<br />
die Station nicht so sehr für das<br />
Drama <strong>und</strong> den Zwischenfall. Der<br />
britische Maler faszinierte durch<br />
die objektiven <strong>und</strong> visuellen<br />
Wirkungen <strong>und</strong> durch<br />
atmosphärische Beobachtungen.<br />
Edouard Manet: Gare Saint -<br />
Lazare (1873) zeigt eine Mutter<br />
<strong>und</strong> ihr Kind vor einem Geländer.<br />
mit sich hinauf von hinten<br />
bauschendem Rauch <strong>und</strong> unter<br />
ihnen dar, wo die Station liegt,<br />
unbeachtet. Claude Monet<br />
befasste sich mit dem <strong>Bahnhof</strong><br />
ausführlicher. Er schuf 1877<br />
Quelle: http://eduseek.interklasa.pl<br />
berühmte Kunstwerke, so dass<br />
sieben Gemälde entstanden, in denen er die Station als ein Objekt für die Studie von<br />
Licht <strong>und</strong> Schatten sowie Rauch <strong>und</strong> Form betrachtet. Es entsteht eine dunstige<br />
Darstellung der <strong>Bahnhof</strong>satmosphäre.<br />
Im zwanzigsten Jahrh<strong>und</strong>ert sahen europäische Künstler den <strong>Bahnhof</strong> mehr als Symbolik<br />
<strong>und</strong> Abstraktion. Für Futuristen waren sie, im Gegensatz zu den Impressionisten, vor<br />
allem Teil des Neuen <strong>und</strong> der Gegenwart. Der in Italien entstandene Futurismus hatte<br />
sich zum Ziel gesetzt, die moderne Welt widerzuspiegeln. Er behandelte Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Technologie <strong>und</strong> war mutig, fiebrig, abenteuerlich, gewaltsam, innovativ <strong>und</strong> mit<br />
gutem Geschmack <strong>und</strong> Harmonie versehen. Sie sahen die Bahn als eine der Urquellen<br />
des Lärms im modernen Leben <strong>und</strong> als ein Symbol der Beschleunigung von Leben.<br />
Außerdem verbanden sie mit dem <strong>Bahnhof</strong> den Hass auf Ruhe, die Furcht vor<br />
Langsamkeit, die Liebe des Neuen, die größere Freiheit, das Reisen, die Energie, die<br />
Bewegung <strong>und</strong> die mechanische Macht. Gino Severinis Suburban Train arriving at Paris<br />
(1915) versucht, die Natur der Geschwindigkeit einzufangen.<br />
385 Dethier,1981, Die Welt der Bahnhöfe, Le temps des gares.<br />
223
Abb. 74: Gino Severinis: Suburban Train arriving at Paris<br />
Quelle: http://www.poster.de/<br />
Die Kubisten konzentrieren sich auf ein Objekt <strong>und</strong> seine wesentliche Natur. Sie<br />
verstehen den Bestand eher als eine oberflächliche Erscheinung. Fernand Legers Die<br />
Station (1923) zeigt den <strong>Bahnhof</strong> als geometrisches Konstrukt mit Blöcken, Linien <strong>und</strong><br />
Formen.<br />
Es ist in der deutschen Malerei der 1920er nicht schwer, die Vorstellung der totalitären<br />
Gesellschaft zu erkennen, die im folgenden Jahrzehnt entstehen sollte. Josef Wedewers<br />
Bahnkreuzung (1927) zeigt das leere Ende eines Bahnsteigs. Nur zwei Milchkannen <strong>und</strong><br />
eine abgelegte Zeitung sind in dem Kunstwerk dargestellt. Die ganze Szene ist leer <strong>und</strong><br />
wüst. Friedrich Busacks Bahn Kreuzung (1928) zeigt Eisenbahnlinien, Telegrafenmasten,<br />
Drähte <strong>und</strong> die scharfen Umrisse von einem Gebäude, einer Straßenleuchte, einer Notiz<br />
auf einer Postkarte. Zusätzlich ist ein Bahnbeamter mit einem Stock abgebildet. Alles ist<br />
hart, geometrisch, streng <strong>und</strong> geordnet. Die Atmosphäre ist in Gustav W<strong>und</strong>erwalds<br />
Gemälden ähnlich. Die Vorstellung von Railway Embankment Berlin N. (1926) wird von<br />
einem riesigen System von Telegraphendrähten dominiert. Abgebildet sind außerdem<br />
eine in der Ferne befindliche kleine Station <strong>und</strong> ein durchfahrender Zug mit einer langen<br />
Rauchsäule. Es ist eine Metapher für die unwiderstehlichen Kräfte, die die Menschheit<br />
zerstören können. S-Bahn Station Spandau (1928) zeigt in ähnlicher Weise die Ecke von<br />
einem Bahnsteig <strong>und</strong> enthält ein allein stehendes <strong>Bahnhof</strong>sbüro. Aber die beschriebene<br />
Stimmung wird schnell von den Eisenbahnlinien überschattet. Es wird deutlich an die<br />
K<strong>und</strong>gebungen von Nürnberg erinnert, bei denen Massen von Leuten in geometrische<br />
Formen organisiert wurden. Es ist der visuelle Ausdruck des Verlustes von Individualität,<br />
Freiheit <strong>und</strong> Gewissen 386 .<br />
386 Richards, MacKenzie, 1986, The railway station: a social history<br />
224
Abb. 75: Gustav W<strong>und</strong>erwalds, Railway Embankment Berlin N.<br />
Quelle: http://eduseek.interklasa.pl<br />
In den letzten Jahren des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts wurde damit begonnen, die Bahnhöfe auf<br />
Postkarten festzuhalten. Das war die neue visuelle Kunst der Photographie. Die ersten<br />
Postkarten wurden 1869 in Österreich herausgegeben <strong>und</strong> schon ein Jahr später wurden<br />
in Großbritannien Postkarten mit <strong>Bahnhof</strong>ansichten gedruckt. In der Zeit, als Edward VII<br />
den Thron bestieg, waren Ansichtskarten ein etabliertes Kunstgenre, dass das Leben auf<br />
der Straße porträtierte. Sie wurden überall verkauft <strong>und</strong> ab 1903 wurden jährlich 6oo<br />
Millionen Postkarten verschickt. Ab 1914 wurden 880 Millionen Karten versendet.<br />
Während des 1. Weltkriegs waren Postkarten ungemein wichtig. Sie erhielten die<br />
Verbindungen zwischen Familien aufrecht <strong>und</strong> dienten der Verbreitung von Propaganda.<br />
Nach 1918 verdoppelte sich die Zahl der versendeten Postkarten. Mit der zunehmenden<br />
Verwendung des Telefons verfiel die Bedeutung der Postkarte <strong>und</strong> ab 1930 war ihre<br />
Blütezeit vorüber. Aber in ihrer Glanzzeit stellte die Ansichtskarte jeden Aspekt vom<br />
Leben dar. Die Bahn war ein alltägliches Gesprächsthema. In Europa gaben die meisten<br />
der größeren Bahnunternehmen ihre eigenen Postkarten heraus. So konnten sie die<br />
landschaftlichen Schönheiten an ihren Strecken darstellen. Die Bahnhöfe wurden in ganz<br />
Europa, in den Vereinigten Staaten <strong>und</strong> in allen anderen Kontinenten auf Postkarten<br />
gedruckt 387 .<br />
387 Załuski, 2006, Dworzec kolejowy w strukturze miasta<br />
225
8. Internationale Bahnhöfe im Vergleich<br />
Seit über 150 Jahren prägen Eisenbahnen <strong>und</strong> Bahnhöfe Städte <strong>und</strong> Landschaften. Seit<br />
dieser Zeit haben sich die Technik der Züge <strong>und</strong> die Architektur der Bahnhöfe gewandelt.<br />
Je nach kulturellem Kontext wurden <strong>Bahnhof</strong>sprojekte anders verstanden <strong>und</strong> gestaltet.<br />
Die Übersicht dient dem Überblick über einige herausragende Projekte im Ausland.<br />
Hervor zu heben sind in diesem Sinne England, das als die Wiege der Eisenbahn gilt <strong>und</strong><br />
eine lange Tradition aufweist, Japan, in dem die Eisenbahn eine enorm wichtige Rolle im<br />
Verkehrssystem einnimmt <strong>und</strong> Frankreich, das auch auf eine lange Eisenbahn Tradition<br />
zurück blicken kann <strong>und</strong> durch sein Hochgeschwindigkeitsnetz neue Maßstäbe in Europa<br />
gesetzt hat.<br />
8.1 Eisenbahn in Japan<br />
Die Bahn ist in Japan das wichtigste Verkehrsmittel, weit wichtiger als das Auto, da die<br />
weit ausgedehnten <strong>und</strong> dicht besiedelten städtischen Ballungsräume nur durch sie<br />
zeittechnisch sinnvoll erschlossen werden können. Aus diesem Gr<strong>und</strong> entwickelten sich<br />
früher als in Europa Japans Bahnhöfe zu multifunktionalen Orten mit<br />
stadtteilzentrumstypischen Funktionen. In ihnen lassen sich unterschiedlichste Angebote<br />
ausmachen; Wohnen, Einzelhandel, Kultur <strong>und</strong> öffentliche Einrichtungen stehen als<br />
Ergänzungsfunktionen neben dem reinen Bahnbetrieb bereit. Sie bilden zentrale Orte mit<br />
einer hohen Funktionsdichte heraus. Mittendrin in dichter städtischer Bebauung stehen<br />
die groß angelegten Baukörper, die durch die Sprache der Architektur ihre<br />
Multifunktionalität verdeutlichen. 388<br />
Die Standortwahl für Büro- <strong>und</strong> Einzelhandelsflächen ist nicht abhängig von Autobahnen<br />
oder Abfahrten, sondern wird von der Nähe <strong>und</strong> der Erreichbarkeit des nächsten<br />
<strong>Bahnhof</strong>s bestimmt. Die Bahn ist die Lebensader Japans <strong>und</strong> speziell Tokios. Auf dem<br />
schmalen Küstenstreifen, der intensiv bebaut ist, ist Land kostbar <strong>und</strong> teuer. Seit den<br />
1980er Jahren entwickelt sich Tokio zu einem weltweit wichtigen Finanzzentrum. Seit<br />
dieser Zeit haben sich die Bodenpreise in der Innenstadt so dramatisch erhöht, dass<br />
wohnen im Zentrum der <strong>Stadt</strong> unbezahlbar geworden ist, außer für einige Wenige, die<br />
sich die Mieten in luxuriösen Apartmenthäusern leisten können. 389<br />
Für den langen Arbeitsweg, der das Wohnen am <strong>Stadt</strong>rand zur Folge hat, ist die<br />
Eisenbahn unverzichtbar. Es ist keine Frage der Wohnpräferenzen oder Aversionen, die<br />
den Menschen an den Rand der Städte drängt, es ist die enorme Nachfrage nach Land,<br />
die den Bodenpreis in die Höhe treibt <strong>und</strong> somit gar keine andere Alternative bietet, als<br />
an der städtischen Peripherie <strong>und</strong> darüber hinaus zu wohnen. Die typische Lebensweise<br />
in Japan ist das „Pendlertum“. Täglich bewegen sich Millionen Menschen von den<br />
Wohnvierteln in die Innenstadt zur Arbeit. Andere Tätigkeiten, die für das tägliche Leben<br />
notwendig sind, werden gleich auf dem Arbeitsweg oder dem Nachhauseweg erledigt. Die<br />
Straßen, die auf Bahnhöfe zulaufen <strong>und</strong> als Medium des Transports von der Wohnung<br />
zum <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> in die <strong>Stadt</strong> dienen, sind hoch verdichtete <strong>und</strong> multifunktionale<br />
388<br />
GEIPEL, Kaye, Die Dichte entwerfen. Japanische Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umgebung in: Bauwelt 1995, Heft 8,<br />
S. 366.<br />
389<br />
GEIPEL, Kaye, Die Dichte entwerfen. Japanische Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umgebung in: Bauwelt 1995, Heft 8,<br />
S. 366.<br />
226
Schneisen, die alle möglichen Dienstleistungen <strong>und</strong> Waren liefern. Das ist typisch für die<br />
japanische Kultur, in der dem Weg oder der Straße eine hohe Bedeutung beigemessen<br />
wird. Man spricht auch von der „Kultur des Weges“ (Michi no bunka), anders als in<br />
Europa, bei dem die „Kultur des Platzes“ (Hiroba no bunka) vorherrscht. 390<br />
Wie wichtig die Eisenbahn für die Mobilität der Menschen ist, verdeutlichen einige Zahlen.<br />
In ganz Japan hat die Bahn einen Anteil von 35% bei der Passagierbeförderung, im<br />
Zentrum Tokios sogar von 90%. Dagegen hat die Bahn in England nur einen Anteil von<br />
5,6%, während die Bahn in Frankreich mit 8,7% an der Passagierbeförderung beteiligt<br />
ist. Etwas anders sieht es hingegen in den Ballungsräumen aus. Der Transport wird in<br />
Paris zu 59% von der Bahn abgewickelt, weniger als in London, wo 75,5% der<br />
Passagiertransporte auf die Bahn entfallen. 391<br />
Bis in die 70er Jahre <strong>und</strong> frühen 80er Jahre des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts wurden die<br />
<strong>Bahnhof</strong>shallen durch andere Gebäude eingeengt, über- <strong>und</strong> umbaut. Die „<strong>Stadt</strong>“ wurde<br />
aus Platzmangel bis an den Rand <strong>und</strong> darüber hinaus an die Bahnhöfe heran gebaut, so<br />
dass es manchmal schwer wird, den <strong>Bahnhof</strong> an sich auszumachen, wenn über seinem<br />
Dach ein Winkel des benachbarten Hotels oder ein Teil des nahe liegenden<br />
Einkaufszentrums sich über seinen Hallenausgang wölbt. Die Architekturwelt spricht<br />
hierbei von hybriden Gebäuden, andere sehen darin Chaos <strong>und</strong> die Vakanz von<br />
<strong>Stadt</strong>planung. 392<br />
Eine neue Richtung in Architektur <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>planung wurde in den 1980er Jahren<br />
eingeschlagen. Die älteren Gemenge der <strong>Bahnhof</strong>s- <strong>und</strong> Kommerzgebäude wurden<br />
abgelehnt, dagegen begann man zusammenhängende, kohärente <strong>und</strong> aufeinander<br />
abgestimmte Großprojekte zu realisieren. In Japan heißen solche Gebäude „Eki-buil“.<br />
Diese Bauten sprengen den Größenrahmen bekannter Verkehrsknotenpunkte <strong>und</strong><br />
vereinigen die vorher räumlich getrennten Funktionen wie Einzelhandel, Gastronomie <strong>und</strong><br />
Unterhaltung gewissermaßen „unter einem Dach“. Als gutes Beispiel lässt sich hier der<br />
Komplex des Ueno-<strong>Bahnhof</strong>s in Tokio nennen. 393<br />
Ein Beispiel für die mannigfache Funktionsdichte <strong>und</strong> die Auswüchse der<br />
Bodenspekulation bietet die Bahnstation Ochanumizu im geographischen Zentrum der<br />
City von Tokio in der Nähe des Century Towers. Vor 12 Jahren waren an diesem Ort die<br />
Bodenpreise zehnmal so hoch wie in Paris oder New York. Trotz der exorbitanten<br />
Lagerenten hat sich ein vielfältiges Nebeneinander von groß <strong>und</strong> klein, teuer <strong>und</strong> günstig,<br />
chic <strong>und</strong> alteingesessen erhalten. 394<br />
390<br />
GEIPEL, Kaye, Die Dichte entwerfen. Japanische Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umgebung in: Bauwelt 1995, Heft 8,<br />
S. 366.<br />
391<br />
BONGENAAR in: Bertolini, Luca, Spit, Tejo, Cities on rail, S. 44.<br />
392<br />
GEIPEL, Kaye, Die Dichte entwerfen. Japanische Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umgebung in: Bauwelt 1995, Heft 8,<br />
S. 367.<br />
393<br />
GEIPEL, Kaye, Die Dichte entwerfen. Japanische Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umgebung in: Bauwelt 1995, Heft 8,<br />
S. 368.<br />
394<br />
GEIPEL, Kaye, Die Dichte entwerfen. Japanische Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umgebung in: Bauwelt 1995, Heft 8,<br />
S. 370.<br />
227
8.1.1 Shibuya-Station<br />
Abb. 76: Geschäftsviertel r<strong>und</strong> um den Shibuya <strong>Bahnhof</strong><br />
Quelle: http://www.japaneselifestyle.com.au/tokyo/shibuya.htm<br />
Die Shibuya-Station liegt an dem gleichnamigen Platz <strong>und</strong> ist Endstation der Shin-<br />
Tamagawa-Linie <strong>und</strong> der Inokashira-Linie, zwei privater S-Bahnlinien in Tokio. Sie<br />
verbinden den Westteil des Großraums Tokio mit dem Zentrum. Hier kreuzen sie sich mit<br />
der Yamanote-Ringlinie <strong>und</strong> der Toyoko-Linie, die Richtung Süden nach Yokohama führt.<br />
Zudem starten hier zwei U-Bahnlinien, die ins Zentrum der <strong>Stadt</strong> im Osten vordringen.<br />
Daneben enden an der Shibuya-Station 30 Buslinien. Insgesamt steigen täglich 2<br />
Millionen Menschen um, während die Züge zur Stoßzeit alle 2 Minuten in den <strong>Bahnhof</strong><br />
einfahren. Damit ist er der drittgrößte <strong>Bahnhof</strong> Japans. Zusammen mit einem<br />
Kaufhauskomplex des Konzerns „Tokyu“, geht der <strong>Bahnhof</strong> eine Symbiose zwischen<br />
Verkehrsknotenpunkt <strong>und</strong> Einkaufsparadies ein. Um die Bahnsteige zu wechseln oder das<br />
Gebäude zu verlassen, bewegen sich die Verkehrsteilnehmer durch das Kaufhaus<br />
hindurch, so dass keine eindeutige Trennung zwischen <strong>Bahnhof</strong>sfläche <strong>und</strong><br />
Kaufhausfläche gemacht werden kann. Seit den 1970er Jahren entstanden um den<br />
<strong>Bahnhof</strong> herum Kaufhäuser, Kulturzentren, Kinos <strong>und</strong> Ausstellungsflächen, aber daneben<br />
auch in einer kleinteiligen Umgebung gastronomische Einrichtungen, Läden etc. Durch<br />
die großen Schienennetzerweiterungen im Nachkriegs-Tokio wurde die zentrale Funktion<br />
der historischen Mitte <strong>und</strong> des alten Zentrums der <strong>Stadt</strong> gemindert <strong>und</strong> auf die<br />
Innenstadt umfahrenden Bahnlinien mit ihren Bahnhöfen <strong>und</strong> ihren integrierten<br />
Kaufhäusern verteilt. Tokio entwickelte sich so zu einer polyzentrischen <strong>Stadt</strong>, deren<br />
Impuls vom Schienennetz- <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>sbau ausgingen. Der Shibuyabahnhof wird als<br />
Prototyp der Zentrenbildung angesehen <strong>und</strong> wirkt als Vorbild für andere<br />
<strong>Bahnhof</strong>sprojekte. 395<br />
395 KLAUSER, Wilhelm, Prototyp Shibuya in: Bauwelt 1995, Heft 8, S. 386 f.<br />
228
8.1.2 Shinjuku-Station<br />
Abb. 77: Shinjuku-<strong>Bahnhof</strong> mit angrenzendem Geschäftsviertel<br />
Quelle: http://pic.templetons.com/brad/photo/japan/tokyo-above/<br />
Nach den reinen Passagierzahlen, die täglich ein-, aus- <strong>und</strong> umsteigen, ist er der größte<br />
<strong>Bahnhof</strong> der Welt mit täglich durchschnittlich 2,5 Mio. Menschen. 396<br />
Kurioserweise ist der Shinjukubahnhof kein Haltepunkt für den Shinkansen, dafür aber<br />
für 8 S-, 3 U-Bahnlinien <strong>und</strong> einem Busbahnhof für Fern- <strong>und</strong> Nahbusse. Mit seinen<br />
weiterreichenden Funktionen der Versorgung des täglichen <strong>und</strong> des periodischen Bedarfs<br />
bildet er ein <strong>Stadt</strong>teilzentrum. 397<br />
Abb. 78: Vor dem Shinjuku-<strong>Bahnhof</strong><br />
Quelle: http://jaltcall.org/conferences/call2007/mod/resource/view.php?id=4<br />
Um ihn herum liegen 33 Geschäftsstraßen mit 3275 Läden. 398 Die Warenhäuser auf der<br />
Südseite gehören zu den Ketten von „Odakyu“, „Keio“, „Lumine“, „Mylord“,<br />
396 ROTY in: Bertolini, Luca, Spit, Tejo, Cities on rail , S. 45.<br />
397 http://www.japan-guide.com/e/e3011.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
398 SUZUKI in: Bertolini, Luca, Spit, Tejo, Cities on rail, S. 45.<br />
229
„Takashimaya“, „Isetan“ <strong>und</strong> „Flags“. Zudem sind auch drei Elektronikfachgeschäfte hier<br />
präsent, die zum Teil sieben Filialen in der Nähe des <strong>Bahnhof</strong>s betreiben. Dies sind<br />
„Yodobashi Camera“, „Bic Camera“ <strong>und</strong> „Sakuraya“. Auf der westlichen Seite befindet<br />
sich der „Shinjuku Skyscraper District“, eine Ansammlung von Hochhäusern. Darunter<br />
befinden sich das Rathaus von Tokio, einige renommierte Hotels <strong>und</strong> Bürohäuser mit<br />
Läden <strong>und</strong> Gastronomiebereichen in den Erdgeschossen. Nordöstlich der Station liegt der<br />
Ort „Kabuki-cho“, Japans größtem Rotlichtviertel mit zahlreichen Restaurants,<br />
Karaokebars, üblichen Bars, St<strong>und</strong>enhotels <strong>und</strong> Videotheken. Noch zu erwähnen sind die<br />
zwei bedeutenden Parks, die sich hier befinden, der Central Park <strong>und</strong> der Shinjuku<br />
Gyoen. 399<br />
8.1.3 Tokio Hauptbahnhof<br />
Der Hauptbahnhof von Tokio ist Ausgangspunkt aller Shinkansenlinien. Zudem ist er ein<br />
Haltepunkt für S-Bahnen, Regionalzüge <strong>und</strong> einer U-Bahnlinie. Keine einzige Privatlinie<br />
nutzt den Hauptbahnhof als Haltepunkt. 400<br />
Der japanische Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen verbindet den Norden der<br />
Hauptinsel Honshu von Hachinohe bis nach Fukuoka an dem nördlichen Zipfel Kyushus.<br />
Auf seiner West-Route verbindet er den Ballungsraum Tokio-Yokohama-Kawasaki an der<br />
Südostküste Japans mit dem Ballungsraum von Nagoya <strong>und</strong> weiter westlich mit dem<br />
Ballungsraum Osaka-Kyoto. Auf dem weiteren Verlauf Richtung Westen erreicht der<br />
Shinkansen die Städte Kobe, Mizushima <strong>und</strong> Hiroshima. Im Großraum Tokio durchquert<br />
der Shinkansen Tokios Nachbargemeinden Yamato, Kawaguchi, Urawa <strong>und</strong> Omiya. 401<br />
Abb. 79: Der Hauptbahnhof von Tokio<br />
Quelle: http://www.search.com/reference/Marunouchi<br />
399 http://www.japan-guide.com/e/e3011.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
400 http://www.japan-guide.com/e/e3037.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
401 Diercke Weltatlas, 3. Auflage 1992, S. 177.<br />
230<br />
Der in der zweiten Hälfte des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts erbaute <strong>Bahnhof</strong><br />
beherbergt eine Kunstgalerie, ein<br />
Hotel <strong>und</strong> ein Kaufhaus. Westlich<br />
befindet sich Marunouchi, der<br />
bekannteste Geschäfts Distrikt<br />
Japans. Hier stehen unter anderem<br />
das „Marunouchi-Building“ mit Büros,<br />
Läden <strong>und</strong> Restaurants, das<br />
„Marunouchi Oazo“ mit Buchladen,<br />
Restaurants, einem Hotel <strong>und</strong><br />
Einkaufsmöglichkeiten sowie das<br />
„Tokyo International Forum“, ein<br />
Gebäude, dass für Ausstellungen,<br />
Konzerte <strong>und</strong> Kongresse genutzt
wird. Ein Stück weiter westlich befindet sich der kaiserliche Palast mit dem ihn<br />
umgebenden kaiserlichen Park. 402<br />
8.2 Eisenbahn in England<br />
England ist das Mutterland der Eisenbahn. Die industrielle Revolution, die<br />
Dampfmaschine, die Erzeugung von Stahl <strong>und</strong> Eisen in großen Mengen <strong>und</strong> die<br />
Massenanfertigung von Fertigwaren aller Art, begünstigten die Entwicklung der<br />
Eisenbahn, anfänglich für den Gütertransport, später auch für den Personenverkehr. Die<br />
erste Eisenbahn fuhr zwischen Manchester <strong>und</strong> Liverpool im Jahre 1830. Einige Zeit<br />
danach bildeten sich große Kapitalgesellschaften heraus, die mit dem Geld ihrer<br />
Kapitalgeber Schienentrassen durch das Land legten <strong>und</strong> an den Halte- <strong>und</strong> Endpunkten<br />
Bahnhöfe mit Betriebsflächen <strong>und</strong> Verkehrsflächen anlegten <strong>und</strong> den Bahnbetrieb<br />
unterhielten. Nun gab es zu dieser Zeit keine staatliche Eisenbahn <strong>und</strong> jede private<br />
Eisenbahngesellschaft ließ Züge auf Strecken fahren, die ihrer Meinung nach lukrativ<br />
waren. Dies erklärt die regional unterschiedlich ausgeprägte Ausstattung mit<br />
Eisenbahninfrastruktur in England. 403<br />
8.2.1 London Broadgate<br />
Abb. 80: Eine historische Abbildung des <strong>Bahnhof</strong>s um 1900<br />
Im <strong>Stadt</strong>gebiet von London befinden<br />
sich zehn überregional bedeutende<br />
Bahnhöfe. Dies sind die Waterloo-<br />
Station, Paddington-Station, Charing<br />
Cross, Victoria-Station, Bridge,<br />
Fenchurch Street, Liverpool Street,<br />
Euston-Station, Kings Cross <strong>und</strong> St.<br />
Pancras. 404 Das Hauptaugenmerk soll<br />
hier aber auf eine spektakuläre<br />
Quelle: http://www.urban75.org/london/broad-<br />
Umnutzung eines alten <strong>Bahnhof</strong>s im<br />
Zentrum Londons gerichtet werden, die<br />
street.html<br />
Mitte der 1980er Jahre initiiert wurde.<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> Broad Street war einer der größten <strong>und</strong> bedeutendsten Bahnhöfe in ganz<br />
London. Er lag unmittelbar neben dem <strong>Bahnhof</strong> Liverpool Street <strong>und</strong> war die Endstation<br />
der North London Bahngesellschaft, die den Betrieb im Norden des Ballungsraums<br />
Londons durchführte. 1986 wurde er nach heftigen Protesten abgerissen.<br />
402<br />
http://www.japan-guide.com/e/e3037.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
403<br />
http://home.arcor.de/fredrik.matthaei/London Undergro<strong>und</strong>/Britische_Eisenbahngesellschaften.htm, Zugriff<br />
am 09.07.07.<br />
404<br />
http://www.visitlondon.com/, Zugriff 09.07.07.<br />
231
Als er 1865 als Kopfbahnhof errichtet wurde, diente er als Endstation für die North<br />
London Line. Er verband die östlichen <strong>und</strong> westlichen <strong>Stadt</strong>teile <strong>und</strong> weiter nördlich<br />
liegende Vororte mit dem Zentrum. Zu damaliger Zeit war er neben der Victoria Station<br />
<strong>und</strong> der Liverpool Street Station der meistfrequentierte <strong>Bahnhof</strong> Londons. 405<br />
Abb. 81: Broad Street Station in den 1940ern<br />
Quelle:www.geocities.com/londondestruction/broadstreet.html<br />
232<br />
Der Niedergang begann am Anfang des<br />
20. Jahrh<strong>und</strong>erts, als Busse, Straßenbahnen<br />
<strong>und</strong> die U-Bahn der Eisenbahn<br />
die K<strong>und</strong>en wegnahmen. Während des<br />
2. Weltkrieges wurde er stark zerstört<br />
<strong>und</strong> nur notdürftig wieder instand<br />
gesetzt, während wichtige<br />
Vorortbahnen ihren Betrieb aufgaben.<br />
Immer weniger Passagiere nutzten den<br />
<strong>Bahnhof</strong>. Schließlich schloss die<br />
Gesellschaft das Hauptgebäude des<br />
<strong>Bahnhof</strong>s 1956.<br />
Schalter <strong>und</strong> Informationstafeln wurden anschließend unter kleinen Verschlägen an den<br />
Kopfenden der Bahnsteige untergebracht. Die komplette Schließung, die 1963 erfolgen<br />
sollte, konnte eine Bürgerinitiative noch abwenden. Seitdem vegetierte der <strong>Bahnhof</strong> mit<br />
wenigen tausend K<strong>und</strong>en in der Woche vor sich hin <strong>und</strong> verlor sogar noch das Dach.<br />
1967 wurde es entfernt, da es einsturzgefährdet war. 1969 wurde der Betrieb auf vier<br />
der neun Bahnsteige für immer eingestellt. In den 1970er Jahren verloren die<br />
Bahngesellschaften ihr Interesse an dem <strong>Bahnhof</strong>, so dass Vorortzüge ihren Betrieb<br />
einstellten. 1985 begann man den <strong>Bahnhof</strong> abzutragen. Seit 1986 ist er, bis auf das alte<br />
Bahnviadukt, gänzlich verschw<strong>und</strong>en. 406<br />
Auf dem Gelände des alten <strong>Bahnhof</strong>s an der Broad Street im Norden der Londoner<br />
Innenstadt steht heute das Broadgate Centre, ein großer Büro- <strong>und</strong><br />
Einzelhandelskomplex mit einer Fläche von r<strong>und</strong> 130.000 m². Der Eigentümer ist die<br />
Immobilienfirma British Land, die der Firma Broadgate Estate die Organisation <strong>und</strong> die<br />
Verwaltung des Betriebes übertragen hat. Nach Angaben von British Land bietet der<br />
Gebäudekomplex eine Angebotsfläche von 360.000 m² für Büronutzung,<br />
Einzelhandelsnutzung <strong>und</strong> Erlebnis- <strong>und</strong> Unterhaltungseinrichtungen. R<strong>und</strong> 30.000<br />
Menschen nennen diesen Ort ihren Arbeitsplatz. Erweiterungspläne sehen vor, das<br />
Angebot an Fläche zu vergrößern. Hierfür werden Gebäude auf einem Areal etwas weiter<br />
nördlich über den Bahntrassen der Liverpool Street Station errichtet, darunter auch der<br />
Broadgate Tower, mit 168 Metern das dritthöchste Gebäude Londons. Die neuen<br />
Gebäude werden 246.000 m² Nutzfläche anbieten. 407<br />
Abb. 82: moderner Bürokomplex am alten Standort des <strong>Bahnhof</strong>s<br />
405 http://www.subbrit.org.uk/sb-sites/stations/b/broad_street/index.shtml, Zugriff am 09.07.07.<br />
406 http://www.subbrit.org.uk/sb-sites/stations/b/broad_street/index.shtml, Zugriff am 09.07.07<br />
407 googleearth, Broadgate, London, Zugriff am 29.06.07
Quelle: http://www.iankitching.me.uk/travel/london/2000/0311.html<br />
Ein Gefühl der Melancholie <strong>und</strong> der Tristesse wird von einem persönlichen<br />
Erfahrungsbericht erzeugt, der von einem Londoner stammt, der in den 1980er Jahren<br />
zum letzten Mal den <strong>Bahnhof</strong> als Passagier nutzte; er schrieb:<br />
„I remember my last trip to this station, early eighties, late one afternoon, and was quite<br />
bothered by the fact that, central commuter terminal that as was, I was the only one in<br />
there. You could hear the buzz of the city outside, but why was Broad Street deserted?<br />
That was in the few years running up to its destruction. I had never seen any public<br />
building so left to rot, full of leaks and littered with puddles, grass growing here and<br />
there. What was wrong? It was a sorry sight, but Broad Street was still quite stunning. It<br />
seemed to demand, even in those days, that the Station be cared for and brought back<br />
to life. This was once a major British Rail station in London. Next door to Liverpool Street<br />
station, and serving the northern suburbs and Home Counties, Broad Street once had<br />
more commuters treading its platforms than most other London stations. 408<br />
Mit dem Abriss des alten <strong>Bahnhof</strong>es an der Broad Street wurde ein Stück kulturelles Erbe<br />
mit einem hohen Denkmalwert für immer vernichtet. Er ist der Bodenspekulation <strong>und</strong><br />
Profitgier von Eisenbahngesellschaft, Immobiliengesellschaft <strong>und</strong> Baubranche zum Opfer<br />
gefallen, wie viele einmalige Gebäude vor ihm. Man kann nur hoffen, dass in Zukunft<br />
historisch bedeutsame Gebäude von der Bauwut <strong>und</strong> der Bodenspekulation verschont<br />
bleiben <strong>und</strong> die Menschen den ideellen <strong>und</strong> kulturellen Wert von schützenswerten,<br />
denkmalrelevanten Gebäuden besser erkennen <strong>und</strong> sich für ihren Erhalt einsetzen.<br />
8.3 Eisenbahn in Frankreich<br />
Paris ist der gesellschaftliche Mittelpunkt <strong>und</strong> gleichzeitig der wichtigste<br />
Verkehrsknotenpunkt des Landes. Paris` Bahnhöfe dienen der Metro, dem<br />
Regionalverkehr <strong>und</strong> dem Hochgeschwindigkeitsverkehr des TGV (Train a grande<br />
vitesse).<br />
408 http://www.subbrit.org.uk/sb-sites/stations/b/broad_street/index.shtml, Zugriff am 09.07.07<br />
233
Von Paris ausgehend verlaufen 6 Linien des TGV ins Land. Im Süden des Landes werden<br />
Marseille <strong>und</strong> Lyon bedient, im Südwesten Bordeaux, im Nordwesten Rennes, im Norden<br />
Lille <strong>und</strong> im Osten die kürzlich eröffnete Strecke nach Straßburg. 409<br />
Die erste eröffnete Linie war die Strecke Paris-Lyon im Jahre 1981. Seitdem erreicht man<br />
Lyon von Paris in 2 St<strong>und</strong>en. Früher benötigte man für die gleiche Strecke 4 St<strong>und</strong>en. 410<br />
Zudem bedienen die Hochgeschwindigkeitszüge „Eurostar“ London via Lille <strong>und</strong> der<br />
„Thalys“ fährt über Brüssel nach Amsterdam <strong>und</strong> nach Köln. 411412<br />
Die wichtigsten Bahnhöfe von Paris sind: Gare (<strong>Bahnhof</strong>) d`Austerlitz, Gare de l`Est,<br />
Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare du Nord <strong>und</strong> Gare St. Lazare. Der <strong>Bahnhof</strong> Gare<br />
du Nord ist ein Haltepunkt für zahlreiche Fernverkehrsverbindungen in den Norden<br />
Frankreichs <strong>und</strong> nach Deutschland <strong>und</strong> für die Metro. Unter der Erdoberfläche erstreckt<br />
sich ein weit verzweigtes Wegesystem mit Läden <strong>und</strong> Kiosken zwischen Metrostation <strong>und</strong><br />
Empfangsgebäude. 413<br />
Das Empfangsgebäude des Gare du Nord wurde 1866 fertig gestellt. Der Vorgängerbau<br />
aus dem Jahre 1846 wurde zu klein für den wachsenden Verkehr <strong>und</strong> wurde 1861<br />
abgetragen <strong>und</strong> in Lille wieder aufgebaut um dort als Hauptbahnhof zu fungieren. Der Stil<br />
des Empfangsgebäudes ist in Neoklassizismus gehalten. 414<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> Gare Montparnasse existiert bereits seit 1840. Das heutige<br />
Empfangsgebäude wurde in den 1960ern erbaut. Er befindet sich in der südlichen<br />
Innenstadt von Paris. Hier kreuzen sich mehrere Metrolinien, der TGV <strong>und</strong> einige<br />
Regionallinien. 1989 wurde der <strong>Bahnhof</strong> Endpunkt des TGV Atlantique, der die Städte Le<br />
Mans, Nantes, Tour <strong>und</strong> Bordeaux mit der Hauptstadt verbindet. 415<br />
Der <strong>Bahnhof</strong> Gare du Lyon wurde am Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts eingeweiht. Das<br />
<strong>Bahnhof</strong>sgebäude stammt aus den Jahren von 1895-1902. Erbaut wurde es von Marius<br />
Toudoire. Der Erbauer dieses <strong>Bahnhof</strong>s war das Unternehmen Paris-Lyon-Marseille. Nach<br />
Modernisierungsumbauten ist der <strong>Bahnhof</strong> auch ein Haltepunkt für den TGV. Die Züge<br />
verkehren nach Südfrankreich, in die Alpenregion, in die Schweiz, nach Italien <strong>und</strong><br />
Griechenland. Das Empfangsgebäude beherbergt ein nobles Restaurant sowie kleinere<br />
Lädchen <strong>und</strong> Kioske. 416<br />
Der Ostbahnhof (Gare de l`Est) ist Abfahrts- <strong>und</strong> Ankunftsort der Fernverkehrszüge in<br />
die Region Champagne-Ardenne, Lothringen-Elsass sowie internationaler Verkehre nach<br />
Luxemburg, Deutschland <strong>und</strong> anderer Länder in Zentraleuropa. Zudem verkehren dort<br />
auch Regionalzüge sowie Metrolinien. Seit kurzem existiert die TGV-Verbindung nach<br />
Straßburg, Karlsruhe <strong>und</strong> Stuttgart, sowie Mülhausen, Basel <strong>und</strong> Zürich. Zugleich<br />
409 Spiegel online, Zugriff 25.06.07.<br />
410 Diercke Weltatlas, 1992, S. 95.<br />
411 http://www.aferry.de/eurostar-de.htm, Zugriff am 09.07.07.<br />
412 http://www.thalys.com/, Zugriff am 09.07.07.<br />
413 http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E8DED40C6AEAB4F529FDF696215<br />
7CD02A~ATpl~Ecommon~Scontent.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
414 http://www.paris.org/Gares/Nord/nord.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
415 http://www.paris.org/Gares/Montparnasse/, Zugriff am 09.07.07.<br />
416 http://www.paris.org/Gares/Lyon/lyon.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
234
verbindet der Inter City Express die Zentren Frankfurt am Main, Saarbrücken, Metz <strong>und</strong><br />
Paris. 417<br />
Der Gare d´Austerlitz wurde 1840 durch eine private Bahngesellschaft errichtet, um die<br />
Strecke von Paris nach Corbeil zu bedienen, die drei Jahre später bis nach Orléans<br />
verlängert wurde. Das Empfangsgebäude wurde 1868 neu errichtet. Heute verkehren<br />
hier die U-Bahn <strong>und</strong> Fernverkehrszüge in den Südwesten Frankreichs, Spanien <strong>und</strong><br />
Portugal. 418<br />
Durch die veränderte Lage im Verkehrsnetz Frankreichs wurden weite Teile der<br />
Betriebsflächen des <strong>Bahnhof</strong>s Austerlitz obsolet. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurde die Trasse<br />
südöstlich des <strong>Bahnhof</strong>s dem Bodenmarkt zugeführt <strong>und</strong> bebaut. Auf den ehemaligen<br />
Gleisanlagen entstand unter anderem der Neubau der Bibliothèque de France. 419<br />
8.3.1 Euralille, Lille<br />
Abb. 83: Luftaufnahme von Euralille<br />
235<br />
Erbaut <strong>und</strong> organisiert wurde das<br />
Projekt durch den halbstaatlichen<br />
Bauträger <strong>und</strong> Planungsgesellschaft<br />
"Euralille" im Jahre 1994, 6 Jahre<br />
nach ersten Entwürfen. Als<br />
Chefarchitekt wurde Rem Koolhaas<br />
eingesetzt, der wiederum weitere<br />
Architekturgrößen in die Arbeit<br />
einband. Als Standort wählte man ein<br />
70 Hektar großes Areal am östlichen<br />
Rand der Altstadt, das noch bis 1985<br />
vom Militär genutzt wurde.<br />
Zusammen ergibt der Komplex eine<br />
Nutzfläche von 300.000 m². Der<br />
Gebäudekomplex ist TGV-<strong>Bahnhof</strong>,<br />
Einkaufszentrum, Messezentrum,<br />
Konzert-veranstaltungsort, Kongress-<br />
Quelle: http://www.mairie-lille.fr/sections/sitezentrum sowie Hotel- <strong>und</strong><br />
fr/Menu_horizontal_haut/Tourisme-<br />
Bürostandort. Hierin befinden sich<br />
Decouvrir_Lille/tourisme/Tourisme_d_affaires/ 130 Einzelhandelsgeschäfte, ein<br />
?theme=printable<br />
Supermarkt der Kette Carrefour,<br />
Restaurants <strong>und</strong> Wohnungen. Der<br />
TGV-<strong>Bahnhof</strong> ist Knotenpunkt für die Züge nach London, Paris <strong>und</strong> Brüssel. Brauchte<br />
man früher 7 St<strong>und</strong>en von London nach Lille, so sind es heute nur noch 2, nach Paris<br />
braucht man nur mehr 1 St<strong>und</strong>e, früher 2 <strong>und</strong> die Fahrzeit nach Brüssel halbierte sich auf<br />
417 http://www.paris.org/Gares/de.l.Est/est.f.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
418 http://www.paris.org/Gares/Austerlitz/austerlitz.f.html, Zugriff am 09.07.07.<br />
419 Bahnflächen als Potentiale der <strong>Stadt</strong>entwicklung in: Beiträge zur <strong>Stadt</strong>entwicklung 39, <strong>Stadt</strong> Leipzig.
eine halbe St<strong>und</strong>e. Das alte Lille mit 170.000 Einwohnern <strong>und</strong> einem Einzugsbereich von<br />
annähernd 1,5 Mio. Menschen, altindustrielles Zentrum für Chemie, Textilien, Kohle <strong>und</strong><br />
Metall Produktion, deren Zeit bereits abgelaufen ist, schafft sich durch den <strong>Bahnhof</strong> einen<br />
Einzugsbereich von 70 Millionen Menschen, die sich in einem Umkreis von 2 TGV-<br />
Fahrst<strong>und</strong>en befinden, also in einem Umkreis von 700 Kilometern um Lille leben. 420<br />
Abb. 84: Einkaufszentrum Triangle des Gare<br />
236<br />
Die Einzigartigkeit dieses Komplexes<br />
geht von seiner Dimension aus.<br />
Projekte solcher Größenordnungen<br />
wurden ehemals nur in peripheren<br />
<strong>Stadt</strong>lagen, „auf der grünen Wiese“<br />
errichtet, in Lille befindet sich ein<br />
solches Projekt nun in unmittelbarer<br />
Nähe zum Zentrum. Was hier von<br />
Koolhaas <strong>und</strong> seinen<br />
Architektenkollegen errichtet wurde,<br />
ist ein neuer <strong>Stadt</strong>teil aus dem<br />
Baukasten am Rande der Innenstadt.<br />
Statt den TGV-Kreuzungsbahnhof<br />
weit außerhalb der <strong>Stadt</strong> zu errichten,<br />
konnten die politisch<br />
Verantwortlichen der <strong>Stadt</strong> durchsetzen, den <strong>Bahnhof</strong> inmitten der <strong>Stadt</strong> zu platzieren. Es<br />
entstand ein TGV-Tunnelbahnhof der in seiner gesamten Länge an der Erdoberfläche<br />
liegt, das wohl größte Parkhaus der Welt, mit 6000 Plätzen direkt unter dem <strong>Bahnhof</strong><br />
gelegen <strong>und</strong> dem U-Bahn-Kreuzungsbahnhof der <strong>Stadt</strong>, sowie in nächster Nähe die<br />
<strong>Stadt</strong>autobahn. Der Architekt Jean Nouvel entwarf <strong>und</strong> errichtete das Einkaufszentrum<br />
„Triangle des Gares“ mit 130 Läden, 45.000 m² Büroflächen <strong>und</strong> 570 Wohnungen. 421<br />
Quelle: http://www-lor.int-evry.fr/~vincent/VisiteLille/<br />
vis_phot.html<br />
Einer dieser Läden ist der „Hypermarché Carrefour“ mit einer Verkaufsfläche von<br />
12.000m², die sonst nur am Rande der <strong>Stadt</strong> zu finden sind. In einem ausgeklügelten<br />
Bausystem, bei dem das Einkaufsverhalten der Menschen ausgenutzt wird, legte man<br />
den Supermarkt in den hinteren Teil des Einkaufszentrums, als K<strong>und</strong>enlocker<br />
wohlgemerkt, um dann „zufällig“ auf andere Angebote im vorderen Teil des Zentrums zu<br />
stoßen. Daneben reihen sich 130 Boutiquen <strong>und</strong> sieben große Einkaufsmärkte mit<br />
15.000m² ein. Die Autofahrer unter den K<strong>und</strong>en können ihren Wagen in die Tiefgarage<br />
stellen, die sie für anderthalb St<strong>und</strong>en kostenlos nutzen können, obwohl der Fußweg in<br />
die Innenstadt nur 10 Minuten beträgt. Neben den Supermärkten <strong>und</strong> Boutiquen befinden<br />
sich auch Cafés, Bankfilialen <strong>und</strong> ein Postamt in der Ladenpassage. Kurios erscheinen<br />
weitere Nutzungen im oberen Geschoss der Anlage, einmal ein überkonfessioneller<br />
Gebetsraum, ein Kindergarten <strong>und</strong> ein Umkleidebereich für Jogger. 422<br />
Sogar eine Handelshochschule mit ihren Verwaltungsräumen, Seminarräumen,<br />
Vorlesungssälen <strong>und</strong> Studentenwohnungen lassen sich im „Triangle des Gares“ finden,<br />
420 MÖNNINGER, Michael, Plankton der Vorstädte in: Der Spiegel, 47/1994, S. 182.<br />
421 MÖNNINGER, Michael, Plankton der Vorstädte in: Der Spiegel, 47/1994, S. 183.<br />
422 SR, Le Triangle des Gares in: Bauwelt 1994, Heft 44, S. 2450.
oben in der dritten Etage. Daneben hat sich auch die französische Staatsbahn eine<br />
Büroetage angemietet. 423<br />
Von Koolhaas selbst konzipiert wurde das multifunktionale Veranstaltungszentrum „Grand<br />
Palais“, das Räumlichkeiten für Musikkonzerte, Kongressveranstaltungen <strong>und</strong> Messen<br />
bereitstellt. Es liegt etwas abseits vom Einkaufszentrum <strong>und</strong> dem neuen TGV-<strong>Bahnhof</strong><br />
hinter Gleisanlagen <strong>und</strong> einer Schnellstraße. 424<br />
Noch zu nennen sind die Bürotürme der Architekten Christian de Portzamparc <strong>und</strong> Claude<br />
Vasconi, die über <strong>und</strong> neben dem neuen TGV-<strong>Bahnhof</strong> positioniert wurden. 425<br />
Abb. 85: Moderne Bürotürme neben dem TGV-<strong>Bahnhof</strong><br />
Quelle: http://www.linternaute.com/imprimer/sortir/lille-l-exuberante-du-nord/le-quartiermoderne-euralille.shtml<br />
Die Anlage des neuen TGV-<strong>Bahnhof</strong>s von Lille <strong>und</strong> dem angeschlossenen Handels-, Büro<strong>und</strong><br />
Dienstleistungsprojekt repräsentiert einen ultramodernen Städtebau (für Europa) des<br />
ausgehenden 20. Jahrh<strong>und</strong>erts. Als Motor der Entwicklung treten private oder<br />
halbstaatliche Gesellschaften auf, die eine möglichst hohe profitable Verwertbarkeit der<br />
Fläche anstreben, auch zum Preis von maßstäblichen Verzerrungen der Mittel, wie der<br />
Fall des Riesenprojekts Lille zeigt. Eine <strong>Stadt</strong> wie London kann Bauten solcher<br />
Dimensionen vertragen, dagegen machen sich Händler aus der Liller Innenstadt <strong>und</strong> die<br />
von Euralille extreme Konkurrenz. Man kann das Projekt jedoch noch kritischer sehen.<br />
Stefan Röchert <strong>und</strong> Moritz von Voss betrachten das gesamte Projekt äußerst kritisch, da<br />
sie Euralille in seiner Existenz in Frage stellen. Sie attestieren Lille zwar eine Attraktivität<br />
für den Handel <strong>und</strong> Bürostandort dank der exzellenten Verkehrsanbindung an große<br />
europäische Zentren (Paris, London, Brüssel), jedoch sehen sie den Standort Lille gerade<br />
wegen seiner guten Anbindung an die großen Zentren, in der Schanierfunktion,<br />
überflüssig, da die Zentren zeitlich noch näher aneinanderrücken <strong>und</strong> somit ihre<br />
423 Ebenda, S. 2451- 2453<br />
424 Ebenda, S. 2455.<br />
425 Ebenda, S. 2450.<br />
237
Erreichbarkeit steigern. Sie erkennen im TGV-Anschluss das Hindernis, dass der Region<br />
das Überwinden der peripheren Lage verwehrt. 426<br />
426 Röchert, Stefan <strong>und</strong> v.Voss, Moritz, Das Projekt Euralille. Projektbericht.<br />
238
Quellen:<br />
Albert, Bernhard: <strong>Bahnhof</strong> 21 - oder die größte Umgestaltung der Städte. Online unter<br />
http://www.frankfurt.org/inis/WobiG/bahn1.html (Letzter Zugriff: 25.6.2007)<br />
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378 (2396)<br />
(1994, 2439)), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2007 (BGBl. I<br />
S. 522)<br />
Apel, Dieter; Lehmbrock, Michael; Pharoa, Tim; Thiemann-Linden, Jörg; Kompakt, mobil,<br />
urban: „<strong>Stadt</strong>entwicklungskonzepte zur Verkehrsvermeidung im internationalen<br />
Vergleich“; Difu-Beiträge zur <strong>Stadt</strong>forschung, Band 24; Deutsches Institut für Urbanistik;<br />
Anfang 1998<br />
Bartkowiak, Jost (2004): <strong>Stadt</strong>zentren im Umbruch: Zur Revitalisierung von<br />
Großstadtzentren, deren Bedeutung für <strong>Stadt</strong>ökonomie, Städtebau <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>gesellschaft.<br />
Am Beispiel zentralstädtischer <strong>Bahnhof</strong>sareale. Peter Lang Verlagsgesellschaft, Frankfurt<br />
am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien<br />
Bärtschi, H.-P. (2005): Bahnhöfe. In: Historisches Lexikon der Schweiz. Online unter<br />
www.dhs.ch/externe/protect/textes/d/D41756.html (Letzter Zugriff: 2.6.2007)<br />
Baumgärtner, Götz (2005): Neue <strong>Bahnhof</strong>sprojekte. Nationalatlas B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland – Verkehr <strong>und</strong> Kommunikation. Leibniz- Institut für Länderk<strong>und</strong>e. Leipzig.<br />
S. 46<br />
Bayazit, Cem et al. (2002): Filetstücke – ausländische Vorbilder. In: Österreichische<br />
Gesellschaft für Wirtschaftsraumforschung (Hrsg.): Wirtschaftsgeographische Studien,<br />
Heft 27/28. Facultas Verlag, Wien<br />
Beck, Martin; „Fahrrad am <strong>Bahnhof</strong>“; Beitrag 3.3.4.1 in Apel, Holzapfel, Kiepe,<br />
Lehmbrock, Müller; „Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung“ 1992<br />
Becker, Josef; Dipl.-Ing.; Dissertation; „Qualitätsbewertung <strong>und</strong> Gestaltung von<br />
Stationen des regionalen Bahnverkehrs“; Darmstadt 2005<br />
Beckmann, Klaus J., 2002: Personenbahnhöfe als Kristallisationskerne zukunftsfähiger<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung. Eisenbahntechnische R<strong>und</strong>schau 51/2002, S. 369-377. Hamburg:<br />
Hestra-Verlag<br />
Bertolini, Luca & Spit, Tejo (1998): Cities on Rails: The Redevelopment of Railway<br />
Station Areas. E & FN Spon, London<br />
Binney (1984): Great railway station of Europe<br />
Blase, Dieter; „Die Erneuerung der <strong>Bahnhof</strong>sbereiche an der Köln-Mindener Eisenbahn<br />
<strong>und</strong> Fahrradstationen im Emscherraum“; in: „Bahnhöfe - Eintrittstor zur <strong>Stadt</strong>“, DSSW-<br />
Dokumentation; 1996<br />
239
Boczek, Barbara, Christ, Wolfgang ,Loose, Willi, Lücking, Gero; Umweltbahnhof<br />
Rheinland-Pfalz, Planungshandbuch; Mediastadt, Büro für <strong>Stadt</strong>kommunikation <strong>und</strong> Öko-<br />
Institut, Institut für angewandte Ökologie im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft,<br />
Verkehr, Landwirtschaft <strong>und</strong> Weinbau <strong>und</strong> der Deutschen Bahn AG; 1997<br />
Brauer, Kerry-U (2003): Gr<strong>und</strong>lagen der Immobilienwirtschaft. 4. Auflage. Gabler Verlag.<br />
Leipzig<br />
Brockhaus in zehn Bänden (2004): 1. Auflage. Verlag Brockhaus. Mannheim<br />
Brunn, Burkhard et al. (1992): Der Hauptbahnhof wird <strong>Stadt</strong>tor. Zum Ende des<br />
Automobilzeitalters. Anabas-Verlag Günter Kämpf KG, Frankfurt a.M<br />
B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches<br />
Architekturzentrum DAZ (Hrsg.) (1996): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden<br />
Büro für Städtebau <strong>und</strong> Architektur, Dr. H. Holl (Würzburg) (2002): Vorbereitende<br />
Untersuchungen, <strong>Bahnhof</strong>sviertel, Untersuchungsbericht. Programm "<strong>Stadt</strong>- <strong>und</strong> Ortsteile<br />
mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale <strong>Stadt</strong>". <strong>Stadt</strong>erneuerung Hof GmbH,<br />
Hof<br />
DB Station & Service AG (o. J.): Ausstattungshandbuch zur Standardisierung, Planung<br />
<strong>und</strong> Entwicklung von Personenbahnhöfen, Berlin<br />
DB Station & Service AG (2006): <strong>Bahnhof</strong>skategorisierung DB Station & Service AG,<br />
Stand 01.01.2007, Berlin<br />
DB Station & Service AG (2006): Stationspreisliste 2007, Stand 01.01.2007, Berlin<br />
DB Station & Service AG Marketing (o. J.): Geschäfte 1. Klasse - Top-Gewerbeflächen in<br />
Deutschlands Bahnhöfen<br />
Dethier, Jean (1978): Der <strong>Bahnhof</strong>: ein neuer Turmbau zu Babel. In: Die Welt Der<br />
Bahnhöfe, Elefanten- Press- Verlag, Berlin. S. 6<br />
Dethier, Jean (1981): Die Welt der Bahnhöfe, Le temps des gares<br />
Deutsche Bahn AG (2006): Städteverbindungsbuch Leipzig 2007, Frankfurt am Main<br />
Deutsche Bahn AG (2007): Das Trassenpreissystem der DB Netz AG, Frankfurt am Main<br />
Deutsche Bahn AG (2007): Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG<br />
(SNB), Frankfurt am Main<br />
Diercke Weltatlas (1992): 3. Auflage. Verlag Westermann. Braunschweig<br />
Dürr, Heinz (1996): Bahn frei für eine neue <strong>Stadt</strong>. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten,<br />
Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.):<br />
240
Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert. Braunschweig, Wiesbaden:<br />
Vieweg<br />
Dürr, Heinz. Die Projekte 21 - Eine Vision für Städte <strong>und</strong> Bahnhöfe. Vortragsmanuskript.<br />
[Aus einem Vortrag auf dem Symposium 'Fokus Stuttgart II' am 19. Juni 1996 in<br />
Stuttgart]. Stuttgart<br />
Eisenbahn-Bau- <strong>und</strong> Betriebsordnung (EBO) vom 8. Mai 1967 (BGBl. 1967 II S. 1563),<br />
zuletzt geändert durch Artikel 499 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S.<br />
2407)<br />
Federal Transit Administration (FTA); Innovative Financing Techniques for American’s<br />
Transit Systems; September 1998<br />
Feldtkeller, Andreas (1994): Die zweckentfremdete <strong>Stadt</strong>. Wider die Zerstörung des<br />
öffentlichen Raumes. Campus Verlag, New York, Frankfurt a.M<br />
Fliessbach, Gabriele, Skript 10 Kartographie <strong>und</strong> DV-Anwendung, Fernerk<strong>und</strong>ung,<br />
Sommersemester 2006, Graue Literatur des ISR, TU Berlin<br />
Gehards H. & Keller H. (1990): Baufinanzierung von A bis Z, 2. Auflage,<br />
Betriebswirtschaftlicher Verlag. Wiesbaden<br />
Geipel, Kaye (1995): Die Dichte entwerfen - Japanische Bahnhöfe <strong>und</strong> ihre Umgebung.<br />
In: Bauwelt, 86. Jahrgang, Heft 8, 1995<br />
Gormsen, Niels & Kühne Armin (2002): Leipzig. Den Wandel Zeigen. Verlag Edition<br />
Leipzig. 2000. 5. Auflage. Leipzig<br />
Grabow, B & B. Hollbach-Grömig (1998): <strong>Stadt</strong>marketing – eine kritische Zwischenbilanz<br />
(=DIFU-Beiträge zur <strong>Stadt</strong>forschung, Bd. 25). Berlin<br />
Gräve, D., K. Wellner & A. Wicht (1998): die Auswirkungen der Eröffnung des<br />
Einkaufscenters „Promenaden am Hauptbahnhof“ auf die Händler der Leipziger<br />
Innenstadt. Unveröffentlichte Forschungsarbeit der Universität Leipzig, Lehrstuhl Handel<br />
<strong>und</strong> Distribution. Leipzig, S. 15<br />
Hackelsberger, Christoph (1996): Nicht mehr Glanzpunkte, eher blinde Flecken des<br />
Verkehrs. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches<br />
Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden<br />
Häßler, Michael: „<strong>Bahnhof</strong>sarchitektur im Spiegel zeitgenössischer<br />
Baustilentwicklung“;2006; aus Prof. Dr.-Ing. Richrath, Klaus; Prof. Dipl.- Ing. Ringel,<br />
Johannes; „<strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> – Untersuchungen zu den Wechselwirkungen zwischen<br />
<strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> städtischem Umfeld“; Karlsruhe 2005<br />
Harting, Michael (2007): Ziele <strong>und</strong> Perspektiven für die Bahn – die Sicht des B<strong>und</strong>es. In:<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Bahn – Almanach 2006/2007, Wekel, Julian [Hrsg.]: Deutsche Akademie für<br />
Städtebau <strong>und</strong> Landesplanung (DASL), Berlin, 2007<br />
241
Hatzfeld, Ulrich (1999): Zur städtebaulichen <strong>und</strong> verkehrlichen Funktion der Bahnhöfe.<br />
In: Bahnhöfe, Sicherheit, Service, Aufenthaltsqualität. Institut für Landes- <strong>und</strong><br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Dortm<strong>und</strong>. S. 70<br />
Hight, Christopher (2006): Landscape Urbanism. In: Mostafavi, Mohsen & Najle, Ciro<br />
(Hrsg.): A Manual for the Machinic Landscape. AA Verlag, London<br />
Hoffmann-Axthelm, Dieter (1996): <strong>Stadt</strong>unterfahrung: Zu einer modischen Wendung im<br />
Verhältnis von <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Bahn. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG,<br />
Förderverein Deutsches Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die<br />
<strong>Stadt</strong> im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden<br />
Hollbach-Grömig, Beate (8. 1. 2007): <strong>Stadt</strong>marketing: Ziele – Aktivitäten –<br />
Erfolgsfaktoren, einer b<strong>und</strong>esweiten Umfrage. Präsentation des Deutschen Institutes für<br />
Urbanistik. S. 1-22<br />
Institut für Landes- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklungsforschung; „Bahnhöfe – Sicherheit, Service,<br />
Aufenthaltsqualität“; Dortm<strong>und</strong> 1999<br />
Institut für <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> Wohnen des Landes Brandenburg (ISW) im Auftrag des<br />
Ministeriums für <strong>Stadt</strong>entwicklung, Wohnen <strong>und</strong> Verkehr des Landes Brandenburg;<br />
Entwicklung von <strong>Bahnhof</strong>sumfeldern - Investieren in die Zu(g)kunft; Dezember 1995<br />
Jaschke, Hans-Gerd, (1997): Öffentliche Sicherheit im Kulturkonflikt. Frankfurt/Main,<br />
New York: Campus Verlag<br />
Klauser, Wilhelm (1995): Prototyp Shibuya. In: Bauwelt, 86. Jahrgang, Heft 8, 1995<br />
Korn, Juliane (2006): Transiträume als Orte des Konsums - eine Analyse des<br />
Standorttyps unter besonderer Berücksichtigung der Bahnhöfe. Dissertation. Humboldt-<br />
Universität. Berlin<br />
Krätke, Stefan (1995): <strong>Stadt</strong> – Raum – Ökonomie: Einführung in aktuelle Problemfelder<br />
der <strong>Stadt</strong>ökonomie <strong>und</strong> Wirtschaftsgeographie. Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin<br />
Krau, Ingrid & Romero Andreas (1998): Bahnhöfe als Einkaufs- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungszentren. In: Informationen zur Raumentwicklung , Heft 2/3 1998<br />
Krütli, Pius et al. (2005): <strong>Bahnhof</strong> SBB/SNCF: Treibende Kraft bei der Entwicklung der<br />
städtischen Umgebung. In: Scholz, Roland W. et al. (Hrsg.): Bahnhöfe in der <strong>Stadt</strong><br />
Basel: Nachhaltige <strong>Bahnhof</strong>s- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung in der trinationalen Agglomeration.<br />
ETH-UNS Fallstudie 2004. Verlag Rüegger, Zürich, Chur<br />
Landeshauptstadt München, Referat für <strong>Stadt</strong>planung <strong>und</strong> Bauordnung u.a. (2000):<br />
Hauptbahnhof Laim-Pasing, Fachgutachten Einzelhandel, <strong>Stadt</strong>teilzentren Laim-Pasing<br />
Landeshauptstadt München, Referat für <strong>Stadt</strong>planung <strong>und</strong> Bauordnung u.a. (2000):<br />
Hauptbahnhof Laim-Pasing, Freiraum- <strong>und</strong> Ausgleichsflächengutachten<br />
242
Landeshauptstadt München, Referat für <strong>Stadt</strong>planung <strong>und</strong> Bauordnung u.a. (2000):<br />
Hauptbahnhof Laim-Pasing, Fachgutachten Verkehr, Verkehrsuntersuchung,<br />
Variantenvergleich Pasing Nordumgehung, Knotenpunktbetrachtung Laim<br />
Linke, Hartmut (1999): Bahnhöfe als Einzelhandelsstandort – Entwicklungen, Potentiale<br />
<strong>und</strong> Empfehlungen für eine „Renaissance der Innenstädte“. Diplomarbeit Universität Trier<br />
Matthews, Volker (1998): Bahnbau, 4. Auflage, Teubner-Verlag, Leipzig<br />
MÖLLER, Lars (1996): Einstiege in die Hochgeschwindigkeit. Neue Bahnhöfe der ICE<br />
Neubaustrecke Köln-Rhein/Main. Köln<br />
Mönninger, Michael (1994): Plankton der Vorstädte. In: Der Spiegel. 47/1994<br />
Mumford, Lewis (1961): The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its<br />
Prospects. Harcourt, Brace & World, Inc., New York<br />
Muncke, Martin (2004): Ingenierbauwerke bei der Deutschen Bahn AG, Anforderungen<br />
<strong>und</strong> Gestaltung. In: Umrisse, Zeitschrift für Baukultur. Ausgabe 2 2004<br />
Neumann, Peter: Berlins Bahnhöfe, Berlin. 2004<br />
Oosten, Wouter-Jan (2000): Railway stations and a geography of networks. Paper<br />
presented at the 6th Annual Congress of the Netherlands Research School for Transport,<br />
Infrastructure and Logistics. Online unter:<br />
www.eur.nl/WebDOC/doc/fsw/fswalg20010507142923.<strong>pdf</strong> (Letzter Zugriff: 30.05.2007)<br />
Parissien, Steven (1997): Bahnhöfe der Welt. Station to station. Knesebeck Verlag.<br />
München<br />
Polak, John W.; Transport Planning and the Legislative Framework: The Example of CAAA<br />
and ISTEA in the United States; Centre for Transport Studies, Imperial College London;<br />
Oktober 1997<br />
Pretsch, Hélène (ISB); Spieshöfer, Alexander (ILS NRW); Puccio, Benjamin (Adeus);<br />
Soulas, Claude (Inrets); Leclercq, Régis (CETE de l’Ouest); Bentayou, Gilles (Certu);<br />
Deutsch französisches Projekt „Bahn Ville“; 2004<br />
Recker, Müller, Gesichtspunkte zur Gestaltung von <strong>Bahnhof</strong>svorplätzen, Frankfurt am<br />
Main. 1961<br />
Regionalplan Südostoberbayern; Teil B: Fachliche Festlegungen - Nachhaltige<br />
Entwicklung<br />
Entwicklung<br />
der fachlich raumbedeutsamen Strukturen ökologisch nachhaltige<br />
Renner, Mechthild, 2004: Revitalisierung von Bahnbrachen – zum Sachstand.<br />
Informationen zur Raumentwicklung 9/10.2004, Bonn: BBR<br />
Reulecke, Jürgen, Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, Frankfurt am Main 1985<br />
243
Richard, Jochen, 2007. Bahnflächen als Entwicklungsprozess. In: <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Bahn –<br />
Almanach 2006/2007, Wekel, Julian [Hrsg.]: Deutsche Akademie für Städtebau <strong>und</strong><br />
Landesplanung (DASL, Berlin, 2007<br />
Richards, MacKenzie (1986): The railway station: a social history<br />
Röchert, Stefan <strong>und</strong> v.Voss, Moritz (1997/98): Das Projekt Euralille. Projektbericht.<br />
Technische Universität. Berlin<br />
Roth, Ralf (2005): Das Jahrh<strong>und</strong>ert der Eisenbahn. Die Herrschaft über Raum <strong>und</strong> Zeit<br />
1800-1914. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern<br />
Schivelbusch, Wolfgang (2000): Die Geschichte der Eisenbahnreise. 3. Auflage. Fischer<br />
Verlag. Frankfurt<br />
Schivelbusch, Wolfgang (1984): Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung<br />
von Raum <strong>und</strong> Zeit im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert. Ullstein Verlag, Frankfurt/M, Berlin, Wien<br />
Scholz, Roland W. et al. (Hrsg.) (2005): Bahnhöfe in der <strong>Stadt</strong> Basel: Nachhaltige<br />
<strong>Bahnhof</strong>s- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung in der trinationalen Agglomeration. ETH-UNS Fallstudie<br />
2004. Verlag Rüegger, Zürich, Chur<br />
Schürmann, Carsten & Spiekermann, Klaus (1999): Dortm<strong>und</strong> Hauptbahnhof wird<br />
Verkehrsmagnet. In: Institut für Raumplanung Dortm<strong>und</strong>, Arbeitspapier 169, Die<br />
Überbauung des Dortm<strong>und</strong>er Hauptbahnhofs – Raumplanerische Beiträge zu einem<br />
Großprojekt<br />
Senatsverwaltung für <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> Umweltschutz Berlin, Referat<br />
Öffentlichkeitsarbeit (1992): Städtebaulicher Ideenwettbewerb Hauptbahnhof Berlin /<br />
Spreeufer, Auslobung<br />
Skyline (1995): Kaufhäuser mit Gleisanschluss<br />
Speck, Georg; Wie schaffen wir attraktive Bahnhöfe? , Das Konzept „Umweltbahnhof<br />
Rheinland-Pfalz“; in: Bahnhöfe - Eintrittstor zur <strong>Stadt</strong>, DSSW-Dokumentation; 1996<br />
SR (1994): Le Triangle des Gares. In: Bauwelt. 85. Jahrgang. Heft 44. 1994<br />
<strong>Stadt</strong> Leipzig, Der Oberbürgermeister, Dezernat <strong>Stadt</strong>entwicklung <strong>und</strong> Bau,<br />
<strong>Stadt</strong>planungsamt (Hrsg.): Bahnflächen als Potenziale der <strong>Stadt</strong>entwicklung, Leipzig,<br />
2003<br />
Staudacher, Christian (2002): <strong>Bahnhof</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong> – Standort <strong>und</strong> Lebensgemeinschaft.<br />
In: Österreichische Gesellschaft für Wirtschaftsraumforschung (Hrsg.):<br />
Wirtschaftsgeographische Studien, Heft 27/28. Facultas Verlag, Wien<br />
Stauffacher, Michael et al. (2005): Bahnhöfe als Schlüssel nachhaltiger Mobilität <strong>und</strong><br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung: Entwicklungsperspektiven für die <strong>Stadt</strong> Basel <strong>und</strong> die TAB. In: Scholz,<br />
Roland W. et al. (Hrsg.): Bahnhöfe in der <strong>Stadt</strong> Basel: Nachhaltige <strong>Bahnhof</strong>s- <strong>und</strong><br />
244
<strong>Stadt</strong>entwicklung in der trinationalen Agglomeration. ETH-UNS Fallstudie 2004. Verlag<br />
Rüegger, Zürich, Chur<br />
Süddeutsche Zeitung (29.03.1997): Wir legen Wert auf einen Branchenmix. Der<br />
Immobilien-Markt<br />
Terwiesche, Michael, (1997): Innenstädte – eine obdachlosenfreie Zone.<br />
Verwaltungsr<strong>und</strong>schau, 12/97<br />
The Effects of Land Use and Travel Demand Management Strategies on Commuting<br />
Behaviour, November 1994, Cambridge Systematics<br />
Töpfer, Klaus, 1997. Vorwort des B<strong>und</strong>esministers für Raumordnung, Bauwesen <strong>und</strong><br />
Städtebau. In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches<br />
Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg<br />
United States Code (USC), Title 49; Chapter 53 Mass Transportation, Section 5303<br />
Metropolitan planning; Federal Transit Administration (FTA)<br />
Verkehrsb<strong>und</strong> Berlin Brandenburg GmbH; Präsentation; „SPNV Fahrplan; ÖPNV<br />
Neuerungen 2006/07“<br />
Von Gerkan, Marg <strong>und</strong> Partner (1996): Frankfurt 21 – Städtebauliche Studie. In: B<strong>und</strong><br />
Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches Architekturzentrum<br />
DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag,<br />
Braunschweig, Wiesbaden<br />
von Gerkan, Meinhard (1996): Renaissance der Bahnhöfe als Nukleus des Städtebaus.<br />
In: B<strong>und</strong> Deutscher Architekten, Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches<br />
Architekturzentrum DAZ (Hrsg.): Renaissance der Bahnhöfe: Die <strong>Stadt</strong> im 21.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden<br />
Wehner, Oliver (2002): Die Realisierung eines schienengeb<strong>und</strong>enen Großbauvorhabens<br />
am Beispiel der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main der Deutschen Bahn AG. (Dissertation,<br />
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt<br />
a.M.). Frankfurt a.M. S. 187<br />
Wehrheim, Jan (2002): Die überwachte <strong>Stadt</strong>. Sicherheit, Segregation <strong>und</strong> Ausgrenzung.<br />
In: Häußermann, Harmut et al. (Hrsg.): <strong>Stadt</strong>, Raum <strong>und</strong> Gesellschaft Band 17. Verlag<br />
Leske + Budrich, Opladen<br />
Wolfensberger-Malo, Maya (2006): <strong>Bahnhof</strong>: Funktionen im Siedlungsraum.<br />
Semesterarbeit. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich<br />
Wolfgang Brinkmann, Andrea Dittrich, Peter Endemann, Guido Müller; Institut für<br />
Landes- <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklungsforschung des Landes NRW (ILS); Ministerium für Arbeit,<br />
Soziales <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>entwicklung, Kultur <strong>und</strong> Sport des Landes NRW (Hrsg.);<br />
„Baulandentwicklung an der Schiene – NRW“ - Studie zum Mobilitätsverhalten der<br />
245
Wohnbevölkerung in Gebieten mit <strong>und</strong> ohne Schienenverkehrshaltepunkt; Dortm<strong>und</strong>,<br />
1999<br />
Wulfhorst, Gebhard; Kurzbericht des Projektes „Bahn Ville – Schienengestützte<br />
Siedlungsentwicklung <strong>und</strong> Verkehrsverknüpfung in deutschen <strong>und</strong> französischen<br />
Regionen – Inhaltliche Wirkungszusammenhänge, Rahmenbedingungen auf deutscher<br />
<strong>und</strong> französischer Seite, Arbeitspaket 2B“; Aachen 2002<br />
Załuski (2006): Dworzec kolejowy w strukturze miasta<br />
Internetquellen:<br />
googleearth, Broadgate, London (Letzter Zugriff: 29.06.07)<br />
home.12move.nl/sh829487/engelandk<strong>und</strong>e/vk.htm (2007). (Letzter Zugriff: 28.07.2007)<br />
http://de.biz.yahoo.com/15052007/336/deutsche-bahn-verzeichnet-starken-zuwachsfahrgastzahlen.html<br />
(2007): Deutsche Bahn AG verzeichnet starken Zuwachs an<br />
Fahrgastzahlen. Yahoo.biz. (Letzter Zugriff: 29.07.2007)<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/<strong>Bahnhof</strong>_Lille-Europe (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Tokio (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://die.bahn.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/<br />
personenbahnhoefe/stationspreise/stationspreise.html: Deutsche Bahn AG. Transparent,<br />
übersichtlich <strong>und</strong> stabil. Das neue Stationspreissystem. (Letzter Zugriff: 16.05.2007)<br />
http://en.wikipedia.org/wiki/Shibuya_station (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:088:0009:01:P<br />
L:HTML, Luemut des Europäischen Komitees in der Sache : "Rolle der Bahnhöfe in den<br />
Ballungsgebieten <strong>und</strong> in den Städten der Europäischen Union", (2006/C 88/03)<br />
http://home.arcor.de/fredrik.matthaei/London<br />
Undergro<strong>und</strong>/Britische_Eisenbahngesellschaften.htm (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://homepage.univie.ac.at/peter.weichhart/LVs/Seminare/AktFRegent0203/Ref4Bahn<br />
hofsprojekte.<strong>pdf</strong> (2002): <strong>Bahnhof</strong>sprojekte. S. 16<br />
http://jaltcall.org/conferences/call2007/mod/resource/view.php?id=4<br />
(Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
http://members.aol.com/hallerwillem (Letzter Zugriff: 28.06.2007)<br />
http://persoenlicherfahrplan.bahn.de/bin/pf/query-p2w.exe/dn?<br />
(Letzter Zugriff: 13.06.07)<br />
http://pic.templetons.com/brad/photo/japan/tokyo-above/ (Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
246
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin_Zoologischer_Garten, „Das Bild der <strong>Bahnhof</strong> im 70- 80<br />
Jahren“<br />
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_kolejowy „Der Regreß des <strong>Bahnhof</strong>s <strong>und</strong> seines<br />
Architektur”<br />
http://www.3sat.de/nano/bstuecke/97592/index.html (2006): Bahnprivatisierung in<br />
England ein schlimmer Misserfolg. (Letzter Zugriff: 21.07.2007)<br />
http://www.achwir.net/sw/bahnhof_wilhelmshoehe.php<br />
http://www.aferry.de/eurostar-de.htm (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.attac.de/privatisierung/privatisierungswahn/railtrack.html (2007). Die Welt<br />
im Privatisierungswahn. (Letzter Zugriff: 07.07.2007)<br />
http://www.bahn.de/p/view/planen/reiseplanung/streckenkarten_fernv.shtml<br />
(Letzter Zugriff: 24.05.07)<br />
http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/nord/hannover__hbf/bahnhofsteam/bahnhofs<br />
team.html (2007): Mitarbeiter sorgen für Service, Sicherheit <strong>und</strong> Sauberkeit im <strong>Bahnhof</strong>.<br />
Deutsche Bahn AG. (Letzter Zugriff: 28.07.2007)<br />
http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/start.html (Letzter Zugriff: 11.07.2007)<br />
http://www.baufachinformation.de/zeitschriftenartikel.jsp?z=06019018865 (2005): Von<br />
Kathedralen des Verkehrs zu Einkaufszentren mit Gleisanschluss – Bahnhöfe.<br />
Frauenhofer Informationszentrum für Raum <strong>und</strong> Bau. (Letzter Zugriff: 21.05.2007)<br />
http://www.bayerischestaatszeitung.de/index.jsp?MenuID=33&year=2006&ausgabeID=261&rubrikID=2&artikel<br />
ID=3188 (2006): Wirtschaftsfaktor Hauptbahnhof. Bayrische Staatszeitung.<br />
(Letzter Zugriff: 20.07.2007)<br />
http://www.berlin.ihk24.de/produktmarken/standortpolitik/analysen_fakten/wirtschaft_in<br />
_zahlen/Top-Liste.jsp (2006): IHK Berlin, Die 100 größten Arbeitgeber der Berliner<br />
Wirtschaft. (Letzter Zugriff: 24.06.2007)<br />
http://www.berliner-verkehrsseiten.de/s-bahn/Strecken/Elektrifizierung/S_21/s_21.html<br />
(2006): Planungslinie S 21 (Berlin). (Letzter Zugriff: 13.07.2007)<br />
http://www.cafepress.com/commutershirts/2003345 (Letzter Zugriff: 15.07.2007)<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/unternehmen/konzern/aufeinenblick/aufeinenblick.html<br />
(Letzter Zugriff: 24.06.07)<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/netz/trassen/software<br />
/trassenpreisauskunft__tpis.html (Letzter Zugriff: 24.05.07)<br />
247
http://wwwcda2.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/vertraege__agb/abp__station<strong>und</strong>service__200<br />
70410.<strong>pdf</strong> (Letzter Zugriff: 07.06.07)<br />
http://www.bahnhof.de/site/bahnhoefe/de/sued/stuttgart__hbf/daten__<strong>und</strong>__fakten/dat<br />
en__<strong>und</strong>__fakten__.html (2007) (Letzter Zugriff: 24.06.2007)<br />
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/umweltbericht2005<br />
__download-version.<strong>pdf</strong> (Letzter Zugriff: 24.06.07)<br />
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/vermietungsbroschuere__b<br />
ahnhoefe.<strong>pdf</strong> (2007): Vermietungsbroschüre. DB Station & Service AG. S. 5<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/b<br />
ahnhofsagentur/bahnhofs__agentur.html (2007): <strong>Bahnhof</strong>sagentur Deutsche Bahn AG.<br />
(Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/umweltbericht2005<br />
__download-version.<strong>pdf</strong> (Letzter Zugriff: 24.06.07)<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/b<br />
ahnhofskategorien/bahnhofs__kategorien.html (Letzter Zugriff: 25.06.2007)<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/b<br />
ahnhofsagentur/bahnhofs__agentur.html(2007):<strong>Bahnhof</strong>sagentur<br />
(Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
Deutsche Bahn AG.<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/b<br />
ahnhofsagentur/bahnhofs__agentur.html (2007): <strong>Bahnhof</strong>sagentur Deutsche Bahn AG.<br />
(Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/b<br />
ahnhofskategorien/bahnhofs__kategorien.html (Letzter Zugriff: 24.06.07)<br />
http://www.db.de/site/bahn/de/unternehmen/konzern/gesellschaften/infrastruktur__dien<br />
stleistungen/personenbahnhoefe/personenbahnhoefe.html (2007): DB Station & Service<br />
AG, Firmenprofil. (Letzter Zugriff: 24.06.2007)<br />
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/sonstige/db__station<strong>und</strong>se<br />
rvice__kompetenzprofil.<strong>pdf</strong>:DBStation&Service2007): Das Kompetenzprofil. Entwicklung,<br />
Vermarktung <strong>und</strong> Betrieb von Personenbahnhöfen.<br />
(Letzter Zugriff: 24.06.2007)<br />
http://www.das-neue-dresden.de/hauptbahnhof.html (Letzter Zugriff: 15.07.2007)<br />
http://www.directrail.com/eurostar_lille.html (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://www.dwds.de/?woerterbuch=1&corpus=1&kompakt=1&last_corpus=DWDS&qu=Z<br />
entrum (2007): Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Das Digitale<br />
Wörterbuch der Deutschen Sprache des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts. (Letzter Zugriff: 10.07.2007)<br />
248
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/<br />
Doc~E8DED40C6AEAB4F529FDF6962157CD02A~ATpl~Ecommon~Scontent.html<br />
(Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.geocities.com/londondestruction/broadstreet.html (Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
http://www.gerhardfrey.de/-/Russell_Hollowood.html (2006): Die traurige Geschichte<br />
der Privatisierung der britischen Bahn. (Letzter Zugriff: 18.07.2007)<br />
http://www.gleisbau-welt.de/site/gleisbau/einteilung.htm (Letzter Zugriff: 02.07.07)<br />
http://www.gleisbau-welt.de/site/gleisbau/einzelteile.htm (Letzter Zugriff: 02.02.07)<br />
http://www.gleisbau-welt.de/site/gleisbau/gleisbau.htm (Letzter Zugriff: 02.07.07)<br />
http://www.gradnet.de/papers/pomo2.papers/wucherpfennig00.htm(2007):Wucherpfenn<br />
ig.Architektur,Atmosphäre,Diskurs Zur Ästhetisierung eines städtischen Raumes im Zuge<br />
der “Renaissance der Bahnhöfe. (Letzter Zugriff: 21.07.2007)<br />
http://www.hbfberlin.de/site/berlin_hauptbahnhof/de/geschichte/das_19_jahrh<strong>und</strong>ert/da<br />
s_19_jahrh<strong>und</strong>ert.html (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://www.hbf-berlin.de/site/berlin__hauptbahnhof/de/geschichte/das 20_jahrh<strong>und</strong>ert/<br />
das_20_jahrh<strong>und</strong>ert.html (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://www.hbf-berlin.de/site/berlinhauptbahnhof/de/geschichte/nach_dem_mauerfall/<br />
nach_dem_mauerfall.html (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://www.iankitching.me.uk/travel/london/2000/0311.html (Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
http://www.japan-guide.com/e/e3011.html (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.japan-guide.com/e/e3037.html (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.japaneselifestyle.com.au/tokyo/shibuya.htm (Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
http://www.linternaute.com/imprimer/sortir/lille-l-exuberante-du-nord/le-quartiermoderne-euralille.shtml<br />
(Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
http://www-lor.int-evry.fr/~vincent/VisiteLille/vis_phot.html (Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
http://www.mairie-lille.fr/sections/site-fr/Menu_horizontal_haut/Tourisme-<br />
Decouvrir_Lille/tourisme/Tourisme_d_affaires/?theme=printable<br />
(Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
http://www.mdot-realestate.org/tod.asp (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://www.morgenpost.de/content/2005/10/02/berlin/783242.html(2005):<br />
Schwarzlicht-Kunst ganz bunt im U3-Event-<strong>Bahnhof</strong> am Potsdamer Platz. Berliner<br />
Morgenpost. (Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
249
http://www.morgenpost.de/content/2007/02/08/berlin/881803.html (28.02.2007): Viele<br />
Geschäfte schließen schon um 20 Uhr - Ladenschluss: Seit Beginn des Jahres kehrt der<br />
Einzelhandel zu den alten Öffnungszeiten zurück. (Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
http://www.mybritishrail.de/tanfieldrailway.htm(2007):TanfieldRailway.<br />
(Letzter Zugriff: 22.07.2007)<br />
http://www.networkrail.co.uk/aspx/1584.aspx(2007):NetworkRailStationDevelopment.<br />
(Letzter Zugriff: 24.06.2007)<br />
http://www.oebb-immobilien.at/vip8/immo/de/Film_<strong>und</strong>_Event/index.jsp(2007):ÖBB<br />
Immobilien. (Letzter Zugriff: 21.06.2007)<br />
http://www.paris.org/Gares/Austerlitz/austerlitz.f.html (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.paris.org/Gares/de.l.Est/est.f.html (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.paris.org/Gares/Lyon/lyon.html (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.paris.org/Gares/Montparnasse/ (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.paris.org/Gares/Nord/nord.html (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.ph-linz.at/LuF/flora/Unkraut.html (Letzter Zugriff: 27.06.07)<br />
http://www.search.com/reference/Marunouchi, Zugriff am 10.07.07<br />
http://www.sengers.ch/basel/basel/basel-1.asp:SchweizBilder:<strong>Stadt</strong>Basel.<br />
(Letzter Zugriff: 23.06.2007)<br />
http://www.smartergrowth.net/issues/landuse/tod/history.htm<br />
(Letzter Zugriff: 30. 06. 2007)<br />
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,489489,00.html: Spiegel Online: Simons,<br />
Stefan (2007): Neue TGV-Strecke – Frankreich schrumpft. (Letzter Zugriff: 27.06.2007)<br />
http://www.spiekermann.de/Hochbau/Referenzen/MTC_3do.<strong>pdf</strong>: Spiekermann Beratende<br />
Ingenieure: Multi- Themen- Center 3do – Dortm<strong>und</strong> Hbf. (Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
http://www.stuttgarter-zeitung.de/<strong>pdf</strong>/sonderthemen/immostandort.<strong>pdf</strong><br />
(2007): Anzeigensonderveröffentlichung - Der Immobilienstandort Stuttgart. Stuttgarter<br />
Zeitung. (Letzter Zugriff: 21.05.2007)<br />
http://www.subbrit.org.uk/sb-sites/stations/b/broad_street/index.shtml<br />
(Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/27.05.2006/2557461.asp: Der Tagesspiegel<br />
(27.05.2006), Berlins gläsernes Tor zur Welt. (Letzter Zugriff: 16.05.2007)<br />
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/;art271,2006708 (2007): Neue Hürden für die<br />
Bahnprivatisierung. Der Tagesspiegel.10.04.2007. (Letzter Zugriff: 12.07.2007)<br />
250
http://www.thalys.com/ (Letzter Zugriff: 09.07.07)<br />
http://www.urban75.org/london/broad-street.html (Letzter Zugriff: 10.07.07)<br />
http://www.visitlondon.com/, Zugriff 09.07.07<br />
http://www.voila-uhren.de/index.php?blog=64&page=1&paged=2<br />
(Letzter Zugriff: 15.07.2007)<br />
http://www.wedebruch.de/gesetze/betrieb/ebo1.htm (Letzter Zugriff: 27.06.07)<br />
http://www.wedebruch.de/gesetze/gr<strong>und</strong>lagen/aeg_200612zwei.htm#para15<br />
(Letzter Zugriff: 27.06.07)<br />
http://www.welt.de/print-wams/article142455/Abschied_vom_<strong>Bahnhof</strong>_Zoo.html<br />
(2006): Abschied vom <strong>Bahnhof</strong> Zoo. Die Welt. (Letzter Zugriff: 13.07.2007)<br />
http://www.westbahn.de/bahn/dv_titel/dv_dbn/dv_dbn-mitgelt/dv_dbn-mitgelt.html<br />
(Letzter Zugriff: 03.07.07)<br />
http://www.wdr.de/tv/service/geld/inhalt/20050616/b_2.phtml (2005): Sonntagseinkauf<br />
im Hauptbahnhof – Teure Supermärkte? WDR. (Letzter Zugriff: 26.06.2007)<br />
http://www.wiebel.de/<strong>pdf</strong>/christaller.<strong>pdf</strong> (2001): Wiebel, Dirk. Christallers Theorie der<br />
Zentralen Orte. (Letzter Zugriff: 29.07.2007)<br />
http://www.be-active.ch/passerelle: Passerelle Basel SBB. (Letzter Zugriff: 26.06.2007)<br />
http://www.hochgeschwindigkeitszuege.com<br />
http://www.itten-brechbuehl.ch:<br />
(Letzter Zugriff: 23.06.2007)<br />
Itten+Brechbuehl AG: Projekte: Verkehr.<br />
http://www.kassel.de<br />
http://www.lgc.org/freepub/land_use/articles/buildcomm/page01.html<br />
(Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://www.railcity.ch/index_basel.htm: RailCity Basel. (Letzter Zugriff: 25.06.2007)<br />
http://www.railport.de<br />
http://www.solingen-internet.de<br />
http://www.stuttgart.de<br />
http://www.stuttgart21.de<br />
http://www.transitorienteddevelopment.org (Letzter Zugriff: 30.06.2007)<br />
http://www.uni-stuttgart.de<br />
251
http://www5.in.tum.de/lehre/seminare/semsoft/unterlagen_02/eisenbahn/website/privat<br />
isierung.html (kein Datum): Die Privatisierung der Eisenbahn in England.<br />
(Letzter Zugriff: 28.07.2007)<br />
252
Tabellenverzeichnis:<br />
Tabelle 1: <strong>Bahnhof</strong>sarten nach baulicher Anordnung der Gleis- <strong>und</strong> sonstigen<br />
Anlagen <strong>und</strong> nach Funktion ...................................................................... 10<br />
Tabelle 2: Gegenüberstellung von Vor- <strong>und</strong> Nachteilen der Vermietung aus Sicht<br />
der Deutschen Bahn AG ........................................................................... 22<br />
Tabelle 3: Nutzer- Bedarfs- Analyse der Deutschen Bahn AG ......................... 25<br />
Tabelle 4: Ladenfläche in den Top-Bahnhöfen der Deutschen Bahn................. 29<br />
Tabelle 5: Auflistung großer Einzelhandelszentren in/um Leipzig .................... 30<br />
Tabelle 6: Auflistung großer Einzelhandelszentren in/um Frankfurt ................. 32<br />
Tabelle 7: Übersicht der Modulfamilie 813 des technischen Regelwerks der<br />
Deutschen Bahn AG ................................................................................ 40<br />
Tabelle 8: Kategorisierung von Bahnsteigen nach DB Station & Service AG ..... 45<br />
Tabelle 9: Matrix der Ausstattungsmerkmale eines Bahnsteigs je Kategorie ..... 46<br />
Tabelle 10: Verbindungsmatrix ................................................................. 53<br />
Tabelle 11: Klassierung nach Verbindungszahl je Woche ............................... 55<br />
Tabelle 12: Ergebnisübersicht der Zugverkehrsanalyse ................................. 61<br />
Tabelle 13: Streckenkategorien <strong>und</strong> ihre Merkmale ...................................... 64<br />
Tabelle 14: Trassenprodukte <strong>und</strong> ihre Faktoren ........................................... 66<br />
Tabelle 16: <strong>Bahnhof</strong>skategorien der DB Station & Service AG ........................ 70<br />
Tabelle 17: Stationspreisliste der DB Station & Service AG, nach B<strong>und</strong>esländern<br />
geordnet (alle Angaben in €) .................................................................... 71<br />
Tabelle 18: Stationspreise je Verkehrshalt für die 20 deutschen Kategorie-1-<br />
Bahnhöfe, nach Höhe des Preises sortiert ................................................... 72<br />
Tabelle 19: Leistungen je <strong>Bahnhof</strong>skategorie gemäß ABP .............................. 77<br />
Tabelle 20: Arbeitsplätze in den Bahnhöfe ................................................ 83<br />
Tabelle 21: Anteile der kommerziellen Flächen in den 20 größten Bahnhöfen ... 85<br />
Tabelle 22: Ergebnisse der Analyse der Homepages ..................................... 95<br />
Tabelle 23: Zeittafel der Stile der <strong>Bahnhof</strong>sarchitektur ................................ 169<br />
Tabelle 24: Vor- <strong>und</strong> Nachteile einer poly- bzw. monozentrischen<br />
Siedlungsstruktur im Hinblick auf das Bahnangebot <strong>und</strong> die Siedlungsdispersion<br />
........................................................................................................... 178<br />
Tabelle 25: Gemeinsamkeiten aller <strong>Bahnhof</strong>sumfelder ................................. 197<br />
Tabelle 26: Typ 1 die <strong>Bahnhof</strong>sumfelder der Kopfbahnhöfe .......................... 197<br />
Tabelle 27: Gemeinsamkeiten aller Durchgangsbahnhöfe ............................. 198<br />
Tabelle 28: Typ 2 Durchgangsbahnhöfe mit Strukturunterschieden hinter dem<br />
<strong>Bahnhof</strong> ................................................................................................ 198<br />
Tabelle 29: Typ 3 Durchgangsbahnhöfe ohne starke Strukturunterschiede im<br />
Umfeld ................................................................................................. 199<br />
253
Abbildungsverzeichnis:<br />
Abb. 1: Vermietungsbroschüre der DB Station & Service AG .......................... 12<br />
Abb. 2: Vermietungsumsätze der Bahnhöfe der Deutschen Bahn AG 2006 ....... 20<br />
Abb. 3: Personenbezeichnungen in einem <strong>Bahnhof</strong> ...................................... 27<br />
Abb. 4: Darstellung der Einzelhandelszentren in/um Leipzig .......................... 31<br />
Abb. 5: Bahnhöfe der Kategorie 1 haben Flughäfen zum Benchmark .............. 33<br />
Abb. 6: Aufbau des Gleises ....................................................................... 42<br />
Abb. 7: Querschnitt durch den Bahnkörper ................................................. 43<br />
Abb. 8: Querschnitt durch den Bahnsteigkörper ........................................... 47<br />
Abb. 9: Beispielrechnung ......................................................................... 48<br />
Abb. 10: Städte mit Kategorie-1-Bahnhöfen ............................................... 51<br />
Abb. 11: ICE-Netz 2007 ........................................................................... 56<br />
Abb. 12: EC-/IC-Netz 2007 ...................................................................... 57<br />
Abb. 13: Trassenpreisformel ..................................................................... 62<br />
Abb. 14: Trassen <strong>und</strong> ihre Kategorien im Bereich der DB Netz AG Niederlassung<br />
West (Ausschnitt) ................................................................................... 65<br />
Abb. 15: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Mobility Switch Point“ 84<br />
Abb. 16: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Kommerzielle<br />
Flächennutzung“ ..................................................................................... 85<br />
Abb. 17: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Identität“ ................. 88<br />
Abb. 18: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Raumgliederung“ ...... 89<br />
Abb. 19: Die Hierarchiestufen für die <strong>Bahnhof</strong>sfunktion „Wirtschafsstandort“ ... 89<br />
Abb. 20: Impuls des Hochgeschwindigkeitsverkehrs (HGV) in Kassel-<br />
Wilhelmshöhe in Abhängigkeit von der Entfernung zum <strong>Bahnhof</strong> ................... 106<br />
Abb. 21: Identifizierung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes durch einen fußläufig<br />
erreichbaren Radius ............................................................................... 108<br />
Abb. 22: Identifizierung des <strong>Bahnhof</strong>sumfeldes nach den entwickelten Funktionen<br />
........................................................................................................... 109<br />
Abb. 23: Identifizierung durch Erkennung des Entwicklungspotenzials ........... 110<br />
Abb. 24: Frankfurt am Main 1873 <strong>und</strong> 1887 ............................................... 113<br />
Abb. 25: Frankfurt am Main 1903 <strong>und</strong> 1936 ............................................... 115<br />
Abb. 26: München: alter Hauptbahnhof. (1847-1949) <strong>und</strong> <strong>Bahnhof</strong>sneubau (ab<br />
1960) ................................................................................................... 118<br />
Abb. 27: Frankfurt/M: Luftbild <strong>und</strong> städtebaulicher Entwurf für Frankfurt21<br />
(1996) ................................................................................................. 120<br />
Abb. 28: Planungsinstrumente bei der Standortentwicklung ehemaliger<br />
Bahnverkehrsflächen in Kernstadtbereichen ............................................... 127<br />
Abb. 29: Projekte von EuroVille ................................................................ 137<br />
Abb. 30: Luftbild der Passerelle von Südwesten <strong>und</strong> Passerelle von Innen ...... 138<br />
Abb. 31: Luftbild der Passerelle von Südwesten <strong>und</strong> Passerelle von Innen ...... 138<br />
Abb. 32: Streckenverlauf der ICE–NBS Köln-Rhein/ Main ............................. 151<br />
Abb. 33: Räumliche Lage des ICE-<strong>Bahnhof</strong>s Limburg Süd ............................ 152<br />
Abb. 34: <strong>Bahnhof</strong> Limburg Süd ................................................................ 153<br />
Abb. 35: Lage des ICE-<strong>Bahnhof</strong>s Limburg im <strong>Stadt</strong>gebiet ............................. 154<br />
Abb. 36: Blick vom ICE-<strong>Bahnhof</strong> Richtung <strong>Stadt</strong>zentrum .............................. 154<br />
Abb. 37: Städtebaulicher Entwicklungsbereich............................................ 155<br />
Abb. 38: Alter <strong>Bahnhof</strong> in Kassel-Wilhelmshöhe .......................................... 156<br />
Abb. 39: <strong>Bahnhof</strong> Kassel-Wilhelmshöhe..................................................... 157<br />
Abb. 40: Alter <strong>Bahnhof</strong> Solingen Abb. 41: Solingen Hauptbahnhof 1933 ....... 158<br />
Abb. 42: Solingen Hauptbahnhof nach dem zweiten Weltkrieg ...................... 159<br />
Abb. 43: Stuttgart Hauptbahnhof ............................................................. 159<br />
254
Abb. 44: Projekt Stuttgart 21 .................................................................. 160<br />
Abb. 45: Der städtebauliche Rahmenplan von Stuttgart21 ........................... 161<br />
Abb. 46: <strong>Bahnhof</strong> Bozen ......................................................................... 162<br />
Abb. 47: Umverlegung des <strong>Bahnhof</strong>s (3 Varianten) ..................................... 163<br />
Abb. 48: Neugestaltung des <strong>Bahnhof</strong>sareals .............................................. 164<br />
Abb. 49: Siedlungsentwicklung in Gemeinden mit <strong>und</strong> ohne Bahnanschluss .... 173<br />
Abb. 50: Entwicklungsmöglichkeiten einer Siedlung .................................... 179<br />
Abb. 51: Bürgerbus zur Befahrung stillgelegter ÖPNV Strecken ..................... 183<br />
Abb. 52: Frankfurt am Main Typ 1 nah Abb. 53: Strukturmodell Typ 1 nah .. 201<br />
Abb. 54: Frankfurt am Main Typ 1 fern Abb. 55: Strukturmodell Typ 1 fern .. 201<br />
Abb. 56: Düsseldorf Typ 2 nah Abb. 57: Strukturmodel Typ 2 nah ......... 203<br />
Abb. 58: Düsseldorf Typ 2 fern Abb. 59: Strukturmodel Typ 2 fern ......... 203<br />
Abb. 60: Hamburg Typ 3 nah Abb. 61: Strukturmodel Typ 3 nah ......... 206<br />
Abb. 62: Hamburg Typ 3 fern Abb. 63: Strukturmodel Typ 3 fern ......... 206<br />
Abb. 64: Berlin Hauptbahnhof nah Abb. 65: Berlin Hauptbahnhof fern ......... 208<br />
Abb. 66: Gare Lille Europe nah Abb. 67: Gare Lille Europe fern .............. 209<br />
Abb. 68: Shibuya Station Tokio nah Abb. 69: Shibuya Station Tokio fern ..... 210<br />
Abb. 70: Das Hauptportal des <strong>Bahnhof</strong>s in Helsinki 1904 ............................. 215<br />
Abb. 710: Ein Vorstadtbahnhof, Sarcelles, Frankreich .................................. 216<br />
Abb. 72: S. Kelper: Liverpool Lime Street .................................................. 220<br />
Abb. 73: Claude Monet: Gare Saint Lazare ................................................ 223<br />
Abb. 74: Gino Severinis: Suburban Train arriving at Paris ............................ 224<br />
Abb. 75: Gustav W<strong>und</strong>erwalds, Railway Embankment Berlin N. .................... 225<br />
Abb. 76: Geschäftsviertel r<strong>und</strong> um den Shibuya <strong>Bahnhof</strong> ............................. 228<br />
Abb. 77: Shinjuku-<strong>Bahnhof</strong> mit angrenzendem Geschäftsviertel ................... 229<br />
Abb. 78: Vor dem Shinjuku-<strong>Bahnhof</strong> ......................................................... 229<br />
Abb. 79: Der Hauptbahnhof von Tokio ...................................................... 230<br />
Abb. 80: Eine historische Abbildung des <strong>Bahnhof</strong>s um 1900 ......................... 231<br />
Abb. 81: Broad Street Station in den 1940ern ............................................ 232<br />
Abb. 82: moderner Bürokomplex am alten Standort des <strong>Bahnhof</strong>s ................ 232<br />
Abb. 83: Luftaufnahme von Euralille ......................................................... 235<br />
Abb. 84: Einkaufszentrum Triangle des Gare .............................................. 236<br />
Abb. 85: Moderne Bürotürme neben dem TGV-<strong>Bahnhof</strong> ............................... 237<br />
255