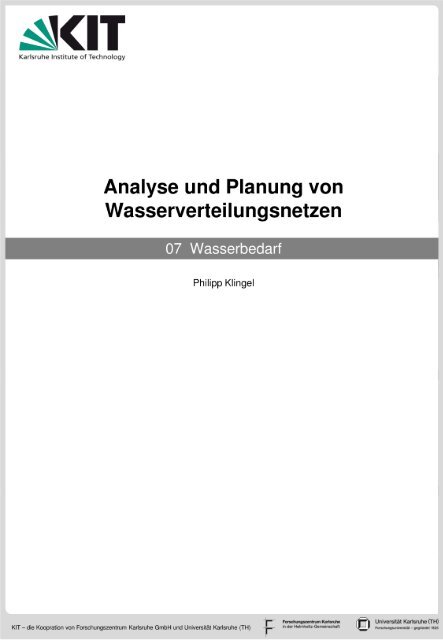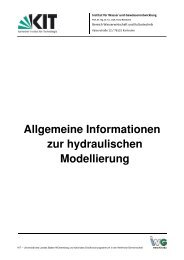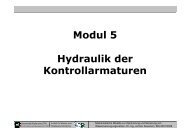07 Wasserbedarf
07 Wasserbedarf
07 Wasserbedarf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2<br />
3<br />
Überblick<br />
Einleitung<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Industrieller/gewerblicher/öffentlicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Löschwasserbedarf<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
Modellierung von <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Einleitung<br />
Verbraucher<br />
Bevölkerung<br />
Kleingewerbebetriebe<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Gewerbe- und Industriebetriebe<br />
Landwirtschaft<br />
Öffentliche Einrichtungen (Schulen,<br />
Krankenhäuser, Stadtreinigung etc.)<br />
Feuerschutz<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
[A. Knobloch]
4<br />
5<br />
Einleitung<br />
Einflüsse auf die benötigte Rohrnetzeinspeisung<br />
Soziale Faktoren<br />
Ökonomische Faktoren<br />
Einleitung<br />
Technische Faktoren<br />
Politische Faktoren<br />
Wasserverbrauch<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Tatsächliche in einer bestimmten Zeitspanne im Rahmen der Wasserversorgung<br />
abgegebene Wassermenge (DIN 4046, 1983).<br />
<strong>Wasserbedarf</strong><br />
Planungswert für die in einer bestimmten Zeitspanne benötigte<br />
Wassermenge, die ein Wasserversorgungssystem unter Einhaltung<br />
der Versorgungskriterien liefern muss (DIN 4046, 1983).<br />
Dabei wird zwischen Trinkwasserbedarf, Betriebswasserbedarf, Haus-<br />
haltswasserbedarf, Löschwasserbedarf, Bewässerungsbedarf Bewässerungsbedarf usw.<br />
unterschieden.<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
6<br />
7<br />
Einleitung<br />
Analyse und Planung<br />
Wo wird Wasser verbraucht ?<br />
Wie viel Wasser wird verbraucht ?<br />
Wie variiert der Wasserverbrauch über die Zeit ?<br />
Modellierung<br />
Ermittlung der Bedarfsmengen (durchschnittl. Tagesbedarfswerte)<br />
Ermittlung der zeitlichen Variation (Spitzenfaktoren und Ganglinien)<br />
Ermittlung der räumlichen Zuordnung des <strong>Wasserbedarf</strong>s<br />
Berücksichtigung der Wasserverluste<br />
Ggf. Berücksichtigung des Löschwasserbedarfs<br />
Ggf. Projektion der Bedarfswerte für die Planung<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Einflussfaktoren auf die Bedarfsmenge<br />
Klima<br />
Dargebot<br />
Sonstige Bezugsquellen<br />
Wasserqualität<br />
Wasserpreis und Kontrolle der Abnahme<br />
Kanalisation<br />
Lebensstandard<br />
Größe Versorgungsgebiet / Einwohneranzahl<br />
Wasserverluste<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
(Mutschmann & Stimmelmayr, 20<strong>07</strong>)
8<br />
9<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Einwohnerbezogene Tagesmittelwerte in Deutschland<br />
Die DVGW W 410 (2008) definiert den mittleren einwohnerbezogenen<br />
Tagesverbrauch inkl. Kleingewerbe qdm, der meist aus dem Jahres-<br />
bedarf/verbrauch Q Qa ermittelt wird:<br />
q dm ... Mittlerer einwohnerbezogener Tagesverbrauch [l/E/d]<br />
Q a ... Jährlicher <strong>Wasserbedarf</strong> [m³/a]<br />
Der mittlere Tagesbedarf Q dm ergibt sich aus dem jährlichen <strong>Wasserbedarf</strong><br />
oder dem einwohnerbez. Tagesverbrauch und den Einwohnern:<br />
Q<br />
dm<br />
Qa<br />
qdm<br />
⋅E<br />
= =<br />
365 1000<br />
Q dm ... Mittlerer Tagesbedarf [m³/d]<br />
E ... Einwohner [Personen]<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Einwohnerbezogene Tagesmittelwerte in Deutschland<br />
Extrem: q dm = 60 – 500 l/E/d<br />
Normal: q dm = 90 – 140 l/E/d<br />
Mittelfristige Prognose: q dm = 120 l/E/d<br />
q dm<br />
[l/E/d]<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100 [Jahr]<br />
1990 1995 2000 2005<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
(DVGW W 410, 2008)
10<br />
11<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Komponenten des häuslichen Bedarfs in Deutschland<br />
Körperpflege (K)<br />
WC-Spülung (WC)<br />
Wäsche (W)<br />
Geschirr (G)<br />
Reinigung & Garten (RG)<br />
Trinken & Essen (TE)<br />
Kleingewerbe (KG)<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
[l/E/d]<br />
gesamt<br />
120<br />
Komponenten des häuslichen Bedarfs in Deutschland<br />
Körperpflege (K)<br />
WC-Spülung (WC)<br />
Wäsche (W)<br />
Geschirr (G)<br />
Reinigung & Garten (RG)<br />
Trinken & Essen (TE)<br />
Kleingewerbe (KG)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
[%]<br />
gesamt<br />
100<br />
(DVGW W 410, 2008)<br />
(DVGW W 410, 2008)
12<br />
13<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Spezifischer Verbrauch der Komponenten in Deutschland<br />
Komponente Verbrauch [l/Vorgang]<br />
Wannenbad 115 – 180<br />
Waschmaschine 50 – 175<br />
Dusche 40 – 80<br />
Geschirrspülen (Hand) 25 – 40<br />
Geschirrspülen (Maschine) 15 – 50<br />
WC-Spülung 6 – 12<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Wasserverbrauch im internationalen Vergleich<br />
[l/E/d]*<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
(Mutschmann & Stimmelmayr, 20<strong>07</strong>)<br />
[Land]<br />
* Mittlerer einwohnerbezogener Tagesverbrauch inklusive Kleingewerbe (Karger u.a., 2005)
14<br />
15<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Schwankungen des <strong>Wasserbedarf</strong>s<br />
Der <strong>Wasserbedarf</strong> schwankt bezogen auf die durchschnittlichen Tagesund<br />
Stundenwerte. Bezogen auf die Jahreswerte schwankt der<br />
<strong>Wasserbedarf</strong> nur geringfügig.<br />
Mittlerer Tagesbedarf Q dm schwankt über das Jahr<br />
Mittlerer Tagesbedarf Q dm schwankt über die Woche<br />
Mittlerer Stundenbedarf Q hm schwankt über den Tag<br />
Einflussfaktoren auf die Bedarfsschwankungen<br />
Klima und Jahreszeit (Bewässerung etc.)<br />
Freizeit (Wochenenden, Feiertage, Betriebsferien, Schulferien etc.)<br />
Struktur des Versorgungsgebiets<br />
Größe des Versorgungsgebiets<br />
Tagesablauf<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Charakteristische Ganglinie des Tagesbedarfs<br />
[<strong>Wasserbedarf</strong>]<br />
Aufstehen<br />
Mittag Feierabend<br />
Zubettgehen<br />
0 6 12 18 24<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
[Uhr]<br />
(Karger u.a., 2005)
16<br />
17<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Charakteristische Ganglinie des Wochenbedarfs<br />
[<strong>Wasserbedarf</strong>]Arbeitstage<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
WE Arbeits- WE Arbeits- WE<br />
tagetage 0 7 14 21<br />
So So So So<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Schwankungen des <strong>Wasserbedarf</strong>s im Jahr<br />
[Tag]<br />
(Karger u.a., 2005)<br />
Die DVGW W 410 (2008) definiert den maximalen Tagesbedarf Qdmax eines Betrachtungszeitraums (z.B. 1, 10, 20 Jahre) in einem Versor-<br />
gungsgebiet zwischen 0.00 und 24.00 Uhr:<br />
Q dmax ... Maximaler Tagesbedarf [m³/d]<br />
Das Verhältnis von maximalem zum mittlerem Tagesverbrauch gibt der<br />
Tagesspitzenfaktor f d an (DVGW W 410, 2008):<br />
Q<br />
f d =<br />
Q<br />
d max<br />
dm<br />
f d ... Tagesspitzenfaktor [ - ]<br />
Q dm ... Mittlerer Tagesbedarf [m³/d]<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
18<br />
19<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Schwankungen des <strong>Wasserbedarf</strong>s am Tag<br />
Die DVGW W 410 (2008) definiert für die Schwankungen der Stundenwerte<br />
den Stundenbedarf Q(h) zur Stunde h:<br />
Q(h) ... Tageszeit abhängiger Stundenbedarf [m³/h]<br />
Außerdem ist der durchschnittliche Stundenbedarf am Tag des mittleren<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>s Q hm definiert:<br />
Q<br />
hm<br />
Qdm<br />
Qa<br />
= =<br />
24 365 ⋅ 24<br />
Q hm ... Mittlerer Stundenbedarf [m³/h]<br />
Q dm ... Mittlerer Tagesbedarf [m³/d]<br />
Q a ... Jährlicher <strong>Wasserbedarf</strong> [m³/a]<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Schwankungen des <strong>Wasserbedarf</strong>s am Tag<br />
Das Verhältnis von Tageszeit abhängigem Stundenbedarf und mittlerem<br />
Stundenbedarf am Tag des mittleren <strong>Wasserbedarf</strong>s gibt der Tageszeit<br />
abhängige Lastfaktor f(h) an (DVGW W 410, 2008):<br />
Q(<br />
h)<br />
f ( h)<br />
=<br />
Q<br />
hm<br />
f(h) ... Tageszeit abhängiger Lastfaktor [ - ]<br />
Q(h) Q(h) ... ... Tageszeit abhängiger Stundenbedarf [m³/h]<br />
Q hm ... Mittlerer Stundenbedarf [m³/h]<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
20<br />
21<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Schwankungen des <strong>Wasserbedarf</strong>s am Tag<br />
Weiter ist der höchste Stundenbedarf am Tag des höchsten <strong>Wasserbedarf</strong>s<br />
Qhmax und der höchste Stundenbedarf am Tag mit durchschn.<br />
<strong>Wasserbedarf</strong> Q Qhmax, dm definiert. Analog wird der maximale Einwohner- Einwohnerbezogene<br />
Stundenverbrauch qhmax definiert (DVGW W 410, 2008):<br />
Q hmax ... Maximaler Stundenbedarf [m³/h]<br />
Q hmax,dm ... Maximaler Stundenbedarf am Durchschnittstag [m³/h]<br />
q hmax ... Maximaler einwohnerbezogener Stundenbedarf [l/E/s]<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Schwankungen des <strong>Wasserbedarf</strong>s am Tag<br />
Das Verhältnis von maximalem Stundenverbrauch bei maximalem<br />
Tagesverbrauch zu durchschnittlichem Stundenverbrauch im Betrach-<br />
tungszeitraum (mind. 1 Jahr) gibt der Stundenspitzenfaktor f fh an (DVGW<br />
W 410, 2008):<br />
Q<br />
f h =<br />
Q<br />
hmax<br />
hm<br />
f h ... Stundenspitzenfaktor [ - ]<br />
Q hmax ... Maximaler Stundenbedarf [m³/h]<br />
Q hm ... Mittlerer Stundenbedarf [m³/h]<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
22<br />
23<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Schwankungen des <strong>Wasserbedarf</strong>s am Tag<br />
Die tageszeitliche Schwankung des Bedarfs kann auch als Anteil st des<br />
Stundenbedarfs am Tagesbedarf beschrieben werden (DVGW W 410,<br />
2008):<br />
Q(<br />
h)<br />
st = ⋅100<br />
Q<br />
d<br />
st ... Stundenprozentwert [%]<br />
Q(h) ... Tageszeit abhängiger Stundenbedarf Stundenbedarf [m³/h]<br />
Q d ... Tagesbedarf [m³/h]<br />
Häuslicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Schwankungen des <strong>Wasserbedarf</strong>s am Tag<br />
Analog kann der maximale Stundenprozentwert stmax als Anteil des<br />
höchsten Stundenbedarfs am höchsten Tagesbedarf angegeben werden<br />
(DVGW W 410, 2008):<br />
st<br />
max<br />
Q<br />
=<br />
Q<br />
hmax<br />
dmax<br />
⋅100<br />
st max ... Maximaler Stundenprozentwert [%]<br />
Q Qhmax ... ... Maximaler Stundenbedarf [m³/h]<br />
Q dmax ... Maximaler Tagesbedarf [m³/h]<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
24<br />
25<br />
‚Sonstiger‘ <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Industrieller, gewerblicher und öffentlicher <strong>Wasserbedarf</strong>s<br />
Industriebetriebe<br />
Gewerbebetriebe<br />
Verwaltung<br />
Polizei<br />
Krankenhäuser<br />
Stadtreinigung<br />
Parkanlagen und öffentliche Brunnen<br />
Schulen<br />
Kindergärten<br />
. . .<br />
‚Sonstiger‘ <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Richtwerte für Gewerbe und Industrie (Auswahl)<br />
Gewerbe Einheit Mittlerer <strong>Wasserbedarf</strong> [m³]<br />
/ Einheit<br />
Bäckerei Arbeiter/Arbeitstag 0,15<br />
Metzgerei Arbeiter/Arbeitstag 0,25<br />
Brauerei 1000 l Bier 3,00<br />
Molkerei 1000 l Milch 4,00<br />
Industrie Einheit Mittlerer <strong>Wasserbedarf</strong><br />
[l/s] / Einheit<br />
Betriebe mit geringem Verbrauch Hektar 0,5 – 1,0<br />
Betriebe mit mittlerem Verbrauch Hektar 2,5 – 5,0<br />
Betriebe mit hohem Verbrauch Hektar 5,0 – 10,0<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
(Karger u.a., 2005)
26<br />
27<br />
‚Sonstiger‘ <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Richtwerte für öffentliche Einrichtungen (Auswahl)<br />
Einrichtung Einheit Mittlerer <strong>Wasserbedarf</strong> f d f h<br />
[m³/d] / Einheit<br />
Schulen Person 0,01 – 0,03 1,7 7,5<br />
Büros & Verwaltung Person 0,01 – 0,04 1,8 5,6<br />
Krankenhäuser Person 0,12 – 0,83 1,3 3,2<br />
Hotels Person 0,10 – 1,40 1,4 4,4<br />
Löschwasserbedarf<br />
Einflussgrößen<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Siedlungsform (Wohn-, Gewerbe-, Industriegebiet etc.)<br />
Zahl der Geschosse<br />
Geschossflächenzahl<br />
Baumassenzahl<br />
Brandausbreitungsgefahr<br />
Zuständigkeiten in Deutschland<br />
Geregelt in Gesetzen der Länder<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
(Karger u.a., 2005; DVGW W 410, 2008)<br />
Löschwasserbedarf wird meist von der Feuerwehr bestimmt<br />
Wasserversorger ist für die Bereitstellung verantwortlich
28<br />
29<br />
Löschwasserbedarf<br />
Richtwerte für bauliche Nutzung (Auswahl)<br />
Siedlungsform Kleine Brandausbreitungsausbreitungsgefahr<br />
Kleinsiedlungen<br />
Wochenendhausgebiete<br />
Reine Wohngebiete<br />
Allg. Wohngebiete<br />
Mischgebiete<br />
Dorfgebiete<br />
Gewerbegebiete<br />
Kerngebiete<br />
Gewerbegebiete<br />
Mittlere Brandausbreitungsausbreitungsgefahr<br />
Große Brandausbreitungsgefahr<br />
24 m³/h 48 m³/h 96 m³/h<br />
48 m³/h 96 m³/h 96 m³/h<br />
96 m³/h 96 m³/h 192 m³/h<br />
Industriegebiete 96 m³/h 192 m³/h 192 m³/h<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
Analyse und Planung<br />
(Mutschmann & Stimmelmayr, 20<strong>07</strong>; DVGW W 405, 2008)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des durchschnittlichen <strong>Wasserbedarf</strong>s (Basisbedarf)<br />
Ist-Zustand<br />
Zukünftig (Schätzung)<br />
Differenzierung zw. häuslichem und gewerblichem/industriellen/<br />
öffentlichem <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ggf. Berücksichtigung der Wasserverluste<br />
Ggf. Berücksichtigung der Löschwasserversorgung<br />
Umrechnung auf Spitzenfaktoren (Skalierung der<br />
Basisbedarfswerte) für verschiedene Bemessungsaufgabn<br />
Umrechnung auf Bezugszeiten für die Bemessung bestimmter<br />
Anlagenteile (ZW, HW, VW, AW)<br />
> 09 Bemessung<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
30<br />
31<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
Bezugszeiten<br />
Bemessung auf maximale Durchflüsse führt zu Überbemessung<br />
(Kosten, hygienische Probleme)<br />
Bemessung der Versorgungsanlagen auf Spitzendurchflüsse Q S<br />
und Bezugszeiten t B (DVGW W 410, 2008)<br />
Bei Angabe eines Spitzendurchflusses und einer Bezugszeit ist der<br />
tatsächliche Durchfluss maximal die Dauer der Bezugszeit größer<br />
als der angegebene Spitzendurchfluss<br />
Q<br />
Q S<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
t<br />
t<br />
0 1 t2 t3 24<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Bezugszeiten nach DVGW W 410 (2008)<br />
t i = Bezugszeit t B<br />
Anlagenteil Spitzendurchfluss Q S Bezugszeit t B<br />
Anschlussleitung (AW) Spitzendurchfluss 10 s<br />
Zubringer-, Haupt- & Versorgungsleitungen<br />
(ZW, HW, VW)<br />
Spitzendurchfluss 1 h<br />
Pumpen Spitzendurchfluss 1 h<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
32<br />
33<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
Ermittlung des <strong>Wasserbedarf</strong>s im Ist-Zustand<br />
Verbrauchsabrechnungen => durchschnittlicher Bedarf<br />
Messkampagnen => durchschnittlicher Bedarf<br />
Aufzeichnungen/Messungen => Spitzenfaktoren<br />
Umrechnung auf die Bezugszeiten<br />
Ermittlung des künftigen <strong>Wasserbedarf</strong>s<br />
Richtwerte für den häuslichen Bedarf (DVGW W 410, 2008):<br />
Spezifische Angaben für Einwohner und Wohneinheiten<br />
Faktoren zur Umrechnung für entspr. Bezugszeiten<br />
Angaben zu Spitzenfaktoren<br />
Richtwerte für den industriellen Bedarf (DVGW W 410, 2008):<br />
Angaben zum spezifischen Bedarf von Verbrauchergruppen<br />
Angaben zu Spitzenfaktoren<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des häusl. Spitzenbedarfs über Richtwerte<br />
Versorgungseinheiten < 1000 Einwohner<br />
Anzahl der Einwohner und Gleichzeitigkeit der Entnahme sind<br />
maßgebend für die Spitzenwerte<br />
Ermittlung über Tabellen und Grafiken (DVGW W 410, 2008)<br />
Q hmax<br />
[l/E/s]<br />
1,000<br />
0,100<br />
0,010<br />
0,001<br />
Einwohner [E]<br />
0 10 100 1000<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
(DVGW W 410, 2008)
34<br />
35<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
Ermittlung des häusl. Spitzenbedarfs über Richtwerte<br />
Versorgungseinheiten > 1000 Einwohner<br />
Anzahl der Einwohner und Gleichzeitigkeit der Entnahme sowie weitere<br />
Faktoren (soziale Struktur, Kleingewerbe, Klima, Siedlungsstruktur)<br />
sind maßgebend für die Spitzenwerte<br />
Berechnung der Spitzenwerte über Spitzenfaktoren<br />
f<br />
f<br />
d<br />
h<br />
Q<br />
=<br />
Q<br />
Q<br />
=<br />
Q<br />
dmax<br />
dm<br />
h max<br />
=<br />
=<br />
Q<br />
Q<br />
dmax<br />
h max<br />
⋅ 365<br />
Q<br />
a<br />
⋅ 365 ⋅ 24<br />
Q<br />
Berechnung der Spitzenwerte über Stundenprozentwerte<br />
st<br />
max<br />
hm<br />
Q<br />
=<br />
Q<br />
h max<br />
d max<br />
⋅100<br />
a<br />
Q<br />
=<br />
Q<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
h max<br />
dm<br />
⋅ f<br />
d<br />
⋅100<br />
f<br />
=<br />
f<br />
100<br />
⋅<br />
24<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des häusl. Spitzenbedarfs über Spitzenfaktoren<br />
Berechnung des mittleren Tages- bzw. Stundenbedarfs<br />
Q a q dm ⋅ E<br />
Q Qdm<br />
= =<br />
365 1000<br />
Q<br />
hm<br />
Q<br />
=<br />
24<br />
dm<br />
Qa<br />
=<br />
365 ⋅ 24<br />
Berechnung des maximalen Tages – bzw. Stundenspitzenbedarfs<br />
(Empirischer Ansatz nach DVGW W 410, 2008)<br />
Q<br />
Q<br />
dmax<br />
hmax<br />
= f<br />
= f<br />
d<br />
h<br />
⋅Q<br />
⋅Q<br />
dm<br />
hm<br />
=<br />
3,<br />
9<br />
⋅E<br />
= 18,<br />
1⋅E<br />
−0,<br />
<strong>07</strong>52<br />
−0,<br />
1682<br />
⋅Q<br />
⋅Q<br />
dm<br />
hm<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
h<br />
d
36<br />
37<br />
<strong>Wasserbedarf</strong>sermittlung<br />
Ermittlung des häusl. Spitzenbedarfs über Stundenprozente<br />
Berechnung des maximalen Stundenspitzenbedarfs<br />
(Empirischer Ansatz nach DVGW W 410, 2008)<br />
Q<br />
hmax<br />
= st<br />
=<br />
max<br />
19,<br />
3<br />
Modellierung<br />
⋅Q<br />
⋅E<br />
dmax<br />
−0,<br />
093<br />
⋅100<br />
⋅ Q<br />
dmax<br />
⋅100<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Zu berücksichtigende Wasserentnahmen an den Knoten<br />
Häuslicher Bedarf<br />
‚Sonstiger‘ Bedarf (industriell, gewerblich, öffentlich)<br />
Ggf. Wasserverluste (wenn nicht anders Berücksichtigt)<br />
> 06 Wasserverluste<br />
Ggf. Löschwasserbedarf (bei Löschwasseruntersuchungen)<br />
Q =<br />
Q + Q + Q + Q<br />
Knoten<br />
häusl.<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
sonst.<br />
VR<br />
Löschw.
38<br />
39<br />
Modellierung<br />
Modellierung der Wasserentnahme an einem Knoten<br />
Angabe der durchschnittlichen Entnahmemenge (Basisbedarf)<br />
> 02 Grundlagen der Modellierung<br />
Angabe einer Skalierung des Basisbedarfs (Ganglinie)<br />
> 03 Grundlagen der Rohrnetzberechnung<br />
Mehrere Entnahmen können berücksichtigt werden<br />
> 04 Einführung in die Simulationssoftware EPANET<br />
Modellierung<br />
Q ( t)<br />
= Q ⋅ f + + Q ⋅ f<br />
Knoten<br />
1t<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Modellierung der Wasserentnahme an einem Knoten<br />
[Faktor f t]<br />
Ganglinie skaliert den Basisbedarf entsprechend der zeitlichen<br />
Diskretisierung des Simulationszeitraums (Dauer und Anzahl der<br />
Zeitschritte).<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
1<br />
n<br />
nt<br />
n<br />
n<br />
f<br />
t<br />
t=<br />
1<br />
= 1<br />
[Zeitschritt]
40<br />
41<br />
Modellierung<br />
Modellierung der Wasserentnahme an einem Knoten<br />
Bsp. EPANET<br />
Q N 68 ( t ) = Q 1 ⋅ f 1 t + Q 2 ⋅ f 2 t<br />
Q<br />
N68<br />
( 2)<br />
=<br />
Modellierung<br />
0,<br />
18628<br />
l<br />
s<br />
⋅<br />
0,<br />
295<br />
+<br />
Ganglinie1<br />
0,<br />
08492<br />
⋅0<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Modellierung der Wasserentnahme an einem Knoten<br />
Als Basisbedarf ist der mittlere Tagesbedarf Q dm sinnvoll.<br />
Als Tagesganglinie (f (ft) t) ist die Skalierung des mittleren Tages- Tagesbedarfs<br />
zw. minimalem und maximalem Bedarf sinnvoll.<br />
Zur Berücksichtigung des maximalen Tagesbedarfs ist ein<br />
zweiter, konstanter Skalierungsfaktor (f d) sinnvoll.<br />
Tagesspitzenfaktor und tageszeitabhängige Lastfaktoren können<br />
aber auch in einer Ganglinie berücksichtigt werden.<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
l<br />
s<br />
Ganglinie2
42<br />
43<br />
Modellierung<br />
Modellierung der Wasserentnahme an einem Knoten<br />
Beispiel<br />
Anzahl n der Zeitschritte t = 24<br />
Dauer eines Zeitschritts = 1 h<br />
Basisbedarf = Q dm (mittlerer Tagesbedarf)<br />
Konstante Skalierung = f d (Tagesspitzenfaktor)<br />
Skalierung der Zeitschritte = f t (Stundenfaktoren)<br />
Q dm<br />
f d<br />
f h<br />
Modellierung<br />
Q<br />
f d<br />
f t<br />
t<br />
t<br />
t<br />
Q ( t)<br />
= Q ⋅ f ⋅ f<br />
K<br />
h<br />
dm<br />
f = f ⋅ f<br />
tmax<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Datenbasis für die Ermittlung des Basisbedarfs<br />
Löschwasserbedarf<br />
Vorschriften<br />
Technische Regelwerke<br />
Wasserverluste<br />
> 06 Wasserverluste<br />
Häuslicher und sonstiger <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Verbrauchsabrechnungen<br />
Messungen (Großwasserzähler, Hauszähler)<br />
Sekundärdaten (z.B. Bevölkerungsverteilung)<br />
Annahmen (z.B. aus technischen Regelwerken)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
t<br />
d<br />
d
44<br />
45<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des häuslichen Basisbedarfs<br />
Lage und Verbrauchsmenge der Hausanschlüsse<br />
sind bekannt<br />
=> Über die Hausanschlüsse pro Knoten<br />
Lage und Verbrauchsmenge der Hausanschlüsse<br />
sind nicht bekannt<br />
=> Über die Personen pro Knoten<br />
Modellierung<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des häuslichen Basisbedarfs<br />
Über die Hausanschlüsse pro Knoten<br />
Ermittlung der Durchschnittswerte für jeden Hausanschluss<br />
Zuordnung der Durchschnittswerte zum entsprechenden<br />
Entnahmeknoten als Basisbedarf<br />
Ggf. Zuordnung mehrerer Durchschnittswerte (Hausanschlüsse) zu<br />
einem Entnahmeknoten (Reduzierung der Knotenanzahl)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
46<br />
47<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des häuslichen Basisbedarfs<br />
Über die Personen pro Knoten<br />
Ermittlung von Durchschnittswerten pro Person q dm<br />
Ermittlung der Personenanzahl an den Entnahmeknoten PK Ermittlung des Basisbedarfs der Entnahmeknoten Q kdm = q dm P K<br />
Ermittlung von Durchschnittswerten pro Person q dm<br />
Hauszählerablesungen (Stichproben) und<br />
Angaben zu Personen pro Haushalt<br />
Ablesungen von Großwasserzählern (Rohrnetzeinspeisung) und<br />
Angaben zur Bevölkerung der Versorgungszone<br />
Ermittlung des Basisbedarfs an den Knoten P K bzw. Q kdm :<br />
Knoteneinzugsflächen<br />
Häuser/Wohneinheiten<br />
Knotenanzahl<br />
Modellierung<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Graph, Bevölkerungsdichte D [E/L²] & mittlerer einwohnerbezogener<br />
Bedarf q dm [l/E/d] sind bekannt<br />
Ermittlung der Einzugsflächen A K [L²] über Annahmen<br />
Ermittlung des Basisbedarf: Q = q ⋅D<br />
⋅ A = q ⋅P<br />
Kdm<br />
dm<br />
A 1 A 2 A 3<br />
A 4 A 5 A 6<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
K<br />
dm<br />
K
48<br />
49<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Graph, Bevölkerungsdichte D [E/L²] & mittlerer einwohnerbezogener<br />
Bedarf q dm [l/E/d] sind bekannt<br />
Ermittlung der Einzugsflächen A K [L²] über Voronoi-Diagramme<br />
Diagrammflächen beinhalten die Punkte mit dem kürzesten Weg<br />
zum zugehörigen Knoten.<br />
Q = q ⋅D<br />
⋅ A<br />
Kdm<br />
dm<br />
Voronoi-Diagramme<br />
Trianguliertes irreguläres<br />
Netz (TIN)<br />
Mittelsenkrechten<br />
Modellierung<br />
K<br />
A 4<br />
A 1 A 2 A 3<br />
A 5<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Beispiel: Graph (gegeben)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
A 6<br />
Haus<br />
Knoten<br />
Strang
50<br />
51<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Beispiel: Bevölkerungsverteilung (gegeben)<br />
Modellierung<br />
325 E<br />
158 E/ha<br />
934 E<br />
102 E/ha<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Beispiel: Voronoi-Diagramme (berechnet)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
52<br />
53<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Beispiel: Einzugsflächen (berechnet)<br />
Modellierung<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Beispiel: Personen pro Einzugsfläche/Knoten (berechnet)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
P = D ⋅ A<br />
K<br />
K
54<br />
55<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Beispiel: Wasserentnahme pro Knoten (berechnet)<br />
Modellierung<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
QK = PK<br />
⋅ q<br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Knoteneinzugsflächen<br />
Graph, Bevölkerungsdichte & mittlerer einwohnerbezogener Bedarf<br />
müssen bekannt sein<br />
Annahme, dass innerhalb einer Fläche die Bevölkerungsverteilung<br />
homogen ist (exakte Bebauung wird nicht beachtet)<br />
Effizientes Verfahren<br />
Automatisierbar (z.B. im GIS)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
56<br />
57<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Wohneinheiten<br />
Graph, Personen pro Wohneinheit P WE [E/WE] & mittlerer einwohnerbezogener<br />
Bedarf q dm [l/E/d] sind bekannt<br />
Ermittlung der Wohneinheiten WE<br />
Zuordnung der Wohneinheiten zu Knoten (Annahmen/Einzugsflächen)<br />
Ermittlung Basisbedarf: Q = WE ⋅P<br />
⋅ q<br />
Modellierung<br />
2<br />
Kdm<br />
K<br />
WE<br />
2 2 2 2 2<br />
1 1 1 1<br />
2<br />
2<br />
1/2<br />
1/2<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des Basisbedarfs über Wohneinheiten<br />
1<br />
1<br />
Graph, Siedlungsflächen (Stadtplan), Personen pro Wohneinheit<br />
und mittlerer einwohnerbezogener Bedarf müssen bekannt sein<br />
Evtl. Abgleich zw. Gesamtbevölkerung/Rohrnetzeinspeisung und<br />
der über Wohneinheiten ermittelte Bevölkerung/Bedarf notwendig<br />
Genaues Verfahren<br />
Aufwendig<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
1<br />
2<br />
4<br />
2<br />
3<br />
dm
58<br />
59<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des Basisbedarfs über die Knotenanzahl<br />
Graph, Bevölkerung P ges (ggf. verschiedener Bereiche) und mittlerer<br />
einwohnerbezogener Bedarf sind bekannt<br />
Gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung eines Bereichs auf die<br />
Knoten (Anzahl n): P n<br />
PK ges =<br />
Ermittlung Basisbedarf: Q = P ⋅ q<br />
Modellierung<br />
P<br />
1 =<br />
P<br />
4<br />
Kdm<br />
P<br />
ges<br />
6<br />
K<br />
P<br />
2 =<br />
dm<br />
P<br />
Pges<br />
P5<br />
=<br />
= 6<br />
6<br />
P<br />
ges<br />
ges<br />
6<br />
P<br />
3 =<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
P<br />
6 =<br />
P<br />
P<br />
6<br />
ges<br />
6<br />
ges<br />
P ges<br />
Ermittlung des Basisbedarfs über die Knotenanzahl<br />
Graph, Bevölkerungsverteilung und mittlerer einwohnerbezogener<br />
Bedarf müssen bekannt sein<br />
Ungenaues Verfahren (Genauigkeit hängt von der Anordnung<br />
der Knoten ab)<br />
Bei der Erstellung des Graphen sollte die Bedarfsverteilungsmethode<br />
berücksichtigt werden<br />
Einfach und schnelles Verfahren<br />
Leicht automatisierbar<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
60<br />
61<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des ‚sonstigen‘ Basisbedarfs<br />
Q<br />
Industrieller, öffentlicher und gewerblicher <strong>Wasserbedarf</strong> sind im<br />
Versorgungsgebiet meist punktuell verteilt.<br />
Es empfiehlt sich jeden ‚sonstigen‘ <strong>Wasserbedarf</strong> mit einem<br />
eigenen Knoten zu modellieren (Transparenz).<br />
Wird das Modell zu groß, kann der ‚sonstige‘ <strong>Wasserbedarf</strong> auch<br />
einem Knoten mit häuslichem Bedarf zugewiesen werden.<br />
häusl .<br />
Qhäusl.<br />
Modellierung<br />
Q<br />
Q häusl . häusl .<br />
Q<br />
Betr.<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Q = Q + Q<br />
K<br />
häusl .<br />
Betr .<br />
Betrieb Betrieb<br />
Ermittlung des ‚sonstigen‘ Basisbedarfs<br />
Aufstellen von Verbraucherkategorien, z.B.<br />
Schule<br />
Verwaltung<br />
Krankenhaus<br />
Betrieb<br />
Ansatz für die Bedarfsermittlung für jede Kategorie, z.B.<br />
Tagesbedarf pro Schüler<br />
Tagesbedarf pro Arbeiter<br />
Tagesbedarf pro Bett Bett<br />
Messwerte/Tabellenwerte/Schätzungen<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
62<br />
63<br />
Modellierung<br />
Ermittlung des ‚sonstigen‘ Basisbedarfs<br />
Beispiel: Wohngebiete & sonstige Verbraucher<br />
103 E<br />
Polizei<br />
Modellierung<br />
Verwaltung<br />
941 E<br />
702 E<br />
262 E<br />
257 E<br />
Schule<br />
Apotheke<br />
Bahnhof<br />
Verwaltung<br />
Moschee<br />
Klinik<br />
667 E<br />
325 E<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Ermittlung des ‚sonstigen‘ Basisbedarfs<br />
934 E<br />
Beispiel: Verbraucherkategorien und Ermittlungsansatz<br />
Kategorie Ansatz<br />
Apotheke mittl. Tagesbedarf pro Person<br />
Bahnhof Null (keine Toiletten o.ä.)<br />
Klinik mitt. Tagesbedarf pro Bett<br />
Moschee mitt. Tagesbedarf pro Besucher<br />
Polizei mittl. Tagesbedarf pro Person<br />
Schule mittl. Tagesbedarf pro Schüler<br />
Verwaltung mittl. Tagesbedarf pro Person<br />
. . . . . .<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Einheit Anzahl Bedarf [l/s]
64<br />
65<br />
Modellierung<br />
Ermittlung der Ganglinien<br />
Datenbasis<br />
Zählerablesungen (Groß- und Hauswasserzähler)<br />
Messungen (Versorgungszone, DMA)<br />
Literatur (z.B. Mutschmann & Stimmelmyr, 20<strong>07</strong>)<br />
Technische Regelwerke (z.B. DVGW W 410, 2008)<br />
Annahmen (z.B. für Industriebetriebe, Gewerbe)<br />
Einheitliche Ganglinien für Verbraucherkategorien, z.B.<br />
Häuslicher Bedarf<br />
Gewerbe<br />
Industriebetrieb<br />
Schulen<br />
. . .<br />
Modellierung<br />
Ermittlung der Ganglinien<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Beispiel Ermittlung Ganglinie aus Großwasserzählerablesungen<br />
Reines Wohngebiet<br />
Ca. 600 Einwohner<br />
Großwasserzähler (kumulierte Menge) an der Hauptleitung<br />
Stündliche Ablesungen<br />
M<br />
DMA3<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
66<br />
67<br />
Modellierung<br />
Ermittlung der Ganglinien<br />
[l]<br />
Beispiel Ermittlung Ganglinie aus Großwasserzählerablesungen<br />
Modellierung<br />
Ermittlung der Ganglinien<br />
[l/h]<br />
In der Stunde t abgelesene<br />
Menge V kt (kumulierte Menge)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Beispiel Ermittlung Ganglinie aus Großwasserzählerablesungen<br />
Menge V t in der Stunde t<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
[Stunde<br />
t]<br />
Vt = Vk<br />
t − Vk<br />
t−1<br />
[Stunde<br />
t]
68<br />
69<br />
Modellierung<br />
Ermittlung der Ganglinien<br />
[%]<br />
Beispiel Ermittlung Ganglinie aus Großwasserzählerablesungen<br />
Modellierung<br />
Ermittlung der Ganglinien<br />
[Faktor f t]<br />
Anteil st t der Stundenmenge V t<br />
an der Tagesmenge V d<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
V<br />
t stt = n=<br />
24<br />
Beispiel Ermittlung Ganglinie aus Großwasserzählerablesungen<br />
Abweichung (Lastfaktor) f t der Stundenmenge<br />
V t von der mittleren Stundenmenge V tm<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
f<br />
t<br />
V tm<br />
1<br />
Vt<br />
=<br />
V<br />
tm<br />
V<br />
t<br />
24<br />
⋅100<br />
[Stunde<br />
t]<br />
Vt<br />
1 =<br />
n = 24<br />
[Stunde]
70<br />
71<br />
Zeichen nach DVGW W 410 (2008)<br />
Symbole Einheiten Erläuterungen<br />
E [Pers] Einwohner<br />
f fd [ - ] Tagesspitzenfaktor<br />
f(h) [ - ] Tageszeit abhängiger Lastfaktor<br />
f h [ - ] Stundenspitzenfaktor<br />
Q a [m³/a] Jährlicher <strong>Wasserbedarf</strong><br />
q dm [l/E/d] Mittl. einwohnerbezogener Tagesverbrauch<br />
Q d [l/E/d] Tagesbedarf<br />
Q dm [m³/d] Mittlerer Tagesbedarf<br />
Q dmax [m³/d] Maximaler Tagesbedarf<br />
Q(h) [m³/h] Tageszeit abhängiger Stundenbedarf<br />
Q hm [m³/h] Mittlerer Stundenbedarf<br />
q hmax [l/E/d] Max. einwohnerbezogener Stundenbedarf<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Zeichen nach DVGW W 410 (2008)<br />
Symbole Einheiten Erläuterungen<br />
Q hmax [m³/h] Maximaler Stundenbedarf<br />
Q Qhmax,dm [m³/h] Max. Stundenbedarf am Durchschnittstag<br />
Q S [m³/h] Spitzendurchfluss<br />
st [%] Maximaler Stundenprozentwert<br />
st max [%] Stundenprozentwert<br />
st max [%] Stundenprozentwert<br />
t B [s, min, h, d] Bezugszeit<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>
72<br />
73<br />
Literatur<br />
<strong>Wasserbedarf</strong><br />
Mutschmann, J. und Stimmelmayr, F. (20<strong>07</strong>): Taschenbuch der<br />
Wasserversorgung, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag.<br />
(UB Karlsruhe: Lesesaal Technik, Fachgruppe bau 8.6, Signatur:<br />
76 A 469(14))<br />
Karger, R.; Cord-Landwehr, K. und Hoffmann, F. (2005):<br />
Wasserversorgung, 12. Auflage, Teubner Verlag.<br />
Modellierung von <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Literatur<br />
Walski, T. u.a. (2003): Advanced Water Distribution Modeling and<br />
Management, 1. edition, Haestad Methods, Waterbury.<br />
(Download: http://www.haestad.com/books/pdf/awdm.pdf)<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong><br />
Regelwerke der Deutschen Vereins des Gas- und<br />
Wasserfaches e.V. (DVGW)<br />
DVGW Arbeitsblatt W 410 (2008): <strong>Wasserbedarf</strong> – Kennwerte und<br />
Einflussgrößen<br />
DVGW Arbeitsblatt W 405 (2008): Bereitstellung von Löschwasser<br />
durch die öffentliche Trinkwasserversorgung<br />
Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN)<br />
DIN 4046 (1983): Wasserversorgung - Begriffe<br />
Kurs „Analyse & Planung von Wasserverteilungsnetzen“ <strong>07</strong> <strong>Wasserbedarf</strong>