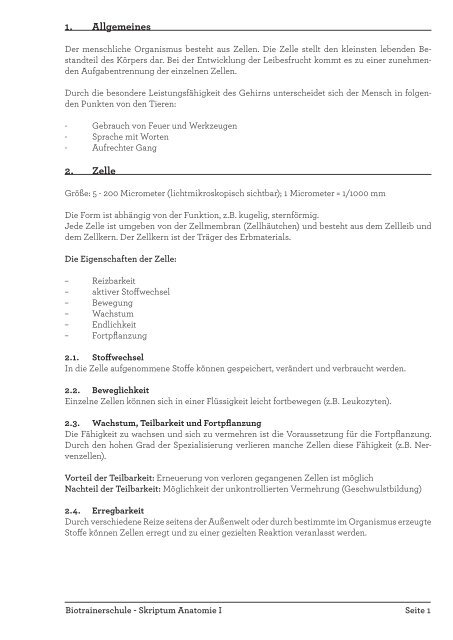Allgemeines 1. Zelle 2. - Zauner-Dungl Gesundheitsakademie
Allgemeines 1. Zelle 2. - Zauner-Dungl Gesundheitsakademie
Allgemeines 1. Zelle 2. - Zauner-Dungl Gesundheitsakademie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>1.</strong><br />
<strong>Allgemeines</strong><br />
Der menschliche Organismus besteht aus <strong>Zelle</strong>n. Die <strong>Zelle</strong> stellt den kleinsten lebenden Bestandteil<br />
des Körpers dar. Bei der Entwicklung der Leibesfrucht kommt es zu einer zunehmenden<br />
Aufgabentrennung der einzelnen <strong>Zelle</strong>n.<br />
Durch die besondere Leistungsfähigkeit des Gehirns unterscheidet sich der Mensch in folgenden<br />
Punkten von den Tieren:<br />
- Gebrauch von Feuer und Werkzeugen<br />
- Sprache mit Worten<br />
- Aufrechter Gang<br />
<strong>2.</strong><br />
<strong>Zelle</strong><br />
Größe: 5 - 200 Micrometer (lichtmikroskopisch sichtbar); 1 Micrometer = 1/1000 mm<br />
Die Form ist abhängig von der Funktion, z.B. kugelig, sternförmig.<br />
Jede <strong>Zelle</strong> ist umgeben von der Zellmembran (Zellhäutchen) und besteht aus dem Zellleib und<br />
dem Zellkern. Der Zellkern ist der Träger des Erbmaterials.<br />
Die Eigenschaften der <strong>Zelle</strong>:<br />
– Reizbarkeit<br />
– aktiver Stoffwechsel<br />
– Bewegung<br />
– Wachstum<br />
– Endlichkeit<br />
– Fortpflanzung<br />
<strong>2.</strong><strong>1.</strong> Stoffwechsel<br />
In die <strong>Zelle</strong> aufgenommene Stoffe können gespeichert, verändert und verbraucht werden.<br />
<strong>2.</strong><strong>2.</strong> Beweglichkeit<br />
Einzelne <strong>Zelle</strong>n können sich in einer Flüssigkeit leicht fortbewegen (z.B. Leukozyten).<br />
<strong>2.</strong>3. Wachstum, Teilbarkeit und Fortpflanzung<br />
Die Fähigkeit zu wachsen und sich zu vermehren ist die Voraussetzung für die Fortpflanzung.<br />
Durch den hohen Grad der Spezialisierung verlieren manche <strong>Zelle</strong>n diese Fähigkeit (z.B. Nervenzellen).<br />
Vorteil der Teilbarkeit: Erneuerung von verloren gegangenen <strong>Zelle</strong>n ist möglich<br />
Nachteil der Teilbarkeit: Möglichkeit der unkontrollierten Vermehrung (Geschwulstbildung)<br />
<strong>2.</strong>4. Erregbarkeit<br />
Durch verschiedene Reize seitens der Außenwelt oder durch bestimmte im Organismus erzeugte<br />
Stoffe können <strong>Zelle</strong>n erregt und zu einer gezielten Reaktion veranlasst werden.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 1
<strong>2.</strong>5. Reizübertragung<br />
Die Reizübertragung erfolgt im menschlichen Organismus über zwei Systeme:<br />
Reizleitende Systeme: Zellmembranen<br />
Reiztransformierende Systeme: zentrales Nervensystem<br />
vegetatives Nervensystem<br />
<strong>Zelle</strong>-Milieu-System<br />
Die Zellmembran bildet die Grenzfläche für die Ionenwanderung. Sie stellt ein für den gesamten<br />
Organismus einheitliches System der biochemischen Reizleitung dar.<br />
In der Umgebung der <strong>Zelle</strong> (Milieu) und im Nervensystem erfolgt die Umwandlung (Transformierung)<br />
des Reizes in elektromagnetische Energie. Die Zellmembran dient also der Aufrechterhaltung<br />
der Kommunikation zwischen Zellinnerem und Zelläußerem, während das Nervensystem<br />
für die rasche Überwindung großer Entfernungen sorgt.<br />
Der kontinuierliche Informationsaustausch zwischen Zellinnerem und Zelläußerem wird durch<br />
den vergleichsweise trägen Mechanismus der Ionenwanderung bewerkstelligt (Ionen = Ladungsträger<br />
bzw. elektrisch geladene Atome oder Moleküle).<br />
Die Informationsübermittlung im Nervensystem erfolgt ungleich rascher in Form von elektromagnetischen<br />
Frequenzen.<br />
<strong>2.</strong>6.<br />
Ultrastruktur der <strong>Zelle</strong><br />
Die <strong>Zelle</strong> besteht aus:<br />
A) Zellkern, Nukleus: membranbegrenzt (Kernmembran)<br />
Der Zellkern enthält das Kernkörperchen, Nukleolus;<br />
Er ist das Steuerungszentrum der <strong>Zelle</strong>, Informationszentrum,<br />
Träger der Erbanlagen (enthält die genetische Information = DNA, Chromosomen)<br />
B) Zellleib, Cytoplasma: membranbegrenzt (Zellmembran = Plasmalemm)<br />
a) Hyaloplasma: Grundplasma, Grundsubstanz des Cytoplasma<br />
b) Zellorganellen: sind spezielle lebensnotwendige Strukturen:<br />
membranbegrenzt:<br />
Mitochondrien: Kraftwerke der <strong>Zelle</strong><br />
Energieversorgung der <strong>Zelle</strong>, Zellatmung<br />
Golgi Apparat: Erzeugung, Verdichtung, Verpackung von Zellprodukten<br />
Membrandepot für Sekretion<br />
Endoplasmatisches Retikulum:<br />
g ER: glatt, agranulär:Synthese von Lipiden, Steroiden, Glykogen, Sacchariden;<br />
Entgiftung<br />
r ER: rauh, granulär: mit Ribosomen behaftet<br />
Proteinsynthese für Sekretion,<br />
für den extrazellulären Bedarf = exkretorische Proteinbildung<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 2
Lysosomen: membranüberzogene Partikel, die lytisch wirkende Enzyme für die<br />
Zellverdauung (Autolyse, Heterolyse) enthalten<br />
Peroxisomen, Mikrobodies: enthalten Peroxidasefermente<br />
Abbau von Stoffwechselprodukten<br />
Transportvesikel für: Endocytose: Aufnahme fester Stoffe (Phagocytose)<br />
und flüssiger Stoffe (Pinocytose)<br />
Exocytose: Abgabe von Stoffen<br />
Durchschleusung<br />
nicht membranbegrenzt:<br />
Centriol: als Diplosom = paarweise in L-Form<br />
9 Tripletts von Mikrotubuli, wird bei der Zellteilung benötigt<br />
Ribosomen: in Spiralen, Rosetten, Proteinnähmaschinen<br />
intrazelluläre Proteinbildung<br />
C) Metaplasma:<br />
metaplasmatische Einschlüsse<br />
Mikrotubuli: Röhrchen aus Proteinfilamenten<br />
Mikrofilamente: Stäbchen<br />
Tonofilamente in Epithelzellen<br />
Myofilamente in Muskelzellen<br />
Gliofilamente in Gliazellen<br />
Neurofilamente in Nervenzellen<br />
D) Paraplasma: cytoplasmatische Einschlüsse<br />
Stoffwechselprodukte<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Glykogen: Polysaccharide: Speicherstoff in Le, Mu, N,<br />
Fettstoffe: tröpfchenförmig in Fettzellen (sonst pathologisch)<br />
Proteine: Eiweiß<br />
Pigmente: Farbstoffe: exogen zugeführt Ruß, Carotinoide<br />
endogen: selbst gebildet: Melanin, Lipofuscin, …<br />
Abb. <strong>1.</strong> Mitochondrium für die Steroidsynthese<br />
Abb. <strong>2.</strong><br />
Mitochondrium für die Zellatmung<br />
Seite 3
Abb. 3.<br />
<strong>2.</strong>7.<br />
Zellquerschnitt<br />
Vorgänge an der Zellmembran<br />
Die <strong>Zelle</strong> als Informationsvermittler<br />
Die Feinstruktur der Zellmembran wurde elektromikroskopisch aufgeklärt. Sie stellt eine<br />
Elementarmembran dar, die für nahezu alle tierischen und menschlichen <strong>Zelle</strong>n ident ist (“unitmembrane-structure”,<br />
Einheitsmembran).<br />
Sie besteht aus drei Schichten:<br />
äußere Schicht: wasserlöslich; Hydratmantel, Eiweiß-Körper<br />
besitzen meist Zuckeranteil = Glykokalix (Antigenerkennung,<br />
Rezeptor, Blutgruppeneigenschaft)<br />
mittlere Schicht: (hydrophobe) Lipiddoppelschicht<br />
innere Schicht: wasserlöslich, Proteinmantel<br />
Die EW-Körper können die Membran auch durchdringen – Tunnel – Proteine:<br />
Durch und durch Proteine: Transportmechanismus, Ionen-Kanäle<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 4
Der Zusammenhalt der Schichten beruht auf der Wirkung von elektrostatischen Anziehungskräften,<br />
die an der Oberfläche der Zellmembran lokalisiert sind. Die Membran ist nicht starr,<br />
sie stellt ein FLUID MOSAIC MEMBRAN MODEL dar.<br />
Abb. 4.<br />
Zellmembranmodell<br />
Die besonderen Eigenschaften der Zellmembran sind verantwortlich für die unterschiedliche<br />
Zusammensetzung der Intrazellulärflüssigkeit und Interstitialflüssigkeit (Ionen und Proteinverteilung),<br />
da die Zellmembran semipermeabel ist, d.h. für verschiedene Substanzen ungleich<br />
gut (schlecht) durchlässig ist. Bei intakten Zellwänden kommt es durch die verschiedenen<br />
Konzentrationen von Ionen und Proteinen zwischen Zellinnerem und Interzellular-Raum zu einer<br />
Potentialdifferenz über die Zellmembran hinweg (Zellinneres negativ gegenüber Zellaußenseite).<br />
Da alle <strong>Zelle</strong>n an ihren Außenseiten gleichsinnig geladen sind, kann es dadurch im Normalfall<br />
nie zu einem unmittelbaren Kontakt der <strong>Zelle</strong>n und damit zu einer Störung der Zellfunktion<br />
kommen.<br />
Die gegensinnige Ladung von Zellinnerem zu Zelläußerem (bei ruhenden und gesunden <strong>Zelle</strong>n)<br />
wird durch eine nur geringe Verschiebung von Ionen hervorgerufen (wandernde Ionen: Gesamtionenzahl<br />
= 1:100 000 (bis 1:1 000 000). Die Zellmembran weist im Normalfall feinste Poren auf,<br />
durch welche der Ionentransport erfolgen kann.<br />
Im Ruhezustand ist die Membran dicht - die Poren sind geschlossen.<br />
Das Zellinnere weist negative Ladung auf; es enthält vor allem Kaliumionen und Eiweißkörper<br />
(Zellkern, Zellorganellen).<br />
Das Zelläußere ist positiv geladen gegenüber dem Zellinneren; es enthält vor allem Natrium-<br />
und Chlorionen (Kochsalzlösung).<br />
Durch die ungleiche Ionenverteilung in der intrazellulären und der extrazellulären Flüssigkeit<br />
herrscht an der Membran eine elektrische Spannung - das “Ruhemembranpotential”.<br />
Dieses liegt zwischen minus 40 bis minus 100 mV (Millivolt = tausendstel Volt). Das Ruhemembran-potential<br />
ist ein Maß für die Erregbarkeit der <strong>Zelle</strong>. Die meisten lebenden <strong>Zelle</strong>n halten<br />
dieses Potential im wesentlichen kontinuierlich aufrecht - d.h. dass durch einen “aktiven Trans-<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 5
port-mechanismus” (Enzyme) = Energie verbrauchender Prozess (ATP) laufend Natriumionen<br />
Na+ aus der <strong>Zelle</strong> gepumpt werden (im Austausch gegen Kaliumionen K+ : Na+ - K+-Austausch<br />
gekoppelt 1:1) durch “passive Diffusion” kehrt sich dieser Vorgang wieder um, so dass im wesentlichen<br />
ein kontinuierlicher Ionenstrom in kleinem Umfang zwischen Zellinnerem und Zelläußerem<br />
abläuft.<br />
Die Zellmembran ist praktisch undurchlässig für intrazelluläres Protein und andere organische<br />
Anionen (A-). Sie ist mäßig durchlässig für Na+ und ziemlich gut für K+ und C1- (die K+-Permeabilität<br />
ist 50 - 100mal größer als für Na+). Die Natur versucht die ungleiche Ionenverteilung<br />
(den Konzentrationsunterschied) durch verschiedene Mechanismen (z.B. Wanderung entlang<br />
der Konzentrationsgradienten) aufzuheben.<br />
Abb. 5.<br />
ZELLE MILIEU<br />
<strong>Zelle</strong> - Milieusystem<br />
Die nicht diffusiblen Anionen bleiben im Zellinneren. Einige K+ diffundieren auswärts, einige<br />
C1- einwärts durch vorhandene Poren. Dadurch entsteht eine Potentialdifferenz.<br />
Einigen wenigen Na+ gelingt es, die Membran zu überwinden, doch werden sie durch einen dauernd<br />
vorhandenen Pumpmechanismus sofort wieder aktiv (im Austausch mit K+) aus der <strong>Zelle</strong><br />
befördert: Na-K-Pumpe. Wird die Pumpe behindert durch Stoffwechselhemmstoffe, kommt es<br />
zum dauernden Konzentrationsausgleich, das Ruhemembranpotential wird Ø und die <strong>Zelle</strong> geschädigt.<br />
Nerven- und Muskelzellen weisen die Eigenschaft auf, die Ionendurchlässigkeit auf einen Reiz<br />
zu verändern - sie sind leichter erregbar als die Normalzellen.<br />
Dieser Reiz kann sein: – mechanisch<br />
– elektrisch<br />
– chemisch<br />
– thermisch<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 6
Ein wirksamer Reiz bewirkt eine Verschiebung der Membranschichten und eine Öffnung der<br />
Membranporen. Ist der Reiz stark genug, kommt es zu einem “Aktionspotential”, AP, das im Nerv<br />
das weitergeleitete Signal darstellt und am Muskel zur Kontraktion führt. Dieser Vorgang geht<br />
mit einem Zusammenbrechen des Ruhemembranpotentials einher; Kalium strömt aus der <strong>Zelle</strong>,<br />
Natrium in die <strong>Zelle</strong> (= “Depolarisation”).<br />
Die “Natrium-Kalium-Pumpe” stellt dann das Ruhemembranpotential wieder her (=”Repolarisation”).<br />
Die kurzzeitige Umpolung des Zellinneren von minus 40 - 100 mV auf bis zu plus 20 mV<br />
während der Dauer des Aktionspotentials stellt den Reiz für das Inkrafttreten der Ionenpumpe<br />
dar.<br />
Abb. 6.<br />
Abb. 7.<br />
Aktionspotential der Nervenzelle/Skelettmuskelzelle<br />
Flüssigkeitsverteilung und Elektrolytverteilung in Blut und Zellraum<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 7
Abb. 8.<br />
Ruhemembranpotential, Depolarisation und Repolarisation<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 8
3. Gewebe<br />
Zellverbände mit gleichartiger Aufgabe nennt man Gewebe.<br />
3.<strong>1.</strong><br />
3.<strong>2.</strong><br />
Die Gewebearten<br />
Deckgewebe<br />
Muskelgewebe<br />
Stützgewebe<br />
Blut<br />
Bindegewebe<br />
Nervengewebe<br />
Gewebeveränderungen<br />
Hypertrophie: Gewebevermehrung durch Zellvergrößerung, Zunahme der<br />
Intrazellularsubstanz (z.B. Muskeltraining)<br />
Atrophie: Gewebeverminderung durch Zellverkleinerung<br />
(z.B. Muskelschwund bei Inaktivität)<br />
Hyperplasie: Reaktive Vermehrung der Zellzahl durch einen Reiz<br />
(z.B. Vergrößerung der Brustdrüse in der Schwangerschaft)<br />
Involution: Verminderung der Zellzahl (z.B. Verkleinerung der Brustdrüse nach<br />
dem Abstillen)<br />
Hypoplasie, Aplasie:Verminderte oder fehlende Anlage eines Organs<br />
(z.B. erbliche Missbildung)<br />
Metaplasie: reversible Umwandlung von Gewebe zur Anpassung an veränderte<br />
Umstände (z.B. Fettgewebsbildung)<br />
Regeneration: Gewebsneubildung zur Behebung von Gewebsverlusten<br />
(z.B. Wundheilung), Wiederherstellung, Ersatz<br />
Degeneration: Entartung von Geweben unter Verlust ihrer spezifischen<br />
Funktion (z.B. Tumorbildung, Überbeanspruchung)<br />
Transport: An der Oberfläche der <strong>Zelle</strong> befindliche Flimmerhaare können durch ihre Beweglichkeit<br />
kleine Stoffteilchen abfangen und weiterbefördern. (Reinigung der Atemluft von Staubkörnchen.)<br />
3.3.<br />
Stoffaufnahme, Stoffabgabe, Erregbarkeit<br />
Stoffaufnahme: Durch Vergrößerung der Oberfläche der einzelnen <strong>Zelle</strong>n sind diese besonders<br />
geeignet, Stoffe durch ihr Zellhäutchen zu schleusen (Aufnahme von Nahrungsstoffen durch die<br />
Darmschleimhaut).<br />
Stoffabgabe (Sekretion): Produktion und Abgabe von bestimmten Stoffen an die Oberfläche<br />
oder in die Blutbahn = Drüsenfunktion<br />
– Abgabe an die Oberfläche = Drüse mit äußerer Sekretion (Schweißdrüse)<br />
– Abgabe ins Blut = Drüse mit innerer Sekretion = Hormondrüse (z.B. Schilddrüse)<br />
Hormone sind Botenstoffe, die durch die Blutbahn in den gesamten Organismus gelangen und<br />
im Körper Reaktionen auslösen.<br />
Erregbarkeit: Alle <strong>Zelle</strong>n sind erregbar. <strong>Zelle</strong>n mit einer besonders großen Erregbarkeit heißen<br />
Sinneszellen (z.B. Riechzellen in der Nase).<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 9
3.4.<br />
Deckgewebe, Epithelgewebe<br />
Das Deckgewebe dient der Auskleidung von Oberflächen<br />
äußere Oberfläche Haut<br />
innere Oberfläche Schleimhaut<br />
Das Deckgewebe besteht aus aneinander gereihten <strong>Zelle</strong>n.<br />
Aufgaben:<br />
Schutz: z.B. Haut - durch Bildung von Hornsubstanz an der Außenschicht des mehrschichtigen<br />
Deckgewebes wird der Körper gegen Austrocknung, Temperaturunterschiede und Krankheitserreger<br />
geschützt.<br />
- Schutz vor physikalischen und chemischen Einflüssen<br />
- Regulierung der Körpertemperatur (Schweißsekretion)<br />
- Stoffwechsel, Atmung, Entgiftung<br />
- Verbindung mit Umwelt, Sinnesempfindungen<br />
- Schutz vor Krankheitserregern (mechanisch chemische Schutzfunktion)<br />
Abb. 9.<br />
diverse Epithelien im Querschnitt<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 10
3.5.<br />
Bindegewebe<br />
Das BGW wird aus dem Mesoderm gebildet. Es dient der<br />
– Umhüllung und Unterteilung der Organe<br />
– der Einbettung und Zuleitung von Blut und Nerven<br />
Das BGW baut sich aus <strong>Zelle</strong>n (Fibroblasten und Fibrozyten) auf und der von den FB gebildeten<br />
Grund- und IZS (Kittsubstanz und eingelagerte Fasern). Während das Deckgewebe nur aus<br />
aneinander gereihten <strong>Zelle</strong>n besteht, enthält das Bindegewebe verschiedene Bausteine:<br />
<strong>Zelle</strong>n:<br />
a) fixe Bindegewebszellen (z.B. Fettzellen, Knorpelzellen, Knochenzellen, Fibrozyten,...)<br />
b)freie Bindegewebszellen (z.B. weiße Blutkörperchen, Histiozyten, Wanderzellen,<br />
eosine <strong>Zelle</strong>n, Mastzellen, Plasmazellen, Pigmentzellen, Fettzellen)<br />
Interzellularsubstanz:<br />
a) ungeformt: Grundsubstanz, amorph = ohne Struktur<br />
Matrix, Polysaccharid-Proteinkomplex<br />
Die Matrix: verleiht dem Gewebe plastische Verformbarkeit<br />
und elastische Formkonstanz<br />
b) geformt: Fasersubstanz:<br />
Kollagene Fasern: häufigste BGW-Faser = EW-Faser (Protein)<br />
6 kg/mm² Zugbeanspruchung<br />
um 5 % dehnbar<br />
um 10 % gedehnt = irreversibel geschädigt<br />
Schädigung bedeutet zerreißen der Fascien, Bänder, Sehnen<br />
(Retikulin-Fasern: sie werden durch eine Hüllsubstanz vor Aggregation<br />
zu Faserbündeln geschützt; Basalmembran)<br />
Elastische Fasern besitzen 150 % Dehnungsfähigkeit<br />
bei 20 kg/cm2 auf 150 % zu verlängern<br />
können im Alter schwinden,<br />
können im Alter durch Einlagerungen behindert werden<br />
Vorkommen in Haut, Gefäßwand, Lunge, Bändern der WS,<br />
c) Einlagerungen: anorganisch: Salze<br />
Die Interzellularsubstanz ist stark wasserhältig. Bei abnormer Vermehrung des Wassergehaltes<br />
entsteht Gewebsschwellung (Ödem).<br />
Funktion des Bindegewebes:<br />
– Mechanischer Schutz (u.a. Stützung, Verpackung)<br />
(Organhüllen, Verschiebeschicht zwischen Organen etc.)<br />
– Stofftransport<br />
– Speicherung<br />
– Wundheilung<br />
– Immunabwehr<br />
– Gerüst von Organen = Stroma<br />
– Informationsträger als Teil des ZNS<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 11
Gliederung des Bindegewebes:<br />
I ungeformtes Bindegewebe<br />
II geformtes Bindegewebe (Stützgewebe)<br />
I Ungeformtes Bindegewebe<br />
1) Mesenchym (embryonales Bindegewebe): kommt nur während der Entwicklung vor, aus<br />
ihm gehen die anderen Gewebe hervor.<br />
2) Gallertgewebe (z.B. Zahnpulpa): kommt in der Nabelschnur und in sich entwickelten<br />
Sehnen vor (keine Fasern).<br />
3) Retikuläres Bindegewebe (netzartiges Bindegewebe): kommt vor allem im<br />
Knochenmark und in den lymphatischen Organen (Lymphknoten, Tonsillen, Thymus,<br />
Milz) vor. Es besteht aus Retikulumzellen und Retikulinfasern.<br />
Retikulumzellen können sich unter bestimmten Umständen zu Fett- und Blutzellen<br />
verwandeln. Die Retikulinfasern bilden die Hauptbestandteile der Fasergerüste in den<br />
verschiedensten Geweben und Organen.<br />
a) lymphoretikulär<br />
b) retikulär (rotes Knochenmark)<br />
Abb. 10.<br />
Die verschiedenen BGWsarten<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 12
4) Fettgewebe<br />
Es kann als Sonderform (besondere Speicherform) des retikulären Bindegewebes aufgefasst<br />
werden. Es dient hauptsächlich der Energiespeicherung (Kaloriendepot), als mechanischer<br />
Druckpolster und als Isoliersubstanz (Wärmeschutz). Fettzellen speichern Fett als Strukturstoff<br />
bei allen anderen <strong>Zelle</strong>n ist Fettspeicherung ein Zeichen von Stoffwechselstörungen.<br />
4a) Baufett: weiß<br />
ist unabhängig vom Ernährungszustand und dient als Polsterung (druckelastisches<br />
Gewebe, Fettzelle = Tennisball) und Wärmeschutz für innere<br />
Organe und Gelenke (Fußsohle, Handfläche, Nierenkapsel, Wange, Augenhöhle,<br />
Brustdrüse)<br />
Baufett ist lebensnotwendig, wird erst sehr spät abgebaut<br />
4b) Speicherfett, Depotfett; weiß oder braun<br />
ist abhängig vom Ernährungszustand und kann bei Bedarf abgebaut und<br />
in Energie umgewandelt werden (besonders rasch verfügbar)<br />
Das Unterhaut-Fettgewebe (meist bes. stark um Körpermitte) dient der<br />
Temperaturregulierung, der Isolierung und dem Energiehaushalt.<br />
5) Bindegewebe im engeren Sinne: Lockeres und dichtes Bindegewebe.<br />
Der Unterschied zwischen lockerem und dichtem Bindegewebe liegt vor allem in der Anordnung<br />
der so genannten Kollagenfasern. Es enthält außerdem noch elastische Fasern, zahlreiche Formen<br />
von (freien) Bindegewebszellen (Wanderzellen, Fresszellen, weiße Blutzellen, Fasern bildende<br />
<strong>Zelle</strong>n etc.) und die so genannte "amorphe Grundsubstanz".<br />
5a) lockeres, faserarmes BGW: Organgerüst, Abwehr, Wasserspeicher,<br />
Regenerationsvorgänge<br />
interstitielles BGW: mit Gefäßen, Nerven<br />
5b) straffes, faserreiches BGW:<br />
geflechtartig: Fasern bilden ein filzartiges Geflecht<br />
Lederhaut, Organkapseln (wie Strumpf), harte Augenhaut, harte Hirnhaut<br />
parallelfasrig: Ausrichtung auf Einfluss von Zugkräften<br />
Sehnen, Bänder, Fascien, Gelenkskapsel, …<br />
Das Bindegewebe kann vom ganzheitlichen Standpunkt her gesehen auch als Bestandteil des so<br />
genannten "<strong>Zelle</strong>-Milieu-Systems" nach Prof. Pischinger, angesehen werden. Es fungiert dabei<br />
als "Transitstrecke" zwischen Organ und Umgebung (darüber später mehr).<br />
Abb. 1<strong>1.</strong><br />
Fettgewebe, embryonales Mesenchym, straffes und retikuläres BGW<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 13
3.6.<br />
Stützgewebe<br />
Das Stützgewebe unterscheidet sich durch die außerordentliche Festigkeit vom eigentlichen Bindegewebe<br />
und bildet das Stützgerüst des Körpers. Man kann es auch als geformtes Bindegewebe<br />
bezeichnen.<br />
3.6.<strong>1.</strong> Sehnen, Bänder<br />
Sie bestehen in erster Linie aus Kollagenfaserbündeln und so genannten Fibrozyten (= ruhende<br />
Bindegewebszellen) = straffes, faserreiches (parallel gerichtetes) zellarmes Bindegewebe. Sie<br />
werden vom lockeren Bindegewebe umhüllt, in dem die Nerven und Blutgefäße eingelagert sind.<br />
Sie sind schlecht durchblutet und haben keine eigenen Blutgefäße: Sie werden durch Diffusion<br />
(= Umspülung) ernährt = schlechte Heilung bei Verletzung.<br />
Elastische Bänder:<br />
Sie stellen eine Sonderform dar, durch ihren besonders hohen Anteil an elastischen Fasern. Die<br />
wichtigsten elastischen Bänder sind die Ligamenta flava der Wirbelsäule (Umhüllung des Wirbelkanals).<br />
3.6.<strong>2.</strong> Knorpel<br />
Das Knorpelgewebe ist sehr widerstandsfähig, schneidbar, biegungselastisch und druckelastisch.<br />
Die Knorpelzellen, Chondrozyten, sind glykogenreich und wasserreich; sie haben blasiges<br />
Aussehen, kugelige Gestalt mit kugeligem Kern, liegen meist in Knorpelhöhlen, werden von<br />
einem Zellhof und einer Kapsel umgeben.<br />
Chondron, Territorium: ist die funktionelle Baueinheit des Knorpels, die aus einem Knorpelzellnest<br />
und ungebundener, fibrillenfreier GS besteht.<br />
Die Interzellularsubstanz ist gefäß- und nervenlos, daher werden die Knorpelzellen durch Diffusion<br />
ernährt von einer an der Oberfläche gelegenen gefäß- und nervenreichen Bingegewebshaut:<br />
Knorpelhaut, Perichondrium.<br />
Die Art der IZS ist verantwortlich für Art und Funktion des Knorpels:<br />
– hyaliner Knorpel<br />
– elastischer Knorpel<br />
– Faserknorpel<br />
Beim hyalinen Knorpel (milchig, bläulich) werden die reichlich kollagenen Fasern durch die<br />
Grundsubstanz maskiert (LM nicht sichtbar, die GS verhält sich färberisch wie die Fasern). Durch<br />
die Gefäßlosigkeit können im Inneren degenerative Prozesse begünstigt werden, wie:<br />
– Kalkeinlagerungen<br />
– Asbestfaserung (= Demaskierung der Fasern)<br />
Eine Regeneration ist lediglich beim Faserknorpel und beim elastischen Knorpel möglich, da<br />
diese vom Perichondrium überzogen werden, von dem aus der Knorpel neu gebildet werden<br />
kann. Beim hyalinen Knorpel ist eine Neubildung lediglich vom Rand her möglich. Hierbei wird<br />
zunächst ein Faserknorpel gebildet, der dann zu einem hyalinen Knorpel umgebildet wird.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 14
Hyaliner Knorpel kommt vor: als Gelenksknorpel: nicht von Perichondrium überzogen<br />
als Rippenknorpel im Respirationstrakt: Nase, Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien, Epiphysenfugenknorpel<br />
(Wachstumsfuge)<br />
Der elastische Knorpel enthält reichlich elastische Fasernetze, ist gelblich und besonders biegsam<br />
und elastisch. Vorkommen: in Ohrmuschel und Kehldeckel (Epiglottis).<br />
Der Faserknorpel, Bindegewegsknoprpel, enthält weniger <strong>Zelle</strong>n, dafür mehr kollagene Faserbündel.<br />
Vorkommen: in Bandscheiben, Symphyse, Meniskus, Discus.<br />
Das Wachstum des Knorpels ist möglich<br />
a) vom Perichondrium aus: Chondrone neu gebildet, …<br />
perichondral - apositionelles Wachstum (Anbau)<br />
b) von innen heraus: enchondrales Wachstum durch Vermehrung der<br />
interstitiellen Grundsubstanz<br />
Abb. 1<strong>2.</strong><br />
Hyaliner Knorpel mit Asbestfaserung, hyaliner Knorpel Faserknorpel, elastischer Knorpel<br />
3.6.3. Knochengewebe<br />
Das Knochengewebe besteht aus:<br />
– Knochenzellen = Osteozyten<br />
– Grundsubstanz Osteoid<br />
– kollagenen Fibrillen<br />
– Kittsubstanz<br />
– anorg. Salze (Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Ca++, K+, Na+, …, C1-, F-, ...)<br />
Die Salze bedingen die Härte und Festigkeit des Knochens, die organischen<br />
Bestandteile sind verantwortlich für die Elastizität.<br />
1) Der Geflechtknochen entspricht einem verknöcherten BGW (keine bestimmte Faserrichtung,<br />
in der Entwicklung vorkommend)<br />
2) Der Lamellenknochen ist höher organisiert; Er zeigt eine deutliche Schichtung durch Abwechseln<br />
von Lagen von Zwischensubstanz (= Lamelle) und Lagen von Knochenzellen. Die Knochenzellen<br />
sind in die Knochen-substanz eingemauert und stehen über Fortsätze (in Kanälen) miteinander<br />
in Verbindung. Die lamelläre (konzentrische) Anordnung erfolgt um Gefäßkanäle. Als<br />
Osteon oder Haver´sches System bezeichnet man einen Gefäßkanal mit seinen Lamellen. Die<br />
Gefäßkanäle der Osteone stehen über kleine schräglaufende Kanäle in Verbindung: Volkmann-<br />
Kanal. Die Osteone befinden sich immer im Umbau, denn Bau und Anordnung der Osteone sind<br />
abhängig von Beanspruchung und Belastung des Knochens. Der Umbau der Osteone zeigt sich<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 15
in der Ausbildung von Schaltlamellen. Ein weiteres Kennzeichen der Beanspruchung ist die Bildung<br />
von Trajektorien, Spannungslinien; das bedeutet: die Fasern werden verstärkt ausgerichtet<br />
auf Zugbeanspruchung. Die Faserrichtung (Wicklungsrichtung) der Lamellen in den einzelnen<br />
Osteonen wechselt (von einer Lamelle zur nächsten) = höhere Beanspruchung möglich.<br />
Abb. 13.<br />
Knochengewebe<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 16
Knochen kann sich bilden<br />
direkt aus BGW: – direkte Ossifikation (Verknöcherung)<br />
desmaler Knochen (Belegknochen) entsteht<br />
direkt aus Mesenchym od. perichondral<br />
Gesichtsschädel, Schädeldach, Schlüsselbein<br />
indirekt: – durch Umwandlung von Knorpel<br />
indirekte Ossifikation, enchondral, Ersatzknochen<br />
Wachstum, Ernährung:<br />
Der Knochen wird durch die Knochenhaut = Periost und die Gefäßkanäle ernährt (U zu Knorpel:<br />
Knochenzellen stehen über Fortsätze miteinander in Verbindung: aktiver Stofftransport im Gegensatz<br />
zu Knorpel, Bänder: Diffusion = Umspülung).<br />
Das Dickenwachstum erfolgt vom Periost aus direkt, apositionell (Anbau). Weiters wird die<br />
Dicke des (Röhren-)Knochens von innen her durch den Abbau gesteuert. Das Längenwachstum<br />
erfolgt von der Epiphysenfuge aus (hyaliner Knorpel). Das Knochenwachstum (-bildung) hängt<br />
ab von:<br />
– Vitaminen – Vit. A, C, D<br />
– Hormonen – Parathormon, Calcitonin, STH, Cortison…<br />
– Nahrung – Salze, Proteine, Säure/Basenhaushalt<br />
– mechanisch – Beanspruchung (Knochen ist trainierbar)<br />
– Elektrolythaushalt<br />
Knochenaufbau (Röhrenknochen)<br />
Periost<br />
Compacta äußere Generallamelle hohe Biegfestigkeit<br />
Osteone, Schalt-Lamellen min. Materialaufwand<br />
innere Generallamelle max. Festigkeit<br />
Spongiosa Knochenbälkchen: Leichtbauweise<br />
Knochenmark<br />
Zug und Druck wird von der Knochenkonstruktion aufgefangen. Die<br />
Hauptspannung führt zum Aufbau = Struktur des spongiösen Knochens<br />
in Spannungstrajektoren: trajektorielles Fachwerk.<br />
Die große funktionelle Anpassung wird erreicht durch das außerordentlich<br />
dynamische Knochengewebe, das sich ständig im Umbau befindet.<br />
Bei zu hoher (plötzlicher) Beanspruchung (Torsion, Knickung, …): Bruch,<br />
Fraktur: bei Kindern selten: elastischer = biegsamer Knochen (Grünholzfraktur);<br />
bei älteren Menschen: Knochen hart, spröde - bricht leichter (durch<br />
organischen Zellverlust)<br />
Die Heilung von Knochenverletzungen ist i. a. besser als bei Bänderverletzungen<br />
(durch Blutversorgung, …)<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Abb. 14.<br />
Trajektorien im Knochen<br />
Seite 17
Aufgaben des Knochengewebes<br />
a) Stützorgan<br />
b) Blut bildendes Organ (Knochenmark)<br />
c) Speicherung von Mineralstoffen<br />
Abb. 15.<br />
Spongiosa<br />
In den kleinen Zwischenräumen der Spongiosa befindet sich das rote Knochenmark (und in Epiphysen,<br />
Wirbelkörper, …):<br />
1,5 kg beim Erwachsenen<br />
dient der Blutbildung<br />
770 Milliarden <strong>Zelle</strong>n/d<br />
In den Röhren der langen Röhrenknochen befindet sich das gelbe Knochenmark (Fettmark, Ersatzmark).<br />
Bei erhöhtem Blutbedarf wird gelbes in rotes Knochenmark umgewandelt.<br />
3.7. Muskelgewebe<br />
Die Muskelzellen können (chemisch, elektrisch, mechanisch und thermisch) erregt werden. Dabei<br />
entsteht ein Aktionspotential, das sich entlang der Zellmembran fortpflanzt. Die Muskelzellen<br />
enthalten kontraktile Proteine und verfügen über einen Kontraktionsmechanismus (aktiviert<br />
durch AP).<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 18
Man unterscheidet 3 Typen der Muskulatur:<br />
3.7.<strong>1.</strong> Glatte Muskulatur<br />
Eingeweide, Gefäßmuskulatur; unwillkürliche Tätigkeit, unterliegt vorwiegend dem VNS; Leistung<br />
ist auf Dauer ausgerichtet, arbeitet langsam, ausdauernd, ist nicht ermüdbar. LM: keine<br />
Querstreifung sichtbar, einkernige <strong>Zelle</strong>.<br />
3.7.<strong>2.</strong> Quergestreifte Muskulatur<br />
Skelettmuskulatur; willkürliche Tätigkeit, schnell, ermüdbar, auf rasche Leistung ausgerichtet,<br />
dafür rasch ermüdbar, unterliegt überwiegend dem ZNS (Willen). LM: im Mikroskop Querstreifung<br />
gut sichtbar, jede <strong>Zelle</strong> hat viele randständige Kerne.<br />
3.7.3. Herzmuskel<br />
Sonderform, vereint die guten Eigenschaften der beiden anderen Muskelarten, unwillkürliche<br />
Tätigkeit, Leistung auf Dauer ausgerichtet, unterliegt überwiegend dem VNS; schnell, ausdauernd,<br />
nicht ermüdbar, willentlich nicht beeinflussbar, kontrahiert sich rhythmisch ohne Reiz von<br />
außen (durch Anwesenheit von Schrittmacherzellen). LM: quergestreift, 1 mittelständiger Kern,<br />
<strong>Zelle</strong> verzweigt.<br />
Abb. 16.<br />
glatte Muskulatur, quergestreifte Muskulatur und Herzmuskulatur<br />
3.7.4. Aufbau und Funktion der Skelettmuskulatur<br />
Die Baueinheit eines Muskels ist die Muskelzelle oder Muskelfaser. Sie geht an ihren Enden in<br />
die Sehne über. Die Muskelzellen können bis zu 30 cm lang werden. Sie sind im Muskel parallel<br />
zwischen den Sehnenenden angeordnet, so dass sich die Kontraktionskräfte der Einzelfasern addieren.<br />
Mehrere Muskelzellen bilden ein Primärbündel (dazwischen befindet sich lockeres BGW<br />
= Endomysium). Mehrere Primärbündel bilden ein Sekundärbündel = Fleischfaser.<br />
Die Muskelzelle enthält Myofilamente (aus kontraktilen Proteinen aufgebaut), die die Kontraktion<br />
ermöglichen. Diese Myofilamente (EW-Stäbchen) bilden Myofibrillen (Ø 1 Micrometer), die<br />
für die Kontraktion verantwortlich sind.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 19
Bei den Proteinen handelt es sich um:<br />
1) Myosin (schwer)<br />
2) Aktin (leicht)<br />
3) Tropomyosin und Troponin<br />
Im quergestreiften Muskel sind die Myofilamente regelmäßig angeordnet, in den Myofibrillen<br />
(dicke = Myosinfilamente und dünne = Aktinfilamente wechseln einander regelmäßig ab) →<br />
Querstreifung. Diese EW-Stäbchen (Myofilamente) gleiten bei der Kontraktion ineinander durch<br />
Knüpfung von chemischen Bindungen über Ca2+ und Verbrauch von Energie (ATP, Zucker,<br />
Fett).<br />
Damit der Muskel wieder erschlaffen kann, muss das Ca2+ in seinen ursprünglichen Speicher<br />
wieder aktiv zurückgepumpt werden (ebenfalls energieverbrauchend).<br />
Myosinfilamente 10 nm Ø<br />
Aktinfilamente 5 nm Ø bestehend aus:<br />
Abb. 17.<br />
Die Myofibrillen sind von Strukturen aus Plasmamembran (Sarkolemm) umgeben (Vesikel<br />
= Bläschen - transversale Tubuli T-System = Röhren). (Im EM Myofibrillen wie von Sieb durchlöchert,<br />
ER formt einen unregelmäßigen Vorhang;)<br />
T-System: rasche Weiterleitung des AP an Myofibrille<br />
ER: Ca2+-Verschiebung, Ca-Speicher, Zellstoffwechsel<br />
Ereignisfolge der Kontraktion:<br />
1) Entladung des motorischen Neurons<br />
2) Freisetzen von Transmitter (Acetylcholin) an der motorischen Endplatte<br />
3) Bildung des Endplattenpotentials<br />
4) Bildung des AP in den Muskelfasern<br />
5) Ausbreiten der Depolarisierungswelle über das T-System ins Innere der Muskelfaser<br />
6) Freisetzen von Ca2+ aus den lateralen Säcken des sarkoplasmatischen Reticulums und Diffusion<br />
zu den dicken Myosinfilamenten und dünnen Aktinfilamenten<br />
7) Bindung von Ca2+ an Troponin C, Freilegung der Bindungsstellen am Aktin<br />
8) Bildung von Querverbindungen zwischen Aktin und Myosin, Übereinandergleiten der Aktinfilamente<br />
über die Myosinfilamente, wodurch es zur Verkürzung kommt.<br />
Erschlaffung<br />
Aktin und Myosin<br />
1) Rückpumpen von Ca2+ in das sarkoplasmatische Retikulum<br />
2) Lösen der Ca2+ Bindung am Troponin C<br />
3) Beendigung der Wechselwirkung zwischen Aktin und Myosin<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 20
Die rote Farbe des Muskels wird durch das Myoglobin, den roten Muskelfarbstoff (der als O2-<br />
Speicher in der Muskelzelle dient) und die gute Durchblutung des Muskels bedingt. Sowohl Kontraktion<br />
als auch Erschlaffung sind energieverbrauchende Prozesse. Dabei wird ATP zerlegt und<br />
aus chem. gespeicherter Energie entsteht zu 20 % mechanisch und zu 80 % Wärmeenergie.<br />
Der ATP-Speicher wird dauernd wieder aufgefüllt, indem andere Energiespeicher (wie Zucker,<br />
Fett, EW) ihre Energie an den ATP-Speicher abgeben. Dabei wird Zucker und Fett unter O2- Zufuhr<br />
zerlegt, ATP gebildet und als Restprodukt fällt CO2 und H2O (Stoffwechselendprodukte)<br />
an. Bei O2-Mangel kann Fett nicht verwertet werden, dann kann eine Zeit lang noch Zucker zu<br />
Milchsäure, Lactat (Schlackenstoff) abgebaut werden. Auf diesem Weg entsteht nur sehr wenig<br />
ATP und auch nur sehr kurzfristig (bis zur Übersäuerung). Lactat verursacht den Muskelkater;<br />
bei andauernder Überlastung entsteht schließlich durch Überladung der Muskelzelle mit Abfallstoffen<br />
der Muskelkrampf.<br />
Abb. 18.<br />
Der quergestreifte Muskel<br />
Die Muskelsehne besteht aus BGW und stellt die<br />
Verbindung zwischen Muskel und Knochen her. Die<br />
Gleitstellen der Sehnen über den Knochen werden<br />
von Schleimbeutel ausgekleidet. Die Sehnen selbst<br />
sind meist von Sehnenscheiden (Führungsrohr)<br />
umgeben.<br />
Die Muskulatur ist der aktive Bewegungsapparat<br />
Das Skelett ist der passive Bewegungsapparat<br />
Beim Skelettmuskel unterscheidet man:<br />
langsame Muskelzellen: für grobe, lang anhaltende kraftvolle Bewegungen, dunklere Muskelzellen,<br />
myoglobinreich (Plasma), viele Mitochondrien, weniger Myofibrillen, tonische Arbeiten, z.B.<br />
autochtone Rückenmuskulatur (im Sport beim Dauerläufer erforderlich).<br />
schnelle Muskelzellen: für feine, schnelle, präzise Bewegungen, hellere Muskelzellen, weniger<br />
Mitochondrien, myoglobinarm, rasche phasische Arbeiten, mehr Myofibrillen, z.B. Fingermuskulatur<br />
(im Sport beim Sprinter erforderlich).<br />
Selbst in Ruhe besitzt der Muskel eine bestimmte Eigenspannung, auch Ruhetonus bezeichnet.<br />
Je nach elektrischer Reizbarkeit und Leitfähigkeit weist der Muskel einen bestimmten Span-<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 21
nungszustand (Tonus) auf. Die Muskelarbeitsleistung kann sowohl statisch als auch dynamisch<br />
erfolgen.<br />
statisch = isometrisch, bedeutet höchster Krafteinsatz gegen einen unüberwindbaren Widerstand.<br />
Dabei wird der Muskel je nach Stellung des Gelenkes auf ein bestimmtes Maß verkürzt.<br />
dynamisch = isotonisch, bedeutet Überwindung eines Widerstandes, wobei sich der Muskel durch<br />
die Bewegung im Gelenk verkürzt oder verlängert.<br />
Der Skelettmuskel kann trainiert werden durch Krafttraining. Er wird dabei leistungsfähiger<br />
(kräftiger, knolliger), besser durchblutet (aussprossen von neuen Blutgefäßen zur besseren Versorgung),<br />
wenn Training und Erholungsphasen richtig und lange genug sind. Die Steigerung der<br />
Leistungsfähigkeit beruht auf dem Prinzip der Überkompensation.<br />
Wichtig ist aber auch die Ausgangssituation von Durchblutung, Aufwärmung, Dehnungsfähigkeit<br />
und Ruhetonus des Muskels. Der Ruhetonus lässt sich durch manuelle Manipulation (Massage)<br />
beeinflussen und beruht auf der Koppelung von Muskelzelle-Muskelspindel und ZNS (siehe<br />
Nervensystem).<br />
Abb. 19.<br />
Das AP des quergestreiften Muskels und die mechanische Reizbeantwortung<br />
3.8.<br />
Nervengewebe<br />
Das menschliche Nervensystem besteht aus mehr als 200 – 10 9 Nervenzellen = Neuronen. Das<br />
Neuron ist die funktionelle Einheit des Nervensystems.<br />
Es besteht aus: - Zellkörper (Soma)<br />
- Nervenfaser (Axon oder Neurit + Umhüllung)<br />
- Nervenfortsätzen (Dendriten)<br />
Im reifen Zustand hat die Nervenzelle ihre Teilungsfähigkeit verloren (Vermehrung od. Ersatz<br />
alter <strong>Zelle</strong>n nicht mehr möglich).<br />
Der Zellkörper ist das trophische Zentrum: Fortsätze, die von ihm abgetrennt werden, degenerieren<br />
(sterben ab, werden wieder neu gebildet).<br />
Die Dendriten sind der Ort des Erregungsempfanges.<br />
Die Zellmembran des Zellkörpers setzt sich entlang des Axons (= Neuriten) fort.<br />
Der Neurit leitet die Erregung der Nervenzellen weiter. Er erhält eine Hülle (aus Schwann‘schen<br />
<strong>Zelle</strong>n) zur Isolierung (gegen die Umgebung).<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 22
Bei einem Teil der Neurone bilden die Schwann`schen <strong>Zelle</strong>n sehr viele Schichten, die "Myelin-<br />
oder Markscheide" (lipoidhaltig). Sie ist entlang der Nevenfaser in regelmäßigen Abständen<br />
durch tiefe Einschnürungen = Ranvier‘sche Knoten unterbrochen. Die markhaltigen = dicken<br />
Nervenfasern mit einer relativ hohen Leitungsgeschwindigkeit stehen den marklosen = dünnen<br />
Nervenfasern mit geringer Leistungsgeschwindigkeit gegenüber.<br />
Abb. 20.<br />
Die Nervenzelle<br />
Das Axon endet mit zahlreichen kleinen kolbenförmigen Auftreibungen, den Endknöpfchen<br />
(Bouton terminal). Sie bildet zusammen mit der Membran der anliegenden (= zu erregenden)<br />
<strong>Zelle</strong> die Synapse, den Ort der Erregungsübertragung. Die im vorigen Kapitel geschilderten<br />
Vorgänge an den Zellmembranen von "erregbaren <strong>Zelle</strong>n" (Muskel- und Nervenzelle) laufen nun<br />
nicht mehr ungeordnet nach allen Richtungen ab, sondern werden in darauf spezialisierten Stellen<br />
in elektrische oder chemische Energie umgewandelt und in eine Richtung gelenkt. Diese<br />
Stellen heißen Synapsen.<br />
Die Nervenzelle wird an ihren Dendriten erregt, die Erregung über den Neuriten elektrisch und<br />
chemisch weitergeleitet bis zu seinen Endknöpfchen. In den Endkolben befinden sich Vesikel<br />
(Bläschen), die einen Transmitter (Überträgerstoff) speichern. Bei Eintreffen eines elektrischen<br />
Signals verschmelzen die Vesikel mit der präsynaptischen Membran und setzen den Transmitter<br />
(Vesikel platzen) in den synaptischen Spalt frei. Der nun freigesetzte Transmitter erregt die<br />
postsynaptische Membran (Zellmembran der nachfolgenden = zu erregenden <strong>Zelle</strong>).<br />
In der Synapse findet statt: Selektion = Filterung<br />
Transformation = Umwandlung<br />
Modulation = Frequenzbestimmung<br />
Sie fungiert als "Gleichrichter": Der ungeordnete Stromfluß wird in eine Richtung gelenkt.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 23
Elektrische Erregung<br />
Vesikel mit Transmitter<br />
Präsynaptische Membran (Endkolben = Nervenzellmembran)<br />
Synaptischer Spalt<br />
postsynaptische Membran (Drüsen-, Muskel-, Nervenzelle)<br />
Abb. 2<strong>1.</strong><br />
Die Synapse – der Endkolben<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 24
4.<br />
Organsysteme<br />
Mehrere Arten von Geweben bilden eine Einheit mit genau festgelegter Funktion = Organ<br />
(Magen, Leber, …).<br />
Wenn mehrere Organe dem gleichen Zweck dienen, spricht man von Organsystemen<br />
(Verdauungstrakt, Bewegungsapparat, …).<br />
5.<br />
Passiver Bewegungsapparat<br />
Das Skelett<br />
Skelett = passiver Bewegungsapparat (mit Gelenken)<br />
Gerüst aus einer Vielzahl miteinander verbundener Knochen.<br />
Nach der Form unterscheiden wir: flache, lange, kurze und lufthaltige Knochen. Die Knochen<br />
sind von einer gefäß- und nervenreichen Haut (Periost) überzogen. Nur die Gelenksenden besitzen<br />
stattdessen einen Knorpelüberzug (Gelenksknorpel).<br />
5.<strong>1.</strong><br />
Knochenverbindung<br />
– Haft = feste Verbindung<br />
– Gelenk = bewegliche Verbindung<br />
5.<strong>1.</strong><strong>1.</strong><br />
Haft: feste Verbindung<br />
Bandhaft (Syndesmose) Membrana interossea (UA, US)<br />
Ligamenta flava (elastische Bänder zw. den Wirbelbögen)<br />
(Schädelfugen beim Kind)<br />
(Befestigung = Einkeilung der Zähne im Kiefer)<br />
Knorpelhaft (Synchondrose) Epiphysenfuge in Adoleszenz<br />
Verbindung: Rippen - Sternum,<br />
Bandscheiben - Wirbel<br />
Knochenhaft (Synostose) Epi – und Symphyse Diaphysen nach Wachstumsabschluss<br />
(Schädelfugen beim Erwachsenen)<br />
(Gelenksversteifung = Ankylose; krankhafter Prozess)<br />
5.<strong>1.</strong><strong>2.</strong><br />
Gelenk: bewegliche Verbindung<br />
Ein Gelenk ist eine bewegliche Verbindung zweier oder mehrerer Knochen,<br />
Gelenke besitzen:<br />
Gelenkkörper (Knochen) mit Gelenkflächen (vom glatten, hyalinen Gelenksknorpel überzogen)<br />
Gelenkkapsel umhüllt das Gelenk vollständig, teilweise durch straffes BGW (= Bänder) verstärkt.<br />
2-schichtiger-Aufbau:<br />
Membrana synovialis (elastische Fasern, Gefäße, Nerven) innen<br />
Membrana fibrosa außen<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 25
Ausläufe der Gelenkskapsel, die zwischen Sehnen und Muskeln zu liegen kommen, heißen<br />
Schleimbeutel (Bursa). Ihre Aufgabe ist die Herabsetzung der Reibung zwischen den einzelnen<br />
Gewebsschichten. Sie können auch getrennt von der Gelenkkapsel vorkommen.<br />
Gelenkspalt kapillärer Spalt zwischen den Gelenkflächen<br />
Gelenkschmiere = Synovia von der inneren Schicht der Gelenkkapseln<br />
gebildet, ernährt sie den Gelenkknorpel<br />
und setzt die Reibung im Gelenk herab.<br />
Gelenkknorpel überzieht Gelenkflächen (2 - 5 mm dick, hyalin)<br />
vermindert Reibung, hat kein Perichondrium, von Synovia ernährt,<br />
keine Regeneration nach Verletzungen wirkt als Stoßdämpfer;<br />
braucht, um Funktion aufrecht zu erhalten:<br />
Bewegung- und Belastungsreize, ansonsten:<br />
Degeneration (Arthrose).<br />
Der Kontakt wird erhalten durch:<br />
Gelenkkapsel, Bänder, Muskeln, Art der Gelenkflächen zueinander, Gelenkspalt, Luftdruck<br />
Passen die Gelenkflächen der Knochen nicht genau aufeinander, wird die Unebenheit durch<br />
Faserknorpelscheiben (Discus, Meniskus) ausgeglichen.<br />
Die Einteilung der Gelenke erfolgt nach dem Bewegungsausmaß:<br />
a) Einachsige Gelenke = Gelenke mit 1 Freiheitsgrad<br />
Scharniergelenk = Ginglymus, Fingergelenke<br />
Drehgelenk (Radgelenk: dist. Radioulnarg.<br />
Zapfengelenk: prox. Radioulnarg.)<br />
b) Zweiachsige Gelenke = Gelenke mit 2 FHG<br />
Eigelenk: Radiocarpalgelenk<br />
Sattelgelenk: Daumengrundgelenk<br />
c) Dreiachsige Gelenke = G. mit 3 FHG<br />
Kugelgelenk: Schultergelenk<br />
(Nußgelenk): Hüftgelenk (Pfanne > Kopf)<br />
Abb. 2<strong>2.</strong><br />
Die verschiedenen Gelenkstypen im Schema<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 26
Abb. 23.<br />
6.<br />
Die Gelenkstypen<br />
Vokabular und Richtungsbezeichnung<br />
Vertical lotrecht<br />
horizontal waagrecht<br />
dexter rechts<br />
sinister links<br />
superior oben<br />
inferior unten<br />
anterior vorne<br />
posterior hinten<br />
ventral bauchwärts<br />
dorsal rückenwärts<br />
proximal rumpfwärts<br />
distal rumpf-fern<br />
cranial kopfwärts<br />
caudal schwanzwärts<br />
central im Mittelpunkt liegend<br />
peripher am Rand liegend<br />
rostral schnabelwärts<br />
coronal kranzwärts<br />
medianus in der Mitte liegend<br />
saggital in Richtung der Pfeilnaht<br />
medial zur Mitte hin liegend<br />
lateral nach außen hin liegend<br />
radial speichenwärts<br />
ulnar ellenwärts<br />
palmar = volar = hohlhandseitig<br />
plantar fußsohlenseitig<br />
Flexor Beuger<br />
Extensor Strecker<br />
Abductor Wegspreizer<br />
Adductor Beizieher<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Rotator Dreher<br />
medius der Mittlere<br />
intermedius dazwischen<br />
superficial oberflächlich<br />
profundus tief<br />
longitudinal längs<br />
transversus quer<br />
apical spitzenwärts<br />
basal grundwärts<br />
frontal stirnwärts<br />
occipital hinterhauptwärts<br />
fibular wadenbeinwärts<br />
tibial schienbeinwärts<br />
Discus Scheibe<br />
Discus intervertebralis Bandscheibe<br />
Discusprotrusion Bandscheibenvorwölbung<br />
Discusprolaps Bandscheibenvorfall<br />
Vertebra Wirbel<br />
Corpus Körper<br />
Seite 27
7.<br />
7.<strong>1.</strong><br />
Die Wirbelsäule<br />
Allgemeiner Überblick<br />
Die WS ist als "Rückgrat" Stütze und Lastträger des Rumpfes, als Wirbelkanal Schutzhülle für<br />
das Rückenmark (RM). Die Last wird durch die Wirbelkörper getragen, das RM zieht durch den<br />
langen Kanal aufeinander liegender Wirbellöcher.<br />
Die WS ist in der Seitenansicht doppelt S-förmig gekrümmt und besteht aus 33 - 34 Einzelwirbeln<br />
und den dazwischen liegenden Zwischenwirbelscheiben = Bandscheiben.<br />
Wirbel = Vertebra<br />
Bandscheibe = Discus intervertebralis<br />
7 Halswirbel = 7 Cervikal-Wirbel HWS<br />
12 Brustwirbel = 12 Thorakal-Wirbel BWS<br />
5 Lendenwirbel = 5 Lumbal-Wirbel LWS<br />
5 Kreuzwirbel = 5 Sacral-Wirbel = Kreuzbein, Os sacrum<br />
4 - 5 Steißwirbel = 4 - 5 Coccygeal-Wirbel = Steißbein, Os coccygis<br />
Kreuz- und Steißwirbel verknöchern frühzeitig miteinander und bilden gemeinsam das Kreuz-<br />
und Steißbein. Mit Ausnahme des <strong>1.</strong> und <strong>2.</strong> Halswirbels, Atlas und Axis, haben alle Wirbel die<br />
gleiche Grundform.<br />
Der Wirbelkörper setzt sich nach hinten fort in den Wirbelbogen. Dieser endet mit dem nach<br />
dorsal-caudal gerichteten Dornfortsatz (DFS). Vom Wirbelbogen gehen weiters noch ab 2 obere<br />
und 2 untere Gelenksfortsätze und 2 Querfortsätze (QFS).<br />
Das Wirbelloch wird von der Wirbelkörperhinterfläche und dem Wirbelbogen gebildet. Die Gesamtheit<br />
der Wirbellöcher bildet den RM-Kanal. Je zwei Wirbelbögen bilden die Zwischenwirbellöcher,<br />
durch die die RM-Nerven austreten. In diesen Zwischenwirbellöchern liegen auch die<br />
Spinalganglien.<br />
Die DFS sind als gratförmige Erhebung zu tasten ("Rückgrat"). Die Form der DFS, die Stellung<br />
der Wirbelgelenke und deren Beweglichkeit sind in den einzelnen Abschnitten der WS verschieden.<br />
7.<strong>2.</strong> Die Wirbelsäule als Funktionseinheit<br />
Die WS ist als Organ Spiegel des körperlich-seelischen (psychischen) Wohlbefindens.<br />
(z.B. Haltungsschwächen, gramgebeugt, Freude,..... Rumpf)<br />
Grundfunktionen: - Schutz und Stütze<br />
- Bewegungsachse des Körpers<br />
- Gleichgewicht- (Aufrecht-) Erhaltung<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 28
Durch den Aufbau der WS aus Wirbeln und Bandscheiben und als Anpassung an funktionelle<br />
Beanspruchung (aufrechter Gang, Federung des Kopfes, Statik-Gleichgewicht) finden sich verschiedene<br />
physiologische Krümmungen in den WS-Abschnitten:<br />
Abb. 24.<br />
Die Wirbelsäulenabschnitte<br />
Die Halswirbelsäule: Atlas und Axis (I. und II. HW)<br />
3. – 6. HW<br />
7. HW Prominens = Vertebra prominens<br />
Abb. 25. Atlas von oben<br />
Abb. 26.<br />
Atlas von unten<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 29
Abb. 27. Axis von vorne<br />
Abb. 28. Axis von seitlich<br />
Abb. 29. Axis von oben<br />
Halswirbelsäule: III. bis VII. HW<br />
Abb. 30. C5 von oben<br />
Abb. 3<strong>1.</strong> Halswirbel von der Seite Abb. 3<strong>2.</strong> C6 von vorne<br />
Abb. 33.<br />
C7 Vertebra prominens von oben<br />
Brustwirbelsäule<br />
Abb. 34. Brustwirbel von seitlich<br />
Abb. 35. Brustwirbel von oben<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Abb. 36.<br />
T6 + T7 von der Seite<br />
Seite 30
Abb. 37. schematische Darstellung<br />
der Gelenkflächen für die<br />
Wirbel-Rippen-Gelenke<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Abb. 38. Lendenwirbel von oben<br />
Abb. 39. Lendenwirbel von seitlich<br />
Abb. 40. Interartikularportion<br />
Abb. 4<strong>1.</strong> Os sacrum ventral<br />
Abb. 4<strong>2.</strong> Os sacrum dorsal<br />
Abb. 43. Os sacrum von oben<br />
Abb. 44.<br />
Os sacrum von seitlich<br />
Seite 31
Abb. 45. KB von seitlich, weibl. und männl.<br />
Abb. 46.<br />
Os coccygis von vorne und hinten<br />
7.3. Statik der Wirbelsäule<br />
Die WS als Stütze und Bewegungsachse ruht auf dem Beckengürtel, der aus dem Kreuzbein<br />
und den beiden Hüftbeinen besteht. Die beiden Hüftbeine sind an ihrer Vorderseite über die<br />
Symphyse verbunden. Das Kreuzbein ist mit jedem Hüftbein über das Kreuz-Darmbein-Gelenk<br />
(Iliosacralgelenk ISG) verbunden. Das ISG ist ein straffes Gelenk mit sehr geringem Bewegungsumfang.<br />
Die ISG sollen als Stoßdämpfer (federnd) wirken. Bei Belastung kann es daher zur<br />
Verwringung des Beckengürtels, das heißt zur Verdrehung der Hüftbeine (Rotation um Transversalachse)<br />
kommen.<br />
durch - Stehen am Standbein<br />
- Springen, hastige Bewegungen, Asphaltlaufen<br />
- Stufensteigen<br />
Dabei kann eine Fixierung eines ISG im Endbewegungsraum erfolgen: als ISG-Blockade bezeichnet.<br />
Das andere, freie ISG wird nun hypermobil, um die Blockade zu kompensieren (dabei<br />
meist Schmerzausstrahlung).<br />
Bei dieser Blockade gibt es 2 prinzipielle einander ausschließende Möglichkeiten:<br />
a) Vorschreitstellung: Hüftbein ventral-cranial gedreht und fixiert,<br />
Bein funktionell kürzer (Hüftgelenk)<br />
b) Rückschreitstellung: Hüftbein dorsal-caudal gedreht und fixiert,<br />
Bein funktionell länger (Hüftgelenk)<br />
Diese funktionelle Beinlängendifferenz (BLD) kann bei minimal rotiertem Beckengürtel = ISG-<br />
Blockade (um wenige mm) bis einige cm ausmachen und daher zu einem Beckenschiefstand<br />
führen.<br />
Beckenschiefstand bedingt durch: funktionelle BLD (ISG-Blockade)<br />
Oder anatomische BLD (Wachstum, Bruch...)<br />
Der Beckenschiefstand führt zu veränderter Statik der WS, da der Körper versucht, trotz schiefer<br />
Basis, das Gleichgewicht (aufrechte Haltung) zu bewahren. Daher wird durch seitliche Verkrümmung<br />
der Beckenschiefstand ausgeglichen.<br />
Seitliche WS-Verkrümmung = Skoliose (nicht physiologisch). Skoliosen können aber auch durch<br />
starke einseitige Beanspruchung bedingt sein (Einkaufstaschen oder Koffertragen, Rechtshänder,<br />
Linkshänder) oder durch WS-Erkrankungen. Über längere Zeit hinweg führen Skoliosen zu<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 32
Verspannungen der Muskulatur und zu Schäden an Bandscheiben und Wirbeln.<br />
Bevor ein Keil bei Beinlängendifferenz verabreicht wird, ist zu kontrollieren, ob funktionelle oder<br />
anatomische Beinlängendifferenz vorliegt.<br />
Keil nur bei anatomischer Beinlängendifferenz (abh. von Alter, Keilgröße) bei funktioneller<br />
BLD sonst krasse Überbeanspruchung und Abnützung des ISG (hypermobile Seite) und Hüftgelenk<br />
(hypermobile Seite bevorzugt).<br />
Die Statik der WS wird auch noch vom Schuhwerk beeinflusst:<br />
flache Schuhe, Minusschuhe: entspannte lockere Muskulatur<br />
Schuhe mit höheren Absätzen: Kippen des Beckengürtels, vermehrte Muskelarbeit nötig<br />
Die Beweglichkeit der Wirbelkörper wird u.a. auch durch die Bandscheiben (BS) gewährleistet.<br />
Sie liegen zwischen den Wirbelkörpern und tragen die volle Last.<br />
Die Bandscheiben bestehen aus: Gallertkern Nucleus pulposus<br />
Faserring Anulus fibrosus<br />
Die Dicke der BS nimmt (der Beanspruchung gemäß) von cranial nach caudal zu. Die Funktion<br />
der BS: Sie dienen als Stoßdämpfer. Durch Belastung werden sie zusammengedrückt. Bei länger<br />
dauernder Entlastung nehmen sie wieder die ursprüngliche Form an. Der Gallertkern ist gut verformbar<br />
und kann daher bei plötzlichem Staudruck, aber auch bei Beugung und Streckung der<br />
WS, als Druckverteiler und örtlicher Druckentlaster wirken. Die BS sind durch die Längsbänder<br />
noch zusätzlich in ihrer Lage gesichert (Ligamentum longitudinale posterius flächenhaft mit BS<br />
verwachsen).<br />
Verliert der Gallertkern seine Elastizität, so führt das zur ungleichmäßigen Druckverteilung im<br />
Zwischenwirbelraum mit Schädigung der Wirbelkörper und Einschränkung der WS-Bewegung.<br />
Zerreißt der Faserring, so weicht der Gallertkern nicht nur bei Biegungsbewegungen, sondern<br />
auch bei jeder senkrechten Druckbelastung der WS unkontrolliert nach vorne oder hinten aus.<br />
Ein solcher Bandscheibenvorfall kommt besonders häufig im LWS-Bereich (Ort der stärksten<br />
Belastung) vor.<br />
Der hintere Bandscheibenvorfall kann daher zur Kompression und damit zur Druckschädigung<br />
von RM und/oder peripheren Nerven führen (Näheres später).<br />
Die Stabilität der WS wird durch eine Reihe von Bändern und Muskeln gewährleistet, die dem<br />
starken Druck der Gallertkerne die Waage halten. Durch Versagen des WS-Stützgerüstes, vor<br />
allem jedoch durch Versagen der an den Wirbeln ansetzenden Bänder und Muskeln (durch fehlendes<br />
Training wie Gymnastik, ...), kommt es zu Haltungsschwächen und damit auf Dauer zu<br />
WS-Verkrümmungen. Sie können anfangs noch durch willkürliche Muskelspannung ausgeglichen<br />
werden.<br />
7.4.<br />
Bänder der Wirbelsäule<br />
a) Längsbänder der WS: erhöhen die Festigkeit der WS (beim Vor-, Rückneigen),<br />
hemmen die Bewegung, schützen die BS<br />
- vorderes Längsband: zieht an den Vorderflächen der Wirbelkörper vom<br />
Hinterhaupt (HH) bis zum Kreuzbein, wird caudal<br />
breiter, steht mit den Wirbelkörpern in fester<br />
Verbindung (aber nicht mit BS)<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 33
- hinteres Längsband: zieht vom HH nach caudal bis zum Kreuzbein,<br />
entlang der Hinterflächen der Wirbelkörper<br />
in fester Verbindung mit Ober- und Unterkanten<br />
der Wirbel und den BS<br />
b) elastische Bänder zw. den Wirbelbögen (Ligmenta flava, gelbe Bänder)<br />
Auch im Ruhezustand gespannt;<br />
Bei Beugung stärker gedehnt;<br />
Helfer beim Aufrichten der WS<br />
c) Nackenband, Ligamentum nuchae<br />
vom HH bis zu den DFS der HWS<br />
Muskelansatz<br />
d) Bänder zw. DFS, QFS, …<br />
7.5. Gelenke der Wirbelsäule<br />
Die kleinen Wirbelgelenke sind für die geringen Bewegungsmöglichkeiten zwischen 2 Wirbeln<br />
verantwortlich. Erst die Gesamtheit aller Bewegungsglieder (Wirbel und BS) erlauben eine entsprechende<br />
Bewegung. Die kl. Wirbelgelenke werden von cranial nach kaudal zu straffer. In der<br />
HWS sind sie weit und schlaff mit meniskusähnlichen Einlagerungen, wodurch eine Erhöhung<br />
der Beweglichkeit erreicht wird.<br />
HWS Seit-, Vor-, Rückbewegung bzw. ger. Drehung möglich<br />
BWS Vorwärtsdrehung, wenig Streckung + Beugung; (Behinderung durch Rippen)<br />
LWS Beugung, Streckung<br />
Das obere Kopfgelenk: Articulatio atlanto-occipitalis (Atlas-HH)<br />
bandgesichertes Eigelenk<br />
Vor-Rück-Bewegen: "Ja-sagen", Seite neigen<br />
Das untere Kopfgelenk: Articulatio atlanto-axialis (Atlas-Axis)<br />
Drehgelenk (26° nach jeder Seite)<br />
"Nein-sagen", Atlas dreht um Dens axis<br />
bandgesichert; Kreuzband<br />
aus Lig. transversum atlantis (quer hinter Dens)<br />
aus Längsbündel<br />
zusätzlich Lig. apicis dentis (zum For. occ.) und Flügelbänder<br />
7.6. Der Brustkorb<br />
Der Brustkorb besteht aus zwölf Rippenpaaren, die hinten an den zwölf Brustwirbeln und vorne<br />
mit einem knorpeligen Teil am Brustbein befestigt sind.<br />
Die Rippen sind flache Knochenspangen mit rotem, blutbildendem Knochenmark.<br />
<strong>1.</strong> 7 Paar echte Rippen = Brustrippen Sie sind direkt mit dem Brustbein in Verbindung.<br />
<strong>2.</strong> 3 Paar unechte Rippen = Bogenrippen<br />
Sie setzten vorne an der nächst höheren Rippe an und bilden somit den Rippenbogen.<br />
3. 2 Paar fliegende Rippen; Vorderes Ende der Rippen frei.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 34
Das Brustbein hat folgende Teile:<br />
– Handgriff<br />
– Körper<br />
– Schwertfortsatz<br />
Der Brustkorb ist nach oben und unten offen und beinhaltet lebenswichtige Organe (Herz,<br />
Lunge).<br />
Abb. 47. Sternum<br />
Abb. 48.<br />
Thorax<br />
8. Der Schultergürtel und die obere Extremität<br />
Den Schultergürtel bilden die beiden röhrenförmigen Schlüsselbeine und die beiden dreieckigen<br />
Schulterblätter. Das Schlüsselbein, Clavicula, ist mit seinem körpernahen Ende in einem<br />
funktionellen Kugelgelenk mit dem Brustbein, Sternum, verbunden. Das Schulterblatt, Scapula,<br />
ist am köperfernen Ende der Clavicula über ein Gelenk befestigt. Die Scapula ist muskulär am<br />
Rumpf befestigt ("aufgehängt").<br />
An der oberen Gliedmaße unterscheidet man:<br />
Oberarm: Humerus Oberarmknochen (Röhrenknochen)<br />
Unterarm: Ulna Elle (Röhrenknochen)<br />
Radius Speiche<br />
Zwischen Elle und Speiche spannt sich eine derbe Bindegewebshaut aus, die als Muskelursprungsgebiet<br />
dient (= Zwischenknochenhaut Membrana interossea).<br />
Hand:<br />
Handwurzel: Carpus 2 Reihen mit je 4 kurzen Knochen<br />
Mittelhand: Metacarpus 5 Mittelhandknochen<br />
Finger: Digiti Daumen 2-gliedrig<br />
<strong>2.</strong>-5. Finger 3-gliedrig<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 35
8.<strong>1.</strong><br />
Die Gelenke der oberen Extremität<br />
8.<strong>1.</strong><strong>1.</strong> Das Schultergelenk<br />
(Articulatio humeri) ist ein Kugelgelenk zwischen Scapula und Humerus. Die Schultergelenkspfanne<br />
mit ihrer geringen Höhlung (flache Pfanne) bildet keine optimale Sicherung für das<br />
Gelenk, sodass das Schultergelenk, da keine stärkeren Bänder vorhanden sind, zu den muskulär<br />
fixierten (gehaltenen = gesicherten) Gelenken gerechnet wird. (Die Pfanne - Cavitas glenoidalis -<br />
sie steht senkrecht auf die Scapularebene, ist wesentlich kleiner als der Oberarmkopf.)<br />
Pfannenoberfläche: 6 cm² = Luftdruck wirkt mit ca. 6 kg<br />
Gewicht der oberen Extremität: ca. 4 kg<br />
Durch das Fehlen stärkerer Bänder kann es im Schultergelenk leicht zur Luxation = Verrenkung<br />
kommen. (Bei einer Luxation verschwindet die Schulterwölbung.) Das Schultergelenk steht mit<br />
verschiedenen Schleimbeuteln (Gleitschutz für Sehnen) in Verbindung.<br />
8.<strong>1.</strong><strong>2.</strong> Das Ellbogengelenk<br />
(Art. cubiti), ist ein Drehscharniergelenk zw. Humerus, Ulna, Radius. Die schlaffe Gelenkkapsel<br />
wird verstärkt durch Seitenbänder (Ligamentum collaterale radiale und Lig. coll. ulnare). Das<br />
Lig. anulare radii (Ringband) schließt den Radiuskopf ein (bewegliches Widerlager bei Pronation<br />
und Supination).<br />
– Art. humeroradialis = Kugelgelenk<br />
– Art. humeroulnaris = Scharniergelenk<br />
– Art. radioulnaris proximalis = Zapfengelenk<br />
(Drehbewegung von Radius um Ulna)<br />
Bewegungen im Ellbogengelenk:<br />
– Flexion - Extension<br />
– Pronation - Supination<br />
Pronation: Radius, Ulna überkreuzen einander<br />
Supination: Radius, Ulna liegen parallel<br />
Zwischen Radius und Ulna spannt sich eine derbe Bindegewebsmembran (Membrana interossea)<br />
aus, die als Muskelursprungsgebiet dient und Zug- bzw. Druckspannungen von einem Knochen<br />
zum anderen überträgt. Die Articulatio radioulnaris distalis, ein Radgelenk, ermöglicht mit<br />
dem proximalen Radioulnargelenk die Pronation und Supination.<br />
8.<strong>1.</strong>3.<br />
Die Handgelenke<br />
Art. radiocarpea, prox. Handwurzelgelenk, Eigelenk<br />
zw. Ulna und Handwurzelknochen befindet sich ein Discus (articularis)<br />
Radius artikuliert mit proximalen Handwurzelknochen.<br />
Flexion (Palmarflexion) - Extension (Dorsalflexion)<br />
Radialabduktion – Ulnarabduktion<br />
Art. mediocarpea, dist. Handwurzelgelenk: Dorsalflexion<br />
(zw. prox. und dist. Reihe der Handwurzelknochen)<br />
Art. carpometacarpeae, straffe Gelenke<br />
dist. Handwurzelknochen - Mittelhandknochen<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 36
Art. carpometacarpea pollicis: Daumengrundgelenk, Sattelgelenk<br />
Daumen Adduktion - Abduktion<br />
Opposition - Repostition<br />
Zirkumduktion<br />
Fingergelenke: Metacarpophalangealgelenke "Kugelgelenke" Mittelhand-Finger<br />
Interphalangealgelenke Scharniergelenke Finger<br />
MCP<br />
PIP<br />
DIP<br />
Abb. 49. Membrana interossea Abb. 50. Pronation, Supination Unterarm<br />
Abb. 5<strong>1.</strong> Art. cubiti<br />
Abb. 5<strong>2.</strong> Bewegungen Schultergelenk<br />
Abb. 53.<br />
Sagittalschnitt Art. humeri<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 37
8.<strong>2.</strong><br />
Vokabular: knöcherne Strukturen am Schulterblatt und an der oberen Extremität<br />
Scapula: Schulterblatt<br />
* Margo medialis innerer Schulterblattrand<br />
* lateralis äußerer "<br />
* superior oberer "<br />
* Spina scapulae Schulterblattgräte<br />
* Fossa supraspinata "Obergrätengrube"<br />
* Fossa infraspinata "Untergrätengrube"<br />
* Acromion Schulterhöhe<br />
* Angulus inferior unterer Schulterblattwinkel<br />
* Angulus lateralis äußerer Schulterblattwinkel<br />
* Angulus superior oberer Schulterblattwinkel (med. gelegen)<br />
* Processus coracoideus Rabenschnabelfortsatz<br />
Tuberculum supraglenoidaleHöckerchen über d. Schultergelenkspfanne<br />
(f.l. Bizepskopf)<br />
Tuberculum infraglenoidale Höckerchen unter der Schultergelenkspfanne<br />
(f.l. Trizepskopf)<br />
Humerus: Oberarmknochen<br />
* Caput humeri Oberarmkopf<br />
(Collum anatomicum, anat. Hals)<br />
(Collum chirurgicum, chir. Hals)<br />
* Tuberculum majus großer Muskelansatzhöcker (lateral)<br />
* Tuberculum minus kleiner Muskelansatzhöcker (medial)<br />
Sulcus intertubercularis Rinne für die Sehne d. langen Bicepskopfes<br />
Crista tuberculi majoris Knochenleiste (vom Tub. majus) für Ansatz<br />
des M. pectoralis major<br />
Crista tuberculi minoris Knochenleiste (vom Tub. min) für Ansatz<br />
d. M. teres major + latissimus dorsi<br />
* Corpus humeri Oberarmschaft<br />
Sulcus nervi radialis Rinne für den N. radialis<br />
* Tuberositas deltoidea Rauhigkeit für Ansatz d. M. deltoideus<br />
* Condylus humeri Dist. Humerusende<br />
am Condylus humeri unterscheidet man:<br />
Capitulum humeri Humerusköpfchen f. Gelenk mit Radius<br />
Trochlea humeri Gelenkswalze f. " Ulna<br />
(Fossa coronoidea Grube für Processus coronoideus d. Ulna)<br />
(Fossa radialis " Radiusköpfchen)<br />
Epicondylus medialis<br />
* Sulcus nervi ulnaris Rinne für N. ulnaris<br />
* Epicondylus lateralis<br />
Fossa olecrani Grube für Ellenhaken<br />
Radius: Speiche<br />
* Caput radii Speichenkopf (proximal)<br />
(Circumferentia articularis gleitet in der Incisura radialis ulnae)<br />
Collum radii Hals zw. Caput und Tuberositas<br />
* Corpus radii Speichenschaft<br />
* Tuberositas radii mediale Rauhigkeit (Ansatz d. M. biceps brachii)<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 38
(Margo inter osseus Rand zur Befestigung d. Membrana interossea)<br />
Processus styloideus distal seitl. gelegener Ausläufer<br />
Incisura ulnaris Ausnehmung für Gelenk mit Ulna<br />
Ulna: Elle<br />
* Olecranon Ellenhaken<br />
Incisura trochlearis prox. Gelenkfläche für Trochlea humeri<br />
Processus coronoideus Knochenvorsprung am cord. Ende d. Inc. troch.<br />
* Tuberositas ulnae Rauhigkeit für Ansatz d. M. brachialis<br />
Incisura radialis Gleitfläche für Circum ferentia articularis radii<br />
Corpus ulnae Ellenschaft<br />
* Caput ulnae Ellenköpfchen (distal)<br />
Circum ferentia articularis Gleitfläche am Caput ulnae für Radius<br />
Processus styloideus stiftartiger Fortsatz am distalen Ulnaende<br />
Carpus: Handwurzel<br />
Os scaphoideum (naviculare)* Kahnbein<br />
Os lunatum * Mondbein<br />
Os triqetrum * Dreiecksbein<br />
Os pisiforme * Erbsenbein<br />
Os trapezium * großes Vieleckbein<br />
Os trapezoideum * kleines Vieleckbein<br />
Os capitatum * Kopfbein<br />
Os hamatum * Hakenbein<br />
Metacarpus: Mittelhand<br />
Ossa metacarpalia Mittelhandknochen<br />
Basis proximals breiteres Ende<br />
Corpus Schaft<br />
Caput distaler Gelenkskopf<br />
Digitus der Finger<br />
Digiti die Finger<br />
Phalanx Fingerglied (proximal, intermedia, distal)<br />
Basis<br />
Corpus<br />
Caput<br />
Pollex Daumen<br />
Index Zeigefinger<br />
Die mit * bezeichneten Strukturen sollten für die Prüfung als Mindestanforderungsmaß gelten.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 39
Abb. 54.<br />
Schultergürtel und Obere Extremität ap (SG+OE ap)<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 40
Abb. 55.<br />
SG+OE pa<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 41
8.3. Der Beckengürtel und die untere Extremität<br />
Das knöcherne Becken, Pelvis, besteht aus den beiden Hüftbeinen, dem Kreuzbein und dem<br />
Steißbein.<br />
Das Hüftbein, Os coxae, besteht aus:<br />
– Darmbein Os ilium<br />
– Sitzbein Os ischii<br />
– Schambein Os pubis<br />
Diese 3 Knochen synostosieren (sind knöchern zusammengewachsen = verschmolzen) in der<br />
Hüftgelenkspfanne. Darm-, Sitz- und Schambein verwachsen erst beim Jugendlichen. Die beiden<br />
Hüftbeine sind ventral über eine Knorpelhaft - die Symphyse - miteinander verbunden.<br />
Während das Becken im Kindesalter bei beiden Geschlechtern gleich ist, entwickelt sich das<br />
weibliche Becken in der Pubertät unter hormonellem Einfluss breiter (Ermöglichung des normalen<br />
Geburtsvorganges).<br />
Jedes Hüftbein ist mit dem Kreuzbein, Os sacrum, über ein sehr straffes Gelenk (Kreuz-Darmbeingelenk<br />
= Iliosacralgelenk ISG) verbunden. Die rauhen Gelenkflächen passen sehr gut ineinander<br />
und die straffe Gelenkkapsel wird noch durch sehr kräftige Verstärkungsbänder unterstützt,<br />
sodass die ISG nahezu unbewegliche Gelenke sind.<br />
Dennoch kommt den ISG eine Stoßdämpferfunktion zu. Außerdem gewähren sie die Möglichkeit<br />
der Verwringung des Beckengürtels und damit einen möglichen Ausgleich einer Beinlängendifferenz.<br />
Diese Verwringung des Beckengürtels kann zur Fixation im Endbewegungsraum führen<br />
= ISG Blockade. Dabei wird die Statik für die gesamte Wirbelsäule verändert, da die Basis, auf der<br />
die WS ruht, kippt. Durch seitliche = S-förmige Verkrümmungen = Skoliose versucht der Körper<br />
die schiefe Basis auszugleichen und das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.<br />
8.3.<strong>1.</strong> Morphologie des knöchernen Beckens<br />
Man unterscheidet ein großes Becken und ein kleines Becken. Unter dem kleinen Becken versteht<br />
man den Bereich unterhalb der Linea terminalis (Linie von Promontorium-Symphysenoberrand).<br />
Beim aufrechten Stand ist das Becken ungefähr 60° gegen die Horizontale geneigt (Inclinatio<br />
pelvis). Die Körperlast wird mittels einer Gewölbekonstruktion vom "Kreuzbein" über das Darmbein<br />
auf die Oberschenkel übertragen. Dieses Gewölbe wird ventral durch die Schambeinäste<br />
und die Symphyse fest verankert (Sitzbein unbelastet). Beim Sitzen wird die Beckeneingangsebene<br />
horizontal gestellt (Die Last wird nun auf die Sitzbeinhöcker übertragen).<br />
Geschlechtliche Unterschiede des Beckens:<br />
Weibliches Becken Männliches Becken<br />
geräumig, breit, niedrig enger, höher, schmäler<br />
breiter ausladend Darmbeinschaufeln steiler eingestellt<br />
queroval Beckeneingang kartenherzförmig<br />
dreieckig Foramina obturata längsgerichtet oval<br />
Arcus pubis Beckenausgang Angulus subpubicus<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 42
Abb. 56.<br />
Das Becken / der Beckengürtel<br />
An der unteren Gliedmaße unterscheidet man:<br />
Oberschenkel: Femur Oberschenkelknochen (Röhrenknochen)<br />
Unterschenkel: Tibia Schienbein<br />
Fibula Wadenbein (Röhrenknochen)<br />
Zwischen Tibia und Fibula spannt sich eine derbe Bindegewebshaut (= Zwischenknochenhaut,<br />
Membrana interossea) aus, die als Muskelursprungsgebiet dient.<br />
Die Kniescheibe, Patella, ist der größte Sesamknochen des menschlichen Körpers. Sie ist in die<br />
Sehne des M. quadriceps "eingewoben".<br />
Fuß:<br />
– Fußwurzel Tarsus 7 Fußwurzelknochen<br />
– Mittelfuß Metatarsus 5 Mittelfußknochen<br />
– Zehen Digiti Großzehen 2-gliedrig<br />
<strong>2.</strong>-5. Zehe 3-gliedrig<br />
8.3.<strong>2.</strong><br />
Die Gelenke der unteren Extremität<br />
<strong>1.</strong> Das Hüftgelenk (Articulatio coxae) Kugelgelenk zw. Os coxae und Femur. In ihr verschmelzen<br />
Darmbein, Schambein und Sitzbein. Die Pfanne wird an ihrem Rand von einer Knorpel-Lippe<br />
(Labrum acetabulare) verstärkt. Die Gelenkspfanne umgibt so (bedeckt) 2/3 des Femur-Kopfes.<br />
Die Pfanne enthält noch einen Fettpolster, von dem ein kleines Band (mit Gefäßen für den Kopf)<br />
zum Femur-Kopf zieht.<br />
Die Gelenkkapsel ist am Os coxae befestigt (Labrum acetabulare ragt frei in das Gelenk vor).<br />
Femurseitig setzt die Kapsel am "Schenkelhals" (Collum femoris) an. Unter den Bändern, die die<br />
Gelenkkapsel verstärken, findet sich das stärkste Band des menschlichen Körpers.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 43
– Ligamentum iliofemorale Zugfestigkeit 350 kg<br />
weiters noch:<br />
– Lig. ischiofemorale<br />
– Lig. pubofemorale<br />
Diese 3 Bänder verstärken die Gelenkskapsel, hemmen aber allzu großen Bewegungsumfang.<br />
Luxationen (Verrenkungen) sind selten, und gehen wenn mit Kapseleinriss und Bandriss einher.<br />
(Ernährungsstörungen im Femurkopf !?) Durch starke Belastungen (Gewicht, Bewegungsumfang,<br />
…) ist das Hüftgelenk großen Abnützungserscheinungen ausgesetzt.<br />
Bewegungen im Hüftgelenk:<br />
– Anteversion (= Flexion) - Retroversion<br />
– Abduktion - Adduktion<br />
– Zirkumduktion<br />
– Rotation<br />
<strong>2.</strong> Das Kniegelenk (Art. genus) Drehscharniergelenk zw. Femur, Tibia, Patella.<br />
Das Kniegelenk ist das größte und komplizierteste Gelenk des menschlichen Körpers.<br />
Die Inkongruenz der Gelenkflächen zw. Femur und Tibia wird durch die Einschaltung von Menisci<br />
ausgeglichen (flache Pfanne des Schienbeinkopfes).<br />
Die Gelenkkapsel wird verstärkt durch Seitenbänder. Diese Seitenbänder sind bei gestrecktem<br />
Knie gespannt. Die Gelenkflächen der Femurcondylen besitzen einen abnehmenden Krümmungsradius,<br />
daher sind die Seitenbänder bei gebeugtem Knie schlaff.<br />
Der mediale Meniscus ist mit dem medialen Seitenband, Lig. collaterale mediale, verwachsen<br />
(im Gegensatz zum lateralen Meniscus, nicht mit lateralem Seitenband Lig. collaterale laterale<br />
verwachsen). Der mediale Meniscus ist daher durch übermäßige Beanspruchung (unkoordinierte<br />
Bewegungen, Überlastungen, … bei geringerer Beweglichkeit) verletzungsanfälliger. Da bei<br />
gebeugtem Knie die Stabilität durch die schlaffen Seitenbänder nicht gegeben ist, wird die Kapsel<br />
noch durch die beiden Kreuzbänder verstärkt.<br />
Die Kreuzbänder dienen der Kontakterhaltung bei Drehbewegungen (in Beugestellung). Die<br />
Kreuzbänder werden bei Außenrotation im Knie auseinander gedreht › Außenrotationswinkel<br />
größer als Innenrotationswinkel. (vorderes Kreuzband Lig. cruciatum anterius zieht von proximal<br />
lateral nach distal medial; hinteres Kreuzband Lig. cruciatum posterius zieht von proximal<br />
medial nach distal lateral)<br />
Bei Kreuzbandriss tritt das Schubladenphänomen auf.<br />
Die Meniscen sind "sichelartige = halbmondförmige" Faserknorpelstücke, die im Querschnitt<br />
nach innen zu abgeplattet sind. Die Meniscen sind gefäß- und nervenlos. Der mediale Meniscus<br />
ist mit dem medialen Seitenband verwachsen. Beim Kniegelenk findet man zahlreiche Schleimbeutel.<br />
Einige dieser Schleimbeutel kommunizieren mit der Gelenkshöhle (Kapsel).<br />
Bewegungen im Kniegelenk:<br />
Flexion - in gebeugter Stellung auch geringe Rotation möglich<br />
Kreuzbänder angespannt, Seitenbänder entspannt<br />
Extension - beim Strecken des Knies Schlußrotation (von 5° in den letzten 10° der Streckung)<br />
Seitenbänder straff angespannt<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 44
Abb. 57.<br />
Das Hüftgelenk, Aufbau und Schnitt<br />
Abb. 58.<br />
Das Kniegelenk<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 45
3. Die Fußgelenke<br />
Oberes Sprunggelenk (Art. talocruralis) zw. Tibia, Fibula, Talus<br />
Scharniergelenk (transversale Gelenkachse)<br />
Dorsalflexion - Plantarflexion (mit Wackelbewegungen)<br />
Bänder: medial das größte Lig. deltoideum (aus 4 Teilbändern) = Pfannenband.<br />
Die Tibia bildet den medialen Knöchel, die Fibula den lateralen Knöchel<br />
Unteres Sprunggelenk (Art. subtalaris + talocalcaneonavicularis)<br />
zw. Talus, Calcaneus, Os naviculare, Zapfengelenk<br />
Rotation (Drehung): Pronation - Supination<br />
Übrige Gelenke zw. den Fußwurzel- und Mittelfußknochen: straffe Gelenke<br />
Zehengrundgelenke stellen Kugelgelenk dar.<br />
Zehengelenke (Interphalangealgelenke): Scharniergelenke<br />
8.3.3.<br />
Vokabular: knöcherne Strukturen am Beckenring und an der unteren Extremität<br />
Os Coxae: Hüftbein<br />
* Foramen obturatum ("verstopftes Loch") gebildet von Scham- u. Sitzbein<br />
* Acetabulum Hüftgelenkspfanne<br />
* Os ilium Darmbein<br />
Corpus osis ilii<br />
* Ala ossis ilii Darmbeinschaufel<br />
* Crista iliaca Darmbeinkamm<br />
* Spina iliaca anterior superior vorderer oberer Darmbeinstachel<br />
* Spina iliaca anterior inferior vorderer unterer Darmbeinstachel<br />
* Spina iliaca posterior superior hinterer oberer Darmbeinstachel<br />
* Spina iliaca posterior inferior hinterer unterer Darmbeinstachel<br />
Facies glutea Außenfläche der Darmbeinschaufel<br />
* Facies auricularis Kontaktfläche mit Os sacrum<br />
Tuberositas iliaca Verankerung der Ligg. sacro iliaca<br />
* Os ischii Sitzbein<br />
Corpus ossis ischii Sitzbeinkörper<br />
Ramus ossis ischii<br />
* Tuber ischiadicum Sitzbeinhöcker<br />
* Spina ischiadica Sitzbeinstachel<br />
* Os pubis Schambein<br />
Linea terminalis Verbindung vom Promontorium zum<br />
Symphysenoberrand<br />
Femur: Oberschenkelknochen<br />
* Caput ossis femoris Oberschenkelkopf<br />
* Collum osis femoris Oberschenkelhals<br />
* Trochanter major großer Rollhöcker<br />
* Trochanter minor kleiner Rollhöcker<br />
* Corpus ossis femoris Femurschaft<br />
* Condylus medialis mediale Kniegelenkswalze<br />
* Epicondylus medialis Knochenerhebung am medialen Condylus<br />
* Condylus lateralis laterale Kniegelenkswalze<br />
* Epicondylus lateralis Knochenerhebung am lateralen Condylus<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 46
Tibia: Schienbein<br />
* Facies articularis superior Kniegelenksfläche<br />
* Condylus medialis<br />
* Condylus lateralis<br />
Facis articularis fibularis Gelenkfläche für Fibulakopf<br />
Corpus tibiae Tibiaschaft<br />
* Tuberositas tibiae Rauhigkeit für Ansatz d. M. quadriceps<br />
* Malleolus medialis innerer Knöchel<br />
Incisura fibularis Anlagerungsfläche für Fibula<br />
Facies articularis inferior Gelenksfläche für Talus (Sprunggelenk)<br />
Fibula: Wadenbein<br />
Caput fibulae Wadenbeinkopf<br />
Collum fibulae Wadenbeinhals<br />
Corpus fibulae Wadenbeinschaft<br />
Malleolus lateralis äußerer Knöchel<br />
Patella: Kniescheibe<br />
Basis patellae oben gelegene breitere Kniescheibenkante<br />
Apex patellae unten liegende Spitze (der Kniescheibe)<br />
Tarsus: Fußwurzel (von Ferse bis Mittelfußknochen)<br />
Talus: Sprungbein<br />
Caput tali Sprungbeinkopf<br />
Collum tali Sprungbeinhals<br />
Corpus tali Sprungbeinkörper<br />
Trochlea tali Sprungbeinrolle<br />
Calcaneus: Fersenbein<br />
Tuber calcanei Fersenbeinhöcker (hinten)<br />
Sustentaculum tali medialer, konsolenartiger Vorsprung<br />
(unterhalb davon Rinne für M. flexor hallucis longus)<br />
Sulcus tendinis m.peronaeilongus Rinne an der Außenseite<br />
* Os naviculare Kahnbein<br />
* Os cuneiforme mediale inneres Keilbein<br />
* Os cuneiforme intermedium mittleres<br />
* Os cuneiforme laterale äußeres<br />
* Os cuboideum Würfelbein<br />
Metatarsus: Mittelfuß Basis proximales Ende<br />
Corpus Schaft<br />
Caput Kopf (distal)<br />
Digiti: Zehen<br />
Phalanges Zehenglieder<br />
Phalanx proximalis erstes Zehenglied<br />
Phalanx media mittleres Zehenglied<br />
Phalanx distalis Nagelglied der Zehe<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 47
Abb. 59.<br />
Hüftbein und UE re pa<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 48
Abb. 60.<br />
Hüftbein und UE re ap<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 49
8.4. Morphologie und Funktion des Fußskelettes, Statik des Beines<br />
Im hinteren Abschnitt des Fußskelettes liegen die Knochen übereinander, im mittleren und<br />
vorderen Abschnitt jedoch nebeneinander. Dadurch entsteht das Fußgewölbe (Längs- und<br />
Quergewölbe).<br />
– Rückfuß Talus, Calcaneus<br />
– Mittelfuß übrige Fußwurzelknochen<br />
– Vorfuß Metatarsus, Zehen<br />
Vom Talus aus setzt sich eine innere Knochenreihe fort (Talus, Os naviculare, Ossa cuneiformia,<br />
3 med. Mittelfußknochen + Zehen). Vom Calcaneus aus setzt sich eine äußere Knochenreihe fort<br />
(Calcaneus, Os cuboideum, beide äußeren Mittelfußknochen + Zehen). Daher ist der Fuß vorne<br />
breit und hinten schmal, und hinten höher als vorne. Der Fuß ist ein von innen her zugängliches<br />
Nischengewölbe (mit Längs- + Querkrümmung). Das Fußgewölbe trägt die Last des Körpers.<br />
Knöcherne Stützpunkte des Gewölbes (ebene Grundlage) sind:<br />
Tuber calcanei, Caput des Os metatarsale I und Caput des Os metatarsale V (Unterstützungsfläche<br />
= Dreieck) Der Fußabdruck ist durch die vorhandenen Weichteile wesentlich größer.<br />
Die Druckfortpflanzung erfolgt von der Tibia über Talus zum Calcaneus + Mittelfuß + Vorfuß.<br />
Durch die Druckübertragung nach beiden Richtungen besteht die Tendenz, das Gewölbe einzudrücken<br />
(Bandapparat + plantare Muskeln wirken entgegen). Der Bandapparat ist unermüdbar<br />
und hat eine größere Widerstandskraft als die Muskeln. Ist er allerdings überdehnt, kann er<br />
seine alte Form aus sich heraus nicht wiedergewinnen.<br />
Der Bandapparat gliedert sich:<br />
Plantar-Aponeurose<br />
Lig. plantare longum verschiedene kurze plantare<br />
Bänder<br />
Plantar-Aponeurose: oberflächlich, Fersenbeinhöcker<br />
- Plantarfläche der Zehen<br />
Plantare Muskeln: kurze Fußmuskeln + Sehnen<br />
der langen Fußmuskeln<br />
Die kurzen Fußmuskeln: Spannen des<br />
Fußgewölbes, wirken dem Absinken der Metatarsalknochen<br />
entgegen.<br />
Lig. plantare logum: (tief) zieht vom Calcaneus<br />
(Tuber) zum Os cuboideum + Basen der Metatarsalia<br />
II – V, verspannt das Längsgewölbe,<br />
übrige kurze plantare Bänder: Verspannung<br />
Längs + Quergewölbe<br />
Durch mangelnde Bewegung (Inaktivitätsatrophie<br />
der Muskeln) und Fehlbelastung<br />
(Gewicht, Schuhwerk, Stehen, …) kann es zu<br />
verschiedenen Fußdeformitäten und damit Fehlstellungen<br />
kommen. Z.B. beim Durchsinken<br />
= Einbrechen des Fußgewölbes ... Plattfuß.<br />
Während der Plattfußentstehung starke<br />
Schmerzen im Fuß und Unterschenkel durch<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Abb. 6<strong>1.</strong><br />
Das Fußskelett<br />
Seite 50
Überdehnung der Muskulatur. Ganz entscheidend für die<br />
gesamte Statik (des Körpers) ist der Aufbau der unteren<br />
Gliedmaße. Neben Veränderungen der Wachstumsfugen<br />
ist der "Collum-Corpus-Winkel" verantwortlich für eine<br />
anatomische Beinlängendifferenz.<br />
Femur:<br />
Collum-Corpus-Winkel: Der Winkel, den Collum femoris<br />
und Corpus femoris miteinander einschließen. Beim<br />
Erwachsenen 126° - 128°. Er ist verantwortlich für die<br />
Stabilität des Oberschenkelknochens. (Je kleiner desto<br />
größer die Gefahr des Schenkelhalsbruches).<br />
Der Collum-Corpus-Winkel beeinflußt die Stellung des<br />
Femurschaftes zur Traglinie des Beines (Gerade = Linie<br />
von Mitte Femurkopf - Mitte Kniegelenk - Mitte Calcaneus).<br />
Pathologische Änderungen des Winkels führen<br />
zu Stellungsanomalien der Beine (O-Beine, X-Beine) und<br />
Überlastung der Bänder und Gelenke.<br />
Zusätzlich zum Collum-Corpus-Winkel muß man noch<br />
den Torsionswinkel beachten:<br />
Eine Gerade durch Collum femoris<br />
Eine Gerade quer durch Condylen 12°<br />
Der Torsionswinkel (steht im Zusammenhang<br />
mit der Beckenneigung) ermöglicht<br />
erst die Übertragung von Beugebewegungen<br />
im Hüftgelenk in Drehbewegungen<br />
am Caput femoris. Bei abnormen Werten:<br />
Einwärts- oder Auswärtsdrehung des<br />
Beines. Eine Fehlhaltung des Beines bedingt<br />
eine abnorme Belastung und daher<br />
frühzeitige Abnützungserscheinungen<br />
des Kniegelenkes (und der übrigen Gelenke).<br />
Traglinie: Bänder - Kapsel - Knorpel, …<br />
Abb. 63. Der Collum-Corpus-Winkel<br />
in verschiedenen Entwicklungsstadien<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Abb. 6<strong>2.</strong><br />
Die verschiedenen Fußgewölbe<br />
Seite 51
9. Aktiver Bewegungsapparat: Die Skelettmuskulatur<br />
Die aktive Bewegung der einzelnen Skeletteile wird ermöglicht durch die willkürliche Betätigung<br />
der quergestreiften Skelettmuskulatur. Mit wenigen Ausnahmen (mimische Gesichtsmuskulatur)<br />
sind diese an zwei Punkten am knöchernen Skelett befestigt:<br />
Ursprung körpernahe Befestigung (punctum fixum)<br />
Ansatz körperferne Befestigung (punctum mobile)<br />
Meistens enden die Muskelfasern nicht direkt am Knochen sondern setzten mittels eines festen,<br />
faserreichen Bindegewebes = Sehne am Knochen an. Zwischen Ursprungs- und Ansatzsehne<br />
spannt sich eine Vielzahl von Muskelfasern aus (= Muskel-Bauch), die von einer Bindegewebshülle<br />
= Fascie umgeben ist. Die Wirkung eines Muskels ergibt sich aus dem Faserverlauf in Bezug<br />
auf die Gelenksachse. Entsprechend der drei möglichen Gelenksachsen unterscheidet man<br />
folgende Gruppen:<br />
Beuger Strecker (Flexor Extensor)<br />
Beizieher Wegspreizer (Adductor Abductor)<br />
Innen- Außendreher (Innen- Außenrotator)<br />
Die Muskelkraft ist abhängig von der Zahl der kontrahierten Muskelfasern und vom Hebelarm<br />
(Hebelgesetz).<br />
M Musculus<br />
U Ursprung körpernah = proximales Ende, punctum fixum<br />
A Ansatz körperfern = distales Ende, punctum mobile<br />
W Wirkung<br />
N Nervenversorgung<br />
9.<strong>1.</strong><br />
Rückenmuskulatur<br />
a) oberflächliche Schicht<br />
* o M. trapezius Kapuzenmuskel<br />
U: Occiput Hinterhaupt<br />
DFS C7, Th 1 - 12<br />
A: Spina scapulae Schulterblattgräte<br />
Acromion Schulterhöhe<br />
Clavicula Schlüsselbein<br />
W: Scapula - drehung,- hebung,- senkung; Kopfdrehung<br />
N: N. accessorius C2-4<br />
* o M. latissimus dorsi Breiter Rückenmuskel Schürzenbinder<br />
U: DFS Th 7 - 12<br />
L 1 - 5<br />
Os sacrum Kreuzbein<br />
Os ilium Darmbein<br />
A: Crista tuberculi minoris humeri<br />
W: Rückführen und Einwärtsdrehung d. Armes<br />
N: N. thoracodorsalis C6-8<br />
b) mittlere Schichte<br />
* o M. rhomboideus major<br />
U: DFS Th 1 - 4<br />
A: Margo medialis scapulae innerer Schulterblattrand<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 52
W: Medial-, Aufwärtsbewegung der Scapula<br />
N: N. dorsalis scapulae C4,5<br />
* o M. rohomboideus minor<br />
U: DFS C6,7<br />
A Margo medialis scapulae<br />
W Medial- u. Aufwärtsbewegung der Scapula<br />
N N. dorsalis scapulae C4,5<br />
* o M. levator scapulae<br />
U: QFS C 1-4<br />
A: Angulus superior scapulae oberer Schulterblattwinkel<br />
W: Hebung d. Angulus scapulae, Halsdrehung<br />
N: N. dorsalis scapulae C4,5<br />
M. serratus posterior superior<br />
U: DFS, C 6,7 Th 1, (C 6 - Th 2)<br />
A: <strong>2.</strong> - 5. Rippe<br />
W: Hilfsm. bei Inspiration<br />
N: Interkostalnerven Th 1-4<br />
M. serratus posterior inferior<br />
U: DFS Th 11, 12 L 1, 2 (Th 11 - L 2)<br />
A: untere 4 Rippen<br />
W: Rückdrehung der unteren 4 Rippen<br />
N: Interkostalnerven Th 9-12<br />
c) tiefe Schichte<br />
o M. erector spinae<br />
System von unterschiedlich langen, einander überkreuzenden Muskeln die<br />
zwischen Wirbelbögen und Wirbelfortsätzen ausgespannt sind.<br />
W: Bewegung der Wirbel gegeneinander<br />
Ermöglichung des aufrechten Ganges<br />
Die autochtone Rückenmuskulatur (M erector spinae) = eigenständige Muskulatur (der WS)<br />
hat Haltefunktion. = rote Muskulatur ... myoglobinreich, Mitochondrien-, …<br />
Fascia thoracolumbalis: umscheidet im LWS-Bereich den M. erector spinae<br />
Oberflächliches Blatt ausgespannt zw.: DFS, Rippenwinkel, 1<strong>2.</strong> Rippe<br />
Darmbeinkamm (Crista iliaca)<br />
tiefes Blatt von LWS -QFS<br />
Sie dient als Aponeurose für M. latissimus dorsi<br />
M. serratus posterior inferior<br />
M. transversus abdominis<br />
M. splenius capitis<br />
U: DFS C 4 -Th 3<br />
A: Linea nuchae superior (äußere Hälfte)<br />
Processus mastoideus Warzenfortsatz<br />
W: Rückneigung + Drehung d. Kopfes<br />
N: (Rami dorsales) C1-8<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 53
M. splenius cervicis<br />
U: DFS Th 3 - 5<br />
A: QFS C 1,2<br />
W: Rückneigung, Drehung d. Kopfes (über HWS)<br />
N: C1-8<br />
Abb. 64.<br />
Rückenmuskulatur<br />
9.<strong>2.</strong><br />
Kopf- und Halsmuskulatur<br />
Kopfmuskeln<br />
Kurze Kopfmuskeln:<br />
U: Atlas bzw. Axis (QFS, DFS)<br />
A: Occiput Hinterhaupt<br />
Mastoid Warzenfortsatz<br />
W: Neigung und Drehung des Kopfes<br />
N: Ramus dorsalis nervi spinalis C 1<br />
o M. longus capitis<br />
U: QFS C 3 - 6<br />
A: Occiput<br />
W: da Verlauf ventral d. WS: Vor- + Seitneigung des Kopfes<br />
N: Plexus cervicalis C1-4<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 54
Halsmuskeln<br />
o Platysma (Brustheber)<br />
Großflächiger Hautmuskel am Hals<br />
zieht vom unteren Gesichtsteil bis auf den oberen Thorax<br />
N: N. facialis<br />
o M. sternocleidomastoideus<br />
U: Sternum Brustbein<br />
Clavicula Schlüsselbein<br />
A: Mastoid Warzenfortsatz<br />
W: Kinnhebung + Drehung zur Gegenseite<br />
N: N. accessorius C1,2<br />
o M. longus colli<br />
verbindet bogenförmig die Körper des <strong>2.</strong> - 5. Halswirbels mit den<br />
unteren HW und oberen BW (QFS C 6 = Mittelpunkt)<br />
W: Seit- + Vorneigung des Kopfes<br />
N: Plexus cervicalis + brachialis C2-8<br />
Abb. 65.<br />
Kurze Nackenmuskeln<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 55
Abb. 66. Kopf- und Halsmuskeln<br />
Abb. 67.<br />
Gesichts- und Kaumuskulatur<br />
o Skalenusmuskulatur (3 Muskeln)<br />
U: QFS C 2 - 7<br />
A: <strong>1.</strong> + <strong>2.</strong> Rippe<br />
W: Seitneigung des Halses, Hebung der Rippe<br />
N: C5-7 / C4-8 / C7,8<br />
bilden die Skalenuslücken (Durchtritt des Plexus brachialis und Gefäße für<br />
Arm) bei Verspannung ausstrahlende Schmerzen, …<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 56
o Mimische Gesichtsmuskulatur<br />
Die größtenteils vom Gesichtsschädel entspringenden Muskelfasern strahlen in die<br />
Haut ein.<br />
W: Bewegung der Gesichtsöffnungen,<br />
Mienenspiel<br />
o Kaumuskeln<br />
Mehrere Muskeln zwischen Schädelbasis einerseits und Ober- und Unterkiefer<br />
andererseits.<br />
W: Kau-, Mahlbewegung<br />
o Augenmuskeln<br />
äußere: vom Kehlkopf nach oben zum Zungenbein und nach unten zum Brustbein<br />
ziehend.<br />
innere: feine Muskeln zwischen den einzelnen Knorpeln des Kehlkopfskeletts<br />
W: Offenhaltung des Luftweges,<br />
Tonbildung<br />
9.3. Brustmuskulatur<br />
a) oberflächliche Schichte<br />
o M. pectoralis major großer Brustmuskel<br />
U: Clavicula Schlüsselbein<br />
Sternum Brustbein<br />
Rectusscheide (4.-6. Rippenknorpel)<br />
A: Crista tuberculi majoris humeri (beim) großen Höcker<br />
W: Adduktion, Innenrotation, (Anteversion) -> Armverschränker<br />
N: Nervi pectorales C5-Th1<br />
o M. serratus anterior vorderer Sägemuskel<br />
U: <strong>1.</strong> - 9. Rippe<br />
A: med. Schulterblattrand<br />
W: Scapula fixieren, senken, drehen, nach vorne ziehen (hilft beim Hochheben<br />
des Armes)<br />
N: N. thoracicus longus C5-7<br />
b) mittlere Schichte<br />
o M. pectoralis minor kleiner Brustmuskel<br />
U: 3. - 5. Rippe<br />
A: Processus coracoideus (Coracoid) Rabenschnabelfortsatz<br />
W: zieht Scapula nach vorne + unten, Hilfsatemmuskel<br />
N: N. pect. C6-8<br />
c) tiefe Schichte<br />
o M. intercostales Zwischenrippenmuskulatur<br />
zwischen je 2 Rippen gelegene Muskeln mit gekreuztem Faserverlauf in mehreren<br />
Schichten.<br />
W: Hebung bzw. Senkung des Brustkorbes (je nach Faserrichtung)<br />
(Atemhilfsmuskel)<br />
N: Intercostalnerven<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 57
o Diaphragma Zwerchfell<br />
Kuppelförmige, muskulöse Trennwand zw. Brust u. Bauchhöhle mit<br />
Durchtrittsöffnungen für Gefäße, Speiseröhre,....<br />
N: N. phrenicus C4 (C3-5)<br />
U: LWS Körper L 1 - 3 ( ~ )<br />
7 - 12 Rippe<br />
Brustbein<br />
A: Centrum tendineum kleeblattähnlich, sehnige Zentralfläche<br />
W: Einatmung (bei Erschlaffung: Dehnung durch Vorspannung der Lunge)<br />
wichtigster Atemmuskel (60 % der Atemtätigkeit)<br />
9.4. Bauchmuskeln<br />
Vier Muskeln bilden die vordere und seitliche Bauchwand, die alle gemeinsam folgende Wirkung<br />
haben:<br />
– Beugung und Drehung des Rumpfes<br />
– Schutz der Baucheingeweide<br />
– Bauchpresse (Geburt, Stuhlgang, Heben, ...)<br />
o Äusserer schräger Bauchmuskel (M. obliquus externus abdominis)<br />
Faserverlauf von oben seitlich nach unten zur Mitte<br />
U: 5. - 1<strong>2.</strong> Rippe<br />
A: Rectusscheide<br />
N: Th 5 - 12<br />
o Innerer schräger Bauchmuskel (M. obliquus internus abdominis)<br />
Faserverlauf von oben Mitte nach unten seitlich<br />
U: Fascia thoracolumbalis, Crista iliaca Darmbeinkamm<br />
Lig. inguinale Leistenband<br />
A: 10 - 12 Rippe Rectusscheide<br />
N: Th 7 - 12<br />
o Querer Bauchmuskel (M. transversus abdominis)<br />
Faserverlauf quer-innerste Schicht<br />
U: 7 - 12 Rippe (innen)<br />
Fascia thoracolumbalis, Crista iliaca<br />
Lig. inguinale<br />
N: Th 7 - 12<br />
o Gerader Bauchmuskel (M. rectus abdominis)<br />
U: 5 - 7 Rippe, Proc. xiphoideus<br />
A: cranialer Schambeinrand (innerhalb Tuberculum pubis)<br />
N: Th 7 - 12<br />
Die Bauchwand ist nicht überall gleich stark. Bei Erhöhung des Innendruckes im Bauchraum<br />
können die Schwachstellen nachgeben und nach außen gewölbt werden. Man spricht von einem<br />
Weichteilbruch (= Hernie).<br />
Wichtigste Gefahrenpunkte:<br />
Nabelgegend - Nabelbruch<br />
Leistenkanal - Leistenbruch<br />
Operationsnarbe - Narbenbruch<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 58
o M. quadratus lumborum<br />
U: Darmbeinkamm<br />
A: 1<strong>2.</strong> Rippe, QFS der LWS<br />
W: Rippensenkung, Seitneigung<br />
N: Th 7 - 12<br />
Abb. 68.<br />
Brust- und Bauchmuskeln<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 59
9.5.<br />
Beckenbodenmuskulatur<br />
Der Beckenausgang des knöchernen Skeletts wird durch eine Muskelplatte nach unten begrenzt.<br />
Die Ausgänge der Beckenorgane treten durch diese Platte nach außen.<br />
Der muskuläre Beckenboden hat eine wesentliche tragende Funktion für die Organe des kleinen<br />
Beckens.<br />
9.6.<br />
Extremitätenmuskeln<br />
Während die körpernahen Muskeln kräftige Muskelbäuche und kurze Sehnen besitzen, finden<br />
wir körperfern schlankere Muskelbäuche mit längeren Sehnen. Dadurch nimmt der Umfang der<br />
Extremität körperfern ab und eine feinere und größere Beweglichkeit ist möglich (besonders<br />
im Bereich der Hand von Nutzen: für Greifbewegungen unumgänglich notwendig. z.B. Goldschmied,<br />
Schreiben, …)<br />
9.6.<strong>1.</strong><br />
Muskulatur der oberen Extremität<br />
<strong>1.</strong> Schulter und Oberarmmuskel<br />
o M. deltoideus Delta-Muskel<br />
Starker Muskel, der die Schulterkontur bildet. Die Muskelfasern umschließen das Schultergelenk<br />
haubenförmig. Aus diesem Grund kann der M. deltoideus, je nachdem welcher Teil sich zusammenzieht,<br />
alle Bewegungen im Schultergelenk ausführen.<br />
U: Spina scapulae Schulterblattgräte<br />
Acromion Schulterhöhe<br />
Clavicula Schlüsselbein<br />
A: Tuberositas deltoidea humeri<br />
W: Außen-, Innenrotation; Ad-Abduktion; Ante-, Retroversion,<br />
N: N. axillaris C4 - C6<br />
o M. supraspinatus oberer Grätenmuskel<br />
U: Fossa supraspinata Obergrätengrube<br />
A: Tuberculum majus humeri großer OA-Höcker<br />
W: Abduktion, Innenrotation, hält Humerus in Pfanne<br />
N: N. suprascapularis C4 - C6<br />
o M. infraspinatus unterer Grätenmuskel<br />
U: Fossa infraspinata Untergrätengrube<br />
A: Tuberculum majus humeri großer OA-Höcker<br />
W: Außenrotation<br />
N: N. suprascapularis C4 - C6<br />
o M. teres minor kleiner Rundmuskel<br />
U: Scapula, neben M. infraspinatus (Margo lat.)<br />
A: Tuberculum majus humeri<br />
W: Außenrotation, schw. Adduktion<br />
N: N. axillaris C5,6<br />
o M. teres major Großer Rundmuskel<br />
U: Skapula (Seitenkante)<br />
A: Crista tuberculi minoris humeri (Tuberculum minus)<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 60
W: Innenrotation, Adduktion, Rückführung<br />
N: N. subscapularis C6,7<br />
o M. subscapularis Unterschulterblattmuskel<br />
U: Fossa subscapularis (den Rippen zugekehrte Fläche der Scapula)<br />
A: Tuberculum minus humeri<br />
W: Innenrotation<br />
N: N. subscapularis C5 - 8<br />
o M. biceps brachii zweiköpfiger OA-Muskel<br />
U: Tub. supraglenoidale + Proc. corac.<br />
A: gemeinsam an Tuberositas radii<br />
Ulna (über Aponeurose)<br />
W: Beugung und Supination im Ellbogengelenk, Schultergelenk: Anteversion,<br />
Abduktion (Caput longum)<br />
Adduktion (Caput breve)<br />
N: N. musculocutaneus C5,6<br />
* Caput longum langer Bicepskopf<br />
U: Tuberculum supraglenoidale (Höcker über Schultergelenkspfanne)<br />
(A):<br />
W: schwache Abduktion + Innenrotation im Schultergelenk<br />
Beugung + Supination Ellbogengelenk<br />
* Caput breve kurzer Bicepskopf<br />
U: Processus coracoideus Rabenschnabelfortsatz<br />
(A):<br />
W: Anteversion + Adduktion d. Armes im Schultergelenk<br />
Supination + Beugung im Ellbogengelenk<br />
o M. coracobrachialis Hakenmuskel<br />
U: Processus coracoideus Rabenschnabelfortsatz<br />
A: Humerus (Mitte vorne)<br />
W: Anteversion, schw. Adduktion + Innenrotation<br />
N: N. musculocutaneus, C6,7<br />
o M. brachialis Armbeuger liegt unter dem M. biceps brachii<br />
U: unt. 2/3 d. Humerusvorderfläche<br />
A: Tuberositas ulnae<br />
W: Beugung im Ellbogengelenk<br />
N: N. musculocutaneus C5,6<br />
o M. triceps brachii dreiköpfiger Armmuskel<br />
U: Tub. infraglen., Humerus hinten<br />
A: Olecranon ... Ellenhaken<br />
W: Schultergelenk: Retroversion, Adduktion<br />
Ellbogen: Streckung<br />
N: N. radialis, C6 - 8<br />
* Caput longum<br />
U: Tuberculum infraglenoidale<br />
A: Olecranon<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 61
W: Adduktion im Schultergelenk, Streckung im Ellbogengelenk<br />
* Caput laterale, Caput mediale<br />
U: Humerus Hinterfläche<br />
A: Olecranon<br />
W: Streckung im Ellbogengelenk<br />
Abb. 69.<br />
Oberarmmuskulatur<br />
Unterarmmuskeln<br />
Die Unterarmmuskeln kann man der Lage nach in drei große Gruppen einteilen. Die einzelnen<br />
Muskeln und ihre zum Teil unterschiedlichen Funktionen werden in dieser groben Einteilung<br />
nicht berücksichtigt.<br />
o Ulnare Beuger Gruppe<br />
U: OA zur Mitte hin, Ulna<br />
A: Beugeseite der Hand (Handwurzel, Mittelhand, Finger)<br />
W: Beugung, Ulnarabduktion (Handgel.)<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 62
o Radiale Beuger Gruppe<br />
U: OA vorne, Radius<br />
A: Beugeseite der Hand<br />
W: Beugung, Radialabduktion<br />
o Strecker Gruppe<br />
U: OA hinten<br />
A: Streckseite der Hand<br />
W: Streckung<br />
Beuger oberflächliche Schicht<br />
- M. flexor carpi ulnaris N. ulnaris<br />
- M. palmaris longus N.medianus<br />
- M. flexor carpi radialis<br />
- M. brachioradialis N. radialis<br />
Beuger mittlere Schicht<br />
- M. flexor digitorum superficialis N. medianus<br />
Beuger tiefe Schicht<br />
- M. flexor digitorum profundus N. medianus + N. ulnaris<br />
- M. flexor pollicis longus N. medianus<br />
-(M. pronaror quadratus) N. medianus<br />
Strecker oberflächliche Schicht<br />
- M. extensor carpi radialis longus<br />
- M. extensor carpi radialis brevis<br />
- M. extensor digitorum N. radialis<br />
- M. extensor digiti minimi<br />
- M. extensor carpi ulnaris<br />
Strecker tiefe Schicht<br />
- (M. supinator)<br />
- M. abductor pollicis longus<br />
- M. extensor pollicis brevis<br />
- M. extensor pollicis longus N. radialis<br />
- M. extensor indicis<br />
o M. flexor carpi ulnaris<br />
Caput humerale + ulnare<br />
U: Epicondylus medialis humeri<br />
Olecranon<br />
Ulna<br />
A: ulnare Mittelhandknochen<br />
W: Ulnarabduktion, Beugung im Handgelenk<br />
N: N. ulnaris C7,8<br />
o M. palmaris longus<br />
U: Epicondylus medialis humeri<br />
A: Palmaraponeurose<br />
W: Spannen der Palmaraponeurose<br />
Handgelenk Beugung<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 63
Bewegung <strong>2.</strong> - 5. Finger im Grundgelenk<br />
N. N. medianus C8 - Th1<br />
o M. flexor carpi radialis<br />
U: Epicondylus medialis humeri<br />
A: Basis os. metacarpale II<br />
W: Pronation, Beugung, Radialabduktion Handgelenk<br />
N: N. medianus, C6-8<br />
o M. flexor digitorum superficialis<br />
Caput humero-ulnare, Caput radiale<br />
U: Epicondylus medialis humeri<br />
Ulna (Proc. coronoideus)<br />
Radius (Vorderfläche)<br />
A: Mittelglied d. <strong>2.</strong> - 5. Finger<br />
W: Beugung aller übersprungenen Gelenke<br />
N: N. medianus, C7 - Th1<br />
o M. flexor digitorum profundus<br />
U: obere Ulna-Hälfte<br />
A: Fingerendgliedbasen 2-5<br />
W: Beugung d. übersprungenen Gelenke<br />
N: N. medianus und N. ulnaris C6 - Th1<br />
o M. pronator teres<br />
Caput humerale, Caput ulnare<br />
U: Epicondylus medialis humeri<br />
Ulna (Processus coronoideus)<br />
A: Radiusaußenfläche (Mitte)<br />
W: Pronation + Beugung im Ellbogen<br />
N: N. medianus, C6,7<br />
o M. flexor pollicis longus<br />
U: Radiusvorderfläche (Mitte)<br />
A: Daumenendglied<br />
W: Beugung der übersprungenen Gelenke<br />
N: N. medianus C6-8<br />
o M. pronator quadratus<br />
U: Ulnavorderfläche (unt. 1/4)<br />
A: Radiusvorderfläche (unt. 1/4)<br />
W: Pronation<br />
N: N. medianus C6 - Th1<br />
o M. brachioradialis<br />
U: Humerus (+ Septum intermusculare)<br />
A: Radius (Proc. styl.)<br />
W: bringt UA aus extremer Pronation und Supination in Mittelstellung<br />
N: N. radialis C5,6<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 64
o M. extensor carpi radialis longus<br />
U: Epicondylus lateralis humeri<br />
A: Streckseite des <strong>2.</strong> Mittelhandknochens<br />
W: Beugung im Ellbogen<br />
Radialabduktion, Dorsalflexion im Handgelenk<br />
N: N. radialis C5 - 7<br />
o M. extensor carpi radialis brevis<br />
U: Epicondylus lateralis humeri<br />
A: 3. Mittelhandknochen (proximale Streckseite)<br />
W: Dorsalflexion, Radialabduktion im Handgelenk, schw. Beugung im Ellbogen<br />
N: N. radialis C7<br />
o M. extensor digitorum<br />
U: Epicondylus lateralis humeri<br />
A: Endglieder <strong>2.</strong>-5. Finger (über Dorsalaponeurose)<br />
W: Fingerstreckung, Dorsalflexion im Handgelenk (Ulnarabduktion)<br />
N: N. radialis C6 - 8<br />
o M. extensor digiti minimi<br />
U: Epicondylus lateralis humeri<br />
A: Dorsalaponeurose des 5. Fingers<br />
W: Kleinfingerstreckung, im Handgelenk Dorsalflexion + Ulnarabduktion<br />
N: N. radialis C6 - 8<br />
o M. extensor carpi ulnaris<br />
Caput humerale, caput ulnare<br />
U: Epicondylus lateralis humeri + Ulna (Rückseite)<br />
A: Basis 5. Mittelhandknochen<br />
W: Dorsalflexion, Ulnarabduktion im Handgelenk<br />
N: N. radialis C7,8<br />
o M. supinator<br />
U: Epicondylus lateralis humeri<br />
Ulna<br />
A: Radius (bis Rückfläche)<br />
W: Supination<br />
N: N. radialis, C5,6<br />
o M. abductor pollicis longus<br />
U: Membrana interossea (Rückseite) + Radius + Ulna<br />
A: Basis Metacarpale I<br />
W: Radialabduktion, Dorsalflexion im Daumengrundgelenk<br />
Supinator<br />
N: N. radialis C7,8<br />
o M. extensor pollicis brevis<br />
U: Radius (Streckseite)<br />
Membrana interossea<br />
A: Basis des Daumengrundgelenks<br />
W: Streckung + Abduktion des Daumens im Grundgelenk<br />
N: N. radialis C8, Th1<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 65
o M. extensor pollicis longus<br />
U: Membrana interossea<br />
Ulna Rückfläche<br />
A: Daumenendphalanx<br />
W: Adduktion + Streckung des Daumens<br />
N: N. radialis C7,8<br />
o M. extensor indicis<br />
U: Membrana interossea<br />
Ulna (Rückfläche)<br />
A: Dorsalaponeurose d. Zeigefingers<br />
W: Streckung von Zeigefinger + Handgelenk<br />
N: N. radialis C8, Th1<br />
Abb. 70.<br />
Unterarmmuskulatur<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 66
Abb. 7<strong>1.</strong><br />
Handmuskulatur<br />
Handmuskulatur<br />
Für die feinen Bewegungen der Finger (Werkzeugtätigkeit) gibt es noch die "kurze Finger- Muskulatur".<br />
Diese Muskeln entspringen an den Handwurzel- und Mittelhandknochen (Ursprung) und<br />
setzen an den Fingergliedern an (Ansatz).<br />
Es gibt:<br />
o Muskulatur des Thenar (Daumenballenmuskulatur)<br />
M. abduktor pollicis brevis N. medianus C8 - Th1<br />
M. opponens pollicis N. medianus C6, 7<br />
M. flexor pollicis brevis (Caput superficiale) N. medianus C8 - Th1<br />
(Caput profundum) N. ulnaris C8 - Th1<br />
M. adductor pollicis brevis (Caput transversum) N. uln.<br />
(Caput obiliquum)<br />
o Muskulatur des Hypothenar (Kleinfingerballen)<br />
M. abductor digiti minimi N. ulnaris C8, Th1<br />
M. flexor digiti minimi brevis N. ulnaris C8, Th1<br />
M. opponens digiti minimi N. ulnaris C8, Th1<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 67
o Muskulatur der Mittelhand<br />
N. ulnaris C8, Th1<br />
Mm. interossei dorsales (doppel=2köpfig) (4x) Spreizg 2,4, Rad+Uln.abd. 3<br />
Mm. interossei palmares (einköpfig) (3x) Add. 2, 4, 5<br />
Mm. lumbricales (4x) Grundgelenkbeugung<br />
Mittel- und Endgelenkstreckung<br />
9.6.<strong>2.</strong> Muskulatur der unteren Extremität<br />
Hüft- und Oberschenkelmuskeln<br />
In Anpassung an die Lebensform (aufrechter Stand) überwiegen im Bereich der Hüftmuskeln<br />
die in mehreren Schichten angeordneten Strecker.<br />
Strecker: Oberflächliche Schichte<br />
o M. glutaeus maximus großer Gesäßmuskel<br />
U: Os ilium Darmbein (kamm)<br />
Os sacrum Kreuzbein<br />
A: Tractus iliotibialis<br />
Femur (OS hinten)<br />
W: Adduktion, Abduktion Außenrotation, Streckung im Hüftgel.<br />
N: N. glutaeus superior L5 - S2<br />
Strecker: Mittlere Schichte<br />
o M. glutaeus medius<br />
U: Os ilium Darmbein(schaufel) außen<br />
A: Trochanter major (hinten) großer Rollhöcker<br />
W: Abduktion, Außenrotaion, (Innenrotation) Streckung im Hüftgelenk<br />
N: N. glutaeus sup. L4,5<br />
o M. glutaeus minimus<br />
U: Os ilium<br />
A: Trochanter major (vorne)<br />
W: Abduktion, Innenrotation, Beugung u. Streckung im Hüftgelenk<br />
N: N. glutaeus sup. L4 - S1<br />
Strecker: Tiefe Schichte: kurze Hüftmuskeln<br />
U: Os sacrum (Vorderfläche) Kreuzbein<br />
Os ischium (Spina, Tuber)<br />
A: Femur (Trochanter major)<br />
W: Abduktion, Adduktion, Streckung, Außenrollung<br />
N: Plexus sacralis<br />
- M. piriformis L5 - S2<br />
- M. gemellus superior<br />
- M. obturatorius internus<br />
- M. gemellus inferior<br />
- M. quadratus femoris<br />
- M. obturatorius internus<br />
- M. obturatorius externus N. obturatorius L1-4<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 68
lange Strecker - OS<br />
o M. biceps femoris<br />
* Caput longum<br />
U: Tuber ischiadicum<br />
A: Caput fibulae<br />
W: Streckung, Adduktion, Außenrollung im Hüftgelenk<br />
Beugung, Außenrollung im Kniegelenk<br />
N: N. ischiadicus (N. tibialis) L5 - S2<br />
* Caput breve<br />
U: Femur (hinten) OS<br />
A: Caput fibulae<br />
W: Beugung u. Außenrollung im Kniegelenk<br />
N: N. ischiadicus (N. fibularis) S1, 2<br />
o M. semitendinosus<br />
U: Tuber ischiadicum<br />
A: Pes anserinus (med. der Tuberositas tibiae) "Gänsefuß"<br />
W: Streckung, Innenrotation, Adduktion im Hüftgelenk<br />
Beugung, Innenrollung, Kniegelenk<br />
N: N. tibialis (N. ischiadicus) L5 - S2<br />
o M. semimembranosus<br />
U: Tuber ischiadicum<br />
A: (Pes anserinus) Condylus medialis tibiae<br />
W: Streckung, Adduktion, Einwärtsrollung im Hüftgelenk<br />
Beugung, Innenrotation im Kniegelenk<br />
Kniegelenkskapselspanner<br />
N: N. tibialis L5 - S2<br />
Beuger:<br />
o M. iliopsoas aus<br />
M. psoas major<br />
M. iliacus<br />
A: Trochanter minor<br />
W: Hüftgel. Beugung<br />
Außenrotation<br />
o M. psoas major<br />
U: Körper + QFS L 1-4<br />
A: Trochanter minor<br />
W: Hüftgelenk Beugung + Außenrotation, ermöglicht das Gehen<br />
Streckung LWS = Rumpf - Vorbeugen<br />
Rumpfheben im Liegen<br />
N: Plexus lumbalis L1 - 4<br />
o M. iliacus<br />
U: Fossa ilicia Darmbeinschaufel Innenseite<br />
A: Trochanter minor<br />
W: Hüftgelenk: Beugung + Außenrotation<br />
N: N. femoralis L2-4<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 69
o M. tensor fasciae latae<br />
U: (neben) Spina iliaca anterior superior vorderer oberer Darmbeinstachel<br />
A: über Tractus iliotibialis<br />
lateral an Tuberositas tibiae<br />
W: Beugung, Abduktion, Innenrollung im Hüftgelenk<br />
Beugung/Streckung + Schlußrotation im Kniegelenk<br />
N: N. glutaeus superior L4,5<br />
o M. sartorius Schneidermuskel<br />
U: Spina iliaca anterior superior<br />
A: Medial d. Tuberositas tibiae<br />
W: Außenrollung, Beugung, Abduktion Hüftgelenk<br />
Beugung, Innenrollung im Kniegelenk<br />
N: N. femoralis L1-3<br />
o M. quadriceps femoris<br />
A: über Quadricepssehne (Patella eingeflochten) an Tuberositas tibiae<br />
N: N. femoralis L2-4<br />
vierköpfiger Muskel:<br />
M. rectus femoris<br />
U: Spina iliaca anterior inferior<br />
W: Beugung im Hüftgelenk, Streckung im Kniegelenk<br />
M. vastus lateralis<br />
U: Trochanter major<br />
M. vastus intermedius<br />
U: Femurvorderseite<br />
M. vastus medialis<br />
U: Femurinnenseite<br />
W: Streckung im Kniegelenk<br />
o M. articularis genus (in der Tiefe)<br />
U: Femurvorderseite<br />
A: Kniegelenkskapsel<br />
W: " spannung<br />
N: N. femoralis<br />
Beiziehergruppe:<br />
o M. gracilis<br />
U: Os pubis Schambein<br />
A: medial der Tuberositas tibiae<br />
W: Adduktion, Beugung Hüftgelenk, Beugung im Kniegelenk<br />
N: N. obturatorius L2-4<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 70
o M. adductor magnus<br />
U: Tuber ischiadicus<br />
A: Epicondylus medialis femoris<br />
W: Adduktion, Streckung im Hüftgelenk + Innenrotation<br />
N: N. obturatorius und N. ischiadicus L3 - L5<br />
o M. adductor longus<br />
U: Neben Symphyse<br />
A: Femur medial (in Mitte)<br />
W: Adduktion + Beugung + Außenrotation im Hüftgelenk<br />
N: N. obturatorius L2 - 4<br />
o M. adductor brevis<br />
U: Os pubis<br />
A: Femur (med. ob. Hälfte)<br />
W: Adduktion + Außenrollung + Beugung im Hüftgelenk<br />
N: N. obturatorius L2 - 4<br />
o M. pectineus<br />
U: Os pubis (Pecten)<br />
A: Trochanter minor<br />
W: Beugung, Adduktion, Außenrotation im Hüftgelenk<br />
N: N. fermoralis L2,3 + N. obturatorius L2 - L4<br />
<strong>2.</strong> Unterschenkelmuskeln<br />
Die Unterschenkelmuskulatur beinhaltet Muskeln, die die Sprunggelenke überspringen und zur<br />
Bewegung des Fußes und der Zehen dienen. Ähnlich wie bei der Hand liegen die Muskelbäuche<br />
im Bereich des Unterschenkels, und nur die Sehnen erreichen den Fuß.<br />
Beuger: Wadenmuskulatur - oberflächliche Schichte<br />
o M. triceps surae dreiköpfiger Wadenmuskel<br />
N: N. tibialis S1/2<br />
bestehend aus:<br />
- M. gastrocnemius Zwillingswadenmuskel<br />
oberflächlicher 2-köpfiger Wadenmuskel<br />
W: Beugung im Kniegelenk, Plantarflexion, Supination im Sprunggelenk<br />
- M. soleus Schollenmuskel<br />
* o M. gastrocnemius:<br />
-- Caput laterale<br />
U: proximal von Condylus lateralis femoris<br />
-- Caput mediale<br />
U: proximal vom Condylus medialis femoris<br />
A: über Achillessehne am Calcaneus (Tuber calcanei)<br />
o M. soleus Schollenmuskel<br />
U: obere Tibia- u. Fibulaenden<br />
A: Achillessehne<br />
W: Plantarflexion, Supination<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 71
o M. popliteus<br />
U: Epicondylus lateralis femoris<br />
A: Tibia (Rückseite)<br />
W: Beugung im Kniegelenk, Innenrotation d. US<br />
N: N. tibialis L4 - S1<br />
o M. plantaris<br />
U: Condylus lateralis femoris<br />
A: über M. soleus in Achillessehne<br />
W: (Beugung, Innenrotation)<br />
N: N. tibialis S1,2<br />
tiefe Schichte: lange Zehenbeuger (Sehnen laufen über = unter Innenknöchel)<br />
o M. flexor digitorum longus<br />
U: Tibia<br />
A: Zehenendglieder 2-5<br />
W: Plantarflexion, Supination, Zehenbeuger<br />
N: N. tibialis S1 - 3<br />
o M. tibialis posterior<br />
U: Membrana interossea<br />
A: Os naviculare Kahnbein<br />
ossa cuneiformia Keilbeine<br />
os cuboideum Würfelbein<br />
ossa metatarsalia 2-4 Mittelfußknochen 2-4<br />
W: Plantarflexion, Supination<br />
N: N. tibialis L4/5<br />
o M. flexor hallucis longus<br />
U: Fibula<br />
A: Großzehenendglied<br />
W: Plantarflexion, Supination, Großzehenbeugung<br />
N: N. tibialis S1 - S3<br />
Strecker Gruppe<br />
o M. tibialis anterior<br />
U: Tibia<br />
Membrana interossea<br />
A: Os cuneiforme mediale<br />
Os metatarsale 1<br />
W: Dorsalflexion, Supination<br />
N: N. peronaeus profundus L4,5<br />
o M. extensor digitorum longus<br />
U: Condylus lateralis tibiae<br />
Membrana interossea<br />
A: Dorsalaponeurose der <strong>2.</strong>-5. Zehe<br />
W: Dorsalflexion, Pronation<br />
N: N. peronaeus profundus L5, S1<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 72
o M. extensor hallucis longus<br />
U: Membrana interossea<br />
Fibula<br />
A: Großzehenendglied<br />
W: Dorsalflexion d. Fußes, Großzehenstreckung<br />
N: N. peronaeus profundus L4 - S1<br />
Seitliche Gruppe - Wadenbeinmuskulatur<br />
o M. peronaeus longus<br />
U: Fibula<br />
A: Schräg unter der Fußsohle am<br />
Os cuneiforme mediale<br />
Os metatarsale 1<br />
W: Plantarflexion, Pronation<br />
N: N. peronaeus superficialis L5 - S1<br />
o M. peronaeus brevis<br />
U: Dist. 2/3 der Fibula<br />
A: Os metatarsale 5 (Tuberositas)<br />
W: Plantarflexion, Pronation<br />
N: N. peronaeus superficialis L5 - S1<br />
3. Fußmuskeln (kurze Fußmuskeln)<br />
Strecker: am Fußrücken<br />
o M. extensor hallucis brevis<br />
U: Calcaneus<br />
A: Großzehengrundglied<br />
W: Großzehenstreckung<br />
N: N. peronaeus profundus, S1,2<br />
o M. extensor digitorum brevis<br />
U: Calcaneus<br />
A: Dorsalaponeurosen der <strong>2.</strong>-5. Zehen<br />
W: Zehenstreckung<br />
N: N. peronaeus profundus S1, 2<br />
Die plantaren Fußmuskeln werden oberflächlich von der Plantaraponeurose (Längszüge Tuber<br />
calcanei - Zehen) bedeckt. Sie bilden die Stütze des Längs- und Quergewölbes.<br />
Großzehenmuskel:<br />
o M. abductor hallucis<br />
U: Tuber calcanei, Plantaraponeurose<br />
A: Basis der Grundphalanx<br />
W: Abduktion nach medial<br />
Stütze des Gewölbes<br />
N: N. plantares (med.+lat.) L5, S1<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 73
o M. flexor hallucis brevis<br />
U: Os cuneiforme mediale<br />
Lig. plantare longum<br />
A: Grundphalanx d. Großzehe<br />
W: Beugung der Großzehe<br />
N: N. plant. med. + lat. L5, S1<br />
- beim Spitzentanz erforderlich<br />
o M. adductor hallucis<br />
N: Plantaris lat. S1,2<br />
- Caput obliquum<br />
U: Os metatarsale 2-4<br />
Os cuboideum + cuneiforme laterale<br />
A: Grundphalanx d. Großzehe<br />
W: Stütze des Längs- u. Quergewölbes<br />
- Caput transversum<br />
U: Kapselbänder d. Zehengrundgelenke 3-5<br />
A: Großzehengrundphalanx<br />
W: Stütze des Quergewölbes<br />
Die Muskeln der Kleinzehe:<br />
o M. abductor digiti minimi<br />
formt den lateralen Fußrand<br />
U: Calcaneus<br />
A: seitlich an der Grundphalanx d. 5. Zehe<br />
W: Plantarflexion, Abduktion d. 5. Zehe<br />
N: N. plant. lat. S1,2<br />
o M. flexor digiti minimi brevis<br />
U: Basis ossis metatarsale 5<br />
Lig. plant. longum<br />
A: Kleinzehengrundphalanx<br />
W: Plantarflexion der Kleinzehe<br />
N: N. plant. lat. S1,2<br />
Kurze Muskeln im mittleren Bereich:<br />
o M. flexor digitorum brevis<br />
U: Tuber calcanei, Plantaraponeurose<br />
A: Mittelphalanx d. Zehen 2-5 (gespaltene Sehnen)<br />
W: Zehenbeugung, Stütze d. Längsgewölbes<br />
N: N. plant. med. L5, S1<br />
o M. quadratus plantae<br />
U: Calcaneus<br />
A: seitl. Rand d. Sehnen d. M. flexor dig. long.<br />
W: Stütze d. Längsgewölbes<br />
N: N. plant. lat. S1,2<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 74
o Mm. lumbricales<br />
U: med. Seite d. Sehnen d. langen Zehenbeugers<br />
A: med. Rand. d. Grundphalangen<br />
W: Add. d. Zehen zur Großzehe<br />
N: N. plant. med. + lat. L5 - S2<br />
o Mm. interossei plantares<br />
Mm. interossei dorsales<br />
(zweiköpfig)<br />
Abb. 73.<br />
Oberschenkelmuskeln II<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Abb. 7<strong>2.</strong><br />
Oberschenkelmuskeln I<br />
Seite 75
Abb. 74.<br />
Unterschenkelmuskeln<br />
Abb. 75.<br />
Fußmuskulatur<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 76
10. Das Nervensystem<br />
Das Nervensystem ist der Ort der Steuerung und Koordination aller Vorgänge im Organismus.<br />
Vom biophysikalischen Standpunkt aus betrachtet ist es der Ort der Reizumwandlung (Reiztransformation).<br />
Beim Nervensystem unterscheidet man:<br />
nach der Funktion:<br />
- animalisches NS: sensomotorisches NS<br />
- VNS = ANS vegetatives = autonomes NS<br />
nach der Lokalisation:<br />
- ZNS zentrale NS: Gehirn, Rückenmark<br />
- PNS peripheres NS:Spinalnerven, Hirnnerven, …<br />
alle Nervenbahnen außerhalb des Gehirns u. Rückenmarkes<br />
Das sensomotorische NS dient der bewussten Wahrnehmung, der willkürlichen Bewegung und<br />
der Nachrichtenverarbeitung.<br />
Motorischer Anteil: zentrifugale Richtung und Leitung (vom Zentrum in die Peripherie),<br />
Steuerung der willkürlichen Muskeltätigkeit: Endsynapsen: motorische Endplatten<br />
Sensibler Anteil: zentripetale Leitung (von der Peripherie zum Zentrum gerichtet), Registrierung<br />
von Tast-, Schmerzempfindung, Temperatur, Synapsen-Tastkörperchen, Schmerzrezeptoren.<br />
10.<strong>1.</strong> Rückenmark und Spinalnerven<br />
Das Rückenmark stellt ein primitives Zentrum für einfache Funktionen des Nervensystems dar<br />
(z.B. bestimmte Reflexe, vegetative Funktionen etc.). Komplexere Aufgaben werden über das Gehirn<br />
abgewickelt. Beim Erwachsenen hat das Rückenmark einen Durchmesser von einem Zentimeter<br />
und eine Länge von 40 - 50 cm, es reicht<br />
also etwa bis in Höhe des zehnten bis zwölften<br />
Brustwirbels.<br />
Im Querschnitt ist eine dunkle schmetterlingsförmige<br />
Figur erkennbar, die graue Substanz.<br />
Diese enthält die Nervenzellen der so genannten<br />
efferenten (zur Muskulatur führenden)<br />
Bahnen im Vorderhorn und die <strong>Zelle</strong>n der so<br />
genannten Interneurone (Umschaltung von Information)<br />
im Hinterhorn.<br />
Die Nervenzellen der afferenten Bahnen (zum<br />
Gehirn führend) befinden sich in den Spinalganglien<br />
außerhalb des Rückenmarks. Die<br />
weiße Substanz enthält hauptsächlich Nervenfasern<br />
(Neuriten) von auf- und absteigenden<br />
Bahnen. Überdies enthält das Rückenmark auch<br />
Fasern des vegetativen Nervensystems, welche<br />
überwiegend aus den vor der Wirbelsäule gelegenen,<br />
so genannten "Grenzstrangganglien"<br />
stammen.<br />
Abb. 76.<br />
Schema Rückenmark<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 77
Pheriphere Nerven werden gebildet aus:<br />
a) Rückenmarksnerven (Nervi spinales)<br />
b) Gehirn- und Schädelnerven (Nervi zerebrales)<br />
Die Rückenmarksnerven oder Spinalnerven bestehen aus vorderer und hinterer Wurzel. Der<br />
kurze Spinalnerv liegt im Zwischenwirbelloch und teilt sich in einen hinteren und einen vorderen<br />
Ast. Auf Höhe der Hinterwurzel liegt das Spinalganglion, welches die sensiblen Nervenzellen<br />
der afferenten (= zentripetalen) Fasern des zerebrospinalen Nervensystems enthält. Durch<br />
die Vorderwurzel treten die efferenten (= zentrifugalen motorischen) Fasern aus. Im Ganzen gibt<br />
es ca. 32 Paare von Rückenmarksnerven:<br />
8 Paare Hals (= cervikal) Nerven, C1 - C8<br />
12 Paare Brust (= thorakal) Nerven, Th1 - Th12<br />
5 Paare Lenden (= lumbal) Nerven, L1 - L5<br />
5 Paare Kreuzbein (= sacral) Nerven, S1 - S5<br />
1 - 2 Paare Steißbein (= coccygeal) Nerven, Col - Co2<br />
Die vorderen Äste der Spinalnerven bilden im Halsbereich und im Lumbosakralbereich Geflechte<br />
(Plexen):<br />
Halsgeflecht (Plexus cervikalis):<br />
C1 - C4<br />
Armgeflecht (Plexus brachialis):<br />
C5 - Th1<br />
Lendengeflecht (Plexus lumbalis):<br />
L1 - L4 (Nervus femoralis)<br />
Kreuzbeingeflecht (Plexus sacralis):<br />
L4 - S3 (Nervus ischiadicus)<br />
S2 - S4 (Nervus pudendus)<br />
S4 - S5 (Nervus coccygeus)<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 78
10.<strong>1.</strong><strong>1.</strong> Reflex, Reflexbogen<br />
Über die afferenten Fasern der Hinterwurzel, die von den Nervenzellen des Spinalganglions<br />
ihren Ursprung nehmen, wird die sensible Erregung den Hinterhornzellen des RM übermittelt<br />
und von diesem zum Gehirn weitergeleitet.<br />
Die Umschaltung kann auch in der Medulla oblongata erfolgen. Die afferenten Fasern können<br />
aber auch zu den Vorderhornzellen verlaufen und die Erregung so auf sie übertragen. Die so ausgelöste<br />
Muskelreaktion bezeichnet man als Reflex, die Neuronenschaltung als Reflexbogen.<br />
Im Allgemeinen laufen die afferenten Fasern nicht bis zum motorischen Neuron (monosynaptischer<br />
Reflexbogen).<br />
Klinisch wichtig sind der Eigenreflex (Streckreflex; monosynaptisch) und der Fremdreflex<br />
(Fluchtreflex).<br />
Beim Eigenreflex wird ein Muskel durch einen Schlag auf seine Sehne kurz gedehnt und es<br />
kommt durch die Reizung der Dehnungsrezeptoren als Gegenreaktion zu einer momentanen<br />
Kontraktion des Muskels. Der Reflex läuft in einer Rückenmarkshöhe = Segment über wenige<br />
Neurone ab.<br />
Beim Fremdreflex werden Hautrezeptoren gereizt (Schmerz - Verbrennung ...) und es kommt durch<br />
koordinierte Aktion mehrerer Muskelgruppen zu einer Fluchtbewegung. Dabei breitet sich<br />
die Erregung über mehrere Segmente (verschiedene Höhen des RM) unter Einschaltung zahlreicher<br />
Zwischenneurone, gleichzeitig oder / und auf die Gegenseite weitervermittelt, aus.<br />
Für das Zustandekommen einer geordneten Bewegung müssen bei Kontraktion einer Muskelgruppe<br />
gleichzeitig die zugehörigen Antagonisten erschlaffen (erreicht durch Hemmung der entsprechenden<br />
<strong>Zelle</strong>) z.B. gibt ein Neuron für die Streckmuskulatur einen Impuls weiter, so wird<br />
dieser über eine Axonkollaterale gleichzeitig auf hemmende Zwischenneurone übertragen, die<br />
die Neurone der Beugemuskulatur hemmen.<br />
Die Leitungsgeschwindigkeit der Neurone ist abhängig von<br />
– Umfang des Axons = Dicke der Markscheide<br />
– Abstand der Ranvier`schen Knoten (Länge der Internodien)<br />
Die Leitungsgeschwindigkeit des Nervens steigt mit<br />
– Dicke der Markscheide<br />
– Länge der Internodien<br />
Man unterscheidet:<br />
A Fasern, markhaltig, Durchmesser 3 - 20 μm Lv: - 120 m/sec<br />
Erregungsleistung saltatorisch = sprunghaft<br />
A α - propriorezeptiv 12 - 20 μm Lv: 70 - 120 m/sec<br />
somatomotorisch<br />
β - Berührung, Druck 5 – 12 μm 30 - 70<br />
γ - motorisch zu Muskelspindel 3 – 6 μm 15 - 30<br />
δ - Schmerz, Temperatur 2 – 5 μm 12 - 30<br />
B Fasern, markarm, – 3 μm Durchmesser Lv: – 15 m/sec<br />
präganglionär autonom<br />
C Fasern, marklos, Lv: – 2 m/sec<br />
kontinuierliche Ausbreitung Schmerz, Reflexe<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 79
Abb. 77.<br />
Reflexbogen, Schema<br />
10.<strong>1.</strong><strong>2.</strong> Die Muskelspindel<br />
Regulierung der Muskelspannung: Tonus<br />
Die Muskelspindel ist ein Dehnungsrezeptor. Sie wird bei Dehnung = Streckung des Muskels<br />
erregt. Ihre Aktivität erlischt bei Kontraktion des Muskels. Eine Muskelspindel besteht aus 5 - 10<br />
dünnen quergestreiften Muskelfasern (<strong>Zelle</strong>n), die in einer bindegewebigen Kapsel parallel zu<br />
den übrigen Muskelfasern liegen, und an deren Sehnen ansetzen. Die Fasern der Muskelspindel<br />
(- 10 mm lang) werden auch als intrafusale Fasern bezeichnet, die Arbeitsmuskelfasern (alle<br />
übrigen, die nicht in den Spindeln liegen) als extrafusale Fasern. Muskeln, die an sehr fein abgestimmten<br />
Bewegungen beteiligt sind (Fingermuskeln), besitzen eine große Anzahl von Muskelspindeln.<br />
Muskeln für einfache Bewegungen (Rumpfmuskulatur - autochthone M.) enthalten<br />
wesentlich weniger Spindeln.<br />
Feinbau der Muskelspindel:<br />
Die einzelnen Spindelfasern, die bis zu 10 mm lang sein können, haben einen mittleren äquatorialen<br />
Teil, der eine Anzahl von Zellkernen enthält, aber keine Myofibrillen; dieser Mittelteil ist<br />
daher nicht kontraktil. An ihm endet eine dicke sensible Nervenfaser, deren Ende sich spiralig<br />
um die Muskelfasern (<strong>Zelle</strong>n) wickeln: Anulospiralige Endigung (Faser). An einer oder an beiden<br />
Seiten der anulospiralen Endigung kann eine dünnere sensible Faser mit einer Art von Blütendolden-Endigung<br />
ansetzen: Flowerspray-Endigung (Faser).<br />
Die beiden distalen kontraktilen Abschnitte der Muskelspindel (vom Mittelteil bis zum Sehnenansatz)<br />
werden von dünnen motorischen Fasern: γ-Fasern (Gamma) umgeben. Diese Fasern<br />
stammen von kleinen motorischen Vorderhornzellen (RM) den Neuronen, deren Impulse zur<br />
Kontraktion der distalen = kontraktilen Faserabschnitte führen. Die daraufhin erfolgende Dehnung<br />
des sensorischen Mittelteils führt zur Empfindlichkeitsänderung der Spindel und zur Erregung<br />
der anulospiralen Faser. Bei Streckung des Muskels nimmt die Frequenz der Impulse mit<br />
der Längenänderung des Muskels zu (Informationsübermittlung der jeweiligen Muskellänge).<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 80
Die Erregungen werden über den Reflexbogen den großen Vorderhornzellen zugeführt und über<br />
aufsteigende RM-Bahnen auch dem Kleinhirn + dem EPS. Die Erregung der Vorderhornzelle bei<br />
plötzlicher Dehnung bewirkt eine sofortige Kontraktion des Muskels.<br />
Die Muskelspindel enthält zwei verschiedene Arten von intrafusalen Fasern:<br />
– Kernkettenfasern (Zellkerne in Ketten im Mittelteil)<br />
– Kernhaufenfasern (Zellkerne in Haufen im Mittelteil)<br />
Beide Faserarten werden von anulospiralen<br />
Fasern versorgt. Flowerspray Fasern findet<br />
man (fast nur) an Kernkettenfasern. Die<br />
Kernkettenfasern registrieren den anhaltenden<br />
Dehnungszustand des Muskels. Die<br />
Kernhaufenfasern reagieren auf die aktuelle<br />
Dehnung des Muskels. Die Muskelspindeln<br />
übermitteln so dem Kleinhirn die Information<br />
über die Länge und Geschwindigkeit der Längenänderung<br />
(Streckung), (für die Integration<br />
zur koordinierten Bewegung-Gleichgewicht,<br />
…).<br />
10.<strong>2.</strong> Die 12 Hirnnerven<br />
Sie treten direkt aus dem Gehirn an der Schädelbasis aus und versorgen den Kopf und einen<br />
Großteil der Eingeweideorgane.<br />
I. Bulbus und Traktus olfactorius: Riechnerv<br />
II. Nervus opticus: Sehnerv (versorgt die Netzhaut)<br />
III. Nervus oculomotorius: motorischer Augennerv (Augenmuskeln, Akkommodation,<br />
Pupillenverengung)<br />
IV. Nervus trochlearis: (oberer schräger Augenmuskel)<br />
V. Nervus trigeminus (Nervus supraorbitalis, Nervus maxillaris, Nervus mandibularis):<br />
sensibel - Gesichtshaut, Nasenhöhle, Gaumen, Mundhöhle, Zunge;<br />
motorisch - Kaumuskulatur<br />
VI. Nervus abducens: (äußerer gerader Augenmuskel)<br />
VII. Nervus facialis: motorischer Gesichtsnerv (Gesichtsmuskulatur)<br />
VIII. Nervus vestibulocochlearis: Sinnesnerv des Gleichgewichts- und Gehörorgans<br />
IX. Nervus glossopharyngeus: Geschmacksnerv der Zunge, Schlundnerv<br />
X. Nervus vagus: Kehlkopfmuskulatur; Eingeweidenerv für Atemorgane, Herz,<br />
Verdauungsorgane etc.<br />
XI. Nervus accessorius: motorischer Nerv für Trapez- und Halsmuskel<br />
XII. Nervus hypoglossus: motorischer Zungennerv<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Abb. 78.<br />
Muskelspindel<br />
Seite 81
Abb. 79.<br />
Das menschliche Gehirn im Schnitt<br />
10.3. Das Gehirn<br />
Das Gehirn besteht aus fünf Teilen, die sich aus den fünf Gehirnbläschen des Embryos<br />
ent w ic kel n .<br />
1) Das verlängerte Mark (Medulla oblongata)<br />
2) Hinterhirn (Metencephalon): besteht aus Brücke (Pons) und Kleinhirn (Cerebellum)<br />
3) Mittelhirn (Mesencephalon): besteht aus Vierhügelplatte (Lamina quadrigemina),<br />
Haube (Tegmentum) und den zwei Hirnschenkeln (Crura cerebri)<br />
4) Zwischenhirn (Diencephalon): besteht aus Thalamus, Hypothalamus, Epiphyse<br />
(Zirbeldrüse), Hypophysenvorderlappen (Adenohypophyse), Mamillarkörperchen<br />
(Corpora mamillaria)<br />
5) Endhirn (Telencephalon): besteht aus Stammganglien, zwei Großhirnhälften<br />
(Hemisphären), Rinde (Cortex), Riechhirn.<br />
Das verlängerte Mark plus Mittelhirn plus Hinterhirn = Hirnstamm.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 82
Die Hirnteile im einzelnen<br />
Medulla oblongata<br />
Ursprung der zwölf Hirnnerven<br />
Atmungszentrum<br />
Kreislaufzentrum<br />
Kreuzung der "Pyramidenbahn" (Willkürmotorik):<br />
bei Ausfall oberhalb - Lähmung der Gegenseite<br />
bei Ausfall unterhalb - Lähmung der gleichen Seite<br />
Störung: sofortiger Tod<br />
Hinterhirn<br />
Kleinhirn: Kontrollzentrum der "Extrapyramidalmotorik" (reguliert Muskelspannung,<br />
Muskelkraft, Muskelkoordination)<br />
Meldesammelstelle für Tiefensensibilität und Tastsinn<br />
Störung: Atonie (Mangel an normalem Muskeltonus)<br />
Asthenie (Mangel an normaler Muskelkraft)<br />
Ataxie (Mangel an normaler Muskelkoordination)<br />
Intentionstremor (Zittern am Beginn der Bewegung - z.B. Nystagmus -<br />
Augenmuskelzittern)<br />
Gleichgewichtsstörungen<br />
Schleudergang<br />
Mittelhirn<br />
Weiterleitung von Seh- und Hörreflexen zum Rückenmark<br />
Zentren der "Extrapyramidal-Motorik"<br />
Steuerung der Stimmungslage (Formatio reticularis, Limbisches System)<br />
Störung: Bewegungsausfälle (Zahnradbewegungen, Muskelstarre, Schüttelbewegungen<br />
= Morbus Parkinson)<br />
psychische Spannungszustände, Depressionen, Erschöpfungszustände<br />
Zwischenhirn<br />
Thalamus:<br />
Übermittlungszentrum zwischen Cortex und Körper - der allgemeinen Sensibilität,<br />
Sehfunktion, Riechfunktion (Tastempfindung, Tiefensensibilität,<br />
Temperaturempfindung, Schmerzempfindung)<br />
Anhangsgebilde:<br />
Zirbeldrüse (Epiphyse - Funktion weitgehend unbekannt, Pigmentbildung?)<br />
Hypothalamus:<br />
Oberstes Befehlszentrum des vegetativen Nervensystems<br />
Zentrum des Wasserhaushaltes<br />
Steuerung der Körpertemperatur<br />
Steuerung des Kreislaufes<br />
Steuerung der Nahrungsverwertung<br />
Steuerung des Stoffwechsels<br />
Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus<br />
Steuerung des abhängigen Hormonspiegels<br />
Hypophyse:<br />
Hinterlappen (Neurohypophyse): entsteht durch Ausstülpung des Hypothalamus -<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 83
Bildungsstätte zweier Hormone, (Oxytocin - Steuerung der Uterusmuskulatur, Adiuretin<br />
- Steuerung von Wasserausscheidung und Blutdruck)<br />
Vorderlappen (Adenohypophyse): entsteht durch Ausstülpung des Darmrohres<br />
(Kopfdarmdach); endokrine Drüse<br />
Bildungsstätte von Hormonen: Somatotropes Hormon (Wachstumshormon)<br />
Gonadotrope Hormone: Steuerung der Geschlechtsdrüsen<br />
Glandotrope Hormone: Steuerung der untergeordneten Hormondrüsen (Schilddrüsen,<br />
Nebennierenrinde etc.)<br />
Releasingfaktoren: werden im Hypothalamus gebildet und steuern die<br />
Hormonproduktion im Hypophysen-Vorderlappen.<br />
Es besteht außerdem eine enge Verbindung zwischen Hypothalamus, dem "Limbischen System"<br />
(Formatio reticularis - Zwischenhirn) und der Hirnrinde (Cortex).<br />
Dieses System macht die funktionelle Abhängigkeit zwischen Geist, Seele und Körper verständlich.<br />
Eine Störung dieser vielfältigen Querverbindungen äußert sich als sogenannte "Psychosomatische<br />
Erkrankung".<br />
Endhirn<br />
Graue Substanz (marklos, Nervenzellen): Gehirnrinde (Cortex)<br />
Stammganglien<br />
Riechhirn<br />
Weiße Substanz (markhaltig, Nervenfasern): Leitungsbahnen (Capsula interna)<br />
Zwei Hemisphären: Balken (Verbindungszone)<br />
Gyri (Windungen) - Sulci (Furchen)<br />
Zwei Hohlräume (Seitenventrikel) enthalten Liquor,<br />
Plexus choroideus (Liquorproduktion)<br />
Gehirnrinde:<br />
Zentren für Bewusstsein, Intelligenz, Wille, Sprache, Gedächtnis, Charakter,<br />
Sinnesleistungen, bewusste Muskeltätigkeit, Sensibilität.<br />
Riechhirn:<br />
Entwicklungsgeschichtlich ältester Gehirnteil, beim Menschen sehr klein im Verhältnis<br />
zu anderen Säugetieren.<br />
Stammganglien:<br />
Zentren für so genannte Extrapyramidalmotorik (Regelung der unbewussten<br />
Muskeltätigkeit und Muskelspannung).<br />
Störung: Veitstanz (atonisch-hyperkinetisches Zustandsbild)<br />
Morbus Parkinson (hypertonisch-akinetisches Zustandsbild)<br />
Capsula interna:<br />
Enthält Pyramidenbahnfasern aus dem motorischen Hirnrindenanteil - diese werden<br />
im Bereich der Medulla oblongata gekreuzt und ziehen über die motorischen<br />
Vorderhörner des Rückenmarkes in die periphere Muskulatur.<br />
Störung: Apoplexie (Schlaganfall):<br />
Die Arteria thalamostriata anterolateralis, welche Teile der Stammganglien versorgt,<br />
weist im Bereich der Capsula interna eine Krümmung auf; diese Krümmung stellt eine<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 84
Schwachstelle dar und kann daher bei länger bestehendem hohen Blutdruck bzw.<br />
Arteriosklerose an dieser Stelle am ehesten platzen.<br />
Die Blutung in die Capsula interna führt zu einer mechanischen Druckatrophie und<br />
einem Leistungsausfall der Nervenfasern.<br />
Ergebnis: Lähmung der Gegenseite, weil der Ausfall oberhalb d. Kreuzungsstelle liegt.<br />
Limbisches System<br />
Anteile aus Hirnstamm und Großhirn<br />
Enge Beziehungen zu Thalamus, Hypothalamus und Stammganglien.<br />
Funktion: Beeinflussung der Stimmungslage und des Gemütes;<br />
Steuerung von vegetativen Funktionen und Hormonen.<br />
Störungen: Angstgefühle, Aggressivität, Depressionen, Schlafstörungen etc. - diese werden<br />
ausgelöst durch so genannte "Stressoren" (Verletzungen, Schmerzen, Infektionen, Entzündungen,<br />
Schrecksituationen etc.)<br />
Das Limbische System ist Hauptangriffsort der so genannten "Psychopharmaka".<br />
10.4. Die Willkürmotorik<br />
Die gemeinsame Endstrecke aller an der Motorik beteiligten Zentren ist die große Vorderhornzelle<br />
des RM und ihr Axon das α-Neuron, das die willkürliche Skelettmuskulatur innerviert (motorische<br />
Endplatte).<br />
Die Pyramidenbahn hat ihren Ursprung in der vorderen Zentralwindung und dem vorgelagerten<br />
Cortex (2/3 Präzentralregion, 1/3 Parietallappen) (von den Fasern sind 60 % markhaltig, 40 %<br />
marklos). Die dicken Fasern der Riesenpyramidenzellen sind nur 2-3 % der markhaltigen, (die<br />
übrigen stammen von kleinen Pyramidenzellen). Die Fasern der Pyramidenbahn durchlaufen<br />
die "innere Kapsel". Am Übergang zum Mittelhirn treten sie an die Hirnbasis und bilden die<br />
Hirnschenkel, Crura cerebri, mit. Im Hirnstamm endet ein Teil der Fasern an den Hirnnervenkernen.<br />
Die weiterlaufenden Fasern passieren die Medulla oblongata. In der Pyramidenkreuzung<br />
kreuzen 80 % aller Fasern der Pyramidenbahn auf die Gegenseite und laufen dann als Pyramidenseitenstrang<br />
(Tractus corticospinalis lateralis) zu ihrem Segment.<br />
Die ungekreuzten Fasern verlaufen weiter (im Tractus corticospinalis ventralis) und kreuzen erst<br />
in Höhe des Segmentes auf die Gegenseite.<br />
Die Pyramidenbahnfasern enden zum größten Teil an Zwischenneuronen, nur ein geringer Teil<br />
endet direkt an den motorischen Vorderhornzellen (v. a. für die distalen Extremitätenmuskeln).<br />
Pyramidenbahnimpulse wirken auf Neurone, die Flexoren innervieren, aktivierend, auf Neurone,<br />
die Extensoren innervieren, hemmend.<br />
Die Fasern aus dem Parietallappen regulieren den Zustrom sensibler Erregung über das Hinterhorn.<br />
Auf die Vorderhornzelle wirken auch noch Bahnen des EPS und KH und regulieren so den<br />
Bewegungsumfang (Ausdruck, Gleichgewicht, ...) mit.<br />
Abb. 80. Sensorischer und<br />
motorischer Cortex<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 85
10.5. Vegetatives Nervensystem (VNS)<br />
Synonym: Autonomes oder Viscerales Nervensystem<br />
Das VNS dient der Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Körperfunktionen.<br />
Dazu gehören:Eingeweidetätigkeit (Verdauung, Stoffwechsel)<br />
Kreislauf (Herztätigkeit, Blutdruckregulation)<br />
Atmung<br />
Drüsentätigkeit (Schweiß, Speichel)<br />
Geschlechtsfunktion<br />
Als "autonomes Nervensystem" arbeitet es unabhängig von direkter willentlicher Beeinflussung.<br />
Die Zentren des VNS liegen teils im Gehirn, teils im Rückenmark. Die obersten Befehlsstellen<br />
befinden sich im Hypothalamus; untergeordnete Zentren befinden sich im Mittelhirn, im verlängerten<br />
Mark und in den Seitenhörnern des Rückenmarkes.<br />
Die zuführenden (afferenten oder zentripetalen) Fasern melden Schmerzreize und die Reize der<br />
Mechano- und Chemorezeptoren aus Lunge, Herz, Magen-Darm-Trakt, Harnblase und Gefäßsystem.<br />
Die abführenden (efferenten oder zentrifugalen) Fasern steuern als Reflexantwort die Tätigkeit<br />
der glatten Muskulatur der verschiedenen Organe (Auge, Lunge, Verdauungstrakt, Gefäßsystem,<br />
Harnblase etc.) und die Funktion von Herz und Drüsen.<br />
Das VNS besteht aus den zwei Anteilen:<br />
– Sympathicus<br />
– Parasympathicus<br />
10.5.<strong>1.</strong> Sympathicus<br />
Der Sympathicus hat seinen Ursprung in den Seitenhörnern der grauen Substanz des Brustmarkes<br />
und des oberen Lendenmarkes. Die "präganglionären Fasern" verlassen mit den Vorderwurzeln<br />
das Rückenmark und treten durch die "weißen Verbindungsäste" in den "Grenzstrang"<br />
(Truncus sympathicus) ein.<br />
Grenzstrang:<br />
Der Grenzstrang besteht aus einem<br />
– Halsteil - drei Ganglien<br />
– Brustteil - zwölf Ganglien<br />
– Lendenteil - vier bis fünf Ganglien<br />
– Kreuzbeinteil - vier bis fünf Ganglien<br />
– Steißbeinteil - ein Ganglion<br />
Das Halsteil weist ein obiges und unteres Ganglion auf, wobei das untere Halsganglion mit dem<br />
ersten Brustganglion zum sternförmigen Ganglion (Ganglion stellatum) verwachsen ist.<br />
Vom oberen Halsganglion steigt der Sympathicus in Form eines die Äste der Gehirncarotis umspinnenden<br />
Geflechtes in die Schädelhöhle. Die Schaltung der weißen präganglionären Fasern<br />
erfolgt entweder in der Grenzstrangkette neben der Wirbelsäule (prävertebrale Ganglien) oder<br />
erst weiter weg (paravertebrale Ganglien). Die grauen postganglionären Fasern ziehen als graue<br />
Verbindungsäste zu den Rückenmarksnerven und zu den vegetativen Geflechten. Die Endigung<br />
des Sympathicus bilden Adrenalin und Noradrenalin. Man bezeichnet deshalb den Sympathicus<br />
auch als adrenerges System (arbeitet ergotrop, d.h., er ist auf augenblickliche Höchstleistungen<br />
ausgerichtet).<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 86
10.5.<strong>2.</strong> Parasympathicus<br />
(= Vagus)<br />
Die Zentren des Parasympathicus liegen teils im Gehirn, teil im Kreuzbeinmark.<br />
Die meisten parasympathischen Ganglien sind entweder organnahe oder in die Wand des Organs<br />
eingelagert (= "intramurale Ganglien").<br />
Kopfteil des Parasympathicus:<br />
Hirnnerven 3 - Nervus oculomotorius<br />
7 - Nervus facialis<br />
9 - Nervus glossopharyngeus<br />
10 - Nervus vagus<br />
Kreuzbeinteil des Parasympathicus:<br />
Rückenmarksnerven S 3 – 4<br />
Die Endverzweigungen des Parasympathicus bilden Acetylcholin. Er arbeitet trophotrop, d.h. er<br />
ist für Ernährung und Regeneration verantwortlich.<br />
Vegetative Geflechte<br />
Vegetative Geflechte finden sich im Brust-, Bauch- und Beckengebiet. In ihnen vermischen sich<br />
parasympathische und sympathische Nervenfasern und befinden sich zahlreiche kleinere und<br />
größere Ganglien.<br />
Geflechte im Brustgebiet:<br />
Die vegetativen Geflechte im Brustraum versorgen Lunge, Herz, große Gefäße und Speiseröhre.<br />
Geflechte im Bauchgebiet:<br />
Im Bauchgebiet folgen die vegetativen Geflechte den großen Schlagadern. Das wichtigste Geflecht<br />
ist das Sonnengeflecht (Plexus solaris). Es liegt um die ersten großen Äste der Bauchaorta<br />
herum und wird zur Hauptsache aus den beiden großen und den beiden kleinen Eingeweidenerven,<br />
aus dem Brustteil des sympathischen Grenzstranges sowie vom rechten Vagusnerven<br />
gebildet.<br />
Vom Sonnengeflecht gehen Geflechte zu Magen, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Nebennieren,<br />
Nieren, Geschlechtsdrüsen, Dünndarm und Dickdarm bis zur linken Krümmung.<br />
Geflechte im Becken:<br />
Nach unten setzten sich die Bauchgeflechte in das Beckengeflecht fort, in welches die parasympathischen<br />
Eingeweidenerven und Sympathicusfasern eintreten. Es versorgt den absteigenden<br />
Dickdarm, die Sigmaschlinge, den Mastdarm, die Geschlechtsorgane und die Harnblase.<br />
Funktion des vegetativen Nervensystems<br />
Die Überträgerstoffe (Transmitter) des VNS sind:<br />
– Acetylcholin (ACh)<br />
– Noradrenalin (NA)<br />
– Adrenalin<br />
Acetylcholin<br />
ist der Überträgerstoff des Parasympathicus.<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 87
Außerdem wirkt ACh:<br />
1) an allen präganglionären vegetativen Nervenendigungen;<br />
2) an einigen sympathischen postganglionären Nervenendigungen;<br />
3) an den motorischen Endplatten;<br />
4) an einigen Synapsen des ZNS.<br />
Es erhöht die Membrandurchlässigkeit bzw. -Leitfähigkeit für Natrium-, Kalium- und Calcium-<br />
Ionen; es ermöglicht bzw. fördert die Reizübertragung.<br />
Abb. 8<strong>1.</strong><br />
Transmitterstrecke<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Noradrenalin<br />
Noradrenalin ist der Überträgerstoff des Sympathicus<br />
(mit Adrenalin und Dopamin). Es wird systemisch im<br />
Nebennierenmark freigesetzt (in das Blut)<br />
Bei Überreaktion: Schock (Schocksymptome)<br />
Noradrenalin kommt weiter vor<br />
- an einigen Synapsen des ZNS<br />
- an den meisten postganglionären sympathischen Nervenendigungen.<br />
Sympathicus Parasympathicus<br />
Herz Beschleunigung Verlangsamung<br />
Gefäß in der Peripherie Verengung Erweiterung<br />
Gefäß zentral (Gehirn,<br />
Muskulatur, Herz, Lunge) Erweiterung Verengung<br />
Bronchien Erweiterung Verengung<br />
Lunge Erweiterung Verkleinerung<br />
Speiseröhre Erschlaffung Anspannung<br />
Magentätigkeit Hemmung Anregung<br />
Darmtätigkeit Hemmung Anregung<br />
Leberfunktion Hemmung Anregung<br />
Gallenblase Erschlaffung Anspannung<br />
Pancreasfunktion Hemmung Anregung<br />
Speicheldrüsen zäher Speichel dünner Speichel<br />
Verdauungssäfte Verminderung Vermehrung<br />
Milz Tonuszunahme Tonusabnahme<br />
Nierentätigkeit Hemmung Anregung<br />
Harnblase Harnverhaltung Harnentleerung<br />
Geschlechtsfunktion Hemmung Anregung<br />
Uterus Erschlaffung Anspannung<br />
Muskeltonus Verminderung Erhöhung<br />
Schweißdrüsen spärlich, klebrig reichlich, dünn<br />
Pupillen Erweiterung Verengung<br />
Lidspalte Erweiterung Verengung<br />
Seite 88
1<strong>1.</strong><br />
Vokabular<br />
Abdomen Bauch<br />
Abductor der Abzieher<br />
Accessorius hinzukommend<br />
Adductor der Heranführer<br />
Adeps, adipis Fett<br />
Adhaesio Verbindung<br />
Afferens heranbringend<br />
Albugineus Weißlich<br />
Albus Weiß<br />
Alveolus kleine Aushöhlung<br />
Ampulla Bauchfläschchen<br />
Anastomosis Querverbindung<br />
Ancon, anconis Ellbogen<br />
Angulus Winkel<br />
Antrum Grotte<br />
Anulus Ring<br />
Aorta Hauptkörperschlagader<br />
Apex Spitze<br />
Aponeurosis Flächensehne<br />
Appendix Anhängsel<br />
Arbor Baum<br />
Arcus Bogen<br />
Arteria Schlagader<br />
Arteriola kleine Schlagader<br />
Ascendens Aufsteigend<br />
Autonomicus eigengesetzlich<br />
Axilla Achselhöhle<br />
Azygos Unpaar (Joch)<br />
B<br />
Basilicus Königlich<br />
Basis Grundfläche<br />
Biceps Zweiköpfig<br />
Brachium Arm (Oberarm)<br />
Brevis Kurz<br />
Bronchiolus kleiner Bronchus<br />
Bronchus Luftröhrenast<br />
Bucca Backe, Wange<br />
Bulbus Zwiebel<br />
Bursa Beutel<br />
C<br />
Caecus Blind<br />
Caeruleus Bäuchlein<br />
Calix Kelch<br />
Callosus Schwielig<br />
Capillaris haarähnlich<br />
Capsula Kapsel<br />
Caput Kopf<br />
Cardia Magenmund<br />
Carpus Handwurzel<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Cauda Schwanz<br />
Cavum Hohlraum<br />
Centrum Mittelpunkt<br />
Cerebellum Kleinhirn<br />
Cerebrum Gehirn<br />
Cervix Hals<br />
Chiasma Kreuzung<br />
Chorda Strang<br />
Chylus Darmlymphe<br />
Clavicula Schlüsselbein<br />
Clunis Gesäßbacke<br />
Coccyx Steißbein<br />
Cochlea Schnecke<br />
Collateralis Seitlich<br />
Collum Hals<br />
Colon Dickdarm<br />
Communis Gemeinsam<br />
Conexus Verbindung<br />
Constrictor Zusammenzieher<br />
Cornea Hornhaut<br />
Corona Kranz<br />
Corpus Körper<br />
Cortex, corticis Rinde<br />
Costa Rippe<br />
Coxa Hüfte<br />
Cranium Schädel<br />
Crus, cruris Schenkel<br />
Cutis, cutis Haut<br />
D<br />
Deferens herabführend<br />
Dens, dentis Zahn<br />
Depressor Herabdrücker<br />
Dermis Lederhaut<br />
Descendens herabsteigend<br />
Diaphragma Trennwand<br />
Diaphysis Mittelstück der langen Knochen<br />
Diencephalon Zwischenhirn<br />
Digastricus Zweibäuchig<br />
Digitalis zu Finger / Zehe gehörend<br />
Digitus Finger (Zehe)<br />
Dilator Erweiterer<br />
Discus Scheibe<br />
Dorsum Rücken<br />
Ductus Gang<br />
Duodeni "je zwölf"<br />
Durus Hart<br />
E<br />
Efferens herausführend<br />
Seite 89
Embryo Keimling (Mens 1-3)<br />
Eminentia Erhöhung<br />
Encephalon Gehirn<br />
Endothelium zelliger Innenbelag<br />
Entericus zu den Eingeweiden<br />
gehörend<br />
Epicondylus auf Gelenksfortsatz<br />
aufgesetzter Fortsatz<br />
Epidermis Oberhaut<br />
Epiphysis Knochenendstück,<br />
Zirbeldrüse<br />
Epithelium zellige Flächenabdeckung<br />
Equinus zum Pferd gehörend<br />
Erector der Aufrichter<br />
Extensor Strecker<br />
Extremitas Gliedmaße<br />
F<br />
Facies Außenfläche, Gesicht<br />
Falx, falcis Sichel<br />
Fascia derbe Bindegewebshülle<br />
Fetus noch ungeborenes Kind<br />
(Mens 3-9)<br />
Fibra Faser<br />
Filamentum submikroskopisches<br />
Fäserchen<br />
Filum Faden<br />
Fissura Spalte<br />
Flavus Gelb<br />
Flexor Beuger<br />
Folium Blatt<br />
Foramen Loch<br />
Formatio Gebilde<br />
Fossa Graben<br />
Fovea Grube<br />
Frenulum Bändchen<br />
Frons, frontis Stirn<br />
Fundus Boden<br />
G<br />
Galea Kopfschwarte<br />
Ganglion Nervenknoten<br />
Genesis Entstehung<br />
Genu Knie<br />
Germen Keim<br />
Gingiva Zahnfleisch<br />
Glandula Drüse<br />
Glomerulus kleines Knäuel<br />
Glutaeus zum Gesäß gehörig<br />
Gracilis Schlank<br />
Griseus Grau<br />
Gyrus Windung<br />
H<br />
Hallux, hallucis Großzehe<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Helix, helicis Windung<br />
Hepar, hepatis Leber<br />
Hiatus Öffnung<br />
Hilus Gefäßeintrittsort<br />
Homo, hominis Mensch<br />
Hyalinus Gläserns<br />
Hypoglossus unter der Zunge gelegen<br />
I<br />
Ileum Krummdarm<br />
Impar Ungleich<br />
Incisura Einschnitt<br />
Index, indicis Zeigefinger<br />
Infundibulum Trichter<br />
Inguen, inguinis Leistengegend<br />
Insula Insel<br />
Integumentum Haut<br />
Intestinum Eingeweide<br />
Intima innerste Gefäßauskleidung<br />
Iris, iridis Regenbogenhaut<br />
Ischiadicus zum Sitzbein gehörend<br />
Ischium Gesäß<br />
J<br />
Jejunum Leerdarm<br />
Junctura Verbindung<br />
L<br />
Labium Lippe<br />
Labrum Lippe<br />
Lac, lactis Milch<br />
Lacrima Träne<br />
Lanugo Wollhaar<br />
Laryngeus zum Kehlkopf gehörend<br />
Latissimus der Breiteste<br />
Latus Breit<br />
Lens, lentis Linse<br />
Levator Heber<br />
Lien, lienis Milz<br />
Ligamentum Band<br />
Limbus Saum<br />
Linea Linie<br />
Lingua Zunge<br />
Liquor Flüssigkeit<br />
Lobus Lappen<br />
Longus Lang<br />
Lucidus Hell<br />
Lunula Möndchen<br />
Luteus Gelb<br />
M<br />
Macula Fleck<br />
Major der Größere<br />
Malleus Hammer<br />
Mandibula Unterkiefer<br />
Manubrium Handgriff<br />
Seite 90
Manus Hand<br />
Margo, marginis Rand<br />
Mastoideus brustwarzenförmig<br />
Mater, matris die Umhüllende<br />
Maximus der Größte<br />
Meatus Gang<br />
Mediastinum Mittelfell<br />
Medulla Mark<br />
Membrana zarte Haut<br />
Meninx, meningis Hirnhaut<br />
Meniscus halbmondförmiger<br />
Schaltknorpel<br />
Mesothelium Zellbelag seröser Häute<br />
Metacarpus Mittelhand<br />
Metaphysis an die Epiphyse grenzendes<br />
Diaphysenende<br />
Metatarsus Mittelfuß<br />
Minor der Kleinere<br />
Mitra zweizipfelige Mütze<br />
Mollis Weiche<br />
Mons, montis Berg<br />
Monticulus Hügelchen<br />
Motor Beweger<br />
Mucosus Schleimig<br />
Mucus Schleim<br />
Multifidus vielgespalten<br />
Musculus Muskel<br />
N<br />
Nasus Nase<br />
Nates Gesäß<br />
Natus Geburt<br />
Nephritis Nierenentzündung<br />
Nervus Nerv<br />
Niger Schwarz<br />
Nodulus Knötchen<br />
Nodus Knoten<br />
Nomen, nominis Name<br />
Nucha Nacken<br />
Nucleus Kern<br />
Nutricius Ernährend<br />
O<br />
Obliquus Schräg<br />
Obturator Verstopfer<br />
Occiput, occipitis Hinterhaupt<br />
Occultus Verborgen<br />
Oculus Auge<br />
Oesophagus Speiseröhre<br />
Olfactus Geruchssinn<br />
Oliva Olive<br />
Omentum Netz<br />
Omphalos Nabel<br />
Ophthalmicus zum Auge gehörend<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Orbita Augenhöhle<br />
Organum Organ<br />
Orificium Mündung<br />
Origo, originis Ursprung<br />
Os, oris Mund<br />
Os, ossis Knochen<br />
Ostium Mündung<br />
Oticus zum Ohr gehörend<br />
Ovum Ei<br />
P<br />
Palatum Gaumen<br />
Palma Handfläche<br />
Palmaris zur Handfläche gehörend<br />
Palpebra Augenlid<br />
Papilla Warze<br />
Parasympathicus Antagonist d. Sympathicus<br />
Parenchyma spezifisches Organgewebe<br />
Paries, parietis Wand<br />
Parotis, parotidis Ohrspeicheldrüse<br />
Pars, partis Teil<br />
Parvus Klein<br />
Pecten, pectinis Kamm<br />
Pectus, pectoris Brust<br />
Pellis Fell<br />
Pellucidus Rachen<br />
Pelvis Becken<br />
Perforatus Durchbohrt<br />
Perichondrium Knorpelhülle<br />
Periosteum Knochenhülle<br />
Peripheria Umkreis<br />
Peritonaeum Klein<br />
Permanens, permanentis Bleibend<br />
Peronaeus zum Wadenbein gehörend<br />
Pes, pedis Fuß<br />
Petrosus Felsig<br />
Phalanx, phalangis Finger-, Zehen-Knochen<br />
Pharynx, pharyngis Rachen<br />
Pigmentum Farbstoff<br />
Piriformis birnenförmig<br />
Pisiformis erbsenförmig<br />
Pius anhänglich, zart<br />
Pleura Brustfell<br />
Plexus Geflecht<br />
Pollex, pollicis Daumen<br />
Pons, pontis Brücke<br />
Poples, poplitis Kniekehle<br />
Porta Pforte<br />
Porus Öffnung<br />
Primus der Erste<br />
Princeps, principis der Wichtigste<br />
Processus Fortsatz<br />
Prominens, prominentis Vorsprung<br />
Seite 91
Promontorium Bergvorsprung<br />
Pronator Einwärtsdreher<br />
Propior Näher<br />
Pulmo, pulmonis Lunge<br />
Pulpa Mark<br />
Pupilla Pupille<br />
Pylorus Pförtner<br />
Pyramis, pyramidis Pyramide<br />
Q<br />
Quadratus Rechteckig<br />
Quadriceps, quadricipitis Vierköpfig<br />
R<br />
Radiatio, radiationis Strahlung<br />
Radix, radicis Wurzel<br />
Ramus Ast<br />
Recessus Winkel, Nische<br />
Rectus Gerade<br />
Recurrens, recurrentis zurücklaufend<br />
Reflexus zurückgebogen<br />
Regio Gegend<br />
Renalis zur Niere gehörend<br />
Respiratio, respirationis Atmung<br />
Rete Netz<br />
Retroflexus rückwärts gebogen<br />
Rhomboideus rautenförmig<br />
Ruber Rot<br />
Rudimentum spurenhafte Anlage<br />
S<br />
Sacrum heilig, groß<br />
Sanguis, sanguinis Blut<br />
Scalenus Schief<br />
Scapha Kahn<br />
Sceletus Skelett<br />
Schylus Darmlymphe<br />
Sclera derbe Augapfelwand<br />
Secretum Absonderung<br />
Sectio, sectionis Schnitt<br />
Segmentum Abschnitt<br />
Sensorium Empfindungsvermögen<br />
Serratus Gezähnt<br />
Serum Blutflüssigkeit<br />
Sigmoideus S- od. C-förmig<br />
Simplex, simplicis Einfach<br />
Sinus Erweiterung der<br />
Blutleiter<br />
Spina Dorn, Rückenmark, Rückrat<br />
Splanchnicus zu den Eingeweiden gehörend<br />
Spondylus Wirbel<br />
Squama Schuppe<br />
Stella Stern<br />
Stoma, stomatis Mund<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Stratum Zone, Decke<br />
Stria Streifen<br />
Stylus Griffel<br />
Substantia Substanz<br />
Succus Saft<br />
Sudor, sudoris Schweiß<br />
Sulcus Rinne<br />
Supinus rückwärts gekehrt<br />
Sura Wade<br />
Suspensus Aufgehängt<br />
Sutura Naht<br />
Sympathicus Lebensnerv<br />
Symphysis Vereinigung<br />
Synovia Gelenkschmiere<br />
T<br />
Tactilis berührbar, zum Gefühl<br />
gehörig<br />
Tactus Gefühl<br />
Taenia Band, Streifen<br />
Tectum Dach<br />
Tegmen, tegminis Decke<br />
Tegmentum Decke<br />
Tela Gewebsplatte<br />
Tempus, temporis Schläfe<br />
Tendo Sehne<br />
Tensor Spanner<br />
Tentorium Zelt<br />
Teres, teretis Rund<br />
Terminalis zur Grenze gehörend<br />
Tonsilla Mandel<br />
Trabecula Bälkchen<br />
Trigonum Dreieck<br />
Trochlea Rolle<br />
Tuba Trompete<br />
Tuber, tuberis Höcker<br />
Tuberositas Rauhigkeit<br />
Tubulus Röhrchen<br />
Tubus Röhre<br />
Tunica Gewebsschicht<br />
Tympanum Pauke<br />
U<br />
Umbilicus Nabel<br />
Uncus Haken<br />
Unguis Nagel<br />
Urina Harn<br />
Uterus Gebärmutter<br />
V<br />
Valva Klappe<br />
Vas Gefäß<br />
Vascularis zum Gesäß gehörend<br />
Vastus Gross<br />
Velum Segel<br />
Seite 92
Vena Blutader<br />
Venter, ventris Bauch<br />
Ventriculus Magen, Kammer<br />
Vermis Wurm<br />
Vertebra Wirbel<br />
Vertex, verticis Scheitel<br />
Verus Echt<br />
Vesica Blase<br />
Vesicalis zur Blase gehörend<br />
Vestibulum Vorraum<br />
Visus das Sehen<br />
Vita Leben<br />
Vola Hohlhand<br />
Vortex, vorticis Haarwirbel<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 93
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>1.</strong> <strong>Allgemeines</strong> 1<br />
<strong>2.</strong> <strong>Zelle</strong> 1<br />
<strong>2.</strong><strong>1.</strong> Stoffwechsel 1<br />
<strong>2.</strong><strong>2.</strong> Beweglichkeit 1<br />
<strong>2.</strong>3. Wachstum, Teilbarkeit und Fortpflanzung 1<br />
<strong>2.</strong>4. Erregbarkeit 1<br />
<strong>2.</strong>5. Reizübertragung 2<br />
<strong>2.</strong>6. Ultrastruktur der <strong>Zelle</strong> 2<br />
<strong>2.</strong>7. Vorgänge an der Zellmembran 4<br />
3. Gewebe 9<br />
3.<strong>1.</strong> Die Gewebearten 9<br />
3.<strong>2.</strong> Gewebeveränderungen 9<br />
3.3. Stoffaufnahme, Stoffabgabe, Erregbarkeit 9<br />
3.4. Deckgewebe, Epithelgewebe 10<br />
3.5. Bindegewebe 11<br />
3.6. Stützgewebe 14<br />
3.6.<strong>1.</strong> Sehnen, Bänder 14<br />
3.6.<strong>2.</strong> Knorpel 14<br />
3.6.3. Knochengewebe 15<br />
3.7. Muskelgewebe 18<br />
3.7.<strong>1.</strong> Glatte Muskulatur 19<br />
3.7.<strong>2.</strong> Quergestreifte Muskulatur 19<br />
3.7.3. Herzmuskel 19<br />
3.7.4. Aufbau und Funktion der Skelettmuskulatur 19<br />
3.8. Nervengewebe 22<br />
4. Organsysteme 25<br />
5. Passiver Bewegungsapparat 25<br />
5.<strong>1.</strong> Knochenverbindung 25<br />
5.<strong>1.</strong><strong>1.</strong> Haft: feste Verbindung 25<br />
5.<strong>1.</strong><strong>2.</strong> Gelenk: bewegliche Verbindung 25<br />
6. Vokabular und Richtungsbezeichnung 27<br />
7. Die Wirbelsäule 28<br />
7.<strong>1.</strong> Allgemeiner Überblick 28<br />
7.<strong>2.</strong> Die Wirbelsäule als Funktionseinheit 28<br />
7.3. Statik der Wirbelsäule 32<br />
7.4. Bänder der Wirbelsäule 33<br />
7.5. Gelenke der Wirbelsäule 34<br />
7.6. Der Brustkorb 34<br />
8. Der Schultergürtel und die obere Extremität 35<br />
8.<strong>1.</strong> Die Gelenke der oberen Extremität 36<br />
8.<strong>1.</strong><strong>1.</strong> Das Schultergelenk 36<br />
8.<strong>1.</strong><strong>2.</strong> Das Ellbogengelenk 36<br />
8.<strong>1.</strong>3. Die Handgelenke 36<br />
8.<strong>2.</strong> Vokabular: knöcherne Strukturen am Schulterblatt und an der ob. Extremität 38<br />
8.3. Der Beckengürtel und die untere Extremität 42<br />
8.3.<strong>1.</strong> Morphologie des knöchernen Beckens 42<br />
8.3.<strong>2.</strong> Die Gelenke der unteren Extremität 43<br />
8.3.3. Vokabular: knöcherne Strukturen am Beckenring und an der unt. Extremität 46<br />
8.4. Morphologie und Funktion des Fußskelettes, Statik des Beines 50<br />
9. Aktiver Bewegungsapparat: Die Skelettmuskulatur 52<br />
9.<strong>1.</strong> Rückenmuskulatur 52<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 94
9.<strong>2.</strong> Kopf- und Halsmuskulatur 54<br />
9.3. Brustmuskulatur 57<br />
9.4. Bauchmuskeln 58<br />
9.5. Beckenbodenmuskulatur 60<br />
9.6. Extremitätenmuskeln 60<br />
9.6.<strong>1.</strong> Muskulatur der oberen Extremität 60<br />
9.6.<strong>2.</strong> Muskulatur der unteren Extremität 68<br />
10. Das Nervensystem 77<br />
10.<strong>1.</strong> Rückenmark und Spinalnerven 77<br />
10.<strong>1.</strong><strong>1.</strong> Reflex, Reflexbogen 79<br />
10.<strong>1.</strong><strong>2.</strong> Die Muskelspindel 80<br />
10.<strong>2.</strong> Die 12 Hirnnerven 81<br />
10.3. Das Gehirn 82<br />
10.4. Die Willkürmotorik 85<br />
10.5. Vegetatives Nervensystem (VNS) 86<br />
10.5.<strong>1.</strong> Sympathicus 86<br />
10.5.<strong>2.</strong> Parasympathicus 87<br />
1<strong>1.</strong> Vokabular 89<br />
Biotrainerschule - Skriptum Anatomie I<br />
Seite 95