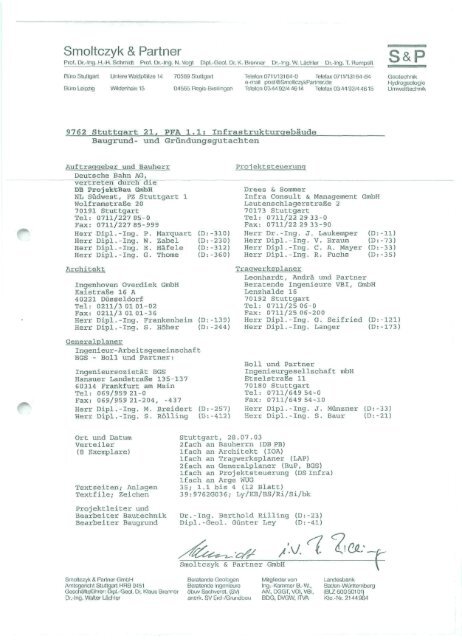Bodengutachten, Teil 1
Bodengutachten, Teil 1
Bodengutachten, Teil 1
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Smoltczyk & Partner<br />
Pro(, Pr.-lng. H.-H. Schmidt Prof. Dr.-Ing. N. Vogrt Dipl.-Geal, Dr. K, Brenner Dr.-Ing. W. Uchter Dr.-Ing. T. Ruinpell<br />
BüroSlullgart<br />
Büro Leipzig<br />
Untere Walclplälze 14 70569 Stullgait<br />
Telefon 0711/13164-0 Telefax 0/11/13! 64-64<br />
Q-rnaü post4tSmollczykPartner.de<br />
Wilcfenhaiii 15<br />
04565 Regls-Bteilngan Telefcn 034492/4 46 14 Telefax 0344 92/4 4615<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1; InfraBtrukburoebäude<br />
Baugrund- und Gründungagutachten<br />
Auftraggeber und Bauherr<br />
Deutsche Bahn AG,<br />
ver treten durch die<br />
DB ProjektBau GmbH<br />
NL Südwest, PZ Stuttgart 1<br />
Wolframstraße 20<br />
70191 Stuttgart<br />
Tel: 0711/227 85-0<br />
Fax: 0711/227 85-999<br />
Herr Dipl.-Ing. P. Marguart<br />
Herr Dipl.-Ing. W. Zabel<br />
Herr Dipl.-Ing. B. Häfele<br />
Herr Dipl.-Ing. G. Thome<br />
Architekt<br />
Ingenhoven Overdiek GmbH<br />
Kaistraße 16 A<br />
40221 Düsseldorf<br />
Tel: 0211/3 0101-02<br />
Fax: 0211/3 01 01-36<br />
Herr Dipl,-Ing. Frankenheim {D:<br />
Herr Dipl.-Ing. S. Höher
Infrastrukturgebäude Seite 2<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
Inhalt<br />
1 Bezug und Unterlagen<br />
2 Lage und Bauwerksbeschreibung<br />
3 Untersuchungsurnfang<br />
4 Baugrund<br />
5 Grundwasser —<br />
6 Geomechanische Bewertung und<br />
Klassifikation des Baugrunds<br />
7 Bautechnische Folgerungen<br />
7.1 Gründung<br />
7.2 Erdaushub und Herstellen der Baugrube<br />
7.3 Wasserhaltung während der Bauzeit<br />
7.4 Bauwerk und Grundwasser<br />
7.5 Hinterfüllung und Erddruck<br />
7.6 Wechselwirkung mit Nachbarbauten<br />
8 Baugrundüberprüfung<br />
Anlagen<br />
siehe Anlagenverzeichnis<br />
Sie können den Anlagenteil des Gutachtens entsprechend<br />
nebenstehender Skizze so herausklappen,<br />
dass die Anlagen neben dem Text liegen.<br />
Seite<br />
3<br />
5<br />
7<br />
9<br />
- —1-2<br />
13<br />
17<br />
17<br />
20<br />
25<br />
26<br />
29<br />
32<br />
34<br />
35
Infrastrukturgebäude Seite 3 Q o n<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1; Talguerung mit Hbf 28.07.03<br />
1 Bezug und Unterlagen<br />
Bezug: Die Deutsche Bahn AG, vertreten durch die DB Projekt-<br />
Bau GmbH (Niederlassung Südwest, Projektzentrum Stuttgart 1),<br />
plant im Rahmen der Aus- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg<br />
die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart einschließlich<br />
der Neubaustrecke Stuttgart - Wendungen. Dieses Ver-<br />
kehrsprojekt Stuttgart 21 umfasst<br />
- im Stadtbereich im Wesentlichen die Umwandlung des bestehenden<br />
Kopfbahnhofes in einen Durchgangsbahnhof, die Zuführung<br />
der Fernbahnen von Feuerbach, Bad Cannstatt, Ober- und<br />
Untertürkheim, den neuen Wartungsbahnhof Untertürkheim<br />
sowie die neue S-Bahn-Anbindung von Feuerbach und Bad Cannstatt;<br />
- im Filderbereich die Neubaustrecke vom neuen Hauptbahnhof<br />
bis Wendungen einschließlich der Anbindung des Flughafens<br />
Stuttgart durch den neuen Filderbahnhof.<br />
Auf der Grundlage unseres Leistungs- und Honorarangebotes vom<br />
0 6.08.97/15.08.97 wurden wir mit Vertrag vom 15.10.97 unter<br />
der Auftragsnuiwner 0322 0100 vom Bauherrn beauftragt, im Team<br />
Baugrund für die Tunnel in offener Bauweise sowie die Erdund<br />
Kunstbauwerke im Stadtbereich, in den PFA = Planfeststellungsabschnitten<br />
1.1, 1.5 und 1.6, Baugrund- und Gründungsgutachten<br />
zu erstellen.<br />
Im Zuge der Planungen zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens<br />
im PFA 1.1 haben wir in einer ersten Stufe, auf<br />
der Basis eines groben Erkundungsrasters, für die in diesem<br />
Abschnitt befindlichen Bauwerke am 10.0 8.98 ein geotechnisches<br />
Übersichtsgutachten vorgelegt.<br />
Das vorliegende Gutachten berücksichtigt alle inzwischen ausgeführten<br />
bauwerksbezogenen Erkundungsbohrungen und behandelt,<br />
gemäß der mit dem Generalplaner abgestimmten Bauwerkseinteilung,<br />
das im Anschluss an den Nordausgang des Bonatzgebäudes<br />
geplante Infrastrukturgebäude (Technikgebäude).
Infrastrukturgebäude Seite 4<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
In diesem Bericht werden die bauwerksspezifisch zu beachten-<br />
den geotechnischen Besonderheiten und deren bautechnische<br />
Folgerungen ausgearbeitet und beschrieben. Die für alle Bau-<br />
werke im PFA 1.1 allgemein gültigen geotechnischen Aussagen<br />
und Empfehlungen sind im übergeordneten geotechnischen<br />
Bericht zum PFA 1.1 im Zusammenhang mit der Dokumentation der<br />
bodenmechanischen Versuche enthalten.<br />
Zum Zeitpunkt der Gutachten-Erstellung ist die Entwurfspla-<br />
nung in Bearbeitung. Das Gutachten wird hierzu mit verwendet<br />
und dient als Grundlage für die Ausschreibung.<br />
An Unterlagen für das geplante Infrastrukturgebäude erhielten<br />
wir vom Architekten, der Ingenhofen Overdiek GmbH, als pdf-<br />
und plt-files am 06.05.03<br />
- 2 Grundrisse (M 1:100): Ebene 0 und Ebene -1, Vorabzug<br />
Stand 04/99,<br />
- 2 Schnitte (M 1:200): Querschnitt Ql und Längsschnitt L2,<br />
Anlagen 7.1.5.13, Blatt 2 und 7.1.5.24 aus den Planfest-<br />
stellungsunterlagen (Stand 24.08.01), sowie am 12.05.03<br />
- 1 Grundriss (M 1:100) mit Lasten OK-Bodenplatte, Stand<br />
12.05.03, erstellt vom Tragwerksplaner.<br />
Von der Arbeitsgemeinschaft Wasser- Umwelt- Geotechnik (ARGE<br />
WUG), Westheim, wurden uns aus der im Team Baugrund erarbei-<br />
teten geologischen, hydrogeologischen, geotechnischen und<br />
wasserwirtschaftlichen Stellungnahme, die auf der Basis des<br />
Erkundungsstandes des vierten Erkundungsprogrammes {4. EKP)<br />
für die Planfeststellung gefertigt wurde, zur Verfügung<br />
gestellt:<br />
- <strong>Teil</strong> 1: Geologie und Hydrogeologie, Januar 2002 (10 Ordner,<br />
1.1 bis 1.10) und<br />
- <strong>Teil</strong> 3: Wasserwirtschaft (Hydrogeologie, Wasserwirtschaft<br />
und Altlasten), Dezember 2001 (4 Ordner, 3.1 bis 3.3).<br />
Ergänzend hierzu erhielten wir die Stellungnahme vom 23.12.02<br />
zu den im Rahmen des 5. EKP erkundeten Grundwasserständen im
Infrastrukturgebäude Seite 5 Oft D<br />
9762 Stuttgart 21, PFÄ 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
Hinblick auf die für den DB-Tunnel angesetzten Bemessungswasserstände<br />
.<br />
Weiter standen uns zur Verfügung:<br />
- Blatt 7221 Stuttgart-Südost der Geologischen Karte (M<br />
1:25 000) von Baden-Württemberg mit Erläuterungen, Stuttgart<br />
I960,<br />
- Blatt 55-4 der Baugrundkarte—von—Stuttgart-— (M—;1:--:• 5 Q00)-,<br />
Stuttgart 1963,<br />
- Blatt 2 der Hydrogeologischen Karte von Stuttgart (M<br />
1:10 000), Stuttgart 1966,<br />
- Blatt NO 26/09 der Höhenflurkarte {M 1:2 500) von Württemberg<br />
aus den Jahren 1888 und 1920.<br />
Außerdem verwendeten wir unser geotechnisches Übersichtsgutachten<br />
zum PFA 1.1 vom 10.08.98 einschließlich der darin aufgeführten<br />
Unterlagen und den Ergänzungen Nr. 1 bis 3 vom<br />
29.01.99, 23.06.99 und 06.12.01.<br />
2 Lage und Bauwerksbeschreibung<br />
Lage: Das geplante Infrastrukturgebäude liegt im Stuttgarter<br />
Talkessel am nordwestlichen, linken Talrand des Nesenbachtals,<br />
im Bereich des Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes am Nordausgang<br />
des bestehenden Hauptbahnhofs (Anlage 1.1).<br />
Das Gelände ist eben und fällt von knapp 247 mNN im Norden um<br />
rund 1 m nach Süden ab. Es ist - abgesehen von einigen Blumenrabatten<br />
- überwiegend mit Asphalt befestigt und wird als<br />
Parkplatz genutzt (Anlage 1.2). <strong>Teil</strong>weise ist das Gelände mit<br />
dem Nordflügel des Bahnhofsgebäudes überbaut, der im Zusammenhang<br />
mit der Herstellung der neuen Bahnhofshalle gemeinsam<br />
mit dem Betriebsfertigungsamt abgebrochen wird.
Infrastrukturgebäude Seite 6 O o<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1; Talquerung mit Hbf 28.07.03 V» *•*<br />
Die geodätischen Daten sind: TK 25 Blatt 7221 Stuttgart-Süd-<br />
ost; R^ 35 13 340 / HS 54 05 220; h = 246,5 mNN (Gelände).<br />
Bauwerksbeschreibung: Bei dem geplanten Infrastrukturgebäude<br />
handelt es sich um ein zweigeschossiges Bauwerk mit einer<br />
Grundfläche von rund 50 m mal 40 m. Das Gebäude wird voll-<br />
ständig unter der Geländeoberfläche liegen. Die untere Ebene<br />
-1 wird Räume der-Bahnbetriebstechnik—sowie Ersatzflächen für<br />
die Technik der S-Bahn aufnehmen. In der oberen Ebene 0<br />
befinden sich neben den ETA-Räumen die Trafoanlagen und Tech-<br />
nikräume des Bonatzgebäudes. Oberirdisch, zwischen Arnulf-<br />
Klett-Platz und Platzniveau Kurt-Georg-Kiesinger-Platz wird<br />
auf dem Gebäude ein Parkplatz für ca. 100 Kurzzeitparker<br />
unter einem Baumcarre angelegt.<br />
Das Gebäude grenzt im Südosten direkt an das Bonatzgebäude,<br />
wo es mit einer Dehnfuge angeschlossen wird. Unmittelbar im<br />
Nordosten wird die neue Bahnhofshalle errichtet, im Nordwe-<br />
sten wird der Hauptsammler West gedükert und der Kanal Lau-<br />
tenschlagerstraße verlegt. Im Südwesten befindet sich die<br />
Rampe zur Idunapassage.<br />
Nach derzeitiger Planung ist der Bau des Infrastrukturgebäu-<br />
des mit eine der ersten Maßnahmen im PFA 1.1, unmittelbar<br />
gefolgt vom Düker Hauptsammler West. Für die Herstellung der<br />
Baugrube wird daher ein Baugrubenverbau erforderlich.<br />
Die Fußbodenhöhe der Ebene 0 ist bei 242,09 mNN (FFB) bzw.<br />
241,79 mNN (RFB) geplant. In der untersten Ebene -1 liegen<br />
die entsprechenden Fußbodenhöhen bei 238,69 mNN (FFB) bzw.<br />
237,99 mNN (RFB).<br />
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Stahlbetonbauwerk, bei<br />
dem die Außenwände des Untergeschosses und die Bodenplatte in<br />
wasserundurchlässigem Beton ausgeführt werden sollen. Die<br />
Gebäudelasten werden streifenförmig über die Außenwände und<br />
Innenstützen mit einem Raster von in der Regel 5,0 m mal
Infrastrukturgebäude Seite 7<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
6,5 in abgetragen. Die Decke über dem oberen Geschoss soll als<br />
Plattenbalken-Stahlbeton-Konstruktion ausgeführt v/erden, da<br />
bei der Nutzlastannahme berücksichtigt wird, dass der PKW-<br />
Parkplatz möglicherweise unbeabsichtigt mit Schwerlastwagen<br />
befahren wird.<br />
Nach Angaben des Tragwerkplaners, der Leonhardt, Andrä und<br />
Partner GnxbH, sind auf OK Bodenplatte Stützenlasten von min.<br />
8ÖÖ kN"ündrtia^. 5 0005cN, in der Reget ^zwischen 2 000 kW und<br />
3 000 kN abzutragen. Die Wandlasten betragen zwischen 180<br />
kN/m und 32 0 kN/ra.<br />
3 Untersuclxungsumfang<br />
Zur Erkundung insbesondere der bauwerksbezogenen geomechani-<br />
schen Baugrundsituation wurden im Zuge des vierten und fünf-<br />
ten Erkundungsprogramms (EKP) von der ARGE Terrasond/Waschek<br />
bzw. der ARGE Stuttgart 21 im Zeitraum zwischen dem 14.09.98<br />
und dem 27,09.02 insgesamt<br />
5 Kernbohrungen nach DIN 4021, Tabelle 1, Zeile 5, im<br />
Fels Tabelle 2, Zeile 5, mit 19,7 m bis 43 m, meist<br />
etwa 20 m Tiefe,<br />
niedergebracht. Die Bohrung BK 11/135 wurde als Grundwasser-<br />
messstelle ausgebaut, die übrigen Bohrungen wurden nach<br />
Abschluss der Untersuchungen mit Zement-Bentonit-Suspension<br />
verschlossen.<br />
Die Bohrpunkte wurden von der jeweiligen ARGE auf Gauss-Krü-<br />
ger-Koordinaten eingemessen und von uns im Lageplan auf<br />
Anlage 1.2 dargestellt.<br />
Zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse wurden auch die Boh-<br />
rungen 1231 und 1421 herangezogen, die für andere Bauvorhaben<br />
im näheren Umfeld der geplanten Baugrube im Zuge früherer<br />
Erkundungen durchgeführt worden waren (sog. Fremdbohrungen).
Infrastrukturgebäude Seite 8<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
Die Bohrung BK 11/135 GM wurde im Rahmen der hydrogeologi-<br />
schen Untersuchungen durch die ARGE WUG veranlasst und in der<br />
Lage festgelegt. Da diese Bohrung unmittelbar im Baufeld des<br />
geplanten Infrastrukturgebäudes niedergebracht wurde, haben<br />
wir die Bohrkerne bis zur bautechnisch relevanten Tiefe von<br />
rund 20 m unter Gelände ingenieurgeologisch aufgenommen. Auf<br />
eine ingenieurgeologische Aufnahme der Bohrung BK 11/13 6 GM,<br />
die voif der ARGE WÜG äls~~ w^rte^e^Gfuhliwä^ einge-<br />
richtet wurde, haben wir auf Grund der unmittelbaren Nähe zur<br />
BK 11/135 GM verzichtet.<br />
Alle von uns ingenieurgeologisch aufgenommenen Bohrungen sind<br />
in Anlehnung an DIN 4023 in Anlage 2 dargestellt und<br />
beschrieben sowie zusammen mit den Fremdbohrungen - soweit<br />
sie im engeren Bereich der Schnitte liegen - in zwei bau-<br />
grundtechnische Geländeschnitte eingearbeitet (Anlagen 3.1).<br />
Jeder Bohrung des 4. und 5. EKP wurden im Mittel je 2 bis 3<br />
Bodenproben der Güteklasse 1 (Sonderproben) und je Tiefenme-<br />
ter etwa 1 Bodenprobe der Güteklasse 3 nach DIN 4023 entnom-<br />
men.<br />
An ausgewählten Proben wurden in unserem geotechnischen Labor<br />
und - in unserem Auftrag und gemäß unseren Vorgaben - im<br />
Labor des Instituts für Geotechnik der Universität Stuttgart<br />
bodenmechanische Versuche durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse aller Versuche werden für den Planfeststel-<br />
lungsabschnitt 1.1 in einem gesonderten Bericht erläutert und<br />
dokumentiert. In diesem Bericht werden die einzelnen Bodenar-<br />
ten bauwerksübergreifend und gesamtheitlich bewertet. Im vor-<br />
liegenden Bauwerksgutachten wird eine Eingrenzung der maßgeb-<br />
lichen Bodenkennwerte anhand der Wassergehaltsbestimmungen<br />
vorgenommen und erforderlichenfalls auf lokale Besonderheiten<br />
hingewiesen.<br />
Altlastenuntersuchungen und sensorische Prüfung des Bohrgutes<br />
nach Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen durch grund-
Infrastrukturgebäude Seite 9 O o n<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
wassergefährdende Stoffe im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes<br />
werden von der ARGE WUG im Rahmen des Verkehrsprojektes<br />
Stuttgart 21 vorgenommen, dokumentiert und bewertet.<br />
Den Bohrungen wurden Wasserproben entnommen und chemisch<br />
untersucht. In den offenen Bohrlöchern wurden außerdem<br />
hydraulische Versuche durchgeführt. Über die Untersuchungsergebnisse<br />
_ undihr© Bewertung- wind—ebenfalls von den ÄRGE_MUG<br />
berichtet.<br />
4 Baugrund<br />
Durch Interpolation zwischen den zwangsläufig punktuellen<br />
Aufschlüssen und unter Berücksichtigung geologischer Zusammenhänge<br />
haben wir ein räumliches Modell des Untergrunds<br />
erarbeitet, das nachfolgend beschrieben und in zwei baugrundtechnischen<br />
Geländeschnitten (Anlagen 3.1) und einer Schichtlagerungskarte<br />
(Anlage 3.2) dargestellt ist.<br />
Danach besteht der Baugrund im Bereich des Infrastrukturgebäudes<br />
vereinfacht aus drei Schichten: aus Auffüllung, Fließerde<br />
und Gipskeuper.<br />
- Zuoberst liegen künstliche Auffüllungen, die im Zusammenhang<br />
mit der Altbebauung des früheren Güterbahnhof-Geländes,<br />
dem S-Bahn-Bau, dem Straßenbau und dem Bau der südöstlich<br />
anschließenden Klettpassage entstanden.<br />
Zuoberst sind es Kiese (Tragschicht unter der Asphaltdecke)<br />
. Darunter sind es inhomogene und häufig wechselnde<br />
Gemische von Schluff und untergeordnet von Sand, Kies und<br />
Bauschutt. Die Konsistenz der bindigen Anteile ist meist<br />
steif und halbfest.<br />
Die Mächtigkeit der Auffüllungen nimmt von weniger als 2 m<br />
im Osten auf über 4 m im äußersten Westen zu.
Infrastrukturgebäude Seite 10<br />
9762 Stuttgart 21, PFÄ 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
Ferner sind die vorhandenen Bauwerke S-Bahn und Klettpas-<br />
sage zu beachten.<br />
- Oberste natürliche Schicht ist in geringem Umfang und nur<br />
bereichsweise vorhandene eiszeitliche Fließerde aus meist<br />
rotbraunen, kiesigen Schlufftonsteinbröckchen.<br />
Die Mächtigkeit beträgt - v/o sie nicht durch Bautätigkeit<br />
abgetragen oder durch Auffüllungen ersetzt ist - meist nur<br />
wenige Dezimeter".<br />
- Den tieferen Untergrund bilden die Schichten des Gipskeu-<br />
pers: ganz überwiegend rotbraune, untergeordnet auch oliv-<br />
graue Schlufftonsteine, die meist sehr mürbe und teilweise<br />
zu einem feinbröckeligen Schlufftonstein-Schluff-Gemisch<br />
entfestigt sind. Die Schlufftonsteine enthalten häufig meh-<br />
rere Zentimeter mächtige "mehlige", schluffig-feinsandige<br />
Gipsauslaugungsreste (GAR) und sind im Übergangsbereich<br />
Boden/angewitterte Festgesteine häufig auf kurze Entfernung<br />
in lateraler und auch vertikaler Richtung in sehr wechsel-<br />
hafter Qualität anzutreffen. Überwiegend sind sie nach<br />
WALLRAUCH (1969) den Verwitterungsklassen W5 {vollkommen<br />
plastifizierter Boden) und W4 (Boden-Festgestein-Übergang)<br />
zuzuordnen. Eine Beschreibung der Verwitterungsklassen kann<br />
Anlage 2.0 entnommen werden. Eine Zunahme der Qualität zur<br />
Tiefe ist im Allgemeinen nicht festzustellen.<br />
Die (natürliche) Oberfläche des Gipskeupers liegt im Norden<br />
und Osten meist 1 m bis 2 m unter Gelände und fällt im<br />
Bereich des geplanten Gebäudes von rund 245 mNN auf rund<br />
242 mNN nach Südwesten, zur Schillerstraße hin, ab. Die<br />
geplante Baugrube (OK Bodenplatte im UG: 237,99 mNN) wird<br />
also rund 5 m bis 8 m in den Gipskeuper einschneiden.<br />
Die von der geplanten Baugrube erschlossenen Schichten des<br />
Gipskeupers sind stratigraphisch den rund 17 m mächtigen<br />
sog. Dunkelroten Mergel (kmlDRM) zuzuordnen, worin auch das<br />
Bauwerk gegründet wird. Darunter folgt in einer mittleren<br />
Mächtigkeit von rund 5 m der sog. Bochinger Horizont<br />
(kmlBH), der noch im Setzungseinflussbereich der Gründung<br />
liegt. Die Basis des Gipskeupers wird von den Grundgips-
Infrastrukturgebäude Seite 11 Q o n<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
schichten (kmlGG) gebildet, die ebenso wie der darunter<br />
folgende Lettenkeuper sind für das geplante Gebäude bautechnisch<br />
nicht von Bedeutung sind.<br />
Obwohl (auslaugungsfähige) Sulfatgesteine in den Dunkelroten<br />
Mergeln nur in untergeordnetem Maße, in geringmächtigen Bänken,<br />
feinschichtigen Lagen und als Knollen auftreten, wurden<br />
beim Aushub- der nördlich- benachbarten J3a_ugrube_ der Südwest,-LB<br />
mehrfach Hohlräume von teilweise mehreren Metern Durchmesser<br />
angetroffen. Ein Beispiel für einen im Baufeld der Südwest-LB<br />
angetroffenen Hohlraum mit etwa 1,1 m Durchmesser ist in<br />
Anlage 4 dargestellt. Die Entstehung dieser Hohlräume muss<br />
durch Verkarstungsvorgänge in den tieferliegenden Grundgipsschichten<br />
erklärt werden. Auch wenn während der bauwerksbezogenen<br />
Erkundung mit den punktuellen BaugrundaufSchlüssen im<br />
Baufeld keine Hohlräume angetroffen wurden, ist während der<br />
Bauausführung grundsätzlich mit dem Vorhandensein vergleichbarer<br />
Hohlräume zu rechnen.<br />
Ebenfalls von Bedeutung ist das Auftreten von Dolinen. Sie<br />
entstanden vor mehreren zehntausend Jahren durch das Einstürzen<br />
von Hohlräumen, die sich durch Auslaugung der im tieferen<br />
Untergrund früher vorhandenen Gipslager gebildet hatten.<br />
Die 35 m tiefe Bohrung 1436, die rund 25 m südöstlich des<br />
geplanten Infrastrukturgebäudes liegt und 1973 für den Bau<br />
der S-Bahn abgeteuft wurde, erschließt bis in 34 m Tiefe<br />
(205,15 mNN) die Füllung einer Doline. Bis 16,2 m Tiefe ist<br />
es überwiegend dunkelgraubrauner, steifer Lehm, der lagenweise<br />
kleine Sandsteinbrocken enthält. Die Schichten wurden<br />
vermutlich vom Nesenbach ursprünglich auf einem höheren<br />
Niveau abgelagert und allmählich durch fortschreitende Auslaugung<br />
und Lösungskorrosion im tieferen Untergrund immer<br />
tiefer versenkt. Darunter sind es verstürzte Keupermergel,<br />
die in 34 m Tiefe Zellkalken und Mergeigrus auflagern, die<br />
den Grundgipsschichten zugeordnet werden.
Infrastrukturgebäude Seite 12 Q o n<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 ^ ** '<br />
Der Anfangsdurchmesser der Dolinen im Gipskeuper liegt, Literaturangaben<br />
zufolge, meist deutlich unter 10 m. Allerdings<br />
sind durch das Nachbrechen der Ränder und durch Aneinanderreihung<br />
mehrerer nah beieinanderliegender Karstschlotten auch<br />
die Ausbildung längerer, linearer, schmaler Strukturen oder<br />
Subrosionssenken von mehreren Dekametern Durchmesser denkbar.<br />
5 Grundwasser<br />
Nach den Untersuchungen der ARGE WUG (Stichtagsmessung vom<br />
02.09.1999, ca. Mittelwasserverhältnisse) fällt der Grundwasserspiegel<br />
von rund 236,5 mNN in der Westecke der geplanten<br />
Baugrube auf etwas mehr als 236 mNN nach Osten, zum Schlossgarten<br />
hin, ab. Er liegt damit knapp unter der geplanten Baugrubensohle.<br />
Von der ARGE WUG wurden bislang die im Rahmen des 1. bis<br />
4. EKP durchgeführten hydrochemischen Untersuchungen dokumentiert<br />
(s. <strong>Teil</strong> 1 der geologischen, hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen<br />
Stellungnahme vom Januar 2002) . Danach<br />
ist der Chemismus der Gipskeuperwässer wesentlich vom Auslaugungsgrad<br />
des Gebirges, weniger von deren stratigraphischen<br />
Zuordnung abhängig. Nach den festgestellten Sulfatgehalten<br />
nvuss insbesondere in der nordwestlichen Talrandzone mit<br />
betonangreifenden Wässern und Böden nach DIN 4 030 gerechnet<br />
werden.<br />
Insgesamt wird die Grundwassersituation und die Grundwasserbeschaffenheit<br />
von der ARGE WUG nach Abschluss des 5. EKP in<br />
einem gesonderten Bericht ausführlich dargestellt und bewertet.
Infrastrukturgebäude Seite 13 C & D<br />
9762 Stuttgart 21, PFÄ 1.1: Talquerung mit Hbf 28,07.03 *-* "* *<br />
6 Geomechanische Bewertung und Klassifikation des Baugrunds<br />
Boden- und felsmechanische Versuche sind erforderlich, um die<br />
angetroffenen Böden und Gesteine mit Hilfe objektiver Vergleichswerte<br />
boden- und felsmechanisch klassifizieren und<br />
charakteristische Werte für erdstatische Berechnungen festlegen<br />
zu können. Im vorliegenden Fall können wir auf unsere<br />
Erfahrungen im Stadtgebiet Stuttgart und auf die Ergebnisse<br />
der im Rahmen des 4. und 5. EKP von uns durchgeführten Feldund<br />
Laborversuche zurückgreifen. Die Beschreibung und statistische<br />
Auswertung unter Berücksichtigung der von den igi<br />
Niedermeyer Instituten im Rahmen des 1. und 2. EKP dokumentierten<br />
bodenmechanischen Versuche wird in einem gesonderten<br />
Bericht für den PFA 1.1 einschließlich Versuchsdokumentation<br />
vorgelegt.<br />
Anhand der Erkundungsergebnisse im Bereich des hier behandelten<br />
Bauwerks und der an dort gewonnenen Proben durchgeführten<br />
Laborversuche ist eine Eingrenzung der für den gesamten Planfeststellungsbereich<br />
festgestellten Baugrundeigenschaften<br />
möglich. Anhand der Wassergehaltsbestimmunqen im unmittelbaren<br />
Bauwerksbereich wird nachfolgend eine Klassifizierung der<br />
Böden vorgenommen.<br />
Der natürliche Wassergehalt der bindigen Matrix der Auffüllung<br />
wurde an 8 Proben bestimmt, lag zwischen etwa wn = 12 %<br />
und wn = 24 % und bestätigt die Heterogenität mit wechselnden<br />
bindigen und nichtbindigen Schichtanteilen. Für die bindigen<br />
Schichtanteile kann die Klassifikation nach DIN 18196 aus<br />
einem Vergleich zwischen den natürlichen Wassergehalten und<br />
den jeweils entsprechenden Konsistenzangaben im Feld (vorwiegend<br />
steif und halbfest, bereichsweise auch fest) über Erfahrungswerte<br />
abgeschätzt werden. Danach sind die Proben überwiegend<br />
als leicht- und mittelplastisch (TL bzw. TM) einzustufen.<br />
Der Ansprache im Feld entsprechend stehen oberflächennah<br />
Kiese mit wechselndem Sandanteil (GW, SW, Tragschichtmateri-
Infrastrukturgebäude Seite 14<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
al) an. In BK 11/29 wurden bei modrigem Geruch auch Pflanzen-<br />
reste angetroffen (OU) , in BK 11/114 in 1,3 m Tiefe eine<br />
0,5 m dicke Betonplatte.<br />
Entsprechend der geringen Schichtmächtigkeit und Bedeutung<br />
wurde an einer Probe aus der Fließerde nur ein natürlicher<br />
Wassergehalt von w = 24,8 % bestimmt. Nach vorliegenden Pla-<br />
stizität sgrenzen3ran__e.tMa_jHi, - 40 % und wP = 17 % hat diese<br />
Probe eine weiche Konsistenz. In der Regel kann jedoch ent-<br />
sprechend der Ansprache im Feld für diese Böden eine steife<br />
bis halbfeste Konsistenz erwartet werden.<br />
Im Gipskeuper wurden an 43 Proben aus den Dunkelroten Mer-<br />
geln, 17 Proben aus dem Bochinger Horizont und 5 Proben aus<br />
den Grundgipsschichten die natürlichen Wassergehalte<br />
bestimmt. Sie liegen zwischen wn = 10,4 % und wn = 33,6 %, im<br />
gesamten Mittel bei wn = 19 %. Die Standardabweichung von ><br />
5 % zeigt den stark wechselnden Verwitterungszustand. Die<br />
Wassergehalte im Einzelnen bestätigen in der Regel die manu-<br />
elle Ansprache, bei der die gesamte Bandbreite von weicher<br />
bis fester Konsistenz bzw. sehr mürber, nur untergeordnet<br />
mürber Schlufftonsteinqualität festgestellt worden war. Über-<br />
wiegend ist die Gesteinsqualität des Gipskeupers als sehr<br />
mürbe zu beschreiben; dort, wo der Gipskeuper zu Schluff ent-<br />
festigt ist, weist er eine überwiegend halbfeste Konsistenz<br />
auf. In BK 11/114 wurde in 10,6 m Tiefe eine 1,5 m mächtige<br />
weiche Lage erbohrt.<br />
Die Wassergehalte im Einzelnen sind in den Anlagen 2.1 rechts<br />
neben den Profilsäulen aufgetragen und lassen in der Regel<br />
erkennen, dass bis zur Endteufe der Bohrungen mit zunehmender<br />
Tiefe keine signifikante Abnahme des Wassergehaltes und damit<br />
eine Zunahme der Qualität bzw. Abnahme des Verwitterungsgra-<br />
des der Schlufftonsteine vorhanden ist. Die ausgeprägte<br />
Streuung des natürlichen Wassergehaltes zeigt vielmehr den<br />
stark streuenden Verwitterungszustand.
Infrastrukturgebäude Seite 15 Qo Q<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
Die Qualität ist neben der Zusammensetzung des Gesteins<br />
(u.a. Anteile von Gips-, Dolomit- oder Mergelstein) auch<br />
durch die Lage im Übergang vom Hang in den Talkessel bzw. den<br />
oberflächennahen Verwitterungsprozessen und durch das Grundwasser<br />
mit den dort stattgefundenen Auslaugungsprozessen<br />
beeinflusst. Die statistische Auswertung der Wassergehalte<br />
der stratigraphischen Schichteinheiten zeigt, dass der<br />
Böchinger HöTizörit~ mit" wn~ =^ 16~%~einen niedrigeren mit 11 e r e n-<br />
Wassergehalt aufweist, als die darüberliegenden Dunkelroten<br />
Mergel (wn = 20 %) und die unterliegenden Grundgipsschichten<br />
(wn - 19,6 %} .<br />
In unserem geotechnischen Übersichtsgutachten zur Planfeststellung<br />
vom 10.08.98 hatten wir im Abschnitt 6.2 die<br />
schlechtere Qualität des Gipskeupers im Bereich des Nesenbachtales<br />
gegenüber dem nordwestlichen, hangseitigen Talrand<br />
aufgezeigt. Danach liegen die Wassergehalte im Bereich des<br />
geplanten Infrastrukturgebäudes in einem Übergangsbereich mit<br />
Tendenz zur Qualität wie im zentralen Nesenbachtal.<br />
Anhand der Bodenansprache im Gelände, der Ergebnisse der<br />
Feld- und Laborversuche sowie unserer Erfahrung mit bodenmechanisch<br />
gleichartigen Böden kann der anstehende Baugrund in<br />
Anlehnung an bautechnische Regelwerke klassifiziert und durch<br />
bodenmechanische Rechenwerte für erdstatische Untersuchungen<br />
beschrieben werden (Tabelle 1).<br />
Bei den angegebenen Kennwerten handelt es sich um charakteristische<br />
Werte, die für Nachweise globaler Sicherheiten gelten.<br />
Berechnungen nach dem neuen Sicherheitskonzept erfolgen<br />
mit den in den entsprechenden Normen angegebenen <strong>Teil</strong>sicherheit<br />
sbeiwerten.
Infrastrukturgebäude Seite 16 O o D<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
geo~ . Bezeichnung AuffüIXung<br />
vorherrschende(r)<br />
- Kor.3iaten2,<br />
- Festigkeit<br />
Kl33sif ikaticnen:<br />
Bodengtappe (DIN 1B196)<br />
Bodenklasse (DIH 1B3DO)<br />
Bodenklasse (DI}.' 183Q1)<br />
Frc sterepfine1ichkeit<br />
KlasM nach KTVE-StB 94<br />
SchruropFgefahr<br />
Reehenwerte:<br />
Wichte v (kN/m )<br />
uutei Auftrieb y' (kN/m )<br />
Reibung3winkel *p' (')<br />
Kohäsion c' (kN/m )<br />
Eteifemod-ji E |MS/fli 1 für<br />
hn n
Infrastrukturgebäude Seite 17 Q q f"?<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07,03 O
Infrastrukturgebäude Seite 18 ^ Ä<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 ^ **<br />
einer "weißen Wanne" wasserundurchlässig ausgebildet werden<br />
soll, bietet es sich an, eine statisch wirksame Bodenplatte<br />
als Gründungselement zu verwenden. Das Bauwerk kann dabei<br />
entweder auf einer durchgehenden lastverteilenden Bodenplatte<br />
mit konstanter Dicke gegründet werden oder es können Einzel-<br />
fundamente ausgebildet werden, zwischen die eine Bodenplatte<br />
zur Aufnahme des Wasserdrucks "eingehängt" wird. Diese Lösung<br />
entspricht der Ausbildung einer Platte mit variabler Dicke,<br />
Die Wasserdruckbelastung der Platte ergibt sich aus dem<br />
Bemessungswasserstand.<br />
Die Berechnung einer derartigen Platte kann nach dem Bet-<br />
tungsmodulverfahren erfolgen. Aus einer Gesamtbetrachtung der<br />
Bodenplatte (Ersatzfläche 41 m mal 46 m, belastet mit einer<br />
mittleren Bauflächenpressung von 135 kN/m 2 einschließlich<br />
Bodenplatte, Fußbodenaufbau und einer Verkehrsbelastung von<br />
5 kN/m 2 , Annahme, dass 70 % der Lasten ständig wirksam sind,<br />
Setzungseinflusstiefe von 10 m, Wiederbelastung des Unter-<br />
grundes, Setzung 2 cm) ergibt sich ein Bettungsmodul (ks) von<br />
7 MN/m 3 . Zur Berücksichtigung der wechselhaften Qualität des<br />
Gipskeupers und der bis zum Bemessungswasserstand schwanken-<br />
den Grundwasserverhältnisse empfehlen wir den Bettungsmodul<br />
zwischen ks = 5 MN/m 3 und ks = 10 MN/m 3 zu variieren und die<br />
Schnittgrößen aus der ungünstigsten Kombination der Bemessung<br />
zugrunde zu legen.<br />
Die mittleren Sohlnormalspannungen von 135 kN/m 2 bewirken<br />
aufgrund der höheren Aushubentlastung im Bodenkontinuum eine<br />
Wiederbelastung.<br />
Auf Grund der geringen Zusatzbeanspruchung durch das Gebäude<br />
erscheinen Dolinen im Baufeld, wie sie in Abschnitt 4<br />
beschrieben sind, beherrschbar. Da das Vorhandensein jedoch<br />
nicht sicher ausgeschlossen werden kann, empfehlen wir die<br />
daraus resultierenden Zwängungsbeanspruchungen dadurch zu<br />
ermitteln und konstruktiv abzudecken, dass in der Umgebung<br />
einer Stütze (einer Fläche von etwa 5 m mal 5 m) der Bet-
Infrastrukturgebäude Seite 19 Q & P<br />
97 62 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
tungsmodul auf 20 % reduziert wird, während in den übrigen<br />
Feldern der konstante Wert angesetzt wird.<br />
Unter der Baugrubensohle möglicherweise vorhandene Hohlräume,<br />
die sich durch die geänderten Randbedingungen (fehlende<br />
Gewölbewirkung des überlagernden Bodens) langfristig bis zur<br />
Gründungsebene ausbreiten können, werden damit jedoch nicht<br />
erfasst. Wir empfehlen daher, im Rahmen der Ausführung das<br />
"VorhahäenseTn von gr^Eeäuntigen Jäohlxäum&n miC£els~B©Rr 5 üögen#<br />
die z.B. mit einem Ankerbohrgerät ausgeführt werden können<br />
und die nach dem Aushub von der Baugrubensohle unter jeder<br />
Stütze bzw. entlang der Außenwände entsprechend dem Raster<br />
der Achsen bis etwa 8,0 m Tiefe unter Fundamentebene ausge-<br />
führt werden, zu erkunden. Angetroffene Hohlräume können dann<br />
mit einer Zementsuspension gezielt verpresst werden.<br />
Besonders beim Anschluss der Untergeschosswände an die Sohl-<br />
platte ist mit erheblichen Zwängungsbeanspruchungen infolge<br />
der (behinderten) Durchbiegung und Verdrehung der Sohlplatte<br />
zu rechnen. Bodenplatte und Wände sind daher kraftschlüssig<br />
so miteinander zu verbinden, dass die Zwängungsbeanspruchun-<br />
gen nicht zu durchgehenden Rissen führen.<br />
Der Einfluss von Lastkonzentrationen in Rand- oder Stützenbe-<br />
reichen wirkt sich auf den Ansatz des Bettungsmoduls aus. Wir<br />
empfehlen, diesen positiven Einfluss im Zuge der Bauwerksop-<br />
timierung mit den konkreten Lastgrößen vorzunehmen. Erfah-<br />
rungsgemäß kann durch eine detaillierte Vorgabe der Bettungs-<br />
modulverteilung eine technisch und wirtschaftlich optimierte<br />
Fundainentierung erzielt werden. Entsprechende Berechnungen<br />
auf der Basis des Steifemodulverfahrens führen wir gerne für<br />
Sie aus.
Infrastrukturgebäude Seite 20 Q D n<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03<br />
7.2 Erdaushub und Herstellen der Baugrube<br />
Die Baugrubensohle wird unter Berücksichtigung von Bodenplattenstärke<br />
und Unterbau bei etwa 236,7 mNN liegen. Die Baugrube<br />
bindet damit zwischen rund 9 m und 10 m ins Gelände<br />
ein, wobei im Südosten und Südwesten bestehende Gebäude bzw.<br />
Bauwerke tangiert werden.<br />
Beim Erdaushub werden Auffüllungen, in geringem Umfang Fließerde<br />
und überwiegend Gipskeuper anfallen. Die Bodenklassen<br />
der zu lösenden Böden sind in Tabelle 1 des Abschnitt 6<br />
genannt.<br />
Eine bodenmechanische Bewertung der Wiederverwendbarkeit der<br />
im PFA 1.1 anfallenden Aushubmaterialien wird im allgemeinen<br />
geotechnischen Bericht unter Berücksichtigung der Ergebnisse<br />
des 5. Erkundungsprogrammes vorgenommen.<br />
Die in den Baugrubensohlen zu erwartenden Böden weichen bei<br />
Wasserzutritt und dynamischer Beanspruchung rasch auf. Über<br />
den jeweils endgültigen Baugrubensohlen ist daher eine<br />
Schutzschicht von > 30 cm zu belassen, solange Baustellenbetrieb<br />
auf der Baugrubensohle stattfindet. Nach Abtrag dieser<br />
Schutzschicht bzw. Fertigstellung des Aushubs sollte die endgültige<br />
Aushubsohle umgehend durch Aufbringen des Bodenplattenunterbaus<br />
nach Abschnitt 7.4 (Vlies, Filterkies und Sauberkeitsschicht<br />
aus Beton) geschützt werden.<br />
Wir weisen auf die Frostgefährdung der in den Baugruben<br />
anstehenden Böden hin, die bei Bauarbeiten im Winter Schutzmaßnahmen<br />
für die Baugrubensohle und gegebenenfalls für<br />
Böschungen erforderlich machen können.<br />
Nach der bislang vorgesehenen Bautaktfolge ist die Herstellung<br />
des Infrastrukturgebäudes mit eine der ersten Baumaßnahmen<br />
im PFA 1.1, unmittelbar gefolgt von der Verlegung und<br />
Dükerung des Hauptsammlers West. Die Baugrube für die unmittelbar<br />
im Nordosten tangierende Bahnhofshalle wird zu einem
Infrastrukturgebäude Seite 21 Q & P<br />
9762 Stuttgart 21, PFÄ 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07,03<br />
späteren Zeitpunkt errichtet. Im Südosten und Südwesten<br />
grenzt das geplante Gebäude unmittelbar an den Bestand.<br />
Sowohl für die Baugrubenherstellung als auch im Endzustand<br />
sind die Wechselwirkungen im Zusammenhang mit der zeitlichen<br />
Abfolge der Herstellung der angrenzenden Baumaßnahmen von<br />
Bedeutung, wozu weitere Detailuntersuchungen erforderlich<br />
sind (s. Abschnitt 7.6).<br />
Für Verbau- und Sicherungsmaßnahmen sind mit den bodenmechanischen<br />
Rechenwerten aus Abschnitt 6 und dem in Abschnitt 4<br />
beschriebenen und in den Anlagen 3 dargestellten Schichten-<br />
verlauf statische Berechnungen anzustellen.<br />
Nach den derzeitigen uns vorliegenden Plänen sehen wir folgende<br />
typische Sicherungsmaßnahmen, die - mit zunehmender<br />
Steifigkeit und damit zunehmenden Anforderungen an die<br />
Begrenzung von Verformungen - in Betracht kommen:<br />
- Frei geböschte Baugrubenflanken können dort ausgeführt werden,<br />
wo der dafür notwendige Platz zum Zeitpunkt der Baugrubenherstellung<br />
zur Verfügung steht (evtl. im Bereich des<br />
Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes oder entlang der späteren Baugrube<br />
Bahnhofshalle).<br />
Je nach Randbedingungen kann eine Kombination freier<br />
Böschungen mit einem Baugrubenverbau zweckmäßig sein.<br />
Im Bereich der Auffüllungen und bindigen Deckschichten<br />
(Fließerde) können die Böschungen nach DIN 4125 bei Höhen<br />
bis 5 m mit Böschungsneigungen bis 45' hergestellt werden.<br />
Im verwitterten, mindestens steifen bis halbfesten Gipskeuper<br />
kann die Böschungsneigung entsprechend bis 60° hergestellt<br />
werden. Für geböschte Baugruben mit mehr als 5 m<br />
Höhe bzw. für belastete Böschungen sind Standsicherheitsnachweise<br />
nach DIN 4084 zu führen.<br />
Bei einer Böschung muss stets ein lastfreier Streifen von<br />
mindestens 1 m an der Böschungsschulter freigehalten werden.<br />
Weiter ist sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser<br />
über die Randböschungen fließt. Hierzu ist es zweckmä-
Infrastrukturgebäude Seite 22 Q & P<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 %J '<br />
ßig, sofern ein Gefälle zur Baugrube besteht, kleine Erdwälle<br />
auf der Böschungskrone anzulegen und für eine<br />
gezielte Ableitung von oberflächig zufließendem Wasser zu<br />
sorgen.<br />
- Temporäre Baugrubenwände als Bohrträgerverbauten mit Holzoder<br />
Spritzbetonausfachung. Diese Verbauwände können dort<br />
zum Jiinsatz kommen, wo freie Flächen zur Verfügung stehen,<br />
vorhandene Bebauung nicht unmittelbar tangiert wird und<br />
keine besonders hohen Anforderungen an die Begrenzung horizontaler<br />
Verformungen und Oberflächensetzungen in der Nachbarschaft<br />
des Verbaus gestellt werden. Erfahrungsgemäß können<br />
mit einer Spritzbetonausfachung die herstellungsbedingten<br />
Verformungen gegenüber einer Holzausfachung begrenzt<br />
werden.<br />
- Bohrpfahlwände mit Betonausfachung. Nach den bislang vorliegenden<br />
Planunterlagen sehen wir momentan keine Bereiche,<br />
wo im Vergleich zu oben genanntem Trägerverbau erhöhte<br />
Anforderungen zur Begrenzung von Horizontalverformungen<br />
gestellt werden müssen, und was die Anordnung einer Bohrpfahlwand<br />
zur Folge hätte. Dies ist im Zuge der weiteren<br />
Planung zu bestätigen.<br />
- Unterfangung bzw. Unterfangungsverbaumaßnahmen mit Hilfe<br />
von verankerten oder vernagelten Spritzbeton- oder Ortbetonschalen.<br />
Derartige Maßnahmen können erforderlich werden,<br />
wenn die Gründungsebene der bestehenden Bebauung über der<br />
Baugrubensohle für das Infrastrukturgebäude liegt (s. a.<br />
Abschnitt 7.6).<br />
Für die Bemessung der Verbausysteme machen wir folgende Angaben<br />
:<br />
- In Abhängigkeit von der sich aus der angrenzenden Bebauung<br />
und dem Eingriff in die Bauwerksumgebung ergebenden Randbedingungen<br />
kann der Erddruckansatz zwischen aktivem Erddruck<br />
und einem erhöhten aktiven Erddruck variieren.
Infrastrukturgebäude Seite 23 O ft D<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 *•* '<br />
Im Einflussbereich von Bauwerken und setzungsempfindlichen<br />
Leitungen (bei Abständen von weniger als dem l,5fachen der<br />
Baugrubentiefe) empfehlen wir, einen erhöhten aktiven Erd-<br />
druck (Mittelwert aus aktivem Erddruck und Erdruhedruck)<br />
anzusetzen. Mit abnehmendem Einfluss der Baugrube auf Nach-<br />
barbebauung (z.B. bei Abständen von mehr als der l,5fachen<br />
Baugrubentiefe) kann auch ein Erddruckansatz E^ =<br />
Ö, 75 . "gah T^Ö725' Eo "gewählt werden""<br />
Die Erddruckverteilung ist gemäß den Vorgaben der EAB unter<br />
Berücksichtigung der Erddruckumlagerung zwischen den Stütz-<br />
stellen und den Fußauflager zu wählen.<br />
- In Bereichen, wo später angrenzende Baugruben hergestellt<br />
und der Verbau rückgebaut werden muss sowie dort, wo Ver-<br />
formungen unkritisch sind, kann eine Holzausfachung einge-<br />
baut werden. Im Einflussbereich von Bauwerken und verfor-<br />
mungsempfindlichen Leitungen sollte eine Spritzbetonausfa-<br />
chung gewählt werden, da sie mit kleineren Verformungen als<br />
eine Holzausfachung wirksam wird. Auch wenn der Grundwas-<br />
serspiegel während der Bauzeit im Bereich des Bemessungs-<br />
wasserstandes liegen sollte, kann in Verbindung mit der<br />
Bauwasserhaltung und einem dadurch erzielten geringen<br />
Grundwasserandrang eine Holzausfachung eingebaut werden.<br />
Bei Herstellung einer Spritzbetonausfachung müssen unter-<br />
halb des Bemessungswasserspiegels Dränöffnungen in der<br />
Spritzbetonschale vorgesehen werden. Die genaue Anordnung<br />
ist auf der Baustelle den örtlichen Gegebenheiten anzupas-<br />
sen. Zusätzlich sind in den grundwasserführenden Schichten<br />
Dränelemente hinter der Spritzbetonausfachung vorzusehen.<br />
Damit wird ein unmittelbarer Wasserdruck auf den Verbau<br />
bzw. die Spritzbetonschale verhindert und der Verbau auch<br />
für den Endzustand im Hinblick auf eine Bauwerksumläufig-<br />
keit durchlässig gestaltet (s. a. Abschnitt 7.4). Bei den<br />
zugehörigen Standsicherheitsnachweisen ist jedoch der<br />
Effekt des durch die offene Wasserhaltung erzeugten Absenk-<br />
trichters zu berücksichtigen (Auftrieb, Strömungskräfte) .
Infrastrukturgebäude Seite 24 Q O D<br />
9762 Stuttgart 21, PFA 1.1: Talquerung mit Hbf 28.07.03 ^ °* '<br />
Als Wandreibungswinkel kann bei Spritzbeton der Wert 8a =<br />