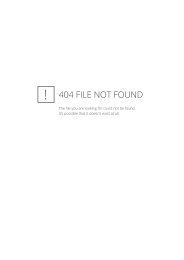Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7<br />
15. 2. 2012<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
S chweizerische <strong>Ärztezeitung</strong><br />
Bollettino dei medici svizzeri<br />
Bulletin des médecins suisses<br />
Spitalmanagement 252<br />
Interdisziplinäre Führungsstrukturen zur Lösung<br />
von Koordinationsproblemen<br />
Horizonte 260<br />
Ethique et morale<br />
Filmkritik 262<br />
Angst und Ansteckung zwischen Epidemien<br />
und Finanzkrise<br />
Buchbesprechung 265<br />
Mit Kindern über Brustkrebs reden<br />
«Zu guter Letzt» von Erhard Taverna 266<br />
Niemandsland<br />
Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch<br />
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch<br />
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
FMH<br />
Editorial<br />
229 Datenschutz und Arztgeheimnis: Der<br />
gesunde Menschenverstand hat gewonnen!<br />
Jacques de Haller<br />
231 Personalien<br />
Organisationen der Ärzteschaft<br />
ASA<br />
233 Ganzheitlich, erfahrungsorientiert<br />
und zunehmend wissenschaftlich fundiert<br />
Joerg Fritschi, Winfried Suske<br />
Im Dezember 2011 wurde zum fünften Mal der Jahreskongress<br />
der «Assoziation Schweizer Ärztegesellschaften<br />
für Akupunktur und Chinesische Medizin» (ASA) abgehalten.<br />
Über 450 ärztliche und nichtärztliche TCMFachleute<br />
waren unter einem Dach vereint.<br />
Weitere Organisationen und Institutionen<br />
SAMW<br />
236 Verzicht auf Marketing<br />
<strong>Schweizerische</strong> Akademie der Medizinischen<br />
Wissenschaften<br />
Briefe / Mitteilungen<br />
237 Briefe an die SÄZ<br />
238 F acharztprüfungen /Mitteilungen<br />
FMH Services<br />
239 Attraktive Personalversicherungen<br />
FMH Insurance Services<br />
241 Stellen und Praxen<br />
Tribüne<br />
INHALT<br />
Management<br />
252 Interdisziplinäre Führungsstrukturen<br />
zur Lösung von Koordinationsproblemen<br />
Germaine Eze, Jürg Leuppi, Claude Rosselet<br />
Das Problem: Ein Rotationsprinzip beim ärztlichen Einsatz<br />
führte bei der Pflege zum Eindruck, die Ärzte kümmerten<br />
sich zu wenig um den reibungslosen Ablauf auf der Station.<br />
Die hier beschriebene Organisationsentwicklung konnte<br />
das Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Funktionsbereichen<br />
und Hierarchieebenen verbessern.<br />
256 Spectrum<br />
Horizonte<br />
Streiflicht<br />
257 «Wir wissen nie, was kommt»<br />
Helga Kessler<br />
Familie Weber hat drei Kinder, zwei von ihnen leiden an<br />
Muskeldystrophie. Eltern wie Kinder leben stets mit der<br />
Angst, dass etwas Unvorhergesehenes passieren könnte.<br />
Ein berührender Bericht aus dem Leben einer Familie, die<br />
sich auf bewundernswerte Weise ihrem Schicksal stellt.<br />
260 Ethique et morale<br />
Françoise Verrey Bass<br />
Eine Fabel: Zwei Federn im Himmel verkörpern die Seelen<br />
zweier Wesen; das eine gestorben, weil es sich wegen e iner<br />
schweren Krankheit selbst das Leben genommen hat, das<br />
andere wurde gar nie geboren.<br />
262 Angst und Ansteckung zwischen<br />
Epidemien und Finanzkrise<br />
Mark Honigsbaum<br />
Einige aktuelle Kinofilme malen HorrorSzenarien an die<br />
(Lein)Wand, ausgelöst durch die ungebremste Verbreitung<br />
gefährlicher Viren. Der Autor zeigt, dass es dabei nicht nur<br />
um Angst vor körperlicher Ansteckung geht, sondern auch<br />
davor, wie sich Panik und Chaos in unserer vernetzten Welt<br />
immer schneller und ungefiltert verbreiten.<br />
Schaffner&Conzelmann, Basel
IMPRESSUM<br />
Horizonte<br />
Redaktion<br />
Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli<br />
(Chefredaktor)<br />
Dr. med. Werner Bauer<br />
Dr. med. Jacques de Haller (FMH)<br />
PD Dr. med. Jean Martin<br />
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA<br />
Prof. Dr. med. Hans Stalder<br />
Dr. med. Erhard Taverna<br />
lic. phil. Jacqueline Wettstein (FMH)<br />
Redaktion Ethik<br />
PD Dr. theol. Christina Aus der Au<br />
Prof. Dr. med. Lazare Benaroyo<br />
Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz<br />
Redaktion Medizingeschichte<br />
PD Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann<br />
PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff<br />
Redaktion Ökonomie<br />
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA<br />
Redaktion Recht<br />
Fürsprecher Hanspeter Kuhn (FMH)<br />
Managing Editor<br />
Annette Eichholtz M.A.<br />
Delegierte der Fachgesellschaften<br />
Allergologie und Immunologie:<br />
Prof. Dr. A. Bircher<br />
Allgemeinmedizin: Dr. B. Kissling<br />
Anästhesiologie und Reanimation:<br />
Prof. P. Ravussin<br />
Angiologie: Prof. B. AmannVesti<br />
Arbeitsmedizin: Dr. C. Pletscher<br />
Chirurgie: Prof. Dr. M. Decurtins<br />
Dermatologie und Venerologie:<br />
PD Dr. S. Lautenschlager<br />
Endokrinologie und Diabetologie:<br />
Prof. Dr. G.A. Spinas<br />
Gastroenterologie: Prof. Dr. W. Inauen<br />
Geriatrie: Dr. M. Conzelmann<br />
Gynäkologie und Geburtshilfe:<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. W. Holzgreve<br />
Buchbesprechung<br />
265 Mit Kindern über Brustkrebs reden<br />
Anna Sax<br />
Was geht in Kindern vor, wenn ihre Eltern schwer erkranken?<br />
Wie soll man ihnen etwa erklären, warum der an<br />
Brustkrebs erkrankten Mutter plötzlich die Kraft fehlt, sich<br />
so wie früher um sie zu kümmern? Das Buch «Manchmal ist<br />
Mama müde» unterstützt Eltern dabei, mit ihren Kindern<br />
über das Unfassbare zu reden.<br />
Redaktionssekretariat<br />
Elisa Jaun<br />
Redaktion und Verlag<br />
EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz<br />
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: redaktion.saez@emh.ch<br />
Internet: www.saez.ch, www.emh.ch<br />
Herausgeber<br />
FMH, Verbindung der Schweizer<br />
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,<br />
Postfach 170, 3000 Bern 15<br />
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12<br />
E-Mail: info@fmh.ch<br />
Internet: www.fmh.ch<br />
Herstellung<br />
Schwabe AG, Muttenz<br />
Marketing EMH<br />
Thomas Gierl M.A.<br />
Leiter Marketing und Kommunikation<br />
Tel. 061 467 85 49, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: tgierl@emh.ch<br />
Hämatologie: Dr. M. Zoppi<br />
Handchirurgie: PD Dr. L. Nagy<br />
Infektologie: Prof. Dr. W. Zimmerli<br />
Innere Medizin: Dr. W. Bauer<br />
Intensivmedizin: Dr. C. Jenni<br />
Kardiologie: Prof. Dr. C. Seiler<br />
Kiefer und Gesichtschirurgie:<br />
Dr. C. Schotland<br />
Kinder und Jugendpsychiatrie: Dr. R. Hotz<br />
Kinderchirurgie: Dr. M. Bittel<br />
Medizinische Genetik: Dr. D. Niedrist<br />
Neonatologie: Prof. Dr. H.U. Bucher<br />
Nephrologie: Prof. Dr. J.P. Guignard<br />
Neurochirurgie: Prof. Dr. H. Landolt<br />
Neurologie: Prof. Dr. H. Mattle<br />
Neuropädiatrie: Prof. Dr. J. Lütschg<br />
Neuroradiologie: Prof. Dr. W. Wichmann<br />
Zu guter Letzt<br />
INHALT<br />
266 Niemandsland<br />
Erhard Taverna<br />
Auf unseren Karten ertragen wir keine weissen Flecken,<br />
u nsere Phantasie füllt sie aus, so wie es schon mittelalterliche<br />
Mönche mit noch unbekannten Weltregionen taten.<br />
Die neuen Niemandsländer liegen eher im Weltraum und<br />
auch – das zeigt dieser Beitrag – in der Medizin.<br />
Anna<br />
Inserate<br />
Werbung<br />
Sabine Landleiter,<br />
Leiterin Anzeigenverkauf<br />
Tel. 061 467 85 05, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: slandleiter@emh.ch<br />
«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»<br />
Matteo Domeniconi, Inserateannahme<br />
Stellenmarkt<br />
Tel. 061 467 86 08, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: stellenmarkt@emh.ch<br />
«Stellenvermittlung»<br />
FMH Consulting Services<br />
Stellenvermittlung<br />
Postfach 246, 6208 Oberkirch<br />
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86<br />
E-Mail: mail@fmhjob.ch<br />
Internet: www.fmhjob.ch<br />
Abonnemente<br />
FMH-Mitglieder<br />
FMH Verbindung der Schweizer<br />
Ärztinnen und Ärzte<br />
Elfenstrasse 18, 3000 Bern 15<br />
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12<br />
Nuklearmedizin: Prof. Dr. J. Müller<br />
Onkologie: Prof. Dr. B. Pestalozzi<br />
Ophthalmologie: Dr. A. Franceschetti<br />
ORL, H<strong>als</strong> und Gesichtschirurgie:<br />
Prof. Dr. J.P. Guyot<br />
Orthopädie: Dr. T. Böni<br />
Pädiatrie: Dr. R. Tabin<br />
Pathologie: Prof. Dr. G. Cathomas<br />
Pharmakologie und Toxikologie:<br />
Dr. M. KondoOestreicher<br />
Pharmazeutische Medizin: Dr. P. Kleist<br />
Physikalische Medizin und Rehabilitation:<br />
Dr. M. Weber<br />
Plast.Rekonstrukt. u. Ästhetische Chirurgie:<br />
Prof. Dr. P. Giovanoli<br />
Pneumologie: Prof. Dr. T. Geiser<br />
EMH Abonnemente<br />
EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
Abonnemente, Postfach, 4010 Basel<br />
Tel. 061 467 85 75, Fax 061 467 85 76<br />
E-Mail: abo@emh.ch<br />
Jahresabonnement: CHF 320.–,<br />
zuzüglich Porto<br />
© 2012 by EMH <strong>Schweizerische</strong>r<br />
Ärzteverlag AG, Basel. Alle Rechte vorbehalten.<br />
Nachdruck, elektronische<br />
Wiedergabe und Übersetzung, auch<br />
auszugsweise, nur mit schriftlicher<br />
Genehmigung des Verlages gestattet.<br />
Erscheint jeden Mittwoch<br />
ISSN 0036-7486<br />
ISSN 1424-4004 (Elektronische Ausg.)<br />
Prävention und Gesundheitswesen:<br />
Dr. C. Junker<br />
Psychiatrie und Psychotherapie:<br />
Dr. G. Ebner<br />
Radiologie: Prof. Dr. B. Marincek<br />
Radioonkologie: Prof. Dr. D. M. Aebersold<br />
Rechtsmedizin: Prof. T. Krompecher<br />
Rheumatologie: Prof. Dr. M. Seitz<br />
Thorax, Herz und Gefässchirurgie:<br />
Prof. Dr. T. Carrel<br />
Tropen und Reisemedizin: PD Dr. C. Hatz<br />
Urologie: PD Dr. T. Zellweger
Editorial FMH<br />
Datenschutz und Arztgeheimnis:<br />
Der gesunde Menschenverstand hat gewonnen!<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Der Datenschutz und die<br />
Wahrung des Patientengeheimnisses<br />
sind zunehmend<br />
ein besonders brisantes<br />
Thema. Dies hängt zweifellos<br />
mit den Möglichkeiten der<br />
elektronischen Verarbeitung<br />
und Speicherung von Daten<br />
zusammen, die bei vielen<br />
Verwaltungen, welche von<br />
einer schönen neuen Welt<br />
à la Huxley träumen, Begehrlichkeiten<br />
und Fantastereien wecken.<br />
Ein gutes Beispiel für solche möglichen Auswüchse ist<br />
der neue Artikel 42 Absatz 3bis KVG [1], der vom Parlament<br />
im vergangenen Dezember verabschiedet wurde. Dieser<br />
Artikel sieht die Verpflichtung der Leistungserbringer vor,<br />
auf der Rechnung die Diagnosen und Prozeduren aller<br />
Patientinnen und Patienten aufzuführen.<br />
Es wurde ein Konsens gefunden, was<br />
uns sehr freut.<br />
Wir hatten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier<br />
in den letzten Monaten wiederholt brieflich und persönlich<br />
kontaktiert, um sie auf die erheblichen Probleme im<br />
Zusammenhang mit diesem untragbaren Gesetzesartikel<br />
aufmerksam zu machen – leider wurden unsere Einwände<br />
nicht ausreichend berücksichtigt.<br />
Bundesrat Didier Burkhalter hatte zwar im Ständerat<br />
erklärt, dieser Artikel betreffe die ambulante Medizin nicht,<br />
doch unverständlicherweise hat er dies im Gesetzestext<br />
nicht festgehalten. Damit lässt der verabschiedete Artikel<br />
alle Optionen offen und somit auch die schlimmsten.<br />
Diese Situation konnte nicht akzeptiert werden, so dass<br />
die Delegiertenversammlung der FMH am 2. Februar<br />
empfohlen hat, das Referendum gegen diese neue<br />
Bestimmung zu ergreifen.<br />
In der Folge kam es zu einem typisch schweizerischen<br />
politischen Spiel: Es wurde eine Lösung gesucht, mit der<br />
sowohl den Anliegen der Ärzteschaft <strong>als</strong> auch den Interessen<br />
des Eidgenössischen Departements des Innern Rechnung<br />
getragen würde. Schliesslich fand man einen Konsens, was<br />
uns sehr freut.<br />
Diesbezüglich ist die Arbeit der Konferenz der kantonalen<br />
Ärztegesellschaften (KKA), insbesondere ihres neuen Co-<br />
Präsidenten Peter Wiedersheim und des Past-Präsidenten<br />
Urs Stoffel zu würdigen, welche entscheidend zu einer<br />
Lösungsfindung beigetragen haben. Ein Lob geht auch an<br />
den neuen Gesundheitsminister Alain Berset, dessen<br />
Offenheit und Reaktionsfähigkeit viel Gutes für die Zukunft<br />
versprechen.<br />
Hinsichtlich der gängigen Praxis<br />
im ambulanten Bereich wird es keine<br />
Änderung geben.<br />
Die Lösung besteht in einem Schreiben des Bundesrats,<br />
in dem seine Absichten überzeugend dargelegt sind und<br />
dank dem vertrauensvoll die Vollzugsverordnung zu diesem<br />
Gesetzesartikel abgewartet werden kann: Wie der Bundesrat<br />
festhält, wird es in Bezug auf die gängige Praxis im<br />
ambulanten Bereich keine Änderung, keine neue<br />
Verpflichtung und keinen detaillierteren Code <strong>als</strong> den<br />
derzeit verwendeten Tessiner Code geben.<br />
Was die stationäre Medizin anbelangt, hat sich Bundesrat<br />
Berset vor der Gesundheitskommission des Nationalrats<br />
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Diagnosen nicht an<br />
die Verwaltung der Krankenkassen, sondern an die<br />
Vertrauensärzte der Versicherer gehen.<br />
Die Ärzteschaft wird respektiert und<br />
kann sich Gehör verschaffen.<br />
Diese Episode der Gesundheitspolitik auf Bundesebene<br />
zeigt, dass mit den aktuell amtierenden Verantwortlichen<br />
der Bundesbehörden ein Dialog geführt werden kann; sie<br />
zeigt auch, dass die Ärzteschaft respektiert wird und sich<br />
Gehör verschaffen kann, was uns natürlich freut.<br />
Mit anderen Worten war die Ankündigung eines<br />
Referendums zwar notwendig, um die Sache ins Rollen zu<br />
bringen. Schliesslich hat sich etwas getan, was ja der<br />
entscheidende Punkt ist: Die Ärzteschaft ist eine glaubwürdige,<br />
konstruktive politische Kraft. Wir werden uns zugunsten<br />
unserer Patientinnen und Patienten weiterhin für die<br />
bestmögliche Medizin einsetzen!<br />
Dr. med. Jacques de Haller, Präsident der FMH<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
229
Personalien<br />
Todesfälle / Décès / Decessi<br />
Reto à Porta (1941), † 30.1.2012,<br />
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,<br />
7250 Klosters<br />
Trajan Hancou (1942), † 31.1.2012,<br />
1209 Genève<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Praxiseröffnung /<br />
Nouveaux cabinets médicaux /<br />
Nuovi studi medici<br />
AG<br />
Valerio Gozzoli, Facharzt für Allgemeine<br />
Innere Medizin,<br />
Bahnhofstrasse 76, 4313 Möhlin<br />
BE<br />
Vreni Kaufmann-Walther, Fachärztin für<br />
Allgemeine Innere Medizin,<br />
Hessstrasse 47, 3097 Liebefeld<br />
Chantal Ruffieux, Fachärztin für Kinder- und<br />
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,<br />
Kramgasse 17, 3011 Bern<br />
Patricia Hirt Minkowski, Fachärztin für<br />
Nephrologie und Fachärztin für Allgemeine<br />
Innere Medizin,<br />
Bubenbergplatz 5, 3011 Bern<br />
Reto Stüdeli, Facharzt für Allgemeine<br />
Innere Medizin,<br />
Harzer 36, 3436 Zollbrück<br />
Annabarbara Pirker, Fachärztin für<br />
Kinder- und Jugendmedizin,<br />
Aarmühlestrasse 4, 3800 Interlaken<br />
Matthias Pirker, Facharzt für Kinder- und<br />
Jugendmedizin,<br />
Aarmühlestrasse 4, 3800 Interlaken<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
BS<br />
Lyudmyla Meteleshko, Fachärztin für<br />
Psychiatrie und Psychotherapie,<br />
Praxis am Claraplatz,<br />
Claragraben 78, 4058 Basel<br />
GE<br />
FMH<br />
Nouchine Kramer, Spécialiste en gynécologie<br />
et obstétrique,<br />
39, avenue de Miremont, 1206 Genève<br />
TG<br />
Günter Lohrke, Praktischer Arzt,<br />
Wilerstrasse 17, 8370 Sirnach<br />
TI<br />
Fiorenzo Acquati, Spécialiste en cardiologie,<br />
Via Giuseppe Motta 35, 6850 Mendrisio<br />
VD<br />
Jean-Marc Vuissoz, Spécialiste en pédiatrie,<br />
34, rue du Midi, 1800 Vevey<br />
Leïla Sekkat, Spécialiste en ophtalmologie,<br />
16, pl. de la Gare, 1020 Renens<br />
ZH<br />
Christina Weber-Chrysochoou, Fachärztin für<br />
Kinder- und Jugendmedizin und Fachärztin<br />
für Allergologie und klinische Immunologie,<br />
Seefeldstrasse 225, 8008 Zürich<br />
231
Personalien FMH<br />
Aargauischer Ärzteverband<br />
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband<br />
<strong>als</strong> ordentlich praktizierendes Mitglied<br />
hat sich angemeldet:<br />
Karin Wiedmer Lupfig, Fachärztin für Kinder-<br />
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie<br />
FMH, Praxis in Wohlen per 1. Mai 2012<br />
Diese Kandidatur wird in Anwendung von<br />
Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes<br />
veröffentlicht. Einsprachen müssen<br />
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung<br />
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung<br />
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht<br />
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist<br />
entscheidet die Geschäftsleitung über<br />
Gesuch und allfällige Einsprachen.<br />
Ärztegesellschaft<br />
des Kantons Luzern<br />
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion<br />
Entlebuch hat sich gemeldet:<br />
Adam Krol, Praktischer Arzt, Praxis ab<br />
1.2.2012: Schmittenrain 1, 6162 Entlebuch<br />
Einsprachen sind innert 20 Tagen zu richten<br />
an das Sekretariat, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern<br />
(Fax 041 410 80 60).<br />
Ärztegesellschaft<br />
des Kantons Schwyz<br />
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des<br />
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:<br />
Stephan Himmelberger, Facharzt für Allgemeine<br />
Innere Medizin FMH, Meierhofstrasse 24,<br />
8820 Wädenswil. Übernahme der Praxis von<br />
Dr. med. Donat Blum in 8834 Schindellegi<br />
per Mai 2012<br />
Christoph Sternberg, Facharzt für Orthopädie<br />
und Unfallchirurgie, Etzelclinic AG, 8808 Pfäffikon,<br />
Belegarzt Spital Lachen.<br />
Einsprache gegen diese Aufnahmen richten<br />
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.<br />
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Ärztegesellschaft Thurgau<br />
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau<br />
haben sich gemeldet:<br />
Gudrun Missler, Fachärztin für Psychiatrie und<br />
Psychotherapie, Salenstein<br />
Daryoush Piltan, Facharzt für Psychiatrie und<br />
Psychotherapie FMH, Kreuzlingen<br />
Einsprachen gegen die Aufnahmen sind innerhalb<br />
von 10 Tagen seit der Publikation beim<br />
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.<br />
Ernennungen / Nominations<br />
Universität Basel<br />
Prof. Viola Heinzelmann ist zur neuen Professorin<br />
für Gynäkologie an der Universität Basel<br />
und zudem zur Leitenden Ärztin an der<br />
Frauenklinik am Universitätsspital Basel ernannt<br />
worden. Sie wird damit zur Assistenzprofessorin<br />
für Gynäkologie (mit Tenure<br />
Track) an der Medizinischen Fakultät gewählt;<br />
sie wird ihre neue Tätigkeit auf den<br />
1. Juli 2012 antreten.<br />
Preise / Prix<br />
Groupe de travail «Cardiologie interventionnelle<br />
et syndrome coronarien aigu»<br />
Dans le cadre de la réunion d’hiver (Wintermeeting)<br />
du groupe de travail «Cardiologie<br />
interventionnelle et syndrome coronarien<br />
aigu» à Montreux, les orateurs suivants ont<br />
été primés pour leur présentation et résolution<br />
de complications lors d’interventions<br />
cardiaques: le Dr Olivier Müller du CHUV<br />
(Lausanne), p.-d., et le Dr Lukas Altwegg, p.-d.,<br />
de l’Hôpital universitaire de Zurich reçoivent<br />
le «StarWars Award»; le Dr Daniel S ürder du<br />
CardioCentro (Lugano) reçoit le «From Stars<br />
to Dust Award»; le Dr Raban Jeger, p.-d., de<br />
l’Hôpital universitaire de Bâle, le «From Dust<br />
to Hell Award» et le Prof. Marco Roffi des HUG<br />
(Genève), le «Fire From Hell Award». Ces prix<br />
exceptionnels décernés lors du 20 e anniversaire<br />
de ce congrès sont assortis d’un cadeau<br />
symbolique.<br />
<strong>Schweizerische</strong> Gesellschaft<br />
für Thoraxchirurgie<br />
Preis der SGT 2011 für die beste publizierte<br />
Arbeit:<br />
Der Preis der <strong>Schweizerische</strong>n Gesellschaft für<br />
Thoraxchirurgie 2011 wurde aufgeteilt an<br />
2 Gewinner. Wir gratulieren folgenden Gewinnern:<br />
Cai Cheng et al. (CHUV Lausanne). Photodynamic<br />
therapy selectively enhances liposomal<br />
doxorubicin uptake in sarcoma tumors<br />
to rodent lungs. Lasers Surg Med. 2010.<br />
(2500 CHF)<br />
Wolfgang Jungraithmayr et al. (USZ Zürich).<br />
A model of chronic lung allograft rejection in<br />
the rat. Eur Resp J. 2010.<br />
(2500 CHF)<br />
Die SGT dankt der Firma Johnson & Johnson<br />
für die Stiftung des Preisgeldes.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 232
ASA ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAFT<br />
ASA TCM-Kongress 2011 zur Traditionellen Chinesischen Medizin in der Schweiz<br />
Ganzheitlich, erfahrungsorientiert<br />
und zunehmend wissenschaftlich fundiert<br />
Joerg Fritschi, Winfried Suske<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Am 1. und 2. Dezember 2011 wurde im Congress Center Basel zum fünften Mal der<br />
Jahreskongress der «Assoziation Schweizer Ärztegesellschaften für Akupunktur und<br />
Chinesische Medizin» (ASA) abgehalten. An der Tagung bildeten sich über 450 Ärztinnen<br />
und Ärzte sowie TCM-Therapeutinnen und -Therapeuten fort.<br />
Die Traditionelle Chinesische Medizin in der Schweiz<br />
«boomt». Immer mehr Patienten verlangen nach<br />
fernöstlichen Heilmethoden wie Akupunktur, Moxibustion<br />
und Heilmitteln, um auf komplementärem<br />
Weg Linderung bei Schmerzen, Allergien, Asthma<br />
und anderen (chronischen) oder zunehmend auch<br />
akuten Krankheiten zu finden. Seit dem 1. Januar<br />
2012 werden ärztliche Leistungen auf dem Gebiet der<br />
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und vier<br />
weiteren komplementärmedizinischen Methoden<br />
wieder von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung<br />
übernommen; unter bestimmten Voraussetzungen<br />
und vorläufig bis 2017. Bis dahin sollen Wirk-<br />
Dem Kongress ist es gelungen, ärztliche<br />
und nicht-ärztliche TCM-Fachleute unter einem Dach<br />
zu vereinen.<br />
Korrespondenz:<br />
Dr. med. Joerg Fritschi<br />
Im Noll 38<br />
CH-4148 Pfeffingen<br />
Tel. 061 756 98 88<br />
dr.fritschi[at]hin.ch<br />
samkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der<br />
komplementären Verfahren evaluiert werden.<br />
Zur Erinnerung: Seit 2006 wurde von den ärztlichen<br />
Behandlungsmethoden der TCM nur noch die<br />
Akupunktur über die Grundversicherung durch die<br />
Krankenkassen übernommen. Andere ärztliche TCM-<br />
Verfahren bzw. die Behandlungskosten von nichtärztlichen<br />
TCM-Therapeuten mit EMR-Anerkennung<br />
(Erfahrungsmedizinisches Register, EMR) wurden und<br />
werden auch künftig grösstenteils durch Zusatzversicherungen<br />
getragen.<br />
Reichhaltiges Angebot an Behandlungs- und<br />
Ausbildungsstätten<br />
Mit der Nachfrage an Traditioneller Chinesischer<br />
M edizin in der Bevölkerung steigt auch das Angebot<br />
auf der medizinisch-therapeutischen Seite: In der<br />
Schweiz gibt es mehrere Dutzend Behandlungszentren<br />
und Ausbildungsstätten bzw. Schulen für Chine-<br />
sische Medizin. Diese bieten sowohl mehrjährige<br />
Vollzeit- <strong>als</strong> auch Teilzeitausbildungen an. Die Assoziation<br />
Schweizer Ärztegesellschaften für Akupunktur<br />
und Chinesische Medizin (ASA) ist die Dachorganisation<br />
der in der TCM tätigen Ärztinnen und Ärzte in<br />
der Schweiz. Sie führt den ASA TCM-Kongress in<br />
e igener Regie durch und ist mit ihren Mitgliedsorganisationen<br />
die grösste Anbieterin von Ausbildungs-<br />
und Weiterbildungskursen in der Chinesischen Medizin<br />
in der Schweiz. Die ASA gibt auch die Standards<br />
für ärztliche Fähigkeitsausweise für TCM heraus. Präsidiert<br />
wird die ASA durch Albert Naterop-Perroud,<br />
Zürich.<br />
Bei der Zulassung für TCM-Therapeuten gelten<br />
die Anforderungen der <strong>Schweizerische</strong>n Berufsorganisation<br />
für TCM, der SBO-TCM. Die SBO-TCM ist <strong>als</strong><br />
ständige Gastgesellschaft jedes Jahr am ASA TCM-<br />
Kongress vertreten und stellt jeweils ein Viertel der<br />
Teilnehmer. Sowohl Hauptredner <strong>als</strong> auch Leiter von<br />
Seminaren und Workshops stammen zum Teil aus ihren<br />
Reihen. Somit ist es dem ASA TCM-Kongress beispielhaft<br />
gelungen, ärztliche und nicht-ärztliche<br />
«TCM-Profession<strong>als</strong>» unter einem Dach zu vereinen.<br />
Leiter des wissenschaftlichen Komitees des seit 2007<br />
bestehenden und von der Healthworld (Schweiz) AG<br />
organisierten ASA TCM-Kongresses ist Joerg Fritschi<br />
(Pfeffingen). Das Leitmotiv lautete in diesem Jahr<br />
«Lunge – Wandlungsphase Metall». Als Gastgesellschaft<br />
des 5. ASA TCM-Kongresses war in Basel die<br />
Österreichische Gesellschaft für Kontrollierte Akupunktur<br />
und TCM dabei, die mit verschiedenen Vorträgen<br />
und Seminaren zum wissenschaftlichen Programm<br />
beitrug.<br />
Traditionelle Chinesische Medizin:<br />
eine Ultrakurzfassung<br />
Im Vergleich zur naturwissenschaftlich orientierten<br />
westlichen Schulmedizin geht die Traditionelle<br />
Chine sische Medizin von anderen Voraussetzungen<br />
aus. Von zentraler Bedeutung ist neben der Theorie<br />
des relativen Gleichgewichts (Yin und Yang) das Qi,<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
233
ASA ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAFT<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Brigitte Ausfeld-Hafter (Kollegiale Instanz für Komplemen<br />
tär medizin – KIKOM) mit Klaus von Ammon, dem<br />
Gewinner des 1. Preises des Förderpreises [foif] × [eis].<br />
Das Thema seiner Arbeit: «Bildgebung bei Kindern mit<br />
ADS und ADHS. Studienprotokoll einer Fall-Kontroll- und<br />
Kohortenstudie 2012−2015.»<br />
die Wurzel aller Energie des menschlichen Körpers.<br />
Harmonie und Gleichgewicht, sprich die körperliche<br />
und geistige Gesundheit, hängen vom ununterbrochenen<br />
und gleichmässigen Fluss des Qi ab. Störungen<br />
können zum Beispiel mit einer Qi-Schwäche oder<br />
einem starken aufsteigenden Qi, einem beeinträchtigten<br />
Leber- oder Herz-Qi, zusammenhängen. Die TCM<br />
will nicht nur Krankheiten heilen, sondern legt grosses<br />
Gewicht auf die geistige Regeneration und die Pflege<br />
der Gesundheit. Dabei kommen seit Jahrhunderten<br />
überlieferte Verfahren der Differentialdiagnose und<br />
Therapieprinzipien zum Einsatz, welche die Anamnese,<br />
Inspektion (u. a. durch Zungendiagnostik),<br />
Palpation sowie fünf verschiedene Therapiemodalitäten<br />
(Arzneimittel, Akupunktur, medizinisches Qi<br />
Gong, Tuina und Diätetik) umfassen.<br />
Schwerpunkt Aurikulomedizin<br />
Der ASA TCM-Kongress 2011 präsentierte sich erneut<br />
mit einem attraktiven und vielseitigen wissenschaftlichen<br />
Programm, bestehend aus Hauptreferaten,<br />
Seminaren, Kursen und weiteren Lernformaten<br />
wie Journal Review und dem Preisträger-Seminar<br />
zum Forschungspreis [foif] x [eis]. Die Veranstaltungen<br />
umfassten sowohl anwenderorientierte<br />
Themen <strong>als</strong> auch wissenschaftliche Ergebnisse der<br />
zunehmend breiter abgestützten Forschung, in der<br />
Akupunktur wie in der Arzneimitteltherapie. Referenten,<br />
Kursleiter und/oder Chairmen stammten<br />
aus der Schweiz (18 Personen), Österreich (5), Frankreich<br />
(3), USA (2), Deutschland (1) und Grossbritannien<br />
(1). Auch zahlreiche Kongressteilnehmer<br />
waren aus dem nahen Ausland angereist.<br />
Einen besonderen Schwerpunkt bildete der Bereich<br />
Aurikulomedizin (Ohrakupunktur). Präsentiert und<br />
diskutiert wurde der Einsatz der von Dr. med. Paul<br />
Nogier aus Nyon und Dr. med. Frank Bahr aus München<br />
entwickelten Aurikulomedizin bei der Behand-<br />
lung des Immunsystems bei viraler Belastung, bei<br />
Lungenerkrankungen oder bei Hauterkrankungen<br />
wie Neurodermitis. Ausserdem erfuhren die Teilnehmer,<br />
wie sich mit Hilfe der aurikulomedizinischen<br />
RAC-Diagnostik (RAC für Reflex auriculo-cardiale<br />
bzw. Nogier-Reflex) chronische Infekte wie eine therapieresistente<br />
Borreliose diagnostizieren lassen, um<br />
sie anschliessend mit Dauerstimulation der aktiven<br />
Punkte, mittels repetitiver ASP-Nadel-Applikation<br />
oder einmalig mittels resorbierbarer Templax-Implantate<br />
schnell und nachhaltig ausheilen zu lassen.<br />
Stark frequentierte Hauptreferate und Kurse<br />
Die Mehrheit der sechs Hauptreferate befasste sich<br />
mit dem Funktionskreis Lunge, dem Leitmotiv des<br />
Kongresses; so zum Beispiel mit der Rolle der Wandlungsphase<br />
Metall in der Psychosomatik, den Metallorganen<br />
Dickdarm und Lunge und den kosmologischen<br />
und energetischen Aspekten der Wandlungsphase<br />
Metall in der chinesischen Physiologie. In<br />
ihrem Hauptreferat «Tempora mutantur» gab Dr.<br />
med. Brigitte Ausfeld-Hafter, Dozentin für TCM/Akupunktur<br />
an der Kollegialen Instanz für Komplementärmedizin<br />
(KIKOM) der Universität Bern einen Überblick<br />
über die Entstehungsgeschichte und wichtigsten<br />
Forschungsprojekte des 1995 ins Leben gerufenen<br />
und schweizweit bislang einzigartigen universitären<br />
TCM-Instituts. Brigitte Ausfeld-Hafter ist eine von<br />
4 Dozentinnen und Dozenten an der KIKOM und<br />
wird am 31. Juli 2012 emeritiert. Dem wissenschaftli-<br />
Das wissenschaftliche Komitee des<br />
ASA TCM-Kongresses 2011<br />
Dr. Joerg Fritschi, FMH Innere Medizin, FACP (Leitung), FA<br />
Akupunktur TCM ASA, MAS Psychotraumatology<br />
Dr. Brigitte Ausfeld-Hafter, Dozentin für TCM/Akupunktur,<br />
KIKOM, Inselspital, Universität Bern, FA Akupunktur TCM<br />
ASA<br />
Simon Becker, Dipl. Akupunkteur und Herbalist SBO-TCM,<br />
Delegierter SBO-TCM, Past-Präsident SBO-TCM<br />
Dr. Dai Nam Dietliker, Fachärztin Allgemeinmedizin, FA<br />
Akupunktur TCM ASA<br />
Dr. Albert Egg, Naturwissenschaftler, FA Akupunktur TCM<br />
ASA, Vorstand ATMA<br />
Dr. Cordula Gubler, FMH Innere Medizin, FA Akupunktur<br />
TCM ASA, Vorstand SACAM<br />
Dr Maxime Mancini, FMH en médecine générale, AFC en<br />
acupuncture-MTC (ASA)<br />
Dr. Anita Meyer, FMH Innere Medizin, FA Akupunktur TCM<br />
ASA, Vorstand SACAM<br />
Dr. Adrian Renfer, FMH Allgemeinmedizin, FA Akupunktur<br />
TCM ASA, Delegierter der SACAM<br />
Dr. Lothar U. Roth, FMH Allgemeinmedizin, Leiter TCM-<br />
Abteilung Privatklinik Reichenbach (Burnout) und Spital<br />
Belp, FA Akupunktur TCM ASA, Co-Präsident SACAM,<br />
ASA-Vorstand<br />
Dr. Sandi Suwanda, FMH Gynäkologie und Geburtshilfe,<br />
Chefarzt TCM Spital Zollikerberg, Past-Präsident ASA<br />
Dr Michel Vouilloz, FMH en médecine interne, FMH en médecine<br />
préventive et santé publique, AFC en acupuncture<br />
MTC (ASA)<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 234
ASA ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAFT<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
chen Komitee des ASA TCM-Kongresses bleibt die in<br />
verschiedenen BAG-Kommissionen tätige und international<br />
geschätzte Gutachterin jedoch bis auf weiteres<br />
erhalten.<br />
Ebenfalls gut besucht waren auch die sechs je<br />
über zwei Stunden dauernden Spezialkurse, bei denen<br />
Methoden erlernt bzw. erfahren werden konnten.<br />
Diese befassten sich mit den sechs Temperamenten<br />
der Chinesischen Psychologie, mit kälte- (Shang han)<br />
bzw. wärmebedingten Erkrankungen (Wen bing), mit<br />
Zungendiagnostik, «Flying Needle»-Akupunkturtechnik,<br />
Phytotherapie bei chronischen und resistenten<br />
Krankheiten sowie klassischen chinesischen Rezepturen<br />
zur Behandlung von hartnäckigem Husten.<br />
Forschungspreis <strong>als</strong> Anreiz<br />
für evidenzbasierte Projekte<br />
Zum vierten Mal nach 2008 wurde am ASA TCM-<br />
Kongress 2011 der <strong>Schweizerische</strong> Förderpreis für<br />
Komplementärmedizin, [foif] × [eis], verliehen. Mit<br />
der Preissumme von insgesamt 11 111 Franken zeichnete<br />
die Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin<br />
(KIKOM) in diesem Jahr drei herausragende Arbeiten<br />
aus den Bereichen der Traditionellen Chinesischen<br />
Medizin, Aurikulomedizin und Klassischen Homöopathie<br />
aus. Den dritten Preis (555 Franken) erhielt in<br />
diesem Jahr Dr. med. Fritz Bieri für eine Arbeit zur Anwendung<br />
der Ohrakupunktur in der Augenheilkunde.<br />
Der zweite Preis (2222 Franken) ging an Dr. med. Barbara<br />
Marschollek und ihre Mitautoren für eine Forschungsarbeit,<br />
die sich der spektroskopischen Analyse<br />
homöopathischer Präparationen widmet.<br />
Mit dem Hauptpreis von 8333 Franken wurden<br />
2011 Dr. med. Klaus von Ammon, Oberarzt für Homöopathie<br />
am Inselspital Bern, für die Arbeit «Bildgebung<br />
bei Kindern mit ADS und ADHS. Studienprotokoll<br />
einer Fall-Kontroll- und Kohortenstudie<br />
2012−2015» ausgezeichnet. Die Studie zielt auf die<br />
funktionelle Darstellung der Wirkung homöopathischer<br />
Arzneimittel bei hyper- und hypoaktiven Kindern<br />
mittels Magnetresonanz ab. Dem interdisziplinären<br />
Team gehören Mitglieder der <strong>Schweizerische</strong>n<br />
Ärztegesellschaft für Homöopathie (SAHP), der Abteilung<br />
für Neurologie und Neuropsychologie der Medizinischen<br />
Universitäts-Kinderklinik Bern, der Neuroradiologie<br />
des Inselspit<strong>als</strong> und des Instituts für Mathematische<br />
Statistik und Versicherungslehre (IMSV)<br />
der Universität Bern an.<br />
Journal Review: Handlungsbedarf<br />
bei randomisierten klinischen Studien<br />
Gemäss lic. phil. Marko Nedeljkovic, wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter an der KIKOM, ist die Zahl der in der<br />
Pubmed-Datenbank registrierten TCM-Forschungsarbeiten<br />
in letzter Zeit stark gestiegen. Was randomisierte<br />
klinische Studien (RCT) auf dem Gebiet der<br />
TCM betrifft, wurden im Jahr 2011 zum Thema Akupunktur<br />
bis Ende November 148 Artikel in Pubmedgelisteten<br />
Zeitschriften veröffentlicht, zehn zur chinesischen<br />
Arzneitherapie. Marko Nedeljkovic präsentierte<br />
in der Journal Review-Session am Kongress<br />
unter anderem eine Übersichtsarbeit der Sichuan<br />
University in Chengdu, welche 3159 RCT kritisch<br />
u nter die Lupe nahm [1]. Die zu 82 % in chinesischer<br />
Sprache verfassten Arbeiten wurden in 260 systematischen<br />
Reviews zitiert, die aus der Chinese Biomedical<br />
Database (CBM, 1978–2009) und der Cochrane<br />
Library (bis 2009) extrahiert wurden.<br />
Die Autoren kommen zum Schluss, dass vor allem<br />
in China durchgeführte Studien häufig gravierende<br />
methodische Fehler aufwiesen und sich nicht an<br />
den internationalen Standards für RCT, den CON-<br />
SORT-Richtlinien (Consolidated Standards of Reporting<br />
Tri<strong>als</strong>), orientieren würden. Um die Qualität<br />
von A kupunkturstudien zu erhöhen, wurden die<br />
CONSORT-Richtlinien vor kurzem um die sogenannten<br />
STRICTA-Standards (Standards for Reporting<br />
I nterventions in Clinical Tri<strong>als</strong> of Acupuncture) erweitert.<br />
Begeisterung und Staunen<br />
für «Flinke Hand Südchinas»<br />
Für authentisches fernöstliches Flair sorgte die Tai-<br />
Chi-Vorführung im ursprünglichen Chen-Stil<br />
durch eine Koryphäe auf dem Gebiet des chinesischen<br />
Tai-Chi. Fu Nenbin ist Instruktor und Beirat<br />
des Chenjiagou Tai Ji Training Centers in der Provinz<br />
Henan. Er gilt <strong>als</strong> Überlieferer des Chen-Stils<br />
und trägt unter anderem den Ehrentitel «Flinke<br />
Hand Südchinas».<br />
ASA TCM-Kongress 2012<br />
Am 6. und 7. Dezember 2012 findet in Solothurn<br />
unter dem Motto «Die Lebensphasen: Die ersten<br />
40 Jahre» der 6. ASA TCM-Kongress statt. Die Tagung<br />
ist allen Freunden der chinesischen Medizin<br />
und solchen, die es werden wollen, wärmstens zu<br />
empfehlen.<br />
Literatur<br />
1 He J, Du L, Liu G, Fu J, He X, Yu J, Shang L.<br />
Quality assessment of reporting of randomization,<br />
allocation concealment, and blinding in traditional<br />
Chinese medicine RCTs: a review of 3159 RCTs<br />
identified from 260 systematic reviews. Tri<strong>als</strong>.<br />
2011;13(12):122.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 235
SAMW WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN<br />
Ich verzichte auf das Marketing<br />
von Produkten – erst recht, wenn<br />
ich an deren klinischer Prüfung<br />
beteiligt war.<br />
Korrespondenz:<br />
Beratende<br />
Kommission<br />
c/o SAMW<br />
Petersplatz 13<br />
4051 Basel<br />
mail@samw.ch<br />
Zusammenarbeit<br />
Ärzteschaft – Industrie<br />
Richtlinien der <strong>Schweizerische</strong>n Akademie<br />
der Medizinischen Wissenschaften<br />
Neufassung ’06<br />
SAMW<br />
<strong>Schweizerische</strong> Akademie<br />
der Medizinischen<br />
Wissenschaften<br />
ASSM<br />
Académie Suisse<br />
des Sciences Médicales<br />
ASSM<br />
Accademia Svizzera delle<br />
Scienze Mediche<br />
SAMS<br />
Swiss Academy<br />
of Medical Sciences<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten mit<br />
der Industrie ist seit langem etabliert, liegt grundsätzlich<br />
im Interesse einer guten Gesundheitsversorgung und<br />
trägt vielfach zu einer Mehrung des Wissens bei. Diese<br />
Zusammenarbeit kann jedoch Interessenkonfl ikte<br />
und Abhängigkeiten mit sich bringen oder in Ausnahmefällen<br />
sogar zu Konfl ikten mit dem Gesetz führen.<br />
Für die Ärzte in Forschung, Klinik und Praxis geht es<br />
bei der Zusammenarbeit mit der Industrie nicht nur um<br />
eine Frage des Rechts, sondern auch um eine zentrale<br />
Frage der Berufsethik.<br />
Indem die Ärzteschaft für sich selber Leitplanken formuliert,<br />
welche die bestehenden Vorschriften präzisieren<br />
und ergänzen, unterstreicht sie ihren Willen zur Unabhängigkeit<br />
und Glaubwürdigkeit.<br />
Die Richtlinien sind abrufbar unter www.samw.ch/Ethik.<br />
Ein Folienset mit einem Musterreferat sowie weitere Unterlagen<br />
sind dort ebenfalls erhältlich. Bei Fragen oder Unklarheiten kann<br />
man sich gerne an die Beratende Kommission zur Umsetzung<br />
der Richtlinien «Zusammenarbeit Ärzteschaft-Industrie» wenden.<br />
Wie sehen Sie das?<br />
Die <strong>Schweizerische</strong> Akademie der Medizinischen<br />
Wissenschaften (SAMW) hat 2006 die Richtlinien<br />
«Zu sam menarbeit Ärzteschaft-Industrie» veröffentlicht.<br />
Diese halten unter anderem fest:<br />
I. 10.<br />
Forscher wirken nicht mit beim Marketing von<br />
Produkten, an deren Prüfung sie beteiligt waren.<br />
Für einen Versuch verantwortliche oder daran beteiligte<br />
Prüfer dürfen ihre Glaubwürdigkeit nicht in<br />
Frage stellen, indem sie sich an Marketingaktionen<br />
für das geprüfte Produkt oder Verfahren beteiligen.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 236
edaktion.saez@emh.ch BRIEFE<br />
Briefe an die SÄZ<br />
eHealth – ein Gadget für Technokraten?<br />
Der Artikel unseres Kollegen Bhend [1] hinterlässt<br />
einen zwiespältigen Eindruck über<br />
das elektronische Patientendossier und den<br />
entsprechenden Gesetzesentwurf [2]. Der Beitrag<br />
zeigt aber in verdienstvoller Weise einige<br />
Probleme auf, über die sich nachzudenken<br />
lohnt. Obwohl niemand bestreitet, dass die<br />
Kommunikation zwischen dem stationären<br />
und ambulanten Bereich verbessert werden<br />
muss – und darum geht es bei der elektronischen<br />
Krankengeschichte –, sollte vertieft darüber<br />
reflektiert werden, welche Daten wir<br />
austauschen wollen. Aus einer Studie unter<br />
den Spital- und Hausärzten im Wallis [3] geht<br />
der Wunsch hervor, im Wesentlichen auf Fakten<br />
wie Berichte von funktionellen Untersuchungen,<br />
Laborresultate, Berichte über bildgebende<br />
Verfahren, Austrittsberichte und Untersuchungsberichte<br />
zugreifen zu können.<br />
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die Erwartungen<br />
der Spitalärzte mit denjenigen der<br />
Hausärzte übereinstimmen, mit der Ausnahme,<br />
dass sich die Spitalärzte zusätzlich<br />
eine Visualisierung der Röntgenbilder wünschen.<br />
Aber das erfreulichste Ergebnis dieser<br />
Studie ist: 81 % der befragten Ärzte befürworten<br />
einen elektronischen Austausch medizinischer<br />
Daten zwischen Leistungserbringern.<br />
Wie Bhend betont, ist die Aktualisierung der<br />
Daten, das heisst die Verfügbarkeit der aktuellen<br />
Daten im elektronischen Patientendossier,<br />
besonders wichtig, und dies speziell im<br />
Zusammenhang mit den Laborresultaten und<br />
der Liste der vom Patienten eingenommenen<br />
Medikamente. Hierbei sollte man auf eine<br />
mögliche Zusammenarbeit mit den Apotheken<br />
zählen können. Die meisten verfügen bereits<br />
über ein elektronisches Medikamentendossier,<br />
in welchem die Medikamente ohne<br />
Rezept erfasst sind, aber auch die von verschiedenen<br />
Ärzten verordneten Medikamente.<br />
Denn obwohl Patienten häufig mehrere<br />
Ärzte konsultieren (Hausarzt und Spezialisten),<br />
ist es üblich, Medikamente in einer<br />
einzigen Apotheke zu beziehen. Parallel dazu<br />
wird es wichtig sein, möglichst in Echtzeit<br />
alle Laboruntersuchungen zu erhalten, damit<br />
so die aktuellsten Resultate zur Verfügung stehen.<br />
Die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers<br />
ist eine grosse Herausforderung für<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
unser Land. Sie wird zwar durch die föderalistische<br />
Struktur nicht gefördert, und es wird<br />
schwierig sein, eine gemeinsame Lösung zu<br />
finden, die alle befriedigt. Wie die Erfahrung<br />
mit dem elektronischen Patientendossier gezeigt<br />
hat, muss der Widerstand gegen Neuerungen<br />
überwunden werden, und es gilt, die<br />
Kliniker davon zu überzeugen, dass die in die<br />
Erfassung investierte Zeit durch den Zugriff<br />
auf die Information bei weitem kompensiert<br />
werden wird [4]. Aber der Einsatz lohnt sich!<br />
Dr. med. Alex Gnaegi, Projektleiter Infomed,<br />
Sitten<br />
1 Bhend H. Zehn Killerkriterien für eHealth.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2011;92(49):1925–8.<br />
2 Loi fédérale sur le dossier électronique du<br />
patient (LDEP) [Internet]. [sans date].[cité 2012<br />
janv 24] Available from: www.admin.ch/ch/f/<br />
gg/pc/documents/2058/LDEP_Projet_fr.pdf<br />
3 Gnaegi A, Fragnière F. Analyse des besoins<br />
d’échanges de données médicales électroniques<br />
avec la médecine ambulatoire, premiers<br />
résultats du projet Infomed.<br />
Swiss Medical Informatics. 2010;(69):50–2.<br />
4 Gnaegi A, Cohen P, Marey D, Rivron M,<br />
Wieser P. Satisfaction des utilisateurs du dossier<br />
patient informatisé valaisan.<br />
Swiss Medical Informatics. 2006;(59):6–8.<br />
Lettre à notre président<br />
Dans son dernier éditorial [1], notre président<br />
faisait état de l’absence de divergences, de<br />
d ésunion au sein de la FMH au sujet des<br />
r éseaux de soins. Je ferais remarquer que<br />
c’était aussi le cas apparemment à la fin de<br />
négociation sur les réseaux de soins, et qu’une<br />
fraction agissante des médecins a renversé la<br />
vapeur, ET la position officielle de la FMH.<br />
Malheureusement, les votations internes ont<br />
montré que c’est joliment du fifty-fifty en ce<br />
qui concerne les médecins qui se sont exprimés,<br />
et même l’association des médecins de<br />
famille est d’un avis opposé. M. de Haller me<br />
faisait remarquer les usages démocratiques<br />
qui donnent en votation populaire l’avantage<br />
à la majorité. Mais nous ne sommes pas dans<br />
ce cas de figure, et plutôt dans celui d’une<br />
commission parlementaire, qui permet à une<br />
minorité importante, comme c’est le cas ici,<br />
de faire valoir son avis, alors qu’on voudrait<br />
la museler, en lui concédant de donner quelque<br />
«coloration locale». C’est clairement inacceptable.<br />
Je ne doute pas que l’argument du «libre<br />
choix du médecin», sur lequel cette campagne<br />
va bien sûr s’appuyer de nouveau, est de<br />
nature à rassembler médecins et patients, en<br />
fonction des désirs idéaux des uns et des autres.<br />
Mais comme le dit M. de Haller, c’est un<br />
«système», qui a son histoire, avec ses a cquis<br />
et aussi ses pesanteurs, et je ne suis pas du<br />
tout convaincu que c’est la «pierre angulaire».<br />
La question, vraiment taboue, est de<br />
savoir si le malade sera moins bien soigné s’il<br />
va chez un médecin qu’il n’y pas spontanément<br />
choisi. Corollairement, le médecin se<br />
sentira-t-il moins lié, professionnellement et<br />
éthiquement parlant, de faire le maximum?<br />
Mon expérience, ma carrière, ne me permets<br />
pas d’appuyer ce point de vue, au contraire:<br />
c’est une question de représentation de notre<br />
devoir, à condition d’avoir une représentation<br />
claire d’un métier certes prestigieux,<br />
mais aussi humble, malgré le pouvoir et les<br />
responsabilités qu’il confère. C’est tout de<br />
même le malade le premier critère! «Mais que<br />
chacun regarde dans son slip, si j’ose dire!»<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
Dr Virgile Woringer, Lausanne<br />
1 De Haller J. Le référendum contre le projet<br />
de loi sur le Managed care aura lieu.<br />
Bull Méd Suisses. 2012;93(4):93.<br />
Qualitätssicherung:<br />
Resultate statt Prozesse<br />
Die Aussage dieses ausgezeichneten Artikels<br />
[1] kann man mühelos und muss man von<br />
der Weiterbildung auf die ganze medizinische<br />
und pflegerische Tätigkeit ausdehnen.<br />
Alle, die wir uns seit unserem Medizinstudium<br />
um Qualität bemüht haben, wissen, dass sich<br />
Prozesse viel leichter überprüfen und zertifizieren<br />
lassen <strong>als</strong> die Resultate unserer Bemühungen.<br />
Grund dafür ist, dass Resultate zu<br />
50% subjektiv gefärbt sind, dass sie auch bei<br />
bester Behandlung und Pflege schlecht herauskommen<br />
können und dass gerade in der<br />
Chirurgie neben vielen anderen Faktoren auch<br />
das Glück eine Rolle spielt ( Rudolf Nissen in<br />
seiner Aufzählung der Faktoren, die einen gu-<br />
237
edaktion.saez@emh.ch BRIEFE / MITTEILUNGEN<br />
ten Chirurgen ausmachen). Deshalb weichen<br />
alle Qualitätsexperten auf die Kontrolle der<br />
Prozesse und der Struktur aus, weil diese<br />
quantifizierbar sind. Diese Entwicklung kann<br />
man in den Spitälern bei Behandlung und<br />
Pflege, in den Arztpraxen, sicher immer mehr<br />
bei den Ärztenetzwerken beziehungsweise<br />
Allgemeinpraxen und auch bei der Spitex beobachten.<br />
Da ist es sehr wichtig, dass Stim-<br />
Mitteilungen<br />
Facharztprüfungen<br />
Facharztprüfung zur Erlangung<br />
des Schwerpunktes Neonatologie zum<br />
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin<br />
Ort: Klinik für Neonatologie, UKBB,<br />
Basel (Dr. med. René Glanzmann)<br />
Datum: Donnerstag, 20., und<br />
Freitag, 21. September 2012<br />
Reservedatum*: Donnerstag, 15., und<br />
Freitag, 16. November 2012<br />
* f alls die Anzahl Kandidaten die Kapazität<br />
überschreitet<br />
Anmeldefrist: 25. Juni 2012<br />
Weitere Informationen finden Sie auf der<br />
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung<br />
AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen<br />
Facharztprüfung zur Erlangung<br />
des Facharzttitels Rheumatologie<br />
Ort: Rheumaklinik, UniversitätsSpital Zürich<br />
Datum: Donnerstag, 16. August 2012<br />
Anmeldefrist: 30. Juni 2012<br />
Weitere Informationen finden Sie auf der<br />
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung<br />
AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
men, wie die von Kollege Binswanger und<br />
auch im gleichen Heft die nüchterne Analyse<br />
des CSS Institutes zur Effizienz von Ärztenetzwerken<br />
[2] zur Vorsicht mahnen. Wir alle<br />
sollten versuchen, Prozess- und Strukturballast<br />
zu sichten und teilweise über Bord zu<br />
werfen.<br />
Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach<br />
Facharztprüfung zur Erlangung des<br />
Facharzttitels für Medizinische Onkologie<br />
Schriftlich-theoretische Prüfung:<br />
– Ort: Kantonsspital Luzern<br />
– Datum: Samstag, 29. Sept. 2012<br />
Die schriftlich-theoretische Prüfung kann<br />
auch in Wien während des ESMO-Kongresses<br />
abgelegt werden (siehe ESMO-Informationen).<br />
Mündlich-praktische Prüfung:<br />
– O rt: Luzerner Kantonsspital Sursee, 6210 Sur-<br />
see, 3. Stock, www.luks.ch/standorte/sursee/<br />
metanavigation/lageplan.html<br />
– D atum: Samstag, 27. Oktober 2012,<br />
ab 09.00 Uhr<br />
Anmeldefrist: 25. August 2012<br />
Weitere Informationen finden Sie auf der<br />
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung<br />
AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen<br />
oder unter www.esmo.ch oder www.<br />
sgmo.ch<br />
vetsuisse-fakultät<br />
Untersuchung zu Missbildungen<br />
des Tränennasenkan<strong>als</strong><br />
Das Institut für Genetik der Universität Bern<br />
und das Departement für Nutztiere der Universität<br />
Zürich untersuchen in einer Studie<br />
die Ursache von Missbildungen des Tränennasenkan<strong>als</strong><br />
beim Menschen und beim Tier.<br />
Ärztinnen und Ärzte, die Patienten mit solchen<br />
Krankheitsbildern sehen, werden um<br />
Kontaktnahme gebeten.<br />
Beim Rind werden in der jüngeren Vergangenheit<br />
gehäuft Missbildungen des Tränennasenkan<strong>als</strong><br />
festgestellt. Diese sind klinisch<br />
durch Fistelöffnungen medial des inneren<br />
1 Binswanger R. Outcome- statt Prozessorientierung<br />
in der ärztlichen Weiterbildung.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2012;93(4):132.<br />
2 Trottmann M, Beck K, Kunze U. Steigern<br />
Schweizer Ärztenetzwerke die Effizienz im<br />
Gesundheitswesen? Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2012;93(4):125–7.<br />
Abbildung 1<br />
Tränenfistel bei einem 3-jährigen Braunviehstier<br />
medial des inneren linken Augenwinkels.<br />
Der Stier wies beidseits identische Veränderungen<br />
auf. (Foto: Ueli Braun)<br />
Augenwinkels charakterisiert (Abb. 1) und<br />
vermutlich genetisch bedingt, da nur Nachkommen<br />
von bestimmten Stieren beim<br />
Schweizer Braunvieh betroffen sind. Die genannten<br />
Institutionen führen umfangreiche<br />
Untersuchungen durch, um der Ursache auf<br />
den Grund zu kommen. Es besteht die Hypothese,<br />
dass es sich um einen monogen rezessiv<br />
vererbten Gendefekt handelt, und das Ziel<br />
der Untersuchungen ist es, diesen zu identifizieren<br />
und zu beschreiben.<br />
Da beim Menschen phänotypisch ähnliche<br />
Veränderungen bekannt sind, welche ebenfalls<br />
familiär gehäuft auftreten, ist es ein<br />
w eiteres Ziel, abzuklären, ob bei Mensch und<br />
Tier die gleichen Gene für die Missbildung<br />
verantwortlich sind. Die involvierten Forscher<br />
sind deshalb daran interessiert, EDTA-<br />
Blutproben von Menschen mit dem Krankheitsbild<br />
zu untersuchen, und bitten alle<br />
Ä rztinnen und Ärzte, die das Krankheits-<br />
bild bei Patienten sehen, um Kontaktnahme.<br />
Ansprechpartner sind Prof. Dr. Ueli Braun,<br />
Departement für Nutztiere der Universität<br />
Zürich (ubraun[at]vetclinics.uzh.ch) und Prof.<br />
Dr. Cord Drögemüller, Institut für Genetik<br />
der Universität Bern (cord.droegemueller[at]<br />
vetsuisse.unibe.ch).<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 238
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Attraktive Personalversicherungen<br />
Damit Sie und Ihre Mitarbeiter weniger Prämien zahlen<br />
m Bitte überprüfen Sie meine Personalversicherungen und senden Sie mir eine Vergleichsofferte.<br />
(Bitte legen Sie uns eine Kopie Ihrer aktuellen Versicherungspolicen bei.)<br />
m Ich wünsche eine persönliche Beratung.<br />
Bitte rufen Sie mich an.<br />
m Ich interessiere mich für:<br />
m Steuerplanung m Pensionskasse BVG<br />
m Erwerbsunfähigkeitsvers. m Rechtsschutzversicherung<br />
m Säule 3a m Berufshaftpflichtversicherung<br />
m<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Eine wichtige Aufgabe von FMH Insurance Services ist es, im Namen der Ärzteschaft Spezialkonditionen bei den Versicherern auszuhandeln.<br />
Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, Ihr Personal zu versichern. Wir haben für Sie die zahlreichen Angebote überprüft<br />
und konnten mit der Visana einen attraktiven Rahmenvertrag aushandeln.<br />
Obligatorische Unfallversicherung (UVG)<br />
Seit gut zwei Jahren basieren die UVG-Prämien nicht mehr auf dem Einheitstarif des <strong>Schweizerische</strong>n Versicherungsverbandes,<br />
sondern werden von den einzelnen Gesellschaften festgelegt. Viele Versicherer haben ihre Prämiensätze bis heute nicht angepasst,<br />
weshalb sich ein Vergleich mit unserem Angebot lohnt:<br />
Unsere Prämie in % des Lohnes Aufteilung<br />
Betriebsunfall 0,088 % 100 % Arbeitgeber<br />
Nichtbetriebsunfall 1,132 % 100 % Arbeitnehmer (in der Regel)<br />
Kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG)<br />
Gemäss Obligationenrecht sind Sie verpflichtet, Ihren Angestellten bei Arbeitsunfähigkeit den Lohn während einer bestimmten<br />
Dauer (je nach Länge des Anstellungsverhältnisses) weiterzuzahlen. Mit einer Krankentaggeldversicherung können Sie dieses Risiko<br />
auf einen Versicherer überwälzen. Zudem profitieren Ihre Angestellten so von einer besseren Vorsorgelösung <strong>als</strong> die gesetzlichen<br />
Minimalleistungen. Auch hier bestehen teilweise grosse Unterschiede bei den Prämiensätzen der Versicherungsgesellschaften:<br />
Wartefrist Unsere Prämie in % des Lohnes Aufteilung<br />
7 Tage 1,57 %<br />
14 Tage 1,06 %<br />
30 Tage 0,70 %<br />
60 Tage 0,44 %<br />
" Antworttalon<br />
Vorname /Name<br />
Adresse<br />
PLZ /Ort<br />
Geburtsdatum<br />
Telefon Privat/Geschäft<br />
Beste Zeit für einen Anruf<br />
E-Mail-Adresse<br />
in der Regel je 50 % Arbeitgeber<br />
und Arbeitnehmer<br />
Bitte einsenden oder per Fax an: 031 959 50 10<br />
Roth Gygax & Partner AG n Koordinationsstelle<br />
Moosstrasse 2 n 3073 Gümligen<br />
Telefon 031 959 50 00 n Fax 031 959 50 10<br />
mail@fmhinsurance.ch n www.fmhinsurance.ch<br />
Talon-Code: IN7/12 / Personalversicherungen
Management TRIBÜNE<br />
Interdisziplinäre Führungsstrukturen<br />
zur Lösung von Koordinationsproblemen<br />
Germaine Eze a ,<br />
Jürg Leuppi b , Claude Rosselet c<br />
a E hem. Fachbereichsleiterin<br />
Pflege und MTT Innere<br />
Medizin am Universitätsspital<br />
Basel<br />
b P rof. Dr., Stellvertretender<br />
Chefarzt Innere Medizin am<br />
Universitätsspital Basel<br />
c l ic. oec. HSG, Inscena<br />
Systemische Beratung GmbH,<br />
Männedorf<br />
Korrespondenz:<br />
lic. oec. Claude Rosselet<br />
Inscena Systemische<br />
Beratung GmbH<br />
Alte Landstrasse 161B<br />
CH-8708 Männedorf<br />
Tel. 044 920 60 10<br />
c.rosselet[at]inscena.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Eine Organisationsentwicklung sollte in der Klinik für Innere Medizin des Universitätsspit<strong>als</strong><br />
Basel das Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Funktionsbereichen<br />
und Hierarchieebenen verbessern. Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen<br />
von Ärzten und Pflegenden wurden in einer interdisziplinären Führungsstruktur<br />
geregelt.<br />
Der prüfende Blick auf die Leistungserbringung von<br />
Institutionen des Gesundheitswesens bringt zwangsläufig<br />
die Forderung nach Rationalisierung mit sich.<br />
Oft genug wird bei der Suche nach entsprechendem<br />
Potential allerdings vergessen, dass es sich bei diesen<br />
Institutionen nicht um Betriebe klassischen Zuschnitts<br />
handelt, sondern um sogenannte «Professional<br />
Organizations». Bereits 1989 wies der kanadische<br />
Professor Henry Mintzberg auf die Besonderheiten<br />
dieses Organisationstypus hin [1]: Die Erfüllung der<br />
Primäraufgabe erfordert den Einsatz gründlich ausgebildeter<br />
Spezialisten, die sich vorab an den Patienten<br />
bzw. Klienten orientieren. Die Leistung kann zudem<br />
nicht mit den üblichen betriebswirtschaftlichen Verfahren<br />
gemessen und standardisiert werden, denn sie<br />
beruht auf einem ausgeklügelten, sich am Einzelfall<br />
orientierenden (Kunst-)Handwerk. Neben Spitälern<br />
werden diesem Organisationstyp zugerechnet: Universitäten,<br />
Gerichte, Treuhand- und Beratungsfirmen.<br />
Dieser Organisationstyp hat neben klaren Vorzügen<br />
– wie z. B. ein hohes Arbeitsethos und eine ausgeprägte<br />
intrinsische Motivation der Mitarbeitenden –<br />
eine Reihe von Mängeln: die schwierige Koordination<br />
zwischen den Profession<strong>als</strong> und zwischen Profession<strong>als</strong><br />
und den Mitarbeitenden der unterstützenden<br />
Organisationseinheiten, die beinahe ausschliessliche<br />
Loyalität der Profession<strong>als</strong> gegenüber ihrem Beruf<br />
und weitgehend fehlende, auf induktivem bzw. divergentem<br />
Denken beruhende grundlegende Innovationskraft.<br />
Es wäre kurzsichtig, diesen Problemen mit Managementpraktiken<br />
zu Leibe rücken zu wollen, wie sie in<br />
der Industrie oder bei Banken und Versicherungen<br />
üblich sind. Die operationellen Funktionen von Institutionen<br />
des Gesundheitswesens lassen sich nicht<br />
einfach «industrialisieren», denn die Logik der hier<br />
geltenden Routinen entspringt dem Geist eines professionellen<br />
State of the Art. Somit sind die Arbeitsprozesse<br />
gegenüber der Standardisierung eines Taylorschen<br />
Zuschnitts einigermassen immun.<br />
Erfolg hat eher, wer flexible und interdisziplinäre<br />
Teams zur Lösung gemeinsamer Probleme einsetzt,<br />
Les structures de direction interdisciplinaires<br />
aident à résoudre les<br />
problèmes de coordination<br />
Si l’on jette un regard critique sur les institutions du<br />
domaine de la santé, on en vient immanquablement<br />
à la rationalisation. Pourtant, lorsqu’on recherche<br />
des solutions, on oublie fréquemment que ces institutions<br />
n’ont pas le profil d’entreprises classiques<br />
mais celui d’«organisations professionnelles». Tout le<br />
pan opérationnel des institutions du domaine de la<br />
santé ne se laisse pas simplement «industrialiser».<br />
Œuvrer de manière flexible et interdisciplinaire à la<br />
recherche de solutions communes, instaurer une<br />
structure de direction concertée autour de réunions<br />
sur des sujets clairement définis et développer une<br />
culture collective basée sur des normes et des valeurs<br />
contraignantes sont en revanche source de succès.<br />
Dans le présent article, vous apprendrez comment le<br />
service de médecine interne de l’hôpital universitaire<br />
de Bâle a pu, en introduisant un système de direction<br />
interdisciplinaire, aplanir les paradoxes et améliorer<br />
la coordination entre les différents protagonistes.<br />
L’hôpital a en effet mis sur pied une équipe d irigeante<br />
interdisciplinaire pour son unité de lits, dans laquelle<br />
le médecinchef, son suppléant, la responsable de<br />
l’unité de soins et les représentants de l’administration<br />
organisent régulièrement des réunions sur des sujets<br />
concernant l’unité de lits.<br />
eine Führungsstruktur mit aufeinander abgestimmten<br />
Besprechungen zu klar definierten Themen implementiert<br />
und auf die Entwicklung einer gemein-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
252
Management TRIBÜNE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
samen Kultur auf der Basis verbindlicher Normen<br />
und Werte baut.<br />
Dieser Beitrag beschreibt, wie in der «Inneren<br />
M edizin» des Universitätsspit<strong>als</strong> Basel (USB) durch<br />
die Einführung einer interdisziplinären Führungsstruktur<br />
grundlegende Paradoxien entschärft und die<br />
Koordination zwischen den Akteuren verbessert werden<br />
konnte.<br />
OE-Prozess zur Entwicklung<br />
einer interdisziplinären Führungsstruktur<br />
Eine Organisationsentwicklung (OE) sollte in der<br />
K linik für Innere Medizin des Universitätsspit<strong>als</strong> Basel<br />
das Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen<br />
Funktionsbereichen und Hierarchieebenen verbessern.<br />
Dabei waren insbesondere die Aufgaben, Verantwortung<br />
und Kompetenzen der beteiligten Funktionsträger<br />
im Rahmen einer interdisziplinären Führungsstruktur<br />
zu regeln.<br />
Grundlegende Paradoxien <strong>als</strong><br />
implizite Spannungsmomente<br />
Nicht der mangelnde gute Wille der einzelnen Akteure<br />
macht gelingende Zusammenarbeit bisweilen<br />
zu einer schier unlösbaren Sache. Es sind eher die von<br />
unterschiedlichen und sich gelegentlich sprunghaft<br />
ändernden Erwartungen aus dem organisationalen<br />
Kontext – Patienten, Angehörige, Berufsgruppen,<br />
P olitiker, Universität u. a. m. – hervorgerufenen und<br />
am Leben gehaltenen Paradoxien.<br />
Diese Paradoxien bilden einen permanenten<br />
U nruheherd. Häufig treten sie nicht deutlich ins<br />
B ewusstsein und finden in Form von Unmut, Frustration<br />
und Resignation ihren Ausdruck. Die durch Paradoxien<br />
ausgelösten Spannungen können nicht vom<br />
einzelnen Mitarbeiter allein, sondern nur gemeinsam<br />
durch zweckmässige und sachorientierte Kommunikation<br />
im Rahmen einer robusten Führungsstruktur<br />
«gemanagt» (aber nie «endgültig» gelöst) werden.<br />
Im Verlaufe von Interviews, die mit leitenden Ärzten<br />
und Pflegenden durchgeführt wurden, konnten<br />
drei zentrale Paradoxien ausgemacht werden:<br />
– Funktionale Ausdifferenzierung des Bereichs Innere<br />
Medizin in Ärzte, Pflege und Administration<br />
versus interdisziplinäres Zusammenwirken in den<br />
Bettenstationen;<br />
– Ausbildungsstätte versus nach betriebswirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten durchrationalisierter Betrieb<br />
mit hohem Qualitätsanspruch und geringer<br />
Fehlertoleranz;<br />
– Hierarchiedenken versus Orientierung an betrieblichen<br />
Notwendigkeiten und Sachthemen.<br />
Funktionale Ausdifferenzierung versus<br />
Zusammenspiel auf den Bettenstationen<br />
Die primäre Organisationsstruktur der «Inneren Medizin»<br />
basiert auf der Ausdifferenzierung in die Professionswelten<br />
der Ärzteschaft, Pflege und Administration.<br />
Jede dieser Welten folgt ihrer eigenen Logik.<br />
Hinter ihren ganz spezifischen Routinen und Praktiken<br />
bildet die Professionswelt einen eigenen Horizont,<br />
bestehend aus identitätstiftenden Erklärungen,<br />
aus. Vor diesem Horizont macht die Handlung der<br />
einzelnen Akteure jeweils ihren Sinn – und erfährt<br />
d adurch ihre Legitimation.<br />
Das sukzessiv erfolgte Auseinanderdriften der Professionswelten<br />
fand in Folgendem seinen Niederschlag:<br />
– Rückzug auf die «eigene» Position bei schwierigen<br />
Abstimmungsprozessen und – in der Folge –<br />
Durchsetzung von suboptimalen Lösungen aus<br />
der je ganz spezifischen Interessenlage heraus;<br />
– Negative Zuschreibungen nach dem Schema: «Bei<br />
uns funktioniert alles gut, die Probleme entstehen,<br />
weil die anderen es f<strong>als</strong>ch machen.»<br />
– Gegenseitige Abschottung auf kollektiver und<br />
R esignation auf individueller Ebene infolge ungelöster<br />
Konflikte.<br />
Dies behinderte das Zusammenspiel zum Wohle des<br />
Patienten. Und dies sowohl an seinem Bett <strong>als</strong> auch<br />
im Umfeld seines Bettes. Denn dazu bedarf es ver-<br />
Das Rotationsprinzip im ärztlichen Einsatz führte bei der Pflege zum<br />
Eindruck, die Ärzte kümmerten sich zu wenig um das Funktionieren<br />
des Betriebes auf der Station.<br />
bindlicher Absprachen zwischen den Mitgliedern der<br />
verschiedenen Professionswelten zu folgenden Aspekten:<br />
– Was braucht ein Patient an Behandlung und an<br />
Pflege (fachlicher Aspekt)?<br />
– Wie sollen Behandlung und Pflege im Einzelfall<br />
aufeinander abgestimmt und organisatorisch geregelt<br />
werden (organisationaler Aspekt)?<br />
Ausbildungsstätte versus robuster Betrieb<br />
Die Aus- und Weiterbildung hat in der «Inneren Medizin»<br />
einen hohen Stellenwert. Allerdings liegt der<br />
A kzent eher auf der Qualifizierung von Assistenz- und<br />
Oberärzten. Ärzte verweilen relativ kurze Zeit auf<br />
e iner Station, was unter dem Aspekt der Personenqualifizierung<br />
Sinn macht: Unterschiedliche Kontexte<br />
ermöglichen vielerlei Erfahrungen und entsprechend<br />
Vermehrung des Wissens. Deshalb wird das<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 253
Management TRIBÜNE<br />
© Schaffner&Conzelmann, Basel<br />
Erfolg hat, wer flexible und interdisziplinäre Teams zur Lösung gemeinsamer Probleme<br />
einsetzt.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Rotationsprinzip im ärztlichen Einsatz hochgehalten;<br />
es ermöglicht raschen fachlichen Kompetenzzuwachs.<br />
Das führte allerdings dazu, dass sich die Pflege in<br />
die Pflicht der Aufrechterhaltung eines robusten Betriebes<br />
auf der Station – und die Gewährleistung einer<br />
konstant hohen organisationalen Qualität – genommen<br />
fühlte. Es schien ausschliesslich ihr die Aufgabe<br />
der Systemqualifizierung, d. h. der kontinuierlichen<br />
Verbesserung der betrieblichen Abläufe zu obliegen.<br />
Auch entstand der Eindruck, dass sich die Ärzte wenig<br />
um das Funktionieren des Betriebes kümmern. – Und<br />
so standen sich Rotationsprinzip und betriebliches<br />
Qualitätsmanagement unversöhnlich gegenüber.<br />
Dass das eine ausschliesslich der einen Professionswelt<br />
und das andere ausschliesslich der anderen<br />
P rofessionswelt zugerechnet wurden verschärfte die<br />
Problematik zusätzlich.<br />
Hierarchiedenken versus Aufgabenorientierung<br />
Mit Begeisterung erzählte ein Arzt von seinen Erfahrungen<br />
in einer amerikanischen Klinik, in der sich<br />
alle Mitarbeitenden mit der gemeinsamen Aufgabe<br />
identifizierten und auf das gemeinsam Geleistete<br />
auch sichtbar stolz waren. Genau dies vermisse er in<br />
der «Inneren Medizin».<br />
Die Leitdifferenz «Oben/Unten» schien im Bewusstsein<br />
sämtlicher Mitarbeitenden tief verankert zu<br />
sein. Allerdings sei an dieser Stelle gleich angemerkt,<br />
dass «Unten» nicht gleichbedeutend mit machtlos<br />
und «Oben» mit mächtig war. Tatsächlich widerspiegelte<br />
sich die Machtfrage in vielen Sachthemen. Diese<br />
Tendenz wurde durch die primäre Organisationsstruktur<br />
noch unterstützt: Diese differenziert, wie<br />
b ereits erwähnt, Berufsgruppen aus. Letztere geniessen<br />
unterschiedliches Prestige. Die Identifikation mit<br />
der gemeinsam erbrachten Leistung rückte dabei gelegentlich<br />
etwas in den Hintergrund.<br />
Fazit<br />
Dass Organisation nicht ein für allemal geregelt und<br />
dann «vergessen» werden kann, hat seinen Grund<br />
in Paradoxien. Diese generieren einen permanen-<br />
ten Abstimmungsbedarf, der in unterschiedlichsten<br />
Kommunikationsräumen (Workshops, Sitzungen, Korridor-<br />
und Kantinengesprächen) zwischen den beteiligten<br />
Akteuren abgearbeitet werden muss. Der funktionale<br />
Ort, an dem dies geschehen kann, sind Besprechungen.<br />
Doch: Welche Besprechungen bringen<br />
tatsächlich einen Nutzen? Welche Themen gibt es<br />
dort? Und wer wird dazu eingeladen?<br />
Lösungsansatz: Führungsstruktur basierend<br />
auf Durchsprachen zwischen<br />
den Funktionsbereichen<br />
Der Grossteil der auf Behandlung und Pflege fokussierten<br />
Prozesse findet innerhalb der einzelnen Bettenstationen<br />
der Klinik für Innere Medizin statt.<br />
Dort haben die Akteure zusammenzuspielen, die<br />
k li nikweit in drei Disziplinen ausdifferenziert sind.<br />
Besprechungen zwischen Ärzten und Pflegenden<br />
gab es zwar immer schon zu Fragen der Behand-<br />
lung und B etreuung einzelner Patienten. In diesem<br />
anlassbezogenen Rahmen konnten auch organisatorische<br />
Fragen thematisiert werden. Im Hinblick auf<br />
Fragen der übergreifenden, interdisziplinären Steuerung<br />
der O rganisationseinheit «Bettenstation» gab<br />
es h ingegen keine strukturell verankerten Möglichkeit<br />
von Besprechungen zwischen Ärzten und Pflegenden.<br />
Ausser auf der Ebene der Klinikleitung waren<br />
S itzungen denn auch nur innerhalb der einzelnen<br />
Professionswelten strukturell verankert: In der Regel<br />
zu intradisziplinären Sachfragen, seltener zu Fragen<br />
der Betriebsführung und -organisation. Für die Bearbeitung<br />
solcher Fragen wurden bei Bedarf Arbeitsgruppen<br />
eingesetzt. Sie entwickelten in Bezug auf gerade<br />
anstehende Probleme Lösungen, deren Umsetzung<br />
allerdings nicht durch eine auf die einzelne<br />
Bettenstation durchgreifende und alle Disziplinen<br />
i ntegrierende Führungsstruktur sichergestellt wurde.<br />
Dieses pragmatische Vorgehen führte dazu, dass<br />
L ösungen an zufällig sich bietenden Gelegenheiten<br />
und nicht an strategischen Notwendigkeiten festgemacht<br />
wurden.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 254
Management TRIBÜNE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Die im Grunde einfache Lösung beinhaltete die<br />
Etablierung eines «Interdisziplinären Leitungsteams<br />
Bettenstation», in dem ein Chefarzt sowie dessen<br />
Stellvertreter, die Stationsleitung «Pflege» und die<br />
Vertreter(innen) der Administration gemeinsam in<br />
regelmässigen Besprechungen über Themen beschliessen,<br />
welche die Bettenstation betreffen [2]:<br />
– Implementierung der übergeordneten Standards<br />
und Realisierung von konzeptbasierten Massnahmen;<br />
– Sicherstellen einer hochstehenden Qualität in<br />
B ehandlung und Pflege;<br />
– Optimierung der gemeinsamen Ressourcen;<br />
– Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und<br />
Klärung von wichtigen Schnittstellen;<br />
– Fragen im Zusammenhang der Aus- und Weiterbildung<br />
von Ärzten und Pflegenden;<br />
– Laufende Problem- und Konfliktbewältigung bei<br />
Eskalationen aus der ausführenden Ebene heraus.<br />
Ergänzend dazu wird auf der Ebene der Klinikleitung<br />
in regelmässig abgehaltenen Klausuren die strategische<br />
Ausrichtung überprüft und ein allfälliger Umsteuerungsbedarf<br />
ermittelt. Die Agenda beinhaltet<br />
folgende Themen:<br />
– Positionierung der Klinik im Universitätsspital<br />
bzw. im erweiterten Kontext des Gesundheitswesens<br />
und Ableitung der passenden Konzepte;<br />
– Entwicklung von Standards und Sicherstellen der<br />
Umsetzung der Massnahmen, die aus übergeordneten<br />
Konzepten abgeleitet sind;<br />
– Durchsetzung von effizienten Ablauf- und Aufbaustrukturen<br />
sowie von Führungssystemen zur<br />
Sicherung einer konstanten Qualität;<br />
– Auswahl und Förderung von Schlüsselpersonen.<br />
Das Leitungsgremium überwacht zudem die Umsetzung<br />
der gefassten Massnahmen und trifft in regelmässigen<br />
Besprechungen Dispositionen zur Koordination<br />
von übergreifenden Themen.<br />
Damit wurde, in Ergänzung zur primären Struktur,<br />
eine sekundäre Struktur über die Organisation der<br />
«Inneren Medizin» gelegt, welche die Gestaltung, Entwicklung<br />
und Lenkung der operativen Einheiten –<br />
den Bettenstationen – sowie des gesamten Bereichs<br />
im Hinblick auf eine gemeinsame Ausrichtung und<br />
auf eine optimale interdisziplinäre Bereitstellung der<br />
Ressourcen gewährleisten soll. Sie leistet einen wesentlichen<br />
Beitrag zur Behebung der in «Professional Organizations»<br />
bestehenden Koordinationsprobleme.<br />
Der Leistungsausweis nach zwei Jahren ist denn<br />
auch beeindruckend. Dank koordiniertem interdisziplinärem<br />
Vorgehen wurden folgende Vorhaben –<br />
zum Teil unter Miteinbezug von Ressourcen aus Forschung<br />
und Lehre – bearbeitet und die Lösungen sukzessive<br />
implementiert und teilweise evaluiert:<br />
– Gemeinsame Patientenvisite auf der Basis eines<br />
verbindlichen Standards;<br />
Welche Besprechungen bringen tatsächlich einen Nutzen?<br />
Welche Themen gibt es dort? Wer wird dazu eingeladen?<br />
– Interprofessionelle und interdisziplinäre Patientenprozesse<br />
(spitalintern und extern), koordinierte<br />
Wahleintritte, patientenfokussierte Ziele und<br />
Massnahmen, gemeinsame Durchführung von<br />
Untersuchungen, Austrittsplanung;<br />
– Koordination von Anamnese und Eintritts-Screening<br />
zwischen Medizin und Pflege (ausgelegt auf<br />
den Fokus von chronisch kranken Patienten);<br />
– Konsiliarvisitenregelung zwischen Spezialisten<br />
und Generalisten in Medizin und Pflege;<br />
– Implementierung eines Case-Managements;<br />
– Planungsrapport Pflegende;<br />
– Bettenkoordination;<br />
– Einführung eines Critical Incidents Reporting<br />
Systems und interprofessioneller Auswertungen;<br />
– Teilweise computerunterstützte Einführungsprogramme<br />
für Assistenzärzte und Pflegende.<br />
Alle diese Massnahmen führten letztlich zu einer<br />
deutlich gesteigerten Qualität im Kontakt mit dem<br />
Patienten. Das fand am deutlichsten bei den Visiten<br />
seinen Niederschlag: Durch die durchgehende interprofessionelle<br />
Partnerschaft zwischen Ärzten und<br />
Pflegenden entwickelte sich sukzessive Exzellenz:<br />
zum Wohl des Patienten.<br />
Literatur<br />
1 Mintzberg H. Mintzberg. On Management – Inside<br />
Our Strange World of Organizations. New York:<br />
Free Press; 1989.<br />
2 Weber H, Langewitz W. Basler Visitenstandard –<br />
Chance für eine gelingende Interaktionstriade<br />
Patient-Arzt-Pflegefachperson.<br />
Psychother Psych Med. 2011;(61):193–5.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 255
Spectrum TRIBÜNE<br />
CRS entend améliorer la<br />
compétence transculturelle<br />
Le département Santé et intégration<br />
(GI) de la Croix-Rouge suisse (CRS)<br />
s’est lancé dans la nouvelle année<br />
avec la nouvelle publication «Transkulturelle<br />
Public Health – ein Weg<br />
zur Chancengleichheit» (en allemand,<br />
avec quelques contributions<br />
en français) et un outil d’apprentissage<br />
en ligne. L’ouvrage transmet<br />
par des articles tirés de la théorie et<br />
de la pratique des connaissances<br />
utiles sur l’approche transculturelle<br />
et l’égalité des chances en santé<br />
p ublique. Quant à l’outil d’apprentissage<br />
en ligne «Compétence transculturelle»,<br />
il s’adresse avant tout<br />
aux infirmiers; il leur permet d’assimiler<br />
de manière ludique les connaissances<br />
de base en la matière.<br />
(CRS)<br />
Assistenzbeitrag seit<br />
1. Januar in Kraft<br />
Der Bundesrat hat den ersten Teil<br />
der 6. IV-Revision auf den 1. Januar<br />
2012 in Kraft gesetzt und die Ausführungsbestimmungenverabschiedet.<br />
Mit dem Assistenzbeitrag erhalten<br />
Menschen mit Behinderung<br />
eine wichtige neue Leistung. Erwachsene,<br />
die Anspruch auf eine<br />
Hilflosenentschädigung haben und<br />
über das nötige Mass an Selbständigkeit<br />
verfügen, können in Eigenregie<br />
individuell eine Hilfe engagieren,<br />
um zu Hause zu leben. Der<br />
Assistenzbeitrag ermöglicht ihnen<br />
so ein eigenständigeres Leben, entlastet<br />
die Angehörigen und macht<br />
einen Heimaufenthalt überflüssig.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
(MS)<br />
Forschungsthemen unterhaltsam und verständlich<br />
erklären, so lautete der Auftrag beim Wettbewerb<br />
«FameLab». Der Sieger setzte Papierflieger ein.<br />
La Suisse en fait-elle assez pour la relève scientifique?<br />
Pour son 60 e anniversaire, le Fonds National Suisse<br />
(FNS) a invité en janvier 250 personnalités de la<br />
r echerche, de l’enseignement supérieur et de la<br />
p olitique à se pencher sur la question d’avenir<br />
«Qu’est-ce qui coince dans l’encouragement de la<br />
recherche?». De jeunes chercheurs ont formulé<br />
leurs attentes: les politiques devraient revoir à la<br />
hausse les subventions universitaires de base proportionnellement<br />
à l’augmentation du nombre<br />
d’étudiants et exercer une pression accrue sur les<br />
REHAB Basel und UKBB rücken näher zusammen<br />
REHAB Basel und das Universitäts-Kinderspital beider<br />
Basel UKBB betreuen zahlreiche Patienten gemeinsam.<br />
Seit Januar 2012 intensivieren die beiden<br />
Institutionen die Partnerschaft, um Kindern,<br />
Jugendlichen und ins Erwachsenenalter eintretenden<br />
Patienten mit Gangstörungen und komplexen<br />
körperlichen Behinderungen eine noch bessere Behandlung<br />
und Rehabilitation bieten zu können.<br />
Das UKBB behandelt Kinder und Jugendliche mit<br />
cerebralen Bewegungsstörungen bis zum 18. Lebensjahr.<br />
Meistens werden diese anschliessend von<br />
Hausärzten oder in Wohneinrichtungen betreut.<br />
Bei schweren Fällen sind jedoch eine regelmässige<br />
Nachsorge beim Neurologen und auch ein therapeutisches<br />
Angebot notwendig. Deshalb übernimmt<br />
das REHAB seit 2001 die erwachsen werdenden<br />
Patientinnen und Patienten des UKBB in<br />
die ambulante Nachsorge.<br />
(REHAB Basel, UKBB)<br />
Vorhang auf für die Forschung<br />
Eine Bühne für drei Minuten, und los geht’s: Das<br />
erste «FameLab» in der Schweiz fand an der Universität<br />
Zürich statt. FameLab ist die etwas andere<br />
Art, Forschung an den Laien zu bringen.<br />
Akademiker sind nicht zwingend Showtalente.<br />
Doch genau das zählt beim FameLab: Die Rednerinnen<br />
und Redner sollen ein Forschungsthema<br />
originell, unterhaltsam und verständlich<br />
erklären, und das in drei Minuten. Insgesamt<br />
waren es neun junge Forschende, die sich auf<br />
die Bühne wagten. Die Jury achtete darauf, ob<br />
der Vortrag wissenschaftlich korrekt war und<br />
auch ein Laienpublikum mitreissen konnte. Am<br />
Ende kürte sie Fabian H. Jenny zum Gewinner<br />
des Tages, der in bestem Englisch und Libellen-<br />
T-Shirt von Fliegen, Flügeln und dem Zusammenhang<br />
mit der Krebsforschung sprach. Und<br />
zwischendurch liess er Papierflieger ins Publikum<br />
segeln.<br />
universités pour assurer une meilleure conciliation<br />
de la vie professionnelle et familiale. Ils souhaitent<br />
des meilleures structures d’encadrement pour les<br />
doctorant-e-s et des perspectives plus attrayantes<br />
pour le corps intermédiaire supérieur. Du FNS, ils<br />
exigent plus de possibilités pour les jeunes chercheurs<br />
de niveau doctorat et post-doctorat de déposer<br />
eux-mêmes des demandes de projet avec une<br />
contribution à l’entretien personnel.<br />
(FNS)<br />
Dank Operation am UKBB und darauf abgestimmten<br />
Therapien im REHAB Basel kann dieser Patient mit<br />
cerebraler Behinderung rund einen Kilometer<br />
selbständig an Stöcken gehen.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
Kurt Müller Klusman<br />
(Universität Zürich)<br />
256
Streiflicht Horizonte<br />
Leben mit Muskeldystrophie<br />
«Wir wissen nie, was kommt»<br />
Helga Kessler<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Wenn zwei Kinder schwer krank sind, stellt dies das Leben einer Familie vollständig<br />
auf den Kopf. Für die Mutter bedeutet das, dass sie fast rund um die Uhr gefordert<br />
ist. eltern wie Kinder leben mit der Angst, dass stets etwas Unvorhergesehenes<br />
passieren kann.<br />
Mütter hören alles, wenn es um ihre Kinder geht. Sie<br />
wachen auf, wenn die Kleinen mitten in der Nacht<br />
schreien. Und sie verstehen ihre Kinder auch dann,<br />
wenn diese Mühe mit dem Sprechen haben. Silvan ist<br />
doppelt gehandicapt. Der Achtjährige muss gegen die<br />
Geräusche eines Atemgeräts ankämpfen, ein regelmässiges<br />
Blasen und Saugen. Zusätzlich eingeschränkt<br />
ist er durch die Atemmaske, die in einen Helm integriert<br />
ist und das meiste von dem verschluckt, was<br />
S ilvan sagt.<br />
«Mama, ich habe heute schon fünf Kordeln gemacht»,<br />
sagt er stolz. Seine Mutter strahlt und lobt<br />
ihn für die schönen Farben, die er ausgewählt hat.<br />
«Ich mach noch mal drei, auch eine für Nadja», kündigt<br />
Silvan an. Für den zarten Jungen bedeutet das<br />
Drehen von Kordeln aus Wollschnüren Schwerstarbeit.<br />
Silvan ist muskelkrank. Die Muskeln in Fingern<br />
und Armen sind so schwach, dass er nicht mehr<br />
selbständig essen kann. Laufen kann er seit zwei<br />
J ahren nicht mehr – seither benötigt er einen Rollstuhl.<br />
Plötzlich wollte er gar<br />
nicht mehr laufen und klagte<br />
über schmerzende Beine.<br />
Auch seine kleine Schwester Nadja kann nur<br />
noch laufen, wenn sie festgehalten wird. Die meiste<br />
Zeit sitzt die Fünfjährige ebenfalls im Rollstuhl. Das<br />
dritte Kind von Judith und Christian Weber, der<br />
zehnjährige Roman, ist gesund. «Er wünscht sich<br />
nichts mehr, <strong>als</strong> dass seine Geschwister auch gesund<br />
wären», sagt der Vater. Die Chancen auf Heilung<br />
stehen schlecht. Beide Kinder leiden unter einer<br />
bislang unbekannten Variante von Muskeldystrophie<br />
(siehe Kasten), bei der die Muskeln in den Beinen und<br />
Armen schwinden, während sich die Brustmuskulatur<br />
versteift, was die Atmung erschwert. Auch Nadja ist<br />
auf eine Atemmaske angewiesen; derzeit aber nur in<br />
«nous ne savons jamais<br />
ce qui nous attend»<br />
Lorsque deux enfants sont gravement malades, c’est<br />
toute la vie de famille qui s’en trouve bouleversée.<br />
Chez la famille Weber, tout tourne autour de Silvan,<br />
huit ans, et nadja, cinq ans, tous deux atteints de<br />
dystrophie musculaire, une maladie qui les empêche<br />
de marcher. ils ont besoin d’aide pour s’habiller,<br />
pour manger, et ne peuvent pas aller tous seuls à<br />
l’école ou au jardin d’enfants comme n’importe quel<br />
enfant en bonne santé. Le troisième enfant de Judith<br />
et Christian Weber, roman, dix ans, est lui en bonne<br />
santé. «il ne souhaite rien de plus que de voir son<br />
frère et sa sœur en bonne santé comme lui», déclare<br />
le père. Mais les chances de guérison sont minimes.<br />
Parents et enfants vivent constamment dans la peur<br />
que quelque chose d’imprévu survienne. «nous ne<br />
savons jamais ce qui nous attend», explique la mère.<br />
Silvan attrape sans arrêt de graves infections et a de<br />
plus en plus de peine à respirer. nadja doit elle aussi<br />
porter un masque respiratoire pendant la nuit.<br />
C hristian accepte mal l’impuissance de la médecine<br />
face à la maladie qui touche ses enfants: «Aujourd’hui,<br />
on peut aller sur la Lune mais personne ne<br />
peut aider mes enfants.»<br />
der Nacht. Silvan benötigt auch am Tag immer wieder<br />
stundenweise Atemunterstützung.<br />
«Es muss ja irgendwie weitergehen», sagt die Mutter<br />
und streicht sich Tränen von der Wange. Der Alltag<br />
ist für die ganze Familie äusserst beschwerlich. Die<br />
beiden kranken Kinder erfordern extrem viel Aufmerksamkeit.<br />
Silvan benötigt Betreuung fast rund um<br />
die Uhr. Am Morgen muss er gewaschen und bewegt<br />
und über eine Magensonde ernährt werden. Er<br />
braucht Hilfe beim Inhalieren und beim Abhusten<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
257
Streiflicht Horizonte<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
von Schleim und muss schliesslich für die Schule<br />
p arat gemacht werden. Nadja braucht ebenfalls Hilfe<br />
beim Waschen, Anziehen und Frühstücken – um 8.00<br />
Uhr wird sie für den Kindergarten abgeholt. Wenn die<br />
Kinder um 12.00 Uhr nach Hause kommen, gibt es<br />
Mittagessen. Weil Silvan so gerne isst, füttert ihn die<br />
Mutter am Mittag und am Abend. «Eine Stunde brauchen<br />
wir mindestens dafür», sagt sie. Am Nachmittag<br />
steht für beide Kinder Physiotherapie auf dem Programm.<br />
Findet die Behandlung ausser Haus statt,<br />
müssen die Kinder jeweils hingebracht und wieder<br />
abgeholt werden.<br />
Das ehepaar kämpft seit Jahren,<br />
seinen Bauernhof rollstuhlgerecht<br />
umbauen zu dürfen.<br />
Bis vor kurzem haben die Eltern, beide 40 Jahre<br />
alt und im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb tätig,<br />
fast alle Betreuungsarbeiten alleine übernommen.<br />
Nun kümmert sich die Spitex während 30 Stunden<br />
pro Woche um Silvan, für Nadja müssen 1 1 ⁄2 Wochenstunden<br />
genügen. Die Invalidenversicherung bezahlt<br />
für beide Kinder Hilflosenentschädigung, für Silvan<br />
den höchsten, für Nadja den mittleren Satz sowie<br />
e inen Intensivpflegezuschlag für Silvan. Zwei bis drei<br />
Mal pro Woche kommt für wenige Stunden eine<br />
Haushaltshilfe, um die dringendsten Arbeiten zu erledigen.<br />
Weitere Unterstützung bekommen die Webers<br />
kaum – die Angehörigen wohnen entweder zu weit<br />
weg oder finden keine Zeit dafür. Im Gegenteil hört<br />
die Familie häufig Kommentare wie «die Spitex<br />
kümmert sich ja, Silvan ist doch mit seinem Rollstuhl<br />
ganz mobil …». Als wären das nicht genug<br />
Hindernisse, kämpft das Ehepaar seit Jahren mit den<br />
Behörden darum, seinen Bauernhof rollstuhlgerecht<br />
umbauen zu dürfen. «Das Schreiben von Briefen an<br />
Behörden kostet am meisten Energie», sagt Christian<br />
Weber. Auch hier fehlt es der Familie an Hilfe, die sie<br />
dringend benötigen würde.<br />
Muskeldystrophie<br />
Diese Gruppe von Muskelerkrankungen hat eine genetische Ursache. Meist werden<br />
sie vererbt, selten sind es spontane Mutationen. Diese führen dazu, dass die<br />
Muskelzellen allmählich beschädigt werden, was zur vollständigen Zerstörung der<br />
betroffenen Muskeln führen kann. Die Krankheitsbilder, welche die Skelettmuskulatur<br />
betreffen, sind sehr unterschiedlich. Muskeldystrophien sind äusserst seltene<br />
Erkrankungen, mit einer Häufigkeit von 10 Erkrankten auf 100 000 Personen. Die<br />
häufigste Muskelerkrankung im Kindesalter ist Duchenne Muskeldystrophie, von der<br />
fast ausschliesslich Jungen betroffen sind. Eine ursächliche Behandlung gibt es<br />
bislang nicht; aktuell werden verschiedene Therapieansätze erforscht. Mit<br />
Physiotherapie, Schienenbehandlung, Operationen und Medikamenten gelingt es,<br />
die Symptome zu lindern und den Verlauf zu verzögern.<br />
Aus kleinen Dingen Kraft schöpfen: Der achtjährige<br />
Silvan leidet an einer Muskeldystrophie und braucht<br />
durchgehend Betreuung.<br />
Doch ihre grösste Sorge gilt den beiden kranken<br />
Kindern. Silvan war 2 1 ⁄2 Jahre alt, <strong>als</strong> seine Schwester<br />
Nadja geboren wurde, und die Mutter merkte, dass etwas<br />
nicht stimmte. Dass er erst spät mit dem Laufen<br />
anfing, hat Judith Weber zunächst nicht beunruhigt:<br />
«Ich dachte, er braucht einfach ein bisschen länger.»<br />
Doch dann wollte er plötzlich gar nicht mehr laufen<br />
und klagte über schmerzende Beine. Eine Blutuntersuchung<br />
zeigte hohe KreatinkinaseWerte, ein klares<br />
Indiz für eine Schädigung der Muskelzellen. Der Arzt<br />
sprach von Muskelentzündung und verabreichte<br />
Schmerzmittel. Eine Biopsie brachte schliesslich Gewissheit,<br />
dass Silvan an einer Muskelerkrankung litt.<br />
Als Nadja vier Monate alt war, wurde auch bei ihr<br />
Muskelschwund diagnostiziert. Für die Familie war<br />
das ein «Riesenschock», zumal Muskelerkrankungen<br />
bei Mädchen eher selten sind und ähnliche Erkrankungen<br />
weder aus der Familie der Mutter noch aus<br />
der des Vaters bekannt waren.<br />
Nadja ist ein aufgewecktes, kleines Mädchen, das<br />
«gerne und viel redet», so der Vater, und sich jeden<br />
Tag auf den Kindergarten freut. Später soll sie eine<br />
R egelschule besuchen können, hoffen die Eltern.<br />
S ilvan besucht eine Klasse im Zentrum für Körperbehinderte.<br />
Auch er ist gerne mit anderen Kindern<br />
zusammen, aber er hat zunehmend Angst, dass ihm<br />
dort nicht geholfen werden kann, wenn er in Atemnot<br />
gerät. Die Mutter quält sich jeden Morgen mit<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 258
Streiflicht Horizonte<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
dem Entscheid, ob es ihm heute so gut geht, dass sie<br />
ihn gehen lassen kann. Immer wieder erreicht sie<br />
dann trotzdem ein Anruf, dass sie sofort kommen<br />
muss. Wenn Silvan nicht zu Hause ist, ist Judith Weber<br />
unruhig. «Ich bin nie ohne Handy unterwegs»,<br />
sagt sie. Und stets muss sie darauf gefasst sein, von einem<br />
Moment auf den anderen alles stehen und liegen<br />
zu lassen. Angst treibt die ganze Familie um: «Wir<br />
wissen nie, was kommt», sagt die Mutter.<br />
Im letzten halben Jahr ist Silvan sehr häufig krank<br />
gewesen. Wegen verschiedener Infekte hat er Monate<br />
im Kinderspital Zürich verbracht, viele Wochen davon<br />
auf der Intensivstation. Nun hoffen die Eltern,<br />
dass er sich stabilisiert hat und regelmässig in die<br />
Schule kann. «Er lernt so gerne und bräuchte mehr<br />
Förderung», findet die Mutter. Neu hat er das Schachspielen<br />
entdeckt; sein Vater spielt mit ihm, so oft er<br />
kann. Mehr <strong>als</strong> für ihre Kinder da zu sein, können die<br />
Eltern kaum tun. Dass die Medizin machtlos, ist,<br />
kann der Vater nur schwer verstehen: «Man kann<br />
heute auf den Mond fliegen, aber meinen Kindern<br />
kann man nicht helfen.»<br />
Die Familie hat sich in ihr Schicksal gefügt. «Wir<br />
sind schon zufrieden, wenn wir’s daheim gut bewerkstelligen<br />
können», sagt Christian Weber. Grössere<br />
Ausflüge oder gar ein Urlaub sind kaum möglich. Einmal<br />
sind sie für drei Tage ins Tessin gefahren, das<br />
Auto vollgepackt mit Rollstühlen und Pflegeutensilien<br />
für die Kinder. «Das war ein Riesenstress», sagt<br />
die Mutter. Trotzdem hätten sie es genossen, zu fünft<br />
einen Ausflug machen zu können. Es sind kleine Ereignisse,<br />
aus denen die Familie Kraft schöpft. Im Sommer<br />
durften Nadja und Silvan beim Zirkus «Wunderplunder»<br />
mitmachen – Bilder zeigen vor Glück strahlende<br />
Kinder.<br />
Christian Weber findet seine Ruhe, wenn er auf<br />
den Feldern unterwegs ist. Seine Frau muss ihre<br />
O asen der Ruhe bewusst suchen. Morgens steht sie<br />
extra früh auf, um alleine frühstücken zu können.<br />
«Ich geniesse das», sagt sie. Gelegentlich geht sie mit<br />
raus aufs Feld, sie organisiert den Hofladen und deko<br />
riert den Hof mit wechselnden Ausstellungen von<br />
dem, was die Felder hergeben: Kürbisse im Herbst,<br />
Melonen im Sommer. Zeit für sich selbst findet sie<br />
kaum. Geht sie abends mal weg, kann sie’s kaum geniessen,<br />
weil sie weiss, dass Silvan nervös ist, wenn sie<br />
nicht im Haus ist.<br />
Die Nächte sind häufig unruhig; beide Kinder<br />
sind mit einer Klingel ausgestattet. Silvan betätigt<br />
seine jede Nacht, meist mehrm<strong>als</strong>. Dann steht die<br />
Die Mutter quält sich jeden Morgen mit dem entscheid,<br />
ob es ihm heute so gut geht, dass sie ihn zur Schule schicken kann.<br />
Mutter auf, gibt ihm zu trinken oder hilft ihm beim<br />
Abhusten von Schleim. Vor allem tröstet sie ihn.<br />
Manchmal ist Judith Weber so müde, dass sie die<br />
Klingel nicht hört. Dann steht der Vater auf. Meist<br />
muss er seine Frau dann doch wecken. Sie ist die Einzige,<br />
die ihren Sohn beruhigen kann, wenn er nicht<br />
mehr schlafen kann.<br />
Zürcher Ärzteball am 12. Mai 2012 im Dolder<br />
Grand zugunsten des Neuromuskulären<br />
Zentrums Zürich<br />
Die zürcher Ärztegesellschaft lädt alle Ärztinnen<br />
und Ärzte und deren Freunde zu einer exklusiven<br />
Ballnacht ins Dolder Grand ein. Der 2. zürcher<br />
Ärzteball ist der glamouröse gesellschaftliche<br />
Höhepunkt des Jahres und findet am 12. Mai<br />
2012 statt. ein Feuerwerk mit der Dani Felber<br />
Band, «Helga is Bag» (ehem<strong>als</strong> Acapickels) und<br />
einer schwindelerregenden Mitternachtsshow<br />
erwartet Sie. Die tombola hat Preise im Wert von<br />
über 60 000 Franken. Der gesamte erlös dieses<br />
Benefizballs kommt dem neuromuskulären<br />
zentrum zürich zugute. Bereits vor zwei Jahren<br />
konnten über 220 000 Franken überwiesen<br />
werden.<br />
Verpassen Sie nicht, sich bald anzumelden. Die<br />
Plätze sind limitiert und werden nach eingang<br />
der Anmeldung vergeben. Weitere informationen<br />
und Anmeldung unter www.aerzteball.ch oder<br />
info[at]aerzteball.ch<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 259
Streiflicht Horizonte<br />
Fable<br />
ethique et morale<br />
Françoise Verrey Bass<br />
Correspondance:<br />
Dr Françoise Verrey Bass<br />
Présidente ASEM<br />
Plänkestrasse 12<br />
CH-2502 Bienne<br />
fraverrey[at]gmx.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Une plume, comme une plume d’oiseau, monte<br />
lentement en vacillant un peu vers le ciel. Ce n’est<br />
pas une belle plume lisse et brillante. Son aspect fait<br />
penser à une vieille plume qui a de la peine à rester<br />
droite. En cours de montée, elle est rattrapée par une<br />
plume d’oie, toute blanche, petite et fine, bien que<br />
touffue, qui tourbillonne sur elle-même en évoluant<br />
rapidement. Arrivée à la hauteur de la plume grise,<br />
elle lui demande d’une petite voix claire qui elle est,<br />
d’où elle vient. D’une voix cassée, fragile, la plume<br />
grise lui répond qu’elle est l’âme d’un homme de<br />
60 ans, atteint d’une maladie neurologique le paralysant<br />
de plus en plus depuis un an et demi, et qui a<br />
choisi de quitter le monde des êtres humains tant<br />
qu’il pouvait encore boire lui-même la «potion magique»<br />
d’Exit, donc qu’il était suisse et venait de<br />
mourir par suicide assisté. La plumette freine son<br />
ascension pour rester à sa hauteur et l’écouter avec<br />
attention. «Et ta vie, elle a été comment?» «Oh! Belle<br />
et pas belle, heureuse et triste, avec des hauts et des<br />
bas, une vie normale, quoi!» Plumette pousse un<br />
gros soupir et constate: «Dans le fond, tu as eu beaucoup<br />
de chance, car tu as eu l’expérience d’une vie,<br />
même si la maladie l’a raccourci. Et… en fait! Tu as eu<br />
la possibilité de décider de ta mort à l’heure qui t’a<br />
convenu, quand tu as réalisé que tu ne pouvais plus<br />
supporter la maladie! Moi, je n’ai pas eu cette opportunité,<br />
je n’ai même rien eu. Car quoique déjà parfaitement<br />
formé et avec un génome tout ce qu’il y a de<br />
plus normal, on a décidé pour moi. Je comprends les<br />
arguments de ma mère et de son entourage, mais<br />
c’est dur d’avoir été bien en route pour l’expérience<br />
unique qu’est la vie et d’avoir été avortée à 11 semaines<br />
de la grossesse. Est-ce un meurtre? De l’euthanasie<br />
active?» L’âme de l’homme en est toute secouée. La<br />
loi suisse autorise les interruptions de grossesses<br />
volontaires jusqu’à la fin du troisième mois «pour<br />
des raisons de santé de la mère». Pendant sa vie<br />
l’homme a été plus d’une fois confronté à l’avortement<br />
d’un fœtus, il y a même eu un cas dans sa famille.<br />
Mais jamais il n’aurait imaginé que l’on puisse<br />
parler de meurtre! Un fœtus si jeune, a-t-il déjà une<br />
âme? Il en est tout perplexe. Alors le Pape aurait-il<br />
tout de même raison avec ses argumentations? Et<br />
aussi tous ces gens qui sont contre l’avortement en<br />
Amérique et ailleurs? Mais de là à devenir soi-même<br />
un criminel en incendiant des cliniques où en s’attaquant<br />
aux médecins, il y a quand même une frontière<br />
à ne pas franchir.<br />
Les sciences de la vie ont fait d’immenses progrès<br />
ces dernières décennies, et l’imagerie médicale aussi.<br />
Dès qu’il y a la première division de cellules, la vie est<br />
en route, c’est à ce moment-là que le nouvel être<br />
humain «naît». Pas question d’éthique ou de morale,<br />
une interruption de grossesse est une interruption<br />
de vie, on ôte la vie à un être humain en devenir.<br />
L’âme de l’homme est songeuse: «Je t’entends<br />
bien, petite plume, et ce que tu m’expliques me rend<br />
très triste. Je n’ai bien sûr jamais réfléchi à ce problème.<br />
Mais dis-moi, que faire quand, à l’examen du<br />
fœtus avant la fin du troisième mois, on décèle une<br />
anomalie grave, un handicap sévère, comme la trisomie?<br />
Que faire quand la femme se retrouve enceinte<br />
après un viol, surtout un viol collectif, la barbarie des<br />
vainqueurs dans un pays conquis?» Les deux plumes<br />
continuent leur ascension en silence, perdues dans<br />
leurs pensées.<br />
«En cas de viol, donner l’enfant à l’adoption?»,<br />
chuchote Plumette. «Comme si en pleine guerre, on<br />
pouvait penser à l’adoption!», tonne Vieille Plume.<br />
«Non, là c’est tout à fait moral de se faire avorter,<br />
même si l’éthique n’y est pas du tout.» «Mouais!», ac-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
260
Streiflicht Horizonte<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
quiesce Plumette après un nouveau temps de réflexion,<br />
«dans ce cas je peux comprendre l’interruption<br />
de grossesse. Pardon, je préfère ce terme à avortement<br />
qui est un mot si laid, totalement dénué<br />
d’éthique.»<br />
Brusquement Plumette freine et provoque:<br />
«Dans le cas d’une interruption de grossesse pour<br />
handicap grave, ne pourrait-on pas supposer par<br />
exemple que Dieu ait voulu mettre le couple à<br />
l’épreuve, et qu’alors, il faille accepter cet enfant<br />
comme il est et s’en occuper?» Vieille Plume secoue<br />
la tête irritée: «Pas d’accord du tout! Qu’est-ce que<br />
Dieu vient faire là où il y a hasard ou même hérédité<br />
calculable. Et moi, je veux bien croire en une entité<br />
suprême qui est partout, mais je me refuse de croire<br />
qu’elle veuille faire souffrir les uns plus particulièrement<br />
que les autres. Quant aux forces du mal qui<br />
nous en voudraient, c’est bon comme sujets de<br />
films!» Songeuse, elle ajoute: «Du reste, on ne sait<br />
même pas si cette entité existe! On ne fait que supposer…<br />
on verra bien… quand on arrivera où? Certainement<br />
pas dans un paradis... Où m’attendraient<br />
72 vierges comme le disent les musulmans! Et pourquoi<br />
pas 72 puceaux pour les femmes? Un Dieu qui<br />
ferait aussi dans ce domaine de telles différences<br />
entre l’homme et la femme? A rire. En quoi sontelles<br />
moins que nous? Nous sommes parfaitement<br />
égaux en tout. Pour preuve, elles sont aussi intelligentes<br />
que nous, accèdent aux mêmes études. Elles<br />
ont juste un détail extérieur différent de nous, permettant<br />
la copulation – un mot bien laid, celui-là<br />
aussi. Les deux détails se complétant, la fécondation<br />
est ainsi rendue possible, et au lieu d’être moins, elles<br />
seraient plutôt plus que nous, parce qu’elles peuvent<br />
porter nos enfants et les mettre au monde…» «Ou interrompre<br />
la grossesse, si elles n’en veulent pas»,<br />
jette Plumette pour stopper ce fleuve soudain de<br />
paroles.<br />
«Bon! Une chose me paraît très claire», ajoute<br />
Vieille Plume pour terminer ce sujet qui ne pourra<br />
jamais être clos. «La prévention est toujours et en<br />
toutes choses la meilleure solution, même si souvent<br />
elle n’est que fille de la morale: avoir une pro tection<br />
anticonceptionnelle, n’importe quoi, mais pourvu<br />
que cela soit vraiment efficace, ou alors s’abstenir, si<br />
on n’est pas prêt pour accueillir une descendance!<br />
Quant au plaisir de l’amour physique, on l’observe<br />
chez tous les êtres vivants, donc c’est une bonne<br />
chose, voulue. J’irais jusqu’à dire que le plaisir que<br />
donne la copulation, ou si tu préfères la relation<br />
amoureuse, est la garantie que la species de l’être va<br />
continuer sur terre. C’est se protéger de la disparition<br />
de cet être spécifique, escargot, chat ou être humain!»<br />
Elles reprennent leur ascension un moment.<br />
«Mais, Petite Plume, que penses-tu de la façon dont<br />
j’ai quitté ma vie?» «Tu me poses une vraie colle»,<br />
répond Plumette en s’arrêtant de nouveau pour<br />
mieux réfléchir. «J’essaie de m’imaginer tes souffrances<br />
et tes douleurs des derniers mois et la paralysie<br />
qui augmente, qui allait te priver de l’usage de<br />
tes mains, t’empêcher complètement de te nourrir,<br />
parce que déglutir serait devenu impossible, qu’il<br />
aurait fallu te mettre une sonde directement dans<br />
l’estomac pour rallonger un chouia ta vie, et que<br />
finalement tu serais mort en étouffant, avec ou sans<br />
pneumonie… sans oublier l’angoisse qui accompagne<br />
l’évolution de la maladie… et ta persuasion<br />
que l’entité qui est partout est Clarté, Amour et Compréhension…»<br />
«Je n’ai pas dit ça!» «Tu ne l’as pas dit, mais j’en<br />
suis toute imprégnée par le rayonnement de ton âme<br />
quand tu penses ‹Dieu›!» «C’est juste, parfaitement<br />
juste!›» «Donc, à ce moment-là, pourquoi me poser<br />
une question d’éthique ou de morale, à laquelle aucun<br />
être, même un philosophe vraiment honnête,<br />
ne peut répondre, car il n’est pas dans la situation<br />
donnée. C’est un choix! Tu n’as jamais vraiment<br />
pensé, pendant ta vie, à cette sortie délibérée. Mais<br />
dans la situation si difficile, dans laquelle tu te trouvais,<br />
tu as choisi. Et personne ne peut t’en blâmer.<br />
Au contraire, après beaucoup de réticences, ta famille,<br />
voyant ta souffrance et souffrant avec toi parce<br />
que t’aimant, ta femme et tes enfants ont accepté<br />
ton choix sans retenue. C’est un choix personnel<br />
que tu as fait, en possession de toutes tes facultés<br />
mentales. Personne n’a le droit de juger. Dans ton<br />
cas – et celui de toutes les autres personnes dans ta<br />
situation – ce choix est loin au-dessus, dela morale<br />
de toute façon, et aussi de l’éthique.»<br />
Plumette s’arrête, à bout de souffle. Vieille Plume<br />
est bouche bée devant son éloquence: «Mais d’où<br />
sors-tu tout cela, toi qui n’a qu’à peine vécu?» Alors<br />
Plumette: «Pense si tu veux que l’âme est immortelle,<br />
crois si tu veux à la réincarnation. Ce qui est vrai,<br />
c’est qu’une forme de savoir et de connaissances<br />
profondes est ancrée depuis toujours dans l’âme des<br />
êtres humains. Non! Des êtres vivants tout court,<br />
avec une communication mentale entre nous, qui<br />
n’est malheureusement pas comprise par tous, mais<br />
des animaux oui. As-tu essayé une fois de parler<br />
mentalement à un chien et observé sa réaction? Car<br />
il en a une, je t’assure. Bref, je n’ai pas eu le temps de<br />
vivre au-delà de 11 semaines, d’accord, mais j’avais<br />
déjà en moi toute l’expérience passée et future du<br />
monde, sinon l’expérience de ma propre vie.»<br />
Elles continuent en silence et tranquillement<br />
leur ascension. Entre elles, l’essentiel a été dit, le reste<br />
ne serait que discussion philosophique bien sûre fort<br />
intéressante et de ce fait nécessaire. Mais ne correspondant<br />
pas vraiment à la vie et à la mort des<br />
humains.<br />
D’autres plumes de toutes les grandeurs, formes<br />
et couleurs se joignent à elles et ainsi, toutes ensembles,<br />
elles arrivent… dans un endroit… de l’univers…<br />
inconnu.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 261
Streiflicht Horizonte<br />
Angst und Ansteckung zwischen<br />
epidemien und Finanzkrise<br />
Mark Honigsbaum<br />
Journalist und Wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am<br />
Medizinhistorischen Institut<br />
der Universität Zürich<br />
Der Text wurde aus dem<br />
Englischen übersetzt.<br />
Korrespondenz:<br />
Mark Honigsbaum, PH.D<br />
Medizinhistorisches<br />
Institut und Museum<br />
der Universität Zürich<br />
Hirschengraben 82<br />
CH8001 Zürich<br />
Tel. 044 634 21 96<br />
m.honigsbaum[at]mhiz.uzh.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Der Film «Planet der Affen: Prevolution», der letztes<br />
Jahr in die Kinos kam, hat ein ganz spezielles Ende.<br />
Während bereits der Abspann läuft, sieht man ein<br />
Flugzeug und seinen mit einem tödlichen Gehirnvirus<br />
infizierten Piloten. Beim Abflug in San Francisco<br />
hatte man schon sein blutiges Husten beobachten<br />
können. Man erahnt, dass auf die Menschheit etwas<br />
Unheilvolles zukommt, denn der Weg des Flugzeugs –<br />
zunächst nach New York und anschliessend nach<br />
Frankfurt – spinnt schon bald ein Netzgewebe aus<br />
kreuz und quer sich überschneidenden Linien um<br />
den Erdball.<br />
Rechnet man die Zahl der Linien, die allein auf<br />
e iner Karte des LufthansaFlugplans eingezeichnet<br />
sind, hoch zehn, sind die Verbreitungsmöglichkeiten<br />
des Virus symbolisch schnell erkennbar – und gleichzeitig<br />
auch das technologische Netzwerk, das die Verbreitung<br />
von materiellen und immateriellen Dingen<br />
in Prevolution ermöglicht. Und nebenbei ist so der<br />
Fortsetzungsfilm mit dem kurz bevorstehenden Weltuntergang<br />
geschickt angekündigt.<br />
Seitdem in den frühen Achtzigerjahren behauptet<br />
wurde, dass der AirCanadaFlugbegleiter Gaetan<br />
D ugas – auch Patient Zero genannt – angeblich Aids<br />
nach Nordamerika eingeschleppt hat, sind neuartige<br />
Ansteckungsängste schwer einzudämmen. Dank des<br />
internationalen Flugverkehrs und der permanenten<br />
Anforderungen der globalen Märkte sind aus dem<br />
R egenwald stammende tödliche Krankheitserreger<br />
nur so weit von einer Metropole entfernt wie eine<br />
A nfahrt per LKW, Bahn oder Flug. In unserer Zeit bedeutet<br />
dies, dass sie nahezu augenblicklich dort sein<br />
können.<br />
In neueren Kinofilmen wie Prevolution oder Contagion<br />
(über das Verbreiten eines neuartigen grippeähnlichen<br />
Virus) geht es allerdings nicht so sehr um<br />
den feindlichen Einfall einer nicht sofort erkennbaren<br />
Erkrankung in unsere <strong>als</strong> keimfrei betrachtete<br />
Umwelt. Dem ContagionRegisseur Steven Soderbergh<br />
etwa geht es vielmehr um das verheerende<br />
Chaos, das durch das besagte technologische Netzwerk<br />
im 21. Jahrhundert angerichtet werden kann.<br />
Es geht um Angst<br />
Natürlich findet sich das Warnschild für biologische<br />
Gefahr auch auf den Werbeplakaten von Contagion,<br />
aber es geht eher um die Gefährdung durch die Infektiosität<br />
der Panik. Man könnte dies auch <strong>als</strong> eine<br />
m oralische oder emotionale Angst vor dem «Contagion»<br />
beschreiben, und genau dies hat Soderberghs<br />
kreative Ader angeregt, denn der englische Untertitel<br />
des Films lautet nothing spreads like fear.<br />
Die Angst oder wenigstens das Geld, das durch<br />
Angst verdient werden kann, bildet auch das Kernstück<br />
des neuen Buchthrillers von Robert Harris The<br />
Fear Index, der gerade auf Deutsch unter dem schlichten<br />
Titel «Angst» erschienen ist [1]. Der Autor nimmt<br />
eine Anleihe bei Charles Darwins The Expression of<br />
Emotions in Man and Anim<strong>als</strong> (1872), um den Leser in<br />
einem nicht gerade subtilen Handlungsablauf auf<br />
den bevorstehenden Nervenkitzel vorzubereiten:<br />
«Das Herz zieht sich schnell und heftig zusammen, so<br />
dass es gegen die Rippen schlägt oder anstösst …»,<br />
schreibt Harris, Darwin zitierend, kurz bevor ein Eindringling<br />
in das Haus seiner Hauptfigur, Dr. Alexander<br />
Hoffmann, hereinplatzt. «Wenn die Furcht auf<br />
den höchsten Gipfel steigt, dann wird der fürchterliche<br />
Schrei des Entsetzens gehört. Grosse Schweisstropfen<br />
stehen auf der Haut.»<br />
es gibt keine Garantie, dass<br />
Viren sich so verhalten, wie<br />
die Mathematik es voraussagt.<br />
Dennoch ist es nicht die Physiologie der Angst,<br />
die Harris interessiert, sondern vielmehr die Angst<br />
aus der Perspektive der Psychologie und der Epidemiologie.<br />
Harris’ Romanfigur Hoffmann, ein brillanter<br />
Physiker, hat den Dienst im CERN quittiert und<br />
in Genf einen Hedge Fonds gegründet. Dafür entwickelte<br />
er einen Algorithmus unter dem Decknamen<br />
VIXAL4, um die Finanzmärkte zu beobachten.<br />
Von einem Schriftsteller, der wie Harris ständig<br />
am Puls des Zeitgeistes schreibt, ist wohl nichts anderes<br />
zu erwarten, <strong>als</strong> dass er in seinen Roman Begriffe<br />
wie Bogeys, Quants und Swaps einfliessen lässt. Lässt<br />
man diesen Finanzjargon jedoch ausser Acht, ist das<br />
Prinzip von VIXAL4 klar: Es ist eine Finanztechnik,<br />
die Aktienleerverkäufe gerade dann empfiehlt, wenn<br />
Aufregung in den Märkten herrscht. Sozusagen <strong>als</strong><br />
Anlagetipp beschreibt er, wie die Furcht das globale<br />
Marktgeschehen stärker bestimmt <strong>als</strong> je zuvor. VIXAL4<br />
wird in seinem Roman so zu einer Art Lizenz, Geld zu<br />
drucken.<br />
Warum aber sollte gerade heutzutage grössere<br />
Furcht herrschen <strong>als</strong> zum Beispiel während des Kalten<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
262
Streiflicht Horizonte<br />
Im Film «Contagion» geht es nicht nur um ein extrem ansteckendes Virus, sondern auch um<br />
die Gefährdung durch die Infektiosität der Panik. © 2011 Warner Bros. Entertainment Inc.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Krieges, <strong>als</strong> die Welt noch unter der ständigen Bedrohung<br />
einer nuklearen Verwüstung leben musste? Verblüffend<br />
stellt Hoffmann (respektive Harris) fest: «Die<br />
zunehmende Marktvolatilität ist eine Funktion der<br />
Digitalisierung, was heisst: überspitzte menschliche<br />
Stimmungsschwankungen durch beispiellose Informationsverbreitung<br />
per Internet.» Für Harris ist es<br />
<strong>als</strong>o die Digitalisierung selbst, die eine epidemische<br />
Ausbreitung der Angst fördert.<br />
Auch Soderberghs ContagionFilm greift den<br />
G edanken auf, dass unser digitalisiertes Leben dazu<br />
tendiert, die Ausbreitung von Angst und anderen ansteckenden<br />
Emotionen zu unterstützen. Indem sich<br />
im Film ein Blogger (gespielt von Jude Law) in eine<br />
Konspirationstheorie hereinsteigert, um die Wahrheit<br />
über das Virus aufzudecken, und sich die Fachleute<br />
im Center for Disease Control (CDC) in Atlanta die<br />
Köpfe zerbrechen, inwieweit sie die Öffentlichkeit<br />
über die Epidemie unterrichten müssen, legt Soderbergh<br />
nahe, dass es in unserer technologischvernetzten<br />
Umwelt mittlerweile fast unmöglich ist, eine Hysterie<br />
in Grenzen zu halten. Stattdessen verselbständigen<br />
sich die von Bloggern und in Facebook & Co.<br />
verbreiteten Gerüchte und Halbwahrheiten in immer<br />
neuer Aufmachung. Mit dem Effekt, dass die Angst<br />
zu einer Art Virus wird und sich, ähnlich einer DNA<br />
Replikation im menschlichen Körper, immer wieder<br />
replizieren wird und Zweifel und Misstrauen verbreitet,<br />
wo immer sie auftritt.<br />
Biomedizinische Metaphern und Informatik<br />
Aber ist es richtig, wenn wir biomedizinische Metaphern<br />
im Zusammenhang mit Informatik und Sozial<br />
Epidemiologie anwenden? Denn Ansteckung ist<br />
nicht das Gleiche wie Übertragung. Darüber hinaus<br />
ist eine Kontamination durch ein lebendes Virus<br />
nicht mit einer «virtuellen» Infektion eines verselbständigten<br />
ComputerCodes zu vergleichen. Und das<br />
tun wir, wenn wir Angst auf Algorithmen reduzieren,<br />
die Finanzmärkte «infizieren».<br />
Wenn man sich, wie bisher, jedoch auf den Ansteckungseffekt<br />
im epidemiologischen Sinn bezieht, der<br />
sich dann <strong>als</strong> Metamorphose im nichtbiologischen<br />
Kontext entwickelt, kann sich eine solche Vorstellung<br />
eher <strong>als</strong> zu abstrakt herausstellen und das ganze Gerede<br />
von Computerviren und «digitaler Epidemie»<br />
lässt dann das übersehen, was sich eigentlich in InformatikNetzwerken<br />
abspielt.<br />
Es gibt auch noch einen weiteren Zusammenhang;<br />
ähnlich wie im Umkreis der Informationssicherheit<br />
werden biologische Bilder angewandt, um<br />
Computerviren zu verstehen und um somit ComputerImmunsysteme<br />
entwickeln zu können. Und in<br />
auf mathematischen Formeln basierenden epidemiologischen<br />
Studien werden Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen<br />
dazu genutzt, die Entwicklung<br />
von Epidemien zu untersuchen.<br />
Die biologische Ansteckung kann<br />
nicht mit derjenigen der virtuellen<br />
Welt des internets gleichgesetzt<br />
werden.<br />
Dank des World Health Organization’s Global Outbreak<br />
Alert and Response Network (GOARN) und einem<br />
elektronisch gesteuerten Berichtsystem über Erkrankungen,<br />
wie zum Beispiel von ProMED, werden derzeit<br />
Suchmaschinen routinemässig eingesetzt, um das<br />
Internet auf ungewöhnliche Krankheitsausbrüche zu<br />
durchforsten, während gleichzeitig andere Computer<br />
eingesetzt werden, um Epidemieausbrüche zu simulieren.<br />
Daraus ergibt sich, was der Medientheoretiker<br />
E ugene Thacker einen «Wettstreit» nennt, der in<br />
R ealzeit zwischen Netzwerken ausgeführt wird: auf<br />
der einen Seite ein biologisches Netzwerk, das Infektionen<br />
erkennt, die darüber hinaus durch moderne<br />
Transporttechnologien begünstigt werden; auf der<br />
anderen Seite ein Informationsnetzwerk, das einen<br />
raschen Datenaustausch zwischen Instituten ermöglicht<br />
[2].<br />
Dahinter steht demnach der Gedanke, dass bestimmte<br />
Verhaltensweisen von Computern mit der<br />
Biologie verstehbar gemacht werden können, während<br />
Ansteckungsgefährdungen durch Mathematik<br />
und Informatik verständlich werden. Obwohl solche<br />
Beobachtungssysteme von Krankheiten wirkungsvoll<br />
funktionieren – bestätigt durch das Beispiel der ge<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 263
Buchbesprechung HORIZONTE<br />
Mit Kindern über Brustkrebs<br />
reden<br />
Manchmal finde ich, Mama hat sich verändert.<br />
mal finde ich, Mama hat sich verändert.<br />
Mamas Haare fehlen, und ihre Brust ist auch weg.<br />
as Haare fehlen, und ihre Brust ist auch weg.<br />
«Mama», sage ich, «du siehst jetzt schon etwas anders aus,<br />
a», sage ich, «du siehst jetzt schon etwas anders aus,<br />
so ohne Haare und ohne Brust.»<br />
ne Haare und ohne Brust.»<br />
«Ja», sagt Mama, «das stimmt. Ich sehe jetzt etwas anders aus.<br />
, sagt Mama, «das stimmt. Ich sehe jetzt etwas anders aus.<br />
Aber ich habe dich noch immer genauso lieb wie vorher,<br />
r ich habe dich noch immer genauso lieb wie vorher,<br />
und nichts in der Welt wird daran etwas ändern.<br />
nichts in der Welt wird daran etwas ändern.<br />
Und wie schon immer, liebt deine Mama Schokoladeneis über alles.<br />
d wie schon immer, liebt deine Mama Schokoladeneis über alles.<br />
Wollen wir uns eins kaufen gehen?»<br />
llen wir uns eins kaufen gehen?»<br />
«Ja», sage ich, «gute Idee, Mama.»<br />
», sage ich, «gute Idee, Mama.»<br />
Anna Sax<br />
anna.sax[at]saez.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Was geht in Kindern vor, wenn ihre Eltern schwer<br />
erkranken? Wie soll man ihnen erklären, weshalb<br />
der Mutter plötzlich die Kraft fehlt, sich so wie früher<br />
um sie zu kümmern? Wie ihnen verständlich<br />
machen, dass sie keinen Lärm machen dürfen, weil<br />
Mama mitten am Tag schlafen muss? Wo bleiben<br />
die Bedürfnisse des Kindes, wenn sich alles nur<br />
noch um die kranke Mutter dreht? Ein liebevoll<br />
i llustriertes Bilderbuch erzählt über den Alltag und<br />
die Sorgen der kleinen Lulu, die lernen muss, mit<br />
der Krankheit ihrer Mutter zu leben und diese zu<br />
verstehen.<br />
Das Buch richtet sich an Kinder zwischen zwei und<br />
acht Jahren und erklärt auf altersgerechte Weise, was<br />
Brustkrebs ist und wie sich die Krankheit und ihre Behandlung<br />
auswirken kann. Und es unterstützt Eltern<br />
darin, mit ihren Kindern über das Unfassbare zu reden.<br />
Lulu backt am liebsten zusammen mit Mama Kuchen,<br />
die besten weit und breit. Und sie spielt gerne<br />
P iratin, und Piratinnen sind bekanntlich nicht besonders<br />
leise. Doch Mama ist manchmal einfach zu müde,<br />
um mit Lulu zu backen oder zu spielen. Sie muss sich<br />
oft ausruhen und verträgt dann keinen Lärm. Mama<br />
hat Brustkrebs. «Weisst du, Lulu», erklärt sie, «mir gefällt<br />
die Chemotherapie nicht. Manchmal wird mir<br />
richtig schlecht davon, und sie macht mich kribbelig<br />
und manchmal schlecht gelaunt. Aber sie ist nötig, damit<br />
wir den Krebs vertreiben können.» Das ist nicht<br />
immer einfach für Lulu, es macht sie traurig und<br />
manchmal richtig wütend. Dann muss sie herumtoben<br />
und brüllt sogar ihren Stoffhasen Hoppel an,<br />
dem sie sonst alle Geheimnisse anvertraut.<br />
Und doch kann das kleine Mädchen der Krankheit<br />
ihrer Mutter auch positive Seiten abgewinnen: So hat<br />
sie manchmal ihren Papa ganz für sich allein, oder sie<br />
schlägt bei der Oma die Trommeln, so laut, dass die<br />
Katze fauchend die Flucht ergreift. Und ihre Mama, die<br />
so anders aussieht ohne Haare und ohne Brust, die hat<br />
sie genau so lieb wie vorher, daran besteht kein Zweifel.<br />
Und so setzen sich Mutter und Tochter zusammen<br />
ins Gras und schauen die Sterne an. «Weisst du was»,<br />
sagt Mama, «manchmal bin ich müde, manchmal<br />
muss ich ins Spital, manchmal bin ich traurig und<br />
manchmal bin ich wütend. Aber immer, Lulu, immer,<br />
immer bist du mir das Allerliebste auf der Welt.»<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
Anne-Christine<br />
Loschnigg-Barmann,<br />
Judith Alder<br />
Manchmal ist Mama<br />
müde<br />
Ein Kinderbuch zum<br />
Thema Brustkrebs<br />
Basel: EMH <strong>Schweizerische</strong>r<br />
Ärzteverlag; 2011.<br />
36 Seiten, 14.50 CHF<br />
ISBN 978-03754-061-9<br />
265
Streiflicht Horizonte<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
rade noch rechtzeitigen Reaktion auf SARS im Jahre<br />
2003 –, könnten sie sich auch <strong>als</strong> Eigentore erweisen.<br />
Interessanterweise ist dies nicht nur eine Frage<br />
e xakter Daten. Durch die Epidemiologie lassen sich<br />
zwar Statistiken erarbeiten, weil sie auf tatsächlichen<br />
Gegebenheiten basieren, wirkliche Viren verhalten<br />
sich allerdings eher auf ungeregelte Weise. Unabhängig<br />
davon, wie genau vorhandene Daten sein mögen,<br />
gibt es keine Garantie darauf, dass Viren sich so verhalten,<br />
wie die Mathematik es voraussagt – daher die<br />
ungenauen Prognosen über Sterblichkeitsraten anlässlich<br />
der Schweinegrippe im Jahr 2009.<br />
Gerade solche oft fehlerhaften Voraussagen haben<br />
die öffentliche Meinung zunehmend misstrauisch<br />
g egenüber der Wissenschaft gemacht. Dies erklärt<br />
auch, weshalb Konspirationstheorien, wie sie der erwähnte<br />
Blogger Alan Krunwiede in Contagion repräsentiert,<br />
grossen Zuspruch finden. Als obsessiver<br />
Blogger verbringt er einen Grossteil des Films damit,<br />
dass er das CDC bezichtigt, mit den grossen<br />
Pharmaunternehmen unter einer Decke zu stecken,<br />
und verteilt gleichzeitig Flugblätter über homöopathische<br />
Mittel gegen das Virus. Natürlich ist hier<br />
eine gewisse Ironie zu erkennen, denn unter Gesichtspunkten<br />
der Sozialepidemiologie ist Misstrauen<br />
ansteckend. Mit Hilfe von Twitter, Facebook und<br />
a nderen sozialen Medien verbreiten sich Konspirationstheorien<br />
so rasch wie alle anderen Viren und<br />
entfachen Skepsis, Angst und manchmal auch Hass<br />
auf Autoritäten, ganz gleich, ob damit nun ein WHO<br />
Repräsentant in Genf oder ein Banker in Zürich gemeint<br />
ist.<br />
Genauso wie die biologische Ansteckung nicht<br />
mit derjenigen der virtuellen Welt des Internets<br />
gleichgesetzt werden kann, sollte man Computerviren<br />
nicht mit ihrem biologischen Pendant in einen<br />
Topf werfen. Das nämlich ist die Falle, in die Epidemiologen<br />
geraten, wenn sie mit Modellen der Mathematik<br />
Ansteckungsgefahren von Mensch zu Mensch<br />
erklären wollen.<br />
Nur deshalb, weil das CDC den Sexualkontakt<br />
von Gaetan Dugas und an HIV infizierten Männern<br />
in San Francisco, Los Angeles und anderen Städten in<br />
Amerika in den frühen Achtzigerjahren rückverfolgen<br />
konnte, war Dugas nicht unbedingt Patient Zero.<br />
So viel man weiss, gibt es noch weitere Patients Zero.<br />
Sie sind lediglich Knotenpunkte in einem grossen<br />
Netz.<br />
Der Rückgriff auf Metaphern eines Contagions<br />
auf den Finanzmärkten erklärt auch nicht die derzei<br />
tigen Volatilitäten dort. Und wenn es noch so nahe<br />
liegt, diese Volatilität der Digitalisierung zuzuschreiben,<br />
ist die Ansicht von Harris doch sicherlich f<strong>als</strong>ch,<br />
wenn er meint, das Internet trage dazu bei, «menschliche<br />
Stimmungsschwankungen» zu verschärfen. Vielmehr<br />
sei solche Volatilität, so heisst es in einem kürzlich<br />
erschienenen Bericht über Contagion in Financial<br />
Networks der Bank of England, auf zunehmend komplexere<br />
Netzwerke und eine Vernetzung unter den<br />
F inanzinstituten zurückzuführen [3].<br />
Wenn Defaults, <strong>als</strong>o Zahlungsausfälle, sich über<br />
das gesamte Finanzsystem verbreiten, so argumentie<br />
Das enge Vernetztsein macht uns für Ansteckungsprozesse emotionaler<br />
natur empfänglich und damit verletzbar.<br />
ren die Autoren des Berichts, dann verringert ein dichtes<br />
finanzielles Netz von Abhängigkeiten, dass immense<br />
Verluste, wie sie im Fall der Lehman Brothers<br />
vorkamen, andere Banken und Investmentgesellschaften<br />
mitreissen. Gleichzeitig machen diese Abhängigkeiten<br />
es aber wahrscheinlicher, dass die Ausbreitung<br />
von Zahlungsproblemen über den Ansteckungseffekt<br />
weiter gestreut ist. Das sich daraus e rgebende Resultat<br />
nennen die Autoren eine robust-yet-fragile tendency: Die<br />
Wahrscheinlichkeit einer epidemischen Ausbreitung<br />
solcher Finanzprobleme ist gering. Sollte der Fall aber<br />
eintreten, würden sie sich sehr weit verbreiten. In dieser<br />
epidemischen Situation der Finanzmärkte befinden<br />
wir uns gerade. Dies erklärt auch, warum FTSE, Dow<br />
und Nikkei immer weiter fielen, <strong>als</strong> die europäischen<br />
Regierungen den BailOut Griechenlands im letzten<br />
Herbst so zögerlich angingen.<br />
Aus diesem Grund ist es heute eine viel grös<br />
sere Herausforderung, das Vertrauen in den Finanzmarkt<br />
wiederherzustellen, <strong>als</strong> dies 1932 der Fall war,<br />
<strong>als</strong> Franklin D. Roosevelt seine berühmte Rede an die<br />
amerikanische Bevölkerung hielt, sie hätte nothing to<br />
fear, but fear itself. Heutzutage ist es das enge Vernetztsein<br />
untereinander, das uns für solche Ansteckungsprozesse<br />
emotionaler Natur empfänglich und damit<br />
verletzbar macht. In diesem Sinne sind die Netzwerke<br />
die eigentlichen Quellen von Unbeständigkeit und<br />
Angst.<br />
Literatur<br />
1 Harris R. Angst. München: Heyne; 2011.<br />
2 Thacker E. Living Dead Networks. Fibreculture<br />
(Onlinezeitschrift). 4; 2005. http://four.fibreculturejournal.org/fcj018livingdeadnetworks/<br />
3 Gai P, Kapadia S. Contagion in Financial Networks.<br />
Bank of England Working Paper No. 383. www.<br />
bankofengland.co.uk/publications/workingpapers/<br />
wp383.pdf<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7 264
Niemandsland<br />
Schimären aus zusammengesetzten<br />
Tierleibern<br />
bevölkern in der Vorstellung<br />
mittelalterlicher Denker<br />
die Randzonen der Erde.<br />
erhard.taverna[at]saez.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Auf unseren Karten ertragen wir keine weissen<br />
F lecken. Am augenfälligsten zeigen das die bilderreichen,<br />
geographischen Darstellungen mittelalterlicher<br />
Klöster. Der Erdkreis, den aussen das schmale<br />
Band des Weltmeeres zusammenhält, wird von der<br />
Gestalt Christi zusammengehalten, Kopf, Hände<br />
und Füsse begrenzen oder überragen den nach<br />
Osten ausgerichteten Rand. Wissenschaft, Weltanschauung<br />
und Kunst gestalten die auf den Glauben<br />
gegründete Topografie der radförmigen Scheibe,<br />
mit dem goldenen Jerusalem im Mittelpunkt. Im<br />
christlichen Schöpfungsplan haben die antiken<br />
Vermessungen keinen Platz. Die Werke folgen einem<br />
sakralen Muster, sie sollen deuten und nicht im<br />
modernen Sinne erklären. Die frommen Zeichner<br />
haben die bewohnten Landschaften fantasievoll<br />
mit biblischen und mythischen Motiven ausgeschmückt,<br />
mit Pilgern und Kreuzfahrern, Argonauten<br />
und Tieren. Die Randzonen bevölkern mit<br />
z unehmendem Radius immer mehr Fabelwesen.<br />
Schimären aus zusammengesetzten Tierleibern,<br />
halb Fisch, halb Vogel, fellbehaart, mit schuppig<br />
geschwänztem Unterleib, fiedelspielende Nereiden,<br />
geflügelte Drachen, heidnische Figuren. Im Bannkreis<br />
des Guten sind Adam und Eva, das goldene<br />
Vlies und die Arche Noah, weit von der Mitte spuken<br />
Geister und Dämonen im Niemandsland.<br />
Selbst innerhalb eines geschlossenen Weltbildes erträgt<br />
die Fantasie keine Leerstellen, wo die konkrete<br />
Anschauung fehlt, beginnt das Reich der<br />
Imagination. Seefahrt und Handel brauchen Kartographen,<br />
Meridiane und Koordinaten, Kompass<br />
und Sextant.<br />
Geologie und Evolutionslehre haben eine neue<br />
Geographie begründet. Diese versetzt Berge und Kontinente<br />
in Bewegung, denn nichts bleibt für immer.<br />
Seither reisen wir durch die Farnwälder und Sümpfe<br />
von Pangäa und Gondwana und navigieren durch die<br />
Thetys, <strong>als</strong> wären wir dort heimisch gewesen. Wieder<br />
begegnen wir Wesen, die kein fleissiger Mönch sich<br />
hätte ausdenken können. Dieser Zoo der Spezialisten<br />
ist längst aus dem wissenschaftlichen Käfig ausgebrochen.<br />
Er führt in Spielfilmen und Träumen ein Eigenleben<br />
und materialisiert sich im Kinderzimmer,<br />
f riedlich vereint mit den Spukgestalten der alten<br />
S agen- und Märchenwelt. Die neuen Erdkarten sind<br />
grenzenlos, wie das neue Denken, alles ist möglich,<br />
reale Horizonte mischen sich mit erdachten Grenzen,<br />
mit Niemandsländern wie Narnia, Avalon und Mittelerde.<br />
Nur wo der Hunger herrscht, bleibt das Schlaraffenland<br />
im leeren Magen verortet. Die Satten orientieren<br />
sich am Imaginären, zum Beispiel an Atlantis.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
ZU GUTER LETZT<br />
Seit Platon erhitzt der versunkene Kontinent die Gemüter<br />
aller Suchenden. Nicht wenige träumen über<br />
ihren Karten von einer ursprünglichen Heimat blauäugiger<br />
und weisser Megalithiker, deren Sternkonstellationen<br />
und steinzeitliche Gitternetze die arische<br />
Richtung vorgeben.<br />
Jeder Gedanke lässt sich in eine Karte übertragen.<br />
Wo die glücklichsten Menschen wohnen, wo die Armut<br />
zu Hause ist, wo Rohstoffe sind und Niederschläge,<br />
wo Krebs vorkommt und Suizide, jeder Massangabe<br />
entspricht eine Farbschattierung innerhalb<br />
der vertrauten Ländergrenzen. Die Statistik kennt<br />
keine weissen Flecken. Die Ränder weiten sich immer<br />
mehr aus, bis zu den Sternen. Die neuen Niemandsländer<br />
liegen im Weltraum. Roboter und Satelliten<br />
kartieren die Planeten und Monde des Sonnensystems.<br />
Wir nehmen sie mit unseren Namen aus Mythologie<br />
und Gegenwart in Besitz. Wo keine Menschen<br />
wohnen, ist Niemandsland. Schon rammt die Fantasie<br />
ihre Fahnen in den Boden. Noch sind die Krater<br />
besitzlos, niemand hat die zweiundsechzig Monde<br />
des Saturns betreten, keiner die Eiskruste des Jupitermondes<br />
Europa durchstossen, um in dessen unterirdischen<br />
Ozean einzutauchen. Doch die neuen Daten<br />
beflügeln die Visionen der Macher und der Geschichtenerzähler.<br />
Die Gedanken kolonisieren die extremsten<br />
Orte, das öde Grenzland, wo die Schimären und<br />
Nereiden zu Hause sind. Es sind Territorien, die es zu erobern<br />
gilt, zukünftige Reiche technischer Macht und<br />
vorweggenommener Heldentaten. Kein Niemandsland<br />
bleibt auf die Dauer unbesiedelt. Ob Sindbads<br />
Magnetberg oder das Eldorado des Konquistadors,<br />
ihre Vorstellungen provozieren die Fantasie und den<br />
Verstand. Die Neugier setzt die Segel, und die Habgier<br />
sorgt für einen kräftigen Wind.<br />
Natürlich ist die Medizin ein Werkzeug dieser<br />
Wünsche. Ihre Forschung kartiert Gene und Hirnareale<br />
und verheisst uns eine prädiktive Zukunft. Noch<br />
weiss kein Mensch, wie dieses erhoffte Neuland<br />
a ussehen wird. Doch schon hat die Literatur sich<br />
dort niedergelassen und adressiert das ganze Spektrum<br />
schlimmster Befürchtungen und transhumaner<br />
Träume. Die einen fürchten den totalitären Gesundheitsstaat,<br />
die anderen beschäftigen die gesellschaftlichen<br />
Auswirkungen einer mindestens 200-jährigen<br />
Lebenszeit. Utopien sind das Niemandsland für langfristige<br />
Projekte, für Sehnsuchtsorte und Katastrophenszenarien.<br />
Das Vakuum der Möglichkeiten füllt<br />
sich augenblicklich mit unseren Illusionen. Darin<br />
u nterscheidet uns nichts von mittelalterlichen<br />
M önchen. Wir können nicht anders.<br />
Erhard Taverna<br />
266
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Die letzte Seite der SÄZ wird von Anna frei gestaltet, unabhängig von der Redaktion.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 7<br />
ANNA<br />
www.annahartmann.net