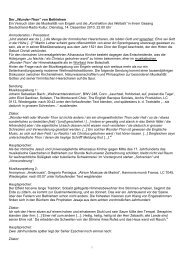1 Das A.B.C. der Klangrede I Geltung, Gesundheit, Gemüt und ...
1 Das A.B.C. der Klangrede I Geltung, Gesundheit, Gemüt und ...
1 Das A.B.C. der Klangrede I Geltung, Gesundheit, Gemüt und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Das</strong> A.B.C. <strong>der</strong> <strong>Klangrede</strong> VII<br />
Mathematik <strong>und</strong> Glaube: Musik als Kryptogramm<br />
Die musikalische Lingua Franca des 16. bis 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts, ihre historischen Vertreter <strong>und</strong> ihre mo<strong>der</strong>nen Verfechter<br />
Auch wenn eine präzise Übertragung klangrednerischer Inhalte des musikalischen Barock in die Sprache <strong>der</strong><br />
Hermeneutik gr<strong>und</strong>sätzlich an mehreren Hürden scheitern kann: xcvi Es gibt Fälle, in denen sich ein solcher Transfer<br />
allemal lohnt, <strong>und</strong> bei denen er sogar nachweislich <strong>der</strong> Absicht ihrer fe<strong>der</strong>führenden Autoren entspricht. Einziges Problem<br />
dabei: Die Urheber <strong>der</strong> Stücke sind dann in <strong>der</strong> Regel keine Berufskomponisten, son<strong>der</strong>n Mathematiker, Schachvirtuosen<br />
o<strong>der</strong> Philosophen, <strong>und</strong> ihre Systemtheorien finden sich in keinem Lehrwerk zur „Musica Poetica“ o<strong>der</strong> zur „<strong>Klangrede</strong>“<br />
wie<strong>der</strong>. Wenn man so will, handelt es sich bei ihren Nie<strong>der</strong>schriften um den Versuch, aus verschiedenen Parametern <strong>der</strong><br />
Musik eine spezielle Form von Plansprache zu konstituieren. Es geht hier um einen gezielten „Lusus Poeticus“ für<br />
Musikverständige, bei dem vermittels einer zuvor festgelegten Kodierung – eines „Paragrammes“ – Noten, Töne o<strong>der</strong><br />
Tonverbindungen durch Buchstaben o<strong>der</strong> Begriffe ersetzt werden.<br />
Diese gezielte Substitution von musikalischem Material durch Elementarbausteine von Sprache führt schließlich zu einer<br />
vollkommen neuen, kunstsprachlichen Semantik, <strong>und</strong> sie ersetzt alle bisher vorgestellten Systeme <strong>der</strong> Musikrhetorik. <strong>Das</strong><br />
bedeutet allerdings auch, dass die Botschaft solcher Musikwerke sich dem Zuhörer ohne ein abgeschlossenes Studium<br />
ihrer geltenden Paragramme niemals unmittelbar – etwa über angeborene Lautmuster xcvii o<strong>der</strong> affektbezogene<br />
Dimensionen – erschließen wird. Verständlichkeit beruht hier ausschließlich auf einer klaren Vereinbarung zwischen<br />
„Sen<strong>der</strong>“ <strong>und</strong> „Empfänger“. Ihr musikalischer Zauber übersteigt in aller Regel kaum den ästhetischen Reiz von<br />
Morsealphabeten o<strong>der</strong> den Lauten, die wir in den Hörern von Tonwahltelefonen beim Wählen wahrnehmen (<strong>der</strong><br />
Nachweis effektiver Unterschiede bei <strong>der</strong> Wahrnehmung von Tonwahlmelodien, die zu den Rufnummern geliebter<br />
Menschen gehören <strong>und</strong> solchen, die wir lästigen Zeitgenossen zuordnen, könnte ohne Weiteres Gegenstand einer<br />
geson<strong>der</strong>ten Untersuchung sein).<br />
Der früheste Ansatz zu einem System, das die Töne von Melodien durch Buchstaben des Alphabets ersetzt, ist beinahe<br />
so alt wie <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> „Musica poetica“ selbst <strong>und</strong> erscheint erstmals 1583 in dem Lehrbuch „De furtivis literatum notis“<br />
aus <strong>der</strong> Fe<strong>der</strong> des neapolitanischen Philosophen Giovanni Battista della Porta. Später greifen die Gelehrten Daniel<br />
Schwenter xcviii sowie Athanasius Kircher xcix seine Idee auf. Die Kodierungen <strong>der</strong> drei Sprachbaumeister unterscheiden<br />
sich nicht sehr voneinan<strong>der</strong>: Sie ordnen den Namen von Tönen innerhalb einer Skala von an<strong>der</strong>thalb Oktaven – abhängig<br />
davon, ob es sich um eine Brevis o<strong>der</strong> eine Semibrevis handelt – jeweils zwei Buchstaben zu. Kircher gelingt es auf diese<br />
Weise etwa, die vielsagende lateinische Behauptung „Ce<strong>der</strong>e cogemur“ („wir werden gezwungen werden, uns in unser<br />
Schicksal zu fügen“) in eine klangvolle Melodie umzuwandeln.<br />
Der passionierte Schachmeister <strong>und</strong> Bücherfre<strong>und</strong> Herzog August II. von Braunschweig-Lüneburg beschert <strong>der</strong> Welt zu<br />
Beginn <strong>der</strong> dritten Dekade des 17. Jahrhun<strong>der</strong>ts unter seinem Decknamen „Gustavus Selenus“ das nächste<br />
kryptographiche System. c Sein Paragramm begnügt sich aber nicht mit <strong>der</strong> Übertragung einzelner Tonnamen in die<br />
Lettern des Alphabets. Er ordnet festgelegten Kombinationen von je zwei unterschiedlichen Tonstufen im relativen<br />
Solmisationssystem einen Buchstaben zu. Der Rhythmus hat bei ihm im Gegensatz zu den Verfahren Della Portas,<br />
Schwenters <strong>und</strong> Kirchers keine funktionale Bedeutung im Hinblick auf die textuelle Aussage <strong>der</strong> Musik <strong>und</strong> gehorcht<br />
ausschließlich dem ästhetischen Gespür des Schreibers. Damit befreit Selenus den Rhythmus als einen entscheidenden<br />
Gestaltungsparameter musikalischer Komposition bewusst von den Fußfesseln kryptographischer Regelsysteme <strong>und</strong><br />
ermöglicht dem Musikschaffenden eine weitaus ungetrübtere Liaison zwischen kreativen <strong>und</strong> sprachlichen Aspekten. Die<br />
hinzugewonnene Freiheit macht ihm offensichtlich großen Spaß: Er verfasst gleich drei vierstimmige Consortstücke, die<br />
allesamt verborgene Textbotschaften enthalten. Der Tenorpart eines dieser Werke gibt etwa einen Kommentar des<br />
Herzogs zur weltpolitischen Lage anno 1620 wi<strong>der</strong>: „Der Spinola ist in die Pfaltz [ein]gefallen. Vae illi“ (lat. „wehe ihm“).<br />
Am Ende ist es Gottfried Wilhelm Leibniz, <strong>der</strong> die verschiedenen kunstsprachlichen Anlagen von Musik bündelt <strong>und</strong> das<br />
Prinzip musikalischer Kryptogrammatik mit dem Entwurf einer schlüssigen Lingua Franca auf die Spitze treibt. ci Seiner<br />
Idee ist im Gegensatz zu allen Vorgängermodellen nicht mehr an einem buchstabengenerierenden Verfahren gelegen,<br />
son<strong>der</strong>n an einem System, das aufeinan<strong>der</strong> bezogene Tonfolgen in komplexe semantische Begriffe – wie etwa die<br />
Substantive „Zeit“, „Tag“, „Woche“, „das Gute“, „das Böse“, „Gott“ o<strong>der</strong> „Teufel“ – überträgt. Musik ist für Leibniz eine<br />
„verborgene Rechenübung <strong>der</strong> Seele“ cii , <strong>und</strong> in <strong>der</strong> kombinatorischen Verknüpfung mit sprachlichen Morphemen, Zeichen<br />
<strong>und</strong> Begriffen sieht er allem Anschein nach das geeignetste Mittel ihrer Offenbarwerdung.<br />
Wenn die neueren Methoden zur Exegese außermusikalischer Inhalte im Schaffen Johann Sebastian Bachs berechtigt<br />
sein sollten, dann können wir in <strong>der</strong> Gestalt des Thomaskantors so etwas wie einen Vollen<strong>der</strong> von Leibnizs – zu<br />
Lebzeiten nur umrisshaft skizziertem – musikalischen Gedanken sehen. Aber die Methoden <strong>der</strong> Hermeneutik sind<br />
umstritten.<br />
Angefangen hat alles damit, dass <strong>der</strong> evangelische Theologe Friedrich Smend – genau zweihun<strong>der</strong>t Jahre nach dem Tod<br />
Bachs – auf dem Porträt, das Elias Gottlieb Haussmann 1746 von dem Director Musices anfertigte, vierzehn silberne<br />
Knöpfe an dessen Jacke entdeckt. ciii Der Umstand selbst wäre kaum <strong>der</strong> Rede wert, hätte Smend damit nach eigenem<br />
Bek<strong>und</strong>en nicht auch eine verschlüsselte Signatur Bachs in Zahlen aufgespürt. Was auf dem Ölgemälde zu sehen ist,<br />
lässt nämlich auch an Partituren nachweisen, zum Beispiel an jenem „Canon Triplex“, den <strong>der</strong> Porträtierte in seiner<br />
rechten Hand hält.<br />
Nachdem Smend das Stück – auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage einer hun<strong>der</strong>t Jahre älteren Untersuchung von Johann Anton André <strong>und</strong><br />
Carl Ferdinand Becker – zunächst erfolgreich in die erfor<strong>der</strong>lichen Stimmeneinsätze <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Intervallverhältnis<br />
aufgelöst hat, verspricht er <strong>der</strong> Leserschaft gleich die nächste Enthüllung, denn „mit <strong>der</strong> Auffindung d[er] Stimmführungen<br />
12