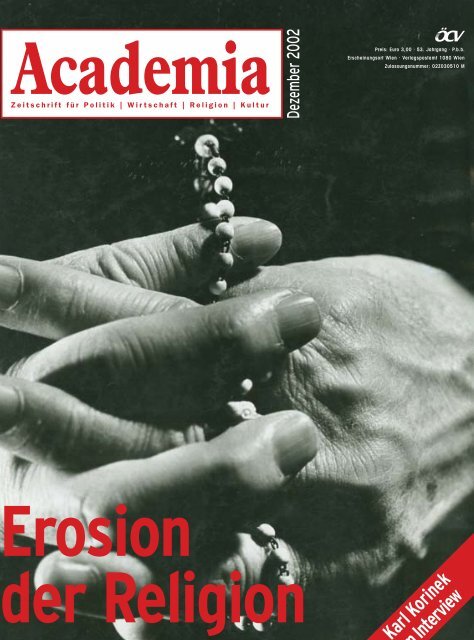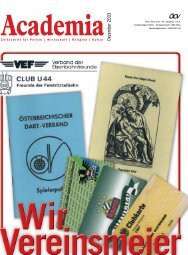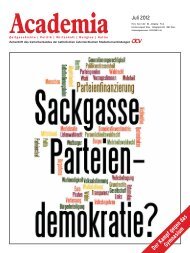Academia 4/2002 - oecv@mursoft.at
Academia 4/2002 - oecv@mursoft.at
Academia 4/2002 - oecv@mursoft.at
- TAGS
- academia
- oecv.mursoft.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dezember <strong>2002</strong><br />
Erosion<br />
der Religion<br />
Preis: Euro 3,00 . 53. Jahrgang . P.b.b.<br />
Erscheinungsort Wien . Verlagspostamt 1080 Wien<br />
Zulassungsnummer: 02Z030510 M<br />
Karl Korinek<br />
im Interview
VOR MIR EIN „JA“.<br />
www.uniqa.<strong>at</strong>
Titel | Erosion der Religion<br />
7<br />
10<br />
12<br />
14<br />
16<br />
17<br />
20<br />
21<br />
22<br />
36<br />
Regina Polak/Paul M. Zulehner<br />
Religiöser Wandel in Österreich<br />
Georg Kastner<br />
Es braucht Mut und Anstrengung<br />
Maximilian Liebmann<br />
Freie Kirche im freien Sta<strong>at</strong><br />
Franz Trimmel<br />
Zwei Paar Schuhe<br />
Erhard Mayerhofer<br />
Thesen zu Religions- und Ethikunterricht<br />
Stefan Lorger-Rauwolf<br />
Der Teufel ist los<br />
Peter A. Ulram<br />
Religionsbekenntnis und Wahlverhalten<br />
Andreas Kresbach<br />
Hauptmissionsgebiet Europa<br />
Europa<br />
Johannes Michael Schnarrer<br />
Das ungelöste Problem<br />
Wirtschaft<br />
Rainer Wolfbauer<br />
Eine Altern<strong>at</strong>ive für die Zukunft<br />
25<br />
28<br />
32<br />
39<br />
42<br />
Politik<br />
Hans-Peter Bischof<br />
Modellprojekt Gesundheitsfonds<br />
Interview mit Karl Korinek<br />
„Unglaublich unüberschaubar“<br />
Fritz Kofler<br />
Die Hoffnung für Graz<br />
Kultur<br />
Fritz Kofler<br />
Foto-Kunst als Berufung und<br />
Lebenserfüllung<br />
Georg Kastner<br />
Geschüttelt, nicht gerührt<br />
Kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 31<br />
Kurz notiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />
Porträt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
Rückspiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
Rezensionen . . . . . . . . . 38, 44, 45, 46, 47<br />
Leserbriefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />
3<br />
Inhalt<br />
Dezember <strong>2002</strong>/Nr. 5<br />
<strong>Academia</strong><br />
Herausgeber, Medieninhaber:<br />
ÖCV und ÖAHB<br />
Mit der Herausgabe beauftragt:<br />
Dr. Herbert Kaspar<br />
Chefredakteur: Mag. Paul Hefelle<br />
Redaktion: Berthold Föger,<br />
Walter Gröblinger, Norbert Hartl,<br />
Gerhard Hartmann, Peter<br />
Hofbauer, Ernst Kallinger, Georg<br />
Kastner, Fritz Kofler, Andreas<br />
Kresbach, Bernhard Marckhgott,<br />
Harald Pfannhauser, Johannes<br />
Michael Schnarrer, Helmut<br />
T<strong>at</strong>zreiter, Gerhard Tschugguel,<br />
Norbert Tschulik, Hubert Weber,<br />
Helmut Weintögl<br />
Layout: Tanja Pichler<br />
Verlagsleitung: Hildegunde Metz,<br />
Herbert Kaspar<br />
Inser<strong>at</strong>akquisition: Media<br />
Contacta, Hans Dieter Roider,<br />
Tel.: (01) 523 29 01<br />
Redaktionsmanagement:<br />
Hildegunde Metz<br />
Anschrift: Lerchenfelder Str. 14,<br />
1080 Wien, Telefon: (01) 405<br />
16 22 DW 30, 31. Fax DW 44,<br />
E-Mail: wt.academia@oecv.or.<strong>at</strong><br />
Repro/Druck: AV-Druck plus GmbH<br />
Faradaygasse 6<br />
A-1030 Wien<br />
Tel. 01/797-85-0<br />
Hinweis: Beiträge in der<br />
ACADEMIA, die die offizielle<br />
Meinung des Österreichischen<br />
Cartellverbandes wiedergeben,<br />
sind als solche ausdrücklich<br />
gekennzeichnet. Alle anderen<br />
Veröffentlichungen stellen die<br />
persönliche Meinung des Autors<br />
dar.<br />
Fotos: AG MEDIA, Aragon Verlag,<br />
Gerhard B. Benesch, Böhlau<br />
Verlag, Burgstaller, Gürer,<br />
Renault, Christopher Kaspar,<br />
Die Presse, Paul Hefelle,<br />
Ironimus, Ibera Verlag,<br />
Ueberreuther, Prinz Poidl,<br />
Tramin, Ursus, Verlagsanstalt<br />
Athesia, ÖCV-Bildarchiv<br />
Verkaufspreis:<br />
öS 41,30,– | 3 Euro, Abo:<br />
öS 137,60,– | 10 Euro/Jahr für<br />
Studenten, Normalabo<br />
öS 206,40,– | 15 Euro/Jahr.<br />
Für unverlangt eingesandte<br />
Manuskripte kann keine Gewähr<br />
übernommen werden.<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Cartoon<br />
4<br />
Danke. ÖVP<br />
1/4 4c<br />
Liebe Freunde im Cartellverband!<br />
Ich danke allen sehr herzlich, die sich in der Initi<strong>at</strong>ive<br />
"p<strong>at</strong>ria 2411" für diesen historischen Wahlerfolg der<br />
ÖVP engagiert haben. Großartig, wie kompetent Sie<br />
sich als Gesinnungsgemeinschaft in unsere Wahlbewegung<br />
eingebracht haben. Ich darf Ihnen versichern:<br />
Die ÖVP und Österreich braucht Sie!<br />
Ein fröhliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches<br />
Jahr 2003 wünscht Ihnen<br />
www.oevp.<strong>at</strong> Danke.<br />
Politiker als Ladenhüter<br />
Bibliophilen Wahlbürgern war schon vor dem 24.<br />
November klar, wessen Wahlaktien am besten standen,<br />
denn ein großer Wiener Restauflagen-Buchhändler<br />
brachte aktuelle, wahlkampfbezogene Sonderangebote:<br />
Haider, Gusenbauer und Van der Bellen<br />
wurden um jeweils Euro 4,99 (st<strong>at</strong>t Euro 23,80) angepriesen.<br />
Nur von Wolfgang Schüssel fand sich keine<br />
Billigauflage – zu recht, wie man inzwischen weiß.<br />
Ob die drei anderen Ladenhüter vor Weihnachten<br />
nochmals verbilligt werden bleibt abzuwarten.<br />
H. K.<br />
Anmerkung: Zur besseren Lesbarkeit verzichten<br />
wir in der ACADEMIA auf Schreibweisen wie<br />
zum Beispiel Österreicher/Innen. Selbstverständlich<br />
sind bei allen derartigen Erwähnungen Frauen<br />
und Männer gleichwertig gemeint.<br />
Leider ist in der letzten Ausgabe der bekannte<br />
Künstler Prof. Ernst Degasperi zu einem „Degaspari“<br />
mutiert, was wir sehr bedauern und hiermit<br />
richtig stellen.<br />
Zeichnung: M.Szyszkowitz;
Exklusivität entspannt genießen<br />
Diners Club Classic Card<br />
Ein Produkt von AirPlus<br />
Mit jedem mal wertvoller www.dinersclub.<strong>at</strong>
Editorial<br />
Liebe Leser!<br />
6<br />
Er ist also wahr geworden. Der Traum von der wirklichen politischen<br />
Wende, die viele Mitglieder der k<strong>at</strong>holischen couleurstudentischen<br />
Verbände lange herbeigesehnt haben. In<br />
einem fulminanten Wahlkampf h<strong>at</strong> die ÖVP unter Wolfgang<br />
Schüssel einen Erdrutschsieg bei den N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahlen am<br />
24. November gelandet. Dabei h<strong>at</strong> sie sich intensiv wie schon<br />
lange nicht um die Mitglieder der k<strong>at</strong>holischen Studentenverbindungen<br />
bemüht. Mitglieder der Korpor<strong>at</strong>ionen – nicht<br />
der Verband als solches, er bleibt parteipolitisch ungebunden<br />
– können sich denn auch einen nicht zu geringen Teil<br />
dieses Erfolges der ÖVP auf Ihre Fahnen heften. Die von Klubobmann<br />
Andreas Khol, R-B, ins Leben gerufene Aktion „p<strong>at</strong>ria<br />
2411“ h<strong>at</strong> vor allem in der Bundeshauptstadt Anteil an<br />
einem beeindruckenden Ergebnis.<br />
Die ACADEMIA h<strong>at</strong> in der letzten Ausgabe des heurigen Jahres<br />
trotz der N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahl ein anderes Titelthema, das<br />
uns gerade in Hinblick auf das Weihnachtsfest wichtig erscheint.<br />
Die Erosion der Religionsgemeinschaften h<strong>at</strong> in<br />
Österreich Ausmaße angenommen, die bisher unvorstellbar<br />
waren. Am deutlichsten sind die Zahlen in Wien, wo<br />
sich der Anteil der K<strong>at</strong>holiken nur mehr um die 50 Prozent<br />
der Gesamtbevölkerung bewegt. Gesamtösterreichisch gesehen<br />
sind nur mehr 74 Prozent k<strong>at</strong>holisch, die zweitgrößte<br />
Gruppe sind mit 12 Prozent bereits die Menschen ohne<br />
religiöses Bekenntnis. Glaubt also unsere Gesellschaft nicht<br />
mehr? Univ. Prof. Paul M. Zulehner und Regina Polak zeigen<br />
in ihrem Beitrag, dass die Antwort darauf vielschichtiger<br />
zu geben ist. Auch Georg Kastner, Am, beschäftigt sich<br />
mit diesem Thema, während sich Franz Trimmel, Am, und<br />
Erhard Mayerhofer mit dem Problem Ethik- und Religionsunterricht<br />
beschäftigen und auch die Stellung der k<strong>at</strong>holischen<br />
Kirche dazu them<strong>at</strong>isieren. Abgerundet wird das Titelthema<br />
durch Beiträge von Andreas Kresbach, Cl, über die<br />
„Stadtmission“, Peter A. Ulram über das Wahlverhalten von<br />
K<strong>at</strong>holiken und Protestanten und Stefan Lorger-Rauwolf<br />
über das Phänomen des S<strong>at</strong>anismus.<br />
Im Politikteil beschäftigen wir uns n<strong>at</strong>ürlich auch mit den N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahlen,<br />
geben aber schon eine Vorschau auf die<br />
Grazer Gemeinder<strong>at</strong>swahl, die zu Jahresbeginn st<strong>at</strong>tfinden<br />
wird. Ein äußerst interessanter Beitrag kommt vom Vorarlberger<br />
Landesr<strong>at</strong> Hans-Peter Bischof, R-B. Er beschäftigt sich<br />
mit neuen Wegen im Bereich der Gesundheitspolitik. Schließlich<br />
haben wir mit dem neuen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes<br />
Karl Korinek, F-B, Rt-D, ein Interview geführt,<br />
in dem er auch seine Wünsche an eine neue Regierung äußert.<br />
Mit einem Porträt von Univ. Prof. Anton F. Zeilinger, M-D,<br />
AIn, starten wir eine neue Serie von Beiträgen, in der wir<br />
ab jetzt in unregelmäßigen Abständen interessante Mitglieder<br />
von ÖCV-Verbindungen vorstellen wollen. Zeilinger<br />
ist Vorstand des Instituts für Experimentalphysik an der<br />
Universität Wien und wahrscheinlich vielen Lesern aus anderen<br />
Medien als „Mr. Beam“ bekannt.<br />
Das Thema Europa h<strong>at</strong> in diesem Heft ebenso wieder seinen<br />
Pl<strong>at</strong>z wie die Kulturberichterst<strong>at</strong>tung, wobei wir diesmal zwei<br />
Berichte im Bereich der Populärkultur aufbieten: Georg Kastner,<br />
Am, deckt interessante Detailaspekte rund um den in<br />
die Jahre gekommenen Geheimagenten James Bond auf,<br />
während wir auch das Jubiläum „40 Jahre Rolling Stones“<br />
nicht unerwähnt lassen wollten.<br />
Wir wünschen allen<br />
unseren Lesern und deren Familien<br />
ein gesegnetes Weihnachtsfest und<br />
ein erfolgreiches Neues Jahr.<br />
Mag. Paul Hefelle, F-B, BbG, Chefredakteur<br />
Dr. Herbert Kaspar, Am, Herausgeber<br />
Am Tag vor dem Sta<strong>at</strong>sfeiertag wurde die Oktober-<br />
Ausgabe der ACADEMIA in den Räumlichkeiten des<br />
Parlamentsklubs der ÖVP präsentiert. Neben<br />
Verbandsprominenz gaben sich viele Autoren dieser und<br />
früherer ACADEMIA-Ausgaben die Ehre und diskutierten<br />
mit Vertretern der Initi<strong>at</strong>ive „p<strong>at</strong>ria 2411“ – wie könnte es<br />
anders sein – über die anstehenden N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahlen.<br />
Für den überraschenden Abschluss sorgte Gastgeber<br />
Andreas Khol, R-B, als er die Anwesenden aufforderte,<br />
Leopold Figl zu Ehren „Burschen heraus“ zu intonieren.<br />
Eine Premiere für das Hohe Haus am Ring.
Regina Polak/Paul M. Zulehner<br />
Religiöser Wandel in Österreich<br />
„Nur mehr 74 Prozent der Österreicher<br />
sind k<strong>at</strong>holisch, die zweitgrößte<br />
Gruppe sind mit 12 Prozent<br />
die Menschen ohne religiöses Bekenntnis“<br />
gab die St<strong>at</strong>istik Austria<br />
Mitte Oktober die Ergebnisse der<br />
Volkszählung 2001 bekannt.<br />
Viele Journalisten verkündeten daraufhin,<br />
dass der Unglaube in Österreich<br />
zunehme und identifizierten so die offizielle<br />
Konfessionszugehörigkeit der<br />
Österreicher mit dem jeweiligen subjektiven<br />
Selbstverständnis.<br />
Um solch naiven Gleichsetzungen<br />
nicht aufzusitzen, gibt es in Österreich<br />
seit 1970 eine regelmäßige religionssoziologische<br />
Untersuchung, die sich tiefer<br />
mit der „Religion im Leben der Österreicher“<br />
beschäftigt. Die jüngste<br />
Untersuchungswelle wurde 2001 unter<br />
dem Titel „Kehrt die Religion wieder?“<br />
publiziert.<br />
Dieser Untersuchung zufolge ist<br />
Österreich nach wie vor ein religiöses<br />
Land: Mehr als zwei Drittel der Österreicher<br />
bezeichnen sich als religiöse<br />
Menschen. Die Religiosität h<strong>at</strong> sogar<br />
an Bedeutung gewonnen: 75 Prozent<br />
glauben an Gott (1990: 69 Prozent), 50<br />
Prozent an ein Leben nach dem Tod<br />
(1990: 44 Prozent), 67 Prozent nehmen<br />
sich regelmäßig Zeit für das Gebet<br />
(1990: 59 Prozent). Das Wiedererwachen<br />
der Religiosität ist überraschenderweise<br />
in allen europäischen Großstädten<br />
zu beobachten (mit Ausnahme<br />
von Paris). In Wien glauben heute zum<br />
Beispiel um acht Prozent mehr Personen<br />
an Gott als noch 1990. Die Überzeugung<br />
der 70er Jahre, dass die Religiosität<br />
verschwinden wird, lässt sich<br />
nicht bestätigen. Vielmehr gilt: Je moderner<br />
eine Zivilis<strong>at</strong>ion ist, umso religiöser<br />
wird sie. Dieser Trend zur Respiritualisierung<br />
erklärt vielleicht auch,<br />
warum der Trend zur Erosion in der k<strong>at</strong>holischen<br />
Kirche weitaus langsamer<br />
vor sich geht, als nach den D<strong>at</strong>en seit<br />
1970 zu erwarten gewesen wäre. So gesehen<br />
wird man den Blick auf die Ergebnisse<br />
der Volkszählung wenden<br />
müssen: Nach wie vor sind 74 Prozent<br />
der österreichischen Bevölkerung ka-<br />
tholisch. Und wer offiziell ohne religiöses<br />
Bekenntnis ist, ist deshalb noch<br />
lange nicht unreligiös oder ungläubig.<br />
Eine differenzierte Wahrnehmung ist<br />
gefragt.<br />
„Neue Religiositäten“<br />
Freilich h<strong>at</strong> sich seit 1970 im religiösen<br />
Feld auch in Österreich viel verändert.<br />
Man spricht von „neuen Religiositäten“.<br />
Unsere Forschung zeigt, dass<br />
sich rel<strong>at</strong>iv unabhängig von offiziellen<br />
Zugehörigkeiten die Menschen ihren<br />
religiös-weltanschaulichen Kosmos<br />
höchst individuell, mehr oder weniger<br />
virtuos und frei zusammenstellen.<br />
Da gibt es in Österreich nach wie vor<br />
mit 27 Prozent die Gruppe der Christen,<br />
die ihr Glaubenspalais gern bewohnen.<br />
Sie glauben, dass sich Gott in Jesus Christus<br />
zu erkennen gegeben h<strong>at</strong>, sehen<br />
ihre Zukunft im Reich Gottes und sind<br />
überzeugt, dass ihr Leben durch die Auferstehung<br />
letzten Sinn bekommt.<br />
Dazu kommen mit 32 Prozent die<br />
„Religionskomponisten“. Sie spielen<br />
ihre ureigene spirituelle Musik. Diese<br />
Menschen verbinden buddhistisches,<br />
esoterisches, n<strong>at</strong>uralistisches und humanistisches<br />
Gedankengut. Sie übernehmen<br />
durchaus auch einzelne Positionen<br />
aus dem Christentum. Wie<br />
kunstfertig dies geschieht – ob es sich<br />
um Neuschöpfungen, Nachschöpfungen,<br />
Kinderlieder, Experimentalmusik,<br />
Symphonien oder Geräusche handelt,<br />
wissen wir vorläufig noch nicht. Ihre<br />
Religiositäten sind die Folge des Verschwindens<br />
der Religion in die priv<strong>at</strong>e<br />
Innerlichkeit.<br />
Dann gibt es die „n<strong>at</strong>uralistischen<br />
Humanisten“ (30 Prozent). Sie fühlen<br />
sich eingebunden in einen schicksalhaften<br />
Kreislauf der N<strong>at</strong>ur. Zugleich<br />
kreist ihr „Glaube“ um den Menschen.<br />
Sie finden Gott in der N<strong>at</strong>ur, in deren<br />
Kreislauf und in deren Gesetzen. Solche<br />
Religiosität ist das Result<strong>at</strong> eines<br />
Christentums, das zuerst priv<strong>at</strong>isiert<br />
und dann von innen her ausgehöhlt<br />
wurde.<br />
Als „Atheist“ bezeichnet sich in Österreich<br />
kaum jemand, wohl aber gibt es<br />
eine 13 Prozent große Gruppe von<br />
„Atheisierenden“, die ihr Leben nicht<br />
auf einen Gott setzt, sondern eher zweifelt.<br />
Die Angehörigen vertreten vor allem<br />
n<strong>at</strong>uralistische und humanistische<br />
Werte, negieren die Existenz Gottes oder<br />
merken zumindest nichts von seiner<br />
7<br />
Titel<br />
Dezember <strong>2002</strong>
+ 27,4 % pro Jahr<br />
seit sechs Jahren!<br />
Mit QUADRIGA können Sie sowohl von steigenden,<br />
als auch von fallenden Kursen profitieren.<br />
ab E 2.000,–<br />
Jetzt kostenloses<br />
Info-Paket anfordern!<br />
, %<br />
Dein Ansprechpartner:<br />
Mag. Rainer Wolfbauer, AW, Vorstand<br />
WWW.QUADRIGAFUND.COM<br />
QUADRIGA AG<br />
1997 + 20,70 %<br />
1998 + 62,55 %<br />
1999 + 25,39 %<br />
2000 + 23,19 %<br />
2001 + 18,82 %<br />
<strong>2002</strong>* + 26,82 %<br />
* NAV per 31. Oktober <strong>2002</strong><br />
Quadriga Gruppe: Wien – Frankfurt – Innsbruck – Zürich – New York – Chicago – Grenada – Hong Kong<br />
Quadriga Asset Management GmbH, Salzgries 15, 1010 Wien, Tel: +43 1 247 00, Fax: +43 1 247 00-11, vienna@quadrigafund.com<br />
Risikohinweis: Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Renditen der Vergangenheit sind keine Garantie für die<br />
Zukunft. Diese Werbung stellt keinen Prospekt im Sinne des österreichischen KMG dar. Für das öffentliche Angebot der Genussscheine der Quadriga Beteiligungs- und Vermögens<br />
AG wurde ein gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erstellter und geprüfter Prospekt am 17. Oktober <strong>2002</strong> im Amtsbl<strong>at</strong>t zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Der Prospekt kann<br />
bei der Quadriga Asset Management GmbH, A-1010 Wien, Salzgries 15, bezogen werden.
Präsenz. Für sie ist mit dem Tod alles<br />
aus, der Sinn des Lebens liegt im Leben<br />
selbst.<br />
Neue Ethik<br />
Der Trend zum Wandel der Religiositäten<br />
h<strong>at</strong> viele Gründe. Man kann ihn<br />
als Antwort auf die weltweite Fortschrittskrise<br />
deuten. Immer mehr Menschen<br />
spüren heute, dass wir unsere Lebensweisen<br />
ändern müssen, wenn wir<br />
überleben wollen. So bricht im religiösen<br />
Bereich vieles auf, weil auf der anderen<br />
Seite vieles einbricht: Der Glaube<br />
an einen endlosen Fortschritt, der<br />
Glaube an die Allmacht von Wissenschaft,<br />
Technik, Wirtschaft. Die Menschen<br />
beginnen wieder nach Gott zu<br />
fragen. Neu ist dabei die Art, wie sie das<br />
tun. So suchen sie nach sich selbst und<br />
können die Würde des Menschen entdecken.<br />
Sie suchen nach neuen Wegen,<br />
miteinander zu leben und können entdecken,<br />
dass sie mit anderen Menschen<br />
und mit Gott immer schon verbunden<br />
sind. Sie wünschen sich eine neue Ethik,<br />
die von Liebe und nicht von strengem<br />
Moralismus getragen ist. Sie suchen<br />
nach persönlicher, aber auch gesellschaftlicher<br />
Heilung.<br />
Auch die Kirchen sind angefragt, zu<br />
prüfen, welchen Anteil sie an diesem<br />
Wandel haben. Als positiver Beitrag ihres<br />
Wirkens ist sicherlich die Freiheit zu<br />
nennen, die sie den Menschen heute<br />
geben, ihren Glauben selbst zu finden<br />
und zu entwickeln. Nachzufragen aber<br />
ist, ob und wie es gelingen kann, unter<br />
veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen<br />
das Antlitz Gottes, wie es<br />
in Jesus Christus und seiner Kirche<br />
wahrnehmbar wird, zu enthüllen.<br />
Zukunftstrend Religion<br />
Religion h<strong>at</strong> Zukunft. Insbesondere<br />
die Ereignisse nach dem 11. September<br />
2001 lassen vermuten, dass sich der<br />
Trend zur Religiosität noch verstärken<br />
wird. Auch das Christentum und die<br />
Kirchen können von diesem Zukunft-<br />
strend „profitieren“, wenn es gelingt,<br />
die Polarität zwischen Offenheit und<br />
Profilierung, Toleranz und Identität<br />
schöpferisch zu meistern. Österreich ist<br />
nach wie vor „christentümlich“: Kaum<br />
jemand lehnt alle christlichen Positionen<br />
ab. Vor allem aber sind die Wertvorstellungen<br />
vieler Menschen vom<br />
Geist des Christentums durchaus geprägt.<br />
Das gilt auch uns, vor allem für<br />
die Jugendlichen, die zwar nur mehr zu<br />
zwei Prozent allen christlichen Items<br />
zustimmen, aber sich umgekehrt intensiv<br />
nach einer Spiritualität sehnen,<br />
die das Alltagsgetriebe durchbricht und<br />
sich durch hohe, solidarische Ethik auszeichnet.<br />
Hier gilt es, die Tradierungskanäle<br />
wieder zu reinigen, zu öffnen<br />
und den Glauben kre<strong>at</strong>iv weiterzuerzählen.<br />
Die Zukunft wird vor allem den Religionskomponisten<br />
gehören. Für sie<br />
kann die Kirche jene Schule werden, in<br />
der sie virtuos komponieren üben und<br />
unverzichtbare Grundlagen humanerer<br />
Spiritualität lernen. Auch die Weggemeinschaft<br />
der Atheisierenden wird<br />
weiterhin wichtig bleiben und bleibt<br />
eine ständige Herausforderung an die<br />
christlichen Kirchen: Was können wir<br />
selbst tun, damit Gottes unverbrüchliche<br />
Liebe zu jedem Menschen durch<br />
die Mühen und Absurditäten des Alltags<br />
durchleuchten kann? Schließlich<br />
ist damit zu rechnen, dass viele Menschen<br />
auch wieder nach konkreten Orten<br />
und Zeiten fragen werden, in denen<br />
sie ihre frei schwebenden Religiositäten<br />
beheim<strong>at</strong>en können. Eine Reinstitutionalisierung<br />
ist in Sicht. Kirchen,<br />
die hier intelligent und mit Respekt vor<br />
der Freiheit und Autonomie der Menschen<br />
Räume und Zeiten anbieten, sich<br />
auf die Suchenden einlassen und ihre<br />
Sch<strong>at</strong>zkisten öffnen, haben eine lebendige<br />
Zukunft vor sich.<br />
Die Autoren<br />
Prof. Dr. Paul M. Zulehner ist Professor für<br />
Pastoraltheologie in Wien,<br />
Frau Mag. Regina Polak ist Assistentin am<br />
Institut für Pastoraltheologie in Wien.<br />
Neuevangelisierung<br />
Europas<br />
Das Motto des „Mitteleuropäischen<br />
K<strong>at</strong>holikentages“ 2003/2004 lautet<br />
„Christus – Hoffnung Europas“. Inspiriert<br />
vom Gedanken der Neuevangelisierung<br />
und der „Europäisierung“<br />
Europas soll die gemeinsame Verantwortung<br />
für Kirche und Gesellschaft im<br />
Mittelpunkt stehen.<br />
Abschluss und Höhepunkt bildet eine<br />
gemeinsame Großveranstaltung in Mariazell.Termin<br />
ist das Wochenende nach<br />
Christi Himmelfahrt 2004 (22./23. Mai<br />
2004).<br />
Als inhaltliche Vorbereitung wird es<br />
gemeinsame Symposien der Bischofskonferenzen<br />
zu folgenden pastoralen<br />
und gesellschaftspolitischen Fragen geben:<br />
„Christliche Werte in der Europäischen<br />
Union“, „Lebensethik“,<br />
„Märtyrer und Glaubenszeugen“, „Religionsunterricht<br />
und Weitergabe des<br />
Glaubens“, „Sozialpartnerschaft/Allianz<br />
für den Sonntag“, „Ehe und Familie“,<br />
„Landwirtschaft/ländlicher Raum“.<br />
Darüber hinaus sind auf n<strong>at</strong>ionaler<br />
und diözesaner Ebene weitere Aktivitäten<br />
vorgesehen. Bedeutende kirchliche<br />
Veranstaltungen, die ohnedies für den<br />
fraglichen Zeitraum geplant sind und<br />
von Form und Inhalt her mit dem „Mitteleuropäischen<br />
K<strong>at</strong>holikentag“ zusammenpassen,<br />
sollen bewusst unter<br />
das gemeinsame Motto gestellt werden.<br />
www.k<strong>at</strong>holikentag.<strong>at</strong><br />
9<br />
Titel<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Titel<br />
Dieser hohe Anteil an offiziell nicht<br />
Glaubenden ist wahrscheinlich noch<br />
erschreckender als der Rückgang des k<strong>at</strong>holischen<br />
Glaubens selbst. Noch ärger<br />
ist die Situ<strong>at</strong>ion in der Bundeshauptstadt.<br />
Während, was schon länger befürchtet<br />
wurde, der K<strong>at</strong>holikenanteil<br />
hier bereits knapp unter 50 Prozent liegt,<br />
ist der Anteil der Bekenntnislosen auf<br />
25 Prozent angestiegen. Die Schuld einzig<br />
und allein bei unserer Glaubengemeinschaft<br />
selbst zu suchen, wäre dennoch<br />
falsch. Unbestrittener Maßen h<strong>at</strong><br />
das leicht naive Krisenmanagement der<br />
K<strong>at</strong>holischen Kirchen gemeinsam mit<br />
medial gepushten Verbalentgleisungen<br />
mancher kirchlicher Amtsträger den einen<br />
oder anderen zum Rückzug aus<br />
dem Schoß der Mutter Kirche bewegt.<br />
Auch dass einige verbeamtete Laienmitarbeiter<br />
in den diözesanen Verwaltungsstellen<br />
den Eindruck erwecken<br />
den K<strong>at</strong>echismus noch nicht einmal gesehen<br />
zu haben und im Umgang mit<br />
K<strong>at</strong>holiken jegliches Fingerspitzen vermissen<br />
lassen, sollte selbstkritisch festgehalten<br />
werden. Dass dies der Zahlungsmoral<br />
beim Kirchenbeitrag eher<br />
abträglich ist und vielleicht den einen<br />
10<br />
Georg Kastner, Am<br />
Es braucht Mut und Anstrengung<br />
Was wir schon immer befürchtet haben<br />
brachte die Volkszählung nun auf den<br />
Punkt: Die K<strong>at</strong>holiken werden anteilsmäßig<br />
rasant weniger in Österreich. Dabei<br />
hätte die Kirche den Menschen viel<br />
zu bieten. Gedanken zu einer Zeit, in der<br />
jene, die sich zu keiner Glaubensgemeinschaft<br />
bekennen wollen, schon die zweitgrößte<br />
Gruppe in der Bevölkerung<br />
darstellen.<br />
oder anderen die Kirche verlassen<br />
lässt, ist sehr traurig aber in Ansätzen<br />
sogar verständlich. N<strong>at</strong>ürlich besteht<br />
dringender Handlungsbedarf der Kirchenführung<br />
um derartige Missstände<br />
rasch zu beseitigen. Aber verglichen mit<br />
jenen Problemen, die von der k<strong>at</strong>holischen<br />
Kirche in den letzten Jahrhunderten<br />
gemeistert wurden, nehmen sich<br />
derartige Vorfälle eher unbedeutend<br />
aus.<br />
Spiritueller Flurschaden<br />
Kaiser Josef II. stürzte die k<strong>at</strong>holische<br />
Kirche am Ende des 18. Jahrhunderts<br />
durch eine gut gemeinte aber für ihn typisch<br />
überhastete Reform in eine weit<br />
größere Krise als vielerorts angenommen.<br />
Selbst der Papst machte sich auf<br />
den Weg um „den missr<strong>at</strong>enen Sohn“<br />
persönlich zur Vernunft zu bringen,<br />
noch lange bevor Johannes Paul II die<br />
päpstliche Welttournee erfand. Es ist<br />
dem in den folgenden Jahren wirkenden<br />
Clemens Maria Hofbauer, bis heute<br />
Stadtp<strong>at</strong>ron von Wien, zu danken,<br />
dass der spirituelle Flurschaden einigermaßen<br />
eingedämmt wurde. Auch die<br />
vernünftigen Änderungen Josephs, wie<br />
Pfarrregulierungen und Religionsfonds<br />
wirkten sich langfristig positiv aus.<br />
Wesentlich schwerwiegender war die<br />
Polarisierung der Zwischenkriegszeit.<br />
Die wiederum „gut gemeinte“ aber aus<br />
heutiger Sicht klar verfehlte Verquickung<br />
von Sta<strong>at</strong> und Kirche unter<br />
Dollfuß und Schuschnigg sollte noch<br />
lange ein Problem der österreichischen<br />
k<strong>at</strong>holischen Kirche bleiben. Die hier<br />
aufgerissenen Gräben wurden erst von<br />
Kardinal Franz König zugeschüttet, ein<br />
Faktum, das ihm völlig zu Unrecht den<br />
Titel „roter Kardinal“ einbrachte. Es ist<br />
bis heute Königs Verdienst, dass Sozialdemokr<strong>at</strong>ie<br />
und Kirche zueinander<br />
fanden, und die Kirche dadurch aus<br />
dem politischen Tagesgeschehen herausgehalten<br />
werden konnte. Diese Öffnung<br />
brachte auch mit sich, dass sich<br />
manche nun offener zu „ihrer Kirche“<br />
bekennen konnten. Das seitens des Kardinals<br />
ehrliche Friedenangebot wurde<br />
von vielen dankbar angenommen.<br />
Ein kleine Gruppe durch und durch<br />
Linker, die vor allem in den letzten Jahren<br />
zu führenden Positionen bei SPÖ<br />
und Grünen aufgestiegen sind, nutzte<br />
dies jedoch schamlos aus. Denn durch<br />
die Hintertür wurde der Bevölkerung<br />
nach und nach jene Ideologie eingeflößt,<br />
die mit Schuld ist am Zurückdrängen<br />
von Christentum und „abendländischer“<br />
Werte. Gerade bei SPÖ und<br />
Grünen finden sich heute Vertreter, die<br />
zwar die absolute Toleranz predigen aber<br />
gleichzeitig einen zutiefst intoleranten<br />
Feldzug gegen diese christlichen Werte<br />
führen. Beleidigt beispielsweise jemand<br />
den Vertreter einer anderen Religionsgemeinschaft<br />
ist sprichwörtlich Feuer<br />
am Dach. Genau jene, die sich in solchen<br />
Fällen am lautesten ereifern, kl<strong>at</strong>schen<br />
jedoch dann laut Beifall wenn es<br />
wieder einmal gegen die k<strong>at</strong>holische<br />
Kirche geht. Warum ist also gerade die<br />
k<strong>at</strong>holische Kirche vielen so ein Dorn<br />
im Auge?<br />
Alles Paletti? Im Gegenteil<br />
Für einen Großteil der Österreicher<br />
sind jene Werte, für welche die Kirche<br />
noch heute steht, immer noch zutreffend.<br />
Fast jeder wünscht sich eine funktionierende<br />
Familie, die Beigeisterung<br />
von Herrn und Frau Österreicher für das<br />
Gebot der christlichen Nächstenliebe<br />
zeigte sich nicht nur bei der spontan<br />
überwältigenden Hochwasserhilfe. Die<br />
Bedeutung der Homosexualität ist in<br />
unserem Land wesentlich geringer als
uns linke Medien und Politiker glauben<br />
machen wollen. Alles paletti!? Ganz im<br />
Gegenteil.<br />
Die Kirche ist unbequem. Obwohl<br />
von den Medien als ewig gestrig heruntergemacht,<br />
steht sie für einen Großteil<br />
der Bevölkerung wesentlich mehr<br />
für Moral als alle Politiker zusammen.<br />
Man spendet lieber der k<strong>at</strong>holischen<br />
Caritas als dubiosen Vereinen von Grünen<br />
und Sozialdemokr<strong>at</strong>en. Ordensspitäler,<br />
k<strong>at</strong>holische Priv<strong>at</strong>schulen und<br />
Pfarrkindergärten sind nach wie vor beliebter<br />
als ihre sta<strong>at</strong>lichen Pendants.<br />
Und dies gibt der Kirche nach wie vor<br />
eine Machtposition, die sie zwar nicht<br />
offen ausnützt, sie aber zu einem Hauptgegner<br />
marxistisch geprägten Ideologen<br />
macht.<br />
Aus dem Kreißsaal in<br />
die Krabbelstube<br />
Ein Hauptangriffsziel ist und bleibt<br />
die Familie, die offensichtlich vollkommen<br />
ausradiert werden soll: Kein<br />
gemeinsamer Name, keine gemeinsame<br />
Altersvorsorge, keine gemeinsame<br />
Zukunft?! Unter der sozialistischen Alleinregierung<br />
begann jener Feldzug,<br />
dessen Erfolge mehr und mehr sichtbar<br />
werden. „AlleinerzieherInnen“,<br />
wohl weislich ganz geschlechtsneutral<br />
mit sozialistischem Kampf I geschrieben,<br />
heißt das Lieblingswort von Glawischnig,<br />
Prammer Gusenbauer und<br />
Co. Dass die Gruppe der alleinstehenden<br />
Frauen wesentlich mehr gefördert<br />
wird, als junge Familien ist ein unübersehbares<br />
Fakt. Die versteckte Botschaft<br />
ist ganz klar: nicht heir<strong>at</strong>en,<br />
dann gibt es mehr Geld, denn dass der<br />
Kindesv<strong>at</strong>er hin und wieder täglich bei<br />
der Kindesmutter übernachtet merkt<br />
ja ohnehin keiner. Anst<strong>at</strong>t es einer Frau<br />
wirklich selbst zu überlassen, ob sie einige<br />
Jahre mit dem Nachwuchs verbringen<br />
will, werden ausschließlich<br />
mehr Kindergärten gefordert, damit die<br />
Frau in jedem Fall ihre Karriere möglichst<br />
rasch fortsetzt. Wenn ein Kind<br />
mit drei noch nicht in einer sta<strong>at</strong>lichen<br />
Betreuungsorganis<strong>at</strong>ion untergebracht<br />
ist, gilt es schon als Außenseiter. Aus<br />
dem Kreissaal in die Krabbelstube<br />
scheint hier oberste Devise zu sein. Dass<br />
Eltern, die beide in einer 40 Stunden<br />
Woche gebunden sind ihren Kindern<br />
weit weniger mitgeben können als die<br />
Tag ein Tag aus sie betreuende Kindergärtnerin<br />
ist wohl jedem klar. Dass die<br />
Familienförderung zu gering ist um auf<br />
ein zweites Einkommen zu verzichten<br />
leider auch. Im Zuge der kollektiven<br />
Kleinkinderbetreuung kann dann auch<br />
ein neues Gesellschaftsmodell wesentlich<br />
leichter propagiert werden. Jegliche<br />
Individualität ausgeschaltet nur<br />
der vollkommenen Freiheit verpflichtet<br />
ist das Christentum dann vielleicht<br />
irgendwann einmal doch überholt und<br />
landet in einem Museum der Geisteswissenschaft,<br />
hofft man. Die ideologischen<br />
Väter der linken Bewegungen<br />
bezeichneten Religion als „Opium fürs<br />
Volk“. Dieses soll offensichtlich durch<br />
allgemein zugängliches Cannabis ersetzt<br />
werden. Der unter Gusenbauer<br />
und Van der Bellen wieder belebte Kulturkampf<br />
zeigte sich im Wahlkampf<br />
mehr als deutlich.<br />
Es liegt an uns als K<strong>at</strong>holiken diesen<br />
Tendenzen möglichst rasch Einhalt zu<br />
gebieten. Dafür wäre eine lebendige Kirche,<br />
die mehr als sexuelle Verbote aussprechen<br />
kann, und sich in der Öffentlichkeit<br />
professioneller präsentiert,<br />
genauso wichtig wie jene politischen<br />
Rahmenbedingungen, die der Kirche<br />
nicht nur das Überleben sichern, sondern<br />
ihr auch eine maximale Entfaltungsmöglichkeit<br />
geben. Fällt einer dieser<br />
beiden Punkte aus, so ist der Versuch<br />
des anderen zum Scheitern verurteilt.<br />
Die k<strong>at</strong>holische Kirche h<strong>at</strong> wahnsinnig<br />
viel zu bieten: Nur leider wissen es zu<br />
Wenige. Es ist nicht leicht, es erfordert<br />
eine ganze Menge Mut, Anstrengung<br />
und vor allem Zusammenarbeit: Aber<br />
es lohnt.<br />
Auskunft erteilen: DW 249 Fr. Vorlaufer<br />
DW 251 Fr. Eugl<br />
11<br />
Titel<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Titel<br />
Entstanden ist das „Mariazeller Manifest”<br />
auf steirischem Boden, als bei<br />
der Magna M<strong>at</strong>er Austriae in Mariazell<br />
zur Vorbereitung des I. Österreichischen<br />
K<strong>at</strong>holikentages nach Österreichs Wiedererstehen<br />
vom 1. bis 4. Mai 1952 ein<br />
Studientag gehalten wurde. Dieser h<strong>at</strong>te<br />
den Zweck, sich eingehend mit dem<br />
K<strong>at</strong>holikentagsthema „Freiheit und<br />
Würde des Menschen” zu befassen und<br />
die offiziellen Reden und Aussagen am<br />
K<strong>at</strong>holikentag in Wien im September<br />
gleichen Jahres präzis vorzubereiten und<br />
zu bewerten. Sein pressemäßiges Ergebnis<br />
war das sogenannte „Mariazeller<br />
Manifest”. In seiner Formulierung<br />
war es die Einzelleistung des damaligen<br />
Pressechefs des K<strong>at</strong>holikentages und<br />
später langjährigen Leiters der K<strong>at</strong>holischen<br />
Presseagentur Österreichs, Richard<br />
Barta. Sein damaliger Stellenwert<br />
kommt in seiner ursprünglichen Denomin<strong>at</strong>ion<br />
zum Ausdruck, die lautete<br />
schlicht und sachlich: „Offizieller Bericht<br />
der Pressestelle des Österreichischen<br />
K<strong>at</strong>holikentages”. Der Bericht<br />
trägt die programm<strong>at</strong>ische Überschrift:<br />
„Eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft”<br />
und war weder von der Österreichischen<br />
Bischofskonferenz ber<strong>at</strong>en,<br />
geschweige denn beschlossen, noch von<br />
Rom bestätigt worden. Erst zehn Jahre<br />
später erhielt er von seinem Autor Richard<br />
Barta die plak<strong>at</strong>iv-griffige Bezeich-<br />
12<br />
Maximilian Liebmann, Cl<br />
Freie Kirche im freien Sta<strong>at</strong><br />
Der Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte<br />
und kirchliche Zeitgeschichte an<br />
der Universität Graz über Entstehung und<br />
Verfasser eines Dokumentes, dass seine<br />
heute gebräuchliche Bezeichnung erst<br />
Jahre nach seiner Formulierung vor 50<br />
Jahren erfuhr. Das „Mariazeller Manifest“.<br />
nung „Mariazeller Manifest”, während<br />
ihn die gleich bekannte wie anerkannte<br />
Zeithistorikerin, die zum engsten<br />
Freundeskreis um Otto Mauer zählende<br />
Zeitzeugin Erika Weinzierl noch 1975<br />
als „K<strong>at</strong>holisches Manifest” titulierte<br />
und im Übrigen in Otto Mauer den inhalt-substantiellen<br />
Verfasser sieht.<br />
Schwer nachvollziehbar<br />
Sein Inhalt ist bisweilen rätselhaft und<br />
kaum nachvollziehbar. So heißt es wörtlich:<br />
„Eine freie Kirche, das heißt die Kirche<br />
ist auf sich selbst gestellt und nur auf<br />
sich selbst. [...] Heute aber h<strong>at</strong> die Kirche<br />
keinen Kaiser und keine Regierung, keine<br />
Partei und keine Klasse, keine Kanonen,<br />
aber auch kein Kapital hinter sich.<br />
Die Zeit von 1938-1945 bildet hier eine<br />
unüberschreitbare Zäsur; die Brücken in<br />
die Vergangenheit sind abgebrochen, die<br />
Fundamente für die Brücke in die Zukunft<br />
werden heute gelegt.”<br />
Schwer oder kaum nachvollziehbar<br />
sind diese Sätze deshalb, weil praktisch<br />
zur gleichen Zeit, wie von der unüberschreitbaren<br />
Zäsur von 1938-1945 und<br />
von den abgebrochenen Brücken gesprochen<br />
wird, d. h. im Mai1952, mit<br />
Vehemenz gerade um deren Wiedererrichtung<br />
gerungen wird, nämlich um<br />
die Gültigkeit des sogenannten „Dollfuß-Konkord<strong>at</strong>es”<br />
von 1933/34. Kirchenintern<br />
mussten die Bischöfe hierbei<br />
sogar eine so scharfe Rüge vom Hl.<br />
Stuhl einstecken, sie seien zu nachlässig<br />
im Kampf für die sta<strong>at</strong>liche Gültigkeit<br />
des Konkord<strong>at</strong>es eingetreten, dass<br />
diese als Reaktion dem Papst kollektiv<br />
ihren Rücktritt förmlich anboten.<br />
Auch auf einem zweiten Gebiet ist<br />
die Behauptung von der unüberschreitbaren<br />
Zäsur von 1938-1945 nicht<br />
nachvollziehbar, hier wurden und werden<br />
die Brücken nicht nur nicht ab-<br />
gebrochen, hier wurden und werden<br />
sie sogar neu zementiert, gemeint ist<br />
das durch das Nazi-Regime mit 1. Mai<br />
1939 eingeführte Kirchenbeitragssystem.<br />
Dieses wurde aus der NS-Zeit<br />
nahtlos in die Zweite Republik übergeführt,<br />
ohne Zäsur, ohne Brückenabbruch.<br />
Analoges kann von der oblig<strong>at</strong>orischen<br />
Ziviltrauung bzw.<br />
standesamtlichen Eheschließung gesagt<br />
werden, die mit l. August 1938 eingeführt<br />
wurde. Auch hier erfolgte keine<br />
Zäsur, kein Abbrechen von Brücken.<br />
Ihre Überleitung in die Zweite Republik<br />
verlief allerdings nicht so friktionsfrei<br />
wie beim Kirchenbeitrag.<br />
Klare Absage an Sta<strong>at</strong>s- und<br />
Politischen K<strong>at</strong>holizismus<br />
Wirklich grundlegend und zeitlos gültig<br />
ist die fundamentale politische Festlegung:<br />
„Keine Rückkehr zu jenen gewaltsamen<br />
Versuchen, auf rein<br />
organis<strong>at</strong>orischer und sta<strong>at</strong>srechtlicher<br />
Basis christliche Grundsätze verwirkli-
chen zu wollen.” Damit erfolgte eine<br />
klare Distanzierung zum konfessionellen<br />
Eherecht, das bis zum Anschluss gegolten<br />
h<strong>at</strong> und eine sta<strong>at</strong>liche Ehescheidung,<br />
d. h. Ehetrennung von<br />
K<strong>at</strong>holiken nicht ermöglichte. Auch<br />
wird die Abkehr von der uralten Forderung<br />
auf Installierung der konfessionellen<br />
Sta<strong>at</strong>sschule, wie es die Bischöfe<br />
bis zum Anschluss gefordert h<strong>at</strong>ten,<br />
besiegelt. Folgerichtig heißt es im Bericht<br />
weiter: „Eine freie Gesellschaft, in<br />
der auch die Kirche frei leben kann, verlangt<br />
aber auch den Abbau jener letzten<br />
Reste totalitärer Einrichtungen, wie<br />
sie zum Schaden der österreichischen<br />
Demokr<strong>at</strong>ie noch in einem gewissen<br />
Absolutismus der politischen Parteien<br />
und in einer politischen Ausnahmegesetzgebung<br />
besteht, verlangt energisch<br />
Frontstellung gegen alle Übergriffe<br />
der Sta<strong>at</strong>sallmacht, gegen jede Anmaßung<br />
des Sta<strong>at</strong>es zur totalitären Erfassung<br />
aller Lebensgebiete, Bekenntnis<br />
zum Prinzip der Subsidiarität,<br />
verlangt Schutz des einzelnen und<br />
Schutz der Persönlichkeit.”<br />
Charta des Dialoges<br />
Der zweite Teil des „Mariazeller Manifestes”,<br />
eine programm<strong>at</strong>ische Ab-<br />
sichtserklärung, die ich Charta des Dialoges<br />
nennen möchte, verdient, in Marmor<br />
gemeiselt zu werden:<br />
„Eine freie Kirche bedeutet aber nicht<br />
eine Kirche der Sakristei oder des k<strong>at</strong>holischen<br />
Ghettos, eine freie, auf sich<br />
selbst gestellte Kirche heißt eine Kirche<br />
der weltoffenen Türen und ausgebreiteten<br />
Arme, bereit zur Zusammenarbeit<br />
mit allen, zur Zusammenarbeit mit dem<br />
Sta<strong>at</strong> in allen Fragen, die gemeinsame<br />
Interessen berühren, also in Ehe, Familie,<br />
Erziehung;<br />
Zusammenarbeit mit allen Ständen,<br />
Klassen und Richtungen zur Durchsetzung<br />
des gemeinsamen Wohls;<br />
Zusammenarbeit mit allen Konfessionen<br />
auf der Grundlage des gemeinsamen<br />
Glaubens an den lebendigen<br />
Gott, Zusammenarbeit auch mit allen<br />
geistigen Strömungen, mit allen Menschen,<br />
wer immer sie seien und wo immer<br />
sie stehen, die gewillt sind, mit der<br />
Kirche für den wahren Humanismus,<br />
für Freiheit und Würde des Menschen<br />
zu kämpfen.”<br />
Zeitgebunden und überholt<br />
Im dritten Teil wird die formalrechtliche<br />
Stellung von Mann und Frau<br />
abgelehnt und die pessimistische Prognose<br />
erstellt: „Wir sind<br />
im Begriffe, ein Volk<br />
hungernder und bettelnder<br />
Greise zu werden,<br />
da uns in wenigen<br />
Jahrzehnten die arbeitende<br />
und produzierende<br />
Gener<strong>at</strong>ion fehlen<br />
wird. Es wird niemand<br />
mehr da sein, der das<br />
Korn baut, damit wir<br />
Brot zu essen haben, der<br />
die Kohle schürft, damit<br />
wir uns wärmen, und<br />
der den Baum fällt, in<br />
dessen Brettern wir zur<br />
letzten Ruhe gebettet<br />
werden. (...) Die Kirche<br />
lehnt eine formalrechtliche<br />
Gleichstellung der<br />
Geschlechter ab, die der Frau nur neue<br />
Lasten aufbürden und sie noch des<br />
spärlichen Schutzes, den das Gesetz ihr<br />
heute bietet, berauben würde; sie weiß<br />
aber auch, dass die Würde der Frau sich<br />
erst dann entwickeln kann, wenn ihr<br />
die Last zeitraubender und aufreibender<br />
Arbeit erleichtert wird.”<br />
Zeugnis echter<br />
Geschichtsbewältigung<br />
Verschiedentlich wird das „Mariazeller<br />
Manifest” als „Magna Charta” des<br />
neuen Verhältnisses von Kirche und Politik<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg in<br />
Österreich im Sinne vom Altlandeshauptmann<br />
der Steiermark, Josef Krainer,<br />
apostrophiert und gefeiert. Krainer:<br />
„Es h<strong>at</strong> die Beziehungen zwischen Kirche<br />
und Politik in der Zweiten Republik<br />
entscheidend bestimmt: die freie Kirche<br />
in einem freien Sta<strong>at</strong>.”<br />
Vierzehn Jahre waren vergangen, seit<br />
den drei gleich heiß umkämpften wie<br />
erfolgreich verteidigten k<strong>at</strong>holischkirchlichen<br />
Kulturkampfbastionen: Keine<br />
sta<strong>at</strong>liche Ehescheidung von K<strong>at</strong>holiken,<br />
keine oblig<strong>at</strong>orische Zivilehe;<br />
Forderung nach Wiedererrichtung der<br />
konfessionellen Sta<strong>at</strong>sschule, d. h. k<strong>at</strong>holische<br />
Kinder nur in rein k<strong>at</strong>holischen<br />
Schulen, und drittens: Finanzierung<br />
der Kirche, speziell des Klerus,<br />
durch das Sta<strong>at</strong>sbudget, denn der Religionsfonds<br />
war schon seit den Zwanzigerjahren<br />
zutiefst defizitär. Alle diese<br />
drei Bastionen h<strong>at</strong>te das NS-Regime<br />
1938/39 vom Tisch gefegt und keine<br />
davon wurde sieben Jahre später beim<br />
Wiedererstehen Österreichs wiedererrichtet.<br />
Das „Mariazeller Manifest” ist in seiner<br />
Grundaussage somit ein hervorragendes<br />
Zeugnis für die Bejahung der<br />
st<strong>at</strong>tgehabten kulturpolitisch-weltanschaulichen<br />
Entwicklung durch die in<br />
Mariazell versammelte jungk<strong>at</strong>holische<br />
Aktivistenrunde rund um den dominanten,<br />
höchst einflussreich agierenden<br />
und entscheidend prägenden Msgr.<br />
Otto Mauer.<br />
13<br />
Titel<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Titel<br />
Beim Lesen der kürzlich veröffentlichen<br />
Presseinform<strong>at</strong>ion der Bundesanstalt<br />
St<strong>at</strong>istik Austria (1) vom 17.10.<strong>2002</strong><br />
blieb der Blick des Betrachters an zwei<br />
Aussagen haften.<br />
1. Der K<strong>at</strong>holikenanteil in Wien ist<br />
auf 49.2 Prozent abgesunken.<br />
2. Der Anteil der Religionslosen ist<br />
auf nunmehr 25,6 Prozent angestiegen.<br />
Diese zwei Sätze sollen als Ausgangspunkt<br />
für die folgenden Betrachtungen<br />
über Religions- und Ethikunterricht dienen.<br />
Abgeleitet von ihnen lässt sich sagen,<br />
dass der Religionsunterricht zum<br />
Minderheitenprogramm geworden ist.<br />
Ursachen und Beweggründe sich aus<br />
dem Religionsunterricht zu verabschieden<br />
sind mannigfaltig. Einige<br />
Punkte sind aber erwähnenswert: Der<br />
Wegfall des traditionell hohen Stellenwertes<br />
des Religionsunterrichtes in der<br />
städtischen Gesellschaft. Es scheint jungen<br />
Menschen nicht mehr wichtig zu<br />
sein, eine gute Religionsnote vorweisen<br />
zu können. Sichtbar wird der Rückgang<br />
auch an der starken Abnahme der<br />
„Kirchlichkeit“ der jungen Menschen.<br />
Mit vielen kirchlichen Institutionen haben<br />
Jugendliche nichts mehr am Hut.<br />
Das Leben und Erleben etwa pfarrlicher<br />
Gemeinschaft h<strong>at</strong> einen geringen Stellenwert,<br />
die Institution h<strong>at</strong> nichts mehr<br />
zu sagen. Ausdruck dafür ist das Ringen<br />
der Religionslehrerinnen und -lehrer<br />
um Akzeptanz der Institution Kirche<br />
bei Jugendlichen, trotz übermächtiger<br />
Gegner wie Freistunde (späteres Kommen<br />
– früheres Gehen) und Caféhaus.<br />
Vielleicht sollten Schulmessen mehr<br />
Eventcharakter aufweisen? Die Rolle der<br />
14<br />
Franz Trimmel, Am<br />
Zwei Paar Schuhe<br />
Impressionen eines interessierten<br />
Beteiligten am Religions- und<br />
Ethikunterricht in Wien<br />
Kirchen als traditioneller gesellschaftlicher<br />
Wertevermittler löst sich auf. Die<br />
jugendlichen „Freiheitskünstler“ und<br />
„Religionskomponisten“ scheinen manche<br />
Wertvorstellungen der Altvorderen<br />
in ihrer Lebensgestaltung einfach außer<br />
Acht zu lassen, zum Ärger mancher Eltern.<br />
Scheu vor Bindungen<br />
Ist es die Scheu vor lebenslangen Bindungen,<br />
die Menschen aus der k<strong>at</strong>holischen<br />
Kirche treibt, oder liegt es einfach<br />
im Zug der Zeit, sich mächtigen<br />
Institutionen nicht mehr zur Gänze anzuvertrauen.<br />
Vielleicht erklärt das die<br />
Zunahme der Personen ohne religiöses<br />
Bekenntnis. Wobei auch die Anonymität<br />
in der globalen Vernetzung große<br />
Ängste schürt und junge Menschen daher<br />
ihre Sehnsucht nach Geborgenheit<br />
und Überschaubarkeit im täglichen Leben<br />
auf verschiedene Arten ausleben,<br />
etwa in „Szenen“. Die Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten<br />
seiner eigenen<br />
Umgebung verlangt die Ausgestaltung<br />
eines für den Lebensvollzug brauchbaren<br />
Wertesystems. In diesem Kontext<br />
ist es verständlich, nach der Sinnhaftigkeit<br />
eines Ethikunterrichtes zu fragen.<br />
Die zunehmende Vielfalt und<br />
Kompliziertheit der angebotenen Wertsysteme<br />
h<strong>at</strong> weitblickende Pädagogen<br />
zu Überlegungen über die Einführung<br />
eines solchen Gegenstandes angeregt.<br />
Seit 1997 gibt es in Österreich zaghafte<br />
Versuche einen „Ethikunterricht<br />
als Ers<strong>at</strong>zgegenstand“ einzuführen. Es<br />
ist zu hinterfragen, Ers<strong>at</strong>z wofür? Für<br />
den geringer werdenden Religionsunterricht?<br />
Was soll er ersetzen? Die Abmeldequoten<br />
der Schüler? Oder ist er<br />
Religionsunterricht durch die Hintertür?<br />
In Wien gingen und gehen die Wogen<br />
in der politischen Landschaft hoch.<br />
Heftige Befürworter wie das Liberale Forum<br />
wurden abgelöst von glaubenstreuen<br />
Frommen, die in ihrer Ghettositu<strong>at</strong>ion<br />
die schulische Wirklichkeit<br />
verkannten, in dem sie meinten, durch<br />
Rückzug auf Glaubensgrundsätze und<br />
deren rigorose Befolgung eine Änderung<br />
der Haltung erreichen zu können.<br />
Auch die sogenannten „Kirchenfresser“<br />
in den unterschiedlichsten Parteien sahen<br />
ihre Chance gekommen, der Kirche<br />
eins auszuwischen. Es gilt auch bei<br />
diesem Thema, wie in vielen anderen<br />
Bereichen, das Bibelzit<strong>at</strong>: „An ihren<br />
Früchten werdet ihr sie erkennen“.Was<br />
könnte daher, salopp gefragt, im Rahmen<br />
des Ethikunterrichtes und der dazugehörenden<br />
Lehrerausbildung eine<br />
Rolle spielen?<br />
Organis<strong>at</strong>orische Probleme<br />
Die Behebung organis<strong>at</strong>orischer Probleme<br />
in schulischen Unterricht – wie:<br />
Wohin mit den abgemeldeten Schülern,<br />
die beaufsichtigt werden müssen?<br />
Wohin mit den unterbeschäftigten<br />
jungen Lehrern, vielleicht gibt es eine<br />
neue Zukunftsperpektive in der Berufsplanung,<br />
speziell für Philosophie- oder<br />
Religionslehrer? Belegbar durch häufige<br />
Anfragen. Das mögen alles Aspekte<br />
sein, die auch auftreten, vielfach ist es<br />
jedoch so, dass der Ethikunterricht mit<br />
positiver Zustimmung durch die Schüler<br />
besucht wird (2), und dass die Ethiklehrer<br />
mit großem Eins<strong>at</strong>z sich um im<br />
Regelunterricht vernachlässigte Themen,<br />
wie Solidarität, Wertschätzung,<br />
Einsichten in kulturelle Unterschiede<br />
annehmen und Orientierungshilfen in<br />
dieser säkularen Welt anbieten, und damit<br />
jungen Menschen die Chance geben,<br />
sich für diese Orientierungen zu<br />
interessieren, um die ihnen am besten<br />
geeignet erscheinenden zu rezipieren.
Ob es die Aufgabe des weltanschaulich<br />
neutralen Sta<strong>at</strong>es ist, jungen Menschen<br />
eine ganzheitliche Bildung angedeihen<br />
zu lassen oder nicht, mögen<br />
Juristen entscheiden. Die Prämissen und<br />
Anknüpfungspunkte lassen sich in der<br />
neuesten Studie zum Ethikunterricht<br />
ganz gut nachlesen (3).<br />
Wichtig erscheint jedoch, dass sich<br />
der Ethikunterricht zu einem eigenständigen<br />
Unterrichtsgegenstand entwickelt,<br />
in dem junge Menschen<br />
Grundlagen für die Auseinandersetzung<br />
in der Welt der Erwachsenen, die ja eine<br />
große Pluralität von ethischen Konzepten<br />
aufweist, erwerben können. Die<br />
Begründung für einen Unterrichtsgegenstand:<br />
„Ethik als Unterrichtsprinzip“,<br />
wie von manchen gefordert, bringt<br />
nicht den gewünschten Erfolg, wie das<br />
Beispiel am Unterrichtsprinzip politische<br />
Bildung zeigt. Was ist passiert? Jahrzehntelang<br />
wurde das Prinzip hochgehalten,<br />
nur h<strong>at</strong> sich leider fast niemand<br />
von den Unterrichtenden darum<br />
gekümmert, sodass im letzten Jahr als<br />
der Weisheit letzter Schluss die Zuweisung<br />
an den Unterrichtsgegenstand Geschichte<br />
erfolgte.<br />
Es ist keine Rel<strong>at</strong>ivierung dieser Aussagen,<br />
wenn man die Meinung vertritt,<br />
dass die Einführung des Ethikunterrichtes<br />
dort gegeben sein sollte, wo Bedarf<br />
besteht. Die Entscheidung sollte<br />
die Schulgemeinschaft treffen und<br />
nicht, wie in so manchen Bundesländern,<br />
die vorgesetzte Behörde. Der Titel<br />
Ethikunterricht ist ein möglicherweise<br />
unglücklich gewählter Ausdruck,<br />
da er die im Unterricht angebotenen<br />
Inhalte, wie philosophische Grundlegung<br />
der Ethik, Kultur- und Religionskunde<br />
nicht erkennen lässt. Kardinal<br />
Schönborn sprach vor kurzem von einer<br />
Wertesolidarität, die ja nur erreicht<br />
werden kann, wenn ein Austausch über<br />
die Werte mit anderen erfolgt. Was ist<br />
dazu besser geeignet als eine Erziehung<br />
im Ethikunterricht?<br />
Schulversuch ja – aber kosten<br />
darf er nichts<br />
Gott sei dank gibt es auch schon eine<br />
Evalu<strong>at</strong>ion des Ethikunterrichtes – nachzulesen<br />
in der unten angeführten Studie<br />
von Prof. Bucher – die manchen<br />
Skeptikern, die gemeint haben: „Wozu<br />
braucht man diesen Gegenstand?“ den<br />
Wind aus den Segeln genommen h<strong>at</strong>.<br />
Zum Abschluss sei in diesem Zusammenhang<br />
noch ein Phänomen erwähnt.<br />
Der Ethikunterricht stützt in der<br />
Unterrichtsorganis<strong>at</strong>ion den Religionsunterricht.<br />
Da die Schüler, vor allem<br />
die der Oberstufe, nicht mehr der<br />
Freistunde frönen können, weil für alle,<br />
die an keinem Unterricht der Religionsgemeinschaften<br />
teilnehmen, der<br />
Ethikunterricht verpflichtend ist, gibt<br />
es eine „Rückwanderung“ in den Religionsunterricht.<br />
Mit einer gewissen Ehrlichkeit<br />
muss man sagen, dass für<br />
Religionslehrer eine höhere Chancengleichheit<br />
eingetreten ist, wenn der<br />
Ethikunterricht parallel zum Religionsunterricht<br />
geführt wird. Vertreter<br />
sta<strong>at</strong>licher und kirchlicher Institutionen<br />
befürworten den Ethikunterricht,<br />
finden ihn gut, es fehlt allerdings das<br />
Geld. Diesbezügliche Aussagen sind lobenswert,<br />
aber sie bleiben für die Betroffenen<br />
unverbindlich – nach dem<br />
Motto: „Schulversuch ja, aber kosten<br />
darf er nichts“. Wenn Unterrichtsministerium<br />
und Stadtschulr<strong>at</strong> einen<br />
Schulversuch genehmigen, so könnten<br />
sie doch auch die nötigen Ressourcen<br />
zu Verfügung stellen, solange der Versuch<br />
eben dauert. Dieses oben angesprochene<br />
Phänomen von der Stützung<br />
des Religionsunterrichtes h<strong>at</strong> bei manchen<br />
politischen Gruppierungen als Gegenreaktion<br />
Unmut ausgelöst, vor allem<br />
bei jenen, die gerne einen<br />
Ethikunterricht st<strong>at</strong>t des Religionsunterrichts<br />
eingeführt hätten. Daher ist<br />
das politische Interesse an seiner Einführung<br />
stark erlahmt. Es ist gefährlich<br />
Prognosen abzugeben, aber persönli-<br />
che Eindrücke von Diskussionen über<br />
den Ethikunterricht, wie das starke Interesse<br />
öffentlicher Institutionen (sie<br />
schicken ihre „Spione“ in solche Veranstaltungen)<br />
bis zum enormen Interesse<br />
der jungen Bildungsschicht und<br />
der verschiedenen religiösen Gruppierungen,<br />
belegen, dass dieses Thema in<br />
der Öffentlichkeit intensiv weiterbrodelt.<br />
Wenn die Unterrichtsministerin<br />
und der Bundeskanzler von einer Bildungsmilliarde<br />
sprechen, so sollten<br />
doch einige wenige hunderttausend<br />
Euro, für den Auf- und Ausbau des<br />
Ethikunterrichtes aufgewendet, keine<br />
gravierende Rolle spielen. Warum nicht<br />
zwei Paar Schuhe? Wenn das eine Paar<br />
seinen Aufgaben nicht mehr genügen<br />
kann, eventuell durch Druckstellen oder<br />
fehlende Absätze, so wäre es doch ganz<br />
gut in anderes Paar zu schlüpfen. Die<br />
vergleichenden Gedanken zu Religionsund<br />
Ethikunterricht dürfen sie weiterspinnen.<br />
(1) Presseinform<strong>at</strong>ion – St<strong>at</strong>istik Austria vom<br />
17.10.<strong>2002</strong><br />
(2) Bucher A., Ethikunterricht in Österreich. Bericht<br />
der wissenschaftlichen Evalu<strong>at</strong>ion der<br />
Schulversuche „Ethikunterricht“, Innsbruck-<br />
Wien 2001<br />
(3) Auer K.H. ( Hg), Ethikunterricht, Standortbestimmung<br />
und Perspektiven Innsbruck-Wien <strong>2002</strong><br />
Der Autor<br />
OStR. Mag. Franz Trimmel, Am<br />
unterrichtet am Pädagogischen Institut<br />
der Stadt Wien sowie an einer Wiener AHS<br />
15<br />
Titel<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Titel<br />
Neue Herausforderungen<br />
❏ Österreich ist eines der traditionsreichsten<br />
k<strong>at</strong>holischen Länder der<br />
Welt. Die hohe Akzeptanz des Religionsunterrichtes<br />
in breiten Bevölkerungskreisen<br />
ist ungebrochen. Ursachen<br />
dafür könnten sein: Besonders<br />
eins<strong>at</strong>zbereite und glaubhafte Religionslehrer<br />
und die Caritas, die in der<br />
Schule durch den Religionsunterricht<br />
zu spüren ist.<br />
❏ Die sozioreligiöse Entwicklung in den<br />
90er Jahren führte zu neuen Herausforderungen.<br />
1971 waren 87 Prozent<br />
der Bevölkerung k<strong>at</strong>holisch, 2001 73,6<br />
Prozent. Sollte die Entwicklung so bleiben,<br />
dann werden möglicherweise 2030<br />
etwa 50 Prozent k<strong>at</strong>holisch sein. Daneben<br />
nehmen Personen ohne religiöses<br />
Bekenntnis oder mit anderen religiösen<br />
Denomin<strong>at</strong>ionen zu. Vor allem die Veränderungen<br />
der sozioreligiösen Land-<br />
16<br />
Erhard Mayerhofer<br />
Thesen zu Religions- und Ethikunterricht<br />
Argumente aus der Sicht der<br />
k<strong>at</strong>holischen Kirche<br />
schaft Österreichs führten zum Schulversuch<br />
„Ethik“.<br />
❏ Globales Denken wird sich verstärken.<br />
Dabei könnte deutlich werden, dass<br />
Religion in vielen Bereichen des Lebens<br />
und der Gesellschaft einen neuen Stellenwert<br />
oder eine andere Bedeutung erhält.<br />
❏ Das Gefüge Kirche-Sta<strong>at</strong>-Gesellschaft<br />
befindet sich im Prozess einer Umstrukturierung<br />
und Neuordnung. Sinnstiftende<br />
und wertgestaltende Kräfte,<br />
wie sie die Kirche bietet, bleiben aber für<br />
Sta<strong>at</strong> und Gesellschaft unverzichtbar.<br />
Ausblick – offene Fragen<br />
❏ Der Religionsunterricht ist ein wesentlicher<br />
Bestandteil des österreichischen<br />
Bildungssystems. Mit Bezug auf<br />
Gott fragt er „nach dem Ganzen und<br />
nach dem Sinn des menschlichen Lebens<br />
und der Welt“ (Würzburger Synode<br />
1974). Ausgehend von der eigenen<br />
Konfession regt er zur Auseinandersetzung<br />
mit weltanschaulichen Positionen<br />
an, leistet einen wichtigen Beitrag zur<br />
Werteerziehung und zeigt Möglichkeiten<br />
der persönlichen Sinnfindung auf.<br />
❏ Für Gesellschaft, Schule und Kirche<br />
stellen sich wichtige Fragen: Was ist die<br />
unersetzbare, nicht von einem anderen<br />
Gegenstand übernehmbare Aufgabe des<br />
Religionsunterrichts? Welche Folgen<br />
hätte eine Ausfall von religiöser Bildung?<br />
❏ Die Kirche steht dem Schulversuch<br />
„Ethik“ nicht ablehnend gegenüber. Sie<br />
möchte aber nicht von sich aus die Initi<strong>at</strong>ive<br />
bei der möglichen Etablierung<br />
eines Gegenstandes „Ethik“ für die<br />
Schülerinnen und Schüler, die an keinem<br />
Religionsunterricht teilnehmen,<br />
ergreifen. Sehr wohl bietet sie sich als<br />
Gesprächspartnerin bei der weiteren<br />
Diskussion an.<br />
❏ Die Lehrpläne von Religionsunterricht<br />
und „Ethik“ weisen zahlreiche<br />
Berührungspunkte auf. So haben ethische<br />
Themen auch im Religionsunterricht<br />
an der Oberstufe der Gymnasien<br />
ihren Pl<strong>at</strong>z. Für den Pflichtgegenstand<br />
Religionsunterricht stellt sich die wichtige<br />
Aufgabe, ein deutlich erkennbares<br />
und von „Ethik“ unterscheidbares<br />
Profil zu entwickeln.<br />
❏ Durch einen künftig möglichen Gegenstand<br />
„Ethik“ könnten manche Religionsgemeinschaften<br />
– evangelische<br />
und orthodoxe Christen oder Moslems<br />
– organis<strong>at</strong>orische Schwierigkeiten bekommen.<br />
❏ Die großen Fragen des Lebens sind<br />
ein entscheidendes Anliegen jeder Bildung:<br />
„Woher kommen wir? Wohin gehen<br />
wir? Was ist Sinn unseres Lebens?“<br />
Diese Fragen sind eine geeignete Richtschnur<br />
sowohl für den Religionsunterricht<br />
als auch für „Ethik“.<br />
Der Autor<br />
Dr. Erhard Mayerhofer, Abteilungsleiter AHS<br />
am Religionspädagogischen Institut der Erzdiözese<br />
Wien;
Stefan Lorger-Rauwolf<br />
Der Teufel ist los<br />
Der Teufel h<strong>at</strong> in unseren Tagen<br />
Hochkonjunktur. Wohl kaum ein<br />
Thema weckt solch starke Emotionen,<br />
bündelt Ängste und Befürchtungen<br />
wie der S<strong>at</strong>anismus.<br />
Medien wissen, dass die Quote<br />
stimmt, wenn sie S<strong>at</strong>anismus als Aufmacher<br />
ganz groß herausbringen. Da<br />
werden kurzerhand suizidäre Jugendliche<br />
und ihre Verzweiflungst<strong>at</strong>en mit<br />
dem Teufel in Verbindung gebracht.<br />
Friedhofsvandalismus und Kirchenschändungen<br />
gehen auf das Konto seiner<br />
Jünger. Mord, Totschlag und Vergewaltigungen<br />
geschehen im Namen<br />
S<strong>at</strong>ans. Da wird ein Thema aufgebauscht,<br />
das damit nur am Rande zu<br />
tun h<strong>at</strong>. Hauptsache ist, der Bericht<br />
schockt. Die eigentlichen Probleme bleiben<br />
aber unbearbeitet.<br />
Auf der anderen Seite warnen diejenigen,<br />
die die zerstörerische Kraft des<br />
Bösen selbst erfahren haben, vor einer<br />
Verharmlosung dieses Themas. Der goldene<br />
Mittelweg zwischen Spekul<strong>at</strong>ion,<br />
Übertreibung und Dram<strong>at</strong>isierung<br />
auf der einen Seite und Beschwichtigung<br />
sowie Verharmlosung auf der anderen<br />
Seite muss gefunden werden. Dies<br />
ist umso schwieriger, da der S<strong>at</strong>anismus<br />
sich weitgehend im Geheimen abspielt.<br />
Außenstehende haben n<strong>at</strong>urgemäß keinen<br />
Einblick in die inneren Zusammenhänge<br />
okkulter Kleingruppen.<br />
Was ist S<strong>at</strong>anismus? – Eine<br />
erste Annäherung<br />
Eine erste Feststellung lautet: S<strong>at</strong>anismus<br />
ist ein sehr schillernder Begriff<br />
und von seiner Philosophie und Weltanschauung<br />
her beurteilt kein einheitliches<br />
Denkgebäude. S<strong>at</strong>anismus<br />
besteht in einer Vielzahl von Vorstellungen<br />
und Seinsarten. Die unterschiedlichsten<br />
Traditionen, von altägyptischen<br />
Mythologien über<br />
Kelten- und Wiccakulte, gnostischem<br />
Gedankengut, Voodoo-Praktiken und<br />
kabbalistischer Zahlenmagie, werden<br />
im modernen S<strong>at</strong>anismus gemischt<br />
und in neue, ausgeklügelte Systeme gebracht.<br />
Eine zweite Prämisse des S<strong>at</strong>anismus<br />
muss zur Kenntnis genommen werden:<br />
In der Philosophie und in der Praxis<br />
vieler s<strong>at</strong>anistischer Systeme geht es<br />
in erster Linie nicht um die Anbetung<br />
oder Anrufung des personifizierten Teufels,<br />
sondern um die „Selbstvergottung“<br />
des Menschen.<br />
Richtungen und Typologien<br />
des S<strong>at</strong>anismus<br />
Wie kann man diese Vielfalt ordnen?<br />
Der Schweizer Religionswissenschaftler<br />
und Sektenexperte Prof. Dr. Georg<br />
Schmid geht von einem hypothetischen<br />
(experimentellen), von einem religiösen<br />
(ideologischen) und von einem p<strong>at</strong>hologischen<br />
S<strong>at</strong>anismus aus.<br />
1. Hypothetischer S<strong>at</strong>anismus:<br />
Die Existenz S<strong>at</strong>ans ist nur eine Hypothese,<br />
die angenommen wird. Der<br />
experimentelle S<strong>at</strong>anismus dient in erster<br />
Linie anderen Zwecken. Man spielt<br />
und experimentiert mit S<strong>at</strong>an um andere<br />
Ziele zu verfolgen. Dazu zählt die<br />
vor allem bei Jugendlichen als Freizeitbeschäftigung<br />
vorkommende s<strong>at</strong>anistische<br />
Betätigung. Sei es, dass die Idee<br />
aufkommt, in der Nacht auf dem Friedhof<br />
den Teufel anzurufen oder ihn<br />
während einer spiritistischen Sitzung<br />
erscheinen zu lassen. Hier steht die Suche<br />
nach Spannung und Neugier im<br />
Vordergrund.<br />
S<strong>at</strong>anistische Vers<strong>at</strong>zstücke sind auch<br />
wichtige Bestandteile der „Heavy-Metal“-Musikszene.<br />
Cover und Texte mit<br />
s<strong>at</strong>anistischen Inhalten und Symbolik<br />
steigern in erster Linie die Verkaufszahlen<br />
der Tonträger und geben weniger<br />
Auskunft über die Weltanschauung<br />
der Musikgruppe oder der Hörer.<br />
Das provokante Tragen von und Hantieren<br />
mit s<strong>at</strong>anistischen Symbolen fällt<br />
ebenso in diesen Bereich. Es kann Ausdruck<br />
der Sehnsucht nach Aufmerksamkeit<br />
sein aber auch Protest gegen die<br />
Erwachsenenwelt. Die Provok<strong>at</strong>ion kann<br />
aber auch ein Hilfeschrei sein, die auf<br />
eine Lebenssitu<strong>at</strong>ion aufmerksam macht,<br />
aus der man sich nur durch Flucht in<br />
eine „s<strong>at</strong>anistische Welt“ befreien kann.<br />
Immer geht es hier nicht eigentlich<br />
um S<strong>at</strong>an, sondern um anderes. Der S<strong>at</strong>anismus<br />
ist nur die Fassade hinter der<br />
sich eine andere Idee oder ein anderes<br />
Problem verbirgt.<br />
2. Religiöser S<strong>at</strong>anismus<br />
Dem ideologischen S<strong>at</strong>anismus liegt<br />
ein mehr oder minder geschlossenes<br />
weltanschauliches System zugrunde,<br />
das ihre Vertreter auch mit intellektueller<br />
Überzeugungskraft vertreten.<br />
Kennzeichnend für diese Form sind der<br />
Eins<strong>at</strong>z von liturgischen Ritualen und<br />
magischen Handlungen. Auffallend ist,<br />
dass nicht „S<strong>at</strong>an“ als Gott angesehen<br />
und verehrt wird, sondern der Mensch<br />
der eigentliche Gott ist. Die magischen<br />
Rituale dienen dieser Selbstvergottung.<br />
17<br />
Titel<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Titel<br />
Für diese Form des S<strong>at</strong>anismus ist die<br />
Person des Okkultisten und Schwarzmagiers<br />
Aleister Crowley (1875-1947)<br />
eine wichtige Gestalt. Das von ihm<br />
18<br />
Das Gesetz von Thelema<br />
Das Gesetz des Starken: Das ist unser<br />
Gesetz.<br />
Und die Freude der Welt.<br />
Tu was du willst, soll sein das ganze<br />
Gesetz.<br />
Du hast kein Recht als deinen eigenen<br />
Willen zu tun.<br />
Tue den, und kein anderer soll Nein sagen.<br />
Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern.<br />
Es gibt keinen Gott außer dem Menschen.<br />
Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht nach seinem<br />
eigenen Gesetz zu leben<br />
Zu arbeiten wie er will,<br />
zu spielen wie er will,<br />
zu ruhen wie er will,<br />
zu sterben wann und wie er will.<br />
Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht zu essen<br />
was er will,<br />
zu trinken was er will,<br />
zu wohnen wo er will,<br />
zu reisen auf dem Antlitz der Erde<br />
wie er will.<br />
Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht zu denken<br />
was er will,<br />
zu sagen was er will,<br />
zu schreiben was er will,<br />
zu zeichnen, malen schnitzen, ätzen,<br />
gestalten und bauen wie er will,<br />
sich zu bekleiden wie er will.<br />
Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht zu lieben<br />
wie er will; auch erfüllet euch nach dem<br />
Willen in Liebe,<br />
wie ihr wollt, wann, wo und mit wem<br />
ihr wollt.<br />
Der Mensch h<strong>at</strong> das Recht all diejenigen<br />
zu töten, die ihm diese Rechte zu<br />
nehmen suchen.<br />
Die Sklaven sollen dienen.<br />
Liebe ist das Gesetz. Liebe unter Willen!<br />
stammende „Gesetz von Thelema“, das<br />
den eigenen Willen zum absoluten Gesetz<br />
erhebt, ist bis heute bei vielen Gruppen<br />
und Organis<strong>at</strong>ionen das ideologische<br />
Leitmotiv (s. Kasten links).<br />
Ein anderer Zweig geht auf Anton<br />
Szandor LaVey zurück, der 1966 in Kalifornien<br />
seine „Church of S<strong>at</strong>an“ gründete.<br />
LaVey ist R<strong>at</strong>ionalist. An einen<br />
Teufel glaubt er nicht. S<strong>at</strong>an ist für ihn<br />
ein Symbol für die Umkehrung ethischer<br />
Prinzipien, eine Chiffre für die<br />
Auflehnung gegen den moralischen<br />
Konsens der Gesellschaft. Der Inhalt seiner<br />
neuen Moral ist ein ungebremster<br />
Egoismus, der sich durch nichts eingrenzen<br />
lässt. Einziges Ziel ist das eigene<br />
Wohlergehen (s. Kasten rechts).<br />
3. P<strong>at</strong>hologischer S<strong>at</strong>anismus<br />
Im Dunstkreis des S<strong>at</strong>anismus finden<br />
immer wieder Straft<strong>at</strong>en st<strong>at</strong>t, die von<br />
psychisch labilen oder kranken Personen<br />
begangen werden. Die Frage, welche<br />
sich in solchen Fällen stellt, ist die<br />
nach Ursache und Wirkung: Begründen<br />
sich Straft<strong>at</strong> und s<strong>at</strong>anistische Betäti-<br />
gung zu gleich in der problem<strong>at</strong>ischen<br />
psychischen Konstitution des Täters,<br />
oder gehen Straft<strong>at</strong> und psychische Veränderung<br />
auf die s<strong>at</strong>anistische Betätigung<br />
zurück. In diesen Zusammenhang<br />
ist auch auf Personen hinzuweisen, die<br />
ihre Verbrechen nach außen hin s<strong>at</strong>anistisch<br />
begründen und mystifizieren.<br />
Die neun s<strong>at</strong>anischen<br />
Grundsätze von<br />
A. S. LaVey<br />
1. S<strong>at</strong>an bedeutet Sinnesfreude anst<strong>at</strong>t<br />
Abstinenz!<br />
2. S<strong>at</strong>an bedeutet Lebenskraft anst<strong>at</strong>t<br />
Hirngespinste!<br />
3. S<strong>at</strong>an bedeutet unverfälschte<br />
Weisheit anst<strong>at</strong>t heuchlerischen<br />
Selbstbetrug!<br />
4. S<strong>at</strong>an bedeutet Güte gegenüber<br />
denjenigen, die sie verdienen, anst<strong>at</strong>t<br />
Verschwendung von Liebe<br />
an Undankbare!<br />
5. S<strong>at</strong>an bedeutet Rache anst<strong>at</strong>t<br />
Hinhalten der anderen Wange!<br />
6. S<strong>at</strong>an bedeutet Verantwortung<br />
für die Verantwortungsbewussten<br />
anst<strong>at</strong>t Fürsorge für psychische<br />
Vampire!<br />
7. manchmal besser, häufig jedoch<br />
schlechter als die Vierbeiner,<br />
da er aufgrund seiner „göttlichen<br />
geistigen und intellektuellen Entwicklung“<br />
zum bösartigsten aller<br />
Tiere geworden ist.<br />
8. S<strong>at</strong>an bedeutet alle sogenannten<br />
Sünden, denn sie alle führen<br />
zu psychischer, geistiger oder emotionaler<br />
Erfüllung!<br />
9. S<strong>at</strong>an ist der beste Freund, den<br />
die Kirche jemals gehabt h<strong>at</strong>, denn<br />
er h<strong>at</strong> sie die ganzen Jahre über<br />
am Leben erhalten!
Zusammenfassend lässt sich sagen,<br />
dass im p<strong>at</strong>hologischen S<strong>at</strong>anismus die<br />
psychische Problem<strong>at</strong>ik manifest ist,<br />
wohingegen die s<strong>at</strong>anistische Betätigung<br />
sich als marginal erweist.<br />
Vom Umgang mit dem<br />
S<strong>at</strong>anismus<br />
Hier möchte ich unterscheiden zwischen<br />
dem singulären Fall und S<strong>at</strong>anismus<br />
als gesellschaftlichen Problem. Für<br />
von S<strong>at</strong>anismus Betroffene, sei es Ausstiegswillige<br />
oder auch Angehörige, gibt<br />
es ein Netz von kirchlichen, sta<strong>at</strong>lichen<br />
und auch priv<strong>at</strong>en Ber<strong>at</strong>ungsstellen, in<br />
denen ihnen geholfen wird. Bei der Ber<strong>at</strong>ung<br />
von Angehörigen ist es immer<br />
notwendig abzuklären, ob die s<strong>at</strong>anistischen<br />
Praktiken nicht andere Probleme<br />
überdecken, die gelöst gehören.<br />
Von großer Bedeutung erscheint die<br />
Auseinandersetzung, die auf gesell-<br />
schaftlicher Ebene st<strong>at</strong>tfinden muss.<br />
Auch wenn der S<strong>at</strong>anismus im Vergleich<br />
zu anderen Anbietern im „neureligiösen<br />
Supermarkt“ immer noch ein zahlenmäßig<br />
kleines Phänomen darstellt,<br />
– gesicherte Zahlen sind nicht vorhanden<br />
– erscheint eine Auseinandersetzung,<br />
die nicht in der Bekämpfung von<br />
äußeren Erscheinungsformen stehen<br />
bleibt, sondern sich dem hinter diesen<br />
Erscheinungsformen stehenden Weltund<br />
Menschenbild zuwendet, angebracht.<br />
Tenor der s<strong>at</strong>anistischen Ideologie<br />
ist das fast euphorische Lob der<br />
Herrschaft des Menschen über den<br />
Menschen. Im S<strong>at</strong>anismus wird der<br />
Egoismus, die Gewalt, die Durchsetzungskraft<br />
des Starken zur kultischen<br />
Verehrung gebracht.<br />
Hält der S<strong>at</strong>anismus mit dieser Verehrung<br />
unserer industrialisierten und<br />
leistungsorientierten Gesellschaft nur<br />
Bitte schickt mir kostenlos nähere Inform<strong>at</strong>ionen über folgende Berufe:<br />
■ Priester<br />
■ Diakon<br />
■ Ordenspriester<br />
■ Ordensbruder<br />
■ Ordensfrau<br />
■ Säkularinstitute<br />
■ Pastoralassistent(in)<br />
■ Religionslehrer(in)<br />
Absender:<br />
■ Kirchenmusiker(in)<br />
■ Mesner(in)<br />
■ Pfarrhaushälterin<br />
■ Entwicklungshelfer(in)<br />
■ Altenhelfer(in)<br />
■ Familienhelfer(in)<br />
■ Sozialarbeiter(in)<br />
■<br />
einen Spiegel der Verhältnisse vor, oder<br />
können wir als Gesellschaft dem S<strong>at</strong>anismus<br />
unsere humanistischen und<br />
christlichen Werte wie Solidarität,<br />
Nächstenliebe, Schutz des Schwächeren<br />
und die Unantastbarkeit der Würde<br />
der Person entgegenhalten?<br />
Weiterführende Liter<strong>at</strong>ur:<br />
Schmid Markus, S<strong>at</strong>anismus, Nr.77/1997 – Teil der<br />
Werkmappe „Sekten, religiöse Sondergemeinschaften,<br />
Weltanschauungen“, Wien 1997<br />
Ruppert Hans Jürgen, Girzikovsky Andreas, Jugends<strong>at</strong>anismus,<br />
Nr. 81/1999 – Teil der Werkmappe<br />
„Sekten, religiöse Sondergemeinschaften, Weltanschauungen“,<br />
Wien 1999<br />
Beide Broschüren sin im Refer<strong>at</strong> für Weltanschauungsfragen<br />
der Erzdiözese Wien, 1010 Stephanspl<strong>at</strong>z<br />
6/VI/56, Tel: 01/51552-3384 zu beziehen.<br />
Der Autor<br />
Du hast Herz und Verstand?<br />
Du willst Infos für<br />
eine Top-Ausbildung<br />
in der Kirche?<br />
Dann sende uns die Postkarte<br />
oder ruf an – 01/512 51 07.<br />
Wir informieren Dich.<br />
Stefan Lorger-Rauwolf, Theologe, ist Mitarbeiter<br />
im Refer<strong>at</strong> für Weltanschauungsfragen,<br />
Sekten und religiöse Gemeinschaften<br />
der Erzdiözese Wien und dort zuständig<br />
für den Bereich Esoterik, Okkultismus und<br />
S<strong>at</strong>anismus.<br />
CANISIUSWERK<br />
An das<br />
Canisiuswerk<br />
Zentrum für geistliche Berufe<br />
Stephanspl<strong>at</strong>z 6<br />
1010 Wien<br />
Bitte<br />
frankieren<br />
Titel
Titel<br />
Dies gilt insbesondere auch für konfessionell<br />
stark gebundene Personen, sprich:<br />
K<strong>at</strong>holiken, die regelmäßig den Gottesdienst<br />
besuchen. In den neunziger Jahren<br />
gaben regelmäßig sechs von zehn ihre Stimme<br />
der ÖVP, <strong>2002</strong> sind es 69 Prozent. Neben<br />
den Zugewinnen bei kirchenferneren<br />
K<strong>at</strong>holiken und Personen ohne religiöses<br />
Bekenntnis fällt aber auch der hohe Zuspruch<br />
auf, den die Volkspartei bei protestantischen<br />
Wählern fand: 41 Prozent oder<br />
plus 31 Prozentpunkte im Vergleich zu<br />
1999. In diesem Segment h<strong>at</strong> nicht nur die<br />
FPÖ, sondern auch die SPÖ an Zustimmung<br />
verloren. Die Hereinnahme der früheren<br />
Superintendentin Gertraud Knoll h<strong>at</strong> somit<br />
der Sozialdemokr<strong>at</strong>ie nicht nur keine<br />
politischen Stimmen von den Evangelischen<br />
gebracht, sie h<strong>at</strong> sogar eher zu einem<br />
Symp<strong>at</strong>hieverlust geführt. Vielleicht lässt<br />
sich daraus eine Lehre ziehen – und zwar<br />
für alle Beteiligten: soziales und politisches<br />
Engagement aus christlicher Überzeugung<br />
heraus ist ein wichtiger Faktor für unser öffentliches<br />
Leben, aber ein Wechsel von einem<br />
hohen Amt in der Kirche in ein hohes<br />
politisches Amt wird nicht sonderlich<br />
geschätzt. Bescheidenheit gilt nicht umsonst<br />
als christliche Tugend.<br />
20<br />
Peter A. Ulram<br />
Religionsbekenntnis und Wahlverhalten<br />
Bei den N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>swahlen vom 24. November<br />
<strong>2002</strong> h<strong>at</strong> die ÖVP nicht nur Wählerschichten<br />
erschlossen, die ihr lange Zeit<br />
weitgehend verschlossen waren, sondern<br />
auch zusätzliche Wähler(innen) in jenen<br />
Gruppen von sich überzeugt, die traditionell<br />
zum Kern der ÖVP-Wählerschaft zählen.<br />
Der Autor<br />
Peter A. Ulram ist Bereichsleiter Politikforschung<br />
im Fessel-GfK-Institut und Univ. Doz.<br />
für Politikwissenschaften.<br />
Wahlverhalten nach Konfessionen<br />
in % SPÖ ÖVP FPÖ GRÜN andere<br />
99 02 99 02 99 02 99 02 99 02<br />
K<strong>at</strong>holischer Kern 20 22 59 69 13 3 1 3 2 1<br />
K<strong>at</strong>holischer Rand 34 38 22 39 30 12 3 9 4 2<br />
Protestantisch 40 34 10 41 32 8 5 14 8 1<br />
ohne Bekenntnis 42 46 6 18 32 15 7 16 9 3<br />
Quelle: FESSEL-GfK, Exit-Polls zu den NRW 1999 und <strong>2002</strong>, jeweils ca.2.200 Befragte.<br />
Zit<strong>at</strong>e:<br />
“<br />
Eine Erhebung bei zweitausend Personen des Klerus der Church of<br />
England im heurigen Jahr brachte für nicht eingeweihte erstaunliche Ergebnisse:<br />
Nur drei von zehn weiblichen Priesterinnen und immerhin<br />
sechs von zehn männlichen Priestern glauben an die jungfräuliche Geburt<br />
Jesu; nur 50 Prozent der weiblichen und siebzig Prozent der männlichen<br />
Priester glauben noch an die Auferstehung. T<strong>at</strong>sächlich kommt<br />
der Bericht zu dem Schluss, dass die Angehörigen des Klerus „rund 75<br />
Prozent von dem was sie jeden Sonntag predigen“ nicht glauben.<br />
Kein Wunder, dass die Bischofskonferenz konkrete Pläne ausarbei-<br />
„<br />
ten lässt, Abweichungen in „Lehre, Ritus und Zeremonielles“ durch spezielle<br />
Kirchengerichte zu ahnden. Was für die einen Vorboten einer kirchlichen<br />
„Hexenjagd“ sind, stellt für andere schlicht das letzte Mittel dar,<br />
einen gemeinsamen Nenner in zentralen Glaubensfragen zu finden. Sollte<br />
es aufgrund dieser Initi<strong>at</strong>iven zu einem Verfahren kommen, dann wäre<br />
dies immerhin das erste Häresieverfahren in der Geschichte der<br />
Kirche seit 1847!<br />
Quelle: The Times, 1. August <strong>2002</strong><br />
„ “<br />
Industrie und Kirchen. So direkt h<strong>at</strong> es noch kein Repräsentant der<br />
deutschen Industrie ausgedrückt wie der Ex-Präsident des Bundesverbandes<br />
der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Olaf Henkel. Er erklärte: Die<br />
Kirchen spielten in der deutschen Gesellschaft keine Rolle mehr. Darin<br />
sehe er nichts Schlimmes. Denn der Bedeutungsverlust der Kirchen habe<br />
die westlichen Gesellschaften freier, offener und toleranter gemacht.<br />
Quelle: Kirche In, Nr. 11, November <strong>2002</strong>
Andreas Kresbach, Cl<br />
Hauptmissionsgebiet Europa<br />
Das Projekt „Stadtmission 2003“ in<br />
Wien nimmt die Herausforderung<br />
der Evangelisierung des Missionsgebietes<br />
Europa an. Geistliche Qualität<br />
soll dabei vor zahlenmäßiger Quantität<br />
gehen und die Kirche zu einem<br />
überzeugenden Gesprächspartner<br />
in den aktuellen Lebensfragen der<br />
Menschheit machen.<br />
Die jüngsten D<strong>at</strong>en bestätigen es: nur<br />
mehr 49 Prozent der Wiener bekennen<br />
sich zur k<strong>at</strong>holischen Kirche. Der nicht<br />
nur anhand solcher Zahlen schon seit<br />
längerer Zeit spürbare Rückgang an K<strong>at</strong>holiken<br />
in der Bundeshauptstadt h<strong>at</strong> in<br />
der Erzdiözese Wien unterdessen zur<br />
Konzentr<strong>at</strong>ion auf den Schwerpunkt<br />
„Stadtmission 2003“ geführt. Dabei sollen<br />
die Ausgangslage, die Aufgaben und<br />
die Chancen der Kirche in der Großstadt<br />
neu definiert werden. Dem „Großstadtsymposion<br />
2001“ folgte kürzlich ein Studientag<br />
unter dem Motto „Mission in<br />
Wien?!“, um neue Zugänge zum vielfach<br />
belasteten Begriff „Mission“ zu finden.<br />
Schließlich werden die dunklen Kapitel<br />
der Kirchengeschichte, für die der<br />
Papst im Namen der gesamten Kirche<br />
um Vergebung gebeten h<strong>at</strong>, der Kirche<br />
von breiten Kreisen immer noch vorgehalten.<br />
Wohl deshalb wird seit geraumer<br />
Zeit anst<strong>at</strong>t von „Mission“ lieber von<br />
„Evangelisierung“ gesprochen.<br />
Dabei sei, wie der in Innsbruck lehrende<br />
Pastoraltheologe Franz Weber am<br />
Studientag betonte, das „Dass“ der Mission<br />
seit urchristlichen Zeiten nie<br />
grundsätzlich in Frage gestanden, doch<br />
gab es um das „Wie“ der kirchlichen<br />
Missionstätigkeit immer wieder inten-<br />
sive Auseinandersetzungen. Zur Inkultur<strong>at</strong>ion<br />
des Evangeliums gebe es jedenfalls<br />
keine Altern<strong>at</strong>ive, weil sich die<br />
Verkündigung der christlichen Botschaft<br />
ja nicht im luftleeren Raum vollziehe,<br />
sondern sich immer an konkrete<br />
Menschen in einer bestimmten<br />
geschichtlich-kulturellen Situ<strong>at</strong>ion wende.<br />
Zum Selbstverständnis der Kirche<br />
gehöre es vielmehr, nicht nur mit einem<br />
oberflächlichen Anstrich, sondern<br />
bis an die Wurzeln einer Kultur zu evangelisieren.<br />
Dies sieht man aber nicht<br />
nur im V<strong>at</strong>ikan so, wie es etwa die l<strong>at</strong>einamerikanischeBischofsversammlung<br />
von Santo Domingo 1992 nachhaltig<br />
in Erinnerung gerufen h<strong>at</strong>.<br />
Missionsgebiet Europa<br />
Die Notwendigkeit der Inkultur<strong>at</strong>ion<br />
des Evangeliums besteht als Aufgabe<br />
freilich schon längst nicht mehr allein<br />
in der Dritten Welt. Nicht nur dem<br />
Papst ist seit geraumer Zeit klar, dass das<br />
Hauptmissionsgebiet für die k<strong>at</strong>holische<br />
Kirche Europa ist. Dies gilt für die<br />
westlichen Konsumgesellschaften im<br />
wohlhabenden Teil Europas genauso<br />
wie für die vom sta<strong>at</strong>lich verordneten<br />
Atheismus kulturell geprägten Gesellschaften<br />
in den Ländern Mittel- und<br />
Osteuropas. So meinte denn auch Johannes<br />
Paul II. zum Übergang ins neue<br />
Jahrtausend in seinem Apostolischen<br />
Schreiben “Tertio Millennio Adveniente”<br />
im Vergleich der heutigen Situ<strong>at</strong>ion<br />
in Europa mit jener am Areopag in<br />
Athen, wo der Apostel Paulus gesprochen<br />
h<strong>at</strong>, dass es in der modernen Kultur<br />
viele und sehr verschiedene Areopage<br />
im Missionsgebiet Europa gibt.<br />
Gleichzeitig ist dies ein Befund, der<br />
dem Kirchenvolk entweder nicht in dieser<br />
Dram<strong>at</strong>ik bewusst ist oder der Europas<br />
K<strong>at</strong>holiken offenbar nur wenig<br />
berührt. Genau dies benennt etwa der<br />
Erfurter Bischof Joachim Wanke als eine<br />
wesentliche Voraussetzung für die Mission:<br />
„Unserer k<strong>at</strong>holischen Kirche fehlt<br />
die Überzeugung, neue Christen gewinnen<br />
zu können“. Dies führe, so der<br />
zur Kongreg<strong>at</strong>ion der Comboni Missionaren<br />
gehörige Franz Weber, zur Frage,<br />
warum uns als Kirche der Glaube<br />
fehle, dass unser Lebenszeugnis so „ansprechend“<br />
sein könne, dass Menschen<br />
auf uns aufmerksam werden und überlegen,<br />
sich der Kirche anzuschließen.<br />
Keine Rückeroberung<br />
So stellte der Missionstheologe auch<br />
klar, dass in unserer Zeit nicht neue Missionsstr<strong>at</strong>egien<br />
für eine „Rückeroberung<br />
des Abendlandes“ gefragt seien, sondern<br />
die Weitergabe des christlichen Glaubens<br />
durch überzeugte Christen, die ihren<br />
Mitmenschen den Weg zu einer persönlichen<br />
Gottesbegegnung zeigen. Da<br />
in der modernen Mission Qualität vor<br />
Quantität gehe, sei das Ziel der Evangelisierung<br />
die „innere Umwandlung des<br />
persönlichen und kollektiven Bewusstseins<br />
der Menschen, ihres konkreten Lebens<br />
und jeweiligen Milieus“ durch jene<br />
im biblischen Sinn „neuen Menschen“,<br />
die selbst die Frohbotschaft als ihr Leben<br />
von Grund auf verändernd erfahren haben.<br />
So geht es bei der Mission heute um<br />
nichts Geringeres als die geistig-geistliche<br />
Erneuerung der Menschheit.<br />
Der christliche Glaube dürfe allerdings<br />
nicht als exotischer, aber gesellschaftlich<br />
unmaßgeblicher Fremdkörper<br />
am pluralistischen Markt der<br />
(pseudo)religiösen Heilsangebote wahrgenommen<br />
werden. Vielmehr müssten<br />
die Kirchen in den brennenden Lebensund<br />
Überlebensfragen der Menschen<br />
als kompetenter Gesprächspartner ernst<br />
genommen werden.<br />
21<br />
Titel<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Europa<br />
Bis Ende des Jahres <strong>2002</strong> sollen die<br />
EU-Beitrittsverhandlungen der zehn<br />
Kandid<strong>at</strong>enländer abgeschlossen sein.<br />
Heikle Themen gibt es noch in fast allen<br />
Ländern, für Tschechien und die<br />
Slowakei wird die Frage des Umgangs<br />
mit den Dekreten immer schwieriger.<br />
Für einen „heißen Winter“ ist also gesorgt.<br />
Uneinige Weisen<br />
Das EU-Parlament gab den Rechtsgelehrten<br />
Jochen Frowein (BRD), Ulf<br />
Bernitz (Schweden) und Christopher<br />
Prout (England) den Auftrag, eine unabhängige<br />
Meinung zu äußern, ob die<br />
Benesch-Dekrete auch heute noch diskriminierende<br />
Rechtswirkungen hätten?<br />
Zunächst veröffentlichte Frowein<br />
eine Rohentwurf und sah kein formales<br />
Hindernis. Nur „moralische Bedenken“<br />
konnte er dem Amnestiegesetz<br />
von 1946 abgewinnen, das jene Personen<br />
von Strafe freistellt, die sich das Eigentum<br />
vertriebener Deutscher und<br />
Ungarn angeeignet haben. Während<br />
Prout diese Amnestiegesetze als „unglücklich“<br />
bezeichnete, wird Bernitz<br />
wesentlich kritischer: Er verweist auf<br />
die UN-Charta für Menschenrechte von<br />
22<br />
Johannes Michael Schnarrer<br />
Das ungelöste Problem<br />
Nun liegt er also vor, der Bericht der drei<br />
„Benesch-Weisen“. Die EU h<strong>at</strong> um ein<br />
Gutachten gebeten, ob die Dekrete aus<br />
1945/46 mit dem Recht der Union vereinbar<br />
wären. Die Dekrete seien zwar<br />
kein absolutes Beitrittshindernis zur EU<br />
für Tschechien und die Slowakei, aber<br />
moralische Gesten des Schuldeingeständnisses<br />
erwarte man sich schon.<br />
I. Die Benesch-Dekrete – eine Auswahl<br />
Dekret Nr. 5 vom 19. Mai 1945 § 2 (1) Das im Gebiet der Tschechoslowakischen<br />
Republik befindliche Vermögen der sta<strong>at</strong>lich unzuverlässigen Personen<br />
wird gemäß den weiteren Bestimmungen dieses Dekretes unter n<strong>at</strong>ionale Verwaltung<br />
gestellt. (...) § 4 Als sta<strong>at</strong>lich unzuverlässige Personen sind anzusehen:<br />
a) Personen deutscher oder magyarischer N<strong>at</strong>ionalität.<br />
Dekret Nr. 12 vom 21. Juni 1945 § 1 (1) Mit augenblicklicher Wirksamkeit und<br />
entschädigungslos wird für die Zwecke der Bodenreform das landwirtschaftliche<br />
Vermögen enteignet, das im Eigentum steht: a) aller Personen deutscher<br />
und magyarischer N<strong>at</strong>ionalität, ohne Rücksicht auf die Sta<strong>at</strong>sangehörigkeit. (...)<br />
Dekret Nr. 33 vom 2. August 1945 § 1 (1) Die tschechoslowakischen Sta<strong>at</strong>sbürger<br />
deutscher oder magyarischer N<strong>at</strong>ionalität, die nach den Vorschriften<br />
einer fremden Bes<strong>at</strong>zungsmacht die deutsche oder magyarische Sta<strong>at</strong>sangehörigkeit<br />
erworben haben, haben mit dem Tage des Erwerbs dieser Sta<strong>at</strong>sangehörigkeit<br />
die tschechoslowakische Sta<strong>at</strong>sbürgerschaft verloren. (2) Die<br />
übrigen tschechoslowakischen Sta<strong>at</strong>sbürger deutscher und magyarischer<br />
N<strong>at</strong>ionalität verlieren die tschechoslowakische Sta<strong>at</strong>sbürgerschaft mit dem<br />
Tage, an dem dieses Dekret in Kraft tritt. (...)<br />
Dekret Nr. 108 vom 25. Oktober 1945 § 1 (1) Konfisziert wird ohne Entschädigung<br />
– soweit dies noch nicht geschehen ist – für die Tschechoslowakische<br />
Republik das unbewegliche und bewegliche Vermögen, namentlich auch Vermögensrechte<br />
(wie Forderungen, Wertpapiere, Einlagen, imm<strong>at</strong>erielle Rechte),<br />
das bis zum Tage der t<strong>at</strong>sächlichen Beendigung der deutschen und magyarischen<br />
Okkup<strong>at</strong>ion in Eigentum stand oder noch steht. (...)<br />
Dekret Nr. 137 vom 27. Oktober 1945 § 1 Die Sicherstellung von Personen,<br />
die als sta<strong>at</strong>lich unzuverlässig angesehen wurden, durch Behörden oder Organe<br />
der Republik, auch außerhalb der gesetzlich st<strong>at</strong>thaften Fälle, oder eine<br />
Verlängerung ihrer vorläufigen Sicherstellung (Haft) über den gesetzlich zulässigen<br />
Zeitraum hinaus wird für gesetzmäßig erklärt. Solche Personen haben<br />
(...) keinen Anspruch auf Schadeners<strong>at</strong>z. § 2 Unter Sicherstellung (...) ist nicht<br />
die Zusammenziehung ausländischer Sta<strong>at</strong>sangehöriger zu verstehen, die von<br />
der zuständigen Behörde an bestimmten Orten zum Zwecke ihrer späteren<br />
Abschiebung durchgeführt wurde. Eine solche Zusammenziehung darf ohne<br />
jegliche Beschränkung durchgeführt werden.<br />
STRAFFREISTELLUNGSGESETZ vom 8. Mai 1946 § 1 Eine Handlung, die in<br />
der Zeit vom 30. September 1938 bis zum 28. Oktober 1945 vorgenommen<br />
wurde und deren Zweck es war, einen Beitrag zum Kampf um die Wiedergewinnung<br />
der Freiheit der Tschechen und Slowaken zu leisten, oder eine gerechte<br />
Vergeltung der T<strong>at</strong>en der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer zum Ziele<br />
h<strong>at</strong>te, ist auch dann nicht widerrechtlich, wenn sie sonst nach den geltenden<br />
Vorschriften strafbar gewesen wäre.
II. Aussagen zur Lösung<br />
der<br />
„Sudetendeutschen Frage“<br />
„Aber es ist möglich oder nötig, mit dem Weggang oder der Ausweisung<br />
ganzer Hunderttausender kompromittierter nazistischer Deutscher und der<br />
Zwangsaussiedlung weiterer Hunderttausender Deutscher (...) zu rechnen.“<br />
(Benesch in einer Depesche an den Zentralausschuss des Heim<strong>at</strong>widerstandes<br />
vom 26/27. November1940)<br />
„In unserem Land wird das Ende des Krieges mit Blut geschrieben werden.<br />
Den Deutschen wird mitleidlos und vervielfacht all das heimgezahlt werden,<br />
was sie in unseren Ländern seit 1938 begangen haben.“ (Benesch, Rundfunkrede<br />
am 27. Oktober 1943)<br />
„Wenn unser Tag kommt, wird das ganze Volk wieder den alten Hussitenruf<br />
anstimmen: Schlagt sie, tötet sie, lasst niemanden am Leben! Jedermann<br />
sollte sich bereits jetzt nach der bestmöglichen Waffe umsehen, die die Deutschen<br />
am stärksten trifft: Wenn keine Feuerwaffe zur Hand ist, sollte man irgendeine<br />
sonstige Waffe vorbereiten und verstecken – eine Waffe, die schneidet<br />
oder sticht oder trifft.“ (Sergej Ingr, Verteidigungsminister der Exilregierung,<br />
Rundfunkansprache vom 3. November 1944)<br />
„Die tschechische und slowakische N<strong>at</strong>ion betrachten (...) die Überführung<br />
der Deutschen und Ungarn einmütig als unerläßliche Voraussetzung der Zukunft<br />
des tschechoslowakischen Sta<strong>at</strong>es und der Bewahrung des Friedens in<br />
Mitteleuropa.“ (Note der tschechoslowakischen Regierung an die amerikanische<br />
Regierung vom 3. Juli 1945)<br />
„Unsere Deutschen widmeten sich zu 80 und 90 Prozent dem Dienst des<br />
barbarischen Nazismus zur Vernichtung unseres Sta<strong>at</strong>es und der Brechung des<br />
moralischen und kulturellen Kräfte und Werte unseres Volkes.“ (Benesch, Rede<br />
vor dem tschechoslowakischen Parlament, 28. Oktober 1945)<br />
„Mir war gleich nach München klar, dass bei der Beseitigung des Münchner<br />
Abkommens und seiner Folgen auch die Minderheitenfrage und besonders<br />
die Frage unserer Deutschen in und für unseren Sta<strong>at</strong> grundsätzlich und<br />
definitiv gelöst werden müsse. (...) Dieses politische Ziel, das ich während<br />
des ganzen Krieges im Auge hielt, musste dem Kriegsverlauf angepasst werden:<br />
vorsichtig und zurückhaltend vor und zu Beginn des Krieges, mit der Entwicklung<br />
des Krieges dann entschlossener und grundsätzlicher.“ (Benesch,<br />
Von München zum Krieg und zum neuen Sieg, Prag 1947, 312ff.)<br />
Gegenstimme dazu: „Der Vertreibungsplan steht im krassen Widerspruch<br />
sowohl zum intern<strong>at</strong>ionalen als auch zum tschechoslowakischen Recht. Die<br />
darin beantragten Maßnahmen werden vor der freien Welt weder vom Standpunkt<br />
einer politischen Vergeltung aus noch unter irgendwelchen Rechtsvorwänden<br />
zu verteidigen sein. Früher oder später wird zugegeben werden<br />
müssen, dass der Aussiedlungsplan auf nackter Willkür, Vermögensraub und<br />
n<strong>at</strong>ionaler Rachelust beruht. Wer immer daran beteiligt war, wird sich nie mehr<br />
als zivilisierter Europäer ausgeben können.“ (Wenzel Jacksch, Rundschreiben<br />
an die sudetendeutschen Sozialdemokr<strong>at</strong>en vom 20. Februar 1945)<br />
1945. Es sei zweifelhaft, ob die Dekrete<br />
selbst mit damals geltendem Völkerrecht<br />
vereinbar gewesen seien. Bernitz<br />
bezeichnet die Amnestiegesetze<br />
aus 1946 als „abstoßend“.<br />
Blick zurück<br />
Sie sind in aller Munde, aber wenn<br />
man fragt, was sind eigentlich die Benesch-Dekrete,<br />
dann wissen das nur die<br />
Wenigsten genau.<br />
Sie sind die sogenannte „Rechtsgrundlage“<br />
für die Enteignung und<br />
Vertreibung von dreieinhalb Millionen<br />
Deutschen und Ungarn. Schon im<br />
„Kaschauer St<strong>at</strong>ut“, dem ersten Programm<br />
der tschechoslowakischen Regierung<br />
der N<strong>at</strong>ionalen Front vom<br />
April 1945, wurde in Artikel VII vorgesehen,<br />
allen Sudetendeutschen die<br />
„tschechoslowakische Sta<strong>at</strong>sbürgerschaft“<br />
abzuerkennen, nachdem man<br />
sie völkerrechts- und menschenrechtswidrig<br />
wieder als „tschechoslowakische<br />
Sta<strong>at</strong>sbürger“ bezeichnete.<br />
Ausgenommen wurden nur jene, die<br />
sich „vor und nach München 1938“,<br />
loyal und treu zur Tschechoslowakei<br />
bekannten, die als „Antinazisten und<br />
Antifaschisten“ angesehen wurden.<br />
Zunächst waren also nur jene Sudetendeutschen<br />
zur Vertreibung „vorgesehen“,<br />
die nach tschechoslowakischer<br />
Auffassung „wegen Verbrechen gegen<br />
die Republik“ zu verurteilen waren.<br />
Aber nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges<br />
wurden alle stigm<strong>at</strong>isiert,<br />
indem sie weiße Armbinden mit dem<br />
schwarzen Aufdruck „N“ (Nemec=<br />
Deutscher) tragen mussten. Auch Lebensmittelkarten<br />
wurden damit versehen<br />
und der größte Teil wurde aus<br />
ihren Wohnungen in Lager getrieben.<br />
Somit erhielt der Hass gegen die Sudetendeutschen<br />
eine Eigendyanmik:<br />
Anfangs wollte man nur die Systemgegner<br />
„eliminieren“, aber das<br />
Kaschauer Programm änderte sich innerhalb<br />
weniger Wochen.<br />
Die Massenaustreibung vollzog sich<br />
in zwei Phasen, der „wilden“ Vertrei-<br />
23<br />
Europa<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Europa<br />
bung in den Mon<strong>at</strong>en Mai bis Juni<br />
1945 und der von den tschechoslowakischen<br />
Behörden und „N<strong>at</strong>ionalausschüssen“<br />
organisierten Massenaustreibungen<br />
von Juli bis Oktober<br />
1946. 240.000 starben dabei, darunter<br />
unzählige Pogrom-Tote. Die totale Enteignung,<br />
Rechtlosmachung und<br />
Zwangsarbeit wurden durch die „Dekrete<br />
des Präsidenten der Republik“<br />
von Sta<strong>at</strong>spräsident Edvard Benesch<br />
ausgelöst. Zu diesen gesetzgeberischen<br />
Akten wurde er durch das Kaschauer<br />
Programm ermächtigt. Die menschenverachtenden<br />
Dekrete wurden<br />
im nachhinein von der N<strong>at</strong>ionalversammlung<br />
bestätigt und besitzen auch<br />
heute noch Gesetzeskraft.<br />
Besonders brisant ist das Gesetz<br />
„über die Rechtmäßigkeit von Handlungen,<br />
die mit dem Kampf um die<br />
Wiedergewinnung der Freiheit der<br />
Anhaltende hervorragende Performance<br />
bescheinigt die R<strong>at</strong>ing<br />
Agentur Moody's Financial Institute<br />
Group der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich<br />
und bestätigt das A1-R<strong>at</strong>ing<br />
für die stärkste Regionalbank Österreichs.<br />
Moody's verweist in seiner Begründung<br />
insbesondere auf die Kosteneffizienz<br />
und das innov<strong>at</strong>ive<br />
Dienstleistungsangebot: „Eine Bestätigung<br />
für die erfolgreiche Geschäftspolitik<br />
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich<br />
und damit der gesamten Raiffeisenbankengruppe<br />
Oberösterreich“, so Raiffeisenlandesbank-Generaldirektor<br />
Dr. Ludwig<br />
Scharinger.<br />
24<br />
Tschechen und Slowaken zusammenhängen“,<br />
das sogenannte Amnestiegesetz.<br />
Es besagt, dass eine Handlung,<br />
die in der Zeit vom 30.9. 1938 bis zum<br />
28.10. 1945 vorgenommen wurde und<br />
deren Zweck es war, einen Beitrag zum<br />
Kampf um die Wiedergewinnung der<br />
Freiheit der Tschechen und Slowaken<br />
zu leisten, oder die eine gerechte Vergeltung<br />
für T<strong>at</strong>en der Okkupanten oder<br />
ihrer Helfershelfer zum Ziel h<strong>at</strong>te, auch<br />
dann nicht widerrechtlich ist, wenn<br />
sie sonst nach den geltenden Vorschriften<br />
strafbar gewesen wäre. Damit<br />
wurden praktisch alle an Deutschen<br />
und Ungarn im Zuge der<br />
Vertreibung begangenen Verbrechen<br />
legalisiert.<br />
Von Prag wird eine moralische Geste<br />
erwartet, die eigene Schuld eingesteht,<br />
wobei die „Erwartungen“ unterschiedlich<br />
sind. Sowohl die neue Prager Re-<br />
R<strong>at</strong>ing zeigt ausgezeichnete<br />
Grundlagen<br />
„Das A1/P-1/B-R<strong>at</strong>ing für die Raiffeisenlandesbank<br />
Oberösterreich spiegelt die<br />
ausgezeichneten finanziellen Grundlagen<br />
und die effiziente Zusammenarbeit innerhalb<br />
dieses Bankensektors in Oberösterreich<br />
wider“, so die Begründung Moody's.<br />
Die R<strong>at</strong>ingagentur verweist<br />
insbesondere auf das effiziente Kostenmanagement<br />
– die Raiffeisenlandesbank<br />
OÖ kann auf eine Cost-Income<br />
R<strong>at</strong>io (das Verhältnis von<br />
Aufwendungen zu Erträgen) von 55,2<br />
Prozent verweisen – und die gute Eigenkapitalausst<strong>at</strong>tung.<br />
gierung wie das Kabinett des Christdemokr<strong>at</strong>en<br />
Dzurinda in Pressburg wiegen<br />
sich in Selbstgenügsamkeit. Auch<br />
Erweiterungskommissar Gunther Verheugen<br />
sieht seine Mission erfüllt. Die<br />
Kritiker werden aber wohl erst dann verstummen,<br />
wenn die Dekrete nicht nur<br />
zu totem Recht erklärt, sondern ganz<br />
aufgehoben werden. So betonte Otto<br />
von Habsburg kürzlich in Wien: „Die<br />
Benesch-Dekrete sind weiterhin ein<br />
großes Unheil.“ Auch nach dem Beitritt<br />
werde diese ungelöste Frage Tschechen<br />
und Slowaken schaden, gäbe es doch<br />
in der Geschichte keine Rechnungen,<br />
die nicht über kurz oder lang beglichen<br />
würden.<br />
Erfolgreiche Geschäftspolitik der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich:<br />
Moody's bestätigt A1-R<strong>at</strong>ing für<br />
die Raiffeisenlandesbank OÖ<br />
Der Autor<br />
Prof. DDr. Johannes Michael Schnarrer ist<br />
Professor für Ethik und Sozialwissenschaften.<br />
A1-R<strong>at</strong>ing für die Raiffeisenlandesbank<br />
OÖ: „Eine Bestätigung für die erfolgreiche<br />
Geschäftspolitik „, so Dr. Ludwig<br />
Scharinger, Generaldirektor der<br />
Raiffeisenlandesbank OÖ.
Hans-Peter Bischof, R-B<br />
Modellprojekt Gesundheitsfonds<br />
Intensive Vernetzung, Kooper<strong>at</strong>ion und Koordin<strong>at</strong>ion<br />
Der Wahlkampf ist zu Ende, die<br />
Rückkehr zur Liste der drängenden<br />
Probleme ist angesagt; und da<br />
steht ein Thema ganz oben: Österreichs<br />
zunehmend unfinanzierbar<br />
werdendes Gesundheitswesen, wo<br />
„systembedingte Geldvernichtung“<br />
(SN) beziehungsweise „Geldverbrennung<br />
im Spital“ (Die Presse)<br />
an der Tagesordnung sind.<br />
„Zwei rührige Landesräte, Maria Haidinger<br />
in Salzburg und Hans-Peter Bischof<br />
in Vorarlberg, bemühen sich, das seit Jahrzehnten<br />
erstarrte österreichische Gesundheitswesen<br />
zu erneuern. Sie müssten überall<br />
Applaus und Unterstützung ernten. Die<br />
Realität sieht leider anders aus“ schrieb Ronald<br />
Barazon noch im April und beklagte<br />
die Vielfalt der Mächtigen im Gesundheitswesen,<br />
die es bislang immer verstanden<br />
h<strong>at</strong>ten, intelligente und zielführende<br />
Reformen zu verhindern. Wenn ein unabhängiger<br />
Journalist und exzellenter Wirtschaftsfachmann,<br />
wie der Chefredakteur<br />
der Salzburger Nachrichten einen Politiker<br />
explizit lobt, dann muss schon mehr dahinter<br />
stecken, als ein innenpolitisches<br />
Strohfeuer.<br />
Vorarlberg wird ab 2003 das Pionier-<br />
Modell eines Landesgesundheitsfonds realisieren.<br />
Ein notwendiges und interessantes<br />
Experiment, von dem das österreichische<br />
Gesundheitswesen insgesamt nur profitieren<br />
kann. Deshalb haben wir den Vorarlberger<br />
Landesr<strong>at</strong> um einen Beitrag zu diesem<br />
Thema gebeten.<br />
Das Thema Gesundheit wird in den<br />
nächsten Jahren eine noch herausragendere<br />
gesellschaftliche Rolle spielen<br />
als bisher und zum Meg<strong>at</strong>rend werden.<br />
Die Verantwortlichen für die Planung<br />
und Weiterentwicklung des Gesundheitssystems<br />
müssen die Herausforderungen<br />
annehmen und aktiv an der Gestaltung<br />
einer qualit<strong>at</strong>iv hochwertigen,<br />
aber vor allem auch finanzierbaren Gesundheitsversorgung<br />
für alle Menschen<br />
mitwirken. Im Mittelpunkt aller Überlegungen<br />
muss aber der P<strong>at</strong>ient stehen,<br />
der sich darauf verlassen können soll,<br />
dass ihm im Bedarfsfall die bestmögliche<br />
medizinische Behandlung und Betreuung<br />
zur Verfügung steht. Denn wer<br />
krank ist, muss sich auf den sicheren<br />
Schutz der Solidargemeinschaft in Form<br />
eines hochwertigen und effizienten Gesundheitssystems<br />
verlassen können.<br />
Unnötiger medizinischer Aufwand und<br />
nicht verzahnte Behandlungspfade sind<br />
aber sicher nicht im Sinne des betroffenen<br />
P<strong>at</strong>ienten. Wenn wir den hohen<br />
Standard unseres Gesundheitswesens<br />
in Qualität und Quantität optimieren<br />
und bedarfsgerecht ausbauen wollen,<br />
haben wir große Aufgaben vor uns. Zur<br />
Optimierung der P<strong>at</strong>ientenbehandlung,<br />
aber auch wegen der Kostenentwicklung<br />
der letzten Jahre, ist es notwendig,<br />
das gesamte System zu überdenken, es<br />
intensiv zu vernetzen und neue Wege<br />
der Kooper<strong>at</strong>ion und Koordin<strong>at</strong>ion zu<br />
gehen.<br />
Das entscheidende Handicap im derzeitigen<br />
System stellt das Problem dar,<br />
dass in den Bereichen Krankenhäuser<br />
und niedergelassene Versorgung völlig<br />
getrennte Verantwortlichkeiten bestehen.<br />
Dadurch wird in vielen Fällen die<br />
durchgängige P<strong>at</strong>ientenbetreuung be-<br />
hindert und ein guter Nährboden für<br />
kostentreibende Doppelgleisigkeiten<br />
gefördert. Das duale Finanzierungssystem<br />
verursacht eine ausgeprägte<br />
Schnittstellenproblem<strong>at</strong>ik mit einem<br />
Verlust an Effizienzpotenzial von bis zu<br />
20 Prozent. Die Weiterentwicklung des<br />
Angebotes im Gesundheitswesen wird<br />
– basierend auf dieser Situ<strong>at</strong>ion – durch<br />
massive Struktur- und Interessenskonflikte<br />
gestört.<br />
Um Qualität, Quantität und Finanzierbarkeit<br />
unseres Gesundheitssystems<br />
erhalten zu können, ist eine Strukturreform<br />
unerlässlich. Wir haben dazu in<br />
Vorarlberg als einen Lösungsans<strong>at</strong>z das<br />
Modellprojekt des „Vorarlberger<br />
Gesundheitsfonds“ entwickelt. Wir<br />
rechnen mit einer deutlichen Effizienzsteigerung<br />
an der kosten- und konfliktträchtigen<br />
Schnittstelle extramural/hospitär.<br />
Das grundsätzliche Motto<br />
lautet: „Ganzheitlich planen – aus einem<br />
Guss finanzieren.“<br />
Geld besser einsetzen<br />
Grundsätzlich ist Wert auf die T<strong>at</strong>sache<br />
zu legen, dass es beim Vorarlberger<br />
Pilotprojekt nicht primär darum<br />
geht, für das Gesundheitswesen weniger<br />
Geld auszugeben, sondern das vorhandene<br />
Geld noch besser einzusetzen.<br />
Nur dann wird es gelingen, die drohende<br />
Kostenspirale durch die Ausnutzung<br />
von vorhandenen Effizienzpotenzialen<br />
nicht durchdrehen zu<br />
lassen.<br />
Nach langen Verhandlungen ist es<br />
schließlich gelungen, das Einverständnis<br />
des Bundesministeriums und des<br />
Hauptverbandes der österreichischen<br />
Sozialversicherungsträger zur Imple-<br />
25<br />
Politik<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Politik<br />
mentierung dieses innov<strong>at</strong>iven Modellprojektes<br />
zu erhalten. Der Gesundheitsfonds<br />
soll Anfang kommenden Jahres<br />
starten und vorerst auf einer<br />
freiwilligen Vereinbarung zwischen allen<br />
wesentlichen Partnern – Land, Gemeinden,<br />
Bund, Hauptverband, Träger<br />
der sozialen Krankenversicherung (Gebietskrankenkasse<br />
und sogenannte<br />
„kleine Kassen“ wie die Versicherungsanstalten<br />
der Bauern, der gewerblichen<br />
Wirtschaft etc.) und Ärztekammer – basieren.<br />
Damit h<strong>at</strong> sich das Projekt als<br />
richtiger Wegweiser zur Reform des Ge-<br />
sundheitswesens nach intensiver Überzeugungsarbeit<br />
durchgesetzt. Mit dem<br />
Bund wurde eine zweijährige Umsetzungsphase<br />
akkordiert, so lange nämlich,<br />
wie die bestehende Artikel 15a-Vereinbarung<br />
noch Gültigkeit h<strong>at</strong>.<br />
Die Planung des Gesundheitswesens<br />
muss in Zukunft über zwischen den Verantwortungspartnern<br />
abgestimmte Zielsetzungen<br />
sektorenübergreifend gestaltet<br />
werden. Diese Planung soll über<br />
ein gemeinsames Gremium, nämlich<br />
das „Kur<strong>at</strong>orium des Fonds“, gesteuert<br />
werden. Das ist das Kernstück des Modellprojektes.<br />
Dieses Kur<strong>at</strong>orium kann<br />
nur auf freiwilliger Basis implementiert<br />
werden, weil ihm bei bestehender Gesetzeslage<br />
keine Durchgriffskompetenz<br />
zukommt. Bestehende Strukturen sol-<br />
26<br />
len aber durch diese Verantwortungsbrücke<br />
verzahnt werden.<br />
Zielsetzungen<br />
Der Gesundheitsfonds soll<br />
– eine landesbezogene ganzheitliche<br />
Zielsetzung und Planung des Gesundheitswesen<br />
mit sektorenübergreifender<br />
Abstimmung und Vernetzung des Leistungsangebotes<br />
ermöglichen,<br />
– durch eine Vereinheitlichung in der<br />
Dokument<strong>at</strong>ion zu einer harmonisierten<br />
Diagnosen- und Leistungserfassung<br />
bei den niedergelassenen Leistungserbringern<br />
und im Spitalsbereich führen<br />
(Leistungsvergleich, Qualitätssicherung,<br />
Evalu<strong>at</strong>ion),<br />
– durch übergreifende Schnittstellenprojekte<br />
und deren „Finanzierung aus<br />
einem Guss“ zur durchgängigen P<strong>at</strong>ientenbetreuung<br />
und Verzahnung aller<br />
Versorgungselemente führen,<br />
– unter bundesweiter Koordin<strong>at</strong>ion implementiert<br />
werden.<br />
Zusammensetzung<br />
des Kur<strong>at</strong>oriums:<br />
– Zwei Vertreter der Vorarlberger Gebietskrankenkasse;<br />
– ein Vertreter, der durch die Sozialversicherungsanstalt<br />
der Bauern, die Versicherungsanstalt<br />
öffentlich Bedien-<br />
steter, die Sozialversicherungsanstalt<br />
der gewerblichen Wirtschaft, die Versicherungsanstalt<br />
der österreichischen<br />
Eisenbahnen und die Versicherungsanstalt<br />
des österreichischen Bergbaues<br />
gemeinsam und einvernehmlich<br />
delegiert wird;<br />
– ein Vertreter des Hauptverbandes der<br />
österreichischen Sozialversicherungsträger;<br />
– zwei Vertreter, die von der Vorarlberger<br />
Landesregierung namhaft gemacht<br />
werden;<br />
– ein Vertreter des Vorarlberger Gemeindeverbandes;<br />
– ein Vertreter der Stadt Dornbirn als<br />
Träger des Krankenhauses Dornbirn;<br />
– ein Vertreter des Bundesministeriums<br />
für soziale Sicherheit und Gener<strong>at</strong>ionen;<br />
– ein Vertreter der Ärztekammer für Vorarlberg.<br />
Dieses Kur<strong>at</strong>orium wird die Aufgabe<br />
haben, gemeinsame Zielsetzungen und<br />
Planungen für das Vorarlberger Gesundheitswesen<br />
zu erarbeiten. Es trägt<br />
die projektbezogene Verantwortung<br />
und ist zuständig für die Finanzierung<br />
der Projekte, deren laufende Evalu<strong>at</strong>ion<br />
und das Controlling. Es soll auch<br />
eine Dokument<strong>at</strong>ion implementiert<br />
werden, die sektorenübergreifend den<br />
ambulanten (sowohl extramural bei den<br />
niedergelassenen Ärzten als auch in den<br />
Spitalsambulanzen) Bereich hinsichtlich<br />
Diagnosen- und Leistungserfassung<br />
abdeckt und mit der LKF-Dokument<strong>at</strong>ion<br />
komp<strong>at</strong>ibel sein muss.<br />
Das sehr innov<strong>at</strong>ive Vorarlberger<br />
Modellprojekt wird neue Impulse in<br />
der österreichischen Gesundheitslandschaft<br />
setzen, weil die Zusammenarbeit<br />
zwischen dem niedergelassenen<br />
Bereich und den Spitälern in<br />
Vorarlberg enger und für Österreich<br />
beispielhaft werden wird. Solche Maßnahmen<br />
müssen vor allem dort realisiert<br />
werden, wo die durchgängige und<br />
reibungsfreie P<strong>at</strong>ientenbetreuung optimiert<br />
werden kann und wo unnötige<br />
Gesundheitsausgaben vermieden
werden können. Dies wird durch einzelne<br />
Projekte wie<br />
– „Präoper<strong>at</strong>ive Diagnostik“,<br />
– „Steigerung der Effektivität des Bereitschaftsdienstes<br />
der niedergelassenen<br />
Ärzte“,<br />
– „Postst<strong>at</strong>ionäre Vernetzung durch koordiniertes<br />
Entlassungsmanagement“,<br />
– „Palli<strong>at</strong>ivmedizin“<br />
in den nächsten zwei Jahren zu erreichen<br />
sein. Die Konzentr<strong>at</strong>ion wird<br />
jetzt unmittelbar auf die Bereiche „Präoper<strong>at</strong>ive<br />
Diagnostik“ und „Ärztebereitschaft“<br />
gerichtet werden. Die dafür notwendigen<br />
Detailausarbeitungen sind<br />
schon angelaufen, was den Beginn 2003<br />
sichern soll. Im nächsten Jahr wird dann<br />
das Hauptaugenmerk auf die Implementierung<br />
des aufwendigen Projektes<br />
„Entlassungsmanagement“ gelegt werden.<br />
Der zweite Schwerpunkt wird das<br />
Thema „Palli<strong>at</strong>ive Care“ sein, dem wir<br />
höchste Aufmerksamkeit schenken werden.<br />
Denn hier sind neue Strukturen<br />
aufzubauen, wobei gerade in diesem<br />
wichtigen Gesundheitsfeld eine optimale<br />
Betreuung der P<strong>at</strong>ienten „schnittstellenfrei“<br />
möglich sein muss. Über<br />
diese beiden Projekte soll ab 2004 die<br />
Vernetzung im Gesundheitswesen verdichtet<br />
werden. Schon parallel zu den<br />
abschließenden Vereinbarungsverhandlungen<br />
werden deshalb Arbeitsgruppen<br />
konkret damit beauftragt, die<br />
inhaltlichen Vorgaben und Zielsetzungen<br />
der erwähnten Vernetzungsprojekte<br />
auszuformulieren.<br />
Die Notwendigkeit einer Reform unseres<br />
Gesundheitswesens ist unbestritten.<br />
Eine der Begründungen sind die<br />
problem<strong>at</strong>ischen Bereiche an den<br />
Schnittstellen zwischen dem Krankenhaus-<br />
und dem ambulanten Versorgungsbereich.<br />
Unser System h<strong>at</strong> keine<br />
qualitäts-, sondern strukturbezogene<br />
Probleme. Dies resultiert vor allem daraus,<br />
dass es bislang völlig getrennte Verantwortungskompetenzen<br />
gab und das<br />
Finanzierungssystem für viele völlig undurchschaubar<br />
ist. Eine Problem<strong>at</strong>ik die<br />
nur mit „ganzheitlicher Planung und<br />
Finanzierung aus einem Guss“ zu lösen<br />
ist. Das erfordert aber eine bessere Vernetzung<br />
zwischen den Versorgungsbereichen<br />
in und außerhalb der Krankenhäuser.<br />
Dass dies über eine regionale<br />
Planung leichter zu erreichen ist, liegt<br />
auf der Hand. Denn eine Weiterentwicklung<br />
unserer Gesundheitslandschaft<br />
ist nur auf Basis der gewachsenen<br />
Strukturen möglich. Vorarlberg h<strong>at</strong><br />
ganz einfach andere Voraussetzungen<br />
als beispielsweise das Burgenland – nicht<br />
qualit<strong>at</strong>iv bewertet, aber in der Analyse<br />
der bestehenden Strukturen klar zu<br />
erkennen.<br />
Aber es sollen nicht alle Wände eingerissen<br />
werden. Wir wollen nicht mit<br />
Revolution, sondern mit Evolution aus<br />
den bestehenden Strukturen heraus das<br />
Ziel der Reform im Konsens und schrittweise<br />
erreichen. Deshalb wird auch mit<br />
den einzelnen Projekten begonnen,<br />
über die schließlich dann eine gesamthafte<br />
Vernetzung und die Abstimmung<br />
des Gesundheitsangebotes möglich sein<br />
wird. Schlussendlich werden sich die<br />
ineffizienten Kostenverschiebungen<br />
nur mit einem integrierten Gesundheitswesen<br />
und dessen Finanzierung<br />
aus einem gemeinsamen Topf verhindern<br />
lassen. Aus den Vorarlberger Erkenntnissen<br />
können – wie schon in der<br />
Vergangenheit mehrfach geschehen –<br />
auch aus diesem Modellprojekt positive<br />
Impulse für die Weiterentwicklung<br />
des österreichischen Gesundheitswesen<br />
entstehen.<br />
Der Autor<br />
Dr. Hans-Peter Bischof , R-B<br />
Vorarlberger Landesr<strong>at</strong> für Gesundheit,<br />
Soziales und Kultur.<br />
Sie sind auf der Suche nach einem sinnvollen<br />
Weihnachtsgeschenk?<br />
Wie wäre es mit einem FURCHE-Abo?<br />
DIE FURCHE ist ein<br />
gesundes, intelligentes und aktuelles Geschenk,<br />
das noch dazu ganz ohne Einkaufsstress<br />
bestellt werden kann.<br />
Der beiliegende FURCHE-Folder informiert Sie.<br />
DIE FURCHE<br />
Lobkowitzpl<strong>at</strong>z 1<br />
1010 Wien<br />
Tel: 01 512 52 61<br />
E-Mail: furche@furche.<strong>at</strong><br />
27<br />
Politik<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Politik<br />
„Unglaublich unüberschaubar“<br />
Univ. Prof. Karl Korinek, F-B, Rt-D, der neue<br />
Präsident des Verfassungsgerichtshofes,<br />
nimmt im ACADEMIA-Gespräch Stellung zu<br />
Fragen der Bundessta<strong>at</strong>sreform und zum<br />
EU-Verfassungskonvent. Er beurteilt die<br />
Flut an Verfassungsgesetzen und äußert<br />
seine Wünsche an die nächste Bundesregierung.<br />
Das Gespräch führten Herbert<br />
Kaspar, Am, und Paul Hefelle, F-B, BbG<br />
<strong>Academia</strong>: H<strong>at</strong> sich mit der Bestellung<br />
zum Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes,<br />
zu der wir herzlich<br />
gr<strong>at</strong>ulieren, der Traum jedes<br />
Vollblutjuristen erfüllt?<br />
Korinek: Der Traum ist bereits erfüllt,<br />
sobald man Mitglied im Gerichtshof ist.<br />
Von bestimmten Funktionen innerhalb<br />
dieses Gremiums hängt es nicht so ab.<br />
Wobei die Aufgabe des Präsidenten sich<br />
von jener des Berichterst<strong>at</strong>ters und des<br />
Richters dadurch unterscheidet, dass sie<br />
nicht primär juristisch ist. Die Tätigkeit<br />
besteht eher in der Leitung und Repräsent<strong>at</strong>ion<br />
des Gerichtshofes nach<br />
außen. Ich habe mir gerade deswegen<br />
lange überlegt, ob ich mich für dieses<br />
ungemein wichtige und ehrenvolle,<br />
aber doch stärker politische als juristische<br />
Amt bewerbe.<br />
Professor Mayer h<strong>at</strong> im Standard gesagt,<br />
dass dieses Jahr kein gutes für<br />
den Verfassungsgerichtshof war.<br />
Stimmt das?<br />
Es war kein schlechtes Jahr, auch<br />
wenn die Turbulenzen zu Jahresbeginn<br />
nicht angenehm waren. Zu der Diskussion<br />
um die Ausschreibung: Es h<strong>at</strong><br />
28<br />
nichts mit dem Verfassungsgerichtshof<br />
als solches zu tun, ob Organe etwas in<br />
bestimmter Weise tun und ob sie das<br />
schneller oder weniger schnell tun.<br />
Außerdem ist diese Art der Ausschreibung<br />
dazu da, Vakanzen zu verhindern.<br />
Das ist in der ordentlichen Gerichtsbarkeit<br />
und beim Verwaltungsgerichtshof<br />
seit Jahrzehnten so üblich und überhaupt<br />
kein Problem. Wer verlangt, dass<br />
man mit der Bestellung der Richter auf<br />
die nächste Regierung warten soll, der<br />
will, dass die Regierung sich ihre Kontrollore<br />
selbst aussucht. Dafür habe ich<br />
kein Verständnis.<br />
Wie soll man die<br />
Flut an Verfassungsgesetzenbewerten?<br />
Viele Bestimmungen<br />
wurden in den<br />
Verfassungsrang<br />
erhoben, um sie<br />
vor dem Zugriff<br />
des Verfassungsgerichtshofes<br />
zu<br />
schützen.<br />
Man h<strong>at</strong> das zunächst in diesem Sinn<br />
eingesetzt, aber nicht bedacht, dass man<br />
damit das Netz immer enger macht.<br />
Dass man oft an eine von diesen über<br />
1000 Bestimmungen im Verfassungsrang<br />
stößt, ist ein großes Hemmnis für<br />
die Gestaltung des Rechts.<br />
Es wurde also Missbrauch betrieben.<br />
Ich wäre mit diesem Begriff vorsichtig.<br />
Eine Pervertierung des Gedankens?<br />
Man h<strong>at</strong> die formale Möglichkeit Verfassungsbestimmungen<br />
zu schaffen ex-<br />
zessiv genützt, auch in Fällen wo es<br />
nicht notwendig gewesen wäre. Damit<br />
h<strong>at</strong> man sich in einem dichten Netz an<br />
Verfassungsbestimmungen verfangen.<br />
Zum Thema Bundesssta<strong>at</strong>sreform<br />
h<strong>at</strong> Alfred Gusenbauer vorgeschlagen,<br />
einen Verfassungskonvent einzuberufen.<br />
Der Verfassungsgerichtshof kann hier<br />
nichts Inhaltliches einbringen, sondern<br />
nur Formales. Aber es fehlt für eine umfassende<br />
Verfassungsreform derzeit<br />
wohl am Grundkonsens. Daher wird<br />
man nicht weiterkommen, wenn man<br />
nicht in einer Punkt<strong>at</strong>ion festhält, worüber<br />
Einigkeit besteht.<br />
Entscheidet der Verfassungsgerichtshof<br />
politisch?<br />
Man erwartet sich oft von der Entscheidung<br />
des Verfassungsgerichtshofes<br />
die Lösung politischer Fragen. Dahinter<br />
steckt ein grundlegendes<br />
Missverständnis. Der Gerichtshof kann<br />
immer nur entscheiden, ob etwas verfassungsgemäß<br />
ist oder nicht. Nicht<br />
aber, ob etwas anderes zweckmäßiger<br />
wäre. Diese beiden Ebenen werden oft<br />
vermischt. Dann kommt für die Bevöl-
kerung ein unverständliches Konglomer<strong>at</strong><br />
heraus; der Gerichtshof entscheidet<br />
aber nicht, ob eine Gebühr gescheit<br />
oder blöd ist, sondern nur, ob sie<br />
der Verfassung entspricht oder nicht.<br />
Selbst wenn sie äußerst vernünftig erscheint,<br />
muss er sie aufheben, wenn sie<br />
nicht der Verfassung entspricht. Aus<br />
diesem Missverständnis heraus entsteht<br />
die Auffassung, dass der Gerichtshof<br />
entschieden habe, es handle sich um<br />
ein schlechtes Gesetz.<br />
Andere Länder haben keine geschriebene<br />
Verfassung, funktionieren<br />
aber bestens. Ist keine Verfassung<br />
die beste Verfassung?<br />
Das ist eine Frage der Tradition. England<br />
ist nahezu das genaue Gegenteil<br />
zu Österreich mit seinem dichten Netz<br />
an Verfassungsregelungen. Es kommt<br />
darauf an, wie man das lebt, auch politisch.<br />
In England wütet die Opposition<br />
zwar gegen Gesetze der Regierung,<br />
aber wenn es zu einem Wechsel<br />
kommt, wird auch im Sinne einer gewissen<br />
Fairness nicht gleich wieder<br />
alles abgeschafft. N<strong>at</strong>ürlich machen<br />
sie neue Gesetze, aber sie treten nicht<br />
an und sagen, dass alles wieder abgeschafft<br />
wird. Der Stil ist ein anderer.<br />
Sie haben auch keinen Verfassungsgerichtshof,<br />
sondern das Oberhaus.<br />
Stichwort Oberhaus. Wer braucht<br />
den Bundesr<strong>at</strong>?<br />
Das zentrale Problem ist, dass es kein<br />
gebundenes Abstimmungsverhalten der<br />
Abgeordneten der Länder gibt. Ich verstehe<br />
nicht, warum der österreichische<br />
N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong> unsere Vertreter bei Gesetzgebungsakten<br />
in der EU weitgehend<br />
binden kann, aber der Landtag die Landesdelegierten<br />
in der Bundesgesetzgebung<br />
nicht. N<strong>at</strong>ürlich h<strong>at</strong> der Bundesr<strong>at</strong><br />
auch Vorteile, weil man auf einer<br />
ruhigeren Ebene sachpolitische Gespräche<br />
führen kann. Ob das realpolitisch<br />
wirklichen Einfluss h<strong>at</strong>, ist etwas<br />
anderes. Außerdem, und das wurde mir<br />
oft gesagt, ist er auch eine politische<br />
Gehschule.<br />
Oder ein politisches Ausgedinge.<br />
Das mag in einzelnen Fällen sein, es<br />
gibt nur wenige, die immer dort sein<br />
wollten.<br />
Herbert Schambeck.<br />
Oder Jürgen Weiß, das sind wirkliche<br />
Persönlichkeiten, die dort eine Pl<strong>at</strong>tform<br />
auch für politische Aktivitäten haben.<br />
Aber die politische Wirksamkeit<br />
bei der Gesetzgebung ist aufgrund der<br />
genannten Fakten gering.<br />
Stichwort EU. Derzeit läuft das<br />
durchaus interessante Projekt eines<br />
EU-Konvents. Wie beurteilst Du die<br />
Chancen, dass sich die heterogenen<br />
Länder einigen können?<br />
Ich glaube, der Konvent h<strong>at</strong> sich ein<br />
bisschen viel auf einmal vorgenommen.<br />
Er werden zu viele Ebenen gleichzeitig<br />
diskutiert, das birgt die Gefahr, dass man<br />
im Allgemeinen stecken bleibt. Eine ordentliche<br />
Kompetenzregelung, die bestimmt,<br />
welche Bereiche in den Mitgliedssta<strong>at</strong>en<br />
zu regeln sind, und welche<br />
auf EU-Ebene würde die Durchschaubarkeit<br />
der Strukturen der Gesetzgebung<br />
in der EU erhöhen. Eine EU-Verfassung<br />
würde die gemeinsame Basis bewusster<br />
machen. Welcher Bürger denkt schon<br />
daran, dass heute die Verträge diese gemeinsame<br />
Basis sind? Ein pluralistisches<br />
System braucht eine gemeinsame<br />
Grundlage. Daher darf man sie nicht<br />
mit Kleinigkeiten überfrachten, denn<br />
sonst wird es eine rein technische Angelegenheit<br />
und verliert die identitätsstiftende<br />
Funktion.<br />
Wie geht ein Vollblutjurist damit um,<br />
dass die Gesetze in der EU nicht vom<br />
Parlament, sondern vom R<strong>at</strong> gemacht<br />
werden?<br />
Der R<strong>at</strong> ist demokr<strong>at</strong>isch mittelbar<br />
legitimiert. Wer im R<strong>at</strong> sitzt, ergibt sich<br />
letztlich aus dem Ergebnis der n<strong>at</strong>ionalen<br />
Parlamentswahlen. Wenn man<br />
die Gesetze auf EU-Ebene durch das<br />
Parlament beschließen lassen will,<br />
dann geht man den ersten Schritt zum<br />
eigenen Sta<strong>at</strong>. Die Errichtung eines<br />
Bundessta<strong>at</strong>es Europa wäre die Konsequenz.<br />
Wir haben in der letzten Ausgabe einen<br />
Beitrag des Völkerrechtlers Humer<br />
veröffentlicht. Er sagt, die Sanktionen<br />
seien als Maßnahme ein<br />
Novum gewesen.<br />
Das ist richtig. Es ist auch die herrschende<br />
Rechtsmeinung, dass sie rechtswidrig<br />
waren, aber wir haben die Frist<br />
versäumt, uns an den EuGH zu wenden.<br />
Zunächst wollten wir es nicht auf<br />
29<br />
Politik<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Politik<br />
rechtlicher Ebene spielen, und als dies<br />
überlegt wurde, war die Frist vorbei.<br />
Letztlich war es aber wohl richtig, das<br />
auf der politischen Ebene zu belassen.<br />
Was wünscht sich der Präsident des<br />
Verfassungsgerichtshofes von der neuen<br />
Regierung?<br />
Dass sie bei der Gesetzgebung verfassungsorientiert<br />
agiert und die Frage<br />
der Verfassungsmäßigkeit immer mit<br />
bedenkt. Eines unserer größten Probleme<br />
ist ja die Fülle an Einzelregelungen,<br />
die immer mehr aus dem System<br />
ausbrechen. Das macht die Rechtsordnung<br />
unglaublich unüberschaubar. Das<br />
ist momentan die größte Gefahr für<br />
den Rechtssta<strong>at</strong>, dass sich keiner mehr<br />
auskennt. Politiker haben in erster Linie<br />
Interesse an der Lösung der Sachfrage,<br />
die Art der Umsetzung interes-<br />
Kommentar Farbenspiele<br />
Eigentlich müsste Wolfgang Schüssel<br />
im 7. Himmel sein. Er h<strong>at</strong> seine Gegner<br />
regelrecht zertrümmert und den<br />
höchsten Stimmenzuwachs einer Partei<br />
seit Beginn der 2. Republik eingefahren.<br />
Letztendlich gibt ihm das Wahlergebnis<br />
auf zwei Ebenen recht: Zum<br />
einen ist es eine Bestätigung dafür, dass<br />
die Wähler die Sinnhaftigkeit von (in<br />
manchen Fällen vielleicht sogar<br />
schmerzhaften) Reformen anerkennen,<br />
zum zweiten h<strong>at</strong> er endgültig den Beweis<br />
geliefert, dass die Einbindung<br />
der Freiheitlichen<br />
wirkungsvoller war als deren<br />
Ausgrenzung.<br />
Und doch ist Schüssels Situ<strong>at</strong>ion<br />
eine schwierige.<br />
Denn dass der Bundeskanzler<br />
drei Optionen zur Regierungsbildung<br />
h<strong>at</strong>, macht die<br />
Situ<strong>at</strong>ion nur auf den ersten<br />
Blick einfacher.<br />
Schwarz-rot hätte nach<br />
Paul Hefelle, F-B, BbG<br />
den Gewinnen beider Partei-<br />
30<br />
siert sie zu wenig. Das führt zu Gesetzen,<br />
die man teils nicht versteht, weil<br />
sie in sich widersprüchlich sind. Ein<br />
Beispiel: Das Zusammenspiel der Vorschriften<br />
über die Festlegung einer Bundesstraßentrasse<br />
mit den Vorschriften<br />
über die Umweltverträglichkeit ist überhaupt<br />
nicht gelungen. Die Rechtslage<br />
wirft Probleme auf, die fast nicht lösbar<br />
sind. Das h<strong>at</strong> dem Gerichtshof bei<br />
der Prüfung der Trasse der B 301 die<br />
größten Schwierigkeiten gemacht. Die<br />
anzuwendenden Gesetze passen hinten<br />
und vorne nicht zusammen. Da<br />
eine Lösung zu finden h<strong>at</strong> Wochen und<br />
Mon<strong>at</strong>e gekostet. Ich habe drei bis vier<br />
Tage gebraucht, bis ich den Fall aufgrund<br />
des Entscheidungsentwurfes, der<br />
blendend ausgearbeitet war, verstanden<br />
habe. Das muss man sich vorstellen,<br />
bei hunderten wichtigen Entscheidungen<br />
im Jahr.<br />
en zwar wieder eine s<strong>at</strong>te Zwei-Drittel-<br />
Mehrheit, die lähmende Art und Weise,<br />
in der sich diese Partnerschaft in den<br />
Neunziger Jahren gegenseitig blockiert<br />
h<strong>at</strong> ist aber nicht gerade eine Empfehlung.<br />
Abgesehen davon: Wie will man<br />
eine Wiederauflage jenen Hunderttausenden<br />
von der FPÖ zur ÖVP zurückgekehrten<br />
Wählern erklären? Viele haben<br />
Schüssel diesmal gewählt, weil er<br />
sich 2000 aus dem „großkoalitionären<br />
Faulbett“ erhoben h<strong>at</strong>.<br />
Also wieder schwarz-blau? Wenn die<br />
„Knittelfelder“ in den Hintergrund ab-<br />
(oder im Idealfall einige von ihnen sogar<br />
aus-) treten wäre eine solche Konstell<strong>at</strong>ion<br />
durchaus vorstellbar. Allein:<br />
Danach sieht es nicht aus. So lange der<br />
Kärntner Egomane mit seinen Spießgesellen<br />
in der FPÖ Einfluss ausübt, ist<br />
jede Fortsetzung der schwarzblauen Reformpolitik<br />
unmöglich. Angesichts der<br />
innerparteilichen Krämpfe, die die Freiheitlichen<br />
derzeit schütteln, weiß man<br />
allerdings nicht einmal, wie lange es<br />
diese FPÖ noch geben wird.<br />
Bleibt schwarz-grün. Wenn man<br />
Wahlkampfparolen und gegenseitige<br />
Lebenslauf<br />
Karl Korinek wurde 1940 in Wien geboren,<br />
wo er auch das Gymnasium und<br />
das Studium der Rechtswissenschaften absolvierte.<br />
Nach der Promotion im Jahre<br />
1963 war er bis 1973 Rechtskonsulent der<br />
damaligen Bundeskammer der gewerblichen<br />
Wirtschaft. 1970 Habilit<strong>at</strong>ion für Verfassungsrecht<br />
sowie Verwaltungsrecht in<br />
Salzburg. Von 1973 bis 1976 dann Professor<br />
an der Uni-Graz, anschließend bis<br />
1995 an der WU-Wien. Seitdem Professor<br />
für Sta<strong>at</strong>s- und Verwaltungsrecht an der<br />
Uni Wien und seit 1992 auch Mitglied des<br />
Lehrkörpers der Donau-Universität Krems.<br />
Seit 1978 Mitglied des Verfassungsgerichtshofes<br />
und seit 1999 dessen Vizepräsident.<br />
Mit Wirkung vom 1.1.2003 wird<br />
Dr. Korinek als Präsident dieses Gerichtshofes<br />
fungieren.<br />
Verletzungen in den Hintergrund rückt<br />
und zur Sachpolitik zurückkehrt, hätte<br />
diese Konstell<strong>at</strong>ion durchaus ihren Reiz.<br />
Abgesehen von gesellschaftspolitischen<br />
Gegensätzen, die bei den Wählern der<br />
beiden Parteien so und so weniger ausgeprägt<br />
sind als bei den Funktionären<br />
(die Grünen haben seit jeher auch und<br />
vor allem im bürgerlichen Lager gefischt),<br />
kann eine Zusammenarbeit gerade<br />
dann fruchtbar sein, wenn sie zwischen<br />
zwei deutlich unterscheidbaren<br />
Partnern st<strong>at</strong>tfindet. In essentiellen Fragen<br />
wie der EU-Erweiterung besteht ja<br />
bereits jetzt weitgehend Konsens.<br />
N<strong>at</strong>ürlich müsste die ÖVP trotz ihres<br />
triumphalen Wahlerfolges den Grünen<br />
ein faires Angebot machen, dass diesen<br />
einen Gesichtsverlust erspart.<br />
Die Grünen aber haben jetzt die reale<br />
Chance – die ohnehin sehr unwahrscheinliche<br />
– Fortsetzung von schwarzblau<br />
und gleichzeitig eine im Parlament<br />
übermächtige große Koalition zu verhindern.<br />
Sie sollten zumindest das Gespräch<br />
darüber nicht verweigern. Im<br />
Trotzwinkerl nimmt man eine Partei<br />
dieser Größe nicht wirklich ernst.
Fünf einfache Wahrheiten,<br />
einer neuen Regierung gewidmet<br />
Als Periodikum müssen wir die tagesaktuellen Kommentare und<br />
Koalitionsspekul<strong>at</strong>ionen weitgehend aktuelleren Medien überlassen,<br />
können uns dafür aber mit einigen grundsätzlichen Eckd<strong>at</strong>en<br />
des Wahlergebnisses und einigen wichtigen Schlüssen daraus<br />
beschäftigen:<br />
Standpunkte<br />
Die ÖVP h<strong>at</strong> die Wahl gewonnen, obwohl<br />
– oder weil – sie der Versuchung<br />
widerstanden h<strong>at</strong>, billige Wahlversprechen<br />
abzugeben (nach dem Muster: Abschaffung<br />
von Ambulanz- und Studiengebühren,<br />
Steuerreform sofort, keine<br />
Abfangjäger und pro Mon<strong>at</strong> einen zusätzlichen<br />
Sonntag arbeitsfrei). Das ist<br />
aber auch ein Kompliment für die<br />
Wähler – von Zynikern gerne als<br />
„Stimmvieh“ bezeichnet – die offensichtlich<br />
nicht so blöd sind, wie manche<br />
der Zeitungen, die sie täglich konsumieren,<br />
vermuten lassen. Das ist aber<br />
auch eine Warnung, die Intelligenz dieser<br />
Menschen bis zur nächsten Wahl nicht zu<br />
enttäuschen.<br />
Festigkeit<br />
Wolfgang Schüssel und die ÖVP haben<br />
diesen Wahlsieg gegen ein jahrelanges<br />
Heruntermachen durch Krone (erst<br />
im Wahlkampf, als Dichand rot-grün befürchtete,<br />
wurde das Kleinform<strong>at</strong> etwas<br />
huldvoller), diverse Fellner-Magazine,<br />
ORF, „zeitgeistige“ Journalisten, in- und<br />
ausländische Zwischenrufer und Mitglieder<br />
der jahrzehntelang linkssubventionierten<br />
Kulturschickeria erzielt. Das<br />
lässt hoffen, dass Regierungen in Hinkunft<br />
auch weiterhin unpopuläre Dinge anpacken<br />
werden und sich nicht nach den Zurufen von<br />
Populisten richten müssen, die nichts zu verantworten<br />
haben.<br />
Unaufgeregtheit und<br />
Seriosität<br />
Die extrem hohe Präferenz für den<br />
Kanzlerkandid<strong>at</strong>en ist auch – neben allem<br />
Wahlkampf-Tam-Tam – darin begründet,<br />
dass die Menschen erkannt haben,<br />
dass Wolfgang Schüssel ein<br />
authentischer Mensch ist, der keine<br />
Phrasen drischt, die ihm irgendein Spin-<br />
Doctor eingelernt h<strong>at</strong>; der Antworten<br />
geben kann, ohne bereits in der barocken<br />
Einleitung die Hälfte der kommenden<br />
Antwort wieder zurückzunehmen,<br />
der aber andererseit0s auch nicht<br />
bereit ist, zu jedem Schwachsinn, der<br />
tagtäglich an ihn herangetragen wird<br />
Stellung zu nehmen. Offensichtlich schätzen<br />
Menschen Überlegtheit, Unaufgeregtheit<br />
und Souveränität mehr als das billige<br />
Schielen auf die nächste Schlagzeile in News.<br />
Wer h<strong>at</strong> die Zukunft?<br />
Wahlstr<strong>at</strong>egen aller Parteien sollten<br />
die Wahl gut analysieren. Sie werden<br />
feststellen, dass die ÖVP zu einer jungen<br />
Partei geworden ist. Bei den<br />
Wählern bis 35 kommt die ÖVP auf –<br />
überdurchschnittliche! – 45 Prozent,<br />
die SPÖ nur auf 29 Prozent (Frauen)<br />
bzw. gar nur 22 Prozent bei den Männern<br />
(!). Das impliziert aber auch den Auftrag,<br />
diese jungen Wähler, die Aufsteiger,<br />
diejenigen die noch Hoffnungen in eine zukunftsgerichtete<br />
Politik haben, nicht zu verprellen.<br />
Herbert Kaspar, Am<br />
Chancen nützen<br />
Dazu gehören aber nicht nur die<br />
Wähler sondern auch diejenigen zahlreichen<br />
Jugendlichen, die dafür gesorgt<br />
haben, dass die ÖVP vor allem in Wien<br />
so ein sens<strong>at</strong>ionelles Ergebnis verbuchen<br />
konnte. Die „Kanzlerteams“, unterstützt<br />
von der Aktion „p<strong>at</strong>ria 2411“<br />
haben gezeigt, was im „roten“ Wien<br />
möglich ist, wenn man die Initi<strong>at</strong>ive in<br />
die Hand nimmt. Die ÖVP ist sicher gut<br />
ber<strong>at</strong>en, diese Energie intelligent zu bündeln<br />
und für die Gewinnung weiterer bürgerlicher<br />
Symp<strong>at</strong>hisanten einzusetzen. Das<br />
sollte wohl am besten parallel zur Wiener<br />
Parteiorganis<strong>at</strong>ion geschehen, denn dass<br />
die vielzitierten „Bezirkskaiser“ schon so<br />
manche engagierte Initi<strong>at</strong>ive auf altbewährte<br />
Manier erstickt haben, mussten<br />
zahlreiche Wiener Parteiobmänner leidvoll<br />
erfahren.<br />
Auch für die ÖH-Wahlen im nächsten<br />
Jahr stellt dies eine gute Ausgangsbasis<br />
dar, Positionen, die im Strudel<br />
der Anti-Regierungs-Stimmung<br />
verloren gingen, wieder zurückzuerobern.<br />
Herbert Kaspar, Am<br />
Herausgeber<br />
31<br />
Kommentar<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Politik<br />
32<br />
Fritz Kofler, FB, BbG<br />
Die Hoffnung für Graz<br />
Sonntag, der 26. Jänner ist ein Lostag<br />
für die steirische Landeshauptstadt.<br />
Denn an diesem Tag wählen die Bewohner<br />
der zweitgrößten österreichischen<br />
Stadt ihren Gemeinder<strong>at</strong>. Mit dem<br />
Quereinsteiger und Grazer Innenstadt-<br />
Geschäftsmann Siegfried Nagl, Cl, verfügt<br />
die Grazer ÖVP über einen jungen<br />
Kandid<strong>at</strong>en für den Bürgermeistersessel,<br />
der in allen Meinungsumfagen als<br />
Nummer 1 gehandelt wird.<br />
p<br />
Kostenlose Fachanalysen:<br />
•Wegfall der Sparbuchanonymität<br />
Auswirkungen auf das Erben,<br />
Schenken und die Deckung<br />
der Pflegekosten<br />
• Steueroptimaler Wohnsitz<br />
D, A, CH – Eine vergleichende<br />
Analyse, 2. überarbeitete<br />
Auflage<br />
Ihr persönliches Exemplar<br />
erhalten Sie bei:<br />
Hypo Investment Bank<br />
(Liechtenstein) AG<br />
Austrasse 59, FL-9490 Vaduz<br />
Tel. +423 2655615<br />
Fax +423 2655623<br />
www.hypo.li, info@hypo.li<br />
Im Jahre 1998 wurde Siegfried Nagl<br />
von Landeshauptmann Waltraud Klasnic<br />
eingesetzt, um die total heruntergekommene<br />
und auf den dritten Pl<strong>at</strong>z<br />
abgerutschte Grazer Volkspartei wieder<br />
zu einen und vorwärts zu bringen.<br />
Als Nagl zum Stadtr<strong>at</strong> für Finanzen<br />
angelobt wurde, erwartete ihn ein gewaltiger<br />
Schuldenberg in der Höhe von<br />
5,2 Milliarden Schilling und eine Fülle<br />
dringend nötiger Ausgaben. Zum ersten<br />
Mal stand ein Unternehmer an der Spitze<br />
des Finanzressorts.<br />
Das Unglaubliche geschah<br />
Im ACADEMIA-Gespräch zieht er Bilanz:<br />
„Die Budgets 1998, 1999, 2000<br />
und 2001 konnten im Gemeinder<strong>at</strong> mit<br />
den Stimmen von SPÖ, FPÖ und ÖVP<br />
beschlossen werden. Diese drei Parteien<br />
einigten sich auf die Verwirklichung<br />
wichtiger Zukunftsprojekte: Die Errichtung<br />
der Stadthalle, die für 2003<br />
schon fast ausgebucht ist, eines Kunsthauses,<br />
des ‘Domes im Berg’ (dabei handelt<br />
es sich um ein Ausstellungszentrum<br />
in den Stollen des Schlossbergs).<br />
Ein neuer Lift zum Grazer Wahrzeichen<br />
wurde beschlossen, auch der Kauf moderner<br />
Straßenbahnzüge und die Renovierung<br />
von Kindergärten und Schulen<br />
wurden zügig durchgeführt”.<br />
Im heurigen Jahr geschah das Unglaubliche.<br />
Der Jungpolitiker Nagl h<strong>at</strong>te<br />
mit Bürgermeister Alfred Stingl (SPÖ)<br />
das Budget <strong>2002</strong> bereits paktiert, als die<br />
eigene Fraktion ihrem Bürgermeister<br />
die Gefolgschaft verweigerte.<br />
Die Finanzlage der Stadt wird immer<br />
schwieriger, denn fast ein Drittel des<br />
Budgets von 760 Millionen Euro verschlingen<br />
die beim neuen sozialistischen<br />
Spitzenkandid<strong>at</strong>en Walter Ferk<br />
ressortierenden Bereiche Personal und<br />
Verkehr.<br />
Auch für die nächsten Jahre sieht<br />
Nagl, der als Kulturreferent für das<br />
Projekt „Kulturhauptstadt Europas<br />
2003” politisch verantwortlich ist, düstere<br />
Zeiten auf die europäischen Städte<br />
zukommen und beklagt, dass diese<br />
in der geplanten europäischen<br />
Verfassung nicht einmal erwähnt werden.<br />
„Der Bürgermeister der Zukunft<br />
muss ein begnadeter Manager sein“,<br />
so Nagl.<br />
Erfreuliche Impulse erwartet er vom<br />
europäischen Kulturjahr 2003, schon<br />
jetzt ist das Interesse aus dem In-und<br />
Ausland beachtlich und die Tourismusbetriebe<br />
sind gut ausgelastet.<br />
Nagl, der besonders bei den urbanen<br />
Wählerschichten punktet, sagt sein politisches<br />
Credo: „Nichts versprechen,<br />
was man nicht halten kann und die Mitbürger<br />
über die Situ<strong>at</strong>ion der Stadt nicht<br />
im unklaren lassen.<br />
„Nagl-Zelte“ als Stätten der<br />
Kommunik<strong>at</strong>ion<br />
Die „Nagl-Zelte” in der ganzen Stadt<br />
dienen nicht nur der Wahlwerbung, sie<br />
sind auch Stätten der Kommunik<strong>at</strong>ion<br />
und Diskussion geworden.<br />
In dieser Situ<strong>at</strong>ion, in der nicht nur<br />
in Graz ,sondern auch in den anderen<br />
Landeshauptstädten gespart werden<br />
muss, sieht Nagl auch Vorteile: „Die<br />
Städte haben Schmerzen, aber die kann<br />
man heilen. Es wird unsere Aufgabe<br />
sein, auch mit Hilfe der Improvis<strong>at</strong>ion<br />
Qualität und Nachhaltigkeit sicherzustellen.<br />
Eine Veräußerung von Anteilen<br />
am Flughafen Graz-Thalerhof an die<br />
Grazer Stadtwerke und der Transfer von<br />
städtischen Liegenschaften an die stadteigene<br />
Immobiliengeschäfte sind wichtige<br />
Maßnahmen zur Verwirklichung<br />
dieses Ziels.”
Wende oder Ende anno 1977<br />
In der November-Ausgabe der<br />
ACADEMIA aus 1952 findet sich<br />
ein interessanter Beitrag zum Thema<br />
Hochschulgebühren-Streit.<br />
Damals gab es noch vier Arten<br />
von Gebühren (Kollegiengeld,<br />
M<strong>at</strong>rikeltaxe und Aufwandsbeitrag;<br />
Taxen an Labor<strong>at</strong>orien<br />
sowie Prüfungstaxen).<br />
Die Aufregung ging damals um die<br />
Erhöhung beziehungsweise Nichterhöhung<br />
der verschiedenen Gebühren.<br />
Während nämlich die beiden letztgenannten<br />
Taxen auf das Vierfache erhöht<br />
wurden, mussten die anderen Gebühren<br />
aus rechtlichen Gründen gleich<br />
bleiben, was vor allem die schmerzlich<br />
betroffenen Hochschullehrer zu Protesten<br />
veranlasste. Die Interessenskollision<br />
veranlasste den Autor, der Hoffnung<br />
Ausdruck zu verleihen, dass „ein Beitrag<br />
aus sta<strong>at</strong>lichen Mitteln“ für diesen<br />
Verdienstausfall geleistet werden würde.<br />
Mit einer weiteren Aussage erwies<br />
sich der Schreiber des Jahres 1952 ebenfalls<br />
als guter Prophet: „sicherlich wird<br />
die endgültige Regelung der Gebührenfrage<br />
noch einige Zeit auf sich<br />
warten lassen“.<br />
In der Weihnachtsausgabe der ACA-<br />
DEMIA findet sich ein Leitartikel des<br />
unvergessenen Friedrich Heer, der ebenfalls<br />
auf die „m<strong>at</strong>erielle Not und Mangellage<br />
des Akademikers“ eingeht, dann<br />
aber sehr bald zum Spirituellen kommt<br />
und die christliche Akademikerschaft<br />
deutlich auffordert, in der Gesellschaft<br />
stärker Flagge zu zeigen.<br />
Es mutet an wie eine konstruierte<br />
Pointe, aber das Cover-Thema der No-<br />
vember/Dezember ACADEMIA 1977<br />
war wortwörtlich dem Thema „WEN-<br />
DE ODER ENDE“ gewidmet. Es ging damals<br />
aber nicht um die Bundesregierung,<br />
sondern um die Krise der<br />
westlichen Zivilis<strong>at</strong>ion.<br />
Das Editorial ortet „Rohstoffknappheit,<br />
Stagfl<strong>at</strong>ion, Arbeitslosigkeit, wie auch Ap<strong>at</strong>hie<br />
und Unmut bis hin zur „großen Verweigerung“<br />
gegenüber unserem politischen<br />
System. Die Verdrossenheit an den Folgen<br />
des wissenschaftlichen, technischen und m<strong>at</strong>eriellen-wirtschaftlichen<br />
Fortschritts wächst<br />
allenthalben. (...) Eine globalere Bewusstseinswende<br />
ist unaufschiebbar. Die Abkehr<br />
von den liberal-kapitalistischen wie auch<br />
marxistischen Emanzip<strong>at</strong>ionstheorien wird<br />
notwendig.“<br />
Unter anderem kommt auch Viktor<br />
Frankl in dieser Ausgabe der ACADE-<br />
MIA zu Wort, der 1977 für sein Lebenswerk<br />
den Innitzer-Preis erhielt.<br />
Schon vor 25 Jahren meinte der Begründer<br />
der Logotherapie (was soviel<br />
wie „Heilung durch Sinnfindung“ bedeutet):<br />
„Die Überflussgesellschaft befriedigt<br />
praktisch alle menschlichen<br />
Bedürfnisse, nur ein Bedürfnis geht leer<br />
aus – das Sinnbedürfnis des Menschen“.<br />
Wenn wir auch die Dezember-ACA-<br />
DEMIA des Jahres <strong>2002</strong> diesem Thema<br />
im weitesten Sinne widmen, dann sicher<br />
nicht deswegen, weil wir im letzten<br />
Viertel Jahrhundert wenn schon<br />
nicht gescheiter, so doch hoffentlich<br />
nicht dümmer geworden sind, sondern<br />
weil sich für uns Christen diese Fragen<br />
immer wieder aufs Neue stellen, nicht<br />
nur aus „gegebenen Anlässen“ (damals<br />
etwa der Terror-Anschlag auf die Olympischen<br />
Spiele in München, heutzutage<br />
die moderne Spielform des intern<strong>at</strong>ionalen<br />
Terrorismus.)<br />
Herbert Kaspar, Am<br />
33<br />
Rückspiegel<br />
Zit<strong>at</strong>e:<br />
“<br />
Ein entlarvendes Interview gewährte<br />
Wolfgang Fellner anlässlich 10 Jahre<br />
„News“, noch vor der Wahl, dem Fachmagazin<br />
„Extradienst“; darin wurde er<br />
wörtlich gefragt:<br />
„Stichwort Wahl: ,News‘ wird große<br />
SPÖ-Nähe nachgesagt, es soll sogar einen<br />
schweren Konflikt mit der ÖVP<br />
geben. Wie ist Ihr politisches Bekenntnis?“<br />
Nachdem Fellner reflexartig die Unabhängigkeit<br />
seines Mediums betont<br />
schimmert dann doch die Wahrheit<br />
ein wenig durch:<br />
„Wir sind in der Redaktion mehrheitlich<br />
eher links-liberal eingestellt –<br />
sowie auch ein ‚Spiegel‘ oder ‚stern‘,<br />
fast alle europäischen Nachrichtenmagazine,<br />
aber wir sind immer<br />
bemüht, auf Leser Rücksicht zu nehmen<br />
die rechts-liberal oder rechts von<br />
der Mitte angesiedelt sind.<br />
(...) Mit Kanzler Schüssel habe ich<br />
ein eher unterkühltes Verhältnis, es<br />
gab aber nie eine Kampfsitu<strong>at</strong>ion“.<br />
Zur Wenderegierung befragt sagte<br />
Fellner unter anderem: „Aber der Großteil<br />
der Journalisten, vermutlich 80 Prozent<br />
oder mehr, sind diesem Experiment<br />
immer skeptisch gegenüber<br />
gestanden.“<br />
„<br />
Die „Salzburger Nachrichten“ vom<br />
5. November brachten im Zuge der Berichterst<strong>at</strong>tung<br />
über ein großes Fest der<br />
ÖVP folgende interessante Selbstdefinition:<br />
„(...) die rund 200 Gäste und das undiplom<strong>at</strong>ische<br />
Corps, also die Journalisten<br />
(...)“<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Porträt<br />
Die Quanten, Gott und die Musik<br />
Univ. Prof. Anton Zeilinger, M-D, AIn, ist einer<br />
breiten Bevölkerungsschicht aus den<br />
Medien als „Mr. Beam“ bekannt. T<strong>at</strong>sächlich<br />
ist der geborene Oberösterreicher einer<br />
der populärsten Physiker weltweit.<br />
Ein Porträt von Paul Hefelle, F-B, BbG<br />
Anton Zeilinger lacht: „Einerseits bin<br />
ich ihnen ja dankbar, weil ich´s net<br />
mach´n muss!“ Aber andererseits stört<br />
es den Quantenphsiker schon, dass bei<br />
Großveranstaltungen des ÖCV zumeist<br />
Politiker die Festrede halten: Denn<br />
schließlich gebe es im Verband ja auch<br />
Wissenschaftler, Topmanager und andere<br />
erfolgreiche Menschen. Eigentlich<br />
überraschend, dass er die Gruppe der<br />
Künstler unerwähnt lässt, ist der 57jährige<br />
doch ein passionierter „Opernund<br />
Musikfan“, der mit seinem wuscheligen<br />
Vollbart und der Nickelbrille<br />
durchaus als Kunstprofessor durchginge.<br />
Im Interesse des Rollenbildes der<br />
Jüngeren, führt er jedenfalls weiter aus,<br />
sollte man diese Vielfalt des Verbandes<br />
stärker betonen, womit wir bei den Themen<br />
„Jugend“ und Universitäten angelangt<br />
sind: „Die Universitäten sind<br />
heute viel zu verschult“, murmelt der<br />
leicht ergraute zweifache V<strong>at</strong>er und stellt<br />
bedauernd fest, dass „die Studenten zu<br />
sehr gezwungen sind, an diesem und<br />
jenem Pflichtseminar teil zu nehmen.“<br />
Das sei eine Fehlentwicklung, die die<br />
universitäre Freiheit beeinflusse. Freiere<br />
Studienpläne würden schließlich<br />
nicht die Leistung mindern. Denn wichtig<br />
sei lediglich, dass die Studenten Wissen<br />
erwerben: „Woher sie es haben kann<br />
den Unis ziemlich egal sein“ stellt er<br />
fest und schwelgt kurz in Erinnerungen<br />
an seine Studienzeit: „Ich habe einmal<br />
34<br />
ein ganzes Jahr lang nichts auf der Uni<br />
getan. Das war gut und wichtig.“<br />
Einer der Besten<br />
Heute ist er freilich der prominenteste<br />
zeitgenössische Erforscher der Quantenwelt<br />
– Vom „Förderungspreis der<br />
Stadt Wien für junge Wissenschafter“<br />
1975 bis zum höchsten Wissenschaftspreis<br />
der Bundesrepublik Deutschland<br />
2001 weisen eine Reihe von Auszeichnungen<br />
auf seine Bedeutung hin – und<br />
sofort wieder bei der Sache: „Die Ver-<br />
waschung zwischen Universität und<br />
Fachhochschulen ist schlecht. Wenn<br />
die Fachhochschulen von Forschung<br />
in kleinem Umfang reden und von akademischen<br />
Graden, dann ist das eine<br />
Fehlentwicklung.“ Auch unkonventionelle<br />
Ideen sind ihm in diesem Bereich<br />
nicht fremd: Warum soll man etwa Studien,<br />
die eine extreme Verschulung erfordern,<br />
nicht in den Fachhochschulbereich<br />
ausgliedern? Oder eine<br />
Grundausbildung auf der Fachhochschule<br />
anbieten, der eine wissenschaftliche<br />
Vertiefung auf der Universität<br />
folgt? Freilich müssten sich auch<br />
die Universitäten verstärkt positionie-<br />
ren, wobei das neue UOG eine große<br />
Chance biete. Ein großer Teil der Widerstände<br />
dagegen sei aus Missverständnissen<br />
heraus entstanden: „N<strong>at</strong>ürlich<br />
will ich keineswegs die Rückkehr<br />
zur Ordinarienuniversität, aber es ist<br />
schon ein Vorteil, wenn nicht mehr jede<br />
Entscheidung in Gremien gefällt wird.<br />
Die Entscheidungen sollen durch die<br />
Besten fallen!“<br />
In der Quantenphysik ist jedenfalls<br />
er, der in seiner Freizeit gerne „einfach<br />
so in der N<strong>at</strong>ur“ die Seele baumeln lässt,<br />
selbst einer der Besten. Und so wird<br />
er seit Jahren als „Mr. Beam“ durch die<br />
Medien gereicht, zu denen er ein gutes<br />
aber durchaus kritisches Verhältnis<br />
h<strong>at</strong>: „Wenn mich eine Zeitung<br />
fragt, ob das Beamen kommt, dann ist<br />
das eine dumme Frage. Man darf sich<br />
das nicht so vorstellen, wie es in Science<br />
Fiction-Filmen geschieht. Dann ist<br />
es nämlich nach wie vor reine Phantasie.“<br />
Wenn es allerdings um die Ebene<br />
der winzigsten Teilchen gehe, dann<br />
sei die Frage berechtigt und mit ja zu<br />
beantworten: „Wenn man es so darstellt<br />
ist das ok.“Aber leider habe es<br />
auch schon irreführende Medienberichte<br />
gegeben.
„Spukhafte Fernwirkung“<br />
Worum geht es also in diesem Forschungsbereich<br />
wirklich? Quantenmechanik<br />
beschäftigt sich mit der Erforschung<br />
der Eigenschaften von kleinsten<br />
Einheiten – etwa Photonen, Elektronen<br />
und Atomen. Anders als Objekte im täglichen<br />
Leben können beispielsweise<br />
zwei oder mehr Quantenobjekte – M<strong>at</strong>erie-<br />
oder Lichtteilchen mit Wellenn<strong>at</strong>ur<br />
– so miteinander verbunden werden,<br />
dass sie, unabhängig davon wie<br />
weit sie voneinander entfernt sind, bei<br />
Beobachtung die gleichen Eigenschaften<br />
aufweisen. Albert Einstein bezeichnete<br />
dieses Phänomen als „spukhafte<br />
Fernwirkung“, den Begriff der Verschränkung<br />
für dieses grundlegende<br />
quantenphysikalische Phänomen h<strong>at</strong><br />
Erwin Schrödinger eingeführt. Zeilinger:<br />
„Einstein h<strong>at</strong> gemeint: So verrückt<br />
kann die Welt nicht sein! Heute wissen<br />
wir, sie ist so verrückt.“<br />
Die Erfolge der Gruppe Zeilinger in<br />
der Grundlagenforschung im Bereich<br />
der experimentellen Quantenphysik<br />
können sich durchaus sehen lassen:<br />
❏ 1997 trägt Zeilinger als Kopf seiner<br />
Forschungsgruppe die weltweit erste<br />
Quantenteleport<strong>at</strong>ion, eine direkte<br />
Übertragung des Zustandes eines Lichtteilchens<br />
unter Überwindung von Zeit<br />
und Raum, ohne die Überwindung eines<br />
Weges von A nach B die Bezeichnung<br />
„Mr. Beam“ ein.<br />
❏ 1998 gelingt die erste Demonstr<strong>at</strong>ion<br />
der Verschränkung von mehr als<br />
zwei Teilchen (Greenberger-Horne-Zeilinger-Zustände),<br />
gewissermaßen die<br />
Erzeugung von Quanten-Drillingen und<br />
damit ein bemerkenswerter Beweis der<br />
Quanten-Nicht-Lokalität.<br />
❏ 1999 die Beobachtung von Quanteninterferenz<br />
für die bisher weltweit<br />
massivsten Objekte, sogenannte Fullerence<br />
(C60 und C70 Moleküle), und<br />
damit die bisher stärkste Ausweitung<br />
der Quantengrenze.<br />
❏ 1999 die erste t<strong>at</strong>sächliche Verschlüsselung<br />
einer Geheimnachricht<br />
durch Quantenkryptographie mit verschränkten<br />
Zuständen. Die Sicherheit<br />
dieser Verschlüsselung ist durch N<strong>at</strong>urgesetze<br />
gewährleistet.<br />
Kein Gottesbeweis<br />
Angesichts dieser wissenschaftlichen<br />
Erfahrungen im Grenzbereich stellt sich<br />
die Frage, ob noch Pl<strong>at</strong>z für Religiosität<br />
bleibt. Zeilinger: „Das ist eine interessante<br />
Frage. Aber es gibt viele Möglichkeiten,<br />
Gott mit einem physikalischen<br />
Weltbild in Einklang zu bringen. Ein<br />
Aspekt ist der, ob es ein persönlicher<br />
Gott sein muss, der direkt in das Geschehen<br />
eingreift. Vielleicht h<strong>at</strong> er ja<br />
nur das Werkl in Gang gebracht und<br />
schaut es sich jetzt an.“ Am Beginn der<br />
Welt könne man jedenfalls immer mit<br />
Gott ansetzen. Abgesehen davon, sei es<br />
eine „sehr gefährliche Sache“, einen<br />
Gottesbeweis antreten zu wollen:<br />
„Glaube ist mehr als das, was ich beweisen<br />
kann.“ Allgemein wären wir gut<br />
ber<strong>at</strong>en, viel weniger in Richtung der<br />
Beweisbarkeit zu gehen, so der Physiker,<br />
„denn wir wissen, dass die Welt<br />
nicht deterministisch ist. Das ist eine<br />
der interessantesten physikalischen Erkenntnisse<br />
des 20. Jahrhunderts.“ Also<br />
gibt es für den N<strong>at</strong>urwissenschaftler Zufälle?<br />
„Zufälle sind eine der Möglichkeiten<br />
für den Eingriff Gottes, der unseren<br />
Erkenntnissen nicht im Wege<br />
steht.“<br />
Das Gehirn arbeitet weiter<br />
Kann ein Mann, der sich tagtäglich<br />
mit solch hochphilosophischen und<br />
gleichzeitig n<strong>at</strong>urwissenschaftlichgrundsätzlichen<br />
Fragen beschäftigt, je<br />
abschalten? „Nein, abschalten kann<br />
man nicht wirklich: Wenn man in eine<br />
Sache so involviert ist, lässt sie einen<br />
nicht einfach los. Auch wenn man nicht<br />
daran denkt, arbeitet das Gehirn weiter.<br />
Und dann kommt einem eine Idee<br />
und man ist wieder voll drinnen.“ Dann<br />
kritzelt der Professor, der oft pro Woche<br />
mehr als zwei klassische Konzerte besucht,<br />
schon einmal das Programmheft<br />
voll: „Aber meine Frau wundert das<br />
nicht mehr, die h<strong>at</strong> sich schon daran<br />
gewöhnt.“ Neben klassischer Musik begeistert<br />
sich Zeilinger für Jazz, ebenfalls<br />
klassisch: „Dem europäischen ‚Modern<br />
Jazz’ kann ich nicht viel abgewinnen.“<br />
Jedes Mal wenn er bei Freunden in den<br />
USA ist, besuchen sie Jazzkeller mit kleinen<br />
Bands: „Das sind Musiker, die man<br />
gehört haben muss“ gerät er ins Schwärmen.<br />
Er selbst spielt ein wenig Cello<br />
und Kontrabass und h<strong>at</strong> früher selbst<br />
„Jazz gemacht“: „Ich habe mir eine<br />
Schallpl<strong>at</strong>te aufgelegt und dazu den<br />
Kontrabass gezupft.“ Er lacht. Und<br />
schaut aus wie ein Kunstprofessor aus<br />
den 1970er Jahren. Obwohl er eigentlich<br />
ein weltberühmter Quantenphysiker<br />
ist.<br />
35<br />
Porträt<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Wirtschaft<br />
Die Entwicklung der Aktienmärkte<br />
in den letzten zweieinhalb Jahren h<strong>at</strong><br />
es uns in unrühmlicher Weise gezeigt:<br />
Es kann nicht immer bergauf gehen und<br />
das Wachstum ist ein knappes Gut. Spätestens<br />
seit dem Pl<strong>at</strong>zen der High-Tech-<br />
Blase im Frühjahr 2000 kann jeder Besitzer<br />
von Aktien oder Aktienfonds<br />
erahnen, dass es nach unten hin nur<br />
eine Grenze gibt: Die Nulllinie. Im Auftrag<br />
der Bundesregierung verkündet<br />
nun der Kapitalmarktbeauftragte Richard<br />
Schenz, dass der Wiener Börse durch<br />
eine neue, sta<strong>at</strong>lich geförderte Priv<strong>at</strong>vorsorge<br />
(„Zukunftsvorsorge“) mehr<br />
Volumen zugeführt werde. Dies sei auch<br />
bitter notwendig, denn „wir werden einen<br />
leistungsfähigen n<strong>at</strong>ionalen Kapitalmarkt<br />
zur optimalen Kapitalmarktversorgung<br />
unserer Wirtschaft<br />
dringend brauchen“, so Schenz.<br />
T<strong>at</strong>sächlich h<strong>at</strong>te die Bundesregierung<br />
in einem ihrer letzten Gewaltakte<br />
vor der Auflösung des N<strong>at</strong>ionalr<strong>at</strong>es<br />
die Einrichtung eines durch Steuergelder<br />
geförderten priv<strong>at</strong>en Zukunftsvorsorgemodells<br />
beschlossen, das allerdings<br />
einen Schönheitsfehler aufweist: die<br />
Anbieter des geförderten Zukunftsvorsorge-Modells<br />
werden nämlich verpflichtet,<br />
60 Prozent der eingezahlten<br />
36<br />
Rainer Wolfbauer, AW<br />
Eine Altern<strong>at</strong>ive für die Zukunft<br />
Während der ehemalige Generaldirektor der<br />
OMV, Richard Schenz, als ehrenamtlicher<br />
Regierungsbeauftragter für den Kapitalmarkt<br />
durch die Lande zieht und wieder<br />
einmal die Werbetrommel für den Börsepl<strong>at</strong>z<br />
Wien rührt, macht sich bei priv<strong>at</strong>en<br />
Aktienbesitzern nach wie vor Tristesse<br />
breit. Das Erfreuliche: Es gibt hierzulande<br />
Altern<strong>at</strong>iven!<br />
Kundengelder in österreichische Aktien<br />
oder Aktien ähnlich unterentwickelter<br />
Kapitalmärkte zu investieren<br />
und gleichzeitig eine hundertprozentige<br />
Kapitalgarantie auf die eingezahlten<br />
Gelder zu gewähren. Sogar dem laienhaften<br />
Betrachter wird dabei allerdings<br />
klar werden, dass es auch dem besten<br />
Aktien-Fondsmanager seriöserweise nur<br />
schwerlich gelingen wird, mit einer verpflichtenden<br />
Aktiengewichtung des<br />
(geographisch betrachtet) Nischenmarktes<br />
Österreich in Höhe von<br />
60 Prozent eine Garantie auf das eingesetzte,<br />
für die Zukunftsvorsorge angesparte<br />
Kapital abzugeben. Die Performance<br />
des österreichischen<br />
Aktienmarktes, der seit Beginn der 90er<br />
Jahre insgesamt keine 10 Prozent auf<br />
das Parkett gelegt h<strong>at</strong>, wird ein solches<br />
Produkt jedenfalls nicht zum großen<br />
Kassenschlager machen. Ein ähnliches<br />
Schicksal, wie es 1999 dem „Rohrkrepierer“<br />
– Pensionsinvestmentfonds beschieden<br />
war, scheint somit vorgezeichnet,<br />
weshalb – dem Vernehmen<br />
nach – bereits eifrig an einer Repar<strong>at</strong>ur<br />
des Zukunftsvorsorge-Modells gearbeitet<br />
wird.<br />
Hedge Fonds<br />
Ein übertriebener, rein wirtschaftlich<br />
orientierter P<strong>at</strong>riotismus kann sehr<br />
leicht zu einem Protektionismus verkommen,<br />
der den Bürgern dieses Landes<br />
mehr schadet als zum m<strong>at</strong>eriellen<br />
Wohl gereicht.<br />
Anst<strong>at</strong>t blind auf die Wunderwirkung<br />
österreichischer Aktien zum Zwecke der<br />
Altersversorgung zu vertrauen, sei hiermit<br />
der Wunsch an die zukünftige Bundesregierung<br />
herangetragen, einem bislang<br />
durch die österreichische<br />
Legisl<strong>at</strong>ive in weiten Teilen unentdeckten<br />
Gebiet der Altersvorsorge mehr<br />
Aufmerksamkeit und Billigung zuzuwenden:<br />
Dem weiten Feld der Altern<strong>at</strong>iven<br />
Investments. Genauer gesagt<br />
geht es um die lukr<strong>at</strong>iven Hedge Fonds,<br />
die bei Herrn und Frau Österreicher auf<br />
immer mehr Interesse treffen. Erstaunlich<br />
ist nämlich, dass das kleine Land<br />
Österreich in den letzten Jahren eine<br />
ungemein breite und intern<strong>at</strong>ional verglichen<br />
teilweise auch außerordentlich<br />
erfolgreiche Landschaft an vorwiegend<br />
dem Inland entstammenden Hedge<br />
Fonds hervorgebracht h<strong>at</strong>.<br />
Breite Diversifizierung<br />
Worin liegt der große Charme dieser<br />
Hedge-Fonds? Im Gegens<strong>at</strong>z zu herkömmlichen<br />
Anlageformen wie Aktien<br />
und Anleihen sind Hedge-Fonds bei<br />
der Veranlagung des ihnen zur Verwaltung<br />
überantworteten Kapitals nicht<br />
dazu gezwungen, innerhalb bestimmter<br />
fix vorgegebener Veranlagungsgrenzen<br />
unabhängig von der jeweiligen<br />
Marktlage Aktien oder Anleihen zu<br />
erwerben. Vielmehr sind Hedge Fonds<br />
-Manager in der Wahl ihrer Disposition<br />
in aller Regel weitgehend frei und<br />
lediglich der selbst auferlegten Investmentstr<strong>at</strong>egie<br />
unterworfen. Demgemäß<br />
können Hedge Fonds im Gegens<strong>at</strong>z zu<br />
herkömmlichen Investmentfonds von<br />
Finanzinstrumenten jeglicher Art Gebrauch<br />
machen und speziell auf innov<strong>at</strong>ive<br />
Finanzinstrumente wie Futuresund<br />
Optionengeschäfte und ähnliche<br />
Termingeschäfte setzen. Dieser im Prinzip<br />
recht simple Ans<strong>at</strong>z macht Hedge<br />
Fonds-Manager letztlich vollkommen<br />
unabhängig von einer rein positiven<br />
Entwicklung an den traditionellen Aktien-<br />
und Anleihenmärkten.<br />
Auf dieser Art konnte etwa der seit<br />
1996 erfolgreich an den intern<strong>at</strong>ionalen<br />
Märkten agierende österreichische
Hedge Fonds-Anbieter Quadriga mit seinem<br />
„Flagship“-Produkt, dem Genussschein<br />
der in Wien ansässigen und börsenotierten<br />
Quadriga AG in den<br />
vergangenen fünf Jahren für seine Investoren,<br />
zu denen mehrheitlich priv<strong>at</strong>e<br />
Anleger zählen, eine jährliche<br />
Durchschnittsrendite von mehr als 30<br />
Prozent p.a. erzielen und ließ damit hinsichtlich<br />
der Ertragszahlen jeden traditionellen<br />
Fondsmanager alt aussehen.<br />
Erreicht werden konnten solche Ergebnisse<br />
durch eine breite Diversifizierung<br />
des verwalteten Kapitals an mehr<br />
als 100 intern<strong>at</strong>ionalen Finanz- und Warenterminmärkten<br />
sowie durch den<br />
strikten Eins<strong>at</strong>z eines computergestützten<br />
Handelssystems, welches jegliche<br />
menschliche Emotion in den Investitionsentscheidungen<br />
ausschaltet.<br />
Verbesserte Risikostreuung<br />
Beeindruckend am Eins<strong>at</strong>z solcher<br />
Produkte ist jedoch nicht bloß die Möglichkeit,<br />
unabhängig von der positiven<br />
Marktstimmung an den globalen Finanzmärkten<br />
Gewinne zu erzielen, als<br />
vielmehr auch der Effekt, der durch den<br />
Eins<strong>at</strong>z dieses Instrumentes als Beimischung<br />
zu einem herkömmlichen Aktienportfolio<br />
erzielt werden kann: Wie<br />
insbesondere anhand der wissenschaftlich<br />
erwiesenen „Modernen Portfoliotheorie“<br />
nachgewiesen werden<br />
kann, an deren Erstellung der dafür mit<br />
dem Wirtschafts-Nobelpreis ausgezeichnete<br />
Amerikaner Harry Markowitz<br />
maßgeblich beteiligt war, reduziert ein<br />
Investment in Hedge Fonds das Risiko<br />
eines traditionellen Portfolios und erhöht<br />
gleichzeitig den Ertrag desselben<br />
signifikant. Aus diesem Grund eignen<br />
sich solche qualit<strong>at</strong>iv hochwertigen<br />
Hedge Fonds als ideale Mittel zur verbesserten<br />
Risikostreuung im Zusammenhang<br />
mit Aktieninvestments. Betrachtet<br />
man nun die heutzutage weit<br />
verbreitete Ansicht, wonach Investitionen<br />
in Aktien vielfach als die lukr<strong>at</strong>ivste<br />
langfristige Form der Zukunftsvorsorge<br />
angepriesen werden und<br />
mittlerweile eine ganze Finanzindustrie<br />
in vermehrtem Maße von diesem Leitgedanken<br />
lebt, so mag es umso mehr<br />
verwundern, dass Hedge Fonds in der<br />
offiziellen Betrachtungsweise nach wie<br />
vor ein mehr oder weniger kümmerliches<br />
Dasein fristen.<br />
An den nächsten Finanzminister sei<br />
somit der dringliche Appell gerichtet,<br />
sich im Sinne der langfristigen Sicherung<br />
der priv<strong>at</strong>en Vermögen und damit<br />
auch der inländischen Kaufkraft in vermehrtem<br />
Maße dem – zugegebenermaßen<br />
heiklen – Kapitel der Hedge<br />
Fonds zu widmen und deren Wert und<br />
Funktion in einem funktionierenden<br />
Kapitalmarkt anzuerkennen. Herr und<br />
Frau Österreicher würden es ihm langfristig<br />
danken!<br />
Der Autor<br />
Mag. Rainer Wolfbauer, AW, ist Vorstand<br />
der Quadriga Beteiligungs- und Vermögens<br />
AG.<br />
37<br />
Wirtschaft<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Rezensionen<br />
„Wann`s dann aus wird sein...“<br />
Des Wieners Affinität zum Tod darf selbst für Westösterreicher<br />
als bekannt vorausgesetzt werden. Dies schlägt sich<br />
nicht nur in der Tradition der „schönen Leich“ nieder, die<br />
dem Wiener Totengräber seinen Namen gibt – Der Pompfinewara<br />
kommt ja von „pompes funebres“, was „feierliches<br />
Leichenbegräbnis“ heißt. Auch das Wiener Lied ist Zeugnis<br />
dieses innigen Verhältnisses, und nicht zuletzt die T<strong>at</strong>sache,<br />
dass der Wiener gemeinhin den Ruf eines lamoyanten<br />
Raunzers h<strong>at</strong>, der mit sich und der Welt als solches in<br />
der Regel mehr als unzufrieden ist – viel schlechter kann es<br />
also „wann`s dann aus wird sein“ auch nicht mehr werden.<br />
Sepp T<strong>at</strong>zels Buch „Wien stirbt anders“ nähert sich der<br />
Frage nicht in einer psychologischen<br />
Abhandlung sondern voll beißendem<br />
Spott und Ironie. Das entspricht seinem<br />
Metier: Er ist Kabarettautor und<br />
Regisseur, wo auch das Buch seinen Ursprung<br />
h<strong>at</strong>.<br />
T<strong>at</strong>zel: „Vor etwa 20 Jahren schrieb<br />
ich für den SIMPL einen größeren Szenenblock<br />
zum Thema ‚Pompes funèbres’<br />
. In einer Leichenhalle war ein unbekannter<br />
Durchschnittswiener<br />
aufgebahrt, von dem sich nun eine Reihe<br />
prominenter Künstler (vom Ensemble<br />
dargestellt) verabschiedete, etwa<br />
Ludwig Hirsch in einer Parodie auf eines<br />
seiner grauen Lieder. Mit dieser Erfolgsnummer<br />
wurde ich plötzlich zum<br />
Spezialisten für vorwiegend wienerische<br />
Leichengesänge. Immer wieder<br />
tauchte jemand auf, der einen einschlägigen Textbeitrag von<br />
mir wollte, und ich selbst schrieb auch für meine eigenen<br />
Programme bei Bedarf solche Nummern; etwa in meiner<br />
Rundfunkreihe ‚Turnier auf der Schallaburg’. 1991 schrieb<br />
ich für den Kabarettisten Walter Schreiber ein Soloprogramm<br />
‚All´weil traurig, fad und z´wider’, in dem n<strong>at</strong>ürlich auch ein<br />
paar Todesnummern vorkamen. Schon ein Jahr später folgte<br />
ein zweites Programm, das vom alten sämtliche dieser<br />
Nummern übernahm und unter dem Motto ‚Wien stirbt anders’<br />
zu einem neuen Programm erweitert wurde. Nach meinem<br />
ORF-Abgang als freier Mitarbeiter, sondierte ich mon<strong>at</strong>elang<br />
ganze Stöße von herumliegenden Manuskripten<br />
und kam dabei auf die Idee, zu diesem Thema nun auch ein<br />
Buch zu verfassen. Ein vorwiegend kabarettistisches.“<br />
Und wie beurteilt der Autor die Affinität des Wieners zum Tod?<br />
T<strong>at</strong>zel: „Über die Affinität des Wieners zum Tod wurden<br />
schon viele Bücher geschrieben, vielleicht auch psycholo-<br />
38<br />
gische Dissert<strong>at</strong>ionen, und viele Vorträge gehalten, in denen<br />
manchmal auch der Begriff ‚Todessehnsucht’ vorkommt.<br />
Der wäre in jedem Falle falsch. Von Einzelpersonen, wie etwa<br />
Kaiserin Elisabeth im gleichnamigen Musical abgesehen, erscheint<br />
der Tod dem Wiener aufgrund der phlegm<strong>at</strong>ischen<br />
Komponente seines Volkscharakters vielleicht nicht so arg<br />
wie einem Kölner, einem Römer oder einem Pariser, aber<br />
Sehnsucht nach dem Tod h<strong>at</strong> er keine. Er ist ja andererseits<br />
als besonders lustig und gemütlich bekannt. Andere Charaktereigenschaften<br />
wie grantig sein, raunzen, nörgeln, alles<br />
schwarz sehen, sich immer von der Welt, dem Schicksal<br />
und der Gemeinde Wien vernachlässigt fühlen, schwächen<br />
ebenfalls die weltweit verbreitete Angst der meisten Menschen<br />
vor dem Tod etwas ab. Zwischen den Extremen, dass<br />
eigentlich alles furchtbar und entsetzlich wäre, man andererseits<br />
aber nie wissen könne, ob das alles<br />
auch wahr ist, pendelt das Gemüt des Wieners<br />
hin und her. Der Wiener liebt auch seit<br />
je das äußere Gepränge und die Großartigkeit<br />
der meist aus der großen Vergangenheit<br />
stammenden Traditionen. Den Opernball<br />
verfolgt er auf dem Bildschirm, an<br />
manchem prunkvollen Begräbnis kann er<br />
aber teilnehmen, womit die Freude an einer<br />
beliebigen ‚schönen Leich´’ Einfluss auf<br />
den Wunsch nimmt, es einmal auch so<br />
schön zu haben. Das lässt nun den Schluss<br />
zu, dass Menschen, denen der Glanz der<br />
Vergangenheit schöner erscheint als der gegenwärtige<br />
Alltag und die von der Zukunft<br />
nicht allzu viel erwarten, auch ein wenig<br />
immer noch in dieser Vergangenheit leben.<br />
Sie sind also dem ‚Was-einmal-war’ näher<br />
als dem ‚Was-einmal-sein-wird.’ Und dieses<br />
‚Was-einmal-war’ ist zwangsläufig ohnehin schon tot,<br />
oder ‚wird es nimmer lang machen.’ ‚Zeigt sich der Tod einst<br />
mit Verlaub’ ist ein nicht abzuwendender Augenblick. ‚Brüderlein<br />
fein, einmal muss geschieden sein’ und ‚Glücklich<br />
ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist’ sind klassische<br />
Beispiele, denen unzählige volkstümliche folgen. Im<br />
Wienerlied – so kitschig und schmalzig es manchmal sein<br />
kann – spiegelt sich die Wiener Seele am deutlichsten. Und<br />
daran h<strong>at</strong> der Tod einen nicht unerheblichen Anteil, zeigt<br />
sich aber eher als Freund, der einem die noch bevorstehenden<br />
Scherereien wenigstens erspart.“<br />
Paul Hefelle, F-B, BbG<br />
Wien stirbt anders. Mit den "Seitentotenblicken"<br />
auf den Zentralfriedhof<br />
Ein Nachruf auf die Zukunft dieser Stadt – S<strong>at</strong>ire<br />
ISBN 3-85052-146-X, Euro 19,-, Verlag Ibera <strong>2002</strong>
Fritz Kofler, F-B, BbG<br />
Aus dieser kurzen Zeit wurde ein<br />
mehrjähriger Aufenthalt und der Entschluss<br />
an einer der berühmtesten intern<strong>at</strong>ionalen<br />
Kunsthochschulen „Parsons<br />
School of Design” Fotographie zu<br />
studieren. Fotokunst wurde für Hermann<br />
Burgstaller, BbG, Beruf, Berufung<br />
und Lebenserfüllung.<br />
Nach den Lehrjahren in Paris ging er<br />
nach New York , und beendete bei der<br />
Zentrale dieser Kunsthochschule sein<br />
Studium mit dem „Bachelor of fine arts”<br />
(BfA).<br />
Besondere Faszin<strong>at</strong>ion bedeutet für<br />
ihn die klassische Landschaftsfotographie<br />
und das Stilleben.<br />
Fotokunst ist für ihn mehr als der<br />
„kleine Bruder der Malerei” . Sie ist für<br />
ihn eine Schule des Sehens und der Impression.<br />
Seit 1999 lebt Hermann Burgstaller<br />
wieder in seiner Heim<strong>at</strong> und h<strong>at</strong><br />
sich ein kleines Kunstfotostudio in Graz<br />
eingerichtet. Kunstexperten des Grazer<br />
Joanneums sind bereits auf ihn aufmerksam<br />
geworden.<br />
Jetzt bereitet er für nächstes Jahr, in<br />
dem Graz die Kulturhauptstadt Europas<br />
ist, seine erste große Ausstellung vor.<br />
Aber auch Menschenbilder faszinieren<br />
ihn und so möchte er in den nächsten<br />
Jahren ebenfalls in Graz ein Porträtstudio<br />
etablieren.<br />
Nach der Volks- und Hauptschule, der<br />
Absolvierung der HTL in Pinkafeld und<br />
dem Präsenzdienst beim Bundesheer<br />
war ihm klar, dass er jeden Groschen für<br />
sein Studium selbst verdienen muss.<br />
T<strong>at</strong>sächlich h<strong>at</strong> er während seiner Studienzeit<br />
auch keinerlei Zuschüsse oder<br />
Stipendien erhalten. Sein Studium h<strong>at</strong><br />
er durch Arbeit bei diversen Werbeagenturen<br />
in Deutschland finanziert.<br />
Bei einem fünfwöchigen Aufenthalt<br />
in Nord-Chile h<strong>at</strong> er in einer kargen felsigen<br />
und wüstenähnlichen Bergregion<br />
Bilder von herber Schönheit und<br />
Einzigartigkeit gemacht, die den<br />
Schwerpunkt seiner ersten großen Ausstellung<br />
bilden sollen.<br />
Die m<strong>at</strong>eriellen Voraussetzungen für<br />
seine künstlerische Arbeit will er durch<br />
professionelle Fotoarbeit schaffen: Ab<br />
dem kommenden Jahr wartet er mit einem<br />
besonderen Leistungsangebot auf:<br />
Außen- und Studioaufnahmen jeder<br />
Art (Gebäude, Personen, Landschaften<br />
und Stilleben), wobei sein bevorzugtes<br />
Aufnahmeform<strong>at</strong> eine 4 x 5 inch Großbildkamera<br />
ist.<br />
Hermann Burgstaller lässt aber keinen<br />
Zweifel aufkommen: Bei all den Plänen<br />
darf die Kunst nicht zu kurz kommen,<br />
denn sie prägt und erfüllt sein<br />
Leben.<br />
39<br />
Kultur<br />
Foto-Kunst als Berufung und Lebenserfüllung<br />
Der Drang nach der großen, weiten<br />
Welt führte den damals 23 jährigen<br />
Steirer 1991 zunächst nach<br />
Paris: Der Grazer Telem<strong>at</strong>ikstudent<br />
wollte ein Semester lang<br />
Französisch lernen.<br />
Hermann Burgstaller:<br />
Fotokunst als Beruf, Berufung<br />
und Lebenserfahrung<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Kurz notiert<br />
Weihnachtsmann contra Christkind – 1 : 0<br />
Wenn man im Internet über die<br />
großen Suchmaschinen den Begriff<br />
„Weihnachtsmann“ abfrägt, erhält man<br />
138.000 Treffer, Santa Claus liegt mit<br />
133.000 Hits fast gleich auf.<br />
Das Christkind liegt mit 19.200<br />
Zählern bereits weit abgeschlagen und<br />
das Christkindl bringt es bei google nur<br />
auf lumpige 5.280 Treffer. (Neugierig<br />
geworden versucht der Autor auch noch<br />
den französischen Père Noël und siehe<br />
da, er bringt es auf 146.000 Treffer.)<br />
In den 70er Jahren war das noch anders.<br />
Damals brachte – so der „Wort<strong>at</strong>las<br />
der deutschen Umgangssprachen“<br />
– im<br />
Norden und Nordosten<br />
des deutschen<br />
Sprachraumes der<br />
Weihnachtsmann<br />
die Geschenke. Ab<br />
dem Rhein beherrschte<br />
dann das<br />
Christkind die weihnachtliche<br />
Szene, selbstverständlich<br />
auch in Österreich<br />
und der deutschsprachigen Schweiz<br />
(wobei auch in einigen Kantonen ein<br />
Weihnachtskind, bzw. ein Weihnachtskindlein<br />
für den Geschenktransport<br />
sorgte). In der italienischen<br />
Schweiz war es ein Bambino Gesù, in<br />
der französischen Schweiz war die Sache<br />
nicht so klar. Neben dem Père Noël<br />
wirkte im Jura sogar eine Dame de Noël,<br />
im k<strong>at</strong>holischen Fribourg war jedoch<br />
auch ein Enfant Jésus im Eins<strong>at</strong>z. Mit<br />
Umweg über die USA – vor allem auch<br />
Dank des rotgewandeten Coca-Cola-<br />
Santa Claus<br />
– kehrte der<br />
ursprünglich<br />
europäische<br />
Nikolaus bzw.<br />
Weihnachtsmann<br />
transformiert<br />
wieder in unsere Brei-<br />
40<br />
ten zurück und ist durchaus erfolgreich<br />
dabei, dem biederen Christkind das<br />
Weihnachtsgeschäft streitig zu machen.<br />
(Dieses Phänomen gilt interessanterweise<br />
nicht nur für den deutschen<br />
Sprachraum, auch die Engländer, die<br />
sich die Geschenke traditionell vom „F<strong>at</strong>her<br />
Christmas“ bringen ließen, bedauern<br />
heute bereits die Amerikanisierung<br />
durch den allgegenwärtigen Santa<br />
Claus).<br />
Hinter diesem Globalisierungs-Import<br />
steckt mehr als nur Geschäftstüchtigkeit<br />
einerseits sowie Kultur- und<br />
Identitätsverlust auf der anderen Seite.<br />
Auch der Verlust an religiöser<br />
Substanz hilft<br />
kräftig mit, das religiös<br />
determinierte<br />
Jesus– bzw. Christkind<br />
durch den<br />
neutralen wohlbeleibt-jovialen<br />
Weihnachtsmann<br />
zu ersetzen.<br />
Ein vor zwei Jahren in<br />
Innsbruck gegründeter Verein<br />
„Pro Christkind“ bekennt sich in seinen<br />
St<strong>at</strong>uten ausdrücklich zur „Unterstützung<br />
der aus dem christlichen Glauben<br />
gewachsenen Tradition des<br />
Christkinds“ – dennoch scheint der<br />
ungleiche Kampf bereits verloren,<br />
denn auch viele traditionelle<br />
Unternehmen<br />
setzen in ihrer Werbung<br />
heute wesentlich<br />
stärker auf den<br />
Weihnachtsmann<br />
als auf das altmodisch<br />
und bieder<br />
empfundene Christkind.<br />
Kleber mit dem Aufdruck„Weihnachtsmann<br />
– nein danke“ werden<br />
daran nichts ändern.<br />
Herbert Kaspar, Am<br />
Jeder Will<br />
Jeder will<br />
das Heil der Welt<br />
doch fehlt es dafür<br />
stets an Geld<br />
Jeder fordert<br />
seinen Teil<br />
und sieht im Eigentum<br />
sein Heil<br />
Für and’res bleibt<br />
daher kein Geld<br />
das Heil der Welt<br />
wird abbestellt.<br />
Dietmar Füssel<br />
h<strong>at</strong> bereits mehrere Bücher publiziert,<br />
darunter einen Lyrikband „Unterwegs“,<br />
den Roman „Rindfleisch“ und die<br />
Komödie „Die Ermordung Caesars“<br />
Nestroypreis<br />
Ab 17. Dezember kann<br />
man im Wiener The<strong>at</strong>ermuseum<br />
bereits den von<br />
Claus Peymann zurückgegebenen<br />
Nestroy-Preis (NE-<br />
STROY – Der Erste Wiener<br />
The<strong>at</strong>erpreis) mit samt aller<br />
dazugehörenden Dokumenten<br />
sehen. Auch André Hellers<br />
dreiste Wahlrede – (un)verschämt<br />
als Laud<strong>at</strong>io bezeichnet<br />
– kann dort bewundert<br />
werden. Es ist tröstlich zu sehen,<br />
wie kurzlebig diese Aktion schließlich<br />
war, die noch vor wenigen Wochen<br />
der große kulturelle Aufreger war. Angesichts<br />
der dram<strong>at</strong>isch veränderten politischen<br />
Landschaft in Österreich werden<br />
sich vielleicht auch André Heller<br />
und Claus Peymann fragen, ob sie nicht<br />
mit diesem überdrehten Aktionismus<br />
ihrer Sache eher geschadet haben.<br />
Apropos Aktionismus. Die beiden Salon-Protestierer<br />
(„ich nehme den Preis<br />
an, ... ich gebe den Preis zurück!) sind<br />
ihrem Lieblingsfeindbild Jörg Haider formal<br />
so unähnlich nicht („ich bin schon<br />
weg, ... ich bin wieder da“) und beide<br />
verbindet auch eine extrem intolerante<br />
Geisteshaltung. Herbert Kaspar, Am
niederösterreich. wir haben noch viel vor.<br />
1000 tage<br />
nö fitnessprogramm!<br />
Über 430 Millionen Euro für unsere Zukunft.<br />
q<br />
Unternehmungslust und Stolz auf Erreichtes auch<br />
in den selbstbewussten Blicken der jüngsten Niederösterreicher.<br />
In den letzten drei Jahren konnten<br />
wir dank des NÖ Fitnessprogramms mehr als 140<br />
besonders zukunftsträchtige Projekte realisieren<br />
oder zumindest starten. 430 Millionen Euro für die<br />
Zukunft Niederösterreichs. Auf geht’s: Wir haben<br />
noch viel vor.<br />
Jetzt um 5 Jahre verlängert!<br />
niederösterreichische landesregierung adresse » 3109 st. pölten, landhauspl<strong>at</strong>z 1, internet » www.noe.gv.<strong>at</strong>
Kultur<br />
42<br />
Georg Kastner, Am<br />
Geschüttelt, nicht gerührt<br />
Ein Blackjacktisch in einem Casino. „Ich<br />
bewundere ihr Glück, Mister ...?“ – „Bond –<br />
James Bond!“ Der berühmteste Spion der<br />
Welt h<strong>at</strong>te sich soeben vorgestellt.<br />
Am 5. Oktober 1962 fiel in einem Londoner<br />
Kino erstmals einer der berühmtesten<br />
Sätze der Filmgeschichte.<br />
Seit 40 Jahren rettet der Meisterspion<br />
mit der legendären Erkennungsnummer<br />
die Welt, liebt schöne Frauen<br />
und trinkt geschüttelte und nicht<br />
gerührte Martinis. 1962 ahnte wahrscheinlich<br />
niemand, dass gerade die erfolgreichste<br />
Filmserie aller Zeiten gestartet<br />
wurde. Erst mehr als drei Mon<strong>at</strong>e<br />
später, am 25. Jänner 1963, kam „Dr.<br />
No“ in die deutschen Kinos und Amerika<br />
eroberte der smarte Brite überhaupt<br />
erst ab dem 8. Mai 1963.<br />
Dabei begann alles schon acht Jahre<br />
früher. Das erste Mal erschien der<br />
Agent im Geheimdienst ihrer Majestät<br />
in einem 48-minütigem TV-Film im<br />
Jahre 1956 im Rahmen der amerikanischen<br />
Fernsehserie „Climax Mystery<br />
The<strong>at</strong>er“. Angeblich war das beste an<br />
dieser in Österreich nie gezeigten Episode<br />
der Bösewicht: Peter Lorre, unvergessener<br />
Charlie Chan und Spezialist<br />
für die Darstellung geistig abnormer<br />
Rechtsbrecher.<br />
Erfunden wurde 007 von Ian Fleming,<br />
was als allgemein bekannt vorausgesetzt<br />
werden darf. Weniger bekannt<br />
ist wahrscheinlich, dass der Autor<br />
im 2. Weltkrieg selbst beim Geheimdienst<br />
tätig war. Wie sein Romanheld<br />
bekleidete er den Rang eines Commanders<br />
bei der Royal Navy. 1964 starb<br />
Fleming im Alter von 56 Jahren an einem<br />
Herzinfarkt.<br />
Für die Handlungen der Bondfilme<br />
war er jedoch kaum verantwortlich. Verschiedenste<br />
Drehbuchautoren veränderten<br />
seine Stories so sehr, dass meist<br />
nur mehr Titel und Charaktere übrig<br />
blieben, so lange bis 1987 selbst diese<br />
Quelle erschöpft war.<br />
Bevor Sean Connery 1962 die berühmt<br />
gewordenen Worte erstmals sprechen<br />
durfte, h<strong>at</strong>te er sich gegen eine beachtliche<br />
Konkurrenz durchzusetzen.<br />
Die erste Wahl war Hollywoodlegende<br />
Cary Grant. Er wollte sich jedoch nicht<br />
für mehrere Filme binden. Dann liebäugelten<br />
die Produzenten mit einer Reihe<br />
von Schauspielern, darunter so klingende<br />
Namen wie Richard Burton, James<br />
Stewart und David Niven. Letztendlich<br />
entschloss man sich für den jungen<br />
Schotten, der außer ein paar Nebenrollen<br />
nicht viel vorzuweisen h<strong>at</strong>te.<br />
Nach dem Erfolg von „Dr. No“ ging<br />
es Schlag auf Schlag: 1963 h<strong>at</strong>ten „Liebesgrüße<br />
aus Moskau“ Premiere, 1964<br />
folgte „Goldfinger“, für manche bis heute<br />
der beste Film der Reihe. Nach „Feuerball“<br />
1965 und „Man lebt nur zweimal“<br />
1967 h<strong>at</strong>te Connery fürs erste<br />
genug. Der Australier George Lazenby<br />
erhielt die Chance seines Lebens, die<br />
er jedoch schon in den ersten fünf Minuten<br />
des Films in den Sand setzte. Kritiker<br />
und Fans waren sich in der Ablehnung<br />
seiner Person einig, lediglich die<br />
amerikanische Auslandspresse nominierte<br />
ihn für den Golden Globe als bester<br />
männlicher Newcomer. 1971 kehrte<br />
Connery noch einmal zurück um in<br />
„Diamantenfieber“ abermals den Superspion<br />
zu verkörpern. Danach nahm<br />
er vorläufig seinen Hut und räumte das<br />
Feld für die nächste Ära in der Geschichte<br />
von 007.<br />
Damit ging auch die Karriere des<br />
übermächtigen Syndik<strong>at</strong>schefs Blofeld<br />
zu Ende, der bis dahin hinter fast allen<br />
Schurkereien steckte, die James Bond<br />
und die Welt erzittern ließen.<br />
1973 übernahm der Engländer Roger<br />
Moore den Part des Geheimagenten.<br />
Sein Gegner war in jedem Film ein anderer<br />
Oberbösewicht, der am Ende des<br />
jeweiligen Epos von Bond höchstpersönlich<br />
wirksam zur Strecke gebracht<br />
wurde. Am Anfang seines fünften Abenteuers<br />
war es Roger Moore auch noch bestimmt<br />
den mittlerweile fast harmlos im<br />
Rollstuhl sitzenden Blofeld endgültig in<br />
einem Londoner Fabrikschlot zu versenken.<br />
Was Moores Unterschied zu Connery<br />
ausmachte, war sein unerschütterlicher<br />
Humor und eine gewisse Ironie, die er<br />
Bond angedeihen ließ. Als er zum Beispiel<br />
in „Moonraker“ in ziemlicher Bedrängnis<br />
von seiner Gespielin gefragt<br />
wurde: „Kennst Du diesen Mann?“<br />
meinte er nur trocken: „Nicht gesellschaftlich.<br />
Er heißt Beißer und so benimmt<br />
er sich auch!“<br />
1985 stand Moore zum siebenten und<br />
letzten Mal in seiner Paraderolle vor der<br />
Kamera, er hörte auf als ihn die Fans verächtlich<br />
als 0070 bezeichnet h<strong>at</strong>ten.<br />
Vom kurzen Intermezzo des ihm folgenden<br />
Walisischen Shakespearemimen<br />
Timothy Dalton, der es auf zwei Einsätze<br />
als James Bond brachte, ist nur zu erwähnen,<br />
dass ihn einer davon nach<br />
Wien führte, wo das Drehteam – Zilk<br />
sein Dank – mehr als hofiert wurde. Ansonsten<br />
sei über seine Leistungen besser<br />
der Mantel des Schweigens gehüllt.<br />
Nach sechs Jahren Pause übernahm<br />
schließlich Pierce Brosnan jene Rolle,<br />
für die ihn die Produzenten schon 1987<br />
als Moore-Nachfolger haben wollten.<br />
Dass der urbritische Spion von einem<br />
Iren dargestellt wird, ist zwar ein Anachronismus<br />
in sich, den Fans scheint<br />
es jedoch zu gefallen.<br />
Neben den mittlerweile 20 regulären
Bondfilmen (inklusive des neuesten<br />
Werkes mit dem Titel „Stirb an einem<br />
anderen Tag“) gab es noch zwei Filme<br />
die nicht zur Reihe gezählt werden. „Casino<br />
Royale“ 1967 war eine Bondparodie<br />
ohne wirkliche Handlung dafür<br />
mit umso mehr kurz ins Bild kommenden<br />
Weltstars: Zu erwähnen sind<br />
Orson Wells, Ursula Andres, Jean Paul<br />
Belmondo, Woody Allen, Deborah Kerr,<br />
William Holden, John Houston und<br />
n<strong>at</strong>ürlich David Niven, der hier doch<br />
noch James Bond sein durfte.<br />
Und dann gab’s auch noch „Sag niemals<br />
Nie“. 1983 konnte Sean Connery<br />
ein letztes mal für die Rolle, die ihn<br />
berühmt gemacht h<strong>at</strong>te, gewonnen<br />
werden. Ein Remake des vierten Bondfilmes<br />
„Feuerball“. Den Bösewicht spielte<br />
mehr als überzeugend Burgschauspieler<br />
Klaus Maria Brandauer.<br />
Er war bei weitem nicht der einzige<br />
Schauspieler deutscher Zunge, der am<br />
Versuch scheiterte, James Bond zu eliminieren.<br />
Auch Gert Froebe als Goldfinger,<br />
Curd Juergens in „Der Spion der mich<br />
liebte“ und Gottfried John in „Goldeneye“<br />
waren überzeugende Verbrechercharaktere.<br />
Weitere intern<strong>at</strong>ionale Topstars<br />
wie Telly Savallas, der Franzose Louis<br />
Jordan, die Horrorspezialisten Donald<br />
Pleasence oder Dracula Christopher Lee<br />
gehörten zu den prominenten Darstellern<br />
der Gegner von 007.<br />
Weit weniger prominent waren die<br />
so genannten Bondgirls. Diana Rigg,<br />
Ursula Andres, Sophie Marceau und Oscar-Preisträgerin<br />
Halle Berry im neuesten<br />
Streifen bilden zwar die rühmli-<br />
chen Ausnahmen, ansonsten fielen die<br />
Damen an der Seite Bonds später eher<br />
durch große Skandale und weniger<br />
durch ihr filmisches Schaffen auf, so sie<br />
nicht gänzlich im Sumpf der B-Movies<br />
verschwanden.<br />
Entgegen der landläufigen Meinung<br />
heimsten die Bondfilme anerkannte<br />
Preise ein: Neun Nominierungen für<br />
den Golden Globe brachten eine Gewinnerin,<br />
nämlich Ursula Andres für<br />
ihre Darstellung in „Dr. No.“ Bei den<br />
Oscars war man noch erfolgreicher:<br />
zehn Nominierungen, davon gleich drei<br />
für „Der Spion der mich liebte“ und<br />
zwei t<strong>at</strong>sächlich gewonnene Auszeichnungen<br />
für die besten Toneffekte in<br />
„Goldfinger“ und die besten Bildeffekte<br />
in „Feuerball“.<br />
Aber auch der Razzie Award, die goldene<br />
Erdbeere, die für die schlechtesten<br />
Leistungen im Film jeweils einen Tag<br />
vor dem Oscar vergeben wird, machte<br />
vor den Bondfilmen nicht halt: Drei<br />
Nominierungen und eine Verleihung<br />
an Denise Richards für ihre Darbietung<br />
in „Die Welt ist nicht genug“.<br />
Und wer war James Bond wirklich?<br />
Laut Ian Fleming übernahm er den Namen<br />
von einem Buchtitel: „Über die Vogelwelt<br />
in der Karibik, von James Bond.“<br />
Weitere bekannte und weniger bekannte<br />
Fakten aus 40 Jahren James<br />
Bond: Geboren 1926, ist er seit seinem<br />
11. Lebensjahr ein Waisenkind. Seine<br />
Mutter war übrigens Schweizerin.<br />
Die englische Fernsehserie „The Avangers“,<br />
bei uns bekannt als „Mit Schirm<br />
Charme und Melone“ steuerte gleich<br />
drei Schauspieler für das 007-Team bei:<br />
Honor Blackman, die erste Partnerin von<br />
„John Steed“ P<strong>at</strong>ric Macnee, der selbst<br />
bei „Im Angesicht des Todes“ Agentenkollege<br />
von 007 war, wurde Connerys<br />
Gespielin in Goldfinger. Ihre Nachfolgerin<br />
in der Serie, Diana Rigg, die legendäre<br />
Emma Peel, durfte Bond als einzige<br />
sogar heir<strong>at</strong>en um dann auf dem<br />
Weg in die Flitterwochen von Blofeld<br />
erschossen zu werden.<br />
Bonds größte Stütze, der Supererfinder<br />
Q wurde von Desmond Llewelyn<br />
dargestellt. Dieser gab zu, sich nicht einmal<br />
mit seinem Handy auszukennen.<br />
Er verstarb 1999 mit 87 Jahren bei einem<br />
Autounfall.<br />
Bonds Fuhrpark kann sich sehen lassen:<br />
Rolls Royce, Aston Martin, Lotus<br />
Esprit, BMW Z3, 750 und Z8, aber auch<br />
Citroen 2CV und Peugeot wurden im<br />
Dienst meist vernichtet.<br />
Die Wiener Fans der Doppelnull<br />
gehörten jahrelang zu den Privilegiertesten.<br />
Bevor Bond auch das Fernsehen<br />
eroberte, liefen erst im Kolosseum 2 und<br />
später in einem Saal des Elite Kinos ausschließlich<br />
Bondfilme.<br />
Seit Bond von Brosnan dargestellt<br />
wird, h<strong>at</strong> sich auch das Kommandoteam<br />
in der Zentrale des britischen MI6 verändert.<br />
Bond h<strong>at</strong> eine Chefin, gespielt<br />
von Oscar-Preisträgerin Judi Dench. Und<br />
auch ihre von Bond immer wieder hofierte<br />
Sekretärin Miss Moneypenny h<strong>at</strong><br />
ein neues Gesicht. Diese Dame h<strong>at</strong> allerdings<br />
mit den Filmen mehr gemein<br />
als alle anderen. Ihr Name ist nämlich<br />
wirklich Bond – Samantha Bond.<br />
43<br />
Kultur<br />
In den 60er Jahren<br />
kam James Bond<br />
sogar als Comic<br />
heraus, wobei der<br />
Zeichner sich<br />
Sean Connery als<br />
Vorbild nahm und<br />
auch die Story<br />
„Casino Royale“<br />
zeichnete, die ja<br />
als echter Bondfilm<br />
nie realisiert<br />
wurde.<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Kultur<br />
40 Jahre und kein bisschen leise<br />
Nicht nur James Bond sondern auch die<br />
Stones kommen in die Jahre.<br />
Eine Rarität unter<br />
Sammlern:<br />
Eintrittskarte zu<br />
einem Rolling<br />
Stones-Konzert in<br />
der Stadthalle vor<br />
29 Jahren<br />
Sir Paul McCartney feierte diesen<br />
Sommer seinen 60er, Alt-Rocker Chuck<br />
Berry ist gar schon 75 und auch andere<br />
Rock-Größen wie F<strong>at</strong>s Domino (73)<br />
Bo Diddley (73), James Brown (69) und<br />
Little Richard (70) haben Anspruch auf<br />
die Rock-Rente. Dagegen machen sich<br />
Mick Jagger (seit heuer eigentlich „Sir<br />
Mick“) und seine Stein-Zeitbrüder fast<br />
jugendlich aus. Dennoch h<strong>at</strong> auch diese<br />
Truppe bereits<br />
40 Bühnenjahre auf<br />
dem Rücken. Im Unterschied zu anderen<br />
Gruppen dieser Zeit rocken sie noch<br />
heute und verstehen damit ihr Publikum,<br />
das bereits drei Gener<strong>at</strong>ionen um-<br />
Rezension Von Absinth bis Zabaione<br />
44<br />
Jeder weiß, was eine<br />
„Bloody Mary“ ist, und<br />
dass der Verzehr eines „Hot<br />
Dog“ nichts mit Nachbars<br />
Hund zu tun h<strong>at</strong> darf man<br />
auch als bekannt voraussetzen.<br />
Aber warum heißt<br />
die „Bloody Mary“ so, und<br />
was h<strong>at</strong> ein Frankfurterwürstel<br />
im Stangerl mit einem<br />
Hund zu tun? Warum<br />
heißen bestimmte<br />
Heringe nach dem Reichs-<br />
spannt, zu begeistern. Keine schwache<br />
Leistung, in Zeiten, in denen die Kurzlebigkeit<br />
von Pop-Gruppen zur Marketingmaxime<br />
erhoben scheint.<br />
Damals, in den 60er Jahren, als so viele<br />
legendäre Bands (wie zum Beispiel<br />
auch The Who oder die Kinks) entstanden,<br />
spitzte sich der musikalische<br />
Wettstreit sehr bald auf zwei dominierende<br />
Gruppen zu: die Be<strong>at</strong>les und die<br />
Rolling Stones. Während die Be<strong>at</strong>les –<br />
aus dem provinziellen Arbeitermilieu<br />
Liverpools stammend – ursprünglich die<br />
bösen Buben waren, rekrutierten<br />
sich die Stones<br />
aus der urbanen<br />
Mittelschicht Londons.<br />
Mick Jagger studierte<br />
immerhin an<br />
der renommierten<br />
London School of<br />
Economics und wäre<br />
heute wahrscheinlich ein City-Banker<br />
im Nadelstreif, der sich auf seine Pension<br />
freut, hätte es ihn nicht zur Musik<br />
verschlagen. Die Marketingstr<strong>at</strong>egien<br />
verlangten allerdings klare Positionierungen<br />
in der Popwelt, weshalb die Be-<br />
kanzler Bismarck, weshalb ein mit<br />
Schinken und Käse gefülltes Schnitzel<br />
„cordon bleu“? Und was, bitte schön,<br />
h<strong>at</strong> die fast-food-Kette Mc Donald`s mit<br />
der Hansestadt Hamburg am Hut, dass<br />
sie ihre gefüllten Laberln nach deren<br />
Bewohnern benennt? Was sind Absinth<br />
und Zabaione, die diesem Buch seinen<br />
Namen gaben?<br />
Fragen über Fragen, auf das dieses<br />
Buch von Hannes Bertschi und Marcus<br />
Reckewitz Antworten gibt. In über 80<br />
kurzen und heiteren Geschichten er-<br />
<strong>at</strong>les, die auch ihren Fans die Story vom<br />
sozialen Aufstieg kommunizieren wollten,<br />
zu den netten Jungs von nebenan<br />
mutierten, während die Stones nach<br />
dem Rezept „Sex, Drugs and Rock’n<br />
Roll“ bewusst auf wilde Raubeine und<br />
Bürgerschreck machten. Durchaus mit<br />
Erfolg.<br />
Ihren musikalischen Höhepunkt h<strong>at</strong>ten<br />
sie schon vor über 30 Jahren mit<br />
„Beggars Banquet“, „Sticky Fingers“ sowie<br />
der genialen LP „Let It Bleed“. Seitdem<br />
ist praktisch nichts Nennenswertes<br />
mehr von ihnen auf den Markt<br />
gekommen, was der anhaltenden Faszin<strong>at</strong>ion<br />
aber keinen Abbruch tut, denn<br />
die alten und jungen Stones-Fans verlangen<br />
ohnehin hauptsächlich nach<br />
den alten Nummern und die sind zum<br />
Teil wirklich großartig.<br />
Nunmehr gehen sie als Denkmal ihrer<br />
selbst nochmals auf Tournee, wobei<br />
es jedes Mal heißt, dass es vielleicht die<br />
letzte ist. Wie auch immer, auf jeden<br />
Fall ist zum 40jährigen Bestandsjubiläum<br />
der Firma Jagger & Richards zu<br />
gr<strong>at</strong>ulieren – „and many happy returns<br />
Sir Mick“. Abe Lincoln<br />
klären die beiden, woher bestimmte<br />
Speisen und Getränke ihren Namen haben,<br />
das oben erwähnte „Frankfurterwürstel“<br />
ist allerdings nicht enthalten<br />
– bei den Deutschen heißt es ja auch<br />
nicht so. Aber das ist eine andere Geschichte,<br />
die vielleicht in einem Fortsetzungsband<br />
ihren Pl<strong>at</strong>z finden würde.<br />
Paul Hefelle F-B, BbG<br />
Von Absinth bis Zabaione<br />
Wie Speisen und Getränke zu ihrem<br />
Namen kamen und andere kuriose<br />
Geschichten<br />
<strong>2002</strong> Argon Verlag GmbH, Berlin<br />
ISBN 3-87024-559-X
Rückwärts nach rechts<br />
Hans-Henning Scharsach, bekannt<br />
durch Bücher wie „Haiders Kampf“, in<br />
denen er sich akribisch mit der Person<br />
des Kärntner Landeshauptmannes auseinandergesetzt<br />
h<strong>at</strong>, liefert diesmal einen<br />
Sammelband zu seinem Leibthema<br />
„Rechtsextremismus“. Unter dem<br />
vielversprechendem Titel: „Rückwärts<br />
nach rechts – Europas Populisten“ behandelt<br />
der „News“-Redakteur eine Reihe<br />
von Rechtspopulisten und zeichnet<br />
deren Aufstieg und Ideologie (sofern<br />
man in manchen Fällen überhaupt von<br />
solch einer reden kann) nach.<br />
Diesem Anspruch – nämlich einen<br />
Überblick über verschiedene rechtspopulistische<br />
Bewegungen Europas zu geben<br />
– wird er durchaus gerecht. Wor-<br />
an er zumindest teilweise scheitert ist<br />
sein Versuch, die Gemeinsamkeiten der<br />
verschiedenen Partei- und Bewegungsführer<br />
als bestimmendes Merkmal darzustellen.<br />
Denn – und daran ändert auch<br />
Scharsachs Auflistung der Merkmale<br />
des Populismus am Ende des Buches<br />
nichts – der Aufstieg der unterschiedlichen<br />
Protagonisten ist stets abhängig<br />
von deren soziokulturellem Umfeld<br />
und nicht zuletzt vom politischen<br />
System, indem sie sich bewegen. Auch<br />
wenn sie sich in ihrer Inszenierung<br />
durchaus gleichen, handelt es sich<br />
letztlich doch um die unterschiedlichsten<br />
Charaktere, die sich nicht zuletzt<br />
im Grad der zur Schau getragenen<br />
Radikalität unterscheiden.<br />
Ein trotzdem spannendes und inform<strong>at</strong>ives<br />
Buch, auch wenn der Autor ein-<br />
... wie die Ausstellungen im Kunsthistorischen Museum Wien.<br />
Werke und Werte anderer Kulturen werden präsentiert. Von<br />
den Schätzen aus Ägypten, der Zeit Kaiser Karl V. bis zu den<br />
Gemälden El Grecos. Wir unterstützen diese Arbeit.<br />
mal mehr der Verlockung nicht widerstanden<br />
h<strong>at</strong>, einen Jörg Haider – neben<br />
Leuten wie Jean Marie Le Pen! – als radikalsten,<br />
gefährlichsten und tabulosesten<br />
Vertreter einer Gruppe darzustellen,<br />
die es in dieser homogenen Art<br />
freilich gar nicht gibt. Zu unterschiedlich<br />
sind eben deren Ausformungen<br />
und mit Abstrichen auch deren Inhalte.<br />
Ein Weg sie zu entzaubern wurde uns<br />
im Österreich der letzten zwei Jahre aufgezeigt.<br />
Paul Hefelle, F-B, BbG<br />
Hans-Henning Scharsach<br />
Rückwärts nach rechts<br />
Europas Populisten<br />
Verlag Carl Ueberreuter, Wien <strong>2002</strong><br />
ISBN 3-8000-3923-0<br />
manches<br />
möglich<br />
machen ...<br />
45<br />
Rezension<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Kultur<br />
Bilder einer Ausstellung –<br />
neu empfunden und realisiert<br />
Ohne eine Ahnung zu haben, was er damit auslösen<br />
könnte, malte und zeichnete der deutsche Künstler Viktor<br />
A. Hartmann in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine<br />
Reihe von Studien, Bildern und Skizzen von Reiseeindrücken.<br />
Als er überraschend etwa 40-jährig starb, organisierten<br />
seine Freunde eine Ausstellung und Modest P.<br />
Mussorgski komponierte zu seinen Ehren einen Klavierzyklus,<br />
der eine Sammlung lebhafter musikalischer Bildbeschreibungen<br />
darstellt.<br />
Diese musikalischen Bildbeschreibungen sollten bekannter<br />
werden, als die Bilder, die Mussorgski inspiriert<br />
h<strong>at</strong>ten. Der Zyklus regte viele andere Musiker an, ihn neu<br />
zu instrumentieren, und zu bearbeiten, so unter anderem<br />
M. Tuschmalow, Leopold Stokowski oder auch Maurice<br />
Ravel, der den Zyklus im musikalisch impressiven Stil interpretierte.<br />
Durch die englische Popgruppe Emerson, Lake & Palmer<br />
wurde die Musik in einem ganz anderem Zeitgeist interpretiert,<br />
fand den Weg in die Hitparaden und erreichte<br />
ein völlig neues Publikum. Ähnliches gelang auch dem<br />
japanischen Elektronik-Musiker Isao Tomita, der die Musik<br />
mit einem Synthesizer<br />
umsetzte.<br />
Wir sehen in den „Bildern<br />
einer Ausstellung“ ein Symbol,<br />
dass Kultur nicht etwas<br />
ist, das auf ein Volk oder eine<br />
bestimmte Zeit beschränkt<br />
ist, sondern Künstler verschiedenster<br />
Richtungen immer<br />
wieder einander neu inspirieren<br />
können. Der<br />
österreichische Künstler Wolf<br />
A. Mantler, Baj, und seine<br />
Frau Lissa (beide an der<br />
Pädagogischen Akademie in<br />
Wien tätig) haben sich von<br />
dem Thema gleichsam<br />
„rückinspirieren“ lassen und Bildvari<strong>at</strong>ionen zu den vier<br />
verschiedenen Musikfassungen geschaffen, die sie heuer<br />
in einem gemeinsamen Filmprojekt erstmals auf der Rosenburg<br />
präsentierten. Die ersten Eindrücke des noch unvollständigen<br />
Projekts waren so vielversprechend, dass<br />
die Künstler für 2003 eine kombinierte Präsent<strong>at</strong>ion von<br />
mindestens zwei Musikfassungen, eine Filmvorführung<br />
(ca. 20 Min.) und eine Ausstellung von Bildern (Gemälde<br />
und Computerausdrucke) ins Auge fassen.<br />
46<br />
Nimm an Löffel und iss mit!<br />
Jeder von uns h<strong>at</strong> wohl<br />
Kindheitserinnerungen, die<br />
mit dem Essen verbunden<br />
sind. Sei es eine Festspeise, die<br />
es immer (und nur) zu Weihnachten<br />
gegeben h<strong>at</strong> oder jene<br />
Dinge, bei denen man der<br />
Mutter mit Vorliebe zur Hand<br />
gegangen ist, etwa Schnitzel<br />
panieren.<br />
Die 1943 geborene Altbäuerin<br />
Johanna Reinisch h<strong>at</strong> sogar<br />
sehr viele Kindheitserinnerungen,<br />
die auch mit dem<br />
Essen zu tun haben. Aufgewachsen als jüngstes von acht Kindern<br />
auf einem 70 Joch großen Bergbauernhof in der Weststeiermark<br />
schöpft sie diesbezüglich aus einem nahezu unerschöpflichen<br />
Fundus, h<strong>at</strong> sie doch die letzten Jahre der absoluten<br />
Selbstversorgung als Kind noch erlebt. Damals galt, wie die Autorin<br />
im Vorwort bemerkt, die Grundregel: „Alles zu seiner Zeit!“,<br />
wenn es um die Verköstigung ging.<br />
Die Erinnerungen an den bäuerlichen Alltag h<strong>at</strong> sie nun niedergeschrieben.<br />
Entstanden ist ein unterhaltsames und gleichzeitig<br />
inform<strong>at</strong>ives Lesebuch, in dem man erfährt was es mit<br />
dem „Weinbeerlbrot“, dem „Miazerlkouch“ und dem „Semmelboggerl“<br />
auf sich h<strong>at</strong>. Reinisch erzählt von den „Schlemmertagen<br />
nach dem Schlachten“ ebenso wie vom „Speckeintreiben“,<br />
von „der Stör“ und vom „Wein von unserem Pfarrer“.<br />
Als speziellen Bonus gibt es am Ende des Buches sogar noch<br />
einige Rezepte aus Großmutters Küche. Paul Hefelle, F-B, BbG<br />
Johanna Reinisch<br />
Nimm an Löffel und iss mit! Bäuerliche Kost<br />
– Vergessene Gerichte; Böhlau Wien <strong>2002</strong><br />
256 S. 60 Farb- u. 18 SW-Abb. Geb.; Euro 24,90<br />
ISBN 3-205-77004-8<br />
Nazigold für Portugal<br />
Immer neue Seiten eines bisher wenig bekannten „Randgeschehens“<br />
des Zweiten Weltkrieges werden durch neue Publik<strong>at</strong>ionen<br />
bekannt. So h<strong>at</strong> das neutrale Portugal unter der autoritären<br />
Führung durch Antonio Oliveira de Salazar eine<br />
bedeutende Rolle als Rohstofflieferant für Deutschland gespielt.<br />
Besonders galt dies für das kriegswichtige Wolfram. Interessant<br />
sind die finanziellen Hintergründe dieser Lieferungen aus Portugal:<br />
Deutschland musste überweigend mit Gold bezahlen,<br />
daneben aber auch mit Waffenlieferungen. Das aus den No-
tenbanken der eroberten Sta<strong>at</strong>en und aus jüdischem<br />
Besitz stammende „Nazigold“ wurde zu<br />
einem erheblichen Teil über die Schweiz nach<br />
Portugal transferiert. Im vorliegenden Buch werden<br />
die komplizierten Vorgänge in einer sehr<br />
lebendigen Art analysiert. Es entsteht ein Bild<br />
der sehr komplexen Zusammenhänge des Wirtschaftskrieges,<br />
dem eine größere Bedeutung zugekommen<br />
ist, als noch lange Zeit angenommen<br />
wurde. Das gut lesbare Buch stützt sich auf<br />
exakte Forschungsarbeit. Alfred Klose, Nc<br />
Zwei große Herausforderungen auf<br />
dem Gebiet der Rechtswissenschaften<br />
werden die nächsten Jahrzehnte prägen:<br />
Das Europarecht und das Recht<br />
der neuen Kommunik<strong>at</strong>ionsmedien.<br />
Genau so, wie das Europarecht mit der<br />
fortschreitenden Integr<strong>at</strong>ion der EU an<br />
Bedeutung gewinnt, bedienen sich immer<br />
mehr Menschen des Mediums Internet,<br />
wickeln einfachste Vorgänge des<br />
alltäglichen Lebens ebenso wie komplexe<br />
Oper<strong>at</strong>ionen der Finanzwelt auf<br />
diesem Weg ab. Diese Vorgänge müssen<br />
nach bestimmten Normen ablaufen.<br />
Normen, die nicht immer leicht<br />
erfassbar sind, weil das Internet einen<br />
eigenen virtuellen Raum geschaffen<br />
h<strong>at</strong>, den so genannten Cyberspace, der<br />
ebenso wie das Europarecht nicht vor<br />
den n<strong>at</strong>ionalsta<strong>at</strong>lichen Grenzen Halt<br />
macht. In ihrer Publik<strong>at</strong>ion „Internet-<br />
Antonio Louca<br />
Nazigold für Portugal -<br />
Hitler und Salazar.<br />
Euro 24,00; Broschiert -<br />
226 Seiten<br />
A. Holzhausen, Wien <strong>2002</strong><br />
ISBN: 3854930607<br />
INTERNET § Recht. Eine europarechtliche Analyse.<br />
recht. Eine europarechtliche Analyse“<br />
geben die Autoren Christoph Per<strong>at</strong>honer<br />
und Thomas Schnitzer einen Einblick<br />
an der Schnittstelle dieser beiden<br />
Rechtsbereiche. Sie behandeln damit<br />
jenen rechtlichen Rahmen, dem alle<br />
Sta<strong>at</strong>en der Europäischen Union im<br />
elektronischen Geschäftsverkehr (ecommerce),<br />
im Domain-Recht und im<br />
Bereich der elektronischen Sign<strong>at</strong>uren<br />
u.a.m. unterworfen sind. Dieses Buch<br />
richtet sich an den Juristen genau so<br />
wie an den interessierten Unternehmer.<br />
Das Buch wurde im Rahmen der<br />
Fachmesse für Neue Medien<br />
„Medi@<strong>2002</strong>“ einem breiten Fachpublikum<br />
vorgestellt. Die Schwerpunkte<br />
des Werkes können aus dem Inhaltsverzeichnis<br />
auf www.internetrecht.it<br />
entnommen werden.<br />
Die Fachautoren Rechtsanwalt DDr.<br />
Christoph Per<strong>at</strong>honer, LL.M. und Dr.<br />
Thomas Schnitzer, LL.M. sind Akademische<br />
Europarechtsexperten und Masters<br />
of Advanced Studies in European<br />
Law. Sie arbeiten als Freiberufler in Bozen<br />
(Südtirol) und setzen sich mit Europarecht,<br />
aber vor allem mit Wirtschaftsrecht<br />
und dem Recht der neuen<br />
Kommunik<strong>at</strong>ionsmedien mit Schwerpunkt<br />
Internetrecht auseinander.<br />
Internet § Recht<br />
Eine europarechtliche Analyse<br />
ISBN 88-8266-146-6<br />
Verlagsanstalt Athesia Ges.m.b.H.,<br />
Bozen <strong>2002</strong><br />
Cartoons des D.I. Markus Szyskowitz<br />
Wann gibt es wieder einen Cartoon von<br />
Markus Szyskowitz in der ACADEMIA?<br />
Ich finde seine Zeichnungen sehr bereichernd.<br />
Vielleicht ist es möglich wieder<br />
eine zu veröffentlichen.<br />
Übrigens meine Hochachtung betreffend<br />
der letzten Ausgaben.<br />
Glück Auf!<br />
Christian Schenk, GlL, Aa<br />
1220 Wien<br />
Zu <strong>Academia</strong> Oktober <strong>2002</strong><br />
Über jede neue Ausgabe der ACADEMIA<br />
freue ich mich grundsätzlich, besonders<br />
über die oft sehr guten Beiträge zum Prinzip<br />
Religio.<br />
Diesmal haben mich aber zwei Dinge verärgert,<br />
die ich benennen möchte, auch<br />
wenn die Redaktion der ACADEMIA kaum<br />
etwas damit zu tun h<strong>at</strong>.<br />
Bezüglich des sogenannten „Republiksantrages“<br />
bzw. „Republiksbeschlusses“<br />
sollte man den Verbindungen, die bezüglich<br />
des Zustandekommens Bedenken<br />
äußerten, Raum in der Zeitschrift geben<br />
und nicht nur die Entgegnung der<br />
Verbandsführung abdrucken. Dies würde<br />
ich als angemessen erachten, da beide<br />
Seiten gehört werden sollen.<br />
Zum Zweiten: Die ganzseitige ÖVP/p<strong>at</strong>ria<br />
2411 Werbeeinschaltung, sowie die einschlägige<br />
Berichterst<strong>at</strong>tung entspricht<br />
nicht der Grundlinie unseres Cartellverbandes.<br />
Ausdrücklich sei auf unsere ÖCV-<br />
S<strong>at</strong>zung verwiesen, welcher man entnehmen<br />
kann, dass es sich beim<br />
Cartellverband um eine parteipolitisch<br />
ungebundene Vereinigung handelt. Das<br />
sage ich, ohne meine Symp<strong>at</strong>hie für Dr.<br />
Schüssel leugnen zu wollen. Dem Verband<br />
leistet man mit solchen Kampagnen<br />
m.E. keinen guten Dienst.<br />
Ich freue mich nichtsdestotrotz auf die<br />
nächste ACADEMIA und grüße sehr herzlich<br />
Pfarrer Dr. Alexander Georg Brenner, V-B<br />
1200 Wien<br />
Zum Republiksbeschluss: Wir haben<br />
lediglich berichtet, dass nach erfolgter<br />
Beschlussfassung von einigen versucht<br />
wurde, diesen Beschluss nachträglich<br />
in Frage zu stellen. Die Radaktion<br />
47<br />
Leserbriefe<br />
Leserbriefe sind der<br />
ACADEMIA immer willkommen,<br />
können aber<br />
nicht in jedem Fall<br />
schriftlich beantwortet<br />
werden. Abgedruckte<br />
Zuschriften müssen sich<br />
inhaltlich nicht unbedingt<br />
mit der Meinung<br />
der ACADEMIA decken.<br />
Die Redaktion behält<br />
sich Kürzungen vor und<br />
veröffenlicht nur Schreiben<br />
mit voller Nennung<br />
des Absenders.<br />
Dezember <strong>2002</strong>
Ein Mitglied der HVB Group www.ba-ca.com<br />
Was wären die großen Erfolge ohne die kleinen?<br />
JUNGv.MATT/Donau