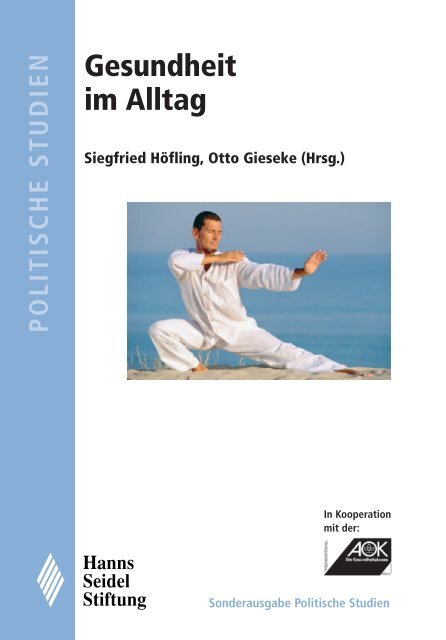Gesundheit im Alltag - Hanns-Seidel-Stiftung
Gesundheit im Alltag - Hanns-Seidel-Stiftung
Gesundheit im Alltag - Hanns-Seidel-Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
POLITISCHE STUDIEN<br />
<strong>Gesundheit</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Alltag</strong><br />
Siegfried Höfling, Otto Gieseke (Hrsg.)<br />
In Kooperation<br />
mit der:<br />
Sonderausgabe Politische Studien
<strong>Hanns</strong><br />
<strong>Seidel</strong><br />
<strong>Stiftung</strong><br />
Herausgeber:<br />
<strong>Hanns</strong>-<strong>Seidel</strong>-<strong>Stiftung</strong> e.V., Vorsitzender: Dr. h.c. Alfred Bayer, Staatssekretär a.D.<br />
Hauptgeschäftsführer: Manfred Baumgärtel<br />
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publikationen: Hubertus Klingsbögl<br />
Redaktion:<br />
Dr. Reinhard C. Meier-Walser (Chefredakteur, v.i.S.d.P.), Wolfgang Eltrich M.A. (Redaktionsleiter),<br />
Barbara Fürbeth M.A. (stellv. Redaktionsleiterin), Paula Bodensteiner (Redakteurin),<br />
Verena Hausner (Redakteurin), Claudia Magg-Frank, Dipl. sc. pol. (Redakteurin),<br />
Irene Krampfl (Redaktionsassistentin)<br />
Anschrift:<br />
Redaktion POLITISCHE STUDIEN, <strong>Hanns</strong>-<strong>Seidel</strong>-<strong>Stiftung</strong> e.V., Lazarettstraße 33, 80636 München,<br />
Telefon 089/1258-260, Telefax 089/1258-469, Internet: www.hss.de, e-mail: PolStud@hss.de<br />
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung,<br />
vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein<br />
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Redaktion reproduziert oder unter Verwendung<br />
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.<br />
Die Beiträge in diesem Heft geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder;<br />
die Autoren tragen für ihre Texte die volle Verantwortung.<br />
Umschlaggestaltung: adacon GmbH, München; Titelfoto: akg-<strong>im</strong>ages<br />
ATWERB-VERLAG KG Publikation © 2003
Inhalt<br />
Siegfried Höfling/ Einführung...................................... 5<br />
Otto Gieseke<br />
Karl W. Lauterbach/ Kosten sparen durch Prävention –<br />
Stephanie Stock was ist realistisch?......................... 8<br />
Walter Schwarz Prävention als gesellschaftliche<br />
Aufgabe – die Rolle der<br />
Krankenkassen............................... 20<br />
Klaus Jacobs Sinn und Unsinn von Bonus-<br />
Malus-Regelungen in der<br />
Prävention ...................................... 36<br />
Eberhard Sinner <strong>Gesundheit</strong>soffensive der<br />
Bayerischen Staatsregierung –<br />
Bürgerbeteiligung und<br />
Bürgermotivation............................ 44<br />
Karl E. Bergmann/ Gesunde Eltern – gesunde Kinder<br />
Renate L. Bergmann <strong>Gesundheit</strong>sförderung für die<br />
junge Familie.................................. 46<br />
Hans Günter Abt Führung und <strong>Gesundheit</strong> –<br />
ein belastetes Verhältnis ................ 58<br />
Otto Gieseke Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
in Klein- und Mittelbetrieben – Ein<br />
Modellprojekt der AOK Bayern ...... 78<br />
Wolfgang Anderer Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter .............. 94<br />
Volker Pudel Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten<br />
verändern? Was können neue<br />
Medien leisten?............................ 113
Angelika Wagner-Link Prävention und die seelische<br />
<strong>Gesundheit</strong>................................... 130<br />
Gernot Böhme Die Sorge um sich – Prävention<br />
als Lebenspraxis .......................... 148<br />
Olaf Geramanis Zeitmanagement – ein Irrweg? .... 162<br />
Autorenverzeichnis ...................................................... 174
Einführung<br />
Siegfried Höfling/Otto Gieseke<br />
„Guten Morgen“, sagte der Arzt, „was kann ich für Sie tun?“<br />
„Es ist wegen der Krankheit meiner Frau.“<br />
„Was fehlt ihr?“<br />
„Ja, sie sagte, ich solle lieber zu Ihnen gehen, um Ihnen zu sagen, sie möchte Sie<br />
gerne sehen.“<br />
„Soll ich sofort kommen?“<br />
„Nein, sie sagte mir dann, sie fühle sich besser, und so bin ich gekommen, um<br />
Ihnen zu sagen, dass Sie doch nicht kommen müssen, weil es ihr inzwischen<br />
besser geht. Obgleich Sie hätten kommen müssen, wenn es ihr nicht besser<br />
gegangen wäre.“ Idries Shah<br />
Allen Umfragen nach hat die <strong>Gesundheit</strong> für alle Menschen oberste Priorität. Auf<br />
der Verhaltensebene findet man das so nicht wieder. Die mangelnde Kostentransparenz<br />
für den Versicherten <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>swesen trägt vermutlich auch zu<br />
dieser Passivität bei. <strong>Gesundheit</strong> durch eigenes gesundheitsbewusstes <strong>Alltag</strong>sverhalten<br />
zu stabilisieren, ist bei dem derzeit vorhandenen sicherheitsspendenden<br />
Helferangebot (siehe obiges Zitat) zu anstrengend.<br />
Die <strong>Gesundheit</strong>spolitiker haben der Öffentlichkeit die Quittung präsentiert und<br />
nun wird an allen Ecken gekürzt oder sogar gestrichen, umstrukturiert und<br />
Kosten werden neu verteilt. Die Hauptlast der <strong>Gesundheit</strong>sreform tragen die Versicherten.<br />
Am „Organ“ Geldbeutel glaubt man, wäre der Einzelne zu packen. Ein<br />
Mehr an persönlicher <strong>Gesundheit</strong>sverantwortung soll gleichsam monetär erlitten<br />
werden. Klaus Jacobs wird in unserem Band auf Sinn und Unsinn von Bonus-Malus-Regelungen<br />
in der Prävention eingehen. Und Karl Lauterbach und<br />
Stephanie Stock können in überzeugender Weise belegen, dass gesundheitspolitische<br />
Investitionen in Präventionsmaßnahmen mittelfristig Kosten in beträchtlicher<br />
Höhe reduzieren werden.<br />
Das grundlegende Dilemma bei Prävention und <strong>Gesundheit</strong>sförderung ist und<br />
bleibt die Aktivierung der Zielgruppen, d.h. die Befreiung des Einzelnen und der<br />
Gruppen aus der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“, wie es bereits Kant
6<br />
Siegfried Höfling/Otto Gieseke<br />
formulierte. Kann der Bürger über Aufklärung, Aktivitätsprogramme, Broschüren,<br />
Fernsehsendungen, ärztliche und psychologische Gespräche dauerhaft dazu motiviert<br />
werden, der eigenen <strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong> <strong>Alltag</strong> größere Bedeutung einzuräumen?<br />
Die Beiträge von Walter Schwarz, Volker Pudel, Hans Günter Abt, Eberhard<br />
Sinner, Wolfgang Anderer, Karl und Renate Bergmann und Otto Gieseke gehen<br />
dieser Frage nach und zeigen die Möglichkeiten und Grenzen von Präventionsprogrammen<br />
bei verschiedenen Zielgruppen und in unterschiedlichen Handlungsfeldern<br />
auf.<br />
Nötig wäre eine neue Form gesundheitlicher Aufklärung, die die Fehler der<br />
1. Aufklärungsepoche vermeidet. Information und Wissensvermittlung reichen<br />
auf Dauer nicht aus, um Verhaltensänderungen in der Bevölkerung und bei Einzelnen<br />
hervorzurufen. Einsicht bewirkt nicht zwingend Verhaltensänderung. Das<br />
können Eltern bestätigen, die ihre Kinder erziehen wollen, ebenso Priester trotz<br />
engagierter sonntäglicher Predigt. Die Complianceforschung bestätigt nachdrücklich<br />
den Verdacht, dass ärztliche Empfehlungen von den Patienten nicht<br />
dauerhaft befolgt werden.<br />
Psychologische und verhaltensmedizinische Strategien sowie Settingansätze<br />
(z.B. in Betrieben und Schulen) kamen bei der 1. großen gesundheitlichen<br />
Aufklärungskampagne zu kurz. Zu Recht fordert Angelika Wagner-Link in ihrem<br />
Artikel den systematischen Ein- und Ausbau der Erkenntnisse aus den Erlebensund<br />
Verhaltenswissenschaften in neue Präventions- und <strong>Gesundheit</strong>sförderungsangebote.<br />
Der Präventionsansatz hat Gegner. Schon kursiert das böse Wort vom Präventionsterror.<br />
In einer Gesellschaft, in der Sparzwang Regie führt, kann Krankheit<br />
nur allzu leicht politisch als inkorrektes Verhalten stigmatisiert werden. Wer krank<br />
wird, ist unverantwortlich, belastet die Solidargemeinschaft und gefährdet<br />
das Gemeinwohl. Ein amerikanischer Präsident soll einmal gesagt haben, dass<br />
gesunde Kinder keine Krankenversicherungen bräuchten.<br />
Bei Intensivierung der Präventions- und <strong>Gesundheit</strong>sförderungsanstrengungen<br />
besteht natürlich die Gefahr, dass <strong>Gesundheit</strong>sverhalten technokratisch anerzogen<br />
wird. Die Freiwilligkeit bei der Übernahme von <strong>Gesundheit</strong>sverantwortung<br />
ist aber Grundbedingung für die Entwicklung eines gesundheitsbewussten Lebensstils,<br />
der durchaus Spaß machen darf. Unsere Autoren Gernot Böhme und<br />
Olaf Geramanis zielen deshalb darauf ab, eine völlig andere Einstellung zu sich,<br />
zur Umwelt, zum Gebrauch der Zeit zu entwickeln. Körper und Seele sollten nicht<br />
weiter verzwecklicht bzw. manipuliert werden, indem man sie mit pädagogischen,<br />
medizinischen und psychologischen Programmen trainiert, nur damit der<br />
Mensch störungsfrei den Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit entsprechen<br />
kann. Stattdessen sollte der Mensch wieder lernen, sich als Leib wahr zu nehmen<br />
und für sich zu sorgen. Die Rückkehr zu einer ganzheitlichen Prävention <strong>im</strong><br />
Sinne eines Leibkonzepts (Gernot Böhme) ist ein völlig anderes, aufregendes<br />
Vorbeugekonzept. Gesellschaftliche Tendenzen zu einer Umorientierung des
Einführung 7<br />
eigenen Lebens auf das Sinnvolle, auf das Maßhalten und die aus dem asiatischen<br />
Raum kommenden Körper- und Entspannungsübungen sind schließlich<br />
nicht mehr zu übersehen.<br />
Der Leser bilde sich sein Urteil bei der hoffentlich spannenden Lektüre dieses<br />
Bandes. Ist er der Überzeugung, dass gemeinsame Anstrengungen und geschicktes<br />
Umsteuern die Bürger in Bewegung setzen werden, gesundheitsorientes Verhalten<br />
in den <strong>Alltag</strong> zu integrieren, oder glaubt er fest daran, dass <strong>Gesundheit</strong><br />
vorwiegend von den Krankheitsexperten „hergestellt“ werden muss, damit sich<br />
der Mensch wieder gesundheitsschädigend verhalten darf. Aber diese Überzeugung<br />
muss man sich dann auch leisten können.<br />
Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer gemeinsamen Veranstaltung von<br />
AOK Bayern und der <strong>Hanns</strong>-<strong>Seidel</strong>-<strong>Stiftung</strong> <strong>im</strong> März 2003 in Wildbad Kreuth.
Kosten sparen durch Prävention –<br />
was ist realistisch?<br />
Karl W. Lauterbach/Stephanie Stock<br />
1. Aktuelle Entwicklungen in der Versorgung chronischer<br />
Erkrankungen<br />
In den industrialisierten Ländern stehen chronische Erkrankungen an erster<br />
Stelle der Todesursachenstatistiken. Die Kosten, die durch chronische Erkrankungen<br />
und ihre Folgen verursacht werden, betragen rund 80% der <strong>Gesundheit</strong>sausgaben<br />
in allen Bereichen. 1 Die steigende Anzahl chronisch Kranker ist<br />
eine Herausforderung für das deutsche <strong>Gesundheit</strong>ssystem, da das System auf die<br />
Therapie akuter, zeitlich begrenzter Erkrankungsepisoden ausgelegt ist. Die für<br />
chronische Erkrankungen besonders geeignete, so genannte integrierte Versorgung<br />
muss erst aufgebaut werden. Chronische Erkrankungen erfordern auf Grund<br />
ihrer multifaktoriellen Ätiologie, der lebenslangen Persistenz sowie der Beeinflussbarkeit<br />
der Risikofaktoren durch Pr<strong>im</strong>är- und Sekundärprävention ein anderes<br />
Versorgungskonzept. 2 Auf die Versorgung chronisch Kranker wird oft das<br />
Konzept der Akutmedizin mit einem Schwerpunkt auf der interventionellen Medizin<br />
übertragen, ohne dass den besonderen Anforderungen an Versorgungsstrukturen<br />
für diese Population Rechnung getragen wird. Daraus resultiert häufig<br />
eine Unterversorgung in risikoadaptierter Prävention, eine Kostensteigerung<br />
durch die Überversorgung mit medizin-technischen Verfahren in Forschung und<br />
Praxis sowie eine nur ungenügende Senkung der Inzidenzrate (Neuerkrankungsrate)<br />
chronischer Erkrankungen. Folge ist, dass die Sterblichkeit akuter Manifestationsformen<br />
chronischer Erkrankungen wie z.B. des akuten Herzinfarktes<br />
gesenkt werden kann, die Inzidenz chronischer Erkrankungen jedoch nicht oder<br />
nicht ausreichend beeinflusst wird. Damit bleibt die Mult<strong>im</strong>orbidität unbeeinflusst<br />
oder steigt sogar an, weil die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten weiterer<br />
chronischer Erkrankungen in den gewonnenen Lebensjahren steigt. Dies gilt<br />
z.B. in hohem Maße für die Koronare Herzkrankheit. Sie ist eine chronische Erkrankung,<br />
deren Inzidenz in den letzten 10 Jahren kontinuierlich angestiegen<br />
ist. Eine ihrer Manifestationsformen, der akute Herzinfarkt, ist eine der häufigs-<br />
1 Fishman P, von Korff M, Lozano P, Hecht J (1997): Chronic care costs in managed care.<br />
Health Aff (Millwood); 1683:239-47.<br />
2 Wagner EH, Austin BT, Von Korff M (1996): Organizing care for patients with chronic<br />
illness. Milbank Q; 74(4):511-44,(b).
Kosten sparen durch Prävention – was ist realistisch? 9<br />
ten Todesursachen für Männer in Deutschland. 3 Entsprechend hat die Bekämpfung<br />
dieser Erkrankung eine hohe Priorität. Es werden viele Ressourcen in die<br />
Forschung patentfähiger Substanzen bzw. Instrumente investiert. Die Ergebnisse<br />
sind häufig neue und teuere Behandlungsformen, die dann Eingang in Leitlinien<br />
finden. 4 Die Forschung an vergleichsweise günstigen Interventionsmaßnahmen<br />
wird hingegen vernachlässigt. Dies spiegelt sich auch in der Therapie<br />
wieder. Die Anzahl der durchgeführten Herzkatheter ist kontinuierlich angestiegen<br />
(Abbildung 1).<br />
Abbildung 1: Steigerungsraten bei interventioneller Diagnostik und<br />
Therapie der Koronaren Herzkrankheit<br />
Linksherzkathetermessplätze<br />
1990 2000/2001 Veränderung<br />
gegenüber 1990<br />
233 527 +126%<br />
Koronarangiografien 193.673 561.623* +190%<br />
PTCAs 33.785 195.841 +480%<br />
Operativ tätige<br />
Herzzentren<br />
Herzoperationen<br />
46 80 +74%<br />
(mit Herz-Lungen-<br />
Maschinen)<br />
38.712 96.593 +150%<br />
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bruckenberger, 2001. 5 * = Zahl aus 1999<br />
Zusammen mit der verbesserten Behandlung in der präklinischen Phase ist hier<br />
die Ursache für die Abnahme der Sterbeziffer des akuten Myokardinfarkts zu<br />
sehen. Ein wahrscheinlicher Grund für die genannte Diskrepanz ist die Tatsache,<br />
dass für die weitere Prognose sowie die Lebensqualität der Patienten die Sekundärprävention<br />
nach dem Ereignis entscheidend ist. Hier zeigen große Studien<br />
noch deutliche Defizite in Deutschland auf. Z.B. werden weniger als die Hälfte<br />
der Patienten evidenzbasiert behandelt und bei den medikamentös behandelten<br />
Patienten überschreiten 66% die Zielwerte der Risikofaktoren (EuroAspire) 6 .<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ziele, Senkung der Inzidenz chronischer<br />
Erkrankungen und Verbesserung der Sekundärprävention, in Deutschland<br />
nicht erreicht werden konnten. Diese Tatsache ist auch darauf zurückzuführen,<br />
3 Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>swesen (2001): Bedarfsgerechtigkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit – Über-, Unter- und Fehlversorgung. Berlin: Nomos.<br />
4 Von Schacky (2002): Koronare Herzkrankheit. Dtsch Med Wochenschr; 127 (7):2429-<br />
2431.<br />
5 Bruckenberger E (2000): Herzbericht 1999 mit Transplantationschirurgie. 12. Bericht des<br />
Krankenhausausschusses der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden<br />
der Länder (AOLG). Hannover.<br />
6 Enbergs A, Liese A, He<strong>im</strong>bach M, Kerber S, Scheld HH, Breithardt G et al., (1997):<br />
Evaluation of secondary prevention of coronary heart disease. Results of the EUROSPIRE<br />
study in the Munster region. Z Kardiol; 86(4):284-91.
10<br />
Karl W. Lauterbach/Stephanie Stock<br />
dass an Stelle von Gesamtkonzepten risikoadaptierter Prävention mit einem<br />
Schwerpunkt auf sich überschneidenden Risikofaktoren für mehrere Erkrankungen<br />
wie z.B. Bewegungsarmut, Adipositas und Raucherprävention die Therapie<br />
einzelner Erkrankungen bzw. deren Symptome <strong>im</strong> Vordergrund steht.<br />
2. Die Bedeutung von Risikofaktoren für die Manifestation<br />
chronischer Erkrankungen: Multifaktorielle Genese<br />
Risikofaktoren können in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren<br />
eingeteilt werden. Beispielsweise gehört eine positive Familienanamnese zu<br />
den nicht beeinflussbaren Risikofaktoren einer Koronaren Herzerkrankung. Modifizierbare<br />
Risikofaktoren, deren Korrektur den weiteren Verlauf der Erkrankung<br />
nachweislich günstig beeinflusst, sind beispielsweise Nikotinabusus, erhöhtes<br />
LDL-Cholesterin, fettreiche Kost und Bluthochdruck. 7 Viele dieser Risikofaktoren<br />
sind lange, bevor die ersten Symptome auftreten, nachweisbar. Sie triggern<br />
die Entstehung der Erkrankung über Jahre und häufig wie z.B. be<strong>im</strong> Diabetes<br />
Mellitus über nachweisbare Vorstufen hinweg. 8 Das Auftreten von Risikofaktoren<br />
ist nicht auf das Erwachsenenalter beschränkt. Beispielsweise kann schon<br />
bei Kindern und Jugendlichen eine stetige Zunahme der Adipositas beobachtet<br />
werden (Abbildung 2).<br />
Abbildung 2: Zunahme der Adipositas bei Jungen in Deutschland<br />
(gemessen anhand der Trizeps Skin fold [TFS])<br />
number of children<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0-2,9 3,0-<br />
4,9<br />
5,0-<br />
6,9<br />
Quelle: Müller et al., 2001. 9<br />
7,0-<br />
8,9<br />
9,0-<br />
10,9<br />
90th percentile<br />
1978<br />
90th ◗ +13,2 %<br />
percentile<br />
1996–1999<br />
11,0-<br />
12,9<br />
◗<br />
13,0-<br />
14,9<br />
Auswertungen mehrerer Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der übergewichtigen<br />
Kinder und Jugendlichen in Deutschland ansteigt. 10 Bei 40% der übergewichtigen<br />
Kinder liegt bereits ein pathologisches Lipidmuster vor, und viele dieser<br />
Kinder bewegen sich gleichzeitig zu wenig. Übergewicht, Bewegungsmangel<br />
und veränderte Blutfette sind ihrerseits Risikofaktoren dafür, weitere chronische<br />
Erkrankungen wie Diabetes Mellitus, Schlaganfall, Herzinfarkt oder einen Blut-<br />
15,0-<br />
16,9<br />
17,0-<br />
18,9<br />
19,0-<br />
20,9<br />
21,0-<br />
22,9<br />
23,0-<br />
24,9<br />
25,0-<br />
26,9<br />
27,0-<br />
28,9<br />
TSF (mm)
Kosten sparen durch Prävention – was ist realistisch? 11<br />
hochdruck zu entwickeln. Gleichzeitig weisen Patienten selten nur einen einzigen<br />
Risikofaktor auf. Viel häufiger handelt es sich um eine Kombination von<br />
Risikofaktoren (multifaktorielle Genese). So weisen mehr als 30% der 40-bis<br />
49-jährigen Männer und nahezu 20% der gleichaltrigen Frauen mindestens zwei<br />
Risikofaktoren auf. 11 Dieses Risikoprofil und die damit verbundene erhöhte Komorbidität<br />
von Patienten, die bereits einen Risikofaktor aufweisen, kann auch<br />
am Verschreibungsverhalten nachvollzogen werden (Abbildung 3).<br />
Abbildung 3: Komorbidität von Patienten mit Adipositas gemessen am<br />
Verschreibungsverhalten<br />
Arzne<strong>im</strong>ittelklasse %<br />
Quelle: Hauner, 1996. 12<br />
Diagnose: Adipositas Diagnose: keine Adipositas<br />
Verschreibung/<br />
Verschreibung/<br />
%<br />
Patient Patient<br />
Antibiotika 34,2 1,8 21,2 1,8<br />
Antidiabetika 9,0 7,1 5,0 6,0<br />
Antihypertonika 13,8 4,0 6,5 4,0<br />
Antitussiva<br />
Betablocker,<br />
45,1 3,1 32,3 2,9<br />
Kalziumkanal-Blocker,<br />
ACE-Hemmer<br />
26,3 4,3 16,0 5,1<br />
Diuretika 19,4 3,0 7,4 4,2<br />
7 Schaefer JR (2001): Medikamentöse Therapie der Hyperlipidämie. Herz; 26 (8):507-512.<br />
8 Uusitupa M, Louheranta A, Lindstrom J, Valle T, Sundvall J, Eriksson J, et al. (2000): The<br />
Finnish Diabetes Prevention Study. Br J Nutr; 83 Suppl 1(6):137-42.<br />
Meigs JB, Mittleman MA, Nathan DM, Tofler GH, Singer DE, Murphy-Sheehy PM, et al.<br />
(2000): Hyperinsulinemia, hyperglycemia, and <strong>im</strong>paired menostasis: the Gramingham<br />
Offspring Study. JAMA; 283(2):221-8.<br />
Henkel E, Kohler C, Temelkova-Kurktschiev T, Hanefeld M (2002): Predictors of abnormal<br />
glucose tolerance in persons at risk of type 2 diabetes: the RIAD study. Dtsch Med<br />
Wochenschr; 127(18):953-7.<br />
DECODE study Group (2003) Age- and sex-specific prevalences of diabetes and <strong>im</strong>paired<br />
glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care; 2681):61-9.<br />
9 Müller MJ, Asbeck I, Mast M, Langnäse K, Grund A (2001): Prevention of obesity – more<br />
than an intention. Concept and first results of the Kiel Obesity Prevention Study (KOPS).<br />
International Journal of Obesity; 25, Suppl 1:66-74.<br />
10 Wabitsch M, Kunze D, Keller E, Kiess W, Kromeyer-Hauschild K (2002): Adipositas bei<br />
Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Fortschritte der Medizin; 120(4):99-106.<br />
Kalies H, Lenz J, von Kries R (2002): Prevalence of overweight and obesity and trends in<br />
body mass index in German pre-school children, 1982-1997. International Journal of<br />
Obesity; 26:1211-1217.<br />
Vetter C (2002): Jeder vierte Erstklässler übergewichtig: Helfen sie ihrem Patienten von<br />
morgen. MMW Fortschr Med; 144(15):16.<br />
11 Thefeld W (2000): Verbreitung der Herz-Kreislauf-Risikofaktoren Hypercholesterinämie,<br />
Übergewicht, Hypertonie und Rauchen in der Bevölkerung. <strong>Gesundheit</strong>sforsch –<br />
<strong>Gesundheit</strong>sschutz; 43:415-423.<br />
12 Hauner H, Koster I, von Ferber L (1996): Frequency of ‚obesity‘ in medical records and<br />
utilization of out-patient health care by ‚obese‘ subjects in Germany. An analysis of<br />
health insurance data. Int J Obes Relat Metab Disord; 20(9):820-4.
12<br />
Karl W. Lauterbach/Stephanie Stock<br />
Durch die Kombination von Risikofaktoren kommt es zu einer Vervielfachung<br />
des Mortalitätsrisikos. Beispielsweise haben Männer mit dem Risikofaktor<br />
„Übergewicht“ ein 4,9-fach erhöhtes Sterberisiko (alle Todesursachen), wenn der<br />
Risikofaktor „Bewegungsarmut“ hinzu kommt <strong>im</strong> Vergleich zu übergewichtigen<br />
Männern, die sich regelmäßig bewegen. 13 Eine Risikoreduktion kann durch die<br />
Bekämpfung von modifizierbaren Risikofaktoren erreicht werden (Abbildung 4).<br />
Abbildung 4: Multifaktorielle Genese des Schlaganfalls: modifizierbare<br />
Risikofaktoren<br />
Schlaganfall – modifizierbare Risikofaktoren<br />
Modifizierbare Risikofaktoren Erhöhung des Schlaganfallrisikos<br />
Blutdruck 2- bis 10fach<br />
Rauchen 2- bis 2,5fach<br />
Diabetes mellitus 2- bis 3fach<br />
Bewegungsmangel 1,5- bis 2fach<br />
Übergewicht 1,5- bis 2fach<br />
Hyperlipidämie 1,5- bis 2fach<br />
Alkoholkonsum 1,5- bis 2fach (J-förmige Beziehung)<br />
Hyperhomocysteinämie bis 5fach<br />
Kontrazeptiva (Östrogengehalt ) bis 2fach<br />
Vorhoffl<strong>im</strong>mern 1- bis 17fach<br />
Quelle: Berlit, 2000. 14<br />
� ––<br />
Ähnlich ist es in der Sekundärprävention der Koronaren Herzkrankheit. Hier<br />
kann das Risiko für einen Re-Infarkt oder einen plötzlichen Herztod durch<br />
die Aufgabe des Rauchens um ca. 50%, durch eine effektive Senkung des Cholesterins<br />
um 10-30% und durch die Therapie mit ASS und Beta-Blockern sowie<br />
der effektiven Therapie eines vorhandenen Bluthochdrucks oder durch regelmäßiges<br />
Ausdauertraining um ca. 20% gesenkt werden. 15<br />
13 Boot ML, Wake M, Armstrong T, Chey T, Hesketh K, Mathur S (2001): The epidemiology<br />
of overweight and obesity among Australian children and adolescents. Aust N Z J Public<br />
Health; 25(2):162-9.<br />
Boot FW, Chakravarthy MV, Gordon SE, Spangenburg EE (2002): Waging war on physical<br />
inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy. J Appl<br />
Physiol; 93:3-30.<br />
14 Berlit P (2000): Schlaganfall: Möglichkeiten der Pr<strong>im</strong>ärprävention. Nervenarzt; 71(4):<br />
231-6.<br />
15 Halle M, Berg A, Keul J (1997): Cholesterinsenkung in der kardiovaskulären Rehabilitation<br />
– Bewegung versus Medikament; Wien Klin Wochenschr; 109(2):29-32.<br />
Hay JW, Yu WM, Ashraf T (1999): Pharmacoeconomics of lipid-lowering agents for<br />
pr<strong>im</strong>ary and secondary prevention of coronary artery disease. Pharmacoeconomics;<br />
15(1):47-74.<br />
Ebrah<strong>im</strong> S, Smith GD (1996): Health promotion in older people for the prevention of<br />
coronary heart disease and stroke. Health Education Authority, London.
Kosten sparen durch Prävention – was ist realistisch? 13<br />
Auf Grund der multifaktoriellen Ätiologie chronischer Erkrankungen lässt<br />
sich durch die Beeinflussung eines Risikofaktors die Wahrscheinlichkeit für das<br />
Auftreten mehrerer chronischer Erkrankungen verringern. So ist Rauchen beispielsweise<br />
ein Risikofaktor für Lungenkrebs (ca. 85% aller Fälle), chronische<br />
Bronchitis, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Koronare Herzkrankheit und Schlaganfall.<br />
16<br />
Bewegungsmangel ist mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für das Auftreten<br />
einer Koronaren Herzkrankheit, eines Schlaganfalls, eines Bluthochdrucks, eines<br />
Diabetes Mellitus, spezifischer Krebsarten, Osteoporose u.a.m. verknüpft. 17<br />
Fehlernährung gilt beispielsweise als Risikofaktor für die Entwicklung von<br />
Übergewicht, Diabetes Mellitus, Hypercholesterinämie, Bluthochdruck, kardiovaskuläre<br />
Erkrankungen, Krebsarten, Osteoporose, Gicht und Erkrankungen des<br />
Bewegungsapparates. Entsprechend kann durch ein modifiziertes Ernährungsverhalten<br />
ein erhöhter Cholesterinspiegel um bis zu 10% gesenkt werden. 18 Bei<br />
einer Verringerung des Übergewichts um ca. 5 bis 10% durch Ernährungsumstellung<br />
und vermehrte körperliche Aktivität kann eine signifikante Verbesserung<br />
des HbA1c, eine Senkung des erhöhten Blutdrucks und des Risikos für eine<br />
Koronare Herzkrankheit erreicht werden.<br />
In der Harvard Nurse’s Studie konnten 91% aller Fälle an aufgetretenem Typ-2<br />
Diabetes durch lebensstilbedingte Faktoren (BMI, Ernährung, Rauchen, Bewegung,<br />
Alkohol) erklärt werden. 19 Andere Studien berichten übereinst<strong>im</strong>mend von<br />
einer Senkung des Diabetesrisikos um 58% durch vermehrte körperliche Aktivität<br />
und einer Senkung des Herzinfarkt- und Schlaganfallrisikos um 30%. 20<br />
Mangel an körperlicher Bewegung erhöht auch für normalgewichtige Frauen das<br />
Risiko an Diabetes zu erkranken um das Doppelte <strong>im</strong> Vergleich zu normalge-<br />
16 Hankey GJ (1999): Smoking and risk of stroke. Journal of Cardiovascular Risk; 6:207-<br />
211.<br />
17 Lengfelder W (2001): Körperliche Inaktivität: Zu beeinflussender Risikofaktor in der<br />
pr<strong>im</strong>ären Prävention? Med Klin; 96(11):66-9.<br />
18 Clarke R, Frost C, Collins R, Appleby P, Peto R (1997): Dietary lipids and blood cholesterol:<br />
quanitative meta-analysis of metabolic ward studies. BMJ; 314:112-117.<br />
19 Manson JE, Cullen P, Assmann G (1999): A prospective study of obesity and risk of<br />
coronary heart disease in women. N Engl. J Med; 322:882-889.<br />
Carey VJ, Walters E, Colditz GA, Solomon CG, Willett WC, Rosner BA, et al., (1997):<br />
Body fat distribution and risk of non-insulin-dependent diabetes mellitus in women.<br />
The Nurses‘ Health Study. AM J Epidemiol; 145(7):614-619.<br />
Boot FW, Gordon SE, Carlson CJ,, Hamilton MT (2000): Waging war on modern chronic<br />
diseases: pr<strong>im</strong>ary prevention through exercise biology. J Appl Physiol; 88:774-787.<br />
20 Knowler WC, Barrettt-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA, et al.,<br />
(2002): Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or<br />
metformin. N Engl J Med; 346(6):393-403.<br />
Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson J, Valle T, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, et al.,<br />
(2001): Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects<br />
with <strong>im</strong>paired glucose tolerance. N Engl J Med; 344(18):1343-1350.
14<br />
Karl W. Lauterbach/Stephanie Stock<br />
wichtigen Frauen mit ausreichend körperlicher Bewegung. 21 Lebensstilverändernde<br />
Maßnahmen wie körperliche Bewegung sind jedoch nicht nur in der<br />
Pr<strong>im</strong>är-, sondern auch in der Sekundärprävention von Bedeutung. Beispielsweise<br />
ist bei Bewegungsmangel in normotensiven Patienten der Blutdruck um ca.<br />
2/3 mmHg (systolisch/diastolisch) erhöht, während er bei hypertensiven Patienten<br />
um 7/6 (systolisch/diastolisch) mm Hg bei Bewegungsmangel <strong>im</strong> Vergleich<br />
zur körperlich aktiven Vergleichsgruppe erhöht ist. Andererseits sinkt bei einer<br />
Senkung des Blutdrucks bei Diabetikern systolisch um 10 mm Hg die Rate diabetesassoziierter<br />
Komplikationen um 12%, die diabetesbedingte Mortalität um<br />
15%, die Herzinfarktrate um 11% und die mikrovaskulären Komplikationen um<br />
13%. 22<br />
Die Nurses Health Study hat gezeigt, dass 82% aller Herzinfarkte durch eine opt<strong>im</strong>ale<br />
individuelle Vermeidung der wichtigsten Risikofaktoren verhindert werden<br />
könnten. Die überragende Bedeutung von Risikofaktoren wie z.B. Rauchen,<br />
Bluthochdruck oder Diabetes kann daher gar nicht überschätzt werden. 23<br />
Zusammenfassend bedeuten diese Ergebnisse, dass der multifaktoriellen Genese<br />
auch eine multifaktorielle Beeinflussbarkeit chronischer Erkrankungen gegenübersteht.<br />
Insbesondere die Risikofaktoren Ernährungsverhalten, Adipositas und<br />
Raucherentwöhnung sind hier zu nennen.<br />
Bei der Interpretation solcher Zahlen sollte allerdings beachtet werden, dass i.d.R.<br />
keine Monokausalität zwischen Risikofaktor und Krankheit gegeben ist und auch<br />
einzelne Risikofaktoren sich gegenseitig beeinflussen. Daher können die durch<br />
eine Modifikation der Risikofaktoren verhinderbaren Anteile weder aufaddiert<br />
werden noch ergeben sie in der Summe 100%.<br />
3. Die Bedeutung risikoadaptierter Prävention für die<br />
Verbesserung des durchschnittlichen <strong>Gesundheit</strong>szustands der<br />
Bevölkerung: Multifaktorieller Präventionsansatz<br />
In der Sekundärprävention chronischer Erkrankungen steht i.d.R. die Therapie<br />
medikamentös modifizierbarer Risikofaktoren bzw. die interventionelle Therapie<br />
<strong>im</strong> Vordergrund, da die Effekte von Maßnahmen zur Lebensstiländerung in<br />
21 Kushi LH, Fee RM, Folsom AR, Mink PJ, Anderson KE, Sellers TA (1997) Physical activity<br />
and mortality in postmenopausal women. JAMA; 277(16):1287-1292.<br />
22 Adler AI, Stratton IM, Neil HA, Yudkin JS, Matthews DR, Cull CA, et al., (2000):<br />
Association of systolic blood pressure with macrovascular and microvascular<br />
complications of type 2 diabetes (UKPDS): prospective observational study. BMJ;<br />
321(7258):412-9.<br />
23 Collins R (1994): Blood pressure, antihypertensive drug treatment and the risks of stroke<br />
and of coronary heart disease. British Medical Bulletin; 50(2):272-298.<br />
Aronne LJ (2001): Treating Obesity: A new target for prevention of coronary heart disease.<br />
Progress in Cardiovascular Nursing, Summer 2001:98-115.
Kosten sparen durch Prävention – was ist realistisch? 15<br />
vielen Studien zwar nachgewiesen, aber nicht lange genug aufrecht erhalten werden<br />
können. Dadurch gelingt es die Sterblichkeit potenziell tödlicher chronischer<br />
Erkrankungen zu senken. Gleichzeitig besteht jedoch die Wahrscheinlichkeit,<br />
in den gewonnenen Lebensjahren eine andere chronische Erkrankung zu<br />
entwickeln (Abbildung 5). Insbesondere <strong>im</strong> höheren Lebensalter steigt der Prozentsatz<br />
der chronisch Kranken, die gleichzeitig an mehreren Erkrankungen leiden<br />
(Mult<strong>im</strong>orbidität).<br />
Abbildung 5: Patienten mit zwölf ausgewählten chronischen<br />
Krankheiten* absolut<br />
Patienten Unter Ab<br />
gesamt 60 Jahre 60 Jahre<br />
Gesamt 221 027 166 535 54 325<br />
Keine der 12 Krankheiten 142 065 127 606 14 296<br />
1 Krankheit von 12 42 734 29 063 13 669<br />
2 Krankheiten von 12 17 641 6 976 10 664<br />
3 Krankheiten von 12 9 805 2 061 7 744<br />
4 Krankheiten von 12 5 192 618 4 574<br />
5 Krankheiten von 12 2 409 157 2 251<br />
6 Krankheiten von 12 854 48 806<br />
7 Krankheiten von 12 253 4 249<br />
8 Krankheiten von 12 66 2 64<br />
9 Krankheiten von 12 7 – 7<br />
10 Krankheiten von 12 1 – 1<br />
11 Krankheiten von 12 – – –<br />
12 Krankheiten von 12 – – –<br />
Quelle: In Anlehnung an Güther, 1998. 24<br />
* Hypertonie, Herzinfarkt und KHK, Angina Pectoris, Herzinsuffizienz, Hirngefäßkrankheiten, Diabetes<br />
Mellitus, Chronische Bronchitis, Magen-Darm-Erkrankungen, Osteoarthrose, Osteoporose, Demenz,<br />
Bösartige Neubildungen<br />
Ein multifaktorieller Präventionsansatz muss daher zum Ziel haben, den Prozentsatz<br />
derjenigen, die eine oder mehrere chronische Erkrankungen entwickeln,<br />
zu senken bzw. das Eintreten der chronischen Erkrankung hinauszuzögern.<br />
Eine Senkung der Inzidenz chronischer Erkrankungen und eine effektive Sekundärprävention<br />
ist i.d.R. nur in nationalen Programmen erreichbar, die sich auf<br />
eine Subpopulation mit einem definierten Erkrankungsrisiko oder auf die ge-<br />
24 Güther B (1998): Morbidität und Krankheitskosten von Alten. <strong>Gesundheit</strong>swesen;<br />
60(1):39-46.
16<br />
Karl W. Lauterbach/Stephanie Stock<br />
samte Bevölkerung beziehen. Nur so können ausreichend große Bevölkerungszahlen<br />
erreicht werden. Beispielsweise konnte in Finnland die Anzahl der neu<br />
eingetretenen Herzinfarkte (Inzidenz) um ca. die Hälfte reduziert werden. Dazu<br />
wurde ein nationales Programm zur Senkung kardiovaskulärer Risikofaktoren <strong>im</strong>plementiert,<br />
auf Grund dessen der durchschnittliche Cholesterinspiegel, die Raucherprävalenz<br />
und der systolische Blutdruck in der Bevölkerung seit 1972 kontinuierlich<br />
gesunken sind. Dadurch konnte das durchschnittliche Risikoprofil<br />
der Bevölkerung verbessert werden. 25<br />
In Deutschland sind bisher keine nationalen Programme zur Pr<strong>im</strong>är- und Sekundärprävention<br />
flächendeckend <strong>im</strong>plementiert. Vielmehr werden <strong>im</strong> Rahmen<br />
von Rehabilitationsmaßnahmen medikamentöse und lebensstilverändernde Maßnahmen<br />
in der Sekundärprävention integriert. Allerdings können auch nach<br />
stationärer Rehabilitation die erreichten positiven Ergebnisse häufig nicht langfristig<br />
stabilisiert werden.<br />
Dies ist nur durch populationsbezogene, sektorenübergreifende nationale Programme<br />
zu erwarten, die gezielt die wichtigsten Risikofaktoren wie z.B. Fehlernährung,<br />
Bewegungsmangel und Raucherentwöhnung modifizieren. Durch die<br />
Modifikation dieser ausgewählten Risikofaktoren ist zu erwarten, dass alle wichtigen<br />
„Volkskrankheiten“ in ihrer Inzidenz und in ihrem weiteren Verlauf beeinflusst<br />
werden können. Einfache und kosteneffektive Maßnahmen wie z.B. Beratungen<br />
zur Raucherentwöhnung bei jedem Arztbesuch können in solchen<br />
Programmen eine wichtige Rolle spielen (Abbildung 6).<br />
Abbildung 6: Ausgewählte, altersspezifische präventive Interventionen<br />
gewichtet nach Evidenzlage<br />
Alter 20 30 40 50 60 70<br />
Beratung (1) • • • • • •<br />
BMI • • • • • •<br />
Blutdruck • • • • • •<br />
Cholesterin • • • •<br />
Okkultes Blut <strong>im</strong> Stuhl • • •<br />
Mammographie • • •<br />
PSA � � �<br />
(1) Beratung aller Altersgruppen (z.B. Raucherprävention, Alkoholsucht)<br />
• Evidenz gesichert � = Evidenz nicht gesichert<br />
Quelle: Hengstler, 2002. 26<br />
25 Vartiainen E (2000): Pr<strong>im</strong>ary Prevention Programme for Coronary Heart Disease. Stroke<br />
and Cancer.<br />
Vartiainen E, Jousilahti P, Alfthan G, Sundvall J, Pietinen P, Puska P (2000): Cardiovascular<br />
risk factor changes in Finland, 1972-1997. Int J Epidemiol; 29(1):49-56.<br />
26 Hengstler P, Battegay E, Cornuz J, Bucher H, Battegay M (2002): Evidence for prevention<br />
and screening: recommendations in adults. Swiss Med Wkly; 132:363-373.
Kosten sparen durch Prävention – was ist realistisch? 17<br />
4. Ausblick: Die Bedeutung multifaktorieller Prävention für die<br />
Kosten der <strong>Gesundheit</strong>sversorgung<br />
Die isolierte Therapie von Symptomen und Folgen chronischer Erkrankungen<br />
kann zwar die Sterblichkeit beeinflussen, nicht aber das Auftreten neuer Erkrankungsfälle<br />
in der Bevölkerung. Eine Opt<strong>im</strong>ierung der Therapie chronischer Krankheiten<br />
ohne gezielte Prävention führt daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem<br />
Ansteigen der Kosten <strong>im</strong> Gesamtsystem, da die Wahrscheinlichkeit für das<br />
Auftreten zusätzlicher chronischer Erkrankungen in den gewonnenen Lebensjahren<br />
nicht verändert wird. Ziel muss es daher sein, in erster Linie das Eintreten<br />
chronischer Erkrankungsfälle (Inzidenz) in der Bevölkerung zu senken. Eine<br />
solche Senkung der Inzidenz gelingt nur über eine effektive und risikoadaptierte<br />
Pr<strong>im</strong>är- und Sekundärprävention. Von lebensstilverändernden Maßnahmen<br />
der Pr<strong>im</strong>är- und Sekundärprävention ist zu erwarten, dass sie gleichzeitig die<br />
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten mehrerer chronischer Erkrankungen senken<br />
bzw. hinauszögern, da sich die Risikofaktoren für die Entwicklung der Erkrankungen<br />
überschneiden (Abbildung 7).<br />
Abbildung 7: Relatives Risiko und bevölkerungsbezogener Anteil der durch<br />
körperliche Inaktivität verursachten chronischen Erkrankungen (USA)<br />
Krankheit Relatives Risiko (und 95% CI)<br />
Bevölkerungsbezogener<br />
Anteil<br />
(%*)<br />
KHK 1,9 (1,6-2,2) 35,8<br />
Schlaganfall 1,4 (1,2-1,5) 19,9<br />
Hypertonie 1,4 (1,2-1,6) 19,9<br />
Kolon/Rectum Ca 1,4 (1,3-1,5) 19,9<br />
Mammakarzinom 1,2 (1,0-1,5) 11,0<br />
Typ-2 Diabetes 1,4 (1,2-1,6) 19,9<br />
Osteoporose 1,6 (1,2-2,2) 27,1<br />
Quelle: Katzmarzyk, 2000. 27<br />
Gelingt es die Pr<strong>im</strong>är- und Sekundärprävention durch lebensstilverändernde Maßnahmen<br />
auf eine breite Basis zu stellen, so können gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit<br />
für das Auftreten mehrerer chronischer Erkrankungen gesenkt und die<br />
Lebensphasen ohne chronische Erkrankungen verlängert werden (Abbildung 8) 28 .<br />
27 Katzmarzyk PT, Gledhill N, Shephard RJ (2000): The economic burden of physical<br />
inactivity in Canada. CMAJ; 163(11):1435-1440.<br />
28 Doblhammer G; Kytir J (2001): Compression or expansion of morbidity? Trends in<br />
healthy-life expectancy in the elderly Austrian population between 1978 and 1998. Social<br />
Science and Medicine 52:385-391.<br />
Fries JF (1990): The Compression of morbidity: near or far? Milbank Q; 67(2):208-232.
18<br />
Karl W. Lauterbach/Stephanie Stock<br />
Die wichtigste konzertierte Maßnahme in Deutschland ist diesbezüglich die Einführung<br />
des mit dem Risikostrukturausgleich gekoppelten ‚Disease Management<br />
Programme‘. Sie sind darauf ausgerichtet, in der Sekundärprävention wichtiger<br />
chronischer Erkrankungen sowie in der Pr<strong>im</strong>ärprävention von Komorbiditäten<br />
Einfluss auf die Versorgung zu nehmen. Ihr Erfolg wird in regelmäßigen Evaluationen<br />
gemessen werden, zuerst anhand sog. Surrogat-Parameter, später anhand<br />
von klinischen Endpunkten. Dieser populations- und krankheitsbezogene Ansatz<br />
sollte <strong>im</strong> Rahmen des avisierten Präventionsgesetzes um Setting-Ansätze bei<br />
der Vermeidung wichtiger Risikofaktoren ergänzt werden. Wichtigste Aufgabe<br />
eines Präventionsgesetzes muss es sein, übergreifende, nationale Programme zur<br />
Pr<strong>im</strong>ärprävention zu fördern, zu koordinieren und deren Evaluation festzulegen.<br />
Beide Ansätze, die Sekundärprävention <strong>im</strong> Rahmen von Disease Management<br />
Programmen sowie die Pr<strong>im</strong>ärprävention <strong>im</strong> Rahmen von Setting-Ansätzen,<br />
können zu einer Verbesserung des durchschnittlichen <strong>Gesundheit</strong>szustands der<br />
Bevölkerung entscheidend beitragen.<br />
Abbildung 8: Verbesserung des durchschnittlichen <strong>Gesundheit</strong>szustands der<br />
Bevölkerung<br />
Quelle: Eigene Darstellung<br />
Folgeerkrankungen, Zusatzeffekte und <strong>Gesundheit</strong>skosten in den so gewonnenen<br />
Lebensjahren sind nur schwer einschätzbar. Den Autoren sind keine Daten<br />
bekannt, die für Kosteneffektivitätsanalysen zur Abschätzung der Gesamtrisikoreduktion<br />
durch z.B. lebensstilverändernde Maßnahmen herangezogen werden<br />
könnten. Auch ist zu erwarten, dass die realistisch erreichbare Reduktion der<br />
Mortaliät nicht der opt<strong>im</strong>al erreichbaren Mortaliätsreduktion entsprechen wird<br />
(Abbildung 9).
Kosten sparen durch Prävention – was ist realistisch? 19<br />
Abbildung 9: Tatsächliche und zu erwartende Reduktion der<br />
Krebsmortalität (USA)<br />
Faktor bzw.<br />
Kombination von<br />
Faktoren<br />
Quelle: Adami, 2001. 29<br />
Erreichte<br />
Reduktion der<br />
Mortalität 1990<br />
Opt<strong>im</strong>ale<br />
Ergebnisse<br />
(Theorie)<br />
Realistische Ziele<br />
für 2020<br />
(%) (%) (%)<br />
Tabak 25 100 60<br />
Alkohol<br />
Fehlernährung<br />
15 100 30<br />
<strong>im</strong> Erwachsenenalter,<br />
inkl. Adipositas<br />
10 30 10-20<br />
Bewegungsarmut<br />
Medizinische<br />
0 15 5<br />
Prozeduren und<br />
Produkte<br />
5 15 10<br />
Dennoch ist davon auszugehen, dass durch eine effektive Pr<strong>im</strong>är- und Sekundärprävention<br />
das Eintreten chronischer Erkrankungen in spätere Lebensabschnitte<br />
verschoben werden und sogar relativ, wenn nicht absolut, kompr<strong>im</strong>iert<br />
werden kann. Dadurch ist zu erwarten, dass zumindest der sonst auf Grund der<br />
höheren Lebenserwartung eintretende Kumulationseffekt der Kosten abgeflacht<br />
werden kann.<br />
29 Adami HO, Day NE, Trichopoulos D, Willett WC (2001): Pr<strong>im</strong>ary and secondary<br />
prevention in the reduction of cancer morbidity and mortaity. Eur J Cancer; 37 Suppl<br />
8:118-27.
Prävention als gesellschaftliche<br />
Aufgabe – die Rolle der<br />
Krankenkassen<br />
1. Einführung<br />
Walter Schwarz<br />
Präventive Leistungen gehören seit dem <strong>Gesundheit</strong>sreformgesetz 1989 zu den<br />
traditionellen Aufgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Die AOK hat sich<br />
damals mit dem Markennamen „AOK – Die <strong>Gesundheit</strong>skasse“ etabliert und ist<br />
diesem Anspruch bis zum heutigen Tag treu geblieben.<br />
Mit Streichung der Pr<strong>im</strong>ärprävention durch die „Dritte Stufe“ der <strong>Gesundheit</strong>sreform<br />
durften die Krankenkassen ab 1.1.1997 keine Maßnahmen der <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
mehr durchführen und finanzieren. Das bedeutete jedoch für die<br />
AOK Bayern keinen Stillstand der Prävention zwischen 1997 und 2000. Durch<br />
die Verlagerung des Schwerpunkts von Präventionsaktivitäten auf den Bereich<br />
der Sekundär-/Tertiärprävention, den Ausbau von betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sanalysen<br />
und die Weiterentwicklung in Modellprojekten ist es der AOK Bayern<br />
auch nach diesem Einbruch gelungen, ihre Präventionsaktivitäten und Fachkompetenz<br />
weiter zu entwickeln.<br />
Mit Veränderung des §20 SGB V zum 1.1.2000 können die Krankenkassen wieder<br />
Leistungen zur pr<strong>im</strong>ären Prävention und <strong>Gesundheit</strong>sförderung zur Verbesserung<br />
des allgemeinen <strong>Gesundheit</strong>szustandes anbieten, insbesondere zur Verminderung<br />
sozial bedingter Ungleichheit. Ebenso sind sie zu Angeboten in der<br />
Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung als ergänzende Maßnahmen zum Arbeitsschutz<br />
verpflichtet.
Prävention als gesellschaftliche Aufgabe – die Rolle der Krankenkassen 21<br />
Abbildung 1: § 20 SGB V – Prävention und Selbsthilfe<br />
Neu ist dabei die Vorgabe des Gesetzgebers für die Krankenkassen, prioritäre<br />
Handlungsfelder und Kriterien festzulegen, insbesondere hinsichtlich Bedarf,<br />
Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalten und Methodik. Als Richtwert ist für Prävention<br />
zurzeit ein Betrag von 2,56 € pro Versicherten vorgesehen, der jährlich<br />
dynamisiert wird.<br />
2. Handlungsfelder der Pr<strong>im</strong>ärprävention und der Betrieblichen<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
Die einheitlichen und gemeinsamen Vorgaben sind von den Spitzenverbänden<br />
der Krankenkassen in einem so genannten „GKV-Leitfaden“ geregelt (http://<br />
www.g-k-v.de). Hier werden konkrete Handlungsfelder benannt, an denen sich<br />
die Präventionsmaßnahmen der Krankenkassen auszurichten haben (vgl. Abb.2).<br />
Abbildung 2: Handlungsfelder der Pr<strong>im</strong>ärprävention und der Betrieblichen<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung
22<br />
Walter Schwarz<br />
Mit Angeboten in den entsprechendenden Handlungsfeldern sollen insbesondere<br />
folgende Krankheitsbilder positiv beeinflusst oder verhindert werden: Herz-<br />
Kreislauferkrankungen, Diabetes mellitus Typ II, Krankheiten des Skeletts, der<br />
Muskeln und des Bindegewebes, Krankheiten des Nervensystems sowie psychische/psychosomatische<br />
Krankheiten.<br />
3. Prävention als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe<br />
Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die <strong>Gesundheit</strong> von Menschen in unserer<br />
Gesellschaft. Neben Erbfaktoren und Geschlecht sind die Chancen für ein<br />
längeres Leben mit weniger gesundheitlichen Einschränkungen auch von der<br />
sozialen Schichtzugehörigkeit abhängig.<br />
So trägt etwa in Deutschland das unterste Fünftel der Bevölkerung – an den<br />
Indikatoren Bildung, Einkommen und Beruf gemessen – in jedem Lebensalter<br />
<strong>im</strong> Durchschnitt ein doppelt so hohes Erkrankungs- und Sterberisiko wie das<br />
oberste Fünftel. 1 Zum Teil in Zusammenhang mit dem sozialen Status stehend,<br />
beeinflussen die gesellschaftlichen Arbeits- und Lebensverhältnisse, in die der<br />
Einzelne eingebunden ist, die <strong>Gesundheit</strong>. Umweltqualität, Arbeitsplatzsituation,<br />
Verkehrsverhältnisse und der Zugang zu Erholungsräumen (vgl. Abb.3)<br />
schaffen Rahmenbedingungen für <strong>Gesundheit</strong>, die in der Gesellschaft unterschiedlich<br />
verteilt sind. Aus diesen Gegebenheiten ist daher eine gesamtgesellschaftliche<br />
Ausrichtung des Präventionshandelns abzuleiten. Alle relevanten<br />
gesellschaftlichen Handlungsbereiche sind einzubeziehen. Prävention hat da<br />
stattzufinden, wo es um die Gestaltung von Lebens-, Arbeits-, Lernbedingungen<br />
sowie von Lebensräumen geht.<br />
Abbildung 3: Prävention als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe<br />
1 Mielck, Andreas: Soziale Ungleichheit und <strong>Gesundheit</strong>, Bern 2000.
Prävention als gesellschaftliche Aufgabe – die Rolle der Krankenkassen 23<br />
Als Beispiele für den Zusammenhang von Lebensverhältnissen und <strong>Gesundheit</strong><br />
seien insbesondere belastende Arbeitsbedingungen mit häufiger Frühverrentung<br />
genannt, aber auch hohe Luftverschmutzung mit der Folge gehäufter Herzinfarkte<br />
und Asthma oder Bluthochdruck infolge erhöhter Lärmbelästigung<br />
(Abb.4).<br />
Abbildung 4: Beispiele für den Zusammenhang von Lebensverhältnissen und<br />
<strong>Gesundheit</strong><br />
Ungünstige Einkommensverhältnisse, Arbeitslosigkeit und niedriger Bildungsstand<br />
wirken sich offensichtlich negativ auf die <strong>Gesundheit</strong>schancen der Bevölkerung<br />
aus. Das macht deutlich, dass den gesetzlichen Krankenkassen nicht die<br />
Alleinverantwortung für die Prävention aufgebürdet werden kann. Eine Kompensation<br />
ungleicher gesellschaftlicher Verhältnisse ist durch die <strong>Gesundheit</strong>spolitik<br />
allein nur sehr begrenzt möglich. Darauf hat auch der Sachverständigenrat<br />
in seinen Gutachten mehrmals hingewiesen. Die Krankenkassen wären – allein<br />
gelassen mit dem Präventionsauftrag – als Feuerwehr gesellschaftlicher Fehlentwicklungen<br />
völlig überfordert.<br />
4. Präventives Handlungsgeflecht der Krankenkassen<br />
Die Präventionsaufgaben der Krankenkassen sind durch das Sozialgesetzbuch<br />
eindeutig festgelegt. Die AOK konzentriert sich daher bei ihren Präventionsaktivitäten<br />
auf die Zielbereiche Versicherte und ihre Familien, Betriebe und Schulen.<br />
Der Bezug auf Versicherte und Betriebe ist <strong>im</strong> §20 SGB V gefordert. Für die schulische<br />
Prävention hat die GKV <strong>im</strong> Präventions-Leitfaden eine Selbstverpflichtung<br />
ausgesprochen, durch Modellprojekte die Möglichkeiten fundierter Präventionsansätze<br />
herauszuarbeiten.
24<br />
Abbildung 5: Präventives Handlungsgeflecht der Krankenkassen<br />
Walter Schwarz<br />
Bei der Konzipierung von Präventionsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass<br />
gesundheitsrelevantes Verhalten nicht isoliert, sondern ganzheitlich <strong>im</strong> Zusammenwirken<br />
mit sozialen Beanspruchungen zu sehen ist. Änderung persönlichen<br />
Verhaltens kann letztlich nur greifen, wenn es in die vielfältigen Person-Umwelt-<br />
Arrangements (Verhältnisse) eingebettet ist. Dieser Erkenntnis wird durch die<br />
Aufforderung (Leitfaden) von Präventionsansätzen <strong>im</strong> „Setting“ Rechnung<br />
getragen.<br />
Künftige Präventionskonzepte gehen daher von den lebensweltlichen Besonderheiten<br />
der Adressatengruppe aus. Als Handlungsorte sind insbesondere Schule<br />
und Betrieb von Bedeutung. Präventionsansätze der AOK Bayern mit den<br />
unterschiedlichen Akteuren folgen <strong>im</strong> Einzelnen an konkreten Beispielen.<br />
5. Aktionsrichtungen der AOK-Prävention<br />
Eine wirksame Prävention muss auf verschiedene Zugangsweisen und Methoden<br />
zurückgreifen, die opt<strong>im</strong>al auf die Zielgruppe, die Lebensumstände und gesundheitlichen<br />
Anlässe best<strong>im</strong>mter Personengruppen zugeschnitten sind. Die Aktionsrichtungen<br />
verfolgen dabei neben individuellen Beratungen und Kursprogrammen<br />
– mit dem Ziel eines persönlichen Verhaltens- und Kompetenztrainings<br />
– auch interaktive Online-Programme, die vor allem eine Förderung der Selbststeuerung<br />
als Zielsetzung beinhalten.<br />
In dem bereits erwähnten Setting-Ansatz greift die AOK Bayern die Strategie auf,<br />
Menschen dort zu erreichen, wo sie einen Teil ihres Lebens verbringen: in der<br />
Familie, der Schule und <strong>im</strong> Betrieb. Hier geht es darum, verhaltens- und
Prävention als gesellschaftliche Aufgabe – die Rolle der Krankenkassen 25<br />
verhältnisbezogene Ansätze der Prävention zu integrieren. Innovative Ansätze<br />
gemeinsam mit Ärzten und anderen Akteuren der <strong>Gesundheit</strong>sförderung kann<br />
die AOK Bayern durch ihre Erfahrung mit evaluierten Modellprojekten nachweisen.<br />
Abbildung 6: Aktionsrichtungen der AOK-Prävention<br />
6. Verteilung der AOK-Präventionsangebote<br />
Die AOK Bayern führt pro Jahr ca. 50.000 <strong>Gesundheit</strong>sberatungen durch, davon<br />
20.000 Intensivberatungen. Im Vordergrund stehen die gesundheitlichen Probleme<br />
Übergewicht, Rückenerkrankungen, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen<br />
und Bluthochdruck, also die typischen chronischen Zivilisationskrankheiten.<br />
Abbildung 7: Verteilung der Präventionsangebote
26<br />
Walter Schwarz<br />
Bei der Verteilung der Kursangebote (=Trainingsangebote) liegt erwartungsgemäß<br />
der Bewegungsbereich ganz vorn mit 50% Anteil. Am stärksten <strong>im</strong> Wachsen begriffen<br />
ist der Stress-/Entspannungsbereich. Hier gilt es, aktiv Stressbewältigungstechniken<br />
und Entspannungsmethoden zu vermitteln, um vor allem die<br />
Zeitverdichtung in unserer Arbeitswelt, aber auch die Doppelbelastung, z.B. von<br />
Frauen mit Familie und Beruf, abzufedern.<br />
7. Interaktive Programme und Online-Beratung<br />
Schnelle Erreichbarkeit, flexible Handhabung, Informationszugang möglichst<br />
von zu Hause aus – diesen wachsenden Bedürfnissen trägt die AOK mit attraktiven<br />
Online-Angeboten Rechnung. Damit erreicht sie auch die Versicherten, die<br />
sich ungern <strong>im</strong> Rahmen von Kursen mit Themen der <strong>Gesundheit</strong>sförderung beschäftigen<br />
wollen. Eigens eingerichtete Foren bieten kompetente Beratung durch<br />
Fachexperten, z.B. zu den Themen Fitness, Ernährung und Fragen zur Kinderentwicklung/Kinderkrankheiten<br />
(vgl. Abb.8).<br />
Abbildung 8: Interaktive Programme und Online-Beratung<br />
Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch die freie Selbstbest<strong>im</strong>mung von Zeit und<br />
Ort wird eine niedrige Einstiegsschwelle geschaffen. Insbesondere jüngere Versicherte<br />
nutzen nachweislich dieses für sie attraktive Medium. Die Foren bieten<br />
darüber hinaus den Austausch der Versicherten untereinander und somit eine<br />
mögliche gegenseitige Unterstützung.
Prävention als gesellschaftliche Aufgabe – die Rolle der Krankenkassen 27<br />
8. PowerKids<br />
Für übergewichtige Kinder ab acht Jahren bietet die AOK in Zusammenarbeit mit<br />
der <strong>Stiftung</strong> Kindergesundheit das Programm „PowerKids“ an. Das Abnahmeprogramm<br />
„PowerKids“ für Kinder erfreut sich besonderer Nachfrage, nicht<br />
zuletzt durch die Mitwirkung von Kinderärzten. Übergewicht wurde zu einer Epidemie<br />
in den westlichen Industrienationen, so urteilt die Weltgesundheitsorganisation<br />
WHO. Wer Pfunde verlieren und sie nicht wieder zunehmen will, muss<br />
seine Ernährung langfristig umstellen. Das gilt bereits für Kinder.<br />
Spielerisch wird mit verschiedenen Medien die gezielte Auswahl von fettärmeren<br />
Lebensmitteln trainiert und der Spaß an Bewegung gefördert. Von inzwischen<br />
22.000 Kindern, die bundesweit an dem Programm teilgenommen haben –<br />
davon waren es allein in Bayern 12.000 – haben nach eigenen Angaben 92,4%<br />
ihr Essverhalten verändert. 69,6% der Kinder sind mit ihrem Gewicht zufrieden<br />
und 77,4% sind nach dem Programm körperlich aktiver als zuvor (Stichproben-<br />
Ergebnisse).<br />
Abbildung 9: PowerKids – ein Abnahmeprogramm für Kinder<br />
9. Arbeiten <strong>im</strong> Setting als erfolgreiche Präventionsstrategie<br />
Besonderes Augenmerk richtet die AOK auf das Vorgehen <strong>im</strong> Setting. Settings<br />
sind z.B. Kindergärten, Schulen oder der Arbeitsplatz. Hier setzen AOK-Konzepte<br />
an, etwa zur Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung oder zur Förderung von mehr<br />
<strong>Gesundheit</strong> in Schulen. Der Vorteil ist offensichtlich: Verhaltensweisen und<br />
Lebens-/Arbeitsbedingungen werden in ihrer Wechselwirkung aufeinander<br />
thematisiert. Dadurch werden auch Menschen erreicht, die durch Ansätze der<br />
individuellen <strong>Gesundheit</strong>sbildung schlecht erreichbar sind.
28<br />
Abbildung 10: Settingansätze als erfolgreiche Präventionsstrategie<br />
Walter Schwarz<br />
Die AOK Bayern verfolgt insbesondere drei Aktionsrichtungen: Projekte in der<br />
betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung, <strong>Gesundheit</strong>sprojekte in der Schule, (siehe<br />
Beispiel „Fit sein macht Schule“) und das Modellprojekt „Präventions-Erziehungs-<br />
Programm“ (PEP).<br />
10. Präventions-Erziehungs-Programm (PEP)<br />
Das Besondere an PEP ist der Interventionsansatz in der Familie: Über mehrere<br />
Jahre hinweg werden Schüler an Nürnberger Grundschulen zusammen mit ihren<br />
Familienangehörigen auf ihre Risikofaktoren für Herzinfarkt untersucht. Die jährliche<br />
Untersuchung beinhaltet die Blutfette (Cholesterin), Blutzucker, Blutdruck,<br />
Gewicht, Körperfett und Rauchverhalten. Außerdem werden die Angehörigen<br />
<strong>im</strong> Familienhaushalt einbezogen, z.B. bei der Erhebung von siebentägigen<br />
Ernährungsprotokollen möglichst aller Familienmitglieder. Darauf abgest<strong>im</strong>mt<br />
werden den Familien Informations- und Beratungsangebote unterbreitet. Eine<br />
Auswertung des Projekts liegt 2004 vor.<br />
Abbildung 11: Modellvorhaben PEP
Prävention als gesellschaftliche Aufgabe – die Rolle der Krankenkassen 29<br />
11. „Fit sein macht Schule“ – ein Projekt zur Bewegungsförderung<br />
in Schulen<br />
Ein Beispiel für eine Kooperation zwischen Krankenkasse und Schulen ist das<br />
Projekt „Fit sein macht Schule“. Wie in der WIAD-Studie 2 belegt, sinkt die<br />
motorische Leistungsfähigkeit der deutschen Schüler <strong>im</strong>mer mehr. Mit „Fit sein<br />
macht Schule“ führt die AOK Bayern ein Projekt für motorisch schwache Schüler<br />
durch, in Abst<strong>im</strong>mung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht<br />
und Kultus.<br />
Abbildung 12: Fit sein macht Schule<br />
Dieses Angebot wendet sich an alle bayerischen Schultypen. Ziel des Projektes<br />
ist die Verbesserung motorischer Defizite und damit des Fitnesszustandes der<br />
Schüler und eine Etablierung von Präventionsansätzen <strong>im</strong> Setting Schule. Zielgruppe<br />
sind Schüler von 12–18 Jahren. Die AOK Bayern unterstützt das Projekt<br />
durch die Kostenübernahme für den Fitnesscheck, durch Hilfestellung der AOK-<br />
Sportfachkräfte be<strong>im</strong> Test sowie die Abgabe eines Materialpaketes und eines<br />
Ordners mit fertigen Stundenbildern.<br />
2 Klaes, Lothar u.a.: Bewegungsstatus von Kindern und Jugendlichen in Deutschland –<br />
Forschungsbericht <strong>im</strong> Auftrag von Deutscher Sportbund und AOK Bundesverband, Bonn<br />
2000.
30<br />
12. Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
Walter Schwarz<br />
Die neue rechtliche Ausgangslage durch die Neufassung des §20 SGB V erlaubt<br />
in der Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung neben <strong>Gesundheit</strong>sanalysen auch<br />
wieder problemzentrierte Angebote. Maßnahmen in den Betrieben setzen dabei<br />
<strong>im</strong>mer vorausgegangene Situationsanalysen voraus.<br />
Abbildung 13: Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung 2002<br />
Im Jahr 2002 hat die AOK Bayern 1.300 Betriebe zur Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
beraten (Abb.13). In 400 Betrieben führten unsere Experten <strong>Gesundheit</strong>sanalysen<br />
durch. 75% der Unternehmen veränderten die betrieblichen<br />
Arbeitsstrukturen. Fast die Hälfte aller Betriebe hat in ergonomische Opt<strong>im</strong>ierungen<br />
investiert. Ein Sechstel der Betriebe hat Angebote zur bedarfsgerechten<br />
Betriebsverpflegung angenommen.<br />
Vermehrt nachgefragt wurden die psychosozialen Angebote: gesundheitsgerechte<br />
Mitarbeiterführung, Stressmanagement (neue Handlungsfelder seit dem Jahr<br />
2000) und Suchtprävention. Die betrieblichen Maßnahmen der AOK Bayern<br />
finden häufig in Kooperationen mit Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden,<br />
Innungen und Berufsgenossenschaften statt. Insbesondere <strong>im</strong> Falle kleinerer<br />
Betriebe bieten sich betriebsübergreifende Ansätze an, z.B. mit Innungen und<br />
überbetrieblichen Ausbildungsstätten (vgl. auch den Beitrag von O. Gieseke in<br />
diesem Band).
Prävention als gesellschaftliche Aufgabe – die Rolle der Krankenkassen 31<br />
13. Bewertung der <strong>Gesundheit</strong>ssituation am Beispiel eines<br />
Produktionsbetriebes<br />
Präventionspolitisch betrachtet verspricht der Einsatz Betrieblicher <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
eine hohe gesundheitliche „Rendite“. Eine Möglichkeit, den<br />
Erfolg zu messen, besteht in der Messung des Krankenstandes.<br />
Abbildung 14: Bewertung der <strong>Gesundheit</strong>ssituation – Beispiel Produktionsbetrieb<br />
So konnte zum Beispiel <strong>im</strong> Rahmen eines Projektes in der Metall- und Elektroindustrie<br />
mit 1.000 Mitarbeitern eine Senkung des Krankenstandes um 2,7%<br />
Punkte erreicht werden. Im Rahmen von <strong>Gesundheit</strong>szirkeln wurden allein<br />
in diesem Produktionsbetrieb 656 – von den Mitarbeitern erarbeitete – Veränderungsvorschläge<br />
entwickelt. Betriebswirtschaftlich ergab sich eine Gesamtinvestition<br />
des Betriebs innerhalb von zwei Jahren in Höhe von 180.000,– €. Gleichzeitig<br />
konnte eine jährliche Einsparung des Betriebes in Höhe von 360.000,– €<br />
an Entgeltfortzahlungskosten (EFZ) erzielt werden.
32<br />
14. Prävention in Kooperation mit Ärzten<br />
Walter Schwarz<br />
Seit über 10 Jahren besteht eine Kooperation zwischen der AOK Bayern und der<br />
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Diese verweisen Patienten auf die AOK-<br />
Ernährungsberatung, wenn ernährungsbedingte Risiken vorliegen. Mit einem<br />
Modellprojekt zur Risikoprävention wurde 1998 eine weitere Vereinbarung zur<br />
Zusammenarbeit in der Prävention geschlossen.<br />
Abbildung 15: Kooperation mit Ärzten in der Prävention<br />
Ziele des Modellprojektes sind, eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen<br />
Ärzten, AOK-Versicherten und der AOK-<strong>Gesundheit</strong>sberatung auszuloten und<br />
präventive Beratungsformen weiter zu entwickeln. Die ärztliche Therapie wird<br />
durch gezieltes Verhaltenstraining und/oder Einzelberatungen unterstützt.<br />
Abbildung 16: Modellprojekt zur Prävention von Risikofaktoren (1)
Prävention als gesellschaftliche Aufgabe – die Rolle der Krankenkassen 33<br />
Die Teilnehmer des Modellprojektes zeigten sich mit der AOK-Beratung sehr<br />
zufrieden (vgl. Abb.16). Der Großteil konnte seine <strong>Gesundheit</strong>sziele erreichen<br />
und veränderte sein Verhalten positiv. Rund drei Viertel der Modellprojekt-Teilnehmer<br />
haben ihr <strong>Gesundheit</strong>sverhalten deutlich verändert. Über die Hälfte der<br />
Versicherten bewegt sich mehr/treibt mehr Sport, zwei Drittel der Versicherten<br />
ernähren sich gesünder und bei fast der Hälfte hat die Fähigkeit, sich zu entspannen,<br />
zugenommen. Auch die Auswirkung auf die allgemeine Lebensqualität<br />
ist gestiegen. Noch sechs Monate nach Abschluss der AOK-Beratung sind die<br />
erzielten Verhaltensänderungen wirksam, sodass von einem zumindest mittelfristigen<br />
Erfolg ausgegangen werden kann.<br />
Die Zusammensetzung der am Projekt beteiligten Versicherten zeigt, dass Prävention<br />
keineswegs auf die jüngeren Mittelschichten fokussiert ist, wie manchmal<br />
behauptet wird. Hausfrauen, Rentner, Arbeitslose und Arbeiter haben einen<br />
großen Anteil in der <strong>Gesundheit</strong>sberatung der AOK.<br />
Abbildung 17: Modellprojekt zur Prävention von Risikofaktoren (2)<br />
15. Kariesprävalenz/Zahngesundheit (LAGZ)<br />
„Vorbeugen ist besser als Bohren“. Die bayerischen Kinder haben nach einer<br />
Studie von 1996 <strong>im</strong> Europavergleich die gesündesten Zähne, vermeldet die Bayerische<br />
Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit (LAGZ).
34<br />
Abbildung 18: Kariesprävalenz bei 12-Jährigen (Caries Res 1996)<br />
Walter Schwarz<br />
Im Vergleich mit Deutschland gesamt ist die Kariesprävalenz in Bayern um ein<br />
Drittel besser. Als Grund für das gute Abschneiden ist die lange Prophylaxetradition<br />
in Bayern anzuführen. Grundlage einer späteren vernünftigen Zahn- und<br />
Mundhygiene sind neben Aufklärung vor allem das „spaßmachende Üben“ des<br />
richtigen Zähneputzens schon in den Kindergärten und in den Grundschulen.<br />
16. Möglichkeiten zum Ausbau der Prävention – politische<br />
Diskussion und AOK-Position<br />
Im Vordergrund steht bei Politik und Wissenschaft die Erkenntnis, dass durch<br />
Prävention der durchschnittliche <strong>Gesundheit</strong>szustand der Bevölkerung nachhaltig<br />
verbessert werden kann. Jedoch selbst bei deutlich mehr finanziellen<br />
Mitteln als dem hierfür gesetzlich zur Verfügung stehenden Betrag von 2,56 €<br />
pro Versicherten kann Prävention nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn<br />
eine breitenwirksame Prävention als gesellschaftliche Gesamtaufgabe verankert<br />
ist. Gerade jetzt, in der aktuellen Reformdiskussion des <strong>Gesundheit</strong>swesens gilt<br />
es, diesem gesamtgesellschaftlichen Ansatz gerecht zu werden. Mit der Gründung<br />
des Forums Prävention ist hierfür zumindest eine Grundlage gelegt. Ein weiterer<br />
Schritt in diese Richtung ist von einem Präventionsgesetz zu erwarten.<br />
Die AOK fordert schon seit längerem eine höhere Besteuerung von Tabak und<br />
Alkohol, um Mittel für die Prävention freizusetzen. Beschlossen ist die höhere<br />
Besteuerung von Tabak. Aktuell wird darüber verhandelt, <strong>im</strong> Rahmen der<br />
<strong>Gesundheit</strong>sreform eine dreistufige Erhöhung der Tabaksteuer einzuführen.<br />
Zigarettenschachteln sollen nach dem Stufenplan 2004 um 40 Cent teuerer<br />
werden, in den beiden Folgejahren jeweils um weitere 30 Cent. Die Erhöhung<br />
der Tabaksteuer soll die Einnahmesituation für den <strong>Gesundheit</strong>sbereich entschärfen.
Prävention als gesellschaftliche Aufgabe – die Rolle der Krankenkassen 35<br />
Nach dem Gesetzentwurf der Regierungskoalition sind auch Bonusregelungen<br />
für die Teilnahme an Präventionsmaßnahmen möglich. Die AOK ist zurzeit<br />
dabei auszuloten, welche Maßnahmen sinnvoll in eine Bonusregelung einzubeziehen<br />
sind. Dabei beschränken sich die Überlegungen nicht nur auf die<br />
Prävention, sondern auch auf neue Versorgungsmodelle wie z.B. Arztnetze oder<br />
Disease-Management-Programme. Bei der Konzipierung von Bonus-Regelungen<br />
ist darauf zu achten, dass dadurch nicht zusätzliche Ausgaben ausgelöst werden.<br />
Auch ist <strong>im</strong> Koalitionsentwurf angedacht, einen GKV-finanzierten Präventions-<br />
Fonds zu schaffen, mit dem gesamtgesellschaftlichen Präventionsaufgaben eine<br />
neue Finanzierungsbasis zukommen soll. Dagegen haben sich alle Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen ausgesprochen, denn eine solche Überlegung steht <strong>im</strong><br />
Widerspruch zum politischen Willen, die Krankenkassen von versicherungsfremden<br />
Aufgaben zu entlasten, die die gesamte Gesellschaft zu übernehmen<br />
hätte. Außerdem würde eine solche Regelung die Krankenkassen in ihrem<br />
eigenen Präventionsengagement schwächen.<br />
Die AOK fordert auch eine nationale Präventionskampagne, weil dadurch ein gesellschaftliches<br />
Kl<strong>im</strong>a begünstigt wird, das den Nutzen präventiver Aktivitäten<br />
für <strong>Gesundheit</strong>, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit betont. Hier sehen wir<br />
ein vom Staat auszufüllendes Handlungsfeld.<br />
Abbildung 19: Ausbau der Prävention (Position AOK)<br />
Auf der Maßnahmenebene setzt die AOK auf den Ausbau von Settingansätzen.<br />
Die guten Erfahrungen in der Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung, die die AOK<br />
weiter intensivieren will, können auch eine Folie für die schulische Prävention<br />
abgeben. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Schule genauso wie die Betriebe<br />
eine Selbstverpflichtung für <strong>Gesundheit</strong>sförderung und Prävention entwickelt.<br />
Ohne klare Zielvorstellungen und Verantwortlichkeiten sowie das Bereitstellen<br />
von Ressourcen gibt es keinen Erfolg.
Sinn und Unsinn von<br />
Bonus-Malus-Regelungen<br />
in der Prävention<br />
1. Ein überaus aktuelles Thema<br />
Klaus Jacobs<br />
Prävention hat zurzeit wieder einmal Konjunktur in der gesundheitspolitischen<br />
Debatte: Politiker aller Parteien verweisen übereinst<strong>im</strong>mend auf die Bedeutung<br />
von Prävention und Früherkennung und befürworten eine Forcierung entsprechender<br />
Aktivitäten. Das war keineswegs <strong>im</strong>mer so. Erst Anfang 1997 war die<br />
Pr<strong>im</strong>ärprävention – mit Ausnahme der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung –<br />
unter dem damaligen <strong>Gesundheit</strong>sminister Horst Seehofer – <strong>im</strong> Rahmen des so<br />
genannten „Beitragsentlastungsgesetzes“ aus dem Pflichtleistungskatalog der<br />
GKV el<strong>im</strong>iniert worden. Dies wurde seinerzeit damit begründet, dass die Krankenkassen<br />
unter dem Deckmantel von <strong>Gesundheit</strong>sförderung eine Vielzahl von<br />
Marketingaktivitäten entwickelt hätten („Bauchtanzkurse“), die nicht mit solidarisch<br />
aufgebrachten Beitragsmitteln finanziert werden sollten. Die rot-grüne<br />
Bundesregierung führte die Pr<strong>im</strong>ärprävention ab 2000 wieder als verbindliche<br />
Kassenleistung ein – allerdings mit einer gesetzlich fixierten Obergrenze von 2,56<br />
Euro je Versichertem sowie einer Verpflichtung für die Kassen, gemeinsam und<br />
einheitlich prioritäre Handlungsfelder und Kriterien zur Umsetzung insbesondere<br />
hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalten und Methodik<br />
zu entwickeln. Aber damit nicht genug: Auch <strong>im</strong> so genannten Gesetz zur Modernisierung<br />
des <strong>Gesundheit</strong>swesens (GMG), das Anfang 2004 in Kraft treten<br />
soll, wird der Stellenwert der Prävention weiter erhöht, indem den Kassen in Zukunft<br />
die Gelegenheit eingeräumt wird, ihre Versicherten für die regelmäßige<br />
Teilnahme an Früherkennungsmaßnahmen sowie die Inanspruchnahme von<br />
qualitätsgesicherten Leistungen der Pr<strong>im</strong>ärprävention bzw. Arbeitgeber und<br />
Arbeitnehmer bei Maßnahmen der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung mit<br />
einem Bonus zu belohnen.<br />
Wie ist diese Reform zu beurteilen? Wenn <strong>im</strong> Folgenden versucht wird, eine<br />
erste Antwort auf diese Frage zu geben, geschieht dies in zwei Schritten: Zunächst<br />
erfolgen einige allgemeine Ausführungen zu Gegenstand und Stellenwert von<br />
Präventionsmaßnahmen in Gesellschaft und Krankenversicherung, ehe speziell<br />
auf die Rolle ökonomischer Anreize in diesem Kontext eingegangen wird.
Sinn und Unsinn von Bonus-Malus-Regelungen in der Prävention 37<br />
2. Prävention: Gegenstand und „eigentliche“ Zuständigkeit<br />
Zunächst erscheint es zweckmäßig, den Präventionsbegriff ein Stück zu präzisieren.<br />
Dabei soll auf den Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion <strong>im</strong><br />
<strong>Gesundheit</strong>swesen (SVRKAiG) zurückgegriffen werden, der sich in Band I seines<br />
Gutachtens 2000/2001 („Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“; BT-Drs.<br />
14/5660) ausführlich mit Prävention befasst hat. Laut Sachverständigenrat lassen<br />
sich drei Ebenen von Prävention folgendermaßen unterscheiden (Ziffer 110):<br />
• Pr<strong>im</strong>ärprävention bezeichnet die generelle Vermeidung auslösender oder<br />
vorhandener Teilursachen (darunter: Risikofaktoren) best<strong>im</strong>mter Erkrankungen<br />
oder ihre individuelle Erkennung und Beeinflussung. Sie setzt vor Eintritt<br />
einer fassbaren biologischen Schädigung ein. <strong>Gesundheit</strong>spolitisches Ziel der<br />
Pr<strong>im</strong>ärprävention ist die Senkung der Inzidenzrate oder der Eintrittswahrscheinlichkeit<br />
bei einem Individuum oder einer (Teil-) Population.<br />
• Sekundärprävention bezieht sich demgegenüber auf die Entdeckung eines<br />
eindeutigen (auch symptomlosen) Frühstadiums einer Krankheit und deren<br />
erfolgreiche Frühtherapie. <strong>Gesundheit</strong>spolitisches Ziel der Sekundärprävention<br />
ist die Inzidenzabsenkung manifester oder fortgeschrittener Erkrankungen.<br />
• Tertiärprävention kann <strong>im</strong> weiteren Sinne als die wirksame Behandlung einer<br />
symptomatisch gewordenen Erkrankung mit dem Ziel, ihre Verschl<strong>im</strong>merung<br />
zu verhüten oder zu verzögern, verstanden werden.<br />
Im hier behandelten Kontext geht es insbesondere um Maßnahmen der Pr<strong>im</strong>ärprävention.<br />
Neben den genannten Präventionsebenen gibt es weitere Ordnungsprinzipien<br />
zur Strukturierung von Präventionsmaßnahmen, u.a. die Unterscheidung<br />
nach Verhaltens- und Verhältnisprävention, nach der Ausrichtung<br />
der Maßnahmen auf best<strong>im</strong>mte Altersgruppen (Lebensphasen) oder nach individuums-<br />
oder kontextbezogener Prävention. Letztere verbindet sich vor allem<br />
auch mit Setting-Ansätzen – darunter werden Interventionen mit stärkerem<br />
Verhältnisbezug und Strukturbildung, insbesondere am Arbeitsplatz/Betrieb, in<br />
Familie/Gemeinde oder Kindergarten/Schule verstanden.<br />
Maßgebliche Grundlage für die (Pr<strong>im</strong>är-)Prävention der Krankenkassen ist § 20<br />
<strong>im</strong> Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V). Danach sollen – so der erste Absatz<br />
– die Kassen in der Satzung Leistungen zur Pr<strong>im</strong>ärprävention vorsehen, die „den<br />
allgemeinen <strong>Gesundheit</strong>szustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur<br />
Verminderung sozial bedingter Ungleichheit erbringen“. Im zweiten Absatz wird<br />
den Kassen die Möglichkeit eingeräumt, „den Arbeitsschutz ergänzende Maßnahmen<br />
der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung“ durchzuführen, und zwar in<br />
Kooperation mit der gesetzlichen Unfallversicherung. Im dritten Absatz ist als<br />
„Soll-Größe“ das hierfür vorgesehene Ausgabenvolumen von 2,56 Euro je Versichertem<br />
(<strong>im</strong> Jahr 2000) formuliert – ein Betrag, für den eine jährliche Anpassung<br />
vorgesehen ist.
38<br />
Klaus Jacobs<br />
Allerdings haben die Kassen dieses Ausgabenvolumen bis heute noch nicht realisiert.<br />
So blieb etwa die AOK <strong>im</strong> Jahr 2002 mit durchschnittlich 1,91 Euro rund<br />
ein Viertel unter dem (inzwischen auf 2,62 Euro je Versichertem) angepassten<br />
Betrag. Weil andere Kassen noch sehr viel weniger ausgaben, betrug der durchschnittliche<br />
Ausgabenbetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt<br />
2002 lediglich 1,24 Euro je Versichertem und damit weniger als die Hälfte des<br />
gesetzlichen Solls. Nicht zuletzt auch vor diesem Hintergrund war <strong>im</strong> ursprünglichen<br />
Entwurf der Bundesregierung für das GMG vorgesehen, § 20 zu ergänzen:<br />
Danach sollte den Kassen allerdings nicht nur die Möglichkeit der Finanzierung<br />
von Gemeinschaftsprojekten mehrerer Träger gegeben werden – sie sollten sogar<br />
verpflichtet werden, mindestens 25 Prozent des für Prävention festgelegten<br />
Betrags zur Finanzierung von Gemeinschaftsprojekten oder als Einlage in den<br />
Gemeinschaftsfonds „Prävention und <strong>Gesundheit</strong>sförderung“ be<strong>im</strong> Bundesversicherungsamt<br />
vorzusehen.<br />
Dass diese Vorschrift schließlich doch keinen Eingang in das GMG gefunden hat,<br />
hat allein rechtstechnische Gründe, denn die Bundesregierung beabsichtigt, demnächst<br />
ein eigenständiges Präventionsgesetz zu verabschieden. Darin sollen entsprechende<br />
Vorgaben gemacht werden, und zwar – den zwischenzeitlich bekannt<br />
gewordenen „Eckpunkten“ des <strong>Gesundheit</strong>sministeriums zufolge – nicht nur <strong>im</strong><br />
Hinblick auf die gesetzliche Krankenversicherung, sondern ebenfalls auf die<br />
Renten- und die Pflegeversicherung. Von den insgesamt dann vorgesehenen 3,00<br />
Euro je Versichertem sollen allerdings 20 Prozent in die Finanzierung bundesweiter<br />
Kampagnen fließen und jeweils 40 Prozent für individuelle Pr<strong>im</strong>ärprävention<br />
bzw. für lebensweltorientierte Leistungen (Setting-Ansätze) ausgegeben<br />
werden. Ob bzw. in welchem Umfang andere Finanzierungsträger – etwa<br />
Bund, Länder und Kommunen oder auch die privaten Krankenversicherungen<br />
– vergleichbar verbindlich beteiligt werden sollen, ist jedoch unklar.<br />
Damit wird in aller Deutlichkeit auf ein grundsätzliches Problem verwiesen, das<br />
mit dem eigentlichen Thema dieses Beitrags – Bonusregelungen in der Prävention<br />
– unmittelbar noch gar nichts zu tun hat: Prävention, insbesondere Pr<strong>im</strong>ärprävention<br />
ist vom Grundsatz her eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dies<br />
wird ganz offenkundig, wenn es etwa um das gesundheitsgerechte Verhalten von<br />
Kindern und Jugendlichen geht, für dessen Förderung es gezielte Maßnahmen<br />
<strong>im</strong> Setting Kindergarten und Schule zu entwickeln und umzusetzen gilt.<br />
Gesamtgesellschaftliche Aufgaben aber sind zuvörderst aus dem allgemeinen<br />
Steueraufkommen zu finanzieren. Die gesetzliche Verpflichtung der Krankenkassen<br />
zur Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben – etwa <strong>im</strong> Rahmen<br />
allgemeiner Präventionsfonds oder für <strong>Gesundheit</strong>skampagnen – bedeutet insoweit<br />
letztlich eine Ausweitung des Katalogs versicherungsfremder Leistungen zu<br />
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung.<br />
Dabei steht völlig außer Frage, dass die Krankenkassen und hier nicht zuletzt die<br />
AOK inzwischen <strong>im</strong> Bereich der Pr<strong>im</strong>ärprävention – etwa gerade auch <strong>im</strong> angesprochenen<br />
Setting Schule – beträchtliches Know how entwickelt haben. Schon
Sinn und Unsinn von Bonus-Malus-Regelungen in der Prävention 39<br />
deshalb wäre es unsinnig zu fordern, dass die Kassen auf diesem Feld nicht mehr<br />
aktiv sein sollten. Aber es wäre ebenso realitätsfern zu leugnen, dass vor allem<br />
der intensive Krankenkassenwettbewerb für zielgerichtete Präventionsaktivitäten<br />
keineswegs <strong>im</strong>mer besonders förderlich ist. Dies ist vielen Experten natürlich<br />
sehr wohl bekannt – gleichwohl akzeptieren sie mehr oder weniger stillschweigend<br />
die ordnungspolitisch fragwürdige „Generalverpflichtung“ der Kassen, weil<br />
sie dies einem sonst womöglich drohenden vollständigen Verantwortungsvakuum<br />
noch <strong>im</strong>mer vorziehen (wobei freilich Verantwortung auch in diesem Kontext<br />
zuallererst Finanzierungsverantwortung heißt). Aber dennoch erscheint es<br />
wichtig zu betonen – und zwar gerade <strong>im</strong> Vorfeld der Konzipierung eines grundlegenden<br />
Präventionsgesetzes –, dass „wirklich“ wichtige gesamtgesellschaftliche<br />
Aufgaben über allgemeine Steuermittel finanziert werden müssen, wie es schließlich<br />
bei anderen wichtigen Aufgaben auch der Fall ist – etwa bei Bildung, Wissenschaft<br />
und Kultur, bei Maßnahmen zur Verkehrsinfrastruktur oder bei der<br />
inneren und äußeren Sicherheit. Hier käme es vermutlich niemandem in den<br />
Sinn, die Einrichtung von Fonds oder nationalen <strong>Stiftung</strong>en zu fordern. Ob letztlich<br />
Prävention vielleicht doch nicht für so wichtig gehalten wird, wie uns<br />
viele Politiker neuerdings gern glauben machen wollen?<br />
Das wettbewerbliche Dilemma der Krankenkassen ist jedenfalls offensichtlich.<br />
Nach wie vor verfügen die Kassen über ausgesprochen wenige „echte“ Profilierungsfelder<br />
<strong>im</strong> Wettbewerb. Insbesondere <strong>im</strong> Vertragsbereich werden ihnen auch<br />
nach der Verabschiedung des GMG weitgehend die Hände gebunden bleiben –<br />
an dieser Einschätzung können auch die äußerst wenigen wettbewerblichen Öffnungen<br />
(Stichwort: integrierte Versorgung) nichts Grundlegendes ändern. Damit<br />
bleiben Präventionsaktivitäten zur Profilierung <strong>im</strong> Wettbewerb grundsätzlich<br />
attraktiv. Hier können sich die Kassen profilieren, weil sie (gewisse) Spielräume<br />
haben und weil sie – zumindest einige – auch „wirklich etwas können“. Aber<br />
eines darf dabei nicht übersehen werden: Die Ausrichtung der entsprechenden<br />
Aktivitäten einschließlich der Festlegung der relevanten Zielgruppen erfolgt –<br />
wenn nicht gar zuvörderst, so doch auf keinen Fall zuletzt – <strong>im</strong>mer auch aus wettbewerblichen<br />
Überlegungen heraus. Zumindest dürfte der <strong>im</strong> Gesetz geforderte<br />
Beitrag zur „Verminderung sozial bedingter Ungleichheit“ dabei keine hervorgehobene<br />
Rolle spielen – eher <strong>im</strong> Gegenteil: Wer sich in einer Kasse vor allem<br />
um die <strong>Gesundheit</strong>schancen sozial Benachteiligter kümmern wollte, würde massiven<br />
Ärger mit seiner Marketingabteilung riskieren und dabei aller Voraussicht<br />
nach den Kürzeren ziehen.<br />
3. Unrealistische Erwartungen und drohende Wettbewerbsgefahren<br />
Der deutliche Hinweis auf das wettbewerbliche Dilemma der Krankenkassen <strong>im</strong><br />
Hinblick auf die Durchführung von gezielten Präventionsaktivitäten bietet eine<br />
gute Überleitung zu den vorgesehenen Bonusoptionen, denn entsprechende<br />
Angebote der Kassen werden ganz wesentlich durch wettbewerbliche Überlegungen<br />
geprägt sein. Zunächst ein Blick auf die neuen gesetzlichen Vorschriften:
40<br />
Klaus Jacobs<br />
Der neue § 65a des SGB V ist überschrieben mit „Bonus für gesundheitsbewusstes<br />
Verhalten“. Im ersten Absatz wird den Kassen das Recht eingeräumt, „in<br />
ihrer Satzung (zu) best<strong>im</strong>men, unter welchen Voraussetzungen Versicherte, die<br />
regelmäßig Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten nach §§ 25 und 26<br />
oder qualitätsgesicherte Leistungen der Krankenkasse zur pr<strong>im</strong>ären Prävention<br />
in Anspruch nehmen, Anspruch auf einen Bonus haben.“ Absatz 2 eröffnet<br />
eine entsprechende Möglichkeit für den Fall der Teilnahme der Versicherten an<br />
best<strong>im</strong>mten Versorgungsformen (Hausarztmodelle, Disease-Management-Programme,<br />
integrierte Versorgung) und hat insofern nichts mit Prävention zu tun.<br />
Der dritte Absatz räumt den Kassen das Recht ein, per Satzung vorzusehen, „dass<br />
bei Maßnahmen der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung durch Arbeitgeber<br />
sowohl der Arbeitgeber als auch die teilnehmenden Versicherten einen Bonus<br />
erhalten.“ Der vierte und letzte Absatz schreibt schließlich vor, dass die „Aufwendungen<br />
für Maßnahmen nach Absatz 1 und 2“ – von der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
in Absatz 3 ist hier nicht die Rede – „mittelfristig aus Einsparungen<br />
und Effizienzsteigerungen, die durch diese Maßnahmen erzielt werden,<br />
finanziert werden (müssen).“ Hierüber haben die Kassen regelmäßig, mindestens<br />
alle drei Jahre, gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechenschaft abzulegen.<br />
Und weiter heißt es: „Werden keine Einsparungen erzielt, dürfen keine<br />
Boni für die entsprechenden Versorgungsformen gewährt werden. Beitragserhöhungen<br />
allein deshalb, weil die Krankenkasse in ihrer Satzung Bonusregelungen<br />
vorsieht, sind nicht zulässig.“<br />
Nun könnte man als Experte schnell zu der Einschätzung kommen, dass es<br />
unter diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen auch in Zukunft keine Bonuszahlungen<br />
der Krankenkassen für die Teilnahme an Maßnahmen der individuellen<br />
Pr<strong>im</strong>ärprävention – dasselbe gilt entsprechend für Früherkennungsmaßnahmen<br />
(Sekundärprävention) – geben wird, denn der Nachweis über<br />
Einsparungen dürfte kaum zu führen sein – schon gar nicht in einem Zeitraum<br />
von lediglich drei Jahren (zumal in der Begründung zum Gesetz überdies noch<br />
klargestellt wird, dass die „Erhebung weiterer Daten, z.B. über die Lebensführung<br />
der Versicherten, [...] in der Satzung nicht als weitere Voraussetzung vorgesehen<br />
werden [darf]“).<br />
Warum aber sieht der Gesetzgeber eine solche Möglichkeit überhaupt vor, wenn<br />
es gar keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür gibt, die Bedingungen erfüllen<br />
zu können? Schließlich ist in der Gesetzesbegründung auch nicht davon die<br />
Rede, dass Bonusregelungen verhindert werden sollen, sondern lediglich ihr „Ausufern“.<br />
Hier wirken offenbar nach wie vor die zumindest äußerst unglücklichen<br />
Ausführungen des Sachverständigenrats für die Konzertierte Aktion <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />
aus seinem eingangs bereits zitierten Jahresgutachten 2000/2001.<br />
Dort heißt es nämlich (Ziffer 115): „Theoretisch (bei nicht saldierter und nicht<br />
diskontierter Betrachtung) lassen sich rund 25 bis 30 Prozent der heutigen <strong>Gesundheit</strong>sausgaben<br />
in Deutschland durch langfristige Prävention vermeiden.“<br />
Zunächst: Von kurzfristigen Wirkungen – etwa nach drei Jahren – ist auch be<strong>im</strong><br />
Sachverständigenrat keine Rede. Gleichwohl hat diese Aussage Hoffnungen, wenn
Sinn und Unsinn von Bonus-Malus-Regelungen in der Prävention 41<br />
nicht sogar Erwartungen geweckt, denen nicht klar und entschieden genug<br />
widersprochen werden kann. Professor Fritz Beske hat dies erfreulich deutlich<br />
getan und verdient, hier ausführlich zitiert zu werden:<br />
„Die Schlussfolgerung des Sachverständigenrats ist nicht nachvollziehbar. In keinem<br />
Land der Welt gibt es wissenschaftlich begründete Untersuchungen über<br />
die globale Einsparung <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>swesen eines Landes durch Prävention. Es<br />
kann nicht nachvollzogen werden, mit welcher Methodik der Sachverständigenrat<br />
aus dem Potenzial vermuteter oder möglicher Ausgabensenkungen für<br />
acht chronische Krankheitsbilder durch Prävention von 25 Milliarden DM bei<br />
Ausgaben von mehr als 72 Milliarden DM und damit einem Einsparpotenzial<br />
von 28,8 Prozent für das gesamte <strong>Gesundheit</strong>swesen ein Einsparpotenzial von<br />
rund 25 bis 30 Prozent errechnet. Die Einschränkungen ,theoretisch‘ und ,bei<br />
nicht saldierter und nicht diskontierter Betrachtung‘ geben einen Hinweis auf<br />
die Unzulänglichkeit der Schlussfolgerung des Sachverständigenrats. In der<br />
öffentlichen Diskussion wird aber sehr schnell auf diese Einschränkung verzichtet.<br />
Es bleibt dann die Feststellung: Nach dem Gutachten des Sachverständigenrats<br />
können in unserem <strong>Gesundheit</strong>swesen und damit auch in der Gesetzlichen<br />
Krankenversicherung durch eine präventionsorientierte Ausrichtung 25 bis 30<br />
Prozent der Ausgaben gespart werden, bei Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
von rund 260 Milliarden DM <strong>im</strong> Jahr 2002 ein Einsparvolumen<br />
zwischen 65 und 78 Milliarden DM. Dies ist irreal und ohne Bezug zur Wirklichkeit.“<br />
(Fritz Beske: Vor Illusionen wird gewarnt. Deutsches Ärzteblatt, Heft<br />
18/2002, S. A1209f.)<br />
Wie begründet die Sorgen von Professor Beske hinsichtlich einer vorschnellen<br />
und undifferenzierten Verwendung der Aussage des Sachverständigenrats durch<br />
Politiker sind, mag – pars pro toto – ein Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion<br />
vom 14.05.2002 („Prävention umfassend stärken“, BT-Drs. 14/9085) belegen,<br />
in dem es heißt: „(...) sind sich die Experten einig, dass durch verstärkte<br />
Investitionen in lang- und mittelfristige Prävention sich 25 bis 30 Prozent der<br />
heutigen <strong>Gesundheit</strong>sausgaben in Deutschland theoretisch einsparen ließen.“<br />
Bemerkenswert, dass hier sogar schon von einer „lang- und mittelfristigen“ Perspektive<br />
gesprochen wird.<br />
Die folgenden Zitate zweier bekannter <strong>Gesundheit</strong>sforscher stellen derartige Einschätzungen<br />
jedoch ebenfalls grundlegend in Frage. So hat der Nestor der deutschen<br />
<strong>Gesundheit</strong>ssystemforschung und langjährige Vorsitzende des Sachverständigenrats,<br />
Professor Michael Arnold, wiederholt in aller Deutlichkeit vor<br />
falschen Erwartungen in Bezug auf Einsparmöglichkeiten durch Prävention<br />
gewarnt: „Man kann die Prävention be<strong>im</strong> besten Willen nicht mit den damit verbundenen<br />
ökonomischen Vorteilen rechtfertigen, sondern 'nur' mit dem humanitären<br />
Anliegen, die Lebensqualität Einzelner durch eine als gesund eingeschätzte<br />
Lebensführung zu verbessern.“ (Michael Arnold: Perspektiven der Medizinischen<br />
Versorgung. Prevent – Ihre <strong>Gesundheit</strong>, 1997, S.4). Und auch Professor Karl<br />
Lauterbach, der aktuelle Chefberater der <strong>Gesundheit</strong>sministerin, kommt nach
42<br />
Klaus Jacobs<br />
einer Bestandsaufnahme der einschlägigen internationalen Literatur zu dem<br />
Ergebnis: „We conclude that substanzial uncertainty remains around the costeffectiveness<br />
of preventive care“ (A. Gandjour/K. W. Lauterbach: Preventive<br />
Care and the prospect of cost savings. European Journal of Health Economics<br />
2002, S.2).<br />
Eine weitere Beobachtung sollte ebenfalls zu denken geben: Die private Krankenversicherung<br />
kümmert sich fast überhaupt nicht um Prävention. Gäbe es<br />
auch nur einigermaßen gesicherte Erkenntnisse über deren positive ökonomische<br />
Wirkungen, wäre dies gewiss anders, zumal die PKV – <strong>im</strong> Unterschied zu<br />
den gesetzlichen Krankenkassen – auch nicht befürchten muss, dass die Erträge<br />
entsprechender Investitionen von anderen geerntet werden könnten, weil in der<br />
PKV faktisch kaum ein Versicherter seine Versicherung wechseln kann.<br />
Damit ist folgende Ausgangssituation gegeben: Obwohl es schlechterdings unmöglich<br />
ist, positive ökonomische Wirkungen von Prävention – zumal in kurzer<br />
Frist – zu erzielen oder gar nachzuweisen, erhalten die <strong>im</strong> scharfen Wettbewerb<br />
untereinander stehenden Krankenkassen ein Bonus-Instrument an die Hand,<br />
und man kann überdies fast sicher sein, dass sie sich Vorwürfen von Seiten der<br />
Politik ausgesetzt sehen werden, wenn sie dieses vermeintlich sinnvolle Instrument<br />
nicht gebührend einsetzen. Es wird also vermutlich zu entsprechenden<br />
Angeboten kommen, wobei die Auswahl der Zielgruppen vornehmlich von Marketing-Überlegungen<br />
best<strong>im</strong>mt sein dürfte. So verwundert es nicht, wenn bereits<br />
vor „Bauchtanzkursen der zweiten Generation“ gewarnt wird.<br />
Abgesehen von der fraglichen Wirkung der Maßnahmen sind erhebliche Mitnahmeeffekte<br />
zu erwarten: An Bewegungsprogrammen n<strong>im</strong>mt vorrangig teil, wer<br />
sich ohnehin bewegt, an Ernährungsberatung sind pr<strong>im</strong>är nicht die Stammkunden<br />
von Fastfood-Lokalen interessiert. Mit ähnlichen Mitnahmeeffekten ist<br />
auch bei Bonuszahlungen für Maßnahmen der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
zu rechnen: Gut geführte (Groß-)Betriebe müssen vom Stellenwert betrieblicher<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung nicht erst durch entsprechende Anreize überzeugt<br />
zu werden – sie (und ihre Beschäftigten) nehmen die angebotenen (oder<br />
gar eingeforderten?) Gratifikationen aber gewiss gern mit. Damit wird jedoch<br />
eine Querfinanzierung bzw. –subventionierung der Teilnehmer an Präventionsprogrammen<br />
durch Nicht-Teilnehmer mehr als wahrscheinlich. Dies wäre auch<br />
gesundheitspolitisch umso problematischer zu bewerten, als sich unter den Nicht-<br />
Teilnehmern mutmaßlich oft sehr viel geeignetere Adressaten der Aktivitäten<br />
befinden dürften. Vor einer entsprechenden Wirkung warnt auch die Bertelsmann-<strong>Stiftung</strong>:<br />
„Wenn gesundheitsbewusstes Verhalten finanziell belohnt wird,<br />
lässt sich absehen, wer davon bevorzugt profitieren wird. Es wird deshalb<br />
nicht einfach sein, finanzielle Anreize für präventives Verhalten so zu gestalten,<br />
dass eine soziale Diskr<strong>im</strong>inierung vermieden wird.“ (<strong>Gesundheit</strong>smonitor<br />
1/2003, S.5).
Sinn und Unsinn von Bonus-Malus-Regelungen in der Prävention 43<br />
Ein letzter Hinweis soll schließlich noch einer weiteren möglichen Gefahr<br />
gelten, die mit einer zunehmenden Ökonomisierung von allgemeinen individuellen<br />
Verhaltensweisen wie Ernährung, Bewegung usw. verbunden sein könnte:<br />
Hiermit könnte nämlich der Boden für individuelle Schuldzuweisungen für das<br />
Auftreten von Krankheiten und die damit verbundene Inanspruchnahme von<br />
Versorgungsleistungen bereitet werden. Individuelle „Schuld“ ist aber noch<br />
<strong>im</strong>mer die einfachste Rechtfertigung für die Einführung bzw. Verschärfung von<br />
Eigenbeteiligungsregelungen („Malus“) – gewiss keine rosige Aussicht für eine<br />
solidarische Krankenversicherung.<br />
Bleibt abschließend zu hoffen, dass sich die Kassen trotz Wettbewerb verantwortungsvoll<br />
<strong>im</strong> Interesse (aller) ihrer Beitragszahler verhalten werden und auf<br />
ungerechtfertigte Bonuszahlungen für die Teilnahme an Präventionsaktivitäten<br />
verzichten (auch bei entsprechenden Aufforderungen seitens der Politik oder der<br />
allwissenden Medien). Bleibt weiterhin zu hoffen, dass die Aufsichtsbehörden<br />
ihre gesetzliche Aufgabe ernst nehmen und nur solche Bonusregelungen in den<br />
Kassensatzungen zulassen, die <strong>im</strong> Hinblick auf positive ökonomische Wirkungen<br />
wenigstens einigermaßen hinreichende Plausibilität aufweisen. Weil diese<br />
beiden Hoffnungen jedoch kaum realistisch erscheinen, bleibt nur eine letzte:<br />
Dass die wichtige Aufgabe der Prävention keinen dauerhaften Schaden nehmen<br />
möge.
<strong>Gesundheit</strong>soffensive der<br />
Bayerischen Staatsregierung –<br />
Bürgerbeteiligung und<br />
Bürgermotivation<br />
Eberhard Sinner<br />
Das Thema <strong>Gesundheit</strong> gehört zu den Megathemen unserer Zeit, es ist seit Jahren<br />
ein Reiz- und Dauerthema. Ein Paradigmenwechsel in unserem <strong>Gesundheit</strong>ssystem<br />
ist längst überfällig. Wir brauchen nachhaltige und zukunftsfähige<br />
Strategien für die Zukunft, müssen deshalb weg von krankheitszentrierter Kuration<br />
hin zu mehr Prävention und <strong>Gesundheit</strong>sförderung. Die Kostenexplosion<br />
<strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>swesen frisst die Substanz auf. Eine Zweiklassenmedizin ist zum<br />
Teil heute schon Realität und die Bundesregierung schafft <strong>im</strong>mer neue Regulierungsmechanismen,<br />
obwohl das <strong>Gesundheit</strong>swesen bereits überreguliert ist. Zum<br />
demografischen Faktor kommt der Anstieg vermeidbarer chronischer Volkskrankheiten.<br />
Unser ungesunder Lebensstil sowie die mangelnde Bewegung haben<br />
Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Herz-Kreislaufbeschwerden zur Folge,<br />
die etwa ein Drittel unserer <strong>Gesundheit</strong>skosten ausmachen.<br />
Hier ist ein generelles Umdenken gefragt. Prävention und <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
müssen dringend aus ihrem derzeitigen Schattendasein gehoben werden. Unsere<br />
Basis ist deshalb eine ganzheitliche und nachhaltige Herangehensweise. So haben<br />
wir in Bayern die Aufgabenbereiche <strong>Gesundheit</strong> und Ernährung erstmals vereint<br />
(Staatsministerium für <strong>Gesundheit</strong>, Ernährung und Verbraucherschutz).<br />
Unser zentrales Leitmotiv ist Prävention – als gesamtgesellschaftliche Aufgabe!<br />
Wir brauchen dringend eine <strong>Gesundheit</strong>sreform aus einem Guss und dazu eine<br />
vernünftige, solide und wachstumsorientierte Gesamtstrategie in der Finanz-,<br />
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik, die unsere Versorgungssysteme wieder<br />
entlastet! Noch gibt unser heutiges System die falschen Anreize und vernachlässigt<br />
die Motivation der Versicherten und den Wettbewerb der Anbieter. Das bayerische<br />
<strong>Gesundheit</strong>sministerium sieht sich hier auch als gesundheitspolitischen<br />
Innovationsmotor, z.B. mit unserer <strong>Gesundheit</strong>sinitiative „Bayern Aktiv“ in Höhe<br />
von 21 Millionen Euro. Es ist ein ganzheitliches Konzept, das sich an alle<br />
Altersgruppen richtet und alle Lebensbereiche umfasst. „Bayern aktiv“ definiert<br />
die Rolle des Patienten neu, nämlich als einen kompetenten Partner in gesundheitlichen<br />
Fragen.
<strong>Gesundheit</strong>soffensive der Bayerischen Staatsregierung 45<br />
Unsere Initiative soll informieren, motivieren, Kraft und Kreativität wecken und<br />
dabei zeigen, dass jeder Einzelne für seine <strong>Gesundheit</strong> auch ein Stück weit selbst<br />
verantwortlich ist. Dabei binden wir alle am <strong>Gesundheit</strong>swesen Beteiligten als<br />
Partner ein (u.a. Ärzte, Krankenkassen, Verbände, Kliniken, Bürgerinnen und Bürger).<br />
Allein <strong>im</strong> ersten Jahr wurden bereits rund 50 Präventionsprojekte erfolgreich<br />
realisiert: Von Projekten zu gesunder Ernährung angefangen über verschiedene<br />
Früherkennungs- und Informationsprojekte bis hin zur Sammlung und<br />
Auswertung statistischer Daten. Darüber hinaus fördern wir beispielsweise auch<br />
den <strong>Gesundheit</strong>sschutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz (z.B. durch das Arbeitsschutzmanagementsystem<br />
OHRIS). Wir wollen nicht nur informieren, sondern<br />
auch die Eigenverantwortung jedes Einzelnen stärken, zu einem gesunden<br />
Lebensstil motivieren und die evidenzbasierte Medizin stärken. Darüber hinaus<br />
sind wir u.a. auch in Grundschulen und Kindergärten aktiv, denn das Ernährungsoder<br />
Suchtverhalten beispielsweise wird häufig bereits in frühester Kindheit geprägt.<br />
Zudem bieten wir mit unserem „Forum Frauengesundheit“ eine Plattform<br />
für Informationsaustausch und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik<br />
an, die gerade <strong>im</strong> Bereich unterschiedlicher Krankheiten und Krankheitsverläufen<br />
von Frauen und Männern ansetzt.<br />
Eine breite Bürgerbeteiligung ist uns dabei ein Anliegen, denn wir nehmen<br />
unsere Bürgerinnen und Bürger ernst. Wir fördern die aktive Mitarbeit von Verbrauchern<br />
und Patienten, z.B. durch unser dialogorientiertes, interaktives Verbraucherschutzinformationssystem<br />
(VIS) oder auch durch unser sehr erfolgreiches<br />
Bürgergutachten für Verbraucherschutz und das neue Bürgergutachten für<br />
<strong>Gesundheit</strong>. Die Fülle an konkreten Anregungen und Forderungen ist uns dabei<br />
auch Programm und Verpflichtung, denn Demokratie funktioniert von unten<br />
nach oben.<br />
Prävention und <strong>Gesundheit</strong>sförderung können dabei nicht nur Krankheiten<br />
reduzieren, sondern auch Kosten sparen. Somit ist ein moderner <strong>Gesundheit</strong>sschutz<br />
auch <strong>im</strong>mer ein Wirtschaftsfaktor und nicht zuletzt können unsere schönen<br />
bayerischen Kur- und Fremdenverkehrsorte davon profitieren. Bayern als<br />
<strong>Gesundheit</strong>sstandort Nummer 1 ist dabei ein langfristiges Ziel. Wir sehen uns als<br />
Bürgerministerium, das auf der Idee vom mündigen Bürger und souveränen Verbraucher<br />
fußt und dabei eine offene und wissenschaftsbasierte Informationspolitik<br />
betreibt.
Gesunde Eltern – gesunde Kinder<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung für die<br />
junge Familie<br />
Karl E. Bergmann/Renate L. Bergmann<br />
1. Entwicklung der <strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong> 20. Jahrhundert<br />
Wenn wir am Anfang des 21. Jahrhunderts von <strong>Gesundheit</strong> und Krankheit<br />
sprechen, meinen wir etwas anderes, als unsere Vorfahren vor etwa 100 Jahren.<br />
Damals starben in Deutschland durchschnittlich mehr als ein Fünftel aller Kinder<br />
bereits <strong>im</strong> ersten Lebensjahr, in manchen Gebieten Deutschlands mehr<br />
als 35 %. Die zentrale Aufgabe des 1907 eröffneten ersten Instituts ‚Kaiserin<br />
Auguste Victoria Institut‘ zur Prävention in der Pädiatrie, war die Bekämpfung<br />
der Säuglingssterblichkeit. Die Sterblichkeit von Kindern <strong>im</strong> Alter von über 1 bis<br />
unter 15 Jahren war mehr als 65-mal so hoch wie heute. Die Sterblichkeit von<br />
Frauen <strong>im</strong> Zusammenhang mit einer Schwangerschaft (Müttersterblichkeit) war<br />
über 50-mal so hoch wie heute, d.h. schwanger zu werden, war wirklich gefährlich.<br />
Auch unabhängig von Schwangerschaften starben von allen Frauen <strong>im</strong><br />
Alter zwischen 20 und 45 Jahren, also in der Lebensphase, in dem sie kleine<br />
Kinder hatten, mehr als 25 %. Die Sterblichkeit der Männer in diesem Alter war<br />
sogar noch höher. Hinzu kamen <strong>im</strong> letzten Jahrhundert zwei verheerende Weltkriege,<br />
sodass ein großer Teil der überlebenden Kinder ohne eigene Mutter und<br />
ohne eigenen Vater aufwachsen musste. Dafür gab es z.B. Waisenhe<strong>im</strong>e, die<br />
heute völlig vom Erdboden verschwunden sind.<br />
Im Jahr 1900 war die Lebenserwartung von Männern und Frauen etwa halb so<br />
hoch wie <strong>im</strong> Jahr 2000. Die zentrale gesundheitspolitische Bedeutung des Sterbens<br />
geht auch aus dem Motto der Mitte des 20. Jahrhunderts gegründeten Weltgesundheitsorganisation<br />
hervor: „Add years to life“ – Verlängerung der Lebenserwartung.<br />
Dieses Motto wurde vor wenigen Jahren umgedreht in: „Add life to<br />
years“. Die großen Veränderungen <strong>im</strong> zurückliegenden Jahrhundert finden ihren<br />
Niederschlag auch <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>sbegriff der WHO: Es ist der „Zustand vollkommenen<br />
körperlichen, seelischen und sozialen Wohlseins“. Das Sterben kommt<br />
in dieser Definition nicht mehr vor. Die Konzepte von <strong>Gesundheit</strong> und Krankheit<br />
haben sich innerhalb eines Jahrhunderts paradigmatisch verändert.
Gesunde Eltern – gesunde Kinder 47<br />
2. Vermeidbare <strong>Gesundheit</strong>sprobleme und Risiken <strong>im</strong> Kindesalter<br />
Wie man an der „Kostenexplosion“ <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>swesen erkennt, sind durch<br />
diese Veränderungen keinesfalls alle Krankheiten verschwunden. Was das Kindes-<br />
und Jugendalter betrifft, so kommt es bei uns jährlich millionenfach zu<br />
unfallbedingten Verletzungen. Etwa 700 Kinder <strong>im</strong> Alter unter 15 Jahren sterben<br />
jährlich an den Folgen solcher Unfälle. Bereits <strong>im</strong> frühesten Lebensalter wird<br />
das Verhalten von vielen Kindern so ungünstig geprägt, dass sie <strong>im</strong> Verlauf des<br />
Lebens an einer Zivilisationskrankheit erkranken, die einem gesunden, glücklichen<br />
und erfüllten Leben <strong>im</strong> Wege steht oder die an Entwicklungs-, Verhaltensund<br />
seelischen Störungen beteiligt ist und deshalb eine ungestörte Entfaltung<br />
der Persönlichkeit und der Fähigkeiten verhindert. Die modernen Erwartungen<br />
an einen opt<strong>im</strong>alen <strong>Gesundheit</strong>sstatus und eine ungetrübte gesundheitsbezogene<br />
Lebensqualität sind sehr hoch, sodass die dafür eingesetzten Ressourcen<br />
die Solidargemeinschaft und den Steuerzahler noch wesentlich mehr kosten als<br />
früher die Vermeidung des frühzeitigen Todes. Die Prävention von Krankheiten<br />
z.B. durch Verbesserung des <strong>Gesundheit</strong>sverhaltens und der gesundheitsrelevanten<br />
Verhältnisse hat insofern in den zurückliegenden Jahren an Bedeutung<br />
gewonnen.<br />
Die gesundheitlichen Anliegen, die aus epidemiologischer Sicht von Bedeutung<br />
sein könnten, sind in den Tabellen 1 bis 3 zusammengefasst. Dabei werden die<br />
<strong>Gesundheit</strong>sprobleme verschiedenen Kategorien zugeordnet, je nach dem, wie<br />
gut die präventive Beeinflussbarkeit wissenschaftlich gesichert ist.
48<br />
Karl E. Bergmann/Renate L. Bergmann<br />
Tab. 1: Beispiele für Risiken, Krankheiten und Sterblichkeit <strong>im</strong><br />
Säuglings- und Kindesalter, deren Vermeidbarkeit (zumindest<br />
teilweise) gesichert ist<br />
Anliegen der Kategorie A (gesichert in Forschung und Praxis):<br />
• Durch Impfungen prävenible Infektionskrankheiten<br />
• unfallbedingte Verletzungen und Mortalität<br />
• Vergiftungen, Fremdkörperaspiration<br />
• Plötzlicher Kindstod<br />
• Mangel- und Fehlernährung, wie Folsäure-, Vitamin D-, K-, Eisen-, Jod-,<br />
Fluoridmangel<br />
• Bewegungsmangel<br />
• Zahnkaries, Nuckelflaschenkaries<br />
• Gebissfehlstellungen<br />
• Säuglingsdiarrhö, hypertone Dehydratation<br />
• Otitis media. Windeldermatitis<br />
• ,Passivrauchen‘ mit seinen gesundheitlichen Folgen, wie Atemwegserkrankungen<br />
• Folgen angeborener Stoffwechselkrankheiten<br />
• Sonnenbrand<br />
Anliegen der Gruppe B (Prävention grundsätzlich vorstellbar):<br />
• Frühgeburtlichkeit, Perinatale Schäden<br />
• Übergewicht<br />
• Hör- und Sehstörungen bzw. ihre Auswirkungen auf die Entwicklung<br />
• Suchtverhalten<br />
• Vernachlässigung, Missbrauch, Misshandlung<br />
• Dissoziales Verhalten<br />
• Lernstörungen und deren Folgen<br />
• allergische Krankheiten<br />
• Typ I Diabetes mellitus
Gesunde Eltern – gesunde Kinder 49<br />
Tab. 2: Zivilisationskrankheiten und Probleme zu deren Entstehung<br />
wahrscheinlich früh ‘gebahnter’ und eingeübter Lebensstil<br />
beiträgt<br />
• Adipositas des Erwachsenen<br />
• Typ II Diabetes mellitus und seine Folgen<br />
• erworbene Hyperlipoproteinämien<br />
• Bluthochdruckkrankheit<br />
• Angina Pectoris, Myocardinfarkt<br />
• zerebrale Durchblutungsstörungen, Apoplex<br />
• Zahnverlust, Zahnlosigkeit, Zahnersatz<br />
• Unfallmorbidität und -mortalität<br />
• Lungenkrebs, oropharyngeale Tumoren, Magen-, und Blasenkrebs<br />
• Cervix-, Corpus- und Brustkrebs, malignes Melanom<br />
• Arthrosen, osteoporotische Knochenbrüche, Dorsopathien<br />
• Leberzirrhose<br />
• chronisch-obstruktive Lungenkrankheiten<br />
• Suizid<br />
• Störungen von Partnerschaft und Sexualität<br />
• HIV-Infektionen, AIDS<br />
• Soziale Deprivation, Kr<strong>im</strong>inalität, Drogenabhängigkeit<br />
• Kontaktekzem<br />
• Depressionen<br />
• Demenzen
50<br />
Karl E. Bergmann/Renate L. Bergmann<br />
Tab. 3: Risikoverhalten von Eltern (kulturelle/epigenetische<br />
Transmission)<br />
• Über- und Untergewicht von Mutter und Vater sind ein Risiko auch für<br />
das Kind<br />
• Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten werden vom Kind übernommen<br />
und haben nicht nur für die Eltern große Bedeutung<br />
• Zigarettenrauchen ist ein <strong>Gesundheit</strong>srisiko für Eltern und Kinder, die<br />
Transmissionsrate des Rauchens zur nächsten Generation ist hoch<br />
• Alkohol-, Drogen- und Fernsehkonsum können schädigen und werden<br />
nachgeahmt<br />
• Unfallträchtiges Risikoverhalten in Haushalt, Freizeit, Beruf und Verkehr<br />
bedeutet Gefahr für die Eltern und riskantes Vorbild für das Kind<br />
• Partnerschaft; gute Partnerschaft erlebt das Kind als Geborgenheit, den<br />
Umgang der Eltern miteinander ahmt es nach<br />
• Freizeitgestaltung mit Partner und Kind schafft Glück und wird weitergegeben<br />
• Soziale Lage, Kenntnisse über Hilfsangebote können die Situation der<br />
Familie verbessern<br />
• Missbrauch; die Übernahme der gemeinsamen Verantwortung und Verpflichtung<br />
zum Schutz des Kindes kann Missbrauch und Misshandlung<br />
vorbeugen<br />
• Ungenügende Vorsorge für die eigene <strong>Gesundheit</strong> bedeutet Risiko und<br />
schlechtes Vorbild
Gesunde Eltern – gesunde Kinder 51<br />
3. Repräsentativerhebung bei jungen Eltern zur Nachfrage nach<br />
Prävention<br />
Die Bereitschaft des Einzelnen, in die Vermeidung von Krankheiten Zeit, Kraft<br />
und Geld zu investieren, ist insgesamt eher gering. Hier scheint es aber große<br />
Einflüsse der Lebensphasen und der Settings zu geben: In werdenden und jungen<br />
Familien und bei älteren Menschen ist ein – durchaus nachvollziehbares –<br />
Interesse an der Krankheitsvermeidung zu erkennen. Für die werdende und<br />
junge Familie haben wir dies durch eine bundesweite Repräsentativerhebung<br />
untersucht, von der einige Ergebnisse hier vorgestellt werden sollen:<br />
Aus Abbildung 1 geht hervor, dass fast drei Viertel aller befragten werdenden und<br />
jungen Eltern eine Beratung über die Vermeidung von Krankheiten und Verletzungen<br />
sowie über die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes für wichtig<br />
halten; 24,7 % würden solche Beratungen nur gezielt in Anspruch nehmen und<br />
weniger als 2 % wären nicht daran interessiert.<br />
Abbildung 1:
52<br />
Karl E. Bergmann/Renate L. Bergmann<br />
Die Themen, für die sich junge Eltern vor allem interessieren, sind in Abbildung<br />
2 zusammengefasst. (Die Interessenschwerpunkte während der ersten<br />
Lebensjahre des Kindes unterscheiden sich von denen in der Schwangerschaft).<br />
Abbildung 2:
Gesunde Eltern – gesunde Kinder 53<br />
Aus Abbildung 3 geht hervor, wo sich Eltern vorzugsweise Rat holen würden.<br />
Diese Auffassungen werden natürlich durch vorhandene Angebote und Erfahrungen,<br />
die junge Eltern gesammelt haben und die ihnen weitergegeben wurden,<br />
beeinflusst.<br />
Abbildung 3:
54<br />
Karl E. Bergmann/Renate L. Bergmann<br />
Abbildung 4 gibt wieder, wen Eltern als Berater erwarten würden. Dabei wird klar,<br />
dass die bevorzugten Berufsgruppen eigentlich auf präventive Beratung junger<br />
Familien nicht ausreichend fachlich vorbereitet sind.<br />
Abbildung 4:
Gesunde Eltern – gesunde Kinder 55<br />
Aus Abbildung 5 ist ersichtlich, dass junge Eltern unverändert das persönliche<br />
Gespräch als Kommunikationsweg bevorzugen. Die Attraktivität mult<strong>im</strong>edialer<br />
Informationsquellen wird natürlich in den kommenden Jahren auch für junge<br />
Eltern steigen.<br />
Abbildung 5:
56<br />
Karl E. Bergmann/Renate L. Bergmann<br />
4. Kontrollierte Studie zur Wirksamkeit und Akzeptanz vorausschauender<br />
Beratung<br />
Unter Förderung durch das Bundesforschungsministerium (BMFT) und mit<br />
Unterstützung des AOK-Bundesverbandes haben wir die Wirksamkeit einer<br />
präventiven („vorausschauenden“) Beratung in einer kontrollierten Studie<br />
untersucht, deren Ergebnisse in den kommenden Monaten noch <strong>im</strong> Einzelnen<br />
präsentiert werden. In dieser Studie wurden 200 junge Familien mit ihrem ersten<br />
Kind in regelmäßigen Abständen und in kleinen Gruppen von 5 bis 8 Eltern<br />
darüber beraten, was in den kommenden Wochen auf sie zukommt. Sie wurden<br />
mit insgesamt 500 Familien verglichen, für die eine solche Beratung nicht zur<br />
Verfügung stand. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurden alle Familien<br />
auf die gleiche Weise aus dem Kreißsaalbuch und damit dem Einzugsgebiet der<br />
geburtsmedizinischen Klinik des Charité-Virchow Klinikums, der größten<br />
geburtsmedizinischen Klinik Deutschlands, rekrutiert.<br />
Das Angebot stieß auf hohe Akzeptanz. Es zeigte sich, dass sich nicht nur das<br />
Wissen, sondern auch das Verhalten junger Eltern durch eine vorausschauende<br />
Beratung günstig beeinflussen lässt:<br />
• Die Kinder der Interventionsgruppe, dies gilt besonders für Mütter mit niedrigerem<br />
Bildungsgrad, wurden häufiger und länger gestillt.<br />
• Beikost wurde in der Interventionsgruppe später eingeführt.<br />
• Die Kinder der Interventionsgruppe waren signifikant schlanker als die der<br />
Kontrollgruppe.<br />
• Sie litten signifikant seltener an fieberhaften Infekten, Durchfall, Erbrechen<br />
und an Otitis Media (Otitis Media hat etwas mit der Position des Kindes insbesondere<br />
bei Flaschenernährung zu tun; dies war eines der Interventionsanliegen).<br />
• Für die Kinder in der Interventionsgruppe wurden seltener medizinische<br />
Leistungen in Anspruch genommen.<br />
• Die Mütter der Interventionsgruppen wussten über die Vermeidung von Zahnkaries<br />
signifikant besser Bescheid.<br />
• Kariesrisikofaktoren waren bei den Müttern und den Kindern der Interventionsgruppen<br />
signifikant seltener nachweisbar als bei den Kontrollgruppen.<br />
• Z.B erhielten die Kinder der Interventionsgruppe signifikant seltener eine<br />
Nuckelflasche zur Beruhigung, zum Einschlafen oder nachts.<br />
• Die Kinder der Interventionsgruppen hatten signifikant seltener die sog.<br />
„Early Childhood Caries“ als die Kontrollgruppen.<br />
• Der Impfstatus war sowohl in der Interventions- als auch Kontrollgruppe<br />
insgesamt sehr gut. In der Interventionsgruppe waren die Kinder häufiger –<br />
entsprechend den STIKO-Empfehlungen - zwe<strong>im</strong>al gegen MMR ge<strong>im</strong>pft.<br />
• Mit 12 Monaten war die Erythrozytenzahl und das mittlere Zellvolumen in<br />
der Interventionsgruppe als Ausdruck einer besseren Ernährung mit Eisen<br />
signifikant höher.<br />
• Kalzium- und Phosphatwerte wiesen auf eine bessere Vitamin D-Versorgung<br />
in der Interventionsgruppe hin.
Gesunde Eltern – gesunde Kinder 57<br />
• Die niedrigeren CRP-Werte in der Interventionsgruppe bestätigten die geringere<br />
Infektionshäufigkeit in dieser Gruppe.<br />
5. Vortragsangebot des AOK-Bundesverbandes<br />
Die für die Intervention verwendeten Instrumente dieser Studie wurden für den<br />
AOK-Bundesverband zu einem Vortragskonzept aufgearbeitet, das 5 Themenschwerpunkte<br />
umfasst:<br />
• Vortrag 1 (Schwangerschaft): Kinder und Neurodermitis – Vorbeugen hilft.<br />
• Vortrag 2: Die ersten Monate: Ihr Kind best<strong>im</strong>mt Ihr Leben.<br />
• Vortrag 3: Das Krabbelalter: Ihr Kind entdeckt die Welt.<br />
• Vortrag 4: Das zweite Lebensjahr: Ihr Kind hat seinen eigenen Willen.<br />
• Vortrag 5: Das 3. Jahr: Ihr Kind wird selbstständig.<br />
Zu den Inhalten, die jeweils altersspezifisch aufgearbeitet sind, gehören folgende<br />
Themen:<br />
– Allergieprävention,<br />
– Eltern-Kind–Beziehung,<br />
– Bedürfnisse der Eltern und des Kindes,<br />
– Ernährung,<br />
– Schlaf,<br />
– Schreien,<br />
– Impfungen,<br />
– Motorische Entwicklung, Geschicklichkeit und Unfallverhütung,<br />
– Bewegung und Spielen,<br />
– Sprachentwicklung,<br />
– Sozialverhalten,<br />
– Emotionale Entwicklung,<br />
– Sauberkeitserziehung.<br />
Es stehen Planungshilfen für die Organisatoren, Vortragstexte und Abbildungen<br />
als Folien oder CD-Rom zur Verfügung. Durch die Unterteilung in wenige Vorträge<br />
geht etwas von dem Charakter der „vorausschauenden Beratung“ verloren.<br />
Aber die Angebote können flexibel für solche Zwecke zusammengestellt werden<br />
und eignen sich dann auch für Vermittlung in kleinen Gruppen. 1<br />
Die praktischen Erfahrungen sprechen dafür, vorausschauende Beratung einzelnen<br />
oder kleinen Gruppen junger Familien durch kompetente Personen<br />
anzubieten. Bei der Weiterentwicklung des Programms <strong>im</strong> Charité–Virchow<br />
Klinikum werden noch interaktive Komponenten und Praktisches ausgearbeitet,<br />
wo Eltern selbst Hand anlegen und Erfahrungen sammeln können.<br />
1 Ansprechpartner ist der AOK – Bundesverband: Kortrijker Straße 1, 53177 Bonn,<br />
Telefon: (02 28) 8 43-0, Fax: (02 28) 84 35 02, E-Mail: AOK-Bundesverband@bv.aok.de
1. Einführung<br />
Führung und <strong>Gesundheit</strong> –<br />
ein belastetes Verhältnis<br />
Hans Günter Abt<br />
„Lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben?“ An dieser Frage scheiden<br />
sich angeblich die Menschen, die gut zu leben wissen, und diejenigen, die<br />
das nicht können, sondern sich für die Pflicht aufopfern. Aber so einfach ist die<br />
Sachlage nicht. Arbeit ist für die meisten Menschen ein wichtiger Teil ihres<br />
Lebens. Das gilt für den Zeitaufwand, für die sozialen Kontakte, für ihr Wissen,<br />
für einige Aspekte der Persönlichkeitsentfaltung und eben auch für die <strong>Gesundheit</strong>.<br />
Arbeit ist nicht <strong>im</strong>mer gesundheitsgefährdend, sie kann <strong>Gesundheit</strong> auch<br />
fördern, wie Studien an Arbeitslosen belegen.<br />
„Führung und <strong>Gesundheit</strong>“ ist ein besonderer Ausschnitt aus dem Themenkreis<br />
„Arbeit und <strong>Gesundheit</strong>“. Seine Besonderheit besteht darin, dass sich mehr und<br />
andere Blickrichtungen anbieten als bei der <strong>Gesundheit</strong> der Mitarbeiter, nämlich<br />
• auf die <strong>Gesundheit</strong> der Führungskräfte,<br />
• auf den Umgang der Führungskräfte mit Mitarbeitern, deren <strong>Gesundheit</strong> Probleme<br />
aufwirft,<br />
• auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die Einfluss auf die <strong>Gesundheit</strong><br />
von Mitarbeitern nehmen können.<br />
Wo liegt nun die Belastung <strong>im</strong> Verhältnis von Führung und <strong>Gesundheit</strong>? Aus<br />
dem Blickfeld des Beraters, der über langjährige Erfahrungen in der <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
und in der Unternehmensberatung zur Anwesenheitsverbesserung<br />
verfügt, erlaube ich mir dazu einige Ausführungen, die sich auf die Praxis<br />
fachlich reflektierter Projekte in gewerblichen und öffentlichen Betrieben stützen,<br />
nicht auf wissenschaftliche Untersuchungen. Die Erfahrungen stammen aus<br />
Projekten in mittleren und größeren Unternehmen von mehreren Hundert bis<br />
zu mehreren Tausend Mitarbeitern.
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 59<br />
2. Aspekte der <strong>Gesundheit</strong><br />
Zum besseren Verständnis der aktuellen Problematik halte ich es für hilfreich,<br />
vier Aspekte zu unterscheiden, unter denen Führungskräfte mit <strong>Gesundheit</strong> in<br />
Berührung kommen.<br />
• Führungskräfte stehen stellvertretend für den Unternehmer, je nach Hierarchieebene<br />
für größere oder kleinere Bereiche. Als Stellvertreter übernehmen<br />
sie mit ihrer Leitungsaufgabe auch Pflichten des Unternehmers für die <strong>Gesundheit</strong><br />
der Mitarbeiter.<br />
• Mit ihrer Leitungsaufgabe besitzen Führungskräfte eigene Gestaltungsspielräume.<br />
Mit ihren Entscheidungen sind unweigerlich auch Folgen gesundheitlicher<br />
Art verbunden. Über die Gestaltung der technischen und organisatorischen<br />
Arbeitsbedingungen nehmen sie aktiv Einfluss auf die <strong>Gesundheit</strong>.<br />
• Führungskräfte sind Teil des sozialen Systems, das gesundheitsfördernd oder<br />
gesundheitsgefährdend wirken kann. Mit ihrem Führungsverhalten nehmen<br />
sie auf Grund ihrer Machtposition eine herausragende Stellung <strong>im</strong> sozialen<br />
Gefüge ein und können besonders starke psychische und psychosomatische<br />
Wirkungen erzielen.<br />
• Führungskräfte sind wie alle Mitarbeiter auf ihre Arbeitsfähigkeit angewiesen.<br />
Eine höhere Position <strong>im</strong> Unternehmen geht meist mit mehr Konkurrenz<br />
unter Führungskräften einher. Insofern empfinden Führungskräfte alle Einschränkungen<br />
ihrer Arbeits- und Leistungsfähigkeit als extrem bedrohlich.<br />
Im Unterschied zur Mehrzahl ihrer Mitarbeiter ist mit ihrer <strong>Gesundheit</strong> und<br />
Arbeitsfähigkeit oft auch ihre herausgehobene Position gefährdet.<br />
3. Führungskräfte als Stellvertreter des Unternehmers<br />
3.1 Normative Regelungen zum Schutz der <strong>Gesundheit</strong> der Mitarbeiter<br />
Auf den ersten Blick sieht das Verhältnis zwischen Führung und <strong>Gesundheit</strong> abgeklärt<br />
aus. Zumindest normativ, durch Gesetze, Vorschriften, aber auch durch<br />
die moderne Weltanschauung wird die Verantwortung für die <strong>Gesundheit</strong> der<br />
Mitarbeiter den Unternehmern und – als deren Vertretungspersonen – den<br />
Führungskräften zugeschrieben, so weit der Einflussbereich des Unternehmens<br />
reicht.<br />
Das Bürgerliche Gesetzbuch fordert die Fürsorgepflicht für die <strong>Gesundheit</strong> der<br />
Mitarbeiter, die Verpflichtung des Unternehmens zu möglichen Schutzmaßnahmen.<br />
Es eröffnet die Möglichkeit, vom Unternehmen Schadensersatz für arbeitsbedingte<br />
<strong>Gesundheit</strong>sschädigungen zu verlangen. Schließlich stellt es sogar<br />
die Haftung bei <strong>Gesundheit</strong>sschäden durch rechtswidriges Handeln in Aussicht.
60<br />
Hans Günter Abt<br />
Dabei versteht die Jurisprudenz unter Handeln nicht nur aktives Tun, sondern<br />
auch das Unterlassen, z.B. von vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. An<br />
Stelle des Unternehmers haften unter Umständen auch dessen Verrichtungsgehilfen,<br />
wie Führungskräfte in der Gesetzessprache etwas Image schmälernd<br />
bezeichnet werden.<br />
Bürgerliches Gesetzbuch: § 823 Schadensersatzpflicht<br />
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die <strong>Gesundheit</strong>, die Freiheit,<br />
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt,<br />
ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.<br />
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines<br />
anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein<br />
Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht<br />
nur <strong>im</strong> Falle des Verschuldens ein.<br />
Das Arbeitsschutzgesetz erwähne ich als zweite normative Grundlage. Es beschreibt<br />
die allgemeinen Pflichten des Unternehmers zur gesundheitlichen<br />
Fürsorge in gebündelter Form und hebt auch die Verantwortung der Führungskräfte<br />
deutlich hervor. Es stellt auch rechtliche Beziehungen zum Strafgesetzbuch<br />
wegen Verstößen gegen den Arbeitsschutz her. Inhaltlich erweitert das Arbeitsschutzgesetz<br />
die Perspektive des <strong>Gesundheit</strong>sschutzes über Arbeitsunfälle und<br />
Berufskrankheiten ausdrücklich auf die arbeitsbedingten <strong>Gesundheit</strong>sgefahren<br />
und die menschengerechte Gestaltung der Arbeit.
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 61<br />
Arbeitsschutzgesetz: § 3 Grundpflichten des Arbeitgebers<br />
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes<br />
unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und<br />
<strong>Gesundheit</strong> der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen<br />
auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden<br />
Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und<br />
<strong>Gesundheit</strong>sschutz der Beschäftigten anzustreben.<br />
(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der<br />
Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der<br />
Beschäftigten<br />
1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen<br />
sowie<br />
2. Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten<br />
und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden<br />
und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.<br />
Arbeitsschutzgesetz: § 7 Übertragung von Aufgaben<br />
Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber je nach<br />
Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die<br />
für die Sicherheit und den <strong>Gesundheit</strong>sschutz bei der Aufgabenerfüllung zu<br />
beachtenden Best<strong>im</strong>mungen und Maßnahmen einzuhalten.<br />
Vor dem Hintergrund dieses ausgeprägten normativen Drucks gibt es für alle<br />
Führungskräfte gute Gründe, sich mit dem Thema <strong>Gesundheit</strong> zu befassen, erst<br />
recht für das Unternehmen insgesamt. Ist das aber auch die betriebliche Wirklichkeit?<br />
Anmerkung<br />
In den folgenden Text sind Fragen zum Selbsttest für Führungskräfte eingefügt.<br />
Können Sie die Fragen mit „+“ bejahen, so sind die Voraussetzungen für eine<br />
gesunde Führungskultur besser, als wenn Sie die Fragen mit „–“ mit Ja beantworten.
62<br />
3.2 <strong>Gesundheit</strong>sverantwortung in der Aufbauorganisation<br />
Hans Günter Abt<br />
Die Prävention von Unfällen und Berufskrankheiten, für die eine eindeutige<br />
Haftung des Unternehmens besteht, ist für die meisten Unternehmen noch<br />
<strong>im</strong>mer das Leitmodell, nach dem sie verfahren. Aber selbst dort, wo neue<br />
<strong>Gesundheit</strong>smanagement-Modelle installiert werden, gibt es viele Parallelen.<br />
Um die Ausgangssituation zu verstehen, ist die zentrale Begrifflichkeit der<br />
„Führungskraft“ zunächst zu differenzieren. Gibt es zwischen dem Industriemeister<br />
und dem Personalleiter eines großen Unternehmens mehr Verbindendes<br />
oder mehr Trennendes? Wie steht es damit be<strong>im</strong> Meister eines städtischen<br />
Bauhofs und dem Fachbereichsleiter Zentrale Dienste in der Stadtverwaltung?<br />
Von „Führungskräften“ zu sprechen, bedeutet eine grobe Verallgemeinerung, die<br />
Wesentliches verdecken kann. Auch wenn jede Führungskraft mit ihrer Position<br />
ein Stück der Unternehmerverantwortung übern<strong>im</strong>mt, so variiert diese in komplexen<br />
Unternehmen inhaltlich sehr stark mit der Hierarchieebene und dem<br />
jeweiligen Aufgabenbereich.<br />
+ Begreifen Sie die Verantwortung für <strong>Gesundheit</strong> und Sicherheit als gemeinsame<br />
Verantwortung aller Führungskräfte, also auch Ihre eigene?<br />
– Sehen Sie die Hauptverantwortung für <strong>Gesundheit</strong> und Sicherheit bei Spezialisten?<br />
In komplexen Unternehmen legt das Management die Verantwortung für <strong>Gesundheit</strong><br />
<strong>im</strong> herkömmlichen Verständnis offiziell in die Verantwortung eines<br />
einzelnen, meist technisch orientierten Vorstandsmitglieds, das für Sicherheit<br />
nach dem klassischen Arbeitsschutz zuständig ist. Demgegenüber liegt die Verantwortung<br />
für Personalangelegenheiten meist bei einer anderen Führungskraft,<br />
die zum Beispiel auch Maßnahmen der Anwesenheitsverbesserung und <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
steuern kann. Beide Bereiche, die Arbeitssicherheit und das<br />
Personalmanagement, werden als Querschnittsaufgaben verstanden, ausgeführt<br />
von internen oder externen Dienstleistern.<br />
In dieser Organisationsform werden bereits die zwangsläufigen Spannungsbögen<br />
für <strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong> Unternehmen sichtbar. Der pr<strong>im</strong>äre Unternehmenszweck ist<br />
es, mit Produkten oder Dienstleistungen Umsatz und Gewinn zu erwirtschaften<br />
oder – <strong>im</strong> öffentlichen Dienst – einen Auftrag für das Gemeinwesen zu erfüllen.<br />
Die <strong>Gesundheit</strong> der Mitarbeiter zu erhalten, ist daneben nur eine aus gesetzlichen<br />
Vorgaben abgeleitete Aufgabe wie be<strong>im</strong> Arbeitsschutz oder ein Ziel, um<br />
die Personalressourcen kostengünstiger zu steuern. Diese Spannungsbögen bleiben<br />
den Führungskräften über alle Hierarchieebenen hinweg erhalten, aber mit<br />
einer wesentlichen Veränderung von oben nach unten. Während die Spannungen<br />
<strong>im</strong> oberen Management in Verhandlungen um Mittel und Einfluss zwischen
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 63<br />
verschiedenen Personen auf gleicher Ebene ausgetragen werden, verlagern sie<br />
sich nach unten zunehmend in die Führungspersonen hinein.<br />
Der <strong>Gesundheit</strong>sschutz wird in der Unternehmensspitze zum Spezialgebiet.<br />
Je stärker die Führungsebenen differenziert sind, umso mehr ziehen sich die Verantwortlichen<br />
in den oberen Ebenen auf ihre Organisationsaufgaben und auf die<br />
Kenntnisnahme und Bewertung von Kennzahlen zurück, sofern solche existieren.<br />
Schleicht sich darum bei vielen Führungskräften auf den unteren bis mittleren<br />
Hierarchieebenen oft das Gefühl ein, be<strong>im</strong> Thema <strong>Gesundheit</strong> alleine<br />
gelassen zu werden?<br />
Immer noch bedeutet die Delegation von Aufgaben auch be<strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>sschutz<br />
zu häufig, dass die Verantwortung der höheren Führungskräfte über die<br />
formelle Pflichtenübertragung und die Klärung von Zuständigkeiten hinaus nicht<br />
mehr wahrgenommen wird. Die Qualifizierung von Führungskräften bleibt häufig<br />
auf der Strecke, ebenso die Wahrnehmung der geforderten aktiven Kontrolle.<br />
Das Wissensmanagement wird weitgehend den Fachleuten überlassen, was<br />
dazu führt, dass bei Führungskräften viele Wissenslücken über die <strong>Gesundheit</strong>sund<br />
Sicherheitsvorschriften existieren. Diese Reduzierung der Verantwortlichkeit<br />
bei höheren Führungsebenen widerspricht nicht nur dem Anliegen der Vorschriften,<br />
sondern ist auch in der Sache ungünstig, weil hier Entscheidungen<br />
über viele Rahmenbedingungen der Arbeit fallen, die auch gesundheitliche<br />
Auswirkungen haben.<br />
+ Haben Sie ein klares Pflichtenheft <strong>im</strong> Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutz?<br />
+ Stehen Ihnen ausreichend Kompetenzen und Mittel zur Verfügung, um diese<br />
Aufgaben erfolgreich auszuführen?<br />
+ Machen Sie sich regelmäßig ein Bild von der gesundheitlichen Beanspruchung<br />
Ihrer Mitarbeiter?<br />
+ Überwachen Sie regelmäßig den Stand der Sicherheit in Ihrem Bereich?<br />
– Haben Sie Schwierigkeiten, auf Rahmenbedingungen der Arbeit in Ihrem Bereich<br />
einzuwirken (z.B. Bau- oder Beschaffungsmaßnahmen)?<br />
– Haben Sie eine pauschale Verpflichtung zum Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutz<br />
übertragen (bekommen)?<br />
– Sind die Zuständigkeiten für Maßnahmen zum Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutz<br />
in Ihrem Unternehmen unklar oder schlecht geregelt?
64<br />
Hans Günter Abt<br />
Führungskräfte, die direkt in der Mitarbeiterverantwortung stehen, sind bei Entscheidungen<br />
höherer Führungsebenen oft nur ausführende Organe. Dennoch<br />
erleben sie genau in dieser Rolle häufig, dass Mitarbeiter ihnen ungesunde oder<br />
auch nur unangenehme Veränderungen vorwerfen. Diese Erfahrung bringt die<br />
mittleren und unteren Führungsebenen in eine schwierige, meist ambivalente<br />
Situation. Distanzieren sich die Führungskräfte von maßgeblichen Entscheidungen,<br />
indem sie auf ihren geringen Einfluss oder gar ihre Ohnmacht hinweisen,<br />
so treten sie ganz aus der Verantwortung heraus und laufen Gefahr, von<br />
oben als unzuverlässige Führungskräfte eingestuft zu werden. Vertreten sie die<br />
Entscheidungen positiv, so erwecken sie bei ihren Mitarbeitern leicht den Eindruck,<br />
Belastungen oder Gefährdungen zu befürworten und ihren Vorschlägen<br />
nicht entgegenkommen zu wollen. Denn wer mit entscheidet, kann auch mit<br />
verändern. Verdruss und Rückzug auf Mitarbeiterseite sind mögliche Antworten<br />
darauf. Viele Führungskräfte erleben solche Situationen daher als die Wahl zwischen<br />
zwei Übeln, wenn sie an übergeordneter Stelle keine Bereitschaft sehen,<br />
sich mit gesundheitlichen Bedenken auseinander zu setzen.<br />
Die Solidarisierung mit der Kritik der Mitarbeiter geht oft mit einem Ausweichverhalten<br />
einher, das in die Sackgasse führt. Einige Führungskräfte zeigen sich<br />
vordergründig mitarbeiterorientiert, nehmen deren Klagen über gesundheitliche<br />
Gefahren und Überbeanspruchung an, signalisieren ihnen aber gleichzeitig, dass<br />
diese nicht veränderbar, nach oben nicht kommunizierbar seien. Auf diesem Verhalten<br />
von Führungskräften basieren viele Kommunikationsblockaden zwischen<br />
unteren, mittleren und höheren Führungsebenen. Dieses Verhalten mag nach<br />
erlebten Frustrationen nachvollziehbar sein. Vielen Führungskräften, die solche<br />
Blockaden praktizieren, ist jedoch nicht klar, dass sie damit die Entscheidung<br />
selbst vorwegnehmen, anstatt die Verantwortung dahin zu geben, wo sie auch<br />
hingehört. Wo dies be<strong>im</strong> Themenkreis <strong>Gesundheit</strong> und Sicherheit geschieht,<br />
bleibt das Thema für die betreffende Führungskraft selbstverständlich <strong>im</strong>mer<br />
unangenehm oder gar gefährlich, weil sie <strong>im</strong> Schadensfall ihren Pflichten nachweislich<br />
nicht nachgekommen ist.<br />
Mir erscheint es schlüssig, dass <strong>Gesundheit</strong> nur als „Störung“ ein Thema sein<br />
kann und nicht als selbstverständlicher Aspekt von Arbeit, wenn gerade die<br />
oberen Führungsebenen sich hier außerhalb der konkreten Verantwortung<br />
sehen.<br />
Die Randstellung des <strong>Gesundheit</strong>sschutzes lässt sich vermeiden. Betriebliche<br />
Kennzahlen zum <strong>Gesundheit</strong>sschutz und Benchmarking-Ansätze sind weit<br />
verbreitet, aber auch in großen Unternehmen noch kein selbstverständlicher<br />
Standard. Mit ihnen wird eine Transparenz geschaffen, die auch die Auseinandersetzung<br />
mit diesem Thema befördern kann. In einer Kultur aktiver betrieblicher<br />
Kommunikation, in der Führungskräfte Risiken und Entwicklungen vorausschauend<br />
und präventiv ansprechen, werden so frühzeitig Fragen nach<br />
unerwünschten Trends gestellt. Gegenmaßnahmen können besprochen und<br />
vereinbart werden.
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 65<br />
Die Handhabung sieht in vielen Betrieben leider anders aus. Kennzahlen werden<br />
meist unabhängig von einem zweiseitigen Austausch eingeführt. Sie sind keine<br />
Gesprächsgrundlage für die Situationsbewertung, sondern bereits das Ergebnis<br />
der Bewertung. Controlling wird Kontrolle pur. Die Führungskräfte der niedrigeren<br />
Hierarchieebenen zeigen deshalb für Kennzahlen zu Sicherheit und<br />
<strong>Gesundheit</strong> sowie für Transparenz keineswegs große Begeisterung. Kennzahlen<br />
werden als Kontrollinstrumente empfunden, nicht als Leit- und Führungshilfen.<br />
Deshalb verstärken auch alle eindeutigen Rückschlüsse von gesundheitsrelevanten<br />
Kennzahlen auf die Führungssituation die Abneigung gegen das Thema bei<br />
den Führungskräften.<br />
+ Verfügen alle Führungskräfte über Kennzahlen zu Sicherheit und <strong>Gesundheit</strong><br />
sowie zum Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutz?<br />
+ Erhalten Sie Unterstützung bei der Klärung und Veränderung negativer Trends<br />
bei <strong>Gesundheit</strong> und Sicherheit?<br />
– Werden Ihnen wegen der Erhöhung von Krankenstands- oder Unfallzahlen nur<br />
Vorwürfe gemacht?<br />
Rechtlich betrachtet hat der weit gehende Rückzug des Managements aus der<br />
Verantwortung für die <strong>Gesundheit</strong> der Mitarbeiter selten eine ausreichende<br />
Grundlage. Sofern nämlich die Verantwortung nicht eindeutig geregelt ist,<br />
stehen die Führungskräfte aller Ebenen in der Pflicht. Eindeutigkeit entsteht<br />
aber nicht durch die allgemeine Zuweisung der Aufgaben be<strong>im</strong> Arbeits- und<br />
<strong>Gesundheit</strong>sschutz, sondern nur durch die Kombination aus der Aufgabenübertragung<br />
mit den entsprechenden Kompetenzen und der Verfügung über ausreichende<br />
Mittel. Des Weiteren obliegt dem Management die Überwachung, dass<br />
das von ihm organisierte System des Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutzes erfolgreich<br />
funktioniert. Im Grunde ist es bereits fragwürdig, wenn ein Unternehmer<br />
oder oberster Dienstherr seiner Führungskraft die Pflichten zum Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutz<br />
überträgt, wenn er weiß, dass diese Führungskraft ihre damit<br />
verbundenen Pflichten gar nicht kennt. Es gibt demnach für alle Führungskräfte<br />
Gründe genug, <strong>Gesundheit</strong> regelmäßig zum Thema zu machen.<br />
4. Führungskräfte als Gestalter von Arbeit und<br />
Arbeitsbedingungen<br />
Bestandteil der meisten Führungsrollen ist die Mitgestaltung der Arbeit und<br />
ihrer Rahmenbedingungen. Hierfür setzen die Führungskräfte in der Unternehmensspitze<br />
zwar mit Grundsatzentscheidungen den Rahmen. Die mittleren<br />
Führungsebenen nehmen mit ihrer Fachkompetenz in der Regel wesentlichen<br />
Einfluss auf Grundzüge der Arbeitsorganisation, auf die Ausgestaltung der Pro-
66<br />
Hans Günter Abt<br />
zesse, und auf die Auswahl und Ausgestaltung der Technik, der Anlagen, Geräte<br />
und ihre Anordnung. Doch selbst bei den unteren Führungsebenen verbleiben<br />
Detailregelungen und -entscheidungen, die Feinabst<strong>im</strong>mung von Prozessen, die<br />
Mitsprache bei der Anschaffung von Arbeitsmitteln, kleinere, aber für die Arbeitsausführung<br />
relevante technische Gestaltungsmaßnahmen. Sie veranlassen<br />
Sicherheitsmaßnahmen – oder unterlassen sie. Somit nehmen alle, auch die<br />
unteren Führungsebenen Einfluss auf die Ausübung der Arbeit und damit auf<br />
deren gesundheitliche Auswirkungen. Zusätzlich stellt sich ihnen die Aufgabe,<br />
Freiräume für gesundheitlich angeschlagene Mitarbeiter zu schaffen, damit aus<br />
Beschwerden keine Erkrankungen, aus Einschränkungen keine Arbeitsunfähigkeitszeiten<br />
werden.<br />
Ihre Verantwortung ist vielen Führungskräften wohl bewusst. Hinweise auf vorhandene<br />
gesundheitliche Gefährdungen sprechen zu Recht ihre direkte Verantwortlichkeit<br />
an. Sie geraten rasch in die Nähe persönlicher Schuldzuweisungen.<br />
Insofern verwundert es nicht, dass viele Führungskräfte gegenüber Kritik an den<br />
Arbeitsbedingungen recht empfindlich reagieren und sie abwehren.<br />
Entlastung haben die Führungskräfte bei der Gestaltung gesunder Arbeitsbedingungen<br />
in den vergangenen Jahren vor allem durch verbesserte Standards<br />
bei der Herstellung von Anlagen, Geräten und anderen Arbeitsmitteln erfahren.<br />
Kriterien der Sicherheit und Ergonomie finden in den Entwicklungen <strong>im</strong> Anlagen-<br />
und Maschinenbau Berücksichtigung, weil <strong>im</strong>mer mehr Kunden sich <strong>im</strong><br />
Vorfeld absichern und nicht <strong>im</strong> Nachhinein kosten- und zeitaufwändig nachbessern<br />
wollen. Hierzu trägt die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische<br />
Betreuung vieler Unternehmen bei, wenn sie rechtzeitig in die Planungen einbezogen<br />
und berücksichtigt wird. Von technischer Seite werden <strong>Gesundheit</strong>srisiken<br />
mit Neuinvestitionen in der Regel reduziert, wenn das Prozessmanagement<br />
in Planung und Beschaffung st<strong>im</strong>mt. Hier funktioniert Prävention wirklich<br />
gut, allerdings ist unklar, inwieweit dadurch ein Lernprozess bei den Führungskräften<br />
einsetzt, die anschließend den Einsatz dieser Anlagen und Arbeitsmittel<br />
betreuen. Mehr Sicherheit und ergonomische Gestaltung bei Maschinen reduzieren<br />
die Anforderungen an die Anwender, sich mit <strong>Gesundheit</strong>srisiken zu<br />
beschäftigen. Dies ist die Kehrseite von risikoarmen Lieferungen frei Haus. Umgekehrt<br />
ist der Trend zu begrüßen, dass die Lieferanten in ihrem Marketing die<br />
Anforderungen des Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutzes <strong>im</strong>mer stärker hervorheben<br />
und damit selbst zur Verbreitung höherer Standards beitragen.<br />
Eine Sondersituation hat man in öffentlichen Betrieben. Durch die Pflicht zur<br />
Ausschreibung von Beschaffungen und baulichen Veränderungen und die Entscheidung<br />
für den kostengünstigsten Anbieter gerät jede Veränderung zum Problem,<br />
wenn ein wichtiger Aspekt nicht bereits vorher mitgedacht und mitgeplant<br />
wurde. Umso wichtiger ist es deshalb, dass <strong>im</strong> öffentlichen Dienst alle, die über<br />
Anschaffungen und Arbeitsplatzgestaltung entscheiden, auch die <strong>Gesundheit</strong><br />
und Sicherheit der Mitarbeiter <strong>im</strong> Blick haben und auch die betroffenen Mitarbeiter<br />
nach ihren Erfahrungen fragen. Ansonsten verschärfen aufwändige,
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 67<br />
teure Nachbesserungen die Kostenproblematik für gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen<br />
um ein Vielfaches.<br />
+ Führen Sie die Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz durch?<br />
+ Prüfen Sie <strong>Gesundheit</strong>sgefährdungen bereits <strong>im</strong> Planungsprozess für Arbeitsräume<br />
und Arbeitsplätze?<br />
– Überlassen Sie es der Arbeitssicherheit, sich um sichere und gesunde<br />
Arbeitsplätze zu kümmern?<br />
– Müssen Sie häufig nachbessern, um Ergonomie- oder Sicherheitsstandards an<br />
Arbeitsplätzen zu erfüllen?<br />
Im Rahmen der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung werden gleichzeitig <strong>im</strong>mer<br />
mehr Unternehmen und Führungskräfte mit neuen Fragen zur <strong>Gesundheit</strong><br />
ihrer Mitarbeiter konfrontiert. Erfahrungsgemäß geht es dabei häufig um<br />
Gefährdungen, die aus den Inhalten der Tätigkeit, aus arbeitsorganisatorischen<br />
Mängeln, aus Dauerkonflikten an Schnittstellen oder in Arbeitsteams oder aus<br />
hohen physischen Daueranforderungen resultieren. Gerade Letztere finden kaum<br />
Akzeptanz, wenn keine vorgeschriebenen Grenzen überschritten, von den Mitarbeitern<br />
aber offenbar dennoch Beeinträchtigungen ihrer <strong>Gesundheit</strong> erlebt<br />
werden. Das Missverständnis, dass die Einhaltung vorgeschriebener Mindeststandards<br />
<strong>Gesundheit</strong>sgefährdungen unter allen Umständen ausschließen oder<br />
den Unternehmer in jedem Falle entlasten würde, ist noch weit verbreitet.<br />
Für die Mehrheit der Führungskräfte halten damit <strong>Gesundheit</strong>sthemen in die Betriebe<br />
Einzug, auf die sie nicht vorbereitet sind. Das Wissen über Stress und Eintönigkeit,<br />
über psychosomatische Zusammenhänge, gerade auch in Verbindung<br />
mit muskulären Beschwerden, über die Stufen sich chronisch entwickelnder Zivilisationskrankheiten<br />
ist gering. Wie gut ist es, wenn Führungskräfte dieses Defizit<br />
bei sich selbst früh erkennen! Dann suchen sie nämlich nach geeigneten<br />
Partnern und verzichten eher darauf, ihre zufälligen Eigenerfahrungen auszugraben<br />
und als Handlungsorientierung zu nutzen. Die Unkenntnis ist wohl einer<br />
der Hauptgründe, dass die <strong>im</strong> Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen<br />
bei vielen Unternehmen unterbleiben oder, wo sie durchgeführt<br />
werden und wie die klassischen Sicherheitschecks aussehen. Arbeitsbedingte <strong>Gesundheit</strong>sgefahren,<br />
denen keine haftungsrechtliche Relevanz zugeschrieben wird,<br />
werden darin noch zu wenig berücksichtigt.
68<br />
Hans Günter Abt<br />
+ Gibt es in Ihrem Bereich Gespräche mit den Mitarbeitern über Arbeitsbelastungen,<br />
Sicherheit und Arbeitszufriedenheit?<br />
+ Arbeiten Sie oft mit der Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizin zusammen?<br />
– Fühlen Sie sich in Sachen <strong>Gesundheit</strong> und Sicherheit alleine gelassen?<br />
– Sind Sie ganz auf Ihre eigene Einschätzung der Arbeitssituation angewiesen?<br />
Ein Königsweg aus diesem Dilemma bietet sich aus meiner Sicht bisher nicht an.<br />
Unabhängig davon, auf welcher Ebene Entscheidungen über die technische,<br />
organisatorische oder soziale Gestaltung der Arbeit fallen, können <strong>Gesundheit</strong>saspekte<br />
von vornherein mitbehandelt werden.<br />
Die regelmäßige Einbeziehung der Mitarbeiter in Situationsanalysen kann ein<br />
Beitrag zum präventiven <strong>Gesundheit</strong>sschutz sein. Strukturierte Mitarbeiterbefragungen<br />
sind ein Weg dahin, weil sie vergleichende Analysen ermöglichen.<br />
Führungskräfte, die sich <strong>im</strong> Rahmen ihrer Fürsorgeverpflichtung aktiv an ihre<br />
Mitarbeiter wenden, um Arbeitszufriedenheit, Wohlbefinden und <strong>Gesundheit</strong>sgefährdungen<br />
zu erfragen, können früh Häufungen von gesundheitlichen<br />
Beschwerden und Erkrankungen erkennen. Die Beteiligung der Mitarbeiter an<br />
der Erarbeitung von Lösungen für erkannte Probleme ist ein weiterer Baustein.<br />
Ein bekanntes Beispiel sind <strong>Gesundheit</strong>szirkel. Sie entlasten die Führungskraft<br />
erheblich. Diese übern<strong>im</strong>mt nicht mehr die alleinige Verantwortung für geeignete<br />
Verbesserungsideen, sondern nutzt die Sachkompetenz ihrer Mitarbeiter.<br />
Darüber hinaus verbessern sich die Akzeptanz für gesundheitsförderliches Mitarbeiterverhalten<br />
und die Kommunikation ganz allgemein.<br />
Die Qualität und Intensität der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen<br />
Betreuung haben bei beiden Punkten einen erheblichen Einfluss. Wo sie über<br />
Min<strong>im</strong>alstandards hinaus gehen, entsprechendes Fachpersonal gut erreichbar ist<br />
und sich vor Ort mit den Arbeitsbedingungen auseinander setzt, sind Arbeitsmedizin<br />
und Sicherheitstechnik den Führungskräften eine wichtige Stütze be<strong>im</strong><br />
Erkennen und Beheben von <strong>Gesundheit</strong>sgefahren.<br />
5. Führungsstil als <strong>Gesundheit</strong>s- oder Krankheitsfaktor<br />
Das Thema „Führung und <strong>Gesundheit</strong>“ wird gegenwärtig nach meinem Eindruck<br />
von der Diskussion um die gesundheitsgefährdende Wirkung eines unangemessenen<br />
Führungsstils dominiert. So deutlich an Einzelbeispielen der Zusammenhang<br />
zwischen dem Führungsverhalten und der <strong>Gesundheit</strong> von Mitarbeitern<br />
sein kann, so wenig scheinen mir die generellen Zusammenhänge bisher geklärt<br />
zu sein. Je stärker sich der Anspruch von Fachtagungen auf die Praxis richtet,
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 69<br />
umso weniger kann ich eine Übereinst<strong>im</strong>mung zwischen wissenschaftlichen<br />
Ergebnissen der Betriebssoziologie und der Arbeitspsychologie und den Thesen<br />
über den Einfluss von Führung auf die <strong>Gesundheit</strong> folgen, die man den Unternehmen<br />
anbietet. Meine Kritik richtet sich dabei insbesondere auf die methodische<br />
Herangehensweise und auf die logischen Ableitungen, die vielfach vorgenommen<br />
werden. So wird als wichtigster Indikator für das Führungsverhalten<br />
die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrer Führungskraft verwendet.<br />
In vielen Mitarbeiterbefragungen kann man feststellen, dass die Zufriedenheit<br />
mit Führungskräften zu wünschen übrig lässt. Aber der Zusammenhang zu den<br />
Fehlzeiten scheint mir wesentlich enger und plausibler als der Zusammenhang<br />
zur <strong>Gesundheit</strong>. Unseriös wird es meiner Ansicht nach vor allem dann, wenn der<br />
Zusammenhang als Erfolgsrezept in der Beratung einfach umgekehrt wird und<br />
sogar noch verlängert wird:<br />
„Erhöhen Sie die Zufriedenheit mit den Vorgesetzten,<br />
• das fördert die <strong>Gesundheit</strong>,<br />
• dann steigt auch der Unternehmenserfolg!“<br />
Davon abgesehen, dass es Führungskräften generell schwer fallen wird, sich als<br />
Risikofaktor für die <strong>Gesundheit</strong> einzustufen, so ist die ablehnende Haltung der<br />
meisten Führungskräfte nachvollziehbar. Ist es ein Wunder, wenn bei Fachtagungen<br />
meist nur über, nicht mit Führungskräften diskutiert wird? Zumindest<br />
dürften Führungskräfte erkennen, dass die Verlängerung der Aussage nicht st<strong>im</strong>mig<br />
ist. Wer einmal Mitarbeiter befragt, nachdem ihnen Freiräume während der<br />
Arbeitszeit beschnitten worden sind, die sie über Jahre oder Jahrzehnte genossen<br />
hatten, wird sich keiner Illusion über eindeutige Querverbindungen von<br />
Arbeitszufriedenheit und Unternehmenserfolg hingeben. Viele Führungskräfte<br />
haben bei Unternehmensveränderungen in der Vergangenheit entsprechende<br />
Erfahrungen machen müssen. Sozialpsychologische Exper<strong>im</strong>ente haben die Leistungsabsenkung<br />
mit steigendem Gruppenkonsens durchaus messen können,<br />
wenn keine Auswahl besonders leistungsbereiter Personen stattgefunden hatte.<br />
Nicht einmal der erste Teil der These, dass Zufriedenheit und <strong>Gesundheit</strong> miteinander<br />
einher gehen, ist in dieser Einfachheit st<strong>im</strong>mig. Zum Basiswissen der<br />
Sozialwissenschaften gehört die Erkenntnis, dass auch der entgegengesetzte<br />
Zusammenhang gelten kann. In Gruppen wächst die Kohäsion, also der innere<br />
Zusammenhalt, wenn die Abgrenzung nach außen verstärkt wird. Fallbeispiele<br />
<strong>im</strong> Betrieb sehen so aus, dass sich die Führungskraft mit ihren Mitarbeitern sehr<br />
stark solidarisch fühlt, aber gegen das betriebliche Umfeld abgrenzt. Dies kann<br />
durchaus zu Lasten der <strong>Gesundheit</strong> gehen, weil bestehende Konflikte nicht gelöst,<br />
aber auch Unzulänglichkeiten an den Arbeitsplätzen nicht thematisiert werden.<br />
Das Ansprechen ungeklärter Gefährdungen wird dem sozialen Zusammenhalt<br />
geopfert, dem guten Binnenkl<strong>im</strong>a. Es muss schon best<strong>im</strong>mt werden, was Inhalt<br />
der Unzufriedenheit ist und ob <strong>Gesundheit</strong> Beachtung findet.
70<br />
Hans Günter Abt<br />
Andererseits beruhen die Behauptungen sicher nicht auf Irrtümern. Ein statistischer<br />
Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit Vorgesetzten und gesundheitlichen<br />
Indikatoren ist anzunehmen. Nur gegen die Eindeutigkeit und<br />
die rein kausale Interpretation sträuben sich die bisherigen wissenschaftlichen<br />
Befunde ebenso wie die Erfahrungen in der Beratungspraxis. Mitarbeiter erleben<br />
hohe Beanspruchungen aus ihrer Tätigkeit und aus den sozialen Beziehungen<br />
<strong>im</strong> Unternehmen natürlich als unangenehm. Sie kreiden es ihren Führungskräften<br />
natürlich oft negativ an, wenn diese sich nach ihrem Eindruck nicht für wünschenswerte<br />
Verbesserungen einsetzen. In diesem Fall leistet die Unzufriedenheit<br />
mit dem Führungsstil zwar keinen direkten Beitrag zur Erkrankung, ist aber<br />
ebenso Ergebnis des Führungsverhaltens wie die gesundheitlichen Probleme.<br />
+ Schlagen die Mitarbeiter in Ihrem Bereich <strong>im</strong>mer wieder Verbesserungen der<br />
Arbeitsbedingungen vor?<br />
– Äußern Mitarbeiter in Ihrem Bereich überwiegend pauschale Kritik an den<br />
Arbeitsbedingungen?<br />
Unbewältigter Stress aus innerbetrieblichen sozialen Beziehungen und erst recht<br />
aus der Beziehung zum Vorgesetzten ist als Anlass für psychosomatische Beschwerden<br />
auch plausibel. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Dauerkonflikten<br />
auf das vegetative System sind unbestritten. Doch der Zusammenhang<br />
zwischen Unzufriedenheit mit der Führungsperson und gesundheitlichen Beeinträchtigungen<br />
ist wahrscheinlicher als der Zusammenhang zwischen positiver<br />
Zufriedenheit und guter <strong>Gesundheit</strong>, weil die Zufriedenheit nur Aussagen<br />
zum Wegfall dieses einen Risikos beinhaltet, nicht aber zu anderen.<br />
Negative Ergebnisse zum Verhältnis von Führungskräften und Mitarbeitern bei<br />
Umfragen <strong>im</strong> Betrieb sind entsprechend vorsichtig zu handhaben. Sie geben auf<br />
jeden Fall Anlass, die Führungsbeziehung zu hinterfragen. Sie sind aber keine<br />
hinreichende Grundlage, den Führungsstil zu bewerten. Nach meinen Erfahrungen<br />
sind negative Befragungsergebnisse bei Führungskräften zu erwarten, die<br />
bei den Mitarbeitern in hohem Maße Unzufriedenheit, aber geringe Ängste<br />
auslösen, sodass ein destruktiver Konfliktverlauf die Mitarbeiter nicht von<br />
Unmutsbekundungen abschreckt, weil sie bereits mit der Führungskraft gebrochen<br />
haben. Gleiche Ergebnisse erzielen aber auch Führungskräfte, bei denen die<br />
Mitarbeiter noch positive Veränderungen erwarten. Dazwischen scheint es eine<br />
Gruppe von Führungskräften zu geben, die für Mitarbeiter nicht berechenbar<br />
sind und gelegentlich zum autoritären Gebrauch ihrer Machtposition neigen.<br />
Hier halten viele Mitarbeiter offenbar ihre Kritik am Führungsstil auch in anonymen<br />
Befragungen zurück. Sie erwarten keine Verbesserung und haben sich mit<br />
diesen Führungspersonen arrangiert. Diese Mitarbeiter wären leichter für ein<br />
Seminar mit dem Thema „Wie ich meinen Chef mit seinen Launen pflege“ zu<br />
gewinnen als für die konstruktive Auseinandersetzung.
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 71<br />
Es hat in vielen mittleren und größeren Betrieben in den Beziehungen zwischen<br />
Mitarbeitern und Vorgesetzten wesentliche Veränderungen gegeben. Die<br />
Führungsspannen wurden vergrößert, die Arbeit wurde verdichtet und zwar für<br />
beide Seiten. Hinzu kommen die Möglichkeiten der digitalen Kommunikationstechnik.<br />
Dadurch wird die direkte persönliche Kommunikation <strong>im</strong>mer stärker<br />
auf verbindliche Abklärungen zur Aufgabenerfüllung und auf Problemsituationen<br />
reduziert. Gesprächssituationen für spontanen Austausch nehmen ab, damit<br />
auch das Verständnis für die Situation des jeweils anderen. Die persönliche<br />
Kommunikation, das wichtigste Instrument zur Herstellung gemeinsamer Identitäten,<br />
geht verloren oder wird – als „Gespräch be<strong>im</strong> Chef“ – ins Negative umgepolt.<br />
In der Konsequenz entstehen oft Meinungen und Situationsbilder bei<br />
Mitarbeitern, die mit denen der Führungskräfte nur noch wenig gemeinsam<br />
haben. Dieses Auseinanderdriften fördert Missverständnisse, Misstrauen und persönliche<br />
Entfremdung voneinander. Situationen, in denen für Mitarbeiter scheinbare<br />
Ungere<strong>im</strong>theiten auftauchen, lösen oft keine Klärungsprozesse aus, sondern<br />
verdeckte Unmutsäußerungen und Unzufriedenheit bei Mitarbeitern. Doch auch<br />
Führungskräfte reagieren auf „falsche“ Einschätzungen ihrer Mitarbeiter häufig<br />
nicht mit der Suche nach besseren Kommunikationsstrategien, sondern mit<br />
der – manchmal sehr emotionalen – „Richtigstellung“ einzelner Fakten, eine<br />
Sisyphusarbeit.<br />
+ Sprechen Sie regelmäßig mit jedem Ihrer Mitarbeiter?<br />
+ Suchen Ihre Mitarbeiter häufig das Gespräch, weil sie Entscheidungen nicht<br />
verstehen?<br />
– Rufen Sie Ihre Mitarbeiter fast nur noch bei Problemen zum Gespräch?<br />
– Äußern Ihre Mitarbeiter häufig Meinungen zur Arbeitssituation, die Sie nicht<br />
teilen?<br />
Die Pauschalierung und Vereinfachung der Aussagen über Führungsstil und<br />
<strong>Gesundheit</strong> erschwert die Veränderung zu Gunsten eines offeneren Führungskonzepts.<br />
Deshalb werden diese Aussagen von Führungskräften entweder gar<br />
nicht oder nur mit sarkastischen Bemerkungen zur Kenntnis genommen. Professionelle<br />
<strong>Gesundheit</strong>sberater können jedoch in dem notwendigen Klärungsprozess<br />
bei Unzufriedenheit einen konstruktiven Ansatz zur Verbesserung finden,<br />
wenn sie vorbehaltlos damit umgehen. Das offene Gespräch zur Klärung<br />
der Meinungsverschiedenheiten ist in der Regel der erste Schritt zur Verbesserung<br />
des Verhältnisses, die Einigkeit über die Veränderungsbedürftigkeit der<br />
zweite und die Vereinbarung von Regeln für die Zukunft der dritte.<br />
Nur selten ist das Verhalten der Führungskraft alleiniger Gegenstand der Klärung.<br />
Vielmehr sind die Situationsbeschreibungen und komplementären Verhaltens-
72<br />
Hans Günter Abt<br />
weisen der Mitarbeiter einzubeziehen. Die meisten Fälle von Unzufriedenheit<br />
mit Führungskräften sind auf defizitäre Kommunikationsstrukturen oder reduziertes<br />
Kommunikationsverhalten zurückzuführen. Führungskräfte überschätzen<br />
in der Regel den Informationsstand ihrer Mitarbeiter ebenso wie deren Verständnis<br />
für die betrieblichen Prozesse und Störungen. Mitarbeiter setzen an<br />
die Stelle fehlender Informationen hingegen Vermutungen, tendenziell eher<br />
negativer Art. Informationsdefizite verbinden sich leichter mit Misstrauen als<br />
mit Vertrauen, vor allem wenn es um organisatorische Zusammenhänge geht.<br />
So mangelt es der Führungskraft in den Augen der Mitarbeiter an Engagement,<br />
an der Einsatzbereitschaft für sie, sobald Prozesse längere Zeit in Anspruch nehmen<br />
und die Transparenz darüber fehlt. Sie interpretieren kundenorientierte<br />
Flexibilität als gegen sie gerichtete oder sie wenigstens nicht berücksichtigende<br />
Willkür in betrieblichen Entscheidungen ihrer Führungskraft.<br />
Was hat das alles mit <strong>Gesundheit</strong> zu tun? Lang anhaltende Verärgerung,<br />
vermeintliche Abwertung erzeugen Ohnmachtgefühle. Die Verbesserung der<br />
Kommunikation reduziert nicht nur die negativen Gefühle, sondern fördert die<br />
aktive Auseinandersetzung mit den sozialen Beziehungen, mit den technischen<br />
und organisatorischen Gegebenheiten, weil sie die Dinge veränderbar erscheinen<br />
lässt. In funktionierenden Beziehungen fordern die Mitarbeiter auch die<br />
Unterstützung durch ihre Führungskraft ein, wenn Überbeanspruchung auftritt.<br />
Sie artikulieren ihre Schwierigkeiten und ziehen sich nicht in Krankheiten und<br />
Fehlzeiten zurück.<br />
+ Haben Sie eine Vorstellung davon, warum Ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit<br />
kommen könnten?<br />
+ Sprechen Sie mit allen Ihren Mitarbeitern nach einer Erkrankung darüber,<br />
wie es ihnen (nicht Ihnen!) geht?<br />
– Beäugen Sie kranke Mitarbeiter meistens misstrauisch?<br />
– Vermeiden Sie kritische Anmerkungen zu Fehlzeiten Ihrer Mitarbeiter ganz?<br />
Nun leisten gegenwärtig leider auch viele Unternehmensberater einen kontraproduktiven<br />
Beitrag zur Verbesserung der Führungsbeziehungen. Sie versprechen<br />
den Unternehmen Erfolge bei der Reduzierung der Fehlzeiten durch die<br />
Einführung von Stufenmodellen für Mitarbeitergespräche nach Krankheit. Oft<br />
sind hierbei nur die veröffentlichten Maßnahmen von OPEL Rüsselshe<strong>im</strong><br />
als „Konzept“ abgeschrieben und werden mit deren kurzfristiger Reduzierung<br />
der krankheitsbedingten Ausfallzeiten hochgerechnet auf den zu erwartenden<br />
Unternehmenserfolg. Die gleichzeitige Kommunikation über Fehlzeiten<br />
und <strong>Gesundheit</strong>sgefahren soll als Themenverknüpfung den Durchbruch<br />
erzielen.
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 73<br />
Die Führungskräfte geraten durch die Einführung solcher Neuerungen oft in<br />
eine widersprüchliche Situation. Die Orientierung auf Fehlzeiten fördert bei<br />
ihnen die Fixierung auf die fehlenden Mitarbeiter und löst deshalb häufig Hilflosigkeit<br />
aus, weil die Führungskräfte die Frage der Fehlzeitensenkung mit<br />
konkreten Fällen verbinden. Mit den Bedingungen, die für eine Verbesserung der<br />
Anwesenheit in der ganzen Mitarbeitergruppe wirken könnten, befassen sie sich<br />
dann nicht mehr. Dabei können sie hier viel mehr und vor allem positiv gestalten.<br />
Die Grundorientierung auf Anwesenheit oder Fehlzeiten ist daher nicht als<br />
sprachlicher Trick zu verstehen, sondern kehrt viele Fragestellungen um. Es heißt<br />
nicht mehr: „Warum meldete sich der Mitarbeiter krank? Und war dies berechtigt?“<br />
Vielmehr wird gefragt: „Was können wir tun, um angeschlagene Mitarbeiter<br />
zu schonen? Fragen unsere Mitarbeiter um Unterstützung bei Schwierigkeiten<br />
nach und erhalten sie diese auch? Kümmern wir uns genug um unsere<br />
Mitarbeiter und wissen diese, wie wichtig sie uns sind?“ Nur wenige Führungskräfte<br />
werden durch Fehlzeitensenkungsprogramme zu diesen Fragen angeregt.<br />
Rückkehrgespräche und Fehlzeitengespräche werden in den Unternehmen und<br />
auch in der Beraterszene kaum differenziert. Vom Standpunkt der Kostensenkung<br />
für den vorzuhaltenden Personalpuffer mag der Gesprächsinhalt nachrangig sein,<br />
aus Sicht der Führungsphilosophie ist er von zentraler Bedeutung. Die meisten<br />
Führungskräfte haben eine hohe Sensibilität dafür, welche Anforderungen ihre<br />
Beziehungen zu den Mitarbeitern belasten können und welche nicht. Rückkehrgespräche<br />
nach Krankheit sind beziehungsförderlich, wenn der Fürsorgecharakter<br />
<strong>im</strong> Mittelpunkt steht. Werden sie durch Belehrungen über die Bedeutung<br />
von Fehlzeiten für den Arbeitsbereich und das Unternehmen angereichert,<br />
so ändert sich ihr Charakter grundlegend. Sie sind weder fürsorgliches noch disziplinarisches<br />
Gespräch und geben den Führungskräften damit überhaupt keine<br />
klare Orientierung. Während Führungskräfte in Trainings <strong>im</strong>mer zum Aufbau<br />
positiver Beziehungen zu ihren Mitarbeitern angehalten werden, sind sie nun<br />
aufgefordert, unabhängig von konkreten Anhaltspunkten auf die betriebliche<br />
Fehlzeitenproblematik hinzuweisen und damit in den Augen der Mitarbeiter<br />
Misstrauen anzudeuten, selbst dort, wo gar kein Misstrauen herrscht. Es ist<br />
verständlich, wenn Führungskräfte solche Gespräche nicht befürworten und<br />
Ausweichstrategien entwickeln.<br />
Auch bei der Variante, dass die ersten Rückkehrgespräche in einem Stufenmodell<br />
nur auf die Fürsorge abheben, ist Führungskräften und Mitarbeitern offenbar<br />
der mögliche Zusammenhang mit späteren Fehlzeitengesprächen <strong>im</strong>mer präsent.<br />
Selbst diese Gespräche erzeugen daher leicht eine Misstrauenskultur, mit<br />
der alle Mitarbeiter überzogen werden, unabhängig davon, ob sie viele oder<br />
wenige Fehlzeiten verursachen. Damit werden Chancen für eine Intensivierung<br />
der Kommunikation über <strong>Gesundheit</strong>sthemen <strong>im</strong> Unternehmen vergeben.<br />
Rechtfertigungsverhalten tritt auf Seiten der Mitarbeiter in den Vordergrund.<br />
Dies ist keine Argumentation gegen Rückkehrgespräche oder gegen Fehlzeitengespräche,<br />
sondern nur gegen ihre Vermischung. Wenn Führungskräfte beide
74<br />
Hans Günter Abt<br />
Gespräche strikt voneinander trennen, so kommunizieren sie mit allen Mitarbeitern<br />
auf der Basis ihrer Fürsorgeverpflichtung. Nur mit wenigen kommunizieren<br />
sie auf Grund eines best<strong>im</strong>mten Fehlzeitenmusters, mit einer noch<br />
kleineren Zahl auf Grund eindeutiger disziplinarischer Verfehlungen mit<br />
arbeitsrechtlichen Folgen. Dadurch kann <strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong> Unternehmen ein<br />
Thema mit eigenständiger Berechtigung bleiben und nicht nur ein abgeleitetes<br />
Thema aus der Personalkostendiskussion.<br />
Festzuhalten bleibt: Wer Mitarbeiter also <strong>im</strong> Zusammenhang mit <strong>Gesundheit</strong><br />
nach der Arbeitszufriedenheit fragt, der sollte auch nach den Hintergründen fragen.<br />
Und – an die Adresse der oberen Führungsebenen gesagt – wer Arbeitszufriedenheit<br />
nachfragen lässt, muss sich auch selbst mit den Ergebnissen auseinander<br />
setzen. Denn ein Großteil der Unzufriedenheit ist eben keine rein<br />
persönliche Angelegenheit.<br />
+ Äußern Ihre Mitarbeiter Ihnen gegenüber Gründe für Unzufriedenheit <strong>im</strong><br />
normalen Gespräch?<br />
+ Kommt es vor, dass Ihre Mitarbeiter Lösungsvorschläge bringen, die besser<br />
sind als Ihre eigenen Ideen?<br />
– Halten Ihre Mitarbeiter mit ihrer Meinung meistens hinterm Berg?<br />
– Fühlen Sie sich durch Mitarbeiterkritik häufiger genervt?<br />
Neben der Arbeitszufriedenheit erscheint mir aus Beratersicht die Kommunikationsqualität<br />
der geeignetere Indikator, um zu einer Einschätzung über die gesundheitlichen<br />
Belange der Mitarbeiter anhand des Führungsverhaltens zu kommen.<br />
Offene Kommunikation fördert generell gute soziale Beziehungen zur<br />
überwiegenden Mehrheit der Mitarbeiter. Allerdings setzt <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
durch Kommunikation voraus, dass auch <strong>Gesundheit</strong>sthemen direkt bearbeitet<br />
werden. Die Reduzierung unstrukturierter Kommunikationsgelegenheiten kann<br />
nur durch eine bewusste, von den Führungskräften aktiv eingeforderte Gesprächskultur<br />
kompensiert werden. Wie Einzel- und Gruppengespräche zweckmäßig<br />
zu kombinieren sind, hängt von der Gesamtsituation ab. Wichtig ist, dass<br />
die Führungskraft das Thema <strong>Gesundheit</strong> nicht nur zulässt, sondern direkt<br />
danach fragt, um zu signalisieren, dass das Thema erwünscht ist.<br />
Vielleicht hört sich dieser Rat einfach an, seine Realisierung ist es nicht. Einstellungen<br />
müssen aufgebrochen, <strong>Alltag</strong>sroutinen müssen verändert werden. Und<br />
warum sollte ein Meister seine Mitarbeiter nach etwas fragen, wenn er kein Gehör<br />
oder keine Unterstützung bei der Lösung der auftauchenden Probleme erwarten<br />
kann? Eine aktive Kommunikationskultur mit den Mitarbeitern wird sich nur<br />
durchsetzen, wenn sie auch für die Führungskräfte bis zu den entscheidenden
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 75<br />
Ebenen Gültigkeit besitzt. Ansonsten bleibt sie ein positiver Ansatz, aber mit<br />
mäßigem Erfolg und mit erhöhter Frustration für die betreffende Führungskraft.<br />
Dies ist meine persönliche Übersetzung der salutogenetischen Anforderungen<br />
für die betriebliche Praxis.<br />
6. Eigene <strong>Gesundheit</strong> der Führungskräfte<br />
Mit diesem Thema habe ich mich nicht eingehend beschäftigt. Daher erhebe ich<br />
nicht den Anspruch, es umfassend darstellen zu können. Doch gerade in der<br />
Rolle als externer Projektberater gerate ich häufig in Situationen, die mir hinsichtlich<br />
der <strong>Gesundheit</strong> von Führungskräften selbst widersprüchlich erscheinen.<br />
Auf diese soll hier noch hingewiesen werden.<br />
Es gibt <strong>im</strong>mer wieder <strong>Gesundheit</strong>sförderungs-Projekte, in denen sich die<br />
Führungskräfte mit ihrer eigenen <strong>Gesundheit</strong> beschäftigen. Aber diese ist in den<br />
meisten Projekten kein Thema. Dieser Sachverhalt kann eine paradoxe Situation<br />
für Führungskräfte schaffen. Sie werden durch betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
oft mit einem für sie neuen Thema konfrontiert, für das ihnen Übung<br />
und Erfahrung völlig fehlen, weil sie ihm bisher ausgewichen sind. Oft waren<br />
Arbeitsbelastungen und <strong>Gesundheit</strong> lediglich ein Thema der Betriebsräte oder<br />
der Arbeitsmedizin. Wenn dann mit hoher Aufmerksamkeit <strong>im</strong> Unternehmen<br />
ein Projekt zur <strong>Gesundheit</strong>sförderung gestartet wird, geraten die beteiligten<br />
Führungskräfte, vor allem auf den unteren und mittleren Führungsebenen, sehr<br />
leicht unter Stress. Sie sollen über Themen kommunizieren, von denen sie zu<br />
wenig wissen oder verstehen und das auch noch unter Beobachtung. Das erzeugt<br />
Kommunikationsstress.<br />
+ Erleben Sie einen konstruktiven Umgang mit dem Thema <strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong><br />
Betrieb?<br />
+ Haben Sie das Gefühl, dass auch auf Ihre eigene <strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong> Unternehmen<br />
Rücksicht genommen wird?<br />
– Gehen Sie dem Thema <strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong> Unternehmen lieber aus dem Weg?<br />
– Haben Sie das Gefühl, dass letztendlich die ganze Verantwortung für <strong>Gesundheit</strong><br />
und Sicherheit an Ihnen hängen bleibt?<br />
Führungskräfte erleben das „Eindringen“ externer Fachleute mit oft misstrauisch<br />
beäugter Qualifikation, die direkt mit ihren Mitarbeitern kommunizieren, ihnen<br />
fremde Verfahren einsetzen und Selbstverständliches in Frage stellen. Das erzeugt<br />
Rollenunsicherheit. Hinzu kommt das bereits erwähnte Gefühl, die eigene Verantwortlichkeit<br />
vielleicht doch nicht genügend ausgefüllt zu haben. Dadurch
76<br />
Hans Günter Abt<br />
kann <strong>Gesundheit</strong>sförderung für Mitarbeiter rasch zum Distress für die Führungskraft<br />
werden. Generelle Schuldzuweisungen sind daher zu vermeiden. Im Sinne<br />
der Salutogenese sind kooperative Vorgehensweisen daher empfehlenswert. Die<br />
frühzeitige und regelmäßige Einbindung, die Erläuterung der Vorgehensweise,<br />
die weit gehende Beteiligung der Führungskräfte an konkreten Maßnahmen<br />
tragen zu einem positiven Erleben bei. Dies schließt den Hinweis auf kritische<br />
Führungssituationen oder auf die Überforderung von Führungskräften in Einzelfällen<br />
ein, nicht aus.<br />
Im Übrigen sind Führungskräfte auch Vorbilder. Legen sie Wert auf gesunde und<br />
sichere Arbeit und tun dies angemessen kund, so geben sie ihren Mitarbeitern<br />
einen Maßstab vor. Gleiches gilt für diejenigen, die Gegenteiliges praktizieren.<br />
Aber Hinweise und Anleitungen zu gesundem und sicherem Arbeiten gewinnen<br />
nur dann Glaubwürdigkeit, wenn auch die Person glaubwürdig ist, die sie<br />
verteilt.<br />
7. Resümee<br />
Das Verhältnis der Führungskräfte zum Thema <strong>Gesundheit</strong> ist nach meinem Eindruck<br />
nicht zwangsläufig belastet, aber doch sehr häufig. Persönliche Defizite<br />
<strong>im</strong> individuellen Führungsverhalten sind nur ein Teil des Problems und wahrscheinlich<br />
nicht der wichtigste. Durch alle Aspekte zieht sich die Bedeutung der<br />
innerbetrieblichen Kommunikation, die auf allen Ebenen Störungen aufweisen<br />
kann. Wer <strong>Gesundheit</strong> als Thema in seinem Unternehmen erfolgreich behandelt<br />
sehen will, sollte dafür sorgen, dass jede Führungskraft ihren Teil der Verantwortung<br />
aktiv wahrn<strong>im</strong>mt und dies auch allen untergeordneten Führungskräften<br />
sowie den Mitarbeitern deutlich macht.<br />
Der Einfluss der Führungskräfte auf die gesundheitsgerechte Gestaltung der<br />
Arbeitsbedingungen fördert <strong>im</strong> einen Fall das positive Interesse am Thema, <strong>im</strong><br />
anderen Fall die Abwehr. Auch hieran hat die betriebliche Organisation einen<br />
erheblichen Anteil, indem sie Gestaltungs- und Veränderungsprozesse durch<br />
Transparenz und Zielorientierung erleichtert oder aber durch hohen Abst<strong>im</strong>mungs-<br />
und Klärungsbedarf erschwert. Je eher ein Erfolg bei Initiativen zur Verbesserung<br />
zu erwarten ist, umso eher wird auch eine Führungskraft bereit sein,<br />
sich dafür zu engagieren.<br />
In der direkten Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist das<br />
Gesprächskl<strong>im</strong>a entscheidend. Hier gibt es <strong>im</strong>mer eingefahrene Muster. Aber wie<br />
über jedes neue Thema kann auch über die <strong>Gesundheit</strong> eine Kl<strong>im</strong>averänderung<br />
angestrebt werden, die positive Ansätze verstärkt. Die Befassung mit <strong>Gesundheit</strong>sthemen<br />
trägt viel zum Auf- oder Ausbau von Vertrauensbeziehungen zwischen<br />
der Mehrheit der Mitarbeiter und ihren Führungskräften bei, selbst wenn<br />
klar ist, dass das Unternehmen auch den eigennützigen Zweck der Anwesenheitsverbesserung<br />
damit verbindet.
Führung und <strong>Gesundheit</strong> – ein belastetes Verhältnis 77<br />
+ Haben Sie den Eindruck, dass in Ihrem Unternehmen jeder weiß, welche<br />
Verantwortung er für <strong>Gesundheit</strong> und Sicherheit der Mitarbeiter hat?<br />
+ Nehmen die meisten Führungskräfte ihre Verantwortung für die <strong>Gesundheit</strong><br />
der Mitarbeiter ernst?<br />
+ Wissen Sie, auf welche Fach- und Führungskräfte Sie be<strong>im</strong> Thema <strong>Gesundheit</strong><br />
zurückgreifen können?<br />
+ Tun Sie aktiv etwas zur Erhaltung Ihrer eigenen <strong>Gesundheit</strong>?<br />
+ Haben Sie eine Idee, was Sie selbst besser machen können, um die <strong>Gesundheit</strong><br />
der Mitarbeiter zu schützen oder zu fördern?<br />
Es sind demnach keine großen Neuerungen <strong>im</strong> Führungsverhalten, die einen<br />
Erfolg auf dem Weg zu gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen versprechen.<br />
Es erscheint mir vielmehr erforderlich,<br />
• ein verantwortliches Management auch <strong>im</strong> Hinblick auf die Mitarbeitergesundheit<br />
über alle Hierarchieebenen hinweg zu praktizieren,<br />
• die Kommunikation zwischen allen Ebenen offen und funktionsfähig zu<br />
halten und das Thema <strong>Gesundheit</strong> einzubeziehen,<br />
• den Führungskräften mit direkter Mitarbeiterverantwortung die Unterstützung<br />
für personale Kommunikation und Spielräume für gesundheitsorientierte<br />
Verbesserungen zu sichern,<br />
• die Führungskräfte mit den vorhandenen fachlichen Ressourcen zum Themenkreis<br />
<strong>Gesundheit</strong> gut zu vernetzen und für eine aktuelle Wissensbasis<br />
zu sorgen (hier fehlen allerdings noch griffige Konzepte),<br />
• das Netzwerk bei Bedarf um weitere Fachkompetenz zu erweitern, wofür<br />
inzwischen verschiedene Partner zur Verfügung stehen.
Betriebliche<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung in Kleinund<br />
Mittelbetrieben – Ein<br />
Modellprojekt der AOK Bayern<br />
1. Fragestellung<br />
Otto Gieseke<br />
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung (BGF) durch Krankenkassen hat zwar inzwischen<br />
eine ansehnliche Reife erlangt. Gleichwohl ist festzustellen, dass die große<br />
Zahl von kleineren Betrieben in Projekten Betrieblicher <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
unterrepräsentiert ist. Dieser Umstand hat die AOK Bayern dazu verleitet, von<br />
1997 bis 2002 ein Modellvorhaben zur Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung in<br />
Klein- und Mittelbetrieben durchzuführen. Das Modellprojekt sollte Ergebnisse<br />
zu folgenden Fragestellungen bringen:<br />
• Welche Konsequenzen haben die Rahmenbedingungen von Klein- und<br />
Mittelbetrieben für Aktivitäten der BGF?<br />
Die bisherigen Erfahrungen der AOK Bayern mit kleineren Betrieben haben<br />
erkennen lassen, dass diese ungünstige Voraussetzungen bieten für gängige Projektstrukturen<br />
der BGF. Die in Großbetrieben üblichen Organisationsstrukturen<br />
(ausgebauter Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutz, Personal-, Organisations- und <strong>Gesundheit</strong>smanagement)<br />
sind in Klein- und Mittelbetrieben seltener anzutreffen.<br />
• Welche BGF-Produkte sind für die besondere Situation von Klein- und<br />
Mittelbetrieben geeignet?<br />
Gängige Methoden in der BGF wie z.B. Krankenstandsanalysen und Mitarbeiterbefragungen<br />
sind <strong>im</strong> Rahmen von Projekten in Großbetrieben entwickelt worden.<br />
Sie sind nicht ohne weiteres auf Kleinbetriebe übertragbar.<br />
• Lassen sich BGF-Ansätze für Branchen entwickeln?<br />
Die Vielzahl von kleinen und mittleren Betrieben lässt zwangsläufig die Frage<br />
nach ressourcenschonenden Vorgehensweisen für die BGF aufkommen, insbesondere<br />
nach branchenbezogenen Verfahren.
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung in Klein- und Mittelbetrieben 79<br />
• In welchem Umfang können die Berufsgenossenschaften BGF-Aktivitäten<br />
unterstützen?<br />
Aus Auftrag, Tradition und Selbstverständnis heraus verfolgen Krankenkassen<br />
und Berufsgenossenschaften zum Teil unterschiedliche Aufgaben. Kompetenzen<br />
und Erfahrungen sind daher verschieden, beide haben aber große Bedeutung für<br />
die <strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong> Betrieb.<br />
2. Struktur der teilnehmenden Betriebe<br />
Am Modellprojekt waren insgesamt 93 Betriebe, Berufsschulen und Innungen<br />
beteiligt. 18 Betriebe waren in die vier verschiedenen Branchenansätze (in den<br />
Bereichen Pflege, Friseure, Polstermöbel und Bau) integriert, ein Projekt fand in<br />
einer Bodenlegerinnung statt, zwei Multiplikatorenschulungen bezogen sich auf<br />
die Bereiche Steintechnik sowie Schreiner-/Z<strong>im</strong>merer-/Bauhandwerk.<br />
2.1 Betriebsgrößen<br />
In den Betrieben waren zwischen min<strong>im</strong>al zwei und max<strong>im</strong>al 430 Mitarbeitern<br />
beschäftigt. Die folgende Abbildung stellt die Anzahl der Betriebe in den verschiedenen<br />
Größenklassen dar, die Kooperations-Projekte (Schulen, Innungen)<br />
wurden unter die Kategorie „Sonstiges“ aufgenommen.
80<br />
2.2 Branchenzugehörigkeit<br />
Otto Gieseke<br />
Bei der Zugehörigkeit zu verschiedenen Wirtschaftszweigen zeigt sich ein sehr<br />
breites Spektrum der Modellprojekte. Die in Abbildung 2 vorgenommene Kategorisierung<br />
orientiert sich vor allem an strukturellen und Tätigkeitskriterien,<br />
die für die betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung von Bedeutung sind, sodass Abweichungen<br />
von den Festlegungen der amtlichen Statistik möglich sind.<br />
Das Friseurgewerbe ist mit 14% sehr stark vertreten, gleichauf liegen die sonstigen<br />
Dienstleistungen und der Bereich Verwaltung (Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe,<br />
Verkehr und Nachrichtenübermittlung sowie Gastgewerbe,<br />
aber auch Reinigungen/Wäschereien und Stadtverwaltungen wurden hierzu<br />
gezählt). Danach folgt die Automobil- und Zulieferbranche, deren Anteil 12%<br />
ausmacht. Die Zuliefererbetriebe sind überwiegend dem Elektro- und Metallgewerbe<br />
zuzuordnen, das ebenfalls stark repräsentiert ist. Auch finden sich<br />
zahlreiche Alten-/Pflegehe<strong>im</strong>e und Krankenhäuser unter den Modellbetrieben<br />
(11%).
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung in Klein- und Mittelbetrieben 81<br />
3. Projektergebnisse<br />
3.1 Motive und Gründe für die Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
Da kleineren Unternehmen die Ansätze Betrieblicher <strong>Gesundheit</strong>sförderung häufig<br />
weniger vertraut sind, ist es von besonderer Bedeutung zu erfahren, welche<br />
Motivationslagen in den Betrieben anzutreffen sind. Wenn der Betrieblichen<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung eine größere Verbreitung zukommen soll, dann ist es für<br />
den „Verkauf“ der BGF wichtig, an die vorhandenen Motive und Erwartungen<br />
anzuknüpfen.<br />
Für 36% der Betriebe war es wichtig, Hilfestellungen zur Senkung des Krankenstandes<br />
zu bekommen. Vor allem bei starkem Konkurrenz- und Kostendruck war<br />
dies eine vorrangige Motivation.<br />
Fast gleich hoch mit 32% war der Wunsch anzutreffen, mehr für die <strong>Gesundheit</strong>ssituation<br />
der Mitarbeiter zu tun. Diese Haltung war häufig in den Betrieben<br />
anzutreffen, die sich durch ein relativ gutes Betriebskl<strong>im</strong>a und gute persönliche<br />
Beziehungen zwischen Inhaber und Mitarbeitern auszeichnen. Aber auch die<br />
Krankheitsbiografien von Inhabern (z.B. <strong>im</strong> Beruf erworbene Rückenprobleme)<br />
spielten eine nicht unbedeutende Rolle. 5% der Betriebe stellen die Vorbildfunktion<br />
des Inhabers heraus.<br />
26% der Betriebe äußerten zu Beginn des Projekts konkrete Probleme, die ihnen<br />
Sorge machten. Im Vordergrund standen hier ergonomische Probleme, derer sich<br />
die Betriebe häufig bewusst sind, wie z.B. <strong>im</strong> Pflegebereich.
82<br />
Otto Gieseke<br />
Das Bedürfnis, <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>s- und Qualitätsmanagement weiter zu kommen,<br />
zeichnet eher größere Betriebe aus. Betriebe, die schon Erfahrungen mit einem<br />
Qualitätsmanagement gesammelt haben, erwarten sich von der Betrieblichen<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung eine weitere Steigerung ihrer bisherigen Anstrengungen,<br />
z.B. die BGF <strong>im</strong> Leitbild zu verankern.<br />
3.2 Besondere Rahmenbedingungen von Klein- und Mittelbetrieben<br />
und deren Auswirkungen für die BGF<br />
Wie einleitend beschrieben, stehen kleinere Betriebe unter anderen Produktionsbedingungen<br />
als größere Betriebe. Ihre Organisation ist weniger differenziert,<br />
es liegen relativ wenige Erfahrungen mit Projektmanagement vor, der<br />
Arbeits- und <strong>Gesundheit</strong>sschutz ist wenig formalisiert, Auftragsspitzen oder<br />
Krankenstände können den gesamten Betriebsablauf verändern.<br />
Diese Umstände schaffen besondere Voraussetzungen für Maßnahmen der<br />
Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung. Der Beratungsaufwand liegt in der Regel<br />
relativ hoch, da die Erfahrungen mit Betrieblicher <strong>Gesundheit</strong>sförderung oder<br />
verwandten Instrumenten wie z.B. Verfahren der Qualitätssicherung nur teilweise<br />
vorliegen. Dies bedeutet häufig auch, dass auf die Berater für BGF ein erhöhter<br />
Steuerungsaufwand zukommt, der in größeren Betrieben von best<strong>im</strong>mten<br />
Personen oder Abteilungen selber wahrgenommen wird.<br />
Auf der anderen Seite ist aber herauszustellen, dass die unkomplizierte Organisationsstruktur<br />
von kleineren Betrieben kurze Entscheidungswege für die<br />
Umsetzung von BGF-Maßnahmen zur Folge hat.<br />
Die in größeren Betrieben bewährten Formen der Projektdurchführung, z.B. die<br />
Bildung eines Arbeitskreises <strong>Gesundheit</strong> in der üblichen Zusammensetzung,<br />
stoßen schnell an Grenzen. Auf Grund der relativ kleinen Mitarbeiterzahl sind<br />
auch best<strong>im</strong>mte Standardinstrumente der BGF wie Krankenstandsanalysen und<br />
Mitarbeiterbefragungen nur eingeschränkt möglich.<br />
Die hohe Empfindlichkeit kleinerer Betriebe für Fehlzeiten oder Auftragsspitzen<br />
erschwert auch die Kontinuität eines BGF-Projekts, da häufig verabredete Termine<br />
nicht eingehalten werden können.<br />
Sowohl diese Besonderheiten der Produktionsweise als auch die eingeschränkten<br />
Möglichkeiten für BGF-Standardinstrumente zwingen zu einer sehr flexiblen<br />
Vorgehensweise sowie zum Einsatz von so genannten „Kompaktinstrumenten“.<br />
Dies ist <strong>im</strong> Übrigen nicht nur eine Folge der Rahmenbedingungen von kleineren<br />
Betrieben, sondern wird von diesen häufig explizit auch eingefordert. So ist<br />
z.B. der in der BGF bewährte „<strong>Gesundheit</strong>szirkel“, der der Analyse von Belastungen<br />
und der Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen dient, <strong>im</strong> Rahmen<br />
des Projekts auf die Hälfte der sonst üblichen Sitzungstermine (von ca. 8 auf
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung in Klein- und Mittelbetrieben 83<br />
4 Sitzungen) konzentriert worden. Ähnliche Anpassungen mussten auch für die<br />
Verfahren <strong>im</strong> Ergonomiebereich vorgenommen werden. Auch ist für die Auswertung<br />
der Krankenstandsdaten eine Kompaktvariante mit ausgewählten<br />
AU-Indikatoren entwickelt worden.<br />
3.3 Branchenansätze<br />
Die Vielzahl von kleinen und mittleren Betrieben und der damit verbundene<br />
hohe Beratungs- und Projektaufwand ließen die Frage nach ressourcenschonenden<br />
Vorgehensweisen aufkommen. Ein <strong>im</strong> Modellprojekt verfolgter Weg liegt<br />
in einem betriebsübergreifenden Ansatz, der in Kooperation mit Innungen und<br />
Ausbildungsstätten/Berufsschulen verfolgt wurde. Relativ homogene Arbeitsbedingungen<br />
und -belastungen erleichtern die Entwicklung branchenbezogener<br />
Lösungen. Überbetriebliche Einrichtungen wie z.B. Berufsschulen bieten günstigere<br />
Rahmenbedingungen für Präventionsprojekte als die Produktionsweisen von<br />
Kleinbetrieben.<br />
Ein weiterer Ansatz besteht in der Anwendung von branchenspezifischen Leitfäden,<br />
mit deren Hilfe die Betriebe ihre <strong>Gesundheit</strong>ssituation selbst bewerten<br />
können. Im Unterschied zu allgemeinen Leitfäden, die nur formal die Vorgehensweisen<br />
eines Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>smanagements aufzeigen, sind bei<br />
branchenbezogenen Leitfäden die spezifischen <strong>Gesundheit</strong>sbelastungen der Branche<br />
eingearbeitet. Darüber hinaus sind zu den jeweiligen Belastungen auch<br />
Lösungsmöglichkeiten aufgeführt, die in anderen Betrieben bereits erfolgreich<br />
umgesetzt wurden.<br />
Im Rahmen des Modellprojekts wurden für vier Branchen Ansätze entwickelt,<br />
die <strong>im</strong> Folgenden kurz skizziert werden:<br />
• Friseurgewerbe,<br />
• Polstermöbelhandwerk,<br />
• Baugewerbe und<br />
• stationäre Altenpflege.<br />
Branchenansatz Polstermöbel<br />
In der Polstermöbelbranche sind überwiegend Klein- und Mittelbetriebe angesiedelt.<br />
In der Modellregion Oberfranken, die als ein Zentrum der Polstermöbelherstellung<br />
in Europa gilt, liegt die Betriebsgröße <strong>im</strong> Durchschnitt bei etwa 100<br />
Beschäftigten. Der Krankenstand ist mit 6,6% <strong>im</strong> Jahr 1999 der höchste <strong>im</strong> Branchenvergleich<br />
in der AOK-Direktion Coburg, wobei die Tätigkeitsgruppe der<br />
Polsterer, Näherinnen und Zuschneiderinnen sogar noch darüber liegt (7,4%).<br />
Auch hier spielt die Diagnosegruppe 13 (der Bereich Skelett, Muskeln, Sehnen<br />
etc.) eine zentrale Rolle, gefolgt von Verletzungen etc. und Herz-Kreislauf-<br />
Erkrankungen.
84<br />
Otto Gieseke<br />
Die Situation in der Polstermöbelbranche in Oberfranken ist neben dem Fachkräftemangel<br />
durch eine starke regionale Konkurrenz gekennzeichnet, die durch<br />
Anbieter kostengünstiger Produkte aus den <strong>im</strong> Osten angrenzenden Ländern und<br />
den Preisdruck großer Möbelhäuser noch weiter verschärft wird. Auswirkungen<br />
auf die Arbeitssituation sind unter anderem ein gesteigertes Produktionstempo<br />
und erhöhte Anforderungen an Kreativität und Flexibilität, die zu zusätzlichen<br />
physischen und psychischen Belastungen führen – dies vor dem Hintergrund,<br />
dass die Tätigkeiten in der Polstermöbelherstellung grundsätzlich durch starke<br />
körperliche Beanspruchungen gekennzeichnet sind.<br />
Unter Beteiligung der Berufsgenossenschaften Holz und Lederindustrie und der<br />
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wurde ein „Leitfaden zur<br />
betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung in der Polstermöbelindustrie“ entwickelt,<br />
der die Hauptbelastungssituationen analysiert, darstellt und Verbesserungsmöglichkeiten<br />
bzw. Hilfestellungen aufzeigt. Er soll die Betriebe dabei unterstützen,<br />
Problemschwerpunkte zu identifizieren, Lösungen zu entwickeln und auf diese<br />
Weise ein betriebliches <strong>Gesundheit</strong>smanagement zu etablieren.
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung in Klein- und Mittelbetrieben 85<br />
Auszug aus: Leitfaden zur BGF in der Polstermöbelindustrie<br />
Veränderungsbedarf<br />
aus der<br />
Sicht des Betriebes<br />
Informationen/<br />
Angebote/<br />
Hilfestellungen<br />
Leitfragen für die<br />
Umsetzung<br />
Probleme/<br />
Belastungen/<br />
Gefährdungen<br />
Arbeitsbereiche/<br />
Tätigkeit<br />
• Zuschnitt:<br />
1.1 Arbeitsplatzgestaltung/Technische Ausstattung<br />
Stehen den MitarbeiterInnen<br />
höhenverstellbare (evtl. hydraulische)<br />
Schneidetische zur<br />
Verfügung?<br />
Wird von den MA die Möglichkeit<br />
genutzt, von allen Seiten des<br />
Tisches aus anzuzeichnen und<br />
zuzuschneiden?<br />
� Weites Vorbeugen<br />
am Schneidetisch<br />
1.1.1 Schneidetisch<br />
• Überlastung der<br />
Wirbelsäule/Bandscheiben<br />
bedingt<br />
Rückenschmerzen<br />
Stehen ausreichende und<br />
funktionelle Flurfördermittel wie<br />
z.B. Scherenhubwagen (Ablagen<br />
für Lederteile und Schablonen)<br />
zur Verfügung?<br />
� Physische<br />
Belastung durch<br />
Heben/Tragen<br />
schwerer<br />
Schablonen und<br />
Lederteile<br />
zum Arbeitstisch<br />
1.1.2 Schablonen
86<br />
Otto Gieseke<br />
Die Ergebnisse der Krankenstands- und Bewegungsanalysen, Mitarbeiterbefragungen,<br />
<strong>Gesundheit</strong>szirkel etc. bildeten die Grundlage zur Gestaltung des „Leitfadens<br />
zur betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung in der Polstermöbelindustrie“. Er<br />
ergänzt die „Gefährdungsanalyse <strong>im</strong> Holzbereich“ der Berufsgenossenschaften<br />
Holz und Lederindustrie, wurde in ihre Informationsmedien integriert und stellt<br />
in systematischer Weise die zentralen und in allen Betrieben in ähnlicher Weise<br />
auftretenden Belastungsbereiche (schweres Heben, körperliche Zwangshaltungen,<br />
Zeitdruck, Lärm, monotone Tätigkeiten etc.) dar. Darüber hinaus enthält er<br />
für die verschiedenen Arbeitsbereiche und die dazugehörigen Tätigkeiten Leitfragen<br />
zur Umsetzung der Verbesserungsvorschläge bzw. konkrete Tipps sowie<br />
Informationen zu entsprechenden Angeboten und Hilfestellungen.<br />
Branchenansatz Pflege<br />
In der stationären Altenpflege werden hohe Anforderungen an die physische und<br />
psychische Belastbarkeit der Pflegekräfte gestellt. Der Umgang mit pflegebedürftigen<br />
Menschen und deren Angehörigen, der Umgang mit Sterbenden, aber auch<br />
organisatorisch bedingte Belastungen wie z.B. unbefriedigend geregelte Dienstpläne<br />
werden als Belastungen <strong>im</strong>mer wieder angeführt. Rücken- und Atemwegserkrankungen<br />
sowie psychische Störungen liegen den Arbeitsunfähigkeiten<br />
häufig zu Grunde.<br />
Die überdurchschnittlich hohe Quote an Berufsaussteigern von 80% innerhalb<br />
der ersten 5 Jahre zeigt zudem, dass ein Großteil der Beschäftigten mit ihrer<br />
Arbeitssituation unzufrieden ist.<br />
Die Projekterfahrungen in der stationären Altenpflege haben gezeigt, dass die<br />
arbeitsbedingten <strong>Gesundheit</strong>sbelastungen relativ homogen sind. Dieser Umstand<br />
hat es ermöglicht, die typischen Belastungssituationen und die dazu mit den<br />
Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsmöglichkeiten in Form eines Leitfadens<br />
zusammenzustellen. Damit wird den Pflegeeinrichtungen <strong>im</strong> Rahmen von BGF-<br />
Projekten ein Instrumentarium an die Hand gegeben, das eine Auseinandersetzung<br />
mit der eigenen <strong>Gesundheit</strong>ssituation <strong>im</strong> Betrieb erlaubt. So genannte „Leitfragen“<br />
erleichtern die Prüfung der Frage, was <strong>im</strong> eigenen Betrieb auf welche<br />
Weise umgesetzt werden kann. Die angeführten Verbesserungsvorschläge sowie<br />
weitere Hilfestellungen erleichtern die Realisierung.<br />
Wichtig ist, dass die Anwendung des Leitfadens in den Pflegeeinrichtungen<br />
<strong>im</strong>mer in einen Beratungsprozess der AOK eingebettet ist.
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung in Klein- und Mittelbetrieben 87<br />
Auszug aus: Leitfaden <strong>Gesundheit</strong> für Beschäftigte in der ambulanten und stationären Altenpflege<br />
Problembereiche/ Probleme/ Leitfragen für Informationen/ Veränderungs-<br />
Tätigkeit Belastungen die Umsetzung Angebote/ bedarf<br />
Hilfestellungen<br />
• Bett wenn möglich so einstellen,<br />
dass der Transfer<br />
mit einem leichten Gefälle<br />
bewerkstelligt werden kann.<br />
• Sind die Betten höhenverstellbar?<br />
• Hohe Belastungen insbesondere<br />
<strong>im</strong> Bereich<br />
der Lendenwirbelsäule<br />
durch Rumpfbeugehaltungen,<br />
häufig mit<br />
gleichzeitiger Körperrotation<br />
und durch statische<br />
Körperhaltungen<br />
mit nach vorne geneigtem<br />
Rumpf.<br />
B) Transfer des<br />
Pflegebedürftigen<br />
• Sind die Fuß- und Seitenteile<br />
der Rollstühle<br />
leicht abnehmbar?<br />
z.B. Bett ❖ Rollstuhl<br />
Rollstuhl ❖❖ Stuhl<br />
• Rollstuhl möglichst nahe<br />
dem Bett positionieren,<br />
Armlehnen abbauen,<br />
Fußstützen einklappen!<br />
• Auch dem Pflegebedürftigen<br />
selbst können entsprechende<br />
Hilfsmittel (z.B. Rutschbretter)<br />
zur Verfügung<br />
gestellt werden, um dessen<br />
Ressourcen besser ausnutzen<br />
und einen höheren Grad<br />
an Unabhängigkeit erreichen<br />
zu können.<br />
• Stehen geeignete<br />
kleine Hilfsmittel zur<br />
Unterstützung des<br />
Transfers zur Verfügung<br />
(z.B. Rutschbrett, Drehscheibe,Mobilisationsgurt,<br />
Stecklaken)<br />
• Wird ein vertikales<br />
Anheben bzw. Tragen<br />
des Pflegebedürftigen<br />
vermieden?<br />
Ein rückenschonender Transfer<br />
sollte durch Techniken der<br />
Schwerpunktverlagerung und<br />
durch das Ziehen, Schieben<br />
oder Bewegen des Pflegebedürftigen<br />
bewerkstelligt<br />
werden.
88<br />
Branchenansatz Friseure<br />
Otto Gieseke<br />
Der Friseurberuf ist gekennzeichnet durch überwiegend stehende Tätigkeiten<br />
in Verbindung mit einseitigen Belastungen des Muskel- und Skelettsystems.<br />
Steh- bzw. Sitzhilfen finden nur langsam Einzug in die Betriebe, die Bewegungsvariation<br />
ist vergleichsweise gering und ungünstige Körperhaltungen überwiegen<br />
wie z.B. das ständige Arbeiten mit hochgehaltenen Armen.<br />
Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems sowie des Bindegewebes (ICD 13)<br />
sind eine häufige Ursache für Fehltage <strong>im</strong> Friseurgewerbe. Von Muskelverspannungen,<br />
-verhärtungen <strong>im</strong> Schulter- und Nackenbereich über leichtere Rückenschmerzen<br />
(HWS-/LWS-Syndrom) bis zu degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule<br />
(Diskopathien) sind nahezu alle bedeutenden Krankheitsbilder vertreten.<br />
Ca. 10% der Krankschreibungen sind auf Rückenprobleme zurückzuführen, die<br />
rund 17% aller AU-Tage verursacht haben.<br />
Die <strong>im</strong> Friseurgewerbe herrschenden Arbeitsbedingungen, die von den Beschäftigten<br />
auszuführenden Tätigkeiten und die daraus resultierenden gesundheitlichen<br />
Belastungen sind in den einzelnen Betrieben weit gehend identisch. Es<br />
überwiegen Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten. Von Seiten der<br />
Anbieter von Maßnahmen der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung ist es kaum<br />
möglich, jedes einzelne Friseurgeschäft in die Programme der betrieblichen<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung einzubeziehen.<br />
Deshalb hat die AOK Bayern einen betriebsübergreifenden Ansatz <strong>im</strong> Einzugsbereich<br />
der Berufsschule Erding entwickelt, bei dem die Auszubildenden zentral<br />
angesprochen werden. Die Betriebe müssen keine Arbeitszeit zur Verfügung<br />
stellen, die AOK-Experten nicht jeden Ausbildungsbetrieb einzeln aufsuchen und<br />
Probleme durch das Rauslösen von Mitarbeitern aus dem Arbeitsprozess lassen<br />
sich vermeiden. Damit ist ein ressourcenschonendes Vorgehen gegeben. Zum<br />
anderen wird pr<strong>im</strong>ärpräventiv auf die jungen Altersgruppen abgestellt, bevor sich<br />
gesundheitsschädigende Verhaltensweisen verfestigen können.<br />
Seit 1997 werden einmal jährlich in der 10. Klasse des Fachbereichs Friseure<br />
erweiterte Bewegungsanalysen am Arbeitsplatz in der Lehrwerkstätte durchgeführt,<br />
die folgende Elemente beinhalten:<br />
• Wissensvermittlung: Grundkenntnisse zu Wirbelsäulenfunktion und berufstypischen<br />
Belastungen sowie <strong>Gesundheit</strong>stipps;<br />
• Fachpraxis: Analyse der konkreten Belastungen am Arbeitsplatz <strong>im</strong> Friseursalon<br />
der Berufsschule und Vermittlung von Ausgleichsübungen, wobei die<br />
Lehrkräfte als Co-Moderatoren eingebunden werden;<br />
• Refreshing-Einheit: Wiederholen der wesentlichen Elemente und individuelle<br />
Beratung zur Verfestigung des Erlernten (Diese Unterrichtseinheit wird seit<br />
1999/2000 <strong>im</strong> letzten Schuljahr der Ausbildung angeboten).
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung in Klein- und Mittelbetrieben 89<br />
Auszug aus der AOK-Broschüre: Gesunder Rücken <strong>im</strong> Friseurhandwerk
90<br />
Otto Gieseke<br />
Die vielfältigen Erfahrungen <strong>im</strong> Verlauf der Belastungsanalysen und Schulungen<br />
führten zur Entwicklung von Anleitungsplakaten für die Friseursalons und mündeten<br />
in der Erstellung der Broschüre „Gesunder Rücken <strong>im</strong> Friseurhandwerk“.<br />
Sie wird einerseits <strong>im</strong> Schulunterricht eingesetzt, um mittels Visualisierung die<br />
richtige Ausführung von Bewegungsabläufen und Übungen einprägsamer zu<br />
gestalten. Zum anderen dient sie der „Hilfe zur Selbsthilfe“ <strong>im</strong> Arbeitsalltag in<br />
den Betrieben.<br />
Erste Gruppeninterviews mit zwei Friseurklassen 1999 zeigten, dass es zunächst<br />
nicht einfach war, das Erlernte in den betrieblichen <strong>Alltag</strong> zu transferieren. Mit<br />
der Einführung der „Refreshing-Einheit“ sollte dem entgegen gewirkt werden.<br />
In einer zweiten Befragung gaben die Auszubildenden an, dass die Tipps für sie<br />
persönlich hilfreich waren und es gelang, die Verhaltensempfehlungen in der<br />
Arbeit umzusetzen, wenn sie vom Inhaber unterstützt wurden.<br />
Die Einbindung der zuständigen Fachlehrer als Co-Moderatoren trug zur gesteigerten<br />
Akzeptanz bei den Auszubildenden bei. Durch die Übertragung von<br />
organisatorischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten konnte nicht nur das<br />
Engagement der Lehrkräfte gesteigert, sondern eine Verstetigung der jährlich<br />
stattfindenden Aktivitäten erreicht werden.<br />
Die Kooperationspartner Berufsschule, Friseurinnung Erding und AOK Bayern<br />
werden das Projekt gemeinsam fortsetzen und durch die kontinuierliche Rückkoppelung<br />
der Ergebnisse laufend weiterentwickeln. Die AOK Bayern ist dabei,<br />
das Projekt auf andere Regionen auszudehnen.<br />
Branchenansatz Baugewerbe<br />
Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft berichtet über gesundheitliche<br />
Beeinträchtigungen, ein etwa gleich hoher Anteil scheidet noch<br />
vor Erreichen der Rentenaltersgrenze als berufs- oder erwerbsunfähig aus dem<br />
Arbeitsleben aus. 1<br />
Der Krankenstand <strong>im</strong> Baugewerbe ist trotz einer relativ günstigen Altersstruktur<br />
überdurchschnittlich hoch. In 2000 waren die AOK-Versicherten in der Baubranche<br />
<strong>im</strong> Mittel 21,7 Tage <strong>im</strong> Jahr krankgeschrieben, wohingegen der gesamtwirtschaftliche<br />
Durchschnitt bei 19,7 Fehltagen lag. Die meisten Ausfallzeiten sind<br />
auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurückzuführen. Häufig sind arbeitsbedingte<br />
Ursachen wie das Heben und Tragen schwerer Lasten, das Arbeiten in<br />
ungünstigen Körperhaltungen (z.B. bei Fliesenlegern und Rohrleitungsinstallateuren)<br />
und Witterungseinflüsse dafür verantwortlich. Auf Grund arbeitsbedingter<br />
1 Redmann, A./Rehbein, I.: Krankheitsbedingte Fehlzeiten <strong>im</strong> Baugewerbe, WldO-<br />
Materialien 42, Bonn 1999.
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung in Klein- und Mittelbetrieben 91<br />
Auszug aus der AOK-Broschüre: Gesunder Rücken <strong>im</strong> Bauhandwerk
92<br />
Otto Gieseke<br />
Expositionen sind Bauarbeiter auch überdurchschnittlich von Haut- und Atemwegserkrankungen<br />
sowie Lärmschwerhörigkeit betroffen. Es kommt <strong>im</strong> Baugewerbe<br />
öfter zu Arbeitsunfällen als in anderen Wirtschaftszweigen, besonders<br />
häufig bei Gerüstbauern, Z<strong>im</strong>merern, Dachdeckern und Betonbauern. 2<br />
In vielen Betrieben der Baubranche sind Aktivitäten der Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
erheblich erschwert, da:<br />
• die Beschäftigten in der Regel auf wechselnden Baustellen arbeiten und somit<br />
für regelmäßige Maßnahmen kaum greifbar sind,<br />
• es sich gerade in der Modellregion Unterfranken oft um Kleinunternehmen<br />
mit ungünstigen strukturellen und/oder personellen Voraussetzungen handelt,<br />
die stark von der aktuellen Auftragslage abhängig sind,<br />
• die Unternehmensleitungen in vielen Fällen wenig aufgeschlossen sind. Häufig<br />
haben sie die Einstellung, dass hohe Arbeitsbelastungen am Bau einfach<br />
„dazu gehören“ und Abhilfe nicht zu schaffen ist. 3<br />
Deshalb hat die AOK Bayern gemeinsam mit den Bauinnungen Schweinfurt,<br />
Rhön-Grabfeld und Würzburg vereinbart, über deren Ausbildungseinrichtungen<br />
geeignete Zugangswege zu den Auszubildenden zu erschließen.<br />
Über die Auszubildenden werden die Schulungsinhalte beispielsweise des Rückentrainings<br />
in zahlreiche Betriebe getragen. Die in den Bauinnungen beschäftigten<br />
Lehrkräfte, Ausbildungsleiter und Geschäftsführer etc. fungieren durch ihren<br />
Kontakt mit den Unternehmen ebenfalls als Multiplikatoren und Meinungsbildner.<br />
So werden z.B. <strong>im</strong> Rahmen von überbetrieblichen Innungsveranstaltungen<br />
die Inhalte des <strong>Gesundheit</strong>sförderungsprojekts und die Schwierigkeiten<br />
in der Umsetzung am Arbeitsplatz sowie der Unterstützungsbedarf für die Auszubildenden<br />
thematisiert.<br />
In den Lehrwerkstätten der drei beteiligten Bauinnungen, in denen die Auszubildenden<br />
regelmäßig zusammenkommen, werden die Arbeitsbelastungen und<br />
deren Auswirkungen beispielsweise auf die Wirbelsäule praxisnah demonstriert.<br />
Die vorhandenen Arbeitsmittel wie Schaufel, Schubkarre, Schaltafel etc. ermöglichen<br />
ein Einüben ergonomisch adäquater Verhaltensweisen unter alltagsnahen<br />
Arbeitsbedingungen. Der Arbeitsmedizinische Dienst der Berufsgenossenschaft<br />
Bau als weiterer zentraler Kooperationspartner des Projekts beteiligt sich an der<br />
Wissensvermittlung zum Thema Rückengesundheit.<br />
Seit 1999 haben insgesamt 702 Auszubildende an den Schulungen teilgenommen.<br />
In Auswertungsgesprächen betonten sie insbesondere die Notwendigkeit<br />
2 Badura, B. u.a.: Leitfaden für das betriebliche <strong>Gesundheit</strong>smanagement, Bielefeld 1998.<br />
3 Hartmann, B. u.a.: Das bauspezifische Rückentraining für Auszubildende, in: Ergo-Med<br />
Zeitschrift für die arbeitsmedizinische und arbeitshygienische Praxis, 24. Jahrgang, 2001.
Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung in Klein- und Mittelbetrieben 93<br />
der Akzeptanz durch die Vorgesetzten und Kollegen in den Betrieben. Diese soll<br />
künftig verstärkt durch die bereits erwähnten Innungsveranstaltungen zum Thema<br />
„Rückengesundheit <strong>im</strong> Bauhandwerk“ gefördert werden. Aus ökonomischen<br />
Gründen wird auch die Einbindung von Multiplikatoren (Lehrkräfte, Ausbildungsleiter)<br />
zur Durchführung des Rückentrainings angestrebt.<br />
Das Projekt wird auf weitere Regionen in Bayern ausgedehnt.<br />
4. Kooperation mit den Berufsgenossenschaften<br />
Wie bereits bei der einleitenden Zielformulierung des Modellprojekts dargestellt,<br />
war die in § 20 SGB V formulierte Zusammenarbeit zwischen den gesetzlichen<br />
Unfallversicherungen und den Krankenkassen Gegenstand des Vorhabens.<br />
Es hat sich gezeigt, dass in der konkreten Zusammenarbeit Synergieeffekte entstehen<br />
können. Dies gilt sowohl in der Analysephase wie auch bei begleitenden<br />
Aktionen und Informationsveranstaltungen; dies besonders bei Themen, in<br />
denen die gesetzlichen Unfallversicherungen besondere Kompetenzen haben,<br />
wie z.B. Lärm, Hautschutz etc.<br />
Grundsätzlich ist als Resultat des Modellprojekts festzuhalten, dass die Art des<br />
Engagements der Berufsgenossenschaften (BG) sehr heterogen ist. In elf Betrieben<br />
nahmen BG-Vertreter aktiv am Prozess der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
teil. Dabei reichten die Aktivitäten von der Beteiligung an Arbeitsplatzbesichtigungen<br />
oder am Arbeitskreis <strong>Gesundheit</strong> bis hin zur Durchführung eigener<br />
ergänzender Aktivitäten, z.B. bei einem Projekt gemeinsam mit dem Polstermöbelfachverband<br />
von Oberfranken und der Holz-BG. Bei einer gemeinsamen<br />
Aktion zum Thema Arbeitssicherheit und Verhalten bei schwerem Heben und<br />
Tragen (sowie zum Thema Lärm) wurde von der Berufsgenossenschaft die theoretische<br />
Seite abgedeckt, und die AOK Bayern übernahm die praktischen Anteile<br />
bei der Gestaltung. Eine ähnliche Ergänzung ergab sich bei einer Logistikfirma.<br />
Hier übernahm die BG Großhandel und Lagerei die Untersuchung der<br />
Belastungen der Mitarbeiter mittels einer Videoanalyse, während die AOK die<br />
<strong>Gesundheit</strong>szirkel durchführte.<br />
In den meisten Fällen konnten sich die Berufsgenossenschaften nicht aktiv<br />
einbringen. Dies wurde mit Kapazitätsproblemen begründet. Auch gab es vereinzelt<br />
Fälle, in denen die BG auf Wunsch des Betriebes nicht beteiligt wurde.<br />
Dabei spielte die Tatsache eine Rolle, dass sie teilweise von den Inhabern eher<br />
als Kontrollinstanz, denn als Partner gesehen wird.
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter<br />
Wolfgang Anderer<br />
1. Was kann die Prävention leisten?<br />
Das erste Krankenhausgesetz von 1974 stellte fest, überzählige Krankenhausbetten<br />
sollten in Pflegeabteilungen übergeführt werden. Bereits damals war man<br />
sich der Tatsache bewusst, dass die sich verändernde Altersstruktur der Bevölkerung<br />
auch zu einem Anstieg der Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen<br />
führen würde. Damals stellte sich als Konsequenz aus dieser Veränderung vor<br />
allen Dingen die Sicherstellung einer pflegerischen Versorgung dieser Menschen<br />
dar. Bei der Gestaltung des Pflegeversicherungsgesetzes, das eine Konsequenz aus<br />
dem Eintritt jener Voraussagen darstellt, war man sich bereits bewusst, dass<br />
stationäre Pflege die teuerste Variante unter den Versorgungsformen für hilfsbedürftige<br />
ältere Menschen darstellt. Aus diesem Grunde formulierte der Gesetzgeber<br />
<strong>im</strong> §5 den Vorrang von Prävention und Rehabilitation vor Pflege.<br />
Pflegebedürftigkeit stellt die letzte Stufe eines Verlustes an Selbstständigkeit<br />
dar, sie bedeutet weit gehende Hilfsbedürftigkeit und das Angewiesensein auf<br />
andere Menschen. Verhinderung von Pflegebedürftigkeit bedeutet damit den<br />
Erhalt der Selbstständigkeit älterer Menschen.<br />
Verlust von Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter, respektive Pflegebedürftigkeit setzt <strong>im</strong>mer<br />
das Vorhandensein einer medizinischen Ursache voraus, das heißt, einer akuten<br />
oder chronischen Erkrankung sei sie körperlicher oder seelischer Natur. Pflegebedürftigkeit<br />
ohne Krankheit ist eine absolute Rarität und kann bei der Betrachtung<br />
wirtschaftlicher Auswirkungen auf die Sozialsysteme getrost vernachlässigt<br />
werden.<br />
In der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion werden auf die Prävention<br />
große Hoffnungen gesetzt. Man erwartet sich erhebliche Kosteneinsparungen,<br />
von manchen Diskutanten wird gar der Eindruck erweckt als könne man durch<br />
geeignete Präventionsmaßnahmen Ärzte und Krankenhäuser quasi überflüssig<br />
machen.<br />
Damit stellt sich die Frage nach dem Sinngehalt der Begriffe Alter und Selbstständigkeit<br />
und Prävention.
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 95<br />
2. Was bedeutet Alter?<br />
Schon längst unterscheidet die Medizin zwischen dem biologischen und kalendarischen<br />
Alter. Weitgehend aus sozialrechtlichen Gründen werden unter dem<br />
Begriff der Älteren in der Regel diejenigen erfasst, die 65 Jahre und älter sind,<br />
mittlerweile hat sich für die über 80-Jährigen der Begriff der Hochbetagten eingebürgert.<br />
Das Vorhandensein eines dieser Merkmale bedeutet jedoch nicht, dass<br />
damit automatisch ein Verlust an Selbstständigkeit verbunden ist.<br />
Ich halte mich nicht für berufen eine philosophisch abgeklärte Definition des<br />
Begriffs der Selbstständigkeit zu geben. Der Begriff der Selbstständigkeit ist<br />
jedoch mit einer Reihe von Merkmalen und Fähigkeiten vergesellschaftet. Dazu<br />
gehören unter anderem:<br />
• selbstbest<strong>im</strong>mtes Leben,<br />
• Bewegungsfreiheit,<br />
• Unabhängigkeit,<br />
• seine Wünsche verfolgen,<br />
• seine Umgebung gestalten,<br />
• gewünschte Informationen einholen und<br />
• kommunizieren können.<br />
Für den einzelnen Menschen spielt das subjektive Gefühl der Selbstständigkeit<br />
und der Selbstbest<strong>im</strong>mung die wesentliche Rolle. Fühlt sich der eine selbstständig,<br />
frei und zufrieden, wenn er zwei Mal in der Woche sein Dorfwirtshaus<br />
aufsuchen und dort mit Freunden und Bekannten die aktuelle Weltlage diskutieren<br />
kann, so bedeutet für einen anderen Selbstständigkeit, dass er jährlich<br />
drei Urlaubsreisen absolviert. Daraus wird klar, dass das subjektive Bedürfnis<br />
an Selbstständigkeit individuell völlig verschieden ist. Es ist unter anderem<br />
abhängig von:<br />
• der Prägung in der Jugend,<br />
• persönlicher Lebenserfahrung,<br />
• Bildung,<br />
• sozialer Stellung,<br />
• Einkommen,<br />
• Begleitkrankheiten und Krankheitsbewältigung,<br />
• familiären Verhältnissen und<br />
• der generellen Einstellung zum Leben.<br />
Als Grundvoraussetzung für eine selbstständige Lebensführung kristallisieren sich<br />
deshalb drei Punkte heraus:<br />
• ausreichende kognitive Leistungsfähigkeit,<br />
• ausreichende Mobilität und<br />
• soziale und materielle Absicherung.
96<br />
Wolfgang Anderer<br />
Woher kommt das gegenwärtige Interesse am Wohlergehen der älteren Menschen?<br />
Abbildung 1: Ältere Menschen und soziale Sicherungssysteme<br />
Ich wage die Behauptung, stünden nicht handfeste finanzielle Gesichtspunkte<br />
<strong>im</strong> Hintergrund, fände das Wohlergehen der älteren Generation bei weitem nicht<br />
die gegenwärtige Aufmerksamkeit. Die Abbildung 1 zeigt die Bedeutung der<br />
Älteren für die sozialen Sicherungssysteme. Zur Ergänzung sei erwähnt, dass die<br />
Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung mittlerweile bei rund 17 Milliarden<br />
Euro jährlich bundesweit und bei etwa 2,5 Milliarden in Bayern liegen. Das Missverhältnis<br />
zwischen Beitragsaufkommen und Leistungsbedarf in der Krankenversicherung<br />
der Rentner weist zudem auf die entscheidende Problemgruppe<br />
unter den gesetzlich Krankenversicherten hin. Es wirft zusätzlich die Frage auf,<br />
ob die Strukturen der <strong>Gesundheit</strong>sversorgung dieser Problemgruppe tatsächlich<br />
gerecht werden. Die aktuellen Weichenstellungen und Planungen der <strong>Gesundheit</strong>spolitik<br />
weisen eher auf eine Opt<strong>im</strong>ierung zu Gunsten der einfach erkrankten<br />
jüngeren Menschen hin.
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 97<br />
Die Abbildung 2, die die Altersstruktur der Pflegehe<strong>im</strong>bewohner in Bayern zeigt,<br />
lässt die Verschiebung der stationär pflegebedürftigen Menschen zu <strong>im</strong>mer<br />
höheren Altersgruppen hin erkennen.<br />
Abbildung 2: Altersstruktur der Pflegehe<strong>im</strong>bewohner<br />
Die wesentlichen Ursachen der Pflegebedürftigkeit sind in Abbildung 3 aufgeführt.<br />
Abbildung 3: Ursachen der Pflegebedürftigkeit
98<br />
3. Der Begriff der Prävention<br />
Wolfgang Anderer<br />
Der Ausdruck kommt aus dem Lateinischen: prävenio, präveni, präventum,<br />
zu Deutsch: zuvorkommen, überholen. Umgangssprachlich wird Prävention in<br />
dem Sinne verwendet, dass man den Eintritt eines unangenehmen Ereignisses<br />
nach Möglichkeit verhindern möchte. Dieser Prozess, auch als Vorbeugung bezeichnet,<br />
wird in der Regel auf Krankheiten, Straftaten und Schadensereignisse<br />
angewandt.<br />
Im Bezug auf Krankheitsverläufe wird der Begriff der Prävention näher definiert.<br />
Von Pr<strong>im</strong>ärprävention sprechen wir bei Maßnahmen, die dazu dienen den Eintritt<br />
einer Erkrankung, z.B. Bluthochdruck, Arteriosklerose, Diabetes oder Osteoporose,<br />
zu verhindern. Besteht eine solche Krankheit, so dienen Maßnahmen der<br />
Sekundärprävention dem Schutz vor dem Eintritt einer Folgekrankheit wie Herzinfarkt,<br />
Schlaganfall oder Knochenbrüchen. Tertiärprävention befasst sich mit<br />
dem Schutz vor der Wiederholung einer Erkrankung, z.B. einem erneuten Myocardinfarkt<br />
oder mit der Verhütung von Krankheitsfolgen bzw. Behinderungen.<br />
In diesem Bereich ergibt sich ein fließender Übergang zur Rehabilitation.<br />
Gegenwärtig setzt die <strong>Gesundheit</strong>spolitik in die Prävention allgemein und in<br />
die Pr<strong>im</strong>ärprävention <strong>im</strong> Besonderen große Hoffnungen, erhebliche Einsparpotenziale<br />
werden postuliert.<br />
3.1 Beispiel Schlaganfall<br />
Am Beispiel des Schlaganfalls lassen sich Möglichkeiten und Grenzen der Prävention<br />
sehr gut demonstrieren. Die Ursache des Schlaganfalls ist in der überwiegenden<br />
Mehrzahl der Fälle eine Durchblutungsstörung des Gehirns, ausgelöst<br />
durch unterschiedliche Ursachen oder eine Einblutung in das Gehirn. Die Symptome<br />
sind vielfältig. Sie können von Schwindel über Sprach- und Schluckstörungen<br />
bis zu schweren Lähmungen und zum Tode führen. Global gesehen<br />
ist der Schlaganfall die häufigste Ursache dauerhafter Behinderungen in den<br />
Industriestaaten. In Deutschland findet man jährlich rund 210.000 Neuerkrankungen,<br />
davon enden rund 43.000 als Todesfälle. Geschätzte Folgekosten werden<br />
mit 14 Milliarden Euro jährlich angegeben.<br />
Die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu erleiden wächst mit zunehmendem<br />
Lebensalter. Eine Abschätzung der Schlaganfallinzidenz in Bayern ist in<br />
Tabelle 1 dargestellt. Sie wurde unter Verwendung von Daten aus dem Erlanger<br />
Schlaganfallregister erstellt. Der Begriff Inzidenz beinhaltet die Anzahl der Neuerkrankungen<br />
pro Jahr in der Gesamtbevölkerung oder in einer best<strong>im</strong>mten<br />
Bevölkerungsgruppe. Bezogen auf die bayerische Gesamtbevölkerung ist pro<br />
10.000 Einwohner mit 19 Schlaganfällen pro Jahr zu rechnen. Während in der<br />
Altersgruppe der unter 45-Jährigen die Inzidenz bei 0,07% liegt, das heißt, pro<br />
10.000 Einwohner in dieser Altersklasse 7 Schlaganfälle zu erwarten sind, steigt
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 99<br />
die Wahrscheinlichkeit bei den 85-Jährigen und älteren auf 2 pro 100, also fast<br />
um den Faktor 30. Von 100 Menschen die 85 Jahre und älter sind, werden <strong>im</strong><br />
Lauf eines Jahres 2 einen Schlaganfall erleiden. Kumulativ betrachtet heißt das,<br />
aus einer Gruppe von Menschen, die jetzt 85 Jahre und älter sind werden <strong>im</strong> Lauf<br />
der nächsten 5 Jahre 10% einen Schlaganfall erleiden.<br />
Abbildung 4 zeigt die aus dieser Schätzung abgeleitete Zahl der zu erwartenden<br />
Schlaganfälle in Bayern nach Altersklassen geordnet. Es zeigt sich die deutliche<br />
Verschiebung hin zu höheren Altersgruppen.<br />
Tabelle 1: Abschätzung der Schlaganfallinzidenz in Bayern<br />
Abbildung 4: Zu erwartende Schlaganfälle in Bayern
100<br />
Wolfgang Anderer<br />
Gibt es Ansatzpunkte für Schlaganfallprävention? Hier muss die Aufmerksamkeit<br />
wieder darauf gelenkt werden, dass Schlaganfall keine monokausale<br />
Erkrankung ist, sondern die Folge verschiedener Vorerkrankungen. Der Versuch<br />
der Schlaganfallverhinderung ist also bereits <strong>im</strong> Bereich der Sekundärprävention<br />
anzusiedeln. Hier werden nun nicht unmittelbar Krankheiten behandelt<br />
wie es beispielsweise bei einer Lungenentzündung mit Bekämpfung der Erreger<br />
möglich wäre, sondern es werden Risikofaktoren angegangen.<br />
3.2 Was bedeutet Risiko?<br />
Es bedeutet, dass bei Vorliegen best<strong>im</strong>mter Merkmale die Wahrscheinlichkeit<br />
eines Schadensereignisses ansteigt. So ist die Wahrscheinlichkeit, nachts um<br />
2 Uhr ein Reh zu überfahren <strong>im</strong> Hofoldinger Forst weitaus größer als in München<br />
am Stachus. Für den einzelnen Menschen ist eine Vorhersage, welche<br />
Erkrankungen ihn treffen werden, schwer möglich. Es ist jedoch möglich, für<br />
eine Gruppe von Menschen mit best<strong>im</strong>mten Merkmalen die Wahrscheinlichkeit<br />
dieses Ereignisses abzuschätzen. Die Tabelle 2 zeigt eine Abschätzung des Schlaganfallrisikos<br />
anhand best<strong>im</strong>mter Risikofaktoren. Diese Tabelle ist <strong>im</strong> Zusammenhang<br />
mit Tabelle 1 zu sehen.<br />
Die Tabelle 2 zeigt eine Aufstellung der Risikofaktoren für Schlaganfall, in der<br />
zweiten Spalte der Tabelle ist die Häufigkeit des Risikofaktors in der Bevölkerung<br />
aufgetragen und die dadurch verursachte Risikoerhöhung für einen Schlaganfall.<br />
Die letzte Spalte enthält das Ausmaß der Risikoverminderung durch Behandlung<br />
der Risikofaktoren. Zusammen mit der Angabe der Schlaganfallinzidenz in den<br />
einzelnen Altersgruppen lässt sich eine weitere Risikoabschätzung vornehmen.<br />
In einer Gruppe von einhundert 85-Jährigen wäre mit 2 Schlaganfällen pro Jahr<br />
zu rechnen. N<strong>im</strong>mt man hingegen eine Gruppe von einhundert 85-Jährigen mit<br />
schwerer Hirnarteriosklerose (in Tabelle 2 unterste Zeile), so ist das Risiko 25fach<br />
erhöht gegenüber dem Normalrisiko. In dieser Gruppe wären also 50 Schlaganfälle<br />
<strong>im</strong> Verlauf eines Jahres zu erwarten. Wichtig ist es, sich die mögliche<br />
Risikoverminderung durch Behandlung vor Augen zu halten. Sie beträgt für<br />
dieses Extrembeispiel gerade 25–40%, das heißt, trotz adäquater Behandlung<br />
würden in dem beschriebenen Kollektiv 60–75% der Schlaganfälle trotz<br />
Behandlung stattfinden. Ein ähnliches Problem stellt der Bluthochdruck dar.<br />
Ca. 30% der Bundesbürger leiden unter erhöhten Blutdruckwerten. Das Schlaganfallrisiko<br />
steigt auf das 4,2fache, durch Behandlung ist lediglich eine Risikoreduktion<br />
um 40% möglich.
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 101<br />
Tabelle 2: Risikofaktoren für Schlaganfall, ihr Einfluss auf das Schlaganfallrisiko<br />
und die Auswirkungen der Prävention<br />
Am Beispiel Bluthochdruck lässt sich auch eine entscheidende Problematik der<br />
präventiven Maßnahmen anschaulich machen. Die durch den Blutdruck hervorgerufenen<br />
Veränderungen in den Organen und Gefäßen wirken sich erst nach<br />
15 bis 20 Jahren aus. Dies bedeutet, dass Schlaganfallprävention auf dem Weg<br />
über Bluthochdruckbehandlung viele Jahre vor dem Auftreten echter Beschwerden<br />
stattfinden muss. Die wesentliche Lehre aus dieser Tabelle besteht darin, dass<br />
durch die Behandlung von Risikofaktoren das Risiko zwar gesenkt, aber nicht<br />
beseitigt werden kann. Selbst durch adäquate Behandlung der Risikofaktoren<br />
könnte die Zahl der Schlaganfälle jährlich max<strong>im</strong>al um 30% gesenkt werden. Die<br />
Problematik wird in der Praxis dadurch verschärft, dass Begleiterkrankungen<br />
bestehen. Die Behandlung erfordert die Verordnung zahlreicher Medikamente<br />
mit komplexen Interaktionen und beschränkter Akzeptanz bei den Patienten.<br />
Damit stellt sich die Frage nach den Folgen eines Schlaganfalls. In Abhängigkeit<br />
von betroffenen Gehirnarealen kann ein Schlaganfall asymptomatisch verlaufen,<br />
es können sich aber auch Lähmungen, Gefühlsstörungen, Sprach- und<br />
Schluckstörungen, Wesensveränderungen, Krampfleiden und eine Vielzahl anderer<br />
Störungen entwickeln. Wie zuvor dargestellt sind Schlaganfälle die häufigste<br />
Ursache für Behinderungen in den westlichen Industriestaaten. Der Begriff<br />
der Behinderung hat bei näherer Betrachtung mehrere D<strong>im</strong>ensionen.<br />
Das Klassifikationssystem ICIDH (International Classification of Impairments,<br />
Disabilities and Handicaps) wurde von der WHO herausgegeben und ist gegen-
102<br />
Wolfgang Anderer<br />
wärtig das gebräuchlichste Instrument zur Darstellung von Behinderungen als<br />
Krankheitsfolge. Während sich die Schädigung in erster Linie <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Akuterkrankung und der daraus resultierenden Organschäden abspielt, bezieht<br />
sich die Fähigkeitsstörung auf die Fähigkeit zur Ausübung best<strong>im</strong>mter Verrichtungen.<br />
Fähigkeitsstörung beinhaltet beispielsweise Einschränkungen in der <strong>Alltag</strong>sfähigkeit<br />
durch Lähmungen, Bewegungsstörungen oder Wahrnehmungsstörungen.<br />
Aus diesen Fähigkeitsstörungen wieder resultieren Beeinträchtigungen,<br />
die sich auf die soziale und ökonomische Situation der Betroffenen auswirken.<br />
Ein Mensch mit Sprachstörung kann beispielsweise plötzlich nicht mehr kommunizieren.<br />
Daraus entsteht eine soziale Isolation, oder bei jüngeren Betroffenen<br />
massive berufliche Einschränkungen. Gerade jüngere schwer betroffene<br />
Schlaganfallpatienten können aus einer Situation des beruflichen Erfolgs heraus<br />
urplötzlich mit massivsten Einschränkungen ihrer Selbstständigkeit konfrontiert<br />
werden. Noch häufiger entsteht für Ältere aus einer solchen Situation Abhängigkeit<br />
und Pflegebedürftigkeit. Die Summe der zuvor genannten Störungen wird<br />
als Behinderung zusammengefasst.<br />
Führt die Behinderung zur Pflegebedürftigkeit, erreichen die Auswirkungen nicht<br />
nur den einzelnen Betroffenen, sondern auch das soziale Umfeld. Der gefürchtete<br />
Pflegefall in der Familie macht manche Lebensplanung zunichte. Wenn<br />
Berufstätige, in der Regel <strong>im</strong> mittleren Lebensalter, plötzlich mit der Situation<br />
konfrontiert werden, dass ein Elternteil auf umfassende Hilfe angewiesen ist,<br />
führt dies in vielen Fällen zur Aufgabe der Berufstätigkeit.<br />
Neben Schlaganfällen führen weitere chronische Krankheiten zum Verlust an<br />
Selbstständigkeit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit. Die Größenordnung zeigt<br />
Abbildung 5. Die Besonderheit dieser Krankheiten, abgesehen von den Frakturen,<br />
liegt darin, dass sie häufig einen schleichenden, chronischen Verlauf nehmen.<br />
Die betroffenen Menschen werden in der Regel zu Hause betreut, der Funktionsverlust<br />
und damit der Verlust an Selbstständigkeit geht schleichend vor sich<br />
und wird als „normale“ Alterserscheinung fehlinterpretiert.<br />
Abbildung 5: Behinderungsträchtige Erkrankungen
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 103<br />
3.3 Geriatrische Rehabilitation als Faktor präventiver Medizin<br />
Das Postulat des Krankenhausgesetzes von 1974, es gäbe zu viele Akutbetten, die<br />
in Pflegeabteilungen umgewandelt werden sollten, wurde schon erwähnt. Bei<br />
der Formulierung des Pflegeversicherungsgesetzes war dem Gesetzgeber bereits<br />
klar, dass stationäre Pflege der teuerste Weg zur Versorgung älterer Menschen ist.<br />
Im §5 des Pflegeversicherungsgesetzes wurde deshalb der Vorrang von Prävention<br />
und Rehabilitation vor Pflege sehr deutlich formuliert. Den Versicherten<br />
werden umfangreiche Rechte auf präventive und rehabilitative Maßnahmen<br />
zugesichert, wenn dadurch Selbstständigkeit erhalten und Pflegebedürftigkeit<br />
vermindert werden können.<br />
In Bayern wird seit 1992 <strong>im</strong> Rahmen des bayerischen Geriatriekonzeptes, bei dem<br />
es sich um ein Fachprogramm <strong>im</strong> Sinne des bayerischen Krankenhausgesetzes<br />
handelt, ein flächendeckendes Netz von geriatrischen Rehabilitationseinheiten<br />
geschaffen. Das Ziel von rund 2400 Betten ist mittlerweile weitgehend erreicht.<br />
Der Auftrag der geriatrischen Rehabilitation ist klar formuliert und hat einen<br />
absolut präventiven Auftrag.<br />
Abbildung 6: Aufgaben der geriatrischen Rehabilitation und die rechtlichen<br />
Grundlagen
104<br />
Abbildung 7: Ziele der geriatrischen Rehabilitation<br />
Wolfgang Anderer<br />
Die Geriatrie orientiert sich bei ihrer Behandlungsplanung einerseits an den<br />
individuellen Fähigkeitsstörungen, andererseits an den Ressourcen der einzelnen<br />
Patienten. Die Mult<strong>im</strong>orbidität dieser Menschen verlangt die Behandlung <strong>im</strong><br />
interdisziplinären Team. Geriatrische Kliniken und Abteilungen in Bayern vereinigen<br />
deshalb eine sehr hohe Kompetenz in den medizinischen, pflegerischen,<br />
therapeutischen und sozialen Fachgebieten.<br />
Es stellt sich die Frage, ob die Geriatrie ihre Aufgabe erfüllen kann. Schließlich<br />
verlangt der Anspruch einer präventiven Wirkung den Nachweis, dass die behandelten<br />
Menschen die erreichte Selbstständigkeit über längere Zeit behalten.<br />
In einer Studie an über tausend Patienten einer geriatrischen Klinik in Rheinland-Pfalz<br />
wurde der Behandlungserfolg nach drei und zwölf Monaten überprüft.<br />
Als Messinstrument diente ein Leistungsindex der die Aktivitäten des täglichen<br />
Lebens (ATL) in fünf Stufen von 0 (unselbstständig) bis 5 (volle Selbstständigkeit)<br />
abbildet.
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 105<br />
Abbildung 8/9: Erweiterter Barthel-Index und ATL-Index<br />
Die Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Bei Aufnahme<br />
weist die überwiegende Mehrzahl der Patienten einen erheblichen Hilfsbedarf<br />
auf, 60% ATL-Index 0. Bei Entlassung liegt der Index 0 nur noch bei jedem siebten<br />
Patienten vor. Auch nach einem Jahr hatte sich der Hilfsbedarf der entlassenen<br />
Patienten nur moderat erhöht.
106<br />
Abbildung 10: Verlauf der Werte des ATL-Index<br />
Wolfgang Anderer<br />
Eigene Daten zeigen einen vergleichbaren Behandlungserfolg, ausgedrückt <strong>im</strong><br />
Barthel-Index, der in erster Linie körperliche Fähigkeiten abbildet und max<strong>im</strong>al<br />
100 Punkte ergeben kann. Die Linksverschiebung der Säulendiagramme weist<br />
für die Patienten einen deutlichen Zugewinn an Selbstständigkeit nach.<br />
Abbildung 11: Behandlungsergebnis bei 958 Patienten der Klinik für<br />
Geriatrische Rehabilitation Ansbach. X-Achse Barthel-Punkte, Y-Achse %.<br />
Links Werte bei Aufnahme, rechts bei Entlassung
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 107<br />
Abbildung 12: Behandlungsergebnisse<br />
3.4 Welche Ansatzpunkte für präventive Maßnahmen sind denkbar?<br />
Mit Blick auf die Selbstständigkeit älterer Menschen steht die Wirksamkeit rechtzeitiger<br />
rehabilitativer Maßnahmen außer Zweifel. Diese Maßnahmen sind <strong>im</strong><br />
Sinne der Tertiärprävention zu sehen. Mittelfristig werden diese Maßnahmen<br />
<strong>im</strong> Vordergrund stehen müssen, wenn es darum geht, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden<br />
und dadurch die sozialen Sicherungssysteme zu entlasten. In der Altersgruppe,<br />
in der die genannten chronischen Krankheiten zur Behinderung führen,<br />
ist wirksame Pr<strong>im</strong>ärprävention nur noch sehr eingeschränkt möglich.<br />
Während die Pr<strong>im</strong>ärprävention in erster Linie Veränderungen der persönlichen<br />
Lebens- und Verhaltensweisen verlangt, erfordert die Sekundärprävention die<br />
Kombination aus medikamentöser Behandlung und veränderter Lebensführung<br />
(„lifestyle“). Die Tabelle 3 zeigt eine Aufstellung der häufigsten Risikofaktoren<br />
und ihren Einfluss auf die verschiedenen behinderungsträchtigen Erkrankungen.<br />
Dabei kristallisieren sich drei entscheidende Ansatzpunkte heraus. Dies sind<br />
Bewegung, richtige Ernährung und Verzicht auf Zigarettenrauchen. Das Wissen<br />
über diese Zusammenhänge ist Allgemeingut. Warum finden diese relativ<br />
einfachen Maßnahmen nicht die erforderliche Verbreitung. Die Abbildungen<br />
13–15 zeigen Ergebnisse aus einer einschlägigen Umfrage und weitere Gesichtspunkte<br />
zur Problematik. Offensichtlich liegen die Hemmnisse weniger <strong>im</strong> rationalen<br />
Bereich.
108<br />
Wolfgang Anderer<br />
Tabelle 3: Einfluss verschiedener Risikofaktoren auf best<strong>im</strong>mte behinderungsträchtige<br />
Erkrankungen, Koronare Herzkrankheit (KHK), zerebrale<br />
Durchblutungsstörungen (CVI) (<strong>Gesundheit</strong> <strong>im</strong> Alter, <strong>Gesundheit</strong>sberichterstattung<br />
des Bundes Heft 10, 2002)<br />
Abbildung 13: Hemmnisse für gesundheitsbewusstes Verhalten<br />
(<strong>Gesundheit</strong>sberichterstattung des Bundes)
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 109<br />
Abbildung 14: Weitere Hemmnisse für gesundheitsbewusstes Verhalten<br />
Abbildung 15: Ausriss aus der Ärztezeitung
110<br />
Wolfgang Anderer<br />
3.5 Was kann die Prävention für die Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter leisten?<br />
Pr<strong>im</strong>ärprävention macht Sinn für diejenigen, die jetzt jung und gesund sind.<br />
Extraindividuelle Faktoren wie gesellschaftliche Einstellungen, Leitfiguren, Gruppendruck<br />
und Modetrends üben erheblichen Einfluss auf das Verhalten der Einzelperson<br />
aus. Demgegenüber ist die formale Einsicht häufig nicht in der Lage,<br />
Bequemlichkeit und dem Wunsch nach momentanem Genuss und „<strong>Alltag</strong>sstress“<br />
zu überwinden. Positive Verhaltensweisen müssen deshalb frühzeitig, am besten<br />
vom Kindergartenalter an, <strong>im</strong>plementiert und während der gesamten Schulzeit<br />
verstärkt werden.<br />
Sekundärprävention erhält <strong>im</strong> mittleren Lebensalter höhere Bedeutung. Die Kombination<br />
aus medikamentöser Behandlung und <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verlangt<br />
zusätzliche Kenntnisse über Körperfunktionen und Krankheitsabläufe. Die Erfahrung<br />
zeigt, dass Grundkenntnisse zu diesen Fragen auch bei Menschen mit<br />
gehobenem Bildungsniveau sehr begrenzt sein können. Offensichtlich sind hier<br />
praxisnähere Unterrichtsmethoden erforderlich<br />
Abbildung 16 zeigt, welche Personen oder Institutionen für geeignete Vermittler<br />
von <strong>Gesundheit</strong>sinformationen gehalten werden. Die besten Werte erhalten<br />
Elternhaus, Hausarzt, mit gewissem Abstand gefolgt von der Schule. Interessanterweise<br />
sind Apotheken in dieser Aufstellung nicht enthalten, ebenso wenig der<br />
Ansatz der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung.<br />
Abbildung 16: Wer vermittelt <strong>Gesundheit</strong>sinformationen
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter 111<br />
Tertiärprävention <strong>im</strong> Sinne der Verhinderung von Pflegebedürftigkeit verlangt<br />
wesentlich differenziertere und umfangreichere Anstrengungen. Die Ursachen<br />
von Behinderung und Pflegebedürftigkeit sind in der Regel multifaktoriell, häufig<br />
sind sie nicht ohne weiteres zu erkennen. Im medizinischen Bereich kommt<br />
der Geriatrie und der geriatrischen Rehabilitation eine Schlüsselrolle zu. Aufgabe<br />
sind Diagnostik, Behandlungsplanung und teilweise Durchführung der<br />
Behandlung, darüber hinaus Organisation der Weiterversorgung. Gegenwärtig<br />
findet geriatrische Behandlung vorwiegend nach Aufenthalten <strong>im</strong> Akutkrankenhaus<br />
statt. In vollem Umfang wirksam wird das Potenzial der Geriatrie erst,<br />
wenn es gelingt, diejenigen Patienten, die zu Hause durch chronische Krankheiten<br />
<strong>im</strong>mer <strong>im</strong>mobiler und pflegebedürftiger werden zu erreichen. Dieses Ziel<br />
verlangt Strukturen und Information. Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, spielen<br />
häufig psychosoziale Faktoren wie Isolation eine wesentliche Rolle. Derartige Probleme<br />
sind nicht mit rein medizinischen Mitteln zu lösen. Vielmehr entstehen<br />
hier die Schnittstellen zur kommunalen Altenhilfe, zur Tätigkeit der Wohlfahrtsverbände<br />
und Kirchen und anderen ehrenamtlichen Engagements sowie<br />
zur Tätigkeit der Hausärzte und niedergelassenen Therapeuten – ein klassischer<br />
Fall von Vernetzung. Vernetzung bedeutet vor allem Informationsaustausch.<br />
Einmal zwischen den Leistungsanbietern untereinander, zum anderen zwischen<br />
Leistungsanbietern und denjenigen, die diese Leistungen nutzen sollen. Da das<br />
Angebot sozialer Leistungen, vorsichtig ausgedrückt, unübersichtlich ist, benötigen<br />
Ratsuchende eine zentrale Anlaufstelle, beispielsweise auf Landkreisebene.<br />
Diese Stelle sollte barrierefrei zugänglich sein, bürgerfreundliche Öffnungszeiten<br />
(besonders für Berufstätige) anbieten und mit möglichst vielen Leistungsanbietern<br />
und relevanten Institutionen vernetzt sein. Als Träger eignen sich in erster<br />
Linie kommunale Gebietskörperschaften, wie die Erfahrungen mit verschiedenen<br />
Seniorenbüros und ähnlichen Einrichtungen zeigen. Dabei handelt es sich<br />
nicht unbedingt um freiwillige Leistungen. Das Pflegeversicherungsgesetz verpflichtet<br />
die kommunalen Gebietskörperschaften nicht nur, den Bedarf an Pflegeplätzen<br />
sicherzustellen, sondern auch begleitende Maßnahmen zur Verhinderung<br />
von Pflegebedürftigkeit zu treffen. Dieser präventive Gesichtspunkt ist<br />
allerdings <strong>im</strong> Ausführungsgesetz nicht mehr deutlich erkennbar.<br />
Bisher wenig Beachtung finden die Zusammenhänge zwischen Pflegebedürftigkeit<br />
älterer Menschen und der Berufstätigkeit von Angehörigen. Pflegende<br />
Angehörige sind überdurchschnittlichen gesundheitlichen und zeitlichen<br />
Belastungen ausgesetzt. Daraus resultieren häufigere Krankheitsfälle und Probleme<br />
<strong>im</strong> Betrieb, beispielsweise mit Arbeitszeiten. Ihre Flexibilität n<strong>im</strong>mt ab.<br />
Wird Pflegebedürftigkeit vermieden oder gelindert, kann eine solche Situation<br />
entschärft werden. Es scheint deshalb sinnvoll, diesen Gesichtspunkt auch<br />
unter dem Komplex Betriebliche <strong>Gesundheit</strong>sförderung zu betrachten.
112<br />
3.6 Fazit<br />
Wolfgang Anderer<br />
Selbstständigkeit <strong>im</strong> Alter zu erhalten und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden liegt<br />
aus humanen und wirtschaftlichen Gründen <strong>im</strong> gesellschaftlichen Interesse.<br />
Rechtzeitig eingeleitete präventive Maßnahmen können einen wesentlichen<br />
Beitrag leisten. Während Pr<strong>im</strong>är- und Sekundärprävention vor allem durch<br />
einen besseren Wissensstand in der Bevölkerung wirken, kommt die aktuelle<br />
Hauptaufgabe der Tertiärprävention in Form der geriatrischen Rehabilitation zu.<br />
Diese benötigt zu ihrer vollen Wirksamkeit eine enge Vernetzung mit der kommunalen<br />
Altenhilfe. Wirksame Information der Betroffenen und Angehörigen<br />
kann durch Einrichtung zentraler Informationsstellen auf Kreisebene erreicht<br />
werden. Ein weiterer Informationsstrang <strong>im</strong> Rahmen der Betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
erscheint sinnvoll.
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten<br />
verändern?<br />
Was können neue Medien leisten?<br />
An Information mangelt es nicht. Dass richtige Ernährung für die <strong>Gesundheit</strong><br />
wichtig ist, hat sich herumgesprochen. Dass viel Bewegung nötig ist, um gesund<br />
zu bleiben, ist zum Allgemeinwissen geworden. Dass Stress die Lebensqualität<br />
mindert, weiß jeder. <strong>Gesundheit</strong> heißt, sich wohl zu fühlen. Auch diese Botschaft<br />
braucht nicht mehr kommuniziert zu werden.<br />
1. Die Realität ist anders<br />
Volker Pudel<br />
Doch die Realität sieht völlig anders aus. Die Kehrseite des Schlaraffenlandes<br />
ist gekennzeichnet durch Stress und Aufregung, Bewegungsarmut, Unbehagen<br />
und ernährungsabhängige Krankheiten, deren Kosten bereits 1990 auf jährlich<br />
über 100 Milliarden DM geschätzt wurden. Prävention gilt als der „Königsweg“<br />
zur Vermeidung vieler Zivilisationskrankheiten. Doch sie hat einen entscheidenden<br />
Nachteil: Prävention lässt sich kaum mit nachhaltiger Wirkung realisieren.<br />
Woran liegt das? Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten nicht trainieren? Wo<br />
liegen die Ursachen?<br />
Am Beispiel „Ernährung“ wird deutlich, dass es nicht an unzureichender<br />
Information der Bevölkerung liegen kann. „Ernährung“ ist bevorzugtes Thema<br />
in allen Medien, es gibt Faltblätter und Broschüren. Ernährungsberater, Ärzte,<br />
Psychologen, aber auch Nachbarn, Freunde und Verwandte besprechen das Thema<br />
„Ernährung“ ebenso wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die <strong>Gesundheit</strong>s-<br />
und Krankenkassen, die Verbraucher-Zentralen, die Bundeszentrale<br />
für gesundheitliche Aufklärung und viele mehr.<br />
Zwar kann keiner abschätzen, wie die Ernährungssituation heute aussehen<br />
würde, hätte es diese verschiedenen Aktivitäten nicht gegeben, dennoch muss<br />
festgestellt werden: Ihr Ziel hat die Ernährungsaufklärung nicht erreicht.<br />
Ernährungsabhängige Krankheiten, Übergewicht und Essstörungen nehmen zu.<br />
Die Verunsicherung über Ernährungsfragen in der Bevölkerung ist so groß wie
114<br />
Volker Pudel<br />
nie zuvor. 90% der Verbraucher kritisieren die Qualität der Ernährungsinformation,<br />
70% beklagen die Widersprüchlichkeit. Nach wie vor bestreitet deshalb<br />
niemand die Notwendigkeit der Ernährungsaufklärung, doch wie kann deren<br />
Wirksamkeit gesteigert werden?<br />
2. Essen und Ernährung<br />
Viele Menschen wissen, was günstiges Verhalten ist, doch sie verhalten sich<br />
anders. Die meisten Menschen essen wie früher, doch begleitet sie heute oft ein<br />
„schlechtes Gewissen“ bei Tisch. Nach wie vor – trotz aller Informationen – gilt,<br />
„<strong>im</strong> Überfluss des Schlaraffenlandes essen die Menschen anders als sie sich<br />
ernähren sollten“. Die Begriffe „Essen“ und „Ernährung“ sind mit völlig unterschiedlichen<br />
Assoziationen verbunden. Dies belegte eine bevölkerungsrepräsentative<br />
Erhebung in zwei Stichproben mit den Fragen: „Worauf legen Sie bei<br />
Ihrer Ernährung besonderen Wert?“ sowie „Worauf legen Sie bei Ihrem Essen<br />
besonderen Wert?“ Die Antworten sind in Abbildung 1 dargestellt.<br />
Abbildung 1<br />
Der Begriff „Ernährung“ erweckt rationale Bezüge, während „Essen“ mit emotionalen<br />
Inhalten verknüpft ist. Das Essverhalten der Menschen ist überwiegend<br />
emotional gesteuert. Darum kann es auch mit kognitiv-rationalen Argumenten<br />
kaum beeinflusst werden. So hat die Ernährungsaufklärung den Menschen Wissensinhalte<br />
vermittelt, die aber als Steuerungsgrößen in die Regulation des Essverhaltens<br />
nicht eingeflossen sind.
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verändern? 115<br />
70% der Verbraucher halten sich, was das Essen angeht, für „einen Genießer“.<br />
In der Lusthierarchie von zwanzig verschiedenen Tätigkeiten steht das „Essen“<br />
hinter Urlaub, Familie und Sex/Liebe an vierter Stelle. Das charakterisiert, welchen<br />
hohen emotionalen Stellenwert das „Essen“ für die Lebensqualität hat. Wie<br />
bei allen emotionalen Inhalten, die die Lebensqualität definieren, kommt dem<br />
„Heute“ eine wesentlich größere Bedeutung bei als dem „Morgen“. Gabriel Laub,<br />
der bekannte Satiriker, formulierte einmal treffend: „Was soll ich zwanzig Jahre<br />
lang Quark und Möhrchen essen, wenn mich dann mit 40 Jahren ein betrunkener<br />
Autofahrer tot fährt?“ Die subjektive Bewertung von Vor- und Nachteilen,<br />
die jetzt oder später erlebt werden (können), stellen die nahezu unlösbare Aufgabe<br />
der Prävention dar.<br />
3. Kontingenzverhältnisse erschweren Prävention<br />
Ein Kind entdeckt eine Eisbude und verspürt den Wunsch, ein Eis zu kaufen<br />
(Abbildung 2). Die Intensität dieses Wunsches wird durch den positiven Aufforderungscharakter<br />
(Vektorlänge) dargestellt.<br />
Abbildung 2
116<br />
Volker Pudel<br />
Der vom Verkäufer verlangte Preis entspricht subjektiv dem negativen Aufforderungscharakter<br />
(Vektorlänge). Das Kind verzichtet auf das Eis, weil es ihm<br />
den Preis nicht wert ist. Nun verändert der Verkäufer die Situation, in dem er die<br />
Bezahlung eine Woche hinausschiebt (Abbildung 3).<br />
Abbildung 3
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verändern? 117<br />
Dadurch entstehen andere Aufforderungsgradienten (Abbildung 4), die sich als<br />
Resultante des Aufforderungscharakters und dem zeitlichen Abstand <strong>im</strong> Winkelmaß<br />
darstellen lassen. Das Kind kauft sich sein Eis und zahlt später. Dieses<br />
Beispiel veranschaulicht das, was in der Lernpsychologie als Kontingenzverhältnis<br />
bezeichnet wird.<br />
Abbildung 4<br />
Für kognitive Ernährungsprävention bestehen also sehr ungünstige Kontingenzverhältnisse,<br />
denn das positive Erlebnis des Geschmacks ist unmittelbar, die<br />
möglichen negativen Konsequenzen werden sehr viel später (wenn überhaupt)<br />
wahrgenommen. So konnte eine repräsentative Erhebung an 2900 Familien mit<br />
Kindern auch zeigen, dass die Ernährungserziehung in deutschen Familien<br />
offenbar funktioniert: Kinder zwischen vier und 16 Jahren wählten Vollkornbrot,<br />
Wurst, Tomate, Käse, Kotelett, Nudelsuppe, Kartoffeln und Graubrot aus 52<br />
Lebensmitteln aus, die „stark machen“ und „gesund sind“. Die Lebensmittel<br />
Pudding, Bonbons, Hamburger, Cola, Schokoriegel, Konfitüre, Schokolade und<br />
Salzgebäck ordneten sie übereinst<strong>im</strong>mend als „macht nicht stark“ und „ungesund“<br />
ein. Allerdings beurteilten sie die erste Gruppe als „mag ich nicht“ und<br />
die zweite Gruppe als „mag ich“. Die Ernährungserziehung hat offenbar das<br />
Wissen der Kinder erreicht, sich aber nicht in den Essbedürfnissen niedergeschlagen.
118<br />
4. Emotionale Grundlagen des Verhaltens<br />
Volker Pudel<br />
Auch die Lebensmittelskandale haben bewiesen, dass nicht das „<strong>Gesundheit</strong>smotiv“<br />
das best<strong>im</strong>mende Motiv für Essen und Trinken ist. Es stellt sich ohnehin<br />
die Frage, ob es so etwas wie ein „<strong>Gesundheit</strong>smotiv“ gibt, das bei gesunden<br />
Menschen aktiviert werden kann. Wie die folgende Liste zeigt, gibt es zahlreiche<br />
Motive, die menschliches Essverhalten beeinflussen:<br />
Motive für die Lebensmittelwahl:<br />
• Geschmacksanspruch (Erdbeeren mit Schlagsahne sind der höchste Genuss),<br />
• Hungergefühl (ich habe einfach Hunger/ich muss das jetzt essen),<br />
• ökonomische Bedingungen (das ist <strong>im</strong> Sonderangebot, das kaufe ich),<br />
• kulturelle Einflüsse (morgens Brötchen mit Kaffee),<br />
• traditionelle Einflüsse (Omas Plätzchen zu Weihnachten),<br />
• habituelle Bedingungen (ich esse <strong>im</strong>mer eine Suppe vor der Mahlzeit),<br />
• emotionale Wirkung (ein Stück Kuchen in der Stresssituation),<br />
• soziale Gründe (bei Fondue lässt es sich gut unterhalten),<br />
• soziale Statusbedingung (die Schulzes laden wir zu Hummer ein),<br />
• Angebotslage (man isst das Mensaessen, weil es dies gerade gibt),<br />
• Fitnessüberlegungen (soll gut fürs Joggen sein),<br />
• Schönheitsansprüche (halte Diät, um schlank zu bleiben),<br />
• Verträglichkeit (Grünkohl esse ich nicht, vertrage ich nicht),<br />
• Neugier (mal sehen, wie das schmeckt),<br />
• Angst vor Schaden (Rindfleisch esse ich nicht mehr wegen BSE),<br />
• pädagogische Gründe (wenn du Schularbeiten machst, bekommst du ein<br />
Bonbon),<br />
• Krankheitserfordernisse (Zucker darf ich nicht essen, wegen meiner<br />
Diabetes),<br />
• magische Zuweisungen (Sellerie esse ich für die Potenz),<br />
• pseudowissenschaftlich (zehn harte Eier zum Abnehmen) und<br />
• <strong>Gesundheit</strong>süberlegungen (soll gesund sein, also esse ich das).<br />
Die „<strong>Gesundheit</strong>süberlegungen“, aufgeführt am Ende der Liste, werden allenfalls<br />
bei Menschen relevant, die sich krank fühlen oder tatsächlich krank sind.<br />
Dann nämlich erleben sie ein Defizit an <strong>Gesundheit</strong> und aktivieren das Motiv<br />
„<strong>Gesundheit</strong>“, um diese wieder zu erlangen. Motive basieren <strong>im</strong>mer auf einem<br />
subjektiven Mangel, der ausgeglichen werden soll.<br />
Die Schlagzeilen über BSE haben weite Teile der Bevölkerung verunsichert. Doch<br />
das emotionale Erlebnis eskalierte erst, nachdem die Tagesschau am 24.11.2000<br />
meldete „Deutschland hat BSE“, während zuvor Bundesminister Funke regelmäßig<br />
versicherte „Deutschland ist BSE-frei“. Dadurch wurde eine emotionale<br />
Störung verursacht, nämlich das Vertrauen der Menschen zerstört. Eine tatsächliche<br />
Furcht vor einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch Rindfleischverzehr<br />
hätte nicht innerhalb weniger Wochen zu einer Normalisierung des<br />
Rindfleischkonsums geführt.
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verändern? 119<br />
5. Ernährung wird als Risiko empfunden<br />
Nach wie vor löst das kognitive Thema „Ernährung“ Verunsicherung aus. Auch<br />
wenn die Lebensmittelsicherheit objektiv noch nie besser war als heute, hält die<br />
Bevölkerung die Ernährung gegenwärtig für riskanter als je zuvor. Diese Verunsicherung<br />
bezieht sich aber <strong>im</strong> Wesentlichen auf den Begriff „Ernährung“, ohne<br />
das „emotionale Essen“ nachhaltig zu tangieren.<br />
Die subjektive Bewertung von Risiken folgt ohnehin nicht den naturwissenschaftlich<br />
festgestellten Wahrscheinlichkeiten. So werden <strong>im</strong> subjektiven Bewertungshorizont<br />
allgemein bekannte Risiken in ihrer Eintretenswahrscheinlichkeit<br />
deutlich abgewertet, während die mehr vagen, unbekannten oder<br />
uneinschätzbaren Risiken deutlich überbewertet werden. So dringen die Risiken<br />
des Straßenverkehrs mit täglich 20 Toten, aber auch die des Skifahrens, des Rauchens<br />
oder Tauchens kaum ins Bewusstsein, während die Risiken von AIDS, Gentechnik<br />
oder BSE beträchtlich überschätzt werden. Das Risikobewusstsein ist<br />
zudem sehr subjektiv gefärbt, denn Ernährung wird für riskant gehalten, nicht<br />
aber das gute Essen. Das Rindersteak gilt als gefährlicher als der Fußweg zum<br />
Metzger, und kein Lottospieler würde glauben wollen, dass seine Chance,<br />
ermordet zu werden, siebenfach höher liegt als die eines richtigen 6er-Tipps.<br />
Die Prävention hat zunächst eine schwierige Kommunikationsaufgabe zu lösen,<br />
will sie die Verunsicherung in der Bevölkerung abbauen. Die folgende Formulierung<br />
beschreibt den Konflikt:<br />
Glauben<br />
bietet<br />
Sicherheit ohne Beweis<br />
Wissenschaft<br />
bietet<br />
Beweis ohne Sicherheit<br />
Den Medien kommt in diesem Prozess eine entscheidende Bedeutung zu, denn<br />
es sind nicht die Tatsachen, die menschliches Verhalten steuern, sondern es sind<br />
die Meinungen, die sich Menschen über die Tatsachen bilden. Die wissenschaftliche<br />
Argumentation kann die Verunsicherung kaum abbauen, da sie die<br />
erwünschte subjektive Sicherheit nicht wirklich bieten kann. So kommt es darauf<br />
an, zutreffende Argumentationen zu liefern, die <strong>im</strong> Stande sind, subjektive<br />
Sicherheit zu vermitteln. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, die seriöse Aufklärer<br />
aber nicht den unseriösen Aufklärern überlassen dürfen. Die „Therapieangebote“<br />
für Übergewichtige liefern zahllose Beispiele, wie Menschen mit falschen<br />
Glaubenssätzen zunächst ein Sicherheitsgefühl bekommen, ohne dass ihnen<br />
tatsächlich geholfen wird.
120<br />
6. Evolutionsbiologische Grundlagen<br />
Volker Pudel<br />
Übergewicht ist eines der zentralen <strong>Gesundheit</strong>sprobleme – in Deutschland<br />
allerdings <strong>im</strong>mer noch nicht als Krankheit anerkannt, sodass die Behandlungskosten<br />
nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Die Forschung der<br />
letzten 15 Jahre hat allerdings eine Fülle an Hinweisen erarbeitet, die den Schluss<br />
nahe legen, dass Übergewicht nicht als Schuld des Individuums, sondern eher<br />
als Schicksal zu bewerten ist. So muss davon ausgegangen werden, dass die<br />
Regulation des Körpergewichts genetisch disponiert ist. Untersuchungen an einund<br />
zweieiigen Zwillingen, die getrennt oder gemeinsam aufwuchsen, aber auch<br />
Adoptionsstudien belegen die genetische Disposition. Andere Studien beweisen,<br />
dass es „gute“ und „schlechte Futterverwerter“ gibt. So wurden nach 100-tägiger<br />
Überernährung mit täglich 1.000 kcal Gewichtszunahmen zwischen vier und<br />
14 Kilogramm festgestellt.<br />
Nach Analyse von Ernährungstagebüchern von 200.000 Personen konnte keine<br />
Beziehung zwischen der Energieaufnahme und dem Körpergewicht nachgewiesen<br />
werden. Allerdings ergab sich eine sehr deutliche positive Beziehung<br />
zwischen der relativen Fettaufnahme und dem Gewicht sowie eine negative<br />
Beziehung zwischen Kohlenhydratverzehr und Gewicht. Eine schottische<br />
Untersuchung kam zu gleichen Ergebnissen, zeigte darüber hinaus, dass der<br />
Zuckerverzehr in umgekehrt proportionaler Relation zum Körpergewicht steht<br />
(vgl. Abbildungen 5–7).<br />
Abbildung 5
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verändern? 121<br />
Abbildung 6<br />
Abbildung 7
122<br />
Volker Pudel<br />
Diese und andere Erkenntnisse müssen auch für die Konzeption von präventiven<br />
Maßnahmen berücksichtigt werden, denn das Essverhalten wird nicht nur<br />
durch kognitive Strategien gesteuert, sondern unterliegt darüber hinaus einer<br />
biologischen Regulation, die dem Individuum selbst aber nicht bewusst wird. Da<br />
das Essverhalten zu den häufigsten Verhaltensweisen zählt, die realisiert werden,<br />
ist zudem von zahllosen Reiz-Reaktionsbeziehungen auszugehen, die das Essverhalten<br />
<strong>im</strong> Sinne konditionierter Reaktionen stabilisieren. So können Veränderungen<br />
weniger durch kognitive Prozesse eingeleitet, sondern nur durch ein<br />
Verhaltenstraining zu neuen Gewohnheitsbildungen verändert werden.<br />
Essverhalten lässt sich daher kaum durch Information oder Wissensvermittlung<br />
beeinflussen, da es als emotional und evolutionsbiologisch reguliertes Verhalten<br />
angesehen werden muss, das über Jahre trainiert und durch Reiz-Reaktionsbeziehungen<br />
stabilisiert wird. Präventionskonzepte, die eine emotionale Ansprache<br />
der Zielpersonen ermöglichen und durch Einsatz neuer Medien Motivation<br />
schaffen, einen Trainingsprozess einzuleiten, können mit günstigeren Ergebnissen<br />
rechnen als jene kognitiv-rational basierten Aufklärungskampagnen der letzten<br />
50 Jahre. Insbesondere das Prinzip des „sozialen Marketings“ führt zu Präventionskonzepten,<br />
die die Zielgruppen erreichen und zur Mitarbeit motivieren.<br />
7. Prinzip des Sozialen Marketings<br />
Die Prinzipien des sozialen Marketings übertragen <strong>im</strong> Grunde die Mix-Faktoren<br />
des kommerziellen Marketings in den Bereich der gesundheitlichen Prävention.<br />
Be<strong>im</strong> kommerziellen Marketing werden Produkte vermarktet, d.h. Ziel der Marketingmaßnahmen<br />
ist, eine Zielgruppe von Konsumenten von den Vorteilen und<br />
der Preiswürdigkeit eines Produktes so zu überzeugen, dass eine Kaufbereitschaft<br />
erweckt wird. Über Aufmerksamkeit, Interesse, Wunsch und Handeln (AIDA =<br />
awareness, interest, desire, action) wird die Zielgruppe in ihrem Verhalten<br />
best<strong>im</strong>mt.<br />
Kein Fabrikant stellt Produkte her, die ein potienzieller Kunde heute kaufen,<br />
aber in zwanzig Jahren erst nutzen kann. Es wäre eine nahezu unmögliche<br />
Marketingaufgabe, für ein solches Produkt eine wirksame Verkaufsstrategie zu<br />
entwickeln. Gleichwohl haben verschiedene Präventionskampagnen genau<br />
dieses versucht, wenn sie z.B. Kindern empfehlen, Milch zu trinken, um <strong>im</strong><br />
Alter einer Osteoporose vorzubeugen.<br />
Die aus dem kommerziellen Marketing bekannten Mix-Faktoren sind: Produkt,<br />
Preis, Public-Relations und Distribution. Es sei vorab bemerkt, dass jeder dieser<br />
Mix-Faktoren für sich opt<strong>im</strong>al gestaltet sein muss, um einen Erfolg zu erzielen.<br />
Die Mix-Faktoren sind nicht gegenseitig ersetzbar oder austauschbar.<br />
Im sozialen Marketing sind jedoch die Bezüge zu den Mix-Faktoren anders als<br />
<strong>im</strong> kommerziellen Marketing. Hier werden zumeist dingliche Produkte zu einem
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verändern? 123<br />
best<strong>im</strong>mten Preis angeboten. Dafür wird Werbung geschaltet und ein Distributionssystem<br />
genutzt. Trotzdem sind die Zielsetzungen <strong>im</strong> sozialen Marketing<br />
vergleichbar: Die Zielperson (oder die Zielgruppe) soll ein best<strong>im</strong>mtes „Produkt“<br />
zu einem best<strong>im</strong>mten „Preis“ besitzen wollen, auch wenn das Produkt kein<br />
Gegenstand und der Preis kein Betrag in Euro ist. Über „Attraktivität“ und „Preiswürdigkeit“<br />
informiert die Public-Relations und zeigt Möglichkeiten, wo das „Produkt“<br />
distribuiert wird.<br />
• Produkt<br />
<strong>Gesundheit</strong>sprävention kann ihre „Produkte“ unter höchst unterschiedlichen<br />
Namen anbieten. Natürlich ist „<strong>Gesundheit</strong>“ der generische Begriff, der zutrifft,<br />
aber bei gesunden Zielpersonen nicht unbedingt Aufmerksamkeit oder Interesse<br />
auslöst. „<strong>Gesundheit</strong>“ lässt sich attraktiver formulieren und anbieten. So<br />
sind Begriffe wie „Wohlgefühl“, „Potenz“ oder „Lebensqualität“ als „Verkaufsargumente“<br />
geeigneter, da sie Bedürfnisse reflektieren, die in breiten Zielgruppen<br />
existent sind. Soziales Marketing versucht, ein Produktangebot zu formulieren,<br />
das genau die Menschen anspricht, die für die Aktion gewonnen werden sollen.<br />
• Preis<br />
Oft werden die „Preise“ in Präventionskampagnen als zu hoch empfunden, wobei<br />
„Preis“ für Abkehr von Gewohnheiten, Verzicht und Verhaltensaufwand steht.<br />
Soziales Marketing versucht, den „Preis“ als preiswert und damit als subjektiv angemessen<br />
zu kommunizieren. Das ist vor allem auch eine Aufgabe der Werbung.<br />
• Public-Relations<br />
Über zielgruppenspezifische Medien wird <strong>im</strong> sozialen Marketingkonzept informiert,<br />
wobei Produktangebot und seine Preiswürdigkeit <strong>im</strong> Vordergrund stehen.<br />
Die PR spricht emotional an, kommuniziert stärker über Infotainment als über<br />
Information, denn schließlich soll PR die Motivation aktivieren, sich mit dem<br />
Produkt zu befassen.<br />
• Distribution<br />
Unerlässlich ist eine breit angelegte Distribution, die jeder motivierten Zielperson<br />
ohne weiteren Verhaltensaufwand ermöglicht, das Produkt zu erreichen.<br />
Die Distribution muss die Kosten der Produktbeschaffung gering halten, um nicht<br />
den „Preis“ durch zusätzlichen Verhaltensaufwand zu erhöhen.<br />
7.1 Erstes Beispiel: Die PfundsKur<br />
Die PfundsKur ist die größte <strong>Gesundheit</strong>saktion zur Prävention von Übergewicht,<br />
die bisher in Baden-Württemberg und Sachsen durchgeführt wurde. Aktionspartner<br />
sind die AOK sowie die Landesrundfunkanstalten SWR bzw. MDR. Die<br />
PfundsKur ist ein Verhaltenstraining über zehn Wochen, bei dem inzwischen<br />
weitere Partner aktiv mitwirken, konzipiert nach den Prinzipien des sozialen<br />
Marketings.
124<br />
Volker Pudel<br />
• Produkt<br />
Die PfundsKur „verkauft“ das Produkt „Lust auf Leben“. Und verspricht konkret:<br />
„Die dicke Chance für die schlanke Linie“.<br />
• Preis<br />
Durch Aussagen wie „Keine Verbote, keine Gebote“ oder „Es ist verboten, sich<br />
ein Lebensmittel zu verbieten“, wird der „Preis“, und damit der Verhaltensaufwand<br />
als gering kommuniziert. Die beiden PfundsKur-Bücher (Trainings-<br />
und Kochbuch) gibt es preiswert <strong>im</strong> Buchhandel.<br />
• Public-Relations<br />
Die PR übernehmen die AOK mit Großflächenplakaten und Anzeigen sowie der<br />
Sender mit Trailern und Infoboxen. Großveranstaltungen mit einer Mult<strong>im</strong>edia-<br />
Präsentation in jeweils mehr als 20 Städten laden ein zum Infotainment über die<br />
PfundsKur. Über 40 Tageszeitungen berichten ebenfalls regelmäßig über zehn<br />
Wochen in jedem Bundesland.<br />
• Distribution<br />
Im gesamten Gebiet jedes Bundeslandes werden AOK-Gruppen für das<br />
zehnwöchige Training eingerichtet. Informationen, Ratschläge und Tipps zur<br />
PfundsKur geben Tageszeitungen sowie regelmäßige Rundfunk- und Fernsehsendungen.<br />
Spezielle PfundsKur-Produkte (fettarm) sind bei Fleischern, Bäckern<br />
und <strong>im</strong> Lebensmittelhandel zu kaufen. Restaurants und Kantinen weisen den<br />
Fettgehalt auf ihren Speisekarten durch „Fettaugen“ aus. Walking- und Fahrradtreffs<br />
finden in der Region statt.<br />
• Erste Bewertung<br />
Die PfundsKur erreichte in beiden Bundesländern eine enorme Aufmerksamkeit<br />
von mehr als 80% in der Bevölkerung. Aktive Teilnehmer, allein in Baden-Württemberg<br />
mehr als 330.000 <strong>im</strong> Jahr 2000, gaben in einer repräsentativen Erhebung<br />
eine sehr positive Bewertung (Schulnote 1,9) für die PfundsKur ab (siehe<br />
dazu Ellrott & Pudel, 2003). Die Inhalte der PfundsKur, den Fettkonsum über<br />
„Fettaugenkontrolle“ auf 20 pro Tag zu senken und den Kohlenhydratverzehr zu<br />
liberalisieren („satt essen an Kohlenhydraten“) wurden allgemein verstanden,<br />
akzeptiert und realisiert.<br />
Mit besonderen Aktionen <strong>im</strong> Sinne von Infotainment wurde die Bevölkerung<br />
motiviert, mehr Lust auf Leben zu gestalten. „Kühlschrankkontrollen“ bei Teilnehmern,<br />
die in Funk und Fernsehen ausgestrahlt wurden, zählten ebenso dazu<br />
wie der PfundsKur-Song oder ein Aufruf, L<strong>im</strong>ericks über die PfundsKur an den<br />
Sender zu schicken. Das Konzept des sozialen Marketings hat dazu beigetragen,<br />
dass die PfundsKur „Lust auf Leben“ als Gemeinschaftsaktion <strong>im</strong> ganzen Bundesland<br />
erlebt wurde, über die man nicht nur miteinander sprechen, sondern<br />
auch gemeinsam mitmachen konnte.
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verändern? 125<br />
Die PfundsKur als große präventive <strong>Gesundheit</strong>skampagne ist eine konzertierte<br />
Aktion mit vielen Partnern, die die Ziele der PfundsKur akzeptieren, aber natürlich<br />
auch aus eigenen Interessen motiviert sind, diese Kampagne zu unterstützen.<br />
Damit ist ein Konzept entwickelt worden, wie <strong>Gesundheit</strong>sprävention<br />
mit den Partnern, die für Essen und Trinken der Bevölkerung zuständig sind,<br />
organisiert werden kann.<br />
Der Erfolg der PfundsKur gründet auch darauf, dass nicht ausschließlich Verhaltensprävention<br />
<strong>im</strong> Vordergrund stand, sondern durch Aktionspartner wie Bäcker,<br />
Fleischer, Gastronomie, Kantinen und Lebensmittelhandel ein gutes Stück Verhältnisprävention<br />
realisiert wurde. Fettärmere Gerichte oder Produkte bieten,<br />
wenn sie erkennbar angeboten werden, einen vergleichsweise einfachen Weg,<br />
sein Essen günstiger zusammen zu setzen.<br />
Die <strong>Stiftung</strong> Warentest beurteilte die PfundsKur als „uneingeschränkt empfehlenswert“.<br />
Ob die PfundsKur auch langfristige Wirkungen <strong>im</strong> Sinne einer Prävention<br />
der Adipositas hat, muss in Zukunft beobachtet und belegt werden. Die<br />
erste Evaluation der PfundsKur in Baden-Württemberg und Sachsen hat jedoch<br />
bewiesen, dass eine bedürfnisgerechte Kommunikation über „Lust auf Leben“<br />
und über „die dicke Chance für die schlanke Figur“ von der Bevölkerung aufgegriffen<br />
und von großen Teilen auch in das eigene Essverhalten umgesetzt wird.<br />
7.2 Zweites Beispiel: PowerKids<br />
PowerKids nennt sich eine Präventionsmaßnahme für übergewichtige Kinder<br />
zwischen 8 und 12 Jahren. In einem Koffer sind für das 10-wöchige Training<br />
unterschiedlichste Materialien, die von den Kindern (möglichst zusammen mit<br />
ihren Eltern) benutzt werden. So werden die „Spielregeln“ für das Training<br />
sowohl in einem Handbuch, aber auch in einem Video erläutert, dass von Dr.<br />
Franziska Rubin moderiert wird, die die Kinder aus dem Kinderkanal kennen.<br />
Ziel des Trainings ist, „Fettzies“ und „Schlaffies“ zu sparen, um damit „Winnies“<br />
zu sammeln. Hat ein Kind 150 Winnies zusammen, wird es zum PowerKid und<br />
darf das Überraschungsgeschenk aus dem Koffer öffnen.<br />
Bei PowerKid wird die Reduktion ungünstigen Verhaltens trainiert und durch<br />
„Winnies“ belohnt. Wenn Kinder Fett („Fettzies“) einsparen und Immobilität<br />
(„Schlaffies“) vermeiden, erhalten sie Belohnungspunkte („Winnies“), wobei<br />
ihnen aber frei gestellt ist, was sie essen und wie sie sich bewegen. Dadurch<br />
erhalten die Kinder einen weiten Freiraum für eigene Entscheidungen und<br />
können sich an dem Prinzip der flexiblen Verhaltenskontrolle orientieren.<br />
PowerKids beginnt mit der Verhaltensbeobachtung, d.h. die Kinder führen ein<br />
Protokoll „Essen und Trinken“, um zu erkennen, wie viel Fett sie konsumieren.<br />
Das Lebensmittel oder die Speise mit dem höchsten Fetteintrag wird dann<br />
zum „Highscore-Fettzie“. Die Halbierung des „Highscore-Fettzies“ ist dann das
126<br />
Volker Pudel<br />
Trainingsziel der kommenden Woche. Über Pyramiden, auf denen Rubbelpunkte<br />
sind, wird der Fettkonsum kontrolliert. Zwei große Poster für das Kinderz<strong>im</strong>mer<br />
haben vorgegebene Flächen, um sowohl für den Verbrauch an Fettzies als auch<br />
an „Schlaffies“ eine anschauliche Bilanz zu erstellen.<br />
Für jede Trainingswoche sind spezielle Aufgaben vorgesehen, z.B. Besuch eines<br />
Fastfood-Restaurants mit der Familie (dazu gibt es einen Fastfood-Führer),<br />
gemeinsames Pizzabacken oder das Aufkleben von „Klebe-Fettzies“ auf die Produkte,<br />
die <strong>im</strong> häuslichen Kühlschrank lagern. PowerKids wird von den Kindern<br />
als ein attraktives Spiel verstanden, in dem sie zum PowerKid werden. Die<br />
Evaluation bei 130 Familien mit mindestens einem übergewichtigen Kind in<br />
München hat gezeigt, dass die übergewichtigen Kinder durch Reduktion von<br />
Nahrungsfett und Immobilität an Gewicht abnehmen.<br />
Offenbar ist es gelungen, mit PowerKids den Kindern ein „Produkt“ zu versprechen,<br />
das sie gerne haben möchten. Der „Preis“, den sie leisten müssen, ist durch<br />
die spielerische Einbettung nicht zu hoch. Auch nicht für die Eltern, die den<br />
PowerKids-Koffer be<strong>im</strong> AOK-Verlag für ca. 30 Euro erwerben können. Die Public-<br />
Relations haben Medien übernommen, sodass bis zum Jahr 2003 schon über<br />
25.000 PowerKids-Koffer abgerufen wurden.<br />
7.3 Drittes Beispiel: Online-Training Sl<strong>im</strong>net<br />
Unter der Internet-Adresse www.sl<strong>im</strong>net.de wird ein Online-Gewichtstraining<br />
angeboten, das alle Möglichkeiten nutzt, die <strong>im</strong> Internet nutzbar sind, z.B. Chats,<br />
Foren, E-mail-Service, Wochenprogramme, interaktive Rückmeldung, etc.<br />
Das Online-Training bietet in der Variante des „Intensivtrainings“ zudem die<br />
Möglichkeit, <strong>im</strong> Online-Shop diätetische Lebensmittel nach §14a der Diätverordnung<br />
zu bestellen, um eine sichere Gewichtsabnahme zu ermöglichen. Die<br />
Moderation der Chats, aber auch die Bearbeitung der eingehenden E-mails wird<br />
von Psychologen bzw. Ernährungswissenschaftlern geleistet. Für die Nutzung der<br />
interaktiven Beratungsleistungen werden 12 Euro/Monat berechnet, während<br />
die Nutzung der nicht interaktiven Elemente kostenfrei ist.<br />
Die Erfahrungen mit diesem auf moderner Technologie basierendem Präventionsangebot<br />
sind noch nicht abschließend zu bewerten. Durch die anfänglich gute<br />
Berichterstattung über Sl<strong>im</strong>net in den Medien haben sich in zwei Jahren über<br />
12.000 Teilnehmer angemeldet. Die weiblichen Teilnehmerinnen überwiegen<br />
mit 85%. Das Durchschnittsalter liegt bei ca. 45 Jahren. Die Chats, aber auch die<br />
Foren, waren zunächst gut besucht. Allerdings führt die Unverbindlichkeit des<br />
Internets dazu, dass die Teilnahme stark fluktuiert und eine längerfristige konstante<br />
Teilnahme an den Gruppenchats nicht erwartet werden kann. Andererseits<br />
wurden auch beachtliche Gewichtsabnahmen bei Teilnehmern erzielt, die durch<br />
das nachfolgende Stabilisierungsprogramm gut gehalten werden konnten.
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verändern? 127<br />
Schließlich musste festgestellt werden, dass die Bereitschaft zum Kauf von diätetischen<br />
Lebensmitteln sehr gering ist, sodass eine Finanzierung der Beratungsleistungen<br />
darüber nicht möglich ist. Die Einführung der Beratungspauschale<br />
von 12 Euro/Monat erzielt ebenfalls keine Kostendeckung. Online-Systeme zur<br />
gesundheitlichen Prävention werden eine Chance haben, wenn die Modalitäten<br />
noch weiter erforscht werden. Dies wird gerade in einer Studie vorgenommen.<br />
7.4 Viertes Beispiel: Expertensystem „Abnehmen mit Genuss“<br />
„Abnehmen mit Genuss“ ist ein computergestütztes Abnahmeprogramm, das als<br />
Nachfolger der „Vier-Jahreszeiten-Kur“ den Versicherten der AOK angeboten wird.<br />
Die Teilnehmer treten in einen schriftlichen Dialog (ergänzt durch SMS und<br />
E-mail), der durch ein Expertensystem generiert wird. Ziel von „Abnehmen mit<br />
Genuss“ ist, die Teilnehmer zu trainieren, sich an eine fettnormalisierte, kohlenhydratliberale<br />
Ernährung zu gewöhnen sowie flexible Verhaltenskontrolle<br />
zu erlernen.<br />
Die Teilnehmer führen ein „Tagebuch Essen & Trinken“ und füllen <strong>im</strong> Verlauf<br />
bis zu 12 Monaten verschiedene Fragebögen aus. Das Expertensystem „antwortet“<br />
auf jede individuelle Datenkonstellation mit einem individualisierten<br />
Beratungsbrief in Klartext. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer ein Handbuch<br />
mit grundsätzlichen Informationen zum Übergewicht und seiner Reduktion. Die<br />
Teilnehmergebühr beträgt 49 Euro, sie wird nach dem Training von der AOK<br />
erstattet.<br />
Die Evaluation zeigte, dass 94% der Teilnehmer, deren Ausgangsgewicht einem<br />
BMI von 30 entsprach, an Gewicht abnehmen. Bei ca. 60% der Teilnehmer kann<br />
die Gewichtsreduktion nach 14 Monaten als erfolgreich bewertet werden (unter<br />
5% des Ausgangsgewichts). Die subjektive Zufriedenheit der Teilnehmer ist hoch<br />
(Schulzensur 1,9 für das Programm). Mit unter 7 € pro Kilogramm Gewichtsverlust<br />
bietet „Abnehmen mit Genuss“ zudem ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.<br />
8. Chancen durch neue Medien<br />
Neue Medien basieren auf Computertechnologie. Sie ermöglichen den Einsatz<br />
von<br />
• Expertensystemen<br />
Sie formulieren eine individualisierte Ansprache auf Grund einer standardisierten<br />
Dateneingabe. Für jede Datenkombination stehen in einer Datenbank Textmodule<br />
zur Auswahl, die über Algorithmen gesteuert und zu einem Klartext<br />
zusammengesetzt werden. Die Textausgabe kann als Brief, E-mail, SMS oder per<br />
Bildschirm erfolgen.
128<br />
Volker Pudel<br />
• Online-Beratung<br />
Online-Beratung über E-mail, Chats und Foren können Teilnehmer ebenfalls ortsunabhängig<br />
nutzen. Sie vermitteln außerdem einen sozialen Kontext.<br />
• Mult<strong>im</strong>edia Präsentation<br />
Mult<strong>im</strong>edia Präsentationen vermitteln Informationen eindrucksvoll und verständlich,<br />
sie fördern zudem emotionale Erlebnisse, die Motivation fördern.<br />
Der Einsatz dieser neuen Medien nach dem Prinzip des sozialen Marketings kann<br />
die Wirkung präventiver Maßnahmen steigern. Es wird durch soziale Einbindung<br />
ein emotionaler Bezug hergestellt, die Teilnahme kann ortsunabhängig stattfinden,<br />
die Kosten-Nutzen-Relation ist günstig. Die Angebote sind zudem beliebig<br />
multiplizierbar.<br />
9. <strong>Gesundheit</strong>sprävention<br />
Auch be<strong>im</strong> Einsatz neuer Medien stellen sich die entscheidenden Fragen, ob<br />
die Angebote auf ein „<strong>Gesundheit</strong>smotiv“ zielen können und ob Menschen<br />
grundsätzlich vernünftig reagieren.<br />
• <strong>Gesundheit</strong>smotiv<br />
Das Essverhalten wird durch zahlreiche Motive gesteuert, zusätzlich reguliert<br />
durch evolutionsbiologische Mechanismen. Bei gesunden Menschen ist kaum<br />
davon auszugehen, dass ein „<strong>Gesundheit</strong>smotiv“ aktiv wird, zumal Motive erst<br />
dann gebildet werden, wenn ein Defizit besteht, auf dessen Behebung das<br />
Motiv ausgerichtet wird. Zwar geben Verbraucher an, dass sie aus gesundheitlichen<br />
Gründen z.B. abnehmen wollen oder Eiweißnahrung zu sich nehmen.<br />
Dahinter verbirgt sich jedoch kein abstraktes <strong>Gesundheit</strong>smotiv, sondern<br />
ein konkretes Schönheits- bzw. Schlankheitsmotiv oder das Motiv, Muskeln<br />
aufzubauen.<br />
• Vernunftmotiv<br />
Ebenso wird auch kein „Vernunftmotiv“ menschliches Verhalten beeinflussen.<br />
In dem Wunsch, dass das eigene Verhalten von anderen Menschen als vernünftig<br />
bewertet wird, drückt sich eine soziale Motivation aus. Gerade das Essverhalten<br />
folgt nicht dem Rationalitätsprinzip, das davon ausgeht, vernünftigen<br />
Menschen vernünftige Informationen zu liefern, damit sie sich vernünftig verhalten.<br />
Menschen essen anders, als sie sich ernähren sollten. An Informationen<br />
mangelt es nicht, doch mit kognitiver Argumentation ist emotionales Verhalten<br />
kaum modifizierbar. Der Psychologe Rothocker hat einmal formuliert: „Der<br />
Mensch denkt nur hie und da rational“. Allerdings werden als Verhaltensbegründungen<br />
in der Regel rationale Argumente angeführt, die jedoch als<br />
Rationalisierungen das ursprünglich emotional gesteuerte Verhalten erklären<br />
sollen. Die soziale Erwünschtheit wirkt als Motiv, eigenes Verhalten als rational<br />
begründet darzustellen.
Lässt sich <strong>Gesundheit</strong>sverhalten verändern? 129<br />
10. <strong>Gesundheit</strong><br />
Es ist schwer definierbar, was „<strong>Gesundheit</strong>“ eigentlich bedeutet. „Wer gesund ist,<br />
ist nur nicht ausreichend genug untersucht“, lautet eine treffende Beschreibung,<br />
die darauf abzielt, dass absolute <strong>Gesundheit</strong>, wie sie von der WHO definiert wird,<br />
unerreichbar ist. „<strong>Gesundheit</strong> bedeutet, auch mit Beeinträchtigungen gut zu<br />
leben“, diese Definition trifft die Realität wesentlich besser, zumal sie auch die<br />
psychische Kompetenz beinhaltet. Schließlich kann auch eine positive Erlebnisbilanz<br />
als Ausdruck von <strong>Gesundheit</strong> angesehen werden, wobei die zeitnahe<br />
Opt<strong>im</strong>ierung der Erlebnisbilanz durchaus langfristig zu wenig opt<strong>im</strong>alen Ergebnissen<br />
führen kann (vgl. Kontingenzverhältnisse).
Prävention und die seelische<br />
<strong>Gesundheit</strong><br />
Angelika Wagner-Link<br />
1. Die Psyche und psychische <strong>Gesundheit</strong> in ihrer Bedeutung<br />
für Prävention und Salutogenese<br />
1.1 Psyche und psychische <strong>Gesundheit</strong><br />
Körperliche Aspekte spielen bekanntermaßen eine wichtige Rolle be<strong>im</strong> Erhalt<br />
und bei der Wiedererlangung von <strong>Gesundheit</strong>; aber auch die Psyche hat einen<br />
wesentlichen Einfluss auf unser Wohl- und Missbefinden.<br />
Unter Psyche wird das seelisch-geistige Leben des Menschen verstanden. Hierunter<br />
fallen sowohl die bewussten als auch die unbewussten Vorgänge des Auffassens,<br />
Erlebens und Verarbeitens von Eindrücken. Die <strong>Gesundheit</strong> ist nach der<br />
WHO ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens<br />
(...) und nicht allein das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen. Die<br />
psychische <strong>Gesundheit</strong> beinhaltet in Folge, dass ein Mensch mit sich und der<br />
Umwelt ohne größere Beeinträchtigung seiner selbst oder anderer zu recht<br />
kommt, dass er weder sich noch andere gefährdet und ohne einschränkenden<br />
Leidensdruck sein Leben gestalten kann.<br />
Seelische <strong>Gesundheit</strong> kann als überdauernder Zustand beschrieben werden, der<br />
gekennzeichnet ist durch gute Anpassung, durch Freude am Dasein und durch<br />
Selbstentwicklung, bis hin zu Selbstverwirklichung. Es handelt sich also um<br />
einen positiven Zustand und nicht um die bloße Abwesenheit einer seelischen<br />
Störung. 1<br />
Bisher wurde der Physis eine wesentlich größere Aufmerksamkeit als der Psyche<br />
geschenkt, wenn es um <strong>Gesundheit</strong> respektive Krankheit geht. Die Physis ist ja<br />
auch sichtbar, leicht zu messen und zu diagnostizieren. Aber erst wenn das ganze<br />
menschliche Verhalten erfasst wird, die Lebensgewohnheiten, die Lebensumstände,<br />
die Einstellung zu <strong>Gesundheit</strong> und die Gedanken und Gefühle – und<br />
1 Becker, P.: Psychologie der seelischen <strong>Gesundheit</strong>, Göttingen 1997 2 .
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 131<br />
nicht nur körperliche Teilaspekte – entsteht ein Kl<strong>im</strong>a der Gleichwertigkeit des<br />
Physischen und Psychischen. Diese Gleichwertigkeit ist für eine eigenverantwortliche<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung und -vorsorge elementar.<br />
Der Großteil chronischer Erkrankungen ist lebensstilbedingt und damit eng u.a.<br />
mit der persönlichen Einstellung, dem individuellen Erleben und dem persönlichen<br />
Verhaltensrepertoire verknüpft. 20% der chronisch Kranken verursachen<br />
bis zu 80% der Kosten <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>swesen! Der gesamte Mensch in seiner Verantwortung<br />
für sein persönliches Wohlergehen (Eigenverantwortung) und seine<br />
individuellen Möglichkeiten muss für eine wirkungsvolle Prävention effizient<br />
und zielgerichtet unterstützt werden.<br />
„Wir müssen versuchen, als Gesunde so zu leben,<br />
wie wir es uns als Kranke vorgenommen haben.“<br />
(Plinius der Jüngere)<br />
Leider fördert(e) das <strong>Gesundheit</strong>ssystem die Haltung des Sich-Nicht-Verantwortlich-Fühlens<br />
von gesundheitlichen Belangen, indem sie die Reparatur vor<br />
die Gesunderhaltung stellt(e). Wie der Entwicklungspsychologe Erikson feststellte,<br />
ist <strong>Gesundheit</strong> kein fester Besitz, sondern muss <strong>im</strong>mer wieder neu erworben<br />
und gefestigt werden. Es gibt viele – bisher zu wenig genutzte – Möglichkeiten,<br />
die Menschen in diesem Entwicklungsprozess zu unterstützen.<br />
1.2 Prävention, Salutogenese und <strong>Gesundheit</strong>spsychologie<br />
Der jeweilige Fokus von Prävention und Salutogenese sowie der <strong>Gesundheit</strong>spsychologie<br />
sind unterschiedlich. Die Prävention geht von der Krankheitsperspektive<br />
aus, d.h. hier geht es darum, Krankheit vorzubeugen. Ziele sind demnach<br />
Verhütung, Heilung und Bewältigung von Krankheiten sowie Vermeidung<br />
krank machender Verhaltensweisen und Umweltbedingungen. 2<br />
Die Salutogenese (<strong>Gesundheit</strong>sförderung) hingegen, die auf den Medizinsoziologen<br />
Aaron Antonovsky 3 zurückgeht, bezeichnet ein neues Denken und eine<br />
neue Herangehensweise in Medizin und Psychologie. Nicht die Entstehung von<br />
Krankheiten (Pathogenese), sondern die Erhaltung von <strong>Gesundheit</strong> sowie das<br />
Auffinden so genannter Schutzfaktoren stehen <strong>im</strong> Mittelpunkt. Diese „<strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbest<strong>im</strong>mung<br />
über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen und sie<br />
damit zur Stärkung ihrer <strong>Gesundheit</strong> zu befähigen.“ 4<br />
2 Rieländer, M./Brücher-Albers, C.: <strong>Gesundheit</strong> für alle <strong>im</strong> 21. Jahrhundert. Neue Ziele der<br />
Weltgesundheitsorganisationen mit psychologischen Perspektiven erreichen, Bonn 1999.<br />
3 Antonovsky, A.: Salutogenese – Zur Entmystifizierung der <strong>Gesundheit</strong>, Tübingen 1997.<br />
4 WHO, 1986.
132<br />
Angelika Wagner-Link<br />
Vielmehr als bisher sollten typische salutogene Fragestellungen in die Prävention<br />
integriert werden, wie z.B.:<br />
• Wie schaffen es relativ gesunde Menschen gesund zu bleiben?<br />
• Welche Ressourcen stehen ihnen zur Erhaltung der <strong>Gesundheit</strong> zur Verfügung?<br />
• Durch welchen Umgang mit Belastungen und schädlichen Einflüssen können<br />
sie ihre <strong>Gesundheit</strong> schützen?<br />
• Wie schaffen sie es, mit Beschwerden und Beeinträchtigungen so gut fertig zu<br />
werden, dass sie keinen oder nur geringen Schaden nehmen?<br />
Die moderne <strong>Gesundheit</strong>spsychologie hat den Ansatz der Salutogenese erheblich<br />
ausgebaut.<br />
Positive <strong>Gesundheit</strong>sziele werden formuliert, z.B. ganzheitliches Wohlbefinden,<br />
gute Lebensqualität oder die Fähigkeit zur konstruktiven Lebensgestaltung. Ferner<br />
geht es darum, wie man durch Förderung gesundheitsbezogener Fähigkeiten<br />
und Ressourcen, <strong>Gesundheit</strong> unterstützen und erhalten kann.<br />
Die Forschungsgebiete sind:<br />
• Ursachenforschung (z.B. Stressforschung),<br />
• Erforschung psychologischer Einflüsse bei verschiedenen Krankheiten,<br />
• Art der Bewältigung von Erkrankungen,<br />
• Erforschung von Prozessen innerhalb des <strong>Gesundheit</strong>ssystems und bei der<br />
Behandlung von Krankheiten (z.B. Arzt-Patienten-Beziehung, Compliance).<br />
Salutogenese und <strong>Gesundheit</strong>spsychologie betonen also <strong>im</strong> Gegensatz zur klassischen<br />
Prävention die psychischen Faktoren für Entstehung von <strong>Gesundheit</strong> und<br />
Krankheit und ihre Auswirkung auf Prävention, Therapie und Rehabilitation.<br />
Im Folgenden wird auf die Wirkung psychischer Faktoren eingegangen, da<br />
diese bisher wider besseren Wissens in der Prävention kaum Beachtung finden.<br />
2. Psychische <strong>Gesundheit</strong>sfaktoren<br />
2.1 <strong>Gesundheit</strong>sfördernde Einstellungen<br />
„Willst Du den Körper behandeln, musst Du zunächst die Seele heilen.“ (Platon)<br />
Best<strong>im</strong>mte Sichtweisen haben sich als gesundheitsförderlich und die Eigenverantwortung<br />
unterstützend herausgestellt. Wer z.B. glaubt, wichtige Ereignisse <strong>im</strong><br />
Leben selbst beeinflussen zu können (Opt<strong>im</strong>ismus und Kontrollüberzeugung),<br />
wer Verstehbarkeit, Geordnetheit und Vorhersagbarkeit erlebt („Kohärenzsinn“<br />
s. Seite 135), wer sich nicht äußeren Kräften oder anderen Menschen ausgeliefert<br />
fühlt (Selbstvertrauen) und wer Belastungen auch mit Humor nehmen kann,<br />
wird seltener krank.
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 133<br />
Opt<strong>im</strong>ismus und Selbstvertrauen<br />
„Pess<strong>im</strong>isten sehen in jeder Chance nur Probleme. Opt<strong>im</strong>isten sehen in jedem<br />
Problem eine Chance.“<br />
Opt<strong>im</strong>ismus ist eine verallgemeinerte positive Ergebniserwartung; ein Zusammenhang<br />
von eigenem Handeln und dem Ergebnis dieser Handlung wird wahrgenommen<br />
5 . Positive Auswirkungen des eigenen Verhaltens werden antizipiert.<br />
Grundlegendes Vertrauen in die Zukunft und in andere Menschen sowie eine<br />
generalisierte positive Ergebniserwartung führen zu Gelassenheit und sind so<br />
genannte Schutzfaktoren menschlicher <strong>Gesundheit</strong>. Menschen, die trotz Misserfolge<br />
und Rückschläge die Hoffnung nicht aufgeben, sind gegen Krankheiten<br />
gefeiter als Pess<strong>im</strong>isten.<br />
Der Einfluss von Opt<strong>im</strong>ismus auf <strong>Gesundheit</strong> und Verlauf verschiedener<br />
Erkrankungen ist vielfach nachgewiesen. Opt<strong>im</strong>isten erholen sich z.B. nach<br />
einer Bypass-Operation besser und ihr Leben normalisiert sich schneller als bei<br />
Pess<strong>im</strong>isten. Im Ganzen kann man nach 5 Jahren eine höhere Lebensqualität<br />
bei Opt<strong>im</strong>isten feststellen. Eine mögliche Erklärung für diese Verhaltensunterschiede<br />
könnte sein, dass die Wahl von Bewältigungsstrategien durch Opt<strong>im</strong>ismus<br />
mitbest<strong>im</strong>mt wird. So blickten vor der Operation die Opt<strong>im</strong>isten in die<br />
Zukunft und machten Pläne für die Zeit danach. Währenddessen die Pess<strong>im</strong>isten<br />
sich mehr mit ihrer jetzigen Lage und mit ihren aktuellen Gefühlen auseinander<br />
setzten. Nach der Operation waren die Opt<strong>im</strong>isten bestrebt, möglichst viel<br />
Informationen und Ratschläge für die weitere Lebensführung zu erhalten. Im<br />
Gegensatz dazu vermieden Pess<strong>im</strong>isten dies und versuchten, Gedanken an<br />
Symptome zu unterdrücken oder zu ignorieren. 6 Für <strong>Gesundheit</strong> und Wohlbefinden<br />
ist eine harmonische und positive Grundeinstellung offensichtlich<br />
wichtig.<br />
Neben einer opt<strong>im</strong>istischen Grundeinstellung ist es für die Entwicklung einer<br />
gesunden Lebensweise unabdingbar, dass der Mensch sich als kompetent für<br />
seine <strong>Gesundheit</strong> empfindet. So ist auch Vertrauen in die Fähigkeit zur Selbststeuerung<br />
des Menschen ein wesentliches Element in der von Carl Rogers bereits<br />
in den 40er-Jahren entwickelten clientzentrierten Gesprächspsychotherapie,<br />
deren Wirksamkeit erst in den letzten Jahren wissenschaftlich anerkannt<br />
wurde.<br />
Demnach spielen Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen eine Schlüsselrolle: Wer<br />
das Gefühl hat, etwas bewirken zu können („Das schaffe ich schon!“), fühlt sich<br />
eher kompetent in der jeweiligen Situation. Die Kompetenzerwartung bezieht<br />
sich auf die persönliche Überzeugung, sich z.B. gesundheitsfördernd verhalten<br />
5 Schwarzer, R.: Psychologie des <strong>Gesundheit</strong>sverhaltens, Göttingen 1996 2 .<br />
6 Ebd.: S.17.
134<br />
Angelika Wagner-Link<br />
zu können. Allerdings braucht man auch die jeweiligen Kompetenzen um wirksam<br />
handeln zu können, sonst läuft man Gefahr, sich zu hohe Ziele zu stecken<br />
oder sich selbst zu belügen. Auch ein unrealistischer Glaube an das gute Ende ist<br />
wenig hilfreich: es führt zur Unterschätzung von Risiken und Überschätzung der<br />
eigenen Person. Die eigene Kompetenzerwartung und Verhaltensänderung sind<br />
zudem abhängig davon, wie realistisch die Zwischenziele gesetzt werden und wie<br />
deren Erlangen subjektiv verarbeitet wird.<br />
Vorstellungen über Handlungswirksamkeit sind bei Laien und Experten jedoch<br />
oft recht unterschiedlich. In einem Versuch sollten zwei Gruppen – eine<br />
Laien-, eine Expertengruppe – präventive Verhaltensweisen nach ihrer Wichtigkeit<br />
in eine Rangordnung bringen, wie bspw. regelmäßige körperliche Aktivität,<br />
Vermeidung des übermäßigen Konsums von Fett, Zucker, etc. Im Ergebnis wurden<br />
Rangunterschiede zwischen Experten und Laien deutlich. Wie z.B. be<strong>im</strong><br />
Verhalten „Nicht Rauchen“: Hier stuften Experten Nicht-Rauchen auf Platz 1,<br />
hingegen Laien nur auf Platz 8. 7 Weite Kreise der Bevölkerung schätzen die Wirksamkeit<br />
von Verhaltensweisen fehl ein! Lediglich 6% der Deutschen sind der<br />
Ansicht, dass sie sich durch ihr eigenes Verhalten gefährden. Zu diesem Ergebnis<br />
kam eine repräsentative Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche<br />
Aufklärung.<br />
Entscheidend ist wie Handlungsergebnisse interpretiert werden, d.h. ob man<br />
etwas der eigenen Leistung oder dem Zufall zuschreibt. Die realistische Kompetenzerwartung<br />
hilft bei der Bewältigung von Stress, dem Ertragen von Schmerzen,<br />
dem Umgang mit chronischen Leiden, der Entwöhnung von Abhängigkeit<br />
und dem Aufbau von <strong>Gesundheit</strong>sverhaltensweisen.<br />
Menschen mit hoher Kompetenzerwartung sind eher in der Lage, Risikoverhaltensweisen<br />
abzubauen und <strong>Gesundheit</strong>sverhaltensweisen über einen längeren<br />
Zeitraum aufrecht zu erhalten. Dafür muss man aber auch von der Notwendigkeit<br />
überzeugt sein, etwas zu verändern und den festen Entschluss haben, handeln<br />
zu wollen.<br />
Wenn die Kompetenzerwartung in einer spezifischen Situation besonders niedrig<br />
ist, steigt die Rückfallgefahr genau dort. Für eine Rückfallprophylaxe ist es<br />
also notwendig Verhaltenskompetenzen für typische Situationen zu trainieren,<br />
wie z.B. Nein-Sagen in Verführungssituationen (Rauchen, Alkohol). Die Verhaltenstherapie<br />
hat hierfür ein umfangreiches Handlungsrepertoire entwickelt.<br />
Unser <strong>Gesundheit</strong>ssystem und seine Vertreter müssen lernen, den Menschen und<br />
den Patienten nicht zu entmündigen, sondern seine Ressourcen für die <strong>Gesundheit</strong>serhaltung,<br />
-wiedererlangung zu stärken, ihm Mut zuzusprechen und<br />
damit sein Selbstvertrauen zu stärken, sozusagen wie mit einem Marker das<br />
7 Ebd.: S.16.
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 135<br />
Potenzial erkennen und unterstreichen. Es ist oft erheblich einfacher und für<br />
alle Betroffenen angenehmer, positive Ressourcen auszubauen als Probleme zu<br />
verändern.<br />
Das aber erfordert individuellen Umgang mit dem Patienten und (noch) Gesunden!<br />
Diese Individualität in der Nutzung der Ressourcen gewinnt besonders<br />
in Entwicklungskrisen nach Erikson besondere Bedeutung. Denn jeder Mensch<br />
hat Lebensabschnitt abhängig unterschiedliche Probleme. Sobald die jeweiligen<br />
Probleme von den Experten erkannt sind, können angepasst und zielgerichtet<br />
Potenziale gesucht und ausgeschöpft werden.<br />
Lebenssinn und Kohärenzgefühl<br />
• Lebenssinn:<br />
Das Empfinden von Lebenssinn, z.B. einen Sinn in der eigenen Tätigkeit zu<br />
finden, schützt und stärkt die <strong>Gesundheit</strong>. Subjektiv sinnvolle Lern-, Arbeits- und<br />
Freizeitziele tragen zu einem lebenswerten Leben bei. Sich persönliche Ziele zu<br />
setzen und diese zu verfolgen, sich einer Sache zu verpflichten und engagiert<br />
handeln zu können, sind Merkmale, die sich als schützende Faktoren für die<br />
<strong>Gesundheit</strong> erwiesen haben.<br />
Das Leben erscheint Menschen sinnvoll:<br />
1. Wenn Ziele vorhanden sind:<br />
Menschen haben das Bedürfnis nach Zielen. Auf Dauer ist Ziellosigkeit den<br />
meisten Menschen kaum erträglich.<br />
2. Wenn es durch Wertvorstellungen geprägt wird:<br />
Persönliche Wertvorstellungen – vorgegeben z.B. durch Religion, Moral,<br />
Politik etc. – geben dem Leben eine Orientierung.<br />
3. Wenn es als kontrollierbar erlebt wird:<br />
Erleben von Sinn ist davon abhängig, ob man sich selbst als einflussreich und<br />
wirksam erlebt (Selbstwirksamkeit). Damit ist allerdings nicht eine stark kontrollierende<br />
Haltung („Ich muss alles <strong>im</strong> Griff haben!“) gemeint, mit der man<br />
für sich und die Umwelt Stress produziert. Das Gefühl, dem Schicksal oder<br />
anderen Menschen hilflos ausgeliefert zu sein, führt zu „Erlernter Hilflosigkeit“,<br />
die u.a. als eine Ursache für Depression angesehen wird.<br />
4. Wenn Menschen sich als wertvoll und wichtig erleben:<br />
Bedeutend sind hier günstige Erziehungseinflüsse in der Kindheit. Sie schaffen<br />
den Rahmen für eine gesunde Entwicklung des Vertrauens in sich und andere.<br />
Je sicherer das Selbstwertgefühl, desto unwichtiger wird die externe Selbstbestätigung<br />
durch Leistungen, durch begründete oder unbegründete Gefühle<br />
von Überlegenheit oder durch Zugehörigkeit zu prestigeträchtigen Gruppen.
136<br />
• Kohärenzgefühl:<br />
Angelika Wagner-Link<br />
Antonovskys Untersuchung an Frauen der Geburtsjahrgänge 1914-1923 verschiedener<br />
ethnischer Gruppen über die Auswirkung der Wechseljahre zeigte,<br />
dass <strong>im</strong>merhin 29% (!) über eine relativ gute psychische <strong>Gesundheit</strong> berichteten,<br />
obwohl die Frauen teilweise in einem Konzentrationslager inhaftiert gewesen<br />
waren oder Kriege miterlebt hatten. 8 Der Organismus kann offensichtlich<br />
unter best<strong>im</strong>mten Voraussetzungen über einen gewissen Zeitraum Belastungen<br />
auffangen.<br />
Grundsätzlich geht Antonovsky von einem Kontinuummodell der <strong>Gesundheit</strong><br />
aus. Ein Mensch ist mit anderen Worten nicht entweder gesund oder krank, sondern<br />
mehr oder weniger gesund oder krank.<br />
<strong>Gesundheit</strong>sbegünstigend ist nach Antonovsky 9 der von ihm so genannte<br />
Kohärenzsinn, eine Grundhaltung des Individuums gegenüber der Welt und dem<br />
eigenen Leben. Diese Grundhaltung, die Welt als zusammenhängend und sinnvoll<br />
zu erleben, setzt sich aus drei Komponenten zusammen:<br />
1. Verstehbarkeit: Außergewöhnliche oder auch gewöhnliche tägliche Belastungen<br />
werden als sinnvoll, nachvollziehbar und erklärbar, nicht chaotisch<br />
erlebt.<br />
2. Bewältigung: Die Zuversicht, dass Anforderungen mit den vorhandenen<br />
eigenen Ressourcen und Hilfen zu bewältigen sind.<br />
3. Sinnhaftigkeit: Das Leben hat Sinn und auch große Belastungen können mit<br />
Würde überstanden werden. 10<br />
Alle Komponenten zusammen generieren eine gesundheitserzeugende (salutogenetische)<br />
Wirkung. Je stärker das Kohärenzgefühl ist, desto größer ist die Möglichkeit<br />
einer Person, flexibel auf Anforderungen zu reagieren.<br />
Ähnliche Komponenten, die effektives Bewältigen von Stresssituationen begünstigen<br />
und generell gegen Stress weniger anfällig machen, hat auch Kobasa 11<br />
ermittelt. Sie hat die drei Merkmale Engagement und Selbstverpflichtung (neugierig<br />
auf das Leben sein und sein Bestes geben bei dem, was man tut), Kontrolle<br />
(sich selbst als einflussreich auf Lebensumstände erleben) und Herausforderung<br />
(Veränderungen als positive Chance erkennen und Ungewissheiten<br />
aushalten können) unter dem Begriff „Hardiness“ zusammengefasst. Darunter<br />
versteht sie die Stärke und Widerstandskraft gegen die Belastungen durch<br />
Stress.<br />
8 BzgA: Was erhält den Menschen gesund?, 2001, Bd.6, S.20.<br />
9 Ebd.: S.28.<br />
10 Ebd.: S.31.<br />
11 Kobasa, S.C.: Stress for life events, personality and health: An inquiry to hardiness,<br />
Journal Per Soc Psychol 37, 1979, S.1-11.
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 137<br />
Das Kohärenzgefühl hat auch Auswirkung auf die Stressoreneinschätzung:<br />
Stressoren werden nicht als Belastung angesehen, sondern als Herausforderung.<br />
So kann eine konstruktive Auseinandersetzung mit konkreten Bedingungen<br />
einer Situation statt finden und mit den durch sie hervorgerufenen Gefühlen.<br />
Eine klare und differenzierte Einschätzung der Belastungssituation wird gefördert.<br />
Durch ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl und der damit gegebenen subjektiven<br />
Sinnhaftigkeit werden Belastungssituationen seltener durch gesundheitlich<br />
riskantes Verhalten wie Rauchen, Alkohol etc. „bewältigt“. Zum Anderen wird<br />
durch ein gutes Kohärenzgefühl eine gesundheitlich günstige St<strong>im</strong>mungslage<br />
hervorgerufen. Dies hat wiederum positive Einwirkung auf das Immunsystem.<br />
Das Kohärenzgefühl ist also wichtig für ein gesundheitsförderliches Verhalten.<br />
Denn je mehr man den Sinn sieht und die Zusammenhänge versteht von eigenem<br />
Handeln, den Konsequenzen und ärztlichen Maßnahmen, desto eher wird<br />
man bereit sein, in seinem Interesse zu handeln.<br />
Humor<br />
„Lachen ist gesund!“<br />
Lachen ist für unsere <strong>Gesundheit</strong> tatsächlich essenziell, wie die Gelotologie – die<br />
Lachforschung – beweist. Denn Lachen baut z.B. Stress ab, stärkt das Immunsystem,<br />
stabilisiert den Kreislauf und vertieft die Atmung.<br />
Angeblich haben Menschen, die mindestens drei mal täglich herzlich lachen,<br />
eine bis zu vier Jahre höhere Lebenserwartung. Lachen führt auch zu einer<br />
vertieften Atmung, sodass der Körper besser mit Sauerstoff versorgt wird. Auch<br />
können sich fröhliche Menschen an lustige Ereignisse doppelt so schnell erinnern<br />
und sich damit noch einmal amüsieren, wie eher negativ programmierte<br />
Personen.<br />
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht!“<br />
Humor kann helfen, schwierige Lebenssituationen (z.B. Krankheit) zu meistern,<br />
Stress und Angst abzubauen und die <strong>Gesundheit</strong> zu stärken – er macht belastende<br />
Situationen leichter und n<strong>im</strong>mt ihnen ihre Strenge. Eine positive Gefühlslage<br />
wird erzeugt. Humor erleichtert den Perspektivenwechsel, indem man einen<br />
Schritt zur Seite tritt und sich selbst und die jeweilige Situation mit heiterer<br />
Distanz betrachtet. Er setzt sich über alle Beschränkungen hinweg, hält sich an<br />
keine vorgegebenen Regeln und durchbricht Tabus. Dies führt zu Spannungsund<br />
Stressabbau. Anwandlungen von Perfektionismus und andere irrationalen<br />
Überzeugungen werden relativiert, Denkblockaden aufgelöst. Kreativität und<br />
Effizienz werden gesteigert und neue Lösungswege können leichter gefunden<br />
werden.
138<br />
Angelika Wagner-Link<br />
Die ideale Lebenseinstellung wird schon von Epikur als: die „Seelenruhe“<br />
(Ataraxia) beschrieben. Er versteht darunter eine akzeptierende Gelassenheit,<br />
durch die der Mensch sich von äußeren Reizen und eigenen Begierden möglichst<br />
unabhängig macht.<br />
Humor ist auch für den zwischenmenschlichen Bereich essenziell. So hilft er verfahrene<br />
Situationen zu entkrampfen und ermöglicht Menschen, einen neuen<br />
Zugang zueinander zu finden und emotionalen Beziehungsstress abzubauen. Gemeinsames<br />
Lachen hat eine gruppenstärkende Funktion, da sich die Gruppenmitglieder<br />
durch das Lachen ihre gegenseitige Sympathie vermitteln und sich<br />
gegenseitig motivieren können z.B. zu gesundheitsfördernden Aktivitäten.<br />
Es macht durchaus Sinn Prävention und <strong>Gesundheit</strong>sförderung auch humorvoll<br />
zu vermitteln und Humor bzw. gemeinsames Lachen zu erlauben, ja sogar dazu<br />
zu an<strong>im</strong>ieren an Stelle sich des erhobenen Zeigefingers zu bedienen. Auch in<br />
der Psychotherapie hat sich Humor als Interventionsmethode nachweislich<br />
bestätigt. 12<br />
2.2 Psychische Faktoren und Lebensstil<br />
Auch der persönlich gesundheitsfördernde oder krank machende Lebensstil ist<br />
von diversen psychologischen Faktoren mit beeinflusst. Davon hängt wiederum<br />
ab, wie wir leben und arbeiten, wie viel Genuss unser <strong>Alltag</strong> uns bietet, wie wir<br />
mit Stress umgehen und wie wir sozial integriert sind. Und diese Gestaltung<br />
unseres Lebens entscheidet wesentlich über <strong>Gesundheit</strong> und Krankheit mit.<br />
Lustvoll arbeiten und leben<br />
Der Mensch braucht Arbeit. Berufstätigkeit ist wichtig sowohl für das Selbstbewusstsein<br />
als auch für die <strong>Gesundheit</strong>. So sind z.B. Arbeitslose häufiger<br />
depressiv und körperlich krank als ins Berufsleben Eingebundene. Das Gegenextrem,<br />
permanente (Selbst)überforderung, ist allerdings mindestens genauso<br />
ungesund.<br />
Schon Aristoteles ging davon aus, dass Menschen in der Mitte glücklich und dann<br />
auch (psychisch) gesund seien. Die Mitte ist dabei relativ und individuell, da<br />
jeder sein eigenes Bezugs- und Wertesystem hat.<br />
Wer es schafft, sich selbst zu motivieren, positiv mit sich und den beruflichen<br />
Anforderungen umzugehen, hat mehr Spaß bei der Arbeit und erbringt bessere<br />
Leistungen als Menschen, die lustlos ihren Berufsalltag verbringen. Dazu gehört<br />
12 Titze, M./Eschenröder, Chr.: Therapeutischer Humor, Frankfurt 1999, S.37 ff.
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 139<br />
auch Unlust zu akzeptieren, um Lust erleben zu können. Wichtig ist letztlich,<br />
dass die Lust-/Unlustbilanz positiv ausfällt. Lustmomente sind besonders intensiv<br />
während eines Flow-Erlebens. Es handelt sich be<strong>im</strong> Flow um einen Zustand<br />
der totalen Hingabe an eine Tätigkeit. Um diese Konzentration zu ermöglichen<br />
oder zu erleichtern, ist es hilfreich, wenn die zu bearbeitende Aufgabe klare<br />
Ziele beinhaltet und unmittelbar Rückmeldung über deren Erreichen liefert.<br />
Flows entstehen bei Herausforderungen und Anstrengungen eher als bei Ruhe<br />
und Erholung. Während dieses Prozesses werden Sorgen und Frustrationen des<br />
<strong>Alltag</strong>slebens verdrängt durch tiefe, aber mühelose Hingabe. Man erlebt ein Gefühl<br />
der Kontrollierbarkeit der jeweiligen Aktivität. Durch hohe Konzentration<br />
auf die jeweilige Aufgabe können sogar so genannte Flow-Erlebnisse erzielt werden.<br />
13 Wichtig ist, dass zwischen Anforderung und Können ein Gleichgewicht<br />
besteht und dass die körperlichen Bedürfnisse (z.B. Ruhepausen, ausreichend<br />
Schlaf, usw.) nicht ignoriert werden.<br />
Stichwortartig kann man Flow beschreiben:<br />
• vertieft sein in eine sinnvoll empfundene Tätigkeit,<br />
• Einswerden mit einer Tätigkeit,<br />
• Hochst<strong>im</strong>mung,<br />
• völliges Aufgehen <strong>im</strong> Erleben,<br />
• Verlust von Zeitempfinden.<br />
„Wer nicht genießt, wird ungenießbar.“<br />
Das Erleben von Lust und die Fähigkeit, Genuss zu empfinden sind maßgebliche<br />
Bestandteile für <strong>Gesundheit</strong>. Wenn der Mensch zu sehr von Leistungsstreben<br />
und Pflichtbewusstsein best<strong>im</strong>mt wird – dies geht oftmals mit einer<br />
Abwertung und Vernachlässigung der Fähigkeit zu genussvollem Erleben einher<br />
– werden Lebensqualität und Lebensfreude massiv beeinträchtigt bis hin zu<br />
depressiven Verst<strong>im</strong>mungen.<br />
Zusätzlich erzeugt der derzeitige Trend gesunde Menschen als potenziell Kranke<br />
zu definieren (mit erhöhtem Cholesterinspiegel, „Risiko“-Schwangerschaft,<br />
Menopause), Angst vor z.T. gar nicht vorhandenen Gefahren und reduziert die<br />
Lebensfreude (abgesehen von finanziellen Kosten).<br />
<strong>Gesundheit</strong> und gesundheitsförderndes Verhalten muss vielmehr als bisher mit<br />
Attraktivität und Genuss assoziiert sein. Positive Beispiele hierfür sind die „Pfundskur“<br />
der AOK, das Konzept „Power Kids“ des Ernährungspsychologen Prof. Volker<br />
Pudel, bei dem es um Gewichtsabnahme übergewichtiger Kinder geht und das<br />
Einführen mediterraner Küche in einigen Kantinen bayrischer Ämter.<br />
13 Czikszentmihalyi, M.: Flow, Harper Perennial, 1993.
140<br />
Stresskompetenz<br />
Angelika Wagner-Link<br />
Stress ist lebensnotwendig und für das Wohl des Menschen unerlässlich. Aber zu<br />
viel Stress hat kurz- und langfristig ungünstige Auswirkungen auf das psychische<br />
und physische Befinden und kann dann krank machen.<br />
Eine Studie von 1997 der „European Foundation of Living and Working Conditions“<br />
14 , bei der mehr als 15.000 Arbeitnehmer in den 15 EU-Mitgliedstaaten<br />
befragt wurden, kam zu dem Ergebnis, dass jeder vierte Arbeitnehmer unter Stress<br />
am Arbeitsplatz leidet. Das Karlsruher Institut für Arbeits- und Sozialhygiene stellt<br />
fest, dass 85% der untersuchten Manager an Beschwerden ohne organischen<br />
Grund leiden. Für krankheitsbedingte Fehlzeiten und Frühverrentung werden<br />
jährlich mindestens 900 Millionen Mark ausgegeben. Das macht ca. 10% der<br />
gesamten <strong>Gesundheit</strong>skosten aus. Es ist mittlerweile ausreichend bekannt, dass<br />
Stress einen höheren Krankenstand, höhere Fluktuation und oft niedrigere Produktivität<br />
bedeutet, trotzdem werden meist keine adäquaten und stringenten<br />
Konsequenzen gezogen. Die Kosten krankheitsbedingter Fehlzeiten beliefen sich<br />
<strong>im</strong> Jahre 2000 auf 60,4 Milliarden DM allein für die Arbeitgeber. 15<br />
Stress ist ein wichtiger ursächlicher Faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,<br />
Rückenbeschwerden, Störungen des Immunsystems, etc. Das Erleben von Stress<br />
ist nicht nur abhängig von kritischen Ereignissen (Stressoren), sondern auch von<br />
den psychischen Faktoren, wie subjektiven Bewältigungsressourcen und Einschätzung<br />
der Person – vor allem der eigenen Kompetenzerwartung. 16 Je stärker<br />
die spezifische Kompetenzerwartung, desto schwächer fällt die Stressreaktion aus.<br />
Die Wirkung eines Stressors hängt von seiner Bewertung ab, d.h. Stress ist<br />
individuell.<br />
Stress kann bewertet werden als:<br />
• Herausforderung:<br />
Man sieht die Chance einer erfolgreichen Bewältigung, eine evtl. schwer erreichbare,<br />
vielleicht risikoreiche, aber mit positiven Folgen verbundene Bewältigung<br />
der Anforderung, bzw. deren Nutzen.<br />
• Bedrohung:<br />
Potenzielle negative Konsequenzen werden antizipiert. Eine negative Folge, die<br />
noch nicht eingetreten ist, wird zu Recht oder Unrecht befürchtet.<br />
• Schaden-Verlust:<br />
Diese Bewertung bezieht sich auf eine bereits eingetretene Schädigung, z.B. eine<br />
beeinträchtigende Verletzung.<br />
14 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Stress<br />
at Work, Dublin 1997.<br />
15 Bandura, B./Litsch, M./Vetter, Ch.: Fehlzeiten-Report 2000, Berlin-Heidelberg 2001.<br />
16 Wagner-Link, A.: Verhaltenstraining zur Stressbewältigung, Stuttgart 2001.
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 141<br />
Während Bedrohung und Schaden-Verlust mit unlustbetonten, negativen Emotionen<br />
(Angst, Ärger, Depression) einhergehen, ist Herausforderung durch ein<br />
eher positives emotionales Befinden gekennzeichnet; Energien werden bereitgestellt<br />
und auf die Bewältigung des jeweiligen Stressors gerichtet. Der Umgang<br />
mit Stress, die so genannte Stresskompetenz, kann gelernt werden. So kann man<br />
kurzfristig versuchen, sich in der Situation zu entspannen, man kann die Aufmerksamkeit<br />
von der stressauslösenden Situation auf etwas anderes lenken, positive<br />
Selbstgespräche führen oder sich z.B. mittels Sport abreagieren. Langfristig<br />
ist es wichtig, gewisse <strong>im</strong>mer wiederkehrende Stressquellen aufzudecken und zu<br />
versuchen diese zu lösen, das eigene Zeitmanagement zu verbessern, seine Einstellungen<br />
zu ändern und Entspannung als Bestandteil des Lebens zu integrieren.<br />
Wichtig ist eine genaue persönliche Stressanalyse, um <strong>im</strong> richtigen Interventionszeitpunkt<br />
mit den jeweilig passenden Methoden auf Belastungen<br />
antworten zu können. Die jeweils individuell angepasste Kombination dieser<br />
Stressbewältigungstechniken führt nachgewiesener Maßen zu Reduktion von<br />
Stress und Stressfolgeschäden z.B. von Stress-Typ A Verhalten 17 . Zielgruppenorientierte<br />
und wissenschaftlich fundierte Methoden zur Stressbewältigung,<br />
finden erst in den letzten Jahren Zugang zu Maßnahmen der <strong>Gesundheit</strong>sförderung,<br />
z.B. der betrieblichen <strong>Gesundheit</strong>sförderung. Allzu oft werden Standardseminare<br />
zum Stressmanagement oder isolierte Einzelmaßnahmen (z.B. Zeitmanagement,<br />
Entspannung, usw.) – wider besseren Wissens – bevorzugt.<br />
Sozialer Rückhalt<br />
Unter sozialem Rückhalt (social support) versteht man soziale Interaktionen<br />
oder Beziehungen, die eine Person konkret unterstützen („soziale Unterstützung“)<br />
oder in einen sozialen Zusammenhang einbetten (soziale Integration). Von Bedeutung<br />
für die Gesunderhaltung sind dabei mehr die Möglichkeit mitmenschlicher<br />
Kontakte und das Angebot sozialer Unterstützung als deren tatsächliche<br />
Inanspruchnahme.<br />
Soziale Netzwerke wirken sich auf Lebenserwartung und Krankheitsanfälligkeit<br />
aus. Personen mit einem intakten sozialen Netzwerk erkranken nur mit 30 bis<br />
50 Prozent der Wahrscheinlichkeit körperlich oder psychisch und leben länger<br />
als Personen ohne soziale Geborgenheit. So ist z.B. die Sterblichkeitsziffer bei<br />
verwitweten Personen bis zu 13fach höher als bei gleichaltrigen verheirateten<br />
Personen. 18<br />
Hier wird deutlich, wie wichtig intakte mitmenschliche Netzwerke für den Menschen<br />
als Sozialwesen und für seine <strong>Gesundheit</strong> sind. Geborgenheit empfindet<br />
17 House, J.: Work, Stress and Social Support, New York 1981.<br />
18 Höfling, S./Gieseke, O.: <strong>Gesundheit</strong>soffensive Prävention. <strong>Gesundheit</strong>sförderung und<br />
Prävention als unverzichtbare Bausteine effizienter <strong>Gesundheit</strong>spolitik, München 2001.
142<br />
Angelika Wagner-Link<br />
man durch häufige und regelmäßig stattfindende mitmenschliche Kontakte, mit<br />
gegenseitiger Anteilnahme und Fürsorge. Wichtig ist, dass die Beziehungen auf<br />
Dauer verlässlich sind.<br />
Familie und Freundeskreis sind zusätzlich insofern für Salutogenese und Prävention<br />
von Bedeutung, als in diesen gesundheitsförderliche Lebensweisen kultiviert<br />
werden können, wie z.B. gesunde Ernährung, Ruhe, Sport, Humor, Lachen,<br />
Freude u.a. Außerdem können hier fast alle kleineren Erkrankungen außerhalb<br />
des offiziellen <strong>Gesundheit</strong>ssystems kuriert werden.<br />
Der Faktor „Gruppennorm“ ist dabei nicht zu unterschätzen. Je nachdem, welche<br />
<strong>Gesundheit</strong>sansichten gerade in den Gruppen existieren, die für einen als<br />
Bezugspunkte gelten, so wird man sich verhalten. <strong>Gesundheit</strong>sförderndes Verhalten<br />
sollte dementsprechend viel mehr als bisher in das soziale Umfeld der<br />
Zielgruppe eingebettet sein. Sozial erwünschtes Verhalten Jugendlicher sollte z.B.<br />
in der Peergroup gefördert werden. Dies ist wichtig für die Implementierung von<br />
gesundheitsfördernden Maßnahmen wie z.B. Nichtrauchen bei Jugendlichen.<br />
Wenn es gelingt, sozial anerkannte Personen aus der Peergroup als aktive Modelle<br />
für Nichtraucher zu trainieren, steigen die Chancen auf Akzeptanz und<br />
Transfer der präventiven Maßnahmen.<br />
2.3 <strong>Gesundheit</strong>swissen<br />
„Gesagt ist nicht gehört,<br />
Gehört ist nicht verstanden,<br />
Verstanden ist nicht einverstanden,<br />
Einverstanden ist nicht behalten,<br />
Behalten ist nicht angewandt,<br />
Angewandt ist nicht beibehalten.“ (Konrad Lorenz)<br />
Unter <strong>Gesundheit</strong>swissen versteht man die Kenntnis der natürlichen physiologischen<br />
und psychosomatischen Prozesse, sowie ihrer positiven Beeinflussung<br />
und potenziellen Gefährdung.<br />
<strong>Gesundheit</strong>swissen ist auch Wissen um die gesunde Persönlichkeitsentwicklung,<br />
um psychische <strong>Gesundheit</strong> und Wohlbefinden und um die Komplexität der<br />
sozialen und gesellschaftlichen Einflüsse auf die individuelle <strong>Gesundheit</strong>.<br />
Die Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Lebensweise setzt Kenntnisse zu<br />
vielfältigen Lebensbereichen, wie Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stressund<br />
Konfliktbewältigung, Hygiene, Kenntnisse zur Vorbeugung von Unfällen<br />
und Krankheiten, zur Selbstbehandlung leichter Krankheiten sowie zu den verschiedenen<br />
professionellen Angeboten der Vorbeugung, Beratung und Therapie<br />
voraus. Das <strong>Gesundheit</strong>skonzept eines Menschen best<strong>im</strong>mt, ob und wann Symptome<br />
wahrgenommen, wie sie erklärt und welche Folgen erwartet werden. Wann
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 143<br />
und aus welchen Gründen ein Mensch sich subjektiv als krank oder gesund<br />
betrachtet und fühlt, hängt ab von seinem Wissen um gesundheitsrelevante Verhaltensweisen,<br />
insbesondere aber auch von seinen Erwartungen hinsichtlich der<br />
Effektivität und der persönlichen Verfügbarkeit gesundheitsbezogenen Verhaltens.<br />
Menschen, die wissen, dass sie ihre <strong>Gesundheit</strong> oder Krankheit beeinflussen<br />
können und sich dafür verantwortlich fühlen, handeln eher gesundheitsbewusst<br />
oder krankheitsangemessen.<br />
Wie kommt nun <strong>Gesundheit</strong>swissen an die verschiedenen gesellschaftlichen<br />
Gruppen?<br />
Trotz aller „Aufklärung“ sind nach wie vor die Haupttodesursache Erkrankungen<br />
des Herz-Kreislauf-Systems. Diese sind zum Großteil lebensstilbedingt. Offensichtlich<br />
ist hier das Wissen (noch) nicht bei den Betroffenen angekommen<br />
oder es besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen Wissen und Umsetzen.<br />
<strong>Gesundheit</strong>sschädigendes Verhalten nach dem Motto „Ich leiste, also bin ich“,<br />
wird zunächst oft gesellschaftlich belohnt. Unsere westliche Leistungsgesellschaft<br />
legt <strong>im</strong>mer noch weniger Wert auf <strong>Gesundheit</strong> und langfristige Leistungsfähigkeit<br />
ihrer Mitglieder als auf Leistungssteigerung, Wirtschaftswachstum und<br />
Konsum.<br />
Auf der anderen Seite begeben sich viele Menschen in eine passive Konsumhaltung.<br />
Die Eigeninitiative der Menschen kann aber unterstützt werden, indem<br />
man ihnen zeigt, was sie schon richtig machen und ihnen hilft, die eigenen<br />
Ressourcen auszubauen. Der <strong>Gesundheit</strong>sexperte, z.B. Arzt kann durch transparente<br />
und motivierende Vermittlung bessere Mitarbeit des Patienten – „Compliance“<br />
– erreichen, die derzeit nur bei ca. 20% liegt! Diese ist aber Grundvoraussetzung<br />
für dauerhafte Umsetzung gesundheitsfördernder Maßnahmen in den<br />
<strong>Alltag</strong>: es geht darum zu Überzeugen statt zu Überreden, denn es sollen Denkund<br />
Verhaltensweisen beeinflusst werden. Leider steht die heutige Interaktionsform<br />
zwischen (<strong>Gesundheit</strong>s-) Experten wie Ärzte, Pflegekräfte, Krankengymnasten<br />
und dem Patienten einem eigenverantwortlichen Umgang mit der <strong>Gesundheit</strong><br />
eher <strong>im</strong> Weg. Hier sollten den Experten konstruktivere Formen der<br />
Kommunikation vermittelt werden, die echten Rapport (Beziehung zum Patienten)<br />
herstellen und deren Bereitschaft erhöhen, Informationen aufzunehmen,<br />
sie zu akzeptieren und ins eigene Repertoire zu übernehmen. Denn ca. 35% der<br />
Patienten verstehen die Anweisungen der Ärzte nicht und ca. 43% der erhaltenen<br />
Informationen werden wieder vergessen. Aufklärung alleine reicht nicht aus,<br />
Transparenz und damit Verstehbarkeit sind wichtig, um selbstwirksam und<br />
eigenverantwortlich für die eigene <strong>Gesundheit</strong> handeln zu können.<br />
Letztendlich spielen alle oben genannten Faktoren eine wichtige Rolle in der<br />
<strong>Gesundheit</strong>sförderung und diese sollten in der Bevölkerung und bei den Betroffenen<br />
gestärkt werden. Wichtig ist aber auch, dass <strong>Gesundheit</strong>sexperten dies<br />
selbst vorleben: humorvoll und opt<strong>im</strong>istisch sind, Selbstvertrauen haben und
144<br />
Angelika Wagner-Link<br />
ihr Leben und ihre Tätigkeit als sinnvoll betrachten. Genauso sollten diese<br />
psychischen Wirkfaktoren bei der Gestaltung von Informationsbroschüren berücksichtigt<br />
werden.<br />
2.4 Eigenverantwortung<br />
„Mensch sein, heißt verantwortlich zu sein.“<br />
Saint-Exupéry<br />
Vieles von dem was man erleidet, ist selbst erzeugt, aber Selbstanklagen <strong>im</strong><br />
Rückblick nützen nicht, sondern schaden nur. Jeder Mensch hat das Recht<br />
Fehler zu machen – und daraus zu lernen! Das kann er aber nur, wenn er die Verantwortung<br />
für sein Handeln und dessen Konsequenzen übern<strong>im</strong>mt. Eigenverantwortlich<br />
zu leben bedeutet dann in erster Linie, nicht abzuwarten, bis Probleme<br />
entstehen, sondern das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu reflektieren<br />
und gegebenenfalls zu korrigieren. Und zwar schon bevor es zwingend erforderlich<br />
wird.<br />
Wir können alle maßgeblich auf unsere <strong>Gesundheit</strong> Einfluss nehmen. Eigenverantwortung<br />
ist sowohl für <strong>Gesundheit</strong>sförderung als auch für Prävention auf<br />
Dauer unerlässliche Grundbedingung! So ist z.B. bei der Behandlung der zahlreichen<br />
Lebensstil bedingten Erkrankungen Eigeninitiative des Patienten ausschlaggebend.<br />
Es existiert ein fundamentales Bedürfnis des Menschen nach Selbstbest<strong>im</strong>mung,<br />
Selbstverwirklichung und Einzigartigkeit. Bisher wird viel zu wenig getan, um<br />
Eigenverantwortung zu fördern. Mehr Eigenverantwortung wird zwar mittlerweile<br />
vehement gefordert, aber kaum gefördert. Z.B. wird <strong>im</strong> Rahmen der Prävention<br />
an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert, aber paradoxerweise werden<br />
gleichzeitig Sanktionen, wie eigene Kosten, für die langfristigen Folgen eines<br />
über Jahre andauernden gesundheitsschädlichen Verhaltens (s. Zahnersatz) angedroht.<br />
Aus psychologischer Sicht kann man Eigenverantwortung sehr wohl lernen, die<br />
Psychotherapieforschung hat das ausreichend bewiesen. Der Erfolg hängt natürlich<br />
auch davon ab, inwiefern <strong>im</strong> Einzelfall und <strong>im</strong> Grossteil der Bevölkerung die<br />
Möglichkeit zu konstruktiver Eigenverantwortung überhaupt gegeben ist. Denn<br />
das <strong>Gesundheit</strong>ssystem und die Profession der <strong>Gesundheit</strong>sberufe verhinderten<br />
teilweise Eigenverantwortungsübernahme. Der kritisch denkende Mensch wurde<br />
oft als Querulant angesehen. Es wird etwas gefordert, was nicht konsequent<br />
gefördert wird. Einige Beispiele hierzu sind zum einen die Reparaturmedizin, die<br />
Betroffene entmündigt und entmenschlicht oder zum anderen der Ablauf in<br />
unseren Krankenhäusern, der für Patienten und Personal eine <strong>im</strong>mense Stressbelastung<br />
und Beschränkung der Handlungsfreiheit bedeutet. Das <strong>Gesundheit</strong>ssystem<br />
sollte den Menschen und seinen Fähigkeiten Raum geben und Ver-
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 145<br />
trauen entgegenbringen, denn eigenverantwortliches Engagement erfordert<br />
Spielraum.<br />
Hinzu kommt, dass Prävention oft aversiv vermittelt wird. Übliche Wege sind<br />
Edukation, Entmündigung, Belehren, Drohen, Vorschriften, Ratschläge, schlechtes<br />
Gewissen erzeugen, bis hin zum Abwerten. Die klassische Interaktionsform<br />
ist häufig der Monolog in Fachsprachen, ohne Rapport also eine echte Beziehung<br />
und Verständnis und damit Verstehen auf beiden Seiten herzustellen. 19<br />
Alle oben genannten Faktoren sind wesentliche Grundvoraussetzung für<br />
verbesserte Eigenverantwortung (s. Abbildung S.146).<br />
Weiterhin muss die generelle Einstellung der Gesellschaft hinsichtlich der<br />
Eigenverantwortung oder des „Eigen-Sinns“ bedacht werden. Schon das Wort<br />
„Eigensinn“ ist negativ konotiert, d.h. man bringt mit diesem Wort eher Begriffe<br />
wie „störend“, „unerwünscht“ u.ä. in Verbindung. Im 18. Jahrhundert<br />
verstand man unter Eigensinn jedoch einen eigenen Sinn haben und stolzen<br />
Mutes sein. Erst <strong>im</strong> 19. Jahrhundert – stark durch die Pädagogik beeinflusst –<br />
gewann das Wort eine negative Bedeutung. Eigensinn sollte dementsprechend<br />
unterdrückt werden, gleichzeitig sollten durch Disziplinierung und Anpassung<br />
fremdbest<strong>im</strong>mte Ziele und Perspektiven in den Vordergrund gestellt werden. Wohin<br />
dieser Erziehungsstil geführt hat, wissen wir.<br />
Wichtig ist es also auch konstruktiven Eigen-Sinn zu stärken, um Eigenverantwortung<br />
zu ermöglichen. So mancher so genannte Lebenskünstler könnte<br />
vielleicht ein interessantes Studienobjekt sein. 20<br />
„Eine Tugend gibt es, die liebe ich sehr, eine einzige. Sie heißt Eigensinn. Von<br />
den vielen Tugenden, von denen wir in Büchern lesen und von Lehrern reden<br />
hören, kann ich nicht so viel halten. (...) Tugend ist: Gehorsam. Die Frage ist nur,<br />
wem man gehorche. Auch der Eigensinn ist Gehorsam. Aber alle andern, so sehr<br />
beliebten und belobten Tugenden sind Gehorsam gegen Gesetze, welche von<br />
Menschen gegeben sind. Einzig der Eigensinn ist es, der nach diesen Gesetzen<br />
nicht fragt. Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen Gesetz, (...), dem Gesetz<br />
in sich selbst, dem Sinn des Eigenen. Es ist schade, dass der Eigensinn so<br />
wenig beliebt ist. Genießt er irgendwelche Achtung? Oh nein, er gilt sogar für<br />
ein Laster, oder doch für eine bedauerliche Unart. Man nennt ihn bloß da bei<br />
seinem vollen schönen Namen, wo er stört und Hass erregt.“ (Hermann Hesse)<br />
Es ist dringend an der Zeit, mehr Eigenverantwortung zu ermöglichen und zu<br />
stärken sowie die Wahrnehmung für gesunde Anteile und Wohlbefinden zu<br />
schulen.<br />
19 Wagner-Link, A.: Kommunikation als Verhaltenstraining, Arbeitsbuch für Therapeuten,<br />
Trainer und zum Selbsttraining, München 2001 2 .<br />
20 Bastian, T.: Lebenskünstler leben länger – <strong>Gesundheit</strong> durch Eigensinn, Göttingen 2000.
146<br />
Angelika Wagner-Link<br />
Hier ist Kreativität gefragt und Synergie durch interdisziplinäre und patientenintegrierende<br />
Zusammenarbeit.<br />
„Verantwortung heißt Antwort geben auf die Fragen des Lebens.“<br />
(Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie) 21<br />
Vielleicht bedeutet dann Eigenverantwortung eigene Antworten auf die Fragen<br />
des eigenen Lebens zu geben.<br />
Abbildung<br />
3. Psychologen als Experten für die Psyche und Psychische <strong>Gesundheit</strong>sfaktoren<br />
Wie unterstützt man nun kompetent und effektiv Menschen in ihrer Eigenverantwortung<br />
für ihre <strong>Gesundheit</strong>?<br />
Wenn die Einsicht der erste Schritt vor dem Handeln ist, muss man zunächst die<br />
Bereitschaft wecken, Verantwortung zu übernehmen. Dazu ist wichtig, dass Menschen<br />
lernen, sich selbst besser zu verstehen, mit sich selbst in Dialog zu treten.<br />
Die Experten für die Psyche, Psychologen und Psychotherapeuten, haben in<br />
ihrer Ausbildung umfassend gelernt, wie Hilfestellungen und Anleitungen hierzu<br />
aussehen können. Die Psychotherapie hat sich als Profession zudem einer umfangreichen<br />
Qualitätssicherung und damit Überprüfung ihrer Methoden auf<br />
Effizienz verschrieben und konnte in vielen <strong>Gesundheit</strong>sbereichen ihre Wirksamkeit<br />
belegen. So können Verhaltenstherapeuten bei Schmerz-Behandlungen<br />
eine Erfolgsquote von ca. 60% aufweisen. Bei Angst-Behandlungen erzielen sie<br />
noch höhere Erfolge, nämlich ca. 80% und das bei zum Teil nur 15 Sitzungen.<br />
21 Frankl, V.E.: Die Sinnfrage der Psychotherapie, München 1981.
Prävention und die seelische <strong>Gesundheit</strong> 147<br />
Zahlreiche Studien zur Therapieforschung geben Aufschluss darüber, welche Faktoren<br />
Eigenverantwortung fördern. Eigenverantwortung wird offensichtlich dann<br />
übernommen, wenn man Sinn in den jeweiligen Maßnahmen und Einschränkungen<br />
sieht, wenn man Selbstvertrauen und kompetentes, zielführendes Verhalten<br />
zur Verfügung hat oder es erlernen kann, wenn man opt<strong>im</strong>istisch ist und<br />
Spaß an einem gesunden Lebensstil hat und in einem Umfeld lebt, das einen<br />
darin unterstützt. Für alle diese Voraussetzungen zum eigenverantwortlichen<br />
Handeln bzgl. <strong>Gesundheit</strong> gibt es wirksame Methoden der Unterstützung, um<br />
die vorhandene Kompetenz zu stärken. Der personenkonzentrierte Kontakt –<br />
Rapport – ist dabei elementar für Kompetenzvermittlung. Denn Erfahrungswerte<br />
und Expertenwissen zusammen erzeugen erstaunliche Synergieeffekte. Genauso<br />
wichtig ist das Selbstvertrauen. Wenn der Behandler den Patienten wertschätzt<br />
und ihm zeigt, wie viel er <strong>im</strong> Grunde schon richtig macht, stärkt er das<br />
Selbstvertrauen und damit auch die Bereitschaft, selber Verantwortung zu übernehmen.<br />
Mit positivem Feedback auch für die kleinen Fortschritte kann die<br />
Motivation langfristig aufrechterhalten werden. Diese Hilfestellungen müssen<br />
lebensnah und konkret sein, denn ohne maßgeschneiderte und transferorientierte<br />
Maßnahmen, ist jede Hilfestellung erfolglos.<br />
Das Aufspüren und Verändern selbstschädigender Denkmuster und Entwickeln<br />
gesundheitsfördernder Einstellungen ist ein weiterer wesentlicher Wirkfaktor.<br />
Entscheidend für die Bereitschaft, Eigenverantwortung zu übernehmen ist die<br />
Art der Kommunikation zwischen Therapeut/<strong>Gesundheit</strong>sexperten und Patient/<br />
Gesunden. Einzelne Therapieformen haben effektive Interaktionsmethoden und<br />
Gesprächstechniken zur Verminderung von Widerständen und Steigerung der<br />
Motivation und der Compliance entwickelt. Sowohl die Verhaltenstherapie, als<br />
auch die Gesprächstherapie sind zudem lösungs- und ressourcenorientierte Verfahren.<br />
Dabei geht es darum, Potenzial zu erkennen und zu unterstreichen, denn<br />
es ist oft effektiver und einfacher, Positives auszubauen als Negatives zu reduzieren.<br />
Wesentliche Elemente der Verhaltenstherapie sind z.B. „Selbstmanagement“,<br />
„Selbstkontrolle“ und Stabilisierung positiven Verhaltens. Und nicht<br />
zuletzt ist eine frühzeitige Rückfallprophylaxe wesentlich, nämlich wie man mit<br />
kleinen, auf die Person zugeschnittenen Schritten vorankommt, die dann ganz<br />
plötzlich zu großen Sprüngen werden können und wie man mit Rückschritten<br />
so umgeht, dass daraus kein Rückfall wird.<br />
Effektive und ökonomische Prävention und <strong>Gesundheit</strong>sförderung der Zukunft<br />
können es sich <strong>im</strong> wahrsten Sinn des Wortes nicht mehr leisten, auf die wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse und Erfahrungswissen aus Psychologie und Psychotherapie<br />
zu verzichten. Nach dem in der Wirtschaft so vielgelobten Diversitiy-<br />
Prinzip ist ein gleichwertiges und sich gegenseitig befruchtendes Miteinander<br />
verschiedener – aber eben nicht nur medizinischer – Fachrichtungen unumgänglich.<br />
Wer den Menschen und seine <strong>Gesundheit</strong> ganzheitlich betrachtet, kann<br />
die Psyche und ihren starken Einfluss auf <strong>Gesundheit</strong> und Krankheit, auf<br />
Therapieerfolg oder -misslingen nicht mehr außer Acht lassen. Die Experten<br />
dafür sind Psychologen und Psychotherapeuten!
1. Einleitung<br />
Die Sorge um sich<br />
Prävention als Lebenspraxis*<br />
Gernot Böhme<br />
Das Thema Selbstsorge hat mit der Philosophie Michel Foucaults seit den 80er-<br />
Jahren des letzten Jahrhunderts wieder eine bedeutende Aufmerksamkeit erfahren.<br />
Foucault entdeckte es – wenn man das so sagen darf – <strong>im</strong> Zuge seiner Forschungen<br />
zur Geschichte der Sexualität: Le soucis de soi heißt der 3. Band seines<br />
entsprechenden Werkes 1 .<br />
Seither finden Ethik als Ästhetik der Existenz und Philosophie als Lebenskunst<br />
ein breites Interesse. Dabei wird oft übersehen, dass es sich – genau genommen<br />
– um eine neue Blüte der alteuropäischen Tradition der Diätetik handelt, also der<br />
meist medizinisch oder philosophisch angeleiteten Lebensführung. Foucault dagegen<br />
war sich dessen wohl bewusst. Sein Interesse an den Ursprüngen europäischer<br />
Diätetik war allerdings motiviert durch die spezielle Frage nach dem Umgang<br />
mit der Sexualität. Da er sich mit seiner Generation noch als Viktorianer<br />
verstand, d.h. als Angehöriger einer Generation, die durch eine restriktive<br />
Sexualmoral geprägt war 2 , wollte er der Inkr<strong>im</strong>inierung der Sexualität auf den<br />
Grund gehen – natürlich in dem Interesse, sich davon zu befreien: „Warum<br />
ist das sexuelle Verhalten, warum sind die dazugehörigen Betätigungen und<br />
Genüsse Gegenstand moralischer Sorge und Beunruhigung?“ 3<br />
Auf dem kulturgeschichtlichen Weg zurück in die griechisch-römische Antike<br />
hat er <strong>im</strong> Kontext der Diätetik zu seinem Erstaunen durchweg in den Texten<br />
eine abmahnende Haltung gefunden, selbst bei Fehlen jeder moralischen Verur-<br />
* Dieser Beitrag ist zugleich der erste Entwurf des Schlusskapitels meines Buches „Leibsein<br />
als Aufgabe: Leibphilosophie in pragmatischer Hinsicht“, das Ende 2003 <strong>im</strong> Verlag<br />
Die Graue Edition (Zug) erschienen ist.<br />
1 Foucault, Michel: Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit, Bd.3, Frankfurt/M. 1986.<br />
2 Das einleitende Kapitel zum Bd.1 von ‚Sexualität und Wahrheit‘ ist überschrieben ‚Wir<br />
Viktorianer‘.<br />
3 Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit, Bd.2, Der Gebrauch der Lüste, Frankfurt/M.<br />
1986, S.17.
Die Sorge um sich – Präventation als Lebenspraxis 149<br />
teilung der Sexualität: „Ärzte beunruhigen sich über die Wirkung der sexuellen<br />
Praktik, empfehlen gern die Enthaltung und erklären, dem Genuss der Lüste die<br />
Jungfräulichkeit vorzuziehen.“ 4 Den Grund dieser Beunruhigung konnte er<br />
jedoch nicht ausmachen. Warum sollte etwas so Natürliches wie Sexualität<br />
schädlich sein?<br />
Vielleicht wäre Foucault zu anderen Ergebnissen gekommen, wenn er gleich<br />
den eigentlichen Ursprung der Sorge um sich, griechisch ‚ep<strong>im</strong>?leia eautou‘,<br />
aufgesucht hätte, wie er sich nämlich in Platons Dialog Alkibiades I findet.<br />
Alkibiades, ein junger Mann aus vornehmem Hause, spricht in diesem Dialog<br />
mit Sokrates darüber, wie er bürgerliche Tugend, wir würden wohl sagen ‚politische<br />
Kompetenz‘, erwerben könne. Sokrates macht ihm klar, dass er sich auf dem<br />
Wege, sich um die öffentlichen Angelegenheiten kümmern zu wollen, zunächst<br />
um sich selbst kümmern müsse. Damit ist das Thema der Selbstsorge gestellt.<br />
Um das Missverständnis abzuhalten, es handele sich dabei etwa um das eigene<br />
Vermögen oder das eigene Ansehen, stellt Sokrates sogleich die entscheidende<br />
Frage, was denn das Selbst selbst sei. Im Zuge der Beantwortung dieser Frage führt<br />
er einen Unterschied ein zwischen dem Gebrauchenden und dem, was er<br />
gebraucht.<br />
„Sokrates: Reden und die Sprache gebrauchen, nennest du doch einerlei?<br />
Alkibiades: Freilich.<br />
Sokrates: Der Gebrauchende aber und was er gebraucht, sind die nicht verschieden?“<br />
(Alkibiades I, 129c)<br />
Für unseren Kontext entscheidend ist, dass dieser Unterschied sogleich auch in<br />
Hinblick auf den Leib durchgeführt wird:<br />
„Sokrates: Und nicht wahr, auch seinen ganzen Leib gebraucht der Mensch?<br />
Alkibiades: Freilich.<br />
Sokrates: Und verschieden war das Gebrauchende und was es gebraucht.<br />
Alkibiades: Freilich.<br />
Sokrates: Verschieden also ist auch der Mensch von seinem eigenen Leibe?<br />
Alkibiades: So scheint es.<br />
Sokrates: Was also ist der Mensch?“ (Alkibiades I, 129 e)<br />
Der Mensch selbst, das Selbst des Menschen, wird von Sokrates als diese<br />
inhaltsleere Instanz des Gebrauchenden best<strong>im</strong>mt – in Differenz zu allem, was<br />
zum Menschen gehört, zur Sprache, dem Leib, den Angehörigen, den sozialen<br />
Beziehungen, dem Vermögen. Und <strong>im</strong> Folgenden trägt dieses Selbst dann den<br />
Namen Seele. Die Selbstsorge wird hier also an ihrem Ursprung auf der Basis der<br />
Unterscheidung von Leib und Seele, genauer gesagt, durch Aufreißen der Differenz<br />
von Leib und Seele eingeführt. Selbstsorge besteht gerade darin, die Instanz<br />
4 Ebd., Bd.3, S.301.
150<br />
Gernot Böhme<br />
des Selbsts in sich zu etablieren, eine Instanz des Selbstbesitzes und der Selbstbeherrschung,<br />
eine Instanz, die in der Lage ist, alles was sonst noch zum Menschsein<br />
gehört, insbesondere den Leib zu gebrauchen.<br />
Damit haben wir an der Wurzel der Selbstsorge entdeckt, was mit dieser Sorge<br />
zugleich an Besorgnis erzeugt wird. In Foucaults Kontext gesprochen: Wir haben<br />
entdeckt, woher die Besorgnis kommt, gerade wenn man sich explizit um den<br />
Gebrauch der Lüste 5 kümmert. Der Leib, die Lust sind nämlich in dieser diätistischen<br />
Haltung etwas anderes als man selbst. Man will sich ihrer bedienen,<br />
aber man ahnt doch, dass sie ihre Selbsttätigkeit haben. Man will sie beherrschen,<br />
aber gerade so muss man sie wohl oder übel als ungebärdig anerkennen. Man<br />
will sie als Eigentum behandeln, und gerade durch diese Haltung macht man sie<br />
zu etwas Fremdem. Der Leib, die Natur und die Sexualität <strong>im</strong> Besonderen werden<br />
in dieser Art der Diätetik als etwas erfahren, das man gerade nicht selbst ist:<br />
als Natur <strong>im</strong> Gegensatz zu Kultur, <strong>im</strong> Gegensatz zu Technik, <strong>im</strong> Gegensatz zu<br />
Zivilisation und von Menschen eingerichteter Gesellschaftlichkeit (nomos).<br />
2. Zur Geschichte der Diätetik<br />
Die Geschichte der europäischen Diätetik, soweit sie als Text zu fassen ist, geht<br />
auf Hippokrates zurück. Im Corpus Hippocraticum finden sich Regeln, die<br />
das Leben unter verschiedenen Umständen wie Kl<strong>im</strong>a, Umwelt, Lebensalter,<br />
Geschlecht so leiten sollen, dass man gesund bleibt oder Krankheiten überwindet.<br />
6<br />
Diese diätetischen Regeln finden ihre kanonische Form bei Galen, und zwar in<br />
einer Weise, in der sich die Differenz, die sich <strong>im</strong> sokratischen Gespräch aufgetan<br />
hat, wieder findet: Galen unterscheidet die res naturales von den res non<br />
naturales. 7<br />
• Zu den res naturales zählen die Körperteile, der Stoffwechsel, die vier Elemente,<br />
die vier Körpersäfte.<br />
• Die res non naturales sind sechs: aer – die Luft, die wir atmen; cibus et potus,<br />
Speisen und Getränke; motus et quies, Bewegung und Ruhe; vigilia et somnus,<br />
Wachen und Schlafen; excreta et secreta, die verschiedenen Ausscheidungen<br />
und Absonderungen und schließlich affectus, die Gefühlsregungen.<br />
5 Titel des 2. Bandes von Sexualität und Wahrheit.<br />
6 Aus dem Corpus Hippocraticum sind als wichtige Schriften zu nennen: de victu; de aere,<br />
aquis et locis; Epidemien. Deutsche Übersetzungen finden sich in: R. Kapferer (Hrsg.),<br />
Hippokrates-Fibel. Auszüge aus der Schriftensammlung ‚Die Werke des Hippokrates‘,<br />
Stuttgart 1943; und in: Hippokrates, Fünf auserlesene Schriften, Zürich/München 1955.<br />
7 Ich benutze hier wie üblich die lateinischen Termini, siehe: Engelhardt, Dietrich von:<br />
Krankheit, Schmerz und Lebenskunst. Eine Kulturgeschichte der Körpererfahrung,<br />
München 1995, S.141; Egger, Irmgard: Diätetik und Askese. Zur Dialektik der Aufklärung<br />
in Goethes Romanen, München 2001, S.73.
Die Sorge um sich – Präventation als Lebenspraxis 151<br />
Im Einzelnen ist diese Einteilung, jedenfalls ohne Erläuterungen, nicht sehr plausibel,<br />
so ist etwa die Luft als Element etwas von Natur Vorgegebenes, und ob die<br />
Ausscheidungen nicht Zwangscharakter haben, ist <strong>im</strong>merhin zu fragen. Ferner<br />
vermisst man die großen Lebensereignisse, die in der leiblichen Existenz des Menschen<br />
vorgegeben sind: Geburt, Tod, Geschlechtsreife, etc. Was aber entscheidend<br />
ist, ist das Raster als solches. Galen und mit ihm die ganze europäische Diätetik<br />
unterscheidet am Menschen in seiner leiblichen Existenz, das, was ihm<br />
unbeeinflussbar vorgegeben ist – seine Natur – von demjenigen, was durch Lebenspraxis<br />
so oder so gestaltet werden kann. Und letzteres nennt er dann nicht<br />
natürlich. Die Diätetik ist so gesehen nicht eine vernünftige Praxis, Natur zu sein,<br />
sondern gerät in einen Gegensatz zur Natur. Da der Mensch sich selbst auf die<br />
Seite der Kultur begeben hat, wird ihm seine eigene Natur fremd.<br />
Das setzt eine eigene Dialektik in Gang. Die besondere Aufmerksamkeit, die dem<br />
leiblichen Geschehen in der diätetischen Einstellung zugewandt wird, kann selbst<br />
zum Unwohlsein bis hin zu Krankheiten eigener Art wie Melancholie und Hypochondrie<br />
führen. Sie dürften die blinden Passagiere auf der Fahrt der Diätetik<br />
durch die Geschichte gewesen sein. Deutlich fassbar sind sie <strong>im</strong> 18. Jahrhundert,<br />
das ja auch zugleich eine Blütezeit der Diätetik war. Ich brauche nur an Namen<br />
wie Hufeland, Z<strong>im</strong>mermann, Unzer und den lateinisch und französisch schreibenden<br />
Schweizer Arzt Tissot zu erinnern. Tissot schrieb nicht nur eine Diätetik<br />
für die Gelehrten, sondern auch eine für die Frauenz<strong>im</strong>mer, nicht nur eine für<br />
Personen von Stande, sondern auch eine für den gemeinen Mann. Es war die<br />
Zeit der Aufklärung, die den Menschen als Vernunftwesen definierte oder besser:<br />
durch Kultivierung, Zivilisierung, Moralisierung zum Vernunftwesen machen<br />
wollte und die zugleich als ihre Kehrseite Hypochondrie und Wahnsinn produzierte.<br />
8 Der Mechanismus ist relativ einfach: Eine rationale, eine vernunftgeleitete<br />
Lebensweise verlangt ständige Aufmerksamkeit auf Leibliches und ein<br />
ständiges Reglement leiblicher Regungen.<br />
Da jedoch durch die Selbststilisierung des Menschen zum Vernunftwesen ihm<br />
ebendiese Regungen fremd geworden sind, werden sie ihm zu Anzeichen möglicher<br />
Krankheiten. Ein bekanntes Opfer dieses Syndroms ist der Philosoph Immanuel<br />
Kant. Es war aber weit verbreitet, sodass es geradezu als die erste Zivilisationskrankheit,<br />
die besonders Berufsgruppen wie Gelehrte und Weber he<strong>im</strong>suchte,<br />
bezeichnet werden konnte. Im 18. Jahrhundert verband sich allerdings noch<br />
eine andere Tradition mit der Diätetik, die den Umgang mit dem eigenen Leib<br />
noch problematischer machte, nämlich die Tradition christlicher Askese. Sie<br />
war lebendig <strong>im</strong> Pietismus bzw. allgemeiner in der protestantischen Ethik, die<br />
auf Sparsamkeit, Fleiß und Arbeitsdisziplin setzte. Die Selbstaffirmation, die<br />
in dieser Tradition aus Enthaltsamkeit und Verachtung leiblicher Regungen<br />
8 Dazu ausführlich das gemeinsam mit meinem Bruder Hartmut geschriebene Buch ‚Das<br />
Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants‘,<br />
Frankfurt/M. 1985, 1992 (2. Aufl.).
152<br />
Gernot Böhme<br />
gewonnen wurde, ließ die hergebrachten diätetischen Regeln der Mäßigung<br />
divergieren.<br />
Diese Zusammenhänge sind mit Recht unter dem Stichwort einer Dialektik der<br />
Aufklärung beschrieben worden 9 und damit als etwas, das uns in der Moderne<br />
durchaus angeht. Wir brauchen nur an Jogging zu denken, das mäßig als diätetische<br />
Maßnahme zu empfehlen ist, extensiv betrieben aber zur Sucht werden<br />
kann. Wir brauchen nur an die Gefahren, die mit der Praxis periodischer Diät<br />
zum Abnehmen verbunden sind, zu denken oder an Hungerkuren, die in die Magersucht<br />
führen. Das sind Extreme, sie charakterisieren jedoch die Ambivalenzen,<br />
die in einem Großteil der heute marktgängigen diätetischen Programme<br />
und allgegenwärtigen Ermahnungen zu gesunder Lebensführung liegen: Insofern<br />
sie veräußerlichen, was am Menschen Natur ist, propagieren sie eine Naturbeherrschung<br />
am Menschen. 10<br />
3. Naturbeherrschung am Menschen<br />
Unter diesem Stichwort müssen wir die Methoden der klassischen und gegenwärtigen<br />
Diätetik neu bewerten und in einen größeren Zusammenhang einordnen.<br />
Es geht um die Frage, ob die Sorge um sich, die dem Menschen in seiner<br />
leiblichen Existenz unausweichlich ist, zu einer Beherrschung und Manipulation<br />
seiner eigenen Natur führen muss. Ob nicht gerade dieser Typ von Sorge in<br />
seiner Konsequenz das Vertrauen in das Getragensein von der Natur untergräbt,<br />
ja nicht nur das Vertrauen, sondern das Getragensein selbst.<br />
Die klassische Diätetik hat die menschliche Natur quasi wie eine black box<br />
behandelt, ein fremdes, kaum bekanntes Wesen, das gewissen Bedingungen<br />
unterworfen werden muss, um es in gewünschter Weise zu bewegen. Dass wir<br />
dieses Wesen selbst sind, spielte für die Diätetiker keine Rolle. Auch heute noch<br />
ist das kaum anders. Schl<strong>im</strong>mer noch, wir sind mit einer ungeheuer angewachsenen<br />
Macht des Menschen, genauer einer ungeheuer angewachsenen Macht der<br />
naturwissenschaftlich-technischen Medizin, die menschliche Natur zu manipulieren,<br />
konfrontiert.<br />
Diese Macht verspricht uns sogar, von der Sorge um die eigene leibliche Existenz<br />
zu entlasten. Die Beherrschung der eigenen Natur, die in den diätetischen Programmen<br />
<strong>im</strong>merhin noch eine sittliche Aufgabe war, kann damit an den Fachmann<br />
delegiert werden.<br />
• Zu denken ist hier an die Pharmaka, die von der Regelung des Schlafs über die<br />
Regelung der Verdauung bis zur Regelung des Appetits und schließlich gar der<br />
Libido reichen.<br />
9 Egger, Irmgard: Diätethik und Askese.<br />
10 Titel eines Buches von Rudolf zur Lippe, Frankfurt/M. 1979.
Die Sorge um sich – Präventation als Lebenspraxis 153<br />
• Zu denken ist an die Reparatur-Medizin, die schon richten wird, was ein nachlässiges<br />
und die eigene Natur missachtendes Leben angerichtet haben: von den<br />
Beipassoperationen, die zugesetzte Arterien umgehen, bis zu Herztransplantationen<br />
und anderen Transplantationen, die verschlissene Teile ersetzen.<br />
• Zu denken ist aber auch an die Schönheitsoperationen, die ja von der Beseitigung<br />
der Spuren eines zerstörerischen Lebens, über die Korrektur der natürlichen<br />
Ausstattung eines Menschen bis zur möglichen Stillstellung des Alterungsprozesses<br />
reichen.<br />
Das alles sind Fortsetzungen der klassischen Diätetik mit anderen Mitteln. Sie<br />
behandeln die menschliche Natur als etwas Äußerliches, den menschlichen Leib<br />
als Körper, als Instrument, das den eigentlich menschlichen Zwecken und Absichten<br />
dient, das gut funktionieren und als Werkzeug möglichst unauffällig sein<br />
soll, als Plakat gesellschaftlichen Erscheinens dagegen möglichst auffällig. Pharmaka,<br />
Drogen, Prothesen, Transplantate, Implantate, plastische Chirurgie, genetische<br />
Therapie, Eugenik, am Anfang in vitro-Fertilisation, am Ende Euthanasie,<br />
da wird fraglich, was am Menschen überhaupt noch als Natur angesehen<br />
werden kann. Man wünschte sich die gute alte Diätetik zurück, die noch der<br />
Natur ihren Respekt erwies, wo sie sie zähmen und freundlich st<strong>im</strong>men oder auch<br />
gelegentlich gängeln wollte. Wenn nicht diese Diätetik schon <strong>im</strong>mer eine Selbstsorge<br />
gewesen wäre, in der das Selbst nicht in der eigenen Natur gesehen wurde,<br />
sondern <strong>im</strong> Subjektcharakter des Ich. Ihm, dem Subjekt, hatte die Natur zu dienen,<br />
ihm gefügig zu sein, ihm den Gebrauch der Lüste zu gewähren. Das heißt<br />
aber, das Subjekt muss seine Beziehung zum Leib revidieren und das heißt auch,<br />
die Diätetik muss eine andere sein.<br />
4. Eine andere Diätetik<br />
Die klassische Diätetik hat durchaus ihre Verdienste und man sollte nicht glauben,<br />
dass man heute ohne sie auskäme. In der technischen Zivilisation, in der<br />
das Leben des durchschnittlichen Menschen weitgehend durch Verkehrs-, Schulund<br />
Arbeitsrhythmen best<strong>im</strong>mt ist, in der die Lebensmittel zu industriellen<br />
Produkten geworden sind, in der die Mehrzahl der Menschen in Großstädten<br />
lebt, in der die Menschen einen beträchtlichen Teil ihrer Lebenszeit <strong>im</strong> Medienkonsum<br />
verbringen, in einer solchen Zivilisation dürfte die Regel, ‚Gebt der<br />
Natur, was der Natur ist‘, zum Min<strong>im</strong>um einer besonnenen Lebensführung<br />
gehören. Die klassischen Ratschläge zu Ausgleich und Mäßigung, das Anraten<br />
guter Luft und gesunder Lebensmittel, die Forderung nach hinreichender Bewegung<br />
behalten ihre Gültigkeit. Nur zeigen die Konsequenzen einer Sorge um<br />
sich, die auf einen möglichst effektiven Gebrauch der Lüste hinausläuft, dass das<br />
die rechte Selbstsorge nicht sein kann. Sie veräußerlicht die menschliche Natur,<br />
macht sie zum Gegenstand und erniedrigt sie zum Instrument und sie versteht<br />
sich selbst als nicht-natürlich. Res naturales auf der einen Seite, res non naturales<br />
auf der anderen.
154<br />
Gernot Böhme<br />
Diese Differenz aufzuheben wäre die Aufgabe einer Diätetik zweiter Ordnung.<br />
Ich nenne sie so, weil sie eine Lebensform, eine Sorge um sich sein sollte, die<br />
nicht ein vorgegebenes anthropologisches Schema – hier die Natur, dort der Geist<br />
– einfach hinn<strong>im</strong>mt, sondern realisiert, dass das, was der Mensch ist, von seinem<br />
Verhalten zu sich und von seiner Lebensführung abhängt. Ich wiederhole es noch<br />
einmal: der Cartesianismus mit seiner Spaltung des Menschen in ‚res cogitans‘<br />
und ‚res extensa‘, in Körperding und denkendes Subjekt, ist nicht einfach eine<br />
falsche Theorie, sondern bezeichnet eine Lebensform. Er kann deshalb auch nicht<br />
durch Argumente widerlegt, sondern er muss durch eine Form des Lebens überwunden<br />
werden. Diese Lebensform ist durch die Formel ‚Der Leib ist die Natur,<br />
die wir selbst sind‘ angezeigt.<br />
In der Diätetik neuer Ordnung geht es um Leib-Sein-Können. Dafür ist es notwendig,<br />
anzuerkennen und einzuüben, dass wir unsere Natur selbst sind. Diese<br />
Aufgabe, die das Leibsein darstellt, enthält zwei Schwierigkeiten. Auf der einen<br />
Seite erfahren wir unsere Natur, wo sie auffällig wird und sich als unsere Natur<br />
aufdrängt, in Schmerz, Krankheit, leiblichen Bedürfnissen, gerade nicht als<br />
unser Selbst, vielmehr als fremd und als eine Last. Wir sind deshalb nur allzu<br />
geneigt, diese Natur zum Objekt zu machen bzw. machen zu lassen und die<br />
Sorge um diese Natur, die trotz aller Fremdheit sich doch <strong>im</strong>mer als unsere aufdrängt,<br />
Experten zu überlassen.<br />
Auf der anderen Seite ist das, was wir als unser Selbst bezeichnen, fern davon,<br />
Leib zu sein wie Nietzsche wollte, etwas, das wir gerade als Nicht-Natur kennen.<br />
Die Seele ist nach Sokrates die gebrauchende, auch den Leib gebrauchende<br />
Instanz; unser Ich nach Freud ein Topos, der gerade nicht Es ist; unser Subjekt<br />
nach Kant ein der Naturkausalität enthobenes, als Freiheit best<strong>im</strong>mtes Ding an<br />
sich. Wir finden uns vor als Spätprodukte einer Menschheitsentwicklung, oder<br />
sagen wir besser eines neuzeitlichen Programms der Selbstbildung, das gerade in<br />
der Emanzipation von der Natur das eigentliche Humanum erblickte.<br />
Und zwischen diesen beiden Problemen steht die große Frage, was wir überhaupt<br />
noch an uns selbst als Natur anerkennen können oder müssen. Allerdings, wir<br />
erfahren an uns <strong>im</strong>mer wieder etwas als gegeben. Aber heißt das, dass wir es als<br />
solches hinnehmen müssen? Schmerzen, Gefühle, Befindlichkeiten – es gibt doch<br />
Psychopharmaka; Körperteile – die lassen sich auswechseln oder durch künstliche<br />
Implantate ersetzen; Verdauung, Atmung – lässt sich regeln und kann<br />
notfalls maschinell vor sich gehen; natürliche Konstitution und Vererbung – wird<br />
man durch Gentechnologie in den Griff bekommen; Geburt und Tod – was soll<br />
das heißen? Klonen ist machbar und der Tod zumindest durch medizinische<br />
Technologie verschiebbar. Was als natürlich galt, versteht sich für uns heute in<br />
keinem Fall mehr von selbst.<br />
An dieser Mitte, in dieser Mitte muss man ansetzen, soll der moderne Mensch<br />
die Souveränität seiner Lebensführung zurückgewinnen. Ich betone Souveränität<br />
und nicht Autonomie, weil es gerade nicht um das selbstherrliche Subjekt geht,
Die Sorge um sich – Präventation als Lebenspraxis 155<br />
sondern um einen Menschen, der souverän ist in dem landläufigen Sinne, dass<br />
er sich auch etwas geschehen lassen kann. 11 So paradox es klingt, die neue<br />
Diätetik, die Wiedergewinnung einer souveränen Lebensführung, muss mit der<br />
Bereitschaft einsetzen, sich etwas gegeben sein zu lassen, und das heißt für uns:<br />
mit der Bereitschaft Natur zu sein.<br />
Das hat sehr weit reichende Konsequenzen. Zunächst wird dadurch heute überhaupt<br />
Mündigkeit konstituiert, speziell der mündige Patient. Unmündigkeit ist<br />
bereits von Kant als die Entlastung von Selbstsorge best<strong>im</strong>mt worden, nämlich<br />
als Entlastung, indem man sich Experten überlässt. In seiner berühmten Schrift<br />
„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ führt er das für unseren Zusammenhang<br />
entscheidende Beispiel explizit an: „Habe ich einen Arzt, der für mich<br />
die Diät beurteilt, (...): so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen“ (A 482).<br />
Mündigkeit heißt dagegen, die eigene Lebensführung – das meint bei Kant Diät<br />
– wieder zu übernehmen, indem man sich nicht der vollständigen Objektivierung<br />
durch medizinische Experten und der schrankenlosen Manipulation durch<br />
medizinische Technologie überlässt.<br />
Ferner bedeutet die Bereitschaft, Natur zu sein, dass man sich sich selbst in<br />
vieler Hinsicht gegeben sein lässt. Es wird <strong>im</strong>mer genug Möglichkeiten der<br />
Selbstbildung durch Aktivität und Selbstgestaltung geben – und man kann trotz<br />
der ubiquitären Rede von der Selbstverwirklichung keineswegs sagen, dass der<br />
durchschnittliche moderne Mensch sie nutzt. Wenn es jedoch um das Leib-Sein-<br />
Können geht, dann gilt es zuallererst, das Pathische als Quelle des Selbst zu entdecken<br />
und anzuerkennen. Das Pathische, allerdings, also was einem gegeben<br />
ist, was einem widerfährt: die Konstitution die man hat, die Physiognomie,<br />
aber auch die Schmerzen, die man erfährt, die Krankheiten, die man erleidet.<br />
Ich nenne das Begrenzende und das Negative zuerst, weil es gerade diese<br />
Elemente des Lebens sind, die uns wirklich angehen und uns eine best<strong>im</strong>mte<br />
Form geben. So wie Schuld radikal individualisiert: mea culpa, so auch der Leib<br />
gerade in seiner Begrenztheit, Verletzlichkeit, Sterblichkeit: Dies ist mein Leib.<br />
Deshalb n<strong>im</strong>mt eine Selbstsorge, die das Selbst in der eigenen Leiblichkeit fundiert,<br />
ihren Anfang in der Anerkennung des Pathischen, dessen, was einem gegeben<br />
ist und was einem widerfährt. Die Natur selbst sein, heißt anzuerkennen,<br />
dass man sich selbst qua Leib gegeben ist.<br />
Natürlich widerfährt einem vom Leibe her nicht nur Negatives und Begrenzendes.<br />
Auch die Daseinslust und das Hingerissensein von der Welt, der ‚appetitus‘ gründet<br />
<strong>im</strong> Leibe. Doch die Grundhaltung, die hier erforderlich ist, verlangt nicht<br />
wie bei den negativen Widerfahrnissen, diese Affektionen nicht zu verleugnen<br />
oder zu verdrängen, sondern sie verlangt, sie überhaupt erst zuzulassen und zu<br />
11 Zum Begriff des souveränen Menschen siehe Kap.19. meines Buches Anthropologie in<br />
pragmatischer Hinsicht. Darmstädter Vorlesungen, 4. Aufl., Frankfurt/M. 1994.
156<br />
Gernot Böhme<br />
ermöglichen. Auch Daseinslust versteht sich in der durch das Leistungsprinzip<br />
dominierten technischen Zivilisation keineswegs von selbst. Das hat viel mit der<br />
aktivischen Grundhaltung des modernen Menschen zu tun, viel aber auch mit<br />
der Zeitverknappung, viel schließlich mit dem Medienkonsum und der auf Signale<br />
eingeschränkten Wahrnehmung. Wir leben in einer Überflussgesellschaft<br />
und haben nichts davon. Auch Freizeit wird noch zum Stress, das Essen zur Erledigung,<br />
die Liebe zur Pflicht, und das Leben überhaupt gerät zur auslaufenden<br />
Sanduhr. Auch hier muss gegen Foucault festgestellt werden, dass Daseinslust<br />
nicht <strong>im</strong> Gebrauch der Lüste bestehen kann, also kein Produkt sein kann, das<br />
dem Leib instrumentell abgerungen wird, sondern vielmehr ein Herabsteigen des<br />
Bewusstseins in den Leib verlangt, damit das Dasein selbst lustvoll erfahren wird.<br />
Auch hier also ist eine Diätetik zweiter Ordnung verlangt, die nämlich darin besteht,<br />
sich überhaupt erst mit dem eigenen Leib zu identifizieren. 12 Selbstsorge<br />
nicht als Sorge für ein Selbst, sondern als Lebenspraxis, sich selbst <strong>im</strong> Leibe zu<br />
finden.<br />
Schließlich bedeutet das Natur-Selbst-Sein eine ganz andere, eine neue Gewichtung<br />
des menschlichen Lebens als leibliche Existenz. Wenn man von unseren<br />
Überlegungen auf die europäische Kulturgeschichte zurückblickt, ist es wirklich<br />
ganz erstaunlich, in welchem Maße die leibliche Existenz abgewertet wurde, und<br />
das heißt doch, in welchem Maße die wirkliche Existenz des Menschen <strong>im</strong> Blick<br />
auf fantastische oder erhoffte Existenzformen übersehen wurde. Wenn Günter<br />
Altner ganz allgemein unserer Kultur eine Naturvergessenheit attestiert 13 , so gilt<br />
das spezieller und in noch erschreckenderem Maße für die Natur, die wir selbst<br />
sind, den Leib. Unsere Kultur ist durch Leibvergessenheit gekennzeichnet. Was<br />
für uns zählt, ist beruflicher Erfolg und gesellschaftliche Stellung, was als Ziel gilt<br />
sind Werke, Leistungen, sind öffentliche Sichtbarkeit und Wirkung, was als<br />
Lebensgenuss angeboten wird sind Reisen, Medienkonsum, Besitz. Der Vollzug<br />
des Lebens selbst entgeht einem darüber, und die leibliche Existenz findet Beachtung<br />
nur als Voraussetzung für anderes. Der Zweck der Diätetik ist Fitness,<br />
und das heißt ja doch Fitness für anderes, das als Wert, Ziel und Inhalt des<br />
Lebens rangiert. Die alte Weisheit, dass man all diese Güter des Lebens nicht mit<br />
ins Grab nehmen kann, gilt in einem viel radikaleren Sinne für das Leben selbst.<br />
Und das entgeht uns auf Grund der bei uns herrschenden Lebensform. Was<br />
also hätte eine Diätetik, die nicht blind der Makrobiotik 14 , der bloßen Lebensverlängerung<br />
diente, zu leisten? Sie hätte uns einzuüben in eine Lebensweise, in<br />
der wir <strong>im</strong> Lebensvollzug selbst sind.<br />
Das elementare Beispiel dafür sind Atemübungen. Zwar ist es nicht möglich,<br />
<strong>im</strong> <strong>Alltag</strong>sleben sich so zu verhalten, dass man sich <strong>im</strong> Atem spürt, aber die<br />
12 Siehe hierzu meine differenzierende Rezension von Shusterman, R.: Philosophie als<br />
Lebenspraxis, Berlin 2001, in: Dt. Zt. f. Philosophie 50 (2002), S.797-802. Somästhetik<br />
– sanft oder mit Gewalt.<br />
13 Altner, Günter: Naturvergessenheit. Grundlagen einer umfassenden Bioethik, Darmstadt<br />
1991.<br />
14 Titel der bekannten Diätetik von Hufeland.
Die Sorge um sich – Präventation als Lebenspraxis 157<br />
Atemübungen als solche ermöglichen die paradigmatische Erfahrung, dass man<br />
lebt <strong>im</strong> Vollzug. Wichtiger für die Gestaltung des <strong>Alltag</strong>slebens ist das Essen. Die<br />
herrschende Diätetik konzentriert sich hier ganz und gar auf die Inhaltsstoffe der<br />
Nahrung. Sie folgt darin blind der zweckrationalen Orientierung unserer Zivilisation,<br />
nach der das Essen nur Mittel zum Zweck ist und die notwendigen<br />
Stoffe gegebenenfalls auch in Form von Pillen eingeworfen werden können. Es<br />
geht jedoch darum, gegen die Rationalisierung des Essens, die ja auch den Namen<br />
einer McDonaldisierung 15 trägt, das Essen als Vollzug, die Mahlzeit zurückzugewinnen.<br />
Die dazu nötige Zeit offen zu halten ist nur durch eine Kultivierung<br />
und Ritualisierung des Essens möglich. Wie auch sonst gilt hier, dass unser<br />
Natursein sich nicht von selbst vollzieht, sondern der kulturellen Form bedarf,<br />
soll es nicht in der technischen Zivilisation zerrieben werden.<br />
Der Gebrauch unseres Körpers als bloßes Instrument war über eine lange<br />
Epoche der Kulturgeschichte eine elementare, eine ökonomische Notwendigkeit.<br />
Für viele Menschen ist das noch heute der Fall, aber körperliche Arbeit oder der<br />
Einsatz des Körpers <strong>im</strong> Kampf ist für technische Zivilisation nicht mehr charakteristisch.<br />
Eine ähnliche Situation hat <strong>im</strong> alten Griechenland zur Erfindung des<br />
Sports geführt. Nun kann der Sport zwar in Leisure-Gesellschaften ein plausibler<br />
Ausgleich für die physische Untätigkeit sein, dass er aber als Paradigma der Diätetik<br />
aufgefasst wurde, muss als gesellschaftliche Fehlentwicklung angesehen werden.<br />
Der Sport gehört seinem Ursprung nach einem militärischen und agonalen<br />
Zusammenhang an. Sport ist als solcher nicht Übung <strong>im</strong> Lebensvollzug, sondern<br />
Training zur Hervorbringung von Leistung. Für eine Diätetik müssen also ganz<br />
andere Gesichtspunkte und Übungen entwickelt werden. Es müssen Leibesübungen<br />
<strong>im</strong> wörtlichen Sinne sein – Übungen, die Leiberfahrung ermöglichen<br />
und deren Vollzug als solcher eine Praxis leiblicher Existenz ist. Leibesübungen<br />
dieser Art sind inzwischen auch weit verbreitet. Zu denken ist aus östlichen Kulturen<br />
an Tai Chi, aus westlichen beispielsweise an Bioenergetik. Natürlich geht<br />
es in solchen Übungen auch um den so genannten körperlichen Ausgleich, der<br />
in der am Sport orientierten Diätetik so sehr in den Vordergrund gestellt wird.<br />
Doch es geht vor allem und grundlegender darum, dass man sich überhaupt in<br />
seinem Leibe findet und zu Hause fühlt. Das hat, wie wir gesehen haben, auch<br />
eine Bedeutung <strong>im</strong> Sinne einer Ethik leiblicher Existenz, weil tief greifende Entscheidungen<br />
in Bezug auf den eigenen Leib nur dann kompetent getroffen<br />
werden können, wenn man ihn auch als den eigenen kennt und erfährt und<br />
nicht nur als ein Körperding, in Bezug auf das man Erwägungen purer Zweckmäßigkeit<br />
anstellt. Doch diese leiblichen Übungen haben auch einen Sinn in<br />
sich, sie sind nicht nur Übungen für etwas anderes – sei es zur Prophylaxe, sei es<br />
zur Rehabilitation –, sondern sie sind selbst Lebensvollzug. Und insoweit sie in<br />
ausgesparten Situationen, abgehoben vom durchschnittlichen Arbeits- und Verkehrsbetrieb,<br />
ihre Zeit haben, sind sie wenigstens doch die paradigmatischere<br />
Erfahrung von Lebensvollzug.<br />
15 Ritzer, George: The McDonaldization of Society. Revised edition, London 1996.
158<br />
Gernot Böhme<br />
Die Frage nach der Selbstsorge war, wie wir am Anfang gesehen haben, bei<br />
Foucault durch das Thema Sexualität motiviert. Er hat in Verfolgung dieser Frage<br />
die klassische Diätetik wieder entdeckt. Er hat in ihr das Misstrauen gegenüber<br />
der Sexualität wieder gefunden, das aufzuklären, er eigentlich aufgebrochen<br />
war. Wir können jetzt sagen, dass es <strong>im</strong> Typ dieser Diätetik bereits angelegt war,<br />
insofern sie sich als eine Art von ökonomischem Umgang mit der eignen Natur<br />
verstand. Diese Natur und damit insbesondere die Sexualität wurde und blieb<br />
darin das Fremde in uns und damit das Unhe<strong>im</strong>liche und u.U. sogar Bedrohliche.<br />
Die neue Diätetik, die ja gerade darauf gerichtet ist, selbst Natur sein zu<br />
können, muss sich deshalb insbesondere am Thema der Sexualität bewähren.<br />
Die klassische Diätetik plädierte für einen restriktiven Umgang mit der Sexualität.<br />
Mäßigung war ja ohnehin die Grundmax<strong>im</strong>e zur Erhaltung der <strong>Gesundheit</strong>.<br />
Im Falle der Sexualität kam aber die noch bis ins 19. Jahrhundert wirksame<br />
Vorstellung hinzu, dass der Koitus ein Verströmen von Lebenskraft sei und deshalb<br />
lebensverkürzend – und zwar bei beiden Geschlechtern. In den späteren<br />
Phasen, insbesondere der römischen Antike, die Foucault erforschte, kamen dann<br />
Ratschläge hinzu, die auf einen möglichst effektiven Lustgewinn bei der Sexualität<br />
abzielten. Beides kann für die neue Diätetik keine Gültigkeit mehr beanspruchen.<br />
Das eine nicht, weil die zu Grunde liegende Theorie falsch ist, das andere<br />
nicht, weil es eine Instrumentalisierung der Sexualität enthält. Umso mehr und<br />
gerade weil diese Vorstellungen die sexuelle Praxis noch beherrschen, ist auch<br />
heute Sexualität nichts, das sich von selbst versteht oder einfach als etwas Natürliches<br />
seine angemessene Form fände. Tatsächlich gibt es ja gegenwärtig auch<br />
kaum einen Bereich, der in solchem Maße von Beraterliteratur überschwemmt<br />
ist. Diese Literatur gibt sich traditionell als Aufklärung. Aber Aufklärung, d.h.<br />
Wissensvermittlung, ist gar nicht das Entscheidende. Vielmehr geht es auch hier<br />
darum, dass man sich in sein Natursein hineinfindet und sich in eine Praxis<br />
einübt, in der man diese Natur als die eigene erkennt und ihr Raum gibt.<br />
Natur zu sein heißt auch hier, dass man sich selbst gegeben ist und dass man<br />
Widerfahrnissen ausgesetzt ist. Die Sexualität taucht auf <strong>im</strong> Zusammenhang der<br />
Erfahrung, dass wir uns geschlechtlich gegeben sind. Wir erfahren unseren Leib<br />
als Geschlechtsleib. Daraus folgt, dass die Sorge um sich <strong>im</strong> Bereich der Sexualität<br />
zu allererst heißen muss, sich mit den biografischen Ereignissen und Lebensvollzügen<br />
der leiblichen Geschlechtlichkeit vertraut zu machen, mit sich<br />
qua Geschlechtsleib in Einklang zu kommen. Das heißt auch zu lernen, dass man<br />
wegen der Geschlechtlichkeit seiner Natur nicht das Menschsein <strong>im</strong> Ganzen<br />
repräsentiert, sondern nur mit dem anderen Geschlecht zusammen. Und es heißt<br />
schließlich, dass man seine eigene Natürlichkeit als Gattungswesen anerkennt:<br />
Wir sind als Naturwesen solche, die sich geschlechtlich reproduzieren. Im Kinderhaben<br />
vollendet sich deshalb die Anerkennung, die man sich selbst als Natur<br />
entgegenbringt.<br />
Sexualität bedeutet aber auch, dass man von anderen Menschen Anmutungen<br />
erfährt. Das ist sogar der Kern der sexuellen Selbsterfahrung, nicht etwa die
Die Sorge um sich – Präventation als Lebenspraxis 159<br />
Erfahrung von Potenz oder Begehren. Vom anderen geht eine Anmutung, eine<br />
Anziehung, eine Beunruhigung aus, und gerade darin erfahren wir uns in unserer<br />
Besonderheit als geschlechtliche Wesen. Sich auf die eigene Natur einzulassen,<br />
bedeutet sich dieser Anmutung zu öffnen, ihr in der Zärtlichkeit folgend<br />
erfüllt sich die leibliche Existenz in der gesteigerten Präsenz des Miteinanders.<br />
Es geht auch anders, das wissen wir. Die Geschehnisse, die zur geschlechtlichen<br />
Biografie gehören, können weit gehend hormonell gemanagt werden, die Einschnitte<br />
medikamentös eingeebnet. Im Extremfall kann man selbst sein Geschlecht<br />
zur Disposition stellen. Die Sexualität kann man als Aktivität verstehen,<br />
und wenn die Natur nicht mitmacht, der Potenz aufhelfen. Man kann auch<br />
ohne Kinder leben und man kann seine sexuellen Bedürfnisse verdrängen oder<br />
abreagieren.<br />
Doch in alledem würde man zeigen, dass man sich nicht wirklich auf das Leben<br />
als leibliche Existenz einlässt, dass man Leibsein nicht als Aufgabe versteht.<br />
5. Schluss: Prävention als Lebenspraxis<br />
Nach dem Erläuterten wäre es angebracht, den Untertitel dieses Beitrags umzudrehen.<br />
Es geht nicht nur darum, die Prävention zur Lebenspraxis zu machen<br />
bzw. sie in die Lebenspraxis einzubauen, es geht eigentlich um Lebenspraxis als<br />
Prävention. Es geht darum, dass man ein Leben führt, in dem man der Natur,<br />
die wir selbst sind, also dem Leib, die angemessene Aufmerksamkeit und Achtung<br />
entgegenbringt.<br />
These 1: Die Achtung vor der eigenen Natur. Unser Leib, die Natur, die wir selbst<br />
sind, ist der uns vorgegebene und <strong>im</strong> Prinzip verlässliche Boden, auf dem wir<br />
leben. Die <strong>im</strong>mer wieder erstaunliche innere Abgest<strong>im</strong>mtheit, Anpassungsfähigkeit<br />
und Verarbeitungskapazität sollte man nicht unnütz stören.<br />
Das bedeutet:<br />
– dass man von medizinischer Intervention sparsamen Gebrauch machen sollte.<br />
Nicht jede Unpässlichkeit sollte Anlass zum Arztbesuch sein. Man bedenke:<br />
25% aller Krankheiten werden als iatrogen eingeschätzt 16 , Nebenwirkungen<br />
von Medikamenten, Ansteckungen in Krankenhäusern, Folgen chirurgischer<br />
Intervention etc.<br />
– dass man seine Naturausstattung nicht willkürlich verändern sollte. Schönheitschirurgie,<br />
Eingriffe in den Hormonhaushalt, Eingriffe in die genetische<br />
Ausstattung werden sich über kurz oder lang rächen. Die Auseinandersetzung<br />
mit dem, was uns als Leib gegeben ist bzw. wie wir uns als Leib gegeben sind,<br />
sollte moralisch und nicht technisch erfolgen.<br />
16 Spain, David M.: Iatrogene Krankheiten, Stuttgart 1967.
160<br />
Gernot Böhme<br />
These 2: Man sollte den eigenen Leib achten, oder besser: man sollte sich selbst<br />
als Leib achten.<br />
Das bedeutet:<br />
– Man sollte die aus dem eigenen Leib aufsteigenden Regungen nicht verdrängen<br />
und manipulieren, sondern sie kennen und beachten. Sie können<br />
Signale sein, die einem anzeigen, was man gut kann und was nicht, sie können<br />
Signale sein, die einem anzeigen, wo die eignen Grenzen liegen und wo<br />
man Ruhe und Erholung braucht. Diese leiblichen Regungen können aber<br />
einem auch anzeigen, was zu einem als Person passt und was nicht und<br />
insofern auch eine Hilfe in der Orientierung in Gesellschaft und der Arbeitswelt<br />
sein. (Diese Art der Beachtung von Leibsignalen ist inzwischen als das<br />
sog. Focussing ausgebildet worden.)<br />
These 3: Sie verlangt die Bereitschaft für Widerfahrnisse. Wir haben gesehen, dass<br />
wir uns gerade in negativen Widerfahrnissen als Selbst finden. Ich nenne das<br />
betroffene Selbstgegebenheit.<br />
Aus der Anerkennung, dass solche Widerfahrnisse zentral zur Person gehören,<br />
folgt zweierlei:<br />
– Es folgt eine gewisse Schmerzbereitschaft. Natürlich soll man nicht jeden<br />
Schmerz hinnehmen, und eine adäquate Schmerztherapie ist gerade in Deutschland<br />
noch ein Desiderat. Auf der anderen Seite kann ein schmerzfreies Leben<br />
nicht das Ideal sein, insbesondere dann nicht, wenn bereits jeder kleine <strong>Alltag</strong>sschmerz<br />
medikamentös weggedrückt wird.<br />
– Es folgt ferner, dass man Krankheit nicht in einem ausschließenden Gegensatz<br />
zu <strong>Gesundheit</strong> sehen darf. Krankheit gehört zum Leben und deshalb ist die<br />
Kunst, mit Krankheiten fertig zu werden, wichtiger als Prävention. Ich darf<br />
hier den Lübecker Medizinhistoriker Dietrich von Engelhardt zitieren: „Im<br />
Gegensatz zu der bekannten und utopischen WHO-Definition von <strong>Gesundheit</strong><br />
als physischem, psychischem und sozialem Wohlbefinden (physical,<br />
psychical and social well-being) müsste <strong>Gesundheit</strong> auch nicht als totales<br />
Freisein von Krankheit, sondern könnte eher als Fähigkeit verstanden werden,<br />
mit Behinderung und Schädigungen leben zu können.“ 17<br />
These 4: Diätetik muss anders verstanden werden, als das heute noch in der<br />
Regel der Fall ist. Diätetik heißt vom Wort her Lebensführung, es geht also<br />
eigentlich nicht um spezielle gesundheitsstabilisierende Maßnahmen in einem<br />
gesundheitsgefährdenden Leben. Da wir als Individuen das Leben in der technischen<br />
Zivilisation bzw. in der Leistungsgesellschaft nicht ändern können,<br />
sollte wenigstens das, was wir für die <strong>Gesundheit</strong> tun, von ihren Kategorien freigehalten<br />
werden.<br />
17 Engelhardt, Dietrich von: Mit der Krankheit leben, Grundlagen und Perspektiven der<br />
Copingstruktur des Patienten, Heidelberg 1986, S.21.
Die Sorge um sich – Präventation als Lebenspraxis 161<br />
Daraus folgt:<br />
– Die Übungen, die man zur <strong>Gesundheit</strong>sförderung betreibt, sollten selbst die<br />
Form des Lebensvollzuges haben, d.h. nicht als Leistung für etwas anderes<br />
erbracht werden. Sport entstammt agonalen und militärischen Zusammenhängen<br />
und eignet sich als solcher nicht als diätetische Übung. Überhaupt<br />
sollte man keine Übungen betreiben, die um eines Ergebnisses vollzogen<br />
werden.<br />
– Daraus folgt ferner, dass man das Essen aus den Fängen der Rationalisierung<br />
befreien und als Lebensvollzug zurückgewinnen muss. Be<strong>im</strong> Essen konzentrieren<br />
sich die meisten Menschen darauf, was sie essen und was nicht. Natürlich<br />
sollte man krank machende Substanzen – Drogen, Alkohol und Nikotin<br />
– meiden und die Nahrungsmittel gesundheitsbewusst auswählen. Was aber<br />
darüber vergessen wird, ist der Vollzug des Essens selbst. Essen als Lebensvollzug<br />
braucht seine Zeit, seinen Rhythmus und sein Ritual.<br />
Aristoteles, den man ja über lange Zeit unserer Kulturgeschichte schlicht den Philosophen<br />
genannt hat, unterschied zwei Weisen des Tuns, nämliche Poiesis und<br />
Praxis. Sie unterscheiden sich wie das Bauen vom Wohnen: Poiesis ist das Herstellen<br />
und vollendet sich <strong>im</strong> Produkt, Praxis ist der Lebensvollzug und dieser<br />
vollendet sich in sich selbst. Die beste Prävention wäre: das Leben nicht als Herstellen<br />
zu verstehen, sondern ihm in der Weise des Vollzuges gerecht zu werden.
Zeitmanagement – ein Irrweg?<br />
1. Einführung<br />
Olaf Geramanis<br />
Das Versprechen, die eigene Zeit tatsächlich managen zu können, ist schon sehr<br />
verlockend. Und wenn Heidegger sagt, dass hinter aller Beschäftigung mit der<br />
Zeit „das Sein zum Tode“ steht, lässt sich dieses „Managen“ <strong>im</strong>mer auch als ein<br />
Versuch verstehen, unsere Vergänglichkeit zu unseren Gunsten beeinflussen zu<br />
wollen. Man wird geboren, man wird sterben, und dazwischen liegt das, was wir<br />
„die Zeit“ nennen. Für diese Zeit existieren wir, und dass dem so ist, daran kann<br />
auch kein Zeitmanagement-Seminar etwas ändern.<br />
Etwas ganz anderes ist allerdings die Illusion einer potenziellen Verfügbarkeit<br />
von Zeit, diese Illusion ist hochattraktiv und ökonomisch produktiv, und dafür<br />
nehmen wir uns auch sehr viel Zeit. Insofern ist die tausendfach zu hörende<br />
Klage: „Tut mir Leid, keine Zeit“ ziemlich unehrlich. Hätten wir nämlich wirklich<br />
keine Zeit mehr, dann wären wir ja tot und könnten uns nicht mehr über<br />
unsere Zeitlosigkeit beklagen. Insofern klagt es sich gut, weil man hierdurch sich<br />
und anderen beweist, dass man offensichtlich noch lebt.<br />
Von besonderem Interesse ist die Prävention als Element der Lebenspraxis. Wenn<br />
es mir also gelingen könnte, die Zeit, die mir zum Leben zur Verfügung steht, individuell<br />
so einzurichten und zu beeinflussen, dass „alles passt“, wäre dies nicht<br />
die beste Prävention?<br />
2. Individuelle Allmachtsgedanken<br />
Derartige individuelle Allmachtsphantasien, alles in Eigenregie herstellen zu<br />
können, haben allerdings auch Risiken und Nebenwirkungen – und diese ergeben<br />
sich nicht nur <strong>im</strong> <strong>Gesundheit</strong>ssektor. Die Frage, die sich hierbei anschließt,<br />
lautet: Sind wir für jene Welt, die wir uns eigenhändig geschaffen haben, überhaupt<br />
geschaffen?
Zeitmanagement – ein Irrweg? 163<br />
Einige Statistiken, die Anlass zum Zweifeln an der menschlichen Allmacht<br />
geben:<br />
• Laut Berechnungen der Rückversicherungsgesellschaften, speziell der Münchner<br />
Rückversicherung, hat die Anzahl der Naturkatastrophen in den letzten<br />
Jahren, u.a. wegen der Missachtung der natürlichen Gegebenheiten, <strong>im</strong>mens<br />
zugenommen. Auch die Allianz meldet einen erheblichen Schadenszuwachs<br />
durch Stürme und Überschwemmungen. (Mit dem Wasser steigen auch die<br />
Versicherungskosten.)<br />
• Die Lebenserwartung von Unternehmen ist massiv gesunken. Ein Durchschnittsunternehmen<br />
wird gerade mal 20 Jahre (Arie de Geus in: Harvard<br />
Business-Manager 3/97).<br />
• 85% der deutschen Führungskräfte leiden unter Schlaflosigkeit, nervösen Magenproblemen<br />
und Herzrhythmusstörungen. 84% klagen über mehr Stress als<br />
noch vor fünf Jahren.<br />
• Be<strong>im</strong> Verkauf von Arzne<strong>im</strong>itteln verzeichnen die Antidepressiva den größten<br />
Umsatzzuwachs: plus 6%. In absoluten Zahlen (1998) wurden 300 Millionen<br />
Tagesdosen an Schlaf- und Beruhigungsmittel <strong>im</strong> Wert von 288 Millionen Mark<br />
in Deutschland verkauft.<br />
• Das Datenvolumen <strong>im</strong> Internet verdoppelt sich ca. alle 100 Tage. Die Zeitvolumina<br />
des Tages und des Jahres verändern sich dagegen überhaupt nicht,<br />
und die Lebenszeit verändert sich – wenn überhaupt – nur geringfügig.<br />
• Die durchschnittliche Nutzungsdauer der Milchkühe liegt nur noch bei knapp<br />
3 Jahren in Deutschland, in den USA bei 2,2 Jahren, in Israel bei 1,8 Jahren.<br />
Auch für Turbotiere gilt: Wer schneller lebt, ist schneller fertig.<br />
• Die Geschwindigkeit der Nahrungsaufnahme ist in einem Schnell<strong>im</strong>bissrestaurant<br />
2,5 mal höher als bei normalen Mahlzeiten (Studie der Schweizer<br />
Vereinigung für Ernährung).<br />
• Das Sichtfeld eines Autofahrers <strong>im</strong> stehenden Wagen liegt bei 180°, es reduziert<br />
sich bei 100 Stundenkilometern auf nur noch 45°.<br />
• Die Folgekosten der Übermüdung werden in Deutschland auf jährlich etwa<br />
20 Milliarden Mark geschätzt (Zulley).<br />
• Vielflieger, speziell jene, die häufig Zeitzonen überfliegen, nehmen nach einer<br />
Studie des <strong>Gesundheit</strong>sdepartments der Weltbank bis zu 80% mehr Krankenkassenleistungen<br />
in Anspruch als jene Menschen, die stationär leben.<br />
3. Hochgeschwindigkeitsmenschen<br />
Wir sind zu Hochgeschwindigkeitsmenschen geworden. Wir hetzen durch die<br />
Welt, und je schneller wir dabei werden, desto eher scheint uns die Zeit davon<br />
zu laufen – oder läuft uns die Zeit gar nicht davon, und es ist die Zukunft, die<br />
stattdessen <strong>im</strong>mer rascher auf uns zurast? Schon wieder ein schnellerer Computer<br />
auf dem Markt, ein „mulifunktionaleres“ Handy, ein sichereres Auto und<br />
schon wieder mehr Fernsehprogramme. Und <strong>im</strong>mer schneller muss man eine<br />
neue Entscheidung darüber treffen, was für einen das Beste ist.
164<br />
Olaf Geramanis<br />
Der Wahlspruch unserer heutigen Zeit könnte daher lauten: „Ich eile, also bin<br />
ich“, was <strong>im</strong> Umkehrschluss heißen würde: „Immer dann, wenn ich nicht eile,<br />
bin ich nicht“. Aber was wollen wir mit unserer Eile eigentlich erreichen? Was<br />
für einer Idee rennen wir da hinterher?<br />
Meine erste Vermutung lautet: Wir managen unser Leben auf höchsten Touren<br />
und laufen dabei Gefahr, vor lauter Beschleunigung das Tempo mit dem Ziel zu<br />
verwechseln. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir der Ansicht sind, wir könnten<br />
die Zeit selbst managen? Was wollen wir erreichen, wenn wir uns in <strong>im</strong>mer<br />
größerer Beschleunigung und voller Ungeduld dem Glauben hingeben, dass wir<br />
die Zeit in unseren Händen haben? Arno Gruen sagt: Ungeduld ist die Unfähigkeit,<br />
die dahinter stehende Angst zu tolerieren.<br />
Welche Angst ist es aber, die dahinter steht? Ist es die Angst, dass wir das Gefühl<br />
haben, in unseren Allmachtsphantasien irgendetwas verloren zu haben? Und<br />
könnte es sein, dass wir versuchen, dieses Wissen darüber, dass irgendetwas fehlt,<br />
durch blinden Aktionismus zu bekämpfen? Immer schneller probieren wir neue<br />
Wege aus, <strong>im</strong>mer neuere Programme, <strong>im</strong>mer neuere Maßnahmen. So beschleunigt<br />
jeder einzelne Mensch richtungslos vor sich hin und wundert sich, dass er<br />
<strong>im</strong>mer einsamer dabei wird. Wann ist uns die Zeit entglitten und was haben wir<br />
auf dem Weg dahin möglicherweise verloren?<br />
4. Vormoderne – Moderne – Postmoderne<br />
Will man die Entwicklung unseres Zeitverständnisses auf eine Kurzformel bringen,<br />
so könnte man folgende Dreiteilung treffen:<br />
• In der vormodernen Zeit fanden wir die Zeit in der Natur und am gestirnten<br />
H<strong>im</strong>mel über uns,<br />
• in der nachfolgenden Moderne fanden wir sie in den Uhren und bei den Kirchturmglocken<br />
und<br />
• heute, in der Postmoderne, entdecken wir sie in Zeitplansystemen, Zeitvorträgen<br />
und Zeitmanagement-Seminaren.<br />
4.1 Die Vormoderne<br />
Die erste Epoche soll als die „Vormoderne“ bezeichnet werden. Sie ist durch<br />
eine enge Verbindung des gesamten Lebens – insbesondere des Arbeitslebens –<br />
mit den Dynamiken der Natur gekennzeichnet. Die natürlichen Zyklen best<strong>im</strong>mten<br />
den Lebensrhythmus. Insbesondere waren dies der Wechsel der Gestirne,<br />
Ebbe und Flut, Regenzeiten und Trockenzeiten, die Jahreszeiten, Tag und<br />
Nacht. An ihnen wurden soziale, kulturelle und individuelle Ereignisse festgemacht.<br />
Man lebte in der Natur und mit der Natur, man ging mit den Hühnern<br />
schlafen und stand be<strong>im</strong> ersten Hahnenschrei wieder auf.
Zeitmanagement – ein Irrweg? 165<br />
Abstrakte Maße wie z.B. Jahreszahlen waren ungebräuchlich. Noch bis ins<br />
17. Jahrhundert, dies lässt sich aus Chroniken ersehen, konnten die wenigsten<br />
Menschen jenes Jahr beziffern, in dem sie geboren waren. Das Leben – als soziales<br />
Leben – begann mit dem Aufgang der Sonne, und es endete meist bei Sonnenuntergang.<br />
Zeit, zu dieser Zeit, hatte <strong>im</strong>mer eine Qualität: So wurden Zeitpunkte<br />
und Zeitstrecken nicht wie heute an einem abstrakten Maß, einer<br />
„Uhrzeit“, sondern an der Länge des lichten Tages festgemacht.<br />
Alles, was dann über die Jahreszeiten hinausging, wurde nicht etwa an Jahrhunderten<br />
oder gar an Jahrtausenden festgemacht, sondern das best<strong>im</strong>mende<br />
„größte“ Maß war die „Generation“. Das Zählen nach Generationen stellte<br />
einen zur Orientierung hinreichend konkreten und langfristigen Zusammenhang<br />
der Ereignisse her. Was dennoch über diesen familiären Rahmen hinaus ging,<br />
wurde nach den Regentschaftszeiten von Monarchen eingeteilt: „Zu Zeiten des<br />
Kaiser Augustus ... “.<br />
Zeit ist in der Vormoderne nicht die Summe von quantitativen Zeitpunkten. Zeit<br />
ist der Zusammenhang von Erlebnissen und Erfahrungen. Diese Zeitordnung<br />
jedoch war der eigenen Disposition grundsätzlich entzogen. Man wäre gar nicht<br />
auf die Idee gekommen, die Zeit „managen“ zu wollen. Sie war von der Natur<br />
vorgegeben und war damit kein Besitz des Menschen. Die Zeit gehörte ja schließlich<br />
Gott, der seinerseits allen Lebewesen ihre jeweiligen Zeiten gab. Daher durfte<br />
zu dieser Zeit auch nicht mit der Zeit gehandelt werden bzw. Zinseinnahmen,<br />
die ja nichts anderes waren als ein Handel mit Zeit.<br />
Ein solcher Blick auf das Vergangene sollte nicht dazu verführen, sich zu idyllischer<br />
Verklärung hinreißen zu lassen. Die Naturnähe war damals auch zwangsläufig<br />
mit all jenen Dramatiken verbunden, in die eine nicht beherrschte und<br />
nicht beherrschbare Natur die Menschen mit einbezog. Man war Hungersnöten,<br />
Überschwemmungen und Trockenheiten ausgeliefert, und nicht wenige Männer,<br />
Frauen und Kinder fielen eben diesen Naturgewalten zum Opfer.<br />
Aber gerade diese Rhythmen der Natur waren es, die Ordnung in Raum, Zeit<br />
und Gesellschaft schufen. (Das Wort Zeit – Tempus, Temps, Tide – hat <strong>im</strong>mer ein<br />
Doppelbezug zum Wetter: Il fait beau temps.) Diese Aufgabe oblag nicht dem<br />
einzelnen Menschen. Die Ordnung wurde jenseits der individuellen Möglichkeiten<br />
geschaffen. Die Rhythmen der Natur waren die stabilisierenden Ordnungsprinzipien<br />
der Lebensführung, in die man sich demütig und ohnmächtig<br />
eingebettet sah. Insofern ist ein solches Zeitverständnis zwingend „begrenzt“.<br />
„Zeit“ war zu dieser Zeit kein Thema. Wieso hätte man über sie reden sollen?<br />
4.2 Die Moderne<br />
Im Ausgang des Mittelalters kam die „Zeit aus dem Rhythmus“, be<strong>im</strong> Übergang<br />
zu jener Epoche, die wir die „Renaissance“ nennen. 1358 wurde in Regensburg
166<br />
Olaf Geramanis<br />
die erste deutsche Schlaguhr am Rathaus angebracht, andere Städte wie Nürnberg<br />
und Augsburg folgten. Von da an konnten die Stadtbewohner in pünktliche<br />
und unpünktliche Einwohner eingeteilt werden. Endlich ließen sich Termine<br />
machen.<br />
Dies stellt zugleich auch den Übergang dar von der Naturzeit zur „Menschenzeit“.<br />
Die Zeit selbst begann nun wertvoll zu werden. Das theologische Verbot, die Zeit<br />
durch Zinseneinnahmen zu „verkaufen“, wurde still und leise aufgehoben. Die<br />
längste Zeit ist die Zeit ein Gottesgeschenk gewesen. Jetzt ist sie eine knappe<br />
Ressource mit der kalkulatorisch umgegangen werden kann. Die Stunde mit<br />
ihrer Unterteilung in sechzig Minuten wurde erfunden. Sie löste das „Tagwerk“<br />
als zentrale handlungsorientierende Maßeinheit der Arbeit zunehmend ab.<br />
Ab dem 17. Jahrhundert dann scheint die Zeit insgesamt schneller zu laufen. Es<br />
entwickelt sich ein völlig neues Gefühl. Die Zeit läuft einem davon. Menschliche<br />
und tierische Arbeitskraft werden durch Maschinen ergänzt und teilweise<br />
ersetzt. An die Stelle der rhythmisch gestalteten Produktivität der Natur tritt nun<br />
die Produktivität der industriell organisierten und maschinellen Arbeit.<br />
Zeit ist nun nicht mehr an konkreten Erlebnisinhalten bzw. an anschaulichen<br />
Erfahrungen festgemacht, sondern weitgehend von Ereignissen losgelöst. Technik<br />
und Ökonomie setzen den Takt an Stelle des Rhythmus. Takt ist die inhaltsleere<br />
Wiederkehr des Immergleichen <strong>im</strong> Gegensatz zu einer rhythmischen Gliederung<br />
des Werdens und Vergehens. Die „Zeit“ und die Zeiteinteilung werden<br />
an das abstrakte Medium Geld gekoppelt, sie werden kapitalisiert. Zeit wird verrechenbar,<br />
die Gleichung „T<strong>im</strong>e is money“ kennt jedes Kind.<br />
Eine derart abstrakte maschinelle Zeit fördert natürlich gerade die Möglichkeit<br />
zur Manipulation <strong>im</strong> Sinne von „Beherrschung“ und vor allem Beschleunigung<br />
der Arbeits- und der Lebensverhältnisse. Maschinen liefern das Zeitmaß, und an<br />
diesem gilt es, sich pr<strong>im</strong>är auszurichten. Die Zeit kehrt nicht mehr (von selbst)<br />
zyklisch wieder, sondern wird linear in eine unendliche Zukunft hin gedacht.<br />
Und diese Vorstellung von Linearität ist es, die die Zeit scheinbar berechenbar<br />
macht. „Zeit“ wird nun grenzenlos in Abschnitte teilbar. Dies ist der Beginn der<br />
Vorstellung, dass man mit der Zeit etwas tun kann. Jetzt glaubt man, die Zeit<br />
selbst manipulieren zu können.<br />
Foucault sagt: Die Ökonomie „setzt auf das Prinzip einer theoretisch endlos wachsenden<br />
Zeitnutzung (...) Es geht darum, aus der Zeit <strong>im</strong>mer noch mehr verfügbare<br />
Augenblicke und aus jedem Augenblick <strong>im</strong>mer noch mehr nutzbare Kräfte<br />
herauszuholen. Man muss darum versuchen, die Ausnutzung des geringsten<br />
Augenblicks zu intensivieren, als ob die Zeit gerade in ihrer Zersplitterung unerschöpflich<br />
wäre oder man durch eine <strong>im</strong>mer feinere Detaillierung auf einen<br />
Punkt gelangen könnte, wo die größte Schnelligkeit mit der höchsten Wirksamkeit<br />
eins ist.“ (Foucault 1976, 198).
Zeitmanagement – ein Irrweg? 167<br />
Die Stechuhren, die Terminpläne, die Fabriksirenen zerhacken die ehemals qualitative<br />
und soziale Zeit, die fließende Zeit. In dem häufigen und verbreiteten<br />
Gebrauch von Uhren, von Kalendern, von Fristen und Zeitnormen entwickelt<br />
sich dieses pr<strong>im</strong>är geldbest<strong>im</strong>mte Zeitverständnis schließlich zum dominanten<br />
sozialen Ordnungsprinzip des <strong>Alltag</strong>s. Kaffeepausen, als protestantische Schrumpfform<br />
einer ausgedehnten Siesta-Kultur, Urlaub, Freizeitausgleich, Fünftagewoche,<br />
all dies sind „Notbremsen“ einer Gesellschaft, die die Zeit und ihre Strukturierung<br />
selbst in die Hand genommen hat. Wir haben unseren Güterwohlstand<br />
diesem Perspektivenwechsel zu verdanken, aber auch unseren Zeitnotstand.<br />
Die Ablösung der Naturrhythmen durch den menschengemachten mechanischen<br />
Takt hat uns zweifelsohne zu neuen Horizonten der Freiheit geführt,<br />
jedoch um den Preis wachsender funktionaler Abhängigkeiten. Wir sind zu Zauberlehrlingen<br />
einer selbstinszenierten Zeitmanipulation geworden. Wir glauben<br />
uns weitgehend unabhängig von den Folgen der „Naturzeiten“ und verheddern<br />
uns stattdessen <strong>im</strong> Netz unserer selbst gemachten Zeitordnung.<br />
4.3 Die Postmoderne<br />
Eines Tages, es ist noch nicht allzu lange her, entdeckte man, dass „Flexibilisierung“<br />
und „Globalisierung“ die richtigen Namen für das sein könnten, woran es<br />
uns jetzt noch fehlt. Dies war der Anfang vom Ende der Moderne, das Ende<br />
einer taktmäßigen Zeitordnung. Und so lautet meine These, dass wir heute vor<br />
einem ähnlichen Epochenwandel des Zeitbewusstseins und des Zeithandels<br />
stehen wie vor 500 Jahren, als die Naturzeit durch die Uhrzeit abgelöst wurde.<br />
Dies berechtigt m.E. die Moderne vom Zeitalter der Postmoderne abzugrenzen.<br />
Jetzt gerät das bis vor kurzem noch relativ unumstrittene moderne Zeitverständnis<br />
ins Wanken: Die Uhren-Zeit und ihr Monopol als best<strong>im</strong>mendes einheitliches<br />
Zeit- und Koordinationsmaß fürs Leben und Arbeiten verliert an Bedeutung. Das<br />
heißt aber auch, dass die bisher gültige Zeitordnung selbst zur Disposition steht:<br />
eine Zeitordnung, die <strong>im</strong>mer auch eine soziale Ordnung war, indem die Zeit für<br />
alle zentral koordiniert wurde.<br />
Die Koordination unseres Lebens durch eine für alle gültige einheitliche Zeit<br />
scheint insofern nicht mehr gewesen zu sein als ein 250-jähriges Strohfeuer.<br />
Jene, die die Uhr für zeitlos hielten, haben sich offenbar getäuscht. Ich möchte<br />
meine These vom Epochenwandel der Zeitorientierung etwas genauer an zwei<br />
Punkten verdeutlichen.<br />
Das Ende der Beschleunigung<br />
Schneller, höher, weiter mag als Dogma noch bei Veranstaltungen der pharmazeutischen<br />
Industrie (man könnte auch Olympische Spiele sagen) von Bedeutung<br />
sein. Ein Wettbewerbsvorteil lässt sich in Zeiten globaler Provinzialität, wo
168<br />
Olaf Geramanis<br />
die Welt zum Dorf geschrumpft ist, nicht mehr herausschlagen. Die absolute<br />
Herrschaft der Uhrenzeit gründet sich maßgeblich auf deren Leistung, die<br />
Lebens-, besonders aber die Arbeitsverhältnisse zu beschleunigen. Und das Bemerkenswerte<br />
an dieser Sache ist, dass sich überhaupt erst mit Hilfe der Uhrzeit<br />
die Zeit selbst gewinnen und verlieren ließ. Den Sonnenlauf kann man eben<br />
nicht beschleunigen.<br />
Das dynamische Prinzip entsprach der Verrechnung von „Zeit in Geld“. Wobei<br />
diese Formel unter Wettbewerbsbedingungen nie „Zeit ist Geld“ hieß, sondern<br />
<strong>im</strong>mer „Zeitvorsprung ist Geld“. Der Zeitvorsprung nämlich war und ist es, der<br />
über Gewinn und Verlust, über Erfolg oder Konkurs entscheidet. Zeit wird dann<br />
zur knappen Ressource, wenn man schneller produzieren oder liefern kann als<br />
die Konkurrenz.<br />
Diese Ressource Zeit bzw. der Spielraum, den es zu erobern galt, ist heute weitgehend<br />
ausgeschöpft. Die Börsenereignisse in New York werden gleichzeitig, in<br />
so genannter „Echtzeit“, in Frankfurt, in Buenos Aires, in Moskau und Tokio<br />
wahrgenommen. Es gibt keinen Informationsvorsprung durch Zeit und keinen<br />
durch räumliche Distanzen verursachten Zeitunterschied mehr. Wo aber der Zeitvorsprung<br />
technisch zunichte gemacht worden ist, gibt es für die Uhren nichts<br />
mehr zu messen. Aus Zeitvorsprüngen, die nicht mehr existieren, kann auch kein<br />
Profit mehr gezogen werden. Da hilft es auch nichts, wenn so mancher Manager<br />
seinen „T<strong>im</strong>er“ wie eine Monstranz vor sich her trägt. Und es ist das Ironische<br />
an der Sache, dass uns die schnellsten Schnelligkeiten den Zwang zum „Genug“<br />
auferlegen. Geld kennt kein „Genug“ – Beschleunigung offenbar schon.<br />
Informationen lassen sich eben nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit<br />
transportieren, es sei denn, man erwartet, dass die Informationen schneller be<strong>im</strong><br />
Empfänger sind, als man sie selbst produziert hat, was wiederum ein zweifelhaftes<br />
Versprechen ist.<br />
Wenn Informationen und Wissen die Ressourcen der Zukunft sind, ist von weiterer<br />
Beschleunigung in Zukunft kein Impuls mehr für das wirtschaftliche Wachstum<br />
zu erwarten. Zeitdruck ist nicht mehr länger ein Instrument, um Wettbewerbsvorteile<br />
zu erlangen. Spontaneität, Kreativität und Innovation lassen sich<br />
weder managen noch per Knopfdruck anordnen. Für jene, die mit Lichtgeschwindigkeit<br />
konkurrieren, ist es sinnlos geworden, schneller als die Konkurrenz<br />
sein zu wollen. Es gewinnen alle, oder, was wahrscheinlicher ist, keiner.<br />
Auch darüber hat uns die Natur mit ihrer eigenen Zeit belehrt.<br />
Das Ende der Pünktlichkeit<br />
Wenn es aber keine Uhren mehr gibt, dann kann man auch nicht mehr pünktlich<br />
sein. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, wird man bemerken, dass<br />
heutzutage jene Menschen, die pünktliches Verhalten von anderen und von sich<br />
selbst verlangen, nicht mehr allzu jung aussehen. Ist es dann ein Generationen-
Zeitmanagement – ein Irrweg? 169<br />
problem, dass man einer verschwindenden Pünktlichkeitsmoral nachtrauert?<br />
Für viele Jugendliche ist Pünktlichkeit anscheinend keine jener Werthaltungen<br />
mehr, die sie für besonders wichtig erachten. Flexibilität erwarten sie, aber Pünktlichkeit?<br />
Warum eigentlich? Wozu? Zur Flexibilität kann es schon auch mal<br />
gehören, dass man mal pünktlich ist, aber ebenso zählt es dazu, dass es kein Problem<br />
darstellt, wenn man es nicht ist. Kommen aber alle <strong>im</strong>mer häufiger und<br />
regelmäßiger zu spät, läuft die Pünktlichkeitserwartung leer. Und das „Zeitalter<br />
der Pünktlichkeit“ geht seinem Ende entgegen. Wenn also <strong>im</strong>mer kurzfristigere<br />
Veränderungen <strong>im</strong> Leben und <strong>im</strong> Arbeitsprozess zunehmen, dann wird es <strong>im</strong>mer<br />
wichtiger, auf das Unerwartete reagieren zu können.<br />
Die Uhrenzeit bot ein situationstunabhängiges Koordinationsschema und schuf<br />
damit Planbarkeit und Verlässlichkeit. So konnte sich auch das Leistungsprinzip<br />
durchsetzen: „Leiste was, dann bist du was.“ Wer treu seinem Betrieb dient,<br />
kann sich <strong>im</strong> Gegenzug darauf verlassen, dass sich diese Treue für ihn auszahlt.<br />
Soziale Reziprozität war das Prinzip dahinter. Nur aus diesem Grunde konnten<br />
angelernte Verhaltensweisen wie Loyalität, Beständigkeit oder eben Pünktlichkeit<br />
in den Stand der Tugenden versetzt werden. Pünktlichkeit ist ja ein rein<br />
formales Kriterium, nach dem Motto: „Sei zum verabredeten Zeitpunkt da, egal<br />
was passiert.“<br />
Unter postmodernen Bedingungen allerdings werden die Flexiblen es sein, die<br />
<strong>im</strong> Berufsleben Karriere machen. Nicht die Pünktlichen. Oder haben sie schon<br />
einmal versucht, an der Börse durch Pünktlichkeit einen Gewinn zu erzielen?<br />
Diejenigen, die nur noch pünktlich sind, kommen bei den heutigen flexiblen<br />
Zuständen und Situationen <strong>im</strong>mer häufiger zu spät. Wer ad-hoc und spontan<br />
organisiert und variabel reagiert, kann aber nicht <strong>im</strong>mer pünktlich sein. Es wird<br />
aber dennoch erwartet, dass man am Punkt ist.<br />
Aber keine Angst: Wenn kalkulierte und kalkulierbare Unpünktlichkeit an die<br />
Stelle der ehemals moralisch hoch aufgeladenen Pünktlichkeitserwartung tritt,<br />
muss dies noch nicht das Ende der Verlässlichkeit bedeuten. Zuverlässigkeit ist<br />
aber nicht mehr situationsungebunden, sondern muss sozial <strong>im</strong>mer wieder neu<br />
ausgehandelt werden. Die Angst, unpünktlich zu sein, hat sich daher in die Befürchtung<br />
gewandelt, nicht an jedem Ort und zu jeder Zeit das Handy und die<br />
Telefonnummer des Gesprächspartners zur Hand zu haben. Postmoderne Moral<br />
besteht nicht darin, pünktlich zu sein, sondern darin zu sagen, um wie viel man<br />
sich verspätet.<br />
Das „Nicht-Pünktlich-Sein“ ist schon allein deshalb kein strafwürdiger und verachtenswerter<br />
Tatbestand mehr, weil das Zuspätkommen in einer sich <strong>im</strong>mer<br />
rascher verändernden Welt zum Normalzustand geworden ist. So lautet die<br />
<strong>im</strong>mer währende Hoffnung, dass man noch früh genug zu spät kommen wird.<br />
Wie gesagt: Die Max<strong>im</strong>e postmodernen Zeithandelns ist es, zum richtigen, nicht<br />
unbedingt zum vereinbarten Zeitpunkt zu erscheinen. Das nun ist nicht etwa<br />
ein Verfall der Zeit-Moral, das ist eine andere Zeit-Moral.
170<br />
5. Das Zeitalter der S<strong>im</strong>ultanten<br />
Olaf Geramanis<br />
Und diese „andere“ individuelle Zeitmoral spiegelt sich in allen Bereichen wider:<br />
Die Flexibilisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen lässt eben nur noch<br />
individuelle zeitliche Orientierungsmaße zu. Sie sind endlich frei, ihr Leben<br />
zu gestalten! Individuell sind die Freiheiten zweifelsohne so groß wie nie zuvor,<br />
aber gesamtgesellschaftlich (kollektiv) werden diese Freiheiten nicht mehr<br />
abgesichert, sodass mit den Freiheiten auch die Zwänge zunehmen.<br />
Die „neuen Freiheiten“ haben nämlich durchaus ambivalente Züge. Die Büros<br />
kennen keinen Arbeitsanfang mehr und keinen Schluss, die Ladenöffnungszeiten<br />
stehen ebenso zur Disposition wie die geregelten Arbeitszeiten. Die<br />
Folge ist, dass das, was wir bisher „Freizeit“ genannt haben, kaum mehr zeitlich<br />
identifizierbar ist: dienstliche Mails von zu Hause aus beantworten, Banküberweisungen<br />
vom PC aus, Müll selbsttätig in der häuslichen Küche sortieren. Sie<br />
haben unerträglich viele Freiheiten – gleichzeitig! Sie sind frei, sich zu entscheiden,<br />
aber wehe, sie entscheiden sich nicht! Damit nehmen diese Freiheiten, sich<br />
entscheiden zu müssen, zwanghafte Züge an.<br />
Das wiederum geht zu Lasten einer Freiheit (<strong>im</strong> Singular), die nicht mit diesen<br />
Freiheiten (<strong>im</strong> Plural) verwechselt werden darf. Auf soziale Zeiten und Rhythmen<br />
wie etwa die Jahreszeiten, das Wochenende (inklusive Sonntag) oder den<br />
Wechsel von Arbeit und Ruhe, Helligkeit und Dunkelheit nehmen die beliebig<br />
zu managenden Medien (bzw. ihre Nutzer) keine Rücksicht. Innerhalb der Zeit<br />
werden zunehmend die Zeiten aufgehoben.<br />
Hat noch in der Vormoderne Jahrtausende lang die untergehende Sonne die<br />
Menschheit völlig problemlos ins Bett gehen lassen, so brauchen sie heute – um<br />
ein gutes Gewissen zu haben – für jegliche Tätigkeit ein ganz spezielles Motiv.<br />
Die postmoderne Angst lautet daher: „Auch wenn ich alles richtig gemacht<br />
habe, könnte ich dennoch das Wichtigste versäumt haben.“<br />
Diesem hochindividualistischen Freiheitsbegriff korrespondiert die Paradiesvorstellung,<br />
alles zu jeder Zeit, sofort und überall erhalten, genießen und auch wieder<br />
verlassen zu können. „Instant“ ist die englischsprachige Zauberformel dafür.<br />
Das Prinzip des Instant-Kaffees hat bereits Karriere gemacht. Das Mobiltelefon<br />
ebenso – es lässt uns heute zu allen Zeiten, an allen Orten Instant-Kontakte<br />
herstellen. Das Gleiche machen Unternehmen, wenn sie auf hochflexible Abrufkräfte<br />
(und deren Arbeitszeit) zurückgreifen – der Mensch, eine wandelnde<br />
Zeitreserve, die übers Lebensarbeitszeitkonto abgeschrieben wird.<br />
„Zeit in Dosen“ und demnächst wohl auch in Wasser auflöslicher Tablettenform<br />
– das Paradies ist nahe. Es ist zu fürchten, denn es wird wohl eine paradiesische<br />
Hölle: hohe Flexibilität, hohe Abhängigkeit.
Zeitmanagement – ein Irrweg? 171<br />
Freiheitsversprechen, die auf eine solche Flexibilitätsmoral aufbauen, können<br />
aber gar nicht eingelöst werden. Dies zeigt der überall erfahrbare Sachverhalt,<br />
dass jeder Zuwachs an Flexibilität gleichzeitig die Abhängigkeit von eben diesen<br />
flexiblen Verhältnissen erhöht. Kürzlich hat IBM in einer groß angelegten Werbekampagne<br />
für den von ihnen bereitgestellten Server diese Wahrheit millionenfach<br />
lesbar offen gelegt: „Server sind so wichtig, dass Menschen 24 Stunden<br />
am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage <strong>im</strong> Jahr von ihnen abhängig sind. Und<br />
dabei so unaufdringlich, dass sie den Menschen erst dann auffallen, wenn sie<br />
nicht da sind.“ Die Botschaft lautet: Man wähnt sich frei, ist es aber nicht. Man<br />
glaubt die Zeit managen zu können, dabei sind wir es, die durch sie getrieben<br />
werden. Und dabei mutieren wir zu S<strong>im</strong>ultanten. Weil wir nicht mehr unterscheiden<br />
können, was wichtig und was unwichtig ist, machen wir alles s<strong>im</strong>ultan!<br />
Wenn sich die Zeit schon nicht mehr beschleunigen lässt, so muss sie verdichtet<br />
werden. Verdichtung der Zeit durch Vergleichzeitigung.<br />
Dies alles prägt unseren <strong>Alltag</strong> inzwischen mit einer Selbstverständlichkeit, dass<br />
es kaum mehr auffällt. Gleichzeitig ist man heutzutage an- und abwesend, gleichzeitig<br />
ist man irgendwie via Handy in Gesellschaft und doch ganz allein. Wir<br />
sind zu hochmobilen Autisten der Gleichzeitigkeit geworden. Und unser Schicksal<br />
lautet: Wir sind <strong>im</strong>mer auf dem Sprung, sind aber nie auf dem Laufenden.<br />
Wir fangen nirgendwo mehr an, wir hören nicht mehr auf, wir tun <strong>im</strong>mer vieles<br />
zur gleichen Zeit – möglichst rasch. Wir sind Nomaden zwischen unterschiedlichen<br />
Zeitanforderungen und verschiedenen Zeitmustern, die wir bald<br />
stündlich neu koordinieren müssen.<br />
Ist Zeitmanagement nun die Lösung für diese Probleme? Wohl kaum, weil gerade<br />
das Zeitmanagement genau von der Angst getrieben ist, der man zu entfliehen<br />
sucht. Die Illusion lautet, dass die individuelle Organisation des Lebens Erlösung<br />
und Freiheit schafft. Weil man jeden Tag vor Augen geführt bekommt,<br />
dass man defizitär ist, muss man <strong>im</strong>mer noch besser werden und scheitert doch<br />
<strong>im</strong>mer wieder aufs Neue. Kafka sagt: „Das Leben lässt sich nicht so einrichten,<br />
wie der Turner den Handstand.“ Spätestens wenn wir das Leben also leben<br />
wollen, werden wir feststellen, dass es sich all den schönen Organisationsprinzipien<br />
einfach entzieht.<br />
Die produktive Dialektik des gesunden Lebens ist eine Dialektik von Vereinzelung<br />
und Vergemeinschaftung und eben nicht nur Individualisierung. Gemeinschaft,<br />
Gesellschaft, Familien benötigen nämlich genauso wie Individuen auch<br />
Ruhezeiten. Sie leben, wenn sie denn leben, ebenso rhythmisch wie die Natur.<br />
Mit total flexiblen Menschen – so bereits ein Hinweis des Vaters der Soziologie,<br />
Emile Durkhe<strong>im</strong> – lässt sich keine Gesellschaft erhalten. Also muss der totalen<br />
Flexibilisierung eine soziale Begrenzung entgegnet werden, beispielsweise über<br />
kollektive, d.h. gemeinschaftliche Zeitmuster. Nur unter der Bedingung, dass<br />
es Zeitmuster gibt, die mittel- und langfristig Regeln folgen und damit voraussagbare<br />
Orientierungen bereitstellen, ist gesellschaftliches und soziales Leben<br />
möglich.
172<br />
Olaf Geramanis<br />
Zeit haben heißt, nicht für alles Zeit zu haben. Flexibilität bedeutet auch, nicht<br />
<strong>im</strong>mer flexibel sein zu müssen, ansonsten ist sie nur die Einfalt der Vielfalt. Nichts<br />
ist so unflexibel wie jemand, der nur flexibel ist. Wer wirklich flexibel sein will,<br />
muss es sich auch leisten können, auf Flexibilität zu verzichten.<br />
6. Soziales Zeitmanagement<br />
Vielleicht gibt es aber so etwas wie „soziales Zeitmanagement“. Hierzu gehört,<br />
dass die Ruhe und das Pausieren wieder als ein wichtiges soziales und gemeinschaftliches<br />
Erfahrungsfeld in ihrer Produktivität erkannt wird. Soziales Leben<br />
(familiäres und gemeinschaftliches Leben) benötigt verlässliche, den Tag überdauernde<br />
Zeitkoordinationssysteme, es benötigt Standardisierungen, die dem<br />
aktuellen Regelungsdruck entzogen sind. Nur durch die Regelmäßigkeit von<br />
erwartbaren Wiederholungsaktivitäten bildet sich Soziales. Die Familien sind auf<br />
Kontinuitätsriten angewiesen. Diese erst geben dem kollektiven Leben den bestandsnotwendigen<br />
Rhythmus. Sie entlasten von der psychischen, der sozialen<br />
Aufdringlichkeit, Zeit <strong>im</strong>mer wieder neu zum Thema zu machen, Zeit permanent<br />
managen, koordinieren und kontrollieren zu müssen. Nur mit Hilfe dieser „relativen<br />
Zeitlosigkeit“ werden wir von der Zeit entlastet sein.<br />
Dies gilt auch für so existenzielle Dinge wie Vertrauen und Solidarität als Fundament<br />
sozialen Handelns. Vertrauen und Solidarität sind nur über verlässliche,<br />
d.h. dauerhafte Zeitstrukturen entwickel- und erhaltbar. Fehlen diese, dann werden<br />
wir noch häufiger alleine sein, alleine in Raum und Zeit. Trotz allzeit geöffneter<br />
Kaufhäuser, trotz Internetanschluss und trotz einer zunehmend wachsenden<br />
televisionären Kanalvielfalt (die <strong>im</strong>mer weniger eine Programmvielfalt ist).<br />
Die Beschleunigung des sozialen Tempos erhöht das Risiko, auf der Strecke zu<br />
bleiben. Verlässliche Zeitstrukturen wie z.B. der Erhalt des Sonntags erinnern uns<br />
daran, dass wir nicht nur Zeit haben, über die wir verfügen können, sondern<br />
auch selbst zeitlich sind.<br />
Meine Anfangsthese lautete, dass möglicherweise alles Reden über Zeit, alles<br />
Handeln mit der Zeit, alles Ordnen der Zeit, letztlich nur ein einziges Ziel hat,<br />
nämlich versöhnt mit der Zeit leben zu können, d.h. nicht mehr über sie sprechen<br />
und sie nicht mehr organisieren zu müssen. Demgegenüber verschlingt<br />
paradoxerweise Zeitmanagement sehr viel Zeit.<br />
Daher zum Schluss die Frage: Wie viel Zeit verbringen Sie eigentlich mit der<br />
Organisation Ihrer Zeit? Und vielleicht entdecken Sie darüber, dass Sie desto<br />
mehr Zeit haben, je weniger Sie über Zeit nachdenken.
Zeitmanagement – ein Irrweg? 173<br />
Weiterführende Literatur<br />
Geramanis, Olaf: Vertrauen – Die Entdeckung einer sozialen Ressource. Stuttgart: Hirzel,<br />
2002.<br />
Geramanis, Olaf: Vertrauensvolle Kontrollkulturen moderner Organisationen – ein<br />
Widerspruch?, in: Geißler/Orthey (Hrsg.), Handbuch für Personalentwicklung,<br />
69. Ergänzungslieferung, September 2001, Beitrag 4.16, S.1–18.<br />
Geramanis, Olaf: Soziale und Unsoziale Kompetenz, in: Organisationsentwicklung, 21.Jg.,<br />
Nr.1, 2002, S.30–39.<br />
Geramanis, Olaf: Vertrauensarbeitszeit – die verpasste Chance?, in: WSI Mitteilungen, 55.Jg.,<br />
Nr.6, Juni 2002, S.347–352.<br />
Götz, Klaus/Geramanis, Olaf: Vertrauen und Eigenverantwortung – inwiefern lässt sich die<br />
„Ressource Mensch“ tatsächlich planbar managen?, in: S. Koch,/J. Kaschube/R. Fisch<br />
(Hrsg.), Eigenverantwortung für Organisationen, Göttingen 2003, S.231–243.
Autorenverzeichnis<br />
Abt, Hans Günther<br />
Dipl.-Soziologe, Berater für <strong>Gesundheit</strong>smanagement, Messel<br />
Anderer, Wolfgang, Dr.<br />
Chefarzt der Klinik für geriatrische Rehabilitation, Bezirksklinikum Ansbach<br />
Bergmann, Karl. E., Prof. Dr. und Bergmann, Renate L., Prof. Dr.<br />
Robert Koch-Institut und Charité-Virchowklinikum der Humboldt-Universität,<br />
Berlin<br />
Böhme, Gernot, Prof. Dr. (em.)<br />
Institut für Philosophie der Technischen Universität Darmstadt<br />
Geramanis, Olaf, Dr.<br />
Institut für Pädagogische Praxis und Erziehungswissenschaft der Universität<br />
der Bundeswehr, Neubiberg<br />
Gieseke, Otto<br />
Dipl.-Volkswirt, Leiter des Bereichs <strong>Gesundheit</strong>sförderung der AOK Bayern<br />
Höfling, Siegfried, Prof. Dr.<br />
Referent für Technologie und Zukunftsfragen der Akademie für Politik und<br />
Zeitgeschehen der <strong>Hanns</strong>-<strong>Seidel</strong>-<strong>Stiftung</strong> e.V., München<br />
Jacobs, Klaus, Dr.<br />
Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, Bonn<br />
Lauterbach, Karl W., Prof. Dr.<br />
Institut für <strong>Gesundheit</strong>sökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität<br />
Köln<br />
Pudel, Volker, Prof. Dr.<br />
Ernährungspsychologische Forschungsstelle der Georg-August-Universität<br />
Göttingen<br />
Schwarz, Walter<br />
stv. Vorstandsvorsitzender der AOK Bayern, München<br />
Sinner, Eberhard, MdL<br />
Staatsminister für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen in der<br />
Bayerischen Staatskanzlei, vormals Bayerischer Staatsminister für <strong>Gesundheit</strong><br />
und Verbraucherschutz, München<br />
Stock, Stephanie, Dr. med<br />
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für <strong>Gesundheit</strong>sökonomie und<br />
Klinische Epidemiologie der Universität Köln<br />
Wagner-Link, Angelika<br />
Dipl.-Psychologin, Institut für Mensch und Management, München
„Vor allem <strong>Gesundheit</strong>“ wünscht man sich gegenseitig an wichtigen<br />
Feiertagen. Aber wie groß ist das persönliche Engagement,<br />
sich das ganze Jahr über gesundheitsbewusst zu verhalten? Die<br />
<strong>Gesundheit</strong>sexperten klagen darüber, dass sich ein Großteil der<br />
Bürger nur versorgen lassen möchte, dass er Reparatur statt<br />
Eigenvorsorge bevorzuge. Jetzt haben <strong>Gesundheit</strong>spolitiker der<br />
Öffentlichkeit die Krankheitskosten präsentiert und nun wird an<br />
allen Ecken gekürzt oder sogar gestrichen, umstrukturiert, die<br />
Kosten neu verteilt. Die Hauptlast der <strong>Gesundheit</strong>sreform tragen<br />
die Versicherten. Am „Organ“ Geldbeutel glaubt man, wäre der<br />
Einzelne zu packen. Ein Mehr an persönlicher <strong>Gesundheit</strong>sverantwortung<br />
soll gleichsam monetär erlitten werden. Es könnte<br />
aber auch anders gehen: Stärkung der Präventionsmaßnahmen,<br />
Ausbau der <strong>Gesundheit</strong>sförderung und Ermutigung zur gesundheitlichen<br />
Eigenverantwortung in einem ganzheitlichen Sinne.<br />
Dieser Band versucht zu zeigen, dass gesundheitspolitische<br />
Investitionen in Präventionsmaßnahmen mittelfristig Kosten in<br />
beträchtlicher Höhe reduzieren werden. Sinn und Unsinn der<br />
Bonus-Malus-Regelungen werden diskutiert und neuere Settingansätze<br />
der Prävention vorgestellt. Besonderes Augenmerk richtet<br />
die Publikation aber auf die Förderung von <strong>Gesundheit</strong> hin zu<br />
einem ganzheitlichen Lebensstil. Wie kann der Mensch in der<br />
Wissensgesellschaft lernen, eine völlig andere Einstellung zu<br />
sich, zur Umwelt, zum Gebrauch der Zeit zu entwickeln? Körper<br />
und Seele sollten nicht weiter verzwecklicht bzw. manipuliert<br />
werden, indem man sie mit pädagogischen, medizinischen und<br />
psychologischen Programmen trainiert, nur damit der Mensch<br />
störungsfrei den Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit entsprechen<br />
kann. Stattdessen sollte er wieder lernen, sich als Leib<br />
wahr zu nehmen und für sich zu sorgen.