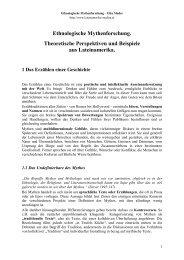Bernhard Leupolt - Lateinamerika-Studien Online
Bernhard Leupolt - Lateinamerika-Studien Online
Bernhard Leupolt - Lateinamerika-Studien Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Drei Jahrzehnte Neoliberalismus in <strong>Lateinamerika</strong>:<br />
Bilanz und Perspektiven.<br />
Ein Seminar des Interdisziplinären Lehrgangs für Höhere<br />
<strong>Lateinamerika</strong>studien am Österreichischen <strong>Lateinamerika</strong>-Institut.<br />
„Wettbewerbsdispositiv oder demokratische<br />
Öffentlichkeit?<br />
Zur Rolle der sozialen Bewegungen in Brasilien“<br />
<strong>Bernhard</strong> <strong>Leupolt</strong><br />
WS 2003/2004
Wettbewerbsdispositiv oder demokratische Öffentlichkeit?<br />
Zur Rolle der sozialen Bewegungen in Brasilien<br />
Kampf aller gegen alle? … Relevanz der Begriffe Taktik und Strategie für die<br />
Analyse der Strukturen und des politischen Prozesses; Wesen und Transformation<br />
der Kräfteverhältnisse. All diese Fragen müßten untersucht werden.<br />
FOUCAULT 1978: 41<br />
Abstract:<br />
Im vorliegenden Beitrag werden die sozialen Bewegungen Brasiliens als wichtige Auslöser<br />
von gesellschaftlichen Veränderungen verstanden. Im ersten theoretischen Teil<br />
werden einleitend die Handlungsspielräume für gesellschaftsveränderndes Handeln<br />
kritisch analysiert. Dabei wird besonders auf die Beschränkungen durch die fortschreitende<br />
Ökonomisierung aller menschlichen Handlungen hingewiesen. Als Ausweg wird<br />
die Demokratisierung im Rahmen des Projekts eines radikalen Reformismus vorgeschlagen.<br />
Im zweiten Teil wird der umfassende Demokratisierungsprozess in der Stadt<br />
Porto Alegre vorgestellt. Hier wurde ein neuartiges Projekt der Zusammenarbeit von<br />
sozialen Bewegungen und Lokalregierung ins Leben gerufen – das Partizipative Budget.<br />
Nach zehnjähriger Bewährungszeit auf Gemeindeebene wurde dieses Konzept auf<br />
eine höhere territoriale Ebene – die des Bundesstaats Rio Grande do Sul übertragen.<br />
Aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen des ersten Abschnitts soll anhand dieser<br />
Fallbeispiele kritisch betrachtet werden, inwieweit das Konzept des radikalen Reformismus<br />
in der Praxis umsetzbar ist. Außerdem soll versucht werden, Lehren für die<br />
Vorgangsweise sozialer Bewegungen zu ziehen.<br />
1. Handlungsspielräume sozialer Bewegungen<br />
Im Lauf der Geschichte zeigte sich, dass diese keineswegs vorbestimmt, sondern vielmehr<br />
gestaltbar ist. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind jedoch nicht beliebig, sondern<br />
müssen innerhalb von Strukturen erfolgen. Diese stellen einerseits den „sozialen Beton,<br />
der den Fluss der Zeit determiniert“ (Novy 2002: 57) dar, sind jedoch andererseits keine<br />
„naturgegebenen Tatsachen“, denn auch sie wurden und werden durch menschliches<br />
Handeln produziert. Daher ist sowohl die Analyse der bestehenden Strukturen wie auch<br />
das Verständnis deren Entstehung und Beeinflussung fundamental, um die Handlungsspielräume<br />
der gesellschaftlichen Akteure auszuloten (Novy 2002: 56 f.). Mit Hilfe der<br />
Staatstheorie nach Gramsci und eines Griffs in die „Werkzeugkiste“ Foucaults sollen<br />
anschießend Analyseinstrumente für eine Strukturanalyse eingeführt werden.<br />
1.1. Kampf um Hegemonie und Dispositive<br />
Nach Gramsci können zwei Formen von Herrschaft unterschieden werden: „Konsens“<br />
und „Zwang“ (Gramsci 1971: 12). Neben der Ordnung, die der Staat durch Zwang<br />
durchsetzt, wie z.B. dem Erlass von Gesetzen, ist daher die Herrschaft über Konsens<br />
mindestens ebenso wichtig. Daher kommt den Einflüssen von nicht-staatlichen Akteuren<br />
der Zivilgesellschaft 1 eine große Bedeutung zu. Diese können wie vielfach die Kirche<br />
und die Medien als legitimierende Akteure, aber auch – durch das Fehlen eines<br />
1 Aufgrund der Vielfalt der Inhalte des Begriffs „Zivilgesellschaft“ (vgl. Boris 1998: 18 ff.) scheint es notwendig<br />
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass hier auf den von Gramsci geprägten Begriff von Zivilgesellschaft<br />
als umkämpftes Terrain jenseits des Staats zurückgegriffen wird. Alle nicht-staatlichen Akteure<br />
werden somit erfasst (Gramsci 1971: 12); der Begriff wird daher nicht synonym mit sozialen Bewegungen<br />
verwendet.
direkten Zwangs – zu Zentren der Opposition (z. B. Gewerkschaften) oder als Basisinitiativen<br />
Kern einer gesellschaftsverändernden sozialen Bewegung werden. Gemeinsam<br />
mit dem Kern des Staates bildet die Zivilgesellschaft nun den „erweiterten Staat“, dem<br />
die Funktion zukommt, für Hegemonie zu sorgen. Staat ist somit auch ein Feld der sozialen<br />
Auseinandersetzung, ein spezifisches, strukturell bestimmtes und konkret jeweils<br />
durch soziale Kämpfe innerhalb der Zivilgesellschaft ausgestaltetes Kräftegleichgewicht<br />
(Novy 2001: 41 ff.). Diese Kämpfe um die Hegemonie werden zwischen wirtschaftlichen,<br />
politischen und intellektuellen Kräften ausgetragen. Die wichtigsten Akteure sind<br />
dabei „organisierte Interessen, politische Parteien und soziale Bewegungen, wobei zusätzlich<br />
den Massenmedien – und weniger dem Bereich der Öffentlichkeit an sich – die<br />
entscheidende Aufgabe zukommt“ (Jessop 2003: 98) 2 .<br />
Um den Kampf um gesellschaftliche Hegemonie genauer untersuchen zu können,<br />
scheint das Foucault’sche Dispositiv hilfreich zu sein. Damit beschreibt er „ein entschieden<br />
heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekurale Einrichtungen,<br />
reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche<br />
Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes<br />
ebensowohl wie Ungesagtes umfasst“ (Foucault 1978: 120). Somit wirkt ein<br />
Dispositiv „mehr in die Breite als in die Tiefe und lenkt Diskurse mehr als dass es ihren<br />
Inhalt festlegt“ (Novy 2003: 288). Diskurse sind demnach als Machtstrategien zu verstehen.<br />
Das Dispositiv gibt dabei einen die Diskurse asymmetrisch strukturierenden<br />
Rahmen vor, da es sich „um eine bestimmte Manipulation von Kräfteverhältnissen handelt“<br />
(Foucault 1978: 122 f.).Das kann insbesondere auch dadurch gelingen, da innerhalb<br />
des Dispositivs auch Raum für Widerspruch bleibt (Novy 2002: 86), denn „[w]o es<br />
Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch oder vielmehr gerade deswegen liegt der Widerstand<br />
niemals außerhalb der Macht“ (Foucault 1983: 116).<br />
1.2. Neoliberale Transformation und Wettbewerbsdispositiv<br />
Während der letzten Jahrzehnte wurden zusehends die Märkte geöffnet, der freie Kapitalverkehr<br />
eingeführt und Staatsunternehmen verkauft. „Die Ideologie, die dieses neue<br />
Regime rechtfertigt, ist der Neoliberalismus. Seine weltweiten Folgen sind Finanzkrisen,<br />
verstärkte Polarisierung von Einkommen und Vermögen, zunehmende Armut sowie eine<br />
Unterbrechung, oft auch ein Rückgang der Industrialisierung in den Entwicklungsländern,<br />
Nicht-Nutzung wirtschaftlicher Ressourcen … bei sinkendem Lebensstandart“<br />
(Schui 2003: 23).<br />
Diskursiv werden diese negativen Effekte als „Sachzwänge der Globalisierung“ legitimiert.<br />
Diese wird dabei als ein völlig neuartiges Phänomen vermittelt, das keine anderen<br />
Alternativen zuließe (Novy 2000). Laut Hirsch ist Globalisierung jedoch „eher eine<br />
neoliberale Propagandaformel denn gesellschaftliche Realität. Die mit ‚Globalisierung’<br />
bezeichnete Entwicklung hat zweifellos im internationalisierten Kapital einen wesentlichen<br />
Akteur, wurde aber sehr wesentlich durch die Politik von Staaten und Regierungen<br />
vorangetrieben“ (Hirsch 2002: 125). Nationalstaaten lösen sich nicht auf, sondern werden<br />
zu nationalen Wettbewerbsstaaten transformiert (Hirsch 2002: 110 ff.). Im Zuge des<br />
neoliberalen Transformationsprozesses kommt es schließlich zu einer Ökonomisierung<br />
von Zivilgesellschaft und Staat (Hirsch 2002: 186, Lemke 1997, Bröckling u.a. 2000).<br />
Novy und Jäger konstatieren daher die Entstehung eines Wettbewerbsdispositivs.<br />
Demnach wird Wettbewerb „zu einem Dispositiv, weil es keineswegs nur auf das Ökonomische<br />
beschränkt ist, sondern expansiv ist und auf beliebig viele Bereiche ausge-<br />
2<br />
Habermas (1990: 28) bezeichnet das Ergebnis der manipulativ eingesetzten Macht der Medien als<br />
„vermachtete Öffentlichkeit“.
dehnt wird: Die Ökonomisierung des Sozialen und der Politik schaffen eine Wettbewerbsgesellschaft<br />
und einen Wettbewerbsstaat“ (Novy/Jäger 2003: 101).<br />
„Die Ökonomie ist nicht mehr ein gesellschaftlicher Bereich unter anderen mit einer<br />
ihm eigenen Rationalität, Gesetzen und Instrumenten; vielmehr umfasst das<br />
Gebiet des Ökonomischen die Gesamtheit menschlichen Handelns“ (Lemke<br />
1997: 248).<br />
In der Eigenschaft des Dispositivs, auch Widerstand mit einzuschließen, liegt somit eine<br />
reale Gefahr für soziale Bewegungen – besonders bezüglich der Einbindung der Zivilgesellschaft<br />
in politische Entscheidungsprozesse, v. a. auf regionaler Ebene. So weist<br />
Mayer darauf hin, dass die neue Form der lokalen Staatlichkeit oftmals „die Betonung<br />
des unternehmerischen Aktivismus, die Privilegierung des lokalen Raums, workfare<br />
statt welfare und die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure“ (Mayer 2003: 270)<br />
darstellt. Letztere stehen in einem ambivalenten Verhältnis, da sie einerseits die Marktkräfte<br />
mit Hilfe ihrer Ressourcen nicht-marktförmiger Koordination wie Solidarität und<br />
Ermächtigung politisch einhegen sollen; andererseits kann es jedoch nur über sie gelingen,<br />
Markt und Konkurrenzrationalität in zivilgesellschaftliche Bereiche einzuführen, die<br />
ansonsten schwer vom globalen Kapital zu durchdringen wären. Somit können „Marktkriterien<br />
dort Einzug halten, wo bislang wohlfahrtsstaatliche Kriterien und soziale Rechte<br />
galten“ (Mayer 2003: 273). Hirsch warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor<br />
der „Entwicklung einer historisch neuen Form von Totalitarismus, die nicht mehr nur von<br />
den Staatsapparaten ausgeht, sondern in den Strukturen der „Zivilgesellschaft“ wurzelt“<br />
(Hirsch 2002: 178).<br />
1.3. Demokratiedispositiv und Radikaler Reformismus<br />
Das Wettbewerbsdispositiv führt dazu, dass „Form und Inhalt emanzipativer Bewegungen<br />
neu gedacht werden müssen, ebenso wie es notwendig ist, über das liberale Verständnis<br />
hinaus weisende Demokratiekonzepte zu entwickeln“ (Hirsch 2002: 191). Das<br />
weist auf die Notwendigkeit der Konstruktion eines Demokratiedispositivs hin. Um dies<br />
zu verwirklichen ist es nötig, die Strukturen des Wettbewerbsdispositivs zu transformieren.<br />
Dies gestaltet sich jedoch schwierig, da gerade innerhalb dieser Strukturen gehandelt<br />
werden muss. Emanzipatives Handeln bedeutet daher in Anlehnung an Foucault<br />
„das Spiel zu spielen und es gleichzeitig nicht zu akzeptieren – und es nicht zu akzeptieren,<br />
indem man es anders spielt“ (Lemke 1997: 369). Es geht also um „eine Suche<br />
nach neuen und anderen „Spielregeln“, die letztlich das Spiel selbst verändern“ (ebenda).<br />
Um das zu ermöglichen, schlagen Esser u. a. (1994) das Konzept des radikalen Reformismus<br />
vor. Reformismus bezeichnet dabei die Auflösung der institutionalisierten<br />
Machtbeziehungen, jedoch nicht schlagartig, sondern durch schwierige und langwierige<br />
Praxis-, Erfahrungs-, Lern- und Selbstaufklärungsprozesse. Radikal meint, dass emanzipative<br />
Politik von Anfang an auf die Überwindung der herrschenden gesellschaftlichen<br />
Formen und ihrer institutionellen Ausprägungen abzielen muss (Esser u. a. 1994).<br />
Hirsch nahm den Gedanken später wieder auf, und forderte weiters „die Entwicklung<br />
einer von Staat und kommerziellen Medien unabhängigen Öffentlichkeit, die unabhängige<br />
Diskussion und Verständigung ermöglicht und damit die Voraussetzung schafft, in<br />
die herrschenden Diskurse einzugreifen“ (Hirsch 2002: 202). Gegen die herrschenden<br />
Ökonomisierungstendenzen muss eine demokratische Zivilgesellschaft entwickelt werden.<br />
Somit will der radikale Reformismus „eine Kulturrevolution, die nicht nur Bewusstseinsinhalte,<br />
sondern vor allem gesellschaftliche und politische Beziehungen und Praktiken<br />
umgreift“ (ebenda).
„Die emanzipative Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse ist eine Angelegenheit<br />
der Menschen selbst, eine Frage konkreter Praxis, die im unmittelbaren<br />
Lebenszusammenhang ansetzen muss“ (Hirsch 2002: 201).<br />
Zusammengefasst handelt es sich „um eine Perspektive des Kampfes innerhalb und<br />
gegen den Kapitalismus, innerhalb und gegen den Staat“ (Hirsch 2002: 190). Novy<br />
(2003) erweiterte das Konzept: Radikaler Reformismus wird demnach nicht ohne<br />
Staatsreform in Richtung eines öffentlichen Staats möglich sein. Nach Habermas ist die<br />
„Herrschaft“ der Öffentlichkeit „ihrer eigenen Idee zufolge eine Ordnung, in der sich<br />
Herrschaft überhaupt auflöst“ (1990: 153). Demnach kann im öffentlichen Staat politisches<br />
Handeln im und gegen den Staat gleichzeitig erfolgen.<br />
2. Soziale Bewegungen und Gesellschaftsveränderung in Brasilien<br />
In Brasilien formierten sich im Demokratisierungsprozess – nach lang andauernder Militärdiktatur<br />
(1964-1985) – zahlreiche soziale Bewegungen. Sie kämpften einerseits für<br />
demokratische Rechte und andererseits für ein Mehr an ökonomischer Mitbeteiligung 3 .<br />
Obwohl der Höhepunkt der Mobilisierung mit der Konsolidierung der (bürgerlichen) Demokratie<br />
sicherlich überschritten wurde, konnte die soziale Bewegung im lateinamerikanischen<br />
Vergleich ihre Stärke relativ gut beibehalten. Der Grund für diese relative<br />
Stärke liegt unter anderem auch in der Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores – PT)<br />
(Boris 1998: 33 f.).<br />
Diese Partei wurde 1980 als eine Art „Plattform“ im Kampf für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen,<br />
höhere Löhne und Gehälter, und besserer öffentlicher Einrichtungen<br />
für Bildung, Wohnen, Verkehrsmittel und Gesundheitseinrichtungen und die Wiedergewinnung<br />
des demokratischen Rechtsstaats gegründet. Somit konnten sich radikale GewerkschafterInnen,<br />
AktivistInnen sozialer Bewegungen und kirchlicher Basisgemeinden<br />
sowie linke Intellektuelle und PolitikerInnen in einer Partei zusammenschließen (PT<br />
2003: 7). Charakteristisch für diese Partei war lange Zeit, dass sie sich einerseits aus<br />
AktivistInnen sozialer Bewegungen zusammensetzte und andererseits deren Autonomie<br />
weitgehend respektierte 4 (Boris 1998: 33 f.).<br />
Seit den Wahlen 1988 stellt die Arbeiterpartei BürgermeisterInnen in den größten brasilianischen<br />
Städten und später auch GouverneurInnen in Bundesstaaten. Somit konnte<br />
die PT (als eine der wenigen Linksparteien <strong>Lateinamerika</strong>s) schon einige Regierungserfahrung<br />
sammeln. Das spektakulärste Ereignis in der Geschichte der Partei war sicherlich<br />
2002 die Wahl ihres Kandidaten – Luis Inácio Lula da Silva – zum Präsidenten des<br />
Landes (PT 2003). Dadurch entstanden neue Hoffnungen zur Umsetzung von Forderungen<br />
der sozialen Bewegungen. Nach einem Jahr Amtszeit ist es jedoch schwierig,<br />
schon eine Bewertung dieser Regierung vorzunehmen (ausführlicher dazu Boris 2003:<br />
28 ff.).<br />
Die Regierung kann jedoch auf einige gute Erfahrungen auf lokaler Ebene verweisen<br />
(ausführlicher dazu Magalhães u.a. 2002). Die Stadt Porto Alegre wird seit 1989 durchgehend<br />
von der PT regiert. Hier konnte sich eine nahezu einzigartige Beziehung der<br />
Lokalregierung zu den sozialen Bewegungen entwickeln. Zwischen 1999 und 2002<br />
3<br />
Im Unterschied zu den sozialen Bewegungen in den Zentrumsökonomien, die vorrangig aus der jüngeren<br />
Generation der Mittelschicht bestehen, sind es in <strong>Lateinamerika</strong> vor allem die Unterschichten – junge<br />
und alte Menschen – die die Stärke der Bewegung ausmachen (Boris 1998: 16).<br />
4<br />
Boris berichtete jedoch schon 1998 vom „Problem, die Parteidisziplin mit der Flexibilität der PT-<br />
Programmatik ständig in Einklang zu bringen“ (34). Pont (2003) konstatiert sogar, „dass die organisierte,<br />
entschiedene Arbeit der PT mit den sozialen Bewegungen nachgelassen hat, als ob der Partei dank ihrer<br />
Größe und der Wahlergebnisse ein angeborenes ‚Recht’ auf die sozialen Bewegungen zustünde“ (76).
wurde dieses Konzept in Rio Grande do Sul auf die Ebene des Bundestaates übertragen.<br />
Ausgehend von diesen Erfahrungen sollen die Chancen und Gefahren für die soziale<br />
Bewegung bei Zusammenarbeit mit dem Staat dargestellt werden.<br />
2.1. Lokalregierung und soziale Bewegungen in Porto Alegre<br />
In Porto Alegre – Hauptstadt des südlichsten brasilianischen Bundesstaats Rio Grande<br />
do Sul – entstand schon in den 70er Jahren – noch während der Militärdiktatur – durch<br />
die Konstituierung von Stadtteilinitiativen eine starke soziale Bewegung. Vorwiegend<br />
BewohnerInnen von irregulären Armenvierteln (favelas bzw. vilas) lehnten sich dagegen<br />
auf, von der Regierung übergangen zu werden. Sie forderten vor allem Investitionen in<br />
städtische Infrastruktur und Leistungen sowie die Autonomie der Stadtteilinitiativen. Sie<br />
standen in Konfrontation zur Stadtregierung und verliehen ihren Forderungen auch<br />
durch spektakuläre Aktionen – wie z.B. Straßenblokaden – Nachdruck. Die Besonderheit<br />
dieser Bewegung bestand darin, dass sie aus ihren alltäglichen Bedürfnissen Forderungen<br />
nach staatsbürgerlichen Rechten ableitete. Damit grenzten sie sich stark vom<br />
vorherrschenden Paternalismus und Klientelismus ab (Fedozzi 2000: 28 ff.). Die Gründung<br />
des „Dachverbands der Lokalinitiativen Porto Alegres“ (União das Associações de<br />
Moradores de Porto Alegre – UAMPA) leistete einen weiteren wichtigen Beitrag zur<br />
kämpferischen Ausrichtung der Bewegung, wie auch zu deren Politisierung. Aufgrund<br />
dieses Hintergrunds waren die sozialen Bewegungen während des Demokratisierungsprozesses<br />
in den 80er Jahren besonders stark ausgeprägt. In diesem Kontext entstand<br />
dann schließlich auch die Forderung innerhalb der Bewegung, das Stadtbudget zu demokratisieren<br />
(Fedozzi 2000: 42 ff.).<br />
Olivio Dutra, der Bürgermeisterkandidat der PT hatte im Zuge des Wahlkampfs 1988<br />
ebendiese Demokratisierung gefordert, wie auch eine Umkehr der Verteilungsprioritäten<br />
von öffentlichen Mitteln, hin zu den gesellschaftlich marginalisierten Gruppen. Nach seinem<br />
Wahlsieg waren die Erwartungen der Lokalinitiativen an die neu gewählte PT-<br />
Regierung daher sehr hoch gesteckt. Die versprochene Demokratisierung des Lokalstaats<br />
sollte dann mit Hilfe des Partizipativen Budgets ermöglicht werden, um die sozialen<br />
Bewegungen erstmals am Lokalstaat teilhaben zu lassen (ausführlicher dazu Becker<br />
2001, Leubolt 2003).<br />
Die PT konnte in Porto Alegre mittlerweile ein sehr hohes Maß an Hegemonie erreichen<br />
– sie stehen nun immerhin in der vierten aufeinander folgenden Legislaturperiode. Dies<br />
ist besonders durch die erfolgten materiellen Verbesserungen der Bevölkerung zu verstehen.<br />
Zwischen 1989 und 1996 verbesserte sich die Versorgung der Stadt mit grundlegender<br />
Infrastruktur sehr stark. Der Prozentsatz der Haushalte, die an das Kanalnetz<br />
angeschlossen sind, konnte von 46% auf 85% erhöht werden, der Zugang zu Fließwasser<br />
von 80% auf 98% (PMPA). Durch die vielfach praktizierte Asphaltierung von Straßen<br />
in irregulären Armenvierteln konnten diese effektiv an das öffentliche Verkehrssystem<br />
angeschlossen werden, da Busse bei stärkeren Regenfällen nicht mehr im Matsch<br />
stecken bleiben (Becker 2001: 197). Weiters war bemerkenswert, dass Armenviertel im<br />
Stadtzentrum urbanisiert wurde, anstatt an den Stadtrand verdrängt zu werden (Solidariedade<br />
2003: 87). Auch im Bildungswesen konnten beachtliche Fortschritte verzeichnet<br />
werden, zwischen 1989 und 1999 hat sich die Zahl der Kinder an öffentlichen Schulen<br />
mehr als verdoppelt. Diese Entwicklungen konnten maßgeblich dazu beitragen, dass<br />
Porto Alegre heute (mit 0,792) den höchsten Human Development Index (HDI) unter<br />
den brasilianischen Metropolen aufweist (PMPA). Da diese Errungenschaften eng mit<br />
den Entscheidungen des Partizipativen Budgets in Verbindung stehen, kann auf positive<br />
materielle Errungenschaften durch die Zusammenarbeit sozialer Bewegungen mit<br />
der Lokalregierung hingewiesen werden.
Anfänglich war die Beziehung der Lokalregierung zu den Lokalinitiativen vor allem<br />
durch einen Konflikt gekennzeichnet (Fedozzi 2000: 61 ff.). Auf der einen Seite verhinderten<br />
finanzielle Engpässe zunächst die Realisierung der geplanten Investitionen; auf<br />
der anderen Seite hatten auch die sozialen Bewegungen Probleme, sich auf die neue<br />
Art zu regieren einzustellen. Vormals teilten sie sich vorwiegend in konfliktive Bewegungen,<br />
die an die offene Konfrontation mit dem Staat gewöhnt waren und klientelistische<br />
Bewegungen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in persönlichen Verhandlungen<br />
mit Politikern, öffentliche Investitionen erreichten. Sie mussten erst damit umgehen<br />
lernen, nun aktiv an der Lokalpolitik beteiligt zu sein (Fedozzi 2001: 124ff). Doch<br />
gerade diese Teilhabe am Lokalstaat sollte sich in vieler Hinsicht als sehr günstig erweisen.<br />
Die einzelnen TeilnehmerInnen lernten im öffentlichen Diskurs, ihre persönlichen<br />
Bedürfnisse zu öffentlichem Interesse zu transformieren. Somit konnte eine<br />
„staatsbürgerliche Sprache“ entwickelt werden, die nicht auf abstrakten Rechten und<br />
Pflichten beruhte, sondern darauf, gemeinsame Probleme zu thematisieren und gemeinschaftlich<br />
Lösungen dafür zu finden (Baiocchi 2002: 26). Die Diskussionen im öffentlichen<br />
Raum begünstigten auch die Entstehung von Solidarität, wie die Teilnehmerin<br />
Roselaine beschreibt:<br />
„Sogar ich habe nur an meine Straße gedacht, als ich zum Partizipativen Budget<br />
gekommen bin. Aber ich habe andere Personen und Gemeinschaften getroffen,<br />
und habe viel größere Probleme kennen gelernt. Was ich als Riesenproblem gesehen<br />
habe, war nichts im Vergleich zur Situation anderer Personen. Keine<br />
Wohnung zu haben, unter einem Tuch zu schlafen oder die Frage der Abwässer<br />
unter freiem Himmel, wo Kinder spielen und laufen. Ich vergaß meine Straße,<br />
sodass sie sogar bis heute nicht asphaltiert ist.“ (In: Solidariedade 2003: 105 5 )<br />
Diese sehr positiven Tendenzen müssen jedoch etwas relativiert werden, da die autonome<br />
Organisation der Lokalinitiativen und sozialen Bewegungen nun zurückgeht, wie<br />
Miguel Rangel von der NRO Solidariedade anmerkt:<br />
„Die Zahl der Konfrontationen nahm ab. Heute sperren wir nicht mehr die Straßen,<br />
sondern diskutieren innerhalb des Partizipativen Budgets.“ (Solidariedade<br />
2003: 138)<br />
Das Partizipative Budget wurde im Lichte des großen Erfolgen zum bevorzugten Ort der<br />
Rekrutierung neuer PT-Mitglieder. Als Folge wurden immer mehr vormals regierungskritische<br />
AktivistInnen zu BeraterInnen und Mitgliedern der Regierung (Baierle 2002: 321;<br />
Solidariedade 2003: 139). Daher komme es zusehends zur Kooptierung der Lokalinitiativen<br />
durch die PT, wie die Teilnehmer Eduino de Mattus deutlich ausdrückt:<br />
„Wir haben erreicht, Familien zu helfen und viele andere wichtige Errungenschaften,<br />
aber wir wissen auch, dass wir nicht mehr als Arbeitskräfte sind. Wir dienten<br />
der Politik der PT und wir dienten ihr sehr gut. Heute müssen wir den Prozess<br />
selbst übernehmen.“ (In: Solidariedade 2003: 139)<br />
Somit wird durch die Ermöglichung der Ermächtigung durch die direkte Teilhabe am<br />
Lokalstaat gleichzeitig auch eine „Aushöhlung der autonomen Organisation der populären<br />
Sektoren“ und die Wiederentstehung „populistischer Beziehungen“ (Baierle 2002:<br />
322) riskiert. Dies kann als Widerspruch zwischen Autonomie und Teilhabe an der Regierung<br />
bezeichnet werden (ebenda). Dennoch ist daran ersichtlich, wie schwierig die<br />
Zielsetzung des radikalen Reformismus zu verwirklichen ist, gleichzeitig im und gegen<br />
den Staat vorzugehen.<br />
5 Diese und alle weiteren Übersetzungen stammen vom Verfasser selbst.
Es ist jedoch wichtig zu vermerken, dass sich, anders als in anderen Städten, in Porto<br />
Alegre die Zahl der Lokalinitiativen in den 90er Jahren vergrößern konnte. Besonders<br />
die höhere Motivation, sich zu mobilisieren trug dazu bei, da dies zur realen Verbesserung<br />
der unmittelbaren Lebenssituation führen kann (Avritzer 2002). Außergewöhnlich<br />
ist weiters, dass die TeilnehmerInnen mehrheitlich aus ärmeren Schichten kommen.<br />
Außerdem sind sowohl Frauen, wie auch ethnische Minderheiten überdurchschnittlich<br />
stark vertreten 6 (Baierle 2002: 306). Baierle (2002: 305) konstatiert demnach die Entstehung<br />
einer „plebejischen Öffentlichkeit“. Durch die Diskussionen in den demokratischen<br />
Entscheidungsgremien, ausgehend von den unmittelbaren materiellen Bedürfnissen<br />
der Teilhabenden, kann eine wichtige Transformation stattfinden – das „Ich“ wird zu<br />
einem „Wir“ (Baiocchi 2002). Daher kann der Diskurs in der Öffentlichkeit dazu beitragen,<br />
die dem Wettbewerbsdispositiv inhärenten Individualisierungstendenzen zu überwinden.<br />
Somit kann von einem wichtigen Schritt in Richtung des Demokratiedispositivs<br />
gesprochen werden.<br />
2.2. Transformation des öffentlichen Lokalstaats auf höhere Ebenen<br />
Olívio Dutra war von 1998 bis 2002 (PT-)Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande<br />
do Sul. In diesem Zeitraum wurde das Konzept des Partizipativen Budgets von der lokalen<br />
auf die regionale Ebene übertragen. Dieser Schritt war deshalb spektakulär, da nun<br />
erstmals in einem relativ großen Raum (über 10 Mio. EinwohnerInnen) praktische Erfahrungen<br />
zur radikalen Demokratisierung gesammelt werden konnten (ausführlicher<br />
dazu Leubolt 2003b). Auf dieser Ebene bot sich die Möglichkeit, die Teilhabe der BürgerInnen<br />
auch unmittelbar auf die politische Beeinflussung der Produktionsstrukturen zu<br />
beziehen (Becker 2001: 197).<br />
So wurden in wirtschaftlicher Hinsicht neue Akzente gesetzt. Die wirtschaftliche Entwicklung<br />
wurde der sozialen Entwicklung untergeordnet (Soares 2002: 20) und somit<br />
dem Wettbewerbsdispositiv eine Absage erteilt. Das wurde besonders an der neuen<br />
Position zum „Standortwettbewerb“ deutlich. Transnationale Konzerne erhielten – anders<br />
als in den meisten übrigen Bundesstaaten – nicht mehr große Teile des Budgets in<br />
Form von Subventionen. Diesbezüglich am spektakulärsten waren sicherlich die Neuverhandlungen<br />
mit Ford und GM, die für ihre Ansiedelung im Bundesstaat staatliche<br />
Investitionen im Wert von vier Mrd. US$ erhalten sollten. GM akzeptierte weitaus geringere<br />
Subventionen, während Ford sich anderswo ansiedelte. Öffentlich gefördert wurden<br />
stattdessen die lokalen Klein- und Mittelbetriebe, einschließlich von Formen der<br />
solidarischen Wirtschaft wie z.B. Kooperativen. Die wirtschaftlichen Entwicklung litt jedoch<br />
nicht darunter – das BIP pro Kopf wuchs beträchtlich stärker als in Brasilien insgesamt<br />
(Leubolt 2003: 81 f.).<br />
Dennoch verlor Tarso Genro, der Kandidat der PT bei den Gouverneurswahlen 2002<br />
gegenüber einem Kandidaten, der vor allem die Abwanderung von Ford kritisierte (Carta<br />
Maior, 13.8.02). Seit Anfang 2003 wird in Rio Grande do Sul daher wieder Standortwettbewerb<br />
betrieben (ebenda, 15.5.03). Obwohl die schon erfolgte Demokratisierung,<br />
aufgrund des Drucks der Bevölkerung nicht abgeschafft werden konnte, wurde sie doch<br />
entscheidend abgeschwächt (ebenda, 4.6.03). Aufgrund der Einbindung in den neuen<br />
wirtschaftspolitischen Kurs muss daher von einem vorläufigen Sieg des Wettbewerbsdispositivs<br />
gegenüber dem Demokratiedispositiv gesprochen werden.<br />
Auf höherer Ebene verlief die Entwicklung gegensätzlich. Mit Lula wurde 2002 erstmals<br />
der Kandidat der PT zum Präsidenten des Landes gewählt. Unter dem Vorzeichen einer<br />
6<br />
Problematisch ist die Beziehung jedoch zu den Allerärmsten und großen Teilen der Mittelschicht, die<br />
kaum teilhaben (Solidariedade 2002: 111 ff.).
Wirtschaftskrise und dem Scheitern des sozialliberalen Projekts seines Vorgängers<br />
Cardoso, konnte er die Wahl deutlich für sich entscheiden. Seit Anfang 2003 regiert er<br />
das Land mit Hilfe einer Koalitionsregierung 7 .<br />
Im Wahlprogramm der PT war noch davon die Rede, dass „die gute Erfahrung mit dem<br />
Partizipativen Budget auf Gemeindeebene nahe legt, dass es trotz der Schwierigkeit,<br />
die mit der Anwendung auf Ebene des Landes damit verbunden ist, auf diese Ebene<br />
ausgedehnt werden soll“ (PT 2002: 3). Nach Regierungsübernahme wurde jedoch<br />
schnell klar, dass es sich hierbei um ein voreiliges Versprechen gehandelt hatte. Der<br />
Dialog mit einigen sozialen Bewegungen – wie z.B. der Landlosenbewegung – intensivierte<br />
sich zwar, jedoch wurde kein gleichwertiges Instrument der Teilhabe eingeführt.<br />
Schritte zur Demokratisierung finden zwar statt, bleiben jedoch weitaus weniger radikal<br />
8 .<br />
Dafür behielten die sozialen Bewegungen hier ein größeres Ausmaß an Autonomie.<br />
Das zeigt sich vor allem am vermehrten sozialen Protest gegen Lula und die Mehrheitsfraktion<br />
der PT (Boris 2003: 25). Dies scheint nicht weiter verwunderlich, denn die „bisherige<br />
überaus korrekte und fast schon servile Erfüllung der Vorstellungen der internationalen<br />
Finanzwelt hat die brasilianische Wirtschaft nicht anzukurbeln vermocht“ (Boris<br />
2003: 27). Da „bei den schwerpunktmäßig mit wirtschaftlichen Fragen befassten Ministerien<br />
ein mehr oder minder deutliches Übergewicht neoliberaler Repräsentanten“ (Boris<br />
2003: 14) zu bestehen scheint, ist es auch fragwürdig, ob die sozialen Bewegungen<br />
bei engerer Zusammenarbeit nicht in das Wettbewerbsdispositiv kooptiert würden.<br />
3. Schlussfolgerungen<br />
Das Wettbewerbsdispositiv wurde in diesem Beitrag als Grundlage neoliberaler Herrschaft<br />
dargestellt. Das hat auch Auswirkungen auf die sozialen Bewegungen – mit Hilfe<br />
von Beteiligungsverfahren kommt es vielfach zu deren Einbindung in den nationalen<br />
Wettbewerbsstaat. Somit kann die Wettbewerbslogik in neue Bereiche menschlichen<br />
Lebens vordringen – insbesondere ins Soziale und in die Politik. Daher besteht die Gefahr<br />
der Entstehung eines „zivilgesellschaftlichen Totalitarismus“ (Hirsch). Als Alternative<br />
wurde das Demokratiedispositiv vorgestellt, das über einen radikalen Reformismus<br />
erreichbar wäre.<br />
An den Fallbeispielen von Porto Alegre und dem Bundesstaat Rio Grande do Sul wurde<br />
gezeigt, dass die sozialen Bewegungen gemeinsam mit einer linken Regierung ein solches<br />
Reformprojekt anstreben können. Durch die Verbindung von alternativer Öffentlichkeit<br />
mit Entscheidungsmacht können reale Verbesserungen der materiellen Situation<br />
der Bevölkerung erfolgen. Persönliche Bedürfnisse können dabei in öffentliches Interesse<br />
transformiert werden. Jedoch wurden auch Probleme aufgezeigt. Die starke Verbindung<br />
der sozialen Bewegungen und der PT ermöglicht den Bewegungen einerseits<br />
die aktive materielle Mitgestaltung der Gesellschaft; andererseits jedoch ist dies mit einem<br />
Verlust an Autonomie verbunden. Daher wäre es leichter, die Bewegungen in das<br />
Wettbewerbsdispositiv einzubinden – was jedoch aufgrund der politischen Ausrichtung<br />
der Regierungen nicht passierte.<br />
Die vorliegende Analyse zeigte somit, dass ein keine „Allheillösung“ für emanzipative<br />
Gesellschaftsveränderungen gibt. Die Zusammenarbeit der Bewegungen mit der Lokalregierung<br />
erwies sich in Porto Alegre als weitgehend fruchtbar für beide Seiten. Einer-<br />
7<br />
Der hier versuchte Ausblick auf die Situation in Brasilien kann nur ansatzweise stattfinden. Eine vollständigere<br />
Darstellung in deutscher Sprache findet sich bei Boris 2003.<br />
8<br />
Ausführlicher dazu Abong 2003, jedoch mit anderer Schwerpunktsetzung.
seits bekamen vormals ausgeschlossene Akteure eine Stimme in der Öffentlichkeit und<br />
profitierten davon auch materiell. Andererseits konnte eine linke Regierung damit beginnen,<br />
ein neues hegemoniales Projekt aufzubauen. Auf der höheren – bundesstaatlichen<br />
Ebene konnte dies leider nicht gelingen, obwohl es auch hier zu Verbesserungen<br />
der Lebensbedingungen kam – besonders für die vormals außer Acht gelassenen<br />
Kleinbäuerinnen und -bauern (Leubolt 2003b: 81 f.). Hier scheint es jedoch bedeutend<br />
schwieriger, eine alternative Öffentlichkeit – jenseits von Konzern- und Medienmacht –<br />
aufzubauen.<br />
Das erste Jahr der Amtszeit der Regierung Lula vermittelte ein anderes Bild der Beziehung<br />
zu den Bewegungen. Wohl auch vor dem Hintergrund einer wettbewerbsfreundlicheren<br />
Politik sind die Konflikte zahlreicher. Das scheint in dieser Situation auch die<br />
tauglichere Strategie zu sein.<br />
Aus diesen Beispielen lassen sich mehrere Lehren für die soziale Bewegung ziehen:<br />
Einerseits kann die Zusammenarbeit mit der Politik sehr fruchtbar sein, wenn somit radikal<br />
reformistisch vorgegangen werden kann. Jedoch müssen die PartnerInnen genau<br />
betrachtet werden – die Gefahr zur Mitarbeit am Wettbewerbsdispositiv ist groß. Außerdem<br />
sollte andererseits die Zielrichtung, gleichzeitig im und gegen den Staat zu arbeiten,<br />
nicht verloren gehen. Das schließt auch mit ein, dass sich die Bewegung nicht mit<br />
der Demokratisierung eines wichtigen Organs – wie des Budgets – zufrieden geben<br />
darf. Vielmehr muss, ausgehend von diesen Erfahrungen, die Eroberung weiterer öffentlicher<br />
Räume angestrebt werden.<br />
Durch diese sukzessive Eroberung öffentlicher Räume seitens der sozialen Bewegungen<br />
kann der Fehler vermieden werden, der schon vor mehr als 150 Jahren das Scheitern<br />
der französischen Arbeiterbewegung besiegelte. Damals warf sich das Proletariat<br />
„auf doktrinäre Experimente, in Tauschbanken und Arbeiter-Assoziationen, also<br />
in eine Bewegung, worin es darauf verzichtet, die alte Welt mit ihren eigenen<br />
großen Gesamtmitteln umzuwälzen, vielmehr hinter dem Rücken der Gesellschaft,<br />
auf Privatweise, innerhalb seiner beschränkten Existenzbedingungen seine<br />
Erlösung zu vollbringen sucht, also notwendig scheitert“ (Marx 1965: 19).
4. Literatur<br />
Abong (2003): Governo e sociedade civil: um debate sobre espaços públicos<br />
democráticos. Peirópolis: Abong.<br />
Avritzer, Leonardo (2002): O orçamento participativo e a teoria democrática: um<br />
balanço critico.<br />
http://www.democraciaparticipativa.org/Arquivos/bibl_balanco_critico.htm, 16.4.2002.<br />
Baierle, Sérgio (2002): The Porto Alegre Thermidor? Brazil’s ‘Participatory Budget’ at<br />
the Crossroads. In: Socialist Register 2003. London: Merlin Press. 305-328.<br />
Becker, Joachim (2001): „Der progressive erweiterte Staat: Zivilgesellschaft, Lokalstaat<br />
und partizipatives Budget in Porto Alegre.“ Journal für Entwicklungspolitik, Nr.2 (2001),<br />
193-199.<br />
Baiocchi, Gianpaolo (2002): Emergent Public Spheres: Talking Politics in Participatory<br />
Governance. Manuskript.<br />
http://www.democraciaparticipativa.org/English/Arquivos/gianpaolo_emergent.pdf,<br />
12.06.2003.<br />
Boris, Dieter (2003): Die Transformation in Brasilien. Supplement der Zeitschrift Sozialismus<br />
Nr.11 (2003). Hamburg: VSA.<br />
– (1998): Soziale Bewegungen in <strong>Lateinamerika</strong>. Hamburg: VSA<br />
Brand, Ulrich und Werner Raza (Hg.) (2003): Fit für den Postfordismus? Theoretischpolitische<br />
Perspektiven des Regulationsansatzes. Münster: Westfälisches Dampfboot<br />
Bröckling, Ulrich, Susanne Krasmann und Thomas Lemke (Hg.) (2000): Gouvernementalität<br />
der Gegenwart. <strong>Studien</strong> zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main:<br />
Suhrkamp.<br />
Esser, Josef, Christoph Görg und Joachim Hirsch (1994): Von den „Krisen der Regulation“<br />
zum „radikalen Reformismus“; In: Esser u.a. (Hg.), 213-228.<br />
– (Hg.) (1994): Politik, Institutionen und Staat. Zur Kritik der Regulationstheorie; Hamburg:<br />
VSA<br />
Fedozzi, Luciano (2001): Orçamento Participativo. Reflexões sobre a experiência de<br />
Porto Alegre. 3. Aufl.Porto Alegre: Tomo Editorial<br />
– (2000): O Poder da Aldeia. Gênese e História do Orçamento Participativo de Porto<br />
Alegre; Porto Alegre: Tomo Editorial.<br />
Foucault, Michel (1983): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt<br />
am Main: Suhrkamp.<br />
– (1978): Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin: Merve<br />
Verlag.<br />
Gramsci, Antonio (1971): Selections from the Prison Notebooks. Hg. v. Hoare, Quintin<br />
und Geoffry Novell Smith. London: Lawrence and Wishart.<br />
Habermas, Jürgen (1990): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer<br />
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990.<br />
Frankfurt/M.: Suhrkamp.<br />
Hirsch, Joachim (2002): Herrschaft, Hegemonie und politische Alternativen. Hamburg:<br />
VSA.
Jessop, Bob (2003): Postfordismuus und wissensbasierte Ökonomie. Eine Reinterpretation<br />
des Regulationsansatzes. In: Brand, Ulrich und Werner Raza (Hg.) (2003), 89-111<br />
Lemke, Thomas (1997): Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen<br />
Gouvernementalität. Berlin und Hamburg: Argument.<br />
Leubolt, <strong>Bernhard</strong> (2003): Das Partizipative Budget. Demokratisierung der Wirtschaftspolitik<br />
in Porto Alegre. In: Kurswechsel Nr. 1 (2003), 44-54.<br />
– (2003b): Demokratisierung als Alternative zum neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell.<br />
Das Partizipative Budget im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do<br />
Sul. In: Journal für Entwicklungspolitik, Nr.3 (2003), 69-86.<br />
Magalhães, Inês, Luiz Barreto und Vicente Trevas (Hg.) (2002): Governo e cidadania.<br />
Balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. 2. Aufl. São Paulo: Fundação<br />
Perseu Abramo.<br />
Marx, Karl. 1965. Der 18te Brumaire des Louis Napoleon. Kempten: Allgäuer Heimatverlag.<br />
Mayer, Margit (2003): Das Potenzial des Regulationsansatzes für die Analyse städtischer<br />
Entwicklungen am Beispiel territorialer Anti-Armutspolitik. In: Brand, Ulrich und<br />
Werner Raza (Hg.), 265-280.<br />
Novy, Andreas (2003): Politik, Raum und Wissen. Zentrale Kategorien eines erneuerten<br />
radikalen Reformismus am Beispiel Brasiliens. In: Brand, Ulrich und Werner Raza (Hg.),<br />
282-303.<br />
– (2002): Entwicklung gestalten. Gesellschaftsveränderungen in der Einen Welt. Frankfurt<br />
a. M.: Brandes & Apsel / Südwind.<br />
– (2001): Brasilien: Die Unordnung der Peripherie. Von der Sklavenhaltergesellschaft<br />
zur Diktatur des Geldes. Wien: Promedia.<br />
– (2000): „Unmasking Globalisation: From Rhetoric to Political Economy – The Case of<br />
Brazil.“ The Cambridge Review of International Affairs, winter 2000.<br />
Novy, Andreas und Johannes Jäger (2003): Internationale politische Ökonomie. Das<br />
Beispiel <strong>Lateinamerika</strong>. http://www.lateinamerikastudien.at/content/wirtschaft/ipo/pdf/ipo.pdf,<br />
09.01.2004.<br />
Pont, Raul. (2003): Hoffnung für Brasilien; Köln: Neuer ISP Verlag<br />
PT – Partido dos Trabalhadores. (2003): Trajetórias. Das Origens á Vitória de Lula; São<br />
Paulo: Fundação Perseu Abramo.<br />
Schui, Herbert. 2003. “Was eigentlich ist Neoliberalismus.” Journal für Entwicklungspolitik,<br />
Nr. 3 (2003), 19-34.<br />
Soares, Laura Tavares (Hg.). (2002): Tempo de desafios. A política social democrática<br />
e popular no governo do Rio Grande do Sul. Pétropolis: Editora Vozes.<br />
Solidariedade. 2003. Caminhando para um Mundo Novo. Orçamento Participativo de<br />
Porto Alegre visto pela comunidade. Petrópolis/ RJ: Editora Vozes.<br />
4.1. Internet Quellen<br />
Carta Maior: http://agenciacartamaior.uol.com.br/, 20.01.2004.<br />
PMPA: Stadtregierung – Porto Alegre: http://www.portoalegre.rs.gov.br, 20.01.2004.