Kommunalabgaben in Sachsen - Kommunale Verwaltung - Freistaat ...
Kommunalabgaben in Sachsen - Kommunale Verwaltung - Freistaat ...
Kommunalabgaben in Sachsen - Kommunale Verwaltung - Freistaat ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Kommunalabgaben</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
- nachgefragt, nachgehakt -<br />
Die Bürger<strong>in</strong>formation
Vorwort<br />
Liebe Mitbürger<strong>in</strong>nen,<br />
liebe Mitbürger,<br />
jeder von uns ist von <strong>Kommunalabgaben</strong> betroffen, sei es als Grundstückseigentümer, sei<br />
es als Mieter über die Mietnebenkosten. Viele von Ihnen, die im Rahmen von Gebührenbescheiden<br />
oder Abrechnungen mit Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren konfrontiert werden,<br />
haben sich sicherlich schon gefragt, wie diese <strong>Kommunalabgaben</strong> zustande kommen.<br />
Die vorliegende Broschüre möchte Ihnen diese Frage beantworten und Ihnen ermöglichen,<br />
sich näher zu <strong>in</strong>formieren.<br />
Im Rahmen der Dase<strong>in</strong>svorsorge erfüllen die Kommunen ihre Aufgaben <strong>in</strong> den Bereichen<br />
der Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung sowie im Bereich Straßenbau. Sie<br />
kommen damit für uns ganz selbstverständlichen Grundbedürfnissen nach Versorgung, Entsorgung<br />
und Mobilität nach; sie tun dies unter Beachtung hoher Qualitätsanforderungen.<br />
Gleichwohl hat Qualität aber ihren Preis. Auch s<strong>in</strong>d die Kommunen verpflichtet, ihre E<strong>in</strong>richtungen<br />
kostendeckend zu betreiben und die Abgaben sozialverträglich zu gestalten. Es<br />
können nur diejenigen Kosten für Leistungen auf die Nutzer umgelegt werden, die tatsächlich<br />
entstehen.<br />
Den verschiedenen Interessen gerecht zu werden, ist nicht e<strong>in</strong>fach. Die vorliegende Broschüre<br />
vermittelt viele Fakten und Zusammenhänge auf dem Gebiet der <strong>Kommunalabgaben</strong><br />
und trägt hoffentlich dazu bei, dass Sie - liebe Mitbürger<strong>in</strong>nen und Mitbürger - Ihrem nächsten<br />
Abgabenbescheid kompetent und kritisch begegnen können.<br />
Dr. Albrecht Buttolo<br />
Staatsm<strong>in</strong>ister des Innern
Inhalt<br />
1. E<strong>in</strong>leitung ............................................................................ 1<br />
2. <strong>Kommunale</strong> Infrastruktur und demografischer Wandel .. 3<br />
3. Zuständigkeiten .................................................................. 4<br />
4. Rechtsgrundlagen ............................................................... 6<br />
5. Pflicht zum Anschluss an öffentliche E<strong>in</strong>richtungen ........ 10<br />
6. Gebühren ............................................................................ 11<br />
7. Beiträge ............................................................................... 14<br />
8. Hilfen des <strong>Freistaat</strong>es ......................................................... 21<br />
9. Zahlungserleichterungen ................................................... 22<br />
10. Aktene<strong>in</strong>sicht, Informations- und Beteiligungsrechte ...... 24<br />
11. Rechtsschutz ....................................................................... 26<br />
12. Ansprechpartner ................................................................. 29
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
Wofür werden die von den Kommunen erhobenen Gebühren und<br />
Beiträge verwendet? Besteht e<strong>in</strong>e Pflicht zum Anschluss an die Wasserversorgung?<br />
Muss der Bürger auch Abfallgebühren bezahlen,<br />
wenn er wenig Abfall entsorgt? Welche Möglichkeiten der Zahlungserleichterung<br />
gibt es? Diese Broschüre liefert Ihnen Antworten auf<br />
Fragen über die Erhebung von öffentlichen Abgaben und hat diese<br />
ansprechend und <strong>in</strong>formativ <strong>in</strong> dem vorliegenden Heft zusammengefasst.<br />
Der Begriff „<strong>Kommunalabgaben</strong>“ fasst Steuern, Gebühren und Beiträge<br />
zusammen, die von Geme<strong>in</strong>den und Landkreisen auf der Grundlage<br />
des Sächsischen <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetzes zur Wahrnehmung<br />
ihrer kommunalen Aufgaben erhoben werden. Dabei stellt sich das<br />
Spektrum der <strong>Kommunalabgaben</strong> recht vielschichtig dar: Es reicht<br />
von der Grund- und Gewerbesteuer über Gebühren für die Nutzung<br />
von Friedhöfen und Abgaben für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung<br />
und Abfallbeseitigung bis h<strong>in</strong> zu Beiträgen für die Erschließung<br />
und den Ausbau von Verkehrsanlagen.<br />
Der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> und die Kommunen stehen <strong>in</strong> den nächsten<br />
Jahren vor großen Herausforderungen: S<strong>in</strong>kende Bevölkerungszahlen,<br />
fallende Zuweisungen aus dem Solidarpakt II und ger<strong>in</strong>gere Mittelzuweisungen<br />
aus den Fördertöpfen der EU s<strong>in</strong>d nur e<strong>in</strong>ige Faktoren,<br />
die letztlich für die angespannte Haushaltslage <strong>in</strong> vielen sächsischen<br />
Geme<strong>in</strong>den ursächlich se<strong>in</strong> werden. So s<strong>in</strong>d die E<strong>in</strong>nahmen der sächsischen<br />
Kommunen im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr um 682<br />
Millionen Euro auf 8.736 Millionen Euro zurückgegangen. 1<br />
Trotz dieser Situation erwarten Sie als Bürger<strong>in</strong> und Bürger im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> zu Recht, dass die Kommunen ihren Aufgaben weiterh<strong>in</strong><br />
nachkommen und diese zur Zufriedenheit erfüllen. Schließlich<br />
sollen die Mülltonnen pünktlich entleert, Straßen rasch ausgebessert<br />
und die Tr<strong>in</strong>kwasserqualität aufrecht erhalten werden. Dies gel<strong>in</strong>gt<br />
auch, wie Umfragen zur Kundenzufriedenheit belegen. So geht beispielsweise<br />
aus dem BDEW 2 - Kundenbarometer von 2007 hervor,<br />
dass 91,8 % der Bürger mit der Tr<strong>in</strong>kwasserqualität zufrieden bzw.<br />
sehr zufrieden s<strong>in</strong>d.<br />
Damit die Kundenzufriedenheit sowie der Umfang und das Qualitätsniveau<br />
der öffentlichen Dienstleistungen auch <strong>in</strong> Zukunft gewährleistet<br />
1 Vierteljährliche Kassenstatistik der Geme<strong>in</strong>den und Geme<strong>in</strong>deverbände E<strong>in</strong>nahmen und Ausgaben<br />
für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2007.<br />
2 Bund der Energie- und Wasserwirtschaft.<br />
1<br />
Zum Begriff<br />
<strong>Kommunalabgaben</strong>
s<strong>in</strong>d, müssen sich die sächsischen Kommunen auf die strukturellen<br />
und konjunkturellen Veränderungen im <strong>Freistaat</strong> e<strong>in</strong>stellen. Mit der<br />
am 1. August 2008 <strong>in</strong> Kraft getretenen <strong>Verwaltung</strong>sreform wurde<br />
dah<strong>in</strong>gehend e<strong>in</strong> bedeutender Schritt unternommen.<br />
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie nun Wissenswertes und Informatives<br />
über die unterschiedlichen Arten der Abgabenerhebung<br />
sowie die Rechte und Pflichten der Kommunen und der Bürger. Auch<br />
f<strong>in</strong>den Sie Rat und Hilfe bei weiterführenden Fragen und Problemen.<br />
2
2. <strong>Kommunale</strong> Infrastruktur und<br />
demografischer Wandel<br />
Die Versorgung der Bevölkerung mit technischer Infrastruktur obliegt<br />
den Kommunen. Nach der politischen Wende bestand zunächst e<strong>in</strong><br />
hoher Nachholbedarf an kommunaler Infrastruktur (<strong>in</strong>sbesondere<br />
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung). Von e<strong>in</strong>er modernen<br />
Infrastruktur hängen jedoch nicht nur die Tr<strong>in</strong>kwasserqualität oder<br />
der „Komfort im Bad“ ab, sondern vor allem auch die Attraktivität<br />
und Qualität von Industrie- und Gewerbestandorten und damit Arbeit<br />
und E<strong>in</strong>kommen.<br />
Viele Maßnahmen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>zwischen im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> realisiert<br />
worden, doch konnten nicht alle Investitionen sofort <strong>in</strong> die Tat umgesetzt<br />
werden. Manches Wünschenswerte musste zunächst <strong>in</strong> die<br />
Zukunft verschoben werden, weil aufgrund des hohen „Investitionsrückstaus“<br />
nicht alles gleichzeitig f<strong>in</strong>anziert werden konnte. Heute<br />
müssen Kostene<strong>in</strong>sparungen durch e<strong>in</strong>en schrittweisen, bedarfsgerechten<br />
Ausbau der Anlagen und durch Anpassung von Standards<br />
an die Bevölkerungsentwicklung erzielt werden, um Beitrags- und<br />
Gebührenzahler künftig zu entlasten.<br />
In Zeiten des demografischen Wandels ist es jedoch für die Kommunen<br />
wichtig, sich nicht auf Ausbau, Erweiterung und Modernisierung<br />
der bestehenden Netze zu beschränken. Benötigt werden Lösungen,<br />
die das sich ändernde Konsumverhalten und den Bevölkerungsrückgang<br />
berücksichtigen, da die hohen Fixkosten der Anlagen von immer<br />
weniger E<strong>in</strong>wohnern getragen werden müssen und mit zu höheren<br />
Wohnnebenkosten führen.<br />
3<br />
Maßnahmen<br />
zeitlich<br />
strecken<br />
„Durchdachte”,<br />
am Bedarf<br />
orientierte<br />
Investitionen<br />
Dem demografischen<br />
Wandel<br />
Rechnung<br />
tragen
Pflichtaufgaben<br />
der Geme<strong>in</strong>den<br />
Zuständigkeit<br />
Erstmalige<br />
Herstellung<br />
Erschließungsträger<br />
3. Zuständigkeiten<br />
Wer ist für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung<br />
und Straßenbau zuständig?<br />
Gesetzliche Vorschriften (z. B. Sächsisches Wassergesetz, Sächsisches<br />
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz, Sächsisches Straßengesetz)<br />
verpflichten die Kommunen, die genannten Aufgaben zu erfüllen.<br />
Deshalb spricht man auch von Pflichtaufgaben. Die Kommunen<br />
können sich diesen Aufgaben nicht entziehen. Sie haben jedoch e<strong>in</strong>en<br />
weiten Ermessensspielraum, auf welche Weise sie die Aufgaben<br />
wahrnehmen. Dabei s<strong>in</strong>d folgende Besonderheiten zu beachten:<br />
Für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung s<strong>in</strong>d die<br />
Geme<strong>in</strong>den zuständig. Die Abfallentsorgung obliegt den Landkreisen<br />
und den Kreisfreien Städten.<br />
Mehrere Aufgabenträger können sich nach dem Sächsischen Gesetz<br />
über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) zu e<strong>in</strong>em Zweckverband<br />
zusammenschließen und diesem die Aufgabe übertragen.<br />
Die Kommunen oder Zweckverbände können sich zur Erfüllung ihrer<br />
Aufgaben auch privater Dritter bedienen.<br />
Beim Straßenbau durch die Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d zwei Fallgruppen zu<br />
unterscheiden:<br />
Erschließung nach dem Baugesetzbuch, §§ 127 ff.<br />
Die Erschließung nach dem Baugesetzbuch umfasst die erstmalige<br />
Herstellung e<strong>in</strong>er zum Ausbau bestimmten Straße e<strong>in</strong>schließlich der<br />
Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung. Das betrifft <strong>in</strong> aller<br />
Regel Neubaugebiete.<br />
Auf der Basis e<strong>in</strong>er Erschließungsbeitragssatzung, die wiederum auf<br />
dem Baugesetzbuch beruht, werden die Eigentümer der Grundstücke<br />
an Erschließungsstraßen zu Erschließungsbeiträgen herangezogen.<br />
Auf die Grundstückseigentümer werden höchstens 90 % der tatsächlich<br />
entstandenen Herstellungskosten umgelegt. Die Geme<strong>in</strong>de hat<br />
m<strong>in</strong>destens 10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes selbst<br />
zu tragen. Sie kann diesen geme<strong>in</strong>dlichen Anteil <strong>in</strong> der Satzung heraufsetzen.<br />
Dies bedarf jedoch e<strong>in</strong>er sorgfältigen Begründung.<br />
Denkbar ist auch, dass die Geme<strong>in</strong>de die Erschließung e<strong>in</strong>es Neubaugebietes<br />
auf e<strong>in</strong>en privaten Erschließungsträger überträgt. Dieser<br />
kann sich dazu verpflichten, 100 % der Erschließungskosten zu tra-<br />
4
gen. Der Erschließungsträger wird sich dann die Erschließungskosten<br />
über den Grundstückskaufpreis von den Grundstückskäufern oder auf<br />
andere Weise von den Grundstückseigentümern erstatten lassen.<br />
Straßenbau nach dem Sächsischen <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz<br />
(SächsKAG), §§ 26 ff.<br />
Anschaffung, Herstellung und Ausbau (d. h. die Erweiterung, Verbesserung<br />
und Erneuerung) von Verkehrsanlagen s<strong>in</strong>d nach dem<br />
Sächsischen <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz Maßnahmen, für die Beiträge<br />
erhoben werden können. Die Beitragserhebung steht im kommunalpolitischen<br />
Ermessen. Dies bedeutet, dass die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> eigener<br />
Verantwortung darüber entscheiden, ob sie Beiträge erheben oder<br />
nicht. Je nach Bedeutung der Straße kann die Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der Satzung<br />
bestimmen, welcher Anteil am beitragsfähigen Aufwand auf die<br />
Eigentümer der anliegenden Grundstücke umgelegt wird.<br />
Der <strong>in</strong> § 28 Abs. 2 SächsKAG festgelegte M<strong>in</strong>destanteil der Geme<strong>in</strong>de<br />
am beitragsfähigen Aufwand beträgt<br />
- bei Verkehrsanlagen,<br />
die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, 25 %,<br />
- bei Verkehrsanlagen, die überwiegend dem<br />
<strong>in</strong>nerörtlichen Durchgangsverkehr dienen, 50 %,<br />
- bei Verkehrsanlagen, die überwiegend<br />
dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, 75 %.<br />
Die Geme<strong>in</strong>den können <strong>in</strong> der Satzung den öffentlichen Anteil auch<br />
höher festsetzen.<br />
Die Erhebung von Straßenbaubeiträgen ist e<strong>in</strong> verantwortungsvoller,<br />
vorteilsgerechter und nachhaltiger Weg, Straßenbaumaßnahmen zu<br />
f<strong>in</strong>anzieren. Entscheidet sich e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Ausübung ihres kommunalpolitischen<br />
Ermessens dafür, e<strong>in</strong>e Beitragssatzung zu erlassen,<br />
ist sie auch verpflichtet, diese Satzung zu vollziehen und Beiträge zu<br />
erheben. Das Ermessen kann bei Geme<strong>in</strong>den, die sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er dauerhaft<br />
angespannten Haushaltslage bef<strong>in</strong>den und daher verpflichtet<br />
s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong> sogenanntes Haushaltssicherungskonzept zur E<strong>in</strong>nahmenverbesserung/Ausgabene<strong>in</strong>sparung<br />
zu erstellen, reduziert se<strong>in</strong>.<br />
5<br />
Beitragsfähige<br />
Maßnahmen<br />
Geme<strong>in</strong>deanteil<br />
Ausübung des<br />
kommunalpolitischen<br />
Ermessens
Sparsame und<br />
wirtschaftliche<br />
Haushaltsführung<br />
Entgelte vor<br />
Steuern<br />
4. Rechtsgrundlagen<br />
Müssen Gebühren und Beiträge alle<strong>in</strong> aufgrund des Sächsischen<br />
<strong>Kommunalabgaben</strong>gesetzes gezahlt werden?<br />
Wenn der Bürger Beiträge oder Gebühren zahlen muss, dann wirken<br />
mehrere Rechtsgrundlagen zusammen, unter ihnen das Sächsische<br />
<strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz. Es s<strong>in</strong>d dies, geordnet nach der zeitlichen<br />
Abfolge des Inkrafttretens bzw. der Bekanntgabe und ihrer Verknüpfung<br />
mite<strong>in</strong>ander,<br />
- die Sächsische Geme<strong>in</strong>deordnung (SächsGemO) bzw.<br />
die Sächsi sche Landkreisordnung (SächsLKrO),<br />
- das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz (SächsKAG),<br />
- die Beitrags- und/oder Gebührensatzung der Geme<strong>in</strong>de/des<br />
Zweckverbandes und<br />
- der Beitrags- oder Gebührenbescheid der Geme<strong>in</strong>de/des<br />
Zweckverbandes.<br />
Die Ausgestaltung dieser Regelungen wird wiederum durch bundes-<br />
und zunehmend durch europarechtliche Vorgaben bee<strong>in</strong>flusst. So<br />
haben laut EU-Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie aus dem Jahr 2000 die Mitgliedsstaaten<br />
z. B. dafür zu sorgen, dass für Wasserdienstleistungen<br />
kostendeckende Entgelte erhoben werden.<br />
a) Die Sächsische Geme<strong>in</strong>deordnung<br />
Die Sächsische Geme<strong>in</strong>deordnung ist für die Geme<strong>in</strong>den - ebenso wie<br />
die Sächsische Landkreisordnung für die Landkreise - e<strong>in</strong>e Art „Grundgesetz“.<br />
Der vierte Teil „Geme<strong>in</strong>dewirtschaft“ bildet die Grundlage<br />
für deren wirtschaftliches Handeln. Die Geme<strong>in</strong>den haben - so sieht<br />
es § 72 SächsGemO vor - ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und<br />
zu führen, dass e<strong>in</strong>e stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.<br />
Diese Pflicht steht unter dem Obersatz:<br />
„Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu<br />
führen.“<br />
Dies bedeutet: Die Geme<strong>in</strong>den haben ihre Ausgaben mit dem Ziel des<br />
Haushaltsausgleichs zu m<strong>in</strong>imieren und für ausreichende E<strong>in</strong>nahmen<br />
zu sorgen.<br />
Auf örtlicher Ebene bestimmen die „Grundsätze der E<strong>in</strong>nahmenbeschaffung“<br />
(§ 73 SächsGemO), auf welche Weise und <strong>in</strong> welchem<br />
Umfang die Geme<strong>in</strong>de von ihren Bürgern und E<strong>in</strong>wohnern, den<br />
6
Grundstückseigentümern oder den Nutzern kommunaler E<strong>in</strong>richtungen<br />
Abgaben erheben kann. Die Sächsische Geme<strong>in</strong>deordnung gibt,<br />
wie alle Geme<strong>in</strong>deordnungen <strong>in</strong> Deutschland, e<strong>in</strong>e bestimmte Rangordnung<br />
bei der Abgabenerhebung vor. Danach s<strong>in</strong>d die E<strong>in</strong>nahmen<br />
der Geme<strong>in</strong>de zunächst aus Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen<br />
und erst dann aus Steuern zu beschaffen (§ 73 Abs. 2 Sächs-<br />
GemO). Diese Rangfolge f<strong>in</strong>det ihre Rechtfertigung <strong>in</strong> dem geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong><br />
als „Verursacherpr<strong>in</strong>zip“ bekannten Rechtsgedanken. Danach hat<br />
zunächst derjenige für die Kosten e<strong>in</strong>er von der Geme<strong>in</strong>de erbrachten<br />
Leistung aufzukommen, der diese Leistung im E<strong>in</strong>zelfall <strong>in</strong> Anspruch<br />
nimmt oder nehmen kann. Die Abgabenerhebung erfolgt also vorteilsorientiert.<br />
E<strong>in</strong>nahmen aus Steuern, die jeden steuerpflichtigen<br />
Bürger unabhängig von der konkreten Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er kommunalen<br />
Leistung treffen, s<strong>in</strong>d erst zulässig, wenn die Möglichkeiten<br />
zur Erhebung leistungsbezogener Abgaben ausgeschöpft s<strong>in</strong>d oder<br />
dies aus anderen Gründen nicht möglich ist.<br />
E<strong>in</strong> Gebot zur Erhebung kostendeckender Entgelte besteht vor allem<br />
für diejenigen E<strong>in</strong>richtungen und Anlagen, die überwiegend dem<br />
Vorteil e<strong>in</strong>zelner Personen oder Personengruppen dienen, wie z. B.<br />
bei Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallbeseitigung.<br />
b) Das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz<br />
Die Sächsische Geme<strong>in</strong>deordnung bzw. die Sächsische Landkreisordnung<br />
schreibt vor, dass die Kommunen Abgaben nach den gesetzlichen<br />
Vorschriften zu erheben haben. Die wichtigste dieser gesetzlichen<br />
Vorschriften ist das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz.<br />
Während die Sächsische Geme<strong>in</strong>deordnung ebenso wie die Sächsische<br />
Landkreisordnung die Pflicht zur E<strong>in</strong>nahmenbeschaffung festlegt,<br />
gewährt das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz den Kommunen<br />
das Recht, <strong>Kommunalabgaben</strong> zu erheben. Es bezeichnet<br />
Steuern, Benutzungsgebühren, Beiträge, Aufwandsersatz, Kurtaxe,<br />
Fremdenverkehrsabgabe und abgabenrechtliche Nebenleistungen<br />
wie Verspätungszuschläge, Z<strong>in</strong>sen und Säumniszuschläge als <strong>Kommunalabgaben</strong>.<br />
Das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz eröffnet den Kommunen<br />
vielfältige Möglichkeiten, die Beitrags- und Gebührenlast zu berechnen<br />
und verträglich auf die Bürger zu verteilen; auf die Kostenentstehung<br />
hat es jedoch ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss. Das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz<br />
ist darüber h<strong>in</strong>aus die gesetzliche Grundlage für die<br />
Gebühren- und Beitragssatzungen der Kommunen.<br />
7<br />
Kostendeckung<br />
SächsKAG<br />
gewährt Recht<br />
zur Abgabenerhebung<br />
Vielfältige<br />
Gestaltungsmöglichkeiten
Ohne Satzung<br />
ke<strong>in</strong>e Abgabe<br />
Erst der Abgabenbescheid<br />
belastet<br />
c) Die Beitrags und Gebührensatzung<br />
Wollen Geme<strong>in</strong>den, Landkreise und Zweckverbände Beiträge und<br />
Gebühren erheben, dann müssen sie auf der Basis der Sächsischen<br />
Geme<strong>in</strong>deordnung bzw. der Sächsischen Landkreisordnung und des<br />
Sächsischen <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetzes e<strong>in</strong>e Beitrags- und/oder Gebührensatzung<br />
erlassen. Satzungen s<strong>in</strong>d Ortsrecht. Sie s<strong>in</strong>d vom Geme<strong>in</strong>derat<br />
bzw. Kreistag oder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes<br />
zu beschließen und öffentlich bekanntzumachen. Jede<br />
Bürger<strong>in</strong> und jeder Bürger hat das Recht, die Satzungen e<strong>in</strong>zusehen<br />
oder sich - auf eigene Kosten - e<strong>in</strong>e Abschrift zu beschaffen.<br />
Erst die örtlichen Satzungen s<strong>in</strong>d für den Bürger unmittelbar von Bedeutung<br />
und für den Abgabenpflichtigen von größtem Interesse. Sie<br />
enthalten im Wesentlichen neben den Bestimmungen über den Anschluss-<br />
und Benutzungszwang sowie den technischen Bestimmungen<br />
- den Beitrags- und/oder Gebührensatz,<br />
- den Beitragsmaßstab, Art und Berechnung des Beitrages für das<br />
e<strong>in</strong>zelne Grundstück,<br />
- Regelungen über die Fälligkeit (Zeitpunkt der Zahlung des<br />
Beitrages/der Gebühr) und<br />
- Billigkeitsmaßnahmen (Möglichkeiten der Stundung und des Erlasses).<br />
d) Die Beitrags und Gebührenbescheide<br />
Das letzte Glied <strong>in</strong> der Kette der Rechtsgrundlagen für die Abgabenerhebung<br />
ist der Beitrags- und Gebührenbescheid. Er ist an e<strong>in</strong>en bestimmten<br />
Adressaten gerichtet und setzt die konkrete Abgabe mit<br />
e<strong>in</strong>em bestimmten Euro-Betrag fest. Der Abgabenbescheid ist e<strong>in</strong><br />
<strong>Verwaltung</strong>sakt. Dieser ist an den Betroffenen zu adressieren und<br />
ihm zu übermitteln. Der Bescheid muss ausreichend verständlich se<strong>in</strong><br />
und die Rechtsgrundlage bezeichnen, so dass der Empfänger die Abgabenerhebung<br />
zum<strong>in</strong>dest nachvollziehen kann, wenn er die zugrunde<br />
liegende Satzung beizieht. Der Bescheid muss unterschrieben und<br />
mit e<strong>in</strong>er Rechtsbehelfsbelehrung versehen se<strong>in</strong>. Bei masch<strong>in</strong>eller<br />
Ausfertigung kann die Unterschrift entfallen. Der Adressat kann den<br />
Bescheid überprüfen lassen (Widerspruch, danach Klage); vgl. dazu<br />
unter 11.<br />
8
Darf die Kommune oder der Zweckverband statt Beiträgen<br />
und Gebühren auch privatrechtliche Entgelte verlangen?<br />
Die Kommunen bzw. Zweckverbände haben auch die Möglichkeit, an<br />
Stelle von Gebühren und Beiträgen (öffentlich-rechtliche Entgelte) privatrechtliche<br />
Entgelte zu verlangen. Das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz<br />
ist dann nicht unmittelbar anwendbar. Es müssen jedoch<br />
auch bei der Erhebung privatrechtlicher Entgelte die allgeme<strong>in</strong>en<br />
Grundsätze des öffentlichen F<strong>in</strong>anzgebarens, das maßgeblich durch<br />
die kommunalabgabenrechtlichen Regelungen geprägt wird, beachtet<br />
werden. Das heißt, dass <strong>in</strong>sbesondere die Entgelthöhe <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
angemessenen Verhältnis zu der <strong>in</strong> Anspruch genommenen Leistung<br />
stehen muss (Äquivalenzpr<strong>in</strong>zip) und die Entgelte<strong>in</strong>nahmen die entgeltfähigen<br />
Kosten der öffentlichen E<strong>in</strong>richtung nicht überschreiten<br />
dürfen (Kostenüberschreitungsverbot). Die Benutzungsbed<strong>in</strong>gungen<br />
werden dabei <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Geschäftsbed<strong>in</strong>gungen geregelt. Die<br />
Entgelthöhen werden über Preisblätter bekannt gegeben. Soweit die<br />
Festsetzung e<strong>in</strong>es Anschluss- und Benutzungszwanges erforderlich ist<br />
(Näheres hierzu siehe unter der Nr. 5), wird dazu von der Kommune<br />
oder dem Zweckverband e<strong>in</strong>e sogenannte Rumpfsatzung erlassen.<br />
Es ist auch zulässig, dass e<strong>in</strong> privates Unternehmen, das von der Kommune<br />
oder dem Zweckverband mit der Wahrnehmung der jeweiligen<br />
Aufgabe, z. B. der Tr<strong>in</strong>kwasserversorgung oder der Abwasserbeseitigung,<br />
beauftragt wurde, privatrechtliche Entgelte <strong>in</strong> eigenem Namen<br />
erhebt. Die Kommune oder der Zweckverband muss dabei jedoch<br />
ausreichenden E<strong>in</strong>fluss auf Entscheidungen des Unternehmens und<br />
damit auch auf die Entgelterhebung nehmen können.<br />
9<br />
Grundsätze des<br />
öffentlichen<br />
F<strong>in</strong>anzgebarens<br />
Entgelterhebung<br />
durch privateUnternehmen<br />
zulässig
Anschluss- und<br />
Benutzungszwang<br />
Dem Stand<br />
der Technik<br />
entsprechende<br />
Kle<strong>in</strong>kläranlagen<br />
auch dauerhaft<br />
nutzbar<br />
Förderung von<br />
Kle<strong>in</strong>kläranlagen<br />
5. Pflicht zum Anschluss an öffentliche E<strong>in</strong>richtungen<br />
Besteht e<strong>in</strong>e Pflicht zum Anschluss an die Wasserversorgung<br />
und die Abwasserbeseitigung?<br />
Die Geme<strong>in</strong>de bzw. der Zweckverband kann „bei öffentlichem Bedürfnis“<br />
durch Satzung den Anschluss von Grundstücken an Anlagen<br />
zur Wasserversorgung, Ableitung und Re<strong>in</strong>igung von Abwasser, Fernwärmeversorgung<br />
und ähnliche, dem öffentlichen Wohl, <strong>in</strong>sbesondere<br />
dem Umweltschutz, dienende E<strong>in</strong>richtungen (Anschlusszwang)<br />
und deren Benutzung (Benutzungszwang) vorschreiben (vgl. § 14<br />
SächsGemO). Die Satzung kann bestimmte Ausnahmen zulassen. Der<br />
Anschluss- und Benutzungszwang muss dem Wohl der Allgeme<strong>in</strong>heit<br />
dienen. Dies ist <strong>in</strong>sbesondere dann zu bejahen, wenn die öffentliche<br />
E<strong>in</strong>richtung der Abwehr gesundheitlicher Gefahren oder dem Schutz<br />
der Umwelt dient.<br />
Was wird mit e<strong>in</strong>er privaten Kle<strong>in</strong>kläranlage oder abflusslosen<br />
Sammelgrube?<br />
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der veränderten f<strong>in</strong>anziellen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen werden über 10 % der sächsischen<br />
Bevölkerung - <strong>in</strong>sbesondere im ländlichen Raum - die Kle<strong>in</strong>kläranlagen<br />
mittelfristig oder dauerhaft zur Abwasserbehandlung nutzen.<br />
Bis spätestens zum Jahr 2015 müssen dabei alle Anlagen dem Stand<br />
der Technik entsprechen, also mit e<strong>in</strong>er biologischen Re<strong>in</strong>igungsstufe<br />
ausgerüstet se<strong>in</strong>.<br />
Die Abwasserzweckverbände und Geme<strong>in</strong>den als Aufgabenträger<br />
der öffentlichen Abwasserbeseitigung s<strong>in</strong>d gehalten, die bestehenden,<br />
noch nicht aktualisierten Abwasserbeseitigungskonzepte unter<br />
den zu erwartenden veränderten f<strong>in</strong>anziellen und demografischen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu überprüfen und anzupassen. Sie müssen<br />
außerdem festlegen, welcher Ortsteil oder welche Teile davon dauerhaft<br />
nicht an öffentliche Abwasserbehandlungsanlagen angeschlossen<br />
werden sollen.<br />
Um die Grundstückseigentümer bei der Nachrüstung der Kle<strong>in</strong>kläranlage<br />
mit e<strong>in</strong>er biologischen Re<strong>in</strong>igungsstufe bzw. dem Neubau e<strong>in</strong>er<br />
Kle<strong>in</strong>kläranlage zu unterstützen, hat das Sächsische Staatsm<strong>in</strong>isterium<br />
für Umwelt und Landwirtschaft die neue „Förderrichtl<strong>in</strong>ie Siedlungswasserwirtschaft<br />
(SWW/2007) vom 2. März 2007“ zur Förderung von<br />
privaten Kle<strong>in</strong>kläranlagen erlassen.<br />
10
6. Gebühren<br />
Welche Kosten werden durch die Benutzungsgebühren gedeckt?<br />
Die Benutzungsgebühr ist e<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gebührensatzung festgesetztes<br />
Entgelt für die Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er öffentlichen E<strong>in</strong>richtung. Sie<br />
wird fortlaufend erhoben. Die Höhe der Gebühren muss im E<strong>in</strong>zelfall<br />
dem Maß der Benutzung oder Inanspruchnahme der kommunalen<br />
E<strong>in</strong>richtung entsprechen.<br />
Die Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung<br />
werden üblicherweise nach dem Wasserverbrauch <strong>in</strong><br />
EUR/m³ bemessen, bei der Abfallentsorgung nach der Menge des<br />
entsorgten Abfalls. Neben den jährlichen Betriebskosten für Personal,<br />
Energie, Instandhaltung, Chemikalien, Fuhrpark, <strong>Verwaltung</strong> usw. (im<br />
Zusammenhang mit der Abfallentsorgung: auch die Deponierücklage<br />
bzw. -rückstellung für die Nachsorge bei stillgelegten Deponien) werden<br />
über die Benutzungsgebühren auch die Investitionen ref<strong>in</strong>anziert.<br />
In die Gebührenkalkulation werden jedoch nicht die gesamten Investitionen<br />
im Jahr des Anfalls der Investitionsausgabe e<strong>in</strong>gestellt,<br />
sondern nur der - entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer<br />
e<strong>in</strong>er Anlage - auf das e<strong>in</strong>zelne Jahr entfallende Anteil der Investitionsausgaben.<br />
Diesen Anteil nennt man kalkulatorische Abschreibungen.<br />
Mit den Abschreibungsmitteln trägt der Träger der E<strong>in</strong>richtung<br />
die Tilgung (Rückzahlung) der Kredite. Daneben wird für die noch<br />
nicht über Abschreibungen ref<strong>in</strong>anzierten Investitionsausgaben e<strong>in</strong><br />
kalkulatorischer Z<strong>in</strong>s <strong>in</strong> die Gebührenkalkulation e<strong>in</strong>gestellt, mit dem<br />
die für Kredite zu leistenden Z<strong>in</strong>sen abgegolten werden.<br />
Wofür werden Grundgebühren erhoben?<br />
Die Benutzungsgebühr kann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Arbeitsgebühr und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Grundgebühr<br />
aufgeteilt werden. Die Arbeitsgebühr (bei der Abfallentsorgung:<br />
zumeist als Leistungs- oder Entsorgungsgebühr bezeichnet)<br />
wird für die tatsächlich <strong>in</strong> Anspruch genommenen Leistungen erhoben.<br />
Die Grundgebühr dient dagegen der Deckung der so genannten<br />
fixen Vorhaltekosten. Fixe Vorhaltekosten s<strong>in</strong>d Kosten, die unabhängig<br />
davon entstehen, <strong>in</strong> welchem Ausmaß die E<strong>in</strong>richtung vom e<strong>in</strong>zelnen<br />
Benutzer tatsächlich <strong>in</strong> Anspruch genommen wird. Dazu gehören<br />
z. B. die <strong>in</strong>vestiven Kosten (kalkulatorische Kosten), die Personalkosten<br />
für das M<strong>in</strong>imum an Stammpersonal oder auch die verbrauchsunabhängigen<br />
Grundpreise für das Vorhalten der Leistungsbereitschaft.<br />
Die Grundgebühr wird z. B. am Nennwert des Zählers (z. B. „Qn 2,5“,<br />
d. h. 2,5 m³ Durchflussmenge pro Stunde) festgemacht.<br />
11<br />
Was decken die<br />
Gebühren ab?<br />
Bestandteile der<br />
Gebühr:<br />
Kalkulatorische<br />
Kosten:<br />
- kalkulatorische<br />
Abschreibungen<br />
- kalkulatorische<br />
Z<strong>in</strong>sen<br />
Betriebskosten<br />
Grundgebühr<br />
für Fixkosten
Trennung <strong>in</strong><br />
Schmutz- und<br />
Niederschlagswasserentgelte<br />
Das bedeutet jedoch nicht, dass damit die Kosten für den Wasserzähler<br />
abgedeckt werden sollen. Es ist deshalb sachlich unzutreffend, die<br />
Grundgebühr als „Zählergebühr“ zu bezeichnen. Die Grundgebühr<br />
bei der Abfallentsorgung wird meistens <strong>in</strong> Abhängigkeit von der Anzahl<br />
der <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushalt lebenden Personen bestimmt.<br />
Weshalb muss nun auch noch für Niederschlagswasser extra<br />
bezahlt werden?<br />
Die meisten Geme<strong>in</strong>den und Zweckverbände erhoben <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
für die Entsorgung des Schmutzwassers und die Ableitung<br />
des Niederschlagswassers e<strong>in</strong>heitliche Gebühren. So war vielen Gebührenzahlern<br />
gar nicht bewusst, dass auch für die Ableitung des<br />
Niederschlagswassers von den Grundstücken Kosten anfielen, die<br />
über die Abwassergebühren mit bezahlt wurden. Die Rechtsprechung<br />
machte jedoch e<strong>in</strong>e Änderung des Sächsischen <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetzes<br />
im Jahr 2004 dah<strong>in</strong>gehend erforderlich, dass für die Erbr<strong>in</strong>gung<br />
unterschiedlicher Leistungen auch unterschiedliche Gebühren<br />
und Beiträge zu erheben s<strong>in</strong>d (§ 9 Abs. 3 SächsKAG). Die Erhebung<br />
e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>heitsgebühr, die z. B. die Leistungen Schmutz was ser ent sorgung<br />
und Niederschlagswasserableitung umfasst, ist seither nur noch<br />
<strong>in</strong> wenigen Fällen zulässig. Daher stellten die meisten Geme<strong>in</strong>den und<br />
Zweckverbände ihr Beitrags- und Gebührensystem auf die Erhebung<br />
getrennter Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelte um.<br />
Hilft es dem Bürger oder der Allgeme<strong>in</strong>heit, Wasser zu sparen?<br />
JA. Jeder nicht verbrauchte Liter Wasser ist e<strong>in</strong>e ökologisch s<strong>in</strong>nvolle<br />
E<strong>in</strong>sparung!<br />
ABER: Die Anlagen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung<br />
s<strong>in</strong>d auf e<strong>in</strong>en bestimmten Bedarf ausgelegt. Das Tr<strong>in</strong>kwasser<br />
muss fließen, auch wenn sich unerwartete Verbrauchsspitzen ergeben.<br />
Die Abwasseranlage muss auch <strong>in</strong> diesen Fällen das verschmutzte<br />
Wasser aufnehmen und re<strong>in</strong>igen können.<br />
Die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Jahr anfallenden Unterhaltungskosten der Anlagen s<strong>in</strong>d<br />
nahezu unabhängig vom Jahresverbrauch. Auch e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Abnahme/E<strong>in</strong>leitung<br />
erfordert die Vorhaltung (Bereithaltung) aller Anlagen;<br />
man spricht von Fixkosten. Die Kostene<strong>in</strong>sparungen <strong>in</strong>folge ger<strong>in</strong>geren<br />
Verbrauchs s<strong>in</strong>d häufig ger<strong>in</strong>g und führen daher meist nicht<br />
zu e<strong>in</strong>er deutlichen Reduzierung der Gebühren.<br />
12
Muss der Bürger auch Abfallgebühren zahlen, wenn bei ihm<br />
wenig Abfall anfällt?<br />
JA. Abfallgebühren müssen bezahlt werden, auch wenn Entsorgungsleistungen<br />
kaum <strong>in</strong> Anspruch genommen werden. H<strong>in</strong>tergrund dafür<br />
s<strong>in</strong>d die stets anfallenden Kosten der Unterhaltung für die Anlagen der<br />
Abfallentsorgung. Angemessene Grundgebühren können nach dem<br />
Sächsischen <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz für die fixen Vorhaltekosten<br />
unabhängig vom Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme erhoben<br />
werden. Bei bewohnten Grundstücken ist regelmäßig anzunehmen,<br />
dass selbst bei größtmöglichem Bemühen um Abfallvermeidung<br />
Abfälle <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gen Mengen entstehen. Nur bei e<strong>in</strong>em unbewohnten<br />
Grundstück kann davon ausgegangen werden, dass überhaupt ke<strong>in</strong><br />
Abfall anfällt. In diesem Fall werden auch ke<strong>in</strong>e Grundgebühren erhoben.<br />
Die Frage, ob e<strong>in</strong> Grundstück bewohnt ist oder nicht, ist nach<br />
den konkreten Umständen zu beurteilen (vgl. zum Beispiel VGH München,<br />
Beschluss vom 26.01.1996, Az.: 4 CS 95/2779).<br />
Muss der Inhaber e<strong>in</strong>er Zweitwohnung „doppelt“ Abfallgebühren<br />
bezahlen?<br />
Inhaber von Zweitwohnungen (Mieter) müssen an dem betreffenden<br />
Wohnort Abfallgebühren entrichten. Nicht entscheidend ist der<br />
Umstand, dass sie schon an ihrem Hauptwohnort Abfallgebühren<br />
entrichten, weil es sich um zwei verschiedene Abfallentsorgungse<strong>in</strong>richtungen<br />
handelt, deren Leistungen tatsächlich <strong>in</strong> Anspruch genommen<br />
werden.<br />
Haben k<strong>in</strong>derreiche Familien die Möglichkeit, ihre Abfallgebühren<br />
zielgerichtet zu senken?<br />
Familien können versuchen, durch ihr „Abfallverhalten“ ihre Gebühren<br />
ger<strong>in</strong>g zu halten. Für die Kommune besteht ke<strong>in</strong>e Rechtspflicht,<br />
soziale Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Sozial bed<strong>in</strong>gte Gebührenermäßigungen<br />
dürfen nicht zu Lasten der übrigen Benutzer (Gebührenzahler)<br />
e<strong>in</strong>geräumt werden. Um sozialen Härtefällen zu begegnen,<br />
ist nur e<strong>in</strong> Entgegenkommen zu Lasten der Allgeme<strong>in</strong>heit möglich.<br />
Denkbar ist beispielsweise, dass die Kommune e<strong>in</strong>en Zuschuss aus<br />
ihrem allgeme<strong>in</strong>en Haushalt gewährt.<br />
13<br />
Abfallgebühren<br />
auch bei ger<strong>in</strong>gerInanspruchnahme<br />
Abfallgebühren<br />
auch für Zweitwohnung<br />
FamilienfreundlicheAbfallgebühren?
Beitrag ist<br />
abhängig vom<br />
Betriebskapital<br />
Globalberechnung<br />
Unterschiedliche<br />
Vorteile =<br />
unterschiedliche<br />
Beiträge<br />
7. Beiträge<br />
Wofür werden Beiträge erhoben?<br />
Beiträge s<strong>in</strong>d Geldleistungen, die der F<strong>in</strong>anzierung des Aufwandes<br />
für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher E<strong>in</strong>richtungen<br />
und Anlagen dienen, jedoch ohne die laufende Unterhaltung<br />
und Instandsetzung. Sie wirken sich m<strong>in</strong>dernd auf die höchstzulässigen<br />
Gebührensätze aus.<br />
Das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz gestattet den Geme<strong>in</strong>den<br />
und Landkreisen, zur angemessenen Ausstattung öffentlicher E<strong>in</strong>richtungen<br />
mit Betriebskapital Beiträge für Grundstücke zu erheben. Das<br />
Betriebskapital ist das für die E<strong>in</strong>richtung notwendige Kapital, se<strong>in</strong>e<br />
Höhe ist <strong>in</strong> der örtlichen Satzung festzulegen.<br />
Die Angemessenheit des Betriebskapitals richtet sich nach<br />
- dem Kapitalbedarf,<br />
- der Belastbarkeit der Beitragspflichtigen und<br />
- e<strong>in</strong>em ausgewogenen Verhältnis der Belastung zwischen den Grundstückseigentümern<br />
(Beitragszahler) und den Benutzern der öffentlichen<br />
E<strong>in</strong>richtung (Gebührenzahler).<br />
Wie werden Beiträge berechnet?<br />
Die Kalkulation der Beiträge erfolgt mittels der sogenannten Globalberechnung.<br />
In der Globalrechnung werden die Investitionskosten<br />
der notwendigen Anlagen rechnerisch durch die von diesen Anlagen<br />
erschlossenen Flächen geteilt. Daraus ergibt sich der Beitragssatz <strong>in</strong><br />
EUR/m² Fläche.<br />
E<strong>in</strong>e ordnungsgemäße Globalberechnung sorgt dafür, dass die Kosten<br />
der Anlagen und die durch diese Anlagen erschlossenen Flächen<br />
deckungsgleich s<strong>in</strong>d. Es werden nur Anlagen berechnet, die für die<br />
Flächen auch benötigt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes<br />
Grundstück ausschließlich se<strong>in</strong>en Anteil am Gesamtsystem der<br />
Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung trägt.<br />
Wie wird der Beitrag bemessen?<br />
Der Kernpunkt der Beitragsregelung <strong>in</strong> der örtlichen Satzung ist die<br />
Bemessungsregelung, die besagt, wie der jeweilige Beitrag für das<br />
e<strong>in</strong>zelne Grundstück zu berechnen ist. Das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz<br />
gibt ke<strong>in</strong>e Beitragsmaßstäbe vor. Es verlangt lediglich,<br />
dass die Beiträge nach e<strong>in</strong>em Maßstab zu bemessen s<strong>in</strong>d, der die un-<br />
14
terschiedlichen Vorteile der Grundstücke - aufgrund ihrer baulichen<br />
oder sonstigen Nutzungsmöglichkeiten - auch unterschiedlich berücksichtigt.<br />
Maßgebend ist also stets die zulässige und nicht die tatsächliche<br />
Nutzung. E<strong>in</strong>e Orientierung des Vorteils an der gegenwärtigen Nutzung<br />
ließe nicht zu, dass für unbebaute Grundstücke e<strong>in</strong> Beitrag erhoben<br />
wird. In diesem Fall müssten die übrigen Entgeltpflichtigen,<br />
also die Gebührenzahler, die Lücke <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzierung schließen.<br />
Dies wäre ungerecht, da auf diese Weise e<strong>in</strong>e Grundstücksbevorratung,<br />
wie diese auch immer motiviert wäre, h<strong>in</strong>sichtlich der Kosten<br />
der öffentlichen E<strong>in</strong>richtung von Dritten f<strong>in</strong>anziert werden würde.<br />
Aber auch unterschiedlich große, jedoch mit gleich großen Gebäuden<br />
bebaute Grundstücke erfordern unter dem maßgebenden Aspekt der<br />
Nutzungsmöglichkeit e<strong>in</strong>e differenzierende Betrachtung.<br />
Warum wird der Beitrag an der Grundstücksfläche<br />
festgemacht?<br />
Sowohl nach dem Bauplanungsrecht als auch nach dem Bauordnungsrecht<br />
ist die Nutzungsmöglichkeit e<strong>in</strong>es Grundstückes maßgeblich<br />
von dessen Größe abhängig. Da die Berechnung des Beitrages auf<br />
die Nutzungsmöglichkeit abstellt, wird im Abgabenrecht ebenfalls<br />
von der Grundstücksfläche als maßgebendem Faktor ausgegangen.<br />
Als grundsätzliche Regel gilt: Je größer das Grundstück, desto<br />
größer ist auch se<strong>in</strong>e Nutzungsmöglichkeit.<br />
Welche Beitragsmaßstäbe s<strong>in</strong>d zulässig?<br />
Beitragsmaßstäbe s<strong>in</strong>d nur dann sachgerecht und zulässig, wenn sie<br />
e<strong>in</strong>en verlässlichen Schluss auf das Ausmaß des Vorteils e<strong>in</strong>es Grundstücks<br />
von der öffentlichen E<strong>in</strong>richtung zulassen. Der Vorteil wird an<br />
dem Maß der Bebaubarkeit e<strong>in</strong>es Grundstückes bemessen.<br />
Die vom Sächsischen Städte- und Geme<strong>in</strong>detag herausgegebenen<br />
Satzungsmuster sehen alternativ zwei Maßstäbe vor<br />
den Nutzungsfaktormaßstab oder<br />
den Geschossflächenmaßstab.<br />
Der Nutzungsfaktormaßstab geht von der Fläche des Grundstückes<br />
aus und berücksichtigt dessen Bebaubarkeit nach der Zahl der<br />
zulässigen Geschosse. Die Grundstücksfläche wird mit e<strong>in</strong>em stufenweise<br />
ansteigenden Faktor vervielfältigt. Dieser Faktor kann <strong>in</strong> der<br />
Satzung z. B. folgendermaßen festgelegt werden:<br />
15<br />
Kriterium<br />
Nutzungsmöglichkeit<br />
Grundstücksfläche<br />
als<br />
Berechnungsgrundlage
Nutzungs faktor<br />
Geschoss fläche<br />
bei e<strong>in</strong>geschossiger Bebaubarkeit der Faktor 1;<br />
bei zweigeschossiger Bebaubarkeit der Faktor 1,5;<br />
bei dreigeschossiger Bebaubarkeit der Faktor 2,0;<br />
bei viergeschossiger Bebaubarkeit der Faktor 2,5.<br />
Beispiel:<br />
Für e<strong>in</strong> 300 m² großes Grundstück bedeutet dies bei zulässiger zweigeschossiger<br />
Bebauungsmöglichkeit und e<strong>in</strong>em angenommenen Beitragssatz<br />
von 3,00 EUR/m² Nutzungsfläche:<br />
300m² Grundstücksfläche x 1,5 = 450 m² Nutzungsfläche<br />
450 m² Nutzungsfläche x 3,00 EUR Beitrag/m² = 1.350 EUR Beitrag.<br />
Der Geschossflächenmaßstab richtet sich nach der für das Grundstück<br />
nach den bauplanungsrechtlichen Bestimmungen grundsätzlich<br />
zulässigen Geschossfläche. Diese wird durch Multiplikation der<br />
Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl<br />
(GFZ) ermittelt. Die GFZ ist diejenige Wohn- oder<br />
sonstige Nutzfläche, die auf dem Grundstück errichtet werden darf.<br />
In Gebieten ohne Bebauungsplan bestimmt sich die GFZ nach der<br />
vorhandenen Bebauung <strong>in</strong> der näheren Umgebung.<br />
Beispiel:<br />
Für e<strong>in</strong> 300 m² großes Grundstück bedeutet dies bei e<strong>in</strong>er GFZ von<br />
0,25 und e<strong>in</strong>em angenommenen Beitragssatz von 9,00 EUR/m² Geschossfläche:<br />
300 m² Grundstücksfläche x 0,25 = 75 m² Geschossfläche<br />
75 m² Geschossfläche x 9,00 EUR Beitrag/m² = 675 EUR Beitrag.<br />
Der Nutzungsfaktormaßstab ist ger<strong>in</strong>gfügig gröber als der Geschossflächenmaßstab,<br />
dafür weitaus praktikabler und verständlicher. Der<br />
Geschossflächenmaßstab ist nämlich dort, wo noch ke<strong>in</strong>e Bebauungspläne<br />
mit festgesetzten Geschossflächenzahlen bestehen und<br />
diese erst mühsam anhand der baulichen Nutzung <strong>in</strong> der näheren<br />
Umgebung bestimmt werden müssen, nur unter großen Schwierigkeiten<br />
und mit erheblicher Rechtsunsicherheit anzuwenden.<br />
Speziell für die Niederschlagswasserentsorgung ist außerdem die mit<br />
e<strong>in</strong>em Grundflächenfaktor modifizierte Grundfläche als Maßstab<br />
möglich. Der Grundflächenfaktor ist abhängig von der überbaubaren<br />
Grundstücksfläche. Je größer die überbaubare Grundstücksfläche<br />
und damit die Fläche, auf der das Niederschlagswasser nicht versickern<br />
kann, ist, desto höher ist dabei auch der Niederschlagswasserbeitrag.<br />
16
Beitragsmaßstäbe wie zum Beispiel die Anzahl der Wohne<strong>in</strong>heiten<br />
oder die Anzahl der Grundstücksbewohner bzw. die tatsächlich bebaute<br />
Grundstücksfläche können nicht herangezogen werden, da sie<br />
nur an die gegenwärtige Nutzung anknüpfen, jedoch die zukünftige<br />
zusätzliche Bebaubarkeit e<strong>in</strong>es Grundstückes (unabhängig von se<strong>in</strong>er<br />
gegenwärtigen Ausnutzung) als Vorteilsmaßstab nicht widerspiegeln.<br />
Soweit für Verkehrsanlagen Beiträge erhoben werden, richten sich<br />
die Verteilungsmaßstäbe nach der Art und dem Maß der baulichen<br />
oder sonstigen Nutzung für sich alle<strong>in</strong> oder <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit der<br />
Grundstücksfläche bzw. der Grundstücksbreite an der Verkehrsanlage<br />
(§ 29 SächsKAG). Es s<strong>in</strong>d also unterschiedliche Maßstäbe denkbar.<br />
Die Entscheidung trifft letztlich der Satzungsgeber. E<strong>in</strong>zelheiten ergeben<br />
sich aus der örtlichen Geme<strong>in</strong>desatzung.<br />
Wer muss Beiträge zahlen?<br />
Beitragsschuldner ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte<br />
oder der sonstige d<strong>in</strong>glich zur baulichen Nutzung Berechtigte.<br />
Warum zahlen nur die Grundstückseigentümer usw. Beiträge?<br />
Mit dem Beitrag soll ke<strong>in</strong>e Beteiligung an der öffentlichen Anlage<br />
„erkauft” werden. Der Beitrag dient vielmehr der Beschaffung des<br />
notwendigen Betriebskapitals. Er wird lediglich nach dem durch die<br />
öffentliche Anlage gebotenen und auf das Grundstück entfallenden<br />
Vorteil bemessen.<br />
Die Erschließung (Wasser, Abwasser oder Straße) ist stets grundstücksbezogen.<br />
Der Eigentümer (oder e<strong>in</strong> sonstiger d<strong>in</strong>glich Nutzungsberechtigter)<br />
nutzt das Grundstück auf Dauer; er ist verfügungsberechtigt<br />
(er kann das Grundstück verkaufen); ihm stehen eventuelle<br />
Wertsteigerungen zu; er kann für die Nutzung se<strong>in</strong>es Eigentums e<strong>in</strong>e<br />
Gegenleistung (Miete oder Pacht) fordern. Die Erschließung dient e<strong>in</strong>em<br />
Grundstück dauernd, der Mieter nutzt das Grundstück nur für<br />
die Zeit der Mietdauer.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund stellt sich die Erschließung als Vorteil für das<br />
Grundstück und damit den Grundstückseigentümer dar. Dieser Vorteil<br />
drückt sich - pauschal - <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er deutlichen Werthaltigkeit, u. U. auch<br />
Wertsteigerung des Grundstückes, aus, die sich als Anschluss an e<strong>in</strong>e<br />
ordnungsgemäße Ver- und Entsorgung oder straßenmäßige Erschließung<br />
präsentiert. Zudem stellt die ordnungsgemäße Erschließung<br />
e<strong>in</strong>es baulich nutzbaren Grundstückes e<strong>in</strong>e Pflicht des Grundstücks-<br />
17<br />
Maßstäbe für<br />
Straßenbaubeiträge<br />
Beitragsschuldner<br />
Vorteil und<br />
Wertzuwachs<br />
für das Grundstück
Zahlungsunfähigkeit<br />
nicht<br />
zu Lasten der<br />
Allgeme<strong>in</strong>heit<br />
Beiträge auch<br />
von „Altanschließern“<br />
eigentümers dar. Der Vorteil - bezogen auf das Grundeigentum - liegt<br />
dar<strong>in</strong>, dass der Eigentümer die Pflicht mit Hilfe des jeweiligen kommunalen<br />
Aufgabenträgers, der die Erschließungsanlagen zur Verfügung<br />
stellt, dauerhaft erfüllen kann. Der Anschluss an die zentrale Wasserversorgungsanlage<br />
stellt e<strong>in</strong>en Vorteil gegenüber dem Hausbrunnen<br />
dar, der Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage e<strong>in</strong>en<br />
Vorteil gegenüber der eigenen Drei-Kammer-Klärgrube und die ausgebaute<br />
Straße gegenüber der schlaglochübersäten oder gegebenenfalls<br />
dem gänzlich unbefestigten Weg.<br />
Warum ruht der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück?<br />
Die beitragspflichtigen Maßnahmen, z. B. die Abwasserbeseitigungsanlagen,<br />
werden als Leistung von der öffentlichen Hand erbracht und<br />
vorf<strong>in</strong>anziert. Kann e<strong>in</strong> Beitrag nicht e<strong>in</strong>gezogen werden, dann geht<br />
dies zu Lasten der Geme<strong>in</strong>schaft der Steuerzahler. Deshalb ist von<br />
Gesetzes wegen festgeschrieben, dass die Beitragsforderung als öffentliche<br />
Last auf dem Grundstück ruht (§ 24 SächsKAG). Dies hat zur<br />
Folge, dass im Falle der Zwangsversteigerung e<strong>in</strong>es Grundstückes, für<br />
das die Beitragsschuld noch nicht oder nicht vollständig beglichen<br />
worden ist, vorrangig die Beitragsforderung der Geme<strong>in</strong>de oder des<br />
Zweckverbandes zu befriedigen ist. Damit wird sichergestellt, dass<br />
die Allgeme<strong>in</strong>heit nicht die f<strong>in</strong>anziellen Folgen des ansonsten „verlorenen”<br />
Beitrages mitzutragen hat. Die Beitragserhebung selbst führt<br />
<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Fall zur Zwangsversteigerung!<br />
Wann entsteht die Beitragsschuld?<br />
Die Beitragsschuld entsteht, sobald das Grundstück an die benutzbare<br />
E<strong>in</strong>richtung angeschlossen werden kann. Voraussetzung ist jedoch,<br />
dass e<strong>in</strong>e Beitragssatzung erlassen wurde. Für bereits angeschlossene<br />
Grundstücke entsteht die Beitragsschuld mit dem Inkrafttreten der<br />
Satzung.<br />
Warum muss auch für bereits angeschlossene Grundstücke e<strong>in</strong><br />
Beitrag gezahlt werden?<br />
Der Vorteil e<strong>in</strong>es Grundstückes aus e<strong>in</strong>er öffentlichen E<strong>in</strong>richtung erschöpft<br />
sich nicht im Anschluss: Er ist dauerhaft und zukunftsgerichtet.<br />
Zielsetzung des Sächsischen <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetzes ist, die entstehenden<br />
Kosten möglichst auf alle Grundstückseigentümer vorteilsgerecht<br />
zu verteilen. Würden die so genannten Altanschließer nicht zu<br />
Beiträgen herangezogen, hätte dies zur Folge, dass unterschiedliche<br />
Gebührensätze festgelegt werden müssten. Zahlen nur die Neuanzu-<br />
18
schließenden e<strong>in</strong>en Beitrag zum Betriebskapital, müssten von den bereits<br />
Angeschlossenen, die <strong>in</strong> der Regel ke<strong>in</strong>e Beiträge gezahlt haben,<br />
aufgrund des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes<br />
(Artikel 3 des Grundgesetzes) höhere Gebühren verlangt werden. Die<br />
unterschiedliche Behandlung von bereits Angeschlossenen und noch<br />
Anzuschließenden würde die Geme<strong>in</strong>den und Zweckverbände darüber<br />
h<strong>in</strong>aus vor große Schwierigkeiten bei der Umsetzung stellen und<br />
hätte erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge.<br />
Was ist, wenn für das Grundstück bereits Beiträge gezahlt<br />
wurden?<br />
Kann der Grundstückseigentümer, z. B. durch Vorlegung der entsprechenden<br />
Belege, nachweisen, dass für das Grundstück bereits Beiträge<br />
gezahlt wurden (<strong>in</strong> der Regel vor 1945), können die gezahlten<br />
Beiträge unter Umständen teilweise auf die Beitragsschuld angerechnet<br />
werden. Das gilt jedoch nur für nachweislich gezahlte Beiträge<br />
und nur sehr e<strong>in</strong>geschränkt für erbrachte Eigenleistungen, z. B. beim<br />
Bau der Kanäle, weil <strong>in</strong> diesen Fällen <strong>in</strong> der Regel das Material gestellt<br />
und die Arbeit entlohnt wurden. War dies nicht der Fall, ist e<strong>in</strong>e Anrechnung<br />
auch hier denkbar, es sei denn, es handelte sich um Hausanschlussleitungen.<br />
E<strong>in</strong>e Pflicht zur Anrechnung bereits gezahlter<br />
Beiträge besteht jedoch nicht (vgl. Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes<br />
Bautzen vom 24.10.1996, Az.: 2 S 175/96, abgedruckt im<br />
<strong>Sachsen</strong>landkurier Nr. 11/1996, Seite 511 [514]).<br />
Muss der Betragspflichtige auch für Fehlplanungen und Überkapazitäten<br />
zahlen?<br />
Überdimensionierte Anlagen s<strong>in</strong>d Ausnahmefälle. Die Kosten für<br />
überdimensionierte Anlagen, deren Überkapazitäten auf objektiv<br />
festgestellten planerischen und prognostischen Fehle<strong>in</strong>schätzungen<br />
beruhen, können nicht auf den Beitrags- und Gebührenzahler<br />
umgelegt werden. Bei Anlagen, die zwar den aktuell zu deckenden<br />
Bedarf überschreiten, deren Reserven sich aber im Rahmen<br />
des vernünftigerweise zu erwartenden und planerisch zu berücksichtigenden<br />
Bedarfs bewegen, liegt ke<strong>in</strong>e Überdimensionierung<br />
vor.<br />
Können die Beiträge an das E<strong>in</strong>kommen gebunden und nach<br />
oben h<strong>in</strong> begrenzt werden?<br />
Ausschlaggebend für die Höhe der Beiträge ist die Höhe des Betriebskapitals.<br />
Es bestimmt ebenfalls die Obergrenze der Beitragssätze.<br />
E<strong>in</strong>e Anb<strong>in</strong>dung des Beitrages an das E<strong>in</strong>kommen, wie z. B. bei K<strong>in</strong>-<br />
19<br />
„Alte” Beiträge<br />
können angerechnet<br />
werden<br />
Ke<strong>in</strong>e Abgaben<br />
für Fehlplanungen<br />
Begrenzung der<br />
Beiträge
Vorauszahlung<br />
Erhebung<br />
weiterer<br />
Beiträge<br />
dergartengebühren, ist nicht zulässig. Diese - nur sehr begrenzt anwendbare<br />
- Verfahrensweise würde e<strong>in</strong>e Abkehr von dem Pr<strong>in</strong>zip<br />
„gleiche Gegenleistung für gleiche Leistung” bedeuten.<br />
Kann die Geme<strong>in</strong>de Vorauszahlungen auf die Beitragsschuld<br />
erheben?<br />
Die Geme<strong>in</strong>de oder der Zweckverband kann angemessene Vorauszahlungen<br />
auf die Beitragsschuld verlangen, sobald mit der Herstellung<br />
der E<strong>in</strong>richtung begonnen worden ist. Diese Vorauszahlung ist<br />
mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen. Ist der Anschluss<br />
an die geme<strong>in</strong>dliche E<strong>in</strong>richtung sechs Jahre nach Bekanntgabe des<br />
Vorauszahlungsbescheides noch nicht entstanden, kann der Beitragspflichtige<br />
die Vorauszahlung zurückfordern.<br />
Beitragserhebung, e<strong>in</strong>e Schraube ohne Ende?<br />
Die Erhebung weiterer Beiträge ist nur dann möglich, wenn<br />
- die zulässige Obergrenze des Betriebskapitals der öffentlichen E<strong>in</strong>richtung<br />
noch nicht erreicht ist,<br />
- der Ausbau der E<strong>in</strong>richtung fortschreitet,<br />
- die Erneuerung der Anlage teuerer ist als die Anschaffungs- und<br />
Herstellungskosten der alten Anlage oder<br />
- sich durch Veränderungen des Leistungsumfanges oder Verr<strong>in</strong>gerung<br />
der geplanten Zuschüsse die ursprünglich vorgesehene F<strong>in</strong>anzierung<br />
nicht verwirklichen lässt.<br />
20
8. Hilfen des <strong>Freistaat</strong>es<br />
Wie hilft der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>, um die Belastungen für die<br />
Bürger zu m<strong>in</strong>dern?<br />
Von 1991 bis Juli 2006 wurden den Geme<strong>in</strong>den und Zweckverbänden<br />
für ihre Aufgaben Tr<strong>in</strong>kwasserversorgung und Abwasserbeseitigung<br />
weit mehr als vier Milliarden Euro zur F<strong>in</strong>anzierung der Investitionen<br />
ausgezahlt. So bewirken z. B. 500 EUR Investitionszuschuss pro E<strong>in</strong>wohner<br />
e<strong>in</strong>e jährliche M<strong>in</strong>derung der Belastung je E<strong>in</strong>wohner um<br />
ca. 40 EUR.<br />
Das Sächsische Staatsm<strong>in</strong>isterium für Umwelt und Landwirtschaft<br />
hat zur weiteren Förderung von Abwasser- und Tr<strong>in</strong>kwasseranlagen,<br />
hierzu zählen auch private Kle<strong>in</strong>kläranlagen und Tr<strong>in</strong>kwasserversorgungsanlagen,<br />
die „Förderrichtl<strong>in</strong>ie Siedlungswasserwirtschaft (SWW<br />
2007)“ beschlossen.<br />
Fördermittel müssen dabei natürlich vorrangig <strong>in</strong> den Fällen e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden, <strong>in</strong> denen es darauf ankommt, die Forderung nach e<strong>in</strong>wandfreiem<br />
Tr<strong>in</strong>kwasser zu erfüllen (z. B. Ersatz von E<strong>in</strong>zelbrunnen bzw.<br />
Sanierung von Tr<strong>in</strong>kwasseranlagen mit Grenzwertüberschreitungen<br />
nach der Tr<strong>in</strong>kwasserverordnung) bzw. dort, wo mit verhältnismäßig<br />
ger<strong>in</strong>gem Mittele<strong>in</strong>satz viele E<strong>in</strong>wohner und sonstige Abwassere<strong>in</strong>leiter<br />
an die Abwasseranlagen angeschlossen werden können.<br />
Unterstützt der <strong>Freistaat</strong> den Wohneigentümer auch unmittelbar?<br />
Trägt der Eigentümer für den eigengenutzten Wohnraum die Belastung<br />
(Grundsteuer, Instandhaltungskosten, Betriebs- und <strong>Verwaltung</strong>skosten)<br />
oder nimmt er zum Kauf, Bau oder Umbau des Gebäudes<br />
oder zur Begleichung von Beitragsforderungen e<strong>in</strong>en Kredit<br />
auf, kann er unter bestimmten Voraussetzungen Wohngeld <strong>in</strong> Form<br />
von Lastenzuschuss erhalten. Nähere Auskünfte erteilt die zuständige<br />
Wohngeldstelle des Landratsamtes bzw. der Stadtverwaltung (bei<br />
Kreisfreien Städten).<br />
21<br />
Prioritäten<br />
setzen<br />
Wohngeld auch<br />
bei kreditf<strong>in</strong>anziertenBeitragsforderungen
Ke<strong>in</strong>e „Enteignung<br />
auf<br />
kaltem Wege”<br />
Vielfältige<br />
Zahlungserleichterungen<br />
Stundung<br />
Erlass<br />
Antrag und<br />
Begründung<br />
erforderlich<br />
9. Zahlungserleichterungen<br />
Muss ich me<strong>in</strong> Grundstück zur Begleichung der Beitragsschuld<br />
verkaufen oder kann es sogar zwangsversteigert werden?<br />
Niemand braucht um se<strong>in</strong> Eigentum zu fürchten. Auch die kommunalen<br />
Aufgabenträger haben den im gesamten Abgabenrecht geltenden<br />
Grundsatz zu beachten, dass auf die wirtschaftliche und persönliche<br />
Situation des Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen ist.<br />
Der Gebührenschuldner darf durch die Abgabenerhebung <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
persönlichen oder wirtschaftlichen Existenz weder vernichtet noch<br />
ernsthaft gefährdet werden. Das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz<br />
bietet daher Möglichkeiten zur sozial verträglichen Gestaltung<br />
der Gebühren und Beiträge. Bei deren konkreter Ausgestaltung haben<br />
die kommunalen Aufgabenträger jedoch e<strong>in</strong>en gewissen Ermessenspielraum.<br />
Welche Möglichkeiten der Zahlungserleichterung gibt es?<br />
Stundung und Erlass s<strong>in</strong>d Formen der Zahlungserleichterungen (Billigkeitsmaßnahmen),<br />
die gesetzlich vorgesehen s<strong>in</strong>d und im Bedarfsfall<br />
gewährt werden können, wenn die entsprechenden Voraussetzungen<br />
vorliegen. Sie gelten für Beiträge und Gebühren gleichermaßen.<br />
Ist die Abgabenforderung durch Bescheid bereits entstanden, kann<br />
sie gegen Z<strong>in</strong>sen (Regel) oder z<strong>in</strong>slos (Ausnahme) gestundet werden,<br />
das heißt, die Fälligkeit wird <strong>in</strong> die Zukunft verschoben (§ 222 der<br />
Abgabenordnung - AO). Oft haben die kommunalen Aufgabenträger<br />
die konkreten Bed<strong>in</strong>gungen hierfür e<strong>in</strong>heitlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Stundungsrichtl<strong>in</strong>ie<br />
festgelegt.<br />
E<strong>in</strong>e besondere Form der Stundung ist die Ratenzahlung. Ist z. B. e<strong>in</strong>e<br />
Beitragsforderung <strong>in</strong> Höhe von 3.000 EUR entstanden, kann dem<br />
Beitragsschuldner e<strong>in</strong>geräumt werden, die Forderung z. B. <strong>in</strong> 12 Monatsraten<br />
von 250 EUR zu begleichen. Die jeweilige Restschuld kann<br />
verz<strong>in</strong>st werden oder aber die Z<strong>in</strong>sschuld wird erlassen.<br />
Der Erlass e<strong>in</strong>er Beitrags- oder Gebührenschuld kommt <strong>in</strong> der Praxis<br />
nur <strong>in</strong> äußerst seltenen Fällen als letztes Mittel <strong>in</strong> Betracht (§ 227 AO).<br />
Für Beiträge spielt er kaum e<strong>in</strong>e Rolle.<br />
In beiden Fällen ist der Abgabenschuldner gehalten, gegenüber dem<br />
Abgabenberechtigten (Kommune oder Zweckverband) nachzuweisen,<br />
dass se<strong>in</strong>e wirtschaftliche Situation angespannt ist und e<strong>in</strong>e<br />
Stundung oder e<strong>in</strong> Erlass <strong>in</strong> Frage kommt. Der Abgabenpflichtige<br />
22
muss dazu se<strong>in</strong>e Vermögensverhältnisse offen legen. Stundung und<br />
Erlass werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Wird der Antrag<br />
abgelehnt, kann Widerspruch e<strong>in</strong>gelegt und gegebenenfalls Klage<br />
vor dem <strong>Verwaltung</strong>sgericht erhoben werden. Die Klage kann aber<br />
im Fall des Unterliegens mit Kosten verbunden se<strong>in</strong>.<br />
Ausschließlich für den Beitrag sieht das Sächsische <strong>Kommunalabgaben</strong>gesetz<br />
noch folgende Möglichkeiten e<strong>in</strong>er Zahlungserleichterung vor:<br />
- Ratenweise Entstehung des Beitrages:<br />
In der Beitragssatzung kann bestimmt werden, dass die Beitragsschuld<br />
<strong>in</strong> mehreren Raten entsteht (§ 22 Abs. 3 SächsKAG). So kann<br />
z. B. e<strong>in</strong>e Beitragsschuld von 6.000 EUR <strong>in</strong> drei Raten von 2.000 EUR<br />
entstehen. Der Beitragsschuldner erhält dann also <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em bestimmten<br />
zeitlichen Abstand drei Beitragsbescheide über jeweils 2.000 EUR.<br />
Jeder dieser Bescheide kann für sich angefochten werden. Mit der<br />
ratenweisen Entstehung der Beitragsschuld entlastet die Kommune<br />
oder der Zweckverband den Beitragspflichtigen, <strong>in</strong>dem von ihm<br />
- losgelöst von dessen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit - der Beitrag<br />
<strong>in</strong> mehreren, <strong>in</strong> der Höhe und im Zeitpunkt festgelegten Raten<br />
gefordert wird.<br />
- Verrentung der Beitragsschuld:<br />
Der Beitragsberechtigte (Kommune oder Zweckverband) kann zulassen,<br />
dass der Beitrag <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er Rente gezahlt wird (§ 22 Abs. 4<br />
SächsKAG). Dies muss nicht <strong>in</strong> der Satzung verankert se<strong>in</strong>. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
wird diese Möglichkeit nur bei mangelnder wirtschaftlicher Leistungskraft<br />
des Beitragsschuldners eröffnet. Der bereits durch Bescheid festgesetzte<br />
Beitrag wird auf schriftlichen Antrag des Beitragsschuldners<br />
durch e<strong>in</strong>en weiteren Bescheid <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Schuld umgewandelt, die <strong>in</strong><br />
höchstens zehn Jahresleistungen zu entrichten ist. Der neue Bescheid<br />
bestimmt Höhe und Fälligkeit der Jahresleistungen. So kann z. B. e<strong>in</strong><br />
Beitrag von 5.000 EUR <strong>in</strong> 10 Jahresraten von 500 EUR beglichen werden.<br />
Der Restbetrag soll jährlich verz<strong>in</strong>st werden.<br />
23<br />
Ratenweise<br />
Entstehung<br />
Verrentung auf<br />
bis zu zehn<br />
Jahren
Betroffene<br />
dürfen Akten<br />
e<strong>in</strong>sehen<br />
E<strong>in</strong>wohner müssen<br />
<strong>in</strong>formiert<br />
werden<br />
Petitionsrecht<br />
Hilfe <strong>in</strong> <strong>Verwaltung</strong>sverfahren<br />
10. Aktene<strong>in</strong>sicht, Informations und<br />
Beteiligungsrechte<br />
Muss die Kommune oder der Zweckverband E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> die Kalkulationsunterlagen<br />
gewähren?<br />
JA. Jeder Beitrags- und Gebührenpflichtige ist als Adressat e<strong>in</strong>es Beitrags-<br />
oder Gebührenbescheides Beteiligter <strong>in</strong> dem <strong>Verwaltung</strong>sverfahren,<br />
das die Beitrags- und Gebührenerhebung zum Ziel hat. In<br />
dieser Eigenschaft hat er das Recht, alle Unterlagen e<strong>in</strong>zusehen, die<br />
Grundlage für die Beitrags- oder Gebührenerhebung s<strong>in</strong>d (vgl. § 1 des<br />
<strong>Verwaltung</strong>sverfahrensgesetzes für den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> und § 29<br />
Abs. 1 des <strong>Verwaltung</strong>sverfahrensgesetzes des Bundes). Dazu zählen<br />
<strong>in</strong>sbesondere auch die Kalkulationsunterlagen.<br />
Welche Informations und Beteiligungsrechte stehen den E<strong>in</strong>wohnern<br />
darüber h<strong>in</strong>aus zu?<br />
Die E<strong>in</strong>wohner s<strong>in</strong>d frühzeitig und umfassend zu <strong>in</strong>formieren, wenn<br />
Planungen und Vorhaben der Geme<strong>in</strong>de die sozialen, kulturellen,<br />
ökologischen oder wirtschaftlichen Belange der E<strong>in</strong>wohner berühren<br />
(§ 11 Abs. 2 SächsGemO). Mit dieser Vorschrift wird e<strong>in</strong>e Informationspflicht<br />
der Geme<strong>in</strong>de, jedoch ke<strong>in</strong> (e<strong>in</strong>klagbarer) Anspruch des<br />
e<strong>in</strong>zelnen E<strong>in</strong>wohners festgeschrieben. Wenn Vorhaben beitrags- und<br />
gebührenrelevant und nicht nur von ganz untergeordneter Bedeutung<br />
s<strong>in</strong>d, muss die Geme<strong>in</strong>de die Bürger entsprechend <strong>in</strong>formieren.<br />
Dies kann im Rahmen e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>wohnerversammlung geschehen oder<br />
aber auch durch Berichte im Amtsblatt.<br />
Den Geme<strong>in</strong>dee<strong>in</strong>wohnern steht e<strong>in</strong> Petitionsrecht zu. Die Geme<strong>in</strong>den<br />
s<strong>in</strong>d verpflichtet, sich mit den Petitionen zu befassen und sie<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Frist, grundsätzlich nach sechs Wochen,<br />
sachlich zu bescheiden (§ 12 SächsGemO). Die Petition darf<br />
Vorschläge, Bitten und Beschwerden zum Gegenstand haben. Sie ist<br />
jedoch ke<strong>in</strong> förmlicher Rechtsbehelf und kann e<strong>in</strong> förmliches <strong>Verwaltung</strong>sverfahren<br />
nicht ersetzen oder dazu dienen, e<strong>in</strong>e umfassende,<br />
kostenlose Rechtsberatung zu erhalten.<br />
Entsprechendes gilt auch für Landkreise und Zweckverbände.<br />
Die Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d ferner verpflichtet, den E<strong>in</strong>wohnern bei der E<strong>in</strong>leitung<br />
von <strong>Verwaltung</strong>sverfahren behilflich zu se<strong>in</strong> (§ 13 Abs.1 Sächs-<br />
GemO). Zu den <strong>Verwaltung</strong>sverfahren zählt auch der Widerspruch<br />
gegen <strong>Verwaltung</strong>sakte, also u. a. Gebühren- und Beitragsbescheide,<br />
selbst wenn über den Widerspruch nicht die Geme<strong>in</strong>de entscheidet.<br />
24
Die Geme<strong>in</strong>de ist verpflichtet, bei der E<strong>in</strong>legung des Widerspruchs<br />
auf die E<strong>in</strong>haltung der Zulässigkeitsvoraussetzungen zu achten. Die<br />
Geme<strong>in</strong>de ist nur im Rahmen ihrer <strong>in</strong>dividuellen Möglichkeiten zur<br />
Unterstützung verpflichtet. Zur Rechtsberatung s<strong>in</strong>d die Geme<strong>in</strong>den<br />
nicht berechtigt.<br />
Gemäß § 44 Abs. 3 SächsGemO können der Geme<strong>in</strong>derat und se<strong>in</strong>e<br />
Ausschüsse bei öffentlichen Sitzungen E<strong>in</strong>wohnern und den ihnen<br />
gleichgestellten Personen (§ 10 Abs. 3 SächsGemO) sowie Vertretern<br />
von Bürger<strong>in</strong>itiativen die Möglichkeit e<strong>in</strong>räumen, Fragen zu Geme<strong>in</strong>deangelegenheiten<br />
zu stellen sowie Anregungen und Vorschläge<br />
zu unterbreiten (Fragestunde). Zu den Fragen nimmt der Vorsitzende<br />
oder e<strong>in</strong> von ihm Beauftragter Stellung. Werden also beitrags-<br />
und gebührenrelevante Maßnahmen im Geme<strong>in</strong>derat und se<strong>in</strong>en<br />
Ausschüssen beraten, kann auch diese Form der Bürgerbeteiligung<br />
s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>. Insbesondere kann auf diese Weise der Dialog mit den<br />
Bürger<strong>in</strong>itiativen gesucht werden. Ihre ausdrückliche Benennung <strong>in</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>deordnung macht deutlich, dass den Bürger<strong>in</strong>itiativen <strong>in</strong>soweit<br />
e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung zukommt.<br />
Der Geme<strong>in</strong>derat und se<strong>in</strong>e Ausschüsse können bei der Vorbereitung<br />
wichtiger Entscheidungen betroffenen Personen und Personengruppen<br />
Gelegenheit geben, ihre Auffassung vorzutragen (Anhörung,<br />
§ 44 Abs. 4 SächsGemO). Auch von dieser Möglichkeit sollte Gebrauch<br />
gemacht werden. Sowohl die Fragestunde als auch die Anhörung<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> das Ermessen des Geme<strong>in</strong>derates und se<strong>in</strong>er Ausschüsse<br />
gestellt.<br />
Entsprechendes gilt auch hier für Landkreise und Zweckverbände.<br />
25<br />
Bürgerfragestunde<br />
Bürgeranhörung
Der beste<br />
Prozess ist derjenige,<br />
der nicht<br />
nötig ist!<br />
Überprüfung<br />
der Satzung<br />
11. Rechtsschutz<br />
Wie kann ich mich gegen die Beitrags und Gebührenerhebung<br />
wehren?<br />
Zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten hat das Sächsische Staatsm<strong>in</strong>isterium<br />
des Innern die Maßnahmenträger gebeten, die Bürger<br />
vorab - gegebenenfalls durch Übersendung von Bescheidentwürfen -<br />
darüber zu unterrichten, welche Beitragsbelastung auf sie zukommt.<br />
Der Beitragspflichtige wird dadurch <strong>in</strong> die Lage versetzt, sich rechtzeitig<br />
auf die Beitragsforderung e<strong>in</strong>zustellen, sei es durch Kapitalbeschaffung,<br />
sei es durch Vorbereitung e<strong>in</strong>es Antrages auf Gewährung<br />
e<strong>in</strong>er Billigkeitsmaßnahme, z. B. e<strong>in</strong>er Stundung. E<strong>in</strong> derartiger „Vorabbescheid”<br />
oder „Bescheidentwurf” ist nicht anfechtbar, er dient<br />
lediglich der Vorbereitung des endgültigen und anfechtbaren Beitragsbescheides.<br />
Wird e<strong>in</strong> Rechtsstreit unvermeidlich, stehen dem Abgabenpflichtigen<br />
grundsätzlich zwei Wege offen, sich gegen mögliche Rechtsverletzungen<br />
zu wehren:<br />
- das Normenkontrollverfahren und<br />
- das Widerspruchsverfahren mit anschließender Anfechtungsklage<br />
vor dem <strong>Verwaltung</strong>sgericht.<br />
a) Normenkontrollverfahren (§ 47 der <strong>Verwaltung</strong>sgerichtsordnung<br />
- VwGO - <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit § 24 des Sächsischen Justizgesetzes -<br />
SächsJG)<br />
Auch ohne von e<strong>in</strong>em Beitrags- oder Gebührenbescheid bereits<br />
betroffen zu se<strong>in</strong>, hat der Bürger die Möglichkeit, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>stufigen<br />
Verfahren vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht die<br />
Beitrags- oder die Gebührensatzung, die ihn betreffen könnte, auf<br />
die Vere<strong>in</strong>barkeit mit höherrangigem Recht überprüfen zu lassen.<br />
Antragsberechtigt ist jede natürliche (Bürger) oder juristische Person<br />
(Unternehmen), die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder<br />
deren Anwendung <strong>in</strong> ihren Rechten verletzt zu se<strong>in</strong> oder <strong>in</strong> absehbarer<br />
Zeit verletzt zu werden. Ist der Bürger beispielsweise der Auffassung,<br />
der Verteilungsmaßstab sei nicht rechtens, kann er unter H<strong>in</strong>weis<br />
auf e<strong>in</strong>en möglichen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz<br />
das Normenkontrollverfahren anstrengen.<br />
26
) Widerspruchsverfahren mit anschließender Anfechtungsklage<br />
vor dem <strong>Verwaltung</strong>sgericht (§§ 42, 68 ff. VwGO)<br />
Die weitaus größere praktische Bedeutung für den Abgabenpflichtigen<br />
hat die Anfechtungsklage, nicht zuletzt deshalb, weil auch <strong>in</strong><br />
diesem Verfahren die Vere<strong>in</strong>barkeit der Satzung mit höherrangigem<br />
Recht geprüft wird, zum<strong>in</strong>dest sofern der Beitrags- oder Gebührenschuldner<br />
Entsprechendes vorträgt.<br />
Der Anfechtungsklage ist e<strong>in</strong> Vorverfahren (Widerspruchsverfahren)<br />
vorgeschaltet. Hierbei handelt es sich um e<strong>in</strong> re<strong>in</strong>es <strong>Verwaltung</strong>sverfahren.<br />
Der Widerspruch gegen den Beitrags- oder Gebührenbescheid<br />
kann <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Monats nach dessen Bekanntgabe entweder bei<br />
der Behörde, die den Abgabenbescheid erlassen hat, oder aber bei<br />
der Widerspruchsbehörde e<strong>in</strong>gelegt werden. Geht der Abgabenbescheid<br />
dem Bürger z. B. am 1. Oktober zu, dann muss er bis zum<br />
darauf folgenden 1. November Widerspruch e<strong>in</strong>gelegt haben. Maßgebend<br />
für die E<strong>in</strong>haltung der Frist ist der Zugang des Widerspruchs<br />
bei der Behörde, nicht der Absendetag oder der Poststempel.<br />
Hat die Geme<strong>in</strong>de, der Landkreis oder der Zweckverband versäumt,<br />
den Abgabenbescheid - wie allgeme<strong>in</strong> erforderlich - mit e<strong>in</strong>er Rechtsbehelfsbelehrung<br />
zu versehen oder ist diese unvollständig oder fehlerhaft,<br />
beg<strong>in</strong>nt die Monatsfrist nicht zu laufen. Der Abgabenpflichtige<br />
hat dann die Möglichkeit, <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Jahres Widerspruch zu<br />
erheben.<br />
Die zuständige Behörde, die den Bescheid erlassen hat, ist vor Durchführung<br />
des Widerspruchsverfahrens verpflichtet, ihre Entscheidung<br />
nach Maßgabe des Widerspruchsbegehrens zu überprüfen. Sie kann<br />
ihre Entscheidung ändern und dem Widerspruch des Betroffenen abhelfen<br />
oder aber veranlassen, dass im Falle der Nichtabhilfe e<strong>in</strong>e Entscheidung<br />
im Widerspruchsverfahren erfolgt (vgl. zur Zuständigkeit:<br />
Grundsätzlich § 73 der VwGO).<br />
Erhält der Abgabenpflichtige e<strong>in</strong>en Widerspruchsbescheid, dann hat<br />
er wiederum <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Monats die Möglichkeit, gegen den Ausgangsbescheid,<br />
also den Gebühren- oder Beitragsbescheid, Anfechtungsklage<br />
vor dem <strong>Verwaltung</strong>sgericht zu erheben (Hauptsacheverfahren).<br />
Die <strong>Verwaltung</strong>sgerichte haben den Sachverhalt - anders als<br />
im Zivilprozess - von Amts wegen zu ermitteln.<br />
Wird die Anfechtungsklage vor dem <strong>Verwaltung</strong>sgericht abgewiesen,<br />
kann vor dem Oberverwaltungsgericht Berufung e<strong>in</strong>gelegt werden,<br />
wenn sie vom Oberverwaltungsgericht auf entsprechenden Antrag<br />
27<br />
Überprüfen<br />
des Beitragsbescheides<br />
Vorverfahren<br />
erforderlich<br />
Abhilfe oder<br />
Widerspruchsbescheid<br />
Sachaufklärung<br />
durch das <strong>Verwaltung</strong>sgericht
Zahlungsverpflichtung<br />
trotz<br />
Widerspruchs<br />
Vorläufiger<br />
Rechtsschutz<br />
zugelassen worden ist. Das Oberverwaltungsgericht ist, sofern Landesrecht<br />
im Streit steht, die letzte Instanz. Werden bundesgesetzliche<br />
Regelungen verletzt, besteht die Möglichkeit, Revision beim Bundesverwaltungsgericht<br />
e<strong>in</strong>zulegen. Im Erschließungsbeitragsrecht<br />
ist dies, weil es sich um Bundesrecht (Baugesetzbuch) handelt, stets<br />
möglich. Weder im Widerspruchsverfahren noch <strong>in</strong> den Verfahren<br />
vor dem <strong>Verwaltung</strong>sgericht besteht Anwaltszwang (die Verpflichtung,<br />
sich von e<strong>in</strong>em Anwalt vertreten zu lassen). Jeder Bürger kann<br />
sich, sofern er dazu <strong>in</strong> der Lage ist, selbst vertreten (lediglich vor dem<br />
Oberverwaltungsgericht und dem Bundesverwaltungsgericht besteht<br />
Anwaltszwang). Gew<strong>in</strong>nt er den Prozess, entstehen ihm ke<strong>in</strong>e Kosten<br />
und der bereits geleistete Beitrag ist ihm zurückzuzahlen. Unterliegt<br />
er, dann muss er sowohl im Widerspruchsverfahren als auch im<br />
Gerichtsverfahren die Kosten tragen. Es kann Prozesskostenhilfe gewährt<br />
werden, wenn die Kosten der Prozessführung aus persönlichen<br />
oder wirtschaftlichen Gründen nicht oder nur zum Teil aufgebracht<br />
werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die beabsichtigte<br />
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung h<strong>in</strong>reichend Aussicht auf<br />
Erfolg bietet und nicht mutwillig ersche<strong>in</strong>t. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung<br />
gelten entsprechend. Die Prozesskostenhilfe muss<br />
beim zuständigen Gericht beantragt werden.<br />
Der Widerspruch hat bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben<br />
und Kosten ke<strong>in</strong>e aufschiebende Wirkung. Er bewirkt also ke<strong>in</strong>en<br />
Zahlungsaufschub. Der Beitrag bzw. die Gebühr muss - trotz E<strong>in</strong>legung<br />
von Rechtsbehelfen - also zunächst bezahlt werden.<br />
Will der Abgabenpflichtige die Zahlung bis zu e<strong>in</strong>er Entscheidung im<br />
Rechtsbehelfsverfahren verh<strong>in</strong>dern, muss er bei der Kommune oder<br />
dem Zweckverband e<strong>in</strong>en Antrag auf Aussetzung der Vollziehung<br />
stellen. Wird diesem Antrag stattgegeben, braucht er den Beitrag so<br />
lange nicht zu bezahlen, bis das Hauptsacheverfahren endgültig entschieden<br />
ist. Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, dann<br />
kann er beim <strong>Verwaltung</strong>sgericht mit dem gleichen Ziel e<strong>in</strong>en Antrag<br />
auf vorläufigen Rechtsschutz stellen. Das <strong>Verwaltung</strong>sgericht kann<br />
nur dann unmittelbar angerufen werden, wenn die Kommune oder<br />
der Zweckverband über den Antrag ohne Mitteilung e<strong>in</strong>es triftigen<br />
Grundes <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er angemessenen Frist nicht entschieden hat<br />
oder e<strong>in</strong>e Vollstreckung droht. Das vorläufige Rechtsschutzverfahren<br />
kann durch das Rechtsmittel der Beschwerde bis vor das Oberverwaltungsgericht<br />
gebracht werden.<br />
28
12. Ansprechpartner<br />
An wen kann ich mich bei Problemen wenden?<br />
Ansprechpartner bzw. „erste Anlaufstelle“ ist grundsätzlich die Geme<strong>in</strong>de<br />
bzw. der Zweckverband, der für die Wasserversorgung oder<br />
die Abwasserbeseitigung zuständig ist. Bei Straßenbaumaßnahmen<br />
ist es die jeweilige Geme<strong>in</strong>de, bei Abfallangelegenheiten der Landkreis<br />
als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger oder ggf. der betreffende<br />
Abfallzweckverband. Soweit Fragen zu e<strong>in</strong>em konkreten<br />
Gebührenbescheid bestehen, ist es s<strong>in</strong>nvoll, die zuständige behördliche<br />
Stelle anzusprechen, die den Bescheid erlassen hat. Bei Unsicherheiten<br />
im H<strong>in</strong>blick auf die Zuständigkeit kann man sich auch stets<br />
mit Anliegen an die jeweiligen Bürgerreferenten wenden, die bei den<br />
Behörden angesiedelt s<strong>in</strong>d. Sie leiten die schriftliche oder mündliche<br />
Anfrage auf jeden Fall an die richtige Stelle weiter. Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
stehen <strong>in</strong> bedeutsamen E<strong>in</strong>zelfällen die Landesdirektionen für Anfragen<br />
zur Verfügung.<br />
29<br />
Ansprechpartner<br />
Kommune/<br />
Zweckverband
Impressum<br />
Herausgeber: Sächsisches Staatsm<strong>in</strong>isterium des Innern,<br />
Wilhelm-Buck-Str. 2,<br />
01097 Dresden<br />
Telefon: (03 51) 5 64 30 40,<br />
Fax: (03 51) 5 64 30 49<br />
Redaktion: Abteilung 2, Recht und <strong>Kommunale</strong>s<br />
Redaktionsschluss: 05/2008<br />
Auflage: 4. Auflage,10.000 Stück<br />
Fotomaterial: Titelseite (v.l.n.r.) Andre Günther [view7], Jakobus, Otto Durst,<br />
bobroy20, S. 1 u. 2 J. Fahrak, S. 3 u. 10 BILLY WELLBORN,<br />
S. 4 u. 5 Michael Kempf, S. 6 - 9 pmphoto, S. 11 - 13 ElenaR,<br />
S. 14 - 20 M.W., S. 21 Digitalpress, S. 22 u. 23 Thomas Aumann,<br />
S. 24 u. 25 Hans-Joachim Roy, S. 26 - 28 Haramis Kalfar,<br />
S. 29 Dusaleev V., alle Fotos Fotolia.com (außer S. 1 u. 2)<br />
Diese Broschüre wird kostenlos abgegeben.<br />
Verteilerh<strong>in</strong>weis:<br />
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen<br />
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie<br />
darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs<br />
Monaten vor e<strong>in</strong>er Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für<br />
alle Wahlen.<br />
Missbräuchlich ist <strong>in</strong>sbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen<br />
der Parteien sowie das E<strong>in</strong>legen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer<br />
Informationen oder Werbemittel.<br />
Untersagt ist auch die Weitergabe zur Verwendung bei der Wahlwerbung.<br />
Auch ohne zeitlichen Bezug zu e<strong>in</strong>er bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift<br />
nicht so verwendet werden, dass dies als Parte<strong>in</strong>ahme der Herausgeber zugunsten<br />
e<strong>in</strong>zelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.<br />
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon,<br />
auf welchem Weg und <strong>in</strong> welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen<br />
ist.<br />
Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder<br />
zu verwenden.


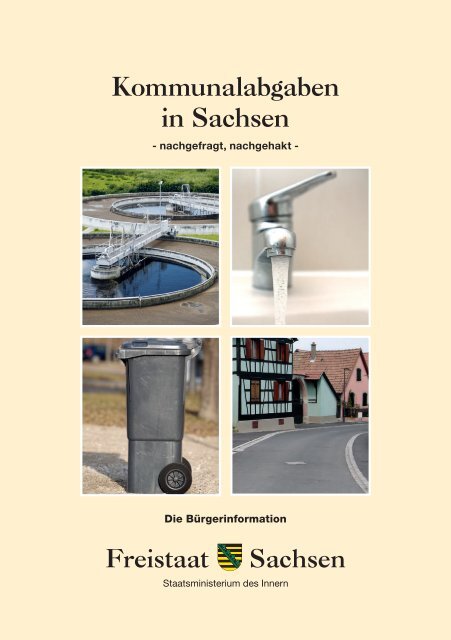

![(Stand 5. November 2013) [Download,*.pdf, 0,80 MB] - Kommunale ...](https://img.yumpu.com/23915246/1/184x260/stand-5-november-2013-downloadpdf-080-mb-kommunale-.jpg?quality=85)







![Nutzung der Rosenholz-Dateien (Anlage) [Download,*.pdf, 0,03 MB]](https://img.yumpu.com/23915228/1/184x260/nutzung-der-rosenholz-dateien-anlage-downloadpdf-003-mb.jpg?quality=85)




