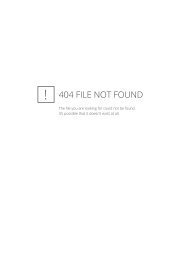Landesbetriebe gemäß § 26 Absatz 1 LHO - Jan Quast
Landesbetriebe gemäß § 26 Absatz 1 LHO - Jan Quast
Landesbetriebe gemäß § 26 Absatz 1 LHO - Jan Quast
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
BÜRGERSCHAFT<br />
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG<br />
Drucksache 20/737<br />
20. Wahlperiode 05.07.11<br />
Große Anfrage<br />
der Abgeordneten <strong>Jan</strong> <strong>Quast</strong>, Thomas Völsch, Andrea Rugbarth,<br />
Barbara Duden, Erck Rickmers, Ksenija Bekeris, Dr. Martin Schäfer,<br />
Dr. Mathias Petersen, Matthias Albrecht, Metin Hakverdi, Dr. Monika Schaal,<br />
Peri Arndt, Dr. Sven Tode, Sylvia Wowretzko (SPD) und Fraktion vom 09.06.11<br />
und Antwort des Senats<br />
Betr.: <strong>Landesbetriebe</strong> <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> <strong>26</strong> <strong>Absatz</strong> 1 <strong>LHO</strong> und netto-veranschlagte Einrichtungen<br />
<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
In den vergangenen Jahren wurden von der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
vermehrt Behördeneinheiten in <strong>Landesbetriebe</strong> (LB) <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> <strong>26</strong> <strong>Absatz</strong> 1<br />
der Landeshaushaltsordnung (<strong>LHO</strong>) oder in netto-veranschlagte Einrichtungen<br />
<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> umgewandelt. Zusätzlich zu den seit 2003<br />
neu gegründeten <strong>Landesbetriebe</strong>n verfügt die Freie und Hansestadt Hamburg<br />
über andere, zum Teil bereits seit Jahrzehnten bestehende, <strong>Landesbetriebe</strong>.<br />
Weder für die älteren, noch für die neu gegründeten <strong>Landesbetriebe</strong><br />
und Einrichtungen gibt es eine transparente und systematische Berichterstattung.<br />
Eine systematische Bewertung der Umwandlungen seit 2003 hat nicht<br />
stattgefunden. Auch die Antworten des Senats auf die Große Anfrage der<br />
SPD-Fraktion (Drs. 19/3570) waren lückenhaft.<br />
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:<br />
I. zu einzelnen <strong>Landesbetriebe</strong>n (<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> <strong>26</strong> <strong>Absatz</strong> 1 <strong>LHO</strong>):<br />
1. LB Erziehung und Berufsbildung<br />
Der Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung (LEB) existiert seit<br />
1985. Der LEB ist unter anderem zuständig für Jugendhilfe, Jugendberufshilfe,<br />
Unterstützung von Familien bei der Erziehung.<br />
a. Wie lautet das Zielbild und wie das Unternehmens- und Organisationskonzept<br />
des Landesbetriebs?<br />
Das aktuelle Zielbild lautet:<br />
„Der Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung (LEB) soll in erster Linie Aufgaben<br />
mit besonderer Bedeutung für die Freie und Hansestadt Hamburg übernehmen. Eine<br />
quantitative Ausweitung des Betriebes soll nicht stattfinden, wohl aber sind qualitative<br />
Anpassungen an die sich verändernden Strukturen der Hamburger Jugendhilfe möglich.<br />
Diese strategische Linie bedeutet im Detail:<br />
Im Geschäftsbereich Jugendhilfe wird der LEB mit speziellen Aufgaben beauftragt, die<br />
aus Sicht der Aufsicht führenden Behörde eine besondere fachpolitische Bedeutung<br />
haben (sog. Kernarbeitsbereich). Es handelt sich um Leistungen, die in engem Zusammenhang<br />
mit Maßnahmen der Krisenintervention der Jugendämter in besonderen<br />
Situationen stehen. Der LEB als Dienststelle der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
stellt die Erbringung dieser Leistungen jederzeit sicher. Hierzu gehören zurzeit
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
- der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) als Basis-Krisendienst in der Hamburger<br />
Jugendhilfe,<br />
- die Kinderschutzhäuser als Tag und Nacht bereite Inobhutnahme- und Betreuungseinrichtungen<br />
für Säuglinge und Kleinkinder,<br />
- die Erstversorgungseinrichtungen für die Inobhutnahme von minderjährigen,<br />
unbegleiteten Flüchtlingen.<br />
Darüber hinaus realisiert der LEB im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
jugendpolitische Maßnahmen, die mit anderen Partnern nicht oder nicht in der gewünschten<br />
Weise erreicht werden können.<br />
Aufgaben mit besonderem fachpolitischem Nutzen für andere Behörden sollen unter<br />
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips nur übernommen werden, wenn ihre<br />
Finanzierung durch die fachpolitisch verantwortliche Behörde gesichert ist. Hierzu<br />
gehört zurzeit nur die von der Justizbehörde genutzte und finanzierte Einrichtung zur<br />
jugendgerichtlichen Unterbringung.<br />
Weitere Angebote der Hilfen zur Erziehung werden nur in dem Umfang betrieben, wie<br />
sie von den Jugendämtern im Rahmen der Jugendhilfeplanung und Belegungspraxis<br />
nachgefragt bzw. von der Fachbehörde aus besonderen fachlichen Gründen gewünscht<br />
werden, soweit ihr Betrieb sich wirtschaftlich realisieren lässt.<br />
Im Geschäftsbereich Berufliche Bildung erbringt der LEB Leistungen der Jugendberufshilfe<br />
sowie Qualifizierungsmaßnahmen für junge Menschen. Für die Aufgaben dieses<br />
Geschäftsbereiches trägt die Aufsicht führende Behörde nicht die fachpolitische<br />
Verantwortung, so dass hier enge Abstimmungen hinsichtlich der fachlichen Ausrichtung<br />
mit der Behörde für Schule und Berufsbildung erforderlich sind.“<br />
Ein darüber hinausgehendes Unternehmenskonzept liegt nicht vor. Die operative<br />
Tätigkeit des Betriebes wird <strong>gemäß</strong> der geltenden Geschäftsordnung mit der Aufsicht<br />
führenden Behörde abgestimmt. Organisatorisch ist der Betrieb gegliedert in zwei<br />
Geschäftsbereiche (Jugendhilfe mit sechs Abteilungen und Berufliche Bildung) sowie<br />
in zwei Administrationsabteilungen (Betriebswirtschaft und Finanzen sowie Personal<br />
und Organisation). Durch die Auflösung des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung<br />
zum 31. Juli 2011 ist eine Reorganisation erforderlich, die zum 1. <strong>Jan</strong>uar 2012 erfolgen<br />
wird.<br />
2<br />
b. Wann wurden diese jeweils vorgelegt und wann mit der Aufsicht führenden<br />
Behörde erstmals vereinbart?<br />
Ein erstes Zielbild wurde 1997 entwickelt und mit dem Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr<br />
1998 vorgelegt.<br />
c. Welche Veränderungen hat es wann am ursprünglichen Zielbild beziehungsweise<br />
dem Unternehmens- und Organisationskonzept des<br />
<strong>Landesbetriebe</strong>s aus welchen Gründen gegeben?<br />
Aktualisierungen wurden vor der Aufstellung der Wirtschaftspläne 2002 und 2005/<br />
2006 vorgenommen und in diesen veröffentlicht. In der Folge wurde das Zielbild an<br />
veränderte betriebliche Verhältnisse angepasst (Schließung der Geschlossenen Unterbringung<br />
Feuerbergstraße) beziehungsweise wird angepasst werden (Schließung<br />
des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung).<br />
d. Welche der Ziele, die mit der Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s verfolgt<br />
wurden, wurden durch welche Maßnahmen bereits erreicht?<br />
Ein vorrangiges Ziel der Gründung des LEB war die Umsetzung der sogenannten<br />
Heimreform, also der Umbau herkömmlicher Erziehungsheime zu pädagogisch zeit<strong>gemäß</strong>en<br />
Betreuungseinrichtungen. Mit der besonderen Betriebsform sollten auch die<br />
bürokratischen Hemmnisse der in Behördenstrukturen eingebundenen Erziehungsheime<br />
und Berufsbildungseinrichtungen abgebaut werden. Vielmehr sollten sie in einer<br />
eigenen Organisation alle erforderlichen Entscheidungskompetenzen erhalten, um<br />
den Alltagsbedürfnissen schnell und flexibel gerecht werden zu können.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Diese betriebswirtschaftlich orientierte Organisationsform wurde außerdem gewählt,<br />
weil sich eigenverantwortliches Handeln auch in kaufmännisch gebuchten Wirtschaftsergebnissen<br />
zeigen sollte. Die Leistungen des Landesbetriebs konnten mit Pflegesätzen<br />
vergütet werden, und der Betrieb sollte künftig sehr viel besser mit Freien Trägern<br />
vergleichbar sein.<br />
Die Heimreform galt bereits zu Beginn der 1990er Jahre als umgesetzt. Dies war in<br />
dieser Geschwindigkeit vor allem auch durch die größere betriebswirtschaftliche Flexibilität<br />
möglich. Zum 1. <strong>Jan</strong>uar 1998 wurde der Kompetenzbereich des Betriebes nochmals<br />
erweitert, in dem er die Dienststelleneigenschaft und damit die Hoheit über Personalentscheidungen<br />
und die Möglichkeit zur direkten Kooperation mit dem Personalrat<br />
erhielt. Das Instrument der fachbehördlichen Globalsteuerung wurde in der Folge<br />
ausgebaut. Auf dieser Basis konnte der zweite große Umstrukturierungsschritt, die<br />
erhebliche Verringerung der Betriebskapazitäten ab 2003, erfolgreich umgesetzt werden.<br />
Die betriebswirtschaftliche Flexibilität ermöglicht es auch, auf wechselnde Anforderungen<br />
an die Leistung des Betriebes schnell zu reagieren.<br />
Durch das betriebliche Rechnungswesen ist ein Höchstmaß an Kostentransparenz<br />
erreicht worden, das im Rahmen von Entgeltverhandlungen Vergleiche zu anderen<br />
Anbietern ermöglicht. Es war und ist vor allem ein Instrument der betrieblichen Steuerung<br />
für Geschäftsführung mit dem Ziel größtmöglicher Wirtschaftlichkeit.<br />
e. Welche Ziele konnten bislang noch nicht erreicht werden? Wie sollen<br />
sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Die mit der Gründung des LEB verfolgten Ziele wurden erreicht.<br />
f. Wie hat sich seit der Gründung des LB bis 2010 der Stellenbestand<br />
entwickelt? (Bitte aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern<br />
sowie nach Eingruppierung.)<br />
In der 25-jährigen Betriebsgeschichte kam es immer wieder zu neuen Aufgabenstellungen,<br />
es wurden aber auch Umstrukturierungen und der Abbau von Betriebskapazitäten<br />
vorgenommen. Dies ist im Wesentlichen im Rahmen des Stellenbestandes beziehungsweise<br />
seiner internen Umstrukturierung erfolgt. Der Gesamtbestand der Stellen<br />
ist daher eher von der Grundtendenz geprägt, Betriebskapazitäten abzubauen.<br />
Der Personalbestand hatte bei der Betriebsgründung im Jahr ein Volumen von 880<br />
Beschäftigten und erhöhte sich bis 1989 geringfügig um 4 Prozentpunkte. Danach<br />
nahm er bis Ende 2010 kontinuierlich auf 571 Beschäftigte beziehungsweise 65 Prozent<br />
des Anfangsbestandes ab.<br />
Maßgebliche Ereignisse für Zuwächse im Personal- und Stellenbestand waren:<br />
- Umstrukturierung der Einrichtungen im Rahmen der Heimreform mit der Folge von<br />
Personalmehrbedarf und qualitativ höherwertigen Stellen,<br />
- Erhöhung der Platzkapazität zur Betreuung von minderjährigen unbegleiteten<br />
Flüchtlingen in den 1990er Jahre und erneut ab 2008 bis heute,<br />
- Übernahme von Aufgaben und Personal anderer Dienststellen (insbesondere Kinder-<br />
und Jugendnotdienst 2002).<br />
Die Entwicklung des Stellenbestandes ist der Anlage 1 zu entnehmen.<br />
g. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Siehe Antwort zu 1. f.<br />
h. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Die gesamten Betriebskosten, also auch die Personalkosten, werden durch die Gesamtheit<br />
aller Erlöse und sonstigen Erträge gedeckt. Die Kalkulation der für die Leistungen<br />
in Rechnung gestellten Entgelte und der Beträge zur Kostenerstattung aus<br />
dem Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg erfolgt kostendeckend.<br />
3
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
4<br />
i. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Die Auflösung des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung ist mit Kosten für den Rückbau<br />
und die Aufgabe der Immobilien sowie Sonderabschreibungen, die Qualifizierung<br />
von Beschäftigten zur Vorbereitung auf eine neue Beschäftigung und Erlösausfällen<br />
durch temporäre Unterauslastung der Kapazitäten verbunden. Der im Erfolgsplan ausgewiesene<br />
Fehlbetrag ist auf die nicht gedeckten Kosten der Auflösung zurückzuführen.<br />
Zur Entwicklung des betroffenen Personalbestandes siehe Antwort zu 1. s. Die<br />
übrigen Bereiche des LEB arbeiten kostendeckend.<br />
j. Welche Stellenhebungen wurden seit der Gründung des LB für welche<br />
Funktionen im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils<br />
durchgeführt?<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
1986 1 A 15 A 16 Geschäftsführung<br />
1986 1 A 10 A 11 Heimleitung<br />
1986 1 VII IVa Leitung Buchhaltung<br />
1989 1 A 10 A 11 Heimleitung<br />
1990 1 A 11 A 12 Leitung Geschäftsstelle des LEB<br />
1992 1 Ib Ia Kaufmännische Leitung<br />
1992 1 IVa III Leitung Wohnungsverbund<br />
1992 1 IVb III Leitung Wohnungsverbund<br />
1993 1 A 10 A 11 Heimleitung<br />
1994 1 IVb IVa Ausbildungsleitung<br />
1994 1 IVb IVa Umsetzung Tarifvertrag f. techn. Angestellte<br />
1994 1 III IIa Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
1995 1 IVb IVa Heimleitung<br />
1998 2 IVb IVa Neue Leitungsstruktur<br />
1999 1 Ia SAV Kaufmännische Leitung<br />
2001 1 IVa III Neue Leitungsstelle<br />
2002 4 IVa III Neue Leitungsstruktur<br />
2003 1 IVb IVa Gem. Art. 10 Haushaltsbeschluss Personalrat<br />
2003 1 A 13 A 14 Controlling<br />
2009/2010 1 E 9 E 11 IuK-Technik<br />
k. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Der LEB deckt den betrieblichen Aufwand durch Entgelte für erbrachte Leistungseinheiten<br />
und sonstige Erträge für erbrachte Leistungen, die bisweilen fälschlicherweise<br />
auch als „Zuschuss“ bezeichnet werden. Insofern wird der laufende Betrieb nicht bezuschusst.<br />
Für seine Leistungen erzielte der LEB folgende Erlöse:<br />
Jahr<br />
Erlöse<br />
in Tsd. €<br />
1985 28.410<br />
1986 28.743<br />
1987 29.435<br />
1988 29.949<br />
1989 31.154<br />
1990 32.789<br />
1991 32.942<br />
1992 40.117<br />
1993 43.517
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Jahr<br />
Erlöse<br />
in Tsd. €<br />
1994 46.874<br />
1995 48.451<br />
1996 47.873<br />
1997 49.222<br />
1998 47.065<br />
1999 45.763<br />
2000 44.583<br />
2001 45.527<br />
2002 44.838<br />
2003 43.816<br />
2004 37.993<br />
2005 33.<strong>26</strong>9<br />
2006 30.996<br />
2007 29.371<br />
2008 30.956<br />
2009 31.790<br />
2010 31.816<br />
l. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für Investitionen erhielt der LEB aus dem Haushalt folgende Zuschüsse:<br />
Jahr Investitionszuschüsse<br />
1985 0,00 €<br />
1986 274.563,74 €<br />
1987 0,00 €<br />
1988 184.065,08 €<br />
1989 214.642,78 €<br />
1990 0,00 €<br />
1991 100.911,81 €<br />
1992 9.335,54 €<br />
1993 1.211.414,74 €<br />
1994 742.928,03 €<br />
1995 506.178,96 €<br />
1996 664.679,45 €<br />
1997 357.904,32 €<br />
1998 194.002,56 €<br />
1999 1.710.548,55 €<br />
2000 1.117.810,14 €<br />
2001 153.387,56 €<br />
2002 803.713,37 €<br />
2003 1.257.528,31 €<br />
2004 950.044,35 €<br />
2005 917.540,75 €<br />
2006 224.000,00 €<br />
2007 290.875,56 €<br />
2008 400.375,60 €<br />
2009 167.754,43 €<br />
2010 0,00 €<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Zahlung von Investitionszuschüssen ist abhängig vom Investitionsbedarf, den der<br />
Betrieb nicht aus eigenen Finanzierungsmitteln decken kann. Der Landesbetrieb kann<br />
das Kapital für größere Investitionen nicht aus den laufenden, kostendeckend kalkulierten<br />
Betriebskosten erwirtschaften und auch nicht auf dem Kapitalmarkt beschaffen<br />
5
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
und ist daher auf Zuschüsse angewiesen. Mit diesen Mitteln wurden Einrichtungen<br />
neu geschaffen, erweitert und modernisiert.<br />
6<br />
m. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für sonstige Zwecke erhielt der LEB folgende Zuschüsse aus dem Haushalt:<br />
Jahr Sonstige Zuschüsse<br />
1985 –1997 0,00 €<br />
1998 707.131,75 €<br />
1999 1.738.392,25 €<br />
2000 2.271.158,54 €<br />
2001 0,00 €<br />
2002 651.000,00 €<br />
2003 467.641,89 €<br />
2004 300.000,00 €<br />
2005 3.973.592,98 €<br />
2006 2.151.200,00 €<br />
2007 3.171.837,68 €<br />
2008 241.000,00 €<br />
2009 4.136.117,80 €<br />
2010 1.999.964,00 €<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Bei diesen Zuschüssen handelte es sich vor allem um solche für den Ausgleich von<br />
Kosten, die bei Betriebsumstrukturierungen und insbesondere bei dem Abbau von<br />
Betreuungskapazitäten entstanden sind.<br />
n. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
Wenn nein, warum nicht?<br />
Der Landesbetrieb hat seit seiner Gründung die von ihm durchgeführten Maßnahmen<br />
selbst immer wieder kritisch auf die Erreichung der mit ihnen verbundenen Ziele hinterfragt,<br />
gegebenenfalls auch mit externer Unterstützung. Auch der Rechnungshof hat<br />
in seinen Untersuchungen das Geschäftsgebaren untersucht und bewertet. Die Schaffung<br />
von Jugendwohnungen und Jugendhilfeverbünden im Zuge der Heimreform war<br />
Gegenstand einer extern in Auftrag gegebenen Evaluationsstudie.<br />
o. Wenn ja:<br />
i. Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag durchgeführt?<br />
Die Evaluationsstudie zum Jugendwohnungskonzept wurde durch das Amt für Jugend<br />
im Jahr 1991 in Auftrag gegeben und von „Sozialforschung und Beratung – Dr. Helmut<br />
Hartmann“ durchgeführt.<br />
ii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
Die Evaluationsstudie kam zu dem Ergebnis, dass die vollzogene Umwandlung der<br />
Heimplätze in Jugendwohnungen organisatorisch und fachlich erfolgreich verlaufen<br />
sei. Allerdings sei die Umstellung für die Beschäftigten nicht problemlos gewesen.<br />
Übereinstimmend bewerteten jedoch alle, dass der Prozess unumkehrbar sei, im Detail<br />
aber einzelne Verbesserungen vorgenommen werden müssten. Die betroffenen<br />
jungen Menschen bewerteten die neue Betreuungssituation als positiv.<br />
iii. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
Der Betrieb griff diese Anregungen beispielsweise mit der Schaffung von Kinderhäusern<br />
für Kinder und jüngere Jugendliche auf, für die sich Jugendwohnungen als ungeeignet<br />
erwiesen. Auch spielte sich mit der Zeit das Zusammenwirken der Beschäftig-
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
ten in ihren Jugendhilfeverbünden ein. Für die zuständige Behörde ergibt sich aus<br />
dieser Evaluationsstudie aktuell kein Handlungsbedarf mehr.<br />
iv. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Die Maßnahmen sind bereits umgesetzt.<br />
p. Steht der LB in geschäftlicher Verbindung zu Dritten?<br />
Ja. Der LEB steht auch in geschäftlicher Verbindung zu Dritten im Sinne von Institutionen<br />
außerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg. Dies waren beziehungsweise<br />
sind vor allem behördliche Auftraggeber (Arbeitsamt beziehungsweise heute Bundesagentur<br />
für Arbeit, team.arbeit.hamburg; Europäische Union - ESF) und andere Jugendämter.<br />
Ja.<br />
i. Wenn ja, wie haben sich die Zahlen aus diesen Geschäften seit<br />
der Gründung des LB entwickelt?<br />
Jahr<br />
Umsatzerlöse<br />
in €<br />
1985 3.423.099,14<br />
1986 2.215.098,76<br />
1987 2.530.880,20<br />
1988 2.613.683,25<br />
1989 2.596.677,77<br />
1990 2.980.359,88<br />
1991 3.138.029,24<br />
1992 3.587.518,53<br />
1993 4.650.457,59<br />
1994 5.083.051,02<br />
1995 4.276.243,80<br />
1996 4.1<strong>26</strong>.825,29<br />
1997 4.463.353,96<br />
1998 2.453.633,87<br />
1999 5.789.925,76<br />
2000 5.837.283,09<br />
2001 5.360.<strong>26</strong>0,03<br />
2002 5.376.249,72<br />
2003 3.956.687,38<br />
2004 3.056.818,10<br />
2005 3.146.984,04<br />
2006 3.206.952,83<br />
2007 1.808.700,06<br />
2008 1.477.446,72<br />
2009 990.716,15<br />
2010 838.376,34<br />
q. Verfügt der LB über eine kaufmännische Buchhaltung?<br />
r. In seinem Jahresbericht 2007 kritisiert der Rechnungshof die weder<br />
mittel- noch langfristig gesicherte Finanzierung des Geschäftsbereichs<br />
Berufliche Bildung des LEB. Im Anschluss daran einigten sich<br />
die beteiligten Behörden auf eine schrittweise Auflösung dieses Geschäftsbereichs<br />
zum Ende des Schuljahres 2009/2010. Aus Drs.<br />
19/5902 geht hervor, dass der Geschäftsbereich bis zum<br />
31.07.2011 schrittweise aufgelöst werden soll. Wie ist der Stand des<br />
Verfahrens?<br />
Der geplante Auflösungszeitpunkt 31. Juli 2011 wird realisiert werden. Im Auflösungsprozess<br />
ist es gelungen, dem Personal bis auf wenige Ausnahmen zum Schließungszeitpunkt<br />
eine dauerhafte Verbleibensperspektive zu verschaffen (siehe hierzu Ant-<br />
7
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
wort zu 1. s.). Von den vier bislang für die berufliche Bildung genutzten Immobilien<br />
befanden sich zwei im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg, zwei waren<br />
angemietet. Die Mietverhältnisse sind aufgelöst worden. Der Standort „Rosenhof“ im<br />
Jugendparkweg in Langenhorn wurde in eine Erstversorgungseinrichtung für minderjährige<br />
Flüchtlinge umgewandelt. Das Objekt „Berufsbildung Bergedorf“ am Billwerder<br />
Billdeich 648 a bietet sich aufgrund seiner Lage zwischen den Wohngebieten Neuallermöhe,<br />
Bergedorf-West und Lohbrügge als Standort für sozialraumorientierte Angebote<br />
der Jugendhilfe an. Die Umnutzung unter Einbeziehung von Dienststellen des<br />
Bezirksamtes Bergedorf, eines freien Trägers und Angeboten des LEB ist in der Planung.<br />
8<br />
s. Laut Drs. 19/5902 sind 66 Mitarbeiter von der Auflösung des Geschäftsbereichs<br />
betroffen.<br />
Von den 66 Beschäftigten, die zum Zeitpunkt der Entscheidung zur Auflösung des<br />
Geschäftsbereichs dort tätig waren, sind bereits fünf Beschäftigte dauerhaft ausgeschieden<br />
beziehungsweise werden in Kürze ausscheiden, drei weitere sind längerfristig<br />
beurlaubt oder erkrankt. Die Perspektive der übrigen 58 stellt sich wie folgt dar:<br />
i. Wie viele dieser Mitarbeiter sind derzeit noch beim LEB-BB<br />
tätig?<br />
Neun Beschäftigte sind noch im Geschäftsbereich Berufliche Bildung des LEB oder in<br />
anderen Dienststellen tätig, jedoch ohne eine dauerhafte Perspektive.<br />
ii. Für wie viele Mitarbeiter konnte bereits eine Einsatzmöglichkeit<br />
im allgemeinbildenden Schulwesen oder im Bereich des Übergangsmanagements<br />
in Ausbildung und Beruf entwickelt werden?<br />
Acht Beschäftigte sind zurzeit für das Übergangsmanagement in Ausbildung und Beruf<br />
vorgesehen. Die Planungen hierzu sind jedoch noch nicht abgeschlossen.<br />
iii. Wie viele Mitarbeiter konnten bereits erfolgreich bei der Vermittlung<br />
auf geeignete Stellen in anderen Arbeitsfeldern und Behörden<br />
unterstützt werden?<br />
In andere Arbeitsfelder des LEB oder in andere Behörden der Freien und Hansestadt<br />
Hamburg konnten bislang 41 Beschäftigte vermittelt werden.<br />
t. In seinem Jahresbericht 2009 forderte der Rechnungshof vom LEB,<br />
eine Betrachtung der Angebote der Jugendhilfe außerhalb des<br />
Kernarbeitsbereichs sowie eine Untersuchung des ganzen <strong>Landesbetriebe</strong>s<br />
vorzunehmen. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Geschäftsbereichs<br />
Jugendhilfe wurde im März 2010 mit dem Ergebnis<br />
abgeschlossen, dass „die Angebote auch außerhalb des Kernarbeitsbereichs<br />
weiterhin durch den Landesbetrieb zu betreiben und<br />
dabei die Kostenstrukturen weiter zu optimieren“ seien (Ergebnisbericht<br />
2010).<br />
i. Welche Optimierungen werden vom LEB im Einzelnen vorgenommen?<br />
Als weitere Optimierungen wurden bislang ins Auge gefasst:<br />
A. Verlagerung des Standortes der Betriebszentrale auf das Gelände Feuerbergstraße<br />
B. Ausgestaltung neuer oder alternativer Betreuungseinrichtungen mit zwei Gruppenbereichen<br />
und damit größeren Betriebseinheiten an einem Standort<br />
C. Weitere Verbesserung der Auslastung der Leitungs- und Verwaltungseinheiten<br />
durch Optimierung der Standorte und Betreuungskapazitäten<br />
D. Auslagerung von Dienstleistungen.<br />
ii. Wie ist der Stand des Optimierungsverfahrens?<br />
iii. Bis wann soll das Verfahren abgeschlossen sein?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Zu A: Das Vorhaben konnte nicht weiterverfolgt werden, da wegen des hohen Aufkommens<br />
zu versorgender, minderjähriger Flüchtlinge die für die Verlagerung vorgesehenen<br />
Raumkapazitäten genutzt werden mussten und auch in absehbarer Zukunft<br />
noch genutzt werden müssen.<br />
Zu B: In Planung sind zwei Baumaßnahmen. Für eine Realisierung bedarf es noch<br />
einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung. Die Anmietung einer entsprechenden Immobilie<br />
steht bevor.<br />
Zu C: In der Jugendhilfeabteilung für den Bereich Hamburg-Nord soll eine weitere<br />
Einrichtung (Neubau, siehe B) eröffnet werden. Weiterhin wurden in einem frei gewordenen<br />
Gebäudeteil einer Einrichtung neue Plätze geschaffen. In Bergedorf sollen die<br />
dortige Administration und die pädagogischen Dienste des LEB in der frei werdenden<br />
Berufsbildungseinrichtung konzentriert werden. Durch die Eröffnung zweier Betreuungseinrichtungen<br />
in der Jugendhilfeabteilung Süd wird die dortige Administration<br />
besser ausgelastet.<br />
Zu D: Nachtwachendienste, die in der Vergangenheit von Beschäftigten durchgeführt<br />
wurden, werden sukzessive an externe Sicherheitsdienste vergeben. Reinigungsleistungen<br />
wurden bereits nahezu vollständig an Dritte vergeben.<br />
u. Aus dem Ergebnisbericht 2010 des Rechnungshofs geht ferner hervor:<br />
„Die BSG hat weiterhin zugesagt, bei Einführung des Neuen<br />
Haushaltswesens in der Behörde den Fortbestand des Landesbetriebs<br />
in seiner dann vorhandenen Form kritisch zu überprüfen und<br />
gegebenenfalls Strukturveränderungen vorzunehmen.“<br />
i. Welche Alternativen sieht die zuständige Behörde zum Fortbestand<br />
des LEB als Landesbetrieb?<br />
Wesentliche Steuerungsinstrumente des Landesbetriebs sind a) die mit der Dienststellenfunktion<br />
nach dem Hamburgischen Personalvertretungsgesetz verbundene Personalhoheit<br />
sowie b) die mit den Regularien des <strong>§</strong> <strong>26</strong> <strong>LHO</strong> und der Ausgestaltung der<br />
jeweiligen Wirtschaftspläne verbundene unternehmerische Flexibilität. Soweit diese<br />
beide im Rahmen des Neuen Haushaltswesens erhalten bleiben oder gar weiter verbessert<br />
werden können, könnte der Fortbestand in der Struktur eines Landesbetriebs<br />
überdacht werden.<br />
2. LB Geoinformation und Vermessung (LGV)<br />
Der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) wurde zum<br />
1.1.2003 eingerichtet. Der LGV ist unter anderem zuständig für die Führung<br />
der geotopografischen Daten in Hamburg sowie als Dienstleister<br />
und Fachberater für die Bereitstellung dieser Daten und Vermessungsarbeiten<br />
aller Art.<br />
a. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
Im Tarifvertrag der Länder wird seit 2006 nicht mehr zwischen Angestellten und Arbeitern<br />
unterschieden. Die Statusgruppen sind in der Statusgruppe Tarifbeschäftigte aufgegangen.<br />
Stellenbestand Stellenbestand<br />
31.12.2008 31.12.2010<br />
Planstellen 97 97<br />
B 4 1 1<br />
B 2 1 1<br />
A 16 2 2<br />
A 15 9 9<br />
A 14 7 7<br />
A 13 15 15<br />
A 12 20 21<br />
A 11 30 29<br />
9
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
noch Planstellen<br />
Stellen für Tarifbeschäftigte<br />
10<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2008<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2010<br />
A 10 10 10<br />
A 9 1 1<br />
A 7 1 1<br />
313,52 313,52<br />
E 15 1 2<br />
E 14 3 2<br />
E 13 5 7<br />
E 12 30 28<br />
E 11 29 29<br />
E 10 29 29<br />
E 9 1 1<br />
E 8 145,52 145,52<br />
E 7 29 29<br />
E 6 <strong>26</strong> <strong>26</strong><br />
E 5 11,5 11,5<br />
E 4 2,5 2,5<br />
E 3 1 1<br />
Stellen gesamt 410,52 410,52<br />
Nein.<br />
Entfällt.<br />
b. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
c. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
d. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
e. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2009 1 E 14 E 15 Fachbereichsleitung Gutachterausschuss<br />
2009 1 E 12 E 13 Fachbereichsleitung Wertermittlung<br />
2009 1 E 12 E 13 Fachbereichsleitung Informationstechnik<br />
2010 1 E 12 E 13 Fachbereichsleitung Kartographie<br />
f. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für den laufenden Betrieb erhielt der LGV folgende Zuschüsse:<br />
2009: 12.767.000 Euro<br />
2010: 69.000 Euro<br />
Für die Jahre 2003 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Reduzierungen von 2003 bis 2008 wurden durch konsequente Ausschöpfung des<br />
Rationalisierungspotenzials erreicht. In 2009 erfolgte darüber hinaus eine Umstellung<br />
auf eine erlösfinanzierte Wirtschaftsführung des Landesbetriebs. So erhält der LGV<br />
nunmehr feste Entgelte von der BSU für in Zielvereinbarungen festgeschriebene ho-
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
heitliche Dienstleistungen. Da die Umstellung auf die Erlösfinanzierung haushaltsmäßig<br />
erst zu einem späteren Zeitpunkt nachvollzogen wurde, weichen die oben genannten<br />
Ist-Daten von den Ergebnissen des Wirtschaftsplans ab.<br />
g. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Für die Jahre 2003 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
Investitionen konnten zunehmend aus Erlösen finanziert werden. Seit 2009 erhält der<br />
LGV keinen Zuschuss für Investitionen aus dem Einzelplan 6 mehr und finanziert Regelinvestitionen<br />
entweder aus den Erlösen oder aus vorhandenen Rücklagen.<br />
Der Zuschuss für Investitionen in IT-Maßnahmen (IT-Globalfonds) entwickelte sich<br />
seit 2009 wie folgt:<br />
2009: 250.000 Euro<br />
2010: 593.000 Euro.<br />
h. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Über die genannten Zuschüsse hinaus erhält der LGV einen Zuschuss für Versorgung<br />
aus dem Haushalt, der sich seit 2009 wie folgt entwickelt hat:<br />
2009: 2.174.000 Euro<br />
2010: 2.242.000 Euro.<br />
Für die Jahre 2003 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
Aufgrund eines hohen Anteils an Personaleinsparungen zwischen 2003 und 2008 ist<br />
der Zuschuss für Versorgung insgesamt ebenfalls stark rückläufig.<br />
Ja, im Jahr 2007.<br />
i. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
Wenn nein, warum nicht?<br />
i. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
Im Rahmen der Einrichtung des Landesbetriebs hat der Senat beschlossen, dass<br />
nach vier Jahren Betrieb anhand der zwischenzeitlich aufgestellten Bilanzen, der Gewinn-<br />
und Verlustrechnungen sowie der Lageberichte überprüft wird, ob die angestrebten<br />
Ziele mit der gewählten Organisationsform erreicht worden sind. Die Evaluation<br />
wurde von der Aufsicht führenden Behörde durchgeführt. Der Senat hat die Ergebnisse<br />
der Evaluation am 20. November 2007 zur Kenntnis genommen.<br />
ii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
Nach Abschluss der Einrichtungsphase in 2003 und drei Geschäftsjahren mit regulärem<br />
Betrieb hatte sich gezeigt, dass die bei der Gründung formulierten organisatorischen,<br />
geofachlichen und ökonomischen Zielsetzungen mit dem Wechsel der Organisationsform<br />
vom Amt zum Landesbetrieb erreicht werden konnten. Als entscheidende<br />
Vorteile haben sich die nachfolgenden Rahmenbedingungen der Organisationsform<br />
Landesbetrieb im Vergleich zur Organisationsform Amt erwiesen:<br />
- Durch den Einsatz der Globalsteuerungsinstrumente – wie Zielbild, jährliche Zielvereinbarung,<br />
quartalsmäßige Erfolgskontrolle – ist die Anforderung zur Formulierung<br />
expliziter Ziele, Prioritäten und Budgets im Vergleich zur Amtsorganisation<br />
stärker ausgeprägt und fördert eine größere Disziplin in der Planumsetzung.<br />
Gleichzeitig eröffnen sich im Rahmen der Globalsteuerung für die Geschäftslei-<br />
11
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
12<br />
tung größere Spielräume bei der Wirtschaftsführung und beim Einsatz finanzieller<br />
Ressourcen. Beim LGV wurden diese Möglichkeiten offensiv genutzt, um Hierarchiestufen<br />
zu verringern, Geschäftsabläufe und Entscheidungsprozesse zu<br />
straffen sowie Beschaffungs- und Vergabeprozesse zu verkürzen. Dieses war eine<br />
entscheidende Voraussetzung, um auf die Veränderungen des technisch geprägten<br />
Aufgabenfeldes mit Flexibilität und Innovationskraft zu reagieren.<br />
- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten wurden durch die Organisationsform<br />
Landesbetrieb transparenter. Dieses gilt speziell für die Außendarstellung gegenüber<br />
Bürgern sowie öffentlichen und privaten Kunden. Ansprechpartner für einen<br />
bestimmten Aufgabenbereich aus dem großen Zuständigkeitsfeld einer Behörde<br />
ist nicht mehr die komplexe BSU, sondern der Landesbetrieb Geoinformation und<br />
Vermessung. Bekanntheitsgrad, Transparenz und Erreichbarkeit des Leistungsangebotes<br />
wurden dabei insbesondere durch Nutzung des Internets verbessert.<br />
- Die in der Gründungsdrucksache genannte Zielsetzung, eine wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung<br />
durch Steuerung mit betriebswirtschaftlichen Instrumenten<br />
zu erreichen, ist nicht zwingend an eine bestimmte Organisationsform gebunden.<br />
Der Übergangsprozess zu einer Landesbetriebsorganisation wirkte beim LGV jedoch<br />
als „Katalysator“, der die Akzeptanz betriebswirtschaftlicher Methoden und<br />
ein ökonomisch orientiertes Verhalten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend<br />
beeinflusst hat.<br />
iii. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
iv. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Als Konsequenz wurde eine Fortentwicklung des Aufgabenbereichs Geoinformation<br />
und Vermessung in der Organisationsform Landesbetrieb festgestellt. Dabei sollten<br />
die Rahmenbedingungen aus den technologischen Entwicklungen ebenso wie die<br />
gesamthamburgischen Belange zukunftsorientiert berücksichtigt und durch operationalisierte<br />
Vorgaben in den jährlichen Zielvereinbarungen konkretisiert werden. Die<br />
Effizienz der Aufgabenerfüllung und der wirtschaftliche Erfolg unterliegen auch weiterhin<br />
einer ständigen Evaluation durch Geschäftsführung, Verwaltungsrat und Aufsicht<br />
führender Behörde.<br />
3. Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen<br />
Der Hamburger Großmarkt befindet sich seit 1962 am seinem Standort<br />
in Hammerbrook. Zu den Aufgaben des <strong>Landesbetriebe</strong>s gehören die<br />
Bereitstellung von Logistik und Service mit und an der Ware zur Stärkung<br />
der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer<br />
Unternehmen.<br />
Als Basis für die Entwicklungsdaten des Betriebs wurde der Zeitraum seit dem Jahr<br />
2000 zugrunde gelegt.<br />
a. Wie lautet das Zielbild und wie das Unternehmens- und Organisationskonzept<br />
des Landesbetriebs?<br />
Das Zielbild ist die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und<br />
mittelständischer Unternehmen der Obst-, Gemüse- und Blumenbranche sowie der<br />
heimischen Erzeuger. Hierfür sollen geeignete Vermarktungseinrichtungen an einem<br />
zentralen Standort zu vertretbaren Kosten für die Marktnutzer vorgehalten werden.<br />
Diese sollen ohne Belastung des Hamburgischen Haushalts nach betriebswirtschaftlichen<br />
Grundsätzen unter Berücksichtigung der politischen Rahmen- und Zielvorgaben<br />
der Behördenleitung betrieben werden. Die Bevölkerung Hamburgs und der Region<br />
soll ganzjährig mit Frischeprodukten aus der gesamten Welt in dem gewohnten Qualitätsstandard<br />
versorgt werden. Der Hamburger Großmarkt soll als einer der wenigen<br />
„tatsächlichen“ Märkte in Deutschland erhalten werden, auf dem wegen seiner Sortimentsvielfalt<br />
und seiner zentralen Lage ein breites Marktgeschehen stattfindet und der<br />
dadurch für alle am Handel beteiligten Firmen die unverzichtbare Funktion eines<br />
Preisbarometers erfüllt.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Das Unternehmens- und Organisationskonzept ergibt sich im Wesentlichen aus dem<br />
Zielbild und bildet sich ab in den Aufgabenschwerpunkten Immobilienmanagement,<br />
Gestellung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur sowie Standortmarketing.<br />
b. Wann wurden diese jeweils vorgelegt und wann mit der Aufsicht führenden<br />
Behörde erstmals vereinbart?<br />
Das Zielbild wird der Aufsicht führenden Behörde regelmäßig mit dem Entwurf des<br />
Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb vorgelegt (erstmalig im Jahr 1998).<br />
c. Welche Veränderungen hat es wann am ursprünglichen Zielbild beziehungsweise<br />
dem Unternehmens- und Organisationskonzept des<br />
<strong>Landesbetriebe</strong>s aus welchen Gründen gegeben?<br />
Das Zielbild besteht im Wesentlichen unverändert fort.<br />
d. Welche der Ziele, die mit der Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s verfolgt<br />
wurden, wurden durch welche Maßnahmen bereits erreicht?<br />
e. Welche Ziele konnten bislang noch nicht erreicht werden? Wie sollen<br />
sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Alle in der Antwort zu 3. a. genannten Ziele werden durch die Vermietung von Verkaufs-<br />
und Logistikflächen auf dem Großmarkt und die kostendeckende Kalkulation<br />
der Nutzungsgebühren erreicht.<br />
Siehe Anlage 2.<br />
f. Wie hat sich seit der Gründung des LB der Stellenbestand entwickelt?<br />
(Bitte aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern<br />
sowie nach Eingruppierung.)<br />
g. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Nein. In den Jahren 2000 bis 2011 hat die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
kontinuierlich abgenommen.<br />
Entfällt.<br />
h. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
i. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 sind keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
j. Welche Stellenhebungen wurden seit der Gründung des LB für welche<br />
Funktionen im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils<br />
durchgeführt?<br />
Der Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen hat folgende Stellenhebungen<br />
durchgeführt:<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2000 1 A 9 A 9 + Z Leitung Liegenschaftsmanagement<br />
2001 1 IX/VII Vc Fg. 1b Schreib- und Verwaltungstätigkeit<br />
2003 1 A 14 A 15 Geschäftsleitung<br />
2003 1 Vc Fg. 6 Vb Fg. 8 Maschinenmeister im Technischen Bereich<br />
2003 1 Vc Fg. 6 Vb Fg. 8 Maschinenmeister im Technischen Bereich<br />
2005 1 VII Fg. 1b Vc Fg. 1b Materialbeschaffung<br />
2005 1 VII Fg. 1 Vc Fg. 1b Parkflächenmanagement<br />
2005 1 VIb Fg. 2 Vc Fg. 1a Sondergruppe Marktaufsicht<br />
2005 1 VIb Fg. 2 Vc Fg. 1b Sondergruppe Marktaufsicht<br />
2005 1 VII Fg. 1 Vc Fg. 1b Sondergruppe Marktaufsicht<br />
2006 1 A 8 A 9 Leitung Marktaufsicht<br />
2008 1 E 11 E 12 Abschnittsleitung Finanzen und Controlling<br />
13
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2008 1 E 9 E 10 Sachbearbeitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit<br />
2009 1 A 10 A 11 Sachgebietsleitung Marktbetrieb<br />
14<br />
k. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Der Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen hat seit dem Jahr 2000 folgende<br />
Beträge an den Haushalt abgeliefert:<br />
Jahr<br />
Ablieferungen<br />
2000 2.500 Tsd. DM<br />
2001 2.500 Tsd. DM<br />
2002 1.250 Tsd. €<br />
2003 1.550 Tsd. €<br />
2004 1.670 Tsd. €<br />
2005 1.351 Tsd. €<br />
2006 1.351 Tsd. €<br />
2007 0 €<br />
2008 0 €<br />
2009 0 €<br />
2010 0 €<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Aufgrund von Investitionsstaus wurde für die Jahre 2007 bis 2010 auf die Ablieferungen<br />
an den Haushalt verzichtet (siehe auch Drs. 18/7047).<br />
l. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Seit dem Jahr 2000 hat der Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen nur in den Jahren<br />
2008 (1.424.000 Euro) und 2009 (5.000.000 Euro) Zuschüsse für Investitionen erhalten.<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Zuschüsse wurden für bauliche Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung<br />
des Großmarkts bereitgestellt (siehe auch Drs. 18/7047 und 19/1442).<br />
m. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für sonstige andere Zwecke erhielt der Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und<br />
Blumen folgende Zuschüsse:<br />
2008: 46.906,66 Euro<br />
2009: 329.423,93 Euro.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Zuschüsse dienten der Erneuerung der Beleuchtung zur Einsparung von Energie.<br />
n. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
Wenn nein, warum nicht?<br />
i. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
ii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
iii. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
iv. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Ja. Die zuständige Behörde hat im Auftrag des Senats die Rechtsform des Großmarktes<br />
geprüft. Die geprüften Rechtsformen „Anstalt des öffentlichen Rechts“ und „Gesellschaft<br />
mit beschränkter Haftung“ sind jedoch entweder unwirtschaftlich, steuerlich ungünstig<br />
und/oder personalwirtschaftlich problematisch beziehungsweise nach vorläufiger<br />
Prüfung beihilferechtlich zumindest bedenklich. Die Aufrechterhaltung der Rechtsform<br />
als Landesbetrieb ist deshalb die wirtschaftlichste Variante, sodass keine Maßnahmen<br />
aufgrund der Prüfung umgesetzt werden müssen.<br />
o. Steht der LB in geschäftlicher Verbindung zu Dritten?<br />
Wenn ja, wie haben sich die Zahlen aus diesen Geschäften seit der<br />
Gründung des LB entwickelt?<br />
Der Großmarkt hat Geschäftsbeziehungen aus der Überlassung von Flächen, Gebäuden<br />
und Räumen. Seit dem Jahr 2000 hat der Großmarkt folgende Umsatzerlöse aus<br />
Geschäftsverbindungen mit Dritten erzielt:<br />
Ja.<br />
Jahr<br />
Einnahmen des Landesbetriebs<br />
Großmarkt Obst, Gemüse und<br />
Blumen aus Geschäftsverbindungen<br />
mit Dritten (Umsatzerlöse)<br />
2010 11.795.393 €<br />
2009 11.890.883 €<br />
2008 12.318.634 €<br />
2007 11.763.183 €<br />
2006 11.395.276 €<br />
2005 11.297.310 €<br />
2004 11.058.967 €<br />
2003 11.349.196 €<br />
2002 10.934.718 €<br />
2001 21.793.212 DM<br />
2000 22.<strong>26</strong>9.294 DM<br />
Siehe Anlage 3.<br />
p. Verfügt der LB über eine kaufmännische Buchhaltung?<br />
q. Laut Drs. 19/1442 von November 2008 wies das Großmarktgebäude<br />
erhebliche Mängel in der baulichen Substanz auf, die die Gefahr<br />
eines Sicherheitsrisikos bargen. Welche der in Tabelle 1 ausgewiesenen<br />
Sanierungsmaßnahmen mit sofortigem Handlungsbedarf<br />
wurden bereits durchgeführt und wie hoch waren die tatsächlich<br />
entstandenen Kosten im Vergleich mit den geschätzten Beträgen?<br />
(Bitte ebenfalls als Tabelle darstellen.)<br />
r. Zusätzlich zu den Maßnahmen mit sofortigem Handlungsbedarf<br />
werden in Drs. 19/1442 mittelfristige Maßnahmen aufgezählt, die<br />
teils unabhängig, teils in Abhängigkeit von der Entscheidung zur<br />
Brückenführung von der Amsinckstraße über das Großmarktgelände<br />
in die HafenCity durchgeführt werden sollen. Welche der von der<br />
Entscheidung unabhängigen in Tabelle 3 aufgeführten Maßnahmen<br />
konnten bereits durchgeführt werden und wie hoch waren die tatsächlich<br />
entstandenen Kosten im Vergleich mit den geschätzten Beträgen?<br />
(Bitte ebenfalls als Tabelle darstellen.)<br />
s. Aus der Drs. 19/1442 geht weiterhin hervor: „Vor dem Hintergrund<br />
der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Großmarktes<br />
müssen die Handlungsmöglichkeiten des Unternehmens erweitert<br />
werden. Zukünftig sollte der Großmarkt in der Lage sein, über Umfang<br />
und Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahmen eigenständig zu<br />
15
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
16<br />
entscheiden und die notwendigen Investitionen über Einnahmen,<br />
Abschreibungen und Kredite selbst zu finanzieren. Mit der gegenwärtigen<br />
Rechtsform des Großmarktes als Landesbetrieb nach <strong>§</strong> <strong>26</strong><br />
Landeshaushaltsordnung ist dies nicht möglich. Als geeignete<br />
Rechtsformen kommen grundsätzlich eine rechtsfähige Anstalt öffentlichen<br />
Rechts (AöR) oder eine Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung (GmbH) in Frage. (...) Die Behörde für Wirtschaft und Arbeit<br />
wurde von Senat beauftragt, die Änderung der Rechtsform des<br />
Großmarktes in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) oder eine<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zu prüfen und das<br />
Ergebnis dem Senat bis zum 2. Quartal 2009 zur Beschlussfassung<br />
vorzulegen.“<br />
i. Wie lautet das Ergebnis der Prüfung durch die Behörde für<br />
Wirtschaft und Arbeit?<br />
ii. Welchen Beschluss hat der Senat bezüglich einer Umwandlung<br />
des <strong>Landesbetriebe</strong>s in eine andere Unternehmensform gefasst?<br />
Siehe Antwort zu 3. n. Ein Senatsbeschluss steht noch aus.<br />
4. LB Hamburger Institut für Berufliche Bildung<br />
Der Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) entstand<br />
zum 1.1.2007. Er ist institutionell angebunden an die Behörde für<br />
Schule und Berufsbildung (BSB), bei der die Aufsicht und die Steuerungshoheit<br />
liegen. Aufgaben des HIBB sind unter anderem die Steuerung,<br />
Beratung und Unterstützung, das Monitoring und die Weiterentwicklung<br />
des Systems beruflicher Bildung in der Freien und Hansestadt<br />
Hamburg, außerdem liegen Schulträgerschaft und Aufsicht über die beruflichen<br />
Schulen beim HIBB. Es stellt die Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags<br />
sicher.<br />
a. Welche Veränderungen am Zielbild beziehungsweise Unternehmens-<br />
und Organisationskonzept des <strong>Landesbetriebe</strong>s hat es seit<br />
Anfang 2009 aus welchen Gründen gegeben?<br />
b. Wie werden diese Veränderungen vom Senat bewertet?<br />
Es hat keine grundsätzlichen Änderungen im Zielbild beziehungsweise des Unternehmens-<br />
und Organisationskonzepts des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung<br />
(HIBB) gegeben. Die zuständige Behörde hatte in der 19. Legislaturperiode eine Evaluation<br />
des HIBB bei der Prognos AG in Auftrag gegeben (siehe auch Drs. 19/7862).<br />
Die Ergebnisse des Abschlussberichts werden auch zu Fragen des Unternehmens-<br />
und Organisationskonzepts des HIBB zurzeit von der zuständigen Behörde beraten<br />
(siehe Antworten 4. l. bis 4. p.).<br />
c. Inwiefern wurden die vom Senat genannten Ziele des LB im Einzelnen<br />
erreicht:<br />
i. neue Ziele und Maßnahmen zu den Reformschwerpunkten<br />
„Übergang Schule – Beruf“, „Weiterentwicklung berufliche<br />
Gymnasien“, „Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbildung“?<br />
Siehe Drs. 19/8472 und 19/7271.<br />
ii. die angemessene personelle und finanzielle Ausstattung des<br />
HIBB sowie Klärung der Schnittstellen insbesondere mit der<br />
BSB?<br />
Die angemessene personelle und finanzielle Ausstattung des HIBB wurde für den<br />
Haushalt 2011/2012 angemeldet (siehe auch Drs. 19/8472). Im Übrigen werden<br />
Schnittstellenfragen im Rahmen der Auswertung des Evaluationsberichts der Prognos<br />
AG erörtert (siehe Antwort zu 4. a. und 4. b.).
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
iii. die Einführung eines Qualitätsmanagements in der HIBB-<br />
Zentrale?<br />
Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in der HIBB-Zentrale findet mit<br />
einer externen Zertifizierung nach QZE („Qualitätszentrierten Entwicklung“) für Verwaltung<br />
und der Option auf die Auszeichnung nach der „Anerkennungs- und Zulassungsverordnung<br />
Weiterbildung“ statt. Erste Elemente sind eingeführt; zurzeit plant die Projektleitung<br />
einen Workshop zusammen mit der begleitenden Beratungsfirma MTO<br />
(Mensch – Technologie – Organisation, Tübingen) für September 2011.<br />
iv. die Übertragung der Auftragsberechtigung für Dataport auf das<br />
HIBB?<br />
Die Auftragsberechtigung für Dataport wurde auf das HIBB übertragen.<br />
d. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
Die Entwicklung des Stellenbestandes inklusive der beruflichen Schulen seit Ende<br />
2008 ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:<br />
Wertigkeit Stellenbestand<br />
am<br />
31.12.2008*<br />
Akt. Stellenbestand<br />
gem.<br />
Haushaltsplan-Entwurf<br />
2011/2012<br />
Beamtenstellen<br />
B 3 1,00 1,00<br />
A 16 54,00 54,00<br />
Veränderung<br />
A 15 249,00 248,00 −1,00<br />
A 14 785,55 772,95 −12,60<br />
A 13 1.286,76 1.330,41 +43,65<br />
Anmerkungen<br />
−1,0 Verlagerung in Kapitel<br />
3110<br />
−11,0 Stellen Verlagerung in<br />
andere Schulkapitel (A14-<br />
Verfahren)<br />
+2,0 gem. Stellenplan 2009<br />
−3,0 Verlagerung in Kapitel<br />
3110<br />
−1,0 Verlagerung Amt W<br />
+6,0 Erhöhung Vertretungsbedarf<br />
gem. Stellenplan 2009<br />
+10,0 Erhöhung Stundentafel<br />
Berufl. Gymnasien gem. Stellenplan<br />
2009/2010<br />
+10,0 gem. Drs. 19/6273<br />
+11,0 Stellentausch A14-<br />
Verfahren<br />
+6,0 Verlagerung aus anderem<br />
Schulkapitel<br />
+5,7 Bestandsanpassung<br />
+1,0 Projekt Aktionsbündnis<br />
(befristet)<br />
+18,0 Umwandlung Raab-<br />
Stellen gem. Stellenplan 2009<br />
−20,0 Verlagerung in Kapitel<br />
3140<br />
−1,0 Verlagerung zu Schulbau<br />
Hamburg<br />
−2,0 Verlagerung in Kapitel<br />
3110<br />
−1,0 Verlagerung Amt W<br />
17
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Wertigkeit Stellenbestand<br />
am<br />
31.12.2008*<br />
18<br />
Akt. Stellenbestand<br />
gem.<br />
Haushaltsplan-Entwurf<br />
2011/2012<br />
Veränderung<br />
A 12/A 13 0 19,00 +19,00<br />
A 12 2,00 3,00 +1,00<br />
A 11/A 12 59,70 59,70 -<br />
A 11 48,40 49,40 +1,00<br />
Anmerkungen<br />
+ 19,0 Verlagerung v. Kap.<br />
3120<br />
Bedarfsorientierte Umvertei-<br />
lung des Stellenbestands<br />
+2,0 gem. Stellenplan 2009<br />
−1,0 Verlagerung Amt W<br />
+2,0 gem. Haushaltsbeschluss<br />
2009<br />
−1,0 Verlagerung in Kapitel<br />
3110<br />
A 10 1<strong>26</strong>,22 123,52 −2,70<br />
−1,0 Verlagerung zu Schulbau<br />
Hamburg<br />
−1,0 Verlagerung in Kapitel<br />
3110<br />
A 9 6,00 6,00 -<br />
A 8 5,00 6,00 +1,00 Stellenhebung A 7 nach A 8<br />
A7 3,00 2,00 −1,00 Stellenhebung A 7 nach A 8<br />
−1,0 Vermerkvollzug dauerhaf-<br />
A 6 6,00 5,00 −1,00 te Besetzung mit Tarifbeschäftigtem<br />
Summe<br />
Beamte<br />
2.632,63 2.679,98 +47,35<br />
Wertigkeit Stellenbestand<br />
am<br />
31.12.08*<br />
Akt. Stellenbestand<br />
gem.<br />
Haushaltsplan-Entwurf<br />
2011/2012<br />
Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)<br />
Veränderung<br />
E 13/IIa 24,59 4,59 −20,00<br />
E 12 0 4,20 +4,20<br />
E 11/IVa 1,00 1,00 -<br />
E 10 0 3,00 +3,00<br />
E 9/IVb dD 21,50 27,00 +5,50<br />
E 8/Vc 41,00 46,00 +5,00<br />
Anmerkungen<br />
−18,0 Umwandlung Raab-<br />
Stellen gem. Stellenplan 2009<br />
−3,0 Verlagerung Amt W<br />
+1,0 befr. Stelle BMBF-<br />
Vorhaben<br />
+ 1,0 gem. Stellenplan 2009<br />
+ 3,20 temporäre Ausbringung<br />
für Wandlung von Sachmitteln<br />
in VORM-Mittel<br />
+ 2,00 Projektstellen befristet<br />
bis 31.07.12<br />
+ 1,0 gem. Stellenplan 2009<br />
+2,0 Tarifgerechte Eingruppierung<br />
v. Mitarbeitern<br />
+0,5 Drs. Handlungskonzept<br />
gegen Jugendgewalt<br />
+2,0 gem. Stellenplan 2009<br />
+1,0 befr. Stelle Kompetenz<br />
Plus<br />
+4,5 Tarifgerechte Eingruppierung<br />
v. Mitarbeitern<br />
+0,5 gem. Stellenplan 2009
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Wertigkeit Stellenbestand<br />
am<br />
31.12.08*<br />
Akt. Stellenbestand<br />
gem.<br />
Haushaltsplan-Entwurf<br />
2011/2012<br />
Veränderung<br />
Anmerkungen<br />
E 7/L 7 4,08 3,08 −1,00<br />
−1,0 Verlagerung zu Schulbau<br />
Hamburg<br />
+1,0 Tarifgerechte Eingruppierung<br />
v. Mitarbeitern<br />
E 6/VI b 83,72 89,24 +5,52 +2,0 gem. Stellenplan 2009<br />
+0,5 befr. Stelle Kompetenz<br />
Plus<br />
−3,62 Verlagerung zu Schul-<br />
E 5/VII/L 4,<br />
147,57<br />
L 5<br />
139,36 −8,21<br />
bau Hamburg<br />
−1,28 Verlagerung in Kapitel<br />
3110<br />
−3,0 Einsparung<br />
E 4 1,00 0 −1,00<br />
−1,0 Verlagerung zu Schulbau<br />
Hamburg<br />
E 3/VIII/L3/<br />
L 2<br />
85,36 39,33 −46,03<br />
−42,22 Verlagerung zu Schulbau<br />
Hamburg<br />
E 2/IXb<br />
und X/L 1<br />
Summe<br />
4,06 2,64 −1,42<br />
−0,78 Verlagerung zu Schulbau<br />
Hamburg<br />
Arbeitnehmer<br />
Summe<br />
Beamte<br />
413,88 359,44 −54,44<br />
und<br />
Arbeitnehmer<br />
3.046,51 3.039,42 -7,09<br />
* Die Daten wurden dem Haushaltsplan 2009/2010 entnommen und um die dort unberücksichtigten<br />
Stellenverlagerungen in andere Schulkapitel zum 1. August 2008 (40 Stellen) ergänzt.<br />
e. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Nein, siehe Antwort zu 4. d.<br />
Entfällt.<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
f. Wie werden die Stellen finanziert?<br />
g. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
h. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
Seit Ende 2008 wurden im HIBB folgende Stellenhebungen durchgeführt:<br />
Wirtschaftsjahr Stellenanzahl bisher neu Status<br />
2009 1 A 7 A 8 Sachbearbeitung kfm.<br />
Rechnungswesen<br />
2009 1 E 6 E 9 IT-Administration<br />
2010 1 E 5 E 9 IT-Administration<br />
2010 1 E 5 E 8 Sachbearbeitung kfm.<br />
Rechnungswesen<br />
2010 1 E 5 E 6 Sachbearbeitung in<br />
der Schulaufsicht<br />
19
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
20<br />
i. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Das HIBB deckt den betrieblichen Aufwand durch Entgelte für erbrachte Unterrichtsleistungen<br />
und sonstige Erträge für erbrachte Leistungen, die bisweilen fälschlicherweise<br />
als „Zuschuss“ bezeichnet werden. Insofern wird der laufende Betrieb nicht<br />
bezuschusst.<br />
Für Unterrichtsleistungen erhielt das HIBB folgende Entgelte:<br />
2007: 224.274.000 Euro<br />
2008: 228.671.000 Euro<br />
2009: 232.065.000 Euro<br />
2010: 250.528.000 Euro.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Steigerung der Leistungsentgelte ist vor allem (vergleiche Wirtschaftsplan 2009/<br />
2010 und Wirtschaftsplan-Entwurf 2011/2012) mit<br />
- der Umstellung auf die Doppik,<br />
- Preissteigerungen, Besoldungs- und Tariferhöhungen,<br />
- der Berücksichtigung von verwaltungsinternen Dienstleistungen und<br />
- der Berücksichtigung von Miet- und Mietnebenkostenzahlungen für Schulgebäude<br />
an das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb ab 2010<br />
begründet.<br />
j. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für Investitionen erhielt das HIBB aus dem Haushalt folgende Zuschüsse:<br />
2007: 3.615.000 Euro<br />
2008: 3.800.000 Euro<br />
2009: 3.438.000 Euro<br />
2010: 4.610.000 Euro.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Entwicklung der Investitionszuschüsse folgt zwei Entwicklungen:<br />
1. Betragsabweichungen nach oben und unten als Ausdruck der veränderten Veranschlagung.<br />
2. In 2010 wurde infolge der Gründung des Sondervermögens Schule - Bau und<br />
Betrieb 1 Million Euro für unterjährig erforderliche Baumaßnahmen (siehe auch<br />
Drs. 19/4208) zusätzlich investiv (ab 2011 dann im Aufwand) veranschlagt.<br />
Nein.<br />
k. Ist das Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Geschäftsführer<br />
des HIBB (siehe unter anderem Drs. 18/7752) mittlerweile abgeschlossen?<br />
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?<br />
l. In Drs. 19/940 sub 1. – 10. berichtet der Senat, dass eine Evaluation<br />
des HIBB von der zuständigen Behörde vorbereitet werde und ferner:<br />
„Zu einzelnen Festlegungen des Evaluationsdesigns im Sinne<br />
der Fragestellungen können daher noch keine abschließenden Aussagen<br />
getroffen werden. Vorgesehen ist die zeitnahe Ausschreibung<br />
des Evaluationsauftrags.“ Das HIBB solle ein Evaluationskonzept
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
erhalten, „mit dem es seine Qualität kontinuierlich überprüfen und<br />
weiter steigern kann“ (Lagebericht 2007, sub 3.). In Drs. 19/971 hat<br />
der Senat seine Absicht erklärt, das HIBB bis 2010 prozessbegleitend<br />
zu evaluieren. Entsprechende Mittel wurden im Rahmen der<br />
Haushaltsberatungen bereitgestellt. Drs. 19/3570 ist zu entnehmen,<br />
dass der Auftrag an die „prognos AG“ vergeben wurde, und dass<br />
Anfang Juli 2009 die Arbeit mit der Gründung einer Projektsteuerungsgruppe<br />
aufgenommen wurde sowie dass weitere Arbeitsschritte<br />
terminiert seien.<br />
i. Ist die Evaluation bereits abgeschlossen?<br />
ii. Wenn ja, wie lauten die Ergebnisse?<br />
iii. Wenn nein, wann ist mit Ergebnissen zu rechnen und welche<br />
Arbeitsschritte müssen noch durchgeführt werden?<br />
Ja, der Abschlussbericht wurde am 14. Februar 2011 unter www.hibb.hamburg.de/<br />
index.php/article/detail/1360 veröffentlicht. Der Bericht wurde dem Schulausschuss<br />
der Hamburgischen Bürgerschaft zugesandt. Zentrale Empfehlungen der Prognos AG<br />
sind, das HIBB in seiner Eigenständigkeit als Landesbetrieb zu stärken, die Aufbauorganisation<br />
ergebnisorientiert zu verbessern, die Grundlagen für die Steuerung zu verbessern,<br />
die Rollen der Akteure im HIBB zu klären, die HIBB-Identität zu stärken, die<br />
Beteiligung aller Interessengruppen der beruflichen Bildung zu sichern und die Zusammenarbeit<br />
von Wirtschaft und Schule in den Mittelpunkt zu stellen.<br />
m. Inwieweit ist es geplant, Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer<br />
an der Evaluation des HIBB zu beteiligen?<br />
n. Soll hierzu ein Begleitgremium eingerichtet werden?<br />
Die Beteiligung der genannten Gruppen wurde durch die Einrichtung eines Beirats<br />
gesichert, der vom Landesausschuss für berufliche Bildung berufen wurde. Im Übrigen<br />
siehe Drs. 19/4616, 19/5911 und 19/7862.<br />
Siehe Drs. 19/5911.<br />
i. Wenn ja, in welcher Zusammensetzung, mit welchen Aufgaben<br />
und welchen Kompetenzen?<br />
o. Sind die Ziele der Evaluation mit dem zuständigen Landesausschuss<br />
für Berufsbildung beraten worden?<br />
p. Mit welchen anderen Gremien oder Institutionen wurde in welcher<br />
Zusammensetzung über die Inhalte der Evaluation beraten?<br />
Der Landesausschuss für Berufsbildung ist beteiligt worden, hat sich aber nicht explizit<br />
mit den Zielen der Evaluation beschäftigt. Außerdem wurden die Inhalte der Evaluation<br />
mit dem Kuratorium des HIBB sowie mit Schulleitungen und Beschäftigten der<br />
HIBB-Zentrale im Rahmen ihrer jeweiligen Dienstbesprechungen beraten. Im Übrigen<br />
siehe Drs. 19/4616, 19/5911 und 19/7862.<br />
5. Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule<br />
Der Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule entstand 1990. Zu den<br />
Aufgaben des LB Hamburger Volkshochschule gehört unter anderem<br />
das Angebot einer allgemein zugänglichen und kostengünstigen Weiterbildung.<br />
a. Wie lautet das Zielbild und wie das Unternehmens- und Organisationskonzept<br />
des Landesbetriebs?<br />
b. Wann wurden diese jeweils vorgelegt und wann mit der Aufsicht führenden<br />
Behörde erstmals vereinbart?<br />
c. Welche Veränderungen hat es wann am ursprünglichen Zielbild beziehungsweise<br />
dem Unternehmens- und Organisationskonzept des<br />
<strong>Landesbetriebe</strong>s aus welchen Gründen gegeben?<br />
21
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
In der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zur Umwandlung der VHS in einen<br />
Landesbetrieb (siehe Drs. 13/4578) wurden die Zielvorstellungen für die VHS benannt:<br />
Diese Leitgedanken gelten in ihren Kernaussagen bis heute fort. Dem Anspruch nach<br />
Aktualität, Modernität und Transparenz ist die VHS unter anderem mit der Formulierung<br />
eines Leitbildes nachgekommen, in dem die oben genannten Ziele aufgenommen<br />
und für alle auf der Homepage nachlesbar dargestellt sind (https://www.vhshamburg.de/ueber-uns/ueber-uns/leitbild-303).<br />
Das Leitbild wurde 2001 erarbeitet und<br />
mit der zuständigen Behörde abgestimmt. Für 2011/2012 ist eine Überarbeitung des<br />
Leitbildes geplant.<br />
Die Ziele werden seit 2005 jährlich durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen<br />
BSB und VHS operationalisiert. Darin werden die Angebotssegmente beschrieben,<br />
kundenbezogene, wirtschaftsbezogene, institutionenbezogene und mitarbeiterbezogene<br />
Ziele definiert und die Form des Berichtswesens festgelegt.<br />
Bezüglich der Organisation hat es Veränderungen und Anpassungen gegeben. Bei<br />
der Einrichtung des Landesbetriebs VHS 1990 sollte ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb<br />
ermöglicht werden, also kaufmännisches Denken und Agieren in den Fokus<br />
kommen. In der Folge gab es 1999 bis 2000 eine erste größere Reorganisation der<br />
VHS. Siehe hierzu Drs. 16/2701, 16/4061 und 16/6129.<br />
2005 musste die VHS einen erheblichen Beitrag zur Konsolidierung des Gesamthaushalts<br />
leisten, die Zuschüsse der Freien und Hansestadt Hamburg wurden um circa<br />
30 Prozent gekürzt. Damit verbunden war eine Konzentration in den Angebotssegmenten<br />
und ebenfalls Personaleinsparungen, die zu Organisationsänderungen führten.<br />
Zwischenzeitlich wurden die Effektivität und Effizienz deutlich gesteigert. Dies und die<br />
deutlich steigende Nachfrage führten dazu, dass die VHS seit 2005 bei fast gleichen<br />
Zuschüssen deutlich gewachsen ist, so ist beispielsweise die Zahl der Belegungen<br />
von 71.204 in 2006 auf 93.205 in 2010 gestiegen.<br />
d. Welche Gutachten, Untersuchungen oder Beratungsdienstleistungen<br />
gab es im Vorfeld im Zusammenhang mit der Gründung dieses<br />
<strong>Landesbetriebe</strong>s?<br />
i. Wie hoch waren die Kosten hierfür?<br />
ii. Gab es öffentliche Ausschreibungen für diese Leistungen? Welches<br />
Unternehmen wurde jeweils beauftragt beziehungsweise<br />
hat diese Leistungen jeweils erbracht?<br />
Der Gründung des Landesbetriebs im Jahr 1989 ging eine umfassende behördeninterne<br />
Befassung voraus. Das Ergebnis wurde in einem umfangreichen Entwurf zur Neuorganisation<br />
der Hamburger Volkshochschule vom 15. Februar 1989 zusammengefasst<br />
und mündete in der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zur Umwandlung<br />
der VHS in einen Landesbetrieb (siehe Drs. 13/4578). Die Kosten für die behördeninterne<br />
Befassung vor Gründung des Landesbetriebs lassen sich nicht näher beziffern.<br />
22<br />
e. Welche der Ziele, die mit der Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s verfolgt<br />
wurden, wurden durch welche Maßnahmen bereits erreicht?<br />
- Flächendeckung ist nahezu erreicht: Präsenz der VHS in allen Bezirken. In sechs<br />
Bezirken ist die VHS mit eigenen Standorten (VHS-Region) vertreten. Zuletzt ist<br />
1992 aus Ressourcen der VHS der Standort im Bezirk Nord hinzugekommen. Mit<br />
den Grundbildungszentrum und Außenstellen ergibt sich folgendes Bild: Zehn<br />
VHS-Häuser, Mitnutzung von 86 Schulen und mehr als 100 weiteren Unterrichtsorten.<br />
- Allgemeine Zugänglichkeit: Es gibt neben den Angeboten für besondere Zielgruppen,<br />
wie Ältere, Junge Menschen, Migranten ein breit gefächertes Angebot aus<br />
den Bereichen Sprache, Kultur, EDV/Technik, Gesundheit und anderem auf allen<br />
Niveaus. Das Programm wurde entsprechend der gestiegenen Nachfrage erweitert.<br />
Die Angebote „Deutsch als Fremdsprache“ sowie „Grundbildung (Alphabetisierung)“<br />
wurden ausgebaut und in jeweils einem Zentrum zusammengefasst. Die
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Entgelte liegen unterhalb der Marktpreise, und es gibt zahlreiche Ermäßigungsmöglichkeiten,<br />
sodass der Zugang zu Veranstaltungen auch für sozial benachteiligte<br />
Bürgerinnen und Bürger möglich ist.<br />
- Innovative Angebote: Die Angebote sind zeit<strong>gemäß</strong> und werden den sich ändernden<br />
Interessen und Bedarfen entsprechend ausgebaut, so ist beispielsweise das<br />
Angebot im Gesundheitsbereich – gesunde Ernährung, Bewegung et cetera – in<br />
den letzten Jahren stark gestiegen. Die Junge VHS wird beispielsweise im Rahmen<br />
des Programms Umwelthauptstadt 2011 eine iPod-Klima-Performance<br />
durchführen. Besondere Angebote werden häufig in Form von Projekten angeboten.<br />
Dies gelingt der VHS aufgrund der erfolgreichen Akquise von Drittmitteln sowie<br />
der guten Vernetzung und zahlreicher Kooperationen unter anderem mit der<br />
Bücherhalle, Hochschulen, Museen, Theatern und den Bezirksämtern, die sich<br />
über die Jahre etabliert haben. Zudem werden die Kursleitungen gut eingeführt<br />
und erhalten regelmäßig Fortbildungen.<br />
- Wirtschaftliche Steuerung wurde entwickelt und ist heute voll funktionsfähig, mit<br />
positiven Finanzergebnissen seit 2003. Die Erträge wurden kontinuierlich gesteigert.<br />
- Transparenz ist durch den jährlichen Jahresbericht und die Veröffentlichung des<br />
Jahresabschlusses gegeben.<br />
f. Welche Ziele konnten bislang noch nicht erreicht werden? Wie sollen<br />
sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Die VHS wird ihre regionale Ausrichtung schrittweise weiter stärken. Inhaltlich werden<br />
die Angebote für Zielgruppen weiterentwickelt. Dazu gehören die Segmente Grundbildung<br />
und Alphabetisierung sowie Angebote für Senioren.<br />
g. Wie hat sich seit der Gründung des LB der Stellenbestand entwickelt?<br />
(Bitte aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern<br />
sowie nach Eingruppierung.)<br />
Stellenbestand bei Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s 1990 und <strong>gemäß</strong> Stellenplänen<br />
2000 und 2011<br />
1990 * 2000 * 2011<br />
Beamte<br />
B 2 1,0 1,0 1,0<br />
A 16 1,0 1,0 1,0<br />
A 15 5,0 6,0 6,0<br />
A 14 3,0 6,0 6,0<br />
A 13 29,0 24,0 9,0<br />
A 8 1,0 0,0 0,0<br />
gesamt<br />
Beschäftigte<br />
40,0 38,0 23,0<br />
Ib E 14 0,0 1,0 1,0<br />
IIa E 13 6,4 19,9 20,2<br />
III E 12 1,0 2,0 1,0<br />
IVa E 11 0,0 6,0 8,0<br />
IVb E 10 1,0 2,0 2,5<br />
Vb/IVb E 9 4,8 7,0 6,5<br />
Vb E 9 1,0 1,0 4,0<br />
Vc/Vb E 8 1,0 0,0 0,0<br />
Vc E 8 4,0 11,5 11,3<br />
VIb E 6 2,0 21,0 21,5<br />
VII E 5 10,0 4,5 3,5<br />
VIII/VII E 3 1,5 0,0 0,0<br />
IXb/VII E 2 3,0 0,0 0,0<br />
VIII E 3 7,0 8,0 8,0<br />
Hilfskräfte E 2 3,0 2,6 2,6<br />
Arbeiter E 2 0,0 4,6 4,6<br />
23
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
24<br />
1990 * 2000 * 2011<br />
noch Beschäftigte<br />
gesamt 45,7 86,5 94,7<br />
Insgesamt 85,7 124,5 117,7<br />
* In den hier für 1990 und 2000 ausgewiesenen Stellen sind – im Gegensatz zu den Anlagen<br />
zu den Wirtschaftsplänen – 85,73 Stellen Richtl. Ang. gD nicht enthalten. Diese Stellen<br />
waren für Unterrichtstätigkeit vorgesehen. Sie wurden nie besetzt, da der Unterricht fast<br />
ausschließlich von freiberuflichen Dozenten durchgeführt wurde und wird. Dafür waren und<br />
sind keine Stellen notwendig. Deshalb sind inzwischen diese Stellen aus dem Stellenplan<br />
der VHS gestrichen und in 2011 nicht mehr enthalten.<br />
h. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Die Personalzuwächse gegenüber 1990 ergaben sich durch die gestiegene Nachfrage,<br />
die erfolgreiche Akquirierung von Drittmittel- und Auftragsmaßnahmen, die notwendige<br />
Vernetzung vor Ort sowie das Nachholen einer bei der Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s<br />
nicht berücksichtigten Stellenausstattung. Der Personalabbau gegenüber<br />
dem Jahr 2000 resultiert aus der aufgrund der Zuschussreduzierung ab 2005<br />
notwendigen Umstrukturierung und des damit ebenfalls verbundenen Abbaus des<br />
Hauptschulabschlussprojektes.<br />
i. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Die Stellen werden als Personalmittel im Rahmen des Wirtschaftsplans kalkuliert und<br />
sind insoweit auch Gegenstand des Zuschusses, der einen Teil des Finanzbedarfs der<br />
VHS deckt, im Übrigen durch zusätzlich generierte Einnahmen, überwiegend aus Entgelterträgen<br />
und Erträgen für Auftragsmaßnahmen und aus Drittmitteln.<br />
j. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
In den Wirtschaftsplänen für 2011 und 2012 sind zusätzliche Stellen geplant, um der<br />
Nachfrage und zusätzlichen Herausforderungen gerecht zu werden (siehe Drs.<br />
20/700).<br />
k. Welche Stellenhebungen wurden seit der Gründung des LB für welche<br />
Funktionen im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils<br />
durchgeführt?<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
1990er 7 Vc Vb/IVb Geschäftsstellenleitungen der Vertriebseinheiten<br />
1993 * VII VIb Sachbearbeitung in den Vertriebseinheiten<br />
* Unterlagen bezüglich der Stellenanzahl liegen nicht mehr vor.<br />
l. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für den laufenden Betrieb erhielt die VHS folgende Zuschüsse:<br />
Jahr<br />
Zuschuss zur Deckung des<br />
Betriebsverlustes<br />
in Tsd. €<br />
Zuschuss für<br />
ausfallende Entgelte<br />
in Tsd. €<br />
1998 5.835 1.454<br />
1999 5.859 1.390<br />
2000 5.788 1.302<br />
2001 5.618 1.183<br />
2002 5.880 1.194<br />
2003 5.876 1.194<br />
2004 5.974 1.194
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Jahr<br />
Zuschuss zur Deckung des<br />
Betriebsverlustes<br />
in Tsd. €<br />
Zuschuss für<br />
ausfallende Entgelte<br />
in Tsd. €<br />
2005 5.585 850<br />
2006 5.032 0<br />
2007 5.038 0<br />
2008 5.038 0<br />
2009 5.041 0<br />
2010 5.041 0<br />
Angaben zu den Jahren vor 1998 liegen nicht mehr vor.<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Absenkung der Zuschüsse erfolgte aufgrund von Konsolidierungsbeschlüssen.<br />
m. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für Investitionen erhielt die VHS folgende Zuschüsse:<br />
Jahr<br />
Investitionszuschüsse<br />
ohne Sonderbeträge<br />
in Tsd. €<br />
Investitionszuschüsse<br />
für besondere Zwecke<br />
in Tsd. €<br />
1998 307<br />
1999 358 205<br />
2000 409<br />
2001 409<br />
2002 409<br />
2003 460<br />
2004 460<br />
2005 460<br />
2006 500 7<br />
2007 500 121<br />
2008 500<br />
2009 500 1.174 *<br />
2010 600 1.186 *<br />
* Im Wesentlichen Zuschüsse zur Sanierung der Gebäude Leuschnerstraße (Bergedorf) und<br />
Waitzstraße (Othmarschen)<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Entwicklung ist maßgeblich auf den Ausbau von Räumen und deren Ausstattung<br />
sowie die Sanierung von Gebäuden auch aufgrund umweltgerechter Maßnahmen<br />
zurückzuführen.<br />
n. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Für sonstige andere Zwecke erhielt die VHS folgende Zuschüsse:<br />
Zuschüsse für<br />
Jahr besondere Zwecke<br />
in Tsd. €<br />
1998 0<br />
1999 436<br />
2000 920<br />
2001 62<br />
Anlass<br />
Sonderzuweisungen zum Abbau des<br />
Defizits<br />
Teilerlös aus dem Verkauf der Koppel<br />
(1.800 Tsd. DM = 920 Tsd. €)<br />
Sonderzuweisung zum Abbau des<br />
Defizits (121 Tsd. DM = 62 Tsd. €)<br />
25
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
<strong>26</strong><br />
Jahr<br />
Zuschüsse für<br />
besondere Zwecke<br />
in Tsd. €<br />
2002 177<br />
Anlass<br />
Übernahme der Kosten des KPMG-<br />
Gutachtens (347 Tsd. DM = 177 Tsd. €)<br />
o. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen der VHS mit der zuständigen Behörde sehen<br />
ein ausführliches Berichtswesen vor. Darüber hinaus berichtet die VHS regelmäßig im<br />
Rahmen der DVV-Statistik (Deutscher Volkshochschul-Verband), die jährlich veröffentlicht<br />
wird. Damit ist in bestimmten Bereichen ein bundesweiter Vergleich möglich.<br />
Seit 1997 hat die VHS das Prüfsiegel von Weiterbildung Hamburg e.V. inne. Damit<br />
wird die Einhaltung von Qualitätsstandards in der Weiterbildung bestätigt. Dies wird<br />
alle drei Jahre von unabhängigen Gutachtern überwacht.<br />
Darüber hinaus unterzieht sich die VHS seit 2004 regelmäßig Zertifizierungsprozessen<br />
nach DIN EN ISO 9001:2008 und der Bewertung auf Basis des EFQM-Modells<br />
(European Foundation for Quality Management). Wie schon 2007 wurde die VHS im<br />
Herbst 2010 nach IQNet Business Excellence mit dem Level Silber ausgezeichnet.<br />
i. Wenn nein, warum nicht?<br />
Eine über das genannte Maß hinausgehende Evaluation wird nicht für notwendig erachtet.<br />
ii. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
Die genannten Überprüfungen werden von der VHS selbst beauftragt. Für das Prüfsiegel<br />
erfolgt sie durch Mitglieder des Gutachterausschusses Allgemeine und Politische<br />
Weiterbildung von Weiterbildung Hamburg e.V., für die Evaluation nach ISO und<br />
dem EFQM-Modell durch Auditoren der DQS GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung<br />
von Managementsystemen).<br />
iii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
Die letzte Zertifizierung durch die DQS erfolgte im September 2010. Es gab keinerlei<br />
Beanstandungen. Die Zertifikate sind damit erneut drei Jahre gültig unter der Voraussetzung<br />
der erfolgreichen, jährlichen Wiederholungsbegutachtung. Als besondere<br />
Stärken der VHS wurden unter anderem erwähnt:<br />
- Die ausgeprägte Kundennähe, die sich in der regionalen Verteilung des Angebots<br />
– einschließlich der Präsenz in ausgewählten sozial benachteiligten Stadtteilen –<br />
sowie in der kontinuierlichen und nachfragegerechten Aktualisierung des Kursangebots<br />
dokumentiert.<br />
- Der aussagefähige Jahresbericht, der in übersichtlicher Form einen Überblick<br />
über die Arbeit der VHS gibt.<br />
- Die hohe Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Kursleitenden<br />
mit der VHS.<br />
Als Potenziale wurden unter anderem benannt:<br />
- Es ist zu prüfen, ob die Audits auf alle Regionen ausgeweitet werden können, da<br />
die positiven Impulse in der gesamten VHS dann besser genutzt werden könnten.<br />
- Fragebögen zur Befragung sollten gemeinsam mit den internen Kunden überarbeitet<br />
werden, um den Nutzen für den Anwender zu vergrößern.<br />
Die letzte Begutachtung durch Weiterbildung Hamburg e.V. wurde im Juni 2011 erfolgreich<br />
abgeschlossen. Es wurde unter anderem angeregt, bei den Regelungen zum<br />
Rücktritt von einer Anmeldung mit Blick auf Qualitätsstandard 28 darauf hinzuweisen,<br />
dass im Fall eines Ersatzteilnehmers beziehungsweise einer Ersatzteilnehmerin keine<br />
weiteren Kosten entstehen.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
iv. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
Die Konsolidierung der VHS ist gelungen. Seit 2003 wird kein Defizit mehr erwirtschaftet.<br />
Die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit einerseits und kostengünstigen Angeboten<br />
andererseits ist erreicht. Der Kostendeckungsgrad konnte von 50 Prozent in 2005<br />
auf 64 Prozent in 2010 erhöht werden. Die VHS ist organisatorisch wie inhaltlich gut<br />
aufgestellt und bietet für die Nutzer hohe Qualität. Der eingeschlagene Kurs ist beizubehalten.<br />
Entfällt.<br />
v. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
p. Steht der LB in geschäftlicher Verbindung zu Dritten?<br />
Wenn ja, wie haben sich die Zahlen aus diesen Geschäften seit der<br />
Gründung des LB entwickelt?<br />
Ja. Die VHS bietet Dienstleistungen an, für die Entgelte zu entrichten sind. Diese haben<br />
sich wie folgt entwickelt:<br />
Jahr<br />
Entgelterträge<br />
in Tsd. €<br />
1998 4.317<br />
1999 4.609<br />
2000 5.095<br />
2001 4.876<br />
2002 4.646<br />
2003 5.052<br />
2004 5.434<br />
2005 5.169<br />
2006 5.117<br />
2007 5.153<br />
2008 5.286<br />
2009 5.575<br />
2010 5.763<br />
Angaben zu den Jahren vor 1998 liegen nicht mehr vor.<br />
Im Betrachtungszeitraum 1998 bis 2010 ergibt sich eine Steigerung der Entgelterträge<br />
um 33,5 Prozent.<br />
Außerdem hat die VHS durch Aufträge Dritter seit 1998 folgende Erträge erwirtschaftet:<br />
Jahr<br />
Auftragsmaßnahmen<br />
Drittmittel<br />
in Tsd. €<br />
1998 237<br />
1999 588<br />
2000 597<br />
2001 962<br />
2002 1.320<br />
2003 1.183<br />
2004 1.180<br />
2005 1.057<br />
2006 1.5<strong>26</strong><br />
2007 1.907<br />
2008 1.702<br />
2009 1.995<br />
2010 2.212<br />
27
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Im Jahr 2002 wurde das Zentrum für Grundbildung und Drittmittel gegründet. Es folgte<br />
im Jahr 2004 ZeDA (Zentrum für Drittmittel und Auftragsmaßnahmen), Vorgänger des<br />
Bildungskontors.<br />
Umsatzerlöse in diesem Bereich sind abhängig von Förderrichtlinien und -beträgen in<br />
den für die VHS relevanten Bereichen und fallen deshalb nicht kontinuierlich an.<br />
Im Betrachtungszeitraum 1998 bis 2010 ergibt sich eine Steigerung der eingeworbenen<br />
Drittmittel um 833,3 Prozent.<br />
Ja.<br />
28<br />
q. Verfügt der LB über eine kaufmännische Buchhaltung?<br />
6. Landesbetrieb Hamburgische Münze<br />
Zu den Aufgaben des LB gehören unter anderem das Prägen von Umlauf-,<br />
Auslands-, Sammler- und Gedenkmünzen sowie die Herstellung<br />
von Medaillen für den öffentlichen und privaten Bedarf.<br />
Das Münzwesen in Hamburg reicht bis in das 9. Jahrhundert zurück; die Hamburgische<br />
Münze in ihrer heutigen Form wurde durch Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft<br />
im Jahre 1873 neu errichtet. Sie nahm ihre Arbeit im Jahr 1875 am Standort<br />
Norderstraße auf und wurde 1982 in einen Neubau in Hamburg-Meiendorf verlagert.<br />
Als Basis für die Entwicklungsdaten des Betriebs wurde der Zeitraum seit dem Jahr<br />
2000 zugrunde gelegt.<br />
a. Wie lautet das Zielbild und wie das Unternehmens- und Organisationskonzept<br />
des Landesbetriebs?<br />
Das Zielbild der Hamburgischen Münze lautet wie folgt:<br />
„1. Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Umlauf- und Sammlermünzen.<br />
1.1. Die technische Ausstattung ist so zu gestalten, dass auch bei kurzfristiger<br />
und unvorhersehbarer Auftragserteilung seitens des Bundesministeriums der<br />
Finanzen eine flexible und termingerechte Aufgabenerfüllung gewährleistet<br />
ist.<br />
1.2. Erhalt des für die Zielerreichung notwendigen qualifizierten Personalstamms<br />
durch Aus- und Weiterbildung.<br />
2. Deckung des Bedarfs der FHH an Medaillen für besondere Anlässe und Repräsentanz<br />
der FHH mit numismatischen Produkten.<br />
3. Angemessene Verzinsung des Eigenkapitals durch wirtschaftliche Betriebsführung.<br />
3.1. Im Fall freier Kapazitäten nach Erfüllung der Ziele 1 und 2 Erzielung zusätzlicher<br />
Umsatzerlöse durch Herstellen von Medaillen und Marken für private<br />
Auftraggeber im In- und Ausland.<br />
3.2. Im Fall freier Kapazitäten nach Erfüllung der Ziele 1 und 2 Erzielung zusätzlicher<br />
Umsatzerlöse durch Herstellen von Münzen und Gedenkmünzen für<br />
fremde Staaten.<br />
4. Berücksichtigung des sonstigen öffentlichen Interesses nach Maßgabe des Senats.“<br />
Ein schriftlich fixiertes Unternehmens- und Organisationskonzept besteht nicht.<br />
b. Wann wurden diese jeweils vorgelegt und wann mit der Aufsicht führenden<br />
Behörde erstmals vereinbart?<br />
Das Zielbild in seiner jetzigen Form wurde mit der zuständigen Behörde im August<br />
2009 vereinbart.<br />
c. Welche Veränderungen hat es wann am ursprünglichen Zielbild beziehungsweise<br />
dem Unternehmens- und Organisationskonzept des<br />
<strong>Landesbetriebe</strong>s aus welchen Gründen gegeben?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Im Rahmen des Zuständigkeitswechsels von der Wirtschaftsbehörde zur Finanzbehörde<br />
wurde das von der Wirtschaftsbehörde entwickelte Zielbild um die Einführung einer<br />
Zielhierarchie erweitert. Des Weiteren wurden geringfügige inhaltliche Anpassungen<br />
vorgenommen.<br />
d. Welche der Ziele, die mit der Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s verfolgt<br />
wurden, wurden durch welche Maßnahmen bereits erreicht?<br />
e. Welche Ziele konnten bislang noch nicht erreicht werden? Wie sollen<br />
sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Bei den beschriebenen Zielen handelt es sich um laufende Aufgaben der Hamburgischen<br />
Münze.<br />
Die Ziele 1 und 2 einschließlich ihrer Unterziele wurden im Berichtszeitraum jährlich<br />
erreicht.<br />
Das Ziel 3 einschließlich seiner Unterziele wurde im Berichtszeitraum in unterschiedlichem<br />
Ausmaß erreicht. Insbesondere die ersten Jahre im Berichtszeitraum wiesen<br />
eine hohe Zielerreichung (vor allem bedingt durch die Erstprägung von Euromünzen)<br />
auf. Aufgrund von stagnierenden Aufträgen des Bundes sowie einem durch die<br />
Finanzkrise bedingten Einbruch auf dem Markt für Auslandsaufträge ist für 2011 von<br />
einer negativen Eigenkapitalverzinsung auszugehen. In 2010 ist es der Hamburgischen<br />
Münze gelungen, trotz schwieriger Bedingungen eine noch leicht positive Eigenkapitalverzinsung<br />
zu erreichen.<br />
Durch mittelfristig steigende Aufträge des Bundes sowie Bemühungen um die Akquisition<br />
von Auslandsaufträgen (gegebenenfalls in Kooperation mit anderen deutschen<br />
Münzstätten) soll die Eigenkapitalverzinsung in den nächsten Jahren wieder verbessert<br />
werden.<br />
Siehe Anlage 4.<br />
Nein.<br />
Entfällt.<br />
f. Wie hat sich seit der Gründung des LB der Stellenbestand entwickelt?<br />
(Bitte aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern<br />
sowie nach Eingruppierung.)<br />
g. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
h. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich generierte<br />
Einnahmen et cetera)?<br />
i. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
j. Welche Stellenhebungen wurden seit der Gründung des LB für welche<br />
Funktionen im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils<br />
durchgeführt?<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2002 1 IVa III Technik-Service und Logistik<br />
2004 1 IIa hD Ib Kaufmännische Leitung<br />
2008 1 E 4 E 7 Lager/Altgeldvernichtung<br />
2008 1 E 10 E 11 Qualitätsingenieur<br />
2008 1 E 14 E 15 Technische Leitung<br />
k. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Die Ablieferungen an den Haushalt haben sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:<br />
29
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
30<br />
Jahr<br />
Betrag<br />
in €<br />
2000 2.925.100,85<br />
2001 2.075.845,04<br />
2002 2.076.000,00<br />
2003 2.800.000,00<br />
2004 2.300.000,00<br />
2005 1.556.000,00<br />
2006 1.556.000,00<br />
2007 1.000.000,00<br />
2008 1.000.000,00<br />
2009 1.000.000,00<br />
2010 500.000,00<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Maßgeblich für die hohen Ablieferungen waren im Wesentlichen die im Zuge der<br />
Euro-Erstprägung erzielten Überschüsse der Jahre 1999 bis 2001 sowie die in den<br />
Folgejahren erzielten jährlichen Überschüsse.<br />
l. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für Investitionen erhielt die Hamburgische Münze folgende Zuschüsse:<br />
2006: 74.000 Euro<br />
2007: 17.000 Euro<br />
2010: 30.000 Euro.<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Zuschüsse wurden im Wesentlichen für Maßnahmen zur Energieeinsparung genutzt.<br />
m. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Zuschüsse für sonstige andere Zwecke wurden im Berichtszeitraum nicht gegeben.<br />
n. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
i. Wenn nein, warum nicht?<br />
ii. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
iii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
iv. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
v. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Eine Evaluation erfolgte durch die Firma Mummert + Partner Unternehmensberatung<br />
AG im Auftrag der seinerzeit zuständigen Wirtschaftsbehörde etwa im Jahr 1995.<br />
Die Untersuchung erfolgte vor dem Hintergrund der sich nach Einführung des Euro<br />
voraussichtlich ergebenden Veränderungen des europäischen Münzmarktes. Im Ergebnis<br />
wurde eine Reihe von Maßnahmen zur Neustrukturierung der Hamburgischen<br />
Münze empfohlen. Hierzu gehörten insbesondere Änderungen der Organisationsstruktur<br />
durch Straffung der Führungsstruktur im Bereich der unmittelbaren Münzproduktion,<br />
Anpassungen des Maschinenbedarfs, die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems,<br />
Änderungen im EDV-Bereich sowie die mittelfristige Reduzierung des
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Personalkörpers. Die Maßnahmen sind in der Folgezeit eingeleitet und weitgehend<br />
umgesetzt worden.<br />
o. Steht der LB in geschäftlicher Verbindung zu Dritten?<br />
Wenn ja, wie haben sich die Zahlen aus diesen Geschäften seit der<br />
Gründung des LB entwickelt?<br />
Die Hamburgische Münze stand über lange Jahre in geschäftlichen Verbindungen zu<br />
einem großen Münzhandelshaus; mit dessen Neuorientierung in die Bundeshauptstadt<br />
sind diese Verbindungen nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Daneben<br />
hat die Hamburgische Münze in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten vereinzelt<br />
Prägeaufträge ausländischer Staaten erfüllt.<br />
Ja.<br />
Jahr<br />
Umsätze gewerblicher<br />
Bereich<br />
(ohne Materialaufwand)<br />
in €<br />
2000 197.277,50<br />
2001 780.943,11<br />
2002 1.889.284,47<br />
2003 838.594,31<br />
2004 858.621,76<br />
2005 973.829,27<br />
2006 735.084,10<br />
2007 1.047.677,11<br />
2008 2.186.659,56<br />
2009 604.434,75<br />
2010 307.346,20<br />
p. Verfügt der LB über eine kaufmännische Buchhaltung?<br />
7. Landesbetrieb Landwirtschaft der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand<br />
Der Landesbetrieb Landwirtschaft der Jugend- und Frauenvollzugsanstalt<br />
Hahnöfersand bewirtschaftet die landwirtschaftlichen Flächen der<br />
früheren Elbinsel.<br />
Der Milchviehbetrieb hatte in der Vergangenheit für die JVA Hahnöfersand einen<br />
hohen vollzuglichen Nutzen und war seit der Umstrukturierung im Jahr 1991 ohne<br />
Zuschüsse bewirtschaftet worden.<br />
Die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung für die Gefangenen mit Lebensmittelpunkt<br />
in Hamburg lässt eine Tätigkeit in der Landwirtschaft grundsätzlich nicht mehr<br />
als tragfähige berufliche Grundlage und sinnvolle Wiedereingliederungsmaßnahme<br />
erscheinen. Neben der geringen Eignung und Bereitschaft der Gefangenen zur Arbeit<br />
in einem landwirtschaftlichen Betrieb fehlt eine zukunftsorientierte berufliche Perspektive.<br />
Diese zu schaffen, ist aber wesentlicher Teil der Kernaufgabe einer Resozialisierung<br />
von Gefangenen im Strafvollzug.<br />
Zudem geht der Milchpreis seit Jahren auf dem Agrarmarkt auf ein nicht auskömmliches<br />
Niveau zurück. Mit Blick auf die letzten Wirtschaftberichte ist für die kommenden<br />
Jahre jeweils mit einem nennenswerten Jahresfehlbetrag zu rechnen.<br />
Zusammenfassend kann es aus Gründen einer wirtschaftlichen und sparsamen<br />
Haushaltsführung nicht verantwortet werden, den Landesbetrieb ohne vollzuglichen<br />
Nutzen als Zuschussbetrieb weiterzuführen. Der Landesbetrieb „Landwirtschaft der<br />
JVA Hahnöfersand“ wurde zum 30. Juni 2011 geschlossen. Die haushaltsmäßigen<br />
Auswirkungen werden noch konkretisiert werden.<br />
a. Wie lautet das Zielbild und wie das Unternehmens- und Organisationskonzept<br />
des Landesbetriebs?<br />
b. Wann wurden diese jeweils vorgelegt und wann mit der Aufsicht führenden<br />
Behörde erstmals vereinbart?<br />
31
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Erstmals wurden Zielbild und Aufgabe des Landesbetriebs „Landwirtschaft der JVA<br />
Hahnöfersand“ in einer Dienstanweisung des Strafvollzugsamtes am 2. Mai 2006 wie<br />
folgt beschrieben:<br />
„Der Landesbetrieb hat als ein Teil des Strafvollzugsamtes die Aufgaben nach <strong>§</strong><strong>§</strong> 2<br />
und 3 in Verbindung mit <strong>§</strong> 35 Strafvollzugsgesetz in der jeweils geltenden Fassung zu<br />
erfüllen. Es ist unter anderem seine Aufgabe, die durch den Strafvollzug gebundenen<br />
Freiflächen zu bewirtschaften, Gefangene zu beschäftigen und für diesen Zweck<br />
Arbeitsplätze bereitzuhalten. Der Landesbetrieb verfügt über 12 Arbeits- und 3 Ausbildungsplätze<br />
für Gefangene. Als Bestandteil des Arbeitskonzeptes für Strafgefangene<br />
der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand ist der Landesbetrieb von großer Bedeutung,<br />
weil auf die qualifizierenden Tätigkeiten in der Landwirtschaft und den verhaltenspsychologischen<br />
Aspekt im verantwortungsvollen Umgang mit Tieren besonderer Wert<br />
gelegt wird. Der Landesbetrieb ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen.“<br />
Keine.<br />
Siehe Vorbemerkung zu 7.<br />
32<br />
c. Welche Veränderungen hat es wann am ursprünglichen Zielbild beziehungsweise<br />
dem Unternehmens- und Organisationskonzept des<br />
<strong>Landesbetriebe</strong>s aus welchen Gründen gegeben?<br />
d. Welche der Ziele, die mit der Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s verfolgt<br />
wurden, wurden durch welche Maßnahmen bereits erreicht?<br />
e. Welche Ziele konnten bislang noch nicht erreicht werden? Wie sollen<br />
sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Entfällt. Im Übrigen siehe Vorbemerkung zu 7.<br />
f. Wie hat sich seit der Gründung des LB der Stellenbestand entwickelt?<br />
(Bitte aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern<br />
sowie nach Eingruppierung.)<br />
Seit seiner Gründung verfügte der Landesbetrieb über folgende Stellen. Die Eingruppierungen<br />
entsprechen dem aktuellen Stand:<br />
1 Landwirtschaftlicher Betriebsleiter: TVL/EG 12<br />
1 Landwirtschaftsmeister: TVL/EG 8<br />
1 Landwirtschaftlicher Angestellter: TVL/EG 3.<br />
g. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben? Wie werden<br />
die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich generierte Einnahmen<br />
et cetera)?<br />
Nein.<br />
h. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Entfällt. Siehe Vorbemerkung zu 7.<br />
Keine.<br />
i. Welche Stellenhebungen wurden seit der Gründung des LB für welche<br />
Funktionen im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils<br />
durchgeführt?<br />
j. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Es hat keinen Zuschuss und keine Ablieferung an den Haushalt gegeben. Verluste<br />
und Überschüsse konnten betriebsintern jahresübergreifend durch Rücklagen (Bildung<br />
und Entnahmen) ausgeglichen werden.<br />
k. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Nach einer Umstellung der Viehwirtschaft 1991 von Schweinemast auf Milchvieh gab<br />
es zum Neubau einer Stallung einmalig einen Haushaltszuschuss zur Investition, die<br />
sich gewinnbringend entwickelte, weil zu der Zeit in der Schweinezucht ein erhöhtes<br />
Risiko lag und weniger Ertrag zu erwirtschaften war als in der Haltung von Milchvieh<br />
und Produktion von Milch.<br />
l. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Siehe Antwort zu 7. j.<br />
m. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
i. Wenn nein, warum nicht?<br />
ii. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
iii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
iv. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
v. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Nein. Die zuständige Behörde und die Gremien hielten eine Evaluation nicht für erforderlich.<br />
n. Steht der LB in geschäftlicher Verbindung zu Dritten?<br />
Wenn ja, wie haben sich die Zahlen aus diesen Geschäften seit der<br />
Gründung des LB entwickelt?<br />
Ja. Im Wesentlichen zu Molkereien und Saatgutunternehmen. Die Preisentwicklung<br />
lässt in der Milchproduktion keine kostendeckende Bewirtschaftung mehr zu.<br />
Ja.<br />
o. Verfügt der LB über eine kaufmännische Buchhaltung?<br />
8. gestrichen (aus redaktionellen Gründen frei)<br />
9. Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester<br />
Das Philharmonische Staatsorchester spielt unter anderem zahlreiche<br />
Kammerkonzerte sowie fast sämtliche Opern- und Ballettvorstellungen in<br />
der Hamburgischen Staatsoper.<br />
a. Wie lautet das Zielbild und wie das Unternehmens- und Organisationskonzept<br />
des Landesbetriebs?<br />
b. Wann wurden diese jeweils vorgelegt und wann mit der Aufsicht führenden<br />
Behörde erstmals vereinbart?<br />
c. Welche Veränderungen hat es wann am ursprünglichen Zielbild beziehungsweise<br />
dem Unternehmens- und Organisationskonzept des<br />
<strong>Landesbetriebe</strong>s aus welchen Gründen gegeben?<br />
33
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Für den Landesbetrieb liegt ein Zielbild vom 12. Februar 1999 vor, das seitdem nicht<br />
verändert wurde. Die Ziele lauten wie folgt:<br />
Oberziele:<br />
- Ausrichtung eines qualitativ hochwertigen sinfonischen Konzertangebotes, das<br />
auch Jugendkonzerte und die Pflege zeitgenössischer Musik einbezieht,<br />
- Pflege der Kammermusik durch ein entsprechendes Konzertangebot der Orchestermitglieder.<br />
- Die Preisgestaltung bei den Konzertangeboten soll auch sozial schwächeren Besucherschichten<br />
den Zugang zu den Konzerten ermöglichen.<br />
- Übernahme der Orchestertätigkeit in der Hamburgischen Staatsoper bei Opernund<br />
Ballettproduktionen,<br />
- Festigung des überregionalen Rufes des Klangkörpers als Spitzenorchester durch<br />
auswärtige Gastspiele,<br />
- Produktionen von Tonträgern und von Rundfunk- und Fernsehaufnahmen.<br />
Teilziele:<br />
- Veranstaltung eines Zyklus der Philharmonischen Konzerte mit Einführungsveranstaltungen,<br />
- Veranstaltung einer Reihe von Kammerkonzerten,<br />
- Leistung der Orchesterdienste für die Hamburgische Staatsoper in den Bereichen<br />
Oper und Ballett,<br />
- Wahrnehmung musikpädagogischer Aufgaben durch die Veranstaltung von Jugend-<br />
und Schülerkonzerten, unter anderem in Zusammenarbeit mit der für Schule<br />
und Jugend zuständigen Behörden sowie durch Angebote von Probenbesuchen<br />
im Konzert- und Opernbereich,<br />
- Veranstaltung von Sonderkonzerten mit besonderen Programmen und Solisten<br />
sowie mit Hamburger Spitzenchören,<br />
- Gestaltung und Mitgestaltung von Musikfesten und Veranstaltungen zu besonderen<br />
Anlässen,<br />
- ständige Pflege von Kontakten zur Hochschule für Musik und Theater Hamburg<br />
und zu anderen Musikbildungsinstitutionen, insbesondere Nachwuchsförderung<br />
durch Beschäftigung von Musikstudentinnen und -studenten mit Praktikantenverträgen<br />
oder als Orchesteraushilfen,<br />
- Durchführung von Gastspielen in anderen Städten der Bundesrepublik Deutschland<br />
und im Ausland,<br />
- Abschlüsse von Verträgen für Tonträger-, Rundfunk- und Fernsehproduktionen,<br />
Durchführung derartiger Produktionen.<br />
Ein schriftliches Unternehmenskonzept liegt nicht vor. Die Arbeit und Disposition der<br />
Philharmoniker Hamburg ist durch die Doppelrolle des Orchesters als Opern- und<br />
Konzertorchester unter Berücksichtigung des Stellenbestandes und der Zahl der tarifvertraglich<br />
zulässigen Dienste in einem sehr hohen Maße vorgeprägt und in Form<br />
eines Kooperationsvertrages mit der Hamburgischen Staatsoper verbindlich ausgestaltet.<br />
Vor diesem Hintergrund bleibt kaum Raum für abweichende unternehmerische<br />
Entscheidungen.<br />
Dennoch ist vor allem die Organisationsstruktur als eigenständiger Landesbetrieb seit<br />
1999 fortlaufend zwischen der zuständigen Behörde und der Geschäftsführung diskutiert<br />
worden, wobei ein besonderes Augenmerk auf einer möglichen Eingliederung des<br />
Landesbetriebs in die Hamburgische Staatsoper GmbH lag. Wegen der ohnehin<br />
schon engen personellen Verbindung beider Einrichtungen in Geschäftsführung und<br />
Verwaltung, die eine gemeinsame Steuerung ermöglicht, wären bei einer Eingliederung<br />
jedoch keine Vorteile zu erwarten, die insbesondere die damit einhergehenden<br />
arbeitsrechtlichen Probleme rechtfertigen würden.<br />
34
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
d. Welche der Ziele, die mit der Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s verfolgt<br />
wurden, wurden durch welche Maßnahmen bereits erreicht?<br />
Es werden zehn qualitativ herausragende sinfonische Doppelkonzerte mit Einführungsveranstaltungen<br />
pro Saison durchgeführt, daneben sechs Kammerkonzerte pro<br />
Saison mit einer Programmgestaltung unter Beteiligung der Orchestermitglieder. Im<br />
Durchschnitt finden 215 Vorstellungsdienste für die Hamburgische Staatsoper pro<br />
Saison (durchschnittlich 162 Oper, 53 Ballett) statt, zusätzlich <strong>26</strong>5 Probendienste. Im<br />
Rahmen der Musikpädagogik werden Schulbesuche (seit 1978) von einzelnen Mitgliedern<br />
der Philharmoniker zur Vorstellung von Instrumenten sowie öffentliche Proben<br />
angeboten, die Philharmoniker wirken beim „Musikkindergarten Hamburg“ mit, es gibt<br />
eine Orchesterpatenschaft mit dem Albert Schweitzer Jugendorchester, Familienangebote<br />
bei einzelnen Konzerten und die besondere Beilage „Ohrenspitzer“ für jüngere<br />
Besucher in den Programmheften. Es werden vier bis fünf Sonderkonzerte mit besonderen<br />
Programmen und Solisten pro Saison durchgeführt. Die Philharmoniker wirken<br />
regelmäßig bei Musikfesten mit, zum Beispiel beim „Hamburger Musikfest“ und den<br />
„Hamburger Ostertönen“. Orchestermitglieder haben Lehrtätigkeiten an der Hochschule<br />
für Musik und Theater Hamburg übernommen, Nachwuchsförderung findet statt<br />
durch den Einsatz von Musikstudenten in Aufführungen, Orchesterpraktikanten und<br />
eine neu gegründete Orchesterakademie. Die Philharmoniker führen regelmäßig<br />
Gastspiele durch (teilweise zusammen mit der Oper), zum Beispiel Europatournee,<br />
Beethovenfest Bonn, Amsterdam, Edinburgh. Es finden jährliche Rundfunkaufzeichnungen<br />
durch den NDR von Opernpremieren statt, daneben Fernsehaufzeichnungen<br />
für ARTE, das ZDF und 3sat, DVD-Produktionen, CD-Projekte im Bereich der Oper<br />
(zum Beispiel „Ring des Nibelungen“) sowie CD-Projekte im Konzertbereich wie Silvesterkonzerte,<br />
Bruckner, Brahms, Mahler.<br />
e. Welche Ziele konnten bislang noch nicht erreicht werden? Wie sollen<br />
sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Die Positionierung der Philharmoniker Hamburg als das „Orchester der Hansestadt“<br />
ist bei wachsender Konkurrenz auf dem Hamburger Musikmarkt, neben der grundsätzlichen<br />
Wahrnehmung als Konzertorchester insbesondere von der Besucherfrequenz<br />
her (rund 70 Prozent Auslastung), noch ausbaufähig. Hierzu sind speziell in<br />
den letzten Jahren viele unterstützende Maßnahmen im Marketingbereich erfolgt.<br />
Trotzdem werden die Philharmoniker in großem Maße noch vorrangig als Orchester<br />
der Hamburgischen Staatsoper angesehen. Konzertprogrammatisch und mit stärkerer<br />
Präsenz soll dem in den nächsten Jahren weiter entgegengewirkt werden.<br />
f. Wie hat sich seit der Gründung des LB der Stellenbestand entwickelt?<br />
(Bitte aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern<br />
sowie nach Eingruppierung.)<br />
Stellenbestand seit 1. <strong>Jan</strong>uar 1999 (unverändert):<br />
Anzahl: Wertigkeit der Stellen:<br />
134 Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern (TVK)<br />
2 SAV<br />
1 E 13<br />
1 E 6<br />
2 E 5<br />
5 E 3<br />
g. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Nein.<br />
h. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Entfällt.<br />
i. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
35
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Keine.<br />
36<br />
j. Welche Stellenhebungen wurden seit der Gründung des LB für welche<br />
Funktionen im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils<br />
durchgeführt?<br />
k. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Der Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester ist nicht darauf ausgelegt, Gewinne<br />
zu erzielen. Er erhält neben den direkten Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.3<br />
aufgrund des zwischen der Hamburgischen Staatsoper und dem Landesbetrieb Philharmonisches<br />
Staatsorchester bestehenden Kooperationsvertrags anteilige Personalkosten<br />
in Höhe von 83 Prozent aus dem Budget der Staatsoper erstattet.<br />
Nachfolgend abgebildet sind die im Einzelplan 3.3 ausgewiesenen Beträge:<br />
Jahr Ist-Ergebnis<br />
in Tsd. €<br />
1989 3.988<br />
1990 4.220<br />
1991 4.209<br />
1992 4.073<br />
1993 4.286<br />
1994 4.397<br />
1995 4.534<br />
1996 4.302<br />
1997 4.335<br />
1998 5.324<br />
1999 5.309<br />
2000 4.829<br />
2001 4.919<br />
2002 4.918<br />
2003 4.946<br />
2004 5.051<br />
2005 5.024<br />
2006 5.046<br />
2007 5.068<br />
2008 5.068<br />
2009 5.068<br />
2010 5.068<br />
Der Anstieg der Zuweisungen basiert im Wesentlichen auf einem Anstieg der Personalausgaben<br />
aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Tarifabschlüsse.<br />
l. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Zuschüsse für Investitionen wurden nicht gegeben.<br />
m. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Sonstige andere Zuschüsse wurden nicht gegeben.<br />
n. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
i. Wenn nein, warum nicht?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
ii. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
iii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
iv. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
v. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Eine förmliche Evaluation fand nicht statt. Im Übrigen siehe Antwort zu 9. a.<br />
o. Steht der LB in geschäftlicher Verbindung zu Dritten?<br />
Wenn ja, wie haben sich die Zahlen aus diesen Geschäften seit der<br />
Gründung des LB entwickelt?<br />
Es liegt ein Kooperationsvertrag mit der Hamburgischen Staatsoper GmbH vom 8. Dezember<br />
2000 vor, der die Überlassung des Philharmonischen Staatsorchesters an die<br />
Staatsoper als Opernorchester sowie die daraus resultierende Verpflichtung der Hamburgischen<br />
Staatsoper GmbH regelt, 83 Prozent der Personalaufwendungen des Landesbetriebs<br />
zu tragen. Gleichzeitig ist die verwaltungsmäßige Betreuung des Landesbetriebs<br />
durch die Staatsoper sowie eine damit einhergehende Erstattung von Aufwendungen<br />
festgeschrieben.<br />
Die Erstattung des Anteils der Hamburgischen Staatsoper an den Ausgaben des Philharmonischen<br />
Staatsorchesters hat sich für die Spielzeiten wie folgt entwickelt:<br />
2004/2005 8.481.000 Euro<br />
2005/2006 8.502.000 Euro<br />
2006/2007 8.609.000 Euro<br />
2007/2008 8.707.000 Euro<br />
2008/2009 8.885.000 Euro<br />
2010/2011 8.889.000 Euro.<br />
Der Staatsoper wurden vom Philharmonischen Staatsorchester folgende Verwaltungskosten<br />
für die Spielzeiten erstattet:<br />
2004/2005 313.000 Euro<br />
2005/2006 303.000 Euro<br />
2006/2007 360.000 Euro<br />
2007/2008 369.000 Euro<br />
2008/2009 374.000 Euro<br />
2010/2011 329.000 Euro.<br />
p. Verfügt der LB über eine kaufmännische Buchhaltung?<br />
Ja.<br />
10. LB Planetarium Hamburg<br />
Der Landesbetrieb Planetarium Hamburg besteht seit dem 1.1.2004. Der<br />
Landesbetrieb versteht sich als Einrichtung der Freizeitbildung und der<br />
Kultur, die spezialisiert ist auf Aufführungen, Ausstellungen und Vorträge,<br />
die sich mit dem Kosmos beziehungsweise Sternenhimmel befassen;<br />
dabei sei es – so der Senat – als kulturelles Dienstleistungsunternehmen<br />
vergleichbar den Museen und Theatern.<br />
Die Führung des Planetariums in Form eines Landesbetriebs soll die<br />
Nutzung wesentlicher betriebswirtschaftlicher Instrumente ermöglichen.<br />
Hierzu gehört unter anderem die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens<br />
und die Verbesserung des Controllings.<br />
37
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
38<br />
Nachdem der Rechnungshof in seinem Bericht 2009 erhebliche Mängel<br />
feststellte, werden einige der kritisierten Punkte im Jahresbericht 2010<br />
erneut bemängelt. So hat die Behörde bislang kein Unternehmenskonzept<br />
vorgelegt, der LB hat das Controlling nicht optimiert und der Stellenplan<br />
wurde noch nicht dem tatsächlichen Bestand angepasst. Andere<br />
Mängel sollen laut zuständiger Behörde in Zukunft beseitigt werden: „Eine<br />
Evaluation der Umwandlung hat die Behörde für 2010 angekündigt.<br />
Eine genaue Ermittlung der Betriebszuschüsse auf Basis einer mittelfristigen<br />
Finanz- und Investitionsplanung sowie eine Anpassung des Wirtschaftsplans<br />
und seine Ergänzung um einen vorschriftsmäßigen Lagebericht<br />
hat sie zum Haushalt 2011/2012 zugesagt“ (Seite 68 folgende).<br />
a. Wie lautet das mittlerweile erstellte Zielbild des Landesbetriebs?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
b. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
31.12.2008 31.12.2010<br />
SAV (Direktor und kfm. Geschäftsführer) 2 1<br />
E 13 2,75 3,75<br />
E 12 0 1<br />
E 11 0 0,5<br />
E 10 1 0<br />
E 9 0 1<br />
E 8 1 1,5<br />
E 5 2 2<br />
c. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Ja, siehe Antwort zu 10. b. Grund für die Stellenausweitung war eine Erweiterung und<br />
Optimierung des Geschäftsbetriebs zur Bewältigung von Aufgabenzuwächsen.<br />
d. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Grundsätzlich werden die Stellen durch die Einnahmen des Landesbetriebs finanziert.<br />
Die oben genannten Stellenneuschaffungen wurden im Einzelnen wie folgt finanziert:<br />
2009 1,0 E 12 (Verwaltungsleiter)<br />
Finanzierung durch Wegfall einer Stelle SAV<br />
(kfm. Geschäftsführer)<br />
2009 1,0 E 9 (Assistenz)<br />
Finanzierung aus laufenden Erlösen des<br />
Planetariums<br />
2010 0,5 E 8 (Vertrieb, Buchhal- Finanzierung aus laufenden Erlösen des<br />
tung)<br />
Planetariums<br />
2010 0,5 E 11 (Marketing) Finanzierung durch Umwandlung der Stelle<br />
2011 1,0 E 13 (Öffentlichkeitsar- Wegfall extern vergebener Pressearbeit<br />
beit)<br />
(bis zu 4.500 €/Monat)<br />
e. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
39
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Keine.<br />
40<br />
f. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
g. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
2009: 349.000 Euro<br />
2010: 299.000 Euro<br />
Für die Jahre 2004 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Reduzierung des Zuschusses war durch die Erhöhung der eigenen Einnahmen,<br />
insbesondere der Eintrittserlöse, bei gleichzeitig sparsamer Bewirtschaftung der Ausgabemittel<br />
möglich.<br />
h. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
2010 Planungsmittel Wasserbeckensanierung 4.000 €<br />
2010 Sanierung Wasserbecken 344.000 €<br />
2010 Sanierung Dachrundgang 13.000 €<br />
Für die Jahre 2004 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
i. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Im Jahr 2010 wurden dem Landesbetrieb Planetarium Mittel in Höhe von 315.000<br />
Euro zur Verfügung gestellt, die für das Projekt „Informations- und Bildungszentrum<br />
für den Klimawandel“ verwendet wurden.<br />
Für die Jahre 2004 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
j. Zur Frage 3. i. in Drs. 19/3570 teilt der Senat als Antwort lediglich<br />
mit, dass für die Optimierung der Aufsicht das Referat Museen der<br />
damaligen Behörde für Kultur, Sport und Medien personell verstärkt<br />
worden sei. Wir fragen daher:<br />
i. Welche „personellen Vorkehrungen“ hat die Behörde im Detail<br />
getroffen?<br />
ii. Wer war vor der Entscheidung, „personelle Vorkehrungen“ zu<br />
treffen, für die Aufsicht über den Landesbetrieb innerhalb der<br />
Behörde zuständig?<br />
Mit dem Übergang der Kulturbehörde in die Behörde für Kultur, Sport und Medien<br />
2008 wurde die bisherige, für die Aufsicht des Planetariums verantwortliche Stabstelle<br />
Museen als Referat „Museen, Planetarium“ in die Linienorganisation der Behörde<br />
integriert.<br />
Bis dahin wurde die Aufsicht über das Planetarium auf einem Sachbearbeitungsdienstposten<br />
der Besoldungsgruppe A 12 wahrgenommen. Mit der Neuorganisation<br />
der Behörde wurde die Aufsicht zunächst mittels Abordnung einer Angehörigen des<br />
höheren Dienstes sichergestellt, seit 15. <strong>Jan</strong>uar 2011 wird die Aufsicht dauerhaft im<br />
Rahmen einer Referentenstelle der Entgeltgruppe E 13 wahrgenommen.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Zudem erfolgte im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme die Verstärkung<br />
des Referats mit einer Stelle Sachbearbeitung der Entgeltgruppe E 8, wodurch weitere<br />
Kapazitäten der Referentenstelle für die Aufsicht über das Planetarium zur Verfügung<br />
stehen.<br />
k. Welche Pläne gibt es bezüglich einer Kooperation mit der Hamburger<br />
Sternwarte in Bergedorf, wie sie im August 2009 geprüft wurde?<br />
Die Kooperation im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für die wissenschaftlichen Ergebnisse<br />
und die Historie der Sternwarte in Sondervorträgen sowie in Präsentationen des Planetariums<br />
wird fortgesetzt und intensiviert.<br />
Daneben findet eine Zusammenarbeit beim Aufbau eines Besucherzentrums der<br />
Sternwarte und bei der gegenseitigen Bewerbung durch regelmäßige gemeinsame<br />
Treffen (unter anderem „Runder Tisch“) statt.<br />
Eine formelle organisatorische Verbindung beziehungsweise ein Betrieb des Besucherzentrums<br />
durch das Planetarium als Außenstelle wird unter ökonomischen Gesichtspunkten<br />
derzeit nicht weiterverfolgt.<br />
11. LB Rathaus-Service<br />
Der Landesbetrieb Rathaus-Service wurde zum 1.1.2005 eingerichtet<br />
und entstand aus der Umwandlung der Abteilung Rathaus-Service des<br />
Staatsamtes der Senatskanzlei. Die Aufsicht obliegt der Senatskanzlei.<br />
Der Landesbetrieb ist unter anderem zuständig für verschiedene Dienstleistungen<br />
in den Feldern Gebäudemanagement, Veranstaltungsorganisation,<br />
Informationsdienste et cetera, die vor allem im Rathaus und im<br />
Gästehaus des Senats erbracht werden.<br />
a. Laut Drs. 19/3570 sollte ein Zielbild für den LB Rathaus-Service „in<br />
Kürze“ entwickelt werden.<br />
i. Wie lautet das aktuelle Zielbild und wie das weiterentwickelte<br />
Unternehmens- und Organisationskonzept des Landesbetriebs?<br />
ii. Wann wurden diese jeweils vorgelegt und wann mit der Aufsicht<br />
führenden Behörde erstmals vereinbart?<br />
iii. Welche Veränderungen hat es wann an dem ursprünglichen<br />
Zielbild beziehungsweise dem Unternehmens- und Organisationskonzept<br />
des Landesbetriebs aus welchen Gründen gegeben?<br />
Die Entwicklung des Zielbildes und die Weiterentwicklung des Unternehmens- und<br />
Organisationskonzeptes sind noch nicht abgeschlossen. Der Prozess hierzu läuft zurzeit<br />
auf allen Ebenen des Betriebes. Der Landesbetrieb Rathaus-Service wird ein<br />
Qualitätsmanagement einführen. Eine Kundenbefragung ist durchgeführt worden.<br />
Eine Auswertung ist noch nicht abschließend erfolgt, weitere Schritte werden dann<br />
daraus abgeleitet.<br />
Im Übrigen siehe Drs. 19/3570.<br />
b. Inwiefern wurden die vom Senat genannten Ziele des LB Rathaus-<br />
Service im Einzelnen erreicht:<br />
Siehe Drs. 19/3570.<br />
i. Ist die kaufmännische Buchführung bereits eingeführt?<br />
ii. Ist ein Controlling eingeführt?<br />
Ja.<br />
iii. Inwieweit konnten die Effizienz und Effektivität des LB gesteigert<br />
werden?<br />
iv. Inwiefern konnte die Kommunikation unter den Serviceeinheiten<br />
optimiert werden?<br />
41
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
42<br />
v. Inwiefern konnten die Ablauforganisation und die Arbeitsabläufe<br />
verbessert werden?<br />
vi. Inwiefern konnte die Leistungstransparenz erhöht werden?<br />
Die Einführung und Weiterentwicklung des Controllings im Landesbetrieb Rathaus-<br />
Service sind gute Voraussetzungen, um den Betrieb wirtschaftlich zu führen. Hierzu<br />
gehört, dass die Ablauforganisation und die Arbeitsabläufe ständig überprüft und gegebenenfalls<br />
verbessert werden. Um die Effizienz und Effektivität des Landesbetriebs<br />
zu steigern, werden die Controllinginstrumente angemessen und wirkungsvoll eingesetzt.<br />
Hierbei werden sowohl die Kosten- als auch die Leistungsseite betrachtet. Die<br />
Durchführung von Workshops ist als unverzichtbare permanente flankierende Maßnahme<br />
zu sehen, die die Kommunikation unter den Serviceeinheiten unter anderem<br />
sicherstellt.<br />
Ja, siehe Drs. 19/3570.<br />
c. Konnte die Problematik im Zusammenhang mit der Bezahlung der<br />
Ratsdiener abschließend gelöst werden?<br />
d. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
Der Stellenbestand des Rathaus-Service hat sich wie folgt entwickelt:<br />
Stellenbestand Stellenbestand<br />
31.12.2008 31.12.2010<br />
Planstellen 2 2<br />
A 12 2 2<br />
Stellen für Tarifbeschäftigte<br />
52,77 53,4<br />
E 15 1 1<br />
E 11 1 1<br />
E 10 2,27 2,9<br />
E 9 4 4<br />
E 8 7,5 7,5<br />
E 6 10 10<br />
E 5 18 19<br />
E 3 5 4<br />
E 2 2 2<br />
Nachwuchskräfte RestFachAzub 2 2 1)<br />
Gesamt 54,77 55,4<br />
1) Ausbildung abgeschlossen; eine Nachwuchskraft wurde übernommen.<br />
Keine Ausbildungs-Neuauflage seit 6/2009<br />
e. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Zwischen den Jahren 2008 und 2010 ist eine Stelle Entgeltgruppe E 10 der Buchhaltung<br />
wegen zusätzlicher Aufgaben um 0,1 aufgestockt worden. Eine halbe Stelle Entgeltgruppe<br />
E 8 wurde nach Entgeltgruppe E 10 gehoben (siehe Antwort zu 11. h.).<br />
Zeitgleich wurde eine Stelle der Entgeltgruppe E 8 um 0,5 aufgrund vermehrter Technikeinsätzen<br />
bei Veranstaltungen aufgestockt.<br />
f. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Der Stellenzuwachs wird innerhalb des Wirtschaftsplans durch Umschichtungen und<br />
zusätzliche Einnahmen finanziert.<br />
g. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind keine Personalzuwächse vorgesehen.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
h. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
Der Landesbetrieb Rathaus-Service hat folgende Stellenhebungen durchgeführt:<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2008* 1 E 9 E 10 Techniker Arbeitssicherheit<br />
1 E 10 E 11 Techn.Ang Facility Management/Architektur<br />
2009 0,5 E 8 E 10 Techniker Veranstaltungstechnik/Sicherheitsaufgaben<br />
1 E 3 E 5 Postservice<br />
* Die für 2008 dargestellten Hebungen wurden in der Drs. 19/3570 versehentlich nicht genannt.<br />
i. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Für die Jahre 2005 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
Der Zuschuss für Versorgung hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt:<br />
2009: 176.000 Euro<br />
2010: 182.146 Euro.<br />
j. In Drs. 18/1042 sowie Drs. 19/3570 führt der Senat gleichlautend<br />
aus: „Arbeitsabläufe (in der Ablauforganisation) werden der neuen<br />
Struktur angepasst, finanzielle Mittel können bedarfsorientierter eingesetzt<br />
werden. Die dadurch erreichbare größere Effizienz und Flexibilität<br />
führt zu einer Optimierung der Geschäftsprozesse.“<br />
Wie sind die genannten Effizienzsteigerungen „schnellere Stellenbesetzungen,<br />
schnelle Reaktionen auf Kundenwünsche, gezielte<br />
Beschaffungsmaßnahmen, kurze Abstimmungswege“ im Einzelnen<br />
dadurch erreicht worden?<br />
Im Rahmen der Veranstaltungsplanung und -durchführung kann der Landesbetrieb<br />
Rathaus-Service aufgrund seiner kurzen Entscheidungswege auf Kundenwünsche<br />
eingehen. Als Beispiele seien hier genannt: Einsatz von speziellen technischen Einrichtungen,<br />
kurzfristige Änderung der Blumendekorationen und die Zusammenstellung<br />
der Speisen und Getränke aufgrund veränderter Teilnehmerzahl oder spezieller Wünsche<br />
der Gäste. Im Übrigen siehe Drs. 19/3570.<br />
k. Wie verteilen sich seit der Gründung des LB-RS die Umsatzerlöse<br />
auf die verschiedenen Kunden der Dienstleistungen des Landesbetriebs?<br />
Welchen Anteil (in Euro) an den Umsatzerlösen hat<br />
- die Bürgerschaft,<br />
- die Senatskanzlei,<br />
- andere Behörden und Ämter,<br />
- andere öffentliche Stellen und<br />
- private Dritte?<br />
Die Umsätze verteilen sich wie folgt:<br />
Kunden/Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
in Tsd. €<br />
Bürgerschaftskanzlei 591 647 1.153 1.071 1.191 1.215<br />
Senatskanzlei 1.577 1.665 3.914 3.092 3.278 3.650<br />
andere Behörden und Ämter 162 172 489 408 470 476<br />
andere öffentliche Stellen 73 83 86 83 86 88<br />
private Dritte 116 127 246 <strong>26</strong>1 303 190<br />
43
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
44<br />
l. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
Wenn nein, warum nicht?<br />
i. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
ii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
iii. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
iv. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Eine Evaluation ist bisher nicht durchgeführt worden. Im Übrigen siehe auch Antwort<br />
zu 11. a. i. bis 11. a. iii.<br />
12. LB Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)<br />
Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) wurde zum<br />
1.1.2007 eingerichtet. Aufgaben des LSBG sind unter anderem die Tätigkeit<br />
als Dienstleister für die Realisierung und die bedarfsgerechte<br />
Erhaltung baulicher Anlagen der technischen Infrastruktur sowie der<br />
Ausbau des Straßennetzes, die Förderung des reibungslosen Verkehrsablaufs,<br />
Maßnahmen zur lmmissionsreduzierung, zum Lärmschutz, zur<br />
Deichsicherung, zur Erhaltung des Systems der Straßenbeleuchtung et<br />
cetera.<br />
Der Großteil der Aufgaben der LSBG wurde zuvor im Amt für Bau und<br />
Betrieb der BSU wahrgenommen.<br />
a. Der Rechnungshof stellt in seinem Bericht 2010 fest, dass „die Behörde<br />
für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) mit dem Landesbetrieb<br />
Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) auch drei Jahre nach<br />
seiner Gründung keine Zielvereinbarungen abgeschlossen hat. Wesentliche<br />
mit der Gründung des LSBG beabsichtigte Ziele wurden<br />
bisher nicht operationalisiert und damit einer erforderlichen Erfolgskontrolle<br />
entzogen. Der LSBG hat seine mittelfristigen Perspektiven<br />
und operativen Ziele nicht in einem Unternehmenskonzept konkretisiert<br />
(vgl. Tzn. 576 bis 578; 582 bis 584)“. Zudem bemängelt der<br />
Rechnungshof ferner das Fehlen von Messgrößen für wesentliche<br />
mit der Gründung des Landesbetriebs verbundene Ziele als Grundlage<br />
einer Erfolgskontrolle. „Der Landesbetrieb prüft die Wirtschaftlichkeit<br />
einer Eigenerstellung gegenüber der Vergabe von<br />
lngenieurleistungen an Externe nicht. Die dafür erforderliche Datenbasis<br />
fehlt. Eine Steuerung des Landesbetriebs mit Zielvereinbarungen<br />
findet nicht statt.“<br />
Inwiefern konnten die vom Rechnungshof kritisierten Mängel zwischenzeitlich<br />
behoben werden?<br />
Für die Jahre 2009 und 2010 wurde am 30. November 2009 eine Zielvereinbarung mit<br />
operationalisierten und messbaren Zielen unterzeichnet. Für die Jahre 2011 und 2012<br />
wurde am 28. Februar 2011 eine Zielvereinbarung unterzeichnet. Darin wurde auch<br />
vereinbart, bis 31. Dezember 2011 ein Unternehmenskonzept vorzulegen. Wesentliche<br />
Elemente eines Unternehmenskonzepts finden sich bereits in der Drs. 18/4149<br />
zur Gründung des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG).<br />
b. Laut Drs. 19/3570 fand zwischen 2007 und 2009 eine Evaluation<br />
des LSBG statt, die Grundlage eines Unternehmenskonzeptes sein<br />
soll.<br />
i. Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag durchgeführt?<br />
Die Evaluation wurde von der zuständigen Behörde durchgeführt. Sie war zuvor im<br />
Rahmen der Gründung des LSBG angekündigt worden (siehe Drs. 18/4149).
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Siehe Drs. 19/8654.<br />
ii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
iii. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
iv. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Der Senat hat die zuständige Behörde beauftragt, dem Senat bis Ende 2012 einen<br />
weiteren Evaluationsbericht zum Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer vorzulegen.<br />
Dieser soll auch Benchmarking-Ergebnisse zu vergleichbaren Einheiten in<br />
anderen Bundesländern und privaten Anbietern enthalten.<br />
c. Liegt bereits ein Unternehmens- und Organisationskonzept vor?<br />
i. Wenn ja, wie lautet dieses?<br />
ii. Wenn nein, wann ist damit zu rechnen?<br />
Nein. Im Übrigen siehe Antwort zu 12. a.<br />
d. In Drs. 19/3570 konnte der Senat noch keine Angaben zu den erreichten<br />
Zielen machen. Nach der mittlerweile erfolgten Evaluation<br />
fragen wir daher:<br />
i. Welche der Ziele, die mit der Gründung als Landesbetrieb verfolgt<br />
wurden, wurden durch welche Maßnahmen bereits erreicht?<br />
ii. Welche Ziele konnten bislang warum noch nicht erreicht werden?<br />
iii. Wie sollen sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Siehe Antworten zu 12. b. ii. sowie 12. b. iii. und 12. b. iv.<br />
e. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
Stellenbestand Stellenbestand<br />
31.12.2008 31.12.2010<br />
Planstellen 145 149<br />
B 6 1 1<br />
B 3 2 2<br />
A 16 8 8<br />
A 15 17 17<br />
A 14 25 25<br />
A 13 29 29<br />
A 12 25 25<br />
A 11 23 25<br />
A 10 7 8<br />
A 9 gD 2 2<br />
A 9 mD 1 1<br />
A 8 4 5<br />
A 7 1 1<br />
Stellen für Tarifbeschäftigte<br />
382,04 404,04<br />
E 15 4 2<br />
E 14 16 15<br />
E 13 34 37<br />
E 12 64 69<br />
E 11 42,5 49,5<br />
E 10 7 13<br />
E 9 51 51<br />
45
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
noch Stellen für<br />
Tarifbeschäftigte<br />
46<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2008<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2010<br />
E 8 40 35<br />
E 7 7 7<br />
E 6 100 110<br />
E 5 13,5 12,5<br />
E 3 2 2<br />
E 2Ü 1 1<br />
E 2 0,04 0,04<br />
Gesamt 527,04 553,04<br />
f. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Ja. Die Personalausstattung des LSBG richtet sich maßgeblich nach der Auftragslage<br />
durch die öffentlichen Auftraggeber. Die Aufträge sind unter anderem aufgrund von<br />
Maßnahmen zur Instandsetzung von Straßen und zum Sprung über die Elbe erheblich<br />
gestiegen. Neueinstellungen erfolgen überwiegend in befristeten Beschäftigungsverhältnissen<br />
auf befristet eingerichteten Projektstellen.<br />
g. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Die Finanzierung aller Stellen/Beschäftigten erfolgt ausschließlich durch Kontrakterlöse<br />
für erbrachte Leistungen.<br />
h. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Die mittelfristige Unternehmensplanung geht von einer gleichbleibend hohen Auftragslage<br />
aus, sodass der Stellenbestand fortgeführt wird.<br />
i. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2009 1 E 12 E 13 Sachgebietsleitung in der Tunnelbetriebszentrale<br />
2009 1 E 8 E 9 Techniker/-in für Planung und Entwurf<br />
von Stadtstraßen<br />
2010 1 E 11 E 12 Ingenieur/-in für Großprojekte<br />
2010 1 E 10 E 11 Bauwerksprüfingenieur/-in im Tunnelbetrieb<br />
2010 1 E 9 E 10 Ingenieur/-in für Planung und Entwurf<br />
von Stadtstraßen<br />
2010 1 E 9 E 10 Technische Aufsicht im Geschäftsbereich<br />
Konstruktive Ingenieurbauwerke<br />
2010 1 E 5 E 6 Assistenz der Geschäftsbereichsleitung<br />
Gewässer und Hochwasserschutz<br />
j. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Der LSBG erhält keine Zuschüsse für den laufenden Betrieb, da er aus den mit seinen<br />
Auftraggebern abgeschlossenen Kontrakten Erlöse erwirtschaftet. Eine Ablieferung an<br />
den Haushalt ist bisher nicht erfolgt.<br />
k. Wurden Effizienzsteigerungen erreicht?<br />
i. Wenn ja, vor allem in welchem Bereich?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
ii. Wie wurden sie gemessen?<br />
Ja. Die Effizienzsteigerungen sind anhand der erwirtschafteten Überschüsse des<br />
LSBG messbar, die es ihm ermöglichen, im Jahr 2011 die für die Gründung zur Verfügung<br />
gestellten Mittel zurückzuerstatten. Beispielsweise ist der Honorarmittelumsatz<br />
pro Mitarbeiter von 2008 bis 2010 um 11,2 Prozent gestiegen und der Baumittelumsatz<br />
pro Mitarbeiter im selben Zeitraum um 8,5 Prozent. Im Übrigen siehe Antwort zu<br />
12. b. ii.<br />
13. LB Verkehr<br />
Der Landesbetrieb Verkehr wurde zum 01.01.1997 gegründet. Zu den<br />
Aufgaben des LB gehören unter anderem die Erstellung und Überprüfung<br />
von Dokumenten für den Straßenverkehr (Führer- und Fahrzeugscheine)<br />
sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für den<br />
Straßenverkehr.<br />
a. Wie lautet das Zielbild und wie das Unternehmens- und Organisationskonzept<br />
des Landesbetriebs?<br />
Das Zielbild des LBV ist in der Geschäftsanweisung (<strong>§</strong> 3) beschrieben:<br />
„Der Landesbetrieb Verkehr wird nach kaufmännischen Grundsätzen geführt und richtet<br />
sich an den folgenden Unternehmenszielen aus:<br />
- Optimale Versorgung der Bevölkerung/gewerblichen Kunden mit Dienstleistungen<br />
- Ausrichtung der Dienstleistungen am Markt und dem Wettbewerb<br />
- Befriedigung der Kundenbedürfnisse orientiert am wirtschaftlichen Nutzen,<br />
- Förderung der Beschäftigten zur Dienstleistungsorientierung und -erfüllung<br />
- Erreichung einer angemessenen Wirtschaftlichkeit bezüglich des eingesetzten<br />
Kapitals auch durch Bildung von Kooperationen“<br />
Die Organisation des LBV erlaubt den direkt mit dem Kunden im Kontakt stehenden<br />
Abteilungen sowohl im Rahmen der Gesamtziele des LBV selbstständig zu operieren<br />
als auch eigene Ziele zu verfolgen. Controlling und Berichtswesen beziehen sich auf<br />
finanzwirtschaftliche Ansätze und im Sinne einer Balanced Score Card zusätzlich auf<br />
Prozess-, Kunden- und Mitarbeiteraspekte. Die Ziele, Aufgaben und Abläufe sind im<br />
Qualitätsmanagementhandbuch (Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008) fixiert.<br />
Die Unternehmenskonzeption spiegelt sich in dem LBV-Geschäftsmodell wieder:<br />
Es wird für den Kunden unterschieden in der Art des Zugangs zum LBV nach<br />
- LBV - Classic (an festen Standorten)<br />
- LBV - Mobil (räumlich unabhängig)<br />
- LBV - Internet.<br />
b. Wann wurden diese jeweils vorgelegt und wann mit der Aufsicht führenden<br />
Behörde erstmals vereinbart?<br />
Zielbild und Unternehmens- und Organisationskonzept sind Bestandteil der Gründungsdrucksache<br />
aus dem Jahr 1996. Die Geschäftsanweisung mit dem geltenden<br />
Zielbild wurde dem Aufsichtsgremium 1998 vorgelegt und beschlossen.<br />
c. Welche Veränderungen hat es wann am ursprünglichen Zielbild beziehungsweise<br />
dem Unternehmens- und Organisationskonzept des<br />
<strong>Landesbetriebe</strong>s aus welchen Gründen gegeben?<br />
Es gab keine Veränderungen an den Zielen. Die Aufbauorganisation wurde geändert,<br />
um die Unternehmenshierarchie zu reduzieren.<br />
d. Welche der Ziele, die mit der Gründung des <strong>Landesbetriebe</strong>s verfolgt<br />
wurden, wurden durch welche Maßnahmen bereits erreicht?<br />
Die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und damit die Entlastung des Haushaltes wurden<br />
erreicht; alle Investitionen und auch alle Betriebsaufwendungen werden aus dem jährlichen<br />
Betriebsergebnis erwirtschaftet.<br />
47
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit wurde durch die betriebswirtschaftliche Profitund<br />
Cost-Center-Orientierung verbunden mit der qualitätsgesteuerten und innovativ<br />
geprägten Unternehmenskonzeption bei gleichzeitig starker Kostenorientierung erreicht.<br />
Die Dienstleistungs- und Kundenorientierung wurde durch Schulungsmaßnahmen und<br />
eine entsprechende kunden- und somit belastungsorientierte Betriebs- und auch Abteilungssteuerung<br />
erreicht.<br />
48<br />
e. Welche Ziele konnten bislang noch nicht erreicht werden? Wie sollen<br />
sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Die mit der Gründung des LBV verfolgten Ziele wurden erreicht.<br />
f. Wie hat sich seit der Gründung des LB der Stellenbestand entwickelt?<br />
(Bitte aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern<br />
sowie nach Eingruppierung.)<br />
Der LBV inklusive der Technischen Prüfstelle (Betriebsübergang zum 1. <strong>Jan</strong>uar 2004<br />
in die TÜV HANSE GmbH als 90-Prozent-Tochterunternehmen des TÜV SÜD) verfügte<br />
im Gründungsjahr 1997 über 388 Stellen. Die Stellenanzahl stieg bis ins Jahr 2004<br />
auf 432,58 Stellen, zum 31. Dezember 2010 verfügte der LBV über 338,58 Stellen.<br />
Stellenbestand Stellenbestand<br />
1.1.1997<br />
31.12.2010<br />
Planstellen 98 98,5<br />
A 16 2 1<br />
A 15 1 1<br />
A 14 3 3<br />
A 13 2 2<br />
A 12 5 5<br />
A 11 5 6,5<br />
A 10 9 6<br />
A 9 1 4<br />
A 9 11 11<br />
A 8 18 19<br />
A 7 41 40<br />
Stellen für Tarifbeschäftigte<br />
290 240,08<br />
Ia/E 15 1 0<br />
Ib/E 14 1 1<br />
IIa/E 13Ü 1 0<br />
IIa/E 13 8 3<br />
III/E 12 8 1<br />
IVa/E 11 70 2<br />
IVb/E 10 8 20<br />
Vb/E 9 3 8<br />
Vc/E 8 24 23<br />
VIb/E 6 23 163,5<br />
VII/E 5 113 1<br />
E 4 1<br />
VIII/E 3 11 12<br />
E 2Ü 1<br />
IXb/E 2 3,58<br />
6 12<br />
4 1 0<br />
3 2 0<br />
2 1 0<br />
1(R) 3 0<br />
Gesamt 388 338,58
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
* Die Veränderungen im Bereich der Arbeiter auf null Stellen ergeben sich durch den Übergang<br />
von fünf Stellen der Lohngruppe 6 auf den TÜV HANSE; die restlichen Stellen wurden aufgrund<br />
der Umstellung des Tarifrechts in Arbeitnehmerstellen umgewandelt.<br />
g. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Nein. Über die gesamte Entwicklung gesehen hat der LBV seinen Personalbestand<br />
reduziert. Es waren 111 Personen vom Betriebsübergang zur TÜV HANSE GmbH<br />
betroffen, von denen 93 dem Übergang nicht widersprochen haben und somit wechselten.<br />
Der LBV ohne die technische Prüfstelle hat im Zeitraum von 2004 bis 2010<br />
seinen Personalbestand von 310 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) auf 298 VZÄ reduziert.<br />
Entfällt.<br />
h. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
i. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
j. Welche Stellenhebungen wurden seit der Gründung des LB für welche<br />
Funktionen im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils<br />
durchgeführt?<br />
Angaben seit 2002 (vorher hatte die Polizei die Personalhoheit über den LBV):<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
1998 1 A 13 A 14 Kaufmännische Leitung<br />
1998 1 A 12 A 13 Produktbereichsleiter Kfz-Zulassung<br />
2005 1 A 12 A 13 Produktbereichsleitung Fahrerlaubnis<br />
und Ausnahmegenehmigungen<br />
2007 1 A 10 A 11 Fahrerlaubnismitte, Sachgebietsleitg.<br />
2009 1 A 10 A 11 Abteilungsleitung TGM (Transport-<br />
und Genehmigungsmanagement)<br />
2010 1 A 7 A 8 Hauptsachbearbeitung Kfz-Zulassung<br />
2011 6 A 7 A 8 Einheitssachbearbeitung<br />
Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis<br />
2011 1 A 12 A 13 Abteilungsleitung Kfz-Zulassung<br />
LBV-Mitte<br />
2011 1 A 11 A 12 Abteilungsleitung Standort LBV-<br />
Bergedorf<br />
2011 1 A 12 A 13 Abteilungsleitung Qualitätsmanagement,<br />
Personal, Organisation<br />
k. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Der LBV hat folgende Beträge an den Haushalt abgeliefert:<br />
Jahr Ablieferungsbetrag<br />
Tsd. €<br />
1997 2.501<br />
1998 2.1<strong>26</strong><br />
1999 2.654<br />
2000 2.654<br />
2001 2.639<br />
2002 1.<strong>26</strong>9<br />
2003 1.982<br />
2004 227<br />
2005 745<br />
2006 1.355<br />
49
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
50<br />
Jahr Ablieferungsbetrag<br />
Tsd. €<br />
2007 1.016<br />
2008 1.355<br />
2009 1.414<br />
2010 1.252<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
Besondere Ereignisse wie die Erhöhung der Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen<br />
in 2002, die Veräußerung der Technischen Prüfstelle Hamburg und der Verbleib<br />
der Widersprechenden des Betriebsüberganges (<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 613a BGB) bei der<br />
Freien und Hansestadt Hamburg in den Jahren 2004 und 2005 wie auch die Umsatzsteuererhöhung<br />
für das Jahr 2007 erforderten entsprechende Anpassungen.<br />
l. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Zuschüsse für Investitionen wurden nicht gegeben.<br />
Entfällt.<br />
i. Worauf ist diese Entwicklung maßgeblich zurückzuführen?<br />
m. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Sonstige andere Zuschüsse wurden nicht gegeben.<br />
n. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
i. Wenn nein, warum nicht?<br />
Es gab keine Evaluation im klassischen Sinne durch externe Dritte. Die Kombination<br />
aus der jährlichen Jahresabschlussprüfung mit dem jährlichen Qualitätsmanagement-<br />
Audit (seit dem Jahr 2006) durch ein externes Auditierungsunternehmen bestätigt,<br />
dass die Ziele im Sinne des Balanced-Scorecard-Modells erreicht werden und der<br />
LBV prozessorientiert ausgerichtet ist.<br />
Entfällt.<br />
Siehe Antwort zu 13. n. und 13. n. i.<br />
Entfällt.<br />
ii. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
iii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
iv. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
v. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
o. Steht der LB in geschäftlicher Verbindung zu Dritten?<br />
Wenn ja, wie haben sich die Zahlen aus diesen Geschäften seit der<br />
Gründung des LB entwickelt?<br />
Der LBV steht in einer permanenten geschäftlichen Verbindung insbesondere zu den<br />
gewerblichen Kfz-Zulassungskunden und Kfz-Haltern sowie zu den Transport- und<br />
Logistikunternehmen, die Ausnahmegenehmigungen über oder beim LBV beantragen.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Darüber hinaus bestehen Geschäftsbeziehungen zu den Lieferanten von Materialien<br />
o.ä. sowie insbesondere zu Softwarepartnern. Die Geschäftszahlenentwicklung ist<br />
positiv, wie die Ablieferungen an den Haushalt zeigen. So haben sich unter anderem<br />
bei den Ausnahmegenehmigungen die Umsatzerlöse in den letzten fünf Jahren um<br />
circa 30 Prozent erhöht.<br />
Ja.<br />
p. Verfügt der LB über eine kaufmännische Buchhaltung?<br />
q. Vor einiger Zeit kam es im LBV zu einem Zwischenfall, nach dessen<br />
Bekanntwerden eine Mitarbeiterin angeklagt wurde.<br />
i. Welcher Schaden ist der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
durch die angeklagte Mitarbeiterin entstanden?<br />
Der Senat sieht von Äußerungen zu laufenden Ermittlungen ab. Die Höhe des Schadens<br />
wird erst mit dem Abschluss der laufenden Ermittlungen feststehen.<br />
ii. Welche Vorsorgemaßnahmen wurden für die Zukunft im Anschluss<br />
an das Bekanntwerden des Zwischenfalls durchgeführt?<br />
Es wurden diverse elektronische Sicherungsmaßnahmen umgehend nach Bekanntwerden<br />
des Vorfalls im Jahr 2009 ergriffen und mit Inbetriebnahme einer neuen Betriebssoftware<br />
im Februar 2011 wurden weitere Kfz-Zulassungssicherheitselemente<br />
realisiert.<br />
14. LB Zentrum für Personaldienste (ZPD)<br />
Der Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste (ZPD) wurde zum<br />
1.1.2004 eingerichtet. Er ist eine wirtschaftlich selbstständige Einheit im<br />
Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgaben des ZPD<br />
sind unter anderem personalwirtschaftliche Dienstleistungen für öffentliche<br />
Organisationen und Kommunen, vor allem aber ist es die „zentrale<br />
Serviceeinheit“ zur Unterstützung der Institutionen der Freien und Hansestadt<br />
Hamburg in übergreifenden Angelegenheiten der Personalverwaltung,<br />
der Bezügeabrechnung und des Personalberichtswesens.<br />
a. Laut Drs. 19/3570 wurde das Zielbild des ZPD mit dem Personalamt<br />
abgestimmt und durchlief zum Antwortzeitpunkt einen Bewertungsprozess.<br />
Wie lautet nach dem Bewertungsprozess von 2009 das<br />
Zielbild des ZPD?<br />
Das strategische Ziel des ZPD wurde bestätigt und lautet weiterhin: „Wir wollen im<br />
Sinne „best practice“ der Marktführer für Personaldienstleistungen des öffentlichen<br />
Bereichs in Norddeutschland sein.“<br />
b. Das Unternehmenskonzept sollte der Aufsicht führenden Behörde<br />
sowie dem Verwaltungsrat im ersten Halbjahr 2010 vorgelegt werden.<br />
Wie lautet das Unternehmenskonzept des ZPD?<br />
Das Unternehmenskonzept wurde in Abstimmung mit der Aufsicht führenden Behörde<br />
dem Verwaltungsrat vorgelegt und in seiner Sitzung am 15. Juni 2010 verabschiedet.<br />
Das „ZPD-Unternehmenskonzept“ baut auf dem in der Antwort zu 14. a. genannten<br />
strategischen Ziel des ZPD auf, beschreibt dessen Leitsätze und seinen Handlungsrahmen<br />
und definiert eine Balanced Scorecard mit den Steuerungsperspektiven Finanzen,<br />
Kunden, Prozesse sowie Lernen und Entwicklung.<br />
c. Laut Drs. 19/3570 wurde zum Antwortzeitpunkt noch an der Umsetzung<br />
einiger grundlegender Ziele des ZPD gearbeitet.<br />
i. Konnten die vom Senat genannten Ziele (Optimierung einer<br />
produktbezogenen Kostenübersicht, Einführung der Kosten-<br />
und Leistungsrechnung et cetera) in der Zwischenzeit erreicht<br />
werden?<br />
51
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
52<br />
ii. Welche Ziele konnten bislang warum noch nicht erreicht werden?<br />
iii. Wie sollen sie in den Jahren 2011/2012 erreicht werden?<br />
Das vom Senat angestrebte Ziel, durch die Gründung des Landesbetriebs eine flexible<br />
Wirtschaftsführung zu ermöglichen, wurde erreicht. Dem Landesbetrieb ZPD ist es<br />
gelungen, wesentliche Impulse zur Modernisierung der Personalarbeit auf den Weg zu<br />
bringen (neues Beihilfeverfahren, elektronisches Zeitwirtschaftsverfahren (eZeit), IT-<br />
Unterstützung von Personalmanagementaufgaben (ePers), online-gestütztes Dienstreisemanagement<br />
(eReise)). Die entsprechenden Umsetzungsprojekte laufen noch.<br />
Die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung konnte aufgrund von personellen<br />
Engpässen und notwendiger Prioritätsentscheidungen in den Jahren 2009 und<br />
2010 nicht wie geplant voranschreiten. Inzwischen laufen im Projekt KLR die organisatorischen<br />
und konzeptionellen Arbeiten. Auf dieser Basis sollen die Vorbereitungen<br />
zum Produktivstart der Kosten- und Leistungsrechnung in 2012 abgeschlossen und<br />
die Grundlage für die Ablösung der Verwaltungskostenabrechnung geschaffen werden.<br />
d. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
Stellenwertigkeit 31.12.2008 31.12.2010<br />
ZPD ePers ZPD ePers<br />
B 3 0 0 1 0<br />
B 2 1 0 0 0<br />
A 16 0 1 1 1<br />
A 15 4 2 4 2<br />
A 14 6 2 3 2<br />
A 13 7 1 9 4<br />
A 12 19 4 16 8<br />
A 11 37 0 39 9<br />
A 10 19,5 2 20,5 1<br />
A 9 gD 5,5 0 5 0<br />
A 9 mD 15 0 15 0<br />
A 8 46 0 42 0<br />
A 7 2 0 0 0<br />
Summe<br />
Planstellen: 162 12 155,5 27<br />
E 15 1 0 1 0<br />
E 14 2 0 4 0<br />
E 13 4 0 5 6<br />
E 12 0 0 3 1<br />
E 11 25 0 33 2<br />
E 10 14 0 9 1<br />
E 9 32,5 0 34 3<br />
E 8 72,5 0 76 0<br />
E 6 3 0 4 0<br />
E 5 1,87 0 2 0<br />
E 4 0 0 1 0<br />
E 3 7 0 8 0<br />
E 2 0 0 2 0<br />
Stellen für<br />
Tarifbeschäftigte: 162,87 0 182 13<br />
Summe<br />
Stellen gesamt: 324,87 12 337,5 40<br />
e. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
f. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Ja. Personalzuwachs gab es durch folgende zusätzliche Aufgaben:<br />
- Beihilfesachbearbeitung (aufgrund der steigenden Fallzahlen, zuschussfinanziert)<br />
- Gestaltung der Personalverfahren für die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen<br />
(zuschussfinanziert)<br />
- Anpassung der Personalverfahren zur Umsetzung des Projekts PAISAP-NHH<br />
(zuschussfinanziert, zeitlich befristet)<br />
- Durchführung des Projekts ePers (zuschussfinanziert, zeitlich befristet)<br />
- Widerspruchsbearbeitung und Unterstützungsprozesse der Beihilfe (zuschussfinanziert)<br />
- Qualitätssicherung und spezielle Berichtsprodukte, Vertrieb (einnahmefinanziert).<br />
g. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Für die Wirtschaftsplanjahre 2011 und 2012 ist vorgesehen, sechs einnahmefinanzierte<br />
Stellen für die Einrichtung eines zentralen Shared Services für die Abrechnung von<br />
Dienstreisen (eReise) zu schaffen (siehe auch Drs. 19/7794).<br />
h. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2009 1 A 15 A 16 Geschäftsbereichsleitung Planung und Steuerung<br />
(stellv. Geschäftsführerin)<br />
2009 1 A 14 A 15 Geschäftsbereichsleitung Betriebliches<br />
Management<br />
2009 1 E 10 E 11 Fachgestaltung für Entgeltabrechnung<br />
2009 1 E 10 E 11 Fachgestaltung für Versorgungsabrechnung<br />
2010 1 E 10 E 11 Fachgestaltung für Entgeltabrechnung<br />
2010 1 E 10 E 11 Qualitätssicherung und Anwenderunterstützung<br />
2010 1 B 2 B 3 Geschäftsführung ZPD<br />
i. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für die Jahre 2004 bis 2007 siehe Drs. 19/3570.<br />
Für den laufenden Betrieb erhielt das ZPD seit 2008 folgende Zuschüsse:<br />
2008: 11.746.000 Euro<br />
2009: 11.557.000 Euro<br />
2010: 11.341.000 Euro.<br />
Für den IT-Betrieb erhielt das ZPD seit 2008 folgende Zuschüsse:<br />
2008: 4.578.000 Euro<br />
2009: 4.861.000 Euro<br />
2010: 4.973.000 Euro.<br />
Für den laufenden Betrieb (einschließlich IT-Betrieb) des Projekt ePers erhielt das<br />
ZPD seit 2008 folgende Zuschüsse:<br />
2008: 913.000 Euro<br />
2009: 1.110.000 Euro<br />
2010: 2.587.000 Euro.<br />
53
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
54<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Entwicklung ist maßgeblich auf folgende (teilweise gegenläufig wirkende) Gründe<br />
zurückzuführen (siehe Drs. 19/3570):<br />
Betriebszuschuss aus dem Haushalt:<br />
- strukturelle Zuschusserhöhung aufgrund der Verlagerung von Intendanzaufgaben<br />
vom Personalamt zum ZPD<br />
- Umsetzung von Einsparverpflichtungen aus dem Projekt ProPers mit insgesamt<br />
143 Stellen (Drs. 17/2<strong>26</strong>7) mit entsprechenden Budgetabsenkungen<br />
- strukturelle Senkung des Zuschusses wegen externer Erträge (unter anderem<br />
Erstattungsregelung <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 61 <strong>LHO</strong>)<br />
- Erhöhung des Zuschusses für die bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher (zentral<br />
finanzierter) Stellen<br />
- strukturelle Zuschusserhöhung zur Abdeckung der Beihilfeleistungen an Beschäftigte<br />
des ZPD<br />
- strukturelle Zuschusserhöhung aufgrund von Besoldungs-/Tariferhöhungen<br />
- Senkung des Zuschusses aufgrund der Umsetzung der Konsolidierungsvorgaben<br />
des Senats.<br />
Seit Gründung des Landesbetriebs wurde der Betriebszuschuss an das ZPD um rund<br />
20 Prozent abgesenkt trotz zum Teil stark steigender Fallzahlen (siehe Lagebericht<br />
zum WP-Entwurf 2011/2012).<br />
Betriebszuschuss für den IT-Betrieb:<br />
- strukturelle Zuschusserhöhung zur Finanzierung des Betriebs zusätzlicher Verfahrensteile<br />
(Anpassung der Bezügeabrechnung an rechtliche Änderungen, PersonalControlling,<br />
Beihilfe 2010)<br />
- Umschichtung der Aufwendungen für die Betreuung von PC durch Dataport<br />
- Strukturelle Zuschusssenkung durch Reduzierung der Rechenzentrumskosten.<br />
Betriebszuschuss ePers:<br />
Dieser resultiert aus der Entwicklung des Projekts.<br />
j. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Für die Jahre 2004 bis 2007 siehe Drs. 19/3570.<br />
Für Investitionen erhielt das ZPD seit 2008 folgende Zuschüsse:<br />
2008: 445.000 Euro<br />
2009: 7<strong>26</strong>.000 Euro<br />
2010: 249.000 Euro.<br />
Für das Projekt ePers erhielt das ZPD folgende Zuschüsse für Investitionen:<br />
2008: 150.000 Euro<br />
2009: <strong>26</strong>6.000 Euro<br />
2010: 40.000 Euro.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Zuschüsse für Investitionen wurden überwiegend für IT-Maßnahmen gegeben, die<br />
zentral veranschlagt werden. Sie sind abhängig vom jeweiligen Projektfortschritt.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Die Höhe des Zuschusses für Investitionen des Projekts ePers resultiert aus der Entwicklung<br />
des Projekts.<br />
k. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des Landesbetriebs<br />
seit seiner Gründung entwickelt?<br />
Zuweisung für Versorgungszuschläge<br />
Zuweisung für Versorgungszuschläge<br />
(ePers)<br />
2004 2005 2006 2007<br />
in Tsd. €<br />
2008 2009 2010<br />
2.031 2.031 2.031 2.031 2.031 2.031 2.031<br />
- - - - 60 144 183<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die Zuweisung für Versorgungszuschläge wurde 2004 auf den genannten Festbetrag<br />
festgelegt, um die Versorgungslasten der Freien und Hansestadt Hamburg, die vor<br />
Gründung des Landesbetriebs entstanden sind, auszugleichen. Die Versorgungszuschläge<br />
für das Projekt ePers steigen entsprechend dem aufwachsenden Personalbestand.<br />
l. Laut Lagebericht des LB Zentrum für Personaldienste im Haushaltsplan-Entwurf<br />
für die Haushaltsjahre 2009/2010 werden sich die Aufwendungen<br />
für Stellen in der Beihilfe-Sachbearbeitung in 2009/2010<br />
erhöhen: „Mit der Verstärkung der Beihilfe-Sachbearbeitung ist<br />
beabsichtigt, die Zielsetzung der Bürgerschaft, eine jahresdurchschnittliche<br />
Bearbeitungsdauer für Beihilfeanträge von höchstens<br />
zehn Arbeitstagen sicherzustellen, einzuhalten.“ Aus Drs. 19/911<br />
geht hervor, dass diese Vorgabe im Zeitraum Mai – Juni 2008 umgesetzt<br />
wurde. Wie viele Arbeitstage betrug die monatsdurchschnittliche<br />
Bearbeitungsdauer für Beihilfeanträge seit Gründung des Landesbetriebs<br />
seit <strong>Jan</strong>uar 2009 bis heute?<br />
Verlauf der monatsdurchschnittlichen Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen seit 2009 bis<br />
heute:<br />
2009 2010 2011<br />
<strong>Jan</strong>uar 13,5 8,4 11,5<br />
Februar 14,7 10,1 11,7<br />
März 14,8 9,0 9,0<br />
April 11,3 8,1 7,0<br />
Mai 8,3 7,8 9,7<br />
Juni 8,4 7,9<br />
Juli 7,4 8,6<br />
August 9,9 11,0<br />
September 8,4 10,0<br />
Oktober 8,7 9,6<br />
November 9,8 9,1<br />
Dezember 7,8 10,6<br />
Ø 10,2 9,2<br />
Damit konnte die Einhaltung des Zehn-Tage-Ziels in den Jahren 2009 und 2010 sichergestellt<br />
werden. Im Jahr 2011 ist die Einhaltung des Ziels wegen steigender Fallzahlen<br />
bislang nicht gewährleistet.<br />
m. Laut Protokoll 19/14 des Haushaltsausschusses hat das ZPD aufgrund<br />
der angestiegenen Zahl von Widersprüchen gegen Beihilfefestsetzungen<br />
eine „task force“ eingesetzt. Diese verfolge „das Ziel,<br />
die damalige Bearbeitungszeit von 17 Monaten möglichst bis zum<br />
Jahresende 2008 auf einen Wert von maximal 3 Monaten zu verkürzen“.<br />
Im Jahr 2008 wurde dieses Ziel erreicht.<br />
55
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Ja.<br />
56<br />
i. Ist dieses Ziel auch 2009 und 2010 erreicht worden?<br />
ii. Welche Maßnahmen werden getroffen, um dieses Ziel auch<br />
weiterhin zu erreichen?<br />
Das Ziel soll auch weiterhin durch Straffung der Arbeitsabläufe, Clusterbildung bei den<br />
Widerspruchsarten und Priorisieren der Aufgaben und bedarfsbezogene Ressourcenzuordnung<br />
erreicht werden.<br />
iii. Wie hat sich die Zahl der Widersprüche in den Jahren 2008,<br />
2009 und 2010 entwickelt?<br />
Die Zahl der Widersprüche hat sich wie folgt entwickelt:<br />
Jahr Gesamtzahl<br />
davon: wegen Kostendämpfungspauschale<br />
2008 5.414 1.396<br />
2009 4.323 924<br />
2010 3.187 687<br />
n. Fand seit der Gründung des LB bereits eine Evaluation statt?<br />
Wenn nein, warum nicht?<br />
i. Wenn ja: Durch wen wurde die Evaluation in wessen Auftrag<br />
durchgeführt?<br />
ii. Wie lauten die Ergebnisse der Evaluation?<br />
iii. Welche Konsequenzen und Maßnahmen zieht der Senat aus<br />
diesen Ergebnissen?<br />
iv. In welchem Zeitraum sollen die Maßnahmen umgesetzt werden?<br />
Nein, eine Evaluation wurde nicht für erforderlich gehalten.<br />
II. zu Nutzen-Einschätzungen und zur Zukunft des Modells Landesbetrieb<br />
(<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> <strong>26</strong> <strong>Absatz</strong> 1 <strong>LHO</strong>):<br />
15. Die Fragen 7. – 9. wurden in Drs. 19/3570 nicht oder nur teilweise beantwortet.<br />
Angesichts der Bedeutung, die der Gründung von <strong>Landesbetriebe</strong>n<br />
jeweils zugewiesen wurde, ist es erstaunlich, dass der Senat<br />
hierzu keine Auskunft geben kann.<br />
Wir bitten um eine detaillierte Beantwortung der Fragen:<br />
a. In welchen Fällen hat sich eine LB-Gründung aus jeweils welchen<br />
Gründen als vorteilhaft erwiesen?<br />
In allen Fällen, weil die mit der jeweiligen Gründung des Landesbetriebs verfolgten<br />
Ziele erreicht wurden.<br />
Die Prognos AG hat in ihrem Evaluationsbericht bestätigt, dass die Zusammenfassung<br />
aller staatlichen berufsbildenden Schulen im Landesbetrieb Hamburger Institut<br />
für Berufliche Bildung im Jahr 2007 maßgeblich dazu beigetragen hat, die Qualität an<br />
berufsbildenden Schulen zu verbessern. Das HIBB hat hiernach unter anderem seine<br />
Handlungsspielräume zum optimierten Ressourceneinsatz, zur Stärkung der Eigenständigkeit<br />
der Schulen und zur Intensivierung der Partnerschaft mit der Wirtschaft<br />
wirkungsvoll genutzt.<br />
Die Gründung des Landesbetriebs VHS hat sich als vorteilhaft erwiesen. Eine weitgehende<br />
Verselbstständigung insbesondere unter Aspekten der Personalhoheit sowie<br />
inhaltlich planerischer und finanzieller Art führt zu einer Flexibilität und damit einer<br />
klaren und eindeutigen Kundenorientierung, wie sie in einer engen Behördenstruktur<br />
nicht möglich wäre. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind mit der jetzigen Struktur<br />
und der Etablierung eines ausgereiften Controllingsystems überwunden.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Die Gründung des Landesbetriebs Landwirtschaft der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand<br />
war wegen der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung und der speziellen agronomen<br />
Umgebung am Markt Voraussetzung für eine Betriebsführung, wie sie in der<br />
Landwirtschaft üblich ist.<br />
Bei der Philharmonie war es notwendig, eine Unternehmensform zu installieren, die<br />
sowohl der besonderen organisatorischen Nähe zur Staatsoper als auch den fachlichen<br />
Interessen und Steuerungsmöglichkeiten durch die zuständige Behörde entsprach.<br />
Mit der Struktur als Landesbetrieb ist es gelungen, die Funktion dieses Dreiecksverhältnisses<br />
effizient und wirtschaftlich bei hoher musikalischer Qualität sicherzustellen.<br />
Dem Planetarium ist es gelungen, nach der Umstrukturierung das Vorstellungsangebot<br />
und die Besucherzahlen zu verdreifachen und gewährte Kredite zurückzuzahlen.<br />
Die Gründung hat sich für das Personalamt und das ZPD als vorteilhaft erwiesen, da<br />
die Effektivität und Effizienz durch eine stärker zurechenbare Ergebnisverantwortung<br />
gesteigert und eine verbesserte Kundenorientierung erreicht werden konnte. Die Verwaltungsabläufe<br />
wurden verschlankt. Außerdem werden zunehmend moderne Instrumente<br />
und Verfahren zur Wirtschaftlichkeitssteuerung eingesetzt. Die Vorteilhaftigkeit<br />
der wirtschaftlichen Eigenständigkeit und Flexibilität zeigt sich auch in der Entwicklung<br />
des Betriebszuschusses.<br />
Durch die Einbindung von Kunden in den Verwaltungsrat des ZPD (zwei Fachbehörden,<br />
ein Bezirksamt) wird die Berücksichtigung von Kundenanforderungen gestärkt.<br />
Im Übrigen siehe Drs. 19/3570.<br />
b. In welchen Fällen hat sich eine LB-Gründung aus jeweils welchen<br />
Gründen als nachteilig erwiesen?<br />
In keinem Fall.<br />
16. Für welche Verwaltungseinheiten wird die Verselbstständigung in Form<br />
von <strong>Landesbetriebe</strong>n derzeit geprüft beziehungsweise angestrebt?<br />
Für die netto-veranschlagte Einrichtung Kasse.Hamburg sowie für die formal als eine<br />
Dienststelle der BWF geführte Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von<br />
Ossietzky (SUB) hat der Senat mit der Vorlage des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/<br />
2012 Wirtschaftspläne für <strong>Landesbetriebe</strong> vorgelegt und damit der Bürgerschaft vorgeschlagen,<br />
diese künftig als <strong>Landesbetriebe</strong> nach <strong>§</strong> <strong>26</strong> <strong>LHO</strong> zu führen.<br />
Darüber hinaus ist die Gründung eines Landesbetriebs nach <strong>§</strong> <strong>26</strong> <strong>LHO</strong> geplant für die<br />
Beschäftigten der Asklepios-Tochtergesellschaft CleaniG GmbH, die von ihrem Rückkehrrecht<br />
zur Freien und Hansestadt Hamburg Gebrauch machen (siehe auch zuletzt<br />
Drs. 20/475).<br />
17. Welche derzeitigen <strong>Landesbetriebe</strong> sollen in eine andere Rechtsform<br />
umgewandelt werden beziehungsweise wurden bereits in eine andere<br />
Rechtsform umgewandelt?<br />
a. Welche Rechtsform wird beziehungsweise wurde jeweils aus welchen<br />
Gründen angestrebt?<br />
Der Landesbetrieb Winterhuder Werkstätten für behinderte Menschen wurde 2007 in<br />
eine GmbH überführt. Durch die betriebliche Eingliederung der Winterhuder Werkstätten<br />
in einen Konzern der stadtnahen Werkstätten für behinderte Menschen sollten die<br />
Kosten gesenkt werden. Die Rechtsform wurde gewählt, weil die übrigen beteiligten<br />
Gesellschaften bereits als GmbH geführt wurden.<br />
18. Welche Prüfungen hat der Rechnungshof in <strong>Landesbetriebe</strong>n <strong>gemäß</strong><br />
<strong>§</strong> <strong>26</strong> <strong>Absatz</strong> 1 <strong>LHO</strong> seit 2002 vorgenommen?<br />
a. Zu welchen Feststellungen ist der Rechnungshof jeweils gelangt?<br />
b. Welche Stellungnahme hat der Senat jeweils abgegeben?<br />
Für die Prüfungsjahre 2002 bis 2008 (Jahresberichte 2003 bis 2009 des Rechnungshofs)<br />
siehe Drs. 19/3570.<br />
57
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Die im Jahresbericht 2010 (Prüfungsjahr 2009) des Rechnungshofs veröffentlichte<br />
Prüfung im „Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer“ und die entsprechende<br />
Stellungnahme des Senats zu den Feststellungen des RH – ergänzend auch den Bericht<br />
des Haushaltsausschusses – sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:<br />
58<br />
Prüfungsjahr<br />
2009<br />
Vom RH geprüfterLandesbetrieb<br />
nach<br />
<strong>§</strong> <strong>26</strong> Abs. 1 <strong>LHO</strong><br />
Landesbetrieb<br />
Straßen, Brücken<br />
und Gewässer<br />
RH-<br />
JB<br />
RH-JB<br />
Drs.-Nr. Tzn.<br />
2010 19/5300<br />
576<br />
bis<br />
584<br />
Senatsantwort<br />
Drs.-Nr.<br />
Bericht<br />
Haushaltsausschuss<br />
Drs.-Nr.<br />
19/6159 19/8080<br />
19. Welche Verbindlichkeitsrückstellungen und in welcher Höhe bildeten (1)<br />
der LB Geoinformation und Vermessung, (2) der LB Zentrum für Personaldienste,<br />
(3) der LB Planetarium Hamburg, (4) der LB Rathaus-Service,<br />
(5) der LB Hamburger Institut für Berufliche Bildung und (6) der LB<br />
Straßen, Brücken und Gewässer pro Jahr seit ihrer jeweiligen Gründung<br />
bis zum 31.12.2009?<br />
Für den Zeitraum seit der jeweiligen Gründung bis zum Jahr 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
Im Jahr 2009 wurden folgende Pensionsrückstellungen gebildet (in Euro):<br />
Geoinformation<br />
und<br />
Vermessung<br />
Zentrum<br />
für Personaldienste<br />
Planetarium Rathaus-<br />
Service<br />
Hamburger<br />
Institut<br />
für Berufliche<br />
Bildung<br />
Straßen,<br />
Brücken<br />
und<br />
Gewässer<br />
3.572.055,00 3.437.737,00 79.692,00 503.312,90 60.116.499,00 5.974.000,00<br />
III. zu einzelnen netto-veranschlagten Einrichtungen (<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2<br />
<strong>LHO</strong>)<br />
20. Staatliche Hochbaudienststelle der Behörde für Stadtentwicklung und<br />
Umwelt, Amt für Bauordnung und Hochbau – Landesbau<br />
Die staatliche Hochbaudienststelle der Behörde für Stadtentwicklung und<br />
Umwelt, Amt für Bauordnung und Hochbau – Abteilung Landesbau (abgekürzt<br />
als: BSU-Landesbau) wurde zum 1.1.2004 als netto-veranschlagte<br />
Einrichtung <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> eingerichtet. Zu den<br />
Aufgaben der BSU-Landesbau gehören unter anderem die Verantwortlichkeit<br />
für Planung und Durchführung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten<br />
von Gebäuden der Freien und Hansestadt Hamburg.<br />
a. Welche Zielsetzungen beinhaltet das in Drs. 19/3570 erwähnte langfristige<br />
Standort- und Strukturkonzept?<br />
Mit dem Standort- und Strukturkonzept wurde die generelle Zielsetzung des Kapazitätsabbaus<br />
in der staatlichen Hochbauverwaltung durch die Definition von Zielgrößen<br />
bei der Anzahl der Standorte und Hochbaudienststellen operationalisiert. Dieser konzeptionelle<br />
Ansatz zielte auf die transparente und effektive Umsetzung des Abbaubeschlusses.<br />
b. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
Die Stellenentwicklung im Landesbau für die Zeit ab Ende 2008 ist in der folgenden<br />
Tabelle dargestellt:<br />
Stellenbestand Stellenbestand<br />
31.12.2009<br />
31.12.2010<br />
Planstellen 33 16<br />
A 15 6 3<br />
A 14 3 2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
noch Planstellen<br />
Stellen für<br />
Tarifbeschäftigte<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2009<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2010<br />
A 13 4 3<br />
A 12 7 5<br />
A 11 8 2<br />
A 10 4 1<br />
A 9 1 0<br />
151,5 34<br />
E 15 2 2<br />
E 14 4 3<br />
E 13 11 3<br />
E 12 59 15<br />
E 11 45 3<br />
E 10 9 0<br />
E 9 gD 5 3<br />
E 8 3 1<br />
E 6 10 4<br />
E 5 3,5 0<br />
Gesamt 184,5 50*<br />
* 5,5 Stellen weniger als in Drs. 20/586 dargestellt wegen eines dortigen redaktionellen Fehlers<br />
Der erhebliche Rückgang bei der Anzahl der Stellen ist auf den Übergang von drei<br />
Hochbaudienststellen in das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb zurückzuführen.<br />
c. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Die netto-veranschlagte Einrichtung „Amt für Bauordnung und Hochbau - Landesbau,<br />
Teilwirtschaftsplan Hochschulbau“ hat seit Ende 2008 seinen Personalbestand von<br />
36 auf 38 Beschäftigte erhöht. Dies hängt zum einen mit der Wahrnehmung von zusätzlichen<br />
Aufgaben im Bereich der Finanzbuchhaltung zusammen, die für die Behörde<br />
für Wissenschaft und Forschung wahrgenommen werden. Zum anderen hat der<br />
Umfang der wahrzunehmenden Bauherren- und Baumanagementleistungen zugenommen.<br />
d. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Die vorgenannten Personalzuwächse werden im Wirtschaftsplan durch zusätzliche<br />
Einnahmen finanziert.<br />
e. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
f. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
2010 wurde für die Wahrnehmung besonders komplexer und verantwortungsvoller<br />
Bauherrenaufgaben eine Stelle von Entgeltgruppe E 12 nach Entgeltgruppe E 13 gehoben.<br />
g. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt aus dem Haushalt für<br />
den laufenden Betrieb der Landesbau-Einrichtung seit ihrer Gründung<br />
entwickelt?<br />
Für den laufenden Betrieb erhielt die Landesbau-Einrichtung folgende Zuschüsse:<br />
2009: 29.000 Euro<br />
2010: 0 Euro.<br />
59
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Für die Jahre 2004 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
60<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
2009 erhielt der Wirtschaftsplan wie in den Vorjahren einen Mietkostenzuschuss für<br />
die Nutzung des ehemaligen Nachhaltigkeitszentrums „VIVO“. Mit dem Wechsel der<br />
dort untergebrachten Hochbaudienststelle in das 2010 gegründete Sondervermögen<br />
Schule - Bau und Betrieb und der kurz darauf erfolgten Aufgabe dieses Standortes<br />
wurde der Zuschuss letztmalig 2009 gezahlt.<br />
h. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen der Landesbau-<br />
Einrichtung seit ihrer Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
i. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke der Landesbau-Einrichtung<br />
seit ihrer Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Ablieferungen an den Haushalt und Zuschüsse aus dem Haushalt für Investitionen<br />
und sonstige andere Zwecke der Landesbau-Einrichtung erfolgten nicht.<br />
j. In Drs. 19/3570 wurde in Frage 25. i. gefragt: „Der Rechnungshof<br />
bemerkt, dass die Sparleistungen der Abteilung Landesbau der BSU<br />
beeindruckend seien (Drs. 19/2082), „jedoch sei Personal abgebaut<br />
worden, ohne zu wissen, ob das verbliebene Personal den Anforderungen<br />
an eine künftige Hochbauverwaltung gerecht werde“; es fehle<br />
ein Konzept für die Entwicklung der staatlichen Hochbaudienststellen.<br />
Wie können beziehungsweise könnten ohne ein solches<br />
Entwicklungskonzept Synergieeffekte gemessen werden?“<br />
Nicht beantwortet wurde vom Senat die Frage, wie ohne ein solches<br />
Entwicklungskonzept Synergieeffekte gemessen werden können<br />
beziehungsweise könnten. Wir bitten um eine detaillierte Beantwortung<br />
der Frage.<br />
Die Synergieeffekte konnten durch Abgleiche des erzielten Ist-Zustandes mit der Ausgangslage<br />
(2004) gemessen werden. Bei der Erzielung von Synergiegewinnen durch<br />
die Zusammenlegung von Standorten, Aufgabenbereichen der inneren Verwaltung<br />
und technischen Fachbereichen waren neben der Kapazitätsreduzierung auch die<br />
Bündelung von Kompetenzen und der Erhalt der Leistungsfähigkeit des staatlichen<br />
Hochbaus wichtig.<br />
k. In Drs. 19/2082 ist zu lesen: „Die Abgeordneten der CDU führten<br />
aus, dass sie Privatisierungen grundsätzlich positiv gegenüber stünden.<br />
Viele Aufgaben könnten durch Private genauso gut erledigt<br />
werden. Die Behörde müsse nur kontrollieren und prüfen.“<br />
In Drs. 19/3570 führt der Senat aus, dass die Beauftragung von freien<br />
Architekten und Ingenieuren mit der Planung und dem Bau von<br />
staatlichen Hochbaumaßnahmen seit der Zusammenlegung der<br />
Hochbaudienststellen kontinuierlich zugenommen habe. Die Wahrnehmung<br />
der Bauherren-/Baumanagementleistungen würde auch in<br />
Zukunft im Mittelpunkt der Aufgabenerledigung der Hochbauverwaltung<br />
stehen.<br />
i. Steht der Senat Privatisierungen grundsätzlich positiv gegenüber?<br />
Der Senat trifft seine diesbezüglichen Entscheidungen grundsätzlich einzelfallbezogen<br />
unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (<strong>§</strong> 7 <strong>LHO</strong>).<br />
ii. Welche Vor- beziehungsweise Nachteile sieht der Senat in der<br />
Erledigung von staatlichen Hochbaumaßnahmen durch freie<br />
Architekten und Ingenieure?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Ein Vorteil liegt darin, dass bei den durchzuführenden Hochbaumaßnahmen das für<br />
den Einzelfall notwendige spezielle Fach-Know-how von freien Architektinnen und<br />
Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren herangezogen werden kann, ohne<br />
dieses große Spektrum an Fachdisziplinen auf Dauer selbst vorhalten zu müssen.<br />
Eine uneingeschränkte Beauftragung von freien Architektinnen und Architekten sowie<br />
Ingenieurinnen und Ingenieuren hat dagegen den Nachteil, dass in der staatlichen<br />
Hochbauverwaltung ein schleichender Verlust der eigenen Fachkompetenz zu erwarten<br />
wäre.<br />
l. Wie viele Standorte mit jeweils wie vielen Mitarbeitern bestanden<br />
jeweils in den Jahren 2002 bis 2010 in der Hochbauverwaltung?<br />
Hinsichtlich des Zeitraumes bis Ende 2008 siehe Drs. 19/3570. Für die Jahre 2009<br />
und 2010 stellt sich die Situation wie folgt dar:<br />
Beschäftigte<br />
Standort 31.12.2009 31.12.2010<br />
Wendenstraße 4 44 0<br />
Bahrenfelder Straße 254 – <strong>26</strong>0 (VIVO) 48 0<br />
Weidestraße 122 c 37 37<br />
Gesamt 129 37<br />
m. Welche Kapazitätsreduzierungen wurden gemessen an welchen<br />
Größen durch die Verringerung der Standorte erzielt?<br />
Hinsichtlich der Kapazitätsreduzierung in den Jahren 2004 bis 2009 siehe Drs.<br />
19/3570. Hinsichtlich der Folgejahre ergibt sich folgende Situation:<br />
2009 2010 2011<br />
Mietfläche in m 2 4.904 1.196 1.196<br />
Mietkosten in € 623.163 131.000 131.000<br />
Betriebskosten in € 177.965 55.000 55.000<br />
21. Kasse.Hamburg (K.HH)<br />
Die Kasse.Hamburg (K.HH) wurde als netto-veranschlagte Einrichtung<br />
<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> zum 1.1.2005 gegründet. Sie bleibt damit<br />
integraler Bestandteil der hamburgischen Verwaltung und ist der Finanzbehörde<br />
angegliedert. Zu den Aufgaben der K.HH zählen unter anderem<br />
Dienstleistungen in den Bereichen betriebliche und fachliche Steuerung,<br />
Forderungsmanagement und Finanzbuchhaltung für Behörden und<br />
Ämter. Die Abteilung „Zentralkasse“ der K.HH führt außerdem die Geschäftskonten<br />
von Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen, nettoveranschlagten<br />
Einrichtungen und <strong>Landesbetriebe</strong>n. Hintergrund der<br />
Schaffung dieser Einrichtung ist die angestrebte Verwaltungsmodernisierung<br />
in Verbindung mit der Einführung der doppelten Buchführung.<br />
a. Der Rechnungshof stellt in seinem Bericht 2010 fest, dass „es für<br />
die Kasse.Hamburg auch fünf Jahre nach ihrer Umwandlung weder<br />
eine mit der Finanzbehörde als Aufsichtsbehörde abgestimmte Zielvereinbarung<br />
als zentrales Instrument der Globalsteuerung noch ein<br />
Zielbild gibt. Die Kasse.Hamburg besitzt bislang auch keinen vollständigen<br />
Überblick über die Kosten einzelner Leistungen. Ein standardisiertes<br />
Berichtswesen und ein auf Zielen und Kennzahlen basierendes<br />
Controlling bestehen nicht (vgl. Tz. 647 f.)“ Der Rechnungshof<br />
kritisiert weiterhin, dass die Instrumente zur betrieblichen<br />
Aufsicht und Steuerung der Kasse.Hamburg durch die Finanzbehörde<br />
auch fünf Jahre nach der Gründung noch nicht die Anforderungen<br />
der Verwaltungsvorschriften und der Errichtungsdrucksache<br />
erfüllten.<br />
Inwiefern hat die Kasse.Hamburg die vom Rechnungshof kritisierten<br />
Mängel aktuell behoben?<br />
61
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Der Senat hatte sich in seiner Stellungnahme zum Jahresbericht 2010 der vom Rechnungshof<br />
vorgebrachten Kritik weitgehend angeschlossen und bereits in der Drs.<br />
19/6159 über eine Reihe von inhaltlichen Veränderungen und Verfahrensverbesserungen<br />
berichtet.<br />
Die K.HH hat ihre strategischen Ziele neu formuliert und im Lagebericht zum Jahresabschluss<br />
2009 zusammengefasst. Darüber hinaus wurde ein standardisiertes Berichtswesen<br />
vereinbart und die Kosten- und Leistungsrechnung der K.HH deutlich<br />
erweitert. Dieser Prozess wird in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde in den nächsten<br />
Jahren kontinuierlich fortgesetzt.<br />
Wie angekündigt wurden zum 1. April 2011 die ministeriellen Aufgaben auf die zuständige<br />
Behörde übertragen, sodass sich die K.HH mit ihren verbliebenen Aufgaben<br />
weitgehend auf das operative Geschäft konzentriert. Die Anforderungen der Verwaltungsvorschriften<br />
und der Errichtungsdrucksache sind damit erfüllt.<br />
62<br />
b. Wie und wann wurde das Dienstleistungsangebot der Kassenabteilung<br />
seit 2008 erweitert?<br />
c. Welche zusätzlichen Leistungen konnten dadurch generiert werden?<br />
Primäre Aufgabe der K.HH bleibt die Sicherstellung des Zahlungsverkehrs für die<br />
Freie und Hansestadt Hamburg. Darüber hinaus baut die K.HH die vorhandenen Leistungen<br />
aus und schafft in diesem Kontext neue Angebote. Zur Veranschaulichung<br />
werden folgende Einzelpunkte beispielhaft genannt:<br />
- Im Zusammenhang mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung hat eine<br />
erhebliche quantitative und qualitative Ausweitung der Stammdatenpflege durch<br />
die K.HH stattgefunden.<br />
- Die doppische Buchhaltung im neuen SAP-Verfahren mit veränderten Schnittstellen<br />
zu den zahlreichen Fachverfahren hat insbesondere im Bereich der Geschäftspartnerpflege<br />
zu deutlich erhöhten Anforderungen geführt. Darüber hinaus<br />
hat die Zentralkasse wesentliche Zuarbeiten für die Erstellung der Bilanz der Freien<br />
und Hansestadt Hamburg übernommen.<br />
- Im Jahr 2009 hat die K.HH mit dem Aufbau eines zentralen Buchhaltungsservice<br />
für die Behörden und Ämter der Freien und Hansestadt Hamburg begonnen (siehe<br />
auch Antworten zu 21. l. und 21. m.).<br />
- Im Jahre 2008 hat die K.HH ein neues Berichtswesen im Bereich der Führung von<br />
Geschäftskonten für die <strong>Landesbetriebe</strong> und Beteiligungen der Freien und Hansestadt<br />
Hamburg eingeführt.<br />
- In der Zentralkasse wurde die Durchführung des Datenaustauschs mit den Hausbanken<br />
für das Hygiene-Institut und das ZAF übernommen.<br />
d. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
Stellenbestand Stellenbestand<br />
31.12.2008 31.12.2010<br />
Planstellen 118 142<br />
A 16 1 1<br />
A 15 1 1<br />
A 14 1 3<br />
A 13 3 3<br />
A 12 5 5<br />
A 11 11 11<br />
A 10 2 1<br />
A 9 gD 10 14
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
noch Planstellen<br />
Stellen für<br />
Tarifbeschäftigte<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2008<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2010<br />
A 9 mD 15 13<br />
A 8 53 70<br />
A 7 10 8<br />
A 6 6 12<br />
61,6 58,6<br />
E 12 1 1<br />
E 11 3 4<br />
E 10 1 1<br />
E 9 8 7<br />
E 8 32,7 32,7<br />
E 6 13,9 10,9<br />
E 5 2 2<br />
Gesamt 179,6 200,6<br />
Der erhöhte Stellenbestand ergibt sich im Wesentlichen aus der Übernahme des Vollstreckungsaußendienstes<br />
der Justizkasse und den damit verbundenen Stellen sowie<br />
dem 2011 auslaufenden Projekt „Neues Forderungsmanagement“.<br />
e. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Ja, im Jahr 2009 wurden acht Justizvollziehungsbeamte, im Jahr 2010 Asklepios-<br />
Rückkehrende im Umfang von 7,1 Vollkräften übernommen. 2011 wurde die Stammdatenpflege<br />
(Geschäftspartner) für die BWF in der SAP-Hochschulreferenz übernommen<br />
(0,65 Vollkraft).<br />
f. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Grundsätzlich werden alle Stellen durch den Betriebszuschuss zum Wirtschaftsplan<br />
finanziert. Die Hochschulen finanzieren für die Übernahme der Stammdatenpflege<br />
eine Stelle.<br />
g. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Es sind zurzeit keine Personalzuwächse vorgesehen.<br />
h. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2009 3 A 13 A 14 Anpassung an den Bedarf nach Aufhebung<br />
der Quoten für Eingangs- und erstes<br />
Beförderungsamt<br />
2009 1 A 12 A 13 Referatsleitung Organisation<br />
2009 1 A 11 A 12 Qualitative Aufgabenveränderung durch<br />
Einsparung von Hierarchiestufen in der<br />
Einnahmebuchhaltung<br />
2009 1 A 10 A 11 Grundsatzsachbearbeitung<br />
2009 2 A 9 mD A 9 gD Referatsleiter im Forderungsmanagement<br />
2009 2 A 7 A 8 SAP-Sachbearbeiter<br />
2009 1 BAT IVb; BAT IVa; Leitung Kundenservice<br />
E 9 E 11<br />
2010 1 BAT IVb; BAT IVa; Stellv. Ltg. der Zentralbuchführung<br />
E 9<br />
2010 1 BAT Vb;<br />
E 9<br />
E 10<br />
BAT IVb;<br />
E 9<br />
Referatsleitung im Forderungsmanagement<br />
63
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2010 1 BAT Vb; BAT IVb; Stellv. Referatsleitung SAP-Koordination<br />
E 9 E 9<br />
2010 1 BAT Vb; BAT IVb; Sachbearbeitung SAP-Koordination<br />
E 9 E 9<br />
64<br />
i. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb der Kasse.Hamburg<br />
seit ihrer Gründung entwickelt?<br />
Die K.HH wird im Wesentlichen durch einen Zuschuss finanziert. Die um einmalige<br />
Positionen bereinigte Entwicklung stellt sich seit 2009 wie folgt dar:<br />
Betriebszuschuss Versorgungszuschläge Summe<br />
Jahr<br />
in Tsd. €<br />
2009 7.439 1.213 8.652<br />
2010 7.309 1.213 8.522<br />
Für die Jahre 2005 bis 2008 siehe Drs. 19/3570.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Der höhere Zuschuss in den Jahren 2007 und 2008 ist auf das ehemalige Landesabgabenamt<br />
zurückzuführen. Es wurde 2007 in die K.HH als neuer Bereich eingegliedert<br />
und 2008 wieder ausgegliedert. Dies erklärt die Reduzierung in 2009 gegenüber 2008.<br />
Darüber hinaus entfallen gegenüber 2005 interne Erstattungen für den Zugriff auf das<br />
Melderegisterverfahren, sodass der Betriebszuschuss insgesamt gesenkt werden<br />
konnte.<br />
Die Absenkung des Betriebszuschusses in 2010 erfolgte aufgrund früherer Konsolidierungsbeschlüsse.<br />
j. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen der Kasse.Hamburg<br />
seit ihrer Gründung entwickelt?<br />
Für die Jahre 2005 bis 2007 siehe Drs. 19/3570. Seitdem hat die K.HH aus dem<br />
Haushalt keine Zuschüsse für Investitionen mehr erhalten.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
In den Jahren 2005 bis 2007 wurde die IT-Ausstattung der K.HH bezuschusst. Es<br />
handelte sich um die Erstausstattung und den Ausbau der technischen Infrastruktur.<br />
Anschließend ging der Bestand aufgrund des „Service Level Agreement zur Umsetzung<br />
des Standard-Ersatzbedarfs“ der Finanzbehörde mit Dataport in den IT-Pool der<br />
Finanzbehörde über. Deshalb wurden der K.HH keine weiteren Zuschüsse für Investitionen<br />
gegeben.<br />
k. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke der Kasse.Hamburg<br />
seit ihrer Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Zu den Zuschüssen für Versorgung siehe Antwort zu 21. i.<br />
Zuschüsse für sonstige andere Zwecke waren durch Einmaleffekte begründet.<br />
Jahr<br />
Betrag<br />
in Tsd. €<br />
Art<br />
2004/2005 195 Umzug ins Dienstgebäude VIVO (Drs. 18/1043)<br />
Mittel aus dem Fond zur Effizienzsteigerung, um die Grün-<br />
2004/2005 479<br />
dung der netto-veranschlagten Einrichtung in der Projektphase<br />
zu finanzieren. Diese Mittel wurden in den Folgejahren<br />
2006/2007 vollständig an den Haushalt zurückerstattet.<br />
Bankgebühren anderer Behörden. Die zuvor kostenlose<br />
2005 104 Führung aller Girokonten der FHH durch die HSH Nordbank<br />
wurde entgeltpflichtig. Dies wurde zunächst durch den Wirt-
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Jahr<br />
noch<br />
2005<br />
Betrag<br />
in Tsd. €<br />
Art<br />
schaftsplan der K.HH getragen. Zum Ausgleich erfolgt die<br />
Erhöhung des Zuschusses. Zugleich wurde der Wechsel zur<br />
Deutschen Bundesbank initiiert, die für die Kontenführung<br />
keine Entgelte verlangt.<br />
2006 165 Bankgebühren anderer Behörden (s.o.)<br />
2008 230<br />
Nachtrag für höhere Aufwendungen des Landesabgabenamtes<br />
(Beauftragung von Gutachten beim Landesbetrieb<br />
Geoinformation und Vermessung).<br />
2009 - entfällt<br />
2010 - entfällt<br />
l. Der Drs. 19/5094 ist zu entnehmen, dass mit der Implementierung<br />
des Projektes HERAKLES zur Zentralisierung der Buchhaltung der<br />
Freien und Hansestadt Hamburg die Aufgaben der Kasse.Hamburg<br />
erweitert werden. Welche zusätzlichen Aufgaben kommen in diesem<br />
Zusammenhang im Einzelnen für die K.HH hinzu?<br />
Die K.HH bietet den Behörden und Ämtern als Dienstleistung die kaufmännische<br />
Buchführung an. Das Angebot umfasst die Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung<br />
sowie die Unterstützung bei den Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten.<br />
m. Welche Stellenzuwächse mit welcher Wertigkeit bedingt dies?<br />
Die Zahl der in der K.HH beschäftigten Buchhalterinnen und Buchhalter hängt von der<br />
Inanspruchnahme des Dienstleistungsangebots durch die Behörden ab. Es wird davon<br />
ausgegangen, dass die Zentralisierung der Buchhaltungsaufgaben zu einer effizienteren<br />
Aufgabenwahrnehmung führt. Die Stellenwertigkeiten für die Buchführung<br />
liegen abhängig von den Aufgaben zwischen Entgeltgruppe E 8 und Entgeltgruppe<br />
E 12.<br />
22. Zentrum für Aus- und Fortbildung<br />
Das ZAF existiert als netto-veranschlagte Einrichtung <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong><br />
2 <strong>LHO</strong> seit dem 1.7.2005. Die Fachaufsicht und die Globalsteuerung<br />
obliegen dem Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg.<br />
Zu den Aufgaben des ZAF zählen unter anderem die fach- und ressortübergreifende<br />
Fortbildung (einschließlich der lT-Fortbildung) für die Beschäftigten<br />
der hamburgischen Verwaltung und angegliederter Einrichtungen,<br />
die Personalgewinnung und die Ausbildung von Nachwuchskräften<br />
für den Verwaltungsdienst.<br />
a. Hat es in den letzten zwölf Monaten Änderungen im Zielbild/Unternehmenskonzept<br />
des ZAF gegeben?<br />
i. Wenn ja, wann wurden diese aus welchen Gründen beschlossen?<br />
Nein.<br />
b. Wie hat sich seit Ende 2008 der Stellenbestand entwickelt? (Bitte<br />
aufgegliedert nach Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie nach<br />
Eingruppierung.)<br />
Der Stellenbestand des ZAF hat sich vom 1. <strong>Jan</strong>uar 2009 bis zum 31. Dezember 2010<br />
wie folgt entwickelt:<br />
Stellenbestand Stellenbestand<br />
31.12.2008 31.12.2010<br />
Planstellen 41,35 44,85<br />
A 16 1 1<br />
A 15 2 2<br />
A 14 5 5<br />
A 13 10 11<br />
A 12 3 5<br />
65
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
66<br />
noch Planstellen<br />
Stellen für Tarifbeschäftigte<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2008<br />
Stellenbestand<br />
31.12.2010<br />
A 11 5 7<br />
A 10 1,75 1,75<br />
A 9 6,6 8,1<br />
A 8 1 1<br />
A 7 5 1<br />
A 6 1 2<br />
25,07 56,6<br />
E 14 0 1<br />
E 13 2,52 6<br />
E 11 0 1<br />
Lehrkraft gD 1,48 1,48<br />
E 9 4,5 5,62<br />
E 8 10,5 16,65<br />
E 6 1 9<br />
E 5 4,57 9,07<br />
E 3 0,5 6,78<br />
Gesamt 66,42 101,45<br />
c. Kam es zu Personalzuwächsen?<br />
Wenn ja, bedingt durch welche zusätzlichen Aufgaben?<br />
Ja. Der dargestellte Personalzuwachs steht in einem unmittelbaren Zusammenhang<br />
mit der quantitativen und qualitativen Ausweitung des Geschäftes:<br />
- Das Geschäftsfeld Fortbildung ist auch nach dem Wachstumsjahr 2008 (siehe<br />
auch Drs. 19/3570) durch die Erbringung von Fortbildungsleistungen für drei große<br />
Projekte gekennzeichnet, die beginnend ab 2008 durch das ZAF umzusetzen<br />
waren (Qualifizierung der Asklepios-Rückkehrenden, Unterstützung des Projekts<br />
Neues Haushaltswesen Hamburg, Umsetzung der IT-Qualifizierungsoffensive).<br />
Die für die Planung, Umsetzung sowie Administration der Fortbildung erforderlichen<br />
Personalressourcen sind im Wesentlichen in 2008 aufgebaut worden (im<br />
Wege der Abordnung), allerdings zu einem großen Teil erst in 2009 stellenwirksam<br />
geworden (Versetzung).<br />
Die Entwicklung des Fortbildungsvolumens der fach- und ressortübergreifenden<br />
Fortbildung der letzten Jahre ist aus anliegender Grafik entnehmbar:<br />
Ist-TN: Ist-Teilnehmende; Ist-TNT: Ist-Teilnahmetage
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
- Das Geschäftsfeld der Ausbildung ist in den Jahren 2009 und 2010 durch die<br />
Umsetzung der Ausbildungsoffensive gekennzeichnet. Aufgrund der Aufstockung<br />
der Ausbildungskapazität im Rahmen der Hamburger Konjunkturoffensive 2009/<br />
2010 – Nachhaltiges Wachstum wurden zusätzliche Aufgaben übernommen, deren<br />
Umsetzung zusätzliches Personal erfordert (siehe auch Drs. 19/2250). Die für<br />
diesen Zweck gebundenen Personalressourcen sind <strong>gemäß</strong> Beschluss der Bürgerschaft<br />
(siehe Drs. 19/3921) befristet zur Verfügung gestellt (bis Ende der Ausbildungsoffensive;<br />
spätestens bis Ende 2015).<br />
- Auch die stärkere Professionalisierung des ZAF hat zusätzliche beziehungsweise<br />
spezialisiertere Aufgaben zur Folge (zum Beispiel Umstellung des Rechnungswesens<br />
auf doppische Buchführung, Stärkung des Transfermanagements, Erweiterung<br />
des Lernportals und dessen Einbindung in das Personalportal).<br />
d. Wie werden die Stellen finanziert (zum Beispiel durch zusätzlich<br />
generierte Einnahmen et cetera)?<br />
Das zusätzliche Personal wird im Geschäftsfeld Ausbildung über den Betriebszuschuss<br />
und im Geschäftsfeld Fortbildung über zusätzlich realisierte Erträge (zum Beispiel<br />
für Fortbildungsleistungen an Projekte oder externe Nachfrager, Raumvermietung)<br />
sowie im Einzelfall über anteilige Personalkostenerstattungen (zum Beispiel für<br />
Asklepios-Rückkehrende) finanziert.<br />
e. Wie sieht die diesbezügliche Entwicklungsperspektive für die Wirtschaftsplanjahre<br />
2011/2012 aus?<br />
Die Planung des Personalbedarfs der Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 sieht in etwa<br />
die Fortschreibung des Personalbestands des Jahres 2010 vor. Unsicherheiten hinsichtlich<br />
des Bedarfs für 2011 und 2012 liegen zurzeit vor allem in der bisherigen vorläufigen<br />
Haushaltsführung, die bei den Behörden und Ämtern zu einer vorsichtigen<br />
Auftragsvergabe führt, sowie in durch politische Entscheidungen bedingte Veränderungen<br />
und Reduzierungen der Auftragslage (zum Beispiel bezüglich des Projekts<br />
Neues Haushaltswesen Hamburg). Das ZAF geht für seine Planungen davon aus,<br />
dass Entscheidungssicherheit im letzten Quartal dieses Jahres gegeben sein wird. Ein<br />
kurzfristiger Personalabbau, der einige Monate später wiederum einen entsprechenden<br />
Personalaufbau erfordern würde, wäre nicht wirtschaftlich, da qualifiziertes und<br />
eingearbeitetes Personal bei Bedarf nicht zur Verfügung stehen würde. Allerdings<br />
wurde bereits ein zum 30. Juni 2011 auslaufender befristeter Vertrag vor diesem Hintergrund<br />
nicht verlängert.<br />
f. Welche Stellenhebungen wurden seit Ende 2008 für welche Funktionen<br />
im Einzelnen zu welchem Wirtschaftsjahr jeweils durchgeführt?<br />
Jahr Anzahl bisher neu Funktion<br />
2009 1 A 11 A 12 stellvertretende Leitung im<br />
Geschäftsbereich Ausbildung<br />
2009 1 A 11 A 12 IT-Fortbildung, Fachliche Leitstelle<br />
CLIX<br />
2009 1 A 7 A 8 Assistenz IT-Programmplanung<br />
2009 0,5 E 3 E 5 Sachbearbeitung Veranstaltungsmanagement<br />
2010 1 E 13 E 14 Leitung Eignungsdiagnostik<br />
2010 1 E 5 E 6 Sachbearbeitung Bewerbungscenter<br />
g. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für den laufenden Betrieb des ZAF seit<br />
dessen Gründung entwickelt?<br />
Für den laufenden Betrieb erhielt das ZAF seit 2008 folgende Zuschüsse:<br />
2008: 4.151.000 Euro<br />
2009: 4.375.000 Euro<br />
67
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
2010: 4.728.000 Euro.<br />
Für den IT-Betrieb erhielt das ZAF seit 2008 folgende Zuschüsse:<br />
2008: 142.000 Euro<br />
2009: 142.000 Euro<br />
2010: 142.000 Euro.<br />
Für die Jahre 2005 bis 2007 siehe Drs. 19/3570.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Die maßgeblichen Gründe für die Veränderung des Zuschussbedarfs sind:<br />
- Strukturelle Zuschusserhöhung für Verwaltungsdienstleistungen des Personalamtes,<br />
- strukturelle Zuschusserhöhung wegen Mietzahlungen Schwenckestraße (Verkauf<br />
des Gebäudes und Rückmietung),<br />
- einmaliger Erhalt von Mitteln zur Umsetzung verschiedener Projekte (Förderung<br />
von Nachwuchskräften mit Migrationshintergrund, Verwaltungsreform),<br />
- einmaliger Zufluss aus der Auslösung des Vermögens Verwaltungsseminar Kupferhof,<br />
- einmalige Verringerung des Zuschussbedarfs durch Einsatz von Deckungsmitteln<br />
aus der Auslösung des Vermögens Verwaltungsseminar Kupferhof,<br />
- strukturelle Zuschusserhöhung für die Finanzierung einer neuen Führungsfortbildung,<br />
- einmalige Zuweisung eines Zuschussbedarfs für die Aufstockung der Ausbildungskapazitäten<br />
im Rahmen der Konjunkturoffensive von Senat und Bürgerschaft<br />
2009/2010.<br />
h. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise de<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für Investitionen des ZAF seit dessen<br />
Gründung entwickelt?<br />
Für Investitionen erhielt das ZAF seit 2008 folgende Zuschüsse:<br />
2008: 1.384.000 Euro<br />
2009: 117.000 Euro<br />
2010: 57.000 Euro.<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Maßgeblicher Grund für die Veränderung des Zuschusses war der Bedarf für den<br />
Umzug und die Herrichtung des neuen citynahen Standortes.<br />
i. Wie hat sich die Ablieferung an den Haushalt beziehungsweise der<br />
Zuschuss aus dem Haushalt für sonstige andere Zwecke des ZAF<br />
seit dessen Gründung entwickelt?<br />
i. Worauf ist dies maßgeblich zurückzuführen?<br />
Über die genannten Zuschüsse hinaus erhält das ZAF einen Zuschuss für Versorgung,<br />
der sich wie folgt entwickelt hat:<br />
2005: 275.000 Euro<br />
2006: 521.000 Euro<br />
2007: 498.000 Euro<br />
2008: 494.000 Euro<br />
2009: 599.000 Euro<br />
2010: 623.000 Euro.<br />
68
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
j. Laut Drs. 19/3570 war das Verkaufsverfahren zum Objekt „Kupferhof“<br />
im August 2009 noch nicht abgeschlossen.<br />
i. Ist das Verkaufsverfahren mittlerweile abgeschlossen?<br />
ii. Wenn ja, wie hoch waren die Erlöse aus der Aufgabe und Veräußerung<br />
des ehemaligen ZAF-Schulungszentrums Kupferhof?<br />
Das Verkaufsverfahren ist nicht abgeschlossen. Die Kommission für Bodenordnung<br />
hat dem Verkauf mit Beschluss vom 17. Februar 2011 zugestimmt. Die Beurkundung<br />
des Kaufvertrages soll bis Mitte August 2011 erfolgen.<br />
k. In Drs. 18/6275 führt der Senat aus, dass die Anmietung des Gebäudes<br />
„Hanse 90°“ kostenneutral sei. Wie hoch waren die Mietkosten,<br />
Nebenkosten und Instandhaltungskosten für das Gebäude<br />
„Hanse 90°“ im Jahr 2009?<br />
Die laufenden Miet-, Neben- und Instandhaltungskosten für das Gebäude „Hanse 90°“<br />
stellen sich im Jahr 2009 wie folgt dar:<br />
Laufende Ausgaben für den neuen citynahen Standort (Hanse 90°)*<br />
Kostenart Plan 2009** Ist 2009<br />
Mietkosten*** 700.000 € 711.000 €<br />
Nebenkosten<br />
428.000 € 389.000 €<br />
Instandhaltungskosten 28.000 € 20.000 €<br />
Gesamtkosten 1.156.000 € 1.120.000 €<br />
* Hierbei handelt es sich um eine periodengerechte Darstellung der Aufwendungen bezogen<br />
auf das Geschäftsjahr 2009.<br />
** siehe Drs. 18/6275<br />
*** Aufgrund einer erforderlichen zusätzlichen Anmietung von Archiv- und Kellerflächen sind<br />
die Mietkosten im Vergleich zu den angesetzten Mietaufwendungen aus der Drs. 18/6275<br />
leicht gestiegen. In der Summe sind die Ist-Kosten jedoch unter den Plankosten geblieben.<br />
l. Wie hoch sind die Umzugs- und Herrichtungskosten in 2009 gewesen<br />
(bitte auflisten wie in Tabelle 7, Seite 6, Drs. 18/6275)?<br />
Die Umzugs- und Herrichtungskosten für das Projekt „neuer citynaher Standort“ stellten<br />
sich bis 2009 wie folgt dar:<br />
Einmalige Ausgaben für Umzug und Standortherrichtung<br />
Plan*<br />
Ist<br />
2007/2008/<br />
2009<br />
Einmalige Betriebsausgaben 171.000 € 175.000 €<br />
Umzugskosten 75.000 € 36.000 €<br />
Auflösungskosten 35.000 € 44.000 €<br />
Beratungskosten 61.000 € 95.000 €<br />
Einmalige Investitionsausgaben 1.700.000 € 1.653.000 €<br />
IT-Technik 135.000 € 90.000 €<br />
Ausbaumaßnahmen 990.000 € 847.000 €<br />
Ersatzbeschaffung und Modernisierung<br />
(Schulbetrieb)<br />
210.000 € 157.000 €<br />
Ersatzbeschaffung und Modernisierung<br />
(Seminarbetrieb)<br />
245.000 € 395.000 €<br />
Ersatzbeschaffung und Modernisierung<br />
(Verwaltungsbetrieb)<br />
120.000 € 164.000 €<br />
Gesamtsumme 1.871.000 € 1.828.000 €<br />
* siehe Drs. 18/6275<br />
Die Übersicht über die Ist-Kosten für den Umzug und die Herrichtung des neuen citynahen<br />
Standortes entspricht der Darstellung in Drs. 19/3570, da zum damaligen Zeitpunkt<br />
nicht nur die bis Ende 2008 erfolgten Zahlungsabflüsse, sondern – im Sinne<br />
einer Gesamtbetrachtung des Projektes – darüber hinaus auch die bereits zu erwartenden<br />
Zahlungsabflüsse der Folgejahre berücksichtigt wurden (zum Beispiel weil sie<br />
69
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
schon in 2008 aufgrund eingegangener Verpflichtungen als Verbindlichkeit bestanden<br />
haben oder aufgrund von Ausschreibungsverfahren/Vertragsverhandlungen als zu<br />
erwartende Verbindlichkeiten zu werten waren).<br />
Im Geschäftsjahr 2009 sind im Rahmen des Projektes „neuer citynaher Standort“ Mittel<br />
in Höhe von 154.000 Euro aus dem Investitionszuschuss abgeflossen.<br />
70<br />
m. Wie haben sich die durchschnittlichen Kosten pro Seminartag und<br />
Teilnehmer in Euro entwickelt? (Angabe bitte wie im Wirtschaftsplan<br />
des ZAF, Haushaltsplan-Entwurf 2007/2008, Einzelplan 1.1, Anlage<br />
2.3, Produktgruppe 06, Kapitel 1146, Seite 43.)<br />
Die Kostenentwicklung ist der Tabelle zu entnehmen:<br />
Durchschnittliche Kosten pro Teilnahmetag Fortbildung<br />
(ohne Führungsfortbildung, ohne IT-Fortbildung), citynah<br />
Durchschnittliche Kosten pro Teilnahmetag<br />
Führungsfortbildung, citynah<br />
Durchschnittliche Kosten pro Teilnahmetag<br />
IT-Fortbildung (Grundlagen- und Standardseminare)<br />
2008 2009 2010<br />
90 € 90 € 85 €<br />
90 € 90 € 95 €<br />
115 € 105 € 100 €<br />
n. Der Rechnungshof stellt in seinem Jahresbericht 2009 erhebliche<br />
Mängel in Steuerung und Management des Landesbetriebs fest<br />
(siehe Seiten 152 – 155, Tzn. 398 – 405): (1) die Seminarraumkapazität<br />
am neuen citynahen Standort liege „über dem zum Zeitpunkt<br />
der Planung bekannten Bedarf“; (2) die zuvor erfolgte Raumanmietung<br />
im Gotenhof und ihr Umbau verstießen „bei rein monetärer Betrachtung<br />
gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit“; (3) die Beurteilung<br />
der Wirtschaftlichkeit der Beauftragung von Dataport für die<br />
fachübergreifende lT-Fortbildung „sei nicht möglich.“<br />
Laut Drs. 19/3124 hat das ZAF zwischenzeitlich ein Raumnutzungskonzept<br />
erstellt, die Verhandlungen mit Dataport waren zum Antwortzeitpunkt<br />
noch nicht abgeschlossen.<br />
i. Sind die Verhandlungen mit Dataport mittlerweile abgeschlossen?<br />
ii. Wie lauten die Ergebnisse?<br />
Die Verhandlungen mit Dataport Training sind bislang wie folgt geführt worden: Der<br />
aus 2008 gültige Rahmenvertrag ist zunächst bis zum 30. Juni 2011 fortgeschrieben<br />
worden (Zeitpunkt der Beendigung der IT-Qualifizierungsoffensive), um die vor Inkraftsetzen<br />
des neuen Leistungsverzeichnisses von Dataport (April 2009) günstigeren<br />
Konditionen für das ZAF wahren zu können. Darüber hinaus ist Mitte 2010 zwischen<br />
dem ZAF und Dataport Training einvernehmlich vereinbart worden, die Seminartypen,<br />
die während des Trainings keine sogenannte FHH-IT-Systemumgebung benötigen,<br />
überwiegend über andere Vertragspartner des ZAF abwickeln zu lassen. Die Verhandlungen<br />
für eine rückwirkend ab dem 1. Juli 2011 geltende Rahmenvereinbarung<br />
zwischen dem ZAF und Dataport Training stehen kurz vor dem Abschluss.<br />
o. In seinem aktuellen Bericht stellt der Rechnungshof fest, dass „die<br />
mit der Neuordnung der Fortbildung durch Gründung des „Zentrums<br />
für Aus- und Fortbildung“ verbundenen Ziele insbesondere in Hinblick<br />
auf die Weiterentwicklung der Bedarfsermittlung sowie der<br />
Evaluation von Fortbildungsveranstaltungen bisher nicht überprüft<br />
worden sind. Damit fehlen gesicherte Erkenntnisse zum Erfolg der<br />
Fortbildungen (vgl. Tzn. 776 bis 779).“<br />
i. Inwiefern konnten die vom Rechnungshof kritisierten Mängel<br />
zwischenzeitlich behoben werden?<br />
ii. Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, den Erfolg der Fortbildungen<br />
zu bewerten?
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Die Verbesserung der Bedarfsermittlung und der Evaluation ist ein kontinuierlicher<br />
Prozess. Hier hat das ZAF insbesondere in den letzten beiden Jahren erhebliche Anstrengungen<br />
unternommen.<br />
- Im Bereich der Bedarfsermittlung wird in einem systematisierten Prozess unter<br />
Einbindung verschiedener Anspruchsgruppen (Personalentwicklung, Gesprächsforum<br />
Personalmanagement, Projektauftraggeber, Spitzenorganisationen der Gewerkschaften<br />
und Berufsverbände) jährlich das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
offenstehende Fortbildungsangebot entwickelt und abgestimmt.<br />
Das für die Behörden zu realisierende Angebot wird jährlich in Planungsgesprächen<br />
mit den einzelnen Behörden konkretisiert.<br />
Um unterjährig flexibel auf kurzfristig auftretende Bedarfe reagieren zu können,<br />
hat das ZAF den Prozess der „Nachsteuerung“ mit den Spitzenorganisationen der<br />
Gewerkschaften und Berufsverbände vereinbart und hält einen erheblichen Teil<br />
seiner Ressourcen hierfür bereit.<br />
- Grundsätzlich werden alle Fortbildungsveranstaltungen, die das ZAF durchführt,<br />
am Ende der Veranstaltung von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mithilfe<br />
eines Beurteilungsbogens zu Qualität und Nutzen aus Sicht der Teilnehmenden<br />
bewertet (Bewertung des Seminarerfolgs). Die Bewertung des Transfererfolgs verlangt<br />
dagegen aufwendigere Untersuchungsdesigns, die insbesondere bei größeren<br />
Schulungsmaßnahmen Sinn machen.<br />
Seit 2009 hat das ZAF folgende Evaluationen durchgeführt:<br />
• 2009: Kundenbefragung Fortbildung: Verschiedene Kundengruppen bewerteten<br />
die Qualität von Fortbildung des ZAF;<br />
• 2009/2010: regelmäßige Befragungen von Führungskräften der Bezirksämter<br />
sowie von Trainerinnen und Trainern, die an den Netzwerken „Verwaltungsreform“<br />
teilnehmen;<br />
• 2010: Evaluation der ersten Schulungswelle „Neues Haushaltswesen“ (umfangreiche<br />
Befragung aller Teilnehmenden nach einer Praxisphase);<br />
• 2010/2011: Evaluation der IT-Qualifizierungsoffensive über Tests und Befragungen.<br />
- Um unabhängig von aufwendigen Evaluationsvorhaben den Transfererfolg zu<br />
verbessern, hat das ZAF in Kooperation mit der Universität St. Gallen, Schweiz,<br />
im Jahr 2011 ein Konzept zum Transfermanagement entwickelt, das darauf abstellt,<br />
Vorgesetzte in den Prozess der Bedarfsermittlung und in den Prozess der<br />
Lernbegleitung nach der Teilnahme an einer Veranstaltung stärker einzubinden.<br />
Eine Befragung von Vorgesetzten zu diesem Konzept wird zurzeit vorbereitet.<br />
23. Immobilienmanagement<br />
Seit dem 1.1.2009 besteht mit dem Immobilienmanagement eine weitere<br />
netto-veranschlagte Einrichtung <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong>. Diese ist<br />
nach einem über Jahre andauernden Prozess, der die Integration der bis<br />
dahin in den Bezirken befindlichen Liegenschaftsdienststellen zum Ziel<br />
hatte, gegründet worden. Die Aufsicht führende Behörde ist die Finanzbehörde.<br />
Die <strong>§</strong> 15-Einrichtung Immobilienmanagement sei zu verstehen<br />
als „Weiterentwicklung der früheren Liegenschaftsverwaltung“ der Finanzbehörde.<br />
Aufgaben der Einrichtung sind unter anderem die Steuerung<br />
wesentlicher Teile des städtischen Immobilienvermögens; zum<br />
anderen agiert es als Marktteilnehmer, indem es Flächen ankauft, entwickelt,<br />
vermarktet und verkauft.<br />
a. Welche Veränderungen beziehungsweise Weiterentwicklungen hat<br />
es seit der Vorlage der Ziele der Einrichtung Immobilienmanagement<br />
im Haushaltsplan 2009/2010 wann aus welchen Gründen gegeben?<br />
71
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
b. Die Frage 28. c. in Drs. 19/3570 nach den Zielen, die mit der Gründung<br />
als netto-veranschlagte Einrichtung Immobilienmanagement<br />
verfolgt wurden, die durch welche Maßnahmen bereits erreicht wurden<br />
beziehungsweise welche Ziele bislang warum noch nicht erreicht<br />
werden konnten, und wie diese in den Jahren 2009/2010 erreicht<br />
werden sollen, wurde vom Senat nicht beziehungsweise nicht<br />
ausführlich beantwortet.<br />
Wir bitten um die detaillierte Beantwortung der Frage.<br />
Das Immobilienmanagement ist zum 1. <strong>Jan</strong>uar 2011 im Rahmen des Neuen Haushaltswesens<br />
als Aufgabenbereich in den Kernhaushalt überführt worden (Teilplan 136<br />
des Einzelplans 9.1). Ziel der Umstellung auf eine netto-veranschlagte Einrichtung<br />
zum 1. <strong>Jan</strong>uar 2009 war – im Vorgriff auf die Umstellung auf das Neue Haushaltswesen<br />
– eine bessere Steuerung durch eine Stärkung von Ressourcen- und Ergebnisverantwortung<br />
sowie eine größere Flexibilität. Es war von vornherein geplant, die<br />
Steuerung durch die Einführung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten zukünftig<br />
noch weiter zu verbessern (siehe dazu die Erläuterungen im Haushaltsplan<br />
2009/2010). Das Neue Haushaltswesen bildet einen geeigneten Rahmen, um diese<br />
Ziele zu erreichen.<br />
An den inhaltlichen Zielen des Immobilienmanagements hat sich weder durch die<br />
Umstellung auf eine netto-veranschlagte Einrichtung noch durch die Umstellung auf<br />
einen Aufgabenbereich im Rahmen des Neuen Haushaltswesens etwas geändert.<br />
72<br />
IV. zu Nutzen-Einschätzungen und zur Zukunft des Modells der netto-veranschlagten<br />
Einrichtung (nach <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong>)<br />
24. Die Fragen 29. – 31. wurden in Drs. 19/3570 vom Senat nicht oder nur<br />
teilweise beantwortet. Wir bitten um eine detaillierte Beantwortung der<br />
Fragen:<br />
a. In welchen Fällen hat sich die Gründung einer netto-veranschlagten<br />
Einrichtung aus jeweils welchen Gründen als vorteilhaft erwiesen?<br />
In allen Fällen, weil die mit der Nettoveranschlagung verfolgten Ziele jeweils erreicht<br />
wurden.<br />
Durch die Veranschlagung der staatlichen Hochschulen als netto-veranschlagte Einrichtungen<br />
konnte deren Eigenverantwortlichkeit und Autonomie gestärkt und die Flexibilität<br />
in der Bewirtschaftung (Globalhaushalt) erhöht werden.<br />
Dem Institut für Hygiene und Umwelt (HU) ermöglicht die Form der Veranschlagung<br />
eine flexiblere Bewirtschaftung. Die mit der Veranschlagung verbundene Kosten- und<br />
Leistungsrechnung führt zu einer höheren Kostentransparenz und erleichtert den Abschluss<br />
von Leistungsvereinbarungen zwischen den Fachbereichen des HU und den<br />
zuständigen Fachbehörden.<br />
Die Orientierung an kaufmännischen Grundsätzen führte in den Hochbaudienststellen<br />
zu einer verstärkten Dienstleistungsorientierung und einem ausgeprägten Kostenbewusstsein.<br />
Des Weiteren führte die Refinanzierung der Personal- und Sachkosten<br />
über Honorareinnahmen zu einer dem Investitions- und Bauunterhaltungsvolumen<br />
angepassten Personalstruktur.<br />
Im ZAF konnten betriebliche Strukturen aufgebaut werden, die es ermöglicht haben,<br />
die verschiedenen Leistungsbereiche innerhalb des ZAF voneinander abzugrenzen<br />
und getrennt darzustellen (Ausbildung, zentrale Fortbildung, dezentrale Fortbildung,<br />
Fortbildung im Auftrag von Projekte). Auch die Kalkulation von Preisen ist nur auf der<br />
Grundlage betriebswirtschaftlicher Instrumentarien möglich. Insbesondere das Fortbildungsgeschäft<br />
ist von hohem zeitlichen Druck seitens der Auftraggeber geprägt und<br />
verlangt vom ZAF eine Realisierung der Veranstaltungen mit sehr kurzen Vorlaufzeiten.<br />
Die gewählte Organisationsform erlaubt es, im Bedarfsfall die notwendigen Entscheidungen<br />
kurzfristig treffen und umsetzen zu können. Für den erfolgreichen Betrieb<br />
waren und sind die umfassenden Deckungsmöglichkeiten, die innerhalb des<br />
Wirtschaftsplans bestehen, unabdingbar. Die Einbindung der Kunden in den Verwal-
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
tungsrat des ZAF (eine Fachbehörde, ein Bezirksamt) stärkt die Ausrichtung des Handelns<br />
des ZAF auf die Kundenanforderungen.<br />
Im Übrigen siehe Drs. 19/3570.<br />
b. In welchen Fällen hat sich die Gründung einer netto-veranschlagten<br />
Einrichtung aus jeweils welchen Gründen als nachteilig erwiesen?<br />
In keinem Fall.<br />
25. Für welche Verwaltungseinheiten wird die „Verselbstständigung“ in Form<br />
einer netto-veranschlagten Einrichtung nach <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> derzeit<br />
geprüft beziehungsweise angestrebt?<br />
Für keine.<br />
<strong>26</strong>. Welche derzeit bestehenden netto-veranschlagten Einrichtungen nach<br />
<strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> sollen noch in dieser Legislaturperiode in eine andere<br />
Rechtsform umgewandelt werden beziehungsweise wurden bereits in<br />
eine andere Rechtsform umgewandelt?<br />
a. Welche Rechtsform wird beziehungsweise wurde jeweils geprüft<br />
beziehungsweise aus welchen Gründen angestrebt?<br />
Siehe Antworten zu 16. sowie 23. a. und 23. b.<br />
Mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2011/2012 hat der Senat der Bürgerschaft auch<br />
vorgeschlagen, die bisherige netto-veranschlagte Einrichtung „Feuerwehrakademie“<br />
als Besonderen Budgetbereich im Rahmen des Neuen Haushaltswesens Hamburg zu<br />
veranschlagen. Der entsprechende Beschluss der Bürgerschaft steht – wie für das<br />
Immobilienmanagement, siehe auch Antworten zu 23. a. und 23. b. – noch aus.<br />
27. Welche ehemals bestehenden netto-veranschlagten Einrichtungen sind<br />
seit dem 1. <strong>Jan</strong>uar 2002 bis heute in andere Organisationen (zum Beispiel<br />
GmbH, gGmbH, Stiftung) umgewandelt beziehungsweise eingegliedert<br />
worden?<br />
28. Waren diese Umwandlungen bereits zum Zeitpunkt der Gründung als<br />
netto-veranschlagte Einrichtung nach <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> vorgesehen?<br />
Die Hochbaudienststellen Planen und Bauen Hamburg, Nord und Bergedorf (ehemalige<br />
Staatliche Hochbaudienststellen Planen und Bauen Hamburg, Landesbau Hamburg-Mitte,<br />
Landesbau Hamburg-Nord, Landesbau Hamburg-Wandsbek, Landesbau<br />
Hamburg-Bergedorf) wurden zum 1. <strong>Jan</strong>uar 2010 aus der netto-veranschlagten Einrichtung<br />
„Staatliche Hochbaudienststelle - Landesbau“ herausgelöst und in das neu<br />
gegründete Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb eingegliedert (Drs. 19/4208).<br />
Zum Zeitpunkt der Gründung der netto-veranschlagten Einrichtung „Staatliche Hochbaudienststelle<br />
- Landesbau“ war die Eingliederung in das Sondervermögen Schule -<br />
Bau und Betrieb nicht vorgesehen.<br />
Im Übrigen siehe Drs. 19/3570.<br />
29. Welche Prüfungen hat der Rechnungshof in netto-veranschlagten Einrichtungen<br />
nach <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> seit 2002 vorgenommen?<br />
30. Zu welchen Feststellungen ist der Rechnungshof jeweils gelangt und<br />
welche Stellungnahme hat der Senat jeweils abgegeben?<br />
Für die Prüfungsjahre 2002 bis 2008 (Jahresberichte 2003 bis 2009 des Rechnungshofs)<br />
siehe Drs. 19/3570.<br />
Die in den Jahresberichten 2010 und 2011 (Prüfungsjahre 2009 und 2010) des Rechnungshofs<br />
veröffentlichten Prüfungen und die entsprechenden Stellungnahmen des<br />
Senats zu den Feststellungen des Rechnungshofs sind der nachstehenden Übersicht<br />
zu entnehmen:<br />
73
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
Prüfungsjahr<br />
74<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
Vom RH geprüfte Einrichtungen<br />
nach<br />
<strong>§</strong> <strong>26</strong> Abs. 1 <strong>LHO</strong><br />
Hamburger Hochschulen,<br />
Verwertung von<br />
Forschungsergebnis-<br />
sen<br />
Universität Hamburg,<br />
Einführung des<br />
kaufmännischen Rechnungswesens<br />
Universität Hamburg,<br />
Bauliche Entwicklung<br />
Universität Hamburg,<br />
Erweiterungsbau<br />
Rechtshaus<br />
HafenCity Universität,<br />
Hochschule für AngewandteWissenschaften,<br />
SAP-Einsatz<br />
RH-<br />
JB<br />
RH-JB<br />
Drs.-<br />
Nr.<br />
2010 19/5300<br />
2010 19/5300<br />
2010 19/5300<br />
2010 19/5300<br />
2010 19/5300<br />
2010 Feuerwehrakademie 2011 20/20<br />
V. Controlling der <strong>Landesbetriebe</strong><br />
Tzn.<br />
55<br />
bis<br />
69<br />
70<br />
bis<br />
93<br />
320<br />
bis<br />
340<br />
483<br />
bis<br />
492<br />
666<br />
bis<br />
680<br />
441<br />
bis<br />
463<br />
Senatsantwort<br />
Drs.-<br />
Nr.<br />
Bericht<br />
Haushaltsausschuss<br />
Drs.-Nr.<br />
19/6159 19/8080<br />
19/6159 19/8080<br />
19/6159 19/8080<br />
19/6159 19/8080<br />
19/6159 19/8080<br />
20/460<br />
Liegt noch<br />
nicht vor.<br />
31. Verfügen alle heutigen Mitglieder der Aufsichtsgremien der oben genannten<br />
<strong>Landesbetriebe</strong> nach <strong>§</strong> <strong>26</strong> und netto-veranschlagten Einrichtungen<br />
nach <strong>§</strong> 15 <strong>Absatz</strong> 2 <strong>LHO</strong> über betriebswirtschaftliches Know-how?<br />
a. Wenn ja, aufgrund welcher Aus- oder Fortbildung?<br />
Soweit die <strong>Landesbetriebe</strong> über eigene Aufsichtsgremien verfügen und die Aufsicht<br />
nicht unmittelbar von der zuständige Behörde wahrgenommen wird, erfolgt die Entsendung<br />
der Mitglieder in die jeweiligen Aufsichtsgremien aufgrund ihrer Funktion und<br />
Fachkompetenz.<br />
b. Welche Fortbildungsangebote erhalten Mitglieder in Aufsichtsgremien<br />
der <strong>Landesbetriebe</strong> und in welchem Umfang wurden solche 2009<br />
und 2010 wahrgenommen?<br />
Den Beschäftigten der hamburgischen Verwaltung steht ein umfangreiches Fortbildungsangebot<br />
zu Verfügung, in denen die betriebswirtschaftlichen Handlungskonzepte<br />
der Freien und Hansestadt Hamburg und die Steuerungsinstrumentarien dargestellt<br />
werden. Im Jahr 2009 wurden besondere Fortbildungsangebote für Mitglieder in Aufsichtsgremien<br />
nicht durchgeführt. 2010 fanden im Rahmen des zentralen Fortbildungsangebotes<br />
des Zentrums für Aus- und Fortbildung folgende Veranstaltungen<br />
statt:<br />
Titel der Veranstaltungen<br />
Anzahl<br />
Veranstaltungen<br />
Ist-<br />
TN 1)<br />
Ist-<br />
TNT 2)<br />
1. Aufsichtsratsmandate bei öffentlichen<br />
Unternehmen<br />
2. Aufsichtsrats-Coaching − Coaching für<br />
1 10 10<br />
Aufsichtsratsmitglieder und Beteiligungsverwaltungen<br />
bei öffentlichen Unternehmen<br />
2 33 33<br />
3. Aufsichtsratsmandate − Bedeutung für<br />
das Beteiligungsmanagement der FHH<br />
1 21 10,5<br />
Gesamtergebnis<br />
1) 2)<br />
TN: Teilnehmende, TNT: Teilnahmetage<br />
4 64 53,5
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Die Fortbildungen wurden für diese Zielgruppen durchgeführt:<br />
1. Mitglieder in Aufsichtsgremien<br />
2. Senatsvertreterinnen/-vertreter und Beschäftigte, die Aufsichtsratsmandate für die<br />
Stadt wahrnehmen, sowie Beschäftigte der Beteiligungsverwaltungen<br />
3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hamburgischen Verwaltung.<br />
32. Wie sind die Controllingeinheiten, die in den Aufsicht führenden Behörden<br />
eingerichtet sind, jeweils personell ausgestattet?<br />
33. Wie viele Stellen, die betriebswirtschaftliche Kenntnisse voraussetzen,<br />
sind in diesen Controllingeinheiten aktuell jeweils vorhanden und wie viele<br />
mit entsprechend qualifiziertem Personal besetzt? Bitte bei den Voraussetzungen<br />
und Besetzungen jeweils nach höherem und gehobenem<br />
Dienst unterscheiden.<br />
LEB: In der BASFI wird die Aufsicht über den LEB von der Leitung des fachpolitisch<br />
zuständigen Fachamtes wahrgenommen und bei Bedarf durch Assistenzen des Fachamtes<br />
(zwei Personen des höheren Dienstes) und der Zentralverwaltung (ebenfalls<br />
zwei Personen des höheren Dienstes) unterstützt.<br />
LGV: In der BSU wird das Controlling über den LGV vom betriebswirtschaftlichen Referat<br />
in der Zentralverwaltung wahrgenommen (30 Prozent einer Stelle des gehobenen<br />
Dienstes).<br />
Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen: In der BWVI wird das Controlling des Landesbetriebs<br />
von der Leitung des fachpolitisch zuständigen Fachamtes wahrgenommen,<br />
die dem höheren Dienst angehört.<br />
HIBB: Die Dienst- und Fachaufsicht über das HIBB ist beim Staatsrat angesiedelt. Im<br />
Übrigen siehe Antwort zu 36.<br />
VHS: In der BSB wird die Aufsicht über die VHS im Amt für Weiterbildung wahrgenommen.<br />
Dort ist eine Stelle des höheren Dienstes unter anderem mit dem Controlling<br />
der VHS betraut und besetzt.<br />
Landesbetrieb Hamburgische Münze: In der Finanzbehörde wird das Controlling neben<br />
weiteren Aufgaben auf einer Stelle des höheren Dienstes wahrgenommen, die<br />
besetzt ist.<br />
Kasse.Hamburg: In der Finanzbehörde wird das Controlling mit einem Stellenanteil<br />
von etwa 40 Prozent neben weiteren Aufgaben auf einer Stelle des gehobenen Dienstes<br />
wahrgenommen, die besetzt ist.<br />
Landwirtschaft in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand: In der Abteilung Personal<br />
und Betriebliche Steuerung des Strafvollzugsamts der Behörde für Justiz und Gleichstellung<br />
sind drei Mitarbeiter neben anderen Aufgaben mit dem Controlling des Landesbetriebs<br />
befasst. Dabei handelt es sich um zwei Stellen des höheren Dienstes und<br />
einer Stelle des gehobenen Dienstes.<br />
Philharmonisches Staatsorchester und Planetarium: Das Controlling der <strong>Landesbetriebe</strong><br />
ist Teil des Controllings aller Beteiligungen im Zuständigkeitsbereich der Kulturbehörde<br />
und wird vom Beteiligungsmanagement wahrgenommen. Von den 4,5 Stellen<br />
für den Gesamtbereich entfallen auf das Controlling der <strong>Landesbetriebe</strong> etwa 0,4 Stelle,<br />
je zur Hälfte zugehörig zum höheren Dienst und zum gehobenen Dienst. Die Stellen<br />
sind besetzt.<br />
Rathaus-Service: Die Globalsteuerung des Landesbetriebs Rathaus-Service wird<br />
durch die Beauftragte für den Haushalt der Senatskanzlei und ihren Vertreter mit einem<br />
Stellenanteil von 5 Prozent wahrgenommen. Eine Stelle ist im höheren und eine<br />
im gehobenen Dienst angesiedelt.<br />
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer: Das Controlling der Aufsicht führenden<br />
Behörde über den Landesbetrieb wurde bis zum 30. April 2011 in der BSU mit<br />
einem Anteil von 30 Prozent einer Stelle des gehobenen Dienstes im Referat Betriebswirtschaft<br />
wahrgenommen. Die Betreuung liegt seit dem 1. Mai 2011 bei der<br />
75
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
BWVI und wird nach Abschluss des entsprechenden Verfahrens mit den von der BSU<br />
übertragenen Ressourcen bearbeitet.<br />
LBV: In der Beteiligungsverwaltung der Behörde für Inneres und Sport, die das Controlling<br />
für alle unter der Fachaufsicht der BIS stehenden öffentlichen Unternehmen<br />
(neben dem LBV noch über das Statistikamt Nord Anstalt des öffentlichen Rechts)<br />
ausübt, steht eine Angestelltenstelle, die dem höheren Dienst vergleichbar ist, zur<br />
Verfügung, für deren Besetzung betriebswirtschaftliche Kenntnisse unabdingbare Voraussetzung<br />
ist.<br />
ZPD und ZAF: Eine Controllingeinheit, die sich ausschließlich mit der Steuerung des<br />
ZPD und des ZAF befasst, besteht im Personalamt nicht. Der Amtsleiter, die stellvertretende<br />
Amtsleiterin und die Beauftragte für den Haushalt, die alle dem höheren<br />
Dienst angehören, steuern die <strong>Landesbetriebe</strong> über ihre Mitgliedschaft im jeweiligen<br />
Aufsichtsgremium. Das für Finanzen und Controlling zuständige Referat des Personalamts<br />
bereitet diese Mitglieder für die jeweilige Sitzung vor.<br />
Landesbau: Das Controlling der netto-veranschlagten Einrichtung Landesbau wird im<br />
Amt für Bauordnung und Hochbau von zwei Personen, die beide dem höheren Dienst<br />
angehören, als Teilaufgabe im Rahmen ihrer darüber hinausgehenden Fachaufgaben<br />
wahrgenommen.<br />
Hochschulen: Überwiegend für Controllingaufgaben sind in der BWF neun Stellen<br />
eingerichtet, wovon für vier Stellen betriebswirtschaftliche Kenntnisse vorausgesetzt<br />
werden. Davon entfallen drei Stellen auf den gehobenen Dienst und eine Stelle auf<br />
den höheren Dienst. Eine qualifizierte Besetzung ist bei allen Stellen gegeben. Daneben<br />
werden in einer Reihe von weiteren Fachreferaten der Behörde jeweils im Rahmen<br />
der Tätigkeiten an mehreren Stellen auch anteilig Fragestellungen des Controllings<br />
wahrgenommen.<br />
76<br />
34. Wie sind die Controllingeinheiten der oben genannten <strong>Landesbetriebe</strong><br />
ausgestattet?<br />
35. Wie viele Stellen, die betriebswirtschaftliche Kenntnisse voraussetzen,<br />
sind in diesen Controllingeinheiten aktuell jeweils vorhanden und wie viele<br />
mit entsprechend qualifiziertem Personal besetzt? Bitte bei den Voraussetzungen<br />
und Besetzungen jeweils nach höherem und gehobenem<br />
Dienst unterscheiden.<br />
LEB: Für das Controlling im LEB sind der Leiter der Abteilung „Betriebswirtschaft und<br />
Finanzen“ (höherer Dienst) und ein Mitarbeiter (gehobener Dienst) mit Stellenanteilen<br />
zuständig.<br />
LGV: Die Controllingeinheit des LGV besteht aus einer Stelle des gehobenen Dienstes,<br />
die besetzt ist.<br />
Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen: Das Sachgebiet „Finanzen und Controlling“<br />
des Landesbetriebs Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen besteht aus vier Stellen<br />
(drei Stellen des mittleren und eine des gehobenen Dienstes), die alle besetzt sind.<br />
HIBB: Für das Controlling sind im HIBB anteilig zwei Mitarbeiter des höheren Dienstes<br />
in der „Stabsstelle Strategisches Controlling“ (davon setzt eine halbe Stelle betriebswirtschaftliche<br />
Kenntnisse voraus) und anteilig drei Mitarbeiter in der Personal- und<br />
Serviceabteilung (davon setzen eine 0,1-Stelle des höheren Dienstes und eine halbe<br />
Stelle des gehobenen Dienstes betriebswirtschaftliche Kenntnisse voraus) zuständig.<br />
VHS: Im Controllingteam der VHS setzen eine halbe Stelle des höheren Dienstes und<br />
1,5 Stellen des gehobenen Dienstes betriebswirtschaftliche Kenntnisse voraus. Diese<br />
Stellen sind besetzt.<br />
Landesbetrieb Hamburgische Münze: Das Controlling wird neben weiteren Aufgaben<br />
auf einer Stelle des gehobenen Dienstes wahrgenommen, die besetzt ist. Darüber<br />
hinaus sind Controllingaufgaben einer Stelle des höheren Dienstes zugeordnet, die<br />
zurzeit nicht besetzt ist.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
Landwirtschaft in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand: Der Leiter der kaufmännischen<br />
Abteilung der JVA Hahnhöfersand (gehobener Dienst) ist in geringem Umfang<br />
mit Controllingaufgaben befasst.<br />
Philharmonisches Staatsorchester: Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit der<br />
Hamburgischen Staatsoper GmbH wird der Geschäftsführende Direktor des Landesbetriebs<br />
Philharmonisches Staatsorchester durch den Controller der Staatsoper unterstützt.<br />
Voraussetzungen und Besetzung der Controllerstelle der Staatsoper entsprechen<br />
den Anforderungen des höheren Dienstes.<br />
Planetarium: Das Controlling für den Landesbetrieb Planetarium wird von der Verwaltungsleitung<br />
(gehobener Dienst) neben anderen Aufgaben in Zusammenarbeit mit<br />
einem externen Dienstleister wahrgenommen. Der Dienstleister führt mit dem IT-System<br />
SAP/R3 die Buchhaltung. Er erstellt entsprechend der Vorgaben der Verwaltungsleitung<br />
monatliche Berichte.<br />
Rathaus-Service: Der Bereich Rechnungswesen/Controlling des Rathaus-Services ist<br />
mit einer 0,77-Stelle im gehobenen Dienst ausgestattet, die besetzt ist. Daneben<br />
nimmt die Geschäftsführung (höherer Dienst) anteilig Aufgaben des Controllings wahr.<br />
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer: Dem Fachbereich Controlling des<br />
LSBG waren am 31. Mai 2011 insgesamt 14 Beschäftigte zugeordnet, von denen<br />
einer zum 1. Juni 2011 in eine andere Tätigkeit wechselte. Diese sind wie folgt eingesetzt:<br />
- Leitung Controlling und Sachgebiet Wirtschaftsplan: Vier Beschäftigte, davon<br />
einer im höheren Dienst und drei im gehobenen Dienst.<br />
- Sachgebiet Kontraktmanagement: Drei Beschäftigte, davon zwei im gehobenen<br />
Dienst und einer im mittleren Dienst. Alle sind für ihr jeweiliges Aufgabengebiet<br />
betriebswirtschaftlich ausreichend qualifiziert. Das ingenieurtechnische Know-how<br />
steht im Vordergrund.<br />
- Sachgebiet Projektcontrolling: Sechs Beschäftigte, davon einer im höheren<br />
Dienst, drei im gehobenen Dienst und zwei im mittleren Dienst. Die Mitarbeiter<br />
sind betriebswirtschaftlich ausreichend qualifiziert.<br />
LBV: Das Controlling des LBV besteht aus insgesamt 1,5 Stellen des gehobenen<br />
Dienstes inklusive des Stellenanteils der zugehörigen Abteilungsleitung. Die Stellen<br />
sind besetzt.<br />
ZPD: Im ZPD besteht im Geschäftsbereich „Planung und Steuerung“ der Fachbereich<br />
„Globalsteuerung und Unternehmensplanung“ mit zwei Stellen (je eine Stelle gehobener/höherer<br />
Dienst), zu dessen Aufgaben unter anderem das strategische Controlling<br />
gehört. Ein Finanzcontrolling wird im Rahmen des Projekts KLR aufgebaut und ist<br />
gegenwärtig mit zwei Stellen der Laufbahngruppe 2 (je eine davon mit Zugang zum<br />
ersten beziehungsweise zweiten Einstiegsamt) ausgestattet. Alle Stellen sind besetzt.<br />
36. Auf welcher Grundlage wird das Controlling der oben genannten <strong>Landesbetriebe</strong><br />
jeweils durchgeführt (Kosten- und Leistungsrechnung et cetera)?<br />
LEB: Das Controlling im LEB wird auf Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung<br />
durchgeführt. Der monatlich erstellte Controllingbericht beinhaltet eine Kosten- und<br />
Leistungsübersicht einschließlich einer Darstellung der Kostendeckung, einen Budgetbericht<br />
und eine interne Benchmarkingübersicht über maßgebliche Kosten- und Leistungsfaktoren.<br />
Darüber hinaus werden bei Bedarf Einzelanalysen durchgeführt.<br />
LGV: Das im Rahmen des operativen Controllings aufgebaute Berichtswesen basiert<br />
auf Daten der Kosten- und Leistungsrechnung (Vollkostenrechnung). Die Budgetkontrolle<br />
erfolgt über das Haushaltsmanagement im SAP-System des LGV. Basis des<br />
strategischen Controllings ist die Entwicklung der Zielvereinbarungen.<br />
Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen: Das Controlling erfolgt auf der Basis einer<br />
Kosten- und Leistungsrechnung.<br />
77
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode<br />
HIBB: Das strategische Controlling des HIBB basiert auf prozessorientierten Produktkennzahlensystemen,<br />
die im Rahmen von Ziel- und Leistungsvereinbarungen vorgegeben<br />
und gesteuert werden. Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen beziehen sich<br />
sowohl auf die Beziehungen zwischen der BSB und dem HIBB als auch auf die Beziehungen<br />
zwischen der HIBB-Zentrale und den einzelnen staatlichen berufsbildenden<br />
Schulen des HIBB. Das HIBB ist zudem dem Kuratorium gegenüber berichtspflichtig.<br />
Das operative Controlling basiert auf einer SAP gestützten Kosten- und Leistungsrechnung<br />
(KLR), die sich noch im Aufbau befindet. Die KLR ist direkt mit dem externen<br />
Finanz- und Rechnungswesen über die SAP-Software verbunden. Es wird angestrebt,<br />
die KLR im Rahmen einer Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung abzubilden.<br />
VHS: Das strategische Controlling der VHS erfolgt im Rahmen der jährlich mit der<br />
BSB vereinbarten Ziel- und Leistungsvereinbarung und nach den betrieblichen Erfordernissen.<br />
In der Ziel- und Leistungsvereinbarung werden die Angebotssegmente beschrieben,<br />
kundenbezogene, wirtschaftsbezogene, institutionenbezogene und mitarbeiterbezogene<br />
Ziele definiert und die Form des Berichtswesens festgelegt. Die jeweiligen Bereiche<br />
werden mit Kennzahlen hinterlegt. In der VHS gibt es Finanzbuchhaltung, Kosten-<br />
und Leistungsrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Soll-Ist-Vergleich, Forecast-<br />
Rechnung und eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung.<br />
Hamburgische Münze: In der zuständigen Behörde wird das Controlling auf der Basis<br />
von Quartalsberichten aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie durch Gespräche<br />
mit der Geschäftsführung wahrgenommen.<br />
Landwirtschaft in der JVA Hahnöfersand: Das Controlling erfolgte auf der Basis einer<br />
Kosten- und Leistungsrechnung. Das Berichtswesen wurde über ein Finanz- und Anlagenbuchhaltungssystem<br />
ergänzt.<br />
Philharmonisches Staatsorchester und Planetarium: Die <strong>Landesbetriebe</strong> der Kulturbehörde<br />
legen eine Wirtschaftsplanung vor. Sie erfassen ihre Kosten und Erlöse in einem<br />
geordneten Rechnungswesen, auf dessen Basis unterjährig in Monats- oder<br />
Quartalsberichten ein Soll-Ist-Vergleich der Wirtschaftsplanung mit der tatsächlichen<br />
geschäftlichen Entwicklung erfolgt.<br />
Rathaus-Service: Das Controlling erfolgt auf der Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung.<br />
Im Rahmen des Controllings wird auch festgestellt, ob die gesetzten Qualitätsziele<br />
erreicht werden (Qualitätsmanagement). Außerdem werden die eigenen Leistungen<br />
mit vergleichbaren Leistungen Dritter verglichen (Marktbeobachtung, Benchmarking).<br />
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer: Der LSBG hat mit seiner Gründung<br />
ein umfangreiches, inzwischen auch optimiertes innerbetriebliches Rechnungswesen<br />
unter Nutzung der SAP-Module CO und PS eingeführt. Mit diesem internen Rechnungswesen<br />
wird nicht nur das Projektcontrolling für investive Projekte oder betriebliche<br />
Aufgaben unterstützt, sondern auch das inzwischen regelhaft installierte externe<br />
Berichtswesen, beispielsweise in Form von<br />
- Quartalsberichten gegenüber dem Verwaltungsrat und der Aufsicht führenden<br />
Behörde, die auch Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis enthalten,<br />
- Monatsberichte, die die Geschäftsführung und die Geschäftsbereichsleiter als<br />
Profitcenterleiter über den bisherigen Unternehmensverlauf auch im Hinblick auf<br />
Prognosen informieren,<br />
- Kostenstellen-, Kontrakt- und Projektberichte.<br />
Darüber hinaus bildet das innerbetriebliche Rechnungswesen die Grundlage für die<br />
Bewertung der fertigen und unfertigen Projekte im Jahresabschluss, die der Prüfung<br />
durch die Vorprüfstelle der Finanzbehörde, die den Jahresabschluss prüft, unterliegen<br />
– und wird zunehmend für Benchmarking-Vergleiche mit anderen Betrieben und Unternehmen<br />
verwendet. Verschiedene Datenbanken und eine Projektsteuerungssoftware<br />
werden zusätzlich vorgehalten, um die Führungskräfte im LSBG über die Projekt-<br />
oder Bearbeitungsverläufe zu informieren.<br />
78
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737<br />
LBV: Das Controlling wird auf Basis des kaufmännischen Rechnungswesens und<br />
einer Kosten- und Leistungsrechnung erstellt. Zum Einsatz kommt ein Berichtswesen,<br />
aufbauend auf monatlichen Finanz- und Geschäftszahlen mit der Zuordnung für den<br />
gesamten LBV und auch für einzelne Abteilungen und Standorte.<br />
ZPD: Bis zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt das interne<br />
Finanz-Controlling auf Basis der SAP-gestützten Finanzbuchhaltung und der Verwaltungskostenabrechnung<br />
sowie des monatlichen Personalkosten-Controllings mit Prognose<br />
der Personalausgaben unter Einsatz der Software Cognos Enterprise Planning<br />
mit Abweichungsanalyse und Ableitung entsprechender Steuerungsmaßnahmen.<br />
37. Inwieweit verfügen die Geschäftsführer/-innen der in dieser Anfrage abgefragten<br />
<strong>Landesbetriebe</strong> beziehungsweise deren Vertreter/-innen über<br />
a. eine kaufmännische Ausbildung oder<br />
b. einen wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschluss (gegebenenfalls<br />
als Anteil an allen Geschäftsführern/-innen angeben) und<br />
c. um welche <strong>Landesbetriebe</strong> handelt es sich jeweils? (Bitte als Tabelle<br />
darstellen.)<br />
Landesbetrieb Kaufmännische Wirtschaftswissenschaftlicher<br />
Ausbildung<br />
Studienabschluss<br />
LEB 0 0<br />
LGV 0 0<br />
Großmarkt Obst, Gemüse<br />
und Blumen<br />
0 0<br />
HIBB 1 0<br />
VHS 0 1<br />
Hamburgische Münze 0 1<br />
Landwirtschaft in der JVA<br />
Hahnöfersand<br />
0 0<br />
Philharmonisches Staatsorchester<br />
1 0<br />
Planetarium 0 1<br />
Rathaus-Service 0 1<br />
Landesbetrieb Straßen,<br />
Brücken und Gewässer<br />
0 0<br />
LBV 0 0<br />
ZPD 0 0<br />
Bei der Ausschreibung beziehungsweise der Besetzung der entsprechenden Stellen<br />
durch die zuständige Behörde wird im Übrigen davon ausgegangen, dass betriebswirtschaftliche<br />
Kenntnisse und kaufmännisches Fachwissen auch auf andere Weise<br />
erworben werden können als durch eine Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches<br />
Studium, die im Einzelfall mehrere Jahrzehnte zurückliegen.<br />
79
80<br />
Anlage 1<br />
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
81<br />
Stellenbestand des <strong>Landesbetriebe</strong>s Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen (jeweils zum 31.12.)<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Beamtenstellen<br />
A 15 - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
A 14 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - -<br />
A 13 h - - - - - - - - - - -<br />
A 13 g - - - - - - 1,0 1,0 - - -<br />
A 12 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
A 11 - - - - - - - - - 1,0 1,0<br />
A 10 - 1,0 - - - 2,0 2,0 1,5 1,0 - -<br />
A 9 g D 1,0 - 1,0 1,0 2,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
A 9 m D 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0<br />
A 8 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
A 7 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - -<br />
A 6 - - - - - - - - - - -<br />
A 5 - - - - - - - - - - -<br />
Summe 10,0 9,0 9,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,5 8,0 7,0 7,0<br />
Angestelltenstellen<br />
(Tarifbeschäftigte)<br />
E 15 (VergGr. I) - - - - - - - - - -<br />
E 14 (VergGr. Ib) - - - - - - - - - - -<br />
E 13 (VergGr. IIa) - - - - - - - - - - -<br />
E 12 (VergGr. III) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0<br />
E 11 (VergGr. IVa) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 - - -<br />
E 10 (VergGr. IVb) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0<br />
E 9 (VergGr. Vb) 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0<br />
E 8 (VergGr. Vc) 5,0 6,0 6,0 4,0 4,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0<br />
E 7 (Lohngr. 6) - - - - - - - - - - -<br />
E 6 (VergGr. VIb) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 8,0 5,0 5,0 5,0<br />
E 5 (VergGr. VII)<br />
E 4 (Lohngr. 3 und<br />
17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 14,0 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0<br />
4) - - - - - - - 5,0 4,0 4,0 4,0<br />
E 3 (VergGr. VIII) 14,0 14,0 14,0 - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Summe 47,0 48,0 48,0 34,0 34,0 33,0 <strong>26</strong>,0 39,0 34,0 34,0 35,0<br />
Anlage 2<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737
82<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Arbeiterstellen<br />
(Tarifbeschäftigte)<br />
E 7 (Lohngr. 6) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - - -<br />
E 6 (Lohngr. 5) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - - -<br />
E 5 (Lohngr. 4) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 - - - -<br />
E 4 (Lohngr. 3) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 - - - -<br />
E 3 (Lohngr. 2) - - - - - - - - - - -<br />
Summe 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 - - - -<br />
Gesamtdarstellung<br />
Beamte 10,0 9,0 9,0 8,0 7,0 8,0 9,0 8,5 8,0 7,0 7,0<br />
Angestellte 47,0 48,0 48,0 34,0 34,0 33,0 <strong>26</strong>,0 - - - -<br />
Arbeiter 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 - - -<br />
Tarifbeschäftigte - - - - - - - 39,0 34,0 34,0 35,0<br />
Summe 72,0 72,0 72,0 57,0 56,0 56,0 48,0 47,5 42,0 41,0 42,0<br />
Nach Inkrafttreten des TV-L im Jahre 2006 erfolgt keine gesonderte Ausweisung von Angestellten und Arbeitern mehr.<br />
Stand jeweils 31.12.<br />
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode
83<br />
Sanierungsmaßnahmen des <strong>Landesbetriebe</strong>s Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen aus Druchsache 19/1442, Tabellen 1 und 3<br />
Sanierungsmaßnahmen Plankosten für sofortigen<br />
Handlungsbedarf 2008<br />
Plankosten für<br />
mittelfristigen<br />
Handlungsbedarf<br />
2009 - 2015<br />
Status Istkosten<br />
Euro Euro Euro<br />
(I Nr. 3 q.) (I Nr. 3 r.)<br />
Zusätzliche Dacheinläufe 1.400.000 800.000 abgeschlossen 983.000<br />
Flächenheizung Dachmulde wegen Schneelasten 220.000 abgeschlossen 118.000<br />
Betonsanierung Hallendecke GM-Halle 2.090.000 4.130.000 abgeschlossen 4.251.000<br />
Großmarkthalle Betonsanierung der Stahlbetonstützen<br />
470.000 abgeschlossen *) 1.122.000<br />
Großmarkthalle Betonsanierung der Stahlbetonaußenteile<br />
Stahlbogen und Zwischenbinder<br />
295.000 abgeschlossen<br />
Großmarkthalle Betonsanierung der Außenbauteile<br />
des südlichen Büroanbaus<br />
285.000 abgeschlossen<br />
Großmarkthalle Betonsanierung Treppen, Lauf-<br />
120.000 abgeschlossen<br />
stege, Stützfüße<br />
Sanierung der Brandschutzklappen 120.000 **)<br />
Sanierung Hauptabflussleitungen 510.000 erfolgt ab 2011<br />
Erneuerung von zwei Lastenaufzügen 460.000 In Vorbereitung<br />
Sanierung nördliche Fassade Halle West II 480.000 erfolgt ab 2011<br />
Großmarkthalle Verfugung Außenfassade 420.000 abgeschlossen 207.601,60<br />
Lüftertürme 2.345.000 erfolgt ab 2012<br />
Bürogebäude Ost Fassadensanierung 600.000 erfolgt ab 2012<br />
Bürogebäude Ost Dachsanierung 190.000 erfolgt ab 2012<br />
Spannstähle der Laufstegaufhängungen 665.000 erfolgt in 2013<br />
*) Die Baumaßnahmen zur Sanierung der Stahlbetonaußenteile Stahlbogen + Zwischenbinder, Außenbauteile des südlichen Büroanbaus, Treppen, Laufstege<br />
und Stützfüße haben ineinander gegriffen, wodurch Synergien entstanden (z.B. bei den Gerüsten). Daher ist eine Aufteilung der Ist-Kosten auf die einzelnen<br />
Maßnahmen nicht möglich.<br />
**) Erfolgt im Rahmen eines neuen Brandschutzkonzepts zeitverzögert in 2011/2012<br />
Anlage 3<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/737
84<br />
Stellen-<br />
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.<br />
bestand<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Planstellen<br />
A 15 bis 2006<br />
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
Stellen für<br />
A 16 ab 2007* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
Tarifbeschäftigte<br />
85,45 86,45 86,45 62,50 63,28 63,28 56,56 55,56 55,56 55,56 55,56<br />
E 15 TV-L 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
E 13 TV-L 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
E 11 TV-L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
E 9 TV-L 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,78 4,78 4,78 4,78<br />
E 8 TV-L 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,78 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
E 7 TV-L 4,50 4,50 4,50 4,50 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
E 6 TV-L 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
E 5 TV-L 1,00 1,00 1,00 0,00 2,78 2,78 2,78 6,78 6,78 6,78 6,78<br />
VIII BAT 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
E 4 TV-L 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
E 3 TV-L 14,00 14,00 14,00 14,00<br />
E 2ü TV-L 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Lohngr. 9 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
Lohngr. 8 16,00 16,00 16,00 11,00 11,00 11,00 10,00<br />
Lohngr. 7 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 4,00<br />
Lohngr. 6 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00<br />
Lohngr. 5 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
Lohngr. 4 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
Lohngr. 3 32,00 33,00 33,00 22,00 21,00 21,00 15,00<br />
Lohngr. 2 1,19 1,19 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Lohngr. 1 1,76 1,76 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Gesamt 86,45 87,45 87,45 63,50 64,28 64,28 57,56 56,56 56,56 56,56 56,56<br />
* Die A16 Stelle kam aus der Wirtschaftsbehörde und wurde gegen die A15 Stelle getauscht.<br />
Anlage 4<br />
Drucksache 20/737 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode