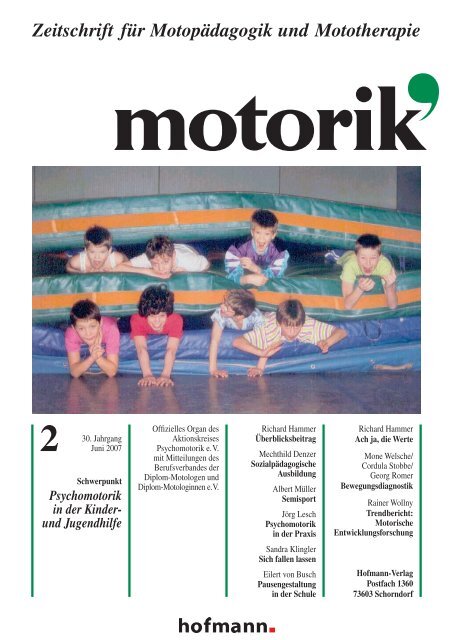Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie - motorik.de
Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie - motorik.de
Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie - motorik.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Motopädagogik</strong> <strong>und</strong> <strong>Mototherapie</strong><br />
2<br />
30. Jahrgang<br />
Juni 2007<br />
Schwerpunkt<br />
Psycho<strong>motorik</strong><br />
in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
Offizielles Organ <strong>de</strong>s<br />
Aktionskreises<br />
Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
mit Mitteilungen <strong>de</strong>s<br />
Berufsverban<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r<br />
Diplom-Motologen <strong>und</strong><br />
Diplom-Motologinnen e. V.<br />
Richard Hammer<br />
Überblicksbeitrag<br />
Mechthild Denzer<br />
Sozialpädagogische<br />
Ausbildung<br />
Albert Müller<br />
Semisport<br />
Jörg Lesch<br />
Psycho<strong>motorik</strong><br />
in <strong>de</strong>r Praxis<br />
Sandra Klingler<br />
Sich fallen lassen<br />
Eilert von Busch<br />
Pausengestaltung<br />
in <strong>de</strong>r Schule<br />
Richard Hammer<br />
Ach ja, die Werte<br />
Mone Welsche/<br />
Cordula Stobbe/<br />
Georg Romer<br />
Bewegungsdiagnostik<br />
Rainer Wollny<br />
Trendbericht:<br />
Motorische<br />
Entwicklungsforschung<br />
Hofmann-Verlag<br />
Postfach 1360<br />
73603 Schorndorf
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Motopädagogik</strong> <strong>und</strong> <strong>Mototherapie</strong><br />
Offizielles Organ <strong>de</strong>s Aktionskreises<br />
Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
mit Mitteilungen <strong>de</strong>s Berufsverban<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r<br />
Dipl.-Motologen/innen e. V.<br />
Herausgeber:<br />
Aktionskreis Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
Geschäftsstelle: Kleiner Schratweg 32<br />
32657 Lemgo<br />
Tel. (0 52 61) 97 09 70, Fax (0 52 61) 97 09 72<br />
Geschäftsführen<strong>de</strong>r Redakteur:<br />
Prof. Dr. phil. Klaus Fischer<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Motologin Dorothee Beckmann-Neuhaus<br />
Wiss. Mitarb. Melanie Behrens<br />
Prof. Dr. phil. Ruth Haas<br />
Dipl.-Motologe Dr. Richard Hammer<br />
Dipl.-Motologe Holger Jessel<br />
Prof. Dr. phil. Heinz Mechling<br />
Prof. Dr. phil. Renate Zimmer<br />
Anschrift <strong>de</strong>r Redaktion:<br />
Prof. Dr. Klaus Fischer<br />
Haselhecke 50, 35041 Marburg<br />
Tel. (0 64 21) 2 33 32 (p), Tel. (02 21) 4 70 46 73 (d)<br />
Fax (0 64 21) 2 56 92 (p), Fax (02 21) 4 70 50 85 (d)<br />
E-Mail: Klaus.Fischer@uni-koeln.<strong>de</strong><br />
Erscheinungsweise: Vierteljährlich<br />
Bezugsbedingungen:<br />
Jahresabonnement (4 Ausgaben) e 39,60;<br />
Vorzugspreis <strong>für</strong> Studieren<strong>de</strong> e 36,–;<br />
Einzelheft e 11,– (jeweils zuzügl. Versandkosten).<br />
Für die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aktionskreises ist <strong>de</strong>r<br />
Bezugspreis <strong>de</strong>r <strong>Zeitschrift</strong> im Mitgliedsbeitrag<br />
enthalten.<br />
Die Abonnement-Rechnung ist sofort zahlbar<br />
rein netto nach Erhalt. Der Abonnement-Vertrag<br />
ist auf unbestimmte Zeit geschlossen, falls nicht<br />
ausdrücklich an<strong>de</strong>rs vereinbart.<br />
Abbestellungen sind nur zum Jahresen<strong>de</strong> möglich<br />
<strong>und</strong> müssen spätestens 3 Monate vor <strong>de</strong>m<br />
31. Dezember beim Verlag eintreffen. Unregel-<br />
mäßigkeiten in <strong>de</strong>r Belieferung bitte umgehend<br />
<strong>de</strong>m Verlag anzeigen.<br />
Der Versand <strong>und</strong> die Abonnement-Bearbeitung<br />
erfolgen über EDV. Für diesen Zweck sind die<br />
da<strong>für</strong> notwendigen Daten gespeichert.<br />
Die Post sen<strong>de</strong>t <strong>Zeitschrift</strong>en auch bei Vorliegen<br />
eines Nachsen<strong>de</strong>antrags nicht nach! Deshalb bei<br />
Umzug bitte Nachricht an <strong>de</strong>n Verlag mit alter <strong>und</strong><br />
neuer Anschrift.<br />
Vertrieb:<br />
Anschrift siehe Verlag<br />
Telefon (0 71 81) 402-127<br />
Anzeigen:<br />
Anschrift siehe Verlag<br />
Telefon (0 71 81) 402-138, Fax (0 71 81) 402-130<br />
Kampka@hofmann-verlag.<strong>de</strong><br />
Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste vom<br />
Januar 2005<br />
Gesamtherstellung:<br />
Druckerei Hofmann<br />
Steinwasenstraße 6–8, D-73614 Schorndorf<br />
International Standard Serial Number:<br />
E 7518<br />
ISSN 0170-5792<br />
Copyright:<br />
© by Aktionskreis Psycho<strong>motorik</strong> e. V. Alle<br />
Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch in Über-<br />
setzungen, nur mit Genehmigung <strong>de</strong>r Redaktion.<br />
Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben<br />
nicht in je<strong>de</strong>m Falle die Meinung <strong>de</strong>r Redaktion<br />
wie<strong>de</strong>r. Die Redaktions behält sich vor, Leser-<br />
briefe gekürzt zu veröffentlichen <strong>und</strong> Manus-<br />
kripte redaktionell zu bearbeiten.<br />
Verlag:<br />
Hofmann GmbH & Co. KG<br />
Postfach 1360, D-73603 Schorndorf<br />
Tel. (0 71 81) 402-0, Fax (0 71 81) 402-111<br />
E-Mail: info@hofmann-verlag.<strong>de</strong><br />
Inhalt<br />
editorial e 57<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport als bewährte Maßnahme<br />
in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe Richard Hammer e 58<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als gestalten<strong>de</strong>s Element in <strong>de</strong>r sozialpädagogischen<br />
Ausbildung Mechthild Denzer e 63<br />
Der „Semisport“ – ein Besispiel wirkungsvoller<br />
Theorie-Praxis-Vernetzung im überregionalen<br />
Beratungs- <strong>und</strong> Behandlungszentrum<br />
(ÜBBZ) Würzburg Albert Mülller e 71<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als bewegungsorientiertes Angebot<br />
einer Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung<br />
Jörg Lesch e 80<br />
Sich fallen lassen – ein Thema in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe!? Sandra Klingler e 84<br />
Herzlich Willkommen im Stefan Kuntz-Stadion –<br />
o<strong>de</strong>r: Pausengestaltung in einer Schule <strong>für</strong><br />
Erziehungshilfe Eilert von Busch e 88<br />
Ach ja, die Werte Richard Hammer e 90<br />
„Und wer sieht uns?“ – Bewegungsdiagnostik<br />
<strong>für</strong> Jugendliche Mone Welsche/<br />
Cordula Stobbe/Georg Romer e 94<br />
Traditionen <strong>und</strong> gegenwärtige Trends <strong>de</strong>r motorischen<br />
Entwicklungsforschung in Deutschland<br />
Rainer Wollny e 102<br />
Buchbesprechungen / Neuerscheinungen e 112<br />
<strong>Zeitschrift</strong>enspiegel e 114<br />
Veranstaltungen e 116<br />
moto.logisch – Neues aus <strong>de</strong>m BVDM e 118<br />
Summaries + Résumés e 120<br />
ak’tuell e 1–6<br />
Titelbild:<br />
Albert Müller, Würzburg<br />
Die <strong>Zeitschrift</strong> MOTORIK wird auf chlorfrei<br />
gebleichtem Papier gedruckt.<br />
Bei dieser chlorfreien Bleiche <strong>de</strong>s Zellstoffs<br />
entstehen keine chlorierten organischen Verbindungen,<br />
die die Abwässer belasten könnten.
Editorial<br />
„Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe“: Der Aktionskreis<br />
Psycho<strong>motorik</strong> lädt ein zu seiner<br />
Fachtagung am 15. September 2007 in<br />
Würzburg.<br />
Veranstaltet wird diese Fachtagung<br />
gemeinsam mit <strong>de</strong>m ÜBBZ, einem<br />
überregionalen Beratungs- <strong>und</strong><br />
Behandlungszentrum, das seit vielen<br />
Jahrzehnten das Medium <strong>de</strong>s „Spiel-<br />
Sports“ als wesentliche pädagogischtherapeutische<br />
Maßnahme in ihr<br />
Konzept festgeschrieben hat. In<br />
Kooperation steht diese Veranstaltung<br />
mit <strong>de</strong>r Kath. Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik<br />
in Saarbrücken, an <strong>de</strong>r diesem<br />
Aspekt zur Entwicklung von Bewegungsfreu<strong>de</strong><br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit <strong>für</strong> die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler aber auch<br />
als Schlüsselqualifikation <strong>für</strong> <strong>de</strong>ren<br />
berufliche Tätigkeit Rechnung getragen<br />
wird.<br />
Wir greifen damit ein wichtiges Thema<br />
auf, <strong>de</strong>nn es zeigt sich immer wie<strong>de</strong>r,<br />
dass bewegungsorientierte <strong>und</strong><br />
körperbezogene Maßnahmen, eingeb<strong>und</strong>en<br />
in das Spiel, ihre pädagogische<br />
<strong>und</strong> therapeutische Wirksamkeit<br />
entfalten – wenn sie eingeb<strong>und</strong>en sind<br />
in einen Alltag, <strong>de</strong>r diese Gr<strong>und</strong>i<strong>de</strong>en<br />
aufgreift <strong>und</strong> sie als Gr<strong>und</strong>lage einer<br />
Alltagsgestaltung zum Tragen kommen<br />
lässt. Dies gilt <strong>für</strong> unseren „alltäglichen<br />
Alltag“, dies gilt insbeson<strong>de</strong>re <strong>für</strong> das<br />
Arbeitsfeld <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe,<br />
da wir dort auf ein Klientel treffen, das<br />
über das Medium Körper <strong>und</strong> Bewegung<br />
eher zugänglich ist als über das Wort.<br />
Dass dies notwendig aber auch möglich<br />
ist, machen die folgen<strong>de</strong>n Beiträge<br />
<strong>de</strong>utlich.<br />
Dazu braucht es interessierte <strong>und</strong><br />
qualifizierte Erzieher/innen. Der Beitrag<br />
von Mechthild Denzer zur Ausbildung<br />
an einer Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik<br />
zeigt die Möglichkeiten auf, wie durch<br />
die entsprechen<strong>de</strong> Gestaltung dieser<br />
Ausbildung die Voraussetzungen da<strong>für</strong><br />
geschaffen wer<strong>de</strong>n können. Eine<br />
praktische Unterrichtsst<strong>und</strong>e zu diesem<br />
Thema wird von Paul-Georg Berthold<br />
geliefert.<br />
Albert Müller präzisiert <strong>und</strong> ver<strong>de</strong>utlicht<br />
dies an einem beson<strong>de</strong>ren Beispiel:<br />
angehen<strong>de</strong> Erzieher/innen haben die<br />
Möglichkeit unter professioneller<br />
Anleitung <strong>und</strong> Supervision Erfahrungen<br />
in einem psychomotorischen Arbeitsfeld<br />
zu machen – vielleicht um später die<br />
Arbeit <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>er besser<br />
verstehen <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren handlungsleiten<strong>de</strong><br />
Prinzipien in <strong>de</strong>n Gruppenalltag<br />
integrieren zu können?<br />
Jörg Lesch zeigt, wie die psychomotorische<br />
Entwicklungsbegleitung als<br />
therapeutische Maßnahme in <strong>de</strong>n<br />
gesamten Kontext einer Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendhilfeeinrichtung eingebettet<br />
wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Spannend liest sich <strong>de</strong>r Beitrag von<br />
Sandra Klingler die sehr differenziert<br />
schil<strong>de</strong>rt, welche Be<strong>de</strong>utung das Fallen,<br />
Loslassen <strong>und</strong> Aufgefangen wer<strong>de</strong>n <strong>für</strong><br />
die Entwicklung <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> somit<br />
auch <strong>für</strong> die konkrete Praxis in <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong> hat.<br />
Eilert von Busch macht eine an<strong>de</strong>re<br />
Facette bewegungsorientierten<br />
Arbeitens <strong>de</strong>utlich. Er schil<strong>de</strong>rt die<br />
Pausengestaltung in einer Schule <strong>für</strong><br />
Erziehungshilfe, wobei hier aufgezeigt<br />
wird, welche Erleichterung dieses<br />
Bewegungsangebot <strong>für</strong> die Schüler,<br />
aber auch <strong>für</strong> die Lehrer bieten kann –<br />
nicht nur Erleichterung son<strong>de</strong>rn auch<br />
eine Möglichkeit verschie<strong>de</strong>ner Aspekte<br />
<strong>de</strong>r Persönlichkeitsentwicklung.<br />
Ein weiteres Beispiel aus <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe bietet Richard<br />
Hammer, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Frage nachgeht, ob<br />
in <strong>de</strong>r psychomotorischen Praxis<br />
auch so etwas Abstraktes wie Werte<br />
vermittelt wird. Natürlich muss diese<br />
Frage bejaht wer<strong>de</strong>n, wie anhand <strong>de</strong>r<br />
Reflexion <strong>de</strong>s Arbeitsalltags eines<br />
Motologen gezeigt wird.<br />
Mone Welsche, Cordula Stobbe, <strong>und</strong><br />
Georg Romer beackern ein stark<br />
vernachlässigtes Feld: die Bewegungsdiagnostik<br />
<strong>für</strong> Jugendliche. Gibt es im<br />
Altersbereich <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r einige interessante<br />
Verfahren zur Motodiagnostik, so<br />
ist die Altersgruppe <strong>de</strong>r Jugendlichen<br />
motodiagnostisch gesehen eher ein<br />
Stiefkind. Hier wer<strong>de</strong>n einige Verfahren<br />
vorgestellt, welche <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Praktiker,<br />
<strong>de</strong>r mit Jugendlichen arbeitet sehr<br />
hilfreich sein kann. Umso mehr, da die<br />
Notwendigkeit einer Diagnostik<br />
zunehmend erkannt wird (vgl. Motorik<br />
2006/4).<br />
Der Beitrag von Rainer Wollny steht ein<br />
wenig neben <strong>de</strong>m inhaltlichen Schwerpunkt<br />
dieses Heftes, versteht sich<br />
jedoch als wichtige Ergänzung. Er zeigt<br />
in einem Überblicksartikel die Traditionen<br />
<strong>und</strong> gegenwärtige Trends <strong>de</strong>r<br />
motorischen Entwicklungsforschung in<br />
Deutschland auf <strong>und</strong> kann somit<br />
letztlich auch wie<strong>de</strong>r seine Rückwirkung<br />
auf die Psycho<strong>motorik</strong>er in <strong>de</strong>r<br />
Praxis haben.<br />
Richard Hammer<br />
57
58<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport als bewährte Maßnahme in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
Richard Hammer<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport als bewährte<br />
Maßnahme in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport haben eine lange Tradition in <strong>de</strong>r Heimerziehung.<br />
Dies zeigen einige Einblicke in die Arbeit von „Klassikern <strong>de</strong>r Heimerziehung“.<br />
Ein Überblick über die aktuelle Situation in Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtungen<br />
macht <strong>de</strong>utlich, dass dies auch heute noch gilt, dass – trotz positiver Ergebnisse<br />
aus Wirksamkeitsstudien – das Angebot bewegungsorientierter Maßnahmen<br />
allerdings auch (noch) keine Selbstverständlichkeit ist.<br />
Acht Jungen im Alter von etwa 10<br />
Jahren stürzen sich in die Turnhalle.<br />
Es ist die 4. Klasse einer Gr<strong>und</strong>schule<br />
mit so genannten „erziehungsschwierigen“<br />
Kin<strong>de</strong>rn. Wir treffen<br />
uns heute zu unserer ersten<br />
gemeinsamen „Sportst<strong>und</strong>e“. Ich<br />
stelle mich vor, will mit ihnen <strong>de</strong>n<br />
weiteren Verlauf <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e klären,<br />
also absprechen, was wir in <strong>de</strong>n<br />
nächsten 50 Minuten machen.<br />
Material, das Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>en<br />
in <strong>de</strong>r Regel so lebendig wer<strong>de</strong>n<br />
lassen, liegt noch nicht vor. Es ist<br />
<strong>de</strong>r Beginn <strong>de</strong>s Schuljahres <strong>und</strong> ich<br />
habe in dieser Einrichtung eben neu<br />
angefangen. Da die Kin<strong>de</strong>r miteinan<strong>de</strong>r<br />
spielen wollen, bleibt uns also<br />
die Wahl zwischen Fußball <strong>und</strong><br />
Hockey. Wir einigen uns, dass die<br />
St<strong>und</strong>e zu jeweils einer Hälfte mit<br />
einer dieser Aktivitäten ausgefüllt<br />
wer<strong>de</strong>n soll.<br />
Nach etwa einem 10-minütigen,<br />
sehr intensiven Fußballspiel beginnt<br />
die Stimmung in <strong>de</strong>r Gruppe zu<br />
eskalieren. Spannung war von<br />
Anfang an da: <strong>de</strong>r Verlust eines<br />
Balles o<strong>de</strong>r das Misslingen eines<br />
Torschusses erzeugt erhebliche<br />
Unruhe, Wutausbrüche sind nur<br />
knapp zu vermei<strong>de</strong>n. Als dann<br />
wie<strong>de</strong>r mal einem Kind <strong>de</strong>r Ball<br />
abgenommen wur<strong>de</strong> – verb<strong>und</strong>en<br />
mit einem Sturz -, war das Fass<br />
endgültig übergelaufen. Wutentbrannt<br />
stürzt es sich auf <strong>de</strong>n<br />
„Übeltäter“ <strong>und</strong> schlägt ihm brutal<br />
mit <strong>de</strong>r Faust ins Gesicht. Dieser<br />
heult empört auf <strong>und</strong> verlässt mit<br />
lautem Schimpfen die Turnhalle. Mit<br />
Mühe hole ich ihn zurück. Mit noch<br />
mehr Mühe gelingt es, wie<strong>de</strong>r einen<br />
Gesprächskreis zusammenzurufen.<br />
Wir sprechen das Geschehene durch<br />
<strong>und</strong> wollen es noch einmal gemeinsam<br />
versuchen.<br />
Diese St<strong>und</strong>en verliefen nicht immer so<br />
dramatisch, allerdings selten wie<br />
geplant. Und dies unterschei<strong>de</strong>t<br />
vermutlich in einem hohen Maße diese<br />
Bewegungsst<strong>und</strong>en von <strong>de</strong>nen einer<br />
Regelschule, in <strong>de</strong>nen es in erster Linie<br />
um die Erziehung zum Sport geht. Hier<br />
steht die Erziehung durch <strong>de</strong>n Sport im<br />
Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong>. Bewegungs- <strong>und</strong> Spielangebote<br />
sind Mittel zum Zweck, sie<br />
„dienen“ in erster Linie <strong>de</strong>m Aufbau von<br />
Selbstkompetenz <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Entwicklung<br />
von sozialen Kompetenzen. Nicht <strong>de</strong>r<br />
Große Sportler steht im Focus <strong>de</strong>r pädagogischen<br />
(<strong>und</strong> therapeutischen)<br />
Tätigkeit son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Versuch, diesen<br />
Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen ein gewisses<br />
Maß an Ichstärke <strong>und</strong> Selbstbewusstsein<br />
zu vermitteln, das ihnen – zum<br />
großen Teil wegen ihrer Herkunft –<br />
nicht in die Wiege gelegt wur<strong>de</strong>. Sie<br />
sollen ihre Stärken kennen lernen <strong>und</strong><br />
sie auch gemeinsam mit <strong>de</strong>n An<strong>de</strong>ren<br />
besser nutzen lernen. Als hervorragen<strong>de</strong>s<br />
Medium haben sich da<strong>für</strong><br />
bewegungsorientierte Angebote<br />
bewährt, wie ein kurzer Blick in die<br />
Geschichtsbücher zeigt.<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport haben eine<br />
lange Tradition in <strong>de</strong>r Heimerziehung.<br />
Dies liegt sicher zum einen daran, dass<br />
Bewegung <strong>und</strong> Spiel zu <strong>de</strong>n wesentlichen<br />
Elementen kindlicher Entwicklung<br />
gehören <strong>und</strong> dass auch Jugendliche<br />
die sportliche Bewegung als<br />
Medium <strong>de</strong>r Selbstentwicklung nutzen.<br />
Zum an<strong>de</strong>ren nutzten engagierte<br />
Heimerzieher ihre Vorlieben <strong>für</strong> <strong>de</strong>n<br />
Sport zum Aufbau von Beziehungen zu<br />
ihren Zöglingen, die sie <strong>für</strong> ihre<br />
erzieherische Arbeit verwen<strong>de</strong>n<br />
konnten.<br />
So galt Don Bosco (1815–1888), <strong>de</strong>r<br />
1856 <strong>de</strong>n Salesianeror<strong>de</strong>n grün<strong>de</strong>te <strong>und</strong><br />
sich zeit seines Lebens als Priester um<br />
arme <strong>und</strong> vernachlässigte Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendliche kümmerte, als „magister<br />
ludi“ von hohen Gna<strong>de</strong>n, <strong>für</strong> <strong>de</strong>n das<br />
Spiel immer ein Element zur eigenen<br />
Freu<strong>de</strong> war. „Durch seine Zauberkünste,<br />
seine Artistik <strong>und</strong> durch sein meisterhaftes<br />
Ballspiel“ (Pöggeler 1987, 9)<br />
faszinierte er „seine“ Jungen <strong>und</strong><br />
konnte sie so an sich bin<strong>de</strong>n <strong>und</strong> sie<br />
„aus einem Leben in Elend <strong>und</strong> Kriminalität<br />
in ein Leben <strong>de</strong>r Hoffnung <strong>und</strong><br />
Menschlichkeit hineinführen“ (ebd.). Zu<br />
diesem Zweck richtete Don Bosco in<br />
Turin 1841 sein erstes „Oratorium“, eine<br />
Art Jugendzentrum, ein, in <strong>de</strong>m neben<br />
Katechismusunterricht v. a. die Möglichkeit<br />
zum Spiel geboten wur<strong>de</strong>.<br />
Für Don Bosco war also die Ausübung<br />
von Spiel <strong>und</strong> Sport ein zentrales<br />
Element seiner erzieherischen Arbeit.<br />
Sie war ihm sogar so wichtig, dass er<br />
die Beteiligung seiner Jungen als<br />
Maßstab <strong>für</strong> eine gute Erziehung<br />
betrachtete: „Ich bin mir meiner Sache<br />
nur sicher, wenn ich die Jungen in <strong>de</strong>r<br />
Freizeit fröhlich laufen <strong>und</strong> springen<br />
sehe“ (Don Bosco z. n. Weinschenk<br />
1980,151).<br />
Auch <strong>für</strong> Father E. J. Flanagan (1886–<br />
1948), <strong>de</strong>r als Begrün<strong>de</strong>r von Boys Town<br />
auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ca. 15 km von<br />
Omaha (USA) entfernten Overloo-Farm<br />
in die Geschichte <strong>de</strong>r Sozialerziehung<br />
einging, waren Spiel <strong>und</strong> Arbeit die<br />
entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Hilfen um mit <strong>de</strong>n<br />
Problemen <strong>de</strong>s Lebens besser fertig zu<br />
wer<strong>de</strong>n. Flanagan weiß, dass die<br />
Erziehung <strong>und</strong> Bildung <strong>de</strong>r Heranwachsen<strong>de</strong>n<br />
nicht über <strong>de</strong>n Kopf geleistet<br />
wer<strong>de</strong>n kann. Die Herausfor<strong>de</strong>rungen in<br />
<strong>de</strong>r spielerischen <strong>und</strong> sportlichen<br />
Betätigung waren <strong>für</strong> ihn ein Bestand-
teil seiner Pädagogik, die dazu beitragen<br />
sollten, die großen Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />
wie es die Selbstverwaltung von<br />
Boys Town verlangte, zu bewältigen.<br />
Anton S. Makarenko (1888–1939)<br />
wur<strong>de</strong> 1920 mit <strong>de</strong>m Aufbau <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Leitung einer Arbeitskolonie <strong>für</strong> min<strong>de</strong>rjährige<br />
Rechtsbrecher beauftragt.<br />
Wenig später benannte er diese Kolonie<br />
nach seinem Vorbild, <strong>de</strong>m Schriftsteller<br />
Maksim Gorkij. Als zentrales Element<br />
<strong>de</strong>s pädagogischen Prozesses wertete<br />
Makarenko das Kollektiv als Lebens-,<br />
Arbeits- <strong>und</strong> Erziehungsgemeinschaft.<br />
Spiel <strong>und</strong> Sport waren bei dieser<br />
Kollektiverziehung zwar auch ein<br />
Bestandteil <strong>de</strong>r Beschäftigungsformen,<br />
an<strong>de</strong>rs als bei Don Bosco o<strong>de</strong>r Flanagan<br />
scheinen sie jedoch zugunsten <strong>de</strong>r<br />
Erziehung durch Arbeit eher eine<br />
zurückgesetzte Rolle zu spielen. So<br />
wer<strong>de</strong>n „Spiele, Froebelsche Beschäftigungen“<br />
nur an „Sonn- <strong>und</strong> Feiertagen<br />
sowie an arbeitsfreien Tagen“ durchgeführt,<br />
die „Körpererziehung“, „Militärische<br />
Gymnastik“ <strong>und</strong> „Ordnungsübungen“<br />
sind darüber hinaus<br />
Bestandteil <strong>de</strong>r Erziehung zur <strong>und</strong> durch<br />
die Arbeit (vgl. Makarenko 1988, 26 f).<br />
Sport, Spiel <strong>und</strong> Bewegung scheinen <strong>für</strong><br />
Makarenko also v. a. im Dienste <strong>de</strong>s<br />
Ausgleichs von <strong>de</strong>r harten Arbeit <strong>und</strong><br />
im Sinne <strong>de</strong>r Disziplinierung gestan<strong>de</strong>n<br />
zu haben.<br />
Für Bruno Bettelheim war <strong>de</strong>r Körper-<br />
<strong>und</strong> Bewegungsausdruck von Kin<strong>de</strong>rn<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen in seiner Einrichtung<br />
ein wichtiger Bestandteil seiner<br />
diagnostischen <strong>und</strong> therapeutischen<br />
Tätigkeit (vgl. dazu ausführlich:<br />
Hammer 2003). Basierend auf <strong>de</strong>r<br />
psychoanalytischen Theorie <strong>de</strong>s Ich,<br />
verstand er „die Entwicklung einer<br />
Körpervorstellung als Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die<br />
Ich-Bildung“ (Bettelheim 1971, 111). Er<br />
legte <strong>de</strong>shalb beson<strong>de</strong>ren Wert auf die<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Körperfunktionen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Bewegungsfähigkeit <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r,<br />
<strong>de</strong>nn ein schlecht funktionieren<strong>de</strong>r<br />
Körper hat in <strong>de</strong>r Regel ein schwaches<br />
Ich zur Folge <strong>und</strong> umgekehrt kann ein<br />
schwaches Ich „schlechte körperliche<br />
Koordination nach sich ziehen“(ebd.).<br />
Ein wesentliches Ziel seines therapeutischen<br />
Angebotes lag <strong>de</strong>shalb im<br />
Erwerb freier Beweglichkeit <strong>und</strong> Beherrschung<br />
<strong>de</strong>r Körperfunktionen <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen. Denn erst „sobald ein<br />
Kind die Fähigkeit erworben hat, sich<br />
frei zu bewegen <strong>und</strong> zu an<strong>de</strong>ren<br />
Menschen in Beziehung zu treten,<br />
pflegt es auch zum Spielen fähig zu<br />
sein“ (ebd., 203). Erst mit <strong>de</strong>r Fähigkeit<br />
zum Spielen eröffnen sich <strong>für</strong> das Kind<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n Jugendlichen weitere Entwicklungschancen.<br />
Neben dieser therapeutischen<br />
Funktion <strong>de</strong>s Sports, die hilft,<br />
die Vergangenheit aufzuarbeiten, sich<br />
mit <strong>de</strong>r Gegenwart auseinan<strong>de</strong>rzusetzen<br />
<strong>und</strong> sich auf die Zukunft vorzubereiten,<br />
bieten sich darüber hinaus<br />
vielfältige Gelegenheiten, soziale<br />
Beziehungen anzuknüpfen <strong>und</strong> die<br />
Fähigkeit zur Lösung sozialer Konflikte<br />
zu erwerben. Dies <strong>und</strong> die zunehmen<strong>de</strong><br />
Beherrschung neuer Fertigkeiten im<br />
Sport tragen wesentlich zur Steigerung<br />
<strong>de</strong>s Selbstvertrauens bei <strong>und</strong> können<br />
dadurch zu einer weiteren Stabilisierung<br />
<strong>de</strong>r Ich-Stärke führen. Damit fällt<br />
es <strong>de</strong>m Kind auch leichter, sich in <strong>de</strong>r<br />
Außenwelt zu bewegen <strong>und</strong> auch dort<br />
Freizeitgelegenheiten zu nutzen wie<br />
Schwimmen, Turnen o<strong>de</strong>r Eislaufen.<br />
Obwohl diese zunächst sehr mit Angst<br />
<strong>und</strong> Unsicherheit behaftet sind bieten<br />
sie <strong>de</strong>nnoch die Möglichkeit, zunehmen<strong>de</strong><br />
Sicherheit im Auftreten außerhalb<br />
<strong>de</strong>s Heimgelän<strong>de</strong>s zu erwerben<br />
(vgl. ebd., 274 f).<br />
Redl <strong>und</strong> Wineman, die in ihrem Buch<br />
„Kin<strong>de</strong>r die hassen“ (1984) ihre<br />
gemeinsame Arbeit mit erziehungsschwierigen<br />
Kin<strong>de</strong>rn im Pioneer House<br />
in Detroit beschreiben, orientieren sich<br />
wie Bettelheim an <strong>de</strong>r psychoanalytischen<br />
Ich-Theorie. Vom sportlichen<br />
Angebot erwarten sie sich eine Ich-<br />
Stärkung ihrer Jugendlichen, d. h. „ein<br />
allmähliches Nachlassen <strong>de</strong>r Triebbedürfnisse“<br />
(ebd. 232). Wesentliche<br />
Be<strong>de</strong>utung haben diese Aktivitäten, die,<br />
<strong>de</strong>r Ich-Schwäche <strong>de</strong>r Jugendlichen<br />
zufolge, sich auf motorischer Ebene<br />
abspielen müssen, sofortige Triebbefriedigung<br />
<strong>und</strong> rasche Zielerreichung<br />
gewährleisten müssen, v. a. in <strong>de</strong>r<br />
Anfangsphase <strong>de</strong>r Heimunterbringung.<br />
Auffallend war, dass die Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendlichen zu Beginn <strong>de</strong>r Heimaufnahme<br />
v. a. allem Aktivitäten bevorzugten,<br />
die wenig strukturiert waren<br />
<strong>und</strong> „die es <strong>de</strong>n Jungen ermöglichten,<br />
das zu erreichen, was als ,rasche<br />
Triebbefriedigung´ bezeichnet wor<strong>de</strong>n<br />
ist <strong>und</strong> was als solche einen hohen<br />
Ableitungswert <strong>für</strong> spannungsbestimmte<br />
Triebstrukturen hatte“ (ebd.<br />
237). Später gewannen eher ruhigere<br />
Spiele an Beliebtheit. Das Bedürfnis ,<br />
„sich <strong>de</strong>s unstrukturierten, stark mit<br />
Erregung gela<strong>de</strong>nen Typus <strong>de</strong>r Aktivität<br />
hinzugeben, (...) wur<strong>de</strong> anscheinend<br />
ersetzt durch eine größere Fähigkeit,<br />
aus <strong>de</strong>n ruhigen, psychologisch<br />
komplexeren Spielen wie Karten,<br />
Puzzles <strong>und</strong> Rätselspielen Befriedigung<br />
zu beziehen“ (ebd.).<br />
Sport, Spiel <strong>und</strong> Bewegung waren also<br />
auch in Redl´s Konzeption von zentraler<br />
Be<strong>de</strong>utung. Im körperlichen Ausdruck<br />
konnten Probleme von Vergangenheit<br />
<strong>und</strong> Gegenwart bearbeitet <strong>und</strong> wichtige<br />
Schritte <strong>für</strong> die zukünftige Entwicklung<br />
gemacht wer<strong>de</strong>n. Die Möglichkeiten zur<br />
Kontaktaufnahme mit Gleichaltrigen<br />
<strong>und</strong> Erwachsenen innerhalb <strong>und</strong><br />
außerhalb <strong>de</strong>s Heimes wur<strong>de</strong>n ebenso<br />
genutzt wie die Formen <strong>de</strong>r Selbstdarstellung,<br />
was bei<strong>de</strong>s in erheblichem<br />
Maße zur Steigerung <strong>de</strong>s Selbstwertgefühls<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Ich-Stärke beitragen.<br />
Dieser Blick in die Geschichte zeigt,<br />
dass Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport schon<br />
seit Jahrh<strong>und</strong>erten einen beson<strong>de</strong>ren<br />
Stellenwert <strong>für</strong> die Erziehung von<br />
„Problemkin<strong>de</strong>rn“ hat (vgl. dazu<br />
ausführlich Hammer 1995). Heute<br />
gewinnt diese Sichtweise in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe zunehmend an<br />
Be<strong>de</strong>utung. Auch dies ist nicht neu.<br />
Schon bei <strong>de</strong>r 9. B<strong>und</strong>estagung „Heim-<br />
<strong>und</strong> Heilerziehung“ 1964 in München<br />
wur<strong>de</strong>n „Leib <strong>und</strong> Leiblichkeit in <strong>de</strong>r<br />
Erziehung“ in <strong>de</strong>n Mittelpunkt <strong>de</strong>r<br />
Richard Hammer<br />
Dipl.-Motologe, Lehrer Sek II Sport<br />
<strong>und</strong> Physik, Ausbildung in Gestalttherapie<br />
<strong>und</strong> Systemische Paar- <strong>und</strong><br />
Familientherapie, Dozent <strong>de</strong>r akM,<br />
1. Vorsitzen<strong>de</strong>r AKP<br />
Anschrift <strong>de</strong>s Verfassers:<br />
Kath. Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik<br />
St.-Josef-Str. 11<br />
66115 Saarbrücken<br />
59
60<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport als bewährte Maßnahme in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
Veranstaltung gestellt (vgl. Flosdorf<br />
1964). Die Teilnahme von mehr als<br />
1200 Heimerziehern mag als Hinweis<br />
da<strong>für</strong> gelten, dass dies auch in <strong>de</strong>r<br />
Praxis <strong>de</strong>r Heimerziehung als zentrale<br />
Frage behan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>. Bei <strong>de</strong>r Tagung<br />
wur<strong>de</strong> aus theologischer, biologischer,<br />
pädagogischer <strong>und</strong> medizinischer Sicht<br />
„Leib <strong>und</strong> Leiblichkeit“ betrachtet. In<br />
vielen Arbeitsgemeinschaften wur<strong>de</strong>n<br />
Themen zur Be<strong>de</strong>utung von Bewegung,<br />
Spiel <strong>und</strong> Sport <strong>für</strong> die kindliche<br />
Entwicklung, <strong>für</strong> die Sexualität, Aspekte<br />
<strong>de</strong>r Schönheits- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitspflege<br />
im Heim etc. behan<strong>de</strong>lt. Beson<strong>de</strong>re<br />
Aufmerksamkeit erhielten die Beiträge<br />
von P. Flosdorf <strong>und</strong> H. Rie<strong>de</strong>r, die sich<br />
seit Anfang <strong>de</strong>r 60er Jahre als Heimleiter<br />
<strong>und</strong> Psychologe (Flosdorf) <strong>und</strong> als<br />
ehemaliger Leistungssportler <strong>und</strong> Sportwissenschaftler<br />
(Rie<strong>de</strong>r) <strong>de</strong>m Bereich<br />
von Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r<br />
Heimerziehung in beson<strong>de</strong>rer Weise<br />
verpflichtet sahen.<br />
In enger Kooperation entwickelten sie<br />
in <strong>de</strong>r „Psychotherapeutisch-Heilpädagogischen<br />
Station“ in Würzburg das<br />
Konzept eines „heilpädagogischen<br />
Spielsports“, bei <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r „Sport,<br />
insbeson<strong>de</strong>re Spielsport, in die Konzeption<br />
therapeutischer Heimerziehung“<br />
integriert wur<strong>de</strong> (Flosdorf/Rie<strong>de</strong>r 1990,<br />
39; Rie<strong>de</strong>r 2003). Ergänzt durch<br />
erlebnispädagogische Angebote wie<br />
Radfahren, Zeltlager <strong>und</strong> Nachtwan<strong>de</strong>rungen<br />
entstand im St. Josephs Haus in<br />
Würzburg unter Mitarbeit von Müller<br />
(1988) das Konzept eines heilpädagogischen<br />
Spielsports, <strong>de</strong>r „versucht,<br />
kompensatorische Rahmenbedingungen<br />
zu schaffen, die <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn, die <strong>für</strong> ihr<br />
Alter <strong>und</strong> <strong>für</strong> ihre Reifung nötigen<br />
psychomotorischen <strong>und</strong> psychosozialen<br />
Lernerfahrungen ermöglichten“<br />
(Flosdorf 1988, 227, Müller 2003,<br />
505 ff).<br />
Als weiteres gelungenes Beispiel,<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport zur Persönlichkeitsbildung<br />
im Rahmen <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe einzusetzen mag das<br />
St. Josephs Haus in Klein-Zimmern<br />
gelten. Hier wur<strong>de</strong>n Sportarten wie<br />
Schwimmen, Mannschaftsspiele,<br />
Kampfsportarten, beson<strong>de</strong>re Unternehmungen<br />
wie Radtouren, Gelän<strong>de</strong>spiele,<br />
Skifreizeiten, darüber hinaus noch<br />
Sportakrobatik <strong>und</strong> Trampolinspringen<br />
mit <strong>de</strong>r Absicht angeboten, die hohe<br />
Erlebnisintensität dieser Sportarten zu<br />
nutzen <strong>und</strong> sie <strong>für</strong> die Entwicklung von<br />
Ich-, Sach- <strong>und</strong> Sozialkompetenz, die<br />
drei Säulen menschlicher Handlungskompetenz,<br />
einzusetzen. Vor <strong>de</strong>m<br />
Hintergr<strong>und</strong> dieser Zielsetzung dürfen<br />
die Sportarten nicht im Sinne <strong>de</strong>r<br />
Vermittlung von Techniken o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Leistungsoptimierung angeboten<br />
wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn so, dass das Kind o<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r Jugendliche im sportlichen Tun<br />
seinen Körper, sich selbst, in Ruhe <strong>und</strong><br />
Bewegung erfährt <strong>und</strong> sich durch <strong>und</strong><br />
mit seinem Körper die materiale<br />
Umwelt aneignet <strong>und</strong> soziale Kontakte<br />
knüpfen kann. Im beson<strong>de</strong>ren Maße<br />
wur<strong>de</strong> im St. Josephs Haus die Sportakrobatik<br />
als „paradigmatisch-motopädagogisches<br />
Arbeitsfeld in <strong>de</strong>r<br />
Heimerziehung“ angeboten. Sie eignet<br />
sich im beson<strong>de</strong>ren Maße <strong>für</strong> <strong>de</strong>n<br />
Einsatz innerhalb <strong>de</strong>r Heimerziehung,<br />
weil sie „neben <strong>de</strong>r Schulung <strong>de</strong>r<br />
motorischen Gr<strong>und</strong>eigenschaften als<br />
beliebig kombinierbare Partner- <strong>und</strong><br />
Gruppenarbeit praktizierbar ist“ (Knab<br />
1983, 56; Knab 2003). Darüber hinaus<br />
kann hier in einem beson<strong>de</strong>ren Maße<br />
über <strong>de</strong>n Körper <strong>de</strong>r Kontakt nicht nur<br />
zum gleichaltrigen Jugendlichen,<br />
son<strong>de</strong>rn vor allem auch zum erwachsenen<br />
Erzieher o<strong>de</strong>r Sportlehrer aufgenommen<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Auch im Haus Carl Sonnenstein in<br />
Fritzlar (vgl. Joans o. J.) zählt die<br />
psychomotorische Entwicklungsbegleitung<br />
zum festen Bestandteil gruppenergänzen<strong>de</strong>r<br />
Maßnahmen. Hier wer<strong>de</strong>n in<br />
Einzel- <strong>und</strong> Gruppenför<strong>de</strong>rung, sowie<br />
als themenbezogene För<strong>de</strong>rangebote<br />
von einem Motologen bewegungsorientierte<br />
<strong>und</strong> körperbezogene Angebote<br />
gemacht, die <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn bei <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Stabilisierung ihrer<br />
Persönlichkeit helfen sollen. Über<br />
gezielte Angebote zur Wahrnehmung<br />
<strong>und</strong> Bewegung <strong>de</strong>s eigenen Körpers <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>r<br />
Umwelt wird ein wesentlicher Beitrag<br />
zur För<strong>de</strong>rung von Selbstbestimmung<br />
<strong>und</strong> Selbstständigkeit sowie <strong>de</strong>r<br />
Handlungskompetenz im sozialen<br />
Bereich geleistet. Die Gestaltung von<br />
Spielsituationen soll hierbei die Kin<strong>de</strong>r<br />
anregen, sich aktiv han<strong>de</strong>lnd seine<br />
Umwelt zu erschließen, um – ihren<br />
Interessen, Wünschen <strong>und</strong> Bedürfnissen<br />
gemäß – sinnvoll auf sie einwirken zu<br />
können.<br />
Im Pallotti-Haus in Neunkirchen (Saar)<br />
ist die „Psycho<strong>motorik</strong>“ – neben <strong>de</strong>m<br />
erzieherischen Alltag, <strong>de</strong>r systemischen<br />
Familientherapie, <strong>de</strong>r Erlebnispädagogik<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r religiösen Erziehung - eine <strong>de</strong>r<br />
tragen<strong>de</strong>n Säulen dieser Jugendhilfeeinrichtung.<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport<br />
spielen <strong>für</strong> die Freizeitaktivitäten eine<br />
wesentliche Rolle: die Kin<strong>de</strong>r können<br />
sich hier aus einem vielfältigen Angebot<br />
Aktivitäten aussuchen, die ihren<br />
augenblicklichen Neigungen <strong>und</strong><br />
Fähigkeiten entsprechen. Kanufahrten,<br />
Klettertouren, Wan<strong>de</strong>rungen o<strong>de</strong>r –<br />
abhängig von <strong>de</strong>r Saison – auch Ski-<br />
<strong>und</strong> Schlittschuhfahren o<strong>de</strong>r Segeltörns<br />
wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Regel gemeinsam von<br />
Gruppenerzieher/innen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n<br />
psychomotorischen Fachkräften <strong>de</strong>r<br />
Einrichtung durchgeführt. Ein regelmäßig<br />
stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Spielenachmittag mit<br />
Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsmöglichkeiten in<br />
<strong>de</strong>r Turnhalle fin<strong>de</strong>t bei <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn<br />
ebenso großen Anklang, wie <strong>de</strong>r –<br />
inzwischen selbstverwaltete – Clubraum,<br />
in <strong>de</strong>m sich die Jugendlichen<br />
treffen, um sich zu unterhalten <strong>und</strong> ihre<br />
Körper im Rhythmus von Techno- <strong>und</strong><br />
Heavy-Metall-Musik zu bewegen.<br />
Als beson<strong>de</strong>re Maßnahme <strong>de</strong>s „gruppenergänzen<strong>de</strong>n<br />
Dienstes“ wird die<br />
„psychomotorische Entwicklungsbegleitung“<br />
angeboten, die als bewegungsorientiertes<br />
<strong>und</strong> körperbezogenes Spiel<br />
gestaltet wird. Bewusst zur Verfügung<br />
gestellte Materialien regen zu unterschiedlichen<br />
Spielaktivitäten an <strong>und</strong><br />
können von <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn entsprechend<br />
ihrer aktuellen Interessen <strong>und</strong> Bedürfnisse<br />
genutzt wer<strong>de</strong>n. Unter diesen<br />
Voraussetzungen entwickelt sich<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>e ein<br />
Spiel, in <strong>de</strong>m die Kin<strong>de</strong>r – in Einzelsituationen<br />
o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Gruppe – ihre<br />
Probleme darstellen <strong>und</strong> bearbeiten<br />
können. Dabei folgt <strong>de</strong>r Erwachsene in<br />
einer weitgehend offenen Situation <strong>de</strong>n<br />
Impulsen <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> lässt somit die<br />
„heilen<strong>de</strong>n Kräfte im kindlichen Spiel“<br />
wirksam wer<strong>de</strong>n (vgl. dazu ausführlich<br />
Hammer 2001).<br />
Weitere gute Beispiele <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Einsatz<br />
von Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport als<br />
pädagogisches <strong>und</strong> therapeutisches<br />
Medium in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
fin<strong>de</strong>n sich in <strong>de</strong>m kürzlich erschienenen<br />
Buch von Dräbing (2006).<br />
Bewegungsorientierte Angebote wie<br />
Psycho<strong>motorik</strong>, Kletter-, Sprung- <strong>und</strong><br />
Schwinganfor<strong>de</strong>rungen, Schwimmen,<br />
kreative Körperarbeit, Tanz <strong>und</strong><br />
alternative Leichtathletik zeigen die<br />
Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten (vgl.
ebd. S. 349–441). Dies ist jedoch kein<br />
Gr<strong>und</strong> in zu große Euphorie auszubrechen.<br />
Mit einem kritischen Blick<br />
verweist Dräbing auf eine „Misere im<br />
Heimsport“ (ebd., S. 58 ff), welche sich<br />
als Folge <strong>de</strong>s KJHG in <strong>de</strong>r Praxis <strong>de</strong>r<br />
Heimerziehung entwickelt hat. Zum<br />
einen wur<strong>de</strong>n Sportlehrerstellen<br />
abgebaut, die notwendigen Fachkräfte<br />
<strong>für</strong> die Aufrechterhaltung <strong>de</strong>s Sportbetriebes<br />
wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Gruppendienst<br />
integriert. Zum an<strong>de</strong>ren führte die (im<br />
Prinzip richtige) Dezentralisierung <strong>de</strong>r<br />
Einrichtungen dazu, dass oft nicht mehr<br />
genügend Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche<br />
anwesend waren um gemeinsam<br />
Mannschaftssport zu treiben. Die<br />
Selbstverständlichkeit, sich in <strong>de</strong>r freien<br />
Zeit auf <strong>de</strong>m Sportplatz zu treffen fällt<br />
weg. Bewegungsaktivitäten müssen<br />
gezielt organisiert wer<strong>de</strong>n – <strong>und</strong> dazu<br />
fehlt häufig das Personal.<br />
Hoffnung macht aber, dass – nach<strong>de</strong>m<br />
in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeszene<br />
jahrelang nur über Strukturen <strong>und</strong><br />
Qualitätssicherung diskutiert wur<strong>de</strong> –<br />
anscheinend die unmittelbare Arbeit<br />
Ernst-Kiphard-Berufskolleg<br />
Fachschule <strong>für</strong> Motopädie<br />
Motorik.qxd 29.05.2007 14:23 Uhr Seite 1<br />
mit <strong>de</strong>m Kind <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Jugendlichen<br />
wie<strong>de</strong>r mehr Aufmerksamkeit bekommen:<br />
die <strong>Zeitschrift</strong> „unsere jugend“<br />
widmet ihre Ausgabe 2006/6 <strong>de</strong>m<br />
Schwerpunkt „Jugend <strong>und</strong> Sport“ <strong>und</strong><br />
das „Forum Erziehungshilfen“ (2007/1),<br />
herausgegeben von <strong>de</strong>r IGFH, stellt das<br />
Thema „Körperlichkeit“ in <strong>de</strong>n Mittelpunkt,<br />
womit die Be<strong>de</strong>utung von Körper<br />
<strong>und</strong> Bewegung in <strong>de</strong>r pädagogischen<br />
<strong>und</strong> therapeutischen Arbeit hervor<br />
gehoben wird. Unterstützt wird diese<br />
Hoffnung durch die Realität <strong>de</strong>s Alltags<br />
in <strong>de</strong>r Heimerziehung. In <strong>de</strong>n seit vielen<br />
Jahren vom Institut <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendhilfe (Mainz) unternommenen<br />
Evaluationsstudien erzieherischer Hilfen<br />
(EVAS) stellt sich heraus, dass knapp die<br />
Hälfte aller Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen in<br />
Heimen eine o<strong>de</strong>r mehrere bewegungspädagogische<br />
Interventionen in<br />
Anspruch nehmen. „In Tagesgruppen<br />
<strong>und</strong> Geschlossener Unterbringung<br />
überschreiten die Werte beträchtliche<br />
60%, in <strong>de</strong>r Heimerziehung liegen sie<br />
immer noch bei über 40%“ (Macsenaere<br />
2006, 198).<br />
Anne Söller<br />
Zeig, was Du kannst<br />
Die Behandlung von Säuglingen <strong>und</strong> Kin<strong>de</strong>rn nach <strong>de</strong>m<br />
Bobath-Konzept<br />
317 Seiten mit 387 Abb., kart., EUR 32,-<br />
ISBN 978-3-7905-0945-8<br />
Dieses Buch führt auf f<strong>und</strong>ierte <strong>und</strong> einfühlsame Weise in<br />
das ganzheitlich orientierte Bobath-Konzept ein. Dabei<br />
berücksichtigt es neueste Erkenntnisse über Lernprozesse<br />
<strong>und</strong> Regenerationsmöglichkeiten <strong>de</strong>s geschädigten Gehirns.<br />
Gera<strong>de</strong> im Umgang mit Babys <strong>und</strong> behin<strong>de</strong>rten Kin<strong>de</strong>rn hat<br />
sich das Bobath-Konzept in <strong>de</strong>r Praxis bestens bewährt. Es<br />
zeigt, wie Therapeuten <strong>und</strong> Eltern ihr Kind – auch wenn es<br />
behin<strong>de</strong>rt ist – mit Handling <strong>und</strong> vielfältigen Anregungen<br />
liebevoll dabei unterstützen können, seine Fähigkeiten voll<br />
zu entfalten. Eine Fülle praktischer Beispiele wird durch<br />
viele Fotos anschaulich.<br />
C O U P O N<br />
Die folgen<strong>de</strong>n Beiträge machen<br />
<strong>de</strong>utlich, dass es nicht nur notwendig<br />
ist im Arbeitsfeld <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendhilfe Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport<br />
anzubieten, son<strong>de</strong>rn auch möglich. Es<br />
braucht dazu interessierte <strong>und</strong> qualifizierte<br />
Erzieher/innen. Der Beitrag von<br />
Mechthild Denzer zur Ausbildung von<br />
Erzieher/innen an einer Fachschule <strong>für</strong><br />
Sozialpädagogik zeigt die Möglichkeiten<br />
auf, wie durch die entsprechen<strong>de</strong><br />
Gestaltung dieser Ausbildung die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen da<strong>für</strong> gelegt wer<strong>de</strong>n<br />
können.<br />
Albert Müller präzisiert <strong>und</strong> ver<strong>de</strong>utlicht<br />
dies an einem beson<strong>de</strong>ren Beispiel:<br />
angehen<strong>de</strong> Erzieher/innen haben die<br />
Möglichkeit unter professioneller<br />
Anleitung <strong>und</strong> Supervision Erfahrungen<br />
in einem psychomotorischen Arbeitsfeld<br />
zu machen – vielleicht um später die<br />
Arbeit <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>er besser<br />
verstehen <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren handlungsleiten<strong>de</strong><br />
Prinzipien in <strong>de</strong>n Gruppenalltag<br />
integrieren zu können.<br />
Jörg Lesch zeigt am Beispiel einer<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung,<br />
Dortm<strong>und</strong>er Berufskolleg <strong>für</strong> Gymnastik <strong>und</strong> Motopädie gGmbH<br />
Berufsweiterbildung – Motopädie<br />
Vollzeit – Teilzeit<br />
Staatl. anerkannte/r Motopä<strong>de</strong>/in<br />
Fachkraft <strong>für</strong> <strong>Motopädagogik</strong> <strong>und</strong> <strong>Mototherapie</strong><br />
auf psychomotorischer Basis<br />
Ernst-Kiphard-Berufskolleg<br />
Dortm<strong>und</strong>er Fachschule <strong>für</strong> Motopädie<br />
Beginn: August 2007<br />
Dauer: 1 Jahr Vollzeit; 2 Jahre Teilzeit<br />
Voraussetzung: Fachausbildung Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen;<br />
Sport- <strong>und</strong> Gymnastiklehrer; 1 Jahr Berufspraxis<br />
Weiterqualifizierung – Motopädie<br />
Kurse – Seminare – Workshops<br />
Fortbildungsangebote<br />
<strong>für</strong> Berufsgruppen <strong>de</strong>r Sozial- <strong>und</strong> Heilpädagogik,<br />
Sprach- <strong>und</strong> Bewegungstherapie, Motopädie, <strong>Mototherapie</strong><br />
Auszug aus unserem Programm:<br />
Kursreihen<br />
Psychomotorische Bewegungserziehung, <strong>Mototherapie</strong><br />
mit Kin<strong>de</strong>rn/Erwachsenen, Entspannungspädagogik<br />
Seminare, Workshops<br />
Arbeit mit spezifischen Klientel, Motorische Entwicklung,<br />
För<strong>de</strong>rdiagnostik, Trampolinkurse<br />
Ernst-Kiphard-Berufskolleg<br />
Victor-Toyka-Str. 6 · 44139 Dortm<strong>und</strong><br />
Tel. 0231/103870 · Fax<br />
0231/103903<br />
E-Mail: info@motopaedieschule.<strong>de</strong><br />
Internet: www.motopaedieschule.<strong>de</strong><br />
Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungszentrum <strong>für</strong> Ges<strong>und</strong>heits-,<br />
Bewegungs- <strong>und</strong> Erziehungsberufe<br />
Victor-Toyka-Str. 6 · 44139 Dortm<strong>und</strong><br />
Tel. 0231/5330753 · Fax 0231/134266<br />
E-Mail: info@fortbildung-dortm<strong>und</strong>.<strong>de</strong><br />
Internet: www.fortbildung-dortm<strong>und</strong>.<strong>de</strong><br />
Bitte einsen<strong>de</strong>n an Ihre Buchhandlung o<strong>de</strong>r an:<br />
Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG,<br />
K<strong>und</strong>enservice, Lazarettstr. 4, 80636 München<br />
Tel: 089/12607-0, Fax 089/12607-333<br />
e-mail: k<strong>und</strong>enservice@pflaum.<strong>de</strong><br />
Wir bestellen<br />
___ Expl. „Zeig, was Du kannst“<br />
ISBN 3-7905-0945-8<br />
_____________________________________________<br />
Name, Vorname<br />
_____________________________________________<br />
Straße<br />
_____________________________________________<br />
PLZ, Ort Telefon<br />
_____________________________________________<br />
Datum, Unterschrift<br />
61
62<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport als bewährte Maßnahme in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
wie die psychomotorische Entwicklungsbegleitung<br />
als therapeutische<br />
Maßnahme in <strong>de</strong>n gesamten Kontext<br />
dieser Einrichtung eingebettet wer<strong>de</strong>n<br />
kann.<br />
Spannend liest sich <strong>de</strong>r Beitrag von<br />
Sandra Klingler, die sehr differenziert<br />
schil<strong>de</strong>rt, welche Be<strong>de</strong>utung das Fallen,<br />
Loslassen <strong>und</strong> Aufgefangen wer<strong>de</strong>n <strong>für</strong><br />
die Entwicklung <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> somit<br />
auch <strong>für</strong> die konkrete Praxis in <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong> hat.<br />
Eilert von Busch macht eine an<strong>de</strong>re<br />
Facette bewegungsorientierten<br />
Arbeitens <strong>de</strong>utlich. Er schil<strong>de</strong>rt die<br />
Pausengestaltung in einer Schule <strong>für</strong><br />
Erziehungshilfe, wobei hier aufgezeigt<br />
wird, welche Erleichterung dieses<br />
Bewegungsangebot <strong>für</strong> die Schüler,<br />
aber auch <strong>für</strong> die Lehrer bieten kann –<br />
nicht nur Erleichterung son<strong>de</strong>rn auch<br />
eine Möglichkeit verschie<strong>de</strong>ner Aspekte<br />
<strong>de</strong>r Persönlichkeitsentwicklung.<br />
Ein weiteres Beispiel aus <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe bietet Richard Hammer,<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Frage nachgeht, ob in <strong>de</strong>r<br />
psychomotorischen Praxis auch so<br />
etwas Abstraktes wie Werte vermittelt<br />
wird. Natürlich muss diese Frage bejaht<br />
wer<strong>de</strong>n, wie anhand <strong>de</strong>r Reflexion <strong>de</strong>s<br />
Arbeitsalltags eines Motologen gezeigt<br />
wird.<br />
M. Welsche, C. Stobbe <strong>und</strong> G. Romer<br />
bearbeiten ein stark vernachlässigtes<br />
Feld: die Bewegungsdiagnostik <strong>für</strong><br />
Jugendliche. Gibt es im Altersbereich<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r einige interessante Verfahren<br />
zur Motodiagnostik, so ist die Altersgruppe<br />
<strong>de</strong>r Jugendlichen motodiagnostisch<br />
gesehen eher ein Stiefkind. Hier<br />
wer<strong>de</strong>n einige Verfahren vorgestellt,<br />
welche <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Praktiker, <strong>de</strong>r mit<br />
Jugendlichen arbeitet, sehr hilfreich<br />
sein können. Umso mehr, da die<br />
Notwendigkeit einer Diagnostik<br />
zunehmend erkannt wird (vgl. <strong>motorik</strong><br />
2006/4).<br />
Der Beitrag von Rainer Wollny steht ein<br />
wenig neben <strong>de</strong>m inhaltlichen Schwerpunkt<br />
dieses Heftes, versteht sich<br />
jedoch als wichtige Ergänzung. Er zeigt<br />
in einem Überblicksartikel die Traditionen<br />
<strong>und</strong> gegenwärtige Trends <strong>de</strong>r<br />
motorischen Entwicklungsforschung in<br />
Deutschland auf <strong>und</strong> kann somit<br />
letztlich auch wie<strong>de</strong>r seine Rückwirkung<br />
auf die Psycho<strong>motorik</strong>er in <strong>de</strong>r<br />
Praxis haben.<br />
Literatur:<br />
Bettelheim, B. (1971): Liebe allein<br />
genügt nicht. Stuttgart: Klett.<br />
Dräbing, R. (2006): Kin<strong>de</strong>r brauchen<br />
Bewegung! Bewegung in <strong>de</strong>r<br />
Jugendhilfe? Aachen: Meyer &<br />
Meyer.<br />
Flosdorf, P. (1964): Spiel, Sport <strong>und</strong><br />
Erziehung. In: Schmiedle, P.<br />
(Hrsg.): Leib <strong>und</strong> Leiblichkeit in<br />
<strong>de</strong>r Erziehung. Freiburg i. Br.:<br />
Lambertus.<br />
Flosdorf, P. (1988): Spielsport - ein<br />
heilpädagogisches Konzept zur<br />
gezielten psychomotorischen<br />
Behandlung verhaltensauffälliger<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlicher.<br />
In: Flosdorf, P.: Theorie <strong>und</strong><br />
Praxis stationärer Erziehungshilfe,<br />
Bd. 2. Freiburg i. Br.:<br />
Lambertus, 223–236.<br />
Flosdorf, P./Rie<strong>de</strong>r, H. (1990): Sport<br />
als Therapie. Ein historischer<br />
Rückblick auf die Entwicklung<br />
eines Konzeptes. In: Huber, G./<br />
Rie<strong>de</strong>r, H./Neuhäuser, G. (Hrsg.):<br />
Psycho<strong>motorik</strong> in Therapie <strong>und</strong><br />
Pädagogik. Dortm<strong>und</strong>: mo<strong>de</strong>rnes<br />
lernen. 39–56.<br />
Hammer, R. (1995): Bewegung in<br />
<strong>de</strong>r Heimerziehung. Inaugural<br />
Diss. Dortm<strong>und</strong>.<br />
Hammer, R. (2001): Bewegung allein<br />
genügt nicht. Dortm<strong>und</strong>:<br />
mo<strong>de</strong>rnes lernen.<br />
Hammer, R. (2003): Die Be<strong>de</strong>utung<br />
von Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport<br />
bei Bruno Bettelheim. In: Knab,<br />
E./Macsenaere, M. (Hrsg.):<br />
Heimerziehung als Lebensaufgabe.<br />
Schriftenreihe <strong>de</strong>s Inst. <strong>für</strong><br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendhilfe. Mainz:<br />
Selbstverlag. Bd. 4, 143–158.<br />
Joans, V. (o. J.): Leistungsbeschreibung<br />
<strong>für</strong> Dipl. Motologen im<br />
Haus Carl Sonnenschein.<br />
Fritzlar.<br />
Knab, E. (1983): Einführung zum<br />
Thema: <strong>Motopädagogik</strong> <strong>und</strong><br />
Heimerziehung <strong>für</strong> Verhaltensgestörte.<br />
In: Knab, E. (Hrsg.):<br />
Heimerziehung - Ein differenziertes<br />
Leistungsangebot.<br />
Frankfurt a. M.: Lang.<br />
Knab, E. (2003): Psycho<strong>motorik</strong> in<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe. In:<br />
Knab, E./Macsenaere, M. (Hrsg.):<br />
Heimerziehung als Lebensaufgabe.<br />
Schriftenreihe <strong>de</strong>s Inst. <strong>für</strong><br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendhilfe. Mainz:<br />
Selbstverlag. Bd. 4, 158–170.<br />
Makarenko, A. S. (1988): Pädagogische<br />
Werke, Bd. 1. Berlin: Volk<br />
<strong>und</strong> Wissen.<br />
Macsenaere, M. (2006): 10 Jahre<br />
Wirkungsforschung in <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe –<br />
Welche Bef<strong>und</strong>e lassen sich<br />
daraus <strong>für</strong> die Psycho<strong>motorik</strong><br />
gewinnen? In: <strong>motorik</strong> 29, 4,<br />
194–200.<br />
Müller, A. (1988): Die therapeutische<br />
Anwendung von Spiel <strong>und</strong><br />
Sport zur För<strong>de</strong>rung bewegungsgestörter<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendlicher. In: Flosdorf, P.:<br />
Theorie <strong>und</strong> Praxis stationärer<br />
Erziehungshilfe, Bd. 2. Freiburg<br />
i. Br.: Lambertus, 237–247.<br />
Müller, A. (2003): „Spiel-Sport“.<br />
In: Flosdorf, P./Patzelt, H.:<br />
Therapeutische Heimerziehung.<br />
Schriftenreihe <strong>de</strong>s Inst.<br />
<strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendhilfe.<br />
Mainz: Selbstverlag. Bd. 5,<br />
505–536.<br />
Pöggeler, F. (1987): Die Pädagogik<br />
Giovanni Boscos. Lüneburg:<br />
Neubauer.<br />
Redl, F./Wineman, D. (1984): Kin<strong>de</strong>r,<br />
die hassen. München, Piper.<br />
Rie<strong>de</strong>r, H. (2003): Sport als Therapie.<br />
In: Flosdorf,P./Patzelt, H.:<br />
Therapeutische Heimerziehung.<br />
Schriftenreihe <strong>de</strong>s Inst. <strong>für</strong><br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendhilfe. Mainz:<br />
Selbstverlag. Bd. 5, 495–504.<br />
Weinschenk, R. (1980): Gr<strong>und</strong>lagen<br />
<strong>de</strong>r Pädagogik Don Boscos.<br />
München: Don Bosco.
Mechthild Denzer<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als gestalten<strong>de</strong>s Element<br />
in <strong>de</strong>r sozialpädagogischen Ausbildung<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport haben sich in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe als pädagogische<br />
<strong>und</strong> therapeutische Maßnahme bewährt. Es zeigt sich jedoch immer wie<strong>de</strong>r,<br />
dass ein erfolgreicher Einsatz eine pädagogische Alltagsgestaltung verlangt, die<br />
auch auf <strong>de</strong>m Gr<strong>und</strong>gedanken basiert, dass Bewegung <strong>und</strong> Spiel gr<strong>und</strong>legen<strong>de</strong><br />
Elemente kindlicher Entwicklung sind. Wie <strong>de</strong>n angehen<strong>de</strong>n Erzieherinnen <strong>und</strong><br />
Erziehern diese Gr<strong>und</strong>lagen erlebnisnah vermittelt wer<strong>de</strong>n können zeigt die Erzieherausbildung<br />
an <strong>de</strong>r Katholischen Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik in Saarbrücken, wo<br />
– orientiert am Lernfeldkonzept – Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport ein wesentlicher<br />
Bestandteil <strong>de</strong>r Ausbildung sind: sowohl zur Steigerung von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohlbefin<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r SchülerInnen, als auch zur Vorbereitung auf ihr zukünftiges Arbeitsfeld.<br />
Einleitung<br />
Der historische Überblick über die<br />
Be<strong>de</strong>utung von Bewegung, Spiel <strong>und</strong><br />
Sport in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
(vgl. Hammer, in diesem Heft) zeigt<br />
<strong>de</strong>utlich, dass in <strong>de</strong>r sozialpädagogischen<br />
Arbeit schon immer ein Zugang<br />
zum Kind über Körper, Bewegung, Spiel<br />
<strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Jugendarbeit über Sport <strong>und</strong><br />
Erlebnispädagogik gesucht <strong>und</strong><br />
gewonnen wur<strong>de</strong>. 1 Eine umfangreiche,<br />
repräsentative, empirische Erhebung<br />
bzgl. Fachkräften, Materialien <strong>und</strong><br />
Bewegungsräumen in <strong>de</strong>n Einrichtungen<br />
<strong>de</strong>r Hilfen zur Erziehung<br />
(Macsenaere 2006) zeigt die großen<br />
Investitionen aller großen <strong>und</strong> kleinen<br />
Einrichtungen, oft unterstützt von<br />
1 Dabei führen <strong>de</strong>r Bereich Bewegung, Spiel <strong>und</strong><br />
Sport sowie die Psycho<strong>motorik</strong>, in <strong>de</strong>r<br />
Fachliteratur zur Jugendhilfe ein Schattendasein,<br />
wie ein Blick in die neue Auflage von<br />
R. Gün<strong>de</strong>r (2007), ein Standardwerk zur<br />
Einführung in die Jugendhilfe, zeigt, in <strong>de</strong>m<br />
dieses weit verbreitete Angebot <strong>de</strong>r Jugendhilfe<br />
überhaupt nicht erwähnt wird. Ebenso wenig<br />
im neuen Heft <strong>de</strong>r IGfH (2007/1), die aus <strong>de</strong>m<br />
großen Angebot <strong>de</strong>r Jugendhilfe, ein kleines<br />
körperbezogenes Projekt <strong>für</strong> Mädchen <strong>und</strong> ein<br />
spezielles Sportprojekt <strong>für</strong> Jungen auswählt.<br />
Das Interesse liegt in dieser Szene immer noch<br />
<strong>de</strong>utlich auf strukturellen, rechtlichen <strong>und</strong><br />
finanziellen Aspekten, maximal in <strong>de</strong>r<br />
Be<strong>de</strong>utung von Partizipation <strong>und</strong> Familienarbeit.<br />
Hin <strong>und</strong> wie<strong>de</strong>r gelingt es <strong>de</strong>r Erlebnispädagogik<br />
mit spektakulären Projekten zur<br />
Kenntnis genommen zu wer<strong>de</strong>n. Für die<br />
Alltagsgestaltung von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
wird dann immer wie<strong>de</strong>r gerne auf<br />
Bettelheim zurückgegriffen! Das ist scha<strong>de</strong>!<br />
Sponsoren, die <strong>de</strong>n Alltag <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>n Einrichtungen auf attraktive Art<br />
<strong>und</strong> Weise bereichern <strong>und</strong> oft <strong>de</strong>n<br />
entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Wohlfühlfaktor <strong>für</strong> die<br />
Kin<strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten. Die Klientel in diesem<br />
Arbeitsfeld ist über das Wort nicht<br />
beson<strong>de</strong>rs gut zu erreichen, öffnet sich<br />
vielmehr in Situationen, die einen eher<br />
spielerischen <strong>und</strong> bewegungsorientierten<br />
o<strong>de</strong>r „spektakulären“, d. h.<br />
erlebnisorientierten Charakter haben.<br />
Diese Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen fühlen<br />
sich über bewegungsorientierte <strong>und</strong><br />
körperbezogene Angebote mehr<br />
angesprochen als über die Sprache.<br />
Dieser sind sie oft nicht so mächtig, sie<br />
können sich jedoch über ihren Körper<br />
ganz gut ausdrücken <strong>und</strong> beherrschen<br />
gelegentlich eher einen Salto als die<br />
Fähigkeit, ihre Gefühle <strong>und</strong> Wahrnehmungen<br />
in einem richtigen Satz zu<br />
formulieren. Die Bewegungsangebote<br />
wer<strong>de</strong>n von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
als Chance gesehen <strong>und</strong> genutzt,<br />
wer<strong>de</strong>n doch hier Möglichkeiten <strong>de</strong>s<br />
sozialen Miteinan<strong>de</strong>rs eröffnet, die sie<br />
sonst nicht haben: Gut miteinan<strong>de</strong>r zu<br />
spielen. Wo gibt es das sonst?<br />
Zu diesem emotionalen Plädoyer kommt<br />
die wissenschaftlich belegte Tatsache,<br />
dass diese Angebote auch ihre pädagogische<br />
<strong>und</strong> therapeutische Wirksamkeit<br />
entfalten. Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche<br />
verän<strong>de</strong>rn sich, wenn sie unter fachlicher<br />
Anleitung psychomotorische<br />
Angebote bekommen <strong>und</strong> sich darauf<br />
einlassen können. Dies zeigen erste<br />
Ergebnisse aus <strong>de</strong>n Wirksamkeitsstudien<br />
mit <strong>de</strong>m Evaluationsinstrument SPES<br />
(vgl. Motorik 2006/4).<br />
Vor <strong>de</strong>m Hintergr<strong>und</strong> dieses Wissensstan<strong>de</strong>s<br />
möchte ich im Folgen<strong>de</strong>n<br />
darstellen, wie sich die Ausbildung <strong>de</strong>r<br />
angehen<strong>de</strong>n Erzieher/innen im Handlungsfeld<br />
Psycho<strong>motorik</strong> gestaltet. Sie<br />
sind es, die im Heimalltag die wesentliche<br />
Beziehung zu <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen gestalten müssen. Sie sind<br />
<strong>für</strong> die Alltagsgestaltung in unterschiedlichen<br />
Dimensionen verantwortlich.<br />
Psycho<strong>motorik</strong> ist dabei ein<br />
wesentliches Medium!<br />
Auf <strong>de</strong>n ersten Blick sieht die Ausbildungssituation<br />
an <strong>de</strong>n Fachschulen <strong>für</strong><br />
Sozialpädagogik gar nicht so schlecht<br />
aus: „Was <strong>de</strong>n Status <strong>de</strong>s Bereichs<br />
Bewegungserziehung/Sport in <strong>de</strong>r<br />
Ausbildung betrifft, so ist festzustellen,<br />
dass er als Fach o<strong>de</strong>r im Rahmen eines<br />
komplexeren Lernbereichs in allen<br />
Län<strong>de</strong>rn festgeschrieben wird“ (Krüger<br />
2001, 196). An <strong>de</strong>r Begrifflichkeit wird<br />
<strong>de</strong>utlich, dass Krüger sich auf das seit<br />
2002 <strong>für</strong> die Fachschulen verbindliche<br />
Lernfeldkonzept, nach <strong>de</strong>m nun alle<br />
Jahrgänge an <strong>de</strong>n Fachschulen unterrichtet<br />
wer<strong>de</strong>n, bezieht. 2 Mit Aufmerksamkeit<br />
<strong>und</strong> Sorge muss beobachtet<br />
wer<strong>de</strong>n, dass mit <strong>de</strong>r Abschaffung <strong>de</strong>r<br />
Unterrichtsfächer <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Darstellung<br />
<strong>de</strong>r Lehrpläne in Lernfel<strong>de</strong>rn zwar die<br />
Möglichkeit <strong>de</strong>s interdisziplinären<br />
Arbeitens geschaffen wer<strong>de</strong>n, an<strong>de</strong>rerseits<br />
aber auch die Gefahr besteht, dass<br />
Bewegungs- <strong>und</strong> Spielerziehung als<br />
Ausbildungsinhalt entfällt, falls in einer<br />
Schule keine qualifizierten Bewegungsfachkräfte<br />
vorhan<strong>de</strong>n sind. 3<br />
Am Beispiel <strong>de</strong>r Katholischen Fachschule<br />
in Saarbrücken soll gezeigt wer<strong>de</strong>n,<br />
wie die Chancen, die das Lernfeldkonzept<br />
bietet, zugunsten <strong>de</strong>r Verankerung<br />
<strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong> innerhalb <strong>de</strong>r<br />
2 Hier kann auf die erheblichen Verän<strong>de</strong>rungen<br />
im Ausbildungskonzept <strong>de</strong>r Fachschulen <strong>für</strong><br />
Sozialpädagogik nur kursorisch, soweit es die<br />
Psycho<strong>motorik</strong> betrifft, eingegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
3 Eine sehr kritische Einschätzung <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung<br />
von Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r<br />
Ausbildung an <strong>de</strong>n Fachhochschulen <strong>für</strong><br />
Sozialpädagogik liefert Dräbing (2006).<br />
63
64<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als gestalten<strong>de</strong>s Element in <strong>de</strong>r sozialpädagogischen Ausbildung<br />
Erzieher/innenausbildung genutzt<br />
wer<strong>de</strong>n können.<br />
Mit <strong>de</strong>m Schuljahr 2005/2006 begann<br />
an <strong>de</strong>n Fachschulen <strong>für</strong> Sozialpädagogik<br />
im Saarland die Arbeit nach <strong>de</strong>m<br />
„Lernfeldkonzept“ 4 , einem neuen<br />
Ausbildungskonzept, das im didaktischen<br />
Bereich b<strong>und</strong>esweit <strong>für</strong> die<br />
beruflichen Schulen verbindlich ist.<br />
Dieses Konzept ermöglicht auf neue Art<br />
einen alten Gedanken <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong><br />
neu zu beleben: Psycho<strong>motorik</strong> nicht<br />
nur als Inhalt zu vermitteln, son<strong>de</strong>rn<br />
psychomotorisch orientierte Metho<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> Prinzipien handlungsleitend in das<br />
Ausbildungskonzept zu integrieren. Die<br />
enge Zusammenarbeit mit Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendhilfeeinrichtungen, <strong>de</strong>n Trägern<br />
<strong>de</strong>r Schule, bietet exzellente Möglichkeiten,<br />
<strong>für</strong> die in diesem Konzept<br />
gefor<strong>de</strong>rte Kooperation <strong>de</strong>r Lernorte<br />
Praxis <strong>und</strong> Schule während <strong>de</strong>r Ausbildung.<br />
Das Potenzial dieser Ausgangsbedingungen<br />
soll im Folgen<strong>de</strong>n im<br />
Hinblick auf die Ausbildung <strong>de</strong>r<br />
zukünftigen Erzieher/innen in <strong>de</strong>r<br />
Jugendhilfe <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong> dargestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Dabei wer<strong>de</strong>n sowohl bereits laufen<strong>de</strong><br />
Projekte, die in <strong>de</strong>n vergangenen zwei<br />
Jahren in Form eines vorbereiten<strong>de</strong>n<br />
Mo<strong>de</strong>llversuchs durchgeführt wur<strong>de</strong>n,<br />
als auch Ausblicke <strong>und</strong> Ziele <strong>für</strong> die<br />
nächsten Jahre dargestellt.<br />
Mechthild Denzer<br />
Dipl.-Motologin, MA,<br />
Lehrerin Sek II in Sport <strong>und</strong> Deutsch<br />
Leiterin <strong>de</strong>r Kath. Fachschule in<br />
Saarbrücken<br />
Anschrift <strong>de</strong>r Verfasserin:<br />
Kath. Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik<br />
St.-Josef-Str. 11<br />
66115 Saarbrücken<br />
Das Lernfeldkonzept<br />
Berufliche Schulen haben sich in ihrem<br />
methodisch-didaktischen Konzept<br />
immer an <strong>de</strong>n allgemeinbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Schulen orientiert. Erst in <strong>de</strong>n letzten<br />
Jahren fin<strong>de</strong>t man gelegentlich<br />
Innovatives. Dies be<strong>de</strong>utet, berufsrelevante<br />
Kenntnisse wur<strong>de</strong>n im Frontalunterricht<br />
<strong>und</strong> Fertigkeiten isoliert in<br />
kleinen Schritten im Werkstattunterricht<br />
eingeübt. Die damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Ferne vom beruflichen Alltag schien <strong>für</strong><br />
alle Berufe, in <strong>de</strong>nen im dualen System<br />
ausgebil<strong>de</strong>t wird, erträglich, <strong>de</strong>nn die<br />
Azubis erlebten <strong>de</strong>n Alltag in hohem<br />
Maße in ‚ihrem’ Ausbildungsbetrieb. Für<br />
die sozialpädagogischen Berufe war die<br />
Ausbildungssituation unbefriedigen<strong>de</strong>r.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen <strong>de</strong>n<br />
Praxisstellen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Schule birgt<br />
immer beson<strong>de</strong>re Schwierigkeiten.<br />
Lange Praktika (Vorpraktikum <strong>und</strong><br />
Berufspraktikum) fin<strong>de</strong>n nur sehr<br />
begrenzt unter schulischer Anleitung<br />
statt. Anpassung <strong>und</strong> Nachahmung als<br />
Überlebensstrategien <strong>de</strong>r Praktikant/<br />
innen sind dabei zu oft das Ergebnis.<br />
Die Einrichtungen selbst beginnen erst<br />
langsam, Kräfte speziell <strong>für</strong> die Anleitung<br />
neuer, meist sehr junger Mitarbeiter/innen<br />
auszubil<strong>de</strong>n. Eine ‚Meisterprüfung’<br />
als Voraussetzung <strong>für</strong> die<br />
Ausbildungsberechtigung ist in <strong>de</strong>n<br />
pädagogischen Berufen nicht vorgesehen.<br />
Die Lehrkräfte selbst kennen<br />
zu<strong>de</strong>m das Arbeitsfeld oft nicht, da sie<br />
eine Lehrer/innensozialisation durchlaufen<br />
haben <strong>und</strong> meist keine Berufserfahrung<br />
im sozialpädagogischen<br />
Arbeitsfeld besitzen. Noch schlechter<br />
sieht die Situation <strong>für</strong> die Jugend- <strong>und</strong><br />
Heimerzieher/innen aus, <strong>de</strong>ren Berufsbild<br />
in <strong>de</strong>n 80er Jahren zugunsten einer<br />
(theorieorientierten) Breitbandausbildung<br />
5 abgeschafft wur<strong>de</strong>, die einen<br />
ganz <strong>de</strong>utlichen Schwerpunkt auf <strong>de</strong>m<br />
Vorschulbereich hat. Die Unzufrie<strong>de</strong>nheit<br />
mit <strong>de</strong>r Erzieher/innenausbildung<br />
hat eine beeindrucken<strong>de</strong> Vielfalt an<br />
4 Zu beobachten ist, ob die im Bologna-Prozess<br />
gefor<strong>de</strong>rte Modularisierung von Inhalten <strong>und</strong><br />
die stetigen For<strong>de</strong>rungen nach FH-Niveau <strong>für</strong><br />
die Erzieherinnen das Lernfeldkonzept nicht<br />
überrollen wer<strong>de</strong>n!<br />
5 In Bayern <strong>und</strong> Ba<strong>de</strong>n-Württemberg blieben die<br />
Fachschulen mit dieser Ausrichtung erhalten,<br />
sind aber in Ba<strong>de</strong>n-Württemberg <strong>de</strong>m<br />
Sozialministerium unterstellt.<br />
Initiativen <strong>und</strong> Aktionen aller Verbän<strong>de</strong><br />
in diesem Bereich ausgelöst, verschärft<br />
durch die wachsen<strong>de</strong> Vielfalt an<br />
Ausbildungswegen, die letztlich alle im<br />
Arbeitsfeld <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
mün<strong>de</strong>n.<br />
Im nun seit fast 10 Jahren im technisch-gewerblichen<br />
Bereich in <strong>de</strong>r<br />
Erprobung befindlichen methodischdidaktischen<br />
Konzept <strong>de</strong>s Lernfel<strong>de</strong>s,<br />
wird versucht, eine spezifische Ausbildungskonzeption<br />
<strong>für</strong> die Beruflichen<br />
Schulen zu entwickeln. Ausgehend vom<br />
zentralen Auftrag, <strong>de</strong>r Vermittlung von<br />
Handlungskompetenzen <strong>für</strong> <strong>de</strong>n<br />
beruflichen Alltag, ist folgen<strong>de</strong>r<br />
Gr<strong>und</strong>aufbau <strong>für</strong> alle Ausbildungen<br />
verbindlich: Anhand von Erhebungen<br />
<strong>und</strong> Befragungen im Praxisfeld wer<strong>de</strong>n<br />
gr<strong>und</strong>legen<strong>de</strong> Handlungsfel<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
beruflichen Alltags einer Profession<br />
erhoben. Innerhalb dieses Handlungsfel<strong>de</strong>s<br />
wer<strong>de</strong>n enger begrenzte Handlungssituationen<br />
<strong>de</strong>finiert. Die notwendigen<br />
Kompetenzen zur Bewältigung<br />
dieser Handlungssituationen wer<strong>de</strong>n<br />
analysiert <strong>und</strong> im Kontakt zwischen<br />
Fachkräften <strong>und</strong> Lehrkräften festgelegt.<br />
Die Handlungssituationen wer<strong>de</strong>n in<br />
zentralen Lernfel<strong>de</strong>rn zusammengefasst.<br />
Diese Lernfel<strong>de</strong>r geben die neuen<br />
Rahmenrichtlinien <strong>de</strong>r Schulbehör<strong>de</strong>n 6<br />
vor. Zur Vermittlung dieser als berufsrelevant<br />
erkannten Kompetenzen<br />
entwerfen die Lehrkräfte im Team<br />
komplexe Lernsituationen, die diese<br />
Kompetenzen herausfor<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
schulen.<br />
Die damit einhergehen<strong>de</strong>n Verän<strong>de</strong>rungen<br />
in <strong>de</strong>r Lehrerrolle können gar<br />
nicht <strong>de</strong>utlich genug betont wer<strong>de</strong>n:<br />
Beratung <strong>und</strong> Mo<strong>de</strong>ration von Lernprozessen,<br />
Teamarbeit, Ausarbeiten<br />
komplexer Lernsituationen mit Lösungsvorschlägen<br />
‚gelungener Praxis’,<br />
Feedback <strong>und</strong> Beurteilung von fachlichen<br />
<strong>und</strong> personalen Kompetenzen<br />
wer<strong>de</strong>n zukünftige Schlüsselkompetenzen<br />
<strong>de</strong>s Lehrers als Lernbegleiter<br />
sein.<br />
6 Wobei die Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn<br />
bei <strong>de</strong>r Begriffsbestimmung: „Lernfeld“<br />
erheblich sind, ebenso wie die Angst, die<br />
Schulen tatsächlich in einen selbstständigen<br />
Kontakt mit <strong>de</strong>n Praxisstellen zu entlassen <strong>und</strong><br />
die Handlungsfel<strong>de</strong>r im Dialog selbst festlegen<br />
zu lassen. Verschärft wird diese Unklarheit im<br />
Konzept, weil gleichzeitig ein erheblicher<br />
St<strong>und</strong>enabbau an <strong>de</strong>n Fachschulen (zumin<strong>de</strong>st<br />
im Saarland) stattfin<strong>de</strong>t.
Anfor<strong>de</strong>rung an die Lehrkräfte<br />
Von Lehrkräften an Fachschulen <strong>für</strong><br />
Sozialpädagogik sollte <strong>de</strong>shalb – neben<br />
einer wissenschaftlichen, bzw. therapeutisch-künstlerischen<br />
Ausbildung –<br />
erwartet wer<strong>de</strong>n:<br />
• vielfältige eigene Ausbildungs- <strong>und</strong><br />
berufliche Erfahrungen, eben auch im<br />
Arbeitsfeld Jugendhilfe,<br />
• Fähigkeit <strong>und</strong> Bereitschaft zur<br />
Teamarbeit <strong>und</strong> Teamteaching, sowie<br />
<strong>de</strong>r gemeinsamen Erarbeitung von<br />
Unterrichtsmaterialien zu komplexen<br />
Lernsituationen,<br />
• Bereitschaft <strong>und</strong> Fähigkeit zur<br />
Kooperation mit <strong>de</strong>r Praxis in Form<br />
von gemeinsamen Projekten,<br />
• Zeit <strong>für</strong> Austausch über <strong>de</strong>n Ausbildungsstand<br />
<strong>de</strong>r Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n mit<br />
<strong>de</strong>n Praxisanleiter/innen,<br />
• Wahrnehmung, Rückmeldung <strong>und</strong><br />
Kritik <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lns <strong>de</strong>r Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
in Praxis <strong>und</strong> Schule,<br />
• Mitarbeit an <strong>de</strong>r Auflösung <strong>de</strong>r<br />
Fächerorientierung im berufsbezogenen<br />
Lernbereich,<br />
• Beteiligung an einer exemplarischen<br />
Alltagsgestaltung in <strong>de</strong>r Schule.<br />
Anfor<strong>de</strong>rung an die Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Die (Heils-)Erwartungen, die an<br />
Erzieher/innen <strong>und</strong> ihre Ausbildung<br />
formuliert wer<strong>de</strong>n, können eigentlich<br />
nur als Karikatur dargestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz bemühen sich viele<br />
Kollegien <strong>de</strong>n hohen Ansprüchen von<br />
außen gerecht zu wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> versuchen,<br />
aus <strong>de</strong>n staatlichen Vorgaben <strong>für</strong><br />
eine schulische Ausbildung gemeinsam<br />
mit <strong>de</strong>n Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n eine theoretisch<br />
f<strong>und</strong>ierte, Kompetenzen vermitteln<strong>de</strong>,<br />
erfahrungsorientierte, persönlichkeitsför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />
Lernumgebung zu<br />
gestalten.<br />
Die Verän<strong>de</strong>rungen sind auch <strong>für</strong> die<br />
Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n spürbar:<br />
• Die Rückzugsräume, die ein verschulter<br />
Alltag mit sich bringt,<br />
verringern sich zunehmend, d. h. eine<br />
verstärkte, aktive Beteiligung an <strong>de</strong>r<br />
eigenen Ausbildung ist Voraussetzung<br />
aller Verän<strong>de</strong>rungen. Motivationsschwächen<br />
können schnell als ein<br />
Gr<strong>und</strong> <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Abbruch <strong>de</strong>r Ausbildung<br />
dienen. Vorhan<strong>de</strong>ne, bzw. zügig<br />
zu lernen<strong>de</strong> Lern- <strong>und</strong> Arbeitstechniken<br />
sind eine zentrale Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> ein erfolgreiches Vorwärtsschreiten,<br />
• Gruppen- <strong>und</strong> Projektarbeit sind<br />
zentrale Handlungskompetenzen <strong>de</strong>r<br />
Erzieher/in <strong>und</strong> damit ein wesentlicher<br />
Ausbildungsbestandteil. Die<br />
Kompetenzen wer<strong>de</strong>n geprüft über<br />
Projekte mit <strong>und</strong> <strong>für</strong> Klienten <strong>und</strong><br />
durch Präsentation von Arbeitsergebnissen<br />
sowie in Abschlussgesprächen,<br />
• Effektives Nutzen von Frontalunterricht<br />
zur Vermittlung eines Überblickes<br />
über fachliche Zusammenhänge,<br />
vertieft durch Einzelarbeit <strong>und</strong><br />
Gruppenarbeit <strong>und</strong> geprüft durch<br />
Fachgespräche (mündliche<br />
Prüfungen), Klausuren, Referate,<br />
Hausarbeiten,<br />
• Persönlichkeitsentwicklung <strong>und</strong> die<br />
da<strong>für</strong> notwendigen Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />
müssen angenommen<br />
wer<strong>de</strong>n; geprüft durch regelmäßige<br />
Teilnahme an Übungen zu Selbsterfahrungen,<br />
Reflexionsgespräche mit<br />
<strong>de</strong>m Vertrauenslehrer, kompetenteres<br />
Verhalten in <strong>de</strong>n Teams, zunehmen<strong>de</strong><br />
Verantwortung <strong>für</strong> das Schulleben,<br />
aktive <strong>und</strong> passive Kritikfähigkeit.<br />
Handlungsfeld: Psycho<strong>motorik</strong><br />
in <strong>de</strong>r Jugendhilfe<br />
In allen Einrichtungen <strong>de</strong>r Jugendhilfe<br />
sind viele Elemente psychomotorischen<br />
Arbeitens zu fin<strong>de</strong>n, auch wenn die<br />
Bezeichnungen da<strong>für</strong> ebenso unterschiedlich<br />
sind, wie die jeweils verantwortlichen<br />
Berufsgruppen. Das Angebot<br />
<strong>de</strong>r Spezialisten, d. h. <strong>de</strong>r Sportlehrer/<br />
innen, Motolog/innen <strong>und</strong> Erlebnispädagog/innen,<br />
aber auch von Übungsleiter/innen<br />
ortsnaher Sportvereine ist<br />
hier nur unter <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r<br />
notwendigen Begleitung durch die<br />
Erzieher/innen von Interesse. Gruppenpädagogisch<br />
relevante Angebote wie<br />
z. B. Klettern, Kanufahren, Hochseilgarten,<br />
Akrobatik-Gruppen, spezielle<br />
psychomotorische För<strong>de</strong>rung <strong>und</strong><br />
Einzeltherapie, u. a. bleiben diesen<br />
Berufsgruppen vorbehalten.<br />
Für das genuine Arbeitsfeld <strong>de</strong>r<br />
Erzieherinnen geht es vor allem um die<br />
Gestaltung <strong>de</strong>s Gruppenalltags unter<br />
psychomotorischen Gesichtspunkten,<br />
d. h. eine bewegungs- <strong>und</strong> spielorientierte<br />
Freizeitgestaltung <strong>und</strong> eine<br />
angemessene, kompetente Einbeziehung<br />
<strong>de</strong>r gruppenübergreifen<strong>de</strong>n<br />
Angebote <strong>für</strong> das einzelne Kind im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Hilfeplans. Für die Erstellung<br />
<strong>de</strong>s „Individuellen Erziehungs-<br />
planes“ sind die Gr<strong>und</strong>kenntnisse in <strong>de</strong>r<br />
Diagnostik <strong>de</strong>s allgemeinen Bewegungs-<br />
<strong>und</strong> Körperverhaltens im<br />
Vergleich zur Altersgruppe sowie<br />
allgemeine För<strong>de</strong>rangebote in Planung,<br />
Durchführung <strong>und</strong> Evaluation von <strong>de</strong>r<br />
Erzieherin zu erwarten.<br />
Handlungssituationen zur „Psycho<strong>motorik</strong><br />
in <strong>de</strong>r Jugendhilfe“<br />
Die psychomotorische Entwicklungsbegleitung<br />
sollte – durchgeführt von<br />
motologischen o<strong>de</strong>r motopädischen<br />
Fachkräften – als therapeutisches<br />
Angebot ein fester Bestandteil je<strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung<br />
sein. Dabei sollten die Erzieher/innen<br />
aber einen Einblick in Indikationen,<br />
Diagnosen <strong>und</strong> Verläufe haben, um die<br />
Therapie im Gruppenalltag unterstützen<br />
zu können. Eine professionelle Erziehung<br />
ist nur gegeben, wenn das Leben<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen immer<br />
wie<strong>de</strong>r durchdrungen ist von Angeboten<br />
<strong>de</strong>s Spielens <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Bewegung. Diese<br />
Situationen umfassen zum einen alle<br />
Bewegungsangebote, die auch „kompetente“<br />
Eltern ihren Kin<strong>de</strong>rn bieten, zum<br />
an<strong>de</strong>ren aber auch Erweiterungen, die<br />
in einem professionell-pädagogischen<br />
Rahmen erwartet wer<strong>de</strong>n können.<br />
Damit ist eine an die Entwicklungsaufgaben<br />
<strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s angepasste Auswahl<br />
von Bewegungsangeboten gemeint,<br />
<strong>de</strong>ren Anleitung <strong>und</strong> Begleitung so<br />
gestaltet ist, dass sie mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit zu Erfolgserlebnissen<br />
<strong>und</strong> wachsen<strong>de</strong>n Kompetenzen<br />
führen. Sie sollen die Defizite, die eine<br />
nicht ausreichend entwicklungsför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />
Umwelt verursachte, ausgleichen<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n vorhan<strong>de</strong>nen Ressourcen<br />
zur Stärkung <strong>de</strong>r Persönlichkeit <strong>de</strong>s<br />
Kin<strong>de</strong>s Raum geben. Dazu gehören:<br />
regelmäßige alltägliche Bewegungseinheiten<br />
wie Inliner(fahren),<br />
Skateboard(fahren), Springseil- <strong>und</strong><br />
Gummitwist, Fahrradfahren in seiner<br />
Vielseitigkeit, Schwimmen mit <strong>de</strong>n<br />
dazugehören<strong>de</strong>n Zeugnissen bis zum<br />
Schwimmabzeichen in Gold, Ballspiele<br />
aller Art als Gruppenaktivitäten, eine<br />
bewegungsorientierte Feriengestaltung<br />
mit Strand- <strong>und</strong> Bergaktivitäten in<br />
Campingumgebung, Spielnachmittage,<br />
Spielfeste, Zirkusgruppen <strong>und</strong> vieles<br />
mehr.<br />
Neben diesen spezifischen Angeboten,<br />
in <strong>de</strong>nen Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport zur<br />
65
66<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als gestalten<strong>de</strong>s Element in <strong>de</strong>r sozialpädagogischen Ausbildung<br />
Geltung kommen, hat die Psycho<strong>motorik</strong><br />
aber noch mehr an Anregung zu<br />
bieten, was das „Geplante Erziehen“ in<br />
<strong>de</strong>r stationären Jugendhilfe betrifft: Für<br />
die bewusste Gestaltung <strong>de</strong>s pädagogischen<br />
Alltags gibt es erprobte <strong>und</strong><br />
bewährte Konzepte, die in einem<br />
Mo<strong>de</strong>llprojekt (Hammer 2001) an einer<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung in<br />
Neunkirchen (Saar) entwickelt <strong>und</strong><br />
wissenschaftlich begleitet wur<strong>de</strong>n.<br />
Weitere Arbeiten, die die Be<strong>de</strong>utung<br />
von Psycho<strong>motorik</strong> im weiteren Sinne<br />
als Teil <strong>de</strong>r Alltagsgestaltung in <strong>de</strong>r<br />
Jugendhilfe beschreiben, stammen<br />
meist aus <strong>de</strong>n 80er Jahren (vgl. Flosdorf<br />
1988). Hier wird <strong>de</strong>utlich gemacht, dass<br />
Beziehungsgestaltung als Voraussetzung<br />
<strong>und</strong> Teil <strong>für</strong> das Gelingen von<br />
pädagogischer Einflussnahme auch <strong>und</strong><br />
vor allem im körperlichen Dialog<br />
zwischen Erwachsenen <strong>und</strong> Kind statt<br />
fin<strong>de</strong>t. (vgl. Aucouturier 2006). Die<br />
vielfältige Verflochtenheit psychischer<br />
<strong>und</strong> körperlicher Prozesse zeigt sich im<br />
Berufsalltag <strong>de</strong>r Erzieher/innen:<br />
Von Erzieher/innen wird ein <strong>für</strong><br />
berufliche Kontexte außergewöhnlich<br />
hoher körperlicher Einsatz<br />
verlangt: Sie stellen sich <strong>für</strong> Ringen<br />
<strong>und</strong> Raufen, <strong>für</strong> Massage <strong>und</strong><br />
Kuscheln, <strong>für</strong> Wettrennen <strong>und</strong><br />
Schwimmen zur Verfügung. Sie<br />
sorgen <strong>für</strong> eine entspannte Stimmung<br />
am Esstisch, durch hohe<br />
Präsenz, ohne angespannt <strong>und</strong><br />
kontrollierend zu sein. Sie treten<br />
entschie<strong>de</strong>n <strong>und</strong> ein<strong>de</strong>utig Fehlverhalten<br />
entgegen <strong>und</strong> unterbin<strong>de</strong>n<br />
es, ohne Gewalt auszuüben o<strong>de</strong>r<br />
anzudrohen. Sie begegnen 5jährigen<br />
körperlich ebenso angemessen<br />
wie 15-jährigen, Mädchen<br />
wie Jungen. Mit Kolleg/innen<br />
bei<strong>de</strong>rlei Geschlechts teilen sie<br />
unterwegs das Minipackzelt <strong>und</strong> mit<br />
<strong>de</strong>r Wohnbereichsleitung nehmen<br />
sie am Fachkongress teil. All dies,<br />
ohne Grenzen zu verletzen, son<strong>de</strong>rn<br />
mit <strong>de</strong>m Auftrag, vergangene<br />
Grenzverletzungen aller Art <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendlichen zu heilen!<br />
Wenn Sie dies über längere Zeit<br />
leisten sollen, gehört dazu die<br />
Fähigkeit einer außeror<strong>de</strong>ntlichen<br />
Selbstwahrnehmung <strong>und</strong> Fähigkeit<br />
zur Selbst<strong>für</strong>sorge. 7<br />
Teams in <strong>de</strong>r Jugendhilfe sind <strong>für</strong> <strong>de</strong>n<br />
pädagogischen Alltag verantwortlich,<br />
d. h. sie gestalten gemeinsam Tag,<br />
Woche <strong>und</strong> Jahr unter pädagogischen<br />
Gesichtspunkten. Zu be<strong>de</strong>nken ist dabei<br />
– neben <strong>de</strong>n oben beschriebenen<br />
Beziehungsstrukturen – die Gestaltung<br />
von Raum, Materialien <strong>und</strong> Zeit. Räume<br />
müssen klare Strukturen besitzen, um<br />
<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen Orientierung<br />
zu geben, ihnen aber auch die<br />
Möglichkeit zur freien Entfaltung<br />
bieten. Rückzugsmöglichkeiten mit<br />
Intimsphäre, aber auch offene Räume<br />
zum gemeinsamen Tun, bil<strong>de</strong>n eine gute<br />
Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> soziales Miteinan<strong>de</strong>r (vgl.<br />
Mahlke/Schwarte 1989). Bei <strong>de</strong>n<br />
Überlegungen zur Gestaltung <strong>de</strong>s<br />
Gruppenalltags oft vernachlässigt, aber<br />
im Detail häufig wirksam, sind die<br />
Materialien, welche die Räume füllen:<br />
stabil <strong>und</strong> fest müssen z. B. die Möbel<br />
sein, um <strong>de</strong>m Bewegungsdrang <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen Stand zu<br />
halten. Spielgegenstän<strong>de</strong> sollten<br />
Kreativität <strong>und</strong> Fantasie för<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
nicht durch zu enge Handhabungsmöglichkeiten<br />
einschränken. Dieses<br />
Zusammenspiel von Struktur <strong>und</strong><br />
Offenheit prägt auch <strong>de</strong>n Umgang mit<br />
<strong>de</strong>r Zeit als Strukturelement: klare<br />
zeitliche Vorgaben dienen <strong>de</strong>r Orientierung<br />
<strong>und</strong> bieten <strong>de</strong>n Rahmen <strong>für</strong> freie<br />
Zeiten, in <strong>de</strong>nen die Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendlichen ihren eigenen I<strong>de</strong>en<br />
nachgehen können. Bleibt als weiteres<br />
Element die Themen, die uns in<br />
unserem Leben begleiten: Lebensthemen<br />
bestimmen in einem hohen Maß<br />
die Verhaltensweisen <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendlichen. In einer Situation, die<br />
z. B. von <strong>de</strong>r Angst über eine mögliche<br />
Trennung <strong>de</strong>r Eltern geprägt wird, lässt<br />
sich schlecht ruhig sitzen <strong>und</strong> Hausaufgaben<br />
machen. Die Verspannung,<br />
Zappeligkeit <strong>und</strong> vielleicht auch<br />
Aggression ist körperlicher Ausdruck<br />
eines nachvollziehbaren Gefühls <strong>de</strong>r<br />
Angst <strong>und</strong> Verlassenheit. Dieses<br />
wahrzunehmen <strong>und</strong> einfühlsam zu<br />
lin<strong>de</strong>rn o<strong>de</strong>r wenigstens zu ertragen,<br />
gehört zum pädagogischen Alltag in <strong>de</strong>r<br />
Jugendhilfe.<br />
7 Diese Beschreibung soll nicht zu <strong>de</strong>r Vermutung<br />
führen, dieses muss o<strong>de</strong>r könne ‚gelehrt’<br />
wer<strong>de</strong>n. Diese Fähigkeiten bringen die jungen<br />
Menschen als Form einer ‚intuitiven Didaktik’<br />
weitgehend mit, aber entsprechend <strong>de</strong>r Aussage<br />
von R. Cohn, soll im Laufe <strong>de</strong>r Ausbildung aus<br />
<strong>de</strong>r ‚Intuition eine Metho<strong>de</strong>’ wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Berücksichtigung <strong>de</strong>r Körperbezogenheit<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Ganzheitlichkeit bei <strong>de</strong>r<br />
Erziehung <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
ist ein zentraler, handlungsleiten<strong>de</strong>r<br />
Impuls, <strong>de</strong>r, von <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong><br />
ausgehend, auf die Ausbildung <strong>de</strong>r<br />
Erzieher/innen Einfluss nehmen sollte<br />
(vgl. Denzer 1999).<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als Ausbildungsinhalt<br />
im Lernfeldkonzept<br />
Vor <strong>de</strong>m Hintergr<strong>und</strong> dieser kursorischen<br />
Darstellung von alltäglichen Handlungssituationen,<br />
in <strong>de</strong>nen psychomotorische<br />
Kompetenzen erfor<strong>de</strong>rlich sind, soll unser<br />
Ausbildungskonzept im Bereich Psycho<strong>motorik</strong><br />
entwickelt wer<strong>de</strong>n. 8 Dieses ist<br />
eingeb<strong>und</strong>en in das Gesamtausbildungskonzept,<br />
<strong>de</strong>ssen Strukturen vom<br />
saarländischen Ministerium <strong>für</strong> Bildung,<br />
Kultur <strong>und</strong> Wissenschaft vorgegeben<br />
sind. Die Rahmenbedingungen sind eine<br />
Begleitung <strong>de</strong>s Vorpraktikums mit 12<br />
Wochenst<strong>und</strong>en, eine 2-jährige Vollzeitschulische<br />
Ausbildung. Zwischen diesen<br />
2 Jahren absolvieren die Schüler/innen<br />
ein Blockpraktikum. Die berufsbezogenen<br />
Inhalte <strong>de</strong>r Ausbildung sind als Lernfel<strong>de</strong>r<br />
sehr offen vorgegeben. Mit <strong>de</strong>m<br />
Abschluss nach <strong>de</strong>m zweiten Schuljahr<br />
beginnt das Anerkennungsjahr, in <strong>de</strong>m<br />
wir vier Blockwochen anbieten. Ein<br />
eigenes Lernfeld Bewegung, Sport o<strong>de</strong>r<br />
gar Psycho<strong>motorik</strong> ist im Lehrplan <strong>de</strong>s<br />
Saarlan<strong>de</strong>s nicht vorgesehen. Es ist im<br />
Rahmen <strong>de</strong>r Entscheidung <strong>de</strong>s Ausbildungsteams<br />
in das Lernfeld „Sozialpädagogische<br />
Bildungsinhalte“ zu integrieren.<br />
Auch im Vorkurs gibt es keine expliziten<br />
Vorgaben, aber die Freiheit, einen<br />
Schwerpunkt auf die Psycho<strong>motorik</strong> zu<br />
legen. Zu bei<strong>de</strong>m haben wir uns<br />
entschlossen.<br />
8 Die Schule entwickelt <strong>de</strong>n Ausbildungsplan<br />
gemeinsam über alle Lernfel<strong>de</strong>r hinweg, sodass<br />
im berufsbezogenen Ausbildungsbereich ein<br />
möglichst hoher Synergieeffekt erzielt wer<strong>de</strong>n<br />
kann, in<strong>de</strong>m <strong>für</strong> einen Zeitraum ein Schwerpunktthema<br />
von <strong>und</strong> <strong>für</strong> alle Lehrkräfte<br />
festgelegt ist. Dieses Konzept ist <strong>für</strong> <strong>de</strong>n<br />
Unterkurs entwickelt <strong>und</strong> in Teilen erprobt,<br />
es wird dieses Jahr erstmals als Ganzes<br />
umgesetzt. Mit <strong>de</strong>m Ziel <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>lagen-<br />
Vermittlung im UK hat sich das Team <strong>für</strong> eine<br />
Orientierung an <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s<br />
anhand von Entwicklungsaufgaben in<br />
chronologischer Abfolge <strong>de</strong>r Altersgruppen<br />
entschie<strong>de</strong>n. Der Plan kann im Internet<br />
eingesehen wer<strong>de</strong>n (www.kfs-saarbruecken.<strong>de</strong>).
Entsprechend <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s<br />
Handlungsfel<strong>de</strong>s muss die Ausbildung<br />
unterschiedliche Ebenen umfassen:<br />
• Selbsterfahrung, Reflexion <strong>de</strong>r<br />
eigenen Bewegungsgeschichte <strong>und</strong><br />
Erweiterung <strong>de</strong>s eigenen Bewegungs-<br />
<strong>und</strong> Wahrnehmungsrepertoires,<br />
• Vertiefung <strong>de</strong>r Fähigkeit zur Selbst-<br />
<strong>und</strong> Fremdwahrnehmung im körperlichen<br />
Dialog,<br />
• Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport <strong>für</strong><br />
unterschiedliche Zielgruppen<br />
auswählen <strong>und</strong> anleiten können.<br />
Die ersten Bewegungseinheiten mit<br />
neuen Schüler/innen sind <strong>für</strong> diese<br />
zunächst verunsichernd. Aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
nicht immer glücklichen Bewegungssozialisation<br />
entwickelt sich bei einigen<br />
Schüler/innen eine misserfolgsorientierte<br />
Haltung bzgl. <strong>de</strong>s eigenen Körpers<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten,<br />
sich zu bewegen – o<strong>de</strong>r auch zu spielen.<br />
Bewegungsängste unterdrücken die<br />
Freu<strong>de</strong> an eigener Bewegung <strong>und</strong><br />
verhin<strong>de</strong>rn dadurch natürlich auch <strong>de</strong>n<br />
unbeschwerten Einsatz von Bewegung<br />
<strong>und</strong> Spiel im pädagogischen Alltag.<br />
Es gilt also durch gut ausgewählte<br />
Bewegungsangebote neuen Spaß an<br />
Spiel <strong>und</strong> Bewegung zu vermitteln <strong>und</strong><br />
somit eine Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die Arbeit mit<br />
<strong>de</strong>m eigenen Körper in Bewegung zu<br />
schaffen. Da die Gruppen meist sehr<br />
heterogene Leistungen zeigen, ist die<br />
Situation auch <strong>für</strong> die sehr guten Sportler/innen,<br />
vor allem aber die guten<br />
Sportler schwierig, da sie sich nicht<br />
trauen, ihre Fähigkeiten voll zu zeigen.<br />
Notwendig sind auch die Vermittlung<br />
von Wissen über <strong>de</strong>n Ablauf <strong>und</strong> die<br />
Be<strong>de</strong>utung von Bewegung <strong>und</strong> Bewegungsentwicklung<br />
im Kin<strong>de</strong>s- <strong>und</strong><br />
Jugendalter sowie über die Erfahrungen<br />
traumatisierter o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>privierter Kin<strong>de</strong>r.<br />
Im Zeitalter <strong>de</strong>r „dicken Kin<strong>de</strong>r“<br />
gewinnt die Bewegung auch unter<br />
ges<strong>und</strong>heitspädagogischen Gesichtspunkten<br />
zunehmend an Be<strong>de</strong>utung<br />
(Bewegung im Alltag, Ernährung,<br />
Lebensrhythmen, …).<br />
Dies alles muss zu einem Können<br />
führen, das es ermöglicht, vielfältige<br />
Bewegungsgelegenheiten <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r im<br />
Alltag zu arrangieren <strong>und</strong> auch die<br />
nötige Achtsamkeit bei <strong>de</strong>r Alltagsstrukturierung<br />
bezüglich Bewegung <strong>und</strong><br />
Spiel zu beweisen. Die konkreten<br />
Inhalte orientieren sich dabei an <strong>de</strong>n<br />
bewährten Ausbildungskonzepten <strong>de</strong>r<br />
Aka<strong>de</strong>mie <strong>für</strong> <strong>Motopädagogik</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Mototherapie</strong> (ak’M) im Aktionskreis<br />
Psycho<strong>motorik</strong>. Diese wer<strong>de</strong>n in je einer<br />
Blockwoche in je<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r ersten 3<br />
Ausbildungsjahre angeboten. Der<br />
Referent ist Spezialist im Arbeitsfeld<br />
Psycho<strong>motorik</strong> in <strong>de</strong>r Jugendhilfe, aber<br />
nicht Teil <strong>de</strong>s Kollegiums <strong>und</strong> damit<br />
auch nicht beteiligt an Bewertungsprozessen.<br />
Sein Auftrag ist insbeson<strong>de</strong>re<br />
die Begleitung intensiver Selbst- <strong>und</strong><br />
Gruppenerfahrungen im Bewegungsbereich.<br />
Daneben ist die Teilnahme an <strong>de</strong>n<br />
wöchentlichen Bewegungsangeboten<br />
<strong>de</strong>r Schule verpflichtend. Diese umfassen<br />
– in Absprache mit <strong>de</strong>n Schülern –<br />
klassische Sportarten, aber auch kleine<br />
Spiele, Fitness <strong>und</strong> Ausdauer, sowie<br />
Wan<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Klettern <strong>und</strong> eine<br />
Vertiefung im Bereich Schwimmen <strong>und</strong><br />
Wassersport (Erwerb <strong>de</strong>s Rettungsschwimmabzeichens<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Sportabzeichens).<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als Metho<strong>de</strong><br />
Seit <strong>de</strong>m Bestehen <strong>de</strong>s Psycho<strong>motorik</strong>kurssystems<br />
im Aktionskreis Psycho<strong>motorik</strong><br />
sind diese methodisch immer mit<br />
<strong>de</strong>m Schwerpunkt Selbsterfahrung<br />
konzipiert. Sicher ist dies einer <strong>de</strong>r<br />
Grün<strong>de</strong> <strong>für</strong> die lange Erfolgsgeschichte!<br />
Das ist ein <strong>de</strong>utlicher Gegensatz zu <strong>de</strong>n<br />
Fachschulausbildungen <strong>de</strong>r vergangenen<br />
Jahre, in <strong>de</strong>nen man sich nur<br />
zaghaft an diese Metho<strong>de</strong> heranwagte<br />
(vgl. Denzer 1999). Nicht ohne Gr<strong>und</strong><br />
ist <strong>de</strong>r schulische Kontext doch immer<br />
ein Bewertungs- <strong>und</strong> Selektionskontext.<br />
Seit ca. 15 Jahren fin<strong>de</strong>t – angeregt<br />
vom Verband <strong>de</strong>r Pädagogiklehrer/innen<br />
(VdP) <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Verbreitung von Pädagogik<br />
als Unterrichtsfach auch im<br />
allgemein bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schulwesen - eine<br />
angeregte fachdidaktische Entwicklung<br />
statt. In diesen neuen Konzeptionen<br />
wird nun - behutsamer als in <strong>de</strong>r<br />
gruppendynamisch wil<strong>de</strong>n Zeit <strong>de</strong>r 70er<br />
Jahre – auf die reflektierte <strong>und</strong><br />
vorsichtige Selbsterfahrung als unverzichtbarer<br />
Bereich <strong>de</strong>r Ausbildung<br />
zurückgegriffen. Die Bereitschaft, sich<br />
auf diese biografisch relevanten<br />
Ausbildungsmetho<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Inhalte<br />
einzulassen, ist eine Bedingung <strong>für</strong> die<br />
Zulassung zur Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik.<br />
Erfahrungsorientierte Metho<strong>de</strong>n<br />
verlangen aber an<strong>de</strong>re Strukturen in<br />
allen Dimensionen: Die Beziehung muss<br />
frei von Bewertungen sein können, <strong>de</strong>r<br />
Raum soll zu Spannung <strong>und</strong> Entspannung<br />
<strong>und</strong> zu kreativen, neuen Erfahrungen<br />
einla<strong>de</strong>n, die Zeit muss sich <strong>de</strong>m<br />
Inhalt <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Thema <strong>de</strong>s zu Lernen<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>m Tempo <strong>de</strong>r Lernen<strong>de</strong>n<br />
anpassen – verb<strong>und</strong>en mit einer hohen<br />
Verantwortungsbereitschaft bei <strong>de</strong>n<br />
Lehrer/innen <strong>und</strong> Schüler/innen. Das ist<br />
in normalen Schulumgebungen kaum<br />
anzutreffen. Deshalb haben wir uns zur<br />
Auslagerung dieser Elemente aus <strong>de</strong>m<br />
Schulalltag in die Blockwochen<br />
entschlossen.<br />
Die allgemeinen pädagogischen Inhalte<br />
<strong>de</strong>r Ausbildung wer<strong>de</strong>n über ihre<br />
Umsetzung in Bewegung in einem<br />
an<strong>de</strong>ren Kontext erfahrbar. Gruppendynamische<br />
Entwicklungen in einer<br />
Gruppe können z. B. durch Bewegungsaufgaben<br />
beobachtbar gemacht <strong>und</strong><br />
dargestellt wer<strong>de</strong>n. Dies ermöglicht ein<br />
hohes Maß an sozialer Wahrnehmung,<br />
stärkt Empathie <strong>und</strong> bil<strong>de</strong>t damit eine<br />
wichtige Voraussetzung <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Beruf<br />
<strong>de</strong>r Erzieher/in. Die Lehrkraft bil<strong>de</strong>t bei<br />
diesen Formen <strong>de</strong>r Vermittlung ein<br />
gutes Mo<strong>de</strong>ll, wenn sie in <strong>de</strong>r Lage ist,<br />
sich ganzheitlich, also auch körperlich<br />
präsent zu zeigen <strong>und</strong> die Beziehung zu<br />
<strong>de</strong>n Inhalten <strong>und</strong> zu <strong>de</strong>n Schüler/innen<br />
auf einer guten wissenschaftlichen<br />
Gr<strong>und</strong>lage nach <strong>de</strong>n Prinzipien <strong>de</strong>r<br />
Themenzentrierten Interaktion (Ruth<br />
Cohn) zu gestalten.<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als Prinzip<br />
Mit <strong>de</strong>n Inhalten <strong>und</strong> <strong>de</strong>r selbsterfahrungsorientierten<br />
Metho<strong>de</strong> sind die<br />
Potenziale <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong> allerdings<br />
nicht erschöpft. Wie die Darstellung <strong>de</strong>s<br />
Handlungsfel<strong>de</strong>s zeigt, bieten sich<br />
psychomotorische Prinzipien auch als<br />
Leitlinie bei <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>s<br />
pädagogischen Alltages an. Die<br />
Zeitstrukturen sind so, dass sie einen<br />
Wechsel von Spannung <strong>und</strong> Entspannung<br />
zulassen. Mit einem Beginn um<br />
8.30 Uhr kommen wir <strong>de</strong>n Bedürfnissen<br />
vor allem <strong>de</strong>r Fahrschüler entgegen. Bis<br />
10.00 Uhr fin<strong>de</strong>t regelmäßig <strong>de</strong>r<br />
allgemein bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> 2-stündige Unterricht<br />
statt. Nach einer ausführlichen<br />
Pause, die auch Raum lässt <strong>für</strong> Bewegungsangebote,<br />
fin<strong>de</strong>t von 10.30 bis<br />
13.00 Uhr <strong>de</strong>r berufsbezogene Unterricht<br />
immer in einem Lernfeld statt. Die<br />
Zeitstruktur bestimmt die Lerngruppe<br />
mit <strong>de</strong>r verantwortlichen Lehrkraft.<br />
Darauf folgen praktische Einheiten mit<br />
67
68<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als gestalten<strong>de</strong>s Element in <strong>de</strong>r sozialpädagogischen Ausbildung<br />
Thema Inhalt Zeitstruktur<br />
Vorkurs Ankommen, • Fahrt nach Taizé (Religionspädagogischer 5 Tage Klassenfahrt<br />
orientieren, sich Schwerpunkt)<br />
entschei<strong>de</strong>n, • Basisqualifikation <strong>de</strong>r akM Kurs 1 5 Tage (Blockwoche)<br />
Rollenwechsel • Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport angstfrei<br />
erleben<br />
Am regelmäßigen Schultag: freitags<br />
Unterkurs Ausbildung aktiv • Erlebnispädagogik im Hochseilgarten 2 Tage<br />
mitgestalten, Teil • Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport, Erwerb <strong>de</strong>s Während <strong>de</strong>s Schuljahres 2-4 Wochen-<br />
eines Teams DLRG- <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Sportabzeichens<br />
st<strong>und</strong>en<br />
wer<strong>de</strong>n • Klassenfahrt zu einer Schneefreizeit 5 Tage (Exkursion)<br />
• Basisqualifikation <strong>de</strong>r akM Kurs 2 5 Tage (Blockwoche)<br />
Oberkurs Mit <strong>de</strong>r Gruppe • Erlebnispädagogik im Wald<br />
5 Tage<br />
gemeinsam etwas • Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport; Bewegungsein- Während <strong>de</strong>s Schuljahres 2–4 Wochen-<br />
leisten, auf heiten in einer 4. Gr<strong>und</strong>schulklasse anleiten st<strong>und</strong>en<br />
eigenen Beinen • Basisqualifikation <strong>de</strong>r akM Kurs 2 <strong>und</strong> 5 Tage Blockwoche<br />
stehen<br />
Anleitung zur Praxis<br />
Aner- Sich verabschie- • Reflexion <strong>de</strong>r Erfahrungen im Gruppen- Anteile in <strong>de</strong>r Supervision während <strong>de</strong>r<br />
kennungs<strong>de</strong>n, unterwegs dienst, körperliche Wahrnehmung <strong>de</strong>r 4 Blockwochen<br />
kurs sein<br />
Kin<strong>de</strong>r, Verwendbarkeit <strong>de</strong>s, in <strong>de</strong>r Ausbildung<br />
gelernten<br />
• Gemeinsame Tour (Wan<strong>de</strong>rn, Radfahren,<br />
Bootswan<strong>de</strong>rung)<br />
3 Tage<br />
<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>schule, welche<br />
im gleichen Gebäu<strong>de</strong> beschult wer<strong>de</strong>n<br />
o<strong>de</strong>r eigene Bewegungs- <strong>und</strong> Kreativeinheiten,<br />
sowie die Möglichkeit zum<br />
selbstständigen Lernen (verpflichtend).<br />
Die Räume sind so gestaltet, dass sie<br />
Ruhe <strong>und</strong> Rückzug, aber auch gemeinsames,<br />
bewegungsorientiertes Tun<br />
erlauben. Ziel ist es, in einer „Ges<strong>und</strong>en<br />
Schule“ zu leben, zu lernen <strong>und</strong> zu<br />
arbeiten (vgl. www.anschub.<strong>de</strong>). 9<br />
Schwerpunkte <strong>de</strong>r Ausbildung<br />
über 4 Jahre:<br />
Inhaltlich sind die Anteile von Bewegung,<br />
Spiel <strong>und</strong> Sport zur Vermittlung<br />
von psychomotorischen Handlungskompetenzen<br />
zwischen Intensiveinheiten<br />
(Blockwochen) <strong>und</strong> regelmäßigen<br />
Angeboten verteilt. Die Zusammenarbeit<br />
mit Outward Bo<strong>und</strong> soll <strong>de</strong>n frühen<br />
Kontakt mit <strong>de</strong>r Erlebnispädagogik<br />
ermöglichen, die in <strong>de</strong>r Jugendhilfe eine<br />
wesentliche Rolle als therapeutisches<br />
Angebot spielt. Daneben fährt je<strong>de</strong><br />
Klasse einmal im Jahr auf eine Klassenfahrt<br />
mit einem spezifischen Thema.<br />
Die gezeigten Inhalte sind im Ausbildungsprogramm<br />
so zu entwickeln, dass<br />
9 Dass dies Ziel, <strong>und</strong> noch nicht Realität ist, zeigt<br />
<strong>de</strong>r hohe Raucheranteil unter unseren Schüler/<br />
innen. Aber wir arbeiten daran.<br />
- in Form eines Spiralcurriculums – <strong>de</strong>r<br />
Aspekt von Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport<br />
immer wie<strong>de</strong>r ein zentraler Ausbildungsteil<br />
ist. Hier einige Meilensteine,<br />
die unsere methodisch-didaktische<br />
Arbeit strukturieren:<br />
Vorkurs: Ziel: Berufsentscheidung<br />
f<strong>und</strong>ieren – Vorauszusetzen<strong>de</strong><br />
Fähigkeiten überprüfen<br />
Über ein Jahr sind die Interessent/innen<br />
an einer Ausbildung zur Erzieher/in in<br />
einem Doppelstatus: sie arbeiten in <strong>de</strong>r<br />
Praxiseinrichtung <strong>und</strong> besuchen die<br />
Schule im Zeitverhältnis ¾ zu ¼. Als<br />
Praktikant/innen haben sie die Gelegenheit<br />
ihre Berufsentscheidung gründlich<br />
<strong>und</strong> unter schulischer Anleitung zu<br />
überprüfen. Die schulische Aufgabe in<br />
dieser Zeit ist es, die notwendigen<br />
Reflexionsprozesse anzustoßen <strong>und</strong> zu<br />
begleiten, so dass sozialpädagogisches<br />
Wahrnehmen, Beobachten, Planen,<br />
Han<strong>de</strong>ln <strong>und</strong> Beurteilen <strong>de</strong>utlich wird.<br />
Daneben wer<strong>de</strong>n Lern- <strong>und</strong> Arbeitstechniken<br />
vermittelt, die im späteren<br />
projekt- <strong>und</strong> gruppenorientierten<br />
Unterricht benötigt wer<strong>de</strong>n. Darüber<br />
hinaus wird ein Überblick über das<br />
sozialpädagogische Arbeitsfeld durch<br />
Exkursionen, Fachtage u.s.w. geboten.<br />
Ebenso gilt diese Zeit aber auch <strong>de</strong>r<br />
Überprüfung <strong>de</strong>r notwendigen Voraus-<br />
setzungen <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Erzieher/innenberuf.<br />
Vor allem die erzieherischen Kernkompetenzen<br />
wie kommunikative Fähigkeiten,<br />
Zuverlässigkeit <strong>und</strong> Eigenständigkeit<br />
im Alltag, überdauern<strong>de</strong><br />
Motivation, Fähigkeit zur Teamarbeit,<br />
intellektuelle Leistungsfähigkeit,<br />
persönliche Stabilität in physischer <strong>und</strong><br />
psychischer Hinsicht sind von Lehrkräften,<br />
Praxisanleiter/innen <strong>und</strong> Mitauszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
wahrzunehmen, rückzumel<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> zu beurteilen.<br />
Für die Ausbildung im psychomotorischen<br />
Feld ist die Gelegenheit zur<br />
Aufarbeitung <strong>de</strong>r (oft!) schlechten bis<br />
traumatischen Erfahrungen im Sportunterricht<br />
zu nutzen. Eigene Erfahrungen<br />
im Bewegungsbereich wer<strong>de</strong>n reflektiert<br />
<strong>und</strong> erweitert. Regelmäßige<br />
Bewegungsspiele in <strong>de</strong>r Ausbildungsgruppe<br />
sollen die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>r eigenen physischen Leistungsfähigkeit<br />
för<strong>de</strong>rn 10 .<br />
Körperbezogene Ausbildungselemente<br />
wer<strong>de</strong>n in die Arbeit intensiv einbezogen,<br />
da sie in beson<strong>de</strong>rem Maße die<br />
Persönlichkeitsentwicklung för<strong>de</strong>rn.<br />
Dies können im einzelnen Haltungs-<br />
<strong>und</strong> Bewegungsanalysen sein, Stimm-<br />
<strong>und</strong> Atemarbeit, aber auch erlebnis-<br />
10 Das Sportabzeichen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n DLRG Gr<strong>und</strong>schein<br />
zu absolvieren wären an dieser Stelle<br />
I<strong>de</strong>alziele.
pädagogische Aktionen im Outdoor-<br />
Bereich mit <strong>de</strong>m Augenmerk auf <strong>de</strong>r<br />
Gruppendynamik. Wer sich <strong>für</strong> <strong>de</strong>n<br />
Beruf entschei<strong>de</strong>t <strong>und</strong> als geeignet<br />
eingeschätzt wird, kennt also bereits<br />
die Arbeitstechniken <strong>und</strong> Herausfor<strong>de</strong>rungen,<br />
die während <strong>de</strong>r Ausbildungszeit<br />
auf sie/ihn warten.<br />
Unterkurs: Gr<strong>und</strong>kenntnisse<br />
Sozialpädagogik<br />
Lernfel<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s ersten Ausbildungsjahres<br />
sind:<br />
(1) Wahrnehmen <strong>und</strong> För<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen:<br />
Es wer<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>lle von Entwicklung<br />
miteinan<strong>de</strong>r verglichen, Fragen an<br />
Faktoren von Entwicklung (endogen,<br />
exogen, …) formuliert, anthropologische<br />
Voraussetzungen von Erziehung <strong>und</strong><br />
Entwicklung gelernt, Kenntnisse<br />
phasenspezifischer Verhaltensweisen<br />
<strong>und</strong> Fähigkeiten angeeignet sowie<br />
günstige Bedingungen <strong>für</strong> Entwicklung,<br />
hin<strong>de</strong>rliches <strong>und</strong> hemmen<strong>de</strong>s <strong>für</strong><br />
Entwicklung kennen gelernt.<br />
Aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong><br />
wer<strong>de</strong>n Inhalte angeboten wie:<br />
psychomotorische Entwicklung,<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Handgeschicklichkeit,<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Sinnessysteme <strong>und</strong><br />
För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Wahrnehmung in diesen<br />
Bereichen, Bewegungsbeobachtung.<br />
(2) Pädagogische Angebote <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r<br />
<strong>und</strong> Jugendliche planen <strong>und</strong><br />
durchführen:<br />
Es wer<strong>de</strong>n Planungsmo<strong>de</strong>lle dargestellt<br />
<strong>und</strong> diskutiert, Voraussetzungen<br />
pädagogischer Arbeit eruiert, Wege, um<br />
Ziele zu fin<strong>de</strong>n, festzulegen <strong>und</strong> zu<br />
formulieren, erarbeitet. Konkrete<br />
Angebote wer<strong>de</strong>n unter <strong>de</strong>m Aspekt von<br />
prozess- <strong>und</strong> zielorientiertem Arbeiten<br />
geplant, durchgeführt <strong>und</strong> reflektiert.<br />
Dabei haben die Schüler/innen die<br />
Gelegenheit, kleinere Einheiten unter<br />
kollegialer <strong>und</strong> Lehreranleitung mit<br />
Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen in unterschiedlichen<br />
Kontexten durchzuführen.<br />
(3) Die Gruppe als Sozialisationsinstanz<br />
wahrnehmen <strong>und</strong> leiten<br />
Neben einer intensiven theoretischen<br />
Einheit zu: Rollenbegriff, Beziehungen –<br />
Bindungen, Sozialisation durch die<br />
<strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Gruppe, Gruppenprozesse,<br />
Gruppenphasen, geht es um die<br />
Paul-Georg Berthold<br />
Lernen in Bewegung –<br />
Erlebnisorientiertes Arbeiten im Vorkurs einer Fachschule<br />
<strong>für</strong> Sozialpädagogik<br />
Erlebnispädagogik auf <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Tatsachen zu holen ist ein Anliegen, das<br />
im wahrsten Sinne <strong>de</strong>s Wortes mit Hilfe <strong>de</strong>r Teamparcours in <strong>de</strong>n Hochseilgärten<br />
schon lange Einzug gehalten hat. Ziel ist die Teambildung jenseits schwin<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>r<br />
Höhen. Im Mittelpunkt steht immer die gesamte Gruppe, die entwe<strong>de</strong>r<br />
gemeinsam die gestellte Aufgabe zu lösen vermag o<strong>de</strong>r gemeinsam scheitert.<br />
Teamverantwortliches Denken <strong>und</strong> Han<strong>de</strong>ln sind gefragt. Die Materialien sind<br />
erschwinglich, <strong>de</strong>r Platzbedarf im alltäglichen Rahmen gegeben. Aufgabe <strong>de</strong>r<br />
Schüler/innen war es, eine Distanz von 6 Metern mit Hilfe von 2 Bohlen mit<br />
einer Länge von 2 Metern <strong>und</strong> 3 Pontons mit 10 cm Durchmesser zu überwin<strong>de</strong>n.<br />
Die Pontons wur<strong>de</strong>n aus Abflussrohren hergestellt, die mit Beton ausgegossen<br />
wur<strong>de</strong>n. Anschließend wur<strong>de</strong>n sie mit Moosgummi (Isomatte) ummantelt.<br />
Nur die Pontons durften <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Distanzstrecke berühren. Anfang<br />
<strong>und</strong> En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Strecke waren durch Gymnastikmatten gekennzeichnet.<br />
„Wir schaffen das in weniger als 1 St<strong>und</strong>e“ war die durchaus realistische<br />
Einschätzung <strong>de</strong>r Teilnehmer/innen. Es wur<strong>de</strong> eine spannen<strong>de</strong> St<strong>und</strong>e, die am<br />
En<strong>de</strong> vom gemeinsamen Erfolg gekrönt war <strong>und</strong> einen konkreten Beitrag<br />
leistete, die Gruppe <strong>für</strong> die bevorstehen<strong>de</strong> dreijährige Ausbildungszeit ein Stück<br />
weit zusammenzuführen.<br />
Zwei Bohlen <strong>und</strong> drei Reststücke einer Abflussröhre waren genügend Material,<br />
um das pädagogische Anliegen <strong>de</strong>r Teamparcours <strong>de</strong>utlich zu machen: die<br />
Aufgabenstellung ist ein<strong>de</strong>utig <strong>und</strong> klar, <strong>de</strong>r Lösungsweg muss von allen<br />
gef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> gegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
konkrete Einübung in <strong>de</strong>r Leitung<br />
von Gruppen. Dies fin<strong>de</strong>t zunächst<br />
unter Anleitung in <strong>de</strong>r eigenen Klasse<br />
statt.<br />
Oberkurs: Professionelles, zielgruppenorientiertes<br />
Planen <strong>und</strong> Durchführen<br />
von Erziehung<br />
Erarbeitung <strong>de</strong>r Fähigkeiten, um <strong>de</strong>n<br />
Entwicklungsstand von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen aufgr<strong>und</strong> wissenschaftlicher<br />
Standards festzustellen.<br />
In Rollen- <strong>und</strong> Planspielen wer<strong>de</strong>n<br />
spezifische Handlungssituationen <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe geplant, durchgeführt<br />
<strong>und</strong> reflektiert:<br />
• Die Aufnahme eines Kin<strong>de</strong>s<br />
• Das Hilfeplangespräch mit <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Festlegung <strong>de</strong>s<br />
Hilfeplans<br />
• Die schulische Begleitung <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s,<br />
insbeson<strong>de</strong>re die Gestaltung <strong>de</strong>r<br />
Hausaufgabensituation.<br />
Im Mittelpunkt <strong>de</strong>r Vermittlung von<br />
psychomotorischen Handlungskompetenzen<br />
steht die Anleitung von Bewegungsst<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> Spielsituationen im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Sportunterrichts einer 4.<br />
Gr<strong>und</strong>schulklasse in Kleingruppen. Dies<br />
geschieht in Kooperation mit <strong>de</strong>r<br />
Gr<strong>und</strong>schule, <strong>de</strong>ren Kin<strong>de</strong>r von einem<br />
lebendigen <strong>und</strong> aufwändigen Bewegungsunterricht<br />
profitieren.<br />
69
70<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als gestalten<strong>de</strong>s Element in <strong>de</strong>r sozialpädagogischen Ausbildung<br />
Anerkennungskurs: Reflektiertes<br />
pädagogisches Han<strong>de</strong>ln in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
Nach Abschluss <strong>de</strong>s Oberkurses sind die<br />
Absolventen – nun als Erzieher/innen<br />
im Anerkennungsjahr – Teil eines Teams<br />
in einer Jugendhilfeeinrichtung. Mit <strong>de</strong>r<br />
Schule sind sie über die betreu-<br />
en<strong>de</strong> Lehrkraft <strong>und</strong> die Blockwochen<br />
verb<strong>und</strong>en. Das Umsetzen folgen<strong>de</strong>r<br />
Gr<strong>und</strong>handlungen sollte nun selbstverständlich<br />
vollzogen wer<strong>de</strong>n können:<br />
Pädagogisches Gr<strong>und</strong>verständnis zeigen,<br />
beruhend auf Achtung <strong>und</strong> Dialog; in<br />
Team <strong>und</strong> Einzelarbeit sind Selbständigkeit<br />
<strong>und</strong> Selbstverantwortung zu<br />
beobachten, das soziale Miteinan<strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>r Gruppe wird abwechslungsreich,<br />
vielseitig bewegungsorientiert <strong>und</strong><br />
situationsbezogen, aber auch in<br />
Beachtung <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n Hilfepläne<br />
gestaltet. Dabei sollte <strong>de</strong>r Orientierung<br />
an Körper, Bewegung <strong>und</strong> Spiel Rechnung<br />
getragen wer<strong>de</strong>n. Alle Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
an eine Fachkraft im Erziehungsdienst<br />
wer<strong>de</strong>n im Laufe <strong>de</strong>s Jahres<br />
selbstständig <strong>und</strong> korrekt bewältigt.<br />
Ausblick<br />
Im Laufe <strong>de</strong>r Ausbildung verän<strong>de</strong>rt sich<br />
also <strong>de</strong>r Schwerpunkt im Bewegungsbereich<br />
von <strong>de</strong>r Selbsterfahrung hin zur<br />
selbständigen Anwendung <strong>und</strong> Evaluation.<br />
Im dritten Jahr arbeiten wir nun<br />
an <strong>und</strong> mit <strong>de</strong>m Lernfeldkonzept. Seit<br />
zwei Jahren mit <strong>de</strong>m Schwerpunkt im<br />
Bereich Psycho<strong>motorik</strong> in ihrer umfassen<strong>de</strong>n<br />
Be<strong>de</strong>utung.<br />
Seit einem Jahr haben wir sehr gute<br />
Bedingungen, was das Raumangebot<br />
<strong>und</strong> die Möglichkeit <strong>für</strong> schulbegleiten<strong>de</strong><br />
Praktika 11 unter direkter Anleitung<br />
durch die Lehrkräfte <strong>de</strong>r Schule angeht.<br />
11 Unsere Räume befin<strong>de</strong>n sich im Gebäu<strong>de</strong> einer<br />
Gr<strong>und</strong>schule mit 200 Kin<strong>de</strong>rn multikultureller<br />
Herkunft!<br />
Wir sehen die erheblichen Fortschritte<br />
in <strong>de</strong>r Selbstständigkeit <strong>und</strong> hohen<br />
Kompetenz, die unsere Schüler/innen in<br />
das Arbeitsfeld mitbringen. Auch in <strong>de</strong>r<br />
Vergangenheit war durch die heimbezogenen<br />
Praktika <strong>und</strong> die strikte Ausrichtung<br />
auf die Jugendhilfe in <strong>de</strong>r Theorie,<br />
die Übernahme in das Arbeitsfeld <strong>und</strong><br />
die Zusammenarbeit <strong>de</strong>r Einrichtungen<br />
mit <strong>de</strong>r Schule gut, wir hoffen durch die<br />
qualitative Verbesserung im Bereich <strong>de</strong>r<br />
psychomotorisch orientierten Persönlichkeitsför<strong>de</strong>rung<br />
diesen Standard<br />
weiter zu steigern.<br />
Eine Berufsausbildung zu absolvieren ist<br />
eine zentrale Entwicklungsaufgabe! In<br />
<strong>de</strong>r engen Begleitung, die durch <strong>de</strong>n<br />
schulischen Kontext gegeben ist, liegt<br />
dabei eine große Chance <strong>für</strong> die<br />
Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n, die sich darauf<br />
einlassen können. Die Rückmeldungen<br />
im Rahmen <strong>de</strong>r Qualitätssicherung, die<br />
regelmäßig anonym von <strong>de</strong>n Klassen<br />
<strong>und</strong> beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>n Absolventinnen<br />
eingefor<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, zeigen, wie<br />
bewusst auch ihnen die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s<br />
biografischen Lernens <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Selbsterfahrung<br />
in allen Bereichen <strong>de</strong>r erzieherischen<br />
Arbeit ist. Dies gilt insbeson<strong>de</strong>re<br />
<strong>für</strong> die wesentliche Herausfor<strong>de</strong>rung in<br />
<strong>de</strong>r Jugendhilfe: <strong>de</strong>r Fähigkeit zu einer<br />
konstruktiven Teamarbeit. Sie benötigt<br />
Standfestigkeit <strong>und</strong> Anpassungsvermögen.<br />
Um diese Eigenschaften in <strong>de</strong>r<br />
Ausbildung zu vertiefen, geht kein Weg<br />
an erfahrungsorientierten, psychomotorischen<br />
Metho<strong>de</strong>n vorbei!<br />
Den Gewinn sollten die AbsolventInnen,<br />
die Kin<strong>de</strong>r – <strong>und</strong> Jugendlichen <strong>und</strong><br />
damit auch die Träger <strong>de</strong>r Jugendhilfeeinrichtungen<br />
haben.<br />
Literatur:<br />
Aucouturier, B. (2006): Der Ansatz<br />
Aucouturier – Handlungsfantasmen<br />
<strong>und</strong> psychomotorische<br />
Praxis. Bonn: proiecta.<br />
Denzer, M. (1999): Erfahrungsorientierte<br />
Elemente in <strong>de</strong>r Ausbildung<br />
von Kin<strong>de</strong>rpflegerinnen –<br />
unveröffentlichte Zulassungs-<br />
arbeit zum zweiten Staats-<br />
examen <strong>für</strong> das Lehramt an<br />
beruflichen Schulen Neunkirchen<br />
(1999).<br />
Dräbing, R. (2006): Bewegung, Spiel<br />
<strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>n Ausbildungsgängen<br />
an Fachhochschulen in<br />
NRW. In: Dräbing, R.: Kin<strong>de</strong>r<br />
brauchen Bewegung! Bewegung<br />
in <strong>de</strong>r Jugendhilfe? Aachen:<br />
Meyer & Meyer. S. 338–348.<br />
Flosdorf, P. (1988): Theorie <strong>und</strong><br />
Praxis stationärer Erziehungshilfe,<br />
Bd. 2. Freiburg i. Br.:<br />
Lambertus.<br />
Gün<strong>de</strong>r, R. (2007): Praxis <strong>und</strong><br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Heimerziehung –<br />
Entwicklungen, Verän<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>und</strong> Perspektiven <strong>de</strong>r stationären<br />
Erziehungshilfe. Freiburg i. Br.:<br />
Lambertus.<br />
Hammer, R. (2001): Bewegung allein<br />
genügt nicht. Dortm<strong>und</strong>:<br />
mo<strong>de</strong>rnes lernen.<br />
IgfH (2007): Forum Erziehungshilfe<br />
Heft 1/2007, Themenschwerpunkt<br />
„Körperlichkeit“.<br />
Krüger, F. W. (2001) : Ausbildungskonzepte<br />
an Berufsfachschulen<br />
<strong>und</strong> Fachschulen <strong>für</strong> Sozialpädagogik<br />
im Bereich Bewegungserziehung/Sport.<br />
In: Zimmer, R./<br />
Hunger, I.: Kindheit in Bewegung.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
S. 195–202.<br />
Macsenaere, M. (2006): 10 Jahre<br />
Wirkungsforschung in <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe: Welche<br />
Bef<strong>und</strong>e lassen sich daraus <strong>für</strong><br />
die Psycho<strong>motorik</strong> gewinnen?<br />
<strong>motorik</strong> 4, S. 194–200.<br />
Mahlke, W./Schwarte, N. (1989):<br />
Raum <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r. Weinheim:<br />
Beltz.
Albert Müller<br />
Der „Semisport“ – ein Beispiel wirkungsvoller<br />
Theorie-Praxis-Vernetzung<br />
im Überregionalen Beratungs- <strong>und</strong><br />
Behandlungszentrum (ÜBBZ) Würzburg<br />
Da es das Ziel heilpädagogischer Ausbildung ist, die fachlichen, handlungs- <strong>und</strong><br />
personenbezogenen Kompetenzen angehen<strong>de</strong>r Heilpädagoginnen zu differenzieren<br />
<strong>und</strong> zu erweitern, müssen Berufs- <strong>und</strong> Lebenserfahrung, theoretisches Fachwissen<br />
<strong>und</strong> heilpädagogische Handlungskompetenzen angemessen integriert wer<strong>de</strong>n. Dies<br />
geschieht u.a. in <strong>de</strong>r spezifischen Lehr- <strong>und</strong> Lernform <strong>de</strong>s Praxisfel<strong>de</strong>s. Hier wird ein<br />
kontextangemessener Transfer von fachtheoretischem Handlungswissen auf<br />
verschie<strong>de</strong>ne heilpädagogische Problemstellungen <strong>und</strong> Tätigkeitsfel<strong>de</strong>r geleistet.<br />
Die anvisierte Theorie – Praxis – Vernetzung heilpädagogischer Vollzeitausbildung<br />
wird am Beispiel <strong>de</strong>s Metho<strong>de</strong>nfachs- <strong>und</strong> Praxisfel<strong>de</strong>s „Motopädagogische <strong>und</strong><br />
mototherapeutische För<strong>de</strong>rung von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen mit Verhaltensstörungen“<br />
dargestellt. Da diese Terminologie im alltäglichen Sprachgebrauch zu umständlich<br />
ist, hat sich im Verlauf <strong>de</strong>r Jahre bei <strong>de</strong>n betroffenen Kin<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Begriff<br />
„Semisport“ eingebürgert.<br />
Organisatorisches zum<br />
„Semisport“<br />
Konzeptuell ist <strong>de</strong>r „Semisport“ im<br />
Therapeutischen Heim St. Josef <strong>und</strong> im<br />
Heilpädagogischen Seminar verankert.<br />
Bei<strong>de</strong> Institutionen sind Teil <strong>de</strong>s ÜBBZ.<br />
„Semisport“ im Unterschied zum „Spiel<br />
– Sport“ heißt diese Aktivität <strong>de</strong>shalb,<br />
weil die Kin<strong>de</strong>r in diesem Konzept mit<br />
<strong>de</strong>n Studieren<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Heilpädagogischen<br />
Seminars zu tun haben, die sich<br />
Handlungskompetenz in diesem<br />
Metho<strong>de</strong>nfach erwerben wollen.<br />
Inhaltlich ist <strong>de</strong>r „Semisport“ in vielen<br />
wichtigen Teilen mit <strong>de</strong>m „Spiel –<br />
Sport“ Konzept vergleichbar. Die<br />
Unterschie<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n im Fortgang <strong>de</strong>r<br />
Beschreibung <strong>de</strong>s Konzepts entsprechend<br />
<strong>de</strong>utlich gemacht.<br />
Jeweils zwei Studieren<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Heilpädagogischen<br />
Seminar gestalten wöchentlich<br />
dienstags <strong>und</strong> donnerstags von<br />
12:00–13:00 psychomotorische<br />
För<strong>de</strong>rst<strong>und</strong>en <strong>für</strong> eine Gruppe von<br />
Kin<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s therapeutischen Heimes St.<br />
Josef. Die Planung <strong>und</strong> Gestaltung<br />
dieses Gruppenkonzeptes liegen in <strong>de</strong>r<br />
Verantwortung <strong>de</strong>s jeweiligen Leiterpairings.<br />
Die einzelnen Einheiten wer<strong>de</strong>n<br />
regelmäßig durch die Spiegelscheiben-<br />
beobachtung begleitet <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r sich<br />
anschließen<strong>de</strong>n Praxisanleitung reflexiv<br />
<strong>und</strong> prospektiv ausgewertet. In einem<br />
Schuljahr wer<strong>de</strong>n ca. 45 bis 50 „Semisport“-Einheiten<br />
absolviert, so dass<br />
je<strong>de</strong>s Leiterpaar eigenverantwortlich<br />
min<strong>de</strong>stens 15 Einheiten durchführt<br />
<strong>und</strong> die restliche Zeit durch Verhaltensbeobachtung<br />
<strong>und</strong> Praxisanleitung die<br />
Kolleginnen unterstützt. Seit 1981<br />
führen wir dieses Konzept durch.<br />
Die momentane „Semisport“-Gruppe<br />
besteht aus 2 Mädchen <strong>und</strong> 6 Jungen<br />
im Alter von 7–11 Jahren. Die Kin<strong>de</strong>r<br />
leben in drei unterschiedlichen Heimgruppen<br />
(„blaue“, „grüne“ <strong>und</strong> „5-<br />
Tagegruppe“) <strong>de</strong>s therapeutischen<br />
Heimes St. Josef <strong>und</strong> besuchen dieselbe<br />
Heimklasse <strong>de</strong>r Elisabeth-Weber-<br />
Schule, einer För<strong>de</strong>rschule zur Erziehungshilfe,<br />
die in das Maßnahmekonzept<br />
<strong>de</strong>s Therapeutischen Heimes<br />
integriert ist <strong>und</strong> zum ÜBBZ-Verb<strong>und</strong><br />
gehört.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> kann <strong>für</strong> alle Kin<strong>de</strong>r<br />
ein gemeinsamer St<strong>und</strong>enbeginn<br />
organisiert wer<strong>de</strong>n. Die St<strong>und</strong>e beginnt<br />
mit <strong>de</strong>m Abholen <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r im<br />
Pausenhof, wobei die Möglichkeit eines<br />
kurzen Austausches zwischen Heilpädagogin<br />
<strong>und</strong> Lehrerin genutzt wird. Im<br />
Anschluss <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e besteht die<br />
Möglichkeit eines Austausches zwischen<br />
Heilpädagogin <strong>und</strong> Erziehern<br />
<strong>de</strong>r jeweiligen Gruppe. Diese aktuellen<br />
Kommunikationsmöglichkeiten<br />
wer<strong>de</strong>n vor allem genutzt, um die<br />
einzelnen Übergänge, die die Kin<strong>de</strong>r<br />
zu leisten haben, reibungsloser zu<br />
gestalten.<br />
Die wöchentlich stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Erziehungsplankonferenz<br />
(EPK) <strong>de</strong>s therapeutischen<br />
Heimes repräsentiert jedoch<br />
die eigentliche Informations- <strong>und</strong><br />
Kommunikationsbörse. Hier laufen alle<br />
Informationen über das Lebensfeld<br />
„Heim“ zusammen <strong>und</strong> wer<strong>de</strong>n daraufhin<br />
fokussiert, ob die Zielerreichung im<br />
Sinne einer person- <strong>und</strong> umweltorientierten<br />
Entwicklungsverän<strong>de</strong>rung<br />
gegeben ist.<br />
Die Kin<strong>de</strong>rgruppe<br />
Die Symptomatik <strong>de</strong>r Aufmerksamkeits<strong>de</strong>fizit-Hyperaktivitätsstörung<br />
(ADHD)<br />
imponiert bei einem Großteil <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r.<br />
Hier han<strong>de</strong>lt es sich um eine im<br />
Gr<strong>und</strong>schulalter häufige, meist persistieren<strong>de</strong><br />
Problematik, mit hoher<br />
psychiatrischer Komorbidität <strong>und</strong><br />
erheblich ungünstiger Auswirkung auf<br />
die Gesamtentwicklung <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r.<br />
Daher kommt einer rechtzeitigen<br />
heilpädagogischen För<strong>de</strong>rung <strong>und</strong><br />
Behandlung individueller <strong>und</strong> sozialer<br />
Kompetenzen ein hoher Stellenwert zu.<br />
Die heilpädagogische För<strong>de</strong>rung wird<br />
durch medizinische Maßnahmen<br />
gestützt. Symptomkriterien <strong>de</strong>r ADHD<br />
betreffen die Aufmerksamkeit (Konzentrationsmangel,<br />
Ablenkbarkeit, kurze<br />
Aufmerksamkeitsspanne), Impulssteuerung<br />
(mangeln<strong>de</strong> kognitive Impulskontrolle)<br />
<strong>de</strong>r körperlichen Aktivität<br />
(vermehrte motorische Unruhe,<br />
Hyperaktivität). Diese Kin<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n<br />
71
72<br />
Der „Semisport“ – ein Beispiel wirkungsvoller Theorie-Praxis-Vernetzung<br />
häufig <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen an die<br />
selektive Aufmerksamkeit, an die<br />
Modulation <strong>de</strong>r Aufgabenwechselprozesse,<br />
an die Antizipation, an die strategischen<br />
Planungsprozesse, an die<br />
kognitive <strong>und</strong> emotive Kontrolle, an das<br />
Arbeitsgedächtnis, <strong>de</strong>n Gedächtnisabruf<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n Antrieb nicht gerecht.<br />
Bei fast allen Kin<strong>de</strong>rn ist diese psychiatrische<br />
ADHD Diagnose gekoppelt mit<br />
sozialer Opposition <strong>und</strong> Aggressivität<br />
(Dissozialität) ohne eine Aussage<br />
darüber zu treffen, wie die Ursache –<br />
Wirkverhältnisse sich zusammensetzen.<br />
Die Mischung allerdings ist immer eine<br />
brisante, ja explosive. Die Mehrzahl <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r kommt aus überlasteten<br />
Familien <strong>und</strong> wird durch „Überfor<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r Mutter als verbleiben<strong>de</strong><br />
Erziehungsperson nach Scheidung“ <strong>und</strong><br />
durch intrafamiliale Kommunikationsprobleme<br />
(Gewalt, Misshandlung) stark<br />
belastet. Zu<strong>de</strong>m leben viele Kin<strong>de</strong>r<br />
unter chronifizierten Belastungen, die<br />
länger als ein halbes Jahr andauern.<br />
Hier ist vor allem gemeint, dass<br />
elterliche Beziehungen durch Trennung<br />
<strong>und</strong> Streit extrem angespannt sind <strong>und</strong>/<br />
o<strong>de</strong>r dass chronisch extreme Vernachlässigung<br />
(emotional, normativ <strong>und</strong><br />
physisch) besteht. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
rückt nicht nur das Kind individuumsorientiert<br />
in <strong>de</strong>n therapeutischen<br />
Albert Müller<br />
Dipl.-Pädagoge, Dipl.-Sportlehrer<br />
Ausbildungsleiter <strong>und</strong> Dozent <strong>de</strong>r<br />
FAK-Heilpädagogik Würzburg;<br />
Schwerpunkte: Entwicklungsför<strong>de</strong>rung<br />
von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen mit<br />
massiven Störungen <strong>de</strong>s Erlebens <strong>und</strong><br />
Verhaltens.<br />
Anschrift <strong>de</strong>s Verfassers:<br />
ÜBBZ<br />
Wilhelm-Dahl-Str. 19<br />
97070 Würzburg<br />
Blickpunkt, son<strong>de</strong>rn auch das Familiensystem;<br />
d. h. die Elternarbeit <strong>und</strong><br />
Elterntherapie stellt ein eigenständiges<br />
Konzept innerhalb <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s<br />
Kin<strong>de</strong>s dar. Nicht nur das Kind, son<strong>de</strong>rn<br />
auch das Umfeld wird begleitet <strong>und</strong><br />
unterstützt.<br />
Der „Semisport“<br />
Damit Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche mit <strong>de</strong>n<br />
oben beschriebenen tiefgreifen<strong>de</strong>n<br />
Entwicklungs- <strong>und</strong> Beziehungsstörungen<br />
<strong>de</strong>n notwendigen emotiven <strong>und</strong><br />
normativen Halt zum Aufbau von<br />
Eigenkontrolle, von prosozialen<br />
Einstellungen <strong>und</strong> Haltungen gewinnen<br />
können, braucht es zeitliche <strong>und</strong><br />
personale Präsenz <strong>und</strong> Responsivität <strong>de</strong>r<br />
Heilpädagoginnen. So drängt sich hier<br />
die Frage auf, ob <strong>de</strong>r Wechsel <strong>de</strong>r<br />
Leiterinnen <strong>für</strong> die Kin<strong>de</strong>rgruppe nicht<br />
eine überfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Zumutung darstellt.<br />
Viel besser wäre ja die Konstanz <strong>und</strong><br />
Stabilität <strong>de</strong>r Bezugspersonen über <strong>de</strong>n<br />
Zeitraum eines Schuljahres. In <strong>de</strong>r Tat<br />
wer<strong>de</strong>n die personellen Übergänge sehr<br />
sensibel bedacht <strong>und</strong> die Kin<strong>de</strong>r<br />
rechtzeitig darauf vorbereitet. Hinsichtlich<br />
<strong>de</strong>r Ziele <strong>und</strong> Interventionen<br />
besteht durch die regelmäßig stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Praxisanleitung eine verbindliche<br />
Setzung, so dass die Gruppe nicht durch<br />
permanent neue Regeln <strong>und</strong> Normen<br />
überfor<strong>de</strong>rt wird. Es ist allerdings nicht<br />
von <strong>de</strong>r Hand zu weisen, dass <strong>de</strong>r Personenwechsel<br />
mit <strong>de</strong>n damit verb<strong>und</strong>enen<br />
neuen sozialen Wahrnehmungen <strong>und</strong><br />
Verän<strong>de</strong>rungsnuancen eine starke<br />
Herausfor<strong>de</strong>rung kindlicher Organisationskompetenz<br />
mit sich bringt. Es wird<br />
das neuerliche Ausprobieren <strong>de</strong>r<br />
Grenzen ins Feld geführt. Es wird um<br />
die Verteilung neuer Rangordnungen<br />
<strong>und</strong> Anerkennung gekämpft. Dieser<br />
Wechsel bietet somit auch die Möglichkeit,<br />
prozessdiagnostisch die Stabilität<br />
<strong>de</strong>r Selbststeuerung im Sinne <strong>de</strong>s<br />
„inneren Haltes“ eines Kin<strong>de</strong>s zu<br />
überprüfen <strong>und</strong> zu stützen.<br />
Trotz dieser einschränken<strong>de</strong>n Bedingungen<br />
wird die individuelle <strong>und</strong> soziale<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s „Semisports“ im Verb<strong>und</strong><br />
mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Metho<strong>de</strong>nkonzepten<br />
<strong>de</strong>s Therapeutischen Heimes betont.<br />
Dieses Konzept trägt zum Aufbau <strong>und</strong><br />
zur För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Eigeninitiative, <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung von prosozialen Einstellungen,<br />
Verhaltensweisen <strong>und</strong> Werten bei.<br />
Daneben gewinnt <strong>de</strong>r „Semisport“<br />
zusätzliche erzieherische <strong>und</strong> gesellschaftliche<br />
Be<strong>de</strong>utung als Ausgleich<br />
<strong>und</strong> Entspannung, als Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge<br />
gera<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Folie von Technisierung<br />
<strong>und</strong> Wan<strong>de</strong>l unserer Lebensbedingungen<br />
hinsichtlich Internet,<br />
Medien, Zunahme chronischer Erkrankungen.<br />
Im „Semisport“ wird ein sowohl<br />
individuums- wie gruppenzentriertes<br />
motorisches <strong>und</strong> soziales Erfahrungsfeld<br />
geschaffen mit <strong>de</strong>r Ausrichtung <strong>und</strong><br />
Dominanz auf das soziale Lernen. In<br />
diesem Sozial- <strong>und</strong> Lebensraum gibt es<br />
wie an<strong>de</strong>rnorts Außenseiter, Gruppenstars,<br />
Streit, oppositionelles, dissoziales<br />
<strong>und</strong> gewalttätiges Verhalten. Diese<br />
Heterogenität <strong>de</strong>r Gruppenmitglie<strong>de</strong>r ist<br />
kein Hin<strong>de</strong>rnis, son<strong>de</strong>rn das Beziehungsfeld,<br />
um individuums- <strong>und</strong><br />
gruppenbezogene Aktivitäten entwickeln<br />
<strong>und</strong> durchführen zu können.<br />
Ziele <strong>de</strong>s „Semisportes“<br />
Die Kin<strong>de</strong>r mit Aufmerksamkeits-/<br />
Hyperaktivitätsstörungen <strong>und</strong> aggressiven<br />
Durchsetzungsstilen sollen von<br />
<strong>de</strong>n körperbezogenen Interventionsangeboten<br />
<strong>de</strong>s „Semisportes“ profitieren.<br />
Einerseits wird ihrem Bedürfnis nach<br />
motorischer Aktivität <strong>und</strong> körperlicher<br />
Bewegung Rechnung getragen,<br />
an<strong>de</strong>rerseits soll die Fähigkeit zur<br />
Selbstregulation <strong>und</strong> Handlungssteuerung<br />
bei auftreten<strong>de</strong>n impulsiven<br />
Verhalten geför<strong>de</strong>rt <strong>und</strong> gestützt<br />
wer<strong>de</strong>n. Im achtsamen Umgang wird<br />
durch Übungen <strong>und</strong> Training eine<br />
gewisse Besserfunktion <strong>und</strong> eine<br />
metakognitive Bewusstheit entwickelt.<br />
Die konstruktive Aggression zielt auf die<br />
Klärung <strong>de</strong>r Beziehungssituation <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Sache. Auf diesem Wege wird die<br />
„dicke Luft“ zwischen zwei Streithähnen<br />
o<strong>de</strong>r in einer Gruppe bereinigt o<strong>de</strong>r<br />
lassen sich streiten<strong>de</strong> Parteien erst<br />
einmal Luft ab, so dass in Folge ein<br />
unbeschwerterer Umgang untereinan<strong>de</strong>r<br />
möglich wird. Diese Form <strong>de</strong>r<br />
prosozialen Auseinan<strong>de</strong>rsetzung erweist<br />
sich als lohnend hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
Konfliktklärung <strong>und</strong> Konfliktbearbeitung.<br />
Wenn <strong>de</strong>r Zorn „verraucht“, das<br />
„Mütchen abgekühlt“ ist, bei<strong>de</strong> Seiten<br />
zur Deeskalation <strong>de</strong>r angespannten<br />
Situation ihren Teil beigetragen haben,<br />
fällt das Sich-Vertragen leichter. Von<br />
daher streben wir mit <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen danach, eine solche Form
<strong>de</strong>r lösungsorientierten konstruktiven<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen zu entwickeln.<br />
Hier<strong>für</strong> brauchen die Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendlichen u. a. folgen<strong>de</strong> soziale<br />
Basiskenntnisse <strong>und</strong> -fertigkeiten, die<br />
sie anfangs nicht verfügbar haben <strong>und</strong><br />
die im gemeinsamen Erfahrungsprozess<br />
aufgebaut wer<strong>de</strong>n sollen:<br />
• genau hinhören, hinschauen, was<br />
ist, statt seinem Vorurteil sofort<br />
Glauben zu schenken<br />
• Blickkontakt zu seinem Gegenüber<br />
aufbauen<br />
• <strong>de</strong>utlich <strong>und</strong> laut sprechen<br />
• direktes <strong>und</strong> offenes Ausdrücken<br />
von positiven <strong>und</strong> negativen<br />
Gefühlen<br />
• Wünsche <strong>und</strong> For<strong>de</strong>rungen klar<br />
äußern<br />
• Kritik in annehmbarer Weise<br />
geben<br />
• Kritik aufmerksam anhören<br />
• unberechtigte For<strong>de</strong>rungen<br />
verbindlich ablehnen<br />
• Fehler machen, Fehler eingestehen<br />
<strong>und</strong> aus <strong>de</strong>n Fehlern lernen<br />
(Fehlerfre<strong>und</strong>lichkeit)<br />
• ein Gr<strong>und</strong>gefühl <strong>für</strong> fairen,<br />
gerechten Ausgleich entwickeln<br />
(von <strong>de</strong>m Guten ein bisschen<br />
mehr, von <strong>de</strong>m Unguten ein<br />
bisschen weniger zurückgeben)<br />
• sich wehren mit fairen Mitteln<br />
• eine Pause vor <strong>de</strong>n aggressiven<br />
Impuls setzen.<br />
Im nächsten Kapitel soll das inhaltliche<br />
<strong>und</strong> methodische Konzept <strong>de</strong>s „Semisportes“<br />
als Lernfeld <strong>für</strong> die oben<br />
beschriebenen sozialen Basiskenntnisse<br />
<strong>und</strong> -fertigkeiten umrissen wer<strong>de</strong>n.<br />
Inhalte <strong>de</strong>s „Semisportes“<br />
Wie schon bei <strong>de</strong>n Zielen besprochen,<br />
sollen die Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen im<br />
„Semisport“ einen konstruktiven<br />
Umgang im Kontext aggressiver Impulse<br />
<strong>und</strong> Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen lernen.<br />
Schwierigkeiten <strong>und</strong> Probleme wer<strong>de</strong>n<br />
zur Darstellung kommen. Prosoziale<br />
Kompetenzen können bei <strong>de</strong>r Bearbeitung<br />
von schwierigen <strong>und</strong> problematischen<br />
Situationen entwickelt wer<strong>de</strong>n.<br />
So verw<strong>und</strong>ert es nicht, dass im<br />
Konzept <strong>de</strong>s „Semisports“ neben vielen<br />
an<strong>de</strong>ren Spiel-, Übungs- <strong>und</strong> Handlungsanreizen<br />
auch Kampf-, Rauf-,<br />
Zieh- <strong>und</strong> Drückspiele angeboten<br />
wer<strong>de</strong>n. Die St<strong>und</strong>enabläufe erfolgen<br />
allerdings im Sinne einer Rhythmisierung<br />
von psychomotorisch expansiven,<br />
lauten <strong>und</strong> psychomotorisch ruhigen,<br />
konzentrierten <strong>und</strong> in die Innerlichkeit<br />
führen<strong>de</strong>n Handlungsmustern. Erfahrungsfel<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r Entspannung folgen auf<br />
Erfahrungsfel<strong>de</strong>r von Anspannung.<br />
Bei <strong>de</strong>n Kampfspielen stehen dabei<br />
Themen wie Kraft <strong>und</strong> Aggression, Nähe<br />
<strong>und</strong> Distanz, regelkonformes Kämpfen,<br />
strukturiertes Kämpfen zwischen <strong>de</strong>n<br />
Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen, zwischen<br />
<strong>de</strong>m Kind <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Pädagogen im<br />
Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong>.<br />
Dabei machen wir die Erfahrung, dass<br />
Kin<strong>de</strong>r beim Kämpfen, Balgen <strong>und</strong><br />
Raufen ausgesprochen Freu<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r<br />
körperlich han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
haben. Sie suchen die körperliche<br />
Berührung, um einerseits ihre Kräfte zu<br />
messen <strong>und</strong> an<strong>de</strong>rerseits im Spannungsfeld<br />
<strong>de</strong>r „Angst-Lust“ ihre<br />
Grenzen abzurastern, die sich hinter<br />
<strong>de</strong>m Wagnis <strong>de</strong>s Kämpfens verbergen.<br />
Sie suchen <strong>de</strong>n Thrill, das Bauchkribbeln<br />
<strong>de</strong>s Austobens, for<strong>de</strong>rn über das<br />
körperliche Wagen Grenzsituationen zur<br />
dinglichen <strong>und</strong> menschlichen Umwelt<br />
heraus. Dieses Ausloten von Grenzen ist<br />
<strong>für</strong> die individuelle Entwicklung von<br />
großer Be<strong>de</strong>utung. Dies umso mehr als<br />
bei <strong>de</strong>m Spiel mit <strong>de</strong>n eigenen Grenzen<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n Grenzen <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren das<br />
eigene Selbstkonzept gegrün<strong>de</strong>t wird.<br />
Der Aufbau in die Bewältigbarkeit <strong>de</strong>r<br />
Konfliktsituation über <strong>de</strong>n angemessenen<br />
körperlichen Einsatz legt die<br />
Basis <strong>für</strong> das Vertrauen in die eigenen<br />
psychomotorischen Kompetenzen,<br />
unterstützt unmittelbar die I<strong>de</strong>ntitätsfindung<br />
auf <strong>de</strong>r Folie <strong>de</strong>s „fair play“. Der<br />
richtige Einsatz <strong>de</strong>r Kraft im Spannungsfeld<br />
zwischen Mut, Übermut,<br />
zwischen Nähe <strong>und</strong> Distanz, zwischen<br />
Hast <strong>und</strong> Warten-Können, zwischen<br />
fairem Kämpfen <strong>und</strong> willkürlichen<br />
Regelüberschreitungen för<strong>de</strong>rt die<br />
Selbstkontrolle. Einmal in <strong>de</strong>r Rücknahme<br />
<strong>de</strong>s eigenen Krafteinsatzes, um <strong>de</strong>m<br />
an<strong>de</strong>ren nicht weh zu tun, aber auch in<br />
<strong>de</strong>r Forcierung <strong>de</strong>r eigenen Verteidigungskräfte,<br />
damit es <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re nicht<br />
zu leicht hat. Bei<strong>de</strong> Einstellungen sind<br />
ein Beitrag zur Fairness <strong>und</strong> betonen<br />
<strong>de</strong>n Respekt vor <strong>de</strong>m Gegner (<strong>de</strong>m<br />
Gegenüber).<br />
Bei <strong>de</strong>n Entspannungs-Spielen bringen<br />
die Kin<strong>de</strong>r sich selber in eine räumliche<br />
<strong>und</strong> personale Begrenzung. Im „Meister<br />
<strong>de</strong>r Selbstbeherrschung“ erfahren die<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen in <strong>de</strong>r zuerst<br />
nur rein äußerlich zu beobachten<strong>de</strong>n<br />
„Ruhe“ <strong>de</strong>n Gegenpol zum motorisch<br />
expansiven Toben. Für viele Kin<strong>de</strong>r<br />
be<strong>de</strong>utet dieser Wechsel, dieser<br />
Übergang in die „Bewegungslosigkeit“<br />
am Anfang eine große Herausfor<strong>de</strong>rung,<br />
<strong>de</strong>r sie mit Vermeidung <strong>und</strong> Ablehnung<br />
begegnen. Mit zunehmen<strong>de</strong>r Übung<br />
können sie die Zentrierung auf sich<br />
unter Außerachtlassens <strong>de</strong>r äußeren<br />
Störungen genießen <strong>und</strong> entspannen<br />
bei diesen Liegeübungen auch ihr<br />
inneres Angespanntsein, kommen in<br />
Gedanken <strong>und</strong> Gefühlen zur Ruhe,<br />
fühlen ihre Mitte (Meditation).<br />
Anspannung ist ein Gegensatz zur<br />
Entspannung. Sie stehen sich wie die<br />
zwei En<strong>de</strong>n eines Bogens diametral<br />
gegenüber <strong>und</strong> halten gera<strong>de</strong> dadurch<br />
die Sehne <strong>de</strong>s Bogens in einer Gr<strong>und</strong>spannung.<br />
Wird <strong>de</strong>r Bogen überspannt,<br />
dann bricht er o<strong>de</strong>r die Sehne reißt. Bei<br />
Unterspannung hängt die Sehne durch.<br />
Also die Vereinseitigung <strong>und</strong> ausschließliche<br />
Betonung nur eines Teiles<br />
<strong>de</strong>s Bogens führt in <strong>de</strong>n Zustand <strong>de</strong>r<br />
Nicht-Gebrauchbarkeit, <strong>de</strong>r Nutzlosigkeit<br />
<strong>de</strong>sselben.<br />
Der „Bogen“ steht <strong>für</strong> unsere individuellen<br />
körperlichen, biologischen <strong>und</strong><br />
psychischen Gr<strong>und</strong>bedingungen. Die<br />
„Sehne“ versinnbildlicht unsere Lebens-<br />
<strong>und</strong> Schaffenskraft, mit <strong>de</strong>r wir auf<br />
unsere Welt gestalterisch einwirken.<br />
Eine abgestimmte An- <strong>und</strong> Entspannung<br />
bewirkt „Eutonie“ <strong>de</strong>rart, dass ich<br />
eine Mitte zwischen <strong>de</strong>n Extremen<br />
fin<strong>de</strong>, d. h. einen notwendigen <strong>und</strong><br />
ausgewogenen Ausgleich zwischen An-<br />
<strong>und</strong> Entspannung herstelle, um die<br />
jeweilige Lebenssituation zu meistern.<br />
Die Mitte fin<strong>de</strong>n setzt immer voraus,<br />
dass die jeweiligen Extreme aufgesucht<br />
<strong>und</strong> angespürt wer<strong>de</strong>n. So kann das<br />
„Dazwischen“, <strong>de</strong>r Unterschied in<br />
Erfahrung gebracht wer<strong>de</strong>n. Jetzt<br />
entstehen Wahlmöglichkeiten, die<br />
Palette <strong>de</strong>r Freiheitsgra<strong>de</strong> meines<br />
Han<strong>de</strong>lns erweitert sich, wird bunter.<br />
Die erlebten Unterschie<strong>de</strong> bil<strong>de</strong>n die<br />
Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> Lernen <strong>und</strong> Entwicklung.<br />
Aus diesen Überlegungen entspringt die<br />
methodische Maßgabe <strong>de</strong>s Ausgleichs.<br />
Je wil<strong>de</strong>r das Toben <strong>und</strong> Spielen, umso<br />
wichtiger ist die Gestaltung eines<br />
Überganges <strong>für</strong> das Zurücknehmen <strong>de</strong>s<br />
motorischen, psychosozialen Span-<br />
73
74<br />
Der „Semisport“ – ein Beispiel wirkungsvoller Theorie-Praxis-Vernetzung<br />
nungsfel<strong>de</strong>s zugunsten eines ruhigeren,<br />
beschaulicheren Handlungsfel<strong>de</strong>s. Je<br />
besser dieser gelingt, umso mehr darf<br />
gewagt wer<strong>de</strong>n.<br />
O<strong>de</strong>r: In je höherem Maße die Selbstkontrolle<br />
körperlicher Kraft, verbaler<br />
<strong>und</strong> brachialer aggressiver Impulse <strong>und</strong><br />
Handlungen wirksam wer<strong>de</strong>n kann,<br />
umso wil<strong>de</strong>r <strong>und</strong> ausufern<strong>de</strong>r dürfen die<br />
Rauf- <strong>und</strong> Kampfspiele ausfallen, umso<br />
weiter dürfen die Grenzen gegenseitiger<br />
Verträglichkeit ausgelotet wer<strong>de</strong>n. So<br />
ergibt sich das scheinbare Paradoxon,<br />
dass die in Wort <strong>und</strong> Tat durchsetzungsfähigsten<br />
Kin<strong>de</strong>r, Jugendlichen<br />
<strong>und</strong> Erwachsenen in spielerischen <strong>und</strong>/<br />
o<strong>de</strong>r ernsten Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen das<br />
höchste Maß an Selbstkontrolle leisten<br />
müssen. Dies be<strong>de</strong>utet, auf einen<br />
ungefilterten, ungebremsten Einsatz <strong>de</strong>r<br />
mir verfügbaren Mittel <strong>de</strong>r Durchsetzung<br />
zu verzichten, damit <strong>de</strong>r Gegenüber<br />
eine faire Chance hat. Es gilt das<br />
Motto: „Was ich nicht will, dass man<br />
mir antut, das füge ich auch keinem<br />
an<strong>de</strong>ren zu.“<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche brauchen zum<br />
Aufbau dieser entwicklungsför<strong>de</strong>rlichen<br />
Einstellungen <strong>und</strong> Haltungen an<strong>de</strong>re<br />
Menschen, die sie ein Stück ihres<br />
Lebensweges begleiten, ihnen hilfreich<br />
zur Seite stehen <strong>und</strong> wenn es sein muss<br />
„Reibungsfläche“ bieten. Deshalb<br />
schließen sich generelle Überlegungen<br />
zu <strong>de</strong>n Leitern/innen eines solchen<br />
Handlungsansatzes an.<br />
Die Leiter/innen als Interaktionsmo<strong>de</strong>lle<br />
Die Leiter/innen <strong>de</strong>s „Semisportes“ sind<br />
Mitspieler, Grenzsetzer <strong>und</strong> Krisenklärer.<br />
Sie tragen Verantwortung <strong>für</strong> die<br />
Vorgabe <strong>und</strong> Setzung <strong>de</strong>r inhaltlichen<br />
<strong>und</strong> organisatorischen Struktur<br />
(minimale – maximale Struktur). Sie<br />
kümmern sich um die Einhaltung <strong>de</strong>s<br />
notwendigen Sicherheitsrahmens.<br />
Die Persönlichkeit <strong>de</strong>r Gruppenleiter<br />
<strong>und</strong> Gruppenleiterinnen, die ein<br />
<strong>de</strong>rartiges Konzept <strong>de</strong>r Bewegungserziehung<br />
vertreten, ist ebenso wichtig<br />
wie ihre technischen, methodischen<br />
Fertigkeiten. Keine Metho<strong>de</strong> (Technik)<br />
ersetzt die positive Einstellung zum<br />
Menschen. Die besten Erfolge zeigen<br />
sich dann, wenn es <strong>de</strong>r Leiter versteht,<br />
die Metho<strong>de</strong> seiner Wahl mit seiner<br />
Person zu verbin<strong>de</strong>n. Keine Metho<strong>de</strong><br />
wirkt allein schon an sich als Metho<strong>de</strong>.<br />
Der Leiter erweckt sie zum Leben, <strong>de</strong>r<br />
Leiter ist mit seiner Person „Metho<strong>de</strong>“.<br />
Min<strong>de</strong>stens zwei Studieren<strong>de</strong> gestalten<br />
die St<strong>und</strong>en, damit die Möglichkeit <strong>de</strong>r<br />
Differenzierung von Aufmerksamkeit<br />
<strong>und</strong> Zuwendung auf ein einzelnes Kind,<br />
eine Untergruppe, eine Krisenintervention,<br />
die ein einzelnes Kind o<strong>de</strong>r die<br />
Gesamtgruppe betrifft, o<strong>de</strong>r auch die<br />
Unfallversorgung <strong>und</strong> Aufsichtspflicht<br />
möglich wird. Hier wird <strong>de</strong>utlich, dass<br />
die Effektivität <strong>de</strong>r Zusammenarbeit<br />
zwischen <strong>de</strong>n verantwortlichen<br />
Gruppenleitern von regelmäßigen <strong>und</strong><br />
differenzierten Aus- <strong>und</strong> Absprachen<br />
über Zielsetzung, Inhalte, Rollenakzentuierung,<br />
Interventionsstile <strong>und</strong> nicht<br />
zuletzt über konkurrieren<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r gar<br />
rivalisieren<strong>de</strong> Interaktionsmuster<br />
bestimmt wird.<br />
Die Leiter/innen bewegen sich darüber<br />
hinaus in einem Spannungsfeld<br />
zwischen minimaler <strong>und</strong> maximaler<br />
Vorgabe <strong>und</strong> Struktursetzung, zwischen<br />
individualisieren<strong>de</strong>r <strong>und</strong> gruppenzentrierter<br />
Intervention <strong>und</strong> Konfliktverarbeitung.<br />
Die oben genannten Verhaltensauffälligkeiten<br />
von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen die sich in sozialer<br />
Inkompetenz, mangeln<strong>de</strong>r Frustrationstoleranz<br />
<strong>und</strong> Affektkontrolle zeigen,<br />
dürfen nicht durch ein inhaltliches<br />
spielerisches, sportliches <strong>und</strong> materiales<br />
Überangebot „maskiert“ wer<strong>de</strong>n. Die<br />
psychosozialen Störungen <strong>und</strong> Schwierigkeiten<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r sollen zur Darstellung<br />
kommen <strong>und</strong> können so wirkungsvoll<br />
bearbeitet wer<strong>de</strong>n. Gleichzeitig<br />
können die Kin<strong>de</strong>r ihre Stärken <strong>und</strong><br />
positiven Ressourcen in Erfahrung<br />
bringen. Mit <strong>de</strong>n Stärken <strong>für</strong> das<br />
Fehlen<strong>de</strong>.<br />
Die personale Gr<strong>und</strong>einstellung <strong>und</strong><br />
Haltung <strong>de</strong>r Leiter/innen, eine an<strong>de</strong>re<br />
Person ernst zu nehmen, zu achten <strong>und</strong><br />
wertzuschätzen äußert sich unter<br />
an<strong>de</strong>rem in <strong>de</strong>r Bereitschaft zur<br />
verstehen<strong>de</strong>n Akzeptanz (Respekt<br />
erweisen) <strong>und</strong> zur verstehen<strong>de</strong>n<br />
Konfrontation (Respekt verschaffen).<br />
Unterstützung <strong>und</strong> Konfrontation, <strong>de</strong>r
Person <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Situation angemessen,<br />
bewirken positive Entwicklung <strong>und</strong><br />
För<strong>de</strong>rung.<br />
Das Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r Leiter/innen bezogen<br />
auf die Gruppe richtet sich nach<br />
Prinzipien wie Individualisieren, dort<br />
anfangen, wo die Gruppe steht, Hilfe<br />
durch Programmgestaltung, sich<br />
entbehrlich machen (s. Flosdorf 1988a,<br />
133).<br />
Wirkebenen <strong>de</strong>s „Semisportes“<br />
Die Prinzipien <strong>und</strong> Strukturmerkmale<br />
dieses von uns (Flosdorf 1988; Rie<strong>de</strong>r<br />
2003; Müller 2003) entwickelten<br />
Konzeptes können als eine Weiterentwicklung<br />
<strong>de</strong>s themenzentrierten<br />
Cohnschen Ansatzes verstan<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
So kommt es bei <strong>de</strong>r Umsetzung <strong>de</strong>s<br />
„Semisportes“ auf das wirkungsvolle<br />
Ausbalancieren <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Ebenen<br />
an:<br />
• Spiele, Übungen <strong>und</strong> sportliche<br />
Inhalte <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e,<br />
• individuelle Dynamik <strong>de</strong>r einzeln<br />
beteiligten Personen (Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Leiter),<br />
• gruppenbezogene Dynamik <strong>de</strong>r<br />
beteiligten Personen (Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Leiter) <strong>und</strong><br />
• die Leiter/innen als handlungsfähiges<br />
Team.<br />
Ziel ist nicht primär die Forcierung <strong>de</strong>r<br />
spielerisch-sportlichen Inhalte wie z. B.<br />
das Erlernen von sportartspezifischen<br />
Bewegungsmustern o<strong>de</strong>r von immer<br />
neuen Spielen. Vielmehr sollen im<br />
Kontext von Spielen <strong>und</strong> sportlichen<br />
Übungen psychosoziale Einstellungen<br />
<strong>und</strong> Haltungen erlebt <strong>und</strong> dann<br />
erfahrbar wer<strong>de</strong>n, die einen bewussteren<br />
<strong>und</strong> behutsameren Umgang mit<br />
sich, <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren <strong>und</strong> <strong>de</strong>r materialen<br />
Welt ermöglichen <strong>und</strong> för<strong>de</strong>rn.<br />
Einbindung <strong>und</strong> Vernetzung<br />
Es scheint zunächst sinnvoll zu sein,<br />
die Gr<strong>und</strong>züge relevanter allgemeiner<br />
Merkmale stationärer heilpädagogischpsychotherapeutischer<br />
Hilfen zu<br />
kennzeichnen, die die Effektivität <strong>de</strong>s<br />
„Semisports” in ihrer Wirksamkeit als<br />
heilpädagogisches <strong>und</strong> Ausbildungskon-<br />
r Die vier Wirkebenen <strong>de</strong>s Handlungsfel<strong>de</strong>s „Semisport“ in integrativer Verbindung mit<br />
an<strong>de</strong>ren Konzepten <strong>de</strong>s Therapeutischen Heimes St. Josef im ÜBBZ Würzburg<br />
zept bedingen. Dieses Konzept ist wie<br />
die an<strong>de</strong>ren Konzepte stationärer<br />
Jugendhilfemaßnahmen räumlich <strong>und</strong><br />
personell integriert in vorgegebene<br />
Rahmenbedingungen <strong>de</strong>s Überregionalen<br />
Beratungs- <strong>und</strong> Behandlungszentrum<br />
Würzburg (ÜBBZ) als Institution<br />
<strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe-<br />
verb<strong>und</strong>es Würzburg. Dieses hat sich<br />
1992 mit seinen Abteilungen:<br />
• Psychotherapeutisch-heilpädagogische<br />
Station <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
jugendliche Mädchen (St. Josefsheim)<br />
• Psychotherapeutischer Beratungsdienst<br />
(Eltern-, Jugendlichen- <strong>und</strong><br />
Erziehungsberatung)<br />
• Fachaka<strong>de</strong>mie <strong>für</strong> Heilpädagogik<br />
(Heilpädagogisches Seminar)<br />
• För<strong>de</strong>rschule zur Erziehungshilfe<br />
(Elisabeth-Weber-Schule) <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
• Heilpädagogischen Tagesstätte<br />
zum Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeverb<strong>und</strong><br />
(Bereich Jugendhilfe im Sozialdienst<br />
katholischer Frauen Würzburg) zusammengeschlossen.<br />
Diese Organisationsstruktur<br />
bietet die Voraussetzung <strong>für</strong><br />
personelle, fachliche, materielle,<br />
räumliche, organisatorische, schulische<br />
<strong>und</strong> jugendhilfepolitische Ressourcennutzung<br />
über Vernetzung. In diesem<br />
Aufsatz sei speziell die Schnittstelle<br />
zwischen Heilpädagogischem Seminar<br />
<strong>und</strong> Therapeutischen Heim St. Josef<br />
hervorgehoben, da ein Konzept wie <strong>de</strong>r<br />
hier dargestellte „Semisport“ projektbezogen<br />
zum Nutzen <strong>de</strong>r betroffenen<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Einrichtung als gezieltes<br />
Jugendhilfeangebot durchgeführt<br />
wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Die <strong>für</strong> <strong>de</strong>n „Semisport“ verantwortlichen<br />
Gruppenleiter/innen bewegen<br />
sich in einem durch vielfältige Informationen<br />
„gefütterten“ Feld <strong>de</strong>r Erzie-<br />
75
76<br />
Der „Semisport“ – ein Beispiel wirkungsvoller Theorie-Praxis-Vernetzung<br />
hungs- <strong>und</strong> Therapieplanung. Sie<br />
gewährleisten einerseits <strong>de</strong>n Informations-<br />
<strong>und</strong> Erfahrungsfluss aus <strong>de</strong>m<br />
„Semisport“ in das Therapeutische<br />
Heim, an<strong>de</strong>rerseits sind sie auf Informationen<br />
<strong>und</strong> Erfahrungen <strong>de</strong>r Gruppenerzieher<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren gruppenübergreifen<strong>de</strong>n<br />
Mitarbeiter/innen<br />
angewiesen. Dies setzt institutionell<br />
organisierte Foren <strong>de</strong>s Informationsaustausches<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Planung voraus.<br />
Die aus <strong>de</strong>m Prozess <strong>de</strong>r Erziehungsplankonferenz<br />
(EPK) <strong>und</strong> <strong>de</strong>r heilpädagogischen<br />
Praxisanleitung abzuleiten<strong>de</strong>n<br />
Zielvorstellungen, das „Was“<br />
<strong>und</strong> das „Wie“ <strong>de</strong>s gemeinsamen<br />
Han<strong>de</strong>lns, ermöglichen eine umfassen<strong>de</strong><br />
För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> gewährleisten<br />
die Effizienz <strong>de</strong>r Zusammenarbeit<br />
zwischen <strong>de</strong>n verantwortlichen Leitern/<br />
innen. Darüber hinaus können Transfer-<br />
<strong>und</strong> Generalisierungsprozesse sozialer<br />
Gr<strong>und</strong>einstellungen aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
konstanten Beteiligung <strong>und</strong> Begleitung<br />
<strong>de</strong>r Gruppenerzieher/innen mit hoher<br />
Effektivität in das Lebensfeld „Gruppe“<br />
gelingen <strong>und</strong> geleistet wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> von<br />
da in <strong>de</strong>n „Semisport“ hineinwirken.<br />
Die Einbindung in das Gesamtkonzept<br />
stationärer Erziehungshilfe gewährleistet<br />
einen einheitlichen aufmerksamen,<br />
individuums- <strong>und</strong> gruppenzentrierten<br />
Umgang hinsichtlich aggressiver<br />
Verhaltensweisen. So können wir im<br />
Verb<strong>und</strong> mit an<strong>de</strong>ren Maßnahmen die<br />
Gewaltproblematik in unserer Einrichtung,<br />
in <strong>de</strong>r je<strong>de</strong>s Jahr zehn bis<br />
fünfzehn Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche mit in<br />
aller Regel massiven <strong>und</strong> schon<br />
langandauern<strong>de</strong>n Verhaltensauffälligen<br />
neu aufgenommen wer<strong>de</strong>n, durch<br />
entsprechen<strong>de</strong> Einsichts- <strong>und</strong> Bewältigungsarbeit<br />
in konstruktive Bahnen<br />
lenken.<br />
Die Mitarbeiter <strong>de</strong>s Therapeutischen<br />
Heimes <strong>und</strong> die Seminaristen stimmen<br />
in hohem Maße - hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
Klarheit in <strong>de</strong>n Erwartungen <strong>und</strong> im<br />
Verhalten was Regeln <strong>und</strong> Normen<br />
angeht -, überein. Eine Übereinstimmung,<br />
um die wir immer wie<strong>de</strong>r neu<br />
„ringen“ <strong>und</strong> die bestimmter Foren<br />
wie Mitarbeiterkonferenzen <strong>und</strong><br />
Praxisanleitung bedarf. Diese<br />
Übereinstimmung ist <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r<br />
<strong>und</strong> Jugendliche von zentraler<br />
Wichtigkeit, um einen verlässlichen<br />
äußeren Halt aufzubauen als<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Aufbau eines<br />
inneren Haltes.<br />
Die Gruppe mit ihrer Dynamik, ihren<br />
Konflikten <strong>und</strong> Lösungsmöglichkeiten<br />
Verhaltensauffällige Kin<strong>de</strong>r sind in <strong>de</strong>r<br />
Regel gemeinschaftsgestörte <strong>und</strong> in<br />
Folge gemeinschaftsstören<strong>de</strong> Kin<strong>de</strong>r. Es<br />
ist daher <strong>für</strong> diese Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche<br />
von großer sozial-emotionaler<br />
Be<strong>de</strong>utung, dass ihre individuellen<br />
Bedürfnisse nach „Dazugehörigkeit“,<br />
nach „Nähe“ <strong>und</strong> „Vertrauen“ <strong>und</strong> nach<br />
„Einfluss-Nehmen“ sozial angemessen<br />
Berücksichtigung fin<strong>de</strong>n <strong>und</strong> nicht<br />
wie<strong>de</strong>r enttäuscht wer<strong>de</strong>n. Da die<br />
Störungsbil<strong>de</strong>r, insbeson<strong>de</strong>re solche mit<br />
expansiv aggressiven impulsiven<br />
Ausprägungen, im Zunehmen<br />
begriffen sind, kann eine ausgewogene<br />
Gruppenzusammenstellung häufig nicht<br />
erfolgen. Bei <strong>de</strong>r Verteilung von<br />
ängstlichen <strong>und</strong> gehemmten Kin<strong>de</strong>rn<br />
gegenüber aggressiven <strong>und</strong> unruhigen<br />
Kin<strong>de</strong>rn existieren dann keine Wahlmöglichkeiten.<br />
Optimal wäre, aber<br />
lei<strong>de</strong>r nicht mehr zu organisieren, wenn<br />
die aggressiv-hypermotorischen Kin<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n geringeren Anteil in <strong>de</strong>r Gruppe<br />
ausmachten.<br />
Die Gruppenleiter/innen müssen bei <strong>de</strong>r<br />
Häufung von aggressiv-dissozialen<br />
Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen be<strong>de</strong>nken, ob<br />
<strong>und</strong> wie sie die vorauszusehen<strong>de</strong><br />
Konfliktverdichtung <strong>und</strong> Eskalierung<br />
von Unruhe <strong>und</strong> exzessivem Agieren zu<br />
steuern vermögen, ohne dass die Kin<strong>de</strong>r<br />
mit <strong>de</strong>r dadurch gehäuften Frustration<br />
überfor<strong>de</strong>rt sind o<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llwirkungen<br />
<strong>und</strong> Selbstwirksamkeitserfahrungen<br />
machen, die ihnen nicht gut tun <strong>und</strong><br />
einer Fortschreibung von dissozialen<br />
Verhaltens- <strong>und</strong> Einstellungsmustern<br />
Vorschub leisten.<br />
Darstellung <strong>de</strong>r vier Wirkebenen <strong>de</strong>s<br />
„Semisportes“ in ihrem wechselseitigen,<br />
dynamischen Bezug zueinan<strong>de</strong>r<br />
In Anlehnung an das von Ruth Cohn<br />
(1976, 110–120) beschriebene Mo<strong>de</strong>ll<br />
<strong>de</strong>r „themenzentrierten Interaktion“<br />
können die einzelnen Faktoren zueinan<strong>de</strong>r<br />
in Beziehung gesetzt wer<strong>de</strong>n. Im<br />
Unterschied zum Cohnschen Mo<strong>de</strong>ll<br />
beziehen wir die Leiter bewusst als<br />
konstituieren<strong>de</strong> Wirkdimension mit ein.<br />
Alle Systemdimensionen sollen durch<br />
entsprechen<strong>de</strong> Interventionen <strong>de</strong>r<br />
Gruppenleiter/innen in einer dynamischen<br />
Balance gehalten wer<strong>de</strong>n, um<br />
so die Handlungs- <strong>und</strong> Gruppenfähigkeit<br />
zu för<strong>de</strong>rn.<br />
So kann ein lebhaftes Agieren <strong>de</strong>r Gruppe<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Leiter die Bedürfnislage<br />
einzelner Kin<strong>de</strong>r „überfahren“ <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>ren Wi<strong>de</strong>rstand, Vermeidungsverhalten<br />
<strong>und</strong> Unlust hervorrufen o<strong>de</strong>r<br />
verstärken. Umgekehrt kann zu langes<br />
Verweilen <strong>und</strong> Eingehen auf die<br />
Störungen eines einzelnen die Gruppe<br />
in ihren Zielen <strong>und</strong> Wünschen frustrieren.<br />
Es kann aber auch die Forcierung<br />
<strong>und</strong> das Festfahren auf die spielerischen<br />
o<strong>de</strong>r sportlichen Angebote Ausdruck<br />
spezifischer Konflikte einzelner o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
gesamten Gruppe sein (Vermeidung von<br />
interpersonellen Konflikten), die sich<br />
ihrerseits in <strong>de</strong>r Art <strong>und</strong> Weise ihrer<br />
Reaktionen gegenüber <strong>de</strong>n Leitern<br />
ver<strong>de</strong>utlichen.<br />
Die Anfangsphase <strong>de</strong>r „Semisport“-<br />
St<strong>und</strong>en ist dadurch charakterisiert,<br />
dass die Leiter/innen ihre Erwartungen<br />
von gelingen<strong>de</strong>r <strong>und</strong> konfliktfreier<br />
Durchführung <strong>de</strong>r „Spiele <strong>und</strong> Übungen“<br />
hintanstellen. Ihre Aufmerksamkeit<br />
richtet sich weniger auf die Realisierung<br />
konkreter Programmpunkte<br />
(Thema), son<strong>de</strong>rn auf die Klärung <strong>de</strong>r<br />
Störung innerhalb unterschiedlicher<br />
Interessensansprüche, <strong>de</strong>ren Form <strong>und</strong><br />
Zielsetzung. Wichtiger als das „Was“ ist<br />
das „Wie“ <strong>de</strong>s gemeinsamen Umgehens.<br />
Die Leiter/innen rücken die Knotenpunkte<br />
Gruppe/Subgruppe („wir“) <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>n Individuumpol („ich“) in <strong>de</strong>n<br />
Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong> <strong>und</strong> nehmen die in diesem<br />
Zusammenhang auftreten<strong>de</strong>n Beziehungsschwierigkeiten<br />
<strong>und</strong> -stärken<br />
wahr, unterstützen bei <strong>de</strong>r Konfliktlösung<br />
<strong>und</strong> bringen sich – so die Situation<br />
dies zulässt – aktiv als Spiel- <strong>und</strong>/<br />
o<strong>de</strong>r Rangelpartner ein. Aus einer<br />
Ansammlung beziehungsloser, rivalisieren<strong>de</strong>r<br />
Individuen (prägruppale Menge)<br />
soll eine kooperieren<strong>de</strong>, arbeitsfähige<br />
Subgruppe <strong>und</strong> Gesamtgruppe wer<strong>de</strong>n.<br />
Je positiver sich <strong>de</strong>r Gruppenprozess<br />
entwickelt <strong>und</strong> sich danach gemeinschaftsstören<strong>de</strong><br />
Kin<strong>de</strong>r zeitweise in<br />
Gruppenaktivitäten bin<strong>de</strong>n lassen, <strong>de</strong>sto<br />
mehr verbin<strong>de</strong>t dann die an einem<br />
Thema orientierte Interaktion alle<br />
Teilnehmer. Die Themenführung wird<br />
vom Gruppenleiter in motivieren<strong>de</strong>r<br />
Form <strong>und</strong> zum richtigen Zeitpunkt an<br />
die Gruppe herangetragen. Hierbei<br />
haben wir die Erfahrung gemacht, dass<br />
die Themenvorgabe bei gutem Timing<br />
<strong>und</strong> in angemessener Dosierung in <strong>de</strong>r<br />
Regel vom Großteil <strong>de</strong>r Gruppe wohlwollend<br />
akzeptiert wird.
Die Gruppenmitglie<strong>de</strong>r mit an<strong>de</strong>rer<br />
Meinung wer<strong>de</strong>n ermutigt, diese zu<br />
formulieren <strong>und</strong> in die Gruppe einzubringen.<br />
Dabei ist das „Wie“ dieser<br />
Interessenvertretung min<strong>de</strong>stens<br />
genauso wichtig wie das „Was“.<br />
Denkbar schlechte Ausgangsvoraussetzungen<br />
haben Kin<strong>de</strong>r mit mangelnd<br />
ausgeprägten, groben sozialen Mustern,<br />
die ihren Unmut <strong>und</strong> das, was sie<br />
wollen o<strong>de</strong>r nicht wollen, als „Stänker“-<br />
<strong>und</strong>/o<strong>de</strong>r „Schläger“-Intervention<br />
k<strong>und</strong>tun.<br />
Dies kann entsprechen<strong>de</strong> überzogene<br />
negative Reaktionen <strong>de</strong>r Gruppe<br />
auslösen: Beleidigen<strong>de</strong> Wortgefechte,<br />
Beschuldigungen, Entwertung, aggressive<br />
brachiale Handlungen, Ausgrenzungsversuche,<br />
negative Solidaritätseffekte<br />
etc.. Neben <strong>de</strong>n lauten,<br />
aggressiven Kin<strong>de</strong>rn wer<strong>de</strong>n auch die<br />
stillen, zurückhalten<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>r, die sich<br />
nicht trauen, ein eigenes Meinungsbild<br />
in <strong>de</strong>r Gruppe zu vertreten, angehalten,<br />
sich schrittweise dieser Gesprächssituation<br />
zu öffnen, um soziale Kompetenz<br />
<strong>und</strong> Assertivness aufzubauen. Bei allen<br />
Klärungsprozessen soll es nicht zu überlangen<br />
Sitzr<strong>und</strong>en kommen, da das<br />
Risiko <strong>de</strong>r Überfor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Aufmerksamkeitspotentials<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r droht.<br />
Ineffektive Sitzkreisr<strong>und</strong>en, die die<br />
Situation unklar lassen <strong>und</strong> kein<br />
praktisches Ergebnis bringen, entwerten<br />
diese Form <strong>de</strong>r Klärungssuche. Sie ufern<br />
dann zu rhetorischem Geplapper mit<br />
leeren Worthülsen aus, wer<strong>de</strong>n als<br />
Forum benutzt, über verbale Strategien<br />
die han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong> Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit<br />
<strong>de</strong>r Situation zu vermei<strong>de</strong>n. Die Leiter/<br />
innen sind hier in <strong>de</strong>r Verantwortung,<br />
an <strong>de</strong>r richtigen Stelle zu unterstützen<br />
o<strong>de</strong>r zu korrigieren.<br />
Mit zunehmen<strong>de</strong>r persönlicher <strong>und</strong><br />
Gruppenstabilität, kann <strong>de</strong>r Aufgabenpol<br />
bei <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>enstrukturierung<br />
fokussiert wer<strong>de</strong>n. Die hierbei auftreten<strong>de</strong><br />
Anfor<strong>de</strong>rungssituation <strong>und</strong> das<br />
unterschiedliche Erleben <strong>de</strong>r Leiter/<br />
innen, wie z. B. minimal strukturieren<strong>de</strong>r,<br />
spielen<strong>de</strong>r Leiter einerseits,<br />
aufgabenstellen<strong>de</strong>r, maximal strukturieren<strong>de</strong>r<br />
Leiter an<strong>de</strong>rerseits wer<strong>de</strong>n nicht<br />
ver<strong>de</strong>ckt, son<strong>de</strong>rn för<strong>de</strong>rn über erfolgreiche<br />
Konfliktbewältigung die Beziehung<br />
untereinan<strong>de</strong>r. Die Leiter/innen<br />
haben die Aufgabe ein Gleichgewicht<br />
auszubalancieren zwischen För<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r innerhalb <strong>de</strong>r spielerischen<br />
Handlungsebene <strong>und</strong> För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r innerhalb angemessener<br />
For<strong>de</strong>rungssituation. Im ersten Fall<br />
wählen die Kin<strong>de</strong>r nach ihren Vorstellungen<br />
<strong>und</strong> Wünschen bestimmte<br />
Handlungssituationen, im zweiten Fall<br />
müssen sie sich mit von außen an sie<br />
herangetragenen For<strong>de</strong>rungssituationen,<br />
die konträr zu ihrer augenblicklichen<br />
Interessenslage sein können,<br />
auseinan<strong>de</strong>rsetzen. Hier unterschei<strong>de</strong>n<br />
wir klar zwischen Arbeit <strong>und</strong> Spiel.<br />
Das Spiel verführt Heilpädagogen durch<br />
seinen starken Anreiz zu „spielen“<br />
häufig dazu, bestimmte Zielsetzungen<br />
<strong>und</strong> Inhalte attraktiv verpackt wie mit<br />
einem „trojanischen Pferd“ didaktisch<br />
geschickt einzuschleusen. Es ist ein<br />
Wi<strong>de</strong>rspruch in sich, Übungs- <strong>und</strong><br />
Trainingsinhalte (Arbeit) mit <strong>de</strong>m<br />
Vehikel „Spiel“ zu transportieren. Denn<br />
normalerweise spielen Kin<strong>de</strong>r das, was<br />
ihnen Spaß macht <strong>und</strong> auf eine Art, die<br />
ihnen Spaß bereitet <strong>und</strong> üben dabei<br />
wichtige Funktionen gegenwärtiger<br />
o<strong>de</strong>r späterer Lebensbewältigung.<br />
Häufig jedoch klei<strong>de</strong>n wir unsere<br />
beabsichtigten Aktivitäten zweckmäßig<br />
<strong>und</strong> zielgerichtet in eine spielerische<br />
Situation ein, <strong>und</strong>, was dann wie Spiel<br />
aussieht, ist in Wirklichkeit anstrengen<strong>de</strong>s<br />
<strong>und</strong> angestrengtes Arbeiten; ist<br />
eine gezielte, unlautere Um<strong>de</strong>finition<br />
<strong>de</strong>r Arbeitssituation. Ein<strong>de</strong>utige, klare<br />
Einstellungen <strong>und</strong> Haltungen zu Spiel<br />
<strong>und</strong> Arbeit können so nicht entwickelt<br />
wer<strong>de</strong>n. Der pädagogische (therapeutische)<br />
Alltag zeigt, dass sich Spieli<strong>de</strong>e<br />
<strong>und</strong> Spielsituation häufig nicht so<br />
einfach herstellen lassen o<strong>de</strong>r wie<br />
zufällig daherkommen, son<strong>de</strong>rn dass die<br />
Kin<strong>de</strong>r aufgr<strong>und</strong> ein<strong>de</strong>utiger Leiterstrukturierung<br />
üben <strong>und</strong> tätig sein<br />
müssen. Dann kann es geschehen, dass<br />
aus Arbeit Spiel wird.<br />
Folgen<strong>de</strong> dreigliedrige St<strong>und</strong>enaufteilung<br />
ist möglich:<br />
In Teil A (Individualphase, minimale<br />
strukturierte Phase: Spiele,<br />
Übungen, Aufgaben, Beschäftigungen<br />
gehen in <strong>de</strong>r Regel vom<br />
Kind aus; das Kind bestimmt seinen<br />
eigenen Handlungsspielraum) wird<br />
Raum <strong>und</strong> Zeit <strong>für</strong> sich ergeben<strong>de</strong><br />
Handlungen einzelner <strong>und</strong>/o<strong>de</strong>r<br />
Subgruppen gegeben. Diese<br />
Aktivitäten können bei entsprechen<strong>de</strong>r<br />
Motivation <strong>und</strong> Gruppen-<br />
erfahrung zu einer gemeinsamen<br />
Gruppentätigkeit führen, müssen es<br />
aber nicht.<br />
Hier wird <strong>de</strong>m Spiel-, Rangel-,<br />
Rauf-, Kampf-, Leistungs- <strong>und</strong><br />
Rückzugsbedürfnis <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendlichen Raum <strong>und</strong> Zeit<br />
gegeben. Diese kommen mit <strong>de</strong>n<br />
unterschiedlichsten Gefühlen,<br />
Gedanken <strong>und</strong> Motiven in die<br />
„Semisport“-St<strong>und</strong>e. Die minimal<br />
strukturierte Spielsituation zu<br />
Beginn einer St<strong>und</strong>e, in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Leiter (Lehrer) sich als Spiel- <strong>und</strong><br />
Gesprächspartner zur Verfügung<br />
stellt <strong>und</strong> die Kin<strong>de</strong>r sich selber<br />
bestimmen, tut <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn gut. Sie<br />
können <strong>de</strong>n Übergang von einem<br />
Lernfeld auf das nächste, von einer<br />
Beziehungssituation auf die nächste<br />
besser bewältigen, können die „alte“<br />
Situation sein lassen, stellen sich<br />
auf die „neue“ Situation ein <strong>und</strong><br />
bauen hierzu neue Motivation auf.<br />
Hier wer<strong>de</strong>n jedoch gleichzeitig<br />
auch wichtige soziale Lernprozesse<br />
<strong>de</strong>r Interessenvertretung <strong>und</strong><br />
Interessendurchsetzung bei <strong>de</strong>r<br />
Raumaufteilung, <strong>de</strong>r Spielgruppenbildung,<br />
<strong>de</strong>r Spielpartnersuche o<strong>de</strong>r<br />
Geräteaufteilung hinsichtlich<br />
Rücksichtnahmen auf an<strong>de</strong>re<br />
gleichzeitig laufen<strong>de</strong> Spielsituationen<br />
<strong>und</strong> Interessenansprüche<br />
an<strong>de</strong>rer Kin<strong>de</strong>r angebahnt, verfeinert<br />
<strong>und</strong>/o<strong>de</strong>r gefestigt. Dabei<br />
kommt es anfangs zu Phasen<br />
heftiger Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen<br />
zwischen Kin<strong>de</strong>rn, zwischen Kind<br />
<strong>und</strong> Leiter/in o<strong>de</strong>r zwischen<br />
Subgruppe <strong>und</strong> Leiter/in. Zu<strong>de</strong>m<br />
beobachten wir, dass das „Spielen“<br />
als kindgemäßestes Medium <strong>de</strong>r<br />
I<strong>de</strong>ntitätsfindung nicht mehr von<br />
allen Kin<strong>de</strong>rn geschätzt <strong>und</strong> gesucht<br />
wird. Wir „müssen“ es zusammen<br />
wie<strong>de</strong>r ent<strong>de</strong>cken (vgl. Müller<br />
1998).<br />
Dabei gilt: Damit Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendliche in Gruppen befriedigen<strong>de</strong>,<br />
prosoziale, entwicklungsför<strong>de</strong>rliche<br />
Erfahrungen machen<br />
können, muss ein verbindliches<br />
soziales Bezugssystem entwickelt<br />
<strong>und</strong> vertreten wer<strong>de</strong>n, wie man<br />
Konflikte ohne „Hauen <strong>und</strong> Stechen“<br />
lösen kann. Die hier<strong>für</strong><br />
notwendigen sozialen Rahmenbedingungen,<br />
Regeln <strong>und</strong> Normen<br />
77
78<br />
Der „Semisport“ – ein Beispiel wirkungsvoller Theorie-Praxis-Vernetzung<br />
wer<strong>de</strong>n umso intensiver begriffen<br />
<strong>und</strong> umgesetzt, je intensiver es<br />
gelingt, <strong>de</strong>n Einzelnen <strong>und</strong> die<br />
Gruppe bei <strong>de</strong>ren Erarbeitung zu<br />
beteiligen. Die Häufigkeit <strong>und</strong><br />
Massivität dieser Konflikte verringert<br />
sich mit zunehmen<strong>de</strong>r Sicherheit<br />
<strong>de</strong>r einzelnen Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Klarheit <strong>de</strong>r Grenzsetzung zugunsten<br />
von Konsens-, Kooperations-<br />
<strong>und</strong> Kompromissbereitschaft. Der<br />
Beginn einer „Semisport“-St<strong>und</strong>e<br />
kann sich je nach Situation <strong>und</strong><br />
Motivation <strong>de</strong>r Teilnehmer auch so<br />
gestalten, dass gleich zu Beginn<br />
ohne lange Aufwärmphase die<br />
Gruppe ein Spiel vorschlägt <strong>und</strong><br />
spielt. O<strong>de</strong>r die Seminaristen lassen<br />
die Freispielphase ausfallen <strong>und</strong><br />
sorgen <strong>für</strong> eine starke Aufgaben-<br />
<strong>und</strong> Leiterzentrierung, weil die<br />
Kin<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>r Selbstbestimmung<br />
überfor<strong>de</strong>rt wären.<br />
In Teil B (maximale strukturierte<br />
Phase: Spiele, Übungen, Aufgaben,<br />
Beschäftigungen gehen von <strong>de</strong>r<br />
Leiter/in aus) bringen die Gruppenleiter/innen<br />
auf <strong>de</strong>m Hintergr<strong>und</strong><br />
ihrer Zielsetzung <strong>für</strong> einzelne <strong>und</strong>/<br />
o<strong>de</strong>r die Gesamtgruppe eine<br />
aufgabenzentrierte Strukturierung<br />
in Form eines Themas in die St<strong>und</strong>e<br />
ein. Im Sinne komplexer Bewegungsaufgaben,<br />
die jeweils individuelle<br />
Lösungsmöglichkeiten<br />
zulassen, wird auf das Ausprobieren<br />
<strong>und</strong> Manipulieren vielfältiger<br />
Bewegungssituationen mit jeweils<br />
unterschiedlicher Betonung <strong>de</strong>r<br />
Lern- <strong>und</strong> Erfahrungsbereiche -<br />
Wahrnehmung, Bewegung, Kognition,<br />
Emotionalität <strong>und</strong> Sozialität<br />
Wert gelegt wird. Bestimmte<br />
Übungssituationen <strong>und</strong> Geräte<br />
jedoch verlangen eine ein<strong>de</strong>utige<br />
Bewegungsvorschrift o<strong>de</strong>r Bewegungsanleitung<br />
seitens <strong>de</strong>r Leiter/<br />
innen.<br />
Teil C <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e gleicht Teil A<br />
insofern, als hier geringe Leiterstrukturierung<br />
hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
Spiele <strong>und</strong> Aufgaben erfolgt. Mit<br />
zunehmen<strong>de</strong>r Gruppenkonsistenz,<br />
-kohäsion, Vertrauen, Offenheit <strong>und</strong><br />
Arbeitshaltung bestimmt die Gruppe<br />
selber, wie sie ihre noch verbleiben<strong>de</strong><br />
Zeit nützt <strong>und</strong> auf welches<br />
Spiel sich die einzelnen Gruppenmitglie<strong>de</strong>r<br />
einigen. Je<strong>de</strong> St<strong>und</strong>e<br />
en<strong>de</strong>t mit einem kurzen verbindlichen<br />
Abschlusskreis. Der Übergang<br />
von Teil A, in <strong>de</strong>m sich <strong>de</strong>r Spielen<strong>de</strong><br />
sein Thema selber gibt, zu Teil<br />
B, einer leiterorientierten, aufgabenzentrierten<br />
Situation, wird durch<br />
eine gemeinsame Gesprächsr<strong>und</strong>e<br />
(Mattenzeit) markiert. Hier kommt<br />
es im Erleben <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendlichen anfänglich zu<br />
Unstimmigkeiten, da die Situation<br />
<strong>de</strong>s Freispiels (ich darf tun, was ich<br />
will, was wir wollen) durch <strong>de</strong>n<br />
Aspekt: Ich schalte um <strong>und</strong> probiere,<br />
das zu tun, was mir als Aufgabe<br />
gestellt wird, abgelöst wird. Gera<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Wechsel von individuellem <strong>und</strong><br />
sozialem Lernfeld, von minimaler<br />
<strong>und</strong> maximaler Strukturierung, die<br />
darin liegen<strong>de</strong>n individuellen <strong>und</strong><br />
sozialen Lern- <strong>und</strong> Erfahrungsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> die hier zu leisten<strong>de</strong>n<br />
Übergänge erweisen sich in <strong>de</strong>r<br />
För<strong>de</strong>rung von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
mit Aufmerksamkeits-,<br />
Hyperaktivitäts- <strong>und</strong> Verhaltensstörungen<br />
als beson<strong>de</strong>rs be<strong>de</strong>utsam.<br />
Die Effektivität dieses methodischen<br />
Ansatzes steht <strong>und</strong> fällt mit <strong>de</strong>r<br />
Qualität <strong>de</strong>r Zusammenarbeit<br />
zwischen <strong>de</strong>n verantwortlichen<br />
Leitern <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>en. Deshalb soll<br />
zum Schluss auf das Feld <strong>de</strong>r<br />
Supervision /Praxisanleitung<br />
eingegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
Supervision/Praxisanleitung<br />
Alles, was im „Semisport“ geschieht, hat<br />
eine Be<strong>de</strong>utung auf je<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r vier<br />
Wirkdimensionen. Im Hinblick auf die<br />
Ziele <strong>und</strong> Einstellungen <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s<br />
(motivationaler Aspekt), im Hinblick auf<br />
die Frage <strong>de</strong>s Könnens o<strong>de</strong>r Nicht-<br />
Könnens (Fähigkeitsaspekt) beim Kind<br />
selbst, im Hinblick auf die Gruppeninteraktion<br />
(sozialer Aspekt), im Hinblick<br />
auf die Themenauswahl <strong>und</strong> im Hinblick<br />
auf die interaktionelle Passung durch<br />
die Leiter/innen.<br />
Man kann diese vier Perspektiven<br />
gewissermaßen als Dimensionen<br />
betrachten, die <strong>de</strong>n Raum aufspannen,<br />
in <strong>de</strong>m das interaktionelle Geschehen<br />
stattfin<strong>de</strong>t. Man kann also als Leiter<br />
o<strong>de</strong>r als Kind in diesem vierdimensional<br />
verorteten Beziehungsraum nicht nicht<br />
kommunizieren, nicht nicht Position<br />
beziehen (s. Watzlawick 1990, 50).<br />
Wenn <strong>de</strong>r Leiter eine <strong>de</strong>r Perspektiven<br />
nicht beachtet, dann nimmt er <strong>de</strong> facto<br />
<strong>de</strong>nnoch eine Position auf dieser<br />
Dimension ein, allerdings eine unreflektierte,<br />
<strong>und</strong> dies wirkt sich negativ auf<br />
das Gesamtergebnis aus.<br />
Wenn wir mit <strong>de</strong>m Bild <strong>de</strong>r „Landkarte“<br />
arbeiten, dann stellt je<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Dimensionen<br />
in sich gewissermaßen eine reich<br />
gestaltete „Landschaft“ mit ihren ganz<br />
eigenen phänomenalen Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
<strong>und</strong> Gesetzmäßigkeiten dar. Es kommt<br />
darauf an, dass sich die Leiter in je<strong>de</strong>r<br />
dieser vier Landschaften geschickt <strong>und</strong><br />
variabel, ausbalanciert bewegen<br />
können. Je<strong>de</strong> Bewegung in <strong>de</strong>r einen<br />
Landschaft be<strong>de</strong>utet auch eine Bewegung<br />
o<strong>de</strong>r Nicht-Bewegung in <strong>de</strong>n drei<br />
an<strong>de</strong>ren Landschaften. Wenn die Leiter<br />
sich nur durch eine dieser Landschaften<br />
bewegen <strong>und</strong> ihre ganze Aufmerksamkeit<br />
in ihr haben, d. h. gewissermaßen<br />
„blind“ <strong>für</strong> die drei an<strong>de</strong>ren Landschaften<br />
sind, dann besteht die Gefahr,<br />
dass die Interaktion <strong>und</strong> die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>n drei an<strong>de</strong>ren<br />
gebremst wird, weil sie in einer <strong>de</strong>r drei<br />
an<strong>de</strong>ren Landschaften an ein Hin<strong>de</strong>rnis<br />
stößt.<br />
Die Seminaristen müssen sich also<br />
Rüstzeug verschaffen, Hin<strong>de</strong>rnisse<br />
sehen zu wollen, damit sie nicht Gefahr<br />
laufen, blind <strong>für</strong> diese Perspektive zu<br />
wer<strong>de</strong>n. Sonst suchen sie auch nur in<br />
ihrer „Landschaft“ nach <strong>de</strong>n Ursachen<br />
<strong>de</strong>s Scheiterns, ohne Bewusstsein da<strong>für</strong>,<br />
dass das eigene „Blindsein“ die eigentliche<br />
Ursache <strong>für</strong> das Scheitern ist.<br />
Verhaftet in eingeengter Perspektive auf<br />
nur eine „Landschaft“ wird dann häufig<br />
die Ursache <strong>für</strong> das Misslingen in die<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen hineingesehen<br />
(„Wenn <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re nicht so ist wie ich<br />
ihn gerne hätte, was verän<strong>de</strong>re ich<br />
zuerst bei mir“, d. h. welchen Perspektivenwechsel<br />
nehme ich bei meiner<br />
Landschaftsschau vor?) Die Studieren<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Heilpädagogik müssen diese<br />
vier „Landschaften“ gründlich kennen<br />
lernen <strong>und</strong> die Fähigkeit erwerben, sich<br />
geschickt in je<strong>de</strong>r zu bewegen <strong>und</strong><br />
fließen<strong>de</strong> Übergänge <strong>und</strong> Wechsel im<br />
Ausbalancieren <strong>de</strong>r jeweiligen Ungewichtigkeiten<br />
herzustellen.<br />
Für die heilpädagogische Anwendung<br />
<strong>de</strong>s „Semisportes“ ist <strong>de</strong>shalb die<br />
Basiskompetenz <strong>de</strong>r Reflexion <strong>und</strong><br />
differenzierten „Landschaftswahrnehmung“<br />
aus unterschiedlichen Perspekti
ven eine gr<strong>und</strong>legen<strong>de</strong> Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> das Gelingen eines solchen Projektes.<br />
Ein wesentliches Ziel heilpädagogischer<br />
Praxisanleitung <strong>und</strong> Supervision<br />
liegt in <strong>de</strong>r „Eichung“ <strong>de</strong>r<br />
Wahrnehmung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r damit verb<strong>und</strong>enen<br />
interpretativen Gehalte hinsichtlich<br />
einer gesehenen, gehörten,<br />
gefühlten Handlungssituation <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
darin Beteiligten. Je kongruenter die<br />
Leiter/innen ihre gesammelten Daten in<br />
einen funktionalen Zusammenhang<br />
bringen können, <strong>de</strong>r tatsächlichen<br />
Lebensrealität, <strong>de</strong>m bunten „Landschaftsbild“<br />
<strong>de</strong>r beteiligten Personen<br />
möglichst nahe kommt, umso breiter<br />
<strong>und</strong> wirkungsvoller kann sich die auf<br />
dieser gemeinsamen Basis gewonnene,<br />
handlungspraktisch be<strong>de</strong>utsame<br />
Feldkompetenz entwickeln.<br />
Die Bereitschaft zur Kontrolle <strong>und</strong><br />
Reflexion <strong>de</strong>r eigenen Affekte, die die<br />
Leiter/innen vor impulsivem <strong>und</strong><br />
blin<strong>de</strong>m Agieren <strong>und</strong> Reagieren<br />
bewahrt, <strong>und</strong> die daraus resultieren<strong>de</strong><br />
Übersicht <strong>und</strong> person <strong>und</strong> gruppenzugewandte<br />
Gelassenheit, Fre<strong>und</strong>lichkeit<br />
<strong>und</strong> Bestimmtheit sind genauso wichtig<br />
wie körperlichsportliche, spielerische<br />
Eigenschaften. Diese reflexive Gr<strong>und</strong>einstellung<br />
wird durch die Zusammenarbeit<br />
von Praxisanleiter <strong>und</strong> Seminaristen,<br />
die gemeinsam die „Semisport“<br />
St<strong>und</strong>en nachbesprechen <strong>und</strong> die<br />
folgen<strong>de</strong>n konzipieren <strong>und</strong> durch das<br />
Angebot <strong>de</strong>r Supervision (wöchentlich)<br />
geför<strong>de</strong>rt <strong>und</strong> differenziert.<br />
So ermöglicht die effektive Gestaltung<br />
<strong>de</strong>r Praxisbezüge im ÜBBZ Würzburg<br />
eine heilpädagogische Ausbildung, die<br />
Kompetenz <strong>und</strong> I<strong>de</strong>ntität von Heilpädagogen<br />
för<strong>de</strong>rt. Sowohl die Person <strong>de</strong>s<br />
Heilpädagogen wie die Einbindung <strong>de</strong>s<br />
Heilpädagogischen Seminars in das<br />
Verb<strong>und</strong>system <strong>de</strong>r Jugendhilfe bil<strong>de</strong>n<br />
die Bezugspunkte heilpädagogischer<br />
Ausbildung. In <strong>de</strong>n strukturell vorgegebenen<br />
Rahmenbedingungen wer<strong>de</strong>n<br />
personale Kompetenzen erworben <strong>und</strong><br />
entwickelt <strong>und</strong> damit die Möglichkeit<br />
einer verbesserten Professionalisierung<br />
gegeben.<br />
Literatur:<br />
Beck, U. (1986): Risikogesellschaft.<br />
Auf <strong>de</strong>m Weg in eine an<strong>de</strong>re<br />
Mo<strong>de</strong>rne. Frankfurt a. M.:<br />
Suhrkamp.<br />
BoszormenyiNagy, I./Spark, G. M.<br />
(1995): Unsichtbare Bindungen.<br />
Die Dynamik familiärer Systeme.<br />
Stuttgart 5 : KlettCotta.<br />
Bronfenbrenner, U. (1981): Die<br />
Ökologie <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Entwicklung. Natürliche <strong>und</strong><br />
geplante Experimente. Stuttgart:<br />
KlettCotta.<br />
Cohn, R. (1976): Von <strong>de</strong>r Psychoanalyse<br />
zur themenzentrierten<br />
Interaktion. Stuttgart: Klett.<br />
110–120.<br />
Dor<strong>de</strong>l, S. (1993): Bewegungsför<strong>de</strong>rung<br />
in <strong>de</strong>r Schule. Dortm<strong>und</strong> 3 :<br />
mo<strong>de</strong>rnes lernen.<br />
Dziewas, H. (1980): Instrumentelle<br />
Gruppenbedingungen als<br />
Voraussetzung <strong>de</strong>s individuellen<br />
Lernprozesses. In: Grawe, K.<br />
(Hrsg.) (1980): Verhaltenstherapie<br />
in Gruppen. München: Urban<br />
& Schwarzenberg. 27–55.<br />
Flosdorf, P. (1988): Spielsport – Ein<br />
Heilpädagogisches Konzept zur<br />
gezielten psychomotorischen<br />
Behandlung verhaltensauffälliger<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlicher.<br />
In: Flosdorf, P. (Hrsg.): Theorie<br />
<strong>und</strong> Praxis stationärer Erziehungshilfe.<br />
Band 2. Die Gestaltung<br />
<strong>de</strong>s Lebensfel<strong>de</strong>s Heim.<br />
Freiburg i. Br.: Lambertus.<br />
Keupp, H. (1995): Riskante Freiheiten<br />
<strong>de</strong>s Aufwachsens heute<br />
<strong>und</strong> die Aufgabe <strong>de</strong>r Erziehungsberatung.<br />
In: Sozialdienst<br />
Katholischer Frauen e. V. (Hrsg):<br />
Psychotherapeutischer Beratungsdienst.<br />
Eltern, Jugendlichen<br />
<strong>und</strong> Erziehungsberatung.<br />
Festschrift zum 40jährigen<br />
Jubiläum. Kitzingen. Selbstverlag.<br />
39–63.<br />
Müller, A. (2003): „SpielSport“. Ein<br />
Konzept heilpädagogischer<br />
Beziehungsgestaltung innerhalb<br />
<strong>de</strong>r stationären Erziehungshilfe.<br />
In: Flosdorf, P./Patzelt, H. (Hrsg.):<br />
Therapeutische Heimerziehung.<br />
Entwicklungen, Konzepte,<br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>und</strong> ihre Evaluation.<br />
Landau (Pfalz): Eigenverlag <strong>de</strong>s<br />
Institutes <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendhilfe. 505–537.<br />
Patzelt, H. (2000): Würzburger<br />
JugendhilfeEvaluationsstudie<br />
(WJE). Die Wirksamkeit von<br />
heilpädagogischtherapeutischen<br />
Hilfen. Würzburg: City<br />
Druck.<br />
Rie<strong>de</strong>r, H. (2003): Sport als Therapie<br />
– Eine neue Dimension <strong>de</strong>r<br />
Nutzung sportlicher Möglichkeiten.<br />
In: Flosdorf, P. u. Patzelt,<br />
H. (Hrsg.): Therapeutische<br />
Heimerziehung. Entwicklungen,<br />
Konzepte, Metho<strong>de</strong>n <strong>und</strong> ihre<br />
Evaluation. Landau (Pfalz):<br />
Eigenverlag <strong>de</strong>s Institutes <strong>für</strong><br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendhilfe. 495–<br />
505.<br />
Watzlawick, P./Beavin, J. H./Jackson,<br />
D. (1990): Menschliche Kommunikation.<br />
Formen, Störungen,<br />
Paradoxien. Bern 8 : Huber.<br />
Zentrum <strong>für</strong> Aus- <strong>und</strong> Fortbildung in<br />
Psychomotorischer Praxis Aucouturier<br />
Achtzehnmonatige Weiterbildung<br />
in Psychomotorischer Praxis Aucouturier (PPA)<br />
in Erziehungsbereich <strong>und</strong> Prävention <strong>für</strong> pädagogische<br />
<strong>und</strong> erzieherische Fachkräfte in Hameln bei Hannover<br />
ab Herbst 2007<br />
• Fortbildungen (Auszüge)<br />
6.–8. 7. 07 Frühkindliches Spiel/<br />
Psycho<strong>motorik</strong> in <strong>de</strong>r Prävention<br />
25./26. 8. 07 Vi<strong>de</strong>osupervision <strong>für</strong> Interessenten<br />
ohne Ausbildung<br />
21.–23. 9. 07 Beweg-Grün<strong>de</strong>, Teil II:<br />
Die Handlungsfantasmen<br />
26.–28. 10. 07 Beweg-Grün<strong>de</strong>, Einführung in die PPA<br />
30. 11. 07 Bernard Aucouturier zu <strong>de</strong>n<br />
Symbolisierungsprozessen<br />
beim Kind<br />
1./2. 12. 07 Psycho<strong>motorik</strong> mit verhaltenauffälligen<br />
Jugendlichen<br />
7.–8. 12. 07 Psycho<strong>motorik</strong> mit autistischen Kin<strong>de</strong>rn<br />
Das neue Buch von Bernard Aucouturier<br />
ist erschienen.<br />
Info unter www.zappa-bonn.<strong>de</strong>/literatur<br />
Programm <strong>und</strong> Information:<br />
ZAPPA • Professor-Neu-Allee 6 • 53225 Bonn<br />
Fon (02 28) 4 79 76 13 • Fax (02 28) 4 79 76 14<br />
79
80<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als bewegungsorientiertes Angebot einer Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung<br />
Jörg Lesch<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als bewegungsorientiertes<br />
Angebot einer Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung<br />
Am Beispiel einer Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung im Saarland wird hier die<br />
Be<strong>de</strong>utung von Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r pädagogischen <strong>und</strong> therapeutischen<br />
Arbeit mit Kin<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>utlich gemacht.<br />
Einleitung<br />
Das Theresienheim Saarbrücken hat sich<br />
in seinem 100-jährigen Bestehen vom<br />
traditionellen Kin<strong>de</strong>rheim zum „Zentrum<br />
<strong>für</strong> heilpädagogische Kin<strong>de</strong>r-,<br />
Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe“ entwickelt<br />
<strong>und</strong> versteht sich als eine mo<strong>de</strong>rne,<br />
innovative Jugendhilfeeinrichtung <strong>für</strong><br />
<strong>de</strong>n Stadtverband Saarbrücken. Träger<br />
<strong>de</strong>r Einrichtung sind die Cts-Schwestern<br />
vom Heiligen Geist gGmbH Saarbrücken.<br />
Durch das breit ausdifferenzierte<br />
erzieherische, sozialarbeiterische <strong>und</strong><br />
therapeutische Angebot leistet die<br />
Einrichtung adäquate Hilfe <strong>für</strong> <strong>de</strong>rzeit<br />
r<strong>und</strong> 160 Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche sowie<br />
<strong>de</strong>ren Familien, in unterschiedlichster<br />
Ausprägung, anknüpfend an die<br />
Ressourcen <strong>de</strong>r Familien:<br />
• Die Kin<strong>de</strong>rtagesstätte unterstützt<br />
Familien mit Kin<strong>de</strong>rn im Alter von<br />
8 Wochen bis 6 Jahre in <strong>de</strong>r<br />
Betreuung, Erziehung <strong>und</strong><br />
Bildung.<br />
• Über das Angebot Ambulante<br />
Familienhilfe wer<strong>de</strong>n Familien in<br />
ihrem sozialen Umfeld stabilisiert.<br />
Der Umfang <strong>de</strong>r Betreuung<br />
richtet sich nach <strong>de</strong>m speziellen<br />
aktuellen Bedarf <strong>und</strong> wird mit<br />
Familie <strong>und</strong> Jugendamt ausgehan<strong>de</strong>lt.<br />
• In Tagesgruppen wer<strong>de</strong>n Schulkin<strong>de</strong>r<br />
betreut, <strong>de</strong>ren Familien<br />
zwar intensive Unterstützung<br />
suchen, das Beziehungssystem<br />
an<strong>de</strong>rerseits noch so tragfähig<br />
ist, dass eine stationäre Unterbringung<br />
nicht erfor<strong>de</strong>rlich ist.<br />
Tagesgruppen sind befristete<br />
Hilfen mit intensiver Elternarbeit.<br />
• In Professionellen Bereitschaftspflegestellen<br />
fin<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>r bis<br />
drei Jahre, die sich aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s<br />
Wegfalls ihrer bisherigen<br />
Bezugsperson in einer akuten<br />
Notsituation befin<strong>de</strong>n, zeitlich<br />
befristete Aufnahme, Pflege <strong>und</strong><br />
Zuwendung. Diese Stellen leisten<br />
Kin<strong>de</strong>rschutz in beson<strong>de</strong>ren<br />
Problemlagen.<br />
• In Professionellen Erziehungsstellen<br />
erhalten Kin<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>ren<br />
Ursprungsfamilie aus unterschiedlichen<br />
Grün<strong>de</strong>n nicht ihrem<br />
Erziehungsauftrag nachkommen<br />
können, im Rahmen eines<br />
professionellen Settings im<br />
Beziehungsfeld Familie Erziehung,<br />
Pflege, För<strong>de</strong>rung <strong>und</strong> Zuwendung.<br />
• Die Heilpädagogischen Kin<strong>de</strong>rgruppen<br />
bieten ein therapeutisches<br />
Milieu <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r von 3<br />
bis 12 Jahren. Das Angebot<br />
richtet sich an Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren<br />
Familien, bei <strong>de</strong>nen es aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer persönlichen <strong>und</strong>/o<strong>de</strong>r<br />
familiären Umstän<strong>de</strong>n/Lebenssituationen/Krisen,<br />
kurz o<strong>de</strong>r<br />
längerfristig angezeigt ist, Hilfe<br />
zur Erziehung anzubieten.<br />
• Die Jugendwohngruppen<br />
betreuen Heranwachsen<strong>de</strong> <strong>und</strong><br />
Jugendliche im Alter von 11 bis<br />
16 Jahre. Zielperspektive ist die<br />
Rückführung in die Herkunftsfamilie<br />
o<strong>de</strong>r Verselbstständigung<br />
über Mobile Betreuung/Betreutes<br />
Wohnen.<br />
• Mobile Betreuung <strong>und</strong> Betreutes<br />
Wohnen sind abgestuft intensive<br />
Angebote <strong>de</strong>r Einzelbetreuung <strong>für</strong><br />
Jugendliche <strong>und</strong> junge Erwachsene,<br />
als letzter Schritt in die<br />
Eigenverantwortung.<br />
Pädagogisch-Therapeutisches<br />
För<strong>de</strong>rkonzept <strong>und</strong> Perso-<br />
nalisierung<br />
Die spezielle Konzeption <strong>de</strong>r Einrichtung<br />
besteht (in Ergänzung zum<br />
familienorientierten Ansatz) darin, <strong>de</strong>n<br />
betreuten Kin<strong>de</strong>rn ein Lebensfeld<br />
anzubieten, in <strong>de</strong>m sie in <strong>de</strong>r befristeten<br />
Zeit ein Optimum an För<strong>de</strong>rung<br />
durch eine heilen<strong>de</strong> Umwelt erfahren<br />
können. Psycho<strong>motorik</strong> hat in diesem<br />
therapeutischen Milieu einen beson<strong>de</strong>ren<br />
Stellenwert. So setzt sich die<br />
Psychomotorische För<strong>de</strong>rung im<br />
Theresienheim aus folgen<strong>de</strong>n drei<br />
Säulen zusammen: Heilpädagogisches<br />
Reiten, Handlungs- <strong>und</strong> Erlebnispädagogik,<br />
Sport- <strong>und</strong> <strong>Motopädagogik</strong>.<br />
Der Teil <strong>de</strong>s gruppenübergreifen<strong>de</strong>n<br />
Fachdienstes, <strong>de</strong>r <strong>für</strong> <strong>de</strong>n stationären<br />
Bereich pädagogisch-therapeutische<br />
Behandlungen bzw. För<strong>de</strong>rangebote<br />
durchführt, ist mit 3 Planstellen <strong>für</strong><br />
aktuell 6 stationäre Gruppen à 9<br />
Kin<strong>de</strong>r/Jugendliche besetzt: 1 Diplom-<br />
Sportlehrer/Motopädagoge, 1 Reitpädagogin,<br />
1 Spieltherapeut. Spieltherapie,<br />
Reitpädagogik, Erlebnispädagogik <strong>und</strong><br />
<strong>Motopädagogik</strong> erfolgen auf <strong>de</strong>r Basis<br />
von Erziehungs- <strong>und</strong> Hilfeplan. Die<br />
jeweils geeignete Maßnahme wird<br />
entwe<strong>de</strong>r im Hilfeplan bei <strong>de</strong>r Aufnahme<br />
abgesprochen o<strong>de</strong>r ergibt sich als<br />
Resultat <strong>de</strong>r Erziehungsplanbesprechungen<br />
<strong>de</strong>r Teams. Ist nach Einschätzung<br />
<strong>de</strong>s Erzieher/innenteams die<br />
jeweilige Einzeltherapie angesagt,<br />
wird <strong>de</strong>r/die entsprechen<strong>de</strong> TherapeutIn<br />
durch <strong>de</strong>n/die zuständigen Bereichsleiter/in<br />
zu einer Fallbesprechung<br />
eingela<strong>de</strong>n. Kommt die Behandlung<br />
zustan<strong>de</strong>, führt <strong>de</strong>r/die Therapeut/in<br />
einen Behandlungsplan mit genauer<br />
Zielbeschreibung, Zeitperspektive,<br />
Entwicklungsverlauf <strong>und</strong> Revisionsterminen.<br />
Die Behandlung wird<br />
<strong>für</strong> die Hilfeplangespräche dokumentiert.
Psychomotorische För<strong>de</strong>rung<br />
<strong>und</strong> Ausstattung<br />
Spiel <strong>und</strong> Bewegung haben eine<br />
elementare Be<strong>de</strong>utung <strong>für</strong> die Entwicklung<br />
<strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s <strong>und</strong> sind Ausdrucksform<br />
seiner Persönlichkeit. Störungen in<br />
<strong>de</strong>r Entwicklung, zum Beispiel motorische<br />
Auffälligkeiten, Retardierungen,<br />
Defizite im psychomotorischen Verhalten<br />
sind bei <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn in unserer<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung<br />
häufig zu beobachten. Ausgehend von<br />
<strong>de</strong>r Bejahung <strong>de</strong>r psychomotorischen<br />
I<strong>de</strong>e wur<strong>de</strong> daher in <strong>de</strong>n letzten 10<br />
Jahren, als beson<strong>de</strong>rer heilpädagogischer<br />
Schwerpunkt, die psychomotorische<br />
För<strong>de</strong>rung ausgebaut. Der<br />
Stellenwert in <strong>de</strong>r Gesamtkonzeption<br />
wird <strong>de</strong>utlich, wenn man sich <strong>de</strong>n<br />
neuen psychomotorischen För<strong>de</strong>rraum<br />
ansieht.<br />
Durch <strong>de</strong>n 1999 durchgeführten Umbau<br />
<strong>de</strong>r früheren Schwimmhalle ist ein<br />
Spiel-, Bewegungs- <strong>und</strong> Lernfeld <strong>für</strong> die<br />
Kin<strong>de</strong>r entstan<strong>de</strong>n, das in Ausstattung<br />
<strong>und</strong> Ausgestaltung wohl einzigartig im<br />
Saarland ist: Komplett ausgelegt mit<br />
dick gepolsterten farbigen Weichbo<strong>de</strong>nmatten,<br />
im Sprungbereich mit einem fest<br />
installierten Trampolin, einem Hangel-,<br />
Kletter- <strong>und</strong> Schwingbereich, einer<br />
Ruhezone mit großer Hängematte, sowie<br />
einer etwa 30 m² großen gepolsterten<br />
Höhle im alten Schwimmbecken unter<br />
<strong>de</strong>m Trampolin, präsentiert sich dieser<br />
r Abb. 2: Die gepolsterte Kletterhalle<br />
Psychomotorische Persönlichkeitsför<strong>de</strong>rung<br />
Sport<strong>und</strong><br />
<strong>Motopädagogik</strong><br />
r Abb. 1: Bewegungsorientierte Angebote im Theresienheim<br />
Bewegungsraum <strong>für</strong> unsere Kin<strong>de</strong>r als<br />
hoch motivierend, um Ängste zu überwin<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> Bewegungs<strong>de</strong>fizite abzubauen.<br />
Daneben gibt es auch noch eine<br />
kleinere Sporthalle mit vielfältigen<br />
psychomotorischen Utensilien, einen<br />
Snoeselenraum <strong>und</strong> ein großes Außengelän<strong>de</strong><br />
mit Rasenplatz <strong>für</strong> verschie<strong>de</strong>nste<br />
Bewegungsspiele.<br />
Handlungs<strong>und</strong><br />
Erlebnispädagogik<br />
Heilpädagogisches<br />
Reiten<br />
Praktische Umsetzung<br />
Im Theresienheim hat je<strong>de</strong>s Kind, je<strong>de</strong>r<br />
Jugendliche im Sinne von Prävention<br />
<strong>und</strong> Rehabilitation mehrere motorische<br />
Angebote in <strong>de</strong>r Woche. Durchgeführt<br />
wer<strong>de</strong>n diese in <strong>de</strong>r Sporthalle, im<br />
Trampolinraum, im Außengelän<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r<br />
in <strong>de</strong>r freien Natur. Speziell im Jugendbereich<br />
wird dabei vorwiegend erleb-<br />
Jörg Lesch<br />
Jahrgang 1961, Diplom-Sportlehrer,<br />
Motopädagoge AkM, Erlebnispädagoge<br />
(u. a. Fachübungsleiter Klettern, Robes<br />
Course Trainer) arbeitet seit 18 Jahren<br />
in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe im<br />
gruppenübergreifen<strong>de</strong>n Fachdienst.<br />
Anschrift <strong>de</strong>s Verfassers:<br />
Königsberger Straße 60<br />
66121 Saarbrücken<br />
81
82<br />
Psycho<strong>motorik</strong> als bewegungsorientiertes Angebot einer Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung<br />
r Abb. 3: Kin<strong>de</strong>r im szenischen Spiel<br />
r Abb. 4: Die Rollbrettlandschaft<br />
nispädagogisch gearbeitet (Kanu,<br />
Klettern, Robes Course) mit festen<br />
Gruppen, klarer Zielsetzung <strong>und</strong><br />
Inhalten bei variabler Gestaltung <strong>und</strong><br />
anschließen<strong>de</strong>r Dokumentation.<br />
Im Kin<strong>de</strong>rbereich hat die <strong>Motopädagogik</strong><br />
als ganzheitlicher Ansatz ihren<br />
festen Stellenwert. In <strong>de</strong>r Praxis wer<strong>de</strong>n<br />
hier die Kin<strong>de</strong>r in koedukativen, meist<br />
altershomogenen Kleingruppen (4 bis 6<br />
Kin<strong>de</strong>r) psychomotorisch geför<strong>de</strong>rt.<br />
Aber auch das gemeinsame Spiel in <strong>de</strong>r<br />
Großgruppe fin<strong>de</strong>t regelmäßig an festen<br />
Terminen statt.<br />
Bei allen Angeboten spielen das Klima<br />
<strong>de</strong>r Annahme <strong>und</strong> das Beziehungsangebot<br />
eine wichtige Rolle.<br />
Liegt eine beson<strong>de</strong>re Indikation vor<br />
(erhebliche motorische <strong>und</strong>/o<strong>de</strong>r soziale<br />
Auffälligkeit), wird in Absprache mit<br />
<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren pädagogisch/therapeutischen<br />
Angeboten eine spezielle<br />
Einzelst<strong>und</strong>e angeboten. Die Zielset
zung, die Inhalte <strong>und</strong> Entwicklungsverän<strong>de</strong>rungen<br />
wer<strong>de</strong>n auf einem geson<strong>de</strong>rten<br />
Formblatt dokumentiert <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>m Hilfeplan beigefügt. Die gebräuchlichsten<br />
motodiagnostischen Verfahren<br />
(KTK, Mot 4-6) zur Überprüfung <strong>de</strong>r<br />
motorischen Leistung fin<strong>de</strong>n ebenso<br />
Anwendung, allerdings nur zur allgemeinen<br />
Grobeinschätzung. Die Tests<br />
können hilfreich sein, ersetzen allerdings<br />
nicht die Analyse <strong>de</strong>s geschulten<br />
Beobachters über mehrere Sequenzen.<br />
Schwerpunktmäßig wird im Theresienheim<br />
auch mit <strong>de</strong>m Trampolin gearbeitet.<br />
Gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n letzten Jahren<br />
fan<strong>de</strong>n viele Kin<strong>de</strong>r mit mangeln<strong>de</strong>r<br />
o<strong>de</strong>r gestörter Entwicklung <strong>de</strong>r Koordinationsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Gleichgewichtsfunktion<br />
Aufnahme. Der Psycho<strong>motorik</strong>raum<br />
mit <strong>de</strong>m Trampolin wird<br />
aufgr<strong>und</strong> seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten<br />
zum Aufbau <strong>und</strong> zur<br />
Erweiterung von Wahrnehmungs- <strong>und</strong><br />
Bewegungsmustern sehr häufig<br />
benutzt. Er erlaubt nicht nur <strong>de</strong>m<br />
spezialisierten Fachdienst son<strong>de</strong>rn auch<br />
<strong>de</strong>m/<strong>de</strong>r Erzieher/in im Gruppendienst<br />
ohne zeitlichen <strong>und</strong> materiellen<br />
Aufwand direkt in die Psycho<strong>motorik</strong><br />
r Abb. 5: Das Bo<strong>de</strong>ntrampolin<br />
einzusteigen, ohne dass ein hohes Maß<br />
an extrinsischer Motivation an <strong>de</strong>n<br />
Kin<strong>de</strong>rn geleistet wer<strong>de</strong>n muss.<br />
In <strong>de</strong>n vergangenen Jahren wur<strong>de</strong>n die<br />
psychomotorischen Angebote vorwiegend<br />
vom gruppenübergreifen<strong>de</strong>n<br />
Dienst durchgeführt. Mittlerweile (auch<br />
aufgr<strong>und</strong> hausinterner Fortbildungen im<br />
Psycho<strong>motorik</strong>raum) gibt es einige<br />
Kolleg/innen, die Psycho<strong>motorik</strong> in ihrer<br />
Arbeit umsetzen. In diesem Zusammenhang<br />
ist ein Snoeselenraum entstan<strong>de</strong>n,<br />
eine Zirkus AG wur<strong>de</strong> ins Leben gerufen<br />
<strong>und</strong> verschie<strong>de</strong>ne Aktivitäten mit<br />
psychomotorischen Inhalten wur<strong>de</strong>n<br />
bereits durchgeführt.<br />
Ansichten<br />
Obwohl in <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n meist<br />
politischen Diskussion Einsparmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Kürzungen in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe an <strong>de</strong>r Tagesordnung<br />
sind <strong>und</strong> ganzheitliche Konzepte wenig<br />
Konjunktur besitzen, zeigen die<br />
Belegungszahlen <strong>de</strong>s Theresienheimes,<br />
dass die pädagogisch-therapeutischen<br />
psychomotorischen För<strong>de</strong>rangebote <strong>für</strong><br />
die Jugendämter immer noch ein<br />
belegungsrelevanter Faktor sind. Auch<br />
ist im Theresienheim die Unterstützung<br />
durch die Heimleitung <strong>und</strong> Bereichsleitung<br />
<strong>de</strong>r Einrichtung, was die finanziellen<br />
<strong>und</strong> fachlichen Bedürfnisse <strong>de</strong>s<br />
gruppenübergreifen<strong>de</strong>n Fachdienstes<br />
angeht, vorbildlich. Die Psycho<strong>motorik</strong><br />
wird von <strong>de</strong>r Leitungsebene mitgetragen.<br />
Die Mitarbeiter/innen im Gruppendienst<br />
sehen verständlicherweise bei<br />
<strong>de</strong>r hohen Belastung <strong>und</strong> <strong>de</strong>n hohen<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen zuerst einmal ihre<br />
Entlastung durch die Angebote, die<br />
psychomotorische I<strong>de</strong>e scheint aber, so<br />
zeigen auch die Umbaumaßnahmen auf<br />
<strong>de</strong>n Gruppen, mehr <strong>und</strong> mehr Fuß zu<br />
fassen. Und wie sehen die Kin<strong>de</strong>r<br />
die Angebote? Wenn man es erreichen<br />
kann, dass fast alle Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche<br />
unserer Einrichtung mit <strong>de</strong>n<br />
verschie<strong>de</strong>nsten motorischen Angeboten<br />
angesprochen wer<strong>de</strong>n, wenn man<br />
beobachten kann, wie diese Freu<strong>de</strong> an<br />
Spiel <strong>und</strong> Bewegung empfin<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
ausdrücken <strong>und</strong> wenn man dabei noch<br />
die positiven Verän<strong>de</strong>rungen in ihrer<br />
Entwicklung erlebt, dann spricht dies<br />
unzweifelhaft <strong>für</strong> sich selbst <strong>und</strong> die<br />
Wertigkeit <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>.<br />
83
84<br />
Sich fallen lassen – ein Thema in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe?!<br />
Sandra Klingler<br />
Sich fallen lassen –<br />
ein Thema in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe?!<br />
An „Fall-Beispielen“ wird die Be<strong>de</strong>utung von sich fallen lassen <strong>und</strong> loslassen <strong>für</strong> die<br />
kindliche Entwicklung <strong>de</strong>utlich gemacht. Vor <strong>de</strong>m Hintergr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Entwicklungstheorie<br />
von Erikson zeigt sich die Wirksamkeit psychomotorischer Angebote – hier<br />
insbeson<strong>de</strong>re das Fallen - im Kontext einer Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfeeinrichtung.<br />
Einleitung<br />
Im Arbeitsfeld <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
begegnen wir Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen, von <strong>de</strong>nen wir das Gefühl<br />
haben, dass sie nach Halt suchen <strong>und</strong><br />
sich von Erwachsenen „fallen gelassen“<br />
fühlen. Heißt es da nicht: Stärke zeigen<br />
statt sich fallen zu lassen? Tatsache ist,<br />
dass man in körper- <strong>und</strong> bewegungsorientierten<br />
Arbeitsfel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendhilfe (z. B. Psycho<strong>motorik</strong>,<br />
Erlebnispädagogik) im Spiel (<strong>und</strong><br />
Han<strong>de</strong>ln) <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r immer wie<strong>de</strong>r aufs<br />
Neue mit <strong>de</strong>m Thema in unterschiedlichen<br />
Facetten konfrontiert wird.<br />
Der Wunsch, sich fallen zu lassen <strong>und</strong><br />
sicher wie<strong>de</strong>r aufgefangen zu wer<strong>de</strong>n,<br />
scheint aber auch ein Phänomen<br />
unserer Zeit zu sein. So stehen mit<br />
erstaunlicher Mehrheit Aktivitäten, die<br />
durch ein Loslösen vom Bo<strong>de</strong>n, einem<br />
Fallen <strong>und</strong> wie<strong>de</strong>r Aufgefangen wer<strong>de</strong>n<br />
gekennzeichnet sind, an erster Stelle<br />
bei <strong>de</strong>n Sportarten, die Jugendliche <strong>und</strong><br />
junge Erwachsene in <strong>de</strong>r heutigen Zeit<br />
auswählen. 7% <strong>de</strong>r Jugendlichen in<br />
Deutschland haben bereits Bungee-<br />
Jumping-Erfahrung beim Sprung von<br />
einer Brücke o<strong>de</strong>r vom Fernsehturm.<br />
Dreimal so viele (21%) wollen <strong>de</strong>n Fall<br />
noch ausprobieren. Am meisten können<br />
sich die Jugendlichen <strong>de</strong>rzeit <strong>für</strong> das<br />
Fallschirmspringen begeistern; fast ein<br />
Viertel aller Jugendlichen (23%) will in<br />
<strong>de</strong>r nächsten Zeit <strong>de</strong>n Fallschirmsprung<br />
noch wagen (B.A.T.-Studie 2000).<br />
Für eine Suche nach <strong>de</strong>n Motiven,<br />
weshalb Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche in <strong>de</strong>r<br />
Erziehungshilfe diese Themen zeigen,<br />
eignen sich als Hintergr<strong>und</strong>informationen<br />
die I<strong>de</strong>en von E. H. Erikson (1973)<br />
zur I<strong>de</strong>ntitätsentwicklung. Aufbauend<br />
auf <strong>de</strong>ren kurze Darlegung wer<strong>de</strong> ich<br />
anhand verschie<strong>de</strong>ner Beispiele aus<br />
meiner Berufspraxis die physische <strong>und</strong><br />
psychische Dimension <strong>de</strong>s Themas<br />
ver<strong>de</strong>utlichen. Die Frage, die sich <strong>de</strong>m<br />
„Praktiker“ im Anschluss stellt ist: Wie<br />
lassen sich Situationen gestalten, damit<br />
Kin<strong>de</strong>r dieses Thema „spielen“ können?<br />
Da <strong>de</strong>r Person <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>er/in<br />
hier beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung zukommt,<br />
wird vor allem sie im Zentrum <strong>de</strong>s<br />
Betrachters stehen. Ein kurzer Blick auf<br />
weitere Elemente <strong>de</strong>r Situationsgestaltung<br />
(Raum, Zeit, Material) soll jedoch<br />
nicht fehlen.<br />
Entwicklung von Urvertrauen<br />
<strong>und</strong> Fallenlassen<br />
Das Urvertrauen entsteht laut Erikson,<br />
<strong>de</strong>r sich mit <strong>de</strong>r psycho-sozialen<br />
Entwicklung zur I<strong>de</strong>ntität beschäftigt<br />
hat, im ersten Lebensjahr eines<br />
Menschen. Das Kind erlebt sich<br />
zunächst in <strong>de</strong>r Symbiose mit <strong>de</strong>r<br />
Mutter o<strong>de</strong>r einer primären Bezugsperson.<br />
Es kann sich selbst nicht halten,<br />
nicht wärmen, nicht behüten, nicht<br />
sauber machen, … Dazu braucht es eine<br />
halten<strong>de</strong> liebevolle Umgebung. Das Kind<br />
erlebt ein passives Fallen lassen <strong>und</strong><br />
gleichzeitig ein Gehalten sein. Der<br />
Kontakt zur Mutter gibt Wärme,<br />
Sättigung, Erholung, Geborgenheit.<br />
Fallen-Lassen unter <strong>de</strong>r Bedingung <strong>de</strong>s<br />
Gehalten-Seins <strong>und</strong> Umhüllt-Seins wird<br />
vom Kind <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Bezugsperson als<br />
lustvoll erlebt. Urvertrauen be<strong>de</strong>utet<br />
aber nicht nur etwas Anfängliches, das<br />
man hinter sich lässt, son<strong>de</strong>rn etwas<br />
Basales, das später alles tragen soll. Auf<br />
<strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s entwickelten „Urvertrauens“<br />
kann es das Kind wagen, in eine<br />
frem<strong>de</strong> Welt hinauszutreten, die ständig<br />
Neues <strong>und</strong> Beängstigen<strong>de</strong>s bietet.<br />
Fehlen<strong>de</strong>s Urvertrauen bei vielen<br />
Heimkin<strong>de</strong>rn<br />
Aus <strong>de</strong>n Anamneseberichten von<br />
Heimkin<strong>de</strong>rn sowie aus Elterngesprächen<br />
wissen wir, dass eine halten<strong>de</strong><br />
liebevolle Umgebung in <strong>de</strong>r frühen<br />
Kindheit nicht immer gegeben war.<br />
Die psychomotorische Entwicklungsbegleitung<br />
bietet <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn die<br />
Möglichkeit, ins kindliche Spiel<br />
einzutauchen. Hier greifen sie oft auf<br />
Bewegungs- <strong>und</strong> Spielformen zurück,<br />
die ihre entwicklungsför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Kraft<br />
schon in viel früheren Entwicklungsstufen<br />
hätten entfalten müssen. Dadurch<br />
wird <strong>für</strong> uns <strong>de</strong>utlich, dass sie im freien<br />
Spiel immer wie<strong>de</strong>r versuchen, ungelöste<br />
Krisen ihrer Vergangenheit zu<br />
bewältigen, um sich damit neue<br />
Entwicklungschancen <strong>für</strong> die Zukunft<br />
zu eröffnen (vgl. Hammer 2000, S. 39).<br />
Während <strong>de</strong>r psychomotorischen<br />
Entwicklungsbegleitung sind Formen<br />
<strong>de</strong>s Sich fallen Lassens im kindlichen<br />
Spiel häufig zu beobachten. An die<br />
„Theorie <strong>de</strong>r psychosozialen Entwicklung“<br />
von Erikson (1973) angelehnt,<br />
erläutere ich einige Fallbeispiele.<br />
Urvertrauen im kindlichen Spiel –<br />
ein „Fall-Beispiel“<br />
Ein 7-jähriger Junge fährt mit<br />
einem Fahrzeug (Kettcar, Cityroller<br />
o<strong>de</strong>r Bobycar) <strong>und</strong> lässt sich einfach<br />
fallen. Nicht etwa, dass er ein<br />
Hin<strong>de</strong>rnis übersehen hätte o<strong>de</strong>r die<br />
Kurve zu eng war, nein – er fällt<br />
einfach so <strong>und</strong> bleibt liegen. Er<br />
wartet, bis ich hin eile, um ihn zu<br />
versorgen. Er lässt sich fallen, will<br />
umsorgt (gehalten) wer<strong>de</strong>n, genießt<br />
dies eine Weile <strong>und</strong> steht dann<br />
wie<strong>de</strong>r auf. Das Spiel beginnt von<br />
neuem - <strong>und</strong> wie<strong>de</strong>rholt sich<br />
mehrmals in einer St<strong>und</strong>e.<br />
Die Kindheit <strong>de</strong>s Jungen war bereits<br />
sehr früh von vielen Krankheiten<br />
<strong>und</strong> langen Krankenhausaufenthalten<br />
geprägt, eine gute Versorgung<br />
durch die Eltern war nicht vorhan-
<strong>de</strong>n. Im Spiel holt er sich Rückversicherung,<br />
baut Vertrauen in eine ihn<br />
nun halten<strong>de</strong> Umwelt auf. Es ist<br />
anzunehmen, dass <strong>de</strong>r Junge sich in<br />
einer unbewältigten psychosozialen<br />
Krise befin<strong>de</strong>t, die seine weitere<br />
Entwicklung belastet. Kann im<br />
kindlichen Spiel eine psychosoziale<br />
Krise bewältigt wer<strong>de</strong>n, so kann das<br />
Kind nach Erikson seine Ich-Integri-<br />
tät fin<strong>de</strong>n.<br />
Emotionales Auftanken<br />
im kindlichen Spiel –<br />
ein „Fall-Beispiel“<br />
Für einen 9-jährigen Jungen ist<br />
fester Bestandteil <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>e,<br />
dass er am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
St<strong>und</strong>e von mir „gekrault“ wer<strong>de</strong>n<br />
will. Die Inhalte <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>en<br />
gestalten sich unterschiedlich, mal<br />
ist er Rockstar, mal ein Verbrecher,<br />
mal Polizist – doch eines ist sicher<br />
<strong>und</strong> wird von <strong>de</strong>m Jungen auch<br />
gleich im Anfangskreis eingefor<strong>de</strong>rt:<br />
„Ich möchte am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e<br />
von dir gekrault wer<strong>de</strong>n!“<br />
Während dieses Abschlussrituals<br />
lässt er sich völlig in die Entspannung<br />
fallen <strong>und</strong> genießt diese<br />
körperliche Zuwendung. Die dabei<br />
entstehen<strong>de</strong> Ruhe <strong>und</strong> Konzentration,<br />
die Intensität <strong>de</strong>r Beziehung, die<br />
beson<strong>de</strong>rs bei <strong>de</strong>r Massage gespürt<br />
wird, erzeugt bei <strong>de</strong>m Jungen das<br />
Gefühl von Halt <strong>und</strong> Geborgenheit.<br />
Er kann „emotional auftanken“.<br />
Erikson beschreibt, dass – je nach<br />
Entwicklungsstand – zunächst<br />
Spiele bevorzugt wer<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>nen<br />
es um <strong>de</strong>n Erwerb von Urvertrauen<br />
geht. Erst darauf aufbauend folgen<br />
Spiele zur Entwicklung von „Autonomie“<br />
<strong>und</strong> „Initiative“. Auf <strong>de</strong>r<br />
Basis <strong>de</strong>s entwickelten „Urvertrauens“<br />
wagt sich <strong>de</strong>r Junge, in eine<br />
frem<strong>de</strong> Welt hinauszutreten (er<br />
schlüpft in verschie<strong>de</strong>ne Rollen), die<br />
ständig Neues, manchmal auch<br />
Beängstigen<strong>de</strong>s bietet. So lernt er<br />
auf eigenen Füßen zu stehen <strong>und</strong><br />
unabhängig vom Erwachsenen zu<br />
wer<strong>de</strong>n. Dabei braucht er Nähe als<br />
Ort <strong>de</strong>s Rückzugs, als „Heimathafen“,<br />
zu <strong>de</strong>m er immer wie<strong>de</strong>r<br />
zurückkehren kann, um „emotional<br />
aufzutanken“. Um sich <strong>de</strong>ssen sicher<br />
zu sein, for<strong>de</strong>rt er dies gleich zu<br />
Beginn <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e ein.<br />
Regressive Elemente im kindlichen<br />
Spiel – ein „Fall-Beispiel“<br />
Selbst wenn ein Kind Spiele zur Entwicklung<br />
von Autonomie <strong>und</strong><br />
Initiative bevorzugt spielt, also sich<br />
in dieser Entwicklungsphase<br />
befin<strong>de</strong>t, kann es durchaus erneut<br />
zur Regression kommen. Im<br />
kindlichen Spiel sind regressive<br />
Elemente zu erkennen, die immer<br />
dann verstärkt zu beobachten sind,<br />
wenn die Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r<br />
Umwelt zunehmen. Wie das Beispiel<br />
eines 13-jährigen Mädchens zeigt,<br />
sucht es dann Situationen, die sie es<br />
an Ruhe, Entspannung <strong>und</strong><br />
Geborgenheit – <strong>de</strong>m Gehalten-<br />
Wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r pränatalen Entwicklungsphase<br />
– erinnern.<br />
Das Mädchen lebt seit 4 Jahren in<br />
einer Wohngruppe <strong>und</strong> besucht die<br />
Schule <strong>für</strong> Erziehungshilfe unserer<br />
Einrichtung. Kontakte zu ihren<br />
Pflegeeltern sind selten. Diese sind<br />
nun weiter weggezogen <strong>und</strong><br />
überlegen, das Mädchen in einer<br />
näherliegen<strong>de</strong>n Einrichtung<br />
unterzubringen. Für das Mädchen<br />
wür<strong>de</strong> dies ein Schulwechsel bzw.<br />
auch ein Wohngruppenwechsel in<br />
eine <strong>für</strong> sie unbekannte Einrichtung<br />
be<strong>de</strong>uten. Die ungewisse Situation<br />
verursacht bei ihm Unsicherheit.<br />
Während <strong>de</strong>r psychomotorischen<br />
För<strong>de</strong>rung drückt es seine Gefühle<br />
im Spiel aus. Es spielt seit über<br />
einem Jahr immer wie<strong>de</strong>r die<br />
Babyrolle, lässt sich auf <strong>de</strong>m großen<br />
Trampolin o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Hängematte<br />
wiegen <strong>und</strong> will gehalten wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Embryonalhaltung, die es dabei<br />
einnimmt, erinnert sehr an <strong>de</strong>n<br />
schweben<strong>de</strong>n Zustand während <strong>de</strong>r<br />
pränatalen Phase im geschützten<br />
Mutterleib.<br />
Auf eigenen Füßen stehen –<br />
Selbstständigkeit durch Loslassen<br />
Das Thema „Sich fallen lassen“ <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Wunsch gehalten zu wer<strong>de</strong>n ereignet<br />
sich nicht nur in kleinen Beziehungskontexten<br />
(Einzelst<strong>und</strong>e, Kleingruppe).<br />
In an<strong>de</strong>ren Facetten zeigt es sich auch<br />
in größeren Kontexten, wie <strong>de</strong>m<br />
regelmäßig stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Spielnachmittag,<br />
einem offenen Bewegungsangebot<br />
in unserer Einrichtung. In <strong>de</strong>r<br />
Turnhalle geben wir <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn durch<br />
verschie<strong>de</strong>ne Aufbauten Spiel- <strong>und</strong><br />
Bewegungsmöglichkeiten vor. Neben<br />
Schaukeln, Springen, Klettern, Fahren,<br />
Raufen ist auch das Fallen lassen immer<br />
wie<strong>de</strong>r Thema <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r.<br />
Ein Kletterturm sowie eine sich in ca.<br />
2 m Höhe befindliche Balustra<strong>de</strong> bieten<br />
<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn die Möglichkeit, sich aus<br />
dieser Höhe auf dicke Matten fallen zu<br />
lassen. Dies ist bei <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn sehr<br />
beliebt. Anfangs brauchen Kin<strong>de</strong>r<br />
oftmals die Sicherheit durch das<br />
Reichen meiner Hand, <strong>de</strong>r Körperkontakt<br />
erleichtert ihnen das Fallen-Lassen.<br />
Hier zeigt sich die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s<br />
Körperkontaktes, es greifen auch Kin<strong>de</strong>r,<br />
die sich sonst sehr selbstständig in <strong>de</strong>r<br />
Turnhalle bewegen, wie<strong>de</strong>r auf das<br />
Gehaltenwer<strong>de</strong>n zurück. Eine solche<br />
Situation be<strong>de</strong>utet <strong>für</strong> die Kin<strong>de</strong>r erst<br />
einmal Unsicherheit. Eine Bezugsperson,<br />
die ihnen Sicherheit <strong>und</strong> Halt vermittelt<br />
ist erfor<strong>de</strong>rlich. Es ist wichtig, Neues zu<br />
wagen, um sich weiter zu entwickeln<br />
<strong>und</strong> Erfolgserlebnisse zu erzielen.<br />
Schritt <strong>für</strong> Schritt wer<strong>de</strong>n die Kin<strong>de</strong>r<br />
mutiger <strong>und</strong> lösen sich von mir. Es<br />
reicht dann auch, wenn ich bei ihnen<br />
stehe <strong>und</strong> zuschaue.<br />
Eine weitere Stufe <strong>de</strong>s Loslösens zeigt<br />
sich, wenn Kin<strong>de</strong>rn die Sicherheit<br />
meines Blickkontaktes aus einer<br />
Entfernung ausreicht. Sie machen nur<br />
durch Zurufen: „Sandra, schau mal!“<br />
Sandra Klingler<br />
staatlich geprüfte Motopädin <strong>und</strong><br />
Erzieherin, Lehrqualifikation <strong>Motopädagogik</strong><br />
akM, Ropes-Course-Trainerin, seit<br />
1998 in <strong>de</strong>r psychomotorischen Arbeit<br />
mit Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen im<br />
Bereich <strong>de</strong>r Erziehungshilfe tätig.<br />
Anschrift <strong>de</strong>r Verfasserin:<br />
Pallotti-Haus<br />
Har<strong>de</strong>nbergstr. 2<br />
66538 Neunkirchen<br />
85
86<br />
Sich fallen lassen – ein Thema in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe?!<br />
r Hinabspringen <strong>und</strong>…<br />
auf sich aufmerksam, diese Sicherheit<br />
genügt ihnen, um sich fallen zu lassen.<br />
Mit freudvollem Gesichtsausdruck<br />
wie<strong>de</strong>rholen sie diese Tätigkeit oft<br />
mehrmals. Der Körperkontakt <strong>und</strong> vor<br />
allem das Gehalten-Wer<strong>de</strong>n zwischen<br />
Bezugsperson <strong>und</strong> Kind wird mit<br />
zunehmen<strong>de</strong>m Alter <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s immer<br />
seltener, wobei er seinen generellen<br />
Stellenwert <strong>und</strong> seine Be<strong>de</strong>utung in<br />
bestimmten Situationen jedoch immer<br />
behalten wird. Deutlich wird dies<br />
beson<strong>de</strong>rs in Situationen <strong>und</strong> Lebensphasen<br />
<strong>de</strong>r Unsicherheit, in <strong>de</strong>nen es<br />
wichtig ist, Altes loszulassen <strong>und</strong> Neues<br />
zu wagen, um sich weiter zu entwickeln<br />
<strong>und</strong> zu einer reifen Persönlichkeit zu<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
r …fallen lassen<br />
Da <strong>de</strong>r Spielnachmittag meistens sehr<br />
gut besucht ist, ist ein Eintauchen in<br />
ein themenspezifisches Rollenspiel mit<br />
einzelnen Kin<strong>de</strong>rn kaum möglich. Eine<br />
weitere Möglichkeit, die <strong>für</strong> viele Kin<strong>de</strong>r<br />
einen beson<strong>de</strong>ren Reiz bietet, ist eine<br />
hochgestellte Leiter, die das Fallen<br />
lassen in weiche Schaumstoffteile<br />
ermöglicht.<br />
Die ganz Mutigen suchen Variationen,<br />
um <strong>de</strong>n Kick beim Fallen lassen zu<br />
erhöhen, sie schließen die Augen (ein<br />
Junge benutzt sein Halstuch als<br />
Augenbin<strong>de</strong>) o<strong>de</strong>r machen <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n<br />
Kin<strong>de</strong>rn so genannten „Bodycheck“.<br />
Dabei wird nicht auf <strong>de</strong>n Füßen<br />
gelan<strong>de</strong>t, son<strong>de</strong>rn auf <strong>de</strong>m Rücken<br />
(Arme <strong>und</strong> Beine sind angezogen). Dies<br />
bestätigt, was Lowen ausgedrückt hat:<br />
„Tätigkeiten, die <strong>de</strong>m Selbst-Ausdruck<br />
dienen, erzeugen ein unmittelbares<br />
Gefühl <strong>de</strong>r Lust <strong>und</strong> Befreiung (Lowen<br />
1988, 36).<br />
Jüngere bzw. ängstlichere Kin<strong>de</strong>r<br />
starten oftmals mehrere Versuche. Sie<br />
nehmen sich ihre Bezugsperson zu<br />
Hilfe, bis sie schließlich trauen, sich<br />
fallen zu lassen. Danach ist die Freu<strong>de</strong><br />
jedoch umso größer. Mit strahlen<strong>de</strong>m<br />
Gesicht erheben sie sich aus <strong>de</strong>n<br />
Schaumstoffteilen, stolz auf sich, es<br />
geschafft zu haben. Meistens wird sich<br />
gleich noch mal angestellt, um einen<br />
Versuch dieser angstbesetzten Tätigkeit<br />
<strong>de</strong>s sich Fallen Lassens nach <strong>de</strong>m<br />
An<strong>de</strong>ren zu wagen.<br />
„Dort wo die größte Angst o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Schmerz sitzt, ist auch die größte Lust“<br />
(Fichtner 2000, S. 73).<br />
Eine Aufgabe <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>er/in ist<br />
es, Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche in ihrer<br />
Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten.<br />
Dabei ist es nötig, <strong>de</strong>m Kind ein<br />
Setting zu bieten, das die Ausbalancierung<br />
bestehen<strong>de</strong>r psychosozialer Krisen<br />
ermöglicht. Eine Atmosphäre <strong>de</strong>r<br />
absoluten Sicherheit zu bieten ist<br />
Rahmenbedingung <strong>für</strong> pädagogischtherapeutisches<br />
Arbeiten. Hierbei<br />
stehen die Aspekte Raum, Zeit, Material<br />
<strong>und</strong> Beziehung in engem Kontakt<br />
zueinan<strong>de</strong>r. Die Beziehung zwischen<br />
Psycho<strong>motorik</strong>er/in <strong>und</strong> Kind nimmt die<br />
Schlüsselstellung ein, <strong>de</strong>shalb ist ihr<br />
mehr Platz gewidmet. Eine Bezugsperson,<br />
die <strong>de</strong>n nötigen Halt bietet, ist<br />
unabdingbar. Halten im psychischen<br />
(Vertrauen ermöglichen, aufkommen<strong>de</strong>n<br />
Gefühlen Raum geben <strong>und</strong> verstehen,<br />
ein geschütztes Setting bieten, in <strong>de</strong>m<br />
sich das Kind sicher fühlt, …) wie auch<br />
im physischen Sinn (das Kind auffangen,<br />
tragen, wiegen, ...) sind damit<br />
gemeint. Die Psycho<strong>motorik</strong>er/in sollte<br />
Kin<strong>de</strong>rn Situationen <strong>de</strong>s Sich fallen<br />
Lassens ermöglichen (weiche Materialien<br />
anbieten), sie festhalten, loslassen<br />
<strong>und</strong> auffangen können.<br />
Eine <strong>für</strong> die Psycho<strong>motorik</strong>er/in oftmals<br />
schwierige Aufgabe ist ein Loslassen<br />
von För<strong>de</strong>rabsichten. Neben <strong>de</strong>r<br />
Aufgabe, <strong>de</strong>r Absicht <strong>de</strong>s Än<strong>de</strong>rn-<br />
Wollens, stellt das Aufgeben von<br />
Kontrolle <strong>für</strong> viele eine große Herausfor<strong>de</strong>rung<br />
dar. „Der erste Schritt lag<br />
auch hier bei mir, wenn ich in mir<br />
keinen Halt habe, nicht die Süße dieser<br />
Freiräume selbst erlebt habe, kann ich<br />
Kin<strong>de</strong>rn diese Räume nicht eröffnen“<br />
(Fichtner 2000, S. 71).<br />
Am Beispiel eines fünfjährigen Jungen,<br />
<strong>de</strong>r während <strong>de</strong>r psychomotorischen<br />
Entwicklungsbegleitung in die Rolle<br />
eines Babys schlüpft, möchte ich die<br />
Rolle <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>er/in ver<strong>de</strong>utlichen.<br />
Meinen Kollegen spricht er mit<br />
„Papa“ an. Er spricht in Babysprache<br />
bzw. lautiert nur <strong>und</strong> will von meinem<br />
Kollegen gehalten wer<strong>de</strong>n wie ein Baby.<br />
Immer wie<strong>de</strong>r will er aus <strong>de</strong>n schützen<strong>de</strong>n<br />
Armen auf die Weichbo<strong>de</strong>nmatte<br />
geworfen wer<strong>de</strong>n, liegt dann da,<br />
lacht <strong>und</strong> krabbelt wie<strong>de</strong>r in die Arme<br />
meines Kollegen. Das Wechselspiel vom<br />
Gehalten-Wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Loslassen<br />
genießt <strong>de</strong>r kleine Junge sichtlich.<br />
Er holt in seinem Rollenspiel Erfahrungen<br />
<strong>de</strong>r frühesten Kindheit nach.<br />
Auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s entwickelten Urvertrauens<br />
versucht er, vom Erwachsenen<br />
unabhängig zu wer<strong>de</strong>n, sucht jedoch<br />
immer wie<strong>de</strong>r die körperliche Nähe, um<br />
„emotional aufzutanken“ <strong>und</strong> sich diese<br />
Loslösung immer wie<strong>de</strong>r aufs Neue<br />
leiblich bewusst zu machen. Der<br />
körperliche Kontakt einerseits <strong>und</strong> das<br />
Loslösen an<strong>de</strong>rerseits – bei<strong>de</strong>s bietet<br />
mein Kollege <strong>de</strong>m Jungen in einem<br />
engen Wechselspiel – sind Voraussetzungen<br />
<strong>für</strong> das Erreichen <strong>de</strong>r Selbstständigkeit<br />
<strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s. Dies befähigte<br />
<strong>de</strong>n Jungen zur Autonomie, so dass er<br />
sich nach einigen Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>en<br />
selbstständig lösen konnte, in<strong>de</strong>m<br />
er verbal äußerte: „Lass mich los!“ <strong>und</strong><br />
sich eigenständig bewegen wollte. Der<br />
Zeitpunkt <strong>de</strong>s Loslassens war gekommen.<br />
Diesen zu erkennen <strong>und</strong> so das<br />
Kind in seiner erworbenen Selbstständigkeit<br />
zu festigen <strong>und</strong> es in seiner
Bewegungsimpulse auf <strong>de</strong>m Trampolin<br />
r Die fe<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Bewegung spüren<br />
Autonomieentwicklung nicht zu<br />
hemmen ist (neben <strong>de</strong>m Halten) eine<br />
weitere zentrale Aufgabe <strong>für</strong> die<br />
Psycho<strong>motorik</strong>er/in.<br />
Ansprechen<strong>de</strong> Bewegungsanreize (wie<br />
beim zuvor beschriebenen Spielnachmittag)<br />
bieten <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn die Möglichkeit,<br />
ihre „Angstlust“ auszuleben.<br />
Beson<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>r heutigen Zeit sehe ich<br />
dies als wichtig an, da zwischen<br />
Bewegungsarmut <strong>und</strong> Leistungssport<br />
oftmals nicht viel geboten wird <strong>und</strong><br />
Dauersitzen an <strong>de</strong>r Tagesordnung ist.<br />
Gespielt wird oft inmitten von Autoverkehr<br />
– immer bewacht von besorgten<br />
Erwachsenenaugen. Unkontrollierte<br />
Bewegungen, „verbotene Experimente“,<br />
das Ausagieren von Angstlust ist fast<br />
unmöglich. Kontrolle gab es wohl schon<br />
immer – aber noch nie war sie so<br />
vollständig wie heute. Ist ein Ausagieren<br />
<strong>de</strong>r „Angstlust“ auf legalem Weg<br />
nicht vorhan<strong>de</strong>n, besteht die Gefahr,<br />
dass diese Risikohandlungen im Alltag<br />
in <strong>de</strong>n Sog <strong>de</strong>r Halbkriminalität <strong>und</strong><br />
Kriminalität (z. B. S-Bahn-Surfen)<br />
geraten können.<br />
Während meiner Berufstätigkeit in <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe konnte ich<br />
feststellen, dass vielen Kin<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r<br />
nötige Halt in <strong>de</strong>r frühen Kindheit<br />
fehlte. Oftmals war nur eine geringe<br />
körperliche Zuwendung vorhan<strong>de</strong>n. Die<br />
Frage stellt sich, ob dies auch mit <strong>de</strong>n<br />
heutigen Umstän<strong>de</strong>n wie Zeitnot,<br />
Scheidungsehen <strong>und</strong> zunehmen<strong>de</strong><br />
Berufstätigkeit bei<strong>de</strong>r Elternteile zu tun<br />
hat. Eines ist jedoch ganz sicher <strong>und</strong> ich<br />
möchte dies zum Schluss nochmals<br />
beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>utlich hervorheben: Zur<br />
Erreichung <strong>de</strong>r Individuation <strong>und</strong><br />
Selbstständigkeit <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s sind<br />
einerseits <strong>de</strong>r körperliche Kontakt –<br />
Gehalten Wer<strong>de</strong>n – <strong>und</strong> an<strong>de</strong>rerseits<br />
das Lösen – Loslassen – unabdingbare<br />
Voraussetzungen.<br />
Das Bekannte loslassen,<br />
das Unbekannte wagen,<br />
die Sicherheit aufgeben <strong>und</strong><br />
immer wie<strong>de</strong>r neu beginnen.<br />
Dies sind die Schritte<br />
eines je<strong>de</strong>n Lernprozesses.<br />
Der Drang nach Bewegung<br />
ist die Lust auf Leben.<br />
(Lensing-Conrady 1996)<br />
Literatur:<br />
An<strong>de</strong>rs, W./Wed<strong>de</strong>mar, S. (2001):<br />
Häute scho(ö)n berührt?<br />
Körperkontakt in Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Erziehung. Dortm<strong>und</strong>:<br />
Borgmann.<br />
Aufmuth, U. (1988): Zur Psychologie<br />
<strong>de</strong>s Bergsteigens. Frankfurt am<br />
Main: Fischer.<br />
Balint, M. (1960): Angstlust <strong>und</strong><br />
Regression. Stuttgart: Ernst<br />
Klett Verlag.<br />
B.A.T. Studie (2000): „Xtrem“:<br />
Jugend zwischen Kick <strong>und</strong> Kult.<br />
Extremsportals Zeitphänomen<br />
In: erleben & lernen, 6.<br />
Boa<strong>de</strong>lla, D. (1991): Befreite<br />
Lebensenergie, Einführung in<br />
die Biosynthese. München:<br />
Kösel-Verlag GmbH<br />
<strong>und</strong> Co.<br />
Borne, R. (2001): Einfach fallen<br />
lassen. Der Rausch nach<br />
Grenzerfahrung. Stuttgart/<br />
Berlin: Mayer.<br />
Fichtner, G. (2000): Vom Leistungssport<br />
zum Doppelmord. In:<br />
Wendler, M./Irmischer, T./<br />
Hammer, R. (Hrsg.): Psycho<strong>motorik</strong><br />
im Wan<strong>de</strong>l. Lemgo: akL, 37–42<br />
Hammer, R. (2000): Psychomotorische<br />
Entwicklungsför<strong>de</strong>rung im<br />
intermediären Bereich. In: Wen-<br />
dler, M./Irmischer, T./Hammer, R.<br />
(Hrsg.) Psycho<strong>motorik</strong> im<br />
Wan<strong>de</strong>l. Lemgo, akL, 37–42<br />
Hammer, R. (2001): Bewegung allein<br />
genügt nicht. Dortm<strong>und</strong>: verlag<br />
mo<strong>de</strong>rnes lernen.<br />
Hammer, R. (2002): Spiel <strong>und</strong><br />
Bewegung in <strong>de</strong>r psychomotorischen<br />
Entwicklungsbegleitung.<br />
Praxis <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>,<br />
Jg. 27 (4).<br />
Kiphard, E. J. (1993): Ungewöhnliche<br />
Bewegungserlebnisse als<br />
Nervenkitzel <strong>und</strong> Abenteuer,<br />
vestibuläre Reizsuche durch<br />
Fallen, Fliegen, Springen,<br />
Schleu<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Drehen. In:<br />
Praxis <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>,<br />
Jg. 18 (1).<br />
Kiphard, E. J. (1997): Nervenkitzel<br />
um je<strong>de</strong>n Preis. Zur Physiologie<br />
<strong>und</strong> Psychologie <strong>de</strong>s Thrills. In:<br />
Motorik, Heft 3.<br />
Lowen, A. (2002): Bioenergetik,<br />
Therapie <strong>de</strong>r Seele durch Arbeit<br />
mit <strong>de</strong>m Körper. Hamburg:<br />
Rowohlt.<br />
Semler, G. (1994): Die Lust an <strong>de</strong>r<br />
Angst, Warum Menschen sich<br />
freiwillig extremen Risiken<br />
aussetzten. München: Heyne.<br />
Warwitz, S. (2001): Sinnsuche im<br />
Wagnis. Leben in wachsen<strong>de</strong>n<br />
Ringen. Hohengehren/Baltmannsweiler:<br />
Schnei<strong>de</strong>r-Verl.<br />
Wendler, M./Irmischer, T./Hammer,<br />
R. (2000): Psycho<strong>motorik</strong> im<br />
Wan<strong>de</strong>l. Lemgo: Verlag Aktionskreis<br />
Literatur <strong>und</strong> Medien.<br />
LABAN/BARTENIEFF<br />
BEWEGUNGSSTUDIEN<br />
Einführungskurse<br />
Berufsbegleiten<strong>de</strong><br />
Fortbildung &<br />
Aufbaustufe<br />
EUROLAB<br />
FORTBILDUNG BASIC<br />
ZERTIFIKATAUSBILDUNG<br />
Leitung: Antja Kennedy<br />
Telefon +49-(0)421-6595624<br />
info@laban-ausbildung.<strong>de</strong><br />
www.laban-ausbildung.<strong>de</strong><br />
87
88<br />
Herzlich Willkommen im Stefan Kuntz-Stadion o<strong>de</strong>r: Pausengestaltung in einer Schule <strong>für</strong> Erziehungshilfe<br />
Eilert von Busch<br />
Herzlich Willkommen<br />
im Stefan Kuntz-Stadion<br />
o<strong>de</strong>r: Pausengestaltung in einer Schule <strong>für</strong> Erziehungshilfe<br />
Im Rahmen eines Anti-Gewaltjahres in einer Einrichtung <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
ergab es sich, dass auch <strong>de</strong>r Bereich Sport/Psycho<strong>motorik</strong> an dieser Schwerpunktsetzung<br />
in <strong>de</strong>r Arbeit mit verhaltensauffälligen Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen beteiligt war.<br />
Nun ist Fußballspielen in Schulen ein alter Hut, erfolgreich Fußballspielen in einer<br />
Schule <strong>für</strong> Erziehungshilfe aber eine echte Herausfor<strong>de</strong>rung.<br />
Einleitung<br />
Woche <strong>für</strong> Woche ist es an unserer<br />
Schule ein festes Angebot, in <strong>de</strong>r<br />
großen Pause <strong>für</strong> 15 Minuten Fußball<br />
anzubieten. Ein Lehrer beaufsichtigt<br />
<strong>und</strong> leitet das Spiel nach einem festen<br />
Regelsystem. Es soll fair bleiben – <strong>und</strong><br />
das ist unheimlich schwer. Unsere<br />
Schüler bringen in die Pausen eine<br />
geballte Ladung von verhaltensoriginellen<br />
Ticks, I<strong>de</strong>en, Gewohnheiten mit.<br />
Die latent vorhan<strong>de</strong>nen Verhaltensprobleme<br />
je<strong>de</strong>s Einzelnen, aktuelle, aus<br />
<strong>de</strong>m Unterrichtsvormittag stammen<strong>de</strong><br />
gruppendynamische <strong>und</strong> Interaktionsstörungen<br />
<strong>und</strong> das Bedürfnis nach einer<br />
maßgeschnei<strong>de</strong>rten Erholungspause, in<br />
<strong>de</strong>r alles drin ist was das Herz begehrt,<br />
kochen zunächst harmlose Situationen<br />
blitzschnell zu einem explosiven<br />
Cocktail hoch. Ärgern, Beleidigungen,<br />
Schlägereien, Quälereien sowie<br />
Provokationen an Sachen <strong>und</strong> Menschen<br />
erfor<strong>de</strong>rn ein Eingreifen <strong>de</strong>r<br />
Erwachsenen. Sie ziehen alle Register,<br />
um diesen Chaosten<strong>de</strong>nzen mit <strong>de</strong>n<br />
jeweils erlernten Spezialkenntnissen aus<br />
Son<strong>de</strong>rpädagogik, Antiaggressionstraining<br />
<strong>und</strong> Mediation usw. entgegen zu<br />
treten.<br />
Der Verfasser skizziert seine Art <strong>de</strong>s<br />
Pausenfußballspiels, die seit Jahren eine<br />
relativ konfliktarme, <strong>für</strong> Schüler <strong>und</strong><br />
Lehrer angenehme tägliche Bewegungszeit<br />
darstellt.<br />
Im Stefan Kuntz-Stadion<br />
Das „Stefan Kuntz-Stadion“ (Stefan<br />
Kuntz ist ein, aus <strong>de</strong>m Schulort<br />
stammen<strong>de</strong>s regionales Fußballidol,<br />
mittlerweile Fußballtrainer, Sportmanager,<br />
früher u. a. Spieler bei FC<br />
Kaiserslautern <strong>und</strong> Nationalspieler –<br />
bekannt <strong>für</strong> seine große Fairness) ist<br />
eine mit Fallschutzplatten belegte,<br />
mit vier Meter hohem Gitterzaun<br />
umzäunte Spielfläche, als Teil <strong>de</strong>s<br />
Schulhofes <strong>für</strong> je<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Pausen<br />
zugänglich.<br />
Die Größe kommt einem Basketballspielfeld<br />
gleich: zehn mal zwanzig<br />
Meter, mit zwei Hallenhandballtoren.<br />
Der Zaun verhin<strong>de</strong>rt, dass <strong>de</strong>r<br />
Ball zu häufig auf <strong>de</strong>n Restschulhof<br />
o<strong>de</strong>r gar auf zwei Straßen, neben<br />
<strong>de</strong>m Schulgelän<strong>de</strong> fliegt. Bänke an<br />
Stirn- <strong>und</strong> Längsseite ermöglichen<br />
ein hautnahes Miterleben <strong>de</strong>s Spiels<br />
durch Fans <strong>und</strong> Mitschüler, die<br />
einfach nur relaxen möchten.<br />
Die Mannschaften<br />
Heute spielt Bremen gegen Bayern.<br />
„Wer möchte Spielführer <strong>und</strong> so<br />
cool wie Klose sein?“ „Wer ist<br />
Makaay?“<br />
Mit solchen Fragen wird die Wahl<br />
zweier Mannschaften unterstützt.<br />
Nach<strong>de</strong>m ca. die Hälfte <strong>de</strong>r Spieler<br />
gewählt ist, teilt <strong>de</strong>r Aufsichtsführen<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>n Rest <strong>de</strong>r Spieler ein.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich sollten zwei gleich<br />
gute Spieler die Rolle <strong>de</strong>s Spielführers<br />
übernehmen, sie entschei<strong>de</strong>n<br />
übrigens auch wer Freistöße <strong>und</strong><br />
Elfmeter schießt, legen Torwartwechsel<br />
fest, achten darauf, dass<br />
<strong>de</strong>r Schiri das mitbekommt.<br />
„Ich bin heute …“ , sagen selbst<br />
Vierzehnjährige mit hochgestreckter<br />
Mel<strong>de</strong>hand.<br />
Mir ist es immer wie<strong>de</strong>r wichtig,<br />
faire B<strong>und</strong>esligaspieler als Spielführer<br />
o<strong>de</strong>r Mannschaftskapitän<br />
vorzugeben, es gab <strong>und</strong> gibt sie<br />
(Marco Bo<strong>de</strong>, Miroslav Klose, Philip<br />
Lahm, Tim Wiese, Per Mertesacker,<br />
Martin Demicheles, Diego, Jeronimo,<br />
Cacau usw.).<br />
Bei <strong>de</strong>r Wahl heißt es aufpassen, es<br />
dürfen keine Mogeleien passieren.<br />
Nur wer gewählt ist betritt das<br />
Spielfeld! Er muss dann zunächst<br />
dicht bei seinem Mannschaftskapitän<br />
warten. Da gr<strong>und</strong>sätzlich je<strong>de</strong>r<br />
mitspielen darf, sind oft zwanzig<br />
Spieler auf <strong>de</strong>m Platz – niemand<br />
wird ausgeschlossen.<br />
Der Spielverlauf<br />
Mit <strong>de</strong>m Appell: „Schießt faire, gute<br />
Tore“, wird <strong>de</strong>r Ball in das Spielfeld<br />
eingeworfen, <strong>de</strong>r Spaß geht los. Auf<br />
engstem Raum muss <strong>de</strong>r Ball<br />
gepasst <strong>und</strong> gestoppt wer<strong>de</strong>n, die<br />
Entscheidung zum erfolgreichen<br />
Torschuss erfolgt blitzschnell.<br />
Da <strong>de</strong>r Ball vom Torwart am Bo<strong>de</strong>n<br />
ruhend geschossen o<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r<br />
Hand geworfen wer<strong>de</strong>n darf,<br />
verlagert sich das Spielgeschehen<br />
schnell vom Angriff zur Defensive<br />
<strong>und</strong> umgekehrt. (Bei zu großen<br />
Unterschie<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schussstärke<br />
kann man <strong>de</strong>n Abstoß aus <strong>de</strong>n<br />
Regeln streichen). Die Enge <strong>de</strong>s<br />
Spielfel<strong>de</strong>s ermöglicht vielen<br />
Spielern auch ohne gute konditionelle<br />
Gr<strong>und</strong>lagen am Ball zu bleiben,<br />
Misserfolge, z. B. bei Deckungsaufgaben,<br />
wer<strong>de</strong>n leichter<br />
durch an<strong>de</strong>re Mitspieler ausgeglichen.<br />
Erfolgreiche Aktionen – Kommentare<br />
die das Herz erfreuen<br />
Erziehungsschwierige Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendliche reagieren auf Erfolgserlebnisse<br />
an<strong>de</strong>rer häufig gleichgültig
<strong>und</strong> ohne Anerkennung <strong>de</strong>s<br />
Geleisteten. Mitunter lösen sie nur<br />
Zorn <strong>und</strong> Frust aus. Auch aus <strong>de</strong>r<br />
Fankurve <strong>de</strong>r Amateuroberliga in<br />
Neunkirchen kennen viele die<br />
Provokations- <strong>und</strong> Beleidigungsrituale,<br />
die auf die gegnerische<br />
Mannschaft zielen.<br />
Dem Verfasser ist es nun sehr<br />
wichtig, trotz <strong>de</strong>r Schirirolle, eine<br />
gute Abwehraktion, einen tollen<br />
Lattenschuss mit Beifall zu kommentieren<br />
<strong>und</strong> er for<strong>de</strong>rt bei<strong>de</strong><br />
Mannschaften immer wie<strong>de</strong>r dazu<br />
auf, die entsprechen<strong>de</strong>n Akteure zu<br />
befeiern, zu beklatschen <strong>und</strong> Lob zu<br />
verteilen. Nach <strong>und</strong> nach kann so<br />
eine Lobkultur entstehen, die die<br />
extrem einseitige Bewertung <strong>de</strong>s<br />
Spiels nach Sieg o<strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage<br />
erweitert. Nach bewusst erlebten,<br />
spannen<strong>de</strong>n Szenen mit vielen<br />
guten Einzelleistungen lässt sich<br />
eine Nie<strong>de</strong>rlage besser aushalten.<br />
Das <strong>für</strong> erziehungsschwierige<br />
Schüler so typische Reaktionsmuster<br />
auszurasten, tritt sehr selten<br />
nach diesen Spielen auf.<br />
Fouls, o<strong>de</strong>r wenn sich einer wehtut<br />
<strong>und</strong> die passen<strong>de</strong>n Rituale<br />
Absichtliche Fouls kommen selten<br />
vor. Kommt es im Kampf um <strong>de</strong>n<br />
Ball zu einem Foulspiel, so ist es<br />
erfor<strong>de</strong>rlich das Spiel zu unterbrechen,<br />
lautstark das Foul zu beschreiben<br />
<strong>und</strong> mit einem indirekten<br />
Freistoß (Mauer drei Schritte<br />
Abstand) weiterspielen zu lassen.<br />
Allerdings darf das Spiel erst dann<br />
wie<strong>de</strong>r angepfiffen wer<strong>de</strong>n, wenn<br />
<strong>de</strong>r Verursacher <strong>de</strong>s Fouls auf <strong>de</strong>n<br />
Gefoulten zugegangen <strong>und</strong> sich per<br />
Abklatschen bei ihm entschuldigt<br />
hat. Dies kann auch ohne Worte<br />
geschehen. Ebenso sollte bei<br />
Spielaktionen, bei <strong>de</strong>nen sich<br />
jemand wehtut obwohl kein Foul<br />
feststellbar ist, sofort das Spiel<br />
gestoppt wer<strong>de</strong>n. Der Schiri<br />
erläutert warum. „Wohl aus<br />
Versehen, trotz regelgerechtem<br />
Verhalten – möglicherweise ist<br />
<strong>de</strong>shalb <strong>de</strong>r Schmerz entstan<strong>de</strong>n.“<br />
Auch hier wird immer <strong>de</strong>r Versöhnungsabklatscher<br />
eingefor<strong>de</strong>rt. Wird<br />
ein Verursacher vermutet o<strong>de</strong>r<br />
genannt, kann man ihn als Helfer<br />
o<strong>de</strong>r Tröster in die Situation mit<br />
einbeziehen. Manchmal passt es<br />
auch einen unmittelbar daneben<br />
Stehen<strong>de</strong>n als „Sanitäter“ um<br />
Mithilfe zu bitten. Es tut gut, nicht<br />
alleine ein Kühlkissen zu holen.<br />
Der oben erwähnte Abklatscher<br />
be<strong>de</strong>utet mittlerweile: ich versuche<br />
das Versehen als solches zu<br />
akzeptieren, bin mit <strong>de</strong>r Übersetzung<br />
einverstan<strong>de</strong>n, verzichte auf<br />
irgen<strong>de</strong>ine Racheaktion. Ein dann<br />
folgen<strong>de</strong>r Schiriball unterstreicht<br />
die Sichtweise <strong>de</strong>s Spielleiters.<br />
Mehr aus Nostalgie zückte ich<br />
irgendwann einmal meine gelbe <strong>und</strong><br />
rote Jugendschiedsrichterkarte, ein<br />
voller Erfolg. Gera<strong>de</strong> zu Beginn <strong>de</strong>r<br />
Fußballpause, wenn gewohnheitsgemäß<br />
die ersten Beleidigungen<br />
umherschwirren, schaffen diese<br />
Karten einen Fairplayrahmen.<br />
Eskaliert die Stimmung bei einem<br />
Mitspieler wegen angeblicher<br />
Fehlentscheidungen doch einmal, so<br />
kassieren sie ruhig selbstbewusst<br />
<strong>de</strong>n Ball ein <strong>und</strong> – warten ab.<br />
Der Ball fliegt über <strong>de</strong>n Zaun<br />
o<strong>de</strong>r: Das Elfmeterritual<br />
In nur einem von zwanzig Fällen<br />
wird <strong>de</strong>r Elfmeter nach <strong>de</strong>m<br />
allgemein gelten<strong>de</strong>n Reglement<br />
gegeben. Die beson<strong>de</strong>re Lage <strong>de</strong>s<br />
Schulhofs an zwei abschüssigen<br />
Straßen in einer Siedlung mit vielen<br />
parken<strong>de</strong>n Autos hat es erfor<strong>de</strong>rlich<br />
gemacht, <strong>de</strong>r allgegenwärtigen<br />
Weitschuss <strong>und</strong> Frustschussbegeisterung<br />
eine kopfgesteuerte Muskeldrossel<br />
einzubauen. Gelingt es<br />
<strong>de</strong>m Schützen eines Über-<strong>de</strong>n-<br />
Zaun-Balles nicht, über die großzügige<br />
Auslegung <strong>de</strong>r Pressballwertung<br />
einer Sanktion zu entgehen, so<br />
wird er vom weiteren Spiel <strong>für</strong> die<br />
laufen<strong>de</strong> Pause ausgeschlossen.<br />
Darüber hinaus darf die gegnerische<br />
Mannschaft einen Elfmeter schießen.<br />
Torwart <strong>und</strong> Schütze wer<strong>de</strong>n<br />
von <strong>de</strong>n jeweiligen Mannschaftskapitänen<br />
festgelegt.<br />
Ähnlich wie bei <strong>de</strong>r Freiwurfsituation<br />
im Basketball dürfen sich alle<br />
Spieler an <strong>de</strong>m Trapez zwischen<br />
Standort Elfmeterschütze (neun<br />
Meter vom Tor entfernt) <strong>und</strong> <strong>de</strong>m<br />
Tor (ein Schritt seitliche Entfernung<br />
von <strong>de</strong>n Torpfosten) aufstellen.<br />
Dann tritt nur <strong>de</strong>r Schütze gegen<br />
<strong>de</strong>n Torwart an, ohne Nachschuss.<br />
Manchmal erinnert die nun<br />
folgen<strong>de</strong> Geräuschkulisse an die<br />
Eckballsituation bei B<strong>und</strong>esligaspielen.<br />
Durch einen Trichter schreien<strong>de</strong>r<br />
<strong>und</strong> anfeuern<strong>de</strong>r Fußballkids<br />
<strong>de</strong>n Ball ins Tor zu schießen, o<strong>de</strong>r<br />
auch nicht, ist ein ganz beson<strong>de</strong>res<br />
Gefühl.<br />
Die Spieldauer – Der Kampf gegen<br />
die Zeit<br />
Beson<strong>de</strong>rs bei knappen Ergebnissen<br />
<strong>und</strong> unentschie<strong>de</strong>nen Spielverläufen,<br />
erhöht das subjektiv eingeblen<strong>de</strong>te<br />
Zeitfenster die Spannung.<br />
„Noch zwei Minuten bis zur<br />
Herbstmeisterschaft - ist das schon<br />
<strong>de</strong>r Endstand?“ So o<strong>de</strong>r ähnlich<br />
könnten Impulse gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Pause klingen, wenn <strong>de</strong>r Schlusspfiff<br />
mit <strong>de</strong>m Pausengong bevorsteht.<br />
Eilert von Busch<br />
Lehramt Sek I <strong>und</strong> II <strong>für</strong> Sport<br />
<strong>und</strong> Geschichte, Zusatzausbildung<br />
Psycho<strong>motorik</strong> Kajakübungsleiter,<br />
Ropes-Course-Trainer; Klassenlehrer<br />
in einer Schule <strong>für</strong> Erziehungshilfe<br />
Anschrift <strong>de</strong>s Verfassers:<br />
Pallotti-Haus<br />
Har<strong>de</strong>nbergstr. 2<br />
66538 Neunkirchen<br />
89
News · Fakten · Informationen<br />
aktuelle Nachrichten <strong>de</strong>s Aktionskreises Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
Jahrestagung <strong>de</strong>s akP 2007<br />
„Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
in Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>m Überregionalen Beratungs- <strong>und</strong> Behandlungszentrum Würzburg<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Kath. Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik Saarbrücken<br />
Ort: ÜBBZ – Überregionales Beratungs- <strong>und</strong> Behandlungszentrum, Wilhelm-Dahl-Str. 9, 97082 Würzburg<br />
Termin: Samstag, 5. September 2007; 9. 5 Uhr bis 7.00 Uhr<br />
Programmablauf:<br />
8.00 Uhr Öffnung <strong>de</strong>s Tagungsbüros im ÜBBZ <strong>und</strong> Ausgabe <strong>de</strong>r Tagungsunterlagen<br />
9. 5 Uhr Eröffnung <strong>de</strong>r Fachtagung durch Dr. N. Beck (ÜBBZ) <strong>und</strong><br />
Dr. R. Hammer (ak’P) in <strong>de</strong>r Mensa<br />
9.30– 0. 5 Uhr Dialogischer Einführungs-Vortrag (Mensa) von Reinhard Köster; Caritasverband <strong>de</strong>r Diözese Trier;<br />
Geschäftsführer <strong>de</strong>r Arbeitsgemeinschaft katholischer Träger von Einrichtungen <strong>und</strong> Diensten <strong>de</strong>r<br />
erzieherischen Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe <strong>und</strong> Dr. Richard Hammer; stellv. Leiter <strong>de</strong>r Kath.<br />
Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik GmbH in Saarbrücken;<br />
. Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aktionskreises Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
Thema: Zur Situation <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe unter beson<strong>de</strong>rer Berücksichtigung von Angeboten<br />
aus Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport<br />
0.30– 2.45 Uhr 1. Workshop- <strong>und</strong> Seminareihe (V1 bis V6)<br />
2.45 Uhr Mittagspause<br />
4.00– 6. 5 Uhr 2. Workshop- <strong>und</strong> Seminarreihe (N1 bis N6)<br />
6.30 Uhr „Bewegter Abschluss“ (Turnhalle Heilpäd. Seminar)<br />
Wir spielen die besten Spiele <strong>de</strong>s För<strong>de</strong>rpreiswettbewerbes<br />
ca. 7.00 Uhr En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Fachtagung<br />
Kosten: Tagungsgebühr incl. Mittagessen: 50,00 €€<br />
Mitglie<strong>de</strong>r ak’P ermäßigt: 40,00 €<br />
Schüler/Studieren<strong>de</strong> mit Nachweis erhalten jeweils 0.– € Ermäßigung.<br />
Anmeldung:<br />
Aktionskreis Psycho<strong>motorik</strong> e.V., Kleiner Schratweg 32, 32657 Lemgo<br />
per Fax 0 52 6 /97 09 72 · per Mail: akp@psycho<strong>motorik</strong>.com · per Internet über online-Formular unter: www.psycho<strong>motorik</strong>.com<br />
Übersicht Workshops<br />
<strong>und</strong> Seminare<br />
Stefan Werner (V <strong>und</strong> N )<br />
Ringen <strong>und</strong> Raufen<br />
Wolfgang Müller (V2 <strong>und</strong> N2)<br />
Was geht hier ab?<br />
Axel Heisel (V3 nur vormittags!)<br />
Abenteuer Turnhalle<br />
Axel Heisel (N3 nur nachmittags!)<br />
Abenteuer Seilbrücken<br />
Im Freien<br />
Georg Schuh (V4 <strong>und</strong> N4)<br />
Die Kletterwand als heilpädagogisches<br />
Medium in <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong><br />
Albert Averbeck (N5 nur nachmittags!)<br />
Spiel-Sport<br />
Seminar<br />
Albert Müller (V6 <strong>und</strong> N6)<br />
Motodiagnostik (TKT)<br />
Forum<br />
Mechthild Denzer (V7)<br />
Die Be<strong>de</strong>utung von Psycho<strong>motorik</strong>,<br />
Bewegung <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r Ausbildung<br />
Schorndorf 30 (2007) Heft 2/2007<br />
Einladung zur 32. Mitglie<strong>de</strong>rversammlung<br />
<strong>de</strong>s Aktionskreises Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
am 4. 9. 2007, um 7.00 Uhr, im ÜBBZ, Wilhelm-Dahl-Str. 9, 97082 Würzburg<br />
Tagesordnung:<br />
. Begrüßung/Wahl <strong>de</strong>s Veranstaltungsleiters<br />
2. Bericht <strong>de</strong>s Vorstan<strong>de</strong>s<br />
3. Bericht <strong>de</strong>s Geschäftsführers<br />
4. Bericht <strong>de</strong>r Kassenprüfer<br />
5. Entlastung <strong>de</strong>s Vorstan<strong>de</strong>s<br />
6. Bestellung <strong>de</strong>r Kassenprüfer <strong>für</strong> 2008<br />
7. Festsetzung <strong>de</strong>s Mitglie<strong>de</strong>rjahresbeitrages<br />
8. Haushaltsvoranschlag <strong>für</strong> 2008<br />
9. Bericht <strong>de</strong>r Leiterin <strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mie <strong>für</strong> <strong>Motopädagogik</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Mototherapie</strong> zu ak’M <strong>und</strong> Kuratorium<br />
0. Bericht <strong>de</strong>s geschäftsführen<strong>de</strong>n Redakteurs <strong>de</strong>r <strong>Zeitschrift</strong> <strong>motorik</strong>’<br />
. Beschlussfassung über vorliegen<strong>de</strong> Anträge<br />
2. Verschie<strong>de</strong>nes<br />
Lemgo, im Juli 2007 Dr. Richard Hammer<br />
. Vorsitzen<strong>de</strong>r AKP
News · Fakten · Informationen<br />
aktuelle Nachrichten <strong>de</strong>s Aktionskreises Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
Informationen aus <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>svertretungen <strong>und</strong> Regionalkreisen<br />
Frühjahrstagung <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>svertretungen<br />
<strong>und</strong> Regional-<br />
kreisleitungen 2007 im Brunnenhaus<br />
„Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen <strong>de</strong>r<br />
Arbeit in <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>svertretungen“ –<br />
unter diesem Thema trafen sich Anfang<br />
März die Lan<strong>de</strong>svertretungen <strong>und</strong><br />
Regionalkreisleitungen zu ihrer Frühjahrstagung<br />
2007 im Brunnenhaus bei<br />
Wermelskirchen im Bergischen Land.<br />
Die Arbeit <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>svertretungen <strong>und</strong><br />
Regionalkreisleitungen sollte neu überdacht<br />
wer<strong>de</strong>n, hat sich doch die<br />
psychomotorische Landschaft in <strong>de</strong>n<br />
letzten Jahren auch regional stark verän<strong>de</strong>rt.<br />
Daher hatte die Tagung zum<br />
Ziel, die aktuelle Situation <strong>de</strong>r regionalen<br />
psychomotorischen Verbreitung<br />
zu analysieren <strong>und</strong> die Arbeit in <strong>de</strong>n<br />
Lan<strong>de</strong>svertretungen mit neuen Impulsen<br />
zu beleben. Viele Fragen stan<strong>de</strong>n<br />
im Raum, die auf Antworten warteten,<br />
eine Aufgabe, <strong>de</strong>r sich die Lan<strong>de</strong>svertretungen<br />
an diesem Wochenen<strong>de</strong><br />
stellen wollten.<br />
Der zusammenfassen<strong>de</strong> Rückblick auf<br />
das Jahr 2006 zeigte sehr <strong>de</strong>utliche<br />
Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Resonanz auf Fortbildungen<br />
<strong>und</strong> an<strong>de</strong>re Angebote in<br />
<strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>svertretungen. Ein Punkt, <strong>de</strong>r<br />
die Gruppe beschäftigt hat, war die<br />
Tatsache, dass auf <strong>de</strong>n Fortbildungen<br />
oft wenig Mitglie<strong>de</strong>r anzutreffen sind.<br />
Daraus ergab sich die Frage: was wünschen<br />
sich Mitglie<strong>de</strong>r eigentlich von<br />
ihrer Lan<strong>de</strong>svertretung o<strong>de</strong>r ihrem<br />
Regionalkreis?<br />
Eine mögliche Antwort darauf lautete:<br />
qualifizierte wohnortnahe Fortbildungen.<br />
Als Konsequenz aus diesen<br />
Überlegungen wur<strong>de</strong> eine engere<br />
Vernetzung zwischen <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r<br />
AKM <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>svertretungen<br />
überlegt. Die Aka<strong>de</strong>mieleiterin<br />
Dr. Astrid Krus stellte dazu ein<br />
Konzept <strong>de</strong>r Möglichkeiten über eine<br />
Zusammenarbeit zwischen LVs <strong>und</strong><br />
Aka<strong>de</strong>mie vor, das die LVs in <strong>de</strong>n<br />
letzten Jahren bereits in Ansätzen<br />
entwickelt hatten.<br />
Ziel soll es sein, die Angebote <strong>de</strong>r<br />
AKM in <strong>de</strong>r Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>n<br />
LVs besser zu regionalisieren um<br />
interessierten Mitglie<strong>de</strong>rn Fahrwege<br />
zu ersparen. An<strong>de</strong>re Angebote wie<br />
kollegialer Austausch etc … wur<strong>de</strong>n<br />
von <strong>de</strong>n Mitglie<strong>de</strong>rn nicht in einer<br />
Kontinuität angenommen.<br />
Im Verlauf <strong>de</strong>r Tagung beschäftigten<br />
sich die LVs <strong>und</strong> Rks mit zwei weiteren<br />
Schwerpunkten:<br />
• wie können neue Mitglie<strong>de</strong>r im<br />
AKP gewonnen wer<strong>de</strong>n,<br />
• wie kann man psychomotorische<br />
Aktivitäten <strong>und</strong> Angebote im eigenen<br />
B<strong>und</strong>esland besser miteinan<strong>de</strong>r<br />
vernetzen.<br />
Es wur<strong>de</strong>n eine Reihe von I<strong>de</strong>en zu<br />
bei<strong>de</strong>n Punkten gesammelt <strong>und</strong> diese<br />
Aufträge <strong>für</strong> das nächste Jahr mit nach<br />
Hause genommen.<br />
Zwischen <strong>de</strong>n Arbeitsphasen konnte<br />
die Gruppe <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>svertreter <strong>und</strong><br />
Regionalkreisleiter unter Leitung von<br />
Axel Heisel eine kreative Pause einlegen.<br />
Er entführte uns unter <strong>de</strong>m Thema:<br />
„Mit Land-Art unterwegs“ in<br />
beeindrucken<strong>de</strong> Ecken <strong>de</strong>s Bergischen<br />
Lan<strong>de</strong>s <strong>und</strong> regte zum Gestalten<br />
äußerst kreativer Naturkunstwerken an<br />
Bäumen, in Wurzeln, auf Ästen <strong>und</strong><br />
Zweigen <strong>und</strong> am Bach an. Sie ließen<br />
uns innehalten, unsere Köpfe frei wer<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> regten zum Verweilen, Schauen,<br />
Staunen <strong>und</strong> weitermachen an.<br />
2 Schorndorf 30 (2007) Heft 2/2007
News · Fakten · Informationen<br />
aktuelle Nachrichten <strong>de</strong>s Aktionskreises Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
Die Frühjahrstagung wur<strong>de</strong> weiter<br />
durch <strong>de</strong>n Besuch <strong>de</strong>s Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>r<br />
Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Psycho<strong>motorik</strong>,<br />
Horst Göbel, bereichert. Er stellte<br />
die Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Psycho<strong>motorik</strong><br />
vor <strong>und</strong> informierte die Lan<strong>de</strong>svertretungen<br />
über Ziele, Aufgaben<br />
<strong>und</strong> anstehen<strong>de</strong> Arbeiten. Er ermutigte<br />
die Lan<strong>de</strong>svertretungen, die oben<br />
schon angesprochene Vernetzung auch<br />
mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Mitgliedsverbän<strong>de</strong>n<br />
Am Tag <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>rversammlung<br />
( 7. 3. 07) im Kin<strong>de</strong>rzentrum „Weißer-<br />
Stein“ in Marburg-Wehrda gab es beim<br />
Lan<strong>de</strong>sverband Hessen eine Fortbildung<br />
zum Thema „Spielketten <strong>für</strong><br />
Bewegungseinheiten im Vor- <strong>und</strong><br />
Gr<strong>und</strong>schulbereich“.<br />
Die Spiel- <strong>und</strong> Theaterpädagogin Andrea<br />
Müller gestaltete diese Fortbildung<br />
in gewohnter Weise mit viel Bewegung<br />
<strong>und</strong> zahlreichen Anregungen <strong>für</strong> die<br />
eigene Praxis in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen<br />
Arbeitsfel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r 25 TeilnehmerInnen.<br />
Bei <strong>de</strong>r ersten Spielkette „Die unmögliche<br />
Reise in einem verrückten Raumschiff“<br />
wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>n im Raum vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Materialien (Matten, Reifen,<br />
Bänke etc.) ein Raumschiff gebaut, in<br />
welchem die „RaumfahrerInnen“ Platz<br />
nahmen <strong>und</strong> von Planet zu Planet flogen:<br />
Auf <strong>de</strong>m „Indianerplaneten“<br />
musste gemeinsam zu Trommelmusik<br />
geschlichen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r „Geräuscheplanet“<br />
hielt zu raten<strong>de</strong> Alltagsgeräusche<br />
parat, auf <strong>de</strong>m Planten „Luftikus“<br />
wur<strong>de</strong>n Luftballons, möglichst ohne<br />
<strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n zu berühren, von einem<br />
zum an<strong>de</strong>ren weitergegeben, <strong>de</strong>r „Rätselplanet“<br />
bot Rätsel zu verschie<strong>de</strong>nen<br />
Märchen, auf <strong>de</strong>m „Tanzplanet“ gab es<br />
flotte Tänze zu erlernen, <strong>de</strong>r Planet<br />
<strong>de</strong>r Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Psycho<strong>motorik</strong>,<br />
wie <strong>de</strong>n Vertretern <strong>de</strong>r Berufsverbän<strong>de</strong>n,<br />
Vertreter <strong>de</strong>r Vereine auf<br />
Lan<strong>de</strong>sebene aufzubauen, um sich gegenseitig<br />
zu unterstützen. Gestärkt<br />
durch die gute Arbeitsatmosphäre <strong>und</strong><br />
gemeinsamen Erfahrungen in <strong>de</strong>r Natur<br />
fuhren alle mit neuen Impulsen im<br />
Gepäck am Sonntag wie<strong>de</strong>r nach<br />
Hause.<br />
Karin Reth-Scholten<br />
„Spielketten <strong>für</strong> Bewegungseinheiten<br />
im Vor- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulbereich –<br />
eine Interessante Fortbildung <strong>de</strong>s akP in Hessen<br />
„alles verkehrt herum“ konnte nur betreten<br />
wer<strong>de</strong>n, wenn zu allen Befehlen<br />
das Gegenteil gemacht wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> im<br />
„Schlaraffenland“ galt es Leckereinen<br />
mit geschlossenen Augen zu testen.<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Reise wur<strong>de</strong> das Raumschiff<br />
wie<strong>de</strong>r abgebaut.<br />
Auch die zweite Spielkette „Piraten“<br />
zeigte sehr abwechslungsreich, wie<br />
Spielketten selbstständig entworfen<br />
<strong>und</strong> aufgebaut wer<strong>de</strong>n können, <strong>de</strong>nn<br />
am Nachmittag nach <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>rversammlung<br />
war dies die Aufgabe <strong>de</strong>r<br />
TeilnehmerInnen.<br />
In Gruppen wur<strong>de</strong>n Spielketten <strong>für</strong> verschie<strong>de</strong>ne<br />
Altersgruppen entwickelt<br />
<strong>und</strong> später vorgestellt. So gab es <strong>für</strong><br />
Vor- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulkin<strong>de</strong>r die Spielketten<br />
„Wetterstation“ <strong>und</strong> „Kutschfahrt“,<br />
<strong>für</strong> Jugendliche entwarf eine<br />
Gruppe eine „Reise mit Motorrä<strong>de</strong>rn<br />
auf <strong>de</strong>r Route 66“ mit coolem Outfit<br />
<strong>und</strong> coolen Angeboten bei <strong>de</strong>n Reisestops.<br />
Damit en<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r abwechslungs-<br />
<strong>und</strong> erlebnisreiche Fortbildungstag.<br />
Die nächste Fortbildung mit <strong>de</strong>m Titel<br />
„Yoga mit Kin<strong>de</strong>rn“ ist am 2. 6. 07 <strong>und</strong><br />
wird von Reinhil<strong>de</strong> Rho<strong>de</strong> geleitet.<br />
Sigrid John-Flöter<br />
Regionalkreis Hessen-Nord<br />
Regionalkreis<br />
Ba<strong>de</strong>n-Württemberg,<br />
Süd-Ost<br />
Fortbildungsprogramm 2007<br />
16. Juni<br />
Erlebnis Hochseilbrücken<br />
Referent: Axel Heisel<br />
Ort: Parkplatz Riesenhof,<br />
Grillplatz im Riesenwald,<br />
Ravensburg Weststadt<br />
Zeit: 0.00– 8.00 Uhr<br />
Kosten: <strong>für</strong> Mitglie<strong>de</strong>r 39,– E<br />
<strong>für</strong> Nichtmitglie<strong>de</strong>r 49,– E<br />
26.–29. Juli<br />
Klettern <strong>und</strong> an<strong>de</strong>re Abenteuer<br />
in <strong>de</strong>n Bergen<br />
Referenten: Alfons Ummenhofer,<br />
Raim<strong>und</strong> Wiedmer,<br />
Peter Bentele<br />
Ort: Naturfre<strong>und</strong>ehaus<br />
Mettmen, 580 m<br />
Schwan<strong>de</strong>n/CH<br />
Kosten: <strong>für</strong> Mitglie<strong>de</strong>r 30,– E<br />
<strong>für</strong> Nichtmitglie<strong>de</strong>r 50,– E<br />
Schüler, Stu<strong>de</strong>nten, Jugendliche<br />
90,– E; Kin<strong>de</strong>r willkommen<br />
ohne Kosten,<br />
Preis Halbpension<br />
50,– SFr.<br />
22. September<br />
Stockkampf & Stocktanz in<br />
<strong>de</strong>r therapeutischen <strong>und</strong><br />
pädagogischen Arbeit<br />
Referentin: Simone Wirth<br />
Ort: Institut <strong>für</strong> soziale Berufe,<br />
Ravensburg<br />
Zeit: 3.00– 8.00 Uhr<br />
Kosten: <strong>für</strong> Mitglie<strong>de</strong>r 25,– E<br />
<strong>für</strong> Nichtmitglie<strong>de</strong>r 35,– E<br />
im Anschluss an diese Fortbildung:<br />
Mitglie<strong>de</strong>rversammlung <strong>de</strong>s ak´P LV BW<br />
9. Nov 2007<br />
Krabbeln macht Schlau,<br />
Psycho<strong>motorik</strong> <strong>für</strong> die Kleinsten<br />
Referenten: Silke Storch-Schöbinger<br />
<strong>und</strong> Peter Bentele<br />
Ort: Langenargen<br />
Zeit: 5.00– 8.00 Uhr<br />
Kosten: <strong>für</strong> Mitglie<strong>de</strong>r 20,– E<br />
<strong>für</strong> Nichtmitglie<strong>de</strong>r 30,– E<br />
Anmeldungen:<br />
per E-Mail bei Peter Bentele<br />
peter.bentele@t-online.<strong>de</strong><br />
Schorndorf 30 (2007) Heft 2/2007 3
News · Fakten · Informationen<br />
aktuelle Nachrichten <strong>de</strong>s Aktionskreises Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
Informationen aus <strong>de</strong>r<br />
Vorwärts kommen statt Sitzen bleiben<br />
Die Aka<strong>de</strong>mie <strong>für</strong> <strong>Motopädagogik</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Mototherapie</strong> ( ) mit ihrem Team<br />
von renommierten Dozenten bietet<br />
stets aktuelle <strong>und</strong> f<strong>und</strong>ierte Konzepte<br />
<strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>. In unseren Kursen<br />
erwerben Sie nicht nur eine hohe fachliche<br />
Kompetenz, son<strong>de</strong>rn erhalten die<br />
Möglichkeit, sich mit ihrem beruflichen<br />
Selbstverständnis auseinan<strong>de</strong>rzusetzen,<br />
um <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Berufsalltags<br />
mit hoher Zufrie<strong>de</strong>nheit <strong>und</strong><br />
ges<strong>und</strong>heitlicher Wi<strong>de</strong>rstandskraft entgegenzutreten.<br />
Bei uns fin<strong>de</strong>n Sie ein maßgeschnei<strong>de</strong>rtes<br />
Lern-System von <strong>de</strong>r Basis zum<br />
Informationstag zur <strong>Motopädagogik</strong><br />
Gebühren: 40,–€ E<br />
Kurse zur pB’M – psychomotorische Basisqualifikation <strong>Motopädagogik</strong><br />
Gebühren:<br />
Mitglie<strong>de</strong>r ak’P: 230,– E<br />
Nichtmitglie<strong>de</strong>r: 265,– E<br />
Studieren<strong>de</strong> Mitglie<strong>de</strong>r ak’P: 2 5,– E<br />
Studieren<strong>de</strong> Nichtmitglie<strong>de</strong>r: 230,– E<br />
Kurs 1: Körper- <strong>und</strong> Leiberfahrung<br />
Speziellen. Mit <strong>de</strong>n vier Kursen <strong>de</strong>r<br />
psychomotorischen Basisqualifikation<br />
<strong>Motopädagogik</strong> erwerben Sie allgemeine<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Handwerkszeug<br />
<strong>de</strong>r psychomotorischen Arbeitsweise.<br />
Weiterführen<strong>de</strong> Qualifikationen vertiefen<br />
ihre Fachkompetenz in verschie<strong>de</strong>nen<br />
Anwendungs- <strong>und</strong> Arbeitsfel<strong>de</strong>rn.<br />
Die Zusatzqualifikationen in<br />
drei verschie<strong>de</strong>nen Bereichen ermöglichen<br />
eine anwendungsbezogene Hilfe<br />
<strong>für</strong> die berufliche Praxis. Die Zertifizierungskurse<br />
erweitern die Kompetenzen<br />
in <strong>de</strong>n Arbeitsfel<strong>de</strong>rn: Kin<strong>de</strong>rgarten<br />
<strong>und</strong> Frühför<strong>de</strong>rung, Schulen, Kin<strong>de</strong>r-<br />
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.psycho<strong>motorik</strong>.com.<br />
Dort können Sie sich <strong>für</strong> Kurse <strong>de</strong>r schnell <strong>und</strong> bequem anmel<strong>de</strong>n.<br />
Knr. Termin: Leitung: Kursort:<br />
07004 . 9. 2007 Eva Maria Schra<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>rtagesstätte Bergstraße, Roßbach<br />
(zuzüglich eventuelle Übernachtungs-<br />
<strong>und</strong> Verpflegungskosten bei gemein-<br />
samer Unterbringung! Wenn keine<br />
gemeinsame Unterkunft/Verpflegung<br />
vorgegeben ist, kommt zu <strong>de</strong>n Kurs-<br />
Knr. Termin: Leitung: Kursort:<br />
07 06 9. 7.–3. 7. 2007 Dorothea Beigel Sport u. Bildungsstätte, Wetzlar<br />
07 07 3. 8.– 7. 8. 2007 Dr G. Hanne-Behnke/Petra Möhrke Nachbarschaftsheim Mittelhof, Berlin<br />
07 08 29. 8.–2. 9. 2007 Prof. Dr. A. Eckert/Gerd Fichtner Sportschule Hachen, S<strong>und</strong>ern<br />
07 09 7. 9.– . 9. 2007 Ingrid Schäfer DJK Sportschule Münster<br />
gebühren eine Pauschale <strong>für</strong> Raum-<br />
<strong>und</strong> Materialnutzung in Höhe von<br />
jeweils 25,00 E€ hinzu!)<br />
Diese praxisorientierte Lehrgangsreihe bietet <strong>de</strong>n TeilnehmerInnen ein umfangreiches Repertoire an Spiel- <strong>und</strong> Lernangeboten<br />
aus <strong>de</strong>n vier Bereichen. Dabei stehen die selbstständige <strong>und</strong> selbsttätige Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>n Angeboten in Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong>.<br />
Kurse zur Psycho<strong>motorik</strong> <strong>für</strong> Menschen mit einer Behin<strong>de</strong>rung<br />
Knr. Termin: Kursleitung: Schwerpunkt: Kursort:<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe, Erwachsene sowie<br />
Ältere Menschen. Themenspezifische<br />
Kurse bieten ein reichhaltiges<br />
Repertoire an unterschiedlichsten<br />
Themen aus <strong>de</strong>r psychomotorischen<br />
Praxis.<br />
Die Trampolinkurse vermitteln vertiefte<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> Erfahrungen im Umgang<br />
mit <strong>de</strong>m Trampolin. Die Bestätigung<br />
<strong>de</strong>r Teilnahme berechtigt zum<br />
Einsatz in <strong>de</strong>r pädagogischen sowie<br />
therapeutischen Arbeit.<br />
07PB2 2 . 9.–23. 9. 2007 Stephan Orth/ Körperliche <strong>und</strong> motorische Bathildisheim, Bad Arolsen<br />
Roman Mayr Entwicklung im Kontext von<br />
Bewegung <strong>und</strong> Wahrnehmung<br />
4 Schorndorf 30 (2007) Heft 2/2007
News · Fakten · Informationen<br />
aktuelle Nachrichten <strong>de</strong>s Aktionskreises Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
Kurse zur Zusatzqualifikation:<br />
Gebühren:<br />
Mitglie<strong>de</strong>r ak’P: 55,– E<br />
Nichtmitglie<strong>de</strong>r: 85,– E<br />
Psychomotorische Diagnostik<br />
(zuzüglich eventuelle Übernachtungs-<br />
<strong>und</strong> Verpflegungskosten bei gemeinsamer<br />
Unterbringung! Wenn keine<br />
gemeinsame Unterkunft/Verpflegung<br />
Knr. Termin: Thema: Leitung: Kursort:<br />
07D 20. 8.–22. 8. 2007 Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen Ingrid Schäfer/ Lan<strong>de</strong>sturnschule <strong>de</strong>s NTB,<br />
psychomotorischer Diagnostik Dr. Ch. Reichenbach Melle<br />
Zertifizierungskurse<br />
Gebühren:<br />
Mitglie<strong>de</strong>r ak’P: 55,– E<br />
Nichtmitglie<strong>de</strong>r: 85,– E<br />
Arbeitsfeld Kin<strong>de</strong>rgarten <strong>und</strong> Frühför<strong>de</strong>rung<br />
(zuzüglich eventuelle Übernachtungs-<br />
<strong>und</strong> Verpflegungskosten bei gemeinsamer<br />
Unterbringung! Wenn keine<br />
gemeinsame Unterkunft/Verpflegung<br />
Knr. Termin: Thema: Leitung: Kursort:<br />
vorgegeben ist, kommt zu <strong>de</strong>n Kurs-<br />
gebühren eine Pauschale <strong>für</strong> Raum-<br />
<strong>und</strong> Materialnutzung in Höhe von<br />
jeweils 5,00 E€ hinzu!)<br />
07KI2 3 . 8.–2. 9. 2007 Bewegte Frühför<strong>de</strong>rung Kathrin Meiners/ Heilpädagogische Fakultät,<br />
method.-didaktische Konse- Jutta Schnei<strong>de</strong>r Köln<br />
quenzen <strong>für</strong> die Frühför<strong>de</strong>rung<br />
07KT2 4. 9.– 6. 9. 2007 An einem Strang ziehen – Holger Jessel Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
interdisziplinäre Zusammen- <strong>und</strong> Motologie, Marburg<br />
arbeit in <strong>de</strong>r Entwicklungs-<br />
begleitung<br />
07KL2 3. 7.– 5. 7. 2007 Kleine Füße, Große Schritte, Prof. Dr. K. Fischer/ Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
Kin<strong>de</strong>r erfahren ihre Jutta Schnei<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Motologie, Marburg<br />
Lebenswelt<br />
Arbeitsfeld Schulen<br />
Knr. Termin: Thema: Leitung: Kursort:<br />
vorgegeben ist, kommt zu <strong>de</strong>n Kurs-<br />
gebühren eine Pauschale <strong>für</strong> Raum-<br />
<strong>und</strong> Materialnutzung in Höhe von<br />
jeweils 5,00 E€ hinzu!)<br />
07ST 6. 7.–8. 7. 2007 Vernetzte För<strong>de</strong>rung, Dorothea Beigel Sport u. Bildungsstätte,<br />
Zusammenarbeit mit Wetzlar<br />
an<strong>de</strong>ren Berufsgruppen <strong>und</strong><br />
Institutionen<br />
07SI 28. 9.–30. 9. 2007 Kin<strong>de</strong>r lernen an<strong>de</strong>rs – Kathleen Schmiegel Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
Lebenswelten von Schülern <strong>und</strong> Motologie, Marburg<br />
<strong>und</strong> Lehrern in <strong>de</strong>r Schul-<br />
wirklichkeit<br />
Arbeitsfeld Erwachsene<br />
Knr. Termin: Thema: Leitung: Kursort:<br />
07EL 5. 9.–7. 9. 2007 Entwicklungsspanne <strong>de</strong>s Prof. Dr. R. Haas/ Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
Erwachsenenalters zwischen Bernd Glauninger <strong>und</strong> Motologie, Marburg<br />
Wohlbefin<strong>de</strong>n <strong>und</strong> gestörtem<br />
Wohlbefin<strong>de</strong>n<br />
07EI 7. 9.–9. 9. 2007 Institutionelle Rahmen- Prof. Dr. R. Haas/ Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
bedingungen <strong>und</strong> Konse- Bernd Glauninger <strong>und</strong> Motologie, Marburg<br />
quenzen <strong>für</strong> die För<strong>de</strong>rung,<br />
Unterstützung <strong>und</strong> Begleitung<br />
Erwachsener<br />
Schorndorf 30 (2007) Heft 2/2007 5
News · Fakten · Informationen<br />
aktuelle Nachrichten <strong>de</strong>s Aktionskreises Psycho<strong>motorik</strong> e. V.<br />
Themenspezifische Kurse<br />
Gebühren:<br />
Mitglie<strong>de</strong>r ak’P: 35,– E<br />
Nichtmitglie<strong>de</strong>r: 60,– E<br />
– Aka<strong>de</strong>mie <strong>für</strong> Moto-<br />
pädagogik u. <strong>Mototherapie</strong><br />
Kleiner Schratweg 32<br />
32567 Lemgo<br />
(zuzüglich eventuelle Übernachtungs-<br />
<strong>und</strong> Verpflegungskosten bei gemeinsamer<br />
Unterbringung! Wenn keine<br />
gemeinsame Unterkunft/Verpflegung<br />
Knr.: Termin: Titel: Leitung: Kursort:<br />
075 3 6. 7.–8. 7. 2007 Trommeln, Bodypercussion Jürgen Hiemeyer Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft <strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Motopädagogik</strong> Motologie, Marburg<br />
075 4 6. 7.–8. 7. 2007 Hyperaktiv & unaufmerksam Dr. G. Hanne-Behnke Therapiezentrum Waidmannslust,<br />
was nun? Berlin<br />
075 5 3. 7.– 5. 7. 2007 Bewegen – Hören – Lernen Michaela Lamy HPZ Piding<br />
075 6 0. 8.– 2. 8. 2007 Was <strong>für</strong> ein Zirkus ...“ Melanie Behrens Lan<strong>de</strong>sturnschule Melle<br />
Sozial-emotionale Entwicklungs-<br />
för<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong><br />
075 7 3 . 8.–2. 9. 2007 „Sprache bewegt sich – Stephan Kuntz Haslach Mühle, Horgenzell<br />
Grammatik dreht sich.“<br />
För<strong>de</strong>rung grammatischer Fähigkeiten<br />
in psychomotorischen Kontexten<br />
075 8 3 . 8.–2. 9. 2007 Ganzheitliche För<strong>de</strong>rmöglichkeiten G. Seidl-Jerschabek Jugendherberge Bad Homburg<br />
<strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r mit Lern- <strong>und</strong><br />
Konzentrationsstörungen<br />
075 9 3 . 8.–2. 9. 2007 Bewegen – Erleben – Bernd Hoffart/ Viktoriastift, Bad Kreuznach<br />
Ges<strong>und</strong>wer<strong>de</strong>n Dr. P. Obenauer<br />
07520 7. 9.–9. 9. 2007 Mit Pfer<strong>de</strong>n stärken Gudrun Langewisch Hofaka<strong>de</strong>mie Dübberort<br />
0752 2 . 9.–23. 9. 2007 Konzentrationsstörungen Gerda Arldt Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft <strong>und</strong><br />
auf <strong>de</strong>r Spur Motologie, Marburg<br />
Tel.: 0 52 6 /97 09 70<br />
Fax: 0 52 6 /97 09 72<br />
E-Mail: akM@psycho<strong>motorik</strong>.com<br />
Internet: www.psycho<strong>motorik</strong>.com<br />
vorgegeben ist, kommt zu <strong>de</strong>n Kurs-<br />
gebühren eine Pauschale <strong>für</strong> Raum-<br />
<strong>und</strong> Materialnutzung in Höhe von<br />
jeweils 5,00 E€ hinzu!)<br />
Psychomotorische Entwicklungsbegleitung/Psychomotorische Therapie<br />
Knr.: Termin: Titel: Leitung: Kursort:<br />
07T2 24. 9.–26. 9. 2007 Neurowissenschaftliche Gr<strong>und</strong>- Dr. G. Hanne-Behnke Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
lagen <strong>für</strong> Praxis <strong>und</strong> För<strong>de</strong>rung <strong>und</strong> Motologie, Marburg<br />
Trampolinspringen<br />
Knr.: Termin: Leitung: Kursort:<br />
07602 0. 9.– 4. 9. 2007 Michael Stäbler Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft <strong>und</strong> Motologie, Marburg<br />
Machen Sie mit!<br />
6 Schorndorf 30 (2007) Heft 2/2007
90<br />
Ach ja, die Werte!<br />
Richard Hammer<br />
Ach ja, die Werte!<br />
Die Psycho<strong>motorik</strong> kann alles – fast. Kann sie auch zur Entwicklung eines Wertebewusstseins<br />
beitragen? Im Beitrag wird – vor <strong>de</strong>m Hintergr<strong>und</strong> eines von H. V.<br />
Hentig entwickelten Wertesystems – <strong>de</strong>utlich gemacht, wie in einer Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>e<br />
Persönlichkeitsverän<strong>de</strong>rungen bewirkt wer<strong>de</strong>n können – oft ohne es zu<br />
beabsichtigen. Man sollte sich aber darüber im Klaren sein.<br />
Werte kann man nicht lehren,<br />
Werte muss man leben.<br />
Viktor E. Frankl<br />
Einleitung<br />
Werte sind in. Wie<strong>de</strong>r? Nein, das<br />
Gespräch über Werte war schon immer<br />
ein be<strong>de</strong>utsames Thema. Platon (427–<br />
347) propagiert das „Gute“ als <strong>de</strong>n<br />
höchsten anzustreben<strong>de</strong>n Wert, Kant<br />
(1724–1804) stellt die Menschenwür<strong>de</strong><br />
in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Nietzsche<br />
(1844–1900) machte die Umwertung<br />
aller Werte zum Programm. Diese Liste<br />
könnte fortgesetzt wer<strong>de</strong>n. Bis heute<br />
<strong>und</strong> beson<strong>de</strong>rs heute. Kardinal Ratzingers<br />
Buch über „Werte in Zeiten <strong>de</strong>s<br />
Umbruchs“ wird heiß diskutiert. Der<br />
Romancier Peter Prange veröffentlicht<br />
im Droemer Verlag eine 750 Seiten<br />
starke Werte-Anthologie, in <strong>de</strong>r sich<br />
Texte von Seneca bis Marx fin<strong>de</strong>n<br />
lassen (2006). Auch TV-Mo<strong>de</strong>ratoren<br />
greifen dieses Thema auf: Sigm<strong>und</strong><br />
Gottlieb publiziert das Buch „Sag mir<br />
Richard Hammer<br />
Dipl.-Motologe, Lehrer Sek II Sport<br />
<strong>und</strong> Physik, Ausbildung in Gestalttherapie<br />
<strong>und</strong> Systemische Paar- <strong>und</strong><br />
Familientherapie, Dozent <strong>de</strong>r akM,<br />
1. Vorsitzen<strong>de</strong>r AKP<br />
Anschrift siehe Seite 59.<br />
wo die Werte sind“ (Collection Rolf<br />
Heyne 2006) <strong>und</strong> von Peter Frey<br />
erscheint im Her<strong>de</strong>r Verlag das Buch:<br />
„77 Wertsachen. Was gilt heute?“<br />
(2006). Die Bertelsmann Stiftung<br />
schließt sich an: Liz Mohn gibt unter<br />
<strong>de</strong>m Titel „Werte“ eine Textsammlung<br />
heraus, die sich mit <strong>de</strong>r Frage beschäftigt,<br />
was die Gesellschaft zusammenhält<br />
(2007). Auch das Nachrichtenmagazin<br />
FOCUS stimmt hier mit ein <strong>und</strong><br />
widmete seine Ausgabe vom 18. 12.<br />
2006 <strong>de</strong>m Thema „Meine Werte“.<br />
Zwischen Freiheit, Familie <strong>und</strong> Respekt<br />
– was uns wichtig ist. So viel Gedrucktes:<br />
weil uns Werte so wichtig erscheinen<br />
o<strong>de</strong>r weil in unserer Gesellschaft<br />
ein totaler Verlust von Werten beklagt?<br />
Zu Recht o<strong>de</strong>r zu Unrecht?<br />
Für die Kin<strong>de</strong>r in Deutschland sind<br />
zwischen-menschliche Werte wie<br />
Fre<strong>und</strong>schaft, Vertrauen <strong>und</strong> Zuverlässigkeit<br />
wichtiger als Geld - <strong>und</strong> als gute<br />
Manieren. Dies ist das Ergebnis <strong>de</strong>s<br />
ersten repräsentativen Kin<strong>de</strong>r-Werte-<br />
Monitors, <strong>de</strong>n das Kin<strong>de</strong>rmagazin<br />
„GEOlino“ anlässlich seines zehnten<br />
Geburtstages in Zusammenarbeit mit<br />
UNICEF <strong>und</strong> mit Unterstützung <strong>de</strong>s<br />
B<strong>und</strong>esministeriums <strong>für</strong> Wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit <strong>und</strong> Entwicklung<br />
durchgeführt hat.<br />
Danach verfügt die Altersgruppe <strong>de</strong>r<br />
6- bis 14-Jährigen über einen ausgeprägten<br />
Gerechtigkeitssinn <strong>und</strong> eine<br />
große Hilfsbereitschaft. Diese „i<strong>de</strong>alistische“<br />
Orientierung steht aber nicht im<br />
Wi<strong>de</strong>rspruch zu einer insgesamt<br />
pragmatischen Gr<strong>und</strong>einstellung.<br />
So hat <strong>für</strong> die heutigen Kin<strong>de</strong>r – an<strong>de</strong>rs<br />
als noch in <strong>de</strong>n 1980er Jahren –<br />
Leistungsbereitschaft eine genauso<br />
hohe Be<strong>de</strong>utung wie Gerechtigkeit o<strong>de</strong>r<br />
Hilfsbereitschaft sie haben (Pressemitteilung<br />
von UNICEF vom 24. 10. 2006).<br />
Ein spannen<strong>de</strong>s Thema – auch <strong>und</strong> vor<br />
allem in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe,<br />
<strong>de</strong>nn dort haben wir es mit Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen zu tun, die als „auffällig“<br />
beschrieben wer<strong>de</strong>n, weil sie nicht<br />
zurechtkommen mit <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen,<br />
die ihnen im Elternhaus, in <strong>de</strong>r<br />
Schule, in ihrer Lebenswelt gestellt<br />
wer<strong>de</strong>n. Könnte es sein, dass sie das<br />
Wertesystem unserer Gesellschaft nicht<br />
kennen o<strong>de</strong>r es nicht akzeptieren<br />
können, weil sie ein ganz an<strong>de</strong>res<br />
haben? Könnte es daran liegen, dass<br />
ihre Wirklichkeitskonstruktion eine<br />
an<strong>de</strong>re ist als die, welche wir ihnen<br />
vorsetzen <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren Akzeptanz wir von<br />
ihnen einfor<strong>de</strong>rn?<br />
„Werte sind I<strong>de</strong>en, die wir bestimmten<br />
Dingen (Gütern) o<strong>de</strong>r Verhältnissen<br />
zuschreiben. Sie sind nicht Eigenschaften<br />
dieser Dinge o<strong>de</strong>r Verhältnisse<br />
<strong>und</strong> auch keine ‚Wesenheiten’, die ein<br />
<strong>für</strong> sich bestehen<strong>de</strong>s ‚Reich <strong>de</strong>r Werte’<br />
bil<strong>de</strong>n. Sie wer<strong>de</strong>n von uns <strong>de</strong>finiert,<br />
aber nicht erf<strong>und</strong>en (...) sie können<br />
auch nicht von uns abgeschafft,<br />
son<strong>de</strong>rn allenfalls verleugnet wer<strong>de</strong>n;<br />
(...) sie stehen im Konflikt miteinan<strong>de</strong>r,<br />
sie bleiben in einer Kultur relativ<br />
konstant. Nicht sie ‚verfallen’, son<strong>de</strong>rn<br />
das Bewusstsein von ihrer Geltung lässt<br />
nach“ (v. Hentig 2001, 69).<br />
Werte sind also Bestandteil unserer<br />
Wirklichkeitskonstruktionen, sie sind<br />
kulturell bedingt <strong>und</strong> sie verän<strong>de</strong>rn<br />
ihren ‚Wert’ mit <strong>de</strong>r Zeit. Wenn also<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche Probleme<br />
haben, sich mit <strong>de</strong>m aktuell bei uns<br />
gelten<strong>de</strong>n Wertesystem nicht zurechtzufin<strong>de</strong>n,<br />
dann liegt es nicht daran, weil<br />
sie <strong>de</strong>ren ‚Wesenheit’ nicht verstehen<br />
können <strong>und</strong> sich in ihren Handlungen<br />
nicht daran orientieren wollen, son<strong>de</strong>rn<br />
weil ihr Denken <strong>und</strong> Tun oft nicht in die<br />
Zeit passt, also unangemessen <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>shalb „auffällig“ ist. Dies zeigt sich in<br />
<strong>de</strong>n „falschen“ Mitteln, d. h. <strong>de</strong>n<br />
stören<strong>de</strong>n Verhaltensformen, mit <strong>de</strong>nen<br />
sie versuchen, ihre Wertvorstellungen<br />
zu realisieren.<br />
Ein Zusammenleben in einer Gemeinschaft<br />
verlangt die Verständigung über<br />
ein gemeinsames Wertesystem <strong>und</strong> die<br />
Einigung über die Mittel <strong>und</strong> Wege,<br />
dieses Wertesystem auch Realität<br />
wer<strong>de</strong>n zu lassen – also eine sozial aus-<br />
gehan<strong>de</strong>lte Wirklichkeitskonstruktion.<br />
Wie aber können wir Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong>
Jugendliche dazu bringen, das von uns<br />
Erwachsenen ausgehan<strong>de</strong>lte Wertesystem<br />
zu akzeptieren, anzuerkennen <strong>und</strong><br />
auch entsprechend zu han<strong>de</strong>ln?<br />
„Die jungen Menschen müssen die<br />
Tauglichkeit <strong>de</strong>r Tugen<strong>de</strong>n erfahren, die<br />
wir ihnen ansinnen“ (ebd., 13). Werte<br />
können nicht gelehrt, sie können nicht<br />
in einem – wie auch immer benannten<br />
– Unterricht vermittelt wer<strong>de</strong>n. „Die<br />
Maxime, soviel Belehrung wie möglich<br />
durch Erfahrung ersetzen, o<strong>de</strong>r doch<br />
wenigstens mit Erfahrung beginnen <strong>und</strong><br />
in ihr mün<strong>de</strong>n lassen, ist <strong>de</strong>r Cantus<br />
firmus meiner Pädagogik, (d. h.), dass<br />
eine Erziehung zu moralischer Urteilsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> Stärke, zu Verantwortungsbewusstsein<br />
<strong>und</strong> Tatkraft ohne Erfahrung<br />
überhaupt nichts taugt“ (ebd., 82).<br />
Diese Erfahrungen aber können nur in<br />
Grenzen „veranstaltet“ wer<strong>de</strong>n. Sie sind<br />
Bestandteil <strong>de</strong>s (pädagogischen) Alltags<br />
von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen – also<br />
auch von Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>en, in<br />
<strong>de</strong>nen wir als Erwachsene Situationen<br />
gestalten, in <strong>de</strong>nen Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche<br />
erleben, was Werte <strong>für</strong> das<br />
Zusammenleben in <strong>de</strong>r Gemeinschaft<br />
be<strong>de</strong>uten. Wird dieses Erleben reflektiert<br />
<strong>und</strong> damit bewusst gemacht, dann<br />
können sie als erfahrene Werte in <strong>de</strong>n<br />
Erfahrungsschatz eingeordnet <strong>und</strong><br />
somit zu einem wesentlichen Bestandteil<br />
<strong>de</strong>r eigenen Biographie gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n (vgl. Hammer 1997).<br />
Jetzt also auch das noch: „Psycho<strong>motorik</strong><br />
ist eine neue Zauberformel! Sie<br />
verspricht Heilung von fast allen Lei<strong>de</strong>n,<br />
die immer häufiger wer<strong>de</strong>n. Nicht nur<br />
die Bewegungsfähigkeit kann sie<br />
verbessern. Sie beseitigt auch Verhaltensstörungen,<br />
emotionale Labilität.<br />
Ängste aller Art <strong>und</strong> Herkunft, sie<br />
macht klüger, fleißiger, wissbegieriger,<br />
bringt Freu<strong>de</strong> <strong>und</strong> Fertigkeit im<br />
Rechnen, Lesen, Rechtschreiben; sie<br />
hilft uns, zu Einfühlsamkeit, Kunstgenuss<br />
<strong>und</strong> – last not least – sie ist <strong>de</strong>r<br />
Integrationsomnibus <strong>für</strong> die Behin<strong>de</strong>rten,<br />
<strong>de</strong>r nur noch in <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Stückzahl produziert wer<strong>de</strong>n müsste!“<br />
Jetter war es damals (1977) schon zu<br />
viel. Soll die Psycho<strong>motorik</strong> jetzt auch<br />
noch Werte vermitteln?<br />
Natürlich „vermitteln“ wir auch Werte,<br />
wenn wir in Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>en mit<br />
Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen rumtollen,<br />
mit ihnen spielen, mit ihnen Kräfte<br />
messen <strong>und</strong> uns mit ihnen im Guten<br />
<strong>und</strong> im Bösen auseinan<strong>de</strong>rsetzen.<br />
Wiesmeyer (2006) macht dies <strong>de</strong>utlich,<br />
in<strong>de</strong>m sie wesentliche Elemente <strong>de</strong>r<br />
Logotherapie von Viktor E. Frankl mit<br />
<strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong> verbin<strong>de</strong>t. Sie zeigt<br />
auf, dass sich die Kategorien <strong>de</strong>r<br />
Erlebniswerte, <strong>de</strong>r Einstellungswerte<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Schöpferischen Werte (Frankl)<br />
auch in <strong>de</strong>r psychomotorischen Arbeit<br />
mit Kin<strong>de</strong>rn entfalten können.<br />
Erlebnisse in <strong>de</strong>n Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>en<br />
ermöglichen Erfahrungen, die immer<br />
auch mit <strong>de</strong>m Erleben von Werten zu tun<br />
haben – von Werten, <strong>de</strong>ren Einlösen das<br />
Zusammenleben in unserer Lebenswelt<br />
ermöglichen. Zur Überprüfung dieses<br />
hohen (?) Anspruchs betrachten wir<br />
zunächst einen Wertekatalog, wie ihn<br />
Hartmut von Hentig <strong>für</strong> eine „Erziehung<br />
<strong>für</strong> das 21. Jahrh<strong>und</strong>ert“ aufgestellt hat<br />
<strong>und</strong> vergleichen dann, was sich davon im<br />
Alltag eines Psycho<strong>motorik</strong>ers wie<strong>de</strong>r<br />
fin<strong>de</strong>n lässt (Hentig 2001, 162):<br />
1. das Leben;<br />
2. Freiheit/Selbstentfaltung/Selbstbestimmung/Autonomie;<br />
3. Frie<strong>de</strong>n/Fre<strong>und</strong>lichkeit/Gewaltlosigkeit;<br />
4. Seelenruhe – zum Beispiel aufgr<strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r erfüllten Pflicht o<strong>de</strong>r aus<br />
Übereinstimmung mit <strong>de</strong>m eigenen<br />
Gewissen/also auch Schuldlosigkeit;<br />
5. Gerechtigkeit;<br />
6. Solidarität/Brü<strong>de</strong>rlichkeit/Gemeinsamkeit<br />
(= Nichteinsamkeit);<br />
7. Wahrheit;<br />
8. Bildung/Wissen/Einsicht/Weisheit;<br />
9. lieben können/geliebt wer<strong>de</strong>n;<br />
10. körperliches Wohl/Ges<strong>und</strong>heit/<br />
Freiheit von Schmerz/Kraft;<br />
11. Ehre/Achtung <strong>de</strong>r Menschen/Ruhm;<br />
12. Schönheit.<br />
Wir tauchen nun ein in einen psychomotorischen<br />
Alltag <strong>und</strong> überprüfen,<br />
was Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche in diesen<br />
St<strong>und</strong>en erleben <strong>und</strong> mit welchen<br />
Werten sie dabei Bekanntschaft machen.<br />
1. St<strong>und</strong>e:<br />
Sieben Kin<strong>de</strong>r einer 6. Klasse haben<br />
sich darauf verständigt, dass sie<br />
heute unser Luftkissen nutzen<br />
wollen. Beim Aufbau ist viel<br />
Gewicht zu bewegen – Zusammenarbeit<br />
ist also unbedingt erfor<strong>de</strong>rlich.<br />
Zwei Kin<strong>de</strong>r haben dazu keine<br />
Lust. Sie wollen Fußball spielen.<br />
Warum nicht? Sie trennen sich in<br />
<strong>de</strong>r Turnhalle ihren Bereich ab,<br />
machen sich Tore <strong>und</strong> bleiben in<br />
dieser St<strong>und</strong>e <strong>für</strong> sich: Schuss- <strong>und</strong><br />
Torwarttraining, Dribblings sind<br />
angesagt. Sie bleiben <strong>für</strong> sich, ohne<br />
die an<strong>de</strong>ren Kin<strong>de</strong>r zu stören <strong>und</strong><br />
auch respektiert von <strong>de</strong>r größeren<br />
Gruppe, die sich ihrem Spiel<br />
widmet. Sie organisieren sich selbst<br />
– ohne Streit!<br />
Die An<strong>de</strong>ren fangen an, sich auf<br />
<strong>de</strong>m Luftkissen auszutoben, wer<strong>de</strong>n<br />
differenzierter, machen Kunststücke<br />
vor, die von an<strong>de</strong>ren nachgemacht<br />
wer<strong>de</strong>n. Einige messen sich im<br />
Zweikampf beim Catchen, bis sich<br />
schließlich ein gemeinsames<br />
Abwurfspiel entwickelt, <strong>für</strong> das sie<br />
von mir ausdrücklich einen Softball<br />
verlangen.<br />
Nach einiger Zeit ziehen sich drei<br />
Mädchen in eine Kuschelecke<br />
zurück. Ein Junge setzt sich dazu –<br />
nicht störend, aber er stört. Sie<br />
weisen mich darauf hin, dass er auf<br />
ihre Bitte nicht weggehen will, was<br />
er aber schnell tut, nach<strong>de</strong>m ich ihn<br />
auffor<strong>de</strong>re, sich mit mir <strong>de</strong>n<br />
Fußballern anzuschließen. Abschließend<br />
können wir in einer Gesprächsr<strong>und</strong>e<br />
unsere Zufrie<strong>de</strong>nheit<br />
über diese St<strong>und</strong>e äußern, mit viel<br />
Lob von meiner Seite <strong>für</strong> das<br />
harmonische Zusammenspiel mit<br />
<strong>de</strong>r Respektierung <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>ren.<br />
Durch die autonome Gestaltung <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>e, <strong>de</strong>ren<br />
Rahmenbedingungen von mir<br />
gesetzt wur<strong>de</strong>n, erleben die Kin<strong>de</strong>r<br />
ein hohes Maß an Selbstständigkeit<br />
<strong>und</strong> Freiheit bei <strong>de</strong>r Entwicklung<br />
ihrer eigenen I<strong>de</strong>en <strong>und</strong> Vorstellungen.<br />
Sie erfahren aber auch, dass<br />
eigene I<strong>de</strong>en oft nur gemeinsam mit<br />
an<strong>de</strong>ren realisierbar sind, was<br />
letztlich auch ein Klima <strong>de</strong>r Gewaltlosigkeit<br />
erzeugt, <strong>de</strong>nn nur dann sind<br />
gesteckte Ziele erreichbar. Dass sich<br />
dann im Abschlussgespräch diese<br />
Zufrie<strong>de</strong>nheit über eine gelungene<br />
St<strong>und</strong>e breit macht, sorgt <strong>für</strong> eine<br />
Seelenruhe, die aus <strong>de</strong>r „erfüllten<br />
Pflicht“ heraus entsteht.<br />
2. St<strong>und</strong>e:<br />
Ich hole die Kin<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>m<br />
Klassenzimmer ab. Auf <strong>de</strong>m Weg in<br />
die Turnhalle erzählt Thorsten 1<br />
1 Der Name ist, wie alle an<strong>de</strong>ren, geän<strong>de</strong>rt.<br />
91
92<br />
Ach ja, die Werte!<br />
begeistert über sein Wochenen<strong>de</strong>.<br />
Er war snowboar<strong>de</strong>n, ist noch ganz<br />
begeistert von seinen Erlebnissen.<br />
Entspricht all das, was er erzählt,<br />
<strong>de</strong>r Realität?<br />
Nach einem kurzen Gespräch, bei<br />
<strong>de</strong>m die Kin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Klasse ihren Plan<br />
<strong>für</strong> die kommen<strong>de</strong> St<strong>und</strong>e absprechen,<br />
teilen sie sich Raum <strong>und</strong><br />
Material ein. Auf <strong>de</strong>m Luftkissen<br />
entwickeln sich ähnliche Spiel- <strong>und</strong><br />
Bewegungsformen wie oben<br />
geschil<strong>de</strong>rt: austoben, rennen,<br />
springen, Salti schlagen, von oben<br />
in das Luftkissen reinspringen,<br />
reinfallen lassen. Schließlich wird<br />
auch hier gecatcht. Als ein Junge<br />
mich einlädt zu einem Kampf,<br />
wehre ich ab (was sonst nicht<br />
meine Art ist). Alfred kommt mir zu<br />
Hilfe: „Lass <strong>de</strong>n Herrn Hammer in<br />
Ruhe, er hat ein wehes Kreuz“ – was<br />
stimmt.<br />
Beim Catchen kommt es zu einer<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzung. Wie so oft<br />
wird <strong>de</strong>r Grat zwischen Spaß <strong>und</strong><br />
Ernst überschritten. Thorsten<br />
schlägt hart zu, verletzt seinen<br />
„Gegner“, <strong>de</strong>r sich das nicht gefallen<br />
lässt <strong>und</strong> zurückschlägt. Ich gehe<br />
dazwischen, unterhalte mich mit<br />
bei<strong>de</strong>n. Thorsten ist ziemlich<br />
gela<strong>de</strong>n, bekommt Tränen in <strong>de</strong>n<br />
Augen, will aber nicht sagen, woher<br />
seine Wut kommt.<br />
Ich la<strong>de</strong> ihn ein, mit Fußball zu<br />
spielen, wobei er <strong>de</strong>n Ball <strong>de</strong>rmaßen<br />
stark in Richtung Tor knallt, dass<br />
Dieter sich zurückzieht. Er hält die<br />
Wut Thorstens nicht aus. Ich steige<br />
also ein, werfe ihm <strong>de</strong>n Ball zu, <strong>de</strong>n<br />
er dann mit all seiner Kraft gegen<br />
die Wand dreschen kann.<br />
Beim Weggehen sagt er: „Hoffentlich<br />
bin ich in <strong>de</strong>r nächsten St<strong>und</strong>e<br />
besser drauf.“<br />
Auch hier können die Kin<strong>de</strong>r wie<strong>de</strong>r<br />
im vorgegebenen Rahmen ihre<br />
St<strong>und</strong>e selbst gestalten, erleben<br />
also, was es heißt, autonom han<strong>de</strong>ln<br />
zu können – in Solidarität mit <strong>de</strong>n<br />
an<strong>de</strong>ren. Die Respektierung meines<br />
verletzten Kreuzes zeigt auch, dass<br />
ein Gefühl <strong>für</strong> die Achtung <strong>de</strong>s<br />
körperlichen Wohls an<strong>de</strong>rer Menschen<br />
vorhan<strong>de</strong>n ist – ein Gefühl,<br />
das auch im Han<strong>de</strong>ln konkret wird.<br />
Auch die körperliche Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
„belehrt“. Die Auflösung<br />
macht <strong>de</strong>utlich, dass beim gemeinsamen<br />
Spielen die Wür<strong>de</strong> <strong>und</strong><br />
Unversehrtheit <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>rn zu<br />
achten ist – was halt auch im Kampf<br />
gegeneinan<strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>lage <strong>de</strong>s<br />
gemeinsamen Han<strong>de</strong>lns sein muss.<br />
3. St<strong>und</strong>e<br />
Martin <strong>und</strong> Thomas, zwei „tragen<strong>de</strong><br />
Pfeiler“ einer 3er-Gruppe, organisieren<br />
ihre St<strong>und</strong>e selbst. Martin sagt<br />
mir schon eine St<strong>und</strong>e vorher auf<br />
<strong>de</strong>m Pausenhof: „Halten Sie die<br />
Grigris bereit, wir wer<strong>de</strong>n klettern.“<br />
Daniel setzt sich auf die Bank, hat<br />
keine Lust. Hinter ihm liegt ein<br />
Hilfeplangespräch, bei <strong>de</strong>r ihm<br />
mitgeteilt wur<strong>de</strong>, dass er bis En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s 9. Schuljahres noch im Heim<br />
bleiben muss – also noch zweieinhalb<br />
Jahre. Kein W<strong>und</strong>er, dass er<br />
jetzt keine Lust hat, Luftsprünge zu<br />
machen.<br />
Er ist sonst sehr lebendig <strong>und</strong> aktiv.<br />
Da die An<strong>de</strong>ren ihre St<strong>und</strong>e selbst<br />
organisieren, habe ich Zeit, mich zu<br />
ihm auf die Bank zu setzen <strong>und</strong><br />
mich mit ihm über seine Situation<br />
zu unterhalten. Die an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n<br />
ziehen sich – über <strong>de</strong>m Luftkissen<br />
schwebend – am Kletterseil<br />
gegenseitig hoch, sich mit <strong>de</strong>n<br />
Grigris absichernd. Sie erreichen<br />
fast die Hallen<strong>de</strong>cke <strong>und</strong> genießen<br />
<strong>de</strong>n Blick von oben (etwa 6 m Höhe)<br />
– ohne Störung, mit Ruhe. Thomas<br />
ist mit dabei, er, <strong>de</strong>r sonst so häufig<br />
im Mittelpunkt steht, weil die<br />
An<strong>de</strong>ren ihn gerne ärgern. Er kommt<br />
mit nach oben, erhält dadurch mehr<br />
Akzeptanz. Er hat inzwischen auch<br />
gelernt, sich zu wehren: „ich will<br />
das jetzt nicht.“<br />
Autonomes Han<strong>de</strong>ln, ein hohes Maß<br />
an Selbstbestimmung zieht sich<br />
durch, ist tragen<strong>de</strong>r Pfeiler <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>en. Ein Element,<br />
das sicher nicht ohne Mühe erreichbar<br />
ist. Viele St<strong>und</strong>en, mit häufigen<br />
Enttäuschungen sind nötig, um<br />
dieses Stadium mit einer Gruppe zu<br />
erreichen: sie kommen mit schon<br />
geklärten Vorstellungen <strong>und</strong> haben<br />
wenig Probleme, diese im gemeinsamen<br />
Diskurs vor <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e<br />
abzuklären <strong>und</strong> dann zu realisieren.<br />
Auf dieser Gr<strong>und</strong>lage ist es möglich,<br />
die Gruppe auch mal „allein“ zu<br />
lassen <strong>und</strong> sich <strong>de</strong>n Problemen<br />
Einzelner zu widmen. Hier erlebt<br />
Daniel, dass er angenommen wird, er<br />
erlebt die Zuwendung, das „geliebt<br />
wer<strong>de</strong>n“ als Bestätigung, als<br />
Würdigung seiner Persönlichkeit.<br />
4. St<strong>und</strong>e:<br />
Thema ist „Rettungseinsatz am<br />
Luftkissen“. Stefan bringt einen<br />
Sanitätskasten mit, ist Notarzt.<br />
Immer wie<strong>de</strong>r passieren „Verletzungen“<br />
beim „Sturz“ vom Luftkissen<br />
o<strong>de</strong>r bei einem Crash mit <strong>de</strong>m<br />
Rollbrett. Mit Rollbrettern wird ein<br />
Krankenwagen gebaut. Kastenteile<br />
dienen dazu, <strong>für</strong> die schlimmsten<br />
Fälle einen Sarg herzustellen. Nicht<br />
je<strong>de</strong>r wird gerettet: ein Neuer (noch<br />
Außenseiter) bleibt liegen. Ich<br />
schenke ihm meine Aufmerksamkeit.<br />
Während <strong>de</strong>s Spiels wird es<br />
plötzlich ruhiger. Vier Kin<strong>de</strong>r ziehen<br />
sich in eine Ecke zurück <strong>und</strong><br />
beschäftigen sich mit einem<br />
Stethoskop, das sich in <strong>de</strong>m<br />
Verbandskasten befand. Stefan<br />
verkauft es <strong>für</strong> 8 e an Christoph. Er<br />
ist darüber sehr glücklich, Christoph<br />
auch. (Ich weiß nicht, wer hier über<br />
<strong>de</strong>n Tisch gezogen wor<strong>de</strong>n ist.)<br />
Christoph bringt das Stethoskop<br />
sofort zu Einsatz. Er testet es bei<br />
<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> stellt bei<br />
<strong>de</strong>m Neuen fest: „Du bist herzlos.“<br />
In dieser St<strong>und</strong>e steht das Thema<br />
„Retten“ im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong>. Hier<br />
drücken die Kin<strong>de</strong>r ihr Bedürfnis aus<br />
nach Versorgung, nach umsorgt<br />
wer<strong>de</strong>n, nach Zuwendung. Sie<br />
inszenieren dies im Spiel <strong>und</strong> geben<br />
sich mit meiner Unterstützung das,<br />
was sie sonst vielleicht zu oft<br />
vermissen. Es geht um das psychische,<br />
aber auch körperliche Wohl,<br />
es geht aber auch um das Erleben<br />
von Brü<strong>de</strong>rlichkeit <strong>und</strong> Gemeinsamkeit.<br />
Was sie beim Verhan<strong>de</strong>ln um<br />
das Stethoskop erfahren lässt sich in<br />
Hentig’s Wertekatalog nur schwer<br />
wie<strong>de</strong>rfin<strong>de</strong>n. Ist es das Wissen um<br />
die Verhältnisse in einer konsumorientierten,<br />
einer kapitalistischen<br />
Gesellschaft?<br />
5. St<strong>und</strong>e:<br />
Sechs Kin<strong>de</strong>r einer 5. Klasse äußern<br />
sehr unterschiedliche Vorstellungen<br />
über die Gestaltung <strong>de</strong>r Psychomo-
torikst<strong>und</strong>e: Zwei wollen Fußball<br />
spielen, zwei schaukeln, zwei wollen<br />
mit <strong>de</strong>n Inlinern fahren. Es ist ihr<br />
Vorschlag, <strong>de</strong>n Raum mit Langbänken<br />
abzuteilen, sodass ein Bereich<br />
<strong>für</strong> die Fußballer, ein an<strong>de</strong>rer <strong>für</strong> die<br />
Schaukel reserviert wird <strong>und</strong><br />
schließlich auch noch genügend<br />
Platz bleibt zum Fahren mit <strong>de</strong>n<br />
Inlinern.<br />
Dies ist möglich, da sie sich<br />
inzwischen (das war nicht immer<br />
so) gegenseitig respektieren <strong>und</strong> in<br />
<strong>de</strong>r Lage sind, auf <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren<br />
Rücksicht zu nehmen. So bleibt am<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e das Resümee: „Das<br />
haben wir gut hingekriegt. Sooo<br />
unterschiedliche Wünsche <strong>und</strong> doch<br />
hat es geklappt.“<br />
Beeindruckt hat mich hier das<br />
Resümee einer Schülerin: „So<br />
unterschiedliche Wünsche <strong>und</strong> doch<br />
hat es geklappt.“ Sie hatten die<br />
Möglichkeit, <strong>de</strong>n Verlauf <strong>de</strong>r St<strong>und</strong>e<br />
frei zu bestimmen – <strong>und</strong> es funktionierte:<br />
in einem Klima <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong>lichkeit<br />
<strong>und</strong> Gewaltlosigkeit, in<br />
Gemeinsamkeit <strong>und</strong> Solidarität mit<br />
<strong>de</strong>n An<strong>de</strong>ren. Kein W<strong>und</strong>er, dass sich<br />
bei <strong>de</strong>n Schülern hier die Seelenruhe<br />
breit macht, die aufgr<strong>und</strong> einer<br />
„erfüllten Pflicht“ entsteht.<br />
6. St<strong>und</strong>e:<br />
Der Psycho<strong>motorik</strong>tag neigt sich zu<br />
En<strong>de</strong>. Es bleibt noch ein Fußballspiel<br />
mit <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn einer Wohngruppe.<br />
Auch hier steht wie<strong>de</strong>r das Prinzip<br />
<strong>de</strong>r Selbstorganisation im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong>.<br />
Die Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
dürfen abwechselnd die Mannschaft<br />
zusammenstellen – nicht wählen!<br />
Auftrag ist: die Mannschaften<br />
müssen in ihrer Spielstärke ausgeglichen<br />
sein. Da zu Beginn dieser<br />
Art <strong>de</strong>r Mannschaftsbildung schon<br />
öfters Mal <strong>de</strong>r Wunsch, <strong>für</strong> sich<br />
selbst eine Topmannschaft zusammenzustellen,<br />
im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong><br />
stand, wur<strong>de</strong> eine Regel eingeführt:<br />
das Spiel dauert generell, bis eine<br />
Mannschaft 10 Tore erzielt hat.<br />
Führt jedoch eine Mannschaft mit<br />
drei Toren Abstand, so ist das Spiel<br />
zu En<strong>de</strong>. Wie so oft wird es ein<br />
intensives, anstrengen<strong>de</strong>s aber <strong>für</strong><br />
alle Beteiligten befriedigen<strong>de</strong>s Spiel,<br />
mit vielen Toren, mit Sieger <strong>und</strong><br />
Verlierer – aber ohne Streit!<br />
Es mag ja ganz banal klingen, aber<br />
es ist eben nicht selbstverständlich,<br />
dass Fußballspiele gelingen – ohne<br />
Streit, ohne Ärger, ohne Raufereien<br />
<strong>und</strong> Rangeleien. Nach<strong>de</strong>m diese<br />
Gruppe seit mehr als eineinhalb<br />
Jahren regelmäßig einmal pro<br />
Woche nach <strong>de</strong>m gleichen Regelwerk,<br />
innerhalb <strong>de</strong>r gleichen<br />
Rahmenbedingungen spielt, hat sich<br />
eine „Spielkultur“ breitgemacht, die<br />
geprägt ist von Ehrgeiz (sie <strong>und</strong><br />
auch wir Erwachsene wollen<br />
gewinnen), aber auch von einem<br />
starken Gefühl <strong>de</strong>s Miteinan<strong>de</strong>r<br />
Spielens, das sich letztlich als<br />
erfolgreicher herausgestellt hat, als<br />
die spektakulären Einzelaktionen.<br />
Die Aufgabe, ausgewogene Mannschaften<br />
zusammenzustellen, gibt<br />
<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
wie<strong>de</strong>r das Gefühl, autonom<br />
han<strong>de</strong>ln zu können – allerdings auf<br />
<strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r Gerechtigkeit. Wird<br />
diese Voraussetzung nicht eingehalten,<br />
kommt das Spiel zu einem<br />
schnellen En<strong>de</strong>.<br />
Bleibt noch festzuhalten, dass die<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendlichen in dieser<br />
Zeit nicht nur gelernt haben mit<br />
bestimmten Werten zu leben <strong>und</strong><br />
sich daran zu orientieren, son<strong>de</strong>rn<br />
dass sich auch ihr Fußballspiel<br />
erheblich verbessert hat – auch hier<br />
wie<strong>de</strong>r ein Baustein zur selbstbewussten<br />
Persönlichkeit.<br />
„Quod erat <strong>de</strong>monstrandum“: Was zu<br />
beweisen war! Wir vermitteln in <strong>de</strong>n<br />
Psycho<strong>motorik</strong>st<strong>und</strong>en auch Werte.<br />
Bleibt zu ergänzen, dass <strong>für</strong> mich in <strong>de</strong>r<br />
Begegnung mit <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen die unantastbare Wür<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Menschen an oberster Stelle steht –<br />
verb<strong>und</strong>en mit seinem körperlichen <strong>und</strong><br />
psychischen Wohl <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Möglichkeit,<br />
sein in ihm wohnen<strong>de</strong>s Potenzial zur<br />
Entfaltung zu bringen. Autonomie <strong>und</strong><br />
Selbstorganisation, gepaart mit<br />
Solidarität, sind die Leitsterne meines<br />
psychomotorischen Han<strong>de</strong>lns.<br />
Han<strong>de</strong>ln wir auf dieser Gr<strong>und</strong>lage,<br />
haben wir berechtigte Aussicht auf<br />
Erfolg, wenn wir als Erfolg bezeichnen,<br />
dass Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche es lernen<br />
in Selbstverantwortung solidarisch zu<br />
han<strong>de</strong>ln. Erreichen können wir dies nur<br />
– hier schließe ich mich v. Hentig an –<br />
unter vier Bedingungen: „1) die Sache<br />
muss <strong>de</strong>n Erziehen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Lehren<strong>de</strong>n<br />
selbst wichtig sein, 2) nichts, was<br />
bleiben soll, kommt schnell, 3) alles<br />
Lernen ist mit Erfahrung zu verbin<strong>de</strong>n,<br />
wenn es schon nicht immer aus ihr<br />
hervorgehen kann, 4) die Person <strong>de</strong>s<br />
Erziehen<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Lehren<strong>de</strong>n muss<br />
ins Spiel kommen, ja, sie ist ihr stärkstes<br />
Mittel“ (v. Hentig 2001, 76).<br />
Das heißt letztlich, „eine Erziehung <strong>für</strong><br />
eine noch offene <strong>und</strong> nicht beliebige<br />
Zukunft, die auf natürliche Weise<br />
einschließt, was als ‚Werteerziehung’<br />
gefor<strong>de</strong>rt wird, liegt im Wi<strong>de</strong>rstreit mit<br />
allem, was darauf angelegt ist, Menschen<br />
ans Gängelband zu nehmen“<br />
(ebd., 101).<br />
Autonomes <strong>und</strong> solidarisches Han<strong>de</strong>ln,<br />
verb<strong>und</strong>en mit <strong>de</strong>r Achtung <strong>de</strong>r Wür<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s An<strong>de</strong>rn, entsteht nur aus <strong>de</strong>m<br />
Erleben erfolgreichen gemeinsamen<br />
Han<strong>de</strong>lns. Erfolgreich kann es aber nur<br />
dann sein, wenn wir als Erwachsene<br />
<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen die<br />
notwendigen Rahmenbedingungen<br />
vorgeben, also Situationen gestalten,<br />
die <strong>für</strong> sie eine Herausfor<strong>de</strong>rung<br />
darstellen, in motorischer, sozialer,<br />
kognitiver Hinsicht – eine Herausfor<strong>de</strong>rung<br />
allerdings, die <strong>für</strong> sie auch<br />
meisterbar ist.<br />
Mein Richtmaß ist hier immer:<br />
So viel Offenheit wie möglich –<br />
aber so viel Struktur wie nötig!<br />
Literatur:<br />
Hammer, R. (1997): „... in seiner<br />
Einheit von Wahrnehmen,<br />
Erleben <strong>und</strong> Bewegen ...“. Auf<br />
<strong>de</strong>r Suche nach <strong>de</strong>m Erleben in<br />
<strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>. In: <strong>motorik</strong>,<br />
21, 3, S. 134–147.<br />
Hentig, H. v. (2001): Ach, die Werte.<br />
Weinheim: Beltz.<br />
Jetter, K. (1977): Dialektischmaterialistische<br />
Aspekte <strong>de</strong>r<br />
Theoriebildung <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>.<br />
In: Daus, R./Roth, K. (Hrsg.):<br />
Motorische Entwicklung.<br />
Darmstadt: Selbstverlag.<br />
Wiesmeyer, M. (2006): Perspektiven<br />
<strong>de</strong>s „sinnzentrierten Ansatzes“<br />
in <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>. Eine<br />
Verknüpfung von Psycho<strong>motorik</strong><br />
<strong>und</strong> Logotherapie. Weinheim/<br />
Basel: Beltz, S. 138–140.<br />
93
94<br />
„Und wer sieht uns?“ – Bewegungsdiagnostik <strong>für</strong> Jugendliche<br />
Mone Welsche / Cordula Stobbe / Georg Romer<br />
„Und wer sieht uns?“ –<br />
Bewegungsdiagnostik <strong>für</strong> Jugendliche<br />
In vielen kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> jugendpsychiatrischen Kliniken gehören bewegungsdiagnostische<br />
Verfahren zum Standard <strong>de</strong>r Versorgung. 2003/04 wur<strong>de</strong> eine Befragung zum<br />
Thema „Einsatz von bewegungsdiagnostischen Verfahren in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie“<br />
durchgeführt. Hier wur<strong>de</strong> die Dominanz von Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utlich, die<br />
primär <strong>de</strong>n motorischen Entwicklungsstand sowie Wahrnehmungsleistungen im<br />
Kin<strong>de</strong>salter überprüfen. In <strong>de</strong>r Erfassung von Bewegungsverhalten sowie in <strong>de</strong>r<br />
Bewegungsdiagnostik jugendlicher Patienten bil<strong>de</strong>ten sich Defizite <strong>und</strong> ein grosser<br />
Bedarf ab. In diesem Artikel wird die Be<strong>de</strong>utung bewegungsdiagnostischer Verfahren<br />
<strong>für</strong> jugendliche Patienten diskutiert <strong>und</strong> bewegungsdiagnostische Ansätze, die bei<br />
Jugendlichen eingesetzt wer<strong>de</strong>n können, wer<strong>de</strong>n vorgestellt.<br />
Einleitung<br />
Wer kennt es nicht, das klassische<br />
Phänomen <strong>de</strong>r Adoleszenz: Nicht mehr<br />
Kind, noch nicht erwachsen, fühlen<br />
Jugendliche sich häufig unverstan<strong>de</strong>n,<br />
zu kurz kommend, zu wenig beachtet<br />
<strong>und</strong> immer irgendwie zwischen <strong>de</strong>n<br />
Stühlen stehend – wo gehören Jugendliche<br />
eigentlich hin <strong>und</strong> wird sich<br />
tatsächlich nicht ausreichend um sie<br />
gekümmert?<br />
Die Geschichte <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendpsychiatrie <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren Entwicklung,<br />
weg von <strong>de</strong>r „großen Schwester“<br />
Erwachsenenpsychiatrie <strong>und</strong> hin zu<br />
einer eigenständigen Fachdisziplin,<br />
zeigt, dass behandlungsbedürftige<br />
Jugendliche zumin<strong>de</strong>st im kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
jugendpsychiatrischen Setting lange<br />
keinen rechten „eigenen“ Platz gehabt<br />
zu haben scheinen. Die ersten Veröffentlichungen<br />
zum kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
jugendpsychiatrischen Bereich befassten<br />
sich ausschließlich mit Patienten im<br />
Kin<strong>de</strong>salter (vgl. u. a. Emminghaus<br />
1887) <strong>und</strong> die Behandlung jugendlicher<br />
Patienten fand in <strong>de</strong>n Anfangszeiten<br />
<strong>de</strong>r heutigen Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie<br />
entwe<strong>de</strong>r im Kontext <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Erwachsenenpsychiatrie<br />
statt (vgl. Remschmidt 1992). Auch<br />
wenn das Jugendalter mit seinen<br />
Entwicklungsstufen, spezifischen<br />
Themen <strong>und</strong> Problematiken im Laufe<br />
<strong>de</strong>r Zeit zunehmend als eigenständiger<br />
Bereich im Diskurs <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendpsychologie <strong>und</strong> Psychiatrie<br />
Anerkennung fand (vgl. u. a. Bühler<br />
1921, Blos 1973, Erikson 1966), dauerte<br />
es erstaunlicherweise bis 1978, bis <strong>de</strong>r<br />
Begriff <strong>de</strong>r Adoleszenz – <strong>und</strong> damit die<br />
Altersgruppe <strong>de</strong>r jugendlichen Patienten<br />
– explizit in <strong>de</strong>n Titel <strong>de</strong>s international<br />
größten Verban<strong>de</strong>s <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendpsychiatrie, <strong>de</strong>r „International<br />
Association for Child and Adolescent<br />
Psychiatry and Allied Professions“<br />
(IACAP and AP), integriert wur<strong>de</strong> (vgl.<br />
Remschmidt 1992, 6). Trotz<strong>de</strong>m wird<br />
vielerorts die Entwicklungsphase <strong>de</strong>r<br />
Adoleszenz als ein „auch heute noch<br />
vernachlässigtes Gebiet“ gesehen, wie<br />
Remschmidt (1992, 1) feststellt.<br />
Jugendliche in <strong>de</strong>r klinischen<br />
Bewegungsdiagnostik <strong>und</strong><br />
-therapie<br />
Betrachtet man die Fachliteratur zu<br />
Themen <strong>de</strong>r Bewegungsdiagnostik <strong>und</strong><br />
Bewegungstherapie 1 , so scheint es, als<br />
wur<strong>de</strong> die Zielgruppe <strong>de</strong>r Jugendlichen<br />
auch in diesem Kontext bisher eher<br />
vernachlässigt. Veröffentlichungen zur<br />
bewegungsorientierten <strong>und</strong> -diagnostischen<br />
Arbeit mit Kin<strong>de</strong>rn fin<strong>de</strong>n sich<br />
sehr häufig (vgl. u. a. Irmischer/Fischer<br />
1989; Passolt 1996; Neuhäuser 1996;<br />
1 Der Begriff <strong>de</strong>r Bewegungsdiagnostik wird<br />
in diesem Artikel als Sammelbegriff <strong>für</strong><br />
motodiagnostische bzw. bewegungsdiagnostische<br />
Konzepte verwen<strong>de</strong>t. Auch <strong>de</strong>r Begriff<br />
<strong>de</strong>r Bewegungstherapie ist in diesem Artikel<br />
als Überschrift <strong>für</strong> alle bewegungs- <strong>und</strong><br />
körperorientierten Therapieformen zu verstehen.<br />
Panten 1997), während die Anzahl <strong>de</strong>r<br />
Publikationen zu bewegungsorientierten<br />
Themen mit Jugendlichen –<br />
sowohl diagnostisch als auch therapeutisch<br />
– <strong>de</strong>utlich spärlicher ausfällt (vgl.<br />
u. a. Welsche 2006; Gille 2002;<br />
Hammer/Müller 2001). Auch wenn in<br />
vielen Arbeiten von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong><br />
Jugendlichen als Zielgruppe gesprochen<br />
wird, so wird meist nicht auf die<br />
beson<strong>de</strong>ren Bedürfnisse <strong>und</strong> Voraussetzungen<br />
von Jugendlichen eingegangen.<br />
Nichts<strong>de</strong>stoweniger stellt die Patientengruppe<br />
<strong>de</strong>r Jugendlichen einen<br />
wesentlichen Bestandteil <strong>de</strong>s klinischen<br />
Klientels dar, sei es im ambulanten,<br />
teilstationären o<strong>de</strong>r vollstationären<br />
Setting. Bewegungstherapeutische<br />
Gruppen- o<strong>de</strong>r Einzeltherapien gehören<br />
auch <strong>für</strong> Jugendliche in <strong>de</strong>n meisten<br />
Kliniken zum therapeutischen Angebot.<br />
Wie aber steht es um die Bewegungsdiagnostik?<br />
Bei Betrachtung von Hölters<br />
Spiralmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s therapeutischen<br />
Prozesses (Abbildung 1) wird <strong>de</strong>utlich,<br />
dass die Bewegungsdiagnostik einen<br />
wichtigen Bestandteil <strong>de</strong>s therapeutischen<br />
Prozesses darstellt.<br />
Durch <strong>de</strong>n Einsatz diagnostischer Mittel<br />
kann<br />
• die Ausgangslage bestimmt wer<strong>de</strong>n:<br />
Mit welchen Problemen, Auffälligkeiten<br />
<strong>und</strong> Bedürfnissen kommt <strong>de</strong>r<br />
Patient?<br />
• eine Indikation zur (bewegungs-)therapeutischen<br />
Behandlung gestellt<br />
wer<strong>de</strong>n: Ist Bewegungstherapie <strong>für</strong><br />
diesen Patienten indiziert? Wenn ja,<br />
mit welchem Ziel?<br />
• die Behandlung im Verlauf o<strong>de</strong>r zum<br />
En<strong>de</strong> evaluiert wer<strong>de</strong>n, um sowohl<br />
Auswirkungen <strong>de</strong>r Behandlung<br />
aufzuzeigen, als auch Hinweise <strong>für</strong><br />
notwendige Verän<strong>de</strong>rungen im<br />
therapeutischen Prozess <strong>de</strong>utlich zu<br />
machen: Was hat sich im Verlauf<br />
verän<strong>de</strong>rt? Ist die Verän<strong>de</strong>rung<br />
positiv o<strong>de</strong>r negativ? Bil<strong>de</strong>n sich<br />
neue Themen o<strong>de</strong>r Problembereich<br />
ab, die in <strong>de</strong>n therapeutischen<br />
Prozess integriert wer<strong>de</strong>n sollten?
Abb. 1: Spiralmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s therapeutischen Prozesses nach Hölter (2000, 103)<br />
Fehlen diagnostische Mittel, stellt sich<br />
die Frage, wie Indikationen zur Bewegungstherapie<br />
gestellt wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> wie<br />
sich Behandlungserfolge, aber auch ein<br />
möglicherweise notwendiger Bedarf<br />
Dipl. Päd. Mone Welsche<br />
M. A. Jahrgang 1971, Studium <strong>de</strong>r<br />
Bewegungserziehung <strong>und</strong> –therapie an<br />
<strong>de</strong>r Uni Dortm<strong>und</strong>. Studium <strong>de</strong>r Somatic<br />
Studies and Labananalysis an <strong>de</strong>r<br />
Universität Surrey, UK. Bewegungstherapeutin<br />
in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie<br />
<strong>de</strong>r Universitätsklinik<br />
Hamburg-Eppendorf. Lehrbeauftragte<br />
an <strong>de</strong>r KHSB in Berlin, FB Heilpädagogik.<br />
Arbeitsschwerpunkt: Qualitative<br />
Bewegungsanalyse <strong>und</strong> -diagnostik,<br />
Jugendliche als Klientel <strong>de</strong>r Bewegungstherapie,<br />
Bewegungsverhalten<br />
<strong>und</strong> Psychopathologie.<br />
Anschrift <strong>de</strong>r Verfasserin:<br />
Dipl. Päd. M. Welsche, M. A.<br />
Klinik <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie<br />
Universitätsklinikum Hamburg-<br />
Eppendorf<br />
Martinistr. 52<br />
20246 Hamburg<br />
E-Mail: mwelsche@<br />
uke.uni-hamburg.<strong>de</strong><br />
nach Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Prozesses<br />
erfassen lassen. Auf theoretischer Ebene<br />
scheint die Notwendigkeit <strong>für</strong> <strong>de</strong>n<br />
Einsatz bewegungstherapeutischer<br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>für</strong> das Jugendalter nachvollziehbar.<br />
Während viele Jugendliche im<br />
Laufe ihrer klinisch-psychiatrischen<br />
Behandlung bewegungstherapeutisch<br />
„gesehen“ wer<strong>de</strong>n, sind sie allerdings<br />
<strong>de</strong>utlich weniger in die bewegungsdiagnostische<br />
Versorgung eingeb<strong>und</strong>en<br />
(Welsche et al. 2005). Diese Beobachtung<br />
kann darauf zurückgeführt<br />
wer<strong>de</strong>n, dass die Anzahl <strong>de</strong>r bewegungsdiagnostischen<br />
Ansätze <strong>für</strong><br />
Jugendliche klein ist <strong>und</strong> die vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Metho<strong>de</strong>n wenig bekannt zu sein<br />
scheinen. Der vorliegen<strong>de</strong> Beitrag<br />
versteht sich als Bestandserhebung zum<br />
Dipl. Päd. Cordula Stobbe<br />
Studium <strong>de</strong>r Bewegungserziehung<br />
<strong>und</strong> -therapie an <strong>de</strong>r Uni Dortm<strong>und</strong>,<br />
Doktorandin <strong>und</strong> wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin im Projekt „Studie zur<br />
Entwicklung von Bewegung, Spiel <strong>und</strong><br />
Sport in <strong>de</strong>r Ganztagsschule“ am<br />
Institut <strong>für</strong> Sportwissenschaft <strong>und</strong><br />
Motologie <strong>de</strong>r Universität Marburg.<br />
Einsatz motodiagnostischer Verfahren<br />
<strong>für</strong> Jugendliche im Kontext <strong>de</strong>r klinischen<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie,<br />
basierend auf <strong>de</strong>n Ergebnissen <strong>de</strong>r<br />
folgen<strong>de</strong>n Umfrage.<br />
Bewegungsdiagnostische<br />
Verfahren in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendpsychiatrie<br />
In <strong>de</strong>n Jahren 2003/04 wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r<br />
Klinik <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie<br />
<strong>und</strong> Psychotherapie am Universitätsklinikum<br />
Hamburg-Eppendorf eine<br />
Erhebung zum Thema „Einsatz von<br />
bewegungsdiagnostischen Verfahren in<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie in<br />
Deutschland“ durchgeführt (Welsche et<br />
al. 2005). Der teilstrukturierte Fragebogen<br />
beinhaltete Fragen zu <strong>de</strong>n Rahmenbedingungen<br />
<strong>de</strong>r Klinik sowie Fragen<br />
zum Einsatz von strukturierten bewegungsdiagnostischen<br />
Verfahren.<br />
Darüber hinaus wur<strong>de</strong> die Qualifikation<br />
<strong>de</strong>r bewegungsdiagnostisch tätigen<br />
Mitarbeiter erfragt, um einen möglichen<br />
Zusammenhang zwischen <strong>de</strong>m<br />
Einsatz bestimmter Verfahren <strong>und</strong> <strong>de</strong>m<br />
Ausbildungsweg <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Therapeuten o<strong>de</strong>r Mitarbeiter untersuchen<br />
zu können. Durch diese Erhebung<br />
sollte ein Überblick über vorhan<strong>de</strong>ne<br />
Verfahren, die in <strong>de</strong>r klinisch-bewegungsdiagnostischen<br />
Arbeit angewen<strong>de</strong>t<br />
wer<strong>de</strong>n, geschaffen wer<strong>de</strong>n. Der<br />
Dr. med. Georg Romer<br />
Jahrgang 1963, stellvertreten<strong>de</strong>r<br />
Direktor <strong>de</strong>r Klinik <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendpsychiatrie <strong>und</strong> Psychotherapie,<br />
Universitätsklinikum Hamburg-<br />
Eppendorf. Psychoanalytischer Paar-<br />
<strong>und</strong> Familientherapeut. Forschungsschwerpunkte:<br />
Versorgungsforschung,<br />
Kin<strong>de</strong>r körperlich kranker Eltern,<br />
operationalisierte psychodynamische<br />
Diagnostik im Kin<strong>de</strong>s- <strong>und</strong> Jugendalter.<br />
95
96<br />
„Und wer sieht uns?“ – Bewegungsdiagnostik <strong>für</strong> Jugendliche<br />
Standardisierte Test- <strong>und</strong> Beobachtungsverfahren zur Überprüfung von Wahrnehmung <strong>und</strong> Motorik<br />
Körperkoordinationstest <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r KTK (Schilling, F./Kiphard, E. J. 1974)<br />
Trampolin-Koordinationstest TKT (Kiphard, E. J. 1980a)<br />
Punktiertest <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r PKT (Kiphard, E. J. 1980b)<br />
Motoriktest <strong>für</strong> 4–6-jährige Kin<strong>de</strong>r MOT 4-6 (Zimmer, R./Volkamer, M. 1987)<br />
Hand Dominanz Test HDT (Steingrüber, H. J./ Lienerst, G. A. 1976)<br />
Tübinger Neuropsychologische Untersuchungsreihe <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r TÜKI (Deegener et al. 1992)<br />
Test <strong>de</strong>r motorischen Entwicklung FTM (Frostig, M. 1985)<br />
Graphomotorische Testbatterie GMT (Rudolf, H. 1986)<br />
Motometrische Rostock-Oseretzky-Skalen ROS (Kurth, E. 1985)<br />
Southern California Sensory Integration SCI (Ayres, A. J. 1980)<br />
Entwicklungstest 6 Monate bis 6 Jahre ET 6-6 (Petermann, F./Stein, I. A. 2000)<br />
Wiener Entwicklungstest WET (Kastner-Koller, U./Deimann, P. 1998)<br />
Leistungsdominanz Test LDT (Schilling, F. 1976b)<br />
Lincoln-Oseretzky-Skalen LOS (Eggert, D. 1971)<br />
Developmental Test of Visual Perception – Adolescents & Adults DTVP-2 (Reynolds et al. 2002)<br />
Developmental Test of Visual Perception DTVP-A (Hammill, D. D. et al. 1993)<br />
Forstig Entwicklungstest <strong>de</strong>r visuellen Wahrnehmung FEW (Lockowandt, O. 2000)<br />
Diagnostisches Inventar Auditiver Alltagssituationen DIAS (Eggert, D./Thomas, P. 1992)<br />
Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen DITKA (Eggert, D./Wegner-Blesin, N. 2000)<br />
Raum-Zeit-Inventar RZI (Eggert, D./Bertrand, L. 2002)<br />
Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen DMB (Eggert, D. 1996)<br />
Movement Assessment Battery for Children M-ABC (Hen<strong>de</strong>rson, S./Sudgen, D. 1992<br />
HamMotScreen (Göbel, H./Panten, D. 2002)<br />
Sensorische Integration (u. a. Kesper, G./Hottinger, C. 2002)<br />
Kiphard Entwicklungsgitter (Kiphard, E. J. 2000)<br />
Denver Entwicklungsskalen (Flehmig. I. et al. 1973)<br />
Sportwissenschaftliche Verfahren (u. a. Bös, K. 2001)<br />
Standardisierte Beobachtung von Bewegungsqualitäten <strong>und</strong> Bewegungsverhalten<br />
Laban Bewegungsanalyse LMA (Laban, R. 1988)<br />
Checkliste motorischer Verhaltensweisen CMV (Schilling, F. 1976a)<br />
Löwener Beobachtungsskala<br />
Fragebögen zum Körperkonzept <strong>und</strong> Körperbild<br />
LOVIPT (Simons, J. et al. 1989)<br />
Body Attitu<strong>de</strong> Test BAT (Probst, M. et al 1990)<br />
Fragebogen zum Körperkonzept FBK-20 (Clement, U./Löwe, B. 1996)<br />
Frankfurter Körperkonzept Skalen FKKS (Deusinger, I. M. 1998)<br />
r Abb. 2: Kategorisierung <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Fragebogenerhebung benannten Verfahren <strong>und</strong> Metho<strong>de</strong>n (nach Welsche et al 2005).<br />
Fragebogen wur<strong>de</strong> an die Bewegungstherapeuten<br />
in insgesamt 143 Kliniken<br />
in Deutschland verschickt <strong>und</strong> mit einer<br />
Beteiligungsrate von 62,2% angenommen.<br />
Die Ergebnisse dieser Erhebung<br />
bestätigen die Einschätzung, dass eine<br />
<strong>de</strong>utliche Mehrzahl <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r klinischen<br />
Praxis eingesetzten bewegungsdiagnostischen<br />
Verfahren ihren Schwerpunkt<br />
im Bereich <strong>de</strong>r quantitativen Überprüfung<br />
basismotorischer Kompetenzen<br />
<strong>und</strong> Wahrnehmungsleistungen hat.<br />
Verfahren, die Bewegungsverhalten,<br />
Bewegungsqualitäten sowie Beziehungsgestaltung<br />
zum eigenen Körper<br />
abbil<strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utlich weniger<br />
häufig eingesetzt. In Abbildung 2 sind<br />
die in <strong>de</strong>r Fragebogenauswertung<br />
benannten standardisierten Verfahren<br />
(n=34) abgebil<strong>de</strong>t <strong>und</strong> in drei Kategorien<br />
eingeteilt:<br />
a) Testverfahren zur Überprüfung von<br />
Wahrnehmungsleistungen <strong>und</strong><br />
motorischen Basiskompetenzen,<br />
b) Bewegungsbeobachtungsverfahren<br />
zu Bewegungsverhalten <strong>und</strong><br />
Bewegungsqualitäten,
c) Fragebögen zur Erhebung <strong>de</strong>s<br />
Körperbil<strong>de</strong>s <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Körperkonzeptes.<br />
Die Dominanz <strong>de</strong>r standardisierten<br />
Verfahren zur Erhebung von Wahrnehmungsleistungen<br />
<strong>und</strong> Basiskompetenzen<br />
wird mit 27 von 34 genannten<br />
Ansätzen <strong>de</strong>utlich. 3 <strong>de</strong>r 34 benannten<br />
bewegungsdiagnostischen Verfahren<br />
sind standardisierte Bewegungsbeobachtungskonzepte,<br />
die nicht rein<br />
motorische Abläufe <strong>und</strong> Auffälligkeiten<br />
untersuchen, son<strong>de</strong>rn Bewegungsverhalten<br />
<strong>und</strong> Bewegungsqualitäten<br />
qualitativ erfassen, beschreiben <strong>und</strong><br />
kategorisieren. Weitere 3 Verfahren<br />
wer<strong>de</strong>n eingesetzt, um Informationen<br />
zum Körperbild <strong>und</strong> Körpererleben <strong>de</strong>s<br />
Patienten durch self-rating Fragebögen<br />
zu erheben. Somit sind Verfahren zur<br />
Erfassung <strong>de</strong>s allgemeinen Bewegungsverhaltens,<br />
<strong>de</strong>r individuellen Bewegungsqualitäten<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Körperkonzeptes,<br />
also Bereiche, die eher über<br />
qualitative Beobachtungen <strong>und</strong><br />
Selbstauskünfte zu erfassen sind, in <strong>de</strong>r<br />
Praxis tatsächlich weniger gebräuchlich.<br />
Ein Überblick zum Altersspektrum<br />
<strong>de</strong>r benannten diagnostischen Metho<strong>de</strong>n<br />
zeigt zu<strong>de</strong>m, dass die Mehrzahl<br />
aller Verfahren <strong>für</strong> <strong>de</strong>n bewegungsdiagnostischen<br />
Einsatz bei Klein- o<strong>de</strong>r<br />
Schulkin<strong>de</strong>rn konzipiert sind. Nur 8 von<br />
34 eignen sich <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Einsatz in <strong>de</strong>r<br />
Altersgruppe <strong>de</strong>r Jugendlichen bzw.<br />
jungen Erwachsenen (ab 14 Jahren).<br />
Wie vermutet, wird eine „Lücke“ in <strong>de</strong>r<br />
bewegungsdiagnostischen Versorgung<br />
jugendlicher Patienten <strong>de</strong>utlich, die sich<br />
in <strong>de</strong>m formulierten Bedarf an Verfahren<br />
<strong>für</strong> Jugendliche von 44% aller<br />
Kolleginnen bestätigt. In <strong>de</strong>r Auswertung<br />
<strong>de</strong>r Ergebnisse zeigt sich, dass nur<br />
einige wenige Ansätze existieren <strong>und</strong><br />
vereinzelt genutzt wer<strong>de</strong>n, die <strong>für</strong><br />
Jugendliche einsetzbar sind, die<br />
• durch Beobachtung das Bewegungsverhalten<br />
<strong>und</strong> Bewegungsqualitäten<br />
erfassen,<br />
• Wahrnehmungsleistungen jugendlicher<br />
Patienten erheben,<br />
• o<strong>de</strong>r mit Hilfe von Fragebögen<br />
Auskunft über das Körperbild <strong>und</strong><br />
Körperkonzept <strong>de</strong>s Patienten geben<br />
können.<br />
Die Existenz dieser Verfahren scheint<br />
wenig verbreitet, wie anhand <strong>de</strong>r<br />
Aufzählung <strong>und</strong> Nutzungsfrequenz<br />
bewegungsdiagnostischer Ansätze in<br />
Abbildung 3 <strong>de</strong>utlich wird.<br />
Welche Verfahren wer<strong>de</strong>n von wie viel KJP (n=81) in Deutschland genutzt?<br />
Körper-Koordinationstest <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r KTK 62 x<br />
Motoriktest <strong>für</strong> 4–6-jährige Kin<strong>de</strong>r MOT 4-6 43 x<br />
„Freie Bewegungsbeobachtung“ 37 x<br />
Trampolin Koordinationstest TKT 21 x<br />
Lincoln-Oseretzky-Skala LOS 16 x<br />
Sensorische Integration SI 16 x<br />
Frostigs Entwicklungstest <strong>de</strong>r visuellen<br />
Wahrnehmung<br />
FEW 9 x<br />
Laban Bewegungsanalyse LMA 7 x<br />
Diagnostisches Inventar motorischer<br />
Basiskompetenzen<br />
DMB 7 x<br />
Kiphard Entwicklungsgitter 5 x<br />
Rostock-Oseretzky-Skalen ROS 3 x<br />
Denver Entwicklungsskalen 3 x<br />
Punktiertest <strong>für</strong> Kin<strong>de</strong>r PKT 3 x<br />
r Abb. 3: Darstellung <strong>de</strong>r Nutzung bewegungstherapeutischer Verfahren in <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendpsychiatrien (nach Welsche et al. 2005)<br />
Bewegungsdiagnostische Verfahren <strong>für</strong><br />
das Jugendalter<br />
Eingehend auf <strong>de</strong>n offensichtlichen<br />
Bedarf an Austausch zu <strong>für</strong> Jugendliche<br />
geeignete bewegungsdiagnostische Metho<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n<br />
Absätzen die aus <strong>de</strong>n Fragebogen<br />
hervorgehen<strong>de</strong>n bewegungsdiagnostischen<br />
Ansätze vorgestellt sowie <strong>de</strong>ren<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten diskutiert.<br />
Metho<strong>de</strong>n zur Überprüfung von<br />
motorisch-koordinativen Parametern<br />
bei Jugendlichen wer<strong>de</strong>n in dieser<br />
Vorstellung nicht berücksichtigt. Ein<br />
Überblick über verschie<strong>de</strong>ne sportpädagogische<br />
Metho<strong>de</strong>n wird bei Bös<br />
gegeben (2001). Darüber hinaus bei<br />
Jugendlichen auch <strong>de</strong>r Trampolin-<br />
Koordinationstest eingesetzt wer<strong>de</strong>n<br />
(vgl. Kiphard 1980, 78), um motorischfunktionale<br />
Bewegungsauffälligkeiten<br />
zu erfassen.<br />
Bewegungsbeobachtung<br />
<strong>und</strong> Analyse<br />
Verfahren zur Beobachtung von<br />
Bewegungsqualitäten <strong>und</strong> Bewegungsverhalten<br />
Wie Hölter es im Kontext <strong>de</strong>r Bewegungsdiagnostik<br />
im Erwachsenenalter<br />
formuliert, ist das Verständnis von<br />
Bewegungsverhalten <strong>und</strong> Bewegungsbild<br />
als Ausdruck ein wichtiger bewegungsdiagnostischer<br />
Blickwinkel, <strong>de</strong>nn<br />
„Persönlichkeit, also auch Persönlichkeitsabweichungen,<br />
(schlagen sich) in<br />
Ausdruckserscheinungen wie in <strong>de</strong>r<br />
Gestik, <strong>de</strong>r Sprache, <strong>de</strong>r Haltung, <strong>de</strong>m<br />
Gang usw. nie<strong>de</strong>r“ (Hölter 1989, 9). Im<br />
Zentrum von diagnostischen Verfahren<br />
<strong>de</strong>r Bewegungsbeobachtung steht somit<br />
die Frage: Wie verhält sich <strong>de</strong>r Mensch?<br />
Wie bewegt er sich? Mit welchen<br />
Qualitäten? Auf welche Art <strong>und</strong> Weise?<br />
Bei <strong>de</strong>n hier vorgestellten Ansätzen sind<br />
sowohl Verfahren zu fin<strong>de</strong>n, die sich auf<br />
rein bewegungsbezogene Parameter<br />
• Laban Bewegungsanalyse (LMA)<br />
• Löwener Beobachtungsskala (LOVIPT)<br />
• Checkliste motorischer Verhaltensweisen (CMV)<br />
Fragebögen • Frankfurter Körperkonzept Skala (FKKS)<br />
• Fragebogen zum Körperbild (FBK-20)<br />
• Body Attitu<strong>de</strong> Test (BAT)<br />
Wahrnehmungstest • Developmental Test for Visual Perception (DTVP-A)<br />
97
98<br />
„Und wer sieht uns?“ – Bewegungsdiagnostik <strong>für</strong> Jugendliche<br />
beschränken, als auch Metho<strong>de</strong>n, die<br />
zusätzliche Beobachtungskriterien <strong>de</strong>s<br />
Verhaltensrepertoires erfassen.<br />
Die Laban Bewegungsanalyse (LMA) ist<br />
ein Gr<strong>und</strong>lagenkonzept <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Bewegung, welches von <strong>de</strong>m<br />
Bewegungstheoretiker Rudolf von<br />
Laban entwickelt wur<strong>de</strong> (Laban 1988).<br />
Labans Konzept <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Bewegung umfasst die Kategorien<br />
Antrieb, Form, Raum, Körper <strong>und</strong><br />
Beziehung (vgl. Abb. 4). Die Kategorie<br />
Antrieb unterteilt sich in die bipolaren<br />
aufgebauten Bereiche: Kraft, Fluss, Zeit,<br />
Raum <strong>und</strong> ihre unterschiedlichen<br />
Kombinationsmöglichkeiten. In <strong>de</strong>r<br />
Kategorie Form wird die Körperform<br />
<strong>de</strong>s Menschen beschrieben. Zu<strong>de</strong>m<br />
können die Qualitäten <strong>de</strong>r Formverän<strong>de</strong>rung<br />
<strong>und</strong> verschie<strong>de</strong>ne Möglichkeiten<br />
<strong>de</strong>r Formverän<strong>de</strong>rungen erfasst wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Kategorie Raum beschäftigt sich<br />
schwerpunktmäßig mit ein- bis<br />
dreidimensionalen Bewegungsmöglichkeiten<br />
<strong>de</strong>s Menschen im Raum,<br />
während die Kategorie Körper u. a.<br />
Körperteile bestimmt, Körperverbindungen<br />
<strong>und</strong> die Initiierung <strong>de</strong>r Bewegung<br />
analysiert. Die Kategorie Beziehung<br />
wur<strong>de</strong> erst in <strong>de</strong>n letzten Jahren<br />
zu einem Bestandteil <strong>de</strong>r LMA. Hier<br />
kann die Beziehung zur materialen o<strong>de</strong>r<br />
personalen Umwelt sowie einzelner<br />
Körperteile miteinan<strong>de</strong>r beschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Laban Bewegungsanalyse wird in<br />
verschie<strong>de</strong>nen Ausbildungswegen<br />
gelehrt. In <strong>de</strong>n internationalen aka<strong>de</strong>-<br />
∞ ein-<br />
∞ zwei-<br />
∞ drei-dimensionale<br />
Bewegungen im Raum<br />
Konzept <strong>de</strong>r Raum Harmonie<br />
Antrieb<br />
Raum<br />
∞ Zeit: plötzlich – verlangsamt<br />
∞ Fluss: geb<strong>und</strong>en – frei<br />
∞ Kraft: kraftvoll – leicht<br />
∞ Raum: direkt – indirekt<br />
sowie 2er <strong>und</strong> 3er-Kombinationen Laban<br />
Bewegungs-<br />
Analyse<br />
Beziehung<br />
z. B.<br />
∞ von Gewahr sein<br />
∞ Über Berührung<br />
∞ Bis Verschlingung<br />
r Abb. 4: Parameter <strong>de</strong>r Laban Bewegungsanalyse<br />
mischen <strong>und</strong> institutionellen Ausbildungsgängen<br />
<strong>de</strong>r Tanz- <strong>und</strong> Bewegungstherapie<br />
ist die LMA als<br />
analytisches Tool Bestandteil <strong>de</strong>s<br />
Ausbildungscurriculums. Neben<br />
privaten Ausbildungsinstituten, welche<br />
zum Certified Movement Analyst (CMA)<br />
ausbil<strong>de</strong>n, existiert in England <strong>und</strong><br />
Amerika seit einigen Jahren die<br />
Möglichkeit, die LMA im universitären<br />
Kontext zu studieren. Um die Metho<strong>de</strong><br />
in <strong>de</strong>r Praxis einsetzen zu können,<br />
empfiehlt sich zumin<strong>de</strong>st eine Kurz-<br />
Fortbildung. Diese wird in verschie<strong>de</strong>nen<br />
Tanz- <strong>und</strong> Bewegungszentren in<br />
Deutschland angeboten (www.eurolab.<br />
<strong>de</strong>).<br />
Beson<strong>de</strong>rheit:<br />
Die LMA ist eine in ihrer Art einzigartige<br />
Basislehre <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Bewegung. Sie bietet eine Möglichkeit,<br />
die Bewegung <strong>de</strong>s Menschen in ihrer<br />
Komplexität <strong>de</strong>tailliert <strong>und</strong> wertfrei zu<br />
beschreiben <strong>und</strong> so das individuelle<br />
Bewegungsbild <strong>de</strong>s Patienten zu<br />
erfassen. Ressourcen, Einschränkungen,<br />
<strong>und</strong> Defizite bil<strong>de</strong>n sich ab <strong>und</strong> wer<strong>de</strong>n<br />
im tanz- <strong>und</strong> bewegungstherapeutischen<br />
Setting als Be<strong>de</strong>utungsphänomen<br />
(SEEWALD 1993) verstan<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
in <strong>de</strong>n Kontext <strong>de</strong>r individuellen<br />
Krankheitsgeschichte gesetzt. Die LMA<br />
kann sowohl zur Evaluation <strong>de</strong>s<br />
Behandlungsverlaufes im Sinne einer<br />
Anfangs- <strong>und</strong> Abschlussdiagnostik (vgl.<br />
Lausberg 1998), als auch als prozessdiagnostisches<br />
Tool eingesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Form<br />
∞ Formqualitäten<br />
(z. B.<br />
öffen – schliessen<br />
steigen – sinken)<br />
∞ Wege <strong>de</strong>r Formverän<strong>de</strong>rung<br />
Formfluss, mo<strong>de</strong>llieren,<br />
zielgerichtet bogen- o. pfeilförmig<br />
∞ Stille Formen<br />
Körper<br />
z. B.<br />
∞ Körperteile<br />
∞ Körperverbindungen<br />
∞ Initiierung<br />
∞ Bartenieff<br />
F<strong>und</strong>amentals<br />
Zu<strong>de</strong>m wird durch die Bestimmung <strong>de</strong>r<br />
Ausgangslage (Hölter 2000, 103) eine<br />
f<strong>und</strong>ierte Indikationsstellung <strong>und</strong><br />
Therapieplanung erleichtert. An <strong>de</strong>n<br />
erfassten Bewegungscharakteristika <strong>de</strong>s<br />
Patienten ansetzend, können dann<br />
durch individuelle Bewegungsangebote<br />
neue Entwicklungsschritte auf emotional-psychischer<br />
Ebene eingeleitet<br />
wer<strong>de</strong>n (vgl. u. a. Bartenieff/Lewis<br />
1986; Hackney 2002; Rollwagen 1994).<br />
Die Löwener Beobachtungsskala<br />
(LOVIPT) stellt eine qualitative Verlaufsbeobachtung<br />
dar, welche <strong>für</strong> <strong>de</strong>n<br />
Einsatz in <strong>de</strong>r psychomotorischen<br />
Therapie im Kontext <strong>de</strong>r Erwachsenenpsychiatrie<br />
entwickelt wur<strong>de</strong>, allerdings<br />
auch im kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> jugendpsychiatrischen<br />
Setting eingesetzt wer<strong>de</strong>n<br />
kann (vgl. Simon J. et al. 1989, Welsche/Romer<br />
2005). Über ein empirisches<br />
Auswahlverfahren wur<strong>de</strong>n neun<br />
relevante Beobachtungskriterien<br />
ausgewählt, welche <strong>de</strong>n Voraussetzungen<br />
nach Bezug zu psychologischen<br />
Aspekten, Beobachtbarkeit <strong>und</strong><br />
Beeinflussbarkeit innerhalb <strong>de</strong>r Therapie<br />
sowie Relevanz <strong>für</strong> die klinische Praxis<br />
haben: <strong>de</strong>r Grad <strong>de</strong>r emotionalen<br />
Beziehung, <strong>de</strong>r Grad <strong>de</strong>r Selbstsicherheit,<br />
<strong>de</strong>r Grad <strong>de</strong>r Aktivität, <strong>de</strong>r Grad<br />
<strong>de</strong>r Entspanntheit, <strong>de</strong>r Grad <strong>de</strong>r<br />
Bewegungskontrolle, <strong>de</strong>r Grad <strong>de</strong>s<br />
situativen Interesses, <strong>de</strong>r Grad <strong>de</strong>r<br />
Expressivität beim Bewegen, <strong>de</strong>r Grad<br />
<strong>de</strong>r verbalen Kommunikation <strong>und</strong> das<br />
Vermögen zur Anpassung <strong>und</strong> Selbstkontrolle.<br />
Diese Kriterien erfassen<br />
psychische <strong>und</strong> motorische Aspekte <strong>de</strong>s<br />
Verhaltensrepertoires im Gruppengeschehen<br />
<strong>und</strong> setzen an <strong>de</strong>n Problembereichen<br />
psychiatrisch behandlungsbedürftiger<br />
Patienten an. Auf einer<br />
7er-Skala, welche beim Nullwert das<br />
„normale“ (<strong>de</strong>r Situation angepasste)<br />
Verhalten angibt, wer<strong>de</strong>n die Abweichungen<br />
im Verhalten bis zu <strong>de</strong>n<br />
Extremen bei –3/+3 beschrieben<br />
(s. Abb. 5).<br />
Um eine möglichst objektive Verhaltensbeobachtung<br />
zu erlangen wird<br />
innerhalb <strong>de</strong>r einzelnen Beobachtungskriterien<br />
in die LOVIPT-Skalen A <strong>und</strong> S<br />
unterteilt. Im LOVIPT-A wer<strong>de</strong>n in<br />
kurzer Form ein<strong>de</strong>utige Adjektive<br />
benannt, mit welchen die Mittelwerte<br />
+2/-2 <strong>de</strong>r jeweiligen Beobachtungskategorie<br />
umschrieben wer<strong>de</strong>n (s. Abb. 6).<br />
Im LOVIPT-S wer<strong>de</strong>n unterschiedliche<br />
Beispiele, Umschreibungen <strong>und</strong>
Grad <strong>de</strong>r emotionalen Beziehung<br />
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3<br />
sehr hohe eine hohe eine leichte emotional nur wenig kaum emotio- so gut wie<br />
emotionale emotionale emotionale angemessenes emotionale nale Bindung keine emotio-<br />
Bindung Bindung Bindung Kontaktverhalten<br />
Bindung<br />
nale Bindung<br />
r Abbildung 5: Beispiel <strong>de</strong>r 7er-Skala am Beobachtungskriterium Grad <strong>de</strong>r emotionalen Beziehung<br />
Möglichkeiten zu konkreten Verhaltensweisen<br />
<strong>für</strong> die Mittelwerte –2/+2 <strong>de</strong>r<br />
jeweiligen Beobachtungskategorie<br />
vorgegeben, um die Bandbreite <strong>de</strong>r<br />
verschie<strong>de</strong>nen Verhaltensmöglichkeiten<br />
aufzuzeigen <strong>und</strong> so <strong>de</strong>m Beobachter<br />
das Verständnis <strong>de</strong>r Kriterien sowie die<br />
Einglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s beobachteten<br />
Verhaltens zu erleichtern. Die Beobachtungsskala<br />
ist nach einer kurzen<br />
Einarbeitungsphase ökonomisch zur<br />
Dokumentation von Gruppenaktivitäten<br />
einzusetzen. Neben einer allgemeinen<br />
guten Beobachtungsfähigkeit <strong>und</strong><br />
Vertrautheit mit <strong>de</strong>n einzelnen Beobachtungskriterien<br />
bedarf es keiner<br />
beson<strong>de</strong>ren Voraussetzungen, um sie<br />
zur Dokumentation <strong>und</strong> prozessdiagnostischen<br />
Einschätzung einsetzen zu<br />
können.<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
Die LOVIPT-Skalen lassen sich leicht<br />
<strong>und</strong> ökonomisch in die Dokumentation<br />
<strong>de</strong>r bewegungstherapeutischen Verläufe<br />
integrieren <strong>und</strong> können darüber hinaus<br />
prozessdiagnostisch genutzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die verschie<strong>de</strong>nen Kriterien sind auch<br />
<strong>für</strong> „Nicht-Bewegungsmenschen“ gut<br />
verständlich. Dies erleichtert <strong>de</strong>n<br />
Austausch mit an<strong>de</strong>ren Berufsgruppen<br />
<strong>und</strong> die Integration <strong>de</strong>r Bewegungsdiagnostik<br />
in das klinische Setting.<br />
Die Checkliste motorischer Verhaltensweisen<br />
(CMV) wur<strong>de</strong> 1975 von Schilling<br />
(1976) entwickelt <strong>und</strong> kann <strong>für</strong><br />
Erwachsene <strong>und</strong> damit auch <strong>für</strong><br />
Jugendliche eingesetzt wer<strong>de</strong>n (vgl.<br />
Hölter 2000, 109), obwohl sie ursprünglich<br />
zur Beobachtung <strong>de</strong>s Bewegungsverhaltens<br />
bei Kin<strong>de</strong>rn zwischen 6 <strong>und</strong><br />
11 Jahren konzipiert wur<strong>de</strong>. Dieses<br />
motoskopische Verfahren besteht aus<br />
78 Adjektiven zur Beschreibung <strong>de</strong>s<br />
Bewegungsverhaltens, die von <strong>de</strong>m<br />
Beobachter als zutreffend o<strong>de</strong>r nicht<br />
zutreffend eingeschätzt wer<strong>de</strong>n. Diese<br />
Checkliste kann neben Bewegungstherapeuten<br />
auch von Erziehern, Lehrern,<br />
Psychologen, Ärzten durchgeführt<br />
wer<strong>de</strong>n, wenn <strong>de</strong>r Patient über längere<br />
Zeit in Bewegung erlebt wur<strong>de</strong>. Anhand<br />
von statistischen Analysen wur<strong>de</strong>n die<br />
78 Items in acht Skalen geglie<strong>de</strong>rt,<br />
wobei fünf Skalen auffällige Bewegungsmerkmale<br />
beschreiben (s. Abb. 7).<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
Diese Checkliste wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Au-<br />
toren bisher nicht eingesetzt, <strong>de</strong>shalb<br />
kann zu dieser Metho<strong>de</strong> keine Stellung<br />
bezogen wer<strong>de</strong>n.<br />
Fragebögen<br />
Der Einsatz von Fragebögen als so<br />
genannte „Ergebnisdiagnostik“ (Hölter<br />
2000, 103 f) ermöglicht die Untersuchung<br />
<strong>de</strong>s individuellen Körper- <strong>und</strong><br />
Bewegungserlebens <strong>de</strong>s Patienten, um<br />
es in Verbindung zur Krankheitsge-<br />
LOVIPT-A Die emotionale Beziehung<br />
- 2: Bei Beobachtungen in <strong>de</strong>r PMT<br />
kann ein Kontaktverhalten, dass kaum<br />
emotionale Bindungen erkennen lässt<br />
als apathisch, gehemmt, zurückhaltend,<br />
abweisend, unzugänglich, als zu<br />
förmlich o<strong>de</strong>r zu steif beschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
schichte zu verstehen <strong>und</strong> Ansatzpunkte<br />
<strong>für</strong> therapeutische Interventionen<br />
zu entwickeln. In <strong>de</strong>r Erhebung<br />
wur<strong>de</strong>n drei Fragebögen benannt, die<br />
zur Erfassung von Körperkonzept,<br />
Körperbild <strong>und</strong> Körperschema eingesetzt<br />
wer<strong>de</strong>n 2 .<br />
Die Frankfurter Körperkonzept Skala<br />
(FKKS) dient <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>de</strong>s auf<br />
<strong>de</strong>n Körper bezogenen Bereichs <strong>de</strong>s<br />
Selbstkonzeptes <strong>de</strong>s Jugendlichen/<br />
Erwachsenen <strong>und</strong> kann ab 12 Jahren<br />
eingesetzt wer<strong>de</strong>n. Auf einer sechsstufigen<br />
Antwortskala von trifft sehr zu<br />
bis trifft gar nicht zu wer<strong>de</strong>n 64 Items<br />
gestellt, die <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n neun Skalen<br />
2 Der Fragebogen zur Beurteilung <strong>de</strong>s eigenen<br />
Körpers (FbeK) von B. Strauß <strong>und</strong> H. Richter-<br />
Appelt (1996) wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Fragebogenerhebung<br />
nicht benannt, ist allerdings auch <strong>für</strong><br />
Jugendliche einsetzbar.<br />
+ 2: Ein Kontaktverhalten, das emotional<br />
überbin<strong>de</strong>nd ist, kann als schleimig,<br />
einschmeichelnd, gekünstelt, übertrieben<br />
geziert, aufdringlich, klammernd,<br />
als zu familiär <strong>und</strong> zu bemutternd<br />
beschrieben wer<strong>de</strong>n.<br />
r Abbildung 6: Umschreibung <strong>de</strong>r Mittelwerte anhand <strong>de</strong>s Beobachtungskriteriums<br />
„Grad <strong>de</strong>r emotionalen Beziehung“<br />
Beobachtungsskalen <strong>de</strong>r Checkliste motorischer Verhaltensweisen<br />
Skala 1: Freudige Spontan<strong>motorik</strong> – z. B. lebhaft, aktiv, bewegungsfreudig<br />
Skala 2: Beherrschte Motorik – z. B. besonnen, bedächtig, konzentriert<br />
Skala 3: Anmutige Motorik – z. B. leicht, elegant, graziös<br />
Skala 4: Schwerfällige Motorik – z. B. träge, mü<strong>de</strong>, bequem<br />
Skala 5: Enthemmte Motorik – z. B. unkonzentriert, zappelig, ablenkbar<br />
Skala 6: Gehemmte Motorik – z. B. tolpatschig, gehemmt, ungeschickt<br />
Skala 7: Überschießen<strong>de</strong> Motorik – z. B. hastig, übereilig, vorschnell<br />
Skala 8: Eckige Motorik – z. B. abgehackt, ruckartig, linkisch<br />
r Abbildung 7: Beobachtungsskalen <strong>de</strong>r Checkliste motorischer Verhaltensweisen<br />
99
100<br />
„Und wer sieht uns?“ – Bewegungsdiagnostik <strong>für</strong> Jugendliche<br />
untergeordnet sind: Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><br />
körperliches Befin<strong>de</strong>n, Pflege <strong>de</strong>s<br />
Körpers, Körperliche Effizienz, Körperkontakt,<br />
Sexualität, Selbstakzeptanz <strong>de</strong>s<br />
Körpers, Akzeptanz <strong>de</strong>s Körpers durch<br />
An<strong>de</strong>re, Aspekte <strong>de</strong>r äußeren Erscheinung<br />
<strong>und</strong> Dissimilatorische Körperprozesse<br />
(Körpergeruch). Die Durchführungsdauer<br />
liegt zwischen 15 <strong>und</strong> 25<br />
Minuten (Deusinger 1998).<br />
Der Einsatz <strong>de</strong>s Fragebogens zum<br />
Körperbild (FKB-20) wird ab 16 Jahren<br />
empfohlen (Clement/Löwe 1996). Dieser<br />
Fragebogen wird zur Diagnose von<br />
Körperbildstörungen <strong>und</strong> Beeinträchtigungen<br />
<strong>de</strong>s Körperbil<strong>de</strong>s eingesetzt. Er<br />
misst in 20 Items auf einer 5 stufigen<br />
Antwortskala von trifft nicht zu bis zu<br />
trifft völlig zu zwei unabhängige<br />
Dimensionen <strong>de</strong>s Körperbil<strong>de</strong>s. Mit <strong>de</strong>r<br />
Skala „Ablehnen<strong>de</strong> Körperbewertung“<br />
(AKB) wird die äußere Körpererscheinung<br />
sowie das Wohlbefin<strong>de</strong>n im<br />
eigenen Körper beurteilt <strong>und</strong> beschrieben<br />
(z. B. Ich fühle mich in meinem<br />
Körper zu Hause). Die Skala „Vitale<br />
Körperdynamik“ (VKD) thematisiert <strong>de</strong>n<br />
bewegungsbezogenen Aspekt <strong>de</strong>s<br />
Körperbil<strong>de</strong>s bezüglich <strong>de</strong>r Einschätzung<br />
<strong>und</strong> Wahrnehmung von Kraft,<br />
Fitness <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit (z. B. Insgesamt<br />
empfin<strong>de</strong> ich mich als stark <strong>und</strong> robust).<br />
Die Durchführungsdauer liegt bei ca. 6<br />
bis 8 Minuten.<br />
Der Body Attitu<strong>de</strong> Test (BAT) stellt einen<br />
weiteren Fragebogen dar, welcher <strong>für</strong><br />
<strong>de</strong>n Einsatz bei Patienten mit Essstörungen,<br />
insbeson<strong>de</strong>re Anorexie,<br />
entwickelt wur<strong>de</strong> (Probst et al. 1990).<br />
In diesem Fragebogen wird in 20 Items<br />
die negative Einschätzung <strong>de</strong>s Körperumfanges<br />
(z. B. Meine Hüften erscheinen<br />
mir als zu breit), die allgemeine<br />
Unzufrie<strong>de</strong>nheit mit <strong>de</strong>m Körper<br />
(z. B. Wenn ich mich mit Gleichaltrigen<br />
vergleiche, bin ich mit meinem Körper<br />
unzufrie<strong>de</strong>n) sowie <strong>de</strong>r Grad <strong>de</strong>r<br />
Vertrautheit mit <strong>de</strong>m eigenen Körper<br />
(z. B. Mein Körper scheint mir zu<br />
gehören) gemessen. Die Durchführungsdauer<br />
beträgt ca. 10 Minuten.<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten aller Fragebögen:<br />
Der Einsatz von Fragebögen <strong>für</strong><br />
Jugendliche hat sich in <strong>de</strong>r Praxis als<br />
sehr hilfreich <strong>und</strong> praktikabel erwiesen,<br />
vor allem wenn im Einzelsetting<br />
gearbeitet wird. Durch die Bearbeitung<br />
<strong>de</strong>r Fragebögen wird <strong>de</strong>n jugendlichen<br />
Patienten die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit<br />
Problemen auf <strong>de</strong>r Körper- <strong>und</strong><br />
Bewegungsebene, die häufig schambesetzt<br />
ist, erleichtert. Zielformulierungen<br />
<strong>und</strong> Therapieplanung können anhand<br />
<strong>de</strong>s Fragebogens besprochen wer<strong>de</strong>n. In<br />
<strong>de</strong>r Arbeit mit Jugendlichen hat sich<br />
gezeigt, dass ein diagnostischer<br />
Erstkontakt, in welchem Probleme,<br />
Motivation <strong>und</strong> Zielvorstellungen<br />
anhand <strong>de</strong>r Fragebogenergebnisse<br />
gemeinsam besprochen <strong>und</strong> erarbeitet<br />
wer<strong>de</strong>n, sehr hilfreich <strong>für</strong> eine guten<br />
Start in die Therapie ist. Der jugendliche<br />
Patient, <strong>de</strong>r aufgr<strong>und</strong> seiner Entwicklungsphase<br />
häufig eher misstrauisch<br />
gegenüber Erwachsenen ist, wird aktiv<br />
in die Planung einbezogen, fühlt sich<br />
ernst genommen <strong>und</strong> eher als Erwachsener<br />
<strong>de</strong>nn als Kind behan<strong>de</strong>lt. Die<br />
Bearbeitung von Fragebögen setzte<br />
allerdings eine gewisse intellektuelle<br />
Fähigkeit <strong>und</strong> die Bereitschaft voraus,<br />
die Fragen zu beantworten. Bei<br />
„jungen“ Jugendlichen, Patienten mit<br />
einer Lernbehin<strong>de</strong>rung o<strong>de</strong>r auch<br />
Patienten, <strong>de</strong>ren Muttersprache nicht<br />
Deutsch ist, können Verständnisschwierigkeiten<br />
auftreten. Darüber hinaus<br />
kann <strong>de</strong>r Einsatz von Fragebögen bei<br />
Patienten, die zum Agieren neigen,<br />
problematisch sein, da die Angaben<br />
nicht unbedingt <strong>de</strong>m tatsächlichen<br />
Erleben entsprechen müssen. Bei akutpsychotischen<br />
Patienten ist die<br />
Anwendung von Fragebögen nicht<br />
ratsam (vgl. Hölter 2000).<br />
Wahrnehmungsdiagnostik<br />
In <strong>de</strong>r Erhebung wur<strong>de</strong> ein Verfahren<br />
zur Überprüfung von Wahrnehmungsleistungen<br />
benannt, das <strong>für</strong> Jugendliche<br />
<strong>und</strong> Erwachsene konzipiert wur<strong>de</strong>. Der<br />
Developmental Test for Visual Perception<br />
(DTVP-A) besteht aus einer Testbatterie<br />
mit sechs Untertests zu visumotorischen<br />
<strong>und</strong> visuellen Wahrnehmungs-<br />
leistungen. Dabei wer<strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong><br />
Fähigkeiten untersucht: Nachzeichnen,<br />
Figur-Gr<strong>und</strong>-Wahrnehmung, die<br />
Wahrnehmung räumlicher Beziehungen,<br />
Gestaltschließen, visuo-motorische<br />
Geschwindigkeit <strong>und</strong> Formkonstanz. Der<br />
Test führt zu einem differenzierten Bild<br />
<strong>de</strong>r Gesamtfähigkeit im Bereich <strong>de</strong>r<br />
visuellen Wahrnehmung <strong>und</strong> ermöglicht<br />
damit die Feststellung vom Vorhan<strong>de</strong>nsein<br />
<strong>und</strong> Ausmaß visueller Wahrnehmungsstörungen<br />
<strong>und</strong> visuo-motorischer<br />
Probleme. Der Test kann <strong>für</strong> Patienten<br />
von 11 bis 74 Jahren eingesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Durchführungsdauer beträgt etwa<br />
25 Minuten (Reynolds et al. 2002).<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten:<br />
Auch dies Verfahren wur<strong>de</strong> von<br />
<strong>de</strong>n Autoren bisher nicht eingesetzt.<br />
Allerdings stellt es in sich schon<br />
eine Beson<strong>de</strong>rheit dar, da an<strong>de</strong>re<br />
Metho<strong>de</strong>n zur Überprüfung von<br />
visuellen Wahrnehmungsleistungen<br />
bei Jugendlichen <strong>und</strong> Erwachsenen<br />
nicht bekannt sind.<br />
Ausblick<br />
In diesem Beitrag wur<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne<br />
bewegungsdiagnostische Verfahren, die<br />
<strong>für</strong> <strong>de</strong>n Einsatz im Jugendalter konzipiert<br />
o<strong>de</strong>r geeignet sind, vorgestellt.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz bleiben Jugendliche im<br />
klinisch-bewegungsdiagnostischen<br />
Setting im Vergleich zur Altersgruppe<br />
<strong>de</strong>r 6- ca. 12-jährigen Kin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utlich<br />
unterversorgt. Es liegt in <strong>de</strong>r Hand <strong>de</strong>r<br />
Bewegungstherapeuten, die mit<br />
jugendlichem Klientel arbeiten, dieser<br />
Altersgruppe nicht nur in <strong>de</strong>r praktischen<br />
<strong>und</strong> therapeutischen, son<strong>de</strong>rn<br />
auch in <strong>de</strong>r theoretischen <strong>und</strong> diagnostischen<br />
Arbeit mehr Aufmerksamkeit zu<br />
schenken, in<strong>de</strong>m I<strong>de</strong>en <strong>und</strong> Konzepte<br />
diagnostischer wie auch therapeutischer<br />
Art publiziert <strong>und</strong> damit<br />
verbreitet wer<strong>de</strong>n. Auf diese Weise kann<br />
ein offensichtlich dringend benötigter<br />
Austausch von Informationen stattfin<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> im Feld <strong>de</strong>r Bewegungstherapie<br />
kann ein „eigener“ Platz <strong>für</strong> die<br />
Bedürfnisse <strong>und</strong> Anfor<strong>de</strong>rung jugendlicher<br />
Patienten entstehen. Darüber<br />
hinaus ist die Diagnostik im klinischen<br />
Setting ein wichtiger Bestandteil <strong>de</strong>s<br />
gesamten Behandlungskonzeptes, um<br />
Indikationen zu stellen, Behandlungen<br />
zu überprüfen/überprüfen zu können<br />
<strong>und</strong> qualitätssichernd zu arbeiten.<br />
Gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r heutigen Zeit von<br />
Ökonomisierung, Controlling <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Entstehung von Leistungszentren<br />
besteht insbeson<strong>de</strong>re <strong>für</strong> unser Berufsfeld<br />
eine zunehmen<strong>de</strong> Notwendigkeit,<br />
Möglichkeiten, Inhalte <strong>und</strong> Metho<strong>de</strong>n<br />
transparenter zu machen. Qualitätssicherung<br />
ist in diesem Zusammenhang<br />
ein wichtiges Stichwort, um die<br />
Bewegungsdiagnostik <strong>und</strong> damit auch<br />
die Bewegungstherapie heute wie in<br />
Zukunft als festen Bestandteil <strong>de</strong>s
Ges<strong>und</strong>heitssystems <strong>und</strong> seiner<br />
Angebote zu verankern!<br />
Eine Literaturliste <strong>und</strong> Kurzbeschreibung<br />
<strong>de</strong>r in Abbildung 2 benannten<br />
Verfahren kann bei <strong>de</strong>n Autoren<br />
angefragt wer<strong>de</strong>n.<br />
Literatur:<br />
Bartenieff, I./Lewis, D. (1996): Body<br />
movement: coping with the<br />
environment. London: Gordon &<br />
Breach.<br />
Blos, P. (1973): Adoleszenz: Eine<br />
psychoanalytische Interpretation.<br />
Stuttgart: Klett. (Orig.:<br />
(1962): On Adolescence. A<br />
Psychoanalytic Interpretation.<br />
London: Free Press, NY u.<br />
Collier-Macmillan.<br />
Bös, K .(Hrsg.) (2001): Handbuch<br />
Motorische Tests. Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Bühler, Ch. (1921): Das Seelenleben<br />
<strong>de</strong>s Jugendlichen. Versuch einer<br />
Analyse <strong>und</strong> Theorie <strong>de</strong>r psychischen<br />
Pupertät. Jena: Fischer,<br />
Jena. 7. Auflage. Stuttgart:<br />
Fischer, 1991.<br />
Clement, U./Löwe, B. (1996):<br />
Fragebogen zum Körperbild -<br />
(FKB-20). Göttingen: Hogrefe.<br />
Deusinger, I. M. (1998): FKKS<br />
Frankfurter Körperkonzeptskalen.<br />
Göttingen: Hogrefe.<br />
Emminghaus, H. (1887): Psychische<br />
Störungen <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>salters.<br />
Tübingen: Laupp.<br />
Erikson, E. H. (1966): I<strong>de</strong>ntität <strong>und</strong><br />
Lebenszyklus. Frankfurt am<br />
Main: Fischer.<br />
Gille, G. (2002): Die Rolle <strong>de</strong>s Sports<br />
bei <strong>de</strong>r Überwindung von<br />
Entwicklungsproblemen von<br />
Mädchen in <strong>de</strong>r Pupertät. In:<br />
Praxis <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>, 27 (2),<br />
82–88.<br />
Hackney, P. (2002): Making Connections:<br />
Total Body Integration<br />
through Bartenieff F<strong>und</strong>amentals.<br />
Amsterdam: Gordon and<br />
Breach.<br />
Hammer, R./Müller, W. (2001):<br />
Jugendliche <strong>und</strong> Gewalt. In:<br />
Motorik, 24 (1), 65–72.<br />
Hölter, G. (2000): Diagnostik<br />
<strong>de</strong>s körper- <strong>und</strong> bewegungsbezogenen<br />
Erlebens <strong>und</strong><br />
Verhaltens. In: Huber, G./<br />
Schüle, K. (Hrsg.): Gr<strong>und</strong>lagen<br />
<strong>de</strong>r Sporttherapie. München:<br />
Ulstein medical, 101–112.<br />
Hölter, G. (1989): Qualitative<br />
Bewegungsanalyse in <strong>de</strong>r<br />
Motodiagnostik von psychisch<br />
kranken Erwachsenen. In:<br />
Motorik, 12 (1), 9–19.<br />
Irmischer, T./Fischer, K. (Red.)<br />
(1989): Psycho<strong>motorik</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung. Schorndorf:<br />
Hofmann.<br />
Kiphard, E. J. (1980a): Der Trampolin-Körperkoordinationstest<br />
(TKT). In: Motorik, 3 (2), 78-83.<br />
Laban, R. (1988): Die Kunst <strong>de</strong>r<br />
Bewegung. Wilhelmshaven.<br />
Lausberg, H. (1998): Does<br />
Movement Behavior Have<br />
Differential Diagnostic<br />
Potential? In: American<br />
Journal of Dance Therapy,<br />
20: 85–99.<br />
Neuhäuser, G. (1996): Motodiagnostik<br />
im Vorschulalter. In: Motorik,<br />
19 (1), 12–17.<br />
Panten, D. (1997): Die Geschichte<br />
vom Kleinen Tiger <strong>und</strong> vom<br />
Kleinen Bär <strong>und</strong> <strong>de</strong>m KTK. In:<br />
Praxis <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>, 22 (2),<br />
135–137.<br />
Passolt, M. (Hrsg.) (1996): Mototherapeutische<br />
Arbeit mit hyperaktiven<br />
Kin<strong>de</strong>rn. München/Basel:<br />
E. Reinhardt.<br />
Probst, M. et al. (1990): Construction<br />
of a questionnaire on the<br />
body experience of anorexia<br />
nervosa. In: Remschmidt, H./<br />
Schmidt, M. H. (Hrsg.):<br />
Anorexia Nervosa. New York:<br />
Hogrefe & Huber Publishers,<br />
103–113.<br />
Remschmidt, H. (Hrsg.) (1992):<br />
Psychiatrie <strong>de</strong>r Adoleszenz.<br />
Stuttgart/New York: Georg<br />
Thieme Verlag.<br />
Reynolds, C. R. et al (2002): Developmental<br />
Test of Visual Perception<br />
Adolescents and Adults –<br />
(DTVP-A). Austin: PRO ED.<br />
Rollwagen, B. (1994): Laban<br />
Bewegungsstudien in <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong>. In: Praxis <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong>, 19 (1), 19–25.<br />
Schilling, F./Kiphard, E. J. (1974):<br />
Körperkoordinationstest <strong>für</strong><br />
Kin<strong>de</strong>r (Manual) – (KTK).<br />
Weinheim: Beltz.<br />
Schilling, F. (1976): Checkliste<br />
motorischer Verhaltensweisen<br />
(CMV). Braunschweig: Westermann.<br />
Seewald, J. (1993) Entwicklungen in<br />
<strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>. Praxis <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong>, 18, 188–193.<br />
Simons, J. et al. (1989): Zielgerichtete<br />
Beobachtung <strong>de</strong>s Bewegungsverhaltens<br />
in <strong>de</strong>r Psychiatrie.<br />
In: Motorik, 12 (2), 66-71.<br />
Strauss, B. Richter-Appelt, H. (1996):<br />
Fragebogen zur Beurteilung <strong>de</strong>s<br />
eigenen Körpers – FbeK Handanweisung.<br />
Göttingen: Hogrefe.<br />
Welsche, M. (2006): Sherborne’s<br />
Beziehungsorientierte Bewegungspädagogik<br />
als Baustein<br />
<strong>de</strong>r klinisch-bewegungstherapeutischen<br />
Arbeit mit Jugendlichen.<br />
In: Praxis <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>,<br />
4, 225–233.<br />
Welsche, M., Rosenthal, S., Romer,<br />
G. (2005): Bewegungsdiagnostik<br />
<strong>und</strong> bewegungstherapeutische<br />
Professionalisierung in <strong>de</strong>r<br />
klinischen Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie.<br />
In: Bewegungstherapie<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssport, 5,<br />
199–205.<br />
Welsche, M./Romer, G. (2005):<br />
Qualitative Bewegungsbeobachtung<br />
in <strong>de</strong>r erlebnis- <strong>und</strong> bewegungspädagogischenGruppenarbeit<br />
mit Jugendlichen im<br />
psychiatrisch-klinischen Setting.<br />
In: Bewegungstherapie <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitssport, 5, 206–214.<br />
101
102<br />
Traditionen <strong>und</strong> gegenwärtige Trends <strong>de</strong>r motorischen Entwicklungsforschung in Deutschland<br />
Rainer Wollny<br />
Traditionen <strong>und</strong> gegenwärtige Trends<br />
<strong>de</strong>r motorischen Entwicklungsforschung<br />
in Deutschland<br />
Die lange Jahre kontrovers geführte Diskussion über die beste Entwicklungstheorie<br />
scheint aufgr<strong>und</strong> uneinheitlicher theoretischer Vorstellungen <strong>und</strong> empirischer<br />
Bef<strong>und</strong>e in eine „entwicklungstheoretische Sackgasse“ geraten zu sein. Perspektivisch<br />
gesehen kommt <strong>de</strong>n metatheoretischen Rahmenkonzeption <strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie<br />
<strong>de</strong>r Lebensspanne von Baltes eine große Innovationskraft <strong>für</strong> die<br />
zukünftige Forschung zu lebenslaufbezogenen Fragen <strong>de</strong>r motorischen Entwicklung<br />
zu. Von beson<strong>de</strong>rem wissenschaftlichem Interesse ist hierbei die Prüfung <strong>de</strong>s<br />
spezifischen Einflusses potenzieller Entwicklungsfaktoren unter extern vali<strong>de</strong>n,<br />
ökologischen Kontextbedingungen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Annahmen <strong>de</strong>s Kontextualismus zum<br />
komplexen Bedingungsgefüge <strong>de</strong>r Ontogenese.<br />
Einführung<br />
Unabdingbare Voraussetzungen <strong>de</strong>r<br />
zielgerichteten För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Ontogenese<br />
<strong>de</strong>s Menschen sind verlässliche<br />
Kenntnisse über <strong>de</strong>n spezifischen<br />
Einfluss <strong>und</strong> das mehrdimensionale<br />
Wirkungsgefüge <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen<br />
Entwicklungsfaktoren. Den differenzierten<br />
Wissensbestän<strong>de</strong>n, Alltags- <strong>und</strong><br />
Berufstheorien langjährig erfahrener<br />
Sportlehrer, Trainer <strong>und</strong> Übungsleiter<br />
über <strong>de</strong>n Erklärungswert potenzieller<br />
Prädiktoren (Mo<strong>de</strong>ratorvariablen,<br />
Bedingungsfaktoren) <strong>für</strong> die allgemein<br />
beobachtbaren interindividuellen<br />
Differenzen <strong>und</strong> intraindividuellen<br />
Variabilitäten in <strong>de</strong>r Motorik <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
motorischen Entwicklung steht eine<br />
ausgesprochen lückenhafte Bef<strong>und</strong>lage<br />
<strong>de</strong>r psychologischen <strong>und</strong> sportwissenschaftlichen<br />
Entwicklungsforschung<br />
gegenüber. Diese Diskrepanz begrün<strong>de</strong>t<br />
sich vornehmlich darin, dass es<br />
Sportpraktiker mit vielfältigen Einzelfällen<br />
zu tun haben, während Entwicklungsforscher<br />
an personenübergreifen<strong>de</strong>n<br />
Gesetzmäßigkeiten interessiert<br />
sind: Was verän<strong>de</strong>rt sich im Verlauf <strong>de</strong>r<br />
Ontogenese? Welche Prädiktoren <strong>und</strong><br />
Wirkungszusammenhänge beeinflussen<br />
die Entwicklung? Welche Altersspezifität<br />
besteht <strong>für</strong> die Plastizität <strong>de</strong>r<br />
körperlichen, kognitiven <strong>und</strong> motorischen<br />
Ontogenese?<br />
Die bis in die 1990er Jahre vorherrschen<strong>de</strong>„Age-Functional-Relationship“-Forschung<br />
führt interindividuelle<br />
Entwicklungsunterschie<strong>de</strong> nahezu<br />
ausschließlich auf das Lebensalter<br />
zurück. Demgegenüber weist die<br />
mo<strong>de</strong>rne „Life-Span“-Psychologie das<br />
kalendarische Alter als eine physikalische<br />
Variable aus, die keine eigenständige<br />
erklären<strong>de</strong> Funktion <strong>für</strong> individuelle<br />
Entwicklungsverläufe <strong>und</strong><br />
Verhaltensän<strong>de</strong>rungen besitzt. Das Alter<br />
kennzeichnet lediglich bestimmte<br />
Zeiträume, in <strong>de</strong>nen biologische,<br />
psychologische, sozialkulturelle,<br />
materiale <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitliche Entwicklungs<strong>de</strong>terminanten<br />
wirken. Entgegen<br />
konventionellen Vorstellungen verläuft<br />
die Ontogenese <strong>de</strong>s Menschen nicht<br />
universell, invariant, unidirektional <strong>und</strong><br />
altersgeb<strong>und</strong>en, son<strong>de</strong>rn je<strong>de</strong>r Entwicklungsverlauf<br />
<strong>und</strong> je<strong>de</strong> Verhaltensweise<br />
resultiert aus <strong>de</strong>m komplexen Wechselspiel<br />
zahlreicher Einflussfaktoren. Der<br />
Grad <strong>de</strong>r Direktheit <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Indirektheit<br />
<strong>de</strong>r Auswirkungen einzelner Bedingungsvariablen<br />
auf die Ontogenese<br />
kann sehr unterschiedlich sein. Beispielsweise<br />
sind unter gleichen Sozialisationsbedingungen<br />
interindividuelle<br />
Differenzen im Entwicklungsverlauf zu<br />
beobachten. Auch können dieselben<br />
Trainingsinterventionen zu interindividuellen<br />
Motorikunterschie<strong>de</strong>n führen.<br />
Gegenwärtig mangelt es <strong>de</strong>r Entwicklungsforschung<br />
sowohl an multivariaten<br />
Analysen komplexer Konfigurationen<br />
von Einflussfaktoren zur Auf-<br />
klärung <strong>de</strong>r Konf<strong>und</strong>ierung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
relativen Be<strong>de</strong>utung einzelner Mo<strong>de</strong>ra-<br />
torvariablen als auch an <strong>de</strong>r engen<br />
Verzahnung theoretischer <strong>und</strong> empirischer<br />
Wissensbestän<strong>de</strong>.<br />
Der vorliegen<strong>de</strong> Übersichtsartikel<br />
thematisiert zunächst die historische<br />
Theoriediskussion <strong>und</strong> Forschungssituation<br />
zur kognitiven <strong>und</strong> (sport)-<br />
motorischen Ontogenese. Anschließend<br />
wer<strong>de</strong>n die momentan favorisierte<br />
Rahmenkonzeption <strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie<br />
<strong>de</strong>r Lebensspanne von<br />
Baltes (1990, 1997) <strong>und</strong> innovative<br />
Forschungsansätze zur motorischen<br />
Entwicklung im Lebenslauf vorgestellt.<br />
Was besagen Theorien <strong>de</strong>r<br />
menschlichen Entwicklung?<br />
Die Vielzahl <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n letzten fünfzig<br />
Jahren rasch wechseln<strong>de</strong>n Entwicklungstheorien<br />
erfor<strong>de</strong>rt eine Systematisierung<br />
<strong>de</strong>r voneinan<strong>de</strong>r abweichen<strong>de</strong>n<br />
Vorstellungen über die potenziellen<br />
Entwicklungsfaktoren <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren<br />
vielschichtigen Wirkungsbeziehungen.<br />
Abbildung 1 ordnet einzelne Erklärungsansätze<br />
danach zu, inwieweit <strong>de</strong>m<br />
Subjekt <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Umwelt eine aktive<br />
o<strong>de</strong>r passive Rolle bei <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Ontogenese zukommt <strong>und</strong> welche<br />
Annahmen bezüglich <strong>de</strong>r Interaktionen<br />
zwischen endogenen <strong>und</strong> exogenen<br />
Prädiktorvariablen bestehen. Akzentuiert<br />
wer<strong>de</strong>n vier entwicklungstheoretische<br />
Gr<strong>und</strong>perspektiven unterschie<strong>de</strong>n:<br />
organismische, exogenistische,<br />
konstruktivistische <strong>und</strong> kontextualistische<br />
Konzeptionen.<br />
Kernannahmen klassischer<br />
Entwicklungskonzeptionen<br />
Traditionelle entwicklungspsychologische<br />
Erklärungsansätze lassen im<br />
Wesentlichen drei Gr<strong>und</strong>konzepte <strong>de</strong>r<br />
Ontogenese erkennen. Während<br />
organismische Entwicklungstheorien<br />
ausschließlich genetische Einflussfak-
Abb. 1: Gr<strong>und</strong>perspektiven <strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie<br />
toren <strong>und</strong> exogenistische Ansätze<br />
vornehmlich materiale <strong>und</strong> soziale<br />
Entwicklungs<strong>de</strong>terminanten favorisieren,<br />
erachten konstruktivistische<br />
Entwicklungskonzepte komplexe<br />
Mensch-Umwelt-Interaktionen als<br />
entwicklungsrelevant. Nachfolgend<br />
wer<strong>de</strong>n die zentralen Annahmen,<br />
Verdienste <strong>und</strong> Unzulänglichkeiten <strong>de</strong>r<br />
klassischen Entwicklungstheorien<br />
dargestellt.<br />
Bis Mitte <strong>de</strong>r 1960er Jahre beherrschen<br />
organismische Phasenkonzeptionen –<br />
Ontogenese als Entfaltung vom<br />
Einfachen zum Komplexen – die<br />
allgemeine Entwicklungspsychologie. In<br />
diesen Theorien gelten als alleinige<br />
Richtungsgeber kognitiver <strong>und</strong> motorischer<br />
Entwicklungsverläufe <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen endogene Anlage-<br />
<strong>und</strong> Reifungsfaktoren. Die Ontogenese<br />
wird durch einen vorab festgelegten,<br />
„schicksalsbestimmten“ genetischen<br />
Plan bestimmt. Die physikalischen <strong>und</strong><br />
sozialen Umweltbedingungen können<br />
zwar modifizierend, aber nicht strukturell<br />
verän<strong>de</strong>rnd auf die Entwicklung<br />
einer Person einwirken. Die von <strong>de</strong>r<br />
frühen Sportwissenschaft favorisierten<br />
organismischen Entwicklungstheorien<br />
von Möckelmann <strong>und</strong> Schmidt (1952,<br />
1981), Mester (1962) <strong>und</strong> Neumann<br />
(1964) betrachten ausschließlich die<br />
leib-seelische Entwicklung von Heranwachsen<strong>de</strong>n.<br />
Als Beurteilungskriterien<br />
<strong>de</strong>s allgemeinen Entwicklungsstan<strong>de</strong>s<br />
gelten die Ausprägung <strong>de</strong>r motorischen<br />
Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten.<br />
Die in <strong>de</strong>n siebziger <strong>und</strong> achtziger<br />
Jahren weit verbreiteten exogenistischen<br />
Phasenkonzeptionen – Ontogenese<br />
als Sozialisation – favorisieren<br />
physikalische, zeit- <strong>und</strong> kulturabhängige<br />
soziale Bedingungsvariablen,<br />
während Anlage- <strong>und</strong> Reifungsfaktoren<br />
nahezu unberücksichtigt bleiben. Der<br />
Mensch wird unter Zugr<strong>und</strong>elegung<br />
behavioristischer Lerntheorien (Skinner,<br />
1953) als ein passives Wesen angesehen,<br />
das auf die „aktive“ Umwelt<br />
reagiert. Die vorherrschen<strong>de</strong>n Umweltbedingungen<br />
rufen bei je<strong>de</strong>r Person die<br />
gleichen Erfahrungen, Kenntnisse <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen hervor.<br />
Die Sportwissenschaft untersucht<br />
vorrangig <strong>de</strong>n speziellen Einfluss<br />
materialer <strong>und</strong> sozialer Bedingungsfaktoren<br />
auf die motorische Entwicklung.<br />
Nach <strong>de</strong>n Erkenntnissen <strong>de</strong>r empirischen<br />
schichtanalytischen Sozialforschung<br />
variieren die Bewegungsaktivitäten<br />
<strong>de</strong>s Menschen in Abhängigkeit<br />
von <strong>de</strong>r sozialen Gesellschaftsschicht<br />
<strong>und</strong> bedingen eine schichttypische<br />
motorische Entwicklung (Überblick:<br />
Voigt, 1978; Heinemann, 1983).<br />
Verlässliche empirische Bef<strong>und</strong>e liegen<br />
nur <strong>für</strong> das Erwachsenenalter vor.<br />
Beispielsweise wen<strong>de</strong>n sich die<br />
Angehörigen „höherer“ Sozialschichten<br />
häufiger <strong>und</strong> über einen längeren<br />
Zeitraum sporttypischen Aktivitäten zu,<br />
als die Mitglie<strong>de</strong>r „unterer“ Sozialschichten.<br />
Bevorzugt wer<strong>de</strong>n körperkontaktfreie<br />
Sportdisziplinen wie Golf,<br />
Tennis o<strong>de</strong>r Volleyball, während in <strong>de</strong>n<br />
unteren sozialen Schichten körperkontaktbetonte<br />
Sportarten (Boxen, Fußball,<br />
Ringen usw.) dominieren. Die in<br />
höheren Sozialschichten weit verbreiteten<br />
Wertorientierungen hinsichtlich<br />
eines Leistungsgedankens, Selbstständigkeit,<br />
Selbstverantwortung <strong>und</strong> <strong>de</strong>s<br />
Verzichts auf direkte Bedürfnisbefriedigung<br />
erleichtern nachweisbar die<br />
Ausübung <strong>de</strong>s Wettkampf- <strong>und</strong><br />
Leistungssports.<br />
Der theoretische <strong>und</strong> empirische<br />
Wissensstand zum Kin<strong>de</strong>s- <strong>und</strong><br />
Jugendalter ist ausgesprochen wi<strong>de</strong>rsprüchlich<br />
<strong>und</strong> lückenhaft. Schichteinflüsse<br />
wer<strong>de</strong>n als eher gering eingestuft.<br />
Sie führen vornehmlich in <strong>de</strong>n<br />
unteren sozialen Schichten zu auffälligen<br />
Beeinträchtigungen <strong>de</strong>r Motorik<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Ontogenese. Untersucht<br />
Rainer Wollny<br />
1980–1986 Lehramtsstudium Sport u.<br />
Biologie, Sek. I u. II, Universitäten<br />
Gießen <strong>und</strong> Bielefeld, 1. Staatsexamen;<br />
1987–1992 wiss. Mitarbeiter, Universität<br />
Bielefeld; 1992 Promotion zum Dr.<br />
phil., Universität Bielefeld; 1992–1994<br />
wiss. Mitarbeiter, Freie Universität;<br />
1995–1998 DFG-Habilitationsstipendiat;<br />
1998–2006 wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter, Universität Hei<strong>de</strong>lberg;<br />
2000 Habilitation u. venia legendi f.<br />
Sportwissenschaft, Universität Hei<strong>de</strong>lberg;<br />
Erster Preis im Carl-Diem-<br />
Wettbewerb 1999/2000 (Habilitationsschrift);<br />
2000–2002 Vertretungs-<br />
professuren a. d. Universitäten Freiburg<br />
u. Stuttgart; 2005 außerplanmäßiger<br />
Professor, Hei<strong>de</strong>lberg; 2006 Universitätsprofessor<br />
in Halle<br />
Anschrift <strong>de</strong>s Verfassers:<br />
Martin-Luther-Universität<br />
Halle–Wittenberg<br />
Department Sportwissenschaft<br />
Sport<strong>motorik</strong> <strong>und</strong> Sportbiomechanik<br />
Selkestraße 9F<br />
06122 Halle (Saale)<br />
103
104<br />
Traditionen <strong>und</strong> gegenwärtige Trends <strong>de</strong>r motorischen Entwicklungsforschung in Deutschland<br />
wer<strong>de</strong>n spezielle Lern- <strong>und</strong> Trainingsinterventionen<br />
(z. B. Hirtz, 1985),<br />
materiale (Wohnungsgröße, Spielflächen,<br />
Spielmaterial usw.), soziale,<br />
ökonomische <strong>und</strong> familiäre Umweltbedingungen<br />
(z. B. Berufstätigkeit <strong>de</strong>r<br />
Eltern, Erziehungsstil, Geschwisterzahl,<br />
Kin<strong>de</strong>rgarten, Sportverein; Vogt, 1978;<br />
Zimmer, 1981). Der nachweisbar<br />
geringe Einfluss einzelner exogener<br />
Prädiktoren auf die motorische Entwicklung<br />
von Heranwachsen<strong>de</strong>n darf<br />
jedoch nicht unterschätzt wer<strong>de</strong>n, da<br />
diese in <strong>de</strong>r Regel nicht isoliert, son<strong>de</strong>rn<br />
kumulierend wirken (Willimczik, 1983).<br />
Den dritten be<strong>de</strong>utsamen Paradigmenwechsel<br />
in <strong>de</strong>r klassischen Entwicklungspsychologie<br />
leiten Mitte <strong>de</strong>r<br />
siebziger Jahre konstruktivistische<br />
Entwicklungstheorien – Ontogenese als<br />
Einsicht <strong>und</strong> Erfahrung – ein. Ihr<br />
bekanntester Repräsentant Piaget<br />
(1966, 1970, 1976) beschreibt die<br />
menschliche Entwicklung als einen<br />
individuellen, selbststrukturieren<strong>de</strong>n<br />
Konstruktionsprozess, <strong>de</strong>n das Subjekt<br />
im aktiven Austausch mit <strong>de</strong>r „passiven“<br />
Umwelt gestaltet. Die vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
materialen <strong>und</strong> sozialkulturellen<br />
Bedingungen dienen <strong>de</strong>m Individuum<br />
lediglich als „Lieferant“ vielfältiger<br />
Fragen, Problemstellungen <strong>und</strong> Lösungsvorschläge.<br />
Spezifische Entwicklungsverläufe<br />
<strong>und</strong> Verhaltensän<strong>de</strong>rungen<br />
beruhen einerseits auf <strong>de</strong>n<br />
selbstregulatorischen Ten<strong>de</strong>nzen <strong>de</strong>s<br />
Menschen zur Wahrung <strong>de</strong>s Gleichgewichts<br />
zwischen <strong>de</strong>r internen <strong>und</strong><br />
externen Struktur, an<strong>de</strong>rerseits auf <strong>de</strong>r<br />
offensichtlichen Neigung zur Ausbildung<br />
höherer Gleichgewichtszustän<strong>de</strong><br />
(Äquilibration). Anpassungen an die<br />
Umwelt erfolgen durch Adaptationen<br />
<strong>de</strong>s Verhaltens an die Umwelterfor<strong>de</strong>rnisse<br />
(Akkommodation) <strong>und</strong> subjektgeleitete<br />
Än<strong>de</strong>rungen sowie Anpassungen<br />
<strong>de</strong>r Umwelt an die individuellen<br />
Bedürfnisse <strong>und</strong> Handlungsmöglichkeiten<br />
<strong>de</strong>s Subjekts (Assimilation).<br />
Assimilationen können nur dann<br />
erfolgreich sein, wenn sie <strong>de</strong>n Umweltbedingungen<br />
nicht zuwi<strong>de</strong>rlaufen.<br />
Daher ist eine ständige Akkommodation<br />
notwendig.<br />
In sportwissenschaftlichen Untersuchungen<br />
zur kindlichen Bewegungsentwicklung<br />
<strong>und</strong> vorschulischen Spiel-<br />
sowie Bewegungserziehung (z. B.<br />
Scherler, 1975; Funke, 1979; Diettrich,<br />
1981; Frankfurter Arbeitsgruppe, 1982;<br />
Zimmer, 1981) wird eine 1:1-Übertragung<br />
<strong>de</strong>r konstruktivistischen Phasentheorie<br />
von Piaget auf die motorische<br />
Ontogenese praktiziert. Diese ist<br />
insofern problembehaftet, da Piaget<br />
ausschließlich die kognitive Entwicklung<br />
von Heranwachsen<strong>de</strong>n fokussiert.<br />
Die Verdienste <strong>de</strong>r klassischen Entwicklungsperspektiven<br />
liegen darin, dass<br />
diese erstmals in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r<br />
Entwicklungspsychologie auf die<br />
qualitativen Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Ontogenese von Kin<strong>de</strong>rn, Jugendlichen<br />
<strong>und</strong> Erwachsenen aufmerksam machen<br />
sowie die Gefahr <strong>de</strong>r Nichtbeachtung<br />
von Entwicklungsabschnitten problematisieren.<br />
Die wesentlichen Unzulänglichkeiten<br />
betreffen die jeweils einseitige<br />
Darstellung <strong>de</strong>r Ontogenese als<br />
einen ausschließlich endogen o<strong>de</strong>r<br />
exogen gesteuerten Prozess, die<br />
Annahme altersgeb<strong>und</strong>ener Entwicklungsphasen<br />
<strong>und</strong> die Vorstellungen über<br />
die zeitlich gleichmäßige Ausprägung<br />
<strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Persönlichkeitsdimensionen.<br />
Neue Entwicklungsstudien<br />
belegen vielfältige Wirkungsbeziehungen<br />
zwischen endogenen <strong>und</strong><br />
exogenen Bedingungsfaktoren, breite<br />
altersunabhängige interindividuelle<br />
Differenzen <strong>und</strong> ontogenetische<br />
Asynchronitäten sowie interkulturelle<br />
Variabilitäten im Tempo <strong>und</strong> Niveau <strong>de</strong>r<br />
Ontogenese. Massiv kritisiert wird auch<br />
die einseitige Ausrichtung <strong>de</strong>r konventionellen<br />
Entwicklungsforschung auf die<br />
Entwicklung von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen.<br />
Das Erwachsenenalter bleibt<br />
aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Unzulänglichkeiten<br />
früherer entwicklungspsychologischer<br />
Untersuchungsmetho<strong>de</strong>n <strong>und</strong> fehlen<strong>de</strong>r<br />
theoretischer Einordnung <strong>de</strong>r empirischen<br />
Bef<strong>und</strong>e lange Zeit nahezu<br />
unberücksichtigt.<br />
Kernannahmen mo<strong>de</strong>rner Entwicklungskonzeptionen<br />
Seit <strong>de</strong>n 1980er Jahren begünstigen die<br />
Forschungsergebnisse <strong>de</strong>r „Life-Span“-<br />
Psychologie <strong>und</strong> die bevölkerungs<strong>de</strong>mografische<br />
Verschiebung <strong>de</strong>r Altersstruktur<br />
von einer „Alterspyrami<strong>de</strong>“ zu einem<br />
„Alterspilz“ die rasche Verbreitung <strong>de</strong>r<br />
kontextualistischen Entwicklungsperspektive<br />
– Ontogenese als Subjekt<br />
UmweltInteraktion. Neu ist die<br />
Annahme, dass ein komplexes System<br />
wechselseitig abhängiger endogener<br />
<strong>und</strong> exogener Einflussfaktoren die<br />
Entwicklung <strong>de</strong>s Menschen lebenslang<br />
beeinflusst. Das Subjekt <strong>und</strong> die<br />
Umwelt gelten als unverzichtbare<br />
miteinan<strong>de</strong>r interagieren<strong>de</strong> Teilkomponenten<br />
<strong>de</strong>s Gesamtsystems (s. Abb. 1).<br />
Der in seinem Genbestand <strong>de</strong>terminierte<br />
menschliche Organismus legt<br />
einerseits die Möglichkeiten <strong>und</strong> die<br />
Grenzen <strong>de</strong>r Persönlichkeitsentwicklung<br />
fest; an<strong>de</strong>rerseits wird <strong>de</strong>r Genbestand<br />
durch die spezifischen Handlungen <strong>de</strong>s<br />
Individuums zum Phänotyp ausgebil<strong>de</strong>t.<br />
Zukunftsweisen<strong>de</strong> Forschungsstrategien<br />
wer<strong>de</strong>n durch die metatheoretische<br />
Rahmenkonzeption <strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie<br />
<strong>de</strong>r Lebensspanne von<br />
Baltes eröffnet (1987, 1990, 1997;<br />
Baltes, Lin<strong>de</strong>nberger/Staudinger, 1998;<br />
Baltes, Staudinger/Lin<strong>de</strong>nberger, 1999),<br />
die auf acht inhaltlichen Leitorientierungen<br />
zu <strong>de</strong>skriptiven <strong>und</strong> kausalanalytischen<br />
Aspekten <strong>de</strong>r Ontogenese<br />
basiert. Die ersten vier in Tabelle 1<br />
aufgeführten Leitsätze gehen auf das<br />
lebenslange ontogenetische Verän<strong>de</strong>rungspotenzial<br />
<strong>de</strong>s Menschen <strong>und</strong> die<br />
gleich bleiben<strong>de</strong> Gewinn-Verlust-<br />
Dynamik <strong>de</strong>r Ontogenese ein. Nach <strong>de</strong>r<br />
fünften Leitlinie (Kontextualismus-<br />
Konzept) resultiert je<strong>de</strong>r Entwicklungsverlauf<br />
aus <strong>de</strong>r Wechselwirkung<br />
ontogenetischer nach Alter gestufter,<br />
evolutionär-historischer (z. B. Kulturkreis,<br />
Gruppenzugehörigkeit, Lebensbedingungen)<br />
<strong>und</strong> nichtnormativer<br />
Einflussfaktoren (z. B. Unfälle, Verän<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>s Ges<strong>und</strong>heitszustan<strong>de</strong>s, Zufälle<br />
mit biografischer Tragweite). Die<br />
sechste Kernannahme „Entwicklung als<br />
Auswahl <strong>und</strong> selektive Optimierung <strong>de</strong>r<br />
adaptiven Kapazität“ beschreibt die<br />
Ontogenese als einen auf biologischen,<br />
psychischen, kulturellen <strong>und</strong> materialen<br />
Einflussfaktoren beruhen<strong>de</strong>n Selektionsprozess.<br />
Die siebte Leitorientierung<br />
„intraindividuelle Plastizität“ betont die<br />
Notwendigkeit <strong>de</strong>r Evaluation <strong>de</strong>s<br />
Ausmaßes <strong>de</strong>r Plastizität <strong>de</strong>s Verhaltens<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>ren Grenzen. Der achte Leitsatz<br />
„Effektive Koordination von Selektion,<br />
Optimierung <strong>und</strong> Kompensation“<br />
thematisiert die unvollständige<br />
biologisch- <strong>und</strong> kulturbasierte Architektur<br />
<strong>de</strong>r menschlichen Entwicklung.<br />
Die Rahmenkonzeption <strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie<br />
<strong>de</strong>r Lebensspanne von<br />
Baltes stellt kein eigenständiges<br />
Erklärungsmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Ontogenese dar, son<strong>de</strong>rn lediglich eine<br />
Bün<strong>de</strong>lung anerkannter entwicklungs-
Tab. 1: Leitorientierungen <strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie <strong>de</strong>r Lebensspanne (mod. nach Baltes et al., 1998, S. 1043)<br />
Leitorientierungen Kernannahmen<br />
Lebenslange Entwicklung Die Entwicklung stellt einen lebenslangen Prozess dar, bei <strong>de</strong>m keine Altersstufe<br />
eine Vorrangstellung einnimmt.<br />
Lebenslange Verän<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>r Mit zunehmen<strong>de</strong>m Lebensalter besteht eine <strong>für</strong> die Ontogenese wachsen<strong>de</strong><br />
Dynamik zwischen Biologie <strong>und</strong> Kultur funktionale Lücke zwischen <strong>de</strong>m biologischen Potenzial <strong>und</strong> <strong>de</strong>n kulturellen<br />
Zielen <strong>de</strong>s Subjekts.<br />
Lebenslange Verän<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>r Die Entwicklung beinhaltet die Zuweisung von Ressourcen in drei Funktionen:<br />
Zuweisung von Ressourcen einzelner Wachstum, Aufrechterhaltung <strong>und</strong> Regulation von Verlusten. Lebenslange Entwick-<br />
Entwicklungsfunktionen<br />
lungsverän<strong>de</strong>rungen beinhalten eine funktionale Verschiebung <strong>de</strong>r Zuweisung von<br />
Ressourcen von Wachstum (Kin<strong>de</strong>salter) zu einem größten Anteil <strong>de</strong>r Aufrechterhaltung<br />
<strong>und</strong> Regulation von Verlusten (Erwachsenenalter).<br />
Entwicklung als Gewinn- <strong>und</strong> Verlust- Die Ontogenese setzt sich lebenslang aus Gewinn (Wachstum) <strong>und</strong> Verlust (Abbau)<br />
Dynamik<br />
zusammen. Die Entwicklung stellt somit eine multidimensionale, multidirektionale<br />
<strong>und</strong> multifunktionale Konzeption dar.<br />
Kontextualismus Individuelle Entwicklungsverläufe resultieren aus <strong>de</strong>n Wechselwirkungen altersbedingter,<br />
evolutionär-historischer <strong>und</strong> nichtnormativer Einflusssysteme.<br />
Entwicklung als Auswahl <strong>und</strong> selektive Die Entwicklung stellt einen Prozess <strong>de</strong>r Selektion, <strong>de</strong>r selektiven Adaptation <strong>und</strong><br />
Optimierung <strong>de</strong>r adaptiven Kapazität <strong>de</strong>r Kompensation dar, <strong>de</strong>r auf biologische, psychologische, kulturelle <strong>und</strong> umgebungsbedingte<br />
Faktoren zurückzuführen ist.<br />
Intraindividuelle Plastizität Die Ontogenese ist durch die intraindividuelle Plastizität (Verän<strong>de</strong>rbarkeit innerhalb<br />
einer Person) charakterisiert. Entwicklungsverläufe variieren in Abhängigkeit von<br />
<strong>de</strong>n Lebensbedingungen <strong>und</strong> -erfahrungen. Die Hauptaufgabe <strong>de</strong>r Entwicklungsforschung<br />
besteht in <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>s Ausmaßes <strong>de</strong>r intraindividuellen Plastizität <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>ren Grenzen.<br />
Effektive Koordination von Selektion, Die erfolgreiche Ontogenese kennzeichnet die subjektive <strong>und</strong> objektive Maximie-<br />
Optimierung <strong>und</strong> Kompensation rung von Gewinnen <strong>und</strong> die Minimierung von Verlusten. Sie stellt das Resultat <strong>de</strong>s<br />
(SOK-Theorie)<br />
Zusammenspiels von Selektion, Optimierung <strong>und</strong> Kompensation dar. Im Lebenslauf<br />
nimmt <strong>de</strong>r ontogenetische Druck <strong>für</strong> diese Dynamik ebenso zu, wie die relative<br />
Unvollendung <strong>de</strong>r Architektur <strong>de</strong>r Entwicklung zunehmend betont wird.<br />
psychologischer Auffassungen. Keiner<br />
<strong>de</strong>r acht Leitorientierungen enthält bei<br />
isolierter Betrachtung „revolutionäre“,<br />
richtungweisen<strong>de</strong> Vorstellungen über<br />
die menschliche Entwicklung <strong>und</strong> die<br />
relevanten Mo<strong>de</strong>ratorvariablen. Der<br />
beson<strong>de</strong>re wissenschaftliche Wert <strong>de</strong>r<br />
Arbeiten von Baltes <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
liegt in <strong>de</strong>r Systematisierung, <strong>de</strong>r<br />
Integration <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Weiterentwicklung<br />
anerkannter entwicklungstheoretischer<br />
Kenntnisse begrün<strong>de</strong>t. Das größte<br />
theoretische <strong>und</strong> untersuchungsmethodische<br />
Anregungs- <strong>und</strong> Innovationspotenzial<br />
<strong>für</strong> die mo<strong>de</strong>rne Entwicklungsforschung<br />
besitzen die bei<strong>de</strong>n<br />
Leitsätze <strong>de</strong>r „intraindividuellen<br />
Plastizität“ <strong>und</strong> <strong>de</strong>s „Kontextualismus“.<br />
Nach <strong>de</strong>m Leitsatz <strong>de</strong>r intraindividuellen<br />
Plastizität stellt die Evaluation <strong>de</strong>s<br />
Ausmaßes <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rbarkeit von<br />
Entwicklungsverläufen die zentrale<br />
Aufgabe <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Entwicklungsforschung<br />
dar. Der Begriff Plastizität<br />
beschreibt das spezifische Potenzial, das<br />
<strong>de</strong>n Menschen aufgr<strong>und</strong> genetischer<br />
Prädispositionen <strong>und</strong> subjektiver<br />
Erfahrungen in Abhängigkeit vom biologischen<br />
Alter befähigt, sich lebenslang<br />
verschie<strong>de</strong>nen Umweltbedingungen<br />
anzupassen. Den Umfang <strong>de</strong>r intraindividuellen<br />
Plastizität <strong>de</strong>r Ontogenese<br />
begrenzen die Entwicklungs-, Kapazitäts-<br />
<strong>und</strong> Kompensationsreserven <strong>de</strong>s<br />
Individuums. Auf <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>lage <strong>de</strong>r<br />
Leitorientierung <strong>de</strong>r intraindividuellen<br />
Plastizität lassen sich die auf Zufälligkeiten<br />
beruhen<strong>de</strong>n intraindividuellen<br />
Verän<strong>de</strong>rungen von internen <strong>und</strong><br />
externen Gesetzmäßigkeiten folgen<strong>de</strong>n<br />
Variabilitäten abgrenzen. Die „Testingthe-Limits“-Metho<strong>de</strong><br />
(Schmidt, 1971) –<br />
das Austesten <strong>de</strong>r speziellen Leistungsmöglichkeiten<br />
einer Person – ermöglicht<br />
die Analyse kognitiver <strong>und</strong> motorischer<br />
Entwicklungs- <strong>und</strong> Kapazitätsreserven.<br />
Die dahinter stehen<strong>de</strong> Annahme geht<br />
davon aus, dass Leistungsunterschie<strong>de</strong><br />
umso stärker hervortreten, je näher<br />
das Subjekt an seine genetisch <strong>de</strong>terminierte<br />
Leistungsgrenze heranreicht.<br />
Die Plastizität <strong>de</strong>s kognitiven <strong>und</strong><br />
motorischen Verhaltens wird auf drei<br />
Ebenen evaluiert: Die baseline performance<br />
(Ausgangsleistung) kennzeichnet<br />
die aktuelle Leistungsfähigkeit, die eine<br />
Person ohne Interventionsmaßnahmen<br />
bei einmaliger Testanwendung erreicht.<br />
Die baseline reserve capacity (Ausgangskapazitätsreserve)<br />
beschreibt die<br />
unter optimalen Bedingungen zu<br />
erzielen<strong>de</strong> obere Grenze <strong>de</strong>s Leistungspotenzials.<br />
Die <strong>de</strong>velopmental reserve<br />
capacity (Entwicklungskapazitätsreserve)<br />
charakterisiert die durch<br />
spezielle Interventionen zu erreichen<strong>de</strong><br />
maximale Leistungsfähigkeit <strong>und</strong><br />
Entwicklungsperspektive <strong>de</strong>s Individuums.<br />
Das Konzept <strong>de</strong>s Kontextualismus<br />
erweitert <strong>de</strong>n Forschungsblick da<strong>für</strong>,<br />
dass komplex interagieren<strong>de</strong> altersbe-<br />
105
106<br />
Traditionen <strong>und</strong> gegenwärtige Trends <strong>de</strong>r motorischen Entwicklungsforschung in Deutschland<br />
zogene, evolutionär-historische <strong>und</strong><br />
nichtnormative Einflusssysteme die<br />
Ontogenese bestimmen.<br />
• Der altersbezogene, lebenslaufzyklische<br />
Prädiktorenbereich<br />
(„age-gra<strong>de</strong>d influences“) umfasst<br />
organismische <strong>und</strong> umweltbezogene<br />
Merkmale, die zu vorhersagbaren<br />
Verhaltensän<strong>de</strong>rungen führen <strong>und</strong><br />
eine variable Altersbindung zeigen.<br />
Hierzu zählen das Lebensalter,<br />
die Genetik, das Wachstum, die<br />
Reifung, das Geschlecht, die<br />
psychischen <strong>und</strong> kognitiven Faktoren,<br />
die koordinativen <strong>und</strong> informationell<br />
<strong>de</strong>terminierten Fähigkeiten, die<br />
Bewegungsbiografie, die sozialkulturelle<br />
<strong>und</strong> die materiale<br />
Umwelt.<br />
• Evolutionärhistorische Faktoren<br />
(„history-gra<strong>de</strong>d-influences“)<br />
charakterisieren eine feste Bindung<br />
an geschichtliche Zeitdimensionen<br />
<strong>und</strong> kulturwan<strong>de</strong>lbezogene Einflüsse<br />
wie langfristige, epochalen historischen<br />
Wan<strong>de</strong>l unterliegen<strong>de</strong><br />
Wertorientierungen o<strong>de</strong>r perio<strong>de</strong>nspezifische<br />
historische Wertewan<strong>de</strong>l<br />
(politische, technologische Umwälzungen,<br />
Zeittrends usw.). Von<br />
zentraler Be<strong>de</strong>utung sind <strong>de</strong>r<br />
Kulturkreis, die Volks- <strong>und</strong> Gruppenzugehörigkeit,<br />
die Familie, die Schule<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Fre<strong>und</strong>eskreis.<br />
• Nichtnormative Prädiktorvariablen<br />
zeigen keine auffälligen Beziehungen<br />
zu altersgeb<strong>und</strong>enen <strong>und</strong> evolutionär-historischen<br />
Faktoren. Sie treten<br />
im Lebenslauf unerwartet auf <strong>und</strong><br />
lassen sich nicht „einfach“ in die<br />
Lebensroutine einer Person einglie<strong>de</strong>rn<br />
(z. B. Verletzungen, Krankheiten).<br />
Für <strong>de</strong>n Einzelnen sind nicht<br />
das Ereignis selbst <strong>und</strong> die objektiven<br />
Folgen be<strong>de</strong>utsam, son<strong>de</strong>rn das<br />
Verhältnis zwischen <strong>de</strong>n situativen<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n individuellen<br />
Bewältigungsressourcen (Filipp,<br />
1995). Kritische Lebensereignisse<br />
wer<strong>de</strong>n dadurch bestimmt, wie viele<br />
Menschen ein vergleichbares Ereignis<br />
trifft. Bei in nahezu gleicher Weise<br />
auf eine größere Personengruppe<br />
einwirken<strong>de</strong> Naturkatastrophen,<br />
Wirtschaftskrisen o<strong>de</strong>r Kriege<br />
scheint die psychologische Erfahrung<br />
<strong>de</strong>s Individuums eine an<strong>de</strong>re zu<br />
sein, als wenn nur einzelne<br />
Menschen betroffen wer<strong>de</strong>n<br />
(z. B. Blitzeinschlag).<br />
Zukunftsweisen<strong>de</strong> Forschungsansätze<br />
zur motorischen Entwicklung<br />
in <strong>de</strong>r Lebensspanne<br />
Das gr<strong>und</strong>lagenwissenschaftliche <strong>und</strong><br />
technologische Forschungsprogramm<br />
zur „Motorischen Entwicklung in <strong>de</strong>r<br />
Lebensspanne“ von Willimczik <strong>und</strong><br />
Conzelmann (1999) zielt auf die<br />
Übertragung <strong>de</strong>r Rahmenkonzeption <strong>de</strong>r<br />
Entwicklungspsychologie <strong>de</strong>r Lebensspanne<br />
auf <strong>de</strong>n (sport)motorischen<br />
Persönlichkeitsbereich. Die enorme<br />
Komplexität <strong>de</strong>s Untersuchungsgegenstan<strong>de</strong>s<br />
erfor<strong>de</strong>rt zunächst neben <strong>de</strong>r<br />
isolierten Analyse ausgewählter<br />
Altersgruppen <strong>und</strong> einzelner Leitsätze<br />
<strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie <strong>de</strong>r<br />
Lebensspanne die thematische Reduktion<br />
<strong>de</strong>s vielschichtigen Bedingungsgefüges<br />
<strong>de</strong>r motorischen Ontogenese<br />
(z. B. Einfluss bestimmter Bedingungsfaktoren,<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r motorischen<br />
Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten). Darüber<br />
hinaus muss das Kontextualismus-<br />
Konzept durch bewegungsbezogene<br />
Prädiktoren (koordinatives <strong>und</strong> informationelles<br />
Fähigkeitsniveau, Fertigkeitsrepertoire,<br />
Bewegungsbiografie usw.)<br />
ergänzt wer<strong>de</strong>n. Momentan liegen nur<br />
wenige sportwissenschaftliche Studien<br />
zur Prüfung <strong>de</strong>r inhaltlichen Kernannahmen<br />
<strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie<br />
r Abb. 2: Strukturgleichungsmo<strong>de</strong>ll (Roth/Wollny, 1999b)<br />
<strong>de</strong>r Lebensspanne von Baltes vor.<br />
Roth et al. (2000) <strong>und</strong> Okonek (1996,<br />
2000) erläutern auf <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>lage <strong>de</strong>s<br />
Leitsatzes <strong>de</strong>s Kontextualismus, wie die<br />
komplexen Wirkungsbeziehungen<br />
potenzieller Entwicklungsfaktoren <strong>und</strong><br />
die Struktur <strong>de</strong>r motorischen Leistungsän<strong>de</strong>rung<br />
über die Zeit multikausal<br />
evaluiert wer<strong>de</strong>n können. Pauer (2001)<br />
<strong>und</strong> Conzelmann (1997, 1999) erforschen<br />
die intraindividuelle Plastizität<br />
motorischer Basisfähigkeiten leistungssportlich<br />
trainieren<strong>de</strong>r Jugendlicher <strong>und</strong><br />
langjährig erfolgreicher Seniorenwettkampfsportler.<br />
Wollny (2002) untersucht<br />
bei 10- bis 59-jährigen Mädchen<br />
<strong>und</strong> Frauen die interindividuellen<br />
Differenzen in <strong>de</strong>r intraindividuellen<br />
Plastizität motorischer Fertigkeitsoptimierungen.<br />
Willimczik, Voelcker-<br />
Rehage/Wiertz (2006) übertragen<br />
ausgewählte Leitsätze <strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie<br />
<strong>de</strong>r Lebensspanne auf<br />
die motorische Ontogenese. Die<br />
nachfolgen<strong>de</strong> Ergebnisdarstellung<br />
sportwissenschaftlicher Studien zu <strong>de</strong>n<br />
theoretischen Leitorientierungen <strong>de</strong>r<br />
Entwicklungspsychologie <strong>de</strong>r Lebensspanne<br />
verzichtet auf statistische<br />
Kennwerte, um die Lesbarkeit <strong>und</strong><br />
die Verständlichkeit <strong>de</strong>s Überblicksartikels<br />
nicht unnötigerweise zu<br />
erschweren.
Kontextualismus <strong>und</strong> interindividuelle<br />
Variabilitäten <strong>de</strong>r Motorik<br />
Roth et al. (2000) zeigen im Rahmen<br />
eines interkulturellen Forschungsprojekts<br />
<strong>de</strong>r Universitäten Hei<strong>de</strong>lberg <strong>und</strong><br />
Nara (Japan) zur Evaluation <strong>de</strong>r<br />
interindividuellen Differenzen in <strong>de</strong>r<br />
allgemeinen motorischen Leistungsfähigkeit<br />
von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
auf, wie verschie<strong>de</strong>ne Prädiktorvariablen<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>ren Wechselwirkungen<br />
untersucht wer<strong>de</strong>n können. Die erfassten<br />
altersbezogenen, kultur- <strong>und</strong><br />
geschlechtsspezifischen sowie nichtnormativen<br />
Prädiktoren wer<strong>de</strong>n zwei<br />
Kausalitätsstufen zugeordnet (vgl. Abb.<br />
2; Roth/Wollny, 1999a, b). Die erste<br />
Gruppe umfasst Faktoren, die von<br />
keiner Vorhersagevariable beeinflusst<br />
wer<strong>de</strong>n, aber umgekehrt auf an<strong>de</strong>re<br />
Prädiktoren wirken (kalendarisches<br />
Alter: 10–17 Jahre; Kulturvergleichsvariable:<br />
Ägypten, Brasilien, Deutschland,<br />
Japan, Südafrika; Geschlecht: Mädchen,<br />
Jungen; nicht-normative Einflüsse). Die<br />
Prädiktorvariablen <strong>de</strong>r zweiten Kausalitätsstufe<br />
(Abb. 2) stellen altersgestufte<br />
Merkmale dar, die von <strong>de</strong>n Faktoren <strong>de</strong>r<br />
ersten Gruppe beeinflusst wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
gleichzeitig keinen Einfluss auf an<strong>de</strong>re<br />
Entwicklungsvariablen ausüben. Die<br />
interindividuellen Differenzen in <strong>de</strong>r<br />
Motorik – die Kriteriumswerte – wer<strong>de</strong>n<br />
über motorische Fähigkeitstests<br />
bestimmt (Kraft-, Ausdauer-, Schnelligkeits-,<br />
Beweglichkeitsfähigkeit,<br />
Koordination unter Zeit- o<strong>de</strong>r Präzisionsdruck).<br />
Die interindividuelle Verschie<strong>de</strong>nheit<br />
in <strong>de</strong>r motorischen<br />
Leistungsfähigkeit schätzt ein lineares<br />
Strukturgleichungsmo<strong>de</strong>ll mit latenten<br />
Variablen. Abbildung 2 gibt die Kausalhypothesen<br />
(H1-H23) <strong>und</strong> die Ursache-<br />
Wirkungsrichtung (Pfeile) wie<strong>de</strong>r.<br />
Die Datenerhebungen <strong>de</strong>s interkulturellen<br />
Forschungsprojekts sind auf <strong>de</strong>n<br />
vier Kontinenten weitgehend abgeschlossen.<br />
Erste Ergebnisauswertungen<br />
<strong>de</strong>uten darauf hin, dass <strong>de</strong>n Prädiktoren<br />
<strong>de</strong>r ersten Gruppe ein be<strong>de</strong>utsamer<br />
Beitrag <strong>für</strong> die Aufklärung <strong>de</strong>r allgemein<br />
beobachtbaren interindividuellen<br />
Differenzen in <strong>de</strong>r motorischen<br />
Entwicklung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r motorischen<br />
Leistungsfähigkeit zukommt. Dies trifft<br />
insbeson<strong>de</strong>re <strong>für</strong> die bislang wenig<br />
evaluierten evolutionsgeschichtlichen,<br />
kulturwan<strong>de</strong>lbezogenen <strong>und</strong> nichtnormativen<br />
Einflussfaktoren zu. Unter<br />
Berücksichtigung <strong>de</strong>r Resultatsten-<br />
<strong>de</strong>nzen bestehen interkulturelle<br />
Unterschie<strong>de</strong> hinsichtlich <strong>de</strong>r Schnellkraft-<br />
<strong>und</strong> Koordinationsfähigkeit. Eine<br />
auffällige Geschlechtstypik zeigen die<br />
Ausdauer-, Schnellkraft- <strong>und</strong> Schnelligkeitsfähigkeit.<br />
Das kalendarische Alter<br />
besitzt lediglich einen differenziellen<br />
Vorhersagewert <strong>für</strong> Schnellkraftleistungen.<br />
Okonek (1996, 2000) geht <strong>de</strong>r Frage<br />
nach: Welche Bedingungsfaktoren<br />
beeinflussen die breitensportliche<br />
Leistungsentwicklung über die Erwachsenenzeit?<br />
Längsschnittlich evaluiert<br />
wer<strong>de</strong>n sowohl personenexterne<br />
(geografische, kulturelle, ökonomische,<br />
soziale Bedingungen, kritische Lebensereignisse<br />
usw.) <strong>und</strong> personeninterne<br />
Einflüsse (Lebensalter, Persönlichkeit,<br />
Ges<strong>und</strong>heits-/Trainingszustand,<br />
Kontrollüberzeugungen, Lebensstil,<br />
Bildungsniveau usw.) als auch <strong>de</strong>ren<br />
Kovariation <strong>und</strong> Interaktion. Die<br />
retrospektive Beurteilung <strong>de</strong>r motorischen<br />
Leistungsentwicklung im<br />
Erwachsenenalter beruht auf <strong>de</strong>n<br />
leichtathletischen Wettkampfleistungen<br />
im Rahmen <strong>de</strong>s „Deutschen Sportabzeichen“<br />
(100-m-Lauf: Schnelligkeit;<br />
3000/5000-m-Lauf: aerobe Ausdauer;<br />
Weitsprung: Schnellkraft/Koordination)<br />
von 386 Breitensportlern (Jahrgang:<br />
1907-1949), die über mehr als zwanzig<br />
Jahre erfolgreich das Deutsche Sportabzeichen<br />
absolviert haben.<br />
Die Struktur <strong>de</strong>r motorischen Leistungsän<strong>de</strong>rung<br />
über die Zeit analysiert<br />
Okonek anhand <strong>de</strong>r Koeffizienten <strong>de</strong>r an<br />
die individuellen (z-transformierten)<br />
Messwie<strong>de</strong>rholungsreihen angepassten<br />
quadratischen Polynome (Steigungsmaße<br />
<strong>de</strong>r Funktion, Beschleunigung <strong>de</strong>s<br />
Leistungsabfalls). Der Vergleich <strong>de</strong>r<br />
Gradienten <strong>de</strong>r drei leichtathletischen<br />
Disziplinen verweist auf folgen<strong>de</strong><br />
Rangfolge <strong>de</strong>r sportmotorischen<br />
Leistungsabnahme im Erwachsenenalter:<br />
Schnellkraft/Koordination vor<br />
aerober Ausdauer <strong>und</strong> Schnelligkeit. Ab<br />
<strong>de</strong>m 50. Lebensjahr ist – mit beachtlichen<br />
interindividuellen Unterschie<strong>de</strong>n<br />
– eine nicht konstante Beschleunigung<br />
<strong>de</strong>s motorischen Leistungsrückgangs<br />
charakteristisch.<br />
Die komplexen Kausalbeziehungen<br />
zwischen <strong>de</strong>r motorischen Leistungsän<strong>de</strong>rung<br />
über die Zeit <strong>und</strong> <strong>de</strong>n erfassten<br />
personenexternen sowie -internen<br />
Einflussfaktoren schätzen vollständige<br />
rekursive Mo<strong>de</strong>lle. Nicht-rekursive<br />
Pfad- <strong>und</strong> multiple Residualanalysen<br />
dienen <strong>de</strong>r Überprüfung spezieller<br />
Einzelhypothesen. Die Ergebnissauswertungen<br />
weisen <strong>de</strong>n Lebensstil, das<br />
Leistungsniveau, die Persönlichkeit, die<br />
Kontrollüberzeugung, das Trainingsverhalten<br />
<strong>und</strong> die Belastung durch<br />
kritische Lebensereignisse als wichtige<br />
Mo<strong>de</strong>ratorvariablen aus. Von herausragen<strong>de</strong>r<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>für</strong> die motorische<br />
Leistungsentwicklung im Erwachsenenalter<br />
ist <strong>de</strong>r Lebensstil im Kin<strong>de</strong>s <strong>und</strong><br />
Jugendalter. Dieser prägt nicht nur <strong>de</strong>n<br />
Lebensstil zwischen <strong>de</strong>m 40. <strong>und</strong> 60.<br />
Lebensjahr, son<strong>de</strong>rn beeinflusst auch<br />
positiv das Training, das Leistungsniveau<br />
<strong>und</strong> die Ges<strong>und</strong>heit im späteren<br />
Erwachsenenalter (ab 60./70. Lebensjahr).<br />
Das im frühen Erwachsenenalter<br />
(20.-30. Lebensjahr) vorherrschen<strong>de</strong><br />
Leistungsniveau för<strong>de</strong>rt zwar ebenfalls<br />
das Training, das Leistungsniveau <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>n ges<strong>und</strong>en Lebensstil zwischen <strong>de</strong>m<br />
40. <strong>und</strong> 70. Lebensjahr, jedoch nicht die<br />
Ges<strong>und</strong>heit. Nicht weiter überrascht das<br />
Resultat, dass <strong>de</strong>r ges<strong>und</strong>e Lebensstil<br />
<strong>und</strong> die durch Trainingsinterventionen<br />
ausgelösten körperlichen Adaptationen<br />
we<strong>de</strong>r die altersbedingte Verschlechterung<br />
<strong>de</strong>r motorischen Leistung noch die<br />
markante Zunahme <strong>de</strong>r „Krankheitsjahre“<br />
im Lebenslauf verringern können.<br />
Intraindividuelle Plastizität motorischer<br />
Basisfähigkeiten in <strong>de</strong>r Lebensspanne<br />
Pauer (2001; Pauer/Roth, 1993)<br />
analysiert die intraindividuelle Plastizität<br />
motorischer Basisfähigkeiten im<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendleistungssport:<br />
Welche speziellen motorischen Fähigkeitsausprägungen<br />
kann das leistungssportliche<br />
Training bei entsprechen<strong>de</strong>n<br />
genetischen Dispositionen auslösen? Die<br />
Langfristigkeit <strong>de</strong>rartiger Anpassungsprozesse<br />
erfor<strong>de</strong>rt ein quasi-experimentelles<br />
Untersuchungs<strong>de</strong>sign. Querschnittlich<br />
verglichen wer<strong>de</strong>n 1481<br />
Berliner Schüler <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendsportschulen (KJS) <strong>de</strong>r ehemaligen<br />
DDR <strong>und</strong> <strong>de</strong>ren Nachfolgeinstitutionen<br />
mit 1019 unausgelesenen<br />
„Normalschülern“. In <strong>de</strong>n dreijährigen<br />
Längsschnitt gehen 448 Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendliche aus sportbetonten Berliner<br />
Schulen ein. Als Kriteriumswerte dienen<br />
15 motorische Fähigkeitsmessungen<br />
(Schnellkraft, Kraftausdauer, Ausdauer,<br />
Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination).<br />
Die Evaluation <strong>de</strong>r interindividu-<br />
107
108<br />
Traditionen <strong>und</strong> gegenwärtige Trends <strong>de</strong>r motorischen Entwicklungsforschung in Deutschland<br />
ellen Kapazitätsdifferenzen in <strong>de</strong>r<br />
allgemeinen motorischen Leistungsfähigkeit<br />
basiert auf drei Prädiktorvariablen:<br />
Kalendarisches Alter (Querschnitt:<br />
8.–19. Lebensjahr;<br />
Längsschnitt: 13.–15. Lebensjahr),<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Trainingsart.<br />
Die Ergebnisse belegen ein hohes<br />
Plastizitätspotenzial <strong>für</strong> die Ausbildung<br />
<strong>de</strong>r motorischen Basisfähigkeiten. Von<br />
herausragen<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung sind die<br />
speziellen Trainingsinterventionen,<br />
insbeson<strong>de</strong>re die Trainingsart, <strong>de</strong>ssen<br />
Wirkung die an<strong>de</strong>ren Bedingungsfaktoren<br />
vollkommen überlagert. Auffällig<br />
ist die disziplinorientierte Ausprägung<br />
<strong>de</strong>r motorischen Fähigkeitsprofile <strong>de</strong>r<br />
jugendlichen Leistungssportler. In<br />
motorischen Bereichen, <strong>de</strong>nen <strong>für</strong> die<br />
sportartbezogene Leistung keine o<strong>de</strong>r<br />
eine eher untergeordnete Be<strong>de</strong>utung<br />
zukommt, sind leistungssportlich<br />
trainierte Jugendliche überhaupt nicht<br />
o<strong>de</strong>r nur wenig besser als gleichaltrige<br />
Normalschüler. Die Kapazitätsreserven<br />
<strong>de</strong>r motorischen Leistungsfähigkeit<br />
lassen sich anscheinend nur dann<br />
vollständig erschließen, wenn die<br />
entsprechen<strong>de</strong>n Fähigkeiten speziell<br />
trainiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Conzelmann (1997, 1999) evaluiert die<br />
individuellen Entwicklungsverläufe<br />
motorischer Basisfähigkeiten zwischen<br />
<strong>de</strong>m 45. <strong>und</strong> 90. Lebensjahr: Wie<br />
verän<strong>de</strong>rn sich die konditionellen<br />
Fähigkeiten im mittleren bis späteren<br />
Erwachsenenalter? Welche Beziehungen<br />
bestehen zwischen <strong>de</strong>r Entwicklung<br />
konditioneller Fähigkeiten <strong>und</strong> biogenetischen<br />
<strong>und</strong> exogenen Einflussfaktoren?<br />
Die kombinierte Quer- <strong>und</strong> retroperspektive<br />
Längsschnittstudie berücksichtigt<br />
620 langjährig erfolgreiche<br />
Seniorenwettkampfsportler, die <strong>de</strong>r Top-<br />
Ten-Liste <strong>de</strong>r inoffiziellen Seniorenbestenliste<br />
<strong>de</strong>s Deutschen Leichtathletik-<br />
Verban<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r Jahre 1986 <strong>und</strong> 1987<br />
angehören (Reckemeier, 1975-1994).<br />
Die Möglichkeiten <strong>und</strong> die Grenzen <strong>de</strong>r<br />
motorischen Leistungsfähigkeit <strong>de</strong>r<br />
Senioren wer<strong>de</strong>n retrospektiv anhand<br />
<strong>de</strong>r Wettkampfleistungen in verschie<strong>de</strong>nen<br />
leichtathletischen Schnellig-<br />
keits-, Kraft-/Schnellkraft- <strong>und</strong> Ausdauerdisziplinen<br />
bewertet. Die Erforschung<br />
<strong>de</strong>s Erklärungswerts potenzieller<br />
Prädiktorvariablen sportlicher Spitzenleistungen<br />
im mittleren bis späteren<br />
Erwachsenenalter – kalendarisches<br />
Alter, Geschlecht, körperliche Aktivi-<br />
täten, Trainingsumfang, Bewegungs-<br />
<strong>und</strong> Krankheitsbiografie, Lebensgewohnheiten<br />
<strong>und</strong> kritische<br />
Lebensereignisse – stützt sich auf<br />
querschnittliche Fragebogendaten<br />
aktueller Merkmalsausprägungen <strong>de</strong>r<br />
Altersklassen M 45 bis M 75.<br />
Die Ergebnisauswertungen belegen,<br />
dass altersbedingte endogene Prozesse<br />
<strong>und</strong> umwelt<strong>de</strong>terministische biologische<br />
Adaptationen maßgeblich die Ausbildung<br />
<strong>de</strong>r konditionellen Fähigkeiten im<br />
Erwachsenenalter bestimmen. Nach <strong>de</strong>r<br />
motorischen Höchstleistungsphase<br />
führen biologische Alterungsprozesse –<br />
bezogen auf das kalendarische Alter –<br />
zu einer nonlinearen (parabolischen)<br />
Verschlechterung <strong>de</strong>r konditionellen<br />
Fähigkeiten. Positive <strong>und</strong> negative<br />
biologische Adaptationsprozesse fin<strong>de</strong>n<br />
zwar während <strong>de</strong>r gesamten Erwachsenenphase<br />
statt, maximale Ausprägungen<br />
bleiben aber nur über einen eng<br />
begrenzten Lebensabschnitt erhalten.<br />
Auffällig ist, dass sich im Erwachsenenalter<br />
die Wirkungen endogener Prozesse<br />
<strong>und</strong> biologischer Adaptationen in Bezug<br />
auf die Ausbildung <strong>de</strong>r konditionellen<br />
Fähigkeiten zwar addiert, jedoch<br />
bestehen keine Interaktionseffekte.<br />
Des Weiteren können <strong>für</strong> einzelne<br />
konditionelle Fähigkeiten markante<br />
Unterschie<strong>de</strong> im Entwicklungsverlauf<br />
belegt wer<strong>de</strong>n. Zum einen liegt das<br />
motorische Höchstleistungsalter<br />
trainierter Personen in <strong>de</strong>n Schnelligkeits-/Schnellkraftdisziplinen<br />
(100 m,<br />
400 m, Hür<strong>de</strong>n, Sprungdisziplinen)<br />
durchschnittlich zwischen <strong>de</strong>m 20. <strong>und</strong><br />
25. Lebensjahr, während die Spitzenleistungen<br />
in <strong>de</strong>n Kraft-/Schnelligkeits-<br />
(Wurf-/Stoßdisziplinen) <strong>und</strong> Ausdauerdisziplinen<br />
im Alter von 25 bis 35<br />
Jahren erzielt wer<strong>de</strong>n. Zum an<strong>de</strong>ren ist<br />
die Trainierbarkeit <strong>de</strong>r aeroben Ausdauer-<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Maximalkraftfähigkeit im<br />
Vergleich zur Schnelligkeits-, Schnellkraft-<br />
<strong>und</strong> anaeroben Ausdauerfähigkeit<br />
altersunabhängig <strong>de</strong>utlich größer.<br />
Erwähnenswert ist schließlich, dass<br />
biologische Alterungsprozesse die<br />
motorische Entwicklung im frühen <strong>und</strong><br />
mittleren Erwachsenenalter (18./20.–<br />
45./50. Lebensjahr) in einem <strong>de</strong>utlich<br />
geringen Maße beeinflussen als<br />
biologische Adaptationsprozesse. Im<br />
späten <strong>und</strong> späteren Erwachsenenalter<br />
(ab. 45./50. Lebensjahr) nimmt <strong>de</strong>r<br />
Einfluss biologischer Alterungsprozesse<br />
<strong>de</strong>utlich zu, während die relative<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Trainingseinflüsse <strong>für</strong><br />
<strong>de</strong>n Ausprägungsgrad <strong>de</strong>r konditionellen<br />
Fähigkeiten auffällig abnimmt.<br />
Intraindividuelle Plastizität sportmotorischer<br />
Fertigkeitsoptimierungen<br />
Die längsschnittliche Optimierungsstudie<br />
von Wollny (2002) zielt auf die<br />
Aufklärung inter- <strong>und</strong> intraindividueller<br />
Leistungsunterschie<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r Stabilisierung<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Variation/Anpassung<br />
<strong>de</strong>s Tischtennis-Rückhand-Schupfschlags:<br />
Warum lernen <strong>und</strong> optimieren<br />
manche Menschen Bewegungen besser<br />
als an<strong>de</strong>re? Untersucht wer<strong>de</strong>n vier<br />
breit variieren<strong>de</strong> altersbezogene<br />
Prädiktoren: Kalendarisches Alter (10-<br />
59 Jahre), Bewegungsbiografie (Fragebogen<br />
zu alltags-, freizeit-, berufs- <strong>und</strong><br />
sportmotorischen Erfahrungen),<br />
koordinative <strong>und</strong> informationelle<br />
Fähigkeitskomponenten. Das dreistufige<br />
Treatment beginnt mit <strong>de</strong>r Aneignung<br />
<strong>de</strong>r Testbewegung, um bei <strong>de</strong>n 52<br />
Tischtennisnovizinnen ein vergleichbares<br />
Ausgangsniveau <strong>de</strong>r Gr<strong>und</strong>technik<br />
zu gewährleisten. Hierauf folgt eine in<br />
Art, Umfang <strong>und</strong> Intensität standardisierte<br />
Übungsphase zur Stabilisierung<br />
o<strong>de</strong>r Variation/Anpassung <strong>de</strong>s Rückhand-Schupfschlags<br />
[1500 Schläge; 5<br />
Messzeitpunkte (MZP)]. Den Abschluss<br />
bil<strong>de</strong>t ein durch <strong>de</strong>n individuellen<br />
Übungsfortschritt bestimmtes Optimierungstraining<br />
(max. 1440 Versuche;<br />
max. 4 MZP). Das Erreichen eines vorab<br />
festgelegten Lernziels markiert das<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Versuchs. Als Kriteriumsmerkmale<br />
wer<strong>de</strong>n nach jeweils 300 Versuchen<br />
quantitative (Zahl <strong>de</strong>r Übungsversuche<br />
bis zum Erreichen <strong>de</strong>s Lernziels;<br />
Zielgenauigkeit: Trefferquote) <strong>und</strong><br />
qualitative Kenngrößen erhoben<br />
(Bewegungsqualität: Tischtennis-<br />
B<strong>und</strong>estrainer-Rating).<br />
Welches „Steinchen“ kann <strong>de</strong>m<br />
„inkompletten Mosaik“ zur ontogenetischen<br />
Be<strong>de</strong>utung alterskorrelierter<br />
Personenmerkmale durch die Untersuchung<br />
von Wollny (2002) hinzugefügt<br />
wer<strong>de</strong>n. Auffällig ist, dass die Bewegungsbiografie<br />
entschei<strong>de</strong>nd die<br />
interindividuellen Differenzen in <strong>de</strong>r<br />
intraindividuellen Plastizität <strong>de</strong>r<br />
motorischen Optimierungsfähigkeit<br />
prägt. Demgegenüber spielen das<br />
kalendarische Alter <strong>und</strong> offenbar auch<br />
das koordinative, informationelle<br />
Fähigkeitsniveau nur eine untergeord-
nete „ontogenetische Rolle“. Es scheint<br />
weitgehend das von Be<strong>de</strong>utung zu sein,<br />
was die Testpersonen an Bewegungs-<br />
<strong>und</strong> Trainingserfahrungen gemacht <strong>und</strong><br />
vor allem, was sie in <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />
versäumt haben.<br />
Im Einzelnen lassen sich die 52<br />
Probandinnen nach <strong>de</strong>n Fragebogendaten<br />
zur Bewegungsbiografie drei<br />
Gr<strong>und</strong>typen mit hohen, mittleren <strong>und</strong><br />
geringen Bewegungserfahrungen<br />
zuordnen. Zwischen diesen drei<br />
Versuchsgruppen bestehen signifikante<br />
Differenzen in <strong>de</strong>r Anzahl <strong>de</strong>r Übungsversuche<br />
bis zum Erreichen <strong>de</strong>s<br />
Lernziels. Die Prüfung <strong>de</strong>r Wirksamkeit<br />
<strong>de</strong>s Schulungsprogramms belegt nur <strong>für</strong><br />
die standardisierte Übungsphase (1.–5.<br />
MZP) eine be<strong>de</strong>utsame treatmentbedingte<br />
Verbesserung <strong>de</strong>r Zielgenauigkeit<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Bewegungsqualität. Im indi-<br />
vidualisierten Übungsabschnitt (6.–9.<br />
MZP) schei<strong>de</strong>n die Versuchspersonen<br />
bei Erreichen <strong>de</strong>s Lernziels „zwangsläufig“<br />
aus <strong>de</strong>r Studie aus. Für die standardisierte<br />
Übungsphase lassen sich <strong>für</strong> die<br />
Zielgenauigkeit <strong>und</strong> die Bewegungsqualität<br />
be<strong>de</strong>utsame Unterschie<strong>de</strong> zwischen<br />
<strong>de</strong>n drei bewegungsbiografischen<br />
Testgruppen belegen.<br />
Das kalendarische Alter besitzt <strong>de</strong>mgegenüber<br />
einen geringen differenziellen<br />
Erklärungswert <strong>für</strong> die beobachtbaren<br />
interindividuellen Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Fertigkeitsoptimierung. Es bestehen<br />
keine signifikanten Differenzen<br />
zwischen <strong>de</strong>n Altersgruppen in <strong>de</strong>r<br />
Anzahl <strong>de</strong>r Übungsversuche bis zum<br />
Erreichen <strong>de</strong>s Lernziels <strong>und</strong> <strong>für</strong> die<br />
standardisierte Übungsphase (1.–5.<br />
MZP) in <strong>de</strong>r Zielgenauigkeit <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Ausführungsqualität. Das allgemeine<br />
koordinative <strong>und</strong> informationelle<br />
Fähigkeitsniveau besitzt nach linearen<br />
schrittweisen multiplen Regressionsanalysen<br />
ebenfalls nahezu keinen<br />
r Abb. 4: Mögliche Hierarchie in alterskorrelierten Prädiktoren<br />
differenziellen Vorhersagewert <strong>für</strong> die<br />
interindividuellen Differenzen in <strong>de</strong>r<br />
Optimierungsfähigkeit. Inwieweit eine<br />
Hierarchie in altersbezogenen Prädiktoren<br />
existiert – möglicherweise gibt es<br />
direkte <strong>und</strong> indirekte Pfa<strong>de</strong> (vgl. Abb. 4)<br />
–, müssen weitere Analysen aufzeigen.<br />
Multidirektionalität, GewinnVerlust<br />
Dynamik <strong>und</strong> Plastizität bei motorischen<br />
Leistungsdimensionen<br />
Willimczik et al. (2006; Voelker-<br />
Rehage/Willimczik, 2006) greifen drei<br />
be<strong>de</strong>utsame Problemstellungen <strong>de</strong>r<br />
mo<strong>de</strong>rnen Entwicklungsforschung auf:<br />
Wie sehen die Entwicklungsverläufe<br />
innerhalb einer <strong>und</strong> zwischen zwei<br />
motorischen Leistungsdimensionen aus<br />
(Multidirektionalität)? Wie verän<strong>de</strong>rt<br />
sich die GewinnVerlustDynamik <strong>für</strong> die<br />
Motorik über die Lebensspanne? Wie<br />
groß ist die intraindividuelle Plastizität<br />
<strong>de</strong>r Aneignung sportmotorischer<br />
Fertigkeiten im Lebenslauf? Querschnittlich<br />
evaluiert wer<strong>de</strong>n bei 917<br />
Frauen <strong>und</strong> Männern (Alter: 6–89<br />
Jahre) die Aneignung <strong>de</strong>s Jonglierens<br />
(mit Tüchern <strong>und</strong> Bällen) <strong>und</strong> das<br />
motorische Fähigkeitsniveau (maximale<br />
Handkraft, Schnellkraft <strong>de</strong>r Beine,<br />
Aktionsschnelligkeit, Reaktionsfähigkeit,<br />
Beweglichkeit, Gleichgewichtsfähigkeit,<br />
Feinkoordination). Die Prä-Post-<br />
Messungen <strong>de</strong>r intraindividuellen<br />
Plastizität erfassen die Ausgangsleistungen,<br />
die Ausgangskapazitätsreserven<br />
<strong>und</strong> nach sechs Übungseinheiten (à 15<br />
Minuten) die Entwicklungskapazitätsreserven<br />
<strong>de</strong>r Versuchspersonen. Die<br />
Differenz zwischen <strong>de</strong>r Entwicklungs-<br />
<strong>und</strong> Ausgangskapazitätsreserve<br />
<strong>de</strong>finieren Willimczik et al. als die<br />
Lernleistung.<br />
Die Entwicklungskurve <strong>de</strong>r motorischen<br />
Leistungsfähigkeit über die Lebensspan-<br />
ne anhand eines komplexen motorischen<br />
Leistungsin<strong>de</strong>x (Zusammenfassung<br />
<strong>de</strong>r z-transformierten Leistungs-<br />
kennwerte <strong>de</strong>r sportmotorischen Tests)<br />
verweist unter Auspartialisierung <strong>de</strong>s<br />
Einflusses von Geschlecht <strong>und</strong> Sportaktivität<br />
<strong>für</strong> die frühe Lebensphase auf<br />
einen auffälligen Zuwachs (Maximum:<br />
15.–29. Lebensjahr) <strong>und</strong> bis zum<br />
Lebensen<strong>de</strong> auf eine relevante Abnahme<br />
<strong>de</strong>r motorischen Leistungsfähigkeit.<br />
Der Rückgang <strong>de</strong>r Leistungsfähigkeit<br />
verläuft nicht linear, wie i<strong>de</strong>alisierte<br />
(Weiss, 1978; Schmidtbleicher, 1994)<br />
o<strong>de</strong>r aus unterschiedlichen Studien<br />
zusammengestellte Entwicklungskurven<br />
(Beck/Bös, 1995) suggerieren; typisch<br />
ist hingegen unabhängig vom Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Umfang <strong>de</strong>r sportlichen<br />
Aktivität eine Plateaubildung zwischen<br />
<strong>de</strong>m 54. <strong>und</strong> 64. Lebensjahr.<br />
Innerhalb einer speziellen Fähigkeitsdimension<br />
(z. B. Kraft) zeigen die<br />
Teilfähigkeiten ausgesprochen unterschiedliche<br />
Entwicklungsverläufe. Für<br />
die Hand- <strong>und</strong> Sprungkraft besteht bis<br />
zum 19. Lebensjahr (Auspartialisierung<br />
<strong>de</strong>s Einflusses von Geschlecht, Sportaktivität<br />
<strong>und</strong> BMI) ein nahezu paralleler,<br />
<strong>für</strong> die bei<strong>de</strong>n Altersklassen 20. bis 24.<br />
Lebensjahr <strong>und</strong> 30. bis 34. Lebensjahr<br />
ein entgegengesetzter <strong>und</strong> bis zum<br />
Lebensen<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>rum ein weitgehend<br />
paralleler Entwicklungsverlauf. Die<br />
Interaktion zwischen <strong>de</strong>m Lebensalter<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Kraftkomponenten<br />
verweist <strong>für</strong> die 6- bis 34-jährigen auf<br />
eine signifikante relevante Mulitdirektionalität<br />
<strong>und</strong> <strong>für</strong> die 35- bis 79-Jährigen<br />
auf eine Unidirektionalität.<br />
Die GewinnVerlustDynamik <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n<br />
Kraftmerkmale verhält sich ebenfalls<br />
sehr unterschiedlich. Die vertikale<br />
Sprungkraft im Kin<strong>de</strong>s- <strong>und</strong> Jugendalter<br />
<strong>und</strong> die maximale Handkraft im<br />
Erwachsenenalter zeigen <strong>de</strong>utlich<br />
109
110<br />
Traditionen <strong>und</strong> gegenwärtige Trends <strong>de</strong>r motorischen Entwicklungsforschung in Deutschland<br />
höhere Werte als das jeweils an<strong>de</strong>re<br />
Kraftmerkmal. Bei <strong>de</strong>r Sprungkraft liegt<br />
das Höchstleistungsalter trainierter<br />
Personen zwischen <strong>de</strong>m 20. <strong>und</strong> 24.<br />
Lebensjahr, bei <strong>de</strong>r Handkraft hingegen<br />
zwischen <strong>de</strong>m 30. <strong>und</strong> 49. Lebensjahr.<br />
Während die maximale Handkraft im<br />
Lebenslauf nahezu linear abnimmt,<br />
kann <strong>für</strong> die vertikale Sprungkraft in<br />
<strong>de</strong>n Altersklassen 45. bis 49. Lebensjahr<br />
<strong>und</strong> 65. bis 69. Lebensjahr ein Leistungsplateau<br />
beobachtet wer<strong>de</strong>n.<br />
Der unterschiedliche Entwicklungsverlauf<br />
<strong>de</strong>r Gleichgewichtsfähigkeit <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r Lernleistung im Jonglieren <strong>de</strong>utet<br />
darauf hin, dass zwischen bei<strong>de</strong>n<br />
motorischen Leistungsbereichen keine<br />
engen Beziehungen bestehen <strong>und</strong> dass<br />
es unzulässig ist, von einer koordinativen<br />
Teilkomponente unmittelbar auf<br />
die sportmotorische Lernleistung<br />
zurückzuschließen. In Übereinstimmung<br />
mit Joch <strong>und</strong> Hasenberg (1991, 1993:<br />
Jonglieren, Badminton) <strong>und</strong> Willimczik,<br />
Meierarend, Pollmann <strong>und</strong> Reckeweg<br />
(1999: Pedalofahren, Skitrainer) verfügt<br />
<strong>de</strong>r Mensch lebenslang über eine hohe<br />
intraindividuelle Plastizität <strong>de</strong>r Fertigkeitsaneignung.<br />
Unstrittig ist, dass das<br />
Jonglieren vor <strong>de</strong>r Pubertät nicht besser<br />
erlernt wird als nach <strong>de</strong>r Pubertät, <strong>und</strong><br />
dass die motorische Lernleistung nach<br />
<strong>de</strong>r Pubertät weiter ansteigt. Auch sind<br />
ältere Menschen durchaus in <strong>de</strong>r Lage<br />
neue Bewegungen zu erlernen. Es<br />
besteht bis ins hohe Alter eine Entwicklungskapazitätsreserve;<br />
die Ausgangsleistung<br />
<strong>de</strong>r Senioren ist zwar <strong>de</strong>utlich<br />
geringer als bei Jugendlichen <strong>und</strong><br />
jungen Erwachsenen, nicht jedoch als<br />
bei Erwachsenen ab <strong>de</strong>m 30. Lebensjahr.<br />
Zusammenfassung <strong>und</strong> Ausblick<br />
Die lange Jahre kontrovers geführte<br />
Diskussion über die beste Entwicklungstheorie<br />
scheint aufgr<strong>und</strong> uneinheitlicher<br />
theoretischer Vorstellungen <strong>und</strong><br />
empirischer Bef<strong>und</strong>e in eine „entwicklungstheoretische<br />
Sackgasse“ geraten<br />
zu sein. Zwar ist die neueste Entwicklungstheorie<br />
nicht automatisch die<br />
Beste. Unverkennbar ist aber, dass<br />
mo<strong>de</strong>rne Konzepte die Ontogenese<br />
umfassen<strong>de</strong>r betrachten als klassische<br />
Ansätze. Perspektivisch kommt <strong>de</strong>r<br />
metatheoretischen Rahmenkonzeption<br />
<strong>de</strong>r Entwicklungspsychologie <strong>de</strong>r<br />
Lebensspanne von Baltes – insbeson<strong>de</strong>re<br />
<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Leitsätzen <strong>de</strong>s Kontextualismus<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r intraindividuellen Plastizität<br />
– aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r hohen Integrationsfähigkeit<br />
verschie<strong>de</strong>ner entwick-<br />
lungstheoretischer Auffassungen <strong>und</strong><br />
empirischer Bef<strong>und</strong>e eine große<br />
Innovationskraft <strong>für</strong> die zukünftige<br />
Forschung zu lebenslaufbezogenen<br />
Fragen <strong>de</strong>r motorischen Entwicklung zu.<br />
Von beson<strong>de</strong>rem wissenschaftlichen<br />
Interesse ist die Prüfung <strong>de</strong>s spezifischen<br />
Einflusses potenzieller Entwicklungsfaktoren<br />
(z. B. Bewegungsbiografie,<br />
Kulturvariablen, nicht-normative<br />
Einflüsse) unter extern vali<strong>de</strong>n, ökologischen<br />
Kontextbedingungen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Annahmen <strong>de</strong>s Kontextualismus zum<br />
komplexen Bedingungsgefüge <strong>de</strong>r<br />
Ontogenese. Zeitwan<strong>de</strong>l-Untersuchungen<br />
<strong>und</strong> kulturvergleichen<strong>de</strong><br />
Studien helfen hier Universalien <strong>und</strong><br />
zeit-kulturspezifische Ursache-<br />
Wirkungszusammenhänge <strong>de</strong>r motorischen<br />
Entwicklung abzugrenzen<br />
(Roth/Wollny, 1999b). Generell ist zu<br />
berücksichtigen, dass im Bereich <strong>de</strong>r<br />
motorischen Ontogenese das komplexe<br />
Bedingungsgefüge <strong>de</strong>r vielfältigen<br />
Einflussfaktoren nur schwer als Ganzes<br />
überprüft wer<strong>de</strong>n kann. In überschaubarer<br />
Zukunft wird sich die sportwissenschaftliche<br />
Entwicklungsforschung<br />
noch mit partiellen Analysen begnügen<br />
müssen (z. B. <strong>de</strong>m Einfluss konditioneller<br />
Fähigkeiten, motorischer Aneignung<br />
o<strong>de</strong>r Optimierung, sporttypischer<br />
Sozialisationsprozesse), die interpretativ<br />
in einen Gesamtrahmen wissenschaftlich<br />
einzuordnen sind.<br />
Literatur:<br />
Baltes, P. B. (1987). Theoretical<br />
propositions of life-span<br />
<strong>de</strong>velopment psychology: On the<br />
dynamics between growth and<br />
<strong>de</strong>cline. Developmental Psychology,<br />
23, 611–626.<br />
Baltes, P. B. (1990). Entwicklungspsychologie<br />
<strong>de</strong>r Lebensspanne.<br />
Theoretische Leitsätze. Psychologische<br />
R<strong>und</strong>schau, 41, 1–24.<br />
Baltes, P. B. (1997). Die unvollen<strong>de</strong>te<br />
Architektur <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Ontogenese: Implikationen <strong>für</strong><br />
die Zukunft <strong>de</strong>s vierten Lebensalters.<br />
Psychologische R<strong>und</strong>schau,<br />
48, 191–210.<br />
Baltes, P. B./Lin<strong>de</strong>nberger, U./<br />
Staudinger, U. M. (1998). Lifespan<br />
theory in <strong>de</strong>velopmental<br />
psychology. In R. M. Lerner (Ed.),<br />
Handbook of child <strong>de</strong>velopment.<br />
Vol. 1. Theoretical mo<strong>de</strong>ls of<br />
human <strong>de</strong>velopment (pp. 1029–<br />
1143). New York: Wiley and<br />
Sons.<br />
Baltes, P. B./Staudinger, U. M./<br />
Lin<strong>de</strong>nberger, U. (1999). Lifespan<br />
psychology: Theory and<br />
application to intellectual<br />
functioning. Annual Review of<br />
Psychology, 50, 471–507.<br />
Beck, J./Bös, K. (1995). Normwerte<br />
motorischer Leistungsfähig<br />
keit. Köln: Sport <strong>und</strong> Buch<br />
Strauß.<br />
Conzelmann, A. (1997). Entwicklung<br />
konditioneller Fähigkeiten im<br />
Erwachsenenalter. Schorndorf:<br />
Hofmann.<br />
Conzelmann, A. (1999). Plastizität<br />
motorischer Fähigkeiten im<br />
Lebensverlauf. Theoretischmethodische<br />
Überlegungen <strong>und</strong><br />
empirische Bef<strong>und</strong>e. psychologie<br />
<strong>und</strong> sport, 3, 76–89.<br />
Diettrich, M. (1981). Umwelt, Spiel<br />
<strong>und</strong> Bewegung. In M. Diettrich<br />
(Hrsg.), Kritische Sporttheorie.<br />
Alternativen <strong>für</strong> die Sport <strong>und</strong><br />
Bewegungserziehung (S. 74–<br />
108). Köln: Pahl-Rugenstein.<br />
Filipp, S.-H. (1995 3 ). Ein allge-<br />
meines Mo<strong>de</strong>ll <strong>für</strong> die Analyse<br />
kritischer Lebensereignisse. In<br />
S.-H. Filipp (Hrsg.), Kritische<br />
Lebensereignisse (S. 3–52).<br />
Weinheim: Psychologie Verlags<br />
Union.<br />
Frankfurter Arbeitsgruppe (1982).<br />
Offener Sportunterricht –<br />
analysieren <strong>und</strong> planen. Reinbek:<br />
Rowohlt.<br />
Funke, J. (1979). Selbständige<br />
Eroberungen im erziehlichen<br />
Milieu. Sportwissenschaft, 9,<br />
370–395.<br />
Heinemann, K. (1983). Einführung in<br />
die Soziologie <strong>de</strong>s Sports.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
Hirtz, P. (1985). Koordinative<br />
Fähigkeiten im Schulsport.<br />
Berlin: Volk <strong>und</strong> Wissen.<br />
Joch, W./Hasenberg, R. (1991).<br />
Lernalter <strong>und</strong> motorische<br />
Lernleistungen. Zur Frage <strong>de</strong>s
optimalen Lernalters bei Kin<strong>de</strong>rn<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen. sportunterricht,<br />
40, 216–222.<br />
Joch, W./Hasenberg, R. (1993).<br />
Motorische Entwicklung <strong>und</strong><br />
altersabhängige motorische<br />
Lernleistungen. Sport Praxis, 3,<br />
3–5.<br />
Mester, L. (1962). Gr<strong>und</strong>fragen <strong>de</strong>r<br />
Leibeserziehung. Braunschweig:<br />
Westermann.<br />
Möckelmann, H./Schmidt, D.<br />
(1952/1981 9 ). Leibeserziehung<br />
<strong>und</strong> jugendliche Entwicklung.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
Neumann, O. (1964). Die leibseelische<br />
Entwicklung im Jugendalter.<br />
München: Barth.<br />
Okonek, C. (1996). Lebensspannen-<br />
Entwicklungspsychologie <strong>und</strong><br />
motorische Entwicklung im<br />
Erwachsenenalter. Ergebnisse<br />
aus einer retrospektiven<br />
Längsschnittstudie. In H. Denk<br />
(Hrsg.), Alterssport: Aktuelle<br />
Forschungsergebnisse (S. 117–<br />
139). Schorndorf: Hofmann.<br />
Okonek, C. (2000) Längsschnittanalysen<br />
<strong>und</strong> Kausalmo<strong>de</strong>lle zur<br />
sportlichen Leistungsentwicklung<br />
im Erwachsenenalter.<br />
Habilitationsschrift. Bonn:<br />
Universität Bonn.<br />
Pauer, T. (2001). Die motorische<br />
Entwicklung leistungssportlich<br />
trainieren<strong>de</strong>r Jugendlicher.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
Pauer, T./Roth, K. (1993). Jugendliche<br />
Leistungssportler – motorische<br />
Spezialisten o<strong>de</strong>r Allro<strong>und</strong>er?<br />
sportunterricht, 42,<br />
405–411.<br />
Piaget, J. (1966). Psychologie <strong>und</strong><br />
Intelligenz. Zürich: Rascher.<br />
Piaget, J. (1970). Piagets theory. In<br />
P. H. Mussen (Ed.), Carmichael’s<br />
Manual of Child Psychology (pp.<br />
703–732). New York: Wiley.<br />
Piaget, J. (1976). Die Äquilibration<br />
<strong>de</strong>r kognitiven Strukturen.<br />
Stuttgart: Klett.<br />
Reckemeier, J. (1975–1994).<br />
SeniorenLeichtathletik.<br />
Ol<strong>de</strong>nburg: Eigenverlag.<br />
Roth, K./Wollny, R. (1999a).<br />
Differentielle Aspekte in <strong>de</strong>r<br />
motorischen Entwicklung. In J.<br />
Wiemeyer (Hrsg.), Forschungsmethodologische<br />
Aspekte von<br />
Bewegung, Motorik <strong>und</strong> Training<br />
im Sport (S. 170–177). Hamburg:<br />
Czwalina.<br />
Roth, K./Wollny, R. (1999b).<br />
Motorische Entwicklung in <strong>de</strong>r<br />
Lebensspanne – Forschungsmethodische<br />
Perspektiven. psychologie<br />
<strong>und</strong> sport, 6, 102–112.<br />
Roth, K.,/Pauer, T./Kimura, M./Ono,<br />
K./Wakayoshi, K./Momenya, T.<br />
(2000). Zur Allgemein<strong>motorik</strong><br />
japanischer <strong>und</strong> <strong>de</strong>utscher<br />
Jugendlicher. In R. Naul/Y. Oka<strong>de</strong><br />
(Hrsg.), Sportwissenschaft in<br />
Deutschland <strong>und</strong> Japan (S. 150–<br />
172). Aachen: Meyer & Meyer.<br />
Scherler, K.-H. (1975). Sensomotorische<br />
Entwicklung <strong>und</strong> materiale<br />
Erfahrung. Schorndorf:<br />
Hofmann.<br />
Schmidt, L. R. (1971). Testing the<br />
limits im Leistungsverhalten:<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen. In<br />
E. Duhm (Hrsg.), Praxis <strong>de</strong>r<br />
klinischen Psychologie (S. 2–29).<br />
Göttingen: Hogrefe.<br />
Schmidtbleicher, D. (1994). Entwicklung<br />
<strong>de</strong>r Kraft <strong>und</strong> Schnelligkeit.<br />
In J. Baur/K. Bös/R.<br />
Singer (Hrsg.), Motorische<br />
Entwicklung. Ein Handbuch (S.<br />
129–150). Schorndorf: Hofmann.<br />
Skinner, B. F. (1953). Science and<br />
human behavior. New York: Mac<br />
Millan.<br />
Voelcker-Rehage, C./Willimczik, K.<br />
(2006). Motor plasticity in a<br />
juggling task in ol<strong>de</strong>r adults a<br />
<strong>de</strong>velopmental study. Age and<br />
Ageing, 35, 422–427.<br />
Voigt, D. (1978). Soziale Schichtung<br />
im Sport. Berlin: Bartels &<br />
Wernitz.<br />
Weiss, U. (1978). Biologische<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> körperliche<br />
Leistungsfähigkeit. In K. Egger<br />
(Hrsg.), Turnen <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r<br />
Schule (S. 33–61). Bern:<br />
Eidgenössische Drucksachen<br />
<strong>und</strong> Materialzentrale.<br />
Willimczik, K. (1983). Sportmotorische<br />
Entwicklung. In K.<br />
Willimczik/K. Roth (Hrsg.),<br />
Bewegungslehre (S. 240–353).<br />
Reinbek: Rowohlt.<br />
Willimczik, K./Conzelmann, A.<br />
(1999). Motorische Entwicklung<br />
<strong>de</strong>r Lebensspanne. Kernannahmen<br />
<strong>und</strong> Leitorientierungen.<br />
psychologie <strong>und</strong> sport,<br />
2, 60–70.<br />
Willimczik, K./Meierarend, E.-M./<br />
Pollmann, D./Reckeweg, R.<br />
(1999). Das „beste motorische<br />
Lernalter“ – Forschungsergebnisse<br />
zu einem pädagogischen<br />
Postulat <strong>und</strong> zu<br />
kontroversen empirischen<br />
Bef<strong>und</strong>en. Sportwissenschaft,<br />
1, 42–61.<br />
Willimczik, K./Voelcker-Rehage, C./<br />
Wiertz, O. (2006). Sportmotorische<br />
Entwicklung über die<br />
Lebensspanne. Empirische<br />
Bef<strong>und</strong>e zu einem theoretischen<br />
Konzept. <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> Sportpsychologie,<br />
13, 10–22.<br />
Wollny, R. (2002). Motorische<br />
Entwicklung in <strong>de</strong>r Lebensspanne<br />
– Warum lernen <strong>und</strong> optimieren<br />
manche Menschen Bewegungen<br />
besser als an<strong>de</strong>re? Schorndorf:<br />
Hofmann.<br />
Zimmer, R. (1981). Motorik <strong>und</strong><br />
Persönlichkeitsentwicklung bei<br />
Kin<strong>de</strong>rn im Vorschulalter.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
111
112<br />
Buchbesprechungen / Neuerscheinungen<br />
Buchbesprechungen / Neuerscheinungen<br />
Dräbing, Reinhard (Hrsg.)<br />
Kin<strong>de</strong>r brauchen Bewegung!<br />
Bewegung in <strong>de</strong>r Jugendhilfe?<br />
Aachen: Meyer & Meyer, 2006.<br />
ISBN 3898991644<br />
23,95 e<br />
Schon die Titelgestaltung<br />
macht klar: hier han<strong>de</strong>lt es<br />
sich um ein programmatisches<br />
Buch. Kin<strong>de</strong>r<br />
brauchen Bewegung! Mit<br />
Ausrufezeichen also.<br />
Bewegung in <strong>de</strong>r Jugendhilfe?<br />
Hier steht das Fragezeichen.<br />
Alle 24 Artikel dieses,<br />
mit viel Engagement von<br />
Praktikern aus <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe geschriebene<br />
Buch dreht sich um<br />
dieses Thema. Kin<strong>de</strong>r<br />
brauchen Bewegung: „man“<br />
weiß dies eigentlich schon<br />
immer, die neuesten<br />
Forschungsergebnisse <strong>de</strong>r<br />
Neurowissenschaften<br />
belegen dies – wie <strong>de</strong>r<br />
Herausgeber in seinem<br />
einleiten<strong>de</strong>n Artikel belegt.<br />
Die Realität in <strong>de</strong>n pädagogischen<br />
Institutionen, in<br />
Kin<strong>de</strong>rgärten, in <strong>de</strong>n Schulen<br />
<strong>und</strong> – wie hier gezeigt –<br />
auch in <strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendhilfeeinrichtungen<br />
sieht an<strong>de</strong>rs aus.<br />
Nach<strong>de</strong>m im 1. Kapitel <strong>de</strong>r<br />
Sport im Heim als ungelöstes<br />
Problem in politischen<br />
Verantwortlichkeiten<br />
verortet <strong>und</strong> auf die Diskrepanz<br />
zwischen Wissen <strong>und</strong><br />
Wirklichkeit aufmerksam<br />
gemacht wur<strong>de</strong>, wird im<br />
folgen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Leser aus <strong>de</strong>r<br />
Erfahrung von Menschen, die<br />
<strong>de</strong>r Praxis von Bewegung,<br />
Spiel <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendhilfe sehr<br />
nahe stehen, ein breites<br />
Spektrum an Möglichkeiten<br />
geboten, wie – trotz<br />
Geldmangel <strong>und</strong> manchmal<br />
politischer Wi<strong>de</strong>rstän<strong>de</strong> –<br />
durch Kreativität <strong>und</strong><br />
Solidarität mit <strong>de</strong>n Betroffenen<br />
Wege gef<strong>und</strong>en<br />
wer<strong>de</strong>n können es <strong>de</strong>nnoch<br />
zu tun: ein Innovationskonzept<br />
<strong>für</strong> Sport, Kampfkunst<br />
als Selbstbehauptungstraining,<br />
Ästhetische Praxis als<br />
Möglichkeit <strong>de</strong>r sensomotorischen<br />
För<strong>de</strong>rung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Symbolbildung, psychomotorische<br />
För<strong>de</strong>rung mit<br />
hyperaktiven Kin<strong>de</strong>rn,<br />
Bewegungslandschaften,<br />
Schwimmen, Kreative<br />
Körperarbeit mit Mädchen,<br />
Tanz als Entwicklungs <strong>und</strong><br />
Bewegungsmöglichkeit <strong>für</strong><br />
Jugendliche mit Lernbehin<strong>de</strong>rung,<br />
sowie auch ein<br />
Angebot an „Alternativer<br />
Leichtathletik“.<br />
Hilfreich ist <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Leser<br />
auch eine ausgewählte<br />
Biographie zum Sport in <strong>de</strong>r<br />
Jugendhilfe.<br />
Hammer, Richard<br />
Bewegung allein genügt<br />
nicht<br />
Dortm<strong>und</strong>: verlag mo<strong>de</strong>rnes<br />
lernen, 2001.<br />
ISBN 3808004886<br />
19,95 e<br />
Die Psycho<strong>motorik</strong> hat sich als<br />
pädagogische <strong>und</strong> therapeutische<br />
Maßnahme in <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
bewährt, stößt allerdings in<br />
ihrer Wirksamkeit an Grenzen,<br />
wenn nicht auch <strong>de</strong>r Alltag<br />
von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
entsprechend gestaltet wird.<br />
Darum geht es in diesem<br />
Buch: es geht um Wege, die<br />
<strong>für</strong> eine ges<strong>und</strong>e Entwicklung<br />
von Kin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
eröffnet wer<strong>de</strong>n müssen. Es<br />
geht um das kindliche Leben<br />
<strong>und</strong> Erleben. Es geht letztlich<br />
um die Frage: wie sorgen wir<br />
als Erwachsene – aus <strong>de</strong>r<br />
Sicht <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong> –<br />
da<strong>für</strong>, dass Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendliche Lebensbedingungen<br />
vorfin<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>nen<br />
sie so etwas wie eine Heimat<br />
fin<strong>de</strong>n, etwas in <strong>de</strong>m sie zur<br />
Persönlichkeit wachsen <strong>und</strong><br />
die Lebenswelt erhalten<br />
können.<br />
Knab, Eckhart<br />
Sport in <strong>de</strong>r Heimerziehung.<br />
Frankfurt a. M.: Peter Lang,<br />
1999<br />
ISBN 3631341350<br />
40,00 e<br />
In dieser 1998 vorgelegten<br />
Dissertationsschrift wird auf<br />
empirischer Gr<strong>und</strong>lage die<br />
Be<strong>de</strong>utung von Bewegung,<br />
Spiel <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe dargestellt.<br />
Nach einer Einführung zur<br />
Klärung <strong>und</strong> Abgrenzung <strong>de</strong>r<br />
Begriffe aus <strong>de</strong>m Bereich<br />
Sport (Leibeserziehung, Sport,<br />
Bewegungserziehung,<br />
Sportwissenschaft, Sportpädagogik,<br />
Psycho<strong>motorik</strong>, <strong>Motopädagogik</strong>,<br />
Motologie) wird<br />
die aktuelle Situation in <strong>de</strong>r<br />
Heimerziehung dargestellt.<br />
Dem folgt ein historischer<br />
Überblick über die Be<strong>de</strong>utung<br />
von Bewegung, Spiel<br />
<strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />
Jugendhilfe bis heute. Dabei<br />
wird insbeson<strong>de</strong>re die<br />
Psycho<strong>motorik</strong> bzw. <strong>Motopädagogik</strong><br />
berücksichtigt.<br />
Im empirischen Teil wird <strong>de</strong>r<br />
aktuelle Stand <strong>de</strong>r Sport<br />
<strong>und</strong> Bewegungserziehung in<br />
<strong>de</strong>n Institutionen <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe dargestellt.<br />
Wichtige For<strong>de</strong>rungen, die<br />
sich aus <strong>de</strong>r Untersuchung<br />
ergaben sind:<br />
1. Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r<br />
Sportpädagogik im Heim<br />
muss ver<strong>de</strong>utlicht wer<strong>de</strong>n<br />
2. Sport als Freizeitpädagogik<br />
<strong>und</strong> Sport als <strong>Motopädagogik</strong><br />
in <strong>de</strong>r Heimerziehung<br />
sind systematisch<br />
zu för<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> weiter zu<br />
entwickeln,<br />
3. <strong>für</strong> Untersuchungen zur<br />
Effektivität <strong>und</strong> zur<br />
Effizienz von Sportpädagogik<br />
besteht Handlungsbedarf.<br />
Klaus Fischer<br />
Rusch, Horst / Weineck, Jürgen<br />
Sportför<strong>de</strong>runterricht<br />
6., überarb. <strong>und</strong> erw. Aufl.<br />
2007.<br />
Schorndorf, HofmannVerlag.<br />
ISBN 9783778093764<br />
34,– e<br />
Das 1998 in 5. Auflage neu<br />
bearbeitete bewährte Lehr<br />
buch <strong>de</strong>s Sportför<strong>de</strong>runterrichts<br />
liegt nun in<br />
überarbeiteter <strong>und</strong> erweiterter<br />
6. Auflage vor. Fast<br />
zehn Jahre sind also seit <strong>de</strong>r<br />
letzten Aktualisierung dieses
Klassikers auf <strong>de</strong>m Gebiet<br />
<strong>de</strong>s Sportför<strong>de</strong>runterrichts<br />
vergangen <strong>und</strong> wenn die<br />
neue Auflage <strong>de</strong>s Rusch/<br />
Weineck auf <strong>de</strong>n ersten Blick<br />
auch nicht so gewaltig ver<br />
än<strong>de</strong>rt erscheint, so sind die<br />
Verän<strong>de</strong>rungen doch<br />
wesentlich: Erweitert wur<strong>de</strong><br />
das Kapitel 4.3 Bewegte<br />
Schule. In <strong>de</strong>r 5. Auflage nur<br />
kurz angerissen, wer<strong>de</strong>n jetzt<br />
konkrete Erfahrungen <strong>und</strong><br />
Ergebnisse aus Projekten in<br />
verschie<strong>de</strong>nen B<strong>und</strong>eslän<strong>de</strong>rn<br />
mit über 700 000<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
präsentiert, die einen<br />
sogenannten „Bewegungs<br />
Checkup“ durchlaufen ha<br />
ben. Kernpunkt <strong>de</strong>s BewegungsCheckups<br />
bil<strong>de</strong>t<br />
dabei <strong>de</strong>r von Rusch/Irrgang<br />
entwickelte erweiterte<br />
Münchner Fitnesstest, <strong>de</strong>r<br />
sich damit auf B<strong>und</strong>esebene<br />
etabliert hat <strong>und</strong> <strong>de</strong>m im<br />
Buch ein ausführliches<br />
Kapitel gewidmet ist. Dort<br />
wird auch auf die Möglichkeit<br />
<strong>de</strong>s Herunterla<strong>de</strong>ns im<br />
Internet hingewiesen. Lei<strong>de</strong>r<br />
fin<strong>de</strong>t sich die gegenüber <strong>de</strong>r<br />
5. Auflage ergänzte 7. Test<br />
übung (aerobe Ausdauer)<br />
nicht in <strong>de</strong>n Normierungstabellen,<br />
wie sie <strong>für</strong> die Übun<br />
gen 1–6 vorliegen. (Eine<br />
Rückfrage bei <strong>de</strong>n Autoren<br />
Rusch/Irrgang hat ergeben,<br />
dass <strong>de</strong>r MFT vom Kultusministerium<br />
Nie<strong>de</strong>rsachsen<br />
eigenmächtig <strong>für</strong> seine<br />
Aktion „Schulen in Bewegung“<br />
um eine 7. Übung<br />
erweitert wur<strong>de</strong>, ohne dass<br />
die Autoren darüber infor<br />
miert wor<strong>de</strong>n sind <strong>und</strong> ohne<br />
dass eine Normierungstabel<br />
le vorgelegt wur<strong>de</strong>.) Hinzugekommen<br />
sind die Kapitel<br />
5.2.6.1 <strong>und</strong> 5.2.6.2 „Aufmerksamkeitsgestörte,<br />
hyperaktive Kin<strong>de</strong>r“ <strong>und</strong><br />
„Dicke Kin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Jugendliche“,<br />
die <strong>de</strong>r verän<strong>de</strong>rten<br />
gesellschaftlichen Situation<br />
Rechnung tragen. Auch „Die<br />
inhaltlichen Säulen <strong>de</strong>r<br />
Karlsruher Rückenschule“<br />
<strong>und</strong> das neue Kapitel<br />
„Rückenschmerzen“ mit<br />
weiterführen<strong>de</strong>n Internet<br />
Adressen sind vor <strong>de</strong>m<br />
Hintergr<strong>und</strong> zunehmen<strong>de</strong>r<br />
Haltungsschä<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
Rückenprobleme von immer<br />
mehr Schulkin<strong>de</strong>rn ein<br />
wichtiger Beitrag zur<br />
Ges<strong>und</strong>heitserziehung. Neu<br />
ist auch das entzücken<strong>de</strong><br />
Titelbild, das statt zweier<br />
konservativer Übungen nun<br />
das Foto eines Kin<strong>de</strong>s im<br />
Vorschulalter zeigt, das<br />
hochkonzentriert an einer<br />
Boul<strong>de</strong>rwand klettert. Damit<br />
erhält <strong>de</strong>r Sportför<strong>de</strong>runterricht<br />
schon rein optisch<br />
einen an<strong>de</strong>ren Schwerpunkt.<br />
Das traditionelle rein ge<br />
s<strong>und</strong>heitsorientierte <strong>und</strong><br />
etwas trockene Bild <strong>de</strong>s<br />
Sportför<strong>de</strong>runterrichts wird<br />
aufgebrochen <strong>und</strong> erfährt<br />
durch Abenteuer <strong>und</strong><br />
Erlebnissport neue Impulse,<br />
weg von <strong>de</strong>r speziellen För<br />
<strong>de</strong>rung leistungsschwacher<br />
Schüler, hin zur För<strong>de</strong>rung<br />
aller durch <strong>de</strong>n zunehmen<br />
<strong>de</strong>n Bewegungsmangel in<br />
ihrer Entwicklung bedrohten<br />
Kin<strong>de</strong>r. Im Buch wird aller<br />
dings kein Bezug auf die<br />
Boul<strong>de</strong>rwand als Teil einer<br />
erlebnisorientierten Bewegungserfahrung<br />
genommen,<br />
zumin<strong>de</strong>st eine Bemerkung<br />
hätte ich erwartet. Offenbar<br />
haben drucktechnische<br />
Abläufe dies verhin<strong>de</strong>rt. Weitere<br />
kleine Kritikpunkte sind:<br />
Wünschenswert gewesen<br />
wäre eine Aktualisierung <strong>de</strong>r<br />
Statistiken, ebenso eine<br />
Erweiterung <strong>de</strong>r Übungsgeräte<br />
(Igelbälle u. a.). Beim<br />
unverän<strong>de</strong>rten, sehr guten<br />
Kapitel Entspannung haben<br />
die Überarbeiter im Text<br />
versäumt, das 5MarkStück<br />
gegen ein EuroStück<br />
auszutauschen – nicht<br />
wichtig, aber nicht aktualisiert.<br />
Insgesamt aber fällt die<br />
Beurteilung ausgesprochen<br />
positiv aus. Die Übungen<br />
bieten eine Fülle von Hin<br />
weisen <strong>für</strong> je<strong>de</strong>n Einsteiger.<br />
Der neue Rusch/Weineck<br />
wird sowohl <strong>de</strong>m gerecht,<br />
<strong>de</strong>r schnell einige Übungen<br />
braucht als auch <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r<br />
sich Hintergr<strong>und</strong>wissen er<br />
arbeiten will. Darüber hinaus<br />
sind die Übungen nicht nur<br />
<strong>für</strong> <strong>de</strong>n Sportför<strong>de</strong>runterricht<br />
einsetzbar, son<strong>de</strong>rn auch <strong>für</strong><br />
<strong>de</strong>n allgemeinen Sportunterricht<br />
<strong>und</strong> teilweise auch sehr<br />
gut geeignet <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Er<br />
wachsenen <strong>und</strong> Seniorensport.<br />
Maria Huber<br />
Rockemann, Ulrike/<br />
Bömermann, Hartmut<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>r sportwissenschaftlichenForschungsmetho<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> Statistik<br />
Schorndorf: Hofmann, 2006.<br />
ISBN 9783778091203<br />
29,90 e<br />
Das Buch soll Studieren<strong>de</strong>n<br />
eine Hilfestellung sein, einen<br />
ersten Zugang zu <strong>de</strong>n<br />
Forschungsmetho<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>n statistischen Verfahren,<br />
die <strong>für</strong> die Sportwissenschaft<br />
Relevanz besitzen, zu<br />
bekommen. Als ein Band <strong>de</strong>r<br />
Lehrbuchreihe „Gr<strong>und</strong>lagen<br />
<strong>de</strong>r Sportwissenschaft“<br />
nimmt es Bezug auf die<br />
Schil<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>n<br />
an<strong>de</strong>ren Büchern <strong>und</strong> behan<strong>de</strong>lt<br />
die dort aufgegriffenen<br />
Forschungsmetho<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n<br />
Gr<strong>und</strong>zügen. Es soll eine<br />
allgemeine Einführung in die<br />
Denkweise vermitteln, die<br />
<strong>de</strong>r empirischen Forschung<br />
zugr<strong>und</strong>e liegt. Zu diesem<br />
Kurs wird ein ergänzen<strong>de</strong>r<br />
OnlineKurs empfohlen<br />
(www.sportwissenschaftaka<strong>de</strong>mie.<strong>de</strong>).<br />
Hartmann-Tews, Ilse/<br />
Rulofs, Bettina (Hrsg.)<br />
Handbuch Sport <strong>und</strong><br />
Geschlecht<br />
Schorndorf: Hofmann, 2006.<br />
ISBN 9783778045800<br />
29,90 e<br />
Nach ersten Beiträgen zu<br />
<strong>de</strong>m Thema „Sport <strong>und</strong><br />
Geschlecht“ in <strong>de</strong>n 1980er<br />
Jahren hat die Geschlechterforschung<br />
mittlerweile<br />
Einzug in die Sportwissenschaft<br />
gehalten. Der<br />
vorliegen<strong>de</strong> Band versammelt<br />
erstmalig systematisch<br />
Analysen zu verschie<strong>de</strong>nen<br />
thematischen Fel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r<br />
sportwissenschaftlichen<br />
Geschlechterforschung in<br />
einem Werk. Das Buch liefert<br />
damit gr<strong>und</strong>legen<strong>de</strong><br />
Einsichten zur Geschlechterordnung<br />
im Sport aus <strong>de</strong>r<br />
Perspektive <strong>de</strong>r Sportsoziologie,<br />
pädagogik, psychologie,<br />
<strong>motorik</strong>, geschichte<br />
<strong>und</strong> politik <strong>und</strong> gibt in<br />
thematischer Breite einen<br />
Überblick über die relevanten<br />
Forschungsthemen.<br />
Melanie Behrens<br />
Die Buchbesprechungen/<br />
Neuerscheinungen<br />
wer<strong>de</strong>n in Motorik<br />
3/2007 fortgesetzt.<br />
113
114<br />
<strong>Zeitschrift</strong>enspiegel<br />
<strong>Zeitschrift</strong>enspiegel<br />
Die hier aufgeführten<br />
Artikel stellen einen<br />
zusammenfassen<strong>de</strong>n<br />
Überblick aus diversen<br />
<strong>Zeitschrift</strong>en dar, die <strong>für</strong><br />
das Fachgebiet Psycho<strong>motorik</strong>/Motologie<br />
von<br />
Be<strong>de</strong>utung sind. Folgen<strong>de</strong><br />
<strong>Zeitschrift</strong>en sehen wir <strong>für</strong><br />
unsere Leser regelmäßig<br />
durch:<br />
• „Behin<strong>de</strong>rte“: Reha-Druck,<br />
Graz<br />
• „Ergotherapie & Reha-<br />
bilitation“: Schulz-<br />
Kirchner, Idstein<br />
• „Frühför<strong>de</strong>rung interdisziplinär“:<br />
Reinhardt,<br />
München/Basel<br />
Praxis <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong><br />
Jahrgang 2005<br />
Panten, D.: Effekte <strong>de</strong>r<br />
Psychomotorischen<br />
Therapie <strong>und</strong> För<strong>de</strong>rung<br />
aus Sicht <strong>de</strong>r Eltern –<br />
eine Katamnesestudie.<br />
1: 4–12.<br />
Reichenbach, C.: (Moto-)<br />
Diagnostik zwischen<br />
Therapie <strong>und</strong> Pädagogik<br />
– Überlegungen zum<br />
• „Geistige Behin<strong>de</strong>rung“:<br />
Lebenshilfe-Verlag, Marburg<br />
• „Gr<strong>und</strong>schule“: Westermann,<br />
Braunschweig<br />
• „Haltung <strong>und</strong> Bewegung“:<br />
BAG, Wiesba<strong>de</strong>n<br />
• „Heilpädagogik“: Heilpädagogische<br />
Gesellschaft<br />
Österreich, Siegenfeld<br />
• „Hörgeschädigten<br />
Pädagogik“: Median-<br />
Verlag, Hei<strong>de</strong>lberg<br />
• „Kin<strong>de</strong>rgarten heute“:<br />
Her<strong>de</strong>r, München<br />
• „Kindheit <strong>und</strong> Entwicklung“:<br />
Hogrefe Verlag,<br />
Göttingen<br />
• „Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendarzt“:<br />
Hanseatisches Verlagskontor<br />
Lübeck<br />
diagnostischen Han<strong>de</strong>ln<br />
in <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>.<br />
1: 13–21.<br />
Schilling, F.: Grapho<strong>motorik</strong><br />
<strong>und</strong> Schriftspracherwerb.<br />
1: 22-30.<br />
Stapf, A.: Früherkennung<br />
hochbegabter Kin<strong>de</strong>r.<br />
1: 31–36.<br />
Krenz, A.: (N)Irgendwo ist<br />
Bullerbü – überlasst <strong>de</strong>n<br />
Kin<strong>de</strong>rn ihre Kindheit.<br />
Ein Plädoyer gegen die<br />
zunehmen<strong>de</strong> Vertreibung<br />
<strong>de</strong>s Kind(er)lebens.<br />
1: 37–40.<br />
Mall, W.: Sensomotorische<br />
Lebensweisen – Menschen<br />
mit „geistiger<br />
Behin<strong>de</strong>rung‘‘ besser<br />
verstehen. 1: 41–52.<br />
Richter, J.: Ich bin, was du<br />
bist, wenn du möchtest,<br />
das(s) ich bin. Bist du<br />
auch ich? Über das<br />
Arbeiten in <strong>und</strong> mit <strong>de</strong>r<br />
Übertragung innerhalb<br />
<strong>de</strong>s „Verstehen<strong>de</strong>n<br />
Ansatzes‘‘. 2: 76–85.<br />
• „Krankengymnastik“:<br />
Pflaum, München<br />
• „Mit Sprache“: Holzhausen<br />
Druck & Medien<br />
GmbH, Wien<br />
• „Päd Forum“: Schnei<strong>de</strong>r,<br />
Hohengehren<br />
• „Prävention“: Deutscher<br />
B<strong>und</strong>es-Verlag Bonn<br />
• „Praxis Ergotherapie“:<br />
Mo<strong>de</strong>rnes Lernen,<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
• „Praxis <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>/<br />
Motopädie“: Mo<strong>de</strong>rnes<br />
Lernen, Dortm<strong>und</strong><br />
• „Schweizerische <strong>Zeitschrift</strong><br />
<strong>für</strong> Heilpädagogik“:<br />
Ediprim AG, Biel<br />
• „Sportpädagogik“: Erhard-<br />
Friedrich Verlag, Seelze<br />
Schoch, R.: In Zukunft:<br />
Improvisieren?! Zeitgemäß<br />
Han<strong>de</strong>ln in <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong>. 2: 86–93.<br />
Doering, W.: Die Zukunft<br />
beginnt JETZT. Entwicklungsbegleitung<br />
Doering<br />
<strong>und</strong> Arbeit am TONFELD.<br />
2: 94-100.<br />
Grensemann, D./Sammann,<br />
K.: Ist die Beziehungsgestaltung<br />
das A <strong>und</strong> O in<br />
<strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong>.<br />
3: 144–149.<br />
Zirngiebel, E./Schulte-<br />
Mattler, U./Schlei<strong>de</strong>n, H./<br />
Schmidt, E./Borbein, J./<br />
Noppeney, A./Linxen, S.:<br />
Fi<strong>de</strong>lius: ein psychomotorischesBeobachtungsverfahren.<br />
3: 150–155.<br />
Bull, A.: Tiergestützte<br />
Therapie <strong>und</strong> Pädagogik.<br />
3: 173–181.<br />
Beckendorf, R.: Therapeutic<br />
Touch in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendpsychiatrie: Die<br />
Kraft <strong>de</strong>r Berührung.<br />
4: 220–233.<br />
• „Son<strong>de</strong>rpädagogik“:<br />
Wissenschaftsverlag<br />
Spiess Berlin<br />
• „Sportunterricht“:<br />
Hofmann, Schorndorf<br />
• „Sportwissenschaft“:<br />
Hofmann, Schorndorf<br />
• „Unsere Jugend“: Reinhardt,<br />
München<br />
• „Welt <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s“: Kösel,<br />
München<br />
• „<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> Erlebnispädagogik“:<br />
Neubauer,<br />
Lüneburg<br />
• „<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> Heilpädagogik“:<br />
Julius Klink-<br />
hardt Verlag, Bad Heilbrunn<br />
• „Zusammen“: Friedrich,<br />
Velber<br />
Zuständige Redakteure: Melanie Behrens, Klaus Fischer<br />
Hanne-Behnke, G./Tham, K.:<br />
Die Rolle <strong>de</strong>r Eltern in<br />
<strong>de</strong>r psychomotorischen<br />
Therapie. Elternkurse als<br />
Therapiebegleitung.<br />
4: 234–240.<br />
Jansen, N.: Knisterwiese,<br />
Trockendusche & Co.<br />
Individuell gestaltetes<br />
Spielzeug <strong>und</strong> Frei-<br />
zeitmaterial <strong>für</strong> Menschen<br />
mit schwerster<br />
Behin<strong>de</strong>rung.<br />
4: 241–248.<br />
Kalbanter-Wernicke, K.:<br />
Die Fünf Wandlungsphasen<br />
im therapeutischen<br />
Alltag. 4: 249–257.<br />
Reihe „Praxis“<br />
Langkammer, S.: Ringen <strong>und</strong><br />
Raufen. Ein Projekt mit<br />
Mädchen an einer Schule<br />
<strong>für</strong> Lernbehin<strong>de</strong>rte.<br />
1: 53–59.<br />
Stöppler, R./Zacharias, M.:<br />
„Roll on!‘‘ Inline Skating<br />
bei Jugendlichen mit
geistiger Behin<strong>de</strong>rung.<br />
2: 104–112.<br />
Kubanski, D.: Übungen<br />
zur Stärkung <strong>de</strong>s<br />
Selbstbewusstseins.<br />
2: 101–103.<br />
Schönra<strong>de</strong>, S.: „Die Abenteuer<br />
<strong>de</strong>r kleinen Hexe im<br />
Buchstabenland.“<br />
Ein psychomotorischer<br />
Zugang zum Lernen<br />
von A–Z. 3: 156–165.<br />
Kopf, B.: Psycho<strong>motorik</strong> in<br />
<strong>de</strong>r pädiatrischen<br />
Onkologie – Angebote<br />
<strong>für</strong> krebskranke Kin<strong>de</strong>r.<br />
3: 166–172.<br />
Bull, A.: Tiergestützte<br />
Therapie <strong>und</strong> Pädagogik.<br />
3: 173–181.<br />
Jackel, B.: Kindliche Berührungserfahrungen<br />
<strong>und</strong><br />
kommunikative Kompetenz.<br />
Möglichkeiten <strong>de</strong>s<br />
Umgangs mit fühl- <strong>und</strong><br />
sprachför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n<br />
Bil<strong>de</strong>rbüchern.<br />
3: 182–188.<br />
Sowa, M.: Jetzt kann ich<br />
endlich mitspielen!<br />
Badminton in heterogenen<br />
Sportgruppen von<br />
Nichtbehin<strong>de</strong>rten <strong>und</strong><br />
Sportlern mit geistiger<br />
Behin<strong>de</strong>rung.<br />
3: 189–194.<br />
Tille, H./Tille, G.: Die Abenteuer<br />
von Robinson<br />
Crusoe. Eine Bewegungsgeschichte<br />
als Gruppenwettkampf.<br />
4: 258–264.<br />
Reihe: „Fingerspiele <strong>für</strong> Jung<br />
<strong>und</strong> Alt“<br />
Kelber-Bretz, W.:<br />
Partner- <strong>und</strong> Gruppenspiele I.<br />
2: 113–119.<br />
Partner- <strong>und</strong> Gruppenspiele II.<br />
4: 265–269.<br />
Jahrgang 2006<br />
Richter, J. T. : Theorie einer<br />
psychomotorischen<br />
Beratung mit <strong>de</strong>r Familie.<br />
Entwicklungslinien <strong>und</strong><br />
Perspektiven einer<br />
familienpsychomotorischen<br />
Metho<strong>de</strong>.<br />
1: 4–13.<br />
Mayr, R.: Erleben, Spüren,<br />
Bewegen. Aspekte<br />
psychomotorischer<br />
Angebote <strong>für</strong> Menschen<br />
mit schwersten Behin<strong>de</strong>rungen.<br />
1: 14–21.<br />
Bull, A.: Tiergestützte Arbeit<br />
mit erwachsenen <strong>und</strong><br />
alten Menschen.<br />
1: 22–32.<br />
Mösch, B.: Lasst die Kin<strong>de</strong>r<br />
gelassen lernen. Körperlichkeit<br />
<strong>und</strong> Beziehungsfähigkeit<br />
als Gr<strong>und</strong>lage<br />
<strong>für</strong> integrative Lernprozesse.<br />
2: 80–86.<br />
Richter, J./Heitkötter, T.: Die<br />
3 Phasen einer psychomotorischenFamilienberatung.<br />
2: 87–97.<br />
Graf, C./Dor<strong>de</strong>l, S.: Bewegungsmangel<br />
<strong>und</strong><br />
Übergewicht bei Kin<strong>de</strong>rn<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen.<br />
2: 98–102.<br />
Högerle, M./B<strong>und</strong>schuh, C.:<br />
Raumwahrnehmung.<br />
Be<strong>de</strong>utung–Entwicklung<br />
– Prozess – För<strong>de</strong>rung.<br />
3: 152–162.<br />
Buchwald-Röser, A.: Plitsch-<br />
Platsch. Nasser Quatsch!<br />
– psychomotorisches<br />
Wasserangebot <strong>für</strong><br />
übergewichtige Kin<strong>de</strong>r.<br />
3: 177–181.<br />
Reihe „Praxis“<br />
Brettschnei<strong>de</strong>r, W./Malek, C.:<br />
„Walking Bus: <strong>de</strong>r aktive<br />
Schulweg. Eine Präventionsmaßnahme<br />
gegen<br />
Zuwachs körperlicher<br />
Inaktivität <strong>und</strong> Übergewicht.<br />
1: 33–36.<br />
Panhans, U./Wirth, S.: MUT<br />
TUT GUT – „Stockkampf<br />
& Tanz‘‘ – in <strong>de</strong>r therapeutischen<br />
<strong>und</strong> pädagogischen<br />
Arbeit.<br />
1: 37–42.<br />
Lange, A.: Abenteuer im<br />
Weltall. 1: 43–46.<br />
Schoch, R.: In Zukunft:<br />
Spielen?! 1: 47–51.<br />
Langer-Bär, H.: „Familie in<br />
Bewegung.“ Ein Projektbericht<br />
über die Verbindung<br />
<strong>de</strong>r Systemischen<br />
Beratung mit <strong>Mototherapie</strong>.<br />
2: 109–116.<br />
Hornung, S./Hofer, H.:<br />
Elternarbeit in <strong>de</strong>r<br />
Psycho<strong>motorik</strong>-Therapie.<br />
Empirische Untersuchung<br />
Teil I. 3: 168–172.<br />
Keller, C./Meister, B./<br />
Mosimann, M./Stal<strong>de</strong>r,<br />
D.: Psycho<strong>motorik</strong>-<br />
Therapie aus <strong>de</strong>r Sicht<br />
<strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s. Empirische<br />
Untersuchung Teil II.<br />
3: 173–176.<br />
Tille, H./Tille, G.: Raffinierte<br />
Staffelspiele <strong>für</strong> rüstige<br />
Senioren ab 70 Jahren.<br />
3: 182–187.<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> Erlebnispädagogik<br />
Jahrgang 2005<br />
Schlick, K.: Naturerlebnisspiele.<br />
1/2: 1–89.<br />
Lienhard V.: Wie Kin<strong>de</strong>r<br />
lernen. 4: 3–6.<br />
Lakemann, U.: Die Angst <strong>de</strong>s<br />
Trainers vorm Transfer.<br />
Erlebnispädagogische<br />
Erfolge aus systemtheoretischer<br />
Sicht.<br />
4: 7–18.<br />
Münch, J.: Wie lässt sich<br />
das Leben erleben?<br />
Eine Erinnerung an<br />
<strong>de</strong>n Pädagogen, Künstler<br />
<strong>und</strong> Philosophen<br />
Hugo Kükelhaus.<br />
4: 19–34.<br />
Kükelhaus, H.: Über das<br />
Erleben von Naturgesetzen<br />
im Spiel. Zur Geräte-<br />
Auswahl <strong>de</strong>s Naturk<strong>und</strong>lichen<br />
Spiel-Werkes in<br />
Montreal. 4: 35–41.<br />
Holsten, A./Gorgas, S./<br />
Rauscher, R./Lehmann, J.:<br />
Psycho<strong>motorik</strong> auf <strong>de</strong>m<br />
Bauernhof. 4: 48–58.<br />
Maiwald, R.: Rhythmischmusikalische<br />
Erziehung.<br />
5: 50–59.<br />
San<strong>de</strong>rs, A./Lehmann, J.:<br />
Konstruktiv-interaktives<br />
Lernen. 6: 33–39.<br />
San<strong>de</strong>rs, A.: Bildung <strong>für</strong> das<br />
Leben in <strong>de</strong>r Weltgesellschaft.<br />
6: 49–57.<br />
Bieligk, M.: Erlebnispädagogische<br />
Ansätze im<br />
Sportunterricht.<br />
7/8/9: 1–180.<br />
Kuhlmann, J.: „BE-G-REIFEN“<br />
im Wald – Ausführungen<br />
zum aktuellen Stand <strong>de</strong>r<br />
Waldkin<strong>de</strong>rgartenpädagogik<br />
in Deutschland.<br />
10: 20–38.<br />
Kaiser, M.: Pfadfin<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
Schule. 11/12: 1–89.<br />
<strong>Zeitschrift</strong>enspiegel<br />
wird in Motorik 3/2007<br />
fortgesetzt.<br />
115
116<br />
Veranstaltungen<br />
Veranstaltungen<br />
20.–21. 7. 2007<br />
„Trauma <strong>und</strong> Entwicklung“<br />
Symposium <strong>de</strong>s Instituts<br />
<strong>für</strong> Analytische Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong><br />
Jugendlichenpsychotherapie<br />
(AKJP) Hei<strong>de</strong>lberg mit<br />
<strong>de</strong>m Schwerpunktthema<br />
Bindungsforschung.<br />
Ort: Hei<strong>de</strong>lberg<br />
E-Mail: info@akjp-hd.<strong>de</strong><br />
URL: http://<br />
www.akjp-hd.<strong>de</strong><br />
22.–24. 7. 2007<br />
„Internationaler Kongress<br />
zur Bewegungsanalyse in<br />
Erziehung, Therapie <strong>und</strong><br />
Forschung“<br />
Zum 20-jährigen Jubiläum<br />
veranstaltet das Zentrum <strong>für</strong><br />
Tanz & Therapie, München<br />
in Kooperation mit <strong>de</strong>r<br />
Universität Hei<strong>de</strong>lberg<br />
diesen internationalen<br />
Kongress zur Bewegungsanalyse<br />
aus <strong>de</strong>n Bereichen<br />
Tanz – Therapie – Pädagogik<br />
– Wissenschaft <strong>und</strong> Wirtschaft.<br />
Die Laban Bewegungsanalyse<br />
<strong>und</strong> das sich<br />
daraus entwickelte Kestenberg<br />
Movement Profile <strong>und</strong><br />
die Movement Pattern<br />
Analysis als differenzierte<br />
Instrumente <strong>de</strong>r psychophysischen<br />
Bewegungsanalyse<br />
wer<strong>de</strong>n durch bekannte<br />
internationale Dozentinnen<br />
<strong>und</strong> Dozenten, die zum Teil<br />
erstmalig in Deutschland<br />
ihre Arbeit vorstellen, durch<br />
Vorträge <strong>und</strong> Workshops<br />
angeboten.<br />
Ort: Freising bei<br />
München<br />
E-Mail: info@<br />
tanztherapiezentrum.<strong>de</strong><br />
URL: http://www.<br />
tanztherapiezentrum.<strong>de</strong>/<br />
in<strong>de</strong>x.html<br />
15. 9. 2007<br />
Fachtagung „Bewegung,<br />
Spiel <strong>und</strong> Sport in <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Jugendhilfe“<br />
Bewegung, Spiel <strong>und</strong> Sport<br />
haben eine lange Tradition in<br />
<strong>de</strong>r Heimerziehung. Dies<br />
liegt sicher zum einen daran,<br />
dass Bewegung <strong>und</strong> Spiel zu<br />
<strong>de</strong>n wesentlichen Elementen<br />
kindlicher Entwicklung<br />
gehören <strong>und</strong> dass auch<br />
Jugendliche die sportliche<br />
Bewegung als Medium <strong>de</strong>r<br />
Selbstentwicklung einsetzen.<br />
Zum an<strong>de</strong>ren nutzten<br />
engagierte Heimerzieher<br />
ihre Vorliebe <strong>für</strong> <strong>de</strong>n Sport<br />
zum Aufbau von Beziehungen<br />
zu ihren Zöglingen,<br />
die sie <strong>für</strong> ihre erzieherische<br />
Arbeit verwen<strong>de</strong>n konnten.<br />
Bei dieser Fachtagung<br />
wer<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne<br />
aktuelle Konzepte aus<br />
<strong>de</strong>r Praxis <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r-<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfe vorge-<br />
stellt.<br />
Veran- Aktionskreis<br />
stalter: Psycho<strong>motorik</strong><br />
e. V., ÜBBZ,<br />
Katholische<br />
Fachschule <strong>für</strong><br />
Sozialpädagogik<br />
Saarbrücken<br />
Ort: ÜBBZ – Überre-<br />
gionales Beratungs-<br />
<strong>und</strong> Behandlungszentrum,<br />
Würzburg<br />
E-Mail: info@skf-wue.<strong>de</strong><br />
URL: http://www.<br />
skf-wue.<strong>de</strong><br />
10.–12. 9. 2007<br />
„Pädagogische<br />
Professionalität“<br />
70. Tagung <strong>de</strong>r Kommission<br />
„Arbeitsgruppe Empirische<br />
Pädagogische Forschung<br />
(AEPF)“ <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> Erziehungswissenschaft<br />
(DGfE).<br />
Ort: Leuphana Universität,<br />
Lüneburg<br />
E-Mail: aepf@unilueneburg.<strong>de</strong><br />
URL: http://www.fb1.<br />
uni-lueneburg.<strong>de</strong>/<br />
fb1/inst_suhf/neu/<br />
prog_tagesablauf.<br />
php<br />
19.–21. 9. 2007:<br />
Empowerment-Kongress<br />
2007: „Selbsthilfe <strong>und</strong><br />
Selbstunternehmung in <strong>de</strong>r<br />
Bürgergesellschaft –<br />
Zivilgesellschaftliches<br />
Engagement <strong>und</strong> Selbstorganisation<br />
als Zukunftsmo<strong>de</strong>ll“<br />
Die gegenwärtige wirtschaftliche<br />
<strong>und</strong> strukturelle<br />
Entwicklung erzeugt<br />
zunehmend ungeschützte<br />
Lebensverhältnisse. Damit<br />
einher gehen das Auseinan<strong>de</strong>rdriften<br />
von Bildungs- <strong>und</strong><br />
Einkommenschancen sowie<br />
die Erosion gemeinsamer<br />
Werte. Umsteuern ist da am<br />
ehesten möglich, wo die<br />
Menschen ihren Lebensmittelpunkt<br />
haben, nämlich vor<br />
Ort. Dort benötigen sie<br />
Ermutigung <strong>und</strong> niedrigschwellige,<br />
befähigen<strong>de</strong> <strong>und</strong><br />
lebensfre<strong>und</strong>liche För<strong>de</strong>rbedingungen,<br />
kurz: Empowerment.<br />
Durch <strong>de</strong>n Empowerment-Kongress,<br />
<strong>de</strong>r die<br />
Selbstbemächtigung <strong>de</strong>r<br />
Bürger auf lokaler Ebene<br />
anstrebt, soll eine breite<br />
Diskussion auf wissenschaftlicher<br />
<strong>und</strong> professioneller<br />
Ebene entfacht wer<strong>de</strong>n.<br />
Ort: Hochschule Mag<strong>de</strong>burg-Stendal<br />
(FH)<br />
E-Mail: info@<br />
kongress2007.<strong>de</strong><br />
URL: http://www.<br />
kongress2007.<strong>de</strong>/<br />
Home<br />
20.–23. 9. 2007<br />
„Selbstregulation: Körper –<br />
Gefühl – Denken“,<br />
3. Kongress <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> Körperpsychotherapie<br />
In <strong>de</strong>r Körperpsychotherapie<br />
nimmt das Konzept <strong>de</strong>r<br />
Selbstregulation ähnlich wie<br />
in <strong>de</strong>r Humanistischen<br />
Psychotherapie <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Systemischen Therapie in <strong>de</strong>r<br />
Theorie wie auch im<br />
praktischen psychotherapeutischen<br />
Han<strong>de</strong>ln einen<br />
wichtigen Platz ein. Die<br />
Fähigkeit <strong>de</strong>s Patienten zur<br />
Selbstregulation gilt als eine<br />
Ressource <strong>für</strong> Heilung,<br />
Verän<strong>de</strong>rung <strong>und</strong> Wachstum.<br />
Der Kongress wird die<br />
verschie<strong>de</strong>nen Dimensionen<br />
<strong>de</strong>r Selbstregulation <strong>und</strong> das<br />
Verhältnis von Körper, Gefühl<br />
<strong>und</strong> Denken aus unterschiedlichen<br />
Perspektiven<br />
beleuchten.<br />
Ort: Freie Universität<br />
Berlin<br />
E-Mail: dgk@<br />
ctw-congress.<strong>de</strong><br />
URL: http://www.ctwcongress.<strong>de</strong>/dgk<br />
26.–28. 9. 2007<br />
„Bewegung - Ges<strong>und</strong>heit -<br />
Lebenswelt“ - Jahrestagung<br />
<strong>de</strong>r dvs-Kommission<br />
Ges<strong>und</strong>heit<br />
Die Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation<br />
(WHO) hat die<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Kommune als<br />
Handlungsfeld <strong>für</strong> die<br />
Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung<br />
erkannt <strong>und</strong> versucht, sie<br />
wie<strong>de</strong>r zu beleben. Sie<br />
för<strong>de</strong>rt (z. B. im healthycity-Projekt)<br />
<strong>und</strong> for<strong>de</strong>rt<br />
Aktivitäten auf <strong>de</strong>r kommunalen<br />
Ebene mit <strong>de</strong>m Ziel,<br />
ges<strong>und</strong>e Lebensräume zu<br />
schaffen. Erst in jüngster
Zeit wird die Ten<strong>de</strong>nz zur<br />
Umsetzung <strong>de</strong>r politischen<br />
I<strong>de</strong>e „Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung“<br />
auch in <strong>de</strong>r Praxis <strong>de</strong>s<br />
Ges<strong>und</strong>heitssports sichtbar.<br />
Bei <strong>de</strong>n Bemühungen um<br />
eine Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s<br />
körperlich-aktiven Lebensstils<br />
<strong>de</strong>r Bevölkerung fin<strong>de</strong>n<br />
zunehmend sozial-ökologische<br />
Fragen <strong>de</strong>r Lebensqualität,<br />
<strong>de</strong>r Lebensbedingungen<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Lebensgestaltung Berücksichtigung.<br />
Damit rückt <strong>de</strong>r<br />
Blick auf so genannte<br />
Settings <strong>de</strong>r bewegungsbezogenenGes<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung<br />
(u. a. Schule, Betrieb,<br />
Kin<strong>de</strong>rgarten, Verein), die im<br />
Rahmen <strong>de</strong>r Tagung beleuchtet<br />
wer<strong>de</strong>n sollen.<br />
Ort: Universität<br />
Hamburg<br />
E-Mail: alexan<strong>de</strong>r.woll@<br />
uni-konstanz.<strong>de</strong><br />
URL: http://www.<br />
sportwissenschaft.<br />
<strong>de</strong><br />
27.–29. 9. 2007<br />
Europäischer Kongress<br />
„Energie-Psychologie ®<br />
<strong>und</strong> Psychotherapie“ –<br />
das reiche Spektrum<br />
heilen<strong>de</strong>r Kraft in<br />
individuellen <strong>und</strong> interaktionellen<br />
Systemen<br />
Die Konzepte <strong>de</strong>r „Energy-<br />
Psychology ® “ können als<br />
revolutionieren<strong>de</strong>s neues<br />
Paradigma in <strong>de</strong>r Psychotherapie<br />
bezeichnet wer<strong>de</strong>n. Sie<br />
verbin<strong>de</strong>n die effektivsten<br />
Zusatzqualifikation<br />
Psycho<strong>motorik</strong>/<br />
<strong>Motopädagogik</strong><br />
7. 9. 2007 bis 6. 7. 2008<br />
(10 Wochenendveranstaltungen)<br />
Ort: Erfurt<br />
Informationen: Institut <strong>für</strong> Psycho<strong>motorik</strong>, Dalbergsweg 10,<br />
99084 Erfurt<br />
Tel.: 03 61 / 2 25 23 34, www.psycho<strong>motorik</strong>.net<br />
Bernard Aucouturier<br />
Ansätze <strong>de</strong>r Kurzzeit-<br />
Psychotherapie mit <strong>de</strong>r<br />
Nutzung von Bio-Energie-<br />
Fel<strong>de</strong>rn.<br />
Ort: Milton-Erickson-<br />
Institut, Hei<strong>de</strong>lberg<br />
E-Mail: office@meihei.<strong>de</strong><br />
URL: http://<br />
www.meihei.<strong>de</strong><br />
25.–28. 10. 2007<br />
„Mentale Stärken –<br />
Sporthypnose – Selbsthypnose<br />
– Mentales<br />
Training – Coaching“<br />
Erstmalig wer<strong>de</strong>n aus aller<br />
Welt zirka 40 Experten <strong>für</strong><br />
Leistungssteigerung,<br />
Organisations- <strong>und</strong> Persönlichkeitsentwicklung<br />
in Sport, Wirtschaft, (Politik),<br />
Schule, Studium <strong>und</strong><br />
Rehabilitation zusammengeführt.<br />
Ort: Stadthalle,<br />
Hei<strong>de</strong>lberg<br />
E-Mail: mental@megrottweil.<strong>de</strong><br />
URL: http://www.<br />
meg-rottweil.<strong>de</strong><br />
1.–4. 11. 2007<br />
Kölner Therapietage<br />
„Psychotherapie reloa<strong>de</strong>d“<br />
Workshopreihe <strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mie<br />
<strong>für</strong> Verhaltenstherapie Köln.<br />
Ort: Im MediaPark 7,<br />
Köln<br />
E-Mail: info@avt-koeln.org<br />
URL: http://www.<br />
koelner-therapietage.<strong>de</strong><br />
Der Ansatz Aucouturier – Handlungsfantasmen<br />
<strong>und</strong> psychomotorische Praxis<br />
288 Seiten, 50 Abbildungen, EUR 29,80<br />
ISBN 10: 3-9811066-0-1<br />
„…Dem Buch sind viele kreative <strong>und</strong> innovative Psycho<strong>motorik</strong>erInnen als<br />
LeserInnen zu wünschen…“<br />
(Richard Hammer)<br />
Holger Jessel<br />
Aufbaubildungsgang<br />
Musikalische För<strong>de</strong>rung im<br />
sozialpädagogischen Arbeitsfeld<br />
Aufbaubildungsgang <strong>für</strong> Absolvent/innen<br />
von Fachschulausbildungen, sozialpädagogischen<br />
<strong>und</strong> pädagogischen Studiengängen.<br />
Dauer: berufsbegleitend<br />
bzw.Teilzeit – 1 Jahr (600 St<strong>und</strong>en)<br />
Beginn: 1. August 2007<br />
Ernst-Kiphard-Berufskolleg<br />
Dortm<strong>und</strong>er Fachschule <strong>für</strong> Motopädie<br />
Victor-Toyka-Str. 6, 44139 Dortm<strong>und</strong><br />
Telefon 0231/103870, Fax 0231/103903<br />
info@motopaedieschule.<strong>de</strong> · www.motopaedieschule.<strong>de</strong><br />
Bestellung bei:<br />
proiecta Verlag · Professor Neu-Allee 6 · D-53225 Bonn · Fon (0) 22 22 – 93 14 16 · Fax (0) 22 22 - 93 13 96<br />
zum Preis von · EUR 29,80 incl. MwSt. · zzgl. EUR 1,40 Versand<br />
117
118<br />
Erste Delegiertenversammlung<br />
<strong>de</strong>r<br />
Deutschen Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Psycho<strong>motorik</strong><br />
Am 6. Mai 2007 trafen sich<br />
in Hamm zum ersten Mal<br />
Vertreter aus <strong>de</strong>n sechs<br />
Sektionen <strong>de</strong>r DGfPM (akp,<br />
DBM, BVDM, WVPM, Aus-<br />
<strong>und</strong> Fortbildungsinstitutionen,<br />
Vereine) zur Delegiertenversammlung<br />
<strong>de</strong>r im<br />
September gegrün<strong>de</strong>ten<br />
DGfPM. Anstelle <strong>de</strong>s<br />
kommissarischen Vorstan<strong>de</strong>s<br />
tritt nun ein Vorstand,<br />
in <strong>de</strong>m alle Sektionen<br />
vertreten sind. Vorstandsmitglie<strong>de</strong>r<br />
sind: Horst Göbel<br />
(1. Präsi<strong>de</strong>nt), Maria Charbel<br />
<strong>und</strong> Resi Seeberger-Wissing<br />
(Vizepräsi<strong>de</strong>ntinnen),<br />
Eckhard Knab, Melanie<br />
Behrens, Riele Marnitz<br />
(Beisitzer). Der weitere<br />
Ausbau <strong>de</strong>s Verban<strong>de</strong>s durch<br />
Zugewinn von neuen<br />
Mitgliedsvereinen,<br />
-verbän<strong>de</strong>n <strong>und</strong> -institutionen,<br />
die Kooperation in <strong>de</strong>m<br />
Europäischen Forum <strong>und</strong> die<br />
Vertretung <strong>de</strong>r Psycho<strong>motorik</strong><br />
im öffentlichen Raum hat<br />
sich <strong>de</strong>r Vorstand zur<br />
dringlichsten Aufgabe<br />
gemacht.<br />
Jahreshauptversammlung<br />
<strong>und</strong><br />
Absolvententreffen<br />
in Marburg<br />
Am 10. November 2007<br />
fin<strong>de</strong>t in Marburg die<br />
diesjährige Jahreshauptversammlung<br />
<strong>de</strong>s Berufsverban<strong>de</strong>s<br />
statt. Sie ist wie<br />
üblich mit einem Fortbildungsangebot<br />
verb<strong>und</strong>en.<br />
Am Vormittag tritt zunächst<br />
in einem Fortbildungsangebot<br />
das immer wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong><br />
<strong>und</strong> im Moment<br />
brandaktuelle Thema <strong>de</strong>r<br />
Jungenför<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>n<br />
Mittelpunkt. Die Aktualität<br />
dieses Themas lässt sich u. a.<br />
an einem vom B<strong>und</strong>esministerium<br />
<strong>für</strong> Familie, Senioren,<br />
Frauen <strong>und</strong> Jugend geför<strong>de</strong>rten<br />
Pilotprojekt „Neue Wege<br />
r Neuer Vorstand <strong>de</strong>r DGfPM Foto R. Mross<br />
<strong>für</strong> Jungs“ ablesen. Dieses<br />
Projekt zeichnet Konzepti<strong>de</strong>en<br />
aus mit <strong>de</strong>r Zielsetzung,<br />
Jungen zu unterstützen,<br />
an<strong>de</strong>re Lebensmo<strong>de</strong>lle<br />
kennen zu lernen <strong>und</strong><br />
Alltags- <strong>und</strong> Sozialkompetenzen<br />
zu stärken (www.<br />
neue-wege-fuer-jungs.<strong>de</strong>).<br />
Wir haben zu unserer<br />
Fortbildung Sabine Hoffmann<br />
(Dipl.-Motologin)<br />
eingela<strong>de</strong>n, die in einem<br />
zweistündigen Workshop<br />
unter <strong>de</strong>r Themenstellung<br />
„Was Jungen bewegt“ zu <strong>de</strong>r<br />
Fragestellung: „Warum sind<br />
Jungen an<strong>de</strong>rs als Mädchen,“<br />
Antworten aus <strong>de</strong>n Bereichen<br />
<strong>de</strong>r Biologie, Soziologie<br />
<strong>und</strong> Entwicklungspsychologie<br />
darstellen <strong>und</strong> daraus<br />
mit <strong>de</strong>n Teilnehmern weitere<br />
Schlussfolgerungen <strong>für</strong> die<br />
motologischeArbeit entwickeln<br />
wird. Als ein weiteres<br />
Informationsangebot wird<br />
Fiona Martzy (Dipl.-Motologin)<br />
mit einem Impulsreferat<br />
zum Thema „Evaluationsforschung<br />
im motologischen<br />
Kontext “ einen motologischen<br />
Blick auf einen Be-<br />
reich werfen, <strong>de</strong>r in wissenschaftlichen,<br />
politischen<br />
<strong>und</strong> gesellschaftlichen<br />
Diskussionen zunehmend<br />
zu einem „Dauerbrenner“<br />
wird.<br />
Natürlich soll es im Rahmen<br />
<strong>de</strong>r JHV auch Raum <strong>und</strong> Zeit<br />
geben, um sich im persönlichen<br />
Kontakt über die<br />
eigene motologische Arbeit<br />
auszutauschen, <strong>und</strong> so<br />
an<strong>de</strong>re o<strong>de</strong>r neue Wege in<br />
<strong>de</strong>r motologischen Arbeit<br />
mitzuteilen <strong>und</strong> zu erfahren.<br />
Das Fortbildungsangebot ist<br />
<strong>für</strong> Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s BVDM<br />
kostenlos. Interessierte, die<br />
nicht Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
Berufsverban<strong>de</strong>s sind,<br />
können gegen ein Entgelt<br />
natürlich an <strong>de</strong>r Fortbildung<br />
teilnehmen.<br />
Informationen können ab<br />
Juli 2007 unter www.<br />
motologie.net erfragt,<br />
Anmeldungen über<br />
motologenverband@<br />
t-online.<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r über<br />
BVDM, Postfach 200655,<br />
35018 Marburg gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
In Kooperation mit <strong>de</strong>m<br />
Studiengang Motologie<br />
fin<strong>de</strong>t am Abend <strong>de</strong>s 10.<br />
November 2007 im IFL,<br />
Barfüßerstr. 1, in Marburg<br />
dann ein Absolvententreffen<br />
statt. Alle ehemaligen<br />
Stu<strong>de</strong>ntinnen <strong>und</strong> Stu<strong>de</strong>nten<br />
<strong>de</strong>s Studiengangs<br />
„Motologie“ in Marburg<br />
o<strong>de</strong>r Erfurt sind hierzu<br />
herzlich eingela<strong>de</strong>n. Neben<br />
Informationen zum neuen<br />
Masterstudiengang bietet<br />
sich hier eine gute Gelegenheit<br />
mal unabhängig von<br />
einer inhaltlichen Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
alte Bekannte<br />
aus <strong>de</strong>r Motologie wie<strong>de</strong>r zu<br />
treffen, neue kennen zu<br />
lernen, zu feiern <strong>und</strong> selbst<br />
in Bewegung zu kommen,<br />
also zu tanzen.<br />
Beson<strong>de</strong>rs gefragt sind an<br />
diesem Abend die Motologinnen<br />
<strong>und</strong> Motologen<br />
<strong>de</strong>s Diplomabschlusses<br />
1987, die hier zusammen ihr<br />
20-jähriges Jubiläum feiern<br />
können.<br />
Informationen unter:<br />
Motoinfo@staff.unimarburg.<strong>de</strong>.
Europäisches Forum<br />
In nicht einmal einem Jahr,<br />
vom 21. bis 23. Mai 2008<br />
fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r nächste Europäische<br />
Kongress zur Psycho<strong>motorik</strong><br />
an <strong>de</strong>r freien<br />
Universität in Amsterdam<br />
statt. Nähere Informationen<br />
unter: www.efp<br />
amsterdam2008.eu.<br />
Neue Homepage<br />
<strong>de</strong>s BVDM<br />
Die neue Homepage <strong>de</strong>s<br />
Berufsverban<strong>de</strong>s unter<br />
www.motologie.net ist<br />
zurzeit im Aufbau.<br />
D. Beckmann-Neuhaus<br />
Berichte<br />
„Psycho<strong>motorik</strong> in<br />
Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung<br />
<strong>und</strong> Prävention.“<br />
Bericht von <strong>de</strong>r 31. Tagung<br />
<strong>de</strong>r Ev. Aka<strong>de</strong>mie Hofgeismar<br />
in Bad Orb vom<br />
8.–10. Dezember 2006<br />
Neugierig auf das mir<br />
bevorstehen<strong>de</strong> Wochenen<strong>de</strong><br />
reiste ich, zum ersten Mal<br />
nach Bad Orb. Nach einer<br />
intensiven Beschäftigung mit<br />
Spielräumen <strong>und</strong> psychomotorischer<br />
Entwicklung, im<br />
Rahmen meiner Bachelorarbeit<br />
im Studiengang<br />
Physiotherapie in Em<strong>de</strong>n,<br />
war ich gespannt darauf wie<br />
in dieser Tagung die Psycho<strong>motorik</strong><br />
<strong>und</strong> die Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung<br />
bearbeitet<br />
<strong>und</strong> in Beziehung zueinan<strong>de</strong>r<br />
gesetzt wer<strong>de</strong>n. Das Ergebnis<br />
vorweg: die Referieren<strong>de</strong>n<br />
thematisierten in einer<br />
ausgewählt anregen<strong>de</strong>n<br />
Begegnungs <strong>und</strong> Lernatmosphäre<br />
zentrale Elemente<br />
einer psychomotorischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung über<br />
die Lebensspanne.<br />
Die Bad Orber Tagung wur<strong>de</strong><br />
von Stephan Kuntz <strong>und</strong> Dr.<br />
Georg Hofmeister konzipiert<br />
<strong>und</strong> mo<strong>de</strong>riert <strong>und</strong> in<br />
Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>m<br />
Arbeitskreis Kirche <strong>und</strong> Sport<br />
<strong>de</strong>r Ev. Kirche Kurhessen<br />
Wal<strong>de</strong>ck realisiert. Die<br />
Teilnehmen<strong>de</strong>n erlebten im<br />
Bewegen, Spielen, Staunen,<br />
Selbsterfahren <strong>und</strong> Reflektieren<br />
eine ausgewogene<br />
Mischung aus Vorträgen <strong>und</strong><br />
Workshops, durch die sie<br />
selbst zu ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>m,<br />
aktivem Verhalten<br />
angeregt wur<strong>de</strong>n. Dieses<br />
Prinzip ist zentrales Interesse<br />
<strong>de</strong>s Bad Orber Forums, <strong>de</strong>nn<br />
es versteht sich selber als ein<br />
Beitrag zur Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung<br />
<strong>und</strong> zur Prävention.<br />
Die Eigenerfahrung <strong>de</strong>r<br />
Teilnehmen<strong>de</strong>n dient als<br />
Ausgangspunkt <strong>de</strong>s berufsbezogenen<br />
<strong>und</strong> persönlichen<br />
Austausches. Dieser konnte<br />
auf internationaler Ebene<br />
stattfin<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn es waren<br />
sowohl unter <strong>de</strong>n Teilnehmerinnen<br />
<strong>und</strong> Teilnehmern<br />
r Entspannung als „achtsamen Dialog“ erleben<br />
als auch unter <strong>de</strong>n Vortragen<strong>de</strong>n<br />
Vertreter aus <strong>de</strong>r<br />
Schweiz, Österreich <strong>und</strong><br />
Deutschland angereist.<br />
Stephan Kuntz führte locker<br />
<strong>und</strong> souverän ein – in die<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Humors <strong>für</strong><br />
die psychomotorische<br />
Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung.<br />
Inspiriert wur<strong>de</strong> sein Vortrag<br />
von <strong>de</strong>n I<strong>de</strong>en <strong>und</strong> <strong>de</strong>m<br />
Lebenswerk von Prof. Dr. E. J.<br />
Kiphard, <strong>de</strong>r in seiner Rolle<br />
als Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen<br />
Psycho<strong>motorik</strong> <strong>und</strong> als<br />
Ehrengast – inzwischen 83<br />
Jahre alt – in Bad Orb<br />
anwesend war. Humor im<br />
Kiphardschen Sinne betont<br />
die Einzigartigkeit je<strong>de</strong>s<br />
Einzelnen <strong>und</strong> lässt ihn<br />
selbstbewusst <strong>und</strong> kompetent<br />
in Konfliktsituationen<br />
han<strong>de</strong>ln. Zum weiteren<br />
Referententeam <strong>de</strong>r Tagung<br />
gehörten: Sylvia Ben<strong>de</strong>r,<br />
Fredrik Vahle, Sonja Quante,<br />
Marianne Eisenburger, Josef<br />
Voglsinger, Ruth Haas,<br />
Rosmarie Härdi, Manfred<br />
Jahn, Karin Brünner, Valerie<br />
Huber, Georg Hofmeister,<br />
Daniela Mautner, Marlene<br />
Tauzher. Sowohl in <strong>de</strong>n<br />
Vorträgen als auch in <strong>de</strong>n<br />
Workshops ergänzten sich<br />
einzelne Facetten einer<br />
psychomotorisch orientierten<br />
Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung in<br />
ungewöhnlich dichter Art<br />
<strong>und</strong> Weise. So öffnete sich<br />
<strong>de</strong>n Teilnehmen<strong>de</strong>n ein<br />
interessanter <strong>und</strong> fein<br />
abgestimmter Erfahrungsraum.<br />
In einer entspannten<br />
<strong>und</strong> anregen<strong>de</strong>n Atmosphäre<br />
umran<strong>de</strong>ten viele weiterführen<strong>de</strong><br />
Gespräche dieses<br />
fachlich hochkarätige<br />
Angebot. Stephan Kuntz <strong>und</strong><br />
Georg Hofmeister schufen in<br />
faszinieren<strong>de</strong>r Art <strong>und</strong> Weise<br />
<strong>de</strong>n Rahmen <strong>für</strong> diesen fein<br />
nuancierten, ganzheitlichen<br />
<strong>und</strong> gleichzeitig berufsbezogenen<br />
Austaus ch.<br />
Meine Erwartungen wur<strong>de</strong>n<br />
in <strong>de</strong>m Erlebnis <strong>de</strong>r Intensität<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Möglichkeiten<br />
zum Austausch noch<br />
übertroffen. Aus <strong>de</strong>r Perspektive<br />
eines „Neulings“ hatte<br />
ich das Gefühl von erfahrenen<br />
Fachleuten ernst<br />
genommen zu wer<strong>de</strong>n. Gerne<br />
erinnere ich mich an <strong>de</strong>n<br />
119
120<br />
Berichte / Summaries<br />
r Vielfältige Entspannungsmöglichkeiten mit Alltagsmaterialen unter <strong>de</strong>r Leitung von Sonja<br />
Quante.<br />
Summaries<br />
Richard Hammer<br />
Movement, play and sport<br />
as an established measure<br />
in children’s and youth’s<br />
welfare service<br />
A look at the work of the<br />
“classics of home education”<br />
shows that movement, play<br />
and sport have a long tradition<br />
in this area of education. A<br />
survey of the current situation<br />
in institutions for childcare<br />
and education reveals that this<br />
is still true today. However, in<br />
spite of the positive results of<br />
studies of effectiveness the<br />
offer of movement-oriented<br />
measures is not always a<br />
matter of course.<br />
Mechthild Denzer<br />
Psychomotor therapy as<br />
an organised element in<br />
social-pedagogical training<br />
Movement, play and sport<br />
have proved their worth as<br />
pedagogical and therapeutic<br />
measures in child and youth<br />
welfare. However, there is<br />
consistent evi<strong>de</strong>nce that their<br />
successful use requires a<br />
pedagogical organisation of<br />
everyday life that is based on<br />
the concept that movement<br />
and play are f<strong>und</strong>amental<br />
elements of child <strong>de</strong>velopment.<br />
How these f<strong>und</strong>amentals<br />
can be conveyed to<br />
prospective educators in a<br />
way drawn from experience<br />
is illustrated by the training<br />
of educators at the Catholic<br />
School for Social Pedagogy in<br />
Saarbrücken. Based on the<br />
learning-field concept,<br />
movement, play and sport are<br />
essential parts of training in<br />
this school: both for improving<br />
the stu<strong>de</strong>nts’ health and<br />
well-being and for preparing<br />
them for their future area<br />
of work.<br />
Albert Müller<br />
“Semisport” as an example<br />
of the successful combination<br />
of theory and<br />
practice in the Würzburg<br />
supraregional counselling<br />
and treatment centre<br />
As it is the goal of therapeutic-pedagogy<br />
training to<br />
differentiate and to extend<br />
the special as well as action-<br />
and person-related competencies<br />
of prospective<br />
remedial teachers, professional<br />
and life experience as<br />
well as special theoretical<br />
knowledge and action<br />
competencies in therapeutic<br />
pedagogy must be integrated<br />
in an a<strong>de</strong>quate way. This is<br />
done among other things in<br />
the specific teaching and<br />
learning form of the<br />
practical field. The aimed at<br />
combination of theory and<br />
practice in a full-time<br />
erinnere ich mich an <strong>de</strong>n<br />
Austausch mit an<strong>de</strong>ren<br />
zurück, die ebenfalls zum<br />
ersten Mal dort waren, <strong>de</strong>nn<br />
unterschiedliche Erfahrungshintergrün<strong>de</strong><br />
erwiesen sich<br />
als interessante Ausgangspunkte.<br />
Mit großen Erwartungen<br />
kann <strong>de</strong>m nächsten<br />
Treffen in Bad Orb entgegengesehen<br />
wer<strong>de</strong>n. Vom 7. bis<br />
9. Dezember 2007 mit <strong>de</strong>m<br />
Thema „Sprache in Bewegung:<br />
Sprachför<strong>de</strong>rung in<br />
psychomotorischen Kontexten“<br />
sind alle Interessierten<br />
herzlich eingela<strong>de</strong>n. Unter<br />
<strong>de</strong>r Leitung von Stephan<br />
Kuntz <strong>und</strong> Georg Hofmeister<br />
wer<strong>de</strong>n als Referieren<strong>de</strong><br />
Dr. Barbara Zolliger,<br />
Prof. Dr. Lütje-Klose,<br />
Prof. Dr. Fredrik Vahle<br />
<strong>und</strong> an<strong>de</strong>re erwartet.<br />
Dirk Peschke<br />
training in therapeutic<br />
pedagogy is shown using the<br />
example of the methodical<br />
subjects “moto-pedagogical<br />
and moto-therapeutic<br />
support of children and<br />
adolescents with be-<br />
havioural disor<strong>de</strong>rs”.<br />
As this terminology is too<br />
long-win<strong>de</strong>d for everyday<br />
language the term “semisport”<br />
has in the course<br />
of the years become the<br />
natural term used by the<br />
children concerned.<br />
Jörg Lesch<br />
Psychomotor therapy as<br />
a movement-oriented offer<br />
of an institution for child<br />
and youth welfare<br />
Using the example of an<br />
institution for child and<br />
youth welfare in the<br />
Saarland, in this article<br />
the significance of move-
ment, play and sport as<br />
elements of pedagogical and<br />
therapeutic work with<br />
children is revealed.<br />
Sandra Klingler<br />
Letting oneself fall –<br />
a topic in children’s<br />
and youth’s care?!<br />
Using individual examples,<br />
the significance of letting<br />
oneself fall and letting go<br />
for the <strong>de</strong>velopment of<br />
children is ma<strong>de</strong> clear.<br />
Against the backgro<strong>und</strong> of<br />
Erikson’s <strong>de</strong>velopmental<br />
theory, the effectiveness of<br />
psychomotor offers –<br />
particularly falling – in the<br />
context of an institution for<br />
child and youth welfare<br />
becomes obvious.<br />
Eilert von Busch<br />
Sincerely welcome in the<br />
Stefan Kuntz Stadium or:<br />
The organisation of breaks<br />
in a school for childcare<br />
and education<br />
In the framework of an antiviolence<br />
year in a school for<br />
childcare and education it<br />
happened that the area of<br />
Résumés<br />
Richard Hammer<br />
Mouvement, jeu et sport en<br />
tant que mesure éprouvée<br />
dans l’ai<strong>de</strong> à l’enfance et<br />
l’adolescence<br />
Mouvement, jeu et sport ont<br />
une longue tradition dans<br />
l’éducation en foyer.<br />
Quelques aperçus du travail<br />
<strong>de</strong> «classiques dans<br />
l’éducation en foyer» le<br />
montrent. Une supervision<br />
<strong>de</strong> la situation actuelle dans<br />
<strong>de</strong>s institutions pour enfants<br />
et adolescents rend manifeste<br />
que cela est le cas encore<br />
aujourd’hui, que – malgré<br />
<strong>de</strong>s résultats positifs<br />
provenant d’étu<strong>de</strong>s<br />
sport and psychomotor<br />
education was also a part of<br />
this main emphasis of the<br />
work with children and<br />
adolescents exhibiting<br />
conspicuous behavioural<br />
traits. Although playing<br />
football in school is an old<br />
hat, it is a real challenge in<br />
a school for childcare and<br />
education.<br />
Richard Hammer<br />
Alas, the values!<br />
Psychomotor therapy can do<br />
everything – almost everything.<br />
Can it contribute to<br />
the awareness of values?<br />
Against the backgro<strong>und</strong> of a<br />
system of values <strong>de</strong>veloped<br />
by H. v. Hentig, this article<br />
shows how changes of the<br />
personality can be achieved<br />
in a psychomotor lesson.<br />
One should be aware of the<br />
fact that this can even<br />
happen unintentionally.<br />
Mone Welsche /<br />
Cordula Stobbe /<br />
Georg Romer<br />
“And who sees us?” – Motor<br />
diagnostics for youths<br />
d’efficacité – l’offre <strong>de</strong><br />
mesures orientées vers le<br />
mouvement n’est quandmême<br />
pas garantie automatiquement.<br />
Mechthild Denzer<br />
La psychomotricité comme<br />
élément créé dans la<br />
formation <strong>de</strong> pédagogie<br />
sociale<br />
Mouvement, jeu et sport se<br />
sont éprouvés en tant que<br />
mesures pédagogiques et<br />
thérapeutiques dans l’ai<strong>de</strong><br />
aux enfants et adolescents.<br />
Il s’avère cependant toujours<br />
<strong>de</strong> nouveau qu’une intervention<br />
à succès <strong>de</strong>man<strong>de</strong> une<br />
Procedures of motor<br />
diagnostics are wellestablished<br />
elements of<br />
care in a lot of children and<br />
youth psychiatry clinics.<br />
A survey conducted on the<br />
topic of “Using Procedures of<br />
Motor Diagnostics in<br />
Children and Youth Psychiatry”<br />
shows that the predominant<br />
methods used are those<br />
for checking the state of<br />
motor <strong>de</strong>velopment and<br />
perceptual performances<br />
during childhood. On the<br />
other hand, there are <strong>de</strong>ficits<br />
leading to a great <strong>de</strong>mand<br />
for methods of motor<br />
diagnosis in young patients.<br />
In this article, the significance<br />
of motor-diagnostic<br />
procedures for young<br />
patients is discussed and<br />
motor-diagnostic methods<br />
which can be used with<br />
adolescents are presented.<br />
Rainer Wollny<br />
Traditions and current<br />
trends of motor <strong>de</strong>velopment<br />
research in Germany<br />
Because of non-uniform<br />
theoretical concepts and<br />
organisation pédagogique<br />
quotidienne qui se fon<strong>de</strong><br />
également sur l’idée <strong>de</strong> base<br />
que mouvement et jeu<br />
constituent <strong>de</strong>s éléments<br />
fondamentaux du développement<br />
<strong>de</strong> l’enfant. Comment<br />
ces principes peuvent<br />
être communiqués en tant<br />
qu’aventures aux futures<br />
éducatrices et éducateurs<br />
montre la formation <strong>de</strong>s<br />
éducateurs <strong>de</strong> l’école<br />
catholique spécialisée pour<br />
pédagogie sociale <strong>de</strong><br />
Saarbrücken où – orientés<br />
au concept du champ<br />
d’apprentissage – mouvement,<br />
jeu et sport constitu-<br />
empirical findings the<br />
discussion about the best<br />
theory of <strong>de</strong>velopment that<br />
was conducted in a very<br />
controversial manner for<br />
many years seems to be<br />
stuck in a “<strong>de</strong>velopmenttheoretical<br />
blind alley”.<br />
When seen perspectively, the<br />
metatheoretical framework<br />
concept of the life-span<br />
<strong>de</strong>velopmental psychology<br />
<strong>de</strong>veloped by Baltes has<br />
great innovative strength<br />
regarding the future<br />
research of the problems of<br />
motor <strong>de</strong>velopment. In this<br />
connection the examination<br />
of the specific influence of<br />
potential <strong>de</strong>velopmental<br />
factors <strong>und</strong>er externally<br />
valid ecological context<br />
conditions and of the<br />
assumptions of contextualism<br />
concerning the com-<br />
plex causal structure of<br />
ontogenesis is of great<br />
interest.<br />
ent une partie fondamentale<br />
<strong>de</strong> la formation: aussi bien<br />
en vue <strong>de</strong> l’accroissement <strong>de</strong><br />
la santé et du bien-être <strong>de</strong>s<br />
élèves qu’à la préparation <strong>de</strong><br />
leur champ professionnel<br />
future.<br />
Albert Müller<br />
Le «semisport» - un exemple<br />
d’interconnexion efficace<br />
entre théorie et pratique au<br />
Centre <strong>de</strong> Consultation et <strong>de</strong><br />
Traitement surrégional <strong>de</strong><br />
Würzburg<br />
Comme le but <strong>de</strong> la formation<br />
<strong>de</strong> pédagogie curative est<br />
<strong>de</strong> différencier et d’élargir<br />
les compétences professi-<br />
121
122<br />
Résumés<br />
onnelles relatives à l’action<br />
et à la personne <strong>de</strong>s péda-<br />
gogues curatifs futures,<br />
il faut intégrer <strong>de</strong> façon<br />
adéquate expérience<br />
professionnelle et vitale,<br />
connaissances spécialisées<br />
et compétences d’action<br />
nécessitées en pédagogie<br />
curative. Cela se passe e.a.<br />
dans la forme d’enseigne-<br />
ment et d’aprentissage<br />
spécifique du champ<br />
pratique.<br />
L’interconnexion visée entre<br />
théorie et pratique <strong>de</strong> la<br />
formation <strong>de</strong> pédagogie<br />
curative à plein temps est<br />
présentée à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’exemple du domaine<br />
méthodologique «Développement<br />
motopédagogique et<br />
motothérapeutique d’enfants<br />
et d’adolescents présentant<br />
<strong>de</strong>s troubles du comportement».<br />
Comme cette<br />
terminologie est trop<br />
compliquée dans l’usage<br />
quotidien <strong>de</strong> la langue, il<br />
s’est installé au cours <strong>de</strong>s<br />
années chez les enfants<br />
concernés le terme <strong>de</strong><br />
«Semisport».<br />
Jörg Lesch<br />
La psychomotricité en tant<br />
qu’offre orientée vers le<br />
mouvement dans une<br />
institution d’ai<strong>de</strong> aux<br />
enfants et adolescents<br />
A l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’exemple d’une<br />
institution d’ai<strong>de</strong> aux<br />
enfants et adolescents dans<br />
le Saarland l’importance du<br />
mouvement, jeu et sport<br />
dans le travail pédagogique<br />
et thérapeutique avec <strong>de</strong>s<br />
enfants est mise en évi<strong>de</strong>nce.<br />
Sandra Klingler<br />
Se laisser tomber – un thème<br />
dans l’ai<strong>de</strong> à l’enfance et<br />
l’adolescence?!<br />
A l’ai<strong>de</strong> d’exemples <strong>de</strong> cas<br />
l’importance pour le<br />
développement <strong>de</strong> l’enfant<br />
<strong>de</strong> se laisser tomber et <strong>de</strong><br />
relâcher est démontrée.<br />
Devant l’arrière-plan <strong>de</strong> la<br />
théorie <strong>de</strong> développement <strong>de</strong><br />
Erikson se montre l’efficacité<br />
d’offres psychomotrices – ici<br />
en particulier se laisser<br />
tomber - dans le contexte<br />
d’une institution d’ai<strong>de</strong> aux<br />
enfants et adolescents.<br />
Eilert von Busch<br />
Bienvenu dans le sta<strong>de</strong><br />
Stefan Kuntz ou: Conception<br />
<strong>de</strong> la récréation dans une<br />
école d’ai<strong>de</strong> à l’éducation<br />
Dans le cadre d’une année<br />
anti-violence il s’est passé<br />
dans une institution <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />
à l’enfance et l’adolescence<br />
qu’également le domaine<br />
sport/psychomotricité a<br />
participé à cette priorité<br />
dans le travail avec <strong>de</strong>s<br />
enfants et <strong>de</strong>s adolescents<br />
perturbés du comportement.<br />
Maintenant le jeu du<br />
football dans les écoles<br />
constitue un vieux<br />
chapeau, jouer avec<br />
succès au football dans<br />
une école d’ai<strong>de</strong> à<br />
l’éducation cependant<br />
constitue un véritable<br />
challenge.<br />
Richard Hammer<br />
Ah oui, les valeurs !<br />
La psychomotricité peut tout<br />
faire – presque. Peut-elle<br />
contribuer également au<br />
développement <strong>de</strong> la<br />
conscience <strong>de</strong> valeurs? Dans<br />
la contribution est mis en<br />
évi<strong>de</strong>nce – <strong>de</strong>vant l’arrièreplan<br />
d’un système <strong>de</strong> valeurs<br />
développé par H. v. Hentig –<br />
comment <strong>de</strong>s changements<br />
<strong>de</strong> personnalité peuvent être<br />
obtenus dans une leçon <strong>de</strong><br />
psychomotricité – souvent<br />
sans intention. Il faudrait<br />
s’en rendre compte.<br />
Mone Welsche /<br />
Cordula Stobbe /<br />
Georg Romer<br />
«Et qui nous voit?» –<br />
Diagnostic moteur pour<br />
adolescents<br />
Dans beaucoup <strong>de</strong> cliniques<br />
pédopsychiatriques <strong>de</strong>s<br />
mesures <strong>de</strong> diagnostic<br />
moteur font partie du<br />
standard <strong>de</strong> la prise en<br />
charge. Il y a eu une enquête<br />
à propos du thème «Mise en<br />
place <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong><br />
diagnostic moteur dans la<br />
pédopsychiatrie». A ce<br />
propos la dominance <strong>de</strong><br />
métho<strong>de</strong>s contrôlant avant<br />
tout le niveau <strong>de</strong> développement<br />
moteur ainsi que <strong>de</strong>s<br />
performances <strong>de</strong> perception<br />
dans l’enfance s’est clairement<br />
montrée. Dans la prise<br />
en considération <strong>de</strong> comportement<br />
ainsi que <strong>de</strong> diagnostic<br />
moteur auprès <strong>de</strong><br />
patients adolescents on a<br />
constaté <strong>de</strong>s déficits et <strong>de</strong><br />
grands besoins. Dans cet<br />
article l’importance <strong>de</strong><br />
mesures <strong>de</strong> diagnostic<br />
moteur auprès <strong>de</strong> patients<br />
adolescents est discutée et<br />
<strong>de</strong>s approches <strong>de</strong> diagnostic<br />
moteur qui conviennent<br />
aux adolescents sont<br />
présentées.<br />
Rainer Wollny<br />
Les traditions et les tendances<br />
actuelles <strong>de</strong> la<br />
recherche <strong>de</strong> développement<br />
moteur en Allemagne<br />
La discussion menée pendant<br />
<strong>de</strong> longues années <strong>de</strong> façon<br />
controversée sur la meilleure<br />
théorie <strong>de</strong> développement<br />
semble s’être engagée dans<br />
une impasse concernant la<br />
théorie <strong>de</strong> développement<br />
sur base <strong>de</strong> représentations<br />
théoriques hétérogènes et <strong>de</strong><br />
résultats empiriques. Du<br />
point <strong>de</strong> vue perspectiviste il<br />
advient à la conception <strong>de</strong><br />
cadre metathéorique <strong>de</strong> la<br />
psychologie <strong>de</strong> développement<br />
<strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> vie <strong>de</strong><br />
Baltes une gran<strong>de</strong> force<br />
d’innovation pour la<br />
recherche future à propos <strong>de</strong><br />
questions se rapportant au<br />
curriculum vitae du développement<br />
moteur. L’examen <strong>de</strong><br />
l’influence spécifique <strong>de</strong><br />
facteurs <strong>de</strong> développement<br />
potentiels est à ce propos<br />
d’un intérêt scientifique<br />
particulier sous <strong>de</strong>s conditions<br />
<strong>de</strong> contexte externes<br />
vali<strong>de</strong>s et écologiques et <strong>de</strong>s<br />
hypothèses <strong>de</strong> contextualisme<br />
du complexe conditionnel<br />
<strong>de</strong> l’ontogenèse.
Es kommt<br />
BEWEGUNG in die<br />
Kin<strong>de</strong>r-LANDSCHAFT<br />
LANDSCHAFT<br />
Sportgerätekatalog<br />
gleich kostenlos<br />
anfor<strong>de</strong>rn!<br />
G. BENZ Turngerätefabrik GmbH + Co. KG<br />
Grüninger Straße 1–3 • 71364 Winnen<strong>de</strong>n<br />
Tel. 07195/69 05-0 • Fax 07195/69 05 77<br />
www.benz-sport.<strong>de</strong> • info@benz-sport.<strong>de</strong><br />
Anzeigenschluss<br />
<strong>für</strong> Ausgabe 3/2007 zum Thema<br />
„Ges<strong>und</strong>heitsför<strong>de</strong>rung“<br />
ist am 17. August 2007<br />
05-117
DIN A4, 32 Karten<br />
ISBN 978-3-7780-6060-5<br />
Bestell-Nr. 6060 � 14.90<br />
Susanne Halbig & Martina Lutter<br />
Arbeitskarten <strong>für</strong><br />
Erlebnislandschaften<br />
in <strong>de</strong>r Turnhalle<br />
Gestaltungs- <strong>und</strong> Aufbaupläne<br />
Dieser Kartensatz bietet Ihnen:<br />
– 29 farbige stabile Stationskarten (DIN A4) mit vielen<br />
Informationen, zur Gestaltung von spannen<strong>de</strong>n Erlebnislandschaften<br />
in Turnhallen.<br />
– Großformatfotos, zahlreiche Abbildungen mit Variationsmöglichkeiten,<br />
sowie Anregungen <strong>und</strong> Anleitungen<br />
zum Stationsaufbau <strong>und</strong> zur Unterrichtsgestaltung.<br />
– Turngerätekombinationen, die weit über <strong>de</strong>n Turnunterricht<br />
hinausgehen<strong>de</strong> Ziele berücksichtigen <strong>und</strong><br />
allen Benutzern extrem viel Spaß <strong>und</strong> Freu<strong>de</strong> bereiten.<br />
Endlich!<br />
Bauen Sie fantasievolle<br />
Bewegungsstationen<br />
im Handumdrehen auf!<br />
Versandkosten � 2.–;<br />
ab einem Bestellwert von � 20.– liefern wir versandkostenfrei.<br />
Steinwasenstraße 6–8 • 73614 Schorndorf • Telefon (0 71 81) 402-125 • Telefax (0 71 81) 402-111<br />
Internet: www.hofmann-verlag.<strong>de</strong> • E-Mail: bestellung@hofmann-verlag.<strong>de</strong>