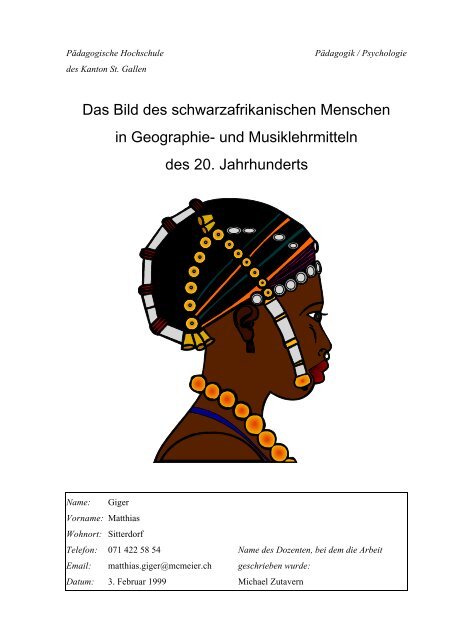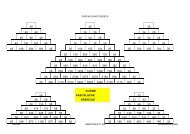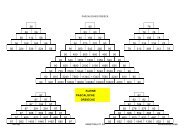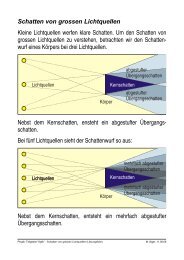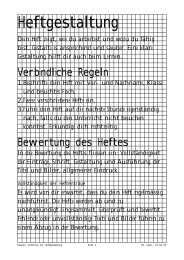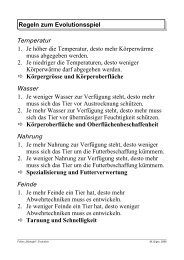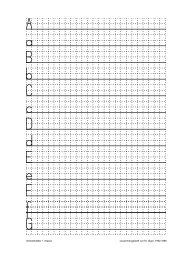Ami Pro - SEMAPDF2.SAM - GIGERs.COM
Ami Pro - SEMAPDF2.SAM - GIGERs.COM
Ami Pro - SEMAPDF2.SAM - GIGERs.COM
- TAGS
- www.gigers.com
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Pädagogische Hochschule<br />
des Kanton St. Gallen<br />
Pädagogik / Psychologie<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Name: Giger<br />
Vorname: Matthias<br />
Wohnort: Sitterdorf<br />
Telefon: 071 422 58 54<br />
in Geographie- und Musiklehrmitteln<br />
Email: matthias.giger@mcmeier.ch<br />
Datum: 3. Februar 1999<br />
des 20. Jahrhunderts<br />
Name des Dozenten, bei dem die Arbeit<br />
geschrieben wurde:<br />
Michael Zutavern
Die Figur war ausserordentlich schön, obgleich nur mässig hoch, der Kopf an sich von dem edelsten Umriss, und das ovale<br />
Gesicht hätte, ohne den aufgequollenen Mund und die Stumpfnase, nicht zarter geformt sein können; dazu kam eine<br />
braune, wenngleich sehr frische Haut, und ein Paar grosse dunkle Augen. Es gab, freilich nur unter den Männern, immer<br />
einige, denen eine so eigene Zusammensetzung gefiel; sie behaupteten, es werden die widersprechenden Teile dieses<br />
Gesichts durch den vollen Ausdruck von Seele in ein unzertrennliches Ganzes auf die reizendste Art verschmolzen. Man<br />
hatte deshalb den Bewunderern Margots den Spottnamen der afrikanischen Fremd- und Feinschmecker aufgetrieben, und<br />
wenn hieran gewisse allgemein verehrte Schönheiten der Stadt sich nicht wenig erbauten, so war es doch verdriesslich,<br />
dass eben die geistreichsten Jünglinge sich am liebsten um diese Afrikanerin versammelten.<br />
Mörike in "Maler Nolten", Digitale Bibliothek 1997, S. 72713<br />
Die Schweizerische Bankgesellschaft, seit 1948 mit einer Niederlassung in Johannesburg, klärt in der Personalzeitung vom<br />
April 1960 auf: "Der südafrikanische Eingeborene ist noch absolut roh, hat keine Erziehung, kann weder lesen noch<br />
schreiben, kurz er ist halb Kind, halb Tier... Einen Eingeborenen zu Gefängnis zu verurteilen ist zwecklos, denn für ihn<br />
bedeutet dies nur Ferien, er hat keine Verantwortung und wird gefüttert. Die einzige Sprache, die er versteht, ist Härte und<br />
Autorität... Er ist auch faul von Natur und charakterlich schlecht, das heisst, er lügt, er betrügt, und sehr oft stiehlt er auch,<br />
wenn er hofft, nicht ertappt zu werden, nicht weil er das, was er stiehlt, braucht oder will, sondern weil es ihm Spass<br />
macht... Er hat keine Führer, er hat keine Planung, und sollte es plötzlich einen Generalstreik der Eingeborenen geben, so<br />
würde der Schwarze viel mehr als der Weisse daran leiden. Er würde nach einer Woche verhungern, weil er weder Kapital<br />
noch Reserven hinter sich hat."<br />
Das Magazin Nr. 7, 1998, S. 29<br />
"Nichts!" wiederholte Leonhard. "Zwanzig bis dreissig in einen kahlen, glühenden Felsenwinkel geklebte Lehmhütten -<br />
hundertundfünfzig übelduftende Neger und Negerinnen mit sehr regelmässigen Affengesichtern und von allen Altersstufen<br />
von Zeit zu Zeit Totengeheul um einen erschlagenen Krieger oder einen am Fieber oder an Altersschwäche Gestorbenen -<br />
von Zeit zu Zeit Siegesgeschrei über einen gelungenen Streifzug oder eine gute Jagd - von Zeit zu Zeit dunkle<br />
Heuschreckenschwärme, welche über das gelbe Tal hinziehen - zur Regenzeit ein troglodytisches Verkriechen in den<br />
Spalten und Höhlen der Felsen! Im Juni des Jahres achtzehnhundertneunundvierzig geschah jener Überfall - rechnet,<br />
rechnet - zählt an den Fingern die Jahre und - gebt mir ein Glas Wasser aus unserm Brunnen: wahrhaftig, es war eine arge<br />
Hitze und sehr schwül in Abu Telfan im Tumurkielande!"<br />
Raabe in "Abu Telfan", Digitale Bibliothek 1997, S. 76944<br />
Für die geleistete Unterstützung möchte ich Herrn Hubert Beck, der mir einen Grossteil seiner Geographiebü-<br />
cher zur Verfügung gestellt hat, Herrn Dr. Joseph Küng für die Zusendung seiner Vorlesungsunterlagen zur<br />
Geschichte Schwarzafrikas, Herrn Bruno Dörig und Herrn Michael Zutavern für zusätzliche Informationen,<br />
Herrn Zutavern für die geleisteten Betreuungsarbeiten, meinen Eltern für das Bereitstellen diverser Materia-<br />
lien und ganz besonders meiner Frau Rukaya, die mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat, und neben<br />
Arbeiten im Hintergrund vor allem viel Geduld aufbringen musste, danken.<br />
Die Grafik auf dem Titelblatt stammt aus der Sammlung "Corel Draw Mega Gallery".<br />
Danksagung<br />
Matthias Giger, November 1998<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 2
1. Einleitung .............................................. 20<br />
2. Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas ................ 25<br />
3. Vorwürfe an das von der Schule vermittelte Bild ............... 35<br />
4. Der schwarzafrikanische Mensch im Geographielehrmittel ....... 93<br />
a) Frühe Lehrmittel ...................................... 95<br />
b) Sechziger Jahre ..................................... 117<br />
c) Siebziger Jahre ...................................... 220<br />
d) Achtziger Jahre ...................................... 326<br />
e) Neunziger Jahre ..................................... 380<br />
5. Der schwarzafrikanische Mensch im Musiklehrmittel ........... 433<br />
6. Der schwarzafrikanische Mensch im Lesebuch und Comic ...... 471<br />
7. Ergebnisse der Untersuchung ............................. 494<br />
8. Anhang ............................................... 537<br />
Für eilige Leserinnen und Leser<br />
Einleitung .......................................................... 20<br />
Vorwürfe an das Afrikabild der Lehrmittel ............................... 60<br />
Der schwarzafrikanische Mensch im Geographielehrmittel .................. 93<br />
Ergebnisse der Untersuchung .......................................... 494<br />
Vorstellung der Arbeitsweise: Themenkreise .............................. 63<br />
Verzeichnis: Weitere Themenkreise ..................................... 90<br />
Kurzzusammenfassung der Arbeit<br />
Inhaltsüberblick<br />
Ziel der Arbeit ...................................................... 20<br />
Zusammenfassung des historischen Bildes des schwarzafrikanischen Menschen .. 58<br />
Zusammenfassung des modernen Bildes des schwarzafrikanischen Menschen ... 533<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 3
Inhaltsverzeichnis<br />
1. EINLEITUNG ................................................................. 20<br />
1.1. Ziel der Arbeit ............................................................. 20<br />
1.2. Persönliche Interessen ....................................................... 20<br />
1.3. Aufbau der Arbeit .......................................................... 21<br />
1.4. Bedeutung des Themas ....................................................... 22<br />
1.5. Bemerkung zu wichtigen Quellen .............................................. 23<br />
1.5.1. Ki-Zerbos "Die Geschichte Schwarzafrikas" ................................... 23<br />
1.5.2. Encarta und Encarta Weltatlas .............................................. 23<br />
1.5.3. Fischer Weltalmanach '98 ................................................. 23<br />
1.5.4. Infopedia .............................................................. 24<br />
1.5.5. FAOSTAT und andere Dienste der FAO ...................................... 24<br />
1.5.6. The Economist .......................................................... 24<br />
2. ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHICHTE SCHWARZAFRIKAS ......................... 25<br />
2.1. Vorgeschichte .............................................................. 25<br />
2.2. Frühgeschichte ............................................................. 26<br />
2.3. Dunkle Jahrhunderte ........................................................ 26<br />
2.4. Von den Königreichen zu den Kaiserreichen ..................................... 27<br />
2.5. Grosse Jahrhunderte ........................................................ 28<br />
2.5.1. Wirtschaft und Gesellschaft in Westafrika ..................................... 30<br />
2.6. Zeit der Wende ............................................................. 31<br />
2.7. Kolonisation und Widerstand ................................................. 33<br />
3. VORWÜRFE AN DAS VON DER SCHULE VERMITTELTE BILD ...................... 35<br />
3.1. Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte ................ 35<br />
3.1.1. Die Antike ............................................................. 35<br />
3.1.2. Die Berichte arabischer Beobachter .......................................... 37<br />
3.1.2.1. El Idrisi .............................................................. 37<br />
3.1.2.2. Ibn Batuta ............................................................ 37<br />
3.1.2.3. Leo Africanus ......................................................... 37<br />
3.1.3. Entdeckungen, Menschenhandel und Sklavenbefreiung ........................... 38<br />
3.1.3.1. Montaigne ............................................................ 40<br />
3.1.3.2. Shakespeare .......................................................... 40<br />
3.1.3.3. Locke ................................................................ 41<br />
3.1.3.4. Defoe ................................................................ 42<br />
3.1.3.5. Wieland .............................................................. 42<br />
3.1.3.6. Lichtenberg ........................................................... 43<br />
3.1.3.7. Lessing .............................................................. 44<br />
3.1.3.8. Schiller .............................................................. 44<br />
3.1.3.9. Forster .............................................................. 44<br />
3.1.3.10. Herder .............................................................. 46<br />
3.1.3.11. Seume .............................................................. 46<br />
3.1.3.12. Paul ................................................................ 47<br />
3.1.3.13. Arnim .............................................................. 47<br />
3.1.3.14. Nettelbeck ........................................................... 47<br />
3.1.3.15. Goethe .............................................................. 49<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 4
Inhaltsverzeichnis<br />
3.1.3.16. Mörike .............................................................. 49<br />
3.1.3.17. Hegel ............................................................... 49<br />
3.1.3.18. Tieck ............................................................... 50<br />
3.1.3.19. Heine ............................................................... 50<br />
3.1.4. Der Kolonialismus ....................................................... 51<br />
3.1.4.1. Raabe ............................................................... 52<br />
3.1.4.2. Darwin .............................................................. 52<br />
3.1.4.3. Fontane .............................................................. 54<br />
3.1.4.4. Wedekind ............................................................. 54<br />
3.1.4.5. Wells ................................................................ 55<br />
3.1.4.6. Kindergedicht ......................................................... 55<br />
3.1.4.7. Heym ................................................................ 55<br />
3.1.4.8. Lindsay .............................................................. 56<br />
3.1.4.9. Weitere häufige Vorstellungen ............................................ 56<br />
3.1.5. Zusammenfassung ....................................................... 58<br />
3.2. Vorwürfe an das Afrikabild der Lehrmittel ...................................... 60<br />
3.3. Themenkreise .............................................................. 63<br />
3.3.1. Ghana ................................................................ 63<br />
3.3.1.1. Widrig Geographie, 1967 ................................................ 63<br />
3.3.1.2. Seydlitz für Realschulen, 1968 ............................................ 63<br />
3.3.1.3. Erdkunde, 1968 ........................................................ 66<br />
3.3.1.4. Länder und Völker, 60er Jahre ............................................ 67<br />
3.3.1.5. Seydlitz für Gymnasien, 1963-1971 ........................................ 68<br />
3.3.1.6. Fahr mit in die Welt, 1971-1974 .......................................... 68<br />
3.3.1.7. Dreimal um die Erde, 1977-1980 .......................................... 68<br />
3.3.1.8. Terra Geographie, 1979 ................................................. 70<br />
3.3.1.9. Musikstudio (1980-1982) ................................................ 70<br />
3.3.1.10. Seydlitz: Mensch und Raum, 1983-1984 ................................... 70<br />
3.3.1.11. Geographie der Kontinente, 1984 ........................................ 71<br />
3.3.1.12. Mensch und Raum, 1983-1986 ........................................... 72<br />
3.3.1.13. Seydlitz: Mensch und Raum, 1987 ........................................ 73<br />
3.3.1.14. Singen Musik (1992) ................................................... 73<br />
3.3.1.15. Klangwelt-Weltklang 2, 1993 ............................................ 73<br />
3.3.1.16. Musik hören, machen, verstehen, 1990-1995 ................................ 74<br />
3.3.1.17. Seydlitz: Geographie, 1994-1996 ......................................... 74<br />
3.3.1.18. Zusammenfassung ..................................................... 75<br />
3.3.2. Krieg ................................................................. 75<br />
3.3.2.1. Lesebuch für die Oberklassen, 30er Jahre ................................... 75<br />
3.3.2.2. Leitfaden für den Geographieunterricht, 1934 ............................... 75<br />
3.3.2.3. Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen, 1961 ............................. 75<br />
3.3.2.4. Geographie Widrig, 1967 ................................................ 76<br />
3.3.2.5. Seydlitz für Realschulen, 1968 ............................................ 76<br />
3.3.2.6. Länder und Völker, Ende 60er Jahre ....................................... 76<br />
3.3.2.7. Seydlitz für Gymnasien, 1963- ca. 1971 ..................................... 77<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 5
Inhaltsverzeichnis<br />
3.3.2.8. Fahr mit in die Welt, 1971-1974 .......................................... 77<br />
3.3.2.9. List Geographie, 1972-1976 .............................................. 78<br />
3.3.2.10. Neue Geographie, 1974-1976 ............................................ 78<br />
3.3.2.11. Dreimal um die Erde, 1977-1980 ......................................... 78<br />
3.3.2.12. Geographie thematisch, 1977-1980 ....................................... 79<br />
3.3.2.13. Musikstudio, 1980-1982 ................................................ 80<br />
3.3.2.14. Seydlitz: Mensch und Raum, 1987 ........................................ 80<br />
3.3.2.15. Klangwelt-Weltklang 2, 1993 ............................................ 80<br />
3.3.2.16. Seydlitz Erdkunde 1993-1995 ............................................ 81<br />
3.3.2.17. Seydlitz Geographie, 1994-1996 ......................................... 82<br />
3.3.2.18. Diercke Erdkunde, 1995-1997 ........................................... 82<br />
3.3.2.19. Zusammenfassung ..................................................... 82<br />
3.3.3. Religion ............................................................... 83<br />
3.3.3.1. Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen, 1912 .................. 83<br />
3.3.3.2. Leitfaden für den Geographieunterricht, 1934 ............................... 84<br />
3.3.3.3. Harms Erdkunde - die Welt in allen Zonen, 1961 ............................. 84<br />
3.3.3.4. Schweizerischer Mittelschulatlas, 1962 ..................................... 84<br />
3.3.3.5. Geographie Widrig, 1967 ................................................ 84<br />
3.3.3.6. Seydlitz für Realschulen, 1968 ............................................ 86<br />
3.3.3.7. Erdkunde Oberstufe, 1968-1969 ........................................... 87<br />
3.3.3.8. Länder und Völker, Ende 60er Jahre ....................................... 87<br />
3.3.3.9. Seydlitz für Gymnasien 1963- ca. 1971 ..................................... 87<br />
3.3.3.10. Geographie für die oberen Klassen der Volksschule, 1972-1977 ................ 87<br />
3.3.3.11. Dreimal um die Erde, 1977-1980 ......................................... 89<br />
3.3.3.12. Seydlitz Erdkunde 1993-1995 ............................................ 89<br />
3.3.3.13. Diercke Erdkunde, 1995-1997 ........................................... 89<br />
3.3.3.14. Zusammenfassung ..................................................... 90<br />
3.3.4. Weitere Themenkreise .................................................... 90<br />
4. DER SCHWARZAFRIKANISCHE MENSCH IM GEOGRAPHIELEHRMITTEL .......... 93<br />
4.1. Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen (1912) ...................... 95<br />
4.1.1. Zusammenfassung ....................................................... 95<br />
4.2. Lesebuch für die Oberklassen (30er Jahre) ....................................... 96<br />
4.2.1. Zusammenfassung ....................................................... 98<br />
4.3. Leitfaden für den Geographiunterricht (1934) .................................... 99<br />
4.3.1. Allgemeiner Teil ........................................................ 99<br />
4.3.2. Der Sudan ............................................................. 101<br />
4.3.3. Die Guineaküste und das Kongogebiet ........................................ 101<br />
4.3.4. Ostafrika .............................................................. 102<br />
4.3.5. Südafrika .............................................................. 103<br />
4.3.6. Zahlenteil ............................................................. 104<br />
4.3.7. Zusammenfassung ....................................................... 104<br />
4.4. Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen (1936) .................................... 105<br />
4.4.1. Die Savanne ............................................................ 105<br />
4.4.2. "Negerleben" ........................................................... 105<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 6
Inhaltsverzeichnis<br />
4.4.3. Heuschreckenplage ...................................................... 107<br />
4.4.4. Zusammenfassung ....................................................... 108<br />
4.5. Sekundarschulatlas (1950) .................................................... 109<br />
4.6. Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule (1953) ............................ 110<br />
4.6.1. Die natürlichen Landschaften ............................................... 110<br />
4.6.2. Die Staaten ............................................................ 111<br />
4.6.3. Zusammenfassung ....................................................... 113<br />
4.7. Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder (1953) .......................... 114<br />
4.7.1. "Im Land der Löwen" .................................................... 114<br />
4.7.2. Der Urwald ............................................................ 114<br />
4.7.3. "Gang in das Maniokfeld" ................................................. 115<br />
4.7.4. Zusammenfassung ....................................................... 116<br />
4.8. Neuer Grosser Weltatlas (1960) ................................................ 117<br />
4.8.1. "Afrika" ............................................................... 117<br />
4.8.2. Weitere Textstellen zu Afrika .............................................. 118<br />
4.8.3. Staaten und Länder von A-Z ............................................... 119<br />
4.8.4. Kartenteil .............................................................. 120<br />
4.8.5. Zusammenfassung ....................................................... 120<br />
4.9. Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961) ................................. 121<br />
4.9.1. "Gebet an die Masken" .................................................... 121<br />
4.9.2. "Afrika, bevor die Europäer kamen" ......................................... 122<br />
4.9.3. "Weisse Farmerin unter Schwarzen" ......................................... 123<br />
4.9.4. Kunst in Benin .......................................................... 123<br />
4.9.5. "Was bei den Weissen anders ist als bei den Schwarzen" .......................... 124<br />
4.9.6. Totengesang der Pygmäen ................................................. 126<br />
4.9.7. "Amos Tutuola: Ein schwarzer Dichter" ....................................... 126<br />
4.9.8. "Der Weisse in schwarzer Sicht" ............................................ 127<br />
4.9.9. Zusammenfassung ....................................................... 128<br />
4.10. Schweizerischer Mittelschulatlas (1962) ........................................ 129<br />
4.11. Geographie (1963) ......................................................... 130<br />
4.11.1. Die Bewohner ......................................................... 130<br />
4.11.2. Der Sudan ............................................................ 131<br />
4.11.3. Ostafrika ............................................................. 132<br />
4.11.4. Das Kongobecken und die Guineaküste ...................................... 132<br />
4.11.5. Südafrika ............................................................. 133<br />
4.11.6. Lesetexte ............................................................. 133<br />
4.11.7. Zusammenfassung ...................................................... 133<br />
4.12. Weltatlas (1965) ........................................................... 134<br />
4.13. Geographie (Widrig, 1967) ................................................... 135<br />
4.13.1. Geschichte ............................................................ 135<br />
4.13.2. Die "Negerstämme und ihre Kultur" ......................................... 136<br />
4.13.3. Die Religion .......................................................... 138<br />
4.13.4. Die Wirtschaft ......................................................... 140<br />
4.13.5. "Pygmäen", "Buschmänner" und "Hottentotten" ................................ 141<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 7
Inhaltsverzeichnis<br />
4.13.6. "Das weisse Afrika" ..................................................... 142<br />
4.13.7. "Unabhängigkeit südlich der Sahara" ........................................ 144<br />
4.13.8. Tropenkrankheiten ...................................................... 145<br />
4.13.9. Insekten .............................................................. 145<br />
4.13.10. Ackerbau und Viehzucht in der Savanne .................................... 146<br />
4.13.11. "Die Guineaküste und das Kongobecken" .................................... 147<br />
4.13.12. Ostafrika ............................................................ 147<br />
4.13.13. Südafrika ............................................................ 148<br />
4.13.14. Zusammenfassung ..................................................... 150<br />
4.14. Seydlitz für Realschulen (1968) ............................................... 151<br />
4.14.1. Band 3 ............................................................... 151<br />
4.14.1.1. Der Norden Afrikas .................................................... 151<br />
4.14.1.2. Die Savannen des Sudans ............................................... 152<br />
4.14.1.3. Äquatorialafrika ...................................................... 154<br />
4.14.1.4. Südafrika ............................................................ 159<br />
4.14.1.5. Ostafrika ............................................................ 164<br />
4.14.1.6. Rückblick auf Afrika ................................................... 167<br />
4.14.2. Band 6: Menschliche Gemeinschaften gestalten die Erde ......................... 168<br />
4.14.3. Zusammenfassung ...................................................... 171<br />
4.15. Erdkunde (1968) ........................................................... 172<br />
4.15.1. Äquatorialafrika und Sudan ............................................... 172<br />
4.15.2. "Europäer in Innerafrika" ................................................. 173<br />
4.15.3. "Der Neger und die neue Wirtschaft" ........................................ 175<br />
4.15.4. "Grosse Ströme im Dienste des Menschen" ................................... 177<br />
4.15.5. "Kolonien werden selbständige Staaten" ..................................... 177<br />
4.15.6. Äquatorialafrika und Sudan ............................................... 179<br />
4.15.7. Ostafrika ............................................................. 179<br />
4.15.8. Südafrika ............................................................. 181<br />
4.15.9. "Ein Erdteil im Aufbruch" ................................................ 184<br />
4.15.10. Zusammenfassung ..................................................... 185<br />
4.16. Erdkunde: Oberstufe (1968-1969) ............................................. 186<br />
4.16.1. Band 1: Die Erde als Natur- und Lebensraum .................................. 186<br />
4.16.2. Band 2: Die Erde als wirtschaftlicher und politischer Raum ....................... 188<br />
4.16.3. Band 3: Deutschland - wirtschaftliche, soziale und politische <strong>Pro</strong>bleme .............. 188<br />
4.16.4. Zusammenfassung ...................................................... 188<br />
4.17. Länder und Völker (60er Jahre) .............................................. 190<br />
4.17.1. Bevölkerung .......................................................... 190<br />
4.17.2. "Der Sudan, Land der Schwarzen" .......................................... 191<br />
4.17.3. Äquatorialafrika ........................................................ 194<br />
4.17.4. Ostafrika ............................................................. 198<br />
4.17.5. Südafrika ............................................................. 204<br />
4.17.6. Inseln Afrikas ......................................................... 208<br />
4.17.7. "Afrika und Europa" .................................................... 208<br />
4.17.8. Zusammenfassung ...................................................... 210<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 8
Inhaltsverzeichnis<br />
4.18. Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971) ........................................ 211<br />
4.18.1. Band 5: Erde und Mensch ................................................ 211<br />
4.18.1.1. Kulturstufen ......................................................... 212<br />
4.18.1.2. Siedlungsformen ...................................................... 212<br />
4.18.1.3. Sammler- und Hackbauvölker ........................................... 213<br />
4.18.1.4. Die Tropen .......................................................... 214<br />
4.18.2. Band 6: Das Weltbild der Gegenwart ........................................ 215<br />
4.18.2.1. "Anthropogene Faktoren" ............................................... 217<br />
4.18.3. Zusammenfassung ...................................................... 219<br />
4.19. Fahr mit in die Welt (1971-1974) .............................................. 220<br />
4.19.1. Allgemeiner Teil ....................................................... 220<br />
4.19.2. Nordafrika ............................................................ 222<br />
4.19.3. Der Sudan und Oberguinea ............................................... 223<br />
4.19.4. Ostafrika ............................................................. 225<br />
4.19.5. Südafrika ............................................................. 226<br />
4.19.6. Zusammenfassung ...................................................... 230<br />
4.20. Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (Aargau 1972-1977) .............. 232<br />
4.20.1. Das Leben (1974) ....................................................... 232<br />
4.20.1.1. Krankheiten .......................................................... 232<br />
4.20.1.2. Wohnen ............................................................. 233<br />
4.20.1.3. Ernährung ........................................................... 235<br />
4.20.2. Band 4: Die Kultur ...................................................... 236<br />
4.20.2.1. Kultur .............................................................. 236<br />
4.20.2.2. Ausbreitung des Menschen und aktuelle Lage (1977) ......................... 237<br />
4.20.2.3. Der Kulturraum ...................................................... 238<br />
4.20.2.4. Lebensweisen ........................................................ 240<br />
4.20.2.5. Erziehung ........................................................... 242<br />
4.20.2.6. Schule .............................................................. 244<br />
4.20.2.7. Religion ............................................................. 246<br />
4.20.2.8. Politik .............................................................. 248<br />
4.20.3. Zusammenfassung ...................................................... 248<br />
4.21. List Geographie (erstmals 1972-1976) .......................................... 250<br />
4.21.1. Band 1 ............................................................... 250<br />
4.21.1.1. "Buschmänner in der Kalahari" .......................................... 250<br />
4.21.1.2. Kaffee .............................................................. 251<br />
4.21.1.3. Eisenerz aus Liberia ................................................... 252<br />
4.21.2. Band 2 ............................................................... 253<br />
4.21.2.1. Zaire ............................................................... 253<br />
4.21.2.2. Ostafrika ............................................................ 254<br />
4.21.2.3. Mali ................................................................ 255<br />
4.21.3. Band 3 ............................................................... 258<br />
4.21.3.1. Südafrika ............................................................ 258<br />
4.21.3.2. Entwicklungshilfe ..................................................... 260<br />
4.21.4. Zusammenfassung ...................................................... 260<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 9
Inhaltsverzeichnis<br />
4.22. Neue Geographie (1974-1976) ................................................ 261<br />
4.22.1. Band 1 ............................................................... 261<br />
4.22.2. Band 2 ............................................................... 262<br />
4.22.2.1. Mosambik ........................................................... 262<br />
4.22.3. Band 3 ............................................................... 264<br />
4.22.3.1. Entwicklungshilfe ..................................................... 266<br />
4.22.3.2. Tansania ............................................................ 266<br />
4.22.3.3. Südafrika ............................................................ 267<br />
4.22.4. Zusammenfassung ...................................................... 271<br />
4.23. Dreimal um die Erde (1977-1980, erstmals 1968-1972) ............................. 272<br />
4.23.1. Band 1: Menschen ihn ihrer Welt (Ausgabe von 1977, erstmals 1968) ............... 272<br />
4.23.1.1. Wildherden in den Savannen Ostafrikas ................................... 272<br />
4.23.1.2. Kakao aus Ghana ..................................................... 274<br />
4.23.2. Band 2: Räume und <strong>Pro</strong>blem (Ausgabe von 1980, erstmals 1970) .................. 275<br />
4.23.2.1. Nigeria ............................................................. 275<br />
4.23.2.2. Republik Südafrika .................................................... 280<br />
4.23.3. Band 3: Unsere Welt im Wandel (Ausgabe von 1977, erstmals 1972) ............... 286<br />
4.23.3.1. Ernährung der Menschheit .............................................. 286<br />
4.23.3.2. Entwicklungspolitik ................................................... 288<br />
4.23.3.3. Entwicklungshilfe ..................................................... 289<br />
4.23.4. Zusammenfassung ...................................................... 292<br />
4.24. Geographie thematisch (1977-1980) ............................................ 293<br />
4.24.1. Band 1 ............................................................... 293<br />
4.24.2. Band 2 ............................................................... 294<br />
4.24.2.1. Brandrodung ......................................................... 294<br />
4.24.2.2. Die Savanne ......................................................... 295<br />
4.24.2.3. Kilimandscharo ....................................................... 297<br />
4.24.2.4. Nigeria ............................................................. 297<br />
4.24.3. Band 3 ............................................................... 299<br />
4.24.3.1. Tansania ............................................................ 299<br />
4.24.4. Zusammenfassung ...................................................... 301<br />
4.25. Silva Weltatlas (1978) ....................................................... 302<br />
4.25.1. Zusammenfassung ...................................................... 303<br />
4.26. Terra Weltkunde (1978) ..................................................... 304<br />
4.27. Terra Geographie (1979) .................................................... 305<br />
4.27.1. Band 1 ............................................................... 305<br />
4.27.1.1. "Das gescheiterte Erdnussprojekt" ........................................ 305<br />
4.27.1.2. "Trockengrenze der Landwirtschaft" ...................................... 306<br />
4.27.1.3. "Dürre im Sahel" ..................................................... 307<br />
4.27.1.4. "Ochsenpflüge für Ghana" .............................................. 308<br />
4.27.1.5. Tansania ............................................................ 308<br />
4.27.1.6. Armut .............................................................. 310<br />
4.27.2. Band 2 ............................................................... 313<br />
4.27.3. Zusammenfassung ...................................................... 313<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 10
Inhaltsverzeichnis<br />
4.28. Unser Planet (1979-1982) .................................................... 314<br />
4.28.1. Band 1 ............................................................... 314<br />
4.28.1.1. Grenzraum: tropischer Regenwald ........................................ 314<br />
4.28.1.2. Ölpalmen ............................................................ 316<br />
4.28.2. Band 2 ............................................................... 317<br />
4.28.2.1. Die Sahelzone ........................................................ 317<br />
4.28.2.2. Prüfkompass ......................................................... 320<br />
4.28.3. Band 3 ............................................................... 320<br />
4.28.3.1. Tansania ............................................................ 320<br />
4.28.3.2. Der Welthandel ....................................................... 322<br />
4.28.4. Zusammenfassung ...................................................... 324<br />
4.29. Schweizer Weltatlas (1981) .................................................. 326<br />
4.30. Seydlitz: Mensch und Raum (1983-1984) ....................................... 327<br />
4.30.1. Band 1 ............................................................... 327<br />
4.30.1.1. "Landnutzung in den Tropen" ............................................ 327<br />
4.30.1.2. Die Massai .......................................................... 329<br />
4.30.1.3. Zaire ............................................................... 331<br />
4.30.1.4. Landnutzung, <strong>Pro</strong>dukte und Wirtschaftssysteme (Tabelle) ..................... 332<br />
4.30.1.5. Höhenstufen am Mount Kenia ........................................... 332<br />
4.30.1.6. Ochsengespann in Kamerun ............................................. 333<br />
4.30.1.7. "Ofenbauprogramm in Overvolta" (Burkina Faso) ........................... 334<br />
4.30.1.8. "Die Industrialisierung Nigerias" ........................................ 335<br />
4.30.2. Weitere Bände ......................................................... 337<br />
4.30.3. Zusammenfassung ...................................................... 338<br />
4.31. Geographie der Kontinente (Schülerband, 1984) ................................. 339<br />
4.31.1. Steckbrief des Kontinents ................................................. 339<br />
4.31.2. Der Regenwald ........................................................ 340<br />
4.31.3. "Bei einem Kakaopflanzer in Ghana" ........................................ 342<br />
4.31.4. Savanne .............................................................. 343<br />
4.31.5. Sahelzone ............................................................ 344<br />
4.31.6. Ostafrika ............................................................. 346<br />
4.31.7. Südafrika ............................................................. 347<br />
4.31.8. "<strong>Pro</strong>bleme, Entwicklungen, Zukunftsaussichten" ............................... 348<br />
4.31.9. Zusammenfassung ...................................................... 350<br />
4.32. Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985) .................................... 351<br />
4.32.1. Band 1 ............................................................... 351<br />
4.32.1.1. Savannen Afrikas ..................................................... 351<br />
4.32.2. Band 3 ............................................................... 355<br />
4.32.3. Zusammenfassung ...................................................... 356<br />
4.33. Terra Erdkunde (1982-1983) ................................................. 358<br />
4.33.1. Zusammenfassung ...................................................... 358<br />
4.34. Mensch und Raum (1983-1986) ............................................... 359<br />
4.34.1. Band 1 ............................................................... 359<br />
4.34.1.1. Kenia ............................................................... 359<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 11
Inhaltsverzeichnis<br />
4.34.1.2. Kakao aus Ghana ..................................................... 361<br />
4.34.2. Band 2 ............................................................... 361<br />
4.34.2.1. Ruanda ............................................................. 362<br />
4.34.2.2. Namibia ............................................................. 362<br />
4.34.2.3. Kamerun ............................................................ 363<br />
4.34.2.4. "Brotfabrik für Nigeria" ................................................ 364<br />
4.34.2.5. "Biogasanlage für Kamerun" ............................................ 365<br />
4.34.3. Zusammenfassung ...................................................... 366<br />
4.35. Terra Erdkunde - Hauptschule (1985-1987) ..................................... 367<br />
4.35.1. Band 2 ............................................................... 367<br />
4.35.2. Zusammenfassung ...................................................... 367<br />
4.36. Seydlitz: Mensch und Raum (1987) ............................................ 368<br />
4.36.1. Geschichte ............................................................ 368<br />
4.36.2. Zaire ................................................................ 370<br />
4.36.3. Ruanda ............................................................... 371<br />
4.36.4. Kano ................................................................ 373<br />
4.36.5. Sambia ............................................................... 375<br />
4.36.6. Malawi ............................................................... 377<br />
4.36.7. Zusammenfassung ...................................................... 379<br />
4.37. Diercke Taschenatlas (1992) ................................................. 380<br />
4.38. Seydlitz Erdkunde (1993-1995) ............................................... 381<br />
4.38.1. Band 3 ............................................................... 381<br />
4.38.1.1. Allgemeines: "Afrika der zweitgrösste Kontinent" ............................ 381<br />
4.38.1.2. Bevölkerung ......................................................... 382<br />
4.38.1.3. Landwirtschaft ....................................................... 383<br />
4.38.1.4. Der Weg zum modernen Afrika ........................................... 384<br />
4.38.1.5. Die Sahelzone ........................................................ 385<br />
4.38.1.6. "Hungergürtel der Erde" ............................................... 387<br />
4.38.1.7. "Wirtschaftsraum Kongobecken" ......................................... 387<br />
4.38.1.8. Ostafrika ............................................................ 389<br />
4.38.1.9. "Exportabhängigkeit afrikanischer Staaten" ................................ 390<br />
4.38.1.10. "Nigeria - ein Staat?" ................................................. 391<br />
4.38.1.11. "Was ist ein Entwicklungsland?" ........................................ 393<br />
4.38.1.12. "Rassenkonflikte in Südafrika" .......................................... 394<br />
4.38.2. Band 4 ............................................................... 396<br />
4.38.2.1. "Ernährungsprobleme" ................................................. 396<br />
4.38.2.2. "Arbeitswanderung und Armutsflüchtlinge" ................................. 397<br />
4.38.3. Zusammenfassung ...................................................... 398<br />
4.39. Seydlitz Geographie (1994-1996) .............................................. 399<br />
4.39.1. Band 3 ............................................................... 399<br />
4.39.1.1. "Die Eroberung der 'Grünen Hölle'" ...................................... 399<br />
4.39.1.2. "Raubbau oder Anpassung?" ............................................ 400<br />
4.39.1.3. Sahel .............................................................. 401<br />
4.39.1.4. "Der Hunger in der Welt" ............................................... 403<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 12
Inhaltsverzeichnis<br />
4.39.1.5. Kenia ............................................................... 404<br />
4.39.2. Band 4 ............................................................... 406<br />
4.39.2.1. Sklavenhandel ........................................................ 407<br />
4.39.2.2. "Entwicklung im ländlichen Afrika" ....................................... 408<br />
4.39.3. Zusammenfassung ...................................................... 409<br />
4.40. Heimat und Welt (1994-1996) ................................................ 410<br />
4.40.1. Band 4 ............................................................... 410<br />
4.40.1.1. "Pygmäen" .......................................................... 410<br />
4.40.1.2. Bantu ............................................................... 411<br />
4.40.1.3. Reisebericht ......................................................... 412<br />
4.40.1.4. "Das Wichtigste kurz gefasst" ............................................ 412<br />
4.40.1.5. "Hunger und Bevölkerungswachstum" ..................................... 413<br />
4.40.2. Zusammenfassung ...................................................... 414<br />
4.41. Geographie: Mensch und Raum (1994-1996) .................................. 415<br />
4.41.1. Band 1 ............................................................... 415<br />
4.41.2. Band 4 ............................................................... 415<br />
4.41.2.1. "Leben in Trockenräumen" .............................................. 416<br />
4.41.2.2. Frauenleben ......................................................... 416<br />
4.41.2.3. Ernährung ........................................................... 417<br />
4.41.2.4. Mali ................................................................ 418<br />
4.41.2.5. Sambia: "Grossprojekte scheitern" ....................................... 420<br />
4.41.3. Zusammenfassung ...................................................... 421<br />
4.42. Diercke Erdkunde (1995-1997) ............................................... 422<br />
4.42.1. Band 3 ............................................................... 422<br />
4.42.1.1. "Pygmäen" .......................................................... 422<br />
4.42.1.2. Bantu ............................................................... 423<br />
4.42.1.3. Agroforstwirtschaft: "Hoffnung für den Regenwald" .......................... 424<br />
4.42.1.4. Sahel und Savanne: Burkina Faso ........................................ 425<br />
4.42.1.5. "Frauen in Burkina Faso" .............................................. 426<br />
4.42.1.6. Desertifikation ....................................................... 428<br />
4.42.1.7. Niederschläge ........................................................ 429<br />
4.42.1.8. Hilfe von Schülern für Afrika ............................................ 430<br />
4.42.2. Band 4 ............................................................... 431<br />
4.42.3. Zusammenfassung ...................................................... 432<br />
5. DER SCHWARZAFRIKANISCHE MENSCH IM MUSIKLEHRMITTEL ................. 433<br />
5.1. Ein Blick in die Fachliteratur ................................................. 433<br />
5.1.1. Knaurs Weltgeschichte der Musik (1979) ...................................... 433<br />
5.1.1.1. Zusammenfassung ...................................................... 435<br />
5.1.2. Geschichte der Musik (1980) ............................................... 435<br />
5.1.3. Geschichte der Musik (1983) ............................................... 436<br />
5.1.4. Die Musik (1983) ........................................................ 436<br />
5.1.5. Das grosse Buch der Musik (1984) ........................................... 436<br />
5.1.6. Musik-Geschichte im Überblick (1985) ....................................... 436<br />
5.1.7. dtv-Atlas zur Musik (1987) ................................................ 436<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 13
Inhaltsverzeichnis<br />
5.1.8. Musikinstrumente der Welt (1988) ........................................... 437<br />
5.1.9. Zusammenfassung zu den Musikbüchern ...................................... 437<br />
5.2. Schulbücher ............................................................... 438<br />
5.2.1. Musik um uns .......................................................... 438<br />
5.2.1.1. Unser Liederbuch - Musik um uns (Nachruck 1986) ........................... 438<br />
5.2.1.2. Musik um uns - Klassen 5 und 6 (1991) ..................................... 438<br />
5.2.1.3. Musik um uns - 7.-10. Schuljahr (1975) ..................................... 438<br />
5.2.1.4. Musik um uns - 7.-10. Schuljahr (1979) ..................................... 439<br />
5.2.1.5. Musik um uns 3 (1995) .................................................. 439<br />
5.2.1.6. Musik um uns 3 (1995) .................................................. 440<br />
5.2.1.7. Musik um uns - 11.-13. Schuljahr (1981) .................................... 441<br />
5.2.1.8. Musik um uns - 11.-13. Schuljahr (1985) .................................... 441<br />
5.2.1.9. Musik um uns - für den Kursunterricht in der Klasse 11 (1988) .................. 442<br />
5.2.1.10. Musik um uns - für den Kursunterricht in den Klassen 12 und 13 (1988) .......... 442<br />
5.2.1.11. Musik um uns - Sekundarbereich II (1996) ................................. 442<br />
5.2.1.12. Zusammenfassung ..................................................... 443<br />
5.2.2. Schweizer Singbücher .................................................... 443<br />
5.2.2.1. Schweizer Singbuch Mittelstufe (1943) ..................................... 443<br />
5.2.2.2. Schweizer Singbuch Unterstufe (1988) ...................................... 443<br />
5.2.2.3. Schweizer Singbuch Mittelstufe (1980) ..................................... 443<br />
5.2.2.4. Schweizer Singbuch Oberstufe (1968) ...................................... 444<br />
5.2.2.5. Musik auf der Oberstufe - Liedteil (1979) ................................... 444<br />
5.2.2.6. Musik auf der Oberstufe - Lehrerheft 2 (1987) ............................... 444<br />
5.2.2.7. Musik auf der Oberstufe - Lehrerband 1 (1988) .............................. 444<br />
5.2.2.8. Musik auf der Oberstufe - Lieder, Tänze, Musikstücke (1988) ................... 444<br />
5.2.2.9. Schulmusik konkret (1991) ............................................... 445<br />
5.2.2.10. 250 Kanons (1996) .................................................... 445<br />
5.2.2.11. Zusammenfassung ..................................................... 445<br />
5.2.3. 1000 chants (1975) ....................................................... 446<br />
5.2.4. Musikunterricht (1979) ................................................... 446<br />
5.2.5. Musikstudio (1980-1982) .................................................. 447<br />
5.2.5.1. Musikstudio 1 (1980) ................................................... 447<br />
5.2.5.2. Musikstudio 2 (1982) ................................................... 447<br />
5.2.5.3. Zusammenfassung ...................................................... 450<br />
5.2.6. Lied international (1982) .................................................. 450<br />
5.2.7. Erlebnis Musik (1985) .................................................... 450<br />
5.2.8. Musik-Kontakte (1983-1987) ............................................... 451<br />
5.2.9. Musicassette (1990-1992) ................................................. 451<br />
5.2.10. Singen Musik (1992) .................................................... 454<br />
5.2.11. Spielpläne Musik (1992-1994) ............................................. 454<br />
5.2.11.1. Zusammenfassung ..................................................... 457<br />
5.2.12. Klangwelt-Weltklang (1991-1993) .......................................... 457<br />
5.2.12.1. Zusammenfassung ..................................................... 458<br />
5.2.13. 111 / 222 / 333 Lieder (1990-1995) ......................................... 459<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 14
Inhaltsverzeichnis<br />
5.2.14. Liedertreff (1994) ...................................................... 459<br />
5.2.15. Die Musikstunde (1992-1997) ............................................. 459<br />
5.2.16. Hauptsache Musik (1995) ................................................. 460<br />
5.2.17. Canto (1996) .......................................................... 461<br />
5.2.18. Musik hören, machen, verstehen (1990-1995) ................................. 461<br />
5.2.18.1. Musik hören, machen, verstehen 2 ........................................ 461<br />
5.2.18.2. Musik hören, machen, verstehen 3 ........................................ 462<br />
5.2.18.3. Musik hören, machen, verstehen 3 - Lehrerband ............................. 463<br />
5.2.18.4. Zusammenfassung ..................................................... 464<br />
5.2.19. Vom Umgang mit dem Fremden (1996) ...................................... 465<br />
5.2.19.1. Dem Fremden begegnen (1996) .......................................... 465<br />
5.2.19.2. Westafrikanische Musik auf drei Eisenglocken .............................. 466<br />
5.2.19.3. Flötenspiel aus Burundi ................................................ 467<br />
5.2.19.4. Zusammenfassung ..................................................... 468<br />
5.3. Vorgestellte Instrumente und Länder ........................................... 469<br />
6. DER SCHWARZAFRIKANISCHE MENSCH IM LESEBUCH UND <strong>COM</strong>IC .............. 471<br />
6.1. Lesebücher und Sprachbücher ................................................ 471<br />
6.1.1. Lehr- und Lesebuch (1912) ................................................ 471<br />
6.1.2. Lesebuch für die Oberklasse (ca. 1930) ....................................... 471<br />
6.1.3. Arbeits- und Lesebuch für die Oberklassen (1936) ............................... 471<br />
6.1.4. Lehr- und Lesebuch, 1943 ................................................. 471<br />
6.1.5. Heimat (1962) .......................................................... 471<br />
6.1.6. Schöne weite Welt, 1966 .................................................. 472<br />
6.1.7. Sprachbüchlein (1968) .................................................... 472<br />
6.1.8. Unsere Zeit (1969) ....................................................... 472<br />
6.1.9. Wort und Bild (1970) ..................................................... 472<br />
6.1.10. Neues Schweizer Lesebuch (1979-1980) ..................................... 472<br />
6.1.11. Lesebuch 4 (1980) ...................................................... 473<br />
6.1.12. Lesen 3 - Band 1 (1981) .................................................. 473<br />
6.1.13. Sprachbuch (1974-1983) ................................................. 474<br />
6.1.14. Lesespiegel, 1984 ...................................................... 475<br />
6.1.15. Drei Schritte (1984) ..................................................... 475<br />
6.1.16. Lesebuch 5. Klasse (1985) ................................................ 477<br />
6.1.17. Der Lesefuchs (1988) .................................................... 477<br />
6.1.17.1. Lesebuch für das 3. Schuljahr ........................................... 477<br />
6.1.17.2. Lesebuch für das 4. Schuljahr (1988) ...................................... 478<br />
6.1.17.3. Zusammenfassung ..................................................... 479<br />
6.1.18. Schaukelpferd, 1989 ..................................................... 479<br />
6.1.19. Fosch, Fusch, Fesch, 1990 ................................................ 479<br />
6.1.20. Karfunkel (1990) ....................................................... 479<br />
6.1.20.1. Nähen und Wassertragen ............................................... 479<br />
6.1.20.2. Die heuschreckliche Invasion ............................................ 480<br />
6.1.20.3. Zusammenfassung ..................................................... 481<br />
6.1.21. Die Welt ist reich (1991) ................................................. 481<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 15
Inhaltsverzeichnis<br />
6.1.22. Das fliegende Haus (1992) ................................................ 481<br />
6.1.23. Spürnase (1993) ........................................................ 482<br />
6.1.24. Deutsch, 1995 ......................................................... 482<br />
6.1.25. Wörterbücher .......................................................... 483<br />
6.2. Streifzug durch die Comicgeschichte ............................................ 485<br />
6.2.1. Fipps der Affe .......................................................... 485<br />
6.2.2. Little Nemo ............................................................ 486<br />
6.2.2.1. Zusammenfassung ...................................................... 488<br />
6.2.3. Tim und Struppi ......................................................... 488<br />
6.2.4. Spirou und Fantasio ...................................................... 491<br />
6.2.5. Das schwarze Marsupilami ................................................ 492<br />
6.2.6. Zusammenfassung ....................................................... 492<br />
7. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG ............................................ 494<br />
7.1. Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen ................................. 494<br />
7.1.1. In den Lehrmitteln erwähnte Berufe von Schwarzafrikanern ....................... 494<br />
7.1.2. Subsistenzproduktion und Exporte ........................................... 495<br />
7.1.2.1. Subsistenzproduktion ................................................... 495<br />
7.1.2.2. Exporte .............................................................. 496<br />
7.1.2.3. Ökologisches Bewusstsein ............................................... 498<br />
7.1.3. Darstellung von Mann, Frau und Kind ........................................ 499<br />
7.1.3.1. Die Rolle des Mannes ................................................... 499<br />
7.1.3.2. Die Rolle der Frau ..................................................... 500<br />
7.1.3.3. Die Rolle des Kindes .................................................... 501<br />
7.1.4. Zugeschriebene Eigenschaften .............................................. 502<br />
7.1.5. Darstellung von Nichtschwarzafrikanern ...................................... 505<br />
7.1.5.1. Araber ............................................................... 505<br />
7.1.5.2. Europäer ............................................................. 506<br />
7.2. Genannte Völker ........................................................... 508<br />
7.2.1. Darstellung der Pygmäen .................................................. 509<br />
7.2.2. Darstellung der "Buschleute" ............................................... 510<br />
7.2.3. Darstellung der Khoi-Khoin (Hottentotten) .................................... 511<br />
7.2.4. Darstellung der Massai .................................................... 511<br />
7.2.5. Darstellung der Fulbe ..................................................... 512<br />
7.2.6. Darstellung der Hausa .................................................... 513<br />
7.2.7. Darstellung der Yoruba ................................................... 513<br />
7.2.8. Darstellung der Ibo ...................................................... 514<br />
7.3. Genannte Länder ........................................................... 515<br />
7.3.1. Äthiopien .............................................................. 517<br />
7.3.2. Demokratische Republik Kongo ............................................. 518<br />
7.3.3. Ghana ................................................................ 519<br />
7.3.4. Kenia ................................................................. 520<br />
7.3.5. Nigeria ................................................................ 521<br />
7.3.6. Südafrika .............................................................. 522<br />
7.3.7. Tansania .............................................................. 523<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 16
Inhaltsverzeichnis<br />
7.4. Weitere Aspekte ............................................................ 525<br />
7.4.1. Geschichte ............................................................. 525<br />
7.4.2. Religion ............................................................... 526<br />
7.4.3. Anteil der Afrikaseiten am Gesamtumfang der Geographielehrmittel ................. 527<br />
7.4.4. Qualität und Aktualität der gemachten Aussage ................................. 528<br />
7.5. Die diskriminierende Verwendung der Sprache ................................... 531<br />
7.6. Zusammenfassung .......................................................... 533<br />
7.6.1. Betrachtung der Vorwürfe ................................................. 533<br />
7.6.2. Die Entwicklung des Bildes vom schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert .... 535<br />
8. ANHANG ..................................................................... 537<br />
8.1. Tabellen .................................................................. 537<br />
8.1.1. Grunddaten zu den afrikanischen Staaten ...................................... 537<br />
8.1.2. UNO-Daten zur Bevölkerung und Wirtschaft ................................... 539<br />
8.1.3. Unabhängigkeit und ethnische Differenzierung ................................. 540<br />
8.1.4. Religionen in Afrika ..................................................... 542<br />
8.1.5. Abhängigkeit von Exportgütern ............................................. 544<br />
8.1.6. Tourismus in afrikanischen Staaten .......................................... 545<br />
8.1.7. Bananenproduktion in Schwarzafrika ......................................... 547<br />
8.1.8. Baumwollproduktion in Afrika ............................................. 548<br />
8.1.9. Eisenerzproduktion und Diamantenproduktion afrikanischer Staaten ................. 549<br />
8.1.10. Erdnussproduktion in Schwarzafrika ........................................ 549<br />
8.1.11. Erdölproduktion in Afrika ................................................ 550<br />
8.1.12. Goldproduktion schwarzafrikanischer Staaten ................................. 551<br />
8.1.13. Kaffeeproduktion schwarzafrikanischer Länder ................................ 551<br />
8.1.14. Kakaoproduktion ausgewählter Länder ...................................... 552<br />
8.1.15. Kupferproduktion afrikanischer Staaten ...................................... 552<br />
8.1.16. Holzverbrauch ausgewählter schwarzafrikanischer Länder ........................ 553<br />
8.1.17. Sisalproduktion ausgewählter Länder ........................................ 553<br />
8.1.18. Teeproduktion schwarzafrikanischer Länder .................................. 554<br />
8.1.19. Uranproduktion afrikanischer Staaten ........................................ 554<br />
8.1.20. Verschiedene landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>dukte ................................... 555<br />
8.1.21. Tierbestände afrikanischer Staaten .......................................... 555<br />
8.1.22. Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion in Afrika ..................................... 557<br />
8.1.23. Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion Tansanias .................................... 559<br />
8.1.24. Staatliche Gliederung Afrikas nach Erdkunde 1968 ............................. 559<br />
8.1.25. Entwicklung der Bevölkerungszahlen ........................................ 561<br />
8.2. Karten .................................................................... 563<br />
8.2.1. Die europäischen Kolonien in Afrika von 1914 ................................. 563<br />
8.2.2. Afrikakarten aus Schweizer Schulatlanten ..................................... 564<br />
8.2.3. Erlangung der Unabhängigkeit .............................................. 565<br />
8.2.4. Einteilung Afrikas nach dem Fünf-Welten-System ............................... 566<br />
8.2.5. Sicherheitssituation in den afrikanischen Staaten ................................ 567<br />
8.2.6. Bevölkerungsdichte ...................................................... 568<br />
8.2.7. Bruttosozialprodukt pro Kopf ............................................... 569<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 17
Inhaltsverzeichnis<br />
8.2.8. Abhängigkeit von Exportprodukten .......................................... 570<br />
8.2.9. Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika ........................... 571<br />
8.2.10. Offizielle Amtssprachen .................................................. 572<br />
8.2.11. Ethnische Differenzierung der schwarzafrikanischen Länder ...................... 573<br />
8.2.12. Religionszugehörigkeit .................................................. 574<br />
8.2.13. Verfügbares Trinkwasser ................................................. 575<br />
8.2.14. Holzverbrauch ausgewählter schwarzafrikanischer Länder ........................ 576<br />
8.2.15. Das neue Bild Afrikas: Der Aidskontinent .................................... 577<br />
8.2.16. Aussergewöhnliche Nahrungsmittelknappheit in afrikanischen Ländern .............. 578<br />
8.3. Beispiele schwarzafrikanischen Lebens .......................................... 579<br />
8.3.1. Die Aufgaben der Frau im schwarzafrikanischen Alltag ........................... 579<br />
8.3.1.1. One woman's day in Sierra Leone ......................................... 579<br />
8.3.1.2. Die Rolle der Frau bei den Joruba ........................................ 580<br />
8.3.2. Das Leben auf dem Land .................................................. 581<br />
8.3.2.1. Kakaoernte bei Adwoa Addae ............................................ 581<br />
8.3.2.2. Aktivitätspfade ghanaischer Familien ...................................... 582<br />
8.3.2.3. Mittel der Überlebenssicherung ........................................... 584<br />
8.3.2.4. Tagesablauf einer ghanaischen Familie .................................... 585<br />
8.3.2.5. Nandele, ein Mädchen vom Lande, erzählt .................................. 588<br />
8.3.2.6. "Traditionelle" Lebensweise .............................................. 590<br />
8.3.3. Das Leben in der Stadt .................................................... 591<br />
8.3.3.1. Raketa, Obstverkäuferin in Ouagadougou, erzählt ............................ 591<br />
8.3.3.2. "Aber es ist auch alles sehr teuer hier" ..................................... 594<br />
8.3.3.3. Die Kenkey-Frauen ..................................................... 595<br />
8.3.3.4. Das Leben am Rande der Stadt ........................................... 596<br />
8.3.3.5. Die Oberschicht ....................................................... 597<br />
8.4. Sonstige ................................................................... 598<br />
8.4.1. Ernährungssituation auf den afrikanischen Kontinent ............................. 598<br />
8.4.2. Vorratslagerung in Schwarzafrika ........................................... 599<br />
8.4.3. Der schwarzafrikanische Mensch in Charles Darwins Werk ........................ 600<br />
8.4.4. Ein Selbstgespräch von Albert Wirz .......................................... 604<br />
8.5. Quellenverzeichnis .......................................................... 607<br />
8.5.1. Afrika in Atlanten und Geographiebüchern: .................................... 608<br />
8.5.1.1. Untersuchte Lehrmittel und Werke ......................................... 608<br />
8.5.1.2. Hintergrundinformation ................................................. 611<br />
8.5.2. Afrikanische Musik in Musikbüchern: ........................................ 612<br />
8.5.2.1. Fachliteratur .......................................................... 612<br />
8.5.2.2. Schulbücher .......................................................... 612<br />
8.5.2.3. Hintergrundliteratur .................................................... 614<br />
8.5.3. Afrika in Lesebüchern: .................................................... 615<br />
8.5.4. Afrika im Comic: ........................................................ 616<br />
8.5.5. Geschichte Afrikas: ...................................................... 617<br />
8.5.6. Sonstige Bücher: ........................................................ 617<br />
8.5.6.1. Romane und Erzählungen ................................................ 617<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 18
Inhaltsverzeichnis<br />
8.5.6.2. Lexika und Wörterbücher ................................................ 618<br />
8.5.6.3. Verschiedene .......................................................... 618<br />
8.5.7. Elektronische Medien: .................................................... 619<br />
8.5.7.1. CD-ROMs ............................................................ 619<br />
8.5.7.2. Videofilme ........................................................... 619<br />
8.5.7.3. Tondokumente ......................................................... 620<br />
8.5.8. Internet: ............................................................... 620<br />
8.5.9. Zeitungen und Zeitschriften: ............................................... 621<br />
8.5.9.1. Artikel aus "Geo - Das neue Bild der Erde" ................................. 621<br />
8.5.9.2. Artikel aus dem "Tages Anzeiger" ......................................... 621<br />
8.5.9.3. Artikel aus "The Economist" ............................................. 623<br />
8.5.9.4. Weitere Artikel ........................................................ 624<br />
8.6. Glossar ................................................................... 625<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 19
1. Einleitung<br />
Nur jene, welche in dieser Sache eigene Erfahrungen haben sammeln können, kennen die Schwierigkeiten, die es bereitet,<br />
um von den afrikanischen Eingeborenen zuverlässige Informationen über sie selbst und ihre Heimat zu erhalten. Häufig<br />
führen sie die Europäer dadurch in die Irre, dass sie alle Fragen bejahen, bloss um der Störung oder Zudringlichkeiten zu<br />
entgehen. Zuweilen erwecken solche Fragen auch den Argwohn der Afrikaner, die hinter der Neugierde der Europäer<br />
irgendeine üble Absicht vermuten. Man benötigt also viel Zeit und eine Fülle von Geduld, um die nötigen Erkundigungen<br />
einzuziehen und die Fragen so abwechslungsreich zu gestalten, dass die Eingeborenen imstande sind, ihren Sinn<br />
einzusehen; auch ist es nötig, die Aussagen verschiedener Individuen miteinander zu vergleichen, um die Gefahr von<br />
Missverständnissen zu vermeiden. Selbst Dolmetschern kann man nicht blindlings Vertrauen schenken, weil sie dazu<br />
neigen, Antworten so zu färben, dass sie der Erwartung ihres Herrn entgegenkommen.<br />
Thomas Winterbottom, Arzt und Entdecker, der Ende des 18. Jahrhunderts nach Sierra Leone reiste, zur <strong>Pro</strong>blematik der<br />
Feldforschung. (Bitterli 1977, S. 311)<br />
In der Einleitung werden die Zielstellung der Arbeit beschrieben, das persönlichen Interesse des Verfassers an<br />
der Thematik aufgezeigt, der grobe Aufbau der Arbeit erläutert, die Bedeutung des Themas umrissen und die<br />
wichtigsten Quellen kurz vorgestellt.<br />
1.1 Ziel der Arbeit<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen, d.h. der Menschen, die in Afrika südlich der Sahara - unter<br />
Ausschluss der weissen Minderheiten Südafrikas und insbesondere der in Nord- und Südamerika lebenden<br />
Nachkommen der ehemals aus Schwarzafrika stammender Sklaven -, soll erforscht und auf Veränderungen in<br />
der Zeit untersucht werden.<br />
Als Quellen dienten in erster Linie Lehrmittel aus dem Schulbereich in den Fächern Geographie und Musik,<br />
sowie zum Vergleich Lesebücher und Comic-Hefte, aber auch Sachbücher, die der Lehrkraft Hintergrundinfor-<br />
mationen für eine zu haltende Lektion liefern. Auf die Betrachtung der Darstellung in Geschichtsbüchern<br />
wurde verzichtet, da die vorher genannten Bereiche einerseits genug Material für eine Analyse lieferten, ande-<br />
rerseits dadurch noch mehr Überschneidungen zustandegekommen wären.<br />
Auch audiovisuelles Material wurde von der Untersuchung ausgeschlossen, da es auf diesem Gebiet einerseits<br />
sehr gutes Dokumentationsmaterial gibt, andererseits diese Medien für Private schwer handhabbar sind.<br />
Es wurde auch bewusst darauf verzichtet, das Bild der Afroamerikaner zu untersuchen, da dieses Thema<br />
immer wieder aufgegriffen und teilweise Bestandteil des normalen Unterrichts geworden ist.<br />
Als Nebenprodukt der Fragestellung nach dem Bild des schwarzafrikanischen Menschen soll bei den Lesern<br />
auch eine Sensibilisierung auf die <strong>Pro</strong>blematik der Darstellung fremder Kulturen in den deutschsprachigen<br />
Schulbüchern und in der Unterrichtstätigkeit stattfinden, die hoffentlich zu einem reflektierteren Umgang im<br />
Klassenzimmer führt.<br />
1.2 Persönliche Interessen<br />
Seit meiner Kindheit haben mich andere Gegenden im allgemeinen und andere Völker und Kulturen im<br />
speziellen interessiert. Dieses Interesse wurde durch die Begegnung im Alter von etwa sechs Jahren mit dem<br />
Südamerikaforscher Arno Calderari, der es nie versäumte, meinen Geschwistern und mir etwas von seinen<br />
Entdeckungsreisen mitzubringen, sicher massgeblich beeinflusst. Seine Erzählungen und Berichte über wilde<br />
Tiere, gewaltige Landschaften und fremde Völker haben mich immer fasziniert.<br />
Einleitung<br />
In der Primarschule wandte sich mein Interesse, angeregt durch das Lesen etlicher Romane von Karl May, den<br />
Indianern Nord- und Südamerikas zu. Durch das Lesen einschlägiger Bücher tat sich vor meinen Augen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 20
uchstäblich eine neue Welt auf, die um ein vielfaches faszinierender war, als die bis anhin verschlungenen<br />
Abenteuerromane. Ausserdem wiesen diese Bücher daraufhin, dass die in Europa als Norm geltende Lebens-<br />
weise nicht eine universelle war. Eine Tatsache, die mich bis hinein in meine Ausbildung als Primarlehrer<br />
immer wieder faszinierte.<br />
Nach einem gedanklichen Abstecher in die Lebensweise der Europäer im Mittelalter und einem kurzen Blick<br />
in die Kulturvielfalt Asiens, ergab sich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit als Primarlehrer 1995 die<br />
Möglichkeit, ein Jahr in Westafrika, genauer in Ghana, zu verbringen und dort einen Ausschnitt aus dem<br />
Farbenspiel der afrikanischen Kulturen in persona zu erleben. Im Laufe meiner dortigen Tätigkeit lernte ich<br />
meine Frau kennen und bin durch sie und die in Ghana gemachten Erlebnisse seither dem afrikanischen Konti-<br />
nent und den dort lebenden Menschen in sehr persönlicher Weise verbunden.<br />
Bereits vor meiner Abreise und erst recht nach meiner Rückkehr bin ich bei vielen meiner Mitmenschen nicht<br />
nur auf ein Interesse an Schwarzafrika, sondern immer wieder auch auf seltsam anmutende Vorurteile gestos-<br />
sen, da insbesondere die Medien und auch die Schule der früheren Jahre ein doch recht einseitiges Bild des<br />
"Dunklen Kontinentes" vermittelt haben und leider noch immer vermitteln.<br />
Aus diesem Grund lag mir viel daran, einigen dieser Vorstellungen nachzugehen, und auch den Wandel dieser<br />
Vorstellungen mit dem Fortschreiten der Zeit näher in Augenschein zu nehmen.<br />
1.3 Aufbau der Arbeit<br />
Die Arbeit gliedert sich grob in die Teile "Einleitung", "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas", "Vor-<br />
würfe an das von der Schule vermittelte Bild", "Der schwarzafrikanische Mensch im Geographielehrmittel",<br />
"Der schwarzafrikanische Mensch im Musiklehrmittel" und "Der schwarzafrikanische Mensch im Lesebuch<br />
und Comic" und "Ergebnisse der Untersuchung", sowie den Anhang.<br />
Der erste Teil der Arbeit, "Einleitung" (ab Seite 20), zu dem auch dieser Abschnitt gehört, gibt Auskunft über<br />
den Untersuchungsgegenstand der Arbeit, die persönlichen Interessen des Autors, den Aufbau der Arbeit und<br />
die Bedeutung des Themas.<br />
Der zweite Teil, "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas" (ab Seite 25), beschäftigt sich kurz mit der<br />
Geschichte Afrikas, wobei Wert darauf gelegt wurde, diese in erster Linie in für eine afrikanische Sichtweise<br />
relevante Weise zu schildern und den Schwerpunkt eindeutig auf die vorkoloniale Geschichte zu legen. Dieser<br />
Ansatz wurde deshalb gewählt, weil sich daraus bereits die Korrektur einiger weit verbreiteter Fehlvorstellun-<br />
gen ergibt, und andererseits auch, weil bis heute die übliche Weltgeschichtsschreibung eher eurozentrisch<br />
abgehandelt wird.<br />
Der dritte Teil der Arbeit, "Vorwürfe an das von der Schule vermittelte Bild" (ab Seite 35), geht auf die erho-<br />
benen Vorwürfe gegen das von der Schule vermittelte Bild des schwarzafrikanischen Menschen ein und dient<br />
als Grundlage für die Untersuchung der Lehrmittel aus dem Bereich Geographie, Musik und Sprache, sowie<br />
für eine Einordnung der vom Comic vermittelten Bilder. Ausserdem vermittelt es einen Überblick über die<br />
geschichtliche Entwicklung des Bildes vom schwarzafrikanischen Menschen und stellt die in den weiteren<br />
Teilen der Arbeit verwendete Arbeitsweise vor. Es soll die Klammer für die Untersuchung der zu betrachten-<br />
den Lehrmittel öffnen.<br />
Einleitung<br />
Im vierten und umfassendsten Teil, "Der schwarzafrikanische Mensch im Geographielehrmittel (ab Seite 35),<br />
werden Geographielehrmittel, und im Vergleich dazu auch einige Geographiebücher, aus dem 20. Jahrhundert<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 21
im Hinblick auf den Wandel des europäischen Bildes vom schwarzafrikanischen Menschen anhand konkreter<br />
Kriterien und Fragestellungen untersucht und es werden Schwächen und Stärken der untersuchten Lehrmittel<br />
anhand dieser Kriterien aufgezeigt.<br />
Im fünften Teil, "Der schwarzafrikanische Mensch im Musiklehrmittel" (ab Seite 433), erfolgt eine Analyse<br />
der Darstellung schwarzafrikanischer Menschen und ihrer Musik in Lehrmitteln und Fachbüchern zum Bereich<br />
Musik, wobei sich die Untersuchung vor allem auf Lehrmittel der achtziger und neunziger Jahre konzentriert.<br />
Im sechsten Teil, "Der schwarzafrikanische Mensch im Lesebuch und Comic" (ab Seite 471), werden zum<br />
Vergleich einige Lese- und Sprachlehrmittel auf ihren Gehalt von Aussagen über die Menschen Schwarzafri-<br />
kas untersucht. Damit soll festgestellt werden, ob die bei den Geographiebüchern festgestellten Entwicklungen<br />
im Sprachbereich einen ähnlichen Weg genommen, oder diese einen ganz anderen Zugang zum Thema gefun-<br />
den haben. Als weitere Vergleichsmöglichkeit enthält der sechste Teil der Arbeit einen Streifzug durch die<br />
Comicgeschichte, der ebenfalls als Vergleich zu den schwergewichtig untersuchten Geographie- und Musik-<br />
lehrmitteln dienen soll.<br />
Der siebte Teil, "Ergebnisse der Untersuchung" (ab Seite 494), fasst die anhand der einzelnen Werke bespro-<br />
chenen Punkte zusammen und gibt einen Überblick über die Entwicklung des in den Lehrmitteln im 20. Jahr-<br />
hundert vermittelten Bildes schwarzafrikanischer Menschen. Damit schliesst dieser Teil die Klammer der<br />
Untersuchung.<br />
Der Anhang der Arbeit (ab Seite 537) enthält neben einigen Tabellen, die einen besseren Überblick über<br />
gewisse Sachverhalte ermöglichen sollen, eine Zahl von Karten zu verschiedenen Themen, die in der Arbeit<br />
angesprochen werden, sowie die Literaturliste der für die Arbeit verwendeten Quellen und ein Glossar,<br />
welches im Text auftretenden Begriffe klären oder definieren soll.<br />
1.4 Bedeutung des Themas<br />
In einer durch immer bessere Kommunikations- und Transportmittel zunehmend kleiner werdenden Welt, gibt<br />
es immer noch viele Menschen und Kulturen, die wir kaum kennen, die uns fremd sind und die wir eher<br />
schlecht als recht verstehen. Viele Menschen reagieren auf den Zustrom dieser neuen und fremden Eindrücke<br />
mit Abwehr und Zurückgezogenheit, die im ungünstigen Fall in Rassismus umschlagen kann. Durch die<br />
Betrachtung fremder Lebensweisen und Werte, die bei näherer Betrachtung vielleicht so fremd gar nicht sind,<br />
haben wir einerseits die Chance, den Dialog zum Fremden aufzubauen, gleichzeitig aber auch die Gelegenheit,<br />
unsere eigenen Werte und Handlungsweisen mit etwas mehr Objektivität zu betrachten.<br />
Insbesondere für die Lehrkraft der Oberstufe ist ein immer besser werdendes Verständnis der Welt und der<br />
Menschen, die in ihr leben, von zunehmender Bedeutung, da der Begegnung mit dem Fremden nicht mehr<br />
ausgewichen werden kann, und die Vorbildfunktion der berufstätig Lehrenden die Haltung der zukünftigen<br />
Generation mit beeinflusst. In diesem Sinne ist eine differenzierte Betrachtung der Lebensweise und Anliegen<br />
des Anderen immer auch ein Beitrag zum besseren Verständnis zwischen zwei Menschen und deren Kulturen<br />
und damit letztlich ein weiterer kleiner Schritt zum Weltfrieden, oder zumindest der Schlüssel für eine gute<br />
Beziehung und sei diese schlussendlich auch nur geschäftlicher Natur.<br />
Einleitung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 22
1.5 Bemerkung zu wichtigen Quellen<br />
Um die in den verschiedenen untersuchten Lehrmittel gemachten Aussagen und Angaben besser beurteilen zu<br />
können, wurde auf eine ganze Reihe von Publikationen zurückgegriffen, die nicht nur dem Vergleich dienten,<br />
sondern auch dazu, Lücken in der Darstellung der Lehrmittel zu erkennen. Die folgenden Absätze stellen eini-<br />
ge der wichtigsten Quellen kurz vor, auf die immer wieder zurückgegriffen wurde. Sie sollen kurz erläutern,<br />
weshalb diese Quellen benutzt wurden.<br />
1.5.1 Ki-Zerbos "Die Geschichte Schwarzafrikas"<br />
Ferdinand Braudel, ein berühmter französischer Historiker, dessen Werk übrigens auch in dieser Arbeit zitiert<br />
wird, schrieb zu Ki-Zerbos Buch: "Ein Geschichtswerk, das ein Buch der Hoffnung ist..., weil es den Schlüssel<br />
zur Identität des afrikanischen Menschen enthält." Schon damit wird klar, dass sich ein solches Buch ausseror-<br />
dentlich gut für eine Arbeit eignet, welche die Vorstellungen über Schwarzafrikaner untersuchen möchte.<br />
Hinzu kommt, dass Joseph Ki-Zerbo, der aus Burkina Faso stammt, als eine der Kapazitäten auf dem Gebiet<br />
der schwarzafrikanischen Geschichte gilt. Nach dem Besuch verschiedener Missionsschulen war er als Hilfs-<br />
lehrer, Journalist und Eisenbahnangestellter tätig, bevor er sein Studium der Geschichte und Politik in Paris<br />
antrat. Nach dem Studium war er als Geschichtslehrer an Gymnasien in Paris, Orléans, Dakar, Conakry und<br />
Wagadugu tätig. 1964 veröffentlichte er sein Buch "Le Monde African Noir", welches seit 1979 in deutscher<br />
Sprache unter dem Titel "Die Geschichte Schwarzafrikas" vorliegt. Des weiteren ist er der Herausgeber des<br />
ersten Bandes der "Allgemeinen Geschichte Afrikas" der UNESCO. 1997 erhielt er den Alternativen Nobel-<br />
preis. Heute gilt der Historiker Ki-Zerbo als einer der renommiertesten Schriftsteller Afrikas.<br />
1.5.2 Encarta und Encarta Weltatlas<br />
Die deutsche Ausgabe der Encarta ist ebenso wie die englische Fassung unterdessen zu einem Standardwerk<br />
unter den Computer-Enzyklopädien geworden. Sowohl vom Umfang wie auch der Qualität der Angaben gese-<br />
hen, ist die Encarta nach Werken wie dem "Grossen Brockhaus" eines der besten deutschen Nachschlagewer-<br />
ke. Zusammen mit dem Weltatlas, der eine Fülle an Informationen auch auf kulturellem Gebiet zu sämtlichen<br />
Ländern der Erde bietet, vermittelt die Encarta ein umfassendes Bild der Welt. Beide Werke erscheinen jähr-<br />
lich in einer neuen Ausgabe.<br />
1.5.3 Fischer Weltalmanach '98<br />
Seit Jahren liefert der Fischer Weltalmanach Daten zu sämtlichen Ländern der Erde. Die Ausgabe '98 ist neben<br />
der bewährten Buchform auch als CD-ROM erhältlich und deshalb für das rasche Auffinden von benötigten<br />
Daten aus dem Bereich der Wirtschaft und der jüngeren politischen Entwicklung besonders geeignet. Leider<br />
enthält der Almanach zu den afrikanischen Staaten wesentlich weniger Angaben als zu den Industrienationen,<br />
auch werden typisch afrikanische Agrarprodukte, sofern es sich nicht um Exportgüter handelt, nicht aufge-<br />
führt. Die statistischen Angaben in der Ausgabe '98 reichen meist bis 1995 und beruhen zu einem grossen Teil<br />
auf amtlichen Angaben oder UN-Daten. Der Fischer Weltalmanach erscheint jährlich.<br />
Einleitung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 23
1.5.4 Infopedia<br />
Die englische Infopedia 2.0 von 1996 ist zwar nicht mehr ganz so aktuell wie die Encarta, liefert aber, da sie<br />
auf der renommierten amerikanischen Enzyklopädie "Funk & Wagnalls New Encyclopedia" von 1996, sowie<br />
einer Reihe von weiteren Werken, darunter auch "Webster's New Biographical Dictionary" basiert, ebenfalls<br />
eine Menge nützlicher Informationen zu den unterschiedlichsten Wissensgebieten.<br />
1.5.5 FAOSTAT und andere Dienste der FAO<br />
Die FAO betreibt seit den sechziger Jahren eine Datenbank zu verschiedenen Aspekten der Agrarproduktion -<br />
für Schwarzafrika ist die Landwirtschaft nach wie vor der wichtigste Wirtschaftszweig -, welche seit kurzem<br />
über Internet unter der Adresse www.fao.org abgerufen werden kann. Diese Datenbank wurde für die Tabellen<br />
im Anhang überall dort benutzt, wo der "Fischer Weltalmanach" keine genauen Daten lieferte. Die Datenbank<br />
wird stetig erneuert, bei vielen Angaben zu Schwarzafrika handelt es sich jedoch um Schätzungen, da aus den<br />
betroffenen Ländern oft keine genaueren Statistiken zur Verfügung stehen.<br />
Neben dieser Daten bietet die FAO auch eine ganze Reihe von Presseunterlagen in der Form von Graphiken,<br />
Fotos und Texten.<br />
1.5.6 The Economist<br />
"The Economist" ist eine englische Wochenzeitung, die sich vor allem mit Wirtschaftsthemen und Politik<br />
beschäftigt, und international als eine der renommiertesten englischen Publikationen gilt, die häufig in anderen<br />
Wochen- und auch Tageszeitungen zitiert wird. Seit wenigen Jahren kann gegen Entgelt per Internet über die<br />
Adresse www.economist.com auf sämtliche publizierten Artikel zugegriffen werden.<br />
Einleitung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 24
2. Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Allzulange schon hatte die Geschichte unser Schicksal zu Bilderbuchszenen erstarren lassen, mit denen zuerst die<br />
Schulbücher und dann die ersten Massenmedien Generationen von Kindern und Heranwachsenden überschütteten; und das<br />
in einem Alter äusserster Formbarkeit, in dem die Ansichten und Vorurteile wie scharfe Pfähle das Bewusstsein zerreissen,<br />
dort immer tiefer eindringen und verkrusten und sich langsam, aber unaufhaltsam verhärten, je nach der Veranlagung, die<br />
ihnen als Bindemittel dient.<br />
(Mongo Beti in Jestel Hrsg., 1982, S. 56)<br />
Die Geschichte Afrikas verliert sich im Dunkel der Zeit - der Urzeit. Lange wurde sie als nicht existent<br />
betrachtet. So erklärte Hegel in seinen "Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie" von 1830 (Ki-Zerbo<br />
1984, S. 24):<br />
Denn es ist keine geschichtlicher Weltteil, es hat keine Bewegung und keine Entwicklung aufzuweisen, und was etwa in<br />
ihm, das heisst, in seinen Norden geschehen ist, gehört der asiatischen und europäischen Welt zu... Was wir eigentlich<br />
unter Afrika verstehen, das ist das Geschichtslose und Unaufgeschlossene, das noch ganz im natürlichen Geiste befangen<br />
ist, und das hier bloss an der Schwelle der Weltgeschichte vorgeführt werden müsste.<br />
Diese Meinung hielt sich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts und wird in einigen Lehrmitteln bis heute<br />
dadurch unterstützt, dass die wiedergegebene Geschichte Afrikas mit der Entdeckung durch die Europäer<br />
einsetzt. (Siehe dazu auch die Zusammenfassung zur Darstellung der Geschichte auf der Seite 525 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Die folgenden Seiten sollen deshalb einen kurzen, stark vereinfachten Überblick über die Geschichte Afrikas<br />
bieten, die über einen grossen Zeitraum nicht mit Hilfe schriftlicher Quellen - und dann oft auch nur durch<br />
Berichte von Reisenden aus anderen Kulturkreisen - dokumentiert werden kann, sondern sich auf mündliche<br />
Überlieferungen und verschiedene Techniken der Archäologie stützen muss.<br />
Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich durch die Grösse des Gebietes und die dadurch vielfältigen Entwick-<br />
lungen, die oftmals nebeneinander abliefen. Zudem kann der aus Europa bekannte Raster der Einteilung der<br />
Geschichte in Epochen wie "Mittelalter" oder "Renaissance" nur sehr bedingt auf die schwarzafrikanische<br />
Geschichte übertragen werden, da die Entwicklung der beiden Räume über lange Zeit weitgehend getrennt,<br />
wenn auch nicht völlig unbeeinflusst voneinander verlief.<br />
2.1 Vorgeschichte<br />
Nach der Lehrmeinung der meisten Autoren gilt Afrika, genauer der Südosten des Kontinentes, heute als<br />
Wiege der Menschheit - diese These erwähnte schon Darwin, der schrieb: "It is therefore probable that Africa<br />
was formerly inhabited by extinct apes closely allied to the gorilla and chimpanzee; and as these two species<br />
are now man's nearest allies, it is somewhat more probable that our early progenitors lived on the African<br />
continent than elsewhere." (Darwin 1871) -, wobei vor allem die zahlreichen, über einen langen Zeitraum von<br />
mehreren Millionen Jahren in einer Detailfülle wie sonst nirgends auf der Erde gemachten Funde diese These<br />
unterstützen.<br />
Die frühesten Funde sind durch die sogenannten "peeble tools", aus Kieseln gefertigte "Werkzeuge", gekenn-<br />
zeichnet, die sich bis 1.5 Mio. Jahre zurückdatieren lassen und teilweise bis vor 100'000 Jahre verbreitet<br />
waren. Die in Europa beobachteten Eiszeiten fanden ihre Entsprechung in den afrikanischen Feuchtzeiten, die<br />
eine Besiedlung der heutigen Trockenräume des afrikanischen Kontinents durch die Urahnen des Menschen<br />
ermöglichten.<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Im Laufe der Jahrtausende verfeinerten sich die zu Beginn wenig differenzierten Steinwerkzeuge immer mehr,<br />
bis im 7. Jahrtausend v. Chr. erste Zeugnisse der Herstellung von Keramik auftraten, welche sowohl die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 25
Vorratshaltung als auch die Sesshaftigkeit förderte. Zudem entwickelte sich aus der anfänglichen Jäger- und<br />
Sammlertätigkeit allmählich erste Ansätze von Tierhaltung und Bodenbau. (Brockhaus 1986 S. 185-186). Da<br />
die damalige Sahara weit regenreicher war als heute, darauf lassen zumindest Untersuchung beispielsweise am<br />
Tschadsee schliessen (Geo 12/1986, S. 136f.), war sie Schauplatz zahlreicher menschlicher Tätigkeiten. Neben<br />
Jagd- und Fischgeräten finden sich zahlreiche Hinweise auf Ackerbau und Viehzucht. Neben Weizen, Gerste<br />
und Flachs wurden die seit dem sechsten oder fünften Jahrtausend typisch afrikanischen Pflanzen wie Sorghum<br />
(sorghum vulgare), Kleinhirse (pennisetum), Reissorten, Sesam, Jamswurzeln (dioscorea), Okra (ibicus escu-<br />
lentes), die Ölpalme (elaeis guineensis), der Kolabaum und wahrscheinlich auch eine Art von Baumwolle<br />
genutzt. (Ki-Zerbo 1984, S.49-51) Auch die Kunst erreichte in diesen Gebieten einen Höhepunkt. Ki-Zerbo<br />
schreibt dazu, dass sie ein "Dominum errichtet hat, das zumindest ebenso wichtig war, wie die Musik neger-<br />
afrikanischen Ursprungs in der Welt von heute". (Ki-Zerbo 1984, S. 54)<br />
2.2 Frühgeschichte<br />
Etwa 4000 Jahre v. Chr. liessen sich die negriden Hirten und Jäger Nordafrikas, durch die zunehmende Klima-<br />
verschlechterung aus dem Gebiet der Sahara vertrieben, im Niltal nieder. In diesem Grenzgebiet bildete sich<br />
unter den Einflüssen der afrikanischen und asiatischen Kulturen und dem zunehmenden Bevölkerungsdruck<br />
eine erste Hochkultur, die über Jahrhunderte prägend für die ganze Region sein sollte. Sie beeinflusste auch<br />
die als Begründer der abendländischen Kultur geltenden Griechen massgebend. Neben der Schaffung monu-<br />
mentaler Bauwerke zeichnete sich die altägyptische Kultur vor allem durch eine Blüte der Wissenschaften und<br />
die Entwicklung eines Schriftsystemes aus. So entdeckten die Altägypter beispielsweise den Blutkreislauf und<br />
wandten medizinische Diagnose-Methoden an; die Landvermessung führte zur Geometrie; in der Metallbear-<br />
beitung wurde nach Kupfer, Gold und Silber um ca. 550 v. Chr. in Meroe (Hauptstadt des an Altägypten<br />
angrenzenden und dieses zeitweilig beherrschende Kusch) auch die Eisenbearbeitung in grossem Stil einge-<br />
führt, und der Ackerbau schwang sich mit ausgeklügelten Bewässerungssystemen zu neuen Höhen auf.<br />
Unter den Völkern, die dieses "ägyptische" Wunder vorbereiteten, muss eine Mehrzahl zu den Negroiden<br />
gezählt werden, wie Ki-Zerbo in seinem Buch "Die Geschichte Schwarzafrikas" auf mehreren Seiten überzeu-<br />
gend ausführt. Zeitweise wurde das ganze Gebiet Ägyptens von schwarzafrikanischen Herrschern aus dem<br />
Süden regiert. (Ki-Zerbo 1984, S.73-81).<br />
2.3 Dunkle Jahrhunderte<br />
Die Zeit von ca. 700 v. Chr. bis ca. 700 n. Chr. wurde von zahlreichen Völkerwanderungen und Auseinander-<br />
setzungen bestimmt, die gegen das Ende der Periode mit der Eroberung der Küstengebiete Nordafrikas durch<br />
die Araber endeten. Da aus dieser Zeit nur wenig schriftliche Quellen bekannt sind, bezeichnet sie Ki-Zerbo<br />
auch als "Dunkle Jahrhunderte". (Ki-Zerbo 1984, S.83) Trotzdem war die Epoche vom technologischen Fort-<br />
schritt geprägt, so fand man in der Nähe Khartoums (Sudan) Zeichen für eine Jahrhunderte dauernde Verhüt-<br />
tung von Eisen, die der Anfangszeit der Epoche zugeordnet wird.<br />
Das Reich Kusch südlich Ägyptens entwickelte sich zu einem politisch, wirtschaftlich und kulturell wichtigem<br />
Zentrum mit alphabetischer Schrift, das nach Äthiopien und dem mittleren und westlichen Sudan ausstrahlte,<br />
bis es um 350 n. Chr. in der Bedeutungslosigkeit verschwand.<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 26
In Äthiopien entstand in der Zeit nach Christi Geburt eine eigenständige christliche Kirche, die sich bis heute<br />
halten konnte. An der Ostküste Afrikas begann sich der Handel mit Indien zu etablieren, der bis zum Erschei-<br />
nen der Portugiesen Anfang des 16. Jh. für die Küstenländer grosse Bedeutung hatte.<br />
Im mittleren und südlichen Afrika lebten die meisten Menschen weiterhin von der Jagd und als Sammler. Im<br />
ganzen Gebiet wurden die Buschleute durch die eindringenden Bantus immer mehr zurückgedrängt. Im Gebiet<br />
der grossen Seen scheint sich die Eisenverarbeitung um 400 n. Chr. sehr schnell ausgebreitet zu haben. In<br />
Simbabwe wurden in Minen Kupfer und Zinn mit Eisenwerkzeugen abgebaut.<br />
Diese Nutzung des Eisens führte zu einer Beschleunigung der Besitzergreifung Afrikas, durch die Völker, die<br />
es heute bewohnen. Das Eisen war auch die Grundlage für eine Überschussproduktion in der Landwirtschaft,<br />
die zu einer Differenzierung innerhalb der Bevölkerung in verschiedene Berufskasten führte. (Ki-Zerbo 1984,<br />
S. 95-99)<br />
2.4 Von den Königreichen zu den Kaiserreichen<br />
Gana, das erste der bedeutenden Reiche im westlichen Sudan, zwischen Senegal und Niger gelegen, entstand<br />
vermutlich im 4. Jh. n. Chr. Auf dem Höhepunkt seiner Macht um 1000 n. Chr. erstreckte es sich von den<br />
Flüssen Senegal und Niger bis in die Wüste hinein über eine Fläche von rund 500'000 km 2 . Die Basis des<br />
sagenhaften Reichtums Ganas war der Handel mit Gold aus dem Süden und Salz aus dem Norden. Der arabi-<br />
sche Reisende Ibn Haukal schrieb um 970 über den damaligen Herrscher Ganas: "Er ist der reichste der Welt<br />
wegen seines Goldes." Diesen Reichtum des Herrschers von Gana drückt auch ein Zitat aus dem Tarik el<br />
Fettach aus, in dessen Beschreibung der königlichen Pferdeställe es heisst:<br />
Jedes der tausend Pferde schlief auf einer eigenen Matte. Jedes trug am Hals und am Bein eine seidene Schnur. Jedes Pferd<br />
verfügte über einen Kupfertopf zum Urinieren... Jedem Pferd standen drei Personen zu Diensten, die eine für das Futter, die<br />
zweite für Getränke, die dritte für die Urin- und Exkrementenbeseitigung. Jeden Abend betrachtete der Herrscher von<br />
seinem Thron aus rotem Gold herab, von fackeltragenden Dienern umgeben, zehntausende seiner Untertanen, die zum<br />
Abendessen in den Palast geladen waren."<br />
Während eine Minderheit ihren Lebensunterhalt durch Handel erwarb, war der Grossteil der Bevölkerung im<br />
Ackerbau und der Viehzucht tätig. El Bekri beschreibt die Bürger Ganas als mit Lendenschürzen aus Baum-<br />
wolle, Seide oder Brokat gekleidet.<br />
Das Reich Gana zeigt die für die sudanesische Kultur typische Staatsstruktur mit einem König an der Spitze<br />
einer schwachen aber zentralistischen Amtsverwaltung. Die meisten Einwohner der Gebiete wurden jedoch<br />
von diesem Staat kaum beeinflusst. Nur der Aussenhandel wurde direkt durch den Herrscher kontrolliert.<br />
Nach dem Einfallen der Almoraviden um 1077 wurde das Reich im 13. Jahrhundert durch das aufsteigende<br />
Mali endgültig vernichtet. (Ki-Zerbo 1984, S. 106-113, 117-119; Bertelsmann Lexikon Geschichte 1996)<br />
In Äthiopien erlangte Axum Bedeutung. Der arabische <strong>Pro</strong>phet Mohammed teilte seinen Gefährten über das<br />
Reich mit: "Wenn ihr nach Abessinien geht, werdet ihr einen König finden, unter dem niemand verfolgt wird."<br />
Diese Haltung der Araber sollte im 10. Jahrhundert dazu führen, dass den Äthiopiern, obwohl sie Christen<br />
waren, im Zusammenhang mit den Kreuzzügen der Europäer nicht der Heilige Krieg erklärt wurde. (Ki-Zerbo<br />
1984, S. 121-125)<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
An der Ostküste erlebten die Städte zwischen dem 7. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts einen stetigen<br />
Aufschwung durch den sich verstärkenden Handel. Vor allem die Araber waren an Gold und Sklaven interes-<br />
siert. Durch den Handel mit Asien bis nach China entstand in diesen Städten eine eigene Kultur, die sich stark<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 27
von der Lebensweise der viel einfacher lebenden Bewohnern des Hinterlandes unterschied. (Ki-Zerbo 1984,<br />
S. 125-126)<br />
2.5 Grosse Jahrhunderte<br />
Das 12. bis 16. Jh. war für Schwarzafrika eine Zeit des Aufschwungs in ökonomischer, politischer und kultu-<br />
reller Hinsicht.<br />
Neben dem Reich Gana entwickelten sich weitere sudanesische Reiche wie Kanem östlich des Tschadsee,<br />
welches spätestens im 9. Jh. entstand, das ebenso alte Songhai, welches im 16. Jh. islamisiert wurde, die<br />
Hausa-Staaten, von denen die heute nigerianische Stadt Kano zeugt, und Mali, das unter dem Herrscher<br />
Kankan Muska (1312-1337) den Höhepunkt der Macht erlebte. Zu dieser Zeit erreichte Mali mit einer Ausdeh-<br />
nung vom Regenwald bis weit in die Sahara und von der Westküste bis in den Tschad und einer Fläche von<br />
rund 2 Mio km 2 den grössten Einfluss. Dieser Einfluss Malis war so gross, dass es sogar auf den europäischen<br />
Karten der damaligen Zeit abgebildet wurde.<br />
Mali war islamisch geprägt, doch gilt es als typischer Vertreter der negro-afrikanischen Königreiche. Ki-Zerbo<br />
beschreibt die politische Gliederung dieses riesigen Reiches in seiner Geschichte Schwarzafrikas mit den<br />
folgenden Worten (Ki-Zerbo 1984, S. 142-143):<br />
Um dieses schier unübersehbare Reich, das zur Zeit Mahmud Kôtis ungefähr 400 Städte zählte, regieren zu können,<br />
machten sich die Könige ein dezentralisiertes System zu eigen. Ihr Reich glich einer Mangofrucht: im Mittelpunkt ein<br />
harter Kern, der direkten Verwaltung des Königs unterstellt, der sich von Zeit zu Zeit und an wechselnden Orten plötzlich<br />
zeigte. Das Königreich war in <strong>Pro</strong>vinzen unterteilt, die an Ort und Stelle von einem dyamani tigui oder farba verwaltet<br />
wurden. Die <strong>Pro</strong>vinzen wiederum waren in Bezirke (kafo) und in Dörfer (doggo) unterteilt. Die dörfliche Gewalt war<br />
manchmal "doppelköpfig". Sie bestand aus einem Oberhaupt der kirchlichen Ländereien und einem politischen Oberhaupt.<br />
Manchmal wurde sogar ein ganzes weit entferntes Gebiet nach diesem Statut organisiert. Walatat hatte z. B. wegen seiner<br />
Bedeutung als Zollstützpunkt einen farba, der allerdings 1352 wegen seiner Unterschlagungen abgesetzt wurde. Rund um<br />
diesen Kern lag ein "Fruchtfleisch" von Königreichen, die in strenger Abhängigkeit gehalten wurden. Sie wurden aber von<br />
ihren früheren Herrschern regiert. Der farba des Königs diente dann als Geschäftsträger und setzte manchmal nach den<br />
Sitten des Landes den örtlichen Häuptling ein. Dieser Statthalter überwachte das Tun und Treiben des örtlichen Gebieters.<br />
Er nahm den von ihm gezahlten Tribut entgegen und konnte im Kriegsfall unter seinen Leuten Dienstverpflichtungen<br />
vornehmen. Solche <strong>Pro</strong>vinzen waren also noch immer organisch dem grossen Reich angegliedert. Schliesslich bildete ein<br />
dritter Bereich, gewöhnlich in den Randgebieten, die "Schale" dieser Mangofrucht. Es waren untergeordnete Königreich<br />
die die Vorherrschaft des Königs von Mali anerkannten und das durch regelmässig übersandte Geschenke zu verstehen<br />
gaben. Aber sie waren weder organisch noch beständig mit dem Zentrum verbunden. Sie waren im Grunde <strong>Pro</strong>tektorate,<br />
deren Zusammenhalt mit der zentralen Regierung von deren Macht abhängig war.<br />
Sowohl die Verwaltung als auch die Truppen des Königs, die für Sicherheit und Ordnung sorgten, wurden<br />
durch Steuern und Zölle finanziert.<br />
Nach dem Zerfall des Reiches Mali um 1450, trat Songhai, dessen Einflussbereich am Höhepunkt der<br />
Entwicklung vom Senegal im Westen bis nach Kano im Osten und von Burkina Faso im Süden bis tief in die<br />
Sahara hineinreichte, in den Vordergrund. Unter Kaiser Mohammed I. (1493-1528), der den Islam übernahm,<br />
erreichte das Gebiet die höchste Blütezeit der sudanesischen Kultur. Bildung wurde vermittelt, und Universitä-<br />
ten entstanden. Die Städte Gao, Kano, Dschenne und Timbuktu erreichten Einwohnerzahlen von bis zu<br />
100'000 Menschen. Der Afrikareisenden Leo Africanus beschrieb Timbuktu, das Zentrum zahlreicher Koran-<br />
schulen in seiner Beschreibung Afrikas von 1526 mit den Worten (Africanus, 1526):<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
There are many wells containing sweet water in Timbuktu; and in addition, when the Niger is in flood canals deliver the<br />
water to the city. Grain and animals are abundant, so that the consumption of milk and butter is considerable. But salt is in<br />
very short supply because it is carried here from Tegaza, some 500 miles from Timbuktu...<br />
There are in Timbuktu numerous judges, teachers and priests, all properly appointed by the king. He greatly honors<br />
learning. Many hand-written books imported from Barbary are also sold. There is more profit made from this commerce<br />
than from all other merchandise.<br />
(Zu Timbuktu siehe auch die Seite 38 dieser Arbeit.) 65 Jahre später wurde Songhai durch ein marokkanisches<br />
Heer, das auf der Suche nach Gold die Sahara durchquert hatte, zerstört. Damit und mit dem Vordringen der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 28
Europäer entlang der Küste änderte sich die Lage im ganzen Westsudan fundamental. (Ki-Zerbo 1984,<br />
S. 145-153; Brockhaus 1986, S. 187)<br />
Neben den grossen Reichen im Westen des Sudans und dem Bornureich (mit einer maximalen Ausdehnung<br />
von ca. 1 Mio km 2 ) im Gebiet des heutigen Tschad, entstanden im Norden des heutigen Nigerias an der<br />
Völkerscheide im 12. Jh. die Stadtstaaten der Hausa, die ihren Wohlstand ebenfalls durch Handel erreichten.<br />
Besonders wichtig waren der Handel mit der Kolanuss mit dem Königreich Gondscha und die Sklavenraubzü-<br />
ge gegen die Völker des Südens. Die im 15. Jh. errichteten Verteidigungswälle der heute noch immer bedeu-<br />
tende Stadt Kano beschreibt Ki-Zerbo wie folgt (Ki-Zerbo 1984, S. 156):<br />
Der grosse Befestigungswall von Kano, der heute noch vorhanden ist... hat eine Höhe von zwölf Metern, umfasst die Stadt<br />
in einer Länge von achtzehn Kilometern und hat sieben grosse Tore.<br />
(Für eine ausführlichere Beschreibung Kanos siehe die Seite 373 dieser Arbeit.) Wegen der stetigen Bürger-<br />
kriege zwischen den verschiedenen Hausastaaten errangen diese nie eine politisch beherrschende Rolle. Sie lag<br />
jedoch auch nicht in der Absicht ihrer vorwiegend in der Landwirtschaft tätigen Bewohner.<br />
Ein ausgeklügeltes Steuersystem umfasste Abgaben auf das Einkommen, Vieh, die Ländereien, auf Luxuser-<br />
zeugnisse und gewisse Berufe wie Fleischer, Färber und <strong>Pro</strong>stituierte. Das komplexe Wirtschaftssystem der<br />
Hausa umfasste Landwirtschaft, Handel und eine vorindustrielle <strong>Pro</strong>duktion von Gütern, die sich vor allem<br />
auch auf die <strong>Pro</strong>duktion von Stoffen konzentrierte. Neben den Bauern und Handwerken entstand ein für Neue-<br />
rungen offenes Bürgertum und eine Verwaltung, die eine leicht veränderte Form der arabischen Schrift für ihre<br />
Dokumente benutzte. (Zu den Hausa siehe auch die Seite 57 dieser Arbeit.)<br />
Im Süden Nigerias entstand im 12. Jh. das Reiche Benin, welches im 15. Jh. den Höhepunkt seiner Macht<br />
unter dem Soldaten und Arzt Eware dem Grossen, erreichte. Der König Benins war ein Monarch, der am<br />
einem Tag eine Armee von 20'000 Mann mobilmachen konnte, jedoch strengen Vorschriften unterworfen war.<br />
Die Hauptstadt Benins übertraf die meisten europäischen Städte der Zeit in Anlage und Planung. Sieur de la<br />
Croix beschreibt in seiner "Relation universelle de l'Afrique ancienne et moderne" von 1688 die Stadt Benin<br />
(Ki-Zerbo 1984, S. 167-168):<br />
"Es gibt mehrere Tore von 8 und 9 Fuss Höhe und 5 Fuss Breite. Sie sind alle aus einem Stück Holz und drehen sich auf<br />
einem Pfahl. Der Palast des Königs besteht aus einer Ansammlung von Bauten, die ebensoviel Raum einnehmen wie die<br />
Stadt Grenoble, und ist von Mauern umschlossen. Es gibt mehrere Wohnungen für die Minister des Herrschers und schöne<br />
Galerien, von denen die meisten ebenso gross sind wie die der Börse von Amsterdam. Sie ruhen auf kupferumhüllten<br />
Holzpfeilern, auf denen ihre Siege eingraviert sind und die man sehr sauberhält. Die meisten dieser königlichen Häuser<br />
sind mit Palmzweigen wie mit Brettern bedeckt; jede Ecke krönt ein pyramidenförmiger Turm mit einem Vogel aus<br />
Kupfer, der seine Schwingen ausbreitet. Dreissig grosse, schnurgerade Strassen gibt es in der Stadt und darüber hinaus eine<br />
Unmenge von kleinen Querstrassen. Die Häuser stehen geordnet nah beieinander mit Dächern, Vordächern und Säulen. Sie<br />
werden von den Blättern der Palme und der Bananenstaude überschattet, weil sie nur ein Stockwerk hoch sind. In den<br />
Häusern der Edelleute gibt es mitten im Haus grosse Galerien und mehrere Zimmer, deren Wände und Böden mit rotem<br />
Lehm verputzt sind. Diese Völker stehen den Holländern in bezug auf Sauberkeit kaum nach. Sie waschen und schrubben<br />
ihre Häuser so ausgiebig, dass sie glänzen und blitzblank sind wie ein Spiegel..."<br />
Die Städte Benin und Ife erlangten vor allem auch durch ihre Kunstwerke aus Bronze und Terrakotta<br />
Weltruhm. (Siehe dazu auch die Seite 123 dieser Arbeit.)<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Nicht nur in Westafrika entstanden in der Zeit der "Grossen Jahrhunderte" verschieden Reiche und Staaten,<br />
entlang der Küste Ostafrikas entwickelten sich im 13. Jahrhundert eine ganze Reihe von Stadtstaaten. Sie<br />
reichten vom afrikanischen Horn bis in das heutige Mosambik hinabreichten und wirkten als Mittler zwischen<br />
dem im Landesinnern lebenden Völkern, auf die sie allerdings wenig Einfluss hatten, und den Handelsleuten,<br />
die mit ihren Schiffen bis Indien und China fuhren. Auch in den Gebieten der grossen Seen entstanden Staaten,<br />
die als Vorläufer der Staaten im Gebiet des heutigen Ruanda, Burundi und Uganda gelten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 29
Über die Reiche Zentralafrikas ist mit Ausnahme des Königreiches Kongo, welches im 14. Jahrhundert<br />
entstand, nur wenig bekannt. Dieses Reich, das im heutigen Angola angesiedelt war, verfügte über ein diffe-<br />
renziertes politisches System mit <strong>Pro</strong>vinzgouverneuren. Unter dem als König Alfonso I. bekannten Herrscher,<br />
der zeitweilig das Christentum in seinem Reich einführte, knüpfte das Reich intensive Handelsbeziehungen<br />
mit den Portugiesen, die allerdings durch den von diesen geförderten Sklavenhandel bald gestört wurden.<br />
(Encarta 1997)<br />
Im südlichen Afrika bestanden auf dem Gebiet des heutigen Simbabwes, verschiedenen Reiche, die teilweise<br />
bereits eine mehrhundertjährige Geschichte aufwiesen und deren Reichtum im Bergbau begründet war. Die<br />
ersten portugiesischen Berichte sprachen von Gängen und riesigen Tunnels, der Schriftsteller Barbosa schrieb<br />
1517 (Ki-Zerbo 1984, S. 197-198):<br />
Hinter diesem Land im Innern dehnt sich das grosse Königreich Monomotapa aus, dessen schwarzhäutiges Volk nach<br />
Sofala kommt, um Gold und Elfenbein zu tauschen.<br />
Da über diese Gebiete wie schon erwähnt relativ wenig bekannt ist, werden hier nur die in Westafrika herr-<br />
schenden Strukturen während der "Grossen Jahrhunderte" noch genauer beschrieben.<br />
2.5.1 Wirtschaft und Gesellschaft in Westafrika<br />
"Es kann als gesichert gelten, dass um 1500 viele Völker in ganz Afrika auf einem hohen Niveau der Güterer-<br />
zeugung, der zivilen Technik, der gesellschaftliche und politischen Organisation standen...", so heisst es im<br />
ersten Band des Brockhaus (Brockhaus 1987, S. 187). Ganz Nordafrika wurde von einem Netz von Handels-<br />
strassen durchzogen, das vom tropischen Regenwald durch die Sahara bis an die Mittelmeerküste reichte (Ki-<br />
Zerbo 1984, S. 172-173):<br />
Die "Güter", die auf diesen Strassen transportiert wurden, waren Sklaven, Kolanüsse, Gummi, Elfenbein und<br />
Häute aus dem Süden nach Norden; Salz, Eisen- und Kupferbarren, Stoffe, Perlen, Handschriften aus dem<br />
Norden und Osten in den Süden.<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 30
Diese Güter wurden auf Märkten umgeschlagen, die in lokale, regionale und überregionale Märkte eingeteilt<br />
werden können. Die lokalen Märkte wurden alle drei oder fünf Tage in den Dörfern abgehalten, sie erlaubten<br />
den Bauern, ihre <strong>Pro</strong>dukte zu tauschen. Ausserdem erfüllten sie die Funktion eines sozialen Austausches der<br />
lokalen Bevölkerung. Die lokalen Märkte wurden nur sporadisch von bedeutenderen Händlern besucht.<br />
Die regionalen Märkte waren Handelszentren der verschiedenen Häuptlingsschaften. Sie fanden täglich statt<br />
und waren besser organisiert als die lokalen Märkte. Städte wie Wagadugu, Kumasi, Benin und die Hausastäd-<br />
te gehörten zu diesen regionalen Zentren ebenso wie wichtige Wegkreuzungen. Neben landwirtschaftlichen<br />
<strong>Pro</strong>dukten wurden auf diesen Märkten auch Handwerkserzeugnisse gehandelt. Der ganze Handel beruhte<br />
mehrheitlich auf einem Geldsystem. Als Zahlungsmittel wurden Eisen- oder Kupferstäbe, Goldstaub aber vor<br />
allem Kauris (eine Schnecke aus dem Indischen Ozean) verwendet. Dieser Handel wurde von den regierenden<br />
Stellen besteuert.<br />
Eine kleine Zahl von Handelsstädten hatte überregionale Funktion, verband die verschiedenen Gebiete und<br />
gelangte zu internationalem Ruf. Zu diesen Städten gehörten beispielsweise Bida, Kano, Dschenne, Mopti und<br />
Timbuktu. In diesen Städten trafen Handwerker wie Schmiede, Messing- und Silberjuweliere, Maurer, Kunst-<br />
tischler, Holzschnitzer, Weber, Glasbläser, Perlenhersteller, Töpfer, Korbflechter, Bierbrauer auf Bauern,<br />
Bergleute, Arzneimittelhersteller, schwarzafrikanische und arabische Händler. Die Märkte zeichneten sich<br />
dadurch aus, dass den meisten Waren feste Preise zugeschrieben wurden, die höchstens saisonal schwankten.<br />
Die sich herausbildenden Gesellschaften der Schwarzafrikaner waren äusserst vielfältig: Sie reichten von patri-<br />
linearen zu matrilinearen, von isolierten "Horden" bis zu höchst differenzierten Gesellschaften mit der Ausbil-<br />
dung unterschiedlichster sozialer Kasten.<br />
Zur Rolle der schwarzafrikanischen Frau, die als Arbeitskraft auch heute noch entscheidend zur Versorgung<br />
Schwarzafrikas beiträgt, schreibt Ki-Zerbo (Ki-Zerbo 1984, S. 183):<br />
Die Frauen bildeten eine besonders unterdrückte Klasse. Gewiss, die afrikanische Frau war mitunter Arbeiterin und Quelle<br />
zusätzlicher Arbeitskräfte auf dem Feld eines Polygamen. Sie diente hin und wieder als Tauschware und als<br />
Hochzeitsgabe, um die sozialen Bindungen zu festigen.<br />
Aber die schwarze Frau besass auch trotz der körperlichen Verstümmelungen, die man ihr manchmal zufügte, Vorrechte.<br />
Sie standen im Widerspruch zu der Unterdrückung und gaben ihr einen beneidenswerten Stand im Vergleich zu Frauen in<br />
anderen Ländern zu derselben Zeit. Solche Sonderrechte waren z. B.: grosse sexuelle Freiheit, in manchen animistischen<br />
Ländern sogar vor der Heirat; die Freiheit, bei Mutterschaften oder Familienbesuchen ihrer Wege zu gehen; eine besonders<br />
starke Bindung an ihre Kinder, weil sie in den ersten Lebensjahren nur für sie dasein konnte; Matrilinearität, die ihrem<br />
Bruder Autorität über ihre Kinder zubilligte; wirtschaftliche Freiheit durch Gewinne aus ihren vielfältigen<br />
landwirtschaftlichen und kaufmännischen Tätigkeiten, vorwiegend in den Küstenregionen, aber auch im Haussaland;<br />
politische und geistige Rechte, die ihr mitunter gar den Weg zum Thron und zur Regentschaft öffnen oder sie zur<br />
angesehenen Priesterin machen, besonders bei Fruchtbarkeitsriten. Hexen allerdings wurden besonders schlecht<br />
behandelt...<br />
Viele der Eigenarten und Errungenschaften der damaligen schwarzafrikanischen Gesellschaft haben sich trotz<br />
des zunehmend grösser werdenden Einflusses der europäischen und amerikanischen Lebensweise bis heute<br />
halten können, zum Vor- oder Nachteil der Bevölkerung Westafrikas. Die grossen Strukturen wurden aber<br />
während der Zeit der Wende Ende des 16. Jh. und durch den sich immer weiter ausbreitenden Sklavenhandel<br />
weitgehend zerstört.<br />
2.6 Zeit der Wende<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Die Zeit vom 16.-19. Jahrhundert muss als eine Zeit der Wende angesehen werden, während der sich die<br />
Strukturen auf dem afrikanischen Kontinent grundlegend änderten. Dazu trugen verschiedene Faktoren bei.<br />
Das westafrikanische Reich Songhai wurde durch den Eroberungsfeldzug der Marokkaner zwar nicht zerstört,<br />
zerfiel aber in der Folge. Der einstige Wohlstand machte, unter dem zusätzlichen Einfluss von<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 31
Klimaänderungen, Hungersnöten und Epidemien Platz. 1616-1619 vernichteten grosse Überschwemmungen<br />
die Ernte. 1639-1943 war eine Folge von dürren Jahren die Ursache von Hungersnöten. zu dieser Zeit brach<br />
auch die Pest unter der bedürftigen Bevölkerung aus, die von ihren Steuerlasten befreit werden musste. Im<br />
Zeitraum von 1738-1756 vernichtete eine weitere Hungersnot und die Pest zwischen dem Niger und den<br />
Hausastaaten 30-50% der Bevölkerung. Die Preise für Lebensmittel stiegen rapide an, eine ganze Zivilisation<br />
zerfiel und die Menschen, die sich Baumwollstreifen und Stoffe aus grober Wolle nicht mehr leisten konnten,<br />
griffen auf Tierfelle und geflochtene Blätter zurück, um sich zu kleiden. Im Tarik es Sudan aus dem 17. Jh.<br />
heisst es zu dieser Zeit (Ki-Zerbo 1984, S. 209):<br />
Alles verändert sich in dieser Zeit. Die Sicherheit macht der Gefahr Platz, der Überfluss dem Elend. Unruhe, schweres<br />
Unglück und Gewalttätigkeit folgten auf den Frieden, überall zerfleischten sich die Menschen gegenseitig; an allen Orten<br />
kreuz und quer verübte man Diebstähle. Der Krieg verschonte weder das Leben noch das Vermögen der Bewohner. Die<br />
Verwirrung war allgemein, sie breitete sich überall aus und steigerte sich bis zur höchsten Stufe.<br />
Dieser Niedergang der westafrikanischen Reiche wurde durch die Unterbindung der Handelsverbindungen mit<br />
Europa und dem Orient durch das Vordringen der osmanischen Völker nach Nordafrika zusätzlich gefördert.<br />
Gleichzeitig errangen auch die der Küste entlangsegelnden Portugiesen mehr und mehr Einfluss, dabei zöger-<br />
ten sie nicht, die Handelsstädte Ostafrikas als lästige Konkurrenten mit Waffengewalt auszuschalten.<br />
Das äthiopische Reich geriet im Zusammenhang mit der Ausdehnung des osmanischen Reiches ebenfalls zuse-<br />
hends unter Druck und wurde von Kriegstruppen der Somali, die auf der Seite der ebenfalls islamischen<br />
Türken kämpften, mehrmals überrannt. Nach der erneuten Festigung des Reiches drangen die Galla aus dem<br />
Süden in das Gebiet Äthiopiens ein, gleichzeitig führten die Türken Feuerwaffen in das Nilgebiet ein. Damit<br />
wurde ein neues Kapitel der Kriegführung auf dem afrikanischen Kontinent aufgeschlagen, in welchem auch<br />
die Portugiesen, auf der Seite der ebenfalls christlichen Äthiopier, eine wichtige Rolle spielten.<br />
Im südlichen Afrika erlebte das Reich Monomotapa seinen Niedergang durch den "Rückstau" der nach Süden<br />
ziehenden Bantuvölker, die dort auf die ins Landesinnere vorrückenden Buren trafen. Zudem war ja auch<br />
dieses Königreich, durch die von den Portugiesen angerichtete Zerstörung der ostafrikanischen Küstenstädte,<br />
seiner Handelsbeziehungen beraubt worden.<br />
Gleichzeitig nahm der von den Portugiesen nach Übersee betriebene Sklavenhandel mit dem Bedarf der Kolo-<br />
nien in der neuen Welt immer grössere Formen an. Die im Gegenzug nach Schwarzafrika eingeführten Feuer-<br />
waffen der Portugiesen - später nahmen auch anderere europäische Mächte am Waffenhandel teil - veränderten<br />
die bisher bestehenden Gleichgewichte zwischen den verschiedenen Völkern Schwarzafrikas. Diese erlitten<br />
durch den Menschenhandel hohe Verluste, die weit über die Zahlen der in der Neuen Welt ankommenden<br />
Sklaven hinausgingen. Denn oft mussten die Sklaven mit Gewalt von anderen Völkern beschafft werden, bevor<br />
sie über mehrere Stationen und Zwischenhändler, die zumeist Schwarzafrikaner waren, an die Küste gebracht<br />
wurden. Während viele schwarzafrikanische Reiche durch den Sklavenhandel destabilisiert wurden, profitier-<br />
ten andere, wie Benin und das der Aschanti. (Ki-Zerbo 1984, S. 205-214)<br />
Die Zeit der Wende in Schwarzafrika wurde also durch eine ganze Reihe von verschiedenen Faktoren verur-<br />
sacht und mitbeeinflusst, von denen die wichtigsten hier aufgezählt werden:<br />
1. Verschiedene Völkerwanderungen von schwarzafrikanischen Völkern, aber auch von Völkern,<br />
die neu in Afrika eindrangen,<br />
2. Klimawandel vor allem im Sudan- und Sahelgebiet,<br />
3. Zerstörung der herrschenden Strukturen durch Eroberungsfeldzüge und sich verschlechternde<br />
Bedingungen,<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 32
4. Zerfall der alten Handelsverbindungen durch die Umorientierung des Handels nach Süden und<br />
das Unterbinden des Handels durch Veränderungen der Gleichgewichte in Nordafrika,<br />
5. Nahrungsmittelknappheiten bedingt durch Klimaveränderungen und den Zerfall von<br />
Infrastrukturen,<br />
6. Epidemien aufgrund mangelhafter Ernährung und durch Neuankömmlinge eingeschleppte<br />
Krankheiten,<br />
7. Technische Überlegenheit der Europäer durch ihre Hochseeschiffe und Feuerwaffen.<br />
Im 19. Jahrhundert konnte Schwarzafrika durch das Verbot des Menschenhandels für Bürger europäischer<br />
Staaten, welches aber nicht immer eingehalten wurde, eine Erholungspause einlegen. In dieser Zeit wurden<br />
Freetown (Sierra Leone) und Libreville (Gabun) als Siedlungen für vom Sklavendienst befreite Schwarzafrika-<br />
ner gegründet. In Äthiopien gelang es dem Kaiser, die Staatsmacht wieder zu stärken und einen von den Italie-<br />
nern geführten Eroberungsversuch abzuwehren. Im Senegal entstanden mehrere islamische Staaten. Die Fulbe<br />
errichteten nach der Eroberung der Hausagebiete einen Staat, der bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts gegen<br />
die Briten bestehen konnte. Die Aschanti in Ghana hatten sich schon früher gegen die weiter nördlich lebenden<br />
Dagomba durchgesetzt und wurden von den Briten, die mehrere Niederlagen gegen sie erlitten, gefürchtet. Im<br />
südlichen Afrika entstanden nach den Eroberungszügen der Zulu, die weitere Völkerwanderungen auslösten,<br />
verschiedene Zulustaaten. Weitere Königreiche entstanden in Malawi (Ngoni), Mosambik (Gaza) und<br />
Simbabwe (Matabele). (Encarta 1997)<br />
2.7 Kolonisation und Widerstand<br />
Nach dem Verbot des Sklavenhandels versuchten insbesondere die Briten, den Handel mit Afrika auf andere<br />
Güter zu lenken. Um dies zu bewerkstelligen, wurden Verträge mit ansässigen Völkern geschlossen, die den<br />
Briten alleiniges Handelsrecht zugestehen sollten. In Ghana kam es wegen des ungeschickten Vorgehens der<br />
Briten zu einer Reihe von Konflikten mit den Aschanti, die 1823 begannen und erst um 1900 mit dem Sieg der<br />
Briten endete.<br />
Im Nigerdelta wurde der Handel mit Palmöl gefördert, die Staaten des Nordens von Nigeria blieben aber<br />
vorerst weitgehend unabhängig von europäischen Einflüssen.<br />
Ostafrika geriet während dieser Zeit in den Einflussbereich der arabischen Sultanate, die sich bereits im 17.<br />
Jahrhundert gegen die Portugiesen durchgesetzt hatten, und die einen weitreichenden Sklavenhandel betrieben,<br />
um ihre Gewürznelkenplantagen auf Sansibar zu betreiben.<br />
Die stetig besseren Kenntnisse der Europäer über den afrikanischen Kontinent, gefördert durch verschiedene<br />
Entdeckerreisen ins Innere des Kontinentes; die Auseinandersetzungen zwischen den Europäern und mit ande-<br />
ren damaligen Grossmächten, die auf Afrika einwirkten, führten anlässlich der Kongokonferenz von 1885 in<br />
Berlin zu der Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter den Europäern.<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Die anschliessenden Versuche der Europäer, diese Gebietsansprüche in die Tat umzusetzen, traf auf den hefti-<br />
gen Widerstand der schwarzafrikanischen Völker. Im Sudan kam es 1885 zum Madi-Aufstand, im heutigen<br />
Simbabwe erhoben sich 1896 die Matabele und Shona gegen die eindringenden britischen Siedler und Buren,<br />
in der Goldküste erhoben sich die Aschanti 1893-1896 und 1900 gegen die Briten, die Fulbe-Hausastadten in<br />
Nigeria kämpften 1901-1903 ebenfalls gegen die Briten, die Sokot erhoben sich 1906, die Deutschen mussten<br />
1904-1908 den Aufstand der Herero im heutigen Nambia und den Maji-Maji-Aufstand in Tanganyika von<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 33
1905-1907 niederschlagen. Am Ende unterlagen die schwarzafrikanischen Völker und Staaten jedoch den<br />
besser ausgerüsteten Europäern und nur Äthiopien konnte unter Kaiser Menelik II. die Eroberungsversuche der<br />
Europäer erfolgreich abwehren. (Encarta 1997)<br />
Nachdem sich die Europäer die schwarzafrikanischen Länder meist unter massivem Einsatz von Waffengewalt<br />
angeeignet hatten, begannen sie unter Zuhilfenahme von Zwangsarbeit und speziellen Steuern mit der Ausbeu-<br />
tung der Rohstoffe. Diese Massnahmen provozierten immer wieder Erhebungen der schwarzafrikanischen<br />
Bevölkerung, die Mitte der sechziger Jahre schliesslich zur Unabhängigkeit vieler schwarzafrikanischer Staa-<br />
ten, innerhalb der von den Europäern festgesetzten Landesgrenzen, führte.<br />
Dieser kurze Überblick zeigt, dass die schwarzafrikanischen Völker eine Geschichte aufweisen, die - obwohl<br />
in weiten Teilen noch zu wenig bekannt - eine ähnliche Komplexität wie jene Europas aufweist. Zudem verlief<br />
die Geschichte Schwarzafrikas keineswegs in Isolation, sondern wurde durch Ereignisse in anliegenden<br />
Ländern und Gebieten wesentlich beeinflusst.<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 34
3. Vorwürfe an das von der Schule vermittelte Bild<br />
Im Bewusstsein aller Kinder der Welt, sowenig sie auch zur Schule oder ins Kino gegangen sein mögen, ist der Schwarze<br />
derjenige, auf den jeder einschlägt, den jeder ohrfeigt oder mit Füssen tritt, den jeder verfolgen und abschlachten kann,<br />
derjenige, den jeder beraubt und dem Gespött der einfältigen Menge ausliefert, den jeder betrügt oder auf eine Kirche<br />
zutreibt wie das Vieh zum Schlachthaus. Er war von jeher und für alle Zeiten zum Opfer ausersehen. Nach der Bibel, d.h.<br />
nach der vorherrschenden jüdisch-christlichen Ideologie war er der Sohn Hams, der Verfluchte, das Tier in<br />
Menschengestalt oder vielmehr der Mensch in Tiergestalt, arbeitsscheu, ein unverbesserlicher Hurenbock, ein unbedarfter<br />
Knecht usw. Er war derjenige, auf den jeder ungestraft seine eigene Verworfenheit projizieren konnte.<br />
(Mongo Beti in Jestel, Hrsg., 1982, S. 57)<br />
Bei der Betrachtung des von der Schule vermittelten Bildes der schwarzafrikanischen Menschen soll einerseits<br />
untersucht werden, welche Bilder im Laufe der Zeit gezeichnet wurden, andererseits auch die Frage gestellt<br />
werden, ob die immer wieder gemachten Vorwürfe im Bezug auf die betrachteten Lehrmittel berechtigt sind.<br />
Um diesen beiden Grundfragen nachgehen zu können, folgt eine kurze Rückschau auf das im Laufe der letzten<br />
Jahrhunderte prägende Bild, darauf folgt eine Aufzählung wichtiger Vorwürfe, die im Zusammenhang mit der<br />
Darstellung schwarzafrikanischer Menschen im und ausserhalb des Schulbuches erhoben wurden, und schliess-<br />
lich wird die im Teil "Der schwarzafrikanische Mensch im Geographielehrmittel" dieser Arbeit benutzte<br />
Arbeitsweise anhand der drei Themenkreisen "Ghana", "Krieg" und "Religion" vorgestellt.<br />
Somit bildet der Teil "Vorwürfe an das von der Schule vermittelte Bild" zusammen mit dem Teil "Ergebnisse<br />
der Untersuchung" ab der Seite 494 eine Klammer um die Teile "Der schwarzafrikanische Mensch im Geogra-<br />
phielehrmittel", "Der schwarzafrikanische Mensch im Musiklehrmittel" und "Der schwarzafrikanische Mensch<br />
im Lesebuch und Comic", in denen das von bestimmten Lehrmitteln vermittelte Bild des schwarzafrikanischen<br />
Menschen anhand konkreter Zitate analysiert und besprochen wird.<br />
3.1 Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Um die im 20. Jahrhundert feststellbaren, in den Lehrmittel vermittelten Bilder von den Menschen Schwarzaf-<br />
rikas in ihrem historischen Kontext zu verstehen, ist eine Betrachtung der Entwicklung dieser Vorstellungen<br />
unabdingbar. Da im Rahmen dieser Arbeit nur ein recht grober Überblick geleistet werden kann, stützen sich<br />
die Ausführungen neben Zitaten aus zeitgenössischen Publikationen, wie beispielsweise Romane, vor allem<br />
auf einen Aufsatz von Gabriel Adeleye "Portraiture of the Black African by Caucasians in Both Antiquity and<br />
Modern Times" sowie das Buch "Die 'Wilden' und die 'Zivilisierten'" von Urs Bitterli.<br />
3.1.1 Die Antike<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Historisch ist nicht mehr feststellbar, wann Europäer erstmals mit Schwarzafrikanern in Kontakt kamen, aller-<br />
dings muss dies schon sehr früh der Fall gewesen sein. Homer (9. Jh. v. Chr.) beschreibt in der Odyssee den<br />
Herold Odysseus als kraushaarig und von dunkler Hautfarbe, was diesen mit grosser Wahrscheinlichkeit als<br />
Schwarzafrikaner ausweist. Während der römischen Herrschaft waren die Kontakte durch die Ausdehnung des<br />
römischen Reiches nach Nordafrika sehr vielfältig geworden. Die Schriftsteller dieser Zeit wussten genug über<br />
die Menschen Schwarzafrikas, um sie recht genau als von dunkler Hautfarbe, die von dem hellen Hautton des<br />
Mulatten bis zum tiefsten Schwarz reiche, zu beschreiben. Die dunkle Hautfarbe wurde sprichwörtlich im<br />
Ausspruch "Aethiopia smechein", "den Äthiopier weiss waschen". Bereits in der Antike zeichnete sich ein<br />
erster Wechsel der Sichtweise auf die schwarzafrikanischen Menschen ab. (Adeleye, 1992)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 35
Während die alten Griechen sich als Volk betrachteten, das von Barbaren umgeben war, die als niedriger<br />
stehende Menschen betrachtet wurden, unzivilisiert, wild und geschaffen für den Dienst am höherstehenden<br />
Hellenen - noch Aristoteles (384-322 v. Chr.) soll seinem Schüler Alexander dem Grossen empfohlen haben,<br />
sie wie Pflanzen oder Tiere zu behandeln -, kam es wenig später zu einem Paradigmawechsel. Unter Alexan-<br />
der dem Grossen (356-323 v. Chr.) wurde die Idee des kosmopolitischen Menschen gefördert, die Philosophen<br />
legten Wert auf die Brüderlichkeit aller Menschen. Diese Entwicklung beeinflusste auch die Einstellung<br />
gegenüber den Schwarzafrikanern. Sie wurden nicht nur als Mitglieder der Gemeinschaft betrachtet, sondern<br />
die Griechen und Römer entwickelten auch eine Theorie zum Einfluss der Umwelt auf die verschiedenen<br />
Ausprägungen der menschlichen Erscheinungsform. Eine Idee, die erst sehr viel später wieder aufgegriffen<br />
werden sollte. Ptolemäus (2. Jh. n. Chr.) war der Ansicht, dass die Schwarzafrikaner ihre dunkle Hautpigmen-<br />
tation und ihr krauses Haar, die kurze Statur und ihre fröhliche Natur der Nähe zur Sonne verdankten. Für die<br />
Menschen der griechisch-römischen Epoche waren die äusseren Eigenschaften lediglich das <strong>Pro</strong>dukt eines<br />
"geographischen Zufalls", die dem Menschen dazu dienten, mit seiner Umwelt zurechtzukommen. (Adeleye<br />
1992)<br />
Als Rom zur imperialen Macht aufstieg, die <strong>Pro</strong>vinzen in Nordafrika verwaltete, kam es zu einer vermehrten<br />
Begegnung zwischen Griechen, Römern und Schwarzafrikanern. Schwarzafrikaner übten während der Zeit des<br />
römischen Imperiums eine Vielzahl von Berufen aus. Einige arbeiteten in der Unterhaltung als Boxer, Akroba-<br />
ten, Gladiatoren, Jäger, Tierbändiger, Tänzer, Jockeys und Schauspieler. Andere erhielten eine Anstellung als<br />
Koch und Diener. (Adeleye 1992)<br />
Schwarze Intellektuelle, wie König Juba II (50 v. Chr.- 24 n. Chr.) von Mauretanien waren keine Seltenheit<br />
und das römische Reich offerierte den Schwarzafrikanern die Möglichkeit in der Armee, im diplomatischen<br />
Dienst oder als Geschäftsmann Karriere zu machen. Darüberhinaus gibt es auch viele Hinweise, dass die<br />
Schwarzafrikaner nicht nur als Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert waren, sondern dass es auch zu Bezie-<br />
hungen und Heiraten zwischen Weiss und Schwarz kam, denn die Römer betrachteten Schönheit als relativ,<br />
eine Idee, die erst sehr viel später wieder aufgegriffen werden sollte. (Adeleye 1992)<br />
Schon Asclepiades (3. Jh. v. Chr.) soll eine Schwarzafrikanerin mit den folgenden Worten gepriesen haben<br />
(Adeleye 1992):<br />
Gazing at her beauty, I melt like wax before the fire. And if she ist black, what difference to me? So are coals, but when we<br />
light them, they shine like rosebuds.<br />
Eine Mauerinschrift in Pompeii (vor 79 n. Chr.) äusserst sich in ähnlicher Weise (Adeleye 1992):<br />
Whoever loves a Black girl is set ablaze by black charcoal; when I see a Black girl, I willingly eat blackberries.<br />
König Juba II. von Mauretanien war zweimal mit einer Frau kaukasischer Abstammung verheiratet und<br />
Plutarch (46-120 n. Chr.) schildert den Fall einer Griechin, die ein schwarzes Kind gebar und deshalb des<br />
Ehebruchs beschuldigt wurde. Aber eine darauf folgende Untersuchung habe gezeigt, dass ihr Urgrossvater ein<br />
Äthiopier war. Für diese Zeit kann also davon ausgegangen werden, dass eine Beziehung zwischen Weissen<br />
und Schwarzafrikanern nur dann als anrüchig galt, wenn es sich dabei um Ehebruch handelte. (Adeleye 1992)<br />
Die wohl beste Beschreibung des Aussehens der Schwarzafrikaner in der damaligen Zeit wird Vergil (70-19 v.<br />
Chr.) zugeschrieben (Adeleye 1992):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
She was by race African, her entire figure testifying to her native land: hair tightly-curled, lips swollen, complexion dark,<br />
the chest broad, breasts lying low, abdomen somewhat pinched, the legs thin and the feet wide and large.<br />
Mit dem Fall des römischen Reiches wurden die Beziehungen Europas zu Schwarzafrika durch den Vorstoss<br />
der arabischen Völker und der Verbreitung des Islams fast vollkommen unterbunden. Erst im 15. Jahrhundert<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 36
sollte es, bedingt durch die Seereisen der Portugiesen, zu einem erneuten intensiveren Kontakt kommen.<br />
(Adeleye, 1992)<br />
3.1.2 Die Berichte arabischer Beobachter<br />
Die meisten Arbeiten arabischer Berichterstatter wurden in Europa erst Jahrhunderte später bekannt. Doch<br />
einige von ihnen hatten bereits sehr früh Kontakt mit europäischen Herrschern. Zu diesen gehörten die<br />
Geographen Sherif el Idrisi und Leo Africanus.<br />
3.1.2.1 El Idrisi<br />
El Idrisi (1100-1165), ein Marokkaner, der im Dienste des König von Sizilien Rogers II. stand, schrieb zur Zeit<br />
der Kreuzzüge eine Geographie zu den Ländern des Sudan, in der er acht grössere schwarzafrikanische Reiche<br />
erwähnt: Tekrur, Gana, Wangara, Kaugha, Kanem, Zaghawa und Nubia (Bitterli 1977, S. 46):<br />
El Idrisi rühmte die Fruchtbarkeit und den Handelsreichtum dieser Gegenden, die Geschäftigkeit der Städte, den Glanz der<br />
Fürstenhöfe und die Unerschöpflichkeit der Goldvorkommen am Nigerlauf.<br />
Die Goldvorkommen Westafrikas sollten auch von späteren Autoren immer wieder erwähnt werden.<br />
3.1.2.2 Ibn Batuta<br />
Wenige Jahre später berichtete der Augenzeuge Ibn Batuta (1304-1369), den seine Reisen um die halbe Welt<br />
führten, in seinem Reisebuch "Rihlah" (Michler 1991, S. 209f.):<br />
Der Reisende braucht sich in diesen Gegenden weder mit Reiseproviant noch mit anderen Lebensmitteln noch mit<br />
Geldstücken zu beladen; er muss nur Steinsalzstücke, Schmuck und einige aromatische Substanzen mitnehmen... Wenn der<br />
Reisende zu einem Dorf kommt, erscheinen die Negerinnen mit Hirse, saurer Milch, Hühnern, Mehl, Reis, Funi - der<br />
Senfkörnern gleicht und aus dem man Kuskus und eine dicke Suppe zubereitet - schliesslich mit Mehl aus Bohnen. Der<br />
Reisende kann ihnen abkaufen, was er sich unter all diesen Sachen wünscht.<br />
Ähnlich hatte sich wenige Jahre zuvor schon der Schriftsteller Al Omari geäussert, der über die Landwirtschaft<br />
des Sahel schrieb (Michler 1991, S. 209f.):<br />
Die Bewohner trinken das Wasser des Nigers und das der Brunnen, die sie gegraben haben... Ihre hauptsächlichsten<br />
Nahrungsmittel sind: Der Reis; der Funi (Hirseart);... der Weizen, der selten ist; das Sorghum (Hirse), das als<br />
Nahrungsmittel für sie selbst und als Futter für ihre Pferde und ihre Lastentiere dient... Man baut bei ihnen eine Pflanze an,<br />
die man Kafi nennt; das sind weiche Wurzeln, die man in die Erde eingräbt und darin lässt, bis sie hart geworden sind.<br />
Damit zählten Ibn Batuta und Al Omari eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln auf, die für die einheimische<br />
Bevölkerung von Bedeutung sind, eine Bedingung, die bei weiten nicht alle Geographielehrmittel des 20. Jahr-<br />
hunderts erfüllen sollten.<br />
3.1.2.3 Leo Africanus<br />
Leo Africanus (1485-1554), ein in Granada geborener Diplomat, der um 1519 neben Ägypten auch den westli-<br />
chen Sudan bereiste, hatte nach eigenen Angaben 15 Staaten persönlich aufgesucht und "deren gesellschaftli-<br />
che Organisation, deren wirtschaftliche Bedeutung, die Lebensform ihrer Bürger in knappen Schilderungen<br />
von grosser Authentizität festgehalten". Besonders seine Beschreibung Timbuktus wurde bekannt, die europäi-<br />
schen Geographen des 18. Jahrhunderts sollten sie mehrfach zitieren, und die Handelsleute führten sie an, um,<br />
allerdings erfolglos, für ihre kommerziellen <strong>Pro</strong>jekte zu werben. (Bitterli 1977, S. 46)<br />
Leo Africanus, der nach seiner Taufe durch den Papst Leo X. den christlichen Namen "Johannis Leo de Medi-<br />
ci" annahm, der aber vor seinem Tod in Tunis 1554 wieder zum Islam konvertierte, schrieb in seiner "Beschre-<br />
ibung Afrikas" von 1526 über die sagenhafte Stadt Timbuktu, die damals den Zenith ihrer Macht bereits über-<br />
schritten hatte (Africanus, 1526):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 37
The houses of Timbuktu are huts made of clay-covered wattles with thatched roofs. In the center of the city is a temple<br />
built of stone and mortar... and in addition there is a large palace... where the king lives. The shops of the artisans, the<br />
merchants, and especially weavers of cotton cloth are very numerous. Fabrics are also imported from Europe to Timbuktu,<br />
borne by Berber merchants.<br />
The women of the city maintain the custom of veiling their faces, except for the slaves who sell all the foodstuffs. The<br />
inhabitants are very rich, especially the strangers who have settled in the country; so much so that the current king has<br />
given two of his daughters in marriage to two brothers, both businessmen, on account of their wealth. There are many wells<br />
containing sweet water in Timbuktu; and in addition, when the Niger is in flood canals deliver the water to the city. Grain<br />
and animals are abundant, so that the consumption of milk and butter is considerable. But salt is in very short supply<br />
because it is carried here from Tegaza, some 500 miles from Timbuktu...<br />
The royal court is magnificent and very well organized. When the king goes from one city to another with the people of his<br />
court, he rides a camel and the horses are led by hand by servants. If fighting becomes necessary, the servants mount the<br />
camels and all the soldiers mount on horseback. When someone wishes to speak to the king, he must kneel before him and<br />
bow down; but this is only required of those who have never before spoken to the king, or of ambassadors. The king has<br />
about 3'000 horsemen and infinity of foot-soldiers armed with bows... which they use to shoot poisoned arrows. This king<br />
makes war only upon neighboring enemies and upon those who do not want to pay him tribute. When he has gained a<br />
victory, he has all of them - even the children - sold in the market at Timbuktu...<br />
There are in Timbuktu numerous judges, teachers and priests, all properly appointed by the king. He greatly honors<br />
learning. Many hand-written books... are also sold. There is more profit made from this commerce than from all other<br />
merchandise.<br />
Instead of coined money, pure gold nuggets are used; and for small purchases, cowrie shells which have been carried from<br />
Persia...The people of Timbuktu are of a peaceful nature. They have a custom of almost continuously walking about the<br />
city in the evening... playing musical instruments and dancing. The citizens have at their service many slaves, both men<br />
and women... There are no gardens or orchards in the area surrounding Timbuktu.<br />
(Zu Timbuktu siehe auch die Seiten 28 und 143 dieser Arbeit.) Neben den Quellen der Antike waren die<br />
Schriften arabischer Intellektueller die einzigen Zeugnisse, auf welche die europäischen Gelehrten während<br />
langer Zeit zurückgreifen konnten. Zwar kam es sicher auch im Zusammenhang mit den Kreuzzügen zu Bege-<br />
gnungen mit Schwarzafrikanern, die Äthiopier nahmen ja auch daran teil, doch drang davon kaum Kunde nach<br />
Europa.<br />
3.1.3 Entdeckungen, Menschenhandel und Sklavenbefreiung<br />
Als die Europäer im 14. Jh. damit begannen, auf der Suche nach neuen Handelswegen den ganzen Erdball zu<br />
erforschen, kam es zu vermehrten Berichten über die Bewohner Schwarzafrikas. Diese wurden jedoch meist<br />
von wenig gebildeten Seefahrern verfasst, ergötzten sich oft an der Schilderung von Fabelwesen oder wieder-<br />
holten einfach, was bereits aus anderen Publikationen bekannt war. Damit trugen sie mehr zur Bildung von<br />
Klischeevorstellungen bei, als dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse zu Tage gefördert hätten. Dazu schreibt<br />
Bitterli (Bitterli 1977, S. 26):<br />
So konnte es beispielsweise geschehen, dass sich, nachdem die "abscheuliche Hässlichkeit" der Hottentotten einmal<br />
apodiktisch festgestellt war, Dutzende von Reisenden darin überboten, dieses Volk in Erscheinung und Sitten boshaft zu<br />
verzeichnen, wodurch ernst zu nehmende Studien über eine der interessantesten Völkergruppen Schwarzafrikas sehr<br />
verzögert wurden.<br />
Immerhin waren bereits im 15. Jahrhundert schwarze Sklaven in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon<br />
keine ungewohnte Erscheinung mehr. Als Haussklaven bildeten sie eine integrierten Teil der Gesellschaft.<br />
Rassenvorurteile spielten kaum eine Rolle und richteten sich vor allem gegen das "Heidentum der Neger". In<br />
Portugal kam es auch zu einer zunehmenden Vermischung der europäischen Bevölkerung mit den Schwarzaf-<br />
rikanern. (Bitterli 1977, S. 181)<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Im 16. Jahrhundert war der Anblick eines Schwarzafrikaners den Portugiesen so vertraut, dass er im Strassen-<br />
bild kaum mehr beobachtet wurde. Der niedersächsische Zoologe und Anthropologe Johann Friedrich Blumen-<br />
bach (1752-1840) reiste hingegegen noch 1790 extra nach Yverdon, um dort einen "Neger" zu besichtigen. Im<br />
England des 18. Jh. wiederum gehörte der Schwarzafrikaner zum Strassenbild der Hafenstädte. 1750 dürften<br />
etwa 10'000 Schwarzafrikaner auf der Insel gelebt haben, die 1772 durch den Mansfield-Entscheid in die Frei-<br />
heit entlassen wurden - erst 1807 aber wurde der Sklavenhandel britischen Staatsbürgern untersagt. Vielen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 38
Schwarzafrikanern gelang es jedoch nicht, ein neues Leben zu beginnen, und ihr sozialer Niedergang verstärk-<br />
te diskriminierende Reaktionen in den Kreisen des englischen Kleinbürgertums. (Bitterli 1977, S. 181)<br />
In Frankreich verlief die Entwicklung anders. Die ihre französischen Herrschaften begleitenden Schwarzafri-<br />
kaner galten nach dem französischen Recht als freie Menschen, zudem war ihre Zahl weit geringer als in<br />
England. Bitterli beschreibt die Funktion der Schwarzafrikaner in Frankreich folgendermassen (Bitterli 1977,<br />
S. 184):<br />
...der schwarze Lakai gehörte als eine Art von Dekorationsfigur, der auch rein ästhetische Bedeutung zukam, zu den<br />
grossen Empfängen der Metropole, und die Dame aus gehobener Gesellschaft liess sich bei ihren Einkäufen - und sei es<br />
auch nur, um eher bemerkt zu werden - gern vom Schwarzen begleiten. Auch gelangten Negerknaben zuweilen als Präsent<br />
hoher Kolonialbeamter in den Dienst edler Damen...<br />
Bis ins 18. Jahrhundert blieben aber die Informationen aus dem Innern des Kontinentes von oft zweifelhaftem<br />
Wert: Sie stützten sich meist auf Fehlinterpretationen oder gewagte Spekulationen, Gerüchte und reine<br />
Mutmassungen (Bitterli 1977, S. 43):<br />
Der Geograph des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts blieb, was die Binnenräume Afrikas anbetraf, zur Hauptsache<br />
auf Nachrichten angewiesen, wie sie die Reisenden der Antike, Herodot, Plinius der Ältere oder Claudius Ptolemäus<br />
gesammelt hatten... Waren die Fachleute schon derart unzulänglich orientiert, so musste die Unkenntnis der Laien als<br />
vollständig gelten. Dem Grossteil der europäischen Bevölkerung, allen jenen Schichten, die in weiter Entfernung von den<br />
Hafenstädten lebten und keine Bücher lasen, war der Name "Afrika" kaum mehr als ein Synonym für das Unbekannte<br />
schlechthin: hier bezeichnete dieses Wort weniger eine Realität als ein entlegenes Fabelreich, das man mit den<br />
Ausgeburten einer zügellosen Phantasie besiedelte und dessen Existenz nur selten, bald bedrohlich, bald verführerisch, ins<br />
Bewusstsein drang.<br />
Das Unwissen der Europäer blieb bei der Begegnung mit den Schwarzafrikanern nicht ohne Folgen (Bitterli<br />
1977, S. 84f.):<br />
Dasselbe Unvermögen, das Phänomen archaischer Kultur intellektuell zu bewältigen, welches in politischer Hinsicht zum<br />
Einsatz gewalttätiger Mittel hinführte, begünstigte in philosophisch-psychologischer Hinsicht die Neigung zur<br />
Diskriminierung der Vertreter anderer Rassen... Die Verlegenheit des Europäers... schlug in eine... Verurteilung des<br />
Eingeborenen um, der als "Barbar" und "Wilder" ein für alle Mal deklassiert wurde. Indem man selbstgerecht die eigene<br />
Lebensform zur absoluten Norm erhob und alles, was davon abwich, als minderwertig und pervertiert brandmarkte, führte<br />
man eine durch keinerlei wissenschaftliche Überlegung fundierte Trennung zwischen Kultur und Natur ein und wies dem<br />
Eingeborenen den zweiten Bereich zu, während man sich ganz selbstverständlich zum Herrn der Schöpfung einsetzte, ohne<br />
sich auch nur über die mit solcher Anmassung verbundenen Verantwortlichkeiten Rechenschaft zu geben.<br />
Die damals entstandenen Bilder des schwarzafrikanischen Menschen wurden durch die in die "Neue Welt"<br />
verschleppten Sklaven, denen oftmals keine Rechte zugestanden wurden, noch verstärkt.<br />
Der französische Schriftsteller und Philosoph Voltaire (1694-1778) soll nach Bitterli den "Neger" als ein<br />
"schwarzes Tier mit Wollhaar" auf dem Kopf bezeichnet haben, "der sich auf zwei Beinen fast so geschickt<br />
wie ein Affe fortbewege und weniger stark als die anderen Tiere seiner Grösse sei, allerdings einige Ideen<br />
mehr im Kopf habe. Ausserdem soll Voltaire geschrieben haben, "unter den Negern würde lebhaft darüber<br />
diskutiert, ob sie von den Affen abstammten oder diese von ihnen". "Die meisten Afrikaner lebten... in einem<br />
Anfangsstadium der Dummheit, folgten bloss ihren Instinkten und seien ausserstande, eine dauerhafte gesell-<br />
schaftliche Basis ihrer Existenz zu begründen". (Bitterli 1977, S. 275) Ähnliche Aussagen lassen sich noch bis<br />
in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts nachweisen.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Die systematische Erforschung setzte erst im Jahre 1788 ein, als in London die "Association for <strong>Pro</strong>moting the<br />
Discovery of the Interior Parts of Africa" gegründet wurde. Die aus Mitglieder- und Gönnerbeiträgen finan-<br />
zierte Gesellschaft wurde aus rein wissenschaftlicher Neugier geschaffen und sollte die Öffentlichkeit durch<br />
Publikationen ins Bild setzten. Im Auftrag dieser Gesellschaft gelang es dem schottischen Arzt Mungo Park<br />
1795, von der Gambia-Mündung zum Niger vorzustossen, und er brachte damit Nachricht von einer Gegend,<br />
über die bis dahin nur spekuliert wurde. (Bitterli 1977, S. 49) Die darauffolgenden weiteren Entdeckungsreisen<br />
von Forschern und Abenteurern wie Stanley und Livingstone wurden von der damaligen Öffentlichkeit nicht<br />
nur als Beitrag zu den geographischen Kenntnissen Europas betrachtet, "sondern als schöpferische Leistung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 39
schlechthin dargestellt, so, als hätte man die neuentdeckten Gebiete nicht bloss gefunden, sondern als wären<br />
sie dank" ihrer Entdecker "erst eigentlich existent geworden". (Bitterli 1977, S. 72)<br />
In ganz Europa, auch in Deutschland begann man sich eingehend mit den Völkern in den neuentdeckten<br />
Gebieten zu befassen. Dabei wurden diese jedoch meist schon im voraus als in ihrer Entwicklung zurückge-<br />
blieben eingestuft. Friedrich von Schiller (1759-1805) gab in seiner Jenaer Antrittsrede von 1789 die Meinung<br />
seiner Zeit über die Bedeutung dieser Entdeckungen wieder (Schiller: Was heisst und zu welchem Ende<br />
studiert man Universalgeschichte?, S. 10f. DB S. 85472f.):<br />
Die Entdeckungen, welche unsre europäischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Küsten gemacht haben,<br />
geben uns ein ebenso lehrreiches als unterhaltendes Schauspiel. Sie zeigen uns Völkerschaften, die auf den<br />
mannigfaltigsten Stufen der Bildung um uns herum gelagert sind, wie Kinder verschiednen Alters um einen Erwachsenen<br />
herumstehen und durch ihr Beispiel ihm in Erinnerung bringen, was er selbst vormals gewesen und wovon er ausgegangen<br />
ist. Eine weise Hand scheint uns diese rohen Völkerstämme bis auf den Zeitpunkt aufgespart zu haben, wo wir in unsrer<br />
eignen Kultur weit genug würden fortgeschritten sein, um von dieser Entdeckung eine nützliche Anwendung auf uns selbst<br />
zu machen und den verlornen Anfang unsers Geschlechts aus diesem Spiegel wiederherzustellen. Wie beschämend und<br />
traurig aber ist das Bild, das uns diese Völker von unserer Kindheit geben! und doch ist es nicht einmal die erste Stufe<br />
mehr, auf der wir sie erblicken.<br />
Trotz all dieser abschätzenden Bemerkungen, den verbreiteten Unwahrheiten, und der Diskussion, ob<br />
Schwarzafrikaner der gleichen Rasse angehörten wie die Europäer, sollte die Abwertung erst mit dem Einset-<br />
zen des Kolonialismus ihren wahren "Höhepunkt" erreichen.<br />
Die im folgenden vorgestellten Literaturbeispiele geben einen Einblick in die Geistesströmung der Zeit von<br />
der beginnenden Erforschung der Küsten Schwarzafrikas bis hin zum Einsetzen der kolonialen Machtgelüste<br />
europäischer Staaten.<br />
3.1.3.1 Montaigne<br />
Michel de Montaigne (1533-1592) gibt in seinen "Essays" von 1575 im dreizehnten Kapitel "Of the Resem-<br />
blance of Children to Their Father" eine Geschichte wieder, die angeblich auf Aesop zurückgeht, und ist damit<br />
ein gutes Beispiel dafür, dass man damals für Informationen über die Schwarzafrikaner weniger auf die eigene<br />
Erfahrung baute, die auch oft nicht gemacht werden konnte, sondern gerne auf die Schriften der Antike<br />
zurückgriff (Montaigne 1575):<br />
...Aesop tells a story, that one who had bought a Morisco slave, believing that his black complexion was accidental in him,<br />
and occasioned by the ill usage of his former master, caused him to enter into a course of physic, and with great care to be<br />
often bathed and purged: it happened that the Moor was nothing amended in his tawny complexion, but he wholly lost his<br />
former health...<br />
Ob diese Geschichte tatsächlich auf Aesop zurückgeht, ist in Anbetracht der Umstände der damaligen Zeit und<br />
der wahrscheinlich schwarzafrikanischen Abstammung dieses Fabelschreibers sehr unwahrscheinlich. Viel-<br />
mehr dürfte sie das in weiten Teilen Europas verbreitete Unwissen des 16. Jahrhunderts widerspiegeln - Portu-<br />
gal war mit einem relativ hohen Anteil von Schwarzafrikaner in seiner Bevölkerung eine Ausnahme.<br />
3.1.3.2 Shakespeare<br />
Gleich in drei Werken William Shakespeares (1564-1616) finden sich Hinweise auf Verbindungen zwischen<br />
Schwarzen und Weissen. In der bluttriefenden Tragödie "Titus Andronicus", geschrieben um 1590, die in der<br />
Antike spielt, wird die Liebschaft der Gotenkönigin Tamora zum Mohren Aaaron beschrieben. So spricht<br />
Tamora im 2. Akt, 3. Szene die folgenden Worte aus (Shakespeare 1992):<br />
"Ah, my sweet Moor, sweeter to me than life!"<br />
Shakespeare orientiert sich bei diesem Stück also ganz an der Antike, deren Ideale zu Shakespeares Zeit<br />
zumindest von den Intellektuellen nachgelebt wurden.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 40
Im "Kaufmann von Venedig", geschrieben um 1595, erwidert Lorenzo, Liebhaber Jessicas, der Tochter des<br />
Juden Shylock, die Anschuldigungen seines Freundes, des Clowns Lancelot, im 3. Akt, 5. Szene mit den<br />
Worten (Shakespeare 1992):<br />
"I shall answer that better to the commonwealth than / you can the getting up of the negro's belly: the / Moor is with child<br />
by you, Launcelot."<br />
Shakespeare schildert damit die Beziehung Lancelots zu einer Mohrin, wobei wie schon in der römischen Zeit,<br />
die Verbindung nicht deshalb kritisiert wird, weil Lancelot sich mit einer Schwarzafrikanerin eingelassen hat,<br />
sondern weil die Beziehung eine uneheliche ist.<br />
1604 schliesslich schrieb Shakespeare eines seiner bedeutendsten Stücke, das Drama "Othello". Darin wird die<br />
Geschichte der Liebe des noblen Mohren Othello zu seiner Frau Desmonda geschildert, die er heimlich und<br />
Gegen den Willen ihres Vaters ehelicht. Durch das Teiben des Untergebenen Jago, der Othello seine Stellung<br />
und sein Glück vergönnt, findet die Beziehung ein tragisches Ende. Im 1. Akt, 1. Szene lässt Shakespeare Jago<br />
die folgenden Wort zu Brabantios, dem Vater Desmondas sprechen (Shakespeare 1992):<br />
"I am one, sir, that comes to tell you your daughter / and the Moor are now making the beast with two / backs."<br />
Die Worte bringen deutlich zum Ausdruck: Nicht die Tatsache, dass die Tochter eine Beziehung zu einem<br />
"Mohren" hat, wird als unschicklich betrachtet, sondern das <strong>Pro</strong>blem liegt in der Beziehung, die den Segen des<br />
Vaters nicht gefunden hat.<br />
Desmonda, von ihrem Vater auf die Verbindung zu Othello angesprochen, antwortet im 1. Akt, 3. Szene mit<br />
den folgenden Worten (Shakespeare 1992):<br />
"My noble father, / I do perceive here a divided duty: / To you I am bound for life and education; / My life and education<br />
both do learn me / How to respect you; you are the lord of duty; / I am hitherto your daughter: but here's my husband, /<br />
And so much duty as my mother show'd / To you, preferring you before her father, / So much I challenge that I may<br />
profess / Due to the Moor my lord."<br />
Offen bleibt bei allen Stellen, ob es sich bei den dargestellten Personen um Mauren oder Schwarzafrikaner<br />
handelt, etliche Stellen weisen jedoch darauf hin, dass tatsächlich Menschen sehr dunkler Hautfarbe gemeint<br />
waren. Dazu vermerkt Hensel auf Seite 204 seinen Spielplans (Hensel 1986, S. 204): "...doch auf den Schwär-<br />
zegrad der Haut kommt es nicht an. Für Shakespeare und seine Zeitgenossen war der Unterschied zwischen<br />
Maure und Neger unerheblich: 'Othello' ist keine Rassentragödie...", d. h. nicht die unglückliche Beziehung<br />
zwischen einer Europäerin und einem Schwarzafrikaner, die zwar nicht zu den Einheimischen zählten, aber<br />
doch in der Gesellschaft ihre respektierten Aufgaben erfüllten, steht im Vordergrund der Betrachtung, sondern<br />
die Tragödie der beiden an und für sich. Damit legt Shakespeare Zeugnis ab für das von der römischen Epoche<br />
geprägte Ideal der Akzeptanz anderer Völker, das es nicht für nötig hielt, eine andere Rasse pauschal zu<br />
verurteilen.<br />
3.1.3.3 Locke<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
John Locke (1632-1704) zeigt in "An Essay Concerning Human Understanding" von 1690 am Beispiel eines<br />
Kindes, welches seine eingeschränkte Vorstellung eines Menschen auf einen Schwarzafrikaner anzuwenden<br />
versucht, auf, wie wichtig die zugrunde liegenden Vorstellung bei der Einschätzung einer Person oder Sache<br />
sind (Locke 1690, 4. Buch "Of Knowledge and <strong>Pro</strong>bability, 7. Kapitel "Of Maxims", Abschnitt 16.):<br />
First, a child having framed the idea of a man, it is probable that his idea is just like that picture which the painter makes of<br />
the visible appearances joined together;... of ideas... whereof white or flesh-colour in England being one, the child can<br />
demonstrate to you that a negro is not a man, because white colour was one of the constant simple ideas of the complex<br />
idea he calls man;... to him,... What is... depends upon collection and observation, by which he is to make his complex idea<br />
called man.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 41
Locke spricht damit eine <strong>Pro</strong>blematik an, über die nachzudenken, sich für manchen Schreiberling gelohnt<br />
hätte, der ohne jegliche Reflektion seiner eigenen Vorstellung über die Menschen Schwarzafrikas, diese Bilder<br />
nach altbewährter Tradition und in gewohnt rassistischer Manier zu Papier gebracht hat und damit zu deren<br />
Verbreitung beitrug.<br />
3.1.3.4 Defoe<br />
Der Roman "Robinson Crusoe" von Daniel Defoe (1660-1731), geschrieben 1719, prägte mit der Gestalt "Frei-<br />
tags" das Bild des Schwarzafrikaners über viele Generationen, obwohl dieser gar keine Schwarzafrikaner war,<br />
wie aus Defoes Beschreibung hervorgeht (Defoe 1719):<br />
His hair was long and black, not curled like wool;... The color of his skin was not quite black, but very tawny;... His face<br />
was round and plump; his nose small, not flat like the negroes;... thin lips...<br />
Defoe hat aber im gleichen Roman - dem Schiffbruch, der zu Robinsons Inseldasein führt, gehen mehrere<br />
Schiffreisen an die Küste Westafrikas voraus - einige schwarzafrikanische Menschen beschrieben (Defoe<br />
1719):<br />
...for who would have supposed we were sailed on to the southward to the truly barbarian coast, where whole nations of<br />
negroes were sure to surround us with their canoes, and destroy us; where we could ne'er once go on shore but we should<br />
be devoured by savage beasts, or more merciless savages of humankind?<br />
Nach der Charakterisierung der Schwarzafrikaner als Menschenfresser kommt es im Roman zu einem wirkli-<br />
chen Kontakt, den Defoe mit umschreibt (Defoe 1719):<br />
I began to see that the land was inhabited; and in two or three places, as we sailed by, we saw people stand upon the shore<br />
to look at us; we could also perceive they were quite black, and stark naked.<br />
Bei einer weiteren Gelegenheit gewinnt Crusoe durch sein Verhalten - er hilft ihnen zusammen mit seinem<br />
maurischen Diener Xury einen Leoparden zu erlegen - das Vertrauen einiger Schwarzafrikaner und erlangt ihre<br />
Dankbarkeit (Defoe 1719):<br />
...Then I made signs to them for some water... and there came two women, and brought a great vessel made of earth, and<br />
burnt, as I suppose, in the sun; this they set down for me, as before, and I sent Xury on shore with my jars, and filled them<br />
all three. There women were as stark naked as the men. I was now furnished with roots and corn, such as it was, and water;<br />
and leaving my friendly negroes...<br />
Defoe schildert also die langsame Annäherung der Hauptfigur Crusoe an die Schwarzafrikaner, die erst als<br />
Kannibalen, schliesslich als "freundliche Neger" angesehen werden. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäu-<br />
schen: der Schwarzafrikaner findet in Defoes Roman vor allem als Sklave und profitable Handelsware immer<br />
wieder Erwähnung.<br />
3.1.3.5 Wieland<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Christoph Martin Wieland (1733-1813), der mehrere Werke der Antike übersetzte, befasste sich in seinem<br />
Bildungsroman "Geschichte des Agathon" von 1766-67 mit der Frage "Was ist das Schöne?" Die Antwort<br />
umschrieb er mit den Worten (Wieland: Geschichte des Agathon, S. 124f., DB S. 10106f.):<br />
Der Europäer wird die blendende Weisse, der Mohr die rabengleiche Schwärze der seinigen vorziehen;... der Africaner<br />
wird die eingedrückte Nase, und die aufgeschwollnen dickroten Lippen;... bezaubernd finden.<br />
1774 beschrieb er in der Satire die "Geschichte der Abderiten" die Beziehung Demokritus zu einer Schwarzaf-<br />
rikanerin (Wieland: Geschichte der Abderiten, S. 52f., DB S. 101735f.):<br />
Gute, kunstlose, sanftherzige Gulleru, - sagte Demokritus, da er nach Hause gekommen war, zu einer wohlgepflegten<br />
krauslockigen Schwarzen, die ihm mit offnen Armen entgegenwatschelte - komm an meinen Busen, ehrliche Gulleru!<br />
Zwar bist du schwarz wie die Göttin der Nacht; dein Haar ist wollicht, und deine Nase platt; deine Augen sind klein, deine<br />
Ohren gross, und deine Lippen gleichen einer aufgeborstnen Nelke. Aber dein Herz ist rein und aufrichtig und fröhlich,<br />
und fühlt mit der ganzen Natur. Du denkst nie Arges, sagst nie was Albernes, quälst weder andre noch dich selbst, und tust<br />
nichts, was du nicht gestehen darfst. Deine Seele ist ohne Falsch, wie dein Gesicht ohne Schminke. Du kennst weder Neid<br />
noch Schadenfreude; und nie hat sich deine ehrliche platte Nase gerümpft, um eines deiner Nebengeschöpfe zu höhnen<br />
oder in Verlegenheit zu setzen. Unbesorgt, ob du gefällst oder nicht gefällst, lebst du, in deine Unschuld eingehüllt, im<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 42
Frieden mit dir selbst und der ganzen Natur; immer geschickt Freude zu geben und zu empfangen, und wert, dass das Herz<br />
eines Mannes an deinem Busen ruhe!...<br />
Die Passage ist vor allem deshalb interessant, weil Wieland in seiner Beschreibung von "Gulleru" dieser zwar<br />
keinerlei Intelligenz zubilligt, sondern sie als Geschöpf der Unschuld bezeichnet, ihr Äusseres mit Worten<br />
schildert, die sie als hässlich erscheinen lassen, aber auf die für die Antike typische Charakterisierung des<br />
redlichen schwarzafrikanischen Menschen zurückgreift.<br />
An einer anderen Stelle des gleichen Werkes bricht die abschätzige Bewertung der Menschen Schwarzafrikas<br />
Wielands deutlicher durch (Wieland: Geschichte der Abderiten, S. 67., DB S. 101750):<br />
Die Schwarzen an der Goldküste... tanzen mit Entzücken zum Getöse eines armseligen Schaffells und etlicher Bleche, die<br />
sie gegen einander schlagen. Gebt ihnen noch ein paar Kuhschellen und eine Sackpfeife dazu, so glauben sie in Elysium zu<br />
sein...<br />
Wieland verfasste ausserdem 1786-89 die phantastische Erzählung "Dschinnistan", auf der Mozarts Zauberflö-<br />
te basiert, in der bekanntlich die Figur des Schwarzen in sehr unvorteilhafter Weise als ungezügeltes von<br />
seinen Trieben beherrschtes Wesen dargestellt wird.<br />
3.1.3.6 Lichtenberg<br />
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) kam in seiner Auseinandersetzung mit Lavater "Über die Physio-<br />
gnomik; wider die Physiognomen" von 1778 auf die damaligen Vorurteile gegenüber den Schwarzafrikanern<br />
zu sprechen und verurteilte diese als nicht haltbar. Die damalige Bewegung der Physiognomen um Lavater<br />
karikierend, schrieb er (Lichtenberg: Über Physiognomik; wider die Physiognomen, S. 30., DB S. 69890):<br />
Allein, ruft der Physiognome, Was? Newtons Seele sollte in dem Kopf eines Negers sitzen können? Eine Engels-Seele in<br />
einem scheusslichen Körper? der Schöpfer sollte die Tugend und das Verdienst so zeichnen? das ist unmöglich.<br />
Damit sprach Lichtenberg die damalige vorherrschende Meinung über die Minderwertigkeit des "Negers" in<br />
physischer wie in psychischer Hinsicht aus, welche die Vorstellung, ein "Neger" könne sich geistig mit einer<br />
Kapazität wie Newton messen, für absurd hielt. Er liess es dabei aber nicht bewenden, sondern stellte sich auf<br />
die Seite der verachteten Schwarzafrikaner, indem er schrieb (Lichtenberg: Über Physiognomik; wider die<br />
Physiognomen, S. 32., DB S. 69892):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Ich will nur etwas weniges für den Neger sagen, dessen <strong>Pro</strong>fil man recht zum Ideal von Dummheit und Hartnäckigkeit und<br />
gleichsam zur Asymptote der Europäischen Dummheits- und Bosheits-Linie ausgestochen hat. Was Wunder? da man<br />
Sklaven, Matrosen und Pauker, die Sklaven waren, einem Candidat en belles lettres gegenüberstellt. Wenn sie jung in gute<br />
Hände kommen, wo sie geachtet werden, wie Menschen, so werden sie auch Menschen; ich habe sie bei Buchhändlern in<br />
London über Büchertitel sogar mit Zusammenhang plaudern hören, und mehr fürwahr verlangt man ja kaum in<br />
Deutschland von einen Bel-Esprit. Sie sind äusserst listig, dabei entschlossen und zu manchen Künsten ausserordentlich<br />
aufgelegt, und sollten daher, da der Versuche mit ihnen noch so wenige sind, gar nicht von Leuten verachtet werden, die<br />
immer von Anlage ohne Bestimmung und Kraft ohne Richtung plaudern. Gegen ihre Westindischen Schinder sind sie nicht<br />
treulos, denn sie haben ihren Schindern keine Treue versprochen.<br />
Damit spricht Lichtenberg eine ganze Reihe von damals vorherrschenden Vorurteilen an und stellt sich gegen<br />
die Annahme, Kultur sei eine angeborene Eigenschaft. Zusätzlich kritisiert er das damalige Bild, indem er zu<br />
Recht darauf aufmerksam macht, in Europa sei - bis auf wenige Ausnahmen - wohl kaum die Elite Afrikas<br />
anzutreffen. Auch das über die Schwarzafrikaner gefällte Urteil der Treulosigkeit entkräftet er mit dem<br />
Hinweis auf das Schicksal, welches sie unter ihren "Schindern" erleiden mussten.<br />
Lichtenberg beschränkt sich aber nicht darauf, gegen die Verleumdung der Schwarzafrikaner anzugehen, er<br />
spricht auch die <strong>Pro</strong>bleme an, die sich aus der Begegnung mit dem Fremden ergeben, wenn er schreibt<br />
(Lichtenberg: Über Physiognomik; wider die Physiognomen, S. 33f., DB S. 69893f.):<br />
Das ruhige Durchschauen durch verjährte Vorurteile; die Scharfsichtigkeit durch das verwilderte Gebüsch den graden<br />
Stamm zu erkennen; die philosophische Selbstverleugnung, zu gestehen man habe nichts Wunderbares gesehen, wo alles<br />
von Wundern wimmeln soll, und die von Durst nach lauterer Wahrheit und von Menschenliebe begleitete Unparteilichkeit<br />
ohne Menschenfurcht, ist ein kostbarer Apparatus, der selten mit an Bord genommen wird, wenn man nach entfernten<br />
Ländern segelt; im Reich der Körper, so gut als der Gedanken.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 43
Mit diesen Äusserungen spricht Lichtenberg sich gegen das herrschende Bild des Schwarzafrikaners aus. Eine<br />
Tatsache, die insofern erstaunlich ist, als es dem scharfsinnigen Betrachter Charles Darwin rund 100 Jahre<br />
später wesentlich schwerer fallen sollte, seine eigenen Vorurteile gegen die schwarzafrikanischen Menschen<br />
zu überwinden. (Zu Darwin siehe auch die Seite 52f. dieser Arbeit.)<br />
3.1.3.7 Lessing<br />
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) beschrieb in seiner Erzählung "Nathan der Weise" von 1779 die<br />
Schwarzafrikaner als "schmutzige Mohren". (Lessing: Nathan der Weise, S. 81. DB S. 66548)<br />
3.1.3.8 Schiller<br />
Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) liess in "Die Räuber" von 1781 eine seiner Figuren mit<br />
dem eigenen Schicksal hadern und sitzt dabei der tradierten Vorstellung von der Hässlichkeit der "Hottentot-<br />
ten" auf, die bereits weiter oben erwähnt wurde (Schiller: Die Räuber, S. 23, DB S. 82943):<br />
...Warum gerade mir... dieses Mohrenmaul? Diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen<br />
Menschensorten das Scheussliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken.<br />
Damit bleibt auch der Freiheitsdenker Schiller in den damaligen Vorstellungen gefangen und gibt diese ohne<br />
jegliche Reflektion weiter.<br />
3.1.3.9 Forster<br />
Georg Forster (1754-1794), der in jungen Jahren den Entdecker Cook auf seiner Reise um die Welt begleitete,<br />
setzte sich in mehreren Schriften mit anderen Völkern, und der Beschreibungen dieser durch die Europäer<br />
auseinander. In seiner Schrift "Ein Blick in das Ganze der Natur" von 1779 schrieb er über die "Menschengat-<br />
tung" (Forster: Ein Blick in das Ganze der Natur, S. 22. DB, S. 17549):<br />
Der Lappländer, der Patagonier, der Hottentot, der Europäer, der Amerikaner, der Neger, stammen zwar alle von Einem<br />
Vater her, sind aber doch weit entfernt sich als Brüder zu gleichen.<br />
Damit nahm er an der damaligen wissenschaftlichen Kontroverse teil, in der darüber gestritten wurde, ob die<br />
verschiedenen Menschenrassen nur einer Art zugehörig wären oder nicht. Eine Debatte, die im Zusammen-<br />
hang mit den Wanderungstheorien über die Vorfahren des heutigen Menschen - noch immer sind einige<br />
Wissenschaftler der Überzeugung, der moderne Mensch hätte sich an verschiedenen Orten der Erde entwickelt<br />
und die einzelnen Gruppen hätten sich dann später vermischt - noch zu keinem Ende gekommen ist, auch<br />
wenn eine Mehrheit der Fachleute davon ausgeht, dass der moderne Mensch in Afrika entstand und sich dann<br />
vor etwa 100'000 Jahren über die ganze Erde auszubreiten begann.<br />
1786 schrieb Forster in seinem Buch "Noch etwas über die Menschenrassen" über das Werk des deutschen<br />
Anatomen Samuel Thomas von Sömmerring (1755-1830), der fünf Jahre später ein Buch "Vom Baue des<br />
menschlichen Körpers" veröffentlichen sollte (Forster: Noch etwas über die Menschenrassen, S. 21, DB S.<br />
17587)<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
In der wichtigen Schrift dieses vortreflichen Mannes werden Sie nicht nur finden, dass die Farbe unter die minder<br />
wesentlichen Eigenschaften gehöre, woran man Neger von Europäern unterscheidet; sondern was das merkwürdigste ist,<br />
dass der Neger sichtbarlich so wohl in Rücksicht äusserer als innerer Gestaltung weit mehr übereinstimmendes mit dem<br />
Affengeschlecht habe, als der Weisse.<br />
Noch bis in das 20. Jahrhundert hinein "fanden" Wissenschaftler immer wieder neue "Beweise" dafür, dass der<br />
Schwarzafrikaner dem Affen näher stünde als der kaukasische Europäer. Aus der körperlichen "Nähe" schloss<br />
man dann, dass auch der Geist des Schwarzafrikaner mehr dem eines Affen als eines "Menschen" gleiche.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 44
Zum Thema der Affenähnlichkeit äussert sich Forster einige Seiten weiter noch einmal (Forster: Noch etwas<br />
über die Menschenrassen, S. 23, DB S. 17589):<br />
Denn auch die beyden Thiergeschlechter, (genera) der Mensch und der Affe, gränzen in der Reihe der Erdenwesen<br />
unglaublich nahe aneinander; näher als viele andere Thiergeschlechter miteinander verwandt sind. Gleichwohl bemerken<br />
wir einen deutlichen Zwischenraum oder Abstand zwischen diesen beyden physischen Geschlechtern; jenes schliesst sich<br />
mit dem Neger, so wie dieses mit dem Orangutang anhebt. Ein affenähnlicher Mensch ist also kein Affe.<br />
Ob nun aber der Neger und der Weisse, als Gattungen (species) oder nur als Varietäten von einander verschieden sind, ist<br />
eine schwere, vielleicht unauflösliche Aufgabe.<br />
Interessant ist, dass sich Forster 1786 dahingehend äussert, es könne nicht gesagt werden, ob "der Neger und<br />
der Weisse" der gleichen Spezies angehörten, während er 1779 noch die Ansicht vertrat, "der Neger" und der<br />
Europäer stammten, trotz ihrer Unterschiede, von "Einem Vater her".<br />
Im gleichen Werk beschäftigt sich Forster auch mit der "Vermischung" von "Weissen" und "Schwarzen", die<br />
er als widernatürlich verurteilt (Forster: Noch etwas über die Menschenrassen, S. 27. DB S. 17593):<br />
Und horchten Menschen nur der Stimme des Instinkts, wäre es nicht ihre Vernunft, welche Lüsternheit und Begierde<br />
erkünstelt... so würden wir sowohl bey Schwarzen als bey Weissen, vor der ungleichartigen Vermischung Ekel und<br />
Abscheu bemerken. Noch jetzt, glaube ich, darf man diesen Widerwillen vom rohen unverdorbenen Landmann erwarte; er<br />
wird die Negerin fliehen; wenigstens wird Geschlechtstrieb nicht das erste seyn, was sich bey ihrem Anblick in ihm regt.<br />
Bedenkt man die Selbstverständlichkeit, mit der im alten Rom Ehen zwischen Menschen europäischer und<br />
schwarzafrikanischer Abstammung betrachtet wurden, bedenkt man dass auch in Portugal die "Rassenvermi-<br />
schung" lange Zeit zu keinerlei Kritik Anlass gab, selbst in Werken Shakespeares beschrieben wurde und zu<br />
Forsters Zeit zumindest in der "Neuen Welt" durchaus an der Tagesordnung war, so können Forsters Ausfüh-<br />
rungen nur als Abscheu gegenüber den schwarzafrikanischen Menschen interpretiert werden.<br />
Später meldet Forster Zweifel an dem von ihm eingeschlagenen Weg an, und er versucht, sich über die morali-<br />
schen Dimensionen einer allzugrossen Distanzierung der "Neger" von den Europäern klarzuwerden (Forster:<br />
Noch etwas über die Menschenrassen, S. 44, DB S. 17610):<br />
Doch indem wir die Neger als einen ursprünglich verschiedenen Stamm vom weissen Menschen trennen, zerschneiden wir<br />
nicht da den letzten Faden, durch welchen dieses gemishandelte Volk mit uns zusammenhieng, und vor europäischer<br />
Grausamkeit noch einigen Schutz und einige Gnade fand?<br />
Denn diese ihnen zugefügten Grausamkeiten verdienen die Schwarzafrikaner trotz ihrer "Minderwertigkeit"<br />
nicht. Ja Forster beschwört gerade die moralische Verpflichtung der Weissen gegenüber den Schwarzafrika-<br />
nern, die sich aus der Überlegenheit der Europäer ergibt (Forster: Noch etwas über die Menschenrassen, S. 47,<br />
DB S. 17613):<br />
Weisser! der du so stolz und selbstzufrieden wahrnimmst, dass wohin du immer drangst, Geist der Ordnung und<br />
Gesetzgebung den bürgerlichen Vertrag begründeten, Wissenschaft und Kunst den Bau der Kultur vollführen halfen; der<br />
du fühlst, dass überall im weiten volkreichen Afrika die Vernunft des Schwarzen nur die erste Kindheitsstufe ersteigt, und<br />
unter deiner Weisheit erliegt - Weisser! du schämst dich nicht am Schwachen deine Kraft zu misbrauchen, ihn tief hinab zu<br />
deinen Thieren zu verstossen, bis auf die Spur der Denkkraft in ihm vertilgen zu wollen? Unglücklicher! von allen<br />
Pfändern, welche die Natur deiner Pflege anbefohlen hat, ist er das edelste. Du solltest Vaterstelle an ihm vertreten, und<br />
indem du den heiligen Funken der Vernunft in ihm entwickeltest, das Werk der Veredlung vollbringen, was sonst nur ein<br />
Halbgott, wie du oft glaubtest, auf Erden vermogte.<br />
In seinem "Leitfaden zu einer künftigen Geschichte der Menschheit" von 1789 versucht Forster zu erklären,<br />
weshalb die "Neger" im Geiste weniger wendig seien als die Europäer. Die Minderwertigkeit bringt er mit<br />
einer grösseren sexuellen Potenz in Verbindung, die den Schwarzafrikanern immer wieder, bis hin zur neusten<br />
Form, der Sorge um die "Bevölkerungsexplosion", nachgesagt wurde (Forster: Leitfaden zu einer künftigen<br />
Geschichte der Menschheit, S. 13. DB S. 17858):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Der Überfluss, gleichviel ob Jagd und Viehzucht oder Ackerbau ihn erzeugte, lässt in der behaglichen Ruhe, die er<br />
veranlasst, durch den sanfteren Reiz wuchernder Säfte den Geschlechtstrieb stärker entflammen. Ein mildes Klima, ein<br />
fruchtbares Land, eine ruhige, ungestörte Nachbarschaft, und wer mag bestimmen, welcher andere Zusammenfluss von<br />
Organisazion und äusseren Verhältnissen beschleunigte das Wachsthum sowol der Chineser und Indier als der Neger,<br />
entwickelte früher ihren Geschlechtstrieb, führte die Polygamie unter ihnen ein, und machte sie zu den volkreichsten<br />
Nazionen der Erde. Allein Erschlaffung ist das Loos einer zu üppigen Verschwendung der Zeugungskräfte. Im Herzen und<br />
Hirn dieser Völker schlief die belebende Kraft, oder zuckte nur konvulsivisch. Zur Knechtschaft geboren, bedurften sie,<br />
und bedürfen noch der Weisheit eines Despoten, der sie zu den Künsten des Friedens anführt, und mechanische Fertigkeit<br />
in ihnen weckt. Die Ruthe des Despotismus, auch wenn eine milde Hand sie regiert, kan jedoch nur das<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 45
Menschengeschlecht auf dem Wege der Nachahmung und Gewohnheit in ewig einförmigem Schritte vor sich hintreiben,<br />
nicht eigenthümliche Bewegung und erfinderische Kraft in ihm hervorrufen.<br />
In seiner Rede "Über das Verhältnis der Mainzer gegen die Franken" von 1792 spricht Forster noch einmal<br />
aus, was er trotz seiner Annahme der geistigen "Minderwertigkeit" der Schwarzafrikaner sein ganzes Leben<br />
vertreten hatte: die äussere Erscheinung könne keinen Aufschluss über das Schicksal eines Menschen geben,<br />
und sei dies ein Schwarzafrikaner. (Forster: Über das Verhältnis der Mainzer gegen die Franken, S. 4, DB S.<br />
17999):<br />
Einige Menschen, hiess es, sind zum Befehlen und Regieren, andere zum Besitz von Pfründen und Ämtern geboren; der<br />
grosse Haufe ist zum gehorchen gemacht; der Neger ist seiner schwarzen Haut und seiner platten Nase wegen schon zum<br />
Sklaven des Weissen von der Natur bestimmt; und was dergleichen Lästerungen der heiligen gesunden Vernunft noch<br />
mehr waren.<br />
Forster schwankt also einerseits zwischen einer abwertenden Beurteilung der Menschen Schwarzafrikas und<br />
der Auflehnung gegen die ihnen durch die intellektuell "überlegenen" Europäer zukommende Behandlung,<br />
welche er aufgrund seines politischen Weltbildes nicht billigen kann.<br />
3.1.3.10 Herder<br />
Johann Gottfried Herder (1744-1803) wandte sich in seinen "Briefen zur Beförderung der Humanität" von<br />
1793-1797 gegen den von den Europäern über Jahrhunderte betriebenen Sklavenhandel in Westafrika (Herder:<br />
Briefe zur Beförderung der Humanität, S. 97. DB S. 42273):<br />
Von Menschen kaufte Menschen der Mensch, und ward / Ein Teufel! - Wer vermag den getrübten Blick / Zu heften auf des<br />
armen Mohren / Elend und Schmach und gezuckte Geissel? / Aufs schwangre Weib, das jammernd die Hände ringt / Am<br />
krummen Ufer; - Tränenlos starret sie / Dem fernen Segel nach; noch schallt ihr /Dumpf in den Ohren das Hohngelächter /<br />
Des Treibers, noch der klirrenden Kette Klang, / Und ihres Mannes Klage, das Angstgeschrei / Der jüngsten Tochter, die<br />
der Wütrich / Ihr aus umschlingenden Armen losriss.<br />
Mit den Worten "Der Neger malt den Teufel weiss" (Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität, S. 911.<br />
DB S. 43087) wehrte er sich gegen die eurozentrische Sichtweise, die die eigene Lebensweise zum Massstab<br />
aller Dinge machte. Und gegen die abwertende Betrachtung der schwarzafrikanischen Menschen verwahrte er<br />
sich mit den Worten (Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität, S. 944. DB S. 43120):<br />
Der Neger hat so viel Recht, den Weissen für eine Abart, einen gebornen Kakerlaken zu halten, als wenn der Weisse ihn<br />
für eine Bestie, für ein schwarzes Tier hält.<br />
Herder gehört damit zu jenen deutschen Denkern, die gegen die primitivistische Sichtweise anschrieben, der<br />
Schwarzafrikaner sei ein Wilder, dem Tier näher als dem Menschen, den es zu zivilisieren gelte.<br />
3.1.3.11 Seume<br />
Johann Gottfried Seume (1763-1810) verurteilte in seinem Werk "Mein Sommer" von 1805-1806 den Sklaven-<br />
handel und äussert sich dahingehend, die Schwarzafrikaner seien im Anbetracht der Umstände dazu legiti-<br />
miert, sich bis zum Äussersten gegen das ihnen zugedachte Schicksal zu wehren (Seume: Mein Sommer,<br />
S. 254f., DB S. 87982f.):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Eines der westindischen Schiffe, das ich mit Scheel besuchte, war ursprünglich ein amerikanisches, dessen ganze<br />
Mannschaft von den Schwarzen auf Guinea niedergemacht worden war. Von den Schwarzen war es an die Portugiesen,<br />
und von diesen an die Dänen gekommen. Man zeigte im Schiffe noch die Merkmale von der Wut der Schwarzen. Es wäre<br />
gar nicht übel, wenn es allen Bristolern und Liverpoolern so ginge, die mit echt britischer Humanität zu ihrer und des<br />
Christentums Schande den Sklavenhandel verewigen. Es wäre ein ganz kleines Vergeltungsrecht für die Greuel, die sie<br />
teils verüben, teils veranlassen.<br />
Seume ist damit einer der wenigen Schriftsteller, die sowohl den Sklavenhandel verurteilen, als auch darauf<br />
verzichten, die davon betroffenen Schwarzafrikaner als hilflose Lämmer zu beschreiben, die zur Schlachtbank<br />
geführt werden. Mit der Erwähnung des Widerstandes auf Seiten der Opfer, lässt Seume zwischen den Zeilen<br />
erahnen, mit welcher Brutalität die Sklaven unterdrückt werden mussten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 46
3.1.3.12 Paul<br />
Jean Paul Friedrich Richter (1763-1825), unter seinem Pseudonym Jean Paul bekannt, muss davon überzeugt<br />
gewesen sein, dass die schwarzafrikanischen Völker ihre Zeit vor allem mit Musik vertrieben und wenig<br />
arbeitsam waren. In der 1804-1805 geschriebenen Biographie "Flegeljahre" schreibt er (Jean Paul: Flegeljahre,<br />
S. 679, DB S. 53153):<br />
Dichter bauen, wie die afrikanischen Völker, ihre Brotfelder unter Musik und nach dem Takte an.<br />
Ähnlich äussert er sich auch in "Dr. Katzenbergers Badereise" von 1809, in der er schreibt (Jean Paul: Dr.<br />
Katzenbergers Badereise, S. 242. DB S. 53647):<br />
Unsere Zeit bildet uns in Kleidern und Sitten immer mehr den wärmern Zonen an und zu, und folglich auch darin, dass<br />
man wenig und nur in Morgen- und Mittagstunden schläft; so dass wir uns von den Negern, welche die Nacht kurzweilig<br />
vertanzen, in nichts unterscheiden als in der Länge unserer Weile und unserer Nacht.<br />
Die Vorstellung, dass sich die "Neger" vor allem beim Tanze verweilten, konnte sich bis in die jüngste Zeit<br />
halten. Wer denkt bei der Erwähnung eines traditionell lebendes "Stammes" im Busch von Afrika nicht an<br />
Trommeln und stundenlange Tänze? In Tat und Wahrheit bilden diese die Ausnahme in einem harten, meist<br />
bäuerlichen Arbeitsalltag.<br />
3.1.3.13 Arnim<br />
Achim von Arnim (1781-1831) beschreibt in seinem 1810 erschienenen "Armut, Reichtum, Schuld und Busse<br />
der Gräfin Dolores" die Reaktion des Herzogs auf das neugeborene, schwarze Kind der Königin (Arnim:<br />
Armut, Reichtum, Schuld und Busse der Gräfin Dolores, S. 250., DB S. 262):<br />
Doch da wird der Prinz viel schwärzer / Als des Herzogs Tintenfinger, / Den er braucht zum Unterzeichnen, / Und der<br />
Herzog sieht mit Schrecken, / Dass es sei ein Mohrenjunge, / Was noch keiner von den Ärzten / Hat gewagt, ihm zu<br />
verkünden.<br />
Im gleichen Werk erwähnt er die Geschichte um König Salomon, der ein Verhältnis mit der Königin Makeda<br />
von Äthiopien, besser bekannt unter dem Name "Königin von Saba", hatte (Arnim: Armut, Reichtum, Schuld<br />
und Busse der Gräfin Dolores, S. 277., DB S. 289):<br />
Die Töchter Jerusalems hatten ein Angaffen, dass König Salomos auserwählte Frau schwarz war, und ihm doch wohl unter<br />
vierzig und hundert Frauen die liebste. Da antwortete sie ihnen jugendlich: "Ich bin schwarz, aber gar schön wie die<br />
Teppiche im Tempel." - Liebe schwarze Tochter, mir ist lieber eine gnadenreiche Schwarze, denn der Schein einer<br />
gnadenlosen Weissen; wer sich auf der himmlischen Heide ermaiet hat, der achtet nicht viel auf das zeitliche<br />
Maiengewand.<br />
In beiden Texten kommt zum Ausdruck, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Beziehung zwischen<br />
Schwarzafrikanern und Europäern keinesfalls als schicklich galt, sondern gar auf Ablehnung stiess und eigent-<br />
lich undenkbar war. Nur im Roman konnte das Undenkbare in der Phantasie des Leser als exotische Beigabe<br />
Wirklichkeit werden.<br />
3.1.3.14 Nettelbeck<br />
Der deutsche Seefahrer Joachim Nettelbeck (1738-1824) unternahm zwei Reisen nach Westafrika, die erste<br />
1748 nach Guinea, die zweite 1771-1772 entlang der Küste des Gebietes, um von dort Sklaven in die Neue<br />
Welt zu verschiffen. Seine "höchst erstaunliche Lebensgeschichte von ihm selbst erzählt", zu Beginn des<br />
19. Jahrhunderts, nach 1807 verfasst, ist nicht nur ein Zeitdokument, dank Nettelbecks scharfer Beobachtungs-<br />
gabe eignet sie sich auch für eine Betrachtung der damaligen Beziehungen zwischen Schwarzafrikanern und<br />
Europäern.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Auf seiner ersten Reise, er war noch ein Junge, erlernte Nettelbeck die Sprache der Guineaküste von "zwei<br />
Negern" aus diesem Gebiet, die als Matrosen dienten und die ihm der Steuermann "zu Lehrern der dortigen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 47
Landessprache" gab. Die erste Begegnung Nettelbecks mit Schwarzafrikanern beruhte also auf einem Schüler-<br />
Lehrer-Verhältnis und nicht auf der Händler-Sklaven-Auseinandersetzung. Auf der ersten Reise nahm Nettel-<br />
beck am Handel mit "vierhundertzwanzig Negern jeden Geschlechts und Alters" teil.<br />
Zu seiner zweiten Reise schreibt Nettelbeck, in Sierra Leone angekommen, dass dort die "Menschen als Ware<br />
angesehen wurden". Die durch den Sklavenhandel verursachten gesellschaftlichen Veränderungen in Schwarz-<br />
afrika beschreibt Nettelbeck mit den Worten (<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE 1996, Nettelbeck):<br />
Wenn es ihnen an solcher Kriegsbeute fehlt, greifen ihre Häuptlinge, die eine despotische Gewalt über ihre Untertanen<br />
haben, auch diejenigen auf, welche sie für die entbehrlichsten halten. Oder es geschieht, dass der Mann sein Weib, der<br />
Vater sein Kind und der Bruder den Bruder auf den Sklavenmarkt zum Verkauf schleppt.<br />
Bei der Ankunft der europäischen Schiffe hätten die schwarzafrikanischen Händler ein "tolles Geschrei" voll-<br />
führt. Über die Sklavinnen berichtet Nettelbeck, dass es "die Natur bei den Negerinnen" an "Busen ... von<br />
jugendlicher Fülle und Elastizität" nicht habe fehlen lassen. Nach dem vollzogenen Handel, der auf den Schif-<br />
fen der Europäer vollzogen wurde, eilten die schwarzafrikanischen Händler "lustig und wohlbenebelt" davon.<br />
Die Sklaven aber, so schreibt Nettelbeck, glaubten "nur zu gewiss,... wir hätten sie gekauft, um uns an ihrem<br />
Fleisch zu sättigen".<br />
Unter Berücksichtigung dieser Umstände kann es kaum verwundern, dass zwischen den verschiedenen Partien<br />
ein nicht unbedeutendes Misstrauen herrschte. Nettelbeck beschreibt dann die Schwarzafrikaner auch als "ver-<br />
räterisch", sie würden "unaufhörlich auf einen Überfall" sinnen. Bei den Landgängen zur Besorgung von<br />
Frischwasser und <strong>Pro</strong>viant, hätte man "die genaueste Vorsicht" walten lassen müssen, "um nicht von den treu-<br />
losen Afrikanern überwältigt zu werden".<br />
Weiter schreibt Nettelbeck, dass die "völlig nackt einhergehenden Neger" sehr empfindlich gegen die "frische<br />
Luft" am Morgen waren. Eine Aussage, die für die von ihm beobachtete Volksgruppe zutreffen dürfte, aber<br />
keinesfalls verallgemeinert werden darf, wie dies nur allzuoft geschah. Nettelbeck berichtet auch von einem<br />
Fall, bei dem die Schwarzafrikaner ein "wehrloses" Schiff "überrumpelt, die Besatzung niedergehauen und das<br />
Schiff hatten stranden lassen, um seine Ladung bequem zu plündern". "Eine solche blutige Gewalttat" sei zwar<br />
empörend, dabei sei aber zu berücksichtigen, "dass dergleichen eigentlich nur als Notwehr oder Wiedervergel-<br />
tung gegen nicht minder abscheuliche Überfälle angesehen werden muss, welche sich die Europäer gegen<br />
diese Schwarzen gestatten".<br />
Nettelbeck erwähnt in seinem Bericht überdies den Goldreichtum der Goldküste und beschreibt die Verwen-<br />
dung von kleinen Goldstücken durch die Schwarzafrikaner (<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE 1996, Nettelbeck):<br />
Die Neger nennen es "heiliges Gold" Sie durchbohren die Stücke, reihen sie auf Fäden und schmücken mit diesen<br />
kostbaren Schnüren Hals, Arme und Beine. In so stattlichem Putze zeigen sie sich gerne auf den Schiffen. Oft trägt ein<br />
einziger einen Wert von mehr als tausend Talern am Leibe...<br />
Einmal auf die Sklavenschiffe verladen, wären die "Neger" mit Kanonen in Schach gehalten worden, die aber<br />
nur "mit Grütze geladen" waren, "damit es im schlimmsten Fall nicht gleich das Leben gelte. "Denn", so<br />
schreibt Nettelbeck, "die Kerle haben ja Geld gekostet!".<br />
Obwohl Nettelbeck die Zustände auf den Sklavenschiffen stark verharmloste, sein Bericht wurde zu einer Zeit<br />
geschrieben als der Sklavenhandel bereits in Verruf geraten war - er selbst schrieb, er habe nicht ahnen<br />
können, dass der einst als "Gewerbe wie andere", über dessen "Recht- und Unrechtmässigkeit" man wenig<br />
nachdachte, bezeichnete "böse Menschenhandel" einmal ein "Schandfleck der Menschheit" genannt würde -<br />
schildert er, hinter schönfärberischen Worten, doch einige der Missstände an Bord (<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE<br />
1996, Nettelbeck):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Aus Gründen, auf die hier nicht näher einzugehen ist, werden meistenteils sechs bis acht junge Negerinnen von hübscher<br />
Figur zur Aufwartung in der Kajüte ausgewählt. Sie erhalten ihre Schlafstelle in ihrer Nähe.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 48
Nettelbeck gibt auch einen Hinweis darauf, wie sich das Klischee des "nackten Negers" verbreiten konnte,<br />
wenn er über die Ankömmlinge auf dem Sklavenschiff schreibt (<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE 1996, Nettelbeck):<br />
Bekanntlich kommen alle diese unglücklichen Geschöpfe beiderlei Geschlechts splitternackt an Bord. Wie sehr nun auch<br />
sonst der Anstand auf diesen Sklavenschiffen verletzt werden mag, so gebietet er doch ihre notdürftige Bedeckung.<br />
Dass auch die weissen Sklavenhalter in der Neuen Welt einer "Negerin" durchaus nicht abgeneigt waren,<br />
zeigen die von Nettelbeck angegebenen Verkaufspreise (<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE 1996, Nettelbeck):<br />
Ein Weibsbild wird je nach ihrem Aussehen für zweihundert bis dreihundert Gulden losgeschlagen, hat sie aber noch<br />
Jugend, Fülle und Schönheit, so steigt sie im Werte bis auf achthundert und tausend Gulden und wird oft von Kennern<br />
noch ausschweifender bezahlt...<br />
Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen, die Gehörtes wieder und wieder kolportierten, bis es zu einem<br />
Klischee verkommen war, welches kaum noch etwas mit den wirklichen Zuständen in Schwarzafrika zu tun<br />
hatte und damit wesentlich zu einem sehr willkürlichen Bild von den Menschen Schwarzafrikas beitrug, gehör-<br />
te Nettelbeck zu denjenigen Europäern seiner Zeit, die nicht nur Erfahrungen aus erster Hand machten,<br />
sondern auch in der Lage waren, die im Verlaufe des Lebens geschaffenen Vorstellungen zu überdenken, wenn<br />
vielleicht auch nur gezwungen durch die Neubewertung einer Tätigkeit wie dem Sklavenhandel.<br />
3.1.3.15 Goethe<br />
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) schildert in seinem Reisebericht "Italienischen Reise" von 1816-1817<br />
eine Begebenheit, bei der eine junge Mohrin, die auf einem türkischen Schiff reiste, gefangengenommen<br />
wurde (Goethe: Italienische Reise, S. 569f.. DB S. 28525f.):<br />
Der Schiffer hat eine grosse Beute gemacht; er fand sehr viel Geld und Waren, Seidenzeug und Kaffee, auch einen reichen<br />
Schmuck, welcher einer jungen Mohrin gehörte.<br />
Es war merkwürdig, die vielen tausend Menschen zu sehen, welche Kahn an Kahn dahinfuhren, um die Gefangenen zu<br />
beschauen, besonders die Mohrin. Es fanden sich verschiedene Liebhaber, die sie kaufen wollten und viel Geld boten, aber<br />
der Kapitän will sie nicht weggeben.<br />
Goethes Schilderung ist nicht die einzige, bei der eine "Mohrin" oder "Negerin" von einem Europäer umwor-<br />
ben oder begehrt wurde.<br />
3.1.3.16 Mörike<br />
Eduard Friedrich Mörike (1804-1875) beschrieb in seinem Roman "Maler Nolten" von 1832 eine Afrikanerin<br />
mit den Worten (Mörike: Maler Nolten, S. 556, DB S. 72713):<br />
Die Figur war ausserordentlich schön, obgleich nur mässig hoch, der Kopf an sich von dem edelsten Umriss, und das ovale<br />
Gesicht hätte, ohne den aufgequollenen Mund und die Stumpfnase, nicht zärter geformt sein können; dazu kam eine<br />
braune, wenngleich sehr frische Haut, und ein Paar grosse dunkle Augen. Es gab, freilich nur unter den Männern, immer<br />
einige, denen eine so eigene Zusammensetzung gefiel; sie behaupteten, es werden die widersprechenden Teile dieses<br />
Gesichts durch den vollen Ausdruck von Seele in ein unzertrennliches Ganzes auf die reizendste Art verschmolzen. Man<br />
hatte deshalb den Bewunderern Margots den Spottnamen der afrikanischen Fremd- und Feinschmecker aufgetrieben, und<br />
wenn hieran gewisse allgemein verehrte Schönheiten der Stadt sich nicht wenig erbauten, so war es doch verdriesslich,<br />
dass eben die geistreichsten Jünglinge sich am liebsten um diese Afrikanerin versammelten.<br />
Obwohl die Afrikanerin als schön beschrieben wird, stört doch die afrikanische Natur Mörike, der es als "ver-<br />
driesslich" empfindet, dass gerade sie besonders anziehend auf die Jünglinge der Umgebung wirkt. Dabei sei<br />
an das Zitat Forsters erinnert, der die Verbindung zwischen schwarzafrikanischen und europäischen Menschen<br />
als "widernatürlich" betrachtete.<br />
3.1.3.17 Hegel<br />
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) urteilte in seiner "Philosophie der Geschichte" von 1837 - nach<br />
dem Aufsatz "Revolutionäre Forderungen an die afrikanische Soziologie" von Omafume Onoge - über die<br />
Menschen Schwarzafrikas (Jestel Hrsg., 1982, S. 81):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 49
Der Neger stellt, wie schon gesagt worden ist, den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar;<br />
von aller Ehrfurcht und Sittlichkeit, von dem, was Gefühl heisst, muss man abstrahieren, wenn man ihn richtig auffassen<br />
will: es ist nichts an das Menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden...<br />
Nicht genug, dass Hegel dem Schwarzafrikaner jegliche Zivilisation abspricht, er gesteht ihm in anderen Stel-<br />
len des gleichen Werkes auch keine eigene Geschichte zu.<br />
3.1.3.18 Tieck<br />
Johann Ludwig Tieck (1773-1853) beschrieb in seinem Buch "Vittoria Accorombona" von 1840 das Aussehen<br />
einer Mulattin mit den folgenden Worten (Tieck: Vittoria Accorombona, S. 222. DB S. 97074):<br />
Nun war eben seit zwei Tagen eine junge, aber überaus hässliche Sklavin von Livorno angekommen, die, ich weiss nicht,<br />
zu welchen Diensten, im Palast gebraucht werden sollte. Sie schielte furchtbar, hatte einen widerwärtig grossen Mund, und<br />
war von jener fast safrangelben Farbe, die durch Vermischung mit Europäern die Kinder erhalten, und so eine Race bilden,<br />
hässlicher, als die Schwarzen selber. Diese Widerwärtigkeiten abgerechnet, war sie übrigens kräftig und gut gebaut.<br />
Damit stellte er sich auf die Seiten derer, die einerseits das europäische Aussehen als absolute Norm, auch im<br />
Hinblick auf den Aspekt der Schönheit betrachteten, andererseits entschieden gegen eine Vermischung<br />
zwischen Europäern und Schwarzafrikanern eintraten.<br />
3.1.3.19 Heine<br />
Heinrich Heine (1797-1856) beschäftigte sich in mehreren seiner Werke mit Schwarzafrika und seinen Bewoh-<br />
nern. In seinen "Reisebildern" (1826-1831) beschrieb er 1828 seine Eindrücke der Stadt London und schilderte<br />
die Folgen der Abschaffung des Menschenhandels durch Grossbritannien für die ehemals versklavten Schwarz-<br />
afrikaner (Heine: Reisebilder. Vierter Teil, S. 106, DB S. 39600):<br />
Der Fremde, der die grossen Strassen Londons durchwandert und nicht just in die eigentlichen Pöbelquartiere gerät, sieht<br />
daher nichts oder sehr wenig von dem vielen Elend, das in London vorhanden ist... Die gewöhnlichen Bettler sind alte<br />
Leute, meistens Mohren, die an den Strassenecken stehen und, was im kotigen London sehr nützlich ist, einen Pfad für<br />
Fussgänger kehren und dafür eine Kupfermünze verlangen.<br />
In seinem Werk "Ludwig Börne: Eine Denkschrift" von 1830-1839 klagt er die Zustände an, unter denen die<br />
Schwarzafrikaner in den Nordstaaten der USA in der amerikanischen Gesellschaft damals leben mussten und<br />
verurteilt die rassistische Einstellung der weissen Amerikaner und der Engländer (Heine: Ludwig Börne. Eine<br />
Denkschrift, S. 51, DB S. 40483):<br />
Die eigentliche Sklaverei, die in den meisten nordamerikanischen <strong>Pro</strong>vinzen abgeschafft, empört mich nicht so sehr wie die<br />
Brutalität, womit dort die freien Schwarzen und die Mulatten behandelt werden. Wer auch nur im entferntesten Grade von<br />
einem Neger stammt und wenn auch nicht mehr in der Farbe, sondern nur in der Gesichtsbildung eine solche Abstammung<br />
verrät, muss die grössten Kränkungen erdulden, Kränkungen, die uns in Europa fabelhaft dünken. Dabei machen diese<br />
Amerikaner grosses Wesen von ihrem Christentum und sind die eifrigsten Kirchengänger. Solche Heuchelei haben sie von<br />
den Engländern gelernt, die ihnen übrigens ihre schlechtesten Eigenschaften zurückliessen.<br />
In "Das Sklavenschiff" aus den "Gedichten" von 1853-1854 beschrieb Heine den Sklavenhandel(Heine:<br />
Gedichte 1853 und 1854, S. 10, DB S. 38388):<br />
Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut, / Dreihundert Säcke und Fässer; / Ich habe Goldstaub und Elfenbein - / Die schwarze<br />
Ware ist besser. / Sechshundert Neger tauschte ich ein / Spottwohlfeil am Senegalflusse. / Das Fleisch ist hart, die Sehnen<br />
sind stramm, / Wie Eisen vom besten Gusse.<br />
Mit diesem Gedicht dokumentiert Heine die bis zur Abschaffung vertretene Ansicht, bei den "Negern" handle<br />
es sich weniger um Menschen als vielmehr um eine Ware, aus der möglichst viel <strong>Pro</strong>fit erzielt werden sollte.<br />
In den "Geständnissen" von 1854 belehrt Heine den Leser anhand einer Reisebeschreibung, die er gelesen<br />
habe, über den Wunsch des Einzelnen anderen Menschen in einem besseren Lichte zu erscheinen (Heine:<br />
Geständnisse, S. 10, DB S. 40705):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Da war der König der Aschantis, von welchem ich jüngst in einer afrikanischen Reisebeschreibung viel Ergötzliches las,<br />
viel ehrlicher, und das naive Wort dieses Negerfürsten, welches die obenangedeutete menschliche Schwäche so spasshaft<br />
resümiert, will ich hier mitteilen. Als nämlich der Major Bowdich in der Eigenschaft eines Ministerresidenten von dem<br />
englischen Gouverneur des Kaps der Guten Hoffnung an den Hof jenes mächtigsten Monarchen Südafrikas geschickt<br />
ward, suchte er sich die Gunst der Höflinge und zumal der Hofdamen, die trotz ihrer schwarzen Haut mitunter<br />
ausserordentlich schön waren, dadurch zu erwerben, dass er sie porträtierte. Der König, welcher die frappante Ähnlichkeit<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 50
ewunderte, verlangte ebenfalls konterfeit zu werden und hatte dem Maler bereits einige Sitzungen gewidmet, als dieser zu<br />
bemerken glaubte, dass der König, der oft aufgesprungen war, um die Fortschritte des Porträts zu beobachten, in seinem<br />
Antlitze einige Unruhe und die grimassierende Verlegenheit eines Mannes verriet, der einen Wunsch auf der Zunge hat,<br />
aber doch keine Worte dafür finden kann - der Maler drang jedoch so lange in Seine Majestät, ihm Ihr allerhöchstes Begehr<br />
kundzugeben, bis der arme Negerkönig endlich kleinlaut ihn fragte, ob es nicht anginge, dass er ihn weiss malte.<br />
Das ist es. Der schwarze Negerkönig will weiss gemalt sein. Aber lacht nicht über den armen Afrikaner - jeder Mensch ist<br />
ein solcher Negerkönig, und jeder von uns möchte dem Publikum in einer andern Farbe erscheinen, als die ist, womit uns<br />
die Fatalität angestrichen hat.<br />
Solche Geschichten wurden bis in das 20. Jahrhundert immer wieder gerne kolportiert, vermittelten sie doch<br />
den Eindruck, der Schwarzafrikaner wünsche selbst seiner "fatalen" Farbe zu entrinnen uns sich den "überlege-<br />
nen" Europäern anzupassen. Zudem ist die Textstelle ein Hinweis darauf, wie sich das Bild, welches sich die<br />
Europäer von den "Negern" machten, im Laufe der Zeit auch in den Köpfen der Schwarzafrikaner einnistete.<br />
Obwohl die damals gehegten Vorurteile längst als rassistisch eingestuft wurden und Slogans wie "black is<br />
beautiful" sicherlich Gegensteuer boten, haben viele schwarzafrikanischen Menschen noch immer das Bedürf-<br />
nis, sich gegen diese ungerechtfertigte "Minderbewertung" zu wehren. Gleichzeitig sind in Schwarzafrika<br />
Tinkturen und Salben beliebt, welche die Hautfarbe aufhellen und das krause Haar straffen sollen.<br />
3.1.4 Der Kolonialismus<br />
Als die Europäer nach den afrikanischen Gebieten zu greifen begannen, verwandelte sich der seit der Abschaf-<br />
fung des Sklavenhandels zunehmend positiver bewertete Schwarzafrikaner in ein Hindernis und einen Feind,<br />
dessen einzige positive Eigenschaft seine auszubeutende Arbeitskraft war.<br />
Die unvermeidlichen Waffengänge, die mit der Eroberung weiter Territorien einhergingen, der aktive und<br />
passive Widerstand, mit der sich die Schwarzafrikaner gegen die Besatzung und die ihnen aufgezwungene<br />
Fronarbeit wehrten, die Versuche der Besatzer, das eigene Tun sich selbst und den Daheimgebliebenen gegen-<br />
über zu rechtfertigen, führten dazu, dass die rein wirtschaftlich und machtpolitisch motivierten Greueltaten auf<br />
dem afrikanischen Kontinent zu einer Zivilisierungsmission umgedeutet wurden, die umso berechtigter<br />
erschien, je mehr man den Schwarzafrikaner verdammte.<br />
Dazu griff man in die Mottenkiste der Vorurteile, die sich während des Sklavenhandels herausgebildet hatten.<br />
Scheinbar belegt durch neue wissenschaftliche Studien, die nicht nur immer neue Unterschiede zwischen<br />
Europäern und Schwarzafrikanern an den Tag brachten, kam man zum Schluss, das Heil des schwarzafrikani-<br />
schen Menschen liege einzig in der technisch und militärisch weit überlegenen Industriekultur Europas.<br />
Erst die Greuel des Ersten und Zweiten Weltkrieges in Europa und der zunehmende Widerstand einer von<br />
Europäern geschaffenen schwarzafrikanischen Bildungselite, die den über sie verbreiteten Vorstellungen durch<br />
ihre scharfsinnigen Schriften Lügen straften, verbunden mit einem gleichzeitigen Rückgang der wahrgenom-<br />
menen Wichtigkeit des Rohstoffkontinents Afrikas für die Industrienationen, führten zu einem erneuten Wech-<br />
sel der Vorstellungen.<br />
Getrieben von der Angst, in Schwarzafrika mehr investieren zu müssen als gewonnen werden konnte, und<br />
geleitet von der zunehmenden Erkenntnis, dass die "Neger" nun in der Lage wären, den Weltmarkt mit<br />
Rohstoffen zu beliefern, ohne dass sie ununterbrochen von Europäern überwacht würden, entliess man die<br />
Schwarzafrikaner in die Unabhängigkeit und gestand ihnen damit zu, das Schicksal ihrer Länder zumindest<br />
teilweise in die eigenen Hände zu nehmen.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 51
3.1.4.1 Raabe<br />
Wilhelm Raabe (1831-1910) zeichnet in seinen Romanen ein wenig schmeichelhaftes Bild der schwarzafrika-<br />
nischen Menschen. Im "Abu Telfan" von 1868 lässt er seine Figur Leonhard die Lebensweise der Afrikaner<br />
beschreiben (Raabe: Abu Telfan, S. 38, DB S. 76944):<br />
"Nichts!... Zwanzig bis dreissig in einen kahlen, glühenden Felsenwinkel geklebte Lehmhütten - hundertundfünfzig<br />
übelduftende Neger und Negerinnen mit sehr regelmässigen Affengesichtern und von allen Altersstufen von Zeit zu Zeit<br />
Totengeheul um einen erschlagenen Krieger oder einen am Fieber oder an Altersschwäche Gestorbenen - von Zeit zu Zeit<br />
Siegsgeschrei über einen gelungenen Streifzug oder eine gute Jagd - von Zeit zu Zeit dunkle Heuschreckenschwärme,<br />
welche über das gelbe Tal hinziehen - zur Regenzeit ein troglodytisches Verkriechen in den Spalten und Höhlen der<br />
Felsen!..."<br />
Eine Charakterisierung, die auf einer ganzen Reihe von Vorurteilen beruht und die bis in das 20. Jahrhundert<br />
immer wieder in der einen oder anderen Form zum Ausdruck kam.<br />
An einer anderen Stelle des gleichen Romans lässt Raabe ein paar Kinder zu Wort kommen, die sich an einen<br />
Besuch aus Afrika wenden (Raabe: Abu Telfan, S. 444, DB S. 77350):<br />
"Er ist wieder da! Mama, der Mann aus dem Mohrenlande ist wieder da! Hurra, vivat! Papa, hier haben wir den Onkel mit<br />
den Elefantengeschichten und Löwengeschichten! Er ist wieder da! Hurra, Herr Mohrenkönig, erzählen Sie uns eine<br />
Geschichte von dem grossen Affen und dem Krokodil und den schwarzen Männern, welche sich nie zu waschen brauchen,<br />
weil es doch nichts hilft, und welche sich nie anzuziehen brauchen, weil sie gar keine Kleider haben, und welchen Sie so<br />
lange Zeit die Stiefel putzen und die Röcke ausklopfen mussten."<br />
Afrika wird als exotischer Kontinent voller wilder Tiere dargestellt, dessen Bewohner sich weder waschen,<br />
noch irgendwelche Kleider tragen, mit anderen Worten gegen die gute Kinderstube in jeglicher nur erdenkli-<br />
chen Art verstossen.<br />
In einer weiteren Stelle kommt Raabe auf die Ähnlichkeiten zwischen Schwarzafrikanern und Europäern im<br />
Bezug auf das Liebesleben zu sprechen (Raabe: Abu Telfan, S. 460, DB S. 77366):<br />
...der junge Mohr nimmt seine Mohrin, wie und wo er sie findet, und die Moresken kommen nach wie in Europa, das erste<br />
Exemplärchen neun Monate nach der Hochzeit, die folgenden in angemessenen, naturgemässen Zeiträumen.... So musste<br />
denn auch das, was die weisse Gesellschaft über diese Verhältnisse dachte und sagte, dem, was jene schwarze Gesellschaft<br />
darüber kundzugeben pflegte, der Form wie dem Inhalt nach sehr ähnlich sein.<br />
In "Der Schüdderump" von 1870 lässt Raabe eine seine Figuren beim Betrachten eines Buches, in dem "men-<br />
schenfressende Mohren" abgebildet sind, über die Begegnung mit einem Schwarzafrikaner berichten (Raabe:<br />
Der Schüdderump, S. 173. DB S. 77674):<br />
"Nein... es ist wahr. In Hamburg hab ich einen schwarzen Menschen gesehen, der war ganz so schwarz als der liebe<br />
Freitag, und vielleicht war er auch aus seinem Dorfe. Seinen Vater Donnerstag hätt ich zu gern gesehen, aber der ist ja tot.<br />
Es steht ganz gewiss in dem Buche, und hier ist sein Bild, wie er gebunden im Kahn liegt und eben an den Bratspiess<br />
gesteckt werden soll."<br />
Das Zitat dokumentiert nicht nur die Vorstellung der "kannibalistischen Schwarzen", es zeigt auch auf, wie<br />
sich im Bewusstsein der damaligen Menschen die Berichte aus Übersee zu einem imaginären Wilden<br />
vermischten, denn Defoes Erzählung "Robinson Crusoe" ist in der Südsee und nicht an der Küste Afrikas ange-<br />
siedelt, hat aber das Bild des Schwarzafrikaners massgebend geprägt. (Siehe dazu die Seite 42 dieser Arbeit.)<br />
Auch im "Stopfkuchen" von 1891 kommt Raabe noch einmal auf die Schwarzafrikaner zu sprechen und<br />
beschreibt sie dort ohne Scheu als "exotisches, heidnisches Niggerpack". (Raabe: Stopfkuchen, S. 7, DB<br />
S. 78790)<br />
3.1.4.2 Darwin<br />
Charles Darwin (1809-1882) erwähnt in den Werken "The Voyage of the Beagle", "The Origin of Species",<br />
"The Descent of Man" und "Emotions in Man and Animal" Schwarzafrikaner in verschiedenen<br />
Zusammenhängen.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 52
In "The Voyage of the Beagle" von 1845 spricht er sich vor allem gegen die in Brasilien damals noch immer<br />
übliche Sklaverei aus. Über eine entflohene Sklavin, die den Freitod der erneuten Sklaverei vorzog, schrieb er<br />
(Darwin, 1845):<br />
In a Roman matron this would have been called the noble love of freedom: in a poor negress it is mere brutal obstinacy.<br />
In einer anderen Begebenheit - Darwin versucht einem Schwarzafrikaner mit Gesten etwas zu erklären - schil-<br />
dert er die Auswirkungen der Sklaverei auf ihre Opfer. (Darwin, 1845)<br />
I talked loud, and made signs, in doing which I passed my hand near his face. He, I suppose, thought I was in a passion,<br />
and was going to strike him; for instantly, with a frightened look and half-shut eyes, he dropped his hands. I shall never<br />
forget my feelings of surprise, disgust, and shame, at seeing a great powerful man afraid even to ward off a blow, directed,<br />
as he thought, at his face. This man had been trained to a degradation lower than the slavery of the most helpless animal.<br />
Offenbar beeindruckt von der Persönlichkeit eines Schwarzafrikaners, der in einem kleinem militärischen<br />
Aussenposten Dienst tat, schrieb Darwin (Darwin 1845):<br />
This posta was commanded by a negro lieutenant, born in Africa: to his credit be it said, there was not a ranche between the<br />
Colorado and Buenos Ayres in nearly such neat order as his... I did not anywhere meet a more civil and obliging man than<br />
this negro...<br />
Eine Bemerkung, die zeigt, dass die damaligen Vorurteile nur sehr bedingt und dann oft auch nur auf<br />
Menschen zutrafen, die infolge ihres Schicksals für ungeeignete Beispiele gehalten werden müssen.<br />
In "The Origin of Species" von 1859 erwähnt Darwin Schwarzafrikaner nur einmal:<br />
Livingstone shows how much good domestic breeds are valued by the negroes of the interior of Africa who have not<br />
associated with Europeans.<br />
Wesentlich ausführlicher geht Darwin auf die Schwarzafrikaner in seinem Buch "The Descent of Man" von<br />
1871 ein. Da die dortigen Angaben sehr umfangreich sind, folgen hier nur einige wenige Ausschnitte, weitere<br />
bemerkenswerte Aussagen aus diesem Werk werden auf der Seite 600 im Anhang unter dem Titel "Der<br />
schwarzafrikanische Mensch in Charles Darwins Werk" ohne Kommentar wiedergegeben.<br />
Neben Bemerkungen zu physischen Eigenschaften der Schwarzafrikaner gibt Darwin Beobachtungen von<br />
Drittpersonen wieder, die oft den damals den Schwarzafrikanern zugeschriebenen Eigenschaften zu widerspre-<br />
chen scheinen. Gegen das Bild des "fröhlichen Negers" stellt sich folgendes Zitat (Darwin 1871):<br />
Mr. Winwood Reade informs me that the negroes of west Africa often commit suicide.<br />
Zur Wahrheitsliebe der oft als falsch und betrügerisch dargestellten Schwarzafrikaner bezieht sich Darwin auf<br />
die Schriften des schottischen Afrikareisenden Mungo Park (Darwin 1871):<br />
Nevertheless, besides the family affections, kindness is common, especially during sickness, between the members of the<br />
same tribe, and is sometimes extended beyond these limits. Mungo Park's touching account of the kindness of the negro<br />
women of the interior to him is well known...There cannot be fidelity without truth; and this fundamental virtue is not rare<br />
between the members of the same tribe: thus Mungo Park heard the negro women teaching their young children to love the<br />
truth. This, again, is one of the virtues which becomes so deeply rooted in the mind, that it is sometimes practised by<br />
savages, even at a high cost, towards strangers; but to lie to your enemy has rarely been thought a sin, as the history of<br />
modern diplomacy too plainly shews...<br />
Schon Darwin vertrat also die Ansicht, dass es den ansonsten eher wahrheitsliebenden Schwarzafrikanern in<br />
Anbetracht der durch die Europäer erzwungenen Umstände nicht verübelt werden könnte, wenn diese es mit<br />
der Wahrheit nicht immer so genau nahmen, da die Lüge ja auch in der modernen Diplomatie ein häufig<br />
verwendetes Mittel gegen den Feind sei.<br />
Wie schon in der Antike, führt Darwin die dunkle Hautfarbe der Schwarzafrikaner nicht auf einen zurücklie-<br />
genden Sündenfall, als Zeichen der Minderwertigkeit gegenüber der weissen Rasse zurück, sondern sieht diese<br />
Eigenschaft als Folge eines natürlichen Selektionsprozesses (Darwin 1871):<br />
Hence it occurred to me, that negroes... might have acquired their dark tints by the darker individuals escaping from the<br />
deadly influence of the miasma of their native countries, during a long series of generations.<br />
Der von der natürlichen Selektion faszinierte Darwin gibt sogar eine "merkwürdige" Beobachtung über ein<br />
schwarzafrikanisches Volk wieder, welches angeblich die Institution der Sklaverei nutze, um die eigene Rasse<br />
zu verschönern (Darwin 1871):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 53
Mr. Winwood Reade informs me that the Jollofs, a tribe of negroes on the west coast of Africa, "are remarkable for their<br />
uniformly fine appearance." A friend of his asked one of these men, "How is it that every one whom I meet is so fine<br />
looking, not only your men but your women?" The Jollof answered, "It is very easily explained: it has always been our<br />
custom to pick out our worst-looking slaves and to sell them." It need hardly be added that with all savages, female slaves<br />
serve as concubines. That this negro should have attributed, whether rightly or wrongly, the fine appearance of his tribe to<br />
the long-continued elimination of the ugly women is not so surprising as it may at first appear; for I have elsewhere shewn<br />
that negroes fully appreciate the importance of selection in the breeding of their domestic animals...<br />
Neben der "kuriosen" Geschichte legt Darwin also auch Zeugnis davon ab, dass viele Schwarzafrikaner keines-<br />
falls in der von Europäern oft zitierten Einheit mit der Natur leben, sondern ihre Kenntnisse ganz gezielt<br />
nutzen, um ihre eigenen durch die natürlichen Gegebenheiten beeinflussten Lebensumstände zu verbessern.<br />
In "The Expression of Emotions in Man and Animal" von 1899 gibt Darwin mehrere Beobachtungen wieder,<br />
die betreffend der emotionellen Äusserungen klar belegen, dass allenfalls vorhandene Unterschiede zwischen<br />
den verschiedenen Menschenrassen sehr klein ausfallen und eher eine Gewohnheitssache als Teil eines natur-<br />
gegebenen Unterschiedes sind. Die Art und Weise wie Darwin diese Beobachtungen schildert, liefert aber<br />
einen deutlichen Hinweis darauf, dass eine solche "Gleichheit" noch zu Ende des 20. Jahrhunderts keinesfalls<br />
eine Selbstverständlichkeit war. (Siehe dazu auch die weiteren Zitate aus Darwins Werk auf der Seite 600 im<br />
Anhang dieser Arbeit.)<br />
3.1.4.3 Fontane<br />
Theodor Fontane (1819-1898) beschreibt in seinem Roman "Der Stechlin" von 1898 das Afrikabild seiner Zeit,<br />
wenn die Figur des Hauptmann von Czako dem verreisenden Woldemar Stechlin eine glänzende Zukunft<br />
voraussagt (Fontane: Der Stechlin, S. 347, DB S. 16384):<br />
"...Und vierzehn Tage nach Ihrem ersten grossen Sportsiege verloben Sie sich mit Ruth Russel oder mit Geraldine<br />
Cavendish, haben den Bedforder oder den Devonshire-Herzog als Rückendeckung und gehen als Generalgouverneur nach<br />
Mittelafrika, links die Zwerge, rechts die Menschenfresser..."<br />
Afrika wird also einerseits als Kontinent der "Zwerge" und "Menschenfresser" bezeichnet, gilt aber für die<br />
Kolonialzeit typisch, als die "Gelegenheit" für einen jungen Mann aus Europa, Karriere zu machen.<br />
3.1.4.4 Wedekind<br />
Frank Wedekind (1864-1918) gibt in seiner Tragödie "Die Büchse der Pandora" von 1904 den Dialog<br />
zwischen einen Schwarzafrikaner, "den Erbprinzen von Uahubee", dessen Sprache "die spezifisch afrikani-<br />
schen Zischlaute hören" lässt "und... von vielfachem Rülpsen unterbrochen" ist, und einer der Hauptfiguren,<br />
Lulu, wieder (Wedekind: Die Büchse der Pandora, S. 108, DB S. 99496):<br />
KUNGU POTI: God dam - ist sehr dunkel im Treppenhaus!<br />
LULU: Hier ist es heller, süsses Herz! - (Ihn an der Hand und vorn ziehend.) Komm, komm!<br />
KUNGU POTI: Aber kalt ist hier. Sehr kalt.<br />
LULU: Trinkst du einen Schnaps?<br />
KUNGU POTI: Schnaps? - Immer trink ich Schnaps! - Schnaps ist gut!<br />
LULU (gibt ihm die Flasche:) Ich weiss nicht, wo das Glas ist.<br />
KUNGU POTI: Macht nichts. (Setzt die Flasche an und trinkt.) Schnaps! - Viel Schnaps!<br />
LULU: Sie sind ein hübscher junger Mann.<br />
KUNGU POTI: Mein Vater ist Kaiser von Uahubee. Ich habe hier sechs Frauen, zwei spanische, zwei englische, zwei<br />
französische. Well - ich liebe nicht meine Frauen. Immer soll ich Bad nehmen, Bad nehmen, Bad<br />
nehmen...<br />
In der Folge versucht Kungu Poti Lulu zu belästigen, was ihm wegen des Eingreifens einer weiteren Person<br />
nicht gelingt, worauf er die Flucht ergreift.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Der beschriebene Schwarzafrikaner wird nicht nur als Trunkenbold und Schmutzfink, der nicht baden will,<br />
dargestellt, er ist auch der zivilisierten Sprache nicht mächtig, frönt der Vielweiberei und verlockt die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 54
Europäerinnen mit seinem Gold. Wedekind stellt in ihm die gefährliche Verlockung des Exotischen dar,<br />
welche dem, der sich zu eingehend mit ihr beschäftigt, zum Verderbnis geraten kann.<br />
3.1.4.5 Wells<br />
Hebert George Wells (1866-1946) beschrieb in seinem Buch "Tongo Bungay" von 1909, in dem er das zeitge-<br />
nössische Leben in England festhielt und die Auswüchse des Kapitalismus kritisierte, die Begegnung eines als<br />
Händler nach Westafrika reisenden Engländers mit einem Schwarzafrikaner. Die in der Ichform gehaltene<br />
Erzählung lässt den Hauptdarsteller kurz bevor er auf den Schwarzafrikaner trifft aussagen (Wells 1909):<br />
The less our expedition saw of the African population the better for its prospects. Thus far we had been singularly free from<br />
native pestering.<br />
Diesen beschreibt er mit den Worten (Wells 1909):<br />
He wasn't by any means a pretty figure. He was very black and naked except for a dirty loin-cloth, his legs were ill-shaped<br />
and his toes spread wide and the upper edge of his cloth and a girdle of string cut his clumsy abdomen into folds. His<br />
forehead was low, his nose very flat and his lower lip swollen and purplish-red. His hair was short and fuzzy, and about his<br />
neck was a string and a little purse of skin. He carried a musket, and a powder-flask was stuck in his girdle.<br />
Als der Schwarzafrikaner bei der Begegnung mit dem Europäer davonrennen will, erschiesst ihn dieser. Nur<br />
langsam steigen die Schuldgefühle in ihm auf:<br />
It occurred to me that perhaps I ought to bury him. At any rate, I ought to hide him... In the night, however, it took on<br />
enormous and portentous forms. "By God!" I cried suddenly, starting wide awake; "but it was murder!"<br />
Wells beschreibt den Schwarzafrikaner zwar als hässlich, gesteht diesem jedoch zu, ein Mensch zu sein - zu<br />
dieser Zeit wurde darüber noch heftig debattiert - und beschreibt sogar die Schuldgefühle des Mörders, eine<br />
Regung, die bei weitem nicht alle wirklichen Europäer zu dieser Zeit gezeigt hätten.<br />
3.1.4.6 Kindergedicht<br />
Michler druckt in seinem Buch "Weissbuch Afrika" ein deutsches Kindergedicht aus dem Jahre 1910 ab, als<br />
Deutschland Kolonialmacht in Afrika war (Michler 1991, S. 88):<br />
"Als unsre Kolonien vor Jahren / noch unentdeckt und schutzlos waren, / schuf dort dem Volk an jedem Tage / die<br />
Langeweile grosse Plage, / denn von Natur ist nichts wohl träger / als so ein faultierhafter Neger. / Dort hat die Faulheit, das<br />
steht fest, / gewütet fast wie eine Pest. / Seit aber in den Kolonien / das Volk wir zu Kultur erziehen / und ihm gesunde<br />
Arbeit geben / herrscht dort ein muntres, reges Leben. / Seht hier im Bild den Negerhaufen / froh kommen die<br />
herbeigelaufen, / weil heute mit dem Kapitän / sie kühn auf Löwenjagden gehn..."<br />
Das Gedicht bezeichnet die "Neger" nicht nur als faul und träge, es vermittelt auch den Eindruck, die Deut-<br />
schen hätten die von ihnen kolonisierten Schwarzafrikaner aus ihrer Kulturlosigkeit befreit und sie zu allerlei<br />
Aktivitäten angeregt. Dabei erwähnt das Gedicht mit keinem Wort die Aufstände gegen die Kolonialregierung<br />
und die von ihr eingeführte Zwangsarbeit.<br />
3.1.4.7 Heym<br />
Georg Heym (1887-1912) schildert in seinem Novellenbuch "Der Dieb" von 1911 in der Erzählung "Jonathan"<br />
die Erlebnisse eines Matrosen, der in Liberia wegen Malaria hospitalisiert wurde, und seine Geschichte nach<br />
einem weiteren Unfall, in einem europäischen Spital schildert (Heym: Der Dieb, S. 52, DB S. 43458):<br />
Wie er aufgewacht war, lag er im Spital von Monrovia mitten unter hundert schmutzigen Negern... Aber es war trotz des<br />
Schmutzes, des Negergestankes, der Hitze, trotz des Fiebers immer noch besser gewesen als hier... "Mitten im Fieber<br />
sangen die Neger ihre Lieder, mitten im Fieber tanzten sie über die Betten. Und wenn einer starb, dann sprang er noch<br />
einmal hoch auf, als wenn ihn der Krater seines Fiebers noch einmal in den Himmel schleudern wollte, ehe er ihn für ewig<br />
verschlang."<br />
Heym beschreibt Schwarzafrika als Platz der Seuchen, das von "stinkenden" und "schmutzigen Negern" besie-<br />
delt ist, die selbst "mitten im Fieber" noch tanzten und sangen, und denen er bis in den Tod einen animalischen<br />
Lebenswillen zuschrieb.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 55
3.1.4.8 Lindsay<br />
Der amerikanische Poet Nicholas Vachel Lindsay (1879-1931) beschreibt in seinem dreiteiligen Gedicht "The<br />
Congo" von 1914 wie die "Kongoneger" aus ihrem Aberglauben durch das Christentum erlöst werden.<br />
Während er im ersten Teil "Their Basic Savagery" von tätowierten Kannibalen spricht, die angeleitet von<br />
ihrem Hexendoktor blutdürstende Lieder singen, in denen die Pygmäen bestohlen, die Araber und Weissen<br />
umgebracht werden sollen, schreibt er im zweiten Teil von Elfenbeinpalästen und lachenden Gesichtern. Die<br />
Schwarzafrikanerinnen schildert er mit den Worten (Lindsay 1914):<br />
Coal-black maidens with pearls in their hair, / Knee-skirts trimmed with the jassamine sweet, / And bells on their ankles<br />
and little black feet.<br />
Schliesslich beschreibt er im dritten Teil "The Hope of their Religion" die Heilung und Abkehr von ihren aber-<br />
gläubischen Bräuchen durch das Christentum, welches sie aber auch mit viel Klamauk zelebrieren (Lindsay,<br />
1914)<br />
A good old negro in the slums of the town / Preached at a sister for her velvet gown. / Howled at a brother for his<br />
low-down ways, / His prowling, guzzling, sneak-thief days. / Beat on the Bible till he wore it out /Starting the jubilee<br />
revival shout. / And some had visions, as they stood on chairs, / And sang of Jacob, and the golden stairs, / And they all<br />
repented, a thousand strong / From their stupor and savagery and sin and wrong / And slammed with their hymn books till<br />
they shook the room / With "glory, glory, glory," / And "Boom, boom, BOOM."<br />
Noch Jahrzehnte später hiess es in einem Musiklehrmittel über den als typisch schwarzafrikanisch geltenden<br />
Gottesdienst, er sei von Augenblicken ekstatischem, völligen "Ausser-sich-Seins", "Schreien und zuckenden<br />
Bewegungen" begleitet ("Musik um uns 3" 1995, S. 44)<br />
3.1.4.9 Weitere häufige Vorstellungen<br />
Die Kolonialisierung des schwarzafrikanischen Kontinentes wurde nicht nur mit der technischen Überlegenheit<br />
der Europäer begründet. Auch aus der Tatsache, dass die Schwarzafrikaner keine Christen waren, wurde eine<br />
moralische Überlegenheit der Kolonisatoren beschworen. Um die eigene Überlegenheit zu verdeutlichen,<br />
wurde den Schwarzafrikanern eine ganze Reihe von Eigenschaften angedichtet.<br />
Immer wieder wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, die Schwarzafrikaner seien schmutzig, ein<br />
Vorurteil, das wahrscheinlich auf die Zeit des Sklavenhandels zurückgeht, als die Schwarzafrikaner auf der<br />
wochenlangen Überfahrt zu hunderten in den viel zu engen Frachträumen gefangengehalten wurden, ohne dass<br />
sie eine Gelegenheit zur Körperpflege gehabt hätten. Noch 1936 schrieb der britische Kolonialbeamte W. E.<br />
Crocker in "Nigeria - a Critique of Colonial Administration" über die Menschen Nigerias (Adeley 1992)):<br />
The first sensation of the European coming into contact with the African is that of smell.<br />
Eine andere den schwarzafrikanischen Menschen zugeschriebene Eigenschaft ist die, sexuell überaktiv zu sein.<br />
Der schon zitierte Crocker meinte dazu (Adeleye 1992):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
... the reproductive impulses are active enough among all peoples, but among none do they monopolise interests and<br />
energies to the degree they do amount among the African.<br />
Ganz ähnlich äusserste sich Sir Harry Johnston über Jugendliche in Schwarzafrika (Adeleye, 1992):<br />
When the youth arrives at puberty there is the tendency towars an arrested development of mind. At this crucial period<br />
many bright and shining examples fall of into disappointing nullity. As might be imagined, the concentration of their<br />
thoughts on sexual intercourse is answerable for this falling away.<br />
Auch Isaak Dinesen spricht in seinem Buch "Shadows on the Grass" noch 1960 davon, die Schwarzafrikaner<br />
würden sich ab einem bestimmten Alter geistig nicht mehr weiterentwickeln (Jestel Hrsg., 1982, S. 268):<br />
Die schwarzen Völker Afrikas, die im Kindesalter erstaunlich frühreif sind, bleiben anscheinend in unterschiedlichem Alter<br />
in der geistigen Entwicklung stehen. Die Kikuyu, Kavirondo und Wakamba, also die Leute, die auf meiner Farm für mich<br />
arbeiten, waren in der frühen Kindheit gleichaltrigen weissen Kindern weit voraus, doch ihre Entwicklung kam recht<br />
plötzlich in einem Stadium zum Stillstand, das dem eines europäischen Kindes im Alter von neun Jahren entspricht. Die<br />
Somali waren weitergekommen; sie hatten alle die Mentalität von 13- bis 17jährigen Jungen unserer Rasse.<br />
In weiteren Berichten wurden die Schwarzafrikaner als faul, unzuverlässig und unfähig beschrieben.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 56
1906 vermerkte der Brite Ewart Grogan über die Schwarzafrikaner in Kenia, eine damals ziemlich verbreitete<br />
Einstellung ausdrückend (Ostafrika 1988, S. 67):<br />
Ein gutes, solides System der Zwangsarbeit würde mehr dazu beitragen, den Nigger innerhalb von fünf Jahren zu erziehen,<br />
als die Millionen, die in den letzten fünfzig Jahren in missionarische Bemühungen gesteckt worden sind... Unter solchen<br />
Gesichtspunkten kann sich auch das empfindsamste britische Gewissen beruhigen.<br />
Die Britin Pearce Gervis schrieb in "Sierra Leone Story" über ihre Bediensteten (Adeleye 1992):<br />
You can't depend on these people at all. I find it's best to get on with things myself.<br />
Eine Einschätzung die bis in die neunziger Jahre immer wieder von Europäern, die aus welchen Gründen auch<br />
immer, in Schwarzafrika tätig sind, vertreten wird. Meist liegt die Ursache dieser abschätzigen Meinung in der<br />
völligen Unfähigkeit der Europäer, sich in die schwarzafrikanische Gesellschaft einzupassen. Oft kommt sie<br />
auch deshalb zustande, weil die Europäer sich nicht zu der schwarzafrikanischen Lebensweise "erniedrigen"<br />
wollen.<br />
In ähnlicher Weise hatte sich schon 1916 der französische Kolonialoffizier E. Beurdeley in "La Justice<br />
indigène en Afrique Occidentale Française: Mission d'Etudes, 1913-1914" geäussert (Adeleye 1992):<br />
Anyone who hat lived for some time in contact with our natives and takes the troubel to observe them, rapidly begins to<br />
discover imperfections in them such as the following: they do not know how to appreciate the value of time any more than<br />
of distance; they are useless at all kinds of work demanding an appreciation of symmetry; they are incapable of laying out<br />
their fields in straight lines; incapable of laying a table cloth evenly on a table; of placing a carpet on the floor parallel to<br />
the walls.<br />
Mit anderen Worten, die Schwarzafrikaner waren "ungeeignet" für die ihnen von den Europäern zugedachten<br />
Arbeiten. Ein weiteres oft genanntes Merkmal ist die Unehrlichkeit, die schon bei Nettelbeck auftauchte.<br />
Walter Miller, ein Missionar, schrieb über die Hausa, sie seien in ihrem Geiste unehrlich, würden gewohn-<br />
heitsmässig betrügen und seien unausrottbare Lügner. (Adeleye 199; zu den Hausa siehe auch die Seiten 29<br />
und 142 dieser Arbeit.) Auch Albert Schweitzer vertrat diese Ansicht. (Siehe dazu die Besprechung des Textes<br />
"Ojembo, der Urwaldschulmeister" auf der Seite 472 dieser Arbeit.)<br />
Vor allem aber wurden die Schwarzafrikaner von den Europäern als unzivilisiert betrachtet. Noch 1951 schrieb<br />
der Historiker Margery Perham in einem Aufsatz "The British <strong>Pro</strong>blem in Africa", erschienen in der Juliausga-<br />
be des "Foreign Affairs" (Adeleye 1992):<br />
...until the very recent penetration of Europe the greater part of the continent was without the wheel, the plough or the<br />
transport animal; without stone houses or clothes except skins; without writing and so without history.<br />
Natürlich gab es auch während der Kolonialzeit andere Stimmen. Der Gouverneur der Goldküste Sir Hugh<br />
Clifford schrieb beispielsweise 1925, beeindruckt von der raschen Verbreitung und Nutzung des Kakao im<br />
heutigen Ghana (Adeleye 1992):<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
This man, reputed to be lazy by the superficiel globe-trotter... has carved from the virgin forest an enormous clearing,<br />
which he has covered with flourishing cocoa farms. Armed with nothing better than an imported axe and machete, and a<br />
native-made hoe, he has cut down the forest giant, cleared the tropical undergrowth and kept it cleared. With no means of<br />
animal transport, no railways and few roads, he has cenveyed his produce to the sea, rolling it down in casks for mile and<br />
carrying it on his own stury cranium. Here is a result to make us pause in our estimate of the negro race.<br />
Typisch für diese wohlwollendere Einschätzung ist, dass sie sich auf eine Tätigkeit der Schwarzafrikaner<br />
bezieht, die im Interesse der Kolonisatoren lagen. Je besser sich die Menschen Schwarzafrikas an die Anforde-<br />
rungen der europäischen Besetzer hielten, desto mehr Lob wurde ihnen zuteil, dies hielt die Europäer jedoch in<br />
der Regel nicht davon ab, sie als Menschen zweiter Klasse zu betrachten.<br />
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, in dem viele Schwarzafrikaner Aktivdienst leisten mussten, und dem<br />
Aufkommen einer Schicht von in Europa und den Vereinigten Staaten ausgebildeten schwarzafrikanischen<br />
Intellektuellen, entspannte sich die Sichtweise der Europäer auf die Schwarzafrikaner, insbesondere dort, wo<br />
die Rohstoffe Schwarzafrikas aufgrund der aufkommenden Kunststoffe an Bedeutung verloren. Wenn es aber<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 57
darum ging, die Interessen der industrialisierten Länder oder der weissen Siedler in Schwarzafrika zu vertre-<br />
ten, waren die alten Vorurteile schnell wieder zur Hand.<br />
So hiess es beispielsweise noch im der Aprilausgabe der Personalzeitung der "Schweizerischen Bankgesell-<br />
schaft" (Das Magazin 7/1998, S. 29):<br />
Der südafrikanische Eingeborene ist noch absolut roh, hat keine Erziehung, kann weder lesen noch schreiben, kurz er ist<br />
halb Kind, halb Tier... Einen Eingeborenen zu Gefängnis zu verurteilen ist zwecklos, denn für ihn bedeutet dies nur Ferien,<br />
er hat keine Verantwortung und wird gefüttert. Die einzige Sprache, die er versteht, ist Härte und Autorität... Er ist auch<br />
faul von Natur und charakterlich schlecht, das heisst, er lügt, er betrügt, und sehr oft stiehlt er auch, wenn er hofft, nicht<br />
ertappt zu werden, nicht weil er das, was er stiehlt, braucht oder will, sondern weil es ihm Spass macht... Er hat keine<br />
Führer, er hat keine Planung, und sollte es plötzlich einen Generalstreik der Eingeborenen geben, so würde der Schwarze<br />
viel mehr als der Weisse daran leiden. Er würde nach einer Woche verhungern, weil er weder Kapital noch Reserven hinter<br />
sich hat.<br />
Besonders in den Konflikträumen Schwarzafrikas konnten sich solche Bilder noch lange halten. Selbst in den<br />
neunziger Jahren wurde im Zusammenhang mit der Machtübernahme durch den ANC in Südafrika davon<br />
gesprochen, dass die Wirtschaft wegen der "Unfähigkeit" der Schwarzafrikaner kollabieren würde. Und seit<br />
Anfang 1998 mehren sich die Stimmen, die im Zusammenhang mit diesem Land plötzlich Töne anschlagen,<br />
die während der weissen Apartheidsregierung nie geäussert wurden.<br />
3.1.5 Zusammenfassung<br />
Das Bild des Schwarzafrikaners aus der Sicht europäischer Völker war keineswegs einer stetige Entwicklung<br />
von der Idee des "Barbaren" hin zum "gleichberechtigten" Menschen unterworfen. Von Ausnahmen abgese-<br />
hen, die es immer gab, und die sich der zeitgenössischen Meinung entgegenstellten, unterlagen die europäi-<br />
schen Vorstellungen von den schwarzafrikanischen Menschen immer wieder Schwankungen, deren Richtungs-<br />
wechsel sich aufgrund der Tatsache, dass sie mit anderen Entwicklungen zusammentrafen, recht gut nachvoll-<br />
ziehen lassen.<br />
In der Antike avancierten die Schwarzafrikaner tatsächlich von "Barbaren" zu nützlichen und geachteten Indi-<br />
viduen innerhalb einer zunehmend kosmopolitischen Umgebung. Mit dem Zerfall des römischen Reiches und<br />
dem Vordringen der Araber in den nordafrikanischen Raum wurde der Kontakt zwischen Europa und Schwarz-<br />
afrika jedoch fast vollkommen unterbrochen.<br />
Die arabischen Schriftsteller drückten über eine Zeit von fast vierhundert Jahren immer wieder ihre Bewunde-<br />
rung über die Errungenschaften der Schwarzafrikaner aus, dies änderte sich jedoch im 16. Jahrhundert.<br />
Schon zweihundert Jahre zuvor hatten sich die Kontakte zwischen Europa und Schwarzafrika durch die<br />
Forschungsreisen der Portugiesen wieder intensiviert. Waren die Europäer bis anhin auf die Berichte der<br />
Araber und der Antike angewiesen, konnten sie sich erstmals wieder eine eigene Vorstellung machen. Anfäng-<br />
lich zeichnete diese, geprägt von den Ideen der Antike und den neuentdeckten Königreichen Schwarzafrikas,<br />
das Bild der Schwarzafrikaner durchaus positiv.<br />
Mit dem Aufkommen des Sklavenhandels zerfielen diese Vorstellungen, der Schwarzafrikaner verkam zur<br />
Ware und wurde zur Rechtfertigung des eigenen Tuns zunehmend als "unzivilisierter Wilder" betrachtet, der<br />
dem Tier näher stand als dem Menschen. Erst die Schriften von schwarzafrikanischen Intellektuellen und die<br />
zunehmende Verurteilung des Sklavenhandels führten zu einer erneuten Veränderung der Vorstellung vom<br />
Schwarzafrikaner.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Der Schwarzafrikaner wurde wieder als Mensch, wenn auch niederer Stufe angesehen, dem die "Segnungen"<br />
der europäischen Zivilisation zukommen sollten. Bemerkenswerterweise fiel diese Entwicklung in eine Zeit,<br />
als Afrika an wirtschaftlicher Bedeutung für Europa verlor. Gleichzeitig verstärkten sich die Bestrebungen, die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 58
Menschen Afrikas näher kennenzulernen. Die "Unzivilisiertheit" der Schwarzafrikaner wurde nicht mehr auf<br />
eine ihnen innewohnende Eigenschaft zurückgeführt, sondern ihrer mangelnden Konfrontation mit den euro-<br />
päischen Werten zugeschrieben. Immer wieder wurde der Schwarzafrikaner aber auch als exotisches Wesen<br />
vom, "ungezügelten Liebhaber" bis zum "edlen Wilden", dargestellt.<br />
Als die europäischen Mächte gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen erneuten Nutzen in den Gebieten Afrikas<br />
sahen, begannen sie diese im Wettstreit miteinander zu kolonialisieren, was zu teilweise heftigen Auseinander-<br />
setzungen mit den Einheimischen führte. Wie schon zur Zeit des Sklavenhandels vermengten sich wirtschaftli-<br />
che Interessen, kriegerische Auseinandersetzungen und der Versuch, das eigene Tun zu rechtfertigen, zu einer<br />
besonders negativen Vorstellung von den Schwarzafrikanern, denen alle nur erdenklichen schlechten Eigen-<br />
schaften zugeschrieben wurden.<br />
Diese Haltung blieb bis zur Unabhängigkeit der schwarzafrikanischen Staaten bestehen, auch wenn sie sich<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich abschwächte. In den sechziger Jahren führte der "wind of change" kurz<br />
zu einer wesentlich positiveren Einschätzung der schwarzafrikanischen Menschen, die aber mit innerafrikani-<br />
schen <strong>Pro</strong>blemen wie den Wirren im Kongo, dem Biafrakrieg und den Hungersnöten in Sahel und dem wirt-<br />
schaftlichen Niedergang vieler afrikanischer Staaten spätestens ab den siebziger Jahren dazu führte, den<br />
Schwarzafrikaner als unfähig, die eigene Entwicklung voranzutreiben, anzusehen.<br />
Erst seit wenigen Jahren gibt es Anzeichen dafür, dass die Vorstellung, die Schwarzafrikaner hätten das Recht,<br />
als gleichwertige Menschen behandelt zu werden, auch umgesetzt wird. Seit den neunziger Jahren stehen die<br />
Industrienationen dem schwarzafrikanischen Kontinent wieder mit vorsichtigem Optimismus gegenüber. Wie<br />
weit entfernt von einer tatsächlichen Akzeptanz des Schwarzafrikaners als gleichwertiger Mensch die Indu-<br />
strienationen aber noch immer sind, zeigen die Ereignisse um die Bombenanschläge an den amerikanischen<br />
Botschaften in Tansania und Kenia im August 1998: Den Amerikanern schien die Feststellung der Täterschaft<br />
wichtiger zu sein als die Rettung der kenianischen Opfer.<br />
Inwiefern sich das von der Schule vermittelte Bild mit den hier skizzierten Entwicklungen deckt, soll die in<br />
dieser Arbeit durchgeführte Analyse der Lehrmittel, vor allem aus dem Bereich Geographie und Musik,<br />
zeigen.<br />
Einführung: Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen durch die Jahrhunderte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 59
3.2 Vorwürfe an das Afrikabild der Lehrmittel<br />
Anhand zweier Listen, von denen sich die erste auf die Lehrmittel im speziellen konzentriert, während die<br />
zweite eher das allgemeine Bild kritisiert, sollen wichtige Vorwürfe festgehalten werden, die dazu dienen<br />
sollen, beim Leser ein kritischeres Bewusstsein für die in den folgenden Teilen der Arbeit besprochenen Texte<br />
zu wecken. Denn allzu oft werden Strukturen und Begriffe - ohne jegliche Absicht - übernommen, die sich<br />
beim näheren Hinsehen als wenig durchdacht und dem Verständnis als wenig dienlich erweisen.<br />
Zwar werden die im folgenden vorgestellten Vorwürfe an das Bild vom schwarzafrikanischen Menschen auch<br />
im Zusammenhang mit der Einzelbesprechung der Lehrmittel von Bedeutung sein, grundsätzlich werden sie<br />
aber im Teil "Ergebnisse der Untersuchung" ab der Seite 494 dieser Arbeit besprochen. Aus diesem Grund<br />
folgt auf einen genannten Vorwurf jeweils ein Verweis auf die entsprechende Textstelle, die dem Vorwurf im<br />
Rahmen einer Zusammenfassung nachgeht. Dabei können aus Gründen der Materialmenge nicht alle in den<br />
Lehrmitteln aufgefundenen Aussagen vermerkt - dies geschieht in der Besprechung der einzelnen Lehrmittel -,<br />
sondern nur ein Überblick gegeben werden.<br />
Helen Schär, Leiterin des Kinderbuchfonds Baobab in Basel, zählte beispielsweise im Artikel "Ein neues Afri-<br />
kabild im Unterricht?" (SLZ 5/98, S. 8-9) folgende Punkte auf, die teilweise von Menschen aus Schwarzafrika<br />
aufgeworfen wurden:<br />
1. Die afrikanische Geschichte und Gesellschaft werde "unvollständig bis ungenau und insgesamt<br />
sehr undifferenziert" betrachtet.<br />
Siehe das Kapitel "Qualität und Aktualität der gemachten Aussage" auf der Seite 528 dieser<br />
Arbeit.<br />
2. Den Schülern werde suggeriert, "in Afrika hätte Geschichte mit dem Auftreten der ersten<br />
Weissen begonnen" oder die vorkoloniale afrikanische Geschichte werde nur angedeutet.<br />
Siehe dazu das Unterkapitel "Geschichte" auf der Seite 525 dieser Arbeit.<br />
3. Den Afrikanern werde seit der Kolonialzeit eine passive Rolle zugeschrieben.<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit.<br />
4. Bei der Erstellung der Lehrmittel wurden keine afrikanischen Fachkräfte beigezogen.<br />
Siehe dazu das Kapitel "Qualität und Aktualität der gemachten Aussage"auf der Seite 528 dieser<br />
Arbeit.<br />
5. Die Texte werden von Auflage zu Auflage weiterverwendet, ohne dass sie überarbeitet werden.<br />
Siehe dazu das Kapitel "Qualität und Aktualität der gemachten Aussage" auf der Seite 528 dieser<br />
Arbeit.<br />
6. Der "Hauptgrund der Armut werde viel zu sehr auf die klimatischen und geographischen<br />
Verhältnisse abgewälzt", während andere Zusammenhänge vernachlässigt würden.<br />
Siehe dazu die Einzelbesprechungen der Lehrmittel.<br />
7. Die Texte hinterliessen "den Eindruck, dass eine Tendenz bestehe, Afrika als armen,<br />
verschuldeten und von Diktatoren beherrschten Kontinent zu stempeln".<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zusammenfassung" auf der Seite 533 dieser Arbeit.<br />
Einführung: Vorwürfe an das Afrikabild der Lehrmittel<br />
8. Schwarzafrikanische Frauen würden "nur in traditionellen Rollen und in den Illustrationen<br />
meistens mit unbedecktem Oberkörper dargestellt", zudem seien sie untervertreten.<br />
Siehe dazu das Unterkapitel "Die Rolle der Frau" auf der Seite 500 dieser Arbeit.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 60
Von schwarzafrikanischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern werden folgende Punkte genannt, die sich auf<br />
das allgemeine Bild und weniger auf die Schulbücher im speziellen beziehen:<br />
1. Schwarzafrikanische Menschen würden als "einfältige Kreaturen" oder "etwas ungeschickte an<br />
der Schwelle zur Moderne stehende Wesen" bezeichnet. (Kabou 1995, S. 103) "Leider<br />
betrachten nur wenige Europäer die Afrikaner als ihresgleichen. Ihr verschwommener Blick auf<br />
uns verrät noch immer Spuren von Kolonialismus." (Maraire 1996, S. 94) Die Europäer glaubten<br />
"allen Ernstes, dass wir von den Affen und sie von Gott abstammen" würden. (Maraire 1996,<br />
S. 172)<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit.<br />
2. Afrikaner seien "Arbeitstiere..., die sich stundenlang in der Sonne abrackern" könnten, "ohne das<br />
leiseste Anzeichen von Erschöpfung zu zeigen" oder er sei ein "fauler Neger, der im natürlichen<br />
Überfluss" lebe. (Kabou 1995, S. 118)<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit.<br />
3. Schwarzafrikaner seien von Trieben gesteuerte Wesen (Maraire 1996, S. 189):<br />
"Es sind einfache und unschuldige Menschen. Sie essen gerne ihr bisschen sadza und Fleisch, trinken hin und wieder ein<br />
Bier, schlaffen mittags unter einem schattigen Baum und zeugen viele Kinder. Das ist alles."<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit.<br />
4. Der Schwarzafrikaner hänge mehr an seinem Stamm "als eine Muschel an ihrem Felsen".<br />
(Kabou 1995, S. 183)<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit.<br />
5. Die Sprache werde in diskriminierender Weise eingesetzt: "Lobola bezeichnen sie als Brautpreis,<br />
Könige sind Häuptlinge, unsere Medizin ist Hexerei und unsere Religion nennen sie<br />
Animismus." (Maraire 1996, S. 47)<br />
Siehe dazu das Kapitel "Die diskriminierende Verwendung der Sprache" auf der Seite 531 dieser<br />
Arbeit.<br />
6. Afrika sei eine wundervoller Kontinent, der vor der Kolonisation eine völlig harmonische<br />
Einheit gebildet habe. (Kabou 1995, S. 126)<br />
Siehe dazu das Kapitel "Geschichte" auf der Seite 525 dieser Arbeit.<br />
7. Der schwarzafrikanische Mensch sei trinkfreudig und lustig, "mehr mit Tamtams und religiösen<br />
Zeremonien beschäftigt... als mit seinem Broterwerb". (Kabou 1995, S. 183)<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit.<br />
8. Europäer würden "Afrika nach wie vor" als "eine amorphe Masse sehen: der schwarze Kontinent,<br />
ein urzeitlicher Sumpf, über dem dampfender Nebel hänge und der von Neandertal-Geschöpfen<br />
und fröhlichen, aber primitiven Eingeborenen bewohnt" werde, "die sich mitten in der Nacht in<br />
schauderhaften rituellen Zeremonien ergehen und zum rasenden Rhythmus von Trommeln"<br />
tanzten. (Maraire 1996, S. 95)<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit.<br />
9. Die Musik Afrikas werde auf die Benutzung der Trommel reduziert. So beschreibt Maraire die<br />
Aussage einer Anthropologin, die anlässlich eines Symposiums über "afrikanische Kultur, Politik<br />
und... Entwicklung des Kontinents" aussagte (Maraire 1996, S. 96):<br />
Einführung: Vorwürfe an das Afrikabild der Lehrmittel<br />
"Ich liebe Afrika. Es ist so schön, und die Afrikaner sind die herzlichsten Menschen in der Welt. Ich habe ihre Konferenz<br />
sehr genossen. Ich bin jedoch enttäuscht, dass es keine Trommeln bei Ihrem Symposium gab. Mein Mann und ich haben<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 61
während unseres Aufenthaltes dort so gerne den kleinen Dorfjungen zugehört, wenn sie nachts spielten. Ich denke, dass<br />
keine Ausstellung oder selbst Diskussion ohne Trommeln vollkommen ist."<br />
Siehe dazu das Kapitel "Vorgestellte Instrumente und Länder" auf der Seite 469 dieser Arbeit.<br />
10. Der Westen beanspruche Errungenschaften Afrikas, beispielsweise die Kultur Altägyptens allein<br />
für sich. (Maraire 1996, S. 103)<br />
Siehe dazu die "Betrachtung der Vorwürfe" ab der Seite 533 dieser Arbeit.<br />
11. Afrika ist nicht in der Lage, sich ohne fremde Hilfe zu entwickeln. Der Kontinent sei "wie eine<br />
Frühgeburt, schutzlos, unterernährt und unterentwickelt - unfähig, sich selbst am Leben zu<br />
erhalten". (Maraire 1996, S. 101)<br />
Siehe dazu das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit.<br />
Ob diese Vorwürfe zutreffen, ob Aussagen aus "didaktischen" Gründen zu sehr vereinfacht wurden und ob das<br />
Lehrmittel auf einer Metaebene Hand bietet, um allenfalls die Aufmerksamkeit auf diese heiklen Fragen zu<br />
lenken, ist Gegenstand der Betrachtung und Untersuchung der mehr als 35 Geographielehrmittel über den Zeit-<br />
raum des ganzen 20. Jahrhunderts, der rund 25 Musiklehrmitteln vor allem der siebziger- bis neunziger Jahre,<br />
sowie einer kleineren Sammlung an Sprach-, Lese- und Comicbüchern. Wer konkret einem Vorwurf nachge-<br />
hen möchte, folgt am besten den bereits gemachten Seitenhinweisen. Für einen detaillierteren Einblick in das<br />
Bild einer bestimmten Zeit, bieten sich die einzelnen Besprechungen der Lehrmittel an. Innerhalb dieser<br />
Besprechungen finden sich für viele Sachthemenkreise weitere Querverweise.<br />
Die Lehrmittel werden innerhalb der Gruppen "Geographie", "Musik", "Lesebuch und Comic" in grösstenteils<br />
chronologischer Ordnung analysiert. Sofern diese Analyse nicht nur wenige Sätze umfasst, werden die wich-<br />
tigsten Gedanken am Ende der Analyse der einzelnen Lehrmittel kurz zusammengefasst. <strong>Pro</strong> Gruppe erfolgt<br />
teilweise eine weitere Zusammenfassung am Schluss der jeweiligen Abschnitte, die im letzten Teil der Arbeit<br />
noch einmal zu einem Gesamtbild zusammengezogen werden. Da einige der gemachten Kommentare für mehr<br />
als ein Lehrmittel von Bedeutung sind, wird jeweils unter Angabe der Seitenzahl auf die entsprechenden Stel-<br />
len verwiesen.<br />
Einführung: Vorwürfe an das Afrikabild der Lehrmittel<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 62
3.3 Themenkreise<br />
Anhand der drei im folgenden vorgestellten Themenkreise soll die in der Besprechung der einzelnen Lehrmit-<br />
tel angewandte Arbeitstechnik exemplarisch dargestellt werden. Der erste Themenkreis befasst sich mit der<br />
Darstellung des westafrikanischen Landes Ghana. - Innerhalb der Einzelbesprechungen finden sich weitere<br />
Angaben zu den in den Lehrmitteln erwähnten Ländern Schwarzafrikas. Die teilweise verstreuten Angaben<br />
wurden durch entsprechende Seitenverweise verknüpft. - Der zweite Themenkreis befasst sich mit dem inner-<br />
halb der Einzelbesprechungen nicht ausführlich behandelten Thema Krieg, und der dritte Themenkreis befasst<br />
sich mit der Darstellung der schwarzafrikanischen Religionen. Diese beiden letzten Themenkreise stehen für<br />
eine Anzahl von weiteren Themen, die innerhalb der Einzelbesprechungen der Lehrmittel angesprochen und<br />
wieder grösstenteils über Seitenhinweise auf andere Textstellen verknüpft sind.<br />
3.3.1 Ghana<br />
Der erste Themenkreis befasst sich anhand von Ghana mit der Darstellung eines Landes in den untersuchten<br />
Lehrmitteln. Ghana wurde gewählt, da dieses Land verschiedene geographisch bedingte Nutzungszonen<br />
aufweist, politisch zu den Vorreitern der Unabhängigkeitsbewegung gehörte und relativ gut dokumentiert ist.<br />
Die den Zitaten beigefügten Kommentare entsprechen zu einem grossen Teil denen, die in der Besprechung<br />
der einzelnen Lehrmittel im Teil "Der schwarzafrikanische Mensch im Geographielehrmittel" ab der Seite 93<br />
dieser Arbeit gemacht werden. Allerdings wurde auf die in den dortigen Ausführungen gemachten Querver-<br />
weise verzichtet. Die Darstellung des historischen Reiches Gana wird in diesem Themenkreis nicht betrachtet,<br />
da dieses der ehemaligen Goldküste zwar den Namen gab, aber das Gebiet des heutigen Ghanas nicht<br />
umfasste.<br />
3.3.1.1 Widrig Geographie, 1967<br />
Widrigs "Geographie" beschäftigt sich als erstes der untersuchten Lehrmittel mit Ghana. Über die erreichte<br />
Unabhängigkeit des Vorreiters und afrikanischen Hoffnungsträgers schreibt Widrig auf der Seite 311:<br />
...Waren es zuerst die Länder des Islams, die ihr Ziel erreichten, so gelang es 1957 der von Negern bewohnten britischen<br />
Goldküste, den Staat Ghana zu gründen. Viele Afrikaner konnten es nun kaum erwarten, nach dem Vorbild Ghanas, das<br />
"europäische Joch" abzuschütteln...<br />
Obwohl der damalige Präsident Ghanas, Kwame Nkrumah als nachahmenswerter Politiker galt, gelang es ihm<br />
in den sechziger Jahren nicht, die Regierungsverantwortlichen der anderen unabhängig gewordenen afrikani-<br />
schen Staaten von seiner Idee, der Schaffung eines afrikanischen Staatenbundes nach dem Vorbild der Verei-<br />
nigten Staaten von Amerika, zu überzeugen.<br />
3.3.1.2 Seydlitz für Realschulen, 1968<br />
Wesentlich ausführlicher mit Ghana beschäftigt sich das Lehrmittel "Seydlitz für Realschulen". Unter dem<br />
Titel die "Staaten Äquatorialafrikas und ihre Wirtschaft" schreibt der Autor auf der Seite 40f. des dritten<br />
Bandes zur Wirtschaft Ghanas:<br />
...Auch die Einheimischen haben inzwischen den Anbau dieser <strong>Pro</strong>dukte übernommen und dabei beträchtliche Fortschritte<br />
erzielt Der grösste Kakaolieferant der Welt ist Ghana, seine Hauptstadt Akkra der wichtigste Kakaoausfuhrhafen.<br />
Ausserdem kommen aus den Regenwäldern wertvolle Hölzer.<br />
Auf der Seite 41 ist ein Foto "Träger bringen Kakaobohnen zur Sammelstelle" abgebildet, das zeigt, wie Scha-<br />
len mit daraufliegenden Säcken, gefüllt mir Kakaobohnen, auf dem Kopf getragen werden. Im Text heisst es<br />
weiter zur Infrastruktur des Landes (S. 41):<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 63
...An der Küste müssen - wie schon in Takoradi und in Tema - moderne Häfen entstehen, damit auch sperrige Güter:<br />
Maschinen, Eisenbahnwagen, Bagger und Industrieausrüstungen, sicher gelöscht werden können... Auch das Strassennetz<br />
genügt nicht den Ansprüchen; es müssen mehr Allwetterstrassen gebaut werden, die auch in der Regenzeit benutzbar sind.<br />
Bahnlinien und Strassen dienen vor allem dazu, die Bodenschätze, aber auch die landwirtschaftlichen Ausfuhrgüter zur<br />
Küste zu transportieren. Auch die Edelhölzer aus dem Regenwaldgebiet müssen mit der Eisenbahn oder mit dem Lkw zu<br />
den Sägewerken und Verschiffungsplätzen geschafft werden.<br />
Für den Transport von Personen hat sich in Ghana das Prinzip der privat geführten Kleinbusse durchgesetzt,<br />
die Trotros genannt werden. Für eine kleine Gebühr werden die Einheimischen in oder ausserhalb der Stadt<br />
von einem Ort zum nächsten befördert, und dies im Gegensatz zu den staatlichen Busbetrieben, die häufig nur<br />
eine oder zwei Fahrten pro Tag anbieten, mit einer weit höheren Verkehrsfrequenz und zu günstigeren Zeiten.<br />
Zu den Bodenschätzen Ghanas äussert sich der Autor (S. 41):<br />
Für den Ausbau der Industrie sind die wertvollen Bodenschätze... Bauxit, Gold und Diamanten... wichtig. Für die<br />
Verarbeitung der Bodenschätze ist vor allem elektrische Energie nötig. Sie wird aus Wasserkraft gewonnen. Grosse<br />
Staudämme am Niger und am Volta sind bereits entstanden oder im Bau.<br />
Auf den Akosombostaudamm, der den Volta aufstaut, wird an anderer Stelle eingehend eingegangen.<br />
Nach den eher allgemein gehaltenen Ausführungen im dritten Band, beschäftigt sich der Autor im sechsten<br />
Band des Lehrmittels noch einmal mit Ghana im speziellen. Im Text "Die Republik Ghana" schreibt der Autor<br />
auf Seite 106:<br />
Ghana gehört zu dem von schwarzen Menschen bewohnten Teil Afrikas, der sich zwischen der Sahara im Norden und der<br />
Kalahari im Süden erstreckt. Seine Grösse entspricht etwa der Grösse der Bundesrepublik Deutschland. Die Einwohnerzahl<br />
beträgt nur 7,9 Millionen. Das Land hat im Norden noch Anteil an der trockenen Savanne, über die feuchte Savanne reicht<br />
es im Süden in das Gebiet des tropischen Regenwaldes.<br />
Das Deutschland der neunziger Jahre ist durch die Wiedervereinigung natürlich nun einiges grösser als Ghana,<br />
das seine Fläche nicht verändert hat. Dafür ist die Bevölkerung Ghanas auf rund 18 Millionen (CIA World<br />
Atlas, 1996) angewachsen. Über die Verteilung der Bevölkerung innerhalb des Landes schreibt der Autor<br />
(S. 106):<br />
Die Bevölkerung ist ungleich über das Land verteilt. Im Norden leben die Menschen in althergebrachter Weise vom<br />
Regenfeldbau, der auf Brandrodungsflächen betrieben wird. Wegen der Gefährdung durch die Tsetsefliege wird nur wenig<br />
Vieh gehalten. Was angebaut wird, dient dem Eigenbedarf der Familien, die nach altem Brauch unter Ältesten oder<br />
Häuptlingen in Sippen oder Stämmen leben. Die scheinbar oberflächliche Landnutzung, bei der die Anbaufläche nach<br />
kurzer Dauer liegenbleibt und durch ein neugerodetes Feld abgelöst wird, ist klimatisch begründet: bei längerer<br />
Beanspruchung wäre nämlich der Boden sehr bald erschöpft und könnte sich nicht wieder erholen. Unter diesen<br />
Umständen kann in diesem Landesteil kaum mit einer erfolgreichen intensiveren Bewirtschaftung und einer daraus<br />
folgenden wirtschaftlichen Besserstellung der Bevölkerung gerechnet werden. Im landwirtschaftlich wenig ertragreichen<br />
Savannengebiet lebt auf zwei Dritteln der Fläche des Landes nur ein Fünftel seiner Bewohner!<br />
Selbst heute leben im grössten der neun Distrikte Ghanas, dem "Northern District", immer noch nur etwa zwei<br />
Millionen Einwohner. Die Distrikthauptstadt der Nordregion, Tamale, verfügt zwar über ein Spital für die rund<br />
200'000 in der Region lebenden Menschen und seit Anfang 1998 über ein neugebautes Kanalisationssystem,<br />
leidet aber besonders während der Trockenzeit im Dezember bis März immer wieder unter Wasserknappheit.<br />
Über den Süden des Landes schreibt der Autor (S. 106):<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
Im Bereich des tropischen Regenwaldes ist die Lage ganz anders. Hier wurde schon während der Kolonialzeit der<br />
Kakaoanbau eingeführt. Heute wird der Kakao hauptsächlich in bäuerlichen Betrieben, weniger auf grösseren Plantagen<br />
erzeugt. Zahlreiche Familien finden dadurch ihr gutes Auskommen. Kakao und Kakaobutter sind wichtige<br />
Ausfuhrprodukte des Landes. So bietet in Ghana die Regenwaldzone günstige Lebensbedingungen für viele Menschen.<br />
Darüber hinaus ziehen die Ernte und die weitere Bearbeitung der Kakaofrüchte alljährlich viele Wanderarbeiter aus den<br />
Savannen in das Regenwaldgebiet. Viele von ihnen lernen hier bessere Lebensverhältnisse kennen und bleiben für immer.<br />
Nach einer Weile holen sie ihre Familien nach. Dadurch nimmt die Bevölkerung in den Savannen ständig ab, im<br />
Küstengebiet steigt sie dagegen weiter an. Diese dauernde Binnenwanderung führt zu einer langsamen Entvölkerung der<br />
nördlichen Landesteile. Sie werden dadurch immer rückständiger und sinken zu Notstandsgebieten ab.<br />
Dieser Entwicklung wurde durch die Verbesserung der Infrastruktur Einhalt geboten. Unterdessen kommt es<br />
für Regierungsbeamte nicht mehr einer "Strafversetzung" gleich, wenn sie im Norden des Landes eingesetzt<br />
werden, sondern sie benutzen die Verpflichtung, sporadisch nach Accra, der Hauptstadt, zu fahren, um Güter<br />
einzukaufen, die sie dann im Norden mit einem guten Gewinn wiederverkaufen können. Aus diesem Grund<br />
sind Posten im Norden bei kleineren und mittleren Beamten unterdessen ausserordentlich beliebt, denn das von<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 64
der Regierung gezahlte Gehalt liegt zwar weit über dem Durchschnittslohn, reicht aber bei einer auch kleinen<br />
Familie für ein Leben nach westlichem Standart nicht aus.<br />
Über das für Ghana wichtige Exportprodukt Kakao heisst es auf der Seite 107:<br />
Ghana ist auf dem Weltmarkt der Hauptlieferant von Kakao. Es erzeugt allein ein Drittel der Welternte. Kakao ist ein<br />
Erzeugnis, das besonders von den hochindustrialisierten Ländern gern gekauft wird. Dennoch schwanken die Preise auf<br />
dem Weltmarkt sehr je nach der Höhe des Angebots. In den letzten Jahren hat sich infolge des verstärkten Anbaus in allen<br />
Kakao erzeugenden Ländern sowie durch bessere Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten die Weltkakaoernte mehr<br />
erhöht als der ebenfalls angestiegene Absatz auf dem Weltmarkt. Das hat zu einem für die Erzeugerländer bedenklichen<br />
Sturz der Preise geführt.<br />
Auch Ende der neunziger Jahre ist Kakao ein noch immer wichtiger Devisenbringer für Ghana, der Anteil an<br />
der Weltproduktion hat aber abgenommen und Ghana steht nur noch an vierter Stelle in der Weltrangliste. Viel<br />
wichtiger ist wieder der Goldabbau geworden - Ghana ist nach Südafrika der grösste Goldproduzent des Konti-<br />
nents -, der aber durch die sinkenden Goldpreise auch unter Druck geraten wird. Im Text fährt der Autor auf<br />
der Seite 107 fort:<br />
Im Küstengebiet ist Kakao das weitaus wichtigste Handelsgewächs, und viele Bauern haben sich ausschliesslich darauf<br />
spezialisiert. Diese Kakaobauern sind völlig abhängig vom Ergebnis ihrer Ernte. Um sie vor den Folgen von<br />
Preisschwankungen zu schützen und um die Preisentwicklung dieses wichtigen Ausfuhrproduktes in der Hand zu behalten,<br />
wird in Ghana die gesamte Kakaoernte der Bauern vom Staat aufgekauft. Dieser kann also den Preis bestimmen, den der<br />
Erzeuger erhält, und gleichzeitig versuchen, den Weltmarktpreis möglichst hoch zu halten. So werden für das wichtigste<br />
Erzeugnis des Landes stabile Wirtschaftsverhältnisse geschaffen. Bei günstigem Weltmarktpreis fliesst dem Staat<br />
ausserdem eine beträchtliche Einnahme zu.<br />
Ghana fördert ganz bewusst kleine Betriebe. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Beratungsstelle in der<br />
Hauptstadt eingerichtet, die über Exportmöglichkeiten, Kredite und Geschäftsführung Auskunft gibt und fast<br />
wöchentlich ihr Angebot am nationalen Fernsehkanal "Ghana Television" bewirbt. Auf Seite 108 heisst es<br />
weiter:<br />
Ghana besitzt grössere Bauxitvorräte. Ausserdem sind Manganerze, Gold- und Diamantenvorkommen vorhanden. Diese<br />
begehrten Bodenschätze können vorerst im Lande nur begrenzt genutzt werden. Sie ergänzen jedoch bis zur Errichtung<br />
eigener Verarbeitungsstätten die Ausfuhr. Hinzu kommt noch ein umfangreicher Export von wertvollem Holz teils in<br />
ganzen Stämmen oder bereits verarbeitet.<br />
Die Bauxitvorkommen bleiben nach wie vor ungenutzt, die Weltpreise für diesen Rohstoff lohnen den Abbau<br />
in Ghana nicht. Auch der Holzexport ist nur noch beschränkt möglich, da die Waldreserven Ghanas in den<br />
letzten Jahren rapide abgenommen haben.<br />
Das Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen beschreibt der Autor auf der Seite 108:<br />
Die Bewohner des Landes bilden noch kein einheitliches Staatsvolk. Mehrere Sprachgruppen leben nebeneinander.<br />
Zwischen den ziemlich wohlhabenden Kakaobauern und den noch ganz auf Selbstversorgung eingestellten<br />
Savannenbewohnern bestehen starke soziale Unterschiede. Die aus dem Norden eingewanderten Saisonarbeiter bilden in<br />
den städtischen Siedlungen des Südens ein besitzloses <strong>Pro</strong>letariat. Die Verbindung zu ihrer Sippe die sie früher im Notfall<br />
unterstützen konnte ist abgerissen.<br />
Vor allem in den Städten gibt es heute viele jungen Leute, deren Eltern verschiedenen Sprachgruppen angehö-<br />
ren. Diese Menschen orientieren sich nicht mehr in erster Linie an ihrer Volksgruppe, sondern fühlen sich als<br />
Ghanaer. Viele Zuwanderer, vor allem in Accra, stammen aber gar nicht aus Ghana sondern aus den nördlich<br />
gelegenen Nachbarländern. Zum Bevölkerungswachstum heisst es weiter im Text (S. 108):<br />
Die Bevölkerungszahl Ghanas nimmt rasch zu. Der jährliche Geburtenüberschuss beträgt 33 auf 1000 (zum Vergleich:<br />
Bundesrepublik Deutschland 6)! Die wachsende Menschenzahl muss mit Nahrungsmitteln und sonstigen Bedarfsgütern<br />
versorgt werden. In der Savanne könnte neues Ackerland geschaffen werden; das erfordert jedoch den Bau von<br />
Bewässerungsanlagen. Die ständige Abwanderung müsste aufhören. Das ist aber nur möglich wenn sich die<br />
Lebensbedingungen so verbessern dass den Bewohnern ein Wegzug nicht mehr lockend erscheint. Für alle diese<br />
Massnahmen sind bedeutende Mittel nötig die die Regierung wegen ihrer vielfältigen anderen Aufgaben bisher nur in<br />
unzureichendem Masse bereitstellen konnte.<br />
Nach den Krisenzeit in den achtziger Jahren hat sich die ghanaische Wirtschaft seit dem Anfang der neunziger<br />
Jahre wieder einigermassen erholt. Es fliessen auch neue Investitionen ins Land. So hat beispielsweise<br />
Samsung in Tema, der Hafenstadt bei Accra, vor einigen Jahren eine Fabrik gebaut, die Fernsehapparate<br />
produziert. Die wirtschaftliche Entwicklung beschreibt der Autor mit den Worten (S. 108):<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 65
Für die wachsende Bevölkerungszahl im Süden vor allem im Küstenbereich müssen neue Arbeitsplätze eingerichtet<br />
werden. Besonders im Bergbau können viele Menschen Arbeit finden. Der Aufbau von Industriewerken setzt aber eine<br />
ausreichende Energieversorgung voraus. Deshalb errichtet die ghanesische Regierung gegenwärtig mit ausländischem<br />
Kapital einen Staudamm am Voltafluss. Dessen Elektrizitätserzeugung wird so gross sein dass sie zunächst noch nicht im<br />
Lande voll verbraucht werden kann selbst wenn mehr Aluminium auf der Grundlage der Bauxitvorkommen gewonnen<br />
wird als bisher.<br />
Die Schaffung neuer Arbeitsplätze bleibt ein <strong>Pro</strong>blem. Es gibt Schätzungen, dass die ghanaische Wirtschaft<br />
jährlich um etwa 5% wachsen muss, nur um neue Stellen für die Jugendlichen, die jährlich auf den Arbeits-<br />
markt drängen, bereitzustellen. Eine Beschäftigung wie sie in den Industrienationen gegeben ist, wird in<br />
Ghana auch in Zukunft kaum möglich sein. Die Landwirtschaft bleibt nach wie vor der wichtigste Beschäfti-<br />
gungssektor. Zur Infrastruktur Ghanas schreibt der Autor (S. 108):<br />
Für eine gesunde Wirtschaft fehlt es also noch an vielem. Vor allem sind die Verkehrseinrichtungen vom Süden des<br />
Landes abgesehen noch unzureichend. Ohne Ausbau von Strassen und Bahnen kann die Förderung im Bergbau nicht<br />
gesteigert werden. Ohne Transportwege ist auch die Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse begrenzt. Alle technischen<br />
Einrichtungen brauchen Fachkräfte. Ihre Ausbildung ist vordringlich. Ausserdem müssen gerade in einem tropischen Land<br />
die Gesundheitsfürsorge verstärkt neue Krankenhäuser gebaut und die Bevölkerung über Sauberkeit und richtige<br />
Ernährung aufgeklärt werden. Alle diese Aufgaben sind mühevoll; nach aussen treten die Verbesserungen zunächst wenig<br />
in Erscheinung. Doch sind sie nötig für die Änderung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse. Bei der Verwendung<br />
der vom Ausland kommenden Entwicklungshilfe müssen die geographischen Gegebenheiten des Landes berücksichtigt<br />
werden; dabei wird von der Führung des jungen Staates viel Einsicht erwartet. Werden die Mittel gelegentlich für<br />
aufwendige umstrittene Pläne verwendet so dürfen die helfenden Länder nicht die Geduld verlieren; sie müssen immer<br />
bedenken dass das Bedürfnis nach einer sichtbaren Bestätigung der Unabhängigkeit nach wie vor gross ist.<br />
Nach wie vor sind viele Hilfswerke und ähnliche Organisationen in Ghana tätig. Nicht immer sind die Bemü-<br />
hungen von Erfolg gekrönt, da immer wieder <strong>Pro</strong>jekte "über den Kopf" der lokalen Bevölkerung geplant und<br />
deren Bedürfnisse nicht immer gerecht werden. Unter der Regierung Rawlings unternimmt das Land aber<br />
grosse Anstrengungen in allen Landesteilen um zumindest den status quo zu sichern.<br />
3.3.1.3 Erdkunde, 1968<br />
Das Lehrmittel Erdkunde zeigt auf der Seite 31 ein Foto "Schwarze und Weisse beim Bau des Voltastaudam-<br />
mes". Der im Jahre 1965 fertiggestellte Voltastausee galt lange Zeit als grösster Stausee der Welt und sollte<br />
Ghana helfen, den Schritt in die Industrialisierung zu machen. Wegen der steigenden Fluten mussten gegen<br />
80'000 Menschen umgesiedelt werden. Die Pläne für deren neuen Siedlungen scheiterten aber infolge von<br />
Geldmangel. Die damals entstandene "Volta River Authority" ist noch heute für die Stromversorgung des<br />
Landes zuständig. Der durch das Wasserkraftwerk erzeugte Strom wird zu einem grossen Teil für die Alumini-<br />
umverhüttung verwendet. - Ursprünglich war geplant, die lokalen Bauxitvorkommen abzubauen, seit Beginn<br />
der Verhüttung wurde aber billigeres Bauxit aus Jamaika eingeführt. - Der Rest des erzeugten Stromes wird<br />
teilweise im Inland verbraucht, teilweise als Devisenbringer an Nachbarländer verkauft. Der zunehmende<br />
Strombedarf und eine gleichzeitig auftretende Wasserknappheit, die auf einen höheren Verbrauch im nördli-<br />
chen Nachbarland Burkina Faso, dem Herkunftsgebiet des Voltas, zurückgeht, hatte nach Berichten aus Ghana<br />
erstmals im Februar 1998 zu einer Versorgungslücke geführt, die sich unvorteilhaft auf die heimische Wirt-<br />
schaft auswirkt, z. B. musste die Zementfabrik ihre Tätigkeit einstellten, was im Zusammenhang mit dem<br />
momentanen Bauboom in Ghana zu einer empfindlichen Preiserhöhung dieses Baustoffes geführt hat. Die<br />
Auswirkungen der Stromknappheit auf eine zumindest teilweise computerisierte Verwaltung kann man sich<br />
denken.<br />
Im Kapitel "Grosse Ströme im Dienste des Menschen" schreibt der Autor auf der Seite 35 über den, den Volta<br />
aufstauenden Akosombostaudamm:<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
...Elektrische Energie soll am Volta-Staudamm in Ghana erzeugt werden. Seine Sperrmauer ist 640 m lang und 113 m<br />
hoch. Ein grosses Werk soll einen Teil des Stromes zur Aluminiumerzeugung nutzen. Mächtige Bauxitlager sind in der<br />
Nähe vorhanden. Durch den Stau wird der Fluss auf 300 km für Schiffe befahrbar...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 66
Die in die Schiffahrt auf dem Voltasee gesetzten Hoffnungen wurden nicht erfüllt, dafür erwies sich der See<br />
als ausgesprochen fischreich und trägt als <strong>Pro</strong>teinlieferant massgeblich zur Ernährung der umliegenden Regio-<br />
nen Ghanas bei.<br />
Ein weiteres Kapitel mit dem Titel "Kolonien wurden selbständige Staaten" zeigt auf der Seite 37 ein Foto mit<br />
der Bildlegende "Parlamentseröffnung in Ghana". Im Text schreibt der Autor zur Entwicklung Ghanas:<br />
Die Republik Ghana entwickelte sich ruhiger. Sie hat sich nach einem grossen Negerreich benannt, das vor Jahrhunderten<br />
im westlichen Sudan bestand. Als britische Kolonie trug dieses Land den Namen Goldküste, weil dort im Sand Gold<br />
gefunden wurde. 1956 hat der junge Eingeborenenstaat seine Unabhängigkeit erhalten.<br />
Kakao ist der Reichtum des Landes. Europäer hatten mit dem Anbau in Pflanzungen begonnen. Als sie damit grossen<br />
Erfolg hatten, zeigten sie den Eingeborenen, wie man den Kakaobaum pflanzen und pflegen muss. Auch Afrikaner legten<br />
Kakaoplantagen an. Heute gibt es neben vielen kleinen Kakaobauern auch eingeborene Unternehmer, die Zehntausende<br />
von Kakaopflanzen besitzen. Sie sind wohlhabend geworden und sind sich ihres Besitzes und ihrer Geltung bewusst.<br />
Ghana liefert heute fast 25% der Welterzeugung an Kakao.<br />
Ein weiterer Reichtum des Landes sind seine Bodenschätze. In den Bergwerken, in denen viele Afrikaner Arbeit finden,<br />
gewinnt man Diamanten, Gold und Manganerze, vor allem aber Bauxit.<br />
Die Hauptstadt Akkra zeigt den Reichtum des Landes. Bauwerke aus Beton und Glas, Krankenhäuser, Schulen und<br />
Kirchen werden errichtet. Das Nationalmuseum und die Staatsbibliothek geben Zeugnis vom kulturellen Leben der Stadt.<br />
Starker Verkehr flutet über die breiten, asphaltierten Strassen.<br />
Der anfängliche wirtschaftliche Erfolg Ghanas fand ein jähes Ende, als die Rohstoffpreise für Kakao ihre<br />
Talfahrt antraten. Obwohl Ghana über eine im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen Staaten gute Infras-<br />
truktur verfügt, in die noch immer massiv investiert wird, - in den letzten drei Jahren wurde z. B. die Kanalisa-<br />
tion der drittgrössten Stadt massiv ausgebaut - zählt es heute zu den ärmeren Ländern der Welt.<br />
Auf der Seite 38 schreibt der Autor in einer Zusammenfassung "Äquatorialafrika und der Sudan" über Ghana:<br />
1957 entstand aus der früheren britischen Kolonie Goldküste und einem schmalen Streifen der einstmaligen deutschen<br />
Kolonie Togo die Republik Ghana... Europäische Wissenschaftler, Ingenieure, Ärzte und Verwaltungsfachleute helfen<br />
beim Aufbau von Verwaltung und Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheitsfürsorge. Durch den Bau von Fabriken,<br />
Strassen, Eisenbahnen und Staudämmen, durch Anleihen und Schenkungen unterstützen die europäischen Staaten diesen<br />
Aufbau.<br />
Diese Hilfe, hinter der lange Zeit massive wirtschaftliche Interessen, später eine Art Wiedergutmachungsmen-<br />
talität für die Kolonialzeit stand, wird in der einen oder anderen Form bis heute weitergeführt und ist in eini-<br />
gen Bereichen dringend nötig, in anderen sind es vor allem die finanziellen Zuschüsse, die die Regierung<br />
Ghanas dazu bewegen, ein Entwicklungsprojekt zu akzeptieren.<br />
3.3.1.4 Länder und Völker, 60er Jahre<br />
Der Band 3 des Lehrmittels "Länder und Völker" beschäftigt sich im Zusammenhang mit Ghana auf der<br />
Seite 32 ebenfalls mit dem Anbau von Kakao:<br />
An der Goldküste schätzt man die Zahl der eingeborenen Kakaobauern auf 300'000. Der Erfolg dieser Wirtschaftsweise ist<br />
überraschend. Heute wird die Hälfte der Kakaoernte der Welt an der Küste von Oberguinea erzeugt und zum grossen Teil<br />
über den Kakaohafen Akkra versandt.<br />
Auf der gleichen Seite findet sich auch eine Zeichnung "Kakaoernte an der Goldküste", die auf der Seite 194<br />
dieser Arbeit wiedergegeben wird.<br />
Über "Bewohner und Siedlungen" von Oberguinea, zu diesem Gebiet gehört auch Ghana, fährt der Autor auf<br />
der Seite 32 fort:<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
...Die Eingeborenen von Oberguinea gehören zu den fortschrittlichsten Vertretern der schwarzen Rasse in Afrika. Sie sind<br />
gross, kräftig und fleissig und waren daher früher auf den Sklavenmärkten besonders begehrt. Die Orte an der Küste sehen<br />
sauber und freundlich aus... Akkra bietet ein recht malerisches Strassenbild. Die Frauen tragen grossgemusterte<br />
Stoffstreifen in bunten Farben. Baumwolle wächst ja im Lande, Weberei und Färberei stehen auf hoher Stufe. Im<br />
Strassenbild fallen viele bebrillte junge Neger auf. Es sind Studenten des Prince-of-Wales-College, das in Schimota<br />
nördlich Akkra liegt...<br />
Diese Beschreibung des Küstengebietes trifft bis zu einem gewissen Grade auch heute noch zu. Allerdings sind<br />
die Küstenstädte seit dem Erscheinen von "Länder und Völker" in einem gewaltigen Tempo gewachsen, so<br />
dass Accra, die Hauptstadt Ghanas, heute gegen 2 Millionen Einwohner zählt. Im Anbetracht dieser<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 67
"Überbevölkerung" der Städte hat sich auch das dortige Erscheinungsbild gewandelt. Zwar gibt es beispiels-<br />
weise in Accra immer noch sehr vornehme Quartiere, die an idyllische Zustände in gewissen Gegenden Euro-<br />
pas erinnern, doch für die meisten Stadtteile ist die teilweise offen geführte Kanalisation und der stetig zuneh-<br />
mende Verkehr zu einem <strong>Pro</strong>blem geworden. Im Text schreibt der Autor zur politischen Entwicklung in Ghana<br />
(S. 32):<br />
...Die frühere Kronkolonie Goldküste wurde 1957 ein unabhängiger Staat (Dominion) unter dem Namen Ghana im<br />
Rahmen der englischen Völkergemeinschaft...<br />
Die weitere Entwicklung des Landes wurde bereits beschrieben.<br />
3.3.1.5 Seydlitz für Gymnasien, 1963-1971<br />
Der sechste Band von "Seydlitz für Gymnasien" fordert in einer Aufgabenstellung auf der Seite 82 den Schü-<br />
lern auf, die "Hauptprobleme und politischen Strömungen in Afrika nach Büchern" von Nkrumah u.a. zu schil-<br />
dern. Kwame Nkrumah (1909-1972) war der erste Premierminister (1957-1960) und spätere Präsident<br />
(1960-1966) Ghanas. Nkrumah träumte von einem Afrika, das sich aus den Fesseln des Kolonialismus lösen<br />
und zu einer Einheit finden könnte, die es zu einem ernstzunehmenden Partner in der internationalen Gemein-<br />
schaft machen würde. Auf der Seite 102 erwähnt der Autor Ghana noch einmal als ein <strong>Pro</strong>duktionsland von<br />
Kakao.<br />
3.3.1.6 Fahr mit in die Welt, 1971-1974<br />
Das Lehrmittel "Fahr mit in die Welt" gibt auf der Seite 64 eine Beschreibung "Quer durch Ghana" wieder:<br />
Die Reise begann in Akkra, einer Stadt in modernem Gewande, fast europäisch. Wir wurden ins Innere des Landes geführt,<br />
ins Reich der kriegerischen Aschantistämme. Wir kamen durch feuchtwarme Tropenwälder und im Norden des Landes in<br />
savannenartige Gebiete. Das Land führt heute Kakao und Edelhölzer, Manganerze, Bauxit und Diamanten aus. Die<br />
Industrie soll profitieren von grossen Wasserkraftwerken, die noch im Bau sind. (Inzwischen ist der Volta-Stausee<br />
vollendet).<br />
Das wirtschaftliche Zentrum des Aschantigebietes, die Stadt Kumasi, die mit ihren rund 800'000 Einwohner<br />
nach der Hauptstadt bevölkerungsmässig an zweiter Stelle steht und sich als Handels- und Universitätsort<br />
behaupten konnte, ist Sitz des Aschantikönigs geblieben, dessen Funktion vor allem zeremonieller Natur ist,<br />
wenngleich er immer noch über einen grossen Einfluss verfügt. Zum Anbau von Kakao schreibt der Autor auf<br />
der Seite 64:<br />
Wir besuchen einen Farmer. Er hat eine Kakaopflanzung. Er klärt uns auf, dass Kakaobäume schon in ihrem 5. Lebensjahr<br />
Früchte tragen können. Den vollen Ertrag liefern sie aber nach 10 bis 12 Jahren. Alle sechs Wochen kann man dann 40 bis<br />
50 gurkenähnliche bis zu 25 cm lange Früchte ernten. Diese Früchte bergen in ihrem Innern 25 bis 50 Kakaobohnen.<br />
Die Kakaobohnen lässt man einige Tage liegen. Darauf werden sie gewaschen und getrocknet, nochmals gereinigt,<br />
geröstet, geschält und zerrieben. Aus der Kakaomasse wird das Fett herausgepresst. Aus dem gewonnenen Kakaopulver<br />
kann dann Schokolade hergestellt werden. Ausser den Plantagen der Weissen gibt es auch viele Betriebe der Eingeborenen.<br />
Das Lehrmittel stattet, als erstes der untersuchten Werke, dem ghanaischen Kakaobauer einen Besuch ab. Ein<br />
Thema, welches in späteren Lehrmitteln mehr oder weniger ausführlich immer wieder aufgegriffen wird.<br />
Auf der Seite 64 ist auch eine Tabelle "Kakao (1966)", die <strong>Pro</strong>duktion und Ausfuhr der wichtigsten <strong>Pro</strong>duzen-<br />
tenländer angibt (Ghana steht an zweiter Stelle hinter der Elfenbeinküste), zu finden.<br />
3.3.1.7 Dreimal um die Erde, 1977-1980<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
Im Band 1 des Lehrmittels "Dreimal um die Erde" schreibt der Autor im Kapitel "Kakao aus Ghana" auf der<br />
Seite 94, auf der auch ein Foto "Trocknen der Kakaobohnen" und Klimawerte zu Kumasi abgedruckt sind:<br />
Die meisten der 200'000 selbständigen Kakaobauern besitzen weniger als 4 ha Land. Für Kakao bekommen sie höhere<br />
Preise als für Gemüse und Obst. Deshalb bauen sie fast nur Kakao an. Für den eigenen Bedarf erzeugen sie Knollenfrüchte<br />
(Maniok, Yams, Taro), Mais, Mehlbananen und Gemüse auf kleinen Feldern (Beeten), die vor den Frauen mit der Hacke<br />
bearbeitet werden. Man kann hier das ganze Jahr über säen, pflanzen und ernten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 68
(Zum Klima Ghanas siehe die Bemerkungen weiter unten.) Der Autor fährt mit einer Beschreibung des Kakao-<br />
anbaus fort:<br />
Vor der Anlage eines neuen Kakaofeldes muss der dichte Wald gerodet werden. Die Bauern schlagen das Unterholz und<br />
Strauchwerk ab und verbrennen es mit der gefällten Bäumen. Einige hohe Bäume lässt man stehen, damit sie Schatten<br />
spenden.<br />
Der Kakao ist eine Pflanze aus dem dunklen, unteren Stockwerk des tropischer Waldes. Als niedrige Schattenspender<br />
werden häufig Mehlbananenstauden gepflanzt. Sie liefern den Bauern zugleich ein wichtiges Nahrungsmittel.<br />
Fünf Jahre dauert es, bis die Kakaosträucher die ersten Früchte tragen. Während dieser Zeit muss der Bauer die Sträuche<br />
häufig beschneiden, ständig das Unkraut beseitigen und immer darauf achten, dass genügend Schatten vorhanden ist. Ein<br />
Kakaostrauch kann 50 Jahre Früchte tragen.<br />
Der Text wird am Ende der Seite durch die Aufforderung "Begründe nach den Klimaangaben... warum in<br />
Ghana in jedem Monat Saat und Ernte möglich sind." abgeschlossen. Diese Aufgabenstellung zeigt auf, wie<br />
heikel die in einem Lehrmittel für die Oberstufe gemachten Aussagen sein können, wird doch hier der<br />
Eindruck erweckt, in Ghana könnten die Bauern jederzeit aussäen oder ernten. Dies trifft jedoch nur auf einen<br />
Teil Ghanas zu, der obwohl bevölkerungsreich, flächenmässig nur einen kleineren Teil des Landes einnimmt.<br />
Je nach Einteilung werden in Ghana zwischen drei bis fünf klimatisch verschiedene Regionen ausgemacht.<br />
Folgt man der Dreiteilung so ergibt sich ein mässig heisser und regenarmer aber schwüler Küstenteil um<br />
Accra, der sehr bevölkerungsreich ist, ein mit tropischem Regenwald versehener und relativ kühler Mittelteil,<br />
der im Text angesprochen wird, und ein grosses Savannengebiet im Norden, welches heiss und ausserhalb der<br />
Regenzeit sehr trocken ist, in dem den Bauern nur sehr enge Zeitfenster zur Aussaat bleiben.<br />
Auf der Seite 95, die eine Karte "Bodennutzung" in Ghana, aus der die eben gemachten Bemerkungen heraus-<br />
gelesen werden könnten, ein Foto "Kakaoernte in Ghana und eine Tabelle "Kakaoernte... (1975)" zeigt, fährt<br />
der Autor mit der Beschreibung des Kakaoanbaus unter der Kernaussage "Die Kakaoernte erfordert sehr viele<br />
Arbeitskräfte" fort:<br />
Von November bis Anfang Februar wird in Ghana Kakao geerntet. Mit der ganzen Familie ziehen die Bauern zur Ernte aus<br />
dem Dorf hinaus. Mit einem Haumesser schlagen die Männer die Früchte ab. Frauen und Kinder sammeln sie vom Boden<br />
auf und tragen sie zu einem Sammelplatz ins Dorf. Dort brechen andere Männer die Früchte mit einem geschickten<br />
Messerschlag auf. Sie dürfen dabei die Samen im Innern, die Kakaobohnen, nicht beschädigen. Frauen und Mädchen lösen<br />
die 30 bis 40 Bohnen aus dem weichen Fruchtfleisch heraus.<br />
Unter der Kernaussage "Die Kakaobohnen müssen nach der Ernte sorgfältig aufbereitet werden" heisst es<br />
weiter:<br />
Sie werden zu kleinen Haufen auf Bananenblätter geschüttet und mit Bananenblättern zugedeckt. Die Bohnen beginnen zu<br />
gären. Das restliche Fruchtfleisch zerfällt, die Bohnen färben sich braun und entwickeln das Schokoladenaroma. Etwa 6<br />
Tage dauert dieser Vorgang. Nach der Gärung breitet der Bauer die Bohnen auf langen Gestellen in der Sonne zum<br />
Trocknen aus... Mehrfach wendet er sie mit der Hand oder mit einem hölzernen Rechen, damit alle Bohnen gleichmässig<br />
trocknen können. Sie setzen sonst Schimmel an. Schliesslich müssen noch alle schlechten Bohnen, Bruchstücke, Schalen<br />
und Schmutzteile ausgelesen werden.<br />
Nun kann der Bauer seine Ernte verkaufen. Er bringt sie zu einer staatlichen Sammelstelle. Dort werden die Bohnen<br />
sorgfältig auf ihre Qualität geprüft. Von seiner 4 ha grossen Pflanzung erntet der Bauer etwa 12 dt Kakaobohnen.<br />
Die letzte Kernaussage "Ghana liefert die meisten Kakaobohnen für den Weltmarkt" trifft heute nicht mehr zu.<br />
Zu der problematischen Abhängigkeit der vieler Entwicklungsländer von wenigen <strong>Pro</strong>dukten schreibt der<br />
Autor auf der Seite 113 des zweiten Bandes unter der Überschrift "Zwei Drittel der Einnahmen in den<br />
Entwicklungsländern stammen aus Rohstoffexporten" zu Ghana:<br />
Ghana konnte zum Beispiel zu Beginn der sechziger Jahre seine Kakaobohnen zu hohen Preisen verkaufen. Wegen der<br />
günstigen Absatzmöglichkeiten legten Nigeria und Kamerun ebenfalls Kakaopflanzungen an, die 1965 erstmals den<br />
Weltmarkt belieferten. Günstige Witterungsbedingungen brachten eine überdurchschnittliche Ernte. Das Mehrangebot<br />
führte zum Preissturz. Ein Teil der Ernte konnte nicht verkauft werden, der andere Teil nur mit Verlusten. Die erwarteten<br />
Deviseneinnahmen blieben aus; Einfuhren von wichtigen Industriewaren mussten unterbleiben.<br />
Auf der Seite 113 ist auch eine Grafik "Veränderungen der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt Ende 1974<br />
gegenüber Anfang 1974 in %" abgedruckt, welche die im Text gemachten Aussagen bezüglich der Preis-<br />
schwankungen noch einmal konkret illustriert, so betrug die Veränderung nach den Angaben für Kakao +64%,<br />
fiel für das betreffende Jahr, eher untypisch, also positiv aus.<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 69
3.3.1.8 Terra Geographie, 1979<br />
Der erste Band des Lehrmittels "Terra Geographie" beschäftigt sich im Zusammenhang mit der Entwicklungs-<br />
hilfe unter dem Titel "Ochsenpflüge für Ghana" mit der ehemaligen Goldküste. Die Seite 172 bildet die drei<br />
Fotos "Traditionelle Ackerbestellung mit der Hacke", eine Frau, welche ihr Kind auf dem Rücken trägt, bear-<br />
beitet das Feld in gebeugter Stellung; "Deutsches Entwicklungsprojekt: Pflügen mit Ochsen", ein Weisser läuft<br />
neben einem Schwarzen her, der den Pflug führt, und "Moderne Ackerbestellung mit dem Traktor". Im Text<br />
schreibt der Autor auf der Seite 172:<br />
Mit einer Hacke und in gebückter Haltung - so haben die Bauern im Norden Ghanas seit Jahrhunderten ihre Äcker bestellt.<br />
Sie sind Hackbauern. Mit der Hacke kann eine Familie etwa 2 ha bearbeiten. Ein Traktor dagegen würde Kraft sparen<br />
helfen und ein Vielfaches schaffen. Nur... Ein Traktor mag für einen Grossbauern lohnend sein. Für einen Kleinbauern hat<br />
er zu viele Nachteile. Aber gerade die Kleinbauern brauchen Entwicklungshilfe am dringendsten. Von den über 10 Mio.<br />
Einwohnern Ghanas leben fast 7 Mio. auf dem Land, die Mehrzahl von ihnen in kleinbäuerlichen Familien. Nur wenn sich<br />
auch ihre Lebensverhältnisse verbessern, wird man von einer echten Entwicklung sprechen können.<br />
Für die Kleinbauern bedeutet ein Ochsengespann mit einem Eisenpflug bereits einen gewaltigen technischen Fortschritt.<br />
Ochsenpaar und Pflug kosten etwa 1'500 DM. Das ist viel Geld. Aber jetzt kann eine Bauernfamilie dreimal soviel Fläche<br />
bestellen wie früher mit der Hacke. Sie erzeugt jetzt so viele Nahrungsmittel, dass sie sogar etwas verkaufen kann.<br />
Entgegen dem Eindruck, den der Text vermitteln mag, sind es gerade die Kleinbauern in Afrika, welche als<br />
Basis aller Entwicklung dienen, d.h. ihre Leistung ermöglicht oft erst die Entwicklung in den Städten. Zur Idee<br />
der Umstellung auf den Pflug ist anzumerken, dass er von der Mehrzahl der Kleinbauern bis heute nicht<br />
bezahlt werden könnte; das Durchschnittseinkommen in Ghana liegt je nach Angaben bei rund 700 Franken<br />
pro Jahr, wobei viele Kleinbauern wohl eher über weniger als 200 Franken pro Jahr verfügen dürften<br />
Zwei weitere Erwähnungen Ghanas finden sich auf der Seite 188, die ein Grafik "Menschen pro Arzt" zeigt, in<br />
der für Ghana ein Wert von 18'000 MpA angegeben wird, und auf der Seite 189, die eine Grafik "Menschen<br />
pro Krankenbett" abbildet, die für Ghana einen Wert von ca. 800 MpK angibt.<br />
3.3.1.9 Musikstudio (1980-1982)<br />
Der Band 2 des Lehrmittels "Musikstudio" zeigt auf der Seite 21 ein Foto "Ewe-Orchester". Im Text schreibt<br />
der Autor unter der Überschrift "Musik im Leben der Stammesgemeinschaft":<br />
Die Liedtexte wurzeln oft im persönlichen Erleben. Bei den Akan in Ghana verbreitete sich ein Wiegenlied, das davon<br />
erzählt, wie zwei Frauen eines bestimmten Mannes gleichzeitig Babies erwarteten. Seiner Favoritin liess der Mann "Fleisch<br />
und Salz", Symbole des Überflusses, zukommen, während die Nebenfrau von Kokojamsblättern leben musste. Trotzdem<br />
brachte sei ein grosses, kräftiges Kind zur Welt, dem sie triumphierend folgendes Wiegenlied sang: "Du Kind von<br />
Kokojamsblättern rund und kräftig. Das Kind von Fleisch und Salz ist schwach und mager."<br />
Die Akan Ghanas, eine ganze Gruppe von Völkern, leben im Regenwald und der Feuchtsavannenzone. Da in<br />
diesen Gebieten keine Rinderhaltung möglich ist, gehört Fleisch zu den "Luxusgütern". Auch Salz ist Mangel-<br />
ware, denn es muss entweder aus den Lagunen an der Küste oder den noch viel weiter entfernten Salzminen<br />
aus dem nördlichen Landesinnern herbeigeführt werden. Zwar gibt es unterdessen natürlich auch Salz in der<br />
aus Europa gewohnten Form zu kaufen, doch ist dies auch nicht preiswerter als das auf dem Markt angebotene<br />
Salz. Trotzdem hat das Salz seit dem 16. Jh., als es in "Gold aufgewogen" wurde, viel von seinem heutigen<br />
Wert verloren.<br />
3.3.1.10 Seydlitz: Mensch und Raum, 1983-1984<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
Der erste Band des Lehrmittels "Seydlitz: Mensch und Raum" beschäftigt sich unter dem Titel "Holz aus<br />
Ghana - Holz für den Export" mit der Holzgewinnung im tropischen Regenwald: Die Seite 26 zeigt zwei Fotos<br />
"Holzfäller bei der Arbeit" und "Schleppen der Stämme zum Sammelplatz", sowie eine Tabelle "Einschlag und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 70
Verwendung von Holz". (Diese wird auf der Seite 328 dieser Arbeit wiedergegeben.) Im Text schreibt der<br />
Autor dazu:<br />
Bereits seit der Zeit, als das Gebiet der Republik Ghana noch britische Kolonie war, sind Edelhölzer ein wichtiger<br />
Exportartikel dieses Landes. Sie werden zumeist als unverarbeitetes Rundholz in andere Staaten verkauft.<br />
Allerdings ist der Einschlag von Holz im tropischen Regenwald immer damit verbunden, dass man grosse Schwierigkeiten<br />
überwinden und schwerwiegende Nachteile in Kauf nehmen muss...<br />
Nach der Aufzählung einiger dieser Schwierigkeiten, gibt der Autor auf der Seite 27 ein "Interview mit dem<br />
Vertreter des Wirtschaftsministeriums von Ghana" wieder:<br />
"In Ihrem Land ist genauso wie in anderen Staaten der Dritten Welt lange Raubbau am Wald getrieben worden. Welche<br />
Ursachen hatte dies?"<br />
"Diese Entwicklung, die allen afrikanischen Staaten grosse Sorgen bereitet, hat heute verschiedene Gründe. Hier möchte<br />
ich nur den wichtigsten erwähnen. Wie alle Entwicklungsländer sind wir gezwungen, Rohstoffe zu verkaufen, weil wir<br />
kaum eigene Industrien besitzen, um diese Rohstoffe weiterverarbeiten zu können. Unsere Importe können wir daher nur<br />
mit den Erlösen aus dem Export von Kakao, Holz, Gold, Bauxit und anderen Rohstoffen bezahlen. "<br />
"Es gibt heute schon Staaten, die bestimmte Edelholzarten nicht mehr exportieren, weil die Vorräte erschöpft sind."<br />
" Wenn wir nichts unternehmen würden, dann könnte das in naher Zukunft auch bei uns geschehen. Deshalb versuchen wir<br />
vorzubeugen. Vor ein paar Jahren haben wir begonnen, auf Rodungsflächen Holzplantagen anzulegen, die ausschliesslich<br />
mit einer Baumart bepflanzt wurden. Man muss nach dem Pflanzen sehr darauf achten, dass die Nährstoffe nicht durch die<br />
Regenfälle aus dem Boden ausgewaschen werden. Deshalb haben wir schnellwachsende Sträucher zwischen die<br />
Baumreihen gepflanzt, um so auch für zusätzliche Nährstoffe zu sorgen. Allerdings haben wir inzwischen festgestellt, dass<br />
das Wachstum der Bäume etwas langsamer ist als im Urwald und dass sie gegen Schädlinge anfälliger sind."<br />
"Man muss wohl die Ergebnisse abwarten?"<br />
"Ja, gegenwärtig haben unsere Forstexperten den Eindruck, dass diese Art der Forstwirtschaft in den Tropen nicht sehr<br />
erfolgreich sein kann. Sie versprechen sich mehr davon, wenn sie die natürliche Verjüngung der Edelhölzer im Urwald<br />
unterstützen. Man kann das Wachstum der Bäume dadurch fördern, dass man einige in der Nähe stehende Bäume fällt,<br />
damit die Nutzbäume mehr Licht bekommen. Auch kann man die Bäume von würgenden Lianen und Schmarotzern<br />
befreien und das umstehende Buschwerk niedrig halten."<br />
Neben der Tatsache, dass hier der Vertreter der ghanaischen Regierung zu Wort kommt, erwähnt der Autor<br />
auch die landwirtschaftliche Forschung des Landes. Die im Interview erwähnten Ansätze konnten allerdings<br />
nur zum Teil umgesetzt werden.<br />
Noch 1990 zitierte Geo einen internen Bericht des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhäuser von 1989 über das<br />
damals als wichtigsten Lieferanten für tropisches Rundholz geltende Ghana, in dem es hiess: "Die Holzhan-<br />
delsbeziehungen zwischen Ghana und der Bundesrepublik Deutschland haben sich seit Jahrzehnten recht posi-<br />
tiv entwickelt... Der Wald wird in keiner Weise geschädigt... Der Einschlag im ghanaischen Wald wird von<br />
der zuständigen Forstverwaltung streng kontrolliert." Der Autor des Artikels, Werner Paczian, kommt aller-<br />
dings zu dem Schluss, dass die im Bericht gemachten Aussagen nicht der Wahrheit entsprächen, da es "gängi-<br />
ge Praxis... gewesen" sei, "Hölzer geringeren als den tatsächlichen Güteklassen zuzuordnen, Arten falsch<br />
auszustellen und Doppelrechnungen auszustellen". (Geo 3/1990, S. 56-58)<br />
3.3.1.11 Geographie der Kontinente, 1984<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
Oskar Bärs "Geographie der Kontinente" widmet sich im Kapitel "Bei einem Kakaopflanzer in Ghana" der<br />
ehemaligen Goldküste. Dabei verwickelt er sich neben der eigentlich sachlichen Darstellung des Themas teil-<br />
weise aber auch in Widersprüche. "Ghana ist der wichtigste Kakaoproduzent der Erde" lautet der die Thematik<br />
einleitende Satz auf der Seite 52. Einer auf Seite 53 abgedruckten Tabelle ist aber zu entnehmen, dass die<br />
Kakaoproduktion in den siebziger Jahren in Ghana laufend abgenommen hat, während sie im Nachbarland, der<br />
Elfenbeinküste enorm zugenommen hat, so dass für das Jahr 1980 Ghana nach der Elfenbeinküste und Brasi-<br />
lien erst auf Platz 3 der Kakaoproduzenten auftritt. Seit dem Erscheinen des Buches hat die Bedeutung des<br />
Kakaos als Exportgut in Ghana weiterhin abgenommen. Inzwischen ist das am meisten Devisen einbringende<br />
Exportgut wieder Gold, das Ghana jahrhundertelang als Goldküste bekannt machte. Trotzdem bleibt der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 71
Kakaoanbau für viele Kleinbauern des Südens von Ghana von Bedeutung. Bär lässt einen dieser Kleinbauern,<br />
Herrn Buabang, auf Seite 52 selbst zu Wort kommen:<br />
"Meine Kakaopflanzung ist mit ihren gut 10 ha eine der grössten der Region. Wir sehen von hier aus gut, wie das Gelände<br />
gegen den Fetentaa-Fluss hin leicht abfällt. Das erste Feld wurde 1960 im obersten Hangabschnitt, hier gerade unter uns,<br />
noch in der Nähe des Hauses angelegt. Weitere Rodungen erfolgten dann in mehr oder weniger regelmässigen<br />
Zeitabständen hangabwärts. Stets wurde der Wald im November gerodet und das Holz im Januar verbrannt. Grosskronige<br />
Bäume liessen wir als Schattenspender für die jungen Kakaobäume meist stehen, denn der Kakaobaum stammt aus der<br />
untersten Baumschicht des ursprünglichen Regenwaldes. Die Bäumchen wurden jeweils in den Monaten März und April<br />
gesetzt. In die Zwischenraume pflanzten wir - als zusätzliche Schattenspender und zugleich zur Eigenversorgung - immer<br />
zugleich Bananen und Knollenfrüchte wie Taro oder Yams. Leider nahm 1974 ein fünf Jahre vorher angelegtes Kakaofeld<br />
durch das Feuer der Brandrodung eines Nachbarn so stark Schaden, dass es in der Folge aufgegeben werden musste. Es<br />
wurde später mit Kaffeebäumen bepflanzt. Sie wissen ja: Kaffee bildet in dieser Gegend häufig das zweite Marktprodukt.<br />
Auf den schlechteren Böden um das Farmhaus, gleich hinter uns, wachsen heute auch kleinere Ananaskulturen. Unser<br />
'Garten', das Feld, auf dem Mais, Taro und Yams für unseren eigenen Bedarf gepflanzt wird, muss jeweils nach zwei bis<br />
drei Jahren verlegt werden, da dann der Boden bereits so erschöpft ist, dass die Erträge zu klein ausfallen. Wir nennen hier<br />
dieses Anbausystem Landrotation.<br />
Nach dieser eingehenden Beschreibung seiner Kakaopflanzung führt Herr Buabang mit seinem Bericht fort:<br />
Nun werden Sie natürlich wissen wollen, wie die Arbeit während des Jahres hier abläuft. Meine Familie und meine sechs<br />
Angestellten - z.T. ebenfalls mit ihren Familien - besorgen alle Arbeiten, die im Laufe des Jahres zu erledigen sind, vom<br />
Roden über das ständige Jäten bis zur Ernte, ihrer Verarbeitung und zur Neupflanzung. Sie erhalten dafür als Entlöhnung<br />
einen Drittel des gesamten Ertrags und natürlich die hier ebenfalls erzeugten Nahrungsmittel. Während der Arbeitsspitzen<br />
zur Erntezeit können wir stets auch auf die Hilfe benachbarter Farmer zählen. Dies beruht natürlich auf Gegenseitigkeit...<br />
... Der Ablauf der Arbeiten ist nicht von Jahr zu Jahr ganz gleich. Er hängt von den Launen des Wetters, vor allem von der<br />
Verteilung der Niederschläge ab. Die beiden Erntezeiten bilden stets die Höhepunkte. d.h. die arbeitsreichste Zeit des<br />
Jahres. Die Männer schlagen täglich die gerade reif gewordenen Früchte mit den Haumessern von den Bäumen. und die<br />
Frauen tragen sie in Körben auf den Arbeitsplatz hinter dem Haus. Dort schlagen einige der Männer die Früchte mit dem<br />
Messer entzwei, worauf Frauen und Kinder mit den Fingern die Kakaobohnen herauslösen und von Verunreinigungen<br />
trennen. In jeder Frucht stecken 30 bis 50 fast weisse Bohnen. Diese werden dann zum Gären (Fermentieren) zwischen<br />
Bananenblättern zu einem Haufen aufgeschichtet und mit Holzstücken beschwert. Durch das Fermentieren werden die<br />
Bohnen braun und entwickeln das Schokoladearoma. Nach sechs Tagen breitet man sie auf Holzgestellen zum Trocknen<br />
aus. Damit sie von der Sonne gleichmässig beschienen werden, dreht man sie mit hölzernen Rechen häufig um und deckt<br />
sie bei Regenschauern und natürlich über Nacht sorgfältig zu. Aus ihrer langen Erfahrung wissen die Arbeiter, wann die<br />
Bohnen so weit getrocknet sind, dass sich die Schale gut vom innern Kern trennen lässt. Das Trocknen dauert je nach<br />
Wetter etwa zwei Wochen. Während der ganzen Zeit liest man immer wieder schlechte Ware heraus und trennt<br />
zusammengeklebte Bohnen. Das fertige Erntegut wird schliesslich in Säcke abgefüllt und bis zum Abtransport im<br />
Lagerraum aufbewahrt.<br />
Wie beschrieben ist die Kakaobohnengewinnung ein sehr arbeitsintensiver <strong>Pro</strong>zess. Herr Buabang fährt fort,<br />
die grösseren Zusammenhänge schildernd:<br />
Die gesamte Ernte wird mit Lastwagen nach dem 25 km entfernten Marktort Berekum gefahren. wo sie von der Einkaufsund<br />
Verarbeitungsgenossenschaft noch etwas weiter behandelt werden muss. Wir haben unsere Erträge in den letzten<br />
Jahren ständig etwas erhöhen können. Im vergangenen Jahr ernteten wir erstmals 200 Säcke Kakaobohnen zu je 27 kg.<br />
Aber wir sollten noch mehr produzieren! Denn alles, was wir kaufen müssen, Gegenstände aus der Stadt, Geräte für das<br />
Haus, Benzin und Nahrungsmittel, ist in den letzten Jahren sprunghaft teurer geworden. Auch die Steuern, das Schulgeld<br />
für die Kinder sowie die Kosten für ihre Kleider sind gestiegen. Für unseren Kakao aber erhalten wir seit Jahren gleich viel,<br />
oder, wenn ich mich recht erinnere, sogar etwas weniger. Die Zwischenhändler an der Küste machen zu grosse Gewinneund<br />
die Weltmarktpreise werden nicht in unserem Land festgesetzt. Wir arbeiten heute für jeden Gegenstand, den wir<br />
drunten kaufen, fast doppelt so lang wie vor 15 Jahren. Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als nochmals Wald<br />
zu roden und noch mehr Kakaobäume zu pflanzen. Junge Bäumchen brauchen aber mindestens fünf Jahre, bis sie erste<br />
Früchte tragen. Was machen wir bis dahin, und wie wird meine Rechnung dann aussehen? Hoffentlich bleiben wir<br />
wenigstens von der Pflanzenkrankheit verschont, die Ghanas Kakaopflanzungen seit einigen Jahren heimsucht und bei der<br />
Wurzeln und Blätter der Bäume absterben. Über 100 Mio. Bäume mussten deswegen schon geschlagen werden."<br />
(Berekum liegt etwa 120 km nordöstlich von Kumasi und ist über eine Überlandstrasse relativ gut zu errei-<br />
chen. Von Kumasi aus bestehen Bahnverbindungen nach Accra und Sekondi-Takoradi, einem Küstenhafen.)<br />
Zusätzlich enthalten die beiden Seiten mehrere Fotos, von denen zwei ghanaische Bauern bei der Arbeit<br />
zeigen: "Öffnen der Kakaofrüchte" und "Trocknen der Kakaobohnen".<br />
3.3.1.12 Mensch und Raum, 1983-1986<br />
Auch der erste Band des Lehrmittels "Mensch und Raum" beschäftigt sich mit dem Thema "Kakao aus<br />
Ghana". Auf der Seite 78f., die auch eine Klimatabelle für Kumasi und ein Foto "Trocknen der Kakaobohnen"<br />
abbildet, schreibt der Autor:<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
...Europäer brachten Kakaopflanzen in das tropische Afrika... In Ghana wird der meiste Kakao in kleinen bäuerlichen<br />
Betrieben angebaut. Die 200'000 selbständigen Kakaobauern besitzen oft weniger als 4 ha Land. Kakao bringt höhere<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 72
Preise als Gemüse und Obst. Weitgehend für den eigenen Bedarf erzeugen sie Knollenfrüchte (Maniok, Yams, Taro), Mais,<br />
Mehlbananen und Gemüse. Die Frauen bearbeiten die kleinen Felder (Beete) mit der Hacke. Man kann hier das ganze Jahr<br />
über säen, pflanzen und ernten.<br />
Die Anlage einer Kakao-Pflanzung erfordert sehr viel Mühe. Die Bauern müssen zunächst den dichten Wald roden. Sie<br />
schlagen das Unterholz und Strauchwerk ab und fällen fast alle Bäume. Das trockene Holz wird verbrannt.<br />
Der Kakao ist eine Pflanze aus dem dunklen, unteren Stockwerk des tropischen Waldes. Schattenbäume müssen die<br />
empfindlichen Kakaobäume vor zuviel Sonnenlicht und zu starkem Wind schützen. Deshalb haben die Bauern beim Roden<br />
nicht alle Bäume gefällt. Als weitere Schattenspender pflanzen sie ausserdem noch Mehlbananen an. Das sind hohe<br />
Stauden. Sie liefern ein wichtiges Nahrungsmittel.<br />
Zu Beginn der Regenzeit werden die Kakaosetzlinge gepflanzt. Etwa fünf Jahre dauert es, bis die Kakaosträucher die<br />
ersten Früchte tragen. Während dieser Zeit muss der Bauer die Sträucher häufig beschneiden, ständig das Unkraut<br />
beseitigen und immer darauf achten, dass genügend Schatten vorhanden ist. Ein Kakaostrauch kann etwa 50 Jahre Früchte<br />
tragen. Dann ist der Boden ausgelaugt. Neue Kakaosträucher müssen an anderen Stellen gepflanzt werden. Auf dem<br />
brachliegenden Land wächst wieder Wald.<br />
Im November beginnt im Süden Ghanas die lange Trockenzeit. Sie dauert bis Ende Februar. In diesen Monaten wird hier<br />
der meiste Kakao geerntet. Die Ernte erfordert sehr viele Arbeitskräfte. Die Bauern ziehen mit der ganzen Familie auf die<br />
Felder. Mit einem Haumesser schlagen die Männer die Früchte ab... Frauen und Kinder sammeln sie vom Boden auf und<br />
tragen sie zu einem Sammelplatz ins Dorf. Dort brechen andere Männer die Früchte mit einem Messerschlag auf. Sie<br />
dürfen dabei die Samen im Innern, die Kakaobohnen, nicht beschädigen. Frauen und Mädchen lösen die 30 bis 40 Bohnen<br />
aus dem weichen Fruchtfleisch heraus.<br />
Der letzte Abschnitt des Textes findet sich im gleichen Wortlaut schon im Lehrmittel "Dreimal um die Erde"<br />
von 1977-1980 (Bd. 1, S. 95) und wird deshalb hier nicht noch einmal wiedergegeben. Nebst dem Text enthält<br />
die Seite 79 eine Karte Ghanas, in der die Kakaoanbaugebiete und der tropische Regenwald eingezeichnet<br />
sind, eine Tabelle "Ausfuhr von Kakao..." mit Angaben von 1980 und ein Foto "Kakaoernte in Ghana",<br />
welches das Abschlagen der Früchte mit dem Haumesser zeigt.<br />
3.3.1.13 Seydlitz: Mensch und Raum, 1987<br />
Das Lehrmittel "Seydlitz: Mensch und Raum" erwähnt Ghana zweimal: Auf der Seite 110 schreibt der Autor,<br />
"in Ghana sei Kakao favorisiert worden", auf der Seite 299 wird der Exportanteil von Kakao für Ghana mit<br />
76% beziffert, während eine Tabelle zu den "Terms of Trade" für Ghana nach dem Rekordjahr von 1978 mit<br />
einem Wert von 193%, 1981 nur noch einen Wert von 75% im Vergleich zum Referenzjahr 1975 angibt.<br />
3.3.1.14 Singen Musik (1992)<br />
Der Band 4 "Experimente" des Lehrmittels "Singen Musik" enthält auf den Seiten 33-35 das Lied "Tu! Tu!<br />
Gbovi" von W. K. Amoaku. Die Melodie des Liedes ist in ganz Ghana als Kinderlied mit unterschiedlicher<br />
Textunterlegung bekannt.<br />
3.3.1.15 Klangwelt-Weltklang 2, 1993<br />
Im Musiklehrmittel "Klangwelt-Weltklang" kommt auf der Seite 26 ein Musiker unter der Überschrift "Lucas<br />
'Mkanlangu': Als Trommelschüler in Ghana" zu Wort:<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
...Die Trommel spricht, führt die Tänzer oder folgt dem Tanz. Die Trommel drückt Freude aus, andererseits ist die<br />
Trommel etwas sehr Würdevolles. Sie kann beten! Ein Trommelvers aus Ghana sagt, ein Häuptling ohne Trommler sei<br />
keiner. Vor der Kolonialisierung liess der Aschantikönig sogar Gerichtsurteile über die Trommel verkünden. Afrikanische<br />
Sprachen haben die Eigenart, dass erst die Tonhöhe die Bedeutung von Wörtern endgültig festlegt. Die Tonhöhenmelodien<br />
werden vom Spieler der Talking drum nachgeahmt...<br />
Als Musikbeispiel führt der Autor ein Beispiel der "Haussa-Talking drum", die im Norden Ghanas verbreitet<br />
ist, an: "Die Schildkröte hat einen harten Panzer. Wer Pfeile auf sie schiesst, ärgert sich nur selbst."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 73
3.3.1.16 Musik hören, machen, verstehen, 1990-1995<br />
Der dritte Band des Lehrmittels "Musik hören, machen, verstehen" stellt auf der Seite 116 den Gigbo vor,<br />
einen traditionellen Tanz aus Ghana. Dazu sind die Noten eines Begleitarrangements abgedruckt, ebenso wie<br />
ein Foto, der in dieser Musik aus Ghana verwendeten "Oblente-Drums". Im Text schreibt der Autor:<br />
Der "Gigbo" ist ein traditioneller Tanz, der in Ghana bei bestimmten sozialen Anlässen aufgeführt wurde. Er stammt aus<br />
Liberia und wurde schon im 19. Jahrhundert in Ghana populär...<br />
Die Seite 117 zeigt ein Foto "Der Master-Drummer Aja-Addy mit einer Talking Drum". Der abgebildete Musi-<br />
ker wird im Lehrerband 3 zum Lehrmittel zitiert (siehe weiter unten).<br />
Die Seite 118 druckt ein Stück "N'ike N'ike" ab, dazu schreibt der Autor:<br />
Das Gigbo-Arrangement wird in dieser oder in variierter Form gerne als Begleitung zum sogenannten Highlife gespielt.<br />
Highlife ist ein Tanzstil und eine Musik, die in den 50er und 60er Jahren zur beliebtesten Tanzmusik in Westafrika,<br />
insbesondere in Ghana und Nigeria, wurde...<br />
Auf der Seite 104 des Lehrerbandes 3 der wird im Schülerband 3 auf der Seite 117 abgebildete ghanaische<br />
Meistertrommlers Aja Addy näher vorgestellt:<br />
...Er ist ein inzwischen auch in Europa berühmter Master-Drummer aus dem Volk der Ga in Ghana. Gleichzeitig ist Aja<br />
Addy Priester der Tigari-Religion, einer traditionellen afrikanischen Religion. Seine Musik ist für ihn viel mehr als nur<br />
Unterhaltung. Sie hat für ihn spirituelle, wir würden sagen philosophische Bedeutung. Aja Addy hat die Philosophie seiner<br />
Musik selbst in Worte gefasst:<br />
"Geduld geht verloren in einer Welt mit einer ständig wachsenden Informationsmenge. Die Menschen verlieren sich in<br />
ihrer eigenen Unruhe und Ungeduld. Musik kann eine heilende Kraft sein, um die Kraft der Geduld wiederzuentdecken.<br />
Du kannst Deinen Körper zur Musik bewegen und augenblicklich beginnst Du Dich zu entspannen. Augenblicklich<br />
empfindest Du Glück.<br />
Wenn ich mehr als zwei Tage lang keine Trommel gespielt habe oder mindestens Musik gehört habe, beginne ich, krank zu<br />
werden. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Mein Grossvater war Priester und mein Vater war ein Trommler. Als<br />
Tigari-Priester weiss ich, dass Musik Medizin ist. Lausche der Musik! Fang' an zu lächeln, und Geduld kommt<br />
unwillkürlich zu Dir zurück. Die Kraft der Musik, des Rhythmus und des Tanzes bereitet Dir den Weg zur Geduld".<br />
In den Anmerkungen zum im Schülerband 3 auf der Seite 118 vorgestellten Lied "N'ike N'ike" schreibt der<br />
Autor auf der Seite 104 zum Thema "Highlife":<br />
...Erst in den 50er und 60er Jahren entwickelte sich daraus eine spezifische schwarz-afrikanische Tanzmusik. Wegbereiter<br />
war E.T. Mensah mit seiner Tempos Band (in Ghana)...<br />
Trotz der Vielzahl von regionalen Ausprägungen blieben diese beiden Hauptformen bis heute stilprägend:<br />
1. Tanz-Bands, in denen die Bläser (Saxophone, Trompeten, Posaunen) dominierten. Ihr Stil ist westlich orientiert mit<br />
starken Einflüssen der afro-kubanischen Tanzmusik...<br />
2. Gitarrenbands, die in der Rhythmik, Melodik, vor allem auch in der Besetzung (afrikanische Perkussion) aber auch der<br />
Spielweise der Instrumente roots-orientierter waren...<br />
Der Highlife-Tanzschritt ist aufgrund der Tatsache, dass er zunächst nur von der Upper Class getanzt wurde, sehr 'cool'.<br />
Ruhige Bewegungen des Oberkörpers, Kopf hoch, Blick nach vorne, kleine Schritte in den Füssen...<br />
In Ghana gehört der Highlife immer noch zu den beliebtesten Tanzformen, vor allem der älteren Leute in den<br />
Städten. Die Jugend orientiert sich zunehmend an den aus Amerika kommenden neueren Tanzformen. Nach<br />
wie vor gehört es aber zur Pflicht eines Teilnehmers der in Ghana beliebten "Dancing contests", die von<br />
verschiedenen Firmen, teilweise landesweit durchgeführt werden, neben einer freien Vorführung des Könnens,<br />
einen Highlife mit obligatem Taschentuch und meist in der traditionellen Kleidung der Aschanti aufzuführen.<br />
3.3.1.17 Seydlitz: Geographie, 1994-1996<br />
Der vierte Band des Lehrmittels "Seydlitz: Geographie" gibt auf der Seite 179 zum Sklavenhandel einen<br />
kurzen Text "Tauschwert eines Sklaven" über die damaligen Ankaufspreise in Ghana wieder:<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
In Christiansborg (Ghana) kostete im Jahre 1750 ein "Mannsklave" in besten ohne Fehl" den Gegenwert von 1920 Mark.<br />
Dafür durften sich die "Lieferanten" aussuchen: "2 Flinten, 40 Pfund Schiesspulver, 30 Liter Branntwein, 1 Stück Kattun, 4<br />
Stück ostindisches Gewebe, 4 Stück grobe schlesische Leinwand, 2 Stangen Eisen, 1 Stange Kupfer, 160 Stück Korallen,<br />
20 Pfund Kaurimuscheln, 1 Zinnschale."<br />
Die Kaurimuscheln waren deshalb begehrt, weil sie teilweise als Währung benutzt wurden. Oft wurden die<br />
versklavten Schwarzafrikaner wochenlang in enge Verliesse eingesperrt, bevor sie auf ein Schiff verfrachtet<br />
wurden und dort die lange Reise nach Übersee antraten. Das Elmina Castle in der Nähe von Cape Coast dient<br />
heute als Museum, in dem der Besucher versuchen kann, sich ein Bild der damaligen Zustände zu machen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 74
3.3.1.18 Zusammenfassung<br />
Eine Zusammenfassung der vermittelten Ansichten und Aspekte zu Ghana im 20. Jahrhundert findet sich im<br />
Teil "Ergebnisse der Untersuchung" unter dem Untertitel "Ghana" auf der Seite 519 im Kapitel "Genannte<br />
Länder" dieser Arbeit.<br />
3.3.2 Krieg<br />
Der zweite Themenkreis soll sich mit der Darstellung der Kriege in Schwarzafrikas und dem kriegerischen<br />
Verhalten der dort lebenden Völker beschäftigen. Bei der Betrachtung stehen dabei die Konflikte zwischen<br />
schwarzafrikanischen Nationen, Bürgerkriege und die während der Kolonialzeit geführten Widerstands- und<br />
Eroberungskämpfe im Zentrum der Betrachtung. Die Auswirkungen des Sklavenhandels und der beiden Welt-<br />
kriege auf Schwarzafrika hingegen sollen nur am Rande in die Betrachtung einfliessen.<br />
3.3.2.1 Lesebuch für die Oberklassen, 30er Jahre<br />
Das "Lesebuch für die Oberklasse" beschreibt als erstes der untersuchten Lehrmittel kriegerische Konflikte in<br />
Schwarzafrika. Auf der Seite 369 schreibt der Autor über die Völker Afrikas:<br />
Die Stämme leben häufig in Fehde miteinander. Die Kriege führen sie mit wilder Grausamkeit. Manche Gegenden, die<br />
einst ein Bild friedlichen Lebens boten, sind so zu menschenleeren, verwilderten Gebieten geworden. Besonders schlimm<br />
hausten früher die arabischen Sklavenjäger. Bis ins Innerste Afrikas drangen diese Räuber vor und brachten Schrecken,<br />
Elend und Tod in die Negerdörfer. Seitdem die Europäer von Afrika Besitz genommen haben, ist diesen Menschenjagden<br />
ein Ende gemacht worden.<br />
Neusch differenziert nicht zwischen den verschiedenen Volksgruppen, beispielsweise den eher einer kriegeri-<br />
schen Tradition verpflichteten Nomaden, die schon seit mehreren hundert Jahren immer wieder eine Bedro-<br />
hung für den Handel im ganzen Sudan darstellten, und den sesshaften und oft friedlicheren Bauernvölker.<br />
Auch ist die Bezeichnung "wilde Grausamkeit" für die in Schwarzafrika damals geführten Kleinkriege und<br />
Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen im Anbetracht des in Europa damals gerade erst<br />
überstandenen Ersten Weltkrieges und seiner Greuel unangebracht.<br />
Als Verleugnung der Geschichte mutet im Anbetracht der tatsächlichen Geschehnisse der vom Autor vermit-<br />
telte Eindruck an, die Europäer hätten den Kontinent befriedet, unter der Kolonialherrschaft sei vieles besser<br />
geworden. Die Kolonisation durch die Europäer führte in vielen Gegenden Schwarzafrikas zu Aufständen<br />
gegen die Eroberer, Elend und in einigen Fällen zur teilweisen Vernichtung von ganzen Völkern.<br />
3.3.2.2 Leitfaden für den Geographieunterricht, 1934<br />
Im "Leitfaden für den Geographieunterricht" findet sich nur eine Stelle auf der Seite 116 in der es heisst, dass<br />
die steppenbewohnenden "mohammedanischen Mischvölker, Somali und Massai... kriegerische Viehzüchter"<br />
seien. Diese Behauptung trifft heute noch zumindest teilweise zu, denn obwohl sich viele dieser Völker unter-<br />
dessen aus Zwang oder freiem Willen der westlichen Zivilisation zumindest teilweise angeglichen haben,<br />
kommt es zwischen ihnen immer wieder zu Auseinandersetzungen um Land, Wasser und Vieh.<br />
3.3.2.3 Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen, 1961<br />
Hermann Baumann beschreibt in "Harms Erdkunde" auf der Seite 269 im Kapitel "Kunst in Benin" den<br />
Königspalast des historischen Reiches Benin:<br />
Einführung: Themenkreis Ghana<br />
Das mit Palmblättern bedeckte Dach ruht auf hölzernen Säulen, die von unten bis oben mit Messing (d. h. Bronzeplatten)<br />
belegt waren, "darauf ihre Kriegstaten und Feldschlachten abgebildet sind"...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 75
Damit weisst Baumann darauf hin, dass auch in Schwarzafrika "Feldschlachten" nicht unbekannt waren, ohne<br />
jedoch von wilden Grausamkeiten zu sprechen.<br />
Einen weiteren Aspekt spricht das Lehrmittel im Kapitel "Amos Tutuola: Ein schwarzer Dichter" auf Seite 303<br />
an, indem Janheinz Jahn über den Dichter schreibt, er habe "drei Jahre lang während des Krieges in der Royal<br />
Air Force in Nigeria" Dienst geleistet. Eine Bemerkung die Zeuge davon ablegt, dass auch Schwarzafrika nicht<br />
von den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges verschont blieb.<br />
3.3.2.4 Geographie Widrig, 1967<br />
Widrig äusserst sich weit weniger nüchtern über die Auseinandersetzungen zwischen schwarzafrikanischen<br />
Völkern und unterstellt diesen nicht nur, ständig Krieg gegeneinander geführt zu haben, sondern bezichtigt sie<br />
auf der Seite 303 gleich auch noch der "Menschenfresserei":<br />
...Indem Sklaven, gefangene Feinde und Hexer getötet und den Geistern als Opfer dargebracht wurden, gelangten deren<br />
Teile auch in die Bratpfanne oder an den Spiess, wobei es nurmehr ein kleiner Schritt war, die Getöteten nach bestimmten<br />
Vorschriften zu verzehren. Die Menschenfresserei und die ständigen Kriege haben zur ungewöhnlichen Entvölkerung<br />
weiter Gebiete Afrikas wesentlich beigetragen.<br />
Auf den Vorwurf der Menschenfresserei soll hier nicht weiter eingegangen werden, da er eingehender an ande-<br />
rer Stelle dieser Arbeit diskutiert wird. Was nun Widrigs letzten Satz angeht, die "Menschenfresserei und die<br />
ständigen Kriege" hätten "zur ungewöhnlichen Entvölkerung weiter Gebiete Afrikas wesentlich beigetragen"<br />
so kann dies wohl nur als eine bewusste Lüge betrachtet werden, die einerseits den Afrikaner als "Unmensch"<br />
darzustellen, andererseits die eigene düstere Vergangenheit des "Sklavenhandels" zu vertuschen versucht, denn<br />
weder ausschliesslich Kriege und schon gar nicht antrophage Praktiken haben zu einem Bevölkerungsrückgang<br />
beigetragen, sondern er wurde wesentlich mitbestimmt durch den über Jahrhunderte von den Europäern und<br />
Arabern praktizierten Menschenraub und die dadurch ausgelösten sozialen Umstrukturierungen. In der Kolo-<br />
nialzeit trugen dann die Zwangsarbeit und eingeschleppte Krankheiten mit dazu bei, dass das Bevölkerungs-<br />
wachstum entscheidend gehemmt wurde.<br />
3.3.2.5 Seydlitz für Realschulen, 1968<br />
Der Band 3 von "Seydlitz für Realschulen" spricht auf der Seite 30 unter der Überschrift "Die Republik Sudan"<br />
von "starken Spannungen" zwischen den "beiden Bevölkerungsgruppen" der Araber und der vornehmlich als<br />
Hackbauern tätigen "Negern".<br />
Diese Spannungen führen bis heute immer wieder zu Auseinandersetzungen, die zeitweise bürgerkriegsähnli-<br />
che Formen annehmen und zuletzt im Mai 1998 wieder die bekannten Bildern von flüchtenden Menschen mit<br />
Hungerbäuchen um die Welt gehen liessen, während die zu Hilfe eilenden humanitären Organisationen ihre<br />
Tätigkeit infolge der chaotischen Zustände stark einschränken mussten. Im August 1998 entschlossen sich die<br />
arabische Regierung und die schwarzafrikanischen Rebellengruppen unter dem zunehmenden internationalen<br />
Druck und vielleicht im Anbetracht der Notlage der im Süden des Landes lebenden Menschen zu Friedensges-<br />
prächen, deren Ausgang hinsichtlich einer friedlichen Lösung im Anbetracht der Geschichte dieses Gebietes<br />
aber angezweifelt werden darf.<br />
3.3.2.6 Länder und Völker, Ende 60er Jahre<br />
Das Lehrmittel "Länder und Völker" zeigt auf der Seite 26 des dritten Bandes die Zeichnung "Wadaikrieger<br />
mit wattierten Rüstungen". (Siehe dazu die Seite 194 dieser Arbeit.)<br />
Einführung: Themenkreis Krieg<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 76
Auf der Seite 65 beschreibt der Autor die Äthiopier als "stolz und kriegstüchtig", deren Staat "sich einst bis<br />
nach Arabien, Ägypten und Ostafrika" erstreckt habe. Zur neueren Geschichte des Landes schreibt der Autor<br />
auf der Seite 46:<br />
In dem Kriege mit Italien wurden viele Siedlungen zerstört...<br />
Die Eroberung Äthiopiens durch die Italiener 1935 wurde von vielen Afrikanern als Schlag gegen ihre Unab-<br />
hängigkeitsbemühungen angesehen, wurde doch dadurch das letzte "afrikanische" Land Kolonie einer europäi-<br />
schen Macht. Weiter berichtet der Autor:<br />
Die italienischen Ansiedler, die Amharafrauen heirateten, durften im Lande bleiben, da die Äthiopier ihre Aufbauarbeit zu<br />
würdigen wissen.<br />
Ein Beispiel für den pragmatischen Umgang der meisten schwarzafrikanischen Staaten mit den damaligen<br />
"Repräsentanten" der Kolonialmächte. Nur in sehr wenigen Staaten wurden die angesiedelten Europäer mit<br />
Gewalt des Landes verwiesen.<br />
3.3.2.7 Seydlitz für Gymnasien, 1963- ca. 1971<br />
Im fünfte Band des Lehrmittels "Seydlitz für Gymnasien" heisst es auf der Seite 109 über die Massai:<br />
Erfüllt von kriegerischem Geist, haben sie immer wieder die benachbarten Ackerbaugebiete angegriffen.<br />
Ende der neunziger Jahre haben sich viele Massai zwar einen Grossteil ihrer traditionellen Lebensweise erhal-<br />
ten können, von Kriegstaten und der Verstümmelung gegnerischer Kämpfer wissen aber nur noch die Ältesten<br />
der Massai aus eigener Erfahrung zu berichten. Die einstig stolze Kriegerkaste der Massai findet nur noch<br />
wenig neue Mitglieder, für die es längst nicht mehr aussergewöhnlich ist, eine Bar zu besuchen und eine<br />
Flasche Cola zu trinken.<br />
3.3.2.8 Fahr mit in die Welt, 1971-1974<br />
"Fahr mit in die Welt" lässt als erstes der untersuchten Lehrmittel auf der Seite 44 einen Schwarzafrikaner zu<br />
den Konflikten in Afrika zu Wort kommen.<br />
"Zeigt mit eurem Verhalten uns gegenüber sowohl in der Neuen wie der Alten Welt, dass ihr es annehmt und daran glaubt,<br />
dass wir alle die gleiche menschliche Natur haben. Dann können und wollen wir in Afrika antworten auf die ausgestreckte<br />
Hand; dann werden wir nicht bloss gemeinsam die <strong>Pro</strong>bleme Afrikas lösen, sondern durch die Bande der Freundschaft, der<br />
Bruderschaft werden wir einen neuen Weg entdecken, um eine Weltgemeinschaft zu schaffen, in der der Mensch ein<br />
reicheres, volleres Leben führt und frei ist vom Krieg und der unheimlichen Furcht vor der Vernichtung. Wir wollen alle<br />
mithelfen, eine Weltgemeinschaft von freien Menschen zu schaffen, die in Freiheit miteinander verbunden sind".<br />
Einerseits kommt in diesen Text eine afrikanische Sichtweise zur Geltung, andererseits hebt sich das abge-<br />
druckte Plädoyer stark vom Bild der unter sich zerstrittenen "Stämme Afrikas" ab.<br />
In einem Text mit dem Titel "Quer durch Ghana" auf der Seite 64 spricht der Autor von den "kriegerischen<br />
Aschantistämmen". Die Aschanti, die zahlenmässig grösste Volksgruppe des heutigen Staates Ghana, waren<br />
als kriegerisch verschrien, weil sie nicht nur über ein stehendes Heer verfügten, sondern es ihnen auch gelang,<br />
sich relativ lange gegen die Briten zu wehren, bevor sie niedergeworfen wurden. Selbst dann kam es immer<br />
wieder zu Aufständen. Die Residenz des Königs der Aschanti, Kumasi, wurde von den Briten dem Erdboden<br />
gleichgemacht und später im Kolonialstil wieder aufgebaut.<br />
Die Seite 65 zeigt ein Foto "Watussi beim Kriegstanz", die einen Kopfschmuck tragen - der dem Aussehen<br />
nach dem Bild aus dem Comic "Little Nemo" auf Seite 486 dieser Arbeit Pate gestanden haben könnte - und<br />
Speere in der Hand halten.<br />
Einführung: Themenkreis Krieg<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 77
3.3.2.9 List Geographie, 1972-1976<br />
Im Band 2 des Lehrmittels "List Geographie" zitiert der Autor auf der Seite 127 einen Zeitungsartikel aus dem<br />
Jahr 1976, der von "tiefverwurzelten ethnischen und historischen Gegensätzen" zwischen den hellhäutigen<br />
Nomaden und den sesshaften schwarzafrikanischen Bauern in Mali spricht:<br />
...Furcht und Abneigung sind historisch bedingt. Nicht vergessen ist jene Zeit, in der die Tuareg die Sudanneger wie Ware<br />
handelten. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein blieben die herrischen Wüstenreiter gefürchtete Sklavenjäger und -händler.<br />
Jahrhundertelang versorgten die Tuareg den arabischen Raum mit schwarzen Sklaven. Sie überfielen die Dörfer,<br />
verschleppten ihre Bewohner, plünderten und vernichteten die Ernte...<br />
Die Sahelstaaten, in denen die Berber und arabischen Völker auf die Schwarzafrikaner treffen, haben fast alle<br />
seit langer Zeit mit dem <strong>Pro</strong>blem der Rassenkonflikte zu kämpfen. In Mauretanien leben viele Schwarzafrika-<br />
ner immer noch in sklavenähnlichen Umständen, obwohl die Sklaverei längst abgeschafft wurde. In Mali und<br />
Niger behielten die Schwarzafrikaner die Oberhand über die meist nomadisch lebenden Berber, der Tschad<br />
war jahrelang in Grenzstreitigkeiten mit dem nördlichen Nachbar Libyen verwickelt, und im Sudan herrscht<br />
seit über 20 Jahren ein immer wieder aufflammender Bürgerkrieg zwischen der islamischen Regierung im<br />
Norden und den christlich-animistischen Schwarzafrikanern im Süden.<br />
Auf der Seite 130 beschreibt der Autor die geschichtliche Entwicklung im Raum Südafrika:<br />
...Die weissen Einwanderer... drangen langsam nach Norden vor, wo nomadisierende Hottentotten und Buschmänner<br />
lebten. Den Feuerwaffen der berittenen Weissen konnten sie nur wenig Widerstand entgegensetzen. Sie wurden<br />
umgebracht oder zogen sich in die weniger fruchtbaren Gebiete im Landesinnern zurück. Erst im 18. Jahrhundert trafen<br />
nordwärts vordringende weisse Viehhalter ("Treckburen") auf gleichfalls viehhaltende nomadisierende Schwarze<br />
("Bantu"), die nach Süden vorstiessen. Zwischen beiden Gruppen kam es in der folgenden Zeit ständig zu kriegerischen<br />
Auseinandersetzungen, in denen die Buren zuletzt die Oberhand gewannen...<br />
List Geographie äussert damit, was die älteren Lehrmittel verschwiegen: Den europäischen Kolonisatoren fiel<br />
das afrikanische Land nicht einfach in den Schoss, sie erkämpften es sich mit Waffengewalt und scheuten<br />
dabei auch vor Greueltaten keineswegs zurück. Aus Belgisch-Kongo ist beispielsweise bekannt, dass Europäer<br />
aufständischen Schwarzafrikanern die Hände abhackten. Diese Greueltaten wurden fotografisch dokumentiert<br />
und lösten in Europa bei ihrem Bekanntwerden einen <strong>Pro</strong>teststurm gegen die Politik des belgischen Königs<br />
Leopold aus. Aber auch andere Kolonialmächte liessen Tausende vom Menschen hinrichten, um ihre Macht-<br />
position auf afrikanischem Boden zu halten.<br />
3.3.2.10 Neue Geographie, 1974-1976<br />
Der dritte Band des Lehrmittels "Neue Geographie" beschäftigt sich ebenfalls mit den Konflikten zwischen<br />
Buren und Schwarzafrikanern. Auf den Seiten 80-81 schreibt der Autor unter der Überschrift "Aus der<br />
Geschichte der Weissen und Schwarzen in Südafrika":<br />
1779 Erster Krieg zwischen Buren und Afrikanern (= gut organisierte, Vieh züchtende Bantu-Stämme). In der<br />
Folgezeit werden die Bantu-Stämme besiegt und zurückgedrängt...<br />
1835-1846 "Grosser Trek": rund 10'000 Buren ziehen auf Ochsenkarren in das Innere des heutigen Südafrika. Sie suchen<br />
neue Weideplätze für ihre grossen Viehherden und wollen der britischen Verwaltung entgehen. Es kommt zu<br />
schweren Kämpfen, z. B. mit den Zulus.<br />
Im Gegensatz zum Lehrmittel "List Geographie" macht die "Neue Geographie" genauere Angaben zum zeitli-<br />
chen Geschehen.<br />
3.3.2.11 Dreimal um die Erde, 1977-1980<br />
Das Lehrmittel "Dreimal um die Erde" beschreibt im Band 2 auf der Seite 44 als erstes der untersuchten Lehr-<br />
mittel die Biafrakrise:<br />
Einführung: Themenkreis Krieg<br />
...Durch bedeutende Erdölfunde seit 1956 erhielt die Ostregion Nigerias ein wirtschaftliches Übergewicht. Daraufhin<br />
erklärten die Ibo 1967 die Unabhängigkeit ihrer <strong>Pro</strong>vinz unter dem Namen Biafra und kämpften drei Jahre gegen die<br />
Zentralregierung in Lagos um ihre Selbständigkeit. Dieser Biafra-Krieg forderte über 2 Mio. Menschenleben. Tausende<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 78
von Kindern starben in Biafra an Hunger und Unterernährung. Grossbritannien und die Sowjetunion unterstützten die<br />
Zentralregierung durch Waffenlieferungen; Frankreich lieferte Waffen an Biafra.<br />
Die "Vereinten Nationen" (UN) und auch die Vereinigung der afrikanischen Staaten ("Organisation für afrikanische<br />
Einheit" OAU) verweigerten Biafra das Selbstbestimmungsrecht.<br />
Die UN lehnte eine "Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines selbständigen Staates" ab; die OAU forderte die<br />
"Unantastbarkeit der afrikanischen Staatsgrenzen", so wie sie willkürlich von den europäischen Kolonialmächten<br />
geschaffen wurden. 1970 musste Biafra bedingungslos kapitulieren. Die demokratische Verfassung von Nigeria wurde<br />
ausser Kraft gesetzt. Eine Militärregierung übernahm in Nigeria die Macht. Alle politischen Parteien wurden verboten.<br />
Der Biafrakrieg ist der erste, in den untersuchten Lehrmitteln beschriebene Krieg, der weltweite Aufmerksam-<br />
keit errang. Die Bilder der Kriegsgreuel und der wegen des Kriegsgeschehens an Unterernährung leidenden<br />
Kinder gingen um die ganze Welt.<br />
Auch 1998 regiert in Nigeria eine von der Weltöffentlichkeit geächtete Militärjunta das Land. Dies hindert<br />
aber europäische und amerikanische Interessengruppen nicht daran, die reichen Erdölvorräte des Landes<br />
auszubeuten und durch ihr Geschäftsgebaren die diktatorische Regierung zu stützen.<br />
Zu den politischen Unruhen in der Republik Südafrika, ausgelöst durch die von der weissen Regierung vertre-<br />
tene Apartheidspolitik, heisst es auf der Seite 59, dass ein "Ausfall von Rohstofflieferungen aus diesem Lande<br />
durch einen Rassenkrieg im Innern" die Wirtschaft der Bundesrepublik "empfindlich treffen" würde.<br />
Auf den Seite 61 schliesslich spannt der Autor den Bogen vom Biafrakrieg in Nigeria zur Apartheidspolitik in<br />
der Republik Südafrika, wenn er schreibt:<br />
Die Anhänger der Apartheidspolitik verweisen immer wieder auf Vorgänge in anderen afrikanischen Staaten, nachdem<br />
diese unabhängig wurden, zum Beispiel auf Nigeria und den Biafrakrieg... Die Regierung Ugandas wies alle Asiaten aus<br />
dem Land. In Angola brach nach der Befreiung von der portugiesischen Kolonialherrschaft ein Bürgerkrieg aus.<br />
Viele Südafrikaner, Weisse und Nichtweisse, befürchten Ähnliches für Südafrika, wenn ein revolutionärer Umsturz käme...<br />
Wobei der Autor nicht erwähnt, dass der "Bürgerkrieg" in Angola, der besser als Rebellenkrieg bezeichnet<br />
würde, von südafrikanischen Kräften nicht unwesentlich, beispielsweise durch die Ausbildung der Rebellen<br />
und Waffenlieferungen, gefördert wurde.<br />
Zur politischen Lage der Entwicklungsländer, zu denen auch fast alle afrikanischen Staaten gehören, schreibt<br />
der Autor im dritten Band auf der Seite 107:<br />
Häufig hemmen Regierungsumstürze und Bürgerkriege die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.<br />
Zu Afrika wäre zu bemerken, dass es in einigen Staaten, wie beispielsweise Nigeria, tatsächlich zu häufigen<br />
Regierungswechsel kam, die durch Gewalt erzwungen wurden, andere Länder waren zumindest politisch<br />
äusserst stabil und wurden im Zeitraum von der Unabhängigkeit bis 1998 nur von einigen wenigen Staatsober-<br />
häuptern regiert, die meist durch demokratische Wahlen abgelöst wurden. Ausserdem vergisst der Autor zu<br />
erwähnen, dass die Bürgerkriege und Putsche in einigen Ländern, so beispielsweise in der Demokratischen<br />
Republik Kongo, auf das Vermächtnis der Kolonialzeit zurückgehen und zeitweise von aussen gefördert<br />
wurden.<br />
3.3.2.12 Geographie thematisch, 1977-1980<br />
Der zweite Band des Lehrmittels "Geographie thematisch" beschäftigt sich ebenfalls mit der unruhigen<br />
Geschichte Nigerias. Auf der Seite 185 zählt er unter der Überschrift "Daten aus der jüngsten Geschichte Nige-<br />
rias" folgende Ereignisse auf:<br />
Einführung: Themenkreis Krieg<br />
15.1.1966 Militärputsch unter Ibo-General Ironsi. Ermordung des Premierministers Balewa. Ausserkraftsetzung der<br />
Bundesverfassung und Errichtung eines Einheitsstaates. Schwere Ausschreitungen gegen Angehörige des<br />
Ibo-Volkes in Kano und Jos.<br />
28.7.1966 Militärputsch unter General Gowon, einem Haussa. Wiederherstellung der alten Bundesverfassung. Weitere<br />
Massaker gegen Ibos in der Nordregion.<br />
27.5.1967 Neugliederung Nigerias in 12 Bundesstaaten<br />
30.5.1967 Der Militärgouverneur der Ostregion Ojukwe erklärt die Unabhängigkeit dieser <strong>Pro</strong>vinz vom nigerianischen<br />
Bundesstaat und gründet die Republik Biafra. Alle ausserhalb Biafras lebenden Ibos werden aufgerufen, in<br />
ihr Stammesgebiet der ehem. Ostregion zurückzukehren. Grausamer Bürgerkrieg in Nigeria.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 79
Wirtschaftsblockade der nigerianischen Bundesregierung gegen Biafra. Unbeschreibliche Hungersnöte in der<br />
ehemaligen Ostregion.<br />
12.12.1970 Sieg der Bundestruppen über Biafra. Ende des Bürgerkrieges. Ostregion wieder Bundesstaat der Republik<br />
Nigeria.<br />
3.2-1976 Neugliederung Nigerias in 19 Bundesstaaten.<br />
Der Autor verzichtet darauf, Bilder aus dem Biafra-Krieg wiederzugeben, die der Welt die hungernden und<br />
sterbenden Kinder vorführten, die spätestens ab Mitte der siebziger Jahre zu einem Synonym für Hunger und<br />
Elend Afrikas werden sollten.<br />
3.3.2.13 Musikstudio, 1980-1982<br />
Das Musiklehrmittel "Musikstudio" zeigt im zweiten Band auf der Seite 22 ein Foto "Kriegstanz der Bamun".<br />
3.3.2.14 Seydlitz: Mensch und Raum, 1987<br />
Das Lehrmittel "Seydlitz: Mensch und Raum" beschäftigt sich ab der Seite 132 unter dem Titel "Ein Kolonial-<br />
kontinent Europas" auch mit den Auseinandersetzungen im damaligen Afrika:<br />
Im Zeitalter des Imperialismus wurde schliesslich auch Afrika kolonialisiert, Frankreich eroberte seit 1834 Algerien, 1854<br />
den Senegal. England besetzte 1882 Ägypten und betrieb erfolgreich eine Kap-Kairo-Politik, in den Burenkriegen<br />
(1899-1902) sogar gegen weisse Burenrepubliken. Portugal verteidigte seine afrikanischen Territorien in Angola und<br />
Mosambik. Das Deutsche Reich und Italien griffen ab 1884 nach den noch freien Küstengebieten. Auf der Berliner<br />
Afrikakonferenz (1884/85) einigten sich die Kolonialmächte auf Einflusssphären und legten Regeln für die Okkupation<br />
Afrikas fest.<br />
Die Zeit der Kolonisierung war voller Kämpfe, weil die europäischen Mächte ihre Konflikte auch in Afrika austrugen und<br />
weil hartnäckiger Widerstand und zahlreiche Aufstände afrikanischer Völker durch Eroberungszüge, Straf- und<br />
Vernichtungsaktionen unterdrückt wurden.<br />
Wenn auch der Autor auf den Widerstand der schwarzafrikanischen Bevölkerung nicht näher eingeht, so wird<br />
dieser doch zumindest erwähnt. Zu den Auswirkungen des Sklavenhandels schreibt er weiter:<br />
Dieser Menschenhandel, in den afrikanische Küstenbewohner aktiv einbezogen wurden, führte nicht nur zu hohen<br />
Menschenverlusten, sondern durch die gewaltsame Beschaffung der Sklaven, durch Kriege und Sklavenjagden zu einer<br />
tiefgreifenden Zerstörung vieler afrikanischer Völker und Kulturen und zur Zerrüttung geordneter politischer und<br />
gesellschaftlicher Werte und Strukturen.<br />
Der Autor verschweigt nicht, dass auch afrikanische Völker in den durch den Sklavenhandel initierten oder<br />
verstärkten Konflikten eine aktive Rolle spielten. Während der Zeit des Sklavenhandels schufen die Europäer<br />
Strukturen, die sich später auch für die Ausbeutung von Rohstoffen als hilfreich erwiesen.<br />
Auf der Seite 133 beschäftigt sich der Autor mit der Entwicklung der frühen Demokratischen Republik Kongo:<br />
Anfang der 50er Jahre entstand die erste politische Bewegung unter Schwarzafrikanern, 1958 kam es zu ersten Unruhen,<br />
die sich 1959 ausweiteten. Daraufhin beschloss die belgische Regierung, der Kolonie bereits zum 30. Juni 1960 die<br />
Unabhängigkeit zu gewähren.<br />
Sezessionsversuche der Kupferprovinz Katanga (Shaba) und innenpolitische Wirren führten zum Bürgerkrieg. Dieser<br />
weitete sich zu einem internationalen Krisenherd aus, weil einerseits belgische Truppen direkt eingriffen und andererseits<br />
die sozialistisch orientierte Regierung Hilfe von der UdSSR erhielt. Erst durch den Einsatz einer UN-Truppe konnte die<br />
Kongokrise einigermassen unter Kontrolle gebracht werden.<br />
Unter Mobutu, der 1965 durch einen Putsch an die Macht kam, wurden die östlichen Berater ausgewiesen und ein<br />
prowestlicher Kurs eingeschlagen, der Zaire die Unterstützung westlicher Mächte sicherte... Jede Opposition im Land<br />
wurde und wird unterbunden und ausgeschaltet.<br />
Die unruhige Geschichte des Landes spiegelt sich in seiner Namensgebung: Das bis zur Unabhängigkeit<br />
Belgisch-Kongo genannte Gebiet, trug ab 1960 bis 1971 den Namen Demokratische Republik Kongo, wurde<br />
dann unter Mobutus neuer Politik des kulturellen Erbes in Zaire umgetauft, in Anlehnung an das von den<br />
Portugiesen falsch ausgesprochene Bakongo-Wortes "nzadi" (=Flusslauf), und heisst seit dem Sturz Mobutus<br />
durch Laurent-Désiré Kabila im Mai 1997 wieder Demokratische Republik Kongo.<br />
3.3.2.15 Klangwelt-Weltklang 2, 1993<br />
Der zweite Band des Lehrmittels "Klangwelt - Weltklang" erwähnt auf der Seite 44 das Hörbeispiel einer<br />
Kriegsmusik der "Banda Linda, Zentralafrika";<br />
Einführung: Themenkreis Krieg<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 80
3.3.2.16 Seydlitz Erdkunde 1993-1995<br />
Der dritte Band des Lehrmittels "Seydlitz Erdkunde" beschäftigt sich in mehreren Kapiteln mit verschiedenen<br />
Konflikten in Schwarzafrika. Auf der Seite 123 schreibt der Autor, über die Entwicklungsländer, zu denen<br />
auch die meisten afrikanischen Staaten zählen, dass "17 Mio. Menschen... auf der Flucht vor Krieg, Terror und<br />
Hunger" seien. Eine Karte "Hunger in Afrika (Stand 1993) bezeichnet die Staaten Liberia, Angola, Sudan,<br />
Äthiopien, Somalia, Ruanda, und Mosambik als "Länder, die unter Bürgerkrieg oder dessen Folgen leiden".<br />
Auf der Seite 134 schreibt der Autor zu Nigeria:<br />
...rund 250 verschiedene Völker und Stämme... und deren unterschiedliche regionale Verteilung führten in der<br />
Vergangenheit und Gegenwart immer wieder zu Putschversuchen und Bruderkriegen...<br />
"Aus der Geschichte Nigerias" nennt der Autor unter anderem folgende Daten:<br />
1804 Krieg der Fulani gegen die Haussa-Staaten, Sieg und Ausdehnung des Reiches nach Süden (Jorubaland)<br />
1861 Lagos wird britische Kronkolonie, nachfolgend Unterwerfung der Joruba (1886), Ibo (1898) und Fulbe<br />
(Fulani/Haussa 1903)<br />
1960-1966 Krisen, Unruhen, Militärputsch, Kampf um die Macht, Stammesauseinandersetzungen<br />
1967-1970 Die Ostregion (Ibos) erklärt sich zur "Republik von Biafra", die Nord- und Westregion erobern nach 2.5<br />
Jahren Krieg Biafra; Hungersnöte bei den Ibos, seitdem Militärregierung<br />
1993 Geplante Einsetzung einer gewählten zivilen Regierung<br />
Der Sieger der Wahl von 1993 Chief Moshood Abiola gelangte nie an die Macht, da die Wahlen durch die<br />
Militärregierung nicht anerkannt wurden. Abiola starb im Juli 1998 im Gefängnis, kurz vor seiner Freilassung<br />
und einen Monat nach dem Tod des nigerianischen Diktators Sani Abacha, der das Land fünf Jahre lang<br />
regierte. Der Nachfolger Abachas, General Abdusalam Abubakar versprach Ende Juli 1998 Neuwahlen und die<br />
Einsetzung einer zivilen, demokratisch gewählten Regierung auf den Mai 1999. Im August zeichneten sich<br />
Bestrebungen der Bevölkerung der südlichen Teile des Landes ab, sich vom Rest Nigerias loszusagen. Ob es<br />
der Militärregierung und der für 1999 geplanten Militärregierung gelingen wird, das Land zusammenzuhalten<br />
muss sich wieder einmal weisen.<br />
Im Kapitel "Rassenkonflikte in Südafrika" schreibt der Autor auf der Seite 138 über die Wanderungen der<br />
Buren ins Landesinnere am Ende des 18. Jahrhunderts:<br />
Sie dehnten gewaltsam ihr Siedlungsland aus und verdrängten dabei die Hottentotten und Buschmänner. Diese schwarzen<br />
Ureinwohner zogen sich schliesslich ins unfruchtbare Hinterland zurück...<br />
Seit dem 18. Jahrhundert trafen die nach Norden vordringenden weissen Viehhalter auf nomadisierende Schwarze, die aus<br />
Ostafrika eingewandert waren. Im Kampf um das Weideland setzten sich die Weissen durch...<br />
Mitte des 19. Jh. endete eine ganze Reihe von Kriegen gegen Schwarzafrikaner mit ihrer Unterwerfung...<br />
In einem letzten Kapitel "Arbeitswanderungen und Armutsflüchtlinge" gibt der Autor auf der Seite 148 eine<br />
Karte "Länder mit Flüchtlingen (Auswahl) nach Angaben der UN-Flüchtlingskommission" mit Zahlen von<br />
April 1991 wieder. Für Afrika werden insgesamt rund 6 Millionen Flüchtlinge angegeben. Davon entfallen<br />
nach der Karte auf die einzelnen Länder als Aufnahmestaaten (Zahlen in Klammern: Flüchtlinge in Tausend):<br />
Algerien (170), Senegal (58), Sierra Leone (129), Elfenbeinküste (300), Kamerun (52), Uganda (142), Ruanda<br />
(22), Burundi (270), Simbabwe (183), Sudan (768), Äthiopien (985) Somalia (100), Kenia (35), Tansania<br />
(265), Zaire (427), Sambia (138), Malawi (940), Swasiland (420). Als Ursachen für die Flüchtlingsbewegun-<br />
gen werden unter anderem "Krieg und Bürgerkrieg, Menschenrechtsverletzungen und Bedrohung von Minder-<br />
heiten" genannt.<br />
Eine Grafik "Auf der Flucht", welche die Zahl der Flüchtlinge, die ihr Heimatland verlassen haben beziffert,<br />
gibt für Mosambik 1.725 Mio., Somalia 0.865 Mio., Äthiopien und Eritrea 0.835 Mio., Angola 0.404 Mio. und<br />
den Sudan 0.263 Mio. Flüchtlinge an.<br />
Auf der Seite 149 folgt ein Text "Ruanda 1994" in dem es heisst:<br />
Einführung: Themenkreis Krieg<br />
Der Bürgerkrieg und die Massenmorde in Ruanda haben einen der grössten Flüchtlingsströme in der Geschichte ausgelöst.<br />
Fast eine halbe Mio. Menschen flohen innerhalb von zwei Tagen in das benachbarte Tansania. Als ruandische Rebellen der<br />
Patriotischen Front (FPR) das Grenzgebiet zu Tansania eroberten, wurde die Massenflucht plötzlich unterbrochen. Das<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 81
UN-Flüchtlingswerk forderte die FPR dringend auf, die Grenze wieder zu öffnen. In Tansania entstand bei der Kleinstadt<br />
Ngara nach UN-Angaben das grösste Flüchtlingslager der Welt mit fast einer halben Mio. Menschen. Tansania erliess<br />
einen dringenden Hilfsappell, weil es dem riesigen Zustrom nicht gewachsen sei.<br />
Dieser grausamste Massenmord der schwarzafrikanischen Geschichte, der sich aus länger zurückliegenden<br />
Spannungen entwickelt hatte, zeigte deutlich auf, dass von solchen Geschehnissen nicht nur das betreffende<br />
Land, sondern auch die Nachbarländer in Mitleidenschaft gezogen worden.<br />
3.3.2.17 Seydlitz Geographie, 1994-1996<br />
Der dritte Band des Lehrmittels "Seydlitz Geographie" greift auf der Seite 54 den Konflikt im Sahelgebiet auf,<br />
wenn es einen Regierungsbeamten aus Mali über die Nomaden aussagen lässt:<br />
"Die Nomaden müssen endlich sesshaft gemacht werden: Sie bewegen sich ungebunden, sind bewaffnet, scheuen keinen<br />
Kleinkrieg um Weiden, kreuzen Grenzen nach Gutdünken, entziehen sich dem staatlichen Gesundheitsdienst, ebenso dem<br />
Schulbesuch..."<br />
Auf der Seite 61 schreibt der Autor unter der Überschrift "Kenias Weg in die Neuzeit" über die Massai:<br />
Das bekannteste Volk ist das der Massai, ein Volk einstmals kriegerischer Hirten...<br />
Weiter schreibt der Autor, dass "das Massailand... allen Massai" gehörte. In den letzten Jahren kam es aber<br />
vermehrt zu Landkonflikten zwischen verschiedenen Volksgruppen, zu denen auch die Massai zählen. Dabei<br />
ging es nicht in erster Linie um das Land an sich, sondern um günstige Weideplätze und Wasservorkommen.<br />
(Kenia, ZDF 1998)<br />
Der vierte Band des Lehrmittels enthält ein Kapitel "Schwarzafrika" indem der Autor auf der Seite 178<br />
schreibt:<br />
Schwarzafrika... das ist der Schauplatz von Massakern, Aufständen, Stammes- und Bürgerkriegen.<br />
Damit zeichnet er das Bild des im Chaos versinkenden Kontinents, welches sich auch in den Zeitungs- und<br />
Fernsehberichten lange grosser Beliebtheit erfreute.<br />
3.3.2.18 Diercke Erdkunde, 1995-1997<br />
Der vierte Band des Lehrmittels "Diercke Erdkunde" zeigt auf der Seite 150 zum Thema "Auf der Flucht" eine<br />
Grafik, die als Fluchtgrund neben anderen Krieg, Unterdrückung, Gewalt und Ungerechtigkeit nennt.<br />
3.3.2.19 Zusammenfassung<br />
In 19 der untersuchten Lehrmittel aus dem Geographie- und Musikbereich, etwa der Hälfte der Geographie-<br />
lehrmittel und -bücher, wird kriegerisches Verhalten oder eine kriegerische Auseinandersetzung erwähnt.<br />
Die folgenden Lehrmittel erwähnen bestimmte Volksgruppen als kriegerisch: "Leitfaden für den Geographie-<br />
unterricht" (1934), die Somali und Massai; "Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen" (1961), das alte<br />
Benin; "Fahr mit in die Welt" (1972), die Aschanti; "Länder und Völker" (60er Jahre), die Wadaikrieger<br />
(Tschad), und Äthiopier; "Seydlitz für Gymnasien" (1963- ca. 1971), die Massai; "List Geographie"<br />
(1972-1976), die Tuareg; "Seydlitz Geographie" (1994-1996), die Massai.<br />
Kriegstänze werden in den Lehrmitteln "Fahr mit in die Welt" (1972), die Watussi; "Musikstudio" (1980-1982)<br />
die Bamun; "Klangwelt-Weltklang 2" (1993), die Banda Linda (Zentralafrika) erwähnt oder vorgestellt.<br />
In den Lehrmitteln "Lesebuch für die Oberklassen" (30er Jahre) und "Geographie Widrig" (1967) sprechen die<br />
Autoren von der Entvölkerung des afrikanischen Kontinentes durch die stetigen "Stammeskriege", während in<br />
"Seydlitz: Mensch und Raum" (1987) von "tiefgreifende Zerstörungen" durch die vom Sklavenhandel initier-<br />
ten Veränderungen die Rede ist.<br />
Einführung: Themenkreis Krieg<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 82
Kolonialkriege werden in den Lehrmitteln "Länder und Völker" (60er Jahre), Äthiopien; "List Geographie"<br />
(1972-1976), Südafrika; "Neue Geographie" (1974-1976), Südafrika; "Seydlitz: Mensch und Raum" (1987),<br />
Senegal, Südafrika, Angola, und Mosambik; und "Seydlitz Erdkunde" (1993-1995), Nigeria und Südafrika,<br />
erwähnt.<br />
Nur gerade drei der Lehrmittel sprechen von Spannungen zwischen arabischen und schwarzafrikanischen<br />
Völkern im Sahelgebiet: "Seydlitz für Realschulen" (1968), Sudan; "List Geographie" (1972-1976), Mali; und<br />
"Seydlitz Geographie" (1994-1996), ebenfalls Mali.<br />
Von Bürgerkriegen ist in vier Lehrmitteln die Rede: "Dreimal um die Erde" (1977-1980), Biafra, ausserdem<br />
wird ausgesagt, die Bürgerkriege "hemmen" die "wirtschaftliche Entwicklung" der schwarzafrikanischen Staa-<br />
ten; "Geographie thematisch" (1977-1980), Biafra; "Seydlitz: Mensch und Raum" (1987), Kongo<br />
(Katangagebiet); und "Seydlitz Erdkunde" (1993-1995), Liberia, Angola, Sudan, Äthiopien, Somalia, und<br />
Ruanda, als damals aktuelle Bürgerkriege, Biafra als historischen Bürgerkrieg.<br />
Eine ganze Reihe von Lehrmitteln enthält darüberhinaus weitere Aussagen. Im "Leitfaden für den Geographie-<br />
unterricht" (1934) wird behauptet, die Europäer hätten die schwarzafrikanischen Gebiete befriedet. "Harms<br />
Erdkunde - Die Welt in allen Zonen" (1961) erwähnt den Militärdienst eines Schwarzafrikaners in der Royal<br />
Air Force in Nigeria. "Dreimal um die Erde" (1977-1980) äussert die Angst, ein allfälliger Bürgerkrieg in<br />
Südafrika könnte zum Ausfall von Rohstofflieferungen nach Europa führen, ausserdem werden der Biafrakrieg<br />
und die Vertreibung von Ausländern in Uganda (unter Idi <strong>Ami</strong>n) als Argument für die Aufrechterhaltung der<br />
Apartheid in Südafrika benutzt. Das Lehrmittel "Seydlitz: Mensch und Raum (1987) erwähnt als einziges<br />
ausdrücklich Aufstände der schwarzafrikanischer Völker gegen die Kolonisatoren. "Seydlitz Erdkunde"<br />
(1993-1995) erwähnt den Krieg der Fulani gegen die Hausa von 1804, ausserdem werden Flüchtlinge, speziell<br />
im Zusammenhang mit Ruanda, als Opfer des Krieges thematisiert. "Seydlitz Geographie" (1994-1996)<br />
charakterisiert Schwarzafrika als "Schauplatz von Massakern, Aufständen, Stammes- und Bürgerkriegen" (Bd.<br />
4, S. 178). "Diercke Erdkunde" (1995-1997) erwähnt noch einmal Flüchtlinge.<br />
Die Aufzählung zeigt, dass die älteren Lehrmittel dazu neigten, die Schwarzafrikaner als sich gegenseitig<br />
abschlachtende "Stämme" zu charakterisieren, die nur Dank der Europäer den Frieden fanden, während erst ab<br />
Ende der sechziger Jahren die von den Europäern geführten Kolonialkriege und erst ab Mitte der siebziger<br />
Jahren erstmals Bürgerkriege in den unabhängig gewordenen Staaten Schwarzafrikas erwähnt werden. Die<br />
durch diese Binnenkriege ausgelösten Flüchtlingsströme finden sogar erst in den neunziger Jahren Erwähnung.<br />
3.3.3 Religion<br />
Im dritten Themenkreis soll die Darstellung der afrikanischen Religionen in den untersuchten Geographielehr-<br />
mitteln diskutiert werden. Auf einen Einbezug der Musiklehrmittel wurde verzichtet. Wie schon bei den<br />
beiden anderen Themenkreisen werden nur diejenigen Lehrmittel erwähnt, die nennenswerte Aussagen zum<br />
Thema machen. Die Kommentare decken sich zu einem Grossteil mit denen, die in der Besprechung der<br />
einzelnen Lehrmittel gemacht wurden.<br />
3.3.3.1 Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen, 1912<br />
Das älteste der untersuchten Lehrmittel äussert sich nur in einem einzigen Abschnitt auf der Seite 386 über die<br />
Menschen Schwarzafrikas, in dem er heisst:<br />
Einführung: Themenkreis Krieg<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 83
...Das Christentum hat noch wenig Eingang in Afrika gefunden; stark verbreitet ist im Norden die mohammedanische<br />
Religion. Millionen von Negern aber leben im Zustande heidnischen Aberglaubens und entsetzlicher Roheit...<br />
Die Leser erfahren also, dass der Schwarzafrikaner ein Heide von entsetzlicher Roheit ist, der seinen Zustand<br />
wohl aber nicht selbst verschuldet hat, da ja das Christentum noch nicht bis zu ihm vorgedrungen ist.<br />
3.3.3.2 Leitfaden für den Geographieunterricht, 1934<br />
Der Autor des "Leitfadens" beschreibt unter dem Titel "Die Religion" die verschiedenen Glaubensysteme der<br />
schwarzafrikanischen Menschen. Auf der Seite 213 schreibt er zum "Fetisch- und Dämonendienst", nach der<br />
Aussage, dass der Mensch in der Religion versuche, "die Rätsel, welche ihn bewegen" zu lösen:<br />
Fetisch- und Dämonendienst ist die Religion niedrigstehender Völker. Bei diesen Heiden ist das Priestertum (Zauberer,<br />
Schamane) stark entwickelt (Verehrung der Tiere und Ahnen).<br />
Der anschliessende Vergleich des Islam mit dem Christentum scheint die Sichtweise des Autors in Bezug auf<br />
die verschiedenen Religionen widerzuspiegeln (S. 213):<br />
...Der Islam (= Hingabe an Gott), der heute noch in... Afrika an Verbreitung gewinnt, ist wie das Christentum eine<br />
monotheistische (= ein Gott) Religion. Dieses ist die Religion der Europäer, die es durch die Mission unter die Heiden<br />
bringt.<br />
Nach Ansicht des Autors ist es also die Aufgabe "der Europäer,... durch die Mission" den Glauben an den<br />
einen Gott unter die niedrigstehenden Heiden Schwarzafrikas zu bringen. Eine Folgerung die sich aus der<br />
Sichtweise auf die schwarzafrikanischen Religionen und der Tatsache, dass das Christentum, wie im "Lehr-<br />
und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen" von 1912 bemerkt wurde, in Afrika damals "noch wenig<br />
Eingang" gefunden hatte, ergab.<br />
3.3.3.3 Harms Erdkunde - die Welt in allen Zonen, 1961<br />
Harms Erdkunde enthält einen Text "Afrika, bevor die Europäer kamen" von Leo Frobenius, der die in den<br />
weiter oben erwähnten Zitaten behauptete "Überlegenheit" der christlichen Europäer gegenüber den schwarz-<br />
afrikanischen "Heiden auf die Tatsache zurückführt, dass die Europäer damit die Greuel des Sklavenhandels zu<br />
rechtfertigen versuchten (S. 262):<br />
So wurde der Begriff Fetisch als Symbol einer afrikanischen Religion erfunden. Eine europäische Fabrikmarke! Ich selbst<br />
habe in keinem Teil Afrikas die Fetischanschauung bei Negern gefunden. Die Vorstellung vom 'barbarischen Neger' ist<br />
eine Schöpfung Europas.<br />
Diese Folgerung ist nicht sehr weit hergeholt, betrachtet man die Veränderung des europäischen Bildes von<br />
den Schwarzafrikanern im Laufe der Zeit. (Sie dazu die Zusammenfassung zum "Das Bild des schwarzafrika-<br />
nischen Menschen durch die Jahrhunderte" auf Seite 58 dieser Arbeit.)<br />
3.3.3.4 Schweizerischer Mittelschulatlas, 1962<br />
Der "Schweizerische Mittelschulatlas" von 1962 zeigt auf der Seite 107 eine Karte zu den Religionen, auf der<br />
fast ganz Schwarzafrika als den Naturreligionen zugehörend bezeichnet wird.<br />
3.3.3.5 Geographie Widrig, 1967<br />
Während die bisher betrachteten Geographielehrmittel und -bücher nur sehr kurz auf die Religionen in<br />
Schwarzafrika eingegangen sind, widmet Widrig dem Thema in seinem Buch "Geographie" eine längere<br />
Passage.<br />
In seinen Ausführungen über "Die Negerstämme" schreibt Widrig auf den Seiten 302 und 303 zur Religion<br />
dieser Menschen:<br />
Einführung: Themenkreis Religion<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 84
Es ist wahrscheinlich, dass ursprünglich der Glaube an ein höchstes göttliches Wesen die Grundlage für die Religion des<br />
Negers war. Heute stehen der Ahnenkult, der Geisterglaube und der Fetischdienst im Vordergrund. Die Neger glauben an<br />
ein Weiterleben nach dem Tode. Sie glauben, dass ihnen die Toten Gutes oder Böses bringen können. Deshalb ist bei jeder<br />
Gelegenheit auf die Seelen der Verstorbenen Rücksicht zu nehmen. Man hat ihnen Opfer und Gaben darzubringen. Dieser<br />
Ahnenkult ist ein wesentlicher Bestandteil der Religion der afrikanischen Naturvölker.<br />
Widrig geht hier eindeutig davon aus, dass seine eigene Religion, nämlich das Christentum, die einzig wahre<br />
sei, von der die Schwarzafrikaner im Verlaufe der Geschichte irgendwie abgefallen wären. - Eine Vorstellung,<br />
die sich schon bei den ersten Missionaren auf dem afrikanischen Kontinent fand, wie Bitterli in seinem Buch<br />
"Die 'Wilden' und die 'Zivilisierten'" schreibt: "Während sich der Christenmensch nach dem Sündenfall<br />
mühsam zur wahren Gotteserkenntnis emporgearbeitet hatte, war nun freilich der Un- oder Irrgläubige, aus<br />
Gründen, welche sich die theologischen Theoretiker sehr verschieden erklärten, immer mehr von Gott abgefal-<br />
len; seine Gottesverehrung hatte sich zum Götzendienst pervertiert, das Bemühen um Reinheit der Sitten war<br />
dem Hang zur Ausschweifung aller Art gewichen. Doch die guten Seelenkräfte lebten auch im Heiden fort; da<br />
sie aber zu wenig entwickelt waren, als dass dieser den Weg zu Gott allein hätte finden können, ergab sich für<br />
den Christenmenschen die moralische Aufgabe, dem Heiden zu helfen. Neben die lebensrechtliche Verpflich-<br />
tung zur äusseren Mission trat also, wenn man will, eine christlich-humane Verpflichtung, die vom Grundge-<br />
danken eines einzigen Schöpfergottes und von der Einheit des Menschengeschlechtes ausging." (Bitterli 1977,<br />
S. 108) - Nur so kann Widrig zum Schluss kommen, dass die "Neger" ursprünglich monotheistisch veranlagt<br />
waren. Wie zweifelhaft eine solche Annahme ist, zeigt nicht nur ein Blick auf die noch heute existierenden<br />
Glaubenssystem in aller Welt, sondern auch eine Betrachtung alter Glaubenssysteme wie sie z. B. bei den<br />
Indianern Nordamerikas, den Schamanen Sibiriens, den Hindus Indiens oder im vorchristlichen Europa<br />
verbreitet waren.<br />
Die weiteren Ausführungen Widrigs beschreiben den Umgang schwarzafrikanischer Menschen mit dem Zufall<br />
und Unglücksfällen (S. 302):<br />
...Scheidet jemand durch Krankheit oder Unglücksfall, durch den Zahn wilder Tiere oder durch Feindeshand aus dem<br />
Leben, ist der Neger überzeugt, dass der Tod nur durch den Willen eines Geistes oder eines Zauberers verursacht worden<br />
ist. Die unmittelbaren Todesursachen erscheinen ihm nur als das Mittel, dessen sich der Geist bediente. Also nicht das<br />
Krokodil, das seinen Bruder verschlang, ist der Schuldige, sondern ein Geist im Innern des Tieres. Es kann aber auch ein<br />
Hexer unter den Menschen gewesen sein. In diesem Fall muss der vermutliche Missetäter durch eine Giftprobe oder ein<br />
sonstiges grausames Mittel ausfindig und unschädlich gemacht werden. So sind Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg<br />
deutliche Anzeichen dafür, dass Geister in das Leben eingegriffen haben. Man fürchtet sich vor ihnen, besonders in der<br />
Nacht...<br />
Ein Blick zurück in die Geschichte Europas zeigt, dass ähnliche Vorstellung auch nach der Aufklärung den<br />
Europäern gar nicht so fremd waren, man denke nur an die in ganz Europa durchgeführten "Hexenverbrennun-<br />
gen" oder die von katholischen Priestern in einigen Gegenden Europas bis heute praktizierten "Teufelsaustrei-<br />
bungen". Zu solchen Eskalationen scheint es, nach dem aktuellen Wissensstand, in Schwarzafrika nie gekom-<br />
men zu sein.<br />
Den traditionellen Glaubensvorstellung treten heute die Glaubenssysteme einer zunehmend christianisierten<br />
oder islamisierten Gesellschaft entgegen, obwohl auch unter den Anhängern dieser neueren Religionen die<br />
alten Überlieferungen durchaus noch Bestand haben.<br />
Über den in der Literatur immer wieder beschriebenen Fetischdienst der Afrikaner, lässt sich Widrig folgen-<br />
dermassen verlauten:<br />
Einführung: Themenkreis Religion<br />
Es können aber auch irgend ein gewöhnlicher Gegenstand, ein Stein, ein Lehmklumpen, eine Muschel, ein Baum oder eine<br />
geschnitzte Holzfigur von den Geistern zum Aufenthaltsort gewählt werden. Man nennt einen solchen Gegenstand einen<br />
Fetisch, dessen Bedienung Fetischdienst.<br />
Der Glaube um diese Geister, besser würde man sie als Hausgötter bezeichnen, wie dies beispielsweise in<br />
China der Fall ist, wurde von den Europäern oft missverstanden, die in der "Anbetung der Gegenstände" einen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 85
Götzendienst zu erkennen glauben. Dabei betet der Gläubige keinesfalls den Gegenstand an, sondern die spiri-<br />
tuelle Macht, die sich diesen Gegenstand oder das Lebewesen als "Wohnsitz" auserkoren hat - man könnte<br />
ebensogut behaupten, dass ein gläubiger Christ ein Stück Holz verehre, wenn er sich vor dem Kreuz niederk-<br />
niet und betet.<br />
Widrig fährt in seinen Schilderungen fort, wobei zu sagen ist, dass seine Behauptung bezüglich Menschenblut<br />
mit anderen Quellen nicht verifiziert werden konnte und eher an eine immer wieder praktizierte Diffamierung<br />
Andersgläubiger erinnert (siehe weiter unten).<br />
Die Fetische werden durch Zauberdoktoren, die Medizinmänner, ins Leben gerufen. Diese Leute fabrizieren irgend ein<br />
Zaubermittel, das sie ins Innere der Holzgötzen bringen, ohne welches der Fetisch keine Zauberkraft ausstrahlen würde. Er<br />
soll Wohltaten erweisen und Missetäter anzeigen. Die Medizinmänner bestimmen, welche Opfer und Gaben ihm<br />
dargebracht werden müssen. Zuweilen sind die Fetische mit Menschenblut oder Ö1 zu bestreichen. Damit ein solcher<br />
Ölgötze weiss, in welcher Richtung er seine Kraft wirken lassen soll, werden Nägel darein geschlagen. Er gleicht dann<br />
"einer unförmigen Puppe mit roh geschnitztem Gesicht, so voller Nägel, dass er aussieht wie ein Stachelschwein". Die<br />
Medizinmänner spielen oft eine unheilvolle Rolle, indem sie unschuldige Menschen irgend eines Verbrechens schuldig<br />
erklären und sie einem qualvollen Tode ausliefern.<br />
Diese Art des "Voodos", aus den Filmen Hollywoods über Haiti unterdessen einer breiten Öffentlichkeit<br />
bekannt, ist, sofern sie tatsächlich in dieser Form praktiziert wurde, sicherlich nur für einen Teil der Bevölke-<br />
rung Afrikas, der seltsamerweise nie näher präzisiert wird, zutreffend.<br />
Widrig schliesst mit einem Abschnitt auf Seite 303 die jeglicher gesunden Argumentation entbehrt, selbst<br />
wenn seine Vorwürfe betreffend der Menschenfresserei punktuell zutreffen sollten (sie konnten mittels anderer<br />
Quellen nicht eindeutig belegt werden, obwohl die Anschuldigung auch in weiteren Lehrmitteln auftritt):<br />
Es scheint, dass auch die Menschenfresserei, der Kannibalismus, mit Religion und Aberglauben zusammenhängt. Indem<br />
Sklaven, gefangene Feinde und Hexer getötet und den Geistern als Opfer dargebracht wurden, gelangten deren Teile auch<br />
in die Bratpfanne oder an den Spiess, wobei es nurmehr ein kleiner Schritt war, die Getöteten nach bestimmten<br />
Vorschriften zu verzehren...<br />
Um den wahrscheinlichen Wahrheitsgehalt solcher Aussagen ins rechte Licht zu rücken, sei angemerkt, dass<br />
viele Chinesen noch in den fünfziger Jahren der Überzeugung waren, Christen würden in ihren Gottesdiensten<br />
kleine Kinder verzerren.<br />
Eine weitere Erwähnung der Religionen in Schwarzafrika findet sich auf der Seite 306, auf der Widrig zu<br />
einem mit "Hamiten und Semiten" betitelten Abschnitt schreibt:<br />
Die hamitischen Fulbe, Haussa und Tibbu haben sich stark mit Negern gemischt. Die meisten dieser Völker sind zum Islam<br />
übergegangen und fanatische Mohammedaner geworden...<br />
Trotz dieser "negativen" Auswirkungen - die betroffenen Völker sind für das Christentum verloren, auch wenn<br />
vor allem amerikanische Sekten noch immer versuchen, diese zur "Heilslehre" ihrer Form des Christentums zu<br />
bekehren - schreibt Widrig über die Araber, dass sie den Schwarzafrikanern "Sprache und Religion" gebracht<br />
hätten. Er stuft die traditionellen Glaubenssysteme also nicht nur als Perversion des ursprünglichen Glaubens<br />
an ein göttliches Wesen ein, sondern spricht ihnen überhaupt ab, Religion zu sein.<br />
3.3.3.6 Seydlitz für Realschulen, 1968<br />
Das Lehrmittel "Seydlitz für Realschulen" beschäftigt sich im Band 3 im Kapitel "Hirten Händler, Hackbau-<br />
ern" auch kurz mit der Religion der beschriebenen Völker. Auf der Seite 34 vermerkt der Autor dass die<br />
"Sudanneger den Islam" von "den eingewanderten Stämmen" der Fulbe und Haussa übernommen hätten. Die<br />
Verbreitung des Islams in Afrika am Ende des 20. Jahrhunderts ist aus der Karte "Religionszugehörigkeit" auf<br />
der Seite 574 im Anhang dieser Arbeit zu ersehen.<br />
Einführung: Themenkreis Religion<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 86
3.3.3.7 Erdkunde Oberstufe, 1968-1969<br />
Etwas ausführlicher geht der Band 1 von "Erdkunde Oberstufe" auf die religiösen Vorstellungen schwarzafri-<br />
kanischer Menschen auf der Seite 59 ein:<br />
...Die Religion in den besser erschlossenen Gebieten wurde vom... Islam und in jüngerer Zeit vom Christentum überprägt.<br />
Ursprünglich entsprach sie der Stellung der Menschen zur Natur. Den Naturgewalten wurden göttliche Kräfte<br />
zugesprochen (Animismus). Blitz, Donner, Sturm und Wasser wurden und werden noch verehrt. Um die guten und bösen<br />
Geister günstig zu stimmen, Krankheit und Tod zu bannen, bringt man ihnen Opfer dar (Dämonismus). Dinge, die als<br />
schädlich oder nützlich galten, wurden als Idole verehrt (Fetischismus). Zauber- und Geisterglaube kennzeichnen diese<br />
niedrigste Form des Polytheismus.<br />
Die Glaubenssysteme Schwarzafrikas werden also pauschal als "niedrigste Form des Polytheismus" bezeich-<br />
net, nur in den "besser erschlossenen Gebieten" wurden diese von Christentum und Islam überprägt, so die<br />
eurozentrische Sichtweise. Trotz der eher abfälligen Wortwahl unterscheidet sich der Text doch stark von der<br />
Sichtweise der Lehrmittel vom Beginn des Jahrhunderts, die mit Ausnahme des Textes von Frobenius, die<br />
schwarzafrikanischen Religionen mit tiefster Abscheu betrachteten, aus denen es die Schwarzafrikaner zu<br />
erretten galt, notfalls auch durch den Islam.<br />
3.3.3.8 Länder und Völker, Ende 60er Jahre<br />
"Länder und Völker" geht im Band 3 auf der Seite 45 als erstes der untersuchten Lehrmittel auf das Christen-<br />
tum in Äthiopien ein, dass sich weitgehend unabhängig von der katholischen Kirche entwickelt hat:<br />
Schon früh, im 4. Jahrhundert n. Chr., drang von Ägypten her das koptische Christentum ein und wurde zur Staatsreligion.<br />
Daher ist das Land eine christliche Insel in einer islamischen Umwelt.<br />
Obwohl die Christen Äthiopiens immer wieder durch den stärker werdenden Islam unter Druck gerieten,<br />
wurden sie, trotz Teilnahme an den Kreuzzügen, weitgehend von den islamischen Gegenangriffen verschont.<br />
Den Betrachter der neunziger Jahre erinnert das aktuell praktizierte Christentum der Äthiopier rein äusserlich<br />
stark an islamische Formen der Religionsausübung.<br />
Den traditionellen Religionen widmet der Autor nur einen einzigen Satz auf der Seite 51:<br />
Die Religion der heidnischen Neger ist ein Geisterglaube, und zwar verehrt er die Naturgewalten und die Seelen der<br />
Verstorbenen.<br />
Damit reduziert der Autor die grosse Vielfalt der Glaubensformen auf die Begriffe "Geisterglaube", "Ani-<br />
mismus" und "Ahnenverehrung".<br />
3.3.3.9 Seydlitz für Gymnasien 1963- ca. 1971<br />
Auch der "Seydlitz für Gymnasien" sagt auf der Seite 90 des fünften Bandes unter der Überschrift "Die Reli-<br />
gionsgemeinschaften" kaum mehr über die traditionellen schwarzafrikanischen Religionen aus:<br />
...Die niederen religiösen Formen der Geister- und Zauberglaubens, des Animismus und Fetischismus und der<br />
Ahnenverehrung, sind eng an Naturerlebnisse gebunden...<br />
Die in Schwarzafrika immer noch bedeutenden traditionellen Religionsformen werden hier also nicht nur als<br />
"niedrige" Formen betrachtet, der Autor verwendet auch Begriffe wie "Animismus" und "Fetischismus", ohne<br />
sie zu erläutern, geschweige denn auf ihre <strong>Pro</strong>blematik einzugehen.<br />
3.3.3.10 Geographie für die oberen Klassen der Volksschule, 1972-1977<br />
Einführung: Themenkreis Religion<br />
Wieder etwas ausführlicher kommt der vierte Band "Die Kultur" des Lehrmittels "Geographie für die oberen<br />
Klassen der Volksschule" auf die Religionen Schwarzafrikas zu sprechen. Eine erste Aussage zum Einfluss des<br />
Islams findet sich in einem Brief eines Schweizers aus Kamerun auf der Seite 50 des Bandes über die Kultur:<br />
Die meisten Bewohner des Nordens sind Mohammedaner. Überall kann man sehen, wie sie den Gebetsteppich ausbreiten,<br />
aus einem Kaldor Wasser über Gesicht, Hände und Füsse giessen, sich gegen Mekka neigen, den Boden küssen und ihre<br />
Gebete verrichten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 87
Je nach Angaben sollen Ende des 20. Jahrhunderts 25-51% der der rund 14 Mio. Menschen zählendenden<br />
Bevölkerung Kameruns traditionellen Religionen anhängen, während 33-50% sich zum Christentum und<br />
16-25% zum Islam bekennen, wobei das Christentum vor allem im Süden, d.h. den Küstengebieten, und der<br />
Islam vor allem im Norden - gegen die Sudanzone hin - dominant sind.<br />
Im gleichen Band beschäftigt sich der Autor unter dem Titel "Religion" mit den Glaubenssystemen Schwarzaf-<br />
rikas, wobei er auf den Seiten 58f. einen Schwarzafrikaner zu Wort kommen lässt:<br />
...Die Religion gilt bei uns Afrikanern viel mehr als bei euch... Bei euch besteht eine tiefe Kluft zwischen der Religion und<br />
der praktischen Lebensführung. Religion und Leben sind bei euch zwei verschiedene Dinge. Leider kamen das<br />
Christentum und der Kolonialismus von denselben Ausgangspunkten nach Afrika. Bei der Verwaltung unseres Volkes war<br />
die Kirche ein enger Mitarbeiter der Regierungen.<br />
So war es unvermeidlich, dass die Kirche Schaden erlitt. Stünde es in unserer Macht, uns mit Europa in Verbindung zu<br />
setzen, so würden wir raten, die Europäer sollten sich nicht als christliches, sondern e einfach als europäisches Abendland<br />
bezeichnen.<br />
Dieses Zitat, die erste Äusserung eines Schwarzafrikaners zum Thema innerhalb der untersuchten Lehrmittel,<br />
ergänzt der Autor auf der Seite 59 mit weiteren Angaben:<br />
Rund 20% aller Afrikaner sind heute Christen, fast ebensoviele Mohammedaner. Etwa 60% halten an ihren einheimischen<br />
Religionen fest...<br />
Der Glaube der Afrikaner hat manche überraschende Ähnlichkeit mit dem christlichen Glauben. Zwar gibt es viele geistige<br />
Einzelwesen, die ins Leben eingreifen, aber die Afrikaner glauben auch an einen Schöpfer der Welt. Er schuf das Ur-Paar<br />
der Menschen und schenkte diesem von seiner eigenen, unvergänglichen Kraft. Diese ersten Menscheneltern bekamen<br />
Kinder und gaben von ihrem Leben an sie weiter. Beim Sterben des ersten Menschenpaares ging ihr Leib zur Erde zurück,<br />
doch als geistige Wesen blieben sie lebendig. Es ist den Verstorbenen nach afrikanischer Vorstellung möglich, das Leben<br />
ihrer Kinder und Enkel zu beeinflussen.<br />
Dieser Abschnitt ist zu allgemein gehalten, da sich wie schon erwähnt die Kulturen, und damit die Glaubens-<br />
vorstellungen der afrikanischen Völker über ein weites Spektrum hinziehen. Zudem sind einige der "überlie-<br />
ferten" Glaubensvorstellungen stark von christlichen Einflüssen geprägt und gerade die unseren Glaubenssy-<br />
stemen ähnlichen Überlieferungen werden besonders gern zu Objekten der Forschung erklärt. Der Autor fährt<br />
fort (S. 59):<br />
Für den Afrikaner ist die Lebenskraft wichtig. Er möchte möglichst viel Lebenskraft haben. Sie bedeutet für ihn gesund<br />
sein, kräftig sein, Freude haben, Mut besitzen. Er unternimmt alles, um zu diesen Eigenschaften zu kommen. Er vollbringt<br />
eine gute Tat, wenn er auch seinen Kindern und seinen Eltern dazu verhilft. Der Lebenskraft schadet er, wenn er<br />
unaufrichtig oder eifersüchtig ist, wenn er hasst oder lügt.<br />
Über die Lebenskraft kommt der Autor auf die Ahnen und deren Verehrung zu sprechen. Dazu schreibt er:<br />
Die leiblichen Vorfahren und Nachkommen sind dem Afrikaner die Nächsten. Von ihnen hofft er am meisten Hilfe für das<br />
Leben zu bekommen, und ihnen kann er auch am meisten geben. Darum ist für ihn die Familie so wichtig. Die<br />
Nächstenliebe gegenüber fremden Menschen liegt ihm weniger. Nächstenliebe weit über die Familie hinaus ist eine<br />
christliche Tugend.<br />
Ein Arzt aus Lambarene erzählt, er habe immer wieder erlebt, wie gross der Zusammenhalt innerhalb der Familie sei, wie<br />
selbstverständlich in diesem Rahmen Gastfreundschaft geübt werde. Dagegen sei er nicht selten überrascht gewesen zu<br />
sehen, wie engherzig die Afrikaner denken und handeln, wenn ein anderer um Hilfe bittet. Wenn man als Fremder<br />
allerdings das Vertrauen eines Afrikaners gewonnen habe, dann sei es auch wieder anders, dann werde man nämlich als<br />
Sohn oder als Vater einfach in den Familienkreis aufgenommen.<br />
Neben dem Text bildet die Seite 59 auch eine Plastik der Dogon "Ahnenpaar der Dogon, Westsudan" ab. Die<br />
Dogon haben eine ganz eigene Kultur, welche aufgrund ihrer Besonderheiten seit ihrer "Entdeckung" durch<br />
europäische Anthropologen Gegenstand der Forschung ist. Die Seite 60 zeigt das Foto einer afrikanischen<br />
Maske. Ausserdem enthält die Seite ein Gedicht über die Ahnen, auf welches hier nicht weiter eingegangen<br />
wird, da es aufgrund des Textes nicht eingeordnet werden kann und wenig zum Bild des schwarzafrikanischen<br />
Menschen beiträgt. Dazu schreibt der Autor:<br />
Einführung: Themenkreis Religion<br />
Mit der Religion haben auch die Masken etwas zu tun. Sie sind dazu da, die Menschen immer wieder an ein rechtes Leben<br />
zu mahnen, und sie helfen ihnen auch, ein solches zu führen. Die Masken haben Kraft. Zum Beispiel vertreiben sie das<br />
Böse. Sie helfen auch, Menschen mit schlechten Absichten festzustellen und ihr schlimmes Tun zu vereiteln. Manchmal<br />
sprechen durch sie die verstorbenen Vorfahren und erteilen Ratschläge. Oder sie haben nach der Meinung der Afrikaner<br />
auch einen Einfluss auf die Ernte.<br />
Derjenige, der eine Maske trägt, ist kein gewöhnlicher Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen. Die Maske macht ihn zu<br />
etwas Überirdischem. Weil sie diese Fähigkeit hat, ist die Maske auch heilig und nicht etwa nur ein Spielzeug. Darum gibt<br />
es auch strenge Vorschriften, wie man mit den Masken umgehen soll. Masken haben also eine ganz wichtige Aufgabe im<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 88
Leben der afrikanischen Völker. Bei uns versteht man ihren eigentlichen Sinn nicht mehr, obwohl Masken früher auch bei<br />
uns verwendet wurden. Heute dienen sie noch zur Verkleidung an der Fasnacht...<br />
Je nach Volk und Kultur spielen die Masken eine mehr oder weniger wichtige Rolle. In den islamischen oder<br />
christianisierten Gegenden haben sie aber stark an Bedeutung verloren, ganz im Gegensatz zur Musik, die auch<br />
in den Städten im Zusammenhang mit Feiern immer wieder in traditionellem Stil aufgeführt wird.<br />
Der Autor des Lehrmittels versucht also nicht nur ein ausführlicheres Bild schwarzafrikanischer Religionsaus-<br />
prägungen zu geben, sondern er verzichtet auch auf eine Wertung derselben.<br />
3.3.3.11 Dreimal um die Erde, 1977-1980<br />
Der Band 2 des Lehrmittels "Dreimal um die Erde" hält auf der Seite 40 die Vielfältigkeit der afrikanischen<br />
Religionsformen fest, wenn es zur Kernaussage "Die Stämme unterscheiden sich vielfach... in Rasse, Sprache,<br />
Religion und Bildungsstand" eine Tabelle zur Religionszugehörigkeit in Nigeria wiedergibt. Die einzelnen<br />
Angaben, Mohammedaner (48%), Christen (33%) und Naturreligionen (19%), ergänzen sich dabei praktischer-<br />
weise auf 100%, obwohl aufgrund von Daten aus anderen Ländern anzunehmen ist, dass viele Menschen zwei<br />
der erwähnten Glaubenslehren praktizieren, denn nicht selten hängen die Mitglieder einer Familie unterschied-<br />
lichen Glaubenssystemen an.<br />
Obwohl der Autor die "Naturreligionen", d.h. die traditionellen Religionen, erwähnt, geht er nicht näher darauf<br />
ein, so dass sich die Leser abgesehen von der Idee der Naturnähe kein Bild machen können.<br />
3.3.3.12 Seydlitz Erdkunde 1993-1995<br />
Nachdem der Autor von "Seydlitz Erdkunde" im Band 3 auf der Seite 108 in der Beschreibung der Bevölke-<br />
rung Afrikas festgehalten hat, dass zu den "wesentlichen Kennzeichen" eines Volkes seine Religion gehört,<br />
schreibt er auf der Seite 134 im Kapitel zu Nigeria, einem Land, das "unterschiedliche Völker mit verschiede-<br />
nen Religionen" zu einem Staat vereint, dass die "erste Begeisterung über die Unabhängigkeit... für kurze Zeit<br />
die alten Stammes- und Religionsgegensätze vergessen" liess. Eine Karte auf der gleichen Seite zeigt die<br />
Verteilung der "Religionen in Nigeria" und in einem Textkasten "Aus der Geschichte Nigerias" wird erwähnt,<br />
dass die Hausa, die um 700 in das Gebiet des nördlichen Nigerias eingewandert waren, um 1100 islamisiert<br />
wurden und 1841 die christliche Missionierung der Ibo, einem Küstenvolk begann. Über die statistischen und<br />
kartographischen Informationen geht einmal mehr die Beschreibung der traditionellen Religionen Schwarzafri-<br />
kas vergessen.<br />
3.3.3.13 Diercke Erdkunde, 1995-1997<br />
Diercke Erdkunde, das neueste der untersuchten Lehrmittel beschreibt im Band 3 auf der Seite 47 im Kapitel<br />
"Frauen in Burkina Faso" die Religionszugehörigkeiten der Familie des 13jährigen Mädchens Khadija:<br />
Khadija und ihre Eltern sind Moslems, ihre Verwandten dagegen bekennen sich zum Christentum. Alle sind aber auch<br />
Animisten geblieben, d. h. sie glauben auch an Naturgeister oder den Einfluss von den Seelen der Ahnen auf ihr<br />
gegenwärtiges Leben.<br />
Eine für das Landesinnere Westafrikas häufige Konstellation, die von einer gewissen Toleranz der Religions-<br />
gemeinschaften füreinander zeugt. Mindestens solange keine Abwerbungen von der einen Konfession zur<br />
anderen angestrebt werden, eine Verhaltensregel an die sich besonders christliche Gemeinschaften amerikani-<br />
scher Prägung oft nicht halten und dadurch immer wieder für Unruhen sorgen.<br />
Einführung: Themenkreis Religion<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 89
Obwohl das Lehrmittel also auf die verschiedenen Religionen eingeht, bleiben auch hier die Leser mit einer<br />
vagen Beschreibung des Glaubens an "Naturgeister" und die "Seelen der Ahnen" allein.<br />
3.3.3.14 Zusammenfassung<br />
Eine Zusammenfassung des vermittelten Bildes der religiösen Vorstellungen der Menschen Schwarzafrikas im<br />
20. Jahrhundert, bei der auch die Aussagen der Musiklehrmittel mitberücksichtigt werden, findet sich im Teil<br />
"Ergebnisse der Untersuchung" unter dem Untertitel "Religion" ab der Seite 526 dieser Arbeit.<br />
3.3.4 Weitere Themenkreise<br />
Neben den vorgestellten Themenkreisen enthalten die Teile "Der schwarzafrikanische Mensch im Geographie-<br />
lehrmittel", "Der schwarzafrikanische Mensch im Musiklehrmittel" und "Der schwarzafrikanische Mensch im<br />
Lesebuch und Comic" weitere Themen innerhalb der Besprechung der Einzelwerke. Die für das Thema wich-<br />
tigsten Zitate und Anmerkungen sind durch Querverweise miteinander verknüpft. Die folgende thematische<br />
Auflistung verweist jeweils auf den ersten Eintrag einer Kette von Verweisen zu dem unter "Themenkreis"<br />
genannten Thema:<br />
THEMENKREIS SEITE<br />
Landwirtschaft:<br />
Brandrodung ................................................................. ... 362<br />
Hackbau ..................................................................... ... 140<br />
Heuschreckenschwärme ......................................................... ... 107<br />
Entwicklung in Schwarzafrika:<br />
Apartheid .................................................................... ... 149<br />
Elendsquartiere ............................................................... ... 158<br />
Entwicklungshilfe, siehe auch Ochsenpflüge ......................................... ... 145<br />
Hunger ...................................................................... ... 107<br />
Karibastaudamm .............................................................. ... 161<br />
Ochsenpflug .................................................................. ... 267<br />
Schulabgänger ................................................................ ... 269<br />
Sklavenhandel ................................................................ .... 95<br />
Ujamaa ...................................................................... ... 287<br />
Ungünstige Lage des Kontinents .................................................. ... 135<br />
Voltastaudamm ............................................................... ... 170<br />
Wildbestände ................................................................. ... 106<br />
Exportprodukte:<br />
Eisenerzabbau ................................................................ ... 157<br />
Kaffee ...................................................................... ... 112<br />
Kakao ....................................................................... ... 156<br />
Sisal ........................................................................ ... 225<br />
Tee ......................................................................... ... 164<br />
Krankheiten<br />
Einführung: Themenkreis Religion<br />
Lepra ....................................................................... ... 232<br />
Malaria ...................................................................... ... 132<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 90
THEMENKREIS SEITE<br />
Schlafkrankheiten .............................................................. ... 145<br />
Länderdarstellungen:<br />
Angola ...................................................................... ... 159<br />
Äthiopien .................................................................... ... 112<br />
Botswana .................................................................... ... 161<br />
Demokratische Republik Kongo ................................................... ... 158<br />
Kenia ....................................................................... ... 123<br />
Madagaskar .................................................................. ... 115<br />
Malawi ...................................................................... ... 203<br />
Mali ........................................................................ ... 255<br />
Mauretanien .................................................................. ... 100<br />
Mosambik ................................................................... ... 159<br />
Nairobi ...................................................................... ... 165<br />
Namibia ..................................................................... ... 162<br />
Nigeria ...................................................................... ... 123<br />
Ruanda ...................................................................... ... 165<br />
Sambia ...................................................................... ... 161<br />
Simbabwe ................................................................... ... 160<br />
Tansania, siehe auch Ujamaa ..................................................... ... 221<br />
Tschad ...................................................................... ... 264<br />
Nahrungsmittel Schwarzafrikas:<br />
Erdnuss ..................................................................... ... 216<br />
Maniok ...................................................................... ... 115<br />
Personen:<br />
Nkrumah, Kwame ............................................................. ... 218<br />
Schweitzer, Albert ............................................................. ... 124<br />
Sonderthemen:<br />
Benin (Nigeria) ............................................................... .... 29<br />
Brautgeschenk ................................................................ ... 106<br />
Kano (Nigeria) ................................................................ ... 373<br />
Kinder ...................................................................... ... 246<br />
Lagos (Nigeria) ............................................................... ... 157<br />
Medizinmann ................................................................. ... 201<br />
Menschenfresser ............................................................... ... 139<br />
Sahelzone .................................................................... ... 317<br />
Timbuktu (Mali) ............................................................... .... 28<br />
Tourismus ................................................................... ... 166<br />
Traditionelle Erziehung ......................................................... ... 244<br />
Trommelsprache .............................................................. ... 155<br />
Völker:<br />
Einführung: Weitere Themenkreise<br />
Buschmänner ................................................................. .... 97<br />
Hausa, Volk und Sprache ........................................................ .... 29<br />
Massai ...................................................................... ... 164<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 91
THEMENKREIS SEITE<br />
Pygmäen .................................................................... ... 101<br />
Wirtschaft:<br />
Einführung: Weitere Themenkreise<br />
Kleinbusse als Transportmittel .................................................... ... 156<br />
Markt ....................................................................... ... 107<br />
Terms of Trade ................................................................ ... 322<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 92
4. Der schwarzafrikanische Mensch im Geographielehrmittel<br />
Erdkundebücher, die sich bewusst von rassistischem Denken und von der "Primitivität" der Afrikaner distanzieren oder<br />
dagegen angehen, sind sehr selten... Bei der Behandlung der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen... scheint<br />
bisweilen eine melancholische Beurteilung durch, die von der Undankbarkeit gegenüber dem weissen Mann spricht... Man<br />
verharrt in der Haltung eines naiven Paternalismus. Er offenbart sich in Erwähnungen wie unverschämte Wünsche der<br />
Eingeborenen in bezug auf die Entwicklungshilfe... Die Superiorität der mit der Entwicklungshilfe eingeführten westlichen<br />
Werte wird ohne weiteres postuliert... Das Ziel einer "Europäisierung" der Welt scheint der allgemeine Hintergrund aller<br />
Entwicklungshilfebemühungen zu sein.<br />
(Manfred Paeffgen, der eine Studie über das Bild Schwarzafrikas in der Bundesrepublik verfasse, worin er auch die seit<br />
dem 2. Weltkrieg bis 1972 erschienenen Schulbücher analysierte, zitiert in Michler 1991, S. 5)<br />
Anhand von Geographielehrmitteln, die in der Schule zur Anwendung kamen oder kommen, sowie mittels<br />
Geographiebüchern, die allenfalls der Lehrkraft als Lieferant für Hintergrundwissen dienen, soll das Bild des<br />
schwarzafrikanischen Menschen nebst den bereits im Teil "Vorwürfe an das von der Schule vermittelte Bild"<br />
(ab der Seite 35 dieser Arbeit) auch auf eine Reihe von weiteren Kriterien hin untersucht werden. Jedes der im<br />
folgenden aufgeführten Kriterien ist mit einem Hinweis auf die Stellen versehen, an denen es in den Grundzü-<br />
gen diskutiert wird.<br />
1. Anteil des Lehrmittels, der sich mit Afrika allgemein und mit dem schwarzafrikanischen<br />
Menschen, seiner Kultur, Sprache, seinen Traditionen und Errungenschaften beschäftigt.<br />
Siehe dazu das Kapitel "Anteil der Afrikaseiten am Gesamtumfang der Geographielehrmittel" im<br />
Teil "Ergebnisse der Untersuchung" auf der Seite 527 dieser Arbeit.<br />
2. Auswahl der Länder und Darstellung der vielseitigen und unterschiedlichen Formen des Lebens<br />
der schwarzafrikanischen Menschen.<br />
Siehe dazu den Teil "Ergebnisse der Untersuchung" ab der Seite 494 dieser Arbeit.<br />
3. Ethnozentrität der Darstellung der beschriebenen Menschen und Kulturen.<br />
Das Thema wird im Rahmen der Einzelbesprechungen anhand der einzelnen Textstellen<br />
behandelt.<br />
4. Art der aufgeführten Materialien, insbesondere Originalberichte, Quelltexte (meist in<br />
Übersetzungen), sowie Anteil der Materialien, die von Menschen der beschriebenen Länder<br />
erarbeitet oder unter ihrer Mitwirkung erstellt wurden.<br />
Das Thema wird im Rahmen der Einzelbesprechungen anhand der einzelnen Textstellen bespro-<br />
chen, sowie im Kapitel "Qualität und Aktualität der gemachten Aussage" auf der Seite 528 dieser<br />
Arbeit angeschnitten.<br />
5. Aktualität und Wahrheitsgehalt des Materials bezogen auf den Wissensstand der neunziger Jahre,<br />
sowohl im Hinblick auf offensichtliche Fehlinformationen (wo diese nachgewiesen werden<br />
können), als auch in Bezug auf seit dem Erscheinen des Textes vollzogene Veränderungen.<br />
Das Thema wird im Rahmen der Einzelbesprechungen anhand der einzelnen Textstellen bespro-<br />
chen, sowie im Kapitel "Qualität und Aktualität der gemachten Aussage" auf der Seite 528<br />
angeschnitten.<br />
Geographielehrmittel: Einleitung<br />
Zur besseren Einordnung der Quellen in den zeitlichen und räumlichen Rahmen werden zu Beginn der Einzel-<br />
diskussion jeweils, das Entstehungsjahr des Werkes (soweit möglich) oder das Erscheinungsjahr angegeben,<br />
sowie das Zielpublikum (Schulstufe, für die das Lehrmittel gedacht ist). Aussagen der Lehrmittel werden, wo<br />
möglich und für nötig befunden, kommentiert und allenfalls Gegenargumenten oder Fakten gegenübergestellt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 93
Geographielehrmittel: Einleitung<br />
Quellen für die Gegenargumente werden, falls es sich nicht nur um einzelne Zahlen oder Fakten handelt<br />
jeweils angegeben. Dabei wird weitestgehend auf den Wissensstand der neunziger Jahre zurückgegriffen, der<br />
in der Form verschiedener Publikationen, Film- und Tondokumenten, sowie Internetdateien und den für<br />
Computer auf CD-ROM erschienen Enzyklopädien Compton, Encarta, Grolier, Infopedia u. a. vorlag. Bei<br />
Medien, die im computerisierter Form vorlagen, wurde auf Seitenverweise verzichtet, da diese zu einem gros-<br />
sen Teil fehlen und die gesuchten Stellen mittels einer Stichwortsuche rasch aufgefunden werden können.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 94
4.1 Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen (1912)<br />
Millionen von Negern aber leben im Zustande heidnischen Aberglaubens und entsetzlicher Roheit... (S. 386)<br />
Das Lehr- und Lesebuch für die thurgauische Volksschule war für die 7. - 9. Klasse, also die Oberstufe,<br />
gedacht. Nebst Lesetexten verschiedener Autoren enthält es auch einen geographischen Teil (S. 320-429) unter<br />
dem Titel "Aus der Weltbeschreibung und Weltkunde". Davon beschäftigen sich sieben Seiten auch mit dem<br />
afrikanischen Kontinent (S. 384-388, sowie S. 408-410 mit einem Text über den Suezkanal). Auf diesen Seiten<br />
findet sich ein einziger Abschnitt über die den afrikanischen Kontinent bewohnenden Menschen (S. 386):<br />
Von den drei Menschenrassen Afrikas - Weisse, Neger und Malaien - sind die Neger am stärksten, die Malaien am<br />
schwächsten vertreten. Letztere bewohnen die Insel Madagaskar. Die kaukasischen Stämme, wie Abessinier, Araber und<br />
Berbern, nehmen besonders den Nordosten und Norden des Erdteils ein, die Negervölker alles Gebiet von der Sahara bis<br />
zum Kapland. Das Christentum hat noch wenig Eingang in Afrika gefunden; stark verbreitet ist im Norden die<br />
mohammedanische Religion. Millionen von Negern aber leben im Zustande heidnischen Aberglaubens und entsetzlicher<br />
Roheit, und noch mag es lange dauern, bis es gelingt dem empörenden Sklavenhandel ein Ende zu bereiten.<br />
Mehr ist dem Lehrmittel über die Natur des Afrikaners nicht zu entnehmen. Ebensoviel oder wenig Raum<br />
nimmt die Beschreibung der Tierwelt Afrikas ein. Die Schüler lernen also, dass der Schwarzafrikaner ein<br />
Heide ist, und dass er in Roheit, was auch immer darunter verstanden werden soll, lebt. Konkrete Angaben, sei<br />
es zur Kultur, oder auch nur zum Aussehen, werden nicht gemacht.<br />
Der im letzten Satz des Zitats erhobene Vorwurf gegen den Sklavenhandel ist ebenfalls zu kurz geraten. Es<br />
wird nicht deutlich, ob damit der von den omanischen Fürsten bis Anfang des Jahrhunderts praktizierte<br />
Menschenhandel, der punktuell und bis heute andauernde Menschenhandel in Ländern wie etwa dem Sudan,<br />
Senegal oder Mauretanien, oder die bis ins 19. Jahrhundert betriebene Sklaverei der Europäer, die zahlenmäs-<br />
sig am bedeutendsten war - Schätzungen schwanken zwischen 15-75 Millionen Menschen, die dem afrikani-<br />
schen Kontinent durch den Sklavenhandel und seine Folgen verloren gingen (Nentwig 1995, S. 68) -, gemeint<br />
ist. (Zum Sklavenhandel siehe auch die Seite 97 dieser Arbeit.)<br />
4.1.1 Zusammenfassung<br />
Der einzige, kurze Abschnitt, den das Lehrmittel den Schwarzafrikanern widmet, zeugt von der Bedeutungslo-<br />
sigkeit, die der Autor ihnen zumisst. Die Lebensweise der schwarzafrikanischen Völker wird nicht nur als<br />
primitiv beschrieben, sondern als von "entsetzlicher Roheit". Dieses Bild wird durch den Hinweis auf den<br />
Sklavenhandel verstärkt, der die vor allem von den Europäern geförderte, an sich schon fragwürdige Praxis des<br />
Menschenhandels den Völkern Afrikas zum Vorwurf macht - also jenen, die zunehmend darunter gelitten<br />
haben.<br />
Bedingt durch die Kürze des Abschnittes zeichnet der Autor ein völlig undifferenziertes und durch die Art der<br />
Beschreibung äusserst negatives Bild der Menschen in Schwarzafrika, welches, hat es sich erst einmal in den<br />
Köpfen der Schüler festgesetzt, den ansonsten nicht informierten Leser beim Anblick eines Schwarzen unwill-<br />
kürlich erschauern lassen muss.<br />
Geographielehrmittel: Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen (1912)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 95
4.2 Lesebuch für die Oberklassen (30er Jahre)<br />
Diese haben kräftigen Körperbau. Ihre Haut ist dunkelbraun bis schwarz. Starke Kiefer, eine platte Nase und wulstige<br />
Lippen lassen das Gesicht unschön erscheinen. Das Haar ist kraus und wollig. (S. 368)<br />
In dem von der Thurgauischen Lehrmittelkommission bearbeiteten "Lesebuch für die Oberklassen", es dürfte<br />
aus den dreissiger Jahren stammten (das Erscheinungsjahr konnte nicht mehr festgestellt werden), entfallen die<br />
Seiten 294 -378 auf die Geographie, davon beschäftigen sich 8 Seiten (S. 362 - 369) mit Afrika. Der von E.<br />
Neusch bearbeitete Text ist in drei Teile gegliedert: "Der Nil und Ägypten" (S. 362-364), "Die Sahara" (S.<br />
364-366) und "Die Negerländer" (S. 366-369). Im letztgenannten Teil findet sich auf den Seiten 368-369, nach<br />
einer Beschreibung von Landschaft und Tierwelt, folgende Textstelle zur einheimischen Bevölkerung (S. 368):<br />
Die durchwanderten Gebiete sind die Heimat der Neger. Diese haben kräftigen Körperbau. Ihre Haut ist dunkelbraun bis<br />
schwarz. Starke Kiefer, eine platte Nase und wulstige Lippen lassen das Gesicht unschön erscheinen. Das Haar ist kraus<br />
und wollig.<br />
Statt sich auf die sachliche Beschreibung des Äusseren dieser Menschen zu beschränken, wird mit dem Attri-<br />
but "unschön" eine Wertung des Aussehens eingeführt. Dabei gingen die Meinung über die Schönheit der<br />
schwarzen Rassen seit der Römerzeit immer wieder auseinander, wie Adeleye anhand zahlreicher Zitate beleg-<br />
te. (Adeleye, 1992) Im Text setzt Neusch seine Beschreibung fort (S. 368):<br />
Ihre Kleidung besteht aus einem Lendenschurz. In den Küstengegenden werden jedoch schon vielfach Baumwollkleider<br />
getragen.<br />
Hier weisst der Autor einerseits auf eine Veränderung der Gewohnheiten der Küstenbewohner, bewirkt durch<br />
den Kontakt mit europäischen Missionaren hin, andererseits verschweigt er, dass es bei vielen afrikanischen<br />
Völkern lange vor dem Kontakt mit den Europäern Brauch war, sich in unserem Sinne "angemessen" zu<br />
bekleiden. Zu der Lebensweise und den Eigenschaften der Schwarzafrikaner schreibt Neusch (S. 368):<br />
Die Hauptnahrung bilden Hirse und Mais. Dazu kommen allerlei Früchte und Fleisch. Die Neger sind anstellig und zeigen<br />
Geschicklichkeit in mancherlei Dingen. Doch bringen sie es über einen gewissen Stand der geistigen Entwicklung nicht<br />
hinaus.<br />
Hirse und Mais sind bis heute wichtige Nahrungsmittel für viele Menschen in Schwarzafrika, nebst den aufge-<br />
zählten Nahrungsmitteln spielen aber auch Kassawa, Yams und Reis ein bedeutende Rolle, um nur eine weni-<br />
ge aufzuzählen.<br />
Die Bemerkung über die intellektuellen Fähigkeiten des Schwarzafrikaners entspricht dem Zeitgeist, die weis-<br />
se Rasse wurde entweder als Krönung der Schöpfung oder als letztes und damit vollendetes Glied der Evolu-<br />
tion betrachtet. Diese Sicht sollte sich noch lange halten und wird, obwohl sie unterdessen als Rassismus<br />
entlarvt wurde, teilweise noch immer vertreten.<br />
Geographielehrmittel: Lesebuch für die Oberklassen (30er Jahre)<br />
Meist leben sie unter einem Häuptling in Stämmen beisammen. An einzelnen Orten sind auch vorübergehend blühende<br />
Negerstaaten entstanden. Dies ist besonders im westlichen Sudan der Fall. Da wohnen die Neger in volkreichen Dörfern<br />
und Städten beisammen und treiben Ackerbau, Handwerk und Handel. In den grasreichen Gegenden bilden Viehherden<br />
ihren Reichtum. Ihre Hütten sind viereckig, kegel- oder halbkugelförmig. Die Dörfer werden gewöhnlich mit Mauern oder<br />
Dornhecken umgeben. So schafft man sich Schutz gegen wilde Tiere und feindliche Menschen.<br />
Im Gegensatz zu den meisten anderen untersuchten Lehrmitteln werden die Hochkulturen im Sudangebiet<br />
zumindest angedeutet. Ihre Bedeutung wird aber unterschätzt, wie im Kapitel "Übersicht über die Geschichte<br />
Schwarzafrikas" unter dem Titel "Wirtschaft und Gesellschaft Westafrikas" auf den Seiten 30f. dieser Arbeit<br />
aufgezeigt wird. Auch beschreibt der Autor verschiedene Siedlungs- und Hausformen und es wird klar, dass<br />
verschiedene Räume Afrikas ein unterschiedliche Siedlungsdichte aufweisen. Eine Rundhütte ist unter dem<br />
Titel "Negerdorf aus dem Innern Afrikas" mit Hilfe einer Zeichnung auf der Seite 368 abgebildet:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 96
Auf Seite 369 fährt der Autor fort:<br />
Die Stämme leben häufig in Fehde miteinander. Die Kriege führen sie mit wilder Grausamkeit. Manche Gegenden, die<br />
einst ein Bild friedlichen Lebens boten, sind so zu menschenleeren, verwilderten Gebieten geworden. Besonders schlimm<br />
hausten früher die arabischen Sklavenjäger. Bis ins Innerste Afrikas drangen diese Räuber vor und brachten Schrecken,<br />
Elend und Tod in die Negerdörfer. Seitdem die Europäer von Afrika Besitz genommen haben, ist diesen Menschenjagden<br />
ein Ende gemacht worden.<br />
Neusch differenziert nicht zwischen den verschiedenen Volksgruppen, beispielsweise den eher einer kriegeri-<br />
schen Tradition verpflichteten Nomaden, die schon seit mehreren hundert Jahren immer wieder eine Bedro-<br />
hung für den Handel im ganzen Sudan darstellten oder den sesshaften und oft friedlicheren Bauernvölker.<br />
Auch ist die Bezeichnung "wilde Grausamkeit" für die in Schwarzafrika damals geführten Kleinkriege und<br />
Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen, im Anbetracht des in Europa gerade erst über-<br />
standenen Ersten Weltkrieges und seiner Greuel, unangebracht.<br />
Die Entvölkerung ganzer Gebiete ist auf sehr unterschiedliche Faktoren, wie der Niedergang von Reichen,<br />
Sklavenhandel, Epidemien, Klimaverschlechterung, durch die von Europäern eingeführte Zwangsarbeit, um<br />
nur einige zu nennen, zurückzuführen.<br />
Der Sklavenhandel wird ebenfalls sehr lückenhaft dargestellt, da die Schuld vor allem den Arabern zugesch-<br />
oben wird, die diese Praxis zwar über einen längeren Zeitraum als die Europäer "pflegten", zahlenmässig aber<br />
nicht an den durch den Dreieckshandel gestützten Menschenhandel der Europäer herankamen. Zudem wird die<br />
Rolle der Schwarzafrikaner in diesem Handel völlig verschwiegen. Der so in ein einseitiges Licht gerückte<br />
Menschenhandel dient dann im Text von Neusch praktischerweise auch als legitimer Grund für die "Besitz-<br />
ergreifung" Afrikas durch die europäischen Kolonialmächte. (Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 95 und<br />
99 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Lesebuch für die Oberklassen (30er Jahre)<br />
Über die anderen Völker südlich der Sahara schreibt Neusch auf der Seite 369:<br />
Ausser den Negern trifft man im Kongobecken Zwergvölker, die in den Wäldern mit vergifteten Pfeilen Tiere jagen. In den<br />
Steppen des Südwestens wohnen Hottentotten und Buschmänner. Sie sind ebenfalls von kleinem Wuchse, aber von<br />
hellerer Farbe. Die Buschmänner sind die niedrigst stehenden Menschen. In ihrem Aussehen und Wesen gleichen sie fast<br />
tierischen Geschöpfen. Erdlöcher, Felsspalten und ausgehöhlte Ameisenhaufen bilden ihre Wohnungen Pfeil und Bogen<br />
sind ihre einzige Habe. Mit ihnen erjagen sie die schnellfüssigen Tiere der Steppe. Dabei zeigen sie sich als äusserst<br />
gewandte und ausdauernde Läufer. Im Notfalle verzehren sie sogar Insekten, Schlangen und das ekelhafteste Gewürm. Wie<br />
sie unglaubliche Mengen von Nahrung auf einmal geniessen können, so vermögen sie auch lange zu hungern. Als arge<br />
Viehräuber wurden die Buschmänner früher von den weissen Ansiedlern niedergemacht, wo diese ihrer habhaft werden<br />
konnten.<br />
Die Zwergvölker Afrikas werden bis in noch heute im Gebrauch stehende Lehrmittel in ähnlicher Weise<br />
beschrieben. (Siehe dazu weitere Zitate aus anderen Lehrmitteln für die "Pygmäen" auf den Seite 101 für die<br />
"Buschmänner" und "Hottentotten" auf den Seite 103 dieser Arbeit). Im Rahmen der Evolutionstheorie wurden<br />
sie immer wieder als eine Entwicklungsstufe betrachtet, die irgendwo auf dem Weg der Menschwerdung auf<br />
urtümlichen, affenähnlichen Niveau stehengeblieben sei. So wurde noch um 1906 ein "Pygmäe" aus dem<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 97
Kongogebiet im Affenhaus eines amerikanischen Zoos gehalten und dem Publikum zur Belehrung vorgeführt,<br />
nachdem er von einigen Wissenschaftlern auf der Suche nach dem "missing link", dem fehlenden Glied in der<br />
Evolution des Menschen, studiert worden war, die zum Schluss kamen: "The low state of their mental develop-<br />
ment is shown by the following facts. They have no regard for time, nor have they any records or traditions of<br />
the past; no religion is known among them, nor have they any fetish rights; they do not seek to know the future<br />
by occult means... in short, they are... the closest link with the original Darwinian anthropoid ape extant."<br />
Dabei lautete die Fragestelltung: "Who and what are they? Are they men, or the highest apes?" Als der erste<br />
Reiz verflogen war, ersann man zur Erheiterung des Publikums ein weiteres "Experiment" und brachte<br />
Otabenga mit einem Orang-Utan zusammen: "The orangutan imitated the man. The man imitated the monkey.<br />
They hugged, they let go, flopped into each other's arms. Dohong [the orangutan] snatched the woven straw<br />
off Ota's head and placed it on his own.... the crowd hooted and applauded... the children squealed with<br />
delight. To adults there was a more serious side to the display. Something about the boundary condition of<br />
'being human' was exemplified in that cage. Somewhere man shaded into non-human." (Bergmann, 1993)<br />
Im Lesebuch schreibt der Autor weiter über die Besitzverhältnisse auf dem afrikanischen Kontinent (S. 369):<br />
Mit Ausnahme von Liberia in Oberguinea und Abessinien gehört heute das ganze Negergebiet den Europäern. Seitdem<br />
kühne Forscher den Schleier lüfteten, der über dem dunkeln Erdteil lag, ist der wirtschaftliche Wert des Landes erkannt<br />
worden. Mehr und mehr kommen afrikanische <strong>Pro</strong>dukte auf den Weltmarkt. Die Tropenländer liefern Kautschuk, Palmöl,<br />
Palmkerne, Bananen, Erdnüsse, Gummi, Kopal (ein Harz zur Bereitung von Lack und Firnis), Elfenbein. Der Süden<br />
versendet Gold, Diamanten, Kupfer, Wolle, Straussenfedern, Wein, Obst, Zucker, Kaffee, Baumwolle und Tee.<br />
Der erste Satz dieses Abschnittes zeigt die damaligen Machtverhältnisse auf. Nachdem man erkannt hatte, dass<br />
man sich die Menschen Afrika zu Unrecht als Eigentum genommen hatte, eignete man sich, nach einer Zeit<br />
des friedlichen Handelns, praktisch den ganzen Kontinent an. (Siehe dazu die Seite 33 im Teil "Überblick über<br />
die Geschichte Schwarzafrikas" dieser Arbeit.) Wie im Text geschrieben, wurde nach dem Verbot des Skla-<br />
venhandels der afrikanische Kontinent für die europäischen Händler, die vorwiegend entlang der Küste<br />
operierten, uninteressant. Erst die Berichte verschiedener Afrikaforscher und Abenteurer führten zu einem<br />
neuen Interesse Europas an den Ländern Afrikas, der "wirtschaftliche Wert des Landes" für die erstarkende<br />
Industrie in Europa wurde erkannt, und man begann, die Rohstoffe Afrikas auszubeuten.<br />
4.2.1 Zusammenfassung<br />
Das "Lesebuch für die Oberklassen" bedeutet gegenüber dem "Lehr- und Lesebuch" von 1912 eine sowohl<br />
quantitative wie auch qualitative Verbesserung. Anstelle der "entsetzliche Roheit" der Afrikaner spricht man<br />
nun von der "Geschicklichkeit in mancherlei Dingen" und "blühenden Negerstaaten" auch wenn deren Bewoh-<br />
ner "es über einen gewissen Stand der geistigen Entwicklung" nicht hinausbringen. Schlecht kommen die<br />
"Zwergvölker" weg, deren Lebensweise der Autor als besonders primitiv eingestuft, wohl auch deshalb, weil<br />
sie sich wirtschaftlich nicht nur nicht benutzen oder ausbeuten liessen, sondern sich im Falle der "Buschmän-<br />
ner" auf dem Rückzug vor den in ihr Land eindringenden Buren, von denen sie teilweise versklavt wurden, als<br />
"arge Viehräuber" betätigten.<br />
Geographielehrmittel: Lesebuch für die Oberklassen (30er Jahre)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 98
4.3 Leitfaden für den Geographiunterricht (1934)<br />
Die Hottentotten sind ein träges, sorgloses, schmutziges Hirtenvolk. Sie wohnen in bienenkorbartigen Hütten, die mit<br />
Binsenmatten bedeckt sind. Als Viehzüchter sind sie die Todfeinde der Buschmannen einem Jägervolk, das sich der<br />
armseligen Lebensweise in Wüste und Steppe angepasst hat... Die Buschmänner sind der armseligste aller<br />
Menschenstämme. Sie hausen ohne Hütten in Nestern... und... nähren... sich nur von der Jagd auf alles, "was da kreucht<br />
und fleucht". Sie leben... ohne Band zwischen Eltern und Kindern... Sie sind, wie zahlreiche andere Naturvölker, dem<br />
Aussterben nahe. (S. 117)<br />
Das Werk "Leitfaden für den Geographieunterricht", 1934 in der 22. Auflage erschienen, befasst sich auf 17<br />
(S. 103-119) der insgesamt 231 Seiten speziell und in einigen Abschnitten auf weiteren Seiten auch mit dem<br />
afrikanischen Kontinent und seinen Bewohnern.<br />
4.3.1 Allgemeiner Teil<br />
Nachdem der Autor auf den Seiten 103-106 in einem allgemeinen Überblick die Lage, den Bau, die Gewässer,<br />
das Klima, die Pflanzen- und Tierwelt bespricht, folgt auf S. 106 im 7. Abschnitt eine Beschreibung der<br />
Bevölkerung:<br />
Den grössten Teil Afrikas bewohnen die Negervölker. Es sind kräftig gebaute Menschen von brauner bis schwarzer<br />
Hautfarbe; ihr Haar ist kraus; wulstige Lippen bedecken ihre hervortretenden Kiefer; die Nase ist flach mit breiten Flügeln.<br />
Sie beschäftigen sich mit Viehzucht oder Ackerbau, im Urwaldgebiet sind sie Hackbauer. Die meisten stehen noch auf<br />
einer niedern Stufe des Heidentums, dem Fetischismus. - Im N der Sahara wohnen die braunen Mischvölker der Hamiten<br />
und die hellfarbigen Berber. Sie sind vermischt mit den semitischen Arabern, welche den Islam brachten. In den<br />
Trockengebieten Südafrikas leben die hellbraunen Buschmänner als Jäger, die Hottentotten als Viehzüchter, doch werden<br />
sie immer mehr durch die Weissen verdrängt, die den S des Kontinents bevölkern. Hier sind es besonders Holländer und<br />
Briten, während sich im N Franzosen festgesetzt haben.<br />
Nach einer Charakterisierung des Aussehens und der Art der gepflegten Landwirtschaft folgt einer der typi-<br />
schen Bemerkungen über die Kultur der den "Fetischismus" pflegenden schwarzafrikanischen Menschen, die<br />
als niedrigstehend angesehen wird. Richtig schätzt der Autor die <strong>Pro</strong>blematik der Verdrängung ursprünglich<br />
heimischer Völker durch die europäischen Einwanderer im Raum Südafrika ein. Allerdings mussten die<br />
"Buschmänner" und "Hottentotten" auch zunehmend den in diesen Raum vorstossenden Bantus weichen. Mit<br />
einem kurzen Abschnitt über die geringe Bevölkerungsdichte des afrikanischen Kontinents und die Auswir-<br />
kungen des Sklavenhandels auf die Bevölkerung und deren Kultur schliesst der Autor diesen ersten allgemei-<br />
nen Abschnitt über die Bevölkerung:<br />
Der Erdteil ist ziemlich dünn bevölkert, am dichtesten an der Küste und an den Flüssen. Die Sklavenjagden des<br />
verflossenen Jahrhunderts haben blühende Völker vernichtet. Man schätzt die Einwohnerzahl auf etwa 140 Millionen<br />
Menschen (nur 2 Mill. Weisse).<br />
Diese Aussage über den Menschenhandel, der hier als "Sklavenjagd" bezeichnet wird, relativiert die im "Lese-<br />
buch für die Oberklassen" (siehe dazu die Seite 97 dieser Arbeit) gemachten Aussagen über die Folgen des<br />
kriegerischen Gebarens der Völker Schwarzafrikas. (Zum Sklavenhandel siehe auch die Seite 115 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Leitfaden für den Geographieunterricht (1934)<br />
Im 8. Abschnitt beschreibt der Autor die "Wirtschaftlichen Verhältnisse" des afrikanischen Kontinents:<br />
Ackerbau, Handel und Verkehr stehen in Afrika noch auf niederer Stufe. Trotz der grossen Fruchtbarkeit des Tropengürtels<br />
gelangen nur wenig <strong>Pro</strong>dukte zur Ausfuhr, die zudem auf den von Weissen geleiteten Plantagen gewonnen werden<br />
(Kaffee, Kakao, Palmöl, Kopra, Kautschuk). Der Neger pflanzt nur für den eigenen Bedarf Bananen, Jams (eine<br />
kartoffelähnliche Pflanze), Negerhirse (eine Getreideart mit einer grossen Rispe) und Erdnüsse. Die Bewohner der Steppen<br />
treiben Viehzucht. Im S züchten sie Ochsen Fettschwanzschafe, Strausse, im N Kamele, Pferde und Schafe. Verschiedene<br />
Stämme fristen ihr Leben durch Jagd und Sammeln von Früchten. Die Jagd liefert dem Welthandel, zwar immer spärlicher<br />
das Elfenbein.<br />
Wie bei anderen Autoren zum Anfang des 20. Jahrhunderts, z. B. Albert Schweitzer, wird nicht nur die Frucht-<br />
barkeit des Regenwaldes überschätzt, sondern vielfach fehlt auch noch die Einsicht in ökologische Zusammen-<br />
hänge, die der einheimischen Bevölkerung besser bekannt waren, allerdings nicht immer umgesetzt werden<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 99
konnten. Ausserdem wurden viele einheimische Pflanzungen so angelegt, dass sich die Nutzpflanzen gegensei-<br />
tig ergänzten und die Nährstoffe des Bodens optimal ausgenutzt werden konnten.<br />
Die Industrie ist wenig entwickelt, da Steinkohle und Eisen fast ganz fehlen. Der Bergbau fördert Kupfer, Gold und<br />
Diamanten in Südafrika, Eisenerz und Düngstoffe im N.<br />
Diese Aussage steht im Gegensatz zur vor der Kolonialisierung in Teilen Afrikas blühenden Schmiedekunst.<br />
Noch im 16. Jh. wurden in Schmelzöfen für die Eisengewinnung einiger Völker Schwarzafrikas höhere<br />
Temperaturen als in denen Europas erzeugt. Afrikanisches Gold wurde bereits vor dem Eindringen der Euro-<br />
päer bis nach England, Indien oder China gehandelt und trug wesentlich zu der Blüte einer ganzer Reihe von<br />
Reichen im Sudan und in Simbabwe bei.<br />
Der vom Autor erwähnte Abbau von Eisenerz war beispielsweise im Liberia bis zum Ausbruch des Bürger-<br />
krieges von grosser Bedeutung für die Exportwirtschaft. (Zur Eisenerzgewinnung in Liberia siehe auch die<br />
Seiten 157 und 252 dieser Arbeit.) Mauretanien erwirtschaftet fast die Hälfte seiner Exporteinnahmen mit der<br />
Förderung von Rohstoffen, wovon die geförderten Eisenerze mit rund 11 Mio. Tonnen pro Jahr in den neunzi-<br />
ger Jahren den Löwenanteil ausmachen. (Fischer 1998; zu Mauretanien siehe auch die Seite 351 dieser Arbeit.)<br />
Das Gebiet der heutigen Westsahara verfügt noch immer über grosse Phosphatvorkommen, über deren Abbau<br />
aber wegen der Besetzung durch Marokko keine neueren Zahlen erhältlich sind.<br />
Grosse Wüstenflächen und unbefahrbare Flussstrecken haben das Innere Afrikas bis vor kurzer Zeit von jedem grösseren<br />
Verkehr abgeschlossen. Deshalb steht dort der Handel noch auf der Stufe des Tauschverkehrs; nur die Kaurimuschel<br />
besitzt einigen Geldwert, sonst werden alle Waren gegen Baumwollstoffe, Eisenwaren, Vieh usw. eingetauscht. Doch<br />
immer weiter dringen die Eisenbahnen und mit ihnen die Formen des europäischen Handels ins Land. Die<br />
Haupthandelsplätze liegen am Meer oder an wichtigen Karawanenstrassen.<br />
Die vom Autor genannten Eisenbahnen waren vor allem zum Transport der Rohstoffe für den Export gedacht<br />
und wurden deshalb meist in der Form von Stichbahnen ins Landesinnere erstellt. Für die einheimische Bevöl-<br />
kerung haben diese Bahnen auch heute noch oft nur eine kleine Bedeutung.<br />
Zu dem im Text erwähnten Zahlungsmittel der Muscheln, zitiert Braudel in seinem Buch "Sozialgeschichte<br />
des 15. - 18. Jahrhunderts: Der Alltag" einen Portugiesen, der 1619 schrieb: "Die Zimbos... sind gewisse sehr<br />
kleine Meeresschnecken, die an sich keinerlei Nützlichkeit oder Wert besitzen. Die Barbaren haben dieses<br />
Geld einst eingeführt und benutzen es bis heute." (Braudel 1985, S. 482)<br />
In vielen Gegenden Afrikas wird bis heute eine Art des Tauschhandels betrieben, der den Bauern die Subsi-<br />
stenzwirtschaft betreiben, entgegen kommt. Immer haben aber auch andere Zahlungssysteme existiert, die<br />
jedoch, wohl als Folge der europäischen Tätigkeit, verdrängt wurden.<br />
Geographielehrmittel: Leitfaden für den Geographieunterricht (1934)<br />
Afrika, der "Schwarze" Erdteil, ist erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts erforscht worden und es gibt noch<br />
heute unbekannte Regionen. Berühmte Forscher, die vor kaum 50 Jahren zur Aufklärung der geographischen Verhältnisse<br />
des Innern ihr Leben aufs Spiel setzten, waren Livingstone und Stanley.<br />
Die "Erforschung" Afrikas durch Europäer war oftmals nur möglich durch die ortskundigen heimischen<br />
Führer, die solche Expeditionen vielfach im Sinne des Gastrechtes unterstützten, wenn es vereinzelt auch zu<br />
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Exponenten der zwei Kulturkreise kam.<br />
Mit einem kurzen Überblick über die damaligen Machtverhältnisse auf dem afrikanischen Kontinent schliesst<br />
der Autor unter dem Titel "Staatliche Verhältnisse" seine allgemeinen Ausführungen auf der Seite 107 ab:<br />
Afrika ist der Erdteil der Kolonien, denn der grösste Teil ist in den Händen der europäischen Staaten. Dabei beherrscht<br />
Frankreich mehr den westlichen Teil und Madagaskar, während Englands Besitzungen im O von Ägypten bis zum Kap der<br />
Guten Hoffnung reichen. Belgisch ist das Gebiet des Kongo, auch Portugal hat zwei Küstenstriche der tropischen<br />
Gegenden inne, während Italien einige trockene, unfruchtbare Gebiete im N sein eigen nennt. Nur wenige Länder sind<br />
unabhängig, so Abessinien und Ägypten, das allerdings unter britischem Einfluss steht.<br />
Der Autor wendet sich nun der Beschreibung einzelner Landstriche zu. Auf den Seiten 107 - 112 beschreibt er<br />
die Atlasländer, den Wüstengürtel und Ägypten, bevor er sich auf den Seiten 112 - 113 in den vier Abschnitten<br />
"Form und Pflanzenwelt", "Klima", "Besiedlung" und "Staaten" dem Sudan zuwendet.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 100
4.3.2 Der Sudan<br />
Über die Bevölkerung des Sudans schreibt der Autor auf der Seite 112 folgendes:<br />
Die Bewohner sind Sudanneger. Von NW her brachten hamitische Mischvölker, z. B. die Haussa, den Islam mit.<br />
Diese Behauptung ist im Hinblick auf die Hausa nur teilweise korrekt, denn die Hausa wurden erst etwa im<br />
11. Jahrhundert islamisiert, nachdem sie bereits in das Gebiet Nigers, Tschad und Nigerias eingewandert<br />
waren.<br />
In den trockenen Gebieten wird Viehzucht getrieben. In einigen Gegenden wird sie allerdings durch das Auftreten der<br />
Tsetsefliege verhindert. In der feuchteren Savanne herrscht Feldbau als Hackbau vor. Hauptfrüchte sind die Negerhirse und<br />
Erdnüsse.<br />
Die Siedlungen bestehen aus würfelförmigen, meist roten Lehmhäusern oder strohbedeckten Rundhütten. Sie sind oft samt<br />
den Feldern von Lehmmauern umgeben, so dass sie den Anblick eigenartiger Städte gewähren. An Knotenpunkten des<br />
Karawanenverkehrs haben sich grosse Städte entwickelt, welche besonders zur Zeit der Märkte sehr volkreich sind. So<br />
liegt Timbuktu am Niger, wo er die Wüste berührt, Bornu an der Niederung des flachen, abflusslosen Tschadsees. Die<br />
Bedeutung dieser Städte hat seit dem Aufhören des Sklavenhandels stark abgenommen Eine wichtige Handelsstadt ist<br />
Khartum, an der Vereinigung des Weissen und Blauen Nils. Sie liegt im Mittelpunkt des englisch-ägyptischen Sudan, der<br />
heute dank der künstlichen Bewässerung viel Baumwolle liefert. Auch der obere Nil soll zu Bewässerungszwecken gestaut<br />
werden. Sonst liefert das Land noch Erdnüsse. Früher spielte der Handel mit Elfenbein, Straussenfedern und Gold eine<br />
Rolle. In Britisch-Nigeria wird Zinnerz abgebaut.<br />
Die Einschätzung des Autors betreffend der "eigenartigen Städte" des Sudans ist nur teilweise richtig, wenn er<br />
von einem Niedergang "seit dem Aufhören des Sklavenhandels" spricht. Der Niedergang begann, nicht wie<br />
vom Autoren angenommen im 19. Jahrhundert, sondern setzte bereits im 15. Jahrhundert ein, als sich im Zuge<br />
der Ausbreitung des Einflusses der Portugiesen entlang der Westküste, eine Umorientierung der<br />
Sudanbevölkerung vom Norden hin nach den Süden vollzog. Nach dem Verlust ihres ehemaligen Handelsmo-<br />
nopols versanken viele betroffenen Städte in der Bedeutungslosigkeit. (Siehe dazu auch die Tabelle in der<br />
Besprechung des Lehrmittels" Seydlitz: Mensch und Raum" (1987) auf der Seite 375 dieser Arbeit.)<br />
Im vierten Abschnitt, über die Staaten, weist der Autor darauf hin, dass der direkte Einfluss der Europäer auf<br />
das Landesinnere nach wie vor gering sei. Obwohl die Länder des afrikanischen Kontinents unterdessen alle<br />
ihre Unabhängigkeit erlangt haben, lässt sich beispielsweise an der Westküste Afrikas nach wie vor eine<br />
graduelle Abschwächung des euroamerikanischen Einflusses beim Vorstoss ins Landesinnere beobachten: Die<br />
Lebensweise der Menschen in den Küstenstädten unterscheidet sich stark von den traditionellen Mustern in<br />
den Dörfern des Landesinnern.<br />
4.3.3 Die Guineaküste und das Kongogebiet<br />
Auf den Seiten 114-116 folgt eine Beschreibung der Guineaküste und des Kongogebietes, die ebenfalls dem<br />
Schema "Form", "Klima", "Pflanzendecke", "Besiedlung" und "Staaten" folgt.<br />
Im Abschnitt "Klima" auf Seite 114 bemerkt der Autor, dass die Böden infolge Ausschwemmung nicht sehr<br />
fruchtbar seien. "Deshalb erfordern die Plantagen Düngung, und die Eingeborenen müssen ihre Felder ständig<br />
verlegen."<br />
Geographielehrmittel: Leitfaden für den Geographieunterricht (1934)<br />
Der Wanderfeldbau wird in mehreren der später erschienenen Lehrmitteln eingehend thematisiert, deshalb soll<br />
hier auf diese Thematik nicht weiter eingegangen werden. Die Düngung der Plantagen sollte sich Jahre später<br />
als problematisch erweisen, da sie teilweise zu einer Versalzung der Böden führte.<br />
Über die Bewohner dieser Landstriche berichtet der Autor im Abschnitt "Besiedlung" auf Seite 115:<br />
Im Urwald von Oberguinea und des Kongobeckens leben Bantuneger. Sie roden kleine Teile des Urwaldes und bauen<br />
Knollenpflanzen, wie Maniok, Jams, Negerhirse und Bananen an. Viehzucht ist infolge der Verbreitung der Tsetsefliege<br />
unmöglich. In unzugänglichen, sumpfigen Teilen des Urwaldes wohnen Zwergvölker, Pygmäen. Sie leben von der Jagd,<br />
welche sie mit vergifteten Pfeilen betreiben. Eine höherentwickelte Kultur mit Eisen- und Kupferverarbeitung haben die<br />
Sudanneger von Oberguinea.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 101
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 97 und 114 dieser Arbeit.) Es sei auf die vom selben Autor auf Seite<br />
103 gemachte Bemerkung verwiesen, die weiter oben kommentiert wurde, dass "Steinkohle und Eisen fast<br />
ganz" fehlten. Der Autor gliedert die verschiedenen Völker in die auf der Art der Landbestellung und des<br />
materiellen Wohlstandes basierenden Kulturstufen ein, deren Einteilung sich in einigen Lehrmitteln noch<br />
lange halten konnte.<br />
Entgegen den immer wieder aufgestellten Bemerkungen benutzen die "Pygmäen" sehr unterschiedliche Jagd-<br />
techniken, die dem jeweiligen Beutetier angepasst sind und nicht nur auf "vergifteten Pfeilen" beruhen. So ist<br />
beispielsweise bekannt, dass die Akan-Pygmäen ein Pflanzengift beim Fischfang benutzen, welches die Fische<br />
betäubt aber nicht tötet. Ausserdem besteht ein Grossteil der Nahrung aus pflanzlicher Kost wie Knollen und<br />
Wurzeln, die mittels gefertigter Werkzeuge, die nur diesem einen Zweck dienen, gewonnen werden. (Im Wald<br />
der Pygmäen, 1998)<br />
Nur wenige Weisse wohnen in dem feuchten Tropengebiet, denn das Klima ist äusserst ungesund. Malaria, Schlafkrankheit<br />
und andere schreckliche Krankheiten suchen sogar die Eingeborenen heim. Deshalb haben die Europäer nur<br />
Handelsniederlassungen, Faktoreien, an der Küste errichtet, in welchen die Erzeugnisse des Landes gesammelt und<br />
verschickt werden. Es sind vor allem Kakao, Früchte der Öl- und Kokospalme, Kaffee aus zahlreichen Plantagen der<br />
Küstenregion, kostbare Hölzer (Mahagoni, Ebenholz) aus dem Urwald, Kautschuk, Elfenbein aus dem Kongobecken. Der<br />
Süden des Kongostaates ist in der Landschaft Katanga reich an Kupfererzen, und im Hochland von Angola finden sich<br />
Diamanten und Radiumerz.<br />
Im Gegensatz zu dem in dieser Arbeit besprochenen Geographielehrmittel aus dem Jahre 1953 sagt der Autor<br />
klar aus, dass auch die Einheimischen unter den aufgeführten Tropenkrankheiten zu leiden hätten. Die Euro-<br />
päer "dringen nicht im zähem Kampf immer weiter ins Landesinnere vor" wie es in einem späteren Lehrmittel<br />
heisst ("Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule" 1953, S. 113), sondern beschränken ihren Aufenthalt<br />
auf das für den Abtransport der Rohstoffe nötige Minimum.<br />
Mit einem Blick auf die Verkehrsprobleme im Kongogebiet, die für weite Landstriche bis heute nicht gelöst<br />
sind, und die politische Gliederung im Abschnitt "Staaten" auf Seite 116 beendet der Autor seine Betrachtun-<br />
gen über Niederguinea und den Kongo.<br />
4.3.4 Ostafrika<br />
Noch auf der Seite 116 wendet sich der Autor Ostafrika zu. Im 2. Abschnitt "Klima", der auf eine Beschrei-<br />
bung der Topologie folgt, heisst es:<br />
Geographielehrmittel: Leitfaden für den Geographieunterricht (1934)<br />
Da das Klima gesund ist, haben sich weisse Ansiedler niedergelassen, die ausgedehnte Weizen- und Maisfelder bebauen.<br />
An der Küste und am Viktoriasee herrscht Plantagenwirtschaft (Kokospalme, Baumwolle), und heidnische Bantuneger<br />
treiben Ackerbau. Die Steppe bewohnen mohammedanische Mischvölker, Somali und Massai, die kriegerische<br />
Viehzüchter sind.<br />
Im 3. Abschnitt mit dem Titel "Europäischer Kolonialbesitz" beschreibt der Autor die Ostküste, deren Infras-<br />
truktur und <strong>Pro</strong>dukte, bevor er im 4. Abschnitt "Abessinien" über die dortige Bevölkerung zu berichten weiss:<br />
Die dunkelhäutige hamitische Bevölkerung hat ein entartetes Christentum dem Ansturm des Islam gegenüber zu erhalten<br />
vermocht. Es sind Ackerbauer und Viehzüchter. Sie stehen unter der absolutistischen Herrschaft eines Kaisers. Um seine<br />
Gunst bewerben sich Italiener Franzosen und Engländer, die sich an der heissen, unfruchtbaren Küste des Roten Meeres<br />
festgesetzt haben. Wichtig ist, besonders als Einfuhrhafen, das französische Dschibuti, das eine Eisenbahn mit der<br />
Hauptstadt Abessiniens, Adis-Abeba, verbindet.<br />
Wenn der Autor von einem entartetem Christentum spricht, so obliegt er einer Täuschung, handelt es sich bei<br />
der im ehemaligen Abessinien bis heute praktizierten Christentum doch um eine sehr alte, auf das 5. oder 6.<br />
Jahrhundert zurückgehende Form dieser Glaubensrichtung, die in ähnlicher Weise auch von den Kopten in<br />
Oberägypten bis auf den heutigen Tag gepflegt wird. Auf dem Konzil von Nicea wurde ein Glaubensstreit<br />
zwischen dem Begründer des äthiopischen Christentums, dem syrischen Mönch Fromentius, der später als<br />
St. Athanasius bekannt wurde, und einem weiteren Mönch, Arius, zu Gunsten von Athanasius entschieden.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 102
Dies führte zu einer Spaltung der damaligen Kirche. Die Äthiopier und Ägypter blieben dabei, obwohl sie dem<br />
Beschluss, über die Gottesnatur Christi, des Konzils folgten, auf der Seite der Verlierer, denn im Konzil von<br />
Chalkedon wurde die "Irrmeinung" des Arius bestätigt. (Ki-Zerbo 1984, S. 92-93) Wenn schon von Entartung<br />
die Rede ist, müsste man wohl also eher die mitteleuropäische Form, sei der Glaube nun katholisch oder refor-<br />
miert geprägt, als entartet bezeichnen.<br />
Der "absolutistische Kaiser" Abessiniens sorgte dafür, dass Abessinien das einzige Land Afrikas mit einer<br />
mehrheitlich dunkelhäutigen Bevölkerung blieb, welches dem europäischen Eroberungswillen trotzen konnte -<br />
bis es von den Italienern überrannt wurde.<br />
4.3.5 Südafrika<br />
In seiner Betrachtung der Region Südafrika weicht der Autor von seinem bisherigen Schema stark ab. Er glie-<br />
dert den Text in die zwei Abschnitte "Das Innere" (S. 117-119) und "Der Süden und der Westen" (S. 119). Zur<br />
Bevölkerung Südafrikas finden sich folgende Stellen im 1. Abschnitt auf den Seiten 117 - 118:<br />
...Dort dehnt sich die Wüste Kalahari aus, die nicht so wasserarm wie die Sahara ist und daher den letzten Horden der<br />
Buschmänner notdürftig ihre Nahrung liefert, die in allerhand saftreichen Knollen, Wassermelonen und Tieren besteht.<br />
In feuchteren Gebieten liegen die Weiden der Hottentotten.<br />
Hottentotten und Buschmänner gehören einer eigenartigen, gelbbraunen Menschenrasse an.<br />
Die Hottentotten sind ein träges, sorgloses, schmutziges Hirtenvolk. Sie wohnen in bienenkorbartigen Hütten, die mit<br />
Binsenmatten bedeckt sind. Als Viehzüchter sind sie die Todfeinde der Buschmannen einem Jägervolk, das sich der<br />
armseligen Lebensweise in Wüste und Steppe angepasst hat (Giftpfeile). Die Buschmänner sind der armseligste aller<br />
Menschenstämme. Sie hausen ohne Hütten in Nestern, die sie sich in Büschen, Felsspalten oder Ameisenbauten gemacht<br />
haben, und decken sich nachts zum Schutze gegen die Kälte mit Asche zu. Ohne Vieh, alles Anbaues unkundig, nähren sie<br />
sich nur von der Jagd auf alles, "was da kreucht und fleucht". Sie leben nicht in Stämmen, sondern nur in Horden<br />
beisammen, ohne Band zwischen Eltern und Kindern: das Wasser schleppen sie in Strausseneiern mit sich oder verbergen<br />
es in solchen auch im Boden. Sie sind, wie zahlreiche andere Naturvölker, dem Aussterben nahe.<br />
Weiter im S wird das Weideland besser... Hier sind die Ansiedlungen der Kaffern, die in bienenkorbförmigen "Kraalen"<br />
wohnen und Rinder züchten. Von S her sind seinerzeit holländische Kolonisten die Buren, mit ihren schwerfälligen, mit<br />
10-20 Ochsen bespannten Karren eingewandert. Ihre Nachkommen treiben noch heute Viehzucht, deren <strong>Pro</strong>dukte als<br />
Wolle und Straussenfedern ausgeführt werden. Sie müssen regelmässig zu Beginn der Trockenheit mit ihren Herden in<br />
feuchtere Landschaften ziehen (trekken)...<br />
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 97 und 130 dieser Arbeit.) Wie schon in den Lehrmittel "Lese-<br />
buch für die Oberklassen" werden auch hier die in einer "primitiven" Sozialform lebenden Restvölker Afrikas<br />
als "schmutzig" und "armselig" taxiert. Dieser "armseligste aller Menschenstämme" würde aber bald vom<br />
Antlitz der Erde verschwinden, denn er sei "dem Aussterben" nahe. Dabei vergisst der Autor zu erwähnen,<br />
dass die von Süden eingewanderten Buren dazu beigetragen haben, das Volk der "Buschmänner" aus den<br />
Gunsträumen des südafrikanischen Grossraumes zu vertreiben.<br />
Der 2. Abschnitt zum Süden und Westen enthält keine im Rahmen dieser Arbeit interessierenden Aussagen.<br />
Der Autor schliesst seine Betrachtung der afrikanischen Landschaften mit einem kurzen, sich auf Seite 119<br />
befindenden Kapitel über "Die afrikanischen Inseln".<br />
Zwei weitere Abschnitte zu den Menschen des schwarzafrikanischen Raums finden sich auf den Seiten S. 211<br />
unter dem Titel "Die Rassen":<br />
Geographielehrmittel: Leitfaden für den Geographieunterricht (1934)<br />
Zahlreich ist auch die schwarze oder Negerrasse (ca. 200 Mill.). Sie bewohnt Afrika und Südindien. Neben der dunklen<br />
Hautfarbe haben die Neger eine breite, plattgedrückte Nase, vorstehende Kiefer und Kraushaare. Zu Zeit des<br />
Sklavenhandels sind viele von ihnen nach Amerika eingeführt worden, wo sie jetzt einen grossen Bestandteil der<br />
Bevölkerung ausmachen.<br />
Gegenüber dem Lehrmittel "Lesebuch für die Oberklassen" beschränkt sich der Autor in seiner Beschreibung<br />
der "Neger" auf die Schilderung des Äusseren, ohne diese wertend zu beurteilen. Dabei liefert er aber ein viel<br />
zu allgemeines Bild, welches sich nur auf einen Ausprägungstyp unter dem schwarzafrikanischen Menschen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 103
eschränkt, zudem wiederholt er im Wesentlichen die im gleichen Werk in der Einführung gemachten Aussa-<br />
gen, die auf der Seite 99 dieser Arbeit wiedergegeben werden.<br />
Auf der Seite 213 versucht der Autor unter dem Titel "Die Religion" eine allgemeine Erklärung für den<br />
"Fetisch- und Dämonendienst" zu geben (S. 213):<br />
In der Religion versucht der Mensch die Rätsel zu lösen, welche ihn bewegen. Fetisch- und Dämonendienst ist die Religion<br />
niedrigstehender Völker. Bei diesen Heiden ist das Priestertum (Zauberer, Schamane) stark entwickelt (Verehrung der<br />
Tiere und Ahnen).<br />
Der anschliessende Vergleich des Islam mit dem Christentum scheint die Sichtweise des Autors in Bezug auf<br />
die verschiedenen Religionen widerzuspiegeln (S. 213):<br />
...Der Islam (= Hingabe an Gott), der heute noch in Asien und Afrika an Verbreitung gewinnt, ist wie das Christentum eine<br />
monotheistische (= ein Gott) Religion. Dieses ist die Religion der Europäer, die es durch die Mission unter die Heiden<br />
bringt.<br />
Nach Ansicht des Autors ist es also die Aufgabe "der Europäer,... durch die Mission" den Glauben an den<br />
einen Gott unter die niedrigstehenden Heiden Schwarzafrikas zu bringen.<br />
4.3.6 Zahlenteil<br />
Statistische Aussagen über Afrika, die Bewohner des Kontinents und die von ihnen geschaffenen <strong>Pro</strong>dukte<br />
finden sich auf den Seiten 216-223 in der "Statistischen Übersicht über die Staaten der Erde, ihre Grösse,<br />
Einwohnerzahl, Volksdichte, Sprache und Religion (1930)", den Seiten 224-225 in "Die Haupthandelsländer<br />
der Erde und ihre wichtigsten Ausfuhrwaren (1930)" und auf den Seiten 228-229 in der" Übersicht über die<br />
Herkunft wichtiger Welthandelsgüter (1930)".<br />
4.3.7 Zusammenfassung<br />
Der "Leitfaden für den Geographieunterricht" vermittelt einen vergleichsweise differenzierten Eindruck der<br />
schwarzafrikanischen Menschen, der durch die Gliederung Schwarzafrikas in Sudan, Guineaküste und Kongo-<br />
gebiet, Ostafrika und Südafrika bewirkt wird, sagt aber neben der Beschreibung der grundlegenden Wirt-<br />
schaftsformen wenig über die Bräuche und Kultur dieser aus. Die Darstellungen, vor allem im Bezug auf die<br />
Restvölker Afrikas, sind stark rassistisch geprägt. Während die allmählich als Arbeitskräfte der Weltwirtschaft<br />
nützlich werdenden "Neger" zwar noch "missioniert" werden müssen, gibt es in der Welt von 1934 für die als<br />
Jäger und Sammler lebenden Buschleute kein Platz mehr. Die stark eurozentrische Sichtweise des Autors<br />
schlägt sich sichtlich in den gemachten Aussagen nieder.<br />
Geographielehrmittel: Leitfaden für den Geographieunterricht (1934)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 104
4.4 Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen (1936)<br />
Tausende von Menschen fielen... dem Hungertode zum Opfer, denn Vorsorge für schlimme Zeiten liegt dem froh in den<br />
Tag lebenden Neger fern. (S. 350)<br />
Das 1936 im Thurgauischen Lehrmittelverlag erschienene "Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen", unterteilt<br />
in einen geographischen und geschichtlichen Teil, beschäftigt sich im Geographieteil auf 22 von 259 Seiten<br />
und 9 von 39 Tafeln im Anhang mit dem Thema Afrika.<br />
Die Seiten 329-330 geben Auskunft über Import und Export der afrikanischen Gebiete. Für den Sudan und die<br />
mittelafrikanischen Kolonien und Staaten werden folgende Exportgüter genannt:<br />
Holz, Palmkerne, Kakao, Palmöl, Kautschuk, Elfenbein, Tabak, Mandeln, Baumwolle, Kaffee, Gummi, Sesam, Datteln,<br />
Erdnüsse, Kolanüsse, Ingwer, Mahagoniholz, Straussenfedern, Häute und Felle, Rinder, Schafe, Ziegen, Kamele, Salz,<br />
Elfenbein, Kupfer, Zinn, Manganerz, Diamanten, Gold.<br />
Für die südafrikanischen Kolonien und Staaten werden aufgezählt:<br />
Diamanten, Gold, Kupfer, Kohle, Blei, Zinn, Silber, Asbest, Edel- und Halbedelsteine, Vieh, Häute und Felle, Butter,<br />
Wolle, Federn, Milch, Käse, Eier, Weizen, Südfrüchte, Zucker, Tee, Mais, Erdnüsse, Gemüse, Gewürznelken, Kaffee,<br />
Kautschuk, Baumwolle.<br />
Auf den Seiten 330-333 befindet sich ein Text über "Ägypten" von Fritz Jäger, gefolgt von drei Lesetexten "Im<br />
Auto quer durch die Wüste" von G.M. Haardt und L. Audouin-Dubreil auf den Seiten 333-338, "Oasen" von<br />
Heinrich Schmitthenner auf den Seiten 338-339 und "Die Steppe" von Leo Waibel auf den Seiten 339-341.<br />
4.4.1 Die Savanne<br />
Im Text "Die Savanne" von F. Thorbecke auf den Seiten 341-343 fallen folgende Sätze:<br />
...Die Landschaft liegt wie im Todesschlaf: gelb und dürr das hohe Gras, kahl die Bäume, manche Flächen schwarz vom<br />
Grasbrand, den die Eingeborenen entzündet haben...<br />
...das Chamäleon, das in seiner unheimlichen, wenn auch kleinen Drachengestalt und dem wechselnden Farbenspiel seiner<br />
hellgrünen Haut, den abergläubischen Neger mit Entsetzen erfüllt...<br />
...Unter allen Tropenlandschaften bieten die Savannen dem Menschen die günstigsten Lebensbedingungen. Die weiten<br />
offenen Flächen des Graslandes haben Raum zur Siedlung, ohne den schweren Rodungskampf, den der Urwald verlangt,<br />
und die Uferwälder mit dem fruchtbaren Humusboden sind leichter zu roden und in Felder zu verwandeln.<br />
Nebst der Tatsache, dass die Einheimischen Feuer in der Savanne legen, wozu wird im Text nicht erläutert,<br />
erfährt der Leser, dass das Chamäleon den "abergläubischen Neger mit Entsetzen erfüllt" - als ob man aus der<br />
panischen Reaktion, die nicht wenige Europäer im Anbetracht einer Spinne oder sogar einer Maus zeigen auf<br />
deren Glauben schliessen könnte - und dass die Savannen besonders fruchtbar seien.<br />
Der Lesetext, auf den Seiten 343-345, "Der Urwald" von Leo Waibel, der in vielen Lehrmitteln abgedruckt<br />
wurde, enthält keine Informationen zum Thema.<br />
4.4.2 "Negerleben"<br />
Anschliessen folgt auf den Seiten 345-348 ein Text mit dem Titel "Negerleben" von Robert Unterweiz über die<br />
Bewohner Ostafrikas, der hier, da es sehr detaillierte Beschreibungen enthält, leicht gekürzt wiedergegeben<br />
werden soll. Nach einer Beschreibung der Vegetation weiss Unterschweiz über die Bewohner zu berichten<br />
(S. 385f.):<br />
Geographielehrmittel: Arbeits- und Lesebuch für die Oberklassen (1936)<br />
...Fünf bis sieben Stunden weit liegen die Dörfer in der Regel voneinander entfernt, also gerade der Tagesmarsch einer<br />
Karawane. Dem Neger wächst das Essen nicht in den Mund, wie mancher Europäer sich das vorstellt. In monatelanger<br />
harter Arbeit wird von den Männern gerodet; die Bäume werden gefällt, ganz grosse, die zu viel Arbeit machen würden,<br />
werden nur entästet und stehen dann als lange, dürre Stangen auf den Feldern. Trotz der argen Verstümmelung leben sie<br />
zumeist weiter und treiben bald wieder Äste, so dass der Schaden im Wald nicht allzu arg ist. Eine Trockenzeit lang liegen<br />
die gefällten Bäume und Äste an der Erde, dann werden sie verbrannt und die Asche als Dünger in den Boden gehackt.<br />
Einen andern Dünger haben die Leute nicht, und so kommt es, dass die Felder in den meisten Gegenden in einigen Jahren<br />
nicht mehr ertragsfähig sind und neue gerodet werden müssen. Ist dies in der Nähe nicht möglich, so zieht das ganze Dorf<br />
um und siedelt zur nächsten guten Wasserstelle über, denn eine solche ist erstes Erfordernis für das Neugründen einer<br />
Siedlung. Die alte bleibt verlassen liegen... Ein Steppenbrand vernichtet sie bald, Busch wächst in der verbrannten Tembe<br />
(Negersiedlung), Gebüsch und junge Bäumchen auf den verlassenen Feldern; nur Rizinussträucher oder Tomatenbüsche<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 105
gedeihen noch weiter, und nur der Kundige erkennt an der Art des Pflanzenwuchses, dass einst ein Dorf hier stand, denn<br />
auch die schmalen Pfade, die hinführten, verwachsen rasch...<br />
Nach dieser Beschreibung der Urbarmachung des Landes, in der Unterweiz den Brandrodungsfeldbau sehr<br />
detailliert schildert und in der er nicht blind gegenüber dem ökologischen Verhalten der Einheimischen bleibt,<br />
obwohl er diese nur als Nebenprodukt einer ansonsten zu aufwendigen Rodung sieht, das Vorurteil vom para-<br />
diesischen Afrika widerlegt und sich auf die sachliche Beschreibung der Tätigkeit der "Neger" beschränkt,<br />
fährt er auf Seite 346 über die Feldarbeit fort:<br />
...Ist also die Asche in die Erde gebracht, so werden Hirse und Mais angebaut, ferner Süsskartoffeln und Erdnüsse, auf<br />
einem Unrathaufen noch ein paar Speisekürbisse. Männer und Frauen teilen sich in die Arbeit...<br />
Mit Beginn der Regenzeit muss die Feldbestellung vorüber sein. Nun wird noch Unkraut gejätet, die Felder werden oft mit<br />
hohen Knüppelzäunen umfriedet, damit das Wild nicht Schaden tue, und Frauen und Kinder scheuchen körnerfressende<br />
Vögel am Tag, während die Männer die Nachtwache gegen Antilopen und Wildschweine übernehmen.<br />
... Ist die Zeit der Ernte vorbei, dann rüsten sich die Männer, nachdem sie vorher das nötige Reisebier vertilgt haben, für<br />
längere Abwesenheit vom Dorf. Die einen gehen Jahr für Jahr als Träger, andere haben, angeworben für einen<br />
europäischen Plantagenbetrieb, Handgeld schon vor Monaten genommen, sammeln sich nun und gehen für sechs oder<br />
neun Monate in die Fremde, um zu verdienen; wieder andere sind beim Eisenbahnbau beschäftigt. In dieser Zeit trifft man<br />
selbst in grossen Dörfern neben Frauen jeden Alters nur einige Männer im Vollkraftalter, sonst nur Greise und<br />
halbwüchsige Knaben.<br />
Unterweiz beschreibt hier sehr eindrücklich die Folgen der Arbeit, die im Dienste der Europäer geleistet<br />
wurde - meist nicht freiwillig, sondern unter Zwang manchmal unter Androhung von Waffengewalt. (Siehe<br />
dazu die Seite 132 dieser Arbeit.) Ausserdem betont er noch einmal, dass die Menschen Schwarzafrikas nicht<br />
etwa untätig herumsitzen, sondern wenn immer nötig ihren Beschäftigungen nachgehen, um sich und ihre<br />
Familien zu ernähren.<br />
Interessant ist seine Beobachtung über die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern bei der Wache auf<br />
dem Feld, die sich von Schilderungen des vergleichsweise "faulen afrikanischen Mannes" in "Diercke Erdkun-<br />
de" von 1995-1997 (siehe dazu die Seiten 428 dieser Arbeit) stark unterscheidet.<br />
Kommt die Regenzeit, dann kehren die Männer wieder heim, um bei der Feldarbeit zu helfen. Schon vor einigen Tagen<br />
kam ein Mann vom benachbarten Dorf und verkündete abends im Dorfhof, dass er diesen oder jenen in Tabora oder<br />
Kilimatinde gesehen habe... Mit Sehnsucht werden die Zurückkehrenden nun im Dorf erwartet. Plötzlich bringt weither das<br />
dröhnende Antilopenhorn die Kunde von der Ankunft der Erwarteten. Sofort ist alles auf den Beinen, rennt aus der Tembe,<br />
Frauen und Kinder eilen unter trillernden Jauchzern den Ankömmlingen entgegen, und selbst die alten Männer, die sonst<br />
nur wortlos im Hof in der Sonne sitzen, erheben sich und gehen vors Tor...<br />
Jetzt sind sie schon ganz nahe, und die Rodung ums Dorf hallt wider vom gellenden Geschrei der Frauen und Mädchen, die<br />
ihre Männer und Liebsten bei der Heimkehr grüssen. Im bunten Blechkoffer bringen sie ihren Angehörigen bunte Stoffe,<br />
Glasperlen, Kochgeschirr und ähnliches mit; mancher von den Jünglingen hat auch einen Beutel voll Silberrupien<br />
zusammengespart, um damit den Brautpreis für sein Mädchen an die Schwiegereltern zahlen zu können. Die ersten paar<br />
Nächte hindurch wird dann geschwatzt und langatmig alles Erlebte erzählt. Da sitzen die Jungen herum, und aus ihren<br />
Augen blinkt die Sehnsucht, auch einmal hinauszukommen aus dem Dorf und Eisenbahn, Plantagen oder gar die Küste,<br />
das grosse Meer und die Schiffe der Europäer zu sehen. Diese Wandersehnsucht, die eigentlich in jedes Menschen Brust<br />
liegt, ist bei den Negervölkern besonders ausgeprägt. Jahr für Jahr ziehen sie hinaus, manch einer von ihnen kennt ganz<br />
Ostafrika aus eigener Anschauung, manch einer aber auch liegt fern seiner Heimat in fremder Erde begraben. Die Frauen<br />
aber bleiben fast immer zu Hause; und viele von ihnen sterben, ohne über die nächsten Dörfer hinausgekommen zu sein.<br />
Sie haben auch ein vollgerütteltes Mass Arbeit im Dorf zu besorgen.<br />
Diese Beschreibung der Rückkehr der Männer ins Dorf könnte auch eine Szene auf einem anderen Kontinent<br />
wiedergeben, den Unterweiz schildert sie, ohne die speziellen Umstände der damaligen Lebenswirklichkeit der<br />
beschriebenen Menschen, dazu gehört etwa der "Brautpreis", zu vergessen, ganz aus einem Verständnis für<br />
universelle menschliche Regungen heraus. (Zum "Brautpreis" siehe auch die Seite 125 dieser Arbeit.)<br />
Anzumerken bleibt lediglich, dass viele dieser Wanderarbeiter nicht etwa aus reiner Neugier durch "ganz<br />
Ostafrika" zogen, was aufgrund der damaligen Transportmittel und der Grösse des Gebietes nur für sehr weni-<br />
ge möglich gewesen sein dürfte, sondern von wirtschaftlicher Not und der von den Kolonialmächten erhobe-<br />
nen Kopfsteuer getrieben wurden.<br />
Geographielehrmittel: Arbeits- und Lesebuch für die Oberklassen (1936)<br />
Im folgenden Abschnitt schildert Unterweiz die Arbeitsaufteilung zwischen den Geschlechtern:<br />
Eine strenge Grenze ist zwischen der Arbeit der Männer und derjenigen der Frauen gezogen. Alles, was körperlich sehr<br />
hohe Anforderungen stellt und eine in der Zeit kurze, aber gewaltige Anstrengung bedeutet, ist Sache der Männer. Die<br />
körperlich leichte, dafür zeitlich oft lange währende Arbeit leistet die Frau. So schlägt der Mann im Wald das Bauholz und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 106
das Brennholz, während die Frau nur abgefallene Äste sammelt. Der Mann spaltet mit der Axt die schweren Holzklötze,<br />
während Frauen Axt und Messer nicht gebrauchen...<br />
Das Jagen nach Wild mit Vorderlader, mit Speer, Bogen und Pfeil, das Fischen mit der Reuse, Angel oder Fischgabel ist<br />
Männerarbeit; die Frauen dagegen sammeln Kerbtierlarven und fischen mit Körben die kleinen Fischlein, die in<br />
austrocknenden Tümpeln zurückbleiben. Wo Rinderzucht herrscht, treibt der Mann das Vieh auf die Weide, melkt fast<br />
überall und schüttelt die geronnene Milch im Flaschenkürbis zu Butter, versorgt Ziegen und Schafe. Das Roden ist<br />
Männerarbeit, das Pflanzen und Jäten Frauenarbeit. Die Wartung des Feuers, das am Herd der Hütte bei einer guten<br />
Hausfrau nicht verlöschen soll, die Zubereitung des Essens, alles was zum Kochen gehört, also Mehlstampfen und Mahlen,<br />
Wassertragen, ja die Herstellung der Töpfe selbst obliegt den Weibern.<br />
Der Hausbau ist Sache der Männer, das Verschmieren der Wände mit Lehm müssen die Frauen besorgen. Holzarbeiten,<br />
Schnitzen liegt den Männern ob. Die Herstellung von Matten und anderen Erzeugnissen aus Flechtgras ist, wenigstens bei<br />
den meisten Stämmen, Frauenarbeit... Die Arbeit hört auch für den Neger niemals auf; das süsse Nichtstun, das ihm oftmals<br />
angedichtet wird, hätte im Jahr darauf schon einen knurrenden Magen zur Folge. Allerdings wartet er bis zum letzten<br />
Augenblicke, um erst dann das schon brennend Notwendige zu schaffen. Eine zeitliche Voraussicht fehlt ihm; drum<br />
pflanzen im Innern die Neger selten grössere Fruchtbäume. "Heute pflanze ich den Baum, Herr, in fünf Jahren trägt er<br />
vielleicht. Ich weiss doch nicht, ob ich dann noch leben werde, antwortete mir ein Neger einmal. Durch das unvermeidliche<br />
dauernde Übersiedeln würden übrigens die Früchte des alten Dorfplatzes oft nur in stundenweiten Märschen zu haben<br />
sein."<br />
Diese ausführliche Beschreibung der Arbeitsteilung, sie bleibt im Vergleich mit den anderen untersuchten<br />
Lehrmitteln für viele Jahre unübertroffen, ist fast völlig frei von verallgemeinernden Aussagen. So weisst<br />
Unterweiz sogar darauf hin, dass gewisse "Stämme" eine andere Arbeitsaufteilung vornehmen würden. Auch<br />
die im Text genannte "fehlende zeitliche Voraussicht" führt er nicht auf einen Grundzug im Charakter der<br />
Einheimischen zurück, sondern auf deren Lebensweise, indem er einen "Neger" zu Wort kommen lässt, was<br />
gegenüber den älteren der in dieser Arbeit untersuchten Lehrmitteln ein Novum darstellt.<br />
Viel Zeit verwendet der Schwarze auf die künstlerische Ausgestaltung seiner Geräte. Die Frauen bringen sorgfältig allerlei<br />
Ornamente an den Tontöpfen an, und mancher Mann schnitzt viele Tage lang an einem Stuhl oder einer Schnupftabakdose,<br />
oder brennt Kreise, Spiralen und Dreiecke in den Steg seines Musikinstrumentes. Auch für Körperschmuck, Armbänder,<br />
Ohrschmuck, Halsketten, sowie für die manchmal recht schmerzhafte Anbringung von Schmucksachen hat er viel Zeit<br />
übrig. Eigentliche gewerbsmässige Ausübung von Handwerken kennt der Neger im Innern des Landes nicht, sondern jeder<br />
stellt in seinem Haushalt all das her, was er braucht.<br />
Nach der Schilderung des Lebenserwerbs führt der Text von Unterweiz eine Beschreibung der künstlerischen<br />
und kreativen Tätigkeiten der Schwarzafrikaner an, die in den älteren Lehrmitteln keine Erwähnung fand.<br />
Wenn Unterweiz eine wenig differenzierte Arbeitsteilung - "die der Neger im Innern des Landes" nicht kennt -<br />
innerhalb des von im beschriebenen Dorfes feststellt, so ist die wahrscheinlich auf die von ihm beobachtete<br />
Volksgruppe zurückzuführen, denn bei anderen Völkern herrschte eine recht differenzierte Arbeitsteilung, die<br />
allerdings vor allem in den kleinen Dörfern kaum die Norm darstellte.<br />
Für die meisten Gegenstände hat sich im Lauf der langen Zelt ein fester Handelspreis herausgebildet. So gilt ein Huhn<br />
gleich zwei Tauben, zwei Ziegen oder drei sind gleichwertig einer Eisenfeldhacke, je nach Grösse, eine Taube ist eine oder<br />
zwei Pfeilspitzen wert...<br />
Diese Aussage entspricht dem Bild des auf dem Markt stundenlang um den Preis einer Ware feilschenden<br />
Schwarzafrikaners, der nicht nur um den Erwerb eines Gutes bemüht ist, sondern auch den sozialen Austausch<br />
pflegt. Leider ist aus dem Text nicht ersichtlich, ob es sich bei dem von Unterweiz beobachteten Märkten um<br />
lokale oder regionale Handelszentren handelte. (Siehe dazu unter dem Titel "Wirtschaft und Gesellschaft in<br />
Westafrika" auch die Seite 31 dieser Arbeit, sowie die Seite 153.)<br />
4.4.3 Heuschreckenplage<br />
Der Teil über Afrika wird mit dem Lesetext "Heuschreckenplage" von O. Stollowski auf den Seiten 348-349<br />
beendet, der sich ganz auf das Erlebnis der Begegnung mit einem Heuschreckenschwarm vertieft und mit<br />
folgenden Worten schliesst (S. 350):<br />
Geographielehrmittel: Arbeits- und Lesebuch für die Oberklassen (1936)<br />
Die ihrer Hoffnung auf Nahrung beraubten Menschen schauten traurigen Blickes in die heimgesuchte Landschaft.<br />
Schlimmer als Feuer und Wasser hat der Massenfrass der Wanderheuschrecke gehaust, gegen den es keine Hilfe, keine<br />
Rettung gibt, der nachwirkt auf viele Monate hinaus, Not, Entbehrung, Hunger, Verzweiflung, elenden Tod und<br />
Verbrechen im Gefolge!<br />
So lag damals das Land vernichtet auf viele Tagereisen weit ins Innere. Tausende von Menschen fielen später dem<br />
Hungertode zum Opfer, denn Vorsorge für schlimme Zeiten liegt dem froh in den Tag lebenden Neger fern.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 107
(Zum Hungerkrisen in Afrika siehe auch die Seite 148 dieser Arbeit.) Die Heuschreckenschwärme bedeuten<br />
auch heute noch eine Gefahr für einige Anbaugebiete in Afrika, so in Madagaskar 1997, obwohl durch die<br />
UNO unterdessen ein Frühwarnsystem eingerichtet wurde. Oft scheitern Massnahmen aber aus Mangel an<br />
benötigten Ressourcen. Unterdessen wurden auch Stimmen laut, die darauf hinwiesen, dass zumindest einige<br />
der Heuschreckenplagen durch Veränderungen des Ökosystems durch den Menschen verursacht werden. (Zu<br />
den Heuschrecken siehe auch die Seite 145 dieser Arbeit.) Der letzte Satz Stollowskis "...denn Vorsorge für<br />
schlimme Zeiten liegt dem froh in den Tag lebenden Neger fern." beruht auf einem Vorurteil (siehe die diffe-<br />
renziertere Ausführung im zitierten Text von Unterweiz aus dem gleichen Buch auf Seite 107 dieser Arbeit).<br />
4.4.4 Zusammenfassung<br />
Mit Ausnahme des recht ausführlichen Textes "Negerleben" von Unterweiz, der punktuell das Geschehen in<br />
einem Dorf schildert, enthält das Buch kaum Nennenswertes in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit.<br />
"Negerleben" gibt einen recht sachlich geschilderten Einblick in das Dorfleben eines Volkes Schwarzafrikas.<br />
In dem einfühlsamen Text, der die Schwarzafrikaner weniger als Objekt der Anschauung, sondern viel mehr<br />
als Menschen schildert und der bis heute wenig an Gültigkeit für die Schilderung des Lebens fernab der Gross-<br />
städte verloren hat, liegt auch die Stärke des Lehrmittels in Bezug auf die Darstellung der schwarzafrikani-<br />
schen Menschen. Eine Neuigkeit stellt die Aussage eines Schwarzafrikaners dar, der seine Lebensweise "mit<br />
eigenen Worten" begründen kann.<br />
Geographielehrmittel: Arbeits- und Lesebuch für die Oberklassen (1936)<br />
Negativ fällt auf, dass das Lehrmittel nur einen sehr punktuellen Einblick in die Vielfalt Schwarzafrikas liefert<br />
und die Aussagen der Texte teilweise im Widerspruch zueinander stehen. Das gezeichnete Bild des schwarzaf-<br />
rikanischen Menschen bleibt deshalb im Anbetracht der Vielfalt der Lebensweisen zu undifferenziert.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 108
4.5 Sekundarschulatlas (1950)<br />
Der insgesamt 80 Seiten umfassende "Schweizerische Sekundarschulatlas" von 1950, der Vorgänger des auf<br />
der Seite 129 dieser Arbeit besprochenen "Schweizerischen Mittelschulatlas", zeigt auf den Seiten 66-68<br />
Karten zu Afrika.<br />
Die Doppelseite 66-67 bildet eine physische Afrikakarte im Massstab 1:30 Mio. und drei kleinere Karten zu<br />
Gebieten in Nordafrika ab. Die Seite 68 zeigt sechs kleine Karten Afrikas zur "Politischen Gliederung",<br />
Niederschlägen, Völkern, Religionen, Wirtschaft und Volksdichte. (Zur politischen und wirtschaftlichen Karte,<br />
sowie den Karten zur Volksdichte und Religion, siehe auch die Seite 564 im Anhang dieser Arbeit.) Die Karte<br />
zu den Völkern unterscheidet Indo-Europäer, Semiten (Araber) und Hamiten (Berber), Sudan-Neger, Bantu-<br />
Neger, Hottentotten, Buschmänner, Zwergvölker und Indonesier. Die Karte zu den Religionen unterscheidet<br />
katholische und evangelische Christen, abessinische Christen, Schiiten, Sunniten, sowie Heiden. Wobei fast<br />
ganz Nordafrika als schiitisch, das mittlere und südliche Afrika als heidnisch eingefärbt werden, während die<br />
christlichen Gebiete nur einen kleinen Raum einnehmen.<br />
Weitere Abbildungen Afrikas finden sich auf den Seiten 72-79 auf Weltkarten zu unterschiedlichen Themen,<br />
die aber mit Ausnahme der Karten zu verschiedenen Agrarprodukten auf den Seiten 76-77 keine weiteren<br />
Rückschlüsse auf die Lebensweise der schwarzafrikanischen Menschen zulassen.<br />
Geographielehrmittel: Sekundarschulatlas (1950)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 109
4.6 Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule (1953)<br />
...Die Natur zwingt den Neger, Vorräte anzulegen, damit er die Trockenheit unbesorgt überstehen kann. Er jagt, sammelt<br />
Früchte, bearbeitet die Scholle mit der Hacke. Hirse, Mais Süsskartoffeln und Erdnüsse gedeihen vorzüglich.<br />
Kürbisschalen werden verziert und als Gefässe aller Art gebraucht; selbst als Resonanzboden von Zupfinstrumenten finden<br />
sie Verwendung... Der Neger glaubt an gute und böse Geister, denen er in lang andauernden Tänzen huldigt. (S. 116)<br />
Das im Verlag der Erziehungsdirektion des Kantons Zürichs herausgekommene Geographielehrmittel für die<br />
Sekundarschule, 1941 durch den zürcherischen Erziehungsrat in Auftrag gegeben, wurde erstmals 1945<br />
gedruckt. 1948 folgte die 2. unveränderte und 1953 die 3. leicht veränderte Auflage, wobei die Texte für Afri-<br />
ka beibehalten wurden. Dem Prinzip der systematischen Länderkunde folgend, beschreibt Dr. Albert Gut den<br />
Kontinent Afrika auf 27 (S. 109 - 136) von insgesamt 384 Seiten. Dabei liegt der Schwerpunkt der Information<br />
eindeutig auf der physischen Geographie, die nicht als gesondertes Kapitel erscheint, sondern ihre Abhandlung<br />
jeweils im Zusammenhang mit der Beschreibung der einzelnen Gebiete findet. Bemerkenswert ist neben der<br />
sachbetonten Schilderung der Zustände auch die jeweils am Ende eines Abschnittes folgende, kurze Zusam-<br />
menfassung, in der die wichtigsten Aussagen in komprimierter Form wiedergegeben werden.<br />
Auf den Seiten 109 - 110, im Kapitel "Grösse, Erschliessung" steht über die Bevölkerungsdichte Afrikas und<br />
gleichsam als Erklärung für die Besiedlung des Kontinents durch die Europäer:<br />
Der gewaltige Raum ist sehr dünn besiedelt. Auf einen Quadratkilometer leben zehnmal weniger Menschen als in unserem<br />
Erdteil; daher richteten sich die Blicke aus dem überbevölkerten Europa schon früh nach dem weiten Afrika.<br />
Auf Seite 110, in der Zusammenfassung, wird auch auf die Schwierigkeiten, die den Europäern bei der Erobe-<br />
rung des Kontinentes zu schaffen machten, hingewiesen. Allerdings vergessen die Autoren zu erwähnen, dass<br />
die gleichen Schwierigkeiten wohl auch von den Afrikanern überwunden werden mussten.<br />
...Die Erschliessung von Afrika ist erschwert durch Wüste, Urwald, Stromschnellen, Randgebirge und ungesunde<br />
Küstenstriche.<br />
Auf den Seiten 110 -112 wird die Oberflächengestalt des Kontinentes sowie dessen Klima beschrieben, darauf<br />
folgt auf mehreren ein Kapitel über "Die natürlichen Landschaften" (S. 113 - 121).<br />
4.6.1 Die natürlichen Landschaften<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule (1953)<br />
Auf Seite 113 findet sich folgende Textstelle zu den Gefahren und Eigenheiten des tropischen Urwaldes:<br />
...Die drückende Hitze und die grosse Feuchtigkeit der Luft setzen dem Europäer im tropischen Urwald besonders zu<br />
(Treibhausklima). Schwer leiden die Menschen in diesen Gebieten aber auch unter den verheerenden Seuchen der<br />
Schlafkrankheit und Malaria. Trotzdem dringt der Weisse in zähem Kampfe immer tiefer ins Innere vor; man nutzt vor<br />
allem die wildwachsenden Kautschukpflanzen und baut in gerodeten Lichtungen Kaffee und Kakao an (Plantagen). Die<br />
Erzeugnisse müssen von Eingeborenen auf schmalen Pfaden an die am Fluss gelegenen Sammelstellen getragen werden.<br />
Die Neger wohnen meist in der Nähe der Flüsse; ihre laubbedeckten Hütten sind oft zu Strassendörfern aneinander gereiht.<br />
Der Schwarze sammelt Früchte und ist auch Jäger. - Vereinzelte Zwergvölker leben in grosser Abgeschlossenheit in<br />
Waldlichtungen; sie tragen als einzige Bekleidung Lendenschützen aus Bast.<br />
Einerseits wird also der Kampf gegen die Natur geschildert, indem der Weisse Sieger bleibt, andererseits wird,<br />
wenn auch nicht in aller Deutlichkeit, darauf hingewiesen, dass die einheimische Bevölkerung zur Erzeugung<br />
von agraren Exportprodukten gezwungen wird. Auffallend ist die, wenn auch knappe, doch sachliche Schilde-<br />
rung der einheimischen Bewohner des Regenwaldes. Im Gegensatz etwa zum "Lehr- und Lesebuch für thur-<br />
gauische Volksschulen" von 1912 und auch einigen später erschienen Lehrmittel verzichten die Autoren auf<br />
eine Attribuierung der Afrikaner, die bei einem genaueren Hinsehen nicht haltbar ist.<br />
In der Zusammenfassung zur Landschaft des tropischen Urwaldes werden die Nahrungsgrundlagen der einhei-<br />
mischen Bevölkerung sowie die wichtigsten Exportprodukte noch einmal aufgeführt (S. 114).<br />
"...Die Ausfuhrprodukte der Plantagen sind Kautschuk, Kakao und Kaffee. Zwergvölker und Negerstämme leben als<br />
Sammler, Ackerbauer und Jäger."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 110
Auf den Seiten 114-116 wird die Grosslandschaft Savanne beschrieben. Auf der Seite 115 findet sich auch ein<br />
Foto mit der Bildlegende: "Sudan-Neger mit wulstigen Lippen und breiter Nase; Haare zu kleinen Knäueln<br />
zusammengerollt; an der Stirne Schmucknarben; Halsschmuck aus Giraffenhaaren" Warum die abgebildete<br />
Person mit gekrümmten Rücken und vorgestrecktem Hals dasteht, darauf wird nicht weiter eingegangen.<br />
Auf der Seite 116 schliesslich wird das Leben der Menschen in der Savanne beschrieben, die Tätigkeiten zum<br />
Nahrungserwerb aufgeführt, und auch der Hinweis auf die praktizierte Vorratshaltung, die in anderen Lehrmit-<br />
teln, weil sie zwischen den verschiedenen Völkern zuwenig differenzieren, oft und fälschlicherweise verneint<br />
wird, und auf das kulturelle Leben fehlt nicht.<br />
...Die Natur zwingt den Neger, Vorräte anzulegen, damit er die Trockenheit unbesorgt überstehen kann. Er jagt, sammelt<br />
Früchte, bearbeitet die Scholle mit der Hacke. Hirse, Mais Süsskartoffeln und Erdnüsse gedeihen vorzüglich.<br />
Kürbisschalen werden verziert und als Gefässe aller Art gebraucht; selbst als Resonanzboden von Zupfinstrumenten finden<br />
sie Verwendung. Die Hütten mit dem Kegeldach ordnen die Eingeborenen kreisförmig um einen Platz zu einem stattlichen<br />
Runddorf. Der Neger glaubt an gute und böse Geister, denen er in lang andauernden Tänzen huldigt.<br />
Wieder wird, wenn auch stark vereinfacht, das Leben der heimischen Bevölkerung sachlich beschrieben. Der<br />
Glaube an den "Fetisch" ist dem Glauben an "gute und böse Geister" gewichen, "denen in lang andauernden<br />
Tänzen gehuldigt wird". In der Zusammenfassung heisst es dann:<br />
...Die Neger wohnen in Hütten mit kegelförmigen Grasdächern; sie sind Jäger, Sammler und pflanzen Hirse, Erdnüsse und<br />
Kürbisse.<br />
Auf den Seiten 116-118 beschreiben die Autoren die Naturlandschaft Steppe. Die Betonung liegt auf den<br />
saisonalen Niederschlägen und die sich daraus ergebende Lebensweise:<br />
...Die Eingeborenen erwarten jeweils mit grosser Sehnsucht den ersten Regen... Nicht selten lodern zur Zeit der Dürre<br />
Steppenbrände; die Hitze soll die Brut der Insekten vertilgen und die Asche als Düngemittel dienen. Dauert aber diese<br />
Feuer allzu lange, so raubt es dem Boden jeglichen Pflanzenschutz, so dass Wind und Regen den Humus forttragen. Gegen<br />
diese umfangreichen Bodenverwüstungen müssen die Verwaltungen der Kolonien mit allen Mitteln ankämpfen.<br />
Was der Autor hier beschreibt ist die Brandrodung, wie sie teilweise bis heute praktiziert wird. Allerdings<br />
bleibt unklar, ob er sich der Absichtlichkeit dieser Feuer bewusst ist, oder ob er sie gar nur als "Naturkatastro-<br />
phe" sieht. Die im Text geschilderten Nachteile der Buschfeuer werden bis heute gegen die Technik der Bran-<br />
drodung angeführt. Doch weder den kolonialen Regierungen noch den nachfolgenden Regierungen der heuti-<br />
gen Nationalstaaten ist es gelungen, breiten Schichten der Bevölkerung den Verzicht auf diese Landnutzung so<br />
nahezulegen, dass sich daraus eine Verhaltensänderung ergeben hätte. Aus diesen Gründen finden sich in den<br />
Medien der betroffenen Länder jährlich die wiederkehrenden Berichte über die Verwüstung nicht nur ganzer<br />
Landstriche, sondern auch Dörfern und Menschen, die den absichtlich gelegten Flammen zum Opfer fallen.<br />
Der Autor fasst die Erkenntnisse über die Savannenbewohner in einem Satz zusammen:<br />
"...Hier leben die Eingeborenen als nomadisierenden Viehzüchter oder Sammler und Jäger."<br />
Auf den Seiten 118-121 folgt eine Schilderung der Grosslandschaft Wüste und der Oasen, auf die hier nicht<br />
weiter eingegangen werden soll. Nachdem die Eigenarten der Landschaft geschildert worden sind, wendet sich<br />
der Autor den einzelnen Ländern oder Regionen zu, d.h. nach einer naturräumlichen Gliederung folgt nun die<br />
politische.<br />
4.6.2 Die Staaten<br />
Auf den Seiten 122-123 beschreibt der Autor kurz die Atlasländer (Marokko, Algerien, Tunesien), gefolgt von<br />
Ägypten (S. 124-129) mit einem Schwerpunkt auf den Suezkanal. Über die ägyptischer Stadt Kairo schreibt<br />
der Autor:<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule (1953)<br />
Mittelpunkt von Religion und Wissenschaft des Islam ist die Weltstadt Kairo. Am Boden kniende Mohammedaner singen<br />
zu bestimmter Stunde ihr eintöniges Gebet zu Allah. Ein buntes Gemisch von europäischen, orientalischen und<br />
afrikanischen Völkern verleiht den Gassen ein eigenartiges Gepräge.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 111
Auf Seite 129 folgt in wenigen Zeilen ein kurzer Text über Äthiopien, der hier in in voller Länge wiedergege-<br />
ben wird:<br />
Das schwer zugängliche Äthiopien hebt sich deutlich von den umliegenden Ländern ab und nimmt auch klimatisch eine<br />
Sonderstellung gegenüber der Umgebung ein. Der einheimische Kaffeestrauch hat von hier aus alle tropischen Zonen<br />
erobert. Auf der vulkanischen Erde gedeihen bis auf 2500 m Höhe Weizen, Mais und Obst. Das abessinische Christentum<br />
konnte sich gegen den Islam behaupten.<br />
Obwohl der Kaffeestrauch ursprünglich aus dem Gebiet des heutigen Äthiopiens stammte, wurde die Pflanze<br />
wahrscheinlich im Jemen zuerst als Genussmittel genutzt, wo sie 1000-1300 n. Chr. planmässig angebaut<br />
wurde. (Lötschert/Beese 1992, S. 206-208; zum Anbau von Kaffee siehe auch die Seite 164 dieser Arbeit.)<br />
Im doch recht knappen Text wird einerseits klar, woher der Kaffee ursprünglich stammt, andererseits wird<br />
auch auf die christliche Kultur eines Teils der Bevölkerung hingewiesen, deren Glauben sich seit mehr als<br />
1400 Jahren erhalten hat. Im Gegensatz zum Lehrmittel "Leitfaden für den Geographieunterricht" (1934, S.<br />
116) verzichtet Gut auf eine Wertung des in dieser Region praktizierten Christentums. (Zu Äthiopien siehe<br />
auch die Seite 148 dieser Arbeit.)<br />
Auf der Seite 130 folgt eine Beschreibung über Oberguinea und den Sudan, wobei unter Sudan nicht das heuti-<br />
ge Gebiet des Nationalstaates zu verstehen ist, sondern der Landschaftsgürtel der Savanne zwischen dem<br />
Regenwald und der der Wüste benachbarten Steppe:<br />
Am Küstensaum von Oberguinea, der regenreichsten Zone Afrikas, liegt ein üppiger Urwald; an weniger feuchten Stellen<br />
wachsen Edelhölzer (Mahagoni). Überall in den Wäldern gedeiht die Ölpalme. Aus dem Fleisch ihrer Früchte gewinnt man<br />
das Palmöl, das im Lande selbst als Speiseöl, in Europa aber zur Herstellung von Seifen und Kerzen verwendet wird. Die<br />
Kerne geben das feinere Palmkernöl; die Pressrückstände sind ein begehrtes Viehfutter. Die Kakaokulturen haben<br />
Kamerun, Nigeria und die Insel Sao Thome weltberühmt gemacht; diese Gebiete liefern etwa zwei Drittel der<br />
Weltproduktion. Nicht unerheblich ist der Kautschukhandel. Weiter im Landesinnern wird Baumwolle angepflanzt. Wo die<br />
Niederschläge aber abnehmen, geht die Savanne in Steppe über; die grosse Krümmung des Nigers liegt schon mitten in der<br />
Wüste. Wo künstliche Bewässerung möglich ist, trifft man weite Erdnuss-Felder. Kohle, Zinn und Gold werden ausgeführt.<br />
Oberguinea zählt zu den dichtestbesiedelten und bestentwickelten Tropenländern Afrikas.<br />
(Zur Kakaoproduktion siehe auch die Seite 156 dieser Arbeit.) Die Betonung des Textes liegt eindeutig auf der<br />
Bedeutung der damaligen Kolonialgebietes Englands und Frankreichs als Erzeugerländer für die in Europa<br />
begehrten Rohstoffe. Erwähnenswert ist, dass Ghana noch nicht als Kakaoproduzent aufgeführt wird, da die<br />
Kakaoproduktion dort erst in den folgenden Jahren einen Aufschwung erleben sollte.<br />
Auf den Seiten 130-131 folgt eine Beschreibung von Niederguinea und dem Gebiet des Kongobeckens:<br />
Das Stromgebiet des Kongos, das zweitgrösste der Erde, stellt mit seinen 12'000 km schiffbaren Wasserstrecken ein<br />
grossartiges Verkehrsnetz dar, wobei allerdings die Stromschnellen und Fälle umgangen werden müssen. Auf einer Fläche<br />
von 2,3 Mill. km 2 leben hier 15 Mill. Menschen. Neben Kautschuk, Palmöl und Elfenbein nehmen die Erzeugnisse des<br />
Bergbaues eine bedeutende Stellung ein: Im Kongostaat wird Pechblende gewonnen, die das kostbare Radium enthält. Die<br />
<strong>Pro</strong>vinz Katanga ist reich an Kupfer. Etwa 3'000 Europäer und 20'000 Eingeborene arbeiten in Kupfergruben, die heute<br />
10% der Welt-Kupferproduktion liefern. Von grosser Bedeutung sind die neusten Uranfunde (Atomenergie).<br />
Überlandbahnen führen von der Küste des Atlantischen und Indischen Ozeans und der Südspitze Afrikas nach<br />
Elisabethville, dem Mittelpunkt eines ständig wachsenden Industriegebietes.<br />
Wie schon im vorigen Abschnitt liegt auch hier die Betonung auf der Schilderung der <strong>Pro</strong>duktion von Rohstof-<br />
fen. Die damalige Aufbruchstimmung, die in den sechziger Jahren in der Unabhängigkeit vieler afrikanischer<br />
Staaten gipfelte und Anlass zur Hoffnung für den afrikanischen Kontinent gab, deutet sich in der Bemerkung<br />
über die Uranfunde an. Auf Seite 131 fasst der Autor zusammen:<br />
Die tropische Küstenzone von Oberguinea erhält die reichsten Niederschlage von ganz Afrika. Sie liefert viel Palmöl,<br />
Kakao, Kautschuk und Elfenbein. Neben den Pflanzenprodukten sind für das Kongobecken Kupfer, Radium und Uran von<br />
hervorragender Bedeutung.<br />
Auf den Seiten 131-134 folgt eine Beschreibung Südafrikas, wobei dabei ein Gebiet, das über das heutige<br />
Südafrika hinausgeht und z. B. Namibia umfasst, gemeint ist. Über die Bewohner Südafrikas erfährt der Leser<br />
folgendes (S. 133):<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule (1953)<br />
Die zwei Millionen Weissen in Südafrika sind Nachkommen der eingewanderten Holländer (der Buren) und Engländer. Im<br />
Norden leben die Bantuneger, Kaffern und Zulu; von der Urbevölkerung sind nur noch wenige Hottentotten und<br />
Buschmänner im trockenen Nordwesten übriggeblieben. Die Rassenunterschiede führen oft zu heftigen<br />
Auseinandersetzungen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 112
Die Beschreibung der Bevölkerung beschränkt sich also auf eine Aufzählung verschiedener Volksgruppen,<br />
wobei nur die weisse Bevölkerungsgruppe zahlenmässig erfasst wird, dies wohl deshalb, weil über die anderen<br />
Gruppen zur Zeit der Herausgabe des Buches keine verlässlichen Bevölkerungszahlen existierten.<br />
Im Zusammenhang mit dem Gold- und Diamantenabbau macht der Autor unmissverständlich auf die Grundla-<br />
ge des "Reichtums" Südafrikas aufmerksam, der entgegen teilweise anderslautenden Behauptungen, die auch<br />
in Schulbüchern ihren Niederschlag gefunden haben, aber in erster Linie der weissen Bevölkerung zugute kam<br />
(S. 134):<br />
Die billige Arbeitskraft des Schwarzen hat nicht unwesentlich zum raschen Aufstieg beigetragen.<br />
Der Autor fasst kurz zusammen:<br />
Südafrika ist der wichtigste Lieferant von Gold und Diamanten. Die Steppengebiete sind Weideplätze grosser Viehherden<br />
(Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen). Viel Wolle wird nach England ausgeführt.<br />
Damit schliesst er seine Ausführungen über den afrikanischen Kontinent.<br />
4.6.3 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule (1953)<br />
Auf den wenigen Seiten, die dem Autor zum Kontinent Afrika zur Verfügung standen, zeichnet er ein zwar<br />
wenig ausführliches, die Schwarzafrikaner werden fast ausschliesslich auf ihre wirtschaftliche Exportleistung<br />
reduziert, dafür aber sachlich richtiges - unter Verzicht von in anderen Lehrmitteln teilweise noch bis vor<br />
kurzem verwendeten diffamierenden Ausdrücken - Bild des afrikanischen Menschen. Ob dies mit der persönli-<br />
chen Einstellung des Autors im Zusammenhang steht, oder Ausdruck eines während der Weltkriege, in denen<br />
zehntausende von Afrikanern aus den Kolonialgebieten eingesetzt wurden, vollzogenen Paradigmawechsel ist,<br />
kann hier im Rahmen dieser Arbeit nicht mit Sicherheit festgestellt werden.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 113
4.7 Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder (1953)<br />
Die Weiber schwingen die vollen, schweren Körbe auf ihre Köpfe, und gereckten Leibes mit steifem Nacken schreiten sie,<br />
braune Göttinnen der Tropen, eine hinter der andern heimwärts, den Männern nach. (S. 141)<br />
Das 191 starke Buch "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder" erschienen 1953 im Kantonalen<br />
Verlag der Sekundarlehrerkonferenz des Kanton Zürichs, beschäftigt sich auf den Seiten 103-138 in den fünf<br />
Lesetexten "Marakesch", "Zu Esel in der Wüste", "Im Land der Löwen", "Der Urwald" und "Gang in das<br />
Maniokfeld" mit den Eigenarten Afrikas. Die drei letztgenannten Texte auf den Seiten 120-141 werden hier im<br />
Hinblick auf das vermittelte Bild des schwarzafrikanischen Menschen untersucht.<br />
4.7.1 "Im Land der Löwen"<br />
Der erste Text "Im Land der Löwen" von Cherry Kearton ist ein Safaribericht, der nur in einem kurzen<br />
Abschnitt auf Seite 127 auf die Bewohner Afrikas zu sprechen kommt, und der einen Einblick in die Mentali-<br />
tät der Weissen gibt, die sich als Touristen, teilweise auch als Forscher mehr für die Tiere als die Menschen<br />
des Kontinents interessierten:<br />
...Abermals will der Schlaf kommen, da ist es einer unseren schwarzen Boys, der uns aufscheucht. (Wir nennen ihn Boy;<br />
aber in Wirklichkeit ist er ein gutgewachsener Bursche von fünfunddreissig Jahren mit einem Weib und vier drallen<br />
Negerlein, die er in seinem Dorf zurückgelassen hat.) Er stürzt ins Zelt und flüstert: "Bwana! Tembo!" ("Herr, Elefant!")...<br />
Kearton ist sich des Widerspruchs, einen Erwachsenen in gut kolonialbritischer Manier "Boy" zu nennen<br />
durchaus bewusst, stört sich aber nicht weiter daran, sondern fügt mit der Bemerkungen über die "vier drallen<br />
Negerlein" des Dieners der Reisegruppe noch eine weitere Abwertung hinzu.<br />
4.7.2 Der Urwald<br />
Der zweite Text mit dem Titel "Der Urwald" auf den Seiten 129-138, eine Nacherzählung der Stanley-<br />
Expedition von Jakob Wassermann, in die auch einige Zitate Stanleys eingestreut werden, gibt ebenfalls nur<br />
wenig Einblick in das Leben der heimischen Bevölkerung, "die mit ihren vergifteten Pfeilen als Gegner nicht<br />
zu verachten sind." (S. 132)<br />
Auf den Seiten 132-133 wird berichtet, wie der Eroberungszug Stanleys - der sein Fortkommen ohne Beden-<br />
ken mit Waffengewalt erzwang, nicht davor zurückscheute, einen desertierenden Träger eigenhändig zu<br />
exekutieren, und der laut eines Berichtes des Paters Joseph Strässle, einen Häuptling der Basoko dazu brachte,<br />
über die Weissen auszusagen: "Krank seid ihr in euren Köpfen, denn Recht ist das keines!"(Harms Erdkunde<br />
1961, S. 276) - auf die einheimische Bevölkerung wirkte (S. 132):<br />
...Bei den Stromschnellen von Gwengwere stösst man auf sieben grosse Dörfer, die gesamte Bevölkerung hat die Flucht<br />
ergriffen und alles bewegliche Gut mit fortgeschleppt; nur Trümmer von tönernem Kochgeschirr liegen überall herum.<br />
Verhandlungen mit den Uferbewohnern verlaufen gelegentlich wie folgt: Zum Zeichen ihrer friedlichen Gesinnung giessen<br />
sie sich eine Handvoll Wasser über den Kopf, dabei rufen sie: "O Monomopote (das heisst: Sohn des Meeres), wir haben<br />
nichts zu essen, flussabwärts gibt es zu essen." Die Träger, Wangwana und Somali, antworten: "Wir können nicht<br />
weitergehen, wenn ihr uns nichts gebt." Das macht den Wilden Angst; sie werfen den Fordernden dicke Maiskolben,<br />
Paradiesfeigen und Zuckerrohr zu und sind glücklich, wenn man ihnen leere Sardinenbüchsen und Patronenkisten dafür<br />
schenkt...<br />
Die Expedition kam also trotz der Abneigung, auf die sie bei der einheimischen Bevölkerung stiess, voran, d.h.<br />
sobald die "Eingeborenen" entweder bezwungen oder übertölpelt worden waren. Auf der Seite 133 wird<br />
geschildert, wie Stanley einer "Pygmäenfrau" begegnete:<br />
Geographielehrmittel: Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder (1953)<br />
In Ugarrowas Ansiedlung sieht Stanley zum erstenmal eine Zwergin, ein wohlgebildetes Mädchen von siebzehn Jahren,<br />
vierundachtzig Zentimeter gross. Sie gleicht einer farbigen Miniaturdame, sie hat eine Haut wie gelbgewordenes Elfenbein,<br />
bewegt sich mit viel Anmut, und ihre Augen scheinen viel zu gross für so ein kleines Geschöpf. Das Zwergenfräulein<br />
bleibt bei der Expedition.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 114
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 101 und 115 dieser Arbeit.) Diese Frau, deren Namen der Autor<br />
nicht erwähnt, wird im Text wie ein besonderes Ausstellungsstück beschrieben, allerdings fügt sich der gewon-<br />
nene Eindruck nicht so richtig in das von gleichen Lehrmitteln weiter unten vermittelte Bild der "mit todbrin-<br />
genden Pfeilen... im Hinterhalt liegenden Zwerge" ein. Leider gibt der Text keine Auskunft über die Motive,<br />
welche die "Pygmäenfrau" zum Verbleib bei der Expedition bewegten.<br />
Auf der Seiten 135-136 werden die Auswirkungen des arabischen Elfenbein- und Sklavenhandels auf die<br />
heimische Bevölkerung geschildert:<br />
In weitem Umkreis haben sie jede menschliche Niederlassung eingeäschert, sogar die Bananenhaine sind zerstört, jedes<br />
Kanu auf den Flüssen zersplittert, jede Insel verwüstet, die Männer getötet, die Weiber eingefangen, und wo friedliche<br />
Dörfer waren, erheben sich Schutthaufen, Dornsträucher und meterhohes Gestrüpp. Das ganze Raubwesen ist ein<br />
ausgebildetes System. Jedes Pfund Elfenbein hat ein Menschenleben gekostet, für je fünf Pfund, errechnet Stanley, ist eine<br />
Hütte niedergebrannt, für zwei Zähne ein Dorf zerstört, für zwanzig Zähne ein Distrikt vernichtet worden.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 99 und 122 dieser Arbeit.) Auf der Seite 137 folgt noch einmal eine<br />
Beschreibung der Hinterhältigkeit der "Pygmäen", ihrer Behausungen und ihres Tuns:<br />
...und wenn dann noch die todbringenden Giftpfeile der im Hinterhalt liegenden Zwerge in die ungeordneten Reihen<br />
schwirren, ist die wildeste Panik nicht mehr zu vermeiden...<br />
In die "Lichtungen" sind wie Vogelnester die Dörfer der Zwerge hineingebaut; diese Pygmäen, Geschöpfe voll<br />
verschlagenster List, haben die ungeheuren Bäume gefällt, mit ihren unvollkommenen Werkzeugen und schwachen<br />
Gliedern haben sie es vermocht, was mag der Antrieb gewesen sein? die Sehnsucht nach der Sonne vielleicht?<br />
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 114 und 126 dieser Arbeit.) Im Gegensatz zum ersten Text, der sich<br />
mit den Tieren Afrikas beschäftige, steht hier die Tat eines Weissen, die damals rund 80 Jahre zurücklag im<br />
Zentrum - aber auch hier wird nur wenig über das Leben der Bewohner dieser Landstriche ausgesagt. Vieles<br />
beruht auf Vermutungen, stammt aus zweiter oder gar dritter Hand und Beschreibungen, die wohl einer nähe-<br />
ren Betrachtung bedürften, werden kritiklos weitergegeben.<br />
4.7.3 "Gang in das Maniokfeld"<br />
Geographielehrmittel: Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder (1953)<br />
Der dritte Text "Gang in das Maniokfeld" auf den Seiten 138-141 von Friedrich Schnak schliesst den "afrikani-<br />
schen" Teil des Buches mit einem Text über den Maniokanbau auf Madagaskar ab. Die <strong>Pro</strong>bleme des Anbaus<br />
werden in einem didaktisch aufbereiteten "Zwiegespräch" mit einem Maniokbauern erörtert. Die einheimische<br />
Bevölkerung wird hier nicht mehr als unterlegen wie im ersten, oder als fremd und bedrohlich wie im zweiten<br />
Text beschrieben, sondern es ist möglich sich in einer Weise zu unterhalten, die sich wohl kaum von der unter-<br />
scheidet, wie ein Bauer in der Schweiz über seinen Kartoffelacker berichten würde:<br />
Hinter dem laubbraunen Bambus- und Palmblattdorf haben die Eingebornen auf einem sanft abfallenden Hügel ein grosses<br />
Maniokfeld angelegt. Die Männer und Weiber weilen gerade auf dem Acker, der gemeinsames Eigentum ist... Sie sind bei<br />
der Ernte der reifen Wurzeln...<br />
...Die Eingeborenen blicken auf und grüssen mich. Einen von ihnen, den Dorfältesten, der den Weg zu seinem Dorf mit<br />
wilden Ananas und Büscheln wohlriechenden Zitronellagrases bepflanzt hat, kenne ich... Um die Hüften hat er würdevoll<br />
ein rotes Tuch geschlungen, und in der Rechten hält er einen langen, schwarzen Stab, Ebenholz. Seine Männer hacken mit<br />
einem beilähnlichen Werkzeug die Stengel fusshoch über dem Boden ab. Die Weiber reissen die Stiele heraus und scharren<br />
mit den Händen die Stiele aus dem Boden.<br />
Ich weiss, der Maniok ist für die heissen Länder eine so überaus kostbare Nahrungspflanze wie für uns die Kartoffel. Auf<br />
dem bescheidenen Speisezettel der Eingebornen nimmt er, gleich dem Reis, eine bevorzugte Stelle ein...<br />
...denn nun hält er mir einen umständlichen Vortrag über die verschiedenen kulinarischen Verwertungsmöglichkeiten der<br />
gesegneten Wurzel. Mehl stampft man daraus, zu Fladen und kleinen Kuchen. Er schnalzt verstohlen mit der Zunge. Im<br />
Geist bereitet er sich ein köstliches Gericht. Auf der Insel Reunion, berichtet er vertraulich, braut man aus Maniok einen<br />
Schnaps. Kein Zuckerrohrgesöff schmeckt so delikat...<br />
...Die Blätter, die jungen, zarten, geben ein gutes Gemüse...<br />
...Inzwischen haben die andern Eingebornen ihre einfache, bäuerliche Arbeit verrichtet. Die Wurzeln sind in runde, hohe<br />
Palmfaserkörbe eingesammelt. Die Männer nehmen ihre Geräte und verlieren sich den Fusspfad hinunter. Die Weiber<br />
schwingen die vollen, schweren Körbe auf ihre Köpfe, und gereckten Leibes mit steifem Nacken schreiten sie, braune<br />
Göttinnen der Tropen, eine hinter der andern heimwärts, den Männern nach.<br />
Der Dorfälteste wird als würdevoll, erfahren, schlau und mit einem guten Gedächtnis ausgestattet bezeichnet,<br />
die Frauen "als braune Göttinnen" beschrieben und der ganze Text vermittelt den Eindruck arbeitsamer und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 115
freundlicher Menschen, die sich bereitwillig auf die Neugier eines Fremden einlassen. Eine Beschreibung, die<br />
sicher auf viele schwarzafrikanische Menschen zutrifft, auch wenn der Text bereits in Richtung rousseauscher<br />
Verklärung tendiert. (Zu Madagaskar siehe auch die Seiten 163 und 184, zum Maniok die Seite 155 dieser<br />
Arbeit.)<br />
4.7.4 Zusammenfassung<br />
Die auf Schwarzafrika bezogenen Texte des Buches liefern mit Ausnahme des letzten wenig gutes Material<br />
zum Thema. Dieser beschreibt mit der Schilderung des Maniokanbaus eine Situation, die heute ebenso aktuell<br />
ist wie damals, auch wenn die Sprache unterdessen nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen dürfte.<br />
Der im Text zu Wort kommende Bauer wird als aufgeweckter Mensch beschrieben, der genau weiss, was er<br />
will. Allerdings zeigt der Text auch einen Tendenz, die Exotik der Frauen des beschriebenen Volkes<br />
überzubewerten.<br />
Geographielehrmittel: Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder (1953)<br />
Die Pygmäen werden auch in diesem Lehrmittel weniger vorteilhaft beurteilt, als die anderen Volksgruppen<br />
Schwarzafrikas, auch wenn einige ihrer Leistungen den Berichterstatter zu erstaunen scheinen.<br />
Zudem scheinen die Taten der "Weissen" in zwei der drei Texte von grösserer Bedeutung zu sein, als die tägli-<br />
chen Bemühungen der einheimischen Bevölkerung, und dies in einem Lehrmittel, welches unter anderem die<br />
Aufgabe hätte, die Eigenarten fremder Länder zu beschreiben.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 116
4.8 Neuer Grosser Weltatlas (1960)<br />
Die 158 Seiten, davon 30 Seiten Register, umfassende Volksausgabe des "Neuen grossen Weltatlas" von 1960<br />
beschäftigt sich in Bild und Text mit Afrika und den dort lebenden Menschen.<br />
4.8.1 "Afrika"<br />
Die Seiten 15-16 des ersten Teiles des dreiteiligen Werkes - es enthält einen Text-, einen Karten- und einen<br />
Registerteil, die über eigene Seitennumerierungen verfügen - drucken einen längeren Text zu Afrika ab, der<br />
hier auszugsweise wiedergegeben werden soll. Gleich in der Einleitung wird die Beziehung Afrikas mit dem<br />
europäischen Kontinent klargestellt (S. 15):<br />
Afrika ist der dem Nordkontinent Europa zugehörige Südkontinent, die Tropen Afrikas sind die natürliche Ergänzung der<br />
europäischen Wirtschaft in den Breiten eines kühleren Klimas...<br />
Die Tropen Afrikas dienen nach dieser Aussage also vor allem dazu, die Wirtschaft Europas zu ergänzen, oder<br />
im Text zwar nicht ausgesprochen aber eine damals verbreitete Vorstellung, der europäischen Industrie die<br />
nötigen Rohstoffe zu liefern. Weiter heisst es zur geographischen Erschliessbarkeit Afrikas:<br />
In sehr geringem Masse ist Afrika durch Buchten, Halbinseln und Inseln gegliedert... Auch sind seine Küsten wenig<br />
zugänglich... die grossen Flüsse haben häufig kurz vor ihrer Mündung Stromschnellen, die eine durchgehende Schiffahrt<br />
ins Innere unmöglich machen. So blieb Afrika lange der unbekannte, der dunkle Erdteil...<br />
Im folgenden Abschnitt beschäftigt sich der Autor mit den geologischen Gegebenheiten. In diesem Zusam-<br />
menhang heisst es, Afrika sei ein "greisenhafter Kontinent". Des weiteren werden die grossen Flüsse und deren<br />
Potential beschrieben (S. 15):<br />
...Die Möglichkeiten der Bewässerung ausgedehnter Flächen und der Gewinnung von elektrischer Energie haben für die<br />
wirtschaftliche Entwicklung des Erdteils grösste Bedeutung, da weite Gebiete unter Trockenheit leiden und Vorräte an<br />
Kohlen und Erdöl gering sind.<br />
Nach einer Beschreibung der klimatischen Grundlagen wendet sich der Autor den Menschen Afrikas zu:<br />
Man nennt Afrika auch den "Schwarzen Erdteil". Das bezieht sich auf die Bewohner mit ihrer schwarzen Hautfarbe, die<br />
Neger, die fast den ganzen Kontinent südlich der Sahara bewohnen. Man gliedert sie in zwei Hauptgruppen: die<br />
Sudanneger in den offeneren Savannenlandschaften im Norden und die Bantuneger im Kongogebiet und im Süden. In<br />
Nordafrika und in den Nilländern, also ausserhalb von Tropisch-Afrika, leben Araber, Berber, Niloten, Äthiopier und<br />
Somali; mitunter haben sie hellere Haut und sprechen semitische oder hamitische Sprachen. Insgesamt hat der 30,3<br />
Millionen qkm umfassende Erdteil 246 Millionen Bewohner - 8 Menschen auf einen Quadratkilometer.<br />
Wie auch in anderen untersuchten Werken der Zeit, erfahren die "Neger" eine weit gröbere Einteilung als<br />
weitere afrikanische Völker. Zu den Kulturen Afrikas schreibt der Autor (S. 15):<br />
Auch in Afrika gibt es alte Kulturländer, wie Ägypten im fruchtbaren Nildelta und Äthiopien im gesunden gleichnamigen<br />
Hochland. Phönizier, Griechen und Römer hatten ihre Kultur über Nordafrika ausgebreitet - so wurde auch Äthiopien früh<br />
schon dem christlichen Glauben gewonnen. Aber erst die Araber bestimmten mit ihren Wanderungen und ihrem<br />
islamischen Glauben das geistige und politische Leben eines grossen Teils von Afrika bis zum westlichen Kap Verde, zum<br />
Tschadsee und in Ostafrika bis nach der grossen Insel Madagascar. Im ganzen Sudan vom Niger bis zum Nil gab es, zum<br />
Teil bis in die Epoche der europäischen Kolonisation, mächtige einheimische Reiche, wie Mali, Ghana, Sonrhai, Yoruba<br />
oder Bornu.<br />
Ganz dem Zeitgeist entsprechend wird Afrika als Kontinent geschildert, dessen Bewohner ihre Kultur den<br />
Einflüssen von aus anderen Gebieten kommenden Völkern verdanken. Immerhin werden auch die wichtigsten<br />
westafrikanischen Reiche des Mittelalters genannt.<br />
Der folgende Abschnitt auf der Seite 15f. beschäftigt sich mit der Kolonisation und der Unabhängigkeitsbewe-<br />
gung in Afrikas:<br />
Geographielehrmittel: Neuer Grosser Weltatlas (1960)<br />
Anders als in Amerika erfolgte die koloniale Besitzergreifung Afrikas durch die Europäer, abgesehen von wenigen<br />
Stützpunkten der Portugiesen auf ihrer Ostindienfahrt, erst spät. Im Jahrzehnt von l 880 bis 1890 wurde die Aufteilung<br />
Afrikas unter Briten, Franzosen, Spanier, Portugiesen, Deutsche, Italiener und Belgier im wesentlichen beendet. Im 20.<br />
Jahrhundert waren Marokko und Äthiopien die letzten Opfer europäischer Machtausdehnung. Seit den beiden Weltkriegen<br />
drängen nunmehr mit aller Macht die Völker Afrikas zur Unabhängigkeit und Eigenstaatlichkeit. So gab es Ende 1959<br />
bereits zehn selbständige Staaten, im Laufe des Jahres 1960 werden weitere 16 Staaten hinzukommen. Aber auch in den<br />
noch nicht selbständigen Gebieten verstärken sich die Bewegungen zur Abschüttelung der kolonialen Bindungen immer<br />
mehr. Der alte Erdteil erwacht zu neuem Eigenleben, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und gewiss auch<br />
geistig: Die Afrikaner erkämpfen auch ihre kulturelle Gleichberechtigung.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 117
In diesem kurzen Abschnitt verwandeln sich die Afrikaner von "Opfern" der europäischen Aggression in<br />
Menschen, die sich "kulturelle Gleichberechtigung" erkämpfen. Der ganze Erdteil zeige "neues Eigenleben".<br />
Der Text spiegelt die damals in die jungen Länder Afrikas gesetzte Hoffnung. Eine optimistische Sichtweise,<br />
die erst in den neunziger Jahren teilweise wieder aufgegriffen werden sollte.<br />
Nach der Schilderung der Entwicklung im Norden Afrikas schreibt der Autor über die anderen Gebiete (S. 16):<br />
Hingegen hat in Westafrika die Entwicklung zur Bildung afrikanischer Staaten seit der Umwandlung der britischen<br />
Goldküste in den selbständigen Staat Ghana ein fast stürmisches Tempo genommenen: Alle ehemaligen Territorien<br />
Französisch-Westafrikas sowie Togo sind souveräne Republiken geworden. Das britische Nigeria - das volkreichste Land<br />
Afrikas - soll am l. l0. 1960 selbständig werden. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, dass auch die britischen Kolonien<br />
Sierra Leone und Gambia ihre Unabhängigkeit erringen werden. Liberia an der westafrikanischen Küste, das vor hundert<br />
Jahren von freigelassenen amerikanischen Negersklaven gegründet wurde, ist nicht mehr der einzige Neger-Freistaat<br />
Afrikas.<br />
Im eigentlich tropischen Afrika wurden Kamerun, die ehemaligen Territorien Französisch-Äquatorialafrikas und das<br />
ungeheure, noch dünn besiedelte Gebiet des Kongobeckens souveräne Republiken, die z. T. noch der Französischen<br />
Gemeinschaft angehören und unter sich durch eine Zollunion verbunden sind. Das portugiesische Territorium Angola, ein<br />
gesundes Hochland, ist anscheinend noch in Ruhe.<br />
Nach der Schilderung der Veränderungen in den Gebieten West- und Zentralafrikas beschäftigt sich der Autor<br />
auch mit der Entwicklung Südafrikas, nicht ohne kritische Töne anzuschlagen:<br />
Südafrika liegt grösstenteils ausserhalb der Tropen. Hier haben sich früh schon Niederländer,- die "Buren" - und Briten<br />
niedergelassen, die ein ganz modernes europäisches Staatswesen, die Südafrikanische Union, aufgebaut haben. Doch fällt<br />
auf diesen Staat der Schatten der Rassenfrage: Ob die vollständige räumliche Trennung von Negern und Weissen eine<br />
Lösung bringen kann, muss die Zukunft zeigen. In Rhodesien und in Nyassaland, wo die europäische Besiedlung noch in<br />
den Anfängen steht, ist die akute Gefahr noch grösser. Wiederum ruhig verhält sich das portugiesische Ostafrika,<br />
Moçambique. Hinsichtlich des ehemaligen Deutsch-Südwestafrikas ist es noch ungewiss, ob es sich der Südafrikanischen<br />
Union anschliessen wird.<br />
Wie die "Zukunft zeigte", war die "räumliche Trennung von Negern und Weissen" nur eine Lösung auf Zeit,<br />
und auch in den anderen angesprochenen Gebieten sollte sich die Herrschaft der weissen Minderheit in den<br />
folgenden Jahren dem Ende zuneigen. Zu Ostafrika schreibt der Autor (S. 16):<br />
Zu Britisch-Ostafrika gehört als Schutzgebiet das Königreich Uganda am grossen Viktoriasee; seine Bevölkerung ist<br />
besonders begabt und fleissig. In Kenya, wo auch Europäer siedeln, und in Tanganyika, dem ehemaligen<br />
Deutsch-Ostafrika, mit dem höchsten Berg Afrikas, dem Kilimandscharo, sind Verhandlungen im Gang, um die<br />
Verselbständigung vorzubereiten.<br />
Schliesslich beendet der Autor seine Betrachtungen mit einem Blick auf den Inselstaat Madagaskar:<br />
Am Rande von Afrika liegt die von Malaien erst in historischer Zeit, teilweise erst im 15. Jahrhundert besiedelte Insel<br />
Madagaskar, die doppelt so gross ist wie Grossbritannien und Irland zusammen. Die junge Republik ist jetzt völlig<br />
unabhängig. Sie hatte bereits einen Vorläufer in dem wohlgeordneten Reich, das hier schon vor der Ankunft der Franzosen<br />
bestand.<br />
Die in diesem Werk vorliegenden Beschreibungen der Gebiete und Länder Afrikas zeigen, dass es durchaus<br />
möglich ist, eine einigermassen aktuelle Geographie zu betreiben und die im Zusammenhang mit dem thur-<br />
gauischen Lehrmittel "Geographie" von 1963 vermerkten, längst nicht mehr aktuellen Beschreibungen einzel-<br />
ner Staaten durchaus nicht die Regel sein müssen. (Siehe dazu auch die Besprechung des genannten Lehrmit-<br />
tels ab der Seite 130 dieser Arbeit.)<br />
4.8.2 Weitere Textstellen zu Afrika<br />
Afrika wird in verschiedenen weiteren Texten im Zusammenhang mit rein naturgeographischen Sachverhalten<br />
genannt. Im Kapitel "Rassen und Völker - Die Entstehung des Menschen" auf den Seiten 29-30 erwähnt der<br />
Autor den schwarzafrikanischen Menschen, der auch in einer mit "Neger" beschriebenen Zeichnung abgebil-<br />
det wird, nur kurz, sagt aber aus, dass Überreste der frühesten Menschen unter anderem auch am Njassasee<br />
(Ostafrika) entdeckt worden wären.<br />
Geographielehrmittel: Neuer Grosser Weltatlas (1960)<br />
Im Kapitel "Die Bevölkerung der Erde - Verteilung, Siedlungsweise, Millionenstädte" auf den Seiten 30-31<br />
beziffert der Autor das jährliche Bevölkerungswachstum Afrikas mit 2.08%. Ausserdem würden 8.3% aller<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 118
Menschen in Afrika leben. In einer Liste der Millionenstädte auf der Seite 30 wird nur eine einzige afrikani-<br />
sche Stadt, Alexandria mit 1.244 Mio. Bewohner, aufgezählt.<br />
Im Kapitel "Sprachen, Religionen, Kulturen" auf den Seiten 31-32 findet sich auf der Seite 32 eine Karte, die<br />
das Gebiet Afrikas in den orientalisch-islamischen und dem afrikanischen Kulturkreis unterteilt, und damit den<br />
schwarzafrikanischen Menschen eine eigene Kultur zuspricht. Im Text ist dann aber die Rede von "mit Feti-<br />
schen behängten Bäume in Afrika", die den "Geisterglauben animistischer Religionen" der dortigen Menschen<br />
bezeugen würden. Ausserdem heisst es zur afrikanischen Kultur:<br />
Ob sich im erwachenden Afrika ein eigener Kulturkreis der Neger herausbilden wird, mag die nahe Zukunft erweisen.<br />
Den "Negern" sei es also nicht gelungen, eine eigene Kultur zu schaffen, sondern diese müsse in der nahen<br />
Zukunft erst noch entwickelt werden.<br />
Nach dem Text "Nutzpflanzen, Landbauzonen" auf den Seiten 33-34 liefert Westafrika Erdnüsse und Kakao -<br />
Ghana wird als Hauptproduzent von Kakao erwähnt - nach Europa. Kaffee komme aus West- und Ostafrika,<br />
seine Heimat sei Äthiopien. Tabak werde in Zentralafrika angebaut. Der Sudan und Ägypten würden Baum-<br />
wolle liefern, Angola Kapok und der Kongo Kautschuk.<br />
Nach dem Text "Bergbau und Energie" auf den Seiten 34-35 befinden sich einige der bedeutendsten Goldge-<br />
winnungsstätte in Südafrika und Ghana. Platin komme aus Südafrika, Diamanten vor allem aus dem Kongoge-<br />
biet, Kupfer aus Rhodesien, Uran aus dem Kongogebiet und Südafrika. Ausserdem erwähnt der Text das<br />
Voltaprojekt in Westafrika und eine Karte zeigt eine Erdöllagerstätte in Angola.<br />
Im Text "Industriezentren, industrielle <strong>Pro</strong>duktion" auf den Seiten 36 ist von der Raubwirtschaft der Europäer<br />
in den Tropen, deren Rohstoffe von den europäischen Völkern "ausgebeutet" worden wären, die Rede. Die<br />
Entwicklungsländer würden ihren "Ehrgeiz" darin setzten, selbst Industrien aufzubauen. "Eine Karte der Indu-<br />
striezentren der Erde" würde in "zehn oder zwanzig Jahren ganz anders aussehen".<br />
Der Text "Weltverkehr" auf der Seite 38 spricht Afrika 70'000 km Schiene zu, ausserdem würden 9.6% der<br />
Weltflotte unter liberianischer Flagge segeln. Zum Thema "Aussenhandel, Handelsgüter, Handelssprachen"<br />
heisst es auf der Seite 39:<br />
In Afrika folgen auf die weit voranstehende Südafrikanische Union als annähernd gleich wichtige Handelsländer Algerien,<br />
Ägypten, Rhodesien und Nyassaland, Nigeria, die Republik Kongo und Marokko.<br />
Die gebräuchlichsten Handelssprachen in Afrika seien Englisch und Französisch, in Nordafrika sei auch das<br />
Arabische bedeutend.<br />
Ein weiterer Text "Entschleierung der Erde" auf den Seiten 41-42 zeigt unter anderem auch die schrittweise<br />
Erforschung Afrikas durch die Europäer auf.<br />
4.8.3 Staaten und Länder von A-Z<br />
Geographielehrmittel: Neuer Grosser Weltatlas (1960)<br />
Die Seiten 44-48, die den ersten Teil des Bandes beschliessen, geben in Kurzform die wichtigsten Fakten zu<br />
den einzelnen Ländern der Erde wieder. Dabei werden die folgenden afrikanischen Staaten genannt: Ägypten,<br />
Algerien, Angola, Äthiopien, Basutoland, Betschuanaland, Dahomey, Elfenbeinküste, Französisch-Somaliland,<br />
Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Kamerun, Kenya, Komoren, Kongo (die heutige Demokratische Republik<br />
Kongo), Kongo, Liberia, Libyen, Madagascar, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Niger, Nigeria, Nyas-<br />
saland, Portugiesisch-Guinea, Portugiesisch-Ostafrika, Nord- und Südrhodesien, Ruanda-Urundi, Sansibar und<br />
Pemba, São Tomé und Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalia, Spanisch-Guinea, Spanisch-<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 119
Westafrika, Südafrikanische Union, Sudan, Südwest-Afrika, Swasiland, Tanganyika, Togo, Tschad, Tunesien,<br />
Uganda, Volta und die Zentralafrikanische Republik.<br />
Die Angaben zu den einzelnen Länder fallen unterschiedlich ausführlich aus, meist werden aber Fläche,<br />
Bevölkerungszahl, die wichtigsten Gebiete und Volksgruppen, sowie Hauptstadt und wichtige Exportprodukte<br />
genannt.<br />
4.8.4 Kartenteil<br />
Der Kartenteil zeigt neben einer Karte zum "Weltverkehr" auf der Seite 1, spezielle Afrikakarten auf den<br />
Seiten 66-69. Die Seite 66 bildet eine physische Karte Afrikas ab, während die Seite 67 eine politische Karte<br />
des Gebietes im Massstab 1:40 Mio. wiedergibt. Die Doppelseite 68-69 zeigt eine Karte Nordafrikas im Mass-<br />
stab 1:20 Mio., eine entsprechende Karte für das Gebiet südlich des Äquators fehlt.<br />
Die Doppelseite 78-79 schliesslich zeigt neben einer politische Weltkarte auch die Flaggen der afrikanischen<br />
Länder Ägypten, Äthiopien, Ghana, Liberia, Libyen, Marokko, Sudan, Südafrikanische Union und Tunesien.<br />
4.8.5 Zusammenfassung<br />
Der "Neue Grosse Weltatlas" gibt ein für das Erscheinungsjahr äusserst aktuelles Bild Afrikas wieder. Gleich-<br />
zeitig weist er sich eindeutig als <strong>Pro</strong>dukt seiner Zeit aus, indem er einerseits grosse Hoffnungen in die jungen<br />
schwarzafrikanischen Staaten legt, andererseits den Schwarzafrikanern der vergangenen Jahren eine eigentli-<br />
che Kultur abspricht.<br />
Geographielehrmittel: Neuer Grosser Weltatlas (1960)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 120
4.9 Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
...Missionare, Regierungsbeamte der Eingeborenenverwaltung, Anthropologen und "Kafferboeties"..., jene Kaffernbrüder<br />
oder Kaffernschwärmer also, die seit den Zeiten van der Kempfs und dem ersten Auftreten der Londoner<br />
Missionsgesellschaft immer wieder den Versuch unternommen haben, den Schwarzen als gleichberechtigten Bruder zu<br />
behandeln. Kafferboeties sind Leute, die einer sentimentalen, der europäischen Gesellschaft schädlichen Liebhaberei für<br />
Eingeborene huldigen. (S. 312)<br />
Der Band "Die Welt in allen Zonen" ,1961 im Paul List Verlag erschienen, aus der Reihe "Harms Erdkunde",<br />
stellt der Lehrkraft auf 67 der insgesamt 456 Seiten erdkundliche Lesetexte zu Afrika zur Verfügung, darunter<br />
auch einige, die von afrikanischen Grössen wie Kwame Nkrumah (Afrika frei!, S. 264) verfasst wurden.<br />
Aufgrund des Umfangs kann im Rahmen dieser Arbeit nicht auf jeden der Lesetexte im speziellen eingegan-<br />
gen werden, um jedoch trotzdem einen Überblick zu ermöglichen, sollen hier die Afrika betreffenden Einträge<br />
im Inhaltsverzeichnis wiedergegeben und anschliessend ausgewählte Texte detailliert besprochen werden<br />
(kursiv gedruckt: Texte, die ausserhalb der Fragestellung der Arbeit liegen; fett gedruckt: Texte die näher<br />
besprochen werden; in Kapitälchen: Texte von Afrikanern):<br />
SONG DER SOTHO IN SÜDAFRIKA .................................................................................................. 259<br />
GEBET AN DIE MASKEN ........................................................................................................... 260<br />
Herodot berichtet aus Afrika ..................................................................... 261<br />
Afrika, bevor die Europäer kamen .............................................................262<br />
Weisse Farmerin unter Schwarzen .............................................................262<br />
AFRIKA FREI! ..................................................................................................................... 264<br />
Nationalbewusstsein und Staatenwerdung in Afrika ................................................... 267<br />
Die Kunst von Benin ........................................................................268<br />
BENIN ............................................................................................................................ 271<br />
Was bei den Weissen anders ist als bei den Schwarzen .............................................271<br />
Tabus ....................................................................................... 273<br />
Stanley und Moyimba .......................................................................... 275<br />
Moyimbas Bericht ............................................................................. 276<br />
An der Nilquelle .............................................................................. 278<br />
Tunesische Wüste .............................................................................. 280<br />
- Die Salzwüste ............................................................................... 280<br />
- Die Oase von Tozeur .......................................................................... 282<br />
- In der Sandwüste ............................................................................. 283<br />
Das grösste ÖIkamp in der Sahara ................................................................ 284<br />
Kairo und die Ägypter .......................................................................... 286<br />
WARUM DIE EULE EIN NACHTVOGEL IST ...........................................................................................289<br />
Begegnung in Takoradi ......................................................................... 290<br />
Urwald in Afrika .............................................................................. 291<br />
Dünung vor Angola ............................................................................ 295<br />
Die Nebel-Oase Erkowit ........................................................................ 296<br />
Die Eroberung des Kilimandscharo ................................................................ 298<br />
TOTENGESANG DER PYGMÄEN .................................................................................................... 300<br />
Alltag des Wildhüters am Ngorongoro-Krater ........................................................ 301<br />
Amos Tutuola, ein schwarzer Dichter ..........................................................303<br />
GEFÄHRLICH, IM BUSCH ZU WANDERN, ABER GEFÄHRLICHER, AUF DER STRASSE DER TOTEN .......................................... 304<br />
Heuschrecken auf einer Farm in Kenia ............................................................. 306<br />
Die Viktoriafälle .............................................................................. 308<br />
Die Inder in Ostafrika .......................................................................... 309<br />
Der Weisse in schwarzer Sicht ................................................................312<br />
Johannesburg ................................................................................. 315<br />
Zyklon über Madagaskar ........................................................................ 316<br />
Auf den Kanarischen Inseln ...................................................................... 319<br />
Der Nordostpassat ............................................................................. 319<br />
Der Pik des Teide .............................................................................. 321<br />
4.9.1 "Gebet an die Masken"<br />
Geographielehrmittel: Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
Als Hintergrundinformation zum Text "Gebet an die Masken" liefert der Autor folgenden Text (S. 260), der<br />
ein Bild eines Afrikaners zeichnet, dass dem Hoffnungsbild der damaligen Zeit - vor der Unabhängigkeit<br />
vieler Staaten Afrikas - entsprach: dem europäisch gebildeten Menschen, der seine afrikanischen Wurzeln<br />
nicht verleugnet und aus den beiden Kulturen eine sinnvolle Synthese zu schaffen vermag:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 121
Leopold Sedar Senghor ist am 9. Oktober 1906 in Joal-la Portugaise, Senegambien, geboren und heute <strong>Pro</strong>fessor für<br />
afrikanische Sprachen an der Ecole Nationale de la France d'Outremer, Abgeordneter Senegals in der französischen<br />
Nationalversammlung und Mitglied der Beratenden Versammlung des Europa-Rats. Nach Herkunft und Geburt Afrikaner,<br />
nach Erziehung und Bildung Franzose, gilt Senghor als Muster geglückter Assimilation.<br />
Frankreich verfolgte lange Zeit die sogenannte Politik der Assimilation, d.h. die Bewohner der (ehemaligen)<br />
Kolonien sollten langsam aber sicher zu "guten französischen Staatsbürgern" erzogen werden. Positiv an dieser<br />
Politik war die Möglichkeit für schwarze Intellektuelle, eine Ausbildung in Frankreich selbst zu erlangen und<br />
sich so ein Bild über einen Teil der Kultur des Kolonisators zu machen. Andererseits führte diese Politik zu<br />
einer Entfremdung, ja sogar Verachtung der eigenen Kultur bei nicht wenigen Intellektuellen der betroffenen<br />
Länder.<br />
Diese Hin- und Hergerissenheit zwischen zwei Kulturkreisen spricht der Autor an, wenn er in seinem Text<br />
weiterfährt (S. 260):<br />
Ein schwarzer Franzose? Ein französischer Westafrikaner? Das eine mag für den Politiker gelten, das andere mögen ihm<br />
stolze Missionslehrer lobend, gestrige Kolonialherren abfällig nachrufen. Für den Dichter trifft beides nicht zu.<br />
Der geistsprühende, parkettgewandte Franzose zeigt als Lyriker, dass er nichts aufgab vom afrikanischen Erbe- und der<br />
afrikanische Mahner, Deuter, Werber und Ankläger zeigt als Dichter und Weltmann, dass ihm christlicher Glaube,<br />
französische Sprache, europäische Kleidung keine Hülsen sind, die er bedarfsweise anlegt oder abwirft.<br />
Er ist, auch wenn er sich bescheiden selbst so nennt, kein "kultureller Mischling", der, seiner Erbkultur schon halb<br />
verfremdet und der Fremdkultur erst halb erschlossen, wurzellos zwischen beiden triebe. Nein, er ist Vollafrikaner und<br />
Volleuropäer, Vorbild vielleicht eines möglichen Menschentyps der Zukunft: des Eurafrikaners, der in zwei Traditionen<br />
verwurzelt, beide harmonisch vereint.<br />
Mit einer solcherart gebildeten afrikanischen Elite sollten die afrikanischen Staaten dem Fortschritt entgegen-<br />
geführt und gleichzeitig die Bindung mit dem kolonialen "Mutterland" aufrechterhalten werden. Die Bindung<br />
der afrikanischen Staaten an die Kolonialmächte hatte sich, durch Unabhängigkeitserklärungen verschiedener<br />
Gebiete, zur Zeit des Erscheinens des Buches bereits in Teilen Afrikas aufgelöst. Die Hoffnungen und Träume,<br />
die die neuen Staaten Anfang der sechziger Jahre antrieb, haben sich zu einem grossen Teil nicht erfüllt.<br />
4.9.2 "Afrika, bevor die Europäer kamen"<br />
Geographielehrmittel: Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
Im Text "Afrika, bevor die Europäer kamen" auf der Seite 262, der hier in seiner vollen Länge wiedergegeben<br />
werden soll, von Leo Frobenius, einem der bekanntesten und bedeutendsten Afrikaforscher seiner Zeit, - sein<br />
Bericht dient sozusagen als Beweisstück des Wissens um die tatsächlichen Leistungen der schwarzafrikani-<br />
schen Völker, welche aber in noch allzuvielen Lehrmitteln bis in die letzten Jahre hinein ignoriert wurden, und<br />
für die es aufgrund dieses und anderer Texte eigentlich keine Entschuldigung gibt - werden kurz die Lebens-<br />
weise und Errungenschaften einiger afrikanischer Völker in der Zeit vor dem 15. Jahrhundert beschrieben:<br />
Als die ersten europäischen Seefahrer in die Bai von Guinea kamen und bei Weida Land betraten, waren die Kapitäne sehr<br />
erstaunt. Sorgfältig angelegte Strassen, auf viele Meilen ohne Unterbrechung eingefasst von angepflanzten Bäumen;<br />
Tagereisen weit nichts als mit prächtigen Feldern bedecktes Land, Menschen in prunkenden Gewändern aus<br />
selbstgewebten Stoffen! Weiter im Süden dann, im Königreiche Kongo, eine Überfülle von Menschen, die in Seide und<br />
Samt gekleidet waren, eine bis ins kleinste durchgeführte Ordnung grosser, wohlgegliederter Staaten, machtvolle<br />
Herrscher, üppige Industrien, - Kultur bis in die Knochen! Als ebendies erwies sich der Zustand in den Ländern auf der<br />
Ostseite, zum Beispiel an der Mozambiqueküste.<br />
Aus den Berichten der Seefahrer vom 15. bis zum 17. Jahrhundert geht ohne jeden Zweifel hervor, dass das vom<br />
Saharawüstengürtel gen Süden sich erstreckende Negerafrika damals noch in der vollen Schönheit harmonisch<br />
wohlgebildeter Kulturen blühte. Eine Blüte, die europäische Konquistadoren, soweit sie vorzudringen vermochten,<br />
zerstörten. Denn das neue Land Amerika brauchte Sklaven; Afrika bot Sklaven. Sklaven zu Hunderten, Tausenden,<br />
schiffsladungsweise! Der Menschenhandel war jedoch niemals ein leicht zu verantwortendes Geschäft. Es erforderte eine<br />
Rechtfertigung. So wurde der Begriff Fetisch als Symbol einer afrikanischen Religion erfunden. Eine europäische<br />
Fabrikmarke! Ich selbst habe in keinem Teil Afrikas die Fetischanschauung bei Negern gefunden. Die Vorstellung vom<br />
'barbarischen Neger' ist eine Schöpfung Europas.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 115 und 130 dieser Arbeit.) Frobenius zeichnet hier mit deutlichen<br />
Worten ein Bild, das obwohl einseitig, denn er verschweigt traurigere Kapitel der afrikanischen Geschichte,<br />
die ebenso wie die Geschichte anderer Kontinente Höhen und Tiefen aufweist, der Wahrheit wohl näher<br />
kommt als die üblicherweise porträtierten Charakterbilder von den "Wilden" und "Primitiven" Afrikas, die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 122
auch in heute noch im Schulgebrauch befindlichen Lehrmitteln (siehe die Besprechung von Oskar Bärs "Geo-<br />
graphie der Kontinente" auf den Seiten 339f. dieser Arbeit) anzutreffen sind.<br />
4.9.3 "Weisse Farmerin unter Schwarzen"<br />
Tanja Blixen - die 1913 nach Kenia zog um eine Kaffeeplantage zu leiten, und von der die Kenianer sagten:<br />
"Hier ist sie, wo sie nicht sein sollte", 1931 nach dem Konkurs ihrer Unternehmung nach Europa zurückkehrte<br />
dort ihren weltberühmt gewordenen Roman "Out of Africa" über den "Lustgarten Afrika", den es so nie gege-<br />
ben hat, schrieb (Leippe 1985) - spricht in dem von ihr übernommenen Text "Weisse Farmerin unter Schwarz-<br />
en" auf der Seite 263 die Schwierigkeiten der Kommunikation zwischen ihr und der einheimischen Bevölke-<br />
rung an, die wohl zu einem guten Teil auf die Erfahrung der Afrikaner mit der britischen Besetzungsmacht in<br />
Kenia zurückzuführen sind und die in ähnlicher Art überall dort zu Missverständnissen führen können wo das<br />
"afrikanische" Wertesystem auf das "europäische" trifft:<br />
Ehe man den Schwarzen genau kennt, gelingt es einem kaum, von ihm eine gerade Antwort zu bekommen. Auf die direkte<br />
Frage, etwa, wieviel Kühe er besitzt, gibt er eine ausweichende Antwort: "So viele, wie ich dir gestern sagte." Es geht<br />
einem Europäer gegen das Gefühl, solch eine Antwort hinzunehmen, aber wahrscheinlich geht es einem Schwarzen ebenso<br />
gegen das Gefühl, so geradezu gefragt zu werden. Wenn wir drängten oder versuchten, den Leuten eine Erklärung ihres<br />
Benehmens abzupressen, dann zogen sie sich zurück, solange es ging, und kehrten dann irgendeinen grotesken lustigen<br />
Spass hervor, um uns auf falsche Spur zu lenken. Sogar kleine Kinder bewiesen in einer solchen Lage die Abgefeimtheit<br />
alter Pokerspieler, denen es ganz gleich ist, ob man ihre Karten unterschätzt oder überschätzt, solange man nur nicht weiss,<br />
was sie wirklich in der Hand halten. Da, wo wir an die Grundlage ihrer Existenz rührten, benahmen sich die Schwarzen wie<br />
Ameisen, in deren Haufen man mit einem Stock hineinsticht: sie besserten den Schaden mit unermüdlicher Kraft rasch und<br />
ruhig aus, als gelte es, eine Unschicklichkeit zu vertuschen.<br />
Schwierigkeiten der beschriebenen Art dienen im besten Fall der Belustigung aller Beteiligten, im schlimm-<br />
sten Fall können sie zu Fehlentscheidungen führen, die weitere Konsequenzen nach sich ziehen.<br />
Leider kommt es in der Begegnung zwischen Menschen aus den Industrienationen, die als Tourist, als "Ent-<br />
wicklungsexperte" mit dem Ideal des Helfenwollens, oder aus reiner <strong>Pro</strong>fitgier ein schwarzafrikanisches Land<br />
besuchen, und der einheimischen Bevölkerung oft zu solchen Missverständnissen. Diese bleiben dem kurzfri-<br />
stig verweilenden Besucher allzu oft verborgen, da viele schwarzafrikanische Völker eine Kultur der minima-<br />
len Konfrontation pflegen, wie sie in ähnlicher Weise aus Japan und China bekanntgeworden ist. Wer also<br />
nicht sehr genau hinhört, läuft Gefahr, lange Zeit eine falsche Vorstellung von den tatsächlichen Absichten<br />
und Wünschen seines Gegenübers mit sich herumzutragen. (Zu Kenia siehe auch die Seite 165 dieser Arbeit.)<br />
4.9.4 Kunst in Benin<br />
Hermann Baumann beschreibt im Text "Kunst in Benin", aus welchem hier drei Abschnitte diskutiert werden<br />
sollen, den Reichtum und die Kultur des historischen Königreiches Benin, das geographisch mit dem heutigen<br />
Staat gleichen Namens nicht deckungsgleich ist, sondern auf dem Gebiet des heutigen Nigerias lag.<br />
In einem ersten Abschnitt auf der Seite 269 beschreibt der Autor, was der Holländer Samuel Blomert, der<br />
Benin zur Zeit der Hochblüte bereiste, in einem von Dapper 1668 veröffentlichtem Buch über die Hauptstadt<br />
des Königreichs Benin zu berichten wusste:<br />
Geographielehrmittel: Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
...Die Stadt Benin selbst, Herz und Residenz des Königreiches, war auf einer Seite mit einer zwei Meter hohen Mauer aus<br />
Palisaden, die mit rotem Lehm gedichtet waren, umgeben. Auf der anderen Seite begrenzten Busch und Morast die<br />
ungewöhnlich grosse Stadt. Auffallend gradlinige Strassen zerschnitten das Stadtbild; die Gehöfte selbst waren wieder von<br />
Mauern umgeben, und die Häuser hatten viele Gemächer mit spiegelblank geriebenen Wänden und Decken. Der<br />
Königspalast wird von Dapper ziemlich gut charakterisiert. Das mit Palmblättern bedeckte Dach ruht auf hölzernen Säulen,<br />
die von unten bis oben mit Messing (d. h. Bronzeplatten) belegt waren, "darauf ihre Kriegstaten und Feldschlachten<br />
abgebildet sind". Die Dächer der Häuser zeigen oft kleine Türme, welche mit aus Kupfer gegossenen Vögeln besetzt sind...<br />
Ein Bild das sich in ganz wesentlichen Zügen von Berichten unterscheidet, die in nicht wenigen Lehrmitteln<br />
zu finden sind und die sich ganz der Lehm- und Strohhüttenromantik ergeben, und als nur ein Beispiel für<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 123
eine, im europäischen Sinne gedachten Hochkultur in der langen Geschichte Afrikas zeugt. (Eine weitere<br />
Beschreibung der Stadt Benin findet sich im Teil "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas" auf der<br />
Seite 29 dieser Arbeit.) Baumann kommt anschliessend auf die Schattenseiten dieser Kultur zu sprechen (S.<br />
269):<br />
Die Herrschsucht des Königs war ungewöhnlich und ungehemmt, wie in fast allen Despotien Westafrikas. Menschenopfer<br />
- oft 23 am Tage - wurden bei der Königsbestattung und bei den jährlichen Gedenkfeiern für den verstorbenen Herrscher<br />
dargebracht. Eine ununterbrochene Kette blutigster Untaten kennzeichnet den Weg der Benin-Dynastie und ihrer höfischen<br />
Kultur, und es ist bezeichnend, dass mit dem Schwinden der künstlerischen Erlebniskraft des Beninvolkes diese durch das<br />
Verlangen dämonischer Mächte und religiöse Übersteigerung ausgelöste hemmungslose Blutgier zu wachsen schien.<br />
Im Gegensatz zu der Bezeichnung Baumanns der westafrikanischen Reiche als "Despotien", wurden diese<br />
zwar von Herrschern mit sehr weitreichenden Befugnissen regiert, der König selbst war aber einer Vielzahl<br />
von Vorschriften und Kontrollen unterworfen, die, hielt er sie nicht ein, zu seinem Sturz oder Schlimmerem<br />
führen konnten.<br />
Die von Baumann beschriebenen "Menschenopfer", dienten nicht dazu, die Götter zu versöhnen, stellten also<br />
keine Opfer im eigentlichen Sinne dar, sondern Hintergrund der Handlungsweise war die Idee, den verstorbe-<br />
nen König auf seine Reise in die "andere Welt" mit Dienern zu versorgen. Ausserdem gibt es Anzeichen dafür,<br />
dass sich die Handlungsweise logisch begründen lässt, wenngleich sie in europäischen Augen dadurch ethisch<br />
nicht vertretbarer wird: So wurde die Gefahr für den König, vergiftet zu werden, durch das Wissen der Köche,<br />
dass sie ihrem Herrscher in den Tod folgen würden, sicher verringert.<br />
Aus heutiger Sicht scheinen diese Praktiken höchst befremdlich, und es wird kaum einen Schwarzafrikaner<br />
gegen, der nicht auch so empfindet. Die von Baumann erwähnte "hemmungslose Blutgier" konnte mit Hilfe<br />
anderer Quellen jedoch nicht verifiziert werden.<br />
In einem letzten Abschnitt soll Baumann nun zu den in der Zwischenzeit weltberühmten Skulpturen von Benin<br />
zu Wort kommen (S. 270), deren Schönheit sich in Worten nur schwer fassen lässt und die in einem Bildband<br />
aufzustöbern ein lohnendes Unterfangen ist:<br />
Dieser Bronzeguss ist das Erstaunlichste der Beninkultur. Die Vollendung der Technik des Giessens in verlorener Form<br />
(cire perdue) ist derart ungewöhnlich, dass man es versteht, wenn Gelehrte ernsthaft an indische oder europäische<br />
Lehrmeister in Benin dachten. Doch ist man heute wohl allgemein von diesen Vermutungen - mehr als solche waren es nie<br />
- abgekommen, und man sieht jetzt immer mehr in allen Beninkunstwerken den typisch afrikanischen Stil. Wir wissen<br />
heute, dass in Benin wohl eine selten hohe Fertigkeit in dieser Technik erreicht wurde, dass aber von der Goldküste bis<br />
Kamerun ein altes Bronzegiessergebiet bestand, dessen Beziehungen mit dem alten Mittelmeergebiet viel tiefer in die<br />
Geschichte hineinreichen als die kolonialen Einflüsse Europas in Westafrika.<br />
Die damalige Sichtweise auf Afrika wird durch die Bemerkung über "indische und europäische Lehrmeister"<br />
deutlich. Den Schwarzafrikanern wurde nicht zugetraut, aus eigenen Kräften eine hohe Fertigkeit auf irgendei-<br />
nem Gebiet zu erlangen, respektive eine eigene Kultur, die diesen Namen auch verdient hätte, zu schaffen.<br />
Selbst nach der Korrektur dieses Irrtums bezüglich der Erzeugnisse Benins, hält Baumann an der Einflussnah-<br />
me aus dem Mittelmeergebiet fest, auch wenn diese zurückdatiert wird, ohne seine Annahme zu begründen.<br />
Die vielfältigen Handelsbeziehungen der vorkolonialen afrikanischen Reiche wird in besseren Geschichtsbü-<br />
chern über den afrikanischen Kontinent im Detail dargestellt, hier sei auf den Teil "Überblick über die<br />
Geschichte Schwarzafrikas" ab der Seite 25 dieser Arbeit hingewiesen. (Zu Nigeria siehe auch die Seite 126<br />
dieser Arbeit.)<br />
4.9.5 "Was bei den Weissen anders ist als bei den Schwarzen"<br />
Geographielehrmittel: Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
Als typisches Beispiel für das mangelnde Verständnis gegenüber der schwarzafrikanischen Kultur und<br />
unzulässigen Verallgemeinerungen, aufgrund von Einzelerlebnissen oder der Erfahrung mit einer Volksgruppe,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 124
auf einen ganzen Kontinent - deren sich viele oft nicht erwehren können, die aber glücklicherweise nur wenige<br />
zu Papier bringen - mag der Text "Was bei den Weissen anders ist als bei den Schwarzen" von Albert Schweit-<br />
zer, dessen Texte über die einheimische Bevölkerung Afrikas oft nicht über alle Zweifel erhaben sind, auf den<br />
Seiten 271-273 dienen. Zur Diskussion soll hier nur ein Ausschnitt aus seinen Betrachtungen über den "Braut-<br />
preis" (S. 272), der bei weitem nicht allen Völkern Schwarzafrikas bekannt ist, angeführt werden :<br />
Frauen sind hier ein Wertobjekt. Vom Augenblick der Geburt eines Mädchens an stellen die Angehörigen das Kapital, das<br />
das bedeutet, in Rechnung. Von Jugend auf ist diese Betrachtungsweise dem Schwarzen geläufig. Als eine weisse Dame in<br />
meinem Spital Zwillingstöchter gebar und die Kinderchen dem Boy gezeigt wurden, wusste dieser dem Vater nichts<br />
anderes zu sagen als: "Jetzt bist du aber reich!"<br />
Da es in den meisten Ländern Afrikas keine Rentenversorgung gibt, wie sie in vielen Länder Europas üblich<br />
ist, sind eigene Kinder ein Garant für die Versorgung im Alter. Es ist für eine schwarzafrikanische Frau sehr<br />
schwierig kinderlos zu bleiben, da Kinderlosigkeit in vielen afrikanischen Gesellschaften als Unglück oder gar<br />
als "Strafe der Götter" angesehen wird. Afrikanerinnen besitzen vergleichsweise wenige der Rechte, die einer<br />
Frau in Europa zugestanden werden, allerdings kann sie auch in einer Weise schalten und walten, die wohl<br />
viele Europäerinnen in Erstaunen versetzen würde.<br />
Interessant ist die Reaktion des Bediensteten, im Text als Boy bezeichnet, gibt es doch Völker in Afrika, bei<br />
denen eine Zwillingsgeburt als Unglück angesehen wird.<br />
Da die Frau bei der Heirat in gewissen Volksgruppen ihre Familie verlässt, und damit nicht mehr für ihre<br />
Eltern sorgen kann, bezahlt der Bräutigam oftmals einen "Brautpreis", der aber sehr unterschiedlich ausfallen<br />
kann. Besonders in bessergestellten Familien gewisser Völker kann es dabei auch heute noch zu übertriebenen<br />
Forderungen seitens der Eltern kommen. Dabei spielt aber weniger Geldgier, als vielmehr Prestigedenken -<br />
"nicht jeder kann in unsere Familie einheiraten" - eine Rolle. Schweitzer schildert weiter, was für Folgen ein<br />
überhöhter "Brautpreis" haben kann (S. 272):<br />
Das ganze Leben des Schwarzen ist durch die mit der Verheiratung verbundene Geldangelegenheit beherrscht. Um sich die<br />
Mittel zum Kaufe einer Frau zu erwerben, sucht er vom sechzehnten Jahre an eine Verdienstmöglichkeit. Oft muss er sich<br />
zu diesem Zwecke entschliessen, sein Dorf zu verlassen und irgendwo bei einem Weissen eine Stelle anzunehmen. Was er<br />
auf diese Weise in drei bis vier Jahren zusammenbringt, reicht zur Bezahlung der Frau bei weitem nicht hin. Der verlangte<br />
Preis ist gewöhnlich so hoch, dass er das, was ein Eingeborener in zehnjähriger Arbeit beiseite legen kann, übersteigt. Also<br />
heiratet er, indem er die Frau auf Abzahlung kauft. Sein Vater, oder, wenn dieser nicht mehr am Leben ist, ein älterer<br />
Bruder, müssen ihm für die erste Anzahlung, die er zu machen hat, behilflich sein und die Garantie für die Ratenzahlung<br />
übernehmen.<br />
Auch wenn der "Brautpreis" relativ moderat ausfällt - er gilt auch als Beweis dafür, dass der Mann in der Lage<br />
ist, seine zukünftige Familie zu ernähren - bietet er doch für viele eine zumindest zeitweilig kaum zu über-<br />
brückende Hürde, die letztendlich dazu führt, dass sich Frauen als alleinerziehende Mütter durch das Leben<br />
schlagen müssen. Allerdings gibt es auch Studien, die darauf hinweisen, dass der "Brautpreis" auf lange Sicht<br />
einen gesellschaftlichen Nutzen erbringt, indem er zum Beispiel zur Bremsung des Bevölkerungswachstums<br />
beiträgt. Zudem drückt sich in ihm heute eine Bekenntnis zu traditionellen Werten und die Hochachtung vor<br />
der "erworbenen" Frau aus, die durch die Bezahlung des "Brautpreises" nicht in erster Linie in den Besitz des<br />
Mannes übergeht, sondern von ihrer Familie in die Familie des Mannes überwechselt. Der Brautpreis ist also<br />
letztlich nicht eine Sache zwischen Bräutigam und Schwiegereltern, sondern dient der Verbindung zweier<br />
Familien und ist deshalb ein sozialer Kontrakt, der mehr als nur zwei Menschen betrifft. (Zum "Brautpreis"<br />
siehe auch die Seiten 106 und 330 dieser Arbeit.)<br />
Ähnlich fragwürdig wie der erste Text Albert Schweitzers ist, aus den bereits angeführten Gründen, auch der<br />
zweite über "Tabus" auf den Seiten 273-274. (Zu Albert Schweitzer und seinem Werk siehe auch die Seite 209<br />
dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 125
4.9.6 Totengesang der Pygmäen<br />
Der auf der Seite 300 zu findende "Totengesang der Pygmäen" soll hier wiedergegeben werden, da er in<br />
verschiedenen Büchern unterschiedlich beurteilt wird:<br />
Das ist die grosse Kälte der Nacht, das ist das Dunkel.<br />
Der Mensch ist vorübergegangen, der Schatten verschwunden,<br />
Der Gefangene ist frei.<br />
Schöpfer Gott, Schöpfer Gott, zu Dir geht unser Rufen.<br />
Ihr Sterne habt es besser.<br />
Der Vater Mond stirbt und kehrt zurück.<br />
Die Mutter Sonne stirbt und kehrt zurück.<br />
Ihr Sterne habt es besser.<br />
O Sonne, o Sonne!<br />
Der Tod kommt, das Ende naht, der Baum fällt und stirbt.<br />
O Sonne, o Sonne!<br />
Das Kind wird im Schoss der Mutter geboren,<br />
Der Tote lebt, der Mensch lebt, die Sonne lebt.<br />
O Sonne, o Sonne!<br />
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 115 und 141 dieser Arbeit.) Theodor Bohner schreibt auf der glei-<br />
chen Seite zu diesem Gedicht:<br />
Der französische Missionar Trilles teilte das Leben mit Pygmäen in Äquatorial-Afrika, fand bald Vertrauen. Er hat<br />
Totengesänge von ihnen aufgezeichnet. Nach solchen Gesängen verbrannten die Zwerge Habe und Hütte des Toten, damit<br />
er nicht zurückkommen möge.<br />
Im Anbetracht der einfachen Behausungen und der Tatsache, dass andere Bewohner des Regenwaldes in doku-<br />
mentierten Fällen bei dem Verdacht auf Seuchengefahr ihre Dörfer isolierten und die Hütten der Kranken<br />
verbrannten, kommt dieser Verhaltensweise vielleicht mehr als eine rein "spirituelle" Bedeutung zu.<br />
In dem weiter hinten diskutiertem Werk "Geographie" von Widrig heisst es hingegen noch in der "7., durchge-<br />
sehenen Auflage" von 1967 im Zusammenhang mit dem gleichen Text (Widrig 1967, S. 305): "Bei anderen<br />
Lieder täuscht man sich jedoch, wenn man in ihnen Gedankentiefe vermutet. Zusammenhängende Gedanken<br />
können kaum herausgelesen werden." Der Leser möge sich in diesem Falle seine eigenen Gedanken machen<br />
und dabei berücksichtigen, dass solche Texte oft zumindest zwei Übersetzungen erfahren haben<br />
4.9.7 "Amos Tutuola: Ein schwarzer Dichter"<br />
Im Text "Amos Tutuola: Ein schwarzer Dichter" auf Seite 303 skizziert Janheinz Jahn Leben und Werk des<br />
afrikanischen Poeten, dessen Geschichte "Gefährlich, im Busch zu wandern, aber gefährlicher, auf der Strasse<br />
der Toten" - einer Variation der Geschichte des ewig hungrigen und nimmersatten Fabelwesens, die in der<br />
Form des Märchens in Afrika verbreitet und auch in Europa nicht unbekannt ist - auf den Seiten 304-305 abge-<br />
druckt wird. Der Text Jahns soll hier leicht gekürzt wiedergegeben werden, da er für das Leben vieler afrikani-<br />
scher Intellektueller typische Lebensumstände schildert:<br />
Amos Tutuola ist 1920 in Abeokuta geboren, der grossen Stadt "unter dem Felsen" in Westnigeria. Sein Stamm, der Stamm<br />
Yoruba mit über vier Millionen Menschen, wohnt im unteren Nigerknie bis hin zur Küste, die auf vielen Karten immer<br />
noch Sklaven-Küste heisst... Tutuola kam mit vierzehn Jahren in die Heilsarmee-Schule seiner Vaterstadt. Da seine<br />
Begabung auffiel, nahm ihn schon zwei Jahre später die höhere Schule in Lagos auf. Er konnte die Ausbildung nicht<br />
vollenden: 1939 starb sein Vater, und da die Familie das Schulgeld nicht weiterhin aufbringen konnte, ging er aufs Feld<br />
und baute Getreide an. Er wollte die Ernte verkaufen und so sein Schulgeld bezahlen, doch fiel in jenem Jahr kein Regen,<br />
und sein Getreide gedieh nicht. Da wurde er Kupferschmied, zunächst in der Werkstatt seines Bruders, dann drei Jahre lang<br />
während des Krieges in der Royal Air Force in Nigeria. Nach seiner Entlassung wollte er sein Handwerk auf eigene<br />
Rechnung betreiben, doch fehlte es ihm am Grundkapital. Er wurde Angestellter im Labour Department in Lagos. Damit<br />
unzufrieden, begann er zu schreiben.<br />
(Zu Nigeria siehe auch die Seiten 123 und 157 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
Tutuola stellt unserer realen Welt eine Welt höherer, ursprünglicherer Realität gegenüber: den afrikanischen<br />
Kräfte-Kosmos, in dem Leben und Tod, Wirkliches und Vorgestelltes zusammenfallen. Es ist die über-real(istisch)e Welt,<br />
zu der die Surrealisten in ihren Werken vordringen wollten. Das afrikanische Bewusstsein hat jenen unmittelbaren Kontakt<br />
mit dem Unbewussten, jenen Ansatzpunkt des Geistes, den die Surrealisten ahnten und suchten.<br />
In dem Epos "Der Palmweintrinker" zieht der Held zur Totenstadt und besteht auf dem Hin- und Rückweg zahllose<br />
Abenteuer im unheimlichen Busch mit seltsamen Wesen, über deren Existenz er sich nicht wundert. Sie sind für ihn real<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 126
vorhanden, er geht mit ihnen um wie mit den Lebenden und mit den Toten. Wenn er seine Djujus, seine Zauberkräfte,<br />
anwendet, wird er selbst zu einem der seltsamen Wesen. Tutuola glaubt an sie, wie Millionen Afrikaner an sie glauben.<br />
Neben der Schilderung eines wechselhaften Lebenslaufes fallen einige Sätze, die eine nähere Betrachtung<br />
verdienen. So wird das Volk Tutuolas, die Yoruba, als "Stamm" bezeichnet, obwohl es, wie im Text vermerkt<br />
wird, "über vier Millionen Menschen" zählt. Eine Wortwahl, die auf die schwarzafrikanischen Völker immer<br />
wieder zu Unrecht angewandt wird, denn wie Okwudiba Nnoli in "Tribalism or Ethnicity: Ideology versus<br />
Science" 1978 schrieb: "Was machen 2 Millionen Norweger zu einem Volk und ebenso viele Baganda zu<br />
einem Stamm? Ein paar Hunderttausend Isländer zu einem Volk und 14 Millionen Hausa-Fulani zu einem<br />
Stamm? Es gibt dafür nur eine Erklärung: Rassismus..." (Jestel 1982, S. 102)<br />
4.9.8 "Der Weisse in schwarzer Sicht"<br />
Auf den Seiten 312-314 schafft es Peter Sulzer in seinem Text "Der Weisse in schwarzer Sicht", durch die<br />
Umkehrung der Sichtweise, nicht unähnlich Albert Schweitzer in "Was bei den Weissen anders ist als bei den<br />
Schwarzen", soweit vom eigentlichen Thema abzukommen, dass auch einige für diese Arbeit interessante<br />
Sätze über die einheimische schwarze Bevölkerung Südafrikas fallen. Sulzer benutzt die zitierte Sichtweise der<br />
Afrikaner als Entschuldigung für seine eigenen rassistischen Bemerkungen. Dabei beschränkt er sich nicht nur<br />
auf Seitenhiebe gegen die schwarze Bevölkerung, er ist sich auch nicht zu schade, über Leute herzuziehen, die<br />
an ein Zusammenleben von "Schwarz und Weiss" glauben oder sonst mit der einheimischen Bevölkerung<br />
häufig in Kontakt kommen (S.312):<br />
...Missionare, Regierungsbeamte der Eingeborenenverwaltung, Anthropologen und "Kafferboeties"..., jene Kaffernbrüder<br />
oder Kaffernschwärmer also, die seit den Zeiten van der Kempfs und dem ersten Auftreten der Londoner<br />
Missionsgesellschaft immer wieder den Versuch unternommen haben, den Schwarzen als gleichberechtigten Bruder zu<br />
behandeln. Kafferboeties sind Leute, die einer sentimentalen, der europäischen Gesellschaft schädlichen Liebhaberei für<br />
Eingeborene huldigen.<br />
Nach Sulzers Ansicht handelt es sich bei einem schwarzen Südafrikaner also nicht um einen "gleichberechtig-<br />
ten Bruder". Nur schon der Versuch einer solchen Sichtweise ist für ihn eine für die "europäische Gesellschaft<br />
schädliche Liebhaberei".<br />
Weiter lässt er einen Weissen zu Wort kommen, der aussagt, "es gebe hier zu viele Schwarze" (S. 313), was in<br />
Anbetracht der geschichtlichen Realität eine Frechheit ist, die sich aber bis heute in der "Besorgnis" gewisser<br />
Autoren über die Überbevölkerung in den Ländern der "Weltmeister im Kinderkriegen" (Michler 1991, 359)<br />
wiederholt. Auf der gleichen Seite schreibt Sulzer:<br />
Und wenn bei unserem ersten Eindruck vom Schwarzen das Affenähnliche überwiegt, so gelten andererseits auch wir den<br />
Afrikanern nicht sogleich als Menschen...<br />
...Es steht ausser Zweifel, dass der Afrikaner bei seiner Begegnung mit dem weissen Mann in uns das Übermenschliche,<br />
göttergleich Mächtige zu erkennen glaubte. Schon vor dem Auftreten der Europäer in Südafrika bahnten wohl Sage und<br />
Glaube dieser Vorstellung den Weg.<br />
Sulzer führt als Entschuldigung für seine unqualifizierten Bemerkungen also an, dass Afrikaner die Europäer<br />
in einem ähnlichen Licht sehen würden. Dies widerspricht der Gastfreundlichkeit, die viele Europäer, sofern<br />
sie sich nicht selbst als "weisse Götter" deklarieren, in weiten Teilen Afrikas immer wieder erleben durften.<br />
Gleichzeitig versperrt eine solche Bemerkung auch den Zugang zu einer sachlichen Betrachtung rassistischer<br />
Tendenzen bei den Völkern Schwarzafrikas, die durchaus latent vorhanden sind, und sich bei passender Gele-<br />
genheit, wie beispielsweise in Ruanda, gewalttätig äussern können.<br />
Geographielehrmittel: Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
Die Vorstellung des "göttergleichen" Weissen dürfte spätestens seit den beiden Weltkriegen von vielen Afrika-<br />
nern angezweifelt werden, allerdings hat sich eine gewisse Bewunderung im Hinblick auf die technische<br />
Innovationsfreude des "weissen Mannes" in vielen Teilen der Bevölkerung gehalten. Zu dieser Bewunderung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 127
tragen auch die Filme Hollywoods bei, die ein Bild besonders von Amerika vermitteln, das weitab von der<br />
Realität liegt. Sulzer fährt fort (S.314):<br />
Der Schwarze fühlt sich dem Apparat des weissen Staates, in dem er lebt, machtlos preisgegeben. Hinter jeder Massnahme,<br />
sei sie auch noch so gut gemeint, sieht er eine absichtlich gegen ihn gerichtete Finte. Die fieberhafte Hast, mit der, nach<br />
Ansicht der Afrikaner, manche Gesetze im Parlament durchgepeitscht werden, weckt von vornherein den Verdacht des<br />
schwarzen Mannes...<br />
Angesichts der damaligen Situation in Südafrika, in Anbetracht der durch die Weissen verabschiedeten Geset-<br />
ze kann diese Einstellung der schwarzen Südafrikaner kaum verwundern.<br />
...Die Logik des europäischen Gerichtsverfahrens schlägt dem Rechtsempfinden des Afrikaners oft geradezu ins Gesicht.<br />
Nicht nur widerstrebt ihm der Eingriff der Polizei, wo der Verbrecher auf frischer Tat ertappt wird, die Art und Weise, wie<br />
der Schuldige gefunden wird, die Urteilsverkündung nach Paragraphen und der Freispruch im Falle mangelnder Indizien;<br />
die Verteidigungsreden erscheinen dem einfachen Schwarzen als ein Ränke- und Possenspiel, in dem er aus Mangel an<br />
Sachkenntnis, und weil die Advokaten zu teuer sind, notwendigerweise den Kürzeren ziehen muss,...<br />
...Während die britische Justiz in Südafrika noch vor fünfundzwanzig Jahren... bei den gebildeten Afrikanern einen<br />
ausgezeichneten Ruf genossen hatte, scheint heute das Vertrauen dieser Kreise in die Rechtsprechung der Weissen<br />
empfindlich geschädigt, wenn nicht erschüttert zu sein.<br />
Es sei hier auf die Arbeit der "Truth and Reconcilliaton Commission" in Südafrika hingewiesen, die fast<br />
unglaubliche Geschichten der Unterdrückung und Menschenverachtung seitens der damaligen "weissen"<br />
Regierung zu Tage gefördert hat. So wurden im Verlauf der Kommissionsarbeit Forschungsprojekte aufge-<br />
deckt, die auf die Vernichtung der Schwarzen Südafrikas mittels speziell zu entwickelnder chemischer und<br />
biologischer Waffen abzielten. Oppositionelle schwarze Politiker sollten durch verabreichte Gifte in der Haft<br />
verblöden oder eliminiert werden. (TA 15.06.98, S. 5) Sulzer fährt fort (S. 314):<br />
Vom Medizinmann und Zauberer, der er ursprünglich war, verwandelt sich der Europäer für den Bantuneger mehr und<br />
mehr in den rücksichtslosen, stets berechnenden und nur auf materiellen Nutzen bedachten Machtmenschen. Nur<br />
verhältnismässig wenige der Gebildeten und Halbgebildeten besitzen den nötigen Abstand zu den afrikanischen<br />
Gegenwartssorgen, um den weissen Mann in seiner Ganzheit zu sehen.<br />
Hat man nur eine schwache Ahnung der Zustände im damaligen Südafrika, die immerhin zu einem Ausschluss<br />
aus dem ehemals britisch dominierten "Common Wealth" und später zu Sanktionen seitens der UNO führten,<br />
erkennt man, dass dieser Text wohl in ähnlicher politischer Absicht entstanden ist, wie das auf der Seite 2<br />
dieser Arbeit abgedruckte Zitat aus der Personalzeitung einer Schweizer Grossbank von 1960 und nur als blan-<br />
ker Zynismus verstanden werden kann.<br />
4.9.9 Zusammenfassung<br />
Zusammengefasst hinterlässt der Band "Die Welt in allen Zonen" einen gemischten Eindruck, da er einerseits<br />
umfangreiches Material - darunter auch Texte von schwarzen Afrikanern abdruckt - diese jedoch, auch wenn<br />
sie eindeutig rassistische Töne anschlagen, wie etwa im letzten aufgezeigten Beispiel, unkommentiert wieder-<br />
gibt. Insgesamt spiegeln die Texte das damalige zerissene Bild der Weissen, die einerseits froh darüber waren,<br />
sich gewisser Altlasten glimpflich entledigt zu haben - viele Kolonien waren auf dem Weg zur Unabhängig-<br />
keit. Andererseits blickten sie, in denen für sie nach wie vor nützlichen Gebieten der gemässigteren Klimate,<br />
gerade dieser Entwicklung mit Unbehagen entgegen. Bei der Verteidigung des Status quo sollten sie in den<br />
folgenden Jahren in den Länder Süd- und Ostafrikas, wenig Skrupel in der Wahl der Mittel zeigen. Diese<br />
Entwicklung wurde durch die Vermittlung des Bildes eines "unterentwickelten" und "unreifen" Schwarzen<br />
wenn nicht gefördert, so doch massgeblich unterstützt, denn man das eigene Handeln mutierte damit "zum<br />
Guten der bedauernswerten Kreaturen".<br />
Geographielehrmittel: Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 128
4.10 Schweizerischer Mittelschulatlas (1962)<br />
Der 144 Seiten starke "Schweizerische Mittelschulatlas" von 1962 bildet Karten von Afrika auf den Seiten<br />
102-107 ab. Die Doppelseite 102-103 zeigt drei kleine Karten zur Tektonik, den Niederschlägen und der Vege-<br />
tation, und eine grosse Übersichtskarte mit dem Massstab 1 : 30 Mio. Die Seite 104 zeigt eine Karte der Atlas-<br />
länder, die Seite 105 vier kleinere Karten zu Ostafrika, Tunis, Kapstadt und Südafrika. Die Seite 106 bildet<br />
eine Karte zur Wirtschaft im Massstab 1:45 Mio. ab, sowie zwei kleinere Karten auf denen "<strong>Pro</strong>dukte" aus der<br />
Land- und Forstwirtschaft, sowie die "Volksdichte" ersichtlich sind. Die Seite 107 zeigt eine politische Karte<br />
im Massstab 1:45 Mio. und zwei kleinere Karten zu den verschiedenen Völkern - sie werden in Indogermanen,<br />
Türken, Semiten, Hamiten, Sudan-Neger, Bantu-Neger, Hottentotten, Buschmänner, Zwergvölker und Malaien<br />
aufgeteilt - und den Religionen, wobei fast ganz Schwarzafrika den Naturreligionen zugehörend eingefärbt<br />
wird.<br />
Neben diesen speziell Afrika gewidmeten Seiten enthält der Band eine Reihe von Weltkarten auf den Seiten<br />
132-141. Die Seiten 132-133 zeigen Klimakarten in der Zylinderprojektion, auf denen Afrika etwa gleichgross<br />
wie Grönland erscheint. Die Seite 135 zeigt eine Halbkugel der Erde in der äquatorständigen orthographischen<br />
Azimutalprojektion, auf der Afrika wieder zu klein erscheint, da es gegen den Rand der Karte hin abgebildet<br />
wird. Drei weitere Weltkarten in der Zylinderprojektion bilden die Seiten 136-137 ab. Die Karte "Volksdichte"<br />
auf der Seite gibt Afrika ungefähr im richtigen Grössenverhältnis wieder. Zwei weitere Karten zu Verkehr und<br />
Wirtschaft auf den Seiten 139 und 140 geben die Kontinente flächentreu wieder. Dies gilt auch für die Karten<br />
"Völker", "Religionen", "<strong>Pro</strong>dukte 1: Bodenschätze", "<strong>Pro</strong>dukte 2: Getreide", "<strong>Pro</strong>dukte 3: Kolonialprodukte"<br />
und "<strong>Pro</strong>dukte 4: Industriepflanzen".<br />
Da ein Grossteil der im Lehrmittel gezeigten Karten den afrikanischen Kontinent im Verhältnis zu klein abbil-<br />
det, wird Afrika zu einem "Zwerg" unter den Kontinenten degradiert, obwohl es rund dreimal so gross wie<br />
Europa ist. Damit verliert es im Bewusstsein der Leser an Bedeutung und wird zu einem blossen "Anhängsel"<br />
im Süden Europas, womit eine Grundlage für eine undifferenzierte Sichtweise auf die Bewohner des<br />
Kontinentes geschaffen wird, welche die nur wenig differenzierten Legenden noch verstärken: Beispielsweise<br />
im Falle der Völkerkarte Afrikas, welche die eigentlichen Schwarzafrikaner in nur zwei Gruppen, die "Sudan-<br />
Neger" und die "Bantu-Neger" aufteilt.<br />
Die Themen der Themenkarten wurden grösstenteils aus dem auf der Seite 109 dieser Arbeit besprochenen<br />
"Schweizer Sekundarschulatlas" übernommen, wobei sie jedoch einer Anpassung, teilweise Neueinfärbung<br />
unterzogen wurden.<br />
Geographielehrmittel: Schweizerischer Mittelschulatlas (1962)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 129
4.11 Geographie (1963)<br />
Die Neger Afrikas beschäftigen sich mit Viehzucht und Ackerbau und haben zum grossen Teil ihre Sitten und Gebräuche<br />
beibehalten. Die meisten Negervölker treiben Ahnen- und Totenverehrung und glauben an Zauberei. Sie sehen in Steinen,<br />
Lehmklumpen, Muscheln, Bäumen oder geschnitzten Holzfiguren ihre Geister (Fetische) und lassen sich durch Zauberer<br />
und Medizinmänner helfen und beraten. Die Fetische werden oft mit Menschenblut oder Öl bestrichen und mit Nägeln<br />
beschlagen, damit die Kräfte dieses Ölgötzen in der richtigen Art wirken. (S. 167)<br />
Das 247 Seite starke thurgauische Lehrmittel "Geographie" aus dem Jahre 1963 basiert unter anderem auf den<br />
Geographiebüchern von Hotz-Vosseler, Harms und Widrig, die an anderer Stelle ebenfalls Gegenstand der<br />
Untersuchung dieser Arbeit sind. (Siehe dazu die Seiten 99, 121 und 135 dieser Arbeit.)<br />
Nach einem allgemeingeographischen Teil (S. 11 - 37), in dem auf der Seite 19 Bevölkerungszahlen Afrikas<br />
für die Jahre 1900, 1925 und 1961 angegeben werden; einem Zahlen- und Tabellenteil, der auch einige statisti-<br />
sche Werte zu Afrika beinhaltet (S. 19, 45, 47, 50 und 51), befasst sich das Lehrmittelauch mit Afrika<br />
(S. 165-181).<br />
4.11.1 Die Bewohner<br />
Auf den Seiten 165-167 bietet das Buch einen Überblick über die Lage und das Klima Afrikas, bevor es, nach<br />
der Darstellung der Tierwelt, auf der Seite 167 auf die menschlichen Bewohner des Kontinents zu sprechen<br />
kommt:<br />
Die Zahl der Einwohner wird mit 272 Millionen, 8 auf 1 km 2 , angegeben. Als Reste der Urbevölkerung gelten die<br />
Buschmänner und Hottentotten. Sie sind mit einigen andern Zwergvölkern von Negern und Weissen mehr und mehr in die<br />
Wälder und unfruchtbaren Gebiete verdrängt worden und leben ausserordentlich primitiv, nähren sich von Insekten,<br />
Fröschen, Mäusen, Eidechsen, aber auch von Wurzeln, Würmern und Larven. Sie sind von sehr kleinem Wuchs und<br />
erreichen selten die Grösse von 1,40 m. - Den weitaus grössten Teil der Einwohner machen die Neger aus. Sie sind kräftig<br />
gebaute Menschen mit brauner bis fast schwarzer Haut, krausem Haar und wulstigen Lippen.<br />
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 103 und 133 dieser Arbeit.) Während der Autor sich in diesem<br />
ersten Abschnitt bei den normalwüchsigen afrikanischen Völkern auf eine äussere Beschreibung beschränkt,<br />
wird das Leben der kleinwüchsigen Völker kurz als "ausserordentlich primitiv" skizziert. Bei der Beschreibung<br />
der Nahrung dieser Menschen beschränkt der Autor sich auf das Aufzählen von tierischer und pflanzlicher<br />
Nahrung, welche auf die Schüler besonders fremd, wenn nicht sogar widerlich wirken muss. Ob diese Einen-<br />
gung der Nahrungsquellen mit Absicht geschah oder auf schlichtem Unwissen des Autors basiert - die "Pyg-<br />
mäen" nutzen z. B. ein wesentlich reicheres Nahrungsangebot, das nebst dem aufgezählten von Früchten, über<br />
den Honig wilder Bienen, Fische bis hin zu Warzenschweinen reicht - lässt sich aufgrund des vorliegenden<br />
Textes nicht feststellen. Eher widersprüchlich berührt da, die auf der Seite 179 in Form einer Zeichnung als<br />
abbildungswürdig betrachtete Lianenbrücke, welche allerdings für die Schüler nicht beschrieben wird und<br />
unverkennbar die typischen Merkmale, der für die Überquerung von Flüssen erbauten Bauwerke der als "pri-<br />
mitiv" beschriebenen "Pygmäen", zeigt. Weiter fährt der Text, nun die "Neger" ansprechend fort (S. 167).<br />
Im letzten Jahrhundert wurden sie massenhaft gefangen und als Sklaven nach Amerika verkauft. Glücklicherweise setzte<br />
ein Verbot diesem unmenschlichen Handel ein Ende.<br />
In diesen zwei kurzen Sätzen wird der Eindruck des hilflosen Afrikaners vermittelt, der wie ein Tier in die<br />
Falle getrieben und nach Übersee verkauft wird. Ob die Verwendung der Passivform im ersten Satz die<br />
Mitschuld Europas verschleiern soll, sei dahingestellt. Der Hinweis auf die Mitwirkung afrikanischer Küsten-<br />
völker beim Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika, dessen Opfer vor allem die weiter im<br />
Landesinnern ansässigen Völker waren, fehlt. (Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 122 und 135 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Geographie (1963)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 130
Anschliessend geht der Text auf die Lebensweise der negriden Völker Afrikas ein, wobei, wohl auch im Sinne<br />
einer didaktischen Verdichtung, die Lebensweise ganz unterschiedlicher Völker des schwarzafrikanischen<br />
Gebietes pauschal abgehandelt wird (S. 167):<br />
Die Neger Afrikas beschäftigen sich mit Viehzucht und Ackerbau und haben zum grossen Teil ihre Sitten und Gebräuche<br />
beibehalten. Die meisten Negervölker treiben Ahnen- und Totenverehrung und glauben an Zauberei. Sie sehen in Steinen,<br />
Lehmklumpen, Muscheln, Bäumen oder geschnitzten Holzfiguren ihre Geister (Fetische) und lassen sich durch Zauberer<br />
und Medizinmänner helfen und beraten. Die Fetische werden oft mit Menschenblut oder Öl bestrichen und mit Nägeln<br />
beschlagen, damit die Kräfte dieses Ölgötzen in der richtigen Art wirken.<br />
Die "Negervölker" treiben nicht nur einen Kult, der als Verehrung der Ahnen weltweit verbreitet ist, den Schü-<br />
lern wieder eher seltsam erscheinen muss, sie verehren auch Götzen, die sogar mit "Menschenblut... bestri-<br />
chen" würden. Welcher Quelle der Autor diese Aussage entnimmt, bleibt ebenso sein Geheimnis, wie welche<br />
Volksgruppe er damit beschreibt. Aufgrund der kulturellen Vielfalt Afrikas wäre eine solche Erscheinung<br />
durchaus denkbar, sicher aber nicht die Regel, da bei solchen Ritualen normalerweise ein Tier geopfert wird,<br />
wenn es sich nicht nur um ein symbolisches Opfer in Form einer Essensgabe handelt. Mit den folgenden<br />
Worten schliesst der Text (S. 167):<br />
Die Hamiten verbreiteten sich von Ägypten aus über ganz Nordafrika und übten einen grossen Einfluss aus. Zu ihnen<br />
gehören die Ägypter, Berber und Somalineger. Am Nordrande sind Araber und Semiten daheim. In den Küstenländern<br />
wohnen annähernd 5 Millionen Europäer.<br />
Dieser Einfluss der Hamiten wird in Bezug auf die altägyptische Kultur von Ki-Zerbo (siehe die Seite 26<br />
dieser Arbeit) kritisch betrachtet, denn hinter Äusserungen solcher Art steckt oft weniger geschichtlich<br />
fundiertes Wissen, sondern vielmehr der Glaube, die Völker Schwarzafrikas seien zu keinen eigenen Kulturlei-<br />
stungen fähig.<br />
Auf der gleichen Seite finden sich zwei nicht mit Legenden versehene Zeichnungen: die eine bildet eine<br />
Schwarzafrikanerin ab, die wohl Hirse mit dem typischen Holzpflock - der in weiten Teilen Afrikas verbreitet<br />
ist und auch heute noch häufig verwendet wird - zu Mehl verarbeitet; die andere stellt eine geschnitzte Skulp-<br />
tur dar, deren Ursprung in Westafrika liegen dürfte.<br />
Auf den Seite 168 findet sich ein kurzer Text über die Atlasländer. Auf den Seiten 168-169 wird die Sahara<br />
beschrieben und auf den Seiten 169 -171 folgt ein Text über Ägypten, in dem eine Erwähnung der Pyramiden<br />
nicht fehlen darf, sowie ein kurzer Abschnitt über den Suezkanal.<br />
4.11.2 Der Sudan<br />
Geographielehrmittel: Geographie (1963)<br />
Auf der Seite 172 findet sich nebst den Zeichnungen einer Erdnusspflanze und der afrikanischen Rundhäuser,<br />
mit "Negerhütten" untertitelt, ein Text über den Sudan, wobei der Landschaftsgürtel und nicht die gleichnami-<br />
ge Nation gemeint ist. Über die in diesem Gebiet lebenden Menschen gibt der Text Auskunft:<br />
Man bezeichnet damit die Landschaft zwischen Sahara und Urwald. Der Sudan reicht vom Atlantischen Ozean bis nach<br />
Abessinien und ist die Heimat der Sudanneger, die hier eine kümmerliche Landwirtschaft betreiben. Hirse und Erdnüsse<br />
sind die Hauptprodukte, doch werden auch Mais, Bohnen, Batate und Kürbisse gepflanzt. Die Negerhütte ist meistens aus<br />
Ruten geflochten und mit Lehm verstrichen. Stroh deckt das Dach. Die Türen sind so niedrig, dass man nur gebückt<br />
eintreten kann. Fenster hat es keine. Geflochtene Bänke oder Matten zum Schlafen sind die einzige Einrichtung. Krüge und<br />
Mahlsteine bilden mit den Kochtöpfen die Kücheneinrichtung. Eine Vorratshaltung kennt der Neger nicht. Täglich muss<br />
gedroschen und gemahlen werden. Ist der Boden erschöpft, so zieht man aus und sucht sich wieder einen günstigen Acker.<br />
Weiter nordwärts werden die buckligen Rinder als Haustiere gehalten. - Am obern Nil sind grössere Siedlungen zu treffen.<br />
Hier ist der Neger in Plantagen, insbesondere in Baumwollfeldern, beschäftigt.<br />
Der Autor zeichnet das Bild einer armen, in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung. Auch die Behausungen<br />
wirken laut der Beschreibung eher erbärmlich. Das bestimmte architektonische Eigenheiten der Hütten, wie<br />
etwa das Fehlen der Fenster, klimatische Gründe haben, und die Bewohner ein Grossteil der Zeit im Freien<br />
verbringen, darauf weist der Autor nicht weiter hin. Schlichtweg falsch ist der Satz "Eine Vorratshaltung kennt<br />
der Neger nicht.", wie sich nach kurzem Nachdenken über die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, wie etwa<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 131
Mais oder Hirse, unter dem Jahr leicht einsehen lässt. Die traditionellen Vorrichtungen zur Vorratshaltung sind<br />
unterschiedlich weit ausgebaut. Als besonderes <strong>Pro</strong>blem erweist sich das heisse Klima, das eine lange Lage-<br />
rung von z. B. gemahlenem Getreide verunmöglicht. (Siehe dazu auch die Seite "Vorratslagerung in Schwarz-<br />
afrika" im Anhang auf der Seite 599 dieser Arbeit.)<br />
4.11.3 Ostafrika<br />
Auf der Seite 173 findet sich neben einer Zeichnung von Bauern, die gemeinsam ein Feld mit der Hacke bear-<br />
beiten, ein Text über Ostafrika, der folgende Angaben über die heimische Bevölkerung beinhaltet:<br />
...Wie im Sudan treiben die Eingeborenen im Norden mehr Viehzucht, im Süden Hackbau. Sie pflanzen Hirse, Mais,<br />
Manjok (Tapioka), Yams (eine Kletterpflanze, deren Wurzeln gegessen werden), Batate, Erdnüsse und Bananen. Die<br />
Plantagen liefern Sisalhanf, Kautschuk, Baumwolle, Kopra und Kaffee. Der Sisalhanf wird aus den Blättern einer<br />
Agavenart gewonnen.<br />
Die erstgenannten Pflanzen dienen in erster Linie der Selbstversorgung, die man auch als Subsistenzwirtschaft<br />
bezeichnet. Die auf den Plantagen angebauten Arten dienen in erster Linie dem Export. Mittels Erhebung einer<br />
"Kopf"- oder "Hüttensteuer" wurden die Schwarzen Ostafrikas gezwungen, auf den Plantagen der Weissen zu<br />
arbeiten. All dies wird im Text nicht erwähnt, da sich der Autor auf ein blosses Aufzählen der angebauten<br />
Pflanzen beschränkt.<br />
4.11.4 Das Kongobecken und die Guineaküste<br />
Auf der Seite 174 folgt ein Text über "Das Kongobecken und die Guineaküste", der auch einige der häufigsten<br />
Krankheiten der Tropengebiete Afrikas aufzählt:<br />
Das Stromgebiet des Kongo und die Küste von Guinea werden Westafrika genannt. Es ist das eigentliche Urwaldgebiet<br />
Afrikas mit dem heissen und feuchten Klima, das für den Weissen unerträglich ist.<br />
Kurz sei hier bemerkt, dass das feuchtheisse Klima nicht nur dem nicht akklimatisierten Europäer Mühe berei-<br />
tet, sondern, vor allem auch einheimische Kinder unter diesem Klima leiden. Generell führt es nach kurzer<br />
Anstrengung, vor allem auch körperlicher Natur, zu raschen Erschöpfungserscheinungen und allgemeiner<br />
Müdigkeit.<br />
Weiter schreibt der Autor auf der Seite 174 "Malaria, Schlafkrankheit, Schwarzwasserfieber und Amöbenruhr"<br />
seien "die gefürchteten Tropenkrankheiten". Schwarzfieber ist eine Folge der Malaria, wahrscheinlich im<br />
Zusammenhang mit der Einnahme von Malariamitteln wie Chinin, bei der die zerstörten Blutkörperchen durch<br />
die Niere ausgeschieden werden. Dadurch färbt sich der Harn dunkel, woraus sich der Name der Krankheit<br />
ableitet. Dauert das Schwarzfieber längere Zeit an, kommt es, bedingt durch die Überbelastung, zu Nierenver-<br />
sagen. (Zur Malaria siehe auch die Seite 145 dieser Arbeit.) Über das Wirken der Europäer berichtet der Autor<br />
(S. 174):<br />
Der Europäer lebt an der Küste und sammelt und verschifft die <strong>Pro</strong>dukte aus dem Landinnern: Edelhölzer, Kautschuk,<br />
Kaffee, Kakao, Kopra und Kokosnüsse. Die zahlreichen Wasserläufe bilden die Verkehrswege. Von den Ufern tragen die<br />
Eingeborenen die Lasten auf dem Kopfe durch die schmalen Pfade des Urwaldes. In den durch Rodung entstandenen<br />
Lichtungen werden Bananen gepflanzt. Viehzucht ist hier unmöglich.<br />
Die Haltung von Vieh wird durch das Vorkommen der Tsetsefliege, der Überträgerin der weiter oben erwähn-<br />
ten Schlafkrankheit, verhindert. Weiter heisst es (S. 174):<br />
Geographielehrmittel: Geographie (1963)<br />
In einigen schwer zugänglichen Waldgebieten leben noch zerstreute Gruppen von Zwergvölkern die in Hütten mit<br />
Blätterdächern ein äusserst primitives Dasein fristen.<br />
In welcher Weise das Leben der "Zwergvölker" als "primitiv" angesehen werden muss, sieht man davon ab,<br />
dass sie unter einem Blätterdach ein "äusserst primitives Dasein fristen", dafür bleibt der Autor die Erklärung<br />
schuldig. Es sei bereits darauf hingewiesen, dass sich diese Art der Attribuierung der Pygmäen in weiteren<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 132
Lehrmitteln nachweisen lässt. (Siehe dazu auch die Besprechung von Bärs "Geographie der Kontinente", 1984,<br />
auf der Seite 341 dieser Arbeit).<br />
4.11.5 Südafrika<br />
Die länderkundliche Betrachtung afrikanischer Gebiete und Staaten endet mit einem weniger als eine Seite<br />
langen Text über Südafrika (S. 174-175), der nur wenig über die Bewohner dieser Region aussagt:<br />
...In den unwirtlichen Steppen und Wüsten leben die aus den Kulturgebieten vertriebenen Buschmänner und Hottentotten,<br />
Zwergvölker von äussert bescheidener Lebensart.<br />
Die Kulturgebiete Südafrikas sind von vielen Europäern bewohnt Von den rund 16 Millionen Einwohnern der<br />
Südafrikanischen Union sind 3 Millionen Weisse, vorwiegend Buren (Holländer) und Engländer.<br />
Was genau der Autor unter dem Begriff Kulturgebiet versteht, wird nicht näher erläutert. Nach seinem Text<br />
werden diese jedoch vor allem mit den Europäern assoziiert, während die "Buschmänner", "Hottentotten" und<br />
"Zwergvölker" sozusagen in die "Wüste" geschickt wurden. (Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten<br />
130 und 141 dieser Arbeit.) Die Bevölkerungsmehrheit im Gebiet der damaligen Südafrikanischen Union, die<br />
Bantu-Völker, wird nicht einmal erwähnt, sondern es bleibt den Lesern überlassen, diese aufgrund der im Text<br />
angegebenen Bevölkerungszahlen zu beziffern. Da verwundert es auch kaum, dass der Autor auf die anfangs<br />
der sechziger Jahre bereits praktizierte Apartheidspolitik nicht eingeht, obwohl das "afrikanische Jahr 1960",<br />
in dem viele afrikanische Staaten die Unabhängigkeit errangen, zum Zeitpunkt der Drucklegung erst drei Jahre<br />
zurücklag. An diesem Beispiel zeigt sich, wie die politische (und teilweise auch wirtschaftliche) Realität ein<br />
Geographielehrmittel und dessen Themenwahl überholen und veralten lassen kann, bevor es überhaupt in die<br />
Schulstube gelangt.<br />
4.11.6 Lesetexte<br />
Auf den Seiten 176 - 181 folgen drei Lesetexte übertitelt mit "Auf der Cheopspyramide", "Oasen" und "Im<br />
Urwald" (dieser Text wurde aus Harms Erdkunde, 1961 übernommen und gekürzt), die auf das Thema der<br />
Arbeit bezogen aber keinen weiteren Kenntnisgewinn mehr bedeuten.<br />
4.11.7 Zusammenfassung<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese "Geographie" nur wenige Aussagen über die Natur des schwarz-<br />
afrikanischen Menschen macht, über dessen Lebensweise die Leser kaum etwas Greifbares erfahren. Zudem<br />
vermittelt das Lehrmittel ein zweifelhaftes Bild, das nur als bewusste Manipulation oder grosses Unverständnis<br />
seitens der Autoren verstanden werden kann. Geben diese doch im Vorwort selbst an, ihre Beschreibungen<br />
unter anderem auch auf Harms zu stützen, der jedoch ein weit differenzierteres Bild bietet. (Siehe die Bespre-<br />
chung zu "Harms Erdkunde" 1961 auf der Seite 121 dieser Arbeit.) Zudem ist das Lehrmittel, was die politi-<br />
sche Gliederung Afrikas anbelangt, schon vor dem Erscheinen veraltet und lässt im Gegensatz auch zu einigen<br />
älteren Lehrmitteln, keinen Bewohner der vorgestellten Gebiete zu Wort kommen.<br />
Dem Eindruck, die Autoren hätten wenig Ahnung von der Materie - von einem Betretenhaben des schwarzafri-<br />
kanischen Teiles des Kontinents soll nicht einmal die Rede sein - und hätten im wesentlichen ältere Texte in<br />
recht glückloser Weise kopiert, ohne auf aktuelle Entwicklungen Bezug zu nehmen, kann sich der Text nicht<br />
verwehren.<br />
Geographielehrmittel: Geographie (1963)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 133
4.12 Weltatlas (1965)<br />
Der "Grosse Reader's Digest Weltatlas" von 1965 umfasst 217 Seiten, wobei 41 Seiten auf das Register entfal-<br />
len. Der afrikanische Kontinent wird mittels einer physischen Karte auf den drei Seiten 26-28 dargestellt.<br />
Dabei wird Guinea-Bisseau noch als "Portugiesisch Guinea", Burkina Faso als "Obervolta", Benin als "Daho-<br />
mey", Djibouti als "Franz.-Somaliküste", Äquatorialguinea als "Spanisch Guinea", die Demokratische Repu-<br />
blik Kongo als "Kongo", Simbabwe als "Rhodesien", Namibia als "Südwestafrika", Botswana als "Betschuana-<br />
land" und Lesotho als "Basutoland" bezeichnet. Auf den Seiten 76-80 gibt der Weltatlas politische Karten<br />
Afrikas im Massstab 1:12.5 Mio. wieder, auf denen neben topographischen Merkmalen auch die wichtigsten<br />
Verkehrsverbindungen eingezeichnet sind. Ausserdem macht der Atlas auf diesen Seiten Angaben zu Fläche,<br />
Bevölkerungszahl und Hauptstadt einzelner Länder.<br />
Auf weiteren Seiten tritt der afrikanische Kontinent im Zusammenhang mit "Schätzen der Erde - Minerale und<br />
Gesteine" auf den Seiten 114-115, "Formen der Landnutzung" auf den Seiten 122-123 - wobei nur in den<br />
Gebieten des Nils, des Nigerknies, entlang der Westküste und in Südafrika intensiver Anbau verzeichnet wird -<br />
in Erscheinung.<br />
Auf den Seiten 130-131 zur "Entwicklung des Menschen" steht Europa im Zentrum der Betrachtung, Afrika<br />
wird trotz vieler auf einer Karte verzeichneten Funde nur am Rande erwähnt. Über die negride Rasse heisst es<br />
im Weltatlas, Augen-, Haar- und Hautfarbe seien dunkelbraun bis schwarz, die Haare kraus, Bartwuchs und<br />
Körperbehaarung nur spärlich vorhanden, die Nase breit und flach und die Lippen dick und wulstig.<br />
Auf den Seiten 132-133 zu den "Grossen Kulturen" tritt Afrika nur im Zusammenhang mit Ägypten, welches<br />
dem "Nahen Osten" zugeordnet wird, in Erscheinung. Die Karte "Die Religionen der Menschheit" auf den<br />
Seiten 134-135 weist Nordafrika und Teile Ostafrikas als islamisch, Äthiopien, Südafrika, Malawi, Uganda<br />
und Teile Westafrikas als christlich aus. Die meisten Gebiete werden als zu "Stammesreligionen" zugehörig<br />
bezeichnet.<br />
Die Seiten 140-141 beschäftigen sich mit der "Bevölkerung der Erde", wobei das gesamte Afrika mit Ausnah-<br />
me der Wüstenländer als Gebiet "geringer" Bevölkerungsdichte mit "schnellem Wachstum" bezeichnet wird.<br />
Für das Jahr 2000 wird die Bevölkerungszahl Gesamtafrikas auf 517 Millionen geschätzt. (1996 betrug die<br />
Bevölkerung Afrikas bereits über 700 Mio. Menschen. Das Bevölkerungswachstum in den afrikanischen<br />
Ländern wurde damals also unterschätzt.)<br />
Die Karte "Was die Menschen essen" auf den Seiten 142-143 macht Angaben zur Ernährung in Ägypten,<br />
Rhodesien, Gambia, Nigeria und Südafrika. Mais, Hirsearten, Maniok und andere Knollengewächse, sowie<br />
Reis werden als wichtigste Grundnahrungsmittel Schwarzafrikas angegeben. Die Seiten 144-145 zur "Weltge-<br />
sundheit" bezeichnen die meisten Gebiete Schwarzafrikas, darunter auch die Republik Südafrika, als Gebiet, in<br />
dem Unterernährung ziemlich häufig bis weitverbreitet ist. Ausserdem wird fast ganz Afrika als Malariagebiet<br />
ausgewiesen.<br />
Neben der Tatsache, dass die Weltkarten die tatsächlichen Flächenverhältnisse der einzelnen Kontinente gut<br />
wiedergeben, fällt auf, dass die meisten Angaben auch für Afrika relativ differenziert ausfallen, nur auf kultu-<br />
rellem Gebiet bleibt die Vorstellung von "Dunklen Kontinent" bestehen.<br />
Geographielehrmittel: Weltatlas (1965)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 134
4.13 Geographie (Widrig, 1967)<br />
Es scheint, dass auch die Menschenfresserei, der Kannibalismus, mit Religion und Aberglauben zusammenhängt. Indem<br />
Sklaven, gefangene Feinde und Hexer getötet und den Geistern als Opfer dargebracht wurden, gelangten deren Teile auch<br />
in die Bratpfanne oder an den Spiess, wobei es nurmehr ein kleiner Schritt war, die Getöteten nach bestimmten<br />
Vorschriften zu verzehren. Die Menschenfresserei und die ständigen Kriege haben zur ungewöhnlichen Entvölkerung<br />
weiter Gebiete Afrikas wesentlich beigetragen. (S. 303)<br />
Das 1967 in der 7. Auflage beim Logos Verlag in Zürich erschienene Buch "Geographie" von A. Widrig ist<br />
laut dem Vorwort aus der 6. Auflage "für Lehrer geschrieben; doch können es reifere Schüler auch als Hand-<br />
buch benutzen". Es will "den Geographieunterricht mehr nach der Tiefe als nach der Breite... gestalten" und<br />
soll "die Kenntnisse über die nahen und fernen Länder unserer schönen Erde auf freudige Art... mehren!"<br />
(Widrig, 1963/64, S. 7). Afrika wird auf 95 (S. 295-389) der insgesamt 776 Seiten behandelt.<br />
Auch bei diesem Werk ist es aufgrund des umfangreichen Textmaterials nicht möglich, den Inhalt immer im<br />
Detail zu besprechen, deshalb soll hier eine Beschränkung auf die auffallendsten Stellen, Stärken und Schwä-<br />
chen die Regel sein.<br />
4.13.1 Geschichte<br />
In der allgemeinen Einleitung auf den Seiten 295-328 heisst es zur Lage Afrikas unter dem Titel "Afrika, der<br />
dunkle Erdteil" (S. 297):<br />
Man glaubt, dass Afrika schon vor unserer Zeitrechnung mit Schiffen umfahren wurde. So heisst es, dass im Auftrag des<br />
ägyptischen Königs Necho (610-595) phönizische Schiffe vom Arabischen Meerbusen ausfuhren und im dritten Jahr durch<br />
die Säulen des Herkules, also von Gibraltar her, wieder zurückkehrten. Sicher weiss man, dass zur Zeit der Entdeckungen<br />
(1487) der Portugiese Bartolomeo Diaz das Kap der Guten Hoffnung und sein Landsmann Vasco da Gama (1498) den<br />
Seeweg nach Indien fanden. Die Ergebnisse dieser Seefahrten hinterliessen aber in Europa keinen bleibenden Eindruck.<br />
Man beschränkte sich in der Folge auf Küstenfahrten nördlich des Äquators, holte sich dort massenweise schwarze Sklaven<br />
und wendete sich dem näher gelegenen Amerika zu.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 130 und 136 dieser Arbeit.) Im gleichen Kapitel spricht der Autor<br />
von der ungünstigen Lage Afrikas, die er einerseits auf die Form des Kontinents, andererseits - und hier verrät<br />
sich bereits seine stark eurozentrische Haltung - dadurch zu untermauern versucht, dass er die Entfernungen<br />
afrikanischer Städte und Häfen mit derer amerikanischer Orte zu Europa vergleicht. (Siehe dazu auch die<br />
Seite 215 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Die Idee, den Zivilisationsstand von Völkern auf geographische Merkmale der Kontinente zurückzuführen<br />
geht nach Nicolaas Rupkes Aufsatz "Paradise and the Notion of a World Centre" auf den Geographen Carl<br />
Ritter zurück, der vom Gedanken fasziniert war, Europa läge im Zentrum der anderen Kontinente. Sein Schü-<br />
ler Arnold Guyot verglich in seinem Geographiebuch "Earth and Man" von 1859, die Küstenlänge der Konti-<br />
nente - eine allgemeingültige Längenmessung von Küsten ist wegen deren fraktalen Eigenschaften nicht<br />
möglich, da das Ergebnis von der Grössenordnung des gewählten Massstabes abhängig ist - mit deren Fläche.<br />
Aus der vielgestaltigeren Küstenlinie der nördlichen Kontinente schloss er, diese seien für die Entwicklung der<br />
Menschheit besser geeignet als die südlichen Kontinente, die über weniger ausgeprägte Einbuchtungen in der<br />
Landmasse verfügen. Aufgrund dieser Tatsachen nahm er an, dass die "privilegierten Rassen" der nördlichen<br />
Landmassen nicht nur das Recht, sondern die Pflicht hätten, die südlicheren Rassen zu erziehen: "To impart to<br />
other nations the advantages constituting their own glory, is the only way of legitimating the possession of<br />
them. We owe to the inferior races the blessings and comforts of civilization." (Schmutz Hrsg., 1996, S. 82-85)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 135
Über die Schwarzafrikaner sagt Widrig nur in einem Nebensatz aus, sie seien "massenweise" als Sklaven nach<br />
Übersee verschifft worden, d.h. schon bei ihrem ersten Auftreten im Text werden sie, ohne ausdrücklich<br />
genannt zu werden, in eine passive Opferrolle gedrängt.<br />
Auf Seite 298 setzt Widrig seine Überlegungen fort und kommt "auf die Lage im Gradnetz und deren Folgen<br />
für die Erschliessung" zu sprechen, wobei er natürlich wieder die Erschliessung durch die Europäer meint. Auf<br />
der Seite 299 hält er unter dem Titel "Afrika in der Bewertung des letzten Jahrhunderts" Rückblick auf die<br />
Kolonialgeschichte:<br />
Noch zu Anfang der neunziger Jahre erklärte der deutsche Reichskanzler Caprivi, es könnte ihm kein grösseres Unglück<br />
geschehen, als wenn ihm ganz Afrika angeboten würde. Die damaligen Afrikakarten erstreckten sich über dessen<br />
Küstengebiete. Das Innere des Erdteils wurde mit allerlei Bildern von wilden Tieren ausgefüllt, die sich meist auf<br />
abenteuerliche Reiseschilderungen stützten und dem Beschauer fast das Gruseln beibrachten. Es musste als Fortschritt<br />
bezeichnet werden, als diese Ländereien als weisser Fleck mit der nüchternen Anschrift "Unerforschtes Gebiet"<br />
eingezeichnet wurden. - Berühmte Afrikaforscher wie der Missionar David Livingstone, Stanley und andere bereisten unter<br />
grössten Entbehrungen das Landinnere und brachten zuverlässige Kunde über Land und Volk nach Europa. Aber auch auf<br />
englischer Seite fand man zunächst wenig Verständnis für das heisse Afrika. Es war gerade gut genug, den Europäern und<br />
Arabern in einem abscheulichen Sklavenhandel das "Schwarze Elfenbein" zu liefern, was man selbst in englischen<br />
Regierungskreisen als einen "der Nation so wohltätigen Handel" pries. Als den Sklavenjagden und der Ausfuhr der<br />
afrikanischen Menschen von der Westküste nach Amerika ein Ende gesetzt wurde, schien das tropische Afrika wertlos<br />
geworden zu sein. "Im Jahre 1865 beantragte ein königlicher Ausschuss in London, die westafrikanischen britischen<br />
Stützpunkte, die man zur Bekämpfung des Sklavenhandels errichtet hatte, so bald als möglich aufzugeben. Und der<br />
englische Premierminister Salisbury fand, man möge ruhig den 'gallischen Hahn im Sande scharren lassen', also die<br />
afrikanischen Wüsten den Franzosen überlassen."<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 135 und 142 dieser Arbeit.)<br />
Als aber Frankreich nach seiner Niederlage im Jahre 1870 sein Augenmerk doch auf den heissen Erdteil richtete und in<br />
dessen westlichem Teil ein ganzes Kolonialreich aufzubauen begann, brach der Streit um die "Aufteilung"; des<br />
missachteten Afrika los. Es wurden Schutzverträge mit den Eingeborenen abgeschlossen, die ihre Rechte um Spottpreise<br />
verschacherten, ohne dass sie es selber merkten. Zuweilen erachtete man es überhaupt als überflüssig, mit den Schwarzen<br />
Verträge abzuschliessen. Die europäischen Regierungen einigten sich direkt untereinander und wiesen sich gegenseitig<br />
ihre "Einflussgebiete" zu. Um die Jahrhundertwende war Afrika in der Hauptsache "verteilt", und nur Abessinien und<br />
Liberia blieben selbständig, während die Südafrikanische Union (Südafrikanische Republik) eine eigene Verwaltung<br />
erhielt und britisches Dominion wurde.<br />
Ausser der Bemerkung, dass hier eine Geschichtsschreibung ganz aus europäischer Sicht betrieben wird, sei<br />
auf den zweiten Teil dieser Arbeit, den "Überblick über die Geschichte Afrikas", zu den Afrikaforschern<br />
Livingstone und Stanley und deren Werk auf die einschlägige Literatur verwiesen, sowie im Falle Stanleys auf<br />
die in der Besprechung von "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder (1953)" zitierte Bemerkungen<br />
des Häuptlings der Basoko auf der Seite 114 dieser Arbeit.<br />
4.13.2 Die "Negerstämme und ihre Kultur"<br />
Auf der Seite 300 im Abschnitt "Die Rasse" unter dem Titel "Die Negerstämme" beschreibt Widrig Gestalt<br />
und Wuchs der schwarze Rasse mit den folgenden Worten:<br />
Afrika ist die Heimat der Negerrasse. Die Neger sind von kräftigem Wuchs. Sie besiedeln Mittelafrika und die südliche<br />
Hälfte des Erdteils. Das auffallendste Rassenmerkmal des Negers ist die dunkle Hautfarbe. Die Haare sind kraus und<br />
spiralförmig zu Knäuelchen gewunden, zwischen denen die Kopfhaut sichtbar wird. Die Lippen sind gross und wulstig.<br />
Die Nase ist rundkuppig mit breiten Nasenflügeln.<br />
Er unterstützt seine Beschreibung mit der Wiedergabe einer Zeichnung - auf Fotos verzichtet er aus didakti-<br />
schen Gründen bewusst - einer "Ubugwe-Frau, Ostafrika" (siehe die Abbildung weiter unten links), die, im<br />
Gegensatz zu Fotos aus anderen Publikationen (siehe die Abbildung weiter unten rechts, aus dem zürcheri-<br />
schen Lehrmittel "Geographie" von 1953, S. 115), die oftmals mittels harter Schatten und unvorteilhafter<br />
Körperhaltung einen möglichst rohen Eindruck des Schwarzafrikaners zu vermitteln versuchen, einen vorteil-<br />
hafteren Eindruck der abgebildeten Person vermittelt.<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 136
In einem zweiten Abschnitt mit dem Titel "Sprache, Musik und Tanz" schreibt Widrig über den Sprachen-<br />
reichtum Afrikas (S. 301):<br />
Nach ihrer Sprache unterscheidet man Sudan- und Bantuneger. Sprachkundige Forscher glauben festgestellt zu haben, dass<br />
innerhalb der Bantu-Sprachgruppe 182 Sprachen und 119 Mundarten, in der Gruppe der Sudansprachen 264 Sprachen mit<br />
114 Mundarten unterschieden werden können... Oft soll die Sprache nach wenigen Dörfern wieder wechseln...<br />
Die Sprachen- und Kulturvielfalt des afrikanischen Kontinents mag dazu beigetragen haben, dass heute in<br />
vielen afrikanischen Länder die Sprache der ehemaligen Kolonialmächte als offizielle Umgangssprache<br />
verwendet wird. (Siehe dazu die Karte "Offizielle Amtssprachen" im Anhang auf Seite 572 dieser Arbeit.)<br />
Widrig dürfte mit seinen Zahlenangaben eher am unteren Ende der Schätzungen rangieren, die bis zu über<br />
1000 verschiedenen Sprachen nennen. Oft wird in der Literatur auch der Begriff "Dialekt" benutzt, der aber<br />
wenig aussagekräftig ist, da die Sprachferne eines Dialektes zu einem anderen sehr unterschiedlich ausfallen<br />
kann. Gewisse Dialekte unterscheiden sich kaum mehr als dies für verschiedene deutschschweizerischen<br />
Mundarten der Fall ist, andere weisen einen ähnlichen Verwandtheitsgrad auf wie etwa Italienisch und<br />
Englisch.<br />
Auf Seite 301 führt Widrig einige Sprachbeispiele und "afrikanische Sinnsprüche" an bevor er zum Fazit<br />
kommt: "Es hat sich gezeigt, dass der Neger erstaunlich leicht fremde Sprachen lernt." Falls er damit andeuten<br />
sollte, Schwarzafrikaner würden wesentlich schneller eine neue Sprache erlernen, als dies beispielsweise bei<br />
Europäern der Fall ist, handelt es sich sicherlich um eine Übertreibung. Andererseits ist es eine Tatsache, dass<br />
viele Schwarzafrikaner drei, vier oder mehr Sprachen beherrschen, was den Europäern aber nur aufgrund der<br />
eigenen "Sprachenarmut" als seltsam erscheinen mag.<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Ebenfalls auf Seite 301 geht Widrig auf eine weitere Besonderheit afrikanischer Kommunikation ein:<br />
Eine besondere afrikanische Verständigungsform ist die Trommelsprache. Sie ersetzt in weiten Gebieten Innerafrikas<br />
Telegraph und Telephon. Diese Erfindung erlaubt es den Eingeborenen, sich auf Entfernungen von mehreren Kilometern<br />
zu unterhalten. Die Trommeln bestehen aus ausgehöhlten Baumstämmen, die mit Fellen überzogen sind.<br />
(Zur Trommelsprache siehe auch die Seite 155 dieser Arbeit.) Diese Art der Informationsübermittlung wurde<br />
beispielsweise noch in den letzten Jahren in Togo mit Erfolg gebraucht. Allerdings dürfte sie heute nur noch<br />
von einer Minderheit der afrikanischen Bevölkerung verstanden oder gar benutzt werden.<br />
Die Trommel als Überleitung benutzend kommt Widrig auch auf die afrikanische Musik zu sprechen (S. 301f.)<br />
Die Trommel ist auch das Hauptinstrument der Musik für den Tanz... Stundenlang schwingen Tänzer und Tänzerinnen in<br />
brütender Sonnenhitze in einem meisterhaften Rhythmus Arme und Beine. Tanz und Musik bilden eine untrennbare<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 137
Einheit. Meist sind die Tänzer abenteuerlich aufgeputzt. Dabei zeigt sich ein eigenartiges Schönheitsempfinden. Oft wird<br />
der Körper auch auf Lebzeiten durch allerlei Verunstaltungen, Narben und durch Tätowieren "verschönert".<br />
Durch die Verbreitung der elektronischen Medien wurde das eigene Musikschaffen in vielen Gegenden Afrikas<br />
verdrängt. Besonders die jüngere Generation in den Städten ist mit der Discomusik, sei sie amerikanischen,<br />
europäischen oder auch afrikanischen Ursprungs, vertrauter als mit der traditionellen Musik. Diese wird vor<br />
allem bei festlichen Anlässen wie Hochzeiten, Beerdigungen, Erntedankfesten oder anderen traditionellen<br />
Feiern, in einigen Ländern auch als Fach im Stundenplan der Volksschule gepflegt. Es ist ein Irrtum anzuneh-<br />
men, Afrikaner seien in Sachen Tanz und Rhythmus von Natur aus begabt. Das Können vieler Schwarzafrika-<br />
ner auf diesem Gebiet ist vielmehr auf Erfahrungen, die schon im frühesten Kindesalter gemacht werden,<br />
zurückzuführen. So etwa, wenn Eltern ihr zweijähriges Kind dafür loben, dass es sich im Takt zu einer gerade<br />
gespielten Musik bewegt.<br />
Zu den weiteren Bemerkungen Widrigs stellt sich die Frage, was er wohl bei einem Besuch einer Technoparty<br />
sagen würde, wo die "Tänzer abenteuerlich aufgeputzt" in einem "meisterhaften Rhythmus Arme und Beine"<br />
schwingen. Wahrscheinlich würden ihm unter den Tanzenden auch einige auffallen, die ihr Aussehen durch<br />
Piercing und dergleichen "verschönert" haben.<br />
4.13.3 Die Religion<br />
Im dritten Abschnitt seiner Ausführungen über "Die Negerstämme" schreibt Widrig auf den Seiten 302 und<br />
303 über die Religion dieser Menschen:<br />
Es ist wahrscheinlich, dass ursprünglich der Glaube an ein höchstes göttliches Wesen die Grundlage für die Religion des<br />
Negers war. Heute stehen der Ahnenkult, der Geisterglaube und der Fetischdienst im Vordergrund. Die Neger glauben an<br />
ein Weiterleben nach dem Tode. Sie glauben, dass ihnen die Toten Gutes oder Böses bringen können. Deshalb ist bei jeder<br />
Gelegenheit auf die Seelen der Verstorbenen Rücksicht zu nehmen. Man hat ihnen Opfer und Gaben darzubringen. Dieser<br />
Ahnenkult ist ein wesentlicher Bestandteil der Religion der afrikanischen Naturvölker.<br />
Widrig geht hier eindeutig davon aus, dass seine eigene Religion, nämlich das Christentum, die einzig wahre<br />
sei, von der die Schwarzafrikaner im Verlaufe der Geschichte irgendwie abgefallen wären. - Eine Vorstellung,<br />
sie sich schon bei den ersten Missionaren auf dem afrikanischen Kontinent fand, wie Bitterli schreibt: "Wäh-<br />
rend sich der Christenmensch nach dem Sündenfall mühsam zur wahren Gotteserkenntnis emporgearbeitet<br />
hatte, war nun freilich der Un- oder Irrgläubige, aus Gründen, welche sich die theologischen Theoretiker sehr<br />
verschieden erklärten, immer mehr von Gott abgefallen; seine Gottesverehrung hatte sich zum Götzendienst<br />
pervertiert, das Bemühen um Reinheit der Sitten war dem Hang zur Ausschweifung aller Art gewichen. Doch<br />
die guten Seelenkräfte lebten auch im Heiden fort; da sie aber zu wenig entwickelt waren, als dass dieser den<br />
Weg zu Gott allein hätte finden können, ergab sich für den Christenmenschen die moralische Aufgabe, dem<br />
Heiden zu helfen. Neben die lebensrechtliche Verpflichtung zur äusseren Mission trat also, wenn man will,<br />
eine christlich-humane Verpflichtung, die vom Grundgedanken eines einzigen Schöpfergottes und von der<br />
Einheit des Menschengeschlechtes ausging." (Bitterli 1977, S. 108) - Nur so kann er zum Schluss kommen,<br />
dass die "Neger" ursprünglich monotheistisch veranlagt waren. Das diese Annahme höchst zweifelhaft ist,<br />
zeigt nicht nur ein Blick auf die noch heute existierenden Glaubenssysteme in aller Welt, sondern auch eine<br />
Betrachtung alter Glaubenssysteme, wie sie z. B. bei den Indianern Nordamerikas, den Schamanen Sibiriens,<br />
oder den Hindus Indiens oder imvorchristliche Europa verbreitet waren.<br />
Die weiteren Ausführungen Widrigs beschreiben den Umgang schwarzafrikanischer Menschen mit dem Zufall<br />
und Unglücksfällen:<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
...Scheidet jemand durch Krankheit oder Unglücksfall, durch den Zahn wilder Tiere oder durch Feindeshand aus dem<br />
Leben, ist der Neger überzeugt, dass der Tod nur durch den Willen eines Geistes oder eines Zauberers verursacht worden<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 138
ist. Die unmittelbaren Todesursachen erscheinen ihm nur als das Mittel, dessen sich der Geist bediente. Also nicht das<br />
Krokodil, das seinen Bruder verschlang, ist der Schuldige, sondern ein Geist im Innern des Tieres. Es kann aber auch ein<br />
Hexer unter den Menschen gewesen sein. In diesem Fall muss der vermutliche Missetäter durch eine Giftprobe oder ein<br />
sonstiges grausames Mittel ausfindig und unschädlich gemacht werden. So sind Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg<br />
deutliche Anzeichen dafür, dass Geister in das Leben eingegriffen haben. Man fürchtet sich vor ihnen, besonders in der<br />
Nacht...<br />
Ein Blick zurück in die Geschichte Europas zeigt, dass ähnliche Vorstellung auch nach der Aufklärung den<br />
Europäern gar nicht so fremd waren, man denke nur an die in ganz Europa durchgeführten "Hexenverbrennun-<br />
gen" oder die von katholischen Priestern in einigen Gegenden Europas bis heute praktizierten "Teufelsaustrei-<br />
bungen". Zu solchen Eskalationen scheint es, nach dem aktuellen Wissensstand, in Afrika nie gekommen zu<br />
sein.<br />
Den traditionellen Glaubensvorstellung treten heute die Glaubenssysteme einer zunehmend christianisierten<br />
oder islamisierten Gesellschaft entgegen, obwohl auch unter den Anhängern dieser neueren Religionen die<br />
alten Überlieferungen durchaus noch Bestand haben.<br />
Über den in der Literatur immer wieder beschriebenen Fetischdienst der Afrikaner lässt sich Widrig folgender-<br />
massen verlauten:<br />
Es können aber auch irgend ein gewöhnlicher Gegenstand, ein Stein, ein Lehmklumpen, eine Muschel, ein Baum oder eine<br />
geschnitzte Holzfigur von den Geistern zum Aufenthaltsort gewählt werden. Man nennt einen solchen Gegenstand einen<br />
Fetisch, dessen Bedienung Fetischdienst.<br />
Der Glaube an diese Geister, besser würde man sie als Hausgötter bezeichnen, wie dies beispielsweise in<br />
China der Fall ist, wurde von den Europäern oft missverstanden. Sie vermeinten in der "Anbetung der Gegen-<br />
stände" einen Götzendienst zu erkennen. Dabei betet der Gläubige keinesfalls den Gegenstand an, sondern die<br />
spirituelle Macht, die sich diesen Gegenstand oder Lebewesen als "Wohnsitz" auserkoren hat. Ebensogut<br />
könnte behauptet werden, ein gläubiger Christ verehre ein Stück Holz, wenn er sich vor dem Kreuz niederkniet<br />
und betet.<br />
Widrig fährt in seinen Schilderungen fort, wobei zu sagen ist, dass seine Behauptung bezüglich Menschenblut<br />
mit anderen Quellen nicht verifiziert werden konnte (ausser im Lehrmittel "Geographie von 1963, S. 167,<br />
welches sich aber auf eine frühere Ausgabe von Widrig bezieht) und eher an eine immer wieder praktizierte<br />
Diffamierung Andersgläubiger erinnert (siehe weiter unten).<br />
Die Fetische werden durch Zauberdoktoren, die Medizinmänner, ins Leben gerufen. Diese Leute fabrizieren irgend ein<br />
Zaubermittel, das sie ins Innere der Holzgötzen bringen, ohne welches der Fetisch keine Zauberkraft ausstrahlen würde. Er<br />
soll Wohltaten erweisen und Missetäter anzeigen. Die Medizinmänner bestimmen, welche Opfer und Gaben ihm<br />
dargebracht werden müssen. Zuweilen sind die Fetische mit Menschenblut oder Ö1 zu bestreichen. Damit ein solcher<br />
Ölgötze weiss, in welcher Richtung er seine Kraft wirken lassen soll, werden Nägel darein geschlagen. Er gleicht dann<br />
"einer unförmigen Puppe mit roh geschnitztem Gesicht, so voller Nägel, dass er aussieht wie ein Stachelschwein". Die<br />
Medizinmänner spielen oft eine unheilvolle Rolle, indem sie unschuldige Menschen irgend eines Verbrechens schuldig<br />
erklären und sie einem qualvollen Tode ausliefern.<br />
Diese Art des "Voodos", aus den Filmen Hollywoods über Haiti unterdessen einer breiten Öffentlichkeit<br />
bekannt, trifft, sofern sie tatsächlich in dieser Form praktiziert wurde, sicherlich nur für einen Teil der Bevöl-<br />
kerung Afrikas, der seltsamerweise nie näher präzisiert wird, zu.<br />
Widrig schliesst mit einem Abschnitt auf Seite 303, der jeglicher gesunden Argumentation entbehrt, selbst<br />
wenn seine Vorwürfe betreffend der Menschenfresserei punktuell zutreffen sollten (sie konnten mittels anderer<br />
Quellen nicht eindeutig belegt werden, obwohl solche Anschuldigungen auch in weiteren Lehrmitteln<br />
auftreten):<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Es scheint, dass auch die Menschenfresserei, der Kannibalismus, mit Religion und Aberglauben zusammenhängt. Indem<br />
Sklaven, gefangene Feinde und Hexer getötet und den Geistern als Opfer dargebracht wurden, gelangten deren Teile auch<br />
in die Bratpfanne oder an den Spiess, wobei es nurmehr ein kleiner Schritt war, die Getöteten nach bestimmten<br />
Vorschriften zu verzehren. Die Menschenfresserei und die ständigen Kriege haben zur ungewöhnlichen Entvölkerung<br />
weiter Gebiete Afrikas wesentlich beigetragen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 139
Um den wahrscheinlichen Wahrheitsgehalt solcher Aussagen ins rechte Licht zu rücken, sei angemerkt, dass<br />
viele Chinesen noch in den fünfziger Jahren der Überzeugung waren, Christen würden in ihren Gottesdiensten<br />
kleine Kinder verzerren. (Zum Vorwurf des Kannibalismus siehe auch die Seite 196 dieser Arbeit.)<br />
Was nun Widrigs letzten Satz zum Kapitel Religion angeht, die "Menschenfresserei und die ständigen Kriege"<br />
hätten zur ungewöhnlichen Entvölkerung weiter Gebiete Afrikas wesentlich beigetragen" so kann dies wohl<br />
nur als eine bewusste Lüge betrachtet werden, die einerseits den Afrikaner als "Unmensch" darzustellen, ande-<br />
rerseits die düstere Vergangenheit der Europäer im "Sklavenhandel" zu vertuschen versucht. Denn weder Krie-<br />
ge noch allfällige antrophage Praktiken haben ausschliesslich zu einem Bevölkerungsrückgang beigetragen,<br />
der wesentlich mitbestimmt wurde durch den über Jahrhunderte von den Europäern und Arabern praktizierte<br />
Menschenraub und die dadurch ausgelösten sozialen Umstrukturierungen. In der Kolonialzeit trugen dann<br />
Zwangsarbeit und eingeschleppte Krankheiten mit dazu bei, das Bevölkerungswachstum entscheidend zu<br />
hemmen.<br />
4.13.4 Die Wirtschaft<br />
Auch im nächsten Abschnitt über die "Afrikanische Wirtschaftsform" erlaubt sich Widrig nebst durchaus sach-<br />
lichen Darstellungen von Sachverhalten einige Ausrutscher:<br />
Wie jedes Volk, besitzen auch die afrikanischen Naturvölker ihre Kultur. Aber diese ist anders geartet als die der<br />
europäischen Kulturvölker. Entwicklung und Entfaltung der Kultur hängen nicht vom Menschen allein ab. Mittelbar übt<br />
auch das Klima einen Einfluss aus, indem es zum Beispiel Krankheiten begünstigen oder durch die Hitze jede menschliche<br />
Tätigkeit lähmen kann. Das feuchtheisse Afrika als Beherbergerin der Tsetsefliege macht die Viehzucht unmöglich. Daher<br />
fehlt es auch an Zugtieren, und der Neger muss seinen Acker notgedrungen mit der Hacke bestellen. Das Fehlen des<br />
Pfluges ist also nicht einem Mangel an Erfindungskraft des Negers zuzuschreiben. Die einzelnen Stämme, die als<br />
Hirtenvölker und Viehzüchter leben, sind an die trockenen Steppengebiete gebunden. Der afrikanische Hackbau erstreckt<br />
sich vorwiegend auf den Anbau von Jams und Bataten, Negerhirse, Bananen und Erdnüssen. Jams und Batate sind<br />
Pflanzen mit knolligen Wurzelgewächsen, die in ihrem Geschmack an süssliche Kartoffeln erinnern. Nach wenigen Jahren,<br />
wenn der Boden ausgenützt ist, müssen neue Felder aufgesucht werden, denn Dünger ist keiner vorhanden. Jedermann<br />
pflanzt nur soviel, wie er für seinen Lebensunterhalt benötigt. Das ist auch wieder in der Eigenart des Landes begründet.<br />
Die gleichartigen, weiten Räume, die immer wieder die gleichen <strong>Pro</strong>dukte liefern, bieten keine Tauschmöglichkeiten.<br />
Deshalb sind Handel und Verkehr gehemmt.<br />
Der Text enthält mehrere unpräzise oder falsche Informationen. So trifft die Bemerkung über die Viehzucht<br />
nur für Teile des afrikanischen Gebietes zu. In Westafrika ist z. B. die Viehzucht bereits auf ca. 10° nördlicher<br />
Breite möglich. Aus diesem Grund sind auch Widrigs Schlussfolgerungen zum Hackbau falsch. Vielmehr liegt<br />
die Bevorzugung der Hackbau-Kultur, die sich bis heute in den tropischen Gebieten Afrikas gehalten hat, in<br />
der Ausschwemmungsgefahr für den Boden, die durch ein Umpflügen wesentlich erhöht würde. (Zum<br />
Wanderhackbau siehe auch die Seite 153 dieser Arbeit.)<br />
Bei der Aufzählung der angebauten Nutzpflanzen vergisst Widrig, den Maniok (auch Kassawa) genannt zu<br />
erwähnen, der schon früh aus Südamerika eingeführt wurde und sich anschliessend über weite Teile der<br />
Tropen Afrikas verbreitete.<br />
Widrigs Bemerkungen zum Tauschhandel sind kausal ebenfalls falsch begründet. Der mangelnde Austausch<br />
von Waren dürfte eher auf die Unterdrückung des Binnenhandels durch die Kolonialmächte zurückzuführen<br />
sein, da dieser nicht ihren Interessen entsprach, denn vor den Auftreten der Europäer verfügte zumindest das<br />
nördliche Afrika und die Ostküste über weitläufige Handelsnetze. (Siehe dazu die Karte "Handelsstrecken im<br />
Mittelalter" auf der Seite 30 dieser Arbeit.)<br />
Widrig lässt sich zu weiteren Behauptungen verleiten, die nicht nur unhaltbar, sondern für einen Afrikaner<br />
auch beleidigend wirken müssen (S. 304):<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 140
Der Neger lernte nicht, für seine Zukunft zu sorgen. Weitsichtiger Scharfblick und Ausdauer sind seinem Wesen fremd. Er<br />
ist ein Kind des Augenblicks. Dabei ist er aber in den Plantagen unter der heissen Tropensonne immer noch der<br />
leistungsfähigste Arbeiter.<br />
An dieser Stelle sei auf den in der Einleitung zu "Das von der Schule ermittelte Bild" auf der Seite 61 dieser<br />
Arbeit erhobenen Vorwurf, die Afrikaner seien "Arbeitstiere..., die sich stundenlang in der Sonne abrackern"<br />
könnten, verwiesen.<br />
Als Gegenbeispiel sei der Wanderfeldbau der Bantus in den tropischen Regenwäldern angeführt, der eine<br />
Planung auf zwanzig oder mehr Jahre hinaus bedarf. Allgemein lässt sich sagen, die Berichte der Europäer aus<br />
der Kolonialzeit müssen mit Vorsicht genossen werden, da sie gerade den Menschen, deren Kultur sie teilwei-<br />
se zerstört haben Kulturlosigkeit zum Vorwurf machen.<br />
Ein weiteres besonders faszinierendes Beispiel liefert das Volk der Dogon, die das Interesse der Anthropolo-<br />
gen durch ihr Wissen über den Lauf der Sterne auf sich zogen, und deren rituelle Feierlichkeiten bis zu mehre-<br />
re Jahrzehnte im voraus festgesetzt werden.<br />
Widrig schliesst seine Überlegungen zu der Wirtschaftsformen mit den folgenden Worten ab (S. 304):<br />
Mit ihren einfachen Werkzeugen haben die Neger in der Töpferei, der Flechterei, Schnitzerei, Weberei und Färberei, in der<br />
Eisengewinnung und Messinggiesserei Bewundernswertes geleistet. Es ist unrichtig, den Neger für höhere Kulturarbeit<br />
unfähig zu halten. Doch kann er, nach jahrhundertelangem Stillstand in der geistigen Entwicklung, nicht von heute auf<br />
morgen zu einem Träger europäischer Kultur gemacht werden. Reisst man ihn unvermittelt aus seiner afrikanischen<br />
Lebensgemeinschaft heraus und steckt ihn in europäische Kleidung, dann ist er erst ein Nachahmer einer für ihn fremden<br />
Art. Er ist stolz auf seine neue Würde, aber es fehlt ihm die Reife abendländischer Kultur.<br />
Widrig weist auf die Handwerksarbeit und die Kunstgegenstände hin und würdigt diese. Gleichzeitig macht er<br />
den Lesern klar, dass es dem Afrikaner im Vergleich zum Europäer an "Reife" fehle, was nur durch die euro-<br />
zentrische Haltung des Autors begründbar ist. Richtig weist er auf die Schwierigkeit hin, die der Wechsel von<br />
einer Kultur zur anderen mit sich bringt. Besonders in den Städten Afrikas, müssen sich viele Menschen heute<br />
die Frage nach dem eigenen Standpunkt zwischen "traditioneller Lebensweise" und Anpassung an die "Techni-<br />
sierung" der europäischen, amerikanischen Kultur stellen. Dabei gelingt es nicht allen, die positiven Seiten<br />
beider Strömungen zu vereinen.<br />
4.13.5 "Pygmäen", "Buschmänner" und "Hottentotten"<br />
Nach der Betrachtung der Wirtschaftsformen wendet sich Widrig auf den Seiten 304-305 den "Restvölkern"<br />
Afrikas zu, gemeint sind damit die "Pygmäen", "Hottentotten" und "Buschmänner". Über sie weiss er folgen-<br />
des zu berichten:<br />
Die Buschmänner, Hottentotten und die Zwergvölker oder Pygmäen des Kongogebietes sind hellfarbig und gelten als die<br />
Überreste einer afrikanischen Urbevölkerung. Sie unterscheiden sich in Körperbau und Sprache vollständig von den<br />
kräftigen Negerstämmen, von denen sie in die unwirtlichsten Gebiete der Kalahari und des dichten Urwalds<br />
zurückgedrängt wurden. Die Zwergvölker erreichen eine Grösse von 1,40 Meter. Ihre Frauen sind meist noch kleiner.<br />
Nach der Beschreibung der äusserlichen Merkmale wendet Widrig sich der Sprache dieser "Zwergvölker" zu:<br />
Die Sprache der Hottentotten und Buschmänner überrascht den Europäer durch die eigenartigen Schnalzlaute. Doch<br />
berichten weisse Männer, welche die Gastfreundschaft der Buschmänner genossen, von einem bewundernswerten<br />
Reichtum der Dichtung dieses Volkes. Sie erzählt von Freundestreue, Mutterschmerz, Kindespflicht, Gattentreue und<br />
Geschwisterliebe.<br />
Die Naturvölker erzählen sich ihre Dichtungen in lebendiger, melodiereicher Sprache am Lagerfeuer unter Mienen- und<br />
Gebärdenspiel.<br />
(Zu den Schnalzlauten siehe auch die Ausführungen auf der Seite 251 dieser Arbeit). Die Bemerkung über den<br />
"Reichtum der Dichtung" kann nur darauf zurückgeführt werden, dass dieser den als "primitiv" betrachteten<br />
Völkern nicht zugetraut wurde.<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Widrig führt auf der Seite 305 zwei Beispiele von Gesängen an: eine Art Heiratslied und einen Totengesang,<br />
der auf Seite 126 dieser Arbeit in der Besprechung von "Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen (1961)"<br />
wiedergeben ist. Über die Kulturstufe der "Zwergvölker" schreibt Widrig auf Seite 305:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 141
Die Zwergvölker und Buschmänner sind die primitivsten Völker Afrikas. Sie leben als Sammler und Jäger in der Kalahari<br />
und in den dichten Urwäldern des Kongogebietes. Dort fristen sie ein Leben, über dessen Armseligkeit wir uns kein Bild zu<br />
machen imstande sind. Allerlei kleines Getier wie Insekten, Frösche, Mäuse und Eidechsen dient ihnen zur Nahrung. Mit<br />
den Grabstock wühlen sie nach Wurzeln und Knollen, Würmern und Larven. Ein einfacher Wetterschutz, bestehend aus<br />
einigen Stangen und darüber ausgebreitetem Laubwerk, ist ihre Wohnung. Ihre Waffen sind Bogen und vergiftete Pfeile.<br />
So ziehen sie als primitive Nomaden durch die Wildnis, wo sie allmählich aussterben.<br />
Ein Vergleich mit der aus dem thurgauischen Lehrmittel "Geographie" von 1963 auf Seite 130 in dieser Arbeit<br />
zitierten Stelle und der Verweis auf die dort gemachten Bemerkungen soll hier genügen. (Zu den "Pygmäen"<br />
siehe auch die Seiten 126 und 147 dieser Arbeit, zu den "Buschmännern" die Seiten 133 und 149.)<br />
4.13.6 "Das weisse Afrika"<br />
Nach den Teilen "Afrika, der dunkle Erdteil" auf den Seiten 296-300 und "Das schwarze Afrika" auf den<br />
Seiten 300-305, die bereits besprochen wurden, folgt auf den Seiten 306-314 ein mit "Das weisse Afrika" über-<br />
schriebenes Kapitel. In einem ersten Abschnitt betitelt mit "Hamiten und Semiten" auf der Seite 306 schreibt<br />
Widrig unter anderem:<br />
...Die Hamiten sind vorwiegend braun und zeigen europäerähnliche Gesichtszüge. Sie gelten als kriegerisch und<br />
unternehmungslustig. Zu ihnen gehören unter andern die Berber, die Tuareg, einige Stämme zwischen dem oberen<br />
Nilgebiet und der Küste von Somali. Die hamitischen Fulbe, Haussa und Tibbu haben sich stark mit Negern gemischt. Die<br />
meisten dieser Völker sind zum Islam übergegangen und fanatische Mohammedaner geworden...<br />
Widrig gibt hier die künstliche Einteilung der Rassenlehre wieder, die bis heute in verschiedenen Lehrmitteln<br />
angeführt wird, die aber einer näheren Betrachtung nicht standhalten kann, da die Einteilungen einerseits<br />
fehlerhaft sind, andererseits die Übergänge zwischen den Rassen fliessend sind. Die Hausa beispielsweise,<br />
lassen sich allenfalls durch ihre Sprache, die in Westafrika von bis zu 50 Millionen Menschen gesprochen und<br />
als Handelssprache verwendet wird (Vögele 1995, S. 9), von ihren Nachbarn unterscheiden. (Zu den Hausa<br />
siehe auch die Seiten 57 und 152 dieser Arbeit.)<br />
Zum Einfluss des Islams und der arabischen Kultur auf die schwarzafrikanische Bevölkerung schreibt Widrig:<br />
Während des ganzen Mittelalters waren die Araber die Herren des Landes... Nicht die Wüsten, sondern die starken<br />
Negerstämme des Sudans sind es gewesen, die das Vordringen des Arabers gegen Süden aufhielten. Die Beduinen nannten<br />
die Sudanneger Muntschi, das heisst sie haben uns gegessen. Der Araber brachte dem Lande Sprache und Religion... In<br />
Ostafrika ist er zum verbissenen Träger eines wüsten Sklavenhandels geworden.<br />
Im hier verkürzt wiedergegebenen Abschnitt fasst Widrig verschiedene Entwicklungen sowohl in räumlicher<br />
als auch in zeitlicher Sicht zusammen, die nur einen Teil des tatsächlichen Geschehens schildern. Für eine<br />
detaillierte Übersicht sei auf den 2. Teil dieser Arbeit, auf den "Überblick über die Geschichte Afrikas",<br />
hingewiesen.<br />
Unter dem Titel "Europäer - Schlimme Vorbilder" schildert Widrig auf den Seiten 306-307 den Sklavenhandel<br />
in einer sehr bildlichen und sicher beeindruckenden aber wenig sachlichen Weise:<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Man kann sich nur blutenden Herzens jener Sklavenkarawanen erinnern, die einst aus dem Innern Afrikas kamen. Man<br />
hatte die schwarzen Menschen eine Kette bilden lassen. Sie kamen oft tausend Meilen weit aus den endlosen Wäldern und<br />
Steppen, gingen Millionen und Millionen Schritte im Gabelholz, einer hinter dem andern. Sie kamen die gewundenen<br />
Pfade entlang, durch das Dickicht, die Dornen und die Schlammlöcher des Urwaldes. Sie schritten durch Lichtungen<br />
zwischen den hohen und schneidenden Gräsern der weiten Ebenen hindurch. Sie durchquerten Stein- und Sandwüsten,<br />
wateten durch Moräste, ertranken in Flüssen und Furten. Sie erklommen die Stufen der Gebirge und glitten deren Hänge<br />
hinunter. Sie waren dem Wind und der Kälte des Hochlandes ausgesetzt. Der Regen prasselte auf ihre Rücken nieder, und<br />
die Tropensonne brannte auf ihre Köpfe. Sie wurden in den Niederungen von Fliegenschwärmen angefallen, gebissen und<br />
ausgesogen. Ihre Körper waren zerkratzt und zerschunden. Die Haut schälte sich vom Leib, voll von Schmutz und Staub.<br />
Tag und Nacht wurden sie von Schmarotzern, von Läusen und Zecken geplagt. Sie kamen mit gedunsenem Leib,<br />
blutunterlaufenen Augen, herausstehenden Backenknochen daher. Den Fuss im Eisen, den Verbindungsstrick in beiden<br />
Händen, jeder mit seinem Vordermann überdies durch eine lange Holzgabel verbunden, die seinen Hals umklammerte,<br />
jeder mit einer Last auf dem Haupt, so gingen, zogen, schleppten sie sich weiter. Das war die Sklavenkette, die mit Stöcken<br />
und Peitschen vorwärtsgetrieben wurde. Tausende von Schlägen setzten Tausende von Füssen in Bewegung. Schwarze<br />
Geier mit nackten Hälsen liessen sich auf jene Unglücklichen nieder, die den Anstrengungen erlagen.<br />
Berichten ehemaliger Sklaven und Sklavenhändler zufolge wurden die Sklaven oft in verschiedenen Etappen,<br />
verbunden mit mehrmaligen Besitzerwechsel, zur Küste gebracht. Dort begann erst die eigentliche Tortur,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 142
wurden die Sklaven doch oft, bis zur Ankunft des nächsten Sklavenschiffes in Gruppen von hundert oder mehr<br />
Menschen in engen Räumen wochenlang eingesperrt. Umstände die nur noch von den Zuständen auf den<br />
Schiffen während der Überfahrt an Unmenschlichkeit überboten wurden. (Zum Sklavenhandel siehe auch die<br />
Seiten 136 und 155 dieser Arbeit.)<br />
In einem weiteren Abschnitt auf Seite 307 betitelt mit "Entbehrungen" schildert Widrig die Aufopferung der<br />
Europäer, die ihre schwarzen Mitmenschen, so zumindest die Aussage des Textes, aus der Barbarei befreiten:<br />
Es gab immer wieder bedeutende Europäer, die versuchten, als gütige Helfer ins Innere Afrikas vorzudringen. Teils waren<br />
es Forscher, teils Missionare, Ärzte, Offiziere und Soldaten, die in bester Absicht auf alle, aber auch gar alle<br />
Bequemlichkeiten des Lebens verzichteten und sich der afrikanischen Sonne zuwandten. Sie erlernten die Sprachen der<br />
Eingeborenen und passten sich ihrer Lebensweise an. Sie teilten mit den Schwarzen deren hartes Los, nährten sich von<br />
Eidechsen und Schlangen, tranken aus braunen, stinkenden Pfützen. Sie wurden durch Krankheiten niedergestreckt und<br />
schleppten sich dennoch mit eiserner Willenskraft, auf sich allein angewiesen, weiter. Sie starben einsam und verlassen in<br />
afrikanischer Ferne. Ihr Leben war nur Güte und Hingebung an ihre schwarzen Freunde, durch die sie oft verraten,<br />
ausgeplündert und überfallen wurden. Sie erhoben seit jeher die Stimme gegen die Knechtung der afrikanischen Völker.<br />
Sie haben die Eingeborenen dazu gebracht, viele ihrer grausamen Sitten, die Menschenopfer und andere furchtbare Untaten<br />
forderten, aufzugeben.<br />
Diese "bedeutenden" Europäer waren keinesfalls die Regeln, sondern es handelt sich um wenige Ausnahmen.<br />
Besonders die Offiziere und Soldaten dürften sich kaum auf einen vertiefenden Kontakt mit der einheimischen<br />
Bevölkerung eingelassen haben, war es doch ihre Aufgabe die Interessen der europäischen Mächte gegenüber<br />
der Bevölkerung, notfalls mit Gewalt, durchzusetzen. Einer der seltenen Ausnahmen war sicher der englische<br />
Missionar Livingstone, der nach der Rückkehr von seiner ersten Afrikareise die englische Sprache erst wieder<br />
erwerben musste, hatte er sich doch immer bemüht, die Sprache derjenigen Afrikaner zu sprechen, mit denen<br />
er Umgang pflegte. Livingstones Leben schildert Widrig in kurzen Worten auf den Seiten 308-309.<br />
Auf der Seite 309 schreibt Widrig im Zusammenhang mit den Reisen des Franzosen Caillé um 1828 über die<br />
"Legendenstadt Timbuktu":<br />
Und siehe da, die Paläste waren nichts als schlecht gebaute Lehmhäuser. Die goldenen Dächer bestanden aus Kot. Fusstief<br />
stand der Wüstenstaub in den Strassen.<br />
Widrig vergisst dabei, dass Caillé Timbuktu rund 500 Jahre nach der Zeit höchster Blüte besuchte - einer<br />
Zeitspanne während der fast alle der im 14. Jahrhundert bedeutenden Handelsstädte in Bedeutungslosigkeit<br />
versanken. (Zu Timbuktu siehe auch die Seiten 38 und 375 dieser Arbeit.)<br />
Auf den Seiten 310-311 äussert sich Widrig unter dem Titel "Der Weg zur Unabhängigkeit" über die zum Zeit-<br />
punkt des Erscheinens des Buches teilweise bereits unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten und deren<br />
Fähigkeit sich selbst zu verwalten:<br />
Während der Kolonisation hat der Europäer seine modernen Wirtschaftsformen Afrika vermittelt. Er legte Plantagen und<br />
Bergwerke an, führte Industrien ein, baute Strassen und Eisenbahnen, förderte Handel und Verkehr. In den Städten<br />
entstanden moderne Quartiere mit Schulen und Spitälern. Viele Eingeborene fanden Arbeit und Verdienst.<br />
Bei der Abwägung über Nutzen und Schaden, den die Europäer mit ihrer Politik dem afrikanischen Kontinent<br />
brachten, gehen die Meinungen heute auseinander. Auf der einen Seite stand die wirtschaftliche Ausbeutung,<br />
andererseits erleichterten europäische Errungenschaften das Leben der einheimischen Bevölkerung speziell der<br />
Städte, besonders was die Bekämpfung tropischer Infektionskrankheiten anbelangt.<br />
Die durch die Europäer vermittelte Arbeit bestand nur allzuoft darin, den angesiedelten Europäern das Leben<br />
durch die Erledigung unangenehmer Tätigkeiten leichter zu machen oder auf den Plantagen oder in Eigenregie<br />
<strong>Pro</strong>dukte für den Export zu erzeugen. Der Verdienst reichte in der Regel gerade, um die von den Europäern,<br />
mit dem Ziel der Eingliederung der heimischen Bevölkerung in die Weltwirtschaft, erhobene "Kopf-" oder<br />
"Hüttensteuer" zu bezahlen. Widrig fährt fort (S. 310):<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
In den christlichen Missionen bestand kein Unterschied zwischen Schwarz und Weiss. Im modernen Wirtschaftsleben<br />
blieben die Eingeborenen dagegen untergeordnete Beamten oder Arbeiter. Sie waren vielfach ungenügend ausgebildet und<br />
konnten dem europäischen Denken nicht folgen. - Wer zum Beispiel mehr Lohn bekam, erschien oft erst wieder zur Arbeit,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 143
wenn das Geld verbraucht war. - Es geschah auch, dass der Europäer ihre Weiterbildung vernachlässigte oder gar<br />
verhinderte, um dem Weissen die bessern Posten zu sichern.<br />
In Westafrika verfolgte z. B. die Basler Mission eine Politik, die der einheimischen Bevölkerung den<br />
Anschluss an die europäische Kultur ermöglichen sollte. Die Missionare in ihrem Dienst verpflichteten sich,<br />
das einfache Leben der einheimischen Bevölkerung zu teilen. Bis heute haben sich einige Spitäler und Schu-<br />
len, die durch die Basler Mission anfangs des Jahrhunderts errichtet wurden, in Ländern wie Ghana, einen<br />
guten Ruf erhalten.<br />
4.13.7 "Unabhängigkeit südlich der Sahara"<br />
Mit der zunehmend europäisierten Bildung der afrikanischen Elite und den Erfahrungen vieler Schwarzafrika-<br />
ner, die in den beiden Weltkriegen zum Kriegsdienst eingezogen wurden, wuchs das Verlangen nach Unabhän-<br />
gigkeit. Widrig beschreibt dies auf Seite 310-311 mit einer Mischung aus Bedauern und Unverständnis:<br />
In den Städten und Hafenplätzen lernten die Eingeborenen das moderne Leben kennen. Sie sahen, dass der Europäer mehr<br />
verdiente, und sagten sich, Afrika sei ihr Land und der Weisse bestehle sie. Ehemalige afrikanische Studenten europäischer<br />
und amerikanischer Universitäten wurden zu Führern der Unzufriedenen im Kampf gegen den Kolonialismus. Sie zogen<br />
durch die Strassen und trugen Spruchbänder mit der Aufschrift: "Afrika den Afrikanern!" Die Sowjetunion unterstützte<br />
diese Forderung in der Absicht, den Westeuropäer in Afrika zu schwächen.<br />
Mit dem letzten Satz wird klar, dass viele Länder zwar die gewünschte Unabhängigkeit erlangten, von den<br />
Weltmächten USA und UDSSR aber in deren "Kalten Krieg" verwickelt wurden. Auseinandersetzungen deren<br />
Folgen sich noch immer, beispielsweise in Angola oder Äthiopien und Eritrea, auswirken.<br />
Über die erreichte Unabhängigkeit des Vorreiters und afrikanischen Hoffnungsträgers Ghana, der ehemaligen<br />
Goldküste, schreibt Widrig auf Seite 311:<br />
...Waren es zuerst die Länder des Islams, die ihr Ziel erreichten, so gelang es 1957 der von Negern bewohnten britischen<br />
Goldküste, den Staat Ghana zu gründen. Viele Afrikaner konnten es nun kaum erwarten, nach dem Vorbild Ghanas, das<br />
"europäische Joch" abzuschütteln. Die Kolonien wurden fast von heute auf morgen unabhängige Staaten. Schlimm waren<br />
die Folgen: Viele Europäer verliessen Afrika. Die Eingeborenen, plötzlich auf sich selber angewiesen, waren darauf<br />
schlecht vorbereitet. Es fehlte ihnen an Geld, Ausbildung, Erfahrung und innerer Reife, das von den Europäern begonnene<br />
Werk zu übernehmen und weiter aufzubauen...<br />
Ob es in Länder wie Ghana wirklich an der "inneren Reife" der Politiker fehlte oder ob andere Faktoren eine<br />
Rolle spielten, sei dahingestellt. Widrig schätzt aber die Folgen der teilweise übereilten Unabhängigkeit afri-<br />
kanischer Staaten richtig ein, wie die Entwicklung in den folgenden Jahren zeigen sollte.<br />
Auf den Seiten 311-313 versucht Widrig seine These am Beispiel der beiden Länder Marokko und Maureta-<br />
nien zu belegen. Auf den Seiten 313-314 schreibt er unter dem Titel "Unabhängigkeit südlich der Sahara":<br />
Viele afrikanische Menschen sind unsagbar arm, unterernährt, wohnen in elenden Hütten und kein Arzt ist erreichbar,<br />
wenn sie krank sind. Sie verstehen nur mit wenigen Habseligkeiten umzugehen und wissen nicht, was lesen und schreiben<br />
heisst, geschweige denn, was das Wort "Unabhängigkeit" bedeutet. Bei einer Abstimmung fragte ein Neger, bevor er seine<br />
Stimme abgab, ob die Unabhängigkeit ein Mann oder eine Frau sei. In den Städten nennen sich die Eingeborenen mit Stolz<br />
Afrikaner. Sie sind begeistert, wenn sie das Wort Freiheit hören. Manche glauben, diese berechtigte sie, den Besitz des<br />
Europäers zu plündern.<br />
Leider trifft die Beschreibung Widrigs, was die materiellen Verhältnisse anbelangt, bis zum heutigen Tag auf<br />
viele Menschen in Schwarzafrika zu, auch wenn diese ihre Hütten vielleicht nicht als "elend" betrachten. Das<br />
von ihm angeführte Beispiel zur politischen Reife ist eine unzulässige Verallgemeinerung. In vielen Staaten<br />
Afrikas haben die Stimmberechtigten immer wieder gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, die richtige<br />
Entscheidung zu fällen, sofern sie daran nicht unter Androhung von Gewalt gehindert werden.<br />
Als weitere Negativbeispiele führt Widrig Vorfälle in Tansania und die Situation in Nigeria nach der<br />
Unabhängigkeit an. Positiveres weiss er aus Ghana zu berichten, das unter Kwame Nkrumah zum Vorbild für<br />
ganz Afrika wurde (S. 131):<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Viele Eingeborene haben einen unersättlichen Bildungshunger. Um die Analphabeten lesen und schreiben zu lehren,<br />
ziehen in Ghana Wanderlehrer durch das Land, von den schwülen Dschungeln im Süden bis zur Steppe im Norden. Sie<br />
reisen zu Fuss, per Velo oder mit dem Moped. Ehrenamtliche Helfer stehen ihnen zur Seite, die als Erkennungszeichen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 144
eine Nadel mit der blaurot flammenden "Fackel des Wissens" am Hemd tragen. Der weithin hörbare Dorfgong ruft gross<br />
und klein zum Unterricht zusammen. - Für höhere Schulen müssen die afrikanischen Volkssprachen erst bearbeitet werden,<br />
bevor sie als Bildungsmittel dienen können. Wer studieren will, muss europäische Sprachen lernen, um dem Unterricht an<br />
den Hochschulen folgen zu können.<br />
Auch nach der jüngsten Schulreform in Ghana ist das Erlernen des Englischen, das sich vor allem aus politi-<br />
schen Gründen halten konnte, nach wie vor Bedingung für den Eintritt in eine höhere Schule.<br />
Im letzten Abschnitt zur "Unabhängigkeit südlich der Sahara" kommt Widrig auf die Entwicklungshilfe zu<br />
sprechen (S. 131):<br />
Es ist notwendig, dass den unabhängig gewordenen Ländern geholfen wird. Man nennt das Entwicklungshilfe und die<br />
betreffenden Völker unterentwickelte Nationen. Besonnene Afrikaner haben eingesehen, dass der Schritt vom Urwald ins<br />
Atomzeitalter vorbereitet sein muss. So sagte der Präsident der alten Negerrepublik Liberia: "Wir sind deshalb so arm, weil<br />
wir das Pech hatten, nie eine Kolonie gewesen zu sein."<br />
Dieses Zitat ist aufgrund des Bedürfnisses von Widrig, den Begriff "Entwicklungshilfe" zu erläutern, im<br />
Zusammenhang mit der Behandlung dieser Thematik in Lehrmitteln späterer Jahre interessant, denn bis heute<br />
engagieren sich die Industrieländer, teilweise mit viel Engagement und wenig Erfolg, in den Entwicklungslän-<br />
dern Afrikas. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seite 168 dieser Arbeit.)<br />
4.13.8 Tropenkrankheiten<br />
Die Seiten 314-317 widmet Widrig den Tropenkrankheiten. Über die Schlafkrankheit und die Malaria schreibt<br />
er auf Seite 315:<br />
...Die Wirkung der Schlafkrankheit auf die afrikanischen Völker ist furchtbar. Ganze Landstriche im Kongo sind<br />
ausgestorben. Die Hütten der Siedlungen stehen noch da, aber die Eingeborenen sind im Elend untergegangen. Die<br />
Tropenheilkunde hat Mittel geschaffen, welche die Blutschmarotzer im ersten Krankheitsstadium schlagartig vernichten...<br />
...Trotz des Chinins und anderer Bekämpfungsmittel gehen auch heute noch alljährlich Tausende von Menschen an Malaria<br />
zugrunde...<br />
(Zur Schlafkrankheit und ihren Auswirkungen siehe auch die Seite 157132 und 232 dieser Arbeit.) Diese<br />
Worte haben bis heute wenig an Gültigkeit verloren. Nach wie vor stellen die tropischen Infektionskrankheiten<br />
für die Menschen der betroffenen Gebiete ein grosses <strong>Pro</strong>blem dar. Selbst ein wirksames Medikament ist nur<br />
eine Lösung auf Zeit, da die Erreger nach einigen Jahren meist eine Resistenz entwickeln. Auf Seite 316<br />
schreibt Widrig über die Amöbenruhr:<br />
...Die Unsauberkeit der Eingeborenen vermittelt ihr den Weg in das Wasser, in die Kleider, an die Hände, auf die Früchte,<br />
an die täglichen Gebrauchsgegenstände, in die Lebensmittel. Gelangt sie in den Mund und durch diesen in den Magen und<br />
Darm, ist die Ansteckung da...<br />
Eine gefährliche Aussage, die zur Annahme verleitet, die "Eingeborenen" würden keine Hygiene kennen.<br />
Dabei erscheint es vielen Afrikaner unverständlich, dass es Europäer gibt, die nicht täglich mindestens einmal<br />
baden. Zu <strong>Pro</strong>blemen in der Hygiene führt der Wassermangel und vor allem die oftmals in den ländlichen<br />
Gegenden nicht vorhandene Trennung zwischen Trink- und Abwasser.<br />
4.13.9 Insekten<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Auf den Seiten 317-320 beschreibt Widrig die Insektenwelt Afrikas und den Einfluss der Insekten auf den<br />
Menschen. Auffallen dabei ist, dass er mit keinem Wort die Nutzung der Insekten, die wertvolle Lieferanten<br />
der Mangelware "<strong>Pro</strong>tein" sind, durch den Menschen beschreibt. In vielen ländlichen Gegend ist der Jungfern-<br />
flug der Termiten Grund für viel Aufregung unter den Kindern. Von einer elektrischen Lampe oder einer<br />
Kerze des Nachts angelockt, werden die Termiten eimerweise eingesammelt, anschliessend in ihrem eigenen<br />
Fett fritiert und dann entweder an Ort und Stelle verzehrt oder als Vorrat eingelagert. Neben den Termiten<br />
stehen auch weitere Insekten, wie grosse Heuschreckenarten, als eine Art "Frühlingsrolle" oder gewisse<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 145
Raupen, auf dem Speisezettel. Vielfach gelten sie als Delikatesse. (Zu den Heuschrecken siehe auch die Seiten<br />
107 und 198 dieser Arbeit.)<br />
4.13.10 Ackerbau und Viehzucht in der Savanne<br />
Die folgenden Seiten 320-373 enthalten keine Textstellen, die im Rahmen der Untersuchung interessieren. Die<br />
Themen auf diesen Seiten sind: "Der Aufbau des Bodens" (S. 320-322); "Das Klima" (S. 323-327); "Die Saha-<br />
ra" (S. 328-343); "Ägypten" (S. 344-363); "Libyen" (S.363); "Die Atlasländer" (S. 364-369) und ab Seite 370<br />
"Der Sudan".<br />
Auf Seite 373 schreibt Widrig zum Thema "Das Tierparadies", den Interessenkonflikt zwischen Viehzucht und<br />
Erhalt der heimischen Fauna aufgreifend:<br />
...Begreiflich, dass hungernde Steppenvölker sagen, Viehherden und Weiden seien ihnen wichtiger als wilde Tiere.<br />
Versuche und Beobachtungen sollen erwiesen haben, dass ein vernünftig gehegter Wildbestand die Bevölkerung besser<br />
mit Fleisch zu ernähren vermag als Viehzucht...<br />
(Zu den Hungerkrisen in Schwarzafrika siehe auch die Seiten 107 und 148 dieser Arbeit.) Dieser Konflikt<br />
bleibt in Gegenden Ost- und Südafrikas bis heute aktuell, wurde durch den aufkommenden Safaritourimus<br />
jedoch teilweise entschärft. In grossen Teilen der Sudanzone hingegen wurde die Frage aufgrund der zuneh-<br />
menden Bevölkerungszahl und der Dürrejahre zugunsten der Viehzucht entschieden.<br />
Auf den Seiten 374-375 schreibt Widrig unter dem Titel "Haus und Acker":<br />
Der Acker des Negers enthält wenige, anspruchslose Nutzpflanzen. Er ist nicht so gepflegt wie unsere Gärten und Felder.<br />
Wenn der Wald gerodet und der Acker mit der Hacke oberflächlich bearbeitet ist, schiessen noch allerorts Steppengräser<br />
und Schösslinge des Busches, durch tiefgreifende Wurzeln genährt, aus dem Boden. Aus verkohlten Baumstämmen<br />
spriessen neue grüne Zweige. Einen Teil des Astwerks flicht man zu einem Knüppelzaun, der Dorf und Feld umgibt und<br />
gegen wilde Tiere schützen soll. Das Gestrüpp verbrennt zu Asche, die man als Dünger in den Boden hackt. Es braucht viel<br />
harte Arbeit, bis man einen ertragfähigen Acker hat...<br />
Die von Widrig beschrieben Umzäunung dient nicht nur dem Schutz vor Wildtieren, sondern bietet auch den<br />
Ziegen, die von ihren Besitzern frei laufengelassen werden, Einhalt und schützt so die angebauten Pflanzen<br />
vor Frassschäden.<br />
In nächsten Abschnitt beschreibt Widrig die angebauten Pflanzen und fasst die Bemühungen der Bauern, aller-<br />
lei Tiere vom Acker fernzuhalten, in die Worte: "Der Neger steht diesen Feinden meist machtlos gegenüber".<br />
Es folgt eine recht detaillierte Beschreibung der Verwendung der angebauten Hirse auf den gleichen Seiten:<br />
Die Hirse ist dem Neger, was uns das tägliche Brot. Da er keine Arbeitsteilung kennt, muss die Köchin vor jedem Mahl<br />
dreschen und mahlen. "Sie muss das übliche Korn in der nötigen Menge täglich im Mörser stampfen, was unserem<br />
Dreschen entspricht. Dann wird in Handschalen durch Schütteln im Winde die Spreu abgesondert, der Rest zwischen zwei<br />
Steinen mit der Hand gemahlen. Um endlich das Mehl zum Brei kochen zu können, müssen erst noch Wasser und<br />
Brennholz herbeigeschafft werden. So ist es denn dem Arbeiter oder Träger ganz unmöglich, sich ein Frühmahl zu leisten,<br />
denn die aufgehende Sonne sieht ihn schon bei der Arbeit oder auf dem Marsche. So kommt er erst gegen Abend zu seiner<br />
einzigen Mahlzeit, dem einfachen Hirsebrei, der in Gemeinschaft mit andern aus einem Napf mit den Fingern gegessen<br />
wird. Soweit Früchte oder Wurzeln vorhanden sind, was durchaus nicht immer der Fall ist, müssen sie tagsüber den Hunger<br />
stillen helfen." (E. Hennig.) Die Bevölkerung ist daher unterernährt. Trotzdem ist sie guten Mutes,...<br />
Diese Beschreibung zeigt, dass Erzählungen über die "Faulheit der Schwarzen" als falsch angesehen werden<br />
müssen. Bis zum heutigen Tag stehen die Menschen des ländlichen Sudan frühmorgens auf, und verbringen,<br />
solange die Sonne noch nicht allzuheiss auf die Savannenlandschaft herunterbrennt, einen Grossteil des Tages<br />
auf ihren Feldern, auf dem Weg zur nächsten Wasserstelle oder auf der Brennholzsuche.<br />
Im folgenden Abschnitt (S. 375) beschreibt Widrig, Hennig zitierend, die Behausungen, welche für diesen Teil<br />
Afrikas typisch sind und sich überall dort gehalten haben, wo sich der modernere europäische Baustil als zu<br />
teuer erweist:<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Der Acker schliesst in der Regel unmittelbar ans Haus der Familie an. Die Negerhütte ist von grosser Einfachheit, ein<br />
Rechteckbau oder eine Rundhütte mit einem Kegeldach. Die Seitenwände sind gewöhnlich aus Lehm gemauert oder aus<br />
Ruten geflochten und mit Lehm verstrichen. Das Holzdach trägt dicke Strohpolster, die man jährlich erneuert. "Die Hütten<br />
sind im Innern finster, rauchig und eng, die Türen so niedrig, dass der Eintretende sich bücken muss. Einige niedere,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 146
geflochtene Bänke zum Schlafen, Matten, Koch- und Wassergefässe bilden die ganze Einrichtung. Der Raum bietet nur<br />
den notdürftigsten Platz zum Schlafen." (E. Hennig.) Sind die umliegenden Felder erschöpft, sucht die Dorfgemeinschaft<br />
eine neue Wasserstelle und zieht weiter. Ein Savannenbrand und das ganze alte Dörfchen ist spurlos verschwunden!<br />
Widrig beschreibt zwei verschiedene Hüttenformen. Die Rundhütte ist typisch für die regenärmeren Gebiete<br />
des Sudan, die Form des Rechteckbaus für die regenreicheren. In Ghana beispielsweise löst die eine Bauform<br />
die andere innerhalb weniger Kilometer ab. Die Rundhütte gilt dort als Zeichen des Nordens.<br />
Im letzten Abschnitt beschreibt Widrig kurz die Viehzucht:<br />
Je weiter man sich den Wohngebieten der nördlichen Trockensteppen zuwendet, desto mehr tritt die Viehzucht als<br />
Haupterwerbszweig hervor. Die Herden, meist aus Buckelrindern bestehend, werden während der Trockenzeit gegen<br />
Süden getrieben. In der Regenzeit wenden sie sich wieder den trockenen Grasländern zu, schon um den Stichen der<br />
Tsetsefliege zu entgehen.<br />
Diese Viehwanderungen stellen seit der Entstehung der Nationalstaaten ein <strong>Pro</strong>blem dar, weil die Hirten bei<br />
befürchteter Seuchengefahr die Grenzen nicht mehr überqueren dürfen. Oft kommt es auch zu Konflikten<br />
zwischen der Hirten dieser Viehherden und der sesshaften Bevölkerung, die Ackerbau treibt.<br />
4.13.11 "Die Guineaküste und das Kongobecken"<br />
Im nächsten Kapitel "Die Guineaküste und das Kongobecken" auf den Seiten 376-379 beschreibt Widrig,<br />
nachdem er die Leser über "Das Land und seine Gewässer" und "Den tropischen Regenwald: Die Naturland-<br />
schaft" informiert hat, "Mensch und Urwald" auf den Seiten 377-378:<br />
Das Kongogebiet wird vorwiegend von Bantustämmen bewohnt. Die Besiedlung ist sehr unterschiedlich, je nach der Natur<br />
des Landes. Krankheiten und innere Fehden haben ganze Dörfer entvölkert. Der dichte Urwald ist sehr menschenfeindlich<br />
und deshalb auf weite Strecken völlig unbesiedelt. Am günstigsten sind die Lebensbedingungen beim Übergang in die<br />
Savanne, wo die Niederschläge einen hinreichenden Ertrag aus dem Hackbau sichern. Das wichtigste Erzeugnis der<br />
Pflanzungen in den gerodeten Waldgebieten ist die Banane. In den trockeneren Savannengebieten hören die<br />
Bananenpflanzungen auf. An ihre Stelle treten die Körnerfrüchte Hirse und Mais. Dazu kommen noch Maniok, Jams und<br />
Batate, Bohnen und Kürbisse. Die Viehzucht ist in den feuchten Gebieten unmöglich. - Die Siedlungen der Waldgebiete<br />
sind Strassendörfer. In der freien Savanne findet man eher Haufensiedlungen. Völlig zurückgezogen in den Schutz der<br />
schwer zugänglichen Waldgebiete leben noch einige zerstreute Gruppen von Zwergvölkern (Pygmäen). Sie führen ein<br />
überaus armseliges Jäger- und Sammlerleben. Ein niedriges Blätterdach ist ihre Wohnung, ein Bogen mit vergifteten<br />
Pfeilen ihre Waffe. Die Pygmäen werden etwa 140 cm gross.<br />
Typisch an diesem Text ist die Gegenüberstellung der aus europäischer Sicht "zivilisierteren" Bantu und der<br />
"urtümlich" lebenden "Pygmäen". (Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 141 und 154 dieser Arbeit.) Diese<br />
Art des Vergleich findet sich auch 17 Jahre später noch im Lehrmittel "Geographie der Kontinente" von 1984,<br />
das auf Seite 339 dieser Arbeit besprochen wird. Über die wirtschaftliche Entwicklung im Regenwaldgebiet<br />
schreibt Widrig auf Seite 379:<br />
Die wirtschaftliche Erschliessung des Urwaldes steckt noch in den Anfängen. Edle Hölzer, Palmkerne und Kautschuk<br />
bilden seinen Reichtum. Plantagen finden sich an den Verkehrslinien, besonders in den Küstenländern von Guinea. Dort<br />
werden vor allem Kaffee, Kakao, Öl- und Kokospalmen angebaut. - In Katanga, das eine besondere Entwicklung<br />
durchgemacht hat, werden reiche Kupferminen ausgebeutet. Es ist der wirtschaftlich wichtigste Teil des Kongogebietes<br />
und bestrebt, unabhängig zu sein.<br />
Unterdessen haben sämtliche Länder des Kongobeckens die Unabhängigkeit erlangt und die Erschliessung des<br />
Regenwaldes wird zumindest in Europa von breiten Kreisen der Bevölkerung mit anderen Augen betrachtet,<br />
da man die Vernichtung der "grünen Lungen" fürchtet.<br />
4.13.12 Ostafrika<br />
Im nächsten Kapitel zu Ostafrika, auf den Seiten 380-388 beschreibt Widrig die "Grabenbrüche und Seen,<br />
Vulkane und Bruchstufen" (380-381), und die "Ostafrikanische Savannen- und Steppenlandschaft"<br />
(S. 382-384), bevor er auf den Seiten 384-388 unter dem Titel "Volk und Bodenwirtschaft" auf für diese Arbeit<br />
relevante Themen zu sprechen kommt:<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Die Steppenbewohner nördlich des Äquators sind Nomaden. Sie sind vorwiegend Hamiten, die sich mit Negern und<br />
Arabern vermischten. Zu ihnen zählen die Galla, Somali und Massai. Die dunkelhäutigen Abessinier werden als<br />
semitisches Volk angesehen. Die Steppenvölker ernähren sich vorwiegend durch die Viehzucht. Ihre Herden bestehen aus<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 147
Buckel- und Langhornrindern. Südlich des Äquators gehören die Eingeborenen zu den Bantuvölkern. Sie leben<br />
vorwiegend vom Hackbau und pflanzen die gleichen Gewächse an wie im Sudan und im Kongogebiet: Hirse und Mais,<br />
Maniok, Jams, Batate, Erdnüsse und Bananen. An der Küste lebt das handelstüchtige Mischvolk der Suaheli. Ihre Sprache,<br />
das Kisuaheli, gilt in weiten Teilen Ostafrikas als Verkehrs- und Geschäftssprache...<br />
...Wie im übrigen dunklen Erdteil, so entstehen auch in Ostafrika neue Staaten. Die politischen Verhältnisse ändern rasch...<br />
Denkt man an Länder wie Somalia oder Äthiopien, das Widrig auf den Seiten 386-387 beschreibt, wird klar,<br />
dass sich die Verhältnisse bis zum heutigen Tag lange noch nicht in allen Regionen Ostafrikas stabilisiert<br />
haben. Über Äthiopien erfährt der Leser:<br />
Das alte Wort Äthiopien bedeutete früher: Land am oberen Nil. Heute umfasst das Kaiserreich Äthiopien das Hochland<br />
von Abessinien und erstreckt sich nordwärts über Eritrea bis ans Rote Meer. Äthiopien heisst "Land der Dunkelhäutigen";<br />
seine Einwohner nennen sich Äthiopier (nicht Abessinier). Es sind aber viele Tönungen der Haut vorhanden. Die<br />
verhältnismässig hellhäutigen Amharen mit krausen schwarzen Haaren bezeichnen sich als weiss und sagen von den<br />
Europäern, sie seien "rosa"; ihre Mitbürger aus andern Rassen gelten als braun oder schwarz.<br />
An der Spitze des Staates steht der Kaiser, amtlich Negusa Nagast, in Europa Negus Negesti (das heisst "König der<br />
Könige") genannt. Dieser Titel hat in Äthiopien seine Berechtigung, denn in diesem Reich gibt es tatsächlich viele "Ras",<br />
die wie Könige regieren. Die Äthiopier glauben, Kaiser Haile Selassie sei der 225. Nachkomme Salomons. Der Kaiser will<br />
moderne Technik und europäische Lebensweise schrittweise einführen. Die Italiener, die Abessinien von 1935 bis 1940<br />
besetzt hielten, leisteten ihm ungewollt grosse Vorarbeit. In kaum einem andern Land sieht man westliche Zivilisation und<br />
afrikanische Rückständigkeit näher beisammen.<br />
"Vor einer roten Verkehrsampel in Addis Abeba (das heisst 'Neue Blume') hält ein barfüssiger Hirt seine Schafe und<br />
Ziegen zurück, um Autos und hochbeladene Kamele, die 'Grün haben', vorbei zu lassen. Neben modernen, hohen<br />
Geschäftshäusern ducken sich niedrige, uralte Holzbaracken. Männer, wie zu biblischen Zeiten gekleidet, mit weissem<br />
Schultertuch und braunen, enganliegenden Hosen, betrachten die Schaufenster, in denen Badewannen, Radios und<br />
Photoapparate ausgestellt sind. In solchen Läden kann man auch hochempfindliche Kleinbildfilme kaufen...<br />
Widrig führt hier noch weitere Beispiele an, die belegen sollen wie gross der Kontrast zwischen alt und neu ist.<br />
Eine Konfrontation die vielen Menschen Afrikas, die in grossen Städten leben, geläufig ist und die besonders<br />
scharf heraustritt, wenn sie ihre Verwandten in den ländlichen Gegenden des Landes besuchten, wo vielleicht<br />
weder Elektrizität noch fliessendes Wasser vorhanden sind. (Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 112 und 166<br />
dieser Arbeit.)<br />
Auf den Seiten 387-388 beschreibt Widrig unter dem Titel "Dürre und Sintflut" Szenen, die sich in ähnlicher<br />
Weise immer wieder, zuletzt im Mai/Juni 1998, als am Victoriasee, dem grössten Binnengewässer Afrikas, der<br />
Wasserspiegel innert weniger Monate um 1.5 m stieg (TA 29.5.98, S. 16), wiederholt haben:<br />
Fast zwei Jahre lang, von 1959 bis 1961, haben der grösste Teil von Kenya und angrenzende Gebiete Tanganjikas und<br />
Somalilands unter Wasserarmut gelitten. Es war noch nie so schlimm, seit man die Wetterbeobachtungen aufschrieb. Das<br />
Grasland war verbrannt, das Vieh verendet, der Mais verdorrt. Das Elend des Menschen wurde immer schlimmer. Am<br />
schwersten litt der nomadisierende Stamm der Massai, etwa 40'000 Menschen, die 250'000 Stück Vieh verloren. Alles<br />
hungerte, am meisten die Kinder.<br />
Im Frühjahr 1961 halfen die Engländer und Amerikaner. Allein im Mai wurden in Mombasa 100'000 Säcke Mais<br />
ausgeladen. Auf diese Weise ernährte man über 400'000 Menschen und bewahrte sie vor dem Hungertod.<br />
Im Herbst kam der langersehnte Regen - nun aber in Mengen wie nie zuvor. Es schien, aller Regen, der zwei Jahre<br />
ausblieb, müsse nun auf einmal fallen. Die Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten Felder, Dörfer und Städte.<br />
Ganze Bananenpflanzungen wurden fortgeschwemmt, der Weizen von den Wolkenbrüchen niedergewalzt. Das Wasser<br />
unterspülte die Bahndämme, riss Brücken weg, unterbrach Wege und Strassen. Der ganze Verkehr brach zusammen...<br />
Pausenlos, vom Morgen bis zum Abend, starteten in Nairobi schwere Transportflugzeuge, jedes 11 Tonnen Mais und<br />
Maismehl in Säcken an Bord. Sie flogen ihre Lasten bei strömendem Regen über triefende Urwälder, bodenlose Moräste<br />
und endlose Wasserflächen. Bei den Siedlungen der Eingeborenen warfen sie die Säcke ab.<br />
Die Eingeborenen sind bei solchen Klimaverhältnissen schutzlos Hunger und ansteckenden Krankheiten preisgegeben...<br />
(Zu den Hungerkrisen in Schwarzafrika siehe auch die Seiten 107 und 180 dieser Arbeit.) Widrig sieht solche<br />
Katastrophen als Zeichen dafür, dass die betroffenen Länder noch nicht in der Lage sind für sich selbst zu<br />
sorgen, und er hält fest, dass "sie ohne auswärtige Hilfe zugrunde gegangen wären" (S. 388). Die in solchen<br />
Bemerkungen zur Schau gestellten Abhängigkeitsverhältnisse, stiessen bei den heimischen Politikern der<br />
betroffenen Länder nicht immer auf Gegenliebe.<br />
4.13.13 Südafrika<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Auf den Seiten 389-403 wendet sich Widrig Südafrika zu. Nach einer kurzen Beschreibung von "Wüste und<br />
Meer" auf den Seiten 389-390, folgt auf den Seiten 390-395 ein Text über die "Buschmänner" nach Siegfried<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 148
Passage unter dem Titel "Aussterbendes Volk", der hier aufgrund seiner Länge nur auszugsweise wiedergege-<br />
ben wird:<br />
...Die Hottentotten, schätzungsweise etwa 100'000 Menschen, sind von kleinem Wuchs. Sie besitzen eine graugelbe,<br />
überaus runzelige Haut. Ihre Haare sind zu kleinen Knäueln verfilzt. Die Wohnungen bestehen aus einfachen<br />
Bienenkorbhütten. Bei ihrem Bau werden kreisförmig Pfähle in den Boden gesteckt, oben kuppelförmig<br />
zusammengenommen und mit Fellen, Matten oder Tüchern überdeckt. Mehrere solche Hütten nennt man eine Werft...<br />
Die Buschmänner sind ihrer Lebensnotwendigkeiten beraubt und nur noch in den unwirtlichsten und entlegensten<br />
Gebieten der Kalahari anzutreffen. Es gibt noch etwa 10'000. Sie werden durchschnittlich 145 bis 155 cm gross. Ihre Haut<br />
ist, ähnlich jener der Hottentotten, fahlgelb, das kurze Haar knötchenförmig zusammengerollt. Sie wandern familienweise<br />
umher, zuweilen nur Sträucher als Wetterschutz benützend...<br />
Auf diese äusserliche Angaben folgt eine ausführliche Schilderung der Lebensweise der "Buschmänner", die<br />
ihre Jäger- und Sammlertätigkeit, wie Feuer machen, einrichten des Übernachtungsplatzes, Nahrungssuche,<br />
Art der erbeuteten Tiere, Hunger und Entbehrung, beschreibt. Dabei fallen Ausdrucke und Sätze wie: "Wenn<br />
das Fleisch aussen verbrannt, im Innern aber noch halb roh und blutend ist, wird es mit Fingern und Messern in<br />
Stücke zerrissen und gierig verschlungen."; "die... schmutzigen Buschmänner"; "der unstete und scheue<br />
Blick"; "der finstere Gesichtsausdruck"; "Das Leben der Buschmänner ist hart und entbehrungsreich."; "...diese<br />
abgezehrten, schwankenden Gestalten, hohläugig, mit eingefallenen Gesichtern, fleischlosen Gliedern und<br />
skelettartigem Brustkorb, der auffallend vom aufgetriebenen Bauch absticht, der in der Not mit unverdaulicher<br />
Kost gefüllt wurde" und "verkommene Häuflein". Der Text schliesst mit den Worten (S.395):<br />
...Man begreift kaum, wovon dann überhaupt die Buschmänner noch leben, wie sie es fertig bringen, ihr elendes Dasein zu<br />
fristen.<br />
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 141 und 161 dieser Arbeit.) Die Seiten 396-401 beschäftigen<br />
sich mit der Gold- und Diamantengewinnung in Südafrika, die Seiten 402-403 mit "Volk und Staat". Über die<br />
weisse Minderheit in Südafrika schreibt Widrig (S. 402):<br />
...Sie haben sich während drei Jahrhunderten in einer farbigen Umwelt rassenrein erhalten und fühlen sich gegenüber ihren<br />
Vorfahren und Nachkommen verpflichtet, die westeuropäische Kultur in Südafrika zu erhalten...<br />
Auf welche Weise auch immer dieser Satz interpretiert wird, er hat wenig Schmeichelhaftes für die afrikani-<br />
schen Bevölkerungsgruppen in diesem Raum. Als Argument gegen die Abschaffung der Apartheid werden<br />
folgende Gründe angebracht (S. 403):<br />
...Bei Gleichberechtigung würde durch den Stimmzettel der führende Einfluss des Weissen ausgeschaltet und Südafrika ein<br />
Bantustaat. Die eingeborene Bevölkerung wäre nicht imstande, eine vernichtete europäische Zivilisation durch etwas<br />
Gleichwertiges zu ersetzen. Die Weissen machen geltend, dass sich die Zahl der Bantu vervielfacht hätte, seit eine<br />
geordnete Verwaltung die mörderischen Stammeskämpfe beendete und dass die Sterblichkeit dank des modernen<br />
Gesundheitsamtes ständig sinkt. Die Bantu finden in den Städten Arbeit und werden besser bezahlt, als dies in den<br />
Eingeborenenstaaten Afrikas zutrifft. Deshalb wandern sie auch nicht aus. Im Gegenteil, es wollen immer wieder Bantu<br />
von Norden her in die Südafrikanische Republik einwandern. Der Staat gibt gewaltige Summen aus, um<br />
Lebensverhältnisse und Ausbildung der farbigen Bevölkerung zu heben. Die erforderlichen Beträge sind eine Last für den<br />
weissen Steuerzahler. "Tausende von Bantu könnten als Rechtsanwälte, Ärzte, Lehrer, Beamte, Händler, Handwerker und<br />
Facharbeiter in den Bantustädten ihr Brot verdienen..."<br />
Konkrete Argumente für die Abschaffung der Apartheid werden nicht angeführt, Widrig beschränkt sich<br />
darauf, den Friedensnobelpreisträger Albert John Luthuli zu zitieren:<br />
Es gibt aber auch Neger, die in bester Absicht für die Gleichberechtigung kämpfen. Albert John Luthuli, der den<br />
Friedensnobelpreis für 1960 erhielt, erklärte: "Nicht als Neger kämpfe ich gegen die unterschiedliche Behandlung der<br />
Rassen, sondern als Christ."<br />
Immerhin verschweigt er nicht, welche Folgen das Festhalten der Südafrikanischen Regierung an der Apart-<br />
heidspolitik hatte (S. 403):<br />
Die Meinungsverschiedenheiten, die im britischen Commonwealth über der Rassenfrage entstanden sind, haben dazu<br />
geführt, dass die Südafrikanische Republik aus dieser Staatengemeinschaft ausgetreten ist<br />
(Zur Apartheidspolitik Südafrikas siehe auch die Seite 162 dieser Arbeit.) Unterdessen hat die Apartheidspoli-<br />
tik Südafrikas nur noch geschichtlichen Charakter, die daraus erwachsenden <strong>Pro</strong>bleme spielen aber noch<br />
immer eine bedeutende Rolle.<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 149
Widrig schliesst den Afrikateil auf der Seite 404 mit einer Tabelle der afrikanischen Länder und Verwaltungs-<br />
gebiete, die über Fläche, Bevölkerungszahl und Jahr der Unabhängigkeit Auskunft gibt.<br />
4.13.14 Zusammenfassung<br />
Das Buch von Widrig stellt zwar umfangreiches Material, welches auch einen gewissen Raum für Differenzie-<br />
rung lässt - sogar die Rolle der afrikanischen Frau wird einmal kurz erwähnt -, zum Thema der Untersuchung<br />
zur Verfügung, berichtet aber in vielen Belangen einseitig. Er setzt die paternalistische Sicht der Kolonial-<br />
mächte weit stärker ins Zentrum als die Stimme der schwarzafrikanischen Bevölkerung oder macht sich sogar<br />
rassistischer Äusserungen schuldig. So unterlässt es Widrig z. B. kritische Stimmen wie die des afrikanischen<br />
Vordenkers Nkrumah zu Wort kommen zu lassen, die einige andere Textstellen auf wohltuende Weise relati-<br />
viert hätten.<br />
Widrig skizziert ein Bild eines von Europa kulturell und wirtschaftlich abhängigen Schwarzafrikas, welches<br />
im besten Fall dazu fähig ist, für den Export nach Europa zu produzieren, sich sonst aber auf die Subsisten-<br />
zwirtschaft beschränkt, denn die ehemalige "Grösse" der afrikanischen Reiche musste der "Armut" und "man-<br />
gelnder Voraussicht" weichen.<br />
Geographielehrmittel: Geographie Widrig (1967)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 150
4.14 Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
...Aus dem Kassaigebiet kommt mehr als die Hälfte aller Industriediamanten der Erde... Im Hochland von Katanga... finden<br />
sich reiche Vorkommen von Kupfer-, Kobalt-, Zinn und Uranerzen. In modernen Industriewerken werden sie z. T. im<br />
Lande selbst verarbeitet. Die Hüttenwerke in Katanga decken einen hohen Anteil des Weltbedarfs dieser Metalle. Die<br />
Hauptstadt des Katangagebietes ist Lubumbashi (Elisabethville)... Hier und in Jadotville glaubt man sich in ein<br />
europäisches Industriegebiet versetzt: Gleisanlagen, Abraumhalden, Werkstätten, Fabriken und moderne Wohnsiedlungen<br />
für die Bergarbeiter mit Schulen und Krankenhäusern zeigen das neue Gesicht Afrikas. (Bd. 3, S. 43)<br />
Das im Zeitraum 1966 - 1973 erschienene sechsbändige, 744 Seiten umfassende Lehrmittel "Seydlitz für Real-<br />
schulen" befasst sich in den Bänden 3 und 6, beide 1968 erschienen, auf insgesamt 57 Seiten mit Afrika, wobei<br />
zu jedem Kapitel Arbeitsaufträge gestellt und in einem Kästchen "Zum Behalten" die wesentlichen Aussagen<br />
wiederholt werden.<br />
4.14.1 Band 3<br />
Der Band 3 beginnt mit einem allgemeinen Teil zu Afrika auf den Seiten 10-15. Nachdem die Themen "Ge-<br />
birge - Hochländer - Beckenlandschaften" (S. 10), "Das Klima prägt die Landschaften Afrikas" und "Die<br />
Klima- und Pflanzengürtel Afrikas" (S.11-12) behandelt wurden, heisst es auf Seite 13 unter der Überschrift<br />
"Afrika - der 'Schwarze' Erdteil?":<br />
Häufig bezeichnet man Afrika auch als den "Schwarzen" Erdteil. Das ist nur teilweise richtig, denn die Neger bewohnen<br />
nicht ganz Afrika. Im nördlichen Afrika wohnen hellfarbige Menschen... Erst südlich der lebensfeindlichen Sahara beginnt<br />
Negerafrika mit einer Vielzahl von Völkern und Stämmen. Zwei grosse Gruppen heben sich heraus: die Sudanneger im<br />
Sudan und in Oberguinea und die Bantus im Kongobecken und in Hochafrika. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihre<br />
Sprache. Im undurchdringlichen tropischen Regenwald gibt es in geringer Zahl Zwergmenschen, die Pygmäen. Die<br />
kleinwüchsigen Buschmänner und die Hottentotten leben in den südafrikanischen Trockengebieten.<br />
In die Küstenlandschaften sind Menschen anderer Rassen eingewandert...<br />
Mehr als 300 Mill. Menschen leben heute in Afrika. Davon gehört die Hälfte der schwarzen Rasse an... Gemessen an der<br />
Fläche ist Afrika nur dünn besiedelt - allerdings müssen wir bedenken, dass weite Gebiete für eine wirtschaftliche Nutzung<br />
ganz oder teilweise ausfallen.<br />
Nach dieser Einführung schreibt der Autor unter der Überschrift "Zum Behalten" auf der Seite 13:<br />
Der grösste Teil Afrikas liegt zwischen den Wendekreisen; damit ist Afrika ein tropischer Erdteil. Die jährliche Verteilung<br />
der Regen- und Trockenzeiten ist für das Leben der Bewohner von entscheidender Bedeutung. Nach Lage, Bodengestalt,<br />
Klima, Pflanzenwelt und Bevölkerung lässt sich Afrika in sieben Grosslandschaften gliedern: Mittelmeerafrika, Sahara,<br />
Nilländer, Sudan, Äquatorialafrika, Südafrika und Ostafrika.<br />
An diese Einteilung, die sich in ähnlicher Art auch in anderen Lehrmitteln findet, hält sich der Band in der<br />
Beschreibung der verschiedenen Grossräume. Auf Seite 14 schreibt der Autor zur "Erschliessung Afrikas":<br />
...Erst nach dem zweiten Weltkrieg erlangten, vielfach unterstützt von der bisherigen Kolonialmächten, fast alle<br />
afrikanischen Gebiete ihre Unabhängigkeit. Der Weg, den diese Staaten vor sich haben, um sich wirtschaftlich und<br />
politisch zu behaupten, erfordert für alle noch grosse Anstrengungen. Die jungen Länder bedürfen für ihre Entwicklung<br />
noch auf Jahrzehnte der tatkräftigen Hilfe der grossen Industrieländer...<br />
Viele afrikanische Länder mussten sich die Unabhängigkeit aber gegen den Einfluss der sie regierenden Kolo-<br />
nialmächte erkämpfen. Zudem zogen sich einige der europäischen Mächte aus Teilen Afrikas zurück, weil sie<br />
erkannten, dass eine solche Kolonie nicht "wirtschaftlich" geführt werden konnte.<br />
Die als notwendig angesehene Entwicklungshilfe wurde später zum Teil auch als "Wiedergutmachung" an den<br />
Ländern Schwarzafrikas betrachtet, entsprechend sinnvoll fielen gewisse Entwicklungsprojekte aus.<br />
4.14.1.1 Der Norden Afrikas<br />
Nach diesen allgemeinen Ausführungen folgt eine Beschreibung der Grossräume Afrikas. Auf den<br />
Seiten 15-19 heisst es "Mittelmeerafrika - Winterregenländer", auf den Seiten 20-24 "Die Sahara - Wüsten und<br />
Oasen" und auf den Seiten 25-31 "Die Niloase - Ägypten und Sudan". Auf Seite 30 schreibt der Autor in einem<br />
kurzen Text zu "Die Republik Sudan":<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
...Im Norden wohnen Araber und arabische Mischlinge... Im Süden dagegen leben vornehmlich Neger als Hackbauern.<br />
Zwischen beiden Bevölkerungsgruppen bestehen starke Spannungen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 151
Diese Spannungen führen immer wieder zu Auseinandersetzungen, die zeitweise bürgerkriegsähnliche Formen<br />
annehmen und zuletzt im Mai 1998 einmal mehr zu den bekannten Bildern von flüchtenden Menschen mit<br />
Hungerbäuchen führten, während die den Menschen zu Hilfe eilenden humanitären Organisationen ihre Tätig-<br />
keit infolge der chaotischen Zustände stark einschränken mussten.<br />
4.14.1.2 Die Savannen des Sudans<br />
Nach diesen Betrachtungen werden auf den Seiten 32-35 "Die Savannen des Sudans" beschrieben. Drei Fotos<br />
auf der Seite 33 zeigen Menschen mit ihrem Beförderungsmittel, dem Esel, mit der Bildlegende: "Der Weg hat<br />
die typisch rote Farbe des trockenen Savannenbodens"; eine kleine Siedlung, mit der Legende "Savanne zur<br />
Regenzeit. Inmitten grüner Hirsefelder liegen die Gehöfte. Sie sind aus Lehm gebaut und dienen einer ganzen<br />
Sippe als Unterkunft.", sowie eine kleine, Festung mit der Bildlegende "'Burg' eines Häuptlings im Grasland<br />
des Sudan".<br />
Im Kapitel "Hirten Händler, Hackbauern" schreibt der Autor über die Bevölkerung auf Seite 34:<br />
Die offenen Grasländer waren schon frühzeitig recht dicht bevölkert; denn sie boten ausreichend Nahrung und legten den<br />
Menschen nur wenige natürliche Hindernisse in den Weg. Sudan oder arabisch "bilad as sudan" bedeutet "Land der<br />
Schwarzen". Und tatsächlich war der Sudan ursprünglich von Negern besiedelt. Zu ihnen sind aber wegen der leichten<br />
Durchgängigkeit des Landes hellhäutige Stamme aus Nordosten, aus Vorderasien, eingewandert. Dazu gehören die Haussa<br />
und Fulbe. Als Hirtenvölker waren sie den sesshaften Einwohnern an Beweglichkeit überlegen. Im Laufe der Zeit<br />
unterwarfen sie die einheimische Negerbevölkerung und vermischten sich mit ihr. Von den eingewanderten Stämmen<br />
haben die Sudanneger den Islam übernommen.<br />
Nicht nur der Sudan, auch die heutige Wüste Sahara, war einstmals Schauplatz zahlreicher menschlicher Akti-<br />
vitäten. So fanden Archäologen, etwa 300 km vom heutigen Tschadsee, ein über 8500 Jahre altes Boot, das<br />
eine für die damalige Zeit hochstehende technische Fertigung aufwies: "Das archaische Boot ist überaus fach-<br />
männisch gestaltet: Bug und Heck sind sorgsam zugespitzt, und der Stamm bis auf eine Wandstärke von fünf<br />
Zentimeter ausgehöhlt, vermutlich mit Hilfe eines Schwellbrandes..." (Geo 8/94, S. 159) Da wie im Text rich-<br />
tig erwähnt, dieses Gebiet ursprünglich von Schwarzafrikanern besiedelt war, muss das Boot einem geschick-<br />
ten Vorfahren der heutigen Menschen Schwarzafrikas zugeschrieben werden.<br />
Die einwandernden Völker gingen in der Regel rasch in den einheimischen Gruppen auf, so dass sich<br />
beispielsweise die Hausa durch ihre Sprache und Kultur von den benachbarten Völkern unterscheiden, dem<br />
Aussehen nach aber sind sie eindeutig Schwarzafrikaner. Auch die Überlegungen, hinter denen oft die Idee<br />
lag, alle Kultur sei Schwarzafrika von aussen zugekommen, haben wenig Bedeutung, da fast alle Volksgrup-<br />
pen Afrikas immer einer gewissen Durchmischung unterworfen waren. Mit viel Vorsicht lässt sich vielleicht<br />
sagen, dass gerade dort, wo es zu einer besonders starken Durchmischung kam, ein kultureller Wandel einsetz-<br />
te. Dieser hat jedoch wenig mit der Herkunft der einzelnen Volksgruppen zu tun.<br />
Die Verbreitung des Islams in Afrika ist aus der Karte "Religionszugehörigkeit" auf der Seite 574 im Anhang<br />
dieser Arbeit zu ersehen. Auf der Seite 34 fährt der Autor fort:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Die Haussa trifft man heute meist als Handwerker und Händler. Daher ist ihre Sprache im Sudan weit verbreitet. Die Fulbe<br />
sind dagegen vor allem Viehzüchter. Sie halten langhörnige Rinder, Ziegen und Schafe, in den trockeneren Gegenden auch<br />
Esel und Kamele. Ihr Lieblingstier ist das Pferd. Das Grasland eignet sich für die Herden sehr gut. Selbst das ausgedörrte<br />
Heu auf dem Halm bietet Nahrung. In der kurzen Regenzeit kann sogar die Dornsavanne vorübergehend als Weide genutzt<br />
werden. Viel lieber treiben die Nomaden jedoch ihre Tiere südwärts auf die abgeernteten Hirse-, Mais-, Bohnen- und<br />
Erdnussfelder. Im Süden der Trockensavanne, wo die Niederschläge zunehmen, ist bereits Regenfeldbau möglich. Wo man<br />
künstlich bewässern kann, wird Baumwolle und in zunehmendem Umfang auch Reis angebaut, namentlich im Binnendelta<br />
des Nigers und am Tschadsee. Durch den langen Transport zur Küste verteuern sich aber die erzeugten Güter sehr. Für den<br />
Weltmarkt wurde vor allem die Erdnuss wichtig.<br />
Im Text wird nicht erwähnt, dass verschiedene Hausa-Fürsten in Niger bis heute ihre eigenen Reittruppen<br />
unterhalten, die früher als schlagkräftige Armeen dienten. Noch heute steht das Pferd bei den Hausa derart<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 152
hoch in Ehren, dass die Tiere in den königlichen Stallungen ausschliesslich von Hand gefüttert werden.<br />
(Afrika: Das Königtum und seine Grenzen, 1986; zu den Hausa siehe auch die Seiten 142 und 191 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Vor hundert Jahren hat man mit dem Anbau dieser Pflanze, die aus Südamerika stammt, im Senegalgebiet begonnen.<br />
Später, als Eisenbahnen und Strassen das Hinterland erschlossen, legte man auch im Innern des Sudans Erdnussfelder an.<br />
Zu Beginn der Regenzeit wird der Boden mit der Hacke, die an einem kurzen Stiel befestigt ist, gelockert, die Saat in die<br />
Erde gebracht und das Saatloch mit der Hacke wieder zugedrückt. Wenn die Blühten der niedrigen Büsche befruchtet sind,<br />
neigen sich die Stempel zu Boden, und in der Erde reifen dann die Nüsse. Im Oktober/November werden sie mit<br />
harkenähnlichen Geräten aus dem Boden gekratzt. Die Erdnüsse werden entweder unverarbeitet exportiert oder als<br />
Erdnussöl und Ölkuchen.<br />
Der Erdnussanbau sollte mithelfen, den nach dem 2. Weltkrieg in Europa herrschenden Fett- und Ölmangel<br />
aufzufangen. Ausserdem hätten die durch den Handel erwirtschafteten Devisen dazu beitragen sollen, den<br />
Ankauf von Industriegütern der afrikanischen Länder zu finanzieren. Nicht überall hatten diese Pläne Erfolg,<br />
so wurde der Versuch der britischen Mandatsregierung, in Tansania grossflächig Erdnüsse zu kultivieren, zu<br />
einem Disaster. (Siehe dazu auch die Seiten 216 und 305 dieser Arbeit.) Auf den Seiten 34-35 fährt der Autor<br />
fort:<br />
Im Grasland der Trockensavanne sind ausgedehnte "Grossdörfer" entstanden, die sich meilenweit hinziehen. Die<br />
einstöckigen Lehmhäuser haben flache Dächer, fast fensterlose Aussenwände und sind um Innenhöfe herumgebaut. Hoch<br />
erheben sich die schlanken Türme der Minarette über das Gewirr der Gassen, in dem sich der Fremde nur schlecht<br />
zurechtfindet. Vieles erinnert hier an den Orient, nicht nur der Islam, sondern auch die Basare und das lebhafte Treiben der<br />
Handwerker. An Markttagen kommen oft Zehntausende aus den umliegenden Dörfern zu Fuss, zu Pferd, heute aber auch<br />
mit zahlreichen Autobussen in die Stadt. Die farbenprächtigen Gewänder der dunkelhäutigen Menschen bieten ein<br />
malerisches Bild.<br />
(Zu den lokalen Märkten siehe auch die Seiten 107 und 262 dieser Arbeit.) Die Kleider der Menschen in dieser<br />
Region Afrikas sind bis heute sehr bunt geblieben, auch wenn teilweise traditionelle islamische Kleidung in<br />
Weiss getragen wird. Die Buntheit der Kleidung wird durch die farbenprächtigen Muster der Stoffe, die teil-<br />
weise traditionell oft aber auch modern gestaltet sind, noch verstärkt. Die Märkte sind ein letzter Abglanz der<br />
einstmals mächtigen Handelsreiche der Region, deren damaliger Reichtum sich im gelegentlich getragenen<br />
Goldschmuck der Marktfrauen widerspiegelt. (Afrika: Wohlstand durch Handel, 1986)<br />
Der Autor fährt mit einem Rückblick in die Geschichte fort (S. 34):<br />
Früher waren diese stadtartigen Ansiedlungen, wie Timbuktu, Sokoto und Kano, bedeutende Handelsplätze an den grossen<br />
Karawanenstrassen, die sich von Westen nach Osten oder auch quer durch die Sahara ziehen. Für die in grossen Abständen<br />
reisenden Karawanen waren sie Stapelplätze der Waren. Doch das Gesicht dieser Städte wandelt sich rasch, wie alles in<br />
Afrika. Ausserhalb der alten Lehmmauern entwickeln sich in den wichtigeren Orten neue Stadtteile im europäischen Stil<br />
mit breiten Alleen und hohen Gebäuden. Flugplätze und Autorasthöfe ersetzen allmählich die Sammelpunkte der<br />
Karawanen, und der Handel der Gegenwart umfasst nahezu alle Gebrauchsgegenstände, die auch wir in unseren Läden<br />
kennen.<br />
Aus damaliger Sicht waren die Länder Afrikas, die mit neuem Selbstbewusstsein nach der Unabhängigkeit auf<br />
dem Weltmarkt Monopolstellungen für gewisse Rohstoffe erlangten, viel dynamischer als in den darauffolgen-<br />
den Jahren der wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Eine Sichtweise, die seit Anfang der neunziger Jahre wieder<br />
an Boden gewinnt und in 1998 gar als "New Hope for Africa" Schlagzeilen machte, denn der rasche politische<br />
Wandel Afrikas erregt wieder Aufmerksamkeit. Zur Feuchtsavanne schreibt der Autor (S. 34):<br />
In der Feuchtsavanne beginnt das geschlossene Wohngebiet der Neger. Die Sudanneger sind Hackbauern. Auch grössere<br />
Feldflächen bestellen sie mit der Hacke; den Pflug kennen sie nicht. Manche Stämme überlassen die Feldarbeit den Frauen,<br />
während die Männer auf Jagd und Fischfang gehen. Da in den waldreicheren Gebieten wegen der Tsetsefliege keine<br />
Viehhaltung möglich ist, fehlt auch der Dünger. Der Boden verarmt daher sehr schnell, und die Felder müssen nach einigen<br />
Jahren verlegt werden. Die Ackerfläche wandert gewissermassen um das Dorf herum. Für diesen wandernden Hackbau<br />
muss immer wieder neues Land gerodet werden. In der Feuchtsavanne wohnen weniger Menschen als in den offenen<br />
Grasländern; es gibt auch keine grossen Städte.<br />
(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seite 140 und 186 dieser Arbeit.) Eine Veränderung der Landwirtschaft<br />
könnte sich durch die Methoden der Agroforstwirtschaft anbahnen (siehe dazu die Seiten 424f. dieser Arbeit),<br />
wenn sie sich nicht als weiterer Irrtum in einer langen Kette von Fehlschlägen erweist, die bestehenden<br />
Anbaumethoden ohne langfristig negativen Folgen zu reformieren.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 153
Auf der Seite 35 findet sich unter dem Titel "Die jungen Staaten des Sudans" - nebst Kurzdaten zu den<br />
Ländern Senegal, Mali, Obervolta, Niger und Tschad - eine kurze Beschreibung der Sahelstaaten:<br />
Der grösste Teil des Sudans war einst französisches Kolonialgebiet. Daher haben auch die selbständig gewordenen jungen<br />
Republiken Senegal, Mali, Obervolta, Niger und Tschad nach wie vor enge wirtschaftliche Beziehungen zu Frankreich. Mit<br />
Ausnahme von Senegal sind sie Binnenstaaten. Der wichtigste Hafenplatz ist Dakar. Die Stadt hat in den letzten Jahren<br />
einen gewaltigen Aufschwung genommen. Sie ist das "Tor Westafrikas". Der Flugplatz ist nicht nur für Afrika von<br />
Bedeutung, sondern stellt auch eine wichtige Zwischenstation auf dem Wege von Europa nach Südamerika dar. Das<br />
moderne Dakar hat Hochhäuser, Industriewerke, grosse Verwaltungsgebäude und eine Universität. Überseeschiffe löschen<br />
an langen Betonkais Industriewaren aus Europa und Amerika. Als Rückfracht laden sie Erdnüsse, Erdnussöl, Baumwolle<br />
und Häute.<br />
Senegal gilt dank seiner politischen Stabilität nach wie vor als eines der Musterländer Afrikas, das in der<br />
Hauptstadt über eine moderne Infrastruktur verfügt. Dabei gerät in Vergessenheit, dass die Unterschiede<br />
zwischen Stadt und Land nicht grösser sein könnten. Nicht umsonst geriet das Land anlässlich des "Global<br />
March" gegen die Kinderarbeit von 1998 in die Schlagzeilen der Zeitungen. (Zur Kinderarbeit in Senegal siehe<br />
auch die Seite 344 dieser Arbeit.)<br />
Als Zusammenfassung findet sich auf der Seite 35 unter dem Titel "Zum Behalten" folgender Text:<br />
Der Sudan ist die Übergangslandschaft zwischen der Wüste und der Regenwaldzone am Äquator. Von Norden nach Süden<br />
folgen mit zunehmender Niederschlagsmenge und kürzerer Trockenzeiten aufeinander: die Dornsavanne, das Grasland der<br />
Trockensavanne und die Feuchtsavanne. Im dichter besiedelten Grasland wohnen meist hellhäutige Viehzüchter, in der<br />
von Bäumen belebten Feuchtsavanne Sudanneger. Sie treiben Hackbau. Erdnüsse und Baumwolle sind wichtige<br />
Ausfuhrgüter.<br />
Zwar nennt der Autor die wichtigsten Exportgüter, die Grundnahrungsmittel der Einheimischen werden aber<br />
nicht erwähnt.<br />
4.14.1.3 Äquatorialafrika<br />
Nach der Beschreibung des Sudan wendet sich der Autor auf den Seiten 36-44 unter dem Titel "Äquatorialafri-<br />
ka - Tropische Regenwälder" dem nächsten Grossraum zu. Auf den Seiten 36-37 findet sich unter dem Titel<br />
"Feuchtheisses Tropenklima" ein Text über den "Urwald" nach Leo Waibel. Im Kapitel "Der Urwald ist der<br />
Feind des Menschen" auf Seite 38 - auf der neben einer Graphik, die den Vergleich zwischen traditioneller und<br />
moderner Siedlungsform aufzeigt und die Bildlegende "Plan einer Siedlung im tropischen Regenwald" trägt,<br />
auch ein Foto "Fischersiedlung im Nigerdelta mit Kokospalmen und Bananenstauden" abgebildet ist - heisst es<br />
über die Bewohner:<br />
Trotz der üppigen Pflanzenwelt bietet der Urwald für den Menschen keine günstigen Lebensmöglichkeiten. Die<br />
sonnendurchflutete Region der Baumkronen liegt unerreichbar hoch über dem Boden. Das Blätterdach der Baumkronen<br />
verhindert das Eindringen der Sonnenstrahlen, so bleibt auf dem Waldboden eine ungesunde Treibhausluft. Ein Europäer<br />
kann die feuchte Hitze kaum ertragen, zumal auch die Nacht keine Abkühlung bringt. Die herabgefallenen Früchte<br />
verfaulen sehr schnell, es gibt nur wenige jagdbare Tiere. Dazu kommt die Insektenplage. So leben nur wenige Menschen<br />
im Regenwald: Es sind die kleinwüchsigen Pygmäen. Sie werden nur 1,40 m gross, haben aber eine kräftige muskulöse<br />
Gestalt. Ihre Haut ist nicht schwarz wie bei den Sudan- oder Bantunegern, sondern kupferfarben. Sie leben von kleineren<br />
Tieren, die sie sehr geschickt mit vergifteten Pfeilen erlegen; grössere Tiere werden in sorgfältig verdeckten Fallgruben<br />
gefangen und dann getötet. Bleibt der Jagderfolg aus, so ernährt sich die Horde von allem, was an Früchten, Wurzeln,<br />
Samen, Insekten und Weichtieren gesammelt werden kann. Diese umherschweifenden Sammler und Jäger leben in<br />
einfachsten Behausungen. In dem ständig feuchtwarmen Klima genügt ein Regenschutz aus grossen Blättern, die über<br />
biegsame Stöcke gedeckt werden.<br />
Die einst als "primitiv" bezeichneten "Pygmäen" werden in diesem Text als von kleiner aber "muskulöser<br />
Gestalt" geschildert. Sie sind "geschickt" und handeln "sorgfältig". Ihre Behausungen sind zwar einfach, erfül-<br />
len aber im tropischen Regenwald die Bedürfnisse ihrer Bewohner. (Zu den "Pygmäen" siehe auch die<br />
Seiten 147 und 172 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Im Urwald leben auch Negerstämme. Schwächere Stämme der Sudanneger wurden von stärkeren Völkern aus den<br />
Savannen in das Waldland abgedrängt. Von Süden stiessen die kräftigeren Bantuneger rodend und siedelnd in das dichte<br />
Waldland vor. Während die Pygmäen nur Sammler, Fischer und Jäger sind, legen die Neger Felder an. Sie kerben die<br />
Rinde einiger Bäume ringsum ein, so dass sie absterben müssen, und roden dann mit Feuer und Hackmesser das<br />
Buschwerk. Zwischen den stehengebliebenen Baumstümpfen pflanzen die Frauen mit dem Grabstock, dessen unteres Ende<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 154
spatenartig verbreitert ist, Bananen und Maniok. Die Maniokstaude wird 2 m hoch. Aus ihren Wurzelknollen gewinnt man<br />
Stärkemehl.<br />
Auch in diesem Lehrmittel findet sich also wieder die Gegenüberstellung von "Pygmäen" und Waldbantus.<br />
Maniok, auch Kassawa genannt, ist keine in Afrika ursprünglich heimische Pflanze. Sie wurde aus Brasilien<br />
eingeführt und verbreitete sich sehr rasch über grosse Teile des Kontinents. (Zur Maniokpflanze siehe auch die<br />
Seiten 115 und 242 dieser Arbeit.) Über die <strong>Pro</strong>bleme der Bodenbewirtschaftung in den Tropen schreibt der<br />
Autor auf der Seite 36:<br />
Der ungedüngte Boden ist schon nach wenigen Jahren erschöpft. Dann muss ein neues Stück gerodet werden, während der<br />
Urwald die alte Fläche rasch wieder überwuchert. Die Bantuneger halten einige Haustiere, neben Hühnern und Ziegen<br />
auch Schweine, die unter den Hütten nach Nahrung wühlen. Zum Schutze gegen Tiere und Feuchtigkeit werden die<br />
rechteckigen Hütten nämlich oft auf Pfählen errichtet. Unter mächtigen Palmen stehen sie in langer Reihe nebeneinander.<br />
Mit Hilfe der Trommelsprache, die im Wald weithin hörbar ist, verständigt man sich von Dorf zu Dorf.<br />
(Zur Trommelsprache siehe auch die Seite 137 und 434 dieser Arbeit.)<br />
Auf der Seite 39 findet sich, neben einem Foto "Buntes Treiben an der Oberguineaküste bei Akkra. Die Frauen<br />
wollen Fische kaufen.", welches in ähnlicher Art Ende der neunziger Jahre irgendwo an der westafrikanischen<br />
Küste hätte aufgenommen werden können, unter dem Titel "Die Landschaften Äquatorialafrikas - Oberguinea<br />
und das Kamerun-Kongo-Gebiet" auch folgender Textabschnitt:<br />
Die Oberguineaküste ist von Monrovia bis zum Kamerunberg eine Schwemmland- und Ausgleichsküste. Haffe und<br />
Strandseen sind durch Nehrungen vom Ozean getrennt. Fast immer steht vor der Küste eine hohe Brandung. Es fehlt an<br />
guten natürlichen Hafenplätzen. So können die grossen Schiffe nur weit draussen vor der Küste ankern. Die Afrikaner<br />
steuern mit erstaunlicher Geschicklichkeit ihre kleinen Boote durch den Brandungsgürtel. Sie bringen und holen Säcke,<br />
Ballen und Kisten, aber auch die Reisenden von oder an Bord.<br />
Ähnliche Beschreibungen finden sich bereits aus dem 18. Jh. So schreibt der "Seefahrer" Nettelbeck: "Die zu<br />
diesem Handel ausgerüsteten Schiffe pflegten längs der ganzen Küste von Guinea zu kreuzen. Sie hielten sich<br />
unter wenigen Segeln stets etwa eine halbe Meile vom Ufer. Wurden sie dann am Land von Negern erblickt,<br />
welche Sklaven oder Elefantenzähne zu verhandeln hatten, so machten diese am Land ein Feuer an, um dem<br />
Schiff durch den aufsteigenden Rauch ein Zeichen zu geben, dass es vor Anker ginge. Zu gleicher Zeit aber<br />
warfen sie sich auch in ihre Kanus und kamen an Bord, um die zur Schau ausgelegten Waren zu mustern.<br />
Gingen sie dann wieder, so versprachen sie, mit einem reichen Vorrat von Sklaven und Zähnen wiederzukom-<br />
men." (<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE, Nettelbeck, um 1775)<br />
Das nächsten Kapitel auf der Seite 40, auf der zwei Fotos "Elfenbeinmarkt in Kinshasa" und "Ein Mahagoni-<br />
baum wird gefällt, die Arbeiter stehen dabei auf einem 3 m hohen Gerüst." abgebildet sind, steht unter dem<br />
Titel "Der Handel lockt die Europäer an die Küsten Äquatorialafrikas". Der Autor schreibt über die Geschichte<br />
dieses Gebietes:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Kap Verde, das "Grüne Kap", nannten die ersten Seefahrer aus Europa den westlichen Vorsprung Afrikas... Die<br />
Mündungstrichter der kleinen Flüsse boten den Segelschiffen zwar nur wenige, aber gute Anlegeplätze. Hier konnten sie<br />
ihre Wasser- und Nahrungsmittelvorräte ergänzen. Aber es bot sich auch bald die Möglichkeit, gegen manchen billigen<br />
Tand von den Eingeborenen der Küstenstämme Waren einzutauschen, die in Europa hoch bezahlt wurden. Vor allem die<br />
Küste von Oberguinea war ihr Ziel. Dort konnte man den damals sehr wertvollen Pfeffer, dazu Gold und Elfenbein<br />
einhandeln. Noch heute tragen die einzelnen Küstenstreifen die Namen der wichtigsten Handelsgüter der damaligen Zeit.<br />
Viele Schiffe wurden aber auch mit lebendiger Fracht beladen: mit Schwarzen, die man als Sklaven für die schwere Arbeit<br />
auf den Plantagen der Neuen Welt verkaufte. Im dichtbesiedelten Nigergebiet machten arabische Sklavenjäger<br />
rücksichtslose Menschenjagden. Sie brachten ihre Beute gefesselt auf die Märkte an der Küste. Mancher Häuptling fand<br />
sich noch vor 150 Jahren bereit, seine Untertanen an die Sklavenhändler zu verkaufen.<br />
Als erstes der untersuchten Lehrmittel erwähnt der dritte Band von "Seydlitz für Realschulen" die Tatsache,<br />
dass sich die Schwarzafrikaner auch aktiv am Sklavenhandel beteiligten und nicht nur passive Opfer waren.<br />
Die dadurch verursachte Mitschuld kann bei der Begegnung eines Schwarzafrikaners und eines Afroamerika-<br />
ners zu einem gewissen Unbehagen führen, denn zweifelsohne waren die in die "Neue Welt" verschifften<br />
Menschen die grössten Verlierer des Dreieckhandels. Zwar verloren auch viele Zurückgebliebene durch den<br />
Menschenhandel ihre Verwandten, aber nicht wenige zogen daraus einen zumindest kurzfristigen Vorteil.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 155
Der bereits zitierte Nettelbeck schilderte die durch den Sklavenhandel bewirkten Veränderung im Zusammen-<br />
leben der schwarzafrikanischen Völker an der westafrikanischen Küste um 1775 mit den folgenden Worten:<br />
"Da hier Menschen als Ware angesehen wurden, mussten solche Artikel gewählt werden, welche den Schwar-<br />
zen am unentbehrlichsten waren... Einmal gewöhnt, diese verschiedenen Artikel von den Europäern zu erhal-<br />
ten, können und wollen die Afrikaner sie nicht missen. Sie sind darum unablässig darauf bedacht, sich die<br />
Ware zu verschaffen, welche sie dagegen eintauschen können. Also ist auch das ganze Land immerfort in klei-<br />
ne Parteien geteilt, die sich in den Haaren liegen und alle Gefangenen, welche sie machen, entweder an die<br />
schwarzen Sklavenhändler verkaufen oder sie unmittelbar zu den europäischen Sklavenschiffen führen. Wenn<br />
es ihnen an solcher Kriegsbeute fehlt, greifen ihre Häuptlinge, die eine despotische Gewalt über ihre Unterta-<br />
nen haben, auch diejenigen auf, welche sie für die entbehrlichsten halten. Oder es geschieht, dass der Mann<br />
sein Weib, der Vater sein Kind und der Bruder den Bruder auf den Sklavenmarkt zum Verkauf schleppt.<br />
Man wird leicht begreifen, dass es bei solchen Raubzügen an Grausamkeit nicht fehlt und dass sich alle diese<br />
Länder dabei in dem elendsten Zustand befinden. Ebensowenig aber kann auch geleugnet werden, dass die<br />
erste Veranlassung zu all diesem Elend von den Europäern herrührt, welche durch ihre eifrige Nachfrage den<br />
Menschenraub bisher begünstigt und unterhalten haben." (<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE, Nettelbeck, um 1775; zum<br />
Sklavenhandel siehe auch die Seiten 142 und 175 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Zur Erforschung und Eroberung des Inlandes durch die Europäer schreibt der Autor auf der Seite 40:<br />
In das ungesunde und gefährliche Innere drangen die Europäer erst viel später vor. Sie begnügten sich damit, befestigte<br />
Handelsplätze an der Küste anzulegen. Spanier und Portugiesen, Engländer und Franzosen, Holländer, Dänen und<br />
Brandenburger hatten hier ihre Faktoreien angelegt.<br />
Erst im 19. Jahrhundert entstanden aus diesen Handelsniederlassungen durch Verträge mit eingeborenen Häuptlingen, aber<br />
auch durch einfache Besitzergreifung ausgedehnte Kolonien oder Schutzgebiete. Das Deutsche Reich erwarb 1884 die<br />
Schutzgebiete Togo und Kamerun. Sie wurden nach dem ersten Weltkrieg vom damaligen Völkerbund als Mandate an<br />
England und Frankreich zur Verwaltung übergeben.<br />
So befand sich vor dem zweiten Weltkrieg fast ganz Äquatorialafrika im Besitz von drei Staaten: Frankreich,<br />
Grossbritannien und Belgien. Den Portugiesen und Spaniern verblieben nur kleine Reste: Portugiesisch-Guinea... und Sao<br />
Tome. In den letzten Jahren sind alle übrigen Kolonialgebiete selbständige Staaten geworden. So hat sich in wenigen<br />
Jahrzehnten die politische Karte Afrikas völlig gewandelt.<br />
Während das Lehrmittel "Geographie" des Kantons Thurgau um 1963 die Unabhängigkeit der schwarzafrika-<br />
nischen Staaten noch nicht thematisiert, wird diese 1968 als gegebene Tatsache sachlich beschrieben.<br />
Zu den "Staaten Äquatorialafrikas und ihrer Wirtschaft" schreibt der Autor (S. 40f.) über die Westküste:<br />
Von den Europäern wurden einst im Regenwaldgebiet Plantagen - landwirtschaftliche Grossbetriebe in den Tropen -<br />
angelegt. Von dort gelangen Bananen, Kaffee und Kakao, Kokosnüsse, Kolanüsse und Palmöl auf den Weltmarkt. Auch<br />
die Einheimischen haben inzwischen den Anbau dieser <strong>Pro</strong>dukte übernommen und dabei beträchtliche Fortschritte erzielt<br />
Der grösste Kakaolieferant der Welt ist Ghana, seine Hauptstadt Akkra der wichtigste Kakaoausfuhrhafen. Ausserdem<br />
kommen aus den Regenwäldern wertvolle Hölzer.<br />
(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 112 und 169 dieser Arbeit.) Auf der Seite 41 ist ein Foto "Träger brin-<br />
gen Kakaobohnen zur Sammelstelle", das zeigt, wie Schalen mit daraufliegenden Säcken, gefüllt mir Kakao-<br />
bohnen, auf dem Kopf getragen werden. Ausserdem werden Kurzdaten zu den Ländern Liberia, Guinea, Elfen-<br />
beinküste, Dahome, Togo, Sierra Leone, Ghana und Nigeria abgedruckt. Im Text heisst es weiter (S. 41):<br />
Der Bau leistungsfähiger Verkehrswege gehört zu den vordringlichsten Entwicklungsaufgaben der Staaten Oberguineas.<br />
An der Küste müssen - wie schon in Takoradi und in Tema - moderne Häfen entstehen, damit auch sperrige Güter:<br />
Maschinen, Eisenbahnwagen, Bagger und Industrieausrüstungen, sicher gelöscht werden können. Da früher jede<br />
Kolonialmacht ihre eigenen Eisenbahnlinien anlegte, verlaufen die Strecken meist nur als Stichbahnen ins Landesinnere;<br />
sie haben keine Verbindungen untereinander. Auch das Strassennetz genügt nicht den Ansprüchen; es müssen mehr<br />
Allwetterstrassen gebaut werden, die auch in der Regenzeit benutzbar sind. Bahnlinien und Strassen dienen vor allem dazu,<br />
die Bodenschätze, aber auch die landwirtschaftlichen Ausfuhrgüter zur Küste zu transportieren. Auch die Edelhölzer aus<br />
dem Regenwaldgebiet müssen mit der Eisenbahn oder mit dem Lkw zu den Sägewerken und Verschiffungsplätzen<br />
geschafft werden.<br />
Für den Transport von Personen hat sich in ganz Westafrika das Prinzip der privat geführten Kleinbusse durch-<br />
gesetzt, die in Ghana Trotros genannt werden. Für eine kleine Gebühr werden die Einheimischen in oder<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 156
ausserhalb der Stadt von einem Ort zum nächsten befördert und dies im Gegensatz zu den staatlichen Busbe-<br />
trieben, die häufig nur eine oder zwei Fahrten pro Tag anbieten, mit einer weit höheren Verkehrsfrequenz und<br />
zu günstigeren Zeiten.<br />
Zu den Bodenschätzen äussert sich der Autor (S. 41):<br />
Für den Ausbau der Industrie sind die wertvollen Bodenschätze der Oberguineaschwelle (Eisen-, Mangan-, Kupfer und<br />
Zinnerze, Bauxit, Gold und Diamanten) wichtig. Für die Verarbeitung der Bodenschätze ist vor allem elektrische Energie<br />
nötig. Sie wird aus Wasserkraft gewonnen. Grosse Staudämme am Niger und am Volta sind bereits entstanden oder im<br />
Bau.<br />
(Zum Voltastaudamm siehe auch die Seite 170 dieser Arbeit.) In den folgenden Abschnitten stellt der Autor<br />
kurz die verschiedenen Staaten Westafrikas vor. Zu Liberia schreibt er (S. 41):<br />
Liberia ist der älteste selbständige Staat Westafrikas. Er wurde 1822 von Nordamerikanern für von ihnen freigelassene<br />
Negersklaven gegründet. Die Hauptstadt Monrovia wurde benannt nach Monroe, dem damaligen Präsidenten der USA.<br />
Viele grosse Schiffe tragen am Heck den Namen ihres Heimathafens Monrovia. Sie gehören aber Ausländern, die ihre<br />
Tanker und Frachter unter liberianischer Flagge fahren lassen, weil der Staat nicht so hohe Steuern verlangt; ausserdem<br />
macht er für Ausrüstung und Sicherheit weniger Vorschriften. Amerikanische und europäische Firmen betreiben in Liberia<br />
Kautschukplantagen; seit einigen Jahren wird in Gemeinschaft mit deutschen Firmen das reichlich vorhandene Eisenerz<br />
abgebaut.<br />
(Zur Eisenerzgewinnung in Liberia siehe auch die Seiten 100 und 252 dieser Arbeit). Der Autor setzt seine<br />
Länderbeschreibung fort (S. 41):<br />
Die jungen Republiken Guinea, Elfenbeinküste, Dahome und Togo gehörten einst zum französischen Kolonialbesitz; sie<br />
pflegen auch heute noch enge wirtschaftliche Beziehungen zu Frankreich. Die Verkehrssprache ist Französisch. Ähnlich<br />
bestehen zwischen den einst britischen Besitzungen Sierra Leone, Ghana und Nigeria - mit Englisch als Verkehrssprache -<br />
besondere Verbindungen zu Grossbritannien. Ghana, früher Goldküste genannt, führt heute den Namen eines ehemaligen<br />
grossen Negerreiches im Sudan.<br />
(Zu den offiziellen Landessprachen siehe die Karte "Offizielle Amtssprachen" auf der Seite 572 im Anhang<br />
dieser Arbeit.) Für eine besondere Anbindung der Kolonien an Frankreich sorgte der CFA, der jahrelang durch<br />
die französische Währung gestützt wurde, im Zusammenhang mit der Einführung des Euros jedoch immer<br />
mehr in Frage gestellt wird.<br />
Auf der Seite 42 findet sich, neben zwei Fotos "Dorf in Nordnigeria" und "Im Hafen von Takoradi", eine<br />
Beschreibung des 1960 unabhängig gewordenen Nigeria, von dem es auch heisst, jeder fünfte Afrikaner sei ein<br />
Bewohner dieses Landes:<br />
Nigeria ist der volkreichste und dichtestbesiedelte Staat in Äquatorialafrika. Es reicht bis an den Tschadsee. Die<br />
ackerbautreibende Bevölkerung lebt in grossen stadtartigen Siedlungen, umgeben von hohen Lehmmauern. Lagos, der Sitz<br />
der Regierung, hat fast eine halbe Million Einwohner. Grösser noch ist Ibadan mit einer neuen Universität; es hat bereits<br />
mehr als 600'000 Einwohner.<br />
Unterdessen ist Lagos zu einer der grössten Städte Schwarzafrikas (10.3 Mio. Einwohner) angewachsen und<br />
die Bevölkerung Nigerias wird auf rund 120 Mio. Menschen geschätzt. (Weltatlas 1997; zu Nigeria siehe auch<br />
die Seiten 126 und 275, zu Lagos die Seite 279 dieser Arbeit.)<br />
Ähnlich wie in Nigeria errichteten viele der unabhängig gewordenen schwarzafrikanischen Staaten eigenen<br />
Universitäten, in denen aber oft noch Europäer tätig blieben.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Der Autor fährt fort mit der Beschreibung der des Einflussgebietes von Frankreich (S. 42):<br />
Die meisten Staaten in Äquatornähe gehörten früher zu Frankreich; heute bestehen dort die Republiken Kamerun, Gabun,<br />
Kongo (Brazzaville) und die Zentralafrikanische Republik, ein Binnenstaat, der bis an den Rand der Wüste reicht. Im<br />
Tiefland an der Küste liegen - ebenso wie in Oberguinea ausgedehnte Plantagen auf gerodeten Urwaldflächen. Dort<br />
gedeihen Bananen, Tabak, Kakao sowie Kautschukbäume. Im höhergelegenen Hochland von Adamaua, wo die<br />
Regenmengen geringer sind, ist der Anbau von Baumwolle und Erdnüssen möglich. Hier ist es auch gelungen, nach<br />
Ausrottung der Schlafkrankheit grosse Herden von Rindern, Schafen und Pferden zu halten. Durch chemische<br />
Bekämpfungsmittel und dadurch, dass man in den Sumpfgebieten die Brutstätten der Tsetsefliege mit einer dünnen<br />
Ölschicht bedeckte, konnte man der gefährlichen Seuche Herr werden. Aus den Waldgebieten der Niederguineaschwelle<br />
kommt das hellrote Gabun- oder Okoumeholz auf den Weltmarkt.<br />
Wenn der Autor schreibt, die Vernichtung der Tsetsefliege könne durch das Bedecken der "Brutstätten der<br />
Tsetsefliege mit einer dünnen Ölschicht" in den Sumpfgebieten erreicht werden, dann verwechselt er die<br />
Bekämpfung der Tsetsefliege mit der Bekämpfung der Malariamücke, bei der diese, wenn auch nicht gerade<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 157
umweltfreundliche Methode, Wirkung zeigt, da die Malariamücke tatsächlich in ruhig stehenden Gewässern<br />
brütet. Das Tsetsefliegenweibchen jedoch gebiert eine Larve in voller Lebensgrösse, die sie dann im Boden<br />
oder zwischen verrottenden Blättern vergräbt, wo die Larve die Metamorphose zur adulten Form vollzieht.<br />
Dementsprechend ist die "Ölschichtmethode" für die Tsetsefliege wirkungslos. (Infopedia 1996; zur Schlaf-<br />
krankheit siehe auch die Seiten 145 und 197 dieser Arbeit.) Der Autor fährt fort (S. 42):<br />
Die Republik Kongo ist der wichtigste Staat in Äquatorialafrika. Sein Gebiet war bis 1960 belgische Kolonie. Die Republik<br />
nimmt fast das gesamte Kongobecken ein, hat aber nur einen schmalen Zugang zum Ozean. Nachdem das Land<br />
selbständig geworden war, stürzten die grossen Gegensätze zwischen den einzelnen Stämmen die junge Republik in<br />
blutige Unruhen. Erst durch das Eingreifen der UN konnten die Streitigkeiten einigermassen beigelegt werden;<br />
überwunden sind sie noch keineswegs.<br />
Das unter dem Namen Zaire bekannte Land wurde jahrelang durch eine Führungselite um den 1997 durch eine<br />
Rebellenarmee aus dem Nachbargebieten Burundis und Ruandas gestürzten Mobutu Sese Seko wirtschaftlich<br />
ausgebeutet. Der Regierung Kabilas blickt die Weltöffentlichkeit nach kurzer Begeisterung mit Zurückhaltung<br />
entgegen. Allerdings hat die Demokratische Republik Kongo, wie sie nun genannt wird, viele Bodenschätze zu<br />
bieten, die aber infolge der politischen Instabilität und der schlecht ausgebauten Infrastruktur nur schlecht<br />
gefördert werden können. Erschwerend kommt die Nachbarschaft von Staaten hinzu, in denen bis in die späten<br />
neunziger Jahre Bürgerkrieg herrschte.<br />
Auf der Seite 42 beschreibt der Autor die "Leistungen" der ehemaligen Kolonialmacht Belgien:<br />
Das kleine Belgien hatte viel Geld und Arbeit für die Entwicklung seiner achtzigmal grösseren Kongokolonie<br />
aufgewendet. Unter unerhörten Mühsalen wurde eine Eisenbahnlinie durch den fieberverseuchten Urwald von Matadi nach<br />
Kinshasa (Leopoldville) gebaut; sie umging die Stromschnellen im Mündungsgebiet des Kongos. Über diese Strecke rollte<br />
das gesamte Material zum Bau von Werften und Schiffen nach Leopoldville. Mit Hilfe der dort gebauten Flussschiffe<br />
konnte man das Kongobecken weiter erschliessen und die wichtigen Güter des tropischen Regenwaldes, Kautschuk,<br />
Palmkerne, Bananen und Holz, ausführen. So wurde Kinshasa zum Hauptumschlagplatz des Landes. Mit prächtigen<br />
Häuserblocks an breiten Alleen ist es eine der modernsten Grossstädte Afrikas.<br />
Kinshasa ist mit rund 4.2 Mio. Einwohnern Ende des 20. Jahrhunderts einer der grössten schwarzafrikanischen<br />
Städte. Trotz seiner Hochhäuser, wohlhabenden Wohngebieten und der Funktion als geistiges und kulturelles<br />
Zentrum des Landes, kämpft die moderne Grossstadt mit den für viele Entwicklungsländer typischen <strong>Pro</strong>ble-<br />
men, wie Slumbildung - etwa ein Drittel der Einwohner, die oft aus den ländlichen Gegenden angezogen<br />
werden, leben in den Slumgegenden der Aussenbezirke -, hoher Arbeitslosigkeit, chaotischen Verkehrsverbin-<br />
dungen, unzureichenden Wohnmöglichkeiten und Lebensmittelknappheit. (Zu den Slums in Schwarzafrika<br />
siehe auch die Seite 235 dieser Arbeit.) Auf Seite 43 fährt der Autor fort:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Ausser diesen Handelsgütern verfügt die Republik Kongo aber auch über wertvolle Bodenschätze. Aus dem Kassaigebiet<br />
kommt mehr als die Hälfte aller Industriediamanten der Erde. Diese kleinen unansehnlichen Diamanten werden nicht als<br />
Schmuck verwendet, sondern für Bohr-, Schneid- und Schleifgeräte gebraucht. Im Hochland von Katanga, am Oberlauf<br />
des Kongo, finden sich reiche Vorkommen von Kupfer-, Kobalt-, Zinn und Uranerzen. In modernen Industriewerken<br />
werden sie z. T. im Lande selbst verarbeitet. Die Hüttenwerke in Katanga decken einen hohen Anteil des Weltbedarfs<br />
dieser Metalle. Die Hauptstadt des Katangagebietes ist Lubumbashi (Elisabethville). Sie liegt 1245 m hoch und hat ein<br />
gesundes Klima. Hier und in Jadotville glaubt man sich in ein europäisches Industriegebiet versetzt: Gleisanlagen,<br />
Abraumhalden, Werkstätten, Fabriken und moderne Wohnsiedlungen für die Bergarbeiter mit Schulen und<br />
Krankenhäusern zeigen das neue Gesicht Afrikas.<br />
Jadotville, das seit 1966 Likasi heisst, liegt ungefähr 100 km nordöstlich von Lubumbashi und ist ein<br />
Verkehrsknotenpunkt und Bergbauzentrum, in dem Kupfer und Kobalt gewonnen und verarbeitet, sowie Zink,<br />
Kalk und Kadmium verarbeitet werden. Ausserdem verfügt die Stadt, die rund 190'000 Einwohner zählt, über<br />
verschiedene Industrieunternehmen vor allem im Bereich Chemie. (Weltatlas 1997)<br />
Verkehrsmässig liegt das Industriegebiet von Katanga ungünstig, denn der Wasserweg über den Kongo ist lang und<br />
zeitraubend. Ausserdem müssen alle Güter zweimal umgeladen werden. Daher geht der Güterverkehr von und nach<br />
Katanga mit der Eisenbahn über die portugiesischen Häfen Beira in Mosambik am Indischen Ozean oder über Lobito in<br />
Angola am Atlantik.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 158
Beide Routen sollten ab 1975, nach der Unabhängigkeit der beiden Länder von Portugal, infolge der von<br />
Südafrika mitinitiierten Bürgerkriege wegfallen. Damit hatte die damalige Politik der Republik Südafrikas<br />
Auswirkungen bis weit in den Norden.<br />
Auf der Seite 43 sind auch zwei Fotos - "Kupfergrube in Lubumbashi, Katanga" und "Bananenplantage in<br />
Kamerun", das einen der auf Seite 156 dieser Arbeit erwähnten Kleinbusse mit Aufschrift "Trust in God"<br />
zeigt - abgebildet, sowie die Kurzdaten zu den Ländern Kamerun, Gabun, Demokratische Republik Kongo,<br />
Republik Kongo und Zentralafrikanische Republik abgedruckt. Unter "Zum Behalten" schreibt der Autor<br />
(S.43):<br />
...Dichte, menschenfeindliche Regenwälder bedecken weite Gebiete, vor allem das wasserreiche Kongobecken. Hackbau<br />
treibende Negervölker sind von Norden und Süden rodend und siedelnd in den Urwald vorgedrungen. Die tropische<br />
Plantagenwirtschaft liefert dem Weltmarkt Kakao, Erdnüsse, Kautschuk, Palmkerne und Bananen. Die Republik Kongo ist<br />
durch ihre reichen Bodenschätze im Katangagebiet der wirtschaftlich stärkste Staat in Äquatorialafrika.<br />
(Zur wirtschaftlichen Stärke der Demokratischen Republik Kongo siehe die Karte "Bruttosozialprodukt pro<br />
Kopf" auf Seite 569 im Anhang dieser Arbeit, weitere Hinweise finden sich auf der Seite 178.)<br />
Seite 44 zeigt eine Karte des besprochenen Gebietes, sowie eine Tabelle "Kakaoernte 1965". (Eine Tabelle zu<br />
Kakaoernten verschiedener Jahre findet sich auf Seite 552 im Anhang dieser Arbeit.) Auf der Seite 44 findet<br />
sich auch ein kurzer Abschnitt über "Die Inseln vor der Westküste Nordafrikas", der aber keine nennenswerten<br />
Angaben über die Bevölkerung macht.<br />
4.14.1.4 Südafrika<br />
Die Seiten 45-53 beschreiben den Grossraum "Südafrika". Nach den Kapiteln "Auch südlich des Äquators:<br />
Savannen - Wüste - Winterregengebiet" (S.45) und "Südafrika - eine hochgelegene Beckenlandschaft" (S. 46),<br />
sowie einem Foto "Dorf in Angola. Die Eingeborenen leben zum Schutz gegen Löwen in grossen Dörfern mit<br />
Palisadenzäunen. Eine Familie bewohnt mehrere der Rechteckhütten. Rinder und Ziegen werden abends in die<br />
Umzäunung getrieben.", den Kurzdaten zu den Ländern Angola, Mosambik, Rhodesien, Sambia und Malawi<br />
folgt auf den Seite 46-47 eine Beschreibung "Staaten der Savannenländer und ihre Wirtschaft":<br />
Portugal besitzt auf der West- und Ostseite Südafrikas noch grosse Gebiete: Angola am Atlantik und Mosambik am<br />
Indischen Ozean. Beide werden vom Mutterland als gleichberechtigte überseeische <strong>Pro</strong>vinzen behandelt; dadurch wird für<br />
die Bewohner das Gefühl der Abhängigkeit gemildert. Auch gibt es keine Rassentrennung zwischen Weissen und<br />
Farbigen. Dennoch sind Bestrebungen im Gange, Angola und Mosambik zu unabhängigen Staaten zu machen.<br />
Als die beiden Länder Angola un Mosambik 1975 nach langen und heftigen Auseinandersetzungen mit den<br />
Portugiesen, die Unabhängigkeit erreichten, folgten in beiden Ländern Guerillakriege, die teilweise von Kuba<br />
andererseits von der Republik Südafrika mitgetragen wurden und deren Auswirkungen bis weit in die neunzi-<br />
ger Jahre die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder massgeblich beeinflussten. (Zu Mosambik siehe auch<br />
das Zitat weiter unten.) Zu Angola schreibt der Autor (S. 46):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Angola reicht vom Rande des tropischen Regenwaldes am Oberlauf des Kassai über die Feuchtsavanne und die<br />
Trockenwaldzone bis in das Trockengebiet der Kalahari. Im feuchtwarmen Küstenbereich pflanzen die Bantuneger<br />
Ölpalmen und Bananen; in den trockeneren Savannengebieten werden Sisal, Baumwolle und Erdnüsse angebaut...<br />
Angola, der einstmals viertgrösste Kaffee-Exporteur der Welt, erwirtschaftete den Grossteil seiner Devisen<br />
durch die Förderung von Erdöl vor der Küste des Landes und den Diamantenverkauf, der sich aber grössten-<br />
teils in der Hand der UNITA, einer Rebellenorganisation, befindet. Den Einnahmen von rund 4 Mrd. US$ aus<br />
Erdöl und weiteren geschätzten 1 Mrd. US$ aus dem Diamantenverkauf steht ein durch den seit Jahren immer<br />
wieder aufflammenden Bürgerkrieg angehäufter Schuldenberg von über 11 Mrd. US$ gegenüber. Um nicht<br />
zahlungsunfähig zu werden, hat die Regierung die Zahlung der Löhne an die meisten Staatsangestellten 1998<br />
für mehrere Monate eingestellt. Durch den Bürgerkrieg und die während den Jahren der Auseinandersetzungen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 159
vergrabenen Landminen wurde die Landwirtschaft erheblich behindert. Sie ist nicht nur in eine reine Subsi-<br />
stenzwirtschaft zurückgefallen, 1998 lebten auch rund 40% der geschätzten 12.4 Mio. Einwohner, von denen<br />
Ende 1996 1.2 Mio. als Binnenflüchtlinge galten, in der 1575 von den Portugiesen gegründeten Hauptstadt<br />
Luanda, die im Gegensatz zu den ländlichen Gegenden sicher vor den Truppen der UNITA-Rebellen ist.<br />
Bedingt durch diese Überbevölkerung und die mangelnde Versorgungslage zählte Luanda 1998 zu den teuer-<br />
sten Städten der Welt. Wie es die dort lebenden Angolaner im Anbetracht der wirtschaftlichen Situation des<br />
Landes schaffen, über die Runden zu kommen, bleibt ein Rätsel. (Economist 11.04.98, S. 38-39;<br />
zu Angola siehe auch die Seite 203 dieser Arbeit.) Über die wirtschaftlich wichtigen Gebiete Mosambiks<br />
berichtet der Autor (S. 46):<br />
Mosambik hat nur im Hochland beiderseits des Sambesi Anteil an der Trockensavanne... Die wirtschaftlich wichtigste<br />
Landschaft ist das breite und 2000 km lange, niedrige und feuchtheisse Küstenland. Hier werden mit Hilfe schwarzer<br />
Plantagenarbeiter Zuckerrohr, Tabak, Reis und Kokospalmen gepflanzt. Der Hafen Mosambik wurde schon 1508 als<br />
Stützpunkt für die portugiesischen Handelsschiffe auf dem Wege nach Indien angelegt. Beira hat heute grössere<br />
Bedeutung, denn von hier führen mehrere Bahnlinien ins Hinterland, vor allem die Erzbahn ins Katangagebiet. Für das<br />
wichtige südafrikanische Bergbaugebiet Transvaal ist die Hauptstadt Lourenço Marques der Hauptein- und -ausfuhrhafen...<br />
Der auf die Unabhängigkeit folgende 16jährige Guerillakrieg kostete über 600'000 Menschen das Leben. Ein<br />
Viertel der 18-Millionen-Bevölkerung musste aus ihren Dörfern fliehen. Erst 1992 kam auf Druck der interna-<br />
tionalen Gemeinschaft ein Friedensvertrag zustande, der das für den Welthandel mit Fernost wichtige Land<br />
wieder nutzbar mache sollte. (Das Magazin 25/1998, S. 27-28) Die Wahlen von 1994 gewann der seit 1986<br />
amtierende Präsident Joaguím Chissano. Die Wahlen im Juni 1998 gerieten durch den Boykott der ehemaligen<br />
Rebellenorganisation Renamo, die das Land, zuerst unterstützt vom damaligen Rhodesien, dann von Südafri-<br />
ka, jahrelang terrorisierte, in Misskredit. (Economist 23.0.98, S. 44; zu Mosambik siehe auch die Seite 203<br />
dieser Arbeit.) Zu den weiteren Ländern der Region schreibt der Autor auf der Seite 47:<br />
Rhodesien, Sambia und Malawi am langgestreckten Njassasee liegen ebenfalls im Bereich der Trockensavanne, am Nordund<br />
Nordostrand des südafrikanischen Beckens... Alle drei Gebiete hatte einst der englische Staatsmann Cecil Rhodes, an<br />
den noch der Name Rhodesien erinnert, für Grossbritannien erworben. In den Jahren 1963/64 wurden die heutigen Staaten<br />
Malawi und Sambia selbständig, sie gehören auch weiterhin dem Commonwealth of Nations an. Beide Länder werden von<br />
Farbigen regiert. In Rhodesien dagegen hat die von Weissen gebildete Regierung 1965 - gegen den Willen<br />
Grossbritanniens ihre Unabhängigkeit vom britischen Mutterland erklärt. Die hier ansässigen Weissen sind zahlenmässig in<br />
der Minderheit gegenüber den Afrikanern. Im Falle der politischen Gleichberechtigung aller Bewohner gäbe es eine<br />
farbige Mehrheit in der Regierung. Die Weissen, die heute die gesamte Wirtschaft beherrschen, würden dann kaum noch<br />
Einfluss haben.<br />
Ziel der Unabhängigkeitsbewegung des damaligen Rhodesiens war es, politische Reformen, die von Grossbri-<br />
tannien befürwortet wurden, zu verhindern. Erst nach einem Boykott durch Drittländer, jedoch nicht die Nach-<br />
barländer Mosambik und Südafrika, und einem mehrjährigen bewaffneten Kampf gelang es der schwarzen<br />
Bevölkerungsmehrheit, ihre politischen Interessen geltend zu machen. Die von anderen Staaten akzeptierte<br />
Unabhängigkeit wurde so erst 1980 erreicht. Die Auswirkungen der damaligen Politik sind bis heute spürbar,<br />
letztmals als Präsident Mugabwe eine Enteignung der immer noch im Besitz von Weissen stehenden grossflä-<br />
chigen Ländereien ankündigte.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Die afrikanische Schriftstellerin Nozipo Maraire beschrieb in ihrem Buch "Vergiss nicht dein Afrika" die<br />
Bedeutung der durch die Unabhängigkeit bewirkten Veränderungen für die schwarze Bevölkerung:<br />
"Rhodesien war für mich ein verbotenes Land, eine Tummelwiese für die Weissen. Es gab riesige Häuser,<br />
makellose Schulen, Safariparks und Clubs, aber wegen meiner Hautfarbe war mit der Zugang verwehrt. Ich<br />
stand immer draussen, spähte sehnsuchtsvoll hinein und dachte: 'Wie fühlt sich das wohl an? Wie mag das<br />
wohl schmecken?' Und erst nach Jahren des Blutvergiessens und des Aufruhrs wusste ich, wie schön das Leben<br />
hier sein konnte... Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich wie angewurzelt in der Stadt auf einem<br />
Bürgersteig stand und zusah, wie sie diese furchtbaren, ausgrenzenden Buchstaben, die R-H-O-D-E-S-I-E-N<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 160
ergaben, vom Ratshaus nahmen und statt dessen nach und nach den Namen zusammensetzten, der mir den<br />
Schlüssel zum Königreich meines eigenen Landes gab. Ich habe in Rhodesien gewohnt, aber in Simbabwe lebe<br />
ich." (Maraire 1996, S. 71)<br />
Nicht weiter auf die politische Lage "Rhodesiens" eingehend, beschreibt der Autor die wirtschaftlichen<br />
Möglichkeiten von Sambia und dem heutigen Simbabwe:<br />
Sambia und auch Rhodesien besitzen wertvolle Bodenschätze. Die Kupfervorkommen in Katanga und Sambia bilden<br />
zusammen das grösste Kupfererzgebiet der Welt. In Rhodesien baut man Chrom und Eisenerz, Gold und Asbest ab. Die<br />
Bergbauorte sind das Ziel Tausender schwarzer Wanderarbeiter, die aus den umliegenden Staaten stammen und rasch zu<br />
Geld kommen wollen. Der Transport der Bodenschätze erfolgt auf der Nord-Süd-Bahn, die Rhodesien mit Katanga und<br />
dem Kongo verbindet. Für die Versorgung der Industriezentren mit Elektrizität ist ein gewaltiges Kraftwerk am Sambesi<br />
entstanden; der Stausee in der Karibaschlucht ist 320 km lang, die Staumauer 125 m hoch.<br />
(Zum Karibastaudamm siehe auch die Seite 227, zu Sambia die Seite 312, zu Simbabwe die Seite 183 dieser<br />
Arbeit.) Auf den Seiten 47-48 schreibt der Autor unter dem Titel "Die Kalahari - trockene Mitte Südafrikas"<br />
über die dort lebende Bevölkerung:<br />
Nur wenige Menschen leben in dieser Halbwüste. Die Betschuanen gehören zu den Bantustämmen. Die Trockenheit<br />
zwingt sie, mit ihren Rinderherden von Weide zu Weide über weite Flächen zu ziehen. Dürftige Hirse- und Maisfelder<br />
liegen in der Nähe der Viehkrale. Die Reste der kleinwüchsigen gelbhäutigen Buschmänner wurden von den Weissen und<br />
Afrikanern in die trockensten Teile der Kalahari abgedrängt. Unter ständiger Gefährdung durch den Dursttod haben diese<br />
Menschen erstaunliche Fähigkeiten entwickelt, über grosse Entfernungen Wasser aufzuspüren. Sie leben als Sammler und<br />
Jäger und sind allen Zufällen des ungünstigen Klimas ausgesetzt.<br />
Seit 1966 gibt es auch in diesem wirtschaftlich ärmsten Teil Südafrikas einen unabhängigen Staat: das Commonwealthland<br />
Botswana (das ehemalige Betschuanaland).<br />
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 149 und 181 dieser Arbeit.) Die Bewohner Botswana, dessen<br />
Name sich vom Volk der Tswana ableitet, gehören am Ende des 20. Jahrhunderts statistisch gesehen zu den<br />
wohlhabendsten Schwarzafrikanern überhaupt. Das <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen übertrifft sogar dasjenige Südafri-<br />
kas. Den wirtschaftlichen Aufschwung verdankt das einstmals arme Land dem Diamantenabbau. So schrieb<br />
dann auch Hans Brandt in einem Artikel des Tages-Anzeigers vom Juni 1998: "Ohne Diamanten wären die<br />
1.5 Millionen Menschen in Botswana Bewohner eines vergessenen, bettelarmen Landes von der Grösse Frank-<br />
reichs irgendwo in der Kalahari-Wüste. Statt dessen ist Botswana der Musterschüler Afrikas, wohlhabend und<br />
wirtschaftlich zuverlässig, stabil demokratisch und frei von ethnischen Konflikten." (TA 10.06.98, S. 4) Trotz<br />
dieses finanziellen Reichtums, lebt ein grosser Teil der Bevölkerung von der Subsistenzwirtschaft - die Land-<br />
wirtschaft trägt nur etwa 5.5% zum BIP bei und etwa 80% des Nahrungsmittelbedarfs müssen importiert<br />
werden. (Weltatlas 1997) Hinzu kommt, dass fast die Hälfte der Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt: "In<br />
einem Land", in dem die Viehzucht die Hälfte der Bevölkerung ernährt, und "in dem ein Mann seinen Reich-<br />
tum oft noch an der Zahl seiner Kühe misst, hat fast die Hälfte aller Familien gar kein Vieh mehr." (TA,<br />
10.06.98, S. 4) Das Ungleichgewicht in der Einkommensverteilung spiegelt sich auch in der hohen Arbeitslo-<br />
senrate, die je nach Schätzung mit 20-40% angegeben wird. Die Regierung bemüht sich zwar um eine gute<br />
Schulbildung, die die Zukunft des Landes sichern soll, kämpft andererseits aber mit einer Aidsepidemie, die<br />
nach Angaben der UNAIDS zu einer der höchsten HIV-Infektionsraten der Welt geführt hat. (Siehe dazu auch<br />
die Karte "Das neue Bild Afrikas: Der Aidskontinent" im Anhang auf der Seite 577, und zu Botswana die Seite<br />
208 dieser Arbeit.)<br />
Die Kurzdaten zu Botswana und Südafrika sind ebenfalls auf der Seite 48 zu finden. Nach diesen Beschreibun-<br />
gen folgt ein Kapitel über das wirtschaftlichst stärkste Land Afrika südlich der Sahara, der "Republik<br />
Südafrika":<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Die Republik Südafrika ist der grösste und wichtigste Staat Südafrikas... Vielfältig ist das Bild seiner Bewohner. Neben<br />
Weissen und Mischlingen sieht man Neger in europäischer oder bunter Kleidung, dazu Inder oder Malaien mit Turban.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 161
Seite 49 zeigt eine Foto mit der Bildlegende: "Blick über Geschäftshäuser von Johannesburg auf die hellen<br />
Abraumhalden der Goldbergwerke". Der Autor fährt in seiner Beschreibung der Landschaften fort:<br />
...Karru ist ein Wort der Hottentottensprache und bedeutet "trockenes Land". Da das dürftige Gras nur Ziegen und Schafen<br />
ausreichendes Futter geben kann, haben die Siedler vor allem Schaffarmen eingerichtet. Gelegentlich fallen starke<br />
Regengüsse. Dann füllen sich die trockenen Flussläufe rasch mit reissenden Fluten.<br />
Auf Seite 50 heisst es über Johannesburg:<br />
Johannesburg, die grösste Stadt Südafrikas, ist von Goldfeldern umgeben. Vor 80 Jahren gab es diese Stadt noch nicht,<br />
heute hat sie 1,2 Mill. Einwohner, darunter 410'000 Weisse. Das Klima ist für sie gesund und angenehm. In den<br />
Aussenbezirken haben viele von ihnen prächtige Wohnhäuser inmitten gepflegter Gärten. Für die farbigen Afrikaner<br />
werden saubere, geräumige Wohnviertel gebaut...<br />
Die Lebensumstände der meisten Schwarzen in der Republik Südafrika, die sich auch nach dem Machtwechsel<br />
von 1994 in wirtschaftlicher Sicht nur wenig geändert haben, strafen diese, der <strong>Pro</strong>paganda der damaligen<br />
südafrikanischen Regierung entsprungenen "sauberen, geräumigen Wohnviertel", Lüge.<br />
Auf der gleichen Seite folgt eine Beschreibung Südwestafrikas, dem heutigen Namibia, dessen Kurzdaten auf<br />
der Seite 50 abgedruckt sind. Über die Bewohner des Landes heisst auf der Seite 51:<br />
...Als die ersten Siedler - angeregt durch den Bremer Kaufmann und Kolonialpionier Lüderitz - ins Land kamen, ahnten sie<br />
noch nichts von den wertvollen Bodenschätzen des Landes, den Diamanten in der Namib und dem Kupfererz im<br />
Otawi-Bergland. Ihr Ziel war das weite Grasland jenseits der Grossen Randstufe, das ihnen als Viehzuchtgebiet geeignet<br />
erschien. Oft trafen sie bei ihrer Landnahme auf den Widerstand der eingeborenen Hirtenvölker, der stolzen Hereros und<br />
der Kaffern. Das Deutsche Reich nahm diese Gebiete unter seinen Schutz, und bald schufen sich viele Deutsche in<br />
"Südwest" eine neue Heimat.<br />
(Zu Namibia siehe auch die Seite 227 dieser Arbeit.) Der Landraub, denn das Gebiet war ja bereits besiedelt,<br />
wird hier zur Landnahme, der sich die "Eingeborenen" nach Kräften widersetzten.<br />
Die gleiche Seite zeigt auch ein Foto "Auf einer Schaffarm im Nordwesten der Kapprovinz, Südafrika". Auf<br />
Seite 52 finden sich die beiden Fotos "Native township, ein Stadtbezirk am Rande von Johannesburg, der für<br />
Afrikaner angelegt wurde." und "Hirte vom Ovambostamm. Er hat alles bei sich, was er als Hirte braucht:<br />
Lebensmittel, Keule, Pfeil und Bogen."<br />
Über die Bevölkerung Südafrikas schreibt der Autor auf der Seite 52:<br />
...1961 ist Südafrika aus der britischen "Völkergemeinschaft" ausgeschieden. Der Grund war die Rassenfrage. 3.3 Mill.<br />
Weisse leben in der Republik... Ausser den Weissen leben aber noch 14 Mill. schwarze Afrikaner, Inder und Mischlinge im<br />
Lande. Sie sind jedoch an der Regierung des Landes nicht beteiligt. Überall in der Republik Südafrika fällt auf, dass Weisse<br />
und Schwarze streng voneinander getrennt sind. Die Afrikaner haben ihre eigenen Schulen, Kirchen, Eisenbahnabteile,<br />
Postschalter, Restaurants und Kinos; die der Weissen dürfen sie nicht betreten. Für gleiche Leistungen werden die<br />
schwarzen Arbeiter niedriger bezahlt als die weissen. Vor allem dürfen sie keine Ehe mit Weissen eingehen. Ihre<br />
Wohnviertel liegen abseits von denen der Weissen. Am Abend müssen sie die Stadtteile der Weissen verlassen, selbst<br />
wenn sie als Arbeiter tagsüber dort beschäftigt werden. Man nennt die Rassentrennung "Apartheid" oder englisch<br />
"Segregation". Die Folgen sind für die Betroffenen oft sehr hart und führen zu starken Spannungen im Zusammenleben der<br />
Bevölkerung.<br />
Im Gegensatz zu anderen Lehrmitteln, die versuchten, die unhaltbaren Zustände in Südafrika zu beschönigen<br />
und dafür allerlei Argumente bezüglich der Fähigkeiten der Schwarzen und ihrer privilegierten Situation unter<br />
der Herrschaft der Weissen, anführten, spricht der Autor Klartext. Er fährt fort (S. 52):<br />
Die Weissen besitzen den grössten Teil des Landes. Sie haben Südafrika zu dem gemacht, was es heute ist. Sie brauchten<br />
aber dazu die Arbeitskraft der Neger. In den trockenen Grasländern... lebten ursprünglich nur wenige Eingeborene. Daher<br />
mussten im Laufe der Zeit aus anderen Gebieten, sogar aus dem Kongobecken, Arbeiter angeworben werden. Alljährlich<br />
kommen Tausende von Afrikanern, meist Angehörige der Bantustämme, in die grossen Industrieorte. Manche kehren nach<br />
Ablauf ihrer Arbeitsverträge wieder in den Busch zurück; viele aber bleiben für immer. Sie lösen sich von ihrem<br />
Stammesverband und geben allmählich ihre bisherige Lebensform auf. Ohne die Arbeit dieser Menschen kann die<br />
Wirtschaft des Landes nicht gedeihen - das wissen auch die schwarzen Afrikaner. Sie wollen deshalb das politische Leben<br />
mitbestimmen.<br />
Eines der Argumente gegen die Abschaffung der Apartheid war die Aussage, dass Schwarze von ausserhalb<br />
nach Südafrika einströmen würden, d.h. die Apartheid wäre gerechtfertigt, da es unter ihr den Schwarzen<br />
besser ginge, als in den schwarzafrikanischen Ländern. Der Autor relativiert diese Aussage durch die Erwäh-<br />
nung der Anwerbung. Über die Politik der Regierung schreibt er (S. 52):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Die Regierung bemüht sich, das Rassenproblem dadurch zu lösen, dass sie für die Bantuneger Staatsgebiete schafft, in<br />
denen sie nach und nach selbständig alle Fragen ihres wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens regeln können.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 162
Als erstes autonomes Bantugebiet schuf man 1963 das Transkei südwestlich von Durban. Die Weissen wurden<br />
ausgesiedelt. In dieser Form sollen allmählich die vielen zerstreuten Negerstämme in acht selbständigen Bantustaaten -<br />
Bantustan genannt zusammengeschlossen werden. Einer davon ist das Ovamboland im Grenzgebiet von Südwestafrika<br />
und Angola.<br />
Obwohl die UNO klar festhielt, dass die Praxis Südafrikas menschenunwürdig sei, schritt sie nicht ein, selbst<br />
dann nicht, als Südafrika die Apartheidspolitik über die eigenen Grenzen ins Mandatsgebiet Südwestafrika<br />
(Namibia) ausdehnte. (Sie dazu auch die Seite 362 dieser Arbeit.)<br />
Zwei Eingeborenenreservate liegen innerhalb der Republik Südafrika. Lesotho (ehemals Basutoland) ist seit 1966 ein<br />
unabhängiger Staat, Swasiland untersteht dagegen noch der britischen Regierung. Weisse dürfen in den Reservaten kein<br />
Land erwerben. Sie sind nur vorübergehend als Berater, Kaufleute, Ingenieure oder als Missionare tätig. Auch aus diesen<br />
Gebieten, ebenso wie aus Botswana, gehen viele Afrikaner für kürzere oder längere Zeit als Arbeiter in die<br />
südafrikanischen Industriereviere.<br />
(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 149 und 182 dieser Arbeit.) Auf der Seite 53 sind die Kurzdaten<br />
zu Lesotho, Swasiland und Madagaskar, sowie eine Karte zum Grossraum Südafrika abgedruckt. Über die<br />
Insel "Madagaskar - eine Tropeninsel" heisst es (S. 53):<br />
...Die dunkelhäutigen Madagassen haben sich mit Malaien vermischt, die von Südasien her mit ihren seetüchtigen Booten<br />
eingewandert sind. Auf der Insel, vor allem in der Hauptstadt Tananarivo, leben noch viele Franzosen. Nach 1845 gehörte<br />
Madagaskar nämlich zum französischen Kolonialreich; heute ist es ein unabhängiger Staat. Über den Haupthafen<br />
Tamatave an der Ostküste führt die Insel neben anderen Tropenfrüchten die getrockneten Schoten der Vanille aus. Sie wird<br />
ebenso wie Reis, Zuckerrohr, Kokospalmen und Erdnüsse in Pflanzungen angebaut.<br />
1994 standen Kaffee mit 18% des Gesamtwertes, Vanille (17%) und Fisch (13%) im Zentrum der Exporte, die<br />
mit insgesamt 520 Mio. US$ die Importe nicht vollständig decken konnten. (Zu Madagaskar siehe auch die<br />
Seiten 115 und 184 dieser Arbeit.)<br />
Auf der gleichen Seite finden sich unter der Überschrift "Zur weiteren eigenen Arbeit" Fragen und Aufgaben<br />
für die Schüler, von denen hier drei wiedergegeben werden sollen, weil sie einen Einblick in die Sichtweise<br />
des Buches geben:<br />
3. Bedenke die Folgen der Apartheid-Politik vom Standpunkt eines weissen und eines farbigen Südafrikaners! Warum<br />
gewährt die südafrikanische Regierung den Farbigen ihres Landes nicht die volle Gleichberechtigung?<br />
4. Überlege, was sich für einen schwarzen Afrikaner geändert hat, wenn er nach drei Jahren Arbeit im südafrikanischen<br />
Industriegebiet in sein Heimatdorf in der Savanne zurückkehrt!<br />
5. Welche südafrikanischen Erzeugnisse werden in Anzeigen und Läden bei uns angeboten?<br />
Neu ist der Versuch nicht mehr (nur) aus der Sicht des europäischen Kolonisten zu argumentieren, sondern<br />
sich versuchsweise in die Haut eines "farbigen" Menschen hineinzudenken. In Verbindung mit der Fragen nach<br />
den Erzeugnissen Südafrikas ist der Schritt zum Erkennen grösserer Wirtschaftszusammenhänge und damit<br />
vielleicht gar zum Boykott gewisser <strong>Pro</strong>dukte nicht mehr weit.<br />
Damit ist "Seydlitz für Realschulen" das erste der untersuchten Lehrmittel, welches eine Tendenz zeigt,<br />
Geographie und Politik zu verknüpfen. Beschränkten sich die früheren Lehrmittel auf eine mehr oder wenig<br />
akkurate Beschreibung der herrschenden Zustände, so zeichnet sich hier bereits die Frage nach der Verantwor-<br />
tung des Einzelnen für die vorgefundenen Verhältnisse ab.<br />
Am Schluss der Betrachtungen zu Südafrika heisst es unter "Zum Behalten" auf Seite 53:<br />
...Plantagen in der feuchtwarmen Küstenzone und Viehzucht im Grasland bilden für die Republik Südafrika wichtige<br />
Grundlagen der Wirtschaft. Sambia, Rhodesien und die Republik Südafrika sind reich an Bodenschätzen, vor allem an<br />
Gold, Diamanten, Kupfer und Steinkohle.<br />
Im südlichen Afrika bietet das Klima für den Europäer günstige Lebensmöglichkeiten. Die Interessen der weissen und der<br />
schwarzen Bevölkerung stossen hier hart aufeinander. Durch die Politik der "Apartheid", der völligen Rassentrennung,<br />
versucht die Republik Südafrika eine Lösung für das Zusammenleben der so verschiedenen Afrikaner zu finden.<br />
Wie diese Lösung über mehrere Jahre im Detail funktionierte und was für Folgen sie zeitigte, ist Gegenstand<br />
der politischen Aufarbeitung im seit 1994 demokratischen Südafrika.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 163
4.14.1.5 Ostafrika<br />
Auf den Seiten 54-60 wird der Grossraum "Ostafrika" beschrieben. Nach den drei Kapiteln "Savanne in Äqua-<br />
torbreite" (S. 54), "Die Savannen Ostafrikas, die wildreichsten Gebiete der Erde" (S. 54) und "Die drei Land-<br />
schaften Ostafrikas" (S. 54-55) folgt auf den Seiten 55-56 ein Text über "Hackbauern und Hirtenvölker":<br />
Die Bantuneger haben in Ostafrika ihre Heimat. Sie wohnen in runden Hütten; das Kegeldach ist mit harten Gräsern<br />
gedeckt. Rings um die kleinen, von Dornbuschhecken geschützten Dörfer liegen die Felder. Die Frauen brechen bei<br />
beginnender Regenzeit mit der Hacke die oberste Bodenkrume und drücken Hirse- und Maiskörner in den Boden. Da der<br />
Boden nicht gedüngt wird, ist er nach einigen Jahren erschöpft. Dann verlegt man die Felder und häufig auch die<br />
Siedlungen. An den Hängen der Vulkanberge aber, wo der Boden fruchtbarer und genügend feucht ist, kann er dauernd<br />
genutzt werden. An manchen Stellen leben mehr als 200 Menschen je km 2 .<br />
In der weiträumigen Trockensavanne weiden die Massai, ein Hirtenvolk, ihre grossen Rinderherden. Das Vermögen des<br />
Mannes besteht aus seinen Rindern: je zahlreicher die Herde, desto reicher ist er. Die Massai sind einst aus dem Norden<br />
eingewandert. Die Erziehung der männlichen Jugend ist bei ihnen sehr streng und vollzieht sich in einer geschlossenen<br />
Gemeinschaft. Hier wird der junge Mann im Gebrauch der Waffen und in der Jagd unterwiesen. Treibjagden auf Löwen<br />
veranstaltet man als Mutprobe nur mit Speer und Schild. So unterscheidet sich ihre Lebensweise sehr von der der Bantus.<br />
Im Gegensatz zu vielen Bantuvölkern gliedern die Massai ihre Gesellschaft in Altersgruppen, denen bestimmte<br />
Aufgaben zukommen. Das Grundelement der Gesellschaft ist also nicht die Familie, sondern die Gruppe<br />
Gleichaltriger. Ursprünglich liessen die Massai ihr Vieh, das ihnen ihre Hauptnahrung Kuhmilch und Rinder-<br />
blut liefert, im Hochland Kenias weiden. Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Massai ihre Blütezeit erreichten,<br />
fielen die Briten in das Gebiet ein und schleppten die Pocken ein, die die Massai schwächten, und die Rinder-<br />
pest ein, die einen Grossteil der Herden vernichtete. Trotz der dadurch ausbrechenden Hungersnot verweiger-<br />
ten die Massai die Zusammenarbeit mit den Briten, die sie daraufhin zu Beginn des 20. Jahrhunderts in weit<br />
entfernte Gebiete im Süden Kenias und nach Tansania umsiedelten. (Encarta 1997; zu den Massai siehe auch<br />
die Seite 180 dieser Arbeit.)<br />
Auf der Seite 56 sind zwei Fotos mit den Bildlegenden "Bananenplantage am Kilimandscharo" und "Massai-<br />
Hirte mit seiner Rinderherde" abgebildet. Im nächsten Abschnitt auf der gleichen Seite schreibt der Autor<br />
unter dem Titel "Europäer, Inder und Araber in Ostafrika" im Bezug auf die schwarzen<br />
Bevölkerungsschichten:<br />
Als die europäischen Mächte - England und Deutschland - Ostafrika in Besitz nahmen, trafen sie im Küstentiefland<br />
Tausende von Arabern und Indern an; sie waren in den vorhergehenden Jahrhunderten als Händler und Kaufleute in diesen<br />
Teil Afrikas gekommen. Das feuchtheisse Küstenland bot den Europäern, die als Pflanzer, Kaufleute und Verwalter<br />
einwanderten, nur wenig Lebensmöglichkeiten. Ihre Zahl blieb gering. So kommt es, dass das Küstentiefland auch heute<br />
noch vorwiegend von Afrikanern sowie Indern und Arabern bewohnt ist. Manche von ihnen sind Plantagenbesitzer<br />
geworden. Oft wohnen - z. B. in Daressalam - die Inder in eigenen Stadtteilen. Die Suaheli sind eine<br />
Mischlingsbevölkerung aus Arabern und Bantunegern. Ihre Sprache, das Kisuaheli, ist Verkehrssprache in ganz Ostafrika.<br />
Die Aufteilung von Städten wie Dar es Salam in den Bevölkerungsgruppen zugeordnete Stadtteile geht auf die<br />
Kolonialzeit zurück, als die Europäer aus Furcht vor Infektionskrankheiten die indische Bevölkerung als<br />
lebenden Puffer zwischen der weissen Kernsiedlung und den sie umgebenden Quartieren der Schwarzen<br />
benutzten.<br />
Aufschlussreich sind die Sätze im Abschnitt "Sisal, Kaffee und Gewürze aus Ostafrika" auf der Seite 57:<br />
...Für die Europäer bot das Binnenhochland günstige Klimabedingungen. Hier konnten sie in Höhen von 1600 bis 2000 m<br />
Pflanzungen anlegen und notfalls auch körperlich arbeiten. Sie spezialisierten sich vor allem auf Kaffee; das Anbaugebiet<br />
erstreckt sich heute vom Kilimandscharo und Meru bis zu den Usambara-Bergen... Auch die Afrikaner sind inzwischen<br />
dazu übergegangen, in diesem Teil des Hochlandes Kaffee und neuerdings auch Tee anzubauen. Sie haben sich zu<br />
grösseren Genossenschaften zusammengeschlossen. Dadurch stiegen ihre Erträge und ihre Einnahmen. Auch die<br />
Lebensverhältnisse in den Dorfgemeinschaften haben sich seitdem beträchtlich verbessert...<br />
(Zum Anbau von Tee siehe auch die Seite 225, zum Kaffee die Seiten 112 und 166 dieser Arbeit.)<br />
Mit dem Zusammenschluss zu Genossenschaften war es den Afrikanern möglich, die Zwischenhändler zu<br />
umgehen und bessere Konditionen auszuhandeln.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Auf der Seite 57 finden sich zum Kaffeeanbau drei Fotos mit den Bildlegenden "Kaffee-Ernte in Kenia", "Der<br />
Kaffee wird gewaschen" und "Kaffee wird zum Trocknen umgewendet". Das nächste Kapitel behandelt die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 164
"Staaten Ostafrikas" und druckt Kurzdaten zu Tansania, Kenia, Burundi, Uganda und Ruanda ab. Zu den<br />
Bodenschätzen dieser Länder heisst es auf Seite 58, auf der auch ein Foto "Im Hafen von Daressalam" zu<br />
sehen ist:<br />
In Tansania werden auch wertvolle Bodenschätze gewonnen: Diamanten, Zinn-, Blei- und Wolframerze... Zu Tanganjika<br />
gehörten früher auch Ruanda und Burundi; beide Länder sind heute selbständige, dichtbevölkerte Staaten. Die<br />
Stammesgegensätze führen aber selbst in solch kleinen Ländern immer wieder zu heftigen politischen Unruhen.<br />
Diese Konflikte zwischen den Ethnien Hutsi und Tutsi, die seit dem Eindringen der Tutsis im 15. Jh. unter-<br />
schiedlichen Gesellschaftsschichten angehören - die viehhaltenden Tutsis stellten die Oberschicht, die Hutu-<br />
bauern die Unterschicht -, sich ethnisch aber kaum unterscheiden, sind nach der Flucht von 200'000 Tutsis<br />
1959 nie zur Ruhe gekommen und haben in Ruanda 1994 nach dem Tod des Präsidenten Habyarimana, einem<br />
Hutu, zum bis anhin wohl grausamsten Völkermord Afrikas in der jüngeren Geschichte geführt. Je nach Schät-<br />
zungen wurden 800'000 bis über eine Million Bewohner des Landes auf brutalste Weise ermordet. Über zwei<br />
Millionen Menschen flüchteten ins Ausland. 1995 gelang es dem Tutsi Paul Kagame die Herrschaft über das<br />
Land zu erlangen. 1997 strömten 850'000 ruandische Flüchtlinge aus dem damals in einem Bürgerkrieg versin-<br />
kenden Zaire zurück nach Ruanda. Unterdessen hat sich die Lage wieder etwas beruhigt, aber der Konflikt<br />
schwelgt weiter und es kommt immer wieder zu gewaltsamen Todesfällen auch im Nachbarland Burundi.<br />
Zudem müssen über 100'000 inhaftierte, des Genozids beschuldigte Häftlinge in irgendeiner Form der<br />
Gerichtsbarkeit des Landes übergeben werden. (Zu Ruanda siehe auch die Seite 289 dieser Arbeit.)<br />
Auch das im nächsten Abschnitt auf der Seite 58 beschrieben Uganda hat eine wechselhafte Geschichte hinter<br />
sich:<br />
Uganda nimmt den Nordteil des Hochlandes und das Nordufer des Viktoriasees ein. Hier leben die Waganda. Die<br />
Landwirtschaft hat bei ihnen einen hohen Stand erreicht, es werden vor allem Baumwolle und Kaffee ausgeführt. Die<br />
Universität in der Hauptstadt Kampala ist für die weitere Entwicklung des Landes von grosser Bedeutung.<br />
Über Kenia und seine Bevölkerung schreibt der Autor (S. 58):<br />
Kenia war bisher das am stärksten von Weissen besiedelte Land. Hier lebten im Hochland immerhin 50'000 Europäer. Das<br />
macht sich auch im Aussehen der Hauptstadt Nairobi bemerkbar. Sie liegt in 1650 m Höhe. Nairobi wird von mehreren<br />
internationalen Fluglinien angeflogen. Viele Fluggäste sind Touristen aus den USA oder Europa, die von hier aus auf Jagdoder<br />
Fotosafari gehen. In der Hafenstadt Mombasa wird das Strassenbild von Arabern und Indern beherrscht, die ebenso<br />
zahlreich sind wie die schwarzen Afrikaner; die Europäer meiden das ungesunde Klima. Mombasa ist der bedeutendste<br />
Hafenplatz Ostafrikas. Der junge Staat führt mit Hilfe der britischen Regierung ein langjähriges Reformprogramm durch:<br />
Mehr und mehr Afrikaner sollen auf dem bisherigen Farmland der Weissen angesiedelt werden. Das bedeutet, dass die<br />
Zahl der Weissen abnehmen wird und dass die Afrikaner in steigendem Masse selbst die wichtigsten Ausfuhrgüter Kaffee,<br />
Tee und Fleisch bereitstellen wollen.<br />
(Zu Nairobi siehe auch die Seite 203 dieser Arbeit.) Ende des 20. Jahrhunderts gehört Kenia zu den Ländern<br />
mit dem höchstem Bevölkerungswachstum der Welt. So kann es nicht verwundern, wenn für fast die Hälfte<br />
der Kinder, die sich nach der achtjährigen Primarschule für die Sekundarschule qualifiziert haben, die Schul-<br />
plätze fehlen. (TA 20.01.98) Durch das starke Bevölkerungswachstum gerät aber auch die Umwelt zunehmend<br />
unter Druck, so hat der Bedarf nach Brennholz dazu geführt, dass nur noch zwei <strong>Pro</strong>zent des natürlichen<br />
Waldes vorhanden sind. (Zum Brennholzbedarf siehe auch die Karte "Holzverbrauch ausgewählter schwarzaf-<br />
rikanischer Länder" im Anhang auf der Seite 576 dieser Arbeit.)<br />
Wichtigster Faktor in der relativ stabilen Wirtschaft Kenias ist immer noch die Landwirtschaft, die mit ihren<br />
Cash crops Kaffee, Tee und Gartenbauprodukten, sowie Pyrethrum, einer Pflanze aus der Insektizide gewon-<br />
nen werden, rund 36% der Exporte erwirtschaftet. Trotz vielfältiger Anbauprodukte ist es aber der Landwirt-<br />
schaft in den letzten Jahren nicht gelungen, mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. (Weltatlas<br />
1997) 1998 wurde die landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion einmal mehr durch Überschwemmungen in weiten<br />
Teilen Kenias gemindert.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 165
Neben der Landwirtschaft spielt der Tourismus für einige Gebiete Kenias eine grosse Rolle, der aufgrund von<br />
Unruhen an der Küste im Sommer 1997 aber einen massiven Einbruch erlebte. Die Einnahmen reduzierten<br />
sich von rund 500 Mio. US$ auf weniger als 300 Mio. US$. (Zum Tourismus siehe auch die Seite 254, sowie<br />
die Tabelle "Tourismus in afrikanischen Staaten" auf der Seite 545 im Anhang dieser Arbeit) Diese Entwick-<br />
lung zusammen mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von nur gerade 1-2% für 1998 - aufgrund des<br />
hohen Bevölkerungswachstums müsste das Wirtschaftswachstum bei über 5% liegen um die neuen Arbeits-<br />
kräfte aufzufangen - und massiven Korruptionsvorwürfen haben die Regierung des kenianischen Präsidenten<br />
Daniel arap Moi, der sein Amt seit 1978 bekleidet und im Dezember 1997 in nicht sehr sauber verlaufenen<br />
Wahlen für eine weitere Amtszeit bestätigt wurde, unter massiven Druck gestellt. (Economist 18.04.98, S. 44;<br />
zu Kenia siehe auch die Seiten 123 und 203 dieser Arbeit.)<br />
Im nächsten Kapitel zu Äthiopien auf der Seite 59 heisst es unter der Überschrift "Äthiopien und die Somali-<br />
länder - regenreiche Gebirgsländer, trockene Küstenstreifen" zu den klimatischen Bedingungen:<br />
...Ganz und gar trocken ist das Dreieck der Danakilwüste. Hier am Ausgang des Roten Meeres liegt Massaua, die heisseste<br />
Stadt der Erde. Temperaturen von mehr als 45° C im Schatten machen körperliche Arbeit fast unmöglich.<br />
Und unter der Überschrift "Äthiopien - seit 2000 Jahren ein selbständiger Staat" heisst es:<br />
Äthiopien verdankt vor allem seiner abgeschlossenen Lage im Gebirgsland, dass es als einziger Staat Afrikas vom<br />
Altertum bis zur Gegenwart selbständig geblieben ist. Zeitweilige Versuche, von den Küstenländern her das Land zu<br />
erobern, hatten nur für kurze Zeit Erfolg. Heute gehört auch der Küstenstreifen am Roten Meer, das ehemals italienische<br />
Erythrea mit dem Hafen Massaua, als Bundesstaat zum Kaiserreich Äthiopien. Dadurch erhielt der Binnenstaat einen<br />
eigenen Zugang zum Meer. Die ursprünglichen Bewohner gehören hellhäutigen hamitischen Stämmen an, den Galla,<br />
Somali und Danakil. Die Amharen, die jetzige Oberschicht, sind Nachkommen semitischer Stämme, die in Äthiopien<br />
einwanderten. Sie übernahmen schon zur Römerzeit das Christentum. In der natürlichen Festung Äthiopien konnte es sich<br />
bis in die Gegenwart behaupten, obwohl alle Völker der Nachbarländer zum Islam übertraten. Allerdings blieben die<br />
äthiopischen Christen fast ohne Verbindung zum Abendland. So hat sich in der koptischen Kirche eine altertümliche Form<br />
des Christentums erhalten.<br />
Im "Leitfaden für den Geographieunterricht" von 1934 wurde diese "altertümliche Form des Christentums<br />
noch als "entartetes Christentum" beschrieben. (Siehe dazu auch die Seite 102 dieser Arbeit.) Zur landwirt-<br />
schaftlichen <strong>Pro</strong>duktion schreibt der Autor (S. 58):<br />
Die vulkanischen Verwitterungsböden bringen in dem genügend feuchten und nicht zu heissen Klima gute Ernten.<br />
Besonders das Überschwemmungsgelände um den Tanasee ist sehr fruchtbar. Der anbaufähige Boden gehört meist<br />
adeligen Grundbesitzern, denen die Bauern hohe Abgaben zahlen müssen. Nur langsam verbessern staatliche Massnahmen<br />
die Lebensverhältnisse der ärmeren Bevölkerung. Getreide und Kaffee sind die Haupterzeugnisse der Landwirtschaft.<br />
Äthiopien ist die Heimat des Kaffees. Nach der Landschaft Kaffa im Südwesten des Hochlandes trägt er seinen Namen.<br />
Von dort gelangte er durch arabische Händler über das Rote Meer nach Asien.<br />
(Zum Anbau von Kaffee siehe auch die Seiten 164 und 180 dieser Arbeit.) Auf der Seite 59 ist auch ein Foto<br />
mit der Bildlegende "Markt in Harar" abgebildet. Auf der Seite 60 heisst es weiter:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Die Hauptstadt Addis Abeba liegt auf dem Hochland in über 2000 m Höhe. Inmitten einer fast unberührten Landschaft mit<br />
weiten Eukalyptuswäldern steht man plötzlich einer Grossstadt gegenüber, die in ihren neueren Stadtvierteln ganz<br />
europäisch wirkt. Geschäfte mit einem reichen Warenangebot, Hotels und Banken, Büros der Fluggesellschaften und<br />
zahlreiche Autos bestimmen das Strassenbild. Beim Anblick dieser Stadt sieht man, wie weit der Weg von den<br />
altertümlichen Lebensformen bis zur Gegenwart mit ihren technischen Errungenschaften ist. Fluglinien verbinden die<br />
Hauptstadt mit vielen Ländern der Erde. Dreimal wöchentlich verkehrt vom Hafen Dschibuti im kleinen französischen<br />
Somaliland ein Zug, der nach 36 Stunden Addis Abeba erreicht. Dschibuti ist für alle Güter, die man mit der Bahn<br />
transportieren kann, der Ein- und Ausfuhrhafen Äthiopiens.<br />
An vielen Stellen im Lande sind europäische Fachleute als Berater, als Ärzte, Ingenieure, Architekten und Lehrer tätig. Sie<br />
arbeiten zusammen mit einheimischen Kräften an der Entwicklung des Landes und dem Aufbau seiner Wirtschaft. Unter<br />
der Führung seines angesehenen Herrschers hat Äthiopien eine Art Vorsitz in der politischen Zusammenarbeit der jungen<br />
afrikanischen Staaten einnehmen können.<br />
(Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 148 und 179.) Die OAU, die Organisation Afrikanischer Staaten, wurde<br />
auf Wunsch des äthiopischen Kaisers Haile Selassie ins Leben gerufen und hat ihren Hauptsitz nach wie vor in<br />
Addis Abeba. Die Bedeutung dieser Organisation wird unterschiedlich eingeschätzt. Während Michler "den<br />
grössten Staatenbund der Welt" und seine Arbeit weitgehend positiv einschätzt (Michler 1991, S. 69-70),<br />
meint Kabou, die OAU sei an einem "Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Westen", der "morbiden<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 166
Sehnsucht nach der vorkolonialen Vergangenheit" und dem "innerafrikanischen Rassismus" gescheitert und<br />
habe somit jegliche Existenzberechtigung verwirkt. (Kabou 1995, S. 233-239)<br />
Nach der Beschreibung Äthiopiens folgt ein Text über Somalia (S. 60):<br />
Somalia umfasst das Somali-Hochland und die Landschaften am Golf von Aden sowie die südöstlich anschliessende<br />
Küste. Es ist aus dem Zusammenschluss ehemals britischer und italienischer Kolonialgebiete hervorgegangen. In den<br />
trockenen, dünn besiedelten Dornbuschsavannen im Nordteil finden nomadisierende Somali Weide für ihre Kamele,<br />
Ziegen und Schafe. Im Südteil, wo die Niederschläge etwas reichlicher sind, können auf künstlich bewässerten Feldern<br />
Zuckerrohr und Bananen angebaut werden; das Wasser liefern die vom Gebirge herabkommenden Flüsse. Die Hauptstadt<br />
Mogadischu war früher Sitz der Sultane von Sansibar. Der Sultanspalast und einige Moscheen sind prächtige Zeugen<br />
arabischer Baukunst. Über der Stadt liegt ständig eine drückende, feuchtwarme Gluthitze.<br />
Während den Bürgerkriegswirren von 1988-1994 zerfiel das Land in zwei Teile. Der nördliche Teil hat zwar<br />
1991 die Unabhängigkeit ausgerufen, wird aber weltweit von keinem Land als eigenständiger Staat akzeptiert.<br />
Auf der Seite 60 finden sich neben einer Karte zum Gebiet auch die Kurzdaten zum damaligen Kaiserreich<br />
Äthiopien, und den Staaten Somalia und Französisch-Somaliland (Djibouti), ausserdem ist als Zusammenfas-<br />
sung wieder ein Text "Zum Behalten" abgedruckt, in dem es heisst:<br />
...In den klimatisch begünstigten Savannen leben Hackbauern und Hirtenvölker. Ostafrika liefert für den Welthandel Sisal,<br />
Kaffee, Kopra und Gewürze. Durch seine von Natur aus abgeschlossene Lage hat sich Äthiopien seine politische<br />
Selbständigkeit und kulturelle Eigenart seit dem Altertum bewahrt. Es benötigt heute ebenso wie die neu entstandenen<br />
Staaten Ostafrikas Entwicklungshilfe durch die Industrieländer, zeigt aber bereits einen beachtlichen Aufstieg.<br />
Wie an anderer Stelle ausgeführt wird, gelang es Äthiopien nicht, sich aus der Armut und von immer wieder<br />
aufflammenden Kriegen zu befreien. Ende des 20. Jahrhunderts gehört Äthiopien zu den ärmsten Ländern der<br />
Welt.<br />
4.14.1.6 Rückblick auf Afrika<br />
Den Abschluss des Textes über Afrika bildet ein Text mit dem Titel "Rückblick auf Afrika", in dem die<br />
Kernaussagen der einzelnen Abschnitte noch einmal aufgegriffen werden (S. 61):<br />
Afrika wurde erst spät erschlossen. Noch vor zwei Generationen lebten fast alle Eingeborenen in Stammesverbänden, die<br />
von Häuptlingen streng regiert wurden. Ihre Sitten und Gebräuche erschienen dem Europäer primitiv, er fühlte sich weit<br />
überlegen. Die Neger trieben Hackbau, ausserhalb des Regenwaldgebietes auch Viehzucht. Alles Land gehörte dem<br />
Häuptling oder dem Stamm; jeder erzeugte mit einfachsten Mitteln und Werkzeugen nur so viel, wie er brauchte. Was die<br />
Afrikaner bis dahin produzierten - Hirse, Reis, Maniok, Yams und einige Früchte -, reichte nur für ihren eigenen Bedarf;<br />
für den Weltmarkt hatten ihre Ernten keinerlei Bedeutung. Der Trieb zur Arbeit, wie wir ihn kennen, ist beim Afrikaner<br />
ursprünglich nicht gross.<br />
In dieser für die Afrikaner nicht sehr schmeichelhaften Einschätzung, die einerseits auf mangelnder Kenntnisse<br />
der Geschichte Afrikas beruht (siehe hierzu den "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas" ab der<br />
Seite 25 dieser Arbeit) und andererseits auf bewusster Manipulation der Wortwahl, wird eigentlich nur ausge-<br />
sagt, dass die Afrikaner ungern eine Arbeit leisten, deren Früchte andere, nämlich die Europäer, ernten. Der<br />
Text fährt auf Seite 61 fort:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Erst die Europäer haben wirtschaftliche Arbeitsmethoden und Maschinen eingeführt und Pflanzungen angelegt.<br />
Heute werden landwirtschaftliche Erzeugnisse in grossen Mengen ausgeführt, teils von Plantagen, teils aus kleineren<br />
Betrieben der Afrikaner: Bananen, Kakao, Kaffee, Baumwolle, Erd- und Kokosnüsse, Mais, Tabak, Kautschuk und Sisal,<br />
dazu Holz, Felle und Häute. Afrika liefert aber auch in zunehmendem Masse Bergbauprodukte, wie Eisen-, Mangan-,<br />
Kupfer- und Uranerze, Gold und Diamanten, Phosphate und Erdöl, auf den Weltmarkt.<br />
Brücken, Eisenbahnen, Strassen, Flugplätze und Häfen mussten überall dort gebaut werden, wo wirtschaftlich etwas<br />
erschlossen werden sollte. Das konnten zunächst nur die Europäer mit ihrem Geld und ihrer Erfahrung. Aber ohne den<br />
Neger als willigen Arbeiter hätten die Europäer in ihren Kolonien bei dem heissen Klima kaum etwas schaffen können. Für<br />
weisse Siedler sind nur begrenzte Teile in Afrika geeignet.<br />
Noch vor wenigen Jahren hätte man ruhig sagen können, dass Europa zwar Afrika brauche, dies aber umge-<br />
kehrt nicht der Fall sei. Unterdessen haben sich die Strukturen zumindest in den städtischen Gebieten gewan-<br />
delt und es ist eine gegenseitige Abhängigkeit entstanden. Allerdings hat all dies für den Grossteil der Bevöl-<br />
kerung in den ländlichen Gebieten, in denen noch immer ungefähr drei Viertel aller Afrikaner leben, wenig<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 167
Bedeutung, da dort die Strukturen nach wie vor traditionell geprägt sind. Im Text schreibt der Autor weiter<br />
(S. 61):<br />
Nachdem die Afrikaner ein halbes Jahrhundert in den Besitzungen europäischer Kolonialmächte in Abhängigkeit gelebt<br />
hatten, erwachte nach dem zweiten Weltkrieg überall das Streben nach Selbständigkeit. Inzwischen haben fast alle Gebiete<br />
die politische Unabhängigkeit erreicht. Das bedeutet aber noch nicht wirtschaftliche Sicherheit, zumal die Zahl der<br />
eingeborenen Fachleuten noch sehr klein ist. Die ehemaligen Kolonialmächte haben zwar wertvolle Einrichtungen und<br />
Anlagen den neuen Staaten überlassen, aber trotzdem fehlt es noch an vielem, vor allem an Kapital.<br />
Die Weissen versuchen, den jungen afrikanischen Staaten beim Aufbau ihrer Wirtschaft zu helfen. Da gilt es<br />
Bewässerungsanlagen zu bauen und die Afrikaner in neuzeitlichen Anbaumethoden zu unterweisen; da müssen<br />
Verkehrswege angelegt, Fabriken und Werkstätten errichtet werden. Vor allem aber ist es notwendig, viele<br />
Ausbildungsstätten zu schaffen, von der Dorfschule bis zur Universität, wo der Afrikaner all das lernen kann, was er für<br />
das moderne Leben und die Entwicklung seines Landes braucht. Europäer und Afrikaner sind heute im gegenseitigen<br />
Interesse mehr denn je auf Zusammenarbeit angewiesen.<br />
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 145 und 171 dieser Arbeit.)<br />
Der Text bringt deutlich die paternalistische Haltung zum Ausdruck, die damals und teilweise bis heute Moti-<br />
vation für Helfer aus aller Welt war: Der Schwarzafrikaner soll lernen, was er "für das moderne Leben und die<br />
Entwicklung seinen Landes" braucht. Seine Lehrmeister sind natürlich die Europäer, die nach Jahren der<br />
direkten Ausbeutung gemerkt haben, dass die agraren Rohstoffe auch ohne direkte Kontrolle weiter produziert<br />
werden, wenn die Schwarzafrikaner nur in "neuzeitlichen Anbauweisen" unterwiesen werden.<br />
Der Abschnitt schliesst mit einer Farbgrafik, die hier schwarzweiss wiedergegeben wird, weil sie die damalige<br />
Vorstellung der "gegenseitigen Interessen" bildlich darstellt:<br />
Afrika sollte sich also durch die <strong>Pro</strong>duktion von landwirtschaftlichen Rohstoffen, Nahrungsmitteln,<br />
Genussmittel und bergbaulichen Rohstoffen die Devisen zum Kauf von Konsumgütern, Halb- und Fertigwaren,<br />
Transportmittel und Investitionsgüter erwirtschaften.<br />
Leider führte diese Idee bald dazu, dass die ländliche Bevölkerung mit ihrer Agrarproduktion den Konsum der<br />
politisch zumeist einflussreicheren Bevölkerung in den Städten finanzierte. Selbst Ende der neunziger Jahre<br />
verfügen die meisten schwarzafrikanischen Länder nur über einen unbedeutenden Industriesektor.<br />
Der Afrikateil des Bandes Nr. 3 von "Seydlitz für Realstufen" schliesst mit einer ganzseitigen Karte von Afri-<br />
ka, die in stark vereinfachter Form die Topologie des Kontinents wiedergibt.<br />
4.14.2 Band 6: Menschliche Gemeinschaften gestalten die Erde<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Zwei weitere Kapitel zum Thema der Arbeiten finden sich im "Band 6: Menschliche Gemeinschaften gestalten<br />
die Erde" auf den Seiten 106-108 über "Die Republik Ghana" unter "Was sind Entwicklungsländer?" zum<br />
Themenbereich "5. Die Zusammenarbeit der Länder hilft allen Menschen der Erde" und den Seiten 108-109<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 168
über "Die Republik Ägypten". Auf den Text zu Ägypten soll hier nicht weiter eingegangen werden. Im Text<br />
"Die Republik Ghana" schreibt der Autor auf Seite 106:<br />
Ghana gehört zu dem von schwarzen Menschen bewohnten Teil Afrikas, der sich zwischen der Sahara im Norden und der<br />
Kalahari im Süden erstreckt. Seine Grösse entspricht etwa der Grösse der Bundesrepublik Deutschland. Die Einwohnerzahl<br />
beträgt nur 7,9 Millionen. Das Land hat im Norden noch Anteil an der trockenen Savanne, über die feuchte Savanne reicht<br />
es im Süden in das Gebiet des tropischen Regenwaldes.<br />
Das Deutschland der neunziger Jahre ist durch die Wiedervereinigung natürlich nun einiges grösser als Ghana,<br />
das seine Fläche nicht verändert hat. Dafür ist die Bevölkerung Ghanas auf rund 18 Millionen (CIA World<br />
Atlas, 1996) angewachsen. Über die Verteilung der Bevölkerung innerhalb des Landes schreibt der Autor<br />
(S. 106):<br />
Die Bevölkerung ist ungleich über das Land verteilt. Im Norden leben die Menschen in althergebrachter Weise vom<br />
Regenfeldbau, der auf Brandrodungsflächen betrieben wird. Wegen der Gefährdung durch die Tsetsefliege wird nur wenig<br />
Vieh gehalten. Was angebaut wird, dient dem Eigenbedarf der Familien, die nach altem Brauch unter Ältesten oder<br />
Häuptlingen in Sippen oder Stämmen leben. Die scheinbar oberflächliche Landnutzung, bei der die Anbaufläche nach<br />
kurzer Dauer liegenbleibt und durch ein neugerodetes Feld abgelöst wird, ist klimatisch begründet: bei längerer<br />
Beanspruchung wäre nämlich der Boden sehr bald erschöpft und könnte sich nicht wieder erholen. Unter diesen<br />
Umständen kann in diesem Landesteil kaum mit einer erfolgreichen intensiveren Bewirtschaftung und einer daraus<br />
folgenden wirtschaftlichen Besserstellung der Bevölkerung gerechnet werden. Im landwirtschaftlich wenig ertragreichen<br />
Savannengebiet lebt auf zwei Dritteln der Fläche des Landes nur ein Fünftel seiner Bewohner!<br />
Selbst 1997 lebten im grössten der neun Distrikte dem "Northern District" immer noch nur etwa zwei Millio-<br />
nen Einwohner. Die Distrikthauptstadt des Nordregion Tamale, verfügt zwar über ein Spital für die rund<br />
200'000 in der Region lebenden Menschen und seit Anfang 1998 über ein neugebautes Kanalisationssystem,<br />
leidet aber besonders während der Trockenzeit im Dezember bis März immer wieder unter Wasserknappheit.<br />
Über den Süden des Landes schreibt der Autor (S. 106):<br />
Im Bereich des tropischen Regenwaldes ist die Lage ganz anders. Hier wurde schon während der Kolonialzeit der<br />
Kakaoanbau eingeführt. Heute wird der Kakao hauptsächlich in bäuerlichen Betrieben, weniger auf grösseren Plantagen<br />
erzeugt. Zahlreiche Familien finden dadurch ihr gutes Auskommen. Kakao und Kakaobutter sind wichtige<br />
Ausfuhrprodukte des Landes. So bietet in Ghana die Regenwaldzone günstige Lebensbedingungen für viele Menschen.<br />
Darüber hinaus ziehen die Ernte und die weitere Bearbeitung der Kakaofrüchte alljährlich viele Wanderarbeiter aus den<br />
Savannen in das Regenwaldgebiet. Viele von ihnen lernen hier bessere Lebensverhältnisse kennen und bleiben für immer.<br />
Nach einer Weile holen sie ihre Familien nach. Dadurch nimmt die Bevölkerung in den Savannen ständig ab, im<br />
Küstengebiet steigt sie dagegen weiter an. Diese dauernde Binnenwanderung führt zu einer langsamen Entvölkerung der<br />
nördlichen Landesteile. Sie werden dadurch immer rückständiger und sinken zu Notstandsgebieten ab.<br />
Dieser Entwicklung wurde durch die Verbesserung der Infrastruktur Einhalt geboten. Unterdessen kommt es<br />
für Regierungsbeamte nicht mehr einer "Strafversetzung" gleich, wenn sie im Norden des Landes eingesetzt<br />
werden, sondern sie benutzen die Verpflichtung sporadisch nach Accra, der Hauptstadt, zu fahren, um Güter<br />
einzukaufen, die sie dann im Norden mit einem guten Gewinn wieder verkaufen können. Aus diesem Grund<br />
sind Posten im Norden bei kleineren und mittleren Beamten unterdessen ausserordentlich beliebt, denn das von<br />
der Regierung gezahlte Gehalt liegt zwar weit über dem Durchschnittslohn, reicht aber auch bei einer auch<br />
kleinen Familie für ein Leben nach westlichem Standart nicht aus.<br />
Über das für Ghana wichtige Exportprodukt Kakao heisst es auf der Seite 107 (siehe dazu auch die Seiten 156<br />
und 178):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Ghana ist auf dem Weltmarkt der Hauptlieferant von Kakao. Es erzeugt allein ein Drittel der Welternte. Kakao ist ein<br />
Erzeugnis, das besonders von den hochindustrialisierten Ländern gern gekauft wird. Dennoch schwanken die Preise auf<br />
dem Weltmarkt sehr je nach der Höhe des Angebots. In den letzten Jahren hat sich infolge des verstärkten Anbaus in allen<br />
Kakao erzeugenden Ländern sowie durch bessere Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten die Weltkakaoernte mehr<br />
erhöht als der ebenfalls angestiegene Absatz auf dem Weltmarkt. Das hat zu einem für die Erzeugerländer bedenklichen<br />
Sturz der Preise geführt.<br />
Heute ist Kakao ein noch immer wichtiger Devisenbringer für Ghana. Der Anteil an der Weltproduktion hat<br />
aber abgenommen und Ghana steht nur noch an vierter Stelle in der Weltrangliste. Viel wichtiger ist wieder<br />
der Goldabbau geworden - Ghana ist nach Südafrika der grösste Goldproduzent des Kontinents -, der aber<br />
durch die sinkenden Goldpreise auch unter Druck geraten wird. Im Text fährt der Autor fort (S. 107):<br />
Im Küstengebiet ist Kakao das weitaus wichtigste Handelsgewächs, und viele Bauern haben sich ausschliesslich darauf<br />
spezialisiert. Diese Kakaobauern sind völlig abhängig vom Ergebnis ihrer Ernte. Um sie vor den Folgen von<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 169
Preisschwankungen zu schützen und um die Preisentwicklung dieses wichtigen Ausfuhrproduktes in der Hand zu behalten,<br />
wird in Ghana die gesamte Kakaoernte der Bauern vom Staat aufgekauft. Dieser kann also den Preis bestimmen, den der<br />
Erzeuger erhält, und gleichzeitig versuchen, den Weltmarktpreis möglichst hoch zu halten. So werden für das wichtigste<br />
Erzeugnis des Landes stabile Wirtschaftsverhältnisse geschaffen. Bei günstigem Weltmarktpreis fliesst dem Staat<br />
ausserdem eine beträchtliche Einnahme zu.<br />
Ghana fördert ganz bewusst kleine Betriebe. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Beratungsstelle in der<br />
Hauptstadt eingerichtet, die über Exportmöglichkeiten, Kredite und Geschäftsführung Auskunft gibt und fast<br />
wöchentlich ihr Angebot im nationalen Fernsehkanal "Ghana Television" bewirbt.<br />
Auf Seite 107 sind verschieden Fotos abgebildet auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, da keines<br />
von ihnen aus Ghana stammt. Wahrscheinlich hatte der Verlag gerade kein Bildmaterial aus diesem Land zur<br />
Verfügung. Auf Seite 108 heisst es weiter:<br />
Ghana besitzt grössere Bauxitvorräte. Ausserdem sind Manganerze Gold und Diamantenvorkommen vorhanden. Diese<br />
begehrten Bodenschätze können vorerst im Lande nur begrenzt genutzt werden. Sie ergänzen jedoch bis zur Errichtung<br />
eigener Verarbeitungsstätten die Ausfuhr. Hinzu kommt noch ein umfangreicher Export von wertvollem Holz teils in<br />
ganzen Stämmen oder bereits verarbeitet.<br />
Die Bauxitvorkommen bleiben nach wie vor ungenutzt, die Weltpreise für diesen Rohstoff lohnen den Abbau<br />
in Ghana nicht. Auch der Holzexport ist nur noch beschränkt möglich, da die Waldreserven Ghanas in den<br />
letzten Jahren rapide abgenommen haben.<br />
Das Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen beschreibt der Autor auf der Seite 108:<br />
Die Bewohner des Landes bilden noch kein einheitliches Staatsvolk. Mehrere Sprachgruppen leben nebeneinander.<br />
Zwischen den ziemlich wohlhabenden Kakaobauern und den noch ganz auf Selbstversorgung eingestellten<br />
Savannenbewohnern bestehen starke soziale Unterschiede. Die aus dem Norden eingewanderten Saisonarbeiter bilden in<br />
den städtischen Siedlungen des Südens ein besitzloses <strong>Pro</strong>letariat. Die Verbindung zu ihrer Sippe die sie früher im Notfall<br />
unterstützen konnte ist abgerissen.<br />
Vor allem in den Städten gibt es heute viele jungen Leute, deren Eltern verschiedenen Sprachgruppen angehö-<br />
ren. Diese Menschen orientieren sich nicht mehr in erster Linie an ihrer Volksgruppe sondern fühlen sich als<br />
Ghanaer. Viele Zuwanderer, vor allem in Accra, stammen aber gar nicht aus Ghana sondern aus den nördlich<br />
gelegenen Nachbarländern. Zum Bevölkerungswachstum heisst es weiter im Text (S. 108):<br />
Die Bevölkerungszahl Ghanas nimmt rasch zu. Der jährliche Geburtenüberschuss beträgt 33 auf 1000 (zum Vergleich:<br />
Bundesrepublik Deutschland 6)! Die wachsende Menschenzahl muss mit Nahrungsmitteln und sonstigen Bedarfsgütern<br />
versorgt werden. In der Savanne könnte neues Ackerland geschaffen werden; das erfordert jedoch den Bau von<br />
Bewässerungsanlagen. Die ständige Abwanderung müsste aufhören. Das ist aber nur möglich wenn sich die<br />
Lebensbedingungen so verbessern dass den Bewohnern ein Wegzug nicht mehr lockend erscheint. Für alle diese<br />
Massnahmen sind bedeutende Mittel nötig die die Regierung wegen ihrer vielfältigen anderen Aufgaben bisher nur in<br />
unzureichendem Masse bereitstellen konnte.<br />
Seit dem Anfang der neunziger Jahre hat sich die Wirtschaft wieder einigermassen erholt. Es fliessen auch<br />
neue Investitionen ins Land. So hat beispielsweise Samsung in Tema, der Hafenstadt bei Accra, vor einigen<br />
Jahren eine Fabrik gebaut, die Fernsehapparate produziert. Die wirtschaftliche Entwicklung beschreibt der<br />
Autor mit den Worten (S. 108):<br />
Für die wachsende Bevölkerungszahl im Süden vor allem im Küstenbereich müssen neue Arbeitsplätze eingerichtet<br />
werden. Besonders im Bergbau können viele Menschen Arbeit finden. Der Aufbau von Industriewerken setzt aber eine<br />
ausreichende Energieversorgung voraus. Deshalb errichtet die ghanesische Regierung gegenwärtig mit ausländischem<br />
Kapital einen Staudamm am Voltafluss. Dessen Elektrizitätserzeugung wird so gross sein dass sie zunächst noch nicht im<br />
Lande voll verbraucht werden kann selbst wenn mehr Aluminium auf der Grundlage der Bauxitvorkommen gewonnen<br />
wird als bisher.<br />
(Zum Voltastaudamm siehe auch die Seiten 157 und 173 dieser Arbeit.) Die Schaffung neuer Arbeitsplätze<br />
bleibt ein <strong>Pro</strong>blem. Es gibt Schätzungen, dass die ghanaische Wirtschaft jährlich um etwa 5% wachsen müsste,<br />
nur um neue Stellen für die Jugendlichen, die jährlich auf den Arbeitsmarkt drängen, zu schaffen. Eine<br />
Beschäftigung wie sie in den Industrienationen gegeben ist, wird in Ghana auch in Zukunft kaum möglich<br />
sein. Die Landwirtschaft bleibt nach wie vor der wichtigste Beschäftigungssektor. Zur Infrastruktur Ghanas<br />
schreibt der Autor (S. 108):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Für eine gesunde Wirtschaft fehlt es also noch an vielem. Vor allem sind die Verkehrseinrichtungen vom Süden des<br />
Landes abgesehen noch unzureichend. Ohne Ausbau von Strassen und Bahnen kann die Förderung im Bergbau nicht<br />
gesteigert werden. Ohne Transportwege ist auch die Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse begrenzt. Alle technischen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 170
Einrichtungen brauchen Fachkräfte. Ihre Ausbildung ist vordringlich. Ausserdem müssen gerade in einem tropischen Land<br />
die Gesundheitsfürsorge verstärkt neue Krankenhäuser gebaut und die Bevölkerung über Sauberkeit und richtige<br />
Ernährung aufgeklärt werden. Alle diese Aufgaben sind mühevoll; nach aussen treten die Verbesserungen zunächst wenig<br />
in Erscheinung. Doch sind sie nötig für die Änderung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse. Bei der Verwendung<br />
der vom Ausland kommenden Entwicklungshilfe müssen die geographischen Gegebenheiten des Landes berücksichtigt<br />
werden; dabei wird von der Führung des jungen Staates viel Einsicht erwartet. Werden die Mittel gelegentlich für<br />
aufwendige umstrittene Pläne verwendet so dürfen die helfenden Länder nicht die Geduld verlieren; sie müssen immer<br />
bedenken dass das Bedürfnis nach einer sichtbaren Bestätigung der Unabhängigkeit nach wie vor gross ist.<br />
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 168 und 176 dieser Arbeit.) Nach wie vor sind viele Hilfswerke<br />
und ähnliche Organisationen in Ghana tätig. Nicht immer sind die Bemühungen von Erfolg gekrönt, da immer<br />
wieder <strong>Pro</strong>jekte "über den Kopf" der lokalen Bevölkerung geplant und deren Bedürfnissen nicht immer gerecht<br />
werden. Unter der Regierung Rawlings unternimmt das Land aber grosse Anstrengungen in allen Landesteilen,<br />
um zumindest den status quo zu sichern.<br />
4.14.3 Zusammenfassung<br />
Das Lehrmittel "Seydlitz für Realschulen" informiert fast immer sachlich und teilweise sehr detailliert über die<br />
Völker und Länder Afrikas. Durch die rasante Entwicklung des afrikanischen Kontinents haben aber viele der<br />
vermittelten Informationen nur noch einen historischen Wert. Kritisiert werden muss die eurozentrische und<br />
paternalistische Sichtweise, die den Schwarzafrikanern zwar gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten zuschreibt,<br />
sie aber letzten Endes doch als noch "erziehungsbedürftig" betrachtet. Trotz der umfangreichen Textmenge<br />
verpasst es der Autor, Menschen aus Schwarzafrika selbst zu Wort kommen zu lassen, was die oben<br />
angemerkten Schwächen noch verstärkt.<br />
Der zeitgenössische afrikanische Mensch wird durchaus nicht als geschichtsloses Wesen betrachtet, wird aber<br />
als rückständig im Sinne einer nicht mitvollzogenen Entwicklung während der letzten Jahrhunderte gesehen.<br />
Der Schwerpunkt des Lehrmittel liegt eindeutig auf der Beschreibung des wirtschaftlichen Potentials Schwarz-<br />
afrikas, welches nach Meinung des Autros ohne den einheimischen "willigen Arbeiter" nicht verwirklicht<br />
werden kann.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Realschulen (1968)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 171
4.15 Erdkunde (1968)<br />
Als billige Arbeitskräfte holte man Neger in die Bergwerke und Fabriken und gab ihnen in einfachen, sauberen Häusern<br />
Wohnung. Durch fachliche Schulung und menschliche Betreuung machte man sie zu tüchtigen und zuverlässigen<br />
Facharbeitern. Schnell hat der Neger gelernt, mit Münzen und Papiergeld umzugehen. Er kann in den Warenhäusern<br />
kaufen, was er will: Kleider, Sandalen, Lederschuhe, einen Anzug, einen Mantel. Der Afrikaner besucht Schulen und vom<br />
Staat eingerichtete Lehranstalten. Nicht nur im Lesen und Schreiben wird er unterrichtet, auch in Mathematik und in<br />
fremden Sprachen. Hunderte von Negern studieren an den Universitäten von Ibadan, Akkra, Kinshasa (Leopoldville) und<br />
Lubumbashi. (S. 32)<br />
Das in den Jahren 1964-1974 beim Ferdinand Schöningh erschienene, fünfbändige und rund 870 Seiten starke<br />
Lehrmittel "Erdkunde" beschäftigt sich im dritten Band, 1968 erschienen, auf den Seiten 1-64 mit dem afrika-<br />
nischen Kontinent. Nebst diesen Seiten sind auf der Innenseite des Einbandes verschiede Karten zur regional-<br />
geographischen Aufteilung und zur Geschichte Afrikas abgedruckt. Der ganze Afrikateil folgt fast durchge-<br />
hend der gleichen Darstellung: Ein Thema umfasst jeweils eine Doppelseite, wovon ca. die Hälfte auf Text,<br />
der Rest meist auf Fotos, manchmal Tabellen oder Karten entfällt. Ausserdem beginnt jedes Thema, ausser den<br />
eingestreuten Übersichten, mit einem Auftrag oder einer Fragestellung an die Schüler und schliesst mit einer<br />
Zusammenfassung. Am Ende der meisten Themen folgen Fragen zur Verständniskontrolle.<br />
In einem ersten Überblick auf der Seite 1 erfahren die Leser über die Bewohner Afrikas:<br />
...Die Bewohner des fremden Erdteils sehen meist anders aus als die Europäer. Ihre Hautfarbe ist dunkler. Sie reicht vom<br />
Hellbraun bis zum tiefen Schwarz. Manche Afrikaner sind von aussergewöhnlich grossem Wuchs, andere sind zwergenhaft<br />
klein.<br />
Einerseits wird bereits im ersten Abschnitt die Vielfältigkeit der schwarzafrikanischen Völker betont, anderer-<br />
seits könnte durch die Wortwahl der Eindruck eines mit Exoten aller Art angefüllten Raritätenkabinetts von<br />
Riesen und Zwergen entstehen.<br />
4.15.1 Äquatorialafrika und Sudan<br />
Die folgenden Seiten 2-19 beschäftigen sich mit Nordafrika, die Seiten 20-39 mit "Äquatorialafrika und dem<br />
Sudan", wobei folgende Themen angesprochen werden: "In den Urwäldern Äquatorialafrikas" (S. 20-21),<br />
"Grasländer im Sudan" (S. 22-23), "Das Klima prägt die Landschaft" (S. 24-27) und "Sammler und Hackbau-<br />
ern". Zum letztgenannten Thema heisst es auf den Seiten 28-29:<br />
Pygmäen, Zwergmenschen, kaum grösser als 1,40 m, wohnen im Urwald. Sie leben heute nur noch als kleiner Völkerrest<br />
im Innern der dunklen Wälder. Ein Bast- oder Blätterschurz ist ihre einzige Kleidung. Für ihre Ernährung sammeln sie<br />
Früchte, Knollen und Wurzeln. Mit Giftpfeilen erlegen sie die Tiere des Waldes. Zum Schutz vor den Unbilden der<br />
Witterung bauen sie sich aus Zweigen kleine halbkugelige Hütten oder Windschirme, die sie mit Blättern dachziegelartig<br />
decken. Die Pygmäen sind heute noch Sammler und Jäger und stehen auf der niedrigsten Wirtschaftsstufe, denn sie kennen<br />
weder Ackerbau noch Viehzucht.<br />
Im Gegensatz zu früheren Lehrmitteln werden nicht mehr die "Pygmäen" als primitiv angesehen, sondern nur<br />
noch ihre Wirtschaftsstufe wird als "niedrig" bezeichnet. Diese Einstufung wird mit der Tatsache begründet,<br />
dass die "Pygmäen" weder Ackerbau noch Viehzucht treiben, d. h. die Kriterien zur Einstufung werden offen-<br />
gelegt. Zudem liefert der Autor eine Beschreibung der Bauweise der Behausungen dieser Völker. (Zu den<br />
"Pygmäen" siehe auch die Seiten 154 und 173 dieser Arbeit.) Wie auch in anderen Lehrmitteln folgt zum<br />
Vergleich eine Beschreibung der "Neger" (S. 28):<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Neger stellen den Hauptteil der Bewohner des "schwarzen Erdteils". Zwar haben sie alle eine dunkle Hautfarbe und<br />
schwarze Haare, doch sind sie in Körperbau, Grösse und Kopfform, je nach Stamm oder Volk, recht unterschiedlich. Auch<br />
unterscheiden sie sich in ihren Sprachen, von denen es mehrere hundert gibt. Die wichtigsten Sprachfamilien sind die der<br />
Sudan- und Bantuneger. Im Kongobecken und weiter im Süden leben die Bantuneger, im Sudan und an der Küste von<br />
Oberguinea die Sudanneger.<br />
Auch bei der Beschreibung der körperlichen Gestalt wird im Gegensatz zu vielen anderen Lehrmitteln<br />
zwischen den verschiedenen Volksgruppen differenziert. Über die Bantustämme schreibt der Autor (S. 28):<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 172
Die 200 Bantustämme im Kongobecken sprechen 40 verschiedene Sprachen. Meist wohnen die Bantuneger an den<br />
Rändern des Urwaldes in kleinen dörflichen Siedlungen. Sie bestehen aus Giebeldachhütten, die in zwei Reihen um einen<br />
langgestreckten Platz angeordnet sind. Der Wald wird in mühsamer Arbeit von den Männern gerodet; sie brennen die<br />
Baumstämme ab oder hauen sie um. Die Baumstümpfe bleiben stehen. Zwischen ihnen wird der Boden mit der Hacke<br />
gelockert und dann bepflanzt. Er bringt gute Erträge an Knollengewächsen (Maniok, Batate), Bananen, Kürbissen, Mais<br />
und Melonen. Wichtiger noch ist der Anbau des Kakaostrauches und vor allem der Ölpalme. Sie ist für den Neger<br />
besonders wertvoll. Ihre Früchte liefern ihm Palmöl und Palmkernöl, die Stämme und Blätter das Material für den<br />
Hausbau.<br />
Der Anbau von Kakao hat vor allem Bedeutung für die Exportwirtschaft, auch wenn einige daraus gewonnene<br />
<strong>Pro</strong>dukte für den Gebrauch im Inland verwendet werden. Die Ausführungen des Autors zur Ölpalme hingegen<br />
haben auch in den neunziger Jahren nichts von ihrer Bedeutung verloren. Über die Bewohner des Sudans<br />
schreibt der Autor (S. 29):<br />
Auch die Sudanneger sind Hackbauern. Sie bauen sich runde Lehmhütten mit kegelförmigem Grasdach<br />
(Kegeldachhütten). Zur Trockenzeit zünden sie das Gras an, weithin leuchtet dann der Steppenbrand. Die zurückbleibende<br />
Asche soll die Felder düngen, verhindert aber die Bildung von fruchtbarem Humus. Kurz vor der Regenzeit kann man<br />
Hirse, Mais, Erdnüsse und Knollenfrüchte säen oder pflanzen. Wo die Savannen nicht von der Tsetsefliege verseucht sind,<br />
welche auf Menschen und Tiere die gefährliche Schlafkrankheit überträgt, züchten die Bauern auch Rinder, Schafe und<br />
Ziegen.<br />
Nach diesen Ausführungen schreibt der Autor zur Arbeitsteilung, verallgemeinert dabei aber (zu) stark (S. 29):<br />
Die Arbeit ist bei den Negern immer so aufgeteilt, dass die Männer den Wald roden auf die Jagd gehen und in den Flüssen<br />
oder an den Küsten Fischfang betreiben. Die Frauen bearbeiten den Boden und sorgen für das Hauswesen. Sie holen<br />
Wasser, suchen Brennholz, bereiten die Mahlzeiten und stellen Töpferwaren her.<br />
Diese Lebensweise ist noch heute unter den Negern weit verbreitet. Aber durch die Berührung mit den Weissen ändern<br />
sich die Verhältnisse schnell.<br />
Die Veränderungen stellen sich vor allem in den Städten ein. Auf dem Land hat sich das traditionelle Rollen-<br />
verständnis wenig gewandelt, ausser dort, wo die Frauen sich durch die <strong>Pro</strong>duktion für die Agglomerationsge-<br />
biete eine neue Einkommensquelle schaffen konnten.<br />
Seite 28 zeigt ein Foto einer Gruppe von "Pygmäen", die in einer Gruppe um einen Weissen stehen. Auf der<br />
Seite 29 ist ein Foto "Frauen bei der Feldarbeit", das die Arbeit im Urwaldgebiet zeigt, abgebildet. Auf der<br />
gleichen Seite heisst es, in der jeweils am Ende eines Themas folgenden Zusammenfassung:<br />
In Äquatorialafrika wohnen Bantuneger, im Sudan die Sudanneger. Beide leben in dörflichen Gemeinschaften. Die<br />
Bantuneger betreiben Hackbau, die Sudanneger daneben auch Viehzucht. Im Urwald leben noch in geringer Zahl<br />
Pygmäen, die auf der niedrigen Wirtschaftsstufe der Sammler und Jäger stehen.<br />
Obwohl die "Pygmäen" für den afrikanischen Kontinent weder wirtschaftlich noch zahlenmässig bedeutsam<br />
sind, wird ihnen in den meisten Lehrmitteln viel Platz eingeräumt. (Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten<br />
172 und 186 dieser Arbeit.) Ob dahinter die Idee der Vollständigkeit der Darstellung - die aber im Bezug auf<br />
die anderen Völker immer zu kurz kommt - das Interesse an einem Kuriosum oder einfach die Tatsache, dass<br />
ältere Lehrmittel das Thema ja auch aufgriffen, steht, liess sich anhand der vorliegenden Materialien nicht<br />
feststellen.<br />
4.15.2 "Europäer in Innerafrika"<br />
Die Seiten 30-31 sind dem Thema "Europäer in Innerafrika" gewidmet. Auf diesen Seiten werden wieder zwei<br />
Fotos mit den Bildlegenden "Ärztliche Betreuung in Missionsstationen" (S. 30) und "Schwarze und Weisse<br />
beim Bau des Voltastaudammes" (S. 31) abgebildet.<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Der 1965 fertiggestellte Voltastausee galt lange Zeit als grösster Stausee der Welt und sollte dem Land Ghana<br />
helfen, den Schritt in die Industrialisierung zu machen. Durch die steigenden Fluten mussten gegen 80'000<br />
Menschen umgesiedelt werden. Die Pläne für deren neue Siedlungen scheiterten aber infolge von Geldmangel.<br />
Die damals entstandene "Volta River Authority" ist noch heute für die Stromversorgung des Landes zuständig.<br />
Der durch das Wasserkraftwerk erzeugte Strom wird zu einem grossen Teil für die Aluminiumverhüttung<br />
verwendet. - Ursprünglich war geplant, die lokalen Bauxitvorkommen abzubauen. Seit Beginn der Verhüttung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 173
wurde aber billigeres Bauxit aus Jamaika eingeführt. - Der Rest des erzeugten Stromes wird im Inland<br />
verbraucht, oder als Devisenbringer an Nachbarländer verkauft. Der zunehmende Strombedarf und eine gleich-<br />
zeitig auftretende Wasserknappheit, die auf einen höheren Verbrauch im nördlichen Nachbarland Burkina<br />
Faso, dem Quellgebiet des Voltas, zurückzuführen ist, führte nach Berichten aus Ghana erstmals im Februar<br />
1998 zu einer Versorgungslücke, die sich unvorteilhaft auf die heimische Wirtschaft auswirkte, z. B. musste<br />
die Zementfabrik ihre Tätigkeit einstellten, was sich im Zusammenhang mit dem Bauboom in Ghana in einer<br />
empfindlichen Preiserhöhung dieses Baustoffes niederschlug. Die Auswirkungen der Stromknappheit auf eine<br />
zumindest teilweise computerisierte Verwaltung kann man sich denken. (Zum Voltastaudamm siehe auch die<br />
Seiten 170 und 177 dieser Arbeit.)<br />
Im Text auf den Seiten 30-31 wird im ersten Abschnitt die Expedition Stanleys, der mit "145 Negern" den<br />
Lauf des Kongo erforschte, beschrieben. Zur Plantagenwirtschaft heisst es (S. 30):<br />
Europäische Pflanzer legten die ersten Plantagen an. Wo früher undurchdringliches Urwalddickicht war, liegen heute<br />
ausgedehnte Pflanzungen. Da der Europäer in dem heissen Klima keine harte Arbeit leisten kann, ist er auf die Hilfe der<br />
Eingeborenen angewiesen. Sie pflanzen und pflegen die Kautschukbäume, ritzen ihre Rinde auf und sammeln die<br />
Kautschukmilch, die in Fabriken verarbeitet wird. Auch beim Anbau der Banane, bei der Kultur der Ölpalme und bei der<br />
Gewinnung von Palmöl sind die Afrikaner unentbehrlich. In den trockenen Graslandschaften liegen die Baumwoll- und<br />
Erdnusspflanzungen meist an den Flüssen oder in der Nähe der Küste. Angeregt durch die Europäer, haben auch die Neger<br />
Pflanzungen mit Kakao, Ölpalmen, Bananen, Kautschukbäumen und Erdnüssen angelegt. Diese Kulturen liegen<br />
hauptsächlich in den Niederungen, der Kaffee wächst dagegen nur in höheren Gebirgslagen. Am besten gedeiht er auf den<br />
fruchtbaren Böden des Kamerunberges.<br />
Auch in diesem Text wird das Klischee vom "Neger, der im heissen Klima... harte Arbeit leisten kann",<br />
während dies dem Europäer angeblich unmöglich sei, wiederholt. Daneben zeigt der Text, dass es auch nach<br />
der Unabhängigkeit die Aufgabe vieler schwarzafrikanischer Staaten war, Agrarprodukte für den Weltmarkt zu<br />
produzieren. Eine Tatsache, die auch am Ende der neunziger Jahre für die meisten Länder Schwarzafrikas<br />
noch zutrifft, obwohl einige der im technischen Bereich verwendeten Pflanzenprodukte, wie etwa Kautschuk<br />
oder Sisal stark an Bedeutung verloren haben. Teilweise mit sehr ungünstigen Folgen für die<br />
<strong>Pro</strong>duzentenländer.<br />
Der nächste Abschnitt bespricht die Einrichtung von Spitälern und Schulen, dabei wird auch Albert Schweitzer<br />
einmal mehr erwähnt (S. 30):<br />
Europäische Missionare und Ärzte leisten den Eingeborenen wertvolle Hilfe. In Missionsschulen lernen die Afrikaner<br />
Lesen und Schreiben. Sie werden angeleitet, den Boden mit neuen Ackergeräten zu bearbeiten, gute Saat zu gewinnen und<br />
die Nutzpflanzen richtig zu pflegen. Europäische Ärzte betreuen die Bevölkerung. Der Elsässer Dr. Albert Schweitzer<br />
nahm 1913 am Ufer eines Urwaldflusses seine Praxis auf. Heute liegt sein Hospital in Lambarene inmitten einer grossen<br />
Siedlung mit vielen Häusern. Es beherbergt Hunderte von Kranken. Dr. Schweitzer konnte die Arbeit schon Iängst nicht<br />
mehr allein schaffen. Jüngere Ärzte und Krankenschwestern standen ihm zur Seite. Sie führen heute sein Werk weiter.<br />
Eingeborene Arzthelfer sind besonders wichtig, weil sie die Sprache der Kranken verstehen.<br />
Diese Bild ist heute in vielen aber nicht allen Regionen Afrikas veraltet. Nach wie vor sind in einigen Ländern<br />
zwar noch europäische, amerikanische oder auch kubanische Ärzte im Einsatz. Dies ist aber oft nicht wegen<br />
der mangelnden Geschicklichkeit der einheimischen Fachleute der Fall - ganz im Gegenteil üben im Zuge des<br />
"Brain drain" z. B. in Ghana ausgebildete Ärzte ihre Tätigkeit aus finanziellen Gründenin den Industrienatio-<br />
nen aus - vielmehr auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese ausländischen "Experten" oft nicht nur ihr<br />
Wissen in die afrikanischen Länder bringen, sondern auch dringend benötigte finanzielle Mittel. Weiter heisst<br />
es (S. 30):<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Europäische Forscher versuchen, die Tsetsefliege, den Überträger der Schlafkrankheit, auszurotten. Andere Krankheiten<br />
werden mit neuen Heilmitteln erfolgreich bekämpft.<br />
Leider kam es bei der Bekämpfung dieser Infektionskrankheiten immer wieder zu Rückschlägen, so ist z. B.<br />
die Tuberkulose wieder auf dem Vormarsch, die Malariaerreger werden zunehmend resistenter gegen die<br />
benutzten Medikamente. Aids hat vor allem in Ländern Ost- und Südafrikas zur Verwaisung vieler Kinder<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 174
geführt, während sich in Westafrika ein aidsverwandter Virus ausbreitet, der in Europa wenig bekannt ist.<br />
Erfolge zeichnen sich z. B. bei der Bekämpfung des "Guineaworm" ab. All diese Anstrengungen sind aber<br />
nicht nur auf humanitäre Überlegungen zurückzuführen. In gewissen Fällen, besonders bei tödlich verlaufen-<br />
den Viruserkrankungen wie dem Ebolavirus, fürchtet man eine Verbreitung der Erreger in die Industrieländer.<br />
Diese Befürchtungen wurden im Spielilm "Outbreak", der den afrikanischen Kontinent als Reservoir von tödli-<br />
chen Krankheitserregern darstellte, thematisiert.<br />
Der Text fährt mit der Beschreibung der europäischen Leistungen fort (S. 31):<br />
Europäische Ingenieure und Unternehmer haben in Äquatorialafrika wertvolle Bodenschätze erschlossen, Bergwerke<br />
angelegt und Fabriken gebaut. Kraftwerke, die man an den Wasserfällen des Kongo errichtet hat, liefern elektrischen<br />
Strom. Das Netz von Strassen und Eisenbahnlinien wird ständig erweitert. Mit Hilfe von europäischem Geld hat man in den<br />
Hafenstädten gute Kaianlagen und moderne Verladeeinrichtungen geschaffen. In Monrovia, Dakar, Lagos, Akkra, Duala<br />
und Pointe Noire nehmen Ozeanriesen die <strong>Pro</strong>dukte des Landes auf. Von Kano, Bangi und Dakar aus starten die Flugzeuge<br />
zu ihrer Reise in die weite Welt. Die afrikanischen Städte wachsen erstaunlich schnell. Hochhäuser, Getreidemühlen und<br />
Fabriken, Schulen, Banken, Hotels, Krankenhäuser und Villen, von Europäern inmitten herrlicher Parkanlagen erbaut,<br />
prägen das Bild der Grossstädte. Moderne Geschäftshäuser schiessen wie Pilze aus dem Boden. Neben Fabriken und<br />
Bergwerken stehen sauber angelegte Arbeitersiedlungen für die Afrikaner.<br />
Sicherlich waren die damaligen Anstrengungen, in Teilen des Landes, d. h. in der Regel in den schnell wach-<br />
senden grossen Städten, eine Infrastruktur zu schaffen, die möglichst nahe an den Stand der industrialisierten<br />
Länder kam, gross, doch profitierten davon vor allem die eingewanderten Europäer und die schwarze Ober-<br />
schicht. Der Grossteil der Bevölkerung bekam von dieser Entwicklung wenig zu spüren. Interessant ist die<br />
Gewichtung dieses Fortschrittes in diesen und anderen Lehrmitteln der sechziger Jahre, denn spätere Lehrmit-<br />
tel sollten diesen immer noch vorhandenen Bereich "zugunsten" der ländlichen "Armut" vernachlässigen.<br />
Der letzte Abschnitt kommt auf die Kolonialgeschichte und die Einstellung der Europäer gegenüber den Afri-<br />
kanern zu sprechen (S. 31):<br />
Auch das Streben nach Gewinn und Reichtum führte zahlreiche Europäer nach Afrika. Europäische Staaten schufen sich<br />
grosse Kolonialreiche... Viele Weisse fühlten sich den Afrikanern überlegen, sahen in ihnen nur billige Arbeitskräfte, die<br />
man zu selbständigen Leistungen nicht für fähig hielt. Die "Schwarzen" wurden oft missachtet und ausgebeutet. Vom 17.<br />
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Millionen Eingeborene nach Amerika verschleppt und dort als<br />
Sklavenarbeiter an die Plantagenbesitzer verkauft. So ist es zu verstehen, wenn heute manche Afrikaner den "weissen<br />
Mann" hassen, seine Hilfe nur ungern annehmen...<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 155 und 191 dieser Arbeit.) Dieser "Hass" ist bis auf wenige Staa-<br />
ten nicht mehr von sehr grosser Bedeutung. Geblieben ist ein gewisses Misstrauen gegenüber den Ratschlägen<br />
der Experten aus den Industrienationen, was im Anbetracht der Vertretung von Eigeninteressen und vieler<br />
falscher Ratschläge in der Vergangenheit aufgrund der gemachten Erfahrungen wenig verwunderlich ist.<br />
Kabou ist sogar der Meinung, dass dieses Misstrauen einer der Hauptgründe für die Fortschrittsverweigerung<br />
gewisser Bevölkerungsschichten in Schwarzafrika sei. (Kabou 1995) In der Zusammenfassung auf der Seite 31<br />
schreibt der Autor:<br />
Die Arbeit der Europäer hat die Naturlandschaft Äquatorialafrikas teilweise umgestaltet Plantagen, Bergwerke und<br />
Fabriken liefern ihre Erzeugnisse auf den Weltmarkt.<br />
Europäische Forscher, Ärzte, Ingenieure und Lehrer helfen den Afrikanern bei der Erschliessung ihrer Länder.<br />
Der Autor vergisst, dass diese Umgestaltung der Landschaft an den damaligen Grenzen des tropischen Urwal-<br />
des viel früher begann, da bereits die einheimische Bevölkerung einen grossen Einfluss auf die Entstehung<br />
einer "Kultursteppe" hatte.<br />
4.15.3 "Der Neger und die neue Wirtschaft"<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Auf den Seiten 32-33 folgt ein Kapitel "Der Neger und die neue Wirtschaft". Die beiden auf diesen Seiten<br />
abgebildeten Fotos tragen die Beschriftungen "Dorf in Nigeria" (S. 32), die typischen Rundhütten werden<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 175
gezeigt, und "Bergarbeitersiedlung in Nigeria" (S. 33). Im Text zu diesem Thema heisst es im Abschnitt "Der<br />
Afrikaner im Stammesverband":<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
...Die Lebensweise der Afrikaner wurde durch den Zustrom weisser Siedler zunächst nicht verändert. Die Neger wohnten<br />
weiterhin in ihren geschlossenen Dörfern, im Urwald in langen Reihendörfern aus Giebelhütten, in der Savanne in<br />
unregelmässig angelegten Haufendörfern aus Kegeldachhütten. Welcher Arbeit sie auch nachgingen, immer kehrten sie zu<br />
ihren Familien in ihr Dorf zurück. Damit verblieben sie auch stets in der Gemeinschaft ihres Stammes. Man half sich<br />
gegenseitig beim Roden des Waldes, beim Abbrennen des Grases und beim Bearbeiten der Äcker. Man treibt gemeinsam<br />
das Vieh auf die Weide, man geht gemeinsam auf die Jagd. Bei Krankheit, in Unglück und Not ist gegenseitige Hilfe<br />
selbstverständlich. Feste werden mit Spiel und Tanz in der Gemeinschaft gefeiert. Diese Stammesgemeinschaften bestehen<br />
heute noch. Die Entwicklung der letzten Jahre hat aber die Bindungen gelockert.<br />
Hier wird also das Bild des "Negers" gezeichnet, der an seinem "Stamm mehr als eine Muschel am Felsen<br />
klebt". Dabei wird die gegenseitige Solidarität oft überschätzt oder idealisiert, denn diese erfüllt oft die Funk-<br />
tion von in vielen Industrieländern vorhandenen staatlichen oder privaten Vorsorgeversicherungen.<br />
Die geleistete Hilfe für in Not geratene Verwandte hing stark vom Verhalten des Bittstellers ab. Oft wurden<br />
solche in Not geratene Verwandte als billige Hilfskraft im eigenen Haushalt eingesetzt - in ähnlicher Weise,<br />
wie dies in der Schweiz noch bis in die fünfziger Jahre bei den Verdingkindern üblich war.<br />
Im Abschnitt "Der Neger als Industriearbeiter" werden die Vorzüge der Europäisierung gepriesen:<br />
...Die Weissen haben die Bodenschätze Äquatorialafrikas erschlossen. Sie legten Bergwerke an: Zink-, Blei-, Eisen- und<br />
Silbergruben im Kongobecken und an der Guineaküste, Kupferminen an der Katangaschwelle. Um Elisabethville (heute<br />
Lubumbashi genannt) ist ein bedeutendes Industriegebiet mit Kupferhütten, Maschinen- und Textilfabriken entstanden.<br />
Schinkolobwe, nördlich von Lubumbashi, hat die grösste Uranaufbereitungsanlage der Welt. Als billige Arbeitskräfte holte<br />
man Neger in die Bergwerke und Fabriken und gab ihnen in einfachen, sauberen Häusern Wohnung. Durch fachliche<br />
Schulung und menschliche Betreuung machte man sie zu tüchtigen und zuverlässigen Facharbeitern. Schnell hat der Neger<br />
gelernt, mit Münzen und Papiergeld umzugehen. Er kann in den Warenhäusern kaufen, was er will: Kleider, Sandalen,<br />
Lederschuhe, einen Anzug, einen Mantel. Der Afrikaner besucht Schulen und vom Staat eingerichtete Lehranstalten. Nicht<br />
nur im Lesen und Schreiben wird er unterrichtet, auch in Mathematik und in fremden Sprachen. Hunderte von Negern<br />
studieren an den Universitäten von Ibadan, Akkra, Kinshasa (Leopoldville) und Lubumbashi.<br />
"Durch fachliche Schulung und menschliche Betreuung" wurden also die "Neger" zu "tüchtigen und zuverläs-<br />
sigen" Menschen erzogen, die zur Belohnung für ihre Mühen kaufen konnten, was sie "wollten".<br />
Betroffene sehen diese Verbesserungen teilweise sehr viel kritischer, als der Text es hier zum Ausdruck bringt,<br />
denn dieser konzentriert sich ganz darauf, die an den Afrikanern vollbrachte Leistung der Weisen zu huldigen.<br />
Immerhin wird erwähnt, dass auch afrikanische Menschen eine Schule besuchen. (Siehe dazu die Karte "Anal-<br />
phabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" auf der Seite 571 im Anhang dieser Arbeit.)<br />
Im letzten Abschnitt "Verstädterung" wird die <strong>Pro</strong>blematik der Zuwanderung in die Städte besprochen. Dabei<br />
ist zu vermerken, dass die afrikanischen Städte zwar enorm gewachsen sind, bis heute aber schätzungsweise<br />
nur ein Viertel der Menschen Schwarzafrikas überhaupt in Städten oder stadtähnlichen Strukturen leben. Auch<br />
hier gibt es enorme Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Im Text heisst es (S. 33):<br />
...Weil das Geld lockt, wandern die Afrikaner heute in Massen mit ihren Familien in die Städte. Mit neuen Industriewerken<br />
entstehen zwar neue Siedlungen, aber die mustergültig angelegten Eingeborenenviertel können den Zustrom der<br />
Zuwandernden nicht mehr fassen. Die Wohnungsnot wird immer grösser. Viele schwarze Arbeiter wohnen noch in<br />
Holzbaracken an den Stadträndern, wo es weder Wasser- noch Lichtanlagen gibt. Da auch die Arbeit für so viele Menschen<br />
nicht ausreicht, steigt die Zahl der Arbeitslosen. Die Felder in der Heimat aber können nicht bestellt werden, weil es in den<br />
Dörfern an Arbeitskräften fehlt. Äusserlich haben sich zwar die Neger in Kleidung und Lebensweise der europäischen<br />
Zivilisation angepasst. Aber ohne die Stütze der Stammesgemeinschaft sind sie ihrem Stamm entfremdet und wurzellos<br />
geworden. Manche verfallen dem Müssiggang, der Spielleidenschaft und dem Alkoholgenuss. Unzufrieden, zugänglich für<br />
<strong>Pro</strong>paganda, lassen sie sich leicht zu masslosen Forderungen hinreissen. Aus eigener Kraft können die Neger ihre Nöte<br />
nicht beseitigen. Die Industrieländer Europas und die USA geben viel Geld aus, um Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser,<br />
Strassen und Fabriken zu bauen. Diese Unterstützung nennt man Entwicklungshilfe.<br />
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 171 und 222 dieser Arbeit.) Die "masslosen Forderungen" der<br />
einheimischen Bevölkerung werden nicht näher beschrieben. Es dürfte sich dabei aber um die immer lauter<br />
werdenden Unabhängigkeitsforderungen im wirtschaftlichen und auch politischen Bereich handeln. Mit der<br />
formalen Unabhängigkeit wurde meist nur ein kleiner Teil der kolonialen Strukturen beseitigt. Ausserdem<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 176
waren auch Ende der sechziger Jahre einige Staaten noch der direkten Kontrolle der betreffenden Kolonial-<br />
macht unterstellt. In der Zusammenfassung auf der Seite 33 schreibt der Autor kurz:<br />
Die Afrikaner ändern ihre Lebensweise und ihre Wirtschaftsformen. Dabei stehen sie oft vor grossen Schwierigkeiten.<br />
Diese Schwierigkeiten wurden zu einem grossen Teil weder durch die betroffenen Regierungen dieser Länder<br />
noch durch die von aussen gesteuerte Entwicklungshilfe gelöst.<br />
4.15.4 "Grosse Ströme im Dienste des Menschen"<br />
Das nächste Kapitel "Grosse Ströme im Dienste des Menschen" auf den Seiten 34-35 beschäftigt sich nur am<br />
Rande mit der einheimischen Bevölkerung. Zwei Fotos zeigen den Hafen Kinshasas und einen Staudamm in<br />
Uganda. Der Schwerpunkt des Kapitels liegt bei den geplanten oder bereits errichteten Staudämmen. Über den<br />
bereits erwähnten Akosombostaudamm in Ghana heisst es (S. 35):<br />
...Elektrische Energie soll am Volta-Staudamm in Ghana erzeugt werden. Seine Sperrmauer ist 640 m lang und 113 m<br />
hoch. Ein grosses Werk soll einen Teil des Stromes zur Aluminiumerzeugung nutzen. Mächtige Bauxitlager sind in der<br />
Nähe vorhanden. Durch den Stau wird der Fluss auf 300 km für Schiffe befahrbar...<br />
(Zum Voltastaudamm siehe auch die Seiten 173 und 223 dieser Arbeit.) Die in die Schiffahrt auf dem Voltasee<br />
gesetzten Hoffnungen wurden nicht erfüllt, dafür erwies sich der See als ausgesprochen fischreich. Als<br />
<strong>Pro</strong>teinlieferant trägt er massgeblich zur Ernährung der umliegenden Regionen Ghanas bei. In der Zusammen-<br />
fassung heisst es auf der Seite 35:<br />
Die grossen Ströme Innerafrikas sind wegen der Wasserschwankungen und Stromschnellen für eine durchgehende<br />
Schiffahrt nicht geeignet. Wichtig sind sie für die Bewässerung und die Erzeugung von elektrischem Strom. Der<br />
afrikanische Kontinent besitzt 28% der gesamten Wasserkraft der Welt. Nur ein geringer Teil wird bisher genutzt.<br />
Heutige Schätzungen gehen von 40% der Wasserkraft der Welt aus. Nach wie vor bleibt sie aber weitgehend<br />
ungenutzt. Trotzdem ist die Wasserkraft für einige schwarzafrikanische Staaten enorm wichtig. In der Demo-<br />
kratischen Republik Kongo und in Ghana erzeugt sie über 95% der insgesamt produzierten Elektrizität. Für<br />
Kenia liegt der Anteil immer noch über 80%. Da die Hauptproduktion oft auf einige wenige grössere Werke<br />
entfällt, ist die Energieversorgung aber stark abhängig von der verfügbaren Wassermenge. Die folgende Tabel-<br />
le zeigt die <strong>Pro</strong>duktionsschwankungen in Ghana.<br />
Tabelle: <strong>Pro</strong>duktionsschwankungen der Wasserkraftwerke Ghanas<br />
nach "Länderbericht: Ghana 1994", Statistisches Bundesamt Wiesbaden<br />
Jahr 1970 1975 1980 1985 1989 1990 1991<br />
<strong>Pro</strong>duktion in Mrd. kWh 2'882 3'948 5'276 2'996 4'820 5'801 6'108<br />
1 Angabe nach 3D-Weltatlas<br />
4.15.5 "Kolonien werden selbständige Staaten"<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Die Seiten 36-37 beschäftigen sich unter dem Titel "Kolonien wurden selbständige Staaten" mit den Unabhän-<br />
gigkeitsbestrebungen der afrikanischen Länder. Zu diesem Thema findet sich auf der Seite 37 ein Foto mit der<br />
Bildlegende "Parlamentseröffnung in Ghana". (Zur Vorreiterrolle Ghanas unter Kwame Nkrumah im<br />
Unabhängigkeitsstreben der schwarzafrikanischen Länder siehe die Seite 218 dieser Arbeit).<br />
Afrika wurde lange Zeit von europäischen Staaten beherrscht. Sie hatten den Kontinent in Kolonien aufgeteilt. Der Wunsch<br />
nach Freiheit und Unabhängigkeit wurde aber bei den Afrikanern immer brennender. Eine Kolonie nach der anderen<br />
gewann ihre Selbständigkeit, so dass es in Afrika heute nur noch Reste des alten Kolonialbesitzes gibt... Die jungen Staaten<br />
haben aber mit vielen inneren Schwierigkeiten zu kämpfen. Viele Afrikaner fühlen sich weniger ihrem Staat als ihrem<br />
Stamm zugehörig. Da die Grenzen der Kolonien willkürlich gezogen wurden, zerschnitten sie oft die Stammesgebiete. Für<br />
den Zusammenhalt der jungen Staaten sind jedoch die alten Stammesfeindschaften noch gefährlicher. In der Kolonialzeit<br />
wurden die Kämpfe zwischen den einzelnen Stämmen mit Gewalt unterdrückt. Jetzt leben sie wieder auf.<br />
Dieses im Text kritisierte Stammesbewusstsein wurde nur sehr punktuell unterdrückt, generell aber durch die<br />
Kolonialpolitik, welche die Menschen Afrikas zwecks besserer Verwaltung in teilweise künstliche Gruppen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 177
aufteilte, gefördert und teilweise sogar erst geschaffen. Hinter den vom Autor gemachten Aussagen steht das<br />
rassistische Konzept des Tribalismus, das, obwohl auch von afrikanischen Politikern immer wieder herbeige-<br />
zogen, nicht haltbar ist. Ulrich Meister schreibt in seinem Buch "Afrika, die verlorene Illusion": "Aber Triba-<br />
lismus ist kein exklusives afrikanisches Phänomen: anderswo gibt es Regionalismus, Kantönligeist, ein Nordir-<br />
landproblem... Aber nur für Afrika werden solche komplizierten ethnischen, religiösen, soziokulturellen, histo-<br />
rischen Spannungen und Unterschiede auf einen angeblich 'primitiven' Stammeskonflikt reduziert." (Meister<br />
1986, S. 44) Auch bei den Abspaltungsbemühungen des mehrheitlich französischsprachigen Quebecs von<br />
Kanada spricht niemand von Stammeskonflikten, während bei ähnlichen Bestrebungen der Yoruba, die einst<br />
eine eigene Nation bildeten, sich vom Rest Nigerias loszusagen, sofort wieder der Tribalismus im Zentrum der<br />
internationalen Nachrichten steht. Die rassistische Sichtweise spiegelt sich auch darin, dass selbst dann noch,<br />
wenn die betroffenen Gruppen Millionen von Menschen zählen, von Stämmen gesprochen wird, wo anderswo<br />
schon lange von einem Volk oder einer Nation die Rede wäre. (Siehe dazu auch das Zitat von Okwudiba Nnoli<br />
auf der Seite 127 dieser Arbeit.)<br />
Der Autor fährt mit einer Beschreibung der Entwicklung in der Republik Kongo, der heutigen Demokratischen<br />
Republik Kongo fort (S. 36):<br />
Die Republik Kongo mit der Hauptstadt Kinshasa (früher Leopoldville genannt) zeigt besonders deutlich diese<br />
Schwierigkeiten. Das Land besitzt reiche Bodenschätze. In Katanga werden Kupfer, Uran, Kobalt und Zinn gewonnen, bei<br />
Luluaburg Industriediamanten. Als 1960 die Belgier ihrer Kolonie die Selbständigkeit gaben, sollten, wie in den modernen<br />
europäischen Staaten, ein Präsident, eine Regierung und ein Parlament den Staat führen. Aber nach der<br />
Unabhängigkeitserklärung brachen zwischen den einzelnen Stämmen Kämpfe aus. Fast alle europäischen Beamten und<br />
Offiziere, die beim Aufbau helfen sollten, mussten fliehen. Der junge Staat drohte auseinanderzubrechen. Es zeigte sich,<br />
dass die von den Belgiern willkürlich zusammengefügte Kolonie noch nicht zu einem einheitlichen Land<br />
zusammengewachsen war. Die gewählten Abgeordneten fühlten sich als Vertreter ihrer Stämme, das Heer gehorchte nicht<br />
der Regierung und den Offizieren. Viele Soldaten befolgten die Befehle ihrer früheren Stammeshäuptlinge. Um einen<br />
Zusammenbruch des Staates zu verhindern, mussten die Vereinten Nationen 15'000 fremde Soldaten als Polizei in den<br />
Kongo schicken. Nur mit Mühe gelang es bisher, die Einheit des Landes zu bewahren. Noch heute fehlt es an gut<br />
ausgebildeten Beamten, Juristen, Ärzten, Lehrern, Offizieren, Ingenieuren und Wirtschaftsfachleuten. Sie auszubilden, ist<br />
die dringendste Aufgabe. Dazu müssen die wenigen neuen höheren Schulen, Fachschulen und Universitäten ausgebaut<br />
werden. Vielleicht wird an ihnen einmal das Bewusstsein wachsen, zu einem einzigen Volk zu gehören. Bis es soweit ist,<br />
bedarf es noch Jahre harter Arbeit und tatkräftiger Hilfe durch die Industrieländer der Welt. Europäische Berater sind<br />
wieder im Kongo tätig, junge Afrikaner studieren an europäischen Hochschulen.<br />
Ein Foto zur "Kupfermine in Katanga" ist auf Seite 36 abgebildet. (Zur Demokratischen Republik Kongo siehe<br />
auch die Seiten 158 und 253 dieser Arbeit.) Im Text fährt der Autor mit der Beschreibung der Entwicklung in<br />
Ghana fort (S. 37):<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Die Republik Ghana entwickelte sich ruhiger. Sie hat sich nach einem grossen Negerreich benannt, das vor Jahrhunderten<br />
im westlichen Sudan bestand. Als britische Kolonie trug dieses Land den Namen Goldküste, weil dort im Sand Gold<br />
gefunden wurde. 1956 hat der junge Eingeborenenstaat seine Unabhängigkeit erhalten.<br />
Kakao ist der Reichtum des Landes. Europäer hatten mit dem Anbau in Pflanzungen begonnen. Als sie damit grossen<br />
Erfolg hatten, zeigten sie den Eingeborenen, wie man den Kakaobaum pflanzen und pflegen muss. Auch Afrikaner legten<br />
Kakaoplantagen an. Heute gibt es neben vielen kleinen Kakaobauern auch eingeborene Unternehmer, die Zehntausende<br />
von Kakaopflanzen besitzen. Sie sind wohlhabend geworden und sind sich ihres Besitzes und ihrer Geltung bewusst.<br />
Ghana liefert heute fast 25% der Welterzeugung an Kakao.<br />
Ein weiterer Reichtum des Landes sind seine Bodenschätze. In den Bergwerken, in denen viele Afrikaner Arbeit finden,<br />
gewinnt man Diamanten, Gold und Manganerze, vor allem aber Bauxit.<br />
Die Hauptstadt Akkra zeigt den Reichtum des Landes. Bauwerke aus Beton und Glas, Krankenhäuser, Schulen und<br />
Kirchen werden errichtet. Das Nationalmuseum und die Staatsbibliothek geben Zeugnis vom kulturellen Leben der Stadt.<br />
Starker Verkehr flutet über die breiten, asphaltierten Strassen.<br />
Der anfängliche wirtschaftliche Erfolg Ghanas fand ein jähes Ende, als die Rohstoffpreise für Kakao ihre<br />
Talfahrt antraten. (Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 169 und 187 dieser Arbeit.) Obwohl Ghana über<br />
eine im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen Staaten gute Infrastruktur verfügt, in die noch immer<br />
massiv investiert wird - in den letzten drei Jahren wurde z. B. die Kanalisation der drittgrössten Stadt massiv<br />
ausgebaut -, zählt es heute zu den ärmeren Ländern der Welt, wie aus der Karte "Bruttosozialprodukt pro<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 178
Kopf" im Anhang auf Seite 569 dieser Arbeit ersichtlich ist. Zusammenfassend heisst es am Ende dieses Kapi-<br />
tels (S. 37):<br />
Die meisten Staaten Afrikas waren früher Kolonien europäischer Länder. Fast alle haben erst in den letzten Jahren ihre<br />
politische Unabhängigkeit erhalten. Zu ihrer weiteren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung bedürfen<br />
sie noch fremder Hilfe.<br />
Die Karte "Erlangung der Unabhängigkeit" auf der Seite 565 dieser Arbeit zeigt: Ende der sechziger Jahre<br />
wurden vor allem im südlichen Afrika noch viele Staaten von den ehemaligen Kolonialmächten beherrscht.<br />
4.15.6 Äquatorialafrika und Sudan<br />
Auf den Seiten 38-39 zu "Äquatorialafrika und der Sudan" ist eine Karte der Region abgedruckt, sowie eine<br />
Tabelle, die über die staatliche Gliederung der Region Auskunft gibt. Die darin aufgeführten Daten werden im<br />
Anhang auf Seite 559 zusammen mit anderen Länderdaten zu Schwarzafrikas wiedergegeben. Im Text heisst<br />
es zusammenfassend über die Menschen dieses Grossraumes:<br />
Die Bewohner sind in Äquatorialafrika vorwiegend Bantu, im Sudan Sudanneger. Nur im Kongobecken haben sich in<br />
abgelegenen Urwaldgebieten noch Pygmäen halten können. Im Innern der Regenwälder ist die Bevölkerungsdichte<br />
allgemein gering, sie nimmt an den Flussläufen und in der Feuchtsavanne zu, in der Trockensavanne jedoch wieder ab. Als<br />
Sammler und Jäger, Fischer und Hackbauern stehen die Eingeborenen teilweise noch auf den niedrigsten<br />
Wirtschaftsstufen. Jedoch arbeiten viele schon in Fabriken und Bergwerken. Manche übernahmen Plantagen oder schufen<br />
neue. Noch vor wenigen Jahren waren nur Europäer als Pflanzer tätig.<br />
Junge Staaten entstanden hier zwischen 1957 und 1965. Bis dahin gab es ausser den Kolonien europäischer Länder nur die<br />
Republik Liberia. Sie wurde bereits 1847 von freigelassenen afrikanischen Negersklaven gegründet. 1957 entstand aus der<br />
früheren britischen Kolonie Goldküste und einem schmalen Streifen der einstmaligen deutschen Kolonie Togo die<br />
Republik Ghana. 1958 wurde die französische Kolonie Guinea selbständig, und in den nächsten Jahren gingen weitere<br />
Staaten den Weg in die Unabhängigkeit. Jedoch brauchen diese jungen Staaten noch auf Jahre die Hilfe und Unterstützung<br />
Europas. Europäische Wissenschaftler, Ingenieure, Ärzte und Verwaltungsfachleute helfen beim Aufbau von Verwaltung<br />
und Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheitsfürsorge. Durch den Bau von Fabriken, Strassen, Eisenbahnen und<br />
Staudämmen, durch Anleihen und Schenkungen unterstützen die europäischen Staaten diesen Aufbau.<br />
Wieder wird im Text die Behauptung aufgestellt, die jungen Staaten Schwarzafrikas könnten nur mit der Hilfe<br />
und Weisheit der Europäer einen "normalen" Lebensstandard erreichen. Das hinter der Hilfe an diese Länder<br />
massive wirtschaftliche Interessen lagen, wird im Text nicht erwähnt.<br />
4.15.7 Ostafrika<br />
Nach der Besprechung Äquatorialafrikas und der Sudanzone folgt auf den Seiten 40-51 die Schilderung Ostaf-<br />
rikas in den Kapiteln: "Das ostafrikanische Graben- und Seengebiet" (S. 40-41); "Der höchste Berg Afrikas"<br />
(S. 42-43), mit einer Darstellung der Höhenstufen am Kilimandscharo; "Wertvolles Plantagenland" (S. 44-45),<br />
in dem drei Fotos zur Plantagenwirtschaft "Kopragewinnung auf Sansibar" (S. 44) und "Sisalernte" und<br />
"Trocknen der Fasern" (S. 45) wiedergegeben werden. Im Text dazu schreibt der Autor über die Bevölkerung<br />
des Küstentieflandes Ostafrikas (S. 44-45):<br />
...In kleinen Pflanzungen bauen die hier lebenden Bantu Mais, Hirse, Reis und Bananen an. Kokospalmen liefern ihnen<br />
ausser ihren Früchten das Holz für den Hausbau sowie Bast und Fasern für Kleider und Matten. So hat die Kokospalme<br />
hier eine ähnliche Bedeutung wie die Dattelpalme oder die Ölpalme in anderen Landschaften Afrikas. Die Erschliessung<br />
des Küstenlandes ist nicht zuletzt das Werk der Europäer, deren Plantagen Kokosnüsse, Bananen und Zuckerrohr liefern.<br />
Auf der Insel Sansibar kommen Gewürznelken hinzu...<br />
Am Ende des Kapitels schreibt der Autor zusammenfassend:<br />
Die Savannen des ostafrikanischen Hochlandes werden für die Plantagenwirtschaft genutzt. Sie liefern Sisal, Erdnüsse,<br />
Baumwolle und Kaffee für den Weltmarkt. Im Küstentiefland liegen Kokospalmen- und Zuckerrohrpflanzungen.<br />
Das nächste Kapitel auf den Seiten 46-47, in dem auch zwei Fotos mit den Bildlegenden "Im Bergland von<br />
Äthiopien (Strasse Asmara - Addis Abeba)" (S. 46) und "Feldbestellung" (S. 47) wiedergeben werden, ist dem<br />
"Gebirgsland Äthiopien" gewidmet:<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
...Die Landwirtschaft ist wie vor Jahrtausenden die Lebensgrundlage der Äthiopier... In den feuchtheissen Tälern wächst<br />
dichter Regenwald. Elefanten, Büffel und Affen leben in dieser von Menschen nur dünn besiedelten Landschaft. An<br />
geeigneten Stellen werden Hirse, Mais und Baumwolle, Zuckerrohr, Bananen und Tabak angebaut... Der Gürtel des mässig<br />
warmen Klimas ist waldarm... Die Waldarmut ist durch Rodung entstanden. Hier liegt das eigentliche Siedlungsgebiet. Die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 179
Äcker werden noch immer mit dem hölzernen Hakenpflug bearbeitet, der von Rindern oder Eseln gezogen wird. Man baut<br />
Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Wein und Kaffee an. Die Landschaft Kaffa im südwestlichen Äthiopien ist die<br />
Heimat des Kaffeestrauches. Er wächst dort wild. Seine Früchte werden noch heute gesammelt. In den Höhen von 2400 bis<br />
3800 m liegt das Hauptviehzuchtgebiet. Sesshafte Hirten halten Herden von Rindern, Schafen, Ziegen, Eseln und<br />
Maultieren... Bis hierher wird noch Gerste angebaut...<br />
(Zum Kaffeeanbau siehe auch die Seiten 166 und 225 dieser Arbeit.) Nach dieser recht ausführlichen<br />
Beschreibung der landwirtschaftlichen Grundlagen, führt der Autor zu der Entwicklung Äthiopiens aus (S. 46):<br />
...Das Verkehrswesen ist noch wenig entwickelt. Bisher erfolgt der lebhafte Handel zwischen den drei landwirtschaftlich<br />
verschieden genutzten Höhenstufen über schmale Bergpfade. Maultier- und Kamelkarawanen stellen die Verbindung her.<br />
Zur Küste führen nur zwei Eisenbahnlinien. Von dem französischen Hafen Dschibuti am Roten Meer keucht zweimal in<br />
der Woche ein Zug nach der 2400 m hoch gelegenen Hauptstadt Addis Abeba hinauf. Die Fahrt auf der fast 800 km langen<br />
kurvenreichen Strecke dauert drei Tage. Eine zweite, täglich befahrene Strecke führt von Massaua, der heissesten Stadt am<br />
Roten Meer, in kühnen Windungen und Kehrtunnels nach Asmara in 2'340 m Höhe.<br />
Soll die Wirtschaft Äthiopiens gefördert werden, so müssen dringend neue Strassen gebaut werden. Zu diesem Zweck hat<br />
der Kaiser von Äthiopien Europäer und Amerikaner in sein Land geholt. Der weitere Ausbau des Verkehrsnetzes hängt<br />
aber auch vom Aufbau einer eigenen Industrie ab. Bisher sind nur hier und da kleine Fabriken entstanden. Die<br />
Bodenschätze des Landes - Eisenerz, Kohle, Erdöl, Gold und Platin - sind kaum erschlossen.<br />
Das Schwergewicht der Beschreibung liegt hier stark auf den für Europa wichtigen <strong>Pro</strong>dukten Äthiopiens,<br />
wohl deshalb werden Vieh- oder Weihrauchexporte, die immer noch für den Export nach der saudiarabischen<br />
Halbinsel eine wichtige Rolle spielen, nicht erwähnt.<br />
In der Zusammenfassung auf der Seite 47 wird noch einmal wiederholt, dass "Verkehr und Industrie des<br />
Landes nur wenig entwickelt" seien. Dieser Zustand verbesserte sich während der sozialistischen Regierungs-<br />
zeit und den Jahren des Bürgerkrieges nicht. (Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 166 und 226 dieser Arbeit.)<br />
Im letzten Kapitel zu Ostafrika unter dem Titel "Ostafrikas Völkergemisch" auf den Seiten 48-49, auf denen<br />
sich auch drei Fotos mit den Bildlegenden "Watussi mir Rindern" (S. 48), "Gallafrau" und "Massaifrau" (S. 49)<br />
befinden, schreibt der Autor:<br />
Im ostafrikanischen Hochland bilden Bantu den Hauptteil der Bevölkerung. Sie wohnen in geschlossenen Dörfern. Ihre<br />
runden oder rechteckigen Hütten sind aus Lehm errichtet und mit harten Gräsern gedeckt. Die Bantu sind Hackbauern, die<br />
ihre kleinen Felder verlegen, wenn der Boden nach einigen Jahren unbrauchbar wird. Viele unter ihnen haben sich aber<br />
schon als gelehrige Schüler der Weissen erwiesen. Ihnen gehören bereits Plantagen, die Sisal, Baumwolle oder Kaffee für<br />
den Export erzeugen. Vor Jahrhunderten drangen hamitische Völker von Norden her ein. Sie unterwarfen die Bantu östlich<br />
des Viktoriasees. Dort ziehen sie noch heute als viehzüchtende Nomaden mit Rindern, Schafen, Ziegen und Kamelen<br />
durch die Savannen. Ihre wichtigsten Stämme sind die Watussi und die Massai. Die Watussi sind mit einer Körpergrösse<br />
von etwa 2 m die grössten Menschen der Erde. Die Massai drangen bis südlich des Kilimandscharo vor. Sie sind kluge und<br />
mutige Menschen. Ihre Frauen schmücken sich mit Spiralen aus Silberdraht oder Ringen aus Perlen an Hals, Armen und<br />
Beinen. Die Herden der Massai erlitten häufig durch die Rinderpest oder durch lange Trockenheit schwere Verluste. Dann<br />
waren Hungersnöte die Folge, und die Massai raubten aus den Dörfern der Bantu, was sie zum Leben brauchten. Infolge<br />
dieser Hungersnöte ist die Zahl der Wanderhirten stark zurückgegangen.<br />
(Zu den Massai siehe auch die Seiten 164 und 200, zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas die Seiten 148 und<br />
203 dieser Arbeit.)<br />
...Ein Mischvolk aus Bantu, Arabern und Indern sind die mohammedanischen Wasuaheli. Ihre Sprache, das Kisuaheli, ist<br />
die wichtigste Handelssprache Ostafrikas. Seit Beginn unseres Jahrhunderts kamen Europäer als Pflanzer, Kaufleute,<br />
Missionare, Lehrer, Ärzte oder Techniker ins Land. Ihre Aufgaben werden nach und nach von Afrikanern übernommen;<br />
die Weissen kehren nach Europa zurück.<br />
In Äthiopien beherrscht eine dünne Oberschicht als Beamte oder Grossgrundbesitzer das Land. Bis vor wenigen Jahren<br />
waren die Bauern Leibeigene. Die Äthiopier sind Mischlinge aus Semiten, Hamiten und Negern. Sie gliedern sich in<br />
zahlreiche Volksstämme und sprechen weit mehr als hundert verschiedene Sprachen. Die amtliche Landessprache ist die<br />
der Herrenschicht, der Amharen. Im Süden Äthiopiens leben die Galla. Sie sind wie die Somali auf der gleichnamigen<br />
Halbinsel ein hamitisches Hirtenvolk.<br />
Äthiopien, im Südosten Ägyptens gelegen, hat eine lange und wechselvolle Geschichte, die, obwohl sie der<br />
Autor nicht anspricht, wesentlich zu diesem Völkergemisch beigetragen hat. Allerdings ist Äthiopien bei<br />
weitem nicht das einzige Land Schwarzafrikas, welches einen solchen Völkerreichtum aufweist.<br />
Auffallend an der Beschreibung der Bevölkerung und der Landschaft Äthiopiens ist, dass noch nicht von<br />
einem Hungerland gesprochen wird. (Siehe dazu die Besprechung des Kapitels "Die nächste Katastrophe" im<br />
Lehrmittel "Terra Erdkunde für Realschulen" von 1980-1985 auf der Seite 353 dieser Arbeit.) Zusammenfas-<br />
send heisst es am Ende des Kapitels:<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 180
Ostafrika hat die verschiedenartigste Bevölkerung aller afrikanischen Landschaften. Im Hochland leben Bantu und<br />
nomadisierende Hirtenvölker. Im Küstentiefland wohnen Bantu, Araber und Inder. Die Äthiopier sind ein Mischvolk.<br />
Im Gegensatz zu den Bemerkungen im Lehrmittel "Länder und Völker" (siehe dazu die Seite 201 dieser<br />
Arbeit) wird von den Inder nicht behauptet, sie würden die schwarzen Bevölkerungsschichten ausbeuten.<br />
Den Abschluss zum Grossraum Ostafrika bildet der "Überblick: Ostafrika" auf den Seiten 50-51, der neben<br />
einer Karte (S. 50) und einer Tabelle "Staatliche Gliederung" (deren Angaben werden im Anhang dieser Arbeit<br />
auf der Seite 559 wiedergegeben), der im abschliessenden Text folgendes über die Bevölkerung und die<br />
Länder Ostafrikas aussagt:<br />
Der Grossraum Ostafrika reicht vom Hochland von Äthiopien über fast 4'000 km bis an die Sambesimündung. Die<br />
durchschnittliche Breite beträgt 1000 km. Auf einer Gesamtfläche von 4 Millionen km 2 leben hier rund 60 Millionen<br />
Menschen. Trotz der Lage in der Tropenzone sind die Lebensbedingungen verhältnismässig günstig. Die Hochländer<br />
haben mildere Temperaturen als die Küstenebenen... Oft vernichten Affen, Wildschweine oder Vögel die Ernte auf den<br />
Feldern der Eingeborenen. Tag und Nacht stehen Wachen bereit, um die Tiere zu verscheuchen. Darf man sich wundern,<br />
dass der Neger, dem trotz aller Vorsicht eine Affenherde die Maisernte vernichtet hat, zum Giftpfeil greift, obwohl ihm das<br />
Gesetz die Jagd verbietet?<br />
Während in anderen Publikationen, die nur wenige Jahre älter sind, die Jagd von Wildtieren durch Schwarze<br />
mit grossem Unmut betrachtet wird (z. B. in "Dreimal um die Erde" von 1977-1980, siehe dazu die Seite 272<br />
dieser Arbeit), so billigt der Autor diese zwar nicht, teilt den Leser aber die Beweggründe der betroffenen<br />
Menschen mit, die Gesetzgebung in diesem Gebiet zu umgehen.<br />
Die Wirtschaft Ostafrikas blüht auf. Plantagen beliefern den Weltmarkt mit den verschiedensten Erzeugnissen. Wichtig ist<br />
der Ausbau der Verkehrswege. Schon führen Eisenbahnen und Strassen von der Küste ins Innere. Moderne Flughäfen<br />
liegen bei Entebbe, Nairobi, Mombasa und Daressalam. Nur Äthiopien ist wenig erschlossen. Die Bodenschätze Ostafrikas<br />
sind kaum erforscht. Am Viktoriasee gewinnt man Gold, Kupfer und Zinn.<br />
Zur politischen Entwicklung schreibt der Autor auf der Seite 305:<br />
Die staatlichen Verhältnisse sind verschieden wie die Landschaften und die Menschen. Äthiopien ist ein fast 2000jähriges<br />
unabhängiges Kaiserreich. Seit dem 4. Jahrhundert hat sich hier das alte koptische Christentum erhalten. Das Land ist eine<br />
christliche Insel inmitten einer vorwiegend mohammedanischen Umwelt. Es wurde 1936 vorübergehend von den Italienern<br />
besetzt. Aber schon 1941 entstand das Kaiserreich neu. Ihm wurde 1952 die frühere italienische Kolonie Eritrea<br />
angegliedert. Dadurch erhielt es einen Zugang zum Roten Meer. Die Republik Somalia wurde 1960 aus den früheren<br />
Kolonien Italienisch-Somaliland und Britisch-Somaliland gebildet. Französisch-Somaliland ist ein Überseegebiet der<br />
Französischen Republik. Das frühere Deutsch-Ostafrika und später von Grossbritannien verwaltete Tanganjika ist seit 1961<br />
selbständig. 1963 schloss es sich mit dem bis dahin britischen Sansibar zur Republik Tansania zusammen. Die britischen<br />
Schutzgebiete Uganda und Kenia wurden 1962 und 1965 frei. 1962 entstanden aus dem von Belgien verwalteten<br />
Ruanda-Urundi die Republik Ruanda und das Königreich Burundi. Mosambik ist eine portugiesische Überseeprovinz.<br />
Interessanterweise schreibt der Autor im gleichen Lehrmittel, in dem einige Seiten vorher noch von den "un-<br />
verschämten Forderungen" der Schwarzen die Rede war, dass die britischen Schutzgebiete Uganda und Kenia<br />
nun "frei" seien.<br />
Eritrea erlangte 1993 die Unabhängigkeit von Äthiopien, Französisch-Somaliland entspricht dem heutigen<br />
Djibouti und Somalia hat sich, wenn auch von der Weltöffentlichkeit und der OAU (der Vereinigung afrikani-<br />
scher Staaten) - deren erklärtes Ziel es ist, die Ländergrenzen aus der Kolonialzeit nicht zu verändern - nicht<br />
anerkannt, in zwei Territorien gespalten, die dem ehemaligen Italienisch- respektive Britisch-Somaliland<br />
entsprechen.<br />
4.15.8 Südafrika<br />
Auf den Seiten 52-61 wird der Grossraum "Südafrika" besprochen. Nach den zwei Kapiteln "Die Landschaf-<br />
ten" (S. 52-53) und "Die Republik Südafrika, ein reiches Land" (S. 54-55), beschreibt der Autor im Kapitel<br />
"Schwarz und Weiss in Südafrika" auf den Seiten 56-57 - auf denen sich auch ein Foto mit der Bildlegende<br />
"Ovambokral" (S. 57) findet, welches den Haustyp der Ovambo abbildet - die verschiedenen Lebensumstände<br />
der Einheimische:<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Die Urbevölkerung Südafrikas bestand aus Buschmännern und Hottentotten. Sie gehören nicht zu den Negern. Von beiden<br />
Völkern leben nur noch wenige Tausend. Die hellfarbigen Hottentotten sind Wanderhirten. Die gelbbraunen, nur 1,30 bis<br />
1,40 m grossen Buschmänner stehen wie die Pygmäen auf primitiver Kulturstufe. Sie haben sich in die Kalahari<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 181
zurückgezogen. Dort leben sie von Wurzeln, Knollen, Früchten, Fröschen, Raupen und Heuschrecken. Auch Eidechsen<br />
und Strausseneier werden eifrig gesucht.<br />
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 161 und 206 dieser Arbeit.) Wieder ist von der "primitiven<br />
Kulturstufe" die Rede, ohne dass eine genauere Beschreibung darüber folgt, was Kultur eigentlich sei. Zwar<br />
zählt der Autor verschiedene Nahrungsquellen auf, erwähnt aber nicht, dass die Strausseneier nicht nur als<br />
Nahrungsmittel, sondern auch als Wasserbehälter dienten. Über die anderen Völker Südafrikas schreibt er<br />
(S. 56):<br />
Die Bantustämme Zulu, Herero, Ovambo und Basuto drangen von Norden durch den feuchten Osten des Erdteils nach<br />
Süden vor. Wo sie günstige Lebensbedingungen, vor allem Wasser, fanden, hielten sie sich mit ihren Herden auf. Wenn die<br />
Weiden abgegrast waren, zogen sie weiter. Nach und nach sind sie sesshaft geworden. Während die Männer tagsüber mit<br />
ihren Herden umherziehen und zu den grossen Viehtränken wandern, obliegt den Frauen die Feldarbeit. Sie bestellen den<br />
Boden vor allem mit Mais und Hirse. Ihre Siedlungen sind verschieden, je nach der Sitte des Stammes. Die Zulus legen die<br />
eigenartigen, mit Binsenmatten bedeckten, kuppelförmigen Hütten rings um einen freien Platz an, der dem Vieh zum<br />
nächtlichen Aufenthalt dient. Man bezeichnet diese Dorfform als Kral. Durch einen Verhau von Dornsträuchern oder durch<br />
Holzzäune wird das ganze nach aussen abgeschlossen.<br />
Der Autor zählt nicht nur verschiedene Völker auf - in vielen offiziellen Statistiken der damaligen Republik<br />
Südafrika werden diese alle in der Kategorie der Farbigen, d. h. Schwarzen, zusammengefasst und so von<br />
anderen Publikationen übernommen, so dass eine zahlenmässige Differenzierung schwierig ist -, er beschreibt<br />
auch einige der Besonderheiten der verschiedenen Gruppen.<br />
Über die weisse Schicht schreibt der Autor im Zusammenhang mit der schwarzafrikanischen Bevölkerung:<br />
Die Weissen wanderten zur gleichen Zeit wie die Bantu ein... In heftigen Kämpfen boten sie [die Buren, Anm. des<br />
Verfassers] den vordringenden Bantu Halt. Engländer, Buren und Bantu leben heute in der Südafrikanischen Union<br />
zusammen...<br />
Wie in anderen Lehrmitteln wird der Anspruch der Buren auf das Land im südlichen Afrika dadurch unter-<br />
stützt, dass der Eindruck erweckt wird, es habe sich bei diesen Räumen um menschenleere Gebiete gehandelt,<br />
die erst durch die Bantus und Buren besiedelt worden wären. Dabei geht vergessen, dass das Gebiet zwar dünn<br />
besiedelt, aber doch bevölkert war. Hinzu kommt, dass beispielsweise die "Buschleute", infolge der Landesna-<br />
tur und der von ihnen betriebenen Jagd- und Sammelwirtschaft, auf grosse Gebiete, die nur von wenigen<br />
Menschen betreten wurden, angewiesen waren.<br />
Im Abschnitt "Die neue Zeit" heisst es:<br />
...Als Bergbau und Industrie in Südafrika Eingang fanden, verliessen die Bantu zu Hunderttausenden ihre Familien und<br />
zogen in die Städte. Dieser Zustrom hält bis heute an. Zum Teil sind die Schwarzen Wanderarbeiter. Sie finden in<br />
Arbeitslagern kostenlos Unterkunft und Verpflegung, werden dort auch ärztlich betreut. Mit dem verdienten Geld kehren<br />
sie in ihr Stammesgebiet zurück, wo ihre Angehörigen inzwischen die Felder bestellt haben. Ist das Geld aufgebraucht,<br />
nehmen die Männer neue Arbeit auf. Viele kehren aber nach Ablauf ihres Arbeitsvertrages trotz der strengen Passgesetze<br />
nicht wieder in den Kral zurück. Sie holen ihre Familie in die Stadt und bilden die ständig wachsende Schicht der<br />
schwarzen <strong>Pro</strong>letarier in den Randgebieten der grossen Städte. Bergbaubetriebe und Industriewerke haben zwar<br />
Arbeitersiedlungen angelegt; trotzdem fehlt es überall an Wohnungen wie auch an Schulen und Krankenhäusern. Viele<br />
Menschen in den Grossstädten hausen noch in Elendsquartieren.<br />
Selbst unter der 1994 demokratisch gewählten Regierung Mandelas blieben viele Familien ohne Elektrizitäts-<br />
oder Wasserversorgung.<br />
Nach der Beschreibung der Veränderungen in der Lebensweise der schwarzen Bevölkerung, folgt ein<br />
Abschnitt über die Politik der "Apartheid", die spätestens seit Alan Patons Roman "Cry, the Beloved Country"<br />
von 1948 in das Blickfeld der Weltöffentlichkeit geriet:<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
...In der Republik Südafrika stehen 12 Millionen Schwarze den 3 Millionen Weissen gegenüber. Die Europäer fürchten die<br />
schnelle Bevölkerungszunahme bei den Afrikanern. Da aber die Weissen die politische Macht in der Hand behalten<br />
wollen, hat ihre Regierung Gesetze erlassen, nach denen die Afrikaner streng getrennt von den Europäern leben sollen.<br />
Man nennt diese Politik der Trennung "Apartheid". Deshalb wurden den Bantu "Reservate" zugewiesen, die ihnen allein<br />
zur Besiedlung und Nutzung vorbehalten sind, die sie aber auch selbst verwalten. Zur Zeit umfassen diese Reservate ein<br />
Neuntel der Gesamtfläche der Südafrikanischen Union. In ihnen leben etwa 4,2 Millionen Neger. Durch Ankauf von<br />
Farmland versucht die Regierung, die Reservate zu vergrössern.<br />
In den Städten wohnen heute 3,2 Millionen Neger. Hier haben sie aber keine politischen Rechte. Sie müssen besondere<br />
Krankenhäuser, Hotels, Schulen und Kirchen, Postschalter, Lichtspieltheater und Einkaufsläden benutzen und in<br />
Eisenbahnen und Omnibussen gesonderte Plätze einnehmen. Viele Berufe sind ihnen versperrt Ein schwarzer Arbeiter<br />
verdient durchweg nur ein Fünftel von dem Lohn des weissen Arbeiters, der die gleiche Stellung innehat. Die Neger aber<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 182
wissen, dass sie als Arbeitskräfte unentbehrlich sind und verlangen energisch Beseitigung der Rassenschranken, gleiche<br />
Löhne und politische Gleichberechtigung mit den Weissen.<br />
Der neutrale Bericht über die Apartheid, der sich gegenüber dem auf der Seite 2 dieser Arbeit abgedruckten<br />
Zitat stark unterscheidet, dürfte auch auf die Entwicklung in den USA und das Bekanntwerden des dortigen<br />
Predigers Martin Luther King zurückzuführen sein, der in seiner Rede "I have a dream" über die amerikani-<br />
schen Verhältnisse sagte: "...One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst<br />
of a vast ocean of material prosperity...". Weiter führte er aus: "I have a dream that one day this nation will<br />
rise up and live out the true meaning of its creed: 'We hold these truths to be self-evident: that all men are<br />
created equal.'...I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be<br />
judged by the color of their skin but by the content of their character." (King, 1963) Eine Hoffnung die den<br />
informierten Schwarzen Südafrikas seltsam vertraut scheinen musste und für sie bis in die neunziger Jahre ein<br />
Traum bleiben sollte. In der Zusammenfassung zum Kapitel heisst es sachlich und schlicht (S. 57):<br />
Die Bantu bilden heute die breite Arbeitermasse in den Städten Südafrikas. Sie fordern politische und gesellschaftliche<br />
Gleichberechtigung mit den Weissen.<br />
(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 162 und 228 dieser Arbeit.) Das nächste Kapitel auf den Seiten<br />
58-59 beschäftigt sich mit dem Krüger-Nationalpark und enthält keine Aussagen über die Bevölkerung. Am<br />
Ende der Beschreibung des Grossraumes Südafrika folgt wieder ein Überblick, der neben einer Karte (S. 68)<br />
und der Tabelle über die Gebiete, deren Angaben im Anhang der Arbeit auf Seite 559 wiedergegeben werden,<br />
einen zusammenfassenden Text (S. 68-69) abdruckt, in dem es über die Bevölkerung und Länder Südafrikas<br />
heisst:<br />
...Europäische Einwanderer haben vor allem in der Republik Südafrika Farmen angelegt und Industrien aufgebaut. Dabei<br />
haben ihnen die Schwarzen als billige Arbeitskräfte geholfen. Heute fordern die Farbigen die Gleichberechtigung mit den<br />
Weissen. Ausser der seit 1910 unabhängigen Republik Südafrika, die bis 1961 als Union von Südafrika ein Mitglied des<br />
britischen Commonwealth of Nations war, gibt es in Südafrika die seit 1964 selbständigen Republiken Zambia und<br />
Malawi. Im Jahre 1966 wurden aus den britischen Schutzgebieten Betschuanaland und Basutoland die selbständigen<br />
Staaten Botswana und Lesotho, 1968 aus Swasiland Ngwana gebildet. Angola und Mosambik sind portugiesische<br />
Überseeprovinzen. Die frühere deutsche Kolonie Südwestafrika wird seit 1919 von der Republik Südafrika verwaltet. Sie<br />
hat das Gebiet inzwischen mit der Republik vereinigt. Diese Angliederung wird aber von der UNO nicht anerkannt. Auch<br />
der Unabhängigkeitserklärung Rhodesiens, der früheren britischen Kolonie Südrhodesien, haben die meisten Staaten nicht<br />
zugestimmt. Eine Minderheit von 300'000 Weissen unter 4 Millionen Bantus regiert das Land.<br />
Rhodesien, das heutige Simbabwe, erklärte die Unabhängigkeit von Grossbritannien, weil die weissen Siedler<br />
fürchteten, ihre Vorrechte gegenüber der überwiegend schwarzen Bevölkerung zu verlieren. Die Folge war ein<br />
Guerillakrieg, der mit der Niederlage der weissen Oberschicht 1980 endete und das einstmals wirtschaftlich zu<br />
den weitest entwickelten Gebieten Schwarzafrikas gehörende Land um Jahre zurückwarf. Der seither als Präsi-<br />
dent amtierende ehemalige Lehrer und Jurist Robert Mugabwe, der 1995 zuletzt wiedergewählt wurde, geriet<br />
1998 unter Druck als ausgelöst durch seine Ankündigung, einen Teil des immer noch in der Hand von ehema-<br />
ligen weissen Siedlern befindlichen Landes zugunsten von landlosen Simbabwern ohne Entschädigung zu<br />
enteignen, ausländische Investitionen zurückgezogen wurden und die dadurch verursachte Preissteigerungen<br />
beim Grundnahrungsmittel Mais, zu <strong>Pro</strong>testen der Bevölkerung führten. (Zu Simbabwe siehe auch die Seiten<br />
160 und 206 dieser Arbeit.)<br />
Im zweitletzten Teil zu Afrika werden auf den Seiten 62-63 die "Afrikanischen Inseln" beschrieben:<br />
Im Indischen Ozean liegen die Inselgruppen der Komoren und Maskarenen. Mauritius (bis 1968 britisch, seitdem<br />
selbständig) und Reunion (französisch) beliefern den Weltmarkt mit Zucker, Vanille, Pfeffer und anderen Gewürzen.<br />
Häufig werden die Plantagen von verheerenden Wirbelstürmen heimgesucht. Die Bevölkerung besteht auf Reunion<br />
hauptsächlich aus Mulatten, d. h. Mischlingen zwischen Weissen und Negern, auf Mauritius aus Europäern, Indern, Negern<br />
und vielen Mischlingen. Mauritius ist sehr dicht besiedelt. Auf dieser Insel leben im Durchschnitt auf einem<br />
Quadratkilometer um die Hälfte mehr Menschen als in der Bundesrepublik.<br />
Mauritius ist der dichtbesiedeltste Staat Afrikas geblieben, auch wenn einige Agglomerationsgebiete anderer<br />
Länder wahrscheinlich noch höhere Bevölkerungsdichte aufweisen.<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 183
Zu Madagaskar, ein Foto mit der Legende "Reisanbau auf Madagaskar" findet sich auf Seite 63, schreibt der<br />
Autor:<br />
Madagaskar ist die viertgrösste Insel der Erde. Ihre wenig gegliederte Ostküste und die Osthänge der Gebirge bekommen<br />
durch den Südostpassat reiche Steigungsregen. Hier wachsen im feuchtheissen Klima tropische Regenwälder. Auf<br />
Rodungsflächen hat man Plantagen angelegt. Sie liefern Vanille, Gewürze, Zucker, Reis Mais, Bananen, Ananas und<br />
Bambusrohr. Der Westen und das Innere Madagaskars liegen im Regenschatten. Dort überwiegen die Savannen. Sie<br />
werden für die Viehzucht genutzt. Im Hochland baut man Kaffee an. Die Bodenschätze der Insel sind noch wenig<br />
erschlossen. Man fördert Graphit und Gold. Neuerdings wurden auch Uranerzlager entdeckt. Der Bau von Fabriken und<br />
Kraftwerken steht in den Anfangen. Nachdem Madagaskar lange Zeit eine französische Kolonie war, erhielt es 1960 die<br />
Freiheit. Seitdem ist es eine Republik mit enger Bindung an Frankreich. Die Hauptstadt Tananarivo liegt im Hochland. Von<br />
wenigen Europäern abgesehen, sind die Bewohner der Insel Mischlinge aus Malaien, Indern und Bantu.<br />
Das rund 16 Mio. Einwohner zählende Madagaskar, das 1960 die Unabhängigkeit von Frankreich erlangte,<br />
war das erste afrikanische Land, welches sich im Gegenzug zu einem Schuldenerlass darauf verpflichtete, auf<br />
den Raubbau an der Natur zu verzichten. Trotzdem werden immer mehr Waldflächen durch Brandrodung und<br />
den zunehmenden Brennholzbedarf vernichtet. Ein Grossteil der Bevölkerung, die sich aus Madegassen, Fran-<br />
zosen und Indern zusammensetzt, ist in der Landwirtschaft beschäftigt. Sie macht Madagaskar zum weltweit<br />
wichtigsten Exporteur von Vanille. Daneben werden Kaffee, Gewürznelken, Zucker, weitere Agrarprodukte,<br />
Mineralien und Erdölprodukte ausgeführt. (Zu Madagaskar siehe auch die Seiten 115 und 163 dieser Arbeit.)<br />
Zusammenfassend heisst es auf der Seite 63:<br />
Vor den Küsten Afrikas liegen kleine vulkanische Inseln. Sie gehören europäischen Staaten. Madagaskar, die viertgrösste<br />
Insel der Erde, ist eine selbständige Republik.<br />
Einige dieser vulkanischen Inseln stehen noch immer unter dem <strong>Pro</strong>tektorat europäischer Staaten.<br />
4.15.9 "Ein Erdteil im Aufbruch"<br />
Im letzten Kapitel "Ein Erdteil im Aufbruch" auf der Seite 64 legt der Autor die Grundgedanken noch einmal<br />
dar und schreibt:<br />
Die Erforschung Afrikas begann erst spät... Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Rätsel des "dunklen<br />
Erdteils" gelöst. Neben der Abenteuerlust erwachten jetzt Handelsinteressen, Missionseifer und wissenschaftlicher<br />
Forschungsdrang... Im 20. Jahrhundert ist die Erschliessung schnell vorangeschritten. Die Errungenschaften der modernen<br />
Technik halfen den Menschen. Autostrassen und Eisenbahnlinien ersetzen uralte Karawanenwege. Busse rollen durch<br />
Urwald und Wüste. Ein Flugnetz verbindet die wichtigsten Punkte des Kontinents. Flüsse werden reguliert, Kanäle gebaut<br />
und immer neue Flächen für die Wirtschaft gewonnen. Aus unbekannten Dörfern werden moderne Städte. Industriegebiete<br />
entstehen; denn gross ist der Reichtum an Bodenschätzen. Ungeheure Wasserkräfte stehen zur Verfügung. In fast allen<br />
Teilen Afrikas werden Staudämme und Elektrizitätswerke gebaut. Auch die Erzeugung landwirtschaftlicher Güter nimmt<br />
ständig zu. Die Viehzuchtgebiete beliefern den Weltmarkt mit ihren <strong>Pro</strong>dukten.<br />
Eine neue Zeit beginnt. Die Afrikaner werfen ihre Fesseln ab. Nirgends in der Welt hat sich die Landkarte so sehr und so<br />
schnell verändert wie in Afrika seit 1951. Damals wurde Libyen ein selbständiges Königreich. In den folgenden Jahren<br />
erhielten immer mehr Kolonialgebiete ihre Selbständigkeit. Allein im Jahre 1960 entstanden in Afrika 17 neue Staaten. Die<br />
Eingeborenen schauen erwartungsvoll in die Zukunft. Aber viele junge Republiken stehen vor einem mühevollen Weg.<br />
Ihre Grenzen entstanden im vorigen Jahrhundert, als europäische Mächte den Kontinent unter sich aufteilten. Innerhalb<br />
dieser Grenzen wohnen keine einheitlichen Völker. Die meisten Afrikaner lebten bislang in Stammesgrenzen. Oft fehlt die<br />
gemeinsame Sprache. Die beginnende Industrialisierung bringt neue Gegensätze. Wohlstand und drückende Armut<br />
wohnen nebeneinander. Alte Häuptlingsfamilien haben früher Dörfer und Stämme beherrscht. Jetzt geht die Macht an<br />
völlig neue Schichten über. Die Afrikaner wollen diese Schwierigkeiten meistern. Schulen und Universitäten entstehen.<br />
Zahlreiche Farbige studieren an fast allen Hochschulen der Welt. Als Techniker, Ärzte, Lehrer, Juristen oder Politiker<br />
kehren sie in ihre Heimat zurück; aber sie haben es schwer, ihr Wissen weiterzugeben.<br />
Obwohl der Autor nicht blind gegenüber den Schwierigkeiten der damals jungen Staaten ist, bringt er den<br />
schon im Titel geäusserten Eindruckes des "Erdteils im Aufbruch" hier klar zur Sprache. Das Bild einer nicht<br />
einfachen aber hoffnungsvollen Zukunft unterscheidet sich stark von dem ab Mitte der siebziger Jahre bis<br />
Anfang der neunziger vermittelten Bild des "Hunger- und Krisenkontinentes" Afrika.<br />
Zusammenfassend und wohl auch als Ausblick gedacht, enden die Ausführungen über Afrika mit den Worten<br />
(S. 64):<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Das Zeitalter der Kolonien geht zu Ende. Ehemalige Kolonialmächte und die früher von ihnen beherrschten Völker werden<br />
gleichberechtigte Partner.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 184
Zumindest auf politischer Ebene, denn wirtschaftlich konnten sich die meisten schwarzafrikanischen Länder<br />
nicht aus den alten Bindungen lösen.<br />
4.15.10 Zusammenfassung<br />
Der Band 3 des Werkes "Erdkunde" informiert sachlich über die damalige Entwicklung auf dem Kontinent.<br />
Alle Grossräume des Kontinentes werden angesprochen, einige wenige Länder und Gebiete detaillierter behan-<br />
delt. Dabei gibt der Autor aber keine Aussagen von in dieser Weltregion lebenden Menschen wieder, obwohl<br />
er verschiedene Lebensumstände in der Stadt oder auf dem Land schildert. Insgesamt wird die Rolle der Weis-<br />
sen gegenüber den viel zahlreicheren Schwarzen überbewertet. Diese werden aber nicht mehr nur als in der<br />
Subsistenzwirtschaft tätige Bauern oder Viehzüchter geschildert, sondern sie haben "ihre Fesseln" abgeworfen<br />
und sind nach der Meinung des Autors zu "gleichberechtigten Partnern" geworden.<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde (1968)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 185
4.16 Erdkunde: Oberstufe (1968-1969)<br />
Mit der Bevölkerungszunahme und dem wirtschaftlichen Aufschwung in Europa und Nordamerika stieg der Bedarf an<br />
Edelhölzern, Rotang, Kautschuk, an tropischen Gewürzen und Genussmitteln. Die primitive Wirtschaft der Eingeborenen<br />
konnte diesen Bedarf nicht befriedigen. So setzte im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine Europäisierung der Wirtschaft ein...<br />
Überall wurden Plantagen angelegt... Wenn die eingeborenen Arbeitskräfte nicht ausreichten, wurden fremdrassige<br />
Arbeiter eingesetzt. Die Leitung lag jedoch in der Hand von Europäern. Erst in jüngster Zeit und nach dem Abschütteln der<br />
Kolonialherrschaft übernahmen auch geeignete Eingeborene die Führung solcher Plantagen. (Bd. 1, S. 59)<br />
Das 1968 bis 1969 erschienene dreibändige Lehrmittel "Erdkunde für die Oberstufe" behandelt Themen zu<br />
Afrika auf ca. 10 der insgesamt 320 Seiten, wobei sich der Band 3 vorwiegend mit Deutschland beschäftigt.<br />
Die drei Bände sind wenig gegliedert, oft enthält eine Seite ein grosses Foto und einen Fliesstext, der durch<br />
hervorgehobenen Begriffe in Abschnitte unterteilt wird, die im allgemeinen jedoch recht knapp ausfallen.<br />
4.16.1 Band 1: Die Erde als Natur- und Lebensraum<br />
Der erste Band des Lehrmittels enthält die Kapitel "Die Gebiete des immergrünen tropischen Regenwaldes"<br />
(S.58-59) und "Die Savanne" (S. 66-67).<br />
Über die Bewohner des tropischen Regenwaldes schreibt der Autor auf der Seite 58, das ganze Gebiet weltweit<br />
betreffend:<br />
Durch ihre Unwegsamkeit sind die tropischen Regenwälder vielfach Rückzugsgebiete. In diese unzugänglichen Räume<br />
haben sich von Nachbarstämmen bedrängte Volksgruppen zurückgezogen, so die Pygmäen im Kongobecken und in<br />
Südkamerun... Sie ernähren sich fast ausschliesslich von dem, was der Urwald ihnen bietet: Pflanzen und Fische. Fleisch<br />
wird nur selten gegessen. Als Sammler und Wildbeuter durchstreifen sie den Wald, bewohnen Höhlungen zwischen den<br />
Brettwurzeln der Bäume oder errichten aus Zweigen einen Windschirm oder eine kunstlose Hütte.<br />
Die sesshaften Völker wohnten in Dörfern. Aus Binsen, Schilf, Gras und Bambusstangen oder Baumstämmen bauten sie<br />
ihre Häuser. In sumpfigen Gegenden stehen die Häuser auf Pfählen, als Schutz gegen Überschwemmungen und Fieber. Im<br />
Urwald herrschte in der Regel das Reihendorf, im Sumpfgebiet die Einzelhütte.<br />
Neben Jagd und Fischfang wurde ein primitiver Feldbau betrieben. Nach den benutzten Geräten unterscheidet man<br />
Pflanzstock-, Grabstock- und Hackbau. Das Roden, vielfach noch Brandrodung, d. h. Abbrennen nach Schälen der Bäume,<br />
besorgten die Männer. Säen, Pflanzen und Ernten war Sache der Frauen. Angebaut werden im afrikanischen Regenwald<br />
Yams, Hirse und Erdnuss... Wenn nach wenigen Jahren der Boden erschöpft war, wurden neue Rodungen angelegt. Für die<br />
tierische Zukost sorgten die Männer durch Jagd und Fischfang. Die Jagd wurde ursprünglich mit Bogen und Speer...<br />
ausgeübt.<br />
Unzugänglichkeit und Verkehrsfeindlichkeit des Waldes behinderten staatliche Zusammenschlüsse. Heute noch sind die<br />
verschiedensprachigen Stämme scharf voneinander getrennt und stehen sich oft feindlich gegenüber. Völker höherer<br />
Kultur haben sich vielfach vom Rande her in das Gebiet des tropischen Regenwaldes vorgeschoben...<br />
Zwar erwähnt der Text richtig, dass Fisch als wichtige Nahrungsquelle von den "Pygmäen" genutzt wird, was<br />
in anderen Lehrmitteln teilweise vergessen geht, doch zeichnet er ansonsten ein wenig konkretes Bild dieser<br />
Volksgruppe, die in "kunstlosen Hütten" haust. (Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 173 und 197 dieser<br />
Arbeit.) Der Autor verpasst es auch, den "primitiven Feldbau" der "sesshaften Völker" als eine den Umständen<br />
angepasste Nutzungsweise darzustellen. (Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 153 und 191 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Auf der Seite 59, die ein Foto "Hackbau in Uganda" zeigt, fährt der Autor fort, indem er über die Religion<br />
dieser Menschen schreibt:<br />
...Die Religion in den besser erschlossenen Gebieten wurde vom... Islam und in jüngerer Zeit vom Christentum überprägt.<br />
Ursprünglich entsprach sie der Stellung der Menschen zur Natur. Den Naturgewalten wurden göttliche Kräfte<br />
zugesprochen (Animismus). Blitz, Donner, Sturm und Wasser wurden und werden noch verehrt. Um die guten und bösen<br />
Geister günstig zu stimmen, Krankheit und Tod zu bannen, bringt man ihnen Opfer dar (Dämonismus). Dinge, die als<br />
schädlich oder nützlich galten, wurden als Idole verehrt (Fetischismus). Zauber- und Geisterglaube kennzeichnen diese<br />
niedrigste Form des Polytheismus.<br />
Die Glaubenssysteme Schwarzafrikas werden pauschal als "niedrigste Form des Polytheismus" bezeichnet, nur<br />
in den "besser erschlossenen Gebieten" wurden diese von Christentum und Islam überprägt, so die eurozentri-<br />
sche Sichtweise.<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde Oberstufe (1968-1969)<br />
Über die Wirtschaftsweise der angesprochenen Völker weiss der Autor zu berichten (S. 59):<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 186
Die weltwirtschaftliche Erschliessung des tropischen Regenwaldes begann... erst im 19. Jahrhundert. Mit der<br />
Bevölkerungszunahme und dem wirtschaftlichen Aufschwung in Europa und Nordamerika stieg der Bedarf an<br />
Edelhölzern, Rotang, Kautschuk, an tropischen Gewürzen und Genussmitteln. Die primitive Wirtschaft der Eingeborenen<br />
konnte diesen Bedarf nicht befriedigen. So setzte im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine Europäisierung der Wirtschaft ein...<br />
Überall wurden Plantagen angelegt, landwirtschaftliche Grossbetriebe mit industrieller Aufbearbeitung der <strong>Pro</strong>dukte zu<br />
handelsfähigen Rohstoffen. Wenn die eingeborenen Arbeitskräfte nicht ausreichten, wurden fremdrassige Arbeiter<br />
eingesetzt. Die Leitung lag jedoch in der Hand von Europäern. Erst in jüngster Zeit und nach dem Abschütteln der<br />
Kolonialherrschaft übernahmen auch geeignete Eingeborene die Führung solcher Plantagen.<br />
Hier wird ganz klar der Standpunkt vertreten, Aufgabe der schwarzafrikanischen Gebiete sei es, Rohstoffe für<br />
Europa und Nordamerika zu produzieren, ohne dass der Autor sich mit den Auswirkungen einer solchen<br />
Forderung auseinandersetzten würde. Auf der Seite 60 fährt er mit seinen Betrachtungen fort:<br />
Moderne Siedlungen entstanden, Wege wurden angelegt und schliesslich auch Klein- und Eisenbahnen. An den grösseren<br />
Flüssen und an der Küste wurden Häfen als Verladeplätze eingerichtet.<br />
Der Wandel im Landschaftsbild und die Verteilung der Bevölkerung änderten sich noch stärker, seit Bodenschätze<br />
entdeckt und abgebaut wurden. Die Erschliessung abseits gelegener Lagerstätten ist vielfach jedoch noch unwirtschaftlich.<br />
In einem nächsten Abschnitt auf den Seiten 60 und 61 bespricht der Autor unter der Überschrift "Anbau-<br />
bedingungen der wichtigen Kulturpflanzen" in kurzen Texten die Nutzpflanzen Banane, Kakaobaum und<br />
Zuckerrohr. Aus dieser Auswahl wird bereits klar, welche Nutzpflanzen dem Autor wichtig erscheinen: nicht<br />
etwa diejenigen, die die einheimische Bevölkerung ernähren, sondern die für die Industrienationen wichtigen<br />
Agrarexportprodukte. (Siehe dazu auch die Zusammenfassungen zu den Darstellung der Subsistenzproduktion<br />
und der Exporte in den verschiedenen Geographielehrmitteln ab der Seite 495 dieser Arbeit.) Zum Kakaobaum<br />
schreibt der Autor auf der Seite 60:<br />
...Seine Heimat ist Südamerika, doch ist er nach den Küstengebieten des tropischen Westafrika verpflanzt worden. Da der<br />
Baum nur geringe Pflege verlangt, wird der Anbau meist von Eingeborenen betrieben. Staatliche Berater unterstützen sie<br />
bei der Pflege und beim Verkauf.<br />
Der Kakaobaum, ein Verwandter des in Westafrika heimischen Kolabaumes - die "Kolanuss" ist sehr beliebt,<br />
da sie beim Kauen eine stimulierende Wirkung ausübt, und sie findet bei vielen Zeremonien Verwendung -,<br />
gelangte im 16. Jahrhundert nach Afrika. Auf der Seite 61 ist eine Tabelle "Kakaoernte der wichtigsten<br />
Anbauländer" für die Jahre 1934/38 und 1973 abgedruckt, deren Angaben sich im Anhang auf der Seite 552<br />
dieser Arbeit finden. (Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 178 und 224 dieser Arbeit.)<br />
Zum Kautschukbaum schreibt der Autor in Bezug auf die afrikanischen Anbaugebiete, dass das "Sammeln von<br />
Wildkautschuk... aus Lianen des Kongogebietes... heute fast bedeutungslos" sei.<br />
Im Abschnitt zur Savanne schreibt der Autor über deren Bewohner auf der Seite 66:<br />
Die Bewohner der Savannen sind durch die Trockenzeit gezwungen, Vorratswirtschaft zu treiben oder, soweit sie<br />
Viehzüchter sind, mit ihren Herden zu wandern.<br />
In der Feuchtsavanne wird vor allem Hackbau betrieben, da die Tsetsefliege als Überträger der Schlafkrankheit das Halten<br />
von Rindern fast unmöglich macht. Ehe der erste Regen fällt, wird der Boden mit einer kurzen Hacke gelockert; dann<br />
werden Mais, Bohnen und Hirse gesät. Nach der Regenzeit setzt man Kartoffeln, Yams und Batate. In der Trockenzeit wird<br />
das Gras abgebrannt und die Asche als Dünger benutzt. Bei dem geringen Humusanfall ist der Boden aber bald erschöpft.<br />
Neue Felder müssen angelegt werden. So hat sich in diesen Gebieten der Wanderhackbau entwickelt. Da die<br />
Feuchtsavanne sehr wildreich war, wurde auch die Jagd eifrig ausgeübt, vor allem in der Trockenzeit, wenn sich das Wild<br />
an den Wasserstellen sammelt. Die zunehmende Bevölkerungsdichte und der Gebrauch moderner Waffen haben aber zu<br />
einer Vernichtung des Wildes geführt, so dass heute nur noch in den Tierschutzparks das reiche Tierleben beobachtet<br />
werden kann.<br />
(Zum Vorwurf der Vernichtung der Wildbestände vor allem in Ostafrika - in Westafrika wurden die nutzbaren<br />
Gebiete bereits viel früher in eine Kulturlandschaft umgewandelt - siehe auch die Seiten 272 und 273 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde Oberstufe (1968-1969)<br />
Auf der Seite 67, die ein Foto "Dorf in Ostäthiopien" zeigt, schreibt der Autor weiter:<br />
In der Trockensavanne wird zwar ebenfalls Hackbau betrieben. Vor allem werden Körnerfrüchte, in Afrika Hirse, in<br />
Südamerika Mais, angebaut, die während der heissen Zeit nicht verderben. Jedoch ist die Trockensavanne weitgehend auch<br />
ein Gebiet der Viehzucht. Das Gras, nicht so hart wie das der Feuchtsavanne, bietet auch während der Trockenzeit als "Heu<br />
auf der Wurzel" den nomadisierenden Stämmen genügend Futter für ihre Tiere. Vor Beginn der Regenzeit oder, wenn der<br />
Boden nicht völlig austrocknet, innerhalb der Trockenzeit wird das Gras abgebrannt, um frische Triebe zu erzwingen .<br />
Der Landesnatur entsprechend haben sich in den Savannen meist grössere geschlossene Siedlungen entwickelt. Bei der<br />
Weite des Raumes liegen sie in grossen Abständen und sind durch unbefestigte Wege verbunden. Der Handelsverkehr<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 187
wurde in der Feuchtsavanne Afrikas meist mit Trägern durchgeführt, da die Tsetsefliege das Halten von Trag- und<br />
Zugtieren unmöglich machte. Moderne Verkehrsmittel haben diese Träger heute weitgehend ersetzt. Gehandelt werden vor<br />
allem die Erzeugnisse des Handwerks. Töpferei, Web- und Schmiedekunst sind hoch entwickelt.<br />
Die dichtere Bevölkerung und die bessere Wegsamkeit der Savanne gegenüber den Gebieten des tropischen Regenwaldes<br />
ermöglichten auch grössere staatliche Zusammenschlüsse. Besonders den mohammedanischen Völkern Afrikas gelang es,<br />
zeitweise bedeutende Reiche zusammenzuschliessen.<br />
Diese Aussage spiegelt die Meinung einiger älterer Autoren wieder, die afrikanischen Bewohner hätten nur<br />
dort einen halbwegs zivilisierten Stand erreicht, wo sie durch Kräfte von aussen dazu beeinflusst wurden.<br />
Einmal abgesehen davon, dass es auch grosse afrikanische Reiche gab, die völlig authochton entstanden, muss<br />
auch die europäische Zivilisation als fremdbeeinflusst angesehen werden. (Die im Text angedeuteten "bedeu-<br />
tenden Reiche" werden im Teil "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas ab der Seite 28 dieser Arbeit<br />
näher betrachtet.) Zur Wirtschaft der Savanne schreibt der Autor (S. 67):<br />
Die moderne Wirtschaft hat weite Gebiete der Savannen umgestaltet. Kaffee, Baumwolle, Erdnüsse und Sisal sind die<br />
wichtigsten Anbauprodukte... In Afrika finden wir ausgedehnte Erdnussfelder und fast in allen Ländern bis zu den<br />
Subtropen Baumwollanpflanzungen. Die Eingeborenenpflanzungen gewinnen in neuester Zeit für die Wirtschaft der<br />
jungen Staaten und für den Welthandel zunehmend an Bedeutung.<br />
Auffallend bei dieser Aufzählung ist, dass das Ursprungsland des Kaffees, nämlich Äthiopien, in dem auch der<br />
Weihrauchbaum wächst, in diesem Zusammenhang ebensowenig erwähnt wird, wie die Kaffeeanbauländer<br />
Kenia und Uganda.<br />
4.16.2 Band 2: Die Erde als wirtschaftlicher und politischer Raum<br />
Der zweite Band beschäftigt sich in den zwei Abschnitten "Das Ende des Kolonialzeitalter" (S. 74-75) in den<br />
Kapiteln "Die Dritte Welt" und "Vergrösserung der Nährfläche und Bevölkerungswachstum in der Flussoase<br />
am Nil" (S. 98-101) mit Afrika. Zusätzlich enthält der Band noch einige allgemeine Informationen in Form<br />
von Weltkarten. Auf den Abschnitt "Das Ende des Kolonialzeitalters" soll hier kurz eingegangen werden, die<br />
Seiten zum Nilgebiet fallen nicht in den Bereich der Betrachtungen dieser Arbeit.<br />
Die zwei Seiten 74 und 75 zum Ende des Kolonialzeitalters enthalten einen Text, der keine speziellen Aussa-<br />
gen zu Afrika macht und eine Weltkarte, die die politische Situation für 1914 wiedergibt. Zudem sind die<br />
Einflussbereiche grosser Kulturen eingezeichnet, nämlich der indischen, des islamischen und der indianischen.<br />
Halb Afrika liegt zwar im Einflussbereich der indischen und islamischen Kultur, liefert aber laut der Karte<br />
keinen Beitrag zu den Hochkulturen der Menschheit, d.h. es wird zwar von aussen beeinflusst, hat aber selbst<br />
nichts zu bieten.<br />
4.16.3 Band 3: Deutschland - wirtschaftliche, soziale und politische <strong>Pro</strong>bleme<br />
Der dritte Band beschäftigt sich, wie der Titel schon sagt, mit Deutschland. Auf der Seite 80 findet sich aber<br />
noch einmal eine Erwähnung Afrikas. In der Tabelle "Die wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik<br />
(Reihenfolge nach den Stand von 1971)" werden die beiden afrikanischen Länder Südafrika und Nigeria an 21.<br />
respektive 24. Stelle aufgeführt.<br />
4.16.4 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Erdkunde Oberstufe (1968-1969)<br />
Verglichen mit anderen Lehrmitteln aus dem gleichen Zeitraum enthalten die Bände "Erdkunde Oberstufe" nur<br />
sehr spärliche Informationen. Bedingt durch die Kürze gehen ganze Gebiete Afrikas "vergessen" oder treten<br />
nur ganz knapp am Rande in Erscheinung. Die Schwarzafrikaner werden grösstenteils als auf einer niederen<br />
Kulturstufe stehend charakterisiert, auch wenn die grossen Reiche in der Geschichte Westafrikas zumindest<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 188
Geographielehrmittel: Erdkunde Oberstufe (1968-1969)<br />
erwähnt werden. Einige der "geeigneten Eingeborenen" sind sogar in der Lage, verantwortliche Aufgaben<br />
innerhalb der Kolonialwirtschaft zu übernehmen. Das ganze gezeichnete Bild bleibt aber sehr oberflächlich<br />
und wenig fassbar, wahrscheinlich auch bedingt durch die mangelnde Sachkenntnis des Autors.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 189
4.17 Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Die Europäer haben in den letzten Jahrzehnten grosse Anstrengungen gemacht, um Afrika zu erschliessen... und die<br />
Lebenshaltung der Eingeborenen zu verbessern. Es ist daher verständlich, dass die europäischen Staaten aus ihren<br />
afrikanischen Besitzungen bei der gegenwärtigen Notlage Europas einen möglichst grossen Nutzen ziehen und in einer<br />
gemeinsamen Anstrengung Afrika zu einer Rohstoffkammer Europas machen wollen. Sie können es allerdings kaum<br />
verhüten, dass die Schwarzen immer lauter grössere Rechte und Freiheiten verlangen und dass viele Kolonien in den<br />
letzten Jahren sich selbständig gemacht haben. (Bd. 3, S. 3)<br />
Das fünfbändige, bei Klett, nach Auskunft des Verlages in den sechziger Jahren erschienene Lehrmittel "Län-<br />
der und Völker" befasst sich im Band 3, auf 76 der total ca. 800 Seiten, mit Afrika. Nebst den Texten enthalten<br />
die Seiten Länderprofile, die in Stichworten kurz über die Länder informieren, verschiedene Zeichnungen<br />
(einige werden in dieser Arbeit wiedergegeben) und verschiedene Karten, sowie Fragestellungen und Arbeits-<br />
anweisungen zu den verschiedenen Kapiteln.<br />
4.17.1 Bevölkerung<br />
In einem ersten allgemeinen Teil, der mit einer kurzen Entdeckungsgeschichte auf den Seiten 2-3 beginnt,<br />
gefolgt von einem kurzen Abschnitt über "Klima, Lage und Gliederung" auf Seite 3, wird die Bevölkerung<br />
Afrikas beschrieben (S. 2):<br />
Die ursprüngliche Bevölkerung des grössten Teiles von Afrika sind die Neger. Daher nennt man Afrika auch den Erdteil<br />
der Schwarzen. Die Neger gliedern sich in die 2 Hauptgruppen der Sudan- und Bantuvölker.<br />
Mehrere tausend Jahre v. Chr. drangen von Vorderasien hellfarbige Völker, die Hamiten, ein. Sie setzten sich vor allem in<br />
Nordafrika fest und haben sich im Atlasgebirge und in Ägypten ziemlich rein erhalten. Im Osten des Erdteils drangen sie<br />
weit nach Süden vor. Vielfach vermischten sie sich mit den Negern. Die Hamiten sind eine nach Ham, einem Sohn Noahs,<br />
benannte, sprachverwandte Völkergruppe, zu der in Afrika die Berber, Ägypter, Somali, Galla und Massai gehören...<br />
Auf Seite 3 heisst es weiter:<br />
...Die Bevölkerung Afrikas ist daher recht bunt zusammengesetzt. Besonders wanderlustig waren bis in die jüngste Zeit die<br />
Hamiten. Sie drangen durch die Sahara bis in den Sudan und im Osten bis über den Äquator vor. Die starke Mischung der<br />
afrikanischen Bevölkerung zeigt sich nicht nur im Körperbau und in der Hautfarbe, sondern auch in der Sprache, in der<br />
Wohnweise, in der Wirtschaft, in der Lebensweise und im Kulturbesitz. Man unterscheidet beispielsweise über 500<br />
Sprachen, die sich in der überwiegenden Mehrzahl auf die Neger und nur in sehr viel geringerem Masse auf die<br />
hamitischen und semitischen Völker verteilen.<br />
Die Europäer haben in den letzten Jahrzehnten grosse Anstrengungen gemacht, um Afrika zu erschliessen, die natürlichen<br />
Reichtümer der Tier- und Pflanzenwelt und der Bodenschätze zu verwerten und die Lebenshaltung der Eingeborenen zu<br />
verbessern. Es ist daher verständlich, dass die europäischen Staaten aus ihren afrikanischen Besitzungen bei der<br />
gegenwärtigen Notlage Europas einen möglichst grossen Nutzen ziehen und in einer gemeinsamen Anstrengung Afrika zu<br />
einer Rohstoffkammer Europas machen wollen. Sie können es allerdings kaum verhüten, dass die Schwarzen immer lauter<br />
grössere Rechte und Freiheiten verlangen und dass viele Kolonien in den letzten Jahren sich selbständig gemacht haben.<br />
Nach Ansicht des Autor ist die Rohstoffgewinnung Afrikas der Preis, den die "Eingeborenen" für die "ver-<br />
besserte" Lebenshaltung zu zahlen hätten und den sie in Anbetracht "der gegenwärtigen Notlage Europas"<br />
nicht ablehnen können. Das "reiche" Afrikas sollte also dem notleidenden Europa zu Hilfe eilen. Ein Gedanke,<br />
der schon wenige Jahre später, im Anbetracht des "Hungerkontinents Afrika" undenkbar werden sollte.<br />
Ebenfalls auf Seite 2 sind die im Text besprochenen Volksgruppen, Bantu, Massai, Äthiopier und Araber in<br />
der genannten Reihenfolge mittels vier Zeichnungen dargestellt:<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 190
Die Seiten 4-23 beschreiben Nordafrika unter dem Titel "Nordafrika - die Gegenküste Europas". Diese Seiten<br />
Themen ausserhalb der Fragestellung der Untersuchung behandeln, wird hier nicht näher auf sie eingegangen.<br />
Auf der Seite 5 findet sich aber noch ein allgemeiner Überblick über Afrika, der "Landschaft", "Klima", "Wirt-<br />
schaft" und "Staatliche Gliederung" des Kontinents beschreibt. Unter dem Titel Wirtschaft werden die Erzeug-<br />
nisse des afrikanischen Kontinents aufgezählt:<br />
Anteil am Weltexport 1957 in <strong>Pro</strong>zenten:<br />
Palmkerne 91, Wein 68, Olivenöl 43, Erdnüsse 91, Baumwollsaat 61, Erdnussöl 63, Kakaobohnen 65, Sisal 61, Baumwolle<br />
17, Palmöl 63, Palmkernöl 39, Kaffee 20<br />
Anteil an der Weltproduktion 1957/58 in <strong>Pro</strong>zenten:<br />
Gold 59, Manganerz 21, Chromerz 32, Antimonerz 35, Kupfererz 21, Kupfer 20, Phosphat 36, Zinnerz 15<br />
Nach diesen Angaben verfügten die damaligen schwarzafrikanischen Länder bei gewissen Rohstoffen tatsäch-<br />
lich über ein Monopol, dass aber bald gebrochen werden sollte.<br />
Im Abschnitt "Staatliche Gliederung" werden folgende Staaten als selbständig aufgezählt: Ägypten, Äthiopien,<br />
Union von Südafrika, Liberia, Libyen, Sudan, Marokko, Tunesien, Ghana und Guinea.<br />
4.17.2 "Der Sudan, Land der Schwarzen"<br />
Das nächste grosse Kapitel "Der Sudan, Land der Schwarzen" folgt auf den Seiten 23-30. Nach einem Über-<br />
blick über "Die Landschaft und ihr Klima" informiert der Autor ab der Seite 25 über die "Bewohner" dieser<br />
Grosslandschaft unter der Überschrift "Die Sudanneger":<br />
Der Mensch hat diese weiträumigen, offenen Landschaften zu allen Zeiten gerne aufgesucht. Man schätzt die Zahl der<br />
Bewohner auf 50 Millionen, das ist ein Viertel der ganzen afrikanischen Bevölkerung; auf 1 qkm kommen 12 Einwohner.<br />
Allerdings ist die Verteilung über die riesige Fläche recht ungleich. Die Eingeborenen sind Neger. Der Name Sudan<br />
bedeutet ja "Land der Schwarzen". Die Sudanneger sind gross und schlank. Sie sind hervorragende Läufer und Springer.<br />
Das Leben in der offenen, weiten Landschaft stählt ihren Körper und schärft ihre Sinne. Ohne Schwierigkeit können sie<br />
noch auf weite Entfernung einzelne Gegenstände unterscheiden. Sie leben gesellig in Dörfern, ja sogar in Städten, die<br />
allerdings mehr einer Anhäufung von Dörfern gleichen. Einzelne Stämme haben unter mächtigen Häuptlingen und<br />
Königen grosse Staaten gegründet. In den Steppen und auf den Grasfluren der Savannen treiben die Neger vor allem<br />
Viehzucht. Da sie aber für die Trockenzeit Vorräte aufspeichern müssen, sind sie gezwungen, auch Land anzubauen.<br />
Allerdings wird der Ackerbau nicht gründlich betrieben. Den Pflugbau kennen erst wenige Sudanneger. Er ist in den<br />
feuchten Landstrichen auch nicht möglich, da die Tsetsefliege den Rinderbestand vernichtet. Nur mit der Hacke wird der<br />
Boden aufgeritzt, Man nennt daher diese Anbauart Hackbau. Ihn besorgen die Frauen. Da kein Dünger vorhanden ist,<br />
brennt der Neger das Gras in der Trockenzeit ab. Die zurückbleibende Asche wirkt dann als Dünger Den aufgehackten<br />
Boden bestellt der Neger gegen Ende der Regenzeit mit Reis, mit Durra, das ist eine hirseartige Körnerfrucht, mit Mais,<br />
Bohnen, Erbsen und Maniok, dessen dicke, knollenartige Wurzeln gegessen oder zu Mehl verarbeitet werden. Ausserdem<br />
werden Kürbisse, Zwiebeln, Pfeffer und Tabak angebaut. Zu diesen Feldfrüchten kommen Bananen, Erdnüsse und<br />
Baumwolle.<br />
(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 186 und 263 dieser Arbeit.) Nach diesen ausführlichen Bemerkun-<br />
gen zur Siedlungsform und der Landwirtschaft in der Sudanzone, fährt der Autor mit einer Beschreibung der<br />
Handwerksarbeiten fort (S. 26):<br />
Der Sudanneger ist auch ein recht geschickter Handwerker. Er stellt Töpferwaren her, verfertigt Flecht- und Webarbeiten,<br />
verarbeitet das Leder und versteht sogar Eisenerz zu schmelzen. Das geschieht in einfachen, aus Lehm erbauten, 3-4 m<br />
hohen "Hochöfen". Wie bei den alten Germanen und den Hellenen sind die Schmiede besonders geachtet, da sie<br />
vielbegehrte Waffen und Geräte herzustellen vermögen.<br />
(Nebst der Fertigkeit der Waffen- und Werkzeugproduktion hatte der Schmied oft eine darüber hinausgehende<br />
kultische Funktion.) Der Autor kommt zum Schluss (S. 26):<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Trotz dieser vielseitigen Tätigkeit ist der Lebensraum der Sudanneger noch wenig entwickelt. Fremde Völker sind immer<br />
wieder in den Sudan eingedrungen und haben ihn besser auszunutzen versucht. Von Norden und von Westen breiteten sich<br />
hamitische Stämme aus. Sie unterwarfen die Neger und vermischten sich mit ihnen. Der mächtigste dieser hamitischen<br />
Stämme ist das Volk der Fulbe. Sie sind hellfarbig, hager und herrisch. Sie brachten den Islam mit und verbreiteten ihn mit<br />
fanatischem Eifer. Ihr Wohn- und Machtgebiet reicht vom Senegal bis weit über den unteren Niger hinaus. Hier leben sie<br />
als Hirten und bauen sich bienenkorbartige Hütten. Sokoto war einst der Mittelpunkt ihrer Herrschaft. Zwischen ihnen und<br />
dem Tsad-See setzte sich das Mischvolk der Haussa fest. Sie sind das Händlervolk des Sudan und haben durch ihre<br />
Geschäftigkeit, vor allem durch den Sklavenhandel grossen Reichtum erworben. Sie wurden aber von den Fulbe<br />
zurückgedrängt.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 175 und 192 dieser Arbeit.) Die Hausa konzentrieren sich heute<br />
vorwiegend auf das Gebiet der Staaten Niger, wo sie rund 56% der Bevölkerung ausmachen, und Nigeria, ca.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 191
21% der Bevölkerung. Ihre Sprache wird aber in vielen Teilen Westafrikas als Handelssprache und "lingua<br />
franca" verwendet - in fast jeder grossen Stadt West- und Nordafrikas finden sich Gemeinschaften, die Hausa<br />
sprechen - und gehört damit zu den meistgesprochenen afrikanischen Sprachen. (Zu den Hausa siehe auch die<br />
Seiten 152 und 276 dieser Arbeit.) Der Autor fährt auf Seite 26 fort:<br />
Im Süden des Tsad-Sees, wo viele Karawanenwege zusammenlaufen, ist das Völkergemisch besonders gross. Der deutsche<br />
Forschungsreisende Nachtigal brachte 1869 durch die Sahara hierher zum König der Bornu reiche Geschenke des<br />
preussischen Königs Wilhelm I. als Dank für die Hilfe, die Barth im Lande der Bornu einst gefunden hatte.<br />
Barth war ein deutscher Forschungsreisender, der Teile Afrikas erkundete. Wie fast alle europäischen<br />
Forscher, so war auch Bart auf die Hilfe der Einheimischen bei seinen Unternehmungen angewiesen, die in<br />
diesem Lehrmittel im Gegensatz zu vielen anderen ausnahmsweise einmal erwähnt wird.<br />
Über die Araber schreibt der Autor im Zusammenhang mit der schwarzafrikanischen Bevölkerung:<br />
...Im östlichen Teil des Sudan, in den Ländern Wadai und Darfur und am oberen Nil herrschten die Araber. Sie haben den<br />
Negern den Islam aufgezwungen und sie rücksichtslos ausgebeutet. Vor allem haben sie jahrhundertelang durch ihre<br />
grausamen Sklavenjagden die Sudanneger gequält und ganze Landstriche entvölkert. Manche Stämme am Tsad-See<br />
suchten die Frauen und Mädchen vor den Sklavenhändlern dadurch zu entwerten, dass sie die Lippen durch Tellerscheiben<br />
zu einer Art Entenschnabel verzerrten.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 191 und 193 dieser Arbeit.) Im nächsten Abschnitt spricht der<br />
Autor den Wandel an, den die Europäer durch ihr Vordringen bewirkten (S. 26f.):<br />
...Erst die Europäer haben seit einigen Jahrzehnten einen durchgreifenden Umschwung herbeigeführt. Sie drangen von der<br />
atlantischen Küste aus in die Landschaften vor. Dadurch erhielt der Verkehr in diesem Raum eine ganz neue Richtung.<br />
Früher ging er nur nach Norden durch die Wüste, jetzt aber geht er zu den Häfen an der atlantischen Küste...<br />
Dieser Umschwung führte seit dem 16. Jahrhundert zu einem Niedergang der ehemals blühenden, auf den<br />
Karawanenhandel durch die Sahara ausgerichteten Städte der Region.<br />
Über die Leistungen der Europäer im Sudangebiet schreibt der Autor, nach der Aufzählung der durch sie<br />
errichteten Verkehrsinfrastruktur (S. 27):<br />
..Die Europäer legten den Sklavenhandel lahm, sorgten für Ruhe und Ordnung und versuchten, gegen den vordringenden<br />
Islam dem Christentum Eingang zu verschaffen. Sie legten Pflanzungen an, auf denen Baumwolle und Erdnüsse angebaut<br />
werden. Sie bekämpften die furchtbare Schlafkrankheit und die Rinderpest. So wurde nicht nur das Leben von Millionen<br />
Negern vor Siechtum und Tod bewahrt sondern auch der Vieh- und Wildbestand erhalten und vermehrt. Dadurch wurde<br />
die Ernährung der Eingeborenen wesentlich verbessert und der Ertrag der Viehzucht gesteigert. Mit Hilfe des Zugviehs<br />
kann jetzt der Boden besser bewirtschaftet, gedüngt und mit dem Pflug bearbeitet werden...<br />
Die Folgen dieser durch die Europäer geförderten Entwicklung sollten sich erst in den Dürrejahren 1973/74 in<br />
ihrer vollen Auswirkung zeigen. Auffällig ist, dass der Islam hier wesentlich weniger gutwillig aufgenommen<br />
wird als dies beispielsweise im Lehrmittel "Fahr mit in die Welt" (1971-1974) der Fall ist, und in dem es im<br />
Zusammenhang mit der Besprechung der verschiedenen Religionen heisst: "Selbst bei vielen zum Christentum<br />
oder Islam bekehrten Afrikanern brechen immer wieder manche ihrer alten abergläubischen Zauberformeln<br />
hervor". (Fahr mit in die Welt 1972, Bd. 3, S. 59) Der Versuch einer Einordnung der verschiedenen Religions-<br />
systeme auf dem afrikanischen Kontinent aufgrund der Lehrmittel ergibt eine Hierarchie, an deren unterem<br />
Ende sich die traditionellen Glaubenssysteme der Schwarzafrikaner finden, auf die dann der Islam folgt, über-<br />
ragt vom Christentum, welches nochmals in ein "entartetes" äthiopisches und das "höhere" europäische Chri-<br />
stentum unterteilt wird. Der Islam wird je nach Sichtweise als Erlösung angesehen, nämlich dann, wenn er zu<br />
einer Bekehrung der dem "Fetisch" verfallenen "Neger" dient, oder gilt als Bedrohung, wenn er auf bereits<br />
christianisierte Schwarzafrikaner trifft. (Zur Hierarchiesierung der Religionen siehe auch die Seite 209 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Der Autor fährt in seinen Beschreibungen des Sudan, den er in West- und Ostsudan aufteilt, fort. Über den<br />
Westsudan schreibt er:<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
..Das volkreichste und wirtschaftlich leistungsfähigste Gebiet ist der Westsudan... Sowohl der Senegal wie der Niger<br />
überschwemmen in der Regenzeit weite Gebiete. Allein bei Timbuktu werden 30'000 qkm, also soviel wie das ganze<br />
Kulturland Ägyptens, unter Wasser gesetzt. Am Niger wurde im Jahre 1947 eine grosse Talsperre fertiggestellt, durch die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 192
fast 1 Million ha oder 10'000 qkm bewässert werden können. Timbuktu ist seit alters ein Knotenpunkt der Karawanenwege<br />
und ein bedeutender Handelsplatz inmitten einer wüstenhaften Umgebung. Auch in Nigerien können noch ausgedehnte<br />
Flächen bewässert und angebaut werden. Heute schon wohnen im unteren Nigergebiet 50 Menschen auf 1 qkm. Ibadan ist<br />
mit 500'000 Einwohnern die grösste Eingeborenensiedlung Afrikas.<br />
Wie in anderen Textstellen kommt hier die Euphorie über die neu entdeckten Wirtschaftsräume zum<br />
Ausdruck. Nicht umsonst ist der ganze Afrikateil unter das Motto "Afrika - eine Rohstoffkammer" gestellt.<br />
Eine Haltung, die Ende der neunziger Jahre von den USA wieder aufgegriffen wurde (TA 23.3.98, S. 2).<br />
In den beiden Abschnitten über den Mittelsudan, als dessen "natürlicher Mittelpunkt" im Text der Tschadsee<br />
angegeben wird, und den Ostsudan, geht der Autor nicht weiter auf die Bevölkerung ein.<br />
Abschliessen schreibt der Autor auf den Seiten 29-30 unter dem Titel "Die gegenwärtige Lage im Sudan" über<br />
die Chancen und <strong>Pro</strong>blem der Sudanzone:<br />
...Das französische Kolonialgebiet ist 1958 in eine Reihe selbständiger Republiken aufgelöst worden, die aber vorerst in<br />
der Französischen Gemeinschaft verbleiben. Es sind Mauretanien, Senegal, Sudan, Obervolta, Nigerien und Tschad.<br />
Der Sudan ist eine der zukunftsreichsten Landschaften Afrikas. Er bietet noch Millionen Negern einen ausreichenden<br />
Lebensraum. Allerdings müssen die gefährlichen Seuchen der Menschen und Tiere beseitigt, die Anbaugebiete erweitert<br />
und die Anbaumethoden verbessert werden. Auch müssen noch mehr Verkehrswege den mittleren und östlichen Sudan<br />
erschliessen. Vor allem aber fehlt es noch sehr an Arbeitskräften, nachdem durch die Sklavenjagden vom 15.-19. Jh. rund<br />
100 Mill. Neger verschleppt und durch die grausame Gewaltherrschaft einheimischer Häuptlinge weitere Millionen von<br />
Eingeborenen umgekommen sind. Erst wenn diese und manche andere Schwierigkeiten überwunden sein werden, kann die<br />
Grosslandschaft, die einst der Schauplatz grausamer Sklavenjagden war, durch ihre Ernten an Reis, Baumwolle und<br />
Erdnüssen sowie durch die Erzeugnisse ihrer Viehzucht Europa versorgen helfen.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 192 und 197 dieser Arbeit.) Der abgedruckte Text über den Sudan<br />
ist nicht nur sehr ausführlich, sondern grösstenteils sachlich geschrieben. Die Idee der Versorgung Europas<br />
durch den afrikanischen Kontinent, die an anderen Stellen des Bandes immer wieder aufgegriffen wird und die<br />
wohl als zentrale Idee des Bandes betrachtet werden kann, steht im Gegensatz zu den in den Lehrmitteln der<br />
siebziger und achtziger Jahren vertretenen Sichtweise.<br />
Obwohl oft das Gegenteil behauptet wird, hat der Autor mit seiner <strong>Pro</strong>gnose zur Versorgung zusätzlicher<br />
Millionen von Menschen im Sudan recht. Allerdings ist dies nur ohne Nahrungsmittelknappheit möglich, wenn<br />
die Anbauformen angepasst und die Verbindungen zwischen den einzelnen Zentren ausgebaut werden. Eine<br />
allfällige Klimaerwärmung könnte sich jedoch langfristig als äusserst ungünstig für die Bewirtschaftung<br />
erweisen.<br />
Auf den Seiten zum Sudan finden sich auch zwei Zeichnungen (siehe weiter unten in dieser Arbeit), sowie<br />
eine Karte zu "Reisewegen deutscher Afrikaforscher" (S. 28), ein Ländersteckbrief zum Staat Sudan (S. 29)<br />
und zwei ganzseitige Fotos mit den folgenden Beschreibungen:<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
"TAFEL III: Landschaft in Nordkamerun. In diese vulkanische Landschaft südlich des Tsad-Sees sind mehrere Gehöfte mit<br />
Kegeldachhütten eingebettet. Ihre Bewohner bauen unten in der Ebene Hirse an und müssen von dort auch das nötige<br />
Wasser holen. Die hohen Euphorbien (Wolfsmilch-Arten) und Akazien an den Hängen spenden kaum Schatten."<br />
"TAFEL IV: Primitiver Ackerbau in Nord-Äthiopien... Trotz aller Bemühungen des Kaisers um eine Modernisierung der<br />
Landwirtschaft wird der Ackerbau in vielen Gebieten Äthiopiens noch mit dem Hakenpflug betrieben, der nur den Boden<br />
an der Oberfläche aufreisst, ohne ihn umzuwenden. Die eintönige Landschaft mit den kahlen Bergen, die bis zu 2'000 m<br />
aufsteigen, trägt nur eine dürftige Vegetation."<br />
"Eine Negerfrau formt mit der Hand Tongefässe" (S. 25)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 193
"Wadaikrieger mit wattierten Rüstungen" (S. 26)<br />
4.17.3 Äquatorialafrika<br />
Im nächsten Kapitel beschreibt der Autor "Äquatorialafrika" in den vier Abschnitten "Oberguinea - Das wich-<br />
tigste Kakaoland der Erde" (S.31-32), "Kamerun - Klima und Wirtschaftsleben" (S.32-35), "Das Kongogebiet -<br />
Das grösste Urwaldgebiet Afrikas" (S.35-41) und "Das Katangagebiet" (S.41-42).<br />
Nach einem Text zu Landschaft und Klima Oberguineas auf der Seite 31, folgt auf Seite 32 die Beschreibung<br />
des Wirtschaftslebens und der Bewohner, sowie auf Seite 33 eine Beschreibung von Liberia. Über das Wirt-<br />
schaftsleben heisst es auf der Seite 32:<br />
Schon die Bezeichnungen der einzelnen Küstenstrecken deuten darauf hin, dass Pfeffer, Gold, Elfenbein und Sklaven hier<br />
alte Handelsgüter waren. Heute allerdings sind sie durch andere Waren abgelöst worden. Die Urwälder liefern edle Hölzer.<br />
In der Nähe der Küste haben die Europäer Pflanzungen von Kakao und Kokospalmen angelegt. Da aber das feucht-heisse<br />
Klima den Europäern einen längeren Aufenthalt unmöglich macht, haben unter ihrer Anleitung die Eingeborenen den<br />
Anbau von Kakao mehr und mehr selbst in die Hand genommen. An der Goldküste schätzt man die Zahl der eingeborenen<br />
Kakaobauern auf 300'000. Der Erfolg dieser Wirtschaftsweise ist überraschend. Heute wird die Hälfte der Kakaoernte der<br />
Welt an der Küste von Oberguinea erzeugt und zum grossen Teil über den Kakaohafen Akkra versandt. Die Pflanzungen<br />
der Palmen bringen reiche Erträge an Palmöl und Palmkernen ein. Die Kokospalme gedeiht nur in der Küstenzone im<br />
Bereich der feuchten Seeluft sie liefert die Kokosnuss. Aus ihrem Kern gewinnt man Kopra, das zu Speisefett verarbeitet<br />
wird. Die Ölpalme ist dagegen im Urwald weit verbreitet. Sie ist die ölreichste Pflanze der Welt. Die pflaumengrossen<br />
Früchte sitzen in Bündeln zu 800-1000 Stück beisammen. Jeder Baum hat 6-15 solcher Bündel. Aus dem Fruchtfleisch<br />
presst man Öl, mit dem Seife und Kerzen hergestellt werden. Aus den Kernen gewinnt man Öl für Margarine und<br />
Speisefett.<br />
(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 224 und 274 dieser Arbeit.) Wie bereits im Text zum Sudan erwähnt,<br />
kommt auch hier wieder die Betonung auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmungen klar zum Ausdruck.<br />
Ausserdem verrät der Autor, trotz der von einigen Länder bereits erworbenen Unabhängigkeit, die damaligen<br />
Kräfte, wenn er schreibt, dass die "Eingeborenen" die Arbeit für die Europäer erledigen würden, da das Klima<br />
angeblich zu feucht und heiss für sie sei. Hier wird also einmal mehr das Klischee vom Schwarzen präsentiert,<br />
der unermüdlich in der sengenden Sonne seine monotone Arbeit verrichten kann.<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
"Kakaoernte an der Goldküste"<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 194
Die Überraschung beim Aufkommen der Kakaopflanzungen liegt wohl darin, dass es sich dabei nicht um eine<br />
von den Europäern geplante und durchgeführte Aktion handelte, sondern die afrikanischen Kleinbauern in<br />
Westafrika die Gunst der Stunde erkannten und diese Diversifikation in Eigenregie organisierten. Auf der glei-<br />
chen Seite (S. 32) findet sich die weiter oben abgebildete Zeichnung zu Ghana. Über die "Bewohner und Sied-<br />
lungen" von Oberguinea fährt der Autor fort (S. 32):<br />
...Die Eingeborenen von Oberguinea gehören zu den fortschrittlichsten Vertretern der schwarzen Rasse in Afrika. Sie sind<br />
gross, kräftig und fleissig und waren daher früher auf den Sklavenmärkten besonders begehrt. Die Orte an der Küste sehen<br />
sauber und freundlich aus. Lome, die Hauptstadt der früheren deutschen Kolonie Togo und früher eine der schönsten<br />
Städte Westafrikas, hat sich nicht in gleichem Masse wie die übrigen Städte an dieser Küste weiterentwickelt. Akkra bietet<br />
ein recht malerisches Strassenbild. Die Frauen tragen grossgemusterte Stoffstreifen in bunten Farben. Baumwolle wächst ja<br />
im Lande, Weberei und Färberei stehen auf hoher Stufe. Im Strassenbild fallen viele bebrillte junge Neger auf. Es sind<br />
Studenten des Prince-of-Wales-College, das in Schimota nördlich Akkra liegt... Lagos ist der grösste Hafen und die<br />
Hauptstadt von Britisch-Nigeria, das dem Mutterland ein Drittel seines Bedarfes an Öl und Fett lieferte.<br />
Diese Beschreibung des Küstengebietes trifft bis zu einem gewissen Grade auch heute noch zu. Allerdings sind<br />
die Küstenstädte seit dem Erscheinen von "Länder und Völker" in einem gewaltigen Tempo gewachsen, so<br />
dass Accra, die Hauptstadt Ghanas, heute gegen 2 Millionen Einwohner zählt. Im Anbetracht dieser "Überbe-<br />
völkerung" der Städte hat sich auch das dortige Erscheinungsbild gewandelt. Zwar gibt es beispielsweise in<br />
Accra immer noch sehr vornehme Quartiere, die an idyllische Zustände in gewissen Gegenden Europas erin-<br />
nern, doch für die meisten Stadtteile ist die teilweise offen geführte Kanalisation und der stetig zunehmende<br />
Verkehr zu einem <strong>Pro</strong>blem geworden.<br />
Nach einer Bemerkung über die Fruchtbarkeit der Küstenzone fährt der Autor auf den Seiten 32-33 fort:<br />
...Die Neger haben keinen eigenen Grundbesitz. Jeder Familie wird vom Häuptling ein Stück Land zugeteilt. Die vielen<br />
kleinen Negerbetriebe einer Dorfgemeinschaft bringen reiche Ernten auf den Markt. Den wachsenden Wohlstand erkennt<br />
man deutlich an den grossen, belebten Dörfern, die mehr und mehr an den Verkehr angeschlossen werden. Sie liegen im<br />
immergrünen Regenwald. Stichbahnen führen von der Rüste ins Innere. Die frühere Kronkolonie Goldküste wurde 1957<br />
ein unabhängiger Staat (Dominion) unter dem Namen Ghana im Rahmen der englischen Völkergemeinschaft. Auch die<br />
franz. Kolonien Elfenbeinküste und Dahome sind 1958 selbständige Republiken geworden; nur Guinea hat sich von<br />
Frankreich losgesagt. Togo und Brit.-Nigerien erhalten 1960 ihre Unabhängigkeit.<br />
Die damals bereits gebauten Bahnlinien sollten in späteren Jahren nicht weiter ausgebaut werden. Auch das<br />
Versprechen eines zunehmenden Wohlstandes erfüllte sich für die Länder der Westküste nicht. Nach kurzer<br />
wirtschaftlicher Blüte verschuldeten sich die neuen Staaten aufgrund politischer Entscheidungen und dem<br />
Zerfall der Rohstoffpreise, wie etwa für Kakao, immer mehr. Die Frage des Grundbesitzes wurde in der<br />
Zwischenzeit geregelt. Nach wie vor sind die "Häuptlinge" für den "Verkauf", es handelt sich dabei um ein<br />
Erbpachtsystem, zuständig. Die neuen Besitzer werden aber beispielsweise in Ghana in ein national geführtes<br />
Kataster eingetragen und die Besitzverhältnisse so amtlich festgehalten.<br />
Der letzte Abschnitt zu Oberguinea auf der Seite 33, auf der sich auch eine Karte "Die Oberguineaküste und<br />
ihr Hinterland" findet, widmet der Autor der Republik Liberia, über die er schreibt:<br />
An der Südwestecke von Oberguinea liegt die unabhängige Negerrepublik Liberia. Sie wurde 1822 von Negersklaven<br />
gegründet, die Amerikaner nach Afrika zurückgebracht hatten. Die Republik wird von 1,3 Millionen Menschen bewohnt.<br />
Die Hauptstadt Monrovia gleicht einer Gartenstadt mit einem unfertigen Stadtbild aus Lagerhäusern, Öltanks,<br />
Verladerampen und aus neuzeitlichen Häusern, Bretterbuden und Wellblechhütten. Sie zählt 30'000 Einwohner. Der<br />
grösste Teil des Landes ist ein von Elefanten belebter Urwald, in dem die Neger sich auf Lichtungen ihre Dörfer aus<br />
Rundhütten erbaut haben. Nur Saumpfade führen zu diesen Siedlungen. In der Nähe von Monrovia hat eine amerikanische<br />
Gesellschaft seit 1926 die grössten Gummiplantagen der Welt angelegt, auf denen heute 10 Millionen Gummibäume<br />
stehen und 25'000 Eingeborene arbeiten. Monrovia erhielt während des letzten Weltkrieges einen Flughafen und den<br />
bedeutendsten Seehafen der Westküste.<br />
Liberia war bis vor kurzem ein vom Bürgerkrieg geplagtes Land. Viele Menschen suchten als Flüchtlinge<br />
Zuflucht in den Nachbarländern, die teilweise in einem Ausmass Hilfe leisteten, das für viele europäische<br />
Staaten beschämend wirken muss.<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Im zweiten Teil des Kapitels Äquatorialafrika beschreibt der Autor unter dem Titel "Kamerun - Klima und<br />
Wirtschaftsleben" auf den Seiten 33-35 die geographischen Gegebenheiten und den Anbau von Kakao - die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 195
Kakaoanbaugebiete werden auf einer Karte auf Seite 34 dargestellt -, Kaffee und Bananen. Über die einheimi-<br />
sche Bevölkerung wird nur ausgesagt (S. 35):<br />
Heute besitzen auch die Neger ansehnliche Pflanzungen und liefern beträchtliche Mengen auf den Weltmarkt.<br />
Im nächsten Teil auf den Seiten 35-40 unter dem Titel "Das Kongogebiet - Das grösste Urwaldgebiet Afrikas"<br />
schreibt der Autor, nach einer Schilderung des Urwalds, in der auch Leo Waibel kurz zitiert wird, und der<br />
"Luftbewegung zwischen dem Äquator und dem Wendekreis", im Abschnitt "Der Mensch im Urwald" auf den<br />
Seiten 38-40 folgendes (S. 38):<br />
...Der Urwald ist im Gegensatz zu den angrenzenden offenen Landschaften arm an Menschen. Es fehlt nicht nur an<br />
Siedlungsraum; es fehlt auch mitten in der Pflanzenfülle an Nahrung. Die Jagd bringt nicht viel ein, nur die Flüsse sind<br />
reich an Fischen. Der Urwaldneger lebt hauptsächlich von Bananen und von den Früchten der Ölpalme. Ausserdem pflanzt<br />
er auf dem mühevoll gerodeten Urwaldboden Bohnen, Melonen, Kürbisse, Maniok, Yams (eine Knollenfrucht), Taro (mit<br />
kopfgrossen Knollen) und Tabak an. Fast immer sind daher die Urwalddörfer von Bananen- und Ölpalmenhainen<br />
umgeben. Um seinen Bedarf an Fleisch zu decken, züchtet der Neger Schweine, Hühner, Enten, Schafe und Ziegen. Pferde<br />
und Rinder können wegen der Tsetsefliege im Urwald nicht gehalten werden. Der Mangel an Fleischnahrung hat vielleicht<br />
die furchtbare Sitte der Menschenfresserei, den Kannibalismus, verursacht.<br />
Das Thema "Kannibalismus" wird auch im Geographiebuch von Widrig von 1967 (siehe dazu die Seite 139<br />
dieser Arbeit), und in Oskar Bärs "Geographie der Kontinente" von 1984 (siehe dazu die Seite 339 dieser<br />
Arbeit) aufgegriffen und fand seinen Niederschlag auch im Comic, wie das auf der Seite 486 dieser Arbeit<br />
abgebildete Beispiel zeigt. Selbst Autoren von Tierbüchern waren sich nicht zuschade, in ihrer Argumentation,<br />
den Völkern Afrikas "Menschenfresserei" zu unterstellten (siehe dazu die Seite 273 dieser Arbeit). Und im<br />
Witz gehört der den Missionar verspeisende "Wilde" längst zum Allgemeingut. Sowohl in der Enzyklopädie<br />
"Encarta 97" als auch in "Infopedia 1996" finden sich keine eindeutigen Hinweise auf einen in Afrika prakti-<br />
zierten Kannibalismus. Im Grolier hingegen heisst es: "In the cannibalism traditionally practiced in Sierra<br />
Leone... by the leopard society, members of this secret society claimed they turned into leopards, after which<br />
they disemboweled their enemies and ate portions of the corpses." (Grolier, 1993) Allerdings gibt Grolier in<br />
der Quellenangabe auch das Buch von W. Arens "The Man-eating Myth" an, welches frühe Berichte über den<br />
Kannibalismus als unglaubhaft bezeichnet, da der spanische König Ferdinand V. 1503 die Verwendung von<br />
"Menschenfressern", und nur von diesen, als Sklaven in den neu entdeckten Gebieten erlaubte. Die königliche<br />
<strong>Pro</strong>klamation erwies sich auf der Suche nach Sklaven natürlich als äusserst hilfreich. Später diente der<br />
Vorwurf der Menschenfresserei in erster Linie dazu, einen Vorwand zu finden, andere Völker zu unterwerfen.<br />
Ausserdem scheint die Zuweisung der Menschenfresserei eine Eigenschaft zu sein, die viele Völker betrifft. So<br />
berichtet der Schwarzafrikaner Olaudah Equiano in seinem "The Interesting Narrative of the Life" von 1789<br />
davon, dass viele der gefangenen Schwarzafrikaner glaubten, die Weissen würden sie als Nahrungsvorrat auf<br />
ihre Schiffe schleppen. (Equiano, 1789) Der Autor fährt fort (S. 38f.):<br />
So lebt der Urwaldneger zwar unbekümmerter und sorgloser als der Neger der Grasländer und Savannen, da er ja für eine<br />
Trockenzeit nicht zu sorgen hat. Allein sein Leben ist doch entbehrungsreich und ärmlich. Er ist kleiner und gedrungener<br />
als der Sudanneger. Seine Hütte ist entweder ein einfaches Blätterdach aus Palmen- und Bananenblättern oder eine runde,<br />
mitunter auch viereckige Hütte aus Flechtwerk, die mit Palmstroh gedeckt wird. Zum Schutze gegen wilde Tiere und gegen<br />
Überschwemmungen steht sie oft auf Pfählen oder in Bäumen. Die Dörfer liegen meist an einem Fluss, auf einer Flussinsel<br />
oder auf gerodeten Lichtungen im Urwald. Die Bewohner leben in Dorfgemeinschaften, da der Urwald keinen grösseren<br />
Zusammenschluss zulässt.<br />
Einer der im Text erwähnten Haustypen ist auf einer Zeichnung (S. 39) abgebildet:<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
"Bantuneger vor ihrer strohbedeckten Lehmhütte"<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 196
Der Autor fährt auf der gleichen Seite fort (S. 39):<br />
Der Urwaldneger gehört von Kamerun an südwärts zur Gruppe der Bantuneger. Ihre Kultur ist niedriger als die der<br />
Sudanneger. Sie verstehen Webarbeiten und Schnitzereien herzustellen. Sie haben auch eine Trommelsprache entwickelt,<br />
mit der sie sich ausgezeichnet auf weite Entfernungen verständigen. An den Küsten, an den Flüssen und in der Nähe von<br />
Pflanzungen und Missionsstationen, wo die Bantuneger mit den Europäern in Berührung kommen, haben sie sich oft zu<br />
geschickten und brauchbaren Arbeitern entwickelt.<br />
Auch in diesem Text steht wieder die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Menschen des geschilderten Gebietes im<br />
Vordergrund. Die Einstufung der Kultur wird auch hier auf der Basis des materiellen Wohlstandes vollzogen,<br />
andere Beurteilungskriterien werden bei der Bewertung nicht beigezogen. Die "unterste" Stufe auf dieser<br />
Kulturleiter nehmen immer die mit den wenigsten materiellen Gütern versehenen Völker ein. So auch im Band<br />
"Länder und Völker" (S. 39):<br />
Noch tiefer als die Urwaldneger stehen die Zwergvölker oder Pygmäen, die in schwer zugänglichen Wald- und<br />
Sumpfgebieten scheu und zurückgezogen leben. Man schätzt ihre Zahl auf 40'000. Sie sind nur 90-140 cm gross und<br />
schliessen sich noch viel weniger als die Bantuneger zusammen, weil sie nur in kleinen Horden ausreichend Nahrung<br />
finden.<br />
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 186 und 213 dieser Arbeit.) Bei dieser Einteilung in verschiedene<br />
Stufen wird das Hauptmerkmal der eigenen Kultur, für Europa der materielle Wohlstand, als Messlatte<br />
benutzt. Je nach Wahl der Kriterien könnte die Einteilung auch ganz anders ausfallen, ist also nicht<br />
"gottgegeben".<br />
Der Autor schliesst seine Betrachtungen über den Menschen im Urwald mit einer Beschreibung der Schwierig-<br />
keiten bei der Erschliessung des Gebietes, welcher der Ausnützung des "natürlichen Reichtums" im Wege<br />
ständen (S. 39f.):<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
...Wertvoll sind vor allem die Ölpalme, der Kautschukbaum, dessen Saft den Gummi liefert, ferner der Kolabaum, dessen<br />
nussartige Samen von den Negern als Stärkungsmittel genossen werden und von den Weissen zu Arzneimitteln<br />
(Kolapastillen) verarbeitet werden, ferner der Kapokbaum und Edelhölzer, wie Ebenholz, Blauholz Mahagoni- und das<br />
harte Eisenholz...<br />
Die im Text erwähnten Samen des Kolabaumes (Cola acuminata) werden in den englischsprachigen Ländern<br />
Schwarzafrikas als "colanut" bezeichnet. Die Samen enthalten neben Stärke, Zucker, Fett und Eisweiss ca. 2%<br />
Koffein und 0.05% Theobromin und werden zur Herstellung von Erfrischungsgetränken verwendet. In Westaf-<br />
rika werden die Kolasamen gegen Hunger, Durst und Müdigkeit gekaut, darüberhinaus sind sie Bestandteil<br />
gewisser ritueller Handlungen, so beispielsweise im Norden Ghanas bei der Überbringung des "Brautpreises",<br />
wo sie unabdingbar sind. Im Sudan werden die Samen gemahlen und mit Milch und Honig als Getränk genos-<br />
sen. Da sie einen bitteren Geschmack aufweisen und zudem die Zähne rötlich färben, hat die "colanut" beson-<br />
ders bei den Stadtbewohnern an Bedeutung verloren. (Lötschert/Beese 1992, S. 212-213)<br />
Immer noch unter dem Titel "Das Kongogebiet" folgt auf den Seiten 40-41 eine Beschreibung des Kongobek-<br />
kens und des Laufes des Kongo. Zur Politik der belgischen Kolonialmacht heisst es auf Seite 41:<br />
...Stanley durchquerte als erster Weisser 1876-1877 das ganze Kongobecken von Osten nach Westen unter unsäglichen<br />
Gefahren. Schon damals sagte er dem Kongogebiet eine grosse Zukunft voraus. Diese <strong>Pro</strong>phezeiung ist in der belgischen<br />
Kongokolonie in Erfüllung gegangen. Sie ist fast 80mal so gross wie Belgien. Ihre schwarze Bevölkerung wird auf 13<br />
Millionen geschätzt. Es sind Bantuneger, die ungleich über die Kolonie verteilt sind. Zwischen ihnen leben einige<br />
zehntausend Pygmäen. Die belgische Kolonialregierung versucht gegenwärtig, die Pygmäen zu sesshaften Ackerbauern<br />
umzuschulen. Die Dörfer der Neger liegen hauptsächlich an den Flüssen. Durch die Sklavenjagden und durch die<br />
Schlafkrankheit wurden ganze Flussstrecken entvölkert. Heute sind zahlreiche Städte an den Flussstrecken entstanden. Bei<br />
Leopoldville wurde 1954 sogar eine Universität errichtet...<br />
(Zur Schlafkrankheit siehe auch die Seiten 157 und 202, zum Sklavenhandel die Seiten 193 und 204 dieser<br />
Arbeit.) Interessanterweise verschweigt auch dieses Lehrmittel die Zeit als Belgisch-Kongo im Besitz des<br />
belgischen Königs Leopold II. war. Sie wird nur gerade vom Lehrmittel "Seydlitz: Mensch und Raum" von<br />
1987 auf der Seite 133 erwähnt. Die unter Leopold II. herrschende Unterdrückung führte zu Beginn des Jahr-<br />
hunderts zu Aufständen und dem internationalen Ruf nach einer Untersuchungskommission. Diese stellte 1904<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 197
fest, dass die Schwarzafrikaner von den dort agierenden Handelsgesellschaften wie Sklaven behandelt wurden.<br />
Da die von König Leopold II. darauf eingeleiteten Reformen sich als wenig wirksam erwiesen, wurde das<br />
Gebiet 1908 vom belgischen Parlament als Kolonie Belgiens übernommen.<br />
Im letzten Teil zu Äquatorialafrika folgt auf den Seiten 41-42, auf denen sich auch eine Karte über die "Kup-<br />
ferförderung" (S. 41) und der Ländersteckbrief zu "Äquatorialafrika" (S. 42) befindet, eine Beschreibung der<br />
Demokratischen Republik Kongo unter dem Titel "Das Katangagebiet":<br />
Noch viel bedeutender und wertvoller aber ist der Reichtum an Bodenschätzen, der im Katangagebiet erschlossen worden<br />
ist. Hier wird eines der grössten Kupfererzvorkommen der Erde ausgebeutet. Hinzu kommen Zinn, Zink Wolfram,<br />
Mangan, Eisen, Nickel, Gold, Silber, Diamanten, Platin und in jüngster Zeit sogar Uran und andere radiumhaltige Erze in<br />
grossen Mengen. In der nur wenige Kilometer nordöstlich von Elisabethville entstandenen Stadt Schinkolobwe wird heute<br />
über die Hälfte der Weltproduktion an Uran gefördert. Um diese Bodenschätze abzubauen und zu verarbeiten, hat man<br />
mitten im tropischen Afrika eine grosse Industrielandschaft gegründet. Hier rauchen die Schlote der Hochöfen und<br />
Hüttenbetriebe, hier rattern die Räder der Fördermaschinen wie in einem europäischen Industrierevier. Zahlreiche Kupferund<br />
Zinngiessereien, Maschinenfabriken, Werke für Eisen- und Metallwaren, Ölraffinerien, Textilfabriken, Zement- und<br />
Kalkwerke, Ziegeleien und Sägewerke sind entstanden. Die überreichen Wasserkräfte sowie die Kohlengruben in Katanga<br />
und in dem nahen Nordrhodesien liefern die notwendigen Energien. An Stelle der Negerdörfer sind Städte mit Gasthöfen,<br />
Lichtspielhäusern, Vergnügungsstätten und Kaufläden getreten. In den Städten wohnt ein Viertel der Kongobevölkerung.<br />
Der Neger hat fast nur noch die Hautfarbe mit seinen Urwaldverwandten gemeinsam. Im übrigen ahmt er europäische<br />
Sitten nach...<br />
Unter der langen Herrschaft Mobutus, der das Land nach einem Putsch von 1965-1997 ununterbrochen regier-<br />
te, verfielen diese Anlagen zusehend, da sein Regime nicht die Entwicklung des Landes in den Vordergrund<br />
stellte, sondern mehr an der eigenen Bereicherung interessiert war. Trotz dieser offensichtlichen Misswirt-<br />
schaft wurde Mobutu vom Westen aus politischen Gründen bis wenige Wochen vor seinem Sturz gestützt und<br />
war lange - auch in der Schweiz, wo er eine eigene Villa besass - ein gern gesehener Gast.<br />
Auch die neue Regierung Kabilas setzt darauf, dass andere Nationen die Politik der herrschenden Schicht im<br />
Anbetracht der noch auszubeutenden Diamantenvorkommen dulden werden, auch wenn diese bei weitem nicht<br />
immer der internationalen Norm entspricht.<br />
4.17.4 Ostafrika<br />
Auf den Seiten 43-58 beschreibt der Autor das Gebiet von "Ostafrika". Das erste Unterkapitel behandelt "Das<br />
Hochland von Äthiopien - Eine Felsenburg". Nach einem Abschnitt über die Anreise im Flugzeug (S. 43), die<br />
Entstehung des Hochlandes und das Klima, schreibt der Autor in "Landschaftliche Gliederung" auf Seite 44f.:<br />
...Über der Waldzone liegt von 1'700 bis 2'400 m Höhe das "Weinland", in dem aber heute kein Wein mehr angebaut wird.<br />
Hier gewinnt die verhältnismässig dichte Bevölkerung gute Ernten an Baumwolle, Bananen, Bohnen und Kaffee. Die<br />
Landschaft Kaffa im Süden gilt als die Heimat des Kaffeestrauches. In den Zonen des Wald- und Weinlandes leben<br />
zahlreiche Wildtiere, Heuschrecken bilden eine gefürchtete Landplage; sie vernichten oft die Ernte.<br />
(Zu den Heuschrecken siehe auch die Seiten 145 und 203 dieser Arbeit.)<br />
Zwischen 2'400 und 4'500m Höhe dehnen sich Hochweiden aus. Ihr dichter Grasteppich gleicht in der Blütezeit einer<br />
buntfarbigen Fläche. Herden von Rindern (im ganzen 20 Mill.), Eseln, Ziegen, Schafen (im ganzen 30 Mill.) und Pferden<br />
werden hier gehalten; ausserdem ziehen unzählige Wildtiere durch diese offene Landschaft. Bis zu einer Höhe von 3'800 m<br />
wird Getreide angebaut... Zu alledem kommen reiche Bodenschätze an Eisenerzen, Gold, Silber, Platin, Erdöl, Kohle und<br />
Kali. Allein wegen der Unwegsamkeit des Berglandes können alle diese Wirtschaftsgüter nur ganz ungenügend ausgenutzt<br />
werden.<br />
Wie schon in anderen Lehrmitteln finden sich auch in diesem Text keine Erwähnungen von Dürren oder einer<br />
Unterversorgung mit Lebensmitteln. Im Gegenteil, der Autor berichtet von zahlreichen Wild- und Haustieren.<br />
Auf den Seiten 44 und 45 finden sich auch die beiden weiter unten wiedergegebenen Zeichnungen:<br />
Bei der Abbildung des Wappens handelt es sich, abgesehen von den verstreut wiedergegebenen Landesflag-<br />
gen, um die einzige symbolische Repräsentation eines schwarzafrikanischen Gebietes, die in sämtlichen der<br />
untersuchten Lehrmitteln zu finden war. Der Grund liegt wahrscheinlich in der Sonderstellung Äthiopiens<br />
unter den Staaten Schwarzafrikas. Als einziger Nation blieb Äthiopien über mehrere Jahrhunderte hinweg<br />
mehr oder weniger bestehen.<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 198
"Äthiopisches Mädchen" (S. 44)<br />
"Das Wappen Äthiopiens" (S. 45)<br />
Ebenfalls auf der Seite 45 befindet sich ein Abschnitt "Die Bevölkerung", über die der Autor schreibt:<br />
...Auf dem Hochland hat sich einer der ältesten Staaten der Menschheit entwickelt. Es ist das Kaiserreich Äthiopien, das<br />
nach der Vertreibung der Italiener wieder ein selbständiger Staat ist.<br />
Seine ursprüngliche Bevölkerung waren Neger. Im 2. Jahrtausend v. Chr. drangen von Norden her hamitische Völker ein<br />
und drängten die Neger zurück. Sie brachten den Ackerbau mit. Wenige Jahrhunderte v. Chr. kamen aus Arabien<br />
semitische Stämme, die viehzüchtende Nomaden waren. Im 16. Jahrhundert n. Chr. wanderten von Südosten hamitische<br />
Gallavölker ein, die Negerblut in ihren Adern hatten. So entstand in Äthiopien eine Mischung aus mehreren Rassen. Dabei<br />
überwiegt der semitisch-hamitische Einschlag. Mit Recht führt daher das Hochland den Namen "Habesch", d. h. "Land der<br />
Vermischung".<br />
Der Äthiopier hat eine schlanke Gestalt, kastanienbraune Haut, dichtes Kraushaar und regelmässige Züge. Er ist stolz und<br />
kriegstüchtig. Schon früh, im 4. Jahrhundert n. Chr., drang von Ägypten her das koptische Christentum ein und wurde zur<br />
Staatsreligion. Daher ist das Land eine christliche Insel in einer islamischen Umwelt.<br />
Die Ausprägung des Christentums in Äthiopien nahm unter Zara Jakob Mitte des 15. Jahrhunderts militante<br />
Formen an: Er zwang seine Untertanen Glaubensbekenntnisse in der Form von Tätowierungen zu tragen und<br />
richtete eine Inquisitionsstelle ein. (Ki-Zerbo 1984, S.186) Den Betrachter der neunziger Jahre erinnert das<br />
aktuell praktizierte Christentum der Äthiopier rein äusserlich an islamische Formen.<br />
Die Eroberung Äthiopiens durch die Italiener 1935 sahen viele Afrikanern als Schlag gegen ihre Unabhängig-<br />
keitsbemühungen an, wurde doch dadurch das letzte "afrikanische" Land Kolonie einer europäischen Macht.<br />
Zum Thema "Staat und Wirtschaft" schreibt der Autor auf den Seiten 45-46:<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Der äthiopische Staat erstreckte sich einst bis nach Arabien, Ägypten und Ostafrika. Sein Alter und Ansehen spiegeln sich<br />
noch im Königstitel wider. Der heutige Herrscher nennt sich "Haile Selassie I., von Gottes Gnaden König der Könige,<br />
Statthalter der Gottheit, Löwe von Juda, Sohn des Himmels, erhabener Herr der Erde und der Gewässer, Beherrscher<br />
Äthiopiens, würdigster, grösster Herr, alleiniger Erbe des Thrones Salomonis".<br />
Eine zahlenmässig geringe Oberschicht ist Eigentümer des Landes, das von der Masse der früher leibeigenen Bauern und<br />
der einstigen Sklaven bearbeitet wird. Die Bewirtschaftung ist noch recht rückständig. Die Bevölkerung lebt in Dörfern<br />
und Marktplätzen. Die einzige Grossstadt ist Addis Abeba. Sie ist sehr weiträumig angelegt und bedeckt eine Fläche so<br />
gross wie Paris. Die meisten Häuser liegen als Kegeldachhütten zwischen Gärten und Feldern. Die Strassen durchflutet ein<br />
buntes Menschengewimmel. Auf einem Hügel erhebt sich der von Mauern umschlossene Kaiserpalast...<br />
Weiter heisst es auf Seite 46, auf der auch der Ländersteckbrief zu "Äthiopien und Somaliland" abgedruckt ist:<br />
In dem Kriege mit Italien wurden viele Siedlungen zerstört Der Kaiser Haile Selassie I. beseitigt gegenwärtig mit Hilfe<br />
amerikanischer und europäischer Fachleute die Schäden und schafft die Grundlagen für eine bessere Entwicklung des<br />
reichen Landes. Ein Strassennetz wird durch das Innere des Landes angelegt, damit die unermesslichen Viehherden, die<br />
Erzeugnisse des Ackerbaues, die gewaltigen Holzbestände und die kaum erschlossenen Bodenschätze nutzbar gemacht<br />
werden können. Auch Fluglinien im Land und nach Kairo, Nairobi und Karatschi sind eingerichtet worden. Der Kaiser<br />
verwendet ein Drittel der Staatsausgaben, um die Jugend zu erziehen und Handwerker heranzubilden. 1950 wurde das<br />
früher italienische Eritrea als selbständiger Bundesstaat mit Äthiopien vereinigt. Dadurch erhielt dieses Land einen Zugang<br />
zum Meer. Die italienischen Ansiedler, die Amharafrauen heirateten, durften im Lande bleiben, da die Äthiopier ihre<br />
Aufbauarbeit zu würdigen wissen.<br />
Ein Beispiel für den pragmatischen Umgang der meisten schwarzafrikanischen Staaten mit den damaligen<br />
"Repräsentanten" der Kolonialmächte. Nur in sehr wenigen Staaten wurden die angesiedelten Europäer mit<br />
Gewalt des Landes verwiesen. (Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 226 und 266 dieser Arbeit.)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 199
Seit 1993 ist Eritrea wieder ein eigenständiger Staat. Mit einer Bemerkung über den Tana-See, der wie<br />
vermerkt, "sechsmal so gross wie der Bodensee" ist und den Ursprung des Blauen Nils bildet, schliesst der<br />
Autor seine Betrachtungen über Äthiopien und wendet sich in einem kurzen Abschnitt der Somalihalbinsel zu.<br />
Über deren Bewohner schreibt er auf der Seite 47:<br />
...Die Bewohner sind Somalineger. Ihre hellbraune Hautfarbe, ihr hoher Wuchs, ihr schmales Gesicht und ihr gelocktes<br />
Haar verraten hamitische Blutmischung. Sie gehören der mohammedanischen Religion an. Ihren Lebensunterhalt<br />
gewinnen sie durch Viehzucht. Ackerbau wird nur in den Tälern, deren Flüsse von Galeriewäldern begleitet werden,<br />
betrieben. Die Bevölkerungsdichte ist gering; auf 1 qkm kommen kaum 3 Bewohner. Äthiopien, Italien und England teilen<br />
sich in die Halbinsel. Italienisch-Somali wird 1960 unabhängig werden.<br />
Nach Bürgerkriegswirren in Somalia seit dem Ende der achtziger Jahren haben sich die verfeindeten Gruppie-<br />
rung rund 10 Jahre später darauf geeinigt, die Kampfhandlungen einzustellen.<br />
Im nächsten grossen Kapitel auf den Seiten 47-55 beschreibt der Autor unter dem Titel "Das ostafrikanische<br />
Seen- und Grabengebiet" die Länder Kenia, Uganda und das Gebiet des heutigen Tansanias. Nach einer<br />
Beschreibung der "Landschaft" (S. 47-48) und einer Karte "Die ostafrikanischen Grabenzonen" auf der<br />
Seite 48, schreibt der Autor in "Klima und Pflanzenwelt" (S. 48-49) auf der Seite 49 über die heimische Bevöl-<br />
kerung des Hochlandes:<br />
Hier ziehen die viehzüchtenden Neger mit ihren Ziegen-, Schaf- und Rinderherden von Weideplatz zu Weideplatz....<br />
...Jetzt [nach Einsetzen der Regenzeit, Anm. des Verfassers] braucht der viehzüchtende Neger nicht mehr neue<br />
Weidetriften aufzusuchen; der landbauende aber beginnt mit der Aussaat seiner Feldfrüchte...<br />
Auf der Seite 50 beginnt der Autor mit einer ausführlichen Beschreibung der Bevölkerung mit der folgenden<br />
Gliederung: "Die hamitischen Negerstämme" (S. 50), "Die Bantuneger" (S. 50-51), "Inder und Araber"<br />
(S. 51-52) und "Europäer" (S. 52-54), denen der längste Abschnitt gewidmet ist. Über die Massai heisst es auf<br />
der Seite 50 (siehe auch die beiden Zeichnung der Seiten 2 und 50, die auf der Seite 190 dieser Arbeit, respek-<br />
tive anschliessend an den folgenden Text abgedruckt sind):<br />
...Sie wohnen heute zwischen dem Kenia, dem Kilimandscharo und dem Viktoria-See. Ihre Raubzüge dehnten sie früher<br />
bis nach Äthiopien aus; denn sie waren der Meinung, dass Gott ihren Vätern alles Rindvieh anvertraut hätte. Sie sind gross,<br />
kräftig und sehnig. Eine Körpergrösse von 2 m ist das Durchschnittsmass. Ihre Haut ist schokoladenbraun, ihr Haar lang<br />
und strähnig, die Nase gerade, die Lippen schmal und geschlossen. Nie tragen die Männer eine Last auf dem Rücken. Dazu<br />
sind sie zu stolz. Sie schleppen sie höchstens hinter sich her. Ihr Reichtum besteht in dem Besitz von Rindern. Deren Zahl<br />
entscheidet auch, wie viele Frauen ein Mann heiraten kann. Der Schmuck der Frauen besteht aus Eisenringen und<br />
Messingspiralen, die oft ein Gewicht von 25 Pfund und mehr haben. Die Frauen sorgen für den Haushalt. Die alten Leute<br />
werden von der Jugend ehrfürchtig behandelt. Die Massai glauben an einen Gott und fürchten sich nicht vor Geistern. Die<br />
Baganda in Uganda unterhalten in ihrer Hauptstadt Kampala eine eigene Negeruniversität.<br />
"Massai vor ihrer Hütte" (S. 50)<br />
Auf der Zeichnung sind sowohl der typische Schmuck als auch die oft abgebildete Körperhaltung mit dem<br />
angewinkelten Bein (hier beim Jungen) dargestellt. (Zu den Massai siehe auch die Seiten 180 und 225 dieser<br />
Arbeit.) Anschliessend an die Beschreibung der Massai folgt die ausführliche Darstellung der "Bantuneger"<br />
auf den Seiten 50-51:<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Ganz anders ist das Aussehen und das Leben der Bantuneger... Sie sind dunkelbraun bis schwarz, haben krauses Haar,<br />
wulstige, aufgeworfene Lippen und eine breit gedrückte Nase. Sie hausen in kegelförmigen, mit Gras bedeckten Hütten.<br />
Fenster fehlen. Die Frauen halten die Behausung sehr sauber. Zum Schlafen benutzt der Bantu ein Graslager, das mit einer<br />
Matte oder auch mit einem Fell bedeckt wird. Manchmal ruht er auch auf einer über 4 Pfähle gespannten Kuhhaut. Auf<br />
einer solchen nur 1,20 m langen Liegestatt muss der Neger in gekrümmter Haltung schlafen.<br />
Entgegen der Vorurteile vom "schmutzigen und stinkenden Neger", die sich wohl aufgrund der Begegnung mit<br />
den nach einer mehrwöchigen Schiffahrt in Amerika ankommenden afrikanischen Sklaven gebildet hatte,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 200
legen viele Schwarzafrikaner sehr viel mehr Wert auf "Sauberkeit", als dies beispielsweise bei den Europäern<br />
der Fall ist.<br />
Der mit dem Tramper reisende Rucksacktourist, der tagelang nicht geduscht hat, vielleicht aus der Überlegung<br />
heraus, kein kostbares Wasser zu verschwenden, stösst bei der einheimischen Bevölkerung auf Unverständnis<br />
und wird hinter vorgehaltener Hand als "Schmutzfink" beschimpft. Im Text schreibt der Autor weiter (S. 50):<br />
Die vereinzelt stehenden Hütten bilden ein Dorf, mehrere Dörfer einen Bezirk, den ein Häuptling leitet. Dieser nennt sich je<br />
nach der Grösse seines Machtbereiches König oder Sultan. Er ist Richter, Feldherr, Gesetzgeber, Oberzauberer und<br />
Steuereinnehmer. Minister stehen ihm zur Seite. Seine Felder werden von den Untertanen oder von Sklaven bearbeitet.<br />
Nachts bleibt der Bantu in seiner Hütte, denn er fürchtet sich vor den Geistern. Um 6 Uhr früh steht er mit der Dämmerung<br />
auf, wartet aber ab, bis sich die kühle Nachtluft erwärmt hat. Zuerst wäscht er sich und versäumt auch tagsüber keine<br />
Gelegenheit zu baden. Bei der Arbeit wird immer gesungen oder doch gelärmt. Die Frauen sorgen für die Mahlzeit, pflegen<br />
die Kinder, arbeiten auf den Feldern oder flechten Matten und formen Tongefässe. Die Mütter tragen auch bei der Arbeit<br />
die Säuglinge in einem Fell auf dem Rücken.<br />
Wird bedacht, dass viele Einheimische vor der Einführung der billigen Plastiksandalen barfuss zu gehen pfleg-<br />
ten, und nachts Tiere wie das Skorpion zum Vorschein kommen, die im Dunkeln ohne entsprechendes Licht<br />
nicht zu sehen sind, dann geht die beschriebene Scheu, während der Nacht die Hütte zu verlassen, sicherlich<br />
nicht nur auf die Angst vor Geistern zurück. Im Text fährt der Autor fort (S. 51):<br />
Ausser dem Ertrag seiner Felder, der aus Mais, Erbsen, Bohnen, Bataten, Süsskartoffeln, einer haferähnlichen Hirseart und<br />
Erdnüssen bestehen kann, lebt der Neger vor allem von Bananen. Neuerdings baut der Neger auch Baumwolle auf eigenen<br />
Feldern an. Seine Ernten werden oft durch Dürrzeiten, Wildtiere, besonders Wildschweine, Affen und Elefanten, und vor<br />
allem durch Heuschrecken gefährdet oder vernichtet. Der Neger lebt im allgemeinen genügsam. Die Hauptmahlzeit am<br />
Abend besteht aus einem Brei, den die Frauen aus Mais, Hirse und Bananen herstellen. Dazu verzehrt der Neger gerne<br />
Erdnüsse, Hülsenfrüchte und getrocknete Fische. Wenn er aber ein Stück Wild erlegt hat, isst er Fleisch in unglaublichen<br />
Mengen, das er am Spiess röstet. Beim Essen trinkt der Neger nicht. Das kommt vielmehr nach den Mahlzeiten und<br />
besonders bei den häufigen Tänzen, die er leidenschaftlich liebt und vor allem bei Vollmond veranstaltet. Die Frau gilt<br />
nicht viel. Sie ist für den Neger in erster Linie die Arbeitskraft.<br />
In diesem Abschnitt verallgemeinert der Autor zu stark. Ausserdem wird der Eindruck erweckt, alle "Neger"<br />
seien "mondsüchtig" und würden ihre Frauen nicht ehren. Dabei geht vergessen, dass nicht wenige Völker<br />
Schwarzafrikas matrilinear bestimmt sind und oft den Frauen zwar ein gewisses Rollenverhalten zugeschrie-<br />
ben wird, diese andererseits aber grosse Achtung geniessen.<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Die Religion der heidnischen Neger ist ein Geisterglaube, und zwar verehrt er die Naturgewalten und die Seelen der<br />
Verstorbenen. Eine unheimliche Macht üben die Medizinmänner aus, die daher nicht nur geachtet, sondern geradezu<br />
gefürchtet werden.<br />
Diese Betrachtungsweise der traditionellen Heiler und Priester Schwarzafrikas findet sich auch in Hergés "Tim<br />
und Struppi im Kongo". (Siehe dazu die Seite 489 dieser Arbeit.) Auf der Seite 51 findet sich folgende Zeich-<br />
nung, auf der die im Text bereits erwähnte Tätigkeit der Nahrungszubereitung dargestellt ist:<br />
"Bantufrauen mahlen Körner"<br />
Über die Inder schreibt der Autor in einem kurzen Abschnitt (S. 51f.), dass sie die "Neger rücksichtslos"<br />
ausgebeutet hätten. Dabei verschweigt er die Pufferolle, die ihnen durch ihre Mittelstellung zwischen europäi-<br />
scher Oberschicht und einheimischer Unterschicht zukam. Über die Araber heisst es (S. 52):<br />
Araber... verbreiteten ihre Religion, den Islam, über Ostafrika. Sie errichteten überall auf dem Hochland<br />
Handelsniederlassungen. Ihr Hauptgeschäft wurde der Handel mit Elfenbein und Sklaven. Aus einer Mischung von<br />
Arabern und Bantunegern entstand an der Küste der Stamm der Suaheli, deren Sprache als Kisuaheli in ganz Ostafrika zur<br />
Verkehrssprache wurde.<br />
Kisuaheli ist heute neben dem Englischen offizielle Verkehrssprache in den Staaten Kenia und Tansania, wird<br />
von Uganda bis Mosambik und selbst in der Demokratischen Republik Kongo von Teilen der Bevölkerung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 201
gesprochen, und hat damit eine ähnliche Bedeutung für Ostafrika, wie das Hausa in Westafrika. (Zu den Hausa<br />
und ihrer Sprache siehe Seite 29 dieser Arbeit).<br />
Über die Europäer schreibt der Autor im Bezug auf die einheimische Bevölkerung auf den Seiten 52-54:<br />
...Ausser Viehfarmen legten sie mit Hilfe der schwarzen Arbeiter ausgedehnte Pflanzungen an, bauten Eisenbahnen,<br />
Strassen und Brücken, errichteten Schulen und Krankenhäuser und wurden so nicht nur die Herren der Neger, sondern<br />
auch ihre Helfer und Lehrmeister. Sie verschafften ihnen Arbeit und Verdienst, bekämpften den Sklavenhandel und die<br />
furchtbaren Seuchen und Krankheiten. Ausserdem erschlossen sie die reichen Bodenschätze des Hochlandes.<br />
Die furchtbarsten Feinde der Neger sind die unscheinbaren Tsetsefliegen, die unserer Stubenfliege ähneln. Sie leben in den<br />
feuchten Niederungen vom Senegal bis zum Sambesi, vom Tsad- See bis zum Viktoria-See. Von hier verbreiteten sie sich<br />
über Uganda und Rhodesien. Durch ihren Stich übertragen sie die Erreger der Schlafkrankheit auf Menschen und der<br />
Rinderpest auf Tiere. Alljährlich fallen Hunderttausende der Schlafkrankheit zum Opfer und erleiden einen qualvollen Tod.<br />
Zuerst treten nur Fieberanfälle auf. Später schwellen die Hals- und Nackendrüsen an. Wenn die Erreger aber ins Gehirn<br />
gelangen, wird der Kranke von unerträglichen Kopfschmerzen gepeinigt. Er wird unruhig, geistesgestört und tobsüchtig.<br />
Allmählich wird er matt und verfällt in Schlaf. Der Kranke magert zum Skelett ab und erwartet völlig teilnahmslos sein<br />
Ende.<br />
Am Viktoria-See starben um 1900 in wenigen Jahren von 300'000 Negern über zwei Drittel. Ein Landstrich von der Grösse<br />
eines mittelgrossen europäischen Staates starb vollständig aus. In Belgisch-Kongo fielen in kurzer Zeit 2 Millionen<br />
Menschen der Schlafkrankheit zum Opfer.<br />
Die Kolonialmächte haben auf verschiedene Weise die Schlafkrankheit auszurotten versucht. Erfolg hatte schliesslich das<br />
von den deutschen Farbenfabriken in Leverkusen hergestellte Heilmittel Germanin oder Bayer 205. Ihm ist es zu<br />
verdanken, wenn heute die entsetzliche Schlafkrankheit ihre Schrecken verloren hat. Das Gegenstück dieser furchtbaren<br />
Seuche bei den Tieren ist die Rinderpest. Sie vernichtet den Viehbestand und macht den Pflugbau und den Wagenverkehr<br />
unmöglich. Auch gegen die Rinderpest erfanden englische Forscher ein wirksames Mittel. Mit seiner Hilfe hofft man ein<br />
Gebiet von 12 Millionen qkm vom Westsudan bis Äthiopien und bis Südafrika von der Seuche zu befreien. Dann wird der<br />
Neger auch den Hackbau durch den viel ertragreicheren Pflugbau ersetzen können, weil er Zugvieh halten kann. Auf diese<br />
Weise werden nicht nur die Viehherden stark vermehrt, sondern auch die Erträge des Ackerlandes gewaltig gesteigert. Und<br />
wenn auch durch die verbesserten Lebensverhältnisse die Bevölkerungszahl wachsen wird, so werden doch wohl grosse<br />
Mengen von Fleisch, Butter und Häuten sowie beträchtliche Ernteüberschüsse für die Versorgung von Europa zur<br />
Verfügung stehen.<br />
Die ausführliche Beschreibung der Schlafkrankheit lassen wie die Bemerkungen über den Pflugbau mangeln-<br />
des ökologisches und im Fall der Schlafkrankheit geschichtliches Wissen des Autors erahnen, denn in Gebie-<br />
ten Tansanias hatte die einheimische Bevölkerung diese Krankheit ohne die Hilfe der modernen Medizin<br />
ausgerottet, indem sie die Büsche, die der Tsetsefliege als Ruheplatz dienten, rodeten. Durch die Politik der<br />
deutschen Kolonialmacht gegenüber den Einheimischen wurde das bis dahin herrschende Gleichgewicht<br />
gestört. Ganze Landstriche verbuschten und die Tsetsefliege und mit ihr die Schlafkrankheit eroberten riesige<br />
Landstriche zurück.<br />
Die systematische Bekämpfung der Schlafkrankheit durch die Europäer wurde erst möglich, als der britische<br />
Arzt Sir David Bruce (1855-1931) während einer Forschungsreise in Südafrika, den Erreger der Viehseuche<br />
Nagana entdeckte und aufgrund früherer richtig Forschung vermutete, dieser sei auch für die Schlafkrankheit<br />
beim Menschen verantwortlich. Während mehreren weiteren Reisen auf dem afrikanischen Gebiet konnte er<br />
und seine Frau Mary Steele Bruce zwischen 1903 und 1911 nachweisen, dass der Erreger vom Tier zum<br />
Mensch und von Mensch zu Mensch durch die Tsetsefliege übertragen wird. (Infopedia 1996; zur Schlafkrank-<br />
heit siehe auch die Seiten 197 und 337 dieser Arbeit.)<br />
Der Pflugbau hatte ebenfalls nicht vorhergesehene Auswirkungen auf die Ausschwemmung und Erosion des<br />
Kulturlandes. Auffallend ist aber wieder der Hauptgedanke der Versorgung Europas, die trotz eines allfälligen<br />
Bevölkerungswachstums, das tatsächlich auch auftrat, nach der Meinung des Autors keine weiteren <strong>Pro</strong>bleme<br />
aufwerfen sollte. Der Autor fährt fort (S. 53):<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Durch die koloniale Tätigkeit der Europäer wuchs der Wohlstand der eingeborenen Bevölkerung. Die unmenschlichen<br />
Kämpfe unter den Stämmen hörten auf. Die Bevölkerung nimmt wieder zu. Die Neger sind nicht mehr der Willkür ihrer<br />
Häuptlinge und Zauberer ausgeliefert, sondern werden gerecht und menschlich behandelt. Sie werden als Arbeitskräfte auf<br />
den Pflanzungen nicht ausgebeutet, sondern dürfen auch eigenen Grundbesitz erwerben und bewirtschaften. Ja, die<br />
Eingeborenen werden angehalten, eigene Pflanzungen anzulegen.<br />
Eine besonders wertvolle Vorarbeit und Hilfe leisten seit langem dabei die Missionen. Sie bringen den Negern nicht nur<br />
das Christentum, sondern sie unterweisen sie auch im Ackerbau, in der Viehzucht und im Handwerk. Daher befinden sich<br />
bei den vielen Missionsstationen neben der Kirche, der Schule und dem Krankenhaus auch immer Werkstätten und<br />
Musterwirtschaften.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 202
Allerdings hat die europäische Kolonisation auch andere Folgen gezeitigt. Sie zerstörte die alte Kultur der Eingeborenen.<br />
Sie gefährdete die Gesundheit der Neger durch unzweckmässige Kleidung, durch Krankheiten, Seuchen und Laster, vor<br />
allem durch den Alkohol.<br />
Durch die verbesserten Lebensverhältnisse ist der Neger dem Europäer gegenüber immer selbstbewusster geworden. Er<br />
verlangt heute eine grössere Selbständigkeit. Der Ruf "Afrika den Afrikanern" und die Mau-Mau-Bewegung in Kenia<br />
kennzeichnen eindrucksvoll den Ernst dieser Entwicklung.<br />
Nach dieser Beschreibung folgen noch einige Bemerkungen über den Anbau von Sisal - die Art des Anbaus<br />
wird auf einer Zeichnung (S. 53) wiedergegeben - und Kaffee und Baumwolle, sowie über Diamanten- und<br />
Goldlager. Auf der Seite 54 findet sich der Ländersteckbrief zu "Das Ostafrikanische Seen- und Grabengebiet"<br />
und eine Beschreibung der Verkehrssituation. Mit einem Abschnitt über "Die gegenwärtige Lage" auf der<br />
Seite 55, auf der sich auch eine Karte "Die grossen Verkehrslinien Afrikas" befindet, schliesst der Autor seine<br />
Betrachtungen über Ostafrika (S. 55):<br />
Die Engländer haben die meisten ihrer Garnisonen von Vorderasien, Vorderindien und Birma nach Kenia verlegt und<br />
Nairobi, heute eine Grossstadt, zum Sitz des Oberbefehlshabers gemacht. Auch die wirtschaftlichen Pläne beweisen, wie<br />
wichtig dieser Teil seiner afrikanischen Besitzungen dem Mutterland ist; er soll zur Rohstoffkammer für Europa werden.<br />
Im Jahre 1946 hat England einen "Erdnussplan" beschlossen, der aber keinen Erfolg brachte...<br />
(Zu Nairobi siehe auch die Seiten 165 und 220 zum "Erdnussplan" die Seiten 216 und 305, zu Kenia die<br />
Seiten 165 und 225 dieser Arbeit.)<br />
...Früher wurden die Maisfelder der Neger fast jedes Jahr durch Heuschreckenschwärme aus dem Sudan in wenigen<br />
Minuten vernichtet. Noch 1946 verfinsterten solche Schwärme die Sonne und bedeckten den Boden 9 cm hoch.<br />
Hunderttausende von Schwarzen wurden dadurch vom Hungertod bedroht. Heute ist auch diese Gefahr beseitigt. Zum<br />
Schutze der Erdnusspflanzen haben die Engländer im Jahre 1947 an der Grenze Äthiopiens Horchposten aufgestellt. Wenn<br />
diese Heuschrecken melden, steigen sofort Flugzeuge auf und überrieseln die Schwärme mit Giftstoffen. Zu Millionen<br />
fallen die Tiere tot zu Boden und werden in wenigen Stunden von den Ameisenheeren bis auf die Flügel aufgefressen. Das<br />
ostafrikanische Hochland ist heute britischer Kolonialbesitz. Nur ganz im Süden haben die Portugiesen und zwischen<br />
Viktoria- und Tanganjika-See auch die Belgier Anteil an dem Hochland. Sie erhielten den früher deutschen Bezirk von<br />
Ruanda-Urundi, der am dichtesten von ganz Zentralafrika besiedelt ist.<br />
(Zu den Heuschrecken siehe auch die Seiten 198 und 480, zu den Hungerkrisen die Seiten 180 und 256 dieser<br />
Arbeit.) Ruanda und Burundi gehören noch immer zu den am dichtest besiedelten Länder Afrikas. (Vergleiche<br />
dazu die Karte "Bevölkerungsdichte" im Anhang auf der Seite 568 dieser Arbeit).<br />
Nach der Schilderung Ostafrikas beschreibt der Autor auf den Seiten 56-58 unter dem Titel "Das Übergangsge-<br />
biet zwischen Äquatorial- und Südafrika" das Gebiet zwischen Angola und Mosambik, durch dessen offene<br />
Savannenlandschaft "immer wieder lustige Negerstämme" gezogen seien. Die Beschreibung des Gebietes ist in<br />
drei Abschnitte gegliedert. Auf Seite 56 heisst es zu "Portugiesisch-Westafrika oder Angola":<br />
In den letzten Jahren setzte mit dem Bau von Staudämmen, Kraftwerken, Eisenbahnen, Flugplätzen, Häfen und Fabriken<br />
ein stürmischer Aufschwung ein. Portugiesische Bauern werden angesiedelt. Zwischen den Weissen und Schwarzen<br />
herrscht ein gutes Einvernehmen.<br />
(Zu Angola siehe auch die Seiten 159 und 285 dieser Arbeit.) Zu Nordrhodesien (Sambia) und Njassaland<br />
(Malawi) heisst es auf den Seiten 56 und 57:<br />
Diese beiden britischen Kolonien haben eine dichte Bantubevölkerung. Die Neger erfreuen sich grosser Freiheiten; sie<br />
leben und arbeiten friedlich mit den Weissen zusammen...<br />
(Zu Sambia siehe die Seiten 161, zu Malawi die Seiten 377 dieser Arbeit.) Zu "Portugiesisch-Ostafrika" oder<br />
Mosambik schreibt der Autor auf Seite 57, auf der sich auch der Ländersteckbrief zum "Übergangsgebiet<br />
zwischen Äquatorialafrika und Südafrika befindet:<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
...Gute Häfen, besonders Beira, dienen dem Verkehr; der Sambesi öffnet den Weg auf das Hochland. Im Küstenland sind<br />
Pflanzungen von Kopra, Sisal, Baumwolle, Tee und Zucker angelegt worden. Allein es fehlt für die weitere Entwicklung an<br />
Arbeitskräften, zumal viele der Eingeborenen nach Katanga und Südafrika abwandern... Da in Südrhodesien die grössten<br />
Asbestlager der Erde festgestellt wurden und Eisen, Kupfer, Chrom und Kohlen in grossen Mengen vorhanden sind, hofft<br />
man hier ein "Ruhrgebiet der Tropen" schaffen zu können.<br />
Ende der neunziger Jahre gehört Mosambik, dessen Bevölkerung auf 17 Mio. Menschen geschätzt wird, von<br />
denen rund zwei Drittel auf dem Land leben, zu den ärmsten Ländern der Welt. Über 80% der Bevölkerung ist<br />
in der Landwirtschaft tätig, aber weniger als 5% der Fläche des Landes werden überhaupt bebaut. Mosambik<br />
führt vor allem Krustentiere (58% der Exporte), Baumwolle (8%) und Cashewnüsse (6%), sowie Zucker,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 203
Kopra, Tee, Holz und Zitrusfrüchte aus, mit denen es 1993 rund 132 Mio. US$ erwirtschaftete. Da die Importe<br />
durch die Exporte nur teilweise gedeckt werden, betrug die Auslandsverschuldung des Landes 1995 über 5.7<br />
Mrd. US$. (Fischer 1998; zu Mosambik siehe auch die Seiten 159 und 262 dieser Arbeit.)<br />
4.17.5 Südafrika<br />
Auf den Seiten 58-72 beschäftigt sich der Autor in den Kapiteln "Aufbau und Klima" (S. 58-59), "Die einzel-<br />
nen Landschaften" (S. 59-66), "Die Bevölkerung" (S. 66-68) und "Die Staatliche Gliederung" (S. 68-72) mit<br />
Südafrika. In "Die einzelnen Landschaften" heisst es nach der Beschreibung von "Kapstadt" im Abschnitt<br />
"Kapland" auf Seite 60:<br />
Über rötliche Landwege geht im Frühling die Fahrt an grossen Weinfeldern vorbei, in denen Hottentotten arbeiten. Ihre<br />
halbnackten Kinder spielen zwischen Ziegen und Hühnern vor den flachen Lehmhäusern... Die Dienstboten sind<br />
Hottentotten... Die Landarbeiter sind hier wie dort Hottentotten. Ihre Dörfer bestehen aus kleinen, niedrigen Häuschen, die<br />
aus Lehmerde erbaut und mit einem Grasdach gedeckt sind. In einem solchen Dorf darf kein Weisser wohnen. Die<br />
Schwarzen arbeiten auf den Farmen oder in den nahen Städten. Eine Reihe von Missionsstationen sind in dieser Gegend<br />
entstanden. Schon vor 200 Jahren hat die Herrnhuter Brüdergemeinde unter den Hottentotten ihre Tätigkeit<br />
aufgenommen...<br />
Die Missionierung der "Hottentotten" war anfangs mit einigen Missverständnissen verbunden, die sogar<br />
Eingang in die Literatur fand. So schrieb die deutsche Schriftstellerin Bettina von Arnim (1785-1859) in ihrem<br />
1843 erschienen Werk "Dies Buch gehört dem König" über das Resultat der Verteilung europäischer Klei-<br />
dungsstücke an diese Menschen in einem kurzen Dialog, der gleichzeitig auch die damalige Sichtweise wider-<br />
spiegelt: "Pfarrer. Auf dem Kopf haben diese ungebildeten und stumpfen Kinder der Natur diese Kleidungs-<br />
stücke angelegt? - Ei, da geht ja der ganze Zweck der Sittlichkeit verloren." Im gleichen Werk finden sich<br />
weitere Stellen, die auf eine eher beschwerliche Missionierung hinweisen. (Arnim: Dies Buch gehört dem<br />
König, S. 422. DB S. 3712 ) Weiter schreibt der Autor (S. 60):<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
...Kaffern mit kohlschwarzen, wohlgebauten Körpern arbeiten in der brennenden Sonne. Die Kinder der Eingeborenen<br />
spielen vor den armseligen Hütten. Ihre Hautfarbe wechselt vom dunkelsten Schwarz bis zum hellen Weiss und zeigt, wie<br />
weit die Rassenmischung fortgeschritten ist.<br />
...Unzählige, grauschwarze Wellblechhütten beherbergen Tausende von Kaffern, die in den Minen und<br />
Diamantenwäschereien arbeiten...<br />
Der Hinweis auf das Fortschreiten der "Rassenmischung" trotz der Gesetze von 1927 (Immorality Act: verbot<br />
den ausserehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Weissen und Schwarzen) und 1950 (<strong>Pro</strong>hibition of Mixed<br />
Marriages Act: verbot die Heirat zwischen Weissen und Nichtweissen) zeigt, dass einerseits die Apartheidspo-<br />
litik nicht praktikabel war, sich Weisse andererseits nie "zu schade waren", sich mit schwarzafrikanischen<br />
Menschen einzulassen. Auch wenn die Einheimischen als "zweiter Klasse" betrachtet wurden, und die Euro-<br />
päer so zum Anstieg der Zahl der "Eingeborenen" beitrugen, denn dazu wurde ein illegitimes Kind automa-<br />
tisch. Andere solche Vorfälle ziehen sich durch die ganze Geschichte. So schreibt Bitterli: "Zu erwähnen wäre<br />
in diesem Zusammenhang etwa das Beispiel der schwarzhäutigen Konkubinen, die, von reichen amerikani-<br />
schen Pflanzern in New Orleans und anderswo ausgehalten, ein elegantes und geachtetes Dasein führten."<br />
(Bitterli 1977, S. 146). In dieses Bild passen auch die von Nettelbeck gemachten Angaben zum Kaufpreis der<br />
versklavten Menschen aus Schwarzafrika: "Nach diesem Tarif galt damals ein vollkommen tüchtiger männli-<br />
cher Sklave etwa hundert holländische Gulden; ein Bursche von zwölf Jahren und darüber ward mit sechzig<br />
bis siebzig Gulden und ungefähr zu gleichem Preis auch eine weibliche Sklavin bezahlt. War sie jedoch noch<br />
nicht Mutter gewesen und ihr Busen noch von jugendlicher Fülle und Elastizität (und daran pflegt es die Natur<br />
bei den Negerinnen nicht fehlen zu lassen), so stieg sie auch bis auf hundertzwanzig und hundertvierzig<br />
Gulden im Werte." (<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE 1996, Nettelbeck; zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 197<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 204
und 256 dieser Arbeit). Der Schriftsteller Hartmann widmete der Thematik der langen verpönten Beziehung<br />
zwischen Menschen schwarzer und weisser Hautfarbe mit "Die Mohrin" einen ganzen Roman, in dem er die<br />
Geschichte einer Sklavin, die 1763 in der Karibik freigekauft wurde und anschliessend auf einem Berner Patri-<br />
ziersitz lebte, schildert. (Hartmann, 1995) Weitere Beispiele finden sich in der Literatur seit der Antike.<br />
Im Abschnitt Oranje-Freistaat und Transvaal schreibt der Autor auf Seite 61, auf der sich auch eine Grafik<br />
über das zahlenmässige "Verhältnis der Schwarzen und Weissen in Südafrika" findet, über Johannesburg:<br />
...Ein buntes Rassengemisch bewegt sich durch die Strassen. Den etwa 400'000 schwarzen Kontraktarbeitern ist der Zutritt<br />
zum Innern verwehrt. Nur die Angestellten dürfen die Stadt betreten. Die anderen hausen in den Aussenquartieren und<br />
wohnen zum Teil noch in Hinterhöfen, in armseligen Wellblechhütten, die oft aus dem Blech der Benzinbehälter<br />
zusammengestückelt sind: es sind richtige Elendsquartiere.<br />
Im Gegensatz zu einem anderen Lehrmittel, welches von sauberen und geräumigen Wohnvierteln spricht<br />
(Seydlitz für Realschulen 1968, Bd. 3, S. 50), wird hier also vermerkt, dass viele schwarze Südafrikaner in<br />
"richtigen Elendsquartieren" leben. Im Abschnitt "Die Lage der schwarzen Minenarbeiter" auf den Seiten<br />
61-62 schreibt der Autor über die Arbeiter und zur politischen Lage:<br />
Die unverheirateten Minenarbeiter werden in Lagern zusammengefasst. In einem solchen Lager wohnen oft bis 8'000<br />
Männer, die meist zu 20-60 in einem Raum untergebracht sind. Sie verpflichten sich gewöhnlich für ein Jahr. Wenn sie<br />
dann in den Busch zurückkehren, sind sie vielfach krank und verdorben und ihrer Sippe entfremdet. In den<br />
Elendsquartieren der schwarzen Familien ist die Not noch viel grösser. Trunksucht und Sittenlosigkeit verderben die<br />
Neger. Unter solchen Umständen haben es die schwarzen Aufwiegler leicht, die verbitterten Menschen aufzuhetzen. Sie<br />
hämmern ihnen ein, dass Afrika den Schwarzen gehöre, dass der Weisse sie betrüge und ausnütze, dass sie die Mehrheit im<br />
Lande hätten. Das ist die schwarze Gefahr, die in Südafrika droht.<br />
Wie auch in anderen Lehrmitteln wird am Beispiel Südafrikas das Bild des Schwarzafrikaners schärfer und<br />
klarer gezeichnet. Es entsteht fast der Eindruck, als ob die Beschreibung der Zustände im ehemaligen Apart-<br />
heidsstaat bei den Autoren zu einer gewissen Enthemmung führen würde, die sie ihre wahre Gesinnung gegen-<br />
über den Schwarzafrikanern aussprechen lässt.<br />
Das friedliche Zusammenleben von Schwarz und Weiss wird also durch die "schwarzen Aufwiegler", die<br />
möglicherweise noch Kommunisten sind, bedroht, d. h. solange die "Neger" die ihnen zugedachte Stellung<br />
nicht hinterfragen, wird ihnen ein gewisses väterliches Wohlwollen entgegengebracht. Oder wie es Ambose<br />
Bierce im Bezug auf die damalige Haltung der weissen Amerikaner gegenüber den freigesetzten, ehemaligen<br />
schwarzen Sklaven in seinem "The Devil's Dicitionary" ausdrückte: "African, n. A Nigger that votes our way."<br />
(Bierce, 1911) Weiter schreibt der Autor im Text (S. 62):<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Neben der Fürsorge des Staates und der Minen arbeiten vor allem auch die Missionen in diesen Elendsquartieren den<br />
drohenden Gefahren entgegen. Auf dem Witwatersrand mit seinen 50 Goldbergwerken wirken zahlreiche<br />
Missionsgesellschaften. Sie bekämpfen die Trunksucht und suchen die entwurzelten Schwarzen zu einem Leben der Zucht<br />
und Ordnung anzuleiten. Durch die Lehren des Christentums wollen sie den Bantu, die von Natur aus ein starkes<br />
Gemeinschaftsgefühl besitzen, einen neuen, inneren Halt vermitteln. Ihre Arbeit hat auch den Staat zum Bau von Schulen,<br />
Krankenhäusern und ganzen Siedlungen für die Schwarzen veranlasst. Die Elendsquartiere sollen verschwinden. Allein in<br />
Johannesburg werden seit 1955 100'000 Schwarze umgesiedelt und in sauberen Wohnhäuschen ausserhalb untergebracht.<br />
Die früher von den Missionsgesellschaften übernommen Aufgaben werden zusehends von afrikanischen "apo-<br />
stolischen" und "Zions"-Kirchen übernommen, die in den letzten Jahren die europäisch geprägten Kirchen<br />
immer mehr verdrängt haben. Neben der Vermittlung von Arbeitsstellen, Hilfe in Notsituationen und gemein-<br />
samen <strong>Pro</strong>jekten, verpflichten diese neuen Kirchen ihre Mitglieder oft zu Enthaltsamkeit von Alkohol und<br />
Tabak und treten dafür ein, dass Konflikte friedlich gelöst werden. (Geo 3/1995, S. 42-58)<br />
Ein Grossteil dieser Umsiedlungen wurde unter Zwang, mit dem Ziel die betroffenen Gebiete von Schwarzen<br />
zu "befreien", durchgeführt. Es handelte sich dabei also um "ethnische Säuberungen", die der praktischen<br />
Umsetzung der Apartheidspolitik entsprangen. Weiter heisst es im Text auf der Seite 62:<br />
Alljährlich kommen rund 100'000 Bantuneger vor allem aus Mozambique nach Johannesburg, um in den Goldminen zu<br />
arbeiten. Die Übervölkerung in einzelnen Wohngebieten der Schwarzen, die Dürren, Viehseuchen oder<br />
Heuschreckenschwärme verursachen eine solche Notlage, dass der Bantu gerne aus der Wildnis in die Stadt flieht. Die<br />
Arbeit im Bergwerk ist sehr schwer...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 205
"Siedlung für schwarze Minenarbeiter" (S. 62)<br />
Im Abschnitt "In der Bundeshauptstadt" auf den Seiten 62-63 schreibt der Autor:<br />
...Das Strassenbild ist ausserordentlich bunt. Schlankgebaute Zulus in dunkelblauen Uniformen sorgen als Polizisten für<br />
Ordnung. Die Negerfrauen sind in die schreiendsten Farben, hellrot, blau, grün, gelb, gekleidet. Sie drängen sich vor den<br />
Läden der Inder...<br />
Dieses Bild wird bis zum Ende der neunziger Jahre noch in der Reisebranche verwendet. Nach dem Abschnitt<br />
"Die Heuschreckenplage" heisst es in "Von Pretoria zur Ostküste" auf den Seiten 64-65 über die schwarze<br />
Bevölkerung:<br />
...Lourenzo Marques, die Hauptstadt der portugiesischen Kolonie, ist der Ausfuhrhafen Transvaals... Hotelpaläste,<br />
Luxusvillen. Schenken, indische Läden wechseln mit Negerhütten aus Lehm ab. Auf dem Marktplatz sind die grossen<br />
Geschäftshäuser. Eingeborene lungern in Scharen herum. Neger mit den zweirädrigen Rikschas warten auf Kunden...<br />
In der Beschreibung Natals geht der Autor nicht näher auf die Bevölkerung ein und zur Kalahari schreibt er<br />
(S. 65):<br />
Das Durstfeld der Kalahari erscheint dem Menschen ungastlich. Dem primitiven Buschmann dient es als Rückzugsgebiet.<br />
Nach den Pygmäen wird auch die Lebensweise der "Buschmänner" als "primitiv" angesehen. Im Abschnitt<br />
"Das südafrikanische Hochland" erfährt der Leser nichts über die schwarze Bevölkerung und im letzten<br />
Abschnitt, über Südrhodesien, dem heutigen Simbabwe, schreibt der Autor auf der Seite 66:<br />
...Das Land hat ein gesundes Klima und wird daher von rund 200'000 Weissen neben 2,4 Millionen Bantu bewohnt. Diese<br />
treiben Viehzucht und Ackerbau. Dazu kommen der Abbau von Bodenschätzen, besonders Asbest, Chromerz, Kohlen,<br />
Gold, Kupfer und Diamanten und eine starke industrielle Entwicklung. Am Sambesi stehen gewaltige Wasserkräfte zur<br />
Verfügung...<br />
Das 1998 rund 12.2 Mio. Einwohner, 71% davon Shona und 16% Ndebele, zählende Simbabwe - ein Drittel<br />
der Bevölkerung lebt in Städten, davon rund 1 Mio. in der Hauptstadt Harare - besitzt eine relative diversifi-<br />
zierte Wirtschaft: 38% der sich 1995 auf 2.1 Mrd. US$ belaufenden Exporte entfielen auf Agrarprodukte,<br />
weitere 38% auf verarbeitete Güter und 24% auf mineralische Rohstoffe. Die Auslandschulden des gleichen<br />
Jahres beliefen sich auf 4.9 Mrd. US$. (Fischer 1998) Wichtigstes Exportgut der letzten Jahre war Tabak -<br />
Simbabwe ist der weltweit drittgrösste <strong>Pro</strong>duzent von hochwertigem Virginiatabak - mit dessen Verkauf das<br />
Land 1997 435 Mio. US$ erwirtschaftete. Bedingt durch die weltweiten Antitabakkampagnien und grössere<br />
Ernten muss das unter einer Wirtschaftskrise leidende Land 1998 mit wesentlich geringeren Einnahmen rech-<br />
nen und zeigt damit die typischen <strong>Pro</strong>bleme vieler schwarzafrikanischer Staaten auf. (TA 25.05.98, S. 31) Auf<br />
die sich schon damals abzeichnenden Spannungen zwischen den weissen und schwarzen Bevölkerungsgruppen<br />
des Landes kommt der Autor an einer anderen Stelle zu sprechen. (Zu Simbabwe siehe auch die Seiten 183<br />
und 208 dieser Arbeit.)<br />
Im nächsten Kapitel zu Südafrika mit dem Titel "Die Bevölkerung" beschreibt der Autor auf den Seiten 66-68<br />
"Die Buschmänner", "Die Hottentotten", "Die Neger", "Die Inder" und "Die Weissen". Über die "Buschmän-<br />
ner" schreibt er auf den Seiten 66-67:<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Die Bevölkerung Südafrikas setzt sich aus verschiedenen Rassen und Stämmen zusammen. Die älteste Gruppe sind die<br />
Buschmänner; sie gehören einer Urrasse an und waren früher über ganz Südafrika verbreitet. Heute sind sie in die Kalahari<br />
zurückgedrängt worden. Es sind hagere, zwerghafte Gestalten von 1,40 m Grösse. Ihre Haut ist hellbraun, faltig und gleicht<br />
gegerbtem Leder. Die Nase ist breit, die Stirn kurz, der Mund schnauzenförmig. Ihre Sprache besitzt eigenartige<br />
Schnalzlaute. Im Sommer streifen sie unstet in der Kalahari umher. Im trockenen Winter aber schlagen sie ihre<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 206
Standquartiere in der Nähe von Wasser stellen am Rande der Wüste auf. Sie leben unter der Leitung eines Häuptlings in<br />
Sippen beieinander. Er bestimmt bei Tagesanbruch die Arbeit jedes einzelnen. Die Frauen sammeln Holz, holen Wasser in<br />
leeren Strausseneiern und suchen alles Essbare zusammen, was sie finden. Oft sind es nur wasserhaltige Knollen oder<br />
einige Käfer, Raupen, Larven, Heuschrecken und Frösche. Die Männer gehen auf die Jagd. Sie schleichen sich an das Wild<br />
heran, treffen es mit vergifteten Pfeilen und hetzen es dann, bis es zusammenbricht; das kann bei Giraffen 2 - 4 Tage<br />
dauern. Das Fleisch der erlegten Tiere verschlingen sie halbroh in unglaublichen Mengen. Ihr scharfes Auge folgt der<br />
Biene im Flug und führt sie so zu den als Leckerbissen begehrten Honigwaben. Finden sie kein Wasser, so graben sie<br />
Löcher in den Boden und saugen oft mit blutenden Lippen etwas Feuchtigkeit mit einem Rohr aus dem Grund. Ihre<br />
Behausungen bestehen aus einfachen Windschirmen, die sie aus Zweigen zusammenstecken. Dahinter kauern sie sich an<br />
einem Feuer zusammen. Das wärmt nicht nur in den sternklaren, kühlen Nächten, sondern hält auch wilde Tiere fern.<br />
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 181 und 238 dieser Arbeit.) Auf der Seite 76 ist auch die<br />
folgende Zeichnung eines "Buschmannes" abgedruckt:<br />
Über die "Hottentotten" schreibt der Autor auf der gleichen Seite:<br />
Die Hottentotten. Sie gehören wie die Buschmänner einer Urrasse an und können nicht zur Negerrasse gerechnet werden,<br />
obwohl sie einige körperliche Merkmale mit den Negern gemeinsam haben. Von den kleinwüchsigen Buschmännern<br />
unterscheiden sie sich durch ihren etwas grösseren Wuchs und ihre fahlgelbe, faltige Haut. Auch ihre Sprache besitzt<br />
Schnalzlaute. Sie leben heute zusammengedrängt in der Südwestecke von Südafrika. Die Hottentotten und die<br />
Buschmänner sind aussterbende Völker, die für die Weissen keine Gefahr mehr bedeuten<br />
Nachdem der Autor versichert hat, dass die "Urrassen" Südafrikas keine Gefahr mehr für die weisse Bevölke-<br />
rung darstelle, fährt er fort mit der Beschreibung der "Neger" (S. 67):<br />
Gefahr droht vielmehr nur von den Kaffern oder Bantu. Ihre Zahl beträgt in der Südafrikanischen Union 9,6 Millionen. Sie<br />
vermehren sich aber so stark, dass sie in 50 Jahren auf 25 Millionen angewachsen sein können. Sie setzen sich aus<br />
verschiedenen Stämmen zusammen. Im Osten leben die Basuto und Zulu, im Norden die Betschuanen, Matabelen und<br />
Barotsen, im Westen die Herero. Sie sind dunkelbraun bis schwarz und haben eine kräftige Gestalt. Viele von ihnen, wie<br />
die Bewohner des Basuto- und des Swazilandes, sind tüchtige Ackerbauer, andere Viehzüchter. Hunderttausende sind als<br />
Minen- oder Fabrikarbeiter, als Dienstboten und Tagelöhner in die Städte abgewandert. Man bezeichnet diese Landflucht<br />
als schwarze Springflut. Über 75% der männlichen schwarzen Bevölkerung sucht heute mindestens zeitweise in den<br />
Städten Arbeit und Verdienst. Aus Hottentotten und Negern entstand im Kapland eine Mischbevölkerung, die auf den<br />
Bauernhöfen, in den Fabriken und Städten die Arbeitskräfte stellt oder als selbständige Handwerker sich betätigt. Sie<br />
geniessen sogar gleiche Rechte wie die Weissen. Ihre Sprache ist das Afrikaans. Das ist die Sprache der über 1,6 Millionen<br />
Weissen, die in Südafrika geboren sind und meist von Holländern abstammen. Das Afrikaans gilt wie das Englische auch<br />
als Landessprache.<br />
Die "Neger" Südafrikas stellen also nicht nur eine "Gefahr" dar, sie brechen auch wie eine "schwarze Spring-<br />
flut" über die Weissen herein. Auf der Seite 68 folgt ein kurzer Abschnitt über die Inder, von denen es im<br />
Zusammenhang mit der schwarzen Bevölkerung heisst:<br />
...Da der indische Händler infolge seiner Anspruchslosigkeit und Gerissenheit den weissen Kaufmann überall zurückdrängt<br />
und den Neger rücksichtslos ausbeutet, entstand auch eine indische Gefahr, die wiederholt zu schweren Ausschreitungen<br />
gegen die Inder geführt hat... Wie die Neger sollen die 400'000 Inder in Südafrika in besonderen Reservationen angesiedelt<br />
werden...<br />
Die auf der Seite 51 des Lehrmittels gemachte Aussage bezüglich der Ausbeutung der Schwarzafrikaner durch<br />
die Inder wird also noch einmal wiederholt und damit bekräftigt. (Siehe dazu auch die Seite 201 dieser Arbeit.)<br />
Im Abschnitt über die Weissen auf der gleichen Seite wird ausgesagt, sie hätten "das Land am besten entwik-<br />
kelt" und zum "ertragreichsten Teil von ganz Afrika gemacht".<br />
Im folgenden Kapitel "Die Staatliche Gliederung" heisst es im allgemeinen Teil, dass die "im Unionsgebiet<br />
liegenden Negerreservate Basuto- und Swasiland unmittelbar von London aus verwaltet" würden und weiter<br />
(S. 69):<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Kein Weisser darf hier Grundbesitz erwerben. Die Bantu werden zwar von britischen Beamten regiert, haben aber ihre<br />
Häuptlinge behalten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 207
Auf Seite 69 ist auch eine Karte mit dem Titel "Die politische Gliederung Südafrikas" abgebildet. Im<br />
Abschnitt "Die wirtschaftlichen Verhältnisse" auf den Seiten 69-70 schreibt der Autor über das heutige<br />
Botswana:<br />
Im Betschuana-<strong>Pro</strong>tektorat wurden mehrere Bantustämme in den feuchten Randgebieten in Reservaten angesiedelt. Sie<br />
leben unter ihren Häuptlingen und werden im übrigen von britischen Kolonialbeamten verwaltet. Die Negerfrauen<br />
bearbeiten mit der Hacke den Boden und bauen in den Flussniederungen Hirse, Mais, Kürbisse, Melonen und Tabak an.<br />
In der Südafrikanischen Union und in ihren Nachbarländern lebt die weisse und schwarze Bevölkerung vom Ackerbau,<br />
von der Viehzucht und vom Bergbau...<br />
...Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Wirtschaft der Union rein bäuerlich. Mit der Entdeckung der Gold- und<br />
Diamantenlager entstanden bergbauliche Industriezentren, die nicht nur die weisse, sondern auch die schwarze<br />
Bevölkerung anzogen. Aus einem bäuerlichen Gemeinwesen, das weit entfernt von den Brennpunkten der Weltwirtschaft<br />
sich selbst versorgte, wurde eines der wichtigsten Wirtschaftsgebiete, das erste Gold- und Diamantenland der Erde...<br />
(Zu Botswana siehe auch die Seite 161 dieser Arbeit.) Auf der Seite 71, auf der sich auch der Ländersteckbrief<br />
zur Region Südafrika findet, geht der Autor unter dem Titel "Die schwarze Gefahr" auf die Ängste der weissen<br />
Bevölkerung Südafrikas ein:<br />
...Da die Neger sich stärker vermehren als die Weissen, wird sie von Jahr zu Jahr grösser. Dabei braucht der weisse Farmer<br />
und Minenbesitzer den Schwarzen als billige Arbeitskraft, anderseits kann der Schwarze nur mit Hilfe des Weissen seine<br />
Lage bessern. Zu dieser schwarzen Gefahr kommen die Schwierigkeiten mit den Indern. Man will diese Spannungen<br />
bekämpfen, indem man neues Siedlungsland schafft... Ferner versucht man, die Lage der schwarzen Industriearbeiter zu<br />
bessern und ihnen menschenwürdigere Wohnstätten zu geben.<br />
Hier wird das Bild vom Schwarzen, der ohne die Hilfe des Weissen seine "Lage" nicht bessern kann, gezeich-<br />
net. Eine Schutzbehauptung die überall dort angeführt wurde, wo die Sonderstellung der Weissen gegenüber<br />
den schwarzen Bevölkerungsteilen verteidigt werden sollte.<br />
Im Abschnitt "Buren und Briten" auf den Seiten 71-72 heisst es zum gleichen Thema:<br />
...Bei der Parlamentswahl im Jahre 1948 hat die nationale Partei der Buren die Mehrheit erhalten. Sie wollen sich von<br />
Grossbritannien lösen und die Union zu einer selbständigen Republik machen. Sie wollen ferner die Neger aus dem<br />
öffentlichen Leben entfernen, in Reservaten ansiedeln und so in den Stammesverband zurückführen. Man will zu diesem<br />
Zwecke 300'000 qkm, das sind 10 % des Landes, zur Verfügung stellen...<br />
...Diese Spannung zwischen den Briten und Buren hatte zur Folge, dass Südrhodesien, Nordrhodesien und Njassaland sich<br />
im Frühjahr 1949 auf einer Konferenz an den Viktoriafällen verständigten und 1953 sich zu einer<br />
Britisch-Zentralafrikanischen Föderation zusammenschlossen. Es hat den Anschein, dass diese Kolonien sich zu einem<br />
neuen Dominion in der Britischen Völkerfamilie entwickeln werden. Dadurch will man die weitere Ausdehnung der Union<br />
nach Norden verhindern. Die Eingeborenen aber wollen dort ihre Freiheiten und Rechte wahren, die ihnen die Briten in<br />
Njassaland und Nord-Rhodesien eingeräumt haben, während in Süd-Rhodesien die Weissen die herrschende Schicht<br />
bilden.<br />
(Zu Simbabwe siehe auch die Seiten 206 und 368 dieser Arbeit.)<br />
4.17.6 Inseln Afrikas<br />
Im zweitletzten Kapitel "Die Inseln rings um Afrika" auf den Seiten 72-74, der Ländersteckbrief zu "Inseln um<br />
Afrika" ist auf der Seite 73 abgedruckt, schreibt der Autor zu den "Kapverdischen Inseln" (S. 72): "Unter der<br />
weissen Bevölkerung leben viele Neger." Die Bevölkerung Madagaskars wird im Osten als mit den Malaien<br />
verwandt bezeichnet, während sie im Westen "dunkelhäutiger" sei (S. 73). Über Sansibar, heute Teil von<br />
Tansania, heisst es (S.74):<br />
...Es war einst der Sitz eines mächtigen Sultans und einer der grössten Sklavenmärkte. Auf der Insel gibt es ausgedehnte<br />
Gewürznelkenplantagen und andere Gewürzpflanzungen.<br />
Ende der neunziger Jahre werden zwar immer noch Gewürznelken angebaut, diese geschieht aber in einem<br />
weit bescheideneren Rahmen, denn der Zusammenbruch der Plantagen durch das Verbot der Sklaverei auf der<br />
Insel konnte nie mehr aufgefangen werden.<br />
4.17.7 "Afrika und Europa"<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Im letzten Kapitel "Afrika und Europa" auf den Seiten 74-75 bringt der Autor in den drei Abschnitten "Die<br />
Leistungen der Europäer" (S.74-75), "Afrika als Rohstoffkammer Europas" (S. 75) und "Verkehr" (S. 75-76)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 208
noch einmal die Kerngedanken, die sich wie ein roter Faden durch den Band "Länder und Völker" ziehen, zu<br />
Papier. Über die Leistungen der Europäer schreibt er (S. 74f.):<br />
Die europäischen Staaten leisteten in den letzten Jahrzehnten eine riesige Kolonisationsarbeit in Afrika. Sie erforschten den<br />
dunklen Erdteil, sie bekämpften den Sklavenhandel und die furchtbaren Krankheiten, vor allem Malaria und<br />
Schlafkrankheit. Sie bauten Strassen und Eisenbahnen, richteten auf den Flüssen und Seen Schiffahrtslinien ein und legten<br />
Flugstrecken an. Ausserdem bauten sie Häfen, Staudämme, Wasserkraftwerke und erbohrten artesische Brunnen. Sie<br />
errichteten ferner Krankenhäuser und Schulen. Sie hielten die Neger dazu an, den Boden besser zu bearbeiten und<br />
auszunützen. Sie verwandelten ungeheure Flächen des Urwalds, der Savanne, der Steppe, der<br />
Überschwemmungslandschaften und der Trockengebiete in ertragreiches Pflanzungsland. Dadurch verschafften sie den<br />
Eingeborenen Arbeit und Verdienst. Sie beuteten die Bodenschätze aus und bauten Industrien auf. Der Kampf gegen den<br />
Sklavenhandel, gegen Krankheiten und Seuchen, die Arbeit der Missionen waren Werke der Menschlichkeit. Bedeutende<br />
deutsche Ärzte und Wissenschaftler wie Robert Koch haben jahrelang in Afrika für das Wohl der Neger ihr Leben und ihre<br />
Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Der als Deutscher geborene Albert Schweitzer wirkt heute noch ausserordentlich<br />
segensreich in Lambarene am Ogowefluss in Französisch-Kamerun. Einen besonders grossen Anteil an der Sorge für das<br />
leibliche und seelische Wohl der Neger haben die zahlreichen Missionsgesellschaften, die vor allem in den nicht vom Islam<br />
beherrschten Länderräumen das Christentum verbreiten und die Neger menschlich zu erziehen suchen. Man wird dieser<br />
Leistung der Europäer nur dann gerecht, wenn man bedenkt, dass sie erst in den letzten 50 Jahren erreicht wurde.<br />
(Vergleiche dazu die Bemerkungen zu Albert Schweizer auf den Seiten 124 und 472 dieser Arbeit.) All diese<br />
Bemühungen dienten der Mehrproduktion von Rohstoffen für die Kolonialmächte: Die Leistungen für die<br />
schwarze Bevölkerung diente, von wenigen Ausnahmen abgesehen, entweder der Ertragssteigerung oder der<br />
Missionierung.<br />
Allzuoft wurde die Missionierung durch Zwang von aussen erzielt und gründete nicht auf innerer Einsicht der<br />
Betroffenen. Ezekiel Mphahlele, der auch auf der Seite 229 dieser Arbeit zitiert wird, schreibt über die Tätig-<br />
keit der Missionare: "Die Missionare waren damit beschäftigt, uns 'hinauf' zu dem christlichen Gott zu zerren,<br />
zu stossen und zu treten. Sie sammelten eifrig Seelen - schwarze Seelen -, um sie einzupökeln und für den<br />
lieben Gott aufzubewahren, damit er sie eines Tages nach seinem Zeitmass einsammeln könne... Die grandiose<br />
Erpressung: wenn du das Krankenhaus willst, die Klinik, die Schule, musst du die Bibel nehmen, d.h. Christus.<br />
Wir werden Handel mit dir treiben, dich lehren, das Alphabet zu beherrschen und die Kunst der Diskussion,<br />
aber du musst auch den Koran akzeptieren." (Jestel Hrsg., 1982, S. 44f., 53f.) Bitterli schildert die Beweggrün-<br />
de der Mission mit den Worten: "Während sich der Christenmensch nach dem Sündenfall mühsam zur wahren<br />
Gotteserkenntnis emporgearbeitet hatte, war nun freilich der Un- oder Irrgläubige, aus Gründen, welche sich<br />
die theologischen Theoretiker sehr verschieden erklärten, immer mehr von Gott abgefallen; seine Gottesvereh-<br />
rung hatte sich zum Götzendienst pervertiert, das Bemühen um Reinheit der Sitten war dem Hang zur<br />
Ausschweifung aller Art gewichen. Doch die guten Seelenkräfte lebten auch im Heiden fort; da sie aber zu<br />
wenig entwickelt waren, als dass dieser den Weg zu Gott allein hätte finden können, ergab sich für den Chri-<br />
stenmenschen die moralische Aufgabe, dem Heiden zu helfen. Neben die lebensrechtliche Verpflichtung zur<br />
äusseren Mission trat also, wenn man will, eine christlich-humane Verpflichtung, die vom Grundgedanken<br />
eines einzigen Schöpfergottes und von der Einheit des Menschengeschlechtes ausging." (Bitterli, 1977, S. 108)<br />
Damit formuliert er die sich auch in einigen der untersuchten Geographielehrmitteln immer wieder äussernde<br />
Meinung, das Christentum stände an der Spitze einer ganzen Religionshierachie. (Siehe dazu auch die Seite<br />
192 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
Im zweiten Abschnitt "Afrika als Rohstoffkammer Europas" schreibt der Autor auf Seite 75:<br />
Heute hat die Notlage Europas den Anstoss zu einer verstärkten kolonisatorischen Arbeit in Afrika gegeben. Afrika soll die<br />
zukünftige Rohstoffkammer Europas werden. Vor allem haben die Engländer einen grossen Wirtschaftsplan entworfen, da<br />
im Bereich der Britischen Völkerfamilie über ein Drittel der Bevölkerung Afrikas lebt, und zu ihm rund ein Viertel Afrikas<br />
gehört. Über 160 Millionen Pfund sollen für den Bau von Krankenhäusern, Strassen, Brücken, Hafenanlagen, Eisenbahnen<br />
und Talsperren verwandt werden. Ferner sollen Sümpfe trockengelegt und Trockengebiete durch Staudämme und<br />
artesische Brunnen bewässert werden. Wie wichtig gerade diese Arbeiten sind, geht aus der Tatsache hervor, dass über<br />
50% des Erdteils künstlich bewässert werden müssen. Ausserdem soll die rücksichtslose Zerstörung des Waldes<br />
eingeschränkt werden. Die riesigen Wasserkräfte am Sambesi, am Kongo, am Nil und Niger sowie im Hochland von<br />
Ostafrika am Viktoria-, Albert- und Tanasee sollen durch den Bau von Kraftwerken nutzbar gemacht werden. Mit ihrer<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 209
Hilfe will man nicht nur Kraftstrom gewinnen, sondern auch Stickstoff aus der Luft in Kunstdünger verwandeln. In Kenia,<br />
Tanganjika, Nordrhodesien und Nigerien sollen Erdnusspflanzungen in einem solchen Ausmass angelegt werden, dass<br />
Europa in wenigen Jahren seinen Ö1- und Fettbedarf in Afrika decken kann. Am oberen Nil, am Tsad-See, am Nigerknie<br />
und am unteren Niger soll der Anbau von Baumwolle bedeutend erweitert werden. Die Ernten von Kakao, Tabak und<br />
Bananen sollen weiter gesteigert werden. Nach der Vernichtung der Tsetsefliege wird der wenig ertragreiche Hackbau<br />
durch den Pflugbau abgelöst werden. Die vermehrte Viehhaltung liefert nicht nur Dünger für den Anbau, sondern auch<br />
Butter, Fleisch und Häute. Grossbritannien und die Vereinigten Staaten wollen für Bergbau und Industrie grosse Summen<br />
anlegen.<br />
Noch einmal wird der Gedanke des von Afrika mit Rohstoffen und Agrarprodukten versorgten Europas<br />
gesponnen. Im Abschnitt "Verkehr" schliesst der Autor seine Darstellung Afrikas, nicht ohne sich Gedanken<br />
über die politische Zukunft des Kontinents zu machen (S. 75-76):<br />
Alle diese wirtschaftlichen Pläne werden nur dann Erfolg haben, wenn die Verkehrswege verbessert und vermehrt<br />
werden... Der Erfolg der wirtschaftlichen Pläne hängt in hohem Masse von der Mitarbeit der Neger ab. Der Europäer kann<br />
ohne den Neger in den Tropen keine Arbeit leisten. Aber auch der Neger ist ohne den Europäer nicht fähig, sich bessere<br />
Lebensbedingungen zu schaffen.<br />
Hier wird noch einmal die gegenseitige Abhängigkeit beschworen, als ob dadurch ein "Aufstand" der "Neger"<br />
verhindern werden könnte. Im Text schreibt der Autor weiter (S. 75):<br />
Die Buren, die gegenwärtig in der südafrikanischen Union die Führung haben, wollen die farbigen Völker von den weissen<br />
Bürgern ganz getrennt halten. Die Engländer sind überzeugt, dass die Wirtschaft und Kultur in den unendlichen Ländern<br />
Afrikas nur mit Hilfe der Negervölker und nicht gegen sie gesichert und gefördert werden können. Darum gestehen sie den<br />
Schwarzen in einer Reihe von Kolonien immer mehr Rechte zu und suchen die Rassengegensätze nach Kräften zu<br />
mindern. Am weitesten auf diesem Wege sind die Franzosen vorgeschritten. Sie erkennen die farbigen Mitbürger als<br />
gleichberechtigt an, aber sie finden trotzdem unter ihnen viele scharfe Gegner... Auch in Afrika fordern die einheimischen<br />
Völker immer lauter grössere Freiheiten und Rechte, ja sogar völlige Unabhängigkeit. Die Zeit der Kolonialherrschaft in<br />
ihrer bisherigen Form geht ihrem Ende zu. Das Selbstbewusstsein der Schwarzen hat dazu geführt, dass sie die<br />
Bezeichnung "Neger" heute als Beleidigung ablehnen und "Afrikaner" genannt werden wollen.<br />
Trotz dieses Wissens scheuten der Autor und auch spätere Lehrmittel nicht davor zurück, die Schwarzafrikaner<br />
als "Neger" zu bezeichnen.<br />
Der Afrikateil endet mit sieben Fragen an die Schüler von denen hier zwei wiedergeben werden sollen, weil<br />
sie den Grundgedanken des Werkes noch einmal aufgreifen und in seiner Essenz verdeutlichen:<br />
3. Wo möchtest du dich als Kolonist in Afrika niederlassen?<br />
7. Mit welchem Recht kann man Afrika als die zukünftige Rohstoffkammer Europas bezeichnen?<br />
Afrika wird bis zuletzt als Land des Aufbruchs und der Möglichkeiten gesehen. Von den in späteren Lehrmit-<br />
teln - keines von ihnen würde danach fragen, wo sich die Schüler in Afrika niederlassen möchten - verbreiteten<br />
Pessimismus ist noch nichts zu spüren.<br />
4.17.8 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Länder und Völker (60er Jahre)<br />
"Länder und Völker" vermittelt viele sachliche Informationen, stützt sich aber bei der Beurteilung der Bewoh-<br />
ner Afrikas einzig und allein auf deren wirtschaftliche Nützlichkeit. Afrika wird aus einer sehr autoritären<br />
Position heraus beurteilt. Die einheimischen Schwarzafrikaner sollen sich der weissen "Weisheit" zu ihrem<br />
eigenen Besten beugen. Das Aufkommen eigener schwarzafrikanischer Ideen wird als Bedrohung empfunden<br />
und deshalb zurückgewiesen. Trotz der umfangreichen Texte kommen Schwarzafrikaner in diesem Lehrmittel<br />
nicht zu Wort. Die schwarzafrikanische Frau wird als Wesen skizziert, das die Hacke schwingend in der<br />
Knechtschaft ihres Mannes lebt. Die in späteren Lehrmitteln im Zusammenhang mit dem Bevölkerungs-<br />
wachstum oft abgebildeten und als "<strong>Pro</strong>blem" angesprochenen Kinder der Schwarzafrikaner, treten in diesem<br />
Lehrmittel mit Ausnahme der Zeichnung "Äthiopisches Mädchen" (abgebildet auf der Seite 199 dieser Arbeit),<br />
zwei weiteren Zeichnungen und der Erwähnung in einem einzigen Satz, nicht in Erscheinung.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 210
4.18 Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Die moderne Kolonisation begünstigte vor allem die Eingeborenenwirtschaft und veränderte diese zum Teil völlig.<br />
Während die Schwarzen die zum eigenen Bedarf benötigten Pflanzen... heute noch recht extensiv anbauen, sind sie, wo es<br />
sich um die Gewinnung von Ausfuhrprodukten handelt, unter europäischer Anleitung zu einer sorgfältigeren<br />
Wirtschaftsweise übergegangen: Sie erzielen... Ernten, die für den Weltmarkt von Bedeutung sind.... Die bergbauliche<br />
<strong>Pro</strong>duktion Afrikas wurde seit Beginn unseres Jahrhunderts rasch ausgeweitet... Heute ist Tropisch-Afrika massgeblich an<br />
der Gewinnung weltwirtschaftlich wichtiger Bergbauprodukte beteiligt. (Bd. 6, S. 79-80)<br />
Das sechsbändige Lehrmittel "Seydlitz für Gymnasien" beschäftigt sich in den Bänden "Erde und Mensch" und<br />
"Das Weltbild der Gegenwart" auf 25 der insgesamt 815 Seiten mit Schwarzafrika.<br />
4.18.1 Band 5: Erde und Mensch<br />
Die Texte in diesem Lehrmittel sind wenig übersichtlich gegliedert. Eine erste Stelle, die sich auf die Bewoh-<br />
ner Schwarzafrikas bezieht, findet sich auf der Seite 84 unter dem Titel "Die Bedeutung der Pflanzenformatio-<br />
nen für die Kulturentwicklung der Menschheit", zu welcher der der Autor schreibt:<br />
...Die schwer gangbaren Urwaldgebiete waren seit jeher wirksame Naturschranken, Fluchträume und Rückzugsgebiete für<br />
zurückgebliebene Völker (Pygmäen im Kongourwald)...<br />
Schon die erste Erwähnung eines schwarzafrikanischen Volkes zeichnet dieses als "zurückgeblieben" aus. Auf<br />
der Seite 87 findet sich eine Karte der Rassenverteilungen zu der es im Text unter dem Titel "Die menschli-<br />
chen Rassen" heisst:<br />
...Wahrscheinlich vollzog sich die Menschwerdung um die Wende vom Tertiär zum Diluvium in einer halboffenen<br />
Landschaft mit warmem Klima, nach unseren heutigen Vorstellung im Raum zwischen Zentralasien, Südasien und Afrika...<br />
...Noch während der Würm-Vereisung erfolgte wohl in Asien, dem zentralen Kontinent der Erde, die Aufspaltung in die<br />
weisse, gelbe und schwarze Rassengruppe....<br />
...Die Einwanderer nach Afrika benutzten die arabische Landbrücke, die zu jener Zeit vermutlich dichten Graswuchs<br />
aufwies. Das offene Gras- und Savannenland im Osten Afrikas wurde zur Wanderstrasse bis in das südliche Dreieck des<br />
Erdteils...<br />
Zwar sind die Wanderungen der frühen Menschen noch immer nicht eindeutig bestimmt, doch kann mit gros-<br />
ser Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich der modernen Mensch auf dem afrikanischen<br />
Kontinent ausprägte. Auf der Seite 88 werden die Bewohner Schwarzafrikas mit den folgenden Worten<br />
beschrieben:<br />
...Die Negriden sind kraushaarig, dunkelhäutig und breitnasig. Sie sind dem Tropenklima hervorragend angepasst. In dieser<br />
Rassengruppe finden sich sehr alte und primitive Typen, wie die Pygmäen, Buschmänner und Negritos...<br />
Falls der Autor die Bezeichnung "primitiv" nicht abwertend einsetzten wollte, stellt sich die Frage, warum er<br />
dann nicht das deutsche Wort "ursprünglich" verwendet. Die Seite 89 zeigt ein Foto "Negerin mit Kopf-<br />
schmuck" und auf der Seite 90 schreibt der Autor unter dem Titel "Die Religionsgemeinschaften":<br />
...Die niederen religiösen Formen der Geister- und Zauberglaubens, des Animismus und Fetischismus und der<br />
Ahnenverehrung, sind eng an Naturerlebnisse gebunden...<br />
(Siehe dazu auch die Seiten 192 und 209 dieser Arbeit.) Auf der Seite 92 heisst es im Kapitel "Wirtschaftsfor-<br />
men und Siedlungen" unter der Überschrift "Kulturstufen und Kulturkreise":<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Es gibt verschiedene Kulturstufen und Kulturkreise. Ursprünglich waren die einzelnen Kulturen an bestimmte Erdräume<br />
und wohl auch an bestimmte Rassen geknüpft. Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung aber wurden Kulturen auch in<br />
andere Gebiete übertragen. Eroberervölker übernahmen Kultur und Sprache des besiegten Volkes oder zwangen ihre<br />
Kultur den Unterworfenen auf... Schliesslich wurden in der Neuzeit alle Völker der Erde "europäisiert" oder<br />
"amerikanisiert"... Die Maschinenkultur, die vor 200 Jahren von Europa ihren Ausgang genommen hat, überspannt freilich<br />
schon die ganze Erde, und die Lebensräume der Naturvölker sind stark eingeengt oder zu "Reservaten" geworden, in denen<br />
die Eingeborenen die Rolle lebender Schaustücke eines Museums spielen.<br />
Die sich im Laufe der Geschichte ausprägenden Kulturformen dürften immer auf ein Wechselspiel von Isola-<br />
tion und Begegnung zurückzuführen sein. Trotz der "Europäisierung" des gesamten Globus lebt auch Ende der<br />
neunziger Jahre eine Mehrheit aller Menschen in einer agraren Wirtschaftskultur, die sich vom Leben der<br />
meisten Menschen in den industrialisierten Ländern stark unterscheidet. Nur tritt diese Mehrheit kaum mehr in<br />
Erscheinung, da sie nicht über die dafür notwendigen technischen Mittel der Massenkommunikation verfügt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 211
Im gleichen Kapitel werden unter der Überschrift "Formen der Wirtschaft" die Kupfer- und Uranvorkommen<br />
von Katanga erwähnt (S. 92).<br />
4.18.1.1 Kulturstufen<br />
Seite 93 zeigt eine Tabelle der verschiedenen Kulturstufen von "Sammlern und Wildbeutern" über "Hackbau-<br />
ern / Jäger, Fischer und Fallensteller", den "Gartenbau", die "Pflugkultur" und den "Hirtennomadismus" bis zu<br />
den "Hochkulturen". Unter den "Sammlern und Wildbeutern" werden als afrikanische Beispiele die "Pygmäen"<br />
und Buschmänner aufgeführt, unter den "Hackbauern", die "Hackkultur der afrikanischen Savannen" und<br />
schliesslich unter dem "Hirtennomadismus" die "Völker... in trockenen Steppengebieten am Rande der Saha-<br />
ra". In der Einteilung "Hochkulturen" findet Afrika keine Erwähnung.<br />
In der Tabelle "Formen der Bodenbewirtschaftung" werden Beispiele aus Afrika in den Zeilen "Primitive<br />
Selbstversorgungswirtschaft" (Kongobecken, Savanne, tropischer Trockenwald, Randgebiete des Regenwal-<br />
des), "Tropische Kolonialwirtschaft" (Ost- und Westafrika, Sudan und Guineaküste) und "Waldnutzung"<br />
(tropische Wälder in Zentralafrika) aufgeführt, während sich unter der "Weidewirtschaft", dem "intensiven<br />
Feldbau der Tropen und Subtropen" und dem "Jahreszeitenfeldbau mit Pflugkultur und Grossviehhaltung"<br />
keine Beispiele finden.<br />
Die Seite 95 beschäftigt sich mit der "Industrie", den "Verschiedenen Industrietypen" und den "Siedlungen",<br />
ohne das ein konkretes Beispiel aus Afrika genannt würde. Die Leser erfahren nur, dass es "Industrien in allen<br />
bewohnten Erdteilen und in allen Klimareichen" gebe und dass "schweifenden Sammler, Jäger und Fischer und<br />
die schon höher organisierten Viehzüchternomaden... in flüchtigen oder zeitweiligen Siedlungen" wohnten.<br />
"Auch brandrodende Hackbauern verlassen ihre Wohnplätze nach wenigen Jahren wieder... wenn der Boden<br />
ihrer Felder erschöpft" sei.<br />
4.18.1.2 Siedlungsformen<br />
Auf der Seite 96 schreibt der Autor zu der "Form der Häuser":<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
In den heissen Steppen und Oasen Nordafrikas... sind es vielfach kuppel- und würfelförmige Steinhäuser mit<br />
Tonnengewölben und Flachdach, das zum Auffangen von Regenwasser und als Schlafplatz dient... In Ägypten haben die<br />
Behausungen oft kein Dach...<br />
Weitere Informationen über die Lebensweise anderer afrikanischer Völker sind der Tabelle "Die ländlichen<br />
Siedlungen in verschiedenen Kulturbereichen" auf der Seite 97 zu entnehmen. Über die "Pygmäen" und<br />
"Buschmänner" heisst es da beispielsweise ihre Wohnplätze beständen aus "flüchtig aufgebauten Siedlungen in<br />
Urwaldlichtungen und an Wasserstellen", ihre "Wohnstätten" seien "hohle Bäume, Erdhöhlen, Windschirme,<br />
Kuppelhütten, Laubhütten" und ihre Siedlungsform bestände aus "kleinen Gruppensiedlungen", die "im Halb-<br />
rund oder im Kreis angeordnet" seien. Über die Massai berichtet die Tabelle, dass sie die Wohnplätze mit den<br />
Weidegebieten wechselten, sie "Bienenkorbhütten" bauten, und sie in "Kralsiedlungen... (Wohnstätten kreis-<br />
förmig um den Viehplatz)" lebten. Die Sudanneger würden "bei Wanderfeldbau" einen Wohnplatz mehrjährig<br />
benutzen "bis die kultivierte Fläche verlegt wird" in "Bienenkorbhütten, Kegeldachhäusern (Unterbau: mit<br />
Lehm, abgedichteten Flechtwerk, Strohdach), Giebeldachhäusern, Pfahlbauten, Baumhäusern" leben. In der<br />
Tabelle "Funktionale Stadttypen" wird keine einzige afrikanische Stadt genannt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 212
4.18.1.3 Sammler- und Hackbauvölker<br />
Auf der Seite 101 schreibt der Autor unter der Überschrift "Sammler- und Hackbauvölker" im Kapitel "Die<br />
Landschaftsgürtel als natürliche Lebensräume der Erde":<br />
Regenwälder sind kulturfeindlich... Kongobecken (2 bis 3 Einw. je km2),... gehören zu den am dünnsten besiedelten<br />
Gebieten der Erde. Das weglose und nahrungsarme Dickicht ist zum Rückzugs- und Kümmergebiet primitiver<br />
Menschengruppen geworden. Auch heute noch leben weitgehend isoliert von der übrigen Welt im Halbdunkel der Wälder<br />
alte Menschenrassen, wie die Zwergvölker (Pygmäen) des Kongogebietes,... Unstet durchstreifen sie auf der Suche nach<br />
Nahrung vor allem die offenen Waldformationen... Die afrikanischen Pygmäen (griechisch = "Faustmännchen"),<br />
dunkelhäutige, kraushaarige Menschen, werden durchschnittlich nur 140 cm gross. Sie waren schon den Altägyptern<br />
bekannt. Als Sammler und Wildbeuter fristen sie in kleinen Horden, in den tiefsten Tiefen der Kongo-Urwälder ihr Dasein.<br />
Die Frauen sammeln wilde Knollen, essbare Blätter, Früchte, Schnecken, Frösche, Schlangen, Raupen und Honig; die<br />
Männer jagen in Begleitung ihrer Hunde, der einzigen Haustiere, Kleinwild. Gelegentlich schiessen sie mit Bogen und<br />
vergifteten Pfeilen auch grosse Tiere, sogar Elefanten, oder sie plündern die Gärten ihrer grösseren eingeborenen<br />
Nachbarn. Früchte, Blätter und Kleintiere werden roh gegessen, Fleisch wird über offenem Feuer geröstet. Als zeitweilige<br />
Wohnungen flechten sich die umherschweifenden Pygmäen aus Zweigen bienenkorbartige Hütten, in die sie zum Schlafen<br />
durch eine winzige Öffnung hineinkriechen. Kleidung ist in dem gleichmässig heissen Klima unwichtig; sie beschränkt<br />
sich auf einen Lendenschurz aus Fell oder einen Blätterrock. Töpfe aus rohem Ton oder hohle Kürbisse als Wasserbehälter<br />
sind ihre einzigen Geräte. Soziale Organisation und religiöses Leben sind gering ausgebildet; es gibt keinen Zeitsinn und<br />
keine Tradition. Manche Stammesbräuche, Zauberriten und ihre Sprache haben die afrikanischen Pygmäen von den<br />
Negern übernommen, mit denen sie auch wirtschaftliche Kontakte pflegen.<br />
Nach der Beschreibung der Lebensform der "Pygmäen" (siehe dazu auch die Seiten 197 und 237 dieser<br />
Arbeit), wendet sich der Autor den Hackbauern zu, über die er schreibt (S. 101):<br />
Die stärkere Besiedlung der benachbarten offeneren Landschaften hat auch Hackbauvölker in die Randgebiete des Waldes<br />
eindringen lassen. Hierzu gehören in Afrika die Bantus... Wer über die Sumpfwälder der tropischen Küsten fliegt, ahnt<br />
nicht, dass in diesem Gewirr von Wasseradern und Landfetzen Menschen leben. An der Küste sieht man die kleinen Hütten<br />
der Fischer auf den braunen Schlammbänken. Sie sind von Bananenstauden und einigen Kokospalmen umgeben. Am Ufer<br />
liegt der Einbaum. Der Fluss liefert Fische; er ist der einzige Verkehrsweg. - Dort, wo die Flüsse und Ströme durch<br />
natürliche Uferdämme begrenzt werden, hinter denen sich die völlig menschenleeren Sumpfwälder dehnen, reihen sich in<br />
langer Folge rechteckige Hütten aneinander. Scharen von Kindern toben zwischen und unter den Pfahlbauten umher.<br />
Überall ertönt das Gekläff von Hunden. Von den Urbewohnern des Waldes haben die Hackbauvölker in Afrika das<br />
Trommelsignal als Nachrichtenmittel übernommen. Bei allen Lebewesen des Urwaldes, ob Mensch oder Tier, hat sich<br />
unter dem Zwang der natürlichen Verhältnisse das Gehör besser entwickelt als das Sehvermögen.<br />
Dieser letzte Satz erinnert an die kurz vor der Jahrhundertwende im Werk "Anomalies and Curiosities of<br />
Medicine" zitierten Berichte über die Schwarzafrikaner, in dem diesen verschiedene kuriose Eigenschaften<br />
zugeschrieben werden: So wird den "negroes... a rank ammonical oder, unmitigated by cleanliness", also ein<br />
"übler, ammoniakähnlicher Geruch, der selbst beim Beachten der Sauberkeit nicht verschwindet" nachgesagt.<br />
(Gould, Pyle 1896). Im Text fährt der Autor fort (S. 101):<br />
In dem vor Überschwemmungen sicheren Flach- und Hügelland liegen, besonders im Bereich der lichten Waldformationen<br />
der Höhe, Rodungsoasen, wo die Einheimischen mit Grabstock oder Hacke in mühseliger Arbeit tropische<br />
Knollengewächse, wie Taro und Yams, sowie Bergreis, Mais oder Bohnen anpflanzen... Während die Sammler wegen des<br />
Nahrungsmangels nur in kleinen sozialen Gemeinschaften leben, trifft man bei den Hackbauern die oft ein ganzes Dorf<br />
umfassende Sippe als soziale Einheit. Auch ein gewisses Stammesgefühl kann entwickelt sein, doch reicht es kaum über<br />
wenige Dörfer hinaus. Von einem staatlichen Bewusstsein kann nirgendwo die Rede sein.<br />
Hier wird das staatliche Bewusstsein als Wert an sich betrachtet und zur Bewertung eines anderen Volkes<br />
benutzt, welches diese Form des Zusammenlebens nicht notwendigerweise braucht.<br />
Die Seite 101 zeigt auch eine Karte Westafrikas auf, die unter anderem die "Region der ehemaligen Eingebo-<br />
renenstaaten mit Ackerbau, Viehzucht und hoher handwerklicher Kultur" zeigt, die Siedlungsdichte bis zu 50<br />
Bewohner je km 2 ersichtlich wird und zu der es in der Legende unter dem Stichwort "Wirtschaft" heisst:<br />
Kamelzucht, Schafzucht, Rinder- und Pferdezucht. Anbau von Hirse, Erdnuss und Baumwolle (vorwiegend Export).<br />
Anbau von Maniok, Yams, Reis, Bananen, <strong>Pro</strong>duktion von Kakao, Palmöl und Palmkernen, Kaffee und Kautschuk für den<br />
Weltmarkt.<br />
Die Aufzählung der Agrarprodukte beschränkt sich nicht nur auf die für den Export wichtigen Tiere und Pflan-<br />
zen, sondern erwähnt auch die für die Eigenversorgung, und damit für die lokale Bevölkerung viel bedeuten-<br />
deren Arten.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 213
4.18.1.4 Die Tropen<br />
Die Seite 102 steht unter dem Titel "Unerschöpfliche Fruchtbarkeit der Tropen?", dazu schreibt der Autor:<br />
Die bis in unsere Tage hinein immer wieder behauptete unerschöpfliche Fruchtbarkeit der tropischen Regenwaldländer ist<br />
ein Märchen... Die eingeborenen Hackbauern roden deshalb alle paar Jahre neue Felder in den Wald. Schnell schliesst der<br />
Wald wieder die Rodungswunden...<br />
Unter der Überschrift "Weltwirtschaftliche Bedeutung der tropischen Regenwaldländer" heisst es weiter:<br />
Lange blieb der tropische Regenwald, vor allem... im Kongogebiet und im Innern der grossen tropischen Inseln, die<br />
Domäne der Einheimischen. Die Natur setzte der Erforschung und wirtschaftlichen Durchdringung durch die europäischen<br />
Kolonialmächte fast unüberwindliche Schranken. Das feuchtheisse Klima ist für den Weissen auf die Dauer unerträglich<br />
und macht ihn zu dauernder körperlicher Arbeit unfähig. Tückische Tropenkrankheiten (Malaria, Schlafkrankheit,<br />
Schwarzwasserfieber), parasitische Würmer, giftige Spinnen und Schlangen bedrohen überall Gesundheit und Leben. Der<br />
Bau von Strassen, Eisenbahnen und Flugplätzen ist in den immerfeuchten Tropen schwierig. Schliesslich ist das unter den<br />
grössten Mühen dem Urwald entrissene Kulturland ohne Pflege schon nach wenigen Jahren erschöpft. Durch neuzeitliche<br />
Anbaumethoden (Verwendung natürlicher und künstlicher Düngemittel), durch bessere Transport- und<br />
Konservierungsmöglichkeiten für Lebensmittel und durch den Fortschritt der medizinischen Wissenschaft im Kampf gegen<br />
Tropenkrankheiten haben sich die Aussichten für eine erfolgreiche Erschliessung wesentlich gebessert.<br />
Anfänglich kamen nur einzelne begehrte <strong>Pro</strong>dukte des tropischen Urwalds auf dem Wege des Tauschhandels auf den<br />
Weltmarkt: Farb- und Edelhölzer, Gerbrinde, Harz, Drogen, Wildkautschuk, Kerne der Ölpalme, Paranüsse, Elfenbein,<br />
Schlangenhäute. Mehr und mehr aber wurde diese Sammelwirtschaft durch den Anbau tropischer Kulturpflanzen in<br />
Plantagen und Eingeborenenkulturen überflügelt. Sie liefern in erster Linie die tropischen Rohstoffe, die aus unserem<br />
Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken sind...<br />
Als Nahrungsmittel werden "Palmkerne und Palmöl aus Nigeria" und dem Kongogebiet, Bananen von der<br />
Guineaküste; als Genussmittel "Kaffee aus... Tropisch-Afrika, Kakao aus Ghana, Nigeria" aufgezählt. Ausser-<br />
dem wird auf der Seite 102 ein Foto "Urwaldsiedlung am Ufer des Kongo" wiedergegeben. Zwei weitere Fotos<br />
"Sisalpflanzung in Ostafrika. Im Vordergrund Trockenanlagen, rechts Lagerhäuser und eine Kleinbahnanlage<br />
für den Abtransport" und "Kaffeepflanzung mit Schattenbäumen, Ostafrika" sind auf der Seite 103 abgedruckt.<br />
Auf der Seite 104 schreibt der Autor unter dem Stichwort "Eingeborenenwirtschaft":<br />
Die Eingeborenenwirtschaft diente ursprünglich ausschliesslich der Eigenversorgung. Unter der Anleitung, teilweise auch<br />
unter dem Zwang der Weissen, gingen die Einheimischen seit der Jahrhundertwende dazu über, nicht nur für den eigenen<br />
Bedarf, sondern auch für die Weltwirtschaft zu produzieren, um durch den Verkauf Bargeld in die Hand zu bekommen. In<br />
Afrika kamen so an der Guineaküste die Kultur der Ölpalme und der Kakaoanbau grossenteils in die Hände der<br />
Eingeborenen... Die Verdrängung der Europäerplantagen durch Eingeborenenwirtschaften ist eine allgemeine Erscheinung<br />
der letzten drei Jahrzehnte ("Enteuropäisierung" der Erde).<br />
Der Einfluss der Welt der Weissen in den Tropen geht zurück, doch ihr Bedarf an tropischen Erzeugnissen bleibt. Die<br />
Völker in den äquatorialen Regenwaldländern leben weltwirtschaftlich gesehen - vom natürlichen Monopol der Tropen, d.<br />
h. von den nur bei gleichbleibend hoher Wärme und grosser Feuchtigkeit gedeihenden mehrjährigen Kulturpflanzen. Nur<br />
der ursprüngliche Regenwald ist auch heute noch weltwirtschaftlich von geringer Bedeutung. Wegen seiner Artenfülle<br />
kommt er bislang als Zellstofflieferant nicht in Betracht. Sollte jedoch ein technischer Weg gefunden werden, ihn leicht<br />
und billig zu nutzen, werden auch hier an die Stelle des urtümlichen Trägerverkehrs und der Einbäume auf den<br />
Wasseradern die modernen Verkehrsmittel treten. Um die schnellere wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der<br />
Regenwaldländer bemühen sich im besonderen die westlichen Industrieländer im Rahmen der Hilfe für die<br />
Entwicklungsländer der Erde. Der Erfolg der Arbeit hängt dabei weitgehend von der politischen Entwicklung dieser<br />
Länder und von der Verkehrserschliessung ab.<br />
Einige Jahre später fingen Kreise aus Europa an, die zunehmende Abholzung des Regenwaldes anzuprangern.<br />
Die noch Anfang der siebziger Jahre erhobene Forderung nach der Nutzung des Regenwaldes als "Zellstofflie-<br />
ferant" verkehrte sich in ein "Kopfschütteln" über das Verhalten der "Eingeborenen", die ihre eigene Lebens-<br />
grundlage zerstörten.<br />
Im Kapitel "Die Landschaftsgürtel der periodisch feuchten Tropen" (S. 105-109) schreibt der Autor in der<br />
Einleitung:<br />
...Man nimmt an, dass ein grosser Teil des heutigen Graslandes früher bewaldet war und dass erst der Mensch durch<br />
Rodung und Abbrennen viele der Grasfluren geschaffen hat...<br />
Nach der Betrachtung der klimatischen Voraussetzungen des Grossraumes, schreibt der Autor unter der Über-<br />
schrift "Ackerbauern und Viehzüchter" auf der Seite 109:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Geringe Niederschläge und niedrige Temperaturen verbannen die anspruchsvolleren Gewächse der Tropen aus den<br />
Trockensavannen. Die Hirse wird zum wichtigsten Getreide, die Erdnuss liefert Fett für den täglichen Bedarf, und die<br />
Baumwollstauden erzeugen das Rohmaterial für weite Gewänder. Bohnen, Kürbisse und Melonen gedeihen vorzüglich.<br />
Während die Kulturpflanzen an Zahl und Qualität abnehmen, gewinnt die Viehzucht schnell an Bedeutung. An Futter<br />
mangelt es nicht. Das harte Hochgras der Feuchtsavannen ist dem niedrigen Steppengras gewichen, das in der Trockenzeit<br />
am Halm gleichsam zu Heu verdorrt und bis zum Beginn der Regen den Tieren ausreichende Nahrung gewährt. Da und<br />
dort helfen auch die Viehzüchter nach, indem sie Grasbrände anlegen: aus dem Wurzelstock spriesst dann nach wenigen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 214
Tagen neues Grün auf, soweit die spärliche Bodenfeuchtigkeit ausreicht. Auf den Kurzgrassteppen weiden Rinder, Pferde<br />
und Schafe. Kamel und Esel sind wichtige Lasttiere. Die bevorzugte Stellung der Viehzucht hängt weitgehend damit<br />
zusammen, dass es in diesem Klima nur wenig Viehkrankheiten gibt. Auch der Mensch fühlt sich hier wohler als in den<br />
feuchten Savannenländern mit ihrer langen Regenzeit. Gelbfieber und Schlafkrankheit und nicht zuletzt die gefürchtete<br />
Malaria dringen nicht in die Steppenländer ein. Die Dysenterie sowie Haut- und Wurmkrankheiten treten allerdings auch<br />
hier auf und werden streckenweise zu einer Geissel der Bevölkerung (Afrika)...<br />
"An Futter mangelt es nicht" schreibt der Autor. Nur wenige Jahre später verbreiteten fast alle Lehrmittel die<br />
Bilder ausgehungerter Menschen und an Futtermangel verendeten Viehs aus dem beschriebenen Gebiet. Im<br />
Text heisst es weiter (S. 109):<br />
In grossen Teilen Nordafrikas... sind auch heute noch die Grasländer der Lebensraum der Nomaden. Im Viehzuchtgürtel<br />
des Sudans sind die Fulbe und Massai ausgesprochene Rinderzüchter. Die Viehzuchtnomaden führen während grosser<br />
Teile des Jahres ein unstetes Leben. Sie wandern mit ihren Tieren von Weideplatz zu Weideplatz; dessen Wert steht und<br />
fällt mit dem für die Tränke verfügbaren Wasser. Das leicht bewegliche Zelt ist die Wohnstätte der Nomaden. Wo<br />
Viehzucht und Ackerbau gekoppelt sind, wie in Nordwestafrika, haben die Menschen eine feste Behausung: ein<br />
rechteckiges Lehmziegelhaus mit flachem Dach.<br />
Die Bewohner der Grasländer sind in Afrika und Vorderasien gewöhnlich schlank und sehnig gebaut, haben eine<br />
aussergewöhnliche Ausdauer und zeigen grossen persönlichen Mut. Sie schliessen sich gern zu grösseren Verbänden<br />
zusammen, denen vorübergehend staatenbildende Kraft innewohnen kann. Erfüllt von kriegerischem Geist, haben sie<br />
immer wieder die benachbarten Ackerbaugebiete angegriffen. In der religiösen Vorstellungswelt der Steppenvölker lebt<br />
nur ein Gott...<br />
Nur im dicht besiedelten nordafrikanisch-orientalischen Raum hat sich die kulturell recht hochstehende Bevölkerung im<br />
Zeitalter der Europäisierung der Erde zu halten vermocht... im südlichen Afrika... dagegen sind an die Stelle einstiger Jäger<br />
und Sammler europäische Farmer getreten, die riesige Viehzuchtbetriebe errichteten und dadurch mithelfen, die rohstoffund<br />
nahrungshungrige Welt ausreichend mit Wolle, Fleisch und tierischen Fetten zu versorgen.<br />
Auch in diesem Lehrmittel wird Afrika noch als Gebiet bezeichnet, dass die "rohstoff- und nahrungshungrige<br />
Welt" mitzuversorgen hilft.<br />
4.18.2 Band 6: Das Weltbild der Gegenwart<br />
Im Kapitel "Das negride Afrika" auf den Seiten 79-82 vermittelt der Autor Wissen über die Rohstoffländer der<br />
Tropen, den Welthandel und die Entwicklungsmöglichkeiten der schwarzafrikanischen Staaten. In der Einlei-<br />
tung schreibt er auf der Seite 79:<br />
...Kulturgeographisch unterscheidet man drei Teile: Der von hellhäutigen Menschen bewohnte Norden gehört noch zum<br />
Orient. Der äusserste Süden, die Südafrikanische Republik, wird von drei Millionen Weissen und 11 Millionen Schwarzen<br />
bewohnt und ist ein europäisch organisierter und verwalteter Staat. Das negride Afrika mit seinen völlig anderen<br />
Lebensformen umfasst die tropischen Regenwälder und Savannen zwischen der Sahara und dem Kalaharibecken,<br />
zwischen Sansibar und der Guineaküste. In dem Gebiet von 22 Mill. km 2 wohnen 190 Millionen Menschen.<br />
Trotz seiner Nähe zu Europa ist das tropische Afrika lange ein weisser Fleck auf unseren Landkarten geblieben. Für den<br />
Handel lieferte es anfänglich jene wenigen Güter, nach denen einzelne Küstenabschnitte benannt wurden. In das Innere<br />
drang man erst im Laufe des vorigen Jahrhunderts vor und teilte schliesslich diesen letzten noch "herrenlosen"<br />
Überseeraum in Kolonien auf. Nach einer verhältnismässig kurzen Zeit der wirtschaftlichen und organisatorischen<br />
Einflussnahme der europäischen Kolonialmächte haben fast alle Länder des negriden Afrikas nach dem zweiten Weltkrieg<br />
ihre staatliche Selbständigkeit in den Grenzen erreicht, die von den Europäern festgelegt waren.<br />
Während hier also von der "Nähe" Afrikas zu Europa die Rede ist, - das Lehrmittel "Seydlitz Erdkunde" von<br />
1993-1995 spricht im Zusammenhang mit den Erdölexporten Nigerias ebenfalls von der "grösseren Nähe zu<br />
den Abnehmern" (siehe dazu die Seite 392 dieser Arbeit) - beschäftigte sich Widrig in seinem Geographiebuch<br />
von 1967 ausführlich mit der ungünstigen Lage Afrikas, das zu weit von Europa entfernt liege, um eine grösse-<br />
re Rolle im Welthandel zu spielen. (Siehe dazu auch die Seite 135 dieser Arbeit.) Unter der Überschrift "Tro-<br />
pische Rohstoffländer" fährt der Autor auf den Seiten 79-80 fort:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Wenn wir heute von den tropischen Rohstoffen Afrikas sprechen, so denken wir in erster Linie an Palmöl, Erdnüsse,<br />
Kakao, Kaffee, Baumwolle, Sisalhanf, tropische Hölzer. Erst der wachsende Bedarf an solchen Gütern leitete gegen Ende<br />
des vorigen Jahrhunderts die weltwirtschaftliche Erschliessung Afrikas ein.<br />
Die moderne Kolonisation begünstigte vor allem die Eingeborenenwirtschaft und veränderte diese zum Teil völlig.<br />
Während die Schwarzen die zum eigenen Bedarf benötigten Pflanzen (Hirse, Yams, Bataten, Mais) heute noch recht<br />
extensiv anbauen, sind sie, wo es sich um die Gewinnung von Ausfuhrprodukten handelt, unter europäischer Anleitung zu<br />
einer sorgfältigeren Wirtschaftsweise übergegangen: Sie erzielen auf ihren kleinbäuerlichen Anwesen Ernten, die für den<br />
Weltmarkt von Bedeutung sind. Das gilt zum Beispiel für die Oberguineaküste und ihr Hinterland (Kakao, Palmöl,<br />
Erdnüsse). In den 90er Jahren sind weisse Unternehmer nach dem Bau der Eisenbahnen auch in das Hochland von<br />
Ostafrika vorgedrungen und haben Sisal-, Kaffee- und Teepflanzungen angelegt.<br />
Die bergbauliche <strong>Pro</strong>duktion Afrikas wurde seit Beginn unseres Jahrhunderts rasch ausgeweitet. Nachdem die Gold- und<br />
Diamantenvorkommen Südafrikas bekanntgeworden waren, begann man, auch im tropischen Teil des Kontinents nach<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 215
Minerallagern zu suchen. Heute ist Tropisch-Afrika massgeblich an der Gewinnung weltwirtschaftlich wichtiger<br />
Bergbauprodukte beteiligt. Kohle und Erdöl stehen dagegen nur in sehr geringem Umfange zur Verfügung. Dafür ist<br />
Afrika der an Wasserkräften reichste Kontinent.<br />
Auch hier wird die Wirtschaftsweise der Schwarzafrikaner aufgrund der Nützlichkeit für Europa bewertet. So<br />
seien die schwarzafrikanischen Bauern "unter europäischer Anleitung" zu einer "sorgfältigeren<br />
Wirtschaftsweise übergegangen". Der nächste Abschnitt auf der Seite 80 steht unter der Überschrift "Die Stel-<br />
lung Tropisch-Afrikas im Welthandel":<br />
Ohne Zweifel sind in den letzten Jahrzehnten auf vielen Gebieten und an zahlreichen Stellen beachtliche Fortschritte erzielt<br />
worden. Man hat Städte und Strassen, Kraftwerke, Industriebetriebe, Häfen und Bewässerungsanlagen gebaut, hat das<br />
Erziehungswesen verbessert, den Anbau weltwirtschaftlich wichtiger <strong>Pro</strong>dukte, wie Reis und Kaffee, ausgeweitet und mehr<br />
Bodenschätze gefördert. Im wirtschaftlichen Weltvergleich haben jedoch die 42 Länder Tropisch-Afrikas nur geringe<br />
Bedeutung. Zwar kommen von dort 92% der Palmkerne, 87% der Erdnüsse und je 63% des Palmöls und des Sisals auf den<br />
Weltmarkt; aber diese <strong>Pro</strong>dukte machen wertmässig zusammen nur 12% der Exporte Tropisch-Afrikas aus. Bedeutsamer<br />
sind Kaffee, Kakao und Baumwolle, auf die rund 40% der Ausfuhr von Tropisch-Afrika entfallen. Am Export von<br />
Kobalterz ist es mit 65% und an dem von Chrom- und Kupfererzen jeweils mit rund 20% beteiligt.<br />
Fasst man die Ausfuhr Tropisch-Afrikas zusammen, so ergibt sich ein Anteil von nur 3,1% an der Weltausfuhr... Ein Drittel<br />
der afrikanischen Ausfuhr entfiel auf Bergbauprodukte, ein zweites Drittel auf Erzeugnisse landwirtschaftlicher<br />
Unternehmen, die im Besitz von Nichtafrikanern stehen; nur das letzte Drittel kam aus rein afrikanischen Unternehmen.<br />
Das heisst also, dass 190 Mill. Menschen (6% der Weltbevölkerung) in einem Raum von der 100fachen Grösse der BRD<br />
nur 1% der Welthandelsgüter in eigener Verantwortung auf den Weltmarkt bringen. Dazu kommt, dass die Staatshaushalte<br />
aller Länder Tropisch-Afrikas im Jahre 1960 insgesamt nur 10,9 Mrd. DM erreichten, das entspricht einem Viertel des<br />
Haushalts der BRD vom gleichen Jahr. Finanziell betrachtet, sind daher die Entwicklungsmöglichkeiten dieses riesigen<br />
afrikanischen Raumes unter den gegenwärtigen Verhältnissen sehr beschränkt.<br />
Die fast euphorischen Texte der sechziger Jahre werden durch diese Zahlen, an denen sich bis Ende der neun-<br />
ziger Jahre wenig geändert hat, wesentlich gedämpft. Allerdings erscheint ein wichtiger Teil der schwarzafri-<br />
kanischen <strong>Pro</strong>duktion in keiner Statistik, da sie als Subsistenzproduktion gar nicht erfasst werden kann.<br />
Im Abschnitt "Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungsprobleme" schreibt der Autor auf der Seite 80<br />
einleitend:<br />
Häufig richten - nicht nur im tropischen Afrika - die Politiker und Wissenschaftler der Entwicklungsländer ihre Wünsche<br />
am wirtschaftlichen Leistungsstand und am Lebensstandard der Menschen in den Industrieländern aus. Das führt zu<br />
falschen Hoffnungen, zumal bei den Planungen oft die naturgeographischen Voraussetzungen nicht ausreichend<br />
berücksichtigt werden...<br />
Die natürlichen Entwicklungsbarrieren führt der Autor unter der Überschrift "Entscheidende natürliche Hemm-<br />
nisse" auf (S. 80):<br />
Die bisherige Entwicklung Afrikas wurde durch zahlreiche natürliche Hemmnisse erschwert, die grösstenteils auch in der<br />
Zukunft wirksam bleiben werden. Dazu gehören die relative Unzugänglichkeit der ungegliederten Landmasse, die wenigen<br />
natürlichen Häfen und die mangelhafte Schiffbarkeit der Flüsse. Ausserdem fehlen Tropisch-Afrika grosse küstennahe,<br />
ertragreiche und dichtbevölkerte Aufschüttungsebenen, wie sie Süd- und Ostasien besitzen. Die Schwemmländer des<br />
Niger-, Tschad-, Obernil-, Kongo- und des Kalahari-Beckens sind zwar gross an Fläche, aber sie liegen im<br />
Kontinentinneren und - mit Ausnahme des Kongobeckens - klimatisch nicht mehr im Bereich eines ertragreichen<br />
Regenfeldbaus. Mit Hilfe künstlicher Bewässerung oder auch natürlicher Überschwemmungs-Bewässerung könnten<br />
jedoch in den Beckenlandschaften des Sudans grosse Flächen sandiger Alluvialböden ackerbaulich genutzt werden. Das<br />
Gezira-Unternehmen und die neuen Kolonistendörfer im Binnendelta des Nigers sind Beispiele dafür. Im Gezira-Gebiet<br />
wurden z. B. 30'000 Familien angesiedelt, im Niger-Gebiet fast 4'000 in über 100 Dörfern. So grossartig sich diese<br />
Leistungen auch ausnehmen, es sind in Wirklichkeit nur punktartige Ansätze in riesigen Räumen, zu deren Erschliessung<br />
ungeheure Mittel benötigt werden.<br />
In Tropisch-Afrika sind 40% des Landes zu trocken für den Ackerbau oder stark dürregefährdet und 10% während des<br />
grösseren Teiles des Jahres versumpft. Der landwirtschaftlich nutzbare Raum, in dem man mit einer bald kürzeren, bald<br />
längeren Trockenzeit rechnen muss, macht etwa 35% der Fläche aus. Hier wird zumeist nur eine Ernte eingebracht. Nur der<br />
ursprünglich mit tropischen Regenwäldern bestandene Teil hat das ganze Jahr über klimaoptimale Voraussetzungen für das<br />
Pflanzenwachstum. Dieses Gebiet misst 1,4 Mill. km 2 .<br />
Unter der Zwischenüberschrift "Auswirkungen des Landschaftshaushaltes auf die Bodenbewirtschaftung"<br />
macht der Autor folgende Aussagen (S.80):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Besonders ungünstig sind die Bodenverhältnisse... Die innerhalb der Regenfeldbaugrenze weitverbreiteten Rot-, Gelb- und<br />
Braunlehme sowie die Niederungsböden brauchen zur Erhaltung ihrer Fruchtbarkeit Schatten für die Kulturfläche. Wird<br />
die natürliche Vegetation abgeschlagen und ein grossflächiges Ackerbauareal der vollen Sonnenbestrahlung ausgesetzt, so<br />
stört man den naturgegebenen Landschaftshaushalt... Die Kenntnis dieses natürlichen Landschaftshaushaltes ist eine<br />
unabdingbare Voraussetzung für eine sinnvolle agrarische Entwicklungsplanung... Diese Erkenntnisse sind von grosser<br />
praktischer Bedeutung, wie der missglückte Versuch der britischen Colonial Development Corporation in Tanganjika zeigt.<br />
Innerhalb von 5 bis 6 Jahren wollte man durch Grosseinsatz von Maschinen auf 3,2 Mill. acres Land zu einer jährlichen<br />
<strong>Pro</strong>duktion von 600'000 t Erdnüssen kommen. Als aber die Trockenwälder abgeschlagen und riesige Landflächen<br />
umgebrochen waren, verdichtete sich der ungeschützte Boden unter der starken Sonneneinstrahlung. Seine<br />
Wasserkapazität nahm ab. Durch Ausfällung beweglicher Mineralstoffe bildeten sich harte Bodenkrusten. Dazu kam die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 216
Bodenerosion. Das 1947 begonnene Unternehmen war innerhalb von 4 Jahren gescheitert. Es kostete Grossbritannien<br />
umgerechnet 435 Mill. DM.<br />
(Zum Erdnussprojekt in Tansania siehe auch die Seite 305 dieser Arbeit). Im Text fährt der Autor fort, die<br />
Wirtschaftsweise der "Einheimischen"(!) - es ist nicht mehr von "Eingeborenen" die Rede - zu beschreiben<br />
(S.81-82):<br />
Wie helfen sich die Einheimischen? Das jeweils von den Dörfern aus bewirtschaftete Land ist klein. Alle zwei bis drei<br />
Jahre gibt man es auf und rodet in gemeinsamer Arbeit neue Felder und lässt in unregelmässigen Abständen einige<br />
grössere Bäume stehen. Sind Äste und Blattwerk getrocknet, so schickt man Feuer hindurch und bringt danach Zuckerrohr,<br />
Maniok, Mais oder Hirse in die mit der Hacke angelegten Pflanzlöcher. Zwischen den Pflanzstellen liegen Asche und<br />
halbverbrannte Äste. Das ganze Feld macht auf uns einen recht unordentlichen Eindruck. Nach zwei- bis dreijähriger<br />
Nutzung nimmt die Bodenfruchtbarkeit rasch ab. Man überlässt dann das Land wieder für längere Zeit der Natur.<br />
Der üppig wuchernde Regenwald täuscht also einen Nährstoffreichtum des Bodens vor, der in Wirklichkeit nicht besteht.<br />
Der Wald lebt gleichsam durch sich selbst. Schlägt man ihn ab, so fehlt der Humusnachschub. Künstliche Düngung kann<br />
nur beschränkte Hilfe bringen. Führt man dem Boden z. B. die notwendigen Phosphate zu, so werden sie durch Umsetzung<br />
mit Eisen- und Aluminiumoxidhydraten zu unlöslichen Verbindungen und damit für die Ernährung der Pflanzen wertlos.<br />
Stickstoff-, Kalium- oder Magnesiummangel kann dagegen durch mineralischen Dünger behoben werden.<br />
Auch die Versuche, die Hacke, mit der der Boden nur angeritzt wird, durch den Motorpflug zu ersetzen, sind<br />
problematisch: tiefergehende Pflüge verlagern die in der dünnen obersten Bodenschicht angereicherten Humusstoffe in<br />
tiefere Horizonte, wo sie nicht mehr pflanzenwirksam werden können.<br />
Das unordentlich aussehende Feld mit den halbverkohlten Ästen und der Asche ist also nicht Ausdruck schlampiger<br />
Arbeit, sondern eine einfache Form des Bodenschutzes gegen die starke Sonneneinstrahlung, die zur Verhärtung des<br />
Bodens und zur Vernichtung der Bodenbakterien führt. Äste und Asche bewahren zugleich vor der zerstörenden Wirkung<br />
der tropischen Starkregen, die sind die feinen Tonbestandteile fortschwemmen würden. All diese Überlegungen zeigen,<br />
dass in den Regenwaldbereichen nur mit grösster Vorsicht an die Verbesserung des heutigen Betriebssystems der<br />
Afrikaner herangegangen werden kann.<br />
Die Sichtweise auf die <strong>Pro</strong>duktionsformen der Schwarzafrikaner hat sich durch das Scheitern der ersten von<br />
Experten durchgeführten Grossversuche wesentlich gewandelt. "Das unordentlich aussehende Feld... ist also<br />
nicht Ausdruck schlampiger Arbeit", sondern stellt eine angepasste, ökologische Folgen berücksichtigende<br />
Anbauform dar, die über Jahrhunderte entwickelt wurde. Im Text heisst es weiter auf der Seite 81:<br />
Ein weiteres Beispiel: Die riesigen Grasländer Tropisch-Afrikas scheinen auf den ersten Blick beste Voraussetzungen für<br />
die Viehzucht bzw. für die Fleischproduktion zu bieten. Hemmend sind jedoch die weitverbreiteten Rinderkrankheiten und<br />
Tierseuchen. Selbst wenn es gelingen sollte, insbesondere die von der Tsetse-Fliege übertragene Nagana-Seuche<br />
auszurotten, von der etwa die Hälfte der Fläche Tropisch-Afrikas ständig bedroht ist, wäre damit der Weg für eine moderne<br />
Viehwirtschaft noch nicht frei. Denn in den wechselfeuchten Savannengebieten gibt es nur wenige Monate lang eine gute<br />
Naturweide.<br />
Schliesslich wirken sich auch die riesenhaften ungegliederten Weiten Afrikas nachteilig für eine schnelle Entwicklung aus.<br />
An den Aufbau eines geschlossenen kontinentweiten Landverkehrsnetzes ist vorerst nicht zu denken, zumal Eisenbahnen,<br />
Flüsse und Landstrassen immer nur schmale Landstreifen öffnen. So ist die Raumweite Afrikas - im Vergleich mit den<br />
naturgeographisch besser erschlossenen südostasiatischen oder mittelamerikanischen Tropen - für die wirtschaftliche<br />
Erschliessung eine schwere Belastung; sie macht sich in höheren Kosten und damit in geringerer Konkurrenzfähigkeit<br />
bemerkbar.<br />
Damit spricht der Autor einen wesentlichen Punkt an, der auch bei den in späteren Lehrmitteln aufflammenden<br />
Diskussionen über die "Überbevölkerung Afrikas" berücksichtigt werden sollte. Unter einer gewissen Bevölke-<br />
rungsdichte ist eine verkehrstechnische Erschliessung schlichtweg nicht sinnvoll, da zu teuer.<br />
4.18.2.1 "Anthropogene Faktoren"<br />
In einem weiteren Abschnitt unter der Überschrift "Anthropogene Faktoren" kommt der Autor auf der Seite 82,<br />
die auch ein Foto "Die Bekämpfung des Analphabetentums ist eine grosse Aufgabe in den Entwicklungslän-<br />
dern. Zumeist gibt es nur in den Städten höhere Schulen. Schuljugend in Thies (östlich von Dakar), Senegal"<br />
zeigt, auf den Einfluss des Menschen zu sprechen:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Ist schon das Zusammenspiel der naturgeographischen Faktoren in Afrika südlich der Sahara vielfältig und verwickelt, so<br />
werden die Entwicklungsprobleme noch komplizierter, wenn der Mensch in die Untersuchungen und Planungen<br />
einbezogen wird. Denn nun begegnen uns die Vielfalt der afrikanischen Völker, die Unzahl der Stämme, die dörflichen<br />
Gemeinschaften, die schnell wachsenden städtischen Siedlungen, verschiedenartige Wirtschaftsräume und unterschiedliche<br />
Kulturhöhe. Viele Vorhaben auf dem Lande werden erschwert durch das Stammesmosaik, die Sozialstruktur, durch das auf<br />
kleine überschaubare Einheiten ausgerichtete Gemeinschaftsgefühl und durch die alten Herrschaftsformen.<br />
Im Gegensatz dazu beginnt in den Städten die Auflösung der Grossfamilien und der Traditionen. In den grossen<br />
Siedlungszentren vollzieht sich auch schon die Auseinandersetzung zwischen dem einheimischen wohlhabenden<br />
Mittelstand der Kolonialzeit - den Anwälten, Händlern und höheren Beamten - und den revolutionär vordringenden<br />
Gruppen der Avantgardisten aus den Gewerkschaften und den Jugendorganisationen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 217
Im letzten Abschnitt schreibt der Autor unter der Überschrift "Voraussetzungen für die Industrialisierung"<br />
(S. 82):<br />
Natürlicherweise müsste der industrielle Aufbau mit der Aufbereitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und bergbaulicher<br />
Schätze beginnen, weil Kapital, unternehmerische Persönlichkeiten und technische Fachleute fehlen. Die nächste<br />
Aufbauphase hängt dann von den vorhandenen Rohstoff- und Energiereserven, von der Arbeitsaktivität der Bevölkerung<br />
und von den Marktbedingungen ab. Dabei kommt bei dem Mangel an Kohle und Erdöl den Wasserkräften besondere<br />
Bedeutung zu. Die Flüsse Afrikas könnten 40% der Wasserkräfte der Erde liefern! Doch davon wird noch nicht 1/2%<br />
genutzt.<br />
Für jedes Entwicklungsland ist der Start aus eigener Kraft wichtig. Er ist aber keineswegs allein vom verfügbaren Kapital<br />
abhängig. Kaum weniger bedeutsam ist, dass der afrikanische Mensch zum rationalen Handeln geführt wird, dass er<br />
Verständnis für die modernen technisch-wirtschaftlichen Vorgänge und für die Geldwirtschaft aufbringt. Auf diesem Wege<br />
liegen viele Schwierigkeiten. Dazu gehören: die der afrikanischen Mentalität mehr liegende literarisch-sprachliche als die<br />
naturwissenschaftlich-ökonomische Bildung, das überkommene Sozialgefüge und die primitiven Sparmethoden.<br />
Kabou sieht diese Mentalität nicht als Folge eines im Wesen des Schwarzafrikaners liegenden Charakterzuges<br />
an, sondern als psychologische Verweigerung auf einem Gebiet, welches vom ehemaligen Unterdrücker domi-<br />
niert wird, den Wettbewerb aufzunehmen. (Kabou 1995, S. 45-53) Ki-Zerbo ist der Meinung, dass "Afrika...<br />
die Globalisierung als einen passiven Akt" erlebe, "als etwas, das über die Menschen niedergeht, ohne dass sie<br />
dabei mitzureden hätten". Der hochindustrialisierte Norden nähme für sich alle Freiheiten in Anspruch, mache<br />
umgekehrt aber die Grenzen nach Süden hin dicht. Auch viele Mahnungen aus den Norden seien durchaus<br />
entbehrlich, etwa die Mahnung, man möge die Geburtenrate drosseln um der Bevölkerungsexplosion keinen<br />
Vorschub zu leisten: "Wenn Kinder in Ländern mit hohen Sterblichkeitsraten der einzige Garant für die<br />
Versorgung im Alter sind, dann werden die Menschen eben fünf Kinder machen, damit ihnen letztlich wenig-<br />
stens zwei oder drei bleiben." (Der Standard 10.06.98, S. 3)<br />
In einer Aufgabenstellung wird der Schüler aufgefordert, die "Hauptprobleme und politischen Strömungen in<br />
Afrika nach Büchern" von Nkrumah u.a. zu schildern. Kwame Nkrumah (1909-1972) war der erste Premiermi-<br />
nister (1957-1960) und spätere Präsident (1960-1966) Ghanas. Während seiner langjährigen Auslandaufenthal-<br />
te rief der ehemalige Lehrer 1945 in London den 5. Panafrikanischen Kongress ins Leben. Nach seiner Rück-<br />
kehr nach Ghana 1947 setzte er sich für die Unabhängigkeit seines und anderer afrikanischer Länder ein, die<br />
für die ehemalige Goldküste 1957 Wirklichkeit wurde. Der erfolgreiche Aussenpolitiker Nkrumah spielte eine<br />
wesentliche Rolle bei der Gründung der OAU (Vereinigung afrikanischer Staaten) von 1963. Nachdem er sich<br />
1964 zum Präsident auf Lebzeiten wählen liess, wurde Nkrumah 1966 durch einen Militärputsch gestürzt und<br />
verbrachte seine letzten Jahre in Guinea. (Encarta 1997; Infopedia 1996)<br />
Nkrumah träumte von einem Afrika, dass sich aus den Fesseln des Kolonialismus lösen und zu einer Einheit<br />
finden könnte, die es zu einem ernstzunehmenden Partner in der internationalen Gemeinschaft machen würde.<br />
1961 schrieb er unter dem Titel "I Speak of Freedom": "For centuries, Europeans dominated the African conti-<br />
nent. The white man arrogated to himself the right to rule and to be obeyed by the non-white; his mission, he<br />
claimed, was to "civilise" Africa. Under this cloak, the Europeans robbed the continent of vast riches and<br />
inflicted unimaginable suffering on the African people. All this makes a sad story, but now we must be prepa-<br />
red to bury the past with its unpleasant memories and look to the future. All we ask of the former colonial<br />
powers is their goodwill and co-operation to remedy past mistakes and injustices and to grant independence to<br />
the colonies in Africa…. It is clear that we must find an African solution to our problems, and that this can<br />
only be found in African unity. Divided we are weak; united, Africa could become one of the greatest forces<br />
for good in the world." (Nkrumah 1961)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Die Seite 83 zeigt abschliessend vier Fotos "Der Markt im Zentrum der Hausa-Stadt von Kano ist seit Jahrhun-<br />
derten Handelsmittelpunkt für grosse Teile des Sudans.", "In Ojo, nördlich Ibadan (Nigeria), entwickelt sich<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 218
auf der Grundklage traditioneller Kunstfertigkeit heute ein Handwerk. Wir blicken in die Strasse und auf die<br />
Häuser der Kalebassenschnitzer.", "Neue Eingeborenensiedlung in Uganda" und "Im Zentrum von Lagos. Die<br />
baulichen Verhältnisse sind charakteristisch für die in allen grösseren Städten und Entwicklungsländern<br />
bemerkbaren neuen Einflüsse. Ebenerdige Holzhütten und Häuser aus der älteren Kolonialzeit stehen neben<br />
modernen Geschäftsbauten".<br />
4.18.3 Zusammenfassung<br />
Während sich der Band "Erde und Mensch" der Beschreibung der Wirtschafts- und Siedlungsformen, sowie<br />
der Bedeutung der Exportprodukte widmet und dabei das bekannte Bild vom "rückständigen" Schwarzafrika-<br />
ner, der Dank der Anleitung des Weissen Bedeutung auf den Weltmarkt erlangt, kolportiert, befasst sich der<br />
Band "Das Weltbild der Gegenwart" mit der damals aktuellen Situation. Damit setzt es der auch im Band<br />
"Erde und Mensch" geäusserten Hoffnung, Afrika würde zu einem Versorgungsgebiet für die ganze Welt,<br />
einen empfindlichen Dämpfer durch die Schilderung der <strong>Pro</strong>bleme bei der Erschliessung Afrikas als Wirt-<br />
schaftsraum mit Bedeutung für den Weltmarkt.<br />
Aus der Erkenntnis heraus, dass die "primitiven Wirtschaftsformen" des Schwarzafrikaners oft besser an die<br />
Umwelt angepasst ist, als die Modelle der Experten aus den Industrienationen, mutiert dieser vom "Eingebor-<br />
enen" zum "Einheimischen".<br />
Auf die Kultur und den Alltag des Schwarzafrikaners geht der Autor nur wenig ein. Auch enthält das Lehrmit-<br />
tel keine Aussage von schwarzafrikanischen Menschen zu den besprochenen Themen. Immerhin fordert der<br />
Autor die Schüler auf, Texte des ghanaischen Politikers und schwarzafrikanischen Vordenkers Nkrumah zu<br />
lesen.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 219
4.19 Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Ähnlich wie die Deutschen im Sudan leisten fast alle europäischen Völker Entwicklungshilfe. Aber dieser Hilfe stellen sich<br />
oft ungeahnte Schwierigkeiten entgegen... Die grösste Schwierigkeit aber liegt darin, dass die Zauberer und<br />
Medizinmänner nach wie vor einen starken Einfluss auf die Massen ausüben. Seit Jahrtausenden beherrscht der<br />
Geisterglaube und Dämonenzauber das Leben der Afrikaner. Können diese eingewurzelten Anschauungen und<br />
Lebensgewohnheiten in wenigen Jahren aus den Seelen der Afrikaner ausgerissen und völlig beseitigt werden? Selbst bei<br />
vielen zum Christentum oder Islam bekehrten Afrikanern brechen immer wieder manche ihrer alten abergläubischen<br />
Zauberformeln hervor. (Bd. 3, S. 59)<br />
Das in den Jahren 1971-1974 erschienene, dreibändige und 550 Seiten starke Lehrmittel "Fahr mit in die<br />
Welt", aus dem Moritz Diesterweg Verlag, beschäftigt sich im dritten, 1972 in der vierten Auflage erschiene-<br />
nen Band "Aussereuropäische Erdteile, Deutschland und die Welt" auf den Seiten 43-82 mit dem Kontinent<br />
Afrika. Es folgt dabei dem Schema der Grossraumbeschreibung, wie sie schon im Lehrmittel "Leitfaden für<br />
den Geographieunterricht" von 1934 angewendet wurde.<br />
4.19.1 Allgemeiner Teil<br />
Im ersten allgemeinen Teil unter dem Titel "Afrika im Umbruch" wird als erstes der auf der Seite 124 dieser<br />
Arbeit besprochen Text Albert Schweitzers (1875-1965) "Was bei den Weissen anders ist als bei den Schwarz-<br />
en" abgedruckt. Eingeleitet wird der Text mit den Worten: "Aus Lambarene im zentralafrikanischen Urwald<br />
schrieb Albert Schweitzer vor 20 Jahren". Der Text wurde also spätestens um ca. 1950 geschrieben.<br />
Auf der gleichen Seite findet sich ein zweiter Text unter der Überschrift "In Kenia verbreitete die Mau-Mau-<br />
Bewegung in ihrem Freiheitskampf gegen England vor 15 Jahren dieses Flugblatt" indem Jomo Kenyatta<br />
(1891-1978), der Kenia ab 1963 bis zu seinem Tod regierte, zitiert wird:<br />
"Die Europäer bringen das Christentum nur nach Afrika, um uns schön gefügig zu machen, um uns zu lehren, in Geduld<br />
auf den Himmel zu hoffen. Sie haben uns beten gelehrt, und während wir beteten und die Augen schlossen, haben sie uns<br />
das Land gestohlen. Vor 50 Jahren hatten wir unser Land, und die Europäer hatten die Bibel. Jetzt haben wir die Bibel, und<br />
die Europäer haben unser Land."<br />
Hier wird gewissermassen aus der Sicht des afrikanischen Opfers argumentiert. Der Mau-Mau-Aufstand von<br />
1952-1956 war die Folge des wachsenden Unmuts der einheimischen Bevölkerung, vor allem der Kikuyu,<br />
gegen die Landaneignung durch die weissen Siedler in Kenia. Zu Beginn der Auseinandersetzungen wurde<br />
auch der spätere Präsident Kenyatta verhaftet und zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe sowie zwei Jahren<br />
Exil verurteilt. Obwohl die Afrikaner nach dem Aufstand als Verlierer dastanden, über 11'000 Rebellen<br />
wurden getötet und 80'000 Männer, Frauen und Kinder der Kikuyu in Lager eingesperrt, während die Europäer<br />
nur etwa 100 Opfer zu beklagen hatten, errangen sie einen politischen Sieg, der Grossbritannien schliesslich<br />
dazu veranlasste, Kenia 1963 in die Unabhängigkeit zu entlassen. (Encarta, 1997; zu Kenia siehe auch die<br />
Seiten 203 und 225 dieser Arbeit.)<br />
Auf der Seite 44 befindet sich neben einer Karte mit der Überschrift "Unabhängige Länder in Afrika 1951",<br />
die die folgenden Länder als unabhängig bezeichnet: Libyen, Ägypten, Äthiopien, Liberia, Südafrikanische<br />
Union (Vergleiche dazu die Karte "Erlangung der Unabhängigkeit" auf der Seite 565 dieser Arbeit.) und zu der<br />
die Aufgabe "Vergleiche die untenstehende Karte mit der Atlaskarte und stelle fest, wie sich die Unabhängig-<br />
keitsbewegung in Afrika in den letzten Jahren entwickelt hat!" gestellt wird, auch ein Text, in dem es heisst<br />
(S. 44):<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Ein afrikanischer <strong>Pro</strong>fessor wendet sich an die Menschen in Europa und den USA: "Zeigt mit eurem Verhalten uns<br />
gegenüber sowohl in der Neuen wie der Alten Welt, dass ihr es annehmt und daran glaubt, dass wir alle die gleiche<br />
menschliche Natur haben. Dann können und wollen wir in Afrika antworten auf die ausgestreckte Hand; dann werden wir<br />
nicht bloss gemeinsam die <strong>Pro</strong>bleme Afrikas lösen, sondern durch die Bande der Freundschaft, der Bruderschaft werden<br />
wir einen neuen Weg entdecken, um eine Weltgemeinschaft zu schaffen, in der der Mensch ein reicheres, volleres Leben<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 220
führt und frei ist vom Krieg und der unheimlichen Furcht vor der Vernichtung. Wir wollen alle mithelfen, eine<br />
Weltgemeinschaft von freien Menschen zu schaffen, die in Freiheit miteinander verbunden sind".<br />
Einerseits kommt in diesen Text noch einmal die afrikanische Sichtweise zur Geltung, andererseits weicht das<br />
abgedruckte Plädoyer stark vom Bild der unter sich zerstrittenen "Stämme Afrikas" ab. Weiter heisst es im<br />
gleichen Text (S. 44):<br />
Am 5. Februar 1952 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass in das Abkommen über die<br />
Menschenrechte folgender Artikel einzufügen sei: "Alle Völker und alle Nationen sollen das Recht der Selbstbestimmung<br />
haben, nämlich das Recht, frei ihren politischen, sozialen und kulturellen Status zu bestimmen."<br />
Für einige afrikanische Staaten sollte es noch rund vierzig Jahre dauern, bis dieses Ziel umgesetzt wurde. Der<br />
Text erwähnt weiter die Konferenz in Bandung auf Java und sagt über die in den "Bandung-Staaten" (damit<br />
waren die Staaten mit einer farbigen Bevölkerungsmehrheit gemeint, damals etwa die Hälfte der Menschheit)<br />
aus:<br />
In diesen Staaten leben Menschen der verschiedensten Rassen und Religionen. Alle diese Völker, so verschiedenartig sie<br />
auch sind, verfolgten ein gemeinsames Ziel: den Kampf gegen die Herrschaft des "Weissen Mannes". Der grösste Teil<br />
dieser Länder in Asien und Afrika hat jedoch sein Ziel bereits erreicht. Sie sind frei!<br />
Damit ist sicherlich nur die de jure Unabhängigkeit im politischen Sinne gemeint, denn viele Staaten gelang es<br />
nicht, die wirtschaftliche Abhängigkeit abzubauen. In anderen Staaten schalteten und walteten die gleichen<br />
Beamten, die vor der Unabhängigkeit den verlängerten Arm der Kolonialmächte gebildet hatten. Über die<br />
Afrikaner schreibt der Autor:<br />
Zahlreiche Afrikaner besuchen Universitäten in Europa und Amerika. Viele dieser Studenten kehren als Ingenieure, Ärzte,<br />
Politiker, Lehrer, Juristen usw. nach Afrika zurück. Diese Männer bringen reiches Wissen und die Erfahrung, wie die<br />
Menschen in anderen Ländern der Erde leben, mit in ihre Heimat.<br />
Im Gegensatz zum Lehrmittel "Erdkunde: Oberstufe", welches vorwiegend die ländliche Bevölkerung ins<br />
Zentrum der Aufmerksamkeit stellt, stehen hier die Intellektuellen Afrikas im Vordergrund, die sich teilweise<br />
von der traditionellen Lebensweise weit entfernt haben.<br />
In einem nächsten Abschnitt "Und das Verhältnis von Schwarz und Weiss?" wird der Ministerpräsident Nyere-<br />
re von Tanganjika (heute Tansania) zitiert:<br />
"Wir haben durchaus nicht die Absicht, die Weissen zum Lande hinauszuwerfen. Die Weissen haben unser Land<br />
entwickelt. Wir wollen ein Tanganjika aufbauen wo Leute aller Länder friedlich zusammenleben können, ohne wegen der<br />
Hautfarbe viel zu streiten. Alle die im Lande leben wollen, um ihm zu dienen, sollen als Bürger anerkannt werden. Was wir<br />
aber nicht länger dulden wollen, ist, dass die 20'000 Weissen das Zepter fuhren über die fast 9 Millionen Schwarzen..."<br />
(Zu Tansania siehe auch die Seite 266 dieser Arbeit.) Als erstes der untersuchten Lehrmittel zitiert "Fahr mit in<br />
die Welt" hier einen bedeutenden afrikanischen Politiker, der Stellung zu den von seinem Land verfolgten<br />
Zielen nimmt und damit beweist, dass Schwarzafrikaner keineswegs unfähig sind, sich Gedanken über die<br />
eigene politische Zukunft zu machen.<br />
Im letzten Text zu "Afrika im Umbruch" unter der Überschrift "EWG und Afrika" schreibt der Autor (S. 44):<br />
Am 20. 7. 1963 wurde in Jaunde (Kamerun) ein höchst bemerkenswertes Vertragswerk unterzeichnet. 18 afrikanische<br />
Staaten haben sich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) angeschlossen. Der Vertrag sichert eine enge<br />
wirtschaftliche Zusammenarbeit früher abhängiger Gebiete mit der Gemeinschaft. Kernpunkt des neuen Abkommens war<br />
eine Finanzhilfe in Hohe von 730 Millionen Dollar (= 2920 Mio. DM). Sie wird für den Aufbau der Wirtschaft verwendet<br />
und schliesst technische Unterstützungen verschiedener Art ein. Den afrikanischen Partnern wird ferner für einige ihrer<br />
Hauptausfuhrerzeugnisse, wie Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze, zollfreie Einfuhr in die EWG-Länder gewährt.<br />
Die 18 afrikanischen Partner sind: Burundi, Elfenbeinküste, Dahomey, Gabun, Kamerun, Kongo (Brazzaville), Kongo<br />
(Dem. Rep.), Madagaskar, Mali, Mauretanien, Niger, Obervolta, Ruanda, Senegal, Somalia, Tschad, Togo und<br />
Zentralafrikanische Republik (seit 1965 auch Nigeria)...<br />
In der Aufgabenstellung zu diesem Text werden weitere Fakten vermittelt:<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Besprecht die Bedeutung des Abkommens von Jaunde für Afrika und für Europa! Berücksichtigt, dass die genannten 19<br />
Staaten 13 Millionen km 2 afrikanischen Bodens bedecken und etwa 120 Millionen Einwohner zählen (die entsprechenden<br />
Zahlen für ganz Afrika lauten: 30 Mio. km 2 und 318 Mio. Einwohner)!<br />
Mit diesen Angaben wird nicht nur die wirtschaftliche Zusammenarbeit beschrieben, sondern die genannten<br />
Zahlen ermöglichen es den Schülern auch, einen Vergleich zwischen den beiden Vertragsblöcken zu ziehen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 221
Auf den Seiten 45-47 werden die "Landschaftsgürtel Afrikas" dargestellt, bevor die detailliertere Beschreibung<br />
der einzelnen Grossräume folgt: "Nordafrika (Maghreb, Sahara)" (S. 48-59), "Der Sudan und Oberguinea"<br />
(S. 60-65), "Äquatorialafrika" (S. 66-70), "Ostafrika" (S. 71-75) und "Südafrika" (S. 76-82).<br />
4.19.2 Nordafrika<br />
Zu Nordafrika heisst es im Kapitel "Pharaonengräber und Staudämme" auf der Seite 58 unter dem Titel "Deut-<br />
sche Techniker in der Republik Sudan":<br />
Die Republik Sudan umfasst ein Gebiet von 2,5 Mio. km 2 Fläche, also der zehnfachen Grösse der BRD. Ihre Bevölkerung<br />
wurde 1967 auf rund 14 Mio. Menschen geschätzt.<br />
Wahrend der Norden des Landes nur dünn besiedelt ist, drängen sich am Zusammenfluss von Weissem und Blauem Nil in<br />
der Doppelstadt Khartum-Omdurman und in der südlich anschliessenden Gesira zwischen den beiden Flüssen und um die<br />
Hafenstadt Port Sudan am Roten Meer die Menschen zusammen. Die Landschaft zwischen dem Weissen und dem Blauen<br />
Nil ist für Ackerbau, insbesondere die Baumwollkultur, und für Viehzucht günstig. Allerdings muss auch hier künstlich<br />
bewässert werden, da die Regenzeit nur von Juli bis September dauert.<br />
1925, nach Fertigstellung des Sennar-Dammes am Blauen Nil durch die englische Kolonialverwaltung, konnte die Gesira,<br />
in der an manchen Stellen bis zu 12 m fruchtbarer Nilschlamm abgelagert ist, zum ersten Male wirtschaftlich richtig<br />
genutzt werden. Als der Sudan 1956 selbständig wurde, war in der Gesira eine Fläche von 420'000 ha entwässert. Davon<br />
wurde etwa ein Drittel mit Baumwolle, ein weiteres Drittel mit Hirse bestellt, während ein Drittel brach lag. Man erkennt an<br />
diesem Beispiel, dass die früheren Kolonialverwaltungen zum Teil damals schon recht bedeutende Entwicklungshilfe<br />
leisteten.<br />
Wobei sich diese "Entwicklungshilfe" schlussendlich darauf beschränkte, die einheimische Bevölkerung dazu<br />
zu bringen, möglichst viele Rohstoffe für Europa zu produzieren. Weiter heisst es:<br />
Mit Hilfe eines neuen Kanalsystems sollte diese bewässerte Fläche um weitere 320'000 ha vergrössert werden. Eine<br />
deutsche Firmengruppe wurde 1957 mit dem Bau des Kanals betraut. Heute wird auf dem neubewässerten Land bereits<br />
Baumwolle angebaut.<br />
In der Aufgabenstellung zum Text "Deutsche Techniker in der Republik Sudan" wird gefragt: "Welche Vortei-<br />
le bringt nach deiner Meinung die Vergrösserung des Baumwollanbaues für den jungen Staat?" Anschliessend<br />
wird weiter informiert (S. 59):<br />
Ähnlich wie die Deutschen im Sudan leisten fast alle europäischen Völker Entwicklungshilfe. Aber dieser Hilfe stellen sich<br />
oft ungeahnte Schwierigkeiten entgegen. Denke an das manchmal unerträgliche Klima, an Wassermangel, an das Fehlen<br />
von Strassen, an gefährliche Pflanzen und Tiere usw.! Die grösste Schwierigkeit aber liegt darin, dass die Zauberer und<br />
Medizinmänner nach wie vor einen starken Einfluss auf die Massen ausüben.<br />
Seit Jahrtausenden beherrscht der Geisterglaube und Dämonenzauber das Leben der Afrikaner. Können diese<br />
eingewurzelten Anschauungen und Lebensgewohnheiten in wenigen Jahren aus den Seelen der Afrikaner ausgerissen und<br />
völlig beseitigt werden? Selbst bei vielen zum Christentum oder Islam bekehrten Afrikanern brechen immer wieder<br />
manche ihrer alten abergläubischen Zauberformeln hervor.<br />
Dieser Text zeigt auf, wie Entwicklungshilfe damals verstanden wurde. Es ging nicht darum, den Afrikanern<br />
Hand zu bieten, ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, sondern man wollte vielmehr die "eingewur-<br />
zelten Anschauungen und Lebensgewohnheiten... aus den Seelen der Afrikaner" herausreissen "und völlig<br />
beseitigen". Mit anderen Worten, die "Unkultur" der Afrikaner sollte vernichtet und durch die Zivilisiertheit<br />
Europas ersetzt werden. Bei dieser Haltung ist es nicht verwunderlich, dass viele <strong>Pro</strong>jekte am "innern Wider-<br />
stand" der Afrikaner, wie deren Vorbehalte in einer weiteren Fragestellung bezeichnet werden, scheiterten.<br />
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 176 und 237 dieser Arbeit.)<br />
In den letzten Jahren hat in dieser Hinsicht ein Umdenken stattgefunden. So spricht eine Broschüre der ETH<br />
nicht mehr von Entwicklungshilfe, sondern von Entwicklungszusammenarbeit. Damit soll verdeutlicht werden,<br />
"dass hier zwei Partner zusammenarbeiten, die sich gegenseitig zu Leistungen verpflichten". Die Zusammenar-<br />
beit zwischen den Partner sollte nur dann stattfinden, "wenn sie gemeinsame Interessen oder 'verträgliche'<br />
Eigeninteressen verfolgen und die daraus abgeleiteten Ziele alleine nicht erreichen können". Die sei "die<br />
notwendige Voraussetzung dafür, dass man sich auf die vereinbarten Leistungen des jeweiligen Partners"<br />
verlassen könne. (Partnerschaft für die Zukunft, 1997)<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 222
4.19.3 Der Sudan und Oberguinea<br />
In der Beschreibung des "Sudan und Oberguinea" heisst es im Kapitel "Mensch und Tier in der Savanne" auf<br />
der Seite 60:<br />
...Von den Afrikanern wird das hohe dürre Gras in der Trockenzeit angezündet und abgebrannt. Auf diese einfache Art<br />
wird das hohe Gras zur düngenden Asche verbrannt und Raum für neue Felder gewonnen. Rasch verbrennt das dürre Gras,<br />
und rasch wandert die Feuerlinie weiter. Eidechsen, Schlangen und zahllose Heuschrecken werden von den Flammen<br />
aufgescheucht und fallen einem Heer von Raubvögeln zum Opfer, die sich bei jedem Grasbrand einfinden. Für den<br />
Menschen werden diese Brände selten gefährlich; er kann ihnen bei genügender Vorsicht immer ausweichen oder sich mit<br />
raschem Sprung durch die brennenden Grasstengel in Sicherheit bringen. Anders ergeht es dem verängstigten Wild. Die<br />
Antilopen werden vor allem in kreisförmig angelegten Feuern eingeschlossen und dann oft von den Afrikanern erlegt.<br />
Auch der Baumwuchs leidet sehr durch die Brände; im Nu sind Blätter und Knospen zerstört, die Zweige versengt und die<br />
Stämme angekohlt.<br />
Die im Text angeführte Ungefährlichkeit wird durch jährlich wiederkehrende Berichte aus den betroffenen<br />
Gebieten widerlegt, in denen von der Vernichtung ganzer Dörfer und auch von Todesfällen durch die gelegten<br />
Buschfeuer die Rede ist. Der Text fährt fort mit der Erwähnung der klimatischen Verhältnisse im März und<br />
April:<br />
...Von jetzt ab wird es regnen, nicht immer stundenlang, aber Monate hindurch fast täglich bis in den Herbst hinein. Die<br />
schönste Zeit in der Trockensavanne beginnt: nur Tage dauert es, bis sie grünt und blüht. Bald ist die Erde weich geworden<br />
für die Aussaat. Männer, Frauen und Kinder helfen, mit der Hacke den Boden zu "ritzen" und vorzubereiten für die Saat.<br />
Ähnlich wie dies für die Bauernfamilien in der Schweiz noch lange üblich war, sind viele Kinder eine wichtige<br />
Hilfe bei der Bewirtschaftung der Felder oder beim Hüten des Viehs. Allerdings erhielten einige unter ihnen,<br />
vor allem die Mädchen sind davon betroffen, nie die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, da diese zu weit<br />
weg liegt, die Schulgelder zu teuer sind, oder das Kind dringend als Arbeitskraft gebraucht wird. (Siehe dazu<br />
die Karte "Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" auf der Seite 571 im Anhang dieser<br />
Arbeit.)<br />
Auf der Seite 61 befindet sich ein Foto zum Text über die Buschbrände mit der Bildlegende "In der Trocken-<br />
zeit wird das Gras abgebrannt, um Ackerland zu gewinnen". In den jeweils zu einem Kapitel gestellten Aufga-<br />
ben, diesmal zu einer Karte der "Völkerstämme Afrikas", die auf Seite 62 abgebildet ist, wird der Schüler<br />
aufgefordert, zu zeigen, "wo die Neger leben". In diesem Zusammenhang schreibt der Autor über die Watussi<br />
und die Verteilung der Bevölkerung (S. 63):<br />
...Im Sommer 1949 besuchte ein Häuptling der Watussi die belgische Hauptstadt Brüssel. Dort erregte er wegen seiner<br />
Länge von 2,10 m grosses Aufsehen. In seiner Heimat ist das nichts Besonderes. Der Häuptling hat mehrere Wachsoldaten<br />
von der gleichen Körpergrösse. Sie stossen mit dem Kopf fast an die Telefondrähte.<br />
Bei dieser Beschreibung ist zu berücksichtigen, dass der damalige Durchschnittseuropäer von kleinerem<br />
Wuchs war, als dies Ende der neunziger Jahre der Fall ist.<br />
Die meisten Savannengebiete sind dicht bevölkert. Es gibt grosse Dörfer, die mit einem Wall umgeben sind. Aus Ästen und<br />
Palmstengeln wird das Gerüst der Rundhütte gefertigt, die Wände werden geflochten und dann oft mit Lehm beworfen, das<br />
Dach ist ein Kegeldach aus Grasbüscheln. Die Häuser stehen locker verteilt, so dass ein grosses Dorf eine ansehnliche<br />
Fläche einnimmt.<br />
Auf der gleichen Seite befindet sich auch ein Foto "Männer vom Stamm der Watussi", das neben den Hirten<br />
auch einige ihrer mit langen Hörnern versehenen Rinder zeigt, die für diesen Teil Afrikas typisch sind.<br />
Im nächsten Kapitel zum Sudan und Oberguinea folgt eine Beschreibung mit dem Titel "Quer durch Ghana<br />
(Oberguinea)". Auf der Seite 64 heisst es dazu:<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Die Reise begann in Akkra, einer Stadt in modernem Gewande, fast europäisch. Wir wurden ins Innere des Landes geführt,<br />
ins Reich der kriegerischen Aschantistämme. Wir kamen durch feuchtwarme Tropenwälder und im Norden des Landes in<br />
savannenartige Gebiete. Das Land führt heute Kakao und Edelhölzer, Manganerze, Bauxit und Diamanten aus. Die<br />
Industrie soll profitieren von grossen Wasserkraftwerken, die noch im Bau sind. (Inzwischen ist der Volta-Stausee<br />
vollendet).<br />
(Zum Volta-Stausee siehe auch die Seiten 177 und 227 dieser Arbeit). Die Aschanti, die zahlenmässig grösste<br />
Volksgruppe des heutigen Staates Ghana, waren als kriegerisch verschrien, weil sie nicht nur über ein stehen-<br />
des Heer verfügten, sondern es ihnen auch gelang, sich relativ lange gegen die Briten zu wehren, bevor sie<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 223
niedergeworfen wurden. Selbst dann kam es immer wieder zu Aufständen. Die Residenz des Königs der<br />
Aschanti, Kumasi, wurde von den Briten dem Erdboden gleichgemacht und später von den Briten im Kolonial-<br />
stil wieder aufgebaut. Daher ist Kumasi die einzig europäisch anmutende Staat Ghanas, die mit ihren rund<br />
800'000 Einwohner nach der Hauptstadt bevölkerungsmässig an zweiter Stelle steht und sich als Handels- und<br />
Universitätsort behaupten konnte. Ausserdem blieb sie Sitz des Aschantikönigs, dessen Funktion nun vor allem<br />
zeremonieller Natur ist, wenngleich er immer noch über grossen Einfluss verfügt.<br />
Zum Anbau von Kakao schreibt der Autor auf der Seite 64:<br />
Wir besuchen einen Farmer. Er hat eine Kakaopflanzung. Er klärt uns auf, dass Kakaobäume schon in ihrem 5. Lebensjahr<br />
Früchte tragen können. Den vollen Ertrag liefern sie aber nach 10 bis 12 Jahren. Alle sechs Wochen kann man dann 40 bis<br />
50 gurkenähnliche bis zu 25 cm lange Früchte ernten. Diese Früchte bergen in ihrem Innern 25 bis 50 Kakaobohnen.<br />
Die Kakaobohnen lässt man einige Tage liegen. Darauf werden sie gewaschen und getrocknet, nochmals gereinigt,<br />
geröstet, geschält und zerrieben. Aus der Kakaomasse wird das Fett herausgepresst. Aus dem gewonnenen Kakaopulver<br />
kann dann Schokolade hergestellt werden. Ausser den Plantagen der Weissen gibt es auch viele Betriebe der Eingeborenen.<br />
(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 187 und 194 dieser Arbeit.) Das Lehrmittel stattet, als erstes der<br />
untersuchten Werkte, dem ghanaischen Kakaobauer einen Besuch ab. Ein Thema, das in späteren Lehrmitteln<br />
mehr oder weniger ausführlich immer wieder aufgegriffen wird.<br />
Auf der Seite 64 ist auch eine Tabelle "Kakao (1966)", die <strong>Pro</strong>duktion und Ausfuhr der wichtigsten <strong>Pro</strong>duzen-<br />
tenländer angibt (Ghana steht an zweiter Stelle hinter der Elfenbeinküste), zu finden. Die Seite 65 zeigt ein<br />
Foto "Watussi beim Kriegstanz", die einen Kopfschmuck tragen - der dem Aussehen nach dem Bild aus dem<br />
Comic "Little Nemo" auf Seite 486 dieser Arbeit Pate gestanden haben könnte - und Speere in der Hand<br />
halten, sowie ein weiteres Foto "Ernte der reifen Kakaofrüchte".<br />
In der Beschreibung des nächsten Grossraums, Äquatorialafrika, im Kapitel "Geheimnisvoller Urwald",<br />
schreibt der Autor auf der Seite 68:<br />
...Die eigentlichen Bewohner des Kongogebietes sind die Bantus (= "Menschen"). Im Gegensatz zu den Pygmäen (=<br />
"Fäustlinge") leben sie nicht vom Sammeln und von der Jagd, sondern sie roden den Urwald, legen Felder an und betreiben<br />
Ackerbau. Wie schwer das Roden ist, zeigt das Foto: Bantus fällen einen Mahagonibaum.<br />
...Im Urwald breiten sich furchtbare Krankheiten aus: Aussatz, Schlafkrankheit, Gelbfieber und Malaria. Zuweilen werden<br />
ganze Dörfer von den Seuchen dahingerafft.<br />
Das im Text erwähnte Foto ist auf der gleichen Seite abgebildet. Über die Lebensweise der erwähnten<br />
Menschen erfahren wir weiter nichts. Im Kapitel "Das Kongobecken" auf der Seite 69, auf dieser Seite sind<br />
auch zwei Fotos S. 69 "Pygmäen", die im Kreis um zwei Weisse stehen, sowie "Leprakranker" abgebildet,<br />
heisst es in einem Bericht unter der Überschrift "Afrika ist unterwegs", der mit "Auch das Leben der Menschen<br />
verwandelt sich.." eingeleitet wird:<br />
Da sass ich auf dem vordersten Ponton des Kongoschiffes. Ein junger Bursche aus der schwarzen Mannschaft tauchte auf<br />
und liess sich auf einer alten Tonne nieder. Der Bursche wurde schnell zutraulich und gesprächig, als ich ihn in eine<br />
Unterhaltung zog. Es stellte sich heraus, dass ich einen Maschineneleven vor mir hatte, der auf dem Schiff seine<br />
"praktischen Jahre" absolvierte. Am Uelle im äussersten Norden der Kolonie war er geboren. Sein Vater war ein armer<br />
Bauer und Fischer an dem grossen Fluss gewesen; da er sich von dem Häuptling des Dorfes ungerecht behandelt fühlte,<br />
war ihm der Entschluss nicht allzu schwer geworden, sich als Wegebauarbeiter in die Gegend von Stanleyville (heute<br />
Kisangani) anwerben zu lassen. Dort hatte sich die katholische Mission der zugewanderten Familie angenommen. Der<br />
Knabe wurde mit seinen anderen Geschwistern getauft und hörte nun auf den Namen Norbert Tata. Er erhielt die<br />
Möglichkeit, die Grundschule der Mission zu besuchen, und kam danach, da er sich als intelligent erwies, für drei Jahre auf<br />
eine gehobenere Mittelschule, wo sich sein Französisch zu brauchbarer Vollständigkeit entwickelte.<br />
Noch heute ist die Beherrschung einer europäischen Sprache Voraussetzung für den Eintritt in eine höhere<br />
Schule in Schwarzafrika. Weiter heisst es im Bericht auf Seite 70:<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Inzwischen hatte sein Bruder eine andere Schule mit Erfolg besucht, die ihn dazu befähigte, den Posten eines Buchhalters -<br />
eine kleine Anfangsstellung natürlich - in Leopoldville (heute Kinshasa) anzunehmen. Auch den Eltern ging es nun besser.<br />
Der Vater hatte die Möglichkeiten, die ihm die Mission bot, voll zu nutzen gewusst, hatte sich wie seine Kinder ein wenn<br />
auch schlechteres Französisch angeeignet und griff zu, als man ihm eine Stellung - zunächst als ungelernter Arbeiter - in<br />
den Kupferminen bei Elisabethville (heute Lubumbashi) anbot. Dort wohnen die Eltern nun mit einer Tochter, die bei<br />
ihnen geblieben ist, die aber auch lesen und schreiben kann und daher die Briefe vorzulesen vermag, die von den Söhnen<br />
aus Léo und Stan alle Monate einmal eintreffen. Viel Glück und die Empfehlung eines Priesters liessen Norbert die<br />
Stellung im Maschinenraum der "Gouverneur Moulaert" finden - und er ist genau so wild und interessiert hinter Motoren<br />
her wie gleichaltrige Burschen in Europa.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 224
Anders gesagt, obwohl der junge schwarzafrikanische "Bursche" einem anderen Kulturkreis entstammt, inter-<br />
essiert er sich, vielleicht durch seine in der Missionsschule erlangte Bildung, für die gleichen <strong>Pro</strong>bleme wie<br />
junge Europäer der damaligen Zeit, d. h. die Unterschiede können so gross nicht sein.<br />
In der folgenden Aufgabenstellung wird der Schüler aufgefordert eine Liste zum Thema "Der Kongoneger<br />
früher und heute" aufzustellen. Im letzten Abschnitt zu Äquatorialafrika unter der Überschrift "Feuerrote Erde<br />
am Kongo" heisst es (S. 70):<br />
Um Lubumbashi, der modernen Grossstadt, ist die Erde feuerrot, 110'000 schwarze Hüttenarbeiter leben in dieser Stadt.<br />
Die Entfernung zur Hauptstadt Kinshasa beträgt 1'300 bis 1'500 km. Keine Eisenbahnlinie verbindet die beiden Städte.<br />
Bevor der Bergbau aufkam, war Katanga, dessen Hauptstadt Lubumbashi ist, kaum besiedelt. Es war eine armselige<br />
Hochfläche. Was gibt es nun heute in der Grossstadt dieser <strong>Pro</strong>vinz? Da finden wir Freilichttheater, Kinosäle, viele<br />
Schulen, denn es gibt kein Kind ohne Schulunterricht. Krankheitsfälle werden zum grössten Teil in Krankenhäusern<br />
behandelt.<br />
Die Erde ringsum ist gelb bis feuerrot, als schaue überall das Kupfer hervor, das hier meist im Tagebau gewonnen wird.<br />
Aber dabei werden auch Kobalt, Zinn, Wolfram, Uran und Zink gefördert.<br />
Auf der gleichen Seite ist auch ein Foto "Die Hauptstadt der Kongorepublik, Kinshasa" abgebildet, das mehr-<br />
stöckige Bauten inmitten von Bäumen und Menschen auf einem Platz zeigt.<br />
4.19.4 Ostafrika<br />
Auf Seite 71 beginnt die Beschreibung des Grossraumes "Ostafrika". Im Kapitel "Seen, Gletscher und Vulka-<br />
ne" heisst es unter der Überschrift "In Kenia" (S. 71f.):<br />
Das Klima Kenias ist tropisch, die Hitze aber wird durch die Höhenlage gemildert, so dass vor allem in den Gebieten um<br />
1500 m bis 2000 m Höhe ausgedehnte Pflanzungen der Europäer entstanden. Kilometerweit fährt man zwischen Nairobi<br />
und dem Viktoriasee durch Kaffeeplantagen. Hier wurden 1966 40'000 t hochwertigen Arabica-Kaffees geerntet. Ein Teil<br />
der Plantagen ist in den letzten Jahren von auswandernden Europäern verkauft worden. Zunächst waren im Lande lebende<br />
Inder die Käufer, aber auch von ihnen verliessen inzwischen viele das Land. Allein im Winter 1966/67 kamen 7'000 Inder<br />
nach England.<br />
(Zum Anbau von Kaffee siehe auch die Seiten 180 und 251 dieser Arbeit.)<br />
Am Ostufer des Viktoriasees sind in den letzten 25 Jahren Teepflanzungen angelegt worden. Manche von ihnen sind 500<br />
ha gross. Ursprünglich wurde der Tee ausschliesslich exportiert, heute ist er aber auch bei den Einheimischen ein beliebtes<br />
Getränk.<br />
(Zum Anbau von Tee siehe auch die Seiten 164 und 405 dieser Arbeit.)<br />
Noch eine Pflanze wird in Plantagen angebaut: die Sisalagave. Aus ihren Fasern werden Seile und Säcke hergestellt.<br />
(Zum Sisalanbau siehe auch die Seite 300 dieser Arbeit.)<br />
Im feuchtheissen Klima der Küste gedeihen Kokospalmen, Erdnüsse liefern Öl, und in den trockneren nördlichen<br />
Landesteilen wird Baumwolle angebaut. In immer stärkerem Masse geht heute das Land in den Besitz der Afrikaner über.<br />
Die "Kenianisierung" von Verwaltung und Wirtschaft wird unter starkem Druck durchgeführt. Dennoch sind viele<br />
Schwarze arbeitslos und drängen in die Städte. Die Einwohnerzahl Nairobis stieg von 24'000 (1924) auf über 300'000<br />
(1968) an.<br />
1990 betrug die Einwohnerzahl Nairobis 1.5 Mio., 1995 überstieg sie die Zweimillionengrenze. Damit gehört<br />
Nairobi zwar nicht mehr zu den allergrössten afrikanischen Städten, zeigt aber deutlich auf, wie schnell einige<br />
dieser Städte in nur wenigen Jahren wuchsen. (Zu Nairobi siehe auch die Seiten 203 und 405 dieser Arbeit.)<br />
Die zweitgrösste Stadt Kenias, Mombasa, wies 1995 eine Bevölkerung von rund 440'000 Einwohnern auf und<br />
rund 28% aller Kenianer lebten in Städten. (Weltatlas 1997)<br />
Zwei Fotos "Sisalernte" und "Trocknen der Sisalfasern" sind auf der Seite 72 abgebildet. Über das "Hirtenvolk<br />
der Massai" berichtet der Autor (S. 72):<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Am wenigsten hat sich das Hirtenvolk der Massai in Ostafrika der neuen Zeit angepasst. Heute noch sehen sie so aus, wie<br />
die ersten Afrikaforscher sie schildern: Es sind grosse, schlanke Gestalten mit einer bräunlichen Hautfarbe, nicht schwarz.<br />
Sie tragen rostbraune Umhänge aus selbstgegerbten Fellen. Die schmalen Köpfe sind bei den Männern mit seltsam<br />
geflochtenem Haar geschmückt. Die Frauen rasieren ihren Schädel kahl; sie tragen eiserne Schmuckringe um den Hals und<br />
in den Ohren und hohe eiserne Manschetten an Armen und Beinen. Die Männer sind mit langen Speeren bewaffnet. Selbst<br />
den Löwen erlegen sie damit auf der Jagd. Sie ziehen mit ihren grossen Rinderherden als Nomaden umher und wirken im<br />
modernen Afrika wie ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit. Auf den kargen Weideflächen halten sie oft so<br />
viel Vieh, dass die Grasnarbe kahl gefressen wird und die Regengüsse die kostbare Bodenkrume fortspülen. Aber die<br />
Massai wollen kein Vieh verkaufen oder gar schlachten; je mehr Rinder sie besitzen, desto reicher und glücklicher fühlen<br />
sie sich.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 225
Die Massai wohnen in Rundhütten, die aus Lehm und Kuhdung errichtet werden. Daneben liegt der Viehkral, von einer<br />
Dornenhecke zum Schutz gegen die Raubtiere umgeben. Das alte Afrika, wie es vor der Ankunft der Europäer war, ist<br />
noch bei ihnen lebendig.<br />
Die Massai wirken auf den Autoren also wie "ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit", bei denen<br />
"das alte Afrika... noch... lebendig" ist. Durch diese Aussage entsteht der Eindruck, die Massai würden eine<br />
Lebensweise widerspiegeln, die in ganz Kenia, vor der Ankunft der Europäer, vorherrschend gewesen sei.<br />
Dem ist aber nicht so: Da die Massai zu den halbnomadischen Völkern zählen, unterscheidet sich ihre Lebens-<br />
weise stark von derjenigen der ebenfalls im Gebiet Kenias lebenden, zahlreichen sesshaften Völkern.<br />
Auf der Seite 73 ist ein Foto "Stammesangehörige der Massai" abgebildet. (Zu den Massai siehe auch die<br />
Seiten 200 und 329, zu Kenia die Seiten 220 und 254 dieser Arbeit.)<br />
Im zweiten Kapitel zu Ostafrika mit der Überschrift "Das Hochland von Äthiopien" heisst es auf Seite 74 in<br />
einem Bericht "Eine Reise nach Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens" über die Hauptstadt des Landes:<br />
...Erst am Spätnachmittag tauchten wieder Zeichen menschlichen Lebens auf. In einem Eukalyptushain standen, wie<br />
Gartenhäuschen in einem grossen Park, die Häuser von Addis Abeba. So hatte ich mir eine afrikanische Hauptstadt nicht<br />
vorgestellt.<br />
Ich hatte einen Fremdenführer gefunden, und wir gingen durch eine moderne Strasse, als eine Autosirene hörbar wurde.<br />
Der Äthiopier drängte mich an den Strassenrand. "Obacht, Herr, bitte nehmen Sie den Hut ab !" sagte er. Ganz mechanisch<br />
nahm ich den Hut ab und sah verwundert, wie sich das Strassenbild blitzartig veränderte. Alle Leute traten an den<br />
Strassenrand, Autos fuhren seitlich heran und stoppten, im Nu war die Strassenmitte völlig frei. Ein Jeep mit heulender<br />
Sirene flitzte an uns vorüber, und in kurzem Abstand folgte ein englischer Luxuswagen. Auf seinem kleinen Ständer<br />
erkannte ich einen fünfzackigen Stern, der Kaiser. Ich war etwas verwundert, aber mein Führer sagte: "Es gibt nur einen<br />
König der Könige, Herr, und ihm verdanken wir die Autos und die Flugzeuge und die Wasserleitung. Er wird alles ins<br />
Land bringen, was ihr Europäer auch besitzt, denn er denkt nie an sich, sondern nur an uns". Mein Führer zeigte mir auch<br />
seine Wohnung. Von der Churchill Road weg, der Prachtstrasse mit Kinos, Theatern, grossartigen Kaufläden und<br />
unerhörtem Verkehr, zog er mich in einen Seitenweg, und während ich gerade noch glauben konnte, mitten im Trubel einer<br />
europäischen Grossstadt zu sein, war ich plötzlich wieder in Afrika; denn die Steinbauten stehen nur wie Theaterkulissen<br />
an ein paar grösseren Strassen entlang. Hinter den Kulissen aber leben die Eingeborenen wie vor hundert, vielleicht sogar<br />
wie vor tausend Jahren in ihren Tukuls. Das sind Rundhütten aus Reisig, sorgfältig mit Lehm verschmiert und mit Stroh<br />
eingedeckt, einige auch mit Kanisterblech. Sie sehen ganz niedlich aus, diese Tukuls, etwa wie umgekehrte<br />
Schwalbennester.<br />
Abends im Hotel traf ich eine französische Journalistin, die mit uns im Flugzeug war. Sie wollte abends noch die<br />
Lichtreklame von Addis Abeba ansehen. Aber der Portier meinte: "Ab Mitternacht gehört die Stadt der<br />
Gesundheitspolizei!" Das verstanden wir nicht. "Hyänen", sagte der Portier. Aber wir schauten immer noch dumm. Da<br />
erklärte er uns, dass die Kanalisation noch in den Anfängen stecke, und in der Hitze gehe alles schnell in Fäulnis über. Um<br />
Seuchen und Krankheiten zu verhüten, dürfe man deshalb die Hyänen nicht aus der Stadt vertreiben. Ihnen gehörten die<br />
Strassen bei Nacht.<br />
In diesem Text, in der immer wieder beliebten Form des Reiseberichtes, wird der Kontrast zwischen dem<br />
modernen, städtischen und dem traditionellen, eher ländlichen Leben Schwarzafrikas stark betont. Zudem wird<br />
klar, dass auch modern wirkende "Stadtteile" nur über eine mangelnde Infrastruktur verfügen. (Zu Äthiopien<br />
siehe auch die Seiten 179 und 198 dieser Arbeit.)<br />
Auf der Seite 74 und 75 sind zwei Fotos abgebildet: "Im Hochland von Äthiopien in etwa 2700 m Höhe" zeigt<br />
die Rundhäuser der Äthiopier und Erosionserscheinungen; "Äthiopische Landschaft südlich von Asmara" wird<br />
auch in "Erdkunde 3: Afrika, Asien, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1968, S. 46" abgebildet. Damit beendet<br />
der Autor seine Schilderung Ostafrikas.<br />
4.19.5 Südafrika<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Die Beschreibung Südafrikas umfasst die beiden Kapitel "Europäer in Südafrika" und "Republik Südafrika".<br />
Im ersten Kapitel wird auf der Seite 76 das Leben David Livingstones beschrieben, der im Gegensatz zu Stan-<br />
ley einen guten Zugang zur einheimische Bevölkerung fand und von dem es im Text heisst:<br />
..Jahrelang hatte er kein englisches Wort gesprochen, und es war für ihn gar nicht einfach, wieder in seiner Muttersprache<br />
zu reden. Aber die verschiedenen Dialekte der Neger beherrschte er um so besser. Er war einer der ihrigen geworden.<br />
Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Forschen hatte Livingstone immer betont, seine Expeditionen<br />
wären ohne die Mithilfe der Einheimischen kaum möglich gewesen. Der Text im Buch geht allerdings nicht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 226
näher darauf ein, sondern beschreibt die Afrikaner je nach Beziehung zu Livingstone als "Volk", "schwarze<br />
Freunde", "verräterische Träger", "treue schwarze Diener", "Eingeborene" und "seine Getreuen". Nach der<br />
Rettung durch Stanley heisst es von Livingstone:<br />
Aber Livingstone blieb in dem Land, dem sein ganzes Leben gehörte. Im Sumpfgebiet des Bangweolosees starb der<br />
Forscher und Freund der Schwarzen am Sumpffieber...<br />
Ein zweiter Text befasst sich unter dem Titel "Karibaschlucht - Karibakraftwerk" mit der Stromgewinnung<br />
durch Wasserkraft am Sambesi (S. 78f.):<br />
Der Stausee, der sich schon seit 1959 langsam sammelt, läuft schliesslich zu einer Lange von fast 500 Kilometer auf und<br />
wird bis dicht vor die Schluchten unterhalb der Viktoriafälle reichen. Wenn die Anlagen fertig sind, der See voll angestaut<br />
ist, wird das Karibakraftwerk die unvorstellbare Energie von mehr als einer Milliarde Watt produzieren.<br />
Die Folgen des wahrhaft ungeheuren Vorhabens, das über eine Milliarde kostet, sind noch gar nicht abzuschätzen. Das<br />
ganze südliche Zentralafrika wird verwandelt werden. Heute noch nicht vorstellbare Industriegebiete werden entstehen.<br />
Die armseligen Bantustämme die aus dem Seegrund ausgesiedelt wurden, leisteten erbitterten Widerstand dagegen, weil sie<br />
einfach nicht glauben wollten, dass ihre Dörfer und die hohen Wälder ringsum in wenigen Jahren turmhoch unter Wasser<br />
stehen wurden. Alle diese schwarzen einfachen Menschen werden, wenn die Entwicklung ungebrochen weitergeht, in neu<br />
aus dem Boden schiessenden Industrien ihnen noch heute unvorstellbar hohe Löhne verdienen. Sie werden reiche Fange<br />
von Fischen aus dem See ziehen, werden ihre Kinder auf gute Schulen in neuen Städten schicken, die nach all den klugen<br />
Regeln der Moderne mit Schwimmbädern, Parks, Licht und Wasser geplant werden. Und das gestaute Wasser verwandelt<br />
ober- und unterhalb der Karibaschlucht das dürre Land in blühende, grünende Gefilde, die hundertmal mehr Menschen<br />
ernähren können, als es einst möglich war.<br />
Das sich solche Hoffnungen nicht immer erfüllen, und oft die umzusiedelnden Menschen am wenigsten von<br />
solchen Riesenprojekten profitieren, hat sich beispielsweise am Voltastausee in Ghana gezeigt, dem man bei<br />
der Planung mit ähnlich optimistischen Erwartungen entgegenblickte. (Siehe dazu auch die Seiten 223 und 319<br />
dieser Arbeit.)<br />
Der 1955-1959 gebaute 125 m hohe Staudamm staute den 3540 km langen Sambesi zum damals grössten Stau-<br />
see der Welt auf, der eine Länge von rund 280 km und eine Breite von bis zu 40 km erreichte. Als der See sich<br />
in den Jahren 1960-1961 auffüllte, mussten rund 25'000 Menschen umgesiedelt werden. Die durch den Damm<br />
aufgestaute Wasserkraft wird von Sambia und Simbabwe genutzt. Ausserdem gehört der See unterdessen zu<br />
den beliebtesten Touristenattraktionen Simbabwes. (Encarta 1997, Weltatlas 1997; zum Karibastaudamm siehe<br />
auch die Seiten 161 und 290 dieser Arbeit.)<br />
Der nächste Abschnitt sich befasst unter dem Titel "Wolken, aber kein Regen über Südwestafrika" mit dem<br />
Gebiet des heutigen Namibia (S. 79):<br />
Die Buren im Lande, die 2/3 der Weissen stellen, wollen den Anschluss an Südafrika. Das hörten wir aus allen Gesprächen<br />
heraus. Über 1'100 km fuhren wir kreuz und quer durch das Ovamboland, von einer Missionsstation zur andern, von den<br />
Rundhütten der Eingeborenen zu den Stammeshäuptlingen. Überall fanden wir grüssende, winkende Kinder, fanden wir<br />
die ungeheure Leistung der Missionen mit ihren Schulen, Kirchen und Krankenhäusern. Was hier von allen Konfessionen<br />
geleistet wird, wäre wert, in Film und Wort den Menschen in aller Welt vorgeführt zu werden.<br />
Südwestafrika ist ein Land so gross wie Deutschland, Frankreich und Belgien zusammen. Es ist reich; denn seine Wüste<br />
schenkt ihm jährlich für 180 Millionen Mark Diamanten.<br />
Aus dem Meer ziehen die Netze für 100 Millionen Mark Fische. Die "schwarzen" Diamanten, nämlich die Felle der<br />
neugeborenen Karakulschäfchen, füllen die Staatskasse um weitere 50 Millionen Mark, und aus der Otavi-Mine in Tsumeb<br />
brechen die Amerikaner Jahr für Jahr Kupfer, Blei und Zink im Wert von 90 Millionen Mark. Mit den Bauern haben es die<br />
letzten sechs Jahre nicht gut gemeint. Sie haben mit ihrer Trockenheit das Land völlig ausgebrannt. Die Maul- und<br />
Klauenseuche und das Verbot für Fleischexporte haben die eigentlichen Herren des Landes, die Besitzer von Gütern bis zu<br />
100000 ha Grösse, schwer geschädigt...<br />
Im Text wird zwar die Meinung der Buren zum Anschluss Namibias an die Republik Südafrikas wiedergege-<br />
ben, wie die schwarze Bevölkerungsmehrheit darüber denkt, verschweigt der Autor.<br />
Zur Landwirtschaft ist auch ein Foto "Farmarbeiter mit Karakullämmern in Südwestafrika" (S. 79) abgedruckt,<br />
das schwarze Hilfsarbeiter bei der täglichen Arbeit zeigt, sowie ein Foto "Minenarbeiter einer Kupfermine in<br />
Transvaal".<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Namibia, das Mitte der neunziger Jahre je nach Schätzung zwischen 1.5-1.9 Mio. Einwohner zählte, erlangte<br />
nach einem langen Unabhängigkeitskampf und einer wechselhaften Geschichte, die sich in noch andauernden<br />
Grenzunklarheiten mit den meisten Nachbarländern widerspiegelt, 1990 die Unabhängigkeit unter der Führung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 227
der schwarzafrikanischen Befreiungsbewegung SWAPO (South-West Africa People's Organization). Die<br />
Bevölkerung, die zu mehr als einem Drittel in Städten lebt, davon 150'000 in der Hauptstadt Windhuk, politi-<br />
sches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes, setzt sich aus mehreren schwarzafrikanischen<br />
Völkern, wobei die bantusprechenden Ovambo mit ca. 50% die Mehrmeit ausmachen, sowie der Nachkommen<br />
der einstiegen Siedler vor allem aus Südafrika und Deutschland (mit Mischlingen ca. 15%) zusammen. Neben<br />
den Ovambo sind als weitere Völker die Damara, die Herero - die endgültige Niederwerfung des Herero-<br />
Aufstandes gegen die Deutschen bis 1904 forderte etwa 60'0000 Todesopfer - die Dama die Khoikhoin<br />
(Hottentotten) und die San (Buschmänner) von Bedeutung.<br />
Trotz des für Schwarzafrika relativen hohen pro-Kopf-Einkommens, lebt ein Grossteil der Bevölkerung von<br />
der Subsistenzwirtschaft. Ausserdem werden in der Landwirtschaft, die ca. 10% des BIP erwirtschaftet, Rinder<br />
für den Export gezüchtet, sowie Schaffelle exportiert. Wertmässig weit bedeutender ist der Bergbau (ca. 28%<br />
des BIP), der Diamanten, Kupfer, Gold, Zink, Blei und Uran sowie weitere seltene Metalle liefert und einen<br />
Grossteil der Devisen erwirtschaftet. Daneben spielt auch der Fischfang vor der Küste Namibias eine bedeu-<br />
tende Rolle. (Encarta 1997, Weltatlas 1997; zu Namibia siehe auch die Seiten 162 und 362, zu den<br />
"Buschmännern" die Seite 103 dieser Arbeit.)<br />
Im zweiten Kapitel zu Südafrika über die "Republik Südafrika stellt der Autor den Schülern die Frage, ob<br />
Südafrika "ein Land des weissen Mannes" sei. Folgende Informationen werden zu dieser Frage abgedruckt:<br />
1966/67 lebten in der Republik Südafrika 18.7 Mio. Menschen. Davon waren 3.5 Mio. Weisse, 0.5 Mio. Asiaten<br />
(überwiegend Inder), 12,5 Mio. Bantu und der Rest Mischlinge in allen Hauttönungen. Die Weissen waren die Besitzer von<br />
9/10 des Bodens, das letzte Zehntel gehörte den anderen.<br />
Anschliessend folgt ein Text, der darüber aufklären will, wie "die Republik Südafrika zu diesem Rassenge-<br />
misch kam", der sich aber vorwiegend mit dem Machtkämpfen zwischen den Buren und Engländern beschäf-<br />
tigt. Über die schwarze Bevölkerung schreibt der Autor nur, dass sie etwa zur gleichen Zeit wie die burischen<br />
Siedler ins Land vorstiessen. Weiter heisst es im Text (S. 79):<br />
...Bantu leben teilweise als Viehzüchter oder Arbeiter auf europäischen Farmen oder als Stadtbewohner in der Republik<br />
Südafrika. Ein anderer Teil wohnt in dem seit 1968 selbständigen Botsuana (früher Betschuanaland), Lesotho (früher<br />
Basutoland) und Swasiland. Kleine Gruppen von Buschmännern und Hottentotten leben noch in versteckten Teilen<br />
Südwestafrikas und in der Kapprovinz.<br />
Zur politischen Situation in Südafrika schreibt der Autor:<br />
Am 31. 5. 1961 schied die Südafrikanische Union aus dem Commonwealth aus, weil sie an der Apartheid... festhielt, und<br />
wurde Republik... In der Republik Südafrika besitzen nur die Weissen (1/5 der Gesamtbevölkerung) das Wahlrecht. Die<br />
übrigen vier Fünftel dürfen nicht wählen und sind damit von der Regierung ausgeschlossen.<br />
Zum Vergleich wird die Verfassung der USA zitiert, in der 1776 festgeschrieben wurde, dass alle Menschen<br />
von Geburt an gleich seien. Und die Frage wird gestellt, wie sich diese Grundrechte mit der Politik Südafrikas<br />
vereinen lassen. Dieser Ansatz ist sicherlich gut gemeint, greift aber in der Argumentation nicht, da die<br />
Verfasser der US-Verfassung gar nicht daran dachten, die in der Verfassung festgehaltenen Rechte könnten<br />
sich auf Schwarze beziehen.<br />
Auf der Seite 81 folgt ein Text über die Apartheid in Südafrika:<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Fast alles ist geteilt: die Wartestellen für den Omnibus, die Postschalter, die Fahrstühle, die Hotels und Verkehrsmittel, die<br />
Wohnviertel in den Städten, Kirchen und Friedhöfe. Museen, Zoologische Garten und Parks haben verschiedene<br />
Besuchszeiten für Schwarze und Weisse. Das Land ist geteilt, man kann es selbst vom Flugzeug aus sehen. Man weiss<br />
genau, ob man über "weissem" oder "schwarzem" Gebiet fliegt. Die schwarzen Reservate sind meist hügelig oder gebirgig.<br />
Man sieht nur dürftige Maisfelder, Lehmhütten mit Strohdächern, da und dort eine Kirche, eine Schule, eine<br />
Missionsstation, staubige Strassen und roten Sand, viel Busch. Anders die weissen Gebiete: Hell leuchten die Farmen aus<br />
den grossen gepflegten Feldern heraus, von Bäumen und kleinen Wäldern umfriedet, geteerte Strassen im ganzen Land.<br />
Dazwischen liegen die Bergbaugebiete: Gold, Diamanten, Kohle, Erze, Asbest, alles halt die Erde bereit. Um die<br />
Bergwerke, Stahlwerke, Kraftwerke herum liegen die Arbeitersiedlungen und um die Städte, weit draussen, der Kranz der<br />
"schwarzen" Vororte.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 228
Der südafrikanische Schriftsteller und Lehrer Ezekiel Mphahlele, geboren 1919, schrieb in den siebziger<br />
Jahren in einem Aufsatz "Blackness on My Mind": "Wenn man schwarz ist in Südafrika, so weiss man späte-<br />
stens im Alter von fünf Jahren, auf welche Seite der Rassenschranke man gehört. Mit sechzehn Jahren, wenn<br />
man seinen Pass erhält, weiss man, wogegen man ist. Draussen auf dem offenen Arbeitsmarkt bekommt man<br />
die Stärke der weissen Macht zu spüren. Es geht darum zu überleben. Ist man sensibler, will man mehr als nur<br />
überleben." (Jestel Hrsg. 1982, S. 32f.) Im Text fährt der Autor fort (S. 81):<br />
Der weisse Mann in Südafrika ist wohlhabend, viele sind reich. Aber wie lebt der schwarze Mann in dieser von den<br />
Weissen geschaffenen Ordnung? In den Reservaten gelten noch die Gesetze des Stammes. Der Stammeschef entscheidet z.<br />
B. darüber, wann mit der Aussaat und wann mit der Ernte begonnen wird. Grund und Boden gehören dem Stamm; Vieh<br />
und Ernte sind jedoch Privateigentum. Dem Stammeschef steht ein Kreis von Ratgebern, eine Art Ältestenrat zur Seite. Der<br />
Chef erhält von seinem Stamm 300 £ Sterling im Jahr, von der Regierung zusätzlich 72 £; mit einem Jahresgehalt von etwa<br />
4200 DM gilt er als ein wohlhabender Mann.<br />
Wie die Indianer Amerikas werden die Schwarzen in "Reservaten" ihren "Stammeschefs" ausgeliefert, die<br />
ihnen vorschreiben, was wann wie zu geschehen habe. Einmal abgesehen von den belasteten Begriffen "Re-<br />
servat" und "Stamm", kann man sich fragen, was damit ausgesagt werden soll. - Der Anschauung mögen die<br />
folgenden Überlegungen dienen: In der schweizerischen Landwirtschaft können gewisse Abfindungen nur<br />
erlangt werden, wenn die von den letztendlich sieben Stammeschefs, den Bundesräten, beschlossenen<br />
Vorschriften eingehalten werden. Die männliche Bevölkerung der Schweiz wird in einem Rhythmus von zwei<br />
Jahren dazu gezwungen, Frondienst für die Verteidigung ihres Stammes zu leisten. - Diese Beschreibungen<br />
mögen absurd erscheinen, sie zeigen aber klar auf, wie ein Sachverhalt, der hier nicht genauer bekannt ist,<br />
durch die Art der Sprachwahl in ein ganz bestimmtes Licht gerückt werden kann. Im Text fährt der Autor auf<br />
der Seite 81 fort:<br />
Wie will die Regierung die weitere Entwicklung steuern? In der Stadt soll der Bantu keine Rechte besitzen; er wird nur als<br />
Arbeitskraft begehrt und geduldet. Am liebsten möchte man alle Schwarzen aus den Städten herausziehen und sie in die<br />
Reservate schicken. Aber das ist unmöglich, denn Bergbau und Industrie sind von der Arbeitskraft des schwarzen Mannes<br />
abhängig. Auch ziehen die Städte, selbst die trostlosesten Vororte, den Bantu magnetisch an, und wer in der zweiten oder<br />
schon in der dritten Generation in der Stadt lebt, den kann man nicht wieder in den Busch und zu seinem Stamm<br />
zurückschicken.<br />
Auch hier wird wieder ein ganz bestimmtes Bild mittels der Sprache vermittelt. "Leider", so scheint der Text<br />
fast zu klagen, kann man den Schwarzen, den Mohren, der seine Schuldigkeit getan hat, "nicht wieder in den<br />
Busch... zu seinem Stamm zurückschicken", auch wenn man ihn wahrscheinlich am liebsten ins "Pfefferland<br />
schicken" würde. Die Frage nach dem Wollen des Schwarzafrikaners stellt sich erst gar nicht. Willenlos wird<br />
er von den Kräften der Wirtschaft von einem Ort zum anderen getrieben. Deshalb kann es nicht verwundern,<br />
wenn sich der Unmut der schwarzen Bevölkerung zumindest punktuell in Forderungen gegenüber der weissen<br />
Minderheit Luft macht:<br />
So stehen sich in Südafrika Schwarz und Weiss gegenüber. Die Kluft scheint unüberbrückbar zu werden. Die Schwarzen<br />
melden - wie überall in Afrika - ihre Forderungen an und verlangen mehr Rechte. Die Weissen bezeichnen Südafrika als<br />
ihre Heimat; sie sind genau so lange dort wie die Bantu, südlich des Oranje und Vaal sogar 150 bis 200 Jahre langer<br />
ansässig als die Bantu. Sie, nicht die Schwarzen haben das Land entwickelt. "Wenn wir die Goldfelder und die fruchtbaren<br />
Äcker der Hochebene den Schwarzen gaben und wir, die Weissen, zögen in die Reservate, so waren nach wenigen Jahren<br />
die Reservate Garten, aber die Industriegebiete wären Slums, und die fruchtbaren Felder von Transvaal wären<br />
verunkrautet." So sagen die weissen Südafrikaner. Wer möchte von sich behaupten, er wisse, wie hier die Wahrheit zu<br />
finden und Gerechtigkeit zu verwirklichen wäre.<br />
Unterdessen wurde in Südafrika eine Wahrheitskommision eingesetzt, die darüber urteilen soll, welche<br />
Verbrechen gegen die Gerechtigkeit in den letzten Jahren von den verschiedenen Seiten dieser damals künst-<br />
lich verstärkten Fronten verübt wurden. Weiter heisst es auf Seite 81:<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Wie hat nun der Bantu bei dieser Politik der Rassentrennung abgeschnitten? <strong>Pro</strong> Kopf der Bevölkerung hat er heute fraglos<br />
das höchste Einkommen aller schwarzen Völker Afrikas - es übertrifft z. B. das der Einwohner von Ghana oder Nigeria.<br />
Seine Nachbarn im Norden beneiden ihn um seine Verdienstmöglichkeiten. Dass jährlich zwanzigtausend Afrikaner<br />
versuchen, illegal nach Südafrika einzureisen, spricht für sich... Unter der nichtweissen Bevölkerung gibt es 100'000<br />
Autobesitzer - im Verhältnis viermal soviel wie in der Sowjetunion. Von fünf Bantukindern besuchen vier eine Schule.<br />
Mehr als zweitausend Bantus haben Hochschulbildung - verglichen mit weniger als zwölf in einigen der jungen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 229
afrikanischen Staaten die heute in den Vereinten Nationen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Die Geldmittel, die<br />
1962 für die Bantus und andere nichtweisse Gruppen ausgegeben wurden, überstiegen 20 Millionen Pfund. Von diesen<br />
stammten nur 28 <strong>Pro</strong>zent aus dem Steueraufkommen der Bantus, die Differenz brachte die weisse Bevölkerung auf,<br />
durchschnittlich 100 Pfund pro Familie.<br />
Dies ist ein Argument, welches bis in jüngste Zeit immer wieder angeführt wurde. Allerdings muss jeder, der<br />
es verwendet, sich auch die unangenehme Frage stellen lassen, ob nicht ein Grossteil des Reichtums Südafri-<br />
kas auf dem Abbau von Bodenschätzen beruht, welcher zu einem guten Teil durch unterbezahlte schwarze<br />
Arbeiter erledigt wurde.<br />
Unter den Bantu gibt es 7'500 ausgebildete Krankenschwestern, 70 Ärzte, 70 Bibliothekare, 50 Rechtsanwälte. Das für<br />
Nichtweisse erbaute Baragwanath-Hospital in der Nahe von Johannesburg hat 2'500 Betten und 200 Ärzte, von denen die<br />
Hälfte Spezialisten sind. Zwanzig der Ärzte sind Afrikaner. Man sollte die Apartheid vor dem Hintergrund dieser wirklich<br />
hervorragenden Leistungen der weissen Bevölkerung betrachten. Die weissen Südafrikaner sind bereit, in ihren<br />
Anstrengungen fortzufahren, ja sie noch zu verstärken, vorausgesetzt, die Trennung der Rassen wird streng beachtet und<br />
die Zusammenarbeit auf den Bereich der Wirtschaft beschränkt.<br />
In diesem Text wird die Haltung der damaligen herrschenden Schicht der weissen Südafrikaner wiedergege-<br />
ben, man würde weiter für die schwarzen Bevölkerungsschichten sorgen, solange es dieser nicht einfalle, das<br />
eingeführte System der Apartheid zu hinterfragen. Diese erpresserische Haltung wird in der paternalistischen<br />
Sicht des Textes zu einer Erziehungsregel, die, wenn sie verletzt wird, sozusagen zu einem Liebesentzug<br />
seitens der Weissen führt.<br />
Die wirtschaftliche Besserstellung, die für viele Bewohner Südafrikas keine Realität sondern nur statistische<br />
Zahlenspielerei ist - auch unter der jetzigen schwarzen Mehrheitsregierung - steht ein Klima der Gewalt<br />
gegenüber, welches in vielen anderen afrikanischen Staaten normalerweise undenkbar wäre. Auf Seite 82<br />
heisst es weiter:<br />
Von den Auswirkungen der Apartheid sind die Städter unter den Bantu am meisten betroffen, aber abgesehen von der<br />
Rassenschranke geht es ihnen in vieler Hinsicht besser als den Afrikanern in den Städten des übrigen Kontinents. Die<br />
Elendsviertel sind fast völlig aus dem Gesicht der modernen Grossstädte verschwunden. Ansässige Arbeiter, die in den<br />
Bergwerken oder Fabriken beschäftigt sind, werden mit ihren Familien in neuerbauten Wohnsiedlungen untergebracht. Das<br />
Heim einer Familie ist zwar nicht gross, aber bequem und mit allen modernen Vorrichtungen ausgerüstet. Für die Miete<br />
einschliesslich Wasser und Strom zahlt der Arbeiter nicht mehr als 15 <strong>Pro</strong>zent seines Monatsverdienstes. Zwar darf ein<br />
Bantu im Stadtbereich nicht Grundeigentümer werden, doch kann er, wenn er sich ein Haus bauen will, einen Pachtvertrag<br />
auf dreissig Jahre abschliessen.<br />
Die südafrikanische Regierung stellt sich die Apartheid als eine "getrennte und parallele" Entwicklung vor. Um eine solche<br />
Entwicklung zu sichern, schafft die Regierung jetzt Bantustaaten oder -provinzen, die sich nach einer Übergangszeit selbst<br />
verwalten sollen. Das Ziel ist ein Bund schwarzer und weisser <strong>Pro</strong>vinzen, in dem die "Bantustan"-Gebiete<br />
verfassungsmässige Mitglieder sind. 1963 wurde der erste Bantustaat mit den Namen Transkei gegründet. Weitere sieben<br />
Gebiete sollen in den nächsten Jahren nach dem Vorbild von Transkei die Selbstverwaltung erhalten.<br />
Der Eindruck des unvermittelt und unverdientermassen zu Wohlstand gekommenen Schwarzen, den die südaf-<br />
rikanische Regierung bewusst förderte, wird hier also noch einmal wiederholt. (Zur Apartheidspolitik siehe<br />
auch die Seiten 182 und 258 dieser Arbeit.)<br />
Der letzte Text "Gold am Witwatersrand" beschäftigt sich mit den natürlichen Ressourcen Südafrikas, über die<br />
schwarze Bevölkerungsmehrheit heisst es darin (S. 82):<br />
...Wer eine Goldmine besucht und in die Tiefe fährt, wer einmal in seinem Leben vor dem goldführenden Gestein<br />
gestanden und erlebt hat, wie da die halbnackten Schwarzen schweissüberströmt auf dem Rücken liegen und mit den<br />
Füssen den donnernden Presslufthammer in die Felsen drücken, der glaubt, das Gold im Gestein blitzen gesehen zu<br />
haben...<br />
Mit diesem Bild des animalischen Schwarzen, der sich im Schweisse seines Angesichts durch die Felsen bohrt,<br />
um das von der ganzen Welt begehrte Gold zu erlangen, schliesst der Afrikateil des Lehrmittel "Fahr mit in die<br />
Welt".<br />
4.19.6 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Die schwarzafrikanischen Menschen werden zwar nicht mehr als Wilde gesehen, immerhin leisten viele von<br />
ihnen nützliche Arbeit, aber ihre Kultur wird nach wie vor als Unkultur betrachtet, die es zu entwickeln gilt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 230
Bei diesem Entwicklungsprozess fühlt man sich im Recht, die Menschen zu enteignen, wie das beim bespro-<br />
chenen Staudammprojekt der Fall ist, und ihnen die langsam gewachsenen Traditionen und Werte auszutrei-<br />
ben, auf dass sie sich den "überlegeneren" westlichen Idealen zuwenden. All dies, so lässt zumindest der Text<br />
durchblicken, wird getan, weil man der festen Überzeugung ist, alles besser als die grösstenteils noch "rück-<br />
ständigen" Schwarzen zu wissen.<br />
Geographielehrmittel: Fahr mit in die Welt (1971-1974)<br />
Zwar berichtet das Lehrmittel recht ausführlich über die wirtschaftlichen Hintergründe Schwarzafrikas, aber<br />
über die Kulturen der Bewohner erfahren die Schüler wenig. Interessanterweise werden zwar einige Schwarz-<br />
afrikaner im Lehrmittel zitiert, nicht jedoch zur politisch damals heiklen Frage der Apartheidspolitik Südafri-<br />
kas, über die eine geteilte Meinung herrschte. Kinder treten nur in der Form von Schülern in von Weissen<br />
finanzierten Schulen Südafrikas auf, Frauen werden nur am Rande, wenn überhaupt erwähnt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 231
4.20 Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (Aargau 1972-1977)<br />
Von der offenen Veranda meiner Hütte... kann ich das tiefer gelegene Dorf überblicken. Überall sehe ich Frauen, Männer<br />
und Kinder gemächlich hervorkommen. Blinzelnd und sich wohlig reckend, treten sie aus ihren dunklen Behausungen ans<br />
Licht. Die jungen Frauen und die Mädchen gehen zum Bach hinunter. Bald kehren sie zurück, die schweren gefüllten<br />
Gefässe wie gewichtslos frei auf dem Kopf balancierend... Hier und da wird zwischen den spitzdachigen Hütten ein Feuer<br />
entzündet und ein eiserner Topf darübergestellt. Männer putzen sich im Auf- und Abgehen mit faserigen Stäbchen die<br />
Zähne. Lachend verschwinden Frauen hinter ihren Badezäunen und hängen die Eingänge mit bunten Tüchern zu. Andere<br />
Frauen sind mit ihrer Morgentoilette schon fertig. Sie haben Reis oder Kassawawurzeln in die grossen, hölzernen Mörser<br />
geschüttet, und der mir vertraute Ton des rhythmischen Stampfens mit den mannshohen Stangen verstärkt den Eindruck<br />
einer glücklichen Stunde... Die reine Lust am Dasein ist den Menschen eigen. (Bd. 4, S. 54-55)<br />
Das in vier Bänden mit den Themen "Schweiz", "Das Leben", "Die Arbeit" und "Die Kultur" in den siebziger<br />
Jahren beim Kantonalen Lehrmittelverlag Aargau erschienene Lehrmittel zur Geographie für die oberen Klas-<br />
sen der Volksschule enthält in den beiden Bänden "Das Leben" und "Die Kultur" Berichte und Aussagen zu<br />
Afrika. Während der Band "Die Arbeit" nur einige Überblickskarten zum Thema, sowie wenige nicht eindeu-<br />
tig zuzuordnende Fotos enthält.<br />
4.20.1 Das Leben (1974)<br />
Der 96 Seiten umfassende Band "Das Leben" befasst sich in den Kapitel "Auf der Erde verbreitete Krankhei-<br />
ten", "In warmen und heissen Gebieten wohnen" und "Wie man sich ernährt" detailliert oder am Rande mit<br />
Afrika.<br />
4.20.1.1 Krankheiten<br />
Im Kapitel "Auf der Erde verbreitete Krankheiten" schreibt der Autor über die Lepra auf der Seite 44:<br />
...Der Aussatz zerstört langsam den Körper und verstümmelt ihn grauenvoll. Er wird durch Bazillen übertragen. Von der<br />
Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit vergehen fünf bis zwanzig Jahre... In Afrika gibt es im Durchschnitt 20 bis<br />
50 Fälle auf 1000 Einwohnern.<br />
Michler schätzt in seinem "Weissbuch Afrika" dass, etwa 1% der Bevölkerung Nigerias an Lepra erkrankt sei<br />
und sieht darin eine Beispiel für die Vernachlässigung der Basismedizinversorgung in vielen schwarzafrikani-<br />
schen Ländern. (Michler 1991, S. 388) Die Lepra wird ansonsten nur im Lehrmittel "Terra Geographie" von<br />
1979 noch einmal im Zusammenhang mit Schwarzafrika erwähnt. (Siehe dazu auch die Seite 311 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Auf der Seite 45 sind zwei Karten abgebildet "Die gegenwärtige Ausbreitung des Aussatzes (Lepra)", die den<br />
ganzen afrikanischen Kontinent als <strong>Pro</strong>blemzone kennzeichnet, und "Heutige Choleragebiete und Choleraaus-<br />
breitung zwischen 1863 und 1868", welche das Gebiet zwischen Tunesien und Senegals, sowie ganz Ostafrika<br />
als <strong>Pro</strong>blemgebiet kennzeichnet. Über die Cholera schreibt der Autor (S. 45):<br />
Den Cholerakranken peinigen Durchfall, Erbrechen, Austrocknung des Körpers und schmerzhafte Krämpfe. Der<br />
Kommabazillus mit seinen Giften verursacht die Krankheit. Der Patient scheidet neue Kommabazillen mit seinem Kot aus.<br />
Verschmutztes Wasser und verschmutzte Nahrungsmittel verbreiten den Bazillus. Man schützt sich durch Impfung und<br />
grösste Reinlichkeit...<br />
Nach Westafrika gelangte die Krankheit erst 1970. (Geo 3/1995, S. 88) Zwei weitere Karten auf der Seite 46<br />
zeigen "Gebiete, in denen Malaria dauernd vorkommt" und "Grippeausbreitung 1957". Die Malariakarte kenn-<br />
zeichnet ganz Afrika mit Ausnahme der Sahara, des Hochgebirges in Kilimandscharogebiet und Südafrika als<br />
<strong>Pro</strong>blemzone. Im Text dazu schreibt der Autor (S. 46):<br />
Die weitverbreitetste Krankheit ist auch heute noch die Malaria... Die Malaria ist eine Fieberkrankheit. Sie ist so gefährlich,<br />
weil die sich häufig wiederholenden Fieberanfälle den Patienten sehr schwächen und bei ihm eine schwere Blutarmut<br />
hervorrufen. Der Erreger der Krankheit wird durch Anophelesmücken übertragen. Diese leben in Sümpfen. In den Städten<br />
gedeihen sie nicht. Durch Entsumpfung kann man die Malaria eindämmen. Es gibt auch Insektengifte, wie das DDT, mit<br />
denen man die Hütten ausspritzt. Aber gerade das DDT selber gefährdet auch die Gesundheit des Menschen. Es gibt heute<br />
Medikamente, die man über längere Zeit vorbeugend einnehmen kann. Ein ausgezeichnetes Mittel ist Chinin.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 232
Dieser Abschnitt enthält mehrere ungenaue oder sogar falsche Informationen. Erstens beschränken sich die<br />
Symptome der Malaria nicht immer nur auf Fieberschübe, das Erscheinungsbild der Krankheit ist ausseror-<br />
dentlich vielfältig und nicht immer einfach zu diagnostizieren. Kopfweh, Durchfall, Gliederschmerzen oder<br />
Müdigkeit können ebenso Symptome der Krankheit sein, wie die erwähnten Fieberanfälle. Letztendlich<br />
verschafft nur ein Blutbild Klarheit über den Befall mit einem der vier Malariatypen (unterschiedliche Erre-<br />
ger). Zweitens tritt der Tod nicht nur durch Blutarmut auf, sondern oft durch Nierenversagen, die durch die<br />
abgestorbenen Blutkörperchen bei ihrer Ausscheidungsfunktion nachhaltig geschädigt werden können. Der<br />
durch die Blutkörperchen dunkel gefärbte Urin, hat der Krankheit auch den Namen "Schwarzfieber" verliehen.<br />
Nebst den Nierenschädigungen können Organe direkt durch den Erreger befallen und geschädigt werden. Drit-<br />
tens kann die Anophelesmücke sehr wohl in städtischen Gebieten überleben, da für die Entwicklung der<br />
Larven kleinste Wassermengen genügen. Brutstädten können durch alte Autopneus, weggeworfene Dosen,<br />
nichtgeschlossene Wassercontainer und durch die offene Kanalisation künstlich geschaffen werden. Aus<br />
diesem Grund laufen in vielen afrikanischen Staaten Aufklärungskampagnen für die Bevölkerung. Viertens,<br />
sowohl Gifte als auch Medikamente verlieren oft rasch ihre Wirksamkeit, da sich sowohl die Mücke als auch<br />
der Malariaerreger den neuen Herausforderungen rasch anpassen. Ein besonders wirksames Mittel gegen die<br />
Mückenlarven ist eine Ölschicht auf dem Wasser, die den Larven das Atmen verunmöglicht. Diese Methode<br />
birgt aber die Gefahr der Boden- und Wasserverschmutzung in sich. In Ghana halten die Bewohner des<br />
Nordens traditionell Fische in ihren Wassertanks, die die Mückenlarven fressen. Gerade in den Städten wird<br />
diese Methode aber nicht mehr angewendet. Die Resistenz der Malariaerreger gegen Medikamente wird durch<br />
den Missbrauch und durch die von den Touristen oft benutzte Taktik der <strong>Pro</strong>phylaxe gefördert. Deshalb<br />
müssen immer wieder neue Medikamente gegen resistente Malariastämme entwickelt werden. Die neuste<br />
Generation der Medikamente ist aber einerseits für die betroffene Bevölkerung zu teuer und kann ausserdem<br />
zu schweren Nebenwirkungen wie Allergien und geistiger Verwirrung führen. Aus diesen Gründen wird die<br />
Prävention, beispielsweise durch Moskitonetze, wieder verstärkt gefördert. (Zur Malaria siehe auch die Seite<br />
145 dieser Arbeit.)<br />
Über die ärztliche Versorgung der Erkrankten macht das Buch in bezug auf Schwarzafrika keine Aussagen.<br />
Ebensowenig geht der Autor auf andere Infektionskrankheiten ein.<br />
4.20.1.2 Wohnen<br />
Das Kapitel "In warmen und heissen Gebieten wohnen" zeigt auf den Seiten 74-77 Fotos verschiedener<br />
Behausungen. Im Text heisst es auf der Seiten 73 und 78:<br />
...In den warmen und heissen Gebieten findet man eine grössere Vielfalt von Siedlungen als in den gemässigten und kalten.<br />
Das hängt damit zusammen, dass man sich freier entfalten kann, wenn man jahraus, jahrein nie friert...<br />
...In den warmen und heissen Gebieten kann man uneingeschränkter leben; die Wohnstätte darf offener, durchlässiger und<br />
einfacher sein. Eine Bedingung allerdings hat auch das offene und einfach Haus zu erfüllen: es soll dem Menschen immer<br />
die Geborgenheit geben, ohne die er sich nicht wohl fühlt.<br />
Im Gegensatz zu den im Text gemachten Bemerkungen, hat das Haus in den heissen Gebieten neben der Funk-<br />
tion den Regen abzuhalten, vor allem den Schutz der Bewohner vor der Hitze der Sonne zu erfüllen. Aus<br />
diesem Grund ist die offene Architektur oft nicht Ausdruck einer "freieren Entfaltung" sondern ebenso durch<br />
die Tagestemperaturen bestimmt wie beispielsweise die Behausungen der Nordeuropäer. Auf Seite 78 schreibt<br />
der Autor weiter:<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
In warmen und zugleich trockenen Gebieten kennen die Menschen, sofern sie nicht in der Stadt leben, nur das Zelt als<br />
Wohnung... Sie sind Viehzüchter und leben von Schaf, Rind, Kamel und von der Ziege. Ackerbau ist wegen der<br />
Trockenheit nicht mehr möglich, doch die Tiere können sich vom spärlichen Pflanzenwuchs noch schlecht und recht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 233
ernähren. Man muss mit ihnen allerdings weit herumziehen, weil die wenig ergiebigen Weideplätze schnell ausgenützt<br />
sind... Je nach Trockenheit wandern die Menschen mit ihren Herden einige hundert bis über tausend Kilometer hin und her.<br />
Man nennt diese Menschen Nomaden... Es gibt einige Millionen Nomaden, in Afrika allein sechs Millionen.<br />
Leider präzisiert der Autor den Lebensraum dieser Nomaden nicht genauer. Aufgrund der Erwähnung von<br />
Zelten muss aber angenommen werden, dass er damit die im Gebiet der Sahara lebenden Berbervölker meint,<br />
da ostafrikanische Völker, die nomadisieren, andere Wohnformen bevorzugen.<br />
Der Text fährt fort mit der Beschreibung der regenreicheren Trockenzonen (S. 79):<br />
Wenn das Land etwas fruchtbarer ist als das Nomadenland, kann das Vieh auf kleinerem Raum ernährt werden. Zudem ist<br />
es dann oft auch möglich, etwas Ackerbau zutreiben. Unter diesen Verhältnissen erstellen die Menschen mehr oder<br />
weniger feste Siedlungen, doch einige Sippenangehörige gehen mit den Herden weiterhin auf Wanderungen. Man<br />
bezeichnet Menschen mit dieser Wohn- und Lebensweise als Halbnomaden....<br />
Auch hier fehlt wieder der Hinweis auf konkrete Gebiete oder bestimmte Volksgruppen.<br />
Im nächsten Abschnitt lässt der Autor einen "guten Kenner"Afrikas, Dr. René Gardi, über die Siedlungsformen<br />
und die beim Wohnungsbau benutzten Materialien berichten (S. 79):<br />
...Der Afrikaner der Wildnis baut mit dem Material, das ihm zur Verfügung steht, das er in seiner Umwelt findet, das die<br />
Natur ihm schenkt. Er bezahlt es nicht und transportiert es nie auf weite Strecken. Um sein Haus zu bauen, braucht er Fleiss<br />
und Arbeit, aber kaum Kapital. Zum Flechten und zum Drehen von Stricken und Seilen, die man in grosser Zahl beim<br />
Hausbau und für Dachkonstruktionen braucht, stehen sehr verschiedene Pflanzen zur Verfügung. Man zerklopft<br />
Lianenrinde, benutzt die geschmeidigen Fasern der Rotangpalme, spaltet Bambus oder die dreimannslangen Blattscheiden<br />
der Raffiapalmen. Auch der Bast der Kokospalmen ist brauchbar. Anderswo verwendet man verschiedene Grasarten. Beim<br />
Dachbau werden weder Nägel noch Draht benötigt.<br />
Jeder Hausbau stellt ein Gemeinschaftswerk dar. Der Bauherr bietet seine Verwandten auf, die Dorfgenossen, Freunde<br />
gleichen Jahrganges, die nun mithelfen, ohne mit einem Barlohn entschädigt zu werden. Man feiert nach der Arbeit mit<br />
einem Festessen, der Hausherr schlachtet Hühner oder eine Ziege, wenn er vermöglich ist, und später wird er bei einem<br />
anderen Bau Gegenrecht halten.<br />
Wie in den anderen Abschnitten zu den Wohnformen, werden auch hier keine eindeutigen Gebiets- oder<br />
Volkszuordnungen vorgenommen. Die aufgezählten Materialien stammen aus unterschiedlichen Gegenden.<br />
Der Text gleicht dem Versuch, die Bauweise der Inuit ("Eskimo") und die eines schweizerischen Riegelhauses<br />
in einem Abschnitt zusammenfassend darzustellen.<br />
Geglückter ist der Abschnitt, der den Hausbau als Gemeinschaftswerk darstellt. Zumindest in ländlichen<br />
Gegenden trifft die Beschreibung zu. In der Nähe von städtischen Ansiedlungen wird die Arbeit, auch bei<br />
traditioneller Bauweise, meist von Spezialisten in Lohnarbeit erledigt. Zudem muss auch das benötigte Mate-<br />
rial, besonders für das Dach, von aussen zugekauft werden. Im Text fährt der Autor mit der Beschreibung der<br />
Wohnformen fort (S. 79):<br />
Wo die Felder fruchtbar genug sind, kann man sich endgültig niederlassen und solidere Wohnstätten aus Lehm und zum<br />
Teil aus Steinen errichten. Hier leben in der Regel nun auch mehr Menschen in einem Gebiet zusammen als bei den<br />
Nomaden und Halbnomaden. Es lässt sich jetzt auch alles so einrichten, wie man es zum behaglichen Wohnen als nötig<br />
erachtet: Hausvorplätze, Innenhöfe zwischen den Bauten, Sitzmäuerchen vor dem Haus, offene Veranden unter einem<br />
Schattendach und Ruheplatze für die alten Leute unter einem Baum in der Nähe.<br />
Es gibt viele verschiedene Arten von Lehmbauten... Zwischen den eckigen und runden und den freistehenden und<br />
aneinandergebauten Häusern gibt es eine Fülle von Kombinationen .<br />
Auf der Seite 80 ist der Plan eines "stattlichen Lehmhauses" abgebildet, welcher weiter unten mit Legende<br />
wiedergegeben werden soll.<br />
Ein weiterer Text auf der gleichen Seite, nach Dr. R. Gardi, beschreibt "wie man in heissen Gebieten aus<br />
Lehm" baut:<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
...In Gruben werden Tonerden stark mit Wasser vermischt und dann mit den Füssen geknetet. Es scheint, dass das<br />
Beimischen von zerhacktem Stroh, Heu oder Kuhdung nicht bloss als Bindemittel dient, sondern dass die darin enthaltenen<br />
Mikroorganismen chemische und biologische Vorgange auslösen, die der Härtung des Lehmmörtels förderlich sind.<br />
Die Hand wird beim Bauen sozusagen als einziges Werkzeug verwendet. Nur mit der Hand habe man das richtige Gefühl,<br />
heisst es. Dem Maurer wirft man Kugeln aus vorbereitetem Lehm zu, und er zerdrückt und verstreicht sie. Gebaut wird<br />
stets in der Trockenzeit. Bevorzugt sind Tage mit trockenem Wind, und jedermann hilft mit. Kurzweilig ist es,<br />
zuzuschauen, wie die Lehmkugeln dem Maurer zugeworfen werden und wie die Kinder die feuchten Lehmbrocken zur<br />
Baustelle tragen. Bei eckigen Bauten ersetzt man vielerorts den Lehmmörtel durch Trockenziegel. Mit ihnen werden die<br />
Hauskanten solider. Das Ziegelmaterial ist derselbe Lehm, wie er für alle Gebäude verwendet wird. Meistens wird er in<br />
Holzrahmen geformt und dann an der Sonne getrocknet...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 234
Die Trockenzeit wird deshalb bevorzugt, weil ein Platzregen, wie er in den tropischen Gebieten Afrikas<br />
ausserhalb der Trockenzeit häufig vorkommt, das begonnene Bauwerk massiv schädigen kann. Sind die Lehm-<br />
mauern aber erst einmal überdacht, halten sie relativ lange.<br />
Plan eines Lehmhauses aus "Das Leben", Seite 80:<br />
Die starke Gliederung der Wände rührt von den eingemauerten Stützbalken her. Raum 1 ist der Vorhof, von<br />
dem aus man in den Hauptraum 2 eintritt...<br />
3: fensterlose Küche. vorwiegend in der Regen-<br />
zeit benutzt, sonst kocht man im Freien<br />
4: Schlafzimmer; man ruht auf Matten, die am<br />
Boden ausgebreitet werden<br />
5: Ort der Trinkwasseraufbewahrung<br />
6: Lehmblock zum Mahlen der Hirse<br />
7: Krug mit Bier<br />
8: Speicher für Hirse, Mais und Bohnen<br />
9: freistehende Stützbalken<br />
10: besonders grosse Tontöpfe<br />
11: Herd; Krüge der Wand entlang<br />
12: Opferplatz mit dem Hausaltar<br />
13: Krüge, in denen Bier gekocht wird.<br />
Als weitere Siedlungsform wird eine Pfahlbausiedlung in Dahome (Benin) beschrieben (S. 80f.). Dabei wird<br />
auf ein Bild auf den Seite 76 verwiesen:<br />
Dieses Dorf liegt in Afrika, im Süden von Dahomey, und zählt etwa 10'000 Einwohner. Sie leben vom Fischfang und<br />
halten Schweine, Hühner und Ziegen. Beim Hüttenbau werden dickere und dünnere Holzstützen in den Boden gerammt<br />
und aus verschnürten, gespaltenen Bambusstäben und Palmblattrippen Boden und Wände gelegt Das Dach wird mit Gras<br />
oder auch mit Palmblättern gedeckt. Bei dieser Bauweise kann der Wind durch alle Ritzen ziehen und die Räume kühlen.<br />
Abfälle werden ins Wasser geworfen oder fallen durch die Zwischenräume im Boden In der Regenzeit steht das Wasser<br />
hoch, und dann kann man mit den Einbäumen direkt vor die Haustüre gelangen, in der Trockenzeit aber... stehen die<br />
Hütten bis zwei Meter über Wasser.<br />
Auf der Seite 82 schreibt der Autor über die Landflucht, die er am Ende des Kapitels über die Wohnformen<br />
behandelt:<br />
...Häufig ist es aber nicht die Armut, die Menschen vom Land in die Stadt treibt; viele sind auch einfach vom Stadtleben<br />
fasziniert und verlassen darum ihre ländliche Heimat. So kann vor allem in Afrika der Zustrom in die Grossstädte<br />
begründet werden... Man sucht Bretter Karton, Blechfässer und Plastikabfälle und errichtet damit einen provisorischen<br />
Unterschlupf am Stadtrand. Vielleicht findet man schliesslich Arbeit; man kann irgendwo putzen, abwaschen, Material<br />
verladen helfen, doch die Löhne der frisch Zugezogenen sind erheblich niedriger als diejenige der länger Ansässigen, und<br />
es bleibt darum nichts übrig, als im Slum zu verharren...<br />
(Zu den Slums in Schwarzafrika siehe auch die Seiten 158 und 253 dieser Arbeit.)<br />
4.20.1.3 Ernährung<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Im Kapitel "Wie man sich ernährt" behandelt der Autor die landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion unter Zuhilfenahme<br />
von verschiedenen Tabellen, darunter eine, die Bevölkerungszahlen für Afrika in Millionen mit 164 Mio.<br />
(1930), 191 Mio. (1940), 222 Mio. (1950), 278 Mio. (1960) und 344 Mio. (1970) angibt, Graphiken, Bildern<br />
und Karten. Auf Seite 86 schreibt er unter dem Titel "Wo unsere Nahrung erzeugt wird":<br />
...Von Kontinent zu Kontinent ist die Nahrungsmenge, die erzeugt wird, sehr unterschiedlich. Eigentlich sollten die<br />
Kontinente mit viel Bewohnern auch viel Nahrungsmittel hervorbringen... Asien, Afrika und Lateinamerika erzeugen zu<br />
wenig Nahrungsmittel, weil die Landwirtschaft auf diesen Kontinenten nicht genügend produktiv ist...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 235
Damit ist der Schritt weg vom Kontinent mit einem Überfluss an Nahrungsmitteln, wie er in den Lehrmitteln<br />
der sechziger Jahre porträtiert wurde, vollzogen. Noch ist aber nicht vom "Hungerkontinent" der Lehrmittel ab<br />
Mitte der siebziger Jahre die Rede.<br />
Mit einer Tabelle "Die Nahrungsmittelerzeugung der Kontinente" und einer Rechnung der pro Arbeitskraft in<br />
der Landwirtschaft erzeugten Nahrungsmittelmenge versucht der Autor diese Aussagen zu belegen. Dabei<br />
vergisst er, dass die hohe <strong>Pro</strong>duktionsleistung pro Kopf in den Industrienationen vor allem auf dem hohen<br />
Mechanisierungsgrad und der dafür benötigten Energiemenge beruht. Beide Ansätze sind für eine breite<br />
Bevölkerungsschicht in vielen Ländern Afrikas nicht praktikabel. Ausserdem fehlen in der erwähnten Tabelle<br />
bei den "wichtigen Nahrungsmittel" sowohl Maniok als auch Hirse, die für Afrika im Gegensatz zu den Indu-<br />
strienationen von grosser Bedeutung sind. (Siehe dazu die Tabelle "Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion in Afrika"<br />
im Anhang auf der Seite 557 dieser Arbeit.) Aus den angeführten Gründen bleiben die vom Autor über die<br />
Situation im Nahrungsmittelbereich gemachten Bemerkungen wenig aussagekräftig. Kommt hinzu, dass die<br />
<strong>Pro</strong>duktion von Nahrungsmitteln in afrikanischen Ländern im Gegensatz zu denen der industrialisierten Welt<br />
nur mangelhaft erfasst werden kann.<br />
4.20.2 Band 4: Die Kultur<br />
Der Band "Die Kultur", 1977 erschienen, soll auf 96 Seiten wie es in der Einführung heisst, "Einsicht geben in<br />
das heutige geographische Weltbild". Dazu schreibt der Autor auf der Seite 3:<br />
...Aus dem was wir ständig sehen, hören und erleben, wächst in uns eine Vorstellung von der näheren Umgebung und<br />
allmählich auch von der weiteren Welt, und sie ist unser Weltbild... Alles was wir denken, vorkehren, arbeiten, hängt nicht<br />
von allein von unserem Willen, sondern auch von unserem Weltbild ab. Wir richten unser Verhalten stak nach diesem<br />
Weltbild ein... Oder es hilft uns die Grenzen und Möglichkeiten menschlichen Tuns irgendwo in der Welt zu beurteilen...<br />
Das frei entstehende geographische Weltbild hat immer viel Zufälliges an sich. Vielleicht gerade wichtige Dinge entgehen<br />
uns. Oder das Weltbild wird einseitig, weil wir nur Erscheinungen, die uns passen, richtig aufnehmen... Es ist die Aufgabe<br />
der Geographie, für ein einigermassen lückenloses, wahres und verständliches Weltbild zu sorgen.<br />
Ein Ziel, das keines der untersuchten Lehrmittel erreicht, und das damit zwar einem Ideal entspricht, in der<br />
Schule aber scheinbar nicht verwirklicht werden kann. Daraus lässt sich die Forderung ableiten, den Schülern<br />
soll bewusst gemacht werden, dass sich das geographische Weltbild aus mehr oder weniger detaillierten Frag-<br />
menten zusammensetzt, die zu einem individuellen, zeitlich abhängigen, aber objektiv kaum "richtigen" Welt-<br />
bild führen.<br />
Bereits in der Einleitung stellt der Autor hohe Anforderungen an das eigene Werk. Wo er diese in Bezug auf<br />
das Bild des schwarzafrikanischen Menschen erfüllt, ist Gegenstand der nun folgenden Diskussion der Inhalte<br />
des Bandes "Die Kultur".<br />
4.20.2.1 Kultur<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Im Kapitel "Was heisst Kultur?" auf den Seiten 25-27 versucht der Autor einen ersten allgemeinen Einblick in<br />
die Kulturen der Menschen zu vermitteln. Auf der Seite 25 schreibt er, die Unterschiede zwischen den<br />
Menschen, sowie Mensch und Tier beschreibend:<br />
...Allmählich geht uns auf, dass unsere Sprache nicht die einzige ist, dass andere Menschen mit anderen Worten sich auch<br />
sagen können, was wir uns sagen. Aber auch die ganze Art, wie die Fremden sich benehmen, ist anders, als wie es gewohnt<br />
sind. Und so wird uns bewusst, dass man auch ein Mensch sein kann, wenn man völlig anders spricht, lebt und denkt, als<br />
wir es gelernt haben...<br />
Die Natur schreibt dem Menschen den Lebensweg nicht in allen Teilen vor... Die Freiheit, die Möglichkeit, sein Leben<br />
selbst zu bestimmen, ist ein grosses Geschenk... Bei den Menschen ist es unmöglich, vom einen Charakter auf den anderen<br />
zu schliessen. Jeder Mensch ist anders als die anderen, jeder hat seine eigene Art.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 236
Diese Worte unterscheiden sich von den in vielen Lehrbüchern gemachten, pauschalen Beschreibungen über<br />
die Völker Afrikas. Die genaue Betrachtung der im Buch abgedruckten Materialien wird zeigen, ob diese<br />
Grundüberlegungen auch praktisch umgesetzt werden, oder ob sie Theorie bleiben und damit im Konkreten die<br />
hier erhobenen Ansprüche nicht erfüllt werden. Über das Wesen der Kultur führt der Autor auf Seite 26 aus:<br />
...Zur Kultur gehört all das, was den Menschen menschlich macht. Kultur ist die gemeinsame Anstrengung, Mensch zu<br />
sein.<br />
Jede Kultur hat nun zwei Seiten, eine notwendige und eine freiheitliche... Darum sind die verschiedenen Kulturen auf der<br />
Erde immer auch an die Umwelt angepasst...<br />
Über die Unterschiede zwischen den Kulturen schreibt der Autor:<br />
...Jeder Mensch hat das Bedürfnis seinem Leben einen bestimmten Sinn, eine bestimmte Richtung zu geben... Also aus<br />
freier Entscheidung macht es der eine so und der andere ganz anders. Einer möchte bestimmte Ergebnisse erzielen; dem<br />
anderen ist es wichtiger, seiner Denkweise treu zu bleiben... So bildet sich bei jedem Volk eine eigene Kultur.<br />
Damit geht der Autor auf eine <strong>Pro</strong>blematik von grosser Tragweite ein, und es stellt sich die Frage, ob eine<br />
Kultur, wie die europäische, die sich vorwiegend am Fortschritt orientiert, überhaupt in der Lage ist, eine<br />
andere, die ihrer "Denkweise treu bleiben" möchte, wie beispielsweise die einiger Vertreter der "Pygmäen", zu<br />
verstehen. Ausserdem stellt sich die Frage nach der Berechtigung einer "fortschrittsgläubigen Kultur, dieses<br />
Streben nach Fortschritt einer Kultur, die einen anderen Weg eingeschlagen hat, aufzuzwingen, und sei es auch<br />
nur indirekt.<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Die beiden russischen Schriftsteller Strugatzki & Strugatzki sind diesem Thema in mehreren utopischen Erzäh-<br />
lungen und Romanen, unter anderem auch in "Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein", nachgegangen und zum<br />
Schluss gekommen, dass die Nichteinmischung, auch bei für die Augen eines Bürgers aus einem Industriestaat<br />
schrecklichen Verhältnissen, die einzig ethisch vertretbare Lösung darstellt. Allerdings postulieren sie auch<br />
ganz klar, dass wenn die Einmischung einmal Tatsache ist, und dies ist für Schwarzafrika bekanntlich der Fall,<br />
Verantwortung wahrgenommen werden muss. Damit befinden sie sich mitten in der vor einigen Jahren lancier-<br />
ten Diskussion über die Vor- und Nachteile der Entwicklungshilfe (siehe dazu auch die Seiten 222 und 260<br />
dieser Arbeit), obwohl sie nicht diese, sondern die Politik der Sowjetunion, gegenüber in und ausserhalb des<br />
Einflussbereiches dieses Staatenbundes lebenden Gruppierungen, thematisieren wollten. (Strugatzki, 1964)<br />
Auf der Seite 27 schliesslich beschreibt der Autor drei verschiedene Kulturstufen:<br />
1. Stufe: Die Menschen leben ganz mit der Natur zusammen. Sie passen sich vollständig an. Sie verändern nichts... Es gibt<br />
in südlichen, warmen Gebieten Völker... die noch mehr oder weniger auf dieser Kulturstufe stehen.<br />
2. Stufe: Die Menschen beginnen in die Natur einzugreifen, selbständiger zu werden. Sie nehmen die Natur in ihren<br />
Dienst, aber noch so, dass sie in ihrem Lauf in keiner Weise gestört wird... Auf dieser zweiten Stufe werden der<br />
Landschaft angepasste währschaftere Siedlungen, auch schon Städte errichtet. Auf dieser Kulturstufe leben heute noch<br />
viele Völker.<br />
3. Stufe: Schliesslich gelangt der Mensch zur Herrschaft über die Natur, die dazu führt, dass er sie stark umgestaltet...<br />
Sicherlich ist der Ansatz des Autors, die einzelnen Kulturstufen aufgrund des Grades des Eingriffs in die Natur<br />
zu definieren, legitim. Bei der Beschreibung der zweiten Stufe wird aber klar, wie heikel eine solche Defini-<br />
tion ist, wird doch die Natur gerade von Völkern, die Ackerbau betreiben, stark verändert, teilweise in einem<br />
solchen Masse, dass sich der ursprüngliche Zustand erst nach Jahrhunderten oder gar nicht mehr einstellt.<br />
4.20.2.2 Ausbreitung des Menschen und aktuelle Lage (1977)<br />
Das Kapitel "Die Ausbreitung des Menschen und die Umgestaltung der Erde" enthält auch eine für das Thema<br />
dieser Arbeit bedeutsame Aussagen. Nach dem Zugeständnis, dass die Kenntnisse von der ersten Menschen<br />
sehr bescheiden seien, schreibt der Autor unter dem Titel "Die ersten Menschen" auf der Seite 30:<br />
...Nach Knochenfunden in Afrika glaubt man zu wissen, dass die ersten Menschen dort gelebt haben... Nicht eindeutig zu<br />
beantworten ist die Frage, wie die ersten Menschen gelebt haben... Sicher führten sie ein einfaches Leben... Es gibt in<br />
Afrika heute noch sehr einfach lebende Menschen, zum Beispiel das Volk der Pygmäen. Es musste sich vor dem<br />
mächtigen Andrang anderer Menschen in das Urwaldgebiet zurückziehen,... Doch auch wenn die Pygmäen einfach leben,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 237
kennen sie Sagen und religiöse Vorstellungen, die auf einen recht regen Geist hinweisen. Und sie sind in der Lage,<br />
allerhand Gegenstände aus Holz und Bambus herzustellen: Tragkörbe, Matten, Gürtel, Speere, Pfeile und Bogen...<br />
Durch die Art der Formulierung erweckt der Autor den Eindruck, dass die "Pygmäen", weil sie in materieller<br />
Hinsicht in sehr einfachen Verhältnissen lebten, über geringere geistige Fähigkeiten verfügten, als beispiels-<br />
weise ein Europäer. Warum sonst würde er vermerken, dass es bei den "Pygmäen" Hinweise auf einen "recht<br />
regen Geist" gäbe. Auch die Formulierung, sie seien "in der Lage... allerhand Gegenstände aus Holz und<br />
Bambus herzustellen", weist nicht gerade auf eine hohe Einschätzung der intellektuellen Fähigkeiten der "Pyg-<br />
mäen" hin. Zudem verwechselt der Autor das tatsächliche Tun, nämlich das Herstellen gewisser Gegenstände,<br />
mit den diesem Menschen gegebenen Möglichkeiten, als wolle er damit sagen, ein "Pygmäe" sei aufgrund<br />
seiner Ursprünglichkeit geistig nicht in der Lage, etwas Komplizierteres herzustellen. (Zu den "Pygmäen"<br />
siehe auch die Seiten 213 und 240 dieser Arbeit.) Der Autor nimmt auch stillschweigend an, die "Pygmäen"<br />
hätten im Laufe der Menschwerdung seit dem Erreichen der ihr zugeteilten Kulturstufe immer auf dieser<br />
verharrt. Dies ist aber nur eine Vermutung. Aus der Geschichte Europas sind ganz unterschiedliche Kulturpha-<br />
sen bekannt, die keineswegs immer von einer "tieferen" zu einer "höheren" strebten. Trotzdem stellt der Text<br />
gegenüber der Darstellung in älteren Lehrmitteln einen Fortschritt dar.<br />
Auf der Seite 30 ist ein Foto "Pygmäen" abgebildet, dass einen Weissen zeigt, der eine Pygmäenfrau am Arm<br />
packt. Seite 31 zeigt zwei Karten "Lebensraum der ersten Menschen" und "Ausbreitungswege der frühen<br />
Menschen", die der heutigen Lehrmeinung entsprechen, auch wenn nicht alle Anthropologen die "Out-of-<br />
Africa"-Theorie vollumfänglich unterstützen. (Siehe dazu auch Seite 25 im zweiten Teil "Überblick über die<br />
Geschichte Schwarzafrikas" dieser Arbeit.)<br />
Im Zusammenhang mit der Kulturentwicklung des Menschen, der Entdeckung des Feuers und der Sprache,<br />
schreibt der Autor auf Seite 32:<br />
...Die Buschmänner, ein einfaches Volk im südwestlichen Afrika, benützen noch heute Zeichen, um sich auf der Jagd zu<br />
verständigen. So können sie einander ein entdecktes Tier beschreiben, ohne es zu verscheuchen...<br />
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 206 und 240 dieser Arbeit.) Auch hier gelten ähnliche Überle-<br />
gungen wie sich schon im Zusammenhang mit den "Pygmäen" gemacht wurden. Es scheint zwar naheliegend,<br />
diese Zeichen der "Buschmänner" auf eine urtümliche Kulturstufe zurückzuführen, aber niemand würde aus<br />
der Tatsache, dass ein Börsenmakler bei seinen Geschäften sich ebenfalls einer Zeichensprache bedient, daraus<br />
schliessen, dieser zeige Reste eines urtümlichen Verhaltens.<br />
Seite 33 zeigt 15 Beispiele, der von den "Buschmännern" benutzen Zeichen ihrer Zeichensprache. Davon<br />
werden aber nur drei einem konkreten Sachverhalt zugeordnet. Auf der gleichen Seite schreibt der Autor über<br />
die Rassen des Menschen: "Ähnlich aussehende Menschen fasst man zu Rassen zusammen". Dabei erwähnt er<br />
jedoch nicht, dass durch eine solche Definition, aufgrund der fliessenden Übergänge von einer "Rasse" zur<br />
anderen, eine sinnvolle Abgrenzung kaum mehr möglich ist.<br />
Auf der Seite 35 ist eine Karte "Wo eiszeitliche Menschen sicher gelebt haben" abgebildet, die Fundorte in<br />
Südafrika, um die grossen Seen und im Bereich des heutigen Tschad vermerkt.<br />
4.20.2.3 Der Kulturraum<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Im Kapitel "Afrika und Ozeanien; der südliche Kulturraum" definiert der Autor den südlichen Kulturraum in<br />
Afrika geographisch zwischen der Sahara und der Südspitze des Kontinents, mittels einer Karte auf der<br />
Seite 48. Die Zusammenfassung der Schwarzafrikaner mit den in Ozeanien lebenden Völkern mutet seltsam<br />
an, wenn man die verschiedenen Kulturen der beiden "Erdteile" vergleicht. Wahrscheinlich hat sich der Autor<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 238
weniger von der Kultur als vielmehr vom Aussehen der Bewohner des "südlichen Kulturraumes" leiten lassen.<br />
Auf Seite 49 gibt er den Brief eines im Kamerun arbeitenden Schweizers an dessen Eltern wieder:<br />
...Es gibt schöne Läden, Warenhäuser, autobefahrene Strassen und viele Menschen, meist schwarze in den Strassen und<br />
weisse in Geschäften und Büros.<br />
Nach dem Sonnenuntergang war es innert Minuten dunkelste Nacht geworden. Im Landrover verliessen wir das<br />
beleuchtete Europäerviertel, fuhren durch den Vorort der Einheimischen, dann noch an einzelnen, etwas versteckten<br />
Hütten vorbei, sahen hie und da ein Petrollämpchen auf der Veranda, und schliesslich verschluckte uns der Busch...<br />
...Auf Holperstrassen rüttelten wir durch Gummi-, Kaffee- und Bananenplantagen, hinein in den Urwald. Hier und dort<br />
duckten sich immer wieder beidseits des Weges Wohnhütten, mit Gras gedeckt die einen, mit Wellblech die anderen.<br />
Natursandboden im einzigen Raum, Tür und Fenster nur Löcher, des Nachts mit Brettern vermacht Mais zum Trocknen auf<br />
dem Dach, Kaffeebohnen auf dem Boden ausgebreitet. Am Wegrand schritten Menschen mit hohen Lasten auf dem Kopf<br />
in aufrechter, stolzer Haltung einher.<br />
Die Plantagen blieben nach und nach zurück... Nach drei Stunden Fahrt öffnete sich der Urwald wieder, und wir waren in<br />
Kumba, unserem heutigen Wohnort. 60'000 Einwohner zählt die Stadt. Sie ist eine Ansammlung verschiedener Stämme.<br />
Offizielle Sprache ist Englisch. Die Leute verständigen sich aber mit Pidgin, einem Gemisch von Englisch und<br />
Eingeborenendialekt.<br />
Der Autor beschreibt hier eindeutig die nachkolonialen Strukturen des 1961 unabhängig gewordenen Kame-<br />
runs: Die vergleichsweise reichen Europäer leben getrennt von den Schwarzafrikanern. Je ländlicher die<br />
Gegend wird, desto seltener trifft man auf Europäer. Dies ist in vielen Staaten Afrikas bis heute so geblieben.<br />
In der Stadt ist der weisse Europäer ebensowenig eine Sensation wie ein Schwarzer in einer grösseren Stadt der<br />
Schweiz. Auf dem Land hingegen bleibt der Europäer nach wie vor eine Sehenswürdigkeit für die einheimi-<br />
sche Bevölkerung.<br />
Die Beschreibung der Stadt Kumba als "Ansammlung verschiedener Stämme" zeigt wie tief gewisse Vorstel-<br />
lungen bei den Europäern verhaftet sind. Nebst der Idee des Tribalismus schwingt in dieser Formulierung auch<br />
eine Abwertung der von den Einheimischen geschaffenen Strukturen mit. Auf der Seite 50 fährt heisst es im<br />
Brief weiter:<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
...Wir fuhren über einen 2000 Meter hohen Pass, auf dem ein rauher Wind wehte. Unterwegs sahen wir Kabisfelder wie bei<br />
uns... In der Savanne hat man einen weiten Blick. Die Dächer der niederen Lehmhütten schauen wie Mützen aus dem Grün<br />
des Grases. Man hört tagsüber und nachts Trommelschläge, von Gesang, Schellen und Rasseln begleitet. Wir bekamen<br />
auch das vornehmere Steinhaus eines Häuptlings zu sehen. Seine 35 Frauen und 220 Kinder leben in Lehmhütten darum<br />
herum.<br />
Die hier angeführten Zahlen, sowohl die Frauen als auch die Kinder des Häuptlings betreffend, lassen gewisse<br />
Zweifel aufkommen. Insbesondere da der Briefschreiber diese auf der Durchreise "erfahren" haben musste.<br />
Möglicherweise liegt ein Missverständnis bezüglich der Verwandtschaftsverhältnisse vor, denn obwohl die<br />
Polygamie in Afrika immer noch recht weit verbreitet ist, beschränken sich selbst sehr wohlhabende Männer<br />
meist auf die Heirat mit wenigen Frauen. Im Brief heisst es weiter (S. 50):<br />
Noch weiter im Landesinneren, also noch weiter nördlich, wird das Land allmählich karger. Menschlichen Siedlungen<br />
begegnet man immer seltener. Der Grossteil der Bevölkerung lebt gegen die Küste hin; so bleibt für den Norden noch viel<br />
freies Land... Die Leute dort innen sind arm. Sie leben fast ausschliesslich von Hirse und Erdnüssen. Früchte gibt es kaum<br />
mehr. Im Sommer regnet es schon, aber dann fast zu stark. Dann sind die Strassen überflutet und oft unpassierbar. Die<br />
meisten Bewohner des Nordens sind Mohammedaner. Überall kann man sehen, wie sie den Gebetsteppich ausbreiten, aus<br />
einem Kaldor Wasser über Gesicht, Hände und Füsse giessen, sich gegen Mekka neigen, den Boden küssen und ihre<br />
Gebete verrichten.<br />
Je nach Angaben sollen Ende des 20. Jahrhunderts 25-51% der rund 14 Mio. Menschen zählendenden Bevöl-<br />
kerung Kameruns traditionellen Religionen anhängen, während 33-50% sich zum Christentum und 16-25%<br />
zum Islam bekennen, wobei das Christentum vor allem im Süden, d.h. den Küstengebieten, und der Islam vor<br />
allem im Norden - gegen die Sudanzone hin - dominant sind. (Zur Verbreitung der verschiedenen Religionen<br />
in den Ländern Schwarzafrikas siehe auch die Karte "Religionszugehörigkeit" auf der Seite 574 dieser Arbeit.)<br />
Weiter heisst es im Brief auf der Seite 50 des Lehrmittels:<br />
Am nördlichsten Punkt auf unserer Reise stiessen wir auf einen Ort, wo die Menschen noch nackt gehen und sich nur mit<br />
Ketten und Krallen schmücken. Die jungen Männer führten gerade einen Tanz auf mit Speer und Federkleid.<br />
Der Abschnitt suggeriert, die Völker Afrikas hätten sich erst nach dem Eintreffen der Europäer zu kleiden<br />
begonnen. Diese Vorstellung ist weitverbreitet aber falsch. Spärliche Bekleidung begrenzte sich immer auf die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 239
tropischen Gebiete, wo sie auch Sinn macht, da besonders im Regenwald Kleidung im europäischen Sinn unter<br />
dem herrschenden Klima sehr rasch zerfällt und zudem einen idealen Brutplatz für Hautkrankheiten und Para-<br />
siten liefert. Der Schweizer schreibt weiter:<br />
Interessant in afrikanischen Ortschaften sind die Märkte. Hier herrscht immer ein buntes Treiben. Nebst Gemüsen,<br />
Früchten und farbigen Stoffen wird auch Salz und Mais verkauft. Verpackt wird das Verkaufte in Blättern. Papier als<br />
Verpackungsmaterial sieht man selten, Plastik schon gar nicht. Aufgefallen ist mir immer wieder, wie liebenswürdig und<br />
freundlich die Leute sind...<br />
Obwohl unterdessen auch Plastiksäcke als Verpackung diverser Waren dienen, die traditionell mit Pflanzen-<br />
material eingepackt wurden, sieht man selbst in grösseren Städten auch heute noch die beschriebene Form der<br />
Naturverpackung. Auf Seite 51 schreibt der Autor, seine allgemeinen Gedanken zum Kulturraum<br />
abschliessend:<br />
...Im südlichen Kulturraum leben etwa 280 Millionen Menschen, nur 7% aller Menschen auf der Erde. Weitaus der grösste<br />
Teil bewohnt... Afrika... Sofern es sich um eingewanderte Europäer, Amerikaner oder Asiaten handelt, versuchen sie, so<br />
gut es geht. so zu leben, wie sie es von daheim gewohnt sind. Die Einheimischen aber haben im Laufe der Jahrhunderte<br />
ihre eigene Kultur, ihre eigene Art, das Leben zu meistern, entwickelt.<br />
Es gibt im südlichen Kulturraum verschiedene Lebensweisen, aber alle gleichen sich darin, dass sie natürlich und einfach<br />
sind. Natürlichkeit und Einfachheit sind die wichtigen Eigenschaften der südlichen Kultur. Das Schöne daran wirst du<br />
selber finden, wenn du dich in die Lage jener Menschen zu versetzen versuchst.<br />
Nicht in allen in Schwarzafrika geschaffenen Kulturen haben die Menschen ein so einfaches und natürliches<br />
Leben geführt, wie der Autor es hier zu vermitteln scheint. Die Aufforderung an die Schüler, das "Schöne<br />
daran" zu finden ist gefährlich. Leicht könnten diese falsche Schlussfolgerungen ziehen, denn oft liefert gerade<br />
die Armut und nicht das Natürliche die pitoresken Bilder, die der Besucher aus den Industrienationen so sehr<br />
sucht. In Wahrheit ist dieses natürliche Leben voller Gefahren und Entbehrungen, deren Folge vermeidbare<br />
Krankheit und früher Tod sein können. Es gibt heute wohl kaum mehr Schwarzafrikaner, die sich voll und<br />
ganz nach dieser "Natürlichkeit" zurücksehnen, denn auch die einstmals Unterdrückten wissen einige Aspekte<br />
der westlichen Zivilisation, z. B. die Schulmedizin, durchaus zu schätzen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie als<br />
mündige Menschen andere Aspekte dieser Lebensweise nicht auch ablehnen, denn gerade die Schwarzafrika-<br />
ner haben es immer wieder verstanden, Einflüsse von aussen in ihre eigene Kulturentwicklung einfliessen zu<br />
lassen, ohne sich den fremden Einflüssen blind anzuvertrauen. Das Ringen vieler Menschen in den ehemaligen<br />
Kolonien nach einem neuen Selbstbewusstsein und einen "afrikanischen Weg" ist Zeichen dieser Auseinander-<br />
setzung, die zumindest teilweise auf bewussten Entscheiden beruht - und nicht wie manchmal behauptet auf<br />
dem Unvermögen der Afrikaner sich anzupassen.<br />
4.20.2.4 Lebensweisen<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Unter dem Titel "Die einfachste Lebensweise" schreibt der Autor auf der Seite 51:<br />
Fast alle von uns glauben an den Fortschritt... Im südlichen Kulturraum gibt es Völker, die heute noch so wie vor<br />
Jahrtausenden leben. Die Frage nach einem Fortschritt hat sich bei ihnen noch nie gestellt... Auch in unserem eigenen<br />
Leben gibt es Dinge, von denen wir wünschten, dass sie immer gleich bleiben würden. Bei vielem hoffen wir auf eine<br />
baldige Veränderung, aber einiges möchten wir so behalten, wie es immer war...<br />
Zur Unterlegung dieser einleitenden Worte über die "einfachste Lebensweise" führt der Autor als Beispiel für<br />
Afrika die "Buschmänner" und die "Pygmäen" an, über die er auf der Seite 53 schreibt:<br />
Im Trockengebiet der Kalahari im Süden Afrikas leben die Buschmänner. Die Männer jagen Antilopen und Strausse, die<br />
Frauen sammeln pflanzliche Nahrung sowie Schildkröten, Eidechsen, Schlangen und Termiten. Wichtig für Mensch und<br />
Tier sind die Wasserlöcher, von denen sich beide nicht zu weit entfernen können. Dadurch, dass eindringende fremde<br />
Menschen immer mehr von ihrem Land als Weideland benützten, wurden die Buschmänner zurückgedrängt und zum Teil<br />
gezwungen, ihr altes Leben aufzugeben. Im dichten Urwald Zentralafrikas sind es die Pygmäen, die noch ein ganz<br />
ursprüngliches Leben führen. Sie ziehen dort umher, indem sie sich den Bewegungen des Wildes anschliessen. Vor allem<br />
die Jüngeren haben die Aufgabe zu jagen. Die Älteren regeln das Zusammenleben und sorgen dafür, dass keine<br />
Streitigkeiten aufkommen. Einen Häuptling kennen die Pygmäen noch nicht. Jeder Stammesangehörige kann<br />
mitentscheiden. Im Urwald haben die Pygmäen während des ganzen Jahres ziemlich gleichmässige Lebensbedingungen.<br />
Die einzige streng jahreszeitlich gebundene Tätigkeit ist das zweimonatige Honigsammeln. Gejagt werden vor allem<br />
Antilopen, im östlichen Waldgebiet mit Pfeil und Bogen, im Westen dagegen mehr in gemeinschaftlicher Treibjagd mit<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 240
Netzen. Die Jägergruppen sind klein, Frauen und Kinder unterstützen als Treiber die Netzjagd. Auch Elefanten, Okapis,<br />
Affen und Vögeln wird nachgestellt. Das Sammeln von Schnecken und Termiten. Wurzeln und Pilzen, Beeren und Nüssen<br />
bringt weitere Abwechslung in die Nahrung. Die Frauen erledigen diese Arbeit. Vorräte müssen nicht angelegt werden,<br />
denn man findet immer etwas. Im ganzen leben noch etwa 170'000 Pygmäen.<br />
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 237 und 293, zu den "Buschmännern" die Seiten 238 und 250.)<br />
Unter dem Titel "Vielfältige Lebensweise" gibt der Autor auf der Seite 54 einen Überblick über die Völker<br />
Afrikas, die "nicht mehr so einfach" wie die "Buschmänner" und "Pygmäen", aber "gleichwohl noch sehr<br />
natürlich" leben. Mittels einer Karte versucht der Autor, einen Überblick über diese "etwa 750" Völker zu<br />
geben. Als im Waldgebiet lebend, zählt der auf: Grebi, Bete, Aschanti, Joruba, Ibo, Jaunde, Duma, Bokaka,<br />
Bwaka, Bali, Kundu, Wumbu, Lunda. Als "im offenen Land lebende Völker" nennt der Autor: Malinke,<br />
Dogon, Senufo, Songhai, Mossi, Hausa, Jukun, Manga, Mandara, Kreisch, Nuba, Azande, Dume, Galla,<br />
Massai, Njamwezi, Shambala, Makua, Njandja, Lamba, Totela, Buschmänner, Hottentotten, Koba, Chikunda,<br />
Tswana, Zulu. Und für Madagaskar führt er die Sakalava, Bara und Betsimisaraka an.<br />
Auf der gleichen Seite ist auch das Foto "Markt in einer afrikanischen Siedlung" abgebildet, welches eine typi-<br />
sche Marktsituation zeigt, wie sie im Brief eines Schweizers aus Kamerun, der auf Seite 239 dieser Arbeit<br />
besprochen wurde, geschildert wird.<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Der Autor lässt eine Beschreibung eines "Afrikakenners" über das Leben vieler afrikanischer Völker "abseits<br />
von Städten und fremden Einfluss" folgen (S. 54f.):<br />
Erwachen in einer Hütte, das bedeutet zuerst ein Lauschen, ein Hineinhorchen in eine immer wieder wunderbare Welt. Da<br />
sind die Stimmen der Vögel, ebenso jäh aufjubelnd wie das rasch hereinbrechende Licht. Es ist sechs Uhr früh und mit<br />
einem Schlag Tag. Mit einemmal reiben sich die Menschen und die Tiere den tiefen Schlaf aus den Augen. Die Tauben<br />
gurren, der Kuckuck lässt sich wieder und wieder hören, und aus dem Chor unbekannter Vogelstimmen lösen sich das<br />
scharfe Gezwitscher der Weber und die sanften Töne der Nektarvogel. Dann werden menschliche Stimmen wach, ein Ruf,<br />
ein Gelächter, ein fröhlicher Gruss.<br />
Im ersten Abschnitt wird bereits klar, dass die Beschreibung ganz aus europäischer Sicht geschieht, denn der<br />
typische Bewohner dieses Dorfes würde wahrscheinlich ebenso wenig Gedanken an den Lärm der Vögel<br />
verschwenden, wie dies der Städter in Europa hinsichtlich des Autoverkehrs tut. Die Geräuschkulisse fällt nur<br />
dem nicht an sie gewohnten Besucher auf. Richtig wird geschildert, dass die Menschen sehr früh aufstehen.<br />
Schulkinder stehen meist noch vor Tagesanbruch auf, da sie vor der Schule, die oft nur über einen langen<br />
Schulweg zu erreichen ist, noch einige Verrichtungen im Haus, wie etwa den Hofplatz kehren oder Wasserho-<br />
len, erledigen müssen. Der "Afrikakenner" schreibt weiter:<br />
Von der offenen Veranda meiner Hütte im Häuptlingsbezirk kann ich das tiefer gelegene Dorf überblicken. Überall sehe<br />
ich Frauen, Männer und Kinder gemächlich hervorkommen. Blinzelnd und sich wohlig reckend, treten sie aus ihren<br />
dunklen Behausungen ans Licht. Die jungen Frauen und die Mädchen gehen zum Bach hinunter. Bald kehren sie zurück,<br />
die schweren gefüllten Gefässe wie gewichtslos frei auf dem Kopf balancierend.<br />
Wer versucht, es diesen afrikanischen Frauen nachzumachen, wird bald die Schwierigkeit des Unterfangens<br />
einsehen müssen. Wesentlich erleichtert wird das Tragen der Gefässe durch ein zu einem Ring zusammenge-<br />
wickelten und auf dem Kopf getragenes Tuch, das einerseits dem Gefäss eine stabilere Lage verleiht und ande-<br />
rerseits vor dem drückenden Gewicht schützt. Im Bericht heisst es weiter:<br />
Während ich auf das Wärmen meines Badewassers warte, entfaltet sich vor mir Bild auf Bild. Hier und da wird zwischen<br />
den spitzdachigen Hütten ein Feuer entzündet und ein eiserner Topf darübergestellt. Männer putzen sich im Auf- und<br />
Abgehen mit faserigen Stäbchen die Zähne. Lachend verschwinden Frauen hinter ihren Badezäunen und hängen die<br />
Eingänge mit bunten Tüchern zu. Andere Frauen sind mit ihrer Morgentoilette schon fertig. Sie haben Reis oder<br />
Kassawawurzeln in die grossen, hölzernen Mörser geschüttet, und der mir vertraute Ton des rhythmischen Stampfens mit<br />
den mannshohen Stangen verstärkt den Eindruck einer glücklichen Stunde.<br />
Die beschriebene Zahnhygiene hat bis heute zur Folge, dass viele Menschen den ganzen Tag auf einem Stück<br />
Holz bestimmter Baumarten herumkauen, obwohl sie die Zähne wahrscheinlich auch mit einer Zahnbürste<br />
putzen. Ähnliche Beobachtungen kann man bei älteren Leuten auch noch in einigen Gegenden Europas<br />
machen. Das "rhythmische Stampfen" der Frauen bei der Nahrungsmittelzubereitung, das dem "Afrikakenner"<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 241
eine "glückliche Stunde" beschert, bedeutet eine für die Frauen zur täglichen Pflicht gehörende Schwerstarbeit.<br />
Ebensogut könnte man von der Romantik eines Bauern sprechen, der zur frühen Morgenstunde seine Kühe<br />
melkt. Beide Tätigkeiten, wie exotisch sie auf den Aussenstehenden auch wirken mögen, dienen letztendlich<br />
nur dazu, sich selbst und andere mit Nahrungsmittel zu versorgen. Der Berichterstatter schreibt dann auch<br />
richtig:<br />
Das Leben der so mit der Natur verbundenen Menschen ist nicht gefahrlos. Es ist weniger gesichert, weniger beschirmt als<br />
das unsere Und doch entströmt dieser Heimstatt von Menschen, die nach unseren Begriffen nichts besitzen, eine gesunde<br />
Lebensfreude, wie wir sie in dieser elementaren Stärke in unseren Gegenden nirgends finden. Die reine Lust am Dasein ist<br />
den Menschen eigen.<br />
Ähnlich wie in asiatischen Kulturen werden sehr viele Emotionen unter einem Lächeln verborgen. Die Äusse-<br />
rung von Gefühlen wie Wut und Ärger wird als Unbeherrschtheit angesehen, welche einen Mitmenschen<br />
verletzten könnte. Aus diesem Grund erfährt die natürliche "Lebensfreude" vieler Afrikaner durch ihre Mimik<br />
in den Augen des Europäers noch einmal eine Verstärkung. Aufgrund der anderen Lebenserfahrungen und des<br />
Kulturunterschiedes - vor allem die Stütze der Gemeinschaft ist ungemein wichtig - ertragen viele Menschen<br />
Schwarzafrikas Unbillen, die den Europäer in eine schwere Depression führen können. Das heisst aber keines-<br />
wegs, dass diese Menschen mehr Leid ertragen würden, als dies bei den Bewohnern der industrialisierten<br />
Nationen der Fall ist. Denn der Afrikaner ist nicht einfach so mit einer "elementaren Stärke" und "gesunder<br />
Lebensfreude" gesegnet, sondern diese Eigenschaften sind das Resultat seiner Erziehung und Kultur. Weiter<br />
schreibt der "Afrikakenner":<br />
Ein Gang durchs Dorf. Es ist acht Uhr vorbei. Der Ort ist belebt, denn um diese Jahreszeit ist die Feldarbeit im<br />
wesentlichen beendet. In den Zeiten von Saat und Ernte leeren sich die Dörfer am Morgen schnell. Jetzt aber sitzen die<br />
Männer plaudernd vor ihren Hütten. Die Frauen bereiten die Hauptmahlzeit des Tages vor. Andere geben sich mit den<br />
kleinen Kindern ab. Da und dort lässt sich eine junge Frau von einer anderen eine kunstvolle Frisur machen.<br />
(Ursprünglich gab die Art der Frisur über Volkszugehörigkeit und Zivilstand einer Frau Auskunft, heute dient<br />
sie in den meisten Teilen Schwarzafrikas vorwiegend der Zier.)<br />
Ich werde höflich gegrüsst. Einige dienstwillige Unbekannte folgen mir in achtungsvollem Abstand. Kinder, die dem<br />
sonderbaren weissen Mann nachstarren, werden verscheucht. Als ich bei den schmalen Gärten zwischen Dorf und Busch<br />
stehenbleibe, zeigen mir die Männer eifrig die Art ihres Anbaus. Ein Alter bricht einen zwei Meter hohen Stengel der<br />
Kassawa und zeigt mir die fein gegliederten Blätter von bläulichem Grün. Dann bricht er den Stengel in viele Stücke und<br />
stösst sie in den Boden. In wenigen Monaten werden diese Stecklinge die langen, armdicken Wurzeln erzeugen, die neben<br />
dem Reis die wichtigste Nahrung hierzulande sind.<br />
Die Kassawa (Manihot esculenta) ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen der warmfeuchten Tropen. Die<br />
ursprünglich aus Südamerika stammende Pflanze wurde im 16. Jh. von den Portugiesen nach Westafrika<br />
gebracht. Von dort verbreitete sie sich über weite Teile Schwarzafrikas. Die Wurzelknollen, der zu den Wolfs-<br />
milchgewächsen zählende Pflanze, müssen wegen ihres Blausäuregehaltes zuerst ausgepresst, dann gekocht<br />
werden, bevor sie geniessbar werden. Einmal geerntet, müssen die Knollen relativ rasch verarbeitet werden, da<br />
sie sonst zu faulen beginnen. Dies geschieht von Hand im Mörser oder in Fabriken, indem aus den Knollen ein<br />
haltbares Mehl hergestellt wird. (Lötschert/Beese, 1992, S. 176-177) In manchen Ländern Schwarzafrikas,<br />
beispielsweise in Sierra Leone, dienen die Blätter der Pflanze als Gemüse. (Zur Maniokpflanze siehe auch die<br />
Seiten 155 und 286 dieser Arbeit.)<br />
4.20.2.5 Erziehung<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Der Autor schreibt, dass "Sitte und Gemeinschaft" das Wesentliche der Kultur der Menschen Schwarzafrikas<br />
ausmachen würden. Seite 55 zeigt die beiden Fotos "Der Häuptling von Fossimondi (Kamerun) spricht zu<br />
seinen Leuten" und "In der Stadt Accra". Auf Seite 56 fährt der Autor fort:<br />
...Der Mensch ist kein Einzelwesen. Das Menschliche im Menschen entwickelt sich erst in der Gemeinschaft. Und jedes<br />
Zusammenleben, soll es friedlich und fruchtbar sein, muss durch Sitten geregelt werden. Diese Überzeugungen<br />
beherrschen das ganze Leben hier.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 242
In einer Kultur, die wenig geschriebene Gesetze und Verordnungen kennt, erscheint der einzelne Mensch ungebunden. Er<br />
ist es aber nicht. Die Sitte bindet ihn stark an seine Familie und an sein Volk. Der Afrikaner fühlt sich stets als Glied dieser<br />
natürlichen Ordnungen. Die wichtigste Aufgabe der Erziehung besteht darin, dem jungen Menschen diese Bindung immer<br />
wieder in Erinnerung zu rufen, so dass er sie niemals vergessen kann. In der entscheidenden Entwicklungszeit, im<br />
Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen, übernimmt die Gemeinschaft die Erziehung der Jugend aus der Hand der<br />
Eltern. Die Knaben und Mädchen verschwinden für einige Zeit im Busch und werden dort von den Hütern der<br />
Geheimnisse in die Sitten eingeführt. Es ist bezeichnend für die Afrikaner, dass jene Stämme das höchste Ansehen<br />
geniessen, in denen diese Unterweisung der Jugend mit besonderem Ernst erfolgt.<br />
Je nach Volk werden sehr unterschiedliche Bräuche und Rituale vollzogen. Generell kann aber gesagt werden,<br />
dass viele dieser Bräuche, einerseits durch die Missionierung, andererseits durch das immer weiter ausgebaute<br />
Schulwesen, auch auf dem Land zusehends an Bedeutung verlieren. Besonders in den Städten Afrikas stellen<br />
sich vielen Eltern in der Erziehung ihrer Kinder ähnliche Fragen, wie die, welche ein europäisches Elternpaar<br />
beschäftigen: Verwöhne ich meine Kinder nicht zu sehr: Als ich jung war, mussten wir doch..? Habe ich nicht<br />
unter diesen oder jenen Umständen gelitten, wie kann ich meinen Kindern eine bessere Erziehung bieten? Ist<br />
es richtig, mein Kind zu schlagen? Diese und andere Fragen zeigen, dass besonders in den Städten viele<br />
Menschen nach einer ihrer neuen Lebensweise angepassten Erziehung suchen. Nicht verkennen sollte man<br />
dabei den Einfluss der amerikanischen Filme und Fernsehserien, die ein recht einseitiges Bild vermitteln und<br />
dadurch in den Köpfen der Jugendlichen oft ganz falsche Vorstellungen im Bezug auf ihre eigenes Leben<br />
wecken.<br />
Der Autor fährt weiter mit der Schilderung einer traditionellen Initation (S. 56):<br />
Dem Verschwinden der Jungen im Busch liegt die Vorstellung zugrunde, dass der grosse Geist des Urwalds die Kinder<br />
verschlingt und dass sie dann als Erwachsene wiedergeboren werden. Durch geheimnisvolle Schreie im Busch und durch<br />
Musik auf Tonflöten zeigt sich die Stunde der Wiedergeburt an. Dann verkündet der Rufer des Häuptlings, dass die<br />
Wiedergeburt erfolgt ist. In der Dämmerung fordert er nachher die Eltern auf, die neuen Erwachsenen zu empfangen. Sie<br />
hocken vor dem Eingang zum Dorf auf Matten und sind mit Tüchern verdeckt. Nun nennt der Rufer die neuen Namen,<br />
denn die früheren sind bei der Wiedergeburt erloschen, und führt die Familien wieder zusammen. Ist im Busch jemand an<br />
einer Krankheit oder an einer Blutvergiftung gestorben, so findet die Familie eine zerbrochene Schale vor ihrer Hütte. Der<br />
Name des Verstorbenen wird nicht mehr genannt. und es darf auch nicht getrauert und nach ihm gefragt werden.<br />
Diese Schilderung trifft auf ein Volk oder eine Volksgruppe zu. Vielen anderen Völkern Schwarzafrikas würde<br />
sie genauso fremd anmuten wie einem Europäer. Der Autor fährt mit der Schilderung des Lebens in einem<br />
Dorf fort (S. 56):<br />
...Während meines Aufenthaltes im Dorf schaute ich gerne dem Treiben im Häuptlingsbezirk zu. Am Ende des grossen<br />
Platzes stand das Gefängnis, eine runde, fensterlose Hütte, nicht viel anders als die Wohnhütten im Dorf. Tagsüber sassen<br />
die Gefangenen im Schatten des weit überhängenden Daches. Sie plauderten und verfolgten mit Interesse, was um sie<br />
herum geschah. Sie schienen sich selber zu beaufsichtigen. Die meisten waren zu Geldstrafen verurteilt und warteten ab,<br />
bis ihre Familien den erforderlichen Betrag zusammengebracht hatten. Die Angehörigen sind unausweichlich zur Hilfe<br />
verpflichtet. Es ist für sie die grössere Schmach, wenn der Verurteilte lange im Gefängnis sitzen muss, als für diesen selber.<br />
Für viele Afrikaner ist das Absitzen einer Gefängnisstrafe, ja sogar schon der Verdacht der Verhaftung durch<br />
die Polizei eine Schande, durch die sie "ihr Gesicht" vor der Gemeinschaft verlieren. So ist es beispielsweise<br />
im Norden Ghanas üblich, dass ein zu Verhaftender nicht von der Polizei ins Gefängnis überführt wird,<br />
sondern sich selbst ohne Begleitung auf den Weg dorthin macht. Oft kann durch das Vermitteln der Verwand-<br />
ten eine Strafe bei kleineren Vergehen durch einen Vergleich mit der Person, die Anzeige erstattet hatte,<br />
vermieden werden.<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Immer wieder stellte ich im Dorf fest, dass man mit den Afrikanern gut auskommt, wenn man auf sie eingeht und nett zu<br />
ihnen ist. Nicht ertragen können sie es, wenn sie von irgend jemandem verächtlich behandelt werden. Wer verächtlich<br />
behandelt wird, ist tief getroffen. Mancher Afrikaner, dem das geschieht, entschliesst sich zum Äussersten: er verlässt sein<br />
Dorf, um niemals wiederzukehren. Nur wenn man an diese Feinfühligkeit denkt, versteht man die Einstellung gegenüber<br />
den nicht immer geschickten Weissen.<br />
Das "Gesicht zu wahren" ist vielen Afrikaner ebenso wichtig wie einem Chinesen oder Japaner. Aus diesem<br />
Grund werden auch Forderungen und Anfragen in einer wenig direkten Form vorgebracht. Dem Gegenüber<br />
sollte die Möglichkeit gewahrt bleiben, "Nein" zu sagen, ohne dieses Nein tatsächlich aussprechen zu müssen.<br />
Sich direkt an die Schüler wendend, schreibt der Autor zum Thema Landflucht auf der Seite 56:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 243
Du findest das eben beschriebene dörfliche Leben in Afrika wahrscheinlich schön. Aber viele Afrikaner sind doch nicht<br />
mehr zufrieden damit. Die Städte nämlich mit all ihren modernen Einrichtungen werden für sie interessanter, und viele<br />
versuchen heute den Sprung dorthin. Sie hoffen auch mehr zu verdienen als im Dorf. Ausser den Städten haben wegen der<br />
besseren Verdienstmöglichkeiten auch noch die Grosspflanzungen eine gewisse Anziehungskraft. Sie locken, wie die<br />
Städte, die Menschen aus den Dörfern heraus. Dadurch entsteht aber eine grosse Unruhe im afrikanischen Leben und mit<br />
der Zeit wahrscheinlich eine ganz neue Kultur.<br />
Diese neue Kultur, die auch zu einem neuen Bewusstsein geführt hat, kann heute in vielen Städten Afrikas<br />
erlebt werden. Initiiert wurde sie ursprünglich durch die Politik der Kolonialmächte, unterdessen wird sie<br />
durch die Medien gefördert. Solange es dem Einzelnen aber möglich ist, wird er in der Regel zumindest zeit-<br />
weise zu seiner Familie zurückkehren, um einige Zeit mit seinen Angehörigen zu verbringen, und beispiels-<br />
weise die Spezialitäten seiner Mutter zu geniessen.<br />
Was in Afrika jetzt geschieht, kann als eine grosse Landflucht bezeichnet werden. Es wird sogar etwa von der<br />
afrikanischen Völkerwanderung gesprochen. Die Dörfer entleeren sich, und die Stadtgebiete, in die die Menschen streben,<br />
sind der Zuwanderung nicht gewachsen. Es gibt nicht genügend Arbeitsplätze, nicht genügend Wohnungen; den Arbeitern<br />
fehlt die Ausbildung, und sie verdienen nicht so viel, dass sie sich all das Erträumte leisten könnten.<br />
Durch die neuen Einflüsse wandelt sich das Leben vieler Menschen Schwarzafrikas. Ob für den einzelnen eine<br />
sinnvolle Neuorientierung möglich ist, hängt von vielen Faktoren und seinen eigenen Umständen ab. Als<br />
Beispiel einer möglichen Entwicklung erwähnt der Autor die Politik des damaligen Präsidenten von Tansania,<br />
Nyerere. Ein Foto "Siedlung am Stadtrand" illustriert die Infrastrukturprobleme vieler afrikanischer Städte.<br />
4.20.2.6 Schule<br />
Unter dem Titel "Schule, Religion, Politik" bespricht der Autor anhand von Texten Einheimischer diesen<br />
Themenkreis des menschlichen Zusammenlebens. Die Besprechung des Schulwesens wird durch drei Fotos<br />
"Französischunterricht in einer afrikanischen Schule", "Pausenplatz: Schüler beim Grasschlagen" und "Physik-<br />
unterricht" auf den Seiten 57 und 58 unterstützt. Der Autor lässt einen nicht namentlich erwähnten Afrikaner<br />
zu Wort kommen, der über einen "guten Überblick über seine Kultur" verfügt (S. 57):<br />
Ich ging in Tanzania in Ostafrika in die Schule. Der Name meines Landes setzt sich aus drei Teilen zusammen, aus den<br />
Anfangsbuchstaben von Tanganyika und Zanzibar sowie den Schlussbuchstaben von Azania. Azania ist eine alte<br />
griechische Bezeichnung für Ostafrika... Meine erste Schule war die Abendunterhaltung von Erwachsenen und Kindern am<br />
Feuer. Am Feuer wurde viel erzählt, und da lernten wir die Weisheiten der Erwachsenen und unserer Vorfahren kennen.<br />
Wie überall in Afrika, so hatten auch wir einen engen Zusammenhang in der Familie und mit all unseren Mitmenschen.<br />
Man hörte aufeinander und profitierte voneinander. Vor allem das gemeinsame Schlafhaus der Knaben kettete die jüngeren<br />
und älteren zu einer engen Gemeinschaft. Auch bei der Arbeit lernten wir voneinander. Man verrichtete eine Arbeit<br />
sowieso immer zusammen, und da sieht man, wie es die anderen machen.<br />
(Zur Bedeutung der Feuerstelle als Ort der Vermittlung der Tradition siehe auch die Seite 335 dieser Arbeit.)<br />
Offensichtlich gehört der Erzähler zu einem Volk Tansanias, welches eine auf der Altersschicht basierende<br />
Gesellschaftsstruktur kennt. In dieser Form des Zusammenlebens ist nicht die Familie die Einheit der Gesell-<br />
schaft, sondern sie wird durch den Zusammenschluss Gleichaltriger oder Gleichgestellter gebildet. Weiter<br />
heisst es in der Schilderung:<br />
Man hatte dann die Möglichkeit, in die Schulen der Kolonialmächte zu gehen. Aber hier nahmen sie nicht Rücksicht auf<br />
das, was uns lieb war und uns interessierte. Unsere alten Überlieferungen wurden in diesen Schulen oft nicht ernst<br />
genommen und in vielen Fällen sogar zerstört. Sie bildeten einfach Hilfskräfte für die Kolonialverwaltung aus. Dadurch<br />
wurden wir entwurzelt.<br />
Vor allem in der Kolonialzeit lernten die afrikanischen Schüler in der Schule denselben Stoff, der auch den<br />
Schülern in Europa vorgesetzt wurde, d. h. anstatt die Geographie des eigenen Landes besser kennenzulernen,<br />
mussten sie sich beispielsweise mit den Flüssen Europas auseinandersetzten. Selbst im heutigen Schulwesen,<br />
und obwohl unterdessen auch im eigenen Land erstellte Lehrmittel auf den Markt und in die Schulen gelangen,<br />
kann es immer noch vorkommen, dass die Schüler beispielsweise im Französischunterricht Vokabeln zum<br />
Thema Winter in Nordamerika lernen müssen.<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 244
Der Autor lässt den Afrikaner am Beispiel von Tansania über die Veränderungen der Schule weiter berichten<br />
(S. 57):<br />
Nun sind wir frei... und jetzt können wir uns so bilden, wie wir es selber für richtig halten. Die mir bekannte<br />
Bildungsreform in Tanzania hat zwei Ziele: Zuerst muss einmal jeder Tanzanier Bauer werden. Es ist eine siebenjährige<br />
Primarschulbildung vorgesehen, durch die man Bauer wird und moderne Landwirtschaftsmethoden kennenlernt. Die<br />
Bevölkerung Afrikas lebt eben vorwiegend vom Ackerbau. Auch wenn einer später an einer Hochschule studieren will, ist<br />
es nötig, dass er vorher landwirtschaftliche Kenntnisse erwirbt.<br />
Zweitens muss man das, was man in der Schule lernt, auch anwenden können. Darum wird alles auf der Schulfarm und in<br />
der Schulwerkstatt ausprobiert. Die Schule hat auch von dem zu leben, was sie selber hervorbringt. So merkt der Schüler,<br />
dass sein Wohlergehen von der <strong>Pro</strong>duktion von Gütern abhängt. Je mehr erzeugt wird, desto besser geht es der Schule.<br />
Jeder lernt dabei auch Verantwortung tragen. Ganz besonders aber wirkt solche Erziehung der intellektuellen Arroganz<br />
entgegen...<br />
Die damalige Politik Tansanias war vor allem von praktischen Überlegungen bestimmt, daneben hat aber auch<br />
sozialistisches und teilweise wohl auch maoistisches Gedankengut Eingang in die grundsätzliche Überlegun-<br />
gen gefunden.<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Auf den Seiten 57-58 druckt der Autor vier Beispiele aus afrikanischen Aufsätzen ab, die im Bewusstsein der<br />
<strong>Pro</strong>blematik einer Übersetzung hier wiedergegeben werden sollen, da sie einen interessanten Vergleich zu<br />
Texten neueren Datums ermöglichen. Im ersten Beispiel aus Kamerun heisst es (S. 57f.):<br />
Mein Name ist R. N. Ich bin in Buea, der Hauptstadt Westkameruns, geboren im Jahre 1943. Mein Vater, A. N., welcher<br />
Lehrer an einer Missionsschule ist, hat mir von klein auf beigebracht, Englisch zu sprechen.<br />
Ich war sehr klein und kindlich in meinem Gebaren. In der Nachbarschaft hatte es viele andere kleine Kinder, mit denen<br />
ich beim Spiel die Zeit vergeudete. Wir pflegten jeweils eine Anzahl Stöcke zu schneiden, aus, denen wir das Gerüst einer<br />
Hütte errichteten. Das Dach wurde mit Blättern bedeckt, während die Wände aus Papier oder ebenfalls aus Blättern<br />
verfertigt wurden. Dann suchten wir alte Konservenbüchsen zusammen und benutzten sie in unserer baufälligen Hütte als<br />
Kochgeschirr. Unserer Mutter nahmen wir Reis. Einige Freunde besorgten Palmöl, andere Pfeffer und Salz. So konnten wir<br />
uns herrliche Mahlzeiten zubereiten.<br />
Nach dem Essen bastelten wir Lastwagen. Eines Tages schnitten wir sogar Räder aus Baumstämmen und bauten eine Art<br />
Seifenkistenauto, das einen Abhang hinunterfahren konnte. Solche Dinge machten uns übermütig, weshalb mir mein Vater<br />
verbot, weiterhin mit meinen Kameraden zu spielen.<br />
Eines Abends, als ich mit meinem Vater plauderte, begann er mich über die Organisation und die Überlieferungen unseres<br />
Stammes aufzuklären. Von jetzt an musste ich die Stammesvorschriften streng beachten. Dazu gehört zum Beispiel, dass<br />
man sich nicht auf gewisse Steine setzen darf, ohne dabei bestimmte Worte zu sagen. Es war mir auch von jetzt an nicht<br />
mehr erlaubt, gewisse Teile der Stadt zu betreten. Dies deshalb, weil einige Leute als Hexer galten und mit einem Tabu<br />
belegt waren.<br />
Aus dem Text lässt sich einiges über die Haltung des Vaters des Schreibers erfahren, der wohl in einem Zwie-<br />
spalt zwischen alter und neuer Lebensweise gestanden hat. In seiner Erziehung kommen aber zwei auch in<br />
anderen Gegenden Westafrikas typische Phasen zur Geltung. Wenn das Kind noch klein ist, geniesst es sehr<br />
grosse Freiheiten, erreicht es ein bestimmtes Alter, wird es in die Verantwortung eingebunden und muss dann<br />
gewisse Pflichten ohne Murren erfüllen, wenn es nicht bestraft werden will. Wobei die Strafe durchaus auch<br />
körperlicher Natur sein kann. So gilt bei einigen Völkern Ghanas noch immer der Ausspruch: Wer sein Kind<br />
liebt, der schlägt es. Damit ist gemeint, die Eltern müssen dem Kind auf alle Fälle klarmachen, dass es in einer<br />
bestimmten Situation nicht auf die von ihm gezeigte Weise reagieren darf.<br />
Im zweiten, örtlich nicht näher bezeichneten Beispiel heisst es auf der Seite 58:<br />
Die Organisation beginnt bei der Sippe und endet beim Häuptling. In unserem Dorf sind die Sippen sehr gross, denn es<br />
gehören alle Verwandten dazu. Meine Sippe besteht aus Vater und Mutter, zwei Schwestern und zwei Brüdern; dazu<br />
kommen zwei Onkel und eine Tante, vier Basen und fünf Vettern. Mein Vater ist Vorsteher dieser Sippe. Im Dorf nennt<br />
man ihn "Quartierchef". Alle Sippen des Dorfes werden über die Quartierchefs durch den Häuptling regiert. Die<br />
Quartierchefs stehen den einzelnen Sippen vor, während der Dorfhäuptling über den Quartierchefs steht.<br />
Die Organisationsformen innerhalb einer Gemeinde oder einer Region unterscheiden sich bei den afrikani-<br />
schen Völkern in vielfältigster Weise. Häufig verbreitet sind hierarchische Gesellschaftsstrukturen wie im<br />
geschilderten Text, die oft von den europäischen Kolonialmächten benutzt, gefördert und ausgebaut wurden.<br />
Im dritten Beispiel schreibt ein unbekannter Verfasser (S. 58):<br />
Meine Eltern, die weder lesen noch schreiben können, haben mir - allerdings mit einiger Ungewissheit - mitgeteilt, dass ich<br />
ungefähr im Jahre 1946 in Mankaha, einem Dorf im Stammesgebiet der Bafut, geboren wurde. Die Tatsache, dass mir der<br />
Name "Chemuta" gegeben wurde, weist darauf hin, dass ich am Bafuter Markttag geboren bin, denn dieser Name bedeutete<br />
"Einer, der die Mutter vom Besuch des Marktes abgehalten hat". Während meiner Kindheit stand ich meinem Vater näher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 245
als meiner Mutter, denn häufig begleitete ich ihn auf seinen Krankenbesuchen. Er war ein grosser Medizinmann.<br />
Manchmal ging ich auch mit meinem Onkel, um Palmwein zu zapfen: aber meistens half ich den einheimischen Farmern<br />
bei der Arbeit, um auf diese Weise etwas Geld zu verdienen. Zur Abwechslung ging ich auf die Jagd oder fing Fische. Wie<br />
meine Kameraden im Dorf betrieb ich etwas Kleinhandel. Als ich etwa neun Jahre alt war, wurde ich vom Schulunterricht<br />
stark angezogen. und ich versuchte auf eigene Faust, in einer Schule Aufnahme zu finden.<br />
Auch dieser Text legt Zeugnis darüber ab, dass bei vielen Völkern Afrikas die Kinder sehr früh in die Gemein-<br />
schaft eingebunden werden und damit die Lebensweise der Erwachsenen direkt erlernen können. Der Klein-<br />
handel, ob aus Notwendigkeit oder einfach aus Gefallen daran betrieben, ist eine für Kinder, die bereits<br />
einigermassen mit Geld umgehen können, typische Betätigung. Selbst Kinder vermögender Familien versu-<br />
chen sich durch den Verkauf leerer Flaschen oder die <strong>Pro</strong>duktion von Eiswürfeln im Kühlschrank der Mutter,<br />
ein Taschengeld zu verdienen. Für die meisten Kinder bedeutet der Kleinhandel aber die Möglichkeit, zum<br />
Familienunterhalt beizutragen.<br />
Auch das vierte Beispiel schildert, dass den Kinder früh anerzogene Bewusstsein für Verantwortung, das sich<br />
wesentlich von der materiellen Sorglosigkeit vieler Kinder Europas unterscheidet:<br />
In meinem Dorf konnte ich nicht zur Schule gehen; als Waisenkind musste ich mir irgendwie selber zu helfen wissen. Ich<br />
verrichtete dieselben Arbeiten wie andere Kinder und die Frauen. Ich sammelte Palmnüsse, klopfte sie auf und verkaufte<br />
sie. Das Geld gab ich einem alten Mann im Dorf, der es für mich hütete. Ich trug Wasser für unverheiratete Männer, und sie<br />
zahlten mir für jede Kalebasse voll Wasser einen Penny. Ich half den Frauen beim Jäten der Pflanzungen und wurde dafür<br />
bezahlt. Auch verfertigte ich Matten aus Palmblättern für die Dächer usw. Als ich neun Jahre alt war, holte ich mein Geld<br />
bei dem alten Mann ab und konnte so in die Primarschule eintreten...<br />
(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seite 274 dieser Arbeit.)<br />
...Meine Sippe besteht aus 26 weiblichen Mitgliedern und 34 Männern. Mein verstorbener Vater hatte zehn Frauen, und<br />
von diesen hatte er viele Kinder. Mein Vater hatte Söhne. Bruder, Onkel und Neffen. Alle diese Sippenmitglieder hatten<br />
auch wieder viele Kinder. Diese Leute haben mich gern, aber sie haben kein Geld, um mir die Ausbildung zu zahlen. Das<br />
ist unter anderem der Grund. weshalb ich nicht so früh wie andere Kinder in die Schule eintreten konnte.<br />
Das aargauische Lehrmittel spricht als erstes der untersuchten Werke vom Kinderreichtum der Schwarzafrika-<br />
ner und die dadurch verursachten <strong>Pro</strong>bleme bei der Einschulung dieser Kinder. (Siehe dazu auch die Karte<br />
"Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite 571 dieser Arbeit.)<br />
Finanzielle Not ist oft der Hauptgrund dafür, dass Kinder die Schule nicht besuchen können. Denn in einigen<br />
Staaten ist der Schulbesuch an und für sich zwar kostenlos, Schulbücher und Schuluniformen, sowie Schreib-<br />
materialien und Hefte müssen aber von den Eltern bezahlt werden. Diese Kosten können sich auf einen<br />
Monatslohn oder mehr summieren. Hinzu kommt die verlorene Arbeitskraft und die Tatsache, dass eine typi-<br />
sche afrikanische Familie mehr Kinder umfasst als eine europäische.<br />
4.20.2.7 Religion<br />
Zum Thema Religion lässt der Autor wieder den Afrikaner zu Wort kommen, der schon zur Schule zum Wort<br />
kam. Er berichtet auf den Seiten 58-59:<br />
...Die Religion gilt bei uns Afrikanern viel mehr als bei euch... Bei euch besteht eine tiefe Kluft zwischen der Religion und<br />
der praktischen Lebensführung. Religion und Leben sind bei euch zwei verschiedene Dinge. Leider kamen das<br />
Christentum und der Kolonialismus von denselben Ausgangspunkten nach Afrika. Bei der Verwaltung unseres Volkes war<br />
die Kirche ein enger Mitarbeiter der Regierungen.<br />
So war es unvermeidlich, dass die Kirche Schaden erlitt. Stünde es in unserer Macht, uns mit Europa in Verbindung zu<br />
setzen, so würden wir raten, die Europäer sollten sich nicht als christliches, sondern e einfach als europäisches Abendland<br />
bezeichnen.<br />
Der Autor fügt dieser Aussage auf Seite 59 bei:<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Rund 20% aller Afrikaner sind heute Christen, fast ebensoviele Mohammedaner. Etwa 60% halten an ihren einheimischen<br />
Religionen fest...<br />
Der Glaube der Afrikaner hat manche überraschende Ähnlichkeit mit dem christlichen Glauben. Zwar gibt es viele geistige<br />
Einzelwesen, die ins Leben eingreifen, aber die Afrikaner glauben auch an einen Schöpfer der Welt. Er schuf das Ur-Paar<br />
der Menschen und schenkte diesem von seiner eigenen, unvergänglichen Kraft. Diese ersten Menscheneltern bekamen<br />
Kinder und gaben von ihrem Leben an sie weiter. Beim Sterben des ersten Menschenpaares ging ihr Leib zur Erde zurück,<br />
doch als geistige Wesen blieben sie lebendig. Es ist den Verstorbenen nach afrikanischer Vorstellung möglich, das Leben<br />
ihrer Kinder und Enkel zu beeinflussen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 246
Dieser Abschnitt ist zu allgemein gehalten, da sich wie schon mehrmals erwähnt die Kulturen, und damit die<br />
Glaubensvorstellungen der afrikanischen Völker über ein weites Spektrum hinziehen. Zudem sind einige der<br />
"überlieferten" Glaubensvorstellungen stark von christlichen Einflüssen geprägt und gerade die, unseren Glau-<br />
benssystemen ähnlichen Überlieferungen, werden besonders gern zu Objekten der Forschung erklärt. Der<br />
Autor fährt fort:<br />
Für den Afrikaner ist die Lebenskraft wichtig. Er möchte möglichst viel Lebenskraft haben. Sie bedeutet für ihn gesund<br />
sein, kräftig sein, Freude haben, Mut besitzen. Er unternimmt alles, um zu diesen Eigenschaften zu kommen. Er vollbringt<br />
eine gute Tat, wenn er auch seinen Kindern und seinen Eltern dazu verhilft. Der Lebenskraft schadet er, wenn er<br />
unaufrichtig oder eifersüchtig ist, wenn er hasst oder lügt.<br />
(Vergleiche dazu die Darstellung der Schwarzafrikaner durch Albert Schweitzer auf der Seite 472 dieser<br />
Arbeit.) Über die Lebenskraft kommt der Autor auf die Ahnen und deren Verehrung zu sprechen. Dazu<br />
schreibt er auf der Seite 59:<br />
Die leiblichen Vorfahren und Nachkommen sind dem Afrikaner die Nächsten. Von ihnen hofft er am meisten Hilfe für das<br />
Leben zu bekommen, und ihnen kann er auch am meisten geben. Darum ist für ihn die Familie so wichtig. Die<br />
Nächstenliebe gegenüber fremden Menschen liegt ihm weniger. Nächstenliebe weit über die Familie hinaus ist eine<br />
christliche Tugend. Ein Arzt aus Lambarene erzählt, er habe immer wieder erlebt, wie gross der Zusammenhalt innerhalb<br />
der Familie sei, wie selbstverständlich in diesem Rahmen Gastfreundschaft geübt werde. Dagegen sei er nicht selten<br />
überrascht gewesen zu sehen, wie engherzig die Afrikaner denken und handeln, wenn ein anderer um Hilfe bittet. Wenn<br />
man als Fremder allerdings das Vertrauen eines Afrikaners gewonnen habe, dann sei es auch wieder anders, dann werde<br />
man nämlich als Sohn oder als Vater einfach in den Familienkreis aufgenommen.<br />
Die genannte "Engherzigkeit" von der "Arzt aus Lambarene", wahrscheinlich Albert Schweitzer, berichtet,<br />
lässt sich im Kontext der Familie besser verstehen, denn wenn ein Fremder um Hilfe bitten muss, hat er entwe-<br />
der keine Familie mehr, die ihn unterstützen könnte, oder viel wahrscheinlicher, er kann die Hilfe der eigenen<br />
Familie nicht in Anspruch nehmen, da er sich mit ihr zerstritten hat. Im letzteren Fall verdient er die Hilfe als<br />
"schlechter" Mensch in den Augen des Angesprochenen nicht, denn viele afrikanische Menschen sind zwar<br />
ausserordentlich gastfreundlich und grosszügig, verletzt man aber eine ihrer fundamentalen Wertvorstellung,<br />
reagieren sie darauf, wie jeder andere Mensch auch, mit starker Ablehnung Die Hilfe wird entzogen, das allfäl-<br />
lige Verständnis schlägt in Missfallen und Misstrauen um.<br />
Seite 59 zeigt nebst einem Foto "Geschäftsstrasse in Kumba" auch eine Plastik der Dogon "Ahnenpaar der<br />
Dogon, Westsudan", die eine ganz eigene Kultur haben, welche aufgrund ihrer Besonderheiten seit ihrer "Ent-<br />
deckung" Gegenstand der Forschung ist. Die Seite 60 zeigt das Foto einer afrikanischen Maske. Im Text heisst<br />
es weiter (S. 60):<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Ein grösseres Geschenk kann ein Afrikaner einem Fremden kaum geben, als dass er ihm seinen Mutter oder Vatersegen<br />
und damit einen Teil seiner Lebenskraft zugute kommen lässt. Der Arzt aus Lambarene sagt, er habe die Szene erst spät<br />
begriffen, die sich in einer Nacht im Frischoperiertenhaus zutrug: Ich war zu einem Patienten mit starken Schmerzen<br />
gerufen worden. Nachdem ich dem Kranken gegeben hatte, was er brauchte, und das Haus verlassen wollte, wurde ich von<br />
ein paar schwarzen Frauen gerufen, die im Schein einer Petrollampe neben dem Bett ihres operierten Verwandten wachten.<br />
"Viens, notre petit!" riefen sie. Ich setzte mich zu ihnen, und hin und her gingen im Flüsterton Frage und Antwort über den<br />
Zustand ihres Patienten. Ich hatte herzlichen Kontakt mit diesen einfachen Leuten, doch wunderte ich mich damals, warum<br />
ich "notre petit" war für sie. Später ging mir auf, dass die Anrede "unser Kleiner" in ihrem Mund etwas ganz anderes<br />
bedeutete als in unserem europäischen Sprachgebrauch.<br />
Das Umgekehrte kam aber noch öfter vor, dass ich als Vater angesprochen wurde von den Patienten, auch von ganz alten:<br />
"Tu es le pere pour moi: fais bien pour me guerir." Wenn ich einen Mann fragte, ob er mit der empfohlenen Operation<br />
einverstanden sei, lautete die Antwort häufig: "Papa, c'est toi qui connaît les choses; tu n'as qu'à commander." Ich hörte<br />
auch häufig den Gruss: "Bonjour, Papa!"<br />
Diese Zuweisung der Begriffe "Vater", "Mutter", "Sohn" und "Tochter", die nicht dieselbe Bedeutung wie in<br />
der Schweiz tragen, haben neben der Funktion Vertrautheit zu schaffen, auch die Aufgabe, die Rolle einer<br />
Person in der Gesellschaft festzuschreiben. So kann eine Frau mit einem erwachsenen Mann vielleicht unter<br />
normalen Umständen nicht sprechen, ohne das Opfer von Gerüchten zu werden, bezeichnet sie diesen aber<br />
öffentlich als ihren Sohn, und legt damit dessen Rolle fest, so ist ein Gespräch ohne weiteres möglich.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 247
Ausserdem werden in den Grossfamilien oft auch Kinder von Verwandten in die Kernfamilie aufgenommen,<br />
die ihre Pflegeeltern dann ebenfalls mit "Mama" oder "Papa" ansprechen.<br />
In den Text eingeschoben folgt ein Gedicht über die Ahnen, welches hier nicht wiedergegeben wird, da es<br />
aufgrund des Textes nicht eingeordnet werden kann und wenig zum Bild des schwarzafrikanischen Menschen<br />
beiträgt. Im Text fährt der Autor weiter:<br />
Mit der Religion haben auch die Masken etwas zu tun. Sie sind dazu da, die Menschen immer wieder an ein rechtes Leben<br />
zu mahnen, und sie helfen ihnen auch, ein solches zu führen. Die Masken haben Kraft. Zum Beispiel vertreiben sie das<br />
Böse. Sie helfen auch, Menschen mit schlechten Absichten festzustellen und ihr schlimmes Tun zu vereiteln. Manchmal<br />
sprechen durch sie die verstorbenen Vorfahren und erteilen Ratschläge. Oder sie haben nach der Meinung der Afrikaner<br />
auch einen Einfluss auf die Ernte.<br />
Derjenige, der eine Maske trägt, ist kein gewöhnlicher Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen. Die Maske macht ihn zu<br />
etwas Überirdischem. Weil sie diese Fähigkeit hat, ist die Maske auch heilig und nicht etwa nur ein Spielzeug. Darum gibt<br />
es auch strenge Vorschriften, wie man mit den Masken umgehen soll. Masken haben also eine ganz wichtige Aufgabe im<br />
Leben der afrikanischen Völker. Bei uns versteht man ihren eigentlichen Sinn nicht mehr, obwohl Masken früher auch bei<br />
uns verwendet wurden. Heute dienen sie noch zur Verkleidung an der Fasnacht...<br />
Je nach Volk und Kultur spielen die Masken eine mehr oder weniger wichtige Rolle. In den islamischen oder<br />
christianisierten Gegenden haben sie aber stark an Bedeutung verloren, ganz im Gegensatz zur Musik, die auch<br />
in den Städten im Zusammenhang mit Feiern immer wieder im traditionellen Stil aufgeführt wird.<br />
4.20.2.8 Politik<br />
Im letzten Teil der Ausführungen zu Schule, Religion und Politik kommt der Autor auf die afrikanische Politik<br />
zu sprechen, die er am Beispiel Tansanias zu erläutern versucht (S. 60f.):<br />
Und jetzt noch die Politik in Afrika. - Sie ist nichts anderes, sagte unser afrikanischer Gewährsmann, als ein Familienleben<br />
im grossen. Der Gemeinschaftsgeist und die Brüderlichkeit sind auch in unserer Politik das Wichtigste. Die Politik muss<br />
dafür sorgen, dass alle gleich behandelt werden. Nicht so, wie die Kolonialmächte es wollten. Und dann las er uns aus<br />
einem Buch vor, das vor langem von einem europäischen Politiker geschrieben worden ist: Der Eingeborene muss wissen,<br />
dass der weisse Mann sein Herr ist. Das ist er wegen seiner höheren Intelligenz. Der weisse Mann ist das Resultat einer<br />
zweitausendjährigen Entwicklung von griechischer, römischer und christlicher Kultur. Er steht auf einer anderen Stufe als<br />
der Eingeborene. - Aber gerade das nehmen wir nicht an, betonte der Afrikaner. Das sind unmenschliche Äusserungen.<br />
Ähnliche Äusserungen wurden auch in anderen Werken verbreitet. (Siehe dazu das Zitat aus "Harms Erdkunde<br />
- Die Welt in allen Zonen" von 1961 auf der Seite 127 dieser Arbeit.)<br />
Wir haben jetzt in Tanzania ein Einparteiensystem, fuhr er weiter. Das entspricht unserer afrikanischen Lebensweise. Wir<br />
wollen keine Konkurrenz zwischen den einzelnen Menschen; wir sind eine Familie. Alle Bürger können in dieser Partei<br />
mitmachen. Es herrscht immer freie Diskussion.<br />
Die Partei hat folgende Vorschriften aufgestellt: Die Bauern sollen weniger Steuern bezahlen müssen. In den Landgebieten<br />
sollen Schulen, Krankenstationen und Wasserversorgungen gebaut werden. Mietwohnungen und Banken werden<br />
verstaatlicht. Die Regierungsleute müssen Bauern oder Arbeiter sein. Sie dürfen nicht einem wirtschaftlichen Unternehmen<br />
angehören. Sie dürfen kein Haus besitzen, das sie vermieten und nicht selbst bewohnen.<br />
Die damalige Politik Tansanias war sozialistisch geprägt und gehörte nur zu einer von vielen verschiedenen in<br />
Afrika praktizierten Regierungsformen.<br />
4.20.3 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Die beiden Bände "Das Leben" und "Die Kultur" bieten dadurch, dass sie auch Einheimische zu Wort kommen<br />
lassen, ein recht breites Spektrum an Bildern. Durch die mangelnde Bezeichnung der Quellen, insbesondere<br />
bei der Zuordnung gewisser Beobachtungen zu Völkern und Kulturen bleiben sie aber oft zu allgemein und<br />
unverbindlich. Dem Autor gelingt es nicht immer, die im Band 4 in der Einführung erhobenen Anforderungen<br />
der Vermittlung eines "wahren" Weltbildes zu erreichen.<br />
Auffallend ist der Paradigmawechsel in Bezug auf die Nahrungsversorgung des Kontinents: Wurde in früheren<br />
Lehrmitteln ein Nahrungsüberfluss postuliert, ist nun von Nahrungsmangel die Rede.<br />
Ausserdem treten erstmals die "zahlreichen" Kinder der Schwarzafrikaner ins Blickfeld. Sprachen die Lehrmit-<br />
tel bis anhin, mit Ausnahme Südafrikas, wo sich die Schwarzen zu rasch "vermehrten" von einem Mangel an<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 248
Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)<br />
Arbeitskräften, wird nun die grosse Zahl der Kinder als Hindernis für eine zukünftige Entwicklung gesehen.<br />
Auffallend ist auch die Abwendung von der Wirtschaft hin zu anderen Lebensbereichen Schwarzafrikas.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 249
4.21 List Geographie (erstmals 1972-1976)<br />
Für die Beschäftigten der Bergwerke wurden in den neugegründeten Siedlungen nahe den Betriebsanlagen Krankenhäuser,<br />
Schulen, Marktplätze, Geschäfte, Sportanlagen, Klubhäuser und Postämter errichtet. Besonderen Wert legten die<br />
Bergwerksgesellschaften auf den Bau von Wohnsiedlungen, damit die Beschäftigten nicht mehr in primitiven<br />
Barackenlagern zu hausen brauchten. Dennoch entstehen ständig neue Slums... ohne Trinkwasserversorgung,<br />
Kanalisation... und elektrischen Strom mit schmutzigen, zur Regenzeit verschlammten Strassen. Sie sind oft die Brutstätten<br />
von Ungeziefer und ansteckenden Krankheiten. Hier in den Slums vor den umzäunten und bewachten Lagern tauchen die<br />
Gruppen unter, die auf eigenes Risiko unaufgefordert zuwandern und daher oft arbeitslos sind. Sie fallen nicht selten einem<br />
Lohnempfänger zur Last, der nach alter Stammessitte verpflichtet ist, mittellose Angehörige zu unterstützen und ihnen stets<br />
zu helfen. Oft ernährt ein Arbeitender bis zu 10 Arbeitssuchende seines Stammes. (Bd. 1, S. 112)<br />
Das 416 Seiten umfassende Lehrmittel "List Geographie", erschienen in den Jahren 1972-1976 für die 5. - 10.<br />
Klasse, beschäftigt sich in allen Bänden auf insgesamt rund 32 Seiten mit Afrika.<br />
4.21.1 Band 1<br />
Der Band 1 enthält die Kapitel "Sahara-Safari - gelenktes Abenteuer im Tourismus" (S.19-22), "Buschmänner<br />
in der Kalahari" (S.23-25), "Kaffeepflanzer am Kilimandscharo" (S.47-49) und "Eisenerz aus Liberia"<br />
(S. 110-112). Das erste Kapitel über die "Sahara-Safari" bietet keine Informationen zum Thema, auf die ande-<br />
ren drei Kapitel soll hier näher eingegangen werden.<br />
4.21.1.1 "Buschmänner in der Kalahari"<br />
Im Kapitel "Buschmänner in der Kalahari" schreibt der Autor unter der Überschrift "Regenzeit und Trocken-<br />
zeit in der Kalahari" auf der Seite 23 über die Regenzeit, die von Januar bis April dauert:<br />
...Diese Zeit ist für die Hirten vom Bantuvolk der Tswana im Norden und die Buschmänner - die Jäger und Sammler im<br />
Inneren und Westen der Kalahari - die Zeit des Überflusses. Die Savanne ergrünt, bringt Wurzeln, Kräuter und Beeren im<br />
Überfluss... Das Wild an den gefüllten Wasserlöchern wird den Buschmännern eine leichte Beute.<br />
Diese Wildbeuter, die weder Ackerbau treiben noch Lebensmittelvorräte anlegen, treffen in dieser Zeit Vorsorge gegen den<br />
Wassermangel der Trockenzeit, wenn das Wasser in den "Rivieren" und "Pfannen" verdunstet oder versickert ist. Sie füllen<br />
Strausseneier als "Feldflasche" mit Wasser und vergraben sie etwa alle 20 bis 30 km in ihrem Jagdrevier im Sand. Keines<br />
der wassergefüllten Strausseneier - jedes so gross wie etwa 24 Hühnereier - darf zerbrechen, denn jeder Tropfen Wasser ist<br />
kostbar, wenn im September und Oktober die grösste Wassernot herrscht.<br />
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 240 und 302 dieser Arbeit.) Auf der Seite 24 fährt der Autor in<br />
Form eines Reiseberichtes unter der Überschrift "Unterwegs - von Maun nach Gobabis" fort:<br />
...Als wir dabei sind, unsere Zelte aufzuschlagen und Feuerholz zu sammeln, stossen wir auf ein verlassenes "Lager" der<br />
Buschmänner. Es besteht aus einigen Windschirmen, die aus Zweigen geflochten wurden und aus einer Feuerstelle<br />
zwischen grossen Steinen. Die Asche ist noch warm. Wahrscheinlich haben sie schon von weitem unser Auto gehört und<br />
erst einmal Reissaus genommen. Es ist leicht zu verstehen, dass sie ihr Heil in der Flucht suchen, denn Buschmänner sind<br />
sehr scheu. Sie haben keinen festen Wohnsitz, sondern schweifen in Gruppen durch die Trocken- und Dornsavannen,<br />
nähren sich von der Jagd und vom Sammeln wilder Früchte. Man zählt sie deshalb zu den Jäger- und Sammlervölkern. In<br />
früheren Jahrhunderten, als sie noch weite Teile des südlichen Afrikas bewohnten, wurden sie häufig von den Farmern<br />
verfolgt und auch getötet, die Rache nehmen wollten für das von ihnen erlegte Vieh.<br />
Als die Buren ins Landesinnere vorstiessen, um sich neues Land zu erschliessen, mussten ihnen die einheimi-<br />
schen "Buschleute" weichen. Diese Eroberungspolitik der Buren wurde auf ähnliche Weise durchgeführt, wie<br />
das in Nordamerika gegenüber den Indianern geschah. In ihrem eigenen Land wurden die "Buschmänner" so<br />
zu Rechtslosen und Verfolgten.<br />
Unter der Überschrift "Naro" schildert der Autor auf den Seiten 24-25 die Begegnung mit einem<br />
"Buschmann":<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
Wir waren überrascht, als am nächsten Morgen ein äIterer Buschmann sich der Wasserstelle näherte und uns eine<br />
Tsama-Melone anbot, eine begehrte "Buschkost" und ein Friedenszeichen zugleich. Als Kleidung hatte er ein altes<br />
Antilopenfell kunstvoll um seine Hüfte gewunden. An den Füssen trug er noch die vorne etwas nach unten gebogenen<br />
"Rennsandalen" aus Tierhaut, die sich für die Jagd, besonders auf sandigem Untergrund, eignen. Der Buschmann war nur<br />
1,50 m gross, von rotbrauner Hautfarbe und zierlicher Gestalt. Mit den schlitzartig verengten Augen in seinem<br />
faltenreichen Gesicht betrachtete er uns aufmerksam.<br />
Unser Führer Bongi, dessen Mutter ihn eine Buschmannsprache gelehrt hatte, redete ihn freundlich an. Zwar hörte ich nur<br />
Schnalzlaute und Klickse, jedoch konnte mir Bongi die Worte unseres Gastes übersetzen. Durch Tabakgeschenke konnten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 250
wir sein Misstrauen bald überwinden. Er hiess Naro. Seine Gruppe hatte sich in der Nähe des Lagers versteckt. Mit<br />
Giftpfeilen und Bogen waren sie auf der Jagd.<br />
Die Art der Beschreibung des "Buschmannes" erinnert an die Beschreibung "Freitags" in Defoes Roman<br />
Robinson Crusoe. So besteht die Sprache der San nicht nur aus "Schnalzlauten und Klicksen" sondern verfügt<br />
ebenso wie alle anderen Sprachen über eine Auswahl der dem Menschen möglichen Konsonanten und Vokale.<br />
Die "Schnalzlaute und Klickse" stellen also nur die für den Europäer auffälligsten Laute der verschiedenen<br />
Sprachen der "Buschleute" dar. Interessanterweise weisen Säuglinge weltweit eine Phase auf, in der diese<br />
Laute spontan abgegeben werden, d.h. es handelt sich bei den "Schnalzlauten" nicht um eine künstliche Erwei-<br />
terung, sondern um einen Teil der im Menschen angelegten Lautgebungsmöglichkeiten.<br />
Nebst dem Text sind auf der Seite 25 zwei Fotos "Buschmänner haben sich zum Schutz gegen Wind und<br />
Sonne Windschirme aus Zweigen geflochten" und "Buschmänner am Lagerfeuer" abgebildet. Auf der gleichen<br />
Seite berichtet der Autor unter der Überschrift "Weiter auf Safari" über die "Buschleute":<br />
...Bei den Buschleuten hatten wir keine jungen Leute gesehen. Sie hatten sich für einen festen Lohn als Viehhirten auf den<br />
Farmen der Europäer oder als Fährtensucher bei den Jagdsafaris der Touristen aus Übersee anwerben lassen. Nur von Zeit<br />
zu Zeit kehren sie zurück und leben mit den Jagdgruppen für wenige Wochen zusammen. Obgleich diese jungen<br />
Buschmänner Kontakt mit Menschen der modernen Welt haben, ist es sehr schwer, sie sesshaft zu machen...<br />
Die meisten der schätzungsweise noch 50'000 San haben ihre traditionelle Lebensweise aufgegeben und sind<br />
sesshaft geworden. Die oft unter schwierigen Bedienungen lebenden, einst von ihren weissen und schwarzen<br />
Nachbarn verfolgten und versklavten San kämpfen gegen den sich ausbreitenden Alkoholismus und Krankhei-<br />
ten wie Tuberkulose. Einigen ist es aber gelungen, sich den neuen Einflüssen anzupassen, ohne ihre eigene<br />
Tradition vollends aufzugeben. Noch immer gibt es Vertreter der San, die ganz bewusst das traditionelle<br />
Leben ihrer Vorfahren weiterführen.<br />
4.21.1.2 Kaffee<br />
Im Kapitel "Kaffeepflanzer am Kilimandscharo" auf den Seiten 47-49 schreibt der Autor unter dem Titel<br />
"Schnee am Kilimandscharo" über die Hochebenen im Gebiet des Kilimandscharos (S. 47):<br />
...Hier ist das Siedlungsgebiet der Chagga-Pflanzer, die auf dem fruchtbaren Verwitterungsboden am Fuss dieses<br />
erloschenen Vulkanmassivs, des Kilimandscharo, kleine Kaffeefelder angelegt haben. Die Chagga, auch Dschagga<br />
genannt, sind ein Bantuvolk, das Ackerbau und ein wenig Viehwirtschaft treibt.<br />
Auf der gleichen Seite, die auch eine "<strong>Pro</strong>filskizze Kilimandscharo" zeigt, erfahren die Leser weiter, dass<br />
Tansania etwa 40% der Sisal-Welternte liefert. Auf der Seite 48, die zwei Karten "Das Siedlungsgebiet der<br />
Dschagga... am Südostfuss des Kilimandscharo" und "Dschagga-Pflanzungen im Gebiet zwischen Moschi und<br />
Marangua..", sowie zwei Fotos "Ehemals europäische Sisalplantage, heute Staatsbesitz" und "Das Handelszen-<br />
trum Moschi" abbildet, schreibt der Autor weiter:<br />
Als wir in Moschi ankamen, war es leicht für uns, das Geschäfts- und Handelszentrum der Genossenschaft der<br />
Dschagga-Pflanzer zu finden, ein modernes, vierstöckiges Verwaltungsgebäude mit einer Handelsschule, Läden und einem<br />
Hotel... Hinweisschilder zeigten an, dass dort in dieser Woche ein Treffen aller Kaffeepflanzer und der Versand der<br />
Jahresernte der Genossenschaft nach Übersee geplant war.<br />
Auf der Seite 48-49 folgt die Schilderung einer "Dschagga-Kaffeepflanzung", die auf "1550 m Höhe am<br />
Südosthang des Kilimandscharo" liegt:<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
Nach der Begrüssung zeigte mir Limos Vater seine kleine, 1,5 ha grosse Pflanzung "Kihamba"... "Schauen Sie meine 2<br />
Meter hohen Kaffeesträucher und die noch grösseren Bananenstauden an. Sie gedeihen prächtig auf diesen gut beregneten<br />
Vulkanböden. Während der Trockenheit, mit der man für die Monate Juli bis Oktober rechnen muss, werden sie künstlich<br />
bewässert. Wasser liefern uns reichlich die von den Gletschern gespeisten Bäche. Ich bin gerade dabei, Kaffeesträucher der<br />
Sorte ARABICA dort in den 1 m breiten und ebenso tiefen Löchern einzupflanzen. Ich habe sie über unsere<br />
Genossenschaft von der Forschungsstation bei Moschi erhalten. Nach 5 Jahren bringen die Kaffeesträucher die ersten<br />
Früchte. Drei Jahre später liefern sie uns bereits eine gute Ernte für die nächsten 15 Jahre. Den Rohkaffee liefern wir an<br />
unsere Genossenschaft in Moschi und erhalten Bargeld. Unsere Genossenschaft bietet uns viele Vorteile für den<br />
Kaffeeanbau, von den Düngemitteln und Geräten bis zu einer Fachausbildung und zum Verkauf des Rohkaffees auf<br />
ausländischen Märkten. Doch achten Sie auf die hohen Bananenstauden, die zwischen den Reihen stehen. Sie schützen mit<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 251
ihren breiten Blättern die jungen Kaffeesträucher vor zu grosser Sonneneinstrahlung und halten den starken Regen des<br />
Südost-Passats ab. Ausserdem liefern sie uns frische Bananen für den Eigenbedarf."<br />
Nebst der Schilderung des Genossenschaftswesens, welches das sozialistische Tansania förderte, das aber<br />
bereits vor der Unabhängigkeit entstanden ist, um die produzierten Güter zu einem besseren Preis abzusetzen,<br />
beschreibt der Bauer die für das Kilimandscharogebiet typischen Mischkulturen. Der Autor lässt den Bauer in<br />
seinen Erklärungen fortfahren (S. 48):<br />
"...Wir haben verschiedene Bananen gezüchtet, die Sie in Europa nicht kennen. Wir unterscheiden Obst-, Mehl- und<br />
Futterbananen und ausserdem eine zum Bierbrauen. Ferner erhalten meine zwei Milchkühe die Bananenreste als<br />
Zusatzfutter. Der Stallmist kommt wieder aufs Feld, damit alles noch besser wächst!"<br />
Bei dieser Form der Landwirtschaft, die denen der schweizerischen Bergbauern in gewisser Hinsicht ähnlich<br />
ist, werden die Tiere in einem Stall gehalten und dort gefüttert, da sie sonst in den Pflanzungen und Feldern<br />
Schaden anrichten würden.<br />
Auf der Seite 49, die auf einem Foto ein "Dschaggawohnhaus inmitten der Pflanzung 'kiamba' zwischen<br />
Kaffeesträuchern und schattenspendenden Bananenstauden" in moderner Bauweise, d.h. in Ziegelbauweise mit<br />
Blechdach, zeigt, fährt der Autor in seinen Schilderungen fort:<br />
Schon seit zwei Generationen sind die Dschagga von den Europäern im Kaffeeanbau angeleitet worden, besonders von<br />
deutschen und britischen Missionaren und Fachleuten. Heute wird ihr Können überall in Afrika und Europa anerkannt.<br />
Anschliessen lässt er wieder den schon zitierten Bauern zu Wort kommen (S. 49):<br />
"Doch bevor das Geschäft losgeht... muss ich zu meinen Feldern, am Fusse des Gebirges in 1'000 m Höhe. Wir haben dort<br />
ein kleines Anwesen, eine 'shamba', wo wir zeitweise Mais und Gemüse ziehen. Im Gegensatz zu den Dauerkulturen hier<br />
bei unserem Haus benötigen diese Früchte weniger Regen- Vielleicht säe ich nach der kommenden Regenzeit dort unten<br />
Baumwolle ein, wie es einige Nachbarn bereits versuchen. Weizen- und Sisalfelder, wie auf den grossen Staatsgütern, auf<br />
den ehemaligen Inder- und Europäerplantagen, werde ich nicht anlegen. Hierfür ist mein Landbesitz zu klein. Auch fehlen<br />
mir Geld, Maschinen und Arbeitskräfte für solch grosse Unternehmen. Mit dem Kaffeeanbau können wir kleinen Pflanzer<br />
über unsere Genossenschaft konkurrieren, die wir 1925 gegründet haben. Vielleicht gelingt uns das auch mit der<br />
Baumwolle.<br />
Wenn Sie demnächst nach einem sechsstündigen Flug von Deutschland auf dem neuen Internationalen<br />
Kilimandscharo-Flughafen landen und uns wieder besuchen, dann fallen Ihnen bestimmt wieder einige Neuerungen auf."<br />
Aus dieser Textstelle ist deutlich der Wille zum Erfolg herauszuhören, den viele Menschen Schwarzafrikas<br />
immer wieder aufbringen, auch in Situationen, die nicht wenige Europäer wohl als schwierig bis ausweglos<br />
einschätzen würden. Der Autor zeichnet hier also ein sehr optimistisches und dynamisches Bild der wichtig-<br />
sten Berufsgruppe Afrikas: den Bauern.<br />
Zusätzlich zum Text gibt Seite 49 eine Tabelle "Die wichtigsten Kaffeeerzeugerländer..." wieder, in der die<br />
afrikanischen Staaten Äthiopien, Elfenbeinküste, Kamerun, Kenia, Uganda und Zaire aufgeführt werden. (Zum<br />
Kaffeeanbau siehe auch die Seiten 225 und 322, sowie die Tabelle "Kaffeeproduktion schwarzafrikanischer<br />
Länder" im Anhang auf der Seite 551 dieser Arbeit.)<br />
4.21.1.3 Eisenerz aus Liberia<br />
Im nächsten Kapitel auf den Seite 110-112 beschreibt der Autor die Gewinnung von Eisenerz in Liberia. Auf<br />
Seite 110 heisst es in der Einführung zum Thema:<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
Den Eingeborenen Liberias waren die grossen Eisenerzvorkommen ihres Landes schon seit Jahrhunderten bekannt. Sie<br />
bildeten lange Zeit die Grundlage ihrer primitiven Eisenindustrie, die bereits im Jahre 1555 von Kapitän William Towerson<br />
an der Küste Liberias beobachtet wurde.<br />
Die Eisenverhüttung verlor an Bedeutung, als hochwertige Eisenwaren im Tausch gegen Pfeffer, Elfenbein und Hölzer aus<br />
den Industrieländern Europas eingeführt wurden.<br />
Seit 1951 werden die reichen Erzvorkommen unter Beteiligung ausländischer Gesellschaften in grossem Umfang<br />
abgebaut...<br />
Unter der Überschrift "Die Eisenlagerstätten und ihre Nutzung" beschreibt der Autor die verschiedenen Eisen-<br />
erzgruben Liberias. Seite 111 zeigt ein Foto "Der Eisenerztagbau im Bergland von Nimba" sowie eine Karte<br />
der Region und eine Tabelle zur Eisenförderung Liberias, die im angegebenen Zeitraum von 0.198 Millionen<br />
Tonnen (1951) auf 23.2 Millionen Tonnen (1973) pro Jahr anstieg. Im Text werden ausserdem der Transport<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 252
der Erze per Bahn und die Beteiligung Deutschlands an den Erzlagerstätten Liberias geschildert. (Zum Eise-<br />
nabbau in Liberia siehe auch die Seiten 100 und 157 dieser Arbeit.)<br />
Auf Seite 112 geht der Autor schliesslich auf die Veränderungen ein, die der Bergbau bewirkte. Dazu sind im<br />
Buch vier Karten zur "Bergbausiedlung Bong Town" und dem "Erztagbau Bong Mine" abgebildet. Im Text<br />
schreibt der Autor unter der Überschrift "Der Eisenerzbergbau verändert die Lebensgewohnheiten vieler Libe-<br />
rianer" (S. 112):<br />
Der Eisenerzbergbau leistet einen wesentlichen Beitrag zur Veränderung der Landschaft und der Lebensgewohnheiten der<br />
im Bergbau Beschäftigten. In einem vornehmlich landwirtschaftlich genutzten Raum bietet er eine Anzahl von<br />
Arbeitsplätzen an. Dadurch verändert er die Arbeits- und Lebensgewohnheiten der dort lebenden Menschen tiefgreifend,<br />
indem sie zum Beispiel ganz entgegen ihren bisherigen Lebensgewohnheiten zu festgesetzten Zeiten im Bergwerk zur<br />
Arbeit erscheinen müssen. Hier ist der Arbeiter auf sich alleingestellt, losgelöst von Grossfamilie und Stamm, die ihn<br />
umsorgten und schützten.<br />
Für die Beschäftigten der Bergwerke wurden in den neugegründeten Siedlungen nahe den Betriebsanlagen Krankenhäuser,<br />
Schulen, Marktplätze, Geschäfte, Sportanlagen, Klubhäuser und Postämter errichtet. Besonderen Wert legten die<br />
Bergwerksgesellschaften auf den Bau von Wohnsiedlungen, damit die Beschäftigten nicht mehr in primitiven<br />
Barackenlagern zu hausen brauchten. Dennoch entstehen ständig neue Slums (Elendsviertel) ohne Trinkwasserversorgung,<br />
Kanalisation (Abwasseranlagen) und elektrischen Strom mit schmutzigen, zur Regenzeit verschlammten Strassen. Sie sind<br />
oft die Brutstätten von Ungeziefer und ansteckenden Krankheiten. Hier in den Slums vor den umzäunten und bewachten<br />
Lagern tauchen die Gruppen unter, die auf eigenes Risiko unaufgefordert zuwandern und daher oft arbeitslos sind. Sie<br />
fallen nicht selten einem Lohnempfänger zur Last, der nach alter Stammessitte verpflichtet ist, mittellose Angehörige zu<br />
unterstützen und ihnen stets zu helfen. Oft ernährt ein Arbeitender bis zu 10 Arbeitssuchende seines Stammes.<br />
(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 235 und 271 dieser Arbeit.) Bei dieser Praxis handelt es<br />
sich selten, wie oft angenommen, um eine Art von sozialem Parasitimus, sondern derjenige, der ein Einkom-<br />
men gefunden hat, unterstützt nun diejenigen Angehörigen, die ihm mit grosser Wahrscheinlichkeit erst zu<br />
seiner momentanen Arbeit verholfen haben, indem sie beispielsweise für die Schulausgaben aufgekommen<br />
sind. Obwohl die afrikanischen Gesellschaften im Umbruch sind, gilt es nach wie vor als Pflicht, wie im Text<br />
angedeutet, für seine weniger gut gestellten Verwandten aufzukommen.<br />
4.21.2 Band 2<br />
Der Band 2 von "List Geographie" beschäftigt sich in den Kapiteln "Zaire - Vom Rohstoffland zum Industrie-<br />
staat" (S.16-18), "Ferntourismus in Ostafrika" (S.19-21), "Die Niloase" (S. 22-24) und "Mali - Ein Entwick-<br />
lungsland in der Sahelzone" (S.127-131) mit Afrika, wobei die Schwarzafrika betreffenden Kapitel hier näher<br />
besprochen werden sollen.<br />
4.21.2.1 Zaire<br />
Auf den Seiten 16-18 schildert der Autor die Entwicklung Zaires "vom Rohstoffland zum Industriestaat". In<br />
der Einleitung zum Kapitel schreibt der Autor auf der Seite 16:<br />
...Wo früher Jäger mit vergifteten Pfeilen Wild erlegten, betreiben heute afrikanische Ingenieure moderne Industrieanlagen.<br />
Unter der Überschrift "Verkehrsprobleme in einem riesigen Land" schreibt der Autor nach einem Hinweis auf<br />
die Grösse Zaires auf der gleichen Seite:<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
...Die bevölkerungsreichen und wirtschaftlich bedeutenden Regionen liegen randlich um das mit dichtem Regenwald<br />
bedeckte, schwer zugängliche zentrale Kongobecken... Um die wirtschaftsstarken Gebiete an die Hauptstadt Kinschasa und<br />
den bedeutenden Exporthafen Matadi anzuschliessen, schuf man in der Kolonialzeit wichtige Bahnverbindungen. Zaire ist<br />
reich an Bodenschätzen. Die <strong>Pro</strong>vinz Schaba (auch Shaba; früher Katanga), in der riesige Kupfervorkommen ausgebeutet<br />
werden, liegt im äussersten Süden Zaires, weit im Innern des Kontinents. Lange Transportwege (Bahnen, Flussschiffahrt)<br />
mussten erschlossen werden, damit von dort Kupfer an Industriestaaten geliefert werden kann.<br />
Unter der Überschrift "Ein Rohstoffland wird industrialisiert" fährt der Autor fort (S. 16):<br />
Zaire ist ein mit Naturschätzen sehr reich ausgestattetes Land. Es verfügt über eine grosse Anzahl von Erzlagerstätten und<br />
über gute landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktionsmöglichkeiten. Nachdem der belgische König Leopold II. 1884/85 mit Hilfe von<br />
Stanley das gesamte Kongobecken in Besitz genommen hatte, begannen bald grosse europäische Bergbaugesellschaften,<br />
die Bodenschätze zu heben, die wertvollen tropischen Edelhölzer einzuschlagen und grossflächige Plantagen anzulegen.<br />
Nach der Unabhängigkeit im Jahre 1960 wurden viele dieser Betriebe enteignet und vom neuen Staat übernommen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 253
(Zur Politik von Leopold II. in Belgisch-Kongo siehe auch die Seite 197 dieser Arbeit.) Mit dem letzten Satz<br />
vermittelt der Autor den Eindruck, die Demokratische Republik Kongo habe 1960 nicht nur die politische,<br />
sondern auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit erreicht. Tatsächlich wurde sie aber auch politisch weiter von<br />
aussen stark beeinflusst. Schon 1965, nach mehreren Jahren der Unruhen, in der die ehemalige Kolonialmacht<br />
Belgien immer wieder eingriff, stürzte der vom amerikanischen Geheimdienst unterstütze General Mobutu den<br />
damaligen Präsidenten Kasawubu, übernahm selbst das Amt des Präsidenten und regierte das Land bis zu<br />
seinem Sturz 1997. Weiter heisst es im Text:<br />
Zaires Rohstoffreichtum bietet gute Voraussetzungen für die Industrialisierung des Landes. Da die Erzlagerstätten meist<br />
nur einen Gehalt von wenigen <strong>Pro</strong>zent des begehrten Kupfers, Zinks oder Goldes haben, begann man schon vor 1930 mit<br />
der Errichtung von Erzverhüttungsanlagen. Denn nur angereichert konnten Bergbauprodukte über die riesigen<br />
Entfernungen kostengünstig zur Küste transportiert werden. Ebenfalls um Transportkosten zu sparen, gründete man<br />
Palmölmühlen, Baumwollentkernungsanlagen und Sägewerke.<br />
Nach dem 2. Weltkrieg und verstärkt nach Erlangung der Unabhängigkeit entstanden viele neue Industriebetriebe, die<br />
bemüht waren, teure Einfuhren aus Übersee durch <strong>Pro</strong>dukte aus dem eigenen Land zu ersetzen. Heute deckt die zairische<br />
Industrie bereits einen hohen Anteil des Inlandsbedarfs.<br />
1993 exportierte das damalige Zaire Rohstoffe im Wert von rund 1.1 Mrd. US$, wobei 27% der Exporteinnah-<br />
men auf Diamanten, je 11% auf Erdöl und Kupfer, 10% auf Kobalt und 5% auf Kaffee entfielen. Damit haben<br />
die einstmals wichtigen Kupferexporte stark an Bedeutung verloren. Der Bergbau erwirtschaftet aber nach wie<br />
vor den Grossteil der Exporteinnahmen. (Fischer, 1998)<br />
Seite 17 zeigt zwei Tabellen zu den Themen "Industrieprodukte mit hohem Anteil am Inlandsverbrauch" und<br />
"Reise in der heutigen Zeit", sowie eine Karte "Zaire, ein Land mit reichen landwirtschaftlichen und bergbau-<br />
lichen Rohstoffen". In einer Aufgabenstellung sagt der Autor aus, dass die "Gewinnung von Kupfererz... unge-<br />
fähr einen Drittel der Staatseinnahmen" erbringe. Auf der Seite 18 schreibt er über die wirtschaftliche<br />
Entwicklung:<br />
Die Wirtschaftspolitik Zaires verfolgt seit der Unabhängigkeit zwei Hauptziele:<br />
- rasche Steigerung der Kupferproduktion in Süd-Schaba<br />
- Entwicklung der küstennahen Hauptstadt Kinschasa (früher: Leopoldville) und Ansiedlung von verarbeitenden Industrien<br />
in Nieder-Zaire. Dies führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in beiden Gebieten. Demgegenüber bleiben die<br />
anderen Regionen in ihrer Entwicklung zurück.<br />
Unterstützt werden diese Ausführungen durch die Tabellen "Entwicklung des Bergbaus in Zaire", "Anzahl der<br />
Industrieanlagen in Zaire" und einer Tabelle zur Verteilung der industriellen <strong>Pro</strong>duktion, sowie einer Graphik<br />
zur Bevölkerungsentwicklung und ein Foto "Der Hafen von Kinschasa am Kongostrom". (Zur Demokratischen<br />
Republik Kongo siehe auch die Seiten 178 und 331 dieser Arbeit.)<br />
4.21.2.2 Ostafrika<br />
Im Kapitel "Ferntourismus in Ostafrika" auf den Seiten 19-21 beschreibt der Autor das Gebiet der Länder<br />
Kenia und Tansania anhand des Tourismus. Auf die Bewohner dieser Länder geht der Autor nicht speziell ein.<br />
So erfahren die Schüler aus einer nach Brehm zitierten Beschreibung der Savanne (S. 19):<br />
...Nicht einmal der Mensch ist imstande, Abwechslung in dieses ewige Einerlei zu bringen, weil seine Felder, von fern<br />
gesehen, diesem so gleichen, dass man Getreide und Gras nicht voneinander unterscheiden kann.<br />
Zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus zitiert der Autor auf der Seite 20 einen Artikel aus der<br />
Süddeutschen Zeitung von 1976:<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
...In den Jahren 1960-1965 stieg die Besucherzahl Kenias von 35'800 auf 81'400. Nach dem Kaffee, dessen Exporterlöse<br />
mit 30% an der Spitze standen, war der Tourismus damit die zweitwichtigste Devisenquelle geworden.<br />
1978 sollen mehr als 800'000 Touristen "jährlich fast 360 Millionen Mark an Devisen nach Kenia bringen - diese Zahl wird<br />
im Entwicklungsplan des Landes angestrebt". "Selbst das sozialistische Nachbarland Tansania will wieder mehr am<br />
Geschäft des Ferntourismus profitieren - obwohl man dort sich jahrelang geziert hat, Touristen zu akzeptieren."<br />
(Zu Kenia siehe auch die Seiten 225 und 273, zum Tourismus die Seiten 166 und 273 dieser Arbeit.) Auf der<br />
Seite 21 werden vier Fotos abgebildet, von denen wenigstens zwei, nämlich "Auf dem Hof eines Bantu-<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 254
Pflanzers auf den GebirgsfussfIächen hoher Gebirge am Rande der Savanne" und "Bei den Hirtennomaden auf<br />
den trockenen Grasebenen der Savanne, auf der nur einige Schirmakazien oder Affenbrotbäume Abwechslung<br />
bieten" ein Bild von den eigentlichen Bewohnern dieses Grossraums vermitteln.<br />
4.21.2.3 Mali<br />
Im letzten Kapitel des zweiten Bandes "Mali - ein Entwicklungsland in der Sahelzone" auf den Seiten 127-131<br />
informiert der Autor etwas ausführlicher über sein Bild der afrikanischen Wirklichkeit. Dazu bietet er den<br />
Schüler auch einige Materialien, die in den drei Themenblöcken "Unterschiedlicher Entwicklungsstand", "Die<br />
Dürrekatastrophe" und "Entwicklungspolitik" informieren.<br />
In den Texten zum Entwicklungsstand beschreibt der Autor die geschichtliche Entwicklung Malis. Zu den<br />
"traditionellen Reichen im Sudan" schreibt der Autor auf Seite 127:<br />
Die grossen "Reiche" (z. B. Gana, Mali, Songhai), die sich seit dem frühen Mittelalter insbesondere im westlichen Sudan<br />
entwickelt hatten, kannten weder feste Grenzen noch ein Staats- oder Nationalbewusstsein der Bevölkerung. Es handelte<br />
sich vielmehr um "fiskalische Diktaturen" (O. Köhler), d. h. um Gebiete, in denen von einem Kerngebiet aus Generationen<br />
von Herrschern Steuern und Tribute einzogen, soweit ihre Macht dazu reichte. Ein Wechsel der Herrschaftsgruppen blieb<br />
für die Untertanen weitgehend ohne Bedeutung, selbst als islamische Marokkaner die Macht übernahmen.<br />
Zwar ist es richtig, dass ein Wechsel an der Spitze des Staatsgebildes auf die Einwohner der betroffenen<br />
Gebiete nur wenig Auswirkungen hatte, doch durch das Eindringen der Marokkaner wurde das Machtgefüge<br />
destabilisiert und die vorher durch die Truppen des Reiches im Schach gehaltenen Nomadengruppen machten<br />
die Reisewege unsicher und trugen damit zum Verfall der finanziellen Grundlage des Reiches bei. Der Zerfall<br />
des Machtmonopol des Reiches wirkte sich natürlich auch auf die einfachen Bauern des Gebietes aus. (Siehe<br />
zu diesem Thema auch die Seite 31 im Abschnitt "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas dieser<br />
Arbeit).<br />
Zur Kolonialisierung schreibt der Autor unter dem Titel "Die europäischen Kolonialmächte" (S. 127):<br />
Auch nach der Kolonisierung Afrikas durch die Europäer blieb das altgewohnte Herrschaftssystem im Grunde bestehen: es<br />
war nur eine neue Herrschergruppe, die jetzt die Entscheidungsgewalt übernahm, für Sicherheit sorgte und dafür Abgaben<br />
und Arbeitsleistungen forderte.<br />
Daneben ergab sich aber auch erstmals ein echter Wandel: Festlegung von "Landesgrenzen", wirtschaftliche Verbindung<br />
mit dem Mutterland (billige Rohstoffe zur Verarbeitung im Mutterland und Rücklieferung der Fertigwaren in die Kolonie).<br />
In gewissem Masse gehörten dazu auch Kapitalinvestitionen (Einsatz von Geldmitteln) sowie Massnahmen zur<br />
Entwicklung der Infrastruktur (Massnahmen für bessere Versorgung und Verwaltung eines Staates), insbesondere die<br />
Verbreitung einer einheitlichen Schriftsprache.<br />
Nach der Eroberung des gesamten Territoriums durch die Franzosen wurde Mali 1904 zuerst der französischen<br />
Kolonie Haut-Senegal-Niger angegliedert, 1920 wurde die Kolonie unter dem Namen "Soudan" Teil von<br />
Französisch-Westafrika und 1958 in "Sudanesische Republik" unbenannt. 1959 bildete es zusammen mit der<br />
Republik Senegal die Föderation Mali. Den Namen Mali, behielt das Land nach der Unabhängigkeit und dem<br />
Ausscheiden Senegals aus der Föderation bei. Der von 1960-1968 regierende Präsident Modibo Keita wurde<br />
nach dem Versuch, eine Diktatur einzurichten, von der Militärregierung von Moussa Traoré gestürzt. Moussa<br />
regierte das Land bis zu seinem Sturz 1991 mehr oder weniger demokratisch. Seit 1992 regiert der 1997<br />
wiedergewählte Oumar Konaré Mali unter einer neuen Verfassung. (Weltatlas 1997)<br />
Unter dem Titel "Der neue Staat Mali" schreibt der Autor zu dem 1960 unabhängig gewordenen Mali<br />
(S. 127-128):<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
...Das Herrschaftssystem in Mali wird bestimmt durch eine vom Parlament der Kolonialzeit (Nationalversammlung)<br />
verabschiedete Verfassung, in der ein Präsident die Aufgaben und Machtbefugnisse des Staatsoberhauptes und des<br />
Regierungschefs auf sich vereinigt. Eine offizielle Opposition gibt es in diesem Staat nicht. Bei den Wahlen 1964<br />
vereinigten sich fast alle Stimmen auf eine Partei: die "Union Soudanaise" (98%). 1968 wurde sie zwar aufgelöst, und die<br />
Macht übernahm die CMLN (das "Militärkomitee der Nationalen Befreiung"), doch bedeutete das keine Veränderung des<br />
Einparteiensystems.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 255
(Zu Mali siehe auch die Seite 344 dieser Arbeit.) In den Texten zur "Dürrekatastrophe: Folge des Entwick-<br />
lungsrückstandes oder Schicksal eines natürlichen Krisenraumes?" schreibt der Autor unter dem Titel "Das<br />
Ende der Tuareg" zu der Politik der Regierung gegenüber der nomadisch lebenden Bevölkerungsanteile, einen<br />
Zeitungsartikel aus "Die Welt" von 1976 zitierend:<br />
..."Das ist da selbstverständlich, dass die Nomaden keine Lebensmittel bekommen. Die Logik der Regierung ist hart und<br />
einfach: Da die Nomaden keine Steuern bezahlen, werden sie bei Nahrungsmittellieferungen auch nicht berücksichtigt."<br />
Mit der Dürrekatastrophe bietet sich für die malische Regierung die Chance, eine "Endlösung" der Nomadenfrage ohne<br />
grosses Aufsehen zu erreichen. Tiefverwurzelte ethnische und historische Gegensätze trennen hier wie im übrigen Sahel<br />
Nomaden und Sesshafte...<br />
...Stets fühlten sich die hellhäutigen Nomaden nur ihrer eigenen ethnischen Gruppe verbunden, nicht aber einem der<br />
schwarzafrikanischen Staaten im Sahel...<br />
...Furcht und Abneigung sind historisch bedingt. Nicht vergessen ist jene Zeit, in der die Tuareg die Sudanneger wie Ware<br />
handelten. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein blieben die herrischen Wüstenreiter gefürchtete Sklavenjäger und -händler.<br />
Jahrhundertelang versorgten die Tuareg den arabischen Raum mit schwarzen Sklaven. Sie überfielen die Dörfer,<br />
verschleppten ihre Bewohner, plünderten und vernichteten die Ernte. Für die rund drei Millionen Nomaden im<br />
Sahel-Raum, die wahren Opfer der Dürre, besteht wenig Hoffnung. Zehntausende sind bereits verhungert.<br />
(Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 203 und 264, zum Sklavenhandel die Seiten 204<br />
und 262 dieser Arbeit.) Die Sahelstaaten, in denen die Berber und arabischen Völker auf die Schwarzafrikaner<br />
treffen, haben fast alle mit dem <strong>Pro</strong>blem der Rassenkonflikte zu kämpfen. In Mauretanien leben viele<br />
Schwarzafrikaner immer noch in sklavenähnlichen Umständen, obwohl die Sklaverei längst abgeschafft<br />
wurde. In Mali und Niger behielten die Schwarzafrikaner die Oberhand über die meist nomadisch lebenden<br />
Berber. Der Tschad war jahrelang in Grenzstreitigkeiten mit dem nördlichen Nachbar Libyen verwickelt, und<br />
im Sudan herrscht seit über 20 Jahren ein immer wieder aufflammender Bürgerkrieg zwischen der islamischen<br />
Regierung im Norden und den christlich-animistischen Schwarzafrikanern im Süden.<br />
Im zweiten Text zur Dürrekatastrophe zitiert der Autor unter der Überschrift "Mit den Kühen in die Katastro-<br />
phe" aus einem Zeitungsartikel aus "Die Welt" von 1973 auf der Seiten 128 und 129:<br />
An Einzelbeispielen lässt sich belegen, dass eine unausgewogene Entwicklungs- und Agrarhilfe unerwünschte<br />
Folgeerscheinungen auslösen kann...<br />
Weiter schreibt der Autor zur Milchleistung der Kühe in Afrika (S. 128):<br />
...Wegen der extensiven Haltung und insbesondere wegen der Überweidung liegt die Leistung pro Kuh und Jahr nur bei<br />
400 kg. Hiervon sind 300 kg für die Aufzucht des eigenen Kalbes notwendig. Die Kühe können erst dann gemolken<br />
werden, wenn die Ansprüche des Kalbes befriedigt sind. Auf diese Weise lassen sich nicht mehr als etwa 100 kg pro Kuh<br />
und Jahr gewinnen. Diese müssen für 2,6 Menschen reichen. Im statistischen Durchschnitt ergeben sich hieraus nur 3<br />
Gramm Milcheiweiss pro Kopf und Tag.<br />
Geht man den Ursachen der geringen <strong>Pro</strong>duktion nach, so steht der Futtermangel natürlich an erster Stelle. Dieser ergibt<br />
sich wiederum aus einem zu grossen Viehbestand. Fragt man nach der Ursache der hohen Bestandesdichten, so hat man<br />
sich sehr schnell mit dem Statussymbol "Zahl der Rinder", auseinanderzusetzen. Dieses Statussymbol hat natürlich einen<br />
sehr realen Hintergrund. Das Rind ist ja nicht nur Milchlieferant, sondern hier ist es gleichzeitig Sparkasse, Lebens-.<br />
Arbeitslosen- und Krankenversicherung Schliesslich erledigt das Rind noch die Pflugarbeit auf dem Acker.<br />
Die jahrhundertelangen Erfahrungen haben alle Tierbesitzer gelehrt, dass nur derjenige überlebt, dem auch nach einer<br />
Dürrekatastrophe noch lebende Rinder gehören. Die Chance des Überlebens wächst mit der Zahl der Tiere in einer Herde.<br />
Das Dürrerisiko wird erhöht, die Grasnarbe zerstört. Das Trinkwasser wird knapp, die Treibwege zum Fluss werden länger<br />
und beschwerlicher. Die <strong>Pro</strong>duktivität der Rinder sinkt weiter ab. Das Kapital wird zwar vermehrt, aber es trägt keine<br />
Zinsen.<br />
Die Folgen eines zu hohen Viehbestandes werden hier eingehend erläutert, dabei werden allerlei Argumente<br />
für das "fehlerhafte" Verhalten der einheimischen Bevölkerung herangezogen, die eigene Mitwirkung der<br />
Europäer an den beschriebenen Umständen wird erst im folgenden Abschnitt wenigstens angetönt.<br />
Unter der Überschrift "Sand - Dürre - Tod" zitiert der Autor auf den Seiten 129-130 aus einem Bericht des<br />
deutschen Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit von 1974:<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
"Allah hat uns die Herden genommen", sagt mir ein Chef eines Familienkreises. "Allah wird uns auch das Vieh<br />
wiedergeben.'" Aber nicht Allah hat die Dürre über die Sahelzone gebracht. Es war auch nicht Allah, der Niger und<br />
Obervolta, Mauretanien und Mali mit Armut geschlagen hat. Es war nicht das Wetter allein, sondern auch der Mensch.<br />
Brunnenbohrer hatten an den Zugstrassen der Nomaden neue Wasserstellen erschlossen; die Herden wuchsen; die<br />
Tiermedizin bekämpfte wirksam die Seuchen; der vierfüssige Reichtum der Nomaden war einige Jahre lang grösser denn<br />
je. Doch dann frassen die Tiere das schüttere Gras rings um die Brunnen weg, zerstampften die karge Vegetation, machten<br />
die Wege von der Weide zum Wasser immer länger; am Ende verhungerten die Tiere auf dem Weg vom Brunnen oder<br />
verdursteten auf dem Pfad von der Weide.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 256
In einem weiteren Text, der die gleiche Quelle zitiert, werden als Gründe für die Katastrophe die Politik der<br />
Kolonialmächte, die "Ausbeutungsstrategie" der multinationalen Konzerne und die "ungerechten Strukturen<br />
des Welthandels" genannt.<br />
Im letzten Text zitiert der Autor aus einer weiteren Veröffentlichung von Heinz Flohn aus dem Jahr 1974 unter<br />
der Überschrift "Dürren im Sahelgürtel" auf den Seiten 130-131:<br />
Schon die ersten europäischen Reisenden haben die einzelnen Landschaften in ganz verschiedenem Zustand vorgefunden.<br />
Wo Heinrich Barth 1855 im nördlichen Kanem eine "leblose schreckliche Wüste" antraf, fand Gerhard Rohlfs (1865-67)<br />
eine üppige grüne Krautsteppe. Immer wieder treten Gruppen feuchter und trockener Jahre auf: Die letzten Dürreperioden<br />
in unserem Jahrhundert (1907-13, 1937-44 und 1968-73) dauerten ebenso wie die früherer Jahrhunderte immer etwa 5-7<br />
Jahre.<br />
Obwohl im ganzen das Ausmass der Dürrekatastrophe 1968-73 keinesfalls schlimmer war als 1907-13, waren doch ihre<br />
Auswirkungen für Menschen und Wirtschaft viel tiefgreifender. Damals konnten die Nomaden noch nach Süden<br />
ausweichen. Heute ist die Bevölkerungszahl derart gewachsen, dass dies unmöglich ist; auch hindern die politischen<br />
Grenzen eine Flüchtlingsbewegung grösseren Ausmasses. Bei der heutigen Rate der Bevölkerungszunahme von 2,4-2,7%<br />
je Jahr nahm seit der Katastrophe von 1907-13 die Bevölkerungszahl (grob gerechnet) auf das Drei- bis Vierfache zu. Das<br />
gleiche gilt für die Herden. Wenn die Statistiken der betroffenen Länder stimmen, hat sich die Zahl der Ziegen, Rinder und<br />
Kamele in den letzten zwanzig Jahren vor Dürrebeginn etwa verdoppelt. Das geschah in einer feuchten Periode mit<br />
ausreichender Futtergrundlage...<br />
Hier haben sich also die "falschen" Erwartungen der sechziger Jahre endgültig zerschlagen, denn als solche<br />
präsentiert sie der Autor durch den Rückblick auf Dürreperioden seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts.<br />
Im letzten Abschnitt der Materialiensammlung unter dem Titel "Entwicklungspolitik - Hilfe in der Not oder<br />
Beseitigung des Entwicklungsrückstandes?" zitiert der Autor unter der Überschrift "Entwicklungspolitik" einen<br />
Bericht aus "Reader's Digest", der zeitlich nicht näher bezeichnet wird (S. 131):<br />
Auf ihrer Dürrekonferenz im September letzten Jahres haben die sechs am schlimmsten betroffenen westafrikanischen<br />
Staaten die für eine Sanierung erforderlichen Mittel mit rund einer Milliarde Dollar angegeben - doppelt soviel, wie sie<br />
gegenwärtig bekommen. Ausser Getreidekäufen umfasst ihre Liste: 200 Millionen Dollar für Wassererschliessungsprojekte<br />
(ein grosser Teil davon für neue Pumpstationen), weitere Millionen für die Wiederauffüllung der Herden (keines der<br />
Länder denkt im Ernst daran, ihre Grösse zu begrenzen) und nur 26 Millionen Dollar für Wiederaufforstung (kaum genug<br />
für 20'000 Hektar)...<br />
...Und wenn die Geberländer den Sahel nicht für den ganzen Rest des Jahrhunderts subventionieren wollen, müssen auch<br />
sie Vorausschau beweisen. Geld sollte nur für konkrete Zwecke - wie die Wiederaufforstung - hergegeben werden. Und für<br />
neue Bohrlöcher in den Weidegründen sollen nur dann Mittel zur Verfügung gestellt werden, wenn ausgedehnte<br />
Begrünungsmassnahmen und kontrollierte Beweidung Teil des <strong>Pro</strong>jekts sind.<br />
Trat Schwarzafrika in den älteren Lehrmitteln als Rohstofflieferant auf, in dessen Gebiet zwecks Steigerung<br />
der <strong>Pro</strong>duktion vor allem investiert wurde und die Hilfe an unterbemittelte Bewohner nur am Rande eine Rolle<br />
spielte - zu meist im Zusammenhang mit der Missionierung -, so treten die schwarzafrikanische Länder nun als<br />
Almosenempfänger von Geldern auf, die eine kurzfristige Katastrophe überbrücken sollen und an welche die<br />
Geberländer ihre mehr oder wenige strengen Bedingungen knüpfen.<br />
Als weiter Massnahme nennt der Autor die Bekämpfung der Verwüstung durch Baumpflanzungen. Diese Idee<br />
wird in einem weiteren Text, der die Lage als aussichtslos beschreibt, unter der Überschrift "Maximum der<br />
Tragfähigkeit schon überschritten?" als absurd bezeichnet.<br />
Im letzten Text unter der Überschrift "Interview mit Minister Eppler" wird der 1974 amtierende deutschte<br />
Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den folgenden Worten zitiert:<br />
...Aber die <strong>Pro</strong>duktion von subventionierten Getreideüberschüssen, die dann in Länder exportiert werden, die selbst<br />
Agrarländer sind, das nützt langfristig nicht, es schadet sogar...<br />
Damit schliesst der Band 2 des Lehrmittels "List Geographie" mit dem Bild eines sich in einer hoffnungslosen<br />
Lage befindlichen Afrikas, dessen Bewohner den vorherrschenden Entwicklungen wehrlos entgegenstehen, da<br />
sie sich in eine Sackgasse manövriert haben.<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 257
4.21.3 Band 3<br />
Der Band 3 für die Klassen 9 und 10 enthält neben einer Karte zu "Wachstumsraten und Bevölkerungszunah-<br />
me der Erde" auf der Seite 33, welche nebst anderen Gebieten auch für Afrika einen hohen Bevölkerungszu-<br />
wachs ausweist, das Kapitel "Rassenkonflikte in Südafrika" (S. 130-133), das einen Teil der damaligen afrika-<br />
nischen Wirklichkeit beschreibt, sowie ein Kapitel "Entwicklungsländer und Entwicklungshilfe", welches auch<br />
für Afrika relevante Themen behandelt.<br />
4.21.3.1 Südafrika<br />
In der Einleitung zum Kapitel "Rassenkonflikte in Südafrika" schreibt der Autor auf der Seite 130:<br />
"Südafrika" ist zum Inbegriff einer rassenfeindlichen Politik geworden, zu einem Reizwort, das weltweit leidenschaftliche<br />
Diskussionen und <strong>Pro</strong>teste ausgelöst hat.<br />
Die Apartheid-Politik der südafrikanischen Regierung, die die getrennte Entwicklung von Menschen weisser und "nicht<br />
weisser" Hautfarbe gesetzlich bestimmt, wird verurteilt als "Rassismus und Kolonialismus", als Unterdrückung der<br />
farbigen Mehrheit der Bevölkerung Südafrikas durch eine weisse Minderheit, die alle Schaltstellen der Macht und des<br />
wirtschaftlichen Einflusses besetzt hält...<br />
Wurde die Politik Südafrikas in den älteren Lehrmitteln zu einem grossen Teil sehr unkritisch beurteilt, folgt<br />
hier eine deutliche Verurteilung dieser als "Rassismus " bezeichneten Politik.<br />
Der Autor weisst weiter auf die Wichtigkeit der geschichtlichen Entwicklung für das Verständnis der damals<br />
aktuellen Situation hin, zu der er im Bezug auf die schwarzafrikanische Bevölkerung unter der Überschrift<br />
"Von der Verpflegungsstation der Seefahrer zum Vielvölkerstaat" auf der Seite 130 schreibt:<br />
...Die weissen Einwanderer... drangen langsam nach Norden vor, wo nomadisierende Hottentotten und Buschmänner<br />
lebten. Den Feuerwaffen der berittenen Weissen konnten sie nur wenig Widerstand entgegensetzen. Sie wurden<br />
umgebracht oder zogen sich in die weniger fruchtbaren Gebiete im Landesinnern zurück. Erst im 18. Jahrhundert trafen<br />
nordwärts vordringende weisse Viehhalter ("Treckburen") auf gleichfalls viehhaltende nomadisierende Schwarze<br />
("Bantu"), die nach Süden vorstiessen. Zwischen beiden Gruppen kam es in der folgenden Zeit ständig zu kriegerischen<br />
Auseinandersetzungen, in denen die Buren zuletzt die Oberhand gewannen...<br />
Unter der Überschrift "Südafrikas Aufstieg zur Wirtschaftsmacht" beschreibt der Autor die Entdeckung der<br />
Gold- und Diamantenfelder Südafrikas und die dadurch initiierte Industrialisierung von Teilen des Gebietes.<br />
Bezugnehmend auf damalige weisse Führungspersönlichkeiten heisst es im Text auf der Seite 131 nach<br />
E. Leistner:<br />
...Unter ihrer straffen Führung entstand eine hochmoderne, kapitalstarke Bergbauindustrie - Heere von Schwarzen wurden<br />
angeworben für die Arbeit in den Bergwerken und an den mit fieberhafter Eile vorangetriebenen Eisenbahnen zwischen<br />
Fundorten und Küste. Wohnlager der Bergarbeiter schossen aus dem Boden und entwickelten sich zu Städten...<br />
...Erst als Südafrika während des Krieges von seinen überseeischen Lieferländern abgeschnitten wurde, beeilte man sich,<br />
eigenen <strong>Pro</strong>duktionsanlagen zu schaffen. Mit dem Aufbau der verarbeitenden Industrie vollzog sich der Übergang zur<br />
modernen Industriegesellschaft.<br />
Auf der gleichen Seite ist eine Graphik "Bevölkerungszusammensetzung in der Republik Südafrika" für die<br />
Jahre 1904-2030 abgebildet, die zum nächsten Thema unter der Überschrift "Von der Sklaverei zur Apartheid"<br />
überleitet, zu dem es auf den Seiten 131 heisst:<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
Das Zusammenleben der unterschiedlichen Rassen und Gruppen in Südafrika führte im Laufe der Geschichte zu Krisen<br />
und Unterdrückung. In den ersten Jahrhunderten der Besiedlung liessen die Europäer die schwere Arbeit auf ihren Farmen<br />
von völlig rechtlosen schwarzen Sklaven verrichten. Erst im Jahre 1834 wurde auf Betreiben der englischen Kolonialmacht<br />
die Sklaverei offiziell abgeschafft. Mit dem Aufschwung des Bergbaus wurden zunehmend Arbeitskräfte für die Minen<br />
benötigt, und zahlreiche Schwarze strömten auf der Suche nach Verdienstmöglichkeiten in die aufstrebenden jungen<br />
Städte. Um diesen Zustrom zu steuern und um die weisse Bevölkerung vor einer "Überwanderung" zu schützen, begann<br />
die Regierung in Pretoria, mit einem komplizierten System von Erlassen und Bestimmungen alle Beziehungen zwischen<br />
Weissen. Schwarzen, Farbigen und Asiaten zu regeln. 1913 wurde im Gesetz über Eingeborenenland die räumliche<br />
Trennung zwischen den Rassen eingeführt. Bantu, Mischlinge und Asiaten dürfen nur noch in den jeweils ihnen<br />
zugewiesenen Gebieten wohnen. Am Rande der grossen europäisch geprägten Städte, in denen Bergbau und Industrie auf<br />
billige Arbeitskräfte angewiesen sind, entstanden getrennte Arbeitercamps und Wohnviertel.<br />
Der Autor weist deutlich auf die von den Buren praktizierte Sklaverei hin, wodurch ein wesentlich anderes<br />
Bild entsteht, als das vom "weissen" Sklavenbefreier, welches in einigen anderen Lehrmitteln vertreten wird.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 258
(Siehe dazu die Tabelle in der Zusammenfassung der Darstellung der Europäer auf der Seite 506 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Auf der Seite 132, die neben zwei Tabellen zu Schüler- und Studentenzahlen Südafrikas auch zwei Fotos "Die<br />
Stadt Soweto bei Johannesburg" und "Warteraum 'nur für Farbige' im Hauptpostamt zu Kapstadt" zeigt,<br />
schreibt der Autor:<br />
Die Apartheid, die Trennung der Rassen, wurde in allen Bereichen des täglichen Lebens eingeführt. Autobusse,<br />
Restaurants, Postschalter und Parkbänke wurden mit "Whites only"-Schildern für die weisse Bevölkerung reserviert... Die<br />
Hauptbahnhöfe von Pretoria, Johannesburg und Kapstadt wurden nur von den Weissen durch den Haupteingang betreten.<br />
Die Nichtweissen müssen Neben- und Hintereingänge benutzen, haben eigene Warteräume und Toiletten. Berufe, für die<br />
eine Lehre oder höhere Ausbildung erforderlich ist, durften über lange Zeit nur von Weissen ausgeübt werden. Von seinem<br />
16. Lebensjahr an muss ein "Afrikaner" ein reference book bei sich tragen. Darin wird von den Behörden eingetragen, wo<br />
er sich aufhalten darf (in den Gebieten der Weissen nicht länger als 72 Stunden), für welche Art der Arbeit er zugelassen ist<br />
und bei wem er arbeitet. Wenn die Eintragungen lückenhaft sind, wenn er das reference book nicht bei sich trägt oder wenn<br />
er es verloren hat, muss der Schwarze meist ins Gefängnis.<br />
(Zu den "Whites only"-Schildern siehe auch die Seite 268 dieser Arbeit.)<br />
...In ihrer ganzen ursprünglichen Strenge ist die Apartheid heute jedoch kaum noch durchführbar. Bei der geringen<br />
Zunahme der weissen Bevölkerung... macht der Bedarf an geschulten und hochqualifizierten Industriearbeitern zunehmend<br />
die Einstellung von Mischlingen und Schwarzen in Positionen erforderlich, die bisher Weissen vorbehalten waren.<br />
Insbesondere multinationale Unternehmen wurden durch den Druck der öffentlichen Meinung in ihren Mutterländern<br />
gezwungen, auf eine Abschaffung der rassistischen Personal- und Lohnpolitik hinzuwirken.<br />
Die Politik der weissen Regierung Südafrikas wurde relativ lang von ausländischen Firmen toleriert oder sogar<br />
ausgenutzt. Das auf der Seite 2 dieser Arbeit wiedergegebene Zitat aus der Personalzeitung der Schweizeri-<br />
schen Bankgesellschaft von 1960 ist nur ein Beispiel der noch wenige Jahre früher vertretenen Position.<br />
Auf den Seiten 132-133 schreibt der Autor unter der Überschrift "Heimatländer?" zur damals in der Republik<br />
Südafrika betriebenen Homeland-Politik:<br />
Mit dem ,"Group Areas Act" schuf die Regierung Südafrikas 1952 die rechtliche Grundlage für die Aufteilung des Staates<br />
nach rassischen Gesichtspunkten. Den verschiedenen Bantugruppen wurden Gebiete zugewiesen, in denen jeweils nur die<br />
Angehörigen des eigenen Stammes Land erwerben und bearbeiten dürfen. Diese sogenannten Heimatländer... sollen den<br />
verschiedenen Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit einer eigenständigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen<br />
Entwicklung bieten.<br />
So wurde diese Politik zumindest begründet. In Wirklichkeit wollte die weisse Minderheit damit ihre erworbe-<br />
nen Privilegien gegen eine stetig anwachsenden Zahl von Schwarzen verteidigen.<br />
Auf der Seite 133 befindet sich eine Karte "Die Homelands der Afrikaner", welche die Grössenverhältnisse der<br />
den Schwarzen zugeteilten Ländereien in bezug auf das durch die Weissen bewohnte Land zeigt. Über die<br />
Homelands schreibt der Autor auf der gleichen Seite:<br />
Die Homelands sind im Vergleich zu den ,"weissen" Gebieten völlig unterentwickelt. Zu ihnen gehören die unfruchtbarsten<br />
Gebiete in Südafrika, Die Bevölkerung lebt noch überwiegend als arme Kleinbauern und Viehhalter in<br />
Selbstversorgungswirtschaft. Seit Generationen wandert ein beachtlicher Teil der jungen Männer und Frauen auf der Suche<br />
nach Arbeit in die weissen Gebiete ab. Im Völkergemisch der modernen Industriestädte haben viele Bantu den Kontakt zur<br />
Stammestradition und zu ihrem Heimatland völlig verloren...<br />
Einen Artikel der Badischen Zeitung aus dem Jahr 1978 zitierend, schreibt der Autor unter der Überschrift<br />
"Hoffnung auf Zukunft" über die weitere Entwicklung der Republik Südafrika:<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
"Von 1'020 Befragten in den schwarzen Stadtgebieten von Johannesburg (Soweto), Pretoria und Durban stimmten 64,7<br />
<strong>Pro</strong>zent folgender These zu: 'Verbesserungen für Schwarze werden nur durch geduldige Verhandlungen zwischen weissen<br />
und schwarzen Führern herauskommen.' Und 61 <strong>Pro</strong>zent schlossen sich der Meinung an, dass die Schwarzen nie an einen<br />
Kampf denken sollten, denn es sei schlecht, jemanden zu verletzen. sogar wenn es Weisse sind."<br />
Eine Äusserung ihrer politischen Zielvorstellungen ist den schwarzen Südafrikanern, wenn überhaupt, dann nur in den<br />
Homelands möglich... Die Homelands werden nach diesen Angaben von einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt,<br />
ebenso Pläne für eine Teilung Südafrikas in eine schwarze und eine weisse Hälfte...<br />
Als erstes Lehrmittel lässt das Werk aus dem Aargau die schwarze Bevölkerung Südafrikas zu Wort kommen<br />
und vermittelt damit nicht nur einen Gegenpol zu den von älteren Lehrmitteln vertretenen Standpunkten,<br />
sondern zeigt durch das aufgeführte Beispiel auch die Verhandlungsbereitschaft der Schwarzen auf, die den<br />
paranoiden Bildern der "schwarzen Springflut", welche die weisse Bevölkerungsmehrheit niederzuwalzen<br />
droht, entgegensteht. (Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 228 und 268 dieser Arbeit.)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 259
4.21.3.2 Entwicklungshilfe<br />
Im letzten Kapitel "Entwicklungsländer und Entwicklungshilfe" kommen Afrika und seine Bewohner auf den<br />
Seiten 134-137 nur am Rande zur Sprache. Über die Nachrichten aus den betroffenen Ländern schreibt der<br />
Autor, sie seien "nicht geeignet, die bei uns vielfach herrschende Unkenntnis zu beheben oder Voreingenom-<br />
menheit gegenüber den Entwicklungsländern abzubauen" (S. 134).<br />
Als wesentliche Merkmale eines Entwicklungslandes nennt der Autor die Armut und der grosse Anteil der in<br />
der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte. Ausserdem weist er auf die Abhängigkeit von Rohstoffexpor-<br />
ten hin. Auf Seite 135 schreibt er, die Zahl der Arbeitslosen in Afrika betrage je nach Definition 11-60 Mio.<br />
Menschen. Zur Erinnerung sei aufgeführt, dass einige der älteren Lehrmitteln von einem Mangel an Arbeits-<br />
kräften sprachen. Ein weiteres <strong>Pro</strong>blem sieht der Autor in der "sehr starken Bevölkerungszunahme" (S. 135).<br />
Eine Karte "<strong>Pro</strong>-Kopf-Anteil am Volkseinkommen und Leistungen zur Entwicklungshilfe", sowie eine Karte<br />
"Anteil der Analphabeten an der Gesamtbevölkerung", weisen Afrika als einkommensschwach aus und setzen<br />
die Analphabetenrate aller afrikanischen Länder mit Ausnahme von Marokko und Südafrika mit über 50% an.<br />
(Vergleiche dazu die Karte"Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" nach Angaben der<br />
UNICEF von 1996 auf der Seite 571 im Anhang dieser Arbeit.)<br />
Mit dem Thema "Der Teufelskreis der Armut", den die Entwicklungsländer nach Angaben des Autors "aus<br />
eigener Kraft... nicht durchbrechen" können (S. 136), welches die Überschriften "Ausbruch aus dem Teufels-<br />
kreis" und "Von der Entwicklungshilfe zur Partnerschaft" enthält, schliesst der Autor seine Betrachtungen zu<br />
den Entwicklungsländern, ohne Afrika noch einmal speziell zu erwähnen. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch<br />
die Seiten 237 und 266 dieser Arbeit.)<br />
4.21.4 Zusammenfassung<br />
Das Lehrmittel "List Geographie" gibt keinen Gesamtüberblick über die Länder Afrikas wieder, sondern<br />
beschränkt sich auf die eingehendere Beschreibung der Länder Liberia, Zaire, Mali und Südafrika, sowie in<br />
Teilbereichen, Gebiete Kenias und der Kalahariwüste. Je nach Land treten die Bewohner mehr oder weniger in<br />
den Vordergrund. Während ein kenianischer Bauer zitiert wird, werden die "Buschleute" von einem Reisenden<br />
beschrieben.<br />
Afrika tritt nur noch gebietsweise als Rohstofflieferant auf. Am ausführlich behandelten Beispiel von Mali<br />
werden die durch das Bevölkerungswachstum und die Überweidung verursachten <strong>Pro</strong>bleme in der Sahelzone<br />
beschrieben. Die Bilder wechseln von den Aufbruchländern Liberia und Zaire, über das politisch schwierige<br />
Südafrika, dessen Apartheidspolitik verurteilt wird, zu der als "hoffnungslos" geschilderten Lage in Mali.<br />
Damit trägt der Autor den Unterschieden zwischen den Ländern Schwarzafrikas Rechnung. Über die Bevölke-<br />
rung selbst und deren Kultur berichtet er aber nur wenig.<br />
Geographielehrmittel: List Geographie (1972-1976)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 260
4.22 Neue Geographie (1974-1976)<br />
"öffne die zeitungen, und du findest / dort offen gelegt, was es bedeutet / in diesem unseren aufgeklärten land zu leben /<br />
grosse, unverrückbare buchstaben in schicksalhaften schwarz / sagen, dass nach dem recht eine afrikanische braut / von<br />
ihrem mann getrennt werden kann / der sich abmüht, bis vom alter geschwächte muskeln / nichts mehr zur wirtschaft des<br />
landes beitragen können / und dann zu seiner frau in die einöde abgeschoben wird / ohne hoffnung sitzen sie und starren /<br />
auf das ausgelaugte, unfruchtbare land / mit bitterer frage, ob gott sich darum schert / was jenen seinen kindern geschieht /<br />
die nicht mit einer weissen hautfärbung geboren wurden / in unserem aufgeklärten land" (Bd. 3, S. 80)<br />
Das 591 Seiten starke Geographielehrmittel "Neue Geographie", erstmals im Zeitraum 1974-1975 im August<br />
Bagel Verlag für die Klassen 5-10 erschienen, beschäftigt sich in allen drei Bänden auf insgesamt rund 40<br />
Seiten mehr oder weniger ausführlich auch mit Afrika und seinen Bewohnern.<br />
4.22.1 Band 1<br />
Der erste Band für die Klassen 5 und 6, 1974 erschienen, zeigt auf der Seite 9 im Zusammenhang mit dem<br />
Thema Wohnformen zwei Fotos afrikanischer Behausungen, nämlich eine Lehmstadt, die in ihrer Art für das<br />
nördliche Afrika typisch ist, und eine Strohhütte, wie sie über den ganzen Kontinent südlich der Sahara zu<br />
finden sind.<br />
Auf Seite 18 folgt, immer noch zum Thema Wohnformen, ein kurzer Text unter dem Titel "Eine 'Stadt'<br />
versorgt sich selbst", indem eine der zahlreichen Siedlungsformen Südafrikas geschildert wird:<br />
In einem kleinen, weit abgelegenen Eingeborenensiedlung mit nur wenigen hundert Einwohnern, der 'Hauptstadt' des<br />
Modjadjii-Stammes in Südafrika, geht man an einem Tag im Mai der Arbeit nach wie an jedem anderen:<br />
Einige Frauen tragen auf dem Kopf in Tongefässen Wasser aus dem Brunnen herbei, andere stampfen für die<br />
Mittagsmahlzeit in Holzgefässen Mais, der auf den umliegenden Feldern geerntet wurde. Ein Mädchen zerreibt Hirsekörner<br />
mit einem Reibstein auf einer Steinschale. Im Schatten eines Baumes hockt eine Gruppe von Frauen, die mit zugespitzten<br />
Knochen die Steine aus pflaumengrossen Früchten entfernt, aus denen ein Getränk gebraut wird. Eine ältere Frau trägt ein<br />
Bündel Brennholz herbei, das sie aus den Büschen in der Nähe der Siedlung herausgeschlagen hat. Neben einer der aus<br />
getrockneten Lehmsteinen gebauten Hütten formt eine Frau Töpfe aus Ton, die sie später im Holzfeuer brennt. Ein Mann<br />
repariert mit strohlangen Grasbündeln das Grasdach einen Rundhauses. Davor fertigen junge Mädchen Tragkörbe aus<br />
geflochtenen Grasseilen an.<br />
Eine solche 'Stadt' könnte ein Jahr oder viel länger von der Aussenwelt abgeschnitten sein, ohne dass die Menschen grosse<br />
Not leiden müssten. Die Bewohner könnten auch ihre Kleidung und Schuhe selbst herstellen, wie sie es früher getan haben,<br />
und notfalls auch auf eiserne Geräte verzichten..."<br />
Bereits im Titel macht der Autor durch die Setzung von Gänsefüsschen darauf aufmerksam, dass die beschrie-<br />
bene Stadt keine echte Stadt sei. Es handelt sich vielmehr, obwohl angeblich die Funktion einer Hauptstadt<br />
erfüllend, um die "Eingeborenensiedlung" eines "Stammes" aus Südafrika.<br />
Die Schilderung der Arbeitsvorgänge ist teilweise recht unpräzise. So wird aus dem Text nicht klar, womit die<br />
Frauen im beschriebenen Dorf den Mais für die Mittagsmahlzeit "stampfen" - doch wohl kaum mit ihren<br />
Füssen. Auch über die Beweggründe der Frauen, die "mit zugespitzten Knochen die Steine aus pflaumgrossen<br />
Früchten" entfernen, um daraus ein Getränk zu "brauen", erfahren wir nichts näheres. Weder wird die dazu<br />
verwendete Frucht genannt, noch der genaue Verwendungszweck des <strong>Pro</strong>duktes beschrieben.<br />
Der kurze Text hat also weniger die Funktion, den Leser über die Lebensform der beschriebenen Volksgruppe<br />
zu informieren, als vielmehr mittels des Vergleichs, auf die eigene Abhängigkeit von der Welt ausserhalb der<br />
eigenen Wohnsiedlung aufmerksam zu machen.<br />
Das letzte Kapitel zu Afrika im ersten Band "Wildreservate in Ostafrika" enthält keine für die Arbeit relevan-<br />
ten Textstellen, d.h. die einheimische Bevölkerung wird darin nicht beschrieben.<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 261
4.22.2 Band 2<br />
Der 1974 erschienene zweite Band der "Neuen Geographie", für die Klassen 7 und 8, beschäftigt sich in den<br />
drei Kapiteln "Bei Nomaden und Oasenbewohnern der Wüste Sahara" (S. 24-31), "In der afrikanischen Savan-<br />
ne" (S.31-38) und punktuell auch in "Eine Religion prägt Mensch und Raum: der Islam" (S.87-98) mit Afrika.<br />
Aus dem erstgenannten Kapitel zu Sahara soll hier nur ein kurzer Abschnitt zur Bewässerung der Oase In-Sa-<br />
lah in der zentralen Sahara zitiert werden, da das Thema die Fragestellung dieser Arbeit nur am Rande berührt<br />
(S. 27-28):<br />
...So entstand das komplizierte Foggara-Bewässerungssystem. Es konnte nur mit Hilfe der Sklaven, die man in grosser Zahl<br />
aus dem Sudan herbeischaffte, gebaut werden.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 256 und 278 dieser Arbeit.)<br />
Auch heute noch sind etwa 50% der Einwohner von In-Salah Neger, die Nachkommen der ehemaligen Sklaven. Die<br />
verschiedenen Rassen und Stämme wohnen in getrennten Vierteln der Oase. Als nach 1957 viele Schwarze die Oase<br />
verliessen, um in der Erdölindustrie eine bessere und vor allem freiere Lebensmöglichkeiten zu finden, war die Erhaltung<br />
des arbeitsaufwendigen Foggara-Systems nicht mehr möglich. Die Palmgärten drohten zu vertrocknen.<br />
Dies ist einige der Stellen, die darauf hinweist, dass die afrikanische Wirklichkeit weit komplexer und diffe-<br />
renzierter ist, als sie oft in Schulbüchern und Medien dargestellt wird. Die grosse Zahl von Völkern und Spra-<br />
chen des Kontinentes hat sich auch in der Vielfalt der Kulturen und Lebensweisen niedergeschlagen, die nicht<br />
zuletzt durch eine reiche Geschichte und die vielfältigen geographischen Gegebenheiten, die weit über die<br />
einfache Einteilung in tropischer Regenwald, Savanne und Wüste hinausgeht, gefördert werden.<br />
4.22.2.1 Mosambik<br />
Im Kapitel "In der afrikanischen Savanne" auf den Seiten 32-38 gibt der Autor im wesentlichen einen Reisebe-<br />
richt eines nicht näher genannten deutschen Geographen aus dem Jahr 1971 über Mosambik wieder. Dieser<br />
Bericht wird durch einige Fotos untermalt, von denen sich das erste auf der Seite 32 mit der Bildlegende "Auf<br />
einem Markt in Süd-Moçambique. Angeboten werden Garten- und Feldfrüchte sowie handwerkliche Erzeu-<br />
gnisse" findet, untermalt. Im Text heisst es auf den Seiten 32-33 unter dem Eintrag zum "11. September":<br />
...Die runden Häuser der Eingeborenen sind kaum zu erkennen: Ihre kegelförmigen Dächer sind mit Gras gedeckt, dessen<br />
Farbe sich von dem trockenen Bewuchs der Umgebung nicht unterscheidet.<br />
Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir einen Ort an der asphaltierten Hauptstrasse. Je mehr wir uns dem Ort nähern, desto<br />
häufiger überholen wir Frauen, die einen flachen Korb oder eine Basttasche auf dem Kopf tragen. Viele vor ihnen haben<br />
auch ihre Kleinkinder bei sich Aus den Tragetüchern über dem Rücken schauen die dunklen Köpfchen und Beinchen<br />
heraus. Offensichtlich ist heute Markt. Im Ort weisen uns die hin- und herflutenden, bepackten Menschen den Weg dorthin.<br />
So schlendern wir bald durch die im Schatten der Hauswände und Mauern auf den Erdboden ausgebreiteten Waren. Sie<br />
sind für uns ein Spiegelbild dessen, was in der weiteren Umgebung des Ortes angebaut oder hergestellt wird:<br />
Maniok-Knollen und Maismehl, die Grundnahrungsmittel dieses Gebietes, dazu Erdnüsse, Kokosnüsse und verschiedene<br />
Gemüse wie Zwiebeln, Tomaten, Bohnen, eine Art Weisskohl und allerlei Kräuter. Ausserdem werden kleine Haufen<br />
Holzkohle angeboten und vielerlei Geräte: Tontöpfe, Schöpfkellen aus Schalenhälften der Kokosnuss, Körbe und Taschen<br />
aus den Blättern und Bastfasern von Palmen, Handbesen aus Gras oder Kokosfasern, Holzschalen und Halsketten aus<br />
Fruchtkernen.<br />
Die geschilderte Marktszene ist für viele Gebiete Schwarzafrikas typisch und hat eine lange Tradition. (Siehe<br />
dazu auch die Seite 31 im Teil "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas", sowie die Seiten 153 und 349<br />
dieser Arbeit.) Der Geograph berichtet weiter (S. 32):<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
Wir fahren auf der Hauptstrasse, die hier wenige Kilometer von der Küste entfernt parallel zu dieser verläuft, ein paar<br />
Stunden nach Norden. Obwohl sie die einzige nord-südliche Strassenverbindung des Landes ist, begegnen uns in einer<br />
Stunde kaum mehr als ein Dutzend Autos. Darunter sind Busse, die hier die einzigen Nah- und Fernverkehrsmittel sind. Sie<br />
sind meist überfüllt und transportieren zudem auf ihren Dächern noch Berge von Waren, Koffer, Brennholz und selbst<br />
lebendes Kleinvieh wie Hühner und Ziegen.<br />
Wie schon auf der Seite 156 dieser Arbeit erwähnt, sind diese Busse das bevorzugte Beförderungsmittel derje-<br />
nigen Einheimischen, die über keine eigene Transportmöglichkeit verfügen. Im Text heisst es weiter (S. 33):<br />
Auf unserer etwa 200 km langen Fahrstrecke sehen wir nur wenige Reste des natürlichen Buschwaldes der Feuchtsavanne.<br />
Er ist zu beiden Seiten der Strasse fast durchgehend gerodet. Auf den rotbraunen Sandböden sind kleine, unregelmässige<br />
Felder angelegt. Wir erkennen darauf überall Maniokstauden und die trockenen Krautreste von abgeernteten Mais und<br />
Erdnusspflanzen. Dazwischen fallen immer wieder mittelhohe Bäume mit kugelförmigen, dichten Kronen und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 262
dunkelgrünen, ledrigen Blättern auf. Es sind Cashew-Bäume, deren nussartige Anhängsel der Früchte wir aus unseren<br />
Geschäften kennen. Wie wir in einer Siedlung erfahren, werden von den Einheimischen vor allem die im Sommer<br />
reifenden birnengrossen und saftigen Früchte geschätzt.<br />
Unter den Fruchtbäumen fallen ausser den Cashew besonders die hohen Kokosbäume auf. Diese beiden Baumarten<br />
bestimmen hier das Aussehen der Landschaft. Merkwürdig ist es, dass beide Arten ursprünglich gar nicht in Afrika<br />
vorkamen, sondern aus Amerika und Asien stammen, ähnlich wie auch der hier weitverbreitete Mais seinen Ursprung in<br />
Amerika hat...<br />
Diese "Merkwürdigkeit" ist ein Zeugnis der Verbreitung von Nutzpflanzen. Die Cashew-Bäume, deren Samen<br />
als wichtiger Öllieferant dienen, wurden wahrscheinlich erst im 16. Jh. durch die Portugiesen in Afrika einge-<br />
führt. Die Kokospalme dürfte schon früher auf den afrikanischen Kontinent gelangt sein.<br />
Nach dieser detaillierten Schilderung der Feuchtsavannenzone zitiert der Autor unter dem Titel "Durch die<br />
Trockensavanne" weiter das Tagebuch des deutschen Geographen, diesmal den Eintrag vom "14. September"<br />
(S. 33):<br />
...Es ist merklich trockener geworden. Zwischen den einzelnen kleinen Siedlungen mit ihren angrenzenden Feldern liegen<br />
jetzt stundenweit nur noch Grasflächen, die von kleinen Baum- oder Gebüschinseln durchsetzt sind...<br />
Über die Menschen heisst es im Eintrag des gleichen Tages weiter auf der Seite 34:<br />
Wir treffen nur noch selten Menschen an. Meist sind es Frauen, die auf ihren Köpfen schwere, mit Wasser gefüllte<br />
Tongefässe oder Blechkanister tragen. Wir beobachten, dass sie das Wasser manchmal kilometerweit von einem Brunnen<br />
durch den Busch zu ihrem Kraal tragen müssen, und sicher muss dieser Weg an einem Tage mehrmals bewältigt werden.<br />
Hin und wieder sehen wir eine fortschrittlichere Form des Wassertransports: Ein Esel zieht ein mit Wasser gefülltes Fass<br />
wie eine Walze hinter sich her.<br />
Die Versorgung mit Trinkwasser auf dem Land ist nach wie vor ein <strong>Pro</strong>blem, welches es in vielen Staaten<br />
Schwarzafrikas noch zu lösen gilt. Infolge der Wasserknappheit in einigen der Länder kann es, nicht nur durch<br />
eine Verbesserung der Infrastruktur behoben werden. (Siehe dazu auch die Karte "Verfügbares Trinkwasser"<br />
im Anhang auf der Seite 575 dieser Arbeit.)<br />
Im Eintrag zum "16. September" wird der Geograph zur Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung<br />
zitiert (S. 34):<br />
...Nicht weit vom Weg verrät eine grössere Zahl von Grasdächern eine Eingeborenensiedlung. Wir fragen den Häuptling,<br />
ob wir auf seinem Gelände übernachten dürfen. Er weist uns freundlich einen Platz an und lässt uns sogar einen Tisch und<br />
zwei Stühle herbeitragen...<br />
Auch in Westafrika werden Besucher, meist bei einem Glas Wasser, erst einmal willkommen geheissen. Unter<br />
Umständen kann es traditionellerweise mehrere Stunden dauern, bevor das Gespräch auf den eigentlich Grund<br />
des Besuches gelenkt wird. Im Eintrag zum "17. September" heisst es auf der Seite 34:<br />
Vor unserem Aufbruch zeigt uns der Häuptling die Siedlung seiner Grossfamilie. Der Platz ist etwa 100 x 50 m gross, und<br />
es stehen ungefähr 15 Hütten darauf: getrennte Wohnhütten für ihn und einige andere Männer und solche für die Frauen<br />
und Kinder, dazu Vorratshütten in denen jetzt während der Trockenzeit vor allem Maiskolben und Maniokknollen<br />
aufbewahrt werden. Eine Hütte wird gerade neu gebaut: Die Wand ist aus stärkeren Knüppeln und dünneren Zweigen<br />
geflochten, die noch mit Bastfasern aus Baumrinden sorgfältig zusammengebunden sind. Das feste Holzgerüst wird von<br />
beiden Seiten mit Lehm beworfen und somit gut abgedichtet. Neben dem Unterbau entsteht das kegelförmige Dach,<br />
ebenfalls aus zusammengeflochtenem Knüppelholz. Nachdem es aufgesetzt worden ist, kann es mit langen Grasbüscheln<br />
abgedeckt werden.<br />
Die im Text beschriebenen Arbeitsschritte werden auf drei Fotos auf der Seite 35 abgebildet. Die zugehörige<br />
Bildlegende lautet: "Ein Kegeldach-Wohnhaus entsteht; es wird nur natürliches ortsbürtiges Material verwen-<br />
det". Im Text schreibt der Geograph zur Feldbestellung auf der Seite 35:<br />
Auf einem Holzgestell liegen die Arbeitsgeräte Äxte, Haumesser und viele Hacken für die Feldarbeit der Frauen. Sie sind<br />
die wichtigsten Arbeitsgeräte dieser Hackbauern und meistens noch die einzigen in ihrer Landwirtschaft. Eine Pflugschar,<br />
die von einem Ochsen gezogen werden kann, besitzen nur wenige Bauern.<br />
Wir fragen den Häuptling, wieviel Jahre hintereinander ein Feld bebaut werden kann, da es doch nicht gedüngt wird. Wir<br />
erfahren, dass ein Feld nach drei bis vier Jahren wieder aufgegeben und dem Busch überlassen werden muss. Es wird dann<br />
ein anderes Stück Buschwald mit Feuer und Axt gerodet und bepflanzt. Erst nach zehn bis fünfzehn Jahren kann bei<br />
diesem Wanderhackbau ein früheres Feld wieder für eine neue Bepflanzung hergerichtet werden.<br />
(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 191 und 295 dieser Arbeit.) Der Eintrag vom "20. September"<br />
beschäftigt sich mit der Gegend des Limpopo-Tales. Der Geograph schreibt (S. 35):<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
...Zu beiden Seiten des Flusses erstrecken sich auf den fruchtbaren Talböden grosse Feldflächen, die mit modernen<br />
Maschinen bearbeitet werden. Offene Bewässerungskanäle bilden kilometerlange, schnurgerade Bänder, von denen<br />
rechtwinklig schmalere Kanäle abzweigen. Mit diesem Bewässerungsfeldbau kann im Gegensatz zu dem Regenfeldbau der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 263
Savanne fast das ganze Jahr hindurch Mais, Reis und Zuckerrohr angebaut werden. Auf einigen Flächen sind grössere<br />
Zitruskulturen zu sehen. Wir erkennen, welch eine grosse Bedeutung in dieser Klimazone das Wasser hat. Wenn es den<br />
Feldern in der regenlosen Zeit zugeführt werden kann, ist ein ertragreicher Dauerfeldbau möglich.<br />
Im Sudan beispielsweise wurde in der Zwischenzeit festgestellt, dass auch dem Bewässerungsfeldbau enge<br />
Grenzen gesetzt sind, da durch die Verdunstung des zugeführten Wassers und der dabei gleichzeitigen Ausfäl-<br />
lung von Mineralstoffen eine Versalzung des Bodens droht.<br />
Damit endet die Wiedergabe des Tagebuches. Die drei letzten Seiten des Kapitel zeigen auf einigen Fotos, die<br />
teilweise durch kurze Texte erläutert werden, einen Ausschnitt aus der Lebenswirklichkeit der einheimischen<br />
Bevölkerung.<br />
Auf Seite 36 sind die folgenden vier Fotos abgebildet: "Wassertransport in einem Fass in der Trockensavanne<br />
Südostafrikas", auf dem der schon im Text erwähnte Esel mit Fass zu sehen ist; "Wassertransport in Tonkrü-<br />
gen..."; "Grasgedecktes Rundhaus in Süd-Moçambique" und "Hackbäuerin mit Feldhacke...". (Zu Mosambik<br />
siehe auch die Seiten 203 und 290 dieser Arbeit.) Auf der gleichen Seite gibt der Autor Hintergrundinformatio-<br />
nen zu einem auf der Seite 37 abgebildeten Foto "In einer Eingeborenensiedlung in Nordtransvaal/Südafrika"<br />
(S. 36):<br />
Das Bild zeigt den gesamten Hausrat einer Familie im Hof an der Kochstelle (in dem Haus befinden sich nur noch<br />
Schlafmatten aus Gras und ein hölzernes Regal)...<br />
Seite 37 zeigt ein weiteres Foto "Eine Vorratshütte" und zwei Karten Afrikas "Typen herkömmlicher Wohn-<br />
häuser und -hütten in Afrika", welche das "Nomadenzelt", das "Wüstenhaus", das "Savannenhaus" in zwei<br />
Variationen, das "Regenwaldhaus" und die "Bienenkorbhütte" zeigen, sowie "Landwirtschaftliche Nutzungs-<br />
formen in Afrika". Seite 38 zeigt die Fotos "Moderne Arbeiterwohnsiedlung in einem Kiefern-Forstgebiet im<br />
südafrikanischen Hochland (Swasiland)", "An einer offenen Feuerstelle in einer Eingeborenensiedlung Südo-<br />
stafrikas" und "Langhornrinder in der Savanne...". Im einem kurzen Text heisst es zu den Wohnformen (S. 38):<br />
Heute weichen die Wohnhäuser der Afrikaner nicht nur in den Städten, sondern auch in einigen ländlichen Gebieten stark<br />
von den herkömmlichen Wohnhäusern ab. Solche "modernen" Häuser bringen Vor- und Nachteile mit sich...<br />
Band 2 enthält keine weitere Stellen mehr, die im Rahmen dieser Arbeit interessieren würden.<br />
4.22.3 Band 3<br />
Der 1975 für die Klassen 9 und 10 erschienene Band 3 der "Neuen Geographie" beschäftigt sich in den Kapi-<br />
teln "Die Dürrekatastrophe des Sahel" (S.11-14), "Die Dürrebekämpfung am Nordrande der Sahara" (S.14-15),<br />
"Entwicklungshilfe in der Praxis / Das Beispiel Tansania" (S.67-69) und "Das Rassenproblem in Südafrika"<br />
(S.80-85) mit dem Thema Afrika. Ausserdem finden sich in diesem Band noch ein Foto "Pockenschutzimp-<br />
fung im Tschad" auf der Seite 56, welches eine schwarz gekleidete Frau, die einen Nasenring trägt, zeigt,<br />
sowie eine Grafik auf der Seite 60 "Weltbevölkerung und <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen", wobei für ganz Afrika ein<br />
Einkommen von durchschnittlich weniger als 300 US$ angegeben wird (alle anderen Erdteile weisen höhere<br />
Einkommen auf).<br />
Im Kapitel "Die Dürrekatastrophe des Sahel" zitiert der Autor auf der Seite 11 einleitend vier<br />
Zeitungsausschnitte:<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
"Hungersnot bedroht Millionen Nomaden und sesshafte Ackerbauern. Sie sind gezwungen, auf der Suche nach Wasser und<br />
Nahrungsmitteln ihre Heimat zu verlassen."<br />
"Im Tschad sind 100'000 Menschen durch die Dürre vom Hungertod bedroht. Sie ernähren sich von Blättern und<br />
Wurzeln."<br />
"Wir müssen unsere Menschen am Leben erhalten, aber für unsere Bauern und Flüchtlinge handelt es sich nicht nur um<br />
angemessenes Leben, sondern einfach ums Überleben."<br />
"Jedes Jahr glaubten die betreffenden Regierungen, das nächste Jahr werde Regen bringen. Sie warteten, bis es zu spät war.<br />
Nun können sie nur auf Nothilfe hoffen."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 264
(Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 256 und 279, zum Tschad die Seite 354 dieser<br />
Arbeit.) Zu den Zeitungsauschnitten schreibt der Autor kommentierend:<br />
Derartige Berichte in Zeitungen sowie in Rundfunk- und Fernsehsendungen liessen in den vergangenen Jahren das<br />
Unglück ahnen, das Millionen Menschen in der Sahelzone heimgesucht hat.<br />
Berichte, die sich im Abstand von wenigen Jahren wiederholen sollten, und die aus Schwarzafrika, dem<br />
ehemaligen Rohstofflieferanten für den Weltmarkt, endgültig den "Hungerkontinent" der siebziger und achtzi-<br />
ger Jahre machen sollten. Über die Sahelzone schreibt der Autor (S. 11):<br />
SAHEL (= Ufer) nannten die arabischen Kamelreiter im Mittelalter diesen zwischen Wüste und feuchten Tropen gelegenen<br />
Raum, der für sie zugleich auch Übergangszone zu den Ländern der "Schwarzen" war... Hier, ausserhalb der von<br />
Tierseuchen befallenen äquatorialen Regengebiete im Süden, entwickelten sich einst die mittelalterlichen<br />
Sudan-Grossreiche Bornu-Kanem, Mali und Songhai....<br />
(Siehe dazu auch die Seite 28 im Teil "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas" dieser Arbeit.) Weiter<br />
schreibt der Autor (S.11):<br />
...Die Bauern sind gezwungen, die ersten stärkeren Regengüsse abzuwarten, bevor sie den Boden mit ihren einfachen<br />
Geräten bearbeiten können. In manchen Jahren fällt nur wenig Regen, oder der Regen bleibt ganz aus.<br />
Dann müssen die Bauern und Hirten in feuchtere Gebiete nach Süden abwandern.<br />
Der Autor fügt hinzu, dass "geringe klimatische Schwankungen... für die Bewohner dieses Raumes schon zur<br />
Katastrophe werden" können. Weiter führt er aus (S. 11 und 13):<br />
...Die Beobachtungen im Sahel, vor allem im Anschluss an die Dürre von 1913, haben gezeigt, dass die Vegetation in<br />
wenigen Jahren die von der Wüste Sahara eingenommenen Gebiete zurückerobern kann, sobald die Bedingungen etwas<br />
günstiger werden...<br />
...Die Wiederbegrünung der Wüste kann aber nur dann erfolgen, wenn der Mensch den natürlichen Pflanzenwuchs<br />
inzwischen nicht völlig vernichtet hat. In der Sahelzone weideten vor Einsetzen der Dürrekatastrophe 1968 etwa 60 Mio.<br />
Stück Vieh, vor allem Rinder, Ziegen und Schafe. Für nur höchstens ein Drittel dieses Viehbestandes jedoch bietet diese<br />
Savannenzone genügend Weide! Überweidung und damit Zerstörung der Vegetationsdecke führten im Laufe der Jahre zu<br />
einer Bodenerosion grössten Ausmasses. Dazu trugen auch das Buschbrennen, das Abholzen der letzten Baumbestände<br />
und die unkontrollierte Nutzung der Grundwasserreserven mit bei.<br />
Nachdem schon in früheren Jahren die nur scheinbare Fruchtbarkeit des Regenwaldes "entlarvt" worden war,<br />
mutieren nun auch die Gebiete der Sahel von Randgebieten der fruchtbaren Savannen zu auf Störungen<br />
äusserst anfälligen Landschaftsgürteln.<br />
Seite 12 zeigt eine Klimakarte Westafrikas und auf der Seite 13 ist ein Diagramm zu den Niederschlägen<br />
anhand der Messungen einer Station im östlichen Tschad für die Jahre 1935-1970 abgebildet.<br />
Zu den internationalen Bemühungen als Reaktion auf die im Diagramm ausgewiesenen Dürre ab 1965 schreibt<br />
der Autor auf der Seite 13:<br />
Während man sich fragt, ob der Sahel als Lebensraum des Menschen überhaupt noch zu retten ist oder ob dieser Raum für<br />
die Nomaden und Bauern vorerst verloren ist, bemühen sich die internationalen Hilfsorganisationen um die Erstellung<br />
eines Sofortprogrammes und um wirksame Hilfsaktionen. Man hat erkannt, dass nur die Zusammenarbeit der betroffenen<br />
Länder selbst, unterstützt durch internationale Organisationen, Hilfe bringen kann. Zu den Notmassnahmen gehören:<br />
- Lebensmittelversorgung der Bevölkerung,<br />
- Ankauf von Vieh für die Nomaden,<br />
- Verbesserung der Strassen,<br />
- Errichtung von Futtersilos in abgelegenen Gebieten (Vorratswirtschaft),<br />
- Brunnenbau,<br />
- Bodenschutz durch Aufforstung und Einschränkung der Herdengrössen.<br />
Zahlreiche weitere Massnahmen sind geplant:<br />
- Sammeln aller Wetternachrichten und Einrichtung eines Wetter-Vorsorgedienstes,<br />
- Verbesserung des Kartenwesens (Hydrologische Karten grossen Massstabs werden benötigt!),<br />
- Errichtung landwirtschaftlicher Fachinstitute (Pflanzenzucht, Ausbildung von Agronomen),<br />
- Verbesserung des Schulwesens,<br />
- Beschränkung der Herden auf eine bestimmte Grösse und Auswahl der Arten (z. B. Abschaffung der Ziegen, die die<br />
jungen Baumtriebe durch Verbiss vernichten).<br />
In seinen weiteren Ausführungen schreibt der Autor, dass vor allem die Tuareg, d.h. die allgemein als nicht<br />
schwarzafrikanisch angesehenen Nomaden, von der Dürre besonders betroffen worden seien. Seite 14 zeigt<br />
dann noch ein Foto "Verendetes Vieh im Sudan". Die weiteren Seiten befassen sich vor allem mit Algerien<br />
und sind für die Fragestellung dieser Arbeit nicht weiter interessant.<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 265
4.22.3.1 Entwicklungshilfe<br />
Im Abschnitt über die Entwicklungshilfe kommt der Autor nach einigen allgemeinen Überlegungen zu den<br />
Schwierigkeiten der Entwicklungshilfe ab der Seite 67 unter der Überschrift "Entwicklungshilfe in der Praxis"<br />
auch auf einige afrikanische Beispiele zu sprechen, darunter Äthiopien, Marokko und Tansania. Zum Beispiel<br />
Äthiopien schreibt er (S. 67):<br />
...Ein Vertreter einer westeuropäischen Traktoren-Firma zeigte einem äthiopischen Grundbesitzer bei Addis Abeba, wie<br />
man mit Traktor und Pflug rationeller wirtschaften kann. Das Ergebnis war: Der Grundherr kündigte die Pachtverträge mit<br />
den kleinen Bauern. Er legte die Felder zusammen und liess sie durch wenige Arbeitskräfte mit Traktoren grossflächig<br />
bearbeiten. Das brachte höhere Gewinne. Die ehemaligen Pächter aber wanderten in die Wellblechquartiere der nahen<br />
Stadt Addis ab und vermehrten dort die Schicht der Entwurzelten.<br />
(Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 198 und 296 dieser Arbeit). Dieses Beispiel zeigt, dass unter gegebenen<br />
Umständen zumindest einige Afrikaner nicht wesentlich anders reagieren als Europäer in der gleichen Situa-<br />
tion. Darüber hinaus wird klar, dass selbst gutgemeinte Hilfe unvorhergesehene Folgen für die wirtschaftlichen<br />
Beziehungen der Menschen untereinander bewirken kann. Eine Einsicht, der sich Mitte der achtziger Jahre<br />
auch die tansanische Regierung beugen musste. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 260 und 289<br />
dieser Arbeit.)<br />
4.22.3.2 Tansania<br />
Etwas eingehender wird das Beispiel "Tansania" auf den Seiten 67-69 besprochen. Unter der Überschrift "Aus<br />
der Vergangenheit des Landes" schreibt der Autor (S. 67):<br />
Im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen afrikanischer Länder von der Ausbeutung oder Bevormundung durch<br />
europäische Länder erreichte 1961 auch das ostafrikanische Land Tanganjika unter seinem politischen Führer Dr. Julius<br />
Nyerere die Selbständigkeit. Zwei Jahre später erklärte sich Tanganjika zur Republik innerhalb des British Commonwealth,<br />
und 1964 schloss es sich mit der Insel Sansibar zur Republik "Tansania" zusammen. Nyerere blieb Präsident des neuen<br />
Staates.<br />
Anzumerken bleibt, dass Tansania in gewisser Hinsicht ein Sonderfall war, da es nachdem die Deutschen ihre<br />
ehemalige Kolonie aufgeben mussten, von den Briten nur im Mandatsstatus im Auftrag der Völkergemein-<br />
schaft verwaltet wurde und damit weniger stark von aussen kontrolliert wurde, als dies für die meisten anderen<br />
ostafrikanischen Länder der Fall war. Unter der Überschrift "Mut zu einem eigenen Weg" fährt der Autor auf<br />
den Seiten 67 fort:<br />
1967 wurde in Arusha, einer kleineren Stadt in Tansania, das <strong>Pro</strong>gramm eines eigenen Entwicklungsweges entworfen.<br />
Tansania nennt diesen Weg "Policy of self - reliance", d. h.: man will sich auf seine eigenen Kräfte besinnen und verlassen.<br />
Die unter der Berücksichtigung der Forderung nach Demokratie sechs einzelnen Punkte des <strong>Pro</strong>grammes<br />
werden auf der Seite 68, die auch eine Tabelle "Ein Vergleich Tansanias mit der Schweiz" enthält, und der<br />
Seite 69 aufgeführt:<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
1. Sozialer Ausgleich zwischen reich und arm<br />
"Tansania versucht, nach dem Motto 'Einer für alle - alle für einen' zu leben. Wie früher jeder für die Gemeinschaft eines<br />
Stammes und der Stamm für jeden einzelnen gesorgt hatte, so soll auch der moderne Staat Tansania aufgebaut werden.<br />
Der Boden z. B. gehört nicht wie bei uns einzelnen, sondern eigentlich allen zusammen, dem Staat. Dieser überlässt ihn<br />
durch Genossenschaften und Gemeinschaftsdörfer den Bürgern zur Nutzung. So ist es nicht mehr möglich, dass sich<br />
einzelne Landbesitzer auf Kosten von Mietern und Pächtern bereichern.<br />
... ein anderes Beispiel: Nirgendwo sonst in Afrika sind die Löhne für Staatsbeamte so niedrig wie in Tansania."<br />
2. Sich nicht von ausländischer Hilfe abhängig machen<br />
"Tansania ist zwar auch auf ausländische Hilfe angewiesen, aber es will trotzdem unabhängig bleiben. Darum nimmt es<br />
Hilfe aus West und Ost an. China baut zur Zeit eine über 1800 km lange Eisenbahn von Dar es Salam nach Sambia<br />
und gewährte dafür einen zinslosen Kredit von 1,5 Milliarden Franken. Die USA bauen im Süden von Tansania eine<br />
wichtige Strasse." Entwicklungshelfer aus Schweden, der Schweiz, der BRD und aus anderen Ländern helfen seit vielen<br />
Jahren beim Aufbau des Landes...<br />
3. Rückgrat der Entwicklung ist die Landwirtschaft<br />
"Da der grösste Teil der tansanischen Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeitet, hat diese für Tansania eine<br />
entscheidende Bedeutung.<br />
[J. Nyerere]: 'Wir machen den Fehler, zu denken, dass Entwicklung mit Industrie beginnt. Das ist ein Fehler, weil wir<br />
nicht die Mittel haben, viele Industrien in unserem Land einzurichten. Wir haben weder das notwendige Geld, noch das<br />
technische Wissen... Wir können nicht genug Geld bekommen und nicht genug Techniker besorgen, um alle Industrien<br />
in Gang zu setzen, die wir brauchen würden...'."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 266
4. 'Von der Hacke zum Ochsenpflug'<br />
[J. Nyerere]: "'Wir erzielen keinen Fortschritt, indem wir warten, bis jeder Bauer seinen eigenen Traktor besitzt. Wenn<br />
wir darauf warten, werden wir die Hacke nie hinter uns lassen, denn unsere augenblicklichen Methoden sind nicht<br />
ertragreich genug, den Wohlstand zu erzeugen, der uns befähigen würde, Traktoren für alle Leute des Landes zu kaufen<br />
oder Leute auszubilden, sie zu fahren und zu warten...<br />
Wir sind nicht reif für den Traktor, weder finanziell noch technisch, aber wir sind reif für den Ochsenpflug.'"<br />
(Zum Ochsenpflug siehe auch die Seite 308 dieser Arbeit.)<br />
5. Harte Arbeit<br />
J. Nyerere]: "'Die Entwicklung des Landes wird durch Menschen, nicht durch Geld zustandegebracht... Die Energien<br />
von Millionen Männern und Tausenden von Frauen in den Städten werden gegenwärtig vergeudet beim Klatsch, beim<br />
Tanz und beim Trinken. Ein grosser Schatz, der mehr zur Entwicklung unseres Landes beitragen könnte als irgend<br />
etwas, was wir von reichen Nationen bekommen könnten.'"<br />
Nyerere spricht mit dem Punkt "Harte Arbeit" nur aus, was andere Schwarzafrikaner, die auf dem Land leben,<br />
täglich erfahren: nicht Feste und Tänze stehen im Vordergrund, sondern die tägliche Arbeit auf den Feldern.<br />
Gleichsam als Kontrast zu den damals noch in den Anfängen steckenden Entwicklungsplänen Tansanias führt<br />
der Autor ein unter der britischen Mandatsverwaltung im Zeitraum 1946-1950 geplanten "Entwicklungspr-<br />
ojekt" zum Erdnussanbau an. Diese wurde bereits in den Lehrmitteln "Seydlitz für Gymnasien", im Band 6 auf<br />
der Seite 80, und "Terra Geographie", im Band 1 auf der Seite 16, erwähnt. (Siehe dazu auch die Seiten 216<br />
und 305 dieser Arbeit). Dazu schreibt der Autor auf der Seite 69:<br />
...Nach dem 2. Weltkrieg herrschte in verschiedenen Bereichen der Weltwirtschaft Mangel an Rohstoffen. In England<br />
wurden z. B. Überlegungen angestellt, wie man die weltweite und in England besonders spürbare grosse "Fettlücke"<br />
schliessen könne. Im März 1946 schlug die United Africa Company der britischen Regierung vor, in Ostafrika 10'000 km 2<br />
(= 1 Mio. ha) für den Anbau der Erdnuss, deren Frucht 40-50% Öl enthält, zu erschliessen... Im Juni 1946 reisten 3<br />
Sachverständige im Auftrag der britischen Regierung nach Ostafrika, um an Ort und Stelle die Möglichkeiten für den<br />
grossflächigen Anbau von Erdnüssen zu überprüfen. Die Sachverständigen legten im September 1946 ihr Gutachten vor.<br />
Sie beurteilten darin die Chancen des geplanten Erdnussprojekts positiv. Das <strong>Pro</strong>jekt wurde daraufhin um ca. 30% auf 1,3<br />
Mio. ha erweitert. Die Ernteerwartungen lagen bei 600'000 bis 800'000 t jährlich nach Ausnutzung der Gesamtfläche ab<br />
1953. Die in Aussicht genommene riesige Landfläche sollte in 107 Einheiten zu je 12'000 ha aufgeteilt werden: 80 in<br />
Tanganjika, 17 in Nordrhodesien (= Zambia), 10 in Kenia...<br />
Am Anfang des <strong>Pro</strong>jekts standen umfangreiche Rodungen, die sich jedoch aufgrund der ungünstigen Boden- und<br />
Vegetationsverhältnisse als besonders schwierig und kostspielig erwiesen. Im ersten Jahr konnten nur etwa 5% des<br />
Rodungsplanes verwirklicht werden. In den folgenden Jahren machte man weitere Erfahrungen:<br />
a) Die Niederschläge reichten nicht aus. Ihre jahreszeitliche Verteilung stimmte ausserdem nicht mit den Wachstums-,<br />
Reife- und Erntezeiten der Erdnuss überein.<br />
b) Der über die grossen Rodungs- bzw. Anbauflächen ungehindert wehende Wind (und kurze, heftige Regenschauer)<br />
verursachten starke Bodenerosionen.<br />
c) Die Verbackung des Rotlehmbodens in der Trockenzeit beeinträchtigte den maschinellen Erntevorgang: ein Teil der<br />
Nüsse blieben im Boden stecken.<br />
d) Die Fruchtbarkeit des Bodens nahm rascher ab als zuvor angenommen wurde.<br />
e) Auf den grossen Erdnussanbauflächen breiteten sich Pflanzenkrankheiten aus.<br />
In den Jahren bis 1950 wurden jeweils nur etwa 30 % der erwarteten Mengen geerntet. Auf den ursprünglichen Gesamtplan<br />
bezogen entsprach das einem <strong>Pro</strong>zentsatz von nur 1.2% bei doppelten Kosten! Das geplante Erdnussprojekt galt damit als<br />
gescheitert. Es wurde aufgegeben und mit veränderter Konzeption in ein kleineres Versuchsvorhaben umgewandelt. Der<br />
finanzielle Verlust betrug mehr als 300 Millionen DM!<br />
Abschliessend führt der Autor auf der Seite 69 zum Thema der Entwicklungshilfe aus:<br />
Grosse, augenfällige "Entwicklungsprojekte" wurden auch später noch und z. T. bis heute von Industrieländern in<br />
unterentwickelten Ländern geleistet (Industrieanlagen, Kraftwerke, landwirtschaftliche Musterbetriebe, Universitäten etc.).<br />
Nicht selten wurden dabei die natürlichen Bedingungen des Landes, seine Wirtschafts- und Verkehrsstruktur (z. B. rentable<br />
Zulieferungs- und Absatzmöglichkeiten), vor allem aber die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Denkweisen und<br />
Gewohnheiten der Menschen nicht oder nicht genügend berücksichtigt.<br />
Entgegen den Erwartungen, die der Abschnitt zu Tansania im Band 3 der "Neuen Geographie" erwecken könn-<br />
te, scheiterte auch das "angepasste" Entwicklungsprojekt des tansanischen Staates, wie auf der Seite 321 dieser<br />
Arbeit näher ausgeführt wird. (Zu Tansania siehe auch die Seiten 221 und 287 dieser Arbeit.)<br />
4.22.3.3 Südafrika<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
Das letzte Kapitel beschäftigt sich auf den Seiten 80-85 mit dem "Rassenproblem in Südafrika". Seite 80<br />
druckt unter der Überschrift "Südafrika im Urteil von Weissen und Schwarzen" die damalige Haltung der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 267
urischen Regierung ab, die sich als "Bollwerk westlicher Zivilisation in Afrika" sah, sowie in einem Gedicht,<br />
dessen Verfasser nicht genannt wird, die Situation eines Grossteils der schwarzen Bevölkerung (S. 50):<br />
"öffne die zeitungen, und du findest / dort offen gelegt, was es bedeutet / in diesem unseren aufgeklärten land zu leben /<br />
grosse, unverrückbare buchstaben in schicksalhaften schwarz / sagen, dass nach dem recht eine afrikanische braut / von<br />
ihrem mann getrennt werden kann / der sich abmüht, bis vom alter geschwächte muskeln / nichts mehr zur wirtschaft des<br />
landes beitragen können / und dann zu seiner frau in die einöde abgeschoben wird / ohne hoffnung sitzen sie und starren /<br />
auf das ausgelaugte, unfruchtbare land / mit bitterer frage, ob gott sich darum schert / was jenen seinen kindern geschieht /<br />
die nicht mit einer weissen hautfärbung geboren wurden / in unserem aufgeklärten land"<br />
Auf den Seiten 80-81 gibt der Autor unter der Überschrift "Aus der Geschichte der Weissen und Schwarzen in<br />
Südafrika" einen kurzen Überblick über die historischen Geschehnisse in Südafrika wieder:<br />
1652 Gründung eines Stützpunktes für die holländischen Ostindiensegler, Besiedlung Südafrikas durch Weisse<br />
(Buren).<br />
1657 Ankunft der ersten Sklaven aus Madagaskar und Java. (Der Weisse war von Anfang an Herr, der Nichtweisse<br />
Diener)<br />
1779 Erster Krieg zwischen Buren und Afrikanern (= gut organisierte, Vieh züchtende Bantu-Stämme). In der<br />
Folgezeit werden die Bantu-Stämme besiegt und zurückgedrängt.<br />
1834 Abschaffung der Sklaverei durch die neu errichtete britische Kolonialverwaltung.<br />
1835-1846 "Grosser Trek": rund 10'000 Buren ziehen auf Ochsenkarren in das Innere des heutigen Südafrika. Sie suchen<br />
neue Weideplätze für ihre grossen Viehherden und wollen der britischen Verwaltung entgehen. Es kommt zu<br />
schweren Kämpfen, z. B. mit den Zulus.<br />
1860 Ankunft der ersten Inder für die Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen Natals.<br />
~1870 Entdeckung von Bodenschätzen, z. B. Gold, in Transvaal. Beginn der Industrialisierung. Schwarze leisten<br />
schwere Arbeit.<br />
1910 Gründung der Union von Südafrika als Teil des britischen Weltreiches (Empire).<br />
1948 Übernahme der Regierung durch die Nationale Partei. Die "Apartheid" (getrennte Entwicklung) wird<br />
Regierungsprogramm: Durch die Trennung auf möglichst allen Gebieten soll eine weitere Mischung der<br />
Rassen verhindert werden. In "Heimatländern" (homelands) sollen sich die einzelnen Bantu-Stämme zu<br />
unabhängigen Nationen entwickeln. In diesen auch "Bantustans" genannten Gebieten sollen die nichtweissen<br />
Afrikaner einmal alle Rechte besitzen, während sie im "weissen Gebiet" nur als Wanderarbeiter zugelassen<br />
werden sollen.<br />
1960 Sharpeville: bei Anti-Pass-Demonstrationen schiesst die Polizei in die Menge schwarzer Demonstranten...<br />
Verbot der grossen Parteien der Schwarzen, z. B. des "African National Congress", dessen Führer Albert J.<br />
Lutuli für seine Politik des gewaltlosen Widerstands den Friedens-Nobelpreis 1960 erhält.<br />
1963 Errichtung des ersten Bantustans: Transkei<br />
1973 Die führenden Politiker verschiedener Bantustans beschliessen, eine einheitliche "schwarze Nation" zu<br />
schaffen. "Chef" Kaiser Matanzima (Transkei) erklärt: "Wir wollen eine schwarze Nation und nicht schwache<br />
Stammesgruppen."<br />
Die Pläne der südafrikanischen Regierung erläuternd, schreibt der Autor auf der Seite 81, dass die "Bantustans<br />
(homelands)... einmal 13.7% der gesamten Fläche Südafrikas umfassen" sollen, dies entspreche "etwa 50%<br />
seiner landwirtschaftlich genutzten Fläche". Auf der gleichen Seite werden aus einer Karte "Die Bantu-<br />
homelands" die Grenzen dieser Gebiete ersichtlich. Weiter schreibt der Autor unter der Überschrift "Gesetze<br />
regeln das Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen in Südafrika" auf der gleichen Seite:<br />
Unter diesen Gesetzen gibt es einige sehr fragwürdige, die die nicht-weissen Rassen abwerten (diskriminieren):<br />
Gesetze über Unmoral 1927 (Immorality Act):<br />
Der aussereheliche Geschlechtsverkehr zwischen Weissen und Schwarzen ist verboten.<br />
<strong>Pro</strong>hibition of Mixed Marriages Act 1950:<br />
Die Heirat zwischen Weissen und Nichtweissen ist verboten.<br />
Gesetz über die rassische Einteilung 1950 (Population Registration Act):<br />
Grundlage für alle Gesetze der Apartheid ist die Einteilung der gesamten Bevölkerung in Rassen.<br />
Obwohl der Autor dies nicht ausspricht, verboten diese Gesetze jegliche Verbindung zwischen Schwarzen und<br />
Weissen in Südafrika. Allerdings schien sich zumindest ein Teil der Bevölkerung nicht allzusehr um diese<br />
Verbote zu kümmern, wie das Zitat auf aus dem Lehrmittel "Länder und Völker" (Bd. 3, S. 60) aus den 60er<br />
Jahren auf der Seite 204 dieser Arbeit zeigt.<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
In einem weiteren Abschnitt auf der Seite 82, auf welcher ein Foto "For Whites Only...", das eine weisse<br />
Südafrikanerin auf einem Parkbank zeigt, der die sinngemäss übersetzte Aufschrift "Nur für Weisse" trägt,<br />
abgebildet ist (siehe dazu auch die Seiten 259 und 394 dieser Arbeit), schreibt der Autor über die Passgesetze:<br />
Passgesetze 1952 (Natives... Act): Für schwarze Afrikaner werden Kontrollbücher eingeführt, in denen u. a. die<br />
Personenangaben, die Aufenthaltsgenehmigung für weisse Gebiete, der Nachweis über geleistete Arbeit und gezahlte<br />
Steuern enthalten sein muss. "Ein Afrikaner, der das 16. Lebensjahr erreicht. hat, muss im Besitz eines Kontrollbuchs<br />
(Reference Book) sein. Ein Polizist kann jederzeit Einsicht in das Buch verlangen. Kann ein Afrikaner sein Buch nicht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 268
vorweisen, weil er es zu Hause gelassen hat, so macht er sich einer strafbaren Handlung schuldig, die mit einer Geldstrafe<br />
bis zu 28 Dollar oder mit Gefängnis bis zu 1 Monat geahndet wird." Von Juli 1970 bis Juni 1971 standen in Südafrika<br />
615'075 Afrikaner wegen Übertretung der Passgesetze vor Gericht!<br />
Die Folgen dieser Gesetzgebung schildert der Autor unter der Überschrift "Was einem ausländischen Besucher<br />
im "weissen" Südafrika auffällt" auf der Seite 82:<br />
- Es ist nicht üblich, dass ein Weisser einem Schwarzen die Hand gibt.<br />
- Weisse und Nichtweisse wohnen getrennt.<br />
- Es gibt an öffentlichen Gebäuden unterschiedliche Eingänge für Weisse (Whites) und Nicht-Weisse (Non-Whites).<br />
- Alle Bevölkerungsgruppen haben eigene Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Kirchen.<br />
- Nichtweisse und Weisse fahren mit getrennten Bussen und Taxen. Die Eisenbahn hat getrennte Bahnhöfe bzw.<br />
Bahnsteige und Wagen.<br />
- Die meisten Hotels, Restaurants, Kinos und Sportplätze sind "FOR WHITES ONLY".<br />
- Fast alle "niederen" Arbeiten werden von Schwarzen verrichtet (Müllabfuhr, Strassenreinigung, Fussbodenpflege usw.).<br />
- Weisse und Schwarze kleiden sich europäisch.<br />
- In Werkstätten, Büros und auf Baustellen arbeiten Schwarze und Weisse zusammen.<br />
- In Kaufhäusern und Geschäften der Städte gibt es keine Rassentrennung mehr.<br />
Im nächsten Abschnitt auf den Seiten 82-83 beschreibt der Autor unter der Überschrift "Das Bildungswesen in<br />
Südafrika" die Schulpolitik der Regierung der damaligen Republik Südafrika:<br />
"Das Erziehungsprogramm in Südafrika muss allen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gerecht werden;..."<br />
Zu dem Erziehungsprogramm für die Bantus schrieb W. Eiselen, einer der "Väter" des Apartheidsgedankens: "Es ist unser<br />
wohl... erfolgreichstes Experiment zur Förderung der Bantu-Selbsthilfe als Grundlage für das Zugeständnis von Rechten<br />
und Pflichten an das Volk selbst... Von den damals 700'000 stieg die Zahl auf 1'260'000 Bantu-Schüler im Juni 1958, sie<br />
hat sich also in fünf Jahren nahezu verdoppelt."<br />
Vor Erreichen der 5. Klasse verlassen die Hälfte der eingeschulten schwarzen Kinder die Schule. Ein Viertel der Kinder<br />
besucht nur das erste Schuljahr. Beispiel:<br />
1965 eingeschult: 515'449 Kinder (100%)<br />
1966 2. Klasse: 382'742 (74.3%)<br />
1969 5. Klasse: 234'407 (45.5%)<br />
Das <strong>Pro</strong>blem des vorzeitigen Verlassens der Schule ist auch aus anderen schwarzafrikanischen Ländern<br />
bekannt und damit nicht in erster Linie eine Folge der Apartheidspolitik, sondern auf die Armut der damaligen<br />
schwarzen Bevölkerung in Südafrika zurückzuführen. (Siehe zu den vorzeitigen Schulabgängen auch die Seite<br />
298 dieser Arbeit.)<br />
Auch mit Hilfe der auf der Seite 83 abgebildeten Tabellen zu den "Ausgaben für die Erziehung je Schüler<br />
1972" und den Studentenzahlen des gleichen Jahres macht der Autor deutlich klar, wie die Situation in Südaf-<br />
rika tatsächlich aussah. So betrugen nach der Tabelle die durchschnittlichen Ausgaben für einen schwarzen<br />
Schüler gerade einmal 5.5% der Ausgaben für einen weissen Schüler. Zusätzlich mussten sich die schwarzen<br />
Schüler mit einem dreimal schlechteren Lehrer-Schüler-Verhältnis zufriedengeben und obwohl die weissen<br />
Kinder nur 19% aller Schüler ausmachten, stellten sie 85% der Studenten während der Anteil der schwarzen<br />
Studenten bei nur 7% lag.<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
Unter der Überschrift "Löhne und Gehälter in Südafrika" schreibt der Autor auf der Seite 83:<br />
Offiziell gibt es keine ungleiche Behandlung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Lohn- und Gehaltspolitik.<br />
Dennoch bekommen z. B. Lehrer bei etwa gleichem Ausbildungsstand ein unterschiedliches Gehalt:<br />
als Weisser 3'360 - 5'100 Rand/Jahr<br />
als Mischling/Asiat 2'010 - 3'480 Rand/Jahr<br />
als Bantu 1'260 - 2'610 Rand/Jahr<br />
Bei einem Einkommen von mehr als 360 R im Jahr zahlen schwarze Afrikaner Steuern. Die anderen Rassengruppen zahlen<br />
erst ab 676 R im Jahr. Der Familienstand wird berücksichtigt: Verheiratete zahlen erst bei einem Einkommen von 1'151 R<br />
Steuern.<br />
Gesetzlich werden in Südafrika bestimmte Berufe allein den Weissen vorbehalten (Industrial ... Act 1956). In der Regel<br />
arbeiten heute die Weissen in den gelernten, die Afrikaner noch in den ungelernten Berufen. Für alle Arbeiten sind<br />
Mindestlöhne vorgeschrieben.<br />
"In Südafrika dient die Arbeitsreservierung als Vorsichtsmassnahme gegen den Wettbewerb zwischen den einzelnen<br />
Bevölkerungsgruppen: sie ist eine positive Massnahme, die die ordnungsgemässe Koexistenz sicherstellt."<br />
Das Existenzminimum lag 1972 für eine fünfköpfige Familie bei 70,6 R/Monat.<br />
Aus den Angaben im Text wird klar, dass die Entlöhnung der meisten schwarzen Arbeiter für den Lebensun-<br />
terhalt ihrer Familien nicht ausreichte. (Zu den Löhnen in Südafrika siehe auch die Seite 282 dieser Arbeit.)<br />
Gleichzeitig war die weisse Gesellschaft zu einem hohen Grad abhängig von der billigen Arbeit der schwarzen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 269
Arbeiter, und dies nicht nur in der <strong>Pro</strong>duktion, sondern auch bei Arbeiten im Haushalt. (Economist 06.06.98,<br />
S. 49-50)<br />
Ähnliche Aussagen werden auch in der auf Seite 83 abgedruckten Tabelle "Durchschnitts-Monatsverdienste<br />
1972" gemacht, nach der die Löhne der "Bantu" nur ca. 5-18% der "Weissen" ausmachen. Zum Streikrecht<br />
fährt der Autor fort (S. 83):<br />
Schwarze Afrikaner dürfen nicht streiken. Sie besitzen keine anerkannten Gewerkschaften. Dazu sagte der Arbeitsminister<br />
der Republik Südafrika am 8. 5. 1972: "Diese Regierung vertritt den Standpunkt, dass... die Anerkennung von<br />
Bantu-Gewerkschaften... eine Gefahr für Südafrika darstelle, weil das den Arbeitsfrieden gefährde."...<br />
Zum Vergleich führt der Autor die allgemeine Erklärung der Menschenrechte an, zu denen auch das Recht auf<br />
Beitritt zu einer Gewerkschaft gehört. Weiter schreibt er auf den Seiten 83-84:<br />
...Am 12. 9. 1973 lautete eine Schlagzeile der Zeitung "Rand Daily Mail" (Johannesburg): "10 SHOT DEAD." Am Tag<br />
zuvor waren in einem der modernsten Goldbergwerke Südafrikas 10 schwarze Arbeiter von der Polizei erschossen worden,<br />
als sie für höhere Löhne streikten. Die Löhne für weisse Bergleute waren im Juni 1973 um 100 R pro Monat erhöht<br />
worden.<br />
1972 und 1973 streikten etwa 100'000 afrikanische Arbeiter, obwohl für sie der Streik verboten und ein strafbares<br />
Vergehen ist.<br />
Dank der besonders billigen Arbeitskräfte verdienen die Firmen in Südafrika teilweise mehr als in anderen Teilen der Welt.<br />
Viele ausländische Unternehmen haben deshalb Tochtergesellschaften in Südafrika. Auch deutsche Firmen haben hier<br />
Zweigwerke, die den schwarzen Arbeitern einen Lohn unter dem Existenzminimum bezahlen.<br />
Im Gegensatz zu einem Zitat aus dem Lehrmittel "Terra Geographie" von 1979 (Bd. 2, S. 217), wiedergegeben<br />
auf der Seite 313 dieser Arbeit, werden die Schüler nicht direkt aufgefordert, politische Verantwortung zu<br />
übernehmen, aber der Autor prangert die Haltung einiger ausländischer Firmen doch klar an und macht damit<br />
deutlich, dass es sich bei der Apartheidspolitik nicht nur um eine Angelegenheit der Regierung Südafrikas<br />
handelte, da auch andere von diesem System profitierten.<br />
Auf der Seite 84 ist auch die nachfolgend unter dem Titel "Südafrikanische Karikatur" wiedergegebene Zeich-<br />
nung abgebildet, die wohl die Abhängigkeit zwischen weissen und schwarzen Südafrikanern darstellen soll,<br />
aber fatal an die Praxis der südafrikanischen Sicherheitsleute erinnert, schwarze Oppositionspolitiker über<br />
Klippen in Flüsse zu stossen:<br />
Zu der Wohnsituation der Südafrikaner schreibt der Autor unter der Überschrift "Wohnen in Südafrika"<br />
(S. 84):<br />
Jede Bevölkerungsgruppe hat ihre eigenen Wohngebiete, die voneinander klar getrennt sind..." Kein (farbiger) Afrikaner,<br />
der rechtmässig aufgrund einer Erlaubnis in einer Stadt (der Weissen) lebt, kann deswegen seine Frau und Kinder bei sich<br />
wohnen lassen. Sie dürfen nur dann bei ihm wohnen, wenn sie eine eigens hierfür ausgestellte Erlaubnis besitzen." ...<br />
...Zwischen 750'000 und 1 Mio. Menschen leben dagegen im afrikanischen Teil der Stadt (locations), in Soweto. Hier spürt<br />
man kaum etwas von dem Reichtum Südafrikas...<br />
...Über die Hälfte aller Häuser besteht aus Vierraum-Einheitshäusern mit je etwa 30 qm Wohnfläche. Die Zimmer im<br />
Innern sind nicht durch Türen voneinander getrennt. Die Häuser werden meist von grossen Familien bewohnt.<br />
Von den Bantus werden diese Häuser und Wohnbedingungen jedoch häufig als sozialer Aufstieg empfunden...<br />
Die Ausführungen werden durch eine Tabelle zur "Ausstattung der Häuser" ergänzt, laut der beispielsweise nur<br />
15% der Häuser über Elektrizität verfügten.<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
Zur Arbeitssituation der schwarzen Bevölkerungsmehrheit schreibt der Autor auf den Seiten 84 und 85:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 270
220'000 Bantus fahren jeden Tag von Soweto nach Johannesburg; sie legen dabei 15-30 km mit Bahn oder Bus zurück. Für<br />
eine schwarze Hausangestellte beginnt ein normaler Arbeitstag etwa um 6.30 bis 7 Uhr und endet gegen 19 Uhr (bei einer<br />
Mittagspause von 2 Std.).<br />
Durch die langen und oft zeitraubenden Anfahrwege zur Arbeitsstelle sind die schwarzen Arbeitskräfte in den "weissen"<br />
Städten nicht selten 16 Std. täglich von zu Hause weg.<br />
Die Seite 85 zeigt drei Fotos "Blick auf das 'weisse Johannesburg'", "Blick auf Soweto, den afrikanischen Teil<br />
von Johannesburg" und "Kinder eines Slumgebietes bei Johannesburg", auf denen die im Text erwähnten<br />
Unterschiede zu sehen sind. (Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 258 und 280 zu den Slums Schwarz-<br />
afrikas die Seiten 253 und 283 dieser Arbeit.)<br />
Die letzten Bemerkungen des Autors zu Südafrika unter der Überschrift "Andere politische Vorstellungen und<br />
mögliche Auswege" gelten der Zukunft des Landes. Er schreibt (S. 85):<br />
Auf dem "Volkskongress" von Kliptown kamen am 25./26.6.1955 Menschen aller Rassen zusammen. Unter der Leitung<br />
des African National Congress wurde eine Freiheitsurkunde verabschiedet:<br />
"Wir, das Volk von Südafrika, erklären, unserem ganzen Land und der Welt zur Kenntnis: Südafrika gehört allen, die darin<br />
leben, Schwarzen und Weissen... unser Volk ist seines Geburtsrechtes auf Land, Freiheit und Frieden... beraubt worden...<br />
Das Volk soll regieren!... Das Volk soll am Reichtum des Landes teilhaben!... Alle sollen gleiche Menschenrechte<br />
geniessen! ..."<br />
Eine christliche südafrikanische Studiengruppe schlägt für eine sofortige friedliche Veränderung der Gesellschaft u. a. vor:<br />
- Verbesserung des Erziehungswesens für farbige Afrikaner, Fernziel: gleiche Ausgaben für alle.<br />
- Löhne für farbige Afrikaner, die das Existenzminimum sichern, Gewerkschaften für alle Rassen, Aufhebung der<br />
Arbeitsreservierung und der Passgesetze, Fernziel: gleiche Löhne für alle.<br />
- Bau von Sozialwohnungen für farbige Afrikaner, Ziel: menschenwürdige Behausungen für alle.<br />
Geprägt sind diese Vorschläge von der Sorge, dass es ein "zu spät" geben könnte.<br />
Wie die weitere Entwicklung des Landes seither gezeigt hat, war es dank der Geduld der schwarzen Bevölke-<br />
rungsmehrheit auch Mitte der neunziger Jahre noch nicht "zu spät", um eine Lösung zu finden, ohne das Land<br />
in Chaos und Bürgerkrieg zu stürzen. Andererseits zeigen die Schwierigkeiten der heutigen Regierung, dass<br />
die Politik der Apartheid nicht ohne negative Folgen blieb. So weist das Land Ende der neunziger Jahre über<br />
eine der weltweit höchsten Kriminalitätsraten auf.<br />
4.22.4 Zusammenfassung<br />
Der Autor zeichnet ein vielfältiges Bild Schwarzafrikas. Neben der Schilderung des einfachen Lebens auf dem<br />
Land in kleinen Strukturen und dem Marktalltag nennt er typische afrikanische <strong>Pro</strong>dukte wie die Cashewnuss<br />
und vergisst auch die Gastfreundlichkeit der "eingeborenen Stämme" nicht zu erwähnen.<br />
Die Sahelzone ist bereits zum Katastrophengebiet geworden, indem Million vom Hunger bedroht werden und<br />
Hunderttausende bereits gestorben sind. Auch die Schwarzen Südafrikas werden als Opfer, diesmal politischer<br />
Umstände" beschrieben, die sich der ungerechten Behandlung der Weissen geduldig fügen müssen, denn beim<br />
kleinsten Aufmerken wandern sie in Gefängnis oder werden gar erschossen. Andererseits werden auch<br />
Ausschnitte aus einer Schrift des ANC (African National Congress) abgedruckt.<br />
Im Kapitel zu Tansania wird ein längerer Abschnitt aus dem Entwicklungsprogramm des damaligen Minister-<br />
präsidenten Nyerere zitiert. Das vermittelte Bild des Schwarzafrikaner beschreibt also den Bauern ebenso wie<br />
den Intellektuellen, das wehrlose Opfer ebenso, wie den die Entwicklung eines ganzen Landes planenden Poli-<br />
tiker. Nur schwarzafrikanische Frauen und Kinder werden nur am Rande erwähnt.<br />
Geographielehrmittel: Neue Geographie (1974-1976)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 271
4.23 Dreimal um die Erde (1977-1980, erstmals 1968-1972)<br />
Die Schwarzen haben sich von dem, was sie auf weissen Farmen sehen oder dort durch Arbeit lernen, nicht anregen lassen,<br />
ihre hergebrachte Lebens- und Wirtschaftsweise aufzugeben. Der weisse Farmer arbeitet nach modernen Methoden. Der<br />
Schwarze ist zufrieden, wenn die Feldarbeit seiner Frau oder seiner Frauen mit der Hacke die Familie von einer Ernte bis<br />
zur anderen ernährt. (Bd. 2, S. 56)<br />
Das Lehrmittel "Dreimal um die Erde" in drei Bänden, erstmals im Zeitraum 1968-1972 bei Velhagen &<br />
Klasing erschienen, schneidet das Thema Afrika in allen drei Bänden zumindest an. Insgesamt beschäftigt es<br />
sich auf rund 64 der insgesamt 551 Seiten mit dem Thema Afrika, wobei ca. 17 Seiten sich vorwiegend auf die<br />
<strong>Pro</strong>blematik der Entwicklungsländer konzentrieren. Alle drei Bände sind gleich aufgebaut. Neben dem eigent-<br />
lichen Lesetext, der durch Fragen und Kernaussagen unterbrochen wird, enthält das Lehrmittel Ausschnitte aus<br />
Zeitungsartikel, Tabellen, Karten und Fotos.<br />
4.23.1 Band 1: Menschen ihn ihrer Welt (Ausgabe von 1977, erstmals 1968)<br />
Der erste Band, geschrieben für die Klassen 5 und 6, enthält vier Kapitel zu Afrika: "In der Sahara" (S. 71-74),<br />
"Das Niltal - eine Stromoase" (S. 75-77), "Wildherden in den Savannen Ostafrikas" (S. 81-83) und "Kakao aus<br />
Ghana" (S. 94-95). Die beiden ersten Kapitel enthalten Informationen ausserhalb der Fragestellung dieser<br />
Arbeit, die zwei letzten Kapitel werden hier näher besprochen.<br />
4.23.1.1 Wildherden in den Savannen Ostafrikas<br />
Folgt man den Kernaussagen des Kapitels "Wildherden in den Savannen Ostafrikas", so lautet die Argumenta-<br />
tion folgendermassen:<br />
Ostafrika gehört zu den wildreichsten Gebieten der Erde<br />
Der Wildreichtum nimmt ab.<br />
Die ostafrikanischen Staaten richteten Wildschutzgebiete (Nationalparks) ein.<br />
Die Wildschutzgebiete sind ein Anziehungspunkt für Touristen.<br />
Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle des Staates. Andererseits kostet er den Staat auch viel Geld.<br />
Diese Gedankengänge werden im Haupttext und mittels weiterer Materialien im Detail ausgeführt. So heisst es<br />
im Haupttext zur Kernaussage "Der Wildreichtum nimmt ab." (S. 81):<br />
Die Bauern und Hirten brauchen zur Versorgung der wachsenden Bevölkerung mit Nahrungsmitteln mehr Acker- und<br />
Weideflächen. Am Ende der Trockenzeit brennen die Bauern in den Savannen das Grasland ab und legen dann Felder an,<br />
die sie meist mit Hirse bestellen. Auch die Hirten brennen das Gras der Savanne ab, damit beim ersten Regen frisches Gras<br />
aufspriesst. Sie treiben ihre Viehherden in die Weidegebiete wilder Tiere. Sie machen dem Wild nicht nur den Platz streitig,<br />
sie jagen es auch und halten sich dabei nicht an die Jagdgesetze.<br />
Hier wird von der lokalen Bevölkerung verlangt, das Wild, welches teilweise auch Schäden auf den Feldern<br />
der Bauern anrichtet, zu schützen und ihm den Lebensraum zu wahren. (Siehe dazu auch die Seite 106 dieser<br />
Arbeit.) Eine Forderung, der in Europa nur wenige Menschen wirklich nachkommen würden, wenn man an die<br />
Diskussionen im Zusammenhang mit der Wiederansiedlung gewisser Wildtiere beispielsweise in der Schweiz<br />
denkt.<br />
Als Hintergrundinformation wird ein Abschnitt aus Grzimeks Buch "Auch Nashörner gehören allen Menschen"<br />
aus dem Jahr 1962 abgedruckt (S. 81):<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Nicht das Jagen der Eingeborenen an sich ist so gefährlich. Sie haben es schliesslich schon seit Jahrtausenden getan. Aber<br />
jetzt können sie mit Schusswaffen und Drahtschlingen Hunderte und Tausende auf einmal umbringen und erhalten viel<br />
mehr Fleisch, als sie verwerten können. Sie tun das aus Freude am Jagen und weil ihnen im Schwarzhandel für Elfenbein,<br />
Nashorn-Hörner und andere Trophäen hohe Preise geboten werden. Dass sie für ein Jahr als Wilddiebe ins Gefängnis<br />
wandern, wenn man sie erwischt, will ihnen nicht in den Kopf. Sie sehen ja gleichzeitig weisse Jagdgäste aus Europa und<br />
Amerika Elefanten schiessen.<br />
Dieser Abschnitt zeigt die <strong>Pro</strong>blematik der Sichtweise. Ob die, im Text als "Eingeborenen" bezeichneten<br />
Einheimischen wirklich "aus Freude am Jagen" und nicht vielmehr aus wirtschaftlicher Not an der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 272
Dezimierung des Wildbestandes Anteil haben, sollte zumindest in Frage gestellt werden. Sicher ist, dass die<br />
"Jagdgäste aus Europa und Amerika" nicht aus Gründen der Ernährung zum Gewehr greifen. Da sie aber wirt-<br />
schaftlich potenter sind als die Einheimischen, ist ihnen erlaubt, was den anderen versagt bleibt. Auch in Euro-<br />
pa gab es eine Zeit, in der die Jagd nur einer Oberschicht erlaubt war. Diese Zeit wird heute auch als "finsteres<br />
Mittelalter" bezeichnet.<br />
Die Argumentation des zitierten Textes ist allerdings vergleichsweise harmlos. So schreibt z. B. R. H. Francé<br />
in dem im gleichen Jahr 1962 nachgedruckten Buch "Die Welt der Tiere" im Kapitel "Elefantenschicksal":<br />
"Einst ging es ja in dieser Hinsicht in Afrika geradezu grotesk zu. Es wurde eine derartige Raub- und Schand-<br />
wirtschaft getrieben, dass es im Sudan- und Kongogebiet Dörfer gab, deren Umzäunungen aus Elefantenzäh-<br />
nen errichtet waren! Man hatte keine bessere Verwendung für sie. Man fertigte aus ihnen höchstens noch<br />
Kriegstrompeten und abergläubischen Tand und wüstete mit dem Leben der edlen Tiere - bis eine merkwürdi-<br />
ge Vergeltung für diese Niam-Niam und Mangbettu-Völker hereinbrach, die sich ja auch nicht scheuten, neben<br />
den abscheulichsten Formen von Sklaverei sich selbst der Menschenfresserei zu ergeben. Gerade wegen der<br />
Elfenbeinverschwendung lockten sie die Gier der von Norden hereinflutenden Araber, die mit den Elefanten-<br />
zähnen gleich auch die erbeuteten Neger verkauften und dieses Land mit Brand, Plünderung und unmenschli-<br />
chen Qualen überzogen." (Francé 1962, S. 337) Auf Seite 82 schreibt der Autor:<br />
In Kenia werden jährlich etwa 15'000 Elefanten ohne Jagderlaubnis getötet. Die Wilderer brechen ihnen die Stosszähne aus<br />
und lassen die Kadaver liegen. Wenn das Töten weitergeht, sind Elefanten in Kenia in 10 Jahren ausgerottet. Die<br />
Regierung hat 1975 jede Jagd auf Elefanten verboten.<br />
Unter der Kernaussage "Die ostafrikanischen Staaten richteten Wildschutzgebiete (Nationalparks) ein." wird<br />
klar, dass dies anfänglich nicht aus erster Linie aus Eigeninteressen geschah, sondern auf Druck "internationa-<br />
ler Forderungen".<br />
Zur Aussage "Die Wildschutzgebiete sind ein Anziehungspunkt für Touristen." ist auf Seite 73 eine "Anzeige<br />
einer Fluggesellschaft" abgedruckt, in der es heisst:<br />
...Fernab ausgetretener Pfade pirschen Sie zusammen mit wenigen Personen in Kleinbussen oder zu Fuss durch die acht<br />
schönsten Wildreservate Kenias..." Das Camp reist mit, und am Abend eines erlebnisreichen Tages finden Sie Ihr<br />
komfortables Zelt, freundliches und geschultes Personal am Etappenziel vor.<br />
Sie erleben die Freiheit und Weite Afrikas in einer Ursprünglichkeit und Wildheit...<br />
Wie beispielsweise auch im Lehrmittel "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 (Bd. 3, S. 132) wird hier eine<br />
Reisewerbung für Touristen abgedruckt, welche die Wildnis Afrikas erleben wollen, ohne aber auf den aus der<br />
Heimat gewohnten Komfort zu verzichten. In dieser Werbung haben sich die in "entsetzlicher Roheit lebenden<br />
Neger" von 1912 (siehe die Seite 95 dieser Arbeit) zum "freundlichen und geschulten Personal" gewandelt.<br />
Auf der gleichen Seite befindet sich auch eine Karte, welche die Grösse der Nationalparks zeigt - nach dieser<br />
rund 30'000 km 2 .<br />
Als Kontrast zu diesem Text, der das Bild eines romantisch verklärten Afrikas zeichnet, wird im Haupttext zur<br />
Aussage "Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle des Staates. Andererseits kostet er den Staat auch<br />
viel Geld." über das Leben der Menschen Kenias berichtet (S. 83):<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Kenia nahm durch den Tourismus 1974 etwa 100 Mio. DM ein. Die Safari-Touristen reisen zumeist in Gebiete, die dünn<br />
besiedelt sind. Dort mussten mit hohen Kosten Einrichtungen für den Fremdenverkehr gebaut werden: Strassen und<br />
Flugplätze, Wasser- und Elektrizitätsleitungen, Hotels und andere Unterkünfte. Die Einnahmen aus dem Tourismus decken<br />
daher kaum die Ausgaben für die Schutzgebiete.<br />
Die einheimische Bevölkerung hat nur einen geringen Nutzen vom Fremdenverkehr. Die Ausrüstung für die Safaris, vom<br />
Geländewagen bis zu den Getränken, kommt aus dem Ausland. Meist leiten ausländische Fachleute die Hotels. In Kenia<br />
verdienen nur etwa 100'000 Eingeborene am Tourismus, als Wildhüter, als Dienstboten und als Andenkenverkäufer. Vier<br />
Fünftel der Bevölkerung haben nur ein <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen von 400 DM im Jahr. Manche einheimische Politiker<br />
betrachten daher die Wildschutzgebiete nur als eine teure Gefälligkeit gegenüber den Weissen, die in ihren eigenen<br />
Ländern viele Tierarten ausgerottet haben. Sie wollen die Nationalparks in Ackerland und Viehweiden umwandeln, das<br />
Fleisch der Tiere verwerten und Elfenbein und Leopardenfelle ins Ausland verkaufen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 273
Um die letzten Tierparadiese für die Menschheit auf Dauer zu erhalten, benötigen Kenia und die anderen ostafrikanischen<br />
Staaten mehr Unterstützung von den Vereinten Nationen und den reichen Ländern. Nur damit können sie die Wildherden<br />
in ihrer Umgebung bewahren und das Einkommen der Bevölkerung erhöhen.<br />
In diesem Text wird also ein recht nüchternes Bild vom Nutzen des Tourismus gezeichnet. (Zum Tourismus in<br />
Kenia siehe auch die Seiten 254 und 306, zu Kenia allgemein die Seiten 254 und 359 dieser Arbeit.)<br />
4.23.1.2 Kakao aus Ghana<br />
Im Kapitel "Kakao aus Ghana" werden auf den Seiten 94-95 folgende Kernaussagen gemacht:<br />
Der Kakaostrauch wächst in den feuchtheissen Wäldern der Tropen.<br />
In Ghana wird der meiste Kakao nicht in grossen Pflanzungen, sondern in kleinen bäuerlichen Betrieben angebaut.<br />
Die Kakaoernte erfordert sehr viele Arbeitskräfte.<br />
Die Kakaobohnen müssen nach der Ernte sorgfältig aufbereitet werden.<br />
Ghana liefert die meisten Kakaobohnen für den Weltmarkt.<br />
(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 194 und 278 dieser Arbeit.) Im Haupttext schreibt der Autor dazu auf<br />
der Seite 94, auf welcher auch ein Foto "Trocknen der Kakaobohnen" und Klimawerte zu Kumasi abgedruckt<br />
sind:<br />
Die meisten der 200'000 selbständigen Kakaobauern besitzen weniger als 4 ha Land. Für Kakao bekommen sie höhere<br />
Preise als für Gemüse und Obst. Deshalb bauen sie fast nur Kakao an. Für den eigenen Bedarf erzeugen sie Knollenfrüchte<br />
(Maniok, Yams, Taro), Mais, Mehlbananen und Gemüse auf kleinen Feldern (Beeten), die vor den Frauen mit der Hacke<br />
bearbeitet werden. Man kann hier das ganze Jahr über säen, pflanzen und ernten.<br />
(Zum letzen Satz siehe auch die Bemerkungen weiter unten.) Der Autor fährt mit der Beschreibung des<br />
Kakaoanbaus fort (S. 94):<br />
Vor der Anlage eines neuen Kakaofeldes muss der dichte Wald gerodet werden. Die Bauern schlagen das Unterholz und<br />
Strauchwerk ab und verbrennen es mit der gefällten Bäumen. Einige hohe Bäume lässt man stehen, damit sie Schatten<br />
spenden.<br />
Der Kakao ist eine Pflanze aus dem dunklen, unteren Stockwerk des tropischer Waldes. Als niedrige Schattenspender<br />
werden häufig Mehlbananenstauden gepflanzt. Sie liefern den Bauern zugleich ein wichtiges Nahrungsmittel.<br />
Fünf Jahre dauert es, bis die Kakaosträucher die ersten Früchte tragen. Während dieser Zeit muss der Bauer die Sträuche<br />
häufig beschneiden, ständig das Unkraut beseitigen und immer darauf achten, dass genügend Schatten vorhanden ist. Ein<br />
Kakaostrauch kann 50 Jahre Früchte tragen.<br />
Der Text wird am Ende der Seite durch die Aufforderung "Begründe nach den Klimaangaben... warum in<br />
Ghana in jedem Monat Saat und Ernte möglich sind." abgeschlossen. Diese Aufgabenstellung zeigt auf, wie<br />
heikel die in einem Lehrmittel für die Oberstufe gemachten Aussagen sein können, wird doch hier der<br />
Eindruck erweckt, in Ghana könnten die Bauern jederzeit aussäen oder ernten. Dies trifft jedoch nur auf einen<br />
Teil Ghanas zu, der obwohl bevölkerungsreich, flächenmässig nur einen kleineren Teil des Landes einnimmt.<br />
Je nach Einteilung werden in Ghana zwischen drei bis fünf klimatisch verschiedene Regionen ausgemacht.<br />
Folgt man der Dreiteilung so ergibt sich ein mässig heisser und regenarmer aber schwüler Küstenteil um<br />
Accra, der sehr bevölkerungsreich ist; ein mit tropischem Regenwald versehener und relativ kühler Mittelteil,<br />
der im Text angesprochen wird; und ein grosses Savannengebiet im Norden, welches heiss und ausserhalb der<br />
Regenzeit sehr trocken ist, indem den Bauern nur sehr enge Zeitfenster zur Aussaat bleiben.<br />
Auf der Seite 95, die eine Karte "Bodennutzung" in Ghana, aus der die eben gemachten Bemerkungen heraus-<br />
gelesen werden könnten, ein Foto "Kakaoernte in Ghana und eine Tabelle "Kakaoernte... (1975)" zeigt, fährt<br />
der Autor mit der Beschreibung des Kakaoanbaus unter der Kernaussage "Die Kakaoernte erfordert sehr viele<br />
Arbeitskräfte" fort:<br />
Von November bis Anfang Februar wird in Ghana Kakao geerntet. Mit der ganzen Familie ziehen die Bauern zur Ernte aus<br />
dem Dorf hinaus. Mit einem Haumesser schlagen die Männer die Früchte ab. Frauen und Kinder sammeln sie vom Boden<br />
auf und tragen sie zu einem Sammelplatz ins Dorf. Dort brechen andere Männer die Früchte mit einem geschickten<br />
Messerschlag auf. Sie dürfen dabei die Samen im Innern, die Kakaobohnen, nicht beschädigen. Frauen und Mädchen lösen<br />
die 30 bis 40 Bohnen aus dem weichen Fruchtfleisch heraus.<br />
(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seiten 246 und 344 dieser Arbeit.) Unter der Kernaussage "Die Kakaobohnen<br />
müssen nach der Ernte sorgfältig aufbereitet werden" heisst es weiter:<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 274
Sie werden zu kleinen Haufen auf Bananenblätter geschüttet und mit Bananenblättern zugedeckt. Die Bohnen beginnen zu<br />
gären. Das restliche Fruchtfleisch zerfällt, die Bohnen färben sich braun und entwickeln das Schokoladenaroma. Etwa 6<br />
Tage dauert dieser Vorgang. Nach der Gärung breitet der Bauer die Bohnen auf langen Gestellen in der Sonne zum<br />
Trocknen aus... Mehrfach wendet er sie mit der Hand oder mit einem hölzernen Rechen, damit alle Bohnen gleichmässig<br />
trocknen können. Sie setzen sonst Schimmel an. Schliesslich müssen noch alle schlechten Bohnen, Bruchstücke, Schalen<br />
und Schmutzteile ausgelesen werden.<br />
Nun kann der Bauer seine Ernte verkaufen. Er bringt sie zu einer staatlichen Sammelstelle. Dort werden die Bohnen<br />
sorgfältig auf ihre Qualität geprüft. Von seiner 4 ha grossen Pflanzung erntet der Bauer etwa 12 dt Kakaobohnen.<br />
Die letzte Kernaussage "Ghana liefert die meisten Kakaobohnen für den Weltmarkt" trifft heute nicht mehr zu.<br />
(Siehe dazu auch die Tabelle "Kakaoproduktion ausgewählter Länder" auf der Seite 552 im Anhang dieser<br />
Arbeit.)<br />
4.23.2 Band 2: Räume und <strong>Pro</strong>blem (Ausgabe von 1980, erstmals 1970)<br />
Der Band 2 "Räume und <strong>Pro</strong>bleme" für die Klassen 7 und 8, 1970 erstmals erschienen, beschäftigt sich in den<br />
drei Teilen "Nigeria; Von der Kolonie zum unabhängigen Staat" (S. 39-45), "Entkolonialisierung und Soziali-<br />
sierung in Algerien" (S. 46-52) und "Rassenkonflikte in der Republik Südafrika" (S. 53-62) mit Afrika. Die<br />
Seiten zu Nigeria und Südafrika sollen im Rahmen dieser Arbeit genauer betrachtet werden.<br />
4.23.2.1 Nigeria<br />
Der Teil zu Nigeria umfasst vier Kapitel, deren Titel vor der Besprechung des Haupttextes im Sinne einer<br />
Übersicht über die Kerngedanken zusammen mit den Kernaussagen wiedergegeben werden sollen (S.39-45):<br />
Die Wirtschaftslandschaften Nigerias:<br />
Im westlichen Teil des Regenwaldes lebt über die Hälfte der Bevölkerung vom Kakaoanbau.<br />
In der Ostregion des Regenwaldes lebt ein anderer Negerstamm, die Ibo.<br />
In der Trockensavanne bauen die Haussa Baumwolle und Erdnüsse an.<br />
In der Trockensavanne leben auch Hirtennomaden, die Fulani (Fulbe).<br />
Stammesgegensätze in Nigeria:<br />
Die Stämme unterscheiden sich vielfach nicht nur durch völlig verschiedene Wirtschafts- und Lebensweisen, sondern auch<br />
durch Rasse, Sprache, Religion und Bildungsstand.<br />
Sklavenhandel und Kolonialismus:<br />
Seit Ende des 16. Jahrhunderts war Lagos für Jahrhunderte das Zentrum des Sklavenhandels.<br />
Während der Kolonialzeit war Nigeria wie alle anderen europäischen Kolonien in Afrika Lieferant von Rohstoffen.<br />
Schwierigkeiten des neuen Staates:<br />
Im Jahr 1960 erhielt Nigeria die Unabhängigkeit.<br />
Erdöleinnahmen sollen den wirtschaftlichen Aufbau des Landes beschleunigen.<br />
Damit fasst der Autor kurz die wichtigsten Merkmale des Landes zusammen. Bei den im Text genannten<br />
"Stämmen" handelt es sich um Völker, die mehrere Millionen Menschen zählen. (Siehe dazu auch die Seite<br />
127 dieser Arbeit.) Immerhin wird klar ausgesagt, dass sich die einzelnen Völker, von denen es in Nigeria sehr<br />
viel mehr als die aufgezählten gibt, sich stark unterscheiden.<br />
Im Haupttext schreibt der Autor zur Kernaussage "Im westlichen Teil des Regenwaldes lebt über die Hälfte<br />
der Bevölkerung vom Kakaoanbau." auf Seite 39:<br />
Die meisten gehören zum Negerstamm der Yoruba. Sie haben grosse Teile des Regenwaldes gerodet. Dabei liessen sie<br />
einzelne hohe Bäume stehen, vor allem wild wachsende Ölpalmen und Mangobäume, um den Kakaopflanzen Schutz vor<br />
zu starker Sonneneinstrahlung zu bieten. Für die Eigenversorgung bauen die Yoruba ausser Bananen noch Maniok, Yams<br />
und Mais an.<br />
Auf der gleichen Seite folgt ein Zitat nach Angelika Sievers aus dem Buch "Nigeria" (1970 erschienen), das<br />
die Siedlungen im Urwald beschreibt:<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
...Hier und da stösst man auf kleine Rodungen. Mittendrin ein schlichtes Gehöft aus lehmbeworfenen Hütten mit<br />
Wellblechdächern, eine einfache Kakaobohnen-Trocknungsanlage (zementierter Boden), etwas Gemüseland, Hühner,<br />
Enten. Hier leben und arbeiten einige Familienmitglieder eines Häuptlings, seine jüngeren Frauen mit ihren Kindern. Er<br />
selbst wohnt mit der übrigen Familie in der Stadt.<br />
Auf der Seite 39 ist ausserdem ein Foto "Ernte der Fruchtstände von Ölpalme" abgebildet, welches eine Frau<br />
mit geflochtenem Haar - die Muster variieren je nach Alter, Stand, und Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe -<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 275
und dem als Kleidung dienenden um den Körper gewickelten Tuch zeigt. Dieser Wickelrock wird noch immer<br />
von viele Frauen in Westafrika getragen. Zur Kernaussage "In der Ostregion des Regenwaldes lebt ein anderer<br />
Negerstamm, die Ibo." schreibt der Autor weiter auf den Seiten 39:<br />
Ihre Wirtschaft wird weitgehend von der Ernte der Ölpalmenfrüchte und vom Exporterlös für Palmkerne bestimmt.<br />
Auf der Seite 40 folgt ein weiterer Text nach Sievers, indem es heisst:<br />
Für das Wachstum der Ölpalmen wird nichts getan, erst mit der Ernte beginnt die Arbeit. Jede Familie besitzt einen kleinen<br />
Palmgarten oder auch nur einzelne Palmen, die sie abernten darf. Die Fruchtstände mit 1'000 bis 2'000 pflaumengrossen<br />
roten Palmfrüchten sind 50 bis 60 kg schwer. Palmsammler, die im Klettern sehr geschickt sind, holen sie herunter. Das Öl<br />
wird aus dem Fruchtfleisch ausgepresst. Das geschieht auch heute noch grossenteils in Handarbeit. Auf diese Weise<br />
können aber nur 55% des in den Früchten enthaltenen Öls gewonnen werden. Mit modernen Ölmühlen erzielt man 85%,<br />
und zwar ein Öl von besserer Qualität. Das Palmöl wird im Lande verbraucht; die Palmkerne, die auch Öl enthalten,<br />
werden ausgeführt.<br />
Das Palmöl dient zum Kochen und wird in recht ansehnlichen Mengen verbraucht. Da es einen hohen Karotin-<br />
gehalt aufweist, bildet es einen wichtigen Bestandteil der westafrikanischen Diät. Ausserdem werden aus<br />
Palmöl Seifen, Margarine und Kerzen hergestellt. Die Ölpalmen dienen aber auch der Gewinnung von Palm-<br />
wein, der in grossen Teilen Westafrikas sehr beliebt ist. Zur Gewinnung wird ein der Teil der männlichen<br />
Blütenstände abgeschnitten und der austretende zuckerhaltige Saft vergoren. (Lötschert/Beese 1992,<br />
S. 202-203)<br />
Unter der nächsten Kernaussage "In der Trockensavanne bauen die Hausa Baumwolle und Erdnüsse an." fährt<br />
der Autor auf Seite 40 mit dem Haupttext fort:<br />
Die Baumwolle wird immer mehr im Lande verarbeitet, während die Erdnüsse exportiert werden. Nach der Ernte lagern sie<br />
in der Umgebung von Kano, bis man sie nach und nach mit der Bahn zur Küste transportiert...<br />
Die Hausa haben bereits vor Jahrhunderten eine blühende Handwerks- und Handelskultur geschaffen. Beson-<br />
ders ihre traditionell gewebten Stoffe erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Ausserdem können die<br />
Hausa auf eine lange literarische Tradition zurückgreifen. Hausa gehört zu den wenigen schwarzafrikanischen<br />
Sprachen, in der mehrere Zeitungen erscheinen. Die anfänglich den arabischen Zeichen angelehnte Schrift<br />
wurde unter der britischen Besatzung durch ein romanisches Alphabet abgelöst. (Zu den Hausa siehe auch die<br />
Seiten 191 und 392 dieser Arbeit.)<br />
Es folgt eine Beschreibung der Erdnusspflanze und ein Foto eines haushohen "Erdnusslagers bei Kano", bevor<br />
der Autor unter der nächsten Kernaussage "In der Trockensavanne leben auch Hirtennomaden, die Fulani<br />
(Fulbe)." auf der gleichen Seite weiterfährt:<br />
Sie versorgen die Bevölkerung mit Milch, Käse und Fleisch und handeln mit Häuten und Fellen. Das Ansehen eines<br />
Mannes wird an der Grösse seiner Herde gemessen. Jedes Familienmitglied besitzt eine Anzahl Kühe; die Frauen bringen<br />
Kühe als Mitgift in die Ehe ein. Andererseits hängt die Zahl der Frauen, die ein Mann sich leisten kann, von der Grösse<br />
seiner Herde ab.<br />
Diese kurzen Stellen zeigen schon , wie unterschiedlich nicht nur die Lebensräume und -grundlagen der afrika-<br />
nischen Völker sind, sondern wie sich auch ihre Kulturen im gesellschaftlichen Leben auf unterschiedlichste<br />
Weise ausdrückten. Ein weiteres kurzes Zitat nach Sievers beendet die Ausführungen des ersten Kapitels zu<br />
Nigeria auf der Seite 40:<br />
Die Hirten ziehen mit ihren Zelten in jahreszeitlichem Rhythmus von einem Weideplatz zum anderen. Die Länge der<br />
jährlich zurückgelegten Wanderungen beträgt 240 bis 1000 km. nach dem Ende der Regenzeit im Norden suchen sie die<br />
Weidegründe weiter im Süden auf, wo die Regenzeit länger dauert und wo die Flussniederungen ausreichend Gras bieten.<br />
Die durch das Bevölkerungswachstum immer grösser werdende Landknappheit (134 E/qkm) in Nigeria stellt<br />
diese Praxis immer mehr in Frage.<br />
Das nächste Kapitel "Stammesgegensätze in Nigeria" beschäftigt sich mit den verschiedenen Volksgruppen<br />
Nigerias. Im einleitenden Satz heisst es (S. 40):<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Nigeria ist der menschenreichste Staat in Afrika; aber die Nigerianer sind noch kein einheitliches Volk geworden. Die<br />
Bevölkerung verteilt sich auf über 250 verschiedene Stämme.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 276
Es folgt eine Tabelle welche die Grösse der Volksgruppen für 1978 mit 16 Mio. Hausa, 15 Mio. Yoruba, 12<br />
Mio. Ibo und 7 Mio. Fulani angibt, sowie 26 Mio. Menschen unter "Kleinere Stämme" zusammenfasst.<br />
Unter der Kernaussage "Die Stämme unterscheiden sich vielfach nicht nur durch völlig verschiedene<br />
Wirtschafts- und Lebensweisen, sondern auch durch Rasse, Sprache, Religion und Bildungsstand." folgt eine<br />
weitere Tabelle zur Religionszugehörigkeit, deren einzelne Angaben, Mohammedaner (48%), Christen (33%)<br />
und Naturreligionen (19%), sich praktischerweise auf 100% ergänzen. Aufgrund von Daten aus anderen<br />
Ländern ist anzunehmen, dass viele Menschen zwei der erwähnten Glaubenslehren praktizieren, denn nicht<br />
selten hängen die Mitglieder einer Familie unterschiedlichen Glaubenssystemen an.<br />
Auf Seite 41 folgt, nach einem Foto "Erdnussernte in Westafrika", auf dem eine von drei abgebildeten Frauen<br />
ihr Kind auf dem Arm trägt, ein längerer Text über die Völker und Geschichte Nigerias:<br />
Yoruba, Ibo und Haussa sind Neger. Die Fulani stammen von hellhäutigen nordafrikanischen Völkern ab, sind aber zum<br />
Teil stark mit der Negerbevölkerung vermischt. Die Yoruba sind grossenteils protestantische, die Ibo katholische Christen.<br />
Haussa und Fulani sind Anhänger des Islam (Mohammedaner).<br />
Diese völlig verschiedenen Gruppen wurden 1914 von der britischen Regierung in einer Kolonie zusammengefasst; sie<br />
entstand aus mehreren kleinen britischen Besitzungen und erhielt nach dem grössten Fluss des Landes den Namen Nigeria.<br />
Im Süden Nigerias beeinflusste die britische Kolonialregierung die Wirtschaft des Landes, die Verwaltung und das<br />
kulturelle Leben der Bevölkerung viel stärker als im Norden. Sie beteiligte frühzeitig Einheimische als Beamte und<br />
Angestellte an der Verwaltung, am Post-, Verkehrs-, Schul- und Gesundheitswesen. In der Nordregion dagegen behielten<br />
die islamischen Emire ihre Stellung in der Verwaltung und damit auch ihre Macht- und Vorrangstellung in der<br />
Gesellschaft. Die Engländer übten nur indirekt ihre Herrschaft aus.<br />
In der Nordregion Nigerias gibt es auch heute noch Bauern, welche die Felder der Grossgrundbesitzer bearbeiten und für<br />
die Nutzung einen grossen Teil der Ernte abgeben müssen.<br />
Alle Regierungshäupter seit der Unabhängigkeit stammten aus den nördlichen Gebieten. Verliert eine nigeria-<br />
nische Regierung das Vertrauen der Volksgruppen im Norden, sind ihre Tage gezählt. Im Text schreibt der<br />
Autor weiter (S. 40):<br />
Der Bildungsunterschied zwischen dem Norden und dem Süden des Landes ist gross. Im Süden gehen bereits 90 % der<br />
schulpflichtigen Kinder zur Schule, im Norden nur 20 %. Die Verwaltungsstellen im islamischen Norden müssen immer<br />
noch zum grossen Teil von christlichen Ibo besetzt werden, weil nicht genügend Haussa und Fulani lesen und schreiben<br />
können.<br />
Wird bedacht, dass die einstigen Hausastadtstaaten während ihrer Blütezeit (siehe dazu die Seite 29 im Teil<br />
Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas" dieser Arbeit) mit Hilfe schriftlicher Dokumente verwaltet<br />
wurden, erstaunt diese Entwicklung und ist ein Zeichen für die grossen Umwälzungen, die die Europäer auf<br />
dem afrikanischen Kontinent auslösten. Im Text heisst es weiter (S. 41):<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Das Zusammenwachsen der Stämme zu einem einheitlichen nigerianischen Volk wird auch durch eine fehlende<br />
gemeinsame Sprache erschwert. Keine der vielen Stammessprachen Nigerias wird im ganzen Lande verstanden. Zwar<br />
handelt es sich vielfach nur um verschiedene Dialekte; doch sind die sprachlichen Unterschiede so gross, dass die<br />
Bewohner eines Dorfes oder einer Stadt sich mit ihren Nachbarn nicht mehr ausreichend verständigen können, wenn sie<br />
auch nur einen Kilometer von ihnen entfernt wohnen. Deshalb ist Englisch die einzig mögliche Verständigungssprache<br />
zwischen den Stämmen.<br />
Die mehr als 3000 klassifizierten ethnischen Gruppen, die in Afrika leben, sprechen etwa 1000 verschiedene<br />
Sprachen. Nebst Englisch und Französisch, sind Arabisch, Swahili und Hausa die meistverbreiteten Sprachen.<br />
Neben diesen weit verbreiteten Sprachen gibt es auch solche, die nur von wenigen hundert bis tausend<br />
Menschen gesprochen werden. Allgemein werden die afrikanischen Sprachen in die vier Sprachfamilien<br />
Hamitosemitisch (auch Afroasiatisch), Nilosaharanisch, Khoisan und Niger-Kordofanisch eingeteilt. Zu der<br />
hamitosemitischen Familie gehören neben Arabisch und Hausa auch die Berbersprachen, Somali und verschie-<br />
dene andere Sprachen in den Ländern zwischen Mauretanien und Äthiopien. Zu der nilosaharanischen Familie<br />
gehören die Sprachen der Songhai, der Massai, sowie der Dinka. Zur Khoisan-Familie gehören die Sprachen<br />
der San (Buschleute) und Nama, insgesamt sprechen nur etwa 200'000 Menschen eine dieser Familie zugehöri-<br />
ge Sprache. Zu der Familie der Niger-kordofanischen Sprachen gehören Zulu, Akkan, Mande, Yoruba und<br />
viele andere. Die meisten afrikanischen Sprachen sind sogenannte Tonsprachen, d.h. ähnlich wie im<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 277
Chinesischen ist die Bedeutung eines Wortes von der Tonhöhe der einzelnen Silben abhängig und nicht nur<br />
von der Aneinanderreihung der verschiedenen Laute.<br />
Im nächsten Kapitel "Sklavenhandel und Kolonialismus" wird auf den Seiten 42-44 unter der Kernaussage<br />
"Seit Ende des 16. Jahrhunderts war Lagos für Jahrhunderte das Zentrum des Sklavenhandels." nach Pierre<br />
Bertaux aus der "Fischer Weltgeschichte" zitiert:<br />
Sklaverei hat es in Afrika wie in Europa in alter Zeit immer gegeben. Bei den Griechen und Römern waren Sklaven die<br />
Arbeiter und Dienstboten der reichen Familien, so auch bei den Häuptlingen und anderen vornehmen Familien in Afrika.<br />
Als die Europäer in Amerika Plantagen anlegten, wurden afrikanische Sklaven zu einer begehrten "Exportware". Die<br />
Länder Westeuropas bezogen immer mehr Zucker, Tabak, Kaffee, Kakao, Baumwolle aus der "Neuen Welt". Daher<br />
wurden dort immer mehr Sklaven als billige Arbeitskräfte benötigt.<br />
Wer einige hundert Sklaven liefern konnte, erwarb sich dadurch bereits ein Vermögen. Wie viele Afrikaner nach Amerika<br />
verkauft wurden, weiss man nicht. Die Schätzungen schwanken zwischen 10 und 30 Mio. Etwa jeder vierte starb bereits<br />
auf dem Transport.<br />
In Afrika arbeiteten die stärkeren Stämme an der Küste mit den Europäern zusammen. Schwarze Sklavenjäger brachten<br />
Gefangene aus schwächeren Stämmen an die Küste und übergaben sie dort den weissen Sklavenhändlern. Um ihnen nur<br />
einige Dutzend arbeitsfähige Männer und Frauen verkaufen zu können, vernichteten sie ganze Dörfer und töteten Kinder<br />
und Greise. Weite Gebiete im Innern Afrikas wurden so entvölkert. Die Sklavenküste, das heutige Nigeria, lieferte den<br />
Hauptanteil der "Ware".<br />
Die Einteilung in "starke Stämme an der Küste" und "schwächere Stämme" ist heikel, da durch die von den<br />
Europäern eingeführten und gehandelten Feuerwaffen, die vorherigen Machtverhältnisse stark verändert<br />
wurden. Ausserdem dürfte es sich bei der oben genannten Textstelle wahrscheinlich um einen Zusammenzug<br />
des Textes von Bertaux handeln, denn zumindest in der Ausgabe von 1995 ist das Zitat so in in der "Fischer<br />
Weltgeschichte" von 1995 nicht enthalten. (Bertaux 1995, S. 147-156)<br />
Auf der Seite 43 wird der Vergleicht mit Ostafrika gezogen und der Autor schreibt:<br />
In Ostafrika waren vor allem Araber die Sklavenjäger und Sklavenhändler. Erst gegen Ende des 18. Jh. und zu Beginn des<br />
19. Jh. wurde die Sklaverei nach und nach abgeschafft, zuerst von Grossbritannien in seinen Kolonien. Zur gleichen Zeit<br />
(1804) verboten auch die USA die Einfuhr von Sklaven. Frankreich hob 1848 die Sklaverei in seinen Kolonien auf, die<br />
USA 1865. Portugal und Brasilien setzten den Menschenhandel noch bis 1888 fort.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 262 und 369 dieser Arbeit.) Unter der Kernaussage "Während der<br />
Kolonialzeit war Nigeria wie alle anderen europäischen Kolonien in Afrika Lieferant von Rohstoffen."<br />
schreibt der Autor (S. 43):<br />
In der Westregion Nigerias führten die Engländer um 1870 den Anbau von Kakao in den kleinbäuerlichen Betrieben der<br />
Eingeborenen ein. Manche Yorubafamilien wurden im Laufe der Zeit wohlhabend. Europäer durften in Nigeria keine<br />
Besitzungen erwerben; auch vertrugen sie das Klima nicht so gut wie in Ostafrika.<br />
Aus dem Ölpalmengebiet in der Ostregion versorgte sich England mit Palmöl und Palmkernen. Die Mündungsarme im<br />
Nigerdelta erhielten daher den Namen "oil rivers".<br />
Für die Industrialisierung des Landes tat die britische Kolonialregierung wenig. Die nigerianische Baumwolle wurde in<br />
Grossbritannien versponnen und verwebt, die Textilware dann wieder nach Nigeria eingeführt. Die Verarbeitung der<br />
Erdnüsse für die Margarineherstellung erfolgte ausschliesslich in Europa, ebenso die Verarbeitung der getrockneten<br />
Kakaobohnen zu Kakaopulver und Schokolade.<br />
(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 274 und 291 dieser Arbeit.) Die Schokoladeherstellung gestaltet sich<br />
im heissen Klima eines tropischen Landes recht schwierig. Die Herstellung einer zartschmelzenden Schokola-<br />
de, in Europa besonders begehrt, ist bei Tagestemperaturen gegen 40°C nicht möglich. Aus diesem Grund glei-<br />
chen in Afrika hergestellte Schokoladen eher einer Art Kochschokolade. Im Text heisst es auf den Seiten<br />
43-44 weiter:<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Die Engländer bauten in Nigeria zur Erschliessung des Landes Eisenbahnen und durchgehende Strassen. Sie schufen damit<br />
bessere Verbindungen zwischen den einzelnen Regionen. In der Kolonie richteten sie eine einheitliche, straffe Verwaltung<br />
ein. Dadurch erreichten sie, dass im ganzen Lande erstmals Friede zwischen den bis dahin einander feindlich gesinnten<br />
Stämmen herrschte. Aber die Stammesgegensätze, die Religions- und Sprachunterschiede konnten sie in knapp 50 Jahren<br />
nicht beseitigen.<br />
Im letzten Kapitel zu Nigeria "Schwierigkeiten des neuen Staates" wird unter der Kernaussage "Im Jahr 1960<br />
erhielt Nigeria die Unabhängigkeit." zuerst ein Text nach Wolfgang Kaden aus dem Buch "Das nigerianische<br />
Experiment" (1968) über die Durchführung der ersten Parlamentswahlen abgedruckt (S. 44):<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 278
...Die Nigerianer mussten ihr erstes Parlament wählen Es war sehr schwierig, bald nach der Unabhängigkeitserklärung freie<br />
und geheime Wahlen durchzuführen. Schon die Aufstellung der Wählerlisten war nicht einfach, da es in den Gemeinden<br />
kein Wählerverzeichnis gab.<br />
Wer bei der Wahl seine Stimme abgeben wollte, musste sich registrieren lassen und erhielt dann eine Wahlkarte. Aber<br />
niemand konnte kontrollieren, ob der Wähler sich nicht an zwei oder drei Orten in die Liste eintragen liess. Im Wahlkampf<br />
spielten nicht so sehr die unterschiedlichen Ziele der Parteien, sondern vielmehr die Stammesunterschiede eine Rolle. Wer<br />
in einer Stadt oder in einem Bezirk die Macht hatte, bestimmte auch die Wahl und ihren Ausgang.<br />
Die Erstellung von Wahlregistern und deren Kontrolle ist auch Ende der neunziger Jahre noch in vielen afrika-<br />
nischen Staaten einer kräfteraubende Arbeit, die oft ein Jahr oder länger in Anspruch nimmt. Was den zweiten<br />
Vorwurf der "Stammesunterschiede" angeht, so sind diese nicht immer gerechtfertigt, da oft nicht eine undefi-<br />
nierbares Zusammengehörigkeitsgefühl zu einer Wahlentscheidung führt, sondern recht klare Eigeninteressen<br />
der verschiedenen Volksgruppen. Kaden führt weiter aus (S. 44):<br />
Am Wahltag erhielt jeder Wähler, der eine Wahlkarte hatte, einen Stimmzettel. Da die meisten Wähler nicht lesen können,<br />
waren die Wahlurnen jeweils mit dem Symbol einer Partei gekennzeichnet mit einem Hahn, einer Palme oder einer Hacke.<br />
Manche Wähler nahmen ihren Stimmzettel heimlich mit nach draussen und verkauften ihn dort an Beauftragte der<br />
stärksten Partei. Vielfach wurden auch gefälschte Wahlzettel von der örtlichen Partei eingeworfen und mitgezählt.<br />
Die Nordregion, wirtschaftlich und kulturell rückständig, hatte nach der Bevölkerungszahl das Übergewicht und stellte<br />
daher auch die meisten Abgeordneten im Parlament.<br />
Beides Praktiken, die noch am Anfang dieses Jahrhunderts in Bundesstaaten der USA (beschrieben in Upton<br />
Sinclairs "Der Dschungel") beobachtet wurden. Im Haupttext fährt der Autor fort mit einer Beschreibung des<br />
Biafrakrieges fort (S. 44):<br />
...Durch bedeutende Erdölfunde seit 1956 erhielt die Ostregion Nigerias ein wirtschaftliches Übergewicht. Daraufhin<br />
erklärten die Ibo 1967 die Unabhängigkeit ihrer <strong>Pro</strong>vinz unter dem Namen Biafra und kämpften drei Jahre gegen die<br />
Zentralregierung in Lagos um ihre Selbständigkeit. Dieser Biafra-Krieg forderte über 2 Mio. Menschenleben. Tausende<br />
von Kindern starben in Biafra an Hunger und Unterernährung. Grossbritannien und die Sowjetunion unterstützten die<br />
Zentralregierung durch Waffenlieferungen; Frankreich lieferte Waffen an Biafra.<br />
(Zu den Hungerkrisen in Schwarzafrika siehe auch die Seiten 264 und 286 dieser Arbeit.)<br />
Die "Vereinten Nationen" (UN) und auch die Vereinigung der afrikanischen Staaten ("Organisation für afrikanische<br />
Einheit" OAU) verweigerten Biafra das Selbstbestimmungsrecht.<br />
Die UN lehnte eine "Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines selbständigen Staates" ab; die OAU forderte die<br />
"Unantastbarkeit der afrikanischen Staatsgrenzen", so wie sie willkürlich von den europäischen Kolonialmächten<br />
geschaffen wurden. 1970 musste Biafra bedingungslos kapitulieren. Die demokratische Verfassung von Nigeria wurde<br />
ausser Kraft gesetzt. Eine Militärregierung übernahm in Nigeria die Macht. Alle politischen Parteien wurden verboten.<br />
Auch 1998 regierte in Nigeria eine von der Weltöffentlichkeit geächtete Militärjunta das Land. Dies hinderte<br />
aber europäische und amerikanische Interessengruppen nicht daran, die reichen Erdölvorräte des Landes<br />
auszubeuten und durch ihr Geschäftsgebaren die diktatorische Regierung zu stützen.<br />
Unter der Kernaussage "Erdöleinnahmen sollen den wirtschaftlichen Aufbau des Landes beschleunigen."<br />
schreibt der Autor auf der Seite 44:<br />
Die hohen Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl brachten dem Land plötzlichen Reichtum, aber auch viele neue<br />
Schwierigkeiten. Für die verstärkte Einfuhr von Baustoffen, Maschinen, Stahlerzeugnissen sowie Lebensmitteln waren die<br />
Häfen des Landes nicht eingerichtet. Teilweise lagen bis zu 500 Schiffe in der Bucht von Lagos, die nur sehr schleppend<br />
entladen werden konnten .<br />
Darunter waren auch Schiffe, die verderbliche Waren transportierten. Obwohl die Verkäufer um die Zustände<br />
in Nigeria wussten, und damit rechnen konnten, dass die gelieferte Ware nie ihr Ziel erreichen würde, trieben<br />
sie bereitwillig Handel mit einer verschwenderischen Regierung. Ende der siebziger Jahre wurde Nigeria zum<br />
grössten Markt des Kontinents. Die westlichen Industriestaaten lieferten im Zeitraum von 1970-1984 Waren<br />
im Wert von ca. 120 Mrd. US$ an Nigeria. (Michler, 1991, S. 105)<br />
Der "Ölreichtum" war nicht von Dauer, wie die Karte "Bruttosozialprodukt pro Kopf" im Anhang auf<br />
Seite 569 dieser Arbeit zeigt. Die Folgen des Ölbooms beschreibt der Autor auf der Seite 45:<br />
Die Menschen strömten aus dem Busch in die Städte. Lagos (4.5 Mio. Einwohner) konnte den Zuwachs nicht verkraften.<br />
Wohnungen fehlten, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und die Stromversorgung versagten, das Telefonnetz<br />
fiel aus, der Strassenverkehr brach zusammen.<br />
(Zu Lagos siehe auch die Seiten 157 und 335 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Die Regierung versucht, Abhilfe zu schaffen. Das Wachstum des Landes soll stärker durch den Staat kontrolliert und<br />
gesteuert werden. Die "Nigerianisierung" der Wirtschaft wurde durch Gesetz festgelegt. Der Staat erhält von den<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 279
ausländischen Konzernen 60% der Einnahmen aus dem Verkauf des Erdöls, 80% aus dem des Erdgases; drei neue<br />
Raffinerien führen sämtliche Einnahmen an den Staat ab. Ausländische Unternehmen müssen einheimische Firmen mit<br />
40% bis 60% an ihren Betrieben in Nigeria beteiligen.<br />
Mit diesen Einnahmen soll die eigene Wirtschaft gefördert werden. Die Einfuhr von Lebensmitteln ist durch hohe Zölle<br />
eingeschränkt. Der eigenen Landwirtschaft werden feste Preise garantiert und Subventionen gezahlt. Verluste beim<br />
Transport der Lebensmittel sollen durch den Bau von Kühl- und Lagerhäusern verringert werden. Häfen und Strassen<br />
werden beschleunigt ausgebaut.<br />
Nach allgemeinen Wahlen ist am 1. Oktober 1979 die Militärdiktatur von einer parlamentarischen Demokratie abgelöst<br />
worden. Parteien können sich wieder politisch betätigen. Vor den Wahlen ist die Zahl der Bundesstaaten von 12 auf 19<br />
erweitert worden, um die Macht der vier grossen Stämme einzudämmen.<br />
Nigeria ist eines der wirtschaftlich stärksten Länder im tropischen Afrika. Aber immer noch ist die Bevölkerung arm, denn<br />
der neue Reichtum kommt nur wenigen zugute, 5% der Einwohner verfügen über 50% der Einnahmen.<br />
Mit diesen Worten schliesst der Autor seine Betrachtungen über Nigeria ab. (Zu Nigeria siehe auch die<br />
Seiten 157 und 297 dieser Arbeit.)<br />
4.23.2.2 Republik Südafrika<br />
Die den "Rassenkonflikten in der Republik Südafrika" gewidmeten Seiten 53-62 beschäftigen sich mit der<br />
Apartheidspolitik Südafrikas. Auf diesen Seiten werden folgende Kernaussagen gemacht:<br />
Eine Minderheit beherrscht die Republik Südafrika.<br />
Die Weissen nahmen schon vor mehr als 300 Jahren das Kapland in Besitz.<br />
Die jetzige Regierung der Republik Südafrika fördert eine "getrennte Entwicklung" für Weisse und Nichtweisse,<br />
"Apartheid" genannt.<br />
In den Homelands können die Millionen Schwarzen nicht allein von der Landwirtschaft leben.<br />
Die Schwarzen sind für die Wirtschaft Südafrikas unersetzbar.<br />
Südafrika ist reich an Bodenschätzen.<br />
Schwarze, Mischlinge und Asiaten müssen in voneinander getrennten Vorstädten leben.<br />
Um die Trennung nach Rassen kontrollieren zu können, ist in jedem Pass die Rasse des Inhabers vermerkt.<br />
Die Republik Südafrika ist das einzige Land der Welt, in dem Rassengesetze gelten.<br />
(Für und wider die Apartheid.)<br />
Die Vereinten Nationen verurteilen die Rassenpolitik der Republik Südafrika.<br />
Der Anteil der Nichtweissen an der Gesamtbevölkerung nimmt ständig zu.<br />
Der Haupttext soll nun im Detail besprochen und diskutiert werden. Auf der Seite 53 findet sich unter der<br />
Kernaussage "Eine Minderheit beherrscht die Republik Südafrika" eine Tabelle, die Bevölkerung und<br />
Abgeordnete im Parlament nach den verschiedenen Gruppen Weisse (4.6 Mio.), Schwarze (18.4 Mio.),<br />
Mischlinge (2.8 Mio.) und Asiaten (0.9 Mio.) aufsplittet. Nach der Tabelle entsandte nur die weisse Bevölke-<br />
rung Abgeordnete ins Parlament. Damit ist die oben gemachte Aussage zumindest in der Politik eindrücklich<br />
bestätigt worden. Im Haupttext heisst es dazu (S. 53):<br />
Nur Weisse dürfen in Gemeinden, Städten, <strong>Pro</strong>vinzen und für das Parlament des Landes Abgeordnete wählen. Nur Weisse<br />
sind Mitglieder der Regierung. Schwarze, Mischlinge und Asiaten, zumeist Inder, haben kein Mitbestimmungsrecht bei der<br />
Beratung von Gesetzen, nach denen sie regiert werden.<br />
Nur Weisse dürfen Richter und Verwaltungsbeamte sein. Schwarze Ärzte dürfen nur Nichtweisse behandeln. Nur Weisse<br />
dürfen Waffen tragen. Etwa die Hälfte der südafrikanischen Polizeikräfte sind Schwarze. Sie haben keine Schusswaffen,<br />
nur Gummiknüppel. Sie dürfen keinen Weissen anhalten oder festnehmen, es sei denn, sie "ertappen ihn auf frischer Tat".<br />
Es gibt seit jüngster Zeit einige schwarze Polizeioffiziere; doch auch sie müssen den Weisungen weisser Polizisten folgen.<br />
Nur weisse Arbeiter und Angestellte dürfen sich in Gewerkschaften zusammenschliessen, über Lohnforderungen mit den<br />
Unternehmern verhandeln und auch streiken. Nur Weisse dürfen Führungsposten in der Wirtschaft innehaben.<br />
(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 268 und 284 dieser Arbeit.) Kurz zusammengefasst werden die<br />
Schwarzen als Bürger 2. Klasse behandelt, die nur über sehr wenige Rechte verfügen, aber vielen Pflichten<br />
unterworfen sind.<br />
Unter der Kernaussage "Die Weissen nahmen schon vor mehr als 300 Jahren das Kapland in Besitz." heisst es<br />
im Zusammenhang mit der schwarzen Bevölkerung, den Zeitraum 1750-1780 betreffend über die Buren<br />
(S. 53):<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
...Um diese Zeit trafen sie am Grossen Fischfluss zwischen dem heutigen Port Elizabeth und East London - zum ersten Mal<br />
auf Bantuvölker, die seit langem von Norden her auf der Wanderung waren und in Südafrika neues Weide- und<br />
Siedlungsland suchten. Über ein Jahrhundert dauerten die ständigen Kämpfe zwischen Schwarzen und Weissen. Beide<br />
Gruppen behaupteten, dass ihnen das Land gehöre, und sie betrachten beide Südafrika als ihre jahrhundertealte Heimat.<br />
Die Regierung erliess 1913 ein Landverteilungsgesetz: Die Weissen erhielten fünf Sechstel des Landes, die Schwarzen ein<br />
Sechstel. Damit war Südafrika nach Auffassung der Regierung endgültig in "weissen Mannes Land" und "schwarzen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 280
Mannes Land" aufgeteilt. Gegner der Regierung aber sagen: "Wo die Weissen bei ihrer Landnahme auf Schwarze stiessen,<br />
haben sie diese verdrängt, oft mit brutaler Gewalt und fast immer mit militärischen Mitteln."<br />
Wie auch in anderen Texten werden die Bewohner Südafrikas, die vor dem Eindringen der Niederländer und<br />
Bantus in dieser Region lebten nicht namentlich erwähnt. Im Text wird nur in einem Nebensatz erwähnt, dass<br />
das Land damals "kaum besiedelt" war.<br />
Auf den Seiten 53-55, die Seite 54 zeigt eine ganzseitige Karte der "Homelands", fährt der Autor unter der<br />
Kernaussage "Die jetzige Regierung der Republik Südafrika fördert eine 'getrennte Entwicklung' für Weisse<br />
und Nichtweisse, 'Apartheid' genannt." fort:<br />
Nach Ansicht der Regierung sind die Menschen verschiedener Rasse in ihrem Verhalten, ihrer Weltanschauung,<br />
Lebensweise, Sprache und Kultur so unterschiedlich, dass jede Gruppe eigene Staaten bilden soll, um sich voll entfalten zu<br />
können. Für die schwarze Bevölkerung sollen deshalb insgesamt acht "Heimatländer", Homelands, geschaffen werden.<br />
Einige erhielten in den vergangenen Jahren bereits die Selbstverwaltung. Die übrigen Gebiete bestehen noch aus mehr als<br />
100 grösseren und kleineren Flächen. Sie sollen später zu einigen grösseren Homelands zusammengelegt werden. Für<br />
Mischlinge und Asiaten sind keine Siedlungsgebiete vorgesehen.<br />
Im Anbetracht der noch vor wenigen Jahren gemachten Aussagen über Schwarzafrikaner - wie "Länder und<br />
Völker" aus den 60er Jahren warnt vor einer "schwarzen Springflut" (S. 67) - dürfte die Entfaltung der nicht-<br />
weissen Bevölkerung kaum im Zentrum der Interessen gelegen haben. Vielmehr ging es darum, sich diese<br />
Bevölkerung dienstbar zu machen, ohne mit ihr jedoch in allzuengen Kontakt zu geraten. Ob dabei hygieni-<br />
sche Überlegungen mit eine Rolle spielten, wie sie bei den frühen Siedlungen der Briten, beispielsweise in die<br />
Planung der Stadtviertel einbezogen wurden, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ist aber wahrscheinlich.<br />
Die Seite 55 zeigt zwei Fotos "Felder der Weissen und der Bantu in Nordnatal" - die unterschiedlichen<br />
Nutzungsstrukturen sind deutlich sichtbar - und "Bantu-Gehöft in der Transkei".<br />
Auf der Seite 56 unter der Kernaussage "In den Homelands können die Millionen Schwarzen nicht allein von<br />
der Landwirtschaft leben." führt der Autor weiter aus:<br />
Die meisten Homelands sind bereits jetzt übervölkert, da die extensive Landwirtschaft der Schwarzen grosse Flächen<br />
benötigt. Ausserdem ist der Viehbestand viel zu gross; denn die Schwarzen schätzen mehr die Grösse ihrer Herden, nicht<br />
deren Qualität. Auch der Ackerbau bringt nur geringe Erträge. Sie reichen allenfalls für die Ernährung der Familie aus. Das<br />
Land gehört nicht dem einzelnen, sondern ist Stammeseigentum, das vom Häuptling zur Nutzung an die Familien verteilt<br />
wird.<br />
Die schlechten Zustände in den Homelands wurden also nicht etwa auf die ungenügenden Voraussetzungen der<br />
zugeteilten Gebiete zurückgeführt, sondern werden als Resultat des Unvermögens der Schwarzen in der Land-<br />
wirtschaft, ihrer Gesinnung und Lebensweise gesehen. Eine Tabelle, welche die Bevölkerungsdichte für die<br />
Homelands "Transkei" (78 E./km 2 ) und "Bophuthastswana" (62 E./km 2 ) mit derjenigen der Republik Südafrika<br />
(19 E./km 2 ) vergleicht, unterstreicht die gemachten Bemerkungen. Weiter heisst es im Text (S. 56):<br />
Die Homelands nehmen rund 17% der Landfläche Südafrikas ein. In den übrigen Gebieten leben die Weissen zusammen<br />
mit den Mischlingen und Indern, für die keine eigenen Homelands eingerichtet werden. Die Schwarzen wohnen in den<br />
Städten in eigenen Vierteln, die abseits von denen der Weissen liegen. Die verschiedenen Bevölkerungsteile sind aber bis<br />
heute nicht völlig getrennt, weil die Schwarzen als Arbeitskräfte der Weissen benötigt werden. In den Homelands wohnt<br />
bisher weniger als die Hälfte der Schwarzen. Wer in einem Unternehmen der Weissen keine Arbeit findet, wird in die<br />
Homelands umgesiedelt.<br />
Während also die Schwarzen in "ihren" Homelands leben, müssen die Weissen ihr Gebiet "zusammen mit den<br />
Mischlingen und Indern" teilen. Durch den oben stehenden Text entsteht der sachlich falsche Eindruck, die<br />
Schwarzen würden über einen grösseren Landanteil verfügen als die Weissen. Das Gegenteil ist aber der Fall.<br />
Zudem sollte der Text nicht von Umsiedlung, sondern von Zwangsumsiedlungen sprechen, denn der Wider-<br />
stand der Schwarzen wurde jeweils mit dem Aufmarsch bewaffneter Polizeikontingente im Keim erstickt.<br />
Nach den Ausführungen des Autors kommt ein "Vertreter der Apartheidspolitik" zu Wort, um wen es sich<br />
dabei handelt, wird aus den gegebenen Informationen nicht klar:<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Die Schwarzen haben sich von dem, was sie auf weissen Farmen sehen oder dort durch Arbeit lernen, nicht anregen lassen,<br />
ihre hergebrachte Lebens- und Wirtschaftsweise aufzugeben. Der weisse Farmer arbeitet nach modernen Methoden. Der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 281
Schwarze ist zufrieden, wenn die Feldarbeit seiner Frau oder seiner Frauen mit der Hacke die Familie von einer Ernte bis<br />
zur anderen ernährt.<br />
Der Autor führt im Haupttext weiter aus (S. 56):<br />
Die südafrikanische Regierung ist bemüht, die Landwirtschaft der Schwarzen zu verbessern, wertvolleres Vieh einzuführen<br />
und die Herden an Zahl zu verringern. Bisher bauten die Schwarzen nur Mais, Hirse und Bohnen an; jetzt lernen sie<br />
Zuckerrohr, Baumwolle und Obstbäume kennen. Es werden auch Stauseen gebaut und Bewässerungskulturen angelegt.<br />
Die Weissen behaupten, es sei schwer, die Schwarzen aus ihrer Tradition zu lösen.<br />
Mit diesen Worten unterstützt der Autor die Aussagen des "Vertreters der Apartheid", ohne jedoch auf allfälli-<br />
ge Ursachen einzugehen. Weiter heisst es:<br />
Eine Industrialisierung der Homelands durch Schwarze gibt es zur Zeit noch nicht; ihnen fehlen Kapital und technisches<br />
Wissen und Können. In der Transkei wurden bisher nur gewerbliche Kleinbetriebe (Spinnereien, Webereien, Mühlen,<br />
Ziegeleien) eingerichtet; sie beschäftigen insgesamt weniger als 1'000 Schwarze. Die <strong>Pro</strong>duktion aller bestehenden und<br />
geplanten Homelands beträgt zusammen nicht einmal den 55. Teil der Gesamtproduktion der Republik Südafrika.<br />
Um bares Geld in die Hand zu bekommen, sind die Einwohner der Homelands darauf angewiesen, Arbeit und Verdienst in<br />
der Wirtschaft der Weissen zu finden. Vielfach sind neue Industriebetriebe von Weissen mit staatlicher Unterstützung in<br />
unmittelbarer Nähe einer Homelandgrenze auf dem Gebiet der Weissen errichtet worden, Grenzindustrie - border industrygenannt.<br />
Die Schwarzen kommen als Tagespendler aus ihren Wohngebieten in die Fabrik des weissen Unternehmers. Auf diese<br />
Weise sichert sich die südafrikanische Wirtschaft einen ständigen Nachschub von billigen Arbeitskräften.<br />
Die geringen Löhne trugen beispielsweise im Bergbau wesentlich zu den <strong>Pro</strong>fiten der Bergwerke bei. Ein klei-<br />
ner Bruchteil der so erzielten Gewinne floss über die Steuern auch in die Finanzierung schwarzer Schulen, wo<br />
sie dann als "Subvention" durch die Weissen verbucht wurden.<br />
Auf den Seiten 56-57 wird die Kernaussage "Die Schwarzen sind für die Wirtschaft Südafrikas unersetzbar."<br />
im Haupttext und durch verschiedene Tabellen "Weisse und Schwarze in verschiedenen Wirtschaftszweigen",<br />
"Durchschnittlicher Jahreslohn in Südafrika", einer Karte "Grenzindustrie" und eine Ausschnitt aus einer<br />
Zeitung, der die Lebenshaltungskosten anführt, unterstützt. Im Text heisst es auf Seite 56:<br />
Ohne die billige Arbeitskraft der Schwarzen müsste die Wirtschaft der weissen Bevölkerung in Südafrika<br />
zusammenbrechen. Allerdings würden dann auch Millionen Schwarze ihre Existenzgrundlage verlieren...<br />
Rechnet man die auf der Seite 57 gegebenen Durchschnittszahlen für die schwarze Bevölkerung zum Einkom-<br />
men (3750 DM / Jahr) und den Lebenshaltungskosten (324 DM / Monat) gegeneinander auf, so erkennt man<br />
leicht, dass der Verdienst nicht ausreicht, die typische schwarze Familie um 1977 mit den nötigen Gütern zu<br />
versorgen. Und dies obwohl bei den Lebenshaltungskosten die jeweils niedrigsten Verkaufspreise als Grundla-<br />
ge benutzt wurden. Diese Frage wird aber vom Autor des Lehrmittels nicht gestellt. Stattdessen werden die<br />
Schüler dazu aufgefordert, die prozentuale Steigerung der Löhne zu berechnen, wobei die schwarze Bevölke-<br />
rung bei den gegebenen Zahlen am besten abschneidet. Ob die Aufgabenwahl im Hinblick auf diese Ausfüh-<br />
rungen bewusst geschah, sei dahingestellt. Tatsache bleibt, dass der Autor dort den Eindruck eines Fortschrit-<br />
tes erweckt, wo die Lage eigentlich besonders drückend ist.<br />
In diesem Zusammenhang wurde auch immer wieder behauptet, die Schwarzen Südafrikas seien bessergestellt<br />
als die schwarze Bevölkerung anderer afrikanischer Staaten. Dabei wird das BSP und ähnliche Grössen herbei-<br />
gezogen. Das in vielen afrikanischen Staaten aufgrund der Subsistenzwirtschaft und anderer Faktoren das BSP<br />
nur mangelhaft erfasst wird, während andererseits viele Südafrikaner in einer Geldwirtschaft leben, geht dabei<br />
vergessen. (Zu den Löhnen in Südafrika siehe auch die Seite 269 dieser Arbeit.)<br />
Unter der Kernaussage "Südafrika ist reich an Bodenschätzen" wird im Haupttext die Aussage gemacht, dass<br />
die Wirtschaft Südafrikas durch vier Faktoren bestimmt werde (S. 58):<br />
...der Reichtum an Bodenschätzen, das Kapital der Weissen, Wissenschaft und Technik der Weissen und die billige<br />
Arbeitskraft der Nichtweissen...<br />
Über die Arbeit in den Goldminen - Gold macht laut der Angaben im Text wertmässig 50% der Ausfuhren<br />
aus - schreibt der Autor weiter:<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
...Wegen der hohen Erdtemperatur, die trotz Kaltluftzufuhr mehr als 40 °C beträgt, können in dieser Tiefe nur Schwarze<br />
schwere körperliche Arbeit leisten...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 282
Damit taucht wieder einmal das Argument auf, Schwarzafrikaner würden schwere körperliche Arbeit in gros-<br />
ser Hitze als weniger anstrengend empfinden als Weisse. Selbst wenn dieses Argument für die Bewohner der<br />
Tropen Gültigkeit besässe, hiesse dies noch lange nicht, dass es auch für die in einen gemässigten Klima<br />
lebenden Schwarzen Südafrikas zutreffen würde.<br />
In einem ebenfalls auf der Seite 58 abgedruckten Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel der "Frankfurter Allge-<br />
meinen Zeitung" von 1979 steht, dass "Südafrika... im vergangenen Jahr nahezu 9.6 Mrd. DM mit der Gold-<br />
produktion verdient" habe.<br />
In einer Tabelle wird der Anteil Südafrikas an der Weltrohstoffproduktion im Jahr 1976 für Gold mit 58%, für<br />
Platin mit 45% angegeben. Anschliessend warnt der Autor unter Zuhilfenahme eines Zeitungsberichtes aus der<br />
"Süddeutschen Zeitung" von 1978 auf Seite 59, dass ein "Ausfall von Rohstofflieferungen aus diesem Lande<br />
durch einen Rassenkrieg im Innern" die Wirtschaft der Bundesrepublik "empfindlich treffen" würde.<br />
Unter der Kernaussage Schwarze, Mischlinge und Asiaten müssen in voneinander getrennten Vorstädten<br />
leben." heisst es weiter nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1974:<br />
Seit 1954 verfügte die Regierung Zwangsaussiedlungen. Alle Schwarzen mussten die Wohngebiete der Weissen verlassen.<br />
Nach und nach beseitigte die Regierung die Slumviertel und baute neue Unterkünfte. Es entstanden neue Vorstädte, die<br />
locations. Die grösste ist Soweto (South Western Township), die südwestliche Vorstadt von Johannesburg. Täglich fahren<br />
einige 100'000 Schwarze zur Arbeit in die Stadt; Soweto ist für sie nur eine Schlafstadt.<br />
Soweto scheint ein Sammelpunkt aller südafrikanischen Stämme zu sein. Trotz der zahlreichen Einheitshäuser, die<br />
Streichholzschachteln ähneln, hat die Stadt viele Gesichter. Da ist die vornehme Wohngegend Dube, die den Villenvierteln<br />
der Weissen ähnelt. In Dube wohnen schwarze Ärzte, Rechtsanwälte und Kaufleute, die ein Jahreseinkommen von 20'000<br />
Mark haben. Nicht alle in Soweto sind arm.<br />
Es gibt Häuser mit freundlichen Vorgärten, und es gibt unvorstellbaren Schmutz auf den Strassen und Plätzen. Noch hat<br />
nur jede fünfte Strasse elektrische Beleuchtung. Viele Häuser sind ohne Stromanschluss.<br />
(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 271 und 285) Zwei Pläne auf der Seite 58 und ein Foto<br />
auf der Seite 59 illustrieren diese Beschreibung. Weiter heisst auf den Seiten 59-60:<br />
In der Republik Südafrika gibt es annähernd 500 dieser Wohnsiedlungen für Nichtweisse. Die einförmigen Häuser haben<br />
einen Wohnraum, eine Küche und zwei Schlafräume. Die meisten Häuser haben keine Zimmerdecken; man wohnt unter<br />
dem Dach aus Asbest oder Wellblech. Die Bewohner einer location können die Häuser nicht kaufen; sie dürfen sich auch<br />
kein eigenes Haus bauen.<br />
Damit dürften die Häuser im Bezug auf die in ihnen herrschenden Temperaturen nicht sehr angenehm gewesen<br />
sein. Besonders bei starker Sonneneinstrahlung erwärmt sich ein Haus mit Wellblechdach, insbesondere wenn<br />
eine Zimmerdecke fehlt, wesentliche schneller, als eines, das mit Stroh oder anderen pflanzlichen Materialien<br />
gedeckt wird.<br />
Auf der Seite 60 schreibt der Autor unter der Kernaussage "Um die Trennung nach Rassen kontrollieren zu<br />
können, ist in jedem Pass die Rasse des Inhabers vermerkt.":<br />
Seit 1952 muss jeder Afrikaner einen Pass mit sich führen, in dem ausser seinen Personalien auch seine<br />
Aufenthaltserlaubnis, seine Arbeitserlaubnis, seine Arbeitsstelle, seine Steuerzahlungen und seine Rassenzugehörigkeit<br />
eingetragen sind. Die rassische Einstufung entscheidet darüber, wo ein Mensch wohnen und arbeiten darf, welche<br />
politischen Rechte er hat und welche wirtschaftlichen Möglichkeiten ihm offenstehen.<br />
In den letzten Jahren sind viele Bestimmungen gelockert oder aufgehoben worden. So gibt es nicht mehr Parkbänke für<br />
Weisse und Nichtweisse, getrennte Eingänge bei Postämtern und Behörden sowie getrennte Fahrstühle in Hochhäusern.<br />
Aber noch immer gilt, was ein Deutscher 1972 aus Südafrika schrieb:<br />
Durch die Trennung der Wohngebiete werden die Kontaktmöglichkeiten zu anderen Rassen stark eingeschränkt. Dadurch<br />
wird einem die Möglichkeit genommen, deren <strong>Pro</strong>bleme kennenzulernen. Wir dürfen Mischlinge (coloureds), Schwarze<br />
oder Inder in unser Haus einladen. Einen Mischling dürfen; wir bis zu 30 Tagen im Jahr in unserem Haus als Gast<br />
beherbergen. Für Schwarze ist dagegen eine Sondergenehmigung nötig. Mit einem Nichtweissen als Gast kann man kaum<br />
irgend etwas gemeinsam unternehmen: Am besten, man hat keinen solchen Gast. Damit geht man allen Schwierigkeiten<br />
aus dem Wege.<br />
Aus heutiger Sicht sind die damals wirksamen Passgesetze schon aus Datenschutzgründen höchst zweifelhaft,<br />
von den grundlegenderen Verletzung der Menschenrechte einmal ganz abgesehen. Der Vergleich mit den Zita-<br />
ten aus anderen Lehrmitteln, die in dieser Arbeit besprochen werden, zeigt, wie man ein solches Vorgehen<br />
immer wieder zu rechtfertigen suchte.<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 283
Auf der gleichen Seite ist auch eine Graphik zu "Bildung und Erziehung in der Republik Südafrika" abgebil-<br />
det, die eindrücklich zeigt, dass die "Rückständigkeit" der Schwarzen nicht nur auf ihr eigenes Tun zurückzu-<br />
führen ist, sondern Teil der damaligen Politik war.<br />
Weiter schreibt der Autor unter der Kernaussage "Die Republik Südafrika ist das einzige Land der Welt, in<br />
dem Rassengesetze gelten." auf der Seite 60:<br />
Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Rassen sind seit 1947 verboten, Geschlechtsverkehr zwischen ihnen wird<br />
bestraft. Jährlich werden mehr als 500'000 Schwarze wegen eines Vergehens gegen das Passgesetz verurteilt oder weil sie<br />
keine Arbeitserlaubnis vorweisen können. Ohne eine solche Erlaubnis dürfen sie sich nicht länger als 72 Stunden in den<br />
Gebieten der Weissen aufhalten.<br />
Eine Strafe besonderer Art ist der Bann. Er wird aufgrund des Gesetzes zur Unterdrückung des Kommunismus (1950)<br />
gegen Nichtweisse und Weisse verhängt, die sich politisch betätigt haben. Bann bedeutet nicht Ausweisung (Verbannung),<br />
sondern Einschränkung der persönlichen Freiheit. Gebannte müssen sich in einem bestimmten Wohnbezirk ständig<br />
aufhalten, dürfen nicht an Versammlungen teilnehmen, dürfen sich in der Öffentlichkeit jeweils nur mit einer Person<br />
unterhalten, keinen Kontakt mit anderen Gebannten aufnehmen, keine Schulen und keine Fabriken betreten. Sie können<br />
daher nur zu Hause arbeiten oder sind auf Unterstützung von Verwandten und Freunden angewiesen. Gebannte dürfen<br />
nichts in Zeitungen oder Büchern veröffentlichen, und Zeitungen dürfen nichts über gebannte Personen berichten.<br />
Der erwähnte Bann ist also in seiner Funktion den Zwangsmassnahmen des Ausländerrechtes in der Schweiz<br />
vergleichbar, allerdings wurde das Redeverbot für Ausländer in der Schweiz vor kurzem abgeschafft. Wie aus<br />
dieser Bemerkung ersichtlich ist, fällt es nicht schwer, eine Tat im Rückblick als zweifelhaft zu bezeichnen,<br />
eine ganz andere Situation stellt sich bei persönlicher Betroffenheit ein.<br />
Die Seiten 61-62 sind unter dem Titel "Für und wider die Apartheid" der Diskussion der Politik Südafrikas<br />
gewidmet. Im einleitenden Text schreibt der Autor auf Seite 61:<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Die Anhänger der Apartheidspolitik verweisen immer wieder auf Vorgänge in anderen afrikanischen Staaten, nachdem<br />
diese unabhängig wurden, zum Beispiel auf Nigeria und den Biafrakrieg... Die Regierung Ugandas wies alle Asiaten aus<br />
dem Land. In Angola brach nach der Befreiung von der portugiesischen Kolonialherrschaft ein Bürgerkrieg aus.<br />
Viele Südafrikaner, Weisse und Nichtweisse, befürchten Ähnliches für Südafrika, wenn ein revolutionärer Umsturz käme...<br />
Der seit 1961 geführte Rebellenkrieg der Angolaner führte 1975 dazu, dass Portugal das Land in die Unabhän-<br />
gigkeit entliess. Die beiden grossen Rebellenbewegungen MPLA (Movement for the Liberation of Angola)<br />
und UNITA (National Union for Total Independence) konnten sich jedoch auf kein gemeinsames <strong>Pro</strong>gramm<br />
einigen. 1976 gelang es der von der Sowjetunion und Kuba unterstützte MPLA den grössten Teil des Landes<br />
unter ihre Kontrolle zu bringen. Der seit 1970 in der MPLA tätige und rasch aufgestiegene Maurer und Erdö-<br />
lingenieur Jose Eduardo dos Santos wurde zuerst Aussenminister und regiert Angola seit 1979 als Präsident<br />
des Landes. Die UNITA wurde von Südafrika und während der achtziger Jahre auch von den USA unterstützt.<br />
Länder wie die Elfenbeinküste, Kongo und Zaire lieferten ebenfalls Unterstützung. Die UNITA führte einen<br />
Rebellenkrieg gegen die Regierung unter der vor allem die zivile Bevölkerung zu leiden hatte: "The Govern-<br />
ment steals, but UNITA kills", hiess es noch 1998 (Economist, 11.04.98, S. 38) Da weder die eine noch die<br />
andere Partei einen Sieg erringen konnte, kam es 1991 unter der Vermittlung der UNO zu Friedensverhandlun-<br />
gen, die 1992 in Neuwahlen endeten. Diese wurden jedoch vom Rebellenführer Savimbi nicht anerkannt, da<br />
die UNITA nur 40% der Stimmen erreichte, obwohl sie sich wesentlich mehr erhofft hatte. Nach erneuten<br />
Kämpfen, bei denen die UNITA grosse Teile des Landes zurückeroberte, wurde 1994 ein weiterer Friedensver-<br />
trag in der Hauptstadt Lusaka abgeschlossen, der aber von beiden Parteien nur teilweise eingehalten wurde. So<br />
verschob die regierende MPLA die 1996 fälligen Neuwahlen auf unbestimmte Zeit, und die UNITA lieferte<br />
ihre Waffen nur teilweise und sehr zögerlich ab. Seit 1998 haben sich die Spannungen wieder verschärft und<br />
beide Seiten scheinen sich auf eine weitere Auseinandersetzung vorzubereiten, die keine Seite gewinnen kann.<br />
Dabei sind die anfänglichen Ideale längst kommerziellen Interessen gewichen: Während die MPLA die Erdöl-<br />
vorräte vor der Küste erschliesst, um ihre 120'000 Mann starke Armee zu erhalten, von denen aber nur rund<br />
15'000 tatsächlich entsprechend ausgerüstet sind, finanziert die UNITA ihre je nach Schätzung 5'000-15'000<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 284
Rebellen mit dem Verkauf von Diamanten aus den in sich in ihrer Hand befindenden Nordprovinzen des<br />
Landes. Die USA unterstützt seit ihrer Anerkennung der angolanischen Regierung 1993 die MPLA. Die<br />
UNITA wird noch immer von Südafrika aus mit verschiedenen Gütern und Waffen versorgt. (Zu Angola siehe<br />
auch die Seite 203 dieser Arbeit.)<br />
Ein Foto auf der Seite 61 zeigt ausserdem ein "Slum am Stadtrand von Johannesburg" ist aber im Hinblick auf<br />
die folgende Debatte wenig aussagekräftig. (Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 283 und 288<br />
dieser Arbeit.<br />
Anschliessend lässt der Text verschiedene Persönlichkeiten zu Wort kommen. Auf der Seite der Apartheidsbe-<br />
fürworter werden der damalige Justizminister Krüger und der ehemalige Ministerpräsident Vorster zitiert, die<br />
beide zwar den status quo verteidigen, aber keine Begründungen ihm Bezug auf die Fragestellung der Arbeit<br />
geben.<br />
Gegen die Argumentation der Weissen, sie hätten das Land zuerst besiedelt, wehrt sich "Steve Biko ein Führer<br />
der schwarzen Widerstandsbewegung, der 1977 in einem südafrikanischen Gefängnis umkam". Interessanter-<br />
weise wird hier die Wendung "der in einem... Gefängnis umkam" verwendet, hat sich doch unterdessen<br />
herausgestellt, dass er gefoltert und anschliessend ermordet wurde.<br />
Aus einem Bericht des Evangelischen Missionswerkes von 1978 zitiert der Autor (S. 62):<br />
Die Weissen behaupten, die Geschichte Südafrikas beginne 1652 mit dem Erscheinen der Holländer. Dadurch soll die<br />
vielerzählte Lüge unterstützt werden, dass die Schwarzen etwa zur gleichen Zeit in dieses Land gekommen sind wie die<br />
Weissen. Wir müssen unsere Geschichte neu schreiben und den Widerstand gegen die weissen Eindringlinge darstellen.<br />
Weitere Argumente werden von einer Mitarbeiterin des ANC (einer nach den Aussagen des Textes seit 1960 in<br />
Südafrika verbotene Organisation) angeführt, die unter anderem aussagt:<br />
Die Schwarzen sind die Mehrheit im Lande. Sie haben jedoch keine politischen Rechte... Die Schwarzen sind die Reserve<br />
für billige Arbeitskräfte. Sie verrichten die schmutzigen Arbeiten. Die qualifizierten Berufe dürfen sie nicht ergreifen. Sie<br />
profitieren nicht vom Reichtum des Landes... Die Afrikaner dürfen sich in 87 % des Landes nicht aufhalten, es sei denn, sie<br />
werden als Arbeitskraft gebraucht.<br />
(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 280 und 303 dieser Arbeit.) Im nächsten Abschnitt zu Südafrika<br />
unter der Kernaussage "Die Vereinten Nationen verurteilen die Rassenpolitik der Republik Südafrika." schreibt<br />
der Autor:<br />
Nach einem Beschluss des Weltsicherheitsrates darf kein Staat Waffen nach Südafrika liefern. Die meisten afrikanischen<br />
Länder verlangen, dass die Industrieländer ihre Handelsbeziehungen mit Südafrika abbrechen sollen, um die weisse<br />
Regierung zum Nachgeben zu zwingen...<br />
Was die Schweiz nicht daran hinderte weiter ihre Geschäfte mit Südafrika zu treiben und sogar noch vom<br />
Boykott zu profitieren.<br />
Der Autor schliesst seine Ausführungen unter der Kernaussage "Der Anteil der Nichtweissen an der Gesamtbe-<br />
völkerung nimmt ständig zu." auf Seite 62, die auch eine Kreisgrafik für die "Geschätzte Bevölkerung für das<br />
Jahr 2000" zeigt, mit den Worten :<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Die Wirtschaft der Weissen kann schon jetzt nicht auf die Arbeitskraft der Schwarzen verzichten. Sie wird in<br />
zunehmendem Masse auch farbige Facharbeiter benötigen. Wie sie dieses <strong>Pro</strong>blem lösen will, wenn sie den Schwarzen<br />
noch lange das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, bleibt eine offene Frage.<br />
Diese Frage wurde unterdessen zumindest auf politischer Ebene gelöst, die wirtschaftlichen Unterschiede sind<br />
nach wie vor ausgesprochen gross. Entgegen vieler <strong>Pro</strong>gnosen hat aber Südafrika durch den Regierungswech-<br />
sel von 1994 keinen wirtschaftlichen Niedergang erlebt, und dies obwohl der Anteil der schwarzen Bevölke-<br />
rung prozentual bereits 1996 wesentlich über der in der bereits erwähnten Grafik gemachten <strong>Pro</strong>gnose lag. Seit<br />
Anfang 1998 scheinen sich die wirtschaftlichen <strong>Pro</strong>bleme in der Republik Südafrika aber durch Abwanderung<br />
von qualifizierten Arbeitskräften und fehlenden Investitionen, die nicht zuletzt auf die hohe Kriminalität des<br />
Landes zurückzuführen sind, zu verschärfen. Bereits fallen in den Medien Begriffe wie "Korruption",<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 285
"Vetternwirtschaft" und "mangelnde Kompetenz", die bis anhin für die von Nichtweissen geführten schwarzaf-<br />
rikanischen Staaten reserviert waren.<br />
4.23.3 Band 3: Unsere Welt im Wandel (Ausgabe von 1977, erstmals 1972)<br />
Der dritte Band von "Dreimal um die Erde" mit dem Titel "Unsere Welt im Wandel", der erstmals 1972<br />
erschien, beschäftigt sich in zwei grossen Kapiteln mit Themen, die teilweise Afrika tangieren oder in denen<br />
Fallbeispiele aus Afrika genannt werden: "Ernährung der Menschheit" (S. 10-31) und "Entwicklungspolitik"<br />
(S. 106-117).<br />
4.23.3.1 Ernährung der Menschheit<br />
Das Kapitel "Ernährung der Menschheit" befasst sich in drei Unterkapiteln mit der im Titel angesprochenen<br />
Thematik. Auf der Seite 10 ist eine Weltkarte "Länder mit hohem und Länder mit niedrigem Lebensstandard"<br />
abgedruckt, die zeigt, dass viele Länder Afrikas zu den ärmsten Ländern der Welt gehören. Damit sind die<br />
schwarzafrikanischen Länder Mitte der siebziger Jahre endgültig zum Armenhaus der Welt mutiert.<br />
Auf der Seite 11 wird unter der Kernaussage "Der Speisezettel einer Familie in einem Entwicklungsland sieht<br />
anders aus als bei uns" auch das afrikanische Kamerun genannt. Der dazu abgedruckte Speisezettel lautet:<br />
Zum Frühstück gibt es gewöhnlich Maisbrei, manchmal mit Spinat; oder Maiskolben, Erdnüsse oder Kolanüsse; hin und<br />
wieder als Getränk dazu etwas Palmwein. Das Mittagessen besteht aus Süsskartoffeln (Bataten), die in Palmöl gekocht<br />
werden; oder es gibt wie zum Frühstück wieder Maisbrei mit Spinat, Kolanüsse und Palmwein. Die Abendmahlzeit sieht<br />
auch nicht viel anders aus: Maniok, in Palmöl gekocht, oder Maisbrei mit Spinat. Fast alle Speisen werden mit scharf<br />
gewürzten Saucen gegessen. Bananen liefern wertvolle Zukost.<br />
Die Kolanuss wird in vielen Ländern Westafrikas gekaut, weil sie anregend wirkt und sozusagen neuen Ener-<br />
gie verleiht. Die Gewürze, die aus unserer Sicht oft zu grosszügig eingesetzt werden, dienen nicht nur der<br />
Geschmacksverbesserung der Speisen, sie wirken auch antibakteriell, was im tropischen Klima eines Landes<br />
wie Kamerun von grosser Bedeutung ist.<br />
Die Kernaussage "Über die Hälfte der Erdbevölkerung ist unterernährt, sie leidet Hunger." wird auf Seite 11<br />
mittels eines kurzen Texts, der den täglich benötigten Nahrungsbedarf für verschiede Tätigkeiten, einer Tabel-<br />
le, welche die Angaben über den Nährwert von Nahrungsmittel macht und einer mit Kreisgrafiken versehenen<br />
Weltkarte, welche die Ernährungssituation in den verschiedenen Ländern anzeigt, ergänzt. Dabei fällt auf, dass<br />
ein Grossteil der mit "weniger als 30 g tierischem Eiweiss pro Kopf der Bevölkerung" gekennzeichneten<br />
Gebiete auf Afrika entfallen.<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Auf Seite 12 heisst es dazu unter der Kernaussag "Viele Menschen in den Entwicklungsländern, besonders<br />
Kinder, leiden unter Eiweissmangel. Sie sind fehlernährt.". Ein Erwachsener brauche "etwa 1 g Eiweiss ...pro<br />
kg seines Körpergewichtes". Auf der gleichen Seite sind auch zwei Fotos mit den Bildlegenden "Zubereitung<br />
von Maniokbrei" und "Maniokstaude" abgebildet. Der dazu passende Text (S. 12-13) lautet:<br />
Im tropischen Afrika ist Maniok ein Hauptnahrungsmittel. Diese Knollenfrucht enthält nur 1% Eiweiss; Hirse, Mais und<br />
Reis dagegen 8 bis 10%. In Gebieten mit einseitiger Maniok-Ernährung ist die Eiweissmangel-Krankheit Kwashiokor weit<br />
verbreitet. An ihr leiden vor allem Kleinkinder. Sie nehmen ab, ihre Haut verfärbt sich und bricht zu offenen Wunden auf.<br />
Viele sterben bevor sie fünf Jahre alt geworden sind; die, die am Leben bleiben, erreichen nie die volle körperliche und<br />
geistige Leistungsfähigkeit. Ihre Widerstandskraft gegen Krankheit ist sehr gering.<br />
(Zur Maniokpflanze siehe auch die Seiten 242 und 293 dieser Arbeit.) Auf der Seite 13 untermalt das Foto<br />
"Fehlernährtes Kind", auf dem ein Kind mit typischem Hungerbauch zu sehen ist, die im Text gemachten<br />
Aussagen. (Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 279 und 296 dieser Arbeit.)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 286
Seite 14 zeigt ein Foto "Markt in Addis Abeba". Die Schüler werden in der dazu gehörenden Aufgabe aufge-<br />
fordert, diesen Markt "mit Marktständen in deutschen Städten" zu vergleichen.<br />
Auf Seite 15 steht unter der Kernaussage "Die meisten Bauern bewirtschaften nur kleine Flächen.":<br />
...In Schwarzafrika gehört das Land meistens dem Stamm. Es wird jährlich zur Bearbeitung an die Mitglieder des Stammes<br />
neu verteilt...<br />
Eine zu allgemeine Aussage, die auf gewisse Völker zutreffen mag, für andere aber falsch ist. Danach wird im<br />
Text auf die Plantagenwirtschaft aufmerksam gemacht. Und im Zusammenhang mit Afrika heisst es weiter<br />
über die als Folgen dieser Anbauform in manchen Ländern nötig gewordenen Bodenreformen unter der<br />
Kernaussage "Durch Bodenreformen sollen leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe geschaffen werden ."<br />
nach einem Artikel aus "Die Zeit" von 1975 (S. 15):<br />
In Tansania heisst das Zauberwort für die Bodenreform "Ujamaa"; es bezeichnet eine Form des afrikanischen Sozialismus.<br />
Zwölf von vierzehn Millionen Tansanianern leben von der Landwirtschaft; sie leben schlecht davon. Tansania gehört zu<br />
den 25 ärmsten Ländern der Erde. Das grosse Ziel seines Präsidenten Nyerere ist, dass es sich einmal selbst versorgen<br />
kann, unabhängig vom kapitalistischen und vom kommunistischen Ausland. "Wir werden dieses Ziel dann erreichen", sagt<br />
er, "wenn die Menschen in familienhaften Gemeinschaften leben und für das Wohl aller zusammenarbeiten".<br />
In einem Ujamaa-Dorf wird das Land nicht mehr Jahr für Jahr an die Stammesmitglieder verteilt, sondern alle<br />
Dorfbewohner arbeiten und planen gemeinsam, von der Feldbestellung bis zum Bau und Betrieb neuer Einrichtungen:<br />
Brunnen, Bewässerung, Handwerkshäuser, Kindertagesstätten, Schulen, Fürsorge für Kranke. Nach der Verkündung dieses<br />
<strong>Pro</strong>gramms (1967) gab es zunächst grosse Schwierigkeiten, die durch zwei Dürreperioden noch vermehrt wurden. Die<br />
Getreideproduktion ging um ein Drittel zurück. Die Ölkrise verteuerte alle Einfuhren; gleichzeitig sanken die<br />
Weltmarktpreise für alle Ausfuhren (Baumwolle, Kaffee, Sisal). Zwangsumsiedlungen der Bevölkerung in Ujamaa-Dörfer<br />
brachten Unruhen mit sich. Die Führungskräfte für die Ujamaa-Dörfer werden jetzt besser ausgebildet. Sie versuchen, die<br />
Einwohner von der Ujamaa-ldee zu überzeugen; Zwangsumsiedlungen wurden gestoppt.<br />
1973 lebten 1 Mio. Bauern in Ujamaa-Dörfern; 1975 waren es bereits 10 Mio. Ob Ujamaa jemals funktionieren und die<br />
Selbstversorgung des Landes garantieren kann, ist noch ungewiss. Vorläufig braucht Tansania noch Entwicklungshilfe.<br />
(Zu Tansania siehe auch die Seiten 266 und 299, zu Ujamaa die Seite 299 dieser Arbeit.)<br />
Die Seite 16 zeigt ein Foto "Feldbestellung mit dem Hakenpflug in Nordafrika". Unter der Kernaussage "Die<br />
Ernteerträge und die Leistungen der Viehzucht sind gering." schreibt der Autor über Afrika:<br />
... In Afrika bestellen die Frauen die Felder mit der Hacke... In holzarmen Ländern wie Indien oder Ägypten wird der<br />
Rinderdung getrocknet und als Brennmaterial verwendet... Die Rinder bleiben meistens klein und mager; denn sie finden<br />
nur dürftige Nahrung in den trockenen Savannen oder Steppen. Häufig müssen sie weite Strecken zurücklegen, um Weideund<br />
Wasserstellen zu finden. Futterpflanzen baut man nur selten an. Wenn die Menschen kaum satt werden, kann man die<br />
Tiere nicht mit Getreide füttern.<br />
Viele Völker - besonders in Afrika - legen bei der Viehhaltung weniger Wert auf die Milchleistung und das<br />
Schlachtgewicht der Tiere als vielmehr auf die Stückzahl. Der Besitz einer grossen Herde steigert das Ansehen der Familie.<br />
Eine zu grosse Stückzahl auf der Weidefläche führt aber zu Überweidung; die Tiere fressen alles kahl, auch Sträucher und<br />
kleine Bäume. Windverwehungen und Bodenzerstörung sind die Folgen.<br />
Auf Seite 17 folgt die Kernaussage "Durch eine 'Grüne Revolution' sollen die Erträge in Entwicklungsländern<br />
gesteigert werden." In Afrika wird auf diesem Gebiet meist in Zusammenarbeit mit europäischen oder ameri-<br />
kanischen Institutionen geforscht. Allerdings konzentrieren sich die Anstrengungen nicht nur auf Getreidesor-<br />
ten, sondern auch auf andere Grundnahrungsmittel wie Kassawa (Maniok) und Kochbananen.<br />
Zwei ganzseitige Graphiken auf den Seiten 18 und 19 "Landwirtschaftliche Unterentwicklung als geschlosse-<br />
nes System" und "Schema der möglichen wirtschaftlichen Entwicklung" sollen zusammen mit den dazu gehö-<br />
renden Fragen auf der Seite 20 einen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge geben.<br />
Auf der gleichen Seite findet sich ein Foto "Ernährungsberatung in Afrika", die unterdessen nicht mehr nur wie<br />
auf dem Foto gezeigt, mittels Tafeln vor der Dorfgemeinschaft gelehrt wird, sondern z. B. in Ghana im<br />
Rahmen der wöchentlichen Gesundheitssendung auch einen Platz im nationalen Fernsehprogramm gefunden<br />
hat.<br />
Die von einer Grafik untermauerte Kernaussage "Die Ernten in den Entwicklungsländern reichen für die<br />
Versorgung der Bevölkerung nicht aus." ist zu allgemein gefasst und trifft auf viele Länder Afrikas nicht zu,<br />
da Versorgungskrisen oft nur regionalen, selten nationalen Charakter haben. Oft liegt das Hauptproblem in der<br />
Lagerung und dem Transport von allfällig erwirtschafteten Überschüssen.<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 287
Die weiteren Seiten des Kapitels enthalten keine Informationen zu Afrika mehr. Im Unterkapitel "Landwirt-<br />
schaft und Nahrungsmittelproduktion in Industrieländern " (S. 21) versucht der Autor aber darauf aufmerksam<br />
zu machen, dass noch vor 100 Jahren viele Länder Europas ähnliche Strukturen wie die heutigen Entwick-<br />
lungsländer aufgewiesen hätten.<br />
4.23.3.2 Entwicklungspolitik<br />
Im Kapitel Entwicklungspolitik auf den Seiten 106-107 schreibt der Autor im Unterkapitel "Entwicklungs-<br />
länder" unter der Kernaussage "Die Entwicklungsländer gehören zur Dritten oder Vierten Welt." (S. 106):<br />
...Die Einteilung in vier Welten sagt wenig über den Lebensstandard der Bewohner aus...<br />
Im Text zur Kernaussage "Die meisten Menschen in den Entwicklungsländern leben in Armut" schreibt der<br />
Autor:<br />
Der grösste Teil der Bevölkerung ist in der meist rückständigen Landwirtschaft tätig und erzielt nur geringe Erträge. Die<br />
Familien können sich gerade ernähren. Rücklagen oder Überschüsse für den Kauf dringend benötigter Industriewaren und<br />
Arbeitsgeräte werden kaum erwirtschaftet...<br />
...In den Slums der Grossstädte wohnen die Menschen teilweise schlechter, als bei uns die Haustiere untergebracht sind...<br />
(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 285 und 335 dieser Arbeit.) Ergänzend kann gesagt<br />
werden, dass Haustiere in Europa mehr kosten, z. B. was ihre Nahrung aber auch die medizinische Versorgung<br />
anbelangt. Die immer wieder geäusserte Meinung, es könnte nicht mehr für die sogenannte "3. Welt" getan<br />
werden, entspricht also nicht einer Tatsache, sondern beruht einzig und allein auf individuell gesetzten Priori-<br />
tätenlisten, auf denen eben die eigene Katze oder der eigene Hund oft weit höher stehen als irgend ein unbe-<br />
kannter Mensch irgendwo auf dieser Welt. Überspitzt gesagt, die Zufriedenheit des eigenen Haustieres ist<br />
vielen Menschen, nicht nur in Europa, mehr wert, als die Schulbildung eines Kindes in einem finanziell<br />
schlecht gestellten Land Afrikas. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 266 und 299 dieser Arbeit.)<br />
In diesen Gedankengang passt der nächste Abschnitt des Buches unter der Kernaussage "Der Anteil der Anal-<br />
phabeten in den Entwicklungsländern ist besonders hoch.", indem es heisst (S. 107):<br />
Die Menschen haben wenig Möglichkeiten, sich zu informieren, Neues zu lernen. Aus Unwissenheit ändern sie nicht ihre<br />
veralteten und unrentablen Arbeits- und Wirtschaftsformen. Religiöse Vorstellungen hemmen den Fortschritt...<br />
Dieser Gedankengang unterscheidet sich nicht wesentlich von der auf der Seite 222 dieser Arbeit aus dem<br />
Lehrmittel "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 zitierten Vorstellung, man müsse den Schwarzen die Seele<br />
aus der Brust reissen, damit Fortschritt möglich werde. Dabei gibt es auch Volksgruppen, die bewusst auf eine<br />
Entwicklung nach westlichem Vorbild verzichten, weil sie die überlieferten Werte höher einstufen, als den<br />
allenfalls zu erwartenden materiellen Gewinn durch eine Zivilisierung im westlichen Sinne.<br />
In einer Tabelle wird die Analphabetenrate für Äthiopien, welches in älteren Lehrmitteln schon fast als Wirt-<br />
schaftswunderland geschildert wurde (siehe dazu die Zusammenfassung der Darstellung Äthiopiens in den<br />
Lehrmitteln auf der Seite 517 dieser Arbeit), mit 95% angegeben. In der Graphik "Bruttosozialprodukt je<br />
Einwohner in DM (1976)" werden Algerien (1382), Ägypten (704), Sudan (409), Tansania (332), Niger (256),<br />
und Äthiopien (230) aufgeführt. Die USA erwirtschafteten zum Vergleich im selben Jahr 16'559 DM pro Kopf.<br />
Interessant ist ein Vergleich dieser Zahlen mit den Angaben der im Anhang auf der Seite 569 dieser Arbeit<br />
abgedruckten Karte "Bruttosozialprodukt pro Kopf".<br />
Unter der Kernaussage "Für die schnell wachsende Bevölkerung der Entwicklungsländer fehlen Arbeitsplätze"<br />
schreibt der Autor (S. 107):<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Entwicklungsländer führen überwiegend landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>dukte oder Bodenschätze aus. Oft sind die<br />
Staatseinnahmen von dem Verkauf weniger <strong>Pro</strong>dukte abhängig... den meisten Entwicklungsländern fehlt die Infrastruktur...<br />
Facharbeiter gibt es nur wenige. Häufig hemmen Regierungsumstürze und Bürgerkriege die wirtschaftliche Entwicklung<br />
des Landes.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 288
Die Ausführungen des Autors haben ihre Richtigkeit, doch selbst bei einer einsetzenden Industrialisierung, die<br />
es tatsächlich schaffen würde, mehr Arbeitsplätze zu erzeugen als zu vernichten, würde es viele Jahre dauern,<br />
bis die Menschen dieser geschilderten Ländern einen den westeuropäischen Ländern entsprechenden Wohl-<br />
stand erzielen könnten.<br />
4.23.3.3 Entwicklungshilfe<br />
Im Unterkapitel "Entwicklungshilfe" auf den Seiten 108-113 werden folgende Kernaussagen gemacht:<br />
Ein grosser Teil der Entwicklungshilfe wird mit staatlichen Mitteln finanziert.<br />
Entwicklungshilfe wird zu unterschiedlichen Bedienungen gewährt.<br />
Der Deutsche Entwicklungsdienst schickt Helfer in viele Länder der Erde.<br />
Kirchen und Hilfsorganisationen leisten private Hilfe.<br />
Investitionen privater Unternehmer sind in manchen Entwicklungsländer umstritten.<br />
Viele Entwicklungsländer sind verschuldet.<br />
Entwicklungshilfe dient nicht immer der Entwicklung eines Landes.<br />
Zu der Kernaussage über den Deutschen Entwicklungsdienst werden zwei afrikanische Beispiele angeführt. In<br />
einem Zitat aus H. Kraut "Bessere Nahrung für Tansania" in "Das Parlament" von 1970 heisst es auf Seite 109:<br />
In Tansania untersuchten deutsche Wissenschaftler, weshalb die Bantukinder der <strong>Pro</strong>vinz Usambara in ihrem Wachstum<br />
zurückblieben und unter Mangelkrankheiten litten. Die Hauptnahrungsmittel der Bantu sind Bananen und Mais, daher<br />
fehlen Eiweissstoffe. In Usambara baut man eine Gartenbohne an, die viel Eiweiss enthält. Eine Woche nach der Ernte<br />
wurden die Bohnen aber regelmässig durch Insektenfrass vernichtet. Die Wissenschaftler entwickelten aus einer<br />
Chrysanthemenart, die in Usambara wächst, ein Mittel gegen die Insekten. Nun kann man die Bohnen ein halbes Jahr lang<br />
lagern. Da in Usambara zwei Ernten im Jahr möglich sind, können ausreichend Bohnen angebaut und damit die<br />
Eiweissstoffe im Land gewonnen werden. Um die Bantu von der Notwendigkeit dieser Ernährung zu überzeugen, sollten<br />
sie aus eigener Erfahrung lernen. Die Regierung unterstützt solche Massnahmen und empfiehlt den Zusammenschluss zu<br />
Dorfgemeinschaften. "Als erstes wurde im Dorf Mayo, sechs Meilen von Bumbuli entfernt, eine Schulspeisung für 150<br />
Kinder eingerichtet. Hierzu baute das Dorf neben dem Schulgebäude eine Schulkantine. Die Dorfbewohner stiften den<br />
Mais. Bohnen und Gemüse werden in einem Schulgarten angebaut, den die Kinder unter Anleitung eines japanischen<br />
Entwicklungshelfers angelegt haben. Der Erfolg war so überzeugend, dass vier Dörfer eine Schulspeisung einrichten...<br />
Im Dorf Mayo entstand der Wunsch nach einer Quellwasserleitung. Wir vermittelten die unentgeltliche Überlassung der<br />
Rohre durch die Regierung. Die Arbeitskräfte stellte das Dorf und damit den grössten Beitrag zu den Kosten...<br />
Nur so wird erreicht, dass es 'ihre Wasserleitung', 'ihre Schulspeisung' ist, nicht ein Geschenk von auswärts, für dessen<br />
weitere Unterhaltung der Schenkende nach Meinung der Dorfbewohner die Verantwortung übernehmen sollte.''<br />
Hier wird die Meinung vertreten, dass Entwicklungshilfe im Kleinen, unter Einbezug der örtlichen Gegeben-<br />
heiten und Gewohnheiten der Einwohner, geleistet werden soll.<br />
Auf der Seite 110 wird der Bericht einer deutschen Diplomgärtnerin, die als landwirtschaftliche Beraterin in<br />
Ruanda tätig war, ebenfalls aus "Das Parlament" von 1975 zitiert:<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Während der Regenmonate März, April, Mai und Juni lag meine Haupttätigkeit auf dem Gebiet des Erosionsschutzes. In<br />
der Siedlung gibt es viele Gebiete mit starker Hangneigung; dazu kommen ein poröser, staubartiger Boden und sehr heftige<br />
und häufige Regenfälle, vor allem während der Regenzeit, so dass auf schon 5 bis 8 Jahre lang bewirtschafteten Parzellen<br />
stellenweise der nackte Fels zutage tritt.<br />
Mit vier ungelernten Ruandesen begann ich, Höhenlinien auf den einzelnen Parzellen abzustecken. Diese Linien, die sich<br />
alle 40 m hangabwärts wiederholten, wurden mit einem robusten Gras bepflanzt, das zu einer Barriere gegen Wasser und<br />
Erde zusammenwächst.<br />
Meine vier Mitarbeiter haben die Aufgabe sehr schnell begriffen und verstehen es auch meist mit gutem Erfolg, den Bauern<br />
den Nutzen dieser Massnahme zu erklären und sie dazu zu bewegen, beim Pflanzen des Grases mitzuhelfen. Doch viel<br />
Arbeit und Enttäuschung gibt es Wochen und Monate später, wenn wir wieder zu den gleichen Bauern kommen. Viele, vor<br />
allem die Frauen, haben beim Hacken und Neubestellen der Felder auf das noch schwach entwickelte Gras keine Rücksicht<br />
genommen, es stellenweise wieder ausgerissen oder mit Erde überhäuft. So muss man wieder und wieder die Bauern<br />
besuchen, erklären und Hand anlegen.<br />
Um dabei bessere Resultate zu erzielen und um ganz allgemein die Bauern ein bisschen zu animieren mitzumachen, habe<br />
ich einen Wettbewerb in einem Gebiet mit 173 Bauern veranstaltet. Es wurde angekündigt, dass wir jeden besuchen<br />
würden und dabei den Zustand ihrer Parzellen und ihres Weges, die Sauberkeit ihrer Kinder und des Hofraumes benoten<br />
wurden; für die Besten gäbe es Preise...<br />
(Zu Ruanda siehe auch die Seiten 165 und 362 dieser Arbeit.) Wie schwierig die Durchführung solcher <strong>Pro</strong>jek-<br />
te sich gestaltet, kann anhand der <strong>Pro</strong>bleme des Naturschutzes in der Schweiz, der oft auf den Widerstand und<br />
das Unverständnis der lokalen Bevölkerung stösst, leicht nachvollzogen werden. Zusätzlich kommen die<br />
<strong>Pro</strong>bleme der Verständigung, nicht nur auf der Sprachebene, ungewohnte, d. h. fehlende Infrastruktur, die<br />
Ungeduld der <strong>Pro</strong>jektleiter, die vielleicht in drei Monaten oder einem Jahr bereits wieder in Europa sein<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 289
müssen, hinzu. Der Text warnt dann auch richtig vor allzu grossen Erwartungen. Auf der gleichen Seite ist ein<br />
Foto "Entwicklungshelfer auf einer landwirtschaftlichen Versuchsstation in Kamerun" abgebildet, auf dem ein<br />
Traktor mit Egge abgebildet ist, der im Beisein eines Schwarzen von einem Weissen untersucht wird.<br />
Auf Seite 111 schreibt der Autor unter der Kernaussage "Kirchen und Hilfsorganisationen leisten private<br />
Hilfe":<br />
...UNICEF... half in 106 Ländern, zum Beispiel errichtete es Schulen und führte Schulspeisungen durch. Die Mütter<br />
erhielten Unterricht in Säuglingspflege und gesunder Ernährung. Es wurden Anlagen zur Wasserversorgung,<br />
Lehrwerkstätten und Krankenstationen finanziert. UNICEF verteilt kein Geld, sondern Sachspenden, finanziert Helfer und<br />
Berater.<br />
Wobei diese Berater dann teilweise auf Kosten von UNICEF ein recht angenehmes Leben führen, bei der loka-<br />
len Bevölkerung aber nicht immer sehr beliebt sind, vor allem, wenn sie nicht erkennen, dass ihre eigenen<br />
Wertmassstäbe nicht unbedingt denjenigen der Bevölkerung des Landes entsprechen, und auf diese Weise mit<br />
einem hohen finanziellen Aufwand relativ wenig erreichen. Andere Hilfswerke wie Swiss Aid stellen nicht<br />
Berater aus anderen Ländern zur Verfügung, sondern vermitteln und finanzieren Berater aus dem Land, in dem<br />
die Entwicklungshilfe zu leisten ist.<br />
Auf der Seite 111 ist auch die im Buch zweimal genannte "Kinderspeisung in Afrika" abgebildet. Aus einem<br />
grossen Topf werden die Kinder einer Schule je mit einer Schale Reis bedient, was für viele eine willkommene<br />
Bereicherung des Speisezettels bedeutet und einen zusätzlichen Antrieb für den Schulbesuch liefert.<br />
Unter der Kernaussage "Investitionen privater Unternehmer sind in manchen Entwicklungsländern umstritten"<br />
schreibt der Autor auf Seite 112:<br />
...Ein Beispiel für ein umstrittenes <strong>Pro</strong>jekt ist Cabora Bassa in der Volksrepublik Mosambik. Das Land war bis 1975<br />
portugiesische Kolonie. Im Jahre 1969 vergab die portugiesische Regierung den Auftrag zum Bau eines Staudammes bei<br />
Cabora Bassa, 500 km unterhalb des Kariba-Dammes in Sambia. Der grösste Teil des elektrischen Stromes fliesst seit 1975<br />
in einer 1'400 km langen Leitung nach Südafrika. Auch die Kupfervorkommen im benachbarten Sambia und die<br />
Bauxitlager in Malawi könnte man mit Hilfe der Energie von Cabora Bassa erschliessen.<br />
Deutsche, französische, südafrikanische und italienische Firmen bauten und finanzierten den Staudamm und die<br />
Kraftwerke. Von der einheimischen Befreiungsbewegung Frelimo wurde die Anlage als Werk der weissen Vorherrschaft in<br />
Afrika und als Symbol für Kolonialismus und Unterdrückung bekämpft. Nur unter starkem militärischen Schutz konnten<br />
die Arbeiten ausgeführt werden. Auch in den Industrieländern war das <strong>Pro</strong>jekt heftiger Kritik ausgesetzt. Man sah das<br />
Vorhaben als eine Unterstützung der Kolonialmacht Portugal an. Schwedische Firmen zogen daraufhin ihre Zusage zurück,<br />
sich am Bau zu beteiligen.<br />
Die Baufirmen und die Regierungen der beteiligten Länder vertraten demgegenüber die Auffassung: Wenn Mosambik frei<br />
und unabhängig wird, kommt der Nutzen des Staudammes der gesamten Bevölkerung zugute.<br />
Als Mosambik unabhängig wurde, unterstützte die Frelimo-Regierung die Vollendung des <strong>Pro</strong>jektes. Sie plant, die beim<br />
Bau des Staudammes im Lande entdeckten Bodenschätze mit Hilfe des billigen Stromes vom Sambesi zu erschliessen. Die<br />
Deviseneinnahmen aus dem Verkauf des Stromes ermöglichen den Kauf dringend benötigter Maschinen und Fahrzeuge.<br />
Beim Bau des Dammes wurden viele Facharbeiter ausgebildet, die heute anderweitig eingesetzt sind.<br />
(Zum Karibastaudamm siehe auch die Seite 227, zu Mosambik die Seite 262 dieser Arbeit.)<br />
Die weitere Kernaussage "Viele Entwicklungsländer sind verschuldet" unterstreicht der Autor mit einer Grafik<br />
auf der Seite 107, in der auch Ägypten und Sambia dargestellt sind - für beide Länder hat die Verschuldung im<br />
Zeitraum 1970-1973 zugenommen. Im Text schreibt er:<br />
Die Verschuldung der Entwicklungsländer hat sich seit 1955 alle fünf Jahre verdoppelt. Die Zahlungen für Zinsen und<br />
Schuldentilgung wachsen immer mehr an. In einigen Ländern ist die Verschuldung so hoch, dass mehr als die Hälfte neuer<br />
Kredite für den Schuldendienst der älteren Kredite verrechnet werden.<br />
Die Kernaussage "Entwicklungshilfe dient nicht immer der Entwicklung des Landes" (S. 112) wird nur allge-<br />
mein behandelt und durch kein konkretes Beispiel belegt.<br />
Das Unterkapitel "Neue Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit" auf den Seiten 113f. führt folgende<br />
Kernaussagen an:<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Zwei Drittel der Einnahmen in den Entwicklungsländern stammen aus Rohstoffexporten.<br />
Entwicklungsländer bilden Kartelle.<br />
Viele Industrieländer sind von Rohstoffeinfuhren abhängig.<br />
Die Entwicklungsländer fordern eine neue Wirtschaftsordnung.<br />
Die Europäische Gemeinschaft geht in der Entwicklungshilfe neue Wege.<br />
Die Industrialisierung der Entwicklungsländer führt zu Strukturveränderungen in der Wirtschaft der Industrieländer.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 290
Entwicklungshilfe wird unterschiedlich beurteilt.<br />
Zu der Kernaussage "Zwei Drittel der Einnahmen in den Entwicklungsländern stammen aus Rohstoffexpor-<br />
ten." schreibt der Autor auf der Seite 113:<br />
Etwa 50 Entwicklungsländer sind in ihrem Export nahezu auf ein <strong>Pro</strong>dukt angewiesen. Das kann hohe Gewinne bringen,<br />
wenn der Preis für dieses <strong>Pro</strong>dukt auf dem Weltmarkt stärker steigt als die Preise für eingeführte Industriewaren.<br />
In der Regel schwanken aber die Preise für Rohstoffe auf dem Weltmarkt je nach Angebot und Nachfrage. Das führt bei<br />
einer Abhängigkeit von wenigen Exportgütern zu unsicheren Einnahmen in den Rohstoffländern. Ghana konnte zum<br />
Beispiel zu Beginn der sechziger Jahre seine Kakaobohnen zu hohen Preisen verkaufen. Wegen der günstigen<br />
Absatzmöglichkeiten legten Nigeria und Kamerun ebenfalls Kakaopflanzungen an, die 1965 erstmals den Weltmarkt<br />
belieferten. Günstige Witterungsbedingungen brachten eine überdurchschnittliche Ernte. Das Mehrangebot führte zum<br />
Preissturz. Ein Teil der Ernte konnte nicht verkauft werden, der andere Teil nur mit Verlusten. Die erwarteten<br />
Deviseneinnahmen blieben aus; Einfuhren von wichtigen Industriewaren mussten unterbleiben.<br />
(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 278 und 293, eine Tabelle "Kakaoproduktion ausgewählter Länder"<br />
findet sich im Anhang auf der Seite 552 dieser Arbeit.)<br />
Auf der Seite 113 ist auch eine Grafik "Veränderungen der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt Ende 1974<br />
gegenüber Anfang 1974 in %" abgedruckt, welche die im Text gemachten Aussagen noch einmal konkret illu-<br />
striert. So betrug die Veränderung nach den Angaben für Kakao +64%, die für Baumwolle -41%, für Kaut-<br />
schuk -43% und für Kupfer -31%.<br />
Auf Seite 114 schreibt der Autor unter der Kernaussage "Die Entwicklungsländer fordern eine neue<br />
Wirtschaftsordnung.":<br />
Sie sagen, die derzeitige Teilung der Welt in arme und reiche Länder stamme aus der Kolonialzeit. Damals seien die<br />
Kolonien zu Rohstofflieferanten für die Industrieländer entwickelt worden und müssten heute unter dieser einseitigen<br />
Abhängigkeit leiden. Ausserdem seien die Preise für Industriegüter im Vergleich zu den Rohstoffpreisen zu hoch. Daraus<br />
entstehe eine neue Abhängigkeit (Neokolonialismus).<br />
Vergleicht man dazu beispielsweise die Aussage aus dem Lehrmittel "Länder und Völker" aus den 60er Jahren<br />
(Bd. 3, S. 55), Afrika solle die "Rohstoffkammer" Europas werden, so kann diesen Argumenten eine gewisse<br />
Logik nicht abgesprochen werden.<br />
Auf der Seite 115 werden in tabellarischer Form einige "Forderungen der Entwicklungsländer" aufgezählt und<br />
die "Antworten der Industrieländer" diesen Forderungen entgegengestellt.<br />
Auf der Seite 116 beschreibt der Autor unter der Kernaussage "Die Europäische Gemeinschaft geht in der<br />
Entwicklungshilfe neue Wege" das Abkommen von Lomé:<br />
1975 schlossen die 9 Mitgliedsländer der EG in Lome, der Hauptstadt Togos, einen Vertrag mit 46 Entwicklungsländern<br />
aus Afrika (37)... den sogenannten AKP-Ländern.<br />
Auf Seite 117, unter der Kernaussage "Die Industrialisierung der Entwicklungsländer führt zu Strukturverände-<br />
rungen in der Wirtschaft der Industrieländer." schreibt der Autor, H. J. Wald in "Blick in die Wirtschaft" von<br />
1976 zitierend:<br />
..."Handel! - nicht Almosen!" ist die Formel der von den bisherigen Entwicklungshilfe enttäuschten Ländern der Dritten<br />
und Vierten Welt.<br />
Die Entwicklungsländer drängen darauf, ihre Chance, billiger zu produzieren, auch zu nutzen...<br />
Besonders im Bereich der landwirtschaftlichen <strong>Pro</strong>dukte verhinderten Einfuhrzölle und andere Massnahmen<br />
der industrialisierten Ländern den Export gewisser <strong>Pro</strong>dukte aus den Entwicklungsländern.<br />
Unter der Kernaussage "Entwicklungshilfe wird unterschiedlich beurteilt." führt der Autor die folgenden<br />
Thesen auf (S. 117):<br />
- Entwicklungshilfe dient der Ausbeutung der Entwicklungsländer.<br />
- Entwicklungshilfe ist Verschwendung und schadet uns.<br />
- Entwicklungshilfe ist gut und notwendig.<br />
Die weiteren Seiten des dritten Bandes enthalten keine Themen mehr, welche für die Fragestellung der Arbeit<br />
von besonderem Interesse wären.<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 291
4.23.4 Zusammenfassung<br />
Das Lehrmittel bemüht sich, einen Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dabei auch<br />
Einheimische zu Wort kommen zu lassen. Nach wie vor werden aber belastete Begriffe wie "Stamm" und<br />
"Eingeborene" verwendet. Durch die Konzentration auf einige wenige Schwerpunkte fallen andere Gegenden<br />
und Länder dem Vergessen heim.<br />
Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 292
4.24 Geographie thematisch (1977-1980)<br />
...Äthiopien: 20 Hütten um einen staubigen Platz mitten in der Wüste. Tiere gibt es nicht mehr. Nur die Menschen halten<br />
noch aus, leben erbärmlicher als die Tiere, sterben am Hunger: "37 waren es in den letzten zwei Wochen", sagt der<br />
Dorfälteste aber jetzt geht es schneller. Wir haben die letzte Ziege geschlachtet." Männer und Frauen sind in Lumpen<br />
gehüllte Skelette, die Bäuche der Kinder sind aufgequollen durch Eiweiss- und Vitaminmangel. (Bd. 2, S. 17)<br />
Das im Zeitraum 1977-1980 erschienene Lehrmittel "Geographie thematisch" für die Klassen 5 bis 10,<br />
beschäftigt sich auf rund 40 der insgesamt 552 Seiten mit Themen zu Afrika. Das drei Bände umfassende<br />
Lehrmittel enthält neben dem Haupttext zahlreiche Grafiken, Fotos und kurze Aufgabenstellungen zu den<br />
einzelnen Themen.<br />
4.24.1 Band 1<br />
Der erste Band für die Klassen 5 und 6 enthält im Teil "Das Leben in fremden Ländern" (S. 135-160) zwei<br />
Fotos "Dorf am Kilimandscharo, Afrika" und "Dorf in Nordnigeria, Afrika" auf der Seite 139, ein Foto<br />
"Fischersiedlung im Nigerdelta mit Kokospalmen und Bananenstauden" auf der Seite 141, sowie die Kapitel<br />
"Menschen im tropischen Regenwald" (S. 144), "Kakao aus Westafrika" (S. 145), "In einem Wildpark in<br />
Südafrika" (S. 148-149) und "Fahrt durch die Wüste" (S.150-153).<br />
Im Kapitel "Menschen im tropischen Regenwald" schreibt der Autor auf der Seite 144, die auch ein Foto eines<br />
Brandrodungsfeldes und zwei Grafiken "Alte Siedlung" und "Neue Siedlung" zeigt:<br />
Die ursprünglichen Bewohner des Regenwaldes in Afrika sind die Pygmäen. Sie werden nur 1,40 m gross. Ihre Haut ist<br />
nicht schwarz, sondern kupferfarben.<br />
Kleinere Tiere erlegen sie geschickt mit vergifteten Pfeilen, grössere werden in Fallgruben gefangen. Bleibt der Jagderfolg<br />
aus, so ernähren sie sich von allem, was an Früchten, Wurzeln, Samen, Insekten und Weichtieren gesammelt werden kann.<br />
Die Pygmäen sind Jäger und Sammler. Sie bauen keine festen Behausungen; ein Regenschutz aus grossen Blättern, die<br />
über biegsame Stöcke gedeckt werden, genügt ihnen.<br />
Dieser Text entspricht einer gekürzten Fassung des schon in "Seydlitz für Realschulen" (Bd. 3, S. 38, 1968)<br />
abgedruckten Textes. (Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 240 und 339 dieser Arbeit.) Auch der folgende<br />
Text lehnt sich stark an das genannte Lehrmittel an und wiederholt die gleichen Aussagen wie sie schon rund<br />
zehn Jahre früher Eingang in den Unterricht gefunden haben:<br />
Im Urwald leben auch Negerstämme, die kleine Waldstücke roden und dort Siedlungen und Felder anlegen. Sie kerben<br />
zunächst die Rinde einiger Bäume ringsum ein, so dass sie absterben, und gehen dann mit Hackmesser und Feuer gegen<br />
das Buschwerk vor (Brandrodung). Zwischen den stehengebliebenen Baumstümpfen pflanzen die Frauen mit dem<br />
Grabstock, dessen unteres Ende spatenartig verbreitert ist, Bananen und Maniok. Die Maniokstaude wird 2 m hoch. Aus<br />
ihren Wurzelknollen, die gross wie ein Kürbis werden können, gewinnt man Stärkemehl.<br />
(Zur Maniokpflanze siehe auch die Seiten 286 und 295 dieser Arbeit.)<br />
Der Boden wird nicht gedüngt und ist daher schon nach wenigen Jahren erschöpft. Dann muss ein neues Stück gerodet<br />
werden, während der Urwald die alte Fläche rasch wieder überwuchert.<br />
Dieser kurze Text muss als Einführung in die Lebensweise der "Menschen im tropischen Regenwald" genügen.<br />
Das Thema Brandrodung wird allerdings im Band 2 noch einmal aufgegriffen. Im ebenso knappen Kapitel<br />
"Kakao aus Westafrika" schreibt der Autor auf der Seite 145:<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
Ein Beispiel für die planmässige Nutzung des tropischen Regenwaldgebietes ist der Anbau des Kakaobaumes. Er ist nicht<br />
in Afrika heimisch, sondern stammt aus dem tropischen Südamerika. Der bis zu 15 m hohe Kakaobaum gedeiht nur im<br />
feuchtheissen Tropenklima bis zu 700 m Meereshöhe. Da er gegen Sonne und starken Wind sehr empfindlich ist, muss<br />
man ihn zwischen Schattenbäumen (Bananenstauden oder Ölpalmen) pflanzen. Diesen planmässigen Anbau auf grossen<br />
Flächen nennt man Plantagenbau.<br />
Wenn die Früchte reif sind, werden sie mit dem Messer abgeschlagen und zu einer Sammelstelle gebracht. Dort zerschlägt<br />
man sie und löst die Bohnen aus dem roten Fruchtfleisch. Rohe Kakaobohnen schmecken bitter; deshalb lässt man sie,<br />
bedeckt mit Bananenblättern, 2 bis 10 Tage gären. Anschliessend werden die Bohnen gewaschen und getrocknet.<br />
Der getrocknete Rohkakao wird in die Verbraucherländer ausgeführt und dort weiterverarbeitet. Die Bohnen werden<br />
geröstet, von der Schale befreit und gemahlen.<br />
Im ersten Satz wird bereits wird klar, was der Autor von der traditionellen Bebauungsweise der Einheimischen<br />
hält, sonst würde er den Kakaoanbau (siehe dazu auch die Seiten 291 und 342 dieser Arbeit) wohl kaum als<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 293
"planmässig" bezeichnen. Als ob die Brandrodungsfelder völlig planlos und ohne jegliche Absicht angelegt<br />
worden wären. Neben dem Text enthält die Seite 45 eine Tabelle "Kakaoernte 1974" (siehe dazu auch die<br />
Seite 552 im Anhang dieser Arbeit) und zwei Fotos, von denen das eine einen Bauern neben einen Kakao-<br />
baum, das andere Menschen, welche die in Säcken gefüllte Kakaobohnen in einer Schale auf ihrem Kopf<br />
tragen, zeigt. Die gleichen Fotos wurden auch schon im Lehrmittel "Seydlitz für Realschulen" von 1968 (Bd.<br />
3, S. 41) abgebildet.<br />
Das Kapitel "In einem Wildpark in Südafrika", das mit zwei Seiten Umfang (S. 148-149) mehr Text bietet als<br />
die beiden bereits besprochenen Kapitel, kommt nur am Rande auf der Seite 149, im Zusammenhang mit den<br />
Aufgaben der Wildhüter, auf die einheimischen Menschen zu sprechen:<br />
...Aber das Betäubungsmittel wirkte, ehe die schwarzen Boys das Tier in den Schutz der wilden Feigenbäume ziehen<br />
konnten... Wir warteten, die Spritze wirkte, die Boys bekamen das Zebra schliesslich hoch, trieben es in den Schatten der<br />
Feigenbäume...<br />
Wie schon im Geographiebuch "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder" von 1953 im Text "Im<br />
Land der Löwen" (siehe dazu die Seite 114 dieser Arbeit), erfahren die Leser nur, dass die Einheimischen den<br />
an der Natur interessierten Weissen als "Boys", d.h. Jungen für alles, zur Hand gehen dürfen.<br />
Auch das letzte Kapitel im Band 1 "Fahrt durch die Wüste" auf den Seiten 150-153 liefert nur wenig Wissen<br />
über die schwarzafrikanische Bevölkerung. Unter der Überschrift "Oasen" auf der Seite 152 heisst es:<br />
...Die Oasen sind Treffpunkt der Karawanen aus allen Himmelsrichtungen, End- oder Kreuzungspunkte von Autopisten<br />
und daher Handelsplätze. Wie seit Jahrhunderten finden hier Tauschgeschäfte zwischen den Beduinen aus der Wüste und<br />
den Negern aus dem Süden statt...<br />
Mit diesen spärlichen Informationen zu den schwarzafrikanischen Menschen müssen sich der Schüler während<br />
der 5. und 6. Klasse begnügen.<br />
4.24.2 Band 2<br />
Der mit 200 Seiten umfangreichste Band 2 für die Klassen 7 und 8 beschäftigt sich in den sechs Kapiteln<br />
"Brandrodung in West- und Zentralafrika" (S. 14-16), "Regen- und Trockenzeiten im Sudan" (S. 17-18),<br />
"Höhenstufen in den Tropen" (S.28-29), "Wasser in der Sahara" (S. 32-35), "Die Niloase" (S. 37-41) und<br />
"Nigeria - <strong>Pro</strong>bleme eines Vielvölkerstaates" (S. 182-185) mit Afrika zugeordneten Themen.<br />
4.24.2.1 Brandrodung<br />
Im dreiseitigen Kapitel "Brandrodung in West- und Zentralafrika" schreibt der Autor auf der Seite 14:<br />
Der afrikanische Regenwald ist - wenn man von den Pygmäen des Kongogebietes absieht - nicht die ursprüngliche Heimat<br />
der heute dort lebenden Bevölkerung. Stämme aus den offenen Landschaften ausserhalb der immerfeuchten Tropen<br />
drangen vor mehreren hundert Jahren in den Regenwald ein. Sie brachten Kenntnisse über Brandrodung und Ackerbau mit<br />
und entwickelten im Regenwald eine Form der Bodennutzung, die sich von unserem Ackerbau wesentlich unterscheidet.<br />
Im Gegensatz zu einigen älteren Lehrmitteln macht der Autor darauf aufmerksam, dass sich die Bodennutzung<br />
im tropischen Regenwald vom europäischen Ackerbau "wesentlich unterscheidet" und damit nur bedingt ver-<br />
glichen werden kann.<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
Zwei Fotos auf der gleichen Seite zeigen ein Feld nach der Brandrodung und ein bebautes Feld. Seite 15 zeigt<br />
die Fotos einer Siedlung und noch einmal ein gerodetes Feld. Im Text schreibt der Autor (S. 15):<br />
Afrikanische Bauern kultivieren nur kleine, meist unregelmässig begrenzte Flächen. Sträucher und kleinere Bäume schlägt<br />
man mit Buschmesser und Axt; grosse Bäume werden geringelt und gehen ein. Nachdem das Holz dürr geworden ist, wird<br />
es verbrannt (Brandrodung). Der Boden bleibt im wesentlichen so erhalten, wie er sich unter dem dichten Kronenschirm<br />
des Regenwaldes entwickelt hat; ausserdem ist er durch die Holzasche gedüngt. Das gerodete Gebiet wird in<br />
unregelmässige Parzellen eingeteilt, auf denen die verschiedensten Früchte, meist in Mischkultur und in bestimmten<br />
Fruchtfolgen, angebaut werden: Mais wird oft mit Maniok, Taro, Bataten und Mehlbananen kombiniert. Wenn der Mais<br />
fast reif ist, werden die Mehlbananen gepflanzt; Erdnüsse und Zwiebeln folgen nach der Ernte von Taro und Mehlbananen.<br />
An anderer Stelle werden Tomaten, Auberginen und Pfeffer zwischen Yamspflanzen ausgesät.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 294
Beim Brandrodungsfeldbau wird der Boden nur an den Stellen aufgehackt, an denen gepflanzt oder gesät werden soll;<br />
sonst bleibt er unberührt. Dieser Hackbau hat sich für die Erhaltung des Humus als günstig erwiesen. Dennoch dauert die<br />
landwirtschaftliche Nutzung einer Brandrodungsfläche nur wenige Jahre, weil die Ernteerträge zunehmend sinken und die<br />
Unkrautbekämpfung immer schwieriger wird. Der Bauer gibt daher nach einigen Jahren die Fläche auf und rodet neuen<br />
Wald. Wird im Laufe der Zeit die Entfernung zwischen Feld und Wohnstätte zu gross, dann verlegt man auch die Siedlung<br />
(Wanderhackbau).<br />
Der Autor gibt hier eine detaillierte Schilderung, bei der auch die verschiedenen angebauten Pflanzen nicht<br />
vergessen gehen, welche die Besonderheiten des Wanderfeldbaus erläutert. (Zum Wanderhackbau siehe auch<br />
die Seiten 263 und 327 dieser Arbeit.)<br />
Seite 16 zeigt die Fotos "Auf einer Kaffeeplantage - Die Pflanzen wachsen unter Schirmbäumen" und<br />
"Ananas- und Bananenplantage". Im Text fährt der Autor mit der Beschreibung des Wanderhackbaus fort:<br />
Die verlassenen Wirtschaftsflächen werden schnell vom Wald zurückerobert. Dieser nachwachsende Wald (Sekundärwald)<br />
erreicht jedoch nur sehr langsam wieder die Üppigkeit und den Artenreichtum des ursprünglichen Waldes (Primärwald).<br />
Eine starke Ausweitung des Brandrodungshackbaus setzte ein, als die afrikanischen Regenwaldgebiete unter die<br />
Kolonialherrschaft der Europäer kamen. Durch Beendigung von Stammesfehden und später durch die Verbesserung der<br />
Gesundheitsfürsorge begann die Bevölkerung zu wachsen. So kam es, dass die Primärwaldfläche immer kleiner wurde und<br />
dass man bald auch Sekundärwälder roden musste.<br />
Die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, die aber in vielen Gebieten nach wie vor rudimentär ist, wirkt<br />
sich vor allem auf die Säuglingssterblichkeit aus, während die Lebenserwartung für ältere Personen nur<br />
vergleichsweise wenig ansteigt.<br />
Heute wird in manchen Gebieten dieselbe Fläche in Abständen von 15 bis 6 Jahren gerodet, gebrannt und für wenige Jahre<br />
bestellt. In einer so kurzen Zeitspanne kann natürlich kein Wald wieder entstehen; nur noch Buschwerk kommt hoch. Die<br />
Zeit von der letzten Ernte bis zur nächsten Rodung bezeichnet man als Buschbrache. Während der Buschbrache gewinnt<br />
der Boden wieder an Fruchtbarkeit. Es sind aber mindestens 16 Jahre erforderlich, bevor der Boden erneut 4 Jahre lang<br />
bestellt werden kann.<br />
Eine Lösung für dieses <strong>Pro</strong>blem will die Agroforstwirtschaft bieten. (Siehe dazu die Seiten 424f. dieser<br />
Arbeit.)<br />
Neben dem vorherrschenden Brandrodungshackbau haben einige Stämme ein besonderes Verfahren der Bodennutzung<br />
entwickelt: Nur das Unterholz und die kleinen Bäume werden geschlagen, aber nicht verbrannt. Sie bleiben an Ort und<br />
Stelle liegen. Zusätzlich bedeckt man den Boden mit Sträuchern und Kräutern, die aus den angrenzenden Wäldern<br />
herbeigeschafft werden. Nach mehreren Monaten ist das Material von Termiten, Pilzen, Bakterien und anderen Lebewesen<br />
grossenteils gefressen und zersetzt. Der Boden ist gedüngt und kann bestellt werden. Die Felder brauchen nicht verlegt zu<br />
werden.<br />
Über die Versuche der Europäer, eine ihnen vertraute Landwirtschaft aufzubauen, schreibt der Autor:<br />
Im Kongo-Gebiet haben die Europäer vor dreissig Jahren Versuche gemacht, den Boden nach mitteleuropäischem Muster<br />
durch Pflügen zu bearbeiten und grosse Kulturen anzulegen. Diese Versuche schlugen fehl. Nach etwa 10 Anbaujahren<br />
waren die Erträge auf 1/3 bis 1/6 der ursprünglichen Menge gesunken, und die Wurzelfäule beim Maniok war um mehr als<br />
das Fünffache gestiegen.<br />
(Zur Maniokpflanze siehe auch die Seiten 293 und 423 dieser Arbeit.) Im letzten Abschnitt des Textes gibt der<br />
Autor einige der Gründe an, weshalb beispielsweise Kakao zu einem beliebten Anbauprodukt wurde, obwohl<br />
die Pflege der Kulturen und die Verarbeitung der Ernte sehr zeitintensiv sind.<br />
Günstige Wirkungen auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit haben längerlebige Holzgewächse, wie sie in Plantagen<br />
angebaut werden: Kakao, Kaffee, Hevea sowie Öl- und Kokospalmen, ebenfalls Bananenstauden.<br />
So bedeutsam die Plantagen für die Exportwirtschaft der jeweiligen Länder auch sind, so spielen sie für die Ernährung der<br />
schnellwachsenden einheimischen Bevölkerung kaum eine Rolle.<br />
Der Ernährung dienen nach wie vor Pflanzen wie Maniok, verschiedene Bananensorten, Okra und andere in<br />
diesen Gebieten angebaute Pflanzen.<br />
4.24.2.2 Die Savanne<br />
Im Kapitel "Regenzeiten im Sudan" gibt der Autor auf der Seite 17 einleitend einige Zeitungsberichte wieder.<br />
Ein erster Artikel beschreibt die Folgen der Dürre auf die Vegetation, welche die Grundlage der weitflächig<br />
betriebenen Weidewirtschaft bildet. Aus einem Artikel der "Westdeutschen Zeitung" vom Oktober 1973 zitiert<br />
er, die damaligen Ereignisse im Gebiet des Nigers beschreibend:<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
Auf der Suche nach neuem Weideland begann vor Monaten der grosse Treck. Allein im Niger brachen über 80'000<br />
Menschen mit ihren Herden auf, um weiter südwärts in den Nachbarstaaten Nigeria und Dahomey neue Nahrung für ihre<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 295
Viehherden zu suchen. Doch die meisten von ihnen zogen vergeblich: sie erreichten kein neues Weideland, ihr Vieh<br />
verendete unterwegs. Die Menschen leben jetzt in einem Flüchtlingslager am Rande von Niamey.<br />
Mohammed Abdou erzählt, dass die Familie früher im Durchschnitt 10 Kamele, 25 Rinder und 250 Schafe und Ziegen<br />
besass. Nichts von diesem stolzen Besitz ist geblieben. Auf dem wochenlangen Hungermarsch, über 100 km und mehr,<br />
verendete nicht nur das Vieh, auch 15 Mitglieder seiner Grossfamilie starben unterwegs.<br />
Solche Berichte schreckten die Menschen in Europa auf. In den Lehrmitteln sollten diese "Dürrekatastrophen"<br />
zu einem festen Thema werden. Aus einem Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" vom März 1973 zitiert der<br />
Autor über das Gebiet des Tschad (S. 17):<br />
Millionen von Menschen, die im südlichen Saharagürtel zwischen Tschad in Zentralafrika und Mauretanien an der<br />
Westküste leben, droht durch die gewaltige Dürrekatastrophe eine grosse Hungersnot.<br />
Selbst wenn die Regenzeit - gewöhnlich zwischen Mai und September - die ersehnten Niederschläge bringt, stehen<br />
bestenfalls erst nach der nächsten Ernte wieder ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung. Am schwersten betroffen sind<br />
die vielen Kleinbauern, die rund 80% der Bevölkerung der heimgesuchten Staaten ausmachen. Sie leben zumeist weitab<br />
von grösseren Siedlungen und bewirtschaften ein kleines Stück Land, das in den Dürrejahren nicht mehr die Existenz der<br />
Familie sichert.<br />
In einem letzten wiedergegebenen Ausschnitt eines Zeitungsartikels aus "Die Zeit" vom November 1973 heisst<br />
es:<br />
Arabati ist ein Dorf in Äthiopien: 20 Hütten um einen staubigen Platz mitten in der Wüste. Tiere gibt es nicht mehr. Nur die<br />
Menschen halten noch aus, leben erbärmlicher als die Tiere, sterben am Hunger: "37 waren es in den letzten zwei<br />
Wochen", sagt der Dorfälteste aber jetzt geht es schneller. Wir haben die letzte Ziege geschlachtet." Männer und Frauen<br />
sind in Lumpen gehüllte Skelette, die Bäuche der Kinder sind aufgequollen durch Eiweiss- und Vitaminmangel.<br />
(Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 266 und 311, zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas die Seiten 286 und 298<br />
dieser Arbeit.)<br />
Auf der Seite 22 und 23 im Kapitel "Wirtschaftsformen in der Savanne" beschreibt der Autor die verschiede-<br />
nen Ausprägungen der Savanne (S. 22):<br />
Die Waldgebiete der wechselfeuchten Tropen sind in Afrika schon sehr lange von Menschen besiedelt. Durch<br />
Brandrodung ist der natürliche Waldbestand weitgehend zerstört, teils in eine Buschvegetation, teils zu einer offenen,<br />
parkähnlichen Landschaft und in reines Kulturland umgestaltet worden.<br />
Die Feuchtsavanne bietet trotz weitgehender Waldzerstörung und moderner Schädlingsbekämpfungsmittel noch immer<br />
Lebensraum für die Tsetsefliege. Wegen der von ihr übertragenen Tierkrankheit (Nagana) und anderer Viehseuchen<br />
können hier keine Rinder und kaum anderes Grossvieh gehalten werden.<br />
Die Bauern betreiben seit alters her Hackbau als Regenfeldbau, bei dem sich Feldarbeit, Aussaat und Ernte ganz nach dem<br />
Jahresverlauf der Regen- und Trockenzeiten richten. Die Felder müssen ebenso wie in der äquatorialen Regenzone<br />
regelmässig verlegt werden, weil die Erträge schon nach wenigen Jahren stark zurückgehen.<br />
Die Trockensavanne ist frei von der Tsetsefliege. Hier kann der Bauer Grossvieh halten und auch Zugtiere für die<br />
Bodenbearbeitung einsetzen. Die baumarme Trockensavanne ist ebenfalls alter Kulturraum, in dem Regenfeldbau und<br />
Viehhaltung um die Nutzflächen konkurrieren.<br />
Regenfeldbau ist hier noch bei etwa 300-400 mm Niederschlag im Jahr möglich, aber schon sehr unsicher, da die<br />
Regenmengen stark schwanken und die Verdunstung sehr gross ist. Trotzdem versuchen viele Bauern immer wieder, auch<br />
jenseits der klimatischen Trockengrenze unter grossem Ernterisiko noch Regenfeldbau zu betreiben. Zur Sicherung von<br />
hohen und möglichst mehreren Ernten im Jahr wird heute der Ausbau des Bewässerungsfeldbaus gefördert, der z.B. am<br />
Nigerknie mit Reiskultur schon eine längere Tradition hat. In neuerer Zeit wurden in die bäuerliche<br />
Selbstversorgungs-Wirtschaft auch Verkaufsprodukte wie Baumwolle und Erdnuss aufgenommen, die aber hauptsächlich<br />
für den Export angebaut werden.<br />
Seite 22 zeigt ausserdem noch ein Foto "Bewässerungsfeldbau bei Timbuktu". Seite 23 zeigt ein Karte Westaf-<br />
rikas zu den Vegetationszonen und Anbaugebieten und ein Foto, auf dem westafrikanische Rinder abgebildet<br />
sind. Im Text fährt der Autor fort (S. 23):<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
Wichtigster Wirtschaftszweig der Trockensavanne ist die Viehhaltung. In den natürlichen tropischen Grasländern, die<br />
ursprünglich allgemein von Wildherden grösserer Lauftiere bewohnt waren, hat sich besonders im nördlichen Afrika eine<br />
traditionsreiche Viehwirtschaft entwickelt.<br />
Bei den alten Hirtenvölkern der Trockensavanne ist die Viehwirtschaft mehr als nur Nutzviehhaltung. Die seit<br />
Generationen mit der gesamten Lebens- und Wirtschaftsweise verknüpfte Viehhaltung unterliegt besonderen<br />
Wertvorstellungen: Vieh wird nicht allein gehalten zur <strong>Pro</strong>duktion von Fleisch, Milch und Häuten, Der Besitz von Vieh<br />
bedeutet Ansehen, Würde und Einfluss im Zusammenleben der Menschen. Eine Viehherde bedeutet Reichtum und<br />
Sicherheit für die ganze Familie.<br />
Die Trockensavanne ernährt riesige Viehherden: Allein in Nigeria gibt es etwa 11 Mill. Rinder, vorwiegend im tsetsefreien<br />
Norden. Jährlich werden davon etwa 1 Mill. Schlachttiere auf alten Viehtriebwagen zu den Marktgebieten des Südens<br />
getrieben, z.B. die Nigerbrücke in Jebba passieren jährlich 200'000 Rinder.<br />
Nach dem Bericht "FAO Statistics Division and FAO <strong>Pro</strong>duction Yearbook 1991" der UN-Organisation für<br />
Food and Agriculture, betrug das Schlachtvolumen, der im Inland geschlachteten Rinder und Kälber<br />
288'000 Tonnen bei einer Viehzahl von 14.5 Mio. Weitere Länder Schwarzafrikas mit einem grossen Volumen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 296
waren Südafrika (678'000 t), Kenia (326'000 t), Äthiopien (245'000 t) und der Sudan (231'000 t). Die Schweiz<br />
erzielte im Vergleich ein Volumen von 172'000 Tonnen, bei einem Viehbestand von 1.8 Mio. (Weltatlas,<br />
1993) Dieser Vergleich zeigt, dass obwohl der Autor den Eindruck einer gewaltigen Menge von Rindern<br />
vermittelt, die Zahl für Nigeria im Verhältnis zur Bevölkerung doch relativ bescheiden ausfällt, und die Nige-<br />
rianer mit aus den obigen Angaben berechneten 3.2 kg Rindfleisch pro Kopf und Jahr einen weit geringeren<br />
Konsum an Rindfleisch aufweisen als die Schweiz mit 25 kg pro Kopf und Jahr.<br />
In einer Aufgabenstellung weist der Autor den Schüler an:<br />
In der nordafrikanischen Trockensavanne hat es lange vor der Kolonialzeit grosse Reiche und hohe Kulturen gegeben.<br />
Sammelt Material über die alten Kulturen und Städte in der Savannen.<br />
Die dürfte eine eher schwierig zu lösende Aufgabe gewesen sein, denn selbst beim heutigen Wissensstand<br />
enthält die durchschnittliche Bibliothek, von Zeitungen usw. ganz zu schweigen, wenig leicht auffindbares<br />
Material zu diesem Thema.<br />
4.24.2.3 Kilimandscharo<br />
Im Kapitel "Höhenstufen in den Tropen" auf den Seiten 28-29 gibt der Autor den Bericht eines Touristen unter<br />
der Überschrift "Die Besteigung des Kilimandscharo" wieder, in dem es über die Einheimischen heisst (S. 28):<br />
"Als Tourist beginnt man heute die Safari auf den höchsten Berg Afrikas von Marangu auf der Südostseite aus. Diese<br />
Siedlung des Bantustammes der Dschagga zieht sich ungefähr bis 2000 m den Berg hinauf. Mitten zwischen den in<br />
Bananen- und Kaffeepflanzungen versteckten Eingeborenenhütten liegt in einem sehr angenehmen Klima das<br />
Kibo-Hotel... Unter der winterlichen Sonne eines schönen Augustmorgens zog unsere kleine Karawane aus. Die Träger<br />
hatten ihre Wachstuchsäcke mit unserem <strong>Pro</strong>viant auf dem Kopf und einer die Sturmlaterne in der Hand. Etwas unter 2'000<br />
m erreichten wir den Wald und damit die letzten Felder der Dorfbewohner...<br />
Was der Autor genau unter der "winterlichen Sonne" meint, wird nicht klar, da es im Gebiet des Kilimand-<br />
scharo, der nahe am Äquator liegt, wenig Sinn macht, auf die Jahreszeiten der gemässigten Zonen<br />
zurückzugreifen.<br />
Der weitere Bericht enthält keine nennenswerten Informationen über die einheimische Bevölkerung mehr,<br />
sondern beschränkt sich darauf, die Mühen des Aufstieges zu schildern. Ein Foto auf der Seite 28 bildet<br />
ausserdem noch drei Träger beim Aufstieg ab.<br />
4.24.2.4 Nigeria<br />
Im letzten Kapitel des Bandes 2 "Nigeria- <strong>Pro</strong>bleme eines Vielvölkerstaates" auf den Seiten 182-185, unter-<br />
stützt der Autor seinen Text durch zahlreiche statistische Angaben und Karten.<br />
Seite 182 zeigt eine Tabelle "Wichtige Exportgüter 1974" in der Kakao, Erdnüsse, Palmnüsse, Baumwolle,<br />
Kautschuk, Erdnussöl, Palmkernöl und Erdöl aufgeführt werden. Eine Reihe von Kreisgrafiken für die Exporte<br />
von 1900, 1960, 1970 und 1974 zeigt die Verlagerung der Exporte hin zum Erdöl, dessen Exporte 1960 noch<br />
von vergleichsweiser geringer Bedeutung waren, 1974 aber bereits über 90% der Exporte ausmachten. Im Text<br />
schreibt der Autor zur Geschichte Nigerias (S. 182):<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
Im Jahre 1879 gründete der englische Kaufmann Sir George Goldie im Niger-Gebiet die Handelsgesellschaft United Africa<br />
Company. Dieses Unternehmen betrachtete beide Ufer des Niger als ihr Eigentum und verhinderte dadurch die Ansiedlung<br />
anderer Firmen. Das von Stammeshäuptlingen vertraglich der UAC übereignete Gebiet wurde 1886 durch einen Erlass der<br />
englischen Königin von der jetzt in Royal Niger Company umbenannten Gesellschaft auch politisch verwaltet. So entstand<br />
zu Beginn dieses Jahrhunderts durch wirtschaftlichen und militärischen Druck Englands "The Colony and <strong>Pro</strong>tectorate of<br />
Nigeria".<br />
Als die Engländer am Ende des vorigen Jahrhunderts begannen, Einfluss auf das Gebiet des heutigen Nigeria zu nehmen,<br />
fanden sie zum Teil entwickelte Regierungs- und Verwaltungsformen der einheimischen Bevölkerung vor: Im Norden die<br />
mohammedanischen Emirate der Haussa und Fulbe; im Süden die Häuptlingsgebiete des Yoruba-Volkes. Die britische<br />
Kolonialmacht nutzte das Ansehen dieser eingeborenen Herrscher und liess sie die regionale Verwaltung ausführen. Dieses<br />
Prinzip einer englischen Oberherrschaft und der regionalen Verwaltung durch einheimische Führer wurde "indirect rule"<br />
genannt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 297
Auf den Seiten 182 und 183 beschreibt der Autor die "bedeutenden Völker Nigerias":<br />
Die Haussa sind Hirten und Händler, die sich seit dem 13. Jahrhundert zum Islam bekennen. Von den städtischen<br />
Siedlungen im Norden des heutigen Nigeria regierten seit altersher mohammedanische Haussa-Emire dieses Volk. Im 15.<br />
Jahrhundert wanderte das Hirtenvolk der Fulbe in den Lebensraum der Haussa ein. Auch sie bekannten sich zum Islam.<br />
Beide Völker vermischten sich derart, dass eine rassische Trennung heute fast unmöglich ist. Ihre Familienstruktur und ihre<br />
Rechtsprechung sind den Glaubensvorstellungen des Islam entnommen.<br />
Die Yoruba sind das städtebildende Volk in Afrika. Das Yoruba-Land wird in Oberhäuptlings- und Unterhäuptlingsgebiete<br />
eingeteilt, die jeweils von einer städtischen Siedlung aus regiert werden. Die Yoruba leben in Grossfamilien zusammen, die<br />
bis zu fünf Generationen umfassen können. Die Eheschliessung führt auch nicht zu einer eigenständigen Familie, sondern<br />
die Frau heiratet in eine bestehende Grossfamilie ein, um den Fortbestand dieser Sippe zu sichern. Mehrere solcher<br />
Grossfamilien siedeln um einen gemeinsamen Innenhof. Eine derartige Siedlung beherbergt bis zu 500 Bewohner. Das<br />
älteste männliche Mitglied dieser Siedlungsgemeinschaft wird als Oberhaupt anerkannt. Auf diese Weise entstanden<br />
Keimzellen für städtische Siedlungen. Die Yoruba, die nicht von Missionaren zum Christentum bekehrt wurden, glauben<br />
an einen Schöpfer des Himmels und der Erde und an etwa 400 niedere Gottheiten und Geister.<br />
Die Ibos wohnen vor allem in lockeren dörflichen Gemeinschaften einander verwandter Familien. Jede Familie untersteht<br />
der Führung des ältesten männlichen Mitgliedes. Diesen Gemeinschaften übergeordnete Herrscher sind bei den Ibos nicht<br />
üblich. Gegenüber europäischem Kulturgut waren sie nur selten verschlossen, so dass dort Missionsschulen das<br />
Christentum schnell verbreiteten. Die nicht bekehrten Ibos glauben an einen obersten Gott, der dem Menschen die Seele<br />
eingibt, und der für Regen und Fruchtbarkeit sorgt. Andere Götter werden mit Sonne, Himmel, Blitz und Unterwelt in<br />
Zusammenhang gebracht.<br />
(Zu der Darstellung der Religionen siehe auch den Themenkreis "Religion" im Teil "Vorwürfe an das von der<br />
Schule vermittelte Bild" ab der Seite 83 dieser Arbeit.) Auf der Seite 183 finden sich auch zwei Fotos, von<br />
denen das eine Frauen beim Waschen, das andere eine Marktszene zeigt. Seite 184 bildet vier Karten ab: eine<br />
zur historischen Situation seit 1861; eine zu den Bevölkerungsgruppen, wobei Mande, Hausa, Fulbe, Songhai,<br />
Kanuri, Kwa-Völker, Gur-Völker, Bantu, Araber und Berber, sowie zwei Sammelgruppen genannt werden;<br />
eine zu den Grenzen der Bundesstaaten, mit besonderer Hervorhebung des ehemaligen Sezessionsgebietes<br />
Biafra; und eine Karte der Industrie in Nigeria. In einer der Aufgabenstellungen zu diesen Karten schreibt der<br />
Autor S. 184):<br />
Da den christlichen Missionen in der Regel Schulen angeschlossen waren, kannst du anhand der Verteilung der<br />
Missionsstationen den unterschiedlichen Ausbildungsstand der nigerianischen Bevölkerung erklären: 1952 konnten in der<br />
Nordregion nur 2% der Einwohner lesen und schreiben, während in der Ost- und Westprovinz 17% der Bevölkerung<br />
Alphabeten waren.<br />
1995 betrug der Alphabetisierungsgrad in Nigeria 57%, wobei 67% der männlichen Bevölkerung und 47% der<br />
weiblichen Bevölkerung lesen konnten. Noch 1980 konnten nur 47% der männlichen und 23% der weiblichen<br />
Bevölkerung lesen. Trotz dieser Verbesserung erreichen nach wie vor nur 80% aller eingeschulten Kinder,<br />
wobei nach offiziellen Angaben alle Knaben aber nur 79% der Mädchen eingeschult werden, die 5. Klasse. In<br />
die Oberstufe schafft es nur gerade ein Drittel aller Kinder. (UNICEF 1998, S. 108; siehe zu den die Schule<br />
verlassenden Kinder auch die Seiten 269 und 312 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
Seite 185 gibt unter der Überschrift "Daten aus der jüngsten Geschichte Nigerias" folgende Ereignisse wieder:<br />
1946 Umwandlung der zentralen Kolonialherrschaft in eine bundesstaatliche Kolonialverwaltung bestehend aus<br />
einer Nord-, einer West- und einer Ostregion.<br />
1944-1951 Bildung von drei grossen politischen Parteien: National Council of Nigeria and the Camerons - NCNC (Ibos),<br />
Action Group-AG (Yoruba), Northern People's Congress-NPC (Haussa-Fulbe).<br />
1.10.1960 Unabhängigkeit Nigerias von der britischen Kolonialherrschaft.<br />
1963 Zerfall der Action Group und Abgliederung der Mid-West-Region von der West-Region als viertem<br />
Bundesstaat.<br />
1.10.1963 Gründung der Republik Nigeria. Balewa Premierminister (NPC), Azikiwe (NCNC) Präsident.<br />
15.1.1966 Militärputsch unter Ibo-General Ironsi. Ermordung des Premierministers Balewa. Ausserkraftsetzung der<br />
Bundesverfassung und Errichtung eines Einheitsstaates. Schwere Ausschreitungen gegen Angehörige des<br />
Ibo-Volkes in Kano und Jos.<br />
28.7.1966 Militärputsch unter General Gowon, einem Haussa. Wiederherstellung der alten Bundesverfassung. Weitere<br />
Massaker gegen Ibos in der Nordregion.<br />
27.5.1967 Neugliederung Nigerias in 12 Bundesstaaten<br />
30.5.1967 Der Militärgouverneur der Ostregion Ojukwe erklärt die Unabhängigkeit dieser <strong>Pro</strong>vinz vom nigerianischen<br />
Bundesstaat und gründet die Republik Biafra. Alle ausserhalb Biafras lebenden Ibos werden aufgerufen, in<br />
ihr Stammesgebiet der ehem. Ostregion zurückzukehren. Grausamer Bürgerkrieg in Nigeria.<br />
Wirtschaftsblockade der nigerianischen Bundesregierung gegen Biafra. Unbeschreibliche Hungersnöte in der<br />
ehemaligen Ostregion.<br />
(Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 296 und 311 dieser Arbeit.)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 298
12.12.1970 Sieg der Bundestruppen über Biafra. Ende des Bürgerkrieges. Ostregion wieder Bundesstaat der Republik<br />
Nigeria.<br />
3.2-1976 Neugliederung Nigerias in 19 Bundesstaaten.<br />
Der Autor verzichtet darauf, Bilder aus dem Biafra-Krieg wiederzugeben, welche der Welt die hungernden<br />
und sterbenden Kinder vorführten, die spätestens ab Mitte der siebziger Jahre zu einem Synonym für Hunger<br />
und Elend Afrikas werden sollten.<br />
Seite 185 zeigt auch einen Kreisgrafik zur Bevölkerungsverteilung, in der die folgenden Volksgruppen und ihr<br />
Anteil in <strong>Pro</strong>zenten der Gesamtbevölkerung angegeben werden: Hausa (20.8%), Yoruba (20.3%), Ibo (16.6%),<br />
Fulbe (8,6%), sowie vier weitere Gruppen mit einem Anteil von je mehr als 2% der Gesamtbevölkerung und<br />
sieben weiteren einzel aufgeführten Gruppen. Die restlichen Gruppen werden mit einem Anteil von 13.5%<br />
angegeben. (Zu Nigeria siehe auch die Seiten 275 und 335 dieser Arbeit.)<br />
4.24.3 Band 3<br />
Band 3 für die Klassen 9 und 10 beschäftigt sich im Kapitel "Tansania - ein Land der 'Vierten Welt'?" auf den<br />
Seiten 165-169 speziell mit Afrika. Eine weitere Erwähnung findet der Kontinent in einer Grafik zum "Hun-<br />
gergürtel" der Erde und auf einem Foto auf der Seite 189 mit der Bildlegende "Kind in Afrika, einseitige<br />
Ernährung".<br />
4.24.3.1 Tansania<br />
Der Autor leitet das Kapitel zu Tansania mit drei verschiedenen Textquellen und einem Vergleich zwischen<br />
dem BSP und dem Bevölkerungswachstum in Kenia und Tansania für 1960 und 1970 ein, wobei Kenia überall<br />
besser abschneidet als Tansania. Der erste Text beschreibt kurz die Entwicklungszusammenarbeit der Bundes-<br />
republik Deutschland mit Tansania. Im zweiten Text wird der damalige tansanische Präsident Nyerere mit<br />
einer Aussage von 1962 zum afrikanischen Sozialismus zitiert (S. 165):<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
"Eine der wirklich sozialistischen Errungenschaften unserer (traditionellen afrikanischen) Gesellschaft war das Gefühl der<br />
Sicherheit, das sie ihren Mitgliedern gab, und die allgemeine Gastfreundschaft, auf die sich jeder verlassen konnte.<br />
In den Stammesgesellschaften waren der Einzelne oder die Familie innerhalb des Stammes reich oder arm, je nachdem, ob<br />
der ganze Stamm reich oder arm war. Jeder konnte sich auf den Reichtum verlassen, den die Gemeinschaft, deren Mitglied<br />
er war, besass.<br />
In der traditionellen afrikanischen Gesellschaft war jeder ein Arbeiter. Es gab keine andere Möglichkeit, den<br />
Lebensunterhalt für die Gemeinschaft zu erwerben.<br />
Ein altes Suaheli-Sprichwort sagt: Deinen Gast behandle zwei Tage als Gast, am dritten Tag gib ihm eine Hacke!<br />
Wir müssen auf die traditionelle afrikanische Weise des Grundbesitzes zurückgreifen, nach der ein Mitglied der<br />
Gesellschaft einen Anspruch auf ein Stück Land nur unter der Bedingung erhält, dass er es nutzt.<br />
Die Grundlage und das Ziel des afrikanischen Sozialismus ist die Grossfamilie. Der wirkliche afrikanische Sozialist sieht<br />
nicht eine Klasse als seine Brüder an und eine andere als seine natürlichen Feinde, eher betrachtet er alle Menschen als<br />
seine Brüder. Genau darum heisst der erste Artikel des TANU--Bekenntnisses (auf Englisch): I believe in human<br />
brotherhood and in the unity of Africa.<br />
'Ujamaa' oder Familiengemeinsinn beschreibt dann unseren Sozialismus. Wir in Afrika haben ebensowenig Bedarf daran,<br />
zum Sozialismus bekehrt zu werden, wie über Demokratie belehrt zu werden. Beide haben ihre Wurzeln in unserer eigenen<br />
Vergangenheit - in der traditionellen Gesellschaft, aus der wir hervorgegangen sind.''<br />
(Siehe zu Ujamaa auch die Seiten 287 und 309 dieser Arbeit.) Der letzte Text gibt einen Ausschnitt aus einem<br />
Artikel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Mai 1980 wieder, in dem es heisst (S. 165):<br />
Auffallende Unterschiede in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung gibt es auch zwischen schwarzafrikanischen<br />
Ländern, die sich nach der Zahl ihrer Bevölkerung, nach Klima und Fläche, nach ihrer jüngeren Geschichte und ihrem<br />
kolonialen Hintergrund, nach vorhandenen oder fehlenden Bodenschätzen vergleichen lassen. Eines solcher Länderpaare<br />
ist Kenia/Tansania.<br />
Die ungleiche Entwicklung liegt daran, dass ausländische Investoren eher nach Kenia gingen als in das benachbarte<br />
Tansania und dass die einheimischen Farmer und Kaufleute in Kenia reinvestierten, statt, wie in Tansania, ihr Kapital aus<br />
dem Lande zu schaffen oder aufzuzehren. Der Grund dafür war und ist noch immer, dass sich Kenia für eine<br />
marktwirtschaftliche Ordnung entschieden hat, während Tansania eher einen sozialistischen Kurs steuert. Es ist sogar<br />
schwierig, Tansania Entwicklungshilfe zu geben; denn Tradition und heutige Weltanschauung setzen oft unerwartete<br />
Schranken.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 299
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 289 und 308 dieser Arbeit.) Auf der Seite 166 schreibt der Autor<br />
zur "Geschichte Tansanias":<br />
Tanganjika war 1885-1918 deutsches Schutzgebiet, stand danach unter britischer Verwaltung, wurde 1961 selbständig,<br />
1963 Republik.<br />
Sansibar und Pemba waren seit 1963 unabhängiges Sultanat im Commonwealth.<br />
1964 Föderation zwischen Tanganjika, Sansibar und Pemba unter dem neuen gemeinsamen Namen Tansania.<br />
Hauptstadt war die Hafenstadt Daressalam, heute ist es Dodoma im Landesinneren.<br />
Auf der Seite 166 ist eine Tabelle "Daten zur Vereinigten Republik Tansania" abgedruckt, die Angaben zu<br />
Fläche, Bevölkerung, medizinischen Versorgung und dem Bildungswesen macht. Seite 167 beschäftigt sich<br />
auf drei Karten "Ökologische Gliederung Tansanias", "Verteilung der Niederschläge" und "Eisenbahnen und<br />
Städte" mit der wirtschaftsgeographischen Grundlage Tansanias. In der Legende zur Karte "Ökologische Glie-<br />
derung" schreibt der Autor (leicht gekürzt wiedergegeben):<br />
Zone 1: Humides bis subhumides Klima<br />
a) Bergweiden und Grasländer oberhalb des Nebelwaldes in den Gipfelregionen der Bergriesen. Geringes<br />
Nutzungspotential, hohe Bedeutung für den Wasserhaushalt und evtl. für den Tourismus.<br />
b) Nebelwaldgürtel und Gebiete des tropischen Regenwaldes mit meist starker Umwandlung der natürlichen Vegetation in<br />
verschiedene Typen der Kultur- bzw. Savannenlandschaften.<br />
Nutzungspotential: Forstwirtschaft und intensive Landwirtschaft, in höheren Lagen insbesondere für Kaffee, Tee,<br />
Pyrethrum, Weizen und Kartoffeln, in mittleren und tieferen Lagen alle Kulturpflanzen Ostafrikas.<br />
Zone 2: Subhumides Klima...<br />
Nutzungspotential: auf guten Böden intensive Landwirtschaft, besonders mit Mais, Hirse, Baumwolle, Weizen und<br />
Cashew-Nüssen. Daneben ist Weidewirtschaft sehr bedeutend.<br />
Zone 3: Subhumides bis semiarides Klima...<br />
Nutzungspotential: keine Viehzucht möglich wegen starker Verseuchung durch die Tsetsefliege. Ackerbau ist nur<br />
bedingt möglich wegen ungünstiger Niederschlagsverhältnisse und mineralarmer Böden. Mais und Hirse werden für die<br />
Selbstversorgung angebaut, Erdnüsse, Tabak und Sisal für den Markt.<br />
Zone 4: Semiarides Klima...<br />
Optimale Nutzung nur durch Weidewirtschaft und wegen des Wildreichtums auch durch Fremdenverkehr.<br />
Zone 5: Arides Klima...<br />
Ackerbau ist noch lokal unter besonderen Bedingungen möglich, die Weidewirtschaft ist aufgrund von Wassermangel<br />
und einer nicht geschlossenen Grasdecke stark eingeschränkt... Eine wildwirtschaftliche Nutzung könnte eine günstige<br />
Alternative bzw. Ergänzung darstellen.<br />
Diese Aufteilung des Autor zeigt, wie sich die Bedingungen nur innerhalb eines einzigen Landes von einer<br />
Gegend zur anderen stark ändern können. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass viele Länder Afrikas<br />
wesentlich grösser sind als die Länder Europas und durch diese grösseren Flächen die Vielfältigkeit der Land-<br />
schaft nicht weiter erstaunen sollte.<br />
Auf der Seite 168 schreibt der Autor unter der Überschrift "Der Sisalanbau - Beispiel für Plantagenwirtschaft":<br />
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Tanganjika die aus Mexiko stammende Sisalagave zur Gewinnung von<br />
Naturfasern angebaut. Die Plantagenbetriebe verdrängten nur in sehr geringem Umfang bäuerlichen Anbau zur<br />
Selbstversorgung, da die Sisalagave bei bescheidenen Ansprüchen an Boden und Niederschlag vorwiegend in den fast<br />
ungenutzten Trockenräumen im Küstengebiet angebaut wurde.<br />
In den 50er Jahren erreichte der Anbau mengen- und flächenmässig die grösste Ausdehnung und im Jahr des<br />
Preishochstandes (1964) mit 230'000 t (297'000 t in ganz Ostafrika) die höchste <strong>Pro</strong>duktion. Der Preisverfall seit 1964 zog<br />
einen <strong>Pro</strong>duktionsrückgang auf 105'000 t im Jahr 1977 nach sich.<br />
Die Plantagenbetriebe versuchten, die geringeren Einnahmen durch Rationalisierung, insbesondere Mechanisierung,<br />
aufzufangen. Dabei verloren von 1962 bis 1968 allein 70'000 Arbeitskräfte (2/3 der 1962 Beschäftigten) ihren Arbeitsplatz<br />
im Sisalanbau.<br />
Nach Angaben des FAO-Berichtes "FAO Statistics and FAO <strong>Pro</strong>duction Yearbook 1991" gehörten Tansania<br />
mit einer Jahresproduktion von 40'000 Tonnen und Kenia mit einer <strong>Pro</strong>duktion von 39'000 Tonnen noch<br />
immer zu den grössen Sisalproduzenten der Welt. Daneben produzierten auch Madagaskar (21'000 t) und<br />
Südafrika (8'000 t), sowie die Länder Angola, Äthiopien, Guinea, Mosambik und die Zentralafrikanische<br />
Republik Sisal. (Zum Sisalanbau siehe auch die Seite 225 und 405, sowie die Tabelle "Sisalproduktion ausge-<br />
wählter Länder" im Anhang auf der Seite 553 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
Auf der gleichen Seite findet sich auch ein Foto "Strassenbild aus Maranju", das Menschen vor einem<br />
Handelshaus abbildet, und auf dem auch ein Traktor zu sehen ist. Ausserdem druckt die Seite eine Tabelle<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 300
"Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion" für den Zeitraum 1973-1976 ab, deren mengenmässig wichtigste <strong>Pro</strong>dukte<br />
hier wiedergegeben werden sollen:<br />
Tabelle: Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion (Tansania)<br />
(Auswahl aus der gleichnamigen Tabelle aus "Geographie thematisch" Bd. 3, S. 168)<br />
in (1000 t) 1973 1974 1975 1976<br />
Maniok 3'350 5'425 6'000 5'100<br />
Hirse, Sorghum 419 324 440 390<br />
Mais 603 1'446 825 897<br />
Reis 204 293 150 172<br />
Zuckerrohr 1'295 1'311 1'260 1'185<br />
Die Seite 169 bildet das Foto "Beispiel für Kleingewerbe" und die Graphik "Kokospalmen-Rindviehprojekt in<br />
der Tanga-Region" ab, welche die zu erwartenden Ernteerträge über einen Zeitraum von neun Jahren<br />
graphisch darstellt. Unter der Überschrift "Mischkultur - ein Beispiel für Subsistenzwirtschaft" schreibt der<br />
Autor:<br />
Bei der notwendigen Modernisierung und Intensivierung der heimischen Landwirtschaft kommt es darauf an, ökologisch<br />
bewährte Formen des traditionellen afrikanischen Landbaus (z.B. Mischkultur, Mulche, Unkrautbrache) möglichst zu<br />
bewahren und mit modernen Formen vorsichtig zu kombinieren.<br />
Wegen des Kapitalmangels der meisten Kleinbauern kann der Schwerpunkt nicht in einer Technisierung liegen, vielmehr<br />
muss die Verbesserung auf angepasste Technologien und ökologisch günstige Anbaumethoden ausgerichtet sein.<br />
Unter der Überschrift "Ländliches Entwicklungsprogramm für die Tanga Region" wird ein ab 1972 laufendes<br />
<strong>Pro</strong>jekt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Tansania erläutert, welches schliesslich rund 1 Mio.<br />
Menschen betreffen sollte. (Zu Tansania siehe auch die Seiten 287 und 306 dieser Arbeit.)<br />
4.24.4 Zusammenfassung<br />
Während der erste Band unter teilweisen Verwendung von Texten, die schon in einem rund zehn Jahre älteren<br />
Lehrmittel abgedruckt wurden, ein wenig differenziertes Bild zeichnet und Schwarze in der Art eines Lehrmit-<br />
tels aus den 50er Jahren als "Boys" bezeichnet, gibt der zweite Band einen Einblick in die Landwirtschaft der<br />
Savannenzonen, der etwas detaillierter ausfällt.<br />
Der zweite Band zeichnet im wesentlichen das Bild eines von der Subsistenzwirtschaft geprägten Kontinents,<br />
in dem schreckliche Hungersnöte, bedingt durch Krieg oder Dürre auftreten, die das Vieh verenden lassen und<br />
die Menschen "in Lumpen gehüllte Skelette" verwandeln. Ausserdem bietet der Band einen Überblick über die<br />
wichtigsten Völker Nigerias und deren Wirtschaftsweise und soziale Strukturen.<br />
Geographielehrmittel: Geographie thematisch (1977-1980)<br />
Der dritte Band widmet sich ganz dem mit kritischen Augen betrachteten sozialistischen Reformversuch<br />
Tansanias. Dabei kommt einmal mehr der damalige Präsident Nyerere zum Wort.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 301
4.25 Silva Weltatlas (1978)<br />
Der 256 Seiten (davon 80 Seiten Register) umfassende "Grosse Silva Weltatlas" bildet auf den Seiten 132-145<br />
Karten und Bilder zu Afrika ab. Auf der Doppelseite 132-133 wird Afrika kurz charakterisiert als "Ein Konti-<br />
nent im Aufbruch zur Freiheit und zur Macht. Ein Erdteil dessen zahllose Völkerstämme stolz und selbstbe-<br />
wusst wurden", bevor der Autor in der Einleitung auf der Seite 132 schreibt:<br />
...Ein Kontinent, dessen Erforschung erst vor 100 Jahren begann: Symbolhaft für Afrika... Lebensfreude bei einem<br />
Negerfest im Staate Ghana.<br />
Auf der Seite 133 findet sich das im Text erwähnte Bild zum "Negerfest" abgedruckt. In der Einleitung<br />
schreibt der Autor weiter (S. 132):<br />
Afrika - den dunklen Kontinent und den schwarzen Kontinent nennt man es noch immer. Zu Unrecht: denn der<br />
Lebensraum der vielfältigen Negerstämme beginnt erst südlich der Sahara... Als echte Schwarze gelten nur die Sudanneger<br />
mit ihren rund 60 Stämmen und die Bantu mit ihren rund 200 Stämmen. Sklaverei und Ausbeutung waren viele<br />
Jahrhunderte hindurch das Schicksal Schwarzafrikas. Erst nach dem 2. Weltkrieg errangen viele afrikanische Staaten<br />
Selbständigkeit. Nur tief im Süden, in Rhodesien und Südafrika, liegen noch immer weisse Bastionen. Doch auch deren<br />
Ende ist unaufhaltsam.<br />
Die Doppelseite 134-135 zeigt 15 Fotos, von denen 7 Fotos in dieser Arbeit von Interesse sind. Ihre Bildlegen-<br />
den lauten:<br />
Bild 5:... In dem feuchtheissen Klima Äquatorial-Afrikas werden in Plantagen Bananen, Kakao, Kaffee, Zuckerrohr, Sisal<br />
und Baumwolle angebaut.<br />
Bild 7: Südwestafrika. In den weiten Dornstrauchsteppen und Trockensavannen, zum Teil auch in der Wüste oder<br />
Halbwüste, leben Negerstämme und Buschmänner auf steinzeitlicher Kulturstufe als Sammler und Jäger mit Pfeil und<br />
Boden.<br />
Bild 9: Grüne Bananen und Sonnenschirm im Korb, das Kleine auf dem Arm - eine junge Mutter aus der <strong>Pro</strong>vinz Rio Muni<br />
in Äquatorial-Guinea symbolisiert das friedliche Afrika.<br />
Bild 10: Marktszene in Dar es Salaam, einem bedeutenden Handelsplatz an Afrikas Ostküste. Übersetzt heisst die<br />
Hauptstadt Tansanias "Hafen des Friedens".<br />
Bild 11: In der entlegenen Trockensavanne, im Hochland von Adamaoua im nördlichen Kamerun, leben die Afrikaner fast<br />
unberührt von der Zivilisation in ihren primitiven, strohgedeckten Rundhütten.<br />
Bild 13: Johannesburg, drittgrösste Stadt des Kontinents, zeigt europäischen und amerikanischen Zuschnitt. Mit 1.4<br />
Millionen Einwohner bildet Johannesburg auch das wirtschaftliche Zentrum der Republik...<br />
Bild 15: Nach der Zuckerrohrernte in den Plantagen von Moçambique werden die Stümpfe der Pflanzen angezündet und<br />
verbrannt. Die jährliche Ernte beträgt 200'000 Tonnen.<br />
Die Doppelseite 136-137 bildet eine politische Karte Afrikas und Europas im Massstab 1:30 Mio. ab. Die<br />
Seiten 138-141 sind Nordafrika gewidmet. Die Doppelseite 138-139 zeigt 7 Abbildungen, von denen 3 Fotos<br />
von Interesse sind. "Afrikanische Frauen bereiten das Essen: aus Hirse, Maniok oder Yams gestampftem Brei<br />
wie hier in Ghana" lautet die Bildlegende zum einen, "Bis zum äussersten Rand wird auf einem Hochplateau<br />
in Äthiopien in kleinfeldriger Landwirtschaftsstruktur Gras angebaut... Es handelt sich dabei um die Grasart<br />
'Tef', aus deren Körnern äthiopisches Brot gebacken wird." und "Ein typisches Dorf in Nigeria am frühen<br />
Morgen... Die Kegeldachhütten, die typische afrikanische Hausform, stehen hinter 'Zäunen' aus Schilfmatten"<br />
lauten sie für die beiden anderen Bilder. Im Text schreibt der Autor zu Nordafrika auf der Seite 139:<br />
...Wie das Ufer eines neuen Landes erschien den Arabern das Gebiet zwischen Wüste und anschliessender Savanne. In<br />
dieser Sahelzone (Sahel heisst Ufer) gibt es nur dürftige Vegetation, ist nur nomadische Viehhaltung möglich.<br />
Katastrophale Dürren können die Existenz der Bewohner vernichten...<br />
Die Doppelseite 140-141 zeigt eine physische Karte Afrikas nördlich des Äquators im Massstab 1:15 Mio. Die<br />
Seiten 142-145 sind dem südlichen Afrika gewidmet. Im Text schreibt der Autor auf den Seiten 142-143 zur<br />
geschichtlichen Entwicklung:<br />
Geographielehrmittel: Silva Weltatlas (1978)<br />
... Die Portugiesen waren Ende des 15. Jahrhunderts die ersten. Ihnen folgten Holländer, Briten, Deutsche und Franzosen in<br />
späteren Jahrhunderten als Kolonisatoren, als weisse Herren, die sich die schwarzen Eingeborenen untertan machten.<br />
Buschmänner, Hottentotten und Damara sind die Ureinwohner des Landes. Die gleichfalls dort angesiedelten Bantu<br />
drangen erst lange nach ihnen, von Nordosten kommend, ein. Die Buschmänner, ein pygmäenhaft kleiner<br />
Menschenschlag, nur bis 1.40 Meter gross, gehören zu den genügsamen Jägern und Sammlern, die in wasserarme<br />
Steppengebiete zurückgedrängt wurden, wo sie, wie am Rande der sandigen Dornensavanne Kalahari, ein kümmerliches<br />
Dasein fristen, letzte Zeugen für das urtümliche Afrika...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 302
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 250 und 383 dieser Arbeit.) Ein weiterer Abschnitt beschreibt<br />
die Städte des südlichen Afrika, von denen 15 mehr als "100'000 Einwohner" aufweisen würden. Über die<br />
Republik Südafrika schreibt der Autor auf der Seite 143:<br />
Die Republik Südafrika ist, was ihre Wirtschaft anbelangt, der bedeutendste Staat des Kontinents... Die rassenfeindliche<br />
Politik der sogenannten "Apartheid", die die Farbigen zu Menschen zweiter Klasse degradiert, ist in heutiger Zeit Anlass zu<br />
harten Auseinandersetzungen in der UN. Erbittert kämpft die schwarze Bevölkerung der Republik Südafrika wie die<br />
Eingeborenen des gesamten Kontinents vor ihnen um Unabhängigkeit...<br />
(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 284 und 348 dieser Arbeit.) Ein weiterer Abschnitt beschäftigt<br />
sich mit der Wirtschaft der Grosslandschaft des südlichen Afrikas. Eines der vier Fotos ist mit der Legende<br />
"Zu Stammesfesten werden die prächtigen Schmuckgewänder hervorgeholt wie eh und je" versehen. Die<br />
Seite 144 zeigt eine physische Karte Afrikas südlich des Äquators im Massstab 1:15 Mio. Auf der Seite 145<br />
schreibt der Autor zu den "paradiesischen Inseln" vor der Ostküste Südafrikas, gemeint sind Madagaskar, die<br />
Komoren und Seychellen:<br />
... Auf diesen Inseln werden hauptsächlich Vanille, Kaffee, Zuckerrohr und Kakao angebaut...<br />
Neben dem speziellen Afrikateil, enthält der Band Weltkarten auf den Seiten 22, 27, 28 und 29, 30, 31, 32 und<br />
33, wobei die <strong>Pro</strong>blematik verschiedener <strong>Pro</strong>jektionen auf den Seiten 30 und 31 besprochen wird und die<br />
meisten Karten einigermassen flächentreu sind, sowie statistische Daten auf den Seiten 23-26.<br />
4.25.1 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Silva Weltatlas (1978)<br />
Auf den wenigen Seiten bietet der Atlas ein breites , wenn auch wenig vertieftes Bild Schwarzafrikas. Symbol-<br />
haft für den Kontinent sei "die Lebensfreude... bei einem Negerfest" andererseits kämpften die Schwarzen<br />
Südafrikas "erbittert... um ihre Unabhängigkeit", während die "Buschmänner... am Rande... der Kalahari ein<br />
kümmerliches Dasein fristen" und eine Mutter mit Kind "das friedliche Afrika" symbolisierte.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 303
4.26 Terra Weltkunde (1978)<br />
Geographielehrmittel: Terra Weltkunde (1978)<br />
Die beiden Bände "Terra Weltkunde" für das 5. und 6. Schuljahr in Baden-Württemberg enthalten nur verein-<br />
zelte Informationen zu Afrika. Der Band 1 für das 5. Schuljahr zeigt vier nicht näher bezeichnete Fotos afrika-<br />
nischer Menschen auf der Seite 72. Im Text dazu heisst es: "Völker schwarzer Hautfarbe (negride) gab es<br />
ursprünglich nur in Afrika" und Seite 73 zeigt eine kleine Karte "Sprachen und Rassen Afrikas", wobei die<br />
"Rassen" Sudanide, Äthiopide, Bambuti, Bantu und "Hottentotten" genannt werden. Band 2 für das 6. Schul-<br />
jahr zeigt ein einziges Foto "Dorf in Rhodesien", auf dem eine Familie vor ihren Hütten zu sehen ist. Die<br />
beiden Bände enthalten auf den insgesamt 192 Seiten keine weiteren Stellen zum Thema dieser Arbeit.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 304
4.27 Terra Geographie (1979)<br />
...Nun blättert der Tourist in den <strong>Pro</strong>spekten: schöne bunte Bilder von Giraffen und Zebras, Löwen und Elefanten, von<br />
Eingeborenentänzen, von Luxushotels am Indischen Ozean, vom Sandstrand unter Palmen. Aber ist das Kenia?...<br />
...Kenia ist ein Entwicklungsland - wie die meisten Staaten Afrikas. Unsere Regierung leistet Entwicklungshilfe. Das Geld<br />
dafür zahlen alle Bürger unseres Staates: Steuergelder. Wir wollen wissen, wohin unser Geld geht und welche <strong>Pro</strong>bleme in<br />
jenen Ländern gelöst werden müssen. Als politisch interessierte Bürger möchten wir mehr wissen, als in den<br />
Touristenprospekten steht. (Bd. 2, S. 214-215)<br />
Die beiden Bände für die Klassen 7/8 und 9/10 des Lehrmittels "Terra Geographie", 1979 im Klett Verlag<br />
erschienen, beschäftigen sich auf rund 38 der insgesamt 492 Seiten mit Afrika.<br />
4.27.1 Band 1<br />
Der Band für das 7. und 8. Schuljahr enthält die Kapitel "Das gescheiterte Erdnussprojekt" (S. 16-17) "Trok-<br />
kengrenze der Landwirtschaft" (S.94-95), "Dürre im Sahel" (S.96-97), "Ochsenpflüge für Ghana" (S. 172-173),<br />
"Unterschiedliche Wege zur Entwicklung: Tansania" (S. 178-179 ), "500 Millionen Menschen hungern"<br />
(S. 182 -183), "Im Teufelskreis der Armut 1: Bevölkerungsvermehrung" (S. 186-187), "Im Teufelskreis der<br />
Armut 2: Viele Kranke - zuwenig Ärzte" (S. 188-189) und "Im Teufelskreis der Armut 3: Schlechte Ausbil-<br />
dung" (S. 190-191). Jedes Kapitel enthält ausser dem Text Zeichnungen, Fotos und Aufgabenstellungen.<br />
4.27.1.1 "Das gescheiterte Erdnussprojekt"<br />
Im Kapitel "Das gescheiterte Erdnussprojekt" auf der Seite 16, die auch eine Zeichnung und eine Beschreibung<br />
der Erdnusspflanze abdruckt, schreibt der Autor zum geschichtlichen Hintergrund des in der Fachliteratur<br />
immer wieder zitierten Anbauprojektes in Tansania (siehe dazu auch die Seite 216 dieser Arbeit):<br />
Der Zweite Weltkrieg ging zu Ende, aber der Hunger war noch nicht vorbei. Es fehlte vor allem an Fett. Man suchte nach<br />
Möglichkeiten, die "Fettlücke" zu schliessen. So auch in England. Im März 1946 wurde der britischen Regierung der<br />
Vorschlag unterbreitet, in der Kolonie Tanganyika, dem heutigen Tansania, eine Fläche von 10'000 km 2 ... für den<br />
Erdnussanbau zu erschliessen. An drei Stellen sollten dafür Trockenwälder und Dornsträucher der Savanne gerodet<br />
werden. Man wollte jährlich 600 '000 t Erdnüsse erzeugen.<br />
Nach dem einführenden Text folgt ein Bericht, der einzelne Phasen des <strong>Pro</strong>jektes schildert (S. 16):<br />
1946: Im Juni reisen drei Sachverständige im Auftrag der britischen Regierung nach Ostafrika. Bereits im September<br />
melden sie. dass die Temperaturen für den Anbau von Erdnüssen ideal seien. Aus den Unterlagen der wenigen<br />
Klimastationen entnehmen sie, dass im Durchschnitt ausreichend Niederschläge fallen. Die bestehenden Verkehrswege<br />
scheinen für die Versorgung der Erdnussplantagen und den Abtransport der Ernte zu genügen. Nur im südlichen<br />
Rodungsgebiet muss eine Stichbahn gebaut werden.<br />
Daraufhin beschliesst die britische Regierung die vorgesehenen Anbauflächen um ein Drittel zu vergrössern und das<br />
<strong>Pro</strong>jekt sofort zu beginnen. Bis 1953 sollen etwa 13'000 km 2 gerodet und mit Erdnüssen bebaut sein.<br />
Auf der Seite 17 heisst es weiter:<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
1947: Erste Schwierigkeiten treten auf. Die geeigneten Maschinen können nicht schnell genug in der notwendigen Anzahl<br />
geliefert werden. Der Hafen Daressalam ist überfordert. Man muss alte Kriegspanzer zu Traktoren umbauen. Das zähe<br />
Wurzelwerk der Dornbüsche ist schlecht zu beseitigen. Nur 5% der für dieses Jahr vorgesehenen Flächen können bestellt<br />
werden.<br />
1949: Die Rodung des Trockenwaldes dauert viermal so lange wie ursprünglich angenommen. Die Kosten für die<br />
europäischen Arbeitskräfte in den entlegenen Gebieten, für den Bau der Bahnlinie und für die Beschaffung von Maschinen<br />
und Ersatzteilen steigen schnell. Die Gesamtkosten liegen zehnmal höher als vorgesehen. Das Ernteergebnis aber bleibt<br />
weit hinter den Erwartungen zurück. Die Niederschläge fallen innerhalb eines Jahres sehr unregelmässig. Sie bleiben oft<br />
gerade dann aus, wenn die Pflanzen sie für ihr Wachstum dringend benötigen. Die Bodendecke wird durch die<br />
grossflächige Rodung zerstört. Die riesigen Felder begünstigen die Ausbreitung von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten.<br />
1950/51: Alle Arbeiten werden eingestellt, denn erst 6% der vorgesehenen Gesamtfläche sind gerodet, die Ernteerträge<br />
sind um 70% hinter den berechneten Mengen zurückgeblieben. Das mit vielen Hoffnungen begonnene Vorhaben, kaum<br />
genutzte Savannengebiete in ertragreiches Kulturland zu verwandeln, ist endgültig gescheitert. Die Verluste machen mehr<br />
als 300 Mio. DM aus.<br />
Dieses Musterbeispiel einer falschen Agrarpolitik in Schwarzafrika kann auch ein Hinweis auf die Schwierig-<br />
keiten der frühen einheimischen Bauern sein, die erstmals versuchten, den Boden nutzbar zu machen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 305
Nebst der chronologischen Beschreibung des Erdnussprojektes bildet die Seite 17 drei Fotos ab: "Erdnuss-<br />
pflanze", "Rinderherde auf einem abgeernteten Erdnussfeld" und "Ernte auf einem Erdnussfeld. Die Erdnüsse<br />
werden mit der Hand abgestreift", welches drei Frauen, die eine mit Kind, zeigt. Über die weitere Entwicklung<br />
der für den Erdnussanbau gedachten Ländereien Tansanias schreibt der Autor (S. 17):<br />
Nach diesem Fehlschlag ging man daran, auf kleinen Versuchsfeldern die Eignung der Flächen für den Ackerbau zu<br />
überprüfen. Man stellte fest: Die häufigen Dürrejahre lassen einen Ackerbau ohne Bewässerung nicht zu. Einige Flächen<br />
eignen sich für den Tabakanbau. Im übrigen Gebiet ist nach Ausrottung der Tsetsefliege, Rinderhaltung möglich. Heute<br />
wird auf den ehemaligen Erdnussfeldern eine ertragreiche Rinderwirtschaft betrieben.<br />
Die Wirtschaft Tansanias ist nach wie vor von der Landwirtschaft bestimmt. Ein Grossteil der Exporteinnah-<br />
men wird in der Agrarproduktion erwirtschaftet. 1995 belief sich der Wert der Exporte auf rund 660 Mio. US$,<br />
wobei 22% auf Kaffee, 16% auf Baumwolle und 10% auf Cashewnüsse entfielen. Daneben werden auch Sisal,<br />
Tee, Chrysanthemen, Erdnüsse, Tabak, Gewürznelken, Kokosnüsse und Zuckerrohr für den Export angebaut.<br />
Die Bedeutung der Landwirtschaft spiegelt sich auch in der Bevölkerungsverteilung. Nur gerade ein Viertel<br />
der rund 32 Mio. Einwohner, die sich in mehr als 120 Völker gliedern, leben in den Städten, wobei das durch<br />
Dodoma als Hauptstadt abgelöste Dar es Salam nach wie vor das wirtschaftliche Zentrum des Landes bildet.<br />
Das als "wildreichstes Land der Erde" geltende Tansania verfügt noch über grosse Waldbestände, die aller-<br />
dings durch die Gewinnung von neuem Farmland und den zunehmenden Brennholzbedarf rasch abnehmen.<br />
Die Reservate, die 13% des Landes ausmachen, sind eine der Hauptattraktionen des Tourismus, aus dem<br />
Tansania 1995 325 Mio. US$ erwirtschaftete. (Zum Tourismus siehe auch die Seiten 273 und 347 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Obwohl sich der Lebensstandard Tansanias in den letzten Jahre für viele Einwohner verbesserte, kämpft das<br />
Land nach wie vor mit grossen <strong>Pro</strong>blemen. Seit der Wahl des Präsidenten Benjamin Mkapa 1995, der<br />
versprach, die Korruption im Land zu bekämpfen, hat Tansania zwar wieder die Zustimmung des IMF gefun-<br />
den, muss aber einen Schuldenberg von 7.3 Mrd. US$ abbauen.<br />
Immer wieder üben die Geschehnisse in den Nachbarländern Einfluss auf Tansania aus. 1979 schickte der<br />
damalige Präsident Nyerere, nach Grenzübergriffen der marodierenden Truppen Idi <strong>Ami</strong>ns, Einheiten der<br />
tansanischen Armee nach Uganda, die massgeblich zum Sturz des ugandischen Diktators <strong>Ami</strong>n beitrugen. In<br />
jüngster Zeit sorgte Ruanda für Unruhe an der Westgrenze Tansanias. Im März 1995 strömten über 500'000<br />
ruandische Flüchtlinge nach Tansania. 1996 musste Tansania 110'000 burundische Flüchtlinge aufnehmen,<br />
deren Zahl bis Mitte 1997 wegen des Kriegsgeschehens im Kongo auf über 300'000 anwuchs. (Weltatlas 1997,<br />
Fischer 1998; zu Tansania siehe auch die Seiten 299 und 320, sowie die Tabelle "Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duk-<br />
tion Tansanias" im Anhang auf der Seite 450 dieser Arbeit.)<br />
4.27.1.2 "Trockengrenze der Landwirtschaft"<br />
Das Kapitel "Trockengrenze der Landwirtschaft" bildet eine ganzseitige Grafik auf der Seite 94 ab, welche die<br />
möglichen Anbaupflanzen und Nutztiere in den Gebieten unterschiedlicher Trockenheit angibt. Für den tropi-<br />
schen Regenwald werden Maniok, Mais, Reis, Mehl- und Obstbanane, Zuckerrohr, Kakao, Kaffee, Kautschuk,<br />
Ölpalme, Schweine und Ziegen aufgeführt; für die Feuchtsavanne Maniok, Yams, Mais, Mehl- und Obstbana-<br />
ne, Erdnuss, Baumwolle; für die Trockensavanne Hirse, Erdnuss, Baumwolle, Sisal und teilweise Rinder, für<br />
die Dornsavanne teilweise Hirse und Erdnuss, extensive Weidewirtschaft mit Rindern und Ziegen, sowie bei<br />
Bewässerung Baumwolle, Reis und Zuckerrohr. Die nördlicher gelegenen Gebiete sind nicht Gegenstand der<br />
Betrachtung dieser Arbeit, deshalb wird auf sie nicht weiter eingegangen.<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 306
Die Seite 95 zeigt eine grosse Karte "Landwirtschaft", zu der der Autor verschiedene Aufgaben stellt und die<br />
folgende Nutzungszonen wiedergibt: "Gartenbau um Kano", "Erdnusszone" im Norden des Landes, "Baum-<br />
wollgebiet" südlich von Kano, "Hirsezone" südlich des Baumwollanbaus um ca. 10° nördlicher Breite, "Yams-<br />
zone" südlich des Hirseanbaus, "Kakaoanbau" und "Ölsümpfe" im Küstengebiet nördlich des Nigerdeltas. Im<br />
Text heisst es auf der gleichen Seite kurz:<br />
Die Viehhaltung ist auf der Karte nicht verzeichnet. So ist die "Erdnusszone" überwiegend ein Gebiet der Rinderweide.<br />
Von dort werden Rinder über viele hundert Kilometer zu den Schlachthöfen im dichtbesiedelten Süden des Landes<br />
getrieben. In Südnigeria selbst werden keine Rinder gehalten. Schuld sind die Tsetsefliegen, die eine Rinderkrankheit<br />
hervorrufen. Sie leben in den feuchteren und stärker bewaldeten Teilen der afrikanischen Tropen.<br />
(Zur Tsetsefliege siehe auch die Seite 157 dieser Arbeit.)<br />
4.27.1.3 "Dürre im Sahel"<br />
Das Kapitel "Dürre im Sahel" auf den Seiten 96 und 97 zeigt insgesamt elf Walterdiagramme zu Temperatur<br />
und Niederschlägen in der besprochenen Zone, sowie ein Grafik zum Niederschlag im Nigergebiet (S. 95) für<br />
die Jahre 1905-1976, welches für den Zeitraum 1970-1974 eine unterdurchschnittliche Regenmenge aufweist.<br />
Im Text schreibt der Autor dazu (S. 95):<br />
Mehrere Millionen Rinder und Ziegen verhungerten und verdursteten 1972/73 im Sahel. Hunderttausende von Menschen<br />
verhungerten... Im Juli 1973 wagten es einige Bewohner, Hirse zu säen; dann kam der trockene August, und alles war<br />
umsonst.<br />
In einer der Aufgabenstellungen schreibt der Autor:<br />
Mehrere gute Regenjahre lassen die Dürregefahr vergessen. Die Bewohner vergrössern ihre Herden und roden Land, denn<br />
immer mehr Menschen müssen ernährt werden. Ein einzelnes schlechtes Jahr ist noch nicht gefährlich. Wenn die<br />
Niederschläge aber gleich mehrere Jahre nacheinander deutlich unter dem Durchschnittswert bleiben, dann ist die<br />
Katastrophe da...<br />
Katastrophen, die in früheren Jahrhunderten teilweise durch Vorratshaltung entschärft werden konnten. Durch<br />
die von den Kolonialmächten verordnete Zwangsarbeit wurde vielen Bauern die Möglichkeit genommen, in<br />
guten Jahren ein Überschuss zu produzieren. Die sich daraus ergebenden Gewohnheiten führten dann Jahre<br />
später zu den oben zitierten Zuständen.<br />
Seite 97 gibt in einer Tabelle die Rinderbestände der Länder Mali, Obervolta und Niger für die Jahre 1950,<br />
1967, 1974 und 1975 wieder.<br />
Tabelle: Rinderbestand in Ländern mit Anteil an der Sahelzone<br />
nach Terra Geographie 7/8, Seite 97, ergänzt (graue Spalten)<br />
Land 1950 1967 1974 1975 Zunahme 1<br />
Aufstockung 2<br />
Mali 3'000'000 5'100'000 3'700'000 3'886'000 5% 7 Jahre<br />
Obervolta 1'161'000 2'600'000 1'600'000 1'700'000 6% 8 Jahre<br />
Niger 2'818'000 4'100'000 2'313'000 2'500'000 9% 9 Jahre<br />
1 von 1974 auf 1975<br />
2 Zeit bis zur Erholung der Bestände auf das Niveau von 1967, bei gleichbleibendem Wachstum<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
Der deutliche Rückgang der Bestände geht auf die Dürrejahre 1968-1974 zurück, anschliessend setzte eine<br />
Erholung ein, die bei der gleichen Wachstumsrate für eine Wiederaufstockung des Bestandes innert 7-9 Jahren<br />
gesorgt hätte. (Weitere Tabellen zu Viehbeständen finden sich auf den Seiten 402 und 555 dieser Arbeit.)<br />
Auf der gleichen Seite finden sich auch Angaben von 1970 zu Rate der Analphabeten, die für alle drei Länder<br />
mit rund 90% angegeben wird, bei einer Gesamtbevölkerungszahl von rund 15 Mio. Menschen. (Siehe dazu<br />
auch die Karte "Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite 571 dieser<br />
Arbeit.) Ausserdem zeigt die Seite 97 zwei Fotos "An einem Tiefbrunnen (Obervolta" und "Dornsavanne ohne<br />
Futter (1973)" auf dem ein verhungertes Rind zu sehen ist. Im Text schreibt der Autor kommentierend:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 307
Neue Tiefbrunnen (bis 100 m tief, elektrische Pumpen) bewahren das Vieh vor dem Verdursten, wenn die Wasserlöcher<br />
und die alten Brunnen (bis 15 m tief) austrocknen. Sie bewahren es jedoch nicht vor dem Verhungern!<br />
Der Autor erwähnt nicht, dass gerade auch die Schaffung dieser Brunnen die lokale Bevölkerung dazu verlei-<br />
tete, ihre alten, besser angepassten Gewohnheiten zu ändern und die Aufstockung ihrer Herden zu<br />
beschleunigen.<br />
4.27.1.4 "Ochsenpflüge für Ghana"<br />
Die Idee der Entwicklungshilfe wird im Kapitel "Ochsenpflüge für Ghana" auf den Seiten 172 und 173 aufge-<br />
griffen. Seite 172 bildet die drei Fotos "Traditionelle Ackerbestellung mit der Hacke", eine Frau, welche ihr<br />
Kind auf dem Rücken trägt, bearbeitet das Feld in gebeugter Stellung; "Deutsches Entwicklungsprojekt: Pflü-<br />
gen mit Ochsen", ein Weisser läuft neben einem Schwarzen, der den Pflug führt; und "Moderne Ackerbestel-<br />
lung mit dem Traktor". Im Text schreibt der Autor auf der Seite 172:<br />
Mit einer Hacke und in gebückter Haltung - so haben die Bauern im Norden Ghanas seit Jahrhunderten ihre Äcker bestellt.<br />
Sie sind Hackbauern. Mit der Hacke kann eine Familie etwa 2 ha bearbeiten. Ein Traktor dagegen würde Kraft sparen<br />
helfen und ein Vielfaches schaffen. Nur:<br />
- Ein Traktor ist sehr teuer.<br />
- Ein Traktor ist schwer zu bedienen.<br />
- Ein Traktor braucht ständig Benzin und viele spezielle Ersatzteile.<br />
- Ein Traktor braucht grosse Felder, sonst lohnt er sich nicht.<br />
- Ein Traktor macht viele Arbeitskräfte überflüssig.<br />
Ein Traktor mag für einen Grossbauern lohnend sein. Für einen Kleinbauern hat er zu viele Nachteile. Aber gerade die<br />
Kleinbauern brauchen Entwicklungshilfe am dringendsten. Von den über 10 Mio. Einwohnern Ghanas leben fast 7 Mio.<br />
auf dem Land, die Mehrzahl von ihnen in kleinbäuerlichen Familien. Nur wenn sich auch ihre Lebensverhältnisse<br />
verbessern, wird man von einer echten Entwicklung sprechen können.<br />
Für die Kleinbauern bedeutet ein Ochsengespann mit einem Eisenpflug bereits einen gewaltigen technischen Fortschritt.<br />
Ochsenpaar und Pflug kosten etwa 1'500 DM. Das ist viel Geld. Aber jetzt kann eine Bauernfamilie dreimal soviel Fläche<br />
bestellen wie früher mit der Hacke. Sie erzeugt jetzt so viele Nahrungsmittel, dass sie sogar etwas verkaufen kann.<br />
Entgegen dem Eindruck den der Text vermitteln mag, sind es gerade die Kleinbauern in Afrika, welche als<br />
Basis des Fortschrittes dienen, d.h. ihre Leistung ermöglicht oft erst die Entwicklung in den Städten. Zur Idee<br />
der Umstellung ist anzumerken, dass ein Pflug von der Mehrzahl der Kleinbauern bis heute nicht bezahlt<br />
werden könnte: Das Durchschnittseinkommen in Ghana liegt je nach Angaben bei rund 700 Franken pro Jahr,<br />
wobei viele Kleinbauern wohl eher über weniger als 200 Franken pro Jahr verfügen dürften. (Zum Ochsen-<br />
pflug siehe auch die Seiten 267 und 333 dieser Arbeit.) Auf Seite 173 fährt der Autor fort:<br />
Deshalb spricht man von angepasster Technik. In jüngster Zeit werden viele Entwicklungsprojekte gefördert, die<br />
angepasste Techniken verbreiten wollen. Angepasste Techniken gibt es nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in allen<br />
Bereichen des Lebens: im Verkehrswesen, in der Industrie, im Gesundheitswesen, bei der Energieerzeugung und beim<br />
Hausbau.<br />
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seite 299 und 324 dieser Arbeit.) Das Schwergewicht der Seite 173<br />
liegt auf den fünf Fotos, von denen vier Afrika zugeordnet sind: "Wassertransport in gegerbten Ziegenbälgen<br />
in der Sahelzone", "Herstellung von Kunststoffeimern in Kamerun", "Eselkarren in Tansania" und "Herstellung<br />
von Bausteinen in Tansania". Ob der Autor die Thematik bewusst über das eigentliche Kapitelthema Ghana<br />
ausdehnen wollte, oder ob kein entsprechendes Bildmaterial aus der ehemaligen Goldküste zur Verfügung<br />
stand, lässt sich anhand des Lehrmittels nicht nachvollziehen. Diese Praxis ist einer differenzierte Betrachtung<br />
der einzelnen Räume Afrikas aber sicher nicht förderlich, kann aber im Zusammenhang mit der Berichterstat-<br />
tung auch in anderen Medien beobachtet werden.<br />
4.27.1.5 Tansania<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
Auf den Seiten 178 und 179 beschäftigt sich der Autor unter dem Titel "Unterschiedliche Wege zur Entwick-<br />
lung: Tansania" mit der ehemaligen deutschen Kolonie an der Ostküste Afrikas. Auf der Seite 178f. schreibt<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 308
der Autor, nachdem er die Daten zur Unabhängigkeit und Vereinigung des Staates Tanganjika (1961) und der<br />
Insel Sansibar (1963) zu Tansania (1964) kurz aufführt:<br />
Während der deutschen und englischen Kolonialzeit hatte sich Tansania sehr einseitig entwickelt. Die Europäer hatten den<br />
Anbau von Kaffee, Baumwolle, Sisal und Gewürznelken für den Weltmarkt gefördert. Diese Weltmarktprodukte wurden<br />
fast ausschliesslich in Grossbetrieben erzeugt, in Plantagen. Die Plantagen lagen überall dort, wo Klima und<br />
Bodenverhältnisse günstige Anbaumöglichkeiten bieten: an der Küste und in höhergelegenen Gebieten im Innern des<br />
Landes, wo ein kühleres Klima herrscht. Dort wohnten auch die Europäer, und dort war das Land verhältnismässig gut<br />
erschlossen: mit Strassen und Eisenbahnen, mit Schulen und Krankenhäusern. Etwa 20'000 Europäer lebten in diesen<br />
bevorzugten Gebieten.<br />
Die afrikanische Bevölkerung dagegen 10 Mio. Menschen, die fast ausschliesslich Landwirtschaft betrieben - lebten in den<br />
weiten Landesteilen mit ungünstigen natürlichen Bedingungen. Dort bringen die Böden nur geringe Erträge, und die<br />
Niederschläge fallen sehr unregelmässig. Die meisten Afrikaner wirtschafteten hauptsächlich für die Selbstversorgung. Sie<br />
kannten keinen Pflug, sondern bearbeiteten den Boden mit der Hacke. Lediglich in der Umgebung der Plantagen bauten<br />
auch Afrikaner Pflanzen für den Weltmarkt an.<br />
Aus dem Text entsteht der Eindruck, die Europäer und Schwarzafrikanern in Tansania hätten die jeweiligen<br />
Siedlungsräume frei gewählt, d. h. die Schwarzen hätten vor Beginn an in den wirtschaftlich ungünstigeren<br />
Landesteilen gelebt. Der Autor verliert kein Wort über die von den eindringenden Europäern initiierten<br />
Umsiedlungen. (Siehe dazu auch die Seite 164 dieser Arbeit.) Weiter schreibt der Autor (S. 178):<br />
So war die Lage 1964 für den jungen Staat sehr schwierig. Auf der einen Seite gab es kleine hochentwickelte Gebiete mit<br />
Weltmarktproduktion und guten Verdienstmöglichkeiten; auf der anderen Seite gab es sehr grosse unentwickelte Gebiete<br />
mit bescheidener Selbstversorgung. Die Reichen im Lande verdienten hundertmal soviel wie die Armen. Solche<br />
Gegensätze sind typisch für Entwicklungsländer.<br />
Für Entwicklungsländer treffen diese Aussagen noch immer zu, doch wäre ihre Gültigkeit auch auf die Indu-<br />
strieländer zu prüfen und damit wohl als typische Eigenschaft von Entwicklungsländern zu verwerfen. Im Text<br />
fährt der Autor fort (S. 179):<br />
Julius Nyerere, der seit 1964 Tansania regiert, hat besondere Vorstellungen, wie die zurückgebliebenen Gebiete und deren<br />
Bevölkerung zu entwickeln sind. Er will eine Entwicklung aus eigenen Wurzeln. Die Entwicklung soll nicht von aussen<br />
aufgepfropft werden. Die Tansanier sollen lernen, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, als Reichtümer anzusammeln.<br />
Die menschliche Würde und die soziale Gleichheit sollen in Tansania Vorrang haben. Nyerere knüpft dabei an alte<br />
afrikanische Vorstellungen an. Das Schlüsselwort heisst "Ujamaa" oder "Familiengemeinsinn".<br />
(Siehe zu Ujamaa auch die Seiten 299 und 321 dieser Arbeit.)<br />
1975 lebten bereits drei Viertel der Landbevölkerung Tansanias in rund 7'000 Ujamaa-Dörfern. Tansania hat heute eine<br />
Gesellschaft der Gleichen. Die Reichsten verdienen nur noch neunmal soviel wie die Ärmsten. Zugleich aber ist Tansania<br />
eine Gesellschaft der Armen. Das Land gehört zu den 25 ärmsten Entwicklungsländern. Viele Ausländer führen das darauf<br />
zurück, dass es in Tansania an Verantwortungsbewusstsein und Einsatzfreude mangelt, weil es kein persönliches<br />
Erfolgsstreben gäbe. Ohne ausländische Hilfe könnte der Staat nicht mehr auskommen. Über ein Drittel des<br />
Staatshaushaltes muss vom Ausland finanziert werden. Das Land ist so hoch verschuldet, dass die Weltbank drei<br />
Forderungen an Tansania gestellt hat, ehe sie neue Hilfe gewähren will:<br />
a) Tansania soll weniger Geld für soziale Einrichtungen ausgeben, aber mehr für die Landwirtschaft und Industrie.<br />
b) Tansania soll den Bauern mehr Geld für ihre Ernteerträge zahlen, um sie zu höheren Leistungen anzuspornen.<br />
c) Tansania soll keine Dorfbewohner mehr zwingen, in Ujamaa-Einrichtungen mitzuarbeiten.<br />
Solche Forderungen führen nach Meinung privater Entwicklungsorganisationen zu einer zusätzlichen<br />
Verschlechterung der Lebensqualität der ärmsten Bevölkerungsschichten: Die Löhne zu blockieren senke die<br />
Kaufkraft. Werden die Staatsausgaben gesenkt, so werde vor allem im Sozialbereich, bei Schulen, Kranken-<br />
häusern und Entwicklungsprojekten gespart. Eine Streichung der Nahrungsmittelsubventionen führe dazu, dass<br />
die Grundnahrungsmittel für die Ärmsten unerschwinglich würden. Die Importe zu reduzieren könne zu einem<br />
<strong>Pro</strong>duktionsausfall, aus Mangel an Ersatzteilen, und steigender Arbeitslosigkeit führen. (Michler, 1991, S. 440)<br />
Die im Text genannten Gründe für eine Verarmung des Landes mögen als innere Gründe beigetragen haben,<br />
daneben spielten aber auch externe Gründe, welche die Bewohner Tansanias nicht beeinflussen konnten, wie<br />
etwa die Welthandelspreise für Rohstoffe oder Konflikte in den Nachbarländern, eine wichtige Rolle.<br />
Der Haupttext wird untermalt durch einen Textkasten mit dem Titel "Ujamaa-Dorf Luhanga", in den es auf der<br />
Seite 178 heisst:<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
"Luhanga ist auf dem tansanischen Entwicklungsweg weit vorangekommen: Die freiwillige Dorfpolizei bekämpft<br />
Verbrechen, die dorfeigene Apotheke und die Klinik bekämpfen Krankheiten, die dorfeigene Schreinerei und die<br />
Schmiede bekämpfen Arbeitslosigkeit, eine Frauen-Genossenschaft verkauft Milch und Erfrischungsgetränke. Mit den<br />
Einnahmen aus den dörflichen Unternehmen werden Schule und Sozialeinrichtungen unterhalten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 309
Obwohl jede Familie einen Garten besitzt, in dem sie selbst Nahrungsmittel anbauen kann, werden die Dorfmitglieder<br />
ermutigt, in den gemeinsamen Unternehmen zu arbeiten. Anstelle von Bezahlung erhalten sie Punkte. Dafür dürfen sie die<br />
gemeinsamen Einrichtungen in Anspruch nehmen.<br />
Das hier geschilderte Punktesystem dürfte von einem im maoistischen China praktizierten Modell übernom-<br />
men worden sein. Weiter heisst es in der Beschreibung des Dorfes:<br />
Es gibt kein Fernsehen, aber häufig führt John Haule, ein begeisterter Anhänger der Staatspartei, Filme vor. Die Filme<br />
zeigen den Dorfbewohnern, wie sie besser pflügen und säen können. Sie regen die Dorfbewohner an, gute Sozialisten zu<br />
werden.<br />
Diejenigen, die sich weigern, an der grossen Gemeinschaft teilzunehmen, müssen ihren Preis bezahlen. Man sperrt sie von<br />
den sozialen Einrichtungen aus. Wenn Eltern ihr krankes Kind zum Arzt bringen müssen, kann ihnen das Recht verwehrt<br />
werden, den Bus zu nehmen. Ein arbeitsloser Dorfbewohner, der sich weigert, in der Schreinerei oder der Schmiede zu<br />
arbeiten, wird aus dem Dorf getrieben. Man befürchtet, dass er ohne Arbeit bald zum Dieb wird."<br />
Ein Stück weit entsprach diese Praxis der überlieferten Lebensweise, bei der ein Mitglied bei gewissen Verfeh-<br />
lungen aus der Gemeinschaft ausgestossen, allenfalls sogar in die Sklaverei verkauft wurde - aus der man sich<br />
innerhalb einer afrikanischen Gemeinschaft durch harte Arbeit und vorbildliches Benehmen wieder zur Frei-<br />
heit hocharbeiten konnte -, nur wurden die Normen unter der sozialistischen Regierung nicht mehr von der<br />
betroffenen Dorfgemeinschaft festgesetzt, sondern von Funktionären eingeführt. Zu welchen Auswüchsen, die<br />
es auch in Tansania gab, ein solches System fähig sein kann, ist aus dem maoistischen China hinlänglich<br />
bekannt. Seite 179 bildet eine Zeichnung eines solchen Dorfes ab:<br />
(Zu Tansania siehe auch die Seiten 306 und 320 dieser Arbeit.)<br />
4.27.1.6 Armut<br />
Das Kapitel "500 Millionen Menschen hungern" auf den Seiten 182 und 183 enthält nur wenige direkte Anga-<br />
ben zu Afrika, die meisten sind allgemeiner Natur. So heisst es auf der Seite 182:<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
...So wie sie hungern Millionen von Menschen in Asien, Afrika und Südamerika... Unterernährung und Mangelernährung<br />
haben ähnliche Folgen: Der geschwächte Körper versucht, alle Anstrengungen zu vermeiden, um möglichst wenige Joule<br />
zu verbrauchen. So nimmt die Arbeitsleistung rasch ab. Die Trägheit vieler Menschen in den Entwicklungsländern, über<br />
die wir so oft schimpfen oder spotten, ist weniger auf das Klima oder auf angeborene Faulheit zurückzuführen. Viel<br />
häufiger ist es der Hunger, der die Menschen geschwächt hat.<br />
Hunger kann gefährlich sein wie eine Krankheit, besonders für Kinder unter 5 Jahren. Ungenügend ernährte Kinder<br />
bleiben im Wachstum zurück. Ihr Gehirn wird früh in seiner Entwicklung geschädigt. Hunger macht dumm. Selbst<br />
Erwachsene werden durch Hunger für Krankheiten anfälliger.<br />
Der Autor führt hier eine gefährliche Argumentation. Erstens unterstellt er, dass die Menschen in den Entwick-<br />
lungsländern und damit auch in Schwarzafrika tatsächlich träger als beispielsweise Europäer sind. Zweitens<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 310
vermittelt er auf eine neue Weise das Bild vom "dummen" und zurückgebliebenen Schwarzafrikaner, welches<br />
schon in den ältesten der untersuchten Lehrmitteln vertreten wurde. Nur führt er die intellektuelle Minderwer-<br />
tigkeit nicht mehr auf eine rasseneigene Ausprägung zurück, sondern sieht sie als Folge eines Gesellschaftssy-<br />
stems, welches nicht in der Lage ist, für die eigenen Kinder zu sorgen. "Dumme" Afrikaner zeugen mehr<br />
"dumme" Afrikaner könnten die Ausführungen des Autor überspitzt werden.<br />
Seite 183 zeigt eine Karte "Der Hungergürtel der Erde", auf der die Staaten Äthiopien, Mauretanien, Senegal,<br />
Gambia, Guinea-Bisseau, Mali, Niger und Tschad als Länder mit "Hungersnot" bezeichnet werden. Guinea,<br />
Nigeria, Zaire, Tansania, Kenia, Somalia und Sudan werden mit "Gefahr einer Hungersnot" bezeichnet. Der<br />
Einflussbereich der Republik Südafrika liegt ausserhalb der Zone des "Hungergürtels". Diese Einteilung wird<br />
auch von anderen Lehrmitteln stereotyp übernommen. (Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die<br />
Seiten 298 und 317 dieser Arbeit.)<br />
Im Kapitel "Im Teufelskreis der Armut 2: Viele Kranke - zuwenig Ärzte" schreibt der Autor auf der Seite 188:<br />
Ein Arzt der Missionsstation Dessie nördlich von Addis Abeba (Äthiopien) befuhr mit seinem Kleinbus regelmässig die<br />
Strasse nach Asmara, um die Leprakranken in den Dörfern am Weg zu betreuen. Ihm fiel die grosse Zahl von<br />
Augenkranken auf, die an der Ägyptischen Augenkrankheit, dem Trachom litt. Er behandelte sie.<br />
Der Erreger des Trachoms ist ein Virus. Er wird von Fliegen übertragen. Auf der Innenseite der Augenlider des Erkrankten<br />
bilden sich körnige Knötchen. Es entsteht eine Bindehautentzündung. Schliesslich lassen sich die Lider nicht mehr ganz<br />
schliessen. Die Wimpern kehren sich nach innen und reiben auf der Hornhaut so dass sie trübe wird.<br />
(Zur Lepra siehe auch die Seite 232, zu Äthiopien die Seiten 296 und 352 dieser Arbeit.) Neben dem Text<br />
enthält die Seite 188 eine Grafik "Menschen pro Arzt" in der Äthiopien mit ca. 65'000 Menschen pro Arzt<br />
aufgeführt wird. Das heutige Benin wird unter dem damaligen Namen Dahomey mit ca. 28'000 MpA, Lesotho<br />
mit 23'000 MpA, Togo mit 18'000 MpA und Ghana mit 13'000 MpA angegeben. Zusätzlich sind ein Foto<br />
"Ohne ärztliche Hilfe würde dieses Kind erblinden" und eine Textkasten wiedergeben, in dem es heisst:<br />
"Es dauerte gar nicht lange, bis in jeder unserer Ambulanzen täglich bis zu 50 Tuben Augensalbe an trachomenkranke<br />
Augenpatienten ausgegeben wurden. Bald behandelten wir in den auswärtigen Lepra-Kontrollstationen neben 2'400<br />
Aussätzigen annähernd 400 neue Patienten im Monat, die alle wegen eines Augenleidens Hilfe bei uns suchten. Doch was<br />
waren schon 400 neue Augenpatienten pro Monat, die alle nur mehr oder weniger zufällig den Weg zu uns gefunden<br />
hatten? Was bedeutet diese Zahl schon... in einer <strong>Pro</strong>vinz mit 3 Millionen Einwohnern, von denen bis zu 90% von Trachom<br />
befallen sind? Fanden wir doch selbst in entlegenen und ganz dünn besiedelten Gegenden bei einem einzigen kurzen<br />
Besuch neben vielen anderen Augenleiden allein 146 trachomerkrankte Schüler ohne Hilfe"<br />
Weitere Informationen werden in den Aufgabenstellungen vermittelt:<br />
1. "Das Trachom kann glücklicherweise mit den einfachsten Mitteln behandelt und geheilt werden. Doch wer von den<br />
Bedürftigen kann sich schon privat eine teure Augensalbe kaufen, von der hier eine Tube fast 3 DM kostet"<br />
Ausserdem hat man festgestellt, dass in Orten mit guter Wasserversorgung weniger Menschen an Trachom erkranken...<br />
2. Das Trachom ist nur eine von vielen gefährlichen Krankheiten der Tropen und Subtropen. Malaria, Gelbfieber, Pocken,<br />
Cholera, Lepra, Bilharziose und Schlafkrankheit sind andere...<br />
3. Besonders krankheitsanfällig und gefährdet sind Säuglinge und Kleinkinder. In Imesi, Westnigeria, starb im Jahr 1957<br />
jedes vierte Kind bei der Geburt oder im ersten Lebensjahr. 1962, nachdem eine Klinik gebaut worden war, starb nur<br />
noch jedes zwölfte...<br />
Afrika wird damit als Seuchenkontinent gezeichnet. Im Unterschied zu einigen älteren Lehrmitteln, in denen<br />
das ungesunde Klima für Europäer im Vordergrund stand, leidet hier nun die einheimische Bevölkerung und<br />
die Europäer bringen den Notleidenden Hilfe.<br />
Seite 189 zeigt ein Foto "Kranke warten vor der Klinik" und eine Grafik "Menschen pro Krankenbett, wobei<br />
Äthiopien mit 2400 Menschen pro Krankenbett angegeben wird, Togo mit 900 MpK, Dahomey (Benin) und<br />
Ghana mit ca. 800 MpK und Lesotho mit 600 MpK.<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
Im Kapitel "Im Teufelskreis der Armut 3: Schlechte Ausbildung" schreibt der Autor im Text auf der Seite 190:<br />
Mit ungeheuren Anstrengungen trieben die Länder Afrikas... den Ausbau ihres Bildungswesens voran. Der Anstieg der<br />
Schülerzahlen in den Entwicklungsländern... zeugt davon.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 311
Auf der gleichen Seite ist eine "Weltkarte des Bildungsstandes: Analphabeten (Stand 1978)" abgebildet, die<br />
für alle Länder Afrikas einen hohen Analphabetenanteil ausweist. (Siehe dazu auch die Karte "Analphabetisie-<br />
rungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite 571 dieser Arbeit.)<br />
Seite 191 zeigt ein Foto "Sinnvoller Unterricht? - Bau von Ochsenkarren in einer afrikanischen Schule". In<br />
einer Aufgabenstellung schreibt der Autor:<br />
Man braucht vier Jahre Grundschule, um lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Ein Beispiel aus einer typischen<br />
afrikanischen Schule: Von 100 Schülern aus der 1. Klasse waren noch anwesend in der 2. Klasse: 66 Schüler, 3. Klasse: 57<br />
Schüler, 4. Klasse: 46 Schüler, 5. Klasse: 37 Schüler.<br />
(Vergleiche diese Zahlen mit den Angaben zu Nigeria für 1995 auf der Seite 298 dieser Arbeit.) Eine weitere<br />
Tabelle, die Angaben über die Zahl der Jugendlichen im schulfähigen Alter, welche die Schule besuchen<br />
macht, gibt Zahlen für 1970 und 1975 der folgenden afrikanischen Länder an: Ägypten (54, 68), Äthiopien (8,<br />
14), Kenia (38, 69), Niger (4, 10), Somalia (5, 11). Im Text schreibt der Autor (S. 191):<br />
...Nicht alles, was man an den Schulen in einem Industrieland lernt, kann man in einem Entwicklungsland auch<br />
gebrauchen. Fundula aus Sambia ist dafür ein Beispiel:<br />
"Fundula hat zwar die Schule erfolgreich beendet, doch in seinem Dorf gibt es für ihn keine Arbeit. Er kann mit dem, was<br />
er in der Schule gelernt hat, im Dorfalltag nicht viel anfangen. Er kennt jetzt zwar die Namen der britischen Könige und<br />
Königinnen (Sambia war früher eine britische Kolonie). Er kann sogar eine schwierige Multiplikationsaufgabe lösen und<br />
sich auch in Englisch einigermassen ausdrücken. Aber was er zum Leben im Dorf braucht, hat er nicht gelernt. Deshalb<br />
möchte Fundula das Dorf verlassen. Er hofft, in der fernen Stadt Arbeit zu finden. Ob er das schafft, ist ungewiss, denn<br />
Fundula ist dort einer von vielen, die Arbeit suchen."<br />
(Zu Sambia siehe auch die Seiten 161 und 375 dieser Arbeit.) Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa<br />
Thiong'o schrieb in seinem Essay "Towards a National Culture" Anfang der siebziger Jahre: "In unseren Schu-<br />
len und unseren Universitäten läuft alles darauf hinaus, dass Europa im Mittelpunkt steht." (Jestel Hrsg., 1982,<br />
S. 275) Noch schärfer kritisierte Okot p'Bitek in "Indigenous Social Ills in Africa's Cultural Revolution" die<br />
Wirkung der Schulen auf die Kultur und das Leben der von ihnen ausgebildeten Kinder und jungen Erwachse-<br />
nen und damit auf die zukünftige Bildungselite der schwarzafrikanischen Länder: "Er kommt mit seinem<br />
Lendenschurz gekleidet und mit blankem Gesäss zur Kirchenschule und hockt vor einer Nonne oder einem mit<br />
einem Kanzus bekleideten Mann, und gemeinsam schreiben sie etwas in den Sand... Abends kommt es hungrig<br />
nach Hause und die Mutter bittet das Kind, auf das Baby aufzupassen, während sie kocht... Spät abends darf<br />
das Schulkind vor der Feuerstelle beim Geschichtenerzählen dabeisein; oft muss es aber noch einige Hausauf-<br />
gaben machen. Dann liest es seltsame Geschichten über Jack, einen weissen Jungen, und Jill, ein weisses<br />
Mädchen, wie sie einen Hügel erklimmen. Es liest über Züge und Schiffe und über einen gewissen Räuber<br />
namens Robin Hood.<br />
Am Sonntagmorgen gehen sie alle in die Kirche und besingen einen gewissen Jesus. Beim Singen steht man<br />
wie angewurzelt und darf sich dabei nicht umsehen. Man darf nicht den Eindruck erwecken, dass es einem<br />
Freude machen könnte. In der Kirche gibt es keine Trommeln, und die Melodien dort sind so furchtbar lang-<br />
weilig!... Für die weitere Ausbildung geht unser Schüler in eine Grossstadt. Dort gibt es weder traditionelle<br />
Musik noch althergebrachte Tänze oder Dichtung. Ausser in den Ferien ist der junge künftige Herrscher nun<br />
gänzlich der Erziehung zur Allgemeinbildung des weissen Mannes unterworfen." (Jestel Hrsg., 1982, S. 254f.)<br />
Ende der neunziger Jahre versuchen die Schulen vieler schwarzafrikanischer Länder ihren Schülern auch das<br />
eigene Kulturerbe zu vermitteln, dabei müssen sich die Lehrkräfte aber noch allzuoft auf Schulbücher stützten,<br />
die in Europa entworfen und gedruckt wurden. Und selbst in den afrikanischen Lehrmitteln wird Europa weit<br />
stärker gewichtet, als dies beispielsweise für Afrika in den europäischen Lehrmitteln der Fall ist. (SLZ 5/98,<br />
S. 9, 10-15)<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 312
4.27.2 Band 2<br />
Der Band "Terra Geographie" für das 9. und 10. Schuljahr aus dem Jahr 1979 enthält ausser im Anhang auf<br />
den Seiten 214-219 unter dem Titel "Wie man sich über fremde Länder informiert. Beispiel Kenia", keine<br />
Angaben zu Afrika.<br />
In diesem Kapitel schreibt der Autor in der Einleitung auf der Seite 214:<br />
...Für solche kurzen "Steckbriefe" über die Staaten genügt der Atlas. Aber kannst du dir jetzt schon vorstellen, wie die<br />
Menschen dort leben, wie die Landschaft dort aussieht, was dort besonders sehenswert ist, welche <strong>Pro</strong>bleme das Land hat?<br />
Nein. Wir brauchen also weitere Informationsquellen...<br />
Einige dieser Informationsmöglichkeiten werden aufgeführt: zum Beispiel von Unterlagen aus einem Reisebü-<br />
ro schreibt der Autor auf den Seiten 214 und 215:<br />
...Nun blättert der Tourist in den <strong>Pro</strong>spekten: schöne bunte Bilder von Giraffen und Zebras, Löwen und Elefanten, von<br />
Eingeborenentänzen, von Luxushotels am Indischen Ozean, vom Sandstrand unter Palmen. Aber ist das Kenia?...<br />
Die eigene Frage aufgreifend, schreibt er weiter den Schüler auf seinen politischen Rechte und Pflichten<br />
aufmerksam machend:<br />
...Kenia ist ein Entwicklungsland - wie die meisten Staaten Afrikas. Unsere Regierung leistet Entwicklungshilfe. Das Geld<br />
dafür zahlen alle Bürger unseres Staates: Steuergelder. Wir wollen wissen, wohin unser Geld geht und welche <strong>Pro</strong>bleme in<br />
jenen Ländern gelöst werden müssen. Als politisch interessierte Bürger möchten wir mehr wissen, als in den<br />
Touristenprospekten steht.<br />
Zu den auf den Seiten 216, 218 und 219 wiedergegebenen Ausschnitten aus Nachschlagewerken und abgebil-<br />
deten Atlanten schreibt der Autor auf der Seite 217:<br />
Informationen über Staaten sind oft schon nach wenigen Jahren veraltet. Ein Beispiel : Im 1975 gedruckten Lexikon<br />
werden noch Englisch und Suaheli als amtliche Sprache angegeben. Aber schon seit 1974 ist Suaheli die einzige<br />
Amtssprache.<br />
Eine Aussage die sich auch auf die in dieser Arbeit besprochenen Lehrmittel erweitern liesse.<br />
4.27.3 Zusammenfassung<br />
Vor allem der Band 1, der zweite Band enthält nur wenige Informationen, zeichnet ein düsteres Bild Afrikas.<br />
Nicht nur ist das ausführlich vorgestellte Land Tansania, welches eine eigene Politik betreibt, auf Hilfe ange-<br />
wiesen, auch die <strong>Pro</strong>jekte der Europäer fruchten nichts wie am Beispiel eines gescheiterten Erdnussprojektes<br />
aufgezeigt wird. Noch schlechter geht es dem schwarzafrikanischen Bauer, der "in gebückter Haltung" auf<br />
seinen Feldern seine Ernte durch eine Dürre verliert, so, dass im nichts bleibt und "alles... umsonst" war. Den<br />
Hungernden kann nur eine angepasste Technik, projektiert von Europäern, helfen, doch selbst die ist zu teuer.<br />
Durch die "ungünstige Entwicklung" werden die Kinder "geschädigt", sie "verdummen" an <strong>Pro</strong>teinmangel und<br />
selbst wenn sie eine Schule besuchten können, werden sie mit dem dort gelernten Wissen "nicht viel anfangen"<br />
können. Kurz, der Schwarzafrikaner ist ein vom Schicksal gebeutelter Mensch, der nur dank der<br />
Entwicklungshilfe aus Europa überhaupt eine Überlebenschance hat.<br />
Geographielehrmittel: Terra Geographie (1979)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 313
4.28 Unser Planet (1979-1982)<br />
Mit der wachsenden Bevölkerung stieg der Landbedarf: immer mehr Land wurde nutzbar gemacht, aber die Erträge<br />
sanken. Je starker die Böden beansprucht wurden, um so geringer wurde ihre Fruchtbarkeit. Aber die Menschen mussten<br />
doch ernährt werden! Sie holzten... immer mehr Bäume ab, liessen dem Boden nicht mehr die Zeit, sich zu erholen, und<br />
bestellten ihn in ihrer Not zu früh. Dies förderte nicht nur eine verstärkte Verarmung der Nährstoffe im Boden, sondern<br />
führte auf die Dauer zu Austrocknung und Verwüstung des Landes. Der Bedarf an Brenn- und Bauholz in der ohnehin<br />
holzarmen Savanne kam hinzu. Und die gefrässigen Ziegen taten das ihre... Auch die Savannenbrände, von Bauern wie<br />
Nomaden gelegt, waren schädlich. (Bd. 2, S. 30)<br />
Das im Zeitraum 1979-1982, 608 Seiten umfassende, im Georg Westermann Verlag für die Klassen 5-10<br />
erschienene Lehrmittel "Unser Planet", beschäftigt sich in allen drei Bänden auf rund 31 Seiten mit Themen zu<br />
Schwarzafrika.<br />
Band 1, für das 5. und 6. Schuljahr, beschäftigt sich mit den "Entdeckerfahrten der Europäer ins Innere der<br />
Kontinente" und stellt die Grossräume "Wüste" und "Regenwald" vor, ein weiteres Kapitel ist den "Ölpflan-<br />
zen" gewidmet. Band 2, für das 7. und 8. Schuljahr, beschäftigt sich mit der "Ernährungslage der Weltbevölke-<br />
rung "und stellt den "Gunstraum Savanne" vor. Band 3, für das 9. und 10. Schuljahr, stellt das Entwicklungs-<br />
land "Tansania" vor und beschäftigt sich mit dem Welthandel.<br />
4.28.1 Band 1<br />
Das Kapitel "Expeditionen ins Innere der Kontinente" auf den Seiten 8-9 weiss unter der Überschrift "Quer<br />
durch den 'dunklen Erdteil'" nur wenig über die einheimische Bevölkerung zu berichten, einleitend schreibt der<br />
Autor (S. 8):<br />
Jahrhundertelang fuhren die Europäer an Afrika nur vorüber. Zwar errichtete man Stützpunkte an den Küsten für die<br />
Fahrten nach Indien und handelte hier mit Gold, Elfenbein und Negersklaven, aber das Innere Afrikas blieb weitgehend<br />
unbekannt, da ein Eindringen mit Schwierigkeiten verbunden war...<br />
Weiter schreibt der Autor auf der gleichen Seite:<br />
...dass die Eingeborenen Fremden gegenüber meist feindlich eingestellt waren, weil viele Afrikaner als Sklaven nach<br />
Amerika verschleppt wurden...<br />
...immer wieder zischten vergiftete Pfeile durch das Dickicht der Wälder.<br />
Der Hauptteil der Seite 8 beschäftigt sich nicht mit den afrikanischen Menschen, sondern mit der Expedition<br />
Stanleys von 1874-1877. Die weiteren Auswirkungen dieser Expedition werden mit den folgenden Worten<br />
zusammengefasst:<br />
Mit dem Verschwinden eines weiteren weissen Flecks auf der Landkarte beginnt der Wettlauf der europäischen Mächte,<br />
um afrikanisches Land mit seinen Reichtümern in Besitz zu nehmen.<br />
Damit wird die ganze <strong>Pro</strong>blematik der Kolonialisierung Afrikas auf die Dimension eines sportlichen Wett-<br />
kampfes reduziert. Die kolonialisierten Völker Afrikas treten nicht in Erscheinung. Diese Sichtweise wird<br />
durch die Arbeitsvorschläge am Ende des Kapitels auf der Seite 9 noch verstärkt. Dort werden die Schüler<br />
unter anderem aufgefordert, anhand der auf der gleichen Seite abgebildeten Karte herauszufinden, "welche<br />
europäischen Völker" hauptsächlich an der Erschliessung der verschiedenen Kontinente beteiligt waren".<br />
Auf der Seite 30 ist das Foto einer Afrikanerin mit Kopftuch abgebildet, die in der Bildlegende mit "Jambo!"<br />
grüsst. Auf der gleichen Seite erfährt der Leser, dass der Sudan der neuntgrösste Staat der Erde sei. Die Seiten<br />
38-45 beschäftigen sich im Kapitel "Grenzraum Trockenraum: Wüste" mit der Sahara.<br />
4.28.1.1 Grenzraum: tropischer Regenwald<br />
Im Kapitel zum tropischen Regenwald auf den Seiten 52-57 stellt der Autor dar, wie sich das Verständnis für<br />
die natürlichen Gegebenheiten in diesem Grossraum bei den Europäern gewandelt hat.<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 314
Unter der Überschrift "Grosse Hoffnung auf hohe Erträge" auf Seite 52 gibt der Autor einen Brief einer Siedle-<br />
rin in Yangambi (im Gebiet derDemokratischen Republik Kongo, ehemals Belgisch-Kongo) aus dem Jahre<br />
1895 wieder, in dem es heisst:<br />
...Übrigens haben die Afrikaner hier eine ganz seltsame Art, die Felder anzulegen. Sie scheinen auch aus dem Boden nur<br />
wenig herauszuholen...<br />
Auf Seite 53, auf welcher auch ein Foto "Feld im tropischen Regenwald" abgebildet ist, gibt der Autor unter<br />
dem Titel "Fehlschläge im Kongo" ein Interview mit einem Landschaftsexperten wieder, in dem folgende<br />
Sätze fallen:<br />
...die Bantu-Neger holen aus ihren Feldern zu wenig heraus. Ihre Anbaumethoden sind primitiv, sie kennen ja nur die<br />
Hacke oder den Grabstock. Die Ernten reichen gerade aus, um die Ernährung der Familie zu sichern. Denken Sie daran,<br />
dass die Sterblichkeit durch die Erfolge unserer Ärzte gemindert wurde. Die Bevölkerung wächst. Städte und Dörfer haben<br />
sich sehr vergrössert...<br />
...Wenn man die Ernten erhöhen will, muss man moderne Methoden anwenden: die Hacke muss durch den Pflug ersetzt<br />
werden. Und überhaupt müssen die Neger viel häufiger auf den Feldern arbeiten. Man kann doch die Pflanzen nicht sich<br />
selbst überlassen...<br />
...Das entsprechende Stück Wald wurde total gerodet, wir haben keinen Baum stehen und keine Wurzel im Boden gelassen.<br />
Dann haben wir tief gepflügt, geeggt usw. Aber das kennen Sie doch selbst aus Europa. Wir bauten Reis an oder Manjok.<br />
eine Knollenpflanze. Wir säten und pflanzten in dichten Linien. Natürlich mussten wir auch die entsprechenden<br />
Pflegemassnahmen durchführen. z. B. Jäten des Unkrauts...<br />
...Zu Beginn schienen sich unsere Erwartungen zu bestätigen. Im ersten Jahr erzielten wir eine hervorragende Ernte, ...<br />
...der Boden scheint nicht besonders fruchtbar zu sein; jedenfalls gingen die Reiserträge in drei Jahren von 2340 kg je ha<br />
auf 565 kg zurück. Und die Manjokernte verringerte sich in einem Jahr von 45 auf 30 t je ha...<br />
...Der Dünger wurde von den täglich niedergehenden Regenfällen weggespült oder verfestigte sich schnell zu wertlosen<br />
Krümeln...<br />
...Ich glaube nun, dass wir viel zuwenig wissen über das Land, über den Wald und über die Wirtschaft der Afrikaner.<br />
Interessant ist, wie im Laufe des Textes mit zunehmenden Verständnis der natürlichen Gegebenheiten der<br />
"Neger" zum "Afrikaner" wird. Hier wird also gewissermassen innerhalb weniger Zeilen eine Veränderung des<br />
Bildes des Schwarzafrikaners vollzogen.<br />
Auf den Seiten 54 und 55 liefert der Autor unter den beiden Titeln "Grüne Nacht am hellen Tag" und "Der<br />
Regenwald lebt von sich selbst" einige Hintergrundinformationen zur Ökologie des Regenwaldes, bevor er im<br />
Kapitel "Ackerbau der Anpassung" auf den Seiten 56-57 die Landwirtschaft der einheimischen Bevölkerung<br />
unter dem Titel "Arbeitskalender im Masolesytem" beschreibt. Der Text, der hier in voller Länge wiedergege-<br />
ben werden soll, wird durch die Fotos "Brandrodung" und "Bestelltes Feld der Bantus" auf der Seite 56 und<br />
dem Foto "Verlassene Rodungsinsel" und der Graphik "Rodungsinseln im Regenwald" illustriert. Im Text<br />
heisst es auf den Seiten 56f.:<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
1. Rodung des Waldes<br />
Die Bantus wählen ein Waldstück aus, das für den Anbau gerodet werden muss. In der grünen Nacht des Regenwaldes<br />
würde ja keine Feldpflanze gedeihen können. Die Rodung ist gemeinsame Arbeit der Männer und sehr mühsam. Man muss<br />
bedenken, dass der Regenwald "Grüne Hölle" genannt wird. Jede, auch die kleinste Bewegung strengt an und treibt den<br />
Schweiss auf die Stirn. Schon gegen 8.00 Uhr zeigt das Thermometer 23 °C. Den ganzen Vormittag über ist die<br />
Sonneneinstrahlung stark. Ab 14.00 Uhr kommen Gewitter auf und ungeheure Regengüsse prasseln herab. Dann ist es die<br />
Nacht hindurch nass, neblig und schwül. Die grösseren Bäume werden oft weit über dem Boden gefällt: es würde zuviel<br />
Mühe kosten, die breit ausladenden Brettwurzeln wegzuschlagen. Manche Bäume lässt man stehen, und die Baumstümpfe<br />
werden nicht herausgerissen. So erhält man sich Schattenbäume, die auch den herabprasselnden Regen etwas abfangen.<br />
Eine vollständige Rodung ist auch deshalb nicht nötig, weil man den Boden nur mit der Hacke, nicht mit dem Pflug<br />
bearbeitet.<br />
2. Verbrennen der Zweige und Äste<br />
Das Gewirr der Zweige und Äste und Stämme wird im Winter, also zur Zeit der geringeren Niederschläge angezündet. In<br />
regenreicheren Monaten hätte man Mühe, überhaupt ein Feuer zu legen. Nach der Brandrodung bietet sich das Bild einer<br />
schwarzen, unordentlichen Fläche, die sich scharf vom benachbarten Regenwald abhebt. Die Asche dient als<br />
willkommener Dünger für den armen Boden .<br />
3. Bestellung des Feldes<br />
Die Frauen bestellen die Felder nach dem Abbrennen der Stämme und Zweige, also Ende Februar. Der Boden wird nicht<br />
bearbeitet: kein Pflügen, Eggen oder Walzen. Die täglichen Regengüsse würden sonst den Boden wegspülen. Mit dem<br />
Grabstock oder der Hacke gräbt man Saat- oder Pflanzlöcher für Mais und Manjok. Man sät z. B. zuerst den Mais, pflanzt<br />
einige Zeit später die Manjokstecklinge, und Wochen danach werden die Bananen gepflanzt. Dabei wächst alles<br />
durcheinander (Mischanbau). Es gibt also nur ein Feld, nicht etwa ein Maisfeld, ein Manjokfeld und ein Bananenfeld .<br />
4. Pflege und Ernte<br />
Eine Pflege gibt es nicht: kein Unkrautjäten, kein Hacken. Über die jungen Maispflanzen breiten sich bald die Blätter des<br />
Manjoks und dann folgt mit den Blättern der Banane das nächste "Stockwerk" des Mischanbaus. So spenden sich die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 315
Pflanzen gegenseitig Schatten, und die Regengüsse prasseln nicht direkt auf den Boden. Die Reifezeit der einzelnen<br />
Früchte ist unterschiedlich, so dass sich die Ernte in die Länge zieht. Eine besonders lange Reifezeit hat der Manjok: bis zu<br />
einem Jahr. Andere Knollenpflanzen kann man schon nach sieben Monaten ausgraben. Reis, Mais und die anderen<br />
Früchte, wie Kürbis und Bohne, kann man sogar zweimal im Jahr ernten.<br />
5. Verlegung des Dorfes<br />
Nach zwei bis drei Jahren lässt die Bodenfruchtbarkeit nach, und das Feld muss verlassen werden. Der Wald wächst<br />
ziemlich schnell nach, denn die Rodung hatte einige Bäume verschont. Aus deren Samen und aus den Trieben der<br />
Wurzelstöcke entwickelt sich ein neuer Wald. Da das oberste Stockwerk fehlt und das Licht bis zum Boden durchdringt,<br />
entsteht ein dichterer Unterwuchs im nachwachsenden Wald, den man Sekundärwald nennt. Bis sich der ursprüngliche<br />
dunkle Regenwald (Primärwald oder Urwald) erneuert hat, vergehen über hundert Jahre. Die Bantus roden ein neues Stück<br />
Wald. Aber nach und nach liegen die Rodungsinseln immer weiter vom Dorf entfernt. Wenn die Strecke zu gross wird,<br />
verlegt man auch die ganze Siedlung.<br />
Zwar gibt der Autor hier eine detaillierte Schilderung der "shifting cultivation" oder des "Brandrodungswan-<br />
derhackbau" wieder, über die diese Landwirtschaftsform pflegende Menschen weiss er aber wenig zu berich-<br />
ten. So entsteht dann der Eindruck einer zwar der Natur angepassten aber materiell und spirituell ärmlichen<br />
Lebensweise, die der Bevölkerung gerade das tägliche Leben ermöglicht.<br />
4.28.1.2 Ölpalmen<br />
Im letzten Kapitel des Bandes 1 "Ölpflanzen aus aller Welt versorgen uns" auf den Seiten 96-97 gibt der Autor<br />
einen Ausschnitt aus einer Schulfunksendung des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1977 unter dem<br />
Titel "Ernten ohne zu klettern" wieder:<br />
...Wir sind im Hafen von Abidjan, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes Elfenbeinküste. Abidjan gilt als einer der<br />
verkehrsreichsten und "schnellsten" Häfen Westafrikas, weil in Abidjan die Schiffe höchstens ein paar Tage liegen müssen,<br />
bevor die Fracht be- und entladen ist... Auf Förderbändern oder mit Kränen rollen oder schweben Kisten und Ballen an uns<br />
vorbei oder über uns hinweg. Fässer mit Palmöl werden verladen, bestimmt für die Margarinefabriken in Europa. Während<br />
ich dem Verladen zuschaue, denke ich an einen Besuch auf einer jener "Palm-Farmen", wie sie sich heute den ganzen<br />
feuchtwarmen Küstenstreifen der Elfenbeinküste entlangziehen. Vor 15 Jahren verkaufte dieses Land noch kein einziges<br />
Fass Palmöl. Was mir der Verwalter über die Entstehung dieser Plantagen erzählte, war zusammengefasst - dies:<br />
"...Was wir brauchten, war ein <strong>Pro</strong>dukt, das wir aus dem Lande selbst entwickeln konnten. Wir wussten in den Kernen der<br />
Ölpalmfrüchte sitzt ein wertvolles Öl. Aber diese Palmen waren so hoch wie drei Häuser. Es war schwer, ja<br />
lebensgefährlich, die Früchte zu ernten... Wir haben uns gesagt: Wir müssen eine andere Art von Palmen züchten. Unser<br />
landwirtschaftliches Institut in Bouake hat jahrelange Versuche gemacht: gleich gute Früchte, aber niedrigerer Stamm. Eine<br />
Palme, bei der ein Mann die Früchte im Stehen abernten, 50 oder 100 Bündel Ölfrüchte am Tag einfach mit dem<br />
Haumesser abhauen kann. Niemand glaubte an das Unternehmen. Es waren Gelder aus Europa, die uns den Anfang<br />
ermöglichten...<br />
Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel wird hier der Eindruck einer gewissen Initiative vermittelt, doch kam<br />
auch hier der Anstoss, bzw. die Gelder, die den Anfang ermöglichten, von ausserhalb des Kontinents.<br />
Das Interview wird mit einer Karte "Ölplantagen in Westafrika" und der Abbildung verschiedener Briefmarken<br />
zum Thema, sowie einer "Hochstämmigen Ölpalme" illustriert. Auf der Seite 97 schildert der Autor unter dem<br />
Titel "Öl- und Kokospalme - Ölpflanzen der heissen Zonen" den Unterschied zwischen diesen für Afrikas<br />
Tropen wichtigen Nutzpflanzen. Zur Nutzung der Kokosnuss schreibt der Autor:<br />
...Für die Ölgewinnung wird das Fruchtfleisch getrocknet. Man nennt es dann Kopra: aus ihr wird das Öl später<br />
herausgepresst. Auch die Faser- und die Steinschicht nutzen die Einheimischen z. B. für die Herstellung von Kokosmatten<br />
und Schüsseln.<br />
Auf den weiteren Seiten des Bandes wird Afrika nur noch punktuell erwähnt, so z. B in einer Tabelle "Wichti-<br />
ge Industrieregionen in der Welt" auf der Seite 124, in der es heisst:<br />
Afrikas grosse Städte: Aufbau einer vielseitigen Industrie zur Versorgung der Bevölkerung mit Verbrauchsgütern;<br />
Bemühen um industrielle Verarbeitung heimischer Rohstoffe, die meist noch in die Industrieländer ausgeführt werden.<br />
Auf einer Karte "Grossstädte der Erde" erscheinen nur 6 Städte in Afrika, wovon eine in Schwarzafrika liegt.<br />
Die anderen befinden sich in Südafrika oder dem Grossraum Nordafrika.<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 316
4.28.2 Band 2<br />
Der Band 2 zeigt auf der Seite 8 eine Karte zur "Ernährungslage der Weltbevölkerung", die vor allem Afrika<br />
als "Hungergebiet" ausweist. (Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 311 und 344 dieser<br />
Arbeit.) Im Text dazu schreibt der Autor:<br />
Jedes Jahr konsumieren Amerikaner fast das Doppelte der tansanischen Getreideversorgung in alkoholischen Getränken.<br />
1975 verfütterten sie fünfmal soviel Eiweiss an Katzen und Hunde, wie die Bewohner Tansanias (Staat in Ostafrika) es<br />
benötigt hätten.<br />
Wie schon im Lehrmittel "Dreimal um die Erde" von 1977-1980, nachdem die Menschen "in den Slums der<br />
Grossstädte... schlechter als bei uns die Haustiere untergebracht sind..." (Bd. 3, S. 106), sagt der Text aus, dass<br />
manche Schwarzafrikaner, hier die Tansanier, nicht "auf den Hund gekommen" sind, sondern ihr Lebensstan-<br />
dard noch tiefer liegt.<br />
4.28.2.1 Die Sahelzone<br />
Das Kapitel zur Savanne beschäftigt sich auf den Seiten 24-25 unter dem Titel "Zum Beispiel Mali" und 30-31<br />
unter "Gunstraum Savanne - Klimatyrannei oder falsche Wirtschaftsweise" mit für diese Arbeit relevanten<br />
Themen.<br />
Auf der Seite 24 schreibt der Autor zum "Beispiel Mali" unter der Überschrift "Schlüsselwort 'Wasser'":<br />
...Die Staaten in den nördlichen Savannen Afrikas nahe der Wüste sind die sogenannten Sahel-Länder. Sie reichen von<br />
Mauretanien bis Sudan und zählen zu den ärmsten Staaten der Erde.<br />
1972/73 wurden sie von einer sehr schweren Dürrekatastrophe betroffen. 250'000 Menschen starben, fast die Hälfte des<br />
Viehs verhungerte, zahllose Nomaden und Bauern verliessen fluchtartig ihre alten Lebensräume. Die Katastrophe wurde<br />
ausgelöst durch ein mehrjähriges Ausbleiben des Regens...<br />
Aber auch in normalen Jahren ist "Wasser" das Schlüsselwort. Die jährliche Regenmenge würde vielerorts für den Feldbau<br />
ausreichen, wenn sich die Niederschläge nicht auf wenige Monate konzentrierten. Je weiter wir nach Norden kommen, um<br />
so mehr verringern sich die Regentage, und um so unsicherer werden die Niederschläge. Wichtig für die Landnutzung ist<br />
die Trockengrenze. Sie liegt dort, wo sich die Regenfälle auf 3-4 Monate verteilen und nur 400 mm/Jahr erreichen.<br />
Nördlich dieser Grenze ist Feldbau nur bei künstlicher Bewässerung möglich. Auf eine weitere Grenze stossen wir<br />
äquatorwärts, also im Süden. Hier ist es feuchter, die Niederschlage liegen höher und fallen zuverlässiger. Dies begünstigt<br />
die Ausbreitung der Tse-Tse-Fliege, die eine gefährliche Viehseuche überträgt, wodurch Grossviehhaltung unmöglich<br />
wird. Wegen der höheren Niederschläge sind die Böden nicht so fruchtbar wie im Norden. Aber was nutzt ein besserer<br />
Boden im Norden angesichts der Trockenheit?<br />
"As-sahil" ist der arabische Begriff für Ufer, Gestade, Küstenregion. Nach der im "Weissbuch Afrika" auf der<br />
Seite 214 abgedruckten Definition erstreckt sich der sahelische Kernraum "über eine Distanz von 5'500 km<br />
vom Senegal bis an die Rotmeerküste Äthiopiens; seine durchschnittliche Breite macht 420 km aus; damit<br />
beträgt seine Gesamtfläche schätzungsweise 2.32 Mio. km 2 ". Wogegen die Sahelfläche der im "Unser Planet"<br />
genannten Sahelländer rund 2.14 Mio. km 2 beträgt (Äthiopien nicht miteingerechnet). Von den anderen<br />
Gebietsanteilen entfallen 4.27 Mio. km 2 auf die Wüste und 1.39 km 2 auf feuchtere Regionen. Mali, Maureta-<br />
nien, Niger und Tschad weisen keine nennenswerten Flächen in feuchteren Regionen auf. (Michler 1991,<br />
S. 214-215).<br />
Unter der Überschrift "Nomaden im Norden" schreibt der Autor auf Seite 24:<br />
...Mit dem Ende der Regenzeit ziehen die Hirten nach Süden. Sie überschreiten die Trockengrenze und gelangen in Gebiete<br />
schwarzer Ackerbauern die nur teilweise selbst Vieh halten. Manchmal ziehen die Nomaden bis weit in die feuchteren<br />
Gebiete... Auf ihrer Südreise tauschen sie tierische <strong>Pro</strong>dukte (Milch. Fleisch) gegen Hirse oder Maniok. Der Mist ihrer<br />
Tiere ist für die Bauern ein willkommener Dünger. Die Rückwanderung beginnt, wenn die Regenzeit in die nördlichen<br />
Zonen zurückkehrt.<br />
Diese Wanderungen wurden durch die von den Kolonialmächte gezogenen Staatsgrenzen teilweise stark einge-<br />
grenzt. Auf der Seite 25 schreibt der Autor unter der Überschrift "Bauern im Süden":<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Der Bauer ist im Gegensatz zum Nomaden an seine Felder gefesselt. Die unregelmässigen Regenfälle treffen ihn härter.<br />
Die Anbauzeit ist kurz nach der Ernte beginnt die endlos lange Zeit der Dürre, und die Bauern warten auf den nächsten<br />
Regen. Man baut hauptsächlich Hirse an. Sie hat eine kurze Wachstumszeit, und ihre kleine Wurzeltiefe ist der geringen<br />
Bodendurchfeuchtung angepasst. Für die regenlose Zeit muss man sich Reserven schaffen; so wird die Hirse in<br />
Vorratshäusern gesammelt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 317
Michler schreibt dazu im "Weissbuch Afrika", dass die Bauern während der Kolonialzeit durch die ihnen<br />
aufgezwungenen Zwangsarbeiten teilweise nicht mehr in der Lage waren, ihre Getreidespeicher zu füllen und<br />
dass schon damals Nahrungsmittel importiert worden seien. Weiter schreibt Michler der "...Ackerbau im<br />
Bereich von 200 mm mit einer Niederschlagsvariabilität von 40% muss immer wieder zu Einbrüchen in der<br />
Selbstversorgung führen, es sei denn, die Bauern würden entsprechende Vorratslager für mindestens sieben<br />
Jahre anlegen, was früher offensichtlich der Fall gewesen ist." Aus Burkina Faso liegen Michler Berichte vor,<br />
dass es "traditionell verboten war, Getreide zu verzehren, das noch nicht drei Jahre lang gelagert war...".<br />
(Michler 1991, S. 209-212, 218)<br />
Im Text fährt der Autor mit einer Beschreibung des Brandrodungsanbaus fort (S. 25):<br />
Die Felder werden für den Anbau durch Brandrodung (shifting cultivation) vorbereitet. Nach wenigen Jahren ist der Boden<br />
erschöpft, und die Felder werden verlegt. Alles hängt vom Regen ab. In schlimmen Dürrezeiten bleibt er aus. Dann<br />
schlagen die Aussaatversuche fehl, die Reserven gehen zu Ende. und der Bauer ist gezwungen, sein Saatgetreide zu<br />
verzehren. Aber auch in normalen Jahren fällt der Regen oft zur falschen Zeit. Sturzregen schwemmen den Boden fort.<br />
Und in der Dürre ist es der Wind, der die Bodenteilchen wegführt. Günstige, aber nur sehr wenige Ausnahmegebiete<br />
befinden sich in der Nähe von Flüssen, die eine künstliche Bewässerung (d. h. Dauerfeldbau) erlauben. Die Flussquellen<br />
liegen im feuchten Süden. weshalb Senegal und Niger ganzjährig Wasser führen. Unterhalb Bamako hat man Staudämme<br />
und Kanalsysteme geschaffen, wo Reis, Baumwolle und Erdnüsse angebaut werden. Früher floss das Wasser, das zu<br />
grossen Überschwemmungen führte, nutzlos ab. Wie wertvoll ist dieses Wasser, wenn man bedenkt, dass über sieben<br />
Monate lang kein Regen fällt. Im Süden Malis (und auch der übrigen Staaten) kann der Bauer mit regelmässigen und<br />
höheren Regenfällen rechnen. Für manche Pflanzen (z. B. Baumwolle) ist das Klima vielerorts sogar zu feucht. Deshalb<br />
treffen wir hier auf Kulturpflanzen, die wir aus dem Regenwald kennen: Maniok, Banane, Mais usw. Der Boden ist langer<br />
durchfeuchtet, auch in der Trockenzeit bleiben die tiefen Schichten nass, so dass die Wurzeln und Knollen nicht<br />
austrocknen. Wie im Regenwald und bei den Bauern in der trockeneren Zone praktiziert man shifting cultivation mit der<br />
Hacke.<br />
Im zweiten Teil zur Savanne geht der Autor unter dem Titel "Gunstraum Savanne - Klimatyrannei oder falsche<br />
Wirtschaftsweise?" auf die <strong>Pro</strong>bleme der Bewirtschaftung der Sahelzone ein. Zum "Vorrücken der Wüste"<br />
schreibt er (S. 30):<br />
Angesichts der ärmlichen Verhältnisse in den Savannenländern, der schwankenden Klimaverhältnisse und der<br />
katastrophalen Dürre von 1972/ 73 wagt man fast gar nicht die Frage zu stellen, ob die Savannen Gunsträume für das<br />
Leben der Menschen darstellen. Im Vergleich zu Regenwald und Wüste, den lebensfeindlichen Zonen im Süden und<br />
Norden, sind die Savannen aber doch die günstigeren Lebensräume. Hier gibt es grosse Viehherden, die<br />
Bevölkerungsdichte ist grösser, die Zahl der Einwohner höher. Auch das Klima ist trotz aller Hemmnisse für eine<br />
Viehzucht- und Ackernutzung vorteilhafter. Man glaubt sogar, dass der Ursprung des Menschen in den Savannen liegt. In<br />
der halbtrockenen bis trockenen Zone der Dorn- und Trockensavanne spricht man von der Tyrannei des Klimas, d. h. von<br />
übergrosser Klimabelastung. Man meint sogar, ein Vordringen der Wüste nach Süden festzustellen. Da man dies weltweit<br />
beobachtet, glaubte man anfänglich an eine Klimaänderung. Aber heute wissen wir, dass falsche Methoden der<br />
Viehhaltung und des Feldbaus, Anstieg der Bevölkerung und nicht angepasster Einsatz der Technik verantwortlich sind...<br />
Das Vorrücken der Wüste nach Süden geschieht nicht auf ganzer Länge, sondern ist eher die Ausnahme. Viel-<br />
mehr verwüsten gewisse Gebiete durch die dauernde Überbeanspruchung und können sich nicht mehr regene-<br />
rieren. Dadurch entsteht ein Flickenteppich nicht mehr nutzbarer Gebiete. Davon zu unterscheiden sind Gebie-<br />
te, die aufgrund von Trockenheit zeitweilig verwüsten, und die sich bei genügend Niederschlag innert kürzer<br />
Zeit regenerieren.<br />
Entgegen der Aussage im Text gibt es auch Anzeichen für eine längerfristige Klimaveränderung. Im Gebiet<br />
des Sahel, die nicht eindeutig erklärbar sind. So war z. B. der Tschadsee noch in historischer Zeit wesentlich<br />
grösser als heute. (Geo 12/1986, S. 136f.)<br />
Unter dem Titel "Überstockung und Überweidung" geht der Autor auf der Seite 30 auf Ursachen der Desertifi-<br />
kation ein, wie das Phänomen der Verwüstung auch bezeichnet wird:<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
In den letzten 30-40 Jahren hat sich die Bevölkerung der Savannenländer verdoppelt. Die Zahl der Nomadentiere ist noch<br />
viel rascher angewachsen, seit europäische Tierärzte die Viehseuchen bekämpften. Allerdings ist weder die Qualität noch<br />
die Grösse der Weidegebiete mitgewachsen. Zuviel Vieh musste mit immer weniger Weide auskommen (Überstockung).<br />
Es kam noch hinzu, dass man die Ackerbaugebiete nach Norden ausgedehnt hatte, so dass die Nomaden in die noch<br />
trockeneren Gebiete zurückweichen mussten, Die alte Gewohnheit. wegen der grossen normalen Tierverluste so viel Vieh<br />
wie möglich zu halten, wurde beibehalten, um hohes Ansehen zu geniessen, und dies, obwohl die Tiermedizin viele<br />
Krankheiten besiegt hatte. So kam es zur Überweidung grosser Gebiete. Eine Folge ist die gefährliche Verbuschung: starke<br />
Viehherden fressen alles kahl, nur Dornsträucher bleiben zurück. Sie vermehren sich rasch und machen die Weide wertlos.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 318
Auf der anderen Seite führte die Anlage von immer mehr Brunnen zur Verwüstung. Man hatte die Brunnen auf den<br />
Wanderwegen der Nomaden eingerichtet. Nun wurden sie von den rasch anwachsenden Herden umlagert. Die Tiere<br />
zertrampelten den Boden, frassen die Umgebung kahl, so dass sich Ödlandringe um die Wasserstellen bildeten, die sich<br />
immer weiter ausdehnten. Der Boden wurde verdichtet, das Wasser konnte kaum versickern. Es floss oberflächlich ab,<br />
wodurch der Grundwasserspiegel absank. Das Land vertrocknete. Die Wege zu den Brunnen wurden weiter und weiter.<br />
Und als die Dürre kam, sind die meisten Tiere verhungert, nicht verdurstet.<br />
Rückblickend hat sich der ehemals als Pioniertat gedachte Brunnenbau als für die Ökologie des Gebietes<br />
wenig positiv erwiesen. Auch die anderen vom Autor genannten Gründe tragen alle mit zur Verschärfung der<br />
<strong>Pro</strong>blematik bei. Trotz dieser <strong>Pro</strong>bleme stellt Michler die Ernährungsgrundlage der Sahelstaaten nicht grund-<br />
sätzlich in Frage: "...In normalen Jahren können sich die Sahel-Staaten ohne Nahrungsmittelimporte selbst<br />
ernähren. Wenn es dennoch zu Versorgungsengpässen kommt, dann sind diese regional begrenzt und in erster<br />
Linie das Ergebnis einer nicht funktionierenden Verteilung...." (Michler 1991, S. 228)<br />
Zur Verlagerung der Anbaugebiete der sesshaften Bauern nach Norden heisst es in Band 2 von "Unser Planet"<br />
unter dem Titel "Nicht angepasster Feldbau" weiter (S. 30f.):<br />
Mit der wachsenden Bevölkerung stieg der Landbedarf: immer mehr Land wurde nutzbar gemacht, aber die Erträge<br />
sanken. Je starker die Böden beansprucht wurden, um so geringer wurde ihre Fruchtbarkeit. Aber die Menschen mussten<br />
doch ernährt werden! Sie holzten (auch in der Feuchtsavanne) immer mehr Bäume ab, liessen dem Boden nicht mehr die<br />
Zeit, sich zu erholen, und bestellten ihn in ihrer Not zu früh. Dies förderte nicht nur eine verstärkte Verarmung der<br />
Nährstoffe im Boden, sondern führte auf die Dauer zu Austrocknung und Verwüstung des Landes. Der Bedarf an Brennund<br />
Bauholz in der ohnehin holzarmen Savanne kam hinzu. Und die gefrässigen Ziegen taten das ihre: sie kletterten auf die<br />
Bäume, frassen nicht nur Blätter, sondern auch dünne Äste. Auch die Savannenbrände, von Bauern wie Nomaden gelegt,<br />
waren schädlich.<br />
(Siehe dazu auch das Schema "Bevölkerungszunahme und Brennholzbedarf" auf der Seite 334 dieser Arbeit.)<br />
Die durch die Brandrodung entstehenden Veränderungen ansprechend, schreibt der Autor (S. 31):<br />
Solange nur kleine Felder im alten System der shifting cultivation (Brandrodungsfeldbau) angelegt wurden, blieb die Natur<br />
im Gleichgewicht. Das Feld wurde erst dann wieder genutzt, wenn sich Boden und Vegetation erholt hatten. Bäume und<br />
Sträucher halten den Boden fest und erhöhen die Bodenfruchtbarkeit durch Humusnachschub. Übermässiger Anbau aber<br />
führt zu Verödung. Der Wind treibt den Boden fort. und die Erde wird steinhart, wasserlos und überhitzt. Fast überall in der<br />
Savanne trifft man auf baumlose, unfruchtbare Sandstreifen rings um die Dörfer, die sich wie Geschwüre weiter ausbreiten.<br />
Die Bauern hatten den Anbau von Hirse auch deshalb ausgedehnt, weil das Bewässerungsland an den Flüssen stark<br />
erweitert wurde. Hier werden Pflanzen angebaut (z. B. Baumwolle, Erdnuss), die ins Ausland exportiert werden. Sie dienen<br />
nicht der Eigenversorgung - verständlich, dass die anwachsende Bevölkerung auf eine grössere Anbaufläche für Hirse<br />
angewiesen war.<br />
Michler berechnete, dass sich auf den Flächen, die im Sahel für die Baumwoll- und Erdnussexporte verwendet<br />
werden, rund 1.2 Mio. Tonnen Getreide anbauen liessen, womit zusätzlich ca. 7 Millionen Menschen ernährt<br />
werden könnten. Trotzdem ist er der Meinung, dass die "auftretenden Versorgungsengpässe nicht primär durch<br />
dieses Faktum bedingt, sondern mehr durch eine verfehlte Landwirtschaftspolitik (z. B. zu niedrige Aufkauf-<br />
preise) und eine nicht funktionierende Verteilung." Nach seiner Aussage wären die betroffenen Staaten in der<br />
Lage sich trotz des Exportes landwirtschaftlicher <strong>Pro</strong>dukte selbst zu ernähren, wenn sie ihr Potential besser<br />
nutzen würden. (Michler 1991, S. 229, 232) Der Autor fährt auf der Seite 31 fort:<br />
Überhaupt bleibt die Ausdehnung des Bewässerungslandes gefährlich. Viele Bewässerungsvorhaben sind gescheitert, weil<br />
der Boden wegen der hohen Verdunstung Versalzungsschäden erleidet. Je mehr Wasser verdunstet, um so starker erhöht<br />
sich der Salzgehalt im Boden, der eine weitere Nutzung unmöglich macht Auch der Staudammbau ist in trockenen<br />
Gebieten problematisch. Wegen der Ebenheit der Savanne und der nur wenig eingetieften Täler müssen die Dämme sehr<br />
lang sein. Die Staufläche wird riesig gross. Auf einer grossen Wasseroberfläche kann aber mehr Wasser verdunsten. Es<br />
geht verloren, bevor es die Felder erreicht. Stauseen erhöhen den Grundwasserspiegel, wodurch wiederum die<br />
Bodenversalzung gefördert wird. Schliesslich führt die unregelmässige Wasserführung der Flüsse zu Engpässen in der<br />
Wasserversorgung.<br />
Ein zusätzliches <strong>Pro</strong>blem liegt darin, dass die Wasserreserven der Region knapp bemessen sind. So hat z. B.<br />
der höhere Wasserverbrauch aus dem Volta in Burkina Faso dazu geführt, dass in Ghana der Pegel des Stau-<br />
sees absank, was wiederum zu einem Strommangel in den Ländern Ghana, Togo und Benin führte. (Zum<br />
Voltastaudamm siehe auch die Seite 227 dieser Arbeit.) Zur Lösung des <strong>Pro</strong>blems macht der Autor auf der<br />
Seite 31 folgende Vorschläge:<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 319
Insgesamt wird man sagen müssen, dass alle Nutzung in der Savanne den natürlichen Bedingungen Rechnung tragen muss.<br />
Man darf die Natur nicht überlasten. Zu vermeiden sind unkontrollierte Formen der Bewirtschaftung, z B. übergrosse<br />
Herden, Häufung des Viehs in Brunnennähe, mangelnde Bodenpflege usw...<br />
Diese Forderungen decken sich mit denen anderer Autoren. Wie bereits in den vorherigen Kapiteln geht der<br />
Autor zwar auf die Wirtschaftsform der Menschen ein, weiss aber sonst über die Kultur und Lebensweise der<br />
Bewohner der beschriebenen Grossregionen nichts zu sagen.<br />
4.28.2.2 Prüfkompass<br />
Unter dem Titel "Stellungsnahmen aus unterschiedlichen Regionen der Welt" findet sich auf der Seite 116<br />
auch eine Tabelle mit Grunddaten zum Bevölkerungswachstum, Lebenserwartung usw., in der auch der Staat<br />
Sudan aufgeführt wird. Als Anleitung zur selbständigen Weiterarbeit mit statistischen Daten anderer Länder<br />
kann der auf der Seite 117 abgebildete "Prüfkompass" dienen, der hier in vereinfachter Form wiedergegeben<br />
wird:<br />
Lebenserwartung<br />
(Jahre)<br />
ohne<br />
Schulbildung<br />
%<br />
1 Arzt auf<br />
... Einwohner<br />
Bevölkerungswachstum<br />
in<br />
<strong>Pro</strong>mille<br />
Ernährungslage<br />
Vorrat an<br />
Energiestoffen<br />
und Erzen<br />
Energieverbrauch<br />
in kg<br />
SKE<br />
Erwerbstätige<br />
in der Landwirtschaft<br />
Zusätzlich werden die Menschenrechte in vereinfachter Form zitiert. Weitere Informationen die Menschen<br />
Schwarzafrikas betreffend enthält der zweite Band nicht.<br />
4.28.3 Band 3<br />
Ausser in den beiden grossen Kapiteln zu Tansania und dem Welthandel finden sich zwei weitere Stellen zu<br />
Afrika im Band 3 des Lehrmittels "Unser Planet". Seite 155 zeigt eine Grafik "Ernährung - Weltproblem<br />
Nr. 1", aus der hervorgeht, dass die Ernährung der Menschen in Afrika 80% des Kalorienbedarfs und 70% des<br />
Eiweissbedarfs deckt. Ausserdem wird ausgesagt, dass in Afrika nur 43% der vorhandenen ackerbaulichen<br />
Fläche genutzt werde. Seite 168 zeigt ein Foto von "Holzsammlerinnen". In vielen Gesellschaften Afrikas ist<br />
das Holzsammeln traditionell Aufgabe der Frauen und Mädchen.<br />
4.28.3.1 Tansania<br />
Seite 177 widmet sich unter dem Titel "Tansania - Entwicklung durch Ujamaa" dem in diesem Land in den<br />
sechziger bis achtziger Jahren praktizierten afrikanischen Sozialismus. In einem ersten Abschnitt, der hier<br />
ungekürzt abgedruckt wird, gibt der Autor einen Auszug aus der "Arusha-Erklärung" von 1967 wieder<br />
(S. 177):<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Wir stehen im Kampf..., unsere Nation aus dem Zustand der Schwäche herauszuholen und in einen Zustand der Stärke zu<br />
versetzen. Aber wir haben die falsche Waffe gewählt, das Geld. Der Fortschritt eines Landes wird von den Menschen und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 320
nicht durch das Geld herbeigeführt. Der Fortschritt wird von der Landwirtschaft gebracht... Seine Bedingungen sind<br />
Einsatz und Wissen. Eine grosse Hacke anstelle einer kleinen Hacke zu benutzen; Dünger zu benutzen anstelle des blossen<br />
Bodens..., um grössere Ernten zu bewirken. Das Volk hat durch seinen eigenen Einsatz... sehr viel Fortschrittspläne auf<br />
dem Land verwirklicht. Sie haben Schulen, Krankenstationen... gebaut, sie haben Brunnen, Wassergräben und Teiche<br />
ausgehoben, sie haben Strassen und Viehschwemmen angelegt, um sich den Fortschritt selbst in verschiedener Form zu<br />
bringen..." (Julius Nyerere, seit 1964 Präsident von Tansania)<br />
Mittel zum Fortschritt Tansanias durch die Landwirtschaft sollte Ujamaa (u:dschamá) sein. Vielleicht zu übersetzen mit<br />
"Brüderlichkeit" oder "Geist der afrikanischen Grossfamilie", will Ujamaa die alten Lebensformen in Afrika vor der<br />
Kolonialzeit wieder aufgreifen. "Ein Ujamaa-Dorf ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen... und kein Beamter<br />
kann den Mitgliedern vorschreiben, was sie gemeinsam oder was sie weiterhin als Einzelbauern tun sollen." (Nyerere)<br />
Das Kisuahili-Wort "Ujamaa" lässt sich am besten mit "in der Lebensform der traditionellen vorkolonialen<br />
Grossfamilie zusammenleben, miteinander und füreinander arbeiten." übersetzen. "Diese Lebensform soll die<br />
Grundlage für den Aufbau einer egalitären Gesellschaft bilden." (Engelhard 1994, S. 183)<br />
Als wesentliche Punkte der "Arusha-Declaration" führt Engelhard im "Länderprofil: Tansania" nach Nyerere<br />
(1968) auf (Engelhard, 1994 S. 181):<br />
"1. Alle Menschen sind gleich; jedem Menschen kommt Würde zu.<br />
2. Jeder Bürger ist ein Teil der Nation und hat das gleiche Recht, an der Regierung auf lokaler, regionaler und<br />
nationaler Ebene teilzunehmen.<br />
3. Jeder Bürger besitzt das Recht der freien Meinungsäusserung, der Bewegungsfreiheit, der Glaubens- und<br />
der Versammlungsfreiheit innerhalb der bestehenden Gesetze.<br />
4. Jeder einzelne hat das Recht auf Schutz seines Lebens und Eigentums - sofern es rechtmässig erworben ist<br />
- durch die Gesellschaft.<br />
5. Jeder Mensch hat Anspruch auf gerechte Bezahlung seiner Arbeit.<br />
6. Alle Bürger besitzen die natürlichen Ressourcen des Landes gemeinsam, treuhänderisch für ihre<br />
Nachkommen.<br />
7. Der Staat muss volle Verfügungsgewalt über die wichtigsten <strong>Pro</strong>duktionsmittel haben, um wirtschaftliche<br />
Gerechtigkeit sicherzustellen.<br />
8. Es liegt in der Verantwortung des Staates, in das Wirtschaftsleben der Nation aktiv einzugreifen, um das<br />
Wohlergehen aller Bürger sicherzustellen und zu verhindern, dass ein Mensch einen anderen oder eine<br />
Gruppe eine andere ausbeutet und um zu verhindern, dass Reichtum in einem Masse angehäuft wird, der<br />
nicht mit der Existenz einer klassenlosen Gesellschaft vereinbar ist."<br />
Unter dem Titel "Tansania heute - die harte Wirklichkeit" beschreibt der Autor von "Unser Planet" die Umset-<br />
zung und Folgen der Reformbemühungen (S. 177):<br />
Die ersten Ujamaa-Dorfgründungen mit gemeinsamem Landbesitz und gemeinsamer Arbeit, auf die sich Nyereres Vision<br />
einer eigenen Entwicklung stützte, waren erfolgreich. Um die Idee voranzutreiben, wurde aber immer mehr Zwang zum<br />
Zusammenschluss ausgeübt. Inzwischen ist nach offiziellen Angaben fast die gesamte Bevölkerung Tansanias in über<br />
7600 Dörfern zusammengefasst, die wirtschaftlich nicht rentabel arbeiten. Unverständnis, Widerstand gegen staatlichen<br />
Zwang, Fehlplanungen und Missernten im Land und die bekannten weltwirtschaftlichen Bedingungen drohen Nyereres<br />
Vorstellungen ein Ende zu machen.<br />
Tansania ist hoch verschuldet durch Entwicklungshilfe-Darlehen. Es gehört zu den 25 ärmsten Ländern der Erde. Und<br />
wegen der Verstaatlichung der Industrien und der Banken und der sozialistischen Haltung der Regierung sind die<br />
westlichen Länder zurückhaltend mit Hilfeleistungen.<br />
Engelhard begründet das Scheitern des Ujamaa-Versuches mit folgenden Punkten (Engelhard 1994, S.<br />
206-207):<br />
1. Die Rückbesinnung auf vorkoloniale Traditionen geht von teilweise falschen Annahmen aus, da<br />
egalitäre Strukturen nur bei Teilen der damaligen tansanischen Bevölkerung vorherrschend<br />
waren.<br />
2. Die Form des traditionellen Grundbesitzes unterschied sich wesentlich von der durch die<br />
tansanische Regierung verordneten Besitzverhältnissen.<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 321
3. Die sich unter der Kolonialregierung entwickelten Gesellschaftsstrukturen standen im Gegensatz<br />
zu der geplanten Gesellschaftsordnung.<br />
4. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Volksgruppen wurden nicht berücksichtigt.<br />
5. Die ökologischen und ökonomischen Voraussetzungen wurden falsch eingeschätzt.<br />
6. Der Technologiesprung war zu gross. Engelhard schreibt dazu: "Verhängnisvoll wirkte sich auch<br />
der grosse technologische Sprung von der Hacke zum Traktor aus, der mit der Gründung<br />
mancher Ujamaa-Dörfer verbunden war. Die Verwendung moderner, importierter Technologie<br />
bei der kollektiven Bewirtschaftung der Genossenschaftsfelder (und der Staatsfarmen) stellte<br />
angesichts von Unterbeschäftigung und regionaler Arbeitslosigkeit nicht nur eine Missachtung<br />
des Rechtes auf Arbeit dar, sie brachte das Land in immer stärkere Auslandsabhängigkeit, die<br />
man abzubauen angetreten war. Die Entwicklung eigener, angepasster Technologien wurde<br />
verhindert. "<br />
Die Ursachen für das Scheitern des Ujamaa-Versuchs sind also äusserst vielfältig und beruhen teilweise auch<br />
darauf, dass die bei der Planung aufgestellten Prinzipien nicht eingehalten wurden. (Siehe zu Ujamaa auch die<br />
Seite 309 dieser Arbeit.) Zudem fielen in den gleichen Zeitraum auch die Unruhen in Uganda, die Tansania<br />
dazu zwangen, einen grossen Teil der Staatsausgaben in die Landesverteidigung zu stecken. Engelhard schätzt<br />
die dadurch entstandenen Kosten für Tansania auf rund 1 Mrd. DM. (Engelhard 1994, S. 241).<br />
Der Autor von "Unser Planet" lässt den damaligen Präsidenten Tansanias, Nyerere, zehn Jahre nach der Erklä-<br />
rung von Arusha Rückblick halten:<br />
"Wir haben unser Ziel nicht erreicht, es ist noch nicht einmal in Sicht. Was zählt, ist, dass wir in Tansania während der<br />
letzten zehn Jahre ein paar wichtige Schritte auf unsere Ziele hin getan haben - trotz widriger klimatischer und<br />
internationaler Bedingungen."<br />
Der Autor schliesst seine Betrachtungen über Tansania mit den Worten (S. 177):<br />
Tansania ist in diesem Sinne kein Modell für andere Entwicklungsländer, aber es sollte Anerkennung und Unterstützung<br />
finden.<br />
(Zu Tansania siehe auch die Seite 308 dieser Arbeit.) Das Scheitern eines weiteren Entwicklungsplanes für ein<br />
Land Schwarzafrikas kann aus den aufgeführten Gründen also nicht nur auf die Unfähigkeit afrikanischer Poli-<br />
tiker zurückgeführt werden, sondern ist eine Folge komplexer Ursachen, die teilweise ausserhalb des Einfluss-<br />
bereiches der Verantwortlichen liegen, von denen der Autor einige in den nächsten Kapiteln von "Unser<br />
Planet" anspricht.<br />
4.28.3.2 Der Welthandel<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Auf den Seiten 178-181 wird das Thema Schwarzafrika im Zusammenhang mit dem Kapitel "Welthandel -<br />
rasante Entwicklung, aber nicht überall" mehrmals angeschnitten. Eine Tabelle "Welthandel der Bundesrepu-<br />
blik Deutschland über Bremische Häfen (1979) an ausgewählten Gütergruppen" nennt beispielsweise die<br />
folgenden afrikanischen Länder: Marokko 2x, Nigeria 3x, Algerien 1x, Südafrika 1x, und Tansania 3x. Auf<br />
Seite 179 erklärt der Autor unter der Überschrift "Welthandel - Industrieländer unter sich":<br />
...Daneben sind für die Industrieländer auch noch die Entwicklungsländer wichtig: als Rohstofflieferanten und als<br />
Abnehmer von Industriewaren und Nahrungsmitteln. Damit ist auch schon erklärt, warum sich der Welthandel bei den<br />
Entwicklungsländern ungünstiger entwickelt hat. Ihr Güterangebot ist einseitig. Die Sondergruppe der Erdölstaaten<br />
ausgenommen, führen die Entwicklungsländer hauptsächlich Nahrungs- und Genussmittel und mineralischen und<br />
pflanzliche Rohstoffe aus. Auch untereinander ist der Warentausch noch schwächer, weil die Entwicklungsländer wegen<br />
der geringen Industrie ihre Rohstoffe kaum selbst verarbeiten können...<br />
Auf Seite 180 erklärt der Autor die Mechanismen des "Terms of Trade" anhand einer Grafik "Kaufkraftverlust<br />
in einem Entwicklungsland". Am Beispiel des Kaffees in Tansania wird die Abwertung des Rohstoffes<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 322
gegenüber dem Industriegut Armbanduhr aufgezeigt: Für den Zeitraum 1961-64 heisst es in der Graphik: "Für<br />
1 Uhr aus der Schweiz musste Tansania 7.5 kg Kaffee exportieren." Für den Zeitraum 1971-1974 musste<br />
Tansania bereit "14.2 kg Kaffee exportieren". (Zum Kaffeeanbau siehe auch die Seiten 251 und 346 dieser<br />
Arbeit.) Im Text heisst es dazu unter der Überschrift " Armbanduhr gegen Kaffeesack - <strong>Pro</strong>bleme des Waren-<br />
tausches (S. 180f.):<br />
...Ein <strong>Pro</strong>blem ist dabei das Austauschverhältnis der Waren, im internationalen Sprachgebrauch "Terms of Trade"<br />
genannt...<br />
...Die starken Preisschwankungen sind ein grosses Entwicklungshindernis. Insgesamt zeigt ein Vergleich der<br />
Preisentwicklungen in den letzten fünfundzwanzig Jahren, dass die Preise der von den Entwicklungsländern gelieferten<br />
Rohstoffe weniger stark als die Preise der von den Industrieländern gelieferten Fabrikwaren gestiegen sind...<br />
...Am stärksten trifft es die Länder, deren Rohstoffe durch Kunststoffe ersetzt werden können, z. B. Sisal... Länder, die Erze<br />
ausführen, haben eine stabilere Preisentwicklung.<br />
Die im "Unser Planet" beschriebene Verschlechterung der Terms of Trade sollte sich auch in den achtziger und<br />
neunziger Jahren fortsetzen. Michler schreibt in seinem "Weissbuch Afrika": "Der Rohstoffpreiszerfall<br />
während der achtziger Jahre führte dazu, dass Schwarzafrikas Exporterlöse von 51.7 Mrd. $ (1980) nach Welt-<br />
bankangaben auf 29.1 Mrd. $ (1986) sanken, nach IWF-Angaben sogar auf 24.0 Mrd. $ (1986)..." (Michler<br />
1991, S. 132). Den dadurch entstandenen Einnahmeverlust Schwarzafrikas beziffert er für den Zeitraum<br />
1981-1990 auf einem Betrag von 150 Mrd. US$. Zum Vergleich führt er an, dass die schwarzafrikanischen<br />
Staaten im gleichen Zeitraum 105 Mrd. US$ an Entwicklungshilfe erhalten hätten, sie sich bei stabilen<br />
Rohstoffpreisen also aus eigener Kraft hätten finanzieren können. (Michler 1991, S. 142; zu den Terms of<br />
Trade siehe auch die Seite 376 dieser Arbeit.)<br />
Auf der Seite 180 werden in Kurzform auch die AKP-Staaten (Afrika, Karibik, Pazifik), die mit der damaligen<br />
EG durch die Lomé-Abkommen (1975, 1979) vertraglich gebunden waren, und die UNO-Organisation<br />
UNCTAD ("United Nations Conference for Trade and Development"), die von den Entwicklungsländer 1962<br />
gegründet wurde, "um die internationale Wirtschaftsordnung im Sinne der Entwicklungsländer zu ändern",<br />
erwähnt. Der damalige Präsident Tansanias, Julius Nyerere, kommt ebenfalls zu Wort: (S. 180):<br />
Meiner Ansicht nach hat jeder Mensch auf diesem Planeten ein Recht auf die Güter dieser Welt... Wenn wir wollten,<br />
könnten wir Bedingungen aufstellen, die den Güterfluss von den Reichen zu den Armen als gültiges Recht festsetzten, und<br />
nicht als ein System der Bettler.<br />
Auf der Seite 181 führt der Autor unter der Überschrift "Forderungen der Entwicklungsländer" die Wünsche<br />
dieser Länder, anlässlich der UNCTAD-Konferenzen I-V (1964-1979) auf:<br />
1. die Anerkennung ihrer vollen politischen und wirtschaftlichen Souveränität... in ihrem Land und die Gleichstellung aller<br />
Länder der Weltwirtschaft;<br />
2. ...Zollfreiheit und Aufhebung von Handelsbeschränkungen für Waren aus den Entwicklungsländern... Verbesserung der<br />
Terms of Trade;<br />
3. ...Ausgleichlager für 18 wichtige Rohstoffe... die Stabilisierung der Ausfuhrerlöse, die Weiterverarbeitung von<br />
Rohstoffen in den Entwicklungsländern;<br />
4. den Erlass von Schulden aus der Entwicklungshilfe.<br />
Anschliessen beschreibt der Autor unter der Überschrift "Das Abkommen von Lomé - die 'Antwort' der Euro-<br />
päischen Gemeinschaft" die Kernpunkte des Lomé-Abkommens 1975. Eine Karte "AKP-Staaten" zeigt, dass<br />
fast alle afrikanischen Staaten mit der Ausnahme von Ägypten, Libyen, Angola, Namibia, Mosambik, Simbab-<br />
we und Südafrika am Abkommen beteiligt waren. Die nichtbeteiligten schwarzafrikanischen Staaten waren zu<br />
diesem Zeitpunkt in politische Wirren oder Bürgerkriege verwickelt. Südafrika wurde aufgrund der Apart-<br />
heidspolitik wirtschaftlich boykottiert.<br />
Der Autor schreibt zum Abkommen im Text auf der Seite 181:<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
1. Die Gemeinschaft entwickelt die Beziehungen zu den AKP-Staaten als gleichberechtigte Partner.<br />
2. Alle <strong>Pro</strong>dukte der AKP-Staaten haben zollfreien Zugang zum Markt der Gemeinschaft (Ausnahme: wenige<br />
Agrarerzeugnisse). Die AKP-Staaten werden als einheitliches Zollgebiet betrachtet, um den Handel der Länder<br />
untereinander zu fördern.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 323
3. Die Ausfuhrerlöse von 43 Erzeugnissen der Landwirtschaft und von Eisenerz werden stabilisiert, d.h. bei starkem<br />
Absinken der Preise im EG-Markt wird ein Ausgleich bezahlt.<br />
4. Die EG hilft vor allem beim Aufbau von rohstoffverarbeitenden Industrien durch günstige Darlehen und technische<br />
Hilfe.<br />
Die Lomé-Verträge, jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren in der Hauptstadt Togos abgeschlossen (Lomé<br />
I: 1975, Lomé II: 1979, Lomé III: 1985, Lomé IV: 1989) galten in den siebziger und achtziger Jahren als<br />
Modell für die Beziehungen zwischen Nord und Süd. Unterdessen haben sie aber viel von ihrer früheren<br />
Attraktivität verloren. Dies vor allem deshalb, weil die zur Stabilisierung der Rohstoffpreise eingesetzten<br />
Gelder ein viel zu kleines Volumen aufwiesen. (Michler 1991, S. 484-486). Ausserdem blieben einige<br />
Rohstoffe und vor allem Halbfertigwaren von diesem Abkommen ausgeschlossen. 1997 wurde Südafrika in<br />
das Lomé-Abkommen aufgenommen, erhielt aber nicht die gleichen Bedingungen, wie die anderen<br />
AKP-Staaten.<br />
Die Seiten 182-183 wollen mit dem Kapitel "Aktion: Auch wir können etwas für die Dritte Welt tun" den<br />
Schüler unter den Überschriften "Dritte-Welt-Läden und Basare helfen Türen öffnen" und "Vorschlag für ein<br />
<strong>Pro</strong>jekt: "Hilfe für die Dritte Welt" zur Eigeninitiative anregen. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch die<br />
Seiten 308 und 349 dieser Arbeit.)<br />
Das Kapitel "Nord-Süd-Gefälle - Ungleichheit bei den Staaten der Erde" zeigt auf den Seiten 184-185 auf zwei<br />
Karrikaturen und einer Karte "Anteil der Länder am Welthandel" die Abhängigkeiten zwischen den Industrie-<br />
und Entwicklungsländern auf. Im Text schreibt der Autor dazu auf der Seite 184:<br />
...Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass die Entwicklungsländer in den Ungunstzonen im Süden die grossen<br />
<strong>Pro</strong>blemgebiete unserer Erde sind. Hier leiden die Menschen an Hunger und Krankheiten, weil sie arm sind.<br />
Durch die starke Bevölkerungszunahme werden auch die bescheidenen Erfolge in der wirtschaftlichen Entwicklung der<br />
Länder wieder aufgezehrt. Dieser "Teufelskreis der Armut" mit seinen inneren Faktoren ist ein Erklärungsmodell der<br />
Unterentwicklung. Das Abhängigkeitsmodell dagegen will die Unterentwicklung aus der Abhängigkeit von den<br />
Industrieländern, also durch äussere Faktoren, erklären.<br />
Weiter heisst es im Text noch, auch der "dritte Weg" Tansanias "habe es bisher nicht vermocht, gleichsam im<br />
grossen Sprung die Entwicklungsprobleme zu lösen". (Siehe dazu auch die Bemerkungen zum Kapitel "Tansa-<br />
nia" aus dem gleichen Lehrmittel ab der Seite 320 dieser Arbeit.).<br />
Abgeschlossen wird der Band 3 von "Unser Planet" mit einem "Lernspiel für den Erdkundeunterricht", das auf<br />
den Seiten 186-189 erklärt wird. Da die Spielregeln recht umfangreich und komplex sind, wird hier nicht näher<br />
darauf eingegangen. Das Spiel eignet sich aber sicher, den Schülern die Komplexität eines Entwicklungsvor-<br />
ganges in einem Land bewusst zu machen.<br />
4.28.4 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Der Autor versucht, die <strong>Pro</strong>bleme der schwarzafrikanischen Staaten und damit seiner Menschen durch die<br />
Erläuterung wirtschaftlicher Zusammenhänge zu erklären. Dabei gelingt es im, diese recht detailliert darzu-<br />
stellen. Durch die Schwerpunktsetzung vermeidet der Autor eine Darstellung des Schwarzafrikaners als Unter-<br />
menschen, erweckt aber gleichzeitig den Eindruck, dieser müsse von ausser her entwickelt werden.<br />
Unter der Gewichtung wirtschaftlicher Aspekte leidet die Betrachtung anderer Lebensbereiche. So erfahren die<br />
Leser wenig über die geschichtliche Entwicklung der schwarzafrikanischen Gebiete, und die Kultur der<br />
Schwarzafrikaner wird überhaupt nicht angesprochen. Die ganze afrikanische <strong>Pro</strong>blematik wird als eine wirt-<br />
schaftliche geschildert: auf die Konflikte innerhalb und zwischen den Staaten Schwarzafrikas, die eine wirt-<br />
schaftliche Unterentwicklung wesentlich mitbeeinflussen, geht der Autor nicht ein. Zudem kann er bedingt<br />
durch die vertiefte Betrachtung von Fallbeispielen nur einen Teil der Länder Schwarzafrikas ansprechen. Es<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 324
sind dies: die Demokratische Republik Kongo, die Elfenbeinküste, Mali, und Tansania. Diese Länder machen<br />
sowohl von der Fläche als auch den Bevölkerungszahlen oder Wirtschaftspotenz her nur einen kleinen Bruch-<br />
teil der gesamtschwarzafrikanischen Wirklichkeit aus.<br />
Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 325
4.29 Schweizer Weltatlas (1981)<br />
Der 188 Seiten umfassende "Schweizer Weltatlas" von 1981 ist der Nachfolger des auf der Seite 129 dieser<br />
Arbeit besprochenen "Schweizer Mittelschulatlas". Das Werk zeigt eine physische Afrikakarte im Massstab<br />
1:30 Mio. auf der Doppelseite 102-103, auf der auch drei weitere, kleinere naturgeographische Karten abgebil-<br />
det sind. Die Seiten 104-105 zeigen Karten zu den Atlasländern, Ost- und Südafrika, sowie der Städte Tunis<br />
und Kapstadt, die sich, wie schon die vorherige Karte, nur unwesentlich von den entsprechenden Karten im<br />
"Schweizer Mittelschulatlas" unterscheiden. Die Seite 106 zeigt eine grössere Karte zur Wirtschaft Afrikas,<br />
sowie zwei kleine zu Agrarprodukten und der Bevölkerungsdichte, während die Seite 107 eine grössere Karte<br />
zur politischen Gliederung und ebenfalls zwei kleinere Karten zu den Völkern und Religionen Afrikas<br />
abdruckt.<br />
Wie schon die Vorgängerkarten unterscheidet die Karte zu den Völkern zwischen Indogermanen, Türken,<br />
Semiten, Hamiten, Buschmännern, Hottentotten, Zwergvölkern und Malaien, spricht aber nun von Sudanesen<br />
und Bantu an der Stelle von Sudan- und Bantu-Negern. Die Karte zu den Religionen wurde unverändert aus<br />
dem älteren Lehrmittel übernommen, obwohl sich in den rund zwanzig Jahren zwischen dem Erscheinen der<br />
beiden Lehrmittel die Religionszugehörigkeiten zugunsten der christlichen und islamischen Religionen ver-<br />
schoben haben dürften.<br />
Weitere Abbildungen Afrikas finden sich auf Weltkarten zu verschiedenen Themen auf den Seiten 132-141.<br />
Wobei die Themen der Themenkarten grösstenteils aus dem Vorgängerwerk übernommen und die Darstellun-<br />
gen nur in Ausnahmefällen angepasst wurden.<br />
Der "Schweizerische Weltatlas" von 1981 hat gegenüber dem "Schweizerischen Mittelschulatlas" von 1962<br />
nur unwesentliche Änderungen erfahren. Bei einigen Karten, wie beispielsweise zur Dichte der Bevölkerung<br />
haben es Verlag und Autor verpasst, das Werk konsequent zu aktualisieren. Daher fehlte dem "Schweizeri-<br />
schen Weltatlas" bereits zur Zeit der Drucklegung die nötige Aktualität. Der Atlas wurde aber trotzdem bis in<br />
die neunziger Jahre als offizielles Lehrmittel gehandelt. Mitte der neunziger Jahre wurde das besprochene<br />
Lehrmittel von einer überarbeiteten Auflage abgelöst. Da diese nicht zur Verfügung stand, muss im Rahmen<br />
dieser Arbeit auf eine Besprechung der neuesten Auflage verzichtet werden. (Für den Vergleich mit den älte-<br />
ren Ausgaben siehe auch die Seite 564 im Anhang dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Schweizer Weltatlas (1981)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 326
4.30 Seydlitz: Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Nach drei Stunden Fahrt erreichten wir den Massaikral. Fast kreisrund, von dichtem Dorngestrüpp umgeben, waren die<br />
Boma erbaut, Hütten aus einem mit Fell überzogenen Holzgestänge, von aussen mit Lehm beschmiert, der durch die Hitze<br />
gerissen war. An der Seite hatten die Boma ein türloses Loch, den Eingang. In der Mitte ein grosser Platz, graslos und<br />
zertrampelt. "Hier hält sich das Vieh nachts auf." Der Kral wirkte fast ausgestorben. Einige alte Menschen sassen im<br />
Schatten der Hütten, Frauen waren auf dem Weg zur Wasserstelle, einige nackte Kinder spielten am Eingang. (Bd. 1, S. 30)<br />
Das dreibändige Lehrmittel "Seydlitz: Mensch und Raum" für die Klassen 7/8, 9/10 und 11 beschäftigt sich auf<br />
27 der insgesamt 432 Seiten mit Themen zu Afrika. Auf den meisten Seiten wird der Text durch Fotos, Karten<br />
oder Tabellen ergänzt. Ausserdem wird jedes Kapitel mit einer Reihe von Fragen oder Aufgaben<br />
abgeschlossen.<br />
4.30.1 Band 1<br />
Der 1983 erschienene Band für die 7. und 8. Klasse enthält die Kapitel "Landnutzung in den Tropen Afrikas"<br />
(S.22-33), "Höhenstufen am Eiger und am Mount Kenia" (S. 34-39) und "Raumentwicklung und Raumer-<br />
schliessung in Westafrika" (S.136-143).<br />
4.30.1.1 "Landnutzung in den Tropen"<br />
Im Kapitel "Landnutzung in den Tropen Afrikas" gibt der Autor nach einer Einleitung, in der er die klimati-<br />
schen Voraussetzungen, die Tier- und Pflanzenwelt bespricht, einen "Bericht des Vertreters von Zaire vor der<br />
FAO zur Lage der Waldbantu" auf der Seite 24, auf der drei Fotos "Gerodetes Feld", "Feld mit Ananas, Bana-<br />
nen und Maniok" und "Überwuchertes Feld" abgebildet sind, wieder:<br />
Die Gebiete meines Landes, die mit tropischem Regenwald bedeckt sind, sind nur sehr schwach besiedelt. Die Bewohner<br />
müssen entweder von der Jagd oder von der Landwirtschaft leben, da die Anlage von Industrie wegen des Klimas<br />
erschwert und wegen der schwierigen Verkehrsverhältnisse kaum möglich ist...<br />
Der Berichterstatter liefert einen kurzen Rückblick auf die vermutete Fruchtbarkeit des Regenwaldes, die sich<br />
als Irrtum herausstellte, und wendet sich dann dem Nährstoffkreislauf zu:<br />
...Wie anfällig dieser Kreislauf ist, zeigt sich, wenn ein grösseres zusammenhängendes Waldstück gerodet worden ist. Es<br />
gibt dann keinen Nachschub für die Humusbildung mehr, und die noch vorhandenen Nährstoffe werden innerhalb weniger<br />
Jahre aus dem Boden ausgewaschen. Nach zwei Jahren beginnen die ersten niedrigen Pflanzen zu wuchern, nach etwa 20<br />
Jahren ist ein 10 bis 15 m hoher Sekundärwald entstanden, und erst nach 100 bis 150 Jahren ist der Wald mit seiner<br />
ursprünglichen Vegetation wieder vorhanden.<br />
Das bedeutet, dass nur der traditionelle Wanderhackbau der Bantustämme bei einer geringen Bevölkerungsdichte eine<br />
sinnvolle landwirtschaftliche Nutzungsform im tropischen Regenwald ist. Aber wie gesagt, es geht nur bei geringer<br />
Bevölkerungsdichte, denn der Wald benötigt lange Zeit, bis er sich nach einer Rodung wieder erholt hat.<br />
Die Waldbantu leben weit verteilt auf Rodungsinseln im tropischen Regenwald. Ihre kleinen Dörfer liegen zum Teil in der<br />
Nähe von Flüssen, seltener auf den Inseln der Ströme.<br />
Auf der Seite 25, die die vier Fotos "Mehlbanane", "Maniok", "Bataten" und "Urwalddorf" zeigt, heisst es im<br />
Bericht weiter:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Die Rodung des Siedlungsplatzes und der Felder ist sehr mühsam, da Macheten und Beile die einzigen Rodungswerkzeuge<br />
der Bantu sind.<br />
Zunächst werden die Bäume geringelt, um sie zum Absterben zu bringen. Dann werden möglichst viele Bäume gefällt.<br />
Beim Umstürzen reissen die grossen gleich kleinere Bäume und Büsche mit. Trotzdem ist diese Rodung sehr<br />
unvollständig, denn die Bantu lassen Bäume mit essbaren Früchten und Tabubäume stehen. Ausserdem können sie mit<br />
ihren primitiven Werkzeugen Bäume mit Brettwurzeln oder aus Hartholz nicht roden. Danach werden das eingeschlagene<br />
Holz und das Buschwerk angezündet.<br />
Auf dem mit Asche bedeckten Boden - sie dient als Düngung - beginnen die Frauen zwischen den verkohlten<br />
Baumstümpfen mit dem Pflanzen der Bananen- und Maniokstecklinge und der Aussaat von Mais sowie der Anpflanzung<br />
von Bataten. Nach einigen Monaten kann auf dem neuen Feld zum ersten Mal geerntet werden.<br />
Nach etwa zwei Jahren wuchert die natürliche Vegetation des tropischen Regenwaldes von den Rändern der Felder aus<br />
wieder in die gerodete Fläche hinein. Zur gleichen Zeit geht der Nährstoffgehalt des Bodens deutlich zurück. Die Ernten<br />
werden immer geringer, Unkraut breitet sich aus, und nach einigen Jahren muss das Feld ganz aufgegeben werden.<br />
Die Waldbantu ergänzen ihre Nahrung durch Sammeln von Kräutern, Piken, Früchten, Honig und Insekten, die sie in den<br />
umliegenden Waldgebieten selbst sammeln oder von Pygmäen eintauschen, durch Fischfang und durch die Anlage eines<br />
kleinen Gartens in unmittelbarer Nähe ihrer Hütten. Hier bauen sie Gewürze und Gemüse sowie Zuckerrohr und Ananas<br />
an. Hinzu kommen Mango-, Papaya- oder Avokadobäume.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 327
Etwa alle acht bis zehn Jahre verlegen die Waldbantu ihre Dörfer und errichten eine neue Siedlung, allerdings nicht nur<br />
wegen des Wanderhackbaus, sondern auch aus religiösen Gründen, etwa weil ein Platz als verhext gilt, wegen Krankheiten<br />
oder zu grosser Wildschäden.<br />
Der Bericht des "Vertreters von Zaire" ist der bisher umfassendste zum Thema des Wanderhackbaus im tropi-<br />
schen Regenwald. Nebst den in anderen Lehrmitteln ebenfalls wiedergegebenen Beschreibungen erwähnt er<br />
einige Besonderheiten, wie etwa den Tauschhandel zwischen den Bantu und Pygmäen, der nicht so recht ins<br />
Bild der "scheuen Pygmäen" der Lehrmittel "Länder und Völker" (60er Jahre, S. 39) und "Geographie der<br />
Kontinente" (1984, S. 50) passt. (Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 295 und 341 dieser Arbeit.)<br />
Die Seiten 26 und 27 beschäftigen sich unter dem Titel "Holz aus Ghana - Holz für den Export" mit der Holz-<br />
gewinnung im tropischen Regenwald. Die Seite 26 zeigt zwei Fotos "Holzfäller bei der Arbeit" und "Schlep-<br />
pen der Stämme zum Sammelplatz", sowie eine Tabelle "Einschlag und Verwendung von Holz", die hier<br />
wiedergegeben wird:<br />
Tabelle: Einschlag und Verwendung von Holz (1978 in Mio. m 3 )<br />
nach "Seydlitz: Mensch und Raum" (1983-1984) Bd. 1, S. 26 gekürzt<br />
Verwendung<br />
Staat Laubholz Nadelholz Nutzholz Brennholz<br />
Äthiopien 23.2 1.9 1.3 23.8<br />
Elfenbeinküste 10.4 - 5.1 5.3<br />
Ghana 13 - 2.5 10.5<br />
Kenia 14.6 1.2 1.1 14.7<br />
Nigeria 84.9 - 4.3 80.6<br />
Südafrika 11.9 4.8 9.7 7<br />
Tansania 39.9 0.1 1 39<br />
Uganda 20 - 2.2 18.5<br />
Zaire 20.7 - 2.2 18.5<br />
Im Text schreibt der Autor dazu (S. 26):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
In den Industriestaaten auf der nördlichen Halbkugel der Erde werden seit Jahrzehnten neben einheimischen Hölzern auch<br />
Hölzer aus dem tropischen Regenwald Afrikas verarbeitet. Wegen ihrer Eigenschaften nennt man sie in Europa Edelhölzer:<br />
Das Holz ist gleichmässig ohne Jahresringe fest gewachsen, die Bäume sind 30 bis 50 m astfrei und haben nicht selten<br />
einen Durchmesser von mehreren Metern. Sie werden vorwiegend in der Möbelindustrie, beim Wohnungsbau, als<br />
Wandverkleidungen und für Schiffsaufbauten verwendet.<br />
Bereits seit der Zeit, als das Gebiet der Republik Ghana noch britische Kolonie war, sind Edelhölzer ein wichtiger<br />
Exportartikel dieses Landes. Sie werden zumeist als unverarbeitetes Rundholz in andere Staaten verkauft.<br />
Allerdings ist der Einschlag von Holz im tropischen Regenwald immer damit verbunden, dass man grosse Schwierigkeiten<br />
überwinden und schwerwiegende Nachteile in Kauf nehmen muss...<br />
Nach der Aufzählung einiger dieser Schwierigkeiten gibt der Autor auf der Seite 27, auf der zwei Fotos "Zer-<br />
sägen eines Stammes für den Transport" und "Exporthafen San Pedro (Elfenbeinküste) zu sehen sind, ein<br />
"Interview mit dem Vertreter des Wirtschaftsministeriums von Ghana" wieder:<br />
"In Ihrem Land ist genauso wie in anderen Staaten der Dritten Welt lange Raubbau am Wald getrieben worden. Welche<br />
Ursachen hatte dies?"<br />
"Diese Entwicklung, die allen afrikanischen Staaten grosse Sorgen bereitet, hat heute verschiedene Gründe. Hier möchte<br />
ich nur den wichtigsten erwähnen. Wie alle Entwicklungsländer sind wir gezwungen, Rohstoffe zu verkaufen, weil wir<br />
kaum eigene Industrien besitzen, um diese Rohstoffe weiterverarbeiten zu können. Unsere Importe können wir daher nur<br />
mit den Erlösen aus dem Export von Kakao, Holz, Gold, Bauxit und anderen Rohstoffen bezahlen. "<br />
"Es gibt heute schon Staaten, die bestimmte Edelholzarten nicht mehr exportieren, weil die Vorräte erschöpft sind."<br />
" Wenn wir nichts unternehmen würden, dann könnte das in naher Zukunft auch bei uns geschehen. Deshalb versuchen wir<br />
vorzubeugen. Vor ein paar Jahren haben wir begonnen, auf Rodungsflächen Holzplantagen anzulegen, die ausschliesslich<br />
mit einer Baumart bepflanzt wurden. Man muss nach dem Pflanzen sehr darauf achten, dass die Nährstoffe nicht durch die<br />
Regenfälle aus dem Boden ausgewaschen werden. Deshalb haben wir schnellwachsende Sträucher zwischen die<br />
Baumreihen gepflanzt, um so auch für zusätzliche Nährstoffe zu sorgen. Allerdings haben wir inzwischen festgestellt, dass<br />
das Wachstum der Bäume etwas langsamer ist als im Urwald und dass sie gegen Schädlinge anfälliger sind."<br />
"Man muss wohl die Ergebnisse abwarten?"<br />
"Ja, gegenwärtig haben unsere Forstexperten den Eindruck, dass diese Art der Forstwirtschaft in den Tropen nicht sehr<br />
erfolgreich sein kann. Sie versprechen sich mehr davon, wenn sie die natürliche Verjüngung der Edelhölzer im Urwald<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 328
unterstützen. Man kann das Wachstum der Bäume dadurch fördern, dass man einige in der Nähe stehende Bäume fällt,<br />
damit die Nutzbäume mehr Licht bekommen. Auch kann man die Bäume von würgenden Lianen und Schmarotzern<br />
befreien und das umstehende Buschwerk niedrig halten."<br />
Ähnlich wie im Bericht über die Ölpalmen von Abidjan im Lehrmittel "Unser Planet" (siehe dazu die Seite<br />
316) wird auch hier die landwirtschaftliche Forschung eines schwarzafrikanischen Landes erwähnt. Allerdings<br />
konnte nur ein Teil der im Interview erwähnten Ansätze in die Tat umgesetzt werden.<br />
Noch 1990 zitierte Geo einen internen Bericht des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhäuser von 1989 über das<br />
damals als wichtigsten Lieferanten für tropisches Rundholz geltende Ghana, in dem es hiess: "Die Holzhan-<br />
delsbeziehungen zwischen Ghana und der Bundesrepublik Deutschland haben sich seit Jahrzehnten recht posi-<br />
tiv entwickelt... Der Wald wird in keiner Weise geschädigt... Der Einschlag im ghanaischen Wald wird von<br />
der zuständigen Forstverwaltung streng kontrolliert." Der Autor des Artikels, Werner Paczian kommt aller-<br />
dings zum Schluss, dass die im Bericht gemachten Aussagen nicht der Wahrheit entsprächen, da es "gängige<br />
Praxis... gewesen" sei, "Hölzer geringeren als den tatsächlichen Güteklassen zuzuordnen, Arten falsch auszu-<br />
stellen und Doppelrechnungen auszustellen". (Geo 3/1990, S. 56-58)<br />
4.30.1.2 Die Massai<br />
Auf den Seiten 28 und 29 bespricht der Autor die verschiedenen Zonen der Savanne, die Feucht-, Trocken-<br />
und Dornbuschsavanne, sowie deren Tierwelt, bevor er sich auf den Seiten 30 und 31 im Kapitel "Die Massai<br />
in der Trockensavanne" dem bekanntesten Volk Ostafrikas zuwendet. Die Seite 20 zeigt ein Luftfoto "Kral der<br />
Massai" aus dem die typische traditionelle Siedlungsform gut ersichtlich ist. Im Text schreibt der Autor in der<br />
Form eines Reiseberichtes (S. 30f.):<br />
Am dritten Tag unserer Rundreise stand die Besichtigung eines Massaikrals auf dem <strong>Pro</strong>gramm unserer<br />
Ostafrika-Rundreise. Ein Höhepunkt, so hatte die Reiseleitung angekündigt, gelten doch die Massai als einer der wenigen<br />
Stämme, die sich kaum an die moderne Zivilisation angepasst haben. Sie leben weitgehend noch so wie ihre Vorfahren als<br />
viehhaltende Halbnomaden in den Trockensavannen Tansanias.<br />
Bereits in der Einleitung wird klar, nicht die Menschen stehen im Zentrum des Interesses, sondern das Verhal-<br />
ten eines "Stammes", der "sich noch kaum an die Zivilisation" angepasst hat. Im Reisebericht heisst es weiter<br />
(S. 30):<br />
Morgens um 6.00 Uhr sollte die Fahrt beginnen. Kurz vor der Abfahrt erschien ein junger, auffallend grosser Mann und<br />
sprach mit unserem Reiseleiter. Dann stieg er in den Bus und setzte sich neben mich.<br />
Die Fahrt ging von Arusha direkt nach Süden, zunächst auf einer schlecht ausgebauten Strasse durch mehrere Dörfer, dann<br />
auf feldwegartigen Pisten. Allmählich verschwanden die Mais- und Hirsefelder aus der Landschaft. Rechts und links der<br />
Piste dehnte sich schier endlos die Savanne. Ab und zu konnte man auf den weiten Grasflächen weidende Rinderherden<br />
ausmachen.<br />
Nach kurzer Zeit sprach mich mein afrikanischer Nachbar an und fragte mich nach Eindrücken von Tansania. Er erzählte<br />
mir, dass er von seinem Stammesältesten, zusammen mit einigen anderen, ausgesucht worden sei, um in Arusha zur Schule<br />
zu gehen und dort unter anderem Englisch zu lernen.<br />
Wie auch in anderen Texten des Lehrmittels ist hier nicht mehr von "Negern" die Rede, sondern der Autor<br />
spricht von einem "afrikanischen Nachbarn".<br />
Dies sei nötig, fügte er hinzu, denn die Regierung in Daressalam sei gegen die Massai. Sie schütze sie nicht genügend<br />
gegen die Bauern, die in ihre Weidegebiete vordrängen. Im Norden und Osten der Savanne hätten sich seit ein paar Jahren<br />
sesshafte Bauern angesiedelt, die das gute Weideland in Ackerland umwandelten.<br />
"Und das", beklagte er sich, "obwohl heute viel mehr Menschen in unserem Kral leben als noch vor zehn Jahren. Wovon<br />
sollen wir denn in den nächsten Jahren leben?"<br />
Die Konflikte zwischen sesshaften Bauern und (halb)nomadischen Hirtenvölkern sind in grossen Teilen des<br />
afrikanischen Kontinents ein Thema.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Nach drei Stunden Fahrt erreichten wir den Massaikral. Fast kreisrund, von dichtem Dorngestrüpp umgeben, waren die<br />
Boma erbaut, Hütten aus einem mit Fell überzogenen Holzgestänge, von aussen mit Lehm beschmiert, der durch die Hitze<br />
gerissen war. An der Seite hatten die Boma ein türloses Loch, den Eingang.<br />
In der Mitte ein grosser Platz, graslos und zertrampelt. "Hier hält sich das Vieh nachts auf."<br />
Der Kral wirkte fast ausgestorben. Einige alte Menschen sassen im Schatten der Hütten, Frauen waren auf dem Weg zur<br />
Wasserstelle, einige nackte Kinder spielten am Eingang.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 329
Nach der Beschreibung des Krals fährt der Autor mit der Schilderung der Lebensweise der Massai und ihrer<br />
Wanderbewegungen fort (S. 31):<br />
"Unsere Männer sind mit ihren Herden unterwegs. Einige sind so weit entfernt, dass sie noch nicht einmal abends in den<br />
Kral zurückkehren. Hier, in der Nähe unseres Krals, kann man nur noch in der Regenzeit Futter für unsere Tiere finden.<br />
Aber in drei Monaten werden wir unseren Kral verlegen. Unsere Männer haben gesagt, dass dort im Westen hinter den<br />
Bergen gutes Weideland ist und dass sie dort keine weidenden Herden gesehen haben, nur Wild, vor allem Zebras und<br />
Antilopen."<br />
"Könnte es nicht sein", wandte ich ein, "dass dort deshalb, keine Herden sind, weil die Regierung diese Gebiete zum<br />
Nationalpark gemacht hat?"<br />
"Das ist richtig, aber ich bin mit dem Dorfältesten nach Daressalam gefahren, und wir haben die Genehmigung erhalten,<br />
unsere Tiere in dem Gebiet bis zum Manyarasee weiden zu lassen."<br />
"Das überrascht mich, denn ich habe gelesen, dass die tansanische Regierung dieses Gebiet zum Naturschutzgebiet erklärt<br />
hat, damit vom Aussterben bedrohte Tierarten gerettet werden können."<br />
"In den letzten zehn Jahren hatten wir in unseren jetzigen Weidegebieten dreimal eine grosse Dürre. Wir waren froh, dass<br />
unsere Herden so gross waren, damit wenigstens einige Tiere nicht verendeten. Jetzt, wo wir unsere Herden wieder<br />
vergrössern könnten, gibt es zuwenig Futter in dieser Gegend. Sollen denn unsere Herden schon wieder krepieren und wir<br />
damit von einer Hungerkatastrophe bedroht werden? Schutz für die wilden Tiere, sagt Ihr Europäer. Gut! Doch erst<br />
kommen doch wohl die Menschen. Und deswegen die Genehmigung."<br />
Diese Aussage des Massai kann der Autor des Reiseberichtes nicht ohne Kommentar übergehen:<br />
"Sicher hat er von seinem Standpunkt aus recht", dachte ich und nahm mir vor, ihn nicht auf den schlechten Zustand der<br />
Viehherden anzusprechen. "Das höchste Glück der Massai ist ein möglichst grosser Viehbesitz, sein ganzes Tun und<br />
Denken gilt der Erhaltung und Vergrösserung der Herden", hatte ich in einem Buch gelesen.<br />
Hier verpasst der Autor eine Chance. Anstatt sein Gegenüber auf seine Zweifel aufmerksam zu machen,<br />
beschränkt er sich darauf, das in einem Buch gelesene Urteil über die Massau zu wiederholen. Ohne zu prüfen,<br />
ob dieses richtig ist, wird seine ganze weitere Begegnung mit dem Massai von diesen Überlegungen geprägt:<br />
Als Ernährungsgrundlage reichten sicherlich viel kleinere Herden aus, wenn man bedenkt, dass in der Nähe des<br />
Siedlungsplatzes Schafe, Ziegen und Milchkühe gehalten werden, um die Bewohner des Krals zu ernähren. Aber für die<br />
Massai ist das Rind mehr, es ist notwendig als Geschenk, als Tauschobjekt, für den Brautpreis, und es ist bedeutsam für die<br />
religiösen Tabus der Massai.<br />
Je nach Land und Volk sehen die Bräuche rund um das Brautgeschenk anders aus. In Äquatorialguinea fällt<br />
der "Brautpreis" oft so hoch aus, dass viele Paare ohne verheiratet zu sein zusammenleben. Die vor der Heirat<br />
geborenen Kinder gehören rechtmässig dem Vater der Braut. Bei der Bezahlung des "Brautpreises" gehen sie<br />
in die Familie des Mannes über. Bei einer Scheidung müssen die Eltern der Braut den "Brautpreis" zurücker-<br />
statten. In Ghana ist das Brautgeld oder der "Brautpreis" ein Beweis des Bräutigams, dass er eine Familie<br />
unterhalten kann. In Guinea erhalten die Eltern der Braut Kolanüsse, Stoffe, Schmuck oder Vieh. Die Heirat<br />
gilt als abgesegnet, wenn der Vater der Braut eine Kolanuss bricht. In Nigeria muss der Bräutigam der Familie<br />
der Braut Geschenke überreichen, ein Teil seines Eigentums abtreten oder eine Dienstleistung erbringen. In<br />
Sambia ist die Lobola Gegenstand von langen Verhandlungen. In Tansania ist die Mitgift ein Zeichen des<br />
Dankes vom Bräutigam an die Familie der Braut: für die Erziehung, die sie ihr zukommen liessen, gleichzeitig<br />
eine Entschädigung für die verlorene Arbeitskraft. In der Zentralafrikanischen Republik ist die Zahlung eines<br />
"Brautpreises" verboten, aber dennoch üblich. Je nach sozialer Stellung können die den Eltern der Braut über-<br />
brachten Geschenke in der Form von Geld, Kleidung, Tieren, Schmuck, Haushaltgegenständen oder anderen<br />
Dingen recht teuer zu stehen kommen. Auch auf Mauritius, in Gabun unter der Bezeichnung "dot", in Simbab-<br />
we "Roora" oder "Lobola" genannt, sind ähnliche Bräuche weit verbreitet. (Zum "Brautpreis" siehe auch die<br />
Seiten 125 und 461 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
"Sie werden uns doch sicher recht geben, dass wir uns neue Weidegebiete suchen mussten." Ich nickte und dachte daran,<br />
was ich auf der Herfahrt gesehen hatte, braunes verdorrtes Gras in kleinen Büscheln auf gelbgrauem Boden.<br />
Gut, wir befanden uns am Ende der Trockenzeit, aber die wenigen Büsche waren kahl und genauso wie die Rinde der<br />
wenigen Bäume von den Ziegen verbissen. Diese Landschaft würde sich auch in der nächsten kurzen Regenzeit nicht<br />
erholen können.<br />
Eher würde das Gegenteil eintreten. Die starken Gewitterregen werden den Boden wegspülen, noch weniger Wasser wird<br />
durch Pflanzen gespeichert werden können.<br />
Ausserdem setzen sich nach und nach saure harte Gräser durch, die von den Tieren nicht gefressen werden. Selbst bei<br />
schonender Beweidung würde es Jahrzehnte dauern, bis sich die ursprüngliche Vegetation wieder durchgesetzt hätte.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 330
Ein wenig hilflos stand ich da, als ich mich von dem jungen Massai verabschiedete, der aus einer Boma gerufen wurde. Als<br />
ich ihm für die Zukunft viele Rinder wünschte, ging ein strahlendes Lächeln über sein Gesicht.<br />
Der Text enthält in diesen letzten Abschnitten zwei nicht ausdrücklich erwähnte Annahmen:<br />
1. Die Massai sind sich der ökologischen Folgen ihres Handelns nicht bewusst.<br />
2. Die weiter oben gemachten Bemerkungen über die Bedeutung der Herden für die Massai sind<br />
richtig, sonst hätte der Massai beim Abschiedsgruss des Autors, er wünsche ihm viele Rinder,<br />
nicht gelächelt. Tatsächlich sind aber zumindest zwei weitere Interpretationen für die zweite<br />
Annahme möglich: Der Massai freut sich darüber, dass der Besucher in mit freundlichen Worten<br />
verabschiedet hat, oder dem Massai ist der Wunsch des Besuchers peinlich, und er versucht mit<br />
einem Lächeln seine Verlegenheit zu überspielen.<br />
Die Seite 31 zeigt zwei weitere Fotos "Im Kral", auf der eine Frau mit zwei Kinder vor einer der Hütten zu<br />
sehen ist, und "Massai mit Herde". (Zu den Massai siehe auch die Seiten 329 und 404 dieser Arbeit.)<br />
4.30.1.3 Zaire<br />
Im nächsten Kapitel beschreibt der Autor auf der Seite 32 unter dem Titel "Paysanate in Zaire - Versuche einer<br />
modernen Landwirtschaft" die Bemühungen, die Landwirtschaft zu modernisieren und damit die Landflucht<br />
einzudämmen:<br />
Ein besonders grosses <strong>Pro</strong>blem aller afrikanischen Staaten ist der starke Anstieg der Bevölkerung. Eine Ursache dafür ist<br />
die verbesserte Hygiene und medizinische Versorgung. Da der traditionelle Wanderhackbau nur geringe Erträge bringt und<br />
die landwirtschaftlichen Nutzflächen begrenzt sind, setzte eine grosse Landflucht ein. In der Hoffnung auf Arbeitsplätze<br />
zogen die Menschen in die grossen Städte. So entstanden am Rande der meisten afrikanischen Grossstädte ausgedehnte<br />
Elendsviertel, in denen die Menschen in primitiven Hütten hausen.<br />
Um die Landflucht zu bremsen, versucht man, die landwirtschaftliche Nutzung zu intensivieren. Ein solcher Versuch ist die<br />
Anlage von Paysanaten in den Savannen von Zaire mit Dauerfeldbau und Dauersiedlungen.<br />
Der Begriff Paysanat wird im nächsten Abschnitt, in dem "aus dem Gutachten eines belgischen Entwicklungs-<br />
helfers" zitiert wird, umschrieben (S. 32):<br />
...zur Steigerung der Erträge empfehlen wir dringend den Ausbau bereits vorhandener sowie die Neugründung von<br />
Paysanaten. Diese planmässig angelegten Dauersiedlungen sollten mit Schulen und Sanitätsstationen ausgestattet sein. Die<br />
Feldnutzung sollte vererbbar sein. Neben den Gärten und Feldern müssen Weideflächen für das Kleinvieh zur Verfügung<br />
gestellt werden... In den trockneren Gebieten sind Waldstreifen anzulegen, um Erosion zu verhindern. Vorwiegend sollten<br />
Zypressen und Eukalyptusbäume verwendet werden.<br />
...Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass in älteren Paysanaten die einzelnen Parzellen bereits von mehreren Familien<br />
gemeinsam genutzt werden, da in Realteilung vererbt worden ist. Dadurch ist die Fläche je Familie so klein geworden, dass<br />
die Rotation mit eingeschobener Brache aufgegeben werden musste.... Dringend notwendig ist eine gute Versorgung mit<br />
Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und ausgewähltem Saatgut. Anderenfalls werden die Erträge innerhalb kürzester Zeit<br />
stark sinken...<br />
Eine typisch europäische Sichtweise, die zwar das <strong>Pro</strong>blem des geringen Ertrages lösen könnte, aber innert<br />
weniger Jahre Folgeprobleme zeitigen würde. Ein alternativer Ansatz wird mit der Agroforstwirtschaft, im<br />
Lehrmittel "Diercke Erdkunde" von 1995-1997 diskutiert und auf der Seite 424 dieser Arbeit zitiert,<br />
beschrieben.<br />
Die Seite 32 zeigt, den Text illustrierend, zwei Karten "Paysanat im Nordosten von Zaire" und "Zwei Hufen<br />
im Paysanat" (eine Hufe ist ein altes Feldmass, dass die an den Bedürfnissen einer durchschnittlichen Bauern-<br />
familie gemessene Landmenge bezeichnet), auf denen die die kleinräumige Bewirtschaftung und die Besitz-<br />
verhältnisse dargestellt werden. (Zur Demokratischen Republik Kongo siehe auch die Seiten 253 und 370<br />
dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 331
4.30.1.4 Landnutzung, <strong>Pro</strong>dukte und Wirtschaftssysteme (Tabelle)<br />
Die Seite 33 zeigt eine Tabelle "Landnutzung, <strong>Pro</strong>dukte und Wirtschaftssysteme im tropischen Regenwald und<br />
in den Savannen Afrikas, die hier wiedergegeben wird, da sie einen Einblick in die sich stark unterscheidenden<br />
Wirtschaften zwischen und innerhalb der afrikanischen Staaten ermöglichen:<br />
Vegetationszone Landnutzung Landnutzer <strong>Pro</strong>dukte Wirtschaftssystem<br />
Dornbuschsavanne extensive Weidewirtschaft Afrikaner (Halbnomaden) Rinder, Schafe, Ziegen,<br />
Kamele<br />
Trockensavanne extensive Weidewirtschaft Afrikaner (Halbnomaden,<br />
z. B. Massai)<br />
Subsistenzwirtschaft<br />
(Selbstversorgung mit<br />
gelegentlichen<br />
Tauschmöglichkeiten)<br />
Rinder, Ziegen Subsistenzwirtschaft<br />
Wanderhackbau Afrikaner Hirse, Mais, Bohnen Subsistenzwirtschaft<br />
Landwechselwirtschaft Afrikaner Mais, Hirse, Bohnen Subsistenzwirtschaft und<br />
marktorientierte<br />
Wirtschaft<br />
Pflanzungen früher Europäer<br />
(Kolonialmacht), heute<br />
Tee, Baumwolle, Erdnuss weltmarktorientierte Wirtschaft<br />
(Exporte)<br />
Plantagen<br />
überwiegend Afrikaner<br />
Sisal, Kaffee, Erdnuss weltmarktorientierte Wirtschaft<br />
(Exporte)<br />
Feuchtsavanne Wanderhackbau Afrikaner Hirse, Mais Subsistenzwirtschaft<br />
Landwechselwirtschaft Afrikaner Maniok, Yams, Mais,<br />
Bataten, Bananen<br />
Pflanzungen früher Europäer<br />
(Kolonialmacht), heute<br />
Subsistenzwirtschaft,<br />
marktorientierte<br />
Wirtschaft<br />
Kakao, Ölpalme, Kaffee weltmarktorientierte Wirtschaft<br />
(Export)<br />
Plantagen<br />
überwiegend Afrikaner<br />
Bananen, Kakao weltmarktorientierte Wirtschaft<br />
(Export)<br />
Tropischer Regenwald Sammelwirtschaft Afrikaner (z. B. Pygmäen) Wildfrüchte, kleine Tiere<br />
(z. B. Schnecken, Larven)<br />
Wanderhackbau Afrikaner (z. B.<br />
Waldbantu)<br />
Pflanzungen früher Europäer<br />
(Kolonialmacht), heute<br />
Maniok, Mais, Bataten,<br />
Bananen<br />
Subsistenzwirtschaft<br />
Subsistenzwirtschaft<br />
Kakao, Kautschuk weltmarktorientierte Wirtschaft<br />
(Export)<br />
Waldnutzung<br />
überwiegend Afrikaner<br />
Edelholz weltmarktorientierte Wirtschaft<br />
(Export)<br />
Wie schon im Lehrmittel "Geographie" von 1963 (S. 167) wird den Pygmäen als Nahrung wieder allerlei<br />
"Gewürm" zugeordnet. Der Autor hätte auch Fische und Pflanzenkost in der Liste eintragen können, aber<br />
scheinbar erschien es aus seiner Sicht sinnvoller, Früchte, Schnecken und Larven zu nennen.<br />
4.30.1.5 Höhenstufen am Mount Kenia<br />
Auf den Seiten 34-39 folgt das Kapitel "Höhenstufen am Eiger und am Mount Kenia", in welchem der Autor<br />
einen Vergleich zwischen den beiden Bergmassiven anstellt. Im Bezug auf die schwarzafrikanische Bevölke-<br />
rung ist nur die auf der Seite 38 abgebildete Grafik "Wirtschaftliche Nutzung in den Alpen und am Mt. Kenia"<br />
von Bedeutung, in der für die Höhenlage zwischen ca. 300-2000 m die Anbauprodukte Weizen, Hirse, Mais,<br />
Sisal, Batate, Baumwolle, Erdnuss, Banane und Kaffee aufgezählt werden, wobei der Autor diese weit weniger<br />
detailliert angibt, als dies für die Nutzungsmöglichkeiten in den Alpen der Fall ist. Das ganze Kapitel dient<br />
also weniger der Betrachtung einer afrikanischen Lebenswirklichkeit, sondern vielmehr der Verdeutlichung<br />
der eigenen europäischen Umwelt.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 332
4.30.1.6 Ochsengespann in Kamerun<br />
Im letzten grossen Abschnitt des Buches zur "Raumentwicklung und Raumerschliessung in Westafrika"<br />
schreibt der Autor auf der Seite 136 unter dem Titel "Einführung der Ochsenanspannung im Nordwesten<br />
Kameruns - ein Entwicklungsprojekt":<br />
...Ein bestimmendes Merkmal der traditionellen Landwirtschaft Schwarzafrikas ist die fast immer vorhandene Trennung<br />
von Ackerbau und Viehhaltung. Der in Europa bekannte bäuerliche Betrieb mit Ackerbau und Grossviehhaltung ist nur<br />
dort verbreitet, wo er durch Europäer eingeführt bzw. aufgezwungen wurde.<br />
Diese Aussage ist nur dann richtig, wenn der erwähnte "Ackerbau" wirklich wie in Europa gepflegt verstanden<br />
werden soll. Trifft dies nicht zu, wird eine falsche Vorstellung verbreitet, denn in einigen Gebieten bestellten<br />
die schwarzafrikanischen Bauern schon seit langer Zeit ihre Felder und hielten gleichzeitig auch Grossvieh.<br />
Nach dieser Einleitung druckt der Autor eine Tabelle "Durchschnittliche Erträge..." ab, in der die Erträge für<br />
Mais, Erdnuss und Reis der Länder Ghana, Kamerun und Nigeria mit denjenigen Italiens verglichen werden,<br />
und aus der ersichtlich ist, dass die Erträge der afrikanischen Länder um ein Mehrfaches unter denen Italiens<br />
lagen.<br />
Unter der Überschrift "Voraussetzungen für das <strong>Pro</strong>jekt" stellt der Autor die im angesprochenen Gebiet Kame-<br />
runs lebenden Bevölkerungsgruppen vor (S. 136):<br />
...Sesshafte Bauern (Bantugruppen): Sie nutzen den Boden in Landwechselwirtschaft. Auf kleinen Flächen (0,3-0,5 ha je<br />
Familienbetrieb) wird 4 Jahre lang angebaut. In 10- bis 14jähriger Brachezeit kann sich der Boden erholen. Kleinvieh<br />
ergänzt die Nahrungsgrundlage. Die Tätigkeit der Männer beschränkt sich auf einen unbedeutenden Anbau von<br />
Verkaufskulturen, hauptsächlich Kaffee. Die Frauen besorgen die Feldarbeit.<br />
Halbnomadische Hinten (Fulani): Sie sind die einzigen Rinderhalter in diesem Raum. Sie lebten ursprünglich nicht hier,<br />
sondern sind aus nördlichen Regionen zugewandert. Ihr Zuzug hält auch heute noch an.<br />
Ausserdem bildet die Seite 136 die beiden Fotos "Ochsen als Zugtiere" und "Pflug aus Autoteilen" ab. Die<br />
Seite 137 zeigt eine Tabelle "Ziele und Massnahmen des <strong>Pro</strong>jekts", in welcher der lokalen Bevölkerung erst im<br />
letzten Punkt "Entwicklung zur Selbsthilfe" die Möglichkeit zur Eigeninitiative mittels "Unterstützung klein-<br />
bäuerlicher Zusammenarbeit, Hilfe bei der Gründung und Aufbau ländlicher Genossenschaften" eingeräumt<br />
wird.<br />
Im Text schreibt der Autor auf der Seite 137 über die Bevölkerungssituation und die bisherig im Entwick-<br />
lungsprojekt geleistete Arbeit:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Das natürliche Bevölkerungswachstum und die Zuwanderung haben bereits zu einer Landverknappung geführt. Die<br />
notwendige Brachezeit kann nicht mehr eingehalten werden, weil zusätzlich Kulturflächen benötigt werden. Als Folge<br />
davon sinken die durchschnittlichen Hektarerträge.<br />
Etwa 40% der arbeitsfähigen Männer dieses Raumes leben in anderen Teilen des Landes. Sie wandern ab, um z. B. in den<br />
Plantagen der Küstenregion einen Verdienst zu finden. Nur mehrmals im Jahr können sie ihre Familien besuchen.<br />
Das <strong>Pro</strong>jekt begann 1975. Jährlich können 20 Bauern mit ihren Familien in der Zugtieranspannung und den verbesserten<br />
Anbautechniken geschult werden. Während der einjährigen Ausbildung leben die Familien im Ausbildungszentrum. Seit<br />
1978 werden zusätzlich 60 Bauern in Kurzkursen unterwiesen.<br />
Der letzte kurze Text auf der Seite 137 steht unter der Überschrift "Einige Erfahrungen aus der <strong>Pro</strong>jektarbeit":<br />
Die Bemühungen, Männer stärker in die Landwirtschaft einzubinden, haben bereits Erfolg gehabt. Ihr Einsatz führte dazu,<br />
dass die durchschnittlichen Betriebsgrössen bei Gespannhaltung zwischen 2 und 5 ha liegen. Doch das zusätzliche Land<br />
muss erst erschlossen werden. Nahe den Siedlungen stehen dafür keine Flächen zur Verfügung, da sie dem traditionellen<br />
Anbau dienen. Folglich wird abgelegenes, häufig schwer zugängliches Land gerodet. Dafür sind Wege und Brücken zu<br />
bauen. Diese Massnahmen haben aber das Weideland für die Rinder verkleinert, worunter die Fulani zu leiden haben.<br />
Daraus erwachsen neue <strong>Pro</strong>bleme für diesen Raum.<br />
Für den Kauf eines Ochsengespanns und die notwendigen Geräte müssen die Bauern eine ihnen ungewohnte Schuldenlast<br />
(Kredite) aufnehmen. Sie sind zu einem relativ hohen Geldeinkommen gezwungen. Hohe Schulden können aber zur<br />
Aufgabe führen und das <strong>Pro</strong>jekt gefährden. Deswegen sind die Kosten so niedrig wie möglich zu halten.<br />
Ein örtliches Handwerk, das die Herstellung und die Reparatur der landwirtschaftlichen Geräte übernehmen kann, muss<br />
unbedingt geschaffen werden, um Kosten zu senken und längere Ausfallzeiten von Geräten zu vermeiden.<br />
Damit spricht der Autor eines der Hauptprobleme für die Durchführung von <strong>Pro</strong>jekten an: die nicht vorhande-<br />
ne Infrastruktur. Die besten Maschinen, das beste Gerät hat wenig Nutzen, wenn Wartung und Reparatur nicht<br />
gewährleistet werden können. (Zum Ochsenpflug siehe auch die Seiten 308 und 363 dieser Arbeit.)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 333
4.30.1.7 "Ofenbauprogramm in Overvolta" (Burkina Faso)<br />
Auf den Seiten 138-139 wird ein weiteres Entwicklungshilfeprojekt unter dem Titel "Das Ofenbauprogramm<br />
in Obervolta" vorgestellt:<br />
Wald und Busch schwinden immer mehr in Obervolta. Die Ursachen dafür sind die ständig ausgeweiteten<br />
Landwirtschaftsflächen und der zunehmende Holzverbrauch, der den natürlichen Zuwachs übersteigt.<br />
Holz ist für über 90% der Bevölkerung das wichtigste und fast ausschliessliche Brennmaterial für die häusliche Feuerstelle.<br />
Es wird zum Hausbau und zur Fertigung von Gebrauchsgegenständen benötigt. Das Bevölkerungswachstum zieht<br />
zwangsläufig einen erhöhten Holzbedarf nach sich.<br />
Ein langsam eintretender Wandel in manchen Lebensgewohnheiten steigert den Holzverbrauch:<br />
Die Grossfamilie ist in Auflösung begriffen. Kleinfamilien unterhalten eigene Feuerstellen und vermehren deren<br />
Gesamtzahl im Lande.<br />
Es ist üblich, nur eine gekochte Mahlzeit pro Tag zuzubereiten. In manchen Gegenden bürgern sich allerdings zwei warme<br />
Mahlzeiten ein. Dies ist eine Auswirkung der staatlichen und privaten Betreuung zur Verbesserung des<br />
Gesundheitszustandes.<br />
Frisches Gemüse verbessert die Ernährungslage. Die Zahl der Hausgärten nimmt zu. Zäune, meist aus Holz errichtet,<br />
schützen diese vor Tieren.<br />
Früher trugen fast ausnahmslos die Frauen das gesammelte Holz zum Wohnplatz. Heute werden dafür häufiger<br />
tiergezogene Karren eingesetzt. Diese für den Menschen arbeitssparende Transportart verleitet jedoch zu einem<br />
grosszügigeren Verbrauch.<br />
Die Trockenperiode von 1970 bis 1974 bewirkte häufigere und ausgedehnte Buschfeuer. Waldbestände, Baumgruppen<br />
und Gebüsch wurden dadurch stark beeinträchtigt. Diese Schäden konnten noch nicht wieder ausgeglichen werden; denn<br />
der Grundwasserspiegel sank während dieser Zeit erheblich ab. An der Grenze zu Mali, nordwestlich von Ouagadougou,<br />
mussten z. B. Brunnen von 12 m auf 30-40 m vertieft werden, um das Grundwasser zu erreichen.<br />
Die ländliche Bevölkerung Obervoltas muss ständig mehr Zeit und Arbeitskraft aufwenden, um Brennholz zu sammeln. In<br />
der Umgebung von Städten ist kaum noch welches zu finden. Hier muss Brennholz gekauft werden, das von Holzhändlern<br />
aus entfernteren Gebieten bezogen wird. Bis zu einem Drittel seines Monatsverdienstes muss ein Arbeiter dafür zahlen.<br />
Die traditionellen Feuerstellen finden sich entweder vor Häusern/Hütten oder in Kochhütten. Sie bestehen meist aus drei<br />
Steinen, die ringförmig um die Brennstelle angeordnet sind. Auf ihnen steht der Kochtopf. Die Abstände zwischen den<br />
einzelnen Steinen sind so gewählt, dass Holz nachgeschoben werden und Luft hinzutreten kann. Um den Holzverbrauch zu<br />
verringern, schützt man das Feuer vor zu starkem Wind. Dann werden die Abstände zwischen den Steinen mit Ton- oder<br />
Metallstücken geschlossen. Zu trockenes Holz wird angefeuchtet, noch glühendes sofort gelöscht, wenn Feuer nicht mehr<br />
nötig ist. Metalltöpfe leiten die Wärme besser als die dort üblichen Tongefässe und kommen deswegen mehr und mehr in<br />
Gebrauch.<br />
Der Text wird durch die Abbildung "Schnittzeichnung eines Nouna-Ofens" und dem Foto "Nouna-Ofen",<br />
welches eine Frau beim Kochen zeigt, illustriert. Die Seite 139 zeigt ein Schema "Bevölkerungszunahme und<br />
Brennholzbedarf: Ursachen für eine Übernutzung ländlicher Räume", die den Wirkungskreis rund um den<br />
Brennholzbedarf aufzeigt (nach der Abbildung im Lehrmittel):<br />
Zunehmend hoher Zeitaufwand<br />
oder steigende Kosten für die<br />
Beschaffung von Brennholz<br />
Entwaldung<br />
Zunehmende Acker- und Buschrodung,<br />
Ausdehnung von Acker- und Weideflächen,<br />
steigender Brennholzbedarf<br />
Bevölkerungszunahme in landwirtschaftlich<br />
noch ertragreichen<br />
Räumen oder in Städten durch<br />
Zuwanderung von Bevölkerung aus<br />
übernutzten, verarmten Gebieten<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Bodenspülung bei<br />
Niederschlägen,<br />
schnelleres Abfliessen<br />
von Regenwasser,<br />
Überflutung in Flusstälern,<br />
Sinken des<br />
Grundwasserspiegels<br />
Zerstörung des Bodens,<br />
Verlust von Nutzflächen<br />
Ersatz von Brennholz<br />
durch Ernterückstände<br />
(z. B. Stroh, Schalen)<br />
oder getrockneten<br />
Tierkot<br />
Verlust von natürlichem<br />
Dünger, geringere Humusbildung,<br />
Nachlassen der<br />
Bodenfruchtbarkeit<br />
Sinkende Erträge<br />
auf den Feldern<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 334
Im Text schreibt der Autor auf der Seite 139 über das "Ofenbauprogramm":<br />
Das Ofenbauprogramm begann 1979 im Rahmen des Voltaisch-Deutschen Forstprojekts. Ziel ist, die Holzproduktion<br />
durch Aufforstung zu sichern und zu erhöhen sowie den Brennholzverbrauch durch geeignete Ofen zu verringern.<br />
Ausgangspunkt des Vorhabens ist die Stadt Nouna (15'000 Einw.) im Nordwesten Obervoltas am südlichen Rande der<br />
Sahel-Zone. Neben der einheimischen Bevölkerung leben seit der Dürrekatastrophe im Sahel viele von dort Zugewanderte<br />
in der Stadt und ihrer Umgebung.<br />
Bis Anfang 1982 sind etwa 1'200 Nouna-Öfen... gesetzt worden - vor allem in Häusern wichtiger Persönlichkeiten und in<br />
öffentlichen Einrichtungen (z. B. Krankenhäusern). Das Baumaterial stammt grösstenteils aus der Umgebung. Zement<br />
muss hinzugekauft werden. Drei Demonstrationszentren, eines davon in der Landeshauptstadt Ouagadougou, haben den<br />
Ofenbau in weiten Teilen Obervoltas bekannt gemacht.<br />
Über die Vorteile der Verwendung des Ofens schreibt der Autor (S. 139):<br />
Bei guten Öfen ist eine Brennholzersparnis zwischen 30% und 50% gegenüber offenen Feuerstellen möglich. Die Öfen<br />
erzeugen Hitze schneller und halten sie länger. Sie dienen als Backöfen, wenn die Glut herausgenommen wird.<br />
Bei Feuer im Freien wird die Asche meist vom Wind verweht. Es ist dabei kaum zu verhindern, dass sie auf zubereitete<br />
Speisen fällt.<br />
Feuerstellen bergen gesundheitliche Gefahren. Rauch in geschlossenen Räumen kann zu Bindehautentzündungen der<br />
Augen und zur Erkrankung der Atemwege führen. Verbrennungen sind häufig, Kleinkinder sind besonders gefährdet.<br />
(Zu Verbrennungen an Feuerstellen siehe auch die Seite 362 dieser Arbeit.) Zu den Nachteilen des Nouna-<br />
Ofens schreibt der Autor:<br />
Trotz dieser Vorteile ist es nicht sicher, dass die gesamte Bevölkerung den Ofenbau begrüsst; denn offenes Feuer besitzt<br />
für sie manche Vorteile:<br />
Rauchentwicklung hält Moskitos (Mücken) fern, schützt die Balken der Häuser vor Termitenfrass und Zerstörung und<br />
verringert den Insektenbefall der Erntevorräte, die unter dem Dach von Häusern und Hütten aufbewahrt werden.<br />
Offene Feuerstellen spenden Licht am Abend und sind meist der örtliche Mittelpunkt des Familienlebens. Öfen bedeuten<br />
daher meist eine Veränderung der Lebensgewohnheiten.<br />
Die Feuerstelle als Mittelpunkt des sozialen Geschehens und als Ort an dem die Geschichten eines Volkes<br />
weitererzählt werden, erwähnt nur noch das Lehrmittel "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule"<br />
(1972-1977, Bd. 4, S. 57). (Siehe dazu die Seite 244 dieser Arbeit.)<br />
4.30.1.8 "Die Industrialisierung Nigerias"<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Die Seiten 140-143 beschäftigen sich im Kapitel "Die Industrialisierung Nigerias" mit dem bevölkerunsreich-<br />
sten Land Afrikas. Die Seite 140 zeigt ein Foto "Zentrum von Lagos". Im Text schreibt der Autor:<br />
Nigeria nimmt unter den Entwicklungsländern Westafrikas als bevölkerungsreichster Staat eine besondere Stellung ein. Für<br />
seine wirtschaftliche Entwicklung bilden die erschlossenen Erdölvorkommen im und vor dem Nigerdelta eine gute<br />
Grundlage. Seit 1974 ist das Land der wichtigste afrikanische Erdöllieferant auf dem Weltmarkt. Die Erdöldollar fliessen<br />
und haben zu einem rasanten wirtschaftlichen Wachstum geführt. Doch der Reichtum ist ungleichmässig verteilt. Die<br />
Gegensätze zwischen Armen und Reichen haben sich nicht verringert, sondern noch verschärft.<br />
1996 förderte das OPEC-Mitgliedland Nigeria rund 111 Mio. Tonnen Rohöl und war damit der grösste Erdöl-<br />
exporteur Afrikas. Wegen diesen Öllieferungen konnte Nigeria trotz massiver Menschenrechtsverletzungen<br />
unter dem Militärregime Abacha immer wieder drohende Sanktionen vermeiden.<br />
Die hektische Entwicklung wird vor allem in der Hauptstadt Lagos deutlich. Während 1970 in der Stadt und den<br />
dichtbevölkerten Randgebieten 1.5 Mio. Menschen lebten, konzentrierten sich hier 1980 etwa 3.5-4 Mio. Einwohner. In<br />
der Hoffnung auf einen Arbeitsplatz strömen Arbeitswillige vom Land in die Hauptstadt. Sie landen dabei unweigerlich in<br />
den sich ständig vergrössernden Elendsvierteln (Slums) der Stadt, die sich im Anschluss an das Zentrum mit seinen<br />
Hochhäusern und die besseren Wohnviertel bis etwa 30 km ausdehnen.<br />
(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seite 288 und 383 dieser Arbeit.)<br />
Die Versorgungseinrichtungen der Stadt sind völlig überlastet. Jeden Tag bricht irgendwo für Stunden die<br />
Stromversorgung zusammen. Klimageräte und Tiefkühltruhen sind dann ausser Betrieb. Telefonieren ist wegen<br />
Überlastung des Netzes kaum möglich. Die Wasserversorgung ist völlig unzureichend. Die Villen und Bungalows der<br />
Reichen sind mit Wassertanks auf den Dächern oder mit eigenen Pumpen ausgerüstet. In den Strassen türmen sich Berge<br />
von Müll, die von Zeit zu Zeit angesteckt werden und dann die Gegend verpesten.<br />
Trotz eines ständigen Ausbaus reicht das Strassennetz nicht aus. Zu allen Tageszeiten bilden sich lange<br />
Fahrzeugschlangen. Häufig bricht der Verkehr total zusammen.<br />
Seit den siebziger Jahren hat sich die Verkehrssituation zwar verbessert, andere <strong>Pro</strong>bleme bestehen aber<br />
weiterhin. Zu den Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt schreibt der Autor (S. 141):<br />
Die Stadt Lagos ist auf 3 Inseln gelegen. Dadurch ist ihre räumliche Ausdehnungsmöglichkeit beschränkt und die<br />
Erschliessung neuer Baugebiete besonders schwierig. So werden auch ungeeignete Gebiete besiedelt. Das hat vor allem in<br />
den Slums zu teilweise katastrophalen Zuständen geführt. Vor allem während der Regenzeit sind viele Teile der Stadt<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 335
überschwemmt. Ein übler Geruch verbreitet sich dann, der von oberflächlich abfliessenden Wassermassen, vermischt mit<br />
Abfällen und Kot, ausgeht.<br />
Lagos wird heute häufig als das "Calcutta" Afrikas bezeichnet. Doch anders als in Indien ergeben sich hier die <strong>Pro</strong>bleme<br />
nicht durch Hunger und Armut, sondern aus der Hoffnung, am Wohlstand teilnehmen zu können.<br />
(Zu Lagos siehe auch die Seiten 279 und 393 dieser Arbeit.) Die Seite 141 zeigt eine Tabelle "Bevölkerung...<br />
und Anteil der Erwerbspersonen in Wirtschaftsbereichen..." für die Staaten Ghana, Kamerun und Nigeria in<br />
den Jahren 1960 und 1980, sowie zwei Fotos "Lagos - Lagunenstadt" und "Slum in Lagos". Im Text setzt der<br />
Autor seine Beschreibungen fort:<br />
Die Hälfte der Gesamtbevölkerung Nigerias ist im erwerbsfähigen Alter... Mehr als die Hälfte dieser 15-44jährigen (55%)<br />
betätigt sich vor allem als Selbstversorger ständig in der Landwirtschaft. Sie leben mit ihren Familien von den Erträgen<br />
ihrer Felder oder von der Viehhaltung. Die andere knappe Hälfte (45%) gibt an, in Industrie, Gewerbe oder<br />
Dienstleistungen (Verwaltung, Handel, Verkehr u. a.) tätig zu sein. Doch stehen in Nigeria nur für ca. 10% der<br />
Erwerbsfähigen bezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung. Hierin spiegeln sich die Schwierigkeiten wider, mit denen das Land<br />
zu kämpfen hat: Um wenige bezahlte Arbeitsplätze bemühen sich viele Arbeitswillige. Arbeitslosigkeit oder zeitlich<br />
begrenzte Beschäftigung bzw. Unterbeschäftigung sind weit verbreitet. Nur etwa 5% der Erwerbsfähigen verfügt über ein<br />
regelmässiges Einkommen, ungefähr 40% sind als "Gelegenheitsarbeiter" zu betrachten.<br />
An dieser Lage hat die Industrialisierung, trotz aller Fortschritte, nur wenig geändert; denn seit 1970 konnten für nur etwa<br />
1% der Erwerbsfähigen industrielle Arbeitsplätze geschaffen werden. Und doch ist es für Industrieunternehmen nicht<br />
immer möglich, vorhandene Stellen zu besetzen. Es mangelt an einer ausreichenden Zahl von ausgebildeten Fachkräften.<br />
Demgegenüber ist eine hohe Zahl von ungelernten Arbeitswilligen vorhanden. Auf der Suche nach Arbeit drängen vor<br />
allem junge Menschen vom Land in die Städte. Diese Landflucht bringt in den Städten erhebliche Belastungen, wie sie in<br />
Lagos besonders deutlich werden.<br />
Die Seite 142 zeigt zwei Karte zum Thema "Standorte der verarbeitenden Industrie in Nigeria" für die Jahre<br />
1965 und 1975 aus denen ersichtlich wird, dass sich ein Grossteil der wirtschaftlichen Aktivitäten auf den<br />
Raum von Lagos, sowie Kano und Kaduna und im Süden des Landes konzentriert, während weite Teile des<br />
Landes kaum über eine verarbeitende Industrie verfügen. Im Text schreibt der Autor über die Schwierigkeiten<br />
der wirtschaftlichen Entwicklung in Nigeria (S. 142):<br />
- Der Mangel an leistungsfähigen Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen: Die Häfen sind mangelhaft ausgestattet.<br />
Ladungen müssen oft von Seeschiffen auf offener Reede in kleine Einheiten (Leichter) übernommen werden und<br />
umgekehrt. Die Strom- und Wasserversorgung sowie das Strassennetz und die Eisenbahnlinien sind überlastet und<br />
entsprechen nicht den Anforderungen.<br />
- Die unzureichende Wartung von Maschinen und Fahrzeugen: Es fehlen Facharbeiter und ausgebildete Arbeitskräfte.<br />
Die kosten- und zeitaufwendige Ersatzteilbeschaffung für eingeführte Ausrüstungen lässt Maschinen häufig längere Zeit<br />
stillstehen. Arbeitsvorhaben können so nicht planmässig und wirtschaftlich abgewickelt werden.<br />
Zur Industrialisierung Nigerias schreibt der Autor (S. 142):<br />
Die Industrialisierung begann in Nigeria um 1960 zunächst nur zögernd. Mit Hilfe der Einnahmen aus der<br />
Erdölförderung... entstanden ab 1970 verstärkt neue Industriekomplexe, Hafenanlagen und Strassen. Die Einfuhr von<br />
Maschinen, Geräten, Halbfertigwaren und im Lande selbst fehlenden Rohstoffen stieg erheblich an... So ist Nigeria heute<br />
trotz aller Schwierigkeiten der am stärksten industrialisierte Staat Westafrikas.<br />
Trotz des Niedergangs der Wirtschaft Nigerias unter der Herrschaft der Militärregierung Sani Abachas, einem<br />
Hausa, von 1993-1998 hat die oben gemachte Aussage ihre Gültigkeit auch Ende des 20. Jahrhunderts nicht<br />
verloren. Im Text schreibt der Autor weiter:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Die im Rahmen der Industrialisierung Nigerias ausgebauten Verkehrswege sind auch für die Räume ausserhalb der<br />
Wirtschaftszentren von Bedeutung. Entlang von Strassen verdichtet sich die Bevölkerung. Landwirtschaftsbetriebe erhalten<br />
die Möglichkeit, ihre Waren günstiger und schneller auf die städtischen Märkte zu bringen. Die landwirtschaftliche<br />
Marktproduktion wird dadurch angeregt. Der Abtransport von Holz, das für die Ausfuhr bestimmt ist, kann ebenfalls<br />
leichter erfolgen.<br />
Bessere Verkehrsverbindungen zwischen den Städten und dem weiteren Umland bieten der Landbevölkerung den Anreiz,<br />
die Städte aufzusuchen. Dadurch kann sich aber die Landflucht verstärken. Das hat neben Vorteilen für einzelne jedoch<br />
erhebliche Nachteile. Die Erträge der Landwirtschaft sinken häufig bei hoher Abwanderung; denn die ausscheidenden<br />
Arbeitskräfte können nicht durch Maschinen ersetzt werden, weil es zu deren Anschaffung an Geld mangelt, und die<br />
Bauern dafür nicht geschult sind. So fehlen Nahrungsmittel aus eigener <strong>Pro</strong>duktion, die aus dem Ausland eingeführt<br />
werden müssen.<br />
1995 importierte Nigeria Nahrungsmittel im Wert von rund 600 Mio. US$, bei einem gleichzeitigen Exportvo-<br />
lumen von 11.7 Mrd. US$, welches zu 97.4% mit Erdölverkäufen erwirtschaften wurde. Trotz dieser Exporte<br />
summierte sich die Auslandverschuldung bis 1995 auf 35 Mrd. US$, was allerdings wegen der hohen Bevölke-<br />
rung immer noch einer relativ kleinen pro-Kopf-Verschuldung von rund 300 US$ entsprach. Wegen des<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 336
Zerfalls der Raffinerien durch Misswirtschaft muss das Erdölexportland Nigeria unterdessen aber auch Treib-<br />
stoff importieren. (Fischer 1998)<br />
Die Seite 143 zeigt, das Kapitel abschliessend, zwei Fotos "Industriekomplex in Lagos" und "Hafen Tin Can<br />
Island (Lagos)", sowie eine Tabelle zum Aussenhandel Nigerias für die Jahre 1970, 1974 und 1978, wobei der<br />
sprunghafte Anstieg der Erdölexporte zwischen 1970 und 1974, sowie die Umkehrung der grossen Handels-<br />
überschusses von 1974 in ein Handelsdefizit 1978 besonders auffallen. (Zu Nigeria siehe auch die Seiten 297<br />
und 364 dieser Arbeit.)<br />
4.30.2 Weitere Bände<br />
Der Band für die Klassen 9 und 10 enthält keine Informationen zu Schwarzafrika. Der Band für die 11. Klasse<br />
beschäftigt sich auf den beiden Seiten 38-39 unter dem Titel "Ackerbau und Viehzucht in den Savannen" noch<br />
einmal mit Nigeria. Auf der Seite 38, die auch eine Karte "Bodennutzung in Nigeria" zeigt, aus der die Vieh-<br />
triebwege und die unterschiedlichen Vegetationszonen ersichtlich sind, schreibt der Autor:<br />
Die Trockensavannen mit 100 bis 700 mm Jahresniederschlag sind Hauptgebiete der Viehzucht in den Tropen. In Afrika<br />
hat sich ein traditionsreicher Weidenomadismus entwickelt, der privaten Herdenbesitz mit unveräusserlichem<br />
Gemeinschaftsbesitz an Weidegründen und Wasserstellen verbindet.<br />
Diese Umstände führen dazu, dass man in den westafrikanischen Städten der Savannenzone scheinbar "herr-<br />
enlose" Tiere umherwandern sieht. Zu den grösseren Wanderbewegungen schreibt der Autor (S. 38):<br />
Zur Überbrückung jahreszeitlich bedingter Futter- und Wasserknappheit sind Wanderungen des Viehs notwendig.<br />
Zusammensetzung der Herden mit verschiedenen Tierarten, Ausmass und Richtung der Wanderungen hängen davon ab,<br />
ob Mensch und Tier über genügend Wasser und ausreichende Weidegründe verfügen. Auch Seuchen- bzw.<br />
Parasitengefährdung und Salzversorgung der Tiere spielen eine Rolle. Klima und Seuchen führen zu starken<br />
Schwankungen der Tierproduktion. In Trockenperioden werden Herden bis zu 80% oder ganz vernichtet. Wegen der<br />
grossen Abhängigkeit der nomadischen Lebensform vom Vieh erscheint eine Aufstockung der Herden vernünftig und<br />
notwendig. Deshalb werden meist nur Bullen und ältere Kühe verkauft. Die Qualität des Viehs wird weniger nach Fleischund<br />
Milchleistung als nach Widerstandskraft gemessen.<br />
Entsprechend ist die Qualität des zum Verkauf angebotenen Fleisches. Da es auch in den Ländern Westafrikas<br />
nicht üblich ist, an Altersschwäche oder Krankheit gestorbene Tiere zum Verzehr freizugeben, kann es<br />
vorkommen, dass eine Kuh, die sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten kann, auf einem Karren zum<br />
Schlachthaus befördert wird. Aus diesen Gründen ist es empfehlenswert, Rindfleisch entsprechend lange zu<br />
kochen, was dann in der lokalen Küche mit den stundenlang gekochten Gerichten auch der Fall ist. Über die<br />
<strong>Pro</strong>bleme der Grossviehhaltung schreibt der Autor (S. 38):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Die Grossviehhaltung wird in den Tropen durch Seuchen und Parasiten begrenzt. Die seuchengefährdeten Gebiete ergeben<br />
sich aus dem Lebensraum krankheitsübertragender Insekten. Die Tsetsefliege z. B. überträgt Parasiten, die im Blut von<br />
Warmblütern leben und als Erreger von Schlafkrankheit und Nagana, einer fiebrigen Tierseuche, für Mensch und Tier sehr<br />
gefährlich sind. Da man die Krankheitserreger, die auch in den resistenten Wildtieren leben, nicht ausrotten kann, muss<br />
man die Überträger bekämpfen oder krankheitsresistente Rassen züchten. Beides ist bisher nur sehr begrenzt gelungen. Da<br />
die Tsetsefliege an enge Temperaturgrenzen und Schatten gebunden ist, kann man sie durch totale Rodung aus einem<br />
Gebiet vertreiben. Die Ausrottung der Fliege ist trotz des Einsatzes von DDT nicht gelungen. Heute werden biologische<br />
Methoden, etwa Duftfallen mit Sexuallockstoffen oder Sterilisation, in Verbindung mit vorbeugender Behandlung der<br />
Rinder bevorzugt.<br />
(Zur Schlafkrankheit siehe auch die Seite 202 dieser Arbeit.) Die Seite 39 zeigt zwei Diagramme "Nieder-<br />
schläge und Hirseanbau in Nord-Dafur" für einen Mittelwert von 1931-1960 und das Trockenjahr 1949. Im<br />
Text schreibt der Autor unter der Überschrift "Ackerbau an der Trockengrenze":<br />
Die Nutzungsmöglichkeiten in Trockengebieten werden häufig nach mittleren Niederschlagshöhen und jahreszeitlicher<br />
-verteilung beurteilt. Der Landwirt kann sich diesen Grössen leicht durch Bodenbearbeitung, Nutzpflanzenwahl und<br />
geeignete Nutztiere in vielfältiger Weise anpassen. Aber der Niederschlagsvariabilität ist er fast hilflos ausgeliefert. Ohne<br />
künstliche Bewässerung bedeuten unvorhersehbare Schwankungen der Regenmenge in der Anbauphase ein hohes<br />
Ernterisiko.<br />
Geringe Regenmengen lassen sich ackerbaulich am besten nutzen, wenn sie regelmässig und zusammenhängend in einer<br />
kurzen Zeit fallen. Je höher die Niederschlagsvariabilität ist, je weiter entfernt sich deshalb die landwirtschaftliche von der<br />
klimatischen Trockengrenze, weil mit der Variabilität der Niederschläge das Ernterisiko steigt. Die knappen<br />
Wassermengen müssen möglichst vollständig genutzt werden. Gleichzeitig müsste der Bauer auf<br />
Niederschlagsschwankungen flexibel reagieren können. Deshalb baut er Feldfrüchte an, die hohe<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 337
Wasseranspruchslosigkeit mit einer kurzen Wachstumszeit verbinden. Dies gilt für Hirse und Gerste, in geringerem Masse<br />
auch für Mais und Erdnuss sowie für einige Erbsen- und Bohnensorten.<br />
Die noch im Lehrmittel "Dreimal um die Erde" von 1977-1980 (Bd. 3, S. 106) als "rückständig" bezeichnete<br />
Landwirtschaft, wird hier als flexibles System beschrieben, welches auf die äusseren Gegebenheiten durch die<br />
Wahl geeigneter Nutzpflanzen reagiert.<br />
Unter der Überschrift "Entwicklungsprojekt Mokwa Cattle Ranch" beschreibt der Autor ein deutsch-<br />
nigerianisches Entwicklungsprojekt zur Rindermast, in dem er über den Viehbestand Nigerias schreibt:<br />
In Nigeria werden jährlich über 1 Mio. Schlachttiere vermarktet. Fütterungsversuche haben ergeben, dass die<br />
einheimischen Rassen gut zur Mast geeignet sind. Gerade das Magervieh aus der traditionellen Viehzucht der<br />
Trockensavanne stellt ein hohes Mastpotential dar, dessen Ausnutzung das steigende Fleischdefizit Nigerias deutlich<br />
vermindern könnte...<br />
Im Text folgt eine kurze Beschreibung des <strong>Pro</strong>jektes sowie eine chronologische Übersicht für die Jahre<br />
1964-1974, die keine weiteren erwähnenswerten Informationen zum Thema dieser Arbeit mehr enthält.<br />
4.30.3 Zusammenfassung<br />
Der Autor, der zwar noch von "Stämmen" spricht, das Wort "Neger" aber nicht mehr verwendet, zeichnet das<br />
Bild eines von schwierigen Verhältnissen an der Entwicklung gehinderten Schwarzafrikas. Die in anderen<br />
Lehrmitteln meist ausführlich behandelten "Pygmäen" tauchen hier nur in einem Nebensatz auf.<br />
Die Menschen Schwarzafrikas leben nicht mehr in natürlicher Verbundenheit mit ihrer Umgebung, sondern<br />
treiben "Raubbau" an den Wäldern und entwalden durch ihre grossen Viehbestände ganze Gebiete der Savan-<br />
ne. Selbst die beschriebenen Massai verändern, obwohl sie sich kaum an die "höhere Zivilisation angepasst"<br />
haben, ihre Umwelt, denn ihr "höchstes Glück" ist ein "möglichst grosser Viehbestand".<br />
Mit den Ländern Kenia und Zaire werden zwei Länder vorgestellt, die in der Entwicklung der Landwirtschaft<br />
Erfolge verbuchen konnten. Die Länder Kamerun und Burkina Faso werden als Länder beschreiben, die auch<br />
bei vergleichsweise einfachen <strong>Pro</strong>jekten auf die Hilfe von aussen angewiesen sind. Am Beispiel Nigerias zeigt<br />
der Autor auf, dass selbst eine Industrialisierung die <strong>Pro</strong>bleme des Kontinents nicht löst und zu einer äusserst<br />
ungleichen Besitzverteilung führt.<br />
In allen Bänden werden die Schwarzafrikaner als zwar initiative Menschen geschildert, die "flexibel" auf<br />
Einflüsse reagieren, den Umweltbedingungen aber hilflos ausgesetzt sind.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1983-1984)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 338
4.31 Geographie der Kontinente (Schülerband, 1984)<br />
"In Obervolta klettern ausgemergelte Gestalten auf kahle Bäume: sie verschlingen die verdorrten Knospen - und in Mali<br />
zerstören Dorfbewohner Termiten-Bauten: sie suchen die Hirsevorräte der Insekten!... In einigen Gebieten haben<br />
fünfjährige Kinder noch nie Regen erlebt. Wo einst Herden weideten, modern jetzt Kadaver. Wo Hirse wuchs, frisst sich<br />
die Wüste vor. Der Hungertod bedroht 6 Millionen der 24 Millionen Einwohner der Sahel-Staaten. In den Dörfern und<br />
Nomadenlagern herrscht Verzweiflung. Hundert Meter tiefe Brunnen sind ausgetrocknet. Viele Hirten bieten ihre letzten<br />
Rinder zu nie gekannten Niedrigpreisen an. Aber die Menschen haben kein Geld, auch die Ackerbaugebiete sind<br />
ausgedorrt..." (S. 58: aus einem Zeitungsartikel von 1973)<br />
Der 320 Seiten starke Band "Geographie der Kontinente" in der 1. Ausgabe von 1984 dient sowohl in der<br />
Sekundarschule als auch in Mittelschulen zusammen mit den Büchern "Geographie Europas" und dem<br />
"Schweizer Weltatlas" als offizielles Geographielehrmittel in Teilen der Deutschschweiz. Der afrikanische<br />
Kontinent wird auf rund 60 Seiten in Länderberichten, der Beschreibung klimatischen Regionen, Fotos und<br />
Karten erwähnt oder besprochen.<br />
4.31.1 Steckbrief des Kontinents<br />
Der Band bietet in einem "Steckbrief der Kontinente" einen ersten Überblick über den Kontinent Afrika. Auf<br />
Seite 6 ist die Weltkarte von Diego Ribeiro (erstellt 1525-1527) abgebildet. Der dazu passende Text auf Seite<br />
7 klärt den Schüler auf:<br />
"...Die Völker Asiens und Europas haben den afrikanischen Kontinent schon früh betreten und erkundet. Allerdings<br />
beschränkten sich die Kenntnisse über Afrika im wesentlichen auf Gebiete längs der Mittelmeer- und Rotmeerküste... Vom<br />
15. Jahrhundert an erkundeten portugiesische Seefahrer... die Westküste Afrikas... Längs der Küste errichteten sie<br />
Handelsniederlassungen und Stützpunkte für künftige Indienfahrten - das Innere blieb jedoch weiterhin unbekannt, denn<br />
Hindernisse aller Art stellten sich den Erforschern entgegen.<br />
Bereits in der Einführung spricht Bär von den Völkern Asiens und Europas, die sich aktiv auf dem afrikani-<br />
schen Kontinent zeigten, während er die eigentlichen Bewohner nicht einmal erwähnt.<br />
Auf den Seiten 8-11 wird die Erforschung des afrikanischen Kontinents anhand von Berichten des karthagi-<br />
schen Admirals Hanno (um 525 v. Chr.), der auf dem Seeweg bis in das Gebiet des heutigen Kamerun gelang-<br />
te; Gustav Nachtigal (ca. 1867), der vor allem Gebiete der Sahara erforschte; H. M. Stanley, der den vermis-<br />
sten Missionar und Afrikaforscher Livingstone 1871 am Tanganjikasee fand, und der den Lauf des Kongos<br />
erforschte (ca. 1871-76); und Walter Mittelholzer, einem schweizerischen Flugpionier, der den Gipfel des Kili-<br />
mandscharo überflog (ca. 1927), geschildert. Über die bereits lange vor diesen Entdeckungen ansässige Bevöl-<br />
kerung erfahren die Schüler aus dem Bericht von Hanno auf Seite 8:<br />
"...Sieben Tagereisen weiter erreichten wir eine grosse Bucht. Am Tag sahen wir nichts als Wald. Nachts loderten viele<br />
Feuer, und wir hörten unter gewaltigem Lärm den Schall von Pfeifen, Cymbeln und Pauken. Die Furcht trieb uns von<br />
dannen..."<br />
Aus dem Text nach Nachtigal erfährt der Schüler ebenfalls auf Seite 8 nur, dass der deutsche Arzt in Gefan-<br />
genschaft der mohammedanischen Bevölkerung, welche die Christen verachteten, geriet und sich durch die<br />
grausamen Reden seiner Peiniger quälen lassen musste.<br />
Aus dem ersten Text nach Stanley (S. 9) über David Livingstone erfahren die Schüler, dass dessen Expedition<br />
vom Unglück verfolgt wurde. Unter anderem "machten sich die Eingeborenen seine Hilflosigkeit zunutze und<br />
beuteten ihn aus, wo sie nur konnten."<br />
Ausserdem erfahren die Schüler in einem Text nach A. Hochheimer, betitelt mit "Stanley berichtet über Inner-<br />
afrika", aus der Unterredung Stanleys mit einem arabischen Sklavenhändler über die im Kongogebiet ansässi-<br />
gen "Pygmäen" (S.10):<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
"...Die Eingeborenen sind Menschenfresser, eine Reise dorthin heisst Kampf, nichts als Kampf... Hätte er das getan, so<br />
wäre er im Norden von den Eingeborenen aufgefressen worden..."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 339
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 293 und 340 dieser Arbeit.) Aus dem Bericht "Über dem Kilimand-<br />
scharo" nach Mittelholzer ist nichts über die Bevölkerung des überflogenen Gebietes zu entnehmen, denn der<br />
Text gibt sich ganz dem Flugerlebnis hin.<br />
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Schüler in diesem Steckbrief über den afrikanischen Konti-<br />
nent, nebst topographischen Fakten (Karte, S. 11) und dem Verbreitungsgebiet von Krankheiten (Karte, S. 7),<br />
welche auch den erwähnten Forschern immer wieder Mühe bereiten, und einer Karte (S. 11) über "Bevölk-<br />
erung und grosse Städte" zu einem nicht näher datierten Zeitpunkt, nur wenig über die auf dem Kontinent<br />
heimische Bevölkerung erfährt. Die Schüler "wissen" nach dem Lesen der geschilderten Berichte, dass der<br />
Afrikaner mittels verschiedenen Instrumenten einen gewaltigen Lärm vollführt, tapfere Christenmenschen, die<br />
den Unbillen des afrikanischen Wüstenklimas trotzen, in der Gefangenschaft verhöhnt und schlussendlich gar<br />
zur Menschenfresserei neigt. Wie diese den Schülern doch wohl eher fremde Menschen auf den afrikanischen<br />
Kontinent geraten sind, erfahren sie nicht, zumal doch im Eingangstext erklärt wird, dass der afrikanische<br />
Kontinent von Asiaten und den noch tüchtigeren Europäern erst entdeckt wurde.<br />
Wenn einmal von dieser einseitigen bisher vermittelten Sicht des afrikanischen Kontinents abgesehen wird,<br />
der den afrikanischen Völkern nicht gerade zur Ehre gereicht, fällt die unpräzise Beschreibung der Leistung<br />
der europäischen "Entdecker" und Forscher auf, die wenn auch nicht in der Entdeckung dieses Kontinents -<br />
ausser man bestehe darauf, dass nur der Europäer zur Entdeckung und Erforschung fähig sei - immerhin darin<br />
bestand, weite Gebiete Afrikas systematisch zu kartographieren.<br />
4.31.2 Der Regenwald<br />
In einem zweiten Teil beschäftigt sich "Geographie der Kontinente" mit den Landschaftsgürteln, präziser den<br />
Klima- und Vegetationszonen der Erde. In einem Bericht über den Kongo-Urwald (S.47-48) nach E. Egli wird<br />
der Besucher oder Erforscher des Regenwaldes durch einen Schwarzen begleitet:<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
"...Die Ruderschläge werden zögernd. Der Schwarze äugt nach links und rechts unter die Uferbüsche... Nun legt die Piroge<br />
sachte an. Es ist der Eintritt zu einem Urwaldpfad. Der Schwarze hält den runden, kiellosen Einbaum, und ich trete ein in<br />
das jahrtausendealte Geheimnis des Urwaldraumes... Jeden vorgewachsenen Zweig zwickt der Schwarze mit dem Messer<br />
weg."<br />
Dies sind die einzigen Informationen, welche die Schüler aus dem fast zweiseitigen Text über den schwarzafri-<br />
kanischen Menschen entnehmen können. Es bleibt nicht nur unklar, weshalb der "Schwarze" den Reisenden<br />
begleitet, sondern auch zu welcher Volksgruppe er gehört. Was, wenn der "Schwarze" nur einer dieser, wie im<br />
ersten Abschnitt des Buches gelernt, "menschenfressenden Pygmäen" ist? Entsteht bei einem solchen Bericht<br />
nicht der Eindruck, dass Ziel dieses geographischen Berichts sei neben der Aufklärung über die Eigentümlich-<br />
keiten des tropischen Regenwaldes, vor allem die Nabelschau auf die eigene Leistung, und nicht etwa, wie es<br />
vielleicht zu erwarten wäre, Sachinformation über die Bewohner des betroffenen Gebietes?<br />
Auf Seite 49 zum Thema "Gefahr für die Regenwälder" wird erstmals ein schwarzafrikanischer Mensch abge-<br />
bildet, gekleidet in Hose, T-Shirt und mit einer Wollkappe auf dem Kopf, fällt er gerade mit einer Motorsäge<br />
einen Urwaldriesen. Aus dem nebenstehenden Text erfahren die Leser, dass eine solche Tätigkeit dem Urwald<br />
abträglich ist, d.h. der abgebildete Arbeiter vernichtet sozusagen seine eigene Lebensgrundlage. Weshalb er<br />
dieser "selbstzerstörerischen" Tätigkeit nachgeht, darauf geht der Text weiter nicht ein.<br />
Auf den Seiten 50-51 schliesslich kommt Bär endlich auf die Bewohner des Urwaldes zu sprechen (S.50):<br />
"...Die frühesten Bewohner des Regenwalds, Zwergvölker wie z. B. die Pygmäen im Kongo-Urwald... leben mehrheitlich<br />
von der Jagd, vom Sammeln pflanzlicher Nahrung oder vom Fischfang."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 340
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 339 und 400 dieser Arbeit.) Bär verzichtet also darauf, bei der<br />
Ernährung der "Pygmäen" von "Schnecken" und anderen ähnlichen Tieren zu sprechen, wie das in älteren<br />
Lehrmitteln der Fall war.<br />
Auf der gleichen Seite wird in einem "Steckbrief der Pygmäengemeinschaft" über den Lebensraum, die<br />
Wohnung, die äussere Erscheinung, die Kleidung, den Lebensunterhalt, den Tauschhandel und das Gemein-<br />
schaftsleben informiert. Insgesamt zeichnet der Autor das Bild eines fröhlichen, lebensfrohen Volkes, welches<br />
sich von den "Früchten" des Urwaldes nährt, Fremden gegenüber eine gewisse Scheu aufzeigt und in der Lage<br />
ist, einfachste Bauten, d.h. ihre Hütten zu errichten. Wenig erfahren die Schüler hingegen über die kulturellen<br />
Errungenschaften der "Pygmäen", ausser dass sie die Musikinstrumente Flöte, Trommel, Klapper und Rassel<br />
kennen und in ihrer Musik und ihrem Tanz Jagdszenen darstellen. Auch über die von den Pygmäen auf ihren<br />
Wanderungen erstellten Lianenbrücken, die technisch hochstehende Leistungen darstellen, schweigt sich Bär<br />
aus. Insgesamt wird also das Bild eines naturverbundenen kleinwüchsigen Wilden gezeigt, der "in einer unre-<br />
flektierten Ehe mit der Natur..., ohne das Bedürfnis oder den Willen zu besitzen, aus dieser primitiven Harmo-<br />
nie auszubrechen", lebt. (Jestel Hrsg., 1982, S.81). Auf zwei Fotos werden die Pygmäen einmal bewaffnet mit<br />
Pfeil und Bogen, sowie der von ihnen verwendeten Kurzlanze, auf dem zweiten Foto mit den Musikinstrumen-<br />
ten Flöte und einer Art Mbira, die wohl durch Tauschhandel erworben wurde, abgebildet. Von den im ersten<br />
Teil des Lehrmittels erwähnten, aber nicht kommentierten "Menschenfresserei" ist keine Rede mehr.<br />
Mittels einer Sage, deren Quelle nicht näher bezeichnet wird und welche die Entdeckung der Banane schildert,<br />
leitet Bär über zu der ebenfalls im Regenwald ansässigen Volksgruppe der Bantu, die er auch als "Waldneger"<br />
bezeichnet (S. 51):<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
"...Die geschlossenen Dörfer bestehen aus festgefügten Häusern oder Hütten, die aus Pfählen, Latten, Reisig und Lehm<br />
aufgebaut und mit einem Schilf- oder Blätterdach gedeckt sind. Die Gebäude stehen in der Regel beidseits eines Pfades<br />
oder sind um einen zentralen Platz gruppiert. Sie sind einfach eingerichtet und meist in Wohn- und Schlafraum unterteilt.<br />
Neben einer Feuerstelle findet man darin auch Hausrat, wie Krüge, Töpfe oder eiserne Werkzeuge, aber auch Wandbänke,<br />
Matten und Bettgestelle, die selber angefertigt worden sind. Als Haustier hält man Hühner und Hunde, gelegentlich auch<br />
ein Schwein.<br />
Die Bantuvölker kennen die Einehe. Die Grossfamilie ist für die Erziehung und Ausbildung der Kinder selber<br />
verantwortlich. Daneben sind aber die Bindung an die Dorfgemeinschaft und das Stammesbewusstsein unter der Autorität<br />
eines Häuptlings sehr stark. Man liebt Gemeinschaftsfeiern mit rhythmischer Musik. Trommel, Bogengitarre, Klimper und<br />
Harfe sind die üblichen Musikinstrumente. Weit verbreitet ist der Glaube an Geister, die in der Natur, in Menschen oder in<br />
Gegenständen wohnen. Macht über diese Geister hat nur der Medizinmann, dem dadurch eine besondere Stellung im Dorf<br />
zukommt.<br />
Die Urwald-Bantus betreiben Hackbau - die Bearbeitung des Bodens mit Pflug und Zugtieren ist nicht üblich. Das Roden<br />
des Waldes ist dabei Sache der Männer. Sie schlagen das Unterholz mit dem Haumesser oder mit der Axt. Auch die<br />
grossen Bäume werden zum Absterben gebracht und am Ende der niederschlagärmsten Zeit zusammen mit dem<br />
geschlagenen Unterholz, Ästen, Zweigen und Blättern angezündet. Grössere Baumstrünke bleiben dabei stehen - oft auch<br />
ganze Bäume, die später als Schattenspender für empfindliche Pflanzen dienen. Die Asche dieser Brandrodung düngt den<br />
Boden. Die Frauen bestellen die Felder. Der Boden wird aber nicht bearbeitet. Mit dem Grabstock oder mit der Hacke gräbt<br />
man Pflanzlöcher für Mais oder Maniok, Süsskartoffeln (bataten), Kürbisse oder Bananen. Dieser Mischanbau dient dem<br />
täglichen Bedarf. Vorratshaltung ist nicht nötig. Bei Siedlungen in Flussnähe ergänzen gelegentlich Erträge des Fischfangs<br />
mit Speer, Netz oder Reuse, teilweise auch von Booten aus, die tägliche Nahrung. Viehhaltung ist im tropischen<br />
Feuchtklima nicht möglich, da die Rinder den durch Insekten (Tsetsefliege) übertragenen Seuchen zum Opfer fallen..."<br />
Dieser recht detaillierte Bericht gibt Auskunft über die Art der Nahrungsmittelerzeugung bei einer traditionell<br />
lebenden Gruppe der Bantus im Gebiet des Regenwaldes. (Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 327 und<br />
384 dieser Arbeit.) Das Foto auf der Seite 51 zeigt aber deutlich, wenn man die Kleidung der auf dem Feld<br />
arbeitenden Menschen betrachtet, dass auch das traditionelle Dorfleben längst mit westlicher Zivilisation in<br />
Berührung gekommen ist und dadurch wohl nicht nur in der Kleidung beeinflusst wird. Dies gilt selbst für die<br />
Volksgruppe der "Pygmäen", deren Mitglieder oft ein Leben abseits der Traditionen, meist als Bettler an der<br />
Überlandstrassen fristen. Selbst für die "primitiven Pygmäen" bedeutet die traditionelle Lebensweise also ein<br />
ganz bewusster Entscheid, denen Erwägungen über die Vor- und Nachteile verschiedener Lebensformen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 341
zugrundeliegen. Von einer unreflektierten Verbundenheit mit der Natur kann also kaum mehr die Rede sein,<br />
sondern es muss ganz klar von einem Abwägen von Werten und Entscheidung für das eine oder andere Werte-<br />
system gesprochen werden. Diese <strong>Pro</strong>blematik wird von Bär in keiner Weise erwähnt.<br />
4.31.3 "Bei einem Kakaopflanzer in Ghana"<br />
Auf den Seiten 52-53 stellt der Autor unter dem Titel "Bei einem Kakaopflanzer in Ghana" den Anbau von<br />
Kakao in Westafrika vor. (Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 293 und 361 dieser Arbeit.) Dabei verwik-<br />
kelt er sich neben der eigentlich sachlichen Darstellung des Themas teilweise aber auch in Widersprüche.<br />
"Ghana ist der wichtigste Kakaoproduzent der Erde" lautet der die Thematik einleitende Satz (S.52). Einer auf<br />
der Seite 53 abgedruckten Tabelle ist aber zu entnehmen, dass die Kakaoproduktion in den siebziger Jahren in<br />
Ghana laufend abgenommen hat, während sie im Nachbarland, der Elfenbeinküste enorm zunahm, so, dass für<br />
das Jahr 1980 Ghana nach der Elfenbeinküste und Brasilien erst auf Platz 3 der Kakaoproduzenten auftritt. Seit<br />
dem Erscheinen des Buches hat die Bedeutung des Kakaos als Exportgut in Ghana weiterhin abgenommen. In<br />
den letzten Jahren war das am meisten Devisen einbringende Exportgut teilweise wieder Gold, welches Ghana<br />
jahrhundertelang als Goldküste bekannt machte. Trotzdem bleibt der Kakaoanbau für viele Kleinbauern des<br />
Südens von Ghana von Bedeutung. Bär lässt einen dieser Kleinbauern, Herrn Buabang, auf Seite 52 selbst zu<br />
Wort kommen (erstmals wird in diesem Band ein Afrikaner namentlich erwähnt):<br />
"Meine Kakaopflanzung ist mit ihren gut 10 ha eine der grössten der Region. Wir sehen von hier aus gut, wie das Gelände<br />
gegen den Fetentaa-Fluss hin leicht abfällt. Das erste Feld wurde 1960 im obersten Hangabschnitt, hier gerade unter uns,<br />
noch in der Nähe des Hauses angelegt. Weitere Rodungen erfolgten dann in mehr oder weniger regelmässigen<br />
Zeitabständen hangabwärts. Stets wurde der Wald im November gerodet und das Holz im Januar verbrannt. Grosskronige<br />
Bäume liessen wir als Schattenspender für die jungen Kakaobäume meist stehen, denn der Kakaobaum stammt aus der<br />
untersten Baumschicht des ursprünglichen Regenwaldes. Die Bäumchen wurden jeweils in den Monaten März und April<br />
gesetzt. In die Zwischenraume pflanzten wir - als zusätzliche Schattenspender und zugleich zur Eigenversorgung - immer<br />
zugleich Bananen und Knollenfrüchte wie Taro oder Yams. Leider nahm 1974 ein fünf Jahre vorher angelegtes Kakaofeld<br />
durch das Feuer der Brandrodung eines Nachbarn so stark Schaden, dass es in der Folge aufgegeben werden musste. Es<br />
wurde später mit Kaffeebäumen bepflanzt. Sie wissen ja: Kaffee bildet in dieser Gegend häufig das zweite Marktprodukt.<br />
Auf den schlechteren Böden um das Farmhaus, gleich hinter uns, wachsen heute auch kleinere Ananaskulturen. Unser<br />
'Garten', das Feld, auf dem Mais, Taro und Yams für unseren eigenen Bedarf gepflanzt wird, muss jeweils nach zwei bis<br />
drei Jahren verlegt werden, da dann der Boden bereits so erschöpft ist, dass die Erträge zu klein ausfallen. Wir nennen hier<br />
dieses Anbausystem Landrotation.<br />
Nach dieser eingehenden Beschreibung seiner Kakaopflanzung fährt Herr Buabang mit seinem Bericht fort:<br />
Nun werden Sie natürlich wissen wollen, wie die Arbeit während des Jahres hier abläuft. Meine Familie und meine sechs<br />
Angestellten - z.T. ebenfalls mit ihren Familien - besorgen alle Arbeiten, die im Laufe des Jahres zu erledigen sind, vom<br />
Roden über das ständige Jäten bis zur Ernte, ihrer Verarbeitung und zur Neupflanzung. Sie erhalten dafür als Entlöhnung<br />
einen Drittel des gesamten Ertrags und natürlich die hier ebenfalls erzeugten Nahrungsmittel. Während der Arbeitsspitzen<br />
zur Erntezeit können wir stets auch auf die Hilfe benachbarter Farmer zählen. Dies beruht natürlich auf Gegenseitigkeit...<br />
... Der Ablauf der Arbeiten ist nicht von Jahr zu Jahr ganz gleich. Er hängt von den Launen des Wetters, vor allem von der<br />
Verteilung der Niederschläge ab. Die beiden Erntezeiten bilden stets die Höhepunkte. d.h. die arbeitsreichste Zeit des<br />
Jahres. Die Männer schlagen täglich die gerade reif gewordenen Früchte mit den Haumessern von den Bäumen. und die<br />
Frauen tragen sie in Körben auf den Arbeitsplatz hinter dem Haus. Dort schlagen einige der Männer die Früchte mit dem<br />
Messer entzwei, worauf Frauen und Kinder mit den Fingern die Kakaobohnen herauslösen und von Verunreinigungen<br />
trennen. In jeder Frucht stecken 30 bis 50 fast weisse Bohnen. Diese werden dann zum Gären (Fermentieren) zwischen<br />
Bananenblättern zu einem Haufen aufgeschichtet und mit Holzstücken beschwert. Durch das Fermentieren werden die<br />
Bohnen braun und entwickeln das Schokoladearoma. Nach sechs Tagen breitet man sie auf Holzgestellen zum Trocknen<br />
aus. Damit sie von der Sonne gleichmässig beschienen werden, dreht man sie mit hölzernen Rechen häufig um und deckt<br />
sie bei Regenschauern und natürlich über Nacht sorgfältig zu. Aus ihrer langen Erfahrung wissen die Arbeiter, wann die<br />
Bohnen so weit getrocknet sind, dass sich die Schale gut vom innern Kern trennen lässt. Das Trocknen dauert je nach<br />
Wetter etwa zwei Wochen. Während der ganzen Zeit liest man immer wieder schlechte Ware heraus und trennt<br />
zusammengeklebte Bohnen. Das fertige Erntegut wird schliesslich in Säcke abgefüllt und bis zum Abtransport im<br />
Lagerraum aufbewahrt.<br />
Wie beschrieben ist die Kakaobohnengewinnung ein sehr arbeitsintensiver <strong>Pro</strong>zess. Herr Buabang fährt fort,<br />
die grösseren Zusammenhänge schildernd:<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
Die gesamte Ernte wird mit Lastwagen nach dem 25 km entfernten Marktort Berekum gefahren. wo sie von der Einkaufsund<br />
Verarbeitungsgenossenschaft noch etwas weiter behandelt werden muss. Wir haben unsere Erträge in den letzten<br />
Jahren ständig etwas erhöhen können. Im vergangenen Jahr ernteten wir erstmals 200 Säcke Kakaobohnen zu je 27 kg.<br />
Aber wir sollten noch mehr produzieren! Denn alles, was wir kaufen müssen, Gegenstände aus der Stadt, Geräte für das<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 342
Haus, Benzin und Nahrungsmittel, ist in den letzten Jahren sprunghaft teurer geworden. Auch die Steuern, das Schulgeld<br />
für die Kinder sowie die Kosten für ihre Kleider sind gestiegen. Für unseren Kakao aber erhalten wir seit Jahren gleich viel,<br />
oder, wenn ich mich recht erinnere, sogar etwas weniger. Die Zwischenhändler an der Küste machen zu grosse Gewinneund<br />
die Weltmarktpreise werden nicht in unserem Land festgesetzt. Wir arbeiten heute für jeden Gegenstand, den wir<br />
drunten kaufen, fast doppelt so lang wie vor 15 Jahren. Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als nochmals Wald<br />
zu roden und noch mehr Kakaobäume zu pflanzen. Junge Bäumchen brauchen aber mindestens fünf Jahre, bis sie erste<br />
Früchte tragen. Was machen wir bis dahin, und wie wird meine Rechnung dann aussehen? Hoffentlich bleiben wir<br />
wenigstens von der Pflanzenkrankheit verschont, die Ghanas Kakaopflanzungen seit einigen Jahren heimsucht und bei der<br />
Wurzeln und Blätter der Bäume absterben. Über 100 Mio. Bäume mussten deswegen schon geschlagen werden."<br />
(Berekum liegt etwa 120 km nordöstlich von Kumasi und ist über eine Überlandstrasse relativ gut zu errei-<br />
chen. Von Kumasi aus bestehen Bahnverbindungen nach Accra und Sekondi-Takoradi, einem Küstenhafen.)<br />
Zusätzlich enthalten die beiden Seiten mehrere Fotos, von denen zwei ghanaische Bauern bei der Arbeit<br />
zeigen: "Öffnen der Kakaofrüchte" und "Trocknen der Kakaobohnen".<br />
4.31.4 Savanne<br />
Im nächsten Abschnitt im zweiten Teil des Bandes bespricht Bär die wechselfeuchten Tropengebiete Savanne<br />
und die Sahelzone (Seiten 54-61). Davon befassen sich 6 Seiten mit den Menschen, die in dieser Klimazone<br />
wohnhaft sind.<br />
Auf den Seiten 56-57 erfahren die Schüler über die Savannenbewohner:<br />
Die Bewohner der Savanne sind Ackerbauern, in den trockeneren Teilen auch Viehzüchter. Im Gegensatz zu den<br />
Bewohnern des Regenwaldes legen die Bauern hier einen Teil ihrer Ernte als Nahrungsvorrat beiseite; die Viehzüchter sind<br />
teilweise gezwungen, mit ihren Herden zu wandern.<br />
Bär unterscheidet hier also zwischen Völkern, die Nahrungsmittelvorräte anlegen und solchen, die darauf<br />
verzichten. Wobei unter Vorratshaltung die in Europa praktizierte Speicherung von Nahrungsmitteln verstan-<br />
den werden soll. - Denn auch die Völker des tropischen Regenwaldes kennen eine Art Vorratshaltung, indem<br />
sie die Wurzeln des Maniok beispielsweise im Boden lassen, wo sie mehrere Jahre haltbar sind. - Darin unter-<br />
scheidet "Geographie der Kontinente" sich von einigen älteren Lehrmitteln, die behaupten, die "Neger"<br />
würden "fröhlich in den Tag hineinleben" und keine Vorräte anlegen. Zur Feuchtsavanne schreibt der Autor<br />
(S. 56):<br />
In der Feuchtsavanne herrscht der Hackbau vor. Für Grossviehherden ist die Seuchengefahr (Übertragen durch<br />
Tsetsefliegen) noch immer zu gross. Mit der beginnenden Regenzeit lockert man den Boden. Dann werden Mais, Bohnen<br />
oder Hirse gepflanzt. Nach der Regenzeit steckt man Kartoffeln, Yams oder Batate (Süsskartoffeln) in den noch feuchten<br />
Boden. Da der Humusgehalt gering ist und sich die Bodenfruchtbarkeit bald erschöpft, wird auch hier Wanderfeldbau mit<br />
Brandrodung betrieben. Gedüngt wird mit der Asche der verbrannten Bäume und zusätzlich durch das Abbrennen der<br />
Grasflur am Ende jeder Trockenzeit (Buschfeuer. Steppenbrände). Viele Waldgebiete sind so durch den Menschen in<br />
Savannen umgewandelt worden.<br />
Zur Trockensavanne heisst es im Text:<br />
Auch in der Trockensavanne (wegen ihrer Baumarmut oft auch als Steppe bezeichnet) kennt man den Wanderfeldbau mit<br />
Brandrodung. Körnerfrüchte wie Hirse und Mais stehen hier als Anbauprodukte im Vordergrund. Die Trockensavanne ist<br />
aber das eigentliche Viehzuchtgebiet Afrikas, die Region der wandernden Hirtenvölker... Auch hier wird das Gras vor der<br />
Regenzeit häufig abgebrannt, um mit der Asche das Aufkommen der jungen Grasflur zu begünstigen.<br />
Die Hackbauern der Savanne wohnen vorwiegend in Dörfern. Sie erstellen meistens Rundhütten. Über einem Gerüst aus<br />
grösseren Ästen oder Palmstengeln werden aus feinerem Material Wände geflochten und mit Lehm bestrichen. Die Dächer<br />
sind mit Palmblättern oder Gräsern gedeckt. In den grösseren, stadtähnlichen Siedlungen findet man ein reiches Handwerk<br />
(Schmiede, Töpfer, Weber). Viele der Siedlungen liegen in Schutzlagen auf Hügeln - stadtähnliche Siedlungen sind häufig<br />
befestigt.<br />
Im offenen und verkehrsgünstigen Landschaftsgürtel der Savanne haben sich im Laufe der Geschichte verschiedene<br />
Stammesgruppen zu grossen Stammesverbänden (Königreichen) zusammengeschlossen.<br />
(Siehe zu diesen Königreichen auch den Teil "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas auf der Seite 28<br />
dieser Arbeit.) Darüberhinaus bieten die beiden Seiten auf 10 Fotos umfangreiches Bildmaterial: "Pflugbau in<br />
der Savanne (Nigeria)", "Viehzüchter in Obervolta" (dem heutigen Burkina Faso), "Arbeit auf dem Feld",<br />
"Beim Korbflechten", "Dorf und Felder", "In der Schule", "Grossvater erzählt Geschichten", "Auf dem<br />
Wochenmarkt", "Am Kochherd", "Beim Spiel". Auffallend ist die oft sehr bunte Kleidung der auf den Fotos<br />
abgebildeten Personen.<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 343
4.31.5 Sahelzone<br />
Auf den Seiten 58-61 wird die Sahelzone beschrieben, und Bär geht insbesondere auf die Dürre- und Hunger-<br />
problematik im Sahel ein. Über die Bevölkerung schreibt er (S. 58):<br />
Der Sahel ist Kontakt-, Misch- und heute auch Konfliktraum zwischen hellhäutigen, aus Nordafrika stammenden<br />
Hirtenvölkern (Berbern, Arabern, u.a.) und schwarzer Bauernbevölkerung aus West- und Zentralafrika. Im regenreicheren<br />
Südteil leben mehrheitlich Sesshafte. Sie pflanzen je nach Regenfall und Arbeitseinsatz <strong>Pro</strong>dukte für den Eigenbedarf<br />
(Kartoffeln, Bohnen, Zwiebeln, Kürbisse, Hirse) sowie solche für den Verkauf (Erdnüsse, Baumwolle, z.T. auch Hirse).<br />
Der Export liegt in den Händen grosser Gesellschaften.<br />
Beim traditionellen Ackerbau werden die Felder nach zwei bis dreijähriger Nutzung einer mehrjährigen Brache überlassen,<br />
während der sich der Boden wieder erholen kann. Deshalb waren früher in diesem Raum nur etwa 10 bis 20% des Landes<br />
gleichzeitig genutzt. Die Bevölkerungsdichte betrug nicht mehr als 25 Einwohner pro km 2 ; für ein Rind standen rund 4 ha<br />
Weideland zur Verfügung.<br />
(Siehe dazu auch die Karte "Bevölkerungsdichte" im Anhang auf der Seite 568 dieser Arbeit.) Über die Noma-<br />
den schreibt Bär:<br />
Die Nomaden, einst Herren über die sesshaften Bauern, leben im Nordteil, wo die Niederschlagsverhältnisse einen<br />
regelmässigen Anbau erschweren oder verunmöglichen. Den Regenfällen folgend, zogen sie früher mit ihren Herden aus<br />
Kamelen, Rindern, Schafen und Ziegen von einer Weidestelle zur andern, oft ohne sich um politische Grenzen zu<br />
kümmern. Während der Trockenzeit, wenn Tümpel und Wasserlöcher versiegten, trieben sie ihre Tiere - nach überlieferten<br />
Abmachungen - nach Süden auf die abgeernteten Felder der Sesshaften. Ihre Wirtschaftsweise war den naturgegebenen<br />
Verhältnissen angepasst; weitgestreute Weideflächen wurden genutzt, aber nicht übernutzt. Der Anbau beschränkte sich<br />
hier auf einige "Inseln" mit verhältnismässig günstigen Feuchtigkeitsverhältnissen. Die Bevölkerungsdichte belief sich auf<br />
nur 5 Einwohner pro km 2 ; ein Rind benötigte eine Weidefläche von 10 ha.<br />
Diese der Umwelt angepasste Wirtschaftsform wurde in unserem Jahrhundert durch Einwirkungen gestört, die ihre<br />
Wurzeln einesteils im Sahel selbst hatten, zum andern Teil aber von aussen kamen. Die dadurch eingeleitete Entwicklung<br />
ist erschreckend, und das Ende der Katastrophe ist heute noch nicht abzusehen.<br />
Auf Seite 59 wird ein Text zur Dürre nach einem Zeitungsartikel von 1973 wiedergegeben - der Text erscheint<br />
im Lehrmittel "Seydlitz Geographie" von 1994-1996 (Bd. 3, S. 51) noch einmal -, in dem sich unter anderem<br />
folgende Formulierungen über die heimische Bevölkerung finden:<br />
"In Obervolta klettern ausgemergelte Gestalten auf kahle Bäume: sie verschlingen die verdorrten Knospen - und in Mali<br />
zerstören Dorfbewohner Termiten-Bauten: sie suchen die Hirsevorräte der Insekten!... In einigen Gebieten haben<br />
fünfjährige Kinder noch nie Regen erlebt. Wo einst Herden weideten, modern jetzt Kadaver. Wo Hirse wuchs, frisst sich<br />
die Wüste vor. Der Hungertod bedroht 6 Millionen der 24 Millionen Einwohner der Sahel-Staaten. In den Dörfern und<br />
Nomadenlagern herrscht Verzweiflung. Hundert Meter tiefe Brunnen sind ausgetrocknet. Viele Hirten bieten ihre letzten<br />
Rinder zu nie gekannten Niedrigpreisen an. Aber die Menschen haben kein Geld, auch die Ackerbaugebiete sind<br />
ausgedorrt..."<br />
(Zu Mali siehe auch die Seiten 255 und 402, zu den Hungerkrisen Afrikas die Seiten 317 und 351 dieser<br />
Arbeit.) Auf Seite 60 kommt ein Erdnussbauer aus dem Senegal in "Ein Interview für das Fernsehen" nach<br />
einem Tonband eines Fernsehreporters für DRS 1979 zu Wort:<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
Reporter: "Im Zentrum von Senegal, im Dorf Jalab nordöstlich von Dakar, lebt der 36jährige Erdnussbauer Cherno Sow. Er<br />
ist bereit. uns einige Fragen zu beantworten. Herr Sow, wie gross ist ihre Farm und wie viele Leute leben hier?"<br />
Sow: "Ich besitze 2 Hektaren Land. Meine Frau und ich haben drei Kinder. Überdies leben noch drei weitere Mitglieder der<br />
Verwandtschaft mit uns im Familienverband zusammen."<br />
R: "Wie haben Sie Ihren Beruf gelernt?"<br />
S: "Ich habe die Felder von meinem Vater übernommen. Schon als kleiner Bub musste ich mitarbeiten - Zeit für den<br />
Schulbesuch hatte ich nicht."<br />
Neben der Arbeit, die Kinder zusammen auf den Feldern ihrer Eltern leisten, ziehen viele, vor allem Mädchen,<br />
beispielsweise nach Dakkar, wo sie für einen Monatslohn zwischen 8-40 Franken als Haushaltshilfe bis zu 14<br />
Stunden täglich arbeiten. Die "Kinder arbeiten, um ihre Zukunft vorzubereiten und ihre Lage zu verbessern",<br />
wie ein 14jähriges Mädchen aus Senegal gegenüber einem Journalisten äusserte. Drei Viertel dieser Mädchen<br />
haben nie eine Schule besucht und nur die wenigsten von ihnen besitzen einen gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Vertrag und können ihre Stelle deshalb jederzeit verlieren. (TA 19.05.98, S. 11; TA 06.06.98, S. 5; siehe zur<br />
Kinderarbeit auch die Seiten 274 und 351 dieser Arbeit.) Im Interview heisst es weiter:<br />
R: "Was pflanzen Sie auf Ihren Feldern an?"<br />
S: "Zu einem grossen Teil natürlich Erdnüsse, im Wechsel mit Hirse. Wir essen ja hauptsächlich Hirse und etwas Erdnüsse<br />
- Fleisch gibt es nur selten."<br />
R: "Arbeiten Sie mit Maschinen?"<br />
S: "Nein. Alle Arbeiten wie Säen. Unkrautjäten und Ernten werden von Hand erledigt. Dabei hilft die ganze Familie mit."<br />
R: "Aber eben habe ich auch einige Geräte gesehen."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 344
S: "Ja, seit zwei Jahren haben wir einen Pflug. Aber er ist keine Entlastung für uns, sondern bringt uns Schulden und damit<br />
noch mehr Arbeit! Weil ich den Pflug nicht bar bezahlen konnte, musste ich bei der staatlichen Erdnussgesellschaft<br />
einen Kredit zu einem Jahreszins von 25% aufnehmen. Während vier Jahren habe ich nun einen Teil meiner Erdnüsse<br />
der Gesellschaft zu überlassen."<br />
(Zum Ochsenpflug siehe auch die Seite 308 dieser Arbeit.) Der Reporter fragt weiter:<br />
R: "Herr Sow, hat sich hier in den letzten zehn, fünfzehn Jahren etwas geändert?"<br />
S: "Ja. Früher verdiente man genug Geld, um die Familie zu ernähren und zu kleiden. Heute geht es uns schlechter. Zwar<br />
verdienen wir heute mehr Geld. aber es reicht trotzdem nicht aus."<br />
R: "Wieso hat sich das derart verändert?"<br />
S: "Die Leute, die unsere Erdnüsse kaufen, sind nicht mehr die gleichen."<br />
R: "Was können Sie dagegen tun?"<br />
S: "Wir sind Bauern und können nichts dagegen tun, denn diese Leute sind in der Regierung."<br />
R: "Versuchten Sie jemals, etwas anderes zu pflanzen als Erdnüsse?"<br />
S: "Nein. denn nur mit der Erdnuss verdienen wir Geld, um eine Hose, ein Hemd oder andere Sachen zu kaufen. die wir<br />
dringend brauchen."<br />
R: "Aber könnten Sie nicht zum Beispiel Maniok pflanzen und verkaufen?"<br />
S: "Nein. Der Staat würde uns den Maniok nicht abnehmen, und die Ernte ginge kaputt für nichts."<br />
R: "Erklären Sie mir das etwas genauer."<br />
S: "Nach der Ernte liefere ich die Erdnüsse an unsere Genossenschaft, die sie an die Staatsgesellschaft verkaufen muss. Ich<br />
habe keine andere Möglichkeit, auch wenn der festgesetzte Preis nur die Hälfte von dem beträgt. was Erdnussbauern in<br />
andern Teilen der Welt erhalten. Das Geld bekomme ich überdies erst viele Wochen später, und oft werde ich von den<br />
Händlern noch betrogen. denn ich kann ja nicht lesen."<br />
Die Verzögerung bei der Auszahlung des Geldes ist deshalb von Bedeutung, weil der geschuldete Betrag durch<br />
die Inflation rasch an Wert verliert. Der Reporter setzt seine Befragung fort (S. 60):<br />
R: "Was sind denn das für Leute in der Stadt? Werden sie nicht kontrolliert und bestraft?"<br />
S: "Die Staatsgesellschaft hat kein Interesse, sich für uns einzusetzen. Und sie ist zu mächtig. Sie transportiert unsere<br />
Erdnüsse nach Dakar und exportiert sie. Selbst wenn unsere Ernte noch im Land zu Ö1 verarbeitet wird, verdient der<br />
Staat, denn er vergibt die Aufträge - meist an ausländische Gesellschaften. Das Geld kommt aber nie zu uns aufs Land<br />
zurück. Die 5'000 Angestellten der Staatsgesellschaft leben vornehm und im Luxus, wie auch die Leute der Regierung<br />
und überhaupt viele Bewohner der Städte."<br />
R: "Was ist dann die Zukunft hier auf dem Land?"<br />
S: "Die Zukunft ist für uns, Erdnüsse zu pflanzen."<br />
R: "Und wenn das so weitergeht?"<br />
S: "Wenn es so weitergeht, werden die Bauern ganz verarmen und schliesslich verschwinden."<br />
R: "Gäbe es einen Ausweg für die Landbevölkerung?"<br />
S: (stockt) "Wir Bauern könnten überleben, wenn wir nicht fast nur Erdnüsse, sondern wieder mehr Nahrungsmittel für uns<br />
selber und für das eigene Land anbauen könnten. Aber das würde den Städtern und der Regierung kaum gefallen...!"<br />
Der Text schildert also die Sorgen und Nöte des Kleinbauern und thematisiert den Stadt-Landkonflikt aus der<br />
Sicht der ländlichen Bevölkerung. Auf der gleichen Seite findet sich auch ein Foto von Herrn Sow, der seine<br />
Erdnüsse auf dem Feld präsentiert, sowie ein weiteres Foto zum "Verpacken der Erdnüsse".<br />
In einem weiteren Text, einem Bericht des African Groundnut Councils von 1976, auf Seite 61 finden sich<br />
folgende Beschreibungen:<br />
"...durch Siedlungen mit Strohhütten, vorbei an Frauen, Männern und Kindern, die aufgeregt unseren Konvoi begrüssten.<br />
Wir wirken wie die Invasion eines fremden Sterns, denn kaum einmal, dass sich ein Auto in diese Gegend im<br />
senegalesischen Busch verirrt, noch viel weniger ein weisser Mensch... Es ist Abend, als wir das Dorf erreichen, ein<br />
Buschdorf aus ungefähr 20 strohbedeckten Hütten. Am Ende ein riesiger Baum, in dessen Schatten sich die gesamte<br />
männliche Einwohnerschaft des Dorfes versammelt hat. Fünf Reihen dicht stehen oder sitzen sie da, Trommeln dröhnen,<br />
als wir den Wagenschlag öffnen. Eine Gasse wird frei, und man bittet uns an einen Tisch (mit Tischtuch!). Serienmässig<br />
hergestellte Stühle (sehr wahrscheinlich aus Dakar) sind unsere Sitzgelegenheit... Das sind also die Erdnusspflanzer! Das<br />
ganze Dorf ist fast ausschliesslich mit dem Anbau von Erdnüssen beschäftigt; diese bringen das ganze Einkommen. In<br />
gerührten Worten, die für uns übersetzt werden, wird uns - 'den Menschen, die von so weit herkommen' - gedankt, dass wir<br />
uns mit ihren <strong>Pro</strong>blemen beschäftigen. Man hat noch nie solch 'hohen' Besuch gehabt, und entsprechend wartete auch die<br />
gesamte Einwohnerschaft seit dem Morgen unter dem Baum - um ja gerüstet zu sein, wenn unsere Wagen ankamen. Die<br />
Gesichter, teilweise verwittert, zerfurcht und fast ledern, junge, alte, zeitlose, offenbarten kaum etwas von den Gedanken,<br />
die diese Menschen bewegten. Nur die hundert Hände, die sich uns zum Abschied entgegenstreckten, bewiesen die<br />
aufrichtige Dankbarkeit und das Interesse an unserem Besuch."<br />
(Vergleiche dazu auch die Bemerkungen zur Abbildung aus dem Comic "Tim im Kongo" auf der Seite 488<br />
dieser Arbeit.) Weiter werden die im Interview mit Herrn Sow und oben gemachten Aussagen zur Stadt-<br />
Landproblematik relativiert (S. 60):<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
"Die Regierung macht grosse Anstrengungen, die einzelnen Farmer richtig auszubilden und ihnen Maschinen und<br />
Werkzeuge zu günstigen Preisen zur Verfügung zu stellen, die den Ertrag um ein Vielfaches erhöhen sollen. Senegal<br />
gehört zusammen mit Gambia, Mali, Niger, Nigeria und Sudan dem Afrikanischen Erdnuss-Rat (AGC) an.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 345
Der Anteil der im AGC (African Groundnut Council) vereinigten Staaten an der Weltproduktion von Erdnüs-<br />
sen sank im Zeitraum von 1970-1990 von 18% auf nur 10%. Der Meinung, dass die Stadtbevölkerung auf<br />
Kosten der Landbevölkerung ausgehalten wird, trotz staatlicher Hilfe an die Erdnussbauern, ist nicht nur "Herr<br />
Sow", sie wird auch von verschiedenen Autoren geteilt.<br />
Schliesslich werden in einem letzten Text die Ursachen der Dürre-Hunger-Katastrophe und die Möglichkeiten<br />
zur Hilfe analysiert und diskutiert. Der Autor sieht die Katastrophe wie folgt:<br />
- als reine Naturkatastrophe<br />
- als Folge fehlerhaften Verhaltens der Bewohner (Störung des instabilen Naturgleichgewichts),<br />
- als Ergebnis des veränderten Naturhaushalts durch unangepasste, von aussen (Europa) beeinflusste, gestützte oder<br />
bestimmte Gesellschafts- und Wirtschaftsformen.<br />
Im Gegensatz zum Lehrmittel "Terra Erdkunde für Realschulen" von 1980-1985 (Bd. 1, S.109) führt Bär<br />
mehrere Ursachen an und schiebt die Verantwortung nicht einfach auf das Fehlverhalten der Bevölkerung ab.<br />
Er schreibt, dass Soforthilfe zwar erfolgte, dass sich dadurch aber kaum eine nachhaltige Veränderung der<br />
Ursachen ergeben hat und in Zukunft das Schwergewicht auf die Wiederaufbauhilfe gelegt werden müsse<br />
(S. 61).<br />
Auf die darauffolgende Darstellung der tropischen und subtropischen Trockengebiete (Wüsten und Steppen)<br />
wird nicht im Detail eingegangen, da es sich bei der beschriebenen Bevölkerung meist um nicht schwarzafri-<br />
kanische Typen handelt. Es sei aber darauf hingewiesen, dass dieser Teil 11 Seiten umfasst (S.62-71), wovon<br />
sich ca. 6 Seiten im weitesten Sinne mit der dort ansässigen Bevölkerung befassen, wovon wiederum auf ca.<br />
einer Seite Betroffene selbst zu Wort kommen (ähnlicher Umfang wie beim Kakaopflanzer in Ghana). Auf den<br />
folgenden beiden Seiten (S.72-73) folgt schliesslich eine Zusammenfassung der Klimate und Landschaftsgürtel<br />
am Beispiel Afrikas.<br />
4.31.6 Ostafrika<br />
Im dritten Teil "Länder, Landschaften, Regionen" befassen sich die Seiten 196-199 anhand von Fés in Marok-<br />
ko mit der islamischen orientalischen Stadt, die Seiten 200-206 mit "Ägypten und der Nil", die Seiten 207-211<br />
mit den "Staaten Ostafrikas" und die Seiten 212-219 mit der "Republik Südafrika". Auf die beiden letztge-<br />
nannten Kapitel soll an dieser Stelle näher eingegangen werden.<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
Auf den 5 Seiten zu Ostafrika erfährt der Schüler über die Bewohner dieser Region auf Seite 207:<br />
"Hinter einem schmalen Küstenstreifen bilden die drei Staaten Tansania, Kenia und Uganda mit... 49.3 Mio. Einwohner<br />
einen bedeutenden Teil von "Hochafrika"... Während in allen drei Staaten des Hochlandes die trockenen Gebiete... durch<br />
nomadische Viehzüchter genutzt werden, finden wir unter besseren Bedingungen... Kleinpflanzungen der Bantustämme<br />
(Kikuyu, Chagga u.a.) sowie Grossfarmen und Plantagen, die noch auf die Zeit europäischer Herrschaft zurückgehen.<br />
(Zu den verschiedenen Landschaftsgürteln und ihrer Nutzung siehe auch die Seite 332 dieser Arbeit.) Auf<br />
Seite 208 findet sich unter dem Titel "Kaffeepflanzer am Kilimandscharo" folgende Information:<br />
Im Süden und Osten des Berggebietes wohnen in einer bestimmten Höhenstufe die Bantu vom Stamm der Chagga, weit<br />
verstreut inmitten ihrer Pflanzungen. Auf den fruchtbaren vulkanischen Verwitterungsböden pflanzen sie für den<br />
Eigenbedarf verschiedene Bananenarten, dazu Mais, Bohnen, Erbsen, Süsskartoffeln, Zwiebeln, manchmal Tabak u.a...<br />
Ihre Kaffeesträucher gedeihen... im Schatten ihrer Bananenstauden. Die <strong>Pro</strong>duktion von Kaffee in Kleinbetrieben ist hier<br />
nur möglich, weil sich die Farmer in diesem Gebiet schon früh in bäuerlichen Genossenschaften organisiert haben... der<br />
erwirtschaftete Gewinn... wird zur Verbesserung der <strong>Pro</strong>duktionsgrundlagen... sinnvoll eingesetzt.<br />
(Zum Kaffeeanbau siehe auch die Seiten 322 und 391 dieser Arbeit.) Auf die <strong>Pro</strong>blematik der ehemals von<br />
europäischen Siedlern gegründeten und teilweise bis heute bestehenden Grossfarmen im Hochland geht die<br />
Seite 209 näher ein. Die Seiten 210 und 211 beschäftigen sich mit dem Tourismus in Kenia. Zu den Erwartun-<br />
gen der Afrikaner bezüglich des Tourismus wird der ehemalige Staatspräsident der Elfenbeinküste, die wie aus<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 346
einer Weltkarte ersichtlich an der Westküste Afrikas liegt und auch sonst wenig mit Ostafrika zu tun hat, wie<br />
folgt zitiert (S.210):<br />
"Tourismus fördert in hohem Masse den Kontakt zwischen den Menschen auf Erden und ermöglicht ihnen, sich näher<br />
kennen zu lernen, um sich besser zu verstehen und sich zusammenzuschliessen, um die Zukunft aufzubauen.<br />
Anschliessend werden in einem Vergleich "Erwartungen von Touristen", die Meinungen der "Touristen über<br />
Begegnungen mit Afrikanern" und was "Kenianer meinen über die Touristen" in Listenform aufgeführt. Nach<br />
diesen Listen wollen die Touristen im Bezug auf die Einheimischen:<br />
1. "sehen, wie die Schwarzen leben",<br />
2. "viele gute Fotos von wilden Tieren und Negern nach Hause" bringen.<br />
Über die Begegnung mit den Afrikanern sagen die Touristen unter anderem aus, dass<br />
1. sie "ihre eigene Mentalität haben" und man deshalb "vorsichtig vorgehen" muss,<br />
2. sie "noch primitiv" sind,<br />
3. sie sich ja "bemühen... zivilisiert zu werden",<br />
4. sie "kindlich, lustig und fröhlich, nicht aber geschäftstüchtig" sind,<br />
5. und "sehr arbeitsunwillig" sind.<br />
Die Kenianer äussern sich über die Touristen unter anderem wie folgt:<br />
1. "Sie suchen nur den Schmutz, die Armut und jagen mit ihren Kameras hinter unseren Leuten<br />
her".<br />
2. "Sie wollen nicht sehen, dass viele Afrikaner in Steinhäusern wie den ihren leben, Licht haben<br />
und fliessendes Wasser".<br />
3. "Sie sehen nicht, dass wir in harter Arbeit Strassen, Häuser, Schulen bauen und unsere Äcker<br />
bestellen".<br />
4. "Sie können sich nicht vorstellen, dass wir in Betten schlafen, uns waschen und gut ernähren".<br />
5. "Der Tourismus wirkt sich negativ auf unsere Gesellschaft aus."<br />
Mit einer Karikatur, einem Flussdiagramm zu "Aufteilung der Einnahmen aus einer organisierten Reise nach<br />
Kenia", einer Tabelle "Preise und Verdienst", sowie einem Foto einer Massaifrau, die ihr Kind auf dem<br />
Rücken tragend einer Touristin eine Halskette umhängt, schliessen die beiden Seiten über den Tourismus.<br />
(Zum Tourismus siehe auch die Seiten 306 und 360 dieser Arbeit.)<br />
Ohne im Detail auf die Urteile der Touristen und Einheimischen (es gibt auch afrikanische Touristen) näher<br />
einzugehen, muss sich der Autor an dieser Stelle sicher auch die Frage gefallen lassen, inwieweit er in seinem<br />
Buch selbst zur Zementierung der von beiden Seiten geäusserten Meinungen beiträgt.<br />
4.31.7 Südafrika<br />
Auf den 8 Seiten zu Südafrika werden folgende Themen behandelt: "Das Landschaftsprofil" (S.212), "Bevölk-<br />
erung und Rassenprobleme" (S. 213), "Die Apartheid-Politik" (S. 214-215), "Beschäftigung in Bergbau und<br />
Industrie" (S.216-217) und "Gold und Goldbergbau" (S. 218-219).<br />
Über die Bevölkerung (wobei die weisse Minderheit hier bewusst ausgeklammert wird, da sie nicht Gegen-<br />
stand der Untersuchung ist) erfahren die Schüler folgendes (S.213):<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
"...Zusammen mit später einwandernden Europäern anderer Nationen besiedelten und kultivierten sie [die Holländer] das<br />
damals fast menschenleere, nur von den Buschmänner und Hottentotten bewohnte Gebiet am Kap und rückten später<br />
nordwärts ins Landesinnere vor. Etwa zur gleichen Zeit wanderten verschiedene Negervölker (Bantustämme) auf der<br />
Suche nach besseren Weideflächen aus dem tropischen Afrika nach Süden... Die Folge waren lange, blutige<br />
Auseinandersetzungen. Die Schwarzen unterlagen schliesslich und wurden mehrheitlich in "Reservaten" angesiedelt - teils<br />
in den bereits selbständigen Staaten Botswana, Lesotho und Swaziland, teils innerhalb der heutigen Republik Südafrika..."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 347
Bär schreibt, dass das von den Holländern besiedelte Gebiet "fast menschenleer", genauer "nur von Buschmän-<br />
nern und Hottentotten" bewohnt war, er vergisst aber, dass gerade diese Völker durch ihre Wirtschaftsweise<br />
und die Gegebenheiten Südafrikas einen vergleichsweisen hohen Landanspruch hatten. Wenn er schreibt "Die<br />
Schwarzen unterlagen schliesslich... und wurden... in 'Reservate' umgesiedelt", so überspringt er einen Zeit-<br />
raum von rund 100 Jahren, ohne näher auf die tatsächlichen geschichtlichen Abläufe einzugehen.<br />
Auf der gleichen Seite ist ein Foto einer "Bantu-Schulklasse in Johannesburg" abgebildet, sowie Arbeiter auf<br />
einer "Ananasplantage zur Erntezeit". Eine kleine Karte gibt Auskunft über die Wanderbewegungen der<br />
verschiedenen Völker (beachtenswert ist, dass hier die schwarzen Volksgruppen ebenfalls als "Volk" und nicht<br />
wie häufig üblich als "Stamm" bezeichnet werden).<br />
Auf den Seiten 214-215 werden die Grundzüge der Apartheidspolitik mit Hilfe von Karten, Tabellen, <strong>Pro</strong>- und<br />
Kontraargumenten erläutert. Als <strong>Pro</strong>-Argumente werden vor allem der grössere Materielle Wohlstand Südafri-<br />
kas gegenüber anderen afrikanischen Staaten aufgezählt, weitere, eher seltsam anmutende Argumente sind<br />
(S.215):<br />
- Botswana, Lesotho und Swaziland eingerechnet, wurden den Schwarzen über 50% des bebaubaren Landes überlassen<br />
- Schwarz und Weiss haben verschiedene Lebensweisen und verschiedene Reinlichkeitsbedürfnisse<br />
- Die Lohnunterschiede sind durch unterschiedliche Lebenskosten bedingt<br />
- Schwarze und weisse Sportler trainieren heute miteinander und messen sich in Wettkämpfen<br />
(Zu den Löhnen in Südafrika siehe auch die Seiten 269 und 282 dieser Arbeit.) Als Argumente gegen die<br />
Apartheidspolitik wird vor allem die Missachtung der Menschenrechte im Hinblick auf die schwarze Bevölke-<br />
rung angeführt. Unterdessen hat sich auch in Südafrika die Einsicht durchgesetzt, das Schwarze nicht<br />
Menschen zweiter Klasse sind, und das Land wird seit 1994 von einer schwarzen, demokratisch gewählten<br />
Mehrheitsregierung regiert. Die ganze <strong>Pro</strong>blematik der Apartheidspolitk ist unterdessen also vorwiegend als<br />
geschichtlicher Hintergrund der aktuellen Situation Südafrikas von Bedeutung. (Zur Apartheidspolitik siehe<br />
auch die Seiten 303 und 394 dieser Arbeit.)<br />
Auf den letzten beiden Seiten zu Südafrika (S.216-217) wird die Lage im Bergbau und der Industrie angespro-<br />
chen. Acht Fotos und drei Karten beschreiben die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Schwarzen und<br />
Weissen. Da sich daran bis heute, trotz politischem Umbruchs, wenig geändert hat, bleiben diese Seiten<br />
weiterhin aktuell.<br />
4.31.8 "<strong>Pro</strong>bleme, Entwicklungen, Zukunftsaussichten"<br />
Im vierten und letzten Teil des Bandes "Geographie der Kontinente" übertitelt mit "<strong>Pro</strong>bleme, Entwicklungen,<br />
Zukunftsaussichten" (Seiten 259-305) werden vor allem überregionale und globale Themen angesprochen.<br />
Über den schwarzafrikanischen Menschen erfahren die Schüler dabei folgendes:<br />
1. Afrikanische Länder weisen ein besonders hohes Bevölkerungswachstum auf (S. 262)<br />
2. Die afrikanische Bevölkerung leidet besonders unter Unter- respektive Mangelernährung, zum<br />
Teil infolge von Einwirkungen seitens der Industrieländer (S. 264-267)<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
3. Viele afrikanische Länder gehören zu den ärmsten Ländern der Welt (S. 268)<br />
4. Die Schulbildung in afrikanischen Ländern ist im Vergleich zu europäischen Schulen<br />
rudimentär. Die Bevölkerung begreift nicht immer, wozu eine Schulbildung gut sein soll (Text<br />
"Die neue Schule aus dem Aufsatz des Mädchens Myo aus Kamerun", S. 269 (zur Bedeutung des<br />
im Text erwähnten schwarzafrikanischen Marktes siehe die Seiten 262 und 374 dieser Arbeit):<br />
"Es gab keine Schule in meinem Dorf; als wir noch jung waren, spielten wir den ganzen Tag und tanzten auf dem Schmutz<br />
der Strasse. Es gab kein mit Wellblech bedecktes Haus; alle Hütten waren mit Dachstroh oder mit Palmmatten gedeckt. Die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 348
Türen und Fenster waren sehr eng. Alle Menschen schliefen neben dem Feuer; manche verbrachten viele Monate, ohne zu<br />
baden. Die Leute waren oft krank und besonders die Kinder, die von Kwashiorkor betroffen waren.<br />
Der Marktplatz war der einzige Ort des Dorfes, wo viele Leute sich einmal pro Woche versammelten, um Waren<br />
auszutauschen. Es gab nur eine Strasse. und die war sehr schlecht; Autos fuhren selten. und wir liefen immer hin. um sie<br />
fahren zu sehen. Aber eines Tages parkten viele Lastwagen auf diesem Marktplatz, schütteten Sand darauf aus und fuhren<br />
wieder fort. Dann erfuhren wir, dass die Regierung bei uns den Bau einer Schule an diesem Ort befohlen hatte. Die grossen<br />
Händler widersprachen, aber man hörte nicht auf sie. Andere Wagen brachten Steine, Kies und Zement, und bald begann<br />
die Arbeit. Die Maurer machten die Grundmauern und errichteten darüber die Wände; die Zimmerleute machten das<br />
Zimmerwerk, und dann kamen die Dachdecker, um das Wellblech zu legen. Es war das erste mit Wellblech gedeckte Haus<br />
meines Dorfes.<br />
Niemand wusste, was eine Schule ist; man kannte ihren Zweck noch nicht. Deshalb wollten manche Kaufleute des Dorfes<br />
aus diesem Gebäude ihr Geschäftshaus machen.<br />
Und es war nicht leicht, die Kinder in die Schule zu bekommen. Am Anfang mussten die Lehrer alle Hütten durchlaufen,<br />
um sie zu holen; manche Eltern weigerten sich, ihre Kinder fortgehen zu lassen. Aber nach und nach überzeugten die<br />
Lehrer die Einheimischen; sie erklärten ihnen die Nützlichkeit und die Absicht der Schule. So begannen die Kinder meines<br />
Dorfes, in die Schule zu gehen."<br />
5. Das BSP von Afrika ist im Zeitraum 1950-1975 langsamer gewachsen als das durchschnittliche<br />
BSP der Entwicklungsländer. (Tabelle S. 270)<br />
6. Negride haben eine dunkle, grossporige Haut, die dem Sonnen- und Hitzeschutz dient, dunkles<br />
krauses Haar, dunkle Augen, eine breite Nase, oft wulstige Lippen; Männer weisen einen<br />
schwachen Bartwuchs auf. (S. 282)<br />
7. Die Städte Kairo, Lagos, Kinshasa und Addis Abeba gehören zu den am schnellsten wachsenden<br />
Grossstädten der Welt (S. 285). Generell haben die afrikanischen Länder aber eher ländlichen<br />
Charakter (S. 285, 286)<br />
8. Nigeria und Algerien sind wichtige afrikanische Exportländer für Erdöl (S. 289)<br />
9. Afrikanische Länder sind mit Ausnahme Südafrikas rohstoffliefernde Entwicklungsländer<br />
(S. 293).<br />
10. Afrikanische Länder sind Empfänger von Entwicklungshilfe (S. 303).<br />
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 324 und 364 dieser Arbeit.) Die im Text unter Punkt 4 gemach-<br />
ten Aussagen können den tatsächlichen Zuständen vor der Errichtung der Schule entsprechen, oder aber als<br />
"<strong>Pro</strong>paganda" zugunsten der neuen Lebensweise verstanden werden. Die Beschreibung des Schulbaus<br />
entspricht dem Vorgehen beim modernen Hausbau, beispielsweise in Westafrika, und auch die geschilderten<br />
Schwierigkeiten bei der Einschulung der Kinder des Dorfes dürften in Anbetracht anderer Quellen (siehe die<br />
Karte "Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite 571 dieser Arbeit) die<br />
Zustände recht genau schildern. Ob allerdings wirklich niemand wusste, "was eine Schule ist" dürfte bezwei-<br />
felt werden.<br />
Auf Seite 284 wird auf die <strong>Pro</strong>blematik des Rassismus eingegangen und der Begriff wird kurz definiert:<br />
Rassismus. Unsere Haltung Minderheiten, Randgruppen, anderen Rassen oder überhaupt Fremden gegenüber ist häufig<br />
durch Vorurteile geprägt. Es sind vorgefasste negative Urteile, denen eine gewisse Angst vor der Andersartigkeit und<br />
Fremden zugrunde liegt Sie werden oft schon im frühen Alter unbewusst und gedankenlos übernommen, teils aber auch<br />
unbewusst anerzogen, teils aber auch bewusst anerzogen. Das gemeinsame eines solchen Urteils oder Vorurteils verleiht<br />
der eigenen Gruppe Stärke, erhöht ihr Selbstgefühl - und schürt so die Intoleranz. Innerhalb der Gruppe muss man "mit den<br />
Wölfen heulen", da man sonst Gefahr läuft, selber als "Fremder" ausgestossen zu werden. Eine solche Grundhaltung ist<br />
recht oft zu finden. Nun selten tritt sie aber so klar hervor, dass wir sie sofort erkennen können. Meist fliesst sie<br />
unbeabsichtigt ein und ist durch den allgemeinen Sprachgebrauch gewissermassen getarnt.<br />
Wie schnell ein solches Einfliessen vonstatten gehen kann, davon zeugen die zahlreichen Beispiele in den<br />
untersuchten Lehrmitteln. Entgegen der Ausführungen Bärs, gibt es aber auch so etwas wie einen "positiven"<br />
Rassismus, der einer Rasse ein bestimmtes, als positiv empfundenes Merkmal zuschreibt. Dazu gehört das Bild<br />
vom "Edlen Wilden". Eine Person aus einer betroffenen Gruppe wird durch ein solches "positives" Vorurteil<br />
genau so eingeengt, wie durch ein negatives.<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 349
Es folgen einige Beispiele und ein weiterer Text zu Rassenkonflikten und ungelösten Minderheitsprobleme.<br />
Auf einem Foto "Flüchtlingslager (Somalia, 1977)" werden die Opfer einer rassischen Aggression gezeigt.<br />
Sicher ein Thema, das nach wie vor aktuell ist und seit den Vorkommnissen in Ruanda das immer wieder von<br />
"Freunden Afrikas" geäusserte Stereotyp des friedfertigen Afrikaners, der zwar technisch gegenüber dem Euro-<br />
päer zurückgeblieben sei, dafür aber über eine höhere Sozialkompetenz verfüge, als zumindest teilweise falsch<br />
entlarvt hat.<br />
4.31.9 Zusammenfassung<br />
"Geographie der Kontinente" von Oskar Bär hinterlässt einen sehr gemischten Eindruck. Einerseits bietet das<br />
Lehrmittel einen grossen Informationsumfang, andererseits enthält es im ersten Teil unkommentierte Zitate, in<br />
der die Musik Schwarzafrikas als "gewaltiger Lärm", die Schwarzafrikaner selbst aus dritter Hand als "Men-<br />
schenfresser" bezeichnet werden.<br />
Bei der Durchstreifung des Kontinents behandelt Bär die traditionellen Themen "Pygmäen und Bantu" und<br />
"Kakaobauer aus Ghana". Wobei zumindest in letztgenannten Kapitel ein Kakaobauer selbst die Abläufe auf<br />
der Pflanzung beschreiben kann. Ein Erdnussbauer erzählt von den <strong>Pro</strong>blemen beim Anbau von Erdnüssen und<br />
ein Mädchen aus Kamerun schreibt in einem Aufsatz über den Tag, als die Schule im Dorf Einzug hielt.<br />
Die grossen Reiche Westafrikas bezeichnet der Autor als "grosse Stammesverbände", ansonsten fehlen<br />
Hinweise auf die nicht von den Europäern geprägte Geschichte Schwarzafrikas. Die Sahelzone wird als Kata-<br />
strophengebiet geschildert, in der die Menschen als "ausgemergelte Gestalten auf kahle Bäume" klettern, um<br />
ein wenig Nahrung zu finden, und "6 Millionen" (ein Viertel der damaligen Bevölkerung der betroffenen<br />
Länder) vom Hungertod bedroht wird.<br />
Unkommentiert gibt der Autor die Meinung einiger Touristen wieder, die Kenia bereisten und über die<br />
"Negervölker" Afrikas aussagen, dass sie noch "primitiv" seien, sich "ja bemühten zivilisiert zu werden" und<br />
"lustig und fröhlich aber nicht geschäftstüchtig" und ausserdem "sehr arbeitsunwillig" sei.<br />
Immerhin spricht Bär in seinem Werk auch den Rassismus an und gibt eine Definition dafür wieder, verpasst<br />
es aber, diese auf sein eigenes Lehrbuch kritisch anzuwenden, oder den Schülern die Frage nach rassistischen<br />
Tendenzen in Zitaten, wie sie oben angeführt wurden, zu stellen.<br />
Geographielehrmittel: Geographie der Kontinente (1984)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 350
4.32 Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985)<br />
Seit 1968 jedes Jahr weniger Regen; Durst und Hunger in der Sahelzone!... Vom Atlantischen Ozean bis zum Roten Meer<br />
litten die Menschen unter einer verheerenden Dürre. Sie assen die letzten verdorrten Blätter von den Büschen und das<br />
Fleisch der verwesenden Rinder. Auf einer Fläche von etwa 3 Mio. km 2 waren mindestens zehn, wenn nicht zwanzig<br />
Millionen Menschen vom Hungertod bedroht; das war jeder dritte Bewohner dieser Zone zwischen dem tropischen<br />
Regenwald und der Wüste. (Bd. 1, S. 110)<br />
Das 324 Seiten umfassende, dreibändige Geographielehrmittel "Terra Erdkunde für Realschulen" in Baden-<br />
Württemberg, während den Jahren 1980 bis 1985 erschienen, beschäftigt sich auf rund 14 Seiten in den beiden<br />
Bänden für die Klassen 7 und 8 mit Afrika.<br />
4.32.1 Band 1<br />
Der 1985 erschienene Band für die Realschulklasse 7 enthält die für diese Arbeit relevanten Kapitel "Natur<br />
und Mensch in den Wüsten und Savannen" (S. 86-114) und "Natur und Mensch im Tropischen Regenwald"<br />
(S. 117-139), wobei jeweils nur einige der Seiten sich direkt mit Afrika beschäftigen.<br />
4.32.1.1 Savannen Afrikas<br />
Die Seite 106, welche in die Thematik des Kapitels "In den Savannen Afrikas" einführt, zeigt zwei Fotos, von<br />
denen das eine ein für diese Landstriche typische Gehöft, das andere einen Bauern bei der Feldarbeit, abbildet.<br />
Auf der Seite 108 schreibt der Autor unter dem Titel "Ackerbau und Viehhaltung in den Savannen":<br />
In der Feuchtsavanne sind die klimatischen Bedingungen für den Ackerbau günstig. Zu Beginn der Trockenzeit lockern die<br />
Bauern den Boden mit der Hacke auf. Danach pflanzen sie Hirse, Mais und Bohnen. Wegen der hohen Niederschläge kann<br />
am Ende der Regenzeit nochmals gepflanzt werden. Im noch feuchten Boden wachsen dann unter sengender Sonne die<br />
stärkehaltigen Knollenfrüchte rasch heran: Maniok, Yams und Batate (Süsskartoffel).<br />
Die Böden sind nach wenigen Jahren Ackerbau erschöpft. Daher müssen die Bauern ihre Felder immer wieder verlegen.<br />
Wo sie noch ein Stück Land finden können, brennen sie erneut das Grasland ab und roden Bäume und Büsche. Dieser<br />
Wanderfeldbau mit Brandrodung ist in den Savannen weit verbreitet. Viele Bauern pflanzen neben Getreide zur<br />
Selbstversorgung auch Kakao, Kaffee und Bananen für den afrikanischen Markt und für den Weltmarkt an. Manche von<br />
ihnen haben sich sogar ganz auf den Anbau dieser Marktfrüchte spezialisiert. Die Viehhaltung spielt in der Feuchtsavanne<br />
hingegen eine untergeordnete Rolle. Die Seuchengefahr ist hier wegen der Tsetsefliege zu gross. Da die Bevölkerung in<br />
den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat, wird die Feuchtsavanne durch Brandrodung und Wanderfeldbau zu<br />
intensiv genutzt. Entwaldung, Bodenerosion und Erschöpfung der Böden sind die Folge.<br />
Als Hauptproblem für die Verschlechterung der ursprünglich "günstigen" Ackerbaubedingungen nennt der<br />
Autor die zu "intensive" Nutzung bedingt durch das Bevölkerungswachstum.<br />
Zusätzlich zum Text finden sich auf der Seite 108 drei Walter-Diagramme und eine Klimakarte. Unter der<br />
Überschrift "An der Trockengrenze des Ackerbaus" fährt der Autor auf den Seiten 108 und 109 fort:<br />
Die nördlichen Teile der Trockensavanne sowie die Dornsavanne eignen sich von Natur aus am besten für die Viehzucht.<br />
Sie sind seit jeher die Heimat von wandernden Hirtenvölkern. In jüngerer Zeit hat sich aber auch hier der Ackerbau immer<br />
weiter ausgedehnt. Der Anbau in dieser Zone stellt allerdings ein ständiges Risiko dar... Die Sahelländer, die Anteil an der<br />
Trocken- und Dornsavanne haben, gehören zu den ärmsten Ländern der Welt.<br />
Die Seite 109 zeigt neben dem Text zwei Fotos "Anbau von Erdnüssen" und "Brandrodung in Burkina Faso<br />
(Obervolta)". In einem Textkasten schreibt der Autor unter dem Titel "Im Hungergürtel der Erde" (S. 109):<br />
In den Savannen Afrikas hat die Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten besonders stark zugenommen. Viele Kinder<br />
sind der Stolz jeder Familie. Eine grosse Zahl von Rindern soll Notzeiten überbrücken helfen. "Während der letzten<br />
Dürrehabe ich 50 meiner 100 Kühe verloren", sagt ein Nomade in Mauretanien, "zu Beginn der nächsten Dürre werde ich<br />
200 haben." Dieses Verhalten erscheint uns unverständlich. Die Menschen zerstören doch ihren eigenen Lebensraum.<br />
Bleibt ihnen ohne ausreichende Hilfe aber etwas anderes übrig? Unter den gegebenen Umständen kaum, denn sie kämpfen<br />
ums tägliche Brot, ums Überleben.<br />
(Zu Mauretanien siehe auch die Seiten 100 und 354 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985)<br />
In der Sahelzone fehlt es nicht nur an Grundnahrungsmitteln, sondern auch an Brennholz. Kilometerweit ist oft kein Baum<br />
mehr zu sehen. Die bitterarme Bevölkerung kann Brennstoffe wie Kohle und Erdöl nicht kaufen. So bleibt den Frauen und<br />
Kindern nichts anderes übrig, als Holz aus immer grösseren Entfernungen herbeizuschleppen - pro Familie 200 Bäume im<br />
Jahr! Dabei sind die Kinder nicht nur billige Arbeitskräfte. Sie sorgen für ihre Eltern auch im Alter, da es keine staatliche<br />
Altersversorgung gibt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 351
(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seiten 344 und 361 dieser Arbeit.)<br />
So wird die natürliche Vegetation immer mehr zerstört. Das Land trocknet aus. Die Brunnen versiegen, sauberes<br />
Trinkwasser ist schon lange zur Mangelware geworden. Viele Kinder sterben in den ersten Lebensjahren. Millionen von<br />
Menschen verwenden den grössten Teil ihrer Zeit und Kraft darauf, Holz und Wasser herbeizuschaffen. Je teurer und<br />
knapper das Holz ist, um so mehr Dung wird als Brennmaterial verheizt. Die Felder werden schlechter gedüngt, die Erträge<br />
sinken. Daher roden die Menschen immer neue Flächen, um weiteres Ackerland zu gewinnen. Und das oft weit jenseits der<br />
Trockengrenze!<br />
Einmal abgesehen davon, dass der Text schlecht strukturiert ist, werden Folgen geschildert, ohne dass deren<br />
Ursache geklärt wird. Zudem wird nicht differenziert zwischen den herumziehenden Nomaden und den sess-<br />
haften Ackerbauern. Als Ursachen der nicht genauer bezeichneten "Zerstörung" des Lebensraumes erwähnt der<br />
Autor das Bevölkerungswachstum, andeutungsweise die sich vergrössernden Viehbestände, den Brennholzbe-<br />
darf und die Ausweitung der Ackerbauflächen in zu niederschlagsarme Gebiete hinein. Damit wird weit weni-<br />
ger differenziert argumentiert als dies beispielsweise in "Geographie der Kontinente" von 1984 (S. 60) der Fall<br />
war. Zudem wird Afrika, wie schon im Lehrmittel "Geographie thematisch" von 1977-1980 (Bd. 3, S. 189) als<br />
"im Hungergürtel der Erde" liegend beschrieben.<br />
Unter dem Titel "Die Sahelzone - ein gefährdeter Lebensraum" schreibt der Autor auf der Seite 110 unter der<br />
Überschrift "Die Grosse Dürre 1968-1973":<br />
Seit 1968 jedes Jahr weniger Regen; Durst und Hunger in der Sahelzone! Die Felder und Weiden waren verdorrt, die<br />
Bäume abgestorben. Rinder, Schafe, Ziegen und Kamele drängten sich wie die Menschen vor den versiegenden Brunnen.<br />
Überall lagen verendete Tiere. Hier in der Trocken- und Dornsavanne zwischen dem 14. und 18. Breitengrad regierte der<br />
Tod. Zuerst starben die Rinder, dann die Esel, dann die Schafe und Kamele; übrig blieben oft nur die Ziegen.<br />
Vom Atlantischen Ozean bis zum Roten Meer litten die Menschen unter einer verheerenden Dürre. Sie assen die letzten<br />
verdorrten Blätter von den Büschen und das Fleisch der verwesenden Rinder. Auf einer Fläche von etwa 3 Mio. km 2 waren<br />
mindestens zehn, wenn nicht zwanzig Millionen Menschen vom Hungertod bedroht; das war jeder dritte Bewohner dieser<br />
Zone zwischen dem tropischen Regenwald und der Wüste.<br />
Während Bär in seinem im gleichen Zeitraum erschienen Lehrmittel "Geographie der Kontinente" von 1984 in<br />
einem auf der Seite 59 seines Buches wiedergegeben Zeitungsartikel von 1973 von 6 Millionen vom Hunger-<br />
tod bedrohten Menschen spricht, drohte das gleiche Schicksal nach den im oben stehenden Zitat gemachten<br />
Aussagen 10-20 Mio. Menschen. Das Lehrmittel "Unser Planet" von 1979-1982 (Bd. 2, S. 24) nennt rückblik-<br />
kend eine Zahl von 250'000 Hungertoten.<br />
Untermalt wird der Text von einem Foto "...übrig bleiben oft nur die Ziegen", welches eine Ziegenherde zeigt,<br />
und einem Foto, auf dem einem Kind, welchem eine Schale Milch von einem Erwachsenen gereicht wird, zu<br />
sehen ist. Unter der Überschrift "Die nächste Katastrophe... fährt der Autor auf den Seiten 110 und 111 weiter:<br />
Der grossen Dürre 1968-1973 folgte eine Reihe von feuchten Jahren. Bald dachte kaum noch jemand ernsthaft an die<br />
Gefahr einer neuen Katastrophe. Aber wenige Jahre später zeigte sich, dass weder die Regierungen noch die Bevölkerung<br />
der Sahelländer ausreichend für die Zukunft vorgesorgt hatten.<br />
Mr. Hunter, ein englischer Pilot, der seit 1980 Nahrungsmittel und Hilfsgüter in die Sahelzone transportiert, berichtet:<br />
"Die Trockenheit hat bereits jetzt, Anfang 1985, über 300'000 Tote gefordert - Ausser dem Tschad und dem Sudan ist<br />
dieses Mal Äthiopien das am härtesten betroffene Land. Allein hier hungern mindestens zehn Millionen Menschen."<br />
Während der Dürre, welche die Ernten vieler Bauern Äthiopiens vernichtete, erklärte der nach dem Sturz des<br />
Kaisers Haile Selassie von 1974 an die Macht gelangte Generalsekretär Mengistu der neu gegründeten Arbei-<br />
terpartei das Land 1984 zum kommunistischen Staat. Das von der Regierung ins Leben gerufene <strong>Pro</strong>gramm<br />
zur Bekämpfung der Armut, wurde von Umsiedlungsprogrammen begleitet, die auf internationale Ablehnung<br />
stiessen, was die Geberländer aber nicht daran hinderte, weiterhin Nahrungsmittelhilfe über die Regierung an<br />
die Notleidenden zu senden, die diese dazu verwendete, die gegen die Rebellen der EPLF - die für ein freies<br />
Eritrea kämpften - vorrückenden Soldaten zu verpflegen. 1991 brach die Regierung Mengistu nach der Sezes-<br />
sion der nördlichen Gebiete Äthiopiens zusammen und wurde 1992 von der Regierung Meles Zenawi abgelöst,<br />
die mit dem Wiederaufbau des Landes begann. (Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 311 und 355 dieser<br />
Arbeit.) Der Pilot berichtet weiter:<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 352
"Auf dem Flug über die Trocken- und Dornsavanne wird das ganze Ausmass der Dürre sichtbar. Über Hunderte von<br />
Kilometern die gleichen Eindrücke: von der Sonne verbrannte Erde, ausgetrocknete Flussläufe, verdorrte Wälder und<br />
Weiden. Der Tschad-See hat sich 70 km vom Dorf Nguigmi zurückgezogen, dessen Marktplatz er in der Regenzeit zu<br />
überschwemmen pflegte."<br />
Mr. Hunter fährt fort: "Seit Herbst 1984 bin ich vor allem in Äthiopien eingesetzt. Assab, der Glutofen am Roten Meer, ist<br />
zum Umschlagplatz der ausländischen Hilfslieferungen geworden. Jeden Tag fliege ich ein anderes der 15 Auffanglager im<br />
Norden des Landes an. Auf den Pisten zu den Lagern immer dasselbe Bild des Jammers: in Lumpen gehüllte, von grauem<br />
Staub bedeckte, ausgemergelte Gestalten, die sich mühsam voranschleppen. Selbst wenn sie das scheinbar rettende Ziel<br />
erreicht haben, sind sie noch immer in Lebensgefahr. Die meisten Bauernfamilien harren monatelang in ihren abgelegenen<br />
Dörfern aus, immer auf Regen hoffend. Erst kurz vor dem Verhungern verlassen sie ihre Heimat und suchen verzweifelt<br />
nach Hilfe. Die meisten Kinder und alten Leute verhungern schon unterwegs.<br />
In den <strong>Pro</strong>vinzen Wollo und Tigre gibt es für Hunderttausende von Flüchtlingen nur einen einzigen Arzt. Viele Kranke und<br />
Hungernde werden abgewiesen. Eine deutsche Krankenschwester erzählte mir, dass nur diejenigen etwas zum Essen<br />
erhalten, die eine Überlebenschance haben. Die anderen werden weggeschickt und sterben. Neulich habe ich einen<br />
Reporter beobachtet. Er filmte ein fünfjähriges Mädchen, das vor seinen Augen starb. Erschüttert liess er seine Kamera<br />
sinken und weinte."<br />
Mit diesen emotionalen Worten schliesst der Text "Die nächste Katastrophe". Darin zeichnet der Autor ein<br />
Bild einer der Naturgewalten hilflos ausgelieferten Bevölkerung. Die vom Menschen verursachten <strong>Pro</strong>bleme,<br />
wie der damals schon jahrelang tobenden Krieg in Äthiopien, werden nicht erwähnt. (Zu den Hungerkrisen<br />
Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 344 und 356 dieser Arbeit.)<br />
Seite 111 zeigt ausserdem ein grossen Foto "Wasserstelle in der Dornsavanne" und ein Niederschlagsdia-<br />
gramm aus Niger für die Jahre 1940-1984. Eine Graphik "Bevölkerung, Viehbestand und Weideland im Sahel"<br />
zeigt sowohl die Bevölkerungszunahme als auch die Zunahme der Viehbestände der Länder Äthiopien,<br />
Tschad, Niger, Burkina Faso, Senegal und Mauretanien, die nach Aussagen der Grafik im Zeitraum von<br />
1950-1982 enorm zugenommen haben: So hat sich die Zahl der Einwohner dieser Länder im genannten Zeit-<br />
raum von rund 34 Millionen auf 60 Millionen erhöht, also fast verdoppelt, während der Viehbestand an Kame-<br />
len, Rindern, Schafen und Ziegen von 80 Millionen Stück auf rund 116 Millionen angestiegen ist.<br />
Im Text schreibt der Autor unter der Überschrift "Ursachen der Katastrophe" auf der Seite 112:<br />
Natürlich ist es nicht allein die Dürre, die im Sahel immer wieder zu Katastrophen führt! Da die Bevölkerung ständig<br />
wächst, werden im dürregefährdeten Norden die Nahrungsmittel immer knapper. Auch aus dem klimatisch begünstigten<br />
Süden der Sahelländer sind kaum Grundnahrungsmittel zu beziehen. Dort werden nämlich auf bewässerten Flächen vor<br />
allem <strong>Pro</strong>dukte wie Baumwolle, Erdnüsse und Gemüse für den Weltmarkt angebaut. So bleibt den Bauern im Norden gar<br />
nichts anderes übrig, als ihre Felder immer weiter in Gebiete hinein auszudehnen, die schon in Normaljahren keine<br />
lohnende Ernte zulassen...<br />
Der Autor führt auch aus, dass die angelegten Tiefbrunnen zu einer Verschärfung der Situation geführt hätten.<br />
Zu den negativen Folgen der Nutzung dieser Brunnen stellt er im Text die Frage ob nicht die "einheimischen<br />
Landwirtschaftsberater und die ausländischen Brunnenbauern" diese hätten voraussehen können. Weiter<br />
schreibt er (S. 112):<br />
...Vor Beginn der letzten Dürre weideten in den Sahelländern Millionen von Rindern, Kamelen, Schafen und Ziegen...<br />
Doch finden in den dürregefährdeten Gebieten weit weniger Tiere ausreichend Futter. Ein zu hoher Viehbestand führt hier<br />
also zu Überweidung - die Grasnarbe wird zerstört. Gelegentliche Sturzregen und stürmische Winde fördern die<br />
Bodenerosion. Der fruchtbare Humusboden wird abgetragen; Sanddünen breiten sich aus. In weiten Landstrichen rückt die<br />
Wüste vor. Fachleute sprechen von der Wüstenausbreitung oder von der Desertifikation.<br />
(Zur Desertifikation siehe auch die Seite 401 in dieser Arbeit.) In den Aufgabenstellungen schreibt der Autor<br />
auf der Seite 112:<br />
Ein Kenner der Sahelzone sagte neulich: "Die Menschen hier können nichts dafür, dass sie ihren eigenen Lebensraum<br />
zerstören."<br />
Einer der Sätze, welcher eine Einstellung spiegeln, die Kabou in ihrem Buch "Weder arm noch ohnmächtig"<br />
so vehement anficht. (Kabou 1995)<br />
Auf der Seite 113 zählt der Autor unter der Überschrift "Gibt es eine Rettung? Einige Sofortmassnahmen" die<br />
seiner Ansicht einzuleitenden Massnahmen auf:<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985)<br />
Ackerbau darf nur noch bis zur Trockengrenze betrieben werden. Diese Grenze ist je nach Dauer der Regenzeit jedes Jahr<br />
neu festzulegen. Ausserdem sollten auf den bewässerten Flächen im Süden vorrangig Grundnahrungsmittel angebaut<br />
werden. Dies setzt voraus: staatliche Kontrolle, Hilfe für die Bauern in Trockenjahren.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 353
Bodenerosion und Wüstenausbreitung lassen sich eindämmen, wenn Millionen von Bäumen gepflanzt und<br />
Windschutzhecken angelegt werden. Dazu ist eine geregelte Weidewirtschaft erforderlich. Holz darf nur noch mit<br />
Genehmigung der Forstbehörden geschlagen werden. Dieses <strong>Pro</strong>gramm kann nur gelingen, wenn der Staat den Menschen<br />
Holz und andere Energiequellen billig zur Verfügung stellt. Zum Nachdenken: Das <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen im Sahel beträgt<br />
etwa 300 DM im Jahr.<br />
Der Viehbestand muss verringert werden... Wie sollen sie ihr Vieh in die besser entwickelten Gebiete im Süden der<br />
Sahelländer verkaufen, wo es überall an Strassen fehlt?<br />
Ohne Nahrungs- und Futterreserven lässt sich keine Dürrezeit überbrücken. Auch das geht nicht ohne Vorratslager!<br />
Die meisten der vom Autor vorgeschlagenen Massnahmen liessen sich nur unter grossen Schwierigkeiten oder<br />
gar nicht verwirklichen. Unter der Überschrift "Einige längerfristige Massnahmen" heisst es weiter (S. 113):<br />
Damit der Bevölkerung in Notzeiten schneller geholfen werden kann, ist der Ausbau des Strassennetzes vorrangig.<br />
Da fast 90% der Bewohner des Sahel Analphabeten sind, muss dringend das Schulwesen verbessert werden. Ohne<br />
Fachkräfte lässt sich die Wirtschaft der einzelnen Länder nicht entwickeln.<br />
Um nicht ausschliesslich auf die Landwirtschaft angewiesen zu sein, muss die Kleinindustrie gefördert werden:<br />
Vermarktung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen, Einrichtung von Reparaturwerkstätten usw..<br />
Mit ausländischer Hilfe bauen Meteorologen ein Netz von Wetterstationen auf. Bodenkundler und Klimatologen<br />
untersuchen, welche Gebiete sich am besten für den Ackerbau eignen.<br />
Selbst wenn das Schulwesen verbessert würde, müssten die entsprechenden Arbeitsplätze und weiterführenden<br />
Ausbildungen für die Schulabgänger erst geschaffen werden. Die Seite 113 zeigt ausserdem ein Foto "Die<br />
Wüste wächst..." und eine Graphik "Modell einer verbesserten Weidenutzung für 10 Nomadenfamilien mit<br />
jeweils 700 Stück Vieh".<br />
Im letzten Abschnitt unter dem Titel "Länder in den Wüsten und Savannen" werden die afrikanischen Staaten<br />
Mauretanien, Tschad und Äthiopien vorgestellt, von denen es in einer der Aufgabenstellungen heisst, sie<br />
gehörten "zu den ärmsten Ländern der Erde" (S. 114). Auffällig ist bei der Beschreibung der Länder, dass für<br />
Mauretanien und Tschad jeweils die Zahl der Europäer angegeben wird, obwohl sich diese in beiden Fällen auf<br />
nur ca. ein <strong>Pro</strong>mille beläuft, während die anderen Bevölkerungsanteile nur wenig differenziert angegeben<br />
werden. So werden die Schwarzafrikaner nur in Sudanneger und Niloten aufgeteilt. Über die Bevölkerung<br />
Äthiopiens weiss der Autor wenigstens zu berichten, dass "50 Sprachen gesprochen" werden (S. 115).<br />
Zu Mauretanien schreibt der Autor im Abschnitt "Wirtschaft und Verkehr" auf der Seite 114:<br />
In der Landwirtschaft sind 85% aller Erwerbstätigen beschäftigt. Ein Drittel der Bevölkerung sind Nomaden. Kamele,<br />
Ziegen und Schafe sind ihre Lebensgrundlage. Der Ackerbau (Hirse, Mais) und der Anbau von Datteln haben geringe<br />
Bedeutung. Relativ wichtig ist dagegen die Fischerei. Wichtigste Ausfuhrgüter sind Eisenerz (80% des Exportwertes) und<br />
Kupfer, daneben Fisch, Vieh und Viehzuchtprodukte. Es gibt nur unbefestigte Strassen. Bei Nuadhibu liegt der Erzhafen<br />
Cansado. Von hier führt die Eisenbahn zu den Erzlagern und nach F'Derick.<br />
Noch immer spielen die Eisenerzimporte eine wichtige Rolle in der Wirtschaft Mauretaniens, sie werden aber<br />
wertmässig unterdessen von Einnahmen aus der Fischerei übertroffen. Für die Binnenwirtschaft ist vor allem<br />
die Weidewirtschaft bedeutend. Die rund 2.5 Mio. Einwohner des 1960 unabhängig gewordenen Landes setzen<br />
sich aus 80% Mauren und 20% verschiedener schwarzafrikanischer Völker zusammen. Mehr als die Hälfte der<br />
Bevölkerung lebt in Städten, 550'000 Menschen in der Hauptstadt Nouakchott. Das seit 1991 als islamische<br />
Republik deklarierte Land, wird seit 1984 von dem 1992 in den ersten freien Wahlen des Landes bestätigten<br />
Maaouya Ould Si Ahmed Taya regiert. (Zu Mauretanien siehe auch die Seite 351 dieser Arbeit.) Über die<br />
Wirtschaft des Tschad schreibt der Autor auf der Seite 115:<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985)<br />
In der Landwirtschaft sind 85% aller Erwerbstätigen beschäftigt. Hauptwirtschaftszweig ist die Viehzucht (4 Mio. Rinder, 5<br />
Mio. Schafe und Ziegen), die zum Teil von Nomaden betrieben wird. Sie liefert Exportgüter wie Häute und Felle sowie<br />
lebende Tiere. An Agrarprodukten sind Baumwolle (60-70 % des Ausfuhrwertes) und Erdnüsse von Bedeutung. Zur<br />
Selbstversorgung bauen die Eingeborenen Hirse, Mais, Reis und Sesam an, in den Oasen der Sahara vor allem Datteln. An<br />
Bodenschätzen gibt es etwas Zinn. Die industrielle Entwicklung ist auf die Verarbeitung der Agrarprodukte gerichtet; der<br />
Ausbau der Verkehrswege beginnt erst.<br />
Die Wirtschaft des Tschad, der zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, stützt sich vor allem auf die Land-<br />
wirtschaft, obwohl nur etwa 3% des Landes für den Ackerbau geeignet sind. Neben Baumwolle exportiert der<br />
Tschad Lebendvieh, - rund ein Drittel des Tschad wird als Weidefläche genutzt -, Erdnüsse, Naturkautschuk,<br />
Textilien und Fisch aus dem Tschadsee, dessen Uferzonen auch den wichtigsten Bodenschatz des Landes,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 354
Natriumcarbonat, liefern. Zudem sollen in den nächsten Jahren die Erdölfunde bei Doba im Süden des Landes<br />
ausgebeutet werden.<br />
Nur ein Fünftel der 6.9 Millionen Einwohner leben in Städten, wobei die Hauptstadt Ndjamena (früher Fort-<br />
Lamey) rund 600'000 Einwohner zählt. Die Bevölkerung besteht im Norden und Zentrum des Landes vor<br />
allem aus arabischen Volksgruppen, im Süden dominieren die Schwarzafrikaner. Unter den rund 200 Ethnien<br />
mit über 100 verschiedenen Sprachen, bilden die Sara, zu denen fast ein Drittel der Menschen im Tschad<br />
gehören, die grösste Volksgruppe.<br />
Die Landesgrenzen des Tschad sind immer noch Grund für Verhandlungen mit den Nachbarländern. Mit<br />
Libyen, welches die Geschehnisse im Tschad immer wieder beeinflusste, ist es in der Vergangenheit wegen<br />
des Uranvorkommen enthaltenden Azoustreifen im Norden des Landes immer wieder zu Konflikten gekom-<br />
men, die der internationale Gerichtshof 1994 zu Gunsten des Tschad entschied. Die Konflikte mit dem Nach-<br />
barland Libyen, und dessen Unterstützung der arabischen Volksgruppen gegen die schwarzafrikanische Regie-<br />
rung, führten zu einem Bürgerkrieg, der zwischen 1969 und 1993 immer wieder aufflammte. Seit 1991 regiert<br />
der 1996 in den ersten freien Präsidentschaftswahlen des Landes in seinem Amt bestätigte und aus dem<br />
Norden des Landes stammende Idriss Déby das Land, dessen Regierung von verschiedenen Menschenrechtsor-<br />
ganisationen immer wieder angeprangert wurde. (Zum Tschad siehe auch die Seiten 264 und 402 dieser<br />
Arbeit.) Die Einwohner des Landes werden, in der aus älteren Lehrmitteln gewohnten Art, also wieder als<br />
"Eingeborene" bezeichnet. Über Äthiopien weiss der Autor zu berichten (S. 115):<br />
...Bis 1974 war Äthiopien ein Kaiserreich, seither ist das ostafrikanische Land sozialistische Republik... Südlich davon<br />
liegen die Dornsavannen und Halbwüsten der Landschaft Ogaden, wo die Somali seit 1977 um ihre politischen Rechte<br />
gegen die kommunistische Regierung in Addis Abeba kämpfen... Der ganze Norden Äthiopiens leidet immer wieder unter<br />
verheerenden Dürren... Staatssprache ist Amhara,... 55% der Bevölkerung sind äthiopische Christen (besonders Amharen<br />
und Tigre), über 35% Mohammedaner (vor allem Somali und Dankali).<br />
(Siehe zu den äthiopischen Christen auch die Seite 102 dieser Arbeit.)<br />
...In der Landwirtschaft sind 80% aller Erwerbstätigen beschäftigt. Der grösste Teil des Landes wird von nomadischen<br />
Viehzüchtern bewohnt. Wichtigste Anbauprodukte sind Gerste, Hirse, Weizen, Bananen und Kaffee, der 60% des<br />
Ausfuhrwertes ausmacht. Bergbau und Industrie stecken noch in den Anfängen. Das Strassennetz ist besonders in den<br />
nördlichen <strong>Pro</strong>vinzen des Landes noch sehr weitmaschig.<br />
(Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 352 und 401 dieser Arbeit.) Im Kapitel "Tropische Nutzpflanzen" auf den<br />
Seiten 132-133 werden zwar auch für die afrikanische Bevölkerung wichtige Nutzpflanzen vorgestellt, konkret<br />
schreibt der Autor zu Afrika aber nur, dass für Kakao die "gegenwärtig... wichtigsten Anbau und Exportländer<br />
in Westafrika" lägen.<br />
Der Band 1 enthält keine weiteren Informationen zu Afrika mehr. Band 2 (1980 erschienen) für die Realschul-<br />
klasse 8 enthält überhaupt keine Angaben zu Afrika.<br />
4.32.2 Band 3<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985)<br />
Der 1981 erschienene Band 3 für die Realschulklasse 9 beschäftigt sich auf den Seiten 10-13 in den Kapiteln<br />
"Der Hungergürtel der Erde" und "Wie viele Menschen kann die Erde ernähren?" auch mit Afrika.<br />
Seite 10 zeigt ein Foto "Hunger in Uganda", auf dem mehrere Kinder mit "Hungerbäuchen" abgebildet sind,<br />
sowie eine Karikatur, die ein schwarzes Kind zeigt, das seine Arme einer Abfallhalde, auf der Lebensmittel<br />
entsorgt werden, entgegenstreckt. Neben ihm liegt ein bereits verhungertes Kind. Ausserdem sind in einer<br />
Tabelle "Versorgung mit wichtigen Nahrungsmitteln" auch Angaben zu Nigeria und Uganda zu finden. Seite<br />
11 bildet eine Karte "Welt der Satten - Welt der Hungrigen" ab. In der Legende dazu werden die afrikanischen<br />
Länder Äthiopien, Benin, Botswana, Guinea, Mali, Mauretanien, Mosambik, Niger, Obervolta (Burkina Faso),<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 355
Somalia, Tansania, Tschad und Zaire als "vom Hunger bedrohte Länder" aufgeführt. Alle anderen afrikani-<br />
schen Staaten, mit Ausnahme von Südafrika und Libyen werden mit "zu knapp ernährt" oder "ausreichend<br />
ernährt" bezeichnet. Südafrika wird zusammen mit den Industrienationen als "überernährt u. gut ernährt"<br />
aufgeführt, was angesichts der tatsächlichen Lebensumstände vieler schwarzer Südafrikaner an der Zuverläs-<br />
sigkeit der Aussagen für andere Länder zweifeln lässt.<br />
Das Kapitel "Wie viele Menschen kann die Erde ernähren?" beschäftigt sich am Rande unter der Überschrift<br />
"Die Tragfähigkeit der tropischen Regenwälder" auch, wenn nur sehr allgemein mit Afrika. Der Autor schreibt<br />
auf der Seite 12:<br />
Bis in die jüngste Zeit setzen einzelne Länder... Zentralafrikas... grosse Hoffnungen in die Erschliessung ihrer<br />
Regenwälder...<br />
In der immerfeuchten Tropenzone gelingt bis heute vorwiegend nur der Anbau von Dauerkulturen wie Ölpalmen, Kaffee<br />
und Kautschuk. Um Grundnahrungsmittel in grossen Mengen zu erzeugen, bedarf es anderer Anbaumethoden. Mit Hilfe<br />
neuer Pflanzensorten, die unter dem schützenden Blätterdach der Urwaldbäume gedeihen, liesse sich die Bodenerosion<br />
verhindern. Da aber mit Sicherheit viele Jahrzehnte vergehen, bis derartige Züchtungen anwendungsreif sind, werden die<br />
tropischen Regenwälder entgegen früheren Aussagen von Wissenschaftlern also noch lange nur unbedeutende Beitrage zur<br />
Lösung des Ernährungsproblems leisten können.<br />
(Siehe dazu auch die Bemerkungen zur Agroforstwirtschaft auf der Seite 424f. dieser Arbeit.) Auf der Seite 13<br />
schreibt der Autor unter der Überschrift "Die Tragfähigkeit der Savannen":<br />
Die Savannen nehmen grosse Flächen Afrikas... ein. In der Trocken- und Dornsavanne sind die Voraussetzungen für die<br />
Landwirtschaft kaum günstiger als in den tropischen Regenwäldern.<br />
In diesem "Hungergürtel" ist das Bevölkerungswachstum heute am stärksten. Eine hohe Kinderzahl gilt hier als Sicherheit<br />
für das Alter. Eine grosse Zahl von Rindern soll Notzeiten überbrücken helfen. "Während der letzten Dürre habe ich 50<br />
meiner 100 Kühe verloren", sagt ein Nomade in Mauretanien, "zu Beginn der nächsten Dürre werde ich 200 haben!"<br />
Diese Aussagen des mauretanischen Nomaden wurde schon im Band 1 auf der Seite 109 zitiert. Im Text fährt<br />
der Autor fort:<br />
Besonders im Bereich der Trockengrenze gefährdet der Mensch seinen Lebensraum seit Jahrzehnten durch Übernutzung In<br />
weiten Teilen der Savannen ist Brennholz heute genauso Mangelware wie die Nahrung. Tansania und Uganda decken<br />
ihren Energiebedarf zu 96% mit Holz, Kenia und Nigeria zu 90%... die waldreiche Schweiz dagegen nur zu 1,5%. Der<br />
Vernichtung der natürlichen Vegetation folgt somit flächenhaft die Zerstörung der Böden und die Austrocknung des<br />
Landes. 95% der Bevölkerung dieser Zone haben kein sauberes Trinkwasser. Täglich müssen Millionen Frauen und Kinder<br />
den grössten Teil ihrer Kraft und Zeit auf das Schleppen von Wassereimern und Holz verwenden. Wegen der Gefährdung<br />
des natürlichen Gleichgewichts in den wechselfeuchten Tropen, die ohnehin zu den klimatischen Risikoräumen gehören,<br />
ist die Grenze der Tragfähigkeit bei der jetzigen Wirtschafts- und Lebensweise erreicht. In der Sahelzone leben sogar mehr<br />
Menschen, als gegenwärtig aus reichend ernährt werden können. Wegen seines hohen Flächenbedarfs wirkt sich der noch<br />
weit verbreitete Wanderfeldbau hier besonders nachteilig aus. Die zunehmende Bevölkerungsdichte zwingt dazu, immer<br />
mehr Land in immer kürzerer Zeit umzubrechen. Die an sich schon geringen Reserven an nutzbarem Boden sind heute<br />
bereits weitgehend erschöpft. Von den Rändern her wird die Savannenzone durch Raubbau der um ihre Existenz<br />
kämpfenden Völker eingeengt. Heute dehnen sich die Wüsten weltweit auf Kosten der Savannen aus Diesen Vorgang<br />
nennt man Desertifikation.<br />
Nebst dem Text enthält die Seite 13 auch ein Foto "Viehhaltung im Sahel" und einen Textrahmen mit dem<br />
Titel "Reiseeindrücke im Sahel", in dem es heisst:<br />
"An einem Wasserloch ziehen Bauern den ledernen Wassersack aus der Tiefe. Die Männer sind mager und sehnig. Sie<br />
beantworten Fragen nach dem Zustand ihrer Herden mit der vorwurfslosen Gelassenheit von Menschen, denen das<br />
Hinsterben der Tiere längst zum Alltag geworden ist. Nein, sie besässen keine Kühe mehr, keine Milch, keine Vorräte an<br />
Hirse oder Datteln. Drei Frauen in dunkelblauen Tüchern treten hinzu. Sie legen die Hände auf den Magen, um das Wort<br />
zu unterstreichen, das sie mehrfach wiederholen. Das Wort heisst 'Hunger'".<br />
Mit diesen "berührenden" Worten beendet der Autor seine Betrachtungen zur Sahelzone und damit auch seine<br />
Ausführungen zum afrikanischen Kontinent. (Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 351<br />
und 385 dieser Arbeit.)<br />
4.32.3 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985)<br />
Von allen Grossräumen Afrikas wird dem Schüler nur das Gebiet des Sahel, und dieses zur Zeit wirtschaftli-<br />
cher Schwierigkeiten vorgestellt. So wird der Eindruck eines Krisen- und Hungerkontinents Afrikas vermittelt,<br />
der zwar punktuell richtig, auf die Gesamtheit Afrikas bezogen aber eindeutig falsch ist. Ausserdem werden in<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 356
den Texten alle Volksgruppen pauschal behandelt, d.h. zwischen den einzelnen Volksgruppen, ihren Lebens-<br />
weisen und <strong>Pro</strong>blemen wird kaum unterschieden.<br />
Ganz generell wird das Bild eines hilflosen, vom Schicksal gebeutelten Menschen gezeichnet, dem es nicht<br />
gelingen wird, ja nicht gelingen kann, aus seiner Misere zu entfliehen und der dadurch gezwungen ist, sein<br />
Heil in der Hilfe von aussen zu suchen.<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 357
4.33 Terra Erdkunde (1982-1983)<br />
Von den beiden Bänden "Terra Erdkunde" für das 10. und das 11. Schuljahr, die insgesamt 297 Seiten umfas-<br />
sen, beschäftigt sich nur der Band für das 11. Schuljahr mit Afrika. Dabei wird Afrika auf 6 Seiten meist nur<br />
kurz innerhalb eines grösseren Themas erwähnt.<br />
Die Seite 97 zeigt eine Grafik "Welt der Satten - Welt der Hungrigen" laut der Afrika über die meisten Länder<br />
weltweit verfügt, die vom "Hunger bedroht" werden. Die derart in der Karte gezeichneten afrikanischen<br />
Länder sind: Äthiopien, Benin, Botswana, Guinea, Mali, Mauretanien, Mosambik, Niger, Obervolta, Somalia,<br />
Tansania, Tschad, Zaire. Auf derselben Seite ist auch eine Tabelle "Versorgung mit wichtigen Nahrungsmit-<br />
teln" wiedergegeben, welche die afrikanischen Länder Algerien, Nigeria und Uganda aufführt.<br />
Die Seite 98 zeigt eine Grafik "Einteilung der Entwicklungsländer", auf welcher wieder Afrika die am meisten<br />
wenig entwickelten Länder aufweist.<br />
Auf der Seite 100 schreibt der Autor unter der Überschrift "Reichtum, der immer erdrückender wird" im<br />
Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum:<br />
Nganga Muinde wohnt am Rande der Distrikthauptstadt Machakos, eine Autostunde von Nairobi entfernt. Er ist<br />
inzwischen 70 Jahre alt und berichtet stolz von seinen 9 Kindern und 29 Enkeln. Kinder, das hat er gelernt, bedeuten<br />
Reichtum, Arbeitskräfte fürs Feld und eine Art Altersversicherung. Die Frage nach Familienplanung, meint er, kann nur ein<br />
Weisser stellen.<br />
Die Seite 112 zeigt ein Foto "Hirsefeld in der Sahelzone" und auf der Seite 166 sind zwei Fotos zur "Viehhal-<br />
tung im Sahel" abgebildet. Unter der Überschrift "Reiseeindrücke im Sahel" gibt der Autor auf der gleichen<br />
Seite die bereits in "Terra Erkunde für Realschulen", Band 3, Seite 13 von 1981 zitierte (siehe die Seite 356<br />
dieser Arbeit) Textstelle über die hungernden Bauern am Wasserloch wieder.<br />
Die Seite 174 zeigt zwei Fotos "Nahrungsmittelhilfe im Sahel" und geht im Text "Hunger - nicht nur naturbe-<br />
dingt" auf einer Seite auf die Hintergründe der Dürrekatastrophe in der Sahelzone von 1973 ein.<br />
4.33.1 Zusammenfassung<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde (1982-1983)<br />
Wie schon in "Terra Erdkunde für Realschulen" reduziert der Autor Schwarzafrika fast ausschliesslich auf die<br />
krisengeschüttelte Sahelzone und vermittelt unter Verwendung grösstenteils gleicher Texte, das gleiche Bild.<br />
(Siehe die Zusammenfassung von "Terra Erdkunde für Realschulen" auf der Seite 356 dieser Arbeit.)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 358
4.34 Mensch und Raum (1983-1986)<br />
Seit den frühen Morgenstunden ist Niara Mokele unterwegs. Sie sammelt Zweige und Äste vom Boden auf oder bricht sie<br />
von den Bäumen. Sie verschnürt ihr Sammelgut zu einem Bündel, das sie auf dem Kopf transportiert. Niara Mokele<br />
sammelt das Feuerholz, das sie für die Zubereitung der täglichen Mahlzeiten benötigt.<br />
Unter der sengenden Mittagssonne wird die schwere Last immer drückender, und noch liegt der kilometerweite Rückweg<br />
vor ihr. Soll sie schon jetzt umkehren? Der gesammelte Vorrat reicht nicht aus. Zu bald muss sie sonst den weiten Weg<br />
erneut auf sich nehmen. (Bd. 2, S. 124)<br />
Das dreibändige Lehrmittel "Mensch und Raum" für die Klassen 5 - 10, im Zeitraum 1983-1986 erschienen,<br />
beschäftigt sich in den ersten beiden Bänden mit Themen zu Afrika, im letzten Band fehlen diese völlig trotz<br />
des Untertitels der ganzen Reihe "Dreimal um die Erde".<br />
4.34.1 Band 1<br />
Der 1983 erschiene Band für die Klassen 5 und 6 enthält die Kapitel "In der Sahara" (S. 57-60), "Das Niltal -<br />
eine Stromoase" (S. 61-63), "Wildherden in den Savannen Ostafrikas" (S.69-71) und "Kakao aus Ghana"<br />
(S. 78-79), wobei die beiden ersten Kapitel für die Fragestellung dieser Arbeit keine nennenswerten Stellen<br />
enthalten.<br />
4.34.1.1 Kenia<br />
Im Kapitel "Wildherden in den Savannen Ostafrika" schreibt der Autor auf der Seite 69 nach einer kurzen<br />
Einleitung:<br />
Geographielehrmittel: Mensch und Raum (1983-1986)<br />
...Kenia gehört zu den Ländern, deren Bevölkerung am schnellsten wächst. 1968 hatte es 10 Mio. Einwohner, 1980 bereits<br />
über 16 Mio. Es ist auch ein Land ohne Rohstoffe, das weit mehr für die eingeführten Güter bezahlen muss, als es für seine<br />
Ausfuhr erhält.<br />
Unterdessen ist die Bevölkerung Kenias auf schätzungsweise rund 32 Millionen Menschen angewachsen, die<br />
sich in etwa 40 Ethnien aufgliedern. Die grössten Volksgruppen sind die Kikuyu mit 21% der Gesamtbevölke-<br />
rung, die Luhya (14%), Luo (12%) und die Kemba und Kalenjiin (je 11%), während die Massai weniger als<br />
2% der Gesamtbevölkerung stellen. Präsident des Landes ist seit 1978 der einem kleinen Volk der Kalenjin-<br />
gruppe angehörende und ehemalige Lehrer Daniel arap Moi. Neben innenpolitischen <strong>Pro</strong>blemen, 1996 waren<br />
100'000 Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht, 180'000 Flüchtlinge kamen aus dem Ausland, kämpft<br />
das Land mit einer Verschuldung von 7.4 Mrd. US$ (1995) und einem Rückgang im Tourismusgeschäft, das<br />
1996 nach einem leichten Anstieg wieder 465 Mio. US$ einbrachte, durch die Unruhen im Vorfeld der Wahlen<br />
1997 aber wieder eingebrochen sein dürfte. Obwohl Kenia über eine relativ diversifizierte Wirtschaft verfügt,<br />
werden doch 51% der Einnahmen, die sich 1995 auf 1.9 Mrd. US$ beliefen, noch immer aus den Export von<br />
Nahrungsmitteln erwirtschaftet. Weitere 27% stammen aus dem Export von Industriegütern und 15% werden<br />
durch Konsumgüter eingenommen. 1997 verschärfte sich die wirtschaftliche Lage, als der IWF nach Korrupti-<br />
onsvorwürfen - über 400 Mio. US$ sollen für den Export von Gold und Diamanten, obwohl Kenia keinen<br />
Abbau dieser Mineralien betreibt, an Geschäftsleute und Regierungsbeamte geflossen sein - dem Land weitere<br />
Kredite verweigerte. (Fischer 1998) Die Wahlen Ende 1997 wurden von vielen Beobachtern als unfair<br />
beschrieben und die Regierung des wiedergewählten Präsidenten Moi geriet 1998 zunehmend unter Druck.<br />
Im Lehrmittel fährt der Autor auf der Seite 96 mit seiner Beschreibung der <strong>Pro</strong>bleme Kenias fort:<br />
Die Bauern und Hirten brauchen mehr Acker- und Weideland, um die immer grösser werdende Bevölkerung mit<br />
Nahrungsmittel zu versorgen. Am Ende der Trockenzeit brennen die Bauern in den Savannen das Grasland ab. Sie legen<br />
dann Felder an, die sie meistens mit Hirse bestellen.<br />
...Die schnelle Bevölkerungszunahme in Ostafrika, mehr noch aber der Landhunger der Afrikaner, bereiten Fachleuten<br />
wachsende Sorgen. Sie sollen sich um die Erhaltung der Tierbestände des Landes kümmern. Afrikanische Farmer rücken<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 359
jedoch in die Serengeti ein, das berühmteste aller ostafrikanischen Tierreservate, und roden das Land. Man befürchtet, dass<br />
der Lebensraum der wilden Tiere bald erheblich eingeengt wird.<br />
Auch die Hirten brennen das Gras ab, damit beim ersten Regen frisches Gras spriesst. Sie treiben ihre Viehherden in die<br />
Weidegebiete der Wildtiere. Sie nehmen ihnen nicht nur den Platz weg, sie jagen sie auch und halten sich dabei nicht an<br />
die Jagdgesetze. Der Wildreichtum nimmt ab. Einige Tierarten sind schon vom Aussterben bedroht.<br />
In diesem Text, der sich zu einem grossen Teil mit einem Zitat aus dem Lehrmittel "Dreimal um die Erde" von<br />
1977, deckt (siehe dazu die Seite 272 dieser Arbeit), kommt ein Prioritätenkonflikt zwischen der einheimi-<br />
schen Bevölkerung und dem europäischen Wunsch nach dem Erhalt der Wildbestände zum Ausdruck. Der<br />
Autor versäumt es aber, darauf aufmerksam zu machen, dass, auch wenn die Wildbestände "Ostafrikas" von<br />
grossem Wert sind, es sich dabei doch um Tiere handelt, die den Menschen des Gebietes im Weg stehen.<br />
Auf der Seite 70 zitiert der Autor aus dem Buch "Auch Nashörner gehören allen Menschen" von B. Grzimek<br />
aus dem Jahr 1962 (Auch dieser Text wurde bereits in dem oben erwähnten Lehrmittel "Dreimal um die Erde"<br />
zitiert.):<br />
Nicht das Jagen der Eingeborenen an sich ist so gefährlich. Sie haben es schliesslich schon seit Jahrtausenden getan. Aber<br />
jetzt können sie mit Schusswaffen und Drahtschlingen Hunderte umbringen und erhalten viel mehr Fleisch, als sie<br />
verwerten können. Sie tun es, weil ihnen im Schwarzhandel für Elfenbein, Nashorn-Hörner und andere Trophäen hohe<br />
Preise geboten werden. Dass sie für ein Jahr als Wilddiebe ins Gefängnis wandern, wenn man sie erwischt, will ihnen nicht<br />
in den Kopf. Sie sehen ja gleichzeitig weisse Jagdgäste aus Europa und Amerika Elefanten schiessen.<br />
Tatsächlich wurden die Wildbestände Ostafrikas während den sechziger und siebziger Jahren vor allem von<br />
den aus dem Ausland zugereisten Grosswildjägern dezimiert. Erst auf diese Entwicklung hin, waren die Regie-<br />
rungen der betroffenen Länder gezwungen, die Jagd einzuschränken. Ausserdem sind es ja nicht die Schwarz-<br />
afrikaner, die die Beute der Wilddiebe aufkaufen. Unterdessen hat sich die Lage in einigen Länder derart<br />
entschärft, dass wieder laut über eine Nutzung der Wildbestände (z. B. Elfenbein) nachgedacht wird. Im Text<br />
schreibt der Autor zu den Jagdgesetzen (S. 70):<br />
Die Regierung von Kenia hat 1975 jede Jagd auf Elefanten verboten. Vorher wurden jährlich etwa 15'000 Elefanten<br />
getötet. Die Wilderer brachen ihnen die Stosszähne aus und liessen die Körper liegen. Wenn das Töten weitergegangen<br />
wäre, gäbe es schon 1985 keine Elefanten mehr in Kenia.<br />
Zu den Reaktionen der betroffenen Staaten heisst es im Text weiter (S. 70):<br />
Die ostafrikanischen Staaten richteten Wildschutzgebiete (Nationalparks) ein. Sie unterstützen damit die internationale<br />
Forderung nach Naturschutz und Wildschutz...<br />
Obwohl nicht explizit ausgesprochen wird doch klar, dass weniger die afrikanischen Staaten der Ostküste an<br />
einem Erhalt der heimischen Wildtiere interessiert waren, sondern diese Forderungen von aussen an die einzel-<br />
nen Staaten gestellt wurden.<br />
Auf der Seite 71, die auch eine Karte Kenias auf der die Schutzgebiete dargestellt werden, enthält, schreibt der<br />
Autor zum Tourismus in Kenia (auch dieser Text wurde in ähnlicher Form bereits in "Dreimal um die Erde"<br />
wiedergeben):<br />
Geographielehrmittel: Mensch und Raum (1983-1986)<br />
Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für den Staat. Kenia nahm 1980 etwa 300 Mio. DM ein. Die<br />
Safari-Touristen reisen aber meist in Gebiete, in denen wenig Menschen leben. Dort müssen mit hohen Kosten<br />
Einrichtungen für den Fremdenverkehr gebaut werden: Strassen und Flugplätze, Wasser- und Elektrizitätsleitungen, Hotels<br />
und andere Unterkünfte.<br />
Die einheimische Bevölkerung hat nur einen geringen Nutzen vom Fremdenverkehr. Die Ausrüstung für die Safaris, vom<br />
Geländewagen bis zu den Getränken, muss im Ausland gekauft werden. In Kenia verdienen Eingeborene nur als<br />
Wildhüter, Dienstboten und Andenkenverkäufer am Tourismus. Die Bevölkerung hatte 1980 ein durchschnittliches<br />
<strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen von 750 DM im Jahr.<br />
Manche einheimischen Politiker halten die Wildschutzgebiete nur für eine teure Gefälligkeit gegenüber den Weissen. Sie<br />
würden die Nationalparks lieber in Ackerland und Viehweiden umwandeln, das Fleisch der Wildtiere verwerten und<br />
Elfenbein und Leopardenfelle ins Ausland verkaufen.<br />
Kenia und die anderen ostafrikanischen Staaten benötigen mehr Unterstützung von den Vereinten Nationen und von den<br />
reichen Ländern. Nur damit können sie die Wildherden in ihrer Umgebung erhalten und dazu das Einkommen der<br />
Bevölkerung erhöhen. Andernfalls müssten diese Länder die Schutzgebiete aufgeben und sie als Weide- und Ackerland<br />
nutzen.<br />
Hier holt der Autor einige der weiter oben gemachten Versäumnisse nach, indem er zumindest einige Gegenar-<br />
gumente aufführt, doch bleibt auch hier die Sichtweise auf eine europäische beschränkt. Zusätzlich zum<br />
Haupttext enthält die Seite 71 auch die Anzeige einer Fluggesellschaft, welche die Vorzüge Kenias preist und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 360
in der die Kenianer nur als "freundliches und geschultes Personal" erwähnt werden. (Zu Kenia siehe auch die<br />
Seiten 273 und 389, zum Tourismus die Seiten 347 und 390 dieser Arbeit.)<br />
4.34.1.2 Kakao aus Ghana<br />
Im Kapitel "Kakao aus Ghana" schreibt der Autor auf den Seiten 78f., die auch eine Klimatabelle für Kumasi<br />
und ein Foto "Trocknen der Kakaobohnen" abbildet:<br />
...Europäer brachten Kakaopflanzen in das tropische Afrika... In Ghana wird der meiste Kakao in kleinen bäuerlichen<br />
Betrieben angebaut. Die 200'000 selbständigen Kakaobauern besitzen oft weniger als 4 ha Land. Kakao bringt höhere<br />
Preise als Gemüse und Obst. Weitgehend für den eigenen Bedarf erzeugen sie Knollenfrüchte (Maniok, Yams, Taro), Mais,<br />
Mehlbananen und Gemüse. Die Frauen bearbeiten die kleinen Felder (Beete) mit der Hacke. Man kann hier das ganze Jahr<br />
über säen, pflanzen und ernten.<br />
Die Anlage einer Kakao-Pflanzung erfordert sehr viel Mühe. Die Bauern müssen zunächst den dichten Wald roden. Sie<br />
schlagen das Unterholz und Strauchwerk ab und fällen fast alle Bäume. Das trockene Holz wird verbrannt.<br />
Der Kakao ist eine Pflanze aus dem dunklen, unteren Stockwerk des tropischen Waldes. Schattenbäume müssen die<br />
empfindlichen Kakaobäume vor zuviel Sonnenlicht und zu starkem Wind schützen. Deshalb haben die Bauern beim Roden<br />
nicht alle Bäume gefällt. Als weitere Schattenspender pflanzen sie ausserdem noch Mehlbananen an. Das sind hohe<br />
Stauden. Sie liefern ein wichtiges Nahrungsmittel.<br />
Zu Beginn der Regenzeit werden die Kakaosetzlinge gepflanzt. Etwa fünf Jahre dauert es, bis die Kakaosträucher die<br />
ersten Früchte tragen. Während dieser Zeit muss der Bauer die Sträucher häufig beschneiden, ständig das Unkraut<br />
beseitigen und immer darauf achten, dass genügend Schatten vorhanden ist. Ein Kakaostrauch kann etwa 50 Jahre Früchte<br />
tragen. Dann ist der Boden ausgelaugt. Neue Kakaosträucher müssen an anderen Stellen gepflanzt werden. Auf dem<br />
brachliegenden Land wächst wieder Wald.<br />
Im November beginnt im Süden Ghanas die lange Trockenzeit. Sie dauert bis Ende Februar. In diesen Monaten wird hier<br />
der meiste Kakao geerntet. Die Ernte erfordert sehr viele Arbeitskräfte. Die Bauern ziehen mit der ganzen Familie auf die<br />
Felder. Mit einem Haumesser schlagen die Männer die Früchte ab... Frauen und Kinder sammeln sie vom Boden auf und<br />
tragen sie zu einem Sammelplatz ins Dorf. Dort brechen andere Männer die Früchte mit einem Messerschlag auf. Sie<br />
dürfen dabei die Samen im Innern, die Kakaobohnen, nicht beschädigen. Frauen und Mädchen lösen die 30 bis 40 Bohnen<br />
aus dem weichen Fruchtfleisch heraus.<br />
(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seiten 351 und 362 dieser Arbeit.)<br />
Die Kakaobohnen müssen nach der Ernte sorgfältig aufbereitet werden. Sie werden zu kleinen Haufen auf Bananenblätter<br />
geschüttet und mit Bananenblättern zugedeckt. Die Bohnen beginnen zu gären. Das restliche Fruchtfleisch zerfällt, die<br />
Bohnen färben sich braun und entwickeln das Schokoladenaroma. Etwa 6 Tage dauert dieser Vorgang. Nach der Gärung<br />
breitet der Bauer die Bohnen auf langen Gestellen in der Sonne zum Trocknen aus... Mehrfach wendet er sie mit der Hand<br />
oder mit einem hölzernen Rechen, damit alle Bohnen gleichmässig trocknen können. Schliesslich müssen noch alle<br />
schlechten Bohnen, Bruchstücke und Schalen ausgelesen werden. Nun kann der Bauer seine Ernte verkaufen.<br />
Der letzte Abschnitt des Textes findet sich im gleichen Wortlaut schon im Lehrmittel "Dreimal um die Erde"<br />
von 1977-1980 (Bd. 1, S. 95) und wird auf der Seite 274 dieser Arbeit besprochen. (Zum Kakaoanbau siehe<br />
auch die Seiten 342 und 399 dieser Arbeit.) Nebst dem Text enthält die Seite 79 eine Karte Ghanas, in der die<br />
Kakaoanbaugebiete und der tropische Regenwald eingezeichnet sind, eine Tabelle "Ausfuhr von Kakao..." mit<br />
Angaben von 1980 (siehe dazu die Tabelle auf der Seite 552 dieser Arbeit) und ein Foto "Kakaoernte in<br />
Ghana", welches das Abschlagen der Früchte mit dem Haumesser zeigt.<br />
4.34.2 Band 2<br />
Der 1985 erschienene Band für die Klassen 7 und 8 enthält die Kapitel "Ein Arzt für Dreissigtausend: Beispiel<br />
Ruanda" (S. 110), "Ohne Ausbildung keine Chancen: Analphabetentum in Namibia" (S.111), "Ochsengespann<br />
für Kamerun - angepasste Technik" (S.120-121), "Brotfabrik für Nigeria - ein gescheiterter Versuch"<br />
(S.122-123) und "Biogasanlage für Kamerun - umweltschonende Technik" (S.124-125 ), sowie eine Grafik zu<br />
den Hungergebieten der Welt und zwei Fotos "Schlimmes Geschwür" (im Gesicht eines Kindes) und "Säug-<br />
lingsstation in Nigeria", auf dem Kinder in Pappschachteln zu sehen sind, auf den Seiten 96 und 97 im Kapitel<br />
"<strong>Pro</strong>bleme in Entwicklungsländern und Entwicklung durch Zusammenarbeit".<br />
Geographielehrmittel: Mensch und Raum (1983-1986)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 361
4.34.2.1 Ruanda<br />
Im Kapitel "Ein Arzt für Dreissigtausend: Beispiel Ruanda" schreibt der Autor auf der Seite 110, auf der auch<br />
die drei Fotos "Kind mit Verbrennungen" (zeigt angeblich dem im Text erwähnten Miburo), "Wartende Patien-<br />
ten" (etwa 50 Menschen stehen und sitzen vor einem einstöckigen Gebäude) und "Einfachste Mittel auf einer<br />
Krankenstation" abgebildet sind:<br />
Miburo ist ins Herdfeuer gefallen... Das kann leicht geschehen, denn das Essen wird über dem offenen Feuer gekocht. Wer<br />
dort hineinfällt, hat kaum Aussicht auf medizinische Hilfe. Denn Miburo lebt in Ruanda/Ostafrika. Einheimische<br />
Medizinmänner können nur einfache Heilmittel aus Pflanzen und tierischem Material anwenden. Ausserdem nehmen sie<br />
viel Geld. In Ruanda gibt es auch Ärzte, aber ein Arzt ist für 30'000 Einwohner zuständig, die zumeist weit verstreut<br />
wohnen. Miburo muss daher 30 km weit zum Arzt getragen werden. Nachbarn und Verwandte nehmen ihn abwechselnd<br />
auf den Rücken. Vor der Krankenstation warten schon viele andere Patienten... Einen Spezialarzt für Verbrennungen trifft<br />
Miburo auch hier nicht an, dafür muss er in ein grösseres Krankenhaus in der Hauptstadt Kigali gebracht werden. Diese<br />
Möglichkeit hat nicht jeder.<br />
(Zu Verbrennungen durch Herdfeuer siehe auch die Seite 335 dieser Arbeit.) Die flächendeckende Versorgung<br />
der Bevölkerung, und sei es nur mit Basismedizin, bleibt für viele schwarzafrikanische Staaten angesichts der<br />
knappen Finanzmittel ein grosses <strong>Pro</strong>blem. (Siehe dazu auch die Karte "Bruttosozialprodukt pro Kopf" auf der<br />
Seite 569 dieser Arbeit.)<br />
Den 5 Millionen Einwohnern Ruandas... stehen nur drei moderne Krankenhäuser mit je 250 bis 300 Betten zur Verfügung.<br />
In kleineren Krankenhäusern ist die medizinische Hilfe begrenzt: Es fehlt an technischen Apparaturen wie z. B. teuren<br />
Röntgen- und Narkosegeräten. Für die Ernährung und Pflege der Kranken sind Verwandte oder Nachbarn zuständig. So<br />
müssen in einem Raum mit 14 Kranken zusätzlich noch 14 Angehörige schlafen.<br />
Diese "Auslagerung" der Pflege ist in vielen afrikanischen Spitälern üblich. Einige Spitäler weisen Patienten,<br />
die nicht in Begleitung kommen, aus diesen Gründen zurück.<br />
Ärzte in Ruanda wie auch in vielen anderen Entwicklungsländern, die in den Tropen liegen, müssen sich besonders gut in<br />
Tropenkrankheiten auskennen: z. B. bei Malaria, Gelbfieber und Bilharziose. Häufig steht kein hygienisch einwandfreies<br />
Wasser zur Verfügung. Mit dem Essen gelangen Wurmeier in den Magen, wo sich Spul- und Bandwürmer entwickeln. Das<br />
warme tropische Klima beschleunigt Entzündungen. Geschwüre verschlimmern sich rasch.<br />
(Zu den tropischen Krankheiten siehe auch die Seiten 132 (Malaria), 145 (Schlafkrankheit) und 232 (Lepra),<br />
zu Ruanda die Seiten 289 und 371 dieser Arbeit.)<br />
4.34.2.2 Namibia<br />
Im Kapitel "Ohne Ausbildung keine Chance: Analphabetentum in Namibia" schreibt der Autor auf der<br />
Seite 111 einleitend:<br />
Keine Montageanleitungen lesen können, keine Messungen durchführen können, das bedeutet: kaum Chancen haben, eine<br />
Arbeit zu finden, die über einfache Handlangerdienste hinausreicht. So ergeht es der Hälfte aller in Entwicklungsländern<br />
lebenden Menschen über 15 Jahren. Sie werden Analphabeten (Nichtalphabeten) genannt. Es fehle oft Schulen,<br />
Schulbücher und ausgebildete Lehrer. Die Kinder verstehen zumeist die Amtssprache nicht, in der in der Schule<br />
unterrichtet wird. Weite Schulwege und Mithilfe bei der Feldarbeit verhindern häufig einen Schulbesuch.<br />
(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seiten 361 und 383, zum Analphabetismus die Karte "Analphabetisierungsra-<br />
te für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite 571 dieser Arbeit.) Anschliessend folgt ein Text<br />
nach Mira Lobes "Keine Schule für Sara" aus dem Buch "Ich verstehe die Trommeln nicht mehr" von 1983, in<br />
dem es heisst:<br />
Geographielehrmittel: Mensch und Raum (1983-1986)<br />
Sara und Elisabeth leben in einem Internat. Sie sind gleich alt, gehen aber in verschiedene Schulen. Elisabeth ist ein<br />
Mischling und geht in eine Mischlingsschule. Sara ist eine Nama und geht in eine Namaschule. "In Elisabeths Schule<br />
lernen sie andere Sachen als bei uns", ruft Sara. "Schwerere als wir. Die glauben wohl, wir sind zu dumm dafür, weil wir<br />
schwarz sind? Aber ich bin nicht zu dumm! Elisa hat mir ein paar Aufgaben erklärt, und ich habe sie gleich verstanden.<br />
Stimmt's?" Elisabeth nickt. - Vom Farmhaus drüben, wo der Baas, der Herr, wohnt, läuft eine Schwarze zu den Hütten<br />
hinüber. Der zweijährige Samuel sitzt unter dem Schattendach vor der Hütte und weint. Mirjam möchte mit dem Baby<br />
spielen, aber die Mutter schickt sie auf das Weideland hinaus. Die zwei Ziegen müssen zur Tränke geführt werden -<br />
Mirjam geht, sie ist verständig für ihre vier Jahre<br />
Die Eltern sitzen vor der Hütte. "Der Baas hat mich rufen lassen", beginnt der Vater. "Weil du so oft von der Arbeit aus der<br />
Küche der Herrin wegläufst." - "Hast du ihm nicht gesagt, dass ich nach den Kindern sehen muss und dann doppelt so<br />
schnell arbeite, damit ich die Zeit einbringe?" fragt die Mutter. - "Ich habe es ihm gesagt. Aber der Baas sagt: Im Vertrag<br />
steht, dass du acht Stunden im Haus zu sein hast, aber du bist oft nur sechs Stunden da. Wenn wir uns nicht an den Vertrag<br />
halten, dann hält er sich auch nicht daran. Dann müssen wir gehen. 'Du hast doch eine grössere Tochter', hat er gesagt. 'Ihr<br />
habt sie in die Schule geschickt. Hol sie heim. Sie soll auf die jüngeren Kinder aufpassen.'" - "Sara?" sagt die Mutter. "Sie<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 362
lernt gut. Man kann sie von dort nicht wegnehmen." - "Doch. Man kann - sagt der Baas. Es gibt kein Gesetz, dass Sara in<br />
die Schule gehen muss. Auch wenn sie einen Freiplatz im Heim hat. Das Gesetz gilt nur für Weisse." - Der Vater nickt. Der<br />
Baas hatte gesagt: Sara ist nur ein Mädchen. "Nächste Woche hole ich sie heim. Es ist wichtig, dass wir unsere Arbeit<br />
behalten, unsere Hütte, unser Leben hier."<br />
Sara weint, als sie hört, dass sie nicht weiterlernen und Lehrerin werden darf, wie sie es sich gewünscht hat.<br />
In diesem Text werden die schwarzen Menschen als hilflose und bemitleidenswerte Kreaturen geschildert. Die<br />
Eltern werden von ihrem Arbeitgeber dazu gezwungen, den Traum ihres Kindes, später einmal einen Lehrbe-<br />
ruf zu ergreifen, zu zerstören. Wer sich hinter dem "bösen" Baas versteckt, wird aus dem Text nicht klar.<br />
Schlussendlich bleibt den Lesern des Textes nur das Mitleid mit Sarah. Da aber die Situation vom politischen<br />
Umfeld losgelöst geschildert wird, können sie schlussendlich nichts zu der Verbesserung dieser beitragen. So<br />
geschieht ihnen gleich, wie den im Text geschilderten Personen. Die Leser sind einem Schicksal ausgeliefert,<br />
an dem sie nichts ändern können. (Zu Namibia siehe auch die Seite 227 dieser Arbeit.)<br />
Wesentlich sachlicher schildert die abgedruckte Tabelle "Landwirtschaftliche Arbeit und erforderliche Schul-<br />
kenntnisse" nach Heyneman, die hier wiedergeben wird, den Zusammenhang zwischen Zukunftsaussichten<br />
und Schulbildung:<br />
Stufen Landwirtschaftliche Arbeit Mindestmass an Schulkenntnissen<br />
A Verwendung der örtlichen Pflanzensorten<br />
und Geräte<br />
B Verwendung kleiner Mengen von<br />
Düngemitteln<br />
C Verwendung von Pflanzensorten mit hohen<br />
Erträgen, Berechnen der Düngemittel/ha,<br />
des Saatertrages/ha<br />
D Wie Stufe C, dazu Bewässerung, Berechnen<br />
der Wasserzufuhr bei Niederschlag und bei<br />
Bewässerung, entsprechend abgestimmter<br />
Anbau<br />
Kenntnisse von Eltern an Kind weitergegeben:<br />
Addition und Subtraktion<br />
Addition, Subtraktion, Division, Grundkenntnisse im<br />
Lesen<br />
Multiplikation, Bruchrechnung, Lesen, Schreiben,<br />
Kenntnisse in Chemie, Biologie<br />
Mathematik, hohes Leseverständnis, Fähigkeit zum<br />
Erforschen nicht vertrauter Wörter und Pläne, Kenntnisse<br />
in Chemie, Biologie, Physik<br />
Diese Tabelle muss sich allerdings die Frage stellen lassen, ob diese Kenntnisse nicht auch ausserhalb der<br />
Schule erworben werden könnten. Schliesslich gibt es genügend Beispiele in Schwarzafrika, so beispielsweise<br />
die "Fitter" in Ghana, die Autos reparieren (Geo 8/1986, S. 36-50), und auch im mittelalterlichen Europa,<br />
beispielsweise beim Kathedralenbau, bei denen Höchstleistungen vollbracht wurden, ohne dass diese wirklich<br />
auf einer schriftlichen Tradition oder "höheren" Mathematik beruhten<br />
4.34.2.3 Kamerun<br />
Im Kapitel "Ochsengespann für Kamerun - angepasste Technik" schildert der Autor das Leben einer Bäuerin in<br />
der Subsistenzwirtschaft (S. 120):<br />
Geographielehrmittel: Mensch und Raum (1983-1986)<br />
Ihr jüngstes Kind auf dem Rücken festgebunden, arbeitet Tia Samoko auf einem Feld am Rande ihres Dorfes. Es liegt nur<br />
wenige Kilometer nördlich der Stadt Duala. Mit einer schweren Hacke, ihrem einzigen Arbeitsgerät, lockert sie den Boden<br />
auf. Hier will sie Jams und Maniok anbauen. Beide Knollenfrüchte bilden die Hauptnahrung der Familie.<br />
Noch vor Wochen wuchs auf diesem Feld Gras. Tia hat es abgeschlagen und zu Haufen zusammengetragen. Dann hat sie<br />
die Grashaufen mit Erdschollen abgedeckt und angezündet. Die so gewonnene Asche kann sie als Dünger nutzen.<br />
Die Felder, die Tia Samoko allein bestellt, gehören der Dorfgemeinschaft. Jeder Frau steht soviel Land zu, wie sie<br />
bearbeiten kann. Tias Felder sind etwa 1/2 ha gross. Hier baut sie alles für die Versorgung ihrer fünfköpfigen Familie an.<br />
Nur gelegentlich kann sie kleine Überschüsse erzielen, die sie auf dem nahegelegenen Markt verkauft. Von dem so<br />
erwirtschafteten Geld kauft sie die lebensnotwendigen Dinge wie Öl, Medikamente oder Kerosin (Brennstoff für die<br />
Lampe).<br />
Wenn nach zwei Jahren die Ernteerträge stark nachlassen, lässt Tia Samoko die Felder brachliegen und legt neue an.<br />
Manchmal hilft dabei ihr Mann, der ansonsten auf einer Plantage an der Küste arbeitet. Tia Samoko gehört dem<br />
Volksstamm der Bantus an. Sie sind Hackbauern und betreiben Landwechselwirtschaft.<br />
Mit diesem Text gehört das vorliegende Lehrmittel zu den wenigen, die ein Stück der Lebensrealität der<br />
schwarzafrikanischen Frauen schildern und deren Arbeitsleistung würdigen. Nach dem einführenden Text über<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 363
Tia Samoko beschreibt der Autor auf der Seite 120, die auch ein Foto "Auf einer landwirtschaftlichen<br />
Versuchsstation in Kamerun" abdruckt, die allgemeine Lage:<br />
Acht von zehn Kamerunern arbeiten in der Landwirtschaft. Die meisten produzieren wie Tia Samoko fast ausschliesslich<br />
für die Eigenversorgung (Subsistenzwirtschaft). In manchen Jahren ist jedoch die Versorgung gefährdet, da Überschüsse<br />
fehlen. Dann müssen aus anderen Ländern Grundnahrungsmittel eingeführt werden.<br />
Da diese Einfuhren teuer sind, bemüht man sich in Kamerun darum, die eigene Nahrungsmittelerzeugung zu steigern.<br />
Dabei treten jedoch besondere Schwierigkeiten auf. Die bislang bewirtschafteten Ackerflächen könnten zwar stärker<br />
gedüngt werden, doch fehlt dazu das Geld. Auch eine Ausdehnung der Ackerflächen ist kaum möglich, solange der Boden<br />
weiter mit der Handhacke bearbeitet wird, denn die Frauen schaffen meist nicht mehr als einen Hektar.<br />
Diese Beschränkung der Anbaufläche durch die vorhandene Arbeitskraft ist mit ein Grund für den Wunsch<br />
nach vielen Kindern, der nach wie vor ein zentraler Wert vieler schwarzafrikanischer Frauen darstellt. Je mehr<br />
Mitglieder eine Familie umfasst, desto mehr Land kann sie, zumindest theoretisch, bewirtschaften. Dadurch<br />
wird das Risiko eines für den einzelnen katastrophalen <strong>Pro</strong>duktionsausfalles verteilt und damit minimiert.<br />
Kinder bedeuten also zumindest in der traditionellen Lebensweise, die auf Landwirtschaft beruht, tatsächlich<br />
eine Versicherung für schlechte Zeiten und das Alter. Die Seite 121 bildet ein Foto "Ochsengespann mit Pflug"<br />
ab. Im Text schreibt der Autor weiter:<br />
Ausländische Fachleute sollen helfen, die Nahrungsmittelproduktion zu steigern. Einer dieser Helfer ist die Deutsche<br />
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland berät die GTZ die<br />
kamerunische Regierung und führt ein Entwicklungshilfeprojekt durch. Der von der GTZ entsandte Entwicklungshelfer<br />
denkt zunächst daran, einen Traktor einzuführen. Ein solcher Traktor würde etwa 50'000 DM kosten.<br />
Wie viele andere Stämme in Afrika kennen auch die Bantus nicht die Haltung von Grossvieh, sondern nur den Ackerbau.<br />
Ein Fortschritt ist es daher bereits für sie, wenn sie lernen, Ochsen als Zugtiere zu benutzen. Damit verbunden wäre die<br />
Einführung eines Eisenpfluges möglich.<br />
Seit 1977 bildet die GTZ jährlich 20 Bauern in einjährigen Kursen aus. Sie lernen, mit einem Ochsengespann umzugehen<br />
und neue Geräte wie Mehrzweckpflug, Egge und Einradhacke zu bedienen. Während ihrer Ausbildung erlernen die Bauern<br />
auch den Anbau neuer <strong>Pro</strong>dukte. So bauen Sie Mais zur Eigenversorgung und Erdnuss und Reis als Verkaufsfrüchte an.<br />
Nach der einjährigen Ausbildung können die Bauern ein Ochsengespann und die für die Bearbeitung des Bodens<br />
erforderlichen Maschinen für rund 1'500 DM erwerben. Dazu erhalten sie günstige Kredite. Meist werden sie in solchen<br />
Gebieten angesiedelt, die nicht ackerbaulich genutzt waren, weil sie verkehrsmässig ungünstig lagen oder nicht<br />
regelmässig Niederschlag erhielten. Die neuen Betriebe sind 2 bis 5 ha gross. Seit 1978 werden zusätzlich in Kurzkursen<br />
jährlich 60 Bauern ausgebildet. Auch sie erhalten Ackerflächen.<br />
Die Einführung des Ochsengespannes bringt jedoch auch <strong>Pro</strong>bleme mit sich, denn neue Ackerflächen müssen erschlossen<br />
werden. Dies geschieht vor allem im Nordwesten von Kamerun, weil dieses Gebiet bisher ackerbaulich kaum genutzt<br />
worden ist. Hier aber leben die Fulani. Sie sind Hirten und benötigen die Flächen für ihr Vieh. Durch die Ausweitung der<br />
Ackerflächen wird ihr Lebensraum eingeengt.<br />
Ein weiteres Kapitel aus dem gleichen Lehrmittel zu Kamerun wird weiter unten in dieser Arbeit besprochen.<br />
(Zum Ochsenpflug siehe auch die Seite 333 dieser Arbeit.)<br />
4.34.2.4 "Brotfabrik für Nigeria"<br />
Das Kapitel "Brotfabrik für Nigeria - ein gescheiterter Versuch" greift die <strong>Pro</strong>blematik der Entwicklungshilfe<br />
mittels eines Vergleichs der Situation Nigerias 1964 und 1984 noch einmal auf. Die Situation 1964 beschreibt<br />
die Arbeit eines kleinen Bäckers, die von 1984 die Arbeit in einer Brotfabrik und deren Auswirkungen. Auf<br />
der Seite 122, auf der ein Foto "Brotfabrik in Nigeria" zu sehen ist, schreibt der Autor unter der Überschrift<br />
"Nigeria, im März 1964":<br />
Geographielehrmittel: Mensch und Raum (1983-1986)<br />
Nahe der Hauptstrasse liegt die kleine Bäckerei des Herrn Nkomo. Seit den frühen Morgenstunden wird dort bereits<br />
gearbeitet. Während das Thermometer draussen schon 27°C zeigt, liegen die Temperaturen in der Backstube noch um<br />
einiges höher. Dazu trägt der aus Bruchsteinen gemauerte Backofen bei, der den ganzen hinteren Teil des Raumes<br />
einnimmt. Seit zwei Stunden brennt bereits das Feuer im Ofen. Es dauert seine Zeit, bis die zum Backen erforderliche<br />
Temperatur erreicht ist. Wie überall in Nigeria feuert auch Herr Nkomo mit Holzkohle.<br />
An der Stirnseite des Raumes befindet sich ein langer hölzerner Tisch, auf dem verschiedene grosse Schüsseln stehen. Herr<br />
Nkomo ist mit seinem Sohn dabei, den Teig darin anzurühren. Die drei Hilfskräfte kneten den Teig gründlich durch. Der<br />
Schweiss läuft ihnen von der Stirne, so anstrengend ist diese Arbeit. Es dauert eine ganze Zeit, bis der Teig backfertig ist.<br />
Einzeln werden die handgeformten Laibe in den Ofen geschoben, die fertigen mit der langen Holzschaufel herausgeholt<br />
und zum Auskühlen in Regale gepackt. Manches Brot ist zu stark gebacken oder sogar verbrannt. Deshalb muss es<br />
aussortiert werden. Das geschieht häufig, denn es ist schwierig, die richtige Backtemperatur einzuhalten. Ein Teil der Brote<br />
wird bereits in der Backstube verkauft. Die übrigen werden in Weidenkörbe verpackt, auf Handkarren oder Fahrräder<br />
verladen und zu den Kleinverkäufern in andere Teile der Stadt gebracht. Jeder dieser Laibe wiegt 400 g. Damit wird der<br />
tägliche Brotbedarf von zwei Menschen gedeckt.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 364
Tag für Tag werden in der Bäckerei von Herrn Nkomo 400 Brote gebacken. Eine grössere Anzahl schafft er mit seiner<br />
Belegschaft von fünf Personen nicht. Wenn er dennoch mehr Brote backen will, muss er zusätzliche Hilfskräfte einstellen.<br />
In mehr als 100 weiteren Bäckereien wird so das Brot gebacken, wie es Herr Nkomo tut. Täglich werden so 50'000 Brote<br />
hergestellt. Damit können alle Einwohner der Stadt versorgt werden.<br />
Alle Materialien, die die Betriebe benötigen, werden von Händlern aus der Stadt geliefert. So verdienen auch der Müller,<br />
Holzkohlenhändler, Weidenkorbflechter und Kleinverkäufer ihren Lebensunterhalt durch die Bäckereien.<br />
Seite 123 zeigt eine Grafik "Herstellungs- und Verkaufspreis eines Brotes", deren Aussagen lauten, dass die<br />
<strong>Pro</strong>duktion eines Brotlaibes in der Brotfabrik erstens teuer als in der Bäckerei zu stehen kommt, und zweitens<br />
in der Brotfabrik nicht kostendeckend produziert wird. Die zweite Grafik "Auswirkungen der Brotfabrik" sagt<br />
aus, dass durch den Bau der Brotfabrik die Zahl der in diesem Bereich tätigen Bäcker von 625 auf 60 gesunken<br />
ist und die einheimischen Zulieferungen zumeist durch ausländische ersetzt wurden. Im Text schreibt der<br />
Autor dazu unter der Überschrift "Nigeria, im März 1984":<br />
In den letzten Jahren hat sich vieles in der Stadt verändert. Am Rande der Stadt gibt es jetzt eine moderne Brotfabrik. Sie ist<br />
von europäischen Fachleuten geplant und gebaut worden. Die hochmodernen Maschinen der Backstrasse sind mit dem<br />
Flugzeug aus Europa eingeflogen worden. Mehr als 50'000 Brote können täglich produziert werden. Dazu sind insgesamt<br />
60 Angestellte nötig.<br />
Der Bau der Fabrik hat insgesamt 1.4 Mio. Dollar gekostet. Der grösste Teil dieser Summe ist mit<br />
Entwicklungshilfegeldern aus Europa gezahlt worden. Für die Anschaffung von Lieferwagen und die Einrichtung von<br />
Verkaufsläden musste Nigeria selbst aufkommen.<br />
Die kleine Bäckerei des Herrn Nkomo existiert nicht mehr. Wie die meisten anderen Bäckereien ist auch sie durch die<br />
Brotfabrik verdrängt worden. Herr Nkomo hat seine Arbeitskräfte entlassen müssen und ist auch selbst arbeitslos. Es<br />
besteht für ihn kaum Hoffnung auf Arbeit, denn an Arbeitsplätzen fehlt es hier.<br />
Viele seiner ehemaligen Zulieferer sind ebenfalls ein Opfer der Brotfabrik geworden. So kann der Müller sein Mehl nicht<br />
mehr liefern, da es nicht fein genug gemahlen ist. Deshalb wird Mehl aus Europa eingeführt. Auch Holzkohle und<br />
Weidenkörbe werden nicht mehr gebraucht. In der Fabrik werden an ihrer Stelle Öl und Einwickelpapier verwendet.<br />
Die Seiten zur Brotfabrik in Nigeria schildern eindrücklich die Folgen einer nicht durchdachten und nicht<br />
angepassten Entwicklungshilfe, die zwar Arbeitsplätze in den Geberländern schafft, sich aber meist nachteilig<br />
auf die Empfänger auswirkt. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 349 und 397 dieser Arbeit.) Sicher<br />
kein Zufalls ist, dass gerade Nigeria als Beispiel genannt wurde, denn durch den Ölboom der achtziger Jahre<br />
verfügte das Land plötzlich über Kapital, welches zu unreflektierten Ausgaben geradezu einlud. Umso tragi-<br />
scher ist, dass sich das Land dabei verschuldete, und die Schuld von den Teilen der Bevölkerung mitgetragen<br />
werden muss, die dafür nie eine Gegenleistung erhielten. (Zu Nigeria siehe auch die Seiten 335 und 373 dieser<br />
Arbeit.)<br />
4.34.2.5 "Biogasanlage für Kamerun"<br />
Im letzten Kapitel zum Thema Afrika unter dem Titel "Biogasanlage für Kamerun - umweltschonenden Tech-<br />
nik" schreibt der Autor auf der Seite 124, wie schon in den vorigen Kapiteln den Lebensalltag einer Person<br />
schildernd:<br />
Seit den frühen Morgenstunden ist Niara Mokele unterwegs. Sie sammelt Zweige und Äste vom Boden auf oder bricht sie<br />
von den Bäumen. Sie verschnürt ihr Sammelgut zu einem Bündel, das sie auf dem Kopf transportiert. Niara Mokele<br />
sammelt das Feuerholz, das sie für die Zubereitung der täglichen Mahlzeiten benötigt.<br />
Unter der sengenden Mittagssonne wird die schwere Last immer drückender, und noch liegt der kilometerweite Rückweg<br />
vor ihr. Soll sie schon jetzt umkehren? Der gesammelte Vorrat reicht nicht aus. Zu bald muss sie sonst den weiten Weg<br />
erneut auf sich nehmen.<br />
Früher ist ihr Leben viel einfacher gewesen. Für die wenigen Familien des Dorfes gab es ausreichend Holz in der Nähe.<br />
Doch seit damals hat sich manches im Dorf verändert. Viele junge Leute leben nicht mehr in der Grossfamilie, sondern<br />
haben sich eigene Hütten gebaut. Dadurch ist die Anzahl der Feuerstellen angewachsen.<br />
Manchmal hat Niara Mokele die Gelegenheit genutzt, Brennholz zu kaufen. Einmal in der Woche kommt ein Verkäufer ins<br />
Dorf. Doch dafür reicht ihr Geld nicht mehr. Der Verkäufer muss das Holz mit seinem Eselskarren aus immer entfernteren<br />
Gebieten holen. So steigen ständig die Preise.<br />
Die anhand einer Einzelperson geschilderte <strong>Pro</strong>blematik wird anschliessend im grösseren Zusammenhang<br />
betrachtet (S. 124):<br />
Geographielehrmittel: Mensch und Raum (1983-1986)<br />
Neun von zehn Afrikanern sind in einer ähnlichen Situation wie Niara Mokele. Auch für sie ist Holz die einzige<br />
Energiequelle zum Kochen und Heizen. Afrikaner, die in den Städten leben, müssen heute bereits mehr als ein Drittel ihres<br />
Monatslohnes für den Holzkauf ausgeben.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 365
Diese Aussage ist deshalb heikel, weil sie zwei gegebene Tatsachen vermischt. Es ist zwar richtig, dass ein<br />
Grossteil der Menschen nur Holz oder Holzkohle zum Kochen verwendet, das Heizen ist aber in vielen<br />
Ländern weit weniger von Bedeutung. Die Aussage, vor allem die Bewohner gewisser Städte litten unter den<br />
hohen Preisen für Holz, trifft für die meisten Länder Schwarzafrikas zu. Durch die Verknüpfung entsteht aber<br />
der Eindruck, fast alle Afrikaner seien von der Holzknappheit betroffen, obwohl nur ca. 20% aller Afrikaner in<br />
Städten oder stadtähnlichen Ansiedlungen leben. Auch auf dem Land kann Holzknappheit zu einem <strong>Pro</strong>blem<br />
werden, dies ist in der Regel aber weit weniger der Fall als in der Stadt. Trotz der anscheinend so prekären<br />
Lage hat der Autor noch eine Hoffnung (S. 124):<br />
Vielleicht kann die Verwendung neuer Energiequellen die rasche Landschaftszerstörung bremsen. Seit 1979 baut die GTZ<br />
deshalb an verschiedenen Orten in Kamerun Biogasanlagen. Biogas soll Holz als Brennmaterial ersetzen.<br />
Die Seite 124 zeigt eine Karte "Holzversorgungsgebiet von Maroua / Nordkamerun (nach Sale)" auf der die<br />
sich im Laufe der Jahre immer weiter ausdehnenden Hauptversorgungsgebiete für Holz eingezeichnet sind.<br />
Seite 125 zeigt eine Zeichnung "Schnitt durch eine Biogas-Anlage" und drei Fotos "Bau des Faulraumes",<br />
"Umrühren der Faulmasse" und "Abzapfen des Biogases". Im Text schreibt der Autor:<br />
Für den Bau der Anlage werden Materialien verwendet, die man vor Ort vorfindet. Nur die Gasglocke wird aus<br />
importierten Eisenblech gefertigt. Täglich müssen menschliche, tierische und pflanzliche Abfälle in die Anlage eingefüllt<br />
und mit Flüssigkeit vermischt werden. Durch Gärung entsteht Biogas. Nach vierzehn Tagen kann man Biogas, nach 40<br />
Tagen Faulschlamm entnehmen.<br />
Aus einem Bericht der GTZ von 1981 zitiert der Autor, die bereits gemachten Aussagen präzisierend:<br />
Wie Biogas genutzt werden kann, zeigt das folgende Beispiel eines Bauern, der seine Anlage mit dem Mist von 50<br />
Schweinen betreibt: "Mit dem Gas werden alle warmen Mahlzeiten von sechs Familienmitgliedern, vier Farmarbeitern und<br />
des Nachtwächters zubereitet; zusätzlich werden die Wärmelampen für die Eintagsküken des Hofes mit Energie versorgt.<br />
Den aus der Biogas-Anlage anfallenden Faulschlamm, der zuvor als normaler Mist praktisch unverwertbar war, verkauft<br />
der Bauer mittlerweile als gefragte Dünger auf dem Markt."<br />
Abschliessend schreibt der Autor zum geschilderten Biogas-<strong>Pro</strong>jekt auf der Seite 125:<br />
Die Haltung von zehn Schweinen oder 175 Hühnern reicht für den täglichen Energiebedarf einer zehnköpfigen Familie<br />
aus. Biogasanlagen stehen überwiegend bei grösseren Tierhaltern oder Krankenhäusern. Für Kleinbauern sind sie zu teuer.<br />
Hier bietet sich der Baum von Gemeinschaftsanlagen an.<br />
Mit dem Bericht über die Biogasanlagen in Kamerun schliesst der Autor seine Darstellung Schwarzafrikas ab.<br />
4.34.3 Zusammenfassung<br />
Während sich der erste Band des Lehrmittels anhand von Texten, die bereits in älteren Lehrmitteln auftauch-<br />
ten, mit den Wildbeständen Ostafrikas beschäftigt, wobei die Bevölkerung als eine Bedrohung für die Wildtie-<br />
re dieses Grossraums angesprochen werden, sowie einen Text über einen Kakaobauern in Ghana enthält, schil-<br />
dert der Band 2 mit Hilfe von Momentaufnahmen im Leben von Einzelpersonen die Lage in den Ländern<br />
Ruanda, Namibia, Kamerun und Nigeria.<br />
Aus diesen Texten ist zu entnehmen, dass die medizinische Versorgung mangelhaft ist, und die Bevölkerung<br />
an vielfältigen Krankheiten leidet (Ruanda), den schwarzafrikanischen Kindern der Schulbesuch von den<br />
Weissen verweigert wird (Namibia), eine Entwicklung im Agrarsektor mit Hilfe von aussen möglich, wenn<br />
auch nicht immer unproblematisch ist (Kamerun) und eine Entwicklung in Richtung Industrialisierung für alle<br />
Betroffenen nachteilige Folgen hat (Nigeria).<br />
Obwohl der Autor die vorgestellten Personen beim Namen nennt, darunter sind auch die Schicksale zweier<br />
Frauen (Kamerun) und eines Mädchens (Namibia), wird doch der Eindruck eines zwar fleissigen, aber wegen<br />
mangelnder Infrastruktur schlussendlich fremdbestimmten Menschenschlages gezeichnet, der sich der herr-<br />
schenden Zustände nicht erwehren kann.<br />
Geographielehrmittel: Mensch und Raum (1983-1986)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 366
4.35 Terra Erdkunde - Hauptschule (1985-1987)<br />
Das dreibändige Lehrmittel "Terra Erdkunde" für die Hauptschulklassen 7-8 in Baden-Württemberg enthält im<br />
Bezug auf das gleichnamige Lehrmittel für die Realschulen keine neuen Themen, allerdings wurden die Kapi-<br />
tel teilweise verschoben. Insgesamt beschäftigt sich das 310 Seiten starke Lehrmittel auf 9 Seiten mit<br />
Schwarzafrika, wobei nur der Band 2 für die 8. Klasse sich überhaupt mit Schwarzafrika beschäftigt.<br />
4.35.1 Band 2<br />
Der Abschnitt "Natur und Mensch in den Wüsten und Savannen" (S. 4-30) enthält die für diese Arbeit wichti-<br />
gen Kapitel "In den Savannen Afrikas" auf den Seiten 22-23 (siehe dazu die Seite 351 in dieser Arbeit zu Terra<br />
Erdkunde: Realschule 7, S. 106-107), "Ackerbau und Viehhaltung in den Savannenzonen" auf den Seiten<br />
24-25 (siehe dazu die Seite 351 in dieser Arbeit zu Terra Erdkunde: Realschule 7, S. 108-109) und "Die Sahel-<br />
zone - ein gefährdeter Lebensraum" auf den Seiten 26-29 (siehe dazu die Seite 352 dieser Arbeit zu Terra<br />
Erdkunde: Realschule 7, S. 110-115). Zusätzlich enthält der Band im Abschnitt "Entwicklungsländer und<br />
Industrieländer" das Kapitel "Der Hungergürtel der Erde" auf der Seite 96 (siehe dazu die Seiten 355 in dieser<br />
Arbeit zu Terra Erdkunde: Realschule 9, S. 10-11).<br />
4.35.2 Zusammenfassung<br />
Obwohl später publiziert als "Terra Erdkunde für Realschulen" enthält das vorliegende Lehrmittel keine neuen<br />
Aspekte gegenüber den genanntem. (Siehe auch die Zusammenfassung für das Lehrmittel "Terra Erdkunde für<br />
Realschulen" auf der Seite 356 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Terra Erdkunde - Hauptschule (1985-1987)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 367
4.36 Seydlitz: Mensch und Raum (1987)<br />
Kanos Altstadt, Hauptwohnbereich der alteingesessenen Bevölkerung, vermittelt noch immer den Eindruck des<br />
vorkolonialen afrikanischen Stadttyps. Ein 18 km langer und etwa 10 m hoher Erdwall umschliesst nicht nur die Altstadt,<br />
sondern auch einen Teil des stadtnahen Agrarlandes. Mittelpunkt der Altstadt ist der grosse Markt, auf den alle Strassen<br />
strahlenförmig zulaufen. Das Stadtbild der Altstadt ist gekennzeichnet durch eine unregelmässige Anlage von meist<br />
quadratischen ein- und zweistöckigen Lehmbauten mit Innenhof. (S. 284)<br />
Der 352 Seiten umfassende Band für die Gymnasiale Oberstufe des Lehrmittels "Mensch und Raum" enthält<br />
die Kapitel "Afrika" (S.130-135), "Ein Entwicklungsprojekt in Ruanda" (S. 170-171), "Die Westafrikanische<br />
Stadt" (S. 284-286), "Rohstoffländer - Beispiel Sambia" (S. 298-299) und "Agrarländer - Beispiel Malawi"<br />
(S. 302-303).<br />
4.36.1 Geschichte<br />
Im Kapitel "Afrika" schreibt der Autor unter der Überschrift "Geschichtsloser Kontinent?" auf der Seite 130:<br />
Das mittelalterliche Mali-Reich war von Beginn an eine Negergründung. Sein bedeutendster Herrscher, Mansa Musa,<br />
stellte auf seiner Pilgerreise nach Mekka den Glanz und Reichtum seines Reiches zur Schau. Sein Pilgerweg führte ihn<br />
1324 über Kairo, wo er durch prachtvolle Hofhaltung und reichliche Almosen den Goldpreis zum Verfall brachte, wie der<br />
ägyptische Beamte Al Omari noch um 1435 wusste und für die Nachwelt aufzeichnete.<br />
Wirtschaftliche Grundlage der sudanesischen Reiche war der Handel mit Salz, Gold, Elfenbein, Sklaven und Gewürzen.<br />
Knotenpunkte der alten Handelsstrassen waren vor allem die Städte Timbuktu und Gao am Niger. Das Songhai-Reich<br />
erreichte im 16. Jh. die grösste Blüte. "Es ist wunderbar zu sehen, welch ein Reichtum von Waren täglich dort hingebracht<br />
wird und wie kostbar und herrlich all diese Dinge sind", berichtet Leo Afrikanus in seinem 1563 erstmals veröffentlichten<br />
Werk.<br />
(Zu ausführlicheren Berichten Leo Africanus siehe auch die Seiten 28 und 38 dieser Arbeit.)<br />
Ein Expeditionsheer des Sultans von Marrakesch, das bereits über Feuerwaffen verfügte, überwältigte das grosse<br />
Songhaiheer und eroberte 1591 Timbuktu und Gao. Die Eroberer brachten allein 30 Kamelladungen Gold mit zurück, wie<br />
der englische Kaufmann Thomson bei der Ankunft einer Karawane beobachtete und am 4.7.1599 notierte. Der Sultan zog<br />
sich 1618 aus Songhai zurück, aber Handel und staatliche Organisation blieben zerstört. "Von dem Augenblick", so die<br />
Chronik des englischen Kaufmanns, "änderte sich alles. Gefahr trat an die Stelle der Sicherheit, Armut an Stelle von<br />
Reichtum. Auf Frieden folgten Notstand, Katastrophen und Gewalt."<br />
Die Portugiesen stiessen, als sie Ende des 15. Jh. in den Indischen Ozean vordrangen, auf reiche Handelsstädte an der<br />
ostafrikanischen Küste. Der Indische Ozean bildete mit Ostafrika, Arabien und Indien eine arabisch geprägte blühende<br />
Handelsregion.<br />
Die Handelsstädte der Küste standen sicher in engem Kontakt mit den Reichen von Simbabwe und Mapungubwe, die im<br />
Binnenland die begehrten Metalle Eisen, Gold, Zinn und Kupfer förderten, schmolzen und bearbeiteten. Im Hinterland von<br />
Sofala findet man zahlreiche, z. T. eindrucksvolle Ruinen, Tausende von ausgebeuteten Minen und Schlackenfelder der<br />
Eisenverhüttung sowie Reste grosser Terrassenkulturen und Bewässerungskanäle, alles Zeugen langer und vielfältiger<br />
Kulturepochen. Den Portugiesen wurde im 16. Jh. von einem mächtigen Bantu-Königreich berichtet, über das der<br />
Monomotapa, der Herr der Minen, herrschte.<br />
Die im Text erwähnte Ruinenstätte, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, wurden wahrscheinlich im 3.<br />
Jahrhundert n. Chr. angelegt. Von den steinernen Ruinen in Zentralsimbabwe, die gewaltige Mauern aufwei-<br />
sen, stammt auch der Name des Landes, denn "zimbabwe" ist der Begriff der Shona für "steinerne Häuser".<br />
(Weltatlas 1997; zu Simbabwe siehe auch die Seite 208.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Der Text gehört mit Ausnahme einiger Nebenbemerkungen über die grossen Reiche in Westafrika, zu den<br />
wenigen Beispielen in den untersuchten Lehrmitteln, die sich mit der Geschichte Afrikas befassen, ohne den<br />
Eindruck zu vermitteln, diese hätte erst mit dem Eintreffen der Europäer begonnen.<br />
Die drei den Text begleitenden Fotos "Maske aus Westafrika", "Felsenkirche von Lalibela (Äthiopien)" und<br />
"Moschee von Mopti (Mali)" legen Zeugnis über die im Text angesprochene Grösse vergangener Reiche und<br />
Kulturen auf dem afrikanischen Kontinent ab. Die Seite 131 zeigt eine Karte "Alte Kulturen in Afrika", auf der<br />
die ehemaligen Reiche von Gana, Mali und Songhai eingezeichnet sind - wobei nur das Mali-Reich in der<br />
Blütezeit dargestellt wird -, sowie die Hauptstädte des Reiches Kusch, die Hausa-Staaten, das Bornu-Kanem-<br />
Königreich, die Yoruba-Stadtstaaten, Axum, Lalibela und Ankober im heutigen Äthiopien; die Ruinen von<br />
Simbabwe und die Gräber von Mapungubwe. Ausserdem verzeichnet die Karte verschiedene Entdeckerreisen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 368
von Europäern und die islamischen Kalifenreiche im 7. und 8. Jahrhundert. Trotz der zahlreichen Einträge gibt<br />
die Karte nur einen geringen Bruchteil der afrikanischen Geschichte wieder - auch optisch bleiben weite Teile<br />
der Karte leer. Der ein Jahr früher erschienene erste Band des Grossen Brockhaus gibt hingegen eine Karte mit<br />
über fünfzig eingezeichneten, südlich der Sahara liegenden Reichen wieder (Grosser Brockhaus: Erster Band,<br />
1986, S. 188).<br />
Die der Karte nachfolgende Seite 132, ist dann auch nicht der voreuropäischen Geschichte gewidmet, sondern<br />
befasst sich unter dem Titel "Ein Kolonialkontinent Europas" mittels rund der doppelten Textmenge, gegen-<br />
über der mit einem Fragezeichen versehenen "geschichtslosen Kontinent", mit den Einflüssen Europas auf die<br />
afrikanischen Gebiete. Unter der Überschrift "Europas Griff nach Afrika" schreibt der Autor:<br />
In der Antike gehörte Nordafrika zum griechisch-römischen, in den ersten christlichen Jahrhunderten zum<br />
abendländischen Kulturkreis. Das übrige Afrika jenseits der Wüste Sahara lag weitgehend ausserhalb des damaligen<br />
Weltbildes. Seit dem 8. Jh. verhinderte dann die Ausbreitung des Islam über Nordafrika bis nach Spanien für Jahrhunderte<br />
den Kontakt zwischen dem christlichen Europa und Afrika.<br />
Die Portugiesen begannen dann seit 1419 die Westküste zu erkunden, erreichten aber erst gegen Ende des 15. Jh. den<br />
Indischen Ozean. Aber Afrika selbst blieb dennoch lange Zeit für Europa der unbekannte Kontinent. Erst die<br />
Entdeckungsreisen im 19. Jh. brachten Kunde vom Inneren Afrikas nach Europa, in dem die Berichte nicht selten auf<br />
ungläubiges Staunen stiessen.<br />
Im Zeitalter des Imperialismus wurde schliesslich auch Afrika kolonialisiert, Frankreich eroberte seit 1834 Algerien, 1854<br />
den Senegal. England besetzte 1882 Ägypten und betrieb erfolgreich eine Kap-Kairo-Politik, in den Burenkriegen<br />
(1899-1902) sogar gegen weisse Burenrepubliken. Portugal verteidigte seine afrikanischen Territorien in Angola und<br />
Mosambik. Das Deutsche Reich und Italien griffen ab 1884 nach den noch freien Küstengebieten. Auf der Berliner<br />
Afrikakonferenz (1884/85) einigten sich die Kolonialmächte auf Einflusssphären und legten Regeln für die Okkupation<br />
Afrikas fest.<br />
Die Zeit der Kolonisierung war voller Kämpfe, weil die europäischen Mächte ihre Konflikte auch in Afrika austrugen und<br />
weil hartnäckiger Widerstand und zahlreiche Aufstände afrikanischer Völker durch Eroberungszüge, Straf- und<br />
Vernichtungsaktionen unterdrückt wurden.<br />
Wenn auch der Autor auf den Widerstand der schwarzafrikanischen Bevölkerung nicht näher eingeht, so wird<br />
dieser doch zumindest erwähnt. (Siehe dazu auch den Teil "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas" ab<br />
der Seite 33 dieser Arbeit.) Unter der Überschrift "Sklavenhandel" schreibt der Autor weiter (S. 132):<br />
Sklavenhaltung und -handel waren in Afrika wie im antiken Griechenland nichts Ungewöhnliches. Die Sklavenmärkte von<br />
Kano und Mombasa z. B. versorgten über Jahrhunderte die islamisch-arabische Welt mit Haussklaven, Eunuchen und<br />
Sklavinnen. Die Kommerzialisierung des Sklavenhandels durch Europäer und später auch durch Araber für den<br />
Sklavenbedarf in den amerikanischen Kolonien brachte eine neue Dimension des Menschenhandels: Von 1450 bis 1870<br />
wurden zwischen 10 und 30 Mio. afrikanische Sklaven in die Neue Welt verschifft. Neunhundert Schiffsfrachten ab<br />
Liverpool im Zuge des Dreieckhandels brachten allein von 1783-1793 etwa 300'000 Sklaven nach Amerika. Es war<br />
billiger, auf dem Transport Verluste hinzunehmen als für gute Verpflegung zu sorgen. Noch um 1860 wurden an der<br />
ostafrikanischen Küste 50-70'000 Sklaven jährlich umgesetzt. Dieser Menschenhandel, in den afrikanische<br />
Küstenbewohner aktiv einbezogen wurden, führte nicht nur zu hohen Menschenverlusten, sondern durch die gewaltsame<br />
Beschaffung der Sklaven, durch Kriege und Sklavenjagden zu einer tiefgreifenden Zerstörung vieler afrikanischer Völker<br />
und Kulturen und zur Zerrüttung geordneter politischer und gesellschaftlicher Werte und Strukturen.<br />
Auch hier verschweigt der Autor im Gegensatz zu Texten aus anderen Lehrmitteln die Mitwirkung der Küsten-<br />
völker beim Sklavenhandel nicht. (Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 278 und 384 dieser Arbeit.) Die<br />
weiteren Betrachtungen versuchen unter der Überschrift "Koloniales Erbe - wirksam bis heute" die Folgen der<br />
damaligen Politik aufzuzeigen (S. 132):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Die koloniale Durchdringung Afrikas, in der sich Missionierung und kulturelle Überfremdung mit Handel und<br />
wirtschaftlicher Ausbeutung verbanden, hat bis heute nicht überwundene Folgen: Eigene Kulturformen wurden zerstört<br />
und diskriminiert. Die Eliten wurden durch Bildung europäisiert und der eigenen Tradition entfremdet. Europäische<br />
Sprachen und Wertvorstellungen drangen in alle Bereiche ein. Die Grenzen der Kolonialbereiche wurden in Unkenntnis<br />
und ohne Rücksicht auf sprachliche und ethnische Grenzen der Einheimischen gezogen. Die Wirtschaftsbeziehungen<br />
wurden auf Europa ausgerichtet, innerafrikanische Beziehungen verkümmerten.<br />
Auch Ende der neunziger Jahre bleibt der innerafrikanische Handel im Gegensatz zum Überseehandel unbe-<br />
deutend, doch sind als neuen Handelspartner neben Europa und Nordamerika einige Staaten Asiens hinzuge-<br />
kommen. Damit wurde nach einer rund 400 Jahre dauernden Handelspause der bis ins 16. Jh. an der ostafrika-<br />
nischen Küste gepflegte Asienhandel wieder aufgegriffen. In einem der zwei auf der gleichen Seite<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 369
abgedruckten Zitate, lässt der Autor "Lord Lugard, zur Einführung der indirect rule um 1900 in Uganda und in<br />
Nordnigeria, 1922" zu Wort kommen:<br />
Die moralische Verpflichtung gegenüber den unterworfenen Rassen schliessen solche Dinge ein wie die Schulung der<br />
eingeborenen Herrscher, die Übertragung solcher Verantwortungen auf sie, die zu tragen sie befähigt sind, die Errichtung<br />
korruptionsfreier und allen zugänglicher Gerichtshöfe, die Einführung eines Bildungssystems, das dem Fortschritt helfen<br />
wird, ohne falsche Ideale zu erzeugen, die Einführung freier Arbeit und eines gerechten Steuersystems, Schutz der<br />
Bauernschaft vor Unterdrückung und Bewahrung ihrer Rechte auf das Land ...<br />
Eine Forderung, die nur bruchstückhaft umgesetzt wurde, trotzdem aber über das Bewusstsein der dadurch<br />
entstandenen schwarzafrikanischen Bildungselite mit zur Unabhängigkeit der von den Kolonialmächten<br />
besetzten Staaten ab den späten fünfziger Jahren beitrug.<br />
4.36.2 Zaire<br />
Auf der Seiten 133 und 135 stellt der Autor das Beispiel "Zaire - ehemals Belgisch Kongo" vor, zu dem er<br />
unter der Überschrift Kolonialgeschichte auf der Seite 133 schreibt:<br />
Die Portugiesen entdeckten auf ihrem Weg nach Indien entlang der afrikanischen Küste an der Kongomündung ein<br />
wohlorganisiertes Königreich. Der König Nzinga Nkuwu liess sich 1491 taufen, und einer seiner Enkel wurde 1520 in<br />
Lissabon zum Bischof geweiht, für drei Jahrhunderte der einzige katholische Bischof schwarzer Hautfarbe. Die Gier nach<br />
Gold und Sklaven und die gewaltsame Eroberung Afrikas durch andere europäische Staaten machten diese frühe friedliche<br />
Begegnung zwischen Europa und Afrika zunichte.<br />
Auf der Berliner Afrikakonferenz 1884/85 erkannten die Kolonialmächte den Etat Independant du Congo als Privatbesitz<br />
Leopold II. von Belgien an. Dieser überliess Verwaltung und Ausbeutung der Kolonie privaten Gesellschaften gegen<br />
Gewinnbeteiligung. Greuel im Privatstaat führten zu öffentlichen <strong>Pro</strong>testen in Europa und zur Übernahme der Kolonie<br />
durch den belgischen Staat. Dieser leitete tiefgreifende Reformen ein, schuf eine sehr straffe Verwaltung und förderte den<br />
Aufbau von Landwirtschaft, Bergbau und Export. Die Gewinne trugen erheblich zum belgischen Staatsetat bei. Träger der<br />
Kolonialwirtschaft waren belgische Beamte sowie Bergwerks- und Plantagengesellschaften. Afrikaner waren von sozialem<br />
Aufstieg und wirtschaftlicher Verantwortung ausgeschlossen.<br />
(Zur Politik von König Leopold II in Belgisch-Kongo siehe auch die Seite 197 dieser Arbeit.) Damit wider-<br />
spricht der Autor der im Lehrmittel "Seydlitz für Realschulen" von 1968 (Bd. 3., S. 42) vertretenen Meinung,<br />
die europäischen Kolonialmächte hätten in ihren afrikanischen Kolonien mehr investiert als sie zurückbekom-<br />
men hätten. Die Zeit bis zur Unabhängigkeit schildert der Autor unter der Überschrift "Der Weg zur Unabhän-<br />
gigkeit" (S. 133):<br />
Anfang der 50er Jahre entstand die erste politische Bewegung unter Schwarzafrikanern, 1958 kam es zu ersten Unruhen,<br />
die sich 1959 ausweiteten. Daraufhin beschloss die belgische Regierung, der Kolonie bereits zum 30. Juni 1960 die<br />
Unabhängigkeit zu gewähren.<br />
Sezessionsversuche der Kupferprovinz Katanga (Shaba) und innenpolitische Wirren führten zum Bürgerkrieg. Dieser<br />
weitete sich zu einem internationalen Krisenherd aus, weil einerseits belgische Truppen direkt eingriffen und andererseits<br />
die sozialistisch orientierte Regierung Hilfe von der UdSSR erhielt. Erst durch den Einsatz einer UN-Truppe konnte die<br />
Kongokrise einigermassen unter Kontrolle gebracht werden.<br />
Unter Mobutu, der 1965 durch einen Putsch an die Macht kam, wurden die östlichen Berater ausgewiesen und ein<br />
prowestlicher Kurs eingeschlagen, der Zaire die Unterstützung westlicher Mächte sicherte. Zaire ist heute eine präsidiale<br />
Republik mit einem Einkammerparlament. Mobutu ist Staatspräsident, Vorsitzender des Ministerrates, Oberbefehlshaber<br />
und Vorsitzender der einzigen Partei (Mouvement Populaire de la Revolution). Jede Opposition im Land wurde und wird<br />
unterbunden und ausgeschaltet.<br />
Die unruhige Geschichte spiegelt sich in der Namengebung des Landes. Das bis zur Unabhängigkeit Belgisch-<br />
Kongo genannte Gebiet, trug ab 1960 bis 1971 den Namen Demokratische Republik Kongo, wurde dann unter<br />
Mobutus neuer Politik des kulturellen Erbes in Zaire umgetauft, in Anlehnung an das von den Portugiesen<br />
falsch ausgesprochene Bakongo-Wortes "nzadi" (=Flusslauf), und heisst seit dem Sturz Mobutus durch<br />
Laurent-Désiré Kabila im Mai 1997 wieder Demokratische Republik Kongo.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Weiter schreibt der Autor unter der Überschrift "Auf dem Weg zum afrikanischen Nationalstaat" (S. 133):<br />
Ohne ausreichende politische Vorbereitung, ohne eine genügende Zahl von ausgebildeten und qualifizierten<br />
Verwaltungsbeamten und Politikern, ohne eigene, genügend ausgebildete Fachkräfte im Wirtschafts-, Gesundheits- und<br />
Bildungswesen hat Belgisch Kongo fast über Nacht die politische Selbständigkeit erhalten. Ein Binnenraum von 2'345'400<br />
km 2 mit nur 38 km Küste und damals nur etwa 14 Mio. Einwohnern, die sich in fünf ethnische Hauptgruppen mit 400<br />
Dialekten gliederten, sollte ein demokratisch regierter Nationalstaat werden.<br />
In den politischen Wirren der ersten Jahre litten besonders Wirtschaft und Infrastruktur. Die meisten Europäer verliessen<br />
das Land, viele überstürzt. Die <strong>Pro</strong>duktion der agrarischen und bergbaulichen Grossbetriebe ging stark zurück, da<br />
europäische Fach- und Führungskräfte nicht kurzfristig und gleichwertig ersetzt werden konnten. Gut organisierte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 370
<strong>Pro</strong>duktionssysteme verfielen zunächst, als die einheimischen Bauern endlich vom Druck der Kolonialverwaltung und<br />
deren Anbau- und Abgabenzwang befreit waren.<br />
Die Sezessionsbestrebungen der Bergbauprovinz Shaba hielten weiter an. Die Politiker Shabas wollten den Reichtum der<br />
Heimat nicht mit dem Gesamtstaat teilen und die Macht nicht dem fernen Kinshasa überlassen.<br />
Unter der Überschrift "Clandenken und Machtsicherung" beendet der Autor seine Überlegungen zu Zaire<br />
(S. 133):<br />
Die belgische Kolonialelite ist heute durch eine zairische Elite ersetzt, deren etwa 200 Grossfamilien sich den Reichtum<br />
des Landes aneignen. Mobutu und einer seiner engsten Verwandten gehören vermutlich zu den 20 reichsten Männern der<br />
Welt. Nach westlichen Zeitungsberichten hat Mobutu etwa 4 Mrd. US-Dollar auf anonymen Schweizer Privatkonten<br />
angehäuft, was etwa der zairischen Staatsverschuldung entsprechen soll.<br />
In der afrikanischen Gesellschaft spielt die Bindung an die eigene Familie, an den eigenen Clan noch eine sehr wichtige<br />
Rolle. Die Grossfamilie ist noch sehr stark der Bezugspunkt im sozialen Verhalten des Einzelnen. Die politischen Führer,<br />
die neuen Eliten des Staates, sind daher oft stärker ihrer Familie und der eigenen ethnischen Gruppe verpflichtet als dem<br />
Staat.<br />
Die Armee hat hauptsächlich die Aufgabe der Machtsicherung und -erhaltung der jetzigen politischen Führung. Als<br />
Gegenleistung erhält insbesondere das Offizierskorps grosse Privilegien in Form von bevorzugter Versorgung mit<br />
Konsum- und Luxusgütern und ständiger Erneuerung der Ausrüstung.<br />
In diesem Text wird der Eindruck erweckt, das Verhalten des damaligen Machthabers Mobutus müsste für<br />
afrikanische Verhältnisse als normal angesehen werden, da schliesslich die "Grossfamilie" und die Bindung an<br />
sie, einen Politiker gerade dazu verpflichten würden, Vetternwirtschaft zu betreiben. Diese Aussage wird dann<br />
noch mit der Bemerkung vermischt, dass die politischen Führer mehr "der eigenen ethnischen Gruppe<br />
verpflichtet" wären als dem Staat. Damit lassen sich die bis heute andauernden Missstände in Zaire bequem<br />
auf die afrikanische Mentalität zurückführen. Dabei vergisst der Autor zu erwähnen, dass sich Mobutu auch<br />
durch die Unterstützung durch Staaten Europas so lange halten konnte. Was den Vorwurf, der eigenen Ethnie<br />
verpflichtet zu sein angeht, so wird das gleiche Verhalten in Europa fast immer als logisch begründet angese-<br />
hen und durchaus akzeptiert.<br />
Die Seite 134 gibt eine Karte "Aktiv- und Passivräume" Zaires wieder, auf der die Zu- und Abwanderungsra-<br />
ten der verschiedenen Gebiete des Landes ersichtlich werden. Die Regionen um Kinshasa und Lubumbashi,<br />
sowie entlang der Ostgrenze des Landes werden als Konfliktgebiete gekennzeichnet. Vier "Alterspyramiden<br />
der zairischen Bevölkerung" geben Aufschluss über die Struktur der Bevölkerung für Gesamtzaire von 1970,<br />
"Kleinzentren im ländlichen Gebiet", ländliche Gebiete und "Zuwanderergruppen in Kinshasa" für 1960, am<br />
Beispiel der Yaka des Kwango, aus denen ersichtlich ist, dass die Männer den Grossteil der Zuwanderer stel-<br />
len, während die Frauen in den ländlichen Gebieten bleiben. Eine Beobachtung, die auch für andere Staaten<br />
Schwarzafrikas, von Burkina Faso, über Kenia und Tansania bis Südafrika, Gültigkeit besitzt und selbst für die<br />
in Europa ankommenden "Flüchtlinge" gilt. Die Seite 135 zeigt zwei weitere Karten "Wirtschaft" und "Vege-<br />
tation und Böden". Die Karte zur Wirtschaft gibt an, dass in der traditionellen Landwirtschaft Maniok, Mais,<br />
Reis, Hirse, Bananen, Bataten, Erdnüsse und Gemüse angebaut; Rinder, Schafe und Ziegen gehalten werden.<br />
Als cash crops werden Baumwolle, Kaffee, Ölpalmen, Kautschuk, Tee, Zuckerrohr und Kakao genannt.<br />
Kupfer, Kobalt, Zink, Diamanten, Zinn, Gold, Mangan und Steinkohle spielen eine Rolle im Bergbau. Als<br />
Beispiele der Industrie sind Eisenverhüttung, metallverarbeitende Industrie, Textilindustrie, Holzindustrie,<br />
Nahrungsmittelindustrie und Fischverarbeitung eingezeichnet. (Zur Demokratischen Republik Kongo siehe<br />
auch die Seiten 331 und 387 dieser Arbeit.)<br />
4.36.3 Ruanda<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Die Seiten 170-171 stehen unter dem Titel "Ein Entwicklungsprojekt in Ruanda". Dazu gibt der Autor auf der<br />
Seite 170 "Basisdaten" aus dem Fischer Weltalmanach '86 und dem Weltentwicklungsbericht 1985 wieder,<br />
von denen einige hier mit den aktuell erhältlichen Daten verglichen werden sollen:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 371
Angabe nach Lehrmittel Fischer Weltalmanach 1998<br />
Bevölkerung 5.7 Mio. 6.4 Mio.<br />
Einwohnerdichte 216 E/km 2<br />
städtische Bevölkerung 5% 8%<br />
Analphabeten 50% 40%<br />
jährliches Bevölkerungswachstum 3.4% 0.6%<br />
Erwerbspersonen 51% der Gesamtbevölkerung,<br />
davon 91% in der Landwirtschaft<br />
243 E/km 2<br />
Einfuhren 279 Mio. US$ 288 Mio. US$<br />
Ausfuhren 79 Mio. US$ 68 Mio. US$<br />
Wichtige Ausfuhrgüter Kaffee (über 70%), Tee, Zinn,<br />
Wolfram, Baumwolle, Ölfrüchte,<br />
Tabak<br />
BSP pro Kopf 270 $ 180 US$<br />
Einwohner je Arzt 31'340 33'000 1<br />
Lebenserwartung 46 Jahre 47 Jahre<br />
1 Daten von 1988 nach Weltatlas, 1993<br />
keine Angaben,<br />
davon 91% in der Landwirtschaft<br />
Kaffee (60%), Tee (23%),<br />
Das je nach Schätzungen heute 6-8 Mio. Menschen zählende Ruanda, wegen seiner Seen und Berge auch "die<br />
Schweiz Afrikas" genannt, dessen Bevölkerung zu 85% zu den Hutu, 14% zu den Tutsi und 1% zu den Batwa<br />
(Pygmäen) zählt, erlebte seit der Nahrungsmittelknappheit Ende der achtziger Jahre einen Rückgang des pro-<br />
Kopf-Einkommens von rund 40%. Die sich bis 1995 auf 1 Mrd. US$ belaufenden Auslandsschulden standen<br />
Exporten von nur gerade 68 Mio. US$ gegenüber, die zu 60% mit dem Verkauf von Kaffee und zu 23% mit<br />
Tee erwirtschaftet wurden. Die Bedeutung der Landwirtschaft, in der über 90% der erwerbstätigen Bevölke-<br />
rung ein Auskommen findet, zeigt sich auch im geringen Anteil der Stadtbevölkerung von nur 6% wovon rund<br />
220'000 in der Hauptstadt Kigali leben, die gleichzeitig auch das Wirtschaftszentrum des Landes ist. Obwohl<br />
Ruanda eine Schulpflicht für alle 7-15jährigen kennt, gelten rund die Hälfte der Bevölkerung als Analphabe-<br />
ten. Wie sich das Land nach dem Völkermord von 1994 weiterentwickeln wird, ist ungewiss. Im Text schreibt<br />
der Autor auf der Seite 170 zur Einleitung:<br />
Entlang der Schulwege nach Nyabisindu werden Avocado-Bäume gepflanzt. Der deutsche <strong>Pro</strong>jektleiter hofft, dass die<br />
Schulkinder mit den fett- und mineralhaltigen Früchten ihre sonst einseitige Ernährung verbessern und die Kerne in<br />
Sammelstellen gegen einen geringen Betrag für die weitere Pflanzenzucht wieder abliefern.<br />
Unter der Überschrift "Das <strong>Pro</strong>jekt Agro-Pastoral" schreibt der Autor weiter:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Das <strong>Pro</strong>jekt begann mit der Wiederinbetriebnahme einer alten Molkerei aus der Zeit des inzwischen gestürzten Königs der<br />
Tutsi. Nach Anlaufen der <strong>Pro</strong>duktion ergab sich bald die Notwendigkeit, die Milchzulieferung zu erhöhen, ein weit<br />
schwierigeres Unterfangen als die Reparatur der Molkerei. Die Watussi-Rinder sind zwar das Ergebnis einer langen<br />
Haustierzucht, aber die Züchtungsziele waren nicht auf Fleisch- und Milchleistung ausgelegt. Das starke<br />
Bevölkerungswachstum bedingt einen grossen Landmangel und die Verdrängung der Weiden auf die schlechtesten<br />
Standorte. Aber auch die ethnischen Gegensätze zwischen den Hutu-Bauern und den Tutsi-Viehhaltern liessen<br />
Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Rinderhaltung erwarten. Das Folgeprojekt setzte also an verschiedenen Stellen<br />
an: Veterinärdienst sollte die lokale Rasse der Watussi-Rinder verbessern, durch Impfungen das Ostküstenfieber<br />
eindämmen und Zeckenbefall bekämpfen sowie durch zentrale Bullenstationen die Zucht verbessern. Um aber die<br />
bekannten Folgen einer schnellen und unkontrollierten Vermehrung der Viehbestände zu vermeiden, war eine <strong>Pro</strong>jektstufe<br />
erforderlich, die sich den Anbau von Futterpflanzen und die Stallhaltung zum Ziel setzte. Die Stallhaltung ermöglichte<br />
zwei weitere wünschenswerte <strong>Pro</strong>jektziele: Schonung bzw. Regeneration der oft mageren, natürlichen Weiden und die<br />
Ausnutzung des Düngers zur Energiegewinnung. Die Demonstrationsställe wurden als einfache Kuhunterstände aus<br />
Stangenholz mit einem Blätterdach ausschliesslich mit lokalem Material hergestellt. Nägel und Wellblech hätten eingeführt<br />
werden müssen und sind für den einheimischen Bauern ohnehin unerschwinglich .<br />
Auch die Biogasanlagen werden mit minimalem technischen Aufwand erstellt: Der Mist verrottet in einem einfachen,<br />
sickerdichten Betontrog, über den ein Behälter als Gasglocke gestülpt wird. Ein günstiger Nebeneffekt der<br />
Biogasgewinnung ist die Umwandlung der tierischen Exkremente in hochwertigen Naturdünger.<br />
Der Futterpflanzenanbau wurde mit der Kultur von Nahrungs- und Erosionsschutzpflanzen verbunden. Zu diesem<br />
ökologischen Gesamtkonzept gehören auch umfangreiche Baumpflanzungen, um Beschattung, Erosionsschutz,<br />
Humusbildung und Holzzuwachs zu fördern.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 372
Auf der Seite 171 schreibt der Autor weiter:<br />
Das umfangreiche Aufforstungsprogramm geht von mehreren kleinen Baumschulen aus, die dem Bauern gegen Arbeit<br />
Jungpflanzen für Frucht- und Holzbäume zur Verfügung stellen.<br />
Die <strong>Pro</strong>jektleitung hatte zu Beginn noch kein vollständiges und fertiges Konzept, sondern experimentierte in<br />
Zusammenarbeit mit den einheimischen Bauern und Viehzüchtern. Bei allen Massnahmen war allerdings zu<br />
berücksichtigen: die afrikanischen Böden sind meist sehr alt, lange genutzt, stark ausgelaugt und äusserst<br />
erosionsgefährdet. Die Betroffenen sollen ständig einbezogen und beteiligt werden. Die empfindlichen Ökosysteme dürfen<br />
durch Nutzung nicht zerstört, sondern müssen stabilisiert werden.<br />
Daher knüpfte der Anbau bewusst an einheimische Traditionen des Mischanbaus und der Unkrauttoleranz an, um ein<br />
möglichst stabiles Ökosystem mit hoher natürlicher Fruchtbarkeit und geringer Schädlingsbekämpfung auf den<br />
Nutzflächen zu schaffen bzw. zu erhalten.<br />
Unter der Überschrift "Die Einbeziehung der Bevölkerung" schreibt der Autor weiter (S. 171):<br />
Ruanda ist das Land der Tausend Hügel, in dem sich aus vorkolonialer Zeit in Resten ein Gesellschaftssystem der<br />
Hügelgemeinschaften erhalten hat. Die Bauern siedeln in Einzelgehöften um einen zentralen Hügel, auf dem sich die<br />
Gruppe dieses Hügelgebietes regelmässig zur Beratung trifft. Diese alte Tradition lebt heute wieder auf, weil sie von<br />
christlichen Basisgemeinden in die Gemeindearbeit integriert wird (40% der Bevölkerung sind christlich), weil diese<br />
Nachbarschaften auch offiziell anerkannt und gefördert werden und weil die landwirtschaftliche und medizinische<br />
Basisberatung hier eine günstige Ansatzstelle entdeckt hat. Auch traditionelle Formen der Gemeinschaftsarbeit konnten<br />
wiederbelebt werden, die lang Zeit durch Fronarbeit für König und Kolonialverwaltung diskreditiert waren. Einmal<br />
wöchentlich wird für die eigene Hügelgemeinschaft unentgeltlich gearbeitet, etwa bei der Rekultivierung verödeter<br />
Talsenken oder bei der Aufforstung erosionsgeschädigter Hänge.<br />
(Zu Ruanda siehe auch die Seiten 362 und 397 dieser Arbeit.)<br />
Der Nachahmungseffekt ist bereits an vielen Stellen zu beobachten. Bauern haben den Futterpflanzenanbau übernommen,<br />
sich kleine Baumschulen angelegt und für die Anpflanzung und Pflege von Obst- und Holzbäumen gesorgt. Andere<br />
Landesregionen zeigen Interesse an der Übernahme des <strong>Pro</strong>jektes von Nyabisindu.<br />
Als erstes der untersuchten Lehrmittel schildert der Autor in diesem Text die aktive Mitarbeit der ländlichen<br />
Bevölkerung nicht nur bei der Arbeit am <strong>Pro</strong>jekt sondern schon bei der <strong>Pro</strong>jektplanung. Die Seite 171 bildet<br />
ausserdem eine Grafik "Integrierte standortgerechte Landnutzung" ab, aus der die wichtigsten<br />
Wirkungszusammenhänge ersichtlich sind, und zu der es im Text "Standortgerechte Landwirtschaft in<br />
kleinbäuerlichen Betrieben in den Tropen" aus "J. Kotschi, R. Andelheim, Standortgerechte Landwirtschaft,<br />
Eschborn 1984, S. 17f." heisst:<br />
Standortgerechte Landwirtschaft hat zum Ziel, unter "low-external-input -Bedingungen eine hohe und nachhaltige<br />
<strong>Pro</strong>duktivität am betreffenden Standort zu erreichen und dabei gleichzeitig ein ausgewogenes Ökosystem zu erhalten oder<br />
wiederherzustellen:<br />
Flächenproduktivität muss hoch angesetzt werden, da Land in der Regel knapp ist. Arbeitsproduktivität kann niedrig<br />
angesetzt werden, denn Arbeitskraft ist infolge starken Bevölkerungswachstums im Überfluss vorhanden. <strong>Pro</strong>duktivität<br />
von Kapital ist mittel bis sehr hoch anzusetzen. Wirtschaftseigene Betriebsmittel (z. B. Stallmist oder Nährstoffe im Boden)<br />
sind vielleicht kostbar und knapp, aber im Betrieb vorhanden und müssen mit mittlerer bis hoher <strong>Pro</strong>duktivität eingesetzt<br />
werden. Externe Betriebsmittel dagegen (z. B. Mineraldünger, Maschinen) können sehr teuer sein, dass sie nur bei höchster<br />
<strong>Pro</strong>duktivität rentabel sind (bei weiterer Verteuerung scheiden sie dann aus der <strong>Pro</strong>duktion aus). Daraus resultieren<br />
kapitalextensive <strong>Pro</strong>duktionsweisen mit niedrigen Fremdkosten (low-external-input) .<br />
Die Forderung nach Stabilität und Nachhaltigkeit erwächst aus der Verpflichtung der jeweils lebenden Generation, den<br />
zukünftigen Generationen eine Umwelt zu übergeben, die auch ihnen eine Lebensgrundlage bietet. Wie alle produktiven,<br />
stabilen Ökosysteme müssen auch landwirtschaftliche Betriebe und Regionen ein gewisses Mass an Geschlossenheit<br />
aufweisen und innerhalb dieser Einheitlichkeit vielfältig organisiert sein.<br />
Im Gegensatz zu der Entwicklungshilfe, die in den Lehrmittel der sechziger Jahre geschildert wurde, und die<br />
auf die Steigerung der <strong>Pro</strong>duktion für den Export abzielte, zu der nachfolgenden Entwicklungshilfe, die sich<br />
vor allem auf eine Katastrophenmanagement beschränkte, wird hier auf eine Hilfe abgezielt, die nicht nur<br />
nachhaltig wirken soll, sondern Startpunkt für eine Neuentwicklung bilden kann. Die Hoffnungslosigkeit der<br />
Lehrmittel der späten siebziger und frühen achtziger Jahre scheint damit überwunden zu sein.<br />
4.36.4 Kano<br />
Auf den Seiten 284-285 beschäftigt sich der Autor im Kapitel "Die westafrikanische Stadt" mit dem nigeriani-<br />
schen Kano, zu der sich auch eine Karte "Funktionale Gliederung von Kano" findet. Unter der Überschrift<br />
"Das Beispiel Kano" schreibt er auf der Seite 284 einleitend:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Eine Chronik belegt, dass Kano als Siedlung mit einer Eisenschmelze bereits im 10. Jh. existierte und sich seit dem 15. Jh.,<br />
aus dem die Befestigungsanlage stammt, zu einem wichtigen Handelszentrum entwickelte. Der Schwerpunkt lag lange im<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 373
transsaharischen Handel (um 1850 noch 30'000 Kamelladungen Salz), aber Handelsbeziehungen reichten auch bis<br />
Ostafrika und Indien.<br />
(Siehe dazu auch die Karte zu den Handelsstrassen im Nordafrika des Mittelalters auf der Seite 30 dieser<br />
Arbeit.) In den Text eingeschoben folgt ein Zitat von Heinrich Barth von 1858, dessen Reiseroute auf der<br />
bereits besprochenen Karte auf der Seite 131 des Lehrmittels eingezeichnet ist:<br />
"Der grosse Vorteil Kanos ist, dass Handel und Herstellung von Textilwaren Hand in Hand gehen, nahezu jede Familie<br />
nimmt daran teil. Es geht von dieser Industrie, die weithin bekannt ist, etwas Grossartiges aus ..."<br />
Der Autor fährt in seinen Betrachtungen fort, die Stadt beschreibend (S. 284f.):<br />
Nach dem Niedergang des transsaharischen Handels und dem Aufblühen des atlantischen Seeverkehrs konnte Kano trotz<br />
frühindustrieller kolonialer Konkurrenz Europas im Textilhandel seine Bedeutung behaupten, weil das agrarische Umland<br />
nun grosse Mengen begehrter Kolonialprodukte wie Erdnüsse und Baumwolle über Kano in die oberguineischen Häfen<br />
lieferte. Die Wirtschaftsentwicklung wurde wesentlich gestützt durch ein gut ausgebautes Strassennetz und vor allem seit<br />
1911 durch eine Eisenbahn nach Lagos.<br />
Kanos Altstadt, Hauptwohnbereich der alteingesessenen Bevölkerung, vermittelt noch immer den Eindruck des<br />
vorkolonialen afrikanischen Stadttyps. Ein 18 km langer und etwa 10 m hoher Erdwall umschliesst nicht nur die Altstadt,<br />
sondern auch einen Teil des stadtnahen Agrarlandes. Mittelpunkt der Altstadt ist der grosse Markt, auf den alle Strassen<br />
strahlenförmig zulaufen. Das Stadtbild der Altstadt ist gekennzeichnet durch eine unregelmässige Anlage von meist<br />
quadratischen ein- und zweistöckigen Lehmbauten mit Innenhof.<br />
(Zu den schwarzafrikanischen Märkten siehe auch die Seiten 349 und 412 dieser Arbeit.) Im Text schreibt der<br />
Autor weiter:<br />
Seit der britischen Eroberung im 19. Jh. hat sich die Stadt ausserhalb der Wallanlagen kräftig entwickelt. Ehemalige<br />
Nomadenlager vor den Toren im Norden sind inzwischen zu festen Wohnvierteln geworden. Hier lebt vorwiegend die aus<br />
dem islamischen Norden zugezogene Bevölkerung. Zu Beginn der Kolonialzeit wurden Handelsniederlassungen und<br />
Verwaltungsgebäude im Osten der Stadt errichtet. Dieser Teil hat - wie in vielen kolonial überformten Städten - bis heute<br />
seine architektonische Sonderstellung bewahrt. Im Osten entstand auch die planmässig angelegte Neue Stadt, die Sabon<br />
Gari in der Haussa-Sprache. Hier wohnen die afrikanischen Zuwanderer aus den andersgläubigen Regionen, in Kano<br />
besonders die christlichen Ibo (bis zum Bürgerkrieg 1966) und heute vorwiegend Yoruba aus dem Südosten bzw. dem<br />
Süden Nigerias. Die Zuwanderer halten sich oft nur zeitlich begrenzt in Kano auf, gehen ihren Geschäften und<br />
wirtschaftlichen Tätigkeiten nach, können und wollen sich aber nicht in die islamische Stadtkultur und -struktur<br />
eingliedern.<br />
Auf der Seite 285 schreibt der Autor unter der Überschrift "Viertelsbildung und funktionale Gliederung":<br />
Die Stadterweiterung in der Kolonialzeit hat ganz neue, z. T. sehr eigenständig geprägte Stadtviertel entstehen lassen.<br />
Diese Sabon Garis werden in der Gegenwart planmässig durch verbesserte Infrastruktur, neue Industrie-, Gewerbe- und<br />
Wohnviertel ergänzt und erweitert, wie es der Stadtplan von Kano im Südosten ausweist. Dieses funktionale<br />
Gliederungsprinzip hat sich auch in anderen afrikanischen Städten der Gegenwart durchgesetzt.<br />
Die Viertelsbildung selbst ist aber auch in der traditionellen afrikanischen Stadt nichts Ungewöhnliches. Die einzelnen<br />
Wohnviertel waren und sind meist ethnisch, religiös und kulturell, aber auch wirtschaftlich und sozial bedingt. Häufig sind<br />
ethnische und wirtschaftlich soziale Merkmale miteinander verbunden, wie etwa in südnigerianischen Städten die<br />
islamischen Haussa-Quartiere, deren Bewohner überwiegend im Viehhandel tätig waren, oder bei den Tuareg-Quartieren<br />
vor den Toren der Altstadt, weil die Tuareg mit ihren zahlreichen Kamelen nicht in der engen Altstadt leben konnten.<br />
Die Viertelsbildung im Norden ist einmal bedingt durch die starke islamische Prägung, die eine Integration<br />
Andersgläubiger ablehnt. Zum anderen trug auch die britische Kolonialverwaltung zur Segregation und Viertelsbildung<br />
bei, weil sie eigene ethnische Viertel anlegte und die traditionellen Sozial- und Herrschaftsstrukturen zu bewahren suchte.<br />
Kano, das Ende des 20. Jahrhunderts rund 700'000 Einwohner zählt ist die grösste Stadt im Norden Nigerias.<br />
Noch immer sind die Verarbeitung von Erdnüssen und Baumwolle, sowie die Herstellung von Leder- und<br />
Metallwaren die wichtigsten Industriezweige der Stadt. Ausserdem ist die Stadt ein wichtiges Handelszentrum<br />
für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus dem Umland. (Weltatlas 1997) Unter der Überschrift "Moderne<br />
Stadtentwicklung" schreibt der Autor weiter (S. 285):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Stadtkultur hat auch in Westafrika eine jahrhundertelange Tradition. Früher lagen die städtischen Zentren ausschliesslich<br />
im Landesinneren in der Savanne. Sie bildeten bedeutende religiöse, wissenschaftliche und politische Zentren und<br />
besonders am Südrand der Sahara reiche Handelsmetropolen.<br />
Mit dem Untergang der mittelalterlichen Reiche wie Mali oder Songhai schwand auch die politische und wirtschaftliche<br />
Bedeutung der Städte. In der Neuzeit gingen Handelsströme und Wachstumsimpulse an diesen Städten wie Timbuktu oder<br />
Djenne vorbei. Mit dem Beginn der Kolonialzeit in Afrika bekamen Küstenstandorte besondere Bedeutung.<br />
Zunächst bildete sich trotz der Hafenfeindlichkeit der Küste eine ganze Reihe von Handels- und Militärstützpunkten, die<br />
über offene Reedehäfen an der Brandungsküste verfügten. Wenige geschützte Tiefwasserbuchten (z B. bei Dakar) oder<br />
künstlich mit dem Meer verbundene Lagunen (z. B. bei Abidjan) boten günstige Hafenstandorte, die sich rascher als<br />
benachbarte Stützpunkte entwickelten. Solche Zentren gewannen mit dem Bau von Hauptstrassen und Eisenbahnlinien in<br />
das Hinterland einen entscheidenden Standortvorteil.<br />
Einige dieser Küstenstädte haben sich etwa seit 1950 zu grossstädtischen Agglomerationen entwickelt, die im Kernbereich<br />
alle Merkmale westlicher Grossstädte aufweisen und in den ungeordnet bebauten Aussenbezirken das ungeheure<br />
Wachstum von Städten in der Dritten Welt dokumentieren.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 374
Neuerdings versuchen einige Regierungen, durch Funktionsverlagerung die Küstenstädte zu entlasten, indem die<br />
Regierungssitze in neue Hauptstädte im Innern verlegt werden (z. B. von Abidjan nach Yamoussoukro oder von<br />
Daressalam nach Dodomo).<br />
In Nigeria wurde der Regierungssitz 1991 von Lagos nach Abuja, welches 1995 376'000 Einwohner zählte,<br />
verlegt. (Zu Nigeria siehe auch die Seiten 364 und 391 dieser Arbeit.) In der Elfenbeinküste ist Yamoussoukro,<br />
der Heimatort des damaligen Präsidenten Félix Houphouët-Boigny, mit nur 107'000 Einwohnern seit 1983<br />
Hauptstadt. In Tansania begann der Umzug von Dar es Salam nach Dodoma in den siebziger Jahren. Zu dem<br />
1995 134'000 Einwohner zählenden Dodoma werden allerdings unterschiedliche Angaben gemacht. Während<br />
einige Quellen den Ort als Hauptstadt Tansanias seit den siebziger Jahren bezeichnen, sind andere Quellen der<br />
Meinung, der Umzug sei auf das Ende der neunziger Jahre geplant.<br />
Neben dem Text zeigt die Seite 285 ein Foto "Kano", auf dem die im Text beschriebene Altstadt zu sehen ist,<br />
und eine Tabelle "Bevölkerungsentwicklung unterschiedlicher Städte":<br />
Timbuktu<br />
ehem. Hauptstadt des Songhai-Reiches<br />
Abidjan<br />
junge Hauptstadt<br />
16. Jh. 40-50'000 1900 zwei Fischerdörfer<br />
1855 13'000 1939 46'000<br />
1900 5'000 1962 285'000<br />
1973 10'000 1972 600'000<br />
1980 20'000 1980 1.9 Mio.<br />
(Zu Timbuktu siehe auch die Seite 143 dieser Arbeit.)<br />
4.36.5 Sambia<br />
Auf den Seiten 298-303 folgt ein umfangreiches Kapitel "Handelsländer - Handelsgüter", welches am Beispiel<br />
von Sambia und Malawi grundsätzliche Zusammenhänge aufzuzeigen versucht. Unter der Überschrift<br />
"Rohstoffländer - Beispiel Sambia" schreibt der Autor zur "Wirtschaft Sambias" auf der Seite 298:<br />
Nach der Klassifikation der Weltbank gehört Sambia zu den Ländern mit "mittleren Einkommen". Das Bruttosozialprodukt<br />
(BSP) betrug 1981 600 Dollar pro Einwohner (Bundesrepublik Deutschland: 13'450).<br />
Dieser statistische Durchschnittswert verdeckt jedoch die grossen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und räumlichen<br />
Ungleichgewichte in Sambia. So trägt der moderne Sektor, in dem nur etwa 25% der Erwerbstätigen beschäftigt sind, mit<br />
mehr als 90% zum BSP bei. Die Subsistenzwirtschaft ist statistisch nicht erfassbar.<br />
Zum "Kupferbergbau Sambias" schreibt der Autor (S. 298):<br />
Der Bergbau bildet die Grundlage der sambischen Wirtschaft. Das Kupfer- und Kobalt-Bergbaugebiet des Copper Belts ist<br />
das südliche Teilstück eines Kupfererzgebietes, das als eines der grössten der Erde betrachtet wird. Hier liegt ein Viertel<br />
der Weltvorräte.<br />
Während die nordamerikanischen und chilenischen Erze einen Cu-Gehalt von nur 2% aufweisen, liegen die Werte für den<br />
sambischen Copper Belt und das zairische Shaba bei 4% bzw. 6%. Der sambische Kupferbergbau wurde 1970 durch<br />
Übernahme der Kapitalmehrheit unter die Kontrolle des Staates gestellt.<br />
Heute gehören die <strong>Pro</strong>duktionskosten der sambischen Minen zu den höchsten der Welt. Sie lagen zeitweise sogar über dem<br />
Weltmarktpreis... Ursachen hierfür sind nicht nur die Abhängigkeit von Importen und Fachkräften, sondern auch<br />
zunehmender Untertagebau, steigende Kosten für Förderung und Aufbereitung sowie hohe Verwaltungskosten. Gestiegene<br />
Transportkosten auf langen Eisenbahnstrecken und Preisdruck durch weltweiten Nachfragerückgang verschärfen die<br />
Situation für den Binnenstaat Sambia zusätzlich.<br />
Im folgenden Abschnitt erläutert der Autor die Bemühungen des Kupferrohstoffkartells CIPEC, deren Resultat<br />
er wie folgt zusammenfasst:<br />
...Von 1970 bis 1978 sanken die Terms of Trade auf 44% (1970 = 100%), d. h. Sambia konnte 1978 vom Erlös einer Tonne<br />
Kupfer nur 44% der Waren einführen, die es 1979 dafür erhielt.<br />
Zu diesem <strong>Pro</strong>blem lässt der Autor den "Sambia-Experten W. Gaebe" mit seinem Urteil von 1982 aus "Afrika-<br />
Informationen, Heft 40" zu Wort kommen:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
- "Solche verkrüppelten Volkswirtschaften sind Ausdruck der ungleichen Arbeitsteilung zwischen Entwicklungs- und<br />
Industrieländern. Die <strong>Pro</strong>duktionsstruktur zeigt noch 18 Jahre nach der Unabhängigkeit das koloniale <strong>Pro</strong>duktionsmuster<br />
(1889-1964): <strong>Pro</strong>duktion von Rohstoffen für den Export in Industrieländer... und Import von <strong>Pro</strong>duktionsanlagen,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 375
Ersatzteilen, Luxuskonsumgütern und Nahrungsmitteln". Er führt hierzu Beispiele an; u. a. werden für die Herstellung von<br />
Bier Hopfen und Malz eingeführt; für die Bauindustrie werden u. a. Fliesen, Glas und Bodenbeläge importiert.<br />
- "Die binnenwirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin vom Förder-, <strong>Pro</strong>duktions- und Absatzinteresse der<br />
Industrieländer bestimmt, von ausländischem Kapital, know how und ausländischen Investitionsentscheidungen " .<br />
- "Sehr stark sind noch immer die kulturelle Abhängigkeit und die Abhängigkeit von ausländischen Experten... Eine<br />
Sambianisierung, d. h. Übernahme aller Führungspositionen durch Sambier und Verringerung der personellen<br />
Abhängigkeit, ist bisher nicht erreicht". Nach einer Untersuchung von 1977 waren zu diesem Zeitpunkt 81% der Manager<br />
im Finanzbereich und Rechnungswesen Ausländer, 77% der <strong>Pro</strong>duktmanager. Dagegen waren über 90% der<br />
Personaldirektoren Sambier.<br />
Durch den Zerfall der Kupferpreise geriet das Land zunehmend in eine Notlage - Kupfer wird sogar durch<br />
einen orangen Streifen in der Flagge des einen Viertel der bekannten Kupfervorkommen der Welt besitzenden<br />
Landes symbolisiert - und häufte, während der Lebensstandard stetig sank, bis 1995 einen Schuldenberg von<br />
6.9 Mrd. US$ an. Diesem standen Einnahmen aus dem Export von ca. 400 Mio. US$ gegenüberstanden, die zu<br />
65% aus der Kupfergewinnung stammten, obwohl die Kupferproduktion seit Mitte der siebziger Jahre um die<br />
Hälfte gesunken ist. Weitere Exportprodukte Sambias sind Kobalt, Zink und Tabak.<br />
In einem weiteren Text zitiert der Autor "Die Bundesstelle für Aussenhandelsinformation... 1984 über die<br />
wirtschaftliche Entwicklung Sambias" auf den Seiten 298f.:<br />
"Sambia, dreimal so gross wie die Bundesrepublik Deutschland, mit einer Bevölkerung von mittlerweile offiziell ca. 6,2<br />
Mio. Einwohnern, besitzt durch seine Kupfervorkommen, fruchtbaren Böden und günstige klimatische Bedingungen trotz<br />
seiner Binnenlage und Weltmarktferne bessere Entwicklungschancen als die Mehrzahl der schwarz-afrikanischen Länder.<br />
Leider hat Sambia in den ersten neunzehn Jahren nach der Unabhängigkeit (1964) seine wirtschaftlichen Möglichkeiten<br />
nicht voll genutzt. Zu Zeiten hoher Kupferpreise in den 60er und frühen 70er Jahren hat Sambia seine Devisen nicht, wie<br />
alle rückschauend bedauernd feststellen müssen, zur Entwicklung seiner Landwirtschaft, sondern überwiegend dazu<br />
benutzt, ausländische Industrieunternehmen in Sambia aufzukaufen und neue rohstoffimportabhängige staatliche<br />
Industrien zu errichten. Dies entsprach zwar dem politischen <strong>Pro</strong>gramm des Unabhängigkeitskampfes (Aufbau einer<br />
sozialistischen Staatswirtschaft, industrielle Unabhängigkeit von Südrhodesien), aber nicht unbedingt den wirtschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen. In der Wirtschaftspolitik bleibt die Diversifizierung der Wirtschaft und insbesondere der Exporte bei<br />
gleichzeitiger Importsubstitution das dringende Gebot der Stunde. Importsubstitution erscheint dabei leichter als<br />
Exportdiversifizierung. Letztere ist vor allem wichtig und unabweislich für ein wirtschaftliches Überleben Sambias in der<br />
Nachkupferzeit im nächsten Jahrhundert, die nicht mehr so fern ist. Die sambische Führung strebt an, Sambia auf längere<br />
Sicht zum Agrarexportland zu machen und hofft auf weitere Mineralienvorkommen, die im nächsten Jahrhundert Sambia<br />
Devisen bringen sollen. Sambia hat jedoch kaum Voraussetzungen, ein Agrar-Nettoexportland zu werden. Dafür ist es<br />
geographisch zu weit von den Weltmärkten entfernt, und die Nachbarstaaten haben weder Bedarf für sambische <strong>Pro</strong>dukte<br />
noch Devisen. Sambia muss also weitere Bodenschätze zu erschliessen versuchen. Hinsichtlich Uran kann es sich bereits<br />
Hoffnungen machen".<br />
Unter der Überschrift "Rohstoffländer - Entwicklungsländer" schreibt der Autor auf der Seite 299<br />
abschliessend:<br />
Die Hauptausfuhrgüter der meisten Entwicklungsländer sind nach wie vor Rohstoffe. Dabei sind noch immer einige<br />
Länder hochgradig von einem einzigen Exportprodukt abhängig. 1982 sanken die Rohstoffpreise- mit Ausnahme der<br />
Brennstoffe - auf den niedrigsten Stand der Nachkriegszeit.<br />
Ausserdem sind auf der Seite 299 zwei Grafiken "Weltmarktpreise von Buntmetallen" und "Bedeutung des<br />
Kupferbergbaus für Sambia", sowie vier Tabellen "Verhältnis Kupferweltmarktpreis zu den <strong>Pro</strong>duktionskosten<br />
in Sambia...", "Sambias Staatshaushalt 1970-1980...", "Monostrukturierte Rohstoffländer (Auswahl)" - für<br />
Äthiopien wird der wertmässige Anteil von Kaffee an den Gesamtexporten mit 75% beziffert, der von Burundi<br />
mit 90%, Gambia erhält 75% seiner Exporteinnahmen aus Erdnüssen und Erdnussöl, Ghana 76% aus Kakao<br />
und Sambia 90% aus Kupfer - und "Terms of Trade", die nach der Tabelle für Sambia für das Jahr 1981 vergli-<br />
chen mit 1975 auf 67% und für Ghana, nach dem Rekordjahr von 1978 mit 193%, auf 75% gefallen sind. Im<br />
gleichen Zeitraum fielen die Werte für die USA und die BRD nach dem Lehrmittel auf 86%. Dazu passend<br />
schreibt der Autor zu einer Tabelle auf der Seite 302:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Steigende Terms of Trade bedeuten, dass für den Erlös mengenmässig konstanter Exporte mehr Waren importiert und<br />
bezahlt werden können. Terms of Trade über 100 werden daher als günstig bezeichnet, da sie anzeigen, dass sich das<br />
Austauschverhältnis im Aussenhandel gegenüber dem Basisjahr verbessert hat. Terms of Trade unter 100 besagen das<br />
Gegenteil.<br />
(Zu den Terms of Trade siehe auch die Seiten 322 und 420 dieser Arbeit.) Sambia gehört Ende der neunziger<br />
Jahre zu dem am stärksten industrialisierten Ländern Afrikas. Neben dem dominierenden Kupferbergbau und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 376
der Kupferveredlung, besitzt Sambia Einrichtungen zur Erdölverarbeitung, sowie über eine Fahrzeug-,<br />
Düngemittel- und Textilienproduktion. Obwohl die Nahrungsmittelproduktion stetig gesteigert wurde, konnte<br />
sie mit dem Bevölkerungswachstum nicht mithalten. Die 10.3 Mio. Menschen Sambias, von denen 43% in<br />
Städten leben, davon 1.3 Mio. in der Hauptstadt Lukasa, gehören über 70 ethnischen Gruppierungen an. Auf<br />
die Bemba entfallen 36% der Gesamtbevölkerung, auf die Nyana 18% und auf die Tonga, deren Wort für<br />
"grosser Strom" dem Fluss Sambesi und damit dem Land den Namen gegeben hat, 15%. Das Land wird seit<br />
1991 vom ehemaligen Gewerkschafter Frederick Chiluba regiert, der den seit der Unabhängigkeit regierenden<br />
Kenneth Kaunda ablöste. Trotz seines Liberalisierungsprogrammes, welches auch eine Streichung der Subven-<br />
tionen auf Grundnahrungsmitteln beinhaltete, wurde Chiluba 1996 in von der Opposition teilweise boykottier-<br />
ten Wahlen wiedergewählt. 1997 wurden dem Land durch den IWF ein Teil der Schulden erlassen. (Zu<br />
Sambia siehe auch die Seiten 312 und 420 dieser Arbeit.)<br />
4.36.6 Malawi<br />
Auf der Seite 302 schreibt der Autor unter dem Titel "Agrarländer - Beispiel Malawi" zur Statistik des Landes:<br />
In den wenigen Städten des Landes lebten 1983 10% der Bevölkerung. Etwa 90% der Erwerbstätigen waren in der<br />
Landwirtschaft tätig. Subsistenzwirtschaft war weit verbreitet, wurde aber statistisch nicht erfasst. Das BSP pro Kopf lag<br />
bei 220 US-Dollar; 41% des BIP wurden in der Landwirtschaft erwirtschaftet. Hier wurden auch die wichtigsten<br />
Exportprodukte Malawis erzeugt: Auf Tabak entfielen 59%, auf Tee 19% und auf Zuckerrohr 14% der Exporteinnahmen.<br />
Die Zuckerproduktion verzeichnete ab 1982 infolge des gesunkenen Weltmarktpreises sowie des Fortfalls des wichtigsten<br />
Abnehmers (USA) wegen der Einführung neuer Zuckereinfuhrquoten grosse Einbussen im Export.<br />
Die etwa 120 hochproduktiven Grossplantagen, die Betriebsflächen von 200 bis 400 ha aufwiesen, erzeugten etwa 70%<br />
aller für den Export bestimmten <strong>Pro</strong>dukte.<br />
Die Entwicklung des produzierenden Gewerbes (1979: 105 Betriebe) wurde durch die Begrenztheit des Binnenmarktes, die<br />
hohen Transportkosten und den Mangel an Fachkräften behindert. Es handelte sich vornehmlich um Betriebe der<br />
Nahrungs- und Genussmittelbranche (Tabak- und Teeverarbeitung, Konservenfabriken, Schlacht- und Kühlhäuser).<br />
1995 waren noch 86% der arbeitenden Bevölkerung Malawis in der Landwirtschaft tätig. Die sich auf rund 200<br />
Mio. US$ belaufenden Exporte stammten zu 70% aus dem Anbau von Tabak, und zu je 7% aus dem Anbau<br />
von Tee und Zucker. Infolge des zunehmenden Unvermögens, die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu<br />
versorgen, stiegen die Auslandsschulden Malawis 1995 auf 2.1 Mrd. US$ an, und das rohstoffarme Land, das<br />
keine allgemeine Schulpflicht kennt, bleibt auch weiterhin von der Hilfe aus dem Ausland abhängig.<br />
Nur 14% der den Ethnien Chewa, Nyana, Tumbuko, Yao, Lomwe, Sena, Tongo, Ngani und Ngande angehö-<br />
renden 12.3 Mio. Malawier leben in Städten, wobei die frühere Hauptstadt Blantyre ca. 320'000 Einwohner,<br />
die seit 1975 neue Hauptstadt Lilongwe 395'000 Einwohner zählt.<br />
Als "Kennzeichen von Agrarländern" zählt der Autor die folgenden Merkmale auf (S. 302):<br />
- Nur etwa 10% der Bevölkerung leben in Städten.<br />
- Das Bruttosozialprodukt pro Einwohner ist niedrig.<br />
- Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig.<br />
- Subsistenzwirtschaft mit traditionellen Anbaumethoden ist verbreitet.<br />
- Kapitalausstattung, Mechanisierungsgrad und Einsatz von Mineraldünger sind gering.<br />
- Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist sehr hoch.<br />
- Kapitalintensive Grossbetriebe produzieren für den Export.<br />
- Agrargüter sind die wichtigsten Exportprodukte, Industriegüter und Kraftstoffe die wichtigsten Importprodukte.<br />
- Die Terms of Trade verschlechtern sich, da die Preise für Industriegüter schneller steigen als für Agrargüter.<br />
Zur Beurteilung des Landes durch Aussenstehende schreibt der Autor (S. 302):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Manche nennen Malawi ein Musterland, manche kritisieren das politische System scharf. Die einen verweisen dabei auf die<br />
seit Jahren beachtlichen Zuwachsraten der Nahrungsmittelproduktion. Keiner der rund sechs Millionen Einwohner muss<br />
hungern. Die anderen verweisen dagegen auf den patriarchalisch-autoritären Regierungsstil des Präsidenten auf<br />
Lebenszeit, Kamuzu Banda, von dessen Entscheidung alles und jedes abhängt. Statistisch zählt der Binnenstaat Malawi zu<br />
den wirtschaftlich am wenigsten entwickelten Ländern der Erde. Es besitzt keine nennenswerten Bodenschätze, Industrie<br />
und Handwerk sowie Verkehrs- und Nachrichtensysteme sind kaum entwickelt.<br />
Der seit der Unabhängigkeit von 1964 herrschende Hastings Kamuzu Banda verlor 1994 die Präsidentschafts-<br />
wahlen. Neuer Präsident wurde der ehemalige Kolonialbeamte, Bauer und Geschäftsmann Bakili Muzuli, ein<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 377
Yao, der bis Mitte der achtziger Jahre Mitglied des Regierungskabinettes gewesen war. Er versuchte das Land,<br />
welches 1994 unter einer Dürre litt und 800'000 Angolaner Zuflucht bot, aus der Krise zu holen.<br />
Zum Text gibt die Seite 302 drei Tabellen "Die wichtigsten Einfuhrwaren...", "Aussenhandelsindizes und<br />
Terms of Trade" und "Die wichtigsten Lieferanten und Kunden Malawis 1982" wieder. Auf der Seite 303<br />
schreibt der Autor zu den "Kennzeichen Malawis":<br />
Die Landwirtschaft richtete sich - soweit wir aus Berichten Livingstones (1813-873) und anderer wissen - vor dem<br />
Eindringen der Europäer fast ausschliesslich auf Selbstversorgung. Wanderfeld- und Hackbau stellten die übliche Form der<br />
Bodennutzung dar. Daueranbau fand sich nur in den dichter besiedelten Gebieten wie der Uferzone des Malawisees. Auf<br />
Grund der überall gleichen Besitzverhältnisse erfuhr die Landwirtschaft eine räumliche Differenzierung im wesentlichen<br />
durch die unterschiedlichen natürlichen Voraussetzungen, Stammesgewohnheiten und -traditionen und die verschiedene<br />
Intensität der Nutzung.<br />
Mit der europäischen Kolonialherrschaft erfolgte eine stärkere Differenzierung - einerseits durch die Veränderung der<br />
Landbesitzstrukturen, andererseits durch den Zwang zum Bargelderwerb (Kopfsteuer), der den Anbau von Früchten für<br />
den ausländischen Markt (cash crops) vorantrieb.<br />
(Zur Kopfsteuer siehe auch die Seite 132 dieser Arbeit.)<br />
Wenn die afrikanische Landwirtschaft heute trotzdem nur eine geringe Vielfalt der Betriebsstrukturen aufweist, so deshalb,<br />
weil der ganz überwiegende Teil des Landes nach wie vor Stammesland ist, auf dem nur zeitlich begrenzte Nutzungsrechte<br />
vergeben werden.<br />
Der grösste Teil der Arbeitslast in der Landwirtschaft ruht auf der Frau. Nachbarschafts- und Verwandtenhilfe spielen eine<br />
wesentliche Rolle. Das hat sich noch durch die Wanderarbeit - die Männer arbeiten grösstenteils in den Minen Südafrikas -<br />
und die Binnenwanderung verstärkt. Die Auswirkungen der temporären Abwesenheit der Männer durch befristete Ausoder<br />
Binnenwanderung auf die Landnutzung können in vielen Punkten mit denen in Abwanderungsgebieten in den<br />
europäischen Mittelmeerländern verglichen werden.<br />
Neben dem Grossraum Südafrika findet sich ein weiteres Migrationsgebiet in Westafrika, wo vor allem die<br />
Elfenbeinküste, Nigeria und Gabun Saisonarbeiter aus den ärmeren Ländern Senegal, Mali, Burkina Faso,<br />
Niger, Tschad und Benin anziehen. (Meister 1986, S. 87) Da es sich dabei vorwiegend um männliche Arbeits-<br />
kräfte handelt, bleibt die landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion wie schon zur Kolonialzeit, in den Händen der Frau-<br />
en. Zu den Bodennutzungsformen schreibt der Autor nach "Lienau,... Malawi - Geographie eines unterentwik-<br />
kelten Landes. Darmstadt 1981" (S. 303):<br />
Auffälligstes Kennzeichen der malawischen Landwirtschaft ist, wie in vielen tropischen Entwicklungsländern, das<br />
Nebeneinander von kommerziellen Grossbetrieben und kleinbäuerlichen Betrieben auf nach traditionellem Recht<br />
vergebenen Land. Das bedeutet für die Nutzung:<br />
Traditionelle arbeitsintensive und moderne kapitalintensive Formen bilden die Pole der Bodennutzung. Flächenmässig<br />
dominieren die traditionellen Formen. Aus Amerika oder Asien eingeführte Nutzpflanzen haben eine grosse Bedeutung:<br />
Erdnuss, Baumwolle, Süsskartoffel (Batate), Kartoffel, Tabak, Sisal und Mais aus Süd- und Mittelamerika; Tungnuss,<br />
Mangobaum, Teestrauch, Reis, Zuckerrohr und Banane aus Südasien. Wichtigste einheimische Pflanzen sind die als<br />
Grundnahrungsmittel dienende Hirse sowie einige Hülsenfrüchte. Wichtigste Plantagenpflanzen Malawis sind Tee und vor<br />
allem Tabak. Wertvollste Subsistenzfrucht ist heute der Mais, der relativ hohe Erträge bringt und einen hohen Nährwert<br />
besitzt. Die einst weit verbreitete shifting cultivation (Wanderfeldbau mit Brandrodung) beschränkt sich heute auf die dünn<br />
besiedelten Teile der Nordregion.<br />
Bäuerliche Forstwirtschaft gibt es nicht. Der Wald ist jedoch wichtig als Brenn- und Bauholzquelle. In dichter besiedelten<br />
Gebieten stellt die Abholzung mit den Folgen der Bodenerosion und dem Sinken des Grundwasserspiegels ein immer<br />
stärker zunehmendes <strong>Pro</strong>blem dar.<br />
In einem Textkasten nach einem Artikel aus der "Cellesche Zeitung" vom Oktober 1979 schreibt der Autor<br />
abschliessend auf der Seite 303:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Bei den Gesprächen mit Vertretern Malawis klang nicht ohne Stolz immer wieder durch, dass dieses Land seit einiger Zeit<br />
bei der Nahrungsversorgung auf Einfuhren nicht mehr angewiesen sei. 90 <strong>Pro</strong>zent der Bevölkerung arbeiten in der<br />
Landwirtschaft. Verarbeitende Industrien sind erst in bescheidenen Anfängen vorhanden. Die Regierung bemüht sich um<br />
Auslandskapital. Es ist willkommen und keinen Beschränkungen unterworfen. Der Gewinntransfer ist erlaubt. Es wird von<br />
Regierungsseite nicht darauf bestanden, dass Afrikaner im Management vertreten sein müssen. Zwar will man die<br />
Afrikanisierung, jedoch nicht überhastet.<br />
Der Ausbau der Landwirtschaft hat nach wie vor Priorität. Dabei spielt der Tabakanbau eine grosse Rolle. Tabak ist<br />
inzwischen zum bedeutendsten Exportartikel geworden. Auch ein deutscher Zigarettenkonzern ist ein wichtiger Käufer der<br />
dort gezüchteten Spezialtabake, die für "Leicht-Zigaretten" benötigt werden.<br />
Die Regierung will die Industrialisierung des Landes mit Schwerpunkt bei der Verarbeitung und Veredelung<br />
landwirtschaftlicher <strong>Pro</strong>dukte vorantreiben. Auch soll das starke Nord-Süd-Gefälle verringert werden. Daher wurde u. a.<br />
die Hauptstadt des Landes vom Süden in die Mitte des Landes verlegt, von Zomba nach Lilongwe.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 378
Wie weiter oben nachzulesen ist, konnten diese Pläne nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden. Auch der<br />
Tabakanbau dürfte anhand der Pläne der WHO, den Tabakmissbrauch zu bekämpfen, mit neuen Schwierigkei-<br />
ten konfrontiert werden.<br />
4.36.7 Zusammenfassung<br />
"Mensch und Raum für die gymnasiale Oberstufe" vermittelt ein Bild Schwarzafrikas, welches sich wesentlich<br />
von den früher erschienen Lehrmitteln unter der gleichen Bezeichnung für die Real- und Hauptschule abhebt.<br />
Als erstes der untersuchten Lehrmittel hinterfragt es die von Hegel 1830 eingeführte "Geschichtslosigkeit" des<br />
Kontinents und gibt mit dem Beispiel der nigerianischen Stadt Kano einen Einblick in die Entwicklung einer<br />
Stadt Schwarzafrikas seit dem 10. Jh.<br />
Der Autor verzichtet auf eine Darstellung der Schwarzafrikaner als "Primitive" oder "edle Wilde", sondern<br />
konzentriert sich auf die Schilderung der ökonomischen Gegebenheiten der Menschen in Zaire, Ruanda,<br />
Sambia und Malawi. Dazu führt er auch verschiedene Statistiken an.<br />
Wie in den Lehrmitteln der sechziger Jahre steht wieder eindeutig die Wirtschaft der angesprochenen Länder<br />
im Vordergrund, ausser im Kapitel über Kano erfahren die Leser nur wenig über den Alltag der einzelnen<br />
Menschen, dabei kommen auch keine Afrikaner zu Wort.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz - Mensch und Raum (1987)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 379
4.37 Diercke Taschenatlas (1992)<br />
Der 238 Seiten, davon rund 53 Seiten Register, umfassende "Diercke: Taschenatlas der Welt", der hier zum<br />
Vergleich mit den Geographielehrmitteln der neunziger Jahre aufgeführt wird, wohl aber auch für die Schule<br />
gedacht ist, da sich an der Drucklegung auch der Westernmann Schulbuchverlag beteiligte, enthält neben den<br />
Flaggen der afrikanischen Länder auf den Seiten 5-9 diverse Karten.<br />
Die Seiten 12-13 zeigen eine politische Weltkarte, die Seiten 14-15 eine physische Weltkarte. Die Seite 134<br />
zeigt eine politische Afrikakarte für die Zeit von 1914/1918 auf der Äthiopien und Liberia als selbständige<br />
Staaten aufgeführt werden, die restlichen Gebiete stehen nach der Karte unter europäischer Kolonialverwal-<br />
tung. Die Seite 135 zeigt eine politische Karte Afrikas im Massstab 1:65 Mio., die Doppelseite 136-137 eine<br />
physische Karte des Kontinents im Massstab 1:42 Mio. Detailliertere Teilkarten Afrikas im Massstab<br />
1:16 Mio. folgen auf den Seiten 138-149.<br />
Im Gegensatz zu anderen Atlanten verzichtet der "Diercke: Taschenatlas" mit Ausnahme der erwähnten Karte<br />
zur politischen Situation anfangs des Jahrhunderts auf Themenkarten zu Bereichen wie Bevölkerungsdichte,<br />
Religion, Wirtschaft usw. Die Karten in der höchsten Auflösung zeigen die wichtigsten Städte eines Landes<br />
sind aber für eine detaillierte Betrachtung des afrikanischen Kontinentes nicht geeignet. Über die afrikanischen<br />
Menschen schweigt sich das Werk vollkommen aus.<br />
Geographielehrmittel: Diercke Taschenatlas (1992)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 380
4.38 Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Menschen der gesamten Welt sind bereit, den Menschen in den Entwicklungsländern und besonders auch den Bewohnern<br />
in der Sahelzone zu helfen... Wie aber sieht sinnvolle Hilfe aus? Droht der Hungertod, ist sicher kurzfristige Soforthilfe<br />
(Lebensmittellieferungen, Medikamente, Ärzte und Entwicklungshelfer) notwendig. Für langfristige Hilfen gibt es<br />
staatliche Massnahmen... Es gibt auch viele private und kirchliche Hilfsorganisationen. (Bd. 3, S. 122)<br />
Das Lehrmittel Seydlitz Erdkunde, erschienen 1993-1995, beschäftigt sich auf rund 50 der insgesamt ca. 750<br />
Seiten mit Themen zu Afrika, dabei fällt das Hauptgewicht auf den Band 3. Einige weitere Seiten finden sich<br />
im Band 4. Das Lehrmittel bildet zahlreiche Fotos, Karten und Graphiken ab und enthält immer wieder<br />
Einschübe unter dem Titel "Geo-Praxis" oder "Geo-Exkurs", zudem werden Fragen und Aufgaben zu den<br />
einzelnen Kapiteln gestellt.<br />
4.38.1 Band 3<br />
Der Band 3 befasst sich auf über 40 Seiten mit Themen zu Afrika. Aus diesen Seiten werden die für Schwarz-<br />
afrika relevanten Abschnitte näher besprochen. Die einzelnen Kapitel sind mit "Rekorde und Merkwürdigkei-<br />
ten" (S. 100-101), "Afrika - der zweitgrösste Kontinent" (S. 102-111), "Der Nil, Lebensader Ägyptens"<br />
(S. 112-119), "Die Sahelzone - ein gefährdeter Lebensraum" (S. 120-125), "Wirtschaftsraum Kongobecken"<br />
(S. 126-129), "Kenia - Land der Gegensätze" (S. 130-133), "Nigeria - ein Staat?" (S. 134-137), "Rassenkon-<br />
flikte in Südafrika" (S. 138-141) und abschliessend "Geo-Wissen" (S. 142-145) übertitelt.<br />
4.38.1.1 Allgemeines: "Afrika der zweitgrösste Kontinent"<br />
Die Seiten 100 bis 101 zeigen unter dem Titel "Rekorde und Merkwürdigkeiten" eine Höhenkarte Afrikas, auf<br />
der die einzelnen Staaten eingezeichnet sind, sowie sieben Fotos, von denen die Fotos "Afrika hat von allen<br />
Kontinenten das höchste Bevölkerungswachstum", "Einige afrikanische Stämme leben als Jäger und Sammler<br />
noch auf der Stufe der Steinzeit" und "Täglich sterben mehr als 10'000 afrikanische Kinder an Mangelerkran-<br />
kungen und Unterernährung" einen ersten Einblick in Schwarzafrika geben.<br />
Im Kapitel "Afrika - der zweitgrösste Kontinent" schreibt der Autor nach einigen klimageographischen<br />
Betrachtungen unter der Überschrift "Vegetationszonen und ihre Nutzung" auf der Seite 106:<br />
...Die Nutzungsmöglichkeiten des tropischen Regenwaldes sind begrenzt. Die Böden sind wenig fruchtbar...,<br />
Grossviehhaltung ist wegen Futtermangel und Seuchengefahr kaum möglich. Dennoch bauen die Menschen für den<br />
eigenen Bedarf Maniok, Yamswurzeln, Bataten und Mais an, halten Hühner, Ziegen und Schweine. Für den Export werden<br />
Edelhölzer (z. B. Mahagoni) geschlagen, Palmöl gewonnen sowie Bananen, Kaffee und Kakao angebaut...<br />
Zu den Savannenzonen heisst es weiter (S. 106):<br />
...Durch Grosswildjäger und wirtschaftliche Nutzung sind die Wildbestände gefährdet. Deshalb wurden zum Schutz der<br />
Tiere Wildreservate eingerichtet, wie z. B. der Serengeti-Nationalpark in Tansania. Ackerbau wird vorrangig in der Feuchtund<br />
Trockensavanne betrieben., Hirse, Mais, Maniok, Baumwolle, Tabak und Erdnüsse sind wichtige Kulturen. Rinder,<br />
Schafe und Ziegen werden als Nutztiere gehalten. Die Nutzung der Savanne bringt ernsthafte Gefährdungen des<br />
Naturraumes...<br />
Damit spielt der Autor auf die beispielsweise auf der Seite 318 dieser Arbeit in Zitaten aus dem Lehrmittel<br />
"Unser Planet" von 1979-1980 diskutierten <strong>Pro</strong>bleme der Überweidung und Desertifikation an. Seite 106 zeigt<br />
auch eine Grafik "Kulturpflanzen Afrikas" in der für die Savanne Mais, Baumwolle, Hirse, Erdnüsse, Tabak,<br />
Maniok und Hirse; für den tropischen Regenwald Yams, Mais, Bananen, Kakao, Kaffee, Bataten und Maniok<br />
aufgeführt werden.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Der "Geo-Exkurs" auf der Seite 107 ist unter dem Titel "Ins dunkle Afrika" der Erkundung Afrikas durch die<br />
Europäer gewidmet. Die Seite zeigt eine Karte "Afrika - Erschliessung, Forschungsreisen" und ein Bild<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 381
"Afrika - Forschungsreise ins Unbekannte". Im Text schreibt der Autor unter der Überschrift "Abenteuer und<br />
Forscherdrang":<br />
Afrika verschloss lange Zeit den Europäern seine Geheimnisse. Im Altertum waren nur seine nördlichen Teile bekannt.<br />
Portugiesische Seefahrer segelten im 15. und 16. Jh. an der afrikanischen Küste entlang, um einen Seeweg nach Indien zu<br />
finden. Jedoch blieb über Jahrhunderte hinweg das Innere des Kontinents unbekannt...<br />
Als in Europa bereits Dampfmaschinen eingesetzt wurden und Eisenbahnen fuhren, waren weite Teile Afrikas noch weisse<br />
Flecken auf der Landkarte. Erst in der 2. Hälfte des l9. Jh. drangen Europäer in das Innerste Afrikas vor. Ihre Motive<br />
reichten von Abenteuer und Forscherdrang über den Aufbau christlicher Missionen bis hin zu wirtschaftlichen Interessen<br />
ihrer Auftraggeber.<br />
Eine wichtige Frage war die Erforschung des Gewässersystems als Transportweg Das Flusssystem des Kongo und die bis<br />
dahin nicht entdeckte Nilquelle waren von besonderem Interesse. Bei ihren Reisen nahmen die Forscher zahlreiche<br />
Strapazen auf sich. Zum einen waren die Naturgegebenheiten unwirtlich, zum anderen mussten die Forscher immer wieder<br />
die Gunst der Stammeshäuptlinge erwerben. um bestimmte Gebiete ungehindert durchreisen zu können. Zwei der<br />
bekanntesten Forscher waren die Briten Livingstone (1813-1873) und Stanley (1841-1904).<br />
Unter der Überschrift "Livingstone will die Nilquellen finden" fährt der Autor fort (S. 106):<br />
Livingstone kommt in der Mitte des l9. Jh. als Missionar nach Afrika. Er unternimmt drei grosse Forschungsreisen, um die<br />
Eingeborenen vom Christentum zu überzeugen und Handelswege ins Innere Afrikas ausfindig zu machen. Mit<br />
Ochsenkarren zieht er, von Einheimischen begleitet, durch unwegsames Gelände. Immer wieder wird er durch Regengüsse,<br />
aufgeweichten Boden, Stammeskämpfe und Krankheiten aufgehalten.<br />
Livingstone erkennt, dass der Sambesi nicht die erhoffte Wasserstrasse im Inneren Afrikas ist. Als erster Europäer sieht er<br />
die Victoriafälle und beschreibt sie als eindrucksvolles Naturschauspiel.<br />
Auf der Suche nach Nil- und Kongoquellen entdeckt Livingstone den Njassasee und andere Gewässer. Er unterliegt dem<br />
Irrtum, dass die Nebenflüsse des Kongo Lualaba und Luapula Quellflüsse des Nils seien.<br />
Leidenschaftlich kämpft er gegen den grausamen Sklavenhandel der Araber und Portugiesen. Selbst afrikanische<br />
Häuptlinge verkaufen Menschen gegen Waren. Zu jener Zeit hatten die Engländer den Sklavenhandel bereits verboten.<br />
Livingstone stirbt 1873 in Afrika. Er konnte das Nilrätsel nicht lösen. Ihm bleibt das Verdienst, als erster Europäer Afrika<br />
durchquert zu haben. Dabei entdeckte er wesentliche Teile des Gewässernetzes und widerlegte die Vorstellung der<br />
Europäer, dass das Innere Afrikas aus einer sandigen Hochfläche bestehe.<br />
David Livingstone (1813-1873), nach dessen Geburtsort die ehemalige Hauptstadt Malawis, Blantyre, benannt<br />
wurde, studierte Medizin in Glasgow und ging 1940 als Missionar ins heutige Botswana. Er unternahm mehre-<br />
re Erkundungsreisen im südlichen Afrika und gilt als erster Europäer, der dieses Gebiet erkundete. Sein Buch<br />
"Missionary Travels and Researches in South Africa" von 1857 machte ihn über Grossbritannien hinaus<br />
bekannt. Auf der Suche nach der Quelle des Nils starb Livingstone im Gebiet des heutigen Sambia.<br />
(Encarta 1997)<br />
4.38.1.2 Bevölkerung<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Die Seite 108 steht unter der Überschrift "Afrikas Bevölkerung". Eine Karte "Völker Afrikas" und drei Fotos<br />
"Berber", "Sudanneger" - zwei Erwachsene mit Tellern in den Unterlippen werden abgebildet - und<br />
"Buschmann", der auf einem Baum stehend Ausschau hält, ergänzen den Text, in dem es heisst:<br />
Die Einwohner Afrikas gehören unterschiedlichen Rassen an. Menschengruppen mit gleicher Abstammung und<br />
gemeinsamen körperlichen Merkmalen wie Hautfarbe, Körperbau und Gesichtsform gehören zu einer Rasse.<br />
Rassenmerkmale sind angeboren und nicht beeinflussbar. In Nordafrika leben Menschen, die zur hellhäutigen europiden<br />
Rasse gezählt werden. Angehörige der dunkelhäutigen negriden Rasse sind vorwiegend südlich der Sahara beheimatet.<br />
Völker sind Menschengruppen mit gemeinsamer Geschichte und einheitlicher Kultur. Ihre kulturellen Merkmale sind<br />
erworben und veränderbar. Wesentliche Kennzeichen für ein Volk sind seine Religion, Sprache, Lebensweise, Schrift,<br />
Kunst und Wirtschaft... zu den negriden Völkern Afrikas zählen die Sudanneger... und Buschmänner...<br />
Völker unterteilen sich wiederum in Stämme. Stammesmitglieder gehören einer Sprachgruppe an, haben ein<br />
Zusammengehörigkeitsgefühl und leben in einem geschlossenen Siedlungsgebiet.<br />
Innerhalb des Stammes bildet die gesamte Blutsverwandtschaft eines Familienmitgliedes eine Sippe. In der Sippe gibt es<br />
vom Ansehen her Rangordnungen.<br />
Als erstes der untersuchten Lehrmittel definiert das vorliegende die Begriffe "Rasse", "Volk", "Stamm" und<br />
"Sippe". Wird diese Definition als richtig betrachtet, obwohl beispielsweise der Rassenbegriff umstritten ist,<br />
dann wenden die meisten der untersuchten Lehrmittel zumindest den Begriff "Stamm" falsch an, da es sich bei<br />
den beschriebenen Volksgruppen um eigentliche Völker und nicht Stämme handelt. (Siehe dazu auch die<br />
Bemerkung auf der Seite 127 dieser Arbeit.) Auf der Seite 109 schreibt der Autor unter der Überschrift "Be-<br />
völkerungsverteilung", zu der auch eine Karte "Bevölkerungsdichte Afrikas" abgebildet ist:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 382
Der afrikanische Kontinent wird von etwa 650 Mio. Menschen bewohnt (1990). Die Bevölkerung ist sehr ungleichmässig<br />
verteilt... Weite Gebiete sind nicht oder nur sehr dünn besiedelt. Bestimmte Gunsträume, z.B. im Nildelta, in Nigeria und<br />
Südafrika, sind dicht besiedelt. Entscheidend für die unterschiedliche Verteilung der Bevölkerung sind neben den<br />
natürlichen Bedingungen vor allem die im Zuge der historischen Entwicklung entstandenen Wirtschafts- und<br />
Gesellschaftsformen.<br />
(Zur Bevölkerungsdichte siehe auch die Karte "Bevölkerungsdichte" im Anhang auf der Seite 568 dieser<br />
Arbeit.) Unter der Überschrift "<strong>Pro</strong>bleme des Bevölkerungswachstums", dazu findet sich eine Grafik "Bevölk-<br />
erungswachstum im Vergleich", schreibt der Autor (S. 109):<br />
Afrika weist durch sinkende Sterberaten bei gleichzeitig hohen Geburtenraten ein enormes natürliches Wachstum der<br />
Bevölkerung auf... Dadurch sind die meisten Länder Afrikas nicht in der Lage,<br />
- Nahrungsmittel in ausreichender Menge und Qualität bereitzustellen,<br />
- genügend Arbeitsplätze zu schaffen,<br />
- der Masse der Bevölkerung ein Einkommen zu sichern, von dem sie leben kann,<br />
- die Lebensbedingungen menschenwürdiger zu gestalten.<br />
Andere Autoren vertreten die Meinung, dass Schwarzafrika durchaus in der Lage sei, genügend Nahrungsmit-<br />
tel zu produzieren. Vor allem die Verteilung dieser sei das zentrale <strong>Pro</strong>blem. Ausserdem würde es den Bauern<br />
an Anreizen zur Mehrproduktion fehlen, da die Preise künstlich tief gehalten würden, damit die politisch als<br />
einflussreichere angesehene Stadtbevölkerung ruhig gehalten werden kann. Die FAO hingegen weist für viele<br />
schwarzafrikanischen Länder ein Nahrungsmitteldefizit aus. (FAO/GIEWS 1997, 1998; siehe dazu die Karte<br />
"Aussergewöhnliche Nahrungsmittelknappheit in afrikanischen Ländern" auf der Seite 578 dieser Arbeit.)<br />
Was der Autor unter menschenwürdigen Lebensbedingungen versteht, führt er weiter nicht aus. Er fährt fort:<br />
Hohe Geburtenraten bei gleichzeitiger Minderung der Sterberaten lassen den Anteil von Kindern, Jugendlichen und älteren<br />
Menschen, die im nichterwerbsfähigen Alter stehen, steigen. Die arbeitsfähige Bevölkerung muss mit ihrer Arbeit die<br />
Existenzgrundlagen für immer mehr Menschen erwirtschaften.<br />
Die erwerbstätige Bevölkerung Afrikas ist vorwiegend in der Landwirtschaft tätig. Die oft einfachen <strong>Pro</strong>duktionsweisen...<br />
begrenzen aber die Beschäftigungsmöglichkeiten. Da ausserdem die Arbeits- und Lebensbedingungen der<br />
Landbevölkerung schlecht sind, wandern viele Menschen in die Grossstädte..., besonders in die Hauptstädte, ab. Sie<br />
erhoffen sich dort Arbeit und ein besseres Leben. Die meisten von ihnen werden enttäuscht. Die Städte haben sowohl die<br />
Zuwanderer als auch den eigenen hohen natürlichen Zuwachs zu verkraften. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung,<br />
Ausdehnung der Slums, unzureichende oder fehlende Strom- und Wasserversorgung, Abwasser- und innerstädtische<br />
Verkehrsprobleme sind die Folgen.<br />
(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 335 und 393, zum Alltag in der Stadt siehe auch die Texte<br />
zum Stadtleben im Anhang ab der Seite 591 dieser Arbeit.)<br />
Trotz Abwanderungen steigt die Landbevölkerung weiter an. Bemühungen um Reduzierung des natürlichen<br />
Bevölkerungswachstums haben nicht die erwarteten Erfolge gebracht. Die Gründe dafür sind verschieden. Kinder sind in<br />
den afrikanischen Ländern oft die einzige Altersversicherung. Sie müssen arbeiten, damit die Familie überleben kann. In<br />
manchen Gebieten gilt eine hohe Kinderzahl als Segen der Gottheit. Das gesellschaftliche Ansehen der Eltern steigt mit der<br />
Anzahl der Kinder.<br />
(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seiten 362 und 426 dieser Arbeit.) Vor nicht allzulanger Zeit wurde auch in<br />
der Schweiz, vor allem in den katholisch geprägten Gebieten, eine hohe Kinderzahl als Segen Gottes<br />
betrachtet.<br />
4.38.1.3 Landwirtschaft<br />
Die Seite 110 schliesst den allgemeinen Teil zu Afrika mit einem Text "Landwirtschaft in Afrika" ab. Auf der<br />
gleichen Seite findet sich auch eine Grafik "Wirtschaftsformen in Afrika", in der die "Jagd- und Sammelwirt-<br />
schaft", die "Wanderviehzucht", der "Hackbau, meist in Verbindung mit Brandrodung", der "Pflugbau, z. T.<br />
mit Bewässerungsfeldbau" und die "Pflanzungen / Plantagenwirtschaft" aufgeführt werden. Im Text schreibt<br />
der Autor:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Weite Teile Afrikas bieten kaum Möglichkeiten einer landwirtschaftlichen Nutzung. Das betrifft vor allem die<br />
Wüstengebiete.<br />
Unter günstigeren Naturbedingungen hatten sich verschiedene Wirtschaftsformen entwickelt:<br />
Einige Stämme, z. B. die Pygmäen und Buschmänner, jagen wilde Tiere und sammeln Früchte und Wurzeln. Sie betreiben<br />
Jagd- und Sammelwirtschaft. Deshalb benötigen sie ein grosses Territorium, um leben zu können. Durch andere<br />
Nutzungsformen ist ihr Lebensraum bedrohlich eingeengt worden.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 383
(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seite 302, zu den "Pygmäen" die Seite 340 und 400 dieser Arbeit.)<br />
Die Nomaden leben hauptsächlich von Wanderviehzucht. Sie treiben ihre Herden durch die Savannen auf der<br />
Suche nach immer neuen Weideplätzen. Sie sind deshalb nicht sesshaft... <strong>Pro</strong>bleme treten auf, wenn in Trok-<br />
kenjahren nur wenige Weideplätze zur Verfügung stehen. Durch Überweidung kann wertvolles Weideland für<br />
immer vernichtet werden. Die Wüste breitet sich aus.<br />
(Siehe dazu auch die Seiten 353 dieser Arbeit.)<br />
Bei der Brandrodung werden Teile des tropischen Regenwaldes gerodet und abgebrannt. Die so gewonnenen Ackerflächen<br />
sind nur für kurze Zeit fruchtbar und müssen neu angelegt werden. Die Stämme "wandern" mit ihren Feldern durch den<br />
Urwald. Wichtigste Arbeitsgeräte sind Hacke und Grabstock. Daher wird diese Wirtschaftsform Hackbau genannt.<br />
Hackbau ist auch in den Savannen verbreitet.<br />
(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 341 und 385 dieser Arbeit.)<br />
Die traditionelle Landnutzung Afrikas dient meist der Selbstversorgung. Es wird nur so viel produziert, wie zum eigenen<br />
Leben benötigt wird. Aufgrund niedriger <strong>Pro</strong>duktivität werden keine <strong>Pro</strong>dukte vermarktet. Diese Wirtschaftsform wird<br />
auch Subsistenzwirtschaft genannt.<br />
Eine höher entwickelte, produktivere Form der Landwirtschaft ist der Pflugbau. Vor allem in den subtropischen Bereichen<br />
Afrikas... werden z.T. mit Bewässerung Erträge erreicht, die auf Vermarktung der landwirtschaftlichen <strong>Pro</strong>dukte<br />
ausgerichtet sind.<br />
Pflanzungen sind grosse landwirtschaftlich genutzte Flächen, die speziell für den Export angelegt wurden. Erfolgt eine<br />
Erstverarbeitung der <strong>Pro</strong>dukte vor Ort, spricht man von Plantagen. Da die <strong>Pro</strong>duktion ausschliesslich die Abnehmer<br />
bestimmten, kam es zu einseitiger Ausrichtung der Wirtschaft ganzer Länder. So sind z. B. in Kenia Sisal, in Angola<br />
Bananen und Kaffee, in Ghana Kakao favorisiert worden. Diese Monowirtschaft (Monokulturen) hat einseitige<br />
Abhängigkeit vom Weltmarkt zur Folge. Schwankende Marktpreise stürzen die Länder in starke Verschuldung...<br />
(Siehe dazu auch die Bemerkungen zu den Terms of Trade auf der Seite 322 dieser Arbeit.)<br />
4.38.1.4 Der Weg zum modernen Afrika<br />
In das Kapitel "Der Nil, Lebensader Ägyptens" ist auf der Seite 111 ein Geo-Exkurs "Afrika 1914 und heute"<br />
eingeschoben, der sich unter Zuhilfenahme zweier politischer Karten für die Jahre 1914 und 1993 mit der<br />
modernen Geschichte Afrikas beschäftigt:<br />
...Im 15./16.Jh. nahmen europäische, vor allem portugiesische Seefahrer Land in Afrika in Besitz. Das waren zunächst nur<br />
Stützpunkte an der Küste. Sie dienten vorrangig als Häfen für die Versorgung der Segelschiffe, die bis nach Indien<br />
vordrangen.<br />
Etwa zur gleichen Zeit begann eines der traurigsten Kapitel in der Geschichte Afrikas, die massenweise Versklavung der<br />
Negerbevölkerung. Im Jahre 1502 ging die erste Sklavenlieferung nach Amerika. In der "Neuen Welt" wurden billige<br />
Arbeitskräfte benötigt. Portugiesen waren die ersten Sklavenhändler, Engländer beteiligten sich später mit grossen<br />
Sklavenschiffen daran. Oft gelangte die "schwarze Ware" aus dem Inneren Afrikas durch arabische Händler an die Küsten,<br />
von wo aus sie weitertransportiert wurde. Auf den Schiffen waren die Sklaven angekettet oder gefesselt, lagen<br />
dichtgedrängt in den Stauräumen. Viele überlebten die Überfahrt über den Atlantik nicht. Etwa 25 bis 30 Mio. Neger, ein<br />
Viertel der damaligen Gesamtbevölkerung des Kontinents, sind versklavt worden.<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 369 und 407 dieser Arbeit.)<br />
In der zweiten Hälfte des l9. Jh. kam es zum grossen Wettlauf um Ländereien auf dem Kontinent Afrika. Durch mutige<br />
Erkundungsreisen... von Entdeckern angeregt, wollten europäische Herrscherhäuser so viel wie möglich von Afrika<br />
besitzen. England, Frankreich, Portugal, Spanien, Belgien, Italien und Deutschland nahmen Siedlungsgebiete der<br />
Eingeborenen in Besitz. Sie schlossen zunächst Handels- und Schutzverträge mit den Stammeshäuptlingen ab, festigten<br />
ihre Ansprüche auf die Küstenstreifen und machten diese zu Kolonien. Durch Verträge zwischen den Kolonialmächten<br />
wurde dann das oft kaum bekannte Hinterland schematisch aufgeteilt und unterworfen. Die Grenzen der so entstandenen<br />
Kolonien wurden ohne Rücksicht auf traditionelle Stammesgrenzen gezogen. Viele afrikanische Völker wurden so auf<br />
mehrere Kolonien verteilt, andererseits wurden verfeindete Stämme innerhalb einer Kolonie zusammengefasst.<br />
Interessant ist, dass in diesem Abschnitt, der auf die Kolonialgeschichte zurückblickt, die durch "mutige<br />
Entdeckungsreisen" angeregt wurde, plötzlich wieder von "Eingeborenen", "Stämmen" und "Häuptlingen" die<br />
Rede ist, wo eigentlich von "Einheimischen", "Völkern" und "Königen" gesprochen werden sollte.<br />
Die Kolonien waren in erster Linie Lieferanten für Rohstoffe in die europäischen "Mutterländer". Grossflächige<br />
Pflanzungen... zum Anbau landwirtschaftlicher Kulturen wurden angelegt, Bergbaubetriebe errichtet.<br />
(Siehe dazu auch die Besprechung des Lehrmittels "Länder und Völker" aus den sechziger Jahren, welches<br />
Afrika als Rohstofflieferant betrachtete, ab der Seite 190 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Nach 1950 wurden die Kolonien selbständig. Besonders in den 60er Jahren verbreitete sich die Unabhängigkeitsbewegung<br />
über den afrikanischen Kontinent wie ein Lauffeuer... Viele Länder sind noch heute durch Wirtschaft und Sprache eng an<br />
die ehemalige Kolonialmacht gebunden.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 384
(Siehe dazu auch die Karte "Offizielle Amtssprachen" im Anhang auf der Seite 572 dieser Arbeit) In einem<br />
zweiten Einschub zum Kapitel über Ägypten, einer Anleitung zu "Wir werten Texte aus" in der Form "Geo-<br />
Praxis", schreibt der Autor auf der Seite 116, sich auf verschiedene Textquellen beziehend:<br />
...Daher ist es wichtig, dass du Texte kritisch lesen und auswerten kannst, denn nicht alles, was gedruckt erscheint,<br />
entspricht den Tatsachen und ist aktuell.<br />
Ein Umstand, der schon Kästner bekannt war, als er schrieb: "Misstraut gelegentlich euren Schulbüchern! Sie<br />
sind nicht auf dem Berge Sinai entstanden, meistens nicht einmal auf verständige Art und Weise, sondern aus<br />
alten Schulbüchern, die aus alten Schulbüchern entstanden sind, die aus alten Schulbüchern entstanden sind,<br />
die aus alten Schulbüchern entstanden sind. Man nennt das Tradition." (Wort und Bild 1979, S. 208) Die<br />
weiteren Seiten zu Ägypten und dem Nil enthalten keine Stellen mehr, die im Rahmen dieser Arbeit von Inter-<br />
esse wären.<br />
4.38.1.5 Die Sahelzone<br />
Im Kapitel "Die Sahelzone - ein gefährdeter Lebensraum" schreibt der Autor auf der Seite 120, die eine Karte<br />
"Die Sahelzone" und zwei Fotos "Hirseanbau in Niger" und "Auch das Vieh ist von der Trockenheit bedroht"<br />
zeigt:<br />
Die Sahelzone ist ein etwa 400 km breiter Übergangsraum zwischen Sahara und Dornsavanne. Sie hat eine<br />
West-Ost-Ausdehnung von 5'000 km... Hier leben rund 30 Mio. Menschen. Sieben Staaten haben wesentlichen Anteil an<br />
diesem Gebiet... Die Übergänge und Grenzen dieses Raumes sind fliessend.<br />
Der Begriff "Sahel" kommt aus dem Arabischen und heisst "Ufer". Nach dem Durchqueren der lebensfeindlichen Wüste<br />
fanden die Menschen hier erste Zeichen von Vegetation und Wasser. Damit hatten sie das "rettende Ufer" der Savannen<br />
erreicht.<br />
Aber diese Zone ist ein dürregefährdeter Raum, wie häufige Dürreperioden beweisen (1910-1913, 1933-1934, 1940-1941,<br />
1968-1973, 1983-1985). Die Dürrekatastrophe von 1968 bis 1973 war besonders verheerend. 25 Mio. Stück Vieh<br />
verhungerten, verdursteten oder mussten notgeschlachtet werden. Mehr als 100'000 Menschen starben.<br />
In einem älteren Lehrmittel beläuft sich die Schätzung auf rund 250'000 "Hungertote". (Zu den Hungerkrisen<br />
Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 356 und 387 dieser Arbeit.) Im Text fährt der Autor zu den Ursachen der<br />
Dürre fort:<br />
Wesentliche Ursachen liegen in den klimatischen Bedingungen... Besonders Schwankungen oder Ausbleiben der<br />
Niederschlagsmengen erschweren Leben und Wirtschaft in dem Raum, denn dann verdorren die kargen Grasweiden...<br />
Diesen natürlichen Bedingungen haben sich die Menschen seit Jahrhunderten angepasst. Sie leben als Nomaden im Norden<br />
oder als sesshafte Hackbauern im Süden der Sahelzone.<br />
Die Seite 121 zeigt eine Karte "Wanderwege der Nomaden", die vorwiegend die Situation im Tschadgebiet<br />
wiedergibt und ein Foto "Hackbauern". Unter der Überschrift "Nomaden in der Sahelzone schreibt der Autor:<br />
Im nördlichen Teil der Sahelzone leben rund 5 Mio. Nomaden. Nur bei genügend Weideland und ausreichendem<br />
Wasserangebot haben sie eine Lebensgrundlage... Aufgrund des Geburtenüberschusses kam es zu einem raschen<br />
Bevölkerungszuwachs. Dieser erhöhte die Nachfrage nach Fleisch - ein Grund für die Erweiterung der Herden. Die<br />
Herdentiere fressen nicht nur Gras, sondern auch die Blätter der Bäume und Sträucher, die Ziegen selbst das Wurzelwerk.<br />
Die Vegetation wurde mehr und mehr zerstört und konnte sich nicht erholen.<br />
Die Neugeborenen der Nomaden, die zu einem guten Teil nicht zu den Schwarzafrikanern gehören, deren<br />
klare Unterscheidung und Trennung von jenen aber oft schwierig ist, werden also als "Geburtenüberschuss"<br />
bezeichnet.<br />
Unter der Überschrift "Hackbauern in der Sahelzone" schildert der Autor die zweite, vor allem gegen den<br />
Süden der Sahelzone praktizierte Wirtschaftsform (S. 121):<br />
Im südlichen Teil der Sahelzone wird Hackbau betrieben. Die Hackbauern roden und verbrennen Bäume, Sträucher und<br />
Gras. Dann wird der Boden mit der Hacke gelockert, die Asche kommt als Dünger in den Boden. Danach wird gesät (meist<br />
Hirse, es gibt 50 verschiedene Sorten, aber auch Mais und Gemüse). Nach 3-4 Jahren ist der Boden erschöpft.<br />
Die Hackbauern geben ihre Felder auf und erschliessen neue (Wanderfeldbau).<br />
Das ehemalige Ackerland bedeckt sich nach und nach mit Gras- und Buschvegetation und hat 20 bis 25 Jahre Zeit, sich zu<br />
erholen.<br />
(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 384 und 388 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Mit wachsender Bevölkerungszahl musste der Zeitraum des natürlichen Erholens des Bodens verkürzt werden, denn es<br />
wurden mehr Nahrungsmittel benötigt. Durch die Möglichkeit der chemischen Düngung konnte man den Ackerbau weiter<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 385
nach Norden ausdehnen. Unter Nutzung des Wassers aus dem Niger wurde zusätzlich der Anbau von exportorientierten<br />
Kulturen ermöglicht (Erdnüsse, Baumwolle und Sisal).<br />
Als "Folgen dieser übermässigen Nutzung" nennt der Autor (S. 121):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Bodenauslaugung mit nachfolgender Bodenaustrocknung und Auswehung durch Wind und Dünenbildung an<br />
windgeschützten Stellen. Diese Ausdehnung der Wüste nennen wir Desertifikation.<br />
Die Ernteerträge reichen nicht mehr aus, um die Bevölkerung zu ernähren.<br />
Eine weitere Ursache für die Dürre ist der hohe Verbrauch an Holz als Brennmaterial. Heute gibt es bereits bis zu 100 km<br />
baum- und buschlose Zonen im Sahel. Viele Menschen in den Savannen sind mit dem Sammeln von Holz für den<br />
Eigenverbrauch oder für den Verkauf beschäftigt. Der Anteil an baum- und buschlosen Zonen nimmt ständig zu. Sowohl<br />
die Nomaden als auch die Hackbauern haben das Gleichgewicht der Natur so gestört, dass die Auswirkungen der<br />
Dürreperioden verstärkt werden.<br />
Die Wüste breitet sich aus.<br />
(Zum Holzverbrauch als Ursache der Desertifikation siehe auch das Schema auf der Seite 334 dieser Arbeit.)<br />
Die Seite 122 zeigt ein Foto "Lebensmittellieferung in einem Flüchtlingslager im Sudan", sowie ein Schema<br />
"Ursachen für Dürre und Hilfsmöglichkeiten" in der als "Ursachen der Dürre" einerseits die "natürlichen Ursa-<br />
chen" aufgrund der klimatischen Voraussetzungen, andererseits die "vom Menschen bedingten Ursachen" wie<br />
"Bevölkerungswachstum, Vergrösserung der Viehherden, Bohrungen von Tiefbrunnen, Überweidung, Absin-<br />
ken des Grundwasserspiegels, Erweiterung des Anbaus von Exportkulturen, Vernichtung des Baumbestandes,<br />
Verschiebung des Anbaus nach Norden" aufgezählt werden, die teilweise bereits in den Texten "Nomaden in<br />
der Sahelzone" und "Hackbauern im Sahel" genannt wurden. All dies führe, so die Schlussfolgerung im Sche-<br />
ma zu "Erosion, Wüstenausdehnung, Wassermangel, Nahrungsmittelmangel" und schliesslich zum "Tod". Als<br />
"Hilfe für den Sahel" wird ein "Gleichgewicht der Natur", das "Leben" bedeute, angestrebt. "Familienplanung,<br />
Ausbildung von Fachleuten, Ausbau des Strassennetzes, Verringerung des Viehbestandes, Rückkehr zur tradi-<br />
tionellen Weidenutzung, Aussaat von Gras und Anpflanzen von Bäumen und Windschutzhecken, Rückverle-<br />
gung der nördlichen Ackerbaugrenze, Abkehr von Exportkulturen, Verstärkter Anbau von Grundnahrungsmit-<br />
teln, Neue Möglichkeiten für Energiegewinnung, Ersatz des Baummaterials Holz durch Lehmziegel, Eigene<br />
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher <strong>Pro</strong>dukte" sollen dazu beitragen, dieses Gleichgewicht zu<br />
ermöglichen. Jeder dieser Hilfsmassnahmen lässt sich jedoch mit einem Fragezeichen versehen, da sie den<br />
Gewohnheiten der Bewohner teilweise entgegenlaufen, z. B. die Familienplanung, und andererseits eine finan-<br />
zielle Basis erfordern, z. B. für die Ausbildung und anschliessende Bezahlung von Fachleuten - teilweise<br />
wandern diese nach vollendeter Ausbildung ins besser zahlende Ausland ab -, die oft nicht vorhanden ist.<br />
Ebenfalls auf der Seite 122 schreibt der Autor unter der Überschrift "Hilfe gegen den Hunger":<br />
Menschen der gesamten Welt sind bereit, den Menschen in den Entwicklungsländern und besonders auch den Bewohnern<br />
in der Sahelzone zu helfen... Wie aber sieht sinnvolle Hilfe aus?<br />
Droht der Hungertod, ist sicher kurzfristige Soforthilfe (Lebensmittellieferungen, Medikamente, Ärzte und<br />
Entwicklungshelfer) notwendig.<br />
Für langfristige Hilfen gibt es staatliche Massnahmen. So hat allein die Bundesrepublik Deutschland 1988 rund 8 Mrd. DM<br />
für Entwicklungshilfe weltweit bereitgestellt. Es gibt auch viele private und kirchliche Hilfsorganisationen. Klare<br />
Grundsätze aller Einrichtungen sind:<br />
- Hilfe für alle Menschen,<br />
- Beseitigung der Ursachen für Hunger und Unterernährung,<br />
- Unterstützung der Entwicklungsländer bei selbständigen Einzelmassnahmen,<br />
- Einbeziehung des Selbsthilfewillens der Bevölkerung,<br />
- Anregung der gesellschaftlichen Kräfte in den Entwicklungsländern, wie Kirchen, Gewerkschaften und Verbände.<br />
Es geht um die Entwicklung langfristiger Hilfen, die Soforthilfen einschliessen. Nur so kann erfolgreich auf Dauer<br />
geholfen werden...<br />
Michler führt an, dass die Entwicklungshilfeleistungen Deutschlands im Zeitraum 1965-1986 von 0.48% des<br />
Bruttosozialproduktes auf 0.37% gefallen seien. (Michler 1991, S. 487) Ausserdem soll die Weltbank in ihrem<br />
Entwicklungsbericht 1990 festgestellt haben, dass "die Entwicklungshilfe versagt habe, die Armut in den<br />
meisten Länder zu reduzieren. Die Armut zu verringern sei oft nur ein untergeordnetes Motiv der Geber gewe-<br />
sen..." (Michler 1991, S. 524; zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 364 und 397 dieser Arbeit.)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 386
4.38.1.6 "Hungergürtel der Erde"<br />
Auf der Seite 123 findet sich ein Geo-Exkurs unter dem Titel "Hungergürtel der Erde". Die Seite bildet ein<br />
Foto "Hungernde Kinder" aus Afrika ab, zu dem es im Text heisst:<br />
- Über 500 Mio. Menschen sind dauernd unter- oder mangelernährt (fast so viele Menschen, wie in Europa leben),<br />
darunter 200 Mio. Kinder.<br />
- jährlich sterben 50 Mio. Menschen verschiedener Altersgruppen an Hunger.<br />
- Täglich sterben etwa 139'000 Menschen, davon 40'000 Kinder.<br />
- 17 Mio. Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Terror und Hunger.<br />
Zu einer Karte "Hungergürtel der Erde" schreibt der Autor (S. 123):<br />
Auf der Karte... erkennst du, dass die meisten Hungergebiete in den Entwicklungsländern liegen. Besonders krass ist dies<br />
in Afrika erkennbar...<br />
Die Welternährungsorganisation der UNO, die FAO, und andere Hilfsorganisationen weisen ständig auf das<br />
Hungerproblem der Welt und dessen Folgen hin und leiten Schritte ein, die Not zu lindern.<br />
Auf der Karte werden die Staaten Senegal, Mauretanien, Burkina Faso, Mali, Niger, Tschad, Äthiopien und<br />
Mosambik als von "Hungersnot" betroffene Gebiete ausgewiesen. Die Länder Algerien, Sudan, Somalia,<br />
Kenia, Tansania, Uganda, Burundi, Ruanda, Malawi, Zaire, Angola, Nigeria, Guinea und Guinea-Bisseau sind<br />
nach der Karte von der "Gefahr von Hungersnot" bedroht. Die restlichen Staaten weisen die gleiche Einfär-<br />
bung wie beispielsweise Europa ein, die nicht näher kommentiert wird. Auffallend an der Weltkarte ist, dass<br />
ausserhalb Afrikas kein Gebiet als unter einer "Hungersnot" leidend angegeben wird.<br />
Eine weitere Karte "Hunger in Afrika (Stand 1993)" bezeichnet ganz Ost- und Südafrika als "Dürrezone",<br />
ausserdem sind "Länder mit einem jährlichen Bevölkerungswachstum von mehr als 3%" eingefärbt und die<br />
Länder Liberia, Angola, Sudan, Äthiopien, Somalia, Ruanda, und Mosambik werden als "Länder, die unter<br />
Bürgerkrieg oder dessen Folgen leiden" bezeichnet. (Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die<br />
Seiten 385 und 392 dieser Arbeit.) Im Text führt der Autor weiter aus (S. 123):<br />
Hunger ist die brutalste Form menschlicher Hilflosigkeit. Chronischer Hunger verursacht ständige körperliche Qual, denn<br />
dauerhafter Nahrungsmangel führt zur Selbstverzehrung des Körpers:<br />
- Zunächst werden die Fettreserven verbraucht, dann die Skelettmuskeln; die Knochen werden brüchig.<br />
- Wenn Eiweiss, Vitamine und Mineralstoffe knapp werden, verliert der Körper seinen Schutz gegen<br />
Infektionskrankheiten .<br />
- Da die Abwehrstoffe fehlen, kann man bereits an leichten Krankheiten sterben.<br />
- Zuletzt werden lebenswichtige Organe wie Herz, Gehirn und Rückenmark aufgezehrt.<br />
- Zuerst sterben die Schwächsten: Kinder, Alte, Frauen.<br />
- Kinder, die Mangel- und Unterernährung überleben, sind für ihr Leben gekennzeichnet (körperliche, geistige und<br />
seelische Behinderungen).<br />
Im Gegensatz zum Lehrmittel "Terra Geographie" von 1979 (Bd. 1, S. 182) ist hier nicht mehr von "Ver-<br />
dummung" die Rede, obwohl mit "geistiger Behinderung" dasselbe gemeint ist.<br />
In der Geo-Praxis "Wir gestalten eine Wandzeitung" auf den Seiten 124-125 erklärt der Autor, wie eine solche<br />
erstellt werden kann. Von den fünf abgebildeten Beispielen zeigen zwei hungernde afrikanische Kinder.<br />
4.38.1.7 "Wirtschaftsraum Kongobecken"<br />
Das nächste Kapitel auf den Seiten 126-129 steht unter dem Titel "Wirtschaftsraum Kongobecken". Zur Lage<br />
des Beckens schreibt der Autor auf der Seite 126:<br />
...Der grösste Teil des Beckens gehört zum Staatsgebiet der Republik Zaire. Der nördliche Teil des Kongobeckens liegt in<br />
der Republik Kongo und in der Zentralafrikanischen Republik. Der Zaire (Kongo) entwässert das Becken.<br />
Über den Fluss, der das riesige Becken entwässert schreibt der Autor unter der Überschrift "Der 'Grosse Fluss'"<br />
(S. 126):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Kongo bedeutet auf Bantu oder Suaheli der "grosse Fluss". Er wurde durch den Engländer Stanley von 1874 bis 1877 im<br />
belgischen Auftrag erkundet. Er beginnt dort, wo sich die Flüsse Lualaba und Luapula vereinen. Heute trägt er zwei<br />
Namen. In Zaire heisst der Strom seit 1871 wie das Land selbst. Die Volksrepublik Kongo behielt den Flussnamen Kongo<br />
bei... Das Flusssystem des Kongo hat 200 grosse Nebenflüsse und über 13'000 km schiffbare Wasserstrassen. Der Strom<br />
selbst ist auf 2'700 km schiffbar. Er bildet damit den wichtigsten natürlichen Verkehrsweg des Beckens. Zahlreiche<br />
Stromschnellen und Wasserfälle schränken die Binnenschiffahrt jedoch erheblich ein. Hier löst man das <strong>Pro</strong>blem der<br />
Warenbeförderung durch den Wechsel der Verkehrsträger (Binnenschiffahrt - Eisenbahn).<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 387
Die gewaltigen Wassermassen des Kongo und seiner Nebenflüsse ermöglichen die Erzeugung von Elektroenergie in<br />
Wasserkraftwerken.<br />
"Kongo bedeutet auf Bantu oder Suaheli 'grosser Fluss'" so schreibt der Autor. Damit begeht er den gleichen<br />
Fehler wie wenn jemand fragen würde, ob ein Schweizer "Europäisch" sprechen würde, denn "Bantu" ist ein<br />
Sammelbegriff für eine grosse Gruppe von Völkern, die sich fast über das ganze südliche Afrika ausgebreitet<br />
haben und deren Sprachen entsprechend grosse Unterschiede zueinander aufweisen. Neben dem Text bildet die<br />
Seite 126 auch zwei Karten "Kongobecken" und "Stromgebiet des Kongo" ab. Auf der Seite 127 bespricht der<br />
Autor die klimatischen Verhältnisse des tropischen Regenwaldes, bevor er unter der Überschrift "Brandrodung<br />
und Wanderfeldbau" auf die vorherrschende Wirtschaftsform der Bewohner dieses Grossraumes zu sprechen<br />
kommt:<br />
Etwa 70% der Bevölkerung Zaires lebt von der Landwirtschaft. Sie betreiben Selbstversorgungswirtschaft<br />
(Subsistenzwirtschaft) mit gelegentlichem Verkauf von Überschüssen. Es herrscht Wanderfeldbau mit Brandrodung vor...<br />
Die Vorfahren der Bantu haben vor Hunderten von Jahren in den Savannen gelebt und dort gejagt und Felder bestellt. Als<br />
sie in den tropischen Regenwald abgedrängt wurden, haben sie ihre Wirtschaftsformen erhalten. Sie schlagen mit Äxten<br />
und Buschmessern die Sträucher und kleinen Bäume ab. Die Stämme einzelner grosser Bäume werden rund herum<br />
eingekerbt (geringelt), damit die Stämme absterben und austrocknen. Das nun dürr gewordene Holz wird verbrannt. Die<br />
Asche sowie vermoderte Zweige und Laub düngen den Boden.<br />
Die gerodeten Inseln sehen nach unseren Vorstellungen "unordentlich" aus. Die Bantu bauen ihre Pflanzen meist in<br />
Mischkulturen an, z. B. Mais und Maniok, Bananen, Erdnüsse und Zwiebeln. Der Boden wird mit der Hacke nur dort<br />
gelockert, wo eine Pflanze eingesetzt wird. Er wird nicht zusätzlich gedüngt, denn Naturdung fehlt. Mineralischer Dünger<br />
würde ausgewaschen werden und ist ausserdem zu teuer. Die so bestellten Flächen können nur wenige Jahre genutzt<br />
werden, da die Bodenfruchtbarkeit schnell nachlässt. Die Erntemengen verringern sich, und der Urwald wuchert wieder auf<br />
den Flächen (Sekundärwald).<br />
Die Hackbauern geben dann diese Felder auf und erschliessen andere Flächen des Urwaldes in der Nähe ihres Dorfes. Die<br />
Abstände der Ackerflächen zum Dorf werden dabei immer grösser, denn die brachliegenden Flächen sollen 20 bis 25 Jahre<br />
ruhen. Wird die Entfernung zur Siedlung zu gross, muss auch diese aufgegeben werden.<br />
Diese Wirtschaftsform wird Wanderhackbau genannt. Heute werden die gleichen Flächen bereits nach 10 Jahren wieder<br />
durch Brandrodung genutzt. Das hat seine Ursache im grösseren Nahrungsmittelbedarf der wachsenden Bevölkerung. In<br />
der kurzen Brachzeit entsteht kein Wald, sondern nur Buschbrache. Auch der Boden erreicht nicht mehr seine<br />
ursprüngliche Fruchtbarkeit. Dadurch verringern sich die Ernteerträge.<br />
(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 385 und 400 dieser Arbeit.)<br />
In wenigen Gebieten wird die Methode des "Dauerfeldbaus" genutzt. Hier werden nur das Unterholz und kleinere Bäume<br />
abgeschlagen. Die grossen Bäume bleiben stehen und spenden Schatten... Das abgeschlagene Material bleibt am Boden<br />
liegen. Zusätzlich werden Sträucher und Kräuter aus dem Urwald geholt und auf den Boden gelegt. Es dauert nur wenige<br />
Monate, dann hat das feucht-warme Klima das umherliegende Material zersetzt. Damit wird der Boden gedüngt. Angebaut<br />
werden Dauerkulturen, die hauptsächlich aus Fruchtbäumen und -sträuchern bestehen.<br />
Der Text wird unterstützt durch zwei Fotos "Brandrodung" und "Hackbau" sowie einer Grafik "Dauerfeldbau".<br />
Die Seite 129 beschäftigt sich mit den "Staaten des Kongobeckens - Lieferanten wichtiger Rohstoffe". Zu<br />
diesem Thema enthält die Seite eine Karte "Lage der Region Schaba", in welcher der "Kupfergürtel" im<br />
Grenzgebiet zwischen Zaire und Sambia und die grossen Bahnlinien des südlichen Afrikas eingezeichnet sind.<br />
Eine Tabelle zu den "Bergbauerzeugnissen in Zaire und Deutschland" lässt einen Vergleich im genannten<br />
Wirtschaftssektor der beiden Länder zu. Dabei fallen vor allem die grosse Kupfererz- (291'000 Tonnen), sowie<br />
Silber- (50'000 Tonnen) und Zinkgewinnung (62'000 Tonnen) Zaires auf. Die 1.5 Mio. Tonnen Erdöl nehmen<br />
sich dagegen mit der mehr als doppelt geförderten Menge Deutschlands als eher bescheiden aus. Ausserdem<br />
fördert das Land nach der Tabelle 19.4 Mio. Karat Diamanten. Eine weitere Tabelle "Exporte von Kongo und<br />
Zaire" zählt als Exporte der Republik Kongo Zuckerrohr, Erdnüsse, Palmöl, Kautschuk, Kaffee, Kakao, Zink,<br />
Eisen, Kali und Erdöl auf, während für Zaire Baumwolle, Kaffee, Palmöl, Kautschuk, Diamanten, Kobalt,<br />
Uran, Kupfer und Erdöl genannt werden. Im Text schreibt der Autor (S. 129):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Während die für den Export bestimmten Güter hauptsächlich aus dem Kongobecken kommen, werden die<br />
Bergbauprodukte vor allem am Rande des Beckens gefördert. Ein Bergbaugebiet von Weltrang ist die Südprovinz Zaires,<br />
Schaba (Katanga). Seit 1891 wird neben Gold und Diamanten vor allem Kupfer abgebaut. Diese Lagerstätte ist 300 km<br />
lang und 50-80 km breit und gehört zum 800 km langen "Copperbelt", der bedeutendsten Kupferlagerstätte der Welt. Die<br />
Kupfererze werden im Tagebau gewonnen... Der Kupfergehalt liegt sehr hoch (3 bis 4%, max. 6%). Kobalt- und Zinkerze,<br />
Begleiter des Kupfererzes, werden ebenfalls abgebaut.<br />
Der Transport der Bergbauprodukte über den Kongo... war kaum möglich. Zudem lassen sich nur angereicherte Erze<br />
kostengünstig über grosse Entfernungen transportieren. Deshalb wurde schon zur Kolonialzeit die Entwicklung des<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 388
Bergbaus in Verbindung mit dem Bau der Schwerindustrie vor Ort gefördert. Riesige Tagebaue..., Hüttenwerke und<br />
Halden bestimmen das Landschaftsbild und schaffen erhebliche Umweltprobleme.<br />
Vier Grosskraftwerke mit 50 bis 276 MW Leistung nutzen die Wasserkraft. Kalkvorkommen erweitern die industriellen<br />
Möglichkeiten des Raumes. Die Arbeitskräfte für diesen eigentlich dünnbesiedelten Raum wurden durch eine gezielte<br />
Ansiedlungspolitik angeworben, so dass die Städte Lubumbaschi, Likasi und Kolwesi über ein ausreichend ausgebildetes<br />
Arbeiterangebot verfügen.<br />
Die wirtschaftliche Entwicklung ist durch folgende <strong>Pro</strong>bleme gekennzeichnet:<br />
- Abnahme des Wertes der Rohstoffe durch zunehmende Anwendung von Ersatzstoffen in den Industrieländern,<br />
- Sinken der Rohstoffpreise,<br />
- Rückgang des Bergbaus,<br />
- Binnenlage des Gebietes,<br />
- unzureichende Verkehrserschliessung und -anbindung (z.B. Schliessung der Benguelabahn in Angola 1975, Schaffung<br />
der Verbindung durch Mosambik nach Beira 1976, Bau der Tansam-Bahn nach Daressalam 1976),<br />
- Verluste von Waggons und Waren durch Diebstahl auf Schienen und Strassen sowie durch Zerstörung.<br />
Neben den äusseren Schwierigkeiten geben die aufgezählten Gründe auch Aufschluss über innere <strong>Pro</strong>bleme,<br />
wie hohe Kriminalität, auf die der Autor aber nicht weiter eingeht. (Zur Demokratischen Republik Kongo<br />
siehe auch die Seite 370 dieser Arbeit.)<br />
4.38.1.8 Ostafrika<br />
Nach der Betrachtung des Kongobeckens wendet sich der Autor Ostafrika zu, das anhand des Kapitels "Kenia -<br />
Land der Gegensätze" auf den Seiten 130-132 vorgestellt wird. Eine Karte auf der Seite 130 "Landnutzung<br />
Kenias" unterscheidet die folgenden Formen der Landnutzung: die "kleinbäuerliche Landwirtschaft" mit<br />
"Regenfeldbau" und die "grossbetriebliche Landwirtschaft" mit "gemischter Farmwirtschaft, Weidewirtschaft,<br />
traditioneller Weidewirtschaft, Forstreservaten, Nationalparks und Wildschutzparks". Einleitend zum Thema<br />
schreibt der Autor (S. 130):<br />
Bis zur Besitznahme des Landes durch die Briten im Jahre 1890 wohnten auf dem heutigen Staatsgebiet Kenias 2 Mio.<br />
Menschen. Sie betrieben zur Eigenversorgung Ackerbau und Wanderviehzucht. Inzwischen ist die Bevölkerung auf<br />
24.4 Mio. (1989) angestiegen .<br />
Da die Bevölkerung jährlich stark zunimmt, schätzt man, dass im Jahr 2000 das Land etwa 50 Mio. Menschen ernähren<br />
muss. Schon heute werden Nachteile dieses Bevölkerungswachstums in der ständig steigenden Landnot, der<br />
Vegetationsvernichtung mit folgender Bodenerosion, zunehmender Verarmung und den sozialen Gegensätzen deutlich.<br />
Unter der Überschrift "Natürliche Voraussetzungen" fährt der Autor fort (S. 130):<br />
Wie kein anderes Land Afrikas weist Kenia... grosse klima- und lagebedingte Landschaftsgegensätze innerhalb eines<br />
kleinen Raumes auf. Entsprechend der Vielfalt der Standortbedingungen ist es möglich, landwirtschaftliche Nutzpflanzen<br />
der Tropen, Subtropen und gemässigten Zone anzubauen.<br />
Da nur ein Fünftel des Landes für den Regenfeldbau bei Niederschlägen über 750 mm geeignet ist, leben hier neun Zehntel<br />
der Bevölkerung. Vor allem sind es Angehörige verschiedener Bantuvölker mit einer sehr langen Ackerbautradition sowie<br />
in jüngster Zeit sesshaft gewordene Hirten. Darüber hinaus nutzen Wanderviehzüchter die Savannen.<br />
Und zu der "kleinbäuerlichen Nutzung", heisst es (S. 130):<br />
Die jährlichen Niederschlagsmengen, deren Verteilung, die unterschiedliche Bodenfruchtbarkeit, die Höhenlage, die<br />
Betriebsgrössen, die Nähe zu Märkten sowie die Verkehrsanbindung bestimmen die Formen agrarischer Nutzung.<br />
Demzufolge sind in Kenia zu unterscheiden: der Regenfeldbau von der extensiven Weidewirtschaft sowie klein- von<br />
grossbäuerlichen Betrieben.<br />
Einen intensiven Regenfeldbau finden wir vor allem in den Höhenlagen um 1500 m. Kleinbauern betreiben dort auf 1-4 ha<br />
grossen Flächen... traditionellen Hackbau zunächst zur Eigenversorgung. Mais und Hirse sind die Hauptnahrungsmittel. Sie<br />
werden durch Bananen, Süsskartoffeln und verschiedene Gemüsearten ergänzt. Grössere Betriebe bauen für den Export<br />
Kaffee und Tee.<br />
Die Seite 131 zeigt zwei Fotos "Felder im Hochland von Kenia" und "Früchte des Kaffeestrauches". Im Text<br />
fährt der Autor über die landwirtschaftliche Nutzung fort:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Zudem begünstigen die Hochländer eine moderne Viehhaltung, indem die Bauern ihre Tiere aufstallen und mit dem<br />
Stallmist die Felder düngen. Inzwischen sind für viele Bauernfamilien die Erlöse aus dem Verkauf von Milch zu einer<br />
bedeutenden Einnahmequelle geworden.<br />
Die übrigen Höhenstufen sind ebenfalls gekennzeichnet durch vorherrschende Subsistenzwirtschaft kleinbäuerlicher<br />
Betriebe. Sie bauen für die Eigenversorgung z. B. Mais, Hülsenfrüchte, Hirse und Süsskartoffeln und für den Export u.a.<br />
Erdnüsse, Baumwolle und Sisal an. Während in niederschlagsreichen Jahren Überschüsse erwirtschaftet und vermarktet<br />
werden können, müssen Bauern in Dürrejahren Nahrungsmittel mit dem Erlös aus Viehverkäufen hinzukaufen.<br />
Im vom Monsun beeinflussten schmalen Küstenstreifen stehen auf den Rodungsflächen des Feuchtwaldes Apfelsinen-,<br />
Zitronen- und Pampelmusenpflanzungen. Darüber hinaus werden neben Mais u. a. Baumwolle, Ananas, Zuckerrohr und<br />
Sisal angebaut. Im Norden ist das Gebiet infolge der Verseuchung durch die Tsetsefliege (Verbreiter der Schlafkrankheit)<br />
kaum besiedelt...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 389
Zu der Bewirtschaftung der trockenen Gebiete Kenias schreibt der Autor unter der Überschrift "Wandel der<br />
traditionellen Weidewirtschaft" auf der Seite 131:<br />
Etwa vier Fünftel der Fläche Kenias erhalten weniger als 750 mm Jahresniederschlag. Daher werden die natürlichen<br />
Weiden der Savanne nur extensiv durch Wanderviehzucht genutzt. Etwa die Hälfte aller Rinder und Schafe sowie drei<br />
Viertel aller Ziegen des Landes weiden hier. Dieses Gebiet ist der Wirtschaftsraum der nomadisch lebenden Bevölkerung.<br />
Sie umfasst etwa ein Zehntel der Gesamtbevölkerung Kenias. Dennoch ist die Bevölkerungsdichte von 4-10 Menschen pro<br />
km 2 zu hoch, da viehreiche Familien stärker das Weideland beanspruchen als vieharme. Eine Überweidung mit<br />
Vernichtung der Futtergräser, Aufkommen einer unproduktiven Buschvegetation, qualitativ schlechtem Viehbestand und<br />
Erosion sind die Folgen. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die Anlage von Tiefbrunnen und zusätzlichen<br />
Wasserstellen.<br />
Die Bemühungen, die herkömmliche Weidenutzung zu verbessern, reichen bis in die dreissiger Jahre zurück. Mit geringem<br />
Erfolg wurde damals wie heute versucht, die Hirten zur Unterteilung ihrer genutzten Weideflächen anzuregen, um so ein<br />
Nacheinander der Beweidung zu ermöglichen. Nur so könnten sich die Pflanzen wieder erholen. Ausserdem würde<br />
dadurch die Gefahr des Vordringens der Wüste (Desertifikation) gemindert.<br />
Zu den Formen der "Grossbetriebswirtschaft" schreibt der Autor auf den Seiten 131-132:<br />
Während der britischen Kolonialzeit veränderte sich die Landnutzung Kenias:<br />
- europäische Einwanderer wandelten mit Hilfe der Einheimischen etwa 3 Mio. ha Savannenland in Plantagen, Guts- und<br />
Weidewirtschaftsbetriebe um,<br />
- indische Einwanderer legten Zuckerrohrplantagen an und<br />
- die einheimischen Bauern begannen, neben der selbstversorgenden Landwirtschaft auf kleinen Flächen marktorientiert<br />
zu wirtschaften.<br />
Diese "Hilfe der Einheimischen" wurde mit Gewalt erzwungen und die Eigenproduktion für den Export mit<br />
Hilfe der bereits mehrfach erwähnten Kopfsteuer gefördert. Weiter schreibt der Autor:<br />
Vor der Gründung der Republik Kenia (1963) bewirtschafteten überwiegend exportorientierte Grossbetriebe 3.1 Mio. ha.<br />
Da das Bevölkerungswachstum in einigen Gebieten zu einer Landnot führte, verteilte man 400'000 ha an kenianische<br />
Bauernfamilien .<br />
Die in den Regenfeldbaugebieten gelegenen Grossbetriebe bauen v. a. Mais und Weizen an. In gutentwickelten Regionen<br />
wird Feldgraswirtschaft betrieben, indem 1/3 der Betriebsfläche als Ackerland, der Rest als Brache weidewirtschaftlich<br />
genutzt wird... Zuckerrohr, Tee, Kaffee... und Sisal werden auf Plantagen angebaut.<br />
Im Gegensatz zu früher können heute Kleinbauern Kaffee erzeugen. Allerdings müssen sie einer Genossenschaft<br />
angehören. Sie berät die Bauern, stellt ihnen Betriebsmittel zur Verfügung, organisiert die Bearbeitung und Vermarktung.<br />
Inzwischen haben die kleinbäuerlichen Betriebe einen Anteil von 50% an der Kaffeeproduktion des Landes.<br />
(Zum Anbau von Kaffee siehe auch die Seiten 346 und 405 dieser Arbeit.) Der letzte Abschnitt des Kapitels zu<br />
Kenia steht unter der Überschrift "Ferntourismus, ein Wirtschaftsfaktor?" Im Text schreibt der Autor dazu auf<br />
der Seite 132:<br />
Ein Reiseveranstalter wirbt für Kenia: "Erleben Sie Afrika hautnah! Geländewagensafaris und Pirschfahrten vermitteln<br />
Ihnen einen Hauch von Abenteuer und Romantik. Lernen Sie die faszinierende Tierwelt und Vegetation des Landes<br />
kennen. Begegnungen mit den Eingeborenen in ihren ursprünglichen Dörfern vermitteln Ihnen Einblicke in ostafrikanische<br />
Lebensweisen...".<br />
1987 verbuchte Kenia 662'000 Übernachtungen, 976'600 Nationalparkbesucher sowie 5.8 Mrd. kenianische Schilling (=<br />
203 Mio. DM) als Einnahmen aus dem Tourismus.<br />
Der kurze Text, indem wieder einmal von "Eingeborenen" die Rede ist, wird unterstützt durch die Fotos<br />
"Geländewagensafari" und "Feriensiedlung in Kenia". Zusätzlich enthält die Seite einen Textkasten "Leistet<br />
Tourismus Entwicklungshilfe?" in dem zu den vier Thesen "Tourismus bringt dem Land Devisen", "Tourismus<br />
schafft Arbeitsplätze", "Tourismus erhöht den Lebensstandard" und "Tourismus verbessert die Infrastruktur" je<br />
ein Argument und ein Gegenargument angeführt werden. (Zum Tourismus siehe auch die Seiten 360 und 405<br />
dieser Arbeit.) Der Autor gibt also einen vielfältigen Einblick in die Wirtschaftsformen Kenias. Dabei fehlen<br />
aber sowohl Hinweise auf das kulturelle und politische Leben, als auch auf die Lebensweise der Bevölkerung<br />
in den grossen Städten Kenias. (Zu Kenia siehe auch die Seiten 359 und 404 dieser Arbeit.)<br />
4.38.1.9 "Exportabhängigkeit afrikanischer Staaten"<br />
Auf der Seite 133 folgt ein weitere "Geo-Exkurs" unter dem Titel "Exportabhängigkeit afrikanischer Staaten",<br />
in dem der Autor schreibt:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Im Welthandel spielen die Entwicklungsländer nur eine Nebenrolle... Viele Entwicklungsländer sind noch immer vom<br />
Export einiger weniger Rohstoffe aus der Landwirtschaft oder dem Bergbau abhängig... Dies ist seit der Kolonialzeit so,<br />
denn die Kolonialmächte brauchten Rohstofflieferanten und Absatzmärkte. Obwohl die meisten afrikanischen Staaten seit<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 390
1960 politisch unabhängig sind, hat sich an diesem Zustand bis heute wenig geändert. Für viele von ihnen bringt die<br />
Spezialisierung der Wirtschaft auf Rohstoffexport Nachteile:<br />
- Die Selbstversorgung des Landes mit Nahrungsmitteln ist gefährdet.<br />
- Es entstand keine eigene Industrie, und damit wurden Importe notwendig.<br />
- Es kann zu einem Überangebot an Rohstoffen kommen, das die Welthandelspreise drückt.<br />
- Durch die Entwicklung neuer Rohstoffe ist der Bedarf an herkömmlichen Rohstoffen gesunken.<br />
- Die Preise für Agrarprodukte und Rohstoffe sind weltweit sehr gesunken, aber die Preise für fertige (veredelte)<br />
Industriewaren steigen ständig.<br />
Die Folgen dieser Entwicklung werden anhand des Beispiels Burundi nach Michlers "Weissbuch Afrika"<br />
aufgezeigt:<br />
Das Land Burundi erwirtschaftet durch den Kaffee-Export Devisen. Von 1989 bis 1990 fiel der Kaffeepreis um 50%.<br />
Damit erhält Burundi bei gleichem Kaffee-Export nur noch halb so viel Devisen wie 1989. Es musste also seine Importe<br />
um 50% kürzen, um so viel Geld wie 1989 einzunehmen. Allerdings: Das Land ist bereits stark verschuldet. Die Tilgungsund<br />
Zinszahlungen sinken aber nicht wie der Kaffeepreis.<br />
Wenn das Land seine Schulden weiter abzahlen will, bleibt ihm nur noch l/5 der erwirtschafteten Devisenmenge. Also<br />
muss es entweder seine Zahlungsunfähigkeit erklären oder seine Importe radikal drosseln. Beides hat für die Bevölkerung<br />
katastrophale Auswirkungen (weniger Nahrungsmittel, weniger Medikamente, weniger Fertigprodukte, usw.). Ähnlich<br />
geht es vielen Kaffee-exportierenden Ländern...<br />
Weiter schreibt der Autor zum Thema des Preiszerfalles bei den Rohstoffen:<br />
Für Fertigwaren müssen die Entwicklungsländer trotz fallender Rohstoffpreise wesentlich mehr bezahlen. 1985 verkaufte<br />
die Bundesrepublik Deutschland einen LKW (6 bis 10t) für umgerechnet rund 92 Sack Kaffee (zu je 60 kg). 1990 erhielt<br />
sie für den gleichen LKW 332 Sack Kaffee. Anders gesagt, die Entwicklungsländer konnten mit der gleichen gelieferten<br />
Menge Kaffee nur noch ein Viertel des Warenumfangs einkaufen. Um wenigstens grundlegende Lebensbedingungen im<br />
Land abzusichern, müssen sie über Auslandsschulden weiter im alten Umfang importieren. Auch eigene Exporterhöhung,<br />
bringen keine Lösung, denn sie stoppen die Entwicklung im Land. Dieser Teufelskreis kann nur durch gleichberechtigte<br />
Zusammenarbeit der Länder unterbrochen werden.<br />
(Zum Anbau von Kaffee siehe auch die Seite 112 dieser Arbeit.) Die Aussagen des Textes werden in der Form<br />
einer Karikatur "Ist dir klar, dass ich dich in der Hand habe", welche gegenseitige Abhängigkeiten zwischen<br />
Nord und Süd zu veranschaulichen versucht und die bereits in den Lehrmitteln "Unser Planet" von 1979-1982<br />
(Bd. 3, S. 185) und "Geographie der Kontinente - Lehrerkommentar" von 1987 (S. 227) abgedruckt wurde, und<br />
einer Tabelle "Exportgüter ausgewählter Entwicklungsländer in <strong>Pro</strong>zent ihrer gesamten Exporte (1991)" (hier<br />
gekürzt wiedergegeben) unterstützt.<br />
Land Anteil am Gesamtexportvolumen <strong>Pro</strong>dukt<br />
Tschad 87% Baumwolle<br />
Sambia 81% Kupfer<br />
Mauretanien 83% Eisenerz<br />
Ghana 60% Kakao<br />
Uganda 95% Kaffee<br />
Liberia 70% Eisenerz<br />
Nigeria 95% Erdöl<br />
Burundi 90% Kaffee<br />
Somalia 75% Vieh<br />
(Siehe dazu auch die Tabelle und die Karte "Abhängigkeit von Exportgütern" im Anhang auf der Seiten 544<br />
bzw. 570 dieser Arbeit.)<br />
4.38.1.10 "Nigeria - ein Staat?"<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Auf den Seiten 134-136 folgt ein Kapitel zum bevölkerungsreichsten Land Afrikas unter dem Titel "Nigeria -<br />
ein Staat?". Dazu schreibt der Autor in der Einleitung des Kapitels auf der Seite 134:<br />
Nigeria nimmt unter den Ländern Westafrikas als bevölkerungsreichstes Land eine besondere Stellung ein.<br />
Unterschiedliche Völker mit verschiedenen Religionen und Sprachen wurden durch koloniale Grenzziehung zu einem<br />
Staat vereint. Es ist ein reiches Land, aber mit grossen Gegensätzen zwischen arm und reich.<br />
Das Jahr 1960 ist als das "Afrikanische Jahr" in die Geschichte eingegangen. In diesem Jahr endete für Nigeria und viele<br />
andere Gebiete des Kontinents die Kolonialzeit.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 391
Die erste Begeisterung darüber liess für kurze Zeit die alten Stammes- und Religionsgegensätze vergessen. Aber rund 250<br />
verschiedene Völker und Stämme... und deren unterschiedliche regionale Verteilung führten in der Vergangenheit und<br />
Gegenwart immer wieder zu Putschversuchen und Bruderkriegen...<br />
Dazu kommt eine anhaltende Zuwanderung von Menschen aus den benachbarten Küstenstaaten und aus den armen Staaten<br />
des Sahels im Norden. Trotzdem versucht man eine Art "Nationalbewusstsein" zu entwickeln, das aus den reichen und<br />
vielfältigen Traditionen ein selbstbewusstes Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen lassen soll.<br />
Ausserdem zeigt die Seite 134 ein Foto "Nigerianer auf dem Markt", zwei Karten "Stämme in Nigeria" - die<br />
Fulbe, Joruba, Ibo, Tiv, Kanuri und Hausa, deren Gebiete sich teilweise über die Landesgrenzen erstrecken,<br />
werden aufgeführt - und "Religionen in Nigeria", sowie einen Textkasten "Aus der Geschichte Nigerias", in<br />
dem die folgenden Daten genannt werden:<br />
ab 700 Einwanderung der Haussa-Stämme im Norden (Ackerbauern)<br />
ab 1100 Islamisierung der Haussa<br />
ab 1300 Einwanderung der Fulani von Westen (Grossviehnomaden)<br />
1472 Beginn der Handelsbeziehungen zwischen Portugal und den Küstenstämmen<br />
16. Jh. Händler kaufen Sklaven vom Volk der Joruba<br />
1804 Krieg der Fulani gegen die Haussa-Staaten, Sieg und Ausdehnung des Reiches nach Süden (Jorubaland)<br />
1841 Beginn der christlichen Missionierung an der Küste (Volk der Ibo)<br />
1861 Lagos wird britische Kronkolonie, nachfolgend Unterwerfung der Joruba (1886), Ibo (1898) und Fulbe<br />
(Fulani/Haussa 1903)<br />
1914 Zusammenschluss der Kolonie Südnigeria mit Nordnigeria zur Kolonie "Nigeria"<br />
1946 Teilung der Kolonie in drei Verwaltungsgebiete (Nord, West, Ost)<br />
1955-1960 Vorbereitung der Unabhängigkeit<br />
1960 Unabhängigkeit<br />
1960-1966 Krisen, Unruhen, Militärputsch, Kampf um die Macht, Stammesauseinandersetzungen<br />
1967-1970 Die Ostregion (Ibos) erklärt sich zur "Republik von Biafra", die Nord- und Westregion erobern nach 2.5<br />
Jahren Krieg Biafra; Hungersnöte bei den Ibos, seitdem Militärregierung<br />
(Zu den Hungerkrisen Afrikas siehe auch die Seiten 387 und 401, zu den Hausa die Seiten 276 und 458 dieser<br />
Arbeit.)<br />
1979-1983 Gewählte Regierung<br />
1983 Wiederum Einsatz einer Militärregierung<br />
1989 Aufhebung des Verbotes politischer Parteien und Schaffung einer neuen Verfassung<br />
1993 Geplante Einsetzung einer gewählten zivilen Regierung<br />
Der Sieger der Wahl von 1993 Chief Moshood Abiola gelangte nie an die Macht, da die Wahlen durch die<br />
Militärregierung nicht anerkannt wurden. Abiola starb im Juli 1998 im Gefängnis, kurz vor seiner Freilassung<br />
und einen Monat nach dem Tod des nigerianischen Diktators Sani Abacha, der das Land fünf Jahre lang<br />
regierte. Der Nachfolger Abachas, General Abdusalam Abubakar versprach Ende Juli 1998 Neuwahlen und die<br />
Einsetzung einer zivilen, demokratisch gewählten Regierung auf den Mai 1999.<br />
Die Seite 135 zeigt eine Grafik "Erdölausfuhr und Tagesproduktion" für die Jahre 1986-1991. Dazu schreibt<br />
der Autor im Text unter der Überschrift "Industrialisierung durch Erdölexporte":<br />
Bis zu Beginn der siebziger Jahre war Nigeria ein bedeutender Exporteur von unverarbeiteten landwirtschaftlichen<br />
Erzeugnissen wie Kakao, Erdnüssen, Palmenkernen, Baumwolle und Kautschuk.<br />
Heute ist es das wirtschaftlich am weitesten entwickelte Land Westafrikas. Es besitzt viele Bodenschätze wie Steinkohle,<br />
Eisenerz, Bleierz, Zinnerz, Ton, Kalk und Marmor. Darüberhinaus hat es reiche Vorkommen an Erdöl und Erdgas.<br />
Seit den siebziger Jahren erfolgt eine starke Orientierung auf die Förderung und Verarbeitung des Erdöls. Durch die<br />
Erdölförderung entwickelte sich ein bedeutender Exportzweig.<br />
Nach Entdeckung weiterer Erdöllagerstätten werden die bekannten Erdölvorräte auf 20 Mrd. Barrel (l bl = 159 Liter)<br />
geschätzt. Dieses Erdöl hat zwei Vorteile:<br />
- Es ist von hoher Qualität, da es ein leichtes Öl mit geringem Schwefelgehalt ist.<br />
- Nigerias Lagerstätten (vorwiegend im Niger-Delta) haben grössere Nähe zu den Abnehmern als die Lagerstätten des<br />
Nahen Ostens.<br />
Im Geographiebuch von Widrig (1967, S. 297-298) wurde noch ausführlich über die ungünstige Lage des afri-<br />
kanischen Kontinents und die Ferne zu den wichtigsten Märkten gesprochen. (Siehe dazu die Seite 135 dieser<br />
Arbeit.) Im Text fährt der Autor fort.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Der überwiegende Teil wird nach Nordamerika und Westeuropa ausgeführt. Nur 10 bis 20% des jährlich geförderten<br />
Erdöls wird im Inland verarbeitet.<br />
Mit dem Erlös des Erdölexports wurde die Industrialisierung finanziert und Industriebetriebe wie Wasserkraftwerke,<br />
Betriebe der Chemie-, Stahl- und Baustoffindustrie sowie Kraftfahrzeugmontagewerke errichtet. Gleichzeitig entstanden<br />
neue Häfen und Verkehrswege.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 392
Zur Zeit strebt Nigeria Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur an. So soll die einseitige Ausrichtung auf die<br />
Erdölwirtschaft abgebaut werden. Die vorhandenen Industriebetriebe sollen wirkungsvoller genutzt werden. Eine erneute<br />
Orientierung auf die Landwirtschaft wird angestrebt.<br />
Die Erdgasproduktion war bisher sehr gering (27.6 Mrd. m 3 ). 78% des Erdgases (21.4 Mrd. m 3 ) wurden bei der<br />
Erdölförderung abgefackelt. Nigerias Erdgasreserven betragen aber 2'400 Mrd. m 3 , davon lagern 60% im Niger-Delta. Es<br />
werden Überlegungen angestellt, diesen Bodenschatz abzubauen und in Form von Flüssiggas vorwiegend zu exportieren.<br />
Dazu gibt es bereits Lieferverträge über die Dauer von 22 Jahren mit Italien, Spanien und Frankreich. Das Land erhofft<br />
sich daraus neue Deviseneinnahmen für den weiteren Ausbau der Industrie.<br />
Aber ab 1980 sanken die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt stark. Damit wurde die wirtschaftliche Entwicklung Nigerias<br />
gehemmt. Nigeria ist seitdem, wie viele Länder Afrikas, verschuldet und anfällig gegenüber allen Schwankungen des<br />
Weltmarktpreises.<br />
Als weitere <strong>Pro</strong>bleme des Landes zählt der Autor auf:<br />
- Es gibt zu wenig ausgebildete Facharbeiter, aber sehr viele ungelernte Arbeitskräfte.<br />
- Die Strom- und Wasserversorgung ist völlig überlastet.<br />
- Die Verkehrseinrichtungen wie Häfen, Strassen und Eisenbahnlinien entsprechen nicht den notwendigen<br />
Anforderungen.<br />
- Die Wartung von Maschinen und Fahrzeugen ist durch zeit- und kostenaufwendige Ersatzteilbeschaffung und durch das<br />
Fehlen von Fachleuten kaum möglich.<br />
Die Seite 136 steht unter der Überschrift "Landflucht und Verstädterung". Im Text, der durch die beiden Fotos<br />
"Lagos" und "Typische Siedlung in Nigeria" illustriert wird, schreibt der Autor:<br />
Die Hälfte der Bevölkerung Nigerias ist im erwerbsfähigen Alter (49.2%), aber nur 38% haben Arbeit. 55% davon arbeiten<br />
als Selbstversorger in der Landwirtschaft. Die übrigen 45% sind in der Industrie, vor allem aber im Handel und<br />
Gastgewerbe sowie anderen Dienstleistungen beschäftigt.<br />
Auf der Suche nach Arbeit ziehen viele Menschen, besonders jüngere, vom Land in die Stadt. Sie hoffen, dort schneller<br />
Arbeit zu erhalten und ein besseres Leben als auf dem Lande führen zu können. Die durch die Industrialisierung erreichten<br />
besseren Verkehrsverbindungen zwischen den Städten und dem weiteren Umland bieten dazu auch leichtere<br />
Möglichkeiten. Damit verstärkt sich jedoch immer mehr die Landflucht und entwickelt sich zu einem immer grösseren<br />
<strong>Pro</strong>blem.<br />
Obwohl sich die erhofften Vorteile für den einzelnen kaum verwirklichen, gibt es kein Zurück. So entstehen Nachteile für<br />
Land und Stadt: Durch die hohe Abwanderung aus ländlichen Gebieten fehlen dort die Arbeitskräfte. Durch Maschinen<br />
können sie nicht ersetzt werden, weil es zu deren Anschaffung an Geld mangelt. Ausserdem fehlt es den Bauern an<br />
Kenntnissen, mit den Maschinen umzugehen. Letztlich müssen die Nahrungsmittel aus dem Ausland eingeführt werden.<br />
Auch in den Städten bringt die Land-Stadt-Wanderung grosse Nachteile. Die Städte sind zwar gross und von Millionen<br />
Menschen bewohnt, haben aber in weiten Teilen dörflichen Charakter.<br />
In Lagos lebten 1950 0.3 Mio., 1970 1.5 Mio., 1980 4 Mio. Menschen. Für das Jahr 2000 werden 9,3 Mio. Menschen<br />
geschätzt. Die meisten Zuwanderer landen in den sich ständig vergrössernden Elendsvierteln (Slums) der Stadt, die sich im<br />
Anschluss an das Zentrum mit seinen Hochhäusern und den besseren Wohnvierteln bis etwa 30 km ausdehnen.<br />
Bereits 1995 übertraf die Bevölkerung der Hafenstadt Lagos mit ca. 10.3 Mio. Einwohnern die vom Autor für<br />
das Jahr 2000 gestellte <strong>Pro</strong>gnose. Die grösste Stadt Nigerias kämpft nicht nur mit Überbevölkerung, sondern<br />
auch mit katastrophalen Verkehrsbedingungen, einem völlig überlasteten Telefonnetz und stetig steigenden<br />
Lebenshaltungskosten. Die ehemalige Hauptstadt wurde 1991 von der im Landesinnern gelegenen Stadt<br />
Abuja, die damals etwa 1.3 Mio. Einwohner zählte, nach 15 Jahren Planung und Bauzeit abgelöst, ist aber bis<br />
heute das wichtigste Wirtschaftszentrum Nigerias geblieben. (Encarta 1997, Weltatlas 1997; zu den Slums<br />
Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 383 und 405 dieser Arbeit.) Der Autor fährt in der Beschreibung Lagos<br />
fort (S. 136).<br />
Lagos... liegt auf drei Inseln, deshalb ist die räumliche Ausdehnung nur beschränkt möglich. Oft werden deshalb auch<br />
ungeeignete Gebiete besiedelt. Dies führt vor allem in den Slums zu katastrophalen Zuständen. Während der Regenzeit<br />
werden viele Teile der Stadt überschwemmt. Als Folge breitet sich übler Geruch aus, der von den oberflächlich<br />
abfliessenden, mit Abfällen und Kot vermischten Wassermengen verursacht wird. Krankheiten können sich seuchenhaft<br />
übertragen und ausweiten.<br />
In den Strassen türmen sich Berge von Müll, die von Zeit zu Zeit angezündet werden und dann die Gegend verpesten.<br />
Zu allen Tageszeiten bilden sich lange Fahrzeugschlangen. Häufig bricht der Verkehr total zusammen.<br />
Mit anderen Worten, der Autor beschreibt eine Stadt, die über eine überaus mangelhafte Infrastruktur verfügt.<br />
(Zu Nigeria siehe auch die Seite 373 , zu Lagos die Seite 335 dieser Arbeit.)<br />
4.38.1.11 "Was ist ein Entwicklungsland?"<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Ein weiterer "Geo-Exkurs" auf der Seite 137 geht der Frage nach "Was ist ein Entwicklungsland?" Als typi-<br />
sche Merkmale zählt der Autor "ehemalige Kolonien, geringes <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen, sehr ungleiche<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 393
Einkommensverteilung, hoher Geburtenüberschuss, hoher Anteil der Landbevölkerung, rasche Verstädterung,<br />
geringe Lebenserwartung, niedrige Alphabetenquote, Agrarstaaten, Export von Rohstoffen und Halbfertigwa-<br />
ren, niedriges Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung, Mangel an Nahrungsmitteln, insbesondere an<br />
Eiweissen" auf. Nach diesen Kriterien gehören alle schwarzafrikanischen Staaten zu den Entwicklungsländern.<br />
Weiter schreibt er im Text:<br />
...Nach der Einteilung der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der<br />
Zusammenschluss der 24 wichtigsten Industrieländer) gehören zu den Entwicklungsländern folgende Staaten in:<br />
...Afrika: alle Länder ausser der Republik Südafrika...<br />
1994 gehörten Südafrika, Gabun, Mauritius und die Seychellen zu den Ländern mit "hohem Einkommen",<br />
Botswana, Namibia, Swasiland, Kap Verde und Dschibuti zu den Ländern mit "mittleren Einkommen" und<br />
alle anderen schwarzafrikanischen Staaten zu den Länder mit "niederen Einkommen" wobei die Länder Sierra<br />
Leone, Burundi, Malawi, Äthiopien, Somalia, Tansania und Mosambik zu den zehn ärmsten weltweit<br />
gehörten.<br />
Entsprechend ihrer unterschiedlichen Entwicklung können Entwicklungsländer in Gruppen eingeteilt werden:<br />
- Zu den am wenigsten entwickelten Ländern (sog. LDC oder LLDC-Länder) gehören rund 40 Staaten (die Mehrheit sind<br />
afrikanische Staaten).<br />
- Zu den am stärksten von der "Ölkrise" 1974 und deren Auswirkungen betroffenen Länder (MSAC Länder) gehören rund<br />
45 Staaten, die zum Grossteil auch der LDC-Gruppe angehören.<br />
- Schwellenländer... dazu gehören rund 30 Staaten.<br />
Die Seite 137 zeigt auch eine Weltkarte "Entwicklungshilfeempfänger 1990...", in der die Länder Maureta-<br />
nien, Ägypten, Somalia, Guinea-Bisseau, Elfenbeinküste, Togo, Benin, Republik Kongo, Tschad, Zentralafri-<br />
kanische Republik, Gabun, Sambia, Botswana, Mosambik, Lesotho und Swasiland mit über 50 Dollar Hilfe<br />
pro Kopf beziffert werden.<br />
4.38.1.12 "Rassenkonflikte in Südafrika"<br />
Das letzte Kapitel zu Afrika auf den Seiten 138-141 steht unter dem Titel "Rassenkonflikte in Südafrika",<br />
darin schreibt der Autor:<br />
Die Republik Südafrika nimmt unter den afrikanischen Ländern eine Sonderstellung ein. Wirtschaftlich weit entwickelt, ist<br />
sie in politischer Hinsicht seit Jahrzehnten immer wieder in negative Schlagzeilen der Medien geraten. Internationale<br />
<strong>Pro</strong>teste und wirtschaftliche Sanktionen (Massnahmen gegen einen Staat, der das Völkerrecht verletzt hat) richteten sich<br />
gegen die "Apartheid". Unter "apart van die ander" verstehen die Afrikaans sprechenden Buren "abgesondert von den<br />
anderen". Dahinter verbirgt sich die Politik der Rassentrennung. Ein Rückblick in die Geschichte erklärt diese Situation.<br />
Bei diesem Rückblick in die Geschichte setzt der Autor bei der Einrichtung eines Versorgungsstützpunktes am<br />
Kap der Guten Hoffnung durch die Niederländer 1952 ein. Über die nachfolgenden Buren schreibt er:<br />
Sie dehnten gewaltsam ihr Siedlungsland aus und verdrängten dabei die Hottentotten und Buschmänner. Diese schwarzen<br />
Ureinwohner zogen sich schliesslich ins unfruchtbare Hinterland zurück...<br />
(Siehe dazu auch die Seiten 97 dieser Arbeit.)<br />
Seit dem 18. Jahrhundert trafen die nach Norden vordringenden weissen Viehhalter auf nomadisierende Schwarze, die aus<br />
Ostafrika eingewandert waren. Im Kampf um das Weideland setzten sich die Weissen durch...<br />
Mitte des 19. Jh. endete eine ganze Reihe von Kriegen gegen Schwarzafrikaner mit ihrer Unterwerfung. Schliesslich<br />
gründeten die Buren eigene Staaten, den Oranie-Freistaat sowie die freie Republik Transvaal. Schon zu dieser Zeit wurde<br />
eine Politik der Rassentrennung betrieben... 1994 wurde mit Nelson Mandela der erste schwarze Präsident gewählt.<br />
Dieser Text, der hier stark gekürzt wiedergegeben ist, und der sich hauptsächlich mit den Taten der weissen<br />
Siedler beschäftigt, wird von einer Karte "Entstehung der Republik Südafrika", auf der die Wanderbewegun-<br />
gen der verschiedenen Völker eingezeichnet sind, und einer Grafik der "Bevölkerungsanteile in Südafrika<br />
(1990)" nach der die Schwarzen 73.8% der Bevölkerung ausmachen, gefolgt von den Weissen (14.2%), den<br />
Mischlingen (9.2%) und den Asiaten (2.8%).<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Unter der Überschrift "Die Politik der Apartheid" schreibt der Autor auf der Seite 139:<br />
Die Apartheid sicherte der weissen Minderheit die Herrschaft über die farbige Bevölkerung und wirtschaftlichen<br />
Wohlstand. Seit 1913 wurden eine Reihe von Gesetzen erlassen, die bereits eine räumliche Trennung der Rassen bewirkte.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 394
Ab 1948 wurde die Apartheid weiter verschärft. Öffentliche Einrichtungen wie Autobusse, Restaurants oder Parkbänke<br />
wurden mit "whites-only"-Schildern für Weisse reserviert.<br />
(Siehe dazu weiter unten und die Seite 268 dieser Arbeit.)<br />
Verschiedenen Bantugruppen wurden gesonderte Wohngebiete, die Homelands, zugewiesen... Diese Gebiete waren jedoch<br />
im Vergleich zu den weissen Gebieten unterentwickelt. Es gibt dort keine Bodenschätze und Industrie, zudem sind sie<br />
landwirtschaftlich wenig fruchtbar. Vier dieser Homelands (Transkei, Bophuthatswana, Venda, Ciskei) wurden zu<br />
Bantustans und damit zu selbständigen Staaten erklärt. Deren farbige Bewohner galten in der Südafrikanischen Republik<br />
als Ausländer. Ziel der Politik war es, dass es eines Tages keine schwarzen Afrikaner in Südafrika mehr geben sollte.<br />
Wegen der Apartheid kam es wiederholt zu Unruhen, wie beispielsweise 1960 in Sharpeville oder 1985 in Soweto. Viele<br />
Menschen wurden dabei getötet. Die Regierung konnte ihre Politik der Rassentrennung nicht mehr in ihrer ursprünglichen<br />
Strenge durchhalten. Viele Staaten boykottierten Südafrika. Da manche Güter nicht mehr nach Südafrika geliefert und<br />
nicht mehr von dort bezogen wurden, wurde die wirtschaftliche Entwicklung gestört. Zudem konnte die Industrie wegen<br />
der geringen Zunahme der weissen Bevölkerung nicht auf die schwarzen Arbeitskräfte verzichten... Die Schulbildung der<br />
farbigen Bevölkerung wurde deshalb verbessert...<br />
Diese "verbesserte" Schulbildung lässt sich je nach Standpunkt aus der auf der gleichen Seite abgebildeten<br />
Tabelle "Schülerzahlen in weiterführenden Schulen" herauslesen, die hier wiedergegeben wird:<br />
1960 1970 1980 1990<br />
Weisse 245'600 310'600 358'700 382'000<br />
Mischlinge 28'600 59'000 126'900 229'000<br />
Asiaten 16'800 40'182 59'700 91'000<br />
Schwarze 47'600 122'500 573'000 1'967'000<br />
Die Seite 139 zeigt auch eine Karte "Homelands in der Republik Südafrika" und ein Foto "Apartheid am Bade-<br />
strand von Durban" auf dem ein Schild mit der Inschrift "CITY OF DURBAN: UNDER SECTION OF THE<br />
DURBAN BEACH BY-LAWS, THIS BATHING AREA IS RESERVED FOR THE SOLE USE MEMBERS<br />
OF THE WHITE RACE GROUP." abgebildet ist.<br />
Die Seite 140 beschäftigt sich unter der Überschrift "Von Diamanten- und Goldsuchern" mit dem Bergbau in<br />
Südafrika. Über die Bedeutung dieses Wirtschaftszweig für Südafrika schreibt der Autor:<br />
...Südafrika ist inzwischen zu einer der reichsten Bergbauregionen der Welt geworden. Es hat Anteil am "Erzgürtel"<br />
Afrikas, der sich von Schaba (Zaire) über Sambia und Simbabwe bis nach Südafrika hinein erstreckt... Wirtschaftliche<br />
Bedeutung erlangte auch der Uran-, Kupfer- und Kohlenbergbau. Chrom- und Manganvorkommen haben ebenfalls<br />
entscheidend dazu beigetragen, dass Südafrika eine Industrie aufbauen konnte und ein bedeutender Exporteur wertvoller<br />
Rohstoffe ist.<br />
Seite 141 steht, das Kapitel zu Südafrika abschliessend, unter der Überschrift "Wanderarbeiter in Südafrika".<br />
In dem von den zwei Fotos "Township bei Johannesburg" und "Soweto" begleiteten Text, heisst es:<br />
Die Republik Südafrika ist das wirtschaftlich am höchsten entwickelte Land Afrikas. Fast die Hälfte des Volkseinkommens<br />
wird in der Industrie erwirtschaftet, nur 5% in der Landwirtschaft. Das ist der höchste Anteil in der Industrie bzw. der<br />
niedrigste in der Landwirtschaft in ganz Afrika...<br />
Da es in den Homelands und Nachbarländern kaum Bergwerke und Industrie gibt, kommen Hunderttausende von<br />
Schwarzen als billige Arbeitskräfte in die Industriebetriebe der Weissen. Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne zwingen sie<br />
dazu, die Heimat zu verlassen. Meist gehen nur die Männer und lassen ihre Familien zurück. Diese leben dann oft in<br />
grosser Armut.<br />
(Zu den Löhnen in Südafrika siehe auch die Seiten 269 und 282 dieser Arbeit.)<br />
Durch die Änderung der Arbeitsgebiete wurde inzwischen langjährigen Wanderarbeitern und ihren Familien ein<br />
Dauerwohnrecht gewährt. In Townships am Rande der wirtschaftlichen Ballungsgebiete leben sie von den Weissen<br />
getrennt. Einer der grössten ist Soweto bei Johannesburg... mit mehr als 2 Mio. Einwohnern. Dieses Township bildet einen<br />
auffälligen Gegensatz zum Stadtzentrum.<br />
(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 348 und 431 dieser Arbeit.) Die den Abschnitt über Afrika<br />
abschliessenden Seiten 142-144 lassen die Schüler ihr Wissen über Afrika repetieren. Dabei spielt die Bevöl-<br />
kerung nur eine untergeordnete Rolle. Sie wird in der Form eines Lückentextes nur auf Seite 144 in wenigen<br />
Sätzen angesprochen. Seite 145 zeigt eine Reihe von Fotos von Pflanzen, die der Schüler anhand des Bildes<br />
und einer kurzen Beschreibung erkennen sollte.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 395
4.38.2 Band 4<br />
Der vierte Band des Lehrmittels "Seydlitz: Erdkunde" beschäftigt sich auf einigen wenigen Seiten auch mit<br />
Afrika.<br />
4.38.2.1 "Ernährungsprobleme"<br />
Die Seiten 144 und 145 stehen unter dem Titel "Ernährungsprobleme (Folgen von Über- und Unterernäh-<br />
rung)". Der Text enthält keine spezifischen Angaben zu Afrika. Der Autor beschränkt sich auf allgemeine<br />
statistische Angaben, so schreibt er zum Beispiel, dass "der mittlere Tagesbedarf eines erwachsenen Menschen<br />
an Energie... ca. 2'400 kcal." betrage. Dagegen lägen "viele Menschen in den Entwicklungsländern mit täglich<br />
1'500 kcal. als Folgen einer zu geringen und oftmals einseitigen Nahrungszufuhr deutlich darunter". Erwähnt<br />
wird auch, dass "diese ständige Unterernährung" besonders bei Kindern "zu häufigen Mangelerscheinungen"<br />
führe.<br />
Zu dem <strong>Pro</strong>blem der Verteilung von Nahrungsmitteln zwischen den Industrienationen und den Entwicklungs-<br />
ländern heisst es weiter im Text (S. 145):<br />
...Während dort Hunderttausende auf stinkenden Müllkippen nach essbaren Resten suchen, werden Schweine und Rinder<br />
mit hochwertigen Nahrungsmitteln gemästet. Gegenwärtig wird jährlich die Menge Getreide an Tiere verfüttert, mit der<br />
etwa 2.5 Mrd. Menschen ernährt werden könnten. 40% des Weltgetreides, knapp die Hälfte der Fischfänge (Fischmehl),<br />
60% der Ölsaaten und etwa ein Drittel der Milchproduktion wandern in die Mägen von Schweinen, Rindern und Geflügel.<br />
Diese Verfütterung von Getreide und anderen Nahrungsmitteln wird als "Veredlung" bezeichnet. Eine Überproduktion...<br />
stellt daher eine gewaltige Verschwendung von Nährwerten dar. Besonders deutlich wird diese Verschwendung, wenn man<br />
berücksichtigt, dass ein erheblicher Teil dieses Viehfutters aus den Entwicklungsländern importiert wird.<br />
Viele Länder haben grosse Teile des besten Landes für Exportkulturen reserviert, und die meisten Regierungen investieren<br />
mehr in diese Exportkulturen (Kaffee, Kakao, Tee, Baumwolle, Ölsaaten u. a.) als in die Ausweitung der Nahrungskulturen<br />
für die Versorgung der eigenen Bevölkerung.<br />
Der Text wird auf der Seite 144 durch ein Foto "Mangelernährte Kinder in Afrika", eine Karikatur auf der drei<br />
übergewichtige Weisse zwei unterernährte Schwarze betrachtend die Aussage "Und das alles ohne Diät"<br />
machen - dabei gibt es auch in den afrikanischen Ländern Menschen, die trotz oder gerade wegen unausgewo-<br />
gener Ernährung an Übergewicht leiden -, und eine Weltkarte "Kalorienversorgung... 1990", welche die<br />
schwarzafrikanischen Länder Sierra Leone, Tschad, Sudan, Eritrea, Äthiopien, Somalia. Zaire, Angola, Nami-<br />
bia, Mosambik als Länder mit einer Versorgung von weniger als 2000 kcal. ausweist. Seite 145 zeigt eine<br />
Grafik "Welt-Getreideproduktion 1950-1990", die eine Zunahme der Getreideproduktion pro Kopf für diesen<br />
Zeitraum aufweist, eine Grafik "Ursachen des Hungers" - "ungeeignete Entwicklungshilfe, hoher Bevölke-<br />
rungszuwachs, Besitzverhältnisse in der Landwirtschaft, Einschränkung der Nutzung durch Ungunstfaktoren,<br />
Verdrängung der Nahrungskulturen durch Exportkulturen, Verfütterung von Getreide in der Viehwirtschaft,<br />
Eingriffe der Industrieländer in den internationalen Agrarhandel, Rückständigkeit der Landwirtschaft in den<br />
Entwicklungsländern" werden als Gründe aufgezählt - und eine Zeitungsmeldung vom März 1994 in der es<br />
unter dem Titel "In 45 Ländern Hunger" heisst:<br />
...In 45 Staaten der Erde ist die Ernährungslage schlecht oder kritisch. Betroffen seien vor allem afrikanische Länder<br />
südlich der Sahara, geht aus dem gestern in Rom veröffentlichten UN-Bericht hervor... Besonders betroffen von Hunger ist<br />
den Angaben zufolge die Zentralafrikanische Republik,... Dabei könnten nach UN-Angaben mehr als die Hälfte der<br />
Entwicklungsländer den Bedarf an Hauptnahrungsmitteln um das Zweifache decken, wenn sie das Potential ihrer<br />
ertragreichen Flächen nutzten.<br />
Dazu gehören nach Michlers "Weissbuch Schwarzafrika" auf die meisten afrikanischen Staaten. (Michler,<br />
1991)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 396
4.38.2.2 "Arbeitswanderung und Armutsflüchtlinge"<br />
Der "Geo-Exkurs" auf den Seiten 148-149 steht unter dem Titel "Arbeitswanderung und Armutsflüchtlinge".<br />
Die Seite 148 zeigt eine Karte "Länder mit Flüchtlingen (Auswahl) nach Angaben der UN-Flüchtlingskommis-<br />
sion" mit Angaben von April 1991. Für Afrika werden insgesamt rund 6 Millionen Flüchtlinge angegeben,<br />
davon entfallen nach der Karte auf die einzelnen Länder als Aufnahmestaaten (Zahlen in Klammern: Flücht-<br />
linge in Tausend): Algerien (170), Senegal (58), Sierra Leone (129), Elfenbeinküste (300), Kamerun (52),<br />
Uganda (142), Ruanda (22), Burundi (270), Simbabwe (183), Sudan (768), Äthiopien (985) Somalia (100),<br />
Kenia (35), Tansania (265), Zaire (427), Sambia (138), Malawi (940), Swasiland (420). Für die Schweiz wird<br />
zum Vergleich eine Zahl von 29'000 Flüchtlingen angegeben. Zwei Grafiken "Ursachen für Wanderungsbewe-<br />
gungen" - als Ursachen werden "Krieg und Bürgerkrieg, Menschenrechtsverletzungen, Bedrohung von Minder-<br />
heiten, Verelendung (Armut), wirtschaftliche Not und Perspektivlosigkeit, Umweltprobleme..." genannt - und<br />
"Auf der Flucht", welche die Zahl der Flüchtlinge, die ihr Heimatland verlassen haben für Mosambik mit<br />
1.725 Mio., Somalia mit 0.865 Mio., Äthiopien und Eritrea mit 0.835 Mio., Angola mit 0.404 Mio. und den<br />
Sudan mit 0.263 Mio. Menschen beziffert. Im dazugehörigen Text schreibt der Autor (S. 148):<br />
...Von den Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen ins Ausland gehen, leben 35 Mio. in Afrika südlich der Sahara,<br />
jeweils 15 Mio. in Westeuropa und Nordamerika.... Trotz dieser komplexen Ursachen für Wanderungen ist es wichtig,<br />
eindeutig zwischen Flüchtlingen (erzwungene Auswanderung) und anderen Migrantengruppen (freiwillige Auswanderung)<br />
zu unterscheiden.<br />
Grenzüberschreitende Wanderung (Migration) hat gesellschaftliche Auswirkungen in den Herkunfts- wie in den<br />
Aufnahmeländern...<br />
Auf der Seite 149 führt der Autor weiter aus:<br />
Durch Migration werden Ungleichgewichte in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ausgeglichen. Neben der<br />
Möglichkeit, durch Überweisungen Devisen einzunehmen, liegt ein weiterer Effekt für die Herkunftsländer darin, dass sich<br />
für die in der Heimat Verbliebenen ein verbessertes Arbeitsplatzangebot entwickelt. Ein besonderes Risiko liegt aber im<br />
Verlust von Fachkräften, Ärzten, Technikern und Geschäftsleuten durch "brain drain". Allein Afrika hat in den letzten<br />
Jahrzehnten über ein Drittel seiner hochqualifizierten Arbeitskräfte durch Abwanderung verloren. Die Aufnahmeländer<br />
erhalten dagegen ohne eigene Investitionen fertig ausgebildete junge Arbeitskräfte...<br />
Die Seite 149 zeigt eine Tabelle "Ausländeranteil (1990)" für einige OECD-Länder - Schweiz z.B. 16.3% -<br />
eine Karikatur, in der ein vor einem überfüllten Tisch sitzenden Weisser die durch die mit "Europa" beschrifte-<br />
te Tür eintretenden Schwarzen mit den Worten "Kein Platz mehr" abweist, und ein Bild mit Text "Ruanda<br />
1994", in dem es heisst:<br />
Der Bürgerkrieg und die Massenmorde in Ruanda haben einen der grössten Flüchtlingsströme in der Geschichte ausgelöst.<br />
Fast eine halbe Mio. Menschen flohen innerhalb von zwei Tagen in das benachbarte Tansania. Als ruandische Rebellen der<br />
Patriotischen Front (FPR) das Grenzgebiet zu Tansania eroberten, wurde die Massenflucht plötzlich unterbrochen. Das<br />
UN-Flüchtlingswerk forderte die FPR dringend auf, die Grenze wieder zu öffnen. In Tansania entstand bei der Kleinstadt<br />
Ngara nach UN-Angaben das grösste Flüchtlingslager der Welt mit fast einer halben Mio. Menschen. Tansania erliess<br />
einen dringenden Hilfsappell, weil es dem riesigen Zustrom nicht gewachsen sei.<br />
(Zu Ruanda siehe auch die Seiten 165 und 371 dieser Arbeit.) Auf der Seite 153 schreibt der Autor zum Kapi-<br />
tel "Entwicklungshilfe konkret" unter der Überschrift "Entwicklungshilfe in der Diskussion":<br />
Viele Entwicklungshilfeprojekte der Vergangenheit erweisen sich bei näherer Untersuchung als sehr problematisch. In<br />
vielen Fällen wurden nicht die Menschen erreicht, die sich mit dieser Hilfe entwickeln sollten. In immer stärkerem Masse<br />
setzte sich deshalb die Erkenntnis durch, dass nur <strong>Pro</strong>jekte "vor Ort" unter Einbeziehung der betroffenen Menschen mit<br />
ihren Lebensgewohnheiten und Weltanschauungen etwas bewegen werden. Dabei ist ein wesentlicher Faktor, dass die<br />
Beteiligung der Frauen ein "Muss" ist, wenn sich die Lebensverhältnisse zum Besseren wandeln sollen...<br />
Und dieser Text findet sich in einem Lehrmittel, welches die als derart wichtige schwarzafrikanische Frau nur<br />
als zurückgelassenes, in Armut lebendes Anhängsel eines Wanderarbeiters erwähnt. (Zur Entwicklungshilfe<br />
siehe auch die Seiten 364 und 420 dieser Arbeit.)<br />
Auf der gleichen Seite findet sich auch ein Textkasten "Meinungen zur Entwicklungshilfe" und eine Karikatur,<br />
die hier wiedergegeben werden soll, weil sie das Thema der Entwicklungshilfe auf ihre Weise auf den Punkt<br />
bringt:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 397
4.38.3 Zusammenfassung<br />
Die beiden sich mit Afrika beschäftigenden Bände von "Seydlitz Erdkunde" bieten zwar sehr umfangreiche<br />
Materialien zur Geschichte Afrikas seit dem Auftreten der Europäer. Sie geben einen guten Einblick in die<br />
wirtschaftliche Situation der Länder Zaire, Kenia und Nigeria, sowie in die politischen <strong>Pro</strong>bleme Südafrikas<br />
und in die Zusammenhänge in der Weltwirtschaft, über das Leben der schwarzafrikanischen Bevölkerung, die<br />
vor allem als Landbevölkerung dargestellt wird, erfahren die Schüler, abgesehen von den landwirtschaftlichen<br />
<strong>Pro</strong>duktionsformen, aber nicht viel.<br />
Weder geht der Autor näher auf die Gesellschaftsformen ein, noch erwähnt er konkrete Beispiele zur Kultur<br />
oder Religion der schwarzafrikanischen Völker. Auf den zahlreichen Seiten kommt auch kein Schwarzafrika-<br />
ner zu Wort, Frauen werden nur am Rande überhaupt erwähnt, und Kinder nur in einer Tabelle zur Schulbil-<br />
dung in Südafrika aufgeführt.<br />
Damit entsteht das Bild eines sich zwar abmühenden, aber von den Industriestaaten ausgenutzten Schwarzafri-<br />
kaners, der in einem eigentlichen kulturellen Vakuum lebt.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Erdkunde (1993-1995)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 398
4.39 Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Nirgendwo ist der Hunger grösser, das Elend auswegloser. Es hat den Anschein, die sieben Plagen hätten hier eine feste<br />
Heimstatt gefunden. In den überfüllten Hungerlagern sind die Tagesrationen dürftig: 500 g Getreide, 30 g Fett, 4 l Wasser.<br />
Im ganzen Land graue, ausgezehrte Menschen, die endlose Strassen entlangwanken. Das Bauernland droht in der tödlichen<br />
Zange aus Bodenerosion und Bevölkerungsexplosion zerquetscht zu werden. Über Nacht entstehen in staubiger Einöde<br />
uferlose Hungerstädte. (Bd. 3, S. 51)<br />
Das 1994 bis 1996 erschienene vierbändige Lehrmittel "Seydlitz Geographie" für die Oberstufe beschäftigt<br />
sich auf rund 30 der insgesamt 688 Seiten mit Schwarzafrika, wobei Afrika schwergewichtig im Band 3<br />
thematisiert wird. Band 4 enthält nur wenige Seiten zu Afrika, die beiden ersten Bände beschäftigen sich mit<br />
anderen Themen.<br />
4.39.1 Band 3<br />
Band 3 enthält die grossen Themenbereiche "In den immerfeuchten Tropen", wovon die Seite 8 und 9 unter<br />
dem Titel "Die Eroberung der 'Grünen Hölle'" und die Seiten 19-25 unter dem Titel "Lebens- und Nutzungs-<br />
formen" sich direkt mit Afrika beschäftigen, sowie die Kapitel "Sahel - Sand frisst das Land " (S. 51-57),<br />
"Kenia" (S. 58-63) und "Höhenstufen im tropischen Hochgebirge" (S.64-65). Auf der Seite 71 findet sich unter<br />
dem Titel "Tropische Nutzpflanzen" ein kurzer Abschnitt mit der Überschrift "Kakao - Steckbrief einer tropi-<br />
schen Nutzpflanze", in dem es heisst:<br />
...Die Hauptanbaugebiete liegen heute im tropischen Westafrika. Nach Ländern nimmt bei der Kakaoernte die<br />
Elfenbeinküste mit Abstand den ersten Platz ein, gefolgt von Brasilien und Malaysia."<br />
(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 361 und 552 dieser Arbeit.) Das ehemalige Lehrbuchbeispiel - und<br />
dies im wörtlichen Sinn gemeint - zum Thema, das westafrikanische Land Ghana, wird hier nicht einmal mehr<br />
erwähnt. Ausserdem enthält der Band Angaben zum Nomadismus und der Sahara, auf die hier nicht weiter<br />
eingegangen werden soll.<br />
4.39.1.1 "Die Eroberung der 'Grünen Hölle'"<br />
Die detaillierte Schilderung Schwarzafrikas beginnt im Kapitel "Die Eroberung der ''Grünen Hölle'" auf der<br />
Seite 9 mit einem kurzen Text über Livingstone:<br />
...Einmalige Verdienste um die Erschliessung Afrikas erwarb sich der schottische Arzt und Missionar David Livingstone.<br />
Er durchquerte die Kalahari-Wüste, erkundete den Sambesi mit den Viktoriafällen, zog durch ganz Südafrika, entdeckte<br />
den Njassasee und bereiste Ostafrika, wo er die Nilquellen entdeckte. Über drei Jahre lang gab Livingstone kein<br />
Lebenszeichen von sich. Längst verschollen geglaubt, wurde er im November 1871 am Ostufer des Tanganjikasees von<br />
dem Reporter Henry Morton Stanley wiedergefunden: "Dr. Livingstone, nehme ich an?" - "Ja", sagte dieser mit<br />
freundlichem Lächeln, während er seine Mütze lüftete.<br />
Stanley gab bald darauf seine journalistische Karriere auf und wurde ebenfalls leidenschaftlicher Afrikaforscher.<br />
Besondere Verdienste erwarb er sich um die Erkundung der Regenwaldgebiete am Kongo. So machte sich Stanley am 17.<br />
November 1874 zusammen mit 223 afrikanischen und drei weissen Begleitern auf den Weg ins dunkle Afrika. Sie nahmen<br />
sich vor, als erste Menschen den ganzen Kontinent von Ost nach West zu durchqueren.<br />
Wie in anderen Lehrmitteln, so dient auch hier der afrikanische Kontinent als exotische Kulisse für die Be-<br />
gegnung zweier europäischer Grössen, die sich bei dieser Gelegenheit als wahre Gentlemen erweisen. Die<br />
Afrikaner selbst werden nur in einem Nebensatz erwähnt.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Auf der Seite 9 findet sich auch eine Karte "Afrika - Erschliessung, Forschungsreisen" und ein Textrahmen zu<br />
Stanley mit der Überschrift "Ins dunkle Afrika" nach Heinrich Schiffers "Wilder Erdteil Afrika":<br />
...Unablässig gegen angreifende Eingeborene kämpfend, liess Stanley einen Pfad durch den Wald schlagen, um die Boote<br />
über Land zu transportieren. Endlich, am 9. August 1877, erreichten 115 ausgehungerte Menschen die Stadt Boma am<br />
Unterlauf des Kongo. 113 Männer waren bei der Expedition ums Leben gekommen.<br />
Nach dieser Einführung in den afrikanischen Kontinent, die sich in ähnlicher Form auch in "Geographie der<br />
Kontinente" von 1984 findet und in der die voreuropäische Geschichte wieder einmal mit keinem Wort<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 399
erwähnt wird, folgt das nächste Kapitel zu Afrika im zweiten Abschnitt der Bandes, der mit "Lebens- und<br />
Nutzungsformen" übertitelt ist.<br />
4.39.1.2 "Raubbau oder Anpassung?"<br />
Im Kapitel "Raubbau oder Anpassung?" auf den Seiten 18-21 schreibt der Autor auf der Seite 18, die ein Foto<br />
"Pygmäen", eine Karte "Siedlungsgebiet der Pygmäen", auf der die Gebiete der Mbuti, Mbenga und Bongo<br />
eingezeichnet sind, zeigt:<br />
Keine Landschaft Afrikas - nicht einmal die trostlose Wüste - ist so wenig besiedelt wie der tropische Regenwald. Die<br />
einzigen menschlichen Wesen, die sich seit jeher in sein Lebensnetz eingebaut haben, sind die Pygmäen. Diese<br />
Zwergmenschen werden nur 1.40 m gross. Als Jäger und Sammler durchstreifen sie in kleinen Gruppen den Wald.<br />
Kleinere Tiere erlegen sie mit vergifteten Pfeilen, grössere werden in Fallgruben gefangen. Bleibt der Jagderfolg aus, so<br />
ernähren sie sich von allem, was an Früchten, Wurzeln, Samen, Insekten und Schnecken gesammelt werden kann. Als<br />
Nomaden des Urwaldes bauen sie keine festen Behausungen; ein Regenschutz aus grossen Blättern, die über biegsame<br />
Stöcke gedeckt werden, genügt ihnen. Jede Familie braucht ein Gebiet von 10 km 2 , um existieren zu können. Durch die<br />
andauernde Zerstörung des Regenwaldes sind die Pygmäen in ihrer Existenz bedroht.<br />
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 340 und 411 dieser Arbeit.) Der nächste Abschnitt - damit folgt der<br />
Autor dem schon im Lehrmittel "Seydlitz für Realschulen" von 1968 festgelegten und unterdessen zur Tradi-<br />
tion gewordenen Schema - ist der Bantubevölkerung gewidmet, deren Siedlungsweise auf einem Foto "Bantu-<br />
Siedlung" gezeigt wird (S. 18f.):<br />
Ganz anders leben die sesshaften Bantu. Sie betreiben Hackbau. Zunächst schlagen die Männer mit Buschmesser und Axt<br />
Sträucher und kleinere Bäume ab. Dann werden die grösseren Bäume geringelt und zum Absterben gebracht. Schliesslich<br />
fällen sie möglichst viele Bäume. Nachdem das Holz dürr geworden ist, wird es zusammen mit dem geschlagenen<br />
Unterholz, Ästen, Zweigen und Blättern angezündet. Tagelang steht eine riesige Rauchsäule über dem Wald. Einige<br />
grössere Bäume lassen die Bantu als Schattenspender für empfindliche Pflanzen stehen. Die bei der Brandrodung<br />
entstandene Asche wird gleichmässig verteilt; sie düngt den Boden. Die Frauen bestellen die Felder. Den Boden lockern sie<br />
nur dort mit der Hacke, wo auch eine Pflanze eingesetzt wird. Die Bantu bevorzugen eine gemischte Anbauweise. Oft<br />
kombinieren sie Mais mit Knollenfrüchten (Maniok, Taro, Bataten) und Mehlbananen. Nach der Ernte werden Erdnüsse<br />
und Zwiebeln angepflanzt. Tomaten, Auberginen, Pfeffer und Yams ergänzen den Speiseplan. Die Bantu bauen nur das an,<br />
was sie auch selbst verbrauchen; sie sind Selbstversorger.<br />
Schon nach zwei Jahren werden die Ernteerträge spürbar geringer. Von den Rändern her wuchert die natürliche Vegetation<br />
des Urwaldes in die gerodete Fläche hinein. Die Bantu müssen das Feld aufgeben. Inzwischen haben die Männer eine neue<br />
Fläche gerodet. Im Laufe der Jahre verlagern sich die Felder immer weiter vom Dorf weg, sodass die Familie ihre Siedlung<br />
verlassen und andernorts ein Haus bauen muss. Diese Art des Feldbaus, die in allen Regenwaldgebieten zu finden ist,<br />
bezeichnet man als Wanderfeldbau. Die aufgegebenen Rodungsflächen werden rasch von dichtem Gestrüpp überwuchert.<br />
(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 388 und 425 dieser Arbeit.) Nebst dem Text enthält die Seite 19<br />
vier Fotos "Brandrodung", "Hackbau", "Taro... und Bataten" und "Frisch geerntete Maniokknollen". Auf der<br />
Seite 20 führt der Autor unter dem Titel "Zum Wandern gezwungen" die Schwierigkeiten des Anbaus von<br />
Nutzpflanzen im tropischen Regenwald weiter aus. Dazu schreibt er:<br />
...Die Eingeborenen haben längst erkannt, dass der Ackerbau die Fruchtbarkeit des Bodens schnell verringert, während sie<br />
durch die natürliche Urwaldvegetation vergrössert wird. Deshalb überlassen sie ihre Anbauflächen nach wenigen Jahren<br />
der Nutzung wieder dem wilden Pflanzenwuchs...<br />
Unterstützt werden diese Aussagen von drei Grafiken: "Wanderfeldbau in Zentralafrika (Asande-Bauern);<br />
"Etragsentwicklung", aus der sichtbar wird, dass z. B. der Baumwollertrag im südlichen Sudan innerhalb von<br />
fünf Jahren auf 40% zurückgeht, der Anbau von Kassawa im Kongogebiet bereits im zweiten Jahr auf 65%,<br />
der Anbau von Reis und Erdnuss im gleichen Gebiet im zweiten Jahr nur noch 20% respektive 15% der ersten<br />
Ernte einbringt; "Brachdauer und Ernteerträge", welche die zunehmende Erschöpfung des Bodens bei zu<br />
kurzer Brachzeit aufzeigt. (Siehe dazu auch die Grafiken zu den Erträgen aus dem Maniok- und Hirseanbau<br />
bei verschiedenen Anbauformen aus dem Lehrmittel "Diercke Erdkunde" von 1995-1997 auf der Seiten 425<br />
bzw. 430 dieser Arbeit.)<br />
Die Seiten 21-23 beschäftigen sich mit der Vielfalt des Lebens im tropischen Regenwald und der Verbreitung<br />
der Banane. Im Kapitel "Edle Hölzer aus den Tropen" stellt der Autor die wichtigsten Holzarten der Tropen<br />
vor, und auf der Seite 25 schreibt er zum Beispiel Nigeria:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 400
... Nur wenige Entwicklungsländer verfügen über ausreichend Sägemühlen und Furnierwerke, um das kostbare Holz zu<br />
veredeln. Nicht selten müssen Bauholz und Papier teuer eingekauft werden. Nigeria... war einmal ein wichtiges<br />
Holzexportland. Heute muss es hundertmal so viel Holz importieren, wie es exportiert.<br />
(Siehe dazu auch die Tabelle "Holzverbrauch ausgewählter schwarzafrikanischer Länder" im Anhang auf der<br />
Seite 553, sowie die entsprechende Karte auf der Seite 576 dieser Arbeit.)<br />
4.39.1.3 Sahel<br />
Im Kapitel "Sahel - Sand frisst das Land" schreibt der Autor auf der Seite 50 unter der Überschrift "Sahel - ein<br />
'rettendes' Ufer'?":<br />
Im Jahr 1973 wurde die Welt von einer schlimmen Meldung aufgeschreckt. Eine Katastrophe grössten Ausmasses suchte<br />
die Sahelzone heim. Reporter aus aller Welt berichteten von dem schrecklichen Elend. Nahrungsmittel und Medikamente<br />
wurden in unzähligen Aktionen in die betroffenen Gebiete geschafft. Die schlimmste Not konnte gelindert werden.<br />
Dennoch starben Hunderttausende von Menschen. Heute, nach über 20 Jahren, ist es still geworden um die Sahelzone.<br />
Doch das Sterben dort geht weiter. Die Katastrophe im Sahel ist eine leise, eine schleichende Katastrophe... Sahel ist ein<br />
arabisches Wort und bedeutet Ufer oder Küste. Für die Karawanen und Kaufleute, die früher die Wüste durchquerten, mag<br />
die Vegetation der Savanne dasselbe bedeutet haben wie früher für den Seemann das rettende Ufer. Doch heute führt diese<br />
Bezeichnung in die Irre. Denn entlang des Südrandes der Sahara zieht sich vom Atlantik bis zum Roten Meer eine<br />
"Todeszone". Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/Jahr rückt hier die Wüste nach Süden vor und verschlingt<br />
riesige Flächen von Acker- und Weideland. Für immer!<br />
(Zu den hier aufgestellten, wenig fundierten Behauptungen siehe die Ausführungen auf der Seite 353 dieser<br />
Arbeit.) Auf der Seite 50 ist auch ein Foto "Im Sahel", das ein Beispiel für die stattfindende Desertifikation<br />
wiedergibt, und eine Karte "Die Sahelzone" wiedergegeben, in deren Einflussbereich die Städte Dakar<br />
(Senegal), Bamako (Mali), Wagadugu (Burkina Faso), Niamey (Niger), Ndschamena (Tschad) und Khartoum<br />
(Sudan) fallen. Auf der Seite 51 gibt der Autor vier Ausschnitte aus Zeitungsartikeln und zwei Fotos wieder:<br />
auf dem einen ist ein verendetes Rind zu sehen, auf dem anderen Ziegen, die Blätter von einem Baum fressen.<br />
Im ersten Artikel "Die Wüste holt sich täglich 16 Meter Land" vom April 1984 heisst es:<br />
Lautlos, scheinbar unaufhaltsam rückt sie vor und verschlingt jährlich sechs Millionen Hektar fruchtbaren Landes; die<br />
Wüste - eine tödliche Bedrohung für alles Leben.<br />
Wenige Kilometer von Kargi entfernt, im Grenzgebiet zu Äthiopien und Somalia, beginnt die von nur wenigen Büschen<br />
belebte Steppe. 4'000 Nomaden versuchen hier, 50'000 Tiere zu ernähren.<br />
Hier wird die schon im obigen Text vertretene Meinung über das Vorrücken der Wüste noch einmal zemen-<br />
tiert. Der zweite Artikel "Im Sahel siegt die Wüste: 'Sie sterben unter den Fingern weg'" vom August 1973<br />
wurde bereits auf der Seite 59 des im 1984 erschienenen Lehrmittels "Geographie der Kontinente" zitiert.<br />
(Siehe dazu die Seite 344 dieser Arbeit).<br />
Im dritten Artikel "Äthiopien liegt in Trümmern" vom September 1991 heisst es:<br />
Nirgendwo ist der Hunger grösser, das Elend auswegloser. Es hat den Anschein, die sieben Plagen hätten hier eine feste<br />
Heimstatt gefunden. In den überfüllten Hungerlagern sind die Tagesrationen dürftig: 500 g Getreide, 30 g Fett, 4 l Wasser.<br />
Im ganzen Land graue, ausgezehrte Menschen, die endlose Strassen entlangwanken. Das Bauernland droht in der tödlichen<br />
Zange aus Bodenerosion und Bevölkerungsexplosion zerquetscht zu werden. Über Nacht entstehen in staubiger Einöde<br />
uferlose Hungerstädte.<br />
Nach diesem Artikel wird das Land also zwischen "Bodenerosion und Bevölkerungsexplosion zerquetscht".<br />
Der seit Jahren tobende Bürgerkrieg, der erst 1991 ein Ende fand und im Juni 1998 als Grenzstreit zwischen<br />
Eritrea und Äthiopien noch einmal aufflammte, wird nicht erwähnt. (Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 355<br />
und 415, zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas die Seiten 392 und 403 dieser Arbeit.)<br />
Der letzte Artikel vom September 1985 berichtet unter dem Titel "In der Sahelzone wurden die Brunnen zur<br />
tödlichen Falle":<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Sie bauten Brunnen, um den Menschen in der Sahelzone zu helfen. Doch es scheint, dass die Entwicklungshelfer gerade so<br />
die Dürre zur Dauerkatastrophe machten.<br />
Seite 52 zeigt ein Foto "Sahel - Natur pur", auf dem Ziegen und Erosionsgräben zu sehen sind, und eine<br />
Graphik "Niederschlagsmengen in Nukaschott (1945-1988)", nach der die Jahre 1966-1987 unterdurchschnitt-<br />
liche Regenfälle zeigen. Im Text schreibt der Autor unter der Überschrift "Die vorhersehbare Katastrophe":<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 401
Das Klima ist eine wesentliche Ursache für die Hungerkatastrophe im Sahel. Die Lebensverhältnisse werden durch den<br />
jahreszeitlichen Wechsel von Feucht- und Trockenzeiten bestimmt...<br />
Vor allem jahreszeitliche Schwankungen, Abweichungen von langjährigen Durchschnittswerten... oder gar das<br />
mehrjährige Ausbleiben von Niederschlägen (Dürren) erschweren das Leben und Wirtschaften in diesem Risikoraum.<br />
Hinzu kommen in manchen Jahren noch sturzflutartige Regengüsse, die der Landwirtschaft verloren gehen, da die<br />
ausgetrockneten Böden das Wasser nicht aufnehmen können. Die Sahelbewohner haben sich diesen natürlichen<br />
Bedingungen angepasst. Sie leben als Nomaden im trockenen Norden und als Hackbauern im feuchteren Süden. In den<br />
letzten Jahrzehnten haben sich jedoch grosse Veränderungen abgespielt, die das Wirtschaftsleben sowie die gesamte<br />
Lebensweise sehr stark beeinflusst haben.<br />
Seite 53 zeigt ein Foto "Im Sudan" auf dem Ziegen neben einem Brunnen zu sehen sind, eine Karte "Handels-<br />
wege der Nomaden" im Tschadgebiet und eine Tabelle zu den Sahelstaaten, die über Einwohner und Viehbe-<br />
stand Auskunft gibt. Die Tabelle wird hier in gekürzter Form wiedergegeben:<br />
Staat Einwohner in Mio. Viehbestand (Rinder, Kamele, Schafe, Ziegen) in Mio.<br />
1970 1986 1950 1970 1974 1985<br />
Senegal 3.9 6.61 2 5.5 5.1 5.4<br />
Mauretanien 1.3 1.95 4.5 8.5 5.8 8.2<br />
Mali 5 8.68 11 17.3 6.9 19.5<br />
Burkina Faso 5.4 6.75 2.5 7.5 4.8 8.6<br />
Niger 4 6.25 7.7 13.8 10 9.2<br />
Tschad 3.8 5.14 8.7 9.1 8.7 8.9<br />
Sudan 15.7 22.18 18.4 29.5 44.3 25.1<br />
Die Zahlen zeigen deutlich, dass die rasche Vermehrung der Tierbestände während des Zeitraumes 1950-1970<br />
durch die beiden folgenden Dürreperioden um 1973-1974 und 1984 deutlich verlangsamt wurde. Einige<br />
Länder wiesen 1985 sogar niedrigere Viehbestände als 1970 auf, obwohl die Bevölkerung in allen Ländern<br />
stark zunahm. (Weitere Tabellen zu Viehbeständen sind auf den Seiten 307 und 555 dieser Arbeit wiedergege-<br />
ben.) Im Text schreibt der Autor zu den Veränderungen in Leben der Nomaden unter der Überschrift "Der<br />
Mensch" (S. 53):<br />
Ahmed, ein 30-jähriger Nomade aus dem Tschad, berichtet: "Ich besitze eine stattliche Viehherde - 20 Kamele, 30 Rinder,<br />
30 Ziegen, 20 Schafe und 20 Esel. In den letzten Jahren hat es reichlich geregnet. So konnte ich meine Herde vergrössern.<br />
Gerne hätte ich noch mehr Kamele und Rinder; das verschafft mir Ansehen und Reichtum und grössere Sicherheit während<br />
der Trockenzeit bei einer Dürreperiode. Von Beruf bin ich Viehzüchter und Händler. Leider bekomme ich heute für meine<br />
Felle, Häute und Wolle nur noch halb so viel Hirse wie früher. Schon deswegen musste ich meine Herde vergrössern.<br />
Wir leben hier in einer grossen Sippe von 50 Familien mit fast 800 Stück Vieh. Tagsüber beaufsichtigten wir unsere<br />
Viehherden an den grossen Brunnentrögen. In den letzten Jahren ist die Arbeit viel leichter geworden, denn die Regierung<br />
hat bis zu 100 m tiefe Brunnen mit Dieselpumpen bauen lassen. Sie liefern jetzt zu jeder gewünschten Zeit reichlich<br />
Wasser. So brauchen wir mit unseren Herden keine mühseligen langen Wanderungen mehr zu unternehmen und können in<br />
der Nähe der Brunnen bleiben. Trotzdem müssen wir in einigen Tagen weiter nach Süden, denn auch hier wird allmählich<br />
das Wasser knapp. Bei aller Bequemlichkeit ist das Leben aber auch schwieriger geworden. Denn mit den Hirsebauern im<br />
Süden kommt es immer häufiger zu Auseinandersetzungen. Früher konnten wir das Vieh auf ihre abgeernteten Felder<br />
treiben. Heute lassen die Bauern kein Land mehr brachliegen. Im Gegenteil: Sie haben ihren Ackerbau noch weiter nach<br />
Norden ausgedehnt. Ausserdem betreiben sie nun noch selber Viehzucht. Grund genug für Streit."<br />
Im Lehrmittel "Terra Erdkunde für Realschulen" von 1980-1985 (Bd. 1, S. 113) wurde eine Grafik zu einem<br />
Nutzungsmodell, nachdem jeweils 10 Nomadenfamilien mit insgesamt 700 Stück Vieh ein Gebiet nutzen soll-<br />
ten, abgedruckt. (Zum Tschad siehe auch die Seiten 354 und 462 dieser Arbeit.) Auf der Seite 54 lässt der<br />
Autor im Textkasten "Stimmen zum Sahelproblem" vier Personen zu Wort kommen:<br />
Ein Regierungsbeamter aus Mali:<br />
"Die Nomaden müssen endlich sesshaft gemacht werden: Sie bewegen sich ungebunden, sind bewaffnet, scheuen keinen<br />
Kleinkrieg um Weiden, kreuzen Grenzen nach Gutdünken, entziehen sich dem staatlichen Gesundheitsdienst, ebenso dem<br />
Schulbesuch. Auch zur Fleischversorgung der Städter tragen sie nichts bei. Dagegen entnehmen sie den Brunnen<br />
unkontrolliert das Wasser, vergrössern ständig ihre Herden. Und diese fressen dann das Land zur Wüste."<br />
(Zu Mali siehe auch die Seiten 344 und 418 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Ein Entwicklungshelfer aus dem Sudan:<br />
"Unsere Zivilisation ist ungewollt ein Komplize der Wüste, seit langem. Medizinische Fortschritte schufen den<br />
Bevölkerungsdruck. Der Traktor ermunterte zur Bearbeitung von ungeeigneten Böden in ungeeigneten Lagen. Die<br />
Tiermedizin ermöglichte grosse Herden. Der Brunnenbau wiegte die Hirten in falscher Sicherheit. Sie stockten ihre<br />
Bestände auf, sogar über die ökologisch, d.h. für die natürliche Tragfähigkeit des Bodens zulässige Zahl.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 402
Verwüstungsträchtig sind nicht nur die periodisch wiederkehrenden mageren Jahre, kritisch sind die fetten Jahre mit<br />
Niederschlägen über dem erwarteten Durchschnittswert. Dann schlagen Bauern und Hirten die Warnungen in den Wind.<br />
Die Bauern pflügen jenseits der erfahrungsmässigen Anbaugrenze, die Hirten müssen mit überweideten Flächen vorlieb<br />
nehmen. So programmierten im Sahel die 'fetten Jahre' bereits die Katastrophe!"<br />
Ein Bauer aus dem Senegal:<br />
"Ich habe miterlebt, wie französische Kolonialherren uns zwangen, den Hirseanbau aufzugeben und reine Exportkulturen<br />
wie Baumwolle und Erdnüsse anzubauen. Das führte dazu, dass auf dem Höhepunkt der Dürre noch Erdnüsse ausgeführt<br />
wurden, als wir schon am Verhungern waren. Für unsere damalige Regierung bedeutete der Export willkommene<br />
Einnahmen. Mit einem Teil des Geldes wurde dann Getreide eingeführt. Doch die Verkaufspreise für diese importierten<br />
Nahrungsmittel waren für die meisten von uns unerschwinglich."<br />
Ein Journalist aus Burkina Faso:<br />
"Burkina Faso ist ein sehr armes Land, Morgens und abends, wenn es etwas kühler ist, ziehen Karawanen von Eselskarren<br />
am Strassenrand entlang. Sie bringen Feuerholz nach Wagadugu. Vor dreissig Jahren noch soll die Hügelkette im Norden<br />
von Burkina Faso von Wäldern bedeckt gewesen sein. Heute sind die Hänge kahl. Die Plünderung des Waldes, Buschfeuer<br />
zur Rodung neuer Felder und schliesslich die Herden, die den kleinsten grünen Trieb abfressen, allen voran die Ziegen,<br />
haben sie nackt und braun werden lassen. Die Menschen hier haben auf Kosten ihrer Umwelt gelebt. Und jetzt gibt es nicht<br />
mehr genügend natürliche Ressourcen, um die wachsende Bevölkerung mit den überkommenen Anbaumethoden zu<br />
ernähren. Nur zu 80 <strong>Pro</strong>zent kann Burkina Faso seine Einwohner noch selbst ernähren, der Rest muss eingeführt werden."<br />
Der Autor lässt hier also verschiedene Stimmen, davon zumindest zwei Schwarzafrikaner, zu unterschiedli-<br />
chen Aspekten der Dürre und ihrer vom Menschen mitverursachten Folgen, zu Wort kommen. Seite 54 zeigt<br />
auch zwei Fotos "Frauen transportieren Holz (bis zu 10 kg)" und "Bei Nukaschott, Hauptstadt von<br />
Mauretanien".<br />
Unter der Überschrift "Im Kampf gegen den Sand" schreibt der Autor auf der Seite 55, auf der auch die Fotos<br />
"Solaranlage", "Verbau von Erosionsgräben" und "In der Regenzeit" zu sehen sind:<br />
Der Brennholzbedarf ist eine der Hauptursachen der Wüstenbildung, Wegen der Trockenheit und des gestiegenen Bedarfs<br />
ist Holz für 90% der ständig wachsenden Bevölkerung das wichtigste und fast ausschliessliche Brennmaterial. Bis zu 300<br />
Arbeitstage im Jahr und bis zu einem Drittel des Einkommens eines Arbeiters müssen für die Holzbeschaffung<br />
aufgewendet werden. Eine Nomadenfamilie benötigt im Durchschnitt 200 Bäume im Jahr zum Kochen, Backen,<br />
Zäunebauen. Bei einem Dorf von 1000 Familien führt dies zu einer Kahlschlagfläche mit einem Radius bis zu 100<br />
Kilometern. Zum Teil sind diese baumlosen Zerstörungsringe bereits "zusammengewachsen". Mit jedem Kamel, Esel oder<br />
Lastwagen, die heute zu den Holzmärkten in die Sahelstädte kommen, rückt die Wüste ein Stückchen weiter vor. Um die<br />
Bodenabtragung und damit die Ausbreitung der Wüste zu verhindern, haben Experten eine Reihe von boden- und<br />
wassererhaltenden Massnahmen vorgeschlagen:<br />
- Verwendung von Sonnenenergie, z. B. zum Kochen. Doch der Tagesrhythmus der Einheimischen ist durch die<br />
Tageshitze so bestimmt, dass sie ihre Mahlzeiten abends zu sich nehmen. Ein flächendeckender Einsatz von<br />
Sonnenenergieanlagen ist heute noch zu teuer.<br />
- In den Regionen der Hackbauern soll durch den Bau von kleinen Dämmen der schnelle Abfluss des Regenwassers<br />
verhindert werden. Diese Dämme können die Dorfbewohner selbst anlegen. Das Wasser soll in kleinen Vertiefungen<br />
stehen bleiben und in den Boden einsickern (Grundwasserbildung) oder sich weitflächig verteilen...<br />
- In den dürregefährdeten Gebieten muss die Weidewirtschaft als angepasste Wirtschaftsform erhalten bleiben. Eine<br />
Ausdehnung des Ackerbaus ist hier zu vermeiden. Beim Anlegen von Tiefbrunnen und nach Niederschlägen dürfen die<br />
Nomaden ihre Herden nicht planlos vergrössern. Auch Weidewanderungen müssen sein. Hier gilt es, Weidepläne<br />
aufzustellen, die den Besuch der Tiefbrunnen nur in Trockenzeiten gestatten.<br />
- Eine planvolle Aufforstung muss erfolgen, damit auch in Zukunft noch Holz geschlagen werden kann.<br />
Langfristig können nur den Verhältnissen angepasste Massnahmen den Gefahren der vom Menschen geschaffenen Wüste<br />
entgegenwirken.<br />
Von den aufgezählten Massnahmen hat sich der Bau von kleinen Dämmen als der erfolgreichste erwiesen.<br />
(Siehe dazu die Seite 429 dieser Arbeit).<br />
4.39.1.4 "Der Hunger in der Welt"<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
In einem der immer wieder eingestreuten "Geo-Exkurse" geht der Autor auf den Seiten 56 und 57 unter dem<br />
Titel "Der Hunger in der Welt" auf die <strong>Pro</strong>blematik der Unterernährung ein. In einem Textkasten, der mit dem<br />
Bild eines kleinen Kindes unterlegt ist, schreibt der Autor unter der Überschrift "Was ist Hunger":<br />
Bei unzureichender Ernährung mobilisiert der Körper Kraftreserven durch Verbrennung eigener Fette und Kohlenhydrate.<br />
Ein Kilo körpereigenes Fett z. B. liefert ca. 38'000 kJoule... das sind Reserven für etwa 5 Tage. Anhaltende Unterernährung<br />
(= Kalorienmangel) führt zu Hungerkrankheiten. Ebensowichtig ist die Zusammensetzung der Nahrung... Der gesunde<br />
Mensch braucht täglich etwa 30 Gramm tierisches Eiweiss. Sind es weniger kommt es zur Fehlernährung. Quantitative wie<br />
qualitative "Mangelernährung" führen im Entwicklungsalter zu bleibenden Gehirn- und Wachstumsschäden.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 403
Eine Graphik "Warum Hunger? Das Beispiel Sahel: ein Ursachen-Wirkungs-Gefüge" sieht die grundlegenden<br />
Ursachen in den mangelnden oder zur falschen Zeit erfolgenden Niederschlägen und im Bevölkerungswach-<br />
stum, die über eine Kausalkette schliesslich zur "Wüstenausdehnung" im Sahel führen.<br />
Seite 57 zeigt eine Karte "Ernährung der Weltbevölkerung", auf der die meisten schwarzafrikanischen Staaten<br />
als Gebiete, in denen die Menschen "unzureichend ernährt" sind, bezeichnet. Ausnahme sind Guinea, Liberia,<br />
die Elfenbeinküste, Togo, Kamerun, der Sudan, Somalia, Namibia und Südafrika. Der "Hungergürtel"<br />
erscheint auf der Karte in der Form zweier Linien, wird aber nicht mehr als solcher bezeichnet. (Zu den<br />
Hungerkrisen Afrikas siehe auch die Seiten 401 und 408 dieser Arbeit.) Im Text zur Karte schreibt der Autor,<br />
dass "etwa 500 Millionen Menschen... als unterernährt" gelten, wovon "jährlich... etwa 40 Millionen" sterben.<br />
Als weitere <strong>Pro</strong>bleme führt er Wassermangel (50'000 Tote) oder schlechte Wasserqualität, sowie die Krankhei-<br />
ten Tuberkulose (50 Mio. Tote), Bilharziose (200 Mio. Tote), Malaria (200 Mio. Tote) und Wurmkrankheiten<br />
(300 Millionen) auf. Bei diesen Zahlen handelt es sich teilweise um falsche Angaben. Dies wird leicht klar,<br />
wenn sie addiert werden (ca. 750 Mio.). Wahrscheinlich beziehen sich die Zahlen für die Krankheiten auf die<br />
betroffenen oder gefährdeten Personen, jedoch sicherlich nicht auf Verstorbene.<br />
Unter der Überschrift "Wie man Hunger stillt" führt der Autor die Geburtenkontrolle, die Erhöhung der<br />
Nahrungsmittelproduktion und die Nahrungsmittelhilfe an. Wichtig sei es, "in erster Linie die Armut zu besei-<br />
tigen und die Landwirtschaft im Land selbst zu entwickeln". Abschliessend schreibt der Autor nach "Partner<br />
Dritte Welt": (S. 57):<br />
...Woran es letztlich mangelt: Die Nahrungsmittel gelangen nicht immer zu den Ärmsten. Und: Einige hundert Millionen<br />
Menschen sind zu arm, um sich Essen zu kaufen. Man könnte ihnen Lebensmittel schenken. Aber das ist nur die zweitbeste<br />
und keine menschenwürdige Lösung. Man muss diese Armen in die Lage versetzen, sich selbst dauerhaft zu helfen. Nur<br />
das allein kann ihnen wieder Hoffnung und Achtung vor sich selbst geben."<br />
Hier wird eine Entwicklungshilfeorganisation zitiert, die klar aussagt, dass das Hauptproblem in der Verteilung<br />
der vorhandenen Nahrungsmittel liegt und nicht in erster Linie in der Menge der vorhandenen Agrarprodukte.<br />
4.39.1.5 Kenia<br />
Die Seiten 58-63 sind Kenia gewidmet. Unter der Überschrift "Palmen und ewiger Schnee" schreibt der Autor<br />
auf der Seite 59 zu einer Fahrt entlang der Eisenbahnstrecke Mombasa-Kisumu, die den Süden des Landes<br />
erschliesst:<br />
...Nur eine Grosslandschaft Kenias haben wird nicht gesehen - den extrem trockenen Norden, der heute kaum besiedelt ist,<br />
wo aber einst die "Wiege der Menschheit" stand, was die wahrscheinlichst ältesten Menschenknochenfunde der Welt am<br />
Turkansee bezeugen.<br />
Auf den Seiten 60, mit dem Foto "Angehörige der Massai", und 61, mit den Fotos "Nairobi City", "Sisalplanta-<br />
ge" und "Hotel bei Mombasa", folgt ein Text "Kenias Weg in die Neuzeit", in dem der Autor schreibt:<br />
Über 40 Volksgemeinschaften wohnen im heutigen Kenia. Jahrhundertelang lebten die Stämme vorwiegend als Nomaden<br />
oder Halbnomaden im Einklang mit der Natur. Das bekannteste Volk ist das der Massai, ein Volk einstmals kriegerischer<br />
Hirten. Sie lebten von ihren Rinderherden, mit denen sie über die weiten Savannen zogen. Als Halbnomaden waren sie<br />
allerdings nicht ständig auf Wanderschaft, sondern bauten sich Rundhütten aus Stöcken und Flechtwerk. Die Hohlräume<br />
des Rohbaus wurden mit Gras und Blättern ausgefüllt und Dach und Aussenwände danach mit einer Mischung aus<br />
frischem Dung und Erde "verputzt". Die Massai lebten in kleinen Dörfern und ernährten sich von ihren Herden; ihre<br />
Nahrung bestand fast ausschliesslich aus Milch, Fleisch und Rinderblut. Sie jagten kein Wild, sodass die Bestände der<br />
Wildtiere nie gefährdet waren. Es gab auch keinen Privatbesitz an Grund und Boden, das Massailand gehörte allen Massai.<br />
(Zu den Massai siehe auch die Seiten 329 und 405 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Die Stämme lebten völlig unbehelligt von Einflüssen anderer Kulturen. Die einzige Stadt im Gebiet des heutigen Kenia war<br />
über lange Zeiträume hinweg das über 1000 Jahre alte Mombasa am Indischen Ozean. Schon im Mittelalter kamen<br />
persische und arabische Händler mit ihren kleinen Segelschiffen, den Dhaus, hierher und verkauften Porzellan, Seide und<br />
Gewürze. Sie nutzten für ihre Fahrt die Monsunwinde: den Nordostmonsun für die Reise nach Afrika, den Südwestmonsun<br />
für die Rückfahrt, bei der sie Gold, Elfenbein und Sklaven an Bord hatten.<br />
Vor etwa einhundert Jahren änderte sich das Leben in Kenia wie auch in anderen Gebieten Afrikas fast über Nacht. Der<br />
weisse Mann eroberte den schwarzen Kontinent. Die europäischen Mächte teilten Afrika unter sich auf, sie zogen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 404
willkürliche "Schreibtischgrenzen", ohne Rücksicht auf Stammesgrenzen oder Wanderwege der Nomaden... Auf diese<br />
Weise wurde Kenia britisches Schutzgebiet und später britische Kronkolonie. Die Grenze zu Tansania (ehemals deutsche<br />
Kolonie) weist nur deshalb einen Knick östlich des Kilimandscharo auf, weil die englische Königin Victoria ihrem<br />
deutschen Verwandten, dem Kaiser Wilhelm, auch einen schneebedeckten Gipfel zukommen lassen wollte!<br />
Als Leitlinie für die Ansiedlung von Europäern diente die Ugandabahn. Sie ist noch heute das "Rückgrat" Kenias - fast alle<br />
wichtigen Städte des Landes liegen an dieser Strecke. Nirgendwo in Kenia wird der Zusammenstoss zweier<br />
unterschiedlicher Kulturen so deutlich sichtbar wie im Raum um Nairobi.<br />
Der Name "Nairobi" bedeutet in der Massai-Sprache "kaltes Wasser". Hier befand sich noch vor 100 Jahren eine wichtige<br />
Viehtränke für die Herden der Massai. Ab 1899 entwickelte sich am Meilenstein Nr. 327 der Ugandabahn die Siedlung<br />
Nairobi aus dem Nichts. Damals gab es an dieser Stelle lediglich ein Eisenbahnlager - heute ist Nairobi die Hauptstadt<br />
Kenias mit fast 2 Millionen Einwohnern.<br />
(Zu Nairobi siehe auch die Seite 225 dieser Arbeit.)<br />
Durch das schnelle Wachstum der Bevölkerung stellt die Überbevölkerung ein grosses <strong>Pro</strong>blem für das Land dar. Das<br />
Acker- und Weideland wird immer knapper, da nur etwa 1/3 Kenias für eine intensive Landwirtschaft geeignet ist. Die<br />
restlichen Gebiete bestehen zu jeweils 1/3 aus Savannen und Halbwüsten. Heute leben 80% der ungefähr 27 Millionen<br />
Einwohner Kenias auf nur 20% der Staatsfläche. Obwohl nach der Unabhängigkeit 1963 eine Landreform durchgeführt<br />
und viele Kleinbauernstellen geschaffen wurden, gibt es immer mehr Landlose. Ein Grossteil dieser Menschen zieht nach<br />
Nairobi, wo etwa die Hälfte der Einwohner in slumartigen Randsiedlungen unter menschenunwürdigen Bedingungen lebt.<br />
Das traditionelle Leben der afrikanischen Bevölkerung verändert sich immer mehr. Viele versuchen, ihren Lebensunterhalt<br />
im Tourismus zu verdienen, vor allem in den vielen Hotelanlagen nördlich und südlich von Mombasa. Aber auch hier<br />
finden sie, weit entfernt von ihren Heimatdörfern und ihren Familien, oft nur während der Hauptsaison Arbeit. Durch den<br />
sich rasant entwickelnden Touristenstrom - etwa 1 Million Touristen im Jahr - erfolgten tiefe Eingriffe in die Natur. Für das<br />
Land als Ganzes gesehen stellt dieser Wirtschaftszweig aber eine bedeutende Einnahmequelle dar.<br />
(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 393 und 431, zum Tourismus die Tabelle "Tourismus in<br />
afrikanischen Staaten" im Anhang auf der Seite 545 dieser Arbeit.)<br />
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Wirtschaft Kenias ist der Export von Kaffee, Tee und Sisal. Diese <strong>Pro</strong>dukte werden<br />
vorwiegend in riesigen Plantagen angebaut, die zum grossen Teil weissen Eigentümern gehören.<br />
So bestimmt auch nach über 30 Jahren Unabhängigkeit der Einfluss der Europäer immer noch die Wirtschaft und das<br />
Leben in Kenia - mit all seinen guten und schlechten Auswirkungen.<br />
Die Sisalpflanze wurde 1893 von einem Angestellten der Deutschen Ostafrika-Gesellschaft von Florida -<br />
Mexiko hatte eine Exportverbot verhängt - nach Tanga (Tansania) eingeführt. Nur gerade 62 der 1000 impor-<br />
tierten Setzlinge überlebten, aber sie genügten um 1900 den ersten afrikanischen Sisal zu exportieren. (Meister<br />
1986, S. 158 ) Von Tanga verbreitete sich der Sisal rasch in die Nachbarländer. (Zum Sisalanbau siehe auch<br />
die Seite 300 und die Tabelle "Sisalproduktion ausgewählter Länder" im Anhang auf der Seite 553; zum<br />
Kaffeeanbau die Seite 391 und zum Anbau und der Verwendung von Tee die Seiten 225 und 476 dieser<br />
Arbeit.)<br />
Auf den Seiten 62 und 63 folgt ein weiterer "Geo-Exkurs" zum Thema Tourismus in Kenia. Im Text schreibt<br />
der Autor unter der Überschrift "Nationalparks - bedrohte Paradiese":<br />
Im Jahre 1909 reiste der amerikanische Präsident Roosevelt in Begleitung von zwei Grosswildjägern nach Kenia. Während<br />
seiner mehrmonatigen Safari, bei der ihn 600 Träger unterstützten, erlegte er über 500 Wildtiere. Dies war der Beginn eines<br />
neuen Zeitvertreibs für Reiche - gegen Bezahlung in Afrika zu jagen. Erst Ende der siebziger Jahre ging das "goldene<br />
Zeitalter" der Grosswildjäger zu Ende. Kenias Präsident Kenyatta hatte die Jagd wegen des rapide abnehmenden<br />
Wildbestandes verboten und die Errichtung weiterer Schutzgebiete angeordnet...<br />
Die schönsten Wildgebiete sind heute von Schaulustigen so überfüllt, dass die Fachleute die rapide Zerstörung der<br />
natürlichen Umwelt beklagen...<br />
Entgegen der Behauptung anderer Lehrmittel, vor allem die schwarzafrikanische Bevölkerung hätte die Wild-<br />
bestände dezimiert, wird hier ausgesagt, dass die Touristen massgeblich zu der Bedrohung der Wildtiere<br />
beitrugen. In der Textbox "Safari in Kenia" wird der Tourist mit den folgenden Worten beworben:<br />
...In diesem ehemaligen Grosswildjäger-Camp erleben Sie echte Buschatmosphäre. Jede Unterkunft hat eine eigene<br />
Warmwasserdusche...<br />
Als ob irgend jemand im "richtigen Busch" über fliessend Wasser, geschweige denn eine Warmwasserdusche<br />
verfügen würde. Auf der Seite 63 schreibt der Autor im Haupttext weiter:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
...Einige Raubtiere zeigen bereits ein gestörtes Verhalten, da sie ihre Beute nicht mehr anpirschen können, ohne dass ihnen<br />
eine Zuschauerhorde auf den Fersen ist... Auch die Vegetation leidet unter dem Massentourismus. Oftmals hört die<br />
ursprüngliche Vegetation an der Grenze zum Park abrupt auf. Dort werden die Bäume gefällt, um Holz für den Hausbau<br />
oder die Touristenlodges zu gewinnen oder um Schnitzereien für die Souvenirläden herzustellen.<br />
Manche Volksgruppen fühlen sich von der Entwicklung überrollt. Als der Amboseli-Nationalpark geschaffen wurde,<br />
verbot man dem Hirtenvolk der Massai, ihre Herden in den Sümpfen zu tränken. Die Massai schlugen zurück, indem sie<br />
fast alle Spitzmaulnashörner im Park töteten. Von der Regierung werden sie immer wieder dazu aufgefordert, Nutzpflanzen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 405
anzubauen, die Schule zu besuchen, feste Unterkünfte zu errichten und überhaupt endlich sesshaft zu werden und<br />
aufzuhören, ein Ärgernis darzustellen.<br />
Diese Politik dürfte auch in Zukunft wenig Erfolg zeigen, haben sich doch viele Massai bewusst dazu<br />
entschlossen, sich ihre traditionelle Lebensweise zu erhalten, auch wenn sie sich punktuell auf die "moderne<br />
Zivilisation" einlassen. (Zu den Massai siehe auch die Seite 404, zum Tourismus die Seite 390 dieser Arbeit.)<br />
Im Textkasten "Der leise Tod der sanften Riesen" gibt der Autor einen weiteren Grund für den Rückgang der<br />
Elefanten vor der Einrichtung von Schutzgebieten an:<br />
...In den 60er Jahren wurden viele Elefanten abgeschossen, um die Ernten der drastisch zunehmenden Bevölkerung zu<br />
schützen...<br />
Die Kenianer handelten also nicht anders als ein Bauer bei uns, der dafür plädiert, eben die Wildschweine zu<br />
schiessen, die seine Äcker zerstören. (Vergleiche dazu auch die Zitate auf den Seiten 106 und 272 dieser<br />
Arbeit).<br />
Im Kapitel "Bergtour zum höchsten Gipfel Afrikas" werden keine nennenswerten Angaben zur Fragestellung<br />
dieser Arbeit gemacht. (Zu Kenia siehe auch die Seite 389 dieser Arbeit.)<br />
4.39.2 Band 4<br />
Der Band 4 enthält ein Kapitel "Schwarzafrika" auf den Seiten 178-181. Auf der Seite 178 findet sich ein Foto<br />
"Kinder, Kinder" und ein Textkasten mit der Überschrift "Schwarzafrika", in dem es heisst:<br />
- das ist der Raum südlich der Sahara, der im Wesentlichen von der dunkelhäutigen Bevölkerung (Sudan- und<br />
Bantuneger) bewohnt wird.<br />
- das ist das "Tropisch-Afrika" der immerfeuchten und wechselfeuchten Tropen.<br />
- das sind die über 400 Millionen Schwarzen, die sich in rund 2'000 Stämme und Stammesgruppen gliedern, annähernd<br />
1000 Sprachen und unzählige Dialekte sprechen.<br />
- das ist das Afrika mit der rasantesten Bevölkerungsentwicklung auf der Erde.<br />
- das ist das Afrika der ehemaligen Kolonien, von denen die meisten erst ab 1960 ihre Unabhängigkeit erhielten.<br />
- das ist der Schauplatz von Massakern, Aufständen, Stammes- und Bürgerkriegen.<br />
Der Autor verwendet hier wieder den Begriff "Stämme", wo er besser von "Völkern" sprechen würde. (Siehe<br />
dazu auch die Seite 127 dieser Arbeit.) Ausserdem bezeichnet er Afrika als Schauplatz der "Massaker,<br />
Aufstände und Kriege" und zeichnet damit das Bild eines im Chaos versinkenden Kontinents, welches sich<br />
auch in den Zeitungs- und Fernsehberichten lange grosser Beliebtheit erfreute.<br />
Nach dieser kurzen Charakterisierung Schwarzafrikas schreibt der Autor unter dem Titel "Die Weissen<br />
kommen" (S. 178):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Lange blieb Afrika der dunkle, unerforschte Kontinent. Im Altertum war Nordafrika Teil des römischen Reiches. Über die<br />
Araber, die bis in den Sudan und das Nigergebiet Handel betrieben, drang im Mittelalter gelegentlich Kunde nach Europa.<br />
Vom 15. Jahrhundert an erkundeten portugiesische Seefahrer (Bartholomeus Diaz, Vasco da Gama) die Westküste Afrikas<br />
bei ihrer Suche nach dem Seeweg nach Indien. Erst mit erwachendem wirtschaftlichen Interesse wurden der Küstensaum<br />
Westafrikas und Teile des Hinterlandes bekannt. Etwa zur gleichen Zeit begann eines der traurigsten Kapitel in der<br />
Geschichte Afrikas, die massenweise Versklavung der Negerbevölkerung... Der eigentliche "Wettlauf" um Afrika setzte<br />
jedoch erst Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Die europäischen Mächte begannen, den afrikanischen Kontinent planmässig zu<br />
erschliessen. Sie schlossen zunächst Handels- und Schutzverträge mit den Stammeshäuptlingen ab, festigten ihre<br />
Ansprüche auf die Küstenstreifen und machten diese zu Kolonien. Durch Verträge zwischen den Kolonialmächten selbst<br />
wurde dann das oft kaum bekannte Hinterland schematisch aufgeteilt und nach und nach unterworfen. So bildete die<br />
ziemlich zufällige Einrichtung von Handelsstützpunkten die Grundlage für die spätere Aufteilung des Hinterlandes. Die<br />
Grenzen der entstandenen Kolonien wurden - oft mit dem Lineal ohne Rücksicht auf die Ausdehnung und Lebensweise der<br />
bestehenden Stämme festgelegt. Dadurch sind unterschiedliche, z.T. verfeindete Völker in einem Staat vereinigt, andere<br />
Völker wiederum getrennt worden. Hier haben viele der heutigen politischen Unruhen ihre Wurzeln, denn die willkürliche<br />
Festlegung der Grenzen lässt kaum zu, dass die Bewohner zu Nationen zusammenwachsen.<br />
Der Einfluss der Europäer zeigte sich in der Verwaltung der Kolonien, in der Anlage von Plantagen, im Abbau von<br />
Bodenschätzen, in der Erschliessung des Landes durch Strassen und Eisenbahnen sowie im Aufbau des Schulwesens und<br />
in der christlichen Missionierung.<br />
Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten wurde der Kontinent unter 7 europäischen Mächten aufgeteilt, aber ebenso schnell<br />
wurden die Kolonien wieder selbstständig. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Unabhängigkeitsbewegung zwischen 1950 und<br />
1970 über den afrikanischen Kontinent verbreitet.<br />
Diese letzte Äusserung des Autors verschweigt einen Teil der Wahrheit, denn zumindest ab den dreissiger<br />
Jahren waren schwarzafrikanische Intellektuelle bestrebt, die Unabhängigkeit für ihre "Länder" zu erreichen,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 406
einigen gelang dies erst Jahre nach dem im Text genannten Jahr 1970. (Vergleiche dazu die Karte "Erlangung<br />
der Unabhängigkeit im Anhang auf der Seite 565 dieser Arbeit.)<br />
4.39.2.1 Sklavenhandel<br />
Die Seite 179 beschäftigt sich mit dem Sklavenhandel. Im Text schreibt der Autor:<br />
1549 erreichten erstmals 200 Schwarze den amerikanischen Kontinent; 25-30 Millionen, ein Viertel der damaligen<br />
Gesamtbevölkerung Afrikas, und zwar die Kräftigsten, sollten folgen. Die immer grösser werdenden Kaffee-, Tabak- und<br />
Baumwollplantagen "verschlangen" jährlich etwa 50'000-60'000 Sklaven. Dieser Menschenhandel führte entlang von<br />
"Sklavenstrassen" zur Entvölkerung ganzer Landstriche, zur Ausblutung und zur Stagnation der damaligen schwarzen<br />
Bevölkerung. Die Portugiesen waren zwar die ersten Sklavenhändler, die Engländer aber "perfektionierten" den Bau von<br />
Sklavenschiffen. Etwa 400-450 Sklaven wurden jeweils in den Laderaum der Sklavenschiffe wie Stückgut aufgestaut.<br />
Viele erstickten in der unerträglich heissen Luft. Sie wurden wie eine "verdorbene Ware" über Bord geworfen. Erst 1865<br />
wurde in den USA der Sklavenhandel verboten.<br />
(Die im Text geschilderte Beladung des Schiffes wird in der auf der Seite 446 dieser Arbeit wiedergegebenen<br />
Zeichnung abgebildet.) Mittels einer Karte und einem Schema wird ebenfalls auf der Seite 179 der "Drei-<br />
eckshandel dargestellt. Dazu gehört auch ein kurzer Text "Beispiel: Tauschwert eines Sklaven", in dem es<br />
heisst:<br />
In Christiansborg (Ghana) kostete im Jahre 1750 ein "Mannsklave" in besten ohne Fehl" den Gegenwert von 1920 Mark.<br />
Dafür durften sich die "Lieferanten" aussuchen: "2 Flinten, 40 Pfund Schiesspulver, 30 Liter Branntwein, 1 Stück Kattun, 4<br />
Stück ostindisches Gewebe, 4 Stück grobe schlesische Leinwand, 2 Stangen Eisen, 1 Stange Kupfer, 160 Stück Korallen,<br />
20 Pfund Kaurimuscheln, 1 Zinnschale."<br />
Die Kaurimuscheln waren deshalb begehrt, weil sie teilweise als Währung benutzt wurden. Auf der gleichen<br />
Seite ist auch eine Zeichnung abgebildet, die hier wiedergegeben werden soll, da sie auch in verschiedenen<br />
Lehrmitteln aus dem Bereich Musik mehrmals auftaucht:<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Der kamerunische Schriftsteller Mongo Beti, geboren 1932, schrieb in "De la Violence de l'Impérialisme au<br />
Choas Rampant" von 1978 (Jestel Hrsg., 1982, S. 56) zu diesem Thema: "Welcher ehemalige Schüler, sei er<br />
nun schwarz oder weiss, erinnert sich nicht an den nur zu berüchtigten Zug von ausgemergelten schwarzen<br />
Gefangenen, die die glutheisse Savanne überquerten, mit einem Sträfling als Aufseher, der, obwohl selbst<br />
schwarz, eine unbarmherzige Peitsche auf die schon mit Striemen übersäten Rücken herunterklatschen lässt.<br />
Sie sind aneinandergekettet und tragen Halseisen, die ihnen unerbittlich den Hals zusammenpressen. Es wird<br />
sich wohl manch einer wundern, aber für die Afrikaner meiner Generation, für die Schwarzafrikaner unter<br />
französischer Oberhoheit, wie man damals sagte, die vor dem Ersten Weltkrieg die Welt mit offenen Augen<br />
sahen, zeigte sich dieses nur allzu vertraute Schauspiel zuerst in der Realität des täglichen Lebens und tauchte<br />
erst später wieder in Büchern auf. Ich selbst habe als Kind mehrmals Züge von Gefangenen auf der Strasse<br />
vorbeiziehen sehen, deren Fesseln aus dicken Seilen nicht weniger grausam waren als die stählernen Halsringe.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 407
Diese Arbeitskräfte, Ausbeute von Razzien, wurden auf diese Weise von der Kolonialverwaltung zu den Plan-<br />
tagen und Baustellen des Imperialismus gebracht. Denn trotz der internationalen Verträge, trotz der Werke<br />
Victor Hugos und trotz der Vorhersagen von Victor Schoelcher und anderer <strong>Pro</strong>pheten verlängerte sich durch<br />
die französische Kolonisation unsere Sklaverei bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein." (Zum Sklavenhan-<br />
del siehe auch die Seiten 384 und 439 dieser Arbeit.)<br />
4.39.2.2 "Entwicklung im ländlichen Afrika"<br />
Das Kapitel "Entwicklung im ländlichen Afrika" enthält neben dem Haupttext, eine Tabelle mit Grafik "Fak-<br />
ten zur Bevölkerungssituation", aus der hervorgeht, dass Afrika das grösste Bevölkerungswachstum der Welt<br />
aufweist: Die Bevölkerungszahl wird auf 1597 Millionen für das Jahr 2025 geschätzt, von 642 Mio. von 1990.<br />
Die "durchschnittliche Kinderzahl je Frau" betrage für Afrika zwischen 6 und 7 Kindern - ebenfalls ein<br />
Weltrekord. Ein Foto auf der gleichen Seite zeigt "Frauen bei der Arbeit" und eine Kreisgrafik "Arbeitsbela-<br />
stung einer afrikanischen Frau, die folgenden Tätigkeiten aufführt: "pflügen und pflanzen 9 Std. 30 min.",<br />
"Feuerholz sammeln 1 Std.", "Getreide und Hülsenfrüchte zerstampfen 1 Std. 30 min.", "Wasser holen 45<br />
min.", "Feuer machen, kochen 1 Std.", "Essen servieren, essen 1 Std.", "saubermachen und waschen 45 min."<br />
und "zum Feld gehen 30 min.". Im Text schreibt der Autor (S. 180):<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Regelmässig erreichen uns Bilder und Meldungen über Flüchtlingslager und riesige Flüchtlingsströme, über Krankheiten<br />
und Hungerkatastrophen in Schwarzafrika. Afrika gilt als der "Hungerkontinent" schlechthin. Die Gründe sind<br />
vielschichtig und hängen oft miteinander zusammen. Der Hunger in Afrika hat zum grossen Teil seine Ursachen auch in<br />
der kolonialen Vergangenheit, als die Kolonialherren Plantagen für Exportprodukte auf den besten Böden anlegen liessen.<br />
Für die Eigenversorgung blieb zuwenig übrig. Auch heute noch besteht dieses Missverhältnis von Subsistenzwirtschaft<br />
zugunsten der Exportwirtschaft. Hinzu kommt, dass die Preise für tropische Agrarprodukte ständig schwanken oder sogar<br />
sinken. Diese Abhängigkeit trifft besonders die afrikanischen Bauern. Und fast 80% der Bevölkerung in den Staaten<br />
Schwarzafrikas lebt von der Landwirtschaft. Inzwischen konnte zwar die Nahrungsmittelproduktion erheblich gesteigert<br />
werden, dennoch herrscht Hunger. Zu rasch wächst die Bevölkerung, nirgends auf der Welt schneller als in Afrika...<br />
Gerade die "Segnungen" der Zivilisation, der medizinische Fortschritt, hat die Explosion mitverursacht. Dazu kommt die<br />
traditionelle Einstellung des Afrikaners zu Familie und Kindern.<br />
(Zu den Hungerkrisen Afrikas siehe auch die Seiten 403 und 413 dieser Arbeit.) Entgegen der Aussagen des<br />
Textes weisen einige Länder in Nahost ein noch schnelleres Bevölkerungswachstum auf als die schwarzafrika-<br />
nischen Länder. (Zur traditionellen Einstellung und ihren Einfluss auf den "Fortschritt" siehe auch die Ausfüh-<br />
rungen auf der Seite 222 dieser Arbeit.) Zum afrikanischen Dorf schreibt der Autor auf der Seite 180:<br />
Das afrikanische Dorf ist heute noch Siedlungs-, Lebens- und Wirtschaftsmittelpunkt des Stammes, der Sippe oder des<br />
Clans. Inzwischen beginnt jedoch die gemeinschaftsbindende und sichernde Kraft nachzulassen. Sogar im abgelegensten<br />
Dorf steht heute ein Fernsehgerät, über das den Menschen ein Trugbild des glanzvollen Lebens in der Grossstadt<br />
vorgegaukelt wird. Viele Einheimische, insbesondere die Männer, wandern in die Städte ab. Zurück bleiben oftmals die<br />
Frauen, die im Dorf- und Familienleben schon immer eine tragende Rolle gespielt haben.... Heute ist ihre Situation um so<br />
schwieriger. Die hohe Arbeitsbelastung, ihre angeschlagene Gesundheit infolge der hohen Kinderzahl und des<br />
mangelhaften Gesundheitsdienstes auf dem Lande haben eine sinkende Nahrungsmittelproduktion zur Folge. Auch die<br />
Frauen beginnen in die Städte abzuwandern.<br />
Um den Hunger in Afrika wirkungsvoll bekämpfen zu können, muss sowohl das Dorf "aufgerüstet" als auch die Rolle der<br />
Frau bei Entwicklungsmassnahmen viel stärker berücksichtigt werden.<br />
In den neueren Berichten der WHO ist die Gesundheit der Frauen in den Entwicklungsländern, insbesondere<br />
im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft, eines der als zentral erkannten Themen der späten neunziger<br />
Jahre. Die Seite 181 vermittelt unter dem Titel "Wir werten Zeichnungen aus" einen Einblick in eine geogra-<br />
phische Arbeitstechnik. Dazu enthält die Seite zwei Abbildungen und einen kurzen Text, in dem es heisst:<br />
Das afrikanische Dorf muss entwickelt werden. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Massnahmen der "angepassten<br />
Technologie". Durch sie sollen die Initiative der beteiligten Einwohner geweckt und die Lebens- und Arbeitsbedingungen<br />
der Situation des Dorfes entsprechend verbessert werden. Wesentliche Kriterien sind: geringer Kostenaufwand,<br />
produktionssteigernd, lokal angepasst, umweltverträglich, von den Dorfbewohnern verstanden und ohne Spezialausbildung<br />
durchführbar...<br />
Ob eine Bewirtschaftungsweise wie in den beiden Abbildungen, mit der Pflanzung von Ölpalmen und der<br />
Zucht von Rinderherden, tatsächlich möglich ist, sei dahingestellt. Zumindest stellt sich aber die Frage, was<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 408
ein Zugbrunnen in einer Gegend bewirken soll, in der die schon erwähnte Ölpalme wächst, die doch ursprüng-<br />
lich aus dem Regenwald der Guineaküste stammt (Lötschert/Beese 1992, S. 202). Zudem wird einmal mehr<br />
die Forderung erhoben, "das afrikanische Dorf", sprich die ländliche Bevölkerung, müsse "entwickelt werden",<br />
d. h. einmal mehr ist ein Autor der Ansicht, dass nur von aussen ein Entwicklung der Gebiete Schwarzafrikas<br />
möglich sei.<br />
4.39.3 Zusammenfassung<br />
In beiden Bänden des Lehrmittels "Seydlitz Geographie", die sich mit Schwarzafrika beschäftigen, wird gros-<br />
ser Wert auf die Geschichte Schwarzafrikas seit dem Auftauchen der Portugiesen und damit den auf dem<br />
Kontinent erbrachten Taten der Europäer gelegt.<br />
Nach dem traditionellen Vergleich zwischen "Pygmäen" und Bantu bespricht der Autor eingehend die Sahel-<br />
zone und die Dürrekatastrophen der siebziger, achtziger und neunziger Jahre. Dazu kommen auch verschiede-<br />
ne Personen zu Wort, so ein Nomade, ein Bauer, ein Journalist, ein Entwicklungshelfer und ein<br />
Regierungsbeamter.<br />
Die zentrale Idee des Lehrmittels ist die Vermittlung Afrikas als Hungerkontinent, dem es wegen des grossen<br />
Bevölkerungswachstums nicht gelingt, genügend Nahrungsmittel zu produzieren. Dabei sollen die Frauen<br />
Schwarzafrikas, die nur in der traditionellen Rolle als Mutter und Feldarbeiterin dargestellt werden, den<br />
Schlüssel zu einer positiveren Entwicklung spielen.<br />
Geographielehrmittel: Seydlitz Geographie (1994-1996)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 409
4.40 Heimat und Welt (1994-1996)<br />
...Immer öfter sehen wir grosse Rinderherden, die von dunkelhäutigen Hirten gehütet werden. Mein Vater hat gesagt, dass<br />
man diesen Teil des Kontinents auch Schwarzafrika nennt... Der Markt von Kano in Nigeria ist sehr schön. Von weit her<br />
kommen die Bauern um hier ihre Waren anzubieten, z. B. Mais, Hirse und vor allem Erdnüsse. Auf dem Markt haben wir<br />
erfahren, dass es dieses Jahr viel geregnet hat und dass die Ernte deswegen sehr gut ist. (Bd. 4, S. 69)<br />
Das fünfbändige Lehrmittel "Heimat und Welt", 1994 bis 1996 im Westermann Schulbuchverlag für die Klas-<br />
sen 5-9 der Hauptschule in Baden-Württemberg erschienen, behandelt Afrika vor allem im Band für die<br />
8. Klasse. Insgesamt findet Afrika auf rund 30 der insgesamt 536 Seiten Erwähnung.<br />
Eine erste Stelle findet sich im Band für die 5. Klasse auf der Seite 17, auf der auf einer Karte "Herkunfts-<br />
länder der ausländischen Mitschülerinnen und Mitschüler" Marokko und Togo als Herkunftsland von<br />
Schulkindern in Deutschland bezeichnet werden. Die Schülerin Angie aus Togo kommt zu Wort:<br />
Togo ist ein sehr armes Land. Es gibt nur kleine Fabriken und viel Landwirtschaft. Am meisten wird Kakao angebaut.<br />
Meine Eltern arbeiteten auf einer Plantage. An der Küste regnet es fast jeden Tag. Der starke Gewitterregen weicht dann<br />
die Strassen auf, und alles ist matschig. Sommer und Winter wie hier gibt es nicht - auch keinen Schnee..."<br />
Auf der Seite 19 des gleichen Bandes findet sich eine Zeichnung mit der Bildlegende "Meja aus Nairobi:<br />
Jambo". Die Bände für die Klassen 6, 7 und 9 enthalten keine Angaben zum afrikanischen Kontinent.<br />
4.40.1 Band 4<br />
Der Band für die 8. Klasse enthält ein Grosskapitel "Leben in Trockenräumen" welches die Afrika betreffen-<br />
den Kapitel "Wandern um zu überleben" (S. 42-43), "Nomaden im Sahel" (S. 46-47) und "Ausbreitung der<br />
Wüste - vom Menschen verursacht" (S. 48-49 ) enthält, sowie das Grosskapitel "Leben im tropischen Regen-<br />
wald" mit den Kapiteln "Pygmäen - die kleinen Menschen des Waldes" (S.58), "Bantus - Ackerbauern im<br />
tropischen Regenwald" (S. 59), "Wanderfeldbau mit Brandrodung" (S. 60-61), "Afrika - Von Algier bis<br />
Kapstadt" (S.68-70) zu Afrika. Zudem enthält der Band das Kapitel "Hunger gehört zum Alltag" (S. 78-79), in<br />
welchem auch Afrika Erwähnung findet, und ein Foto "In Lagos am 4. Januar" auf der Seite 6.<br />
Im Kapitel "Wandern um zu überleben" wird das Leben einer Tuareg-Nomadin geschildert, auf das hier nicht<br />
weiter eingegangen werden soll. Ebensowenig wie auf die beiden anderen Kapitel zu den Trockenräumen, da<br />
sie die Fragestellung dieser Arbeit nur am Rande streifen. Allerdings ist zu erwähnen, dass der Autor von der<br />
"Katastrophendarstellung" dieses Gebietes, zugunsten einer Schilderung der Lebenswirklichkeit dieser<br />
Menschen während eines Normaljahres mir durchschnittlichen Niederschlägen, abgesehen hat. Die Kapitel<br />
zum Regenwald sollen hier eingehender betrachtet werden.<br />
4.40.1.1 "Pygmäen"<br />
Das Kapitel "Pygmäen - die kleinen Menschen des Regenwaldes" enthält auf der Seite 58 neben dem Haupt-<br />
text eine Kurzinformation, aus der hervorgeht, dass die Pygmäen "Jäger und Sammler" seien, "Hütten aus<br />
Zweigen und Blättern" herstellten, ihnen "Waldfrüchte, Wurzeln, Blätter, Schnecken, Insekten und Fleisch" als<br />
Nahrung dienten, und sie "Speere, Messer und Giftpfeile" als "Jagdgeräte" verwendeten. Weiter ist ein Foto<br />
"Wohnhütte der Pygmäen", auf dem mehrere Menschen zu sehen sind, und eine Zeichnung "Maniok" abgebil-<br />
det, zu der es heisst:<br />
Maniok, Yams und Batate werden in den Tropen wegen ihrer stärkehaltigen Wurzelknollen, ähnlich den Kartoffeln,<br />
angebaut. Die Knollen können gekocht oder gebraten werden. Ihr Mehl wird zu Brei, Brot oder Fladen verarbeitet.<br />
Weshalb der Autor gerade im Kapitel zu den "Pygmäen" die aus Südamerika stammenden Kulturpflanze abbil-<br />
det, wird aus der Bildlegende nicht klar. Im Haupttext schreibt der Autor (S. 58):<br />
Geographielehrmittel: Heimat und Welt (1994-1996)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 410
Die Pygmäen zählen zu den Ureinwohnern Afrikas. Sie sind ein Naturvolk, das sich den Gesetzen des Waldes angepasst<br />
hat. Wie vor Jahrtausenden leben die Pygmäen als Jäger und Sammler im tropischen Regenwald. Etwa 20 Familien<br />
gehören jeweils zu einer Gruppe. Wegen ihrer Körpergrösse (etwa 1.50 m) nennt man sie "die kleinen Menschen des<br />
Waldes". Die Männer gehen auf die Jagd. Ihre Beute, z. B. Affen, Vögel und auch Elefanten, teilen sie gleichmässig unter<br />
allen Jägern auf. Die Frauen sammeln essbare Pflanzen und kleine Tiere. Pygmäenhütten sind aus Laub gebaut. Wird ein<br />
Jagdgebiet aufgegeben, zieht die Gruppe zu einer anderen Stelle und baut dort neue Hütten.<br />
Heute geben immer mehr Pygmäen ihre traditionelle Lebensweise auf. Ihre Jagdgebiete werden immer kleiner durch die<br />
Erschliessung des tropischen Regenwaldes mit Strassen, Siedlungen und Ackerland. Die Pygmäen arbeiten zunehmend in<br />
den Dörfern der Ackerbauern. Dort sind sie als Feldarbeiter, Last- und Wasserträger tätig.<br />
Krankheiten und Alkoholismus führen dazu, dass sich die Zahl der Pygmäen verringert. Vor 50 Jahren lebten etwa 360'000<br />
Pygmäen, heute sind es nur noch rund 100'000.<br />
(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 400 und 422 dieser Arbeit.) Interessant ist vor allem die Entwicklung<br />
der Bezeichnung dieser Menschengruppe von den Giftpfeilen abschiessenden Zwergvölkern der dreissiger<br />
Jahre hin "zu den kleinen Menschen des Regenwaldes" von 1995. Bei der Beschreibung der Ursachen des<br />
Rückgangs der "Pygmäen" vergisst der Autor Mischehen als weiteren und seit Jahrhunderten wichtigen Grund<br />
für das verschwinden kleiner Volksgruppen zu erwähnen. Dies könnte auch mit ein Grund für die abweichende<br />
Angabe der durchschnittlichen Körpergrösse der "Pygmäen" in Bezug auf ältere Lehrmittel sein, die eine<br />
Grösse von 1.40 m angeben, während im Zusammenhang mit einem Bericht von Stanley im Text "Der<br />
Urwald" aus dem 1953 erschienenen "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder" sogar nur von einer<br />
Grösse von 90 cm für eine junge Pygmäenfrau gesprochen wurde. (Siehe dazu die Seite 114 dieser Arbeit.)<br />
4.40.1.2 Bantu<br />
Ähnlich wie das vorherige ist das Kapitel "Bantus - Ackerbauern im tropischen Regenwald" aufgebaut. Eine<br />
Art des Vergleiches der beiden Menschentypen, wie sie sich schon im Lehrmittel "Erdkunde" von 1968,<br />
besprochen ab der Seite 172 dieser Arbeit, findet. Aus der Kurzinformation erfährt der Leser, dass die Bantus<br />
"Ackerbauern" seien, ihre "Hütten aus Lehm und Stroh" bauten, ihnen "Anbaufrüchte wie Bananen, Mais,<br />
Knollenfrüchte (Maniok, Yams und Batate)" als Nahrung dienen, und sie "Grabstock, Hacke und Haumesser"<br />
als "Ackergeräte" benutzen würden. Ein Foto "Bantusiedlung" zeigt den Typ der bereits erwähnten "Hütten aus<br />
Lehm und Stroh". Im Text schreibt der Autor (S. 59):<br />
Auch die Bantus sind ein Naturvolk, das im tropischen Regenwald lebt. Im Gegensatz zu den Pygmäen betreiben die<br />
Bantus Ackerbau, Sie roden und brennen Flächen im Urwald ab und legen darauf Pflanzungen an. Diese Arbeit wird von<br />
den Männern erledigt. Auf den neu gewonnenen Ackerflächen bauen die Bantus Bananen, Mais und Knollenfrüchte, zum<br />
Beispiel Maniok, Yams und Batate, an. Als Ackergeräte benutzen sie Grabstöcke, mit deren Hilfe sie die Pflanzen setzen.<br />
Mit Hacken wird der Boden gelockert. Für die Feldarbeit sind vor allem die Frauen zuständig.<br />
Die Bantus wohnen in kleinen Dörfern. Diese verlassen sie, wenn der Boden durch den Anbau ausgelaugt ist. Dann suchen<br />
sie sich ein neues Waldstück und bauen ein neues Dorf. Ihre Hütten bestehen aus Lehm und Stroh. Sie sind dem<br />
Regenwaldklima angepasst: Der Regen kann von den spitzen Dächern gut ablaufen.<br />
Der grösste Teil der Bantus lebt auch heute noch in dieser traditionellen Weise. Aber immer mehr Bantus wandern in die<br />
Städte ab. Einige versuchen auch Arbeit in den Kobalt-, Kupfer-, Zinn- und Bleiminen im Süden von Zaire und in Sambia<br />
zu finden.<br />
Das Kapitel "Wanderfeldbau mit Brandrodung" auf den Seiten 60 und 61 beschreibt die Form des Anbaus<br />
verschiedener Bantuvölker etwas genauer. Auf der Seite 60 ist ein Foto "Brandrodung" und eine Zeichnung<br />
"Prinzip des Wanderfeldbaus" abgebildet (die gleiche Zeichnung findet sich auch in "Diercke Erdkunde 7",<br />
S. 14 und in ähnlicher Form im Lehrmittel "Unser Planet 5/6", S. 57). Dazu schreibt der Autor auf der Seite<br />
60-61:<br />
Geographielehrmittel: Heimat und Welt (1994-1996)<br />
Die Ackerbauern des tropischen Regenwaldes betreiben eine Landwirtschaft, die den Naturbedingungen des Regenwaldes<br />
angepasst ist. Sie legen ihre Felder durch Brandrodung an: Zuerst werden die kleineren Bäume und die Sträucher<br />
abgeschlagen, dann wird die Fläche abgebrannt. Die grösseren Bäume und die Baumstümpfe verkohlen. Ihre Asche ist ein<br />
guter Dünger. Allerdings ist der Boden viel nährstoffärmer als unsere Böden. Er ist daher schon nach wenigen Jahren<br />
ausgelaugt. Die Bauern roden ein neues Waldstück und legen ein neues Feld an. Das alte, verlassene Feld bleibt brach<br />
liegen. Bald wächst wieder Wald nach. Ungefähr 20 Jahre später werden oft die gleichen Felder gerodet. Diese Form der<br />
Landnutzung nennt man Wanderfeldbau.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 411
Über Jahrhunderte blieb der Schaden für den Regenwald gering, weil die Menschen nur kleine Flächen rodeten und erst<br />
nach vielen Jahren frühere Felder wieder nutzten. Der Wald konnte sich erholen. Heute jedoch ist die Bevölkerung so<br />
gross, dass mehr Flächen gerodet werden und schon nach wenigen Jahren dieselben Flächen wieder abgebrannt werden.<br />
Oft wird auch der Wanderfeldbau aufgegeben und Dauerfeldbau betrieben. Aber dann gehen die Erträge nach wenigen<br />
Jahren zurück. Der Boden ist nicht fruchtbar genug...<br />
Auf die im gleichen Text gestellte Frage "Wie aber kommt es dann, dass die Pflanzenfülle des tropischen<br />
Regenwaldes auf dem nährstoffarmen Boden gedeiht?" gibt ein Text unter dem Titel "Rascher Nährstoffkreis-<br />
lauf" und zwei Abbildungen "Der unberührte tropische Regenwald und seine landwirtschaftliche Nutzung"<br />
sowie eine Graphik "Erosion an Hängen mit gleicher Neigung, aber unterschiedlicher Pflanzendecke"<br />
Auskunft. Letztere beziffert den Abtrag für eine Fläche von 4000 m 2 mit 0 Tonnen für dichten Wald mit<br />
Unterholz, 30 Tonnen für ein Maisfeld und 60 Tonnen für ein Feld ohne Pflanzendecke. (Die gleiche Grafik<br />
findet sich auch in "Diercke Erdkunde 7", S. 15, wobei die entsprechenden Zahlen mit 0, 31 und 59 Tonnen<br />
angegeben werden.<br />
4.40.1.3 Reisebericht<br />
Im Kapitel "Afrika - Von Algier bis Kapstadt" auf den Seiten 68-70 schildert ein Vierzehnjähriger seine<br />
Reiseerlebnisse, die in der Form von Reisenotizen wiedergegeben werden. Zum Streckenabschnitt "Agadez -<br />
Zinder - Kano - Maiduguri - Ngadoundére - Yaoundé" schreibt er auf der Seite 69:<br />
Rinder bei Zinder (22. Reisetag)<br />
...Immer öfter sehen wir grosse Rinderherden, die von dunkelhäutigen Hirten gehütet werden. Mein Vater hat gesagt, dass<br />
man diesen Teil des Kontinents auch Schwarzafrika nennt.<br />
Erdnüsse in Kano (23. Reisetag)<br />
Der Markt von Kano in Nigeria ist sehr schön. Von weit her kommen die Bauern um hier ihre Waren anzubieten, z. B.<br />
Mais, Hirse und vor allem Erdnüsse. Auf dem Markt haben wir erfahren, dass es dieses Jahr viel geregnet hat und dass die<br />
Ernte deswegen sehr gut ist. Jetzt sitzen wir wieder im Auto. Es geht weiter über Maiduguri und Ngaoundere bis Yaounde.<br />
(Zum Markt von Kano siehe auch die Seite 374 dieser Arbeit.) Auf der gleichen Seite ist auch ein Foto "Rin-<br />
derherde am Tiefbrunnen (bei Zinder)" abgebildet. Mit dem Reisebericht folgt das Lehrmittel einer langen<br />
Tradition, den Kontinent Afrika durch Touristen schildern zu lassen. Anstatt die einheimische Bevölkerung zu<br />
Wort kommen zu lassen, traut man dem Vertreter der eigenen Volksgruppe eher zu, ein lehrreiches Bild<br />
vermitteln zu können - selbst wenn es sich dabei um ein Kind handelt. Durch diese Art der Darstellung wird<br />
das Exotische bewusst in den Vordergrund gerückt, die vorhandenen Gemeinsamkeiten werden kaum erwähnt,<br />
da sie es ja nicht wert sind, geschildert zu werden. So kann es denn auch nicht verwundern, wenn die letzte<br />
Seite der Berichterstattung, abgesehen von den abgedruckten Titelköpfen von "Zeitungen in Afrika" keine<br />
Informationen über die einheimische Bevölkerung mehr enthält. Wie schon zu Stanleys Zeiten ist der Berich-<br />
terstatter viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass er die auf der Reise angetroffenen Menschen wirklich<br />
bemerken könnte.<br />
4.40.1.4 "Das Wichtigste kurz gefasst"<br />
Auf der Seite 71 schreibt der Autor unter dem Titel "Erschliessung, Nutzung und Zerstörung" auf der letzten<br />
Seite zum Thema, unter dem Motto "Das Wichtigste kurz gefasst":<br />
Geographielehrmittel: Heimat und Welt (1994-1996)<br />
In den tropischen Regenwäldern leben die Pygmäen, ein Naturvolk von geringer Körpergrösse. Sie sind Sammler und<br />
Jäger. Ihre Zahl ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen.<br />
Die Bantus sind Ackerbauern. Sie betreiben Wanderfeldbau. Dabei legen sie durch Brandrodung Felder an, die sie<br />
beackern, bis der Boden ausgelaugt ist. Dann ziehen sie weiter und brennen ein neues Stück Regenwald ab. Auf dem alten<br />
Feld wächst Wald nach. Da die Bevölkerungszahl stark angestiegen ist, wird mehr und mehr zu Dauerfeldbau<br />
übergegangen. Dadurch werden Wald und Boden geschädigt, es kommt zur Erosion.<br />
Plantagen sind Grossbetriebe, die oft internationalen Firmen gehören. Hier werden in Monokultur Nutzpflanzen für den<br />
Weltmarkt angebaut, z. B. Kaffee und Kakao.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 412
Ein begehrter Rohstoff sind Tropenhölzer. Bei der Holzgewinnung werden Schneisen in den Regenwald geschlagen,<br />
Bäume und Sträucher werden niedergewalzt oder knicken ab. Die Abholzung der tropischen Regenwälder kann zu einer<br />
weltweiten Klimaänderung führen.<br />
Die Sorge angesichts der Rodung im Regenwald gilt nicht etwa den dort ansässigen Menschen, welche die<br />
Auswirkungen als erste zu spüren bekommen, sondern entspringt der Vermutung, die Vernichtung der Regen-<br />
wälder könnte auch Auswirkungen auf das weltweite Klima und damit das eigene Leben zeitigen.<br />
4.40.1.5 "Hunger und Bevölkerungswachstum"<br />
Das letzte Kapitel zu Afrika auf den Seiten 78-79 greift unter dem Titel "Hunger und Bevölkerungswachstum"<br />
ein auch in anderen Lehrmitteln diskutiertes Thema auf. Unter der Überschrift "Hunger gehört zum Alltag"<br />
schreibt der Autor auf der Seite 78 ohne Afrika speziell zu diskutieren:<br />
...Hunger hat viele Ursachen. So können Missernten auftreten durch Dürren, Überschwemmungen, Schädlinge oder<br />
schlechte Böden. Dann fehlen Nahrungsmittel. Ein weiterer Grund für den Hunger ist das schnelle Bevölkerungswachstum.<br />
Insgesamt leben zur Zeit etwa 5.7 Milliarden Menschen auf der Erde. Jeden Tag kommen etwa 250'000 Menschen dazu.<br />
Im Jahr 2025 werden es voraussichtlich 8.5 Milliarden sein. Diese "Bevölkerungsexplosion" findet vor allem in der<br />
sogenannten Dritten Welt statt. Familien mit fünf bis acht Kindern sind keine Seltenheit. Da die medizinische und die<br />
technische Versorgung verbessert wurden, sterben weniger Menschen als früher. Durch den Bau von Wasserleitungen zum<br />
Beispiel verfügen jetzt viele Familien über sauberes Trinkwasser.<br />
Auf der gleichen Seite befindet sich eine Karte "Der Hungergürtel der Erde", die hier wiedergegeben werden<br />
soll, da sie in ähnlicher Form auch in den Lehrmitteln "Terra Geographie 7/8", S. 183, "Terra Erdkunde 9",<br />
S. 11 und "Seydlitz Geographie 3", S. 57, abgebildet wird:<br />
Wie bereits in Grafiken aus anderen Lehrmitteln wird praktisch ganz Schwarzafrika als Hungergebiet ausge-<br />
wiesen. Ausnahmen bilden nur wenige Staaten und wieder Südafrika, obwohl zu bezweifeln ist, dass sich die<br />
zur Zeit der burischen Regierung misslichen Lage der schwarzen Bevölkerung unter der Regierung Mandelas<br />
hinsichtlich der Ernährungsfrage wesentlich gebessert hat.<br />
Geographielehrmittel: Heimat und Welt (1994-1996)<br />
Seite 79 zeigt zwei Fotos, auf dem einen "Hungerflüchtlinge in der Dritten Welt", ist eine Menge von schwar-<br />
zen Kinder zu sehen, die alle ihre Töpfe auslecken, während auf dem anderen "Ein 'reich gedeckter Tisch' in<br />
einem Industrieland" drei Erwachsene ein Bankett vorbereiten. Dieser bildlich überspitzte Vergleich wird<br />
durch die Aussage im Informationstext "Dritte Welt - Eine Welt" mit den Worten "Wir alle leben in der 'einen<br />
Welt' und sollten uns mitverantwortlich fühlen für den Hunger auf der Erde." abgerundet. Auch in diesem<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 413
"aktuellen" Lehrmittel wird also wieder auf das Klischee des von übermächtigen Kräften des Schicksals<br />
gegeisselten afrikanischen Menschen, der nur dank der Nahrungshilfe aus dem gesegneten Europa überleben<br />
kann, zurückgegriffen. (Zu den Hungerkrisen Afrikas siehe auch die Seiten 408 und 417 dieser Arbeit.)<br />
4.40.2 Zusammenfassung<br />
"Heimat und Welt" vermittelt auf den wenigen zur Verfügung stehenden Seiten nur wenig Information zum<br />
Thema. Von der traditionellen Gegenüberstellung von "Pygmäen" und Bantus, welche das Bild einer naturver-<br />
bundenen schwarzafrikanischen Bevölkerung vermittelt, die durch schleichende Veränderung zusehends in<br />
eine bedenkliche Lage gerät, über den eurozentrischen Bericht eines Jungen, der mit seinem Vater den ganzen<br />
afrikanischen Kontinent von Nord nach Süd durchreist, führt der Autor hin zum Kapitel über den im "Hunger-<br />
gürtel" liegenden Kontinent Afrika.<br />
Dabei versäumt es der Autor nicht, die Schüler mitverantwortlich für die Zustände der Hungernden der Welt<br />
zu machen, ohne diesen aber einen Vorschlag zu unterbreiten, wie sie diese Verantwortung wahrnehmen könn-<br />
ten. Der Schwarzafrikaner wird also als Exot dargestellt, den es durch die Mitverantwortung der Schüler<br />
irgendwie zu erhalten gilt.<br />
Geographielehrmittel: Heimat und Welt (1994-1996)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 414
4.41 Geographie: Mensch und Raum (1994-1996)<br />
Stell dir vor, was du an einem Tag für deine Zeitung ausgibst, muss der Hälfte der Menschen auf der Welt einen Tag lang<br />
zum Leben reichen. Stell dir vor, du müsstest einen Tag lang für den Preis einer Schachtel Zigaretten vier Kinder ernähren.<br />
Stell dir vor, deine Familie müsste einen Monat lang von dem Geld leben, das man für eine Musik-CD bezahlen muss.<br />
Du kannst dir das nicht vorstellen? Millionen von... Afrikanern... müssen sich das nicht vorstellen! Sie müssen es leben!<br />
(Bd. 4, S. 75)<br />
Das insgesamt 513 Seiten umfassende Lehrmittel "Mensch und Raum" aus dem Cornelsen Verlag, im Zeit-<br />
raum 1994-1996 erschienen, berichtet in den Bänden für die Klassen 5 und 8 auf 16 Seiten über Afrika. Die<br />
Bände für die Klassen 6, 7 und 9 enthalten keine Informationen zum Thema. Das Lehrmittel bildet Fotos,<br />
Tabellen, Karten und Grafiken ab, der Text ist allgemein recht knapp ausgefallen.<br />
4.41.1 Band 1<br />
Im Band für die 5. Klasse lässt der Autor im Kapitel "Kinder bei uns - und anderswo" auf den Seiten 20-21<br />
eine Schülerin unter der Überschrift "Dahab aus Äthiopien" kurz berichten (Die gleiche Idee eines ersten<br />
Zugangs findet sich auch in dem zeitgleich erschienen Lehrmittel "Heimat und Welt", das ab der Seite 410<br />
dieser Arbeit besprochen wird):<br />
Ich bin die Dahab, und meine Familie stammt aus der Nähe von Gurga/Geto in Äthiopien. Meine Eltern sind kurz nach<br />
meiner Geburt nach Deutschland geflohen und haben dort Asyl bekommen. In Äthiopien war mein Papa Richter, in<br />
Deutschland arbeitet er als Hausmeister. Meine Mama putzt am Abend in der Kreissparkasse, weil der Lohn von Papa nicht<br />
reicht. Ich habe noch drei Geschwister, aber die sind schon aus der Schule. Meine Mutter erzählt mir oft von Äthiopien,<br />
manchmal weint sie dabei. Papa ist sehr schweigsam, er hat noch nie von früher erzählt."<br />
Der Bericht bietet einen Hinweis darauf, wie gewisse Bilder in den Köpfen der Menschen durch alltägliche<br />
Erfahrungen verstärkt werden, da Menschen aus anderen Kontinenten, obwohl mit Universitätsabschluss, bei<br />
der Ansiedlung in Europa zumeist eine Arbeit unter ihrem Qualifikationsniveau annehmen müssen. (Zu Äthio-<br />
pien siehe auch die Seite 401 und 454 dieser Arbeit.)<br />
4.41.2 Band 4<br />
Der Band für die 8. Klasse enthält den Hauptteil der Seiten zu Afrika. Im Kapitel "Erdkunde ist mehr als Stadt,<br />
Land, Fluss..." spricht der Autor die Schüler auf die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung eingehend,<br />
unter der Überschrift "Leben in den Trockenräumen" auf Seite 4 an:<br />
Besorgt euch gute Karten und Bilder auch Reiseprospekte... achtet darauf, ob in Zeitschriften von Ralleys durch Afrika<br />
berichtet wird. Besorgt euch Waren, die in den Trockenräumen hergestellt werden...<br />
Zum "Leben in den tropischen Regenwäldern" fordert der Autor die Schüler auf der Seite 5 auf:<br />
Versucht über die verschiedenen Hilfswerke... Materialien zu bekommen.<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Mensch und Raum (1994-1996)<br />
Die gleiche Seite enthält auch einen Kasten mit dem Foto einer Siedlung aus Mali, auf der eine Frau an ihrer<br />
Kochstelle zu sehen ist. Im Text dazu schreibt der Autor unter der Überschrift "Leben in der Einen Welt":<br />
In diesem Kapitel wollen wir Autoren auch darauf aufmerksam machen, dass durch diese Eine Welt Risse gehen.<br />
Manchmal merken wir das gar nicht, weil wir die grossen Unterscheide zwischen unserem Leben und dem der Mehrheit<br />
der Menschen nicht sehen wollen... Stimmt der Satz eines Entwicklungshelfers, der behauptet: Die Armen der Welt<br />
hungern nicht, weil wir zu viel essen, sondern weil wir zuwenig denken? Am Beispiel des Landes Mali in Afrika wollen<br />
wir euch zeigen, dass wir Reichen sehr wohl auch auf Kosten der Ärmeren leben.<br />
Darüberhinaus werden die Schüler aufgefordert, ihre "Tageszeitung zu Hause" aufmerksam auf "Berichte aus<br />
Ländern der 'Dritten Welt'" durchzuschauen und sich über <strong>Pro</strong>dukte und deren Preise aus Dritte-Welt-Läden zu<br />
informieren. Die Seiten 7 und 8 zeigen weitere Fotos, die aber nicht eindeutig zugeordnet werden konnten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 415
4.41.2.1 "Leben in Trockenräumen"<br />
Im grossen Abschnitt zum "Leben in Trockenräumen" schreibt der Autor unter dem Titel "Ausbreitung der<br />
Wüste" im Textkasten "Wüste gefährdet Milliarde Menschen", nach einem Bericht der NWZ vom Juni 1995,<br />
auf der Seite 46 über Afrika:<br />
...In Afrika drohen nach Schätzungen der Weltbank etwa zwei Fünftel... der nutzbaren Flächen zu Wüsten zu werden...<br />
Auf der gleichen Seite lässt er im Text die Nomadenfrau Zeinab unter der Überschrift "Ich habe hier schon<br />
dreimal ein Haus gebaut" über ihren Kampf gegen die Wüste berichten. Auf den Text, der durch zwei Fotos<br />
illustriert wird, soll hier nicht weiter eingegangen werden, da er die Fragestellung dieser Arbeit nur am Rande<br />
betrifft.<br />
Die Seite 47 zeigt eine Weltkarte "Ausbreitung der Wüsten", sowie eine Karte "Die Sahelzone am Rande der<br />
Sahara", die über den Anbau von Nutzpflanzen und die Tierhaltung Auskunft gibt. (Ähnliche Karten finden<br />
sich in den Lehrmitteln "Seydlitz Geographie 3", S. 50 und "Diercke Erdkunde 7", S. 43.) Im Text schreibt der<br />
Autor unter der Überschrift "Die Ausdehnung der Wüste in der Sahelzone hat verschiedene Gründe":<br />
Die ständig wachsende Bevölkerungszahl zwingt die Hackbauern der südlichen Sahelzone zur Überschreitung der<br />
ackerbaulichen Trockengrenze, die etwa bei einer Niederschlagsmenge von 500 mm liegt. Heute grasen zu viele Tiere auf<br />
zu kleiner Fläche. Alle Bäume und Sträucher wurden gerodet, Kräuter und Gräser entfernt und der Boden wurde gelockert.<br />
Zur Bodenerosion trugen auch die Nomaden bei. Obwohl die Anzahl der Tiere entscheidend für das Ansehen eines<br />
Nomaden ist, hielten die meisten ihre Herden nur so gross, wie die Natur es zuliess. Als die Nachfrage nach Fleisch<br />
zunahm, vergrösserten sie ihre Viehherden. Diese Überweidung hat schwerwiegende Folgen: Der entblösste Boden ist den<br />
kurzen, aber heftigen Regengüssen ausgesetzt und wird von Wasser und Wind abgetragen. Nach und nach tritt der<br />
unfruchtbare Untergrund zutage.<br />
Die Menschen brauchen Holz als Brennmaterial, zum Bau der Wohnhütten und zur Errichtung von Viehzäunen. Eine<br />
Familie verbraucht pro Jahr etwa 200 Bäume mittlerer Grösse. Um die Städte sind in einem Umkreis bis zu 100 Kilometern<br />
baumlose Gebiete entstanden.<br />
(Zum Holzbedarf siehe auch die Karte "Holzverbrauch ausgewählter schwarzafrikanischer Länder" im Anhang<br />
auf der Seite 576 dieser Arbeit.) Der grosse Abschnitt über den tropischen Regenwald enthält ausser einem<br />
Foto "Pygmäen im Kongogebiet" keine spezifischen Informationen über die im Gebiet des Regenwaldes leben-<br />
den Bewohner Afrikas.<br />
4.41.2.2 Frauenleben<br />
Das Kapitel "Frauenleben in der 'Dritten Welt'" berichtet auf den Seiten 70-71 allgemein über die <strong>Pro</strong>bleme<br />
der Frauen und Mädchen in diesen Gebieten. Damit ist "Mensch und Raum" eines der wenigen untersuchten<br />
Lehrmittel, die sich mit dem Alltag der schwarzafrikanischen Frau auseinandersetzten. Der Autor führt aus,<br />
dass obwohl die Frauen hart arbeiten müssen, sie doch wenig verdienen (S. 70):<br />
...Der Verdienst der Frauen beträgt im Vergleich zu den Männern nur knapp die Hälfte. Dabei ist die Arbeitszeit wesentlich<br />
länger als die der Männer.<br />
Diese Aussage wird durch eine Grafik "Der lange Arbeitstag einer Frau" nach den UNICEF-Nachrichten vom<br />
Februar 1980 unterstützt, in welcher der folgende Zeitplan aufgestellt wird:<br />
04.45 Aufstehen, waschen und essen<br />
05.00-05.30 Auf die Felder gehen<br />
05.30-15.00 Arbeit auf den Feldern<br />
15.00-16.00 Brennholz sammeln und nach Hause gehen<br />
16.00-17.30 Körner zerstossen und mahlen<br />
18.30-20.30 Kochen für die Familie und essen<br />
20.30-21.30 Kinder waschen und Geschirr spülen<br />
21.30 Schlafen gehen<br />
Auf der Seite 70 ist auch eine "Statistik zur Frauenarbeit" nach der gleichen Quelle abgedruckt, in der es<br />
heisst:<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Mensch und Raum (1994-1996)<br />
In den staatlichen Statistiken über die Erwerbstätigkeit bleibt die Arbeit der Frauen in der Subsistenzwirtschaft meist<br />
unberücksichtigt... In Afrika wird 80-90% der landwirtschaftlichen Arbeit von Frauen geleistet.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 416
Ähnliche Zeitangaben werden auch in einer FAO-Grafik "One woman’s day in Sierra Leone", die in einem<br />
Zeitungsartikel "Wie neun Milliarden Menschen ernähren?" (TA 25.11.96) in veränderter Form abgedruckt<br />
wurde, und die aussagt, dass seit den siebziger Jahren die Frauen mehr unter der Armut zu leiden hatten als die<br />
Männer, genannt. (FAO Factfile, 1996; siehe dazu auch den entsprechenden Tagesablauf im Anhang auf der<br />
Seite 579 dieser Arbeit.)<br />
Die Seite 71 zeigt ein Foto "Afrikanische Frauen bei der Hirseverabeitung". Im Text führt der Autor aus, dass<br />
"in vielen Regionen der Erde... ausschliesslich die Geburt von Jungen erwünscht" sei. Dies trifft sicher auf<br />
viele Gesellschaften Afrikas nicht zu, da sie teilweise matriarchalisch organisiert sind, oder eine Tochter als<br />
Unterstützung der Mutter wichtige Funktionen übernimmt. Die gegenüber den Knaben schlechtere Schulbil-<br />
dung der Mädchen, die der Autor ebenfalls anspricht, ist auch in den afrikanischen Länder oft beobachtbar.<br />
(Siehe dazu auch die Karte "Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite<br />
571 dieser Arbeit.) Die Bemerkungen über die Armut der Frauen treffen hingegen wieder nur teilweise zu, da<br />
je nach gesellschaftlicher Ausprägung und individueller Position ein ganz anderes Bild entstehen kann. Die<br />
reiche Unternehmerin oder Händlerin ist ebenso Wirklichkeit, wie die alleinstehende Mutter, die versucht<br />
irgendwie über die Runden zu kommen.<br />
4.41.2.3 Ernährung<br />
Das Kapitel "Ernährung in der Einen Welt" auf den Seiten 74-75 zeigt neben einer Statistik zum "Nahrungs-<br />
mittelverbrauch" in der auch Nigeria aufgeführt wird - gegenüber den Industrieländer USA und Deutschland<br />
fällt die Konzentration auf Getreide- und Knollenfrüchte auf, bei einer gleichzeitig deutlich tieferen Gewichts-<br />
menge von zu sich genommenen Nahrungsmitteln - ein Foto, das ein hungerndes afrikanisches Kind zeigt,<br />
welches dem Betrachter eine leere Schale entgegenstreckt.<br />
Die Seite 75 zeigt eine Weltkarte "Die Ernährung der Menschheit", die einige afrikanische Länder als mit<br />
"ausreichender Versorgung" ausweist, während der Grossteil entweder unter "knapper Nahrung" oder gar "wie-<br />
derkehrenden Hungersnöten" leidet. Nur für Südafrika und Libyen wird ein "Nahrungsüberfluss" ausgewiesen.<br />
(Zu den Hungerkrisen Afrikas siehe auch die Seiten 413 und 450 dieser Arbeit.)<br />
Im Text spricht der Autor die Vorstellung des Schülers an (S. 75):<br />
Stell dir vor, was du an einem Tag für deine Zeitung ausgibst, muss der Hälfte der Menschen auf der Welt einen Tag lang<br />
zum Leben reichen.<br />
Stell dir vor, du müsstest einen Tag lang für den Preis einer Schachtel Zigaretten vier Kinder ernähren.<br />
Stell dir vor, deine Familie müsste einen Monat lang von dem Geld leben, das man für eine Musik-CD bezahlen muss.<br />
Du kannst dir das nicht vorstellen? Millionen von... Afrikanern... müssen sich das nicht vorstellen! Sie müssen es leben!<br />
Diese Aussagen sind insofern heikel, als sie davon ausgehen, dass die Menschen dieser Länder ihre Nahrungs-<br />
mittel ausschliesslich mittels Geld beschaffen. Dabei lebt gerade in den afrikanischen Länder nach wie vor ein<br />
Grossteil der Bevölkerung in der Subsistenzwirtschaft, deren Erträge und <strong>Pro</strong>dukte in den offiziellen Statisti-<br />
ken kaum oder nur sehr mangelhaft ausgewiesen werden, wie der Autor auf der Seite 70 selbst in der Statistik<br />
zur Frauenarbeit aussagt.<br />
Einen Bericht des "Nordkuriers" vom Februar 1994 zitierend, schreibt der Autor unter der Schlagzeile "Falsche<br />
Hilfe":<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Mensch und Raum (1994-1996)<br />
Anstatt dass internationale Hilfsorganisationen afrikanischen Ländern mit Nahrungsmittelüberschuss grössere Bestände<br />
davon abkauften und sie in die Hungergebiete schickten, wurde europäischer oder amerikanischer Weizen dorthin<br />
geliefert. Die Hungersnot konnte so zwar gelindert werden, gleichzeitig gewöhnten sich die Bewohner der mit Weizen<br />
versorgten westafrikanischen Städte so sehr an <strong>Pro</strong>dukte aus diesen Nahrungsmitteln, dass sie später den einheimischen<br />
Bauern immer weniger Hirse abnahmen und die <strong>Pro</strong>duzenten dieser für den Sahel typischen Getreideart auf ihren<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 417
Überschüssen sitzen blieben. Als Folge wurde in Westafrika immer weniger Hirse angebaut. Weizen gedieh aufgrund der<br />
natürlichen Bedingungen in der Sahelzone nicht.<br />
Ein Bericht der wahrscheinlich auf Michlers "Weissbuch Afrika" zurückgreift, welcher die gleichen Aussagen<br />
auf der Seite 474 seines Buches macht. (Michler 1991)<br />
Im letzten Abschnitt auf der Seite 75 stellt der Autor einen Vergleich an zwischen "Was wir täglich verzehren"<br />
und "Was ein Mädchen in Burkina Faso verzehrt - wenn Nahrung da ist ...", über dessen Ernährungsgewohn-<br />
heiten er schreibt:<br />
zum Frühstück: eine Tasse Milch mit Wasser verdünnt, einen Esslöffel Hirse<br />
zum Mittagessen: nichts<br />
zum Abendessen: eine Tasse Hirse als Brei gekocht und gewürzt. - Fleisch, Obst, Gemüse oder Salat fehlen völlig.<br />
Eine Beschreibung, die an die tägliche Nahrung der Tagelöhner in Europa vor der Einführung der Kartoffel<br />
erinnert, aber besonders für die Gebiete fernab der Küsten für viele Menschen Schwarzafrikas Alltag ist.<br />
4.41.2.4 Mali<br />
Die Seiten 80-83 sind unter dem Titel "Mali - ein Entwicklungsland" dem grossen westafrikanischen Staat in<br />
der Sahelzone gewidmet. Die Seite 80 zeigt zwei Karten "Klima und Vegetation in Mali" und "Landwirtschaft-<br />
liche Nutzung" und gibt einige statistische Informationen wieder, die hier mit den aktuellsten Daten in der<br />
Form einer Tabelle verglichen werden sollen:<br />
Tabelle: Vergleich statistischer Daten Mali<br />
Mensch und Raum Stand nach Fischer 98 Veränderung in %<br />
Bevölkerung 8.7 Mio. 9.8 Mio. + 13%<br />
Säuglingssterblichkeit 15.7 von 100 11.7 von 100 - 25%<br />
Durchschnittliche<br />
Lebenserwartung<br />
46 Jahre 47 Jahre keine<br />
Bevölkerungswachstum 3.2 % (<strong>Pro</strong>gnose) 2.8% - 13%<br />
Analphabetismus 68% 69% keine<br />
ländlicher<br />
Bevölkerungsanteil<br />
Erwerbstätige in der<br />
Landwirtschaft<br />
Ausfuhrprodukte 85% Baumwolle,<br />
10% Vieh<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Mensch und Raum (1994-1996)<br />
84% 73% - 13%<br />
79% 84% + 6%<br />
57% Baumwolle,<br />
29% Nahrungsmittel<br />
BSP pro Kopf 270 US$ 250 US$ - 7%<br />
- 33% für Baumwolle<br />
Die Tabelle zeigt eindrücklich, in welchem Bereich sich die statistischen Werte, die oft auf ungenauen Anga-<br />
ben basieren, eines afrikanischen Landes innert weniger Jahre (ca. 2-5 Jahre) ändern können. Daraus ist leicht<br />
zu folgern, wie schwierig es ist, ein einem Land gerechten Eindruck zu vermitteln, wenn die zugrundeliegen-<br />
den Daten dafür mehr als ein paar Jahre alt sind. Trotzdem sind diese natürlich nützlich, wenn eine allgemeine<br />
Übersicht über ein Land gegeben werden soll. Die Interpretation dieser Daten allerdings hat mit äusserster<br />
Vorsicht zu geschehen. Die Tabellenwerte zeigen zudem auch, dass ein Rückgang des <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommens<br />
nicht unbedingt auch einen Rückgang der Lebensqualität zur Folge haben muss (Vergleich mit Säuglingssterb-<br />
lichkeit), da dieses von Wechselkursen abhängig ist und zudem in einem Land, in dem ein Grossteil der Bevöl-<br />
kerung von der Subsistenzwirtschaft lebt, viel weniger Bedeutung hat, als in einer Geldwirtschaft, wie sie etwa<br />
die Industrienationen aufweisen. Gleichzeitig zeigen die Daten aber auch den engen finanziellen Spielraum der<br />
malischen Regierung und die Abhängigkeit des Landes von wenigen <strong>Pro</strong>dukten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 418
Im Text schreibt der Autor unter der Überschrift "Entwicklungsstand von Mali" auf der Seite 80:<br />
Mali gehört zu jener Gruppe von Staaten, die zu den Ärmsten der Armen gezählt werden. So ist das Bruttosozialprodukt<br />
mit 270 US-Dollar im Weltvergleich einer der niedrigsten Werte überhaupt und das wirtschaftliche Wachstum ist,<br />
gemessen an der Entwicklung des Bruttosozialproduktes, seit 1970 zunehmend rückläufig. Die UNO ordnet Mali in die<br />
Gruppe der "am wenigsten entwickelten Länder" ein.<br />
Die Seite 81 zeigt zwei Fotos "Viehtränke in Mali" und "Baumwollernte in Mali". Unter dem Titel "Landwirt-<br />
schaft in Mali" schreibt der Autor auf der gleichen Seite zu den "natürlichen Voraussetzungen":<br />
Infolge der grossen Nord-Süd-Ausdehnung hat Mali Anteil an mehreren Klima- und Vegetationszonen. Von Norden nach<br />
Süden nehmen Dauer sowie Ergiebigkeit der jährlichen Regenperiode zu und prägen die Landwirtschaft. Noch<br />
entscheidender ist, dass die Menge der Niederschläge von Jahr zu Jahr extremen Schwankungen unterworfen sein kann.<br />
Es kann geschehen, dass es jahrelang zu wenig regnet und es infolgedessen zu einer Dürre kommt. Eine intensive<br />
landwirtschaftliche Nutzung ist nur im Binnendelta des westlichen Nigerbogens möglich.<br />
Auch innerhalb eines Jahres kann es zu Verschiebungen der Niederschläge kommen, die sich teilweise negativ<br />
auf die Ernte auswirken. Über den "Ackerbau" in Mali berichtet der Autor (S. 81):<br />
Nur weniger als 2% der Fläche Malis werden als Ackerland genutzt. In den Savannen sind die Getreidearten Hirse und<br />
Sorghum als Grundnahrungsmittel vorherrschend. Am Niger und Senegal werden Bewässerungs- und Überflutungsfeldbau<br />
betrieben. Nach Rückgang der Flut wird bei geringen Erträgen Nassreis angebaut. Südlich der 600-mm-Niederschlagslinie<br />
ist Regenfeldbau möglich. Allerdings bergen die Schwankungen der Niederschläge hier ein grosses Ernterisiko, weil die<br />
Anbauzonen infolge des hohen Bevölkerungswachstums über die Trockengrenze nach Norden ausgedehnt wurden. Im<br />
Süden, in einer Zone mit 700 bis 1200 mm Jahresniederschlag, ist eine hohe Erntesicherheit gegeben.<br />
Die traditionelle Wirtschaftsweise ist der Wanderfeldbau. Dabei ist jedoch schon nach drei bis fünf Jahren Anbau der<br />
Boden erschöpft. Früher schloss sich eine 10- bis 20-jährige Brache an, die heute zunehmend verkürzt wird. Dies führte<br />
dazu, dass der Boden weniger Ertrag bringt.<br />
(Siehe dazu auch die Grafik "Erträge von Hirse bei unterschiedlichen Anbaumethoden" auf der Seite 430<br />
dieser Arbeit) Die "Viehwirtschaft" stellt der Autor so dar (S. 81):<br />
Die Viehwirtschaft ist für die Landwirtschaft und den Export Malis von wesentlicher Bedeutung. 1987 ergab die Ausfuhr<br />
von Lebendvieh in die angrenzenden Nachbarländer 28% der gesamten Exporteinkünfte.<br />
In der im gleichen Lehrmittel wiedergegebenen Tabelle werden die Exporteinnahmen aus der Tierhaltung nur<br />
auf 10% der Gesamtexporte beziffert.<br />
Im Süden bildet die Tierhaltung eine wichtige Ergänzung zum Feldbau. Die Herden verbleiben an einem Ort. In<br />
trockeneren Regionen werden sie während der Erntezeit einem Hirten übergeben und wandern kleinere Strecken.<br />
Der Bereich des Nigerbinnendeltas wird im Jahr von über einer Million Rindern durchzogen, welche die trockenfallenden<br />
Überschwemmungsbereiche als Weide nutzen.<br />
In den Wüstenrandgebieten werden für die Viehhaltung grosse Flächen gebraucht. Neben der Rinderzucht ist das Halten<br />
von Schafen, Ziegen und Kamelen am Rande der Sahara von Bedeutung.<br />
(Auch dieser Text erwähnt die Gleichzeitigkeit von Ackerbau und Viehzucht und stellt sich damit der im Lehr-<br />
mittel "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1983-1984 auf der Seite 333 dieser Arbeit zitierten Behauptung<br />
entgegen.) Über die Exportprodukte der Landwirtschaft schreibt der Autor unter der Überschrift "Cash-crops":<br />
Als exportgeeignete Feldfrüchte, sogenannte Cash-crops, werden in Mali vorwiegend Erdnüsse und Baumwolle angebaut.<br />
Sie verarbeitet man neben Zuckerrohr und Tee teilweise im Land. Damit bilden sie Ansätze für eine Industrialisierung im<br />
ländlichen Raum.<br />
Die Seiten 82-83 beschäftigen sich mit den "Entwicklungschancen Malis". Unter der Überschrift "Industria-<br />
lisierung" schreibt der Autor auf der Seite 82:<br />
Die Industrialisierung in Mali steckt noch in den Anfängen. Die <strong>Pro</strong>duktion beschränkt sich auf die Veredelung sowie<br />
Verarbeitung heimischer Agrarprodukte und auf die Herstellung einfacher Konsumgüter. Dabei ist der Absatz fast<br />
ausschliesslich auf den Binnenmarkt ausgerichtet.<br />
Wichtig ist auch die Erschliessung der vorhandenen Rohstoffe.<br />
Das über wenige Bodenschätze verfügende Mali besitzt auch nach jahrhundertelangem Abbau immer noch<br />
kleine Goldvorkommen. Weiter werden Phosphate, Salz, Eisenerz, Uran, Erdöl, Diamanten, Bauxit, Zink,<br />
Lithium und Mangan abgebaut. Kupfervorkommen sind bekannt, werden aber nicht genutzt. Der Mineralabbau<br />
Malis ist von lokaler Bedeutung und spielt für die Erwirtschaftung von Devisen nur eine geringe Rolle.<br />
(Weltatlas 1997)<br />
Zur "Verkehrserschliessung", die mit einem Foto "Bau einer Asphaltstrasse zwischen Bamako und Gao" illu-<br />
striert wird, schreibt der Autor (S. 82):<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Mensch und Raum (1994-1996)<br />
Die Verkehrserschliessung Malis ist völlig unzureichend und hemmt die wirtschaftliche Entwicklung. Ebenso die Tatsache,<br />
dass Mali keinen direkten Zugang zum Meer hat. Die Verbindung zur Hafenstadt Dakar in Senegal wird einzig und allein<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 419
durch die 645 km lange Eisenbahnstrecke hergestellt. Eine nutzbare Strassenverbindung nach Dakar besteht nicht, dafür<br />
aber eine über 700 km nach Abidjan, dem Haupthafen des Staates Elfenbeinküste. Auf diesen beiden Strecken wird der<br />
gesamte internationale Güterverkehr abgewickelt, obwohl sie in schlechtem Zustand oder technisch veraltet sind.<br />
Dies trifft auch für das übrige Strassennetz zu, das ausserdem viel zu kurz ist. Deshalb wird seit Jahren der Ausbau der<br />
Strassen vorangetrieben. Dazu hat die Bundesrepublik Deutschland als einer von mehreren Geldgebern beigetragen.<br />
Zur "Agrarwirtschaft" heisst es weiter (S. 82):<br />
Hauptziel der Entwicklungspolitik Malis ist die landwirtschaftliche Selbstversorgung.<br />
Um die Wasserreserven besser zu nutzen, betreibt die Regierung den Bau von Grossstaudämmen. Durch sie lässt sich<br />
elektrische Energie erzeugen. Ausserdem kann zusätzliches Wasser für die Bewässerung zur Verfügung gestellt werden.<br />
Alternativ zu den grossen Staudammprojekten wird seit den 70er-Jahren der Bau von Kleinstaudämmen gefördert. Sie<br />
ermöglichen eine Ausweitung der Kulturflächen durch Bewässerung.<br />
(Zu anderen Staudammprojekten und ihren Folgen siehe auch die Seite 170 dieser Arbeit.) Die Texte auf der<br />
Seite 82 wurden laut den abgedruckten Angaben des Autors nach verschiedenen Länderberichten aus den<br />
Jahren 1986-1991 geschrieben. Die dafür benutzen Daten waren also zur Zeit der Drucklegung schon minde-<br />
stens fünf Jahre alt.<br />
Die Seite 83 zeigt ein Foto "Mütter mit Kindern in Mali" und zwei Grafiken "Bevölkerungsentwicklung und<br />
<strong>Pro</strong>gnose" und "Terms of Trade", in welcher der Kaufwert eines Lastkraftwagens mit dem Handelswert von<br />
Bananen und Kaffee verglichen wird. Dabei lässt sich die Entwicklung der Terms of Trade für den Zeitraum<br />
zu Ungunsten des Rohstoffproduzenten zwar eindeutig ablesen, welche Bedeutung der relative Preiszerfall von<br />
Bananen und Kaffee für das Land Mali haben könnte, bleibt aber rätselhaft. Wahrscheinlich handelt es sich<br />
dabei um die auch in anderen Lehrmitteln beobachtbare Praxis, fehlende Information für ein Land durch<br />
Beispiele aus anderen Ländern oder gar theoretische Konstrukte zu ersetzen.<br />
Im Text schreibt der Autor unter der Überschrift "Bevölkerungswachstum in Mali", nachdem er der "Bevölk-<br />
erungsentwicklung der Erde" zwei Abschnitte gewidmet hat (S. 83):<br />
Seit den 60er-Jahren haben sich die Geburtenzahlen in Mali kaum verändert. Dem gegenüber sank die Sterblichkeit dank<br />
einer verbesserten medizinischen Versorgung. Dies führt zu dem momentan hohen Bevölkerungswachstum.<br />
Erst in jüngster Zeit wurde in Mali erkannt, dass eine Bevölkerungspolitik zur Senkung der Geburtenzahlen notwendig ist.<br />
Allerdings mangelt es bisher an direkten Massnahmen. Sie würden auch kaum bei der Bevölkerung auf Verständnis<br />
stossen, weil viele Kinder den Eltern aus verschiedenen Gründen als wünschenswert erscheinen. Das gesellschaftliche<br />
Ansehen einer Frau wächst mit der Kinderzahl, Kinder sind eine Altersversicherung und auch wichtige Arbeitskräfte.<br />
Diese <strong>Pro</strong>bleme betreffen nicht nur Mali, sondern auch andere Entwicklungsländer.<br />
Im letzten Abschnitt geht der Autor auf die Terms of Trade ein. Unter der Überschrift "Leben auf Kosten der<br />
anderen" schreibt er (S. 83):<br />
Noch immer exportieren die meisten Entwicklungsländer vor allem Rohstoffe und müssen viele Fertigwaren einkaufen.<br />
Dabei müssen sie immer mehr eigene Waren verkaufen, um gleichbleibende Einfuhren aus den Industrieländern bezahlen<br />
zu können. Die Wertverhältnisse im Handel zwischen Nord und Süd (Terms of Trade) verändern sich zuungunsten der<br />
Dritten Welt.<br />
Diese Entwicklung tritt vor allem die Länder Schwarzafrikas hart. Noch immer stammen über 85% ihrer Exporterlöse aus<br />
dem Rohstoffhandel.<br />
Wie schon die weiter oben besprochene Grafik geht der Text mit keinem Wort auf die spezielle Situation<br />
Malis ein, sondern bleibt im Allgemeinen, d. h. er bezieht sich nicht nur auf die schwarzafrikanischen Länder<br />
sondern auf die Gesamtheit der Entwicklungsländer, die unter sich sehr grosse Unterschiede aufweisen. (Zu<br />
Mali siehe auch die Seite 402, zu den Terms of Trade die Seite 376 dieser Arbeit.)<br />
4.41.2.5 Sambia: "Grossprojekte scheitern"<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Mensch und Raum (1994-1996)<br />
Die Seite 85 steht unter dem Titel "Grossprojekte scheitern" und wendet sich somit der Entwicklungshilfe zu.<br />
Unter der Überschrift "Sambia: Sanierung einer Düngemittelfabrik scheitert" schreibt der Autor:<br />
Ende der 70er-Jahre wurde in Kafue nahe Lusaka eine Düngemittelfabrik errichtet, die den gesamten Landesbedarf an<br />
Düngemitteln decken sollte. Die Regierung wollte mit heimischen Rohstoffen und preiswerter Wasserenergie Düngemittel<br />
produzieren und so die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum verbessern. Erst 1985 wurde die Fabrik mit Verspätung in<br />
Betrieb genommen, da einige Nebenanlagen nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Schon nach kurzer Betriebszeit kam es<br />
zu <strong>Pro</strong>blemen bei der Versorgung mit Kohle und Strom. Auch zahlreiche Schäden an der Anlage führten dazu, dass die<br />
Fabrik nur schwach ausgelastet war. Ein Sanierungsversuch wurde im Jahre 1989 eingestellt. Das <strong>Pro</strong>jekt musste als<br />
gescheitert angesehen werden.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 420
Als "Gründe für den Fehlschlag" führt der Autor an (S. 85):<br />
- Die ständige Versorgung der Anlage mit Kohle und Strom konnte nicht gesichert werden.<br />
- Mangelhafte Wartungen führten zu umfangreichen und kostspieligen Reparaturen.<br />
- Vermarktung und der Verkauf der Düngemittel wurden nicht ausreichend gefördert.<br />
- Dem Management gelang es nicht, die erkannten Fehler zu beheben.<br />
- Durch die enorm gestiegenen Kosten konnte nie gewinnbringend produziert werden.<br />
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 397 und 427 dieser Arbeit.) Nebst dieser kurzen Beschreibung<br />
eines Entwicklungsprojektes bildet die Seite 85 ein Foto einer Siedlung ab, gibt einen kurzen Text und eine<br />
Tabelle zur Entwicklungshilfe Deutschlands wieder, und der Autor schreibt im einem Steckbrief zu Sambia:<br />
Bevölkerungswachstum: Es liegt bei 3.7% pro Jahr. Als Folge muss die Nahrungsmittelproduktion ständig gesteigert<br />
werden.<br />
Hungersnöte: Grosse Teile der Bevölkerung leiden an Armut und Unterernährung. Internationale Hilfsorganisationen<br />
versuchen, bei den immer wiederkehrenden Hungersnöten zu helfen.<br />
Hilfen: Wegen schlechter Verteilungswege und Bestechung erreicht die Hilfe die Kleinbauern meist verspätet.<br />
Landwirtschaft: Sie wurde stark zugunsten der Industrie vernachlässigt. Es fehlt an geeigneten Düngemitteln.<br />
Bodenschätze: Sambia besitzt Bodenschätze wie Kupfer und Kohle.<br />
Energieversorgung: Der Einsatz günstiger Wasserenergie ist möglich, da auch Stauseen genutzt werden können.<br />
(Zu Sambia siehe auch die Seite 375 dieser Arbeit.) Die Seiten 90-91 bieten eine Repetition des bisher vermit-<br />
telten Wissens unter dem Titel "Entwicklungsländer - im Rückblick". Auf der Seite 90 schreibt der Autor unter<br />
der Überschrift "Zahlen und Fakten" zu Afrika:<br />
...Täglich sterben allein in Afrika 10'000 Kinder wegen Unterernährung und fehlender Gesundheitsvorsorge...<br />
Zu der grossen über die Seite reichende politischen Weltkarte "Der Hungergürtel der Erde", die sonst keine<br />
weiteren Informationen mehr enthält, fordert der Autor die Schüler in der Aufgabenstellung auf:<br />
1. Trage in eine Weltkarte den Hungergürtel der Erde ein.<br />
2. Beschreibe den Verlauf des Hungergürtels...<br />
Die Seite 91 zeigt ein Foto eines schwarzen Kindes mit der Textinschrift: "Meine Zukunft - seine Zukunft.<br />
Vergleiche die Zukunftschancen!"<br />
4.41.3 Zusammenfassung<br />
Das Lehrmittel "Mensch und Raum" zeichnet das Bild eines von Überbevölkerung bedrohten und an Hunger<br />
leidenden Afrikas, an dessen Zustand die Menschen Europas Mitschuld tragen: "Die Armen der Welt hungern<br />
nicht, weil wir zuviel essen, sondern weil wir zuwenig denken." (Bd. 4, S. 5)<br />
Damit wird auch unterstellt, dass es die Aufgabe der Europäer sei, für Schwarzafrika nachzudenken, da es<br />
ansonsten keinen Ausweg aus den bedrückenden Zuständen gäbe.<br />
Besonderes Gewicht legt der Autor auf das <strong>Pro</strong>blem der Desertifikation in der Sahelzone, die er als eine Folge<br />
der Überbevölkerung und der daraus resultierenden Übernutzung natürlicher Ressourcen sieht. Diese ist seiner<br />
Meinung nach letztendlich auch für die kargen Mahlzeiten, am Beispiel des täglichen Speiseplanes eines<br />
Mädchen aus Burkina Faso gezeigt, verantwortlich.<br />
Zum <strong>Pro</strong>blem der Armut schreibt der Autor, dass "Millionen von Afrikanern" sich diese nicht vorstellten,<br />
sondern sie täglich "leben" müssten.<br />
Neben einem kurzen Kapitel zu der Arbeitsbelastung der schwarzafrikanischen Frau, konzentriert der Autor<br />
seine Darstellungen auf das Land Mali und eine Schilderung eines gescheiterten <strong>Pro</strong>jektes in Sambia. Hier<br />
wird wieder der Eindruck erweckt, dass schwarzafrikanische Staaten nicht in der Lage seien, grössere <strong>Pro</strong>jekte<br />
mit Erfolg zu Ende zu führen. Die anderen Gebiete Afrikas bleiben in diesem Lehrmittel den Schülern eine<br />
"terra incognita".<br />
Geographielehrmittel: Geographie - Mensch und Raum (1994-1996)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 421
4.42 Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Mit 14 Jahren soll Khadija verheiratet werden. Als sie fünf Jahre alt war, versprach der Grossvater das Mädchen der<br />
Familie eines Freundes. Mit 10 Jahren erhielt sie eine Ausbildung von alten Frauen des Dorfes, die sie auf ihre Aufgaben<br />
als Ehefrau vorbereiteten. Dazu gehörten z. B. Schönheitspflege, die Verwendung von Pflanzen als Medikamente und das<br />
Verhalten Männern gegenüber. Das meiste lernte sie jedoch schon als Kind von ihrer Mutter. Als Baby erlebte sie die Welt<br />
von dem Rücken ihrer Mutter aus. Später lernte sie, wie man Hühner füttert, Hirse zerstampft und die Gärten bebaut. Im<br />
nächsten Jahr wird sie nun ihre eigene Hütte beziehen und eine Familie gründen. Khadija hofft, in ihrer Ehe möglichst viele<br />
Kinder, vor allem Söhne, zu bekommen, die für sie und ihren Mann im Alter einmal sorgen werden. Nur ein Teil ihrer<br />
Kinder wird erwachsen werden, denn die Kindersterblichkeit ist immer noch hoch. (Bd. 3, S. 46)<br />
Das vierbändige Lehrmittel "Diercke Erdkunde" für die Klassen 5 bis 8 der Gymnasien in Baden-Württemberg<br />
beschäftigt sich in den Bänden für die Klassen 7 und 8 auf rund 45 der insgesamt 764 Seiten mit Themen zu<br />
Afrika, wobei rund die Hälfte der Seiten auf die Darstellung der Wüstengebiete entfällt.<br />
4.42.1 Band 3<br />
Der Band für die Klasse 7 enthält die Themenkreise "In den Tropen" mit den Kapiteln "Bei den kleinen<br />
Menschen des Regenwaldes" (S. 10), "Der Wald brennt / Menschen kommen, Wälder gehen" (S. 14-15) und<br />
"Hoffnung für den Regenwald" (S.16-17); "Die Savanne" mit den Kapiteln "Wandern, um zu überleben"<br />
(S. 42-43), "Ein Hackbauerndorf in Burkina Faso" (S.44-45), "Frauen in Burkina Faso" (S. 46-47), "Die Sahel-<br />
zone, ein gefährdeter Naturraum" (S. 48-49), "Kleine Dämme - Grosse Hoffnung" (S.50-51) und "Diercke<br />
Extra" (S. 52-53), sowie den Themenkreis "Die Wüste" auf dessen Inhalt nicht näher eingegangen wird.<br />
4.42.1.1 "Pygmäen"<br />
Zum Themenkreis "In den Tropen" schreibt der Autor unter dem Titel "Bei den kleinen Menschen des<br />
Waldes" auf der Seite 10:<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Um fünf Uhr werde ich von Yao und seinen Jägern vorsichtig geweckt, es ist Zeit zum Aufbruch. Ich habe nur wenige<br />
Stunden in meiner Hängematte unter dem Moskitonetz geschlafen. Zu fremd waren für mich, den Europäer, die<br />
nächtlichen Geräusche des Waldes. Vorsichtig folge ich den kleinen Männern, die mit vergifteten Pfeilen, Bogen,<br />
Blasrohren und Messern bewaffnet zur Jagd aufbrechen.<br />
Der Tag beginnt fast ohne Dämmerung. Als die Sonne aufgeht, setzt ein ohrenbetäubender Lärm von Affen und Vögeln in<br />
den Kronen der Bäume ein. Die Morgenstunden sind die beste Zeit für die Jagd und die Arbeit. Ich bewundere die kleinen<br />
Männer, die sich geschickt im Wald bewegen, jeden Laut deuten können, jede Bewegung in dem tanzenden Licht<br />
wahrnehmen und, so sagt man, grösseres Wild sogar riechen können.<br />
Ohne meine Begleiter wäre ich im Dschungel verloren. Die Pygmäen dagegen kennen jede Pflanze. Sie wissen, welche<br />
Blätter, Früchte, Wurzeln und Pilze essbar sind. Sie wissen, wo man die nahrhaften fetten Maden findet oder wo man nach<br />
Honig suchen muss. Der Wald bietet ihnen alles: Nahrung, Baumaterial und Bekleidung. Zur Behandlung von Krankheiten<br />
verwenden sie die nur ihnen bekannten geheimnisvollen Mittel aus der "Dschungelapotheke".<br />
Plötzlich bleibt Yao regungslos stehen, er hebt sein Blasrohr und schiesst fast lautlos einen Pfeil in die Krone eines<br />
Baumes. Wir warten, und nach einiger Zeit fällt ein getroffener Affe zu Boden- Die Affenherde hat die Gefahr überhaupt<br />
nicht bemerkt und zieht schnatternd weiter.<br />
Gegen Mittag beginnen sich, wie jeden Tag, die Wolken aufzutürmen. Yaos Männer bauen mit wenigen Handgriffen eine<br />
Laubhütte und legen sich zum Schlafen auf den Boden. Auch das heftige Gewitter und der sintflutartige Regen stören ihren<br />
Schlaf nicht. Der Wald beginnt zu dampfen, das Atmen fällt mir schwer. Gegen 17 Uhr lässt der Regen nach. Wir treten<br />
wieder in die schwüle Dämmerung des Waldes hinaus, der die kleinen Menschen ernährt, der ihre Heimat ist, und über den<br />
sie mehr wissen als die europäischen Gelehrten.<br />
Die "Pygmäen" werden in diesem Text also als "kleine Menschen des Urwaldes" bezeichnet, und der Autor<br />
gibt einen Bericht wieder, in dem das traditionelle Leben der Pygmäen geschildert wird. Mit dieser Beschrei-<br />
bung hat er sich weit von den in der ersten Hälfte des Jahrhunderts verfassten Schilderungen entfernt. Nicht<br />
mehr von "Primitiven" und "Menschenfressern" ist die Rede, sondern von Menschen, die über den Regenwald<br />
"mehr wissen als die europäischen Gelehrten" - denn diese sind, so erweckt es zumindest den Anschein, das<br />
Mass aller Dinge. Der Haupttext wird begleitet von zwei Fotos "Die letzten Jäger im tropischen Regenwald"<br />
und "Eine Laubhütte der Pygmäen" - letzteres Foto wurde schon im Geographielehrmittel "Heimat und Welt<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 422
8" von 1995 (S. 58) abgebildet -, sowie einem kurzen Steckbrief "Die Pygmäen", in dem der Autor schreibt<br />
(S. 10):<br />
Ureinwohner der tropischen Regenwälder Afrikas; Grösse etwa 1.50 m. Im Jahre 1950 gab es etwa 300'000 heute nur noch<br />
100'000 Pygmäen.<br />
Lebens- und Wirtschaftsweise früher: Die Pygmäen lebten als Sammler und Jäger in kleinen Gruppen Von 20 bis 50<br />
Personen im Innern der Regenwälder. Die Frauen sammelten Kleintiere (z. B. Frösche, Schlangen, Schnecken, Insekten)<br />
sowie Waldfrüchte, Wurzeln und Honig. Die Männer waren Jäger.<br />
heute: Die meisten Pygmäen haben ihre traditionelle Lebensweise aufgegeben. Sie leben am Rand der Bantusiedlungen<br />
und tauschen Wild und Fisch gegen Getreide und Gemüse. Viele wurden zu billigen Gelegenheitsarbeitern in den<br />
grösseren Siedlungen. Krankheiten und Alkoholismus bedrohen die Existenz dieses Naturvolkes.<br />
Der Autor gibt durch die Zahlen im Text gewissermassen zu, dass er sich bei der Betrachtung der "Pygmäen"<br />
mit einem Nebenthema befasst, denn diese machen nicht einmal 0.2 <strong>Pro</strong>mille der gesamtafrikanischen Bevöl-<br />
kerung aus und haben damit für Afrika etwa die gleiche Bedeutung wie die Tibeter für die Schweiz. (Zu den<br />
Pygmäen siehe auch die Seiten 411 und 435 dieser Arbeit.)<br />
4.42.1.2 Bantu<br />
Auf den folgenden Seiten betrachtet der Autor das Klima des Regenwaldes bevor er auf der Seite 14 unter dem<br />
Titel "Der Wald brennt" auf den Wanderfeldbau zu sprechen kommt:<br />
Als die Pygmäen noch als Jäger und Sammler im Zentrum der grossen Wälder lebten, begannen Ackerbauern, z. B. die<br />
Bantustämme, auf der Suche nach neuen Siedlungsräumen in den Regenwald vorzudringen. Sie rodeten mit Haumessern,<br />
Hacken und Feuer Lichtungen in den Wald, auf denen sie ihre Hütten bauten und Felder anlegten. Dabei zerstörten sie die<br />
Jagdgebiete der Pygmäen. Die kleinen Menschen mussten sich nun immer tiefer in das Innere der Wälder zurückziehen,<br />
wenn sie ihre typische Lebensweise und ihre Unabhängigkeit bewahren wollten.<br />
Bis heute hat sich an der Erschliessung des Regenwaldes durch Brandrodung wenig geändert: Vor den Hauptregenzeiten<br />
schlagen die Männer das Unterholz ab und zünden es an, sobald es trocken ist. Die Asche bleibt auf dem Feld liegen und<br />
düngt den Boden. Nur die verkohlten Skelette der Urwaldriesen bleiben übrig. Sie werden erst allmählich von Wind, Regen<br />
und den Kleinlebewesen des Bodens zerstört.<br />
Nach der Rodung beginnen die Frauen, Hirse und Mais zu säen. Wenn die erste Ernte eingebracht ist, werden mit<br />
Grabstöcken Maniok, Cassava und Süsskartoffeln gepflanzt. Aus den Maniokknollen pressen die Frauen ein stärkehaltiges<br />
Mehl, mit dem sie den täglichen Brei kochen. Zwischen die verkohlten Baumreste setzen die Bauern Stecklinge von<br />
Bananenstauden. Im zweiten Anbaujahr wird ein Teil des Manioks geerntet, der Rest bleibt mit den Bananen bis zur dritten<br />
Ernteperiode auf dem Feld.<br />
(Zur Maniokpflanze siehe auch die Seiten 295 und 425 dieser Arbeit.)<br />
Schon bevor die Waldlichtung abgeerntet ist, beginnt sich die Wunde im Regenwald mit einem niedrigen Sekundärwald zu<br />
schliessen. Erst nach etwa 100 Jahren hat sich dieser Wald in den ursprünglichen, den primären Tropenwald,<br />
zurückgebildet.<br />
Die Bantu wissen aus Erfahrung, dass man selbst auf den Feldern, die nur wenige Jahre bestellt wurden, für lange Zeit<br />
keine zufriedenstellenden Ernten mehr erwarten kann. Die Nährstoffe des Bodens sind sehr schnell erschöpft. Schon nach<br />
vier oder fünf Jahren müssen die Bauern daher weiterziehen und neue Anbauflächen in den Wald brennen. Erst nach etwa<br />
20 Jahren hat sich auf den ehemaligen Brandrodungsfeldern eine neue, dünne Humusschicht gebildet, die mit der Asche<br />
des niedergebrannten Sekundärwaldes erneut Ernten verspricht. Diese Art des Wanderfeldbaus, die man auch "shifting<br />
cultivation" oder "Brandrodungswirtschaft" nennt, ist ähnlich wie die Jagd oder das Sammeln von Früchten eine dem<br />
tropischen Regenwald angepasste Wirtschaftsform.<br />
Mit diesem Text und den weiter oben abgedruckten Stellen über die "Pygmäen" folgt der Autor der Tradition<br />
des Vergleichs dieser beiden Völkergruppen. Die Wirtschaftsform der Bantus wird wie die Sammel- und Jagd-<br />
tätigkeit der "Pygmäen" als "eine dem tropischen Regenwald angepasste Wirtschaftsform" bezeichnet. Neben<br />
dem Text zeigt die Seite 14 die beiden Fotos "In Afrika", auf dem der aufsteigende Rauch eines Feuers im<br />
Regenwald zu sehen ist, und "Brandrodungsfeld", sowie eine Grafik "Prinzip des Wanderfeldbaus im tropi-<br />
schen Regenwald".<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Die Seite 15 zeigt eine Grafik "Erosion", welche die Abtragung von Erdreich durch Wasser für verschiedene<br />
Pflanzendecken angibt (siehe dazu auch die Seite 412 dieser Arbeit) und ein Foto "Wo der Wald geht, folgt<br />
Grasland". Dazu schreibt der Autor unter dem Titel "Menschen kommen, Wälder gehen":<br />
Solange nur wenige Familien und Stämme im tropischen Regenwald Wanderfeldbau betrieben, und die Natur genügend<br />
Zeit hatte, die Brandrodungswunden wieder zu schliessen, schadete diese Wirtschaftsweise dem Wald kaum. Erst als<br />
immer grössere Waldflächen für die Versorgung einer schnell wachsenden Bevölkerung verbrannt und gerodet wurden,<br />
begann das Sterben der Regenwälder. Die Erholungszeiten für den Wald wurden nicht mehr beachtet, und viele Familien<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 423
kehrten zu schnell auf bereits einmal bewirtschaftete Flächen zurück. Die geringe Busch- und Grasvegetation lieferte<br />
jedoch zu wenig düngende Asche. Die Erosion setzte ein und trug die Nährstoffe und den Boden fort.<br />
Nach diesem einleitenden Text lässt der Autor den Bericht des Bauern Motu aus einem Dorf bei Kindu<br />
(Demokratische Republik Kongo) folgen (S. 15):<br />
"Noch vor 20 Jahren lebten wir hier in dichtem Regenwald. Heute wächst in der Nähe des Dorfes kaum noch ein Baum.<br />
Statt im Wald leben wir jetzt in einem Grasland, in einer Savanne. Früher konnten die Männer unseres Dorfes Schweine<br />
und Affen jagen. Heute fangen wir mit Glück eine Baumratte oder ein paar Insekten. Vor allem unsere Kinder leiden<br />
inzwischen an der eiweissarmen Ernährung und werden krank.<br />
Landwirtschaftsberater meinen, wir sollten Bohnen, Erbsen und Gemüse anbauen. Aber selbst diese Pflanzen wachsen auf<br />
den ausgelaugten Böden nur schlecht, und wir mögen ihren Geschmack nicht, Einige Familien versuchten, auf dem neu<br />
entstandenen Grasland Rinder zu halten. Wir sind jedoch in der Rinderzucht zu unerfahren. Viele Tiere bekamen eine<br />
Seuche und starben. Auch die Ernten bei den Ölpalmen, unserer einzigen Geldquelle, gehen zurück. Hätte ich wie früher<br />
nur ein Fass Palmöl geerntet, könnte ich meine Familie mit dem Erlös vier Wochen lang ernähren. Das ausgepresste und<br />
getrocknete Fruchtfleisch konnten wir als Brennmaterial verwenden, und die Asche düngte unsere Felder. Nun müssen wir<br />
noch mehr Brennholz und Holzkohle aus den wenigen, inzwischen weit entfernten Waldresten gewinnen.<br />
Heute verstehe ich, dass unseren Vorfahren der Wald heilig war. Damals durfte niemand einen Baum fällen, ohne als<br />
Gegengabe ein Opfer für die Geister zu bringen oder einen neuen Baum zu pflanzen."<br />
Der Bericht des Bauern rehabilitiert rückblickend gewisse Traditionen, welche in einigen älteren Lehrmitteln<br />
wohl zu denen gezählt worden wären, die den Fortschritt der afrikanischen Länder behinderten. (Siehe dazu<br />
auch den Text "Ojembo, der Urwaldschulmeister" von Albert Schweizer in "Neues Schweizer Lesebuch",<br />
1979-1980, Bd. 2, S. 33f.)<br />
4.42.1.3 Agroforstwirtschaft: "Hoffnung für den Regenwald"<br />
Die Seiten 16-17 beschäftigen sich unter dem Titel "Hoffnung für den Regenwald" mit der Agroforstwirt-<br />
schaft. Zu der dazu führenden Ausgangslage schreibt der Autor:<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Elfenbeinküste: Von den ursprünglich 15 Mio. ha Regenwald sind höchstens noch 3 Mio. übrig geblieben. Nigeria hat<br />
bereits 90% seiner Wälder verloren. In Kamerun wurden durch Brandrodung und Holzeinschlag 80 Mio. ha Wald<br />
vernichtet.<br />
Die Brandrodung und der Wanderfeldbau sind die schlimmsten Feinde des Regenwaldes geworden. Ihnen fallen in Afrika<br />
jährlich bis zu 80% der vernichteten Wälder zum Opfer. Trotz vieler internationaler <strong>Pro</strong>teste wird selbst in den offiziellen<br />
Landnutzungsplänen vieler noch waldreicher Länder immer noch die Umwandlung von Regenwald in landwirtschaftlich<br />
genutzte Flächen befürwortet.<br />
Um eine weitere Zerstörung des tropischen Regenwaldes zu verhindern, suchen Wissenschaftler fieberhaft nach neuen<br />
Nutzungsmethoden, die den Wanderfeldbau durch einen dem Regenwald angepassten Dauerfeldbau ersetzen. Auf den<br />
besseren Standorten kann vielleicht die Agroforstwirtschaft, d. h. die Nutzung von Bäumen und Feldfrüchten helfen, die<br />
letzten Reste der "Schatzkammer der Erde" zu retten.<br />
Nach den einleitenden Worten beschreibt der Autor die Ziele und Eigenarten der Agroforstwirtschaft:<br />
Die Agroforstwirtschaft versucht, den Stockwerkbau des Waldes nachzuahmen: Auf den gerodeten Feldern werden<br />
einzelne Urwaldriesen stehen gelassen, in deren Schatten Fruchtbäume wie Mangos, Papayas, Bananen oder Ölpalmen<br />
angepflanzt werden. Zwischen den Bäumen wachsen in Mischkultur die Feldfrüchte. Sie werden nicht wie bei uns in<br />
sorgfältig ausgerichteten Reihen und nach Sorten getrennt gepflanzt oder ausgesät. Man bemüht sich vielmehr, Pflanzen<br />
derselben Art in einem Abstand von mehreren Metern anzubauen. Die Wurzeln haben dadurch mehr Platz, die Nährstoffe<br />
des Urwaldbodens zu "sammeln". Darüber hinaus behindert der grössere Abstand die Ausbreitung von Schädlingen und<br />
Pflanzenkrankheiten.<br />
Saat, Pflanzung und Ernte werden auf den Feldern und den hausnahen Gärten so geplant, dass der Boden immer durch das<br />
Blattwerk der Pflanzen geschützt wird. Der Ertrag eines 4-5 ha grossen Rodungsfeldes reicht aus, um eine Familie zu<br />
ernähren und gleichzeitig Nutztiere zu halten. Die Tiere liefern wertvolles Eiweiss, das der Körper braucht, um gesund zu<br />
bleiben. Wichtige Eiweisslieferanten wie Fleisch, Milch oder Eier sind jedoch in den typischen Mahlzeiten der<br />
afrikanischen Kleinbauern bislang selten enthalten.<br />
Landwirtschaftsexperten und Ernährungswissenschaftler raten daher, noch mehr Bauern von den Vorteilen einer<br />
zusätzlichen Viehzucht zu überzeugen. Dabei sollen die Tiere aber im Stall oder auf einer Weide nahe am Haus gehalten<br />
werden, um ihre Pflege und Fütterung zu erleichtern und Schäden in den Feldern oder im Wald zu vermeiden. Der Stallmist<br />
wird mit Hausabfällen und Pflanzenresten auf den Feldern und Gärten verstreut und bildet dort eine wertvolle Mulchdecke.<br />
Sie führt dem Boden neue Nährstoffe zu, sie schützt ihn vor der Austrocknung, sie fördert die Arbeit der Mikroorganismen<br />
und verhindert die Erosion nach den heftigen tropischen Regenfällen. Die Ernten, die man mit dieser neuen Anbaumethode<br />
erzielen kann, reichen aus, um die Familien zu ernähren und kleine Überschüsse zu erwirtschaften, die auf den Märkten<br />
verkauft werden können.<br />
In dem benachbarten und geschonten Regenwald können die Männer jagen und wertvolle Harze, Öle, Nüsse, Heilpflanzen<br />
oder Orchideen sammeln. Die <strong>Pro</strong>dukte des Waldes werden über Händler oder Genossenschaften verkauft und helfen, die<br />
Familien mit Geld zu versorgen. Es ist jedoch nicht leicht, die Bauern von dieser neuen, ungewohnten Wirtschaftsweise zu<br />
überzeugen denn oft sind die Traditionen stärker.<br />
Hier werden wieder einmal die Traditionen der Schwarzafrikaner als Entwicklungshindernis angeführt. Im<br />
Gegensatz zum Lehrmittel "Fahr mit in die Welt" von 1972, in dem den Afrikaner die Seele aus der Brust<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 424
gerissen werden sollte, um die alten Vorstellungen vollständig zu beseitigen (siehe das entsprechende Zitat auf<br />
der Seite 222 dieser Arbeit), bleibt der Text hier aber eher sachlich. Der Autor setzt seine Beschreibung fort:<br />
Manche Staaten und Organisationen glauben, dass vor allem in den tropischen Regenwäldern eine grosse Reserve von<br />
kultivierbarem Land liegt. Als Jagd- und Fischrevier ernähren sie nur 2-3 Menschen pro km2. Der Wanderfeldbau versorgt<br />
immerhin bis zu 40 Menschen, die Agroforstwirtschaft dagegen könnte bis zu etwa 200 Menschen pro km2 ernähren,<br />
schätzen Experten.<br />
Naturschützer und Klimawissenschaftler warnen jedoch vor der weiteren Zerstörung des Waldes und würden die<br />
verbleibenden Reste lieber als Naturreservate unter strengen Schutz stellen.<br />
Wie schon im Lehrmittel "Dreimal um die Erde" von 1977-1980 (Bd. 1) im Kapitel zu den "Wildherden in den<br />
Savannen Ostafrikas" geschildert, prallen auch hier die Interessen der Einheimischen auf die der Aussenste-<br />
henden. Der Text wird auf der Seite 16 von einem Foto "Gemischter Anbau von Bananen, Mais, Kaffee und<br />
Erdnüssen in Kamerun" und einer Graphik "Landreserven und kultivierte Landflächen...", die für Afrika noch<br />
sehr grosse Landreserven ausweist, auf der Seite 17 von der Graphiken "Mit Agroforstwirtschaft gegen die<br />
Brandrodung" und "Erträge auf Böden des tropischen Regenwaldes am Beispiel des Manioks", die hier in<br />
leicht veränderter Form wiedergegeben werden soll, begleitet:<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Ertäge von Maniok bei unterschiedlichen<br />
Wirtschaftsformen<br />
in % des ersten Jahres<br />
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr<br />
Brandrodung Agroforstwirtschaft<br />
(Zur Maniokpflanze siehe auch die Seite 423 dieser Arbeit.)<br />
4.42.1.4 Sahel und Savanne: Burkina Faso<br />
Auf den Seiten 42-43 folgt ein Kapitel "Wandern, um zu überleben" über die Wanderungen der Viehnomaden<br />
im Sahel, in dem der Autor das Alltagsleben der Rezeigat beschreibt, ohne ein Katastrophenszenario des<br />
Hunger- oder Dürretodes zu zeichnen. Das Leben der Hackbauern in der Savanne schildert der Autor auf den<br />
Seiten 44-45 im Kapitel "Die Savanne brennt". In der Einleitung zum Kapitel schreibt der Autor auf der<br />
Seite 44, die auch ein Foto "Ein Hirsefeld wird vorbereitet" zeigt:<br />
Während in den nördlichen Savannen die traditionellen Wandergebiete der Viehnomaden liegen, leben in den südlichen,<br />
regenreicheren Gebieten Bauernstämme. Wo der Regenfeldbau Ernten erwarten lässt, bauten sie ihre Dörfer mit festen<br />
Lehmhütten und einer eingeteilten Flur, die aus Feldern und Gärten besteht.<br />
Als die Bevölkerung in den südlichen Savannen wuchs und neue Anbauflächen nicht mehr zur Verfügung standen,<br />
wanderten viele Hackbauern nach Norden bis in die Dornstrauchsavanne hinein. Sie versuchter sogar, jenseits der<br />
Trockengrenze des Regenfeldbaus Dörfer zu gründen Diese wichtige Grenze liegt ungefähr dort, wo die<br />
Jahresniederschläge weniger als 500 mm betragen und der Regenfeldbau deshalb nicht mehr lohnend ist.<br />
Um Felder und Gärten anlegen zu können, musste die Savanne abgebrannt und gerodet werden. Dabei wurden viele<br />
Pflanzen vernichtet, die den Boden vor der Austrocknung und Abtragung schützten.<br />
(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seite 389 dieser Arbeit.) Unter dem Titel "Ein Hackbauerndorf in Burki-<br />
na Faso" schreibt der Autor (S. 44f.):<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Samba, ein Dorf am nördlichen Rand der Trockensavanne, besteht aus 60 grossen Gehöften, die weit in der Savanne<br />
verstreut liegen. Alle Gehöfte sind mit Lehmmauern umgeben. Jede Familie besitzt eine eigene Hütte. Heiratet ein<br />
Familienmitglied, bauen die Bewohner ein neues Lehmhaus. Erst wenn der Platz innerhalb der Schutzmauer nicht mehr<br />
reicht, wird ein neues Gehöft gegründet. Zwischen den Hütten laufen Hühner, Schweine oder Ziegen frei herum. In Samba<br />
gibt es mehrere Brunnen, aus denen die Frauen Wasser pumpen können. "Noch vor wenigen Jahren war die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 425
Wasserversorgung unseres Dorfes ein grosses <strong>Pro</strong>blem", berichtet Frau Bouli. "Wenn nach der Regenzeit der Teich, den<br />
die Männer des Dorfes gegraben hatten, gefüllt war, lieferte er unser Trinkwasser. Es war jedoch schlechte Wasser das uns<br />
oft Krankheiten und vielen Kindern sogar den Tod brachte. In der Trockenzeit mussten wir uns aus einem 10 km entfernten<br />
Brunnen versorgen aus dem wir mit einem Eimer aus 30 Metern Tiefe Wasser heraufzogen. Heute ist es bequemer<br />
geworden: Entwicklungshelfer haben in unserem Dorf eine Pumpe gebaut, die aus 80 Metern Tiefe immer sauberes Wasser<br />
liefert." Wenn im Juni der erste Regen fällt, beginnt die Arbeit auf den Feldern und in den Gärten. Jede Familie besitzt<br />
einen Garten, ein Feld in der Nähe der Siedlung und ein Buschfeld, das oft mehrere Kilometer von der Wohnhütte entfernt<br />
liegt. Das einzige Arbeitsgerät ist die Daba, die Hacke mit dem kurzen Stil. Mit der Aussaat beginnt aber auch die jährlich<br />
wiederkehrende Ungewissheit: "Werden die Niederschläge ausreichen, damit die Pflanzen gedeihen können?" Und was<br />
ebenso wichtig ist: "Wird der Regen regelmässig fallen?" Schon eine Woche ohne Niederschlag kann bei den hohen<br />
Temperaturen zu Ernteausfällen führen. Auf den Buschfeldern werden Hirse, die hier typische Getreideart, und Bohnen<br />
angebaut. Wenn der Boden nach drei bis vier Jahren ausgelaugt ist, muss eine mehrjährige Brache eingehalten oder ein<br />
neues Feld in die Savanne gebrannt werden. Dabei liefert die Asche für kurze Zeit den notwendigen Dünger. Auf den<br />
Hausfeldern werden vor allem Mais und Knollenfrüchte z.B. Maniok, Yams oder Süsskartoffeln, angebaut. Am<br />
intensivsten werden die Gärten gepflegt. Sie werden gedüngt und bewässert, um gute Ernten an Gemüse und<br />
Gewürzpflanzen zu erzielen.<br />
Der Autor unterscheidet zwischen den verschiedenen Kleinstrukturen des traditionellen Feldbaus in Burkina<br />
Faso, dabei lässt er auch schwarzafrikanische Menschen zu Wort kommen. Im Text schreibt der Autor weiter:<br />
Das wichtigste Ziel der Hackbauern ist es, genügend Nahrungsmittel für ihre grossen Familien zu erzeugen. Erst wenn die<br />
Selbstversorgung sichergestellt ist, kann man daran denken, die Überschüsse zu verkaufen und Geld zu erwirtschaften. Es<br />
sind vor allem die Frauen, die auf den Märkten Gemüse, Mangofrüchte oder Geflügel zum Verkauf anbieten. Manche<br />
Kleinbauern versuchen, in der Savanne Baumwoll- oder Erdnussfelder anzulegen. Geld für Dünger oder<br />
Schädlingsbekämpfungsmittel besitzen sie jedoch nicht. Der Ertrag der Felder bleibt daher gering. Nur nach mehreren sehr<br />
günstigen Erntejahren verfügt man über Geld für "Luxusgüter" wie ein Wellblechdach, ein Batterieradio oder ein Fahrrad.<br />
Heute besitzen fast alle Familien auch Schaf- oder Ziegenherden. Die Tiere sind nicht nur wichtige Eiweisslieferanten, sie<br />
sind auch eine lebende Geldreserve für ihre Besitzer. In Notzeiten werden Teile der Herde verkauft, um Hirse oder Saatgut<br />
einkaufen zu können.<br />
Der Autor bemerkt richtig, dass es "vor allem die Frauen" sind, die ihre <strong>Pro</strong>dukte auf dem Markt anbieten und<br />
den Kleinhandel fest in der Hand haben. Zu der durch die Europäer eingeführte Plantagenwirtschaft schreibt<br />
der Autor:<br />
Viele wertvolle Flächen gingen für die Kleinbauern verloren, als auf günstigen Standorten Genossenschaften oder<br />
landwirtschaftliche Grossunternehmen Baumwoll- und Erdnussplantagen anlegten. Der Verkauf dieser <strong>Pro</strong>dukte auf dem<br />
Weltmarkt nützt in erster Linie den Betreibern und der Staatskasse, weniger jedoch den Kleinbauern der Savanne.<br />
(Siehe dazu auch das "Interview für das Fernsehen" mit einem Erdnussbauer aus dem Lehrmittel "Geographie<br />
der Kontinente" von 1984, S. 60.) Der Text wird begleitet von einer Karte "Verbreitungsgebiet der Tsetseflie-<br />
ge. Sie überträgt auf den Menschen die Schlafkrankheit und auf Rinder die Naganaseuche." und den Fotos<br />
"Ein Gehöft in Samba" und "Arbeit auf einem Hirsefeld".<br />
4.42.1.5 "Frauen in Burkina Faso"<br />
Die Seiten 46-47 beschreiben das Leben der "Frauen in Burkina Faso". Unter dem Titel "Afrikas Mädchen<br />
müssen früh erwachsen werden" schreibt der Autor auf der Seite 46:<br />
Khadija Ouadreogo lebt in Samba, in der Trockensavanne Burkina Fasos. Das Dorf liegt etwa 200 km von der Hauptstadt<br />
entfernt. Alles, was für Europäer selbstverständlich ist, gibt es hier nicht: keine Strassen, keine Elektrizität, keinen<br />
Briefträger, keine Geschäfte. Khadija ist 13 Jahre alt und geht noch ein Jahr in die 10 km entfernte Schule. In ihrem Gehöft<br />
leben sechs Familien, insgesamt 65 Personen. Das Mädchen wohnt mit ihrer Mutter und sechs jüngeren Geschwistern in<br />
einer Hütte. Ihr Vater hat noch drei weitere Frauen, denn er ist wohlhabend.<br />
Nur wohlhabende Männer können sich nach islamischen und traditionellen Brauch mehr als eine Frau leisten,<br />
denn der Mann ist verpflichtet, für den Unterhalt der Familie aufzukommen, selbst wenn die erwirtschafteten<br />
Mittel im Gegensatz zu den Einnahmen der Frau gering ausfallen. Ein weiteres Hindernis stellt der "Braut-<br />
preis" dar.<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Khadija und ihre Eltern sind Moslems, ihre Verwandten dagegen bekennen sich zum Christentum. Alle sind aber auch<br />
Animisten geblieben, d. h. sie glauben auch an Naturgeister oder den Einfluss von den Seelen de Ahnen auf ihr<br />
gegenwärtiges Leben.<br />
Eine für das Landesinnere Westafrikas häufige Konstellation, die von einer gewissen Toleranz der Religions-<br />
gemeinschaften füreinander zeugt. Mindestens solange keine Abwerbungen von der einen Konfession zur<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 426
anderen angestrebt werden. Eine Verhaltensregel an die sich besonders christliche Gemeinschaften amerikani-<br />
scher Prägung oft nicht halten und dadurch immer wieder für Unruhen sorgen.<br />
Als Khadija sieben Jahre alt war, hat ihre Mutter sie in der Schule angemeldet. Sie selber kann weder lesen noch schreiben.<br />
Auch die Verkehrssprache, Französisch, beherrscht Frau Ouadreogo nicht. In Burkina Faso gibt es über 100 Sprachen und<br />
Dialekte. Khadijas Mutter kann sich daher nur mit ihren eigenen Stammesangehörigen und den Bewohnern weniger<br />
benachbarter Dörfer verständigen.<br />
Nicht selten sprechen die Bewohner Westafrikas auch mehrere Sprachen, wobei die offizielle Landessprache<br />
nicht unbedingt dazugehören muss. Allerdings tritt eine solche Mehrsprachigkeit, wie im Text am Beispiel von<br />
Frau Ouadreogo geschildert, in sehr ländlichen Gegenden eher selten auf.<br />
Mit 14 Jahren soll Khadija verheiratet werden. Als sie fünf Jahre alt war, versprach der Grossvater das Mädchen der<br />
Familie eines Freundes. Mit 10 Jahren erhielt sie eine Ausbildung von alten Frauen des Dorfes, die sie auf ihre Aufgaben<br />
als Ehefrau vorbereiteten. Dazu gehörten z. B. Schönheitspflege, die Verwendung von Pflanzen als Medikamente und das<br />
Verhalten Männern gegenüber. Das meiste lernte sie jedoch schon als Kind von ihrer Mutter. Als Baby erlebte sie die Welt<br />
von dem Rücken ihrer Mutter aus. Später lernte sie, wie man Hühner füttert, Hirse zerstampft und die Gärten bebaut. Im<br />
nächsten Jahr wird sie nun ihre eigene Hütte beziehen und eine Familie gründen. Khadija hofft, in ihrer Ehe möglichst viele<br />
Kinder, vor allem Söhne, zu bekommen, die für sie und ihren Mann im Alter einmal sorgen werden. Nur ein Teil ihrer<br />
Kinder wird erwachsen werden, denn die Kindersterblichkeit ist immer noch hoch.<br />
(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seite 383 dieser Arbeit.) Die Töchter ziehen in die Familien des Ehemannes<br />
und gehen so der Sippe "verloren". Obwohl die Kindersterblichkeit stark rückläufig ist, bleibt sie für viele<br />
Staaten vor allem der Sahelzone nach wie vor hoch. Neben dem Text zeigt die Seite drei Fotos "Frauen beim<br />
Hirsestampfen", "Im Gemüsegarten" und "Frauen beim Dammbau". Die Seite 47 zeigt einen Lageplan<br />
"Afrikanische Frauen müssen weite Wege gehen", auf der ein Dorf und die Wegstrecken zu den wichtigsten<br />
Orten rund um das Dorf angegeben werden: zum Brunnen 20 min., zum Garten 30 min., zum Hirsefeld des<br />
Vaters 30 min., zum Holzholen 2. Std., zum Markt und Treffpunkt der Frauengruppe 1 Std., zur Ziegenherde<br />
in der Trockensavanne 2 Std., zum Hirsefeld der Mutter 30 min. (Vergleiche diese Zahlen mit den Angaben in<br />
der Grafik "Aktivitätspfade ghanaischer Familien" im Anhang auf der Seite 582 dieser Arbeit.)<br />
Im Text schreibt der Autor unter dem Titel "Afrikas Frauen ernähren den Kontinent" (S. 47):<br />
Safiatou Ouadreogo, Khadijas Mutter, ist 29 Jahre alt. Wie die meisten Frauen in Schwarzafrika sieht sie ihre Aufgabe<br />
darin, für ihren Mann zu arbeiten, Kinder zu bekommen und ihre Familie zu ernähren. Dazu besitzt sie ein eigenes Feld,<br />
einen Garten und verfügt über eigenes Haushaltsgeld.<br />
Der Tag von Frau Ouadreogo beginnt im Morgengrauen mit dem Gang zu dem zwei Kilometer entfernten Brunnen. In<br />
einem Wasserkrug trägt sie etwa 25 Liter Wasser nach Hause. Dann macht sie Feuer und bereitet das Frühstück vor. Am<br />
frühen Vormittag arbeitet sie auf ihrem eigenen Feld, im Garten oder hütet die Ziegen. Anschliessend bearbeitet sie die<br />
Hirsefelder ihres Mannes. Kein Dorfbewohner besitzt Maschinen oder einen Pflug, sie sind zu teuer, und ihr Einsatz würde<br />
die Austrocknung des Bodens beschleunigen. Daher ist die Hacke das einzige Arbeitsgerät der Bauern. Bei den hohen<br />
Temperaturen ist der Hackbau vor allem für die Frauen eine sehr schwere Arbeit. Nach der Feldarbeit sucht Frau<br />
Ouadreogo Brennholz, holt Wasser, braut Hirsebier und bereitet nach Sonnenuntergang Hirsebrei, eine scharfe Sosse und<br />
Gemüse für das Abendessen vor. Gegen 21 Uhr endet ihr Arbeitstag.<br />
Seit zwei Jahren ist Safiatou Mitglied einer Frauengruppe, die von der "Welthungerhilfe", einer deutschen<br />
Hilfsorganisation, unterstützt wird. Die Frauen lernten die Wasserversorgung des Bodens zu verbessern und den<br />
Gemüseanbau zu intensivieren. Inzwischen können sie sogar schon Gemüse auf den Märkten verkaufen. Die Männer<br />
betrachten die Versammlungen der Frauengruppe jedoch mit Argwohn. "Meine jüngeren Töchter möchte ich zu<br />
Verwandten in die Hauptstadt schicken. Vielleicht werden sie dort einmal ein leichteres Leben haben als hier in Samba,"<br />
hofft Frau Ouadreogo.<br />
Wie schon im Lehrmittel "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 (Bd. 4, S. 148) gefordert, wurde die Förderung<br />
der Frauen Schwarzafrikas auf sozialem, wirtschaftlichen und medizinischem Gebiet ein Schlüsselthema für<br />
die Entwicklungshilfe der neunziger Jahre, welches durch die Frauenkonferenz in Peking von 1996 gerade<br />
auch in den westafrikanischen Staaten, in Ghana beispielsweise unter der Leitung der First Lady, einen zusätz-<br />
lichen Aufschwung erlebte. War die schwarzafrikanische Frau lange von keinerlei Interesse, wie auch aus der<br />
Betrachtung der untersuchten Lehrmittel ersichtlich ist, konzentrieren sich die neuen Hoffnungen nun ganz auf<br />
sie. Eine Entwicklung, die sich auch in den Lehrmitteln für den Oberstufenunterricht niederschlug. (Zur<br />
Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 420 und 430 dieser Arbeit.)<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 427
Auf der Seite 47 ist zum Vergleich auch noch der "Typische Tagesablauf eines Mannes" abgedruckt, der die<br />
folgenden Aktivitäten umfasst:<br />
Frühstück, Umzug in die Hütte einer seiner Frauen, Gespräche mit Nachbarn und Freunden, Feldarbeit, Mittagessen mit<br />
Freunden, Mittagsruhe, Feldarbeit, Am Nachmittag Rückkehr ins Dorf, Vorbereitung des Feierabends, Abendessen,<br />
Besuch bei oder von Freunden.<br />
Damit wird das Bild eines wenig produktiven schwarzafrikanischen Mannes gezeichnet, der seine Zeit vor<br />
allem im "Gespräch" mit Nachbarn und Freunden" verbringt. Dieses Vorstellung hat aber längst nicht für alle<br />
Völker Schwarzafrikas Geltung: Viele von ihnen kennen traditionellerweise eine klare Arbeitsteilung, die<br />
Frauen und Männer genau umrissene Aufgabenprofile zuweist. In einer der Aufgabenstellungen werden die<br />
Schüler angewiesen (S. 47):<br />
Kaufe in einem Dritte-Welt-Laden 1 Pfund Hirse. Zerstampfe sie zu Mehl, und koche sie kurz auf. Lasse sie dann etwa 30<br />
Minuten aufquellen. Rühre oft um, damit sie nicht anbrennt. Zum Hirsebrei isst man Papayas, Mangos oder andere Früchte.<br />
Damit soll ein Teil der Lebenswirklichkeit der schwarzafrikanischen Frau nacherlebt werden, die im Kapitel<br />
"Gang in das Maniokfeld" des Werkes "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder" von 1953<br />
(S. 138-141) noch in fast romantischer Verklärung beschrieben wurde. (Siehe dazu die Seite 115 dieser<br />
Arbeit.)<br />
4.42.1.6 Desertifikation<br />
Zum Thema "Die Sahelzone, ein gefährdeter Naturraum" schreibt der Autor unter dem Titel "Ist die Natur am<br />
Ende?" auf der Seite 48:<br />
Schon seit Stunden ziehen die Mädchen mit ihrer Ziegenherde auf der Suche nach einem Futterplatz durch die<br />
Trockensavanne... Auf dem von der Sonne hartgebrannten Boden werden die Tiere jedoch keinen einzigen Grashalm mehr<br />
finden. Das Ziel der Herde sind die Bäume, deren Zweige nun als Nahrung dienen müssen. Was soll aber geschehen, wenn<br />
auch die Bäume kahlgefressen sind und sterben?<br />
Das Überleben im Sahel wird zunehmend schwieriger. Neben den immer wiederkehrenden Trockenjahren ist es auch der<br />
Mensch, der seinen Lebensraum zu zerstören beginnt:<br />
In nur 30 Jahren hat sich die Bevölkerung im Sahel verdoppelt. Die Nomaden vergrösserten ihre Herden, denn auch sie<br />
müssen immer grössere Familien ernähren. Darüber hinaus verspricht bei den Nomadenstämmen eine grosse Herde hohes<br />
Ansehen. Oft bleiben die Tiere jedoch so mager und schwach, dass sie kaum Milch und nur wenig Fleisch geben.<br />
Auch in den Dörfern der Ackerbauern an der Trockengrenze nimmt die Viehhaltung zu. Schon längst sind die dorfnahen<br />
Weiden kahlgefressen, und die Ziegenherden beginnen, in die Weidegebiete der Nomaden einzudringen. Ziegen haben aus<br />
Sicht der Dorfbewohner viele Vorteile... Neben den Kamelen sind sie die genügsamsten Tiere. Wissenschaftler warnen<br />
jedoch: "Ziegen fressen die Pflanzen völlig kahl, so dass sich die Weide oft nicht mehr erholen kann. Sie fördern damit die<br />
gefährliche Überweidung, bei der die schützende Vegetationsdecke aufgerissen wird und der Wind den Boden forttragen<br />
kann." Dieser Vorgang wird als Desertifikation bezeichnet.<br />
Natürliche Wasserlöcher sind in der Trockensavanne selten und liegen weit voneinander entfernt. In guter Absicht wurden<br />
mit ausländischer Hilfe viele neue, besonders tiefe Brunnen gebohrt, die die Dörfer mit sauberem Wasser versorgen. Sie<br />
ziehen aber auch immer mehr Herden an, die versuchen, sich möglichst lange in Brunnennähe aufzuhalten. Schon bald<br />
wächst hier kein Grashalm mehr, und der Boden ist von den Hufen der Tiere zertrampelt.<br />
Wird das Wasser auch zur Bewässerung von Feldern und Gärten heraufgepumpt, kann es zu einer gefährlichen<br />
Grundwasserabsenkung kommen. Dann trocknet das Land aus, und die Erosion zerstört den Boden.<br />
Zum Text bildet die Seite 48 die beiden Fotos "Brennmaterial ist Mangelware" und "Auf der Suche nach<br />
Nahrung", sowie ein Schema "Mögliche Folgen der Tiefbrunnen". Auf der Seite 49 schreibt der Autor unter<br />
dem Titel "Ein Kampf für die Natur":<br />
"Unsere Vorfahren wussten, dass sie mit der Natur leben mussten. Sie muss wieder unser Verbündeter und darf nicht zu<br />
unserem Gegner werden," erkannte die Regierung Burkina-Fasos. Sie nahm den Kampf gegen Erosion und Desertifikation<br />
auf.<br />
Unter der Überschrift "<strong>Pro</strong>gramm der 'Trois Luttes' (drei Kämpfe)" zählt der Autor die Massnahmen der<br />
Regierung auf:<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Ackerbau, Tierhaltung und Forstwirtschaft sind die Pfeiler unserer Lebenssicherung. Ackerbau und Viehhaltung dürfen<br />
nicht länger voneinander getrennt sein, sondern müssen füreinander genutzt werden.<br />
1. Förderung der kleinbäuerlichen Viehzucht mit Stallhaltung. Anbau von Futterpflanzen auf Brachflächen. Anlage von<br />
Mähwiesen. (Frisch geschnittenes und richtig getrocknetes Gras bleibt nährstoffreich. Mähen schont die Graswurzeln,<br />
weidende Ziegen reissen sie heraus.) Düngung der Felder mit Stallmist und Haushaltsabfällen.<br />
2. Viehherden dürfen nicht mehr unbeaufsichtigt in der Savanne nach Futter suchen. Die Hirten müssen auf eine die Natur<br />
schonende Beweidung achten.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 428
3. In der Savanne darf ohne Genehmigung kein Baum mehr gefällt werden. Nur abgestorbene Bäume und trockene Äste<br />
dürfen als Brennholz verwendet werden. Alle Dörfer sind aufgerufen, Bäume zu pflanzen und zu pflegen. Statt der<br />
heimischen Akazien, die sehr langsam wachsen, sollen vor allem Eukalyptusbäume und Fruchtbäume angepflanzt<br />
werden. Der Verkauf von Mangofrüchten, Papayas und Cashew-Nüssen verspricht zusätzliche Einnahmen.<br />
Zu diesen aufgezählten Massnahmen schreibt der Autor (S. 49):<br />
Selbst wenn diese Massnahmen von allen befolgt werden, wird die Sahelzone dennoch immer ein leicht verwundbarer und<br />
für den Menschen risikoreicher Lebensraum bleiben. Wissenschaftler stellten fest, dass sich die Wüste nach den<br />
Dürreperioden in den siebziger und achtziger Jahren um 16% nach Süden ausgedehnt hat. Nach den letzten regenreicheren<br />
Jahren hat sie sich jedoch wieder um 9% zurückgezogen. Besonders die Menschen in der Sahelzone müssen daher<br />
versuchen, die Selbstheilungskräfte der Natur und ihr empfindliches Gleichgewicht zu schonen, damit ihr Lebensraum<br />
bewohnbar bleibt.<br />
Zusätzlich zum Text gibt die Seite 49 eine Karte "Verbreitung der von Desertifikation gefährdeten Gebiete<br />
Afrikas" und eine Tabelle "Freie Tierhaltung in der Trockensavanne", deren Angaben hier wiedergegeben<br />
werden:<br />
Rinder Schafe Ziegen<br />
Flächenbedarf pro Tier 45 ha 6 ha 5 ha<br />
Verfügbarkeit von Wasser täglich jeden 2. Tag jeden 3. Tag<br />
Vermehrungsrate pro Jahr 60% 80% 160%<br />
4.42.1.7 Niederschläge<br />
Zum Thema "Kleine Dämme - grosse Hoffnung" auf den Seiten 50-51 schreibt der Autor unter dem Titel "Wie<br />
Wasser zu einer Gefahr wird" auf der Seite 50:<br />
Es klingt wie ein Widerspruch: Nicht nur Hitze und Trockenheit sind Feinde der Sahelbewohner, ein ebenso gefürchteter<br />
Gegner ist das Wasser. Wenn die Regenzeit mit kurzen, aber heftigen Niederschlägen über das Land zieht, stürzen in<br />
wenigen Stunden grosse Wassermassen auf den ausgetrockneten, von der Sonne hartgebrannten Boden. Die ziegelharte<br />
Erde kann das Wasser nicht aufnehmen. Es fliesst oberflächlich ab, trägt die dünne Humusschicht fort und reisst tiefe<br />
Erosionsrinnen in den roten Savannenboden... Solange die natürliche Gras- und Buschvegetation das abfliessende Wasser<br />
bremste, blieben die Erosionsschäden gering. Als jedoch immer mehr Hackbauern ihre Felder in die Savanne brannten,<br />
wurde der Boden verwundbar gegenüber Wasser und Wind. In den vergangenen 20 Jahren ist allein in den nördlichen<br />
<strong>Pro</strong>vinzen Burkina-Fasos die landwirtschaftlich nutzbare Fläche um etwa 50% geschrumpft. Wie soll aber die restliche<br />
Fläche die wachsende Bevölkerung ernähren? Wann werden die immer mehr beanspruchten Felder ausgelaugt sein, wann<br />
wird die Hirse keine Früchte mehr tragen?<br />
Ein Foto "Erosionsschluchten" zeigt eindrücklich die Kraft des Wassers, denn bei dem im Text angesproche-<br />
nen Erosionserscheinungen handelt es sich wie erwähnt nicht um eine flächenhafte Abtragung der Bodendek-<br />
ke, sondern um eine tiefe Zerfurchung derselben. Zuletzt entstehen mehrere Meter tiefe Gräben, die das Gelän-<br />
de völlig unpassierbar machen. Ein weiteres Foto zeigt die "Wirkung von Querriegeln in Senken" und eine<br />
Graphik "Querschnitt durch ein neu angelegtes Feld" illustrierten die im Text unter dem Titel "Hoffnung durch<br />
Wissen" auf den Seiten 50f. gemachten Aussagen:<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
"Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben, in unserem Dorf bleiben zu können", erzählt Moussa Savadogo, ein Bauer<br />
aus Kayon. Die Ernten wurden von Jahr zu Jahr geringer, und oft waren schon vor dem Ende der Regenzeit die<br />
Hirsespeicher leer. Viele Dorfbewohner verliessen daher ihre Gehöfte und versuchten, bei Verwandten in der Stadt<br />
unterzukommen. Seit drei Jahren sehen wir jedoch wieder mit Optimismus in die Zukunft. Mit Hilfe von<br />
Landwirtschaftsexperten haben wir gelernt, "Wasserbremsen" anzulegen. In den Abflussrinnen und Erosionsschluchten<br />
bauten wir aus Steinen und einem Drahtgeflecht Querriegel. Die Experten versicherten uns, dass diese Steinwälle viele<br />
Vorteile hätten. Sie könnten z. B. dazu beitragen, dass sich in der ausgewaschenen Schlucht in nun ruhigem Wasser die<br />
feinen Bodenbestandteile absetzen und der fortgespülte Boden ersetzt wird. Nach ein paar Jahren könnten wir auf der<br />
bislang unbrauchbaren Fläche ein neues Feld anlegen, das über mehrere Jahre gute Ernten verspricht.<br />
Besonders eindrucksvoll sind jedoch die Erfolge, die wir mit dem Bau von etwa 40 cm hohen Dämmen entlang der<br />
Höhenlinien um unsere Felder erzielten. Das ganze Dorf schuftete unter der sengenden Sonne und bei 45°C wochenlang,<br />
um Steine über Kilometer herbeizuschaffen, sie zu behauen und aufzuschichten. Das Geld für Drahtgeflechte, Schaufeln,<br />
Hämmer und Hacken bekamen wir aus Entwicklungshilfemitteln. In die Felder zogen wir dann zusätzlich tiefe Furchen,<br />
um das Regenwasser noch besser an dem Abfluss zu hindern. An den Rand der Dämme wurden Bäume gepflanzt. Unser<br />
Landwirtschaftsberater erklärte uns ihre Vorzüge für die Haltbarkeit der Steinwälle und den Boden. Wir schätzen Bäume<br />
aber vor allem, weil wir aus ihren Blättern, der Rinde und den Wurzeln Arzneimittel gewinnen und ihre Früchte ernten<br />
können.<br />
Als der erste Regen einsetzte, säten wir Hirse und Bohnen auf die neu angelegten Felder. Drei Monate später hat die Ernte<br />
auch die Zweifler in unserem Dorf von dieser neuen Methode überzeugt. Vor dem Bau unserer Minidämme ernteten wir 5<br />
Eselskarren Hirse, danach waren es 12. Nach der Ernte trieben wir unser Vieh auf das neue Feld. Die Tiere frassen die<br />
trockenen Stengel und Blätter und lieferten natürlichen und kostenlosen Dünger für die nächste Aussaat.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 429
Wir haben viel von unseren Beratern gelernt. Durch ihre Hilfe und unsere Arbeit haben inzwischen in einem Gebiet von<br />
6'000 km 2 über 330'000 Menschen neue Hoffnung gefunden. Wenn wir auch weiterhin Zuschüsse für Geräte, Saatgut und<br />
den Kauf junger Bäume bekommen, können wir in den nächsten Jahren noch mehr Anbauflächen zurückerobern."<br />
Der Bauer beschreibt nicht nur eine Entwicklungshilfe, die mit wenig fremden Ressourcen zu einem greifbaren<br />
Ergebnis führt, er lässt auch "neue Hoffnung" für das einstmals als Katastrophengebiet bezeichnete Acker- und<br />
Weideland und die von ihm lebenden Menschen aufkommen. Bei dieser Art der Bewirtschaftung fällt für den<br />
Export allerdings nichts mehr ab, denn diese Art von Hilfe und Beratung - unterdessen gibt es auch <strong>Pro</strong>jekte in<br />
denen Schwarzafrikaner andere Schwarzafrikaner unter Zuhilfenahme ihres traditionellen Wissens beraten -<br />
konzentriert sich ganz auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und schielt nicht nach dem Weltmarkt.<br />
(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seite 427 dieser Arbeit.)<br />
Die Seite 51 zeigt auf zwei Fotos "Bau von Steinwällen" und "Der Erfolg der Arbeit", was durch die Beratung<br />
geschaffen werden konnte. Eine Grafik "Ernteerträge auf Hirsefeldern", die hier leicht verändert wiedergege-<br />
ben wird, zeigt den Erfolg des Konzeptes:<br />
240<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
0<br />
Ertäge von Hirse bei unterschiedlichen<br />
Anbaumethoden<br />
in % des ersten Jahres<br />
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr<br />
Ernte auf Feldern, die von Steinwällen umgeben sind<br />
Ernte auf ungeschützten Feldern<br />
In einer der Aufgabenstellungen werden die Schüler zum Nachdenken über die Vor- und Nachteilen des<br />
<strong>Pro</strong>jektes aufgefordert (S. 51):<br />
Haltet nun ein typisches "afrikanisches Palaver", zu diesem Thema. Stellt die Stühle in einen Kreis. Afrikaner halten<br />
folgende Regeln ein: Jeder darf seine Meinung sagen. Jeder spricht nur wenn er von dem Chef aufgefordert wird, Keiner,<br />
ausser dem Chef, darf die Rede eines anderen unterbrechen. Jeder versucht die Meinung des anderen zu verstehen.<br />
Die verallgemeinernde Aussage über die "Afrikaner" mindert den Versuch, die Schüler ein Stück "schwarz-<br />
afrikanischer" Entscheidungsfindung nachleben zu lassen.<br />
4.42.1.8 Hilfe von Schülern für Afrika<br />
Die Seiten 52-53 befassen sich in "Diercke Extra" mit der Möglichkeit für die Schüler, selber aktiv zu werden.<br />
Dazu schreibt der Autor unter dem Titel "Schüler engagieren sich" auf der Seite 52:<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Nicht überall auf der Welt geht es Kindern so gut wie bei uns. Nicht überall ist es selbstverständlich, in die Schule zu<br />
gehen, lesen, schreiben und rechnen zu lernen.<br />
Nicht überall ist es möglich, den Wasserhahn aufzudrehen, den Lichtschalter anzuknipsen, in einem Geschäft Essen zu<br />
kaufen oder zu einem Arzt zu gehen, wenn man krank ist.<br />
Aus diesem Grund haben sich viele deutsche Städte Patenstädte in den ärmsten Teilen der Welt gesucht. Sie helfen mit<br />
Geld, Medizin, Maschinen oder auch mit Fachleuten, die die Menschen in den armen Ländern so ausbilden, dass sie die<br />
Not selbst bekämpfen lernen.<br />
Auch viele Schulen engagieren sich. "Spendet, wir helfen!" So kann das Motto von Schulfesten, von Bastelaktionen, von<br />
Theater- und Konzertaufführungen, von Verkaufs- und Verlosungsaktionen oder von sportlichen Unternehmungen lauten.<br />
Am besten ist es, wenn die Schule direkt Kontakt mit einer Gemeinde der dritten Welt aufnimmt. Dann erfährt sie am<br />
schnellsten, was dort am meisten fehlt. Sie entscheidet mit, wofür gesammelt wird und wie die Hilfsgelder angelegt<br />
werden, und sie sieht, welchen Erfolg die Hilfe hat.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 430
Unter dem Titel "Eine Schule für Samba" stellt der Autor eines der <strong>Pro</strong>jekte vor. Zu Burkina Faso heisst es im<br />
Text (S. 52-53):<br />
...Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt... Die Regierung in Burkina Faso entsendet nur dann einen Lehrer<br />
in die abgelegenen Gebiete des Landes wenn dort die Dorfbevölkerung selbständig Klassenräume und Lehrerwohnungen<br />
baut... Die neuen Klassenräume sind dort einfach, aber gross. Nicht selten sind 70 bis 80 Schüler pro Klasse<br />
unterzubringen, und dies bei Raumtemperaturen um 45°C. Schulbücher sind rar, Schulhefte gibt es selten, es wird<br />
überwiegend auf Tafeln geschrieben, und die Kinder nehmen oft Fusswege von 15 bis 20 km in Kauf, nur um in die Schule<br />
gehen zu dürfen!<br />
Die Schule entlastet auch die Familien, denn Wasser und Mahlzeiten werden für die Kinder von den Hilfsorganisationen<br />
kostenlos gestellt.<br />
Eine Ausbildung gibt den Kindern die Chance, vielleicht eine Arbeit in der <strong>Pro</strong>vinzhauptstadt zu bekommen. Ausserdem<br />
lernen sie viel Praktisches, so dass sie Mittel kennenlernen, gegen die Not anzukämpfen...<br />
Diese Aussage unterscheidet sich stark von der im Lehrmittel "Terra Geographie" von 1979 (Bd. 1, S. 191)<br />
gemachten, die davon ausgeht, dass das in der Schule erworbene Wissen wenig Wert für das tägliche Leben<br />
hat. (Siehe dazu die Seite 312 dieser Arbeit.)<br />
Die Materialiensammlung zum Text zeigt auf den Seiten 52 und 53 eine Karte "Völker und Stämme in Burki-<br />
na Faso", auf der die Gebiete der Sénoufo, Lobi, Bobo, Marka, Samo, Mossi (Ackerbauern), Bissa, Peul<br />
(Viehzüchter) und Gourmantsché eingezeichnet sind, ein Foto der Schule, das an der Schule verwendete Fran-<br />
zösischlehrmittel und ein Informationsblatt "Hilfe für Samba".<br />
4.42.2 Band 4<br />
Der 1997 erschienene Band "Diercke Erdkunde 8" für die 8. Klasse enthält die Kapitel "Eine musikalische<br />
Weltkarte" (S. 136-137), "Die Erde hat viele Gesichter" (S.138-139) und "Bevölkerungswanderungen welt-<br />
weit" (S. 150-151).<br />
Auf den Seiten 136-137 schreibt der Autor unter der Überschrift "Es begann in Afrika" zum Thema "Eine<br />
musikalische Weltkarte":<br />
...Im Staat [Südafrika, Anm. des Verfassers] entstand in den siebziger Jahren ein Stil, der weltweit als Soweto Beat bekannt<br />
wurde. Diese musikalische Mixtur aus den Slums von Soweto, die den <strong>Pro</strong>test gegen Armut, Unterdrückung und Apartheid<br />
ausdrückt, verdankt ihre weltweite Popularität vor allem dem Londoner Radio-DJ John Peel (BFBS).<br />
Weitere für den Ethnobeat bedeutende afrikanische Musiker sind. Manu Dibango, Yousou N'Dour, Fela Kuti, Hugh<br />
Massekea und Miriam Makeba.<br />
(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seite 394, zu den Slums Schwarzafrikas die Seite 405 dieser Arbeit.)<br />
Damit ist "Diercke Erdkunde" eines der wenigen Geographielehrmittel, welches, wenn auch nur kurz, diesen<br />
Teilaspekt der Kultur Schwarzafrikas erwähnt. Auf der Seite 138 schreibt der Autor im Kapitel "Die Erde hat<br />
viele Gesichter" zum Thema "Die Kulturerdteile":<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
...Afrika z. B. ist nach dieser Gliederung nicht mehr ein einziger Kontinent, sondern gehört zwei Kulturerdteilen an: dem<br />
schwarzafrikanischen und dem orientalischen Erdteil. Der schwarzafrikanische Teil wird vor allem nach der Rasse und der<br />
Wirtschaftsweise seiner Bewohner abgegrenzt. Den orientalischen Kulturerdteil verbindet vor allem die gemeinsame<br />
Religion, der Islam...<br />
Die Seite 138 zeigt ausserdem 9 Fotos von Menschen aus aller Welt, von denen zwei Schwarzafrikanerinnen<br />
abbilden. Das Wort Kultur definiert der Autor nach Brockhaus und Meyers Enzyklopädien:<br />
Kultur: (lat. colere = bebauen, (be)wohnen, pflegen, ehren)<br />
Als "Kultur" bezeichnet man alles, was der Mensch zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Räumen geschaffen hat, was<br />
also nicht naturgegeben ist. Zur Kultur gehören z. B. Handwerk und Technik, die Art, wie die Erde bewirtschaftet wird,<br />
Wissenschaften, Sprache, Religion, Kunst und Politik.<br />
Die Seite 139 zeigt eine Weltkarte der "Kulturerdteile" wobei Afrika bis zur Sahelzone und dem Horn von<br />
Afrika ganz oder teilweise dem orientalischen Kulturraum zugerechnet wird, dafür wird für die Ostküste kein<br />
solcher Einfluss geltend gemacht. Im Text definiert der Autor den "Kulturerdteil" auf der Seite 139:<br />
Ein Kulturerdteil ist ein Grossraum, der durch eine bestimmte Kultur geprägt wurde und dadurch als Einheit erkennbar<br />
wird. Zu den Raum prägenden Faktoren gehören z. B. die Wirtschaftsformen, die Anlage von Städten, Religion und<br />
Geschichte, typische Wertvorstellungen sowie Sitten und Gebräuche. Merkmale, die Grossräume zu Kulturerdteilen<br />
verbinden, sind fernen Sprachen, die Literatur, die Musik und die Kunst.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 431
Die Seiten 150-151 befassen sich in "Diercke Extra: Auf der Flucht" mit den "Bevölkerungswanderungen welt-<br />
weit". In einer Grafik "Fluchtgründe" werden als Ursachen für Wanderbewegungen die acht Punkte Natur/Um-<br />
welt, Krieg, Unterdrückung, Armut, Gewalt, Ungerechtigkeit, Bevölkerungsdruck und begrenzte Ressourcen<br />
genannt. In einem Textkasten "Aus Zeitungen und Zeitschriften" schreibt der Autor zu Afrika:<br />
Juni 1991: Die Sahelzone ist von der Erosion, Versalzung und Austrocknung der Böden betroffen. Die Menschen können<br />
sich z. T. nicht mehr ernähren. Deshalb wandern zum Beispiel jährlich 40'000 Menschen aus Burkina Faso in die<br />
Elfenbeinküste aus.<br />
Ausserdem zeigen die Seiten 150 und 151 eine grosse Weltkarte "Flüchtlinge und Wanderarbeiter", welche für<br />
die Küstenländer Westafrikas und Südafrika eine Zuwanderung von Arbeitskräften ausweist, für alle Länder<br />
im Gebiet der Sahara und Sahel (ausser Tschad) und die Länder Botswana und Mosambik eine Abwanderung.<br />
Ausserdem zeigt die Karte, dass aus einigen afrikanischen Länder Menschen geflohen sind, während andere<br />
grosse Zahlen von Flüchtlingen aufgenommen haben. Besonders kompliziert sind nach der Karte die Verhält-<br />
nisse in Sudan und Äthiopien, die einerseits Flüchtlinge aufnehmen, aus denen andererseits aber auch<br />
Menschen fliehen.<br />
4.42.3 Zusammenfassung<br />
Das Lehrmittel beginnt die Betrachtung Schwarzafrikas mit dem Vergleich zwischen "Pygmäen" und Bantus,<br />
wobei die "Pygmäen" als "kleine Menschen des Urwaldes" bezeichnet werden, die über den tropischen Regen-<br />
wald "mehr wissen als die europäischen Gelehrten". Die <strong>Pro</strong>bleme der Bantus, die durch eine zunehmend<br />
intensivere Nutzung der Waldgebiete heraufbeschworen wurden, glaubt der Autor mit Hilfe der Agroforstwirt-<br />
schaft einer Lösung nahe. Der einstmalige Pessimismus gegenüber Schwarzafrika ist als zumindest teilweise<br />
einer "neuen Hoffnung" gewichen.<br />
Den grössten Teil des Lehrmittels nehmen einzelne Momentaufnahmen aus einem Dorf in Burkina Faso ein.<br />
Nicht nur die Art der Bewirtschaftung wird aufgezeigt, sondern das Lehrmittel geht auch speziell auf die Rolle<br />
der schwarzafrikanischen Frau ein.<br />
Als Hauptproblem für die Landwirtschaft nennt der Autor Desertifikation und Erosion, für deren Bekämpfung<br />
aber ebenfalls konkrete Massnahmen vorgestellt werden.<br />
Geographielehrmittel: Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Damit zeichnet der Autor ein ziemlich differenziertes Bild des ländlichen Burkina Fasos, vernachlässigt durch<br />
die Schwerpunktsetzung dafür aber ganze Grossräume Schwarzafrikas. Der auf dem Kontinent lebende<br />
Schwarzafrikaner wird als wenig tüchtiger Mann geschildert, der einen Grossteil der Arbeit durch seine<br />
Frau(en) erledigen lässt, die als neue Stütze der Länder Schwarzafrikas angesehen wird.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 432
5. Der schwarzafrikanische Mensch im Musiklehrmittel<br />
We see that the musical faculties, which are not wholly deficient in any race, are capable of prompt and high development,<br />
for Hottentots and Negroes have become excellent musicians, although in their native countries they rarely practise<br />
anything that we should consider music. Schweinfurth, however, was pleased with some of the simple melodies which he<br />
heard in the interior of Africa... The negro in Africa when excited often bursts forth in song;... another will reply in song,<br />
whilst the company, as if touched by a musical wave, murmur a chorus in perfect unison.<br />
Charles Darwin in "The Descent of Man", 1871<br />
Die Betrachtung der Darstellung der Musik Schwarzafrikas gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil "Ein<br />
Blick in die Fachliteratur" werden einige Fachbücher darauf untersucht, wie sie die schwarzafrikanische Musik<br />
darstellen, im zweiten Teil "Schulbücher" erfolgt die Betrachtung und Analyse von im Musikunterricht<br />
verwendeten Schulbüchern.<br />
5.1 Ein Blick in die Fachliteratur<br />
Im folgenden Unterkapitel werden einige meist ältere Werke aus der Fachliteratur betrachtet, um einen<br />
Einblick in die Aufarbeitung der afrikanischen Musik in allgemeinen Werken zur Musik zu erhalten. Einige<br />
der Werke sind Übersetzungen, andere erscheinen bereits in wiederholter Auflage, deshalb werden die Werke<br />
chronologisch nach ihrem Erscheinungsjahr, nicht nach der Erstveröffentlichung, besprochen.<br />
5.1.1 Knaurs Weltgeschichte der Musik (1979)<br />
"Knaurs Weltgeschichte der Musik" mit dem Untertitel "Von den Anfängen bis zur Klassik" beschäftigt sich<br />
im Gegensatz zu anderen Musikwerken auf den insgesamt 480 Seiten durchaus mit der Musik aus<br />
Schwarzafrika.<br />
In den einleitenden Gedanken zur Musik schreibt Honolka auf der Seite 25 zu den drei zentralen Gestaltungs-<br />
elementen der Musik:<br />
...dass auch das dritte zentrale Gestaltelementen der Musik, der Rhythmus, in einem weiteren Kontinent primär auftritt, und<br />
zwar in Afrika.<br />
Im Kapitel "Naturvölker in Afrika" schreibt Honolka auf den Seiten 26-34 über die Einflüsse anderer Kulturen<br />
auf die schwarzafrikanische Musik (S. 26):<br />
Musiklehrmittel: Ein Blick in die Fachliteratur<br />
...Kaum je hat sich das afrikanische Element dem andern untergeordnet; dafür ist die Lebenskraft der negerischen Musik<br />
viel zu gross.<br />
Die "Lebenskraft" der Schwarzafrikaner wird immer wieder angesprochen und wurde von schwarzafrikani-<br />
schen Autoren selbst als eine typisch afrikanische Eigenschaft reklamiert. Auf der Seite 26 schreibt Honolka:<br />
Das muss überhaupt als erstes vermerkt werden: dass die Neger nicht nur besonders musizierfreudig, sondern auch<br />
ausserordentlich musikbegabt sind...<br />
Sicherlich nicht eine Eigenschaft dieser Menschen an sich, sondern eine anerzogenen Fähigkeit, die auf einer<br />
jahrhundertealten Tradition basiert. Im Zusammenhang mit dem Vordringen der elektronischen Medien kann<br />
aber zumindest in gewissen Gegenden ein Rückgang dieser Fähigkeiten beobachtet werden, denn durch sie<br />
wird, wie vor Jahren auch schon die Europäer, der einstmals aktiv musizierende Schwarzafrikaner zum mehr<br />
oder weniger passiven Konsumenten musikalischer "Einheitskonserven" (siehe auch weiter unten).<br />
Über die "Eigenarten, die, trotz vieler Unterschiede im einzelnen alle Negergruppen verbinden und das unver-<br />
kennbar Negerische der afrikanischen Musik ausmachen" schreibt Honolka weiter auf den Seiten 26-27:<br />
...Dazu gehört zuallererst die überragende Stellung des Rhythmus, die offenbar auf besonderen physiologischen<br />
Voraussetzungen bei den Negern beruht. Diese sind nämlich zugleich auch überaus tänzerisch veranlagt. Ihr<br />
Bewegungshabitus ist nicht nur von der Zweckmässigkeit - etwa des Gehens - allein geprägt, sondern auch von<br />
zweckfreien körperlichen Äusserungen, in denen sich seelisch-geistige Funktionen widerspiegeln. Das Tanzen ist dem<br />
Neger ein unentbehrliches, meist unbewusst angewandtes Ausdrucksmittel. Tanz ohne eine zeitgliedernde Ordnung ist aber<br />
nicht denkbar, und so wurde der Rhythmus zwangsläufig zum primären Element der Negermusik.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 433
Der Autor erläutert nicht weiter, auf welchen "physiologischen Voraussetzungen" die tänzerische Veranlagung<br />
des "Negers" beruht. Wie sollte er auch, beruht doch auch diese Fähigkeit auf einer Erziehung, die tänzerische<br />
Äusserungen schon im Kleinkindalter lobt und fördert. Auch die Bemerkung, der Tanz sei "ein meist unbe-<br />
wusst angewendetes Ausdrucksmittel" sollte im Anbetracht der zahlreichen Funktionen des Tanzes in den<br />
traditionellen schwarzafrikanischen Gesellschaften mit Vorsicht betrachtet werden. Denn einerseits kann der<br />
Tanz durchaus dazu dienen, eine Art Trancezustand zu erreichen, mit deren Hilfe Ahnen, Geister oder Götter<br />
angesprochen werden können, andererseits erfüllt er aber auch soziale Funktionen, die von der Verspottung<br />
herrschender Zustände in der Art eines Basler Schnitzelbankes bis hin zur Partnervermittlung, in der Art der<br />
Kommilitonen- oder Maitänze Europas und Nordamerikas, reichen.<br />
Im nächsten Abschnitt beschreibt Honolka die Funktion des Wechselgesanges in der schwarzafrikanischen<br />
Musik, geht auf die Eigenart des Singstiles ein um auf der Seite 28, nicht ohne Bedauern festhaltend, dass die<br />
Musik in den Städten zunehmend europäisiert werde, um dann über "das Musikleben Afrikas" zu schreiben:<br />
Musik ist, so sagt man gerne, in Afrika Sache der ganzen Gemeinschaft. Diese singt, spielt und tanzt, wann immer sie Lust<br />
dazu verspürt: bei abendlicher Geselligkeit, bei Festen und Feiern kultischer und weltlicher Art. Das ist aber nicht das<br />
einzige Feld musikalischer Betätigung. Musiksoziologisch ist Afrika vielschichtiger. Da gibt es auch durchaus den<br />
einzelnen Musizierenden. Es gibt Laiensänger und -spieler, die andere, sei es bei der Arbeit, sei es am Feierabend,<br />
unterhalten. Es gibt Berufssänger, umherziehende Barden, die sich selber auf einem Zupfinstrument begleiten und ganze<br />
Hofkapellen, die im Dienst eines Häuptlings stehen und dessen Macht repräsentieren helfen. Umfängliche kultische<br />
Zeremonielle, seit Generationen geübt und in alter Form bewahrt, finden sich neben der Musik improvisiert<br />
zusammengestellter Ensembles...<br />
Der Autor unterscheidet hier richtig zwischen verschiedenen Ausprägungen des Musiklebens Schwarzafrikas,<br />
welche vom Kind, das aus einer Dose oder Kalebasse ein eigenes Rhythmusinstrument bastelt bis hin zum<br />
professionellen Griot, der am Hofe der Mächtigen musiziert, einen riesigen Bogen spannt.<br />
Die Musik sei "geprägt durch Laien und Berufsmusiker, die noch nicht über ihr Tun reflektieren" heisst es im<br />
Text. Unter der Überschrift "Instrumente" schreibt Honolka auf der Seite 29:<br />
Unter den Musikinstrumenten überwiegen solche Typen, die eine genaue Darstellung des Rhythmus erlauben. Neben einer<br />
Vielzahl von Rasseln, Klappern usw. steht hier vor allem eine Fülle von Trommelarten...<br />
Damit vermittelt Honolka zu Unrecht das Bild, schwarzafrikanische Instrumente wären vor allem Rhythmusin-<br />
strumente, dabei existiert eine grosse Anzahl von anderen Instrumententypen, und selbst Instrumente wie die<br />
Sanduhrtrommel, auch "talking-drum" genannt, besitzen tonalen Charakter. Zu der Trommel als Kommunika-<br />
tionsmittel führt Honolka auf der Seite 29 aus:<br />
Die Schlitztrommeln vermögen im allgemeinen, infolge verschiedener Wandstärken, zwei differierende Töne<br />
hervorzubringen, die meist zumindest um eine kleine Terz auseinanderliegen. Diese Eigenschaft und der weittragende<br />
Schall prädestinieren sie zum Medium der in Afrika gern geübten Trommelsprache. Sie ist nicht eigentlich Musik, bedient<br />
sich aber doch musikalischer Mittel, um - so war es wenigstens früher - Nachrichten durch beauftragte Trommler von Dorf<br />
zu Dorf weiterzugeben. Man hatte dazu die natürliche Sprachmelodie der Sätze auf zwei Töne reduziert, ihr den eigenen<br />
Rhythmus belassen und das Ganze dann, vom Wort gelöst, instrumental hervorgebracht...<br />
(Siehe zur Trommelsprache auch die Seiten 155 und 449 dieser Arbeit.) Als weitere in der schwarzafrikani-<br />
schen Musik verwendete Musikinstrumente nennt Honolka auf den Seiten 29-32:<br />
Unter den Blasinstrumenten sind vor allem Flöten und Trompeten oder Hörner vertreten... Es ist besonders<br />
charakteristisch, dass sich in weiten Teilen Afrikas zwei Instrumente verbreiten konnten, die feststufig abgestimmt sind<br />
und zugleich rhythmisch sehr exakt gespielt werden können: Xylophon und Zupfzungenspiel... Die gleichen musikalischen<br />
Grundeigenschaften, die eben angeführt wurden, besitzen auch die gezupften Saiteninstrumente: Feststufigkeit und<br />
rhythmische Prägnanz... Harfen verschiedenster Form sowie einfache Lauten bilden das Gros dieser Instrumentengruppe.<br />
Hier kannte die Phantasie der Neger keine Grenzen...<br />
Ein Blick in das Musikbuch "Instrumente der Welt" von 1988, welches auf der Seite 437 dieser Arbeit ange-<br />
sprochen wird, bestätigt diese Aussage.<br />
Musiklehrmittel: Ein Blick in die Fachliteratur<br />
Auf der Seite 31 ist zu der Beschreibung der Musikinstrumente passend eine Abbildung "Trommler, Holzpla-<br />
stik aus Südnigerien" abgebildet. Die Seite 33 zeigt eine "Afrikanische Bogenharfe". Ausserdem findet sich ein<br />
zweizeiliges Notenbeispiel "Wechselgesang der Pangwe, Nordkongo" auf der Seite 32. Über die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 434
Mehrstimmigkeit der schwarzafrikanischen Musik und die Fähigkeiten der ausführenden Musiker schreibt<br />
Honolka auf der Seite 34:<br />
...Diese komplizierten Kombinationen und Überlagerungen werden mit einer Selbstverständlichkeit und Sicherheit<br />
dargeboten, dass man ihre kunstvolle Struktur zunächst kaum wahrnimmt, die man aber, sobald man sie erkannt hat,<br />
bewundern muss. Die rhythmische Virtuosität, die afrikanischen Ensembles eigen ist, trifft man nirgendwo anders auf der<br />
Welt...<br />
Im letzten Abschnitt zu der schwarzafrikanischen Musik schreibt Honolka zu der Musik der Pygmäen und<br />
Buschmänner (S. 34):<br />
Sie sind ebenfalls sehr musikalisch, haben vieles von den Negern übernommen und sich so aus einem Stadium primitivster<br />
Musikübung erheben können. Ja, Negerstämme halten sich oft sogar Pygmäen als Musiker. Urtümlich sind bei diesen das<br />
Jodeln und die Gewohnheit, kurze melodische Motive durch eintönige Flöten und Hörner, die sich gegenseitig ergänzen,ausführen<br />
zu lassen und das Ganze dann auch wieder rein vokal zu imitieren. Ausserdem kann man bei diesen Restvölkern<br />
noch viele Bindungen der Musik an Magie und Kult, an Jagdzauber und Naturbeschwörung finden.<br />
Einen guten Eindruck dieser Musik liefert eine neuere Aufnahme von Radio DRS, die im Rahmen der Reihe<br />
"Musik der Welt" unter dem Titel "Musik aus Zentralafrika" im Frühjahr 1998 ausgestrahlt wurde, und die<br />
zeigt, dass die Musik der Pygmäen alles andere als "primitiv" genannt werden muss. (Musik der Welt: Zentra-<br />
lafrika, 1998; zu den Pygmäen siehe auch die Seiten 422 und 448 dieser Arbeit.)<br />
5.1.1.1 Zusammenfassung<br />
In "Knaurs Weltgeschichte der Musik" werden die "Neger" als "musizierfreudig" und "musikbegabt", mit einer<br />
alles andere übertreffenden "rhythmischen Virtuosität" beschrieben. Für sie sei das Musizieren und Tanzen ein<br />
"unentbehrliches, meist unbewusst angewandtes Ausdrucksmittel". Dabei versäumt es Honolka nicht, zwischen<br />
der Musik der Laiensänger und Berufsmusiker zu unterscheiden und vermittelt auch sonst den Eindruck einer<br />
äusserst "vielschichtigen" Musiktradition. Bei den Instrumenten nennt Honolka neben der Gruppe der Trom-<br />
meln auch Blas- und Zupfinstrumente, sowie das Xylophon. Die Musik der Pygmäen wird als "urtümlich" und<br />
der "Magie" verbunden beschrieben.<br />
5.1.2 Geschichte der Musik (1980)<br />
Die 692 Seiten umfassende "Geschichte der Musik" von Karl H. Wörner erwähnt Schwarzafrika nur an einigen<br />
wenigen Stellen. Im Kapitel "Mehrstimmigkeit in aussereuropäischer Musik" druckt der Autor das in Noten<br />
��� �� � ������ � �� �<br />
�<br />
� � �<br />
�<br />
�����<br />
� � � � �� �<br />
�<br />
� �<br />
��� �� � � ����� � � �� �<br />
�<br />
� � �<br />
�<br />
�����<br />
� � � �<br />
festgehaltene Lied "Bateke", ein "Tanzlied für Wechselchor" aus dem Kongo auf der Seite 33 ab:<br />
Dazu schreibt er auf der gleichen Seite, dass es drei Urformen des Wechselgesanges gäbe, nämlich die Chor-<br />
wiederholung, die Refrainwiederholung und den Chorrefrain, die er folgendermassen charakterisiert:<br />
1. Chorwiederholung. Der Chor wiederholt die ganze Vorsängerstrophe.<br />
2. Refrainwiederholung. Der Chor wiederholt nur den Refrain der Vorsängerstrophe.<br />
3. Chorrefrain. Der Vorsänger singt die erste Halbstrophe, der Chor schliesst eine zweite Halbstrophe an. Die Melodiezeile<br />
ist in Strophe und Refrain deutlich geteilt."<br />
Auf der Seite 34 schreibt er weiter:<br />
Musiklehrmittel: Ein Blick in die Fachliteratur<br />
...Während die Hochkulturen Asiens die Mehrstimmigkeit als beherrschendes Stilmittel nicht aufweisen, haben Melanesier,<br />
Neger und negroide Zwergvölker in ihrer vokalen Musik reiche mehrstimmige Formen ausgebildet (Imitation, Kanon,<br />
ostinate Formen, Bordun, polyphone Zwei- und Dreistimmigkeit)...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 435
Auf den Seiten 34 und 35 bemerkt er, dass der "Parallelgesang (Organum)... vor allem Naturvölkern Ostafri-<br />
kas, im Kaukasus und in der Volksmusik Islands bekannt" sei. Damit erschöpft sich das vermittelte Wissen zu<br />
der Musik Schwarzafrikas.<br />
5.1.3 Geschichte der Musik (1983)<br />
In der "Geschichte der Musik" von Walter Kolneder, einem "Studien- und Prüfungshelfer" wie es im Untertitel<br />
heisst, wird Afrika auf den insgesamt 89 Seiten mit der Ausnahme von 13 Zeilen über Ägypten nicht einmal<br />
erwähnt. Zu der Musik Schwarzafrikas findet sich nicht eine einzige Textstelle. Auch andere Kulturräume<br />
werden in ähnlichem Umfang abgehandelt. Die "Geschichte der Musik" konzentriert sich also ganz auf das<br />
europäische Geschehen.<br />
5.1.4 Die Musik (1983)<br />
"Die Musik", eine Übersetzung des englischen Originals von 1979, enthält auf den insgesamt 264 Seiten keine<br />
Erwähnung der schwarzafrikanischen Musik. Im Abschnitt zu Altägypten bildet der Autor auf der Seite 17 ein<br />
Bild "Musiker des Schreibers Amenemheb, in der Zeit von Thutmosis III." ab, auf dem deutliche die dunkle<br />
Hautfarbe des mittleren Musikers, eines Schwarzafrikaners, zu sehen ist.<br />
Zwei weitere Abbildungen auf der gleichen Seite zeigen ebenfalls schwarzafrikanische Musiker.<br />
5.1.5 Das grosse Buch der Musik (1984)<br />
Das aus dem Englischen übersetze "Grosse Buch der Musik", enthält auf den insgesamt 384 Seiten keine<br />
Angaben zur Musik aus Schwarzafrika.<br />
5.1.6 Musik-Geschichte im Überblick (1985)<br />
Auch Jacques Handschins "Musik-Geschichte im Überblick", als Nachdruck der zweiten Auflage von 1964<br />
noch einmal aufgelegt, enthält keine Angaben zur Musik aus Schwarzafrika, befasst sich aber ebenfalls kurz<br />
mit der Musik des alten Ägypten.<br />
5.1.7 dtv-Atlas zur Musik (1987)<br />
Der in zwei Bänden 1987 in der 11. respektive 4. Auflage erschienene "Atlas zur Musik" enthält im ersten<br />
Band zwar einige Bemerkungen zur Musik Altägyptens, zu der schwarzafrikanischen Musik finden sich aber<br />
keine Textstellen.<br />
Musiklehrmittel: Ein Blick in die Fachliteratur<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 436
5.1.8 Musikinstrumente der Welt (1988)<br />
"Musikinstrumente der Welt" eine Übersetzung des 1976 erschienenen englischen Originals, zeigt, dass die<br />
fehlenden Angaben zur Musik Schwarzafrika in einigen der bisher besprochenen Werken keinesfalls auf nicht-<br />
vorhandenes Material zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf bewusstes Weglassen oder schlichtes Nicht-<br />
wissen der verantwortlichen Autoren. Da der Band umfangreiche bebilderte Angaben zur den Instrumenten der<br />
verschiedenen Musikkulturen der Welt macht, können hier nur einige wenige Stellen wiedergegeben werden.<br />
Auf den Seiten 264-265 schreibt der Autor unter dem Titel "Aerophone, Idiophone, Membranophone, Chordo-<br />
phone" zu Afrika:<br />
Musik durchdringt das ganze Leben der afrikanischen Stämme. Sie ist ein wichtiges Unterhaltungsmittel, aber auch ein<br />
integrieren der Bestandteil vieler Zeremonien und Riten, besonders der mit Geburt, Mannbarkeit, Ehe und Tod<br />
zusammenhängenden. Die Darbietungskunst wird von vielen afrikanischen Völkern sehr ernst genommen. Idiophone,<br />
vorwiegend Rasseln und Xylophone, sind sehr wichtig und neben Flöten, Trompeten und Hörnern verbreitete Instrumente<br />
für Musikgruppen. Trommeln jeder Art werden auf dem gesamten Kontinent gespielt und haben bei manchen Stämmen<br />
hohe rituelle Bedeutung. Chordophone, einschliesslich Bogen, Harfen, Lyren, Lauten, Fideln und Zithern, kommen in den<br />
meisten Gegenden vor und werden gewöhnlich sowohl als Solo- wie auch als Begleitinstrument verwendet.<br />
Stellvertretend für die weiteren Angaben, werden hier vier Zeichnungen afrikanischer Instrumente und die<br />
dazugehörenden Legenden wiedergegeben:<br />
Von links nach rechts sind zu sehen: "Harfenlaute, Westafrika" (S. 78), "Musikerin aus Mali mit einseitiger<br />
Fidel" (S. 202), "Kalungu, afrikanische 'sprechende' Trommeln, welche mit einem gekrümmten Schlegel<br />
geschlagen und dazu verwendet, den Tonfall der Sprachen nachzuahmen. Die Tonhöhe der Kalungu kann<br />
durch Veränderungen der Spannung der Verschnürung geändert werden." (S. 148) und "Hornbläser in Bronze<br />
aus der Benin-Kultur Westafrikas" (S. 264).<br />
5.1.9 Zusammenfassung zu den Musikbüchern<br />
Obwohl nur drei der acht untersuchten Fachbücher zur Musik, alle kurz vor oder während der achtziger Jahre<br />
erschienen, kann, auch unter der Berücksichtigung des 1979 erstmals erschienen Buches "Die Musik Afrikas"<br />
von J. H. Kwabena Nketia, davon ausgegangen werden, das bereits Anfang der achtziger Jahre genug Wissen<br />
über die schwarzafrikanische Musik verfügbar war, um dieses zumindest in die Schulbücher der Oberstufe<br />
einfliessen zu lassen.<br />
Musiklehrmittel: Ein Blick in die Fachliteratur<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 437
5.2 Schulbücher<br />
Mit Ausnahme des Lehrmittels "Musik auf der Oberstufe" und der Reihe "Musik um uns" werden die Lehrmit-<br />
tel ungefähr in der Reihenfolge des Jahres der Drucklegung besprochen. Dabei sollen sie unter den folgenden<br />
Fragestellungen betrachtet werden:<br />
1. Erscheinen überhaupt Musikbeispiele aus Schwarzafrika im betroffenen Lehrmittel und wie<br />
gross ist in etwa der Anteil der Beispiele und Texte am Gesamtumfang des Lehrmittels<br />
gemessen?<br />
2. Wie werden die Menschen Schwarzafrikas, wenn überhaupt, im Lehrmittel dargestellt?<br />
3. Sind die Texte zum Thema einigermassen aktuell oder wurden sie aus älteren Ausgaben des<br />
gleichen oder eines anderen Lehrmittels oder aus einer anderen Quelle übernommen?<br />
4. Welche Instrumente werden vorgestellt und wie wird die Musik der Schwarzafrikaner<br />
beschrieben?<br />
Die ersten drei Punkte werden in der Besprechung der einzelnen Musiklehrmittel angesprochen, dem letzten<br />
Punkt wird in "Vorgestellte Instrumente und Länder" auf der Seite 469 dieser Arbeit nachgegangen.<br />
5.2.1 Musik um uns<br />
Unter dem Titel "Musik um uns" sind im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Lehrmitteln erschienen, von<br />
denen einige für die Klassen 5 bis zur Sekundarstufe besprochen werden.<br />
5.2.1.1 Unser Liederbuch - Musik um uns (Nachruck 1986)<br />
Das 1982 erschienene "Buch zum Singen und Musizieren ab dem 5. Schuljahr" enthält auf den insgesamt 288<br />
Seiten als einziges Lied zum Thema "Kumbaya" (S. 178), welches als "Afrikanisches Abendgebet" bezeichnet<br />
wird. Die Quelle dieses Liedes ist jedoch ungewiss, da es in einigen Lehrmitteln aus Südafrika stammend, in<br />
anderen als aus den USA kommend, bezeichnet wird. Die Kapitel "Der Jazz" (S. 84-97) und "Der afro-<br />
amerikanische Tanz" (S. 148) beziehen sich auf die Musik der Schwarzen in den USA und nicht in Afrika und<br />
werden hier deshalb nicht besprochen.<br />
5.2.1.2 Musik um uns - Klassen 5 und 6 (1991)<br />
Das in der 3. Auflage 1991 erschienene, 288 Seiten umfassende "Musik um uns" für die 5. und 6. Klasse<br />
enthält keine Lieder oder Angaben zur Musik Afrikas.<br />
5.2.1.3 Musik um uns - 7.-10. Schuljahr (1975)<br />
Der für die Lehrkraft gedachte Band enthält das Kapitel "Der Jazz" auf den Seiten 59-62, zu dem der Autor auf<br />
der Seite 62 schreibt:<br />
Eine ausgezeichnete Information über den Sklavenhandel und das Fortleben der afrikanischen Traditionen in der Neuen<br />
Welt sowie ein reiches Quellenmaterial über Negergottesdienst und Negerpredigt... bietet das Buch von L. Zenetti, Peitsche<br />
und Psalm (...1963).<br />
Dieser wird dann folgerichtig zu den Ursprüngen dieser Musik auf der gleichen Seite zitiert:<br />
Musiklehrmittel: Musik um uns<br />
Die Kulturform, die die Sklaven aus ihrer westafrikanischen Heimat mitbrachten, unterscheidet sich insgesamt von der<br />
europäischen durch ihre stärkere Hinneigung zum Emotionalen, Ekstatischen... im Augenblick des völligen<br />
"Ausser-Sich-Seins" nimmt der angerufene Gott von den Priestern Besitz und äusserst sich in ihren Schreien und<br />
zuckenden Bewegungen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 438
Das Lehrmittel bezeichnet also zumindest die Menschen aus der westafrikanischen Kultur als mehr zum<br />
"Emotionalen", "Ekstatischen" hingeneigt. In ihrer Religionsausübung äussern sie sich in "Schreien und<br />
zuckenden Bewegungen". Ansonsten finden sich keine Stellen zu Afrika in diesem Band.<br />
5.2.1.4 Musik um uns - 7.-10. Schuljahr (1979)<br />
Der 260 Seiten umfassende Band für den Schüler, ein Nachdruck der Ausgabe von 1975, enthält keine Lieder<br />
aus Afrika. Im Kapitel "Der Jazz" bemerkt der Autor auf der Seite 85 unter dem Titel "Die Hintergründe: Skla-<br />
verei und afrikanisches Erbe", die "Entstehung des Jazz und seiner Vorformen " sei "eng mit der Negersklave-<br />
rei und ihren Folgeerscheinungen verbunden." Dazu schreibt er:<br />
Unauslöschlich sind die furchtbaren Erlebnisse der vielen Millionen, die seit dem 17. Jahrhundert aus Westafrika (vor<br />
allem dem Senegal, der Guineaküste, dem Niger- und Kongogebiet) in die Neue Welt verschleppt werden. Kaum ein<br />
Drittel der in ihren afrikanischen Dörfern Überfallenen soll den Marsch durch den Urwald und die monatelange Überfahrt<br />
überlebt haben.<br />
Nach Zenetti, der im Lehrerband (siehe weiter oben) zur Lektüre empfohlen wird, schreibt der Autor weiter<br />
(S. 85):<br />
"Man trieb die Gefangenen - oft genug mit Peitschen- und Stockhieben - auf die Sklavenschiffe. "Ihr Schluchzen und ihre<br />
leidvollen Lieder', so gestand der Kapitän eines solchen Schiffes, "haben meine Seele oft sehr in Unruhe versetzt. Ich erhob<br />
mich dann und versuchte sie wieder zu beruhigen. Aber oft waren meine Bemühungen vergeblich... und einige blieben bei<br />
der Vorstellung, man wolle sie schlachten'. "Nicht wenige" so berichtet ein Augenzeuge, "erdolchten, erhängten oder<br />
ertränkten sich". - "In der Enge der dicht beieinanderliegenden Schiffsdecks', so beschreibt es Ernst Bornemann in seinem<br />
Buch "American Negro Music", "hatten die Sklaven nicht mehr als 1.20 bis 1.50 Meter an Länge und 60 bis 90 Zentimeter<br />
an Höhe, so dass sie weder ausgestreckt liegen noch aufrecht sitzen konnten. Sie waren gefesselt - die rechte Hand an das<br />
linke Bein - jeweils in Reihen an lange Eisenstangen angeschlossen. In dieser Lage verbrachten sie die Monate ihrer<br />
qualvollen Reise. Sie kamen nur einmal täglich für weniger als eine Minute an Deck, um ihre Bedürfnisse zu verrichten.<br />
Die gedrängte Dichte von so vielen nackten menschlichen Lebewesen, ihr zerschlagenes, schwärendes Fleisch, die<br />
grassierende Ruhr und die ständige Ansammlung von Schmutz machten es für jeden Europäer unmöglich, sich länger als<br />
einige Minuten in den Sklavenräumen aufzuhalten, ohne ohnmächtig zu werden. Die Neger aber wurden ohnmächtig und<br />
erholten sich; oder sie wurden ohnmächtig und starben..."<br />
In Zenettis Zitat werden die Schwarzafrikaner, die als Sklaven in die neue Welt verschifft wurden, als hilf- und<br />
wehrlose Opfer des damaligen Dreieckshandels beschrieben, auf die aktive Rolle der schwarzafrikanischen<br />
Küstenvölker geht das Zitat nicht ein. (Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 407 und 440 dieser Arbeit.)<br />
Zur Musik der Schwarzafrikaner schreibt der Autor auf den Seiten 85-86:<br />
Die Musik, die die Neger aus ihrer Heimat kennen und nach Amerika mitbringen, ist durch einen ausserordentlich vitalen<br />
und vielschichtigen Rhythmus bestimmt und wird überwiegend auf Schlaginstrumenten ausgeführt... Sie dient vor allem<br />
der Anrufung der zahlreichen guten und bösen Götter und Dämonen, an der die ganze Dorfgemeinschaft durch Trommeln,<br />
Klatschen Stampfen, Singen und Tanzen teilnimmt.<br />
Hier wird vermittelt, die Musik Schwarzafrikas werde nur durch die Trommeln geprägt und sie diene "vor<br />
allem der Anrufung der guten und bösen Götter und Dämonen". Die soziale Funktion der Musik wird ebenso-<br />
wenig erwähnt, wie die Rolle der Griots in Westafrika.<br />
Nebst diesem Text enthält der Band ein Foto der Sängerin Fata Damba auf der Seite 18, auf dem die traditio-<br />
nelle Kopfbedeckung der Frauen Westafrikas zu sehen ist.<br />
5.2.1.5 Musik um uns 3 (1995)<br />
Musiklehrmittel: Musik um uns<br />
Der Band "Musik um uns 3" für Schüler enthält keine schwarzafrikanischen Lieder. Im Kapitel "Der Jazz"<br />
werden auf den Seiten 140 und 141 unter der Überschrift "Die Hintergründe: Sklaverei und afrikanisches Erbe"<br />
Zitate aus dem bereits in "Musik um uns - 7.-10. Schuljahr (1979)" abgedruckten Text nach Zenetti (siehe<br />
weiter oben) wiedergegeben. Im Gegensatz zum anderen Band wird die Quelle präzis mit "Lothar Zenetti:<br />
Peitsche und Psalm, München 1963, Seite 12" angeben. Die Seite 140 zeigt ausserdem noch eine Zeichnung<br />
von aneinandergeketteten Sklaven, die auf der Seite 407 dieser Arbeit wiedergegeben ist, und eine weitere<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 439
Zeichnung "Sklaven unter Deck auf dem Liverpooler Segler 'Brookes' (18. Jahrhundert)". (Siehe dazu unter<br />
dem Titel "Musikunterricht (1979)" die Seite 446 dieser Arbeit. Die Seite 141 zeigt auf einer weiteren Zeich-<br />
nung "To Be Sold", den untersten Abschnitt der "Sklavenverkaufsannonce", die hier aus dem Geschichtsbuch<br />
"Alte Völker, neue Staaten" wiedergegeben wird. (Pleticha 1989, S. 313):<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 439 und 446 dieser Arbeit.) Zudem gibt die Seite 141 einen<br />
weiteren, teilweise auch in "Musik um uns 7.-10. Schuljahr (1979)" abgedruckten Text wieder:<br />
Musik und Tanz spielen eine zentrale Rolle im Leben westafrikanischer Stämme. Dies zeigt sich bei allen privaten und<br />
öffentlichen Festen und vor allem den religiösen Beschwörungsszenen, an denen die ganze Dorfgemeinschaft mit<br />
Trommeln, Klatschen, Stampfen, Singen und Tanzen teilnimmt. Mit den Trommelrhythmen werden die Götter gerufen, die<br />
sich in der Ekstase, im völligen "Aussersichsein" der Priesterinnen oder Priester, offenbaren.<br />
Obwohl hier ausdrücklich erwähnt wird, dass die Musik nicht nur "Religiösen Beschwörungsszenen" dient,<br />
lehnt sich der Text doch noch stark an das mehr als 30 Jahre früher publizierte Werk Zenettis an. Im Anbe-<br />
tracht der anhand der Geographielehrmittel nachgewiesenen Veränderungen eine äusserst fragwürdige Praxis.<br />
Ausserdem bildet die Doppelseite 140-141 eine Karte ab, die als Herkunftsgebiete der Sklaven den Senegal,<br />
Gabun und Angola nennen.<br />
Eine weitere Erwähnung zur schwarzafrikanischen Gesellschaft findet sich auf der Seite 144 unter dem Titel<br />
"Der Worksong":<br />
...In der afrikanischen Heimat der Sklaven spielte die Gemeinschaft eine grosse Rolle. Viele Arbeiten, wie Jagen und<br />
Fischen, Pflanzen und Ernten, Wäschewaschen und Nähen, wurden in der Gruppe ausgeführt. Meist wurde dabei<br />
gesungen, getrommelt und getanzt...<br />
Es ist zwar richtig, dass die Gemeinschaft in Schwarzafrika eine wichtige Rolle spielt, doch bleibt äusserst<br />
fragwürdig, ob während der Jagd tatsächlich getrommelt, gesungen und getanzt wurde, sofern es sich dabei<br />
nicht um Treibjagden handelte. Ausserdem werden auch hier wieder nur Trommeln und keine weiteren Instru-<br />
mente erwähnt.<br />
5.2.1.6 Musik um uns 3 (1995)<br />
Musiklehrmittel: Musik um uns<br />
Im "Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer" finden sich auf den Seiten 42-44 einige Ergänzungen zu den im<br />
Schülerband abgedruckten Texten und Bildern. Auf der Seite 42 schreibt der Autor, die "Herkunftsgebiete der<br />
schwarzen Sklaven" hätten sich von Mauretanien/Senegal bis nach Gabun/Angola" erstreckt. Bildlich sind<br />
diese Herkunftsgebiete noch einmal auf einer auf der Seite 43 abgebildeten Karte wiedergegeben, die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 440
wesentlich detaillierter ausfällt, als diejenige im Buch der Schüler. Auf der Seite 44 schreibt der Autor unter<br />
dem Stichwort "Kult":<br />
Die Kultformen, die die Sklaven aus ihrer westafrikanischen Heimat mitbrachten, unterscheiden sich insgesamt von den<br />
europäischen durch ihre stärkere Neigung zum Emotionalen, Ekstatischen. Tanz und (Trommel-)Rhythmus sind für sie<br />
nicht Akzidentien, die zum Eigentlichen des Gottesdienstes - etwa der Predigt - noch hinzukämen. In ihnen selbst - im<br />
Rhythmus, im Tanz, in der Ekstase - findet der kultische Vorgang statt; im Augenblick des völligen "Ausser-Sich-Seins"<br />
nimmt der angerufene Gott von den Priestern Besitz und äussert sich in ihren Schreien und zuckenden Bewegungen.<br />
Nach diesen an Zenetti angelegten Worten folgt ein Zitat Zenettis selbst:<br />
"Die meisten Negerstämme haben einen obersten Gott, der sich jedoch in seiner Erhabenheit kaum um die Menschen<br />
kümmert. Ihr Schicksal wird von zahlreichen Göttern und Dämonen, von guten und bösen Geistern und von den Ahnen<br />
bestimmt Die Kulthandlung soll die Verbindung mit diesen Mächten herstellen ihre guten Einflüsse heranrufen und ihre<br />
schädlichen Eingriffe fernhalten, sie also vergegenwärtigen und beeinflussen. Solche Beschwörung der Götter und<br />
Dämonen vollzieht sich in der Ekstase die durch intensive Trommelrhythmen und stundenlanges Tanzen erzeugt wird. In<br />
dieser Erregung, im vollkommenen Aussersichsein, wird der Mensch von göttlichen Kräften ergriffen."<br />
Das bereits im Band "Musik um uns" von 1975 vermittelte und im Schülerband von 1995 wiederholte Bild des<br />
"ekstatischen" Schwarzafrikaner wird im "Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer" durch zweimaliges Erwäh-<br />
nen zementiert. Damit gräbt es sich nicht nur in den Köpfen der Schüler sondern auch in denen der Lehrkräfte<br />
ein.<br />
5.2.1.7 Musik um uns - 11.-13. Schuljahr (1981)<br />
Der in der seit 1973 10. Auflage erschienene Band enthält keine afrikanischen Lieder. Schwarzafrika wird<br />
nicht erwähnt.<br />
5.2.1.8 Musik um uns - 11.-13. Schuljahr (1985)<br />
Die zweite Auflage des erstmals 1983 neu gestalteten Bandes umfasst 419 Seiten und enthält ein Kapitel "Afri-<br />
kanische Musik" auf den Seiten 276-278. In der Einleitung schreibt der Autor auf der Seite 276:<br />
Der Begriff "afrikanische Musik" schliesst eine Vielzahl von Stammesstilen ein, die in ihrem Entwicklungsstadium weit<br />
voneinander abweichen und von sehr einfachen bis zu hochentwickelten Kulturstufen reichen. Trotz aller<br />
Verschiedenartigkeit aber lassen sich gemeinsame Stilmerkmale erkennen, die die afrikanische Musik deutlich von der<br />
europäischen und der orientalischen abheben...<br />
Als besonderes Merkmal der schwarzafrikanischen Musik nennt der Autor den Rhythmus, der durch die Poly-<br />
rhythmik, Polimetrik und die Kreuzrhythmik eine Komplexität erreiche, die "über die herkömmliche Rhyth-<br />
mik der europäischen Musik weit" hinausgehe. Die Seite 276 bildet ein Notenbeispiel zur Polymetrik ab. Ein<br />
weiteres Beispiel "Aus: 'Prince's Dance' (Goldküste)" ist auf der Seite 277 abgebildet. Unter der Überschrift<br />
"Instrumente" schreibt der Autor auf der gleichen Seite:<br />
Der rhythmisch betonten Anlage der afrikanischen Musik entspricht auch ihr Instrumentarium. Es bevorzugt Schlag- und<br />
Zupfinstrumente und besitzt kein originäres Streichinstrument...<br />
In der folgenden Auflistung werden ca. 25 Instrumente aus der Gruppe der Blas-, Saiten- und Schlaginstru-<br />
mente aufgezählt. Unter der Überschrift "Aufführungspraxis" schreibt der Autor (S. 277):<br />
Musiklehrmittel: Musik um uns<br />
Musik spielt im Dasein des Schwarzafrikaners eine grosse Rolle. Ob bei wichtigen Ereignissen im Leben des einzelnen<br />
oder der Gemeinschaft - bei Initationsfeiern, Hochzeiten und Totenkulten, bei offiziellen Zeremonien, bei Götter-, Zauberund<br />
Jagdbeschwörungen: Musik und Tanz sind immer dabei. Sie dienen nicht nur der Unterhaltung; in ihnen findet die<br />
eigentliche rituelle Handlung statt. Durch sie werden in der Ekstase die Götter und Dämonen gerufen und beschworen.<br />
Musik und (Masken-)Tanz sind bei einigen Stämmen so eng miteinander verbunden, dass für beide dasselbe Wort<br />
gebraucht wird.<br />
Die afrikanische Musik ist eine Gemeinschaftskunst, die die Aufteilung in Publikum und Darbietende nicht kennt. Alle<br />
nehmen am Musizieren teil, sei es durch Singen oder Tanzen, durch Trommeln oder Rasseln oder sei es auch nur durch<br />
Händeklatschen und Fussstampfen.<br />
Als Formen des Musizierens zählt der Autor das "Einstimmige Singen mit begleitenden Instrumenten", den<br />
"Wechselgesang" und "Instrumentalgruppen" auf. Die Seite 278 zeigt ein weiteres Notenbeispiel "Spirit Song<br />
of the Baoulé Bush", das nach der Quellenangabe wie die anderen Beispiele aus "Dauer: Jazz" stammt. Damit<br />
vermittelt der Band für die Klassen 11-13 von 1985 ein weit differenzierteres Bild, als der 1995 erschienene<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 441
Band "Musik um uns 3" für die Oberstufe. Es werden nicht nur verschiedene Instrumente genannt, die Musik<br />
nicht ausschliesslich religiösen Zwecken zugeschrieben, sondern auch ihre sozialen Funktionen bei Hochzeiten<br />
u.a. wird betont.<br />
Der Schwarzafrikaner selbst wird hier noch als Mensch beschrieben, der in der Ekstase seine Götter und<br />
Dämonen anruft, der aber vor allem die Musik in der Gesellschaft pflegt.<br />
5.2.1.9 Musik um uns - für den Kursunterricht in der Klasse 11 (1988)<br />
Das 184 Seiten umfassende Buch, enthält wie das Lehrmittel "Musik um uns - 11.-13. Schuljahr" von 1985 ein<br />
Kapitel "Afrikanische Musik" (S. 130-133), das dem älteren Beispiel ziemlich eng folgt, wenn auch die<br />
Gestaltung etwas anders ausgefallen ist. Auf der Seite 130 wird die schon zitierte (siehe unter "Musik um uns -<br />
11.-13. Schuljahr", 1985) Einleitung abgedruckt, gefolgt von den gleichen musiktheoretischen Überlegungen<br />
zum Rhythmus, inklusive des Notenbeispiels. Neu findet sich auf der Seite 131 ein Foto "Afrikanische Musi-<br />
ker" und eine Zeichnung eines Tänzers während der Text zur Melodik und den Instrumenten wieder aus dem<br />
älteren Lehrmittel übernommen wurde. Auf der Seite 132 werden kleine Zeichnungen der im Text genannten<br />
Instrumente Musikbögen und Hörner abgedruckt. Der Text "Aufführungspraxis" wurde wieder übernommen.<br />
Die Seite 133 druckt wieder das Notenbeispiel "Spirit Song of the Baoulé Bush" ab und zeigt Fotos von "Xylo-<br />
phon", "Sansa" (einer Art Mbira) und "Schlitztrommel".<br />
Der Lehrerband zum Schülerbuch, im gleichen Jahr herausgegeben, enthält keine weiteren nennenswerten<br />
Angaben.<br />
5.2.1.10 Musik um uns - für den Kursunterricht in den Klassen 12 und 13 (1988)<br />
Der Lehrerband enthält zwar Bemerkungen zum Kapitel "Aussereuropäische Musik" im Schülerband, dieser<br />
befasst sich jedoch nicht mit der schwarzafrikanischen Musik, die im Band für die Klasse 11 behandelt wurde.<br />
Aus diesem Grund finden sich im Lehrerband auch nur ein Verweis auf den Lehrerband "Musik um uns - für<br />
den Kursunterricht in der Klasse 11" von 1988.<br />
5.2.1.11 Musik um uns - Sekundarbereich II (1996)<br />
Das 374 Seiten umfassende Lehrmittel enthält wieder das Kapitel "Afrikanische Musik" (S. 228-231), das<br />
schon in den Lehrmitteln von 1985 und 1988 abgedruckt wurde. Auf der Seite 228 wird wieder der auf der<br />
Seite 441 in der Besprechung des Lehrmittels "Musik um uns - 11.-13. Schuljahr (1985)" zitierte Text der<br />
Einleitung abgedruckt und unter dem Titel "Die Musik im Leben der Schwarzafrikaner" der ebenfalls bereits<br />
bekannte Text aus der 11 Jahre älteren Ausgabe, der unter der Überschrift "Aufführungspraxis" stand. Wie<br />
schon in "Musik um uns - für den Kursunterricht in der Klasse 11 (1988)" wird ein Bild "Afrikanische Musi-<br />
ker" wiedergeben. Allerdings mussten die mit Hemd und Hose, sowie traditionellen Tüchern gekleideten<br />
Westafrikaner, halbnackten mit Halsketten geschmückten Trommelspieler, wahrscheinlich aus dem Gebiet des<br />
Sudans, weichen. Die restlichen Seiten 229-231 enthalten die aus dem erwähnten Lehrmittel von 1988 bereits<br />
bekannten Elemente, allerdings wurden sie wieder anders angeordnet. Zusätzlich wird ein kleiner Text zu<br />
"Spirit Song of the Baoulé Bush" auf der Seite 231 abgedruckt, in dem es heisst:<br />
Musiklehrmittel: Musik um uns<br />
Der "Spirit Song" der Ba(o)ulé - ein Stamm im Osten der Elfenbeinküste - zeigt die wichtigsten Merkmale der<br />
afrikanischen Musik und des afrikanischen Musizierens.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 442
Das Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer zum Schülerbuch enthält zusätzlich einige kurze Bemerkungen<br />
(S. 86) zu Hörbeispielen von der Elfenbeinküste, die mit "Trommelrhythmen (Stamm der Dan, Elfenbeinkü-<br />
ste)" "Trompetenorchester (Stamm der Dan, Elfenbeinküste)", "Xylophon-Orchester (Stamm der Senufo,<br />
Elfenbeinküste)" und "Kilango Tanga (Stamm der Kaka, Central African Republic)" bezeichnet werden, wobei<br />
der Inhalt des letzte Beispieles mit den Worten "Eine junge Frau beklagt ihr Schicksal, vom Vater zu einer<br />
Heirat gezwungen worden zu sein, die die Stammesregel untersagte." beschrieben wird. Im Lied wird also<br />
nicht wie vielleicht im ersten Augenblick angenommen, die Heirat in Frage gestellt, weil sie durch die Eltern<br />
arrangiert wurde, sondern weil sie in der angeklagten Form gegen die lokalen Gebräuche verstösst.<br />
5.2.1.12 Zusammenfassung<br />
Die Untersuchung der Lehrmittelreihe hat gezeigt, dass die schwarzafrikanische Musik erst ab Mitte der sieb-<br />
ziger Jahre im Zusammenhang mit dem in den Lehrmitteln weit ausgiebiger besprochenen Jazz erwähnt wird.<br />
Dieser Einteilung folgen auch die rund 20 Jahre später erschienenen Bände für die Sekundarstufe II noch nach.<br />
Eigentliche Musikbeispiele aus Schwarzafrika werden nur in der Sekundarstufe 2, d.h. ab der 11. Klasse abge-<br />
druckt, wobei sich die Musikbeispiele alle auf Westafrika konzentrieren.<br />
5.2.2 Schweizer Singbücher<br />
Die im folgenden besprochenen Bücher wurden und werden im Kanton Thurgau offiziell als Singbücher der<br />
Unter-, Mittel- und Oberstufe verwendet.<br />
5.2.2.1 Schweizer Singbuch Mittelstufe (1943)<br />
Die 294 Seiten umfassende "Liedersammlung für die Volksschule" erstmals 1938 erschienen, enthält zwar, wie<br />
zu erwarten, keine afrikanischen Lieder, erwähnt aber Schwarzafrikanern in einem Liedtext "Der Schmutz-<br />
fink" auf der Seite 224-225, dessen Wortlaut hier wiedergegeben werden soll:<br />
Schwarz sind seine Hände, schwarz ist sein Gesicht. Kommt er wohl aus Afrika? Nein, das kommt er nicht. Schwarz sind<br />
seine Hände, schwarz ist sein Gesicht. Muss doch wohl ein Neger sein! Nein, das ist er nicht. Schwarz und doch kein<br />
Neger, was kann das denn sein? Also Schornsteinfeger? Nein, ein Schmutzfinklein!<br />
Obwohl nicht explizit ausgesprochen wird doch klar, dass wenn vielleicht auch nicht die Person selbst, dann<br />
aber doch zumindest die Hautfarbe des "Negers" als schmutzig empfunden wird. Damit entspricht das Lied<br />
durchaus dem Zeitgeist, der sich in Zitaten von Zeitgenossen ebenso nachweisen lässt, wie in den untersuchten<br />
Lehrmitteln der damaligen Zeit.<br />
5.2.2.2 Schweizer Singbuch Unterstufe (1988)<br />
Das in der heutigen Form vorliegende 253 Seiten umfassende Lehrmittel wurde erstmals 1980 gedruckt. Es<br />
enthält keine der Schweiz fremdsprachigen Lieder und demzufolge auch keine schwarzafrikanischen.<br />
5.2.2.3 Schweizer Singbuch Mittelstufe (1980)<br />
Das 256 Seiten starke Lehrmittel enthält nur wenige Lieder aus dem aussereuropäischen Raum, darunter<br />
finden sich keine Lieder aus Afrika.<br />
Musiklehrmittel: Musik um uns<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 443
5.2.2.4 Schweizer Singbuch Oberstufe (1968)<br />
Im 1968 in der 2. Auflage erschienen Lehrmittel fehlen Lieder aus Afrika ebenso, wie die aus anderen ausse-<br />
reuropäischen Kontinenten.<br />
5.2.2.5 Musik auf der Oberstufe - Liedteil (1979)<br />
Das 1979 in der 4. Auflage erschienene, 164 Seiten umfassende Lehrmittel enthält das Lied "Kumbaya, Afri-<br />
kanisches Abendgebet" (S. 17). Im Vergleich dazu fehlen Lieder aus Asien völlig, während der Band 11<br />
Lieder aus Israel und 6 Gospel enthält.<br />
5.2.2.6 Musik auf der Oberstufe - Lehrerheft 2 (1987)<br />
Der 352 Seiten starke Band enthält eine Seite zur Sklavenfrage im Kapitel "Der Jazz". Dazu schreibt der Autor<br />
auf der Seite 223:<br />
...Vom 17. Jh. bis etwa 1850 wurden ca. 11 Mio. Neger aus Afrika nach Amerika gebracht, und weitere 5 Mio. sollen auf<br />
Transporten umgekommen sein....<br />
Dazu passend ist eine Karte abgebildet, die die "wichtigsten Sklavenmärkte", alle etwas abgerückt von der<br />
Küste gezeichnet, an der West- und Ostküste Afrikas wiedergibt. Weitere Angaben zu Schwarzafrika enthält<br />
der Band nicht.<br />
5.2.2.7 Musik auf der Oberstufe - Lehrerband 1 (1988)<br />
Der 264 Seiten umfassende Band gibt auf der Seite 28 einen kurzen Kommentar zum Lied "Kumbaya" wieder<br />
worin ausgesagt wird, dass die Herkunft des Liedes nicht klar sein, da die "vorliegende Fassung... in Südafrika<br />
gehört und notiert" wurde, es sich bei dem Lied aber auch um einen "Negro-Spiritual aus den USA" handeln<br />
könne.<br />
Auf der Seite 59 wird aus "Dauer: Jazz, die magische Musik" zitiert:<br />
"Durch Musik und Gesang ruft der Afrikaner Kraft herbei, die nach seiner Anschauung die eigentliche Arbeit leistet,<br />
während sein eigenes Arbeiten nur ein Zu-Tun ist."<br />
Damit wird es den Schwarzafrikaner möglich, "sich stundenlang in der Sonne abrackern" zu können, "ohne das<br />
leiseste Anzeichen von Erschöpfung zu zeigen". (Kabou 1995, S. 118) Auf der Seite 82 folgt ein Kommentar<br />
zu dem Lied "Abiyoyo" dessen Herkunft nicht näher gekennzeichnet ist, bei dem es sich aber um ein afrikani-<br />
sches Lied handeln könnte.<br />
Im Kapitel "Negro-Spirituals" schreibt der Autor auf der Seite 208:<br />
...Die europäische Unterbewertung der Musik afrikanischen Ursprungs wurde von niemandem besser widerlegt als von den<br />
Negern selbst...<br />
Gerade zu dieser Unterbewertung trägt das Lehrmittel aber bei, da es mit Ausnahme des in der Herkunft<br />
umstrittenen "Kumbaya" und des nicht eindeutig einzuordnenden "Abiyoyo" kein einziges schwarzafrikani-<br />
sches Musikbeispiel wiedergibt und dies obwohl es auch ein Schwergewicht auf Tanz und Rhythmus legt.<br />
5.2.2.8 Musik auf der Oberstufe - Lieder, Tänze, Musikstücke (1988)<br />
Der 312 Seiten umfassende Schülerband enthält zwei Beispiele afrikanischer Musik, "Kumbaya: Afrikanisches<br />
Abendgebet" und "Abiyoyo", wobei beide Lieder nicht eindeutig zugeordnet werden können. Im Vergleich<br />
dazu druckt das Lehrmittel drei Beispiele aus Asien, zwei der Indianer Nordamerikas, sieben Gospels und 18<br />
Lieder aus Israel ab!<br />
Musiklehrmittel: Schweizer Singbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 444
5.2.2.9 Schulmusik konkret (1991)<br />
Die beiden Bände aus dem Berner Zytglogge-Verlag enthalten keinen Informationen zum Thema.<br />
5.2.2.10 250 Kanons (1996)<br />
Das schweizerische Lehrmittel aus dem Verlag "Musik auf der Oberstufe" enthält die drei schwarzafrikani-<br />
schen Lieder "Sia bilu" (S. 7) - da die Quellenangaben unvollständig sind kann das Lied nicht mit Sicherheit<br />
zugeordnet werden -, "Kongo-Boat-Song" (S. 91) und "Banuwa: Volksweise aus Nigeria" (S. 163).<br />
5.2.2.11 Zusammenfassung<br />
Fiel die Ausbeute bezüglich schwarzafrikanischer Musik schon in der deutschen Lehrmittelreihe "Musik um<br />
uns" (siehe die Besprechung ab der Seite 438 dieser Arbeit) bescheiden aus, so bieten die untersuchten Lehr-<br />
mittel aus der Schweiz mit insgesamt fünf nicht einmal eindeutig zuzuordnenden Notenbeispielen und einigen<br />
wenigen Sätzen Kommentar noch weniger Informationen zum Thema. Über die Schwarzafrikaner selbst erfah-<br />
ren die Schüler nur, dass er die Kraft zur Arbeit durch "Musik und Gesang" herbeiruft.<br />
Trotz dieser Mängel ist im Lehrerband 1 von 1988 von der "Unterbewertung" der Musik der "Neger" die Rede.<br />
Bei den Autoren des Lehrmittels "Musik auf der Oberstufe" war das Bewusstsein 1988 also vorhanden, nur<br />
wurde es nicht umgesetzt.<br />
Musiklehrmittel: Schweizer Singbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 445
5.2.3 1000 chants (1975)<br />
Das französische Liederbüchlein aus dem Jahre 1975 enthält auf den insgesamt 284 Seiten die sechs afrikani-<br />
schen Lieder "Alelé, D'après un chant de pagayeurs. Sur l'Uélé, fleuve du Congo" (S. 22), "Appel Zoulou,<br />
Afrique du Sud (Natal)" (S. 29), "Au Grand Soleil, Côte d'Ivoire (Yakoubas)" (S. 35), "Ira Congo, Afrique"<br />
(S. 115), "Uélé" (S. 237) und "Viens avec nous" (S. 244) und damit mehr Liedbeispiele als alle bisher bespro-<br />
chenen Lehrmittel.<br />
5.2.4 Musikunterricht (1979)<br />
Der 240 Seiten umfassende Schülerband 1 für die Sekundarstufe I, enthält das Kapitel "Slave Songs" auf den<br />
Seiten 62-71. Auf der Seite 62 schreibt der Autor zu den Hintergründer der Beschaffung von Arbeitskräften für<br />
die damaligen Kolonien in Nordamerika:<br />
...Über 250 Jahre lang wurden deshalb mehrere Millionen Afrikaner regelrecht eingefangen und nach Amerika verschleppt.<br />
Sklavenjäger überfielen, manchmal auch mit Hilfe afrikanischer Häuptlinge, die friedlich schlafenden Einwohner, nahmen<br />
sie gefangen und zündeten ihre Hütten an. Gefesselt und den Kopf in eine Holzgabel gesteckt, deren Stiel mit dem<br />
Hintermann verbunden war, wurden sie in einer langen Menschenkette zur Küste getrieben. Oftmals war der Weg sehr<br />
weit, und viele starben vor Erschöpfung. Auf den damals noch kleinen Segelschiffen wurden sie eng zusammengepfercht.<br />
Manchmal befanden sich mehr als 300 Afrikaner auf einem Schiff...<br />
Die Seite 62 zeigt passend zum Text, eine Zeichnung eines solchen Sklavenschiffes und einen Ausschnitt<br />
(mittlerer Teil) aus der Zeichnung "Belegungsplan eines Sklavenschiffes" nach einem Stich aus dem 18. Jh.,<br />
der auch im Lehrmittel "Musik um uns 3" von 1995 wiedergegeben wird. Die Zeichnung wird hier vollständig<br />
aus dem Geschichtsbuch "Alte Völker, neue Staaten" wiedergegeben (Pleticha 1989, S. 309):<br />
(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seite 440 dieser Arbeit.) Auf der Seite 63 ist ein Text "In einem Bericht<br />
aus dem Jahre 1838" abgedruckt, indem es heisst:<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 446
"Übrigens kann dieses Individuum... tatsächlich sprechen, und ich nehme deshalb an, dass er kein Affe, kein Orang-Utan,<br />
Schimpanse oder Gorilla ist; jedoch gestehe ich, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein Mensch sich von einem<br />
Affen lediglich durch das Fehlen des Schwanzes und die Fähigkeit, Töne zu artikulieren, unterscheiden könnte, wie es bei<br />
diesem 'schwarzen Bruder' der Fall zu sein scheint. Solche erstaunlich langen und platten Füsse habe ich bisher ausser bei<br />
affenartigen Vierfüsslern noch nirgends gesehen. Aber wie ich bereits sagte, Isaak kann sprechen, und das beruhigt mich<br />
sehr."<br />
Diese hier zitierte Haltung hielt sich bis in die Anfangsjahre dieses Jahrhunderts, wie der auf der Seite 98<br />
dieser Arbeit erwähnte Fall des Pygmäen Otabenga, der in einem Zoo ausgestellt wurde, zeigt. Ebenfalls zu<br />
Beginn dieses Jahrhunderts plante der niederländische Biologe Herman Marie Bernelot Moen (1875-1938),<br />
wie Armin Geus in seinem Aufsatz "Anthropogenie und Menschenzucht" ausführte, Kreuzungsversuche<br />
zwischen Affen und Menschen, wobei er ein Affenweibchen mit dem Sperma eines "männlichen Negers"<br />
befruchten wollte. Seine Idee griff der deutsche Arzt Hermann Rohleder 1918 auf, der für seine Versuche nur<br />
das Sperma "sogenannter echter Neger oder Sudanier" in Betracht zog, da diese "der Heimat des Schimpansen<br />
am nächsten wohnen". Diese von Moen und Rohleder nie in die Tat umgesetzten Pläne führte der Russe Ilija<br />
Ivanovich Ivanov (1870-1932) auf einer Reise nach Westafrika tatsächlich aus, hatte aber keinen Erfolg, da die<br />
Affenweibchen auf der Rückreise verstarben. (Schmutz Hrsg., 1997, S. 223-234)<br />
Auf den Seiten 63-64 folgen weitere Schilderungen der Schicksale der versklavten Schwarzafrikaner, die hier<br />
nicht näher besprochen werden, da sie die Vorfahren der schwarzen Bevölkerung der heutigen USA betreffen.<br />
Die auf den Seiten 65-71 abgedruckten und kommentierten Lieder stammen alle aus den USA. Der ganze<br />
Band enthält kein einziges Lied aus Schwarzafrika selbst.<br />
Der 1980 erschienene Lehrerband bietet einige Hintergrundinformationen zu den Verhältnissen der Sklaverei<br />
und Arbeitsanweisungen für die Lehrkraft zum Umgang mit dem Thema auf den Seiten 64-68, bietet aber<br />
keine weiteren Informationen zu Schwarzafrika an sich.<br />
Damit wird der Schwarzafrikaner einmal mehr als passives Opfer der ihm von den Europäern zugefügten<br />
physischen und psychischen Erniedrigungen dargestellt.<br />
5.2.5 Musikstudio (1980-1982)<br />
Das zwei Bände umfassende Lehrmittel für die Klassen 9-12 beschäftigt sich vor allem im 2. Band mit<br />
schwarzafrikanischer Musik.<br />
5.2.5.1 Musikstudio 1 (1980)<br />
Das 175 Seiten dicke, österreichische "Arbeitsbuch für die Musikerziehung in der 9. und 10. Schulstufe" zeigt<br />
die Fotos "Trommeln der Frauen (Fodonon-Stamm, Elfenbeinküste)" (S.3), "Lyra aus Zentralafrika<br />
(menschlicher Schädel mit Antilopengehörn)" (S.35) und "Südafrikanischer Streichbogen" (S. 38). Musik-<br />
beispiele aus Schwarzafrika gibt der Band keine wieder.<br />
5.2.5.2 Musikstudio 2 (1982)<br />
Wesentlich ergiebiger ist das Kapitel "Die Musik Schwarzafrikas" auf den Seiten 18-22, des insgesamt 192<br />
Seiten umfassenden "Arbeitsbuches für die Musikerziehung in der 11. und 12. Schulstufe". Der Text enthält<br />
immer wieder kurze Beschreibungen zu den zum Buch erhältlichen Tonträgern, die Musik der Pygmäen,<br />
Bamileke (Kamerun), aus Nordwest-Nigeria, der Yoruba, aus Guinea, der Ewe (Ghana), der Buschmänner, der<br />
Banda und der Bamun (Kamerun) wiedergeben. Auf der Seite 18, die ein Notenbeispiel "Wechselgesang aus<br />
Ostafrika" abdruckt, schreibt der Autor einleitend:<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 447
Ein Blick auf eine Landkarte zeigt uns, dass Afrika in mehrere Kulturbereiche gegliedert ist. Im Norden herrscht arabischer<br />
Einfluss. In Nigeria, Sudan und Teilen Ostafrikas stehen modale Musik (Islam) und "echte" schwarzafrikanische Tradition<br />
oft nebeneinander. Im Süden und an den erschlossenen Küsten überwiegt europäischer Einfluss; Mischformen zwischen<br />
afrikanischer Musik und westlicher Popmusik sind häufig anzutreffen. In den christlichen Missionsgebieten wurde die<br />
afrikanische Perkussionsmusik früher als "unchristlich" angesehen, heute ist man stolz auf Messkompositionen, die<br />
afrikanische Rhythmen aufweisen ("Missa Luba"). Eine Sonderstellung nimmt die Ostspitze ein: In Äthiopien und Somalia<br />
haben Einflüsse jüdischer, koptisch-christlicher, arabischer und afrikanischer Musik einander überlagert. An der Ostküste<br />
und auf der Insel Madagaskar begegneten indonesisch-malaiische Einwanderer der afrikanischen Musik. Sie brachten<br />
wahrscheinlich schon um die Mitte des 1. Jahrtausends das Xylophon nach Afrika. Echte afrikanische Musiktraditionen<br />
sind in Zentral-, West-, Ost- und teilweise Südafrika zu finden. Doch haben alle Volksstämme eigene Musikstile und<br />
Stilvarianten entwickelt, wie z. B. das von der obrigen afrikanischen Vokalmusik völlig abweichende "Jodeln" der<br />
Pygmäen.<br />
Mit diesem Kommentar gibt der Autor einen Überblick über die schwarzafrikanische Musik, der weit über das<br />
hinausgeht, was in den bisher untersuchten Lehrmitteln und selbst den meisten der diskutierten Fachbücher an<br />
Information vermittelt wird. Der Autor zeichnet damit auch ein Bild eines Schwarzafrikaners, der Einflüsse<br />
von aussen in seine eigene Kultur integriert. Unter der Überschrift "Magische Anschauung von Musik" heisst<br />
es auf der Seite 19 zu der Musik der Pygmäen:<br />
Die Urwald-Pygmäen haben vielleicht die ältesten Grundanschauungen über Musik bewahrt. Sie nehmen für Wort und<br />
Musik den gleichen Ursprung an. Die ersten Worte wurden dem Urahnen der Menschheit in rhythmischer Form von einer<br />
im Namen des Weltschöpfers handelnden Mittelsperson enthüllt. Die Rhythmen der Musik stammen von rituellen<br />
Gebetsformeln der Ahnen ab. Der Allgegenwart des Wortes in der Musik entspricht symbolisch das Element des Wassers,<br />
dem Gesang entspricht das Öl. Mit Öl und Wasser werden Trommelfelle befeuchtet, um sie zu spannen - gleichzeitig lässt<br />
man dadurch das Wort des Weltschöpfers in sie eindringen. Die Mischung von Wasser und Öl hat Fruchtbarkeitssymbolik:<br />
Wasser bedeutet das weibliche, Öl das männliche Prinzip. Man giesst diese Mischung in Flöten und Tuben, man präpariert<br />
damit die Saiten von Zupfinstrumenten und das Innere von Glocken. Die Musik wirkt befruchtend, hat Einfluss auf<br />
Zeugung und Vegetation, ist eine ewige Erneuerung der Lebenskräfte...<br />
Diese Sichtweise des Ursprungs des Lebens, die der Autor mit den Alltagserfahrungen der Pygmäen begrün-<br />
det, und die auf einer Reduktion auf Wasser und Öle baut, ist auch in der Biologie nicht fremd, besteht doch<br />
die Zelle hauptsächlich aus Wasser, welches von einer Fett- oder Ölschicht von der Umgebung abgegrenzt<br />
wird. (Zu den Pygmäen siehe auch die Seiten 435 und 487 dieser Arbeit.)<br />
Weiter schreibt der Autor unter der Überschrift "Wichtige Unterschiede zur europäischen Musik" nach<br />
"Michel Huet" auf der Seite 19:<br />
Die afrikanische Musik ist in viel höherem Masse als die europäische durch ihre gesellschaftliche Funktion bestimmt. Sie<br />
strebt nicht nach Wohlklang und selten nach individuellem Ausdruck. Meist hat sie den Charakter einer spontanen,<br />
kollektiven Entladung ... und ist daher mit rhythmischen Körperbewegungen verbunden. Kunst und Leben, weltliche und<br />
religiöse Inspiration sind im Tanz (noch) nicht voneinander getrennt. Die Monotonie der Melodik und der Ostinato der<br />
Trommeln, die ständige Wiederholung von Drehbewegungen im Tanz zielen darauf hin, das Bewusstsein einzuschläfern<br />
und die individuelle Persönlichkeit zurückzudrängen. In den sogenannten Besessenheitstänzen verliert der Tänzer das<br />
Bewusstsein seines Ich und öffnet sich dem Geist, dessen Wesen er sich zu eigen macht und dessen besondere körperliche<br />
Eigenheiten er nachzuahmen sucht. "Obwohl die Besessenheit echt ist , hat sie über ihre klinischen Merkmale hinaus (die<br />
nach dem Urteil von Spezialisten epileptischen Anfällen ähnlich sind) doch Züge, die von Theatralik geprägt sind: die<br />
Aneignung eines Repertoires von Gesten, die einem bestimmten Geist entsprechen, und ihre 'Inszenierung' in einer<br />
bestimmten Situation.<br />
Während also Zenetti im Lehrmittel "Musik um uns" von Ekstase spricht, ist hier von Besessenheit die Rede,<br />
die aber zumindest teilweise gesteuert werden kann, gewissermassen ein "Inszenierung" darstellt, während in<br />
"Knaurs Weltgeschichte der Musik" diese als "unbewusstes... Ausdrucksmittel" angesehen wurde.<br />
Wenn der Autor die "Drehbewegungen" der Tänzer nennt, bezieht er sich wahrscheinlich auf Westafrika, denn<br />
die dortigen Tänze zeigen typische Drehungen auf, während in Ostafrika "Sprungtänze" die gewohnte Form<br />
darstellen. Zu der Verknüpfung zwischen Rhythmus, Tonhöhe und Sprache schreibt der Autor unter der Über-<br />
schrift "Tonsprache" (S. 19):<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Bei vielen Völkern ist die Sprachmelodie entscheidend für die Wortbedeutung... Melodie und Rhythmus der Lieder müssen<br />
in solchen Fallen genau der Sprache folgen Die unregelmässigen Akzente der afrikanischen Musik könnten ebenso aus den<br />
verschiedenen Tonhöhen der Tonsprachen hervorgegangen sein wie die additiven Rhythmen aus den Sprachrhythmen...<br />
Damit will der Autor ausdrücken, dass viele schwarzafrikanische Sprachen tonale Sprachen sind. Die dadurch<br />
mögliche Verbindung von Sprache und Musik kann bis in die afrikanische Popmusik hineinverfolgt werden<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 448
und dürfte die Entstehung der Popmusik in der heutigen Form wesentlich mitgeprägt haben. Weiter erklärt der<br />
Autor das Phänomen der Trommelsprachen (S. 19):<br />
Die afrikanischen Trommelsprachen finden sich ebenfalls überwiegend im Bereich von Sprachen, in denen die Tonhöhe<br />
der Vokale bedeutungsunterscheidend ist (z. B. häufig in Westafrika). Sie sind nicht mit dem Prinzip des Morsens zu<br />
vergleichen, da sie keinen Code verwenden, sondern... Wörter und Sätze nachahmen: durch Spannen des Fells mit dem<br />
Daumenballen... "artikuliert" der Trommler die Klänge.<br />
Bei den Yoruba (Nigeria) ziehen Trommler durchs Dorf und senden Grussformeln oder lobpreisen (gegen Trinkgeld) die<br />
Namen örtlich wichtiger Persönlichkeiten.<br />
Wichtig ist die Unterscheidung der eigentlichen Trommelsprache, die nur Eingeweihte tatsächlich richtig<br />
verstehen und dem "Sprechen der Trommeln", wenn ein bestimmter Rhythmus mit einer bestimmten Wortfol-<br />
ge assoziiert wird. (Siehe dazu auch die Seiten 434 und 468 dieser Arbeit.) Neben dem Text zeigt die Seite 19<br />
zwei Fotos die mit den folgenden Bildlegenden versehen sind:<br />
"Durch die zwei ungleich dicken Schlitzränder der Schlitztrommel lassen sich Töne verschiedener Höhe erzeugen. Damit<br />
können, meist in der Morgenstille, verschlüsselte Botschaften über grosse Entfernungen wiedergegeben werden."<br />
"Der Tanz der 'Vogelmänner' bei den Toma (Guinea) findet aus zwei besonderen Anlässen statt: beim Tod eines Zogui<br />
(eines Mannes, der in die Geheimnisse des Waldes eingeweiht war) und bei Initationsritualen. Das Kostüm und die weisse<br />
Körperfärbung der Männer bezieht sich auf den Vogel des Ursprungsmythos, der der Männergesellschaft die Macht<br />
brachte."<br />
Die Seite 20 erläutert an verschiedenen Beispielen die Grundelemente der afrikanischen Rhythmik. Weitere<br />
kurze Notenbeispiele finden sich auf der Seite 21, die auch ein Foto "Ewe-Orchester" und eines auf dem eine<br />
Mutter mit Kind zu sehen ist, abbildet. Im Text schreibt der Autor unter der Überschrift "Musik im Leben der<br />
Stammesgemeinschaft":<br />
Das gesellschaftliche Leben eines afrikanischen Dorfes findet gewöhnlich im Freien statt. Musikalische Aufführungen<br />
haben nicht den Charakter eines europäischen Konzerts. Die Zuhörer kommen und gehen, es wird von ihnen keine<br />
kontemplative Haltung erwartet. Sie geben ihrer Begeisterung oder Missbilligung lauthals Ausdruck, machen gelegentlich<br />
beim Chor mit oder reihen sich in den Kreis der Tänzer ein.<br />
Grosse Bedeutung für das Gemeinschaftsleben kommt der Vokalmusik zu, da sie Gruppenaktivität und Kommunikation<br />
ermöglicht. Die Kinder singen vor allem Abzähl-, Tanz- oder Bewegungsspiele, aber auch Lieder zu bestimmten Anlässen<br />
(z. B. hat bei den Fon in Dahomey ein Kind den Verlust seiner ersten Zähne mit einem speziellen Lied zu feiern.<br />
Der Autor erwähnt im Gegensatz zu einigen anderen Lehrmitteln hier also die soziale Funktion der Musik<br />
ausdrücklich. Dadurch wird auch klar, dass Musik in Schwarzafrika nicht nur religiöse Musik ist, deren Bedeu-<br />
tung durch die Modernisierung der traditionellen Lebensformen immer weiter zurückgeht.<br />
Die Frauen übernehmen z. B. die Totenklage oder singen bei der Verrichtung häuslicher Arbeiten, wie dem Mahlen und<br />
Stampfen von Getreide oder dem Herrichten des Fussbodens in einer neugebauten Hütte. Die Liedtexte wurzeln oft im<br />
persönlichen Erleben. Bei den Akan in Ghana verbreitete sich ein Wiegenlied, das davon erzählt, wie zwei Frauen eines<br />
bestimmten Mannes gleichzeitig Babies erwarteten. Seiner Favoritin liess der Mann "Fleisch und Salz", Symbole des<br />
Überflusses, zukommen, während die Nebenfrau von Kokojamsblättern leben musste. Trotzdem brachte sie ein grosses,<br />
kräftiges Kind zur Welt, dem sie triumphierend folgendes Wiegenlied sang: "Du Kind von Kokojamsblättern rund und<br />
kräftig. Das Kind von Fleisch und Salz ist schwach und mager."<br />
Die Akan Ghanas, eine ganze Gruppe von Völkern, leben im Regenwald und der Feuchtsavannenzone. Da in<br />
diesen Gebieten keine Rinderhaltung möglich ist, gehört Fleisch zu den "Luxusgütern". Auch Salz ist Mangel-<br />
ware, denn es muss entweder aus den Lagunen an der Küste oder den noch viel weiter entfernten Salzminen<br />
aus dem nördlichen Landesinnern herbeigeführt werden. Zwar gibt es unterdessen natürlich auch Salz in der<br />
aus Europa gewohnten Form zu kaufen, doch ist dies auch nicht preiswerter als das auf dem Markt angebotene<br />
Salz. Trotzdem hat das Salz seit dem 16. Jh., als es in "Gold aufgewogen" wurde, viel von seinem damaligen<br />
Wert verloren.<br />
Auf der Seite 22 fährt der Autor mit seinen Betrachtungen über die Bedeutung der Musik für den traditionell<br />
lebenden Schwarzafrikaner fort:<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Die Frauen wachen auch über die meist sorgfältig ausgearbeiteten Rituale zur Geschlechtsreife der Mädchen. Diese werden<br />
gewöhnlich einer Mastkur unterzogen, damit sie am Tag der Graduierung rundlich und schön aussehen...<br />
Diese Rituale variieren von Volksgruppe zu Volksgruppe und haben ganz unterschiedliche Ausprägungen.<br />
Viele der Rituale sind aber durch die Einflüsse von aussen im Verschwinden begriffen. Die Seite 22 zeigt auch<br />
drei Fotos "Kriegstanz der Bamun", "Trommeln und Xylophon begleiten gegen Ende der Trockenperiode<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 449
Riten zur Reinigung der Erdmächte..." und "Bei den Sara (Tschad) endet die weibliche Initiation mit<br />
Tänzen...". Abschliessend schreibt der Autor auf der Seite 22:<br />
Es gibt in Afrika Lieder aller Art: nachdenkliche, gefühlvolle, satirische, komische, ja sogar Schimpflieder, mit denen sich<br />
z. B. die Akan einmal im Jahr Luft machen... Für die Teilnahme an all den aufgeführten musikalischen Veranstaltungen<br />
sind die musikalische Fähigkeit des einzelnen unerheblich. Wichtig ist es, dass er sich seiner sozialen Rolle gemäss verhält<br />
und sich an der Musik beteiligt, wie es der Brauch gebietet.<br />
Hier betont der Autor also noch einmal die soziale Komponente der zahlreichen Funktionen, die die schwarz-<br />
afrikanische Musik innehat.<br />
5.2.5.3 Zusammenfassung<br />
Der Autor zeichnet ein im Vergleich zu anderen bisher untersuchten Musiklehrmittel ein differenziertes und<br />
reichhaltiges Bild der Musik in Schwarzafrika. Dabei vergisst er auch nicht, Besonderheiten der Sprachen und<br />
Bräuche gewisser Völker zu erwähnen.<br />
Den schwarzafrikanischen Menschen schildert der Autor als soziales Wesen, das mit seinen Mitmenschen<br />
nicht zuletzt mit Hilfe der Musik interagiert, nicht immer ohne Spannungen aber doch in der Gemeinschaft,<br />
und der es versteht, fremde Einflüsse in den Kontext der eigenen Tradition einzubauen.<br />
5.2.6 Lied international (1982)<br />
Das bayerische Lehrmittel gibt auf den insgesamt 276 Seiten die vier Lieder "Lied der Feldarbeiterinnen" aus<br />
Rhodesien (S. 111), "Lied beim Stampfen oder Rammen" aus Tunesien (S. 111), "Lied beim Wechseln der<br />
Segel" (S. 112) und "Ruderlied", beide aus Ägypten, wieder.<br />
5.2.7 Erlebnis Musik (1985)<br />
Die 156 Seiten dicke "Musikkunde 3 für Hauptschulen und allgemeinbildende höheren Schulen" in Österreich,<br />
enthält zwar kein Musikbeispiel aus Schwarzafrika dafür aber "Ein Lied aus unserer Zeit" auf der Seite 119<br />
mit einem Text von Winfried Hofer, der lautet:<br />
Auf der Erde, welche Schande, / leben Kinder noch am Rande, / die für unsern Reichtum schwitzen, / während wir im<br />
Trocknen sitzen: / Umba umba-assa umba eh-a-umba-o.<br />
Und die Kinder schwarzer Rasse, / diese Kinder zweiter Klasse, / wollen, dass wir nicht nur reden, / denn die Luft reicht<br />
doch für jeden. / Umba...<br />
Und die Kinder mit den Bäuchen - / von dem Hunger, von den Seuchen - / wollen, dass wir uns beeilen, denn das Brot lässt<br />
sich doch teilen! / Umba...<br />
Und die Kinder ohne Wissen, / die noch schreiben lernen müssen, / wollen auch einmal nach oben, / denn der Fortschritt<br />
lässt sich proben. / Umba...<br />
Und die Kinder, deren Väter / eingesperrt als "Hochverräter", / wollen aus der Mausefalle, / denn die Sonne scheint für alle.<br />
/ Umba...<br />
Das eine ganze Seite füllende Lied wird durch ein Foto eines kleinen schwarzen Jungen mit Hungerbauch<br />
"passend" illustriert. (Zu den Hungerkrisen Afrikas siehe auch die Seiten 417 und 454 dieser Arbeit.)<br />
Mit diesem Lied passt das Lehrmittel gut in die Reihe der um etwa die gleiche Zeit erschienen Geographie-<br />
lehrmittel, die Afrika als Hungerkontinent schildern und in den dort lebenden Menschen, den Unbillen der<br />
Natur und der Entwicklung der eigenen Bevölkerung hilflos entgegenblickende Wesen sehen, deren einzige<br />
Rettung in der Hilfe durch die Bewohner der Industrienationen besteht.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 450
5.2.8 Musik-Kontakte (1983-1987)<br />
Der 181 Seiten umfassende Band für das 5. und 6. Schuljahr enthält keine Lieder aus Schwarzafrika, zeigt aber<br />
unter dem Titel "Musikalische Besetzung aus aller Welt" auf der Doppelseite 129-130 ein Foto aus Marokko<br />
und eines aus Zaire, auf dem mit nur einem Lendenschurz bekleidete Trompeter zu sehen sind.<br />
Der zweite, 242 Seiten dicke Band für die Klassen 7- 10 enthält die beiden Kapitel "Thema Jazz: Die Ursprün-<br />
ge" (S. 40-41) und "Wir singen und begleiten ein Spiritual" (S. 42-43), die auch einige Aussagen zu Schwarz-<br />
afrika enthalten. Auf der Seite 40 schreibt der Autor über den Sklavenhandel:<br />
Schon seit dem 17. Jahrhundert wurden Einheimische in den Dörfern Westafrikas überfallen und von weissen<br />
Eindringlingen zur Küste getrieben, von wo sie, in Schiffe gepfercht nach Nordamerika verschleppt wurden...<br />
Der Sklavenhandel der Portugiesen an der Westküste Afrikas reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Zur Musik-<br />
auffassung der Schwarzafrikaner heisst es auf der gleichen Seite:<br />
Nach afrikanischen Vorstellungen wird durch Musik Kraft erzeugt, die Arbeit erscheint leichter, im Innern des Menschen<br />
liegende Rhythmen werden wachgerufen.<br />
Die Rhythmen der Musik richteten sich nach dem Rhythmus der Arbeit. Sie wirkten durch Gleichförmigkeit und<br />
Steigerung oft hypnotisierend.<br />
Ähnlich äussert sich auch der 1988 erschienene "Lehrerband 1" von "Musik auf der Oberstufe". (Siehe dazu<br />
die Seite 444 dieser Arbeit.) Zur Herkunft des Spirituals schreibt der Autor auf der Seite 42 über die versklav-<br />
ten Schwarzen in der neuen Welt:<br />
In ihrer afrikanischen Heimat spielte die Götterverehrung eine zentrale Rolle im Leben der Schwarzen. Eine der religiösen<br />
Überzeugungen war, dass der Gott des Siegers anerkannt werden müsse, da er stärker als der eigene war (die Sklaven<br />
betrachteten sich als Besiegte, als Gefangene)...<br />
Aufgrund der damaligen Verhältnisse im damaligen Westafrika betrachteten sich die Sklaven wohl tatsächlich,<br />
zumindest zu einem Teil, als Gefangene, denn diese wurden oft als Sklaven von den Siegern verschleppt. Doch<br />
braucht dazu kaum eine "höhere Macht" herbeigezogen zu werden, d.h. der Glaube der Schwarzafrikaner dürf-<br />
te bei der ganzen Frage der Sklaverei nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben.<br />
5.2.9 Musicassette (1990-1992)<br />
Der 134 Seiten umfassende Band für die "7. Jahrgangsstufe" an bayerischen Schulen enthält keine Angaben<br />
zum Thema.<br />
Der 150 Seiten umfassende Band für die 8. Jahrgangsstufe geht zwar nicht speziell auf Schwarzafrika ein,<br />
erwähnt diesen Teil des Kontinentes und seine Bewohner jedoch an verschiedenen Stellen. Eine Weltkarte auf<br />
der Doppelseite 20-21 zeigt einen Schwarzafrikaner im Süden des Kontinentes, der eine fünfeckige Maske,<br />
einen Lendenschurz und einen Speer trägt. Dazu wird auf ein Hörbeispiel "Ein Afrikaner erzählt seine Lebens-<br />
geschichte" verwiesen, auf das, wie auch auf andere Ton- und Bildträger, im Rahmen dieser Arbeit nicht näher<br />
eingegangen werden soll.<br />
Die Seite 73 zeigt einen Musikbogen mit dem folgenden Begleittext:<br />
Der Musikbogen hat sich bis in unsere Zeit bei einigen Negerstämmen in Afrika erhalten. Er gilt als das Hauptinstrument<br />
der Buschmänner, die damit Tiere in ihren verschiedenen Gangarten und ganze Jagdszenen nachahmen.<br />
Auf der gleichen Seite ist eine Art Harfe aus einem Totenschädel dargestellt, die aber nicht eindeutig Schwarz-<br />
afrika zugeordnet werden kann. Dazu schreibt der Autor (S. 73):<br />
Oft wird der Klang einer schwingenden Saite (oder auch mehrerer) durch einen Hohlraum (Kürbisschale,<br />
Schildkrötenpanzer, Totenschädel) verstärkt.<br />
Sobald der eigene Körper als Instrument dient, glaubt man die Kraft des Dämons sogar in sich selbst zu spüren. Bis zur<br />
Ekstase steigert sich dann das Stampfen der Füsse, das Klatschen der Hände, das Singen und Schreien.<br />
Obwohl auch dieser Abschnitt sich nicht explizit auf Schwarzafrika bezieht, der Schwarzafrikaner dürfte<br />
jedoch mitgemeint sein, vermittelt der Text doch den Eindruck eines unbeherrschten von Dämonen getriebe-<br />
nen Naturmenschen.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 451
Auf der Seite 74 gibt der Autor eine Zeichnung "Livingstones Aufnahme beim Stammeshäuptling Schinte"<br />
wieder, auf der eine grosse Menge von Schwarzafrikanern abgebildet ist. Sowohl Männer als auch Frauen<br />
tragen nur eine Art Lendenschurz, einige Männer sind mit Speeren, Schilden oder Pfeilen bewaffnet. Fünf<br />
Musiker spielen auf zwei Trommeln und drei xylophonartigen Instrumenten. Dazu gibt der Autor einen<br />
Ausschnitt aus David Livingstones "Zum Sambesi und quer durchs südliche Afrika" von 1849-1856 wieder:<br />
"... dann kamen die Soldaten, bis zu den Zähnen bewaffnet, schreiend mit gezogenen Schwertern auf uns zugelaufen und<br />
verzerrten die Gesichter, um so wild als möglich zu erscheinen, wahrscheinlich dachten sie, wir würden aus Furcht<br />
davonlaufen... Der Trommler und die Trompeter machten einen Lärm, soviel die Instrumente nur hergaben... Die<br />
Trommeln sind aus dem Stamme eines Baumes geschnitzt und haben an der Seite ein kleines Loch, das mit Spinnweben<br />
bedeckt ist; oben und unten sind sie mit Antilopenhaut überzogen, und wenn diese straff angezogen werden soll, so halten<br />
sie dieselbe ans Feuer, das sie zusammenzieht."<br />
Wie der Vergleich mit dem Originaltext zeigt, handelt es sich bei dieser Wiedergabe des Berichtes von<br />
Livingstone nicht nur um eine starke Vereinfachung seiner Eintragung vom 17. Januar 1854, sondern sie<br />
vermittelt auch ein ganz anderes Bild von der Begegnung als der Originalbericht, der von einem Empfang mit<br />
militärischen Ehren spricht. Die Beschreibung der Trommeln hingegen wurde genau von Livingstone über-<br />
nommen, der allerdings auch die in der auf der gleichen Seite abgebildeten Zeichnung dargestellten Marimbas<br />
beschreibt. (Livingstone 1857, Kap. 16)<br />
Weiter schreibt der Autor, dass einfache Schlaginstrumente "vor allem Trommeln... seit Urzeiten zum Alltag<br />
der afrikanischen Eingeborenen" gehörten. Sie würden zum "Säen, Ernten, Jagen aber auch zu ihren Festen<br />
und zu ihrem Totenkult" verwendet. Auf der Seiten 74 und 75 verweist der Autor auf zwei Hörbeispiele zur<br />
Musik der Hausa und der Königstrommeln von Ruanda. Die Seite 80 zeigt die stereotype Zeichnung eines<br />
Schwarzafrikaners, der mit "Wollhaar", Ohrring und grossen Lippen die Bongas spielt. Die Seite 82 enthält<br />
unter der Überschrift "Sprachrhythmus" die folgenden Anweisungen an die Schüler:<br />
Versetze dich in die Rolle von Urwaldbewohnern, die mit Trommelrhythmus die folgenden Nachrichten "telegraphieren":<br />
"Achtung, Feind! Flussaufwärts kommt ein Schiff!"<br />
"Holt den Arzt aus der Missionsstation!"<br />
"Grosser Häuptling tot! Verbrennung am Wochenende."...<br />
Obwohl auch diese Aufgabe nicht eindeutig im Kontext zu Schwarzafrika gestellt wird, lässt sich die Verbin-<br />
dung doch ohne weiteres herstellen. Die Schüler werden auf Kosten von anderen Völkern zu einem kurzen<br />
Rhythmusspiel motiviert. Die vorgeschlagenen "Nachrichtenbeispiele" sind nicht nur als rassistisch zu betrach-<br />
ten, sie verunmöglichen dem Schüler auch ein Verständnis der Kommunikationssystem gewisser Völker<br />
Schwarzafrikas, die mit Trommeln Nachrichten übermittelten.<br />
Im Band für die "9. Jahrgangsstufe", mit total 123 Seiten, findet sich auf der Seite 8, unter dem Titel "Tanz für<br />
die Götter" ein Foto "Afrikanischer Kulttanz (Mali)", auf dem Tänzer mit Masken zu sehen sind. Auf der glei-<br />
chen Seite wird auf ein Musikbeispiel eines afrikanischen Tanzes aus Liberia, "mit dem die Aufnahme eines<br />
Knaben in den Kreis der Erwachsenen gefeiert wird", verwiesen. Auf der Seite 37 schreibt der Autor im<br />
Kommentar zum Song "Rock around the Clock":<br />
Der Farbige erlebt die rhythmische Musik unmittelbar, mit seinem ganzen Körper. Im freien Tanz durchmisst er dabei<br />
meist nicht den Raum, sondern bewegt sich auf der Stelle, mit dem Partner nur durch das gemeinsame Rhythmuserlebnis<br />
verbunden.<br />
Der 141seitige Band für die 10. Klasse enthält im Kapitel Thema Jazz (S. 100-106) eine Seite zum Sklaven-<br />
handel. Unter der Überschrift "Sklavenhandel" und der Bemerkung, das "schon im 16. Jahrhundert... die ersten<br />
Westafrikaner von englischen Sklavenhändlern gefangen" worden waren, zitiert der Autor auf der Seite 100<br />
das Zitat aus "L. Zenettis Peitsche und Psalm, Verlag J. Pfeiffer, München 1963, S. 12", welches teilweise<br />
auch schon im Lehrmittel "Musik um uns - 7.-10. Schuljahr" von 1979 wiedergegeben wurde. (Siehe dazu<br />
auch die Seite 439 dieser Arbeit):<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 452
"Man trieb die Gefangenen dann - oft genug mit Peitschen- und Stockhieben - auf die Sklavenschiffe. 'Ihr Schluchzen und<br />
ihre leidvollen Lieder', so gestand Degrandpré, der Kapitän eines solchen Schiffes, 'haben meine Seele oft sehr in Unruhe<br />
versetzt. Ich erhob mich dann und versuchte sie wieder zu beruhigen. Aber oft waren meine Bemühungen vergeblich...,<br />
und einige blieben bei der Vorstellung, man wolle sie schlachten.' - 'Nicht wenige', so berichtet ein Augenzeuge,<br />
'erdolchten, erhängten oder ertränkten sich.'"<br />
Der ehemalige Sklave Equiano beschreibt in seinem Buch "Olaudah Equiano: The Interesting Narrative of the<br />
Life" von 1789 die Schrecken der Überfahrt mit den folgenden Worten: "The stench of the hold while we were<br />
on the coast was so in tolerably loathsome, that it was dangerous to remain there for any time, and some of us<br />
had been permitted to stay on the deck for the fresh air; but now that the whole ship's cargo were confined<br />
together, it became absolutely pestilential. The closeness of the place, and the heat of the climate, added to the<br />
number in the ship, which was so crowded that each had scarcely room to turn himself, almost suffocated us.<br />
This produced copious perspiration, so that the air soon became unfit for respiration, from a variety of loathso-<br />
me smells, and brought on a sickness among the slaves, of which many died, thus falling victims to the impro-<br />
vident avarice, as I may call it, of their purchasers. This wretched situation was again aggravated by the<br />
galling of the chains, now become insupportable; and the filth of the necessary tubs, into which the children<br />
often fell, and were almost suffocated. The shrieks of the women, and the groans of the dying, rendered the<br />
whole a scene of horror almost inconceivable." (Equiano, 1789)<br />
Der Autor des Lehrmittels "Musicassette" schreibt weiter, die Grössenordnung des Sklavenhandels angebend:<br />
Über 35 Millionen Westafrikaner wurden bis zur Mitte des 19. Jahrhundert auf diese Weise verschleppt und erduldeten ein<br />
Leben ohne Freiheit und Menschenwürde...<br />
Je nach Quellen werden teilweise sehr unterschiedliche Zahlen genannt. Neben diesen Textstellen gibt die<br />
Seite 100 auch eine Zeichnung "Sklavenkarawane im Kongogebiet auf dem Marsch zur Küste (Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts" wieder, die auf der Seite 407 dieser Arbeit in der Besprechung des Geographielehrmittels "Seyd-<br />
litz Geographie" von 1994-1996 abgebildet ist. Die ebenfalls im Geschichtsbuch "Alte Völker, Neue Staaten"<br />
abgebildete Zeichnung trägt dort die Legende: "Sklavenjagd: Planmässig durchgeführter Menschenraub. Skla-<br />
venkarawane in Afrika. Mangbetu-Neger im Gebiet des Sudan... Holzstich, 1892". Dazu bemerkt Pleticha:<br />
"Während die Sklavenhändler anfangs selbst Fangexpeditionen unternahmen, wurde der Sklavenfang später<br />
von kooperationsbereiten Teilen der afrikanischen Oberschicht übernommen." (Pleticha 1989, S. 310-311).<br />
Die Seite 101 zeigt die beiden unteren Teile der auf der Seite 440 dieser Arbeit unter der Besprechung des<br />
Musiklehrmittels "Musik um uns 3 (1995)" abgebildeten Inserates. Auf der gleichen Seite findet sich ein Karte<br />
"Wege und Stationen des Jazz", die auch das "Stammesgebiet der Ba-Benzéle-Pygmäen" zeigt, von denen ein<br />
Musikbeispiel eines Mannes, der "in einem Klagelied den Tod seiner Frau Nbu" beklagt auf der Seite 102<br />
unter dem Titel "Das afrikanische Erbe" nach der Schallplattenaufnahme notiert, auf die im Text verwiesen<br />
wird, wiedergegeben ist. Diese Lied wird mit einer Aufnahme des amerikanischen Songs "My little Annie, so<br />
sweet" auf der folgenden Seite verglichen.<br />
Die Seite 106 zeigt ein Foto "Ba-Benzéle-Pygmäen" auf denen einige Musiker und Zuschauer zu sehen sind.<br />
Dazu schreibt der Autor, auf ein weiteres Musikbeispiel verweisend:<br />
Der Eingeborene Mangolo erzählt die Fabel "Mbombokwe", die von einem Specht handelt, der genüsslich fette Raupen<br />
verzehrt, was man im Lied deutlich hören kann. Mangolo wird begleitet von Händeklatschen, Schlaginstrumenten und<br />
Rasseln, die ein kompliziertes rhythmisches Geflecht konstruieren...<br />
Die weiteren Seiten des Lehrmittels enthalten keine Hinweise auf Schwarzafrika mehr.<br />
Einerseits zeichnet der Autor das Bild des versklavten Schwarzafrikaners der seinem Schicksal nur durch den<br />
(Frei-)Tod entgehen kann, andererseits wird mittels eines Vergleichs der Einfluss der Musik der Pygmäen auf<br />
den Jazz aufzuzeigen versucht. In beiden Abschnitten erfahren die Schüler nur wenig über die Lebensweise<br />
und Kultur der Schwarzafrikaner.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 453
5.2.10 Singen Musik (1992)<br />
Das vierbändige, insgesamt 422 Seiten umfassende Lehrmittel enthält in den Bänden "Lieder, Kanons" und<br />
"Lieder, Chansons" mit insgesamt 119 Lieder kein Liedbeispiel aus Afrika. Der Band 3 "Rock und Pop" mit<br />
insgesamt 34 Songs enthält eine Seite mit Zeichnungen zur Sklaventhematik auf der Seite 8 und auf den Seiten<br />
135-136 etwa acht Zeilen Hintergrundinformation zur "USA for AFRICA"-Hungerhilfe vom Sommer 1985 im<br />
Zusammenhang mit dem damaligen Chartstürmer "We are the World". (Zu den Hungerkrisen Afrikas siehe<br />
auch die Seiten 450 dieser Arbeit.) Damit wird für die Mitte der achtziger Jahre typisch, und durch eine weite-<br />
re Dürre im Sahel ausgelöst, Afrika als Hungerkontinent beschrieben.<br />
Der Band 4 "Experimente", mit 30 vorgeschlagenen Arrangements, enthält auf den Seiten 33-35 das Lied "Tu!<br />
Tu! Gbovi" aus Ghana von W. K. Amoaku.<br />
5.2.11 Spielpläne Musik (1992-1994)<br />
Das Lehrmittel enthält im Band für die 7. und 8. Klasse ein Kapitel "Musik in Afrika" auf den Seiten 138-141.<br />
Die Untersuchung wurde anhand des vom Informationsgehaltes deckungsgleichen Lehrerband durchgeführt.<br />
Der Lehrerband bietet dazu reichliche Hintergrundinformationen auf den Seiten 240-243. Unter dem Titel<br />
"Musik der Hamar 1: Flöte und Leier" schreibt der Autor auf der Seite 240, die auch eine Foto einer Siedlung<br />
der Hamar und eine Karte zu ihrem Lebensraum zeigt:<br />
Die Völkerkundler Ivo Strecker und Jean R. Lydall erforschen seit 1970 die Kultur der Hamar in Südäthiopien. Durch<br />
ihren engen und langjährigen Kontakt mit ihren Gastgebern lernten sie zu verstehen, wie das tägliche Leben sich gestaltet<br />
und wie herausragende Ereignisse (die Aufnahme Jugendlicher in die Welt der Erwachsenen, Krieg und Tod) sich in<br />
Festen und Riten niederschlagen und welche Bedeutung die Musik für das Leben und das Selbstverständnis einer<br />
Gemeinschaft hat.<br />
Die Schwarzafrikaner werden zum Forschungsobjekt, durch deren Studium sich der Völkerkundler ein besse-<br />
res Verständnis für ihre Kultur erhofft. Unter der Überschrift "Zur Geschichte der Hamar" schreibt der Autor<br />
(S. 240):<br />
Die Vergangenheit der Hamar liegt im Dunkeln. Mythische Überlieferungen (Sagen und Erzählungen) deuten darauf hin,<br />
dass sie aus einer Verschmelzung von Einwanderern nördlich, östlich und westlich gelegener Stämme (Banna, Kara,<br />
Bume, Ari, Male, Tsamai, Konso) entstanden sind, aber wann dies geschehen sein mag, ist unbekannt. Sicher ist nur, dass<br />
die Hamar bis spätestens Mitte des vorigen Jahrhunderts von den festungsartigen Gebirgen nördlich des Turkanasees<br />
Besitz ergriffen hatten. Sie lebten von Ackerbau (Hirse, Hülsenfrüchte, Kürbisse, Salate), Viehzucht (Rinder, Schafe,<br />
Ziegen, Esel), Bienenzucht, Jagen und Sammeln.<br />
Hier wird ein weiteres Beispiel für die Gleichzeitigkeit von Viehhaltung und Ackerbau beschrieben, das im<br />
Gegensatz zu der im Lehrmittel "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1983-1984 gemachten Aussage steht,<br />
Schwarzafrikaner würden entweder Ackerbau oder aber Viehzucht betreiben. (Siehe dazu die Seite 333 dieser<br />
Arbeit.) Zur Auswirkung der eindringenden Europäer schreibt der Autor weiter:<br />
Um die Jahrhundertwende kamen die ersten Europäer als Grosswildjäger und Entdeckungsreisende. Sie brachten die<br />
Pocken und die Rinderpest mit, und so wie andere Stämme erlitten die Hamar damals hohe Verluste an Menschen und<br />
Vieh.<br />
Einige der wenigen Hinweise darauf, dass die Europäer auch Krankheiten in das als Seuchenkontinent<br />
verschrienes Gebiet Afrikas einschleppten. Weiter heisst es im Text:<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Den Europäern folgten kurz darauf die äthiopischen Gruppen. Unter Kaiser Menelik II. besetzten sie im Wettrennen mit<br />
den englischen und italienischen Kolonialmächten den ganzen Süden und Westen des heutigen Äthiopien. Die Hamar<br />
widersetzten sich, und viele von ihnen kamen dabei ums Leben oder wurden versklavt. Wer fliehen konnte, suchte Schutz<br />
in den unzugänglichen Dickichten der Flüsse in den Tiefebenen und an den Ufern des Turkanasees und des Stefaniesees.<br />
Hier führten die Hamar ein halbsesshaftes Leben. Jede Familie war in dieser Notzeit auf sich selbst gestellt und versuchte,<br />
sich durchzuschlagen. Um 1910 kehrten die Hamar wieder langsam in ihr altes Siedlungsgebiet zurück. Manche ihrer<br />
Traditionen hatten sie unwiederbringlich verloren, und während der Vertreibungszeit hatten sie von anderen Gruppen im<br />
Süden und im Westen neue Dinge und Bräuche kennengelernt, so dass sie heute in vielem ihren Nachbarn im Sudan und<br />
Kenia ähneln.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 454
(Zu Äthiopien siehe auch die Seite 415 dieser Arbeit.) Diese kulturelle Durchmischung fand auf dem afrikani-<br />
schen Kontinent ebenso statt, wie in anderen Regionen der Welt. Dazu schreibt Nketia in seinem Buch "Die<br />
Musik Afrikas" von 1979: "Obwohl die einzelnen Gruppen ihre Identität bewahrten, lebten sie nicht isoliert.<br />
Handeltreibende... reisten weit herum;... Staaten unterhielten miteinander diplomatische Beziehungen. Ebenso<br />
gab es kulturelle Interaktionen durch Entlehnung und Annahme von Kulturgütern, auch von Musik." (Nketia<br />
1991, S. 16)<br />
Auf der Seite 241 werden die Flöte und die Leier der Hamar vorgestellt. Dazu zeigt der Autor eines Mädchens,<br />
das nur mit einem kurzen Lederrock und verschiedenen Ketten gekleidet eine lange Flöte, wie im zitierten<br />
Text weiter unten dargelegt, schräg anbläst. Im Text schreibt der Autor:<br />
Bei den Hamar ist die Flöte das Instrument der Felder. Sie wird von den Mädchen gespielt, während sie die<br />
heranwachsende Hirse gegen Vögel, Affen und andere Tiere bewachen. Der Name der Flöte (woissa) meint wörtlich<br />
übersetzt "das, was das Aufrechtstehen verursacht", und er bezieht sich darauf, dass die Mädchen durch ihr Flötenspiel ein<br />
gutes Wachsen der Hirse ermöglichen und sich dabei gleichzeitig wachsam halten. Den Mädchen ist es aber nicht erlaubt,<br />
eine Flöte herzustellen. Diese Aufgabe ist allein den jungen Männern überlassen...<br />
Ein Beispiel für eine klare Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, die sich in vielen traditionellen Gesell-<br />
schaften in ähnlicher Weise, aber mit teilweise anderen Aufgabenzuteilungen, findet. Über die Herstellung und<br />
die Spielweise dieses Instrumentes schreibt der Autor (S. 241):<br />
Wenn in der Regenzeit der "baraza"-Busch "fett" und "weich" geworden ist, wie sie sagen, suchen sie einen Ast aus, der ein<br />
etwa daumendickes, fünfzig bis achtzig Zentimeter langes, gerades Stück enthält. An den Enden dieses Stückes<br />
zerschneiden sie die Rinde, und während der Ast noch am Stamm ist, drehen und zerren sie so lange, bis sich die Rinde um<br />
das Holz herumdrehen lässt. Dann erst schneiden sie den Ast ab und ziehen ihn aus der Rinde heraus. Der auf diese Weise<br />
gewonnene Zylinder wird die Flöte. Wenn die Rinde vollständig trocken ist, werden mit einem spitzen Eisen vier<br />
Grifflöcher gebrannt, und damit ist die Längsflöte fertig. Ein Mundstück braucht diese nicht, denn der Ton wird durch ein<br />
schräges Anblasen der Zylinderöffnung hervorgebracht.<br />
Als einziges der bisher untersuchten Lehrmittel bietet "Spielpläne Musik" hier eine Beschreibung der Herstel-<br />
lung und Spielweise eines schwarzafrikanischen Musikinstrumentes. Zum anderen bereits erwähnten Instru-<br />
ment, der Leier, deren Spielweise auf einem Foto dargestellt und die in einer Zeichnung dargestellt wird,<br />
schreibt der Autor auf der Seite 214:<br />
Eines Abends, als kurz vor Sonnenuntergang das Vieh ins Gehöft zurückkehrt, stimmt Choke die Saiten und dann, wie es<br />
bei Beginn und Ende eines jeden Stückes üblich ist, schüttelt er die Leier, so dass die Steine rasseln, die in ihrem Innern<br />
verschlossen liegen. Die Melodie, die er den Saiten entlocken will, singt er anfangs kurz vor. Dann spielt er sie, und später<br />
begleitet er wieder mit seiner Stimme...<br />
Nach der Flöte erwähnt das Lehrmittel hier ein zweites Instrument, ohne von Trommeln oder dergleichen zu<br />
sprechen. Hier folgt ein Verweis auf die entsprechende Tonaufnahme, die zum Lehrmittel erhältlich ist, sowie<br />
eine Übersetzung des Liedtextes. Über den Zweck des Liedes schreibt der Autor weiter:<br />
Choke singt hier über gesellschaftliche Beziehungen, ohne reale Personen zu nennen: Er verherrlicht die Freundschaft, die<br />
Nachbarschaft, die Tauschpartnerschaft (Tausch von Ziegen, Schafen und Kühen, um die gegenseitige Zuneigung<br />
auszudrücken) und die Einstimmigkeit unter den Altersgenossen, und dabei "wärmt" er wie er sagt, "das Gehöft an".<br />
Ein weiteres Beispiel, das belegt, dass die Musik Schwarzafrikas auch eine wichtige soziale Funktion hat und<br />
nicht nur dazu dient, im "ekstatischen Ausser-Sich-Sein" den Kontakt mit den Geistern aufzunehmen, und<br />
damit einen vorwiegend religiösen oder kultischen Charakter hat. Über die Herstellung der Leier schreibt der<br />
Autor (S. 241):<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Leiern finden sich nur in manchen Gehöften, aber im Prinzip kann sie jeder herstellen: Eine etwa zwei Handspannen lange<br />
und eine Handspanne breite Schildkrötenschale, deren Unterseite mit einer Axt entfernt worden ist, bildet den<br />
Resonanzkörper. Die Öffnung wird mit Rinds- oder Schweinsleder überzogen, und die beiden Stäbe für die Jocharme der<br />
Leier werden durch das Leder hindurchgeführt. Sie brauchen keine Befestigung am Boden der Schale, weil das Leder,<br />
wenn es trocknet, sie fest umschliesst und an ihrem Platz hält. Wenn das Leder über der Schale vollständig trocken ist,<br />
werden vier Löcher in die Mitte eingebrannt und einige Steinchen ins Innere des Klangkörpers gesteckt. Dann kann die<br />
Leier mit Saiten aus Kuhsehnen bespannt werden. Die Spanntechnik besteht aus einfacher Schlaufenbefestigung an der<br />
einen Seite (am Klangkörper) und einem Winkel an der anderen Seite (am Klangkörper) und einem Winkel an der anderen<br />
Seite (am Querstab). Zuletzt wird ein zylindrisches Holzstück hergestellt, das als Brücke dient und zwischen die<br />
Lederbespannung und die Saiten geklemmt wird.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 455
Die Leiern- und Lauteninstrumente sind in Schwarzafrika sehr verbreitet, Honolka schreibt in "Knaurs Weltge-<br />
schichte der Musik" dazu, dass "hier... die Phantasie der Neger keine Grenzen" gekannt hätte.<br />
Unter dem Titel "Musik der Hamar 2: Gesänge" schreibt der Autor auf der Seite 242 unter der Überschrift<br />
"'Bu'-(Ochsen- und Ziegen-)Gesänge":<br />
Sie sind das Herzstück eines jeden Tanzabends. Ein Hamar hat den Hintergrund dieser Gesänge folgendermassen erklärt:<br />
"Ein Junge, der mit den Kühen geht, macht sich einen Tanzochsen: 'Für meinen Ochsen werde ich vor den Mädchen<br />
tanzen'. Ein Junge, der mit den Ziegen geht, verformt die Hörner eines jungen Ziegenbocks und sagt: 'Für dich werde ich<br />
vor den Mädchen tanzen'. Er legt ihm ein Halsband um und bindet eine Glocke daran, und zur Zierde beschneidet er seine<br />
Ohren. So singt man für den Ochsen oder den Ziegenbock: Wenn das Tier rot ist, singt man von der Röte des Felles, wenn<br />
es weiss ist, singt man vom weissen. Wenn es gefleckt ist, singt man vom gefleckten. So gibt man dem Tier einen Namen<br />
und tanzt und tanzt und lacht. Von jemandem, der kein Tanztier hat, sagt man 'Der ist dumm', und alle Mädchen belachen<br />
ihn, die Altersgenossen belachen ihn. Dann weint er und nimmt alle seine Kraft zusammen, bis er am Ende auch lernt zu<br />
singen."<br />
Hier wird einer der Mechanismen der sozialen Kontrolle beschrieben und noch einmal die soziale Rolle der<br />
Musik bestärkt, welche zugleich aber auch eine religiöse Funktion ausübt:<br />
Jedem "bu"-Gesang liegt das Bemühen zugrunde, über das Singen für sein Lieblingstier ein gutes Verhältnis mit der Natur<br />
herzustellen. Wenn man die richtige Beziehung zu seinem Tanzochsen hat, dann fällt der Regen, dann wird das<br />
gefährlichste Wild zur Beute und auch die Feinde, die einen selbst und die Herde bedrohen, können einem nichts anhaben.<br />
Der älteste anwesende Mann beginnt jeweils mit seinem "bu"-Gesang, und ihm folgen dann die anderen, dem Alter nach.<br />
Jeder einzelne kündigt seinen Tanz an, indem er aus dem Halbkreis der Männer hervorbricht und sich in grossen Sprüngen<br />
auf die Mädchen und Frauen zu bewegt. Wenn er diese erreicht hat, wirft er den Kopf herum, so dass die Federn in seinem<br />
Haar (bzw. in seiner Lehmkappe) das Gesicht des Mädchens berühren, für das er im besonderen singen will.<br />
Für Ostafrika typisch handelt es sich bei der Form des Bewegungsablaufes und einen Sprungtanz, d.h. die<br />
wesentlichen Elemente basieren auf Hüpfen und Springen. Der Autor fährt in der Beschreibung der Abläufe<br />
fort:<br />
Er kehrt nun in den Halbkreis zurück und intoniert mit den anderen Männern den Chor zu seinem Sologesang.<br />
Wenn der Chor stark genug geworden ist, beginnt er mit seinem Solo. Während er seine Stimme erhebt, macht er ein<br />
konzentriertes, starres Gesicht. Er scheint gar nicht mehr anwesend, sondern bei seinem Tanzochsen zu sein. Er hält die<br />
Arme in die Höhe und imitiert dabei die Form der Hörner seines Tieres. Zwischen den einzelnen Versen ruft er<br />
gelegentlich die Namen seines Tieres aus und springt mit steil aufgerichtetem, straffem Körper in die Höhe. Wenn<br />
Mädchen aus seinem Klan anwesend sind, tanzen sie still an seiner Seite und hinter ihm. Alle anderen Mädchen halten sich<br />
vor ihm auf. Sie fixieren ihn starren Blickes, wippen in die Knie, dass die Lederröcke fliegen und schlagen ihre Hacken<br />
zusammen, dass die eisernen Ringe an ihren Beinen klingeln. Gleichzeitig gehen ein oder zwei erfahrene Sänger vor dem<br />
Halbkreis auf und ab und feuern die jungen Männer an, kräftig und im richtigen Rhythmus zu klatschen...<br />
In ähnlicher Form findet auch bei anderen Völkern die Begegnung zwischen Jungen- und Mädchengruppen<br />
statt, die dadurch die überlieferten Volksweisen erlernen und erste Kontakte zum anderen Geschlecht anknüp-<br />
fen können.<br />
Anschliessend gibt der Autor den Text vom "Lied für einen Tanzochsen" wieder. Ausserdem zeigt die<br />
Seite 242 zwei Fotos auf denen die im Text beschriebenen Tanzfiguren zu sehen sind. Auf der Seite 243 stellt<br />
der Autor drei weitere Gesänge vor: "'Merta' (Gesang des Tötens),", "'Aephino' (Weinen und Klagen" und<br />
"'Barjo aela' (Segen)".<br />
Unter der Überschrift "Veränderungen heute" schreibt der Autor:<br />
Die Welt der Hamar, wie sie von den Völkerkundlern Strecker und Lydall angetroffen wurde, ist heute bedroht. Auch<br />
Murras Segen, dessen Kraft auf der Regelmässigkeit der Abläufe in der Natur beruht, kann die Ausbreitung der<br />
Dürrezonen in Afrika nicht aufhalten...<br />
Ausserdem merkt der Autor an, dass die moderne Zivilisation "den Hamar, ähnlich wie vielen anderen<br />
Völkern, nicht nur Gutes bringt".<br />
Abschliessend schreibt der Autor die Musik der Hamar stelle "nur einen sehr kleinen Teil dessen dar, was in<br />
Afrika musikalisch" geschehe.<br />
Im Lehrerband für die 9. und 10. Klasse schreibt der Autor in der Einleitung zum Kapitel "The Roots & Early<br />
Jazz" auf der Seite 250 unter der Überschrift "Afrikanisches Rhythmusgefühl":<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Von einem afrikanischen Meistertrommler stammt der Ausspruch, die Europäer seien rhythmische Analphabeten. Damit<br />
meinte er insbesondere die den Europäern mangelnde und für Afrikaner ganz gewöhnliche Fähigkeit, mehrere rhythmische<br />
Ebenen zugleich zu empfinden und musikalisch auszudrücken.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 456
Auf der gleichen Seite ist auch das Foto "Sultansorchester aus dem Tschad, aufgenommen 1964" abgebildet<br />
auf dem fünf Musiker zu sehen sind, deren Instrumente der Autor in der Bildlegende näher erläutert.<br />
5.2.11.1 Zusammenfassung<br />
Anhand der Beispiele über die Hamar zeichnet der Autor das Bild des traditionellen Afrikas, dessen Traditio-<br />
nen nicht nur in neuester Zeit immer wieder von Fremdeinflüssen geprägt wurden. Dabei beschreibt der Autor<br />
die Musik sowohl als soziales wie auch religiöses Ausdrucksmittel, das in den verschiedensten Lebenssituatio-<br />
nen zum Tragen kommt.<br />
Der Autor ist sich bewusst, dass das Beispiel der Hamar "nur einen sehr kleinen Teil dessen" darstellt, "was in<br />
Afrika musikalisch" geschieht.<br />
5.2.12 Klangwelt-Weltklang (1991-1993)<br />
Der 239 Seiten umfassende Band 1 des österreichischen Lehrmittels "Klangwelt-Weltklang" zeigt auf den<br />
Seiten 44-45 mehrere Briefmarken aus Ruanda, auf denen verschiedene Musikinstrumente zu sehen sind:<br />
Neben Blasinstrumenten, einer Trommel und einem Musikbogen ist auch eine Orgel abgebildet.<br />
Der 256 Seiten umfassende Band 2 enthält ein Kapitel "Aussereuropäische Musik" auf den Seiten 21-27, in<br />
welchem der Autor anhand verschiedener Musikbeispiele auch auf die Musik Schwarzafrikas zu sprechen<br />
kommt.<br />
In der Einführung zur Überschrift "Die Musik der schriftlosen Kulturen (Naturvölker)" schreibt der Autor auf<br />
der Seite 21 ganz allgemein:<br />
Naturvölker leben meist als Nomaden, sie sind Fischer, Jäger, Sammler und Hirten, oder sie sind sesshafte Bauern. Immer<br />
steht ihr Leben im Einklang mit der Natur. Sie haben keine schriftlichen Überlieferungen. Ihre Bräuche, Religion und<br />
Musik werden mündlich von Generation zu Generation weitergegeben.<br />
Soweit sie nicht heute schon durch Zivilisation und Missionierung erfasst worden sind, stehen sie auf der Stufe des<br />
Animismus: die lebendige und leblose Natur ist von guten und bösen Geistern beseelt; verstorbene Lebewesen - auch<br />
erlegte Tiere - hinterlassen ihre Seelen, von denen man Kraft und Hilfe erwartet. Durch Opfergaben, Tanz und Musik muss<br />
man Seelen und Geister milde stimmen, um sie von einem schädlichen Eingreifen in die Geschicke der Menschen<br />
abzuhalten.<br />
Auf den Seiten 23 und 24 beschreibt der Autor "Musizieranlässe und Funktionen der Musik bei Naturvölkern".<br />
Die Seite 23 zeigt drei Fotos: "Musikbogenspieler (Togo)", "Aka-Pygmäen" und "Singen beim Mais-Reiben".<br />
Im Gegensatz zu dem Pygmäenfoto und dem Foto auf der vorherigen Seite zu den asiatischen Senoi aus<br />
Malacca, sind die abgebildeten Personen aus Togo vollständig bekleidet. Die Seite 24 zeigt eine kleine Zeich-<br />
nung "Regenzeremonie, Rhodesien", das seit 1980 als Simbabwe bekannte Land wird mehr als zehn Jahre<br />
später immer noch mit seinem alten Namen bezeichnet, zu der der Autor schreibt:<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Nach einem ostafrikanischen Mythos wird eine Prinzessin lebend unter einem Baum begraben. Wenn die Spitze des<br />
Baumes den Himmel erreicht, kriecht eine Schlange aus den Zweigen und sendet Regen. Über allem schwebt eine Göttin.<br />
Als Musizieranlässe, die er immer durch den Verweis auf ein Tonbeispiel auf dem zum Lehrmittel erhältlichen<br />
Tonträger begleitet, zählt der Autor auf den beiden Seiten 23-24 die Initiation, "Jungen der Linda aus Zentra-<br />
lafrika"; Liebeszauber "Musikbogenspieler aus Togo"; Jagdzauber "Aka-Pygmäen a) vor der Jagd, b) nachher.<br />
Die Aka-Pygmäen kennen als eines von wenigen afrikanischen Naturvölkern polyphones Singen in einer Art<br />
Jodeln"; Arbeitsmusik "a) Frau beim Zerreiben von Mais (Togo). - b) Azande-Frauen beim Mais-Stampfen<br />
(Zaire). - c) Musik zum Schmieden (Kamerun)"; Fruchtbarkeitszauber, Regenzauber, Kriegsmusik, "Banda<br />
Linda, Zentralafrika"; Heilung, Kommunikation - mit höheren Wesen oder über grosse Distanzen mit<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 457
Nachbarn - "Yoruba-Trommler aus Oshogbo, Nigeria", und Totenkult "Epanda. Lied der Aka-Pygmäen zur<br />
Anrufung der Seelen der Vorfahren" auf.<br />
Die Seiten 25-27 stehen unter dem Titel "Annäherung an Afrika: Von Orlando di Lasso bis Paul Simon". Dazu<br />
schreibt der Autor auf der Seite 25, dass zwar die afroamerikanische Musik rasch kommerzialisiert, aber die<br />
"ursprünglichen Ausdrucksformen afrikanischer Kulturen, insbesondere Schwarzafrikas, von uns erst in den<br />
letzten Jahrzehnten zur Kenntnis genommen" wurden.<br />
Unter der Überschrift "Europäische Vorurteile" führt der Autor auf der Seite 25 als Beispiele die Werke "Die<br />
sieben Moriscen" von Orlando die Lasso, "Die Zauberflöte " von Mozart, "Die Afrikanerin" von Giacomo<br />
Meyerbeer und "Afrika" von Camille Saint-Saëns an. Zusätzlich ist eine "Zeichnung eines Afrikaforschers<br />
(1871) abgebildet, die drei Schwarze mit Lauten zeigt.<br />
Auf der Seite 26 schreibt der Autor unter der Überschrift "Gesang und Instrumente in Schwarzafrika":<br />
Ähnlich den frühen Barden oder Wandermusikern Europas verherrlichen afrikanische Sänger als "Hofmusiker" ihren<br />
Herrn, sie legitimieren oder warnen ihn, zur Bogenharfe, der "kora" singend. Sie überliefern Geschichte und Bräuche.<br />
Wegen ihres Spotts und ihrer Schlagfertigkeit sind sie jedoch auch gefürchtet.<br />
Für das persönlichere, intime Musizieren steht der Musikbogen zur Verfügung; der Mundraum gibt Resonanz und filtert<br />
aus dem Grundton die eigentliche Melodie heraus. Zu den beliebten Instrumenten gehören - neben der Kora - das<br />
Daumenklavier Sansa (Mbira, Kalimba) und das "Balafon", ein Xylophon mit Kalebassen-Resonatoren... Man schätzt in<br />
Afrika den reinen Klang weniger als den mit charakteristischen Geräuschbeimischungen.<br />
Als Musikbeispiel führt der Autor ein Lied aus Guinea vor, in dem die Frau ihren Mann das Trinken vorwirft,<br />
"alles, was nicht aus der Wasserquelle stamme, Bier Whisky, Palmwein, Maisbier, Champagner, Marihuana,<br />
Tabletten, zerstöre die Zukunft eines Mannes".<br />
Unter der Überschrift "Missionierung" verweist der Autor auf die "Missa Luba", die der belgischen Pater<br />
Guido Haazen gemeinsam "mit Lehrern und Schülern der Zentralschule in Kamina" (Kongo) "unter Einbezie-<br />
hung der örtlichen Folklore" erarbeitet habe.<br />
Unter der Überschrift "Moderne afrikanische Tanzmusik" schreibt der Autor (S. 26):<br />
Die bei den Stadtbewohnern beliebte Tanz- und Unterhaltungsmusik enthält unter anderem Elemente der Musik der<br />
Weissen, des Boogie (Jive) und afro-karibischer Musik. "High-Life" heisst die erfolgreiche städtische afrikanische<br />
Popmusik, mit traditionellen Rhythmen und Shanty-Anklängen...<br />
Ein Verweis auf Paul Simons "Diamond In The Soles Of Her Shoes" beendet die Ausführungen zur modernen<br />
Tanzmusik.<br />
Im letzten Abschnitt lässt der Autor einen Musiker auf den Seiten 26-27 unter der Überschrift "Lucas 'Mkan-<br />
langu': Als Trommelschüler in Ghana" zu Wort kommen:<br />
...Die Trommel spricht, führt die Tänzer oder folgt dem Tanz. Die Trommel drückt Freude aus, andererseits ist die<br />
Trommel etwas sehr Würdevolles. Sie kann beten! Ein Trommelvers aus Ghana sagt, ein Häuptling ohne Trommler sei<br />
keiner. Vor der Kolonialisierung liess der Aschantikönig sogar Gerichtsurteile über die Trommel verkünden. Afrikanische<br />
Sprachen haben die Eigenart, dass erst die Tonhöhe die Bedeutung von Wörtern endgültig festlegt. Die Tonhöhenmelodien<br />
werden vom Spieler der Talking drum nachgeahmt...<br />
Als Musikbeispiel führt der Autor ein Beispiel der "Haussa-Talking drum" an: "Die Schildkröte hat einen<br />
harten Panzer. Wer Pfeile auf sie schiesst, ärgert sich nur selbst." (Zu den Hausa siehe auch die Seite 392<br />
dieser Arbeit.)<br />
5.2.12.1 Zusammenfassung<br />
Das Lehrmittel "Klangwelt - Weltklang" stellt eine Fülle von afrikanischen Musikbeispielen unterschiedlich-<br />
ster Art, Herkunft und Funktion auf. Zudem thematisiert der Autor auch die europäische Sichtweise auf die<br />
schwarzafrikanische Musik anhand einiger Musikbeispiele.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Der Schwarzafrikaner wird in verschiedenen Facetten vom jodelnden Pygmäen bis zum König der Aschanti<br />
präsentiert, der Gerichtsurteile durch Trommel verkünden liess, präsentiert. Neben der Erwähnung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 458
verschiedener afrikanischer Musikinstrumente, vermittelt der Autor auch einen kurzen Einblick in die "moder-<br />
ne afrikanische Tanzmusik."<br />
5.2.13 111 / 222 / 333 Lieder (1990-1995)<br />
Die drei Lehrmittel "111 Lieder Songbook", "222 Lieder" und "333 Lieder" enthalten auf den insgesamt 640<br />
Seiten nur zweimal das Lied "Kumbaya, my Lord (nach einem afrikanischen Abendgebet)" in den beiden letzt-<br />
genannten Bänden. (Zur Herkunft von "Kumbaya" siehe auch die Ausführungen auf der Seite 444 dieser<br />
Arbeit).<br />
5.2.14 Liedertreff (1994)<br />
Das 319 Seiten umfassende "Liederbuch für die Klassen 5 - 10" enthält ein gemaltes Bild auf der Seite 4, auf<br />
dem schwarze Sklaven tanzen, musizieren und trinken, wobei ca. 25 Personen auszumachen sind. Als Musik-<br />
instrumente dienen zwei Trommeln, eine Fidel und ein Schellenreif. Eine Mutter gibt ihrem Kind die Brust,<br />
von den fünf abgebildeten Frauen sind bei vieren die Brüste sichtbar, zwölf weitere Personen sind nur leicht<br />
beschürzt dargestellt.<br />
Im Liedteil werden zwei Scherzlieder "Meine Tante aus Marokko" und "Hottentottentanz", die im Fall des<br />
zweiten Liedes nur auf einer Wortspielerei beruhen und nichts mit Afrika zu tun hat, sowie die Volksweise aus<br />
Zaire "E Bampangi luyangalala", die dem Inhalt nach wohl eher als Kirchenlied bezeichnet werden sollte.<br />
Damit erschöpfen sich die Angaben zu Schwarzafrika.<br />
Da das weiter oben erwähnte Bild das einzige von Menschen schwarzafrikanischen Ursprungs ist, stellt sich<br />
die Frage, warum gerade dieses im Lehrmittel abgebildet wurde. Zwar mag es den historischen Tatsachen<br />
einigermassen entsprechen, es zementiert aber die Vorstellung vom fröhlichen aber wenig vernünftigen, kaum<br />
zivilisierten Schwarzen, die noch immer in den Köpfen vieler Europäer herumspukt.<br />
5.2.15 Die Musikstunde (1992-1997)<br />
Der 1992 erschienene, 160 Seiten umfassende Band für das 5. und 6. Schuljahr" enthält, ebenso wie der<br />
135seitige Band für die 7. und 8. Klasse, keine Angaben zum Thema. Der Band für das 9. und 10. Schuljahr<br />
enthält ein Kapitel "Zwei Kora-Spieler vom Stamm der Mandinke" auf den Seiten 150-151, in dem der Autor<br />
auf der Seite 150 schreibt:<br />
So klein ein Land wie Gambia an der westafrikanischen Küste auch sein mag, die Bevölkerung setzt sich aus vielen<br />
Volksgruppen zusammen: Mandinke, Fulbe, Wolof und anderen. Jede von ihnen besitzt eine eigene Sprache, eigene<br />
Unterhaltungsformen und natürlich auch eine eigene Musik. Das klassische Instrument der Jali (Barden) vom Stamm der<br />
Mandinke ist die Kora, eine 21-saitige Harfenlaute. Sie gilt als "Instrument der Könige" und besteht aus einer halben<br />
Kalebasse (getrockneter Kürbis), die mit einer Rinderhaut bespannt ist. Durch diesen Korpus wird ein Holzstab getrieben,<br />
an dem die Saiten, die über einen Steg führen, befestigt sind. Gespielt werden die Saiten der Kora nur mit Daumen und<br />
Zeigefingern, die anderen Finger halten das Instrument fest.<br />
Weiter schreibt der Autor auf der Seite 150 zur Funktion der Musiker, von denen "Tata Dindin, ein moderner<br />
Jali" auf einem Foto zu sehen ist:<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Geschichte wird in Afrika nicht aufgeschrieben, sondern erzählt und gesungen. Die Barden oder Griots sind bis zum<br />
heutigen Tage dafür zuständig die Geschichte der alten afrikanischen Königshäuser in tradierten Liedern am Leben zu<br />
halten. War es früher wichtig möglichst viele Erzählungen, deren einzelne Aufführung mehrere Stunden in Anspruch<br />
nahm, auswendig zu kennen, sind im Zeitalter der Massenmedien eher technische Fähigkeiten am Instrument und das<br />
Besingen der Mäzene (Förderer, Gönner) gefragt. Tata Dindin gilt als einer der modernsten Musiker Gambias. Neben der<br />
Interpretation von traditionellen Gesängen begeistert er, genau wie in der Pop- und Rockmusik, die meist jugendlichen<br />
Zuhörer mit eigenen Songs und Tanzmusik.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 459
Natürlich wird die Geschichte Schwarzafrikas seit vielen Jahren schriftlich festgehalten, wie beispielsweise<br />
das Buch "Die Geschichte Schwarzafrikas" (Ki-Zerbo 1984) zeigt. Die meisten afrikanischen Völker kennen<br />
traditionellerweise jedoch wirklich keine Schrift und übermittelten ihre Geschichte deshalb mündlich weiter.<br />
Die Seite 151 zeigt die beschriftete Abbildung eines Kora. Im Text schreibt der Autor:<br />
Ein anderer Jali vom Stamm der Mandike ist Mory Kante. Mit einem Ensemble aus 35 Musikern und Tänzern hatte er über<br />
die Grenzen Afrikas hinaus Erfolg, sodass er den Wechsel nach Europa wagte...<br />
In einem letzten Abschnitt auf der Seite 150 spricht der Autor kritisch die Verwendung traditioneller afrikani-<br />
scher Muster in der Popmusik durch Aussenstehende an.<br />
Der Autor zeichnet also ein Bild des vor allem mit der traditionellen Musik befassten Schwarzafrikas anhand<br />
des Länderbeispieles Gambia auf. Obwohl er die wichtigsten Völker des Landes erwähnt, das zu den kleinsten<br />
Schwarzafrikas zählt, erwähnt der Autor nicht, dass die Musik Gambias und die dort lebenden Menschen nur<br />
einen winzig kleinen Ausschnitt des schwarzafrikanischen Völker- und Kulturmosaiks ausmachen.<br />
5.2.16 Hauptsache Musik (1995)<br />
Der 193 Seiten starke Band "für den Musikunterricht in den Klassen 7 und 8" enthält die beiden Kapitel<br />
"Musiker in Gambia, Westafrika" (S. 24-25) und "Cou-Cou - ein Trommeltanz aus Westafrika" (S. 26-27). Das<br />
Kapitel "Musiker in Gambia" bildet auf der Seite 24 drei Fotos ab, die mit den folgenden Bildlegenden verse-<br />
hen sind:<br />
- Malamini Jobarthe ist ein "Jali" ein hochangesehener Musiker, der zugleich die Aufgabe eines Geschichtenerzählers,<br />
Historikers, Friedensrichters und manchmal auch des Regierungssprechers ausübt. Er spielt zum Klang der Kora, der<br />
21saitigen Harfe. Häufig tritt er - zusammen mit seinen Frauen und Söhnen - bei Familienfesten auf.<br />
- Maodo Souso ist ebenfalls ein Jali. Er begleitet seinen Gesang auf dem Balafon, einem Instrument aus gestimmten<br />
Holzstäben, unter die hohle Kürbisse als Klangkörper gebunden sind. Die Kürbisse sind an einigen Stellen durchlöchert<br />
und mit Papierblättchen beklebt. Die sorgen für den beliebten "schnarrenden" Klang.<br />
- Faoudu Konaté ist ein berühmter Musiker aus Guinea. Er beherrscht meisterhaft die Djembé, eine weit verbreitete<br />
westafrikanische Trommel, über deren Holzkörper ein Ziegenfell gespannt ist.<br />
Die Seite 25 zeigt drei weitere Fotos, von denen zwei wieder mit ausführlichen Bildlegenden versehen sind:<br />
- Sankaranka Tamba ist im Hauptberuf Reisbauer. Er spielt auf vier Boucarabous - grossen, warm klingenden Trommel<br />
mit aufgespanntem Kuhfell. Sein Enkel Pa, neun Jahre alt, ist zugleich sein Schüler. Er spielt schon oft mit ihm<br />
zusammen.<br />
- Bei Dorffesten spielt und singt Sankaranka gemeinsam mit seinem Freund Abbas Dibba zum Tanz der Frauen. Abbas<br />
spielt auf einem vierseitigen, tief klingenden Zupfinstrument, der Dusunguni. Sankaranka sitz ihm gegenüber und<br />
schlägt mit zwei Stöcken einen schnelle Rhythmus auf die Rückseite des Instruments. In ihren Liedern, die sie immer<br />
wieder neu erfinden, erzählen sie witzige Geschichten aus dem Dorfleben.<br />
Im Kapitel "Cou-Cou - ein Trommeltanz" wird auf der Seite 26 auf drei Fotos unter dem Titel "Die Klänge der<br />
Djembé-Trommel" die Grundspielweise dieses Instrumentes erklärt. Ein weiteres Foto zeigt eine Gruppe von<br />
Musikern mit Djemben und Trommeln. Im Text heisst es dazu (S. 26)<br />
Der Cou-Cou ist in ganz Westafrika verbreitet. Er wird vor allem bei festlichen Anlässen - z.B. Hochzeiten,<br />
Namensgebungsfesten oder auch am Ende des Ramadan, des Fastenmonats - getanzt, und zwar einzeln, zu zweit oder in<br />
Gruppen. Dazu spielt das typische westafrikanische Trommelensemble: zwei oder drei Djembétrommeln und<br />
Basstrommeln. Der Basstrommler spielt zugleich auf einer kleinen Eisenglocke, die für den Gesamtklang und die<br />
Orientierung sehr wichtig ist. Ein Solotrommler improvisiert in immer neuen Variationen über die Begleitrhythmen. Er gibt<br />
zugleich das "Signal" für Anfang und Schluss und für die Wechsel der Tanzschritte. - Die afrikanischen Musiker schreiben<br />
ihre Musik nicht auf... Sie kennen keine Noten - sie haben ihre zum Teil sehr komplizierten Rhythmen und Stücke "im<br />
Kopf".<br />
Die Seite 29 zeigt ein weiteres Foto, auf dem zwei traditionell gekleidete Tänzerinnen zu sehen sind. Auf der<br />
gleichen Seite wird auch das Notenbeispiel der "Cou-Cou-Begleitrhythmen" abgedruckt.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Lehrmittel vermittelt anhand einiger westafrikanischer Musikbeispiele die reichhaltige Musikkultur dieses<br />
Grossraumes. Dabei wird das Bild eines schwarzafrikanischen Musikers gezeichnet, der sein Instrument "mei-<br />
sterhaft" beherrscht, "witzige Geschichten aus dem Dorfleben erzählt" und in "immer neuen Variationen über<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 460
Begleitrhythmen" improvisiert. Der Autor zeichnet also das Bild eines in der Tradition aufgewachsenen, dabei<br />
aber äusserst kreativen Menschen.<br />
5.2.17 Canto (1996)<br />
Das 288 Seiten umfassende Liederbuch, für den Einsatz ab der 5. Klasse gedacht, enthält nur das Lied "Kum-<br />
baya, my Lord", das als "Spiritual" und "afrikanisches Abendgebet" bezeichnet wird. (Siehe zu diesem Lied<br />
auch die Seite 444 dieser Arbeit.) Weitere Musikbeispiele, die Schwarzafrika zugeordnet werden könnten,<br />
enthält das Lehrmittel nicht.<br />
5.2.18 Musik hören, machen, verstehen (1990-1995)<br />
Das dreibändige Lehrmittel für die fünfte und höhere Klassen beschäftigt sich in den Bänden 2 und 3 auch mit<br />
Musik aus Schwarzafrika. Der 167 umfassende Band 1 enthält keine Informationen zum Thema.<br />
5.2.18.1 Musik hören, machen, verstehen 2<br />
Im Band 2, der insgesamt 184 Seiten umfasst, findet sich auf der Seite 33 unter dem Titel "Lieder über die<br />
Liebe" das südafrikanische Lied "Mangwane Mpulele" im Notenbeispiel zu dem der Autor im Begleittext auf<br />
der gleichen Seite schreibt:<br />
"Mangwane Mpulele" ist ein Hochzeitslied des Stammes der Sotho in Südafrika. Es erinnert im Text an die Zeiten, als ein<br />
Mann der Familie der Frau, die er heiraten wollte, noch Vieh geben musste, um sie zu bekommen.<br />
(Zum Thema "Brautpreis" siehe auch die Seite 330 dieser Arbeit). Die Übersetzung des in der Originalsprache<br />
abgedruckten Liedes lautet nach dem Autor:<br />
"Tante, mach die Türe auf, ich bin völlig durchregnet. Wenn ich wenigstens zwei oder drei Kühe hätte, dann könnte ich<br />
eine Frau heiraten."<br />
Zur speziellen Notation des Liedes lässt der Autor vom Erfinder, "einem südafrikanischen Fachmann" begrün-<br />
den (S. 33):<br />
"Die normale Notation legt Wert auf die Tonlängen, die in der afrikanischen Musik keine grosse Rolle spielen. Diese<br />
Notation betont die genauen Anfangszeitpunkte eines Tones. Die senkrechten Linien stellen die kleinsten Einheiten des<br />
Pulses der Musik dar. Für praktische Zwecke könnten dies Achtel sein. Pausen, Balken und Bögen werden in diesem<br />
System nicht benutzt, da sie unnötige und sogar in die Irre führende westliche Musikkonzepte und Phrasierungen<br />
einführen."<br />
Damit thematisiert der Autor einen Teil der Schwierigkeiten, die sich bei der Vermittlung der schwarzafrikani-<br />
schen Musik an europäische Zuhörer ergeben. Auf der Seite 65 schreibt der Autor zur Einführung des Kapitels<br />
"Der Jazz":<br />
Mit dem Beginn des Sklavenhandels zwischen Afrika und Amerika in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann auch<br />
eine jahrhundertelange wechselseitige Beeinflussung von europäischer und westafrikanischer Musik. Die Sklaven kamen<br />
fast ausnahmslos aus dem Gebiet der Elfenbeinküste in Westafrika...<br />
Entgegen der hier aufgestellte Behauptung des Autors, wurden die Sklaven aus einem viel grösseren Einzugs-<br />
gebiet in die "Neue Welt" geschafft. (Siehe dazu auch die Seiten 462 dieser Arbeit.) Auf der gleichen Seite<br />
schreibt er unter der Überschrift "Afrikanische Rhythmen":<br />
Afrikanische Rhythmen hören sich meist sehr kompliziert an, doch entstehen sie durch das Nacheinander und<br />
Übereinander gleicher oder verschiedener Rhythmen und Metren.<br />
Dadurch, so muss angefügt werden, entstehen auch die komplexen Muster, die all denen grosse Mühe bereiten,<br />
die nicht in einer solchen Musiktradition aufgewachsen sind.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Die Seiten 141-143 sind unter dem Titel "Tanzende Kinder in Afrika" ganz der Musik und ihrer Bedeutung in<br />
Schwarzafrika gewidmet. Damit beschäftigt sich das Lehrmittel als eine der Ausnahmen mit den Formen der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 461
traditionellen schwarzafrikanischen Erziehung, speziell einem Beispiel der Musikerziehung. Neben einem<br />
grossen Foto, dass die Siedlungsweise der Dangaleat im Tschad zeigt, schreibt der Autor auf der Seite 141:<br />
Die Dörfer der Dangaleat liegen im Staat Tschad, etwa fünfhundert Kilometer östlich des Tschadsees in den<br />
Gebirgssavannen des Zentraltschadischen Massivs. Die ausgedehnten Hirsefelder der Dangaleat, in denen die<br />
Erwachsenen arbeiten, sind oft weit von den Dörfern entfernt. Die Kinder, die im Dorf zurückbleiben, sind während des<br />
ganzen Tages sich selbst überlassen. Die Knaben hüten die Ziegen, die Mädchen betreuen ihre jüngeren Geschwister und<br />
vertreiben sich mit Spielen die Zeit. Zu den beliebtesten Spielen der Dangaleat-Kinder gehört es, die Tänze der<br />
Erwachsenen nachzumachen. Meistens tanzen die Kinder am Nachmittag, wenn die grösste Tageshitze vorüber ist. Dann<br />
versammeln sie sich zu kleinen Tanzgruppen, schlagen entweder eine improvisierte Trommel oder sie klatschen den<br />
Rhythmus mit den Händen und singen dazu. Die Tänze und die Lieder haben sie den Erwachsenen abgeguckt, denn die<br />
Dangaleat-Kinder werden niemals daran gehindert, den Tänzen der Erwachsenen zuzusehen oder auch aktiv daran<br />
teilzunehmen. Sie schliessen sich der Reihe der Tanzenden an und erlernen auf diese Weise die Tanzschritte und<br />
Tanzfiguren "von selbst".<br />
Der Autor beschreibt hier das Hineinwachsen von Kindern und Jugendlichen in die Kultur ihrer Eltern, eine<br />
Methode, die in der traditionellen Erziehung vieler schwarzafrikanischer Völker von grosser Wichtigkeit ist.<br />
Auf der Seite 142 fährt der Autor mit seiner Beschreibung fort:<br />
Die Tanzlieder werden bei den Dangaleat ausschliesslich von Frauen und Mädchen gesungen. Es sind Preislieder für<br />
berühmte Persönlichkeiten, aber auch Spottlieder. Von diesen Liedern behalten die Kinder meist nur Bruchstücke, singen<br />
sie bei ihren Tänzen und bemühen sich mit grossem Ernst, das Verhalten der Erwachsenen getreu nachzuahmen. Deshalb<br />
wird bei der Aufstellung zum Tanz darauf geachtet, dass jeder den Platz einnimmt, der ihm zusteht. Der beste und<br />
vornehmste Platz ist jener in der Mitte. Dort stehen die Ältesten der Gruppe. Sie haben den höchsten Rang, denn bei den<br />
Dangaleat hängt das soziale Prestige hauptsächlich vom Alter ab. Die Gruppenältesten haben nicht nur den Mittelplatz, sie<br />
bestimmen auch, wie lange getanzt wird, welcher Tanz an die Reihe kommt, wer bei einem Solotanz vortreten darf. Die<br />
Jüngsten stehen an den Aussenseiten und unterwerfen sich ohne Widerspruch den Anordnungen der Älteren.<br />
(Zum Tschad siehe auch die Seite 402 dieser Arbeit.) Viele Völker Schwarzafrikas "ehren" traditionellerweise<br />
ihre Alten. Die im Text beschriebene Rollenteilung hingegen, kann von Volk zu Volk sehr stark variieren. Zu<br />
einem, der auf dem Tonträger zum Lehrmittel erhältlichen Musikbeispiel, dessen Grundrhythmus und Schritt-<br />
folge auf der Seite 142 erklärt und in einer Zeichnung erläutert werden, schreibt der Autor:<br />
Die Dangaleat haben zahlreiche Tänze, jeder hat einen Namen, besondere Schritte und Figuren. Die Kinder kennen alle<br />
diese Tänze, aber sie kommen auch oft in die Nachbardörfer, in denen andere ethnische Gruppen, zum Beispiel<br />
Sudanaraber, leben. Sie sehen dort fremde Tänze, und wenn die Dangaleat-Kinder das Tanzen als Spiel betreiben, tanzen<br />
sie ausser den Dangaleat-Tänzen auch Tänze der benachbarten Araber. Das unterscheidet die Tänze der Kinder von jenen<br />
der Erwachsenen, denn die erwachsenen Dangaleat tanzen im allgemeinen nur ihre eigenen Tänze. Den Tanz "al bejer"<br />
haben die Kinder benachbarten Arabern aus dem Sudan abgeschaut und tanzen ihn auf ihre Weise auch etwas anders als<br />
diese Araber.<br />
Auch diese Bemerkungen können als Hinweis darauf verstanden werden, dass es sich bei der traditionellen<br />
Lebensweise der schwarzafrikanischen Völker nicht einfach um einen statischen Verhaltenskodex handelt,<br />
sondern eine aufgrund von Erfahrungen und Ausseneinflüssen sich stetig entwickelnde Lebensweise. Eine<br />
Reihe von elf Bildern, zeigt die mit einem Lendenschurz gekleideten, im Text erwähnten Kinder und bietet<br />
zudem einen zusätzlichen Einblick in die Schrittfolge des vorgestellten Tanzes.<br />
5.2.18.2 Musik hören, machen, verstehen 3<br />
Der 184 Seiten starke Band 3 des Lehrmittels beinhaltet die Kapitel "Die Entwicklung des Jazz im Überblick:<br />
Afrikanische Wurzeln" und "Musik anderer Kulturen: Musik in Schwarzafrika".<br />
In Kapitel zum Jazz schreibt der Autor in der Einleitung auf der Seite 56:<br />
...Die meisten nordamerikanischen Sklaven kamen von der Westküste Afrikas - vor allem aus dem Senegal, der Küste von<br />
Guinea, dem Bereich des Nigerdeltas und aus dem Kongo. Dort gab es überall hochentwickelte Musikkulturen....<br />
Damit widerspricht der Autor der im Band 2 des Lehrmittels fälschlicherweise über die Herkunft der Sklaven<br />
aufgestellten Behauptung. (Siehe dazu auch die Seite 461 dieser Arbeit.) In der Einleitung zum Kapitel "Musik<br />
in Schwarzafrika " schreibt der Autor auf der Seite 114:<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Afrika: geheimnisvolle Rituale und Zauber, dumpfe Trommeln, ekstatische Tänze, wilde Tiere. So oder ähnlich ist unsere<br />
Vorstellung von einem Kontinent, den wir meist nur aus dem Reiseprospekt kennen. Wenn man Afrikaner persönlich<br />
kennenlernt, mit ihnen redet, lacht, tanzt oder ihrer Musik lauscht, dann verändert sich dieses einseitige Bild, dann erfährt<br />
man mehr von dem modernen Afrika, seinen <strong>Pro</strong>blemen, der Faszination seiner Kultur, der Liebenswürdigkeit und<br />
Offenheit seiner Bewohner. Zwar gibt es weiterhin viel Geheimnisvolles in Afrika, aber im heutigen Afrika steht an erster<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 462
Stelle die harte tägliche Arbeit für den Broterwerb: auf dem Feld, auf dem Markt, im Handwerksbetrieb, in der Fabrik.<br />
Afrika ist der zweitgrösste Kontinent und umfasst ein Fünftel der Landfläche der Erde. Seine etwa 610 Mio. Einwohner<br />
teilen sich in ca. 1'000 verschiedene Völker mit jeweils eigener Sprache, eigenen Liedern, Tänzen, Musikformen,<br />
Instrumenten, eigenen Märchen und Erzählungen - eine unüberschaubare kulturelle Vielfalt.<br />
Der Autor spricht das auf Vorurteilen basierende Bild an, welches er in den Köpfen seiner Leser vermutet und<br />
versucht dieses mit der Bemerkung, dass in Afrika an "erster Stelle die harte tägliche Arbeit für den Broter-<br />
werb" stehe, zu korrigieren. Dabei erwähnt er auch die "unüberschaubare kulturelle Vielfalt". Weiter schreibt<br />
er:<br />
Dennoch gibt es bei vielen Völkern im Bereich südlich der Sahara, dem eigentlichen Schwarzafrika, eine Reihe von<br />
vergleichbaren Prinzipien, nach denen sie ihre Musik gestalten. Die beliebteste Musikform ist das Lied. Meist wird es von<br />
einem oder mehreren Instrumenten begleitet. Daneben gibt es auch unzählige Formen von unbegleitetem Gesang,<br />
beispielsweise von einer oder zwei Sängerinnen oder von einem Chor vorgetragen. Die Melodien der Lieder sind in den<br />
über tausend verschiedenen Völkern Afrikas völlig unterschiedlich aufgebaut. Eine für alle verbindliche Liedform oder<br />
auch Skalenform gibt es nicht...<br />
Die Musik Schwarzafrikas ist also keinesfalls, wie oft gedacht, nur Trommelmusik. Noch auf der Seite 114<br />
beschreibt der Autor unter der Überschrift "Oliaku" ein erstes Musikbeispiel des nigerianischen Musikers Meki<br />
Nzewi:<br />
Lieder sind in der Regel bestimmten sozialen Gruppen und bestimmten Anlässen zugeordnet. So gibt es beispielsweise<br />
Lieder für Kinder, für junge Mädchen, für erwachsene Frauen (Mütter), für verheiratete Männer, für alte Frauen oder<br />
Männer. Nur in Ausnahmefällen hat ein Lied eine Bedeutung für alle Altersgruppen. Lieder entstehen im Zusammenhang<br />
des Alltagslebens. Sie erzählen Geschichten, in denen die Weltanschauung eines Volkes, seine Wertvorstellungen, Sitten,<br />
Gebräuche, Rituale verschlüsselt oder offen zum Ausdruck gebracht werden. Oder sie werde einfach nur zum Vergnügen,<br />
zur Unterhaltung oder beim Tanzen gesungen.<br />
Das Lied "Oliaku" stammt aus Nigeria. Die Sprache ist Igbo. Es ist ein langsames Tanzlied und bewundert die schönen<br />
Tanzbewegungen von Oliaku, einer jungen Frau...<br />
Auf der Seite 115 ist das erwähnte Lied im Notendruck abgebildet, zusätzlich bildet die Seite ein Foto "Frau<br />
beim Tanzen in Nsugbe (Ostnigeria)" ab, das die für Frauen aus einfacheren Schichten typische Kleidung in<br />
Westafrika zeigt: zu einer Bluse und einem um die Hüfte geschlungenen Tuch, trägt die Frau ein passendes<br />
kunstvoll um den Kopf gewickeltes Tuch. Diese Art von Kleidung wird für Mädchen auch in der Schule für<br />
die Tanz- und Musikstunde bevorzugt.<br />
Ein weiteres Musikbeispiel wird auf der Seite 116 vorgestellt: der Gigbo. Dazu sind die Noten eines Begleitar-<br />
rangements abgedruckt, ebenso wie ein Foto, der in dieser Musik aus Ghana verwendeten "Oblente-Drums".<br />
Im Text schreibt der Autor:<br />
Der "Gigbo" ist ein traditioneller Tanz, der in Ghana bei bestimmten sozialen Anlässen aufgeführt wurde. Er stammt aus<br />
Liberia und wurde schon im 19. Jahrhundert in Ghana populär...<br />
Die Seite 117 zeigt ein weiteres Begleitpattern und zwei Fotos "Westafrikanische Musikinstrumente" und "Der<br />
Master-Drummer Aja-Addy mit einer Talking Drum". Der abgebildete Musiker wird im Lehrerband 3 zum<br />
Lehrmittel zitiert (siehe weiter unten).<br />
Die Seite 118 druckt ein Stück "N'ike N'ike" ab, dazu schreibt der Autor:<br />
Das Gigbo-Arrangement wird in dieser oder in variierter Form gerne als Begleitung zum sogenannten Highlife gespielt.<br />
Highlife ist ein Tanzstil und eine Musik, die in den 50er und 60er Jahren zur beliebtesten Tanzmusik in Westafrika,<br />
insbesondere in Ghana und Nigeria, wurde. Als 1960 Nigeria seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht England<br />
errang, wurde kurz danach der Song "N'ike N'ike" zum nationalen Hit. Der Text wollte Mut machen zum gemeinsamen<br />
ökonomischen und politischen Aufbau des Landes: "N'ike n'ike kanalu olu ...". "Ruhig und stetig verrichten wir unsere<br />
Arbeit...". Die damals bekannteste Version des Songs wurde von der "Band of the Nigeria Police", einer Big Band mit 72<br />
Musikern eingespielt...<br />
Im Lehrmittel wurde das Lied mit einem anderen, englischen Text versehen.<br />
5.2.18.3 Musik hören, machen, verstehen 3 - Lehrerband<br />
In der Beschreibung zum Kapitel "Afrikanische Wurzeln" des Jazz, schreibt der Autor auf der Seite 56 zu<br />
einem der Hörbeispiele "Rwakanembe" der Banyoro (Ruanda-Burundi):<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
...Das berühmte Makondere-Ensemble der Banyoro aus dem Bereich des heutigen Uganda und Rwanda spielte<br />
ursprünglich nur zu feierlichen Anlässen am Königshofe. Es handelt sich also um eine sozial sehr hochstehende rituelle<br />
Musik...<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 463
Im Kommentar für die Lehrkraft verweist der Autor unter dem Titel "Musik in Schwarzafrika" auf der Seite<br />
102 auf das Buch "Musik in Schwarzafrika" von Walter Schütz, dass einen tieferen Einstieg in die "unglaub-<br />
lich grosse Fülle afrikanischer Musikstile" geben könne. Auf der Seite 103 bespricht der Autor die benutzten<br />
Instrumente des im Schülerband 3 (S. 116) vorgestellten Gibgo. Genannt werden dir Trommeln Djembe,<br />
Kpanlogo und Oblente, sowie die Glocke, die Kalabash (Kürbisrassel) und die Basstrommel.<br />
Auf der Seite 104 wird der im Schülerband 3 auf der Seite 117 abgebildete ghanaische Meistertrommlers Aja<br />
Addy näher vorgestellt:<br />
...Er ist ein inzwischen auch in Europa berühmter Master-Drummer aus dem Volk der Ga in Ghana. Gleichzeitig ist Aja<br />
Addy Priester der Tigari-Religion, einer traditionellen afrikanischen Religion. Seine Musik ist für ihn viel mehr als nur<br />
Unterhaltung. Sie hat für ihn spirituelle, wir würden sagen philosophische Bedeutung. Aja Addy hat die Philosophie seiner<br />
Musik selbst in Worte gefasst:<br />
"Geduld geht verloren in einer Welt mit einer ständig wachsenden Informationsmenge. Die Menschen verlieren sich in<br />
ihrer eigenen Unruhe und Ungeduld. Musik kann eine heilende Kraft sein, um die Kraft der Geduld wiederzuentdecken.<br />
Du kannst Deinen Körper zur Musik bewegen und augenblicklich beginnst Du Dich zu entspannen. Augenblicklich<br />
empfindest Du Glück.<br />
Wenn ich mehr als zwei Tage lang keine Trommel gespielt habe oder mindestens Musik gehört habe, beginne ich, krank zu<br />
werden. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Mein Grossvater war Priester und mein Vater war ein Trommler. Als<br />
Tigari-Priester weiss ich, dass Musik Medizin ist. Lausche der Musik! Fang' an zu lächeln, und Geduld kommt<br />
unwillkürlich zu Dir zurück. Die Kraft der Musik, des Rhythmus und des Tanzes bereitet Dir den Weg zur Geduld".<br />
Der Lehrerkommentar zu "Musik machen, hören, verstehen 3" ist der einzige Band unter allen untersuchten<br />
Musiklehrmitteln, in dem ein schwarzafrikanischer Musiker traditioneller Ausrichtung zitiert wird, nur im<br />
Schülerband 2 des gleichen Lehrmittels kommt noch ein südafrikanischer Musikfachmann zu Wort, der aber<br />
nicht eindeutig als Schwarzafrikaner identifiziert werden kann.<br />
In den Anmerkungen zum im Schülerband 3 auf der Seite 118 vorgestellten Lied "N'ike N'ike" schreibt der<br />
Autor auf der Seite 104:<br />
Das Lied "Nike Nike" kennt jeder Nigerianer. Es war einer der grössten Highlife-Tanzhits in den 60er Jahren. "Das Wort<br />
Highlife wurde von Leuten erfunden, die sich um die Tanzclubs herum aufhielten,... um die Paare zu sehen und zu hören,<br />
die sich dort vergnügten... Die Leute draussen nannten es Highlife, da sie selbst nicht zur Schicht derer gehörten, die<br />
hineingingen, die nicht nur einen relativ hohen Eintritt zu zahlen hatten..., sondern dazu noch Abendkleidung tragen<br />
mussten, einschliesslich einem Zylinder, falls sie sich den leisten konnten"... Nach dieser Aussage eines Zeitzeugen im<br />
Ghana der 20er Jahre war Highlife also nichts anderes als die Bezeichnung für die Tanzmusik der Upper Class in den<br />
damaligen englischen Kolonien (zu denen auch Nigeria zählte). Diese war geprägt vom Stil der gehobenen Tanzmusik in<br />
den USA und in England (Foxtrott, Walzer, Quickstep, Charleston, später Swing).<br />
Erst in den 50er und 60er Jahren entwickelte sich daraus eine spezifische schwarz-afrikanische Tanzmusik. Wegbereiter<br />
war E.T. Mensah mit seiner Tempos Band (in Ghana)...<br />
Trotz der Vielzahl von regionalen Ausprägungen blieben diese beiden Hauptformen bis heute stilprägend:<br />
1. Tanz-Bands, in denen die Bläser (Saxophone, Trompeten, Posaunen) dominierten. Ihr Stil ist westlich orientiert mit<br />
starken Einflüssen der afro-kubanischen Tanzmusik...<br />
2. Gitarrenbands, die in der Rhythmik, Melodik, vor allem auch in der Besetzung (afrikanische Perkussion) aber auch der<br />
Spielweise der Instrumente roots-orientierter waren.<br />
In den 70er Jahren hatte sich in Nigeria ein Highlife-Stil durchgesetzt, der regionale Rhythmen mit dem Gitarrenstil aus<br />
Zaire verband. In Zaire war die Gitarre schon früh an die Stelle des äusserst beliebten Daumenklaviers (der Mbira) getreten<br />
und populär geworden...<br />
Der Highlife-Tanzschritt ist aufgrund der Tatsache, dass er zunächst nur von der Upper Class getanzt wurde, sehr 'cool'.<br />
Ruhige Bewegungen des Oberkörpers, Kopf hoch, Blick nach vorne, kleine Schritte in den Füssen...<br />
In Ghana gehört der Highlife immer noch zu den beliebtesten Tanzformen, vor allem der älteren Leute in den<br />
Städten, obwohl sich die Jugend zunehmend an den aus Amerika kommenden neueren Tanzformen orientiert.<br />
Nach wie vor gehört es aber zur Pflicht eines Teilnehmers der in Ghana beliebten "Dancing contests" die von<br />
verschiedenen Firmen, teilweise landesweit durchgeführt werden, neben einer freien Vorführung des Könnens,<br />
einen Highlife mit obligatem Taschentuch und meist in der traditionellen Kleidung der Aschanti aufzuführen.<br />
5.2.18.4 Zusammenfassung<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Die Bände des Lehrmittels "Musik hören, machen verstehen" geben anhand von Beispielen aus Südafrika,<br />
Tschad, Nigeria, Ghana, Uganda und Ruanda einen breiten Einblick in die Musik Schwarzafrikas. Der Autor<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 464
spricht vermutete Klischees wie "geheimnisvolle Rituale und Zauber, dumpfe Trommeln, ekstatische Tänze"<br />
bewusst an und weist darauf hin, dass in Afrika "die harte Arbeit für den Broterwerb" an erster Stelle stehe.<br />
Zu der Bedeutung der Musik, lässt er auch einen schwarzafrikanischen Musiker zu Wort kommen, der über die<br />
Musik sagt: "Die Kraft der Musik, des Rhythmus und des Tanzes bereitet Dir den Weg zur Geduld."<br />
Der Autor zeichnet das Bild eines hart arbeitenden Schwarzafrikaners, der einen Teil seiner Kreativität in der<br />
Musik lebt, neue Einflüsse in seine eigene Kultur integrierten kann, ohne die traditionellen Werte ganz zu<br />
verlieren.<br />
5.2.19 Vom Umgang mit dem Fremden (1996)<br />
Das in einem "Materialienband für Schülerinnen und Schüler" und dem Band "Anregungen für den Unterricht"<br />
für Lehrkräfte vorliegende Lehrmittel, welches den Untertitel "Treffpunkte aussereuropäischer und europäi-<br />
scher Musik" trägt, geht auf den insgesamt 216 Seiten verschiedentlich auf die Musik Schwarzafrikas ein. Laut<br />
dem Abschnitt "Intentionen" im Band "Anregungen für den Unterricht" auf der Seite 26, sollen unter anderem<br />
folgende beiden Ziele erreicht werden:<br />
- Es soll die Einsicht vermittelt werden, dass Verstehen von Musik kulturgebunden ist.<br />
- Der Unterricht soll zur Anerkennung des Fremden beitragen.<br />
Diese Ziele versucht der Autor, Ernst Klaus Schneider, mit einer "Einführung in die Kursthematik" und dem<br />
Vergleich von verschiedenen Musikstücken in den Kapiteln "Musik als Wiederholung" und "Musik für Flöte<br />
allein" zu erreichen.<br />
5.2.19.1 Dem Fremden begegnen (1996)<br />
Im Materialienband schreibt Schneider unter dem Titel "Einführung in die Kursthematik: Ansichten - Bilder<br />
von Fremden":<br />
Begegnungen mit dem Fremden gehören längst zum Alltäglichen. Sie sind keine Frage der Entfernung, sondern spielen<br />
sich in unmittelbarer Nähe ab. Dabei vollzieht sich oftmals ein erstaunlicher Vorgang: Das anfänglich Fremde kann wenig<br />
später als Alltägliches und Vertrautes erscheinen... Was zunächst fremd erscheint, muss nicht fremd bleiben. Was dem<br />
einen fremd ist, mag dem anderen daneben vertraut sein. Umgekehrt kann das Vertraute dem einzelnen fremd werden. Das<br />
Fremde ist nichts Objektives; es schillert zwischen Verlockung, Gewöhnung und Abwehr. Der Umgang mit ihm kann<br />
<strong>Pro</strong>bleme aufwerfen, die nicht unterschätzt werden dürfen... An der Musik lässt sich erfahren, wie andere Menschen mit<br />
dem Fremden umgegangen sind. Wie in einem Spiegel lassen sich Verhaltensweisen erfassen und als <strong>Pro</strong>bleme bearbeiten,<br />
die allgegenwärtig sind...<br />
Weiter führt der Autor aus, dass "die Berührungen an den Grenzsäumen zwischen den Kulturen... bei den<br />
Europäern zu einer Reihe von höchst unterschiedlichen Reaktionen" führten und führen würden. Als solche<br />
zählt er auf den Seiten 4 und 5 des Materialienbandes auf:<br />
- Das Fremde wird verteufelt...<br />
- Das Fremde erscheint als Vorstufe zu höher entwickelten Kultur. Die höchste Stufe repräsentiert die europäische<br />
Kultur:.. Daraus lässt sich ableiten, dass... die fremden Kulturen entwickelt und europäisch erzogen werden müssen,<br />
damit auch sie an den Segnungen abendländischer Kultur Anteil haben können...<br />
- Das Fremde ist das Faszinierende und Verlockende, dessen Sog so stark ist, dass es an die Stelle des eigenen tritt...<br />
- Das Fremde und das Eigene verschmelzen in einer universal gedachten Kultur...<br />
- Im Umgang mit dem Fremden geht es um Bewusstsein und Anerkennung des Fremden und um die Entwicklung eines<br />
Selbstverständnisses, das das Fremde als solchen anerkennt und mit ihm umgehen kann...<br />
Schneider gibt also eine kurze Analyse der Verhaltensweisen gegenüber Fremden wieder. Diese konnten auch<br />
in der Untersuchung der Geographie- und Musiklehrmittel teilweise nachvollzogen werden. (Siehe dazu den<br />
Teil "Ergebnisse der Untersuchung" ab der Seite 494 dieser Arbeit.) Nach dieser Einführung und dem<br />
Bewusstmachen der grundsätzlichen Schwierigkeiten stellt Schneider verschiedene Musikbeispiele vor, die<br />
den Umgang mit dem Fremden erleichtern helfen sollen.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 465
5.2.19.2 Westafrikanische Musik auf drei Eisenglocken<br />
Im Kapitel "Musik als Wiederholung: Dasselbe - immer wieder" (S. 18-19) beschreibt der Autor als eines von<br />
vier Musikbeispielen, eine "Musik für drei Eisenglocken" aus Westafrika, die anderen Beispiele sind Steven<br />
Reichs "Clapping Music", Bobby McFerrins "Medicin Man" und Robert Schumanns "Kind im Einschlummern<br />
aus 'Kinderszenen'".<br />
Neben einer allgemeinen Einführung findet sich dazu auf der Seite 18 ein Foto: Ein Afrikaner aus Westafrika<br />
mit einer Einfachglocke", das einen Schwarzafrikaner in dem für Westafrika typischen langen und bunt gemu-<br />
sterten Hemd zeigt. Auf der Seite 19 wird unter dem Zitat "Rhythmus ist eine Kraft, die uns durch die Sinne an<br />
der Wurzel unseres Seins erfasst" nach Senghor die "westafrikanische Musik mit drei Eisenglocken" in der<br />
üblichen Notation abbildet.<br />
Diese Musik wird im Band "Anregungen für den Unterricht" auf der Seite 27 als "Musik für einen Häuptling...<br />
aufgenommen in Kpouébo im Juli 1965", also an der Elfenbeinküste, bezeichnet. Auf der Seite 29 schreibt<br />
Schneider dazu:<br />
...Wer mit der Sprache der Baule vertraut ist, kann die Musik als Sprache verstehen. Darin deutet sich an, dass Musik keine<br />
weltweit verständliche Sprache ist, angemessenes Verstehen einer fremden Musik aber durch die Beschäftigung mit einer<br />
Kultur, vor allem durch das Leben in dieser Kultur erlernt werden kann.<br />
- Diese Musik gehört in einen fest umrissenen sozialen Zusammenhang: sie dient der Repräsentation des Häuptlings eines<br />
bestimmten Stammes: Die Musiker gehören zu seinem Gefolge. Angesichts dieser Funktion werden an das Spiel hohe<br />
künstlerische Ansprüche gestellt...<br />
- Die Musik hat lokale Bedeutung für den einzelnen oder für die Gemeinschaft. Dazu gehören auch mündliche Tradierung<br />
und das Fehlen der Zuschreibung zu einem besonders ausgewiesenen Komponisten...<br />
- Die Musik ist hier keine selbständige Kunst, sondern hat als ein Gebrauchsgegenstand "ihren Sitz im Leben"...<br />
Auf den Seiten 20 und 21 des Materialienbandes folgen vier Zitate verschiedener Musiker, darunter auch einer<br />
aus Westafrika. Diese Zitate sollten im Unterricht als Diskussionsgrundlage für die Schüler dienen. Stellvertre-<br />
tend für den Umgang mit diesem Material soll hier nur dasjenige auf der Seite 21 von Eduard Hanslick nach<br />
"Walter Wiora, Ergebnisse und Aufgaben vergleichender Musikforschung, Darmstadt 1997, S. 58" wiederge-<br />
geben werden:<br />
Die kontemplative ist die einzig künstlerische, wahre Form des Hörens; ihr gegenüber fällt der rohe Affekt des Wilden und<br />
der schwärmende des Musik-Enthusiasten in eine Klasse. [...] Halbwach in ihren Fauteuil geschmiegt, lassen jene<br />
Enthusiasten von Schwingungen der Töne sich tragen und schaukeln, statt sie scharfen Blickes zu betrachten. [...] Vom<br />
gedankenlos gemächlichen Dasitzen der Einen bis zur tollen Verzückung der Andern ist das Prinzip dasselbe: die Lust am<br />
Elementarischen der Musik. [...] Je kleiner der Widerhalt der Bildung, desto gewaltiger das Dreinschlagen solcher Macht.<br />
Die stärkste Wirkung übt Musik bekanntlich auf Wilde.<br />
Im Band "Anregungen für den Unterricht" schreibt der Autor zu dem aus dem Jahre 1854 stammenden Zitat<br />
auf den Seiten 30-31 dazu:<br />
Inn den Äusserungen Eduard Hanslicks sind... Eurozentrismus und die Vorstellung einer linearen Evolution erkennbar...<br />
Weit ausführlicher geht er auf ein anderes der abgedruckten Zitate von Robert Lach, in dem dieser "75 Jahre<br />
später" noch ähnlich argumentiert (S. 29-30):<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
...R. Lach verknüpft jedoch seine Beobachtungen mit einer Bewertung, denn er zeigt am Beispiel der Wiederholung, dass<br />
sich die Kultur "von den tiefsten Stufen bis zu den letzten höchsten Gipfeln menschlicher Kunstmusik" in steigernder Form<br />
entwickelt. Darin spiegelt sich ein entwicklungsgeschichtliches Denken, das die Musik von Kindern und von Naturvölkern<br />
als Vorform der europäischen Kunstmusik ansieht... Neben der ideologisch verengten und europäisch zentrierten<br />
Vorstellung von der Evolution des Menschen wird erkennbar, dass R. Lach<br />
- die damals Neue Musik in Europa nicht ernstnahm oder nicht kannte,<br />
- die hohe Differenziertheit der Musik von "Naturvölkern" ebenfalls nicht kannte,<br />
- nur das Musikimmanente beachtete und nach Strukturidentitäten suchte, dabei den kulturellen Zusammenhang der<br />
Musik völlig ausser acht liess...<br />
Zu diesem Eurozentrismus und zur Vorstellung R. Lachs von der Evolution gibt es längst begründete Gegenpositionen.<br />
"Die strukturale Anthropologie zerschlägt grundsätzlich die Unterscheidung von primitiven Kulturen und Hochkulturen",<br />
schreibt Gernot Böhme und fragt weiter "Was ist nun aus der ethnologischen Erfahrung des Anderen für unser<br />
Selbstverständnis zu lernen?" Und er antwortet: "Das erste ist natürlich der Kulturrelativismus. Menschsein tritt nur in einer<br />
bestimmten kulturellen Ausprägung in Erscheinung. Wir müssen damit rechnen, dass wir anderen Kulturen ebenso<br />
komisch, bizarr und phantastisch erscheinen wie diese uns."<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 466
Auf der Seite 22 des Materialienbandes schafft ein Zitat Steve Reichs den Bezug zwischen der Musik für die<br />
Eisenglocken und seiner "Clapping Music", indem Schneider in zu Wort kommen lässt:<br />
"1970 war ich drei Monate in Accra, um bei [...] einem Meistertrommler [...] westafrikanische Trommeltechniken zu<br />
studieren. Ich finde, dass man sich nur auf diesem Wege der nichtwestlichen Welt nähern kann. Indem man das Spiel und<br />
dessen Regeln lernt, gelingt es einem, das was man spielt, zu analysieren, und man entdeckt ganz andere rhythmische<br />
Systeme, andere Tonsysteme und natürlich für und ganz neue Instrumentaltechniken..."<br />
Mit diesem Zitat Reichs, das noch einmal auf die Schwierigkeit eine fremde Musikkultur zu verstehen, ohne<br />
sich eingehend mit dieser zu befassten, eingeht, schliess der Autor das Kapitel "Musik als Wiederholung" ab.<br />
5.2.19.3 Flötenspiel aus Burundi<br />
Im zweiten Kapitel des Materialienbandes "Flötenspiel zum Zeitvertreib..." schreibt der Autor auf der Seite 30<br />
unter der Überschrift "Flötensolo eines Hirten, aufgenommen in Burundi (Schwarzafrika)":<br />
Das Flötenspiel eines Hirten in Burundi gibt uns ein Beispiel für das enge Ineinanderwirken von Musik mit anderen<br />
Tätigkeiten, wie es in vielen Teilen Afrikas noch heute typisch ist. Vor nicht sehr langer Zeit waren bei uns ähnliche<br />
Zusammenhänge zu beobachten...<br />
Schneider denkt hier wohl an die einstmals auch in Europa gebräuchlichen Worksongs. Weiter fährt er fort:<br />
Die Hirten Burundis fertigen ihre Flöte umwirongi aus Materialien an, die in ihrer Umgebung wachsen und die von Natur<br />
aus innen hohl sind (Bambus, Lobelie). Die Hirten kürzen das Rohr auf eine ihrer Meinung nach passende Länge. Am<br />
unteren Ende brennen sie nach Augenmass bzw. Griffgefühl zwei bis vier Grifflöcher ein. Am oberen Rand wird als<br />
Schneidekante zum Anblasen eine U- und V-förmige Einkerbung angebracht.<br />
Die Beschreibung der Herstellung anderer Musikinstrumente findet sich nur noch in "Spielpläne Musik" von<br />
1992-1994 unter all den beschriebenen Musiklehrmitteln.<br />
In einem ersten Text auf der Seite 30 aus "Jos Gansemans/ Barbara Schmidt-Wrenger, Zentralafrika., Musik-<br />
geschichte in Bildern, Bd. 1/9, Leipzig S. 152" heisst es zu dem auf der folgenden Seite abgebildete Notenbei-<br />
spiel "Solo auf einer Hirtenflöte, aufgenommen 1967 in Bugarama/Burundi", das durch ein Foto "Hirte mit der<br />
Längsflöte umwirongi" illustriert wird:<br />
Die rwandischen Hirten spielen tagsüber während des Weideaustriebs der Herde auf dieser Flöte, um sich Zerstreuung zu<br />
verschaffen und sich in der Einsamkeit die Zeit zu vertreiben, aber auch, um dem Vieh beim Grasen das beruhigende<br />
Gefühl des Bewachtwerdens und der Sicherheit in der Wildnis zu geben. Die von mir befragten Hirten behaupteten, dass<br />
der Ton der umwirongi die Diebe und Raubtiere, die um die Herden herumstreichen, abschreckt, die Zauberer, die die<br />
Tiere verhexen und ihnen Krankheiten zufügen, fernhält und die Wachsamkeit der Hüter erhöht. Nachts, wenn sich die<br />
Tiere in der Koppel befinden, greifen die Hirten ebenfalls zur Flöte, um sich zu unterhalten und von <strong>Pro</strong>blemen des Alltags<br />
abzulenken. So spielen die Hutu-Hirten eine Melodie mit dem Titel "Die zänkische Ehefrau", in der sie einen Ehestreit<br />
imitieren. Die hohen Töne geben die Rede der Frau, die tiefen Töne die Antworten des Mannes wieder. Je nachdem, ob die<br />
Erwiderungen zunehmend lebhafter werden, sich beruhigen oder wieder aufflackern, wird der Dialog - wie in ehelichen<br />
Auseinandersetzungen - zur Diskussion, zum Streit, zur Drohung, zum Flehen und zur Versöhnung. Die Tatsache, dass die<br />
Zuhörer verstehen, was ausgesagt werden soll, dass sie die Fötenmelodien in die gesprochene Sprache "übersetzen"<br />
können, macht diese Musik noch realistischer. [...]<br />
Damit spricht Schneider ein Beispiel an, das sich weit von der in "Knaurs Weltgeschichte der Musik" vertrete-<br />
nen Meinung, die Musik Schwarzafrikas sei ein "unbewusst angewandtes Ausdrucksmittel" wegbewegt. Zur<br />
weiteren Funktion der Flöte schreibt Schneider:<br />
Ausser ihrer Verwendung beim Weideaustrieb hat sich die umwirongi auch in den Städten durchgesetzt, wo man sie<br />
beispielsweise in den Händen der Nachtwächter findet. die die nächtliche Stille mit ihrem Spiel unterbrechen. Auch<br />
Körperbehinderte, besonders Blinde, musizieren in den Stadtzentren auf diesem Instrument, um Mitleid und<br />
Grosszügigkeit bei den Vorübergehenden zu wecken.<br />
Jungen Mädchen war es untersagt. Flöte zu spielen. da man fürchtete, dass ihre Herzen leer (oder hohl), das heisst, dass die<br />
Mädchen dumm werden könnten. [...]<br />
In Anbetracht ihrer musikalisch-soziologischen Funktion benutzt man die Längsflöte umwirongi am häufigsten als<br />
Soloinstrument.<br />
Das Lehrmittel "Musik hören, machen, verstehen" von 1993 (Bd. 2, S. 142) zitiert den gegenteiligen Fall, in<br />
dem es nur den Frauen erlaubt ist, eine gewisse Art von Musik zu produzieren, und im Lehrmittel "Spielpläne<br />
Musik" (Lehrerbd. 7./8. Klasse, S. 241) wird ein Instrument vorgestellt, das zwar von den Mädchen gespielt<br />
wird, aber nur von einem Jungen gebaut werden darf.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 467
Ein weiterer Text aus "Gerhard Kubrik, Beziehungen zwischen Musik und Sprache in Afrika" auf der Seite 32<br />
geht auf die Eigenart der "verbalen Bedeutung" der gespielten Melodien und die Eigenart gewisser afrikani-<br />
scher Sprachen ein:<br />
...Woher kommt es, dass Worte hinter den Melodien" rein instrumentaler Stücke [...] stehen können?<br />
Hauptsächlich daher, dass die meisten Sprachen afrikanischer Völker Tonsprachen sind. In Tonsprachen haben alle<br />
Wortsilben bestimmte Toneigenschaften: hohe, mittlere oder tiefe Sprachtöne. Wird nun auf einem Instrument irgendeine<br />
beliebige Melodie gespielt, so erregt sie bei einem Afrikaner mit Tonsprache oft sprachliche Assoziationen. Wortfolgen,<br />
deren Sprachmelodik mit der Melodie des Instrumentalstückes übereinstimmen, werden erregt und gesellen sich zur<br />
Melodie als Einfall...<br />
(Zur Tonsprache siehe auch die Seiten 449 476 dieser Arbeit.) In einem weiteren Text aus "Gerhard Kubrik,<br />
Verstehen afrikanischer Musikkulturen" heisst es:<br />
...Für einen Aussenstehenden ist es unmöglich, durch Anhören von Tonmaterial allein zu einem intrakulturell richtigen<br />
Verstehen zu gelangen. Auch wenn er es nicht zu tun glaubt, verhält er sich zu dem neuen Material zunächst entsprechend<br />
seiner eigenen Musikkultur.<br />
Schneider betont mit diesem Zitat also, dass bei der Beschäftigung mit der schwarzafrikanischen Musik das<br />
Hintergrundwissen über die Umstände in der diese Musik erklingt, eine Voraussetzung für das Verstehen<br />
dieser ist. Wohl aus diesem Grund geben die meisten der untersuchten Musiklehrmittel im Bereich Musik, die<br />
Bände aus der Schweiz gehören nicht dazu, zu den vorgestellten Beispielen auch immer Hintergrundinforma-<br />
tionen weiter.<br />
Der Band "Anregungen für den Unterricht" geht auf den beiden Seiten 42-43 auf das "Flötensolo eines Hirten"<br />
ein. Auf der Seite 42 schreibt der Autor über die Wirkung der Aufnahme des Flötenspiels auf die Bedeutung<br />
dieser Musik:<br />
Der Hirte, der in Bugarama (Burundi) auf seiner Flöte geblasen hat und der, weil sein Name im Schallplattentext nicht<br />
übermittelt wird, anonym bleibt, musizierte bei der Hütearbeit für sich selbst. Musik und Musikmachen waren bei ihm eins.<br />
Sein Spiel besass für ihn Gebrauchswert. Mit der Tonaufnahme dieses Spiels am 11. Juli 1967 wurde diese Musik als<br />
Momentaufnahme festgehalten. Durch Verlangsamung der Aufnahme und Transkription ins Notenbild wurde es möglich,<br />
diese Musik nunmehr wie ein ästhetisches Objekt zu analysieren und sich ihr aus Erkenntnisinteresse in einer Weise<br />
zuzuwenden, wie es der Hirte selbst nie getan hätte. Damit erfassen wir aber nur einen Ausschnitt aus der ursprünglichen<br />
musikalischen Wirklichkeit...<br />
Anschliessend folgt eine kurze Analyse des Tonmaterials und der Spielweise, sowie der verwendeten Patterns,<br />
die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter von Bedeutung ist.<br />
5.2.19.4 Zusammenfassung<br />
Schneider spricht in "Vom Umgang mit dem Fremden" anhand von zwei Musikbeispielen aus Schwarzafrika<br />
die rituelle Bedeutung und den Gebrauchswert der vorgestellten Musik an. In seiner Analyse wird die schwarz-<br />
afrikanische Musik aus dem gleichen Blickwinkel betrachtet wie die mit ihr verglichenen Musikbeispiele aus<br />
den verschiedensten Quellen.<br />
Die eurozentrische Sichtweise, die "primitive" Musik Schwarzafrikas müsse sich hin zur Kunstmusik der west-<br />
lichen Länder entwickeln, lehnt Schneider ab, statt dessen plädiert er für eine "Anerkennung des Fremden".<br />
Dabei versucht er sich auf eine Beschreibung der im Bezug auf die schwarzafrikanischen Menschen gemach-<br />
ten Beobachtungen zu beschränken.<br />
Musiklehrmittel: Weitere Schulbücher<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 468
5.3 Vorgestellte Instrumente und Länder<br />
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die in den Musiklehrmitteln vorgestellten Instrumente, auf<br />
einen Einbezug der untersuchten Geographielehrmittel wurde verzichtet, da diese nur wenige Musikinstrumen-<br />
te überhaupt erwähnen: In der ersten Spalte wird der Name des Lehrmittels, sowie dessen Erscheinungsjahr(e)<br />
angegeben. Die Spalten 2-5 geben die Anzahl unterschiedlicher im Text erwähnter oder abgebildeter schwarz-<br />
afrikanischer Musikinstrumente an, wobei I für Idiophone, M für Mebranophone, C für Cordophone und A für<br />
Aerophone steht. Die Spalten 6 und 7 geben die Anzahl der Musikbeispiele, die entweder als Hörbeispiel oder<br />
in notierter Form im betreffenden Lehrmittel vorgestellt werden: T steht für traditionelle Stücke, P für Popmu-<br />
sik, respektive moderne Stücke. In der letzten Spalte werden die Länder oder Regionen, in Klammern, aus<br />
denen die Beispiele stammen notiert, so weit dies aufgrund der in den Lehrmitteln gemachten Angaben<br />
möglich war.<br />
Tabelle: Musikinstrumente und Länder aus denen erwähnte Musikbeispiele stammen<br />
Lehrmittel (Jahr) Instrumente Musikbeispiele<br />
I M C A T P Land<br />
Knaurs Weltgeschichte der Musik (1979) 5 >1 3 3 1 0 Kongo,<br />
Geschichte der Musik (1980) 0 0 0 0 1 0 Kongo<br />
Die Musik (1983) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Das grosse Buch der Musik (1984) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musik-Geschichte im Überblick (1985) 0 0 0 0 0 0 -<br />
dtv-Atlas zur Musik (1987) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musikinstrumente der Welt (1988) >5 >5 >5 >5 0 0 verschiedene<br />
Unser Liederbuch - Musik um uns (1986) 0 0 0 0 1? 0 Südafrika<br />
Musik um uns - Klassen 5 und 6 (1991) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musik um uns - 7.-10. Schuljahr (1975) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musik um uns - 7.-10. Schuljahr (1979) 0 1 0 0 0 0 -<br />
Musik um uns 3 (1995) 0 1 0 0 0 0 -<br />
Musik um uns - 11.-13. Schuljahr (1981) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musik um uns - 11.-13. Schuljahr (1985) 6 >1 4 10 2 0 Ghana, Elfenbeinküste<br />
Musik um uns - für Klasse 11 (1988) 6 >1 4 10 2 0 Ghana, Elfenbeinküste<br />
M. um uns - Sekundarbereich II (1996) 6 >1 4 10 2 0 Ghana, Elfenbeinküste<br />
Schweizer Singbuch Unterstufe (1988) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Schweizer Singbuch Mittelstufe (1980) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Schweizer Singbuch Oberstufe (1968) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musik auf der Oberstufe - Liedteil (1979) 0 0 0 0 1? 0 Südafrika<br />
Musik auf der Oberstufe (1987) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musik auf der Oberstufe (1988) 0 0 0 0 2? 0 Südafrika<br />
MO - Lieder, Tänze, Musikstücke (1988) 0 0 0 0 2? 0 Südafrika<br />
Schulmusik konkret (1991) 0 0 0 0 0 0 -<br />
250 Kanons (1996) 0 0 0 0 3? 0 Nigeria<br />
1000 chants (1975) 0 0 0 0 5 0 Kongo, Südafrika, Elfenbeinküste,<br />
Musikunterricht (1979) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musikstudio (1980-1982) 2 >1 2 0 10 0 Nigeria, Kamerun, Guinea, Ghana, (Südafrika), (Ostafrika),<br />
Lied international (1982) 0 0 0 0 4 0 Ägypten, Tunesien, Simbabwe<br />
Erlebnis Musik (1985) 0 0 0 0 0 0 -<br />
Musik-Kontakte (1983-1987) 0 0 0 1 0 0 -<br />
Musicassette (1990-1992) 1 2 2 0 5 0 Liberia, Kongo, Nigeria<br />
Singen Musik (1992) 0 0 0 0 1 0 Ghana<br />
Spielpläne Musik (1992-1994) 0 0 1 1 7 0 Äthiopien, Nigeria<br />
Klangwelt-Weltklang (1991-1993) 2 3 4 2 11 1 (Zentralafrika), Togo, Nigeria, Zaire, Guinea<br />
111 / 222 / 333 Lieder (1990-1995) 0 0 0 0 1? 0 Südafrika<br />
Liedertreff (1994) 1 2 1 0 1 0 Kongo<br />
Die Musikstunde (1992-1997) 0 0 1 0 1 1 Gambia<br />
Hauptsache Musik (1995) 1 4 2 0 3? 0 Guinea<br />
Musiklehrmittel: Vorgestellte Instrumente und Länder<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 469
Lehrmittel (Jahr) Instrumente Musikbeispiele<br />
I M C A T P Land<br />
Canto (1996) 0 0 0 0 1? 0 Südafrika<br />
M. hören, machen, verstehen (1990-1995) 3 6 (1) (3) 4 1 Südafrika, Tschad, Nigeria, Ruanda-Burundi<br />
Vom Umgang mit dem Fremden (1996) 1 0 0 1 2 0 Elfenbeinküste, Burundi<br />
Von total 42 untersuchten Musiklehrmitteln und -büchern finden sich in 17 weder Angaben zu den Instrumen-<br />
ten Schwarzafrikas noch abgedruckte oder als Hörbeispiele vorliegende Musikstücke aus schwarzafrikanischen<br />
Ländern. 12 Musiklehrmittel und -bücher erwähnen Idiophone, 13 Membranophone, 13 Cordophone, 10 Aero-<br />
phone und nur gerade sieben stellen mindestens einen Vertreter aus jeder Gattung vor. In immerhin 25 Werken<br />
wird mindestens ein Beispiel traditioneller Musik im Notenbeispiel abgedruckt oder steht im Falle einiger<br />
Lehrmittel auf einem dazugehörigen Tonträger zur Verfügung, modernere Musikbeispiele finden sich jedoch<br />
nur gerade in drei Werken. Auffallend ist bei allen Werken, dass sie sich auf wenige Länder konzentrieren, die<br />
oft sogar im gleichen Gebiet, beispielsweise Westafrika liegen: Fünf Werke enthalten Beispiele aus dem<br />
Kongo, acht aus Südafrika, sechs aus Nigeria und fünf aus der Elfenbeinküste. Weitere Beispiele stammen aus<br />
Burundi, Ruanda, Tschad, Guinea, Gambia, Togo, Äthiopien, Liberia, Kamerun und Ghana.<br />
Von den sieben untersuchten Fachbücher, die grob aus dem Zeitraum der achtziger Jahre stammen, bieten nur<br />
gerade deren drei erwähnenswerte Informationen zur Musik Schwarzafrikas. Bei den Lehrmitteln fällt auf,<br />
dass die schwarzafrikanische Musik nur in der Oberstufe vertreten ist, sieht man einmal vom Lied "Kumbaya"<br />
dessen Herkunft als nicht gesichert gilt. In den schweizerischen Lehrmitteln ist die schwarzafrikanische Musik<br />
erst seit Ende der achtziger Jahre, also seit rund 10 Jahren, ein Thema. Zudem erwähnen einige der Lehrmittel<br />
die schwarzafrikanische Musik nur im Zusammenhang mit dem Jazzentwicklung in Nordamerika. Ausführ-<br />
lichere Betrachtungen der Musik Schwarzafrikas finden sich erst in den Lehrmitteln der neunziger Jahre.<br />
Weitere Aspekte, wie die den Schwarzafrikanern zugeschriebenen Eigenschaften, werden in den Teil "Ergeb-<br />
nisse der Untersuchung" ab der Seite 494 dieser Arbeit berücksichtigt.<br />
Musiklehrmittel: Vorgestellte Instrumente und Länder<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 470
6. Der schwarzafrikanische Mensch im Lesebuch und Comic<br />
Die in den Geographie- und Musiklehrmitteln gemachten Befunde in Bezug auf das Bild des schwarzafrikani-<br />
schen Menschen, welches sie vermitteln, sollen in einem kurzen Quervergleich auf ihre Universalität überprüft<br />
werden. Dabei stehen insbesondere zeitliche Verschiebungen dieses Bildes im Vordergrund des Interesses.<br />
6.1 Lesebücher und Sprachbücher<br />
Die im folgenden besprochenen Lese- und Sprachbücher wurden einerseits auf die bereits in den Teilen zur<br />
Geographie und Musik vorgestellten Fragen untersucht, siehe dazu die Seiten 35f. und 93 dieser Arbeit, ande-<br />
rerseits sollte ein Blick in einige Lehrmittel vor allem der Primarschule, die ja den Geographieunterricht über<br />
die Landesgrenzen hinaus an und für sich noch nicht kennt, zeigen, inwiefern die Schüler allenfalls mit<br />
solchen Bildern konfrontiert werden und in welchem Verhältnis diese zu den später vermittelten Bildern der<br />
"Fächer" auf der Oberstufe stehen.<br />
6.1.1 Lehr- und Lesebuch (1912)<br />
Das 632 Seiten umfassende thurgauische Lehrmittel enthält im Leseteil keine Angaben zu Afrika. (Die im<br />
Geographieteil gemachten Angaben werden ab der Seite 95 dieser Arbeit besprochen.)<br />
6.1.2 Lesebuch für die Oberklasse (ca. 1930)<br />
Das im Auftrag der thurgauischen Lehrmittelkommission bearbeitete, 584 Seite starke Lehrmittel enthält im<br />
Leseteil keine Angaben zu Afrika. (Die im Geographieteil gemachten Angaben werden ab der Seite 96 dieser<br />
Arbeit besprochen.)<br />
6.1.3 Arbeits- und Lesebuch für die Oberklassen (1936)<br />
Das den Untertitel "Geschichte, Geographie" tragende, 469 Seiten umfassende Lehrmittel enthält ausserhalb<br />
des Geographieteiles keine Angaben zu Afrika. (Die im Geographieteil gemachten Angaben werden ab der<br />
Seite 105 dieser Arbeit besprochen.)<br />
6.1.4 Lehr- und Lesebuch, 1943<br />
Das 271 umfassende "Lehr- und Lesebuch für das 7. und 8. Schuljahr der Primarschule des Kantons St.<br />
Gallen" von 1943 zur Literatur und Geschichte enthält mit Ausnahme einer Erwähnung Südafrikas als Konkur-<br />
renten für die einheimischen Bauern bei der Wollproduktion (S. 259) keine Erwähnung Afrikas, obwohl es auf<br />
mehreren Seiten (S. 259-265) auf die <strong>Pro</strong>bleme und Herausforderungen der Kolonisation eingeht.<br />
6.1.5 Heimat (1962)<br />
Das 200 Seiten umfassende Lesebuch für die 4. Klasse der Primarschule aus dem Kanton Thurgau enthält<br />
keine Erwähnungen Afrikas oder seiner Bewohner.<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 471
6.1.6 Schöne weite Welt, 1966<br />
Das 218 Seiten umfassende "Lesebuch für das dritte Schuljahr" enthält trotz des Titels keine Erwähnung Afri-<br />
kas und der dort lebenden Menschen.<br />
6.1.7 Sprachbüchlein (1968)<br />
Während das 48 Seiten umfassende Sprachbüchlein "Piff - Paff - Puff" für die 2. Primarklasse keine Angaben<br />
zu Afrika enthält, erwähnt "Frohe Fahrt ins Land der Sprache" für das 3. Schuljahr auf den insgesamt 48 Seiten<br />
im Kapitel "In die weite Welt" auf der Seite 42 "Neger", die in Lehm- oder Bambushütten im Urwald leben.<br />
6.1.8 Unsere Zeit (1969)<br />
Das in der 2. Auflage 193 Seiten starke Lehrmittel aus dem Kanton St. Gallen für die 3. Primarschulklasse<br />
bezieht sich an zwei Stellen auf Afrika. Auf der Seite 116 heisst es in einem Krippenspiel: "Der König Kaspar<br />
bin ich genannt, ich bin der König aus dem Mohrenland." Auf den Seiten 162-187 gibt der Autor einen<br />
Ausschnitt aus einer verkürzten Fassung von "Robinson Crusoe" wieder. Obwohl dieser Roman wohl eher in<br />
der Südsee als in der Nähe Afrikas anzusiedeln ist, hat er in gekürzter Form das Bild der "Wilden" in exoti-<br />
schen Länder lange entscheidend mitgeprägt. Dieser Ansicht ist auch Bitterli, der dem Roman in seinen<br />
Betrachtungen der Beziehungen zwischen "Wilden" und "Zivilisierten" ein ganzes Kapitel widmet. Die kame-<br />
runische Schriftstellerin Axelle Kabou bezeichnet die Figur des Freitags als Archetypen, der dem schwarzafri-<br />
kanischen Menschen von den Europäern so lange zugeordnet wurde, bis er selbst daran glaubte. (Kabou 1995,<br />
S. 45-53)<br />
6.1.9 Wort und Bild (1970)<br />
Das 1979 in einem gegenüber der Ausgabe von 1970 unveränderten Nachdruck erschienene Lesebuch enthält<br />
auf den Seite 133f. einen Nachdruck der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" deren erster Artikel<br />
"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen<br />
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen." lautet. Ein Text nach einer Rede von<br />
Martin Luther King "Ein Neger ist nur eine halbe Person" auf den Seiten 140-145 und ein Kapitel zur "Unter-<br />
entwicklung" nach Informationen des schweizerischen Hilfswerkes Helvetas auf den Seiten 286-291, das in der<br />
Hauptsache aussagt, dass die schwarzafrikanischen Menschen unsere Hilfe bräuchten, enthalten weitere<br />
Erwähnungen zu Schwarzafrika. Ansonsten tritt Schwarzafrika in diesem Lehrmittel nicht in Erscheinung.<br />
6.1.10 Neues Schweizer Lesebuch (1979-1980)<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Das zweibändige, insgesamt 1106 Seiten starke Lehrmittel "Neues Schweizer Lesebuch" enthält im ersten Teil<br />
keine Erwähnung Schwarzafrikas, im zweiten Band wird ein Text "Ojembo, der Urwaldschulmeister" nach<br />
Albert Schweitzer vom Ende der zwanziger Jahre wiedergegeben. In diesem mehrseitigen Text auf den Seiten<br />
33-39 lobt Albert Schweizer den Lehrer Ojembo, den Übersetzer seiner Predigten, indem er ihn mehrmals mit<br />
den anderen Schwarzafrikanern vergleicht. Dabei fallen Ausdrücke wie "widerspenstige Negerbuben". Zu der<br />
Arbeitsmoral der Afrikaner schreibt Schweitzer: "Oft muss die Regierung schwarze Soldaten ins Dorf legen,<br />
um die Leute zu zwingen, genügend Wald zu Pflanzungen umzuhauen." Dabei vergisst er zu erwähnen, dass<br />
die Armee nicht etwa dann tätig wurde, wenn die einheimische Bevölkerung nicht bereit war, ihre<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 472
Nahrungsmittel anzubauen, sondern sich weigerte, landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>dukte, die für den Export nach Euro-<br />
pa gedacht waren, anzupflanzen. Weiter weiss Schweitzer zu berichten: "Gewöhnlich wohnen die Schwarzen<br />
in ihren Bambushütten, bis diese ihnen verfault über dem Kopfe zusammenbrechen." Zu den Bemühungen<br />
Ojembos, Neuerungen im Sinne der Kolonisatoren einzuführen, heisst es in Schweizers Text: "Die trägen<br />
Menschen lehnten sich gegen ihn auf. Aber Ojembo wurde seiner Widersacher Herr... Er siegte durch die<br />
Lauterkeit und Güte seines Wesens."<br />
Über die damals bereits betriebene Holzwirtschaft für den Export berichtet Schweitzer weiter: "Aber es war<br />
immer ein unordentlicher Betrieb gewesen. Niemand gehorchte. Wenn es galt, die Bäume zu fällen und zu<br />
zerlegen, ins Wasser zu rollen und in Flösse zu binden, war gar mancher unter den mannigfachsten Vorwänden<br />
von der Arbeit gewichen." Bedenkt man die im Geographielehrmittel "Diercke Erdkunde" von 1995-1997<br />
(Bd. 3, S. 15) gemachte Aussage eines Bauern zum Roden der Wälder, so erhält diese Textstelle ein zusätzli-<br />
che Dimension. (Siehe dazu die Seite 424 dieser Arbeit.) Natürlich gelingt es Ojembo, der zum Holzhändler<br />
mutiert, als gutem Schwarzen, der seinem Herrn dient, die Abläufe zu verbessern. Über die Geschäftsmoral der<br />
anderen schwarzen Händler schreibt Schweitzer: "Die Holzhändler waren unerschöpflich in Geschichten von<br />
Vorschüssen, die sie an Schwarze gegeben hatten, ohne das versprochene Holz geliefert zu bekommen, von<br />
Flössen, die sie gekauft hatten, um nachher zu erfahren, dass man sie gleichzeitig an Konkurrenten verkauft<br />
und von beiden Geld eingesteckt hatte, von schlechtem Holze, dass sie an Stelle des ausgemachten guten<br />
erhalten hatten."<br />
Weiter folgt ein Beschreibung, wie Ojembo einigen in die Klemme geratenen weissen Händlern hilft. Dazu<br />
schliesst Schweitzer mit dem qualifizierenden Satz: "Die Schwarzen sind ja nicht leicht gewillt, ihr Leben für<br />
andere aufs Spiel zu setzen." Die damit verbundene Forderung, sich für seinen eigenen Ausbeuter aufzuopfern<br />
wird Schweitzer, der als missionierender Europäer der schwarzafrikanischen Bevölkerung das Heil verkünden<br />
möchte, nicht bewusst.<br />
Dieser Text Albert Schweitzers wird im Band 2 ohne Kommentar wiedergegeben. Es ist zu vermuten, dass er<br />
aber nicht in erster Linie abgedruckt wurde, um die zu einem grossen Teil ökologisch bedenklichen Ansichten<br />
Schweitzers zu hinterfragen, sondern aus dem Stolz heraus was ein Schweizer Mitbürger bei den "Wilden"<br />
Afrikas bewirkt hatte. (Zum Werk Albert Schweitzers siehe auch die Seite 209 dieser Arbeit.)<br />
6.1.11 Lesebuch 4 (1980)<br />
Das 231 Seiten starke thurgauische Lehrmittel für die 4. Primarklasse enthält mit der Ausnahme einer Erwäh-<br />
nung Ägyptens im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte keine Angaben zu Afrika. (Dafür befassen<br />
sich die sieben Seiten 39-45 mit dem Thema Indianer).<br />
6.1.12 Lesen 3 - Band 1 (1981)<br />
Der 152 Seiten umfassende Band des Leselehrmittels für die 3. Klasse druckt auf der Seite 64 unter dem Titel<br />
"Mindo kämmt sich nur einmal pro Woche" einen Text mit zugehörigem Foto ab. Der Text wird hier in voller<br />
Länge wiedergegeben, weil er die Schüler nicht nur durch einen provokativen Titel anspricht, sondern die<br />
Lebenswirklichkeit eines Menschen aus der Altersgruppe der Leser schildert:<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
"Was", werdet ihr denken, "das gibt es, dass sich jemand nur einmal pro Woche kämmt? Das Mädchen muss ja aussehen<br />
wie eine Wetterhexe. Und was sagen wohl die Eltern dazu?"<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 473
Nachdem die von den Lesern wahrscheinlich gemachten Überlegungen ausgesprochen wurden, wird die<br />
Herkunft Mindos beschrieben:<br />
Mindo ist fünf Jahre alt, hat schokoladebraune Haut und einen dichten, schwarzen Krauskopf. Nun, sicher habt ihr es<br />
erraten: Mindo ist ein Negermädchen. Sie ist in Tansania an der afrikanischen Ostküste zu Hause.<br />
Hier vermittelt der Text das Bild des "herzigen Negerleins": die dunkle Hautfarbe wird zur "schokoladebrau-<br />
nen Haut", die dem Kind in der Beschreibung einen süssen Beigeschmack verleiht.<br />
Wieder macht der Text einen Rückgriff auf die Erfahrungen eines Teils der Leserschaft und klärt auch gleich<br />
die Frage, die sich vielen Europäern beim Anblick der Haare eines schwarzafrikanischen Menschen stellt:<br />
Wenn du auch krauses Haar hast, ist es dir sicher auch schon passiert, dass du beim Kämmen gejammert hast, weil es dich<br />
so rupfte und zupfte. Stell dir nun vor, dein Haar wäre noch viel, viel stärker gekraust mit lauter winzigen kleinen, harten<br />
Löckchen. Fährst du mit der Hand über das Haar, fühlt es sich wie Stahlwatte an.<br />
Darum kann Mindo ihre Haare gar nicht bürsten, und auch ein Kamm, wie du ihn brauchst, könnte bei Mindos Krauskopf<br />
nichts ausrichten.<br />
Nachdem so die im Titel durch eine <strong>Pro</strong>vokation aufgeworfene Frage geklärt ist, folgt nun die Schilderung der<br />
Art und Weise, wie Mindo ihr Haar in Ordnung hält, den auf dem auf der gleichen Seite abgebildeten Foto ist<br />
ja deutlich zu sehen, dass Mindo eine für europäische Verhältnisse spezielle Frisur trägt:<br />
Am Sonntag, wenn Mindo gekämmt werden soll, holt ihre Mutter einen handgeschnitzten, groben Holzkamm mit langen<br />
Zähnen. Die Kleine setzt sich dann zwischen Mutters Beine und hält geduldig ihren Kopf ganz still, bis auch die letzte<br />
Haarsträhne dem Kamm keinen Widerstand mehr leistet. Manchmal muss Mindo aber schon das Gesicht verziehen, wenn<br />
ein besonders hartnäckiges "Nest" in Angriff genommen wird.<br />
Mit dem Kämmen allein ist aber die <strong>Pro</strong>zedur noch lange nicht zu Ende. Jetzt wird das Haar nämlich in grosse und kleine<br />
Streifen oder Vierecke eingeteilt. Dann beginnt die Mutter mit einem Büschel Haare ein Zöpfchen zu flechten, und immer<br />
wieder nimmt sie von beiden Seiten neue Haarsträhnen dazu, so dass der Zopf eng anliegt und auf dem Kopf nach hinten<br />
"wandert". Weil dies eine so grosse, lange Arbeit ist, muss Mindo ein bis zwei Stunden stillsitzen.<br />
Zum Glück halten die Zöpfchen lange. Und man braucht die Enden nicht einmal mit einem Gummi- oder Stoffband<br />
zusammenzubinden. Die Haare sind so steif, dass nach einer Woche jedes Zöpfchen in mühevoller Arbeit wieder aufgelöst<br />
werden muss.<br />
Diese genaue Schilderung einer für eine Schwarzafrikanerin "alltäglichen" Körperpflege, die traditionellerwei-<br />
se auch eine starke kulturelle Bedeutung hat - die Art der Haartracht deutete nicht nur auf die Volkszugehörig-<br />
keit hin, sondern auch auf den sozialen Stand der Trägerin - und die vor allem in den Städten einfach zum<br />
Schmuck dient, die aber in den meisten der besprochenen Lehrmitteln nicht einmal erwähnt wird, obwohl es<br />
sich dabei um eine typische afrikanische Besonderheit handelt, schliesst mit den Worten:<br />
Jetzt verstehst du sicher, warum sich Mindo nicht jeden Tag kämmt und trotzdem immer eine schöne Frisur hat.<br />
Der Text klassifiziert das beschriebene Verhalten also weder als gut noch schlecht, sondern begnügt sich<br />
damit, eine Verhaltensweise zu beschreiben und sie aus den vorgefundenen Gegebenheiten zu erklären.<br />
6.1.13 Sprachbuch (1974-1983)<br />
Das in mehreren Auflagen erschiene Sprachbuch in drei Bänden für die 4. - 6. Klasse der Primarschule wurde<br />
im Kanton Thurgau bis vor wenigen Jahren als offizielles Sprachlehrmittel der Mittelstufe verwendet. Für die<br />
Betrachtung des Lehrmittels wurde die Lehrerkommentare verwendet, da diese die jeweiligen Seiten der Schü-<br />
lerbände mitenhalten.<br />
Der Band für die 4. Klasse, in der Lehrerausgabe mit 296 Seiten, macht keine Angaben zu Afrika. Der 408<br />
Seiten dicke Kommentar für die 5. Klasse druckt auf den Schülerseite 40 die Zeichnung eines schwarzen Jazz-<br />
trompeters und eines Pianisten, auf der Seite 41 die Zeichnung eines schwarzen Läufers an der Olympiade ab.<br />
Der ebenfalls 408 Seiten umfassende Kommentar für die 6. Klasse enthält eine Sprachübung "Besuch aus Afri-<br />
ka" auf der Seite 278, die sich aber bei näherem Hinsehen als die Beschreibung der Ankunft eines Afrikarei-<br />
senden am Flughafen entpuppt. Über Afrika selbst verliert der Text kein einziges Wort.<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Die wenigen Informationsbruchstücke zu schwarzafrikanischen Menschen werden also vom Bild des wahr-<br />
scheinlich amerikanischen, sich in der Musik oder im Sport betätigenden Schwarzen geprägt. Diese<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 474
Informationen sind zwar nicht falsch, entsprechen aber dem Klischee, dass Afrikaner entweder trommeln oder<br />
sehr schnell laufen können, ansonsten aber wenig Bedeutendes geleistet haben. (Siehe dazu auch die Zusam-<br />
menfassung "Vorgestellte Instrumente und Länder" zu den Musiklehrmitteln auf der Seite 469 dieser Arbeit.)<br />
6.1.14 Lesespiegel, 1984<br />
Der 72seitige Lesespiegel zeigt zum Thema Weihnachten auf der Doppelseite 52-53 das Gemälde "Der Weg<br />
zum Stall" von Hans Memling, auf dem neben dem schwarzen König Kaspar mehrere weitere, meist auf<br />
Kamelen sitzende Schwarzafrikaner zu sehen sind. Ansonsten enthält das Buch keine weiteren Angaben zum<br />
Thema.<br />
6.1.15 Drei Schritte (1984)<br />
Der erste Band "Riesenbirne und Riesenkuh" des "Interkantonalen Lesebuches für das 2. Schuljahr" enthält auf<br />
den insgesamt 136 Seiten zwar einen Text "Urwälder und Wüsten" (S. 38) und die Zeichnung eines Globus<br />
(S. 40-41), auf der der afrikanische Kontinent zu sehen ist, macht aber keine Angaben zu Afrika selbst.<br />
Während der erste, 184 Seiten umfassende Band "Der Zaubertopf "des "Interkantonalen Lesebuches für das<br />
dritte Schuljahr" das Thema Afrika nicht anspricht, enthält der zweite, 178 Seiten starke Band "Drei Schritte"<br />
neun Seiten zum Thema.<br />
Die Seite 85 zeigt zum Kapitel "Ich wohne, wo ich bin" ein "afrikanisches Rundhaus". Das Kapitel "Zum<br />
Beispiel die Kinder in Afrika" auf den Seiten 101-108 gibt auf der Seite 101 das schon erwähnte "afrikanische<br />
Rundhaus" und ein Märchen "Der Regentropfen" wieder, das nach der Angabe neben dem Text aus Niger<br />
stammt, im Quellenverzeichnis auf der Seite 176 aber als nigerianisches - also aus Nigeria im Gegensatz zu<br />
nigerisch für aus dem Niger kommend - Märchen bezeichnet wird:<br />
Ein Regentropfen fiel einem Kind in die Hand. Er sprach: Schliess die Hand, damit ich nicht sterbe, und lauf zu den Hügeln<br />
mit den Bäumen und lass mich dort frei. Ich werde in die Erde dringen, und es wird Regen fallen.<br />
Das Kind schloss die Hand und rannte zu den Hügeln mit den Bäumen, so schnell es konnte. Aber als es ankam und die<br />
Faust öffnete, war der Regentropfen verdunstet.<br />
Weinend lief das Kind ins Dorf zurück und erzählte den Alten, dass der Regentropfen gestorben sei. Nun würde es nie<br />
mehr regnen. Aber die Alten sagten: Weine nicht! Wir werden hier im Dorf Bäume pflanzen, damit der nächste<br />
Regentropfen keine Zeit hat zu verdunsten. Wir werden Bäume pflanzen, und wir werden Regen haben.<br />
Die Seite 102 druckt den Text "Meines Grossvaters Brunnen", einen Aufsatz einer Schülerin aus Kamerun, ab.<br />
Über die Schülerin heisst es in der Einleitung zum Text:<br />
Die Schülerin Elisabeth Nyemb lebt nicht im Dorf, aus dem ihre Familie stammt. Sie interessiert sich, wie es früher dort<br />
war. Einmal hat sie das Dorf besucht.<br />
Anschliessend folgt der Aufsatz von Elisabeth Nyemb:<br />
Mein Dorf ist sehr klein. Es liegt am Rande eines grossen Stroms. Man kann das Wasser des Flusses nicht benützen, weil es<br />
trübe ist. Darum hat mein Grossvater einen Brunnen gegraben.<br />
Einmal bin ich in mein Dorf gegangen und habe den Brunnen gesehen. Er liegt in der Mitte des Hofes. Er ist sehr tief, etwa<br />
zehn Meter tief. Grosse Steinplatten liegen rundherum.<br />
Man schliess ihn immer. Wenn man Wasser schöpfen will, bindet man einen Eimer an das Ende des langen Seils.<br />
In meinem Dorf liegt die nächste Quelle weit entfernt im Wald. So benützen alle Bauern das Wasser dieses Brunnens. Sein<br />
Wasser ist klar und frisch. Oft kommen die Frauen mit ihren Eimern und plaudern und lachen. Der Brunnen vereinigt die<br />
Menschen. Darum liebe ich ihn.<br />
Das Mädchen beschreibt nichts anderes als die Nutzung des Grundwasserstromes. (Zur Wasserversorgung der<br />
Bevölkerung Schwarzafrikas siehe auch die Karte Verfügbares Trinkwasser" auf der Seite 575 im Anhang<br />
dieser Arbeit.)<br />
Ebenfalls auf der Seite 102 ist der Text eines weiteren Schülers aus Kamerun, Emanuel Mbiam, abgedruckt,<br />
der unter der Überschrift "Die Trommel" erzählt, "wie früher die Trommel als Verständigungsmittel gebraucht<br />
wurde":<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 475
In meinem Dorf, wie in allen andern Dörfern, gibt es eine Trommel, die vor dem Aba steht. Der Aba ist ein grosses Haus,<br />
in dem die Dorfbewohner zusammenkommen, um etwas zu besprechen oder miteinander zu plaudern<br />
Früher war es so: Man komponierte Klänge, die zu jeder Familie passten. Der Mann der die Trommel schlug, spielte zum<br />
Beispiel: Dorf Nkoumadjap tam tadam, Familie Moto tam tam, Sohn von Ela tadadam tam, sagt an tam...<br />
Wenn nun Moto seinem Freund, der vielleicht fünfzig Kilometer weit weg wohnte, etwas ansagen wollte, dann übertrugen<br />
andere Trommeln von anderen Dörfern die Nachricht bis zu seinem Freund. Die Trommel spielte die Rolle des Telefons<br />
oder des Telegramms.<br />
(Zur Benutzung der Trommeln als Kommunikationsmittel siehe auch die Seite 468 dieser Arbeit.) Die Seite<br />
103 bildet zu diesem Text ein Foto "Die Buben spielen gern auf selbstgebastelten Trommeln" und drei Zeich-<br />
nungen verschiedener Trommeln ab:<br />
Trommeltypen<br />
1: Schlitztrommel aus Holz, Kamerun<br />
2: Aschanti-Trommel, Ghana<br />
3: Spanntrommel, Adeli<br />
Auf den Seiten 102-104 folgt der Bericht der der Schülerin Myo aus Kamerun über "Die Schule" der bereits im<br />
Zusammenhang mit dem Geographielehrmittel "Geographie der Kontinente" von 1984 besprochen wurde.<br />
(Siehe dazu die Seite 349 dieser Arbeit.) Gegenüber dem im Geographielehrmittel vorliegenden Text, weisst<br />
die Fassung im Lesebuch einige kleine Anpassungen auf.<br />
Auf der Seite 104-105 folgt die etwas längere, von drei Fotos, von denen eines ein Schulzimmer zeigt, die<br />
beiden anderen sind mit den Bildlegenden "Beim Gummitwist. Das kleinste Geschwister ist dabei und wird<br />
von den Grossen gehütet." und "Reis stampfen." versehen, begleitete Schilderung einer zehnjährigen Schülerin<br />
aus Tansania unter dem Titel "Ein ganz gewöhnlicher Tag":<br />
Nach dem Aufstehen wasche ich ein paar Sachen. Dann koche ich Tee. Dann gehe ich an den Lumembo-Fluss, und<br />
schliesslich ziehe ich mich um für die Schule. Ich öle mein Haar und kämme es. Nun hole ich mein Schwesterchen und<br />
wasche es.<br />
Nachher trinken wir Tee und lassen fast nichts übrig.<br />
(Zum Anbau und Verwendung von Tee siehe auch die Seiten 405 und 478 dieser Arbeit.)<br />
Ich nehme meinen Besen, gehe zur Schule und fange an sauberzumachen. Ich wische das Schulzimmer. Dann ertönt die<br />
Pfeife, ich nehme meine eigene Pfeife und pfeife auch, und wir stellen uns in einer Reihe auf zur Inspektion. Mein Kleid<br />
wird kontrolliert. Wenn es schmutzig oder zerrissen ist, muss ich vor alle andern Schüler treten.<br />
Dann singen wir die Nationalhymne und noch ein anderes Lied und gehen in die verschiedenen Klassenzimmer. Bis um<br />
zehn Uhr haben wir Rechnen. Dann ertönt die Pfeife: Pause. Ich esse ein wenig Zuckerrohr. Dann pfeift es wieder, und wir<br />
gehen ins Schulzimmer zurück. Wir nehmen die Heimatkundehefte und gehen ins Freie. Dort lernen wir etwas über die<br />
Strassen von Ulanga und über pflanzenfressende Tiere wie Giraffen, Zebras und Büffel.<br />
Um halb eins gehe ich zum Essen nach Hause. Um halb zwei bin ich wieder im Klassenzimmer und habe nochmals<br />
Rechnen. Um zwei Uhr haben wir Lesen im Freien, dann gehen wir wieder ins Zimmer, und der Lehrer erzählt etwas über<br />
Hygiene und Gesundheit. Er stellt uns Fragen, und wir schreiben ins Heft. Dann sagt der Lehrer, wir sollen unsere Sachen<br />
zusammenpacken.<br />
Um drei Uhr kommen wir heim. Ich suche mir etwas zu essen. Nach dem Essen wasche ich das Geschirr, ziehe die<br />
Schuluniform aus und schlüpfe in das Kleid, das ich zuhause trage. Dann stampfe ich Reis.<br />
Sicherlich kann bei weitem nicht jedes Mädchen in schwarzafrikanischen Ländern eine Schule besuchen, wie<br />
Ende Mai 1998 anlässlich des "Global March" nach Genf wieder einmal thematisiert wurde, doch dürfte die<br />
Mehrheit der Eltern heute einen Schulbesuch ihrer Töchter zumindest als erstrebenswert ansehen. Die Schilde-<br />
rung einer anderen Lebenswirklichkeit dieser schwarzafrikanischen Schülerin, die der gleichen Altersgruppe<br />
wie die angesprochenen Leser angehört, bietet ein Bild, dass sich von dem des hungernden und hilflos von den<br />
Mächten des Schicksals gebeutelten Schwarzafrikaners unterscheidet, indem der Text zeigt, dass auch in<br />
diesen Ländern Menschen versuchen, durch die eigene Anstrengung, die denen der Europäer so unähnlich<br />
nicht sind, ihren Lebensweg zu finden.<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 476
Auf der Seite 105 folgt ein kurzer Text "Safari" einer tansanischen Schülerin - "Safari" wird als Kisuaheliwort<br />
für "Reise" bezeichnet - in dessen Einleitung ausgesagt wird, dass afrikanische Kinder die wilden Tiere "besser<br />
aus Büchern und Geschichten als aus der Natur" kennen:<br />
Gerne wurde ich einmal eine Safari in den Nationalpark Serengeti machen. Dahin fahren leider immer nur die Touristen<br />
aus Europa. Sie haben genug Geld, um diese Fahrten zu bezahlen. Es muss aufregend sein, vom Auto aus die freilebenden<br />
Giraffen, Zebras, Gazellen, Nashörner, Elefanten oder sogar Löwen und Leoparden aus nächster Nähe zu beobachten.<br />
Die Seiten 106-108 stehen unter dem Titel "Spiel und Spielzeug aus fast nichts". Die Seite 106 zeigt vier<br />
Fotos: ein "<strong>Pro</strong>pellerflugzeug aus 'bati', dem leichten, weichen Holz der Raffia-Palme", einen mit Rädern<br />
versehenen Schuh, der mit "'Gari', Autos, kunstvoll oder ganz einfach gebaut", "'Bandia', die turnenden Holz-<br />
puppen", sowie ein weiteres Gefährt. Die Seite 107 zeigt zwei weitere Fotos "Polizeiposten mit Funkgerät"<br />
und "Wenn man den Trommelwagen vorwärtsschiebt, erklingt ein Schlagzeug-Solo" zu dem der Fotografin im<br />
nebenstehenden Text schreibt, dass die "afrikanischen Kinder... auf ihre Werke stolz sein" könnten. Die Seite<br />
108 schliesst die Seiten zu Afrika mit zwei weiteren Fotos ab:<br />
Nage: Es braucht fünf leere Blechdosen in verschiedenen Grössen, einen Ball und 6-8 Kinder in zwei Gruppen. Die eine<br />
Gruppe versucht, die Büchsen aufeinanderzustellen, ohne vom Ball getroffen zu werden. Die andere Gruppe hat den Ball<br />
und versucht, eins der Kinder der Gegengruppe zu treffen. Gewonnen hat die Gruppe, die alle Büchsen aufeinanderstellt<br />
ohne getroffen zu werden.<br />
Fernsehen: Eine Schachtel, zwei Stecken und ein langer Papierstreifen aus zusammengeklebten Heftseiten. Das<br />
gezeichnete <strong>Pro</strong>gramm wird von einem Stecken auf den anderen gewickelt und läuft so über den Bildschirm.<br />
Besonders in den grösseren Städten spielen die Kinder, trotz der vorgestellten Beispiele und der darin zum<br />
Ausdruck gebrachten Phantasie, gerne mit gekauften Spielzeug, welches meist aus dem Ausland importiert<br />
wurde. Auf dem Land hingegen sind solche käuflichen Spielsachen kaum zu erwerben, die Kinder helfen sich<br />
dann eben selbst. Ausserdem kennen die afrikanischen Kinder, wie auch Schulkinder in Europa, eine Reihe<br />
von Spielen, die in der Gruppe gespielt werden, wie das vorgestellte "Nage".<br />
6.1.16 Lesebuch 5. Klasse (1985)<br />
Das 208 Seiten umfassende Leselehrmittel des Kanton Thurgaus streift das Thema Afrika nur gerade auf dem<br />
auf der Doppelseite 4 und 5 abgebildeten Foto, welches Menschen aus aller Welt zeigt. Von den ca. 90 abge-<br />
bildeten Menschen sind acht (davon vier Kinder) afrikanischen Ursprungs, was ungefähr dem damaligen<br />
Anteil der Menschen schwarzafrikanischer Abstammung an der Gesamtbevölkerung entspricht. Die Aufteilung<br />
zwischen je vier Erwachsenen und Kinder ist jedoch übertrieben, da fast alle afrikanischen zwar einen sehr<br />
hohen Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung aufweisen, es jedoch zwischen Kindern bis ca. 15<br />
Jahren und Erwachsenen in nur wenigen Ländern zu einem 50:50 Verhältnis gekommen ist.<br />
6.1.17 Der Lesefuchs (1988)<br />
Das 181 umfassende Lesebuch für das 2. Schuljahr beschäftigt sich zwar mit Menschen aus verschiedenen<br />
Regionen der Welt, zeigt aber selbst auf einer Zeichnung der Welt, die sich auf der Seite 141 findet, keine<br />
schwarzafrikanischen Menschen. Auch im Band für das 4. Schuljahr fehlen konkrete Angaben zu<br />
Schwarzafrika.<br />
6.1.17.1 Lesebuch für das 3. Schuljahr<br />
Der 181 Seiten umfassenden Band für das 3. Schuljahr der Primarschule enthält auf der Seite 129 einen Text<br />
nach Eva Caspary über den tansanischen Jungen "Paolo" und seine Essgewohnheiten:<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 477
Paolo lebt in einem Dorf bei Dar-es-Salaam in Ostafrika. Er hat noch drei Schwestern und einen Bruder. Wenn Paolos<br />
Mutter auf den Markt geht, kauft sie für das Wochenende Zucker, Tee, Tomaten, Spinat, Kürbis, Mais und Zwiebeln ein.<br />
Am Wochenende gibt es dann folgende Mahlzeiten:<br />
Frühstück Samstag: Aus Wasser und Maismehl kocht Paolos Mutter eine Suppe. Sie mischt ein wenig Zucker darunter<br />
und etwas Butterschmalz, das sie aus dem Rahm der Milch selber gekocht hat.<br />
Mittagessen Samstag: Aus Maismehl und Wasser wird ganz steifer Brei gekocht, der Ugali heisst. Für den Spinat werden<br />
die Blätter und fein geschnittene Zwiebeln in etwas Fett geschmort.<br />
Abendbrot Samstag: Der Kürbis wird geschält, in Stücke geschnitten, weichgekocht und mit etwas Ziegenfett und Salz<br />
verrührt. Zum Kürbisbrei bekommt jeder ein Glas saure Milch.<br />
Frühstück Sonntag: Milch, Wasser, Teeblätter und Zucker werden zusammen gekocht. Der Tee schmeckt sehr süss und<br />
ein bisschen nach Rauch.<br />
(Zur Verwendung von Tee siehe auch die Seite 476 dieser Arbeit.)<br />
Mittagessen Sonntag: Die gestampften Maiskörner werden mit braunen Bohnenkernen zusammen gekocht. Die Kinder<br />
bekommen noch eine reife Banane.<br />
Abendbrot Sonntag: Zum Ugali gibt es eine gute Sosse aus geschmorten Zwiebeln, Tomaten, gestampften Erdnüssen und<br />
Pfeffer. Dazu gibt es Tee.<br />
Die im Text gemachte Aufzählung der verschiedenen verzehrten Nahrungsmittel wirkt dem Bild des Hunger-<br />
kontinents entgegen. Auch die Kinderzahl der Mutter Paolos wird nicht dramatisiert sondern nüchtern in die<br />
Formel "drei Schwestern und einen Bruder" gekleidet. Auffallend im Speiseplan ist die häufige Erwähnung<br />
von Mais. Diese Nutzpflanze erweist sich in weiten Teilen Afrikas als eines der wichtigsten Grundnahrungs-<br />
mittel. Die Erwähnung von Milch geht auf die Tatsache zurück, dass in den meisten Ländern Afrikas zwar ein<br />
Milchmangel herrscht - obwohl ein grösserer <strong>Pro</strong>zentsatz der Erwachsenen Milch weit schlechter verdaut als<br />
dies in Europa der Fall ist - auf dem Land, dort wo Rinderwirtschaft möglich ist, aber durchaus Milch vorhan-<br />
den ist und in verschiedenen Formen genutzt wird.<br />
Auf der Seite 136 zeigt das Lesebuch ein Bild zum Thema "Wo wohnen die Kinder der Erde", auf welchem<br />
unbekleidete Schwarzafrikaner vor einer Strohhütte zu sehen sind.<br />
6.1.17.2 Lesebuch für das 4. Schuljahr (1988)<br />
Im Band für das 4. Schuljahr der Primarschule, der 181 Seiten umfasst, findet sich auf der Seite 116 eine Illu-<br />
stration, die Kinder aus aller Welt darstellt, zu einem Gedicht von James Krüss "Was wünschen die Kinder der<br />
Erde", indem es heisst:<br />
...Viele aber hört man weinen, / Viele aber sind in Not; / Und es wünschen diese Kleinen /<br />
Weiter nichts als etwas Brot, / Denken wir mit vollem Bauch, / an die armen Kinder auch?"<br />
Das Gedicht bezieht sich zwar nicht ausschliesslich auf Schwarzafrika, gibt aber doch eine lange vertretene<br />
Position wieder, die Kinder (und Erwachsene) dazu auffordert, die Armen dieser Erde nicht zu vergessen. Die<br />
dahinter herrschende Haltung des Eurozentrismus wird deutlich klar durch die Formulierung, dass sich diese<br />
Kindern "nichts als etwas Brot" wünschten. Brot ist zwar seit etwa 200 Jahren ein äusserst wichtiges Grund-<br />
nahrungsmittel in Europa, hat aber für viele Länder speziell auch in Afrika traditionell diese Funktion nicht<br />
inne, da es lange wenig bekannt war. Erst durch Hilfslieferungen, vor allem an die Bevölkerung der Städte,<br />
wurde das Bedürfnis nach Brot geweckt. Dadurch müssen nun einige afrikanischen Staaten ausländischen<br />
Weizen für ihre Stadtbevölkerung einkaufen, während die einheimischen Bauern für ihre Getreidesorten<br />
keinen Absatz mehr finden.<br />
Falls solche Texte darauf abzielen, einen Bewusstseinswandel in der angesprochenen Person zu bewirkten,<br />
muss die Frage gestellt werden, ob damit nicht nur Schuldgefühle geweckt und Hilflosigkeit verbreitet werden,<br />
die schlussendlich zu einer Ablehnung eben dieser Menschen führen, denen man ja helfen wollte. Andererseits<br />
kann ein solcher Text auch die Aussage enthalten, der Angesprochene solle mit seinem Leben doch zufrieden<br />
sein, da es anderen doch viel schlechter gehe. Auch dieser Appell führt nicht zu einer Verbesserung der herr-<br />
schenden, teilweise äusserst unbefriedigenden Zustände, sondern zementiert sie vielmehr.<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 478
6.1.17.3 Zusammenfassung<br />
Zwischen den Bänden für die 3. und 4. Primarschulklasse des Lehrmittels "Der Lesefuchs" wird ein Bruch des<br />
Afrikabildes sichtbar. Während im Band 3 die vorgestellte afrikanische Person, mehrere, wenn auch beschei-<br />
dene Mahlzeiten im Tag zu sich nehmen kann, d.h. in einer funktionierenden Umwelt zu leben scheint, wird<br />
im Band 4 der unter den Bedauernswerten dieser Welt sicher mitgemeinte Schwarzafrikaner als Hungerhil-<br />
feempfänger dargestellt, der ohne die Hilfe von aussen nur begrenzt lebensfähig ist.<br />
6.1.18 Schaukelpferd, 1989<br />
Das 96 Seiten umfassende "Lesebuch für Erstklässler" aus dem Kanton St. Gallen zeigt auf der Seite 11, im<br />
Zusammenhang mit einer Doppelseite zur Fasnacht auch die Figur einer "Negerin", die mit krausem Haar,<br />
roten Lippen und grossen, goldenen Ohrringen gezeichnet wird und damit dem schon im letzten Jahrhundert<br />
von Wilhelm Busch gezeichneten Bild der "Neger" (siehe dazu die Abbildung auf der Seite 485 dieser Arbeit)<br />
ziemlich nahe kommt. Ansonsten enthält der Band keine Angaben zum Thema.<br />
6.1.19 Fosch, Fusch, Fesch, 1990<br />
Das 103 Seiten umfassende Lesebuch für die 1. Klasse "Fosch, Fusch, Fesch" aus dem "Interkantonalen Lehr-<br />
mittelverlag Bern" von 1990 enthält keine Texte oder Bilder zum untersuchten Thema.<br />
6.1.20 Karfunkel (1990)<br />
Das 216 Seiten umfassende Lesebuch für das 5. Schuljahr kommt in zwei Texten auf Afrika und die dort<br />
lebenden Menschen zu sprechen. Im Text "Nähen und Wassertragen" auf den Seiten 58-61, wird die Bege-<br />
gnung zwischen dem europäischen Jungen Thomas und dem etwa gleichaltrigen Äthiopier Dimma geschildert.<br />
In einem weiteren Text "Die heuschreckliche Invasion" auf den Seiten 180-181 wird Afrika eher am Rand<br />
erwähnt.<br />
6.1.20.1 Nähen und Wassertragen<br />
Das Schwergewicht des Textes von Cecil Bodker liegt nicht in der Beschreibung der äthiopischen Lebenswei-<br />
se, sondern in der Aufdeckung unterschiedlicher, aber nicht naturgegebener Kulturformen:<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Ihre Kleider waren ganz und ohne Löcher. Weder der Mann noch die Frau oder der Junge trugen zerrissene Sachen.<br />
Dimma bedeckte den Riss in seinem Hemd mit der Hand. Der Riss war schon alt, und bisher hatte er ihn nicht weiter<br />
gestört. Das Hemd konnte er schliesslich tragen, auch wenn es alt und zerrissen war. Jeder trug seine Sachen so lange, bis<br />
sie in Fetzen vom Körper hingen. Kleine Löcher waren unwichtig. Alle trugen zerschlissene Sachen. Ausgenommen die<br />
Fremden. Am Anfang war es Dimma nicht aufgefallen, aber nun, als Thomas seine Hose zerriss und sofort eine andere<br />
anziehen musste, damit seine Mutter den Schaden beheben konnte, fühlte Dimma plötzlich den Riss im Hemd wie eine<br />
Wunde, wie etwas, dessen man sich schämen musste. Und so presste er fest die Hand darauf. Ein wenig später schlich er<br />
hinüber ins Haus seiner Mutter, holte Nadel und Faden. Dann setzte er sich hinter das Haus, auf die Sonnenseite, wo ihn<br />
niemand vom Zelt beobachten konnte. Hier zog er das Hemd aus und begann, den Riss zuzunähen. Aber der war recht<br />
gross, und es war schier unmöglich, ihn so zu flicken, dass es ordentlich aussah.<br />
Bereits in diesem ersten Teil der Geschichte wird das Weltbild des äthiopischen Jungen durch das Verhalten<br />
der Europäer in Frage gestellt. Gleichzeitig erfahren die Leser, dass die Menschen in Äthiopien sich oft in alte<br />
und zerschliessene Sachen kleiden. Weshalb dies so ist, darüber schweigt sich der Text aber aus.<br />
Dimma war gerade halb fertig, als Thomas auftauchte. "Was, du sitzt hier und nähst?" Dimma blickte fragend auf. Das<br />
klang ja, als wäre es verboten, ein Hemd zu flicken! "Warum lässt du das nicht deine Mutter machen?" fragte Thomas<br />
verwundert. "Wieso meine Mutter?" Dimmas Mutter war überhaupt nicht im Haus. Und was hatte sie mit der Sache zu tun?<br />
"Na ja, oder deine Schwester?" fragte Thomas. "Es ist schliesslich mein Hemd!" Dimma begriff nicht, was seine Mutter<br />
oder seine Schwester mit seinem Hemd zu tun hatten. Wenn er es geflickt haben wollte, machte er es selber, und wenn<br />
nicht, unterblieb es eben. "Trotzdem könnte deine Schwester das für dich tun", sagte Thomas. Der Ton, in dem er das<br />
vorbrachte, war Dimma unverständlich. "Wieso denn?" fragte er. "Weil sie ein Mädchen ist, natürlich. Ein Mann näht doch<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 479
nicht." "Ich kann das viel besser als sie", sagte Dimma überheblich. "Ich habe ja auch neulich ihr Kleid geflickt, als es von<br />
oben bis unten riss." "Und warum konnte sie das nicht selber machen?" "Sie musste doch die Teile zusammenhalten."<br />
"Hätte es deine Mutter nicht nähen können?" "Aber warum denn? Wenn ich es doch machen kann!" "Na, hör mal! Das ist<br />
doch schliesslich Weiberarbeit..." "Nähen?" Dimma konnte nicht anders, er musste grinsen. "Ja", sagte Thomas, ohne zu<br />
zögern. Dimma liess sich nicht beirren. Er nähte weiter seinen Riss zusammen. "Männer nähen auch. Ebenso oft wie<br />
Frauen", sagte er. Thomas sah nicht so aus, als würde er das glauben. "Ich würde jedenfalls keine Weiberarbeit machen",<br />
erklärte er. "Meine Mutter würde es auch gar nicht erlauben. " "Gestern hat Tussé Madenas Kleid geflickt", sagte Dimma<br />
ruhig. "Wer ist Madena?" "Seine Tochter, die kleinste. Sie war auf ihren Saum getreten, und der war vollkommen<br />
abgerissen. Während er nähte, lag sie auf seinem Umhang und schlief." Thomas zuckte mit den Schultern. Sein Gesicht sah<br />
irgendwie missbilligend aus. Er setzte sich auch nicht hin, sondern blieb stehen und wartete, bis Dimma fertig war, den<br />
Faden verheftete und Garn und Nadel wieder auf ihren Platz legte.<br />
Die Rollenverteilung in der europäischen Gesellschaft wird hier also durch die Schilderung äthiopischer<br />
Geschlechterrollen in Frage gestellt. Dieser Teil der Geschichte dient also nicht dazu, den Lesern die äthiopi-<br />
sche Lebensform näher zu bringen, sondern über das eigene Rollenverhalten nachzudenken.<br />
Oben vor dem Zelt stand die fremde Frau und winkte ihnen. "Fahrt ihr heute nachmittag mit?" fragte sie. "Wohin?" "Zu<br />
einem der Seen. Vater möchte gern ein paar Vögel schiessen. Wenn ihr ihm nicht in den Weg lauft, könnt ihr gerne<br />
mitkommen." "Alle beide?" "Das sage ich doch. Aber erst müsst ihr mir Wasser holen. Ich habe keines mehr." Sie kam mit<br />
den Kanistern und reichte jedem einen. "Ihr tut mir doch den Gefallen", lächelte sie. Dimma nahm den Kanister erst in die<br />
Hand, nachdem er einen Blick auf Thomas geworfen hatte. Warum sagte er denn gar nichts? Warum wehrte er sich nicht?<br />
"Aber nicht vom Bach!" sagte die Frau. "Ich brauche Quellwasser. Das Bachwasser ist nicht gut." Dimma stand da und<br />
fingerte an seinem Kanister herum. Der Gedanke, dass ausgerechnet er Wasser tragen sollte, gefiel ihm gar nicht. Und noch<br />
dazu von der Quelle, wo jeder ihn vom Weg aus sehen konnte! Warum wollte sie denn kein Bachwasser haben? Das floss<br />
doch gleich in der Nähe. Alle Frauen holten sich ihr Wasser von dort. Schliesslich hätte sie eins der Mädchen darum bitten<br />
können! Verwirrt folgte er Thomas durch die Pforte hinaus und bergab. Sobald sie von den Häusern aus nicht mehr<br />
gesehen werden konnten, blieb Dimma stehen und rief: "Sabineh!" Thomas sah ihn erstaunt an. Sabineh war Dimmas<br />
Schwester, das wusste Thomas. Was wollte er wohl von ihr? Gleich darauf kam sie. Dimma nahm ohne weiteres Thomas<br />
den Kanister aus der Hand und reichte sie beide seiner Schwester. "Geh und hol Wasser!" sagte er. Lächelnd betrachtete<br />
Sabineh die beiden Kanister und strich mit den Händen darüber. Dimma zeigte ihr, wie man den kleinen roten Verschluss<br />
auf- und zuschraubte. "Beeil dich!" sagte er. Noch ehe Thomas widersprechen konnte, lief sie schon den Pfad zum Bach<br />
hinunter. "Geht sie wirklich Wasser holen?" fragte er zornig. "Sie wird es gleich bringen", entgegnete Dimma zufrieden.<br />
"Na hör mal, zwei Kanister!" rief Thomas empört. "Das ist doch viel zu schwer! Wir hätten sie tragen sollen."<br />
Hier wird ein weiterer Kulturkonflikt beschrieben, die die "fremde Frau", ohne es innezuwerden, durch ihre<br />
Forderung an den äthiopischen Jungen hervorruft. Eine <strong>Pro</strong>blematik die häufig unterschätzt wird, aber im<br />
Zusammenhang mit dem Lesetext nicht weiter diskutiert wird. Nach dem für den Europäer Thomas seltsamen<br />
Gebaren Dimmas wird die unterschiedliche Kulturauffassung ausdiskutiert.<br />
"Sie ist daran gewöhnt", grinste Dimma. "Glaub mir, es ist enorm, was die schleppen kann!" "Na ja, aber wir sollten doch<br />
..." sagte Thomas. "Hast du nicht selbst vorhin gesagt, dass du nie Weiberarbeit machen würdest?" lächelte Dimma. "Das<br />
tue ich auch nicht", sagte Thomas. "Wasserholen ist Weiberarbeit", sagte Dimma trocken. "Wieso denn?" fragte Thomas.<br />
Dimma zuckte mit den Schultern. Das war nun einmal so. "Jungen und Männer tragen kein Wasser", erklärte er. "Das tun<br />
nur Frauen und Mädchen." "Quatsch!" rief Thomas. "Ich habe schon oft Wasser geholt. Auch mein Vater tut das. Man kann<br />
doch nicht danebenstehen und zuschauen, wie sich die Frauen abquälen!" Nun war Dimma an der Reihe, sich zu ärgern.<br />
Aber er sagte nichts. Es gab so viele Dinge, die die Fremden gerade umgekehrt machten, fand er, so viel war bei ihnen<br />
anders als bei normalen Menschen!<br />
Durch die Perspektivenumkehrung, das Schlusswort hat sozusagen der Äthiopier Dimma, wird das Verhalten<br />
der Leser noch einmal auf die ihm eigene Normalität hinterfragt. Obwohl nicht direkt ausgesprochen, kann der<br />
Text durchaus als Grundlage für eine Diskussion über kulturelle Normen dienen.<br />
6.1.20.2 Die heuschreckliche Invasion<br />
Der Text von Hans D. Dossenbach über Heuschreckeninvasionen beschreibt in erster Linie das Leben der<br />
Wanderheuschrecken und die Auswirkungen der Schwärme auf die Ernten. In der Einleitung wird der afrikani-<br />
schen Kontinent angesprochen (S. 180):<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Am schlimmsten hausten die Heuschrecken in der Sahelzone in dem riesigen Halbwüstengebiet südlich der Sahara, wo<br />
wegen der anhaltenden Dürre ohnehin eine magere Ernte erwartet wurde. Über weiten Gegenden Afrikas wurde die Ernte<br />
vollständig vernichtet. Nur dank grossangelegter internationaler Hilfsaktionen wurden Tausende von Menschen vor dem<br />
Hungertod bewahrt.<br />
Einmal mehr wird in diesem Text, wenn auch nur beiläufig, ein Afrika vorgestellt, welches unter den Unbillen<br />
der Natur von einer Hungerkatastrophe zur nächsten stolpert und nur dank der ausländischen Hilfe überhaupt<br />
überlebensfähig ist. Immerhin beschreibt der Text im letzten Abschnitt auf der Seite 181 die teilweise Nutzung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 480
der Heuschreckenschwärme durch die Menschen, ohne jedoch dabei die, zuvor als vom Hungertod bedrohten,<br />
beschriebenen Menschen in Afrika noch einmal zu erwähnen:<br />
Manche Völker gleichen den Schaden, den die Heuschrecken anrichten, wenigstens teilweise dadurch wieder aus, indem<br />
sie die Tiere essen. Wie manche anderen Insekten auch, bilden Heuschrecken eine kalorien- und eiweissreiche Nahrung.<br />
Sie werden frisch geröstet gegessen oder auch gedörrt und zu Mehl gestampft, aus dem man dann<br />
Heuschrecken-Hamburger backen kann.<br />
Im Gegensatz zum Text "Heuschreckenplage" aus dem Lehrmittel "Arbeits- und Lesebuch für die Oberklas-<br />
sen" von 1936 (besprochen auf der Seite 107 dieser Arbeit) unterscheidet sich der hier vorliegende Text also<br />
dadurch, dass er aufzeigt, dass sich die Menschen der von den Heuschreckenschwärmen betroffenen Gebiete<br />
zumindest teilweise mit der Bedrohung arrangieren konnten. (Zu den Heuschrecken siehe auch die Seite 203<br />
dieser Arbeit.)<br />
6.1.20.3 Zusammenfassung<br />
Im Lesebuch "Karfunkel" werden die afrikanischen Menschen, die nach dem Text zu Äthiopien über eine<br />
andere Aufteilung der Geschlechterrolle als in Europa verfügen, als wenig wohlhabend - zerissene Kleider sind<br />
die Norm - bis als vom Hungertod bedroht gezeichnet. Diese für Teile Afrikas zutreffende Schilderung läuft<br />
durch das Fehlen von Gegeninformationen Gefahr, auf den ganzen Kontinent verallgemeinert zu werden und<br />
trägt damit zur Verfestigung eines durch die Medien bereits vorgeprägten Afrikabildes bei.<br />
6.1.21 Die Welt ist reich (1991)<br />
Die in der 4. Auflage erschienene "Sammlung von Gedichten für die Mittelstufe der Primarschule" aus dem<br />
Kanton Aargau druckt auf der Seite 198 unter dem Titel "Weisheit aus Afrika" folgende Rätsel und Sprichwör-<br />
ter ab:<br />
Bantu-Land: Wer bringt den Hennen das Brüten bei? Leicht zu sagen: Es ist das Ei.<br />
Angola: Wer den Dattelkern auslacht, der entdeckt zu spät, dass ein Dattelbaum in ihm steckt.<br />
Zimbabwe: Beisst dich einmal eine Schlange nur, erschrickst du vor einer lumpigen Schnur.<br />
Abessinien: Die kleinsten Eidechsen denken daran, wie man wohl ein Krokodil werden kann.<br />
Bantu-Land: Wenn dich etwas glücklich macht, sieht dich Gott im Himmel und lacht.<br />
Ausser den beiden Beispielen aus "Bantu-Land", die nicht näher zugeordnet werden können, da die Bantuvöl-<br />
ker einen grossen Teil des afrikanischen Kontinents südlich der Sahara bevölkern, werden die Herkunftsländer<br />
der Sprüche genannt, was zu einer Differenzierung des Afrikabildes zumindest beitragen könnte. Interessant ist<br />
die Mischung aus für den europäischen Leser völlig fremder und sehr vertrauter Bildsprache der geschilderten,<br />
auch in Europa bestens bekannten menschlichen Regungen, wie Lernen, Spott, Angst, Ehrgeiz und<br />
Zufriedenheit.<br />
Dieses Wiedererkennen des Eigenen im Exotischen hebt sich von der Betonung des Exotischen, die zwar oft<br />
aufregend ist, aber wenig zum Verständnis des Anderen beiträgt, wohltuend ab.<br />
6.1.22 Das fliegende Haus (1992)<br />
Das 275 Seiten starke "interkantonale Lesebuch für das vierte Schuljahr" zeigt auf der Seite 103 eine Kinder-<br />
zeichnung, auf der eine Afrikanerin mit einer Schweizerin Ball spielt. Auf der Seite 207 gibt das Lesebuch<br />
einen gekürzten Text "Fatu ist Lehrerin" aus "Kein Platz für Tränen. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1986"<br />
von Hans-Martin Grosse-Oetringhaus wieder:<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Fatu ist Lehrerin. Sie lebt in Sibassor, einem kleinen Dorf in Senegal. Zwischen hier und Sibassor liegen das weite<br />
Mittelmeer und die noch weitere Sahara-Wüste. Fatu hat eine dunkelbraune, fast schwarze Hautfarbe. Aber das ist nicht<br />
ungewöhnlich, denn alle Menschen dort sind schwarz. Und doch hat es mit dieser Lehrerin etwas ganz Besonderes auf<br />
sich.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 481
Fatu ist erst neun Jahre alt. Aber das ist noch nicht genug der Merkwürdigkeiten: ihre Schüler sind fünfundzwanzig Jahre<br />
älter als sie selbst. Genauer gesagt, es sind ihre Eltern. Aber gleichzeitig sind Vater und Mutter Diop auch Lehrer. Eine<br />
ihrer besten Schülerinnen ist Fatu, denn Fatu geht noch zur Schule, jetzt bereits im dritten Jahr.<br />
Das hört sich alles sehr verwirrend an. Dabei ist es einfach: Jeder in Sibassor ist Lehrer und jeder ist Schüler. Sibassor hat<br />
nämlich eine Schule, die ganz anders ist als andere Schulen. In dieser Schule sollen die Schüler nicht Dinge lernen, für<br />
deren Wissen sie später zwar ein Zeugnis erhalten, aber mit dem sie im Dorf nicht viel anfangen können. Die Schüler<br />
sollen lernen, was sie auch wirklich im Dorfalltag brauchen. So zeigen die Mütter in der Schule ihren Kindern, wie man<br />
näht. Und umgekehrt helfen die Kinder ihren Eltern, Schreiben und Lesen zu lernen.<br />
Denn früher hatten die Eltern in dieser Gegend keine Gelegenheit gehabt, eine Schule zu besuchen.<br />
Fatu ist stolz darauf, ihrer Mutter und ihrem Vater Wörter vorzuschreiben und zu erklären. Sie ist eine sehr gewissenhafte<br />
Lehrerin.<br />
Zunächst war es Fatus Eltern schwergefallen, dass ihre Tochter die Buchstaben und Wörter besser beherrschte als sie<br />
selbst. Doch sie sind ja nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer. Sie wissen in so vielen Dingen Bescheid, die Fatu und die<br />
anderen Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse nicht können. Vater Diop kennt sich im Ackerbau und in der Viehzucht<br />
aus, und Mutter Diop ist eine geschickte Näherin. In dem Schulraum, dessen schmale Fenster nur ein dumpfes Licht in die<br />
Klasse fallen lassen, sitzt sie mit einigen ihrer Nachbarinnen und zeigt den Kindern die ersten Handgriffe zum Stricken und<br />
Häkeln und erklärt ihnen den Schnitt eines Kleides.<br />
Vor ein paar Jahren wurde bei den Jungen und Mädchen der Schule der Wunsch nach einer Schülerzeitung und einer<br />
kleinen Leihbücherei laut. Der Leiter der Schule machte ihnen klar, dass man dazu Geld benötigte. So machten sich die<br />
Schüler Gedanken, wie sie an Geld kommen könnten. Schliesslich hatten sie eine Idee. Oder besser: es waren gleich drei<br />
auf einmal. Sie bauten einen Stall für Hühner, deren Eier sie verkaufen konnten. Dann entstand die Nähwerkstatt. Und<br />
schliesslich legten sie in der Nähe der Dorfpumpe einen Garten an, dessen Gemüse sie verkauften.<br />
Doch der Garten bereitet ihnen auch grosse Sorgen. Das Dorf hat nur einen einzigen Brunnen. Und der muss auch noch<br />
vier weitere Dörfer mit Wasser für Mensch und Vieh versorgen. Da reicht manchmal das Wasser einfach nicht aus, um alle<br />
Beete genügend zu giessen.<br />
Heute sind die Schüler von Sibassor stolz auf ihre kleine, selbst angelegte Bücherei. Sie verwalten sie eigenständig und<br />
führen über alles genau Buch. Eine andere Schülergruppe erstellt eine eigene Zeitung. Ihr <strong>Pro</strong>blem sind die hohen Kosten<br />
für das Tippen und Abziehen der Seiten. Im Augenblick reicht das Geld nicht, um Papier für die nächste Ausgabe zu<br />
besorgen. Aber durch den Verkauf der Eier und des Gemüses hoffen Fatu und ihre Freunde, das nötige Geld bald<br />
zusammenzubekommen.<br />
In diesem Text wird nicht nur der Drang nach Bildung beschrieben, der vielen vor allen jüngeren Menschen in<br />
ganz verschiedenen Ländern Schwarzafrikas eigen ist, sondern eine Schulform, die weit über das hinausgeht,<br />
was in Europa, dem Kontinent der Bildung, bisher geleistet wurde. Natürlich handelt es sich bei dem geschil-<br />
derten Beispiel um eine Ausnahme, sie macht aber deutlich mit welchem Einsatz, viele Menschen in Schwarz-<br />
afrika versuchen, ihre eigene Situation zu verbessern. Obwohl der Text Schwierigkeiten wie Mangel an<br />
Wasser und finanziellen Ressourcen nicht verschweigt, gibt er doch die positive Haltung wieder, dass diese<br />
Schwierigkeiten zu meistern seien und zeichnet dadurch nicht das Bild einer immer hoffnungsloser werdenden<br />
Lage, sondern des Aufbruchs zu neuen Chancen, von dem auch Menschen ausserhalb Afrika lernen können.<br />
6.1.23 Spürnase (1993)<br />
Das 312 Seiten umfassende Lesebuch "Spürnase" für das fünfte Schuljahr enthält zwar einen längeren<br />
Ausschnitt aus dem Roman "Onkel Toms Hütte" von Harriet Beecher-Stowe auf den Seiten 103-110, in<br />
welchem das Schicksal der "Negersklaven" in den USA des 19. Jahrhunderts geschildert wird, sowie eine<br />
"afrikanische" Fabel "Chamäleon und Elefant" - eine Variante der "Hase und Igel"-Fabel -, macht ansonsten<br />
jedoch keine Angaben zu Schwarzafrika oder den dort lebenden Menschen.<br />
6.1.24 Deutsch, 1995<br />
Im Sprachlehrmittel "Deutsch - keine Hexerei" des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes wird Afrika<br />
auf den insgesamt 255 Seiten nur einmal, mit der Nennung Namibias angesprochen (S. 80). Afrikanische<br />
Menschen erwähnt das Lehrmittel hingegen nicht.<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 482
6.1.25 Wörterbücher<br />
Der folgende Abschnitt befasst sich kurz mit einigen der immer wieder im Zusammenhang mit Afrika und den<br />
Schwarzafrikanern auftauchenden Begriffen und deren Vorkommen respektive Beschreibung in<br />
(Schul-)Wörterbüchern.<br />
Das 144 Seiten umfassende "A-Z Wörterbuch" für die Mittelstufe von 1984 enthält einige wenige Einträge zu<br />
Afrika und den afrikanischen Menschen. Diese werden in der Regel nicht näher erläutert und die afrikanischen<br />
Länder fehlen bis auf wenige Ausnahmen, beispielsweise Ägypten, fast ganz. Neben dem Stichwort "Afrika"<br />
finden sich auch die Einträge "Eingeborene... (Ureinwohner)" und "Neger". Das Wörterbuch bietet den Schü-<br />
lern also kaum Hand, sich sprachlich differenziert zu Afrika und den dort lebenden Menschen zu äussern.<br />
Ausserdem sind die aufgeführten Begriffe unterdessen veraltet und sollten keine Verwendung mehr finden.<br />
Jüngeren Datums sind die beiden folgenden Wörterbücher für die Unterstufe: Während der "ABC-Drache", ein<br />
Wörterbuch für die 1. Primarschulklasse von 1993, keine Angaben zu Afrika oder Afrikanern macht, zeigt der<br />
120 Seiten umfassende Band "Ungeheuer viele Wörter" für die 2. und 3. Klasse von 1992 zwei Afrikanerin-<br />
nen: eine Sportlerin auf der Seite 96 und eine Schülerin auf der Seite 114:<br />
Bildausschnitte: links S. 96, rechts S. 114<br />
Weitere Angaben zu Afrika oder schwarzafrikanischen Menschen enthält das Wörterbuch nicht.<br />
Das 1996 nach der neuen Rechtschreibung erschienene Wörterbuch "Wort für Wort" für die Mittel- und Ober-<br />
stufe enthält auf den insgesamt 280 Seiten wesentlich mehr Einträge zu Afrika. Dazu gehören die meisten afri-<br />
kanischen Länder von "Ägypten" bis "Zentralafrikanische Republik". Weitere Stichworte sind "Afrika", "Afri-<br />
kaner" und "Afrikanerin" - die afrikanische Frau wird nun also auch in den Wörterbüchern zu Kenntnis<br />
genommen - , weiterhin findet sich die "Eingeborenen", aber auch die "Einheimischen". Und unter dem Stich-<br />
wort "Neger" heisst es, dies sei ein veralteter Begriff für Schwarze aus Amerika oder Afrika, ausserdem wird<br />
auch die "Negerin" aufgeführt. Im Gegensatz zum älteren "A-Z Wörterbuch" bietet "Wort für Wort" nicht nur<br />
wesentlich mehr Einträge, sondern weist auch, zumindest teilweise, auf den Sprachgebrauch gewisser Wörter<br />
hin.<br />
Zum Vergleich werden hier noch einige wenige Einträge aus anderen, nicht in erster Linie für die Schule<br />
gedachten Werke wiedergegeben. Der "Duden: Die sinn- und sachverwandten Wörter" von 1986 nennt unter<br />
dem Stichwort "Bewohner": Bevölkerung... Population, Einwohner, Ureinwohner, Bürger, Staatsangehörige,<br />
Landeskind, Eingeborener, Einheimischer, Eingesessener...". Unter "Afrika" finden sich "Schwarzer Erdteil"<br />
und "Schwarzafrika", der Eintrag "Afrikaner" verweist auf "Neger" mit den Bezeichnungen: "Schwarzer,<br />
Mohr, Nigger, Farbiger, Afrikaner, Aschanti, Ambo, Bantu, Ibo, Ila, Hutu, Fulbe, Kaffer, Haussa, Mbundu,<br />
Massai, Tussi, Suaheli, Sotho, Basotho, Zulu". (Duden, 1986) Der Duden unterscheidet bei dieser Aufzählung<br />
jedoch nicht zwischen korrekten Bezeichnungen von Völkern Schwarzafrikas, wie beispielsweise Hausa und<br />
Hutu, und veralteten oder gar rassistisch geprägten Begriffen wie "Kaffer" oder sogar "Nigger".<br />
Nach dem "Neuen grossen Lexikon" von 1991 ist "Neger" die "meist abwertend gebrauchte Bezeichnung für<br />
Afrikaner bzw. Schwarze". (Lexikon, 1991)<br />
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 483
Lesebücher und Sprachunterricht<br />
Der "Kleine Wahrig" von 1994 bezeichnet einen "Eingeborenen" als jemanden, "der in einem bestimmten<br />
Land geboren ist und dort lebt", der Ausdruck beziehe sich vor allem auf Naturvölker und Ureinwohner. Ein<br />
"Neger" sei ein "dunkelhäutiger, kraushaariger Bewohner des grössten Teils von Afrika südlich der Sahara"<br />
oder ein "Nachkomme der nach Amerika verschleppten schwarzen Afrikaner". (Wahrig, 1984)<br />
Die "Aktuelle deutsche Rechtschreibung" von 1996 bezeichnet den "Afrikaner" als "Eingeborener von Afrika"<br />
und meint, dass "Neger" ein abwertender Begriff für schwarzhäutige Menschen sei. (Rechtschreibung, 1996)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 484
6.2 Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
(Asterix und Obelix auf Kreuzfahrt 1996, S. 34)<br />
Anhand einiger Beispiele soll die Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen im Comic im Laufe der<br />
bereits mehr als hundertjährigen Comicgeschichte kurz umrissen werden, dabei werden die betreffenden Stel-<br />
len jeweils kurz kommentiert und wo nötig mit weiteren Anmerkungen versehen. Eine Zusammenfassung der<br />
Darstellung im Comic findet sich auf der Seite 492 dieser Arbeit am Ende des Abschnittes.<br />
6.2.1 Fipps der Affe<br />
Die 1879 erschienene Bildergeschichte "Fipps der Affe" von Wilhelm Busch beschreibt auf den ersten drei<br />
Seiten kurz die Affenjagd eines Schwarzafrikaners, die für den Jäger unglücklich endet, da er in der Folge der<br />
Handlung nicht nur seinen Nasenring verliert, sondern auch in schmerzlicher Weise einen Teil seiner Nase.<br />
(Busch 1879, S. 287-290)<br />
Der abgebildete Schwarzafrikaner wird abgesehen von einem übergrossen Nasenring, der in der Handlung der<br />
Geschichte eine wichtige Rolle spielt, unter den Völkern Afrikas aber nicht weit verbreitet ist, im Rahmen der<br />
buschschen Karrikaturen durchaus normal gezeichnet.<br />
Busch schildert, wie der "schwarze Mann" mit einer List, Fipps den Affen zwecks Verzehr - in einigen<br />
Ländern Afrikas gelten Affen als Delikatesse, wobei aber streng zwischen einem zu jagenden und als Haustier<br />
gehaltenen Affen unterschieden wird - einzufangen versucht.<br />
Im Gegensatz zum nachfolgenden besprochenen Comicbeispiel "Little Nemo", drückt der "schwarze Mann"<br />
von Busch sich in klaren Worten aus, wenn er über die Affen berichtet (Busch 1879, S. 288):<br />
"Ein alter Herr ist immer zäh!"<br />
So spricht er oft und macht "Bebä!"<br />
Neben der Handlung, die vor allem dazu dient, die Hauptperson der Bildergeschichte einzuführen, lässt Busch<br />
den Leser wissen, dass Afrika von "bunten Vögeln" und "schwarzen Männern" besiedelt sei. Über die örtlichen<br />
Bräuche dichtet er (Busch 1879, S. 288):<br />
"Kleider sind da wenig Sitte;<br />
Höchstens trägt man einen Hut,<br />
Auch wohl einen Schurz der Mitte;<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 485
Man ist schwarz und damit gut.<br />
Neben der Schwärze der Menschen, die Illustration zeigt richtigerweise einen Menschen mit brauner und nicht<br />
schwarzer Hautfarbe, berichtet Busch also, dass Kleidung im Leben der Schwarzafrikaner keine grosse Bedeu-<br />
tung habe, was für einige Küstenstriche der Gebiete des tropischen Regenwaldes zugetroffen haben mag, für<br />
andere Gegenden Schwarzafrikas aber schon damals sachlich unrichtig war.<br />
Der "schwarze Mann" dieser Geschichte, taucht erst ganz am Ende zum Begräbnis des Affen Fipps noch<br />
einmal auf, wo Busch auf der Seite 318 über ihn schreibt:<br />
Droben auf Adelens Dienersitze<br />
Thront der Schwarze mit dem Nasenschlitze.<br />
Einmal abgesehen von der Tatsache, dass Busch den am Anfang der Geschichte nur mit einem Lendenschurz<br />
gezeichneten "schwarzen Mann" nicht vergisst, tritt er in der für Schwarze damals als angemessen betrachteten<br />
Position des Dieners in Frack und Hut auf. Damit wurde er auf das Ende der Geschichte hin zivilisiert, was bei<br />
der Hauptfigur der Geschichte, dem Affen, ja schlussendlich nicht gelang.<br />
Busch zieht also eine Trennlinie zwischen der Figur des Tieres und des Menschen aus Afrika, was zu seiner<br />
Zeit nicht immer eine Selbstverständlichkeit war und deren Verlauf im Hinblick auf die verschiedenen Völker<br />
Afrikas von mehr oder weniger respektablen Wissenschaftlern ernsthaft diskutiert wurde.<br />
6.2.2 Little Nemo<br />
Bereits in der im Cincinnati Enquirer am 4. Oktober 1903 veröffentlichten Seite "How the Lion Got His Roar"<br />
stellt McCay Schwarzafrikaner mit wild abstehenden Haaren, grossen Augen, schwülstigen Lippen und mit<br />
einem Baströcken gekleidet dar und schafft damit eine Art der Darstellung, die für viele Jahre prägend bleiben<br />
sollte. (McCay 1907, S.6).<br />
In "Little Nemo" landet der Hauptdarsteller in der Ausgabe vom 5. Mai 1907 an der Küste Afrikas wo er von<br />
den dortigen Schwarzen, wieder in Baströckchen gezeichnet, durch deren König willkommen geheissen wird.<br />
Obwohl der ganze Comic in einer Traumwelt spielt, spiegelt er doch die damaligen und teilweise bis heute<br />
überdauernden Machtverhältnisse der Kolonialzeit: dem Weissen wird die ungeteilte Aufmerksamkeit ganzer<br />
Völker zuteil.<br />
In der nächsten Folge vom 12. Mai landet Nemos Freund, der Unruhestifter Flip, bereits in einem Kochtopf<br />
wird aber durch das Eingreifen des Königs gerettet (McCay 1908, S.22).<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 486
Die anfängliche Freundlichkeit der Schwarzafrikaner ist also bereits nach einer Woche ihrer "wahren Natur"<br />
gewichen, die sie, getreu dem bis heute in Witzen kolportierten Klischee, dazu zwingt, ihre Gäste nach einer<br />
kurzen Schonfrist zu kochen und zu verzehren.<br />
Nach Abenteuern im Urwald, wird Nemo in königlicher Pose auf einem von Schwarzen getragenen Holzthron<br />
dargestellt. Am 2. Juni 1907 werden Nemo und seine Freunde Zeugen eines Speertanzes. Bereits am 16. Juni<br />
landen sie dann wieder im Kochtopf und werden diesmal durch weisse Soldaten mit Gewehren gerettet. Am<br />
11. August nehmen Nemo und seine Freunde Abschied von Afrika, wobei sie einer der Schwarzen als neuge-<br />
wonnener Freund begleitet und im weiteren Verlauf als Gefährte Nemos für allerhand Aufregung sorgt<br />
(McCay 1908, S.25-38).<br />
Am 30. August 1908 läuft Nemo noch einmal Gefahr im Kochtopf zu landen, wird diesmal aber von einem<br />
Missionar gerettet, der die Kannibalen mit den Worten "...anstatt Fleisch zu essen und Suppe zu trinken,<br />
warum seid ihr nicht mit Wurzelgemüse, Kräutern, Rinde und Beeren zufrieden?", von ihrem Vorhaben<br />
abbringt. (McCay 1908, S.90)<br />
Neben der stillen Annahme, schwarzafrikanische Menschen seien Jäger und Sammler, d. h. sie würden keine<br />
Kulturpflanzen anbauen, gibt McCay damit der damaligen Ansicht Ausdruck, die Schwarzafrikaner müssten<br />
erzogen werden, um sich der europäischen Kultur anpassen und aktiv zur Weltwirtschaft beitragen zu können.<br />
Zu dieser Zivilisierung gehört auch der Erwerb der Sprache des Kolonisators.<br />
Denn der König der "Wilden" spricht zwar die Sprache Nemos, seine Untertanen verständigen sich aber in<br />
ihrer eigenen Sprache "Guuk Ek Ike Iiik Ek Gack...", die für Nemo und seine Gefährten völlig unverständlich<br />
bleibt. Meist bleiben aber die Schwarzen sogar völlig sprachlos (McCay 1908, S.21-90) und werden damit in<br />
die Nähre von wilden Tieren gerückt.<br />
Am 9. Februar 1908 wird der schwarze Gefährte Nemos "Fratz" dann auch auf einem Bild, welches die folgen-<br />
de Textunterlegung trägt, als Affe dargestellt: "Du bist der Fratz aus dem Dschungel, siehst aus wie Pavian, ein<br />
Ringelschwanzäffchen oder ein Hottentott". (McCay 1908, S.61)<br />
McCay macht also hier ausdrücklich keinen Unterschied zwischen einem Affen und einem "Hottentotten" und<br />
verwischt dadurch die Grenze zwischen dem Tier und dem Schwarzafrikaner, was gegenüber der Darstellung<br />
in Wilhelm Buschs Werk einen eindeutigen Rückschritt bedeutet, aber Anfang des 20. Jahrhunderts kein<br />
Einzelfall war. Einen guten Einblick in die damaligen Debatten liefert Bergmanns Bericht über das Schicksal<br />
des Pygmäen (zu den Pygmäen siehe auch die Seiten 448 und 491 dieser Arbeit) Ota Benga, in dem unter<br />
anderen ein Artikel vom Anfang des Jahrhunderts aus "Scientific American" zitiert wird: "The personal appea-<br />
rance, characteristics, and traits of the Congo pygmies... [conclude they are] small, apelike, elfish creatures,<br />
furtive and mischievois, they closely parallel the brownies and goblins of our fairy tales. They live in the dense<br />
tangled forests in absolute savagery, and while they exhibit many ape-like features in their bodies, they possess<br />
a certain alertness, which appears to make them more intelligent than other negroes... The existence of the<br />
pygmies is of the rudest; they do not practise agriculture, and keep no domestic animals. They live by means<br />
of hunting and snaring, eking this out by means of thieving from the big negroes, on the outskirts of whose<br />
tribes they usually establish their little colonies, though they are as unstable as water, and range far and wide<br />
through the forests. They have seemingly become acquainted with metal only through contact with superior<br />
beings..." (Bergmann, 1993)<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 487
6.2.2.1 Zusammenfassung<br />
Bereits in diesem frühen Klassiker des Comics, der zur Blütezeit des Kolonialismus erschien, werden wesentli-<br />
che Merkmale der Darstellung von Schwarzafrikanern im Comic bestimmt. Sie beherrschen in ihrer tierähnli-<br />
chen Existenz die Sprache nicht, müssen dringend missioniert werden und treten als Gehilfen des Bösewichts<br />
auf, so etwa auch in Hergés "Land des Schwarzen Goldes" (Hergé 1971, S.51-53). Spätere Zeichner schienen<br />
sich von den von McCay geschaffenen oder zumindest visualisierten Zerrbildern nur schwer lösen zu können.<br />
6.2.3 Tim und Struppi<br />
In "Tim und Struppi im Kongo" von Hergé 1930-1931 gezeichnet, kommt es zu folgenden Szenen (Hergé<br />
1931, Seitenzahlen können keine angegeben werden, da diese im Original fehlen):<br />
Der erste Schwarze begegnet Tim bereits auf der ersten Seite mit den Worten: "Ihre Kabine, Massa!", als<br />
dieser das Schiff nach Afrika besteigt. In einer nächsten Szene versucht ein schwarzer Matrose den über Bord<br />
gefallenen Struppi zu retten, stellt sich dabei aber so ungeschickt an, dass Struppi beinahe ertrinkt. Obwohl die<br />
schwarzafrikanischen Menschen unter dem "zivilisierenden" Einfluss Europas unterdessen ihren Platz als<br />
Zudiener des Weissen gefunden haben, werden ihre intellektuellen Fähigkeiten für eine darüberhinausgehende<br />
Rolle als nicht ausreichend angesehen.<br />
Im Kongo angekommen bereiten die Schwarzen Tim einen triumphalen Empfang. Dies geschieht ganz in der<br />
Manier des bereits besprochenen "Little Nemo" von McCay. Dem Weissen schlägt grenzenlose Bewunderung<br />
entgegen, die er aber, nicht ohne ein gewisses Wohlbefinden, eher gelassen entgegennimmt. Eine Tendenz die<br />
sicherlich nicht nur auf den Stolz des Autors auf die Errungenschaften der weissen Kolonisatoren auf dem<br />
"schwarzen Kontinent" zurückgeht, sondern für viele Menschen in Schwarzafrika bis heute Teil einer fatalen<br />
Verhaltensrealität geblieben ist, die sich darin äussert, dass sogenannte "Fachkräfte" aus den Industrienationen<br />
ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten oft einen grösseren und nicht immer positiven Einfluss ausüben als<br />
die einheimischen Spezialisten, welche oft für einen Bruchteil des Lohnes eines "Entwicklungshelfers" ihre<br />
Arbeit verrichten.<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Der kamerunische Schriftsteller Mongo Beti, geboren 1932, schrieb dazu in "De la Violence de l'Impérialisme<br />
au Chaos Rampant" 1978 (Jestel Hrsg., 1982, S. 74): "Technische Entwicklungshilfe, das bedeutet auch zehn-<br />
tausende von afrikanischen Fachleuten, die in Afrika selbst nur lächerliche Aufgaben wahrnehmen dürfen und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 488
Individuen untergeordnet sind, die oftmals nicht einmal ihre Qualifikationen haben...". Zu der Zeit als "Tim<br />
und Struppi im Kongo" entstand, waren solche <strong>Pro</strong>bleme allerdings noch von ungeordneter Bedeutung und die<br />
"Überlegenheit" des Europäers über den Schwarzafrikaner galt als gesicherte Erkenntnis.<br />
Bevor Tim seine Expedition in den Dschungel antritt sucht er sich eine schwarzes Kind als "Mädchen für<br />
alles", einen Boy, den Struppi, Tims Hund, mit der Bemerkung: "Besonders pfiffig sieht der aber nicht aus!"<br />
qualifiziert.<br />
Im Gegensatz zu "Little Nemo" 20 Jahre früher, kann sich der Junge namens Coco bereits gebrochen mit Tim<br />
verständigen "...weisser Mann mit Brummbrumm wegfahren..." oder "Massa! Massa! Gefangener futsch!"<br />
Auch die anderen Schwarzen sind der Kultursprache Tims, dem Französisch nur bedingt mächtig, allerdings<br />
kommt Tim selbst nie in eine Situation, in der er die Sprache der Eingeborenen sprechen müsste, da diese in<br />
diesem Comic über keine eigene Sprache zu verfügen scheinen.<br />
Bei einem durch Tims Leichtsinn verursachten Zugunfall werden weitere "Eigenschaften" der Schwarzafrika-<br />
ner porträtiert, so etwa deren Unvermögen die Technik ohne Hilfe des weissen Mannes zu beherrschen, sowie<br />
eine Tendenz zur Drückebergerei im Anblick von noch zu leistender Arbeit. Erst auf den Befehl des Hundes<br />
machen sich die Schwarzafrikaner dann doch an die notwendige Arbeit, die entgleiste Lok wieder aufzurich-<br />
ten. (Siehe dazu die Abbildung weiter unten.)<br />
Nach der Ankunft in einem Dorf der Einheimischen, darf der böse Medizinmann nicht fehlen, der sich durch<br />
die Ankunft Tims in seiner Macht eingeschränkt fühlt, sich gegen den "Fortschritt" sperrt und im Verlaufe der<br />
Geschichte für einige Schwierigkeiten von Tim sorgt. Tim gelingt es aber mit Hilfe der Technik, einem Gram-<br />
mophon und einer Filmkamera, die Dorfbewohner von den bösen Absichten des Medizinmanns zu überzeugen<br />
und geht dank seiner intellektuellen Überlegenheit als Sieger aus dem Machtkampf hervor. Diese Feindselig-<br />
keit gegenüber Neuerungen, die oft mit Zwangsarbeit verbunden waren, zitieren auch einige der älteren unter-<br />
suchten Geographielehrmittel. (Siehe dazu die Seite 222 dieser Arbeit.)<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Im Verlaufe der Geschichte trifft Tim dann auch auf eine Missionsstation. Dort übernimmt er kurzerhand das<br />
Amt des krankgewordenen Dorflehrers und unterrichtet die Knaben der Missionsschule. Nach weiteren Aben-<br />
teuern kehrt Tim schliesslich nach Europa zurück. Hinter sich lässt Tim die über seine Abreise unglücklichen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 489
Afrikaner: "Die Nachricht von Tims Abreise verbreitet sich in ganz Afrika" ist die zweitletzte Seite übertitelt.<br />
Und die Schwarzen äussern Schlussworte wie: "Grosses Unglück: Tim fort!" und "Ach, wie traurig!".<br />
In seinen frühen Werk "Tim und Struppi im Kongo" wird offensichtlich, dass Hergé wenig über das beschrie-<br />
bene Gebiet und die in ihm lebenden Menschen weiss. In späteren Bänden erhob er selbst den Anspruch, seine<br />
Geschichten näher an der Realität zu zeichnen. Durch seine damalige Arbeitsweise, übernahm er völlig unre-<br />
flektiert die Aussagen der Kolonialpropaganda, die die Schwarzafrikaner als minderwertige Menschen darzu-<br />
stellen versuchte, und verbreitete damit deren Aussagen in die Kinderstube bis zum heutigen Tag.<br />
Bereits in den dreissiger Jahren begann sich eine Schicht von intellektuellen Schwarzen, gegen dieses Bild zu<br />
wehren, schliesslich hatten einige von ihnen die Geschehnisse des 1. Weltkrieges am eigenen Leib erlebt.<br />
Diese Tendenz einer Gegenbewegung der rassisch als minderwertig eingestuften Schwarzafrikaner sollte sich<br />
nach dem Ende des 2. Weltkrieges, in dem Tausende von Schwarzafrikanern Kriegsdienst leisteten, und der<br />
Erlangung der Unabhängigkeit Indiens, verstärken und schliesslich zur Unabhängigkeit der meisten afrikani-<br />
schen Staaten in den sechziger Jahren führen.<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Werden die Schwarzen von Hergé 1930-1931 noch als Karikaturen ihrer selbst dargestellt, werden sie 40 Jahre<br />
später im bereits erwähnten Band "Im Land des Schwarzen Goldes" viel realistischer gezeichnet. Dies mag<br />
einerseits mit dem nach den Unabhängigkeitsbestreben der afrikanischen Nationen verändertem Bild der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 490
Schwarzen zusammenhängen, weist aber sicher auch auf das Bemühen Hergés, die Länder und Menschen in<br />
seiner Arbeit realistischer darzustellen.<br />
6.2.4 Spirou und Fantasio<br />
Erst im von Franquin im Rahmen der bis heute überaus erfolgreichen Spirou-Reihe gezeichneten "Tembo<br />
Tabou" werden die bis anhin vermittelten stereotypen Bilder bewusst aufgebrochen indem sie parodiert<br />
werden. So stehen beispielsweise nicht mehr die exotischen Speisen der Pygmäen im Vordergrund, sondern die<br />
Schwierigkeiten der Besucher aus Europa, diese richtig zu würdigen. Der weisse Mann tritt auch nicht mehr<br />
als Heilsbringer auf, denn als das Dorf der Pygmäen durch Wanderameisen bedroht wird, sind es nicht die<br />
beiden Europäer, die das Dorf vor dem sicheren Untergang retten, sondern deren Phantasiehaustier, das Marsu-<br />
pilami. (Franquin 1974, S.19).<br />
Die in der Geschichte dargestellten Pygmäen schleichen auch nicht mehr, wie in einigen Geographielehrmit-<br />
teln angedeutet, mit der Absicht durch die Wälder, den weissen Eindringling mittels Giftpfeilen zu erlegen,<br />
sondern zeigen die auch im Dokumentarfilm "Im Wald der Pygmäen" (1998) gezeigte Freude am Gesang,<br />
dessen Kunstfertigkeit durch zahlreiche Musikbeispiele belegt ist und einen wichtigen Teil der Kultur dieser<br />
Völker darstellt.<br />
Ausserdem werden die Pygmäen in diesem Comic auch als äusserst erfindungsreich dargestellt, etwa dann,<br />
wenn sie die Schurken in der Geschichte mit Hilfe von "Termitenbomben" in die Flucht schlagen. (Zu den<br />
Pygmäen siehe auch die Seite 487 dieser Arbeit.)<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Erstmal scheint auch ein Schwarzer in der Lage zu sein, sich in der Kultursprache der Helden fliessend auszu-<br />
drücken, selbst wenn es sich dabei um den Schurken handelt, der diesmal aber immerhin sein eigener Chef ist.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 491
Ausserdem werden in diesem Comic zu ersten Mal schwarze Menschen verschiedener Völker gezeichnet.<br />
(Franquin 1974, S.31)<br />
In "Tembo Tabou", "Tembo" ist eine Bezeichnung für Elefant (Aussereuropäische Erdteile 1953, S. 127),<br />
zeichnet Franquin ein Bild der Schwarzafrikaner, dass sich zwar noch an die Bildsprache älterer Werke des<br />
Genres anlehnt, dessen rassistische Darstellungen durch das Mittel der Parodie jedoch zumindest teilweise<br />
gebrochen und damit entkräftet werden. Zu dieser Entwicklung dürften nicht zuletzt die vergleichsweise zahl-<br />
reichen Schwarzafrikaner, die schon damals in Frankreich lebten und wirkten mit beigetragen haben.<br />
Auffallend ist im diesem wie in den anderen besprochenen Beispielen, das Fehlen von schwarzafrikanischen<br />
Frauen, denen, obwohl sie einen grossen Beitrag zur Gesellschaft und Wirtschaft Schwarzafrikas leisten, aller-<br />
höchstens eine Statistenrolle zugebilligt wird, wenn sie nicht ganz fehlen.<br />
6.2.5 Das schwarze Marsupilami<br />
In das "Schwarze Marsupilami" schliesslich, 1989 veröffentlicht, werden Schwarze in derselben Art wie Euro-<br />
päer und andere Volksgruppen dargestellt, wobei den Gesetzen des Comics folgend, die physischen Eigen-<br />
schaften überzeichnet werden.<br />
In geistiger Hinsicht hat der Schwarze hingegen nun auch im Comic mit anderen Volksgruppen gleichgezogen,<br />
was sich auch in der Sprache niederschlägt, so z. B. auf Seite 14: "Der nächste Hafen ist Vera Cruz... Bis dahin<br />
könnten wir's vielleicht gerade noch bringen." Auch die in älteren Werken porträtierte "Verehrung" der Weis-<br />
sen ist dem Bewusstsein der Fehlerhaftigkeit derer gewichen, wodurch der Eindruck eines gestärkten Selbstbe-<br />
wusstseins der Schwarzafrikaner geweckt wird:<br />
6.2.6 Zusammenfassung<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Während Busch 1879 in "Fipps der Affe" seinen "schwarzen Mann" als Menschen, wenn auch in einer durch<br />
seine mangelnde Zivilisiertheit in dienender Funktion sieht, zeichnet McCay Anfang des 20. Jahrhunderts das<br />
Bild eines dem Tier nahestehenden Wesens, dass einer Kultursprache nicht mächtig von seinen Trieben gelei-<br />
tet wird, und diese nur mit Hilfe von aussen unterdrücken kann. Hergé stellt 1930 die Bewohner des Kongo<br />
zwar wieder als Menschen dar, ordnet ihnen aber wenig schmeichelhafte Attribute zu, von denen er 40 Jahre<br />
später in seinem "Im Land des schwarzen Goldes" weitgehend Abstand nimmt. Franquin karikiert diese<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 492
Einstellung 1974 in "Tembo Tabou" indem er die Klischees überzeichnet. Erst 1989 stellt Franquin in "Das<br />
schwarze Marsupilami" einen Schwarzen in der gleichen Weise wie andere Personen dar.<br />
Die vorgestellten Comicbeispiele spiegeln nicht nur die jeweiligen Sichtweisen auf die schwarzafrikanische<br />
Bevölkerung, die sich während eine Grossteils dieses Jahrhunderts durch krassen Rassismus auszeichnet,<br />
sondern sie tragen durch die ihnen eigene, zu Überzeichnung und Vereinfachung neigende Darstellung<br />
verschiedener Menschentypen, sowie durch ihre Beliebtheit, zur Festigung von stereotypen Bildern bei, selbst<br />
wenn sich die Gründe für das Entstehen solcher Bilder längst überlebt haben und einer differenzierteren<br />
Betrachtungsweise gewichen sind.<br />
Streifzug durch die Comicgeschichte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 493
7. Ergebnisse der Untersuchung<br />
Im letzten Teil dieser Arbeit werden die Ergebnisse der Untersuchung des von den Lehrmitteln vermittelten<br />
Bildes vom schwarzafrikanischen Menschen unter den Gesichtspunkten "Darstellung des schwarzafrikanischen<br />
Menschen ", "Genannte Völker", "Genannte Länder", "Weitere Aspekte" und "Die diskriminierende Verwen-<br />
dung der Sprache" dargestellt. Dabei wird nicht mehr auf konkrete Stellen in den Lehrmitteln verwiesen,<br />
sondern es werden nur noch die Lehrmittel an sich genannt. Der ganze Teil wird mit einer Zusammenfassung<br />
abgeschlossen, die die in den einzelnen Gesichtspunkten vermerkten Verschiebungen im Bild des schwarzafri-<br />
kanischen Menschen zu einem Gesamttrend verdichtet.<br />
7.1 Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Die Darstellung des Schwarzafrikaner soll anhand der Aspekte "In den Lehrmitteln erwähnte Berufe von<br />
Schwarzafrikanern", "Subsistenzproduktion und Exporte", "Darstellung von Mann, Frau und Kind", "Zuge-<br />
schriebene Eigenschaften" und "Darstellung von Nichtschwarzafrikanern" zusammengefasst werden.<br />
7.1.1 In den Lehrmitteln erwähnte Berufe von Schwarzafrikanern<br />
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die verschiedenen Berufe, die in den Geographielehrmitteln<br />
im Zusammenhang mit Schwarzafrikanern genannt werden. Unter der Spalte "Jäger" werden auch Sammler<br />
aufgeführt, unter der Spalte "Hirte" auch Viehzüchter.<br />
Tabelle: Berufe<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Lehrmittel Jäger Hirte Bauer Arbeiter Händler Politiker weitere Berufe<br />
Lesebuch, 30er Jahre x x Handwerker<br />
Leitfaden, 1934 x x x x -<br />
Arbeitsbuch Oberklassen, 1936 x x Eisenbahnbauer, Künstler, Träger<br />
Geographie, 1953 x x x Träger<br />
Harms Erdkunde, 1961 x x Angestellter, Dichter, Kupferschmied, Lehrer, Soldat<br />
Geographie, 1963 x x x Träger<br />
Geographie Widrig, 1967 x x x x x x Arzt, Berater, Kaiser, Lehrer, Medizinmann, sieben<br />
verschiedene Handwerker,<br />
Seydlitz Realschule, 1968 x x x x x Fischer<br />
Erdkunde, 1968 x x x x x x Arbeitsloser,<br />
Arzt, Beamte, Fischer, Ingenieur, Jurist, Lehrer,<br />
Missionar, Offizier, Schüler, Student, Techniker,<br />
Töpfer, Ökonom<br />
Erkunde Oberstufe, 1968-1969 x x x Fischer<br />
Länder u. Völker, 60er Jahre x x x x x Dienstbote, Färber, Gesetzgeber, Handwerker,<br />
Kaiser, König, Minenarbeiter, Richter, Schmied,<br />
Steuereinnehmer, Student, Tagelöhner, Weber,<br />
Zauberer<br />
Seydlitz Gymnasien, 1963-1971 x x x x x Anwalt, Beamter, Fischer, Gewerkschafter, Handwerker,<br />
Schnitzer, Wissenschaftler<br />
Fahr in die Welt, 1971-1974 x x x x Arzt, Bergbauarbeiter, Bibliothekar, Buchhalter,<br />
Fischer, Fremdenführer, Häuptling, Ingenieur, Jurist,<br />
Kaiser, Krankenschwestern, Lehrer, Maschinist,<br />
<strong>Pro</strong>fessor, Rechtsanwalt, Schüler<br />
Geographie Aargau, 1972-1977 x x x x Hilfskraft, Schüler<br />
List Geographie, 1972-1976 x x x x x x Ingenieur<br />
Neue Geographie, 1974-1976 x x x x -<br />
Dreimal um die Erde, 1977-1980 x x x x x Polizist, Wilderer<br />
Geographie thematisch x x x x -<br />
Terra Geographie, 1979 x x medizinisches Personal, Polizist, Schmied, Schreiner<br />
Unser Planet, 1979-1982 x x x -<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1983-1984 x x x x Angestellter, Beamter, Fachkraft, Forstexperte, Reiseleiter,<br />
Schüler<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 494
Lehrmittel Jäger Hirte Bauer Arbeiter Händler Politiker weitere Berufe<br />
Geographie der Kontinente, 1984 x x x x x x Lehrer<br />
Terra Erdkunde Realschule, 1980-1985 x x -<br />
Mensch u. Raum, 1983-1986 x x x x Andenkenverkäufer, Arzt, Bäcker, Dienstbote, Hilfskraft,<br />
Müller, Weidenkorbflechter, Wildhüter<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1987 x x x Herrscher, König, Oberbefehlshaber, Personaldirektor,<br />
Schulkinder, Vorsitzender,<br />
Seydlitz Erdkunde, 1993-1995 x x x x x x -<br />
Seydlitz Geographie, 1994-1996 x x x x x Regierungsbeamter<br />
Heimat u. Welt, 1994-1996 x x x x Lastenträger, Wasserträger<br />
Geographie: Mensch u. Raum, 1994-1996 x x Richter<br />
Diercke Erdkunde, 1995-1997 x x x x x Landwirtschaftsberater, Lehrer<br />
Die Tabelle weist einen eindeutigen Trend im Bezug auf die erwähnten Berufe auf: Während bis in die sechzi-<br />
ger Jahre die Berufe aus der Landwirtschaft, sowie die Darstellung von Völkern, die auf einer einfachen Wirt-<br />
schaftsstufe leben, bevorzugt wurde, differenzierte sich das Berufsspektrum im Zeitraum nach der Unabhän-<br />
gigkeit vieler schwarzafrikanischer Staaten von 1960 bis Mitte der siebziger Jahre. Dabei liegt ein Schwerge-<br />
wicht auf der Nennung von vermehrt akademischen Berufen. Im Zusammenhang mit den Hungerkatastrophen<br />
im Sahel verlagert sich danach die Gewichtung auf die Landwirtschaft und Viehzucht, nur vereinzelt werden<br />
noch andere Berufe erwähnt, meist im Zusammenhang mit Entwicklungshilfe oder Tourismus. Die Lehrmittel<br />
der neunziger Jahre konzentrieren sich vornehmlich auf die Schilderung der Subsistenzwirtschaft und der<br />
damit verbundenen Berufe, auch Jagd- und Sammeltätigkeiten werden wieder vermehrt betont. Andere Berufs-<br />
gruppen treten in den Hintergrund oder werden gar nicht mehr erwähnt.<br />
7.1.2 Subsistenzproduktion und Exporte<br />
Mit der Hilfe von Tabellen zur Subsistenzproduktion und zu den Exporten, sowie der Betrachtung des<br />
Wandels im dargelegten Verständnis ökologischer Aspekte, soll die Darstellung des für Schwarzafrikas noch<br />
immer wichtigsten Wirtschaftssektor der Primärproduktion zusammengefasst werden.<br />
7.1.2.1 Subsistenzproduktion<br />
Die Tabelle "Landwirtschaft und Viehzucht" gibt einen Überblick über die in den Lehrmitteln erwähnten<br />
Nahrungsmittel, Haustiere und Anbauprodukte der schwarzafrikanischen Bevölkerung. Folgende Abkürzun-<br />
gen werden verwendet: Ri. = Rinder, Ka. = Kamele, Sf. = Schafe, Zi. = Ziegen, Sw. = Schweine, Hu. =<br />
Hühner, Ms. = Mais, Hi. = Hirse, Rs. = Reis, Er. = Erdnüsse, Ya. = Yams (Jams), Mk. = Maniok (Kassawa),<br />
Bt. = Batate (Süsskartoffel), Ba. = Bananen (Mehl- und Obstbananen), Kü. = Kürbisse, Bo. = Bohnen, Öp. =<br />
Ölpalme.<br />
Tabelle: Landwirtschaft und Viehzucht<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Viehzucht Ackerbau weitere landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>dukte<br />
Lehrmittel Ri. Ka. Sf. Zi. Sw. Hu. Ms. Hi. Rs. Er. Ya. Mk. Bt. Ba. Kü. Bo. Öp.<br />
Lesebuch Oberklassen, 30er Jahre x x Fleisch, Früchte<br />
Leitfaden, 1934 x x x x x x x Knollen, Pferd, Strauss<br />
Arbeits- und Lesebuch, 1936 x x x x x x x x x Eier, Käse, Milch<br />
Geographie, 1953 x x x x x x Früchte, Obst, Weizen<br />
Aussereuropäische Erdteile, 1953 x x Paradiesfeigen, Zuckerrohr<br />
Geographie, 1963 x x x x x x x x x<br />
Geographie Widrig, 1967 x x x x x x x x<br />
Seydlitz Realschulen, 1968 x x x x x x x x x x x x x x Esel, Kokospalme, Pferd, Zuckerrohr<br />
Erdkunde, 1968 x x x x x x x x x x x x Kokospalme, Knollenfrüchte,<br />
Melonen,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 495
Viehzucht Ackerbau weitere landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>dukte<br />
Lehrmittel Ri. Ka. Sf. Zi. Sw. Hu. Ms. Hi. Rs. Er. Ya. Mk. Bt. Ba. Kü. Bo. Öp.<br />
Erdkunde: Oberstufe, 1968-1969 x x x x x x Kartoffeln<br />
Länder u. Völker, 60er Jahre x x x x x x x x x x x x x x Baumwolle, Durra, Ente, Erbse, Kolanuss,<br />
Melonen, Pfeffer, Pferd, Tabak,<br />
Taro, Zwiebeln,<br />
Seydlitz Gymnasien, 1963-1971 x x x x x x x x x x x Baumwolle, Melonen, Pferd, Taro<br />
List Geographie, 1972-1976 x x x Fisch, Weizen<br />
Geographie Aargau, 1972-1977 x x x x x x x x x Früchte, Kabis<br />
Neue Geographie, 1974-1976 x x x x x x x Cashewnuss, Kokospalme, Kräuter,<br />
Tomaten, Weisskohl, Zitrusfrüchte,<br />
Zuckerrohr, Zwiebeln<br />
Dreimal um die Erde, 1977-1980 x x x x x Fleisch, Gemüse, Käse, Kolanüsse,<br />
Mango, Milch, Obst, Palmwein,<br />
Spinat, Taro,<br />
Geographie thematisch, 1977-1980 x x x x x x x x x x x Auberginen, Cashewnuss, Fleisch,<br />
Kartoffeln, Kokospalme, Milch, Pfeffer,<br />
Taro, Tomaten, Weizen,<br />
Zuckerrohr<br />
Terra Geographie, 1979 x x x x x x x x x x Baumwolle, Zuckerrohr<br />
Unser Planet, 1979-1982 x x x x x x x Fleisch, Milch<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1983-1984 x x x x x x x x x x x x Ananas, Avocado, Baumwolle, Fisch,<br />
Früchte, Honig, Insekten, Kräuter,<br />
Mango, Papaya, Weizen, Zuckerrohr<br />
Geographie der Kontinente, 1984 x x x x x x x x x x x x x x x Baumwolle, Fisch, Hunde, Kartoffeln,<br />
Taro, Zwiebeln,<br />
Terra Erdkunde Realschulen, 1980-1985 x x x x x x x x x x x x x Datteln, Fisch, Gerste, Sesam, Weizen<br />
Mensch u. Raum, 1983-1986 x x x x x x x Gemüse, Obst, Taro<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1987 x x x x x x x x x Avocado, Gemüse, Kartoffeln, Milch,<br />
Tee, Tungnuss, Zuckerrohr<br />
Seydlitz Erdkunde, 1993-1995 x x x x x x x x x x x x Ananas, Baumwolle, Gemüse, Hülsenfrüchte,<br />
Milch, Weizen, Zitrusfrüchte,<br />
Zwiebeln<br />
Seydlitz Geographie, 1994-1996 x x x x x x x x x x x Aubergine, Esel, Pfeffer, Taro, Tomaten,<br />
Zwiebeln<br />
Heimat und Welt, 1994-1996 x x x x x x x<br />
Geographie: Mensch u. Raum, 1994-1996 x x x x x x Sorghum<br />
Diercke Erdkunde, 1995-1997 x x x x x x x x x x x Cashewnuss, Erbsen, Esel, Fisch,<br />
Gemüse, Gewürz, Mango, Nüsse,<br />
Papaya, Wild,<br />
Die Tabelle lässt vier Zeitabschnitte in der Darstellung der Nahrungsquellen, des Ackerbaus und der Vieh-<br />
zucht in Schwarzafrika erkennen. Bis Mitte der sechziger Jahre werden Haustiere kaum erwähnt und das<br />
Anbauprodukt Reis wird gar nicht genannt. Mitte der sechziger Jahre bis Anfang der achtziger Jahre<br />
verschwinden Ziegen, Schweine und Hühner in der Mehrheit der Geographielehrmittel, ähnliches lässt sich<br />
auch bei den Süsskartoffeln, Kürbissen und Bohnen beobachten. Die Geographielehrmittel der frühen achtzi-<br />
ger Jahre weisen wieder eine breitere Nahrungspalette auf, ab Mitte der achtziger Jahre verschwinden dafür<br />
Reis, Kürbisse, Bohnen und auch die Ölpalme fast ganz aus den Darstellungen.<br />
7.1.2.2 Exporte<br />
Die Tabelle "Exporte" gibt Auskunft über die in den Geographielehrmitteln erwähnten Exportprodukte aus<br />
dem Bergbau und der Landwirtschaft. Folgende Abkürzungen werden in der Tabelle verwendet: Cu = Kupfer<br />
oder Kupfererz, Au = Gold, Di. = Diamanten, Eö. = Erdöl, Bw. = Baumwolle, Kk. = Kautschuk, Öp. = Ölpal-<br />
menprodukte, Si. = Sisal, Eh. = Edelhölzer, Ka. = Kakao, Kf. = Kaffee, Kn. = Kolanüsse, Ta. = Tabak, Zu. =<br />
Zucker oder Zuckerrohr, Bn. = Bananen, En. = Erdnüsse oder Erdnussprodukte, Kp. = Kokosnüsse oder Kopra,<br />
Eb. = Elfenbein.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 496
Tabelle: Exporte<br />
Bergbau ind. Agrarprodukte Genussmittel Nahrungsmittel Weitere <strong>Pro</strong>dukte<br />
Lehrmittel Cu Au Di. Eö Bw Kk. Öp. Si. Eh. Ka. Kf. Ko. Ta. Tee Zu. Ba. En. Kp. Eb. Verschiedene<br />
Lesebuch Oberklassen, 30er Jahre x x x x x x x x x x x Kopal (Harz), Obst, Straussenfedern,<br />
Wein, Wolle<br />
Leitfaden, 1934 x x x x x x x x x x Düngestoffe, Eisenerz,<br />
Radiumerz Straussenfedern,<br />
Arbeits- und Lesebuch, 1936 x x x x x x x x x x x x x x x Datteln, Felle, Häute, Ingwer,<br />
Kamele, Mais Mandeln,<br />
Manganerz, Salz, Schafe,<br />
Sesam, Rinder, Südfrüchte,<br />
Straussenfedern, Weizen,<br />
Wolle, Ziegen, Zinn<br />
Geographie, 1953 x x x x x x x x Kohle, Pechblende, Radium,<br />
Uran, Wolle, Zinn<br />
Geographie, 1963 x x x x x x<br />
Geographie Widrig, 1967 x x x x x x<br />
Seydlitz Realschulen, 1968 x x x x x x x x x x x x x x x Bauxit, Eisen, Häute, Kobalt,<br />
Mangan, Phosphate, Uran,<br />
Vanille, Zinn,<br />
Erdkunde, 1968 x x x x x x x x x x x x x Ananas, Bambus, Blei,<br />
Gewürze, Gewürznelken,<br />
Graphit, Pfeffer, Platin,<br />
Silber, Vanille, Zink<br />
Erdkunde: Oberstufe, 1968-1969 x x x x x x x x x Genussmittel, Gewürze,<br />
Rotang,<br />
Länder u. Völker, 60er Jahre x x x x x x x x x x x Asbest, Antimon, Chrom,<br />
Kali, Mangan, Phosphat,<br />
Platin, Silber, Zinn<br />
Seydlitz Gymnasien, 1963-1971 x x x x x x x x Paranüsse, Schlangenhäute<br />
Fahr in die Welt, 1971-1974 x x x x x x x Asbest, Bauxit, Erze, Gewürze,<br />
Mangan<br />
List Geographie, 1972-1976 x x x x x x x x x x x x Eisenerz, Kobalt, Mangan,<br />
Zink<br />
Geographie Aargau, 1972-1977 x x x<br />
Dreimal um die Erde, 1977-1980 x x x x x x x x x Chrom, Mangan, Platin,<br />
Uranerz, Vanadium<br />
Geographie thematisch, 1977-1980 x x x x x x x x x x x Ananas, Hevea, Pyrethrum,<br />
Zinn<br />
Terra Geographie, 1979 x x x x x x Gewürznelken<br />
Unser Planet, 1979-1982 x x x x<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum,<br />
1983-1984<br />
x x x x x x x x x x x Bauxit<br />
Geographie der Kontinente, 1984 x x x x x x x Hirse<br />
Terra Erdkunde, 1980-1985 x x x x x x x Eisen, Fisch, Gemüse, Zinn<br />
Mensch u. Raum, 1983-1986 x x<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1987 x x x x x x x x x x x Kobalt, Mangan, Steinkohle,<br />
Zink, Zinn<br />
Seydlitz Erdkunde, 1993-1995 x x x x x x x x x x x x x x x Chrom, Kali, Kobalt,<br />
Mangan, Uran, Zink<br />
Seydlitz Geographie, 1994-1996 x x x x x<br />
Heimat und Welt, 1994-1996 x x x x Blei, Kobalt, Zinn<br />
Geographie: Mensch u. R., 1994-1996 x x x x x Rinder<br />
Diercke Erdkunde, 1995-1997 x<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Die Darstellung der Exporte der schwarzafrikanischen Staaten in den Geographielehrmitteln zeigt ein wenig<br />
einheitliches Bild. Die Art der erwähnten Exportprodukte hängt wesentlich auch von den in den Lehrmitteln<br />
beschriebenen Ländern ab. Trotzdem zeichnet sich ein klarer Trend ab, der durch Aussagen in den Lehrmitteln<br />
gestützt wird: Wurden die schwarzafrikanischen Gebiete anfangs des Jahrhunderts kaum behandelt, fanden die<br />
Rohstoffe insbesondere in den dreissiger Jahren, wahrscheinlich auch bedingt durch die Entwicklung in Euro-<br />
pa, viel Aufmerksamkeit. Gegen Anfang der sechziger Jahre traten die Exporte zugunsten der politischen<br />
Entwicklung in den unabhängig werdenden Länder Schwarzafrikas in den Lehrmitteln in den Hintergrund.<br />
Bereits Ende der sechziger Jahre rückten die Rohstoffe Schwarzafrikas wieder in das Zentrum des<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 497
Bewusstseins, nachdem sich die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den ehemaligen Kolo-<br />
nialmächten und den neuen Staaten wieder eingependelt hatten. Afrika sollte zu einer Rohstoffkammer Euro-<br />
pas gemacht werden, die Europäer wollten für die in den vorangegangenen Jahrzehnten geleisteten Investitio-<br />
nen entschädigt werden. (Länder und Völker, 60er Jahre) Seitdem verringerte sich die Gewichtung der Exporte<br />
in den Lehrmitteln wieder, bis sie in den neunziger Jahren fast vollkommen an Gewicht verloren hatten. Nur<br />
gerade eines der untersuchten Lehrmitteln, die nach 1990 erschienen, erwähnt mehr als zehn verschiedene<br />
Exportprodukte.<br />
7.1.2.3 Ökologisches Bewusstsein<br />
Die Berücksichtigung der Umwelt, in der der schwarzafrikanische Mensch sich seine Lebensgrundlage schafft,<br />
vollzieht sich in den untersuchten Geographielehrmitteln in vier unterscheidbaren Phasen:<br />
In der ersten Phase bis Mitte der fünfziger Jahre wird die Natur vor allem als feindselig betrachtet. Ihr muss<br />
mit Chemikalien, Maschinen und Machete zu Leibe gerückt werden, um ihr die begehrten Rohstoffe abzuja-<br />
gen. Der Schwarzafrikaner der noch vorwiegend traditionell wirtschaftet ist dabei nur eine mässige Hilfe.<br />
In der zweiten Phase, bis Anfang der siebziger Jahre, wird zwar vereinzelt vor den Folgen gewisser Tätigkeiten<br />
der in Schwarzafrika lebenden Menschen gewarnt, diese werden aber wenig betont und ihre Auswirkungen nur<br />
kurz umschrieben. "Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule" von 1953 warnt vor umfangreichen<br />
Bodenverwüstungen durch Brandrodung, "Seydlitz für Realschulen" von 1968 betont die scheinbar<br />
oberflächliche Landnutzung der einheimischen Bauern sei klimatisch bedingt, "Erdkunde" 1968 erwähnt die<br />
durch Rodungen geschaffene Waldarmut in Äthiopien, "Erdkunde: Oberstufe" von 1968-1969 bedauert, dass<br />
die zunehmende Bevölkerungsdichte und der Gebrauch moderner Waffen zu einer Vernichtung des Wildes<br />
geführt haben, "Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren spricht davon, dass die rücksichtslose<br />
Zerstörung des Waldes eingeschränkt werden soll und "Seydlitz für Gymnasien" von 1963- 1971 bezeichnet<br />
die unerschöpfliche Fruchtbarkeit der tropischen Regenwälder als ein Märchen, das Abschlagen der natürli-<br />
chen Vegetation störe den naturgegebenen Landschaftshaushalt und die Kenntnis des natürlichen Landschafts-<br />
haushaltes sei eine unabdingbare Voraussetzung für eine sinnvolle agrarische Entwicklungsplanung. In all<br />
diesen Lehrmitteln steht nicht die Ernährung der einheimischen Bevölkerung im Zentrum des Interesses,<br />
sondern die möglichen Auswirkungen gewisser Handlungen auf die für Europa gedachte landwirtschaftliche<br />
Exportproduktion Schwarzafrikas.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Dies ändert sich in der dritten Phase, ab Mitte der siebziger Jahre bis Mitte der achtziger Jahre, in der die Fehl-<br />
handlungen der Menschen - vor allem die Schwarzafrikaner werden als verantwortlich bezeichnet, obwohl<br />
auch vereinzelt ausgesagt wird, dass die von Europa initiierte Entwicklung mitverantwortlich für Fehlentwick-<br />
lungen seien - in unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem Leiden während durch Dürren und Desertifikation<br />
verursachten Hungersnöten gebracht werden. "List Geographie" von 1972-1976 nennt als Ursachen der<br />
Hungerkatastrophen im Sahel Überweidung infolge Brunnenbaus und hohes Bevölkerungswachstum, "Neue<br />
Geographie" von 1974-1976 spricht ebenfalls von Überweidung und nennt ausserdem Abholzung und unkon-<br />
trollierte Nutzung der Grundwasserreserven, "Geographie thematisch" von 1977-1980 sagt aus, die Bauern im<br />
Sahel versuchten jenseits der klimatischen Trockengrenze Regenfeldbau zu betreiben. "Unser Planet" von<br />
1979-1982 fordert eine angepasste Wirtschaftsweise in den Regenwälder und macht Bevölkerungswachstum,<br />
Überweidung, und den Brennholzbedarf der einheimischen Bevölkerung für den Hunger im Sahel<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 498
verantwortlich, ausserdem führe eine Bewässerung zur Versalzung des Bodens. "Seydlitz: Mensch und Raum"<br />
von 1983-1984 führt die fortschreitende Desertifikation auf den Brennholzbedarf der Bevölkerung zurück,<br />
während "Terra Erdkunde für Realschulen" von 1980-1985 den Anbau jenseits der Trockengrenze und einen<br />
zu hohen Viehbestand für die <strong>Pro</strong>bleme verantwortlich macht. Die tropischen Regenwälder würden überdies<br />
zur Lösung des Ernährungsproblems nur unbedeutende Beiträge leisten können.<br />
Die vierte Phase ab Mitte der achtziger Jahre zeichnet sich durch ein besseres Verständnis der gegeben<br />
Umstände aus. Ausserdem wird die Lage zwar weiter als problematisch, jedoch nicht mehr als hoffnungslos<br />
geschildert. Dabei tritt auch die Sorge zutage, die ökologischen Veränderungen in Schwarzafrika könnten<br />
Auswirkungen auf Europa haben. "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1987 erklärt, dass die afrikanischen<br />
Böden meist sehr alt, lange genutzt, stark ausgelaugt und äusserst erosionsgefährdet seien, "Heimat und Welt"<br />
von 1994-1996 warnt, dass die Abholzung der tropischen Regenwälder zu einer weltweiten Klimaänderung<br />
führen könnte, "Geographie: Mensch und Raum" von 1994-1996 erwähnt noch einmal die Überschreitung der<br />
Trockengrenze und "Diercke Erdkunde" von 1995-1997 setzt auf eine behutsame Modernisierung der traditio-<br />
nellen Wirtschaftsformen Schwarzafrikas, denn ein Jagd- und Fischrevier ernähre 2 Menschen pro qkm, der<br />
Wanderfeldbau 40 Menschen qkm, und die vorgestellte Agroforstwirtschaft 200 Menschen pro qkm. Ziel sei<br />
es, die Selbstheilungskräfte der Natur und ihr empfindliches Gleichgewicht zu schonen, damit die gefährdeten<br />
Lebensräume Schwarzafrikas für den Menschen bewohnbar blieben. In dieser letzten Phase fällt auf, dass nicht<br />
mehr die Exportproduktion der schwarzafrikanischen Staaten im Zentrum der Betrachtung stehen, sondern das<br />
menschenwürdige Überleben der einheimischen Bevölkerung.<br />
7.1.3 Darstellung von Mann, Frau und Kind<br />
Nicht in allen Lehrmitteln wird bei der Beschreibung der Menschen Schwarzafrikas zwischen Männern, Frau-<br />
en und Kindern unterschieden, in einigen werden Frauen und Kinder nicht einmal erwähnt. In den folgenden<br />
Abschnitten werden die den Männern, Frauen und Kindern in den Lehrmitteln im Laufe der Zeit zugeschriebe-<br />
nen Rollen diskutiert und zusammengefasst.<br />
7.1.3.1 Die Rolle des Mannes<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Die dem schwarzafrikanischen Menschen am häufigsten zugeschriebene Tätigkeit ist die Feldarbeit, wobei<br />
meistens darauf hingewiesen wird, dass der Mann für das Roden der Felder zuständig sei. In einzelnen Lehr-<br />
mitteln wird aber auch die weitere Arbeit im Feld erwähnt, so beispielsweise in Terra Geographie (1979), wo<br />
der Bauer mit einer Hacke und in gebückter Haltung die Äcker bestellt. Weitere Lehrmittel in denen der<br />
schwarzafrikanische Mann bei der Feldarbeit dargestellt wird sind: Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen<br />
(1936), Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder (1953), Erdkunde (1968), Erdkunde: Oberstufe<br />
(1968-1969), Fahr mit in die Welt (1971-1974), Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (Aargau<br />
1972-1977), Dreimal um die Erde (1977-1980), Unser Planet (1979-1982), Seydlitz: Mensch und Raum<br />
(1983-1984), Geographie der Kontinente (Schülerband, 1984), Seydlitz Geographie (1994-1996), Heimat und<br />
Welt (1994-1996), Diercke Erdkunde (1995-1997) und Diercke Erdkunde (1995-1997). Ausserdem wird dem<br />
Mann eher der Anbau von sogenannten Cash crops zugeschrieben.<br />
Weitere Tätigkeiten, die typischerweise den schwarzafrikanischen Männer zugeschrieben werden, sind die<br />
Jagd, der Fischfang, die Rinderzucht und der Hausbau, so beispielsweise in den Lehrmitteln Arbeits- und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 499
Lesebuch für Oberklassen (1936), Seydlitz für Realschulen (1968), Erdkunde (1968), Länder und Völker der<br />
Erde (60er Jahre), Seydlitz: Mensch und Raum (1983-1984).<br />
Findet der schwarzafrikanische Mann kein Auskommen mehr auf dem Land, wandert er in städtische Gebiete<br />
ab, um dort ein Auskommen für sich und seine Familie zu finden oder um das für die Bezahlung des "Braut-<br />
preises" notwendige Geld zu beschaffen, denn er ist ganz durch die mit dem Verheiraten verbundenen Geldan-<br />
gelegenheiten beherrscht, wie in "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder" von 1953 dargestellt<br />
wird. Abwanderung wegen Lohnarbeit wird in den folgenden Lehrmitteln erwähnt: Arbeits- und Lesebuch für<br />
Oberklassen (1936), Dreimal um die Erde (1977-1980), Seydlitz: Mensch und Raum (1983-1984), Seydlitz:<br />
Mensch und Raum (1987), Seydlitz Geographie (1994-1996).<br />
Weiter tritt der schwarzafrikanische Mann als würdevoller Dorfältester in "Aussereuropäische Erdteile -<br />
Geographische Bilder" von 1953 auf, als Ehemann vieler Frauen und Kinder, in "Geographie für die oberen<br />
Klassen der Volksschule" von 1972-1977 und in "Diercke Erdkunde" von 1995-1997, der mit seinen Freunden<br />
plaudert, während sich seine Frauen auf den Feldern abrackern.<br />
War der schwarzafrikanische Mann in den früheren Lehrmitteln die einzige einheimische Person, die in<br />
Erscheinung trat, muss er in den neueren Lehrmitteln die Aufmerksamkeit der Leser immer mehr mit der<br />
schwarzafrikanischen Frau teilen. Dabei entwickelte er sich von einem nutzlosen, kaum zivilisierten Wesen<br />
über einen Arbeiter der eine gewisse Geschicklichkeit aufbrachte und als immer unentbehrlicher betrachtet<br />
wurde bis hin zum angesehenen Politiker und Intellektuellen, der die Geschicke seines Landes in die eigene<br />
Hand nahm. Mit den Hungerkatastrophen im Sahel verlor er diese ihm zugeschriebene Tüchtigkeit, wurde<br />
zuerst als Almosenempfänger betrachtet und schliesslich als Taugenichts, der auf Kosten seiner Frauen in den<br />
Tag hineinlebt und sich seine Zeit mit Plaudereien unter Freunden vertreibt.<br />
7.1.3.2 Die Rolle der Frau<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Mehr noch als bei der Beschreibung der Männer steht bei den Frauen die Feld- und Hausarbeit im Zentrum der<br />
Betrachtung. Kein einziges der untersuchten Geographielehrmittel schildert die schwarzafrikanische Frau<br />
ausserhalb des Dreiecks Hausarbeit, Feldarbeit und Markbesuch. Die Musiklehrmittel erwähnen Frauen nur im<br />
Zusammenhang mit dem Familienleben. Nur das Leselehrmittel "Das fliegende Haus" von 1992 schildert ein<br />
Mädchen in der Rolle einer "Lehrerin". Feldarbeit der Frauen, die im Gegensatz zur geleistete Rodungsarbeit<br />
der Männer vor allem mit den Worten säen, pflegen, ernten umschrieben werden kann, wird in den Lehrmit-<br />
teln "Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen" von 1936, "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder"<br />
von 1953, "Seydlitz für Realschulen" von 1968, "Erdkunde" von 1968, "Erdkunde: Oberstufe" von 1968-1969,<br />
"Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren, "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974, "Geographie für die<br />
oberen Klassen der Volksschule" von 1972-1977, "Neue Geographie" von 1974-1976, "Dreimal um die Erde"<br />
von 1977-1980, "Geographie thematisch" von 1977-1980, "Unser Planet" von 1979-1982, "Seydlitz: Mensch<br />
und Raum" von 1983-1984, "Geographie der Kontinente" von 1984, "Mensch und Raum" von 1983-1986,<br />
"Seydlitz: Mensch und Raum" von 1987, "Seydlitz Geographie" von 1994-1996, "Geographie: Mensch und<br />
Raum" von 1994-1996 und "Diercke Erdkunde" von 1995-1997 erwähnt.<br />
Hausarbeit wie Kochen, Holz und Wasser holen und Putzen werden der schwarzafrikanischen Frau in den<br />
Lehrmitteln "Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen" von 1936, "Erdkunde" von 1968, "Länder und Völker<br />
der Erde" aus den 60er Jahren, "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule" von 1972-1977, "Neue<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 500
Geographie" von 1974-1976, "Seydlitz: Mensch und Raum von 1983-1984, "Terra Erdkunde für Realschulen"<br />
von 1980-1985, "Mensch und Raum" von 1983-1986, "Seydlitz Geographie" von 1994-1996, "Geographie:<br />
Mensch und Raum" von 1994-1996 und "Diercke Erdkunde" von 1995-1997 zugeschrieben.<br />
Ausserdem können schwarzafrikanische Frauen nach der Darstellung der Lehrmittel einige einfache Handar-<br />
beiten wie Töpfern und Flechten verrichten, oder sie verkaufen ihre <strong>Pro</strong>dukte auf dem Markt: "Erdkunde" von<br />
1968, "Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren, "Neue Geographie" von 1974-1976 und "Diercke<br />
Erdkunde" von 1995-1997.<br />
Nur wenige der Geographielehrbücher vermitteln darüber hinausgehende Informationen: Wenn die schwarzaf-<br />
rikanische Frau nicht halbnackt dargestellt wird (Länder und Völker der Erde, 60er Jahre) kleidet sie sich in<br />
die schreiendsten Farben (Länder und Völker der Erde, 60er Jahre) oder lässt sich kunstvolle Frisuren machen<br />
(Geographie für die oberen Klassen der Volksschule, 1972-1977).<br />
Darüberhinaus lässt sich aber auch bei der Darstellung der schwarzafrikanischen Frau eine deutliche Entwick-<br />
lung aufzeigen. Wurde sie in "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder" von 1953 noch als Wertob-<br />
jekt oder als Kapital dargestellt, in "Länder und Völker der Erde" der 60er Jahre in erster Linie als Arbeitskraft<br />
gesehen, die nicht viel gilt, erringt sie bereits in "Mensch und Raum" von 1983-1986 in der Gestalt der Bäue-<br />
rin Tia Samoko mehr Aufmerksamkeit. "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1987 sagt aus, dass der grösste Teil<br />
der Arbeitslast in der Landwirtschaft auf ihr ruhe, nach "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 ist die Beteiligung<br />
der Frauen ein "Muss", wenn sich die Lebensverhältnisse zum Bessern wandeln sollen, "Seydlitz Geographie"<br />
von 1994-1996 fordert, dass die Rolle der Frau bei Entwicklungsmassnahmen viel stärker berücksichtigt<br />
werden müsse und nach "Geographie: Mensch und Raum" von 1994-1996 leistet die schwarzafrikanische Frau<br />
80-90% der landwirtschaftlichen Arbeit.<br />
Trotz dieser zunehmenden Wertschätzung, vor allem seit den neunziger Jahren, bleibt die schwarzafrikanische<br />
Frau aber noch immer ein Wesen, das wegen der hohen Kinderzahl unter einer angeschlagenen Gesundheit<br />
leidet (Seydlitz Geographie, 1994-1996), viel arbeitet und wenig verdient (Geographie: Mensch und Raum,<br />
1994-1996) und weder lesen noch schreiben kann (Diercke Erdkunde, 1995-1997).<br />
7.1.3.3 Die Rolle des Kindes<br />
Bis in die siebziger Jahre werden Kinder in den Geographielehrmitteln nur vereinzelt erwähnt. Dabei steht die<br />
Mithilfe bei der Feldarbeit oder die Verrichtung anderer Arbeiten oft im Vordergrund. Als Arbeitskraft werden<br />
Kinder in den Lehrmitteln "Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen" von 1936, "Fahr mit in die Welt" von<br />
1971-1974, "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule" von 1972-1977, "Neue Geographie" von<br />
1974-1976, "Dreimal um die Erde" von 1977-1980, "Geographie der Kontinente" von 1984, "Terra Erdkunde<br />
für Realschulen von 1980-1985, "Mensch und Raum" von 1983-1986, "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 und<br />
"Diercke Erdkunde" von 1995-1997 erwähnt.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Neben der Arbeit der Kinder wird der Schulbesuch von Kindern immer wieder erwähnt, oft wird aber auch<br />
vermerkt, dass die Kinder die Schule nur teilweise oder gar nicht besuchen. Nach "Fahr mit in die Welt" von<br />
1971-1974 gibt es in Lumbumbashi (Kongo) kein Kind ohne Schulunterricht, während in "Geographie für die<br />
oberen Klassen der Volksschule" von 1972-1977 Kinder versuchen in die Schule zu gehen, in "Neue Geogra-<br />
phie von 1974-1976 viele keine vollständige Schulbildung erhalten, in "Dreimal um die Erde" von 1977-1980<br />
nur ein Teil der Kinder die Schule besucht und in "Terra Geographie" von 1979 nur wenige die 5. Klasse<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 501
erreichen und wenig Brauchbares in der Schule lernen. Die Lehrmittel "Geographie der Kontinente" von 1984,<br />
"Seydlitz: Mensch und Raum" von 1987, "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 erwähnen den Schulbesuch nur,<br />
während "Mensch und Raum" von 1983-1986 und Diercke Erdkunde" von 1995-1997 lange Schulwege<br />
anmerken.<br />
Ab Mitte der siebziger Jahre werden Kinder immer häufiger auch im Zusammenhang mit Hunger und durch<br />
unzureichende Ernährung hervorgerufene Mangelkrankheiten, die zu einem frühen Tod führen können,<br />
beschrieben. Die folgenden Lehrmittel enthalten Aussagen in diese Richtung: "Dreimal um die Erde" von<br />
1977-1980, "Geographie thematisch" von 1977-1980, "Terra Geographie" von 1979, "Geographie der Konti-<br />
nente" von 1984, "Terra Erdkunde für Realschulen" von 1980-1985, "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995,<br />
"Geographie: Mensch und Raum" von 1994-1996 und "Diercke Erdkunde" von 1995-1997.<br />
In anderen Rollen treten Kinder nur sehr selten auf. Etwas mehr Gewicht auf die Schule und auch auf das Spiel<br />
von Kindern legen einige Musik- und Sprachlehrmittel.<br />
Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass Kinder bei der Beschreibung des schwarzafrikanischen<br />
Menschen meist nur eine Nebenrolle einnehmen, Mädchen öfters im Zusammenhang mit Arbeiten für den<br />
Haushalt genannt werden als Knaben, die nur selten und dann meist in der biographischen Beschreibung einer<br />
Persönlichkeit auftreten, sie bis Anfang der siebziger Jahre oft nicht einmal erwähnt wurden, ab diesem Zeit-<br />
punkt im Umfeld der Schule genannt und ab Mitte der siebziger Jahre zunehmend als Opfer von Hunger und<br />
Elend dargestellt werden.<br />
7.1.4 Zugeschriebene Eigenschaften<br />
In den meisten Lehrmitteln werden den Schwarzafrikanern ganz bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Der<br />
nachfolgende Text bietet eine Zusammenfassung der auffälligsten Zuschreibungen der untersuchten<br />
Geographielehrmittel.<br />
Auch bei diesen Darstellungen lassen sich unterschiedliche Zeitabschnitte abgrenzen. Bis Ende der sechziger<br />
Jahre dominieren die Aussagen, welche die Schwarzafrikaner als wenig zivilisierte, den Europäern eindeutig<br />
unterlegene Menschen darstellen.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Das "Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen" von 1912 berichtet von der entsetzlichen Roheit<br />
der "Negervölker". Nach dem "Lesebuch für die Oberklassen" aus den 30er Jahren ist der früher von wilder<br />
Grausamkeit beherrschte "Neger" anstellig in manchen Dingen, bringt es über einen gewissen Stand der geisti-<br />
gen Entwicklung jedoch nicht hinaus. Das "Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen" von 1936 attestiert dem<br />
"Neger" harte Arbeit zu leisten, eine zeitliche Voraussicht fehlt ihm aber. Nach "Harms Erdkunde - Die Welt<br />
in allen Zonen" von 1961 erkenne der Schwarze bei der Begegnung mit weissen Menschen das Übermenschli-<br />
che, göttergleich Mächtige in den Europäern, er selbst sei machtlos und misstrauisch. "Geographie Widrig"<br />
von 1967 bezeichnet den Schwarzafrikaner als leistungsfähigster Arbeiter unter der Tropensonne, dem Weit-<br />
sicht und Ausdauer aber fremd sind. Er leide unter einer jahrhundertelangem Stillstand geistiger Entwicklung,<br />
ihm fehle die Reife abendländischer Kultur, ungenügend ausgebildet, könne er dem europäischen Denken<br />
nicht folgen und Unzufrieden mit dem Kolonialismus, wende er sich der Sowjetunion zu. Trotz seines uner-<br />
sättlichen Bildungshungers ist der "Eingeborene" arm, unterernährt, könne weder lesen noch schreiben und<br />
brauche die Hilfe von Europa, den er sei dem Hunger und ansteckenden Krankheiten schutzlos preisgegeben.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 502
Ab Mitte der sechziger Jahre, nach dem Erringingen der Unabhängigkeit vieler schwarzafrikanischer Staaten,<br />
rückt weniger das "Wilde" und "Primitive" des Schwarzafrikaners ins Zentrum der Aufmerksamkeit, als die<br />
"Nützlichkeit" dessen als Arbeiter und Rohstoffproduzent.<br />
"Seydlitz für Realschulen" von 1968 sieht in den Schwarzafrikanern willige Arbeiter, die aber noch kein<br />
einheitliches Staatsvolk bilden. Die "Erdkunde" von 1968 bezeichnet den Schwarzafrikaner als unentbehrlich,<br />
gegenseitige Hilfe unter Verwandten sei selbstverständlich, warnt aber auch davor, dass einige der Schwarzaf-<br />
rikaner dem Müssiggang, der Spielleidenschaft und dem Alkoholgenuss verfallen, einige Unzufriedene<br />
zugänglich für <strong>Pro</strong>paganda seien und sich gegenüber den Europäern, die ihnen den Fortschritt brachten, leicht<br />
zu masslosen Forderungen hinreissen lassen. Auch könnten sie aus eigener Kraft ihre Nöte nicht beseitigen und<br />
fühlten sich weniger ihrem Staat als ihrem Stamm zugehörig. "Länder und Völker der Erde" aus den 60er<br />
Jahren bezeichnet die "Sudanneger" als gesellig, sie seien recht geschickte Handwerker, die Töpferwaren<br />
herstellen, Flecht- und Webarbeiten verfertigen, das Leder verarbeiten und es sogar verstehen Eisenerz zu<br />
schmelzen. Die "Eingeborenen von Oberguinea" bezeichnet das Lehrmittel als fleissig, sauber und freundlich,<br />
währen die Menschen Äquatorialafrikas, die in der Vergangenheit "Menschenfresserei" betrieben hätten, ein<br />
entbehrungsreiches und ärmliches Leben führten. Der "Bantu" versäume keine Gelegenheit zu baden, liebe<br />
Tänze leidenschaftlich und sei selbstbewusster geworden.<br />
"Seydlitz für Gymnasien" von 1963- ca. 1971 attestiert den Bewohnern Ostafrikas grossen persönlichen Mut,<br />
sie seien erfüllt vom kriegerischen Geist und bildeten Verbände, denen vorübergehend staatenbildende Kraft<br />
innewohnen könne. Die Schwarzafrikaner bräuchten bei der Entwicklung des Landes aber die Hilfe der Euro-<br />
päer, denn der afrikanischen Mentalität liege die literarisch-sprachliche Bildung mehr als die<br />
naturwissenschaftliche-ökonomische. In "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 werden die Schwarzafrikaner<br />
als zutrauliche, gesprächige, intelligente und interessierte Menschen beschrieben, die in einer Weltgemein-<br />
schaft von freien Menschen leben wollen und deshalb mehr Rechte verlangen.<br />
Nach "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule" von 1972-1977 ist der Afrikaner liebenswürdig und<br />
freundlich, besitzt eine elementare Stärke und eine Lust am Dasein. Für ihn ist es eine grosse Schmach im<br />
Gefängnis zu sitzen. Man komme gut mit ihnen aus, wenn man nett zu ihnen sei, sie könnten es aber nicht<br />
ertragen, wenn sie irgend jemand verächtlich behandle. Viele Afrikaner seien nicht mehr zufrieden mit dem<br />
Leben auf dem Lande und würden bei der Abwanderung in die Stadt entwurzelt, denn die leibliche Vorfahren<br />
und Nachkommen seien dem Afrikaner die nächsten und die Nächstenliebe weit über die Familie hinaus liege<br />
ihnen weniger.<br />
Der Zeitraum ab Mitte der siebziger Jahre zeichnet sich dadurch aus, dass die Lehrmittel darauf hinweisen,<br />
dass die Schwarzafrikaner ihre Länder selbst regieren, ihr Geschick selber in die Hand nehmen, gleichzeitig<br />
richtet sich die Aufmerksamkeit aber auch auf die Fehlentwicklungen die zu Kriegen und Hungerkatastrophen<br />
auf dem afrikanischen Kontinent führten.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
"List Geographie" von 1972-1976 bemerkt, dass das Können der schwarzafrikanischen Bauern Ostafrikas beim<br />
Kaffeeanbau überall in Afrika und Europa anerkannt werde und sie innovativ seien. Die Regierung Zaires<br />
betreibt eine Wirtschaftspolitik, gleichzeitig herrsche dort aber auch Arbeitslosigkeit, während im Sudan<br />
weder ein Staats- noch Nationalbewusstsein vorhanden sei und in Mali unter einer Militärregierung Zehntau-<br />
sende bereits verhungert seien, denn die schicksalsergebenen Menschen könnten sich nicht mehr selber ernäh-<br />
ren. Gerade auch wegen einer hohen Analphabetenquote könnten die Schwarzafrikaner den Teufelskreis der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 503
Armut nicht aus eigener Hilfe durchbrechen. Auch die "Neue Geographie" von 1974-1976 betont, dass sich die<br />
Schwarzafrikaner nicht mehr selber ernähren könnten, ausserdem werden die Energie von Millionen von<br />
Männern und Tausenden von Frauen in den Städten beim Klatsch, beim Tanz und beim Trinken vergeudet.<br />
"Dreimal um die Erde" von 1977-1980 unterscheidet zwischen Schwarzafrikanern, die als freundliches und<br />
geschultes Personal im Tourismus arbeiten, während sich andere nicht an die Jagdgesetze halten und aus Freu-<br />
de am Jagen diejenigen Elefanten ausrotteten, die die Grundlage für eben diesen Tourismus bildeten. Nach<br />
dem Lehrmittel wählen die Bewohner schwarzafrikanischer Länder ihre eigenen Parlamente, zeigten dabei<br />
aber vor allem Stammesloyalität. Durch die ungleiche Einkommensverteilung sei nach wie vor ein Grossteil<br />
der Bevölkerung sehr arm. "Geographie thematisch" 1977-1980 schildert die hungernde Bevölkerung<br />
Schwarzafrikas gar als in Lumpen gehüllte Skelette und auch in "Terra Geographie" von 1979 ist von einer<br />
Gesellschaft der Armen die Rede, da es an Verantwortung und Einsatzfreude der Bevölkerung mangle, die<br />
kein persönliches Erfolgsstreben aufzeige. Diese Menschen, die an verschiedenen Krankheiten leiden würden,<br />
wären nicht träge, weil ihnen die Faulheit angeboren sei, sondern weil sie Hunger litten. "Unser Planet" von<br />
1979-1982 spricht von durch primitive Anbaumethoden an ihre Felder gefesselte Bauern, die an Hunger ster-<br />
ben. "Terra Erdkunde für Realschulen" von 1980-1985 bemerkt, dass viele Kinder der Stolz jeder schwarzafri-<br />
kanischen Familie seien; ihnen, wegen des raschen Bevölkerungswachstums beim Kampf ums Überleben<br />
nichts anderes übrigbleibe, als ihren eigenen Lebensraum zu zerstören; sie an Tropenkrankheiten leidende<br />
Analphabeten seien, die sich in der Form von in Lumpen gehüllten, von grauem Staub bedeckten, ausgemer-<br />
gelten Gestalten mühsam voranschleppten.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Ab Mitte der achtziger Jahre bleibt die Unfähigkeit der Schwarzafrikaner, sich selbst zu ernähren, weiterhin<br />
ein Thema, doch enthalten die Lehrmittel vermehrt auch wieder positivere Beschreibungen. Es scheint als<br />
wollten die Lehrmittel die physische Armut der Bevölkerung Schwarzafrikas durch die Beschreibung eines<br />
psychischen und kulturellen Reichtums kompensieren, dazu passt auch die vermehrte Auseinandersetzung mit<br />
Schwarzafrika in den Musiklehrmitteln, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen werden soll.<br />
Gleichzeitig wird in den Lehrmitteln auch betont, dass die in vielen schwarzafrikanischen Ländern herrschen-<br />
de Armut nicht nur die Folge einer selbstbestimmten Fehlentwicklung ist, sondern auch andere Faktoren, wie<br />
beispielsweise das Verhalten der Industrienationen für die Entwicklung mitverantwortlich zeichnen. Ausser-<br />
dem wird die hohe Kinderzahl schwarzafrikanischer Familien zusehends als grösseres <strong>Pro</strong>blem empfunden.<br />
In "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1983-1984 ist vom strahlenden Lächeln der Schwarzafrikaner die Rede,<br />
"Geographie der Kontinente" von 1984 betont, man kenne die Einehe und liebe Gemeinschaftsfeiern mit<br />
rhythmischer Musik. Auf Besuch kommende Europäer werden aufgeregt begrüsst und ihnen wird die Dankbar-<br />
keit für ihren Besuch in Form von grosser Gastfreundlichkeit bewiesen. Allerdings enthält das Lehrmittel auch<br />
Aussagen, nachdem die Schwarzafrikaner unterernährt seien, nur über eine rudimentäre Schulbildung verfüg-<br />
ten, eine eigene Mentalität hätten. Sie würden sich zwar bemühen, zivilisiert zu sein, seien lustig und fröhlich,<br />
wären aber noch primitiv, kindlich, wenig geschäftstüchtig und arbeitsunwillig.<br />
Nach "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1987 haben die Schwarzafrikaner die Kolonialisierung noch nicht<br />
überwunden, sie seien ihrer Familie und der eigenen ethnischen Gruppe oft stärker verpflichtet als dem Staat,<br />
und die Nachbarschafts- und Verwandtenhilfe spiele eine grosse Rolle. "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995<br />
sagt aus, dass die Schwarzafrikaner zur Selbsthilfe angeleitet werden müssten, da sie sich nicht selbst ernähren<br />
könnten und unter menschenunwürdigen Bedingungen lebten. Nach "Seydlitz Geographie" von 1994-1996<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 504
leben die verhungernden Schwarzafrikaner, deren traditionelle Einstellung zum Kinderreichtum führt, unter<br />
menschenunwürdigen Bedienungen und auf Kosten der Umwelt. Auch "Heimat und Welt" von 1994-1996<br />
schliesst sich dieser Argumentation an. "Geographie: Mensch und Raum" von 1994-1996 meint, dass das hohe<br />
Bevölkerungswachstum in einer Gesellschaft der Ärmsten der Armen, die an Unterernährung leidet, auf den<br />
Wunsch der Eltern nach vielen Kinder zurückzuführen sei. Und nach "Diercke Erdkunde" von 1995-1997<br />
besitzen die schwarzafrikanischen Bauern zwar eine gewisse Erfahrung, sie können sich wegen der vielen<br />
Sprachen aber nicht über ihre Dörfer hinaus miteinander verständigen. Innerhalb des Dorfes versuchten sie,<br />
ihre <strong>Pro</strong>bleme durch stundenlange Palaver zu lösen.<br />
Die Betrachtung der Lehrmittel zeigt, dass die den Schwarzafrikanern zugeschriebenen Eigenschaften in<br />
einem engen Zusammenhang mit der historischen Entwicklung in Afrika und Europa stehen. Bis zur Unabhän-<br />
gigkeit vieler schwarzafrikanischer Staaten in den sechziger Jahren dominierte, bedingt durch die Rechtferti-<br />
gungsversuche ganzen Völkern eine Regierung aufzuzwingen, die diese ablehnten, der Versuch, den Schwarz-<br />
afrikaner als unzivilisiertes Wesen darzustellen. Nach der Unabhängigkeit wurde die Unentbehrlichkeit des<br />
schwarzafrikanischen Arbeiters und Bauern, der für Europa produzierte, betont. Mit dem Auftreten der<br />
Hungerkatastrophen im Sahel verschwand diese Haltung der Europäer, die eine gewisse Gleichberechtigung<br />
schuf, wieder und machte dem Bild des ohne die Hilfe von aussen kläglich verhungernden, in seine letzten<br />
Lumpen gehüllten Schwarzafrikaners Platz, der nur dank der Soforthilfe von aussen überleben konnte. Ab<br />
Mitte der achtziger Jahre sprach man den schwarzafrikanischen Menschen wieder mehr Fähigkeiten zu, dies<br />
wohl auch deshalb, weil unterdessen viele von den Industrienationen initierten Entwicklungsprojekte geschei-<br />
tert waren und diesen die stetige Hilfe zuviel wurde. Der schwarzafrikanische Mensch sollte sich endlich aus<br />
eigener Kraft zu einem nützlichen Wesen machen. Gleichzeitig begann man die rasche Vermehrung desselben<br />
zu fürchten, der vielleicht in der Form eines Flüchtlings eines Tages vor der eigenen Tür stehen könnte.<br />
7.1.5 Darstellung von Nichtschwarzafrikanern<br />
Nicht nur die direkte Beschreibung einer Menschengruppe lässt Rückschlüsse auf das über sie vermittelte Bild<br />
zu, sondern auch die anderen Gruppen zugeschriebene Eigenschaften. Aus diesem Grund sollen hier die in den<br />
Geographielehrmitteln im Zusammenhang mit Schwarzafrika gemachten Aussagen über die ebenfalls auf<br />
diesen Raum einwirkenden und mit den Schwarzafrikanern immer wieder interagierenden Araber und Euro-<br />
päer zusammengefasst werden.<br />
7.1.5.1 Araber<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Die Araber werden in den meisten Geographielehrmitteln, in denen sie erwähnt werden, als Sklavenhändler<br />
dargestellt, die mit grosser Grausamkeit gegen die schwarzafrikanische Bevölkerung vorgingen. Das "Lese-<br />
buch für die Oberklassen" aus den 30er Jahren bezeichnet sie als Sklavenjäger und Räuber, nach "Aussereur-<br />
opäische Erdteile - Geographische Bilder" von 1953 äscherten sie jede menschliche Niederlassung ein, nach<br />
"Geographie Widrig" von 1967 waren sie verbissene Träger eines wüsten Sklavenhandels an der Ostküste,<br />
"Seydlitz für Realschulen" von 1968 nennt ihre rücksichtslosen Menschenjagden und sagt aus, sie haben den<br />
"Negern" den Islam aufgezwungen und sie rücksichtslos ausgebeutet, und in "Seydlitz Erdkunde" von<br />
1993-1995 wird der grausame Sklavenhandel der Araber genannt. Die Lehrmittel "Länder und Völker" aus den<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 505
60er Jahren, "Dreimal um die Erde" von 1977-1980, "Geographie der Kontinente" von 1984 und "Seydlitz:<br />
Mensch und Raum" von 1987 erwähnen den Sklavenhandel der Araber ebenfalls.<br />
Nur gerade die Geographielehrmittel "Leitfaden für den Geographieunterricht" von 1934, "Seydlitz für Real-<br />
schulen" von 1968 und "Länder und Völker" aus den 60er Jahren erwähnen positive Seiten des in Nord- und<br />
Ostafrika herrschenden Einflusses arabischer Völker.<br />
Die Darstellung der Araber scheint sich bis in die jüngste Zeit vorwiegend auf deren Rolle im Sklavenhandel<br />
zu beschränken, die lange dazu dienen musste von den ebenfalls im Menschenhandel verwickelten Europäern<br />
abzulenken, deren Mitwirken in diesem "Geschäft" in den Geographielehrmitteln erst nach und nach zugege-<br />
ben wurde.<br />
7.1.5.2 Europäer<br />
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über das Selbstverständnis der Europäer im Bezug auf Schwarzaf-<br />
rika und seine Menschen. Die Spalte "Sklaven" gibt an, ob in einem Lehrmittel die Beteiligung der Europäer<br />
am Sklavenhandel erwähnt wird, die Spalte "Hilfe" ob Entwicklungshilfe in irgendeiner Form im Lehrmittel<br />
erscheint, die Spalte "Fortschr." ob von Europäern durchgeführte Massnahmen im betreffenden Lehrmittel als<br />
Fortschritt bezeichnet oder empfunden werden, die Spalte "Export" gibt an, ob Europäer im Lehrmittel als<br />
Exporteure von Waren nach Europa auftreten, und die Spalte "Weitere" verweist auf andere erwähnte Taten<br />
der Europäer.<br />
Tabelle: Rolle der Europäer<br />
Lehrmittel Sklaven Hilfe Fortschr. Export Weitere<br />
Lesebuch Oberklassen, 30er Jahre beendeten Sklavenhandel, machten Buschmänner nieder<br />
Leitfaden Geographieunterricht, 1934 x x<br />
Harms Erdkunde, 1961 Liebhaberei für Eingeborene, vernichten afrikanische Kultur<br />
Geographie, 1963 x verboten Sklavenhandel<br />
Geographie Widrig, 1967 x x x<br />
Seydlitz für Realschulen, 1968 x x x auf Hilfe der Eingeborenen angewiesen<br />
Erdkunde, 1968 x x<br />
Länder und Völker der Erde, 60er Jahre x x legten Sklavenhandel lahm, wollen möglichst grossen Nutzen ziehen<br />
Fahr mit in die Welt, 1971-1974 passen sich an<br />
Geographie Aargau, 1972-1977 ungeschickter Umgang mit Afrikanern<br />
List Geographie, 1972-1976 x x Export subventionierte Getreideüberschüsse<br />
Neue Geographie, 1974-1976 x<br />
Dreimal um die Erde, 1977-1980 x befriedeten feindlich gesinnte Stämme<br />
Geographie thematisch, 1977-1980 x beendeten Stammesfehden<br />
Terra Geographie, 1979 x x<br />
Unser Planet, 1979-1982 x wissen zuwenig über Afrikaner<br />
Seydlitz: Mensch und Raum, 1983-1984 x<br />
Geographie der Kontinente, 1984 x halten Afrikaner für unzivilisiert<br />
Mensch und Raum, 1983-1986 x beuten kleine Kinder aus,<br />
Seydlitz: Mensch und Raum, 1987 x Greuel im Kongo<br />
Seydlitz Erdkunde, 1993-1995 x x<br />
Seydlitz Geographie, 1994-1996 x x<br />
Diercke Erdkunde, 1995-1997 x x<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Bis Ende der sechziger Jahre traten die Europäer in den Geographielehrmitteln vorwiegend als Sklavenbefreier<br />
auf, erst ab diesen Zeitraum wird ihre Beteiligung am Sklavenhandel eingestanden. In vielen Geographielehr-<br />
mitteln werden die Europäer ausserdem als selbstlose Helfer, die Fortschritt und neuen Wohlstand brachten,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 506
geschildert, aber nur wenige erwähnen die aktiv betriebene Exportförderung der Europäer auf dem schwarzaf-<br />
rikanischen Kontinent.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 507
7.2 Genannte Völker<br />
Die Tabelle "Genannte oder beschriebene Völker" bietet einen Überblick über die in den einzelnen Geogra-<br />
phielehrmitteln beschriebenen oder erwähnten Völker. Folgende Abkürzungen werden im Tabellenkopf<br />
verwendet: Ba. = Bantu, Su. = "Sudanneger", Py. = "Pygmäen", Bu. = "Buschmänner", Kh. = Khoi-Khoin<br />
(Hottentotten), Ma. = Massai, Ha. = Hausa, Fu. = Fulbe, Yo. = Yoruba.<br />
Tabelle: Genannte oder beschriebene Völker<br />
Lehrmittel Ba. Su. Py. Bu. Kh. Ma. Ha. Fu. Yo. Ibo weitere Völker<br />
Lehr- und Lesebuch, 1912 Abessinier, Neger, Malaien<br />
Lesebuch Oberklassen, 30er Jahre x x x Neger<br />
Leitfaden, 1934 x x x x x x x Kaffern, Negervölker, Somali<br />
Geographie, 1953 x x x x Kaffern, Neger, Zulu,<br />
Aussereuropäische Erdteile, 1953 x Somali, Wangwana<br />
Harms Erdkunde, 1961 x x x<br />
Schweizerischer Mittelschulatlas, 1962 x x x x x Malaien<br />
Geographie, 1963 x x x Neger, Somalineger<br />
Geographie Widrig, 1967 x x x x x x x Galla, Somali, Suaheli, Tuareg, Tibbu,<br />
Seydlitz für Realschulen, 1968 x x x x x x x<br />
Erdkunde, 1968 x x x x x x Basuto, Galla, Herero, Ovambo, Somali, Wasuaheli, Watussi, Zulu<br />
Erdkunde: Oberstufe, 1968-1969 x<br />
Länder und Völker , 60er Jahre x x x x x x x x Basuto, Barotse, Betschuanen, Galla, Matabele, Somali<br />
Seydlitz für Gymnasien, 1963-1971 x x x x x Negride<br />
Fahr mit in die Welt, 1971-1974 x x x x x Watussi<br />
Geographie Aargau, 1972-1977 x x x x x x x Aschanti, Azande, Bali, Bara, Bete, Betsimisaraka, Bokaka, Bwaka, Chikunda,<br />
Dogon, Duma, Dume, Galla, Grebi, Jaunde, Jukun, Koba, Kreisch,<br />
Kundu, Lamba, Lunda, Makua, Malinke, Mandara, Manga, Mossi, Njamwezi,<br />
Njandja, Nuba, Sakalava, Senufo, Shambala, Songhai, Totela, Tschwana,<br />
Wumbu, Zulu,<br />
List Geographie, 1972-1976 x x x Chagga, Tswana<br />
Neue Geographie, 1974-1976 x Modjadjii<br />
Terra Weltkunde, 1978 x x x Äthiopide, Bambuti<br />
Terra Geographie, 1979 keine Nennung von Völkern<br />
Dreimal um die Erde, 1977-1980 x x x x<br />
Geographie thematisch, 1977-1980 x x x x x x Chagga<br />
Unser Planet, 1979-1982 x<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1983-1984 x x x x<br />
Geographie der Kontinente, 1984 x x x x x Chagga, Kikuyu<br />
Terra Erdkunde Realschulen, 1980-1985 x Amharen, Danakil, Niloten, Somali<br />
Mensch u. Raum, 1983-1986 x Nama<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1987 x x x Tuareg, Yaka<br />
Seydlitz Erdkunde, 1993-1995 x x x x x x x x x Kanuri, Tiv<br />
Seydlitz Geographie, 1994-1996 x x x Mbenga, Mbuti, Bongo<br />
Heimat und Welt, 1994-1996 x x<br />
Geographie: Mensch u. Raum, 1994-1996 x<br />
Diercke Erdkunde, 1995-1997 x x<br />
Die Tabelle zeigt deutlich, dass die meisten der untersuchten Lehrmittel, ob älteren oder jüngeren Datums,<br />
eine wenig differenzierte Sichtweise der schwarzafrikanischen Völker bieten, denn oft beschränken sie sich<br />
nur in eine grobe Unterteilung von Bantu und "Sudanneger", sowie die Nennung einiger weniger Völker. Das<br />
Lehrmittel "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule" von 1972-1977, welches mit 44 genannten<br />
Völkern mit Abstand die detaillierteste Aufzählung bietet, nennt nur gerade ein halbes <strong>Pro</strong>zent der Völker<br />
Schwarzafrikas.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Völker<br />
Die folgenden Abschnitte gehen etwas näher auf das in den Lehrmitteln vermittelte Bild der häufiger genann-<br />
ten Völker ein. Da es sich weder bei den Bantu, noch bei den "Sudannegern" um eigentliche Völker handelt,<br />
beide Begriffe umfassen eine Vielzahl von Völkern und Volksgruppen, wurden diese an dieser Stelle nicht<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 508
erücksichtigt, es sei jedoch auf das Kapitel "Zugeschriebene Eigenschaften" auf der Seite 502 dieser Arbeit<br />
verwiesen.<br />
7.2.1 Darstellung der Pygmäen<br />
Die Darstellung der Pygmäen, die in den meisten Geographielehrmitteln, nur in den siebziger und achtziger<br />
Jahren werden sie nur relativ selten genannt, und auch einigen Musiklehrmitteln erwähnt oder beschrieben<br />
werden, änderte sich im Laufe dieses Jahrhunderts stark.<br />
Im "Lesebuch für die Oberklassen" aus den 30er Jahren und dem "Leitfaden für den Geographieunterricht von<br />
1934 wird ihre Jagd mit Giftpfeilen erwähnt. "Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule" von 1953<br />
beschreibt ihre Kleidung als nur aus einem Lendenschurz aus Bast bestehend. Nach "Aussereuropäische<br />
Erdteile - Geographische Bilder von 1953 sind sie Geschöpfe voll verschlagenster List mit schwachen Glie-<br />
dern, aber viel Anmut. "Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen" von 1961 gibt als Ausnahme unter den<br />
Geographielehrmitteln einen Teil ihrer Kultur in der Form eines Totengesangs wieder, nach der "Geographie"<br />
von 1963 fristen sie aber ein äusserst primitives Dasein. Ähnlich äussert sich auch "Geographie Widrig von<br />
1967, laut dem die Pygmäen ein Leben fristen, über dessen Armseligkeit wir uns kein Bild zu machen imstan-<br />
de seien. "Seydlitz für Realschulen von 1968 schildert sie als von kräftiger und muskulöser Gestalt, während<br />
die "Erdkunde" von 1968 betont, dass sie auf der niedrigsten Wirtschaftsstufe stehen würden. Wohl deshalb<br />
versuchte die belgische Kolonialregierung laut "Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren die<br />
Pygmäen zu sesshaften Ackerbauern umzuschulen. "Seydlitz für Gymnasien von 1963- ca. 1971 meint, dass<br />
die soziale Organisation und das religiöses Leben der Pygmäen gering ausgebildet seien, sie weder über einen<br />
Zeitsinn noch Traditionen verfügten und ihr Dasein fristen würden, indem sie die Gärten ihrer grösseren "ein-<br />
geborenen" Nachbarn plünderten. Dem entgegnet die "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule"<br />
von 1972-1977, dass die Pygmäen, auch wenn sie einfach lebten, doch Sagen und religiöse Zeremonien<br />
kennen würden, die auf einen regen Geist hinwiesen. Ausserdem seien sie in der Lage, allerhand Gegenstände<br />
aus Holz und Bambus herzustellen und führten ein ganz ursprüngliches Leben. Nach "Geographie thematisch"<br />
von 1977-1980 sind sie geschickt, "Seydlitz - Mensch und Raum" von 1983-1984 erwähnt ihren Tauschhandel<br />
mit den Bantu und weist darauf hin, dass sie Schnecken und Larven essen würden.<br />
Nach "Geographie der Kontinente" von 1984 waren die Pygmäen früher Menschenfresser, leben nun aber<br />
mehrheitlich von der Jagd, vom Sammeln pflanzlicher Nahrung oder vom Fischfang. "Seydlitz Erdkunde" von<br />
1993-1995 nennt als Nahrungsquellen wilde Tiere, Früchte und Wurzeln und bemerkt, dass ihr Territorium<br />
stark eingeengt worden sie. Nach "Seydlitz Geographie" von 1994-1996 sind die Zwergmenschen durch die<br />
Zerstörung des Regenwaldes sogar in ihrer Existenz bedroht. "Heimat und Welt" von 1994-1996 spricht von<br />
kleinen Menschen des Regenwaldes, von denen immer mehr die traditionelle Lebensweise aufgeben und deren<br />
Zahl durch Krankheit und Alkoholismus verringert würde. Auch "Diercke Erdkunde" von 1995-1997 bezeich-<br />
net die Pygmäen als kleine Menschen des Regenwaldes, die sich geschickt bewegen würden, jedem Laut<br />
deuten und jede Bewegung wahrnehmen könnten. Auch dieses Lehrmittel erwähnt, dass die meisten Pygmäen<br />
ihre traditionelle Lebensweise aufgegeben hätten und die Existenz dieses Naturvolkes durch Krankheit und<br />
Alkoholismus bedroht seien.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Völker<br />
So wandelte sich das Bild des Pygmäen von einer mit Giftpfeilen bewaffneten im Dunkel des Waldes herum-<br />
schleichenden Bedrohung über ein nutzloses auf tiefster Wirtschaftsstufe sein Leben fristendes Wesen zu<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 509
einem kleinen Menschen des Regenwaldes, der durch seine sich verändernde Umwelt bedroht ist, und den es<br />
zu erhalten gilt. Damit spiegelt die Beschreibung der Pygmäen die Empfindung des Europäers gegenüber der<br />
Natur des tropischen Regenwaldes, der erst als todbringender Dschungel den Weg zu den Schätzen Afrikas<br />
versperrte, sich dann als für die Rohstoffproduktion weitgehend wertlos erwies und schliesslich immer mehr zu<br />
einem als romantisch verklärten Zufluchtsort wurde, für eine Gesellschaft, die sich immer mehr von der Natur<br />
entfernte.<br />
7.2.2 Darstellung der "Buschleute"<br />
Die "Buschleute" oder "Buschmänner" werden in verschiedenen Geographielehrmitteln bis Ende der siebziger<br />
Jahre häufig erwähnt, in den achtziger und neunziger Jahren ist nur noch selten von ihnen die Rede. Dafür<br />
gehören sie zu den wenigen Völkern Schwarzafrikas, die sowohl in den Geographie- als auch in den Musi-<br />
klehrmitteln mehrmals erwähnt werden.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Völker<br />
Das "Lesebuch für die Oberklassen" aus den 30er Jahren bezeichnet die "Buschmänner" als niedrigst stehende<br />
Menschen, die ekelhaftestes Gewürm verzehrten, arge Viehräuber seien und deshalb von den Weissen nieder-<br />
gemacht würden. Der "Leitfaden für den Geographieunterricht" von 1934 nennt sie den armseligsten aller<br />
Menschenstämme, der von allem lebt, "was da kreucht und fleucht" und dem Aussterben nahe sei. Auch "Geo-<br />
graphie - Lehrmittel für die Sekundarschule" von 1953 betont, dass nur noch wenige übriggeblieben seien.<br />
Nach der "Geographie" von 1963 würden diese Reste der Urbevölkerung, die in unfruchtbare Gebiete<br />
verdrängt worden sei, eine äusserst bescheidener Lebensart pflegen und sich von Frösche, Mäuse, Eidechsen,<br />
Wurzeln, Würmer und Larven ernähren. Nach "Geographie Widrig" von 1967 fristen sie ein Leben, über<br />
dessen Armseligkeit wir uns kein Bild zu machen imstande wären, sie seien schmutzig, unsteten und scheuen<br />
Blickes, zeigten einen finstere Gesichtsausdruck, hätten hohläugige, eingefallene Gesichter, fleischlose Glie-<br />
der, einen skelettartiger Brustkorb und seien ein verkommenes Häuflein. "Seydlitz für Realschulen" von 1968<br />
spricht dagegen von der erstaunlichen Fähigkeit, über grosse Entfernungen Wasser aufzuspüren, dieses in die<br />
trockensten Teile der Kalahari abgedrängt Volkes. Nach "Erdkunde" von 1968 stehen die "Buschmänner" wie<br />
die "Pygmäen" auf einer primitiver Kulturstufe, sie hätten sich in die Kalahari zurückgezogen und lebten dort<br />
von Wurzeln, Knollen, Früchten, Fröschen, Raupen, Heuschrecken, Eidechsen und Strausseneiern, die sie<br />
eifrig suchten. "Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren beschreibt sie als hagere, zwergenhafte<br />
Gestalten, mit schnauzenförmigen Mund, die unstet umherstreiften aber als aussterbendes Volk, für die Weis-<br />
sen keine Gefahr mehr bedeuteten würden. "Seydlitz für Gymnasien von 1963- ca. 1971 bezeichnet sie als sehr<br />
alte und primitive Typen. Und nach "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 lebten sie noch in versteckten<br />
Teilen Südwestafrikas und in der Kapprovinz. "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule" von<br />
1972-1977 nennt sie ein einfaches Volk. Nach "List Geographie" von 1972-1976 sind die aufmerksamen<br />
"Buschmänner" mit ihrer zierliche Gestalt, den schlitzartig verengte Augen und einem faltenreichen Gesicht,<br />
sehr scheu, schweifen in Gruppen durch die Savanne und wurden häufig von den Farmern verfolgt und getö-<br />
tet. "Knaurs Weltgeschichte der Musik" von 1979 bezeichnet sie als sehr musikalisch. Da sie vieles von den<br />
"Negern" übernommen haben, hätten sie sich aus einem Stadium primitivster Musikübung erheben können.<br />
"Geographie der Kontinente" von 1984 spricht im Zusammenhang mit dem Vordringen der Buren von einem<br />
fast menschenleere, nur von den "Buschmänner" bewohnten Gebiet am Kap. Das Musiklehrmittel "Musicasset-<br />
te" von 1990-1992 bezeichnet den Musikbogen als das Hauptinstrument der Buschmänner, die damit Tiere in<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 510
ihren verschiedenen Gangarten und ganze Jagdszenen nachahmten. Und "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995<br />
sagt aus, dass die "Buschmänner" aufgrund der von ihnen gepflegten Sammelwirtschaft ein grosses Territori-<br />
um benötigten, um leben zu können. Durch andere Nutzungsformen sei ihr Lebensraum aber bedrohlich einge-<br />
engt worden.<br />
Anders als bei den "Pygmäen" verwandelt die Darstellung in den Lehrmitteln die "Buschmännern" im Laufe<br />
der Zeit nicht von einem verachteten Geschöpf in ein Symbol für Naturverbundenheit. Auch wenn immer<br />
wieder vom Aussterben der "Buschmänner" die Rede ist, vermittelt kein einziges der untersuchten Lehrmittel<br />
das Gefühl, dass dadurch der Menschheit ein Verlust entstehen würde.<br />
7.2.3 Darstellung der Khoi-Khoin (Hottentotten)<br />
Die Khoi-Khoin werden bis Ende der siebziger Jahre regelmässig unter der Bezeichnung "Hottentotten"<br />
erwähnt, tauchen dann aber nur noch vereinzelt in den einzelnen Lehrmitteln auf. Die Beschreibungen in den<br />
Geographielehrmitteln fallen meist kurz aus, oft wird sogar nur der veraltete Name dieses Volkes zusammen<br />
mit anderen Völkern erwähnt.<br />
Der "Leitfaden für den Geographieunterricht" von 1934 bezeichnet sie als träge, sorglose, schmutzige und<br />
armselig Viehzüchter, während "Geographie - Lehrmittel für die Sekundarschule" von 1953 erwähnt, dass nur<br />
noch wenige Hottentotten übriggeblieben seien. Nach der "Geographie" von 1963 sind die "Hottentotten" ein<br />
Zwergvolk von äusserst bescheidener Lebensart und "Geographie Widrig" von 1967 bezeichnet sie als Überre-<br />
ste einer afrikanischen Urbevölkerung, die von kleinem Wuchs sei, eine graugelbe, überaus runzelige Haut und<br />
zu kleinen Knäueln verfilzte Haare besässen und deren Sprache eigenartigen Schnalzlaute enthalten würde.<br />
"Seydlitz für Realschulen" von 1968 bezeichnet sie als kleinwüchsig und die "Erdkunde" von 1968 als<br />
Wanderhirten. Nach "Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren seien die "Hottentotten" als Dienstbo-<br />
ten und Landarbeiter tätig, ausserdem handle es sich bei ihnen um ein aussterbendes Volk, welches für die<br />
Weissen keine Gefahr mehr bedeute. "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 sagt aus, dass sie noch in versteck-<br />
ten Teilen Südwestafrikas und in der Kapprovinz leben würden, während "List Geographie" von 1972-1976 die<br />
Verdrängung durch die Buren und den Rückzug der "Hottentotten" erwähnt, der auch im Geographielehrmittel<br />
"Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 angesprochen wird.<br />
Trotz der häufigen Erwähnung der Khoi-Khoin in den Geographielehrmitteln beschreibt keines der Lehrmittel<br />
dieses Volk eingehend und dessen Lebensweise bleibt unklar.<br />
7.2.4 Darstellung der Massai<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Völker<br />
Die Beschreibung der Massai in den Geographielehrmitteln ändert sich mit der Zeit nur wenig. Der "Leitfaden<br />
für den Geographieunterricht" von 1934 bezeichnet sie als kriegerische Viehzüchter, "Geographie Widrig"<br />
1967 erwähnt die Hungersnot von 1959-1961 unter den Massai, "Seydlitz für Realschulen" von 1968 spricht<br />
davon, dass die jungen Männer durch eine strenge Erziehung im Gebrauch der Waffen und in die Jagd unter-<br />
wiesen werden. Nach "Erdkunde" von 1968 sind die Massai kluge und mutige Menschen, deren Frauen sich<br />
mit Silberspiralen oder Perlringen an Hals, Armen und Beinen schmücken. Wenn die Herden der Massau<br />
durch die häufige Rinderpest oder durch lange Trockenheit schwere Verluste und sie Menschen unter einer<br />
Hungersnot litten, würden die Massai aus den Dörfern der Bantu rauben, was sie zum Leben bräuchten. "Län-<br />
der und Völker der Erde" aus den 60er Jahren erwähnt ebenfalls den Schmuck der Frauen, der aber aus<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 511
Eisenringen und Messingspiralen gefertigt sein soll. Die Massai glaubten an einen Gott und fürchteten sich<br />
nicht vor Geistern, ausserdem würden die Männer nie eine Last auf dem Rücken tragen.<br />
Die Lehrmittel ab den siebziger Jahren betonen, dass sich die Massai der modernen Zivilisation wenig ange-<br />
passt hätten. So beispielsweise in "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974, in dem auch das seltsam geflochtene<br />
Haar der Männer und die kahlrasierten Schädel der Frauen, die Schmuckringe tragen würden, erwähnt wird.<br />
Zudem würden die Massai selbst Löwen mit ihren Speeren erlegen; je mehr Rinder sie besässen, desto reicher<br />
und glücklicher würden sie sich fühlen. Bei ihnen sei das alte Afrika noch lebendig. Auch "Seydlitz: Mensch<br />
und Raum" von 1983-1984 bemerkt, dass sich die Massai kaum an die moderne Zivilisation angepasst hätten,<br />
von Hungerkatastrophen bedroht würden und ihr höchstes Glück ein möglichst grosser Viehbesitz sei. Nach<br />
"Seydlitz Geographie" von 1994-1996 besteht ihre Nahrung fast ausschliesslich aus Milch, Fleisch und Rinder-<br />
blut, ausserdem seien sie das bekannteste Volk Kenias.<br />
Die letzte Bemerkung dürfte zumindest auf die Leser der erwähnten Lehrmittel zutreffen, gehören dort die<br />
Massai doch zu den am häufigst genannten Völker.<br />
7.2.5 Darstellung der Fulbe<br />
Die Fulbe oder auch Fulani werden in einigen Geographielehrmitteln und einem einzigen Musiklehrmittel (Die<br />
Musikstunde, 1992-1997) erwähnt. Meist werden sie als Viehzüchter beschrieben, die aus dem Norden nach<br />
Schwarzafrika eingewandert seien und sich dort unter Beibehaltung des Islams mit den schwarzafrikanischen<br />
Völkern vermischt hätten.<br />
Die erste Erwähnung der Fulbe findet sich in "Geographie Widrig" von 1967, wo sie als fanatische Mohamme-<br />
daner bezeichnet werden. Nach "Seydlitz für Realschulen" von 1968 waren die Fulbe als Hirtenvolk den sess-<br />
haften Einwohnern an Beweglichkeit überlegen. Sie würden langhörnige Rinder, Ziegen und Schafe, in den<br />
trockeneren Gegenden auch Esel und Kamele halten, ihr Lieblingstier sei aber das Pferd. "Länder und Völker"<br />
aus den 60er Jahren nennt die Fulbe das mächtigste Volk der hamitischen Stämme Westafrikas. Sie seien hell-<br />
farbig, hager und herrisch und hätten den Islam mit fanatischem Eifer verbreitet, ihr Wohn- und Machtgebiet<br />
hätte vom Senegal bis weit über den unteren Niger hinaus gereicht.<br />
Nach "Dreimal um die Erde" von 1977-1980 steigt bei den Fulbe, die die Bevölkerung mit Milch, Käse und<br />
Fleisch versorgten, das Ansehen eines Mannes mit der Grösse seiner Herde, im Gegensatz zu anderen Völkern<br />
brächten die Frauen Kühe als Mitgift in die Ehe ein, andererseits hänge die Zahl der Frauen, die ein Mann sich<br />
leisten könne, von der Grösse seiner Herde ab. Ausserdem sagt das Lehrmittel aus, dass 7 Mio. Fulani in Nige-<br />
ria lebten, sie aber politisch untervertreten seien, da nicht genügen von ihnen lesen und schreiben könnten.<br />
"Geographie thematisch" von 1977-1980 erwähnt, dass sie im 15. Jahrhundert in ihren heutigen Lebensraum<br />
eingewandert seien und nach der Unabhängigkeit Nigerias eine politische Partei gegründet hätten. Nach<br />
"Seydlitz - Mensch und Raum" von 1983-1984 und "Mensch und Raum" von 1983-1986 leiden die Fulani an<br />
der Ausdehnung der Ackerbauflächen in Kamerun, die es immer schwieriger für sie macht, Weiden für ihr<br />
Vieh zu finden. "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 erwähnt die Einwanderung der Fulani in ihren jetzigen<br />
Lebensraum um 1300, den Krieg und Sieg der Fulani gegen die Hausa-Staaten um 1800 und ihre Unterwer-<br />
fung durch die Briten um 1900.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Völker<br />
Damit hat sich das in den Lehrmitteln gezeichnete Bild der Fulbe in Laufe der Zeit nur wenig geändert, aller-<br />
dings wurden aus den fanatischen Mohammedanern im Zeitraum von den sechziger bis in die neunziger Jahre,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 512
politisch aktive Menschen, die auf eine immerhin in zwei Lehrmitteln als erwähnenswert empfundene<br />
Geschichte zurückblicken können.<br />
7.2.6 Darstellung der Hausa<br />
Obwohl die Hausa oder Haussa in einigen Geographielehrmitteln und den beiden Musiklehrmitteln "Musicas-<br />
sette" von 1990-1992 und "Klangwelt-Weltklang" von 1991-1993 erwähnt werden, enthalten diese bis auf eine<br />
Ausnahme nur spärliche Informationen zu diesem Volk.<br />
Im "Leitfaden für den Geographieunterricht" von 1934 werden die Hausa nur gerade erwähnt, "Geographie<br />
Widrig" von 1967 erwähnt, dass sich die Hausa stark mit den Negern gemischt hätten und zum Islam überge-<br />
gangen seien. Nach "Seydlitz für Realschulen" von 1968 trifft man die Hausa "heute" meist als Handwerker<br />
und Händler in ganz Westafrika an, deshalb sei ihre Sprache im Sudan weit verbreitet. Auch "Länder und<br />
Völker" aus den 60er Jahren erwähnt den Handel der Hausa und fügt hinzu, dass sie durch ihre Geschäftigkeit,<br />
vor allem aber durch den Sklavenhandel grossen Reichtum erworben hätten. "Seydlitz für Gymnasien" von<br />
1963- ca. 1971 erwähnt die Hausastadt Kano, in "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule" von<br />
1972-1977 werden die Hausa wieder nur erwähnt. Nach "Dreimal um die Erde" von 1977-1980 bauen die<br />
Hausa in der Trockensavanne Baumwolle und Erdnüsse an. Das Lehrmittel erwähnt ebenfalls die Stadt Kano<br />
und weist die Hausa, die "Neger" und Mohammedaner seien, mit damals 16 Mio. Menschen als grösstes Volk<br />
Nigerias aus, unter denen aber nicht genügend lesen und schreiben könnten.<br />
"Geographie thematisch" von 1977-1980 erwähnt die Emirate der Hausa und sagt aus, dass sich die als Hirten<br />
und Händler tätigen Hausa im 13. Jahrhundert zum Islam bekannten. 1966 sei es in Nigeria unter einem Gene-<br />
ral der Hausa zu einem Militärputsch gekommen. "Seydlitz - Mensch und Raum" von 1987 erwähnt die<br />
ehemaligen Hausa-Staaten und gibt eine detaillierte Schilderung der Stadt Kano wieder. "Seydlitz Erdkunde"<br />
von 1993-1995 schliesslich erwähnt die Einwanderung der Haussa in den Norden Nigerias um 700, die Islami-<br />
sierung dieses Volkes setzt das Lehrmittel ab 1100 an, und um 1900 seien die Hausa von den Briten als letztes<br />
grosses Volk Nigerias unterworfen worden.<br />
Das vermittelte Bild der Hausa in den untersuchten Lehrmitteln bleibt abgesehen von den Bemerkungen zu<br />
ihrer Religion im Laufe des 20. Jahrhunderts relativ stabil, allerdings sind viele Beschreibungen unvollständig,<br />
ungenau oder widersprechen sich zu einem gewissen Grade.<br />
7.2.7 Darstellung der Yoruba<br />
Die Yoruba werden in einigen Geographie- und einem Musiklehrmittel erwähnt, meist fehlt aber eine vertie-<br />
fendere Darstellung dieses Volkes.<br />
"Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen" von 1961 bezeichnet die Yoruba als Stamm mit über vier Millio-<br />
nen Menschen. "Dreimal um die Erde" von 1977-1980 macht darauf aufmerksam, dass die Yoruba grosse<br />
Teile des Regenwaldes gerodet haben, um Kakao, durch dessen Anbau manche Yorubafamilie unter den 15<br />
Mio. Yoruba im Laufe der Zeit wohlhabend geworden sei, und Nahrungsmittel für den Eigenbedarf anzupflan-<br />
zen. Ausserdem wird ein Häuptling erwähnt, der trotz der Angabe, dass die Yoruba grösstenteils protestantisch<br />
seien, mehrere Frauen habe.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Völker<br />
"Geographie thematisch" von 1977-1980 beschreibt die Yoruba als das städtebildende Volk in Afrika, dessen<br />
Land in Oberhäuptlings- und Unterhäuptlingsgebiete eingeteilt werde, die jeweils von einer städtischen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 513
Siedlung aus regiert werden. Die Yoruba würden in Grossfamilien zusammenleben, die bis zu fünf Generatio-<br />
nen umfassen könnten. Mehrere solcher Grossfamilien siedelten um einen gemeinsamen Innenhof. Eine derar-<br />
tige Siedlung beherberge bis zu 500 Bewohner, deren Oberhaupt das älteste männliche Mitglied der Siedlungs-<br />
gemeinschaft sei. Die Yoruba, die nicht von Missionaren zum Christentum bekehrt worden seien, glaubten an<br />
einen Schöpfer des Himmels und der Erde und an etwa 400 niedere Gottheiten und Geister. Ausserdem hätten<br />
sie sich in einer politischen Partei organisiert.<br />
Das Musiklehrmittel "Musikstudio" von 1980-1982 führt aus, dass bei den Yoruba Trommler durchs Dorf<br />
ziehen und Grussformeln aussenden oder (gegen Trinkgeld) die Namen örtlich wichtiger Persönlichkeiten<br />
lobpreisen würden.<br />
"Seydlitz - Mensch und Raum von 1987 erwähnt nur gerade die Stadtstaaten der Yoruba, während "Seydlitz<br />
Erdkunde" von 1993-1995 den Sklavenhandel der Yoruba im 16. Jahrhundert und ihre Unterwerfung durch die<br />
Briten Ende des 19. Jahrhunderts erwähnt.<br />
7.2.8 Darstellung der Ibo<br />
Die Ibo werden nur in einigen wenigen Geographielehrmitteln der achtziger und neunziger Jahre erwähnt,<br />
meist aber etwas eingehender beschrieben als dies beispielsweise für die Yoruba oder Hausa der Fall ist.<br />
Nach "Dreimal um die Erde" von 1977-1980 ist die Wirtschaft der 12 Mio. Ibo in Nigeria, die katholische<br />
Christen seien, vor allem vom Exporterlös aus der Ernte der Ölpalmenfrüchte bestimmt. Die Erklärung der<br />
Unabhängigkeit der Ibos nach Erdölfunden in ihrem Gebiet, habe zu dem unter dem Namen Biafra-Krieg<br />
bekanntgewordenen Bürgerkrieg in Nigeria geführt, der 2 Mio. Menschen das Leben gekostet habe.<br />
Nach "Geographie thematisch" von 1977-1980 wohnen die Ibos vor allem in lockeren dörflichen Gemein-<br />
schaften einander verwandter Familien. Jede Familie unterstehe der Führung des ältesten männlichen Mitglie-<br />
des. Diesen Gemeinschaften übergeordnete Herrscher seien bei den Ibos nicht üblich. Gegenüber europäischen<br />
Neuerungen hätten sie sich offen gezeigt.<br />
"Seydlitz - Mensch und Raum" von 1987 erwähnt die christlichen Ibo nur als Bewohner der Stadt Kano und<br />
"Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 erwähnt noch einmal den durch die Ibos ausgelösten Biafra-Krieg, der zu<br />
Hungersnöten unter diesen geführt habe.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Völker<br />
In den meisten Lehrmitteln wird den als fortschrittlich angesehenen Ibos also die Schuld für den Biafra-Krieg<br />
zugeschoben, ohne dass allerdings die damalige Entwicklung näher wiedergegeben wird.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 514
7.3 Genannte Länder<br />
Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, welche Länder in den einzelnen Lehrmitteln vertieft behandelt werden.<br />
Dabei wurde als Einheit die Anzahl der für diese Arbeit interessierenden Absätze gewählt, sie gibt also<br />
Auskunft darüber, in welchem Ausmass das Lehrmittel ein Bild des schwarzafrikanischen Menschen einer<br />
bestimmten Nationalität vermittelt. Seiten mit rein landschaftsgeographischem Inhalt wurden dabei ebensowe-<br />
nig berücksichtigt wie Bilder, Fotos und Nordafrika zuzurechnende Textstellen.<br />
Die Einheit "Absatz" wurde deshalb gewählt, da sie am ehesten eine praktikable Einschätzung der vermittelten<br />
Informationsmenge vermittelt: das Zählen von einzelnen Worten wäre zu aufwendig gewesen, Seitenzahlen<br />
aufgrund der unterschiedlichen Schriftgrössen und Layouts nicht wirklich aussagekräftig genug.<br />
Ländertabelle: Angola (ANG) bis Mali (RMM)<br />
ANG ETH BEN RB BF RU ZRE CI WAG GH CAM EAK LB RM MW RMM<br />
Geographie (1953) 1 1<br />
Geographische Bilder (1953) 6<br />
Harms Erdkunde (1961) 1 1 3 1<br />
Geographie (Widrig 1967) 4 2 2 3 1<br />
Seydlitz Realschule (1968) 1 5 1 5 12 1 1 1<br />
Erdkunde (1968) 4 3 4 1<br />
Länder u. Völker (60er) 9 2 3 1 1 1<br />
Fahr in die Welt (1971-1974) 4 4 2 5<br />
Geographie Aargau (1972-1977) 1 14<br />
List Geographie (1972-1976) 5 2 5 8<br />
Neue Geographie (1974-1976) 1<br />
Dreimal um die Erde (1977-1980) 7 5<br />
Geographie thematisch (1977-1980) 1<br />
Terra Geographie (1979) 5 1 3<br />
Unser Planet (1979-1982) 5 2 13<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum (1983-1984) 12 11 6 6<br />
Geographie der Kontinente (1984) 1 7 4<br />
Terra Erdkunde Realschule (1980-1985) 4<br />
Mensch u. Raum (1983-1986) 5 15 10<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum (1987) 12 13<br />
Seydlitz Erdkunde (1993-1995) 2 12 13<br />
Seydlitz Geographie (1994-1996) 1 1 1 14 1<br />
Heimat u. Welt (1994-1996)<br />
Geographie: Mensch u. Raum (1994-1996) 1 13<br />
Diercke Erdkunde (1995-1997) 32<br />
Musiklehrmittel<br />
Musikstudio (1980-1982) 1<br />
Spielpläne Musik (1992-1994) 15<br />
Musik hören, machen, verstehen (1990-1995) 4<br />
Die Musikstunde (1992-1997) 3<br />
Hauptsache Musik (1995) 4<br />
Vom Umgang mit dem Fremden (1996) 9<br />
Sprach- und Leselehrmittel<br />
Drei Schritte (1984) 3<br />
Der Lesefuchs (1988)<br />
Karfunkel (1990) 8<br />
Das fliegende Haus (1992)<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
Total 2 62 1 3 47 11 63 2 7 53 43 60 8 9 13 35<br />
Die folgenden Abkürzungen für Ländernamen werden in der Tabelle verwendet: Angola (ANG), Äthiopien<br />
(ETH), Benin (BEN), Botswana (RB), Burkina Faso (BF), Burundi (RU), Demokratische Republik Kongo<br />
(ZRE), Elfenbeinküste (CI), Gambia (WAG), Ghana (GH), Kamerun (CAM), Kenia (EAK), Liberia (LB),<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 515
Madagaskar (RM), Malawi (MW), Mali (RMM), Mauretanien (RIM), Mosambik (MOC), Namibia (NAM),<br />
Niger (RN), Nigeria (WAN), Ruanda (RWA), Sambia (Z), Senegal (SN), Simbabwe (ZW), Somalia (SO),<br />
Südafrika (RSA), Sudan (SUD), Tansania (EAT), Tschad (TCH), Togo (TG), Uganda (EAU).<br />
Ländertabelle: Mauretanien (RIM) bis Uganda (EAU)<br />
RIM MOC NAM RN WAN RWA Z SN ZW SO RSA SUD EAT TCH TG EAU<br />
Geographie (1953) 1<br />
Geographische Bilder (1953)<br />
Harms Erdkunde (1961) 2 1 2 1<br />
Geographie (Widrig 1967) 4<br />
Seydlitz Realschule (1968) 1 1 1 1 1 6 1 1<br />
Erdkunde (1968) 5<br />
Länder u. Völker (60er) 1 1 14<br />
Fahr in die Welt (1971-1974) 3 2 12 5 1<br />
Geographie Aargau (1972-1977) 7<br />
List Geographie (1972-1976) 9 7<br />
Neue Geographie (1974-1976) 11 24 12 2<br />
Dreimal um die Erde (1977-1980) 3 29 23 9<br />
Geographie thematisch (1977-1980) 2 12 1 16<br />
Terra Geographie (1979) 1 12<br />
Unser Planet (1979-1982) 8<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum (1983-1984) 18 10<br />
Geographie der Kontinente (1984) 11 30<br />
Terra Erdkunde Realschule (1980-1985) 1 1<br />
Mensch u. Raum (1983-1986) 4 6 4<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum (1987) 8 9 8<br />
Seydlitz Erdkunde (1993-1995) 19 1 11<br />
Seydlitz Geographie (1994-1996) 1 1 1 3<br />
Heimat u. Welt (1994-1996) 1 1<br />
Geographie: Mensch u. Raum (1994-1996) 4<br />
Diercke Erdkunde (1995-1997)<br />
Musiklehrmittel<br />
Musikstudio (1980-1982)<br />
Spielpläne Musik (1992-1994)<br />
Musik hören, machen, verstehen (1990-1995) 3 3 4<br />
Die Musikstunde (1992-1997)<br />
Hauptsache Musik (1995)<br />
Vom Umgang mit dem Fremden (1996)<br />
Sprach- und Leselehrmittel<br />
Drei Schritte (1984) 2 5<br />
Der Lesefuchs (1988) 4<br />
Karfunkel (1990)<br />
Das fliegende Haus (1992) 7<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
Total 1 15 8 6 98 14 13 19 5 2 145 7 92 10 1 1<br />
Die beiden Tabellen zum Umfang der Darstellungen der Länder Schwarzafrikas in verschiedenen Lehrmitteln<br />
zeigen, dass zwar die meisten der schwarzafrikanischen Staaten irgendeinmal in einem Lehrmittel beschrieben<br />
werden, die einzelnen Lehrmitteln beschäftigen sich in der Regel jedoch nur mit einer kleinen Anzahl von<br />
Ländern. Ausserdem geraten gewisse Länder für einige Jahre in das Zentrum der Aufmerksamkeit, um dann<br />
nur noch kurze Erwähnung zu finden. Äthiopien wird beispielsweise vor allem in den Lehrmitteln der sechzi-<br />
ger Jahre beschrieben, gleiches lässt sich über die Demokratische Volksrepublik Kongo sagen, während Ghana<br />
eher in den sechziger uns siebziger Jahren Aufmerksamkeit findet und Kenia und Tansania schwergewichtig in<br />
den achtziger und neunziger Jahren beschrieben werden. Bis 1975 wird Südafrika in den meisten Ländern<br />
erwähnt, ab diesem Zeitpunkt erhält Nigeria wesentlich mehr Gewicht. Auf die Länder Äthiopien,<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 516
Demokratische Republik Kongo, Ghana, Kenia, Nigeria, Südafrika und Tansania soll im Folgenden speziell<br />
eingegangen werden.<br />
7.3.1 Äthiopien<br />
Die Darstellung Äthiopiens beschränkt sich fast ausschliesslich auf die Geographielehrmittel bis Ende der<br />
siebziger Jahre. Nur das Musiklehrmittel "Spielpläne Musik" von 1992-1994 beschäftigt sich mit der Darstel-<br />
lung der Musik der Hamar noch einmal vertieft mit einem der vielen Völker Äthiopiens und das Lesebuch<br />
"Karfunkel" von 1990 enthält eine Geschichte, die Äthiopien zum Schauplatz hat. Die Geographielehrmittel<br />
vollziehen bis zu einem gewissen Grad die politische und wirtschaftliche Lage Äthiopiens nach, vermitteln<br />
aber in der Regel ein einseitiges Bild.<br />
Das "Lehrmittel für die Sekundarschule" von 1953 erwähnt nur, dass Äthiopien schwer zugänglich sei. Nach<br />
"Geographie Widrig" von 1967, sind die Männer, des von einem Kaiser regierten Landes, mit weissem Schul-<br />
tertuch und braunen, enganliegenden Hosen wie in biblischen Zeiten gekleidet, während in den Schaufenstern<br />
der Hauptstadt Addis Abeba Badewannen, Radios und Photoapparate ausgestellt, und in den Läden sogar<br />
hochempfindliche Kleinbildfilme zu kaufen seien.<br />
"Seydlitz für Realschulen von 1968 betont die Tatsache, dass Äthiopien seit 2000 Jahren ein selbständiger<br />
Staat sei, in der koptischen Kirche habe sich eine altertümliche Form des Christentums erhalten. Ausserdem<br />
wird auch in diesem Lehrmittel der Kontrast zwischen dem Land und der Stadt beschrieben: eine fast unbe-<br />
rührte Landschaft stehe einer Grossstadt gegenüber, die in ihren neueren Stadtvierteln ganz europäisch wirke.<br />
Äthiopien habe unter der Führung seines angesehenen Herrschers eine Art Vorsitz in der politischen Zusam-<br />
menarbeit der jungen afrikanischen Staaten einnehmen können. Auch Äthiopien benötige zwar Entwicklungs-<br />
hilfe durch die Industrieländer, zeige aber bereits einen beachtlichen Aufstieg.<br />
Die "Erdkunde" von 1968 nennt die durch Rodung entstandene Waldarmut und vermittelt durch die Aufzäh-<br />
lung verschiedener Nahrungsmittel den Eindruck eines gesegneten Landes, in dem das Verkehrswesen aller-<br />
dings noch wenig entwickelt sei und das dringend ausgebaut werden müsse. Zu diesem Zweck habe der<br />
Kaiser, des von einer dünnen Oberschicht regierten Landes, welches seit 2000 Jahren ein unabhängiges Kaiser-<br />
reich sei, Europäer und Amerikaner in sein Land geholt.<br />
"Länder und Völker" aus den 60er Jahren meint, dass trotz aller Bemühungen des Kaisers um eine Modernisie-<br />
rung der Landwirtschaft, der Ackerbau in vielen Gebieten Äthiopiens noch mit dem Hakenpflug betrieben<br />
werde, und die eintönige Landschaft mit den kahlen Bergen, die bis zu 2'000 m aufsteigen, trage nur eine dürf-<br />
tige Vegetation. Gleichzeitig betont das Lehrmittel den Wild- und Viehreichtum des Landes und nennt zahlrei-<br />
che noch abzubauende Rohstoffe.<br />
"Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 betont noch einmal die Gegensätze Äthiopiens zwischen moderner<br />
Grossstadt und traditioneller Lebensweise.<br />
Die "Neue Geographie" von 1974-1976 steht mit dem Beispiel einer fehlgegangenen Entwicklungshilfe am<br />
Wendepunkt der Darstellung Äthiopiens. Beschäftigte sich die Darstellung in den bereits erwähnten Lehrmit-<br />
teln mit einem Land, welches sich wirtschaftlich zu entwickeln schien und auf eine Jahrtausende alte Kultur<br />
zurückblicken kann, wird Äthiopien ab Mitte der siebziger Jahre als Land des Hunger gezeichnet.<br />
Nach "Geographie thematisch von 1977-1980 leben die Menschen erbärmlicher als die Tiere und sterben am<br />
Hunger, der die Menschen zu in Lumpen gehüllte Skelette reduziert.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 517
Nach "Terra Geographie" von 1979 finden zahlreiche Kranke nur bei den aus dem Ausland anreisenden Ärzten<br />
Heilung, wenn sie nicht mit ihrem Leiden allein gelassen werden, und "Terra Erdkunde für Realschulen" von<br />
1980-1985 spricht von mindestens zehn Millionen Menschen, die Hunger leiden. Nach "Seydlitz Geographie"<br />
von 1994-1996 ist der Hunger nirgends grösser, das Elend nirgends auswegloser. Es habe den Anschein, die<br />
sieben Plagen hätten in Äthiopien eine feste Heimstatt gefunden. Das Bauernland drohe in der tödlichen Zange<br />
aus Bodenerosion und Bevölkerungsexplosion zerquetscht zu werden.<br />
Äthiopien wandelte sich während den siebziger Jahren also von einem stolzen, wenn auch oft noch wirtschaft-<br />
lich rückständigen Staat, in ein Hungergebiet, welches nirgends grössere Dimensionen annahm. Von der<br />
langen Tradition Äthiopiens ist, seitdem die Aufmerksamkeit der Lehrmittel auf die Hungerkatastrophen fiel,<br />
nichts mehr übriggeblieben.<br />
7.3.2 Demokratische Republik Kongo<br />
Das ehemalige Zaire, seit dem Sturz Mobutus wieder Demokratische Republik Kongo genannt, wird in<br />
verschiedenen Geographielehrmitteln erwähnt.<br />
"Geographie - Lehrmittel für Sekundarschulen" von 1953 beschreibt den Kongo als rohstoffreiches Land mit<br />
ständig wachsenden Industriegebieten, während "Geographie Widrig" von 1967 meint, dass die wirtschaftliche<br />
Erschliessung des Urwalds am Kongo noch in den Anfängen stecke. Nach "Seydlitz für Realschulen" von 1968<br />
ist das Land, das nach seiner Unabhängigkeit durch die grossen Gegensätze zwischen den einzelnen "Stäm-<br />
men" in blutige Unruhen gestürzt wurde, der wichtigster Staat Äquatorialafrikas, der in der Hauptstadt Kinsha-<br />
sa über eine der modernsten Grossstädte Afrikas, ausserdem über wertvolle Bodenschätze und moderne Indu-<br />
striewerke, verfüge. "Erdkunde" 1968 erwähnt die Schwierigkeiten nach der Unabhängigkeit, bei denen der<br />
junge Staat auseinanderzubrechen drohte und sagt aus, dass es noch am Nationalbewusstsein der Bevölkerung<br />
fehle. Es bedürfe noch Jahre harter Arbeit und tatkräftiger Hilfe durch die Industrieländer bis sich dies ändere.<br />
"Länder und Völker" aus den 60er Jahren erwähnt noch einmal den Reichtum an Bodenschätzen, und spricht<br />
von einer grossen Industrielandschaft mitten im tropischen Afrika, in der die Schlote der Hochöfen und<br />
Hüttenbetriebe rauchten und die Räder der Fördermaschinen ratterten, wie in einem europäischen Industriere-<br />
vier. Der "Neger" in den Städten des Kongos habe fast nur noch die Hautfarbe mit seinen Urwaldverwandten<br />
gemeinsam. Nach "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 sind die Jungen im Kongo genauso wild und interes-<br />
siert hinter Motoren her wie gleichaltrige Burschen in Europa. In den Städten fänden sich Freilichttheater,<br />
Kinosäle, viele Schulen, denn es gäbe kein Kind ohne Schulunterricht, und Krankenhäuser. Nach "List<br />
Geographie" von 1972-1976 betreiben afrikanische Ingenieure moderne Industrieanlagen in einem mit Natur-<br />
schätzen sehr reich ausgestattetes Land, in dem früher Jäger mit vergifteten Pfeilen Wild erlegten.<br />
"Unser Planet" von 1979-1982 erwähnt nur den Hackbau im Kongogebiet, während "Seydlitz: Mensch und<br />
Raum" von 1983-1984 meint, dass wegen dem starken Anstieg der Bevölkerung, die ein besonderes <strong>Pro</strong>blem<br />
darstelle, die landwirtschaftliche Nutzung intensiviert werden müsse.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
Nach "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1987 wurde das Land ohne ausreichende politische Verantwortung<br />
fast über Nacht und ohne über die nötigen Fachkräfte zu verfügen, in die politische Unabhängigkeit entlassen<br />
und wird seitdem von einer schmalen Elite regiert, die eine bevorzugte Versorgung mit Luxusgütern erfährt,<br />
während der Staatschef Mobutu vermutlich zu den zwanzig reichsten Männern der Welt gehöre.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 518
Nach "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 lebt der Grossteil der Bevölkerung im Wirtschaftsraum Kongobek-<br />
ken von der Landwirtschaft. Die Schwerindustrie habe unter schlechten Transportverbindungen zu leiden und<br />
schaffe erhebliche Umweltprobleme.<br />
In der Darstellung der Demokratischen Republik Kongo zeigt sich ein starker Bruch gegen Ende der siebziger<br />
Jahre: Wurde vorher vor allem das wirtschaftliche Potential und der Rohstoffreichtum betont, erwähnen die<br />
Lehrmittel danach nur noch die landwirtschaftliche Komponente des Landes. Erst in den neunziger Jahren<br />
wird die Schwerindustrie des Landes wieder genannt.<br />
7.3.3 Ghana<br />
Ghana gehört zu den in den untersuchten Lehrmitteln am häufigsten erwähnten Ländern Schwarzafrikas.<br />
Neben den Beschreibungen in verschiedenen Werken zur Geographie, findet das Land auch in zwei Musik-<br />
lehrmitteln, "Musikstudio" von 1980-1982, "Singen Musik" von 1992, "Klangwelt-Weltklang 2" von 1993 und<br />
"Musik hören, machen, verstehen" von 1990-1995, Erwähnung, wobei das Land unter ganz verschiedenen<br />
Sichtweisen geschildert wird. Die Darstellung des Landes in den Geographiebüchern soll hier kurz zusammen-<br />
gefasst werden.<br />
"Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen" von 1961 druckt einen Text von Kwame Nkrumah ab, nachdem<br />
Ghana als Beispiel all diejenigen innerlich ermutigen und stärken soll, die sich immer noch unter fremder<br />
Herrschaft befänden. Nach "Geographie Widrig" von 1967 konnten es viele Afrikaner kaum erwarten, nach<br />
dem Vorbild Ghanas das "europäische Joch" abzuschütteln.<br />
Nach "Seydlitz Realschule" von 1968 entwickelt sich Ghana, der Hauptlieferant für Kakao auf dem Welt-<br />
markt, rasch - unter anderen wird der Voltastaudamm erwähnt -, für eine gesunde Wirtschaft fehle es aber<br />
noch an vielem, während die Bevölkerung des Landes, die rasch zunehme, noch kein einheitliches Staatsvolk<br />
bilde. Die "Erdkunde" von 1968 kommt ebenfalls auf den Voltastaudamm zu sprechen, meint aber, dass der<br />
Kakao der Reichtums eines Landes sei, welches sich ruhiger als andere afrikanische Staaten entwickelt habe.<br />
Nach "Länder und Völker" aus den 60er Jahren gehören die Einwohner Ghanas zu den fortschrittlichsten<br />
Vertretern der schwarzen Rasse in Afrika. Die Hauptstadt Accra biete ein recht malerisches Strassenbild, in<br />
dem die vielen bebrillten jungen "Neger" auffallen. Der Kakaoanbau wird nur kurz angetönt. "Fahr mit in die<br />
Welt" von 1971-1974 beschreibt Accra als eine Stadt in modernem Gewand von fast europäischen Charakter.<br />
Ausserdem stattet es als erstes der untersuchten Lehrmittel einem Kakaobauern einen Besuch ab.<br />
"Dreimal um die Erde" von 1977-1980 widmet sich ganz dem Kakaoanbau und macht auf die <strong>Pro</strong>bleme der<br />
Preisschwankungen eines solchen <strong>Pro</strong>duktes aufmerksam, die dazu führten, dass Einfuhren von wichtigen<br />
Industriegütern unter Umständen unterbleiben müssen.<br />
"Terra Geographie" von 1979 erwähnt die Bauern Nordghanas, welche mit der Hacke und gebückter Haltung<br />
ihre Felder wie schon seit Jahrhunderten bestellten. "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1983-1984 beschreibt<br />
den Export von Edelhölzern aus Ghana, den ein Vertreter des Wirtschaftsministerium in einem Zitat als Raub-<br />
bau am Wald bezeichnet.<br />
"Geographie der Kontinente" von 1984 und "Mensch und Raum" von 1983-1986 widmen sich ausschliesslich<br />
der Kakaoproduktion des Landes, während "Seydlitz: Geographie" von 1994-1996 Ghana nur im Zusammen-<br />
hang mit dem Tauschwert eines Sklaven erwähnt.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 519
Während Ghana in den Geographielehrmitteln der sechziger Jahre und der ersten Hälfte der siebziger Jahre als<br />
Vorreiter unter den schwarzafrikanischen Staaten geschildert wird, tritt in den achtziger Jahren die Kakaopro-<br />
duktion in den Vordergrund. In den Geographiebüchern der neunziger Jahre wird das Land nur noch am Rande<br />
erwähnt, tritt dafür aber in den Musiklehrmitteln mehr in Erscheinung.<br />
7.3.4 Kenia<br />
Das als Touristenland geltende Kenia wird in den Lehrmitteln der sechziger und siebziger Jahre häufig, meist<br />
jedoch nur kurz erwähnt. Etwas ausführlichere Beschreibungen finden sich in einigen Lehrmitteln der neunzi-<br />
ger Jahre.<br />
"Geographie Widrig" von 1967 kennzeichnet Kenia als Land, in dem sich Dürre und Überschwemmungen<br />
ablösen und die "Eingeborenen" bei solchen Klimaverhältnissen Hunger und ansteckenden Krankheiten<br />
schutzlos ausgeliefert seien.<br />
In "Seydlitz für Realschulen" von 1968 wird Kenia als das am stärksten von Weissen besiedelten Land in<br />
Ostafrika beschrieben, dies mache sich auch im Aussehen der Hauptstadt Nairobi bemerkbar. In Zukunft<br />
würde die Zahl der Europäer aber abnehmen und deren Exportproduktion zunehmend von Afrikanern über-<br />
nommen. "Länder und Völker" aus den 60er Jahren meint, dass die Afrikaner in Kenia durch die verbesserten<br />
Lebensverhältnisse gegenüber dem Europäer immer selbstbewusster geworden wären, und es dadurch<br />
vermehrt zu Aufständen gegen die koloniale Tätigkeit der Europäer gekommen sei.<br />
"Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 beschränkt sich vorwiegend auf die Beschreibung der agraren Export-<br />
produkte eines Landes, dessen Verwaltung und Wirtschaft unter starkem Druck "kenianisiert" werde. Die<br />
Beschreibung der Bevölkerung vermittelt den Eindruck, dass Kenia vor allem von arbeitslosen Schwarzen, und<br />
Massai, die sich der neuen Zeit wenig angepasst haben, bewohnt wird.<br />
Nach "List Geographie" von 1972-1976 ist Kenia nach seiner Rolle als Kaffee-Exporteur, vor allem ein Touri-<br />
stenland, dessen Besucherzahlen im Steigen begriffen seien. "Dreimal um die Erde" von 1977-1980" kritisiert<br />
das Töten der Elefanten, denen durch Wilderer die Stosszähne abgebrochen würden, obwohl die Regierung<br />
schon 1975 jede Jagd auf Elefanten verboten habe. Ausserdem wird Kenia als Land der Wildschutzreservate<br />
dargestellt, die nach Meinung mancher einheimische Politiker nur ein teure Gefälligkeit gegenüber den Weis-<br />
sen, die in ihren eigenen Ländern viele Tierarten ausgerottet hätten, darstellten. "Terra Geographie" von 1979<br />
fragt nach, ob die schönen bunten Bilder von wilden Tieren, "Eingeborenentänzen", Luxushotels und vom<br />
Sandstrand unter Palmen wirklich repräsentativ für Kenia seien.<br />
Nach "Mensch und Raum" von 1983-1986 gehört Kenia zu den Ländern, deren Bevölkerung am schnellsten<br />
wächst. Ausserdem verfüge es kaum über Rohstoffe und müsse weit mehr für die eingeführten Güter bezahlen<br />
als er für seine Ausfuhren erhalte. Ausserdem erwähnt es auch die Bedrohung des Wildes durch die einheimi-<br />
sche Bevölkerung, die vom Tourismus, eine der wichtigsten Einnahmequellen des Staates, nur einen geringen<br />
Nutzen habe.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
Nach "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 weist Kenia wie kein anderes Land in Afrika, grosse klima- und<br />
lagebedingte Landschaftsgegensätze innerhalb eines kleinen Raumes auf, die einen starken Einfluss auf die<br />
Bewirtschaftung und Verteilung der Bevölkerung ausübten. Neben der Kaffeeproduktion wird wieder der<br />
Tourismus als wichtige Einnahmequelle des Landes angegeben. Auch "Seydlitz Geographie" von 1994-1996<br />
sieht das schnelle Wachstum der Bevölkerung, deren traditionelles Leben sich immer mehr verändere, und die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 520
dadurch bedingte Überbevölkerung als ein grosses <strong>Pro</strong>blem für das Land an. Ein wichtiger Faktor für de Wirt-<br />
schaft des Landes sei der Export von Kaffee, Tee und Sisal. Zum Tourismus meint das Lehrmittel, dass die<br />
schönen Wildgebiete von Schaulustigen so überfüllt seien, dass einige Raubtiere bereits ein gestörtes Verhal-<br />
ten zeigten.<br />
Gewann Kenia im Verlaufe der sechziger Jahre nach den Aussagen der Geographielehrmittel immer mehr an<br />
Bedeutung als Exporteur von Genussmitteln, rückt ab den siebziger Jahren die Tourismusindustrie des Landes,<br />
die zumeist kritisch bewertet wird, in den Vordergrund der Betrachtung.<br />
7.3.5 Nigeria<br />
Nigeria wird in den Geographielehrmitteln seit den sechziger Jahren immer wieder beschrieben. "Harms<br />
Erkunde - Die Welt in allen Zonen" von 1961 widmet sich ganz der "Kunst in Benin" und beschreibt damit<br />
einem Teil der Geschichte Nigerias, der einerseits eine ungewöhnlich hohe Fertigkeit in der Technik der Bron-<br />
zegiesserei, andererseits Despotien hervorgebracht haben soll, in denen Menschenopfer dargebracht wurden.<br />
"Seydlitz für Realschulen" von 1968 beschäftigt sich ganz mit der damaligen Gegenwart Nigerias und erwähnt<br />
die Städte des Landes, unter denen Ibadan die grösste sei. "Dreimal um die Erde" von 1977-1980 schildert<br />
Nigeria als ein Land, dessen Bewohner bedingt durch ihre unterschiedliche Lebens- und Wirtschaftsweise,<br />
noch kein einheitliches Volk geworden seien, in dem ein grosser Nord-Südgegensatz herrsche, und das Zusam-<br />
menwachsen der "Stämme" zu einem einheitlichen nigerianischen Volk durch eine fehlende gemeinsame Spra-<br />
che erschwert werde. "Geographie thematisch" von 1977-1980 diskutiert die <strong>Pro</strong>bleme des Vielvölkerstaates<br />
Nigeria: durch die Unabhängigkeitserklärung der Ibos in der Ostregion des Landes sei es zu einem grausamen<br />
Bürgerkrieg und unbeschreiblichen Hungersnöten gekommen. Damit erwähnt das Lehrmittel als erstes den<br />
Biafrakrieg.<br />
"Seydlitz - Mensch und Raum" von 1983-1984 beschäftigt sich mit der Industrialisierung Nigerias, welches als<br />
bevölkerungsreichstes Land Westafrikas eine besondere Stellung einnehme, und in dessen Hauptstadt Lagos<br />
die hektische Entwicklung deutlich werde. Obwohl das Land seit den siebziger Jahren mit Hilfe der Einnah-<br />
men aus der Erdölförderung neue Industriekomplexe, Hafenanlagen und Strassen errichte, würden doch<br />
Nahrungsmittel aus eigener <strong>Pro</strong>duktion fehlen, so dass diese aus dem Ausland eingeführt werden müssten.<br />
"Mensch und Raum" von 1983-1986 befasst sich anhand einer Brotfabrik ebenfalls mit der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung Nigerias: die zunehmende Industrialisierung führe zu Arbeitslosigkeit in der einheimischen<br />
Bevölkerung und der zunehmenden Abhängigkeit von Importen.<br />
"Seydlitz: Mensch und Raum" von 1987 beschreibt die Stadt Kano, welche bereits im 10. Jahrhundert in einer<br />
Chronik belegt sei. Ausserdem bemerkt das Lehrmittel, dass Stadtkultur in Westafrika eine jahrhundertelange<br />
Tradition habe.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
"Seydlitz Erdkunde" von 1993-1994 stellt die Frage, ob Nigeria, ein reiches Land mit grossen Gegensätzen<br />
zwischen arm und reich, ein Staat sei. Das Zusammenleben von rund 250 verschiedenen Völkern und Stäm-<br />
men hätte in der Vergangenheit und Gegenwart immer wieder zu Putschversuchen und Bürgerkriegen geführt.<br />
Trotzdem versuche man, ein eine Art "Nationalbewusstsein" zu entwickeln. Die Exportwirtschaft des Landes<br />
sei vor allem auf das Erdöl ausgerichtet, durch dessen Erlöse die Industrialisierung finanziert worden sei. Das<br />
verschuldete Land verfüge aber über zuwenig Facharbeiter und die Wartung von Maschinen und Fahrzeugen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 521
sei daher kaum möglich. "Heimat und Welt" von 1994-1996 erwähnt noch einmal die Stadt Kano, deren Markt<br />
sehr schön sei.<br />
Im Gegensatz zur Darstellung anderer Länder, lässt sich in den untersuchten Lehrmitteln keine eindeutige<br />
Entwicklung feststellen. Zwar kreisen diese fast immer um die Bereiche Entwicklung, afrikanische Staat und<br />
Biafrakrieg, scheinen aber eher zufällig zum zentralen Thema gemacht zu werden.<br />
7.3.6 Südafrika<br />
Südafrika wird speziell in den Lehrmitteln der sechziger und siebziger Jahre immer wieder thematisiert und als<br />
Land der Spannungen zwischen schwarzen und weissen Bevölkerungsgruppen geschildert. Die Darstellung der<br />
Apartheidspolitik änderte sich jedoch im Laufe der Jahre.<br />
Während bereits die "Geographie" von 1953 von den Spannungen zwischen den Rassen spricht und meint, die<br />
billige Arbeitskraft der Schwarzen habe nicht unwesentlich zum raschen Aufstieg des Landes beigetragen, und<br />
"Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen" von 1961 aussagt, dass die Logik der europäischen Gerichtsver-<br />
fahren dem Rechtsempfinden des Afrikaner oft geradezu ins Gesicht schlage, dabei aber die den Menschen-<br />
rechten zuwiderlaufende Gesetzgebung der damaligen Republik Südafrika verschweigt, spricht "Geographie<br />
Widrig" von 1967 davon, dass sich die Buren über drei Jahrhunderte in einer farbigen Umwelt rassenrein<br />
erhalten hätten und warnt davor, dass die Gleichberechtigung der Schwarzafrikaner Südafrika zu einem Bantu-<br />
staat machen würde, denn die eingeborene Bevölkerung wäre nicht in der Lage, eine vernichtete europäische<br />
Zivilisation durch etwas Gleichwertiges zu ersetzten. Auch "Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren<br />
erwähnt diese drohende Gefahr für Südafrika, die als schwarze Springflut bezeichnet wird, meint aber gleich-<br />
zeitig, dass die Schwarzen in richtigen Elendsquartieren wohnen würden.<br />
"Seydlitz für Realschulen" von 1968 bemerkt, dass es auffalle, wie Weisse und Schwarze streng voneinander<br />
getrennt seien und sagt aus, dass die Apartheidspolitik den Schwarzen keine volle Gleichberechtigung zugeste-<br />
he. In der "Erdkunde" von 1968 heisst es, dass die "Neger" keine politischen Recht hätten und sich mit einem<br />
Bruchteil der Löhne der Weissen zufriedengeben müssten. "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 spricht von<br />
einem geteilten Land, in dem die Schwarzen von den Wahlen ausgeschlossen seien und in den Reservaten<br />
noch die Gesetze des "Stammes" gelten würden. Das Lehrmittel weisst aber auch darauf hin, dass von fünf<br />
Bantukinder vier eine Schule besuchen und die weisse Bevölkerung die schwarzen Südafrikaner subventionie-<br />
re. Ausserdem seien die weissen Südafrikaner bereit, in ihren Anstrengungen fortzufahren, ja sie noch zu<br />
verstärken, vorausgesetzt, die Trennung der Rassen werde streng beachtet und die Zusammenarbeit auf den<br />
Bereich der Wirtschaft beschränkt.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
Deutlicher schärfer spricht sich "List Geographie von 1972-1976 zur Apartheidspolitik Südafrikas aus, welche<br />
zu einem Inbegriff einer rassenfeindlichen Politik geworden sei. Die "Neue Geographie" von 1974-1976<br />
erwähnt die Verleihung des Friedensnobelpreises an Albert J. Lutuli, der sich für eine Politik des gewaltlosen<br />
Widerstands einsetze, und nennt die Gesetzgebung der Apartheidregierung fragwürdig. Ausserdem stellt das<br />
Lehrmittel fest, dass durch die billige Arbeitskraft der Schwarzen die Firmen in Südafrika teilweise mehr<br />
verdienten als in anderen Teilen der Welt. "Dreimal um die Erde" von 1977-1980 erwähnt, dass die Schwar-<br />
zen keine Mitbestimmungsrechte hätten und sie aus dem Wohngebieten der Weissen in übervölkerte Home-<br />
lands zwangsumgesiedelt würden. "Geographie der Kontinente" von 1984 begnügt sich damit, verschiedene<br />
Stimmen zur Apartheidspolitk zu Wort kommen zu lassen, ohne direkt Stellung zu nehmen, verzichtet aber<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 522
nicht darauf, die Wirtschaft Südafrikas im Detail zu schildern. "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 erwähnt<br />
Südafrika schliesslich als Land, welches immer wieder in die negative Schlagzeilen der Medien gerate.<br />
Insgesamt ergibt sich bei der Schilderung der südafrikanischen Politik eine Verschiebung der Perspektive<br />
zugunsten der schwarzen Bevölkerungsteile des Landes, dem wird aber meist der wirtschaftliche Erfolg des<br />
Landes gegenübergestellt. Oft "vergessen" dabei die Lehrmittel zu erwähnen, dass dieser vor allem den nicht-<br />
schwarzen Bevölkerungsteilen zugute kam. Was fast alle Lehrmittel auszeichnet ist die stereotype Beschrei-<br />
bung des wohlhabenden Weissen und des armen, manchmal als ausgenutzt betrachteten Schwarzen. Die auch<br />
existierende weisse Unterschicht Südafrikas hingegen wird in keinem der untersuchten Lehrmittel erwähnt.<br />
7.3.7 Tansania<br />
Die Beschreibungen Tansanias entfallen alle auf die Geographielehrmittel der siebziger und frühen achtziger<br />
Jahre, vorher und danach wird das Land höchstens am Rande erwähnt.<br />
In "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 wird der damalige Ministerpräsident Nyerere zitiert, nachdem die<br />
neue Regierung des Landes nicht die Absicht habe, die Weissen aus dem Land hinauszuwerfen, sie es aber<br />
auch nicht länger dulden wolle, dass 20'000 Weisse das Zepter über fast 9 Millionen Schwarze führten.<br />
Nach der "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule" von 1972-1977 nutzten die Tansanier die<br />
neugewonnene Freiheit nach der Unabhängigkeit, um eine Bildungsreform durchzuführen, mit den erklärten<br />
Zielen, die Schüler in der Landwirtschaft zu unterweisen und ihnen das zu lehren, was sie auch anwenden<br />
könnten. Mit eine solchen Erziehung wolle man der intellektuellen Arroganz entgegenwirken. Das gleiche<br />
Lehrmittel zitiert auch die Aussage eines Tansaniers, nachdem die Religion bei den Afrikanern viel mehr gelte<br />
als bei den Europäern. Ausserdem entspreche das Einparteiensystem des Landes der afrikanischen<br />
Lebensweise.<br />
Nach "List Geographie" von 1972-1976 soll selbst das sozialistische Tansania sich in Anlehnung an das Nach-<br />
barland Kenia immer mehr für den Tourismus interessieren, obwohl man sich jahrelang geziert habe. Ausser-<br />
dem stattet das Lehrmittel einem Kaffeebauern einen Besuch ab, der betont, sie würden laufend Neuerungen<br />
einführen.<br />
Die "Neue Geographie" von 1974-1976 stellt das vom damaligen tansanischen Präsidenten Nyerere aufgestell-<br />
te Entwicklungsprogramm vor, nachdem sich die Tansanier mehr auf ihre eigenen Kräfte besinnen und verlas-<br />
sen wollen, denn die Entwicklung eines Landes werde nicht durch Geld, sondern durch Menschen<br />
zustandegebracht.<br />
"Dreimal um die Erde" von 1977-1980 konzentriert sich auf die von aussen geleistete Entwicklungshilfe in<br />
Tansania, das zu den 25 ärmsten Länder der Welt gehöre, und auf die vom damaligen Präsident Nyerere<br />
eingeleitete Bodenreform unter dem Motto "Ujamaa", welches eine Form des afrikanischen Sozialismus<br />
bezeichne. Dabei zweifelt das Lehrmittel an, ob Ujamaa jemals funktionieren und die Eigenversorgung des<br />
Landes garantiert werden könne.<br />
Auch "Geographie thematisch" von 1977-1980 beschäftigt sich, wieder wird der damalige Präsident Nyerere<br />
zitiert, mit der Entwicklungspolitik Tansanias. Dabei wird betont, dass in Tansania weniger investiert würde,<br />
weil die Regierung einen sozialistischen Kurs steuere.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
"Terra Geographie" von 1979 beschreibt ebenfalls die Entwicklungspolitik Tansanias, dessen Bevölkerung fast<br />
ausschliesslich von der Landwirtschaft lebe. Dabei wird Nyerere noch erwähnt aber nicht mehr zitiert, und das<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 523
Lehrmittel betont die hohe Verschuldung des armen Landes, die auf den Mangel an Verantwortungsbewusst-<br />
sein und Einsatzfreude, sowie auf das fehlende Erfolgsstreben der einheimischen Bevölkerung zurückzuführen<br />
sei.<br />
"Unser Planet" von 1979-1982 zitiert ebenfalls Nyerere, nachdem sich das Land in einem Kampf dafür befin-<br />
de, die Nation aus dem Zustand der Schwäche herauszuholen und in einen Zustand der Stärke zu versetzen.<br />
Die Entwicklungspolitik des Landes sei gescheitert, weil die gesamte Bevölkerung in Dörfern zusammenge-<br />
fasst worden sei, die wirtschaftlich nicht rentabel arbeiten würden. Die westlichen Länder seien wegen der<br />
sozialistischen Haltung der Regierung Tansanias, einem armen und hochverschuldeten Land, zurückhaltend<br />
mit Hilfeleistungen.<br />
"Mensch und Raum" von 1983-1984 schliesslich befasst sich nicht mehr mit der Politik des Landes, sondern<br />
schildert eine Begegnung mit einem Massai, der unterwegs in die Stadt zu einem Schulbesuch ist.<br />
Wie bei keinem zweiten Land findet in den Beschreibungen Tansanias die Politik einen grossen Raum. Wurde<br />
diese Anfangs noch mit einer gewissen Verwunderung beschrieben, scheint in den Lehrmitteln der achtziger<br />
Jahre fast Erleichterung darüber zu herrschen, dass die Entwicklungspolitik der sozialistischen Regierung<br />
gescheitert war.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Genannte Länder<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 524
7.4 Weitere Aspekte<br />
Die Darstellung der Geschichte und der Religionen Schwarzafrikas soll kurz zusammengefasst werden. In<br />
einem weiteren Abschnitt soll kurz auf die "Qualität und Aktualität der gemachten Aussage" eingegangen<br />
werden.<br />
7.4.1 Geschichte<br />
Bei der Darstellung der Geschichte Schwarzafrikas sollen drei Bereiche in die Zusammenfassung einfliessen:<br />
Die Darstellung der afrikanischen Reiche, der Sklavenhandel und das Vordringen der Europäer.<br />
Nur einige wenige der untersuchten Lehrmittel erwähnen, meist nur kurz, die vor dem Auftreten der Europäer<br />
bestehenden Reiche Schwarzafrikas, oder diejenigen Reiche, die ausserhalb des Einflussbereiches der Euro-<br />
päer lagen. Eine Ausnahme bildet Äthiopien, dessen weit zurückreichende Geschichte in mehreren Lehrmitteln<br />
erwähnt wird. (Siehe dazu die Zusammenfassung zu Äthiopien auf der Seite 517 dieser Arbeit.)<br />
Der "Leitfaden für den Geographieunterricht" von 1934 erwähnt die blühenden Völker des Sudangebietes. Das<br />
Geographielehrmittel "Aussereuropäischer Erdteile - Geographische Bilder" von 1953 schildert in einem Text<br />
das Kunsthandwerk des alten Benin, der "Seydlitz für Realschulen" von 1968 erwähnt die alten Karawanen-<br />
strassen in Nordafrika, die Städte Timbuktu, Sokoto und Kano und spricht von prunkenden Gewändern, eine<br />
bis ins kleinste durchgeführte Ordnung, wohlgegliederten Staaten und machtvollen Herrschern. Nach "Erdkun-<br />
de: Oberstufe" von 1968-1969 gelang es besonders den mohammedanischen Völkern Afrikas, sich zeitweise zu<br />
bedeutenden Reichen zusammenzuschliessen. "Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren erwähnt<br />
Äthiopien als einer der ältesten Staaten der Menschheit, sowie das Königreich Bornu und sagt aus, dass die<br />
Bewohner des Sudangebietes grosse Staaten gründeten. "List Geographie" von 1972-1976 erwähnt grosse<br />
Reiche im Sudan und macht auf eine primitive Eisenindustrie in Liberia aufmerksam. Die "Neue Geographie"<br />
von 1974-1976 erwähnt die Reiche von Bornu-Kanem, Mali und Songhai. Nach "Geographie der Kontinente"<br />
von 1984 haben sich in den Savannen Afrikas verschiedene Stammesgruppen zu grossen Stammesverbänden<br />
zusammengeschlossen. "Seydlitz: Mensch und Raum" von 1987, welches als einziges Lehrmittel ausführlich<br />
auf die voreuropäische Geschichte Schwarzafrikas eingeht, nennt die Reiche von Mali und Simbabwe, zitiert<br />
eine Beschreibung Timbuktus des arabischen Gelehrten Leo Africanus, und stellt anhand von Kano die jahr-<br />
hundertelange Tradition der Stadtkultur in Westafrika vor.<br />
Die Musiklehrmittel gehen vereinzelt auf die alten Reiche ein, viel dominanter ist aber die Schilderung des<br />
Sklavenhandels, der in Verbindung mit der Geschichte des Jazz oft recht breit, wenn meistens auch einseitig<br />
dargestellt wird. In den Geographielehrmitteln werden die Schwarzafrikaner zumeist als Opfer des Sklaven-<br />
handels geschildert, nur in Einzelfällen beinhalten sie eine differenzierte Darstellung dieses Menschenhandels<br />
in dem die Einflüsse sowohl der Europäer und Araber als auch die Mitwirkung schwarzafrikanischer Völker<br />
dargestellt werden.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Weitere Aspekte<br />
Die meisten Geographielehrmittel legen das Schwergewicht der Geschichtsdarstellung auf die Eroberung des<br />
afrikanischen Kontinentes durch die Europäer, dabei werden immer wieder Entdeckerfiguren wie Livingstone,<br />
der meist als Freund der Schwarzen geschildert wird, und Stanley, der sich mit dem Gewehr in der Hand durch<br />
den afrikanischen Dschungel kämpft, zitiert oder erwähnt. Dies wäre durchaus verständlich, wenn sich die<br />
Autoren darauf konzentriert hätten, den durch diese Personen errungenen Erkenntnisgewinn der Geographie<br />
Afrikas zu schildern, meist ergehen sich die Berichte aber in der Schilderung von Schwierigkeiten und<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 525
Auseinandersetzungen mit "Eingeborenen", die wenig mit der Geographie an sich zu tun haben und zudem ein<br />
Bild Schwarzafrikas vermitteln, dass vollkommen veraltet ist und längst nicht mehr der Wirklichkeit des Zeit-<br />
punktes des Erscheinens der angesprochenen Lehrmitteln entspricht. Auch der Widerstand der schwarzafrika-<br />
nischen Bevölkerung gegen die Kolonisatoren wird in den meisten Lehrmitteln verschwiegen. (Siehe dazu den<br />
Themenkreis "Kriege" ab der Seite 75 im Teil "Vorwürfe an das von der Schule vermittelte Bild" dieser<br />
Arbeit.)<br />
Nach dem "Lesebuch für die Oberklassen aus den 30er Jahren gehörte Ende des 19. Jahrhunderts fast das<br />
ganze "Negergebiet" den Europäern. Nach dem "Leitfaden für den Geographieunterricht" von 1934 befand<br />
sich Schwarzafrika zu dieser Zeit in europäischen Händen. "Geographie Widrig von 1967 bemerkt, dass die<br />
"Eingeborenen" ihre Rechte zu einem Spottpreis an die Europäer verschachert hätten. Die "Erdkunde" von<br />
1968 hält fest, dass Afrika lange Zeit von europäischen Staaten beherrscht wurde und diese die Kämpfe<br />
zwischen den einzelnen Stämmen mit Gewalt unterdrückt hätten. "List Geographie" von 1972-1976 schreibt<br />
über den Kongo: "Wo früher Jäger mit vergifteten Pfeilen Wild erlegten, betreiben heute afrikanische Inge-<br />
nieure moderne Industrieanlagen. Nach "Unser Planet" von 1979-1982 nahmen die Europäer das afrikanisches<br />
Land mit seinen Reichtümern in Besitz und nach "Seydlitz Geographie" von 1994-1996 wurde der Kontinent<br />
unter europäischen Mächten aufgeteilt.<br />
Nur einige wenige Lehrmittel geben detaillierte Daten zur jüngeren Geschichte Schwarzafrikas wieder. Diese<br />
beschränken sich zudem auf die Länder Nigeria, im Zusammenhang mit dem Biafrakrieg, und Südafrika.<br />
Die Versuche, eine Geschichte Schwarzafrikas in einem Geographielehrmittel zu beschreiben, enden also<br />
zumeist damit, eine wenig differenzierte Aufzählung der Taten der europäischen Entdecker und Kolonisatoren<br />
zu geben und den Schwarzafrikaner als Opfer einer überlegenen Zivilisation darzustellen, der über keine<br />
eigentliche eigene Geschichte verfügte. Nach Michlers "Weissbuch Schwarzafrika" (Michler, 1991, S. 4-6),<br />
Boris Schneider, der eine Untersuchung über die "Dritte Welt im Geschichtsunterricht in Schweizer Schulen"<br />
durchführte (Fürnrohr Hrsg., 1982, S. 184-187), und Aussagen von Schwarzafrikanern (SLZ 5/98, S. 8, 16-17)<br />
gilt dies auch für Geschichtslehrmittel, die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wurden.<br />
7.4.2 Religion<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Weitere Aspekte<br />
Die traditionellen Religionen Schwarzafrikas werden in den meisten Lehrmitteln entweder gar nicht erwähnt,<br />
oder als minderwertig gegenüber dem Islam und Christentum betrachtet. Nach der Aussagen einiger Lehrmit-<br />
tel stellen die traditionellen Religion auch ein Hindernis auf dem Weg des Fortschrittes dar.<br />
Das "Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen" von 1912 bezichtigt die "Negervölker" des<br />
heidnischen Aberglaubens, nach "Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen" von 1961 verfallen sie sogar in<br />
eine durch dämonische Mächte ausgelöste hemmungslose Blutgier. Laut der "Geographie" von 1963 betreiben<br />
die Schwarzafrikaner Ahnen- und Totenverehrung und glauben an Zauberei. "Geographie Widrig" von 1967<br />
nennt Ahnenkult, Geisterglaube, Fetischdienst, ausserdem sei der "Neger" davon überzeugt, dass der Tod nur<br />
durch den Willen eines Geistes oder eines Zauberers verursacht würde und früher sei ihm auch Menschenfres-<br />
serei und Kannibalismus nicht fremd gewesen. Einige Völker seien zum Islam übergegangen und fanatische<br />
Mohammedaner geworden. Die "Erdkunde" von 1968 nennt Äthiopien eine christliche Insel inmitten einer<br />
vorwiegend mohammedanischen Umwelt. Nach der "Erdkunde: Oberstufe" von 1968-1969 kennzeichnen<br />
Zauber- und Geisterglaube die niedrigste Form des Polytheismus, dem die Schwarzafrikaner anhängen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 526
"Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren spricht den Fulbe, die den Islam nach Westafrika gebracht<br />
und verbreitet haben sollen, einen fanatischen Eifer zu, während der Bantu nachts in seiner Hütte bleibe, da er<br />
die Geister fürchte. Auch in diesem Lehrmittel ist Äthiopien eine christliche Insel in einer islamischen<br />
Umwelt, während in den traditionellen Religionen der Medizinmann eine unheimliche Macht ausübt. "Fahr<br />
mit in die Welt" von 1971-1974 spricht von Geisterglaube und Dämonenzauber, nach "Dreimal um die Erde"<br />
von 1977-1980 hemmen die religiösen Vorstellungen der Schwarzafrikaner den Fortschritt. Nach "Geographie<br />
der Kontinente" von 1984 ist der Glaube an Geister in Schwarzafrika weit verbreitet und erst "Diercke Erdkun-<br />
de von 1995-1997 spricht davon, dass verschiedene Religionen in einer Familie gepflegt werden können, alle<br />
aber auch Animisten geblieben seien, die an Naturgeister und den Einfluss von den Seelen der Ahnen<br />
glaubten.<br />
Auch in den Musiklehrmitteln spielt die Religion nur eine untergeordnete Rolle: Während "Musik um uns -<br />
7.-10. Schuljahr" von 1975 noch von schwarzafrikanischen Priestern berichtet die im Augenblick der Besitz-<br />
nahme durch ihren angerufenen Gott in Schreien und zuckenden Bewegungen verfallen - eine Vorstellung die<br />
in der Lehrmittelreihe "Musik um uns" bis in die neunziger Jahre weiterverbreitet wurde - erwähnt "Musikstu-<br />
dio" von 1980-1982 die "Missa Luba", erläutert einige Grundsätze des Glaubens eines Pygmäenvolkes und<br />
spricht den Mitwirkenden eines Besessenheitstanzes eine gewisse Inszenierungsfreiheit zu.<br />
7.4.3 Anteil der Afrikaseiten am Gesamtumfang der Geographielehrmittel<br />
Die Tabelle "Anzahl der Afrikaseiten" gibt Auskunft über den Anteil, den die Beschreibungen Afrikas in den<br />
einzelnen Lehrmitteln einnehmen. Dabei wurden, sofern nicht mittels einer Fussnote anders vermerkt, alle<br />
Seiten, inklusive der Beschreibung der nordafrikanischen Länder berücksichtigt, auch wenn diese sich<br />
beispielsweise nur klimageographisch mit Afrika auseinandersetzen. Da die meisten Lehrmittel auch Seiten<br />
enthalten, die sich nur teilweise mit Afrika beschäftigen, beruhen die Angaben auf unterschiedlich genauen<br />
Schätzungen.<br />
Tabelle: Anzahl der Afrikaseiten<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Weitere Aspekte<br />
Lehrmittel, Buch Afrika Andere Total Anteil in %<br />
Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen 7.- 9. Schuljahr, 1912 ........................ ........... 7 ......... 102<br />
1091 ........ ............ 6<br />
Lesebuch für die Oberklassen (30er Jahre) ..................................................... ........... 7 .......... 78<br />
852 ......... ............ 8<br />
Leitfaden für den Geographieunterricht, 1934 .................................................. 19 3<br />
......... ......... 212 ......... 231 ............ 8<br />
Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen, 1936 .................................................. .......... 21 ......... 274<br />
295 4<br />
........ ............ 7<br />
Geographie- Lehrmittel für die Sekundarschule, 1953 (1945) ...................................... .......... 27 ......... 357 ......... 384 ............ 7<br />
Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder, 1953 ......................................... .......... 35 ......... 156 ......... 191 ........... 18<br />
Harms Erdkunde - Die Welt in allen Zonen, 1961 ............................................... .......... 67 ......... 389 ......... 456 ........... 14<br />
Schweizerischer Mittelschulatlas (1962) ...................................................... ........... 8 ......... 136 ......... 144 ............ 5<br />
Geographie (Thurgauisches Lehrmittel), 1963 .................................................. .......... 14 ......... 233 ......... 247 ............ 5<br />
Geographie (Widrig), 1967 ................................................................ .......... 94 ......... 682 ......... 776 ........... 12<br />
Seydlitz für Realschulen (1968) ............................................................. .......... 57 ......... 687 ......... 744 ............ 7<br />
Erdkunde (1968) ........................................................................ .......... 65 ......... 805 ......... 870 ............ 7<br />
Erdkunde: Oberstufe (1968-1969) ........................................................... .......... 10 ......... 310 ......... 320 ............ 3<br />
Länder und Völker der Erde (Ende 60er Jahre) ................................................. .......... 76 ......... 724 ......... 800 ............ 9<br />
Seydlitz für Gymnasien (1963- ca. 1971) ...................................................... .......... 25 ......... 790 ......... 815 ............ 3<br />
Fahr mit in die Welt (1971-1974) ........................................................... .......... 40 ......... 510 ......... 550 ............ 7<br />
Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (Aargau 1972-1977) ............................. .......... 19 ......... 365 ......... 384 ............ 4<br />
List Geographie (erstmals 1972-1976) ........................................................ .......... 32 ......... 384 ......... 416 ............ 7<br />
Neue Geographie (1974-1976) ............................................................. .......... 40 ......... 551 ......... 591 ............ 6<br />
Dreimal um die Erde (1977-1980, erstmals 1968-1972) .......................................... .......... 64 ......... 487 ......... 551 ........... 11<br />
Geographie thematisch (1977-1980) ......................................................... .......... 40 ......... 512 ......... 552 ............ 7<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 527
Lehrmittel, Buch Afrika Andere Total Anteil in %<br />
Silva Weltatlas .......................................................................... .......... 14 ......... 162<br />
176 5<br />
........ ............ 7<br />
Terra Weltkunde (1978) ................................................................... ........... 2 ......... 190 ......... 192 ............ 1<br />
Terra Geographie (1979) .................................................................. .......... 38 ......... 454 ......... 492 ............ 7<br />
Unser Planet (1979-1982) ................................................................. .......... 31 ......... 577 ......... 608 ............ 5<br />
Seydlitz: Mensch und Raum (1983-1984) ..................................................... .......... 27 ......... 405 ......... 432 ............ 6<br />
Geographie der Kontinente (Schülerband 1984) ................................................ .......... 59 ......... 261 ......... 320 ........... 18<br />
Terra Erdkunde für Realschulen (1980-1985) .................................................. .......... 14 ......... 310 ......... 324 ............ 4<br />
Mensch und Raum (1983-1986) ............................................................ .......... 21 ......... 284 ......... 305 ............ 6<br />
Seydlitz: Mensch und Raum (1987) .......................................................... .......... 14 ......... 338 ......... 352 ............ 3<br />
Seydlitz Erdkunde (1993-1995) ............................................................. .......... 50 ......... 700 ......... 750 ............ 6<br />
Seydlitz Geographie (1994-1996) ........................................................... 30 6<br />
......... ......... 658 ......... 688 ............ 4<br />
Heimat und Welt (1994-1996) .............................................................. .......... 30 ......... 506 ......... 536 ............ 5<br />
Geographie: Mensch und Raum (1994-1996) .................................................. 167 ......... ......... 497 ......... 513 ............ 3<br />
Diercke Erdkunde (1995-1997) ............................................................. .......... 45 ......... 719 ......... 764 ............ 5<br />
Gesamtzahlen für alle Geographielehrmittel ................................................. ........ 1'158 ...... 14'805 ....... 15'963 ............ 7<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
nur Seiten mit geographischem Inhalt berücksichtigt<br />
nur Seiten mit geographischem Inhalt berücksichtigt<br />
geschätzt, da das Thema auch in allgemeinen Tabellen usw. behandelt wird<br />
nur Seiten mit geographischem Inhalt berücksichtigt, aber ohne Tafeln<br />
exklusive 80 Seiten Register<br />
ohne Nordafrika<br />
ohne Nordafrika<br />
Sowohl die Gesamtseitenzahlen als auch der Anteil der Afrika gewidmeten Seiten schwanken von einem Lehr-<br />
mittel zum anderen äusserst stark. Ein allgemeiner Trend lässt sich nicht feststellen. Generell kann aber festge-<br />
halten werden, dass Afrika in den untersuchten Lehrmitteln im Bezug auf die Bevölkerungszahlen und die<br />
Fläche des Kontinentes gegenüber anderen Erdteilen unterrepräsentiert bleibt, im Bezug auf die wirtschaftliche<br />
Bedeutung auf lokaler und globaler Ebene überrepräsentiert ist.<br />
7.4.4 Qualität und Aktualität der gemachten Aussage<br />
Da die Länder Schwarzafrikas seit dem Beginn dieses Jahrhunderts eine äusserst dynamische Entwicklung<br />
durchliefen, aus einer anderen Sichtweise könnte sie auch als chaotisch bezeichnet werden, stellt sich die<br />
Frage nach der Aktualität der in den Lehrmitteln wiedergegebenen Informationen.<br />
Beschränkt sich ein Lehrmittel auf die Schilderung von Einzelschicksalen stellt sich das <strong>Pro</strong>blem weniger, als<br />
bei Lehrmitteln, die vor allem mit Hilfe von statistischen Daten einen Überblick zu vermitteln versuchen, denn<br />
diese Angaben können je nach Land ein Alter von bis zu 15 Jahren aufweisen, auch wenn sie aus offiziellen<br />
Quellen stammen und entsprechen, einmal abgesehen von der durch die <strong>Pro</strong>bleme bei der Erhebung verursach-<br />
ten Ungenauigkeiten, oft nicht mehr der tatsächlichen Lage des Landes überein.<br />
Obwohl die Lehrmittelautoren an diesem Zustand nichts ändern können, wäre es doch zumindest angebracht,<br />
die Schüler auf solche <strong>Pro</strong>bleme hinzuweisen, was aber nur selten der Fall ist. Hinzu kommt dann noch eine<br />
weitere "Alterung" der Angaben, durch die Zeitspanne, die zwischen der Erstellung und dem Erscheinen<br />
respektive der Verwendung des Lehrmittels im Unterricht verstreicht.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Weitere Aspekte<br />
Als weit gravierender muss die verbreitete Unsitte bewertet werden, historische Texte ohne entsprechenden<br />
Kommentar abzudrucken. Oft handelt es sich dabei um stark verkürzte Passagen, die im ungünstigsten Fall<br />
nicht einmal mehr die Absicht des ursprünglichen Autoren wiedergeben, zumeist aber ein veraltetes Bild einer<br />
bestimmten Gegend und Menschengruppe vermitteln. Diese Praxis steht auch im Widerspruch zu der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 528
Tatsache, das Aussagen von vor Ort lebenden Personen, insbesondere den Schwarzafrikanern selbst, äusserst<br />
selten Eingang in die Lehrmittel finden und dort immer noch die Ausnahme bilden.<br />
Bezogen auf die Richtigkeit der Aussagen kann den meisten Lehrmitteln, zumindest ab den siebziger Jahren in<br />
der Regel ein gutes Zeugnis abgelegt werden, bei einigen Einzelthemen entsprechen die Angaben aber, vor<br />
allem aufgrund einer zu starken Vereinfachung, der Simplifizierung komplexer Wirkungszusammenhänge,<br />
nicht den Tatsachen vor Ort. Leider sind davon besonders relativ aktuelle Themen betroffen, wie etwa die<br />
Unabhängigkeitsbestrebungen der schwarzafrikanischen Länder in den Schilderungen der Lehrmittel aus den<br />
sechziger Jahren, die Texte über die Dürren der Sahelzone aus den siebziger und achtziger Jahren.<br />
Als weiteren <strong>Pro</strong>blemkreis müssen die immer wieder vorkommenden Pauschalbezeichnungen betrachtet<br />
werden, die nicht zwischen einzelnen Völkern und Staaten Schwarzafrikas unterscheiden, sondern diese immer<br />
wieder in der Form eines Eintopfes präsentierten, der die ursprünglichen Fakten nicht einmal mehr erahnen<br />
lässt. Allzuoft werden auf wenige Völker oder vereinzelte Gegenden zutreffende Tatsachen auf den ganzen<br />
Kontinent verallgemeinert:<br />
Das "Lesebuch für die Oberklassen" aus den 30er Jahre verkündet beispielsweise, dass die Bewohner des<br />
Landesinnern mit einen Lendenschurz gekleidet seien, während in der Küstengegend bereits Baumwollkleider<br />
getragen würden, was bei weitem nicht für alle Gegenden Schwarzafrikas zutrifft. Das "Arbeits- und Lesebuch<br />
für Oberklassen von 1936 behautet, dass der "Neger" im Innern des Landes keine gewerbsmässige Ausübung<br />
von Handwerken kennt, und dem froh in den Tag lebenden "Neger" die Vorsorge für schlimme Zeiten fernlie-<br />
ge. Die "Geographie" von 1963 behauptet gar, dass die Schwarzafrikaner ihre Fetische mit Menschenblut oder<br />
Öl bestreichen würden und spricht ihnen eine Vorratshaltung ebenfalls ab.<br />
"Geographie Widrig" von 1967 behauptet, dass der "Neger" erstaunlich leicht fremde Sprachen lerne, die<br />
Trommelsprache eine besondere afrikanischen Verständigungsform sei, Menschenfresserei und ständigen<br />
Kriege zur ungewöhnlichen Entvölkerung weiter Gebiete Afrikas wesentlich beigetragen hätten, der "Neger"<br />
nicht gelernt habe für seine Zukunft zu sorgen, da im weitsichtiger Scharfblick und Ausdauer fremd seien, er<br />
keine Arbeitsteilung kenne, und die Bevölkerung zwar unterernährt aber trotzdem guten Mutes sei.<br />
"Seydlitz für Realschulen" von 1968 behauptet, der Trieb zur Arbeit sei beim Afrikaner ursprünglich nicht<br />
gross gewesen, nach "Erdkunde" von 1968 haben früher alte Häuptlingsfamilien Dörfer und Stämme<br />
beherrscht. "Länder und Völker der Erde" aus den 60er Jahren meint, dass durch die koloniale Tätigkeit der<br />
Europäer der Wohlstand der eingeborenen Bevölkerung gewachsen sei und die Neger nicht mehr der Willkür<br />
ihrer Häuptlinge und Zauberer ausgeliefert seien, sondern gerecht und menschlich behandelt würden. Nach<br />
"Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 ziehen die Städte den Bantu magisch an.<br />
Die "Geographie für die oberen Klassen der Volksschule" von 1972-1977 weiss, dass bei den Afrikanern jene<br />
Stämme das höchste Ansehen geniessen, welche die Unterweisung der Jugend mit besonderem Ernst verfolg-<br />
ten. In "Dreimal um die Erde von 1977-1980 heisst es, dass die Schwarzen sich von dem, was sie auf weissen<br />
Farmen sahen oder durch Arbeit lernten, nicht haben anregen lassen, ihre hergebrachte Lebens- und Wirt-<br />
schaftsweise aufzugeben. Der Schwarze sei zufrieden, wenn die Feldarbeit seiner Frau oder seiner Frauen mit<br />
der Hacke die Familie von einer Ernte bis zur anderen ernähre. Ausserdem bestellten in Afrika die Frauen die<br />
Felder, nur mit einer Hacke in der Hand.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Weitere Aspekte<br />
"Seydlitz: Mensch und Raum" von 1983-1984 sagt aus, dass die fast immer vorhandene Trennung von Acker-<br />
bauern und Viehhaltung ein bestimmendes Merkmal der traditionellen Landwirtschaft Schwarzafrikas seien.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 529
Nach "Mensch und Raum" von 1983-1986 kann man in Ghana das ganze Jahr über säen, pflanzen und ernten,<br />
die Bantus würden wie viele andere Stämme in Afrika, die Haltung von Grossvieh nicht kennen, sondern nur<br />
den Ackerbau. In den Lehrmitteln der neunziger Jahre finden sich noch solche Pauschalaussagen in "Seydlitz<br />
Erdkunde" von 1993-1995, die behauptet, das gesellschaftliche Ansehen der Eltern steige mit der Anzahl ihrer<br />
Kinder und in "Seydlitz Geographie" von 1994-1996, nach der Afrika der Schauplatz von Massakern, Aufstän-<br />
den, Stammes- und Bürgerkriegen ist.<br />
Selbst dort wo solche pauschalen Aussagen punktuell richtig sind und nicht auf einer rassistischen Grundhal-<br />
tung basieren, vermitteln sie ein Bild, das ebenso falsch ist wie die Vorstellung, alle Schweizer könnten eine<br />
Kuh melken, würden Jodeln und Schokoladen giessen oder Uhren fabrizieren. Damit tragen sie wenig zum<br />
Verständnis der schwarzafrikanischen Völker bei. Durch das Schaffen falscher Vorstellungen verhindern sie<br />
oft sogar eine unbefangene Betrachtung dieser, da die schnell gelernte einfache "Wahrheit" nur schwer zugun-<br />
sten eines differenzierteren Bildes aufgegeben wird.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Weitere Aspekte<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 530
7.5 Die diskriminierende Verwendung der Sprache<br />
Nicht nur die Art der Themenwahl, sondern auch die Sprache mit der ein bestimmter Sachverhalt beschrieben<br />
wird, tragen massgeblich dazu bei, ob eine sich bildende Vorstellung positiv oder negativ geprägt wird.<br />
Gerade im Bezug auf die schwarzafrikanischen Länder und ihre Einwohner hat sich im Laufe der Zeit ein<br />
Vokabular herausgebildet, dessen Ausprägung von vielen Schwarzafrikanern als beleidigend empfunden wird:<br />
"Das Selbstbewusstsein der Schwarzen hat dazu geführt, dass sie die Bezeichnung 'Neger' heute als Beleidi-<br />
gung ablehnen und 'Afrikaner' genannt werden wollen." (Länder und Völker, 60er Jahre) Auch Michler kriti-<br />
siert die Verwendung gewisser Begriffe wenn er schreibt, dass die in Lehrmitteln noch immer als "Eingebor-<br />
ene" bezeichnet würden: "Und die Schüler wissen auch, was damit gemeint ist, obwohl es unausgesprochen<br />
bleibt: 'Eingeborene' sind nicht-zivilisierte, im Vergleich zu uns noch unterentwickelte Menschen, während<br />
der Begriff 'Einheimischer' eine solche Wertung nicht enthält. Bei einer wirklich veränderten Geisteshaltung<br />
gegenüber Afrika müsste ein solches Vokabular längst verschwunden sein. Die schwarzen Bewohner unseres<br />
Nachbar-Kontinents sind weder 'Neger' noch 'Eingeborene', sondern ganz schlicht und einfach Afrikaner oder<br />
Einheimische!" (Michler 1991, S. 6) Ob die Verwendung solcher Begriffe tatsächlich die Geisteshaltung<br />
gegenüber den schwarzafrikanischen Menschen wiedergibt, sei dahingestellt. Allein die Höflichkeit würde es<br />
aber jedem Lehrbuchautoren gebieten, auf solche als beleidigend empfundene Ausdrücke zu verzichten. Neben<br />
der Verwendung der Wörter "Neger" und "Eingeborene", die durch Begriffe wie "Afrikaner" oder "Schwarz-<br />
afrikaner" bzw. "Einheimische" ersetzt werden können, gibt es weitere Ausdrücke, die der Anpassung bedür-<br />
fen. Anstelle der "Hottentotten" sollte von den "Khoikhoin" die Rede sein, "Pygmäen" ist ein Sammelbegriff<br />
für verschiedene Völker, die wenn möglich bei ihrem Namen genannt werden sollten, oft ist eine als "Stamm"<br />
bezeichnete Gruppe von Menschen in Wirklichkeit ein "Volk", beim "Brautpreis" handelt es sich vielleicht um<br />
eine "Mitgift", eine "Aussteuer" oder ein "Brautgeschenk", ein "Häuptling" ist vielleicht ein "König" oder ein<br />
"Dorfvorsteher" und der "Medizinmann" ein "Heiler" oder "Priester".<br />
Die Tabelle "Sprachgebrauch bietet eine Übersicht, über die in den einzelnen Geographielehrmitteln verwen-<br />
deten Bezeichnungen für die schwarzafrikanischen Menschen. Auf eine Auflistung der anderen Lehrmitteln<br />
wurde verzichtet, da sich dadurch keine neuen Erkenntnisse ergeben hätten. Folgende Abkürzungen werden in<br />
der Tabelle verwendet: Ne. = Neger, Sw. = Schwarzer, Af. = Afrikaner, Me. = Mensch, Eg. = Eingeborene,<br />
Eh. = Einheimische, Ew. = Einwohner, Bw. = Bewohner, Bv. = Bevölkerung, St. = Stamm, V. = Volk und H.<br />
= Häuptling.<br />
Tabelle: Sprachgebrauch<br />
Lehrmittel Ne. Sw. Af. Me. Eg. Eh. Ew. Bw. Bv. St. V. H. weitere Aussagen, Bezeichnungen<br />
Lesebuch Volksschulen, 1912 x leben in entsetzlicher Roheit<br />
Lesebuch Oberklassen, 30er Jahre x x x<br />
Leitfaden, 1934 x x die Stämme fristen ihr Leben auf einer niedrigen Stufe des<br />
Heidentums; Fetischismus; Buschmänner: Horden<br />
Arbeits- und Lesebuch, 1936 x<br />
Geographie, 1953 x x x<br />
Aussereuropäische Erdteile, 1953 x x Kinder: "dralle Negerlein"; Pygmäen: "Zwerge"<br />
Harms Erdkunde, 1961 x x x x die Yoruba: "Stamm mit über vier Millionen Menschen"<br />
Geographie, 1963 x x<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Die diskriminierende Verwendung der Sprache<br />
Geographie Widrig, 1967 x x die Unsauberkeit der Eingeborenen<br />
Seydlitz Realschulen, 1968 x x x x x<br />
Erdkunde, 1968 x x x Eingeborenenstaat<br />
Erdkunde: Oberstufe, 1968-1969 x x x x Animismus; Dämonismus; Fetischismus<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 531
Lehrmittel Ne. Sw. Af. Me. Eg. Eh. Ew. Bw. Bv. St. V. H. weitere Aussagen, Bezeichnungen<br />
Länder u. Völker, 60er Jahre x x x x x wo die Bantuneger mit den Europäern in Berührung kommen,<br />
haben sie sich oft zu geschickten und brauchbaren Arbeitern<br />
entwickelt; lustige Negerstämme; schwarze Springflut<br />
(Südafrika);<br />
Seydlitz Gymnasien, 1963-1971 x x x x Stammesbräuche, Zauberriten aber keine Traditionen; ein gewisses<br />
Stammesgefühl kann sich entwickeln, von einem staatlichen<br />
Bewusstsein kann nirgendwo die Rede sein; lebender Schaustükke<br />
eines Museums<br />
Fahr in die Welt, 1971-1974 x x<br />
List Geographie, 1972-1976 x x x x x Angehörige; Beschäftigte; Generationen<br />
Geographie Aargau, 1972-1977 x x x Stammesangehörige<br />
Neue Geographie, 1974-1976 x x x x x x x x x<br />
Dreimal um die Erde, 1977-1980 x x x x x x Mitarbeiter<br />
Geographie thematisch, 1977-1980 x x x x<br />
Terra Geographie, 1979 x x x<br />
Unser Planet, 1979-1982 x x x x x x<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1983-1984 x x x x x afrikanischer Nachbar<br />
Geographie der Kontinente, 1984 x x x x x x Stammesbewusstsein; Stammesgruppe; Stammesverbände<br />
Terra Erdkunde Realschulen, 1980-1985 x x x<br />
Mensch u. Raum, 1983-1986 x x x x x<br />
Seydlitz: Mensch u. Raum, 1987 x x x x x Betroffene; Stammesgewohnheiten<br />
Seydlitz Erdkunde, 1993-1995 x x x x x x x x<br />
Seydlitz Geographie, 1994-1996 x x x x x x x x<br />
Heimat und Welt, 1994-1996 x x<br />
Geographie: Mensch u. Raum, 1994-1996 x x<br />
Diercke Erdkunde, 1995-1997 x x x x x Stammesangehörige<br />
Die Tabelle zeigt eindeutig, dass der "Neger" und der "Eingeborene" auch in den Lehrmitteln der neunziger<br />
Jahre noch nicht unbedingt aus dem Vokabular verschwunden sind, demnach auch neuere Lehrmittel Begriffe<br />
enthalten, die erstens veraltet sind und zweitens auf gewisse ethnische Gruppen beleidigend wirken, obwohl<br />
genügend Alternativen bestehen. Ausserdem werden die Begriffe "Stamm" und "Häuptling" immer wieder<br />
falsch verwendet.<br />
Ergebnisse der Untersuchung: Die diskriminierende Verwendung der Sprache<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 532
7.6 Zusammenfassung<br />
In der Zusammenfassung des von den Lehrmitteln vermittelten Bildes sollen die im Teil "Vorwürfe an das von<br />
der Schule vermittelte Bild" erhobenen Anschuldigungen noch einmal pauschal im Hinblick auf ihre Berechti-<br />
gung betrachtet werden, im zweiten Teil folgt dann ein kurzer Überblick der Entwicklung des Bildes des<br />
Schwarzafrikaners im 20. Jahrhundert, der sozusagen die Fortsetzung der Zusammenfassung zum historischen<br />
Bild des schwarzafrikanischen Menschen auf der Seite 58 dieser Arbeit bildet.<br />
7.6.1 Betrachtung der Vorwürfe<br />
Die in "Vorwürfe an das Afrikabild der Lehrmittel" ab der Seite 60 dieser Arbeit erhobenen Vorwürfe werden<br />
hier noch einmal auf ihre Berechtigung hin überprüft und kurz kommentiert.<br />
1. Die Geschichte und die Gesellschaft Schwarzafrikas werden undifferenziert betrachtet:<br />
Viele der untersuchten Lehrmittel beschränken sich auf die Darstellung weniger Ausschnitte der<br />
schwarzafrikanischen Realität ohne auf diese Einschränkungen aufmerksam zu machen. Ausser-<br />
dem enthalten einige immer noch Pauschalbeurteilungen, die bei näherem Hinsehen nicht haltbar<br />
sind. Etliche Lehrmittel liefern aber auch Beschreibungen, die eine im Rahmen des Möglichen<br />
liegende Differenzierung aufweisen. Leider ist es keinesfalls so, dass die neueren Lehrmittel<br />
unter diesem Aspekt wesentlich besser abschneiden würden als die älteren, sondern der Grad der<br />
Differenzierung ist stark vom einzelnen Lehrmittel abhängig.<br />
2. Die Darstellung der Geschichte Schwarzafrikas setzt mit dem Auftreten der Europäer ein:<br />
Fragmente der voreuropäischen Geschichte Schwarzafrikas werden zwar in einigen Lehrmitteln<br />
erwähnt, eine vertiefte Auseinandersetzung findet aber nur in Ausnahmefällen statt, wogegen<br />
den Europäern ein in der Regel weit breiterer Raum zugestanden wird.<br />
3. Dem Afrikaner wird eine passive Rolle zugeschrieben:<br />
Dieser Vorwurf trifft generell zu, besonders in den Musiklehrmitteln werden die Schwarzafrika-<br />
ner vor allem in der Rolle des Sklaven geschildert. Bei den Geographielehrmitteln treten<br />
Ausnahmen im Zusammenhang mit Texten zur Unabhängigkeit der schwarzafrikanischen Staa-<br />
ten auf und bei der Schilderung von Bauern, denen eine gewisse Eigeninitiative zugestanden<br />
wird, in den neueren Lehrmitteln. Besonders die Texte zu den Hungerkatastrophen im Sahel<br />
zeichnen aber das Bild eines sein Schicksal hilflos erleidenden Wesens.<br />
4. Alte Texte werden in neuen Auflagen ohne Überarbeitung weiterverwendet:<br />
Dies lässt sich in vielen Lehrmitteln beobachten, dabei werden die betreffenden Texte zwar oft<br />
sprachlich und graphisch überarbeitet, die zugrundeliegenden Fakten werden aber meist nicht<br />
neu beurteilt und eine Überprüfung auf deren Richtigkeit findet nicht mehr statt, obwohl sich die<br />
zugrundeliegende Situation unterdessen massgeblich geändert haben kann. Die meisten Lehrmit-<br />
teln erwecken den Eindruck, sich auf wenige Themen zu konzentrieren, die als "Klassiker"<br />
bereits in älteren Schulbüchern vorgekaut wurden.<br />
5. Die Armut wird nur als klimatisch und geographisch bedingt dargestellt:<br />
Ergebnisse der Arbeit: Zusammenfassung<br />
Die meisten Lehrmittel machen in der Tat diese beiden Faktoren für die Armut der schwarzafri-<br />
kanischen Menschen verantwortlich, einige nennen aber auch die Zusammenhänge der<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 533
Weltwirtschaft oder die Kultur der Schwarzafrikaner als Grund. Politische Ursachen hingegen<br />
werden kaum erwähnt.<br />
6. Afrika wird als verschuldeter und von Diktatoren beherrschter Kontinent abgestempelt:<br />
Dieser Vorwurf trifft auf die untersuchten Lehrmittel nicht zu, da diese Politik und Verschuldung<br />
der schwarzafrikanischen Staaten nur in Ausnahmefällen ansprechen und dann kaum von Dikta-<br />
toren die Rede ist.<br />
7. Schwarzafrikanische Frauen werden nur in traditionellen Rollen und mit nacktem Oberkörper<br />
dargestellt:<br />
Auf die meisten Abbildungen in den Lehrmittel trifft der Vorwurf der Abbildung von "halb-<br />
nackten" Frauen nicht zu, aber alle, auch die neueren, stellen die schwarzafrikanische Frau,<br />
wenn sie überhaupt erwähnt wird, fast ausschliesslich in traditionellen Rollen dar. Einzige<br />
Ausnahme bildet die Erwähnung einiger schwarzafrikanischer Sängerinnen.<br />
8. Schwarzafrikanische Menschen sind einfältige Kreaturen:<br />
Mit wenigen Ausnahmen trifft dieser Vorwurf in der einen oder anderen Form für Lehrmittel bis<br />
in die achtziger Jahre zu, ist aber besonders für die älteren Lehrmittel zutreffend. Nur wenige<br />
Lehrmittel erwähnen Schwarzafrikaner mit höheren Positionen oder Bildung.<br />
9. Afrikaner sind Arbeitstiere, die sich stundenlang in der Sonne abrackern können:<br />
Immer wieder werden solche Vorstellungen geäussert, meist wenn die Arbeitsteilung zwischen<br />
Schwarzen und Weissen diskutiert wird.<br />
10. Schwarzafrikaner seien von Trieben gesteuerte Wesen:<br />
Dieser Vorwurf lässt sich anhand der Untersuchung der betrachteten Lehrmittel nur in Ausnah-<br />
mefällen nachvollziehen, tritt aber in den Lehrmitteln für den Musikunterricht und im Comic<br />
häufiger auf als in den Geographiebüchern.<br />
11. Der Schwarzafrikaner hängt an seinem Stamm:<br />
Diese Vorstellung wird verschiedentlich geäussert und als Begründung für politisches und sozia-<br />
les Verhalten herangeführt.<br />
12. Die Sprache wird in diskriminierender Weise eingesetzt:<br />
Obwohl dieser Vorwurf vor allem für ältere Lehrmittel zutrifft, sind auch die Schulbücher der<br />
neunziger Jahre nicht frei von politisch unkorrekten Äusserungen.<br />
13. Afrika ist ein wundervoller Kontinent:<br />
Die Vorstellung wird nur in einigen wenigen Lehrmitteln zumeist im Zusammenhang mit dem<br />
Tourismus geäussert, in den meisten dominiert das Bild eines von Seuchen und Hunger geplag-<br />
ten Kontinents, der kein angenehmer Aufenthaltsort für einen Europäer bildet.<br />
14. Der schwarzafrikanische Mensch beschäftigt sich mehr mit Zeremonien als dem Broterwerb:<br />
Obwohl diese Vorstellung auch in einigen Geographielehrmitteln geäussert wird, kommt sie<br />
doch in den Musiklehrmitteln besonders häufig vor.<br />
15. Die Musik Afrikas werde auf die Trommel reduziert:<br />
Dieser Vorwurf trifft vor allem auf die Geographielehrmittel zu, falls sie die die Musik Schwarz-<br />
afrikas überhaupt ansprechen, die meisten Musiklehrmittel zeichnen ein weit differenzierteres<br />
Bild, während im Comic dieses Klischee häufig abgebildet wird.<br />
Ergebnisse der Arbeit: Zusammenfassung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 534
16. Der Westen beansprucht Errungenschaften Schwarzafrikas für sich:<br />
Besonders in den älteren Lehrmitteln werden Errungenschaften der schwarzafrikanischen Bevöl-<br />
kerung auf die Zuwanderung von hellhäutigen Stämmen zurückgeführt, d. h. den Schwarzafrika-<br />
ner wird eine eigene Entwicklung abgesprochen. In den neueren Lehrmitteln ist dies jedoch nicht<br />
mehr der Fall.<br />
17. Afrika ist nicht in der Lage, sich ohne fremde Hilfe zu entwickeln:<br />
Dieser Ansicht sind die meisten Geographielehrmitteln. Ohne die Europäer, so die vorherrschen-<br />
de Meinung, wäre es dem Schwarzafrikaner nicht möglich, einen menschenwürdigen Lebens-<br />
standard zu erreichen.<br />
Der kurze Überblick zeigt, dass die meisten der in "Vorwürfe an das Afrikabild der Lehrmittel" erhobenen<br />
Anschuldigungen an das Schwarzafrikabild in den Schulbüchern zumindest auf einen Teil der Lehrmittel<br />
zutreffen, einige haben bis zu den neuesten Lehrmitteln ihre Berechtigung nicht verloren. Für die Lehrkraft,<br />
die diese Lehrmittel verwendet, ist es deshalb äusserst wichtig, eine Sensibilität für solche Fragen zu entwik-<br />
keln, denn sie kann sich keinesfalls auf die Unbedenklichkeit der Lehrmittel hinsichtlich dieser <strong>Pro</strong>bleme<br />
verlassen.<br />
7.6.2 Die Entwicklung des Bildes vom schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert<br />
In diesem zweiten Teil der Zusammenfassung werden vereinzelte Ausnahmefälle nicht mehr berücksichtigt<br />
sondern in vereinfachter Form die breitere Entwicklung nachgezeichnet, die sich deutlich in mehrere Zeitab-<br />
schnitte unterteilen lässt.<br />
Bis hinein in die sechziger Jahre wird der Schwarzafrikaner vorwiegend als unzivilisierter, meist auf niedriger<br />
Kulturstufe stehender Wilder gezeichnet, der seiner eigenen Roheit nur dank der Erziehung und Zuwendung<br />
des Europäers entfliehen kann. Allfällige Wünsche in Richtung Unabhängigkeit werden als unverschämt<br />
betrachtet, da der Schwarzafrikaner nicht in der Lage sei, die von den Europäern geschaffene Zivilisation aus<br />
eigener Kraft zu erhalten. Ist der Schwarzafrikaner allerdings erst einmal in den Kontakt mit den von ihm als<br />
gottgleich angesehenen Europäern getreten, kann er sich zu einem durchaus brauchbaren Arbeiter entwickeln,<br />
dessen geistige Entwicklung aber eine gewisse Grenze nicht überschreiten kann.<br />
Ende der sechziger Jahre ändert sich die Bewertung des Schwarzafrikaners fundamental, bedingt durch die<br />
Erreichung der Unabhängigkeit vieler schwarzafrikanischer Staaten. Der schwarzafrikanische Mensch wird<br />
nicht mehr als Kind gesehen, den es an der Hand in die Annehmlichkeiten der europäischen Zivilisation zu<br />
führen gilt, sondern er wird zum Partner, dem man auf seinem Weg Hilfe von aussen zukommen lässt, im<br />
Gegenzug zu seiner weiteren Bereitschaft, Europa mit Rohstoffen zu versorgen. Plötzlich wird entdeckt, dass<br />
der Schwarzafrikaner zu einem hohen Grade bildungsfähig ist, auch wenn ihm ein staatliches Bewusstsein<br />
noch fehlt.<br />
Dieses Bild wird im Zeitraum von der Mitte der siebziger bis Mitte der achtziger Jahre angesichts der Dürre-<br />
und Hungerkatastrophen, des Biafrakrieges und des wirtschaftlichen Niedergangs der meisten schwarzafrikani-<br />
schen Staaten empfindlich gestört, und weicht der Vorstellung eines zerlumpten, zu einem Skelett reduzierten<br />
Wesen, welches ohne Hilfe von aussen nicht einmal in der Lage ist, sich und seine zahlreichen Kinder selbst<br />
zu ernähren. Überhaupt wird seine Lage als hoffnungslos beurteilt, besonders da die ihm zukommenden Hilfe-<br />
massnahmen nicht zu greifen scheinen.<br />
Ergebnisse der Arbeit: Zusammenfassung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 535
Erst Gegen Ende der achtziger Jahre wird dieses Bild durch die Vorstellung des hart um das Überleben kämp-<br />
fenden Schwarzafrikaners, oder besser Schwarzafrikanerin, ersetzt, die mit gebeugten Rücken, auf dem sie<br />
eines ihrer zahlreichen Kinder trägt, die Hacke schwingend, ganz Schwarzafrika ernährt. Der schwarzafrikani-<br />
sche Mann verkommt zu einem wertlosen Menschen, der seine Zeit mit Geschwätz unter Freunden vertreibt.<br />
Das Bild einer neuen Hoffnung gründet sich einerseits auf einer positiven Entwicklung in der Landwirtschaft,<br />
andererseits auf einer gewissen Ermüdung der Bereitschaft zur weiteren Entwicklungshilfe im alten Stil, auf<br />
einem Kontinent der als von Bürgerkriegen, Seuchen und einem zu raschen Bevölkerungswachstum bedroht<br />
gilt.<br />
Die Entwicklung des Bildes vom schwarzafrikanischen Menschen bleibt also, wie schon früher, von Eigenin-<br />
teressen der Europäer und ihrer eigenen Weltsicht abhängig. Die Entwicklung in Schwarzafrika dagegen bleibt<br />
allenfalls Auslöser für eine Veränderungen der von aussen herangetragenen Vorstellungen. Damit weicht die<br />
von den schwarzafrikanischen Menschen erlebte Wirklichkeit noch immer stark von den in den Lehrmitteln<br />
Europas geprägten Vorstellungen und Bildern ab. Dadurch, und auch durch das oft falsche Bild der Schwarzaf-<br />
rikaner von der europäischen Lebenswirklichkeit, werden Missverständnisse bei einer direkten Begegnung<br />
gefördert, die im besten Fall ein Verstehen erschweren, möglicherweise aber auch zu fatalen Fehlentscheidun-<br />
gen im Umgang miteinander führen können. Um diese Kluft zu überwinden müssen sich beide Parteien von<br />
ihren Vorstellungen befreien und sich ohne Bildnis des anderen, mit offenem Geiste und einer Grundhaltung<br />
der Toleranz gegenübertreten.<br />
Ergebnisse der Arbeit: Zusammenfassung<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 536
8. Anhang<br />
Der Anhang enthält neben dem Quellenverzeichnis, welches sämtliche für die Arbeit benutzen Quellen<br />
vermerkt, und dem Glossar, das einige der in der Arbeit verwendeten Ausdrücke definiert oder erklärt, zahl-<br />
reiche Tabellen, vor allem zur wirtschaftlichen Situation der Länder Schwarzafrikas, einige Karten, die einen<br />
Teil der in den Tabellen aufgeführten Daten visualisieren, sowie Texte zur Alltagssituation von schwarzafrika-<br />
nischen Menschen, die eine Einschätzung einiger in den Besprechungen der einzelnen Lehrmittel gemachten<br />
Aussagen ermöglichen sollen, aber vielleicht auch als Anregung und Hintergrundinformation für einen verbes-<br />
serten Geographieunterricht dienen können.<br />
8.1 Tabellen<br />
Die abgedruckten Tabellen sollen dazu dienen, die in den Lehrmitteln gemachten Angaben zu überprüfen und<br />
sollen es ermöglichen, die Bedeutung des jeweiligen Themas für ein Land im historischen Kontext einschätzen<br />
zu können.<br />
Für alle Tabellen gilt: Fehlen Angaben in der Tabelle, waren diese in den benutzten Quellen nicht vorhanden.<br />
Falls ein Wert mit Null beziffert wird, ist dieser entweder kleiner als die in der Tabelle benutze kleinste<br />
Messeinheit oder es lagen keine Daten vor.<br />
8.1.1 Grunddaten zu den afrikanischen Staaten<br />
Die Tabelle zu den Grunddaten gibt Auskunft über das <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen und das Bruttosozialprodukt<br />
(BSP), die Zahl der Einwohner, die Fläche der einzelnen Staaten und die Besiedlungsdichte. Die Zahlen zur<br />
Bevölkerung und den <strong>Pro</strong>-Kopf-Angaben und die daraus errechneten Grössen sollten mit Vorsicht betrachtet<br />
werden, da es sich dabei meist um Schätzungen handelt. Genaue Angaben sind für afrikanische Länder oft<br />
nicht erhältlich. Die Daten lassen aber zumindest eine grobe Einschätzung der genannten Grössen zu.<br />
Tabelle: Grunddaten zu den Ländern<br />
Angaben nach Fischer Weltalmanach '98 und CIA 1996<br />
Land BSP pro Kopf BSP<br />
in US$<br />
1<br />
Einwohner Fläche<br />
in Mrd. US$ in 1000<br />
in qkm<br />
Anhang: Tabellen<br />
Einwohner 2<br />
pro qkm<br />
Mosambik 80 1.29 16'168 799'000 20.24<br />
Westsahara 222 226'000 0.98<br />
São Tome und Prin. 1'000 0.14 144 960 150<br />
Äthiopien 100 5.64 56'404 1'133'000 49.78<br />
Dem. Rep. Kongo 120 5.26 43'848 2'345'000 18.7<br />
Tansania 120 3.56 29'646 945'000 31.37<br />
Burundi 160 1 6'264 28'000 223.71<br />
Malawi 170 1.66 9'757 118'000 82.69<br />
Ruanda 180 1.15 6'400 26'000 246.15<br />
Sierra Leone 180 0.76 4'195 72'000 58.26<br />
Tschad 180 1.16 6'448 1'284'000 5.02<br />
Niger 220 1.99 9'028 1'267'000 7.13<br />
Burkina Faso 230 2.39 10'377 274'000 37.87<br />
Madagaskar 230 3.14 13'651 587'000 23.26<br />
Uganda 240 4.6 19'168 241'000 79.54<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 537
Land BSP pro Kopf BSP<br />
in US$<br />
1<br />
Einwohner Fläche<br />
in Mrd. US$ in 1000<br />
in qkm<br />
Anhang: Tabellen<br />
Einwohner 2<br />
pro qkm<br />
Guinea-Bissau 250 0.27 1'070 36'000 29.72<br />
Mali 250 2.45 9'788 1'240'000 7.89<br />
Nigeria 260 27.02 103'912 924'000 112.46<br />
Kenia 280 7.47 26'688 583'000 45.78<br />
Togo 310 1.27 4'085 57'000 71.67<br />
Gambia 320 0.36 1'113 11'000 101.18<br />
Zentralafr. Rep. 340 1.11 3'275 623'000 5.26<br />
Benin 370 2.03 5'475 113'000 48.45<br />
Äquatorialguinea 380 0.15 400 28'000 14.29<br />
Ghana 390 6.66 17'075 239'000 71.44<br />
Sambia 400 3.59 8'978 753'000 11.92<br />
Angola 410 4.42 10'772 1'247'000 8.64<br />
Mauretanien 460 1.05 2'274 1'031'000 2.21<br />
Komoren 470 0.23 499 2'000 249.5<br />
Somalia 500 4.75 9'491 638'000 14.88<br />
Simbabwe 540 5.95 11'011 391'000 28.16<br />
Guinea 550 3.63 6'591 246'000 26.79<br />
Eritrea 570 2.04 3'574 121'000 29.54<br />
Senegal 600 5.08 8'468 197'000 42.98<br />
Kamerun 650 8.64 13'288 475'000 27.97<br />
Elfenbeinküste 660 9.23 13'978 322'000 43.41<br />
Kongo 680 1.79 2'633 342'000 7.7<br />
Lesotho 770 1.52 1'980 30'000 66<br />
Liberia 770 2.1 2'733 98'000 27.89<br />
Ägypten 790 45.66 57'800 998'000 57.92<br />
Sudan 800 21.37 26'707 2'506'000 10.66<br />
Kap Verde 960 0.36 380 4'000 95<br />
Marokko 1'110 29.48 26'562 459'000 57.87<br />
Swasiland 1'170 1.05 900 17'000 52.94<br />
Dschibuti 1'200 0.76 634 23'000 27.57<br />
Algerien 1'600 44.73 27'959 2'382'000 11.74<br />
Tunesien 1'820 16.36 8'987 164'000 54.8<br />
Namibia 2'000 3.09 1'545 824'000 1.88<br />
Botswana 3'020 4.38 1'450 582'000 2.49<br />
Südafrika 3'160 131 41'457 1'221'000 33.95<br />
Mauritius 3'380 3.81 1'128 2'000 564<br />
Gabun 3'490 3.76 1'077 268'000 4.02<br />
Libyen 6'510 35.2 5'407 1'776'000 3.04<br />
Seychellen 6'620 0.49 74 500 148<br />
Afrika 681.48 479.04 702'938 30'319'460 23.18<br />
Deutschland 27'510 2'252.22 81'869 357'000 229.32<br />
Schweiz 40'630 285.99 7'039 41'000 171.68<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 538
Land BSP pro Kopf BSP<br />
in US$<br />
1<br />
Einwohner Fläche<br />
in Mrd. US$ in 1000<br />
1 berechnet aus den Angaben zur Bevölkerung und dem <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen<br />
2 berechnet aus den Angaben zur Bevölkerung und der Fläche<br />
8.1.2 UNO-Daten zur Bevölkerung und Wirtschaft<br />
in qkm<br />
Einwohner 2<br />
pro qkm<br />
Die Tabelle gibt einige der im UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder der Welt von 1998 angegebenen Daten<br />
wieder. Diese geben Auskunft über die Bevölkerungszahl - hier treten auffällige Abweichungen gegenüber<br />
anderen Quellen auf -, den Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu frischem Trinkwasser, die Alphabetisie-<br />
rungsrate für Erwachsene, das BSP, den Anteil der Bereiche Gesundheit, Bildungswesen und Verteidigung am<br />
Staatshaushalt, und den zu leistenden Schuldendienst im Vergleich zu den Exporten.<br />
Tabelle: UNO-Daten zur Bevölkerung und Wirtschaft<br />
(Quelle UNICEF-Bericht "The State of the World's Children 1998" S. 91-127)<br />
Land Populat.<br />
in 1000<br />
für 1996<br />
Zugang zu Trinkwasser<br />
in % der Bevölkerung für<br />
1990-1996<br />
Personen über 15, die lesen und schreiben<br />
können (in % der Gesamtbevölkerung)<br />
BSP<br />
1995<br />
Anteil einzelner Bereiche an den<br />
Gesamtausgaben des Staates in<br />
% für 1990-1996<br />
Schuldendienst in %<br />
der Exporte<br />
Total Stadt Land 1980 m 1980 w 1995 m 1995 w Gesund. Schule Verteid. 1970 1995<br />
Ägypten 63'271 87 97 79 54 26 64 39 790 2 12 9 26 21<br />
Algerien 28'784 78 91 64 55 24 74 49 1'600 3 37<br />
Angola 11'185 32 69 15 16 7 56 29 410 6 15 34 15<br />
Äquatorialguinea 410 95 88 100 77 45 90 68 380 1<br />
Äthiopien 58'243 25 91 19 32 14 46 25 100 5 14 20 11 20<br />
Benin 5'563 50 41 53 28 10 49 26 370 6 31 17 2 13<br />
Botswana 1'484 93 100 91 70 43 81 60 3'020 5 21 12 1 4<br />
Burkina Faso 10'780 42 66 37 19 4 30 9 230 7 17 14 4 17<br />
Burundi 6'221 52 92 49 37 12 49 23 160 4 16 16 4 22<br />
Côte d'Ivoire 14'015 42 56 32 34 14 50 30 660 4 21 4 7 18<br />
Dem. Rep. Kongo 46'812 42 89 26 75 45 87 120 1 1 4 5 6<br />
Djibouti 617 90 77 100 45 18 60 33 780 7<br />
Eritrea 3'280 22 60 8 100<br />
Gabun 1'106 68 90 50 54 28 74 53 3'490 6 13<br />
Gambia 1'141 48 67 37 13 53 25 320 7 12 4 1 11<br />
Ghana 17'832 65 88 52 59 31 76 54 390 7 22 5 5 15<br />
Guinea 7'518 46 69 36 34 11 50 22 550 3 11 29 13<br />
Guinea-Bissau 1'091 59 32 67 53 26 68 43 250 1 3 4 30<br />
Kamerun 13'560 50 57 43 59 30 75 52 650 5 18 9 3 17<br />
Kap Verde 396 51 70 34 64 38 81 64 960<br />
Kenia 27'799 53 67 49 72 44 86 70 280 5 19 6 6 23<br />
Komoren 632 53 76 45 56 40 64 50 470 2<br />
Kongo 2'668 34 53 7 65 40 83 67 680 11 11<br />
Lesotho 2'078 62 91 57 71 45 81 62 770 13 21 6 1 17<br />
Liberia 2'245 46 79 13 38 11 54 22 490 5 11 9 8<br />
Libyen 5'593 97 97 97 73 31 88 63 5'540<br />
Madagaskar 15'353 34 68 21 56 43 60 32 230 6 11 5 32 7<br />
Malawi 9'845 37 80 32 64 28 72 42 170 7 12 5 8 22<br />
Mali 11'134 66 87 55 20 9 39 23 250 2 9 8 1 7<br />
Marokko 27'021 65 98 34 42 16 57 31 1'110 3 18 14 8 39<br />
Mauretanien 2'333 74 88 59 41 19 50 26 460 4 23 3 19<br />
Mauritius 1'129 98 95 100 82 67 87 79 3'380 9 17 2 3 5<br />
Mosambik 17'796 63 44 12 58 23 80 5 10 35 58<br />
Namibia 1'575 57 87 42 78 74 2'000 10 22 7<br />
Anhang: Tabellen<br />
Niger 9'465 48 76 44 14 3 21 7 220 4 9<br />
Nigeria 115'020 50 80 39 47 23 67 47 260 1 3 3 4 22<br />
Ruanda 5'397 79 55 30 70 52 180 5 26 1 28<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 539
Land Populat.<br />
in 1000<br />
für 1996<br />
Zugang zu Trinkwasser<br />
in % der Bevölkerung für<br />
1990-1996<br />
Personen über 15, die lesen und schreiben<br />
können (in % der Gesamtbevölkerung)<br />
BSP<br />
1995<br />
Anteil einzelner Bereiche an den<br />
Gesamtausgaben des Staates in<br />
% für 1990-1996<br />
Schuldendienst in %<br />
der Exporte<br />
Total Stadt Land 1980 m 1980 w 1995 m 1995 w Gesund. Schule Verteid. 1970 1995<br />
Sambia 8'275 27 50 17 65 43 86 71 400 14 15 6 24<br />
Sao Tome u. Princ. 135 82 73 42 350 17<br />
Senegal 8'532 63 90 44 31 12 43 23 600 4 12<br />
Seychellen 74 83 86 6'620 8 12 4 7<br />
Sierra Leone 4'297 34 58 21 30 9 45 18 180 10 13 10 11 27<br />
Simbabwe 11'439 79 99 69 83 68 90 80 540 8 24 17 2 20<br />
Somalia 9'822 31 46 28 8 1 36 14 110 1 2 38 2 7<br />
Südafrika 42'393 99 99 53 77 75 82 82 3'160 5<br />
Sudan 27'291 50 66 45 43 17 58 35 310 11 0<br />
Swasiland 881 60 89 46 64 57 78 76 1'170 2<br />
Tansania 30'799 38 73 29 66 34 79 57 120 6 8 16 1 16<br />
Togo 4'201 55 82 41 49 18 67 37 310 5 20 11 3 5<br />
Tschad 6'515 24 48 17 47 19 62 35 180 8 8 4 7<br />
Tunesien 9'156 98 100 95 61 32 79 55 1'820 6 17 6 18 17<br />
Uganda 20'256 46 77 41 62 32 74 50 240 2 15 26 3 18<br />
Ztrlafr. Republik 3'344 38 55 21 41 19 69 52 340 5 3<br />
8.1.3 Unabhängigkeit und ethnische Differenzierung<br />
Die Tabelle gibt an, wann die einzelnen afrikanischen Länder ihre Unabhängigkeit erreichten und nennt die<br />
wichtigsten Volksgruppen der jeweiligen Länder, und den Anteil der grössten Gruppe an der Gesamtbevölke-<br />
rung, sowie die Gruppen welche über 10% der Gesamtbevölkerung ausmachen (diese sind sofern Angaben<br />
vorhanden waren, durch Fettdruck hervorgehoben).<br />
Tabelle: Unabhängigkeitsjahr und ethnische Differenzierung<br />
Angaben nach Fischer Weltalmanach 98, CIA 1996, Infopedia 1996, Grolier 1993<br />
Land grösste Volksgruppe<br />
in %<br />
Volksgruppen<br />
mit > 10%<br />
Wichtigste Volksgruppen Unabhängig<br />
Ägypten 99 1 Ägypter, Beduinen, Berber 1922<br />
Algerien 83 2 Araber, Berber 1962<br />
Angola 37 3 Ovimbundu, Mbundu, Kongo 1975<br />
Äquatorialguinea 80 2 Fang, Bubi 1968<br />
Äthiopien 40 2 Omoro, Anhare und Tigre, Sidamo,<br />
Shankella, Somali, Afar,<br />
Gurage<br />
Benin 39 3 Fon, Yoruba, Adja, Bariba, Houeda,<br />
Peulh, Djougou, Dendi<br />
Botswana 95 1 Tswana, Kalanga, Basarwa,<br />
Kgalagadi<br />
Burkina Faso 24 1 Mossi, Gurunsi, Senufo, Lobi, Bobo,<br />
Mande, Fulani<br />
v. Chr. G<br />
Burundi 85 2 Hutu, Tutsi, Twa 1962<br />
Dem. Rep. Kongo 18 4 >200: Mongo, Luba, Kongo,<br />
Mangbetu-Azande<br />
Dschibuti 60 2 Somali, Afar, Europäer, Araber 1977<br />
Elfenbeinküste 23 4 ca. 60: Baule, Agni, Kru, Malinke,<br />
Bambara, Dioula, Senufo, Dan,<br />
Guro, Gagou, Lobi<br />
Anhang: Tabellen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 540<br />
1960<br />
1966<br />
1'960<br />
1960<br />
1960
Land grösste Volksgruppe<br />
in %<br />
Volksgruppen<br />
mit > 10%<br />
Wichtigste Volksgruppen Unabhängig<br />
Eritrea 50 2 Tigray, Tigre und Kunama, Afar,<br />
Saho<br />
Gabun 30 4 Fang, Eshira, M'Bete, Kota,<br />
Omyene<br />
Gambia 42 4 Mandingo, Fulani, Wolof, Diola,<br />
Sarakole<br />
Ghana 44 3 Akan, Mossi-Dagomba, Ewe,<br />
Ga-Adangme, Guan, Gurma, Grusi<br />
Guinea 40 3 Fulani, Malinke, Sussu 1958<br />
Guinea-Bissau 27 5 Balante, Fulani, Malinke, Manjaca,<br />
Pepel, Beafada, Mancanha,<br />
Bijago<br />
Kamerun 31 4 ca. 200: Fang, Bamileke, Fulani,<br />
Pahouin<br />
Kap Verde 71 2 Kreolen, Afrikaner 1975<br />
Kenia 22 5 Kikuyu, Luo, Luhya, Kalenjiin,<br />
Kamba, Kisii, Meru<br />
Komoren 97 1 Mischbevölkerung 1975<br />
Kongo 48 4 Kongo, Sangha, M'Bochi, Teke 1960<br />
Lesotho 79 2 Sotho, Nguni, San 1966<br />
Liberia 20 2 Kpelle, Gio, Mani, Loma, Ghandi,<br />
Mende, Bassa, Kru, Grebo, Krahn,<br />
Dei, Gola, Kissi, Vai<br />
Libyen 97 1 Berber und Araber 1951<br />
Madagaskar 99 1 Madegassen (Merina, Betsileo,<br />
Côtiers, Betsimisaraka, Tsimihety,<br />
Antausaka, Sakalave<br />
Malawi 90 1 Cheva, Maravi, Nyanja, Tumbuko,<br />
Yao, Lomwe, Sena, Tonga, Ngoni,<br />
Ngonde<br />
Mali 50 4 Mande (Bambara, Malinke, Sarakole),<br />
Peul, Voltaic, Tuareg und<br />
Mauren, Songhai<br />
Marokko 36 3 Berber, Araber, arabisierte<br />
Berber<br />
Mauretanien 40 3 Mauren, Fulani, Wolof 1960<br />
Mauritius 68 2 Indo-Mauritier, Kreolen, Chinesen 1968<br />
Mosambik 47 4 Makua-Lomwe, Yao, Makone,<br />
Chewe, Nyanja, Tsonga, Chopi,<br />
Shona<br />
Namibia 50 1 Ovambo, Herero, Damara, San,<br />
Caprivian, Tswana, Kavango, Afrikaander,<br />
Europäer<br />
Niger 56 2 Haussa, Dyerma, Fulani, Tuareg,<br />
Kanuri<br />
Nigeria 21 4 > 250: Hausa, Fulani, Yoruba, Ibo 1960<br />
Ruanda 90 1 Hutu, Tutsi, Twa 1962<br />
Anhang: Tabellen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 541<br />
1993<br />
1960<br />
1965<br />
1957<br />
1974<br />
1961<br />
1963<br />
1822<br />
1960<br />
1964<br />
1960<br />
1956<br />
1975<br />
1990<br />
1960
Land grösste Volksgruppe<br />
in %<br />
Volksgruppen<br />
mit > 10%<br />
Wichtigste Volksgruppen Unabhängig<br />
Sambia 36 4 73: Bemba, Nyana (Chewa, Nsenga,<br />
Ngoni), Tonga (Lenje, Soli, Ila),<br />
Nordwest-Gruppe (Luvale, Lunda,<br />
Kaonde, Barotse (Lotsi, Nkoya)<br />
São Tome und Principe Mestizen, Angolaren, Forros, Servizier,<br />
Europäer<br />
Senegal 36 3 Wolof, Fulani, Serer, Tukulor,<br />
Dioula, Mandingo<br />
Seychellen 90 1 Kreolen, Inder Madegassen, Chinesen,<br />
Europäer<br />
Sierra Leone 35 2 Mende, Temne, Limba, Kono 1961<br />
Simbabwe 22 5 Shona (Karanga, Korekore, Zezeru,<br />
Manyiku), Ndebele<br />
Somalia 85 1 Somalier, Araber 1960<br />
Südafrika 75 2 Schwarzafrikaner (Zulu, Xhosa,<br />
Sotho, Tswana, Tsonga, Swasi),<br />
Europäer, Mischlinge, Inder<br />
Sudan 49 2 Araber, Dinka, Nubier, Beja, Nuer 1956<br />
Swasiland 84 1 Swasi 1968<br />
Tansania 2 0 > 120 1961<br />
Togo 46 4 Adja-Ewe, Kabyè-Tem, Gruma 1960<br />
Tschad 30 ca. 200: Sara, Nganbaye, Mbaye,<br />
Goulaye, Moundang, Moussei,<br />
Massa, Toubou, Hadjerai, Fulbe,<br />
Kotoko, Kanembou, Baguirmi,<br />
Boulala, Zaghawa, Maba<br />
Tunesien 98 1 Araber und Berber 1956<br />
Uganda 17 2 Ganda, Karamokong, Teso, Acholi,<br />
Lango, Lugbara, Madi, Lendu<br />
1964<br />
1975<br />
1960<br />
1976<br />
1980 (1960 )<br />
Westsahara Berber und Araber besetztes G.<br />
Zentralafr. Rep. 34 4 Baya, Banda, Mandjia, Sara,<br />
Mboum, M'Baka<br />
Deutschland 95 1 Deutsche, Türken 1991 (1871)<br />
Schweiz 74 2 deutschspr., frzspr., italspr.<br />
Schweizer,<br />
8.1.4 Religionen in Afrika<br />
Anhang: Tabellen<br />
1931<br />
1960<br />
1962<br />
1960<br />
1848 (1291)<br />
Die Tabelle zu den Religionen Afrikas gibt Auskunft über den Anteil der Anhänger einer bestimmten Religion<br />
an der Gesamtbevölkerung. Die Daten können nur als grobe Schätzwerte dienen, da die Religionszugehörig-<br />
keit nicht immer eindeutig festgelegt werden kann. Insbesondere die traditionellen Glaubensysteme werden oft<br />
neben Islam und Christentum weiter gepflegt, teilweise existieren auch Mischreligionen, die nicht eindeutig<br />
einer Gruppe zugeordnet werden können, diese wurden zu der Gruppe "keine Angaben" hinzugefügt. Die Spal-<br />
te "afr. Rel." (= Afrikanische Religionen) umfasst eine Vielzahl von unterschiedlichen traditionellen Glaubens-<br />
systemen auf dem afrikanischen Kontinent. Die Bevölkerungszahlen wurden noch einmal angegeben, um die<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 542
absolute Zahl der Anhänger einer Religion einschätzen zu können, ausserdem sollen die Daten die Unterschie-<br />
de in den Angaben zwischen verschiedenen Quellen aufzeigen.<br />
Tabelle: Religionen<br />
Angaben nach CIA 1996, ergänzt durch Weltatlas 1997 in % der Gesamtbevölkerung<br />
Anhang: Tabellen<br />
Land Christen Moslem afr. Rel. Hindu k. A. Population 1<br />
Ägypten ............. ........ 6 ....... 94 ........ 0 ........ 0 ........ 0 .... 63'575<br />
Algerien ............. ........ 1 ....... 99 ........ 0 ........ 0 ........ 0 .... 29'183<br />
Angola .............. ....... 53 ........ 0 ....... 47 ........ 0 ........ 0 .... 10'342<br />
Äquatorialguinea ...... ........ 0 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ...... 100 ...... 431<br />
Äthiopien ............ ....... 36 ....... 47 ....... 12 ........ 0 ........ 5 .... 57'171<br />
Benin ............... ....... 15 ....... 15 ....... 70 ........ 0 ........ 0 ..... 5'709<br />
Botswana ............ ....... 50 ........ 0 ....... 50 ........ 0 ........ 0 ..... 1'477<br />
Burkina Faso ......... ....... 10 ....... 40 ....... 50 ........ 0 ........ 0 .... 10'623<br />
Burundi ............. ....... 67 ........ 1 ....... 32 ........ 0 ........ 0 ..... 5'943<br />
Côte d'Ivoire ......... ....... 12 ....... 60 ....... 25 ........ 0 ........ 3 .... 14'762<br />
Dem. Rep. Kongo ...... ....... 70 ....... 10 ....... 10 ........ 0 ....... 10 .... 46'498<br />
Djibouti ............. ........ 6 ....... 94 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ...... 427<br />
Eritrea .............. ........ 0 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ...... 100 ..... 3'427<br />
Gabun .............. ....... 65 ........ 1 ....... 34 ........ 0 ........ 0 ..... 1'172<br />
Gambia ............. ........ 9 ....... 90 ........ 1 ........ 0 ........ 0 ..... 1'204<br />
Ghana ............... ....... 30 ....... 24 ....... 38 ........ 0 ........ 8 .... 17'698<br />
Guinea .............. ........ 8 ....... 85 ........ 7 ........ 0 ........ 0 ..... 7'411<br />
Guinea-Bissau ........ ........ 5 ....... 30 ....... 65 ........ 0 ........ 0 ..... 1'151<br />
Kamerun ............ ....... 33 ....... 16 ....... 51 ........ 0 ........ 0 .... 14'261<br />
Kap Verde ........... ........ 0 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ...... 100 ...... 446<br />
Kenia ............... ....... 66 ........ 0 ....... 26 ........ 0 ........ 8 .... 28'176<br />
Komoren ............ ....... 14 ....... 86 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ...... 569<br />
Kongo .............. ....... 50 ........ 2 ....... 48 ........ 0 ........ 0 ..... 2'527<br />
Lesotho ............. ....... 80 ........ 0 ....... 20 ........ 0 ........ 0 ..... 1'970<br />
Liberia .............. ....... 10 ....... 20 ....... 70 ........ 0 ........ 0 ..... 2'109<br />
Libyen .............. ........ 0 ....... 97 ........ 0 ........ 0 ........ 3 ..... 5'445<br />
Madagaskar .......... ....... 41 ........ 7 ....... 52 ........ 0 ........ 0 .... 13'670<br />
Malawi .............. ....... 75 ....... 20 ........ 5 ........ 0 ........ 0 ..... 9'452<br />
Mali ................ ........ 1 ....... 90 ........ 9 ........ 0 ........ 0 ..... 9'653<br />
Marokko ............. ....... 99 ........ 1 ........ 0 ........ 0 ........ 0 .... 29'779<br />
Mauretanien .......... ........ 0 ...... 100 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ..... 2'336<br />
Mauritius ............ ....... 28 ....... 17 ........ 0 ....... 52 ........ 3 ..... 1'140<br />
Mosambik ........... ....... 30 ....... 20 ....... 50 ........ 0 ........ 0 .... 17'877<br />
Namibia ............. ....... 85 ........ 0 ....... 15 ........ 0 ........ 0 ..... 1'677<br />
Niger ............... ........ 0 ....... 80 ........ 0 ........ 0 ....... 20 ..... 9'113<br />
Nigeria .............. ....... 40 ....... 50 ....... 10 ........ 0 ........ 0 ... 103'912<br />
Ruanda .............. ....... 74 ........ 1 ....... 25 ........ 0 ........ 0 ..... 6'853<br />
Sambia .............. ....... 65 ....... 15 ........ 1 ....... 15 ........ 4 ..... 9'159<br />
Sao Tome und Principe . ...... 100 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ...... 144<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 543
Land Christen Moslem afr. Rel. Hindu k. A. Population 1<br />
Senegal ............. ........ 2 ....... 92 ........ 6 ........ 0 ........ 0 ..... 9'092<br />
Seychellen ........... ....... 98 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ........ 2 ....... 77<br />
Sierra Leone .......... ....... 10 ....... 60 ....... 30 ........ 0 ........ 0 ..... 4'793<br />
Simbabwe ........... ....... 25 ........ 1 ....... 24 ........ 0 ....... 50 .... 11'271<br />
Somalia ............. ........ 0 ...... 100 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ..... 9'639<br />
Südafrika ............ ....... 67 ........ 2 ........ 0 ........ 2 ....... 29 .... 41'743<br />
Sudan ............... ........ 5 ....... 70 ....... 25 ........ 0 ........ 0 .... 31'547<br />
Swasiland ............ ....... 60 ........ 0 ....... 40 ........ 0 ........ 0 ...... 998<br />
Tansania ............. ....... 45 ....... 35 ....... 20 ........ 0 ........ 0 .... 29'058<br />
Togo ............... ....... 20 ....... 10 ....... 70 ........ 0 ........ 0 ..... 4'570<br />
Tschad .............. ....... 25 ....... 50 ....... 25 ........ 0 ........ 0 ..... 6'976<br />
Tunesien ............ ........ 1 ....... 98 ........ 0 ........ 0 ........ 1 ..... 9'019<br />
Uganda .............. ....... 66 ....... 16 ....... 18 ........ 0 ........ 0 .... 20'158<br />
Westsahara ........... ........ 0 ...... 100 ........ 0 ........ 0 ........ 0 ...... 222<br />
Zentralafr. Republik .... ....... 50 ....... 15 ....... 24 ........ 0 ....... 11 ..... 3'274<br />
1 Schätzungen für 1996 in 1000<br />
8.1.5 Abhängigkeit von Exportgütern<br />
Die Tabelle zeigt, welche Exportgüter für einzelne afrikanische Staaten die grösste Bedeutung haben. Auffal-<br />
lend ist, dass der Grossteil der Devisen zumeist mit einigen wenigen <strong>Pro</strong>dukten erwirtschaftet wird, d. h. die<br />
Exportwirtschaft der betroffenen Staaten sehr einseitig ausgelegt ist. In der Tabelle werden die folgenden<br />
Abkürzungen verwendet: Di = Diamanten, Ei = Eisen oder Eisenerz, Eö = Erdöl, G = Gold, Ph = Phosphate, V<br />
= verschiedene Mineralien und Erze, Gn = Gewürznelken, Kf = Kaffee, Kk = Kakao, Ta = Tabak, Te = Tee,<br />
Va = Vanille, Zu = Zucker, Ba = Bananen, Cn = Cashewnüsse, En = Erdnüsse, Mf = Fische und Meeresfrüch-<br />
te, Pp = Palmölprodukte, FL = Fleisch und Leder (Häute), Bw = Baumwolle, Gu = Gummi und Kautschuk, H<br />
= Holz, FB = Food & Beverages, Hf = Halbfertigwaren und Manufakturwaren, Kg = Konsumgüter, Re =<br />
Reexport von Schiffen, Tf = Textilfasern und Textilien. Alle Angaben wurden, sofern nicht anders vermerkt,<br />
in <strong>Pro</strong>zenten angegeben.<br />
Tabelle: Abhängigkeit von Exportgütern<br />
Angaben von 1995 oder älter nach Fischer Weltalmanach 98, CIA 1996, Weltatlas 1997<br />
Land Exporte<br />
in Mio. $<br />
Anhang: Tabellen<br />
Minerale und Metalle Genussmittel Nahrungsmittel Agrarprd. Weitere Exportgüter Total<br />
Di Ei Eö G Ph V Gn Kf Kk Ta Te Va Zu Ba Cn En Mf Pp FL Bw Gu H F1 Hf Kg Re Tf<br />
Ägypten 5'400 48 9 14 71<br />
Algerien 9'500 97 97<br />
Angola 3'000 6 90 96<br />
Äquatorialguinea 62 10 21 39 11 81<br />
Äthiopien 296 64 14 78<br />
Benin 310 21 5 60 86<br />
Botswana 1'800 78 6 5 89<br />
Burkina Faso 273 8 5 63 76<br />
Burundi 68 81 81<br />
Dschibuti 184 28 28<br />
Elfenbeinküste 2'900 12 55 11 78<br />
Eritrea 33 26 26<br />
Gabun 2'100 80 6 14 100<br />
Gambia 35 9 19 12 40<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 544
Land Exporte<br />
in Mio. $<br />
Minerale und Metalle Genussmittel Nahrungsmittel Agrarprd. Weitere Exportgüter Total<br />
Di Ei Eö G Ph V Gn Kf Kk Ta Te Va Zu Ba Cn En Mf Pp FL Bw Gu H F1 Hf Kg Re Tf<br />
Ghana 1'000 45 26 14 85<br />
Guinea 562 12 71 6 89<br />
Guinea-Bissau 32 94 94<br />
Kamerun 1'200 29 13 11 10 11 74<br />
Kap Verde 4 12 63 75<br />
Kenia 1'600 11 18 25 54<br />
Komoren 14 55 55<br />
Kongo 1'000 90 90<br />
Dem. Rep. Kongo 419 27 11 21 5 64<br />
Lesotho 142 57 57<br />
Liberia 530 61 20 11 92<br />
Libyen 7'200 90 90<br />
Madagaskar 240 11 45 20 76<br />
Malawi 365 70 7 7 84<br />
Mali 415 57 29 86<br />
Marokko 4'000 17 30 23 21 91<br />
Mauretanien 390 49 50 99<br />
Mauritius 1'300 10 40 44 94<br />
Mosambik 170 40 40<br />
Namibia 1'300 33 33<br />
Niger 232 67 20 87<br />
Nigeria 9'900 98 98<br />
Ruanda 52 62 62<br />
Sambia 1'075 80 80<br />
São Tome u. Principe 7 85 85<br />
Senegal 940 16 26 11 53<br />
Seychellen 50 28 8 36<br />
Sierra Leone 115 16 71 6 7 100<br />
Simbabwe 2'200 10 12 30 25 77<br />
Somalia 100 40 38 78<br />
Südafrika 27'900 27 20 5 52<br />
Sudan 535 13 24 11 48<br />
Swasiland 798 25 5 30<br />
Tansania 462 22 18 18 58<br />
Togo 162 48 22 70<br />
Tschad 132 80 80<br />
Tunesien 4'700 9 86 95<br />
Uganda 424 97 97<br />
Westsahara 62 62<br />
Zentralafr. Republik 154 45 29 9 13 96<br />
Total Afrika 97'782 Gesamtexportvolumen entspricht etwa dem der Schweiz (1995: 94'173 Mio. US$)<br />
8.1.6 Tourismus in afrikanischen Staaten<br />
Die Tabelle zeigt die Bedeutung des Tourismus für die einzelnen afrikanischen Staaten. Im Gegensatz zur<br />
Schweiz ist der Tourismus für viele afrikanische Länder unbedeutend, d. h. er trägt nur unwesentlich zum<br />
Bruttoinlandprodukt (BIP) bei. Nur in wenigen Länder übersteigen die Beiträge des Tourismus 5%. Auch die<br />
Einnahmen pro eingereistem Tourist weisen eine breite Spanne auf.<br />
Tabelle: Tourismus in afrikanischen Staaten<br />
Angaben für 1992 nach Weltatlas 1993, Einnahmen pro Tourist und Anteil am BIP durch Berechnung<br />
Land Einnahmen<br />
in Mio. US$<br />
Touristenzahl<br />
pro<br />
Jahr in 1000<br />
Bevölkerung<br />
in 1000<br />
BIP in Mio.<br />
US$<br />
Einnahmen<br />
pro Tourist<br />
in US$<br />
Anhang: Tabellen<br />
Anteil am<br />
BIP in %<br />
Ägypten 2'029 2'112 55'680 39'199 960 5.2<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 545
Land Einnahmen<br />
in Mio. US$<br />
Touristenzahl<br />
pro<br />
Jahr in 1000<br />
Bevölkerung<br />
in 1000<br />
BIP in Mio.<br />
US$<br />
Einnahmen<br />
pro Tourist<br />
in US$<br />
Anteil am<br />
BIP in %<br />
Algerien 54 1'193 26'041 54'000 45 0.1<br />
Angola 46 8'902 8'300<br />
Äquatorial-Guinea 367 156<br />
Äthiopien 20 82 54'270 6'600 243 0.3<br />
Benin 47 117 4'995 2'000 401 2.4<br />
Botswana 65 365 1'360 3'600 178 1.8<br />
Burkina Faso 9 46 9'567 2'900 195 0.3<br />
Burundi 4 109 5'821 1'130 36 0.4<br />
Dem. Rep. Kongo 7 46 37'928 9'800 152 0.1<br />
Djibouti 6 47 433 340 127 1.8<br />
Elfenbeinküste 48 200 12'951 10'000 240 0.5<br />
Gabun 8 128 1'106 3'300 62 0.2<br />
Gambia 26 101 909 207 257 12.6<br />
Ghana 118 172 16'009 6'200 686 1.9<br />
Guinea 7'784 3'000<br />
Guinea-Bissau 1'003 162<br />
Kamerun 22 115 12'658 11'500 191 0.2<br />
Kenia 424 822 26'164 9'700 515 4.4<br />
Kongo 7 46 2'377 2'400 152 0.3<br />
Lesotho 9 182 1'880 420 49 2.1<br />
Liberia 2'777 988<br />
Libyen 4 90 4'485 28'900 44 0.0<br />
Madagaskar 18 35 11'942 2'400 514 0.8<br />
Malawi 11 132 8'709 1'900 83 0.6<br />
Mali 32 44 8'538 2'200 727 1.5<br />
Marokko 1'052 4'162 26'167 27'230 252 3.9<br />
Mauretanien 15 2'103 1'100 1.4<br />
Mosambik 16'617 1'700<br />
Namibia 1'452 2'000<br />
Niger 10 16 8'319 2'400 625 0.4<br />
Nigeria 25 190 90'122 30'000 131 0.1<br />
Ruanda 10 43 7'718 2'100 232 0.5<br />
Sambia 6 141 8'385 4'700 42 0.1<br />
Senegal 152 234 7'947 5'000 649 3.0<br />
Sierra Leone 19 98 4'436 1'400 193 1.4<br />
Simbabwe 47 664 10'339 7'100 70 0.7<br />
Somalia 46 8'325 1'700<br />
Anhang: Tabellen<br />
Südafrika 815 1'710 41'688 104'000 476 0.8<br />
Sudan 5 16 26'477 12'100 312 0.0<br />
Swasiland 25 279 825 563 89 4.4<br />
Tansania 95 187 27'432 6'900 508 1.4<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 546
Land Einnahmen<br />
in Mio. US$<br />
Touristenzahl<br />
pro<br />
Jahr in 1000<br />
Bevölkerung<br />
in 1000<br />
BIP in Mio.<br />
US$<br />
Einnahmen<br />
pro Tourist<br />
in US$<br />
Anteil am<br />
BIP in %<br />
Togo 23 103 3'814 1'500 223 1.5<br />
Tschad 10 21 5'239 1'000 476 1.0<br />
Tunesien 685 3'224 8'424 10'900 212 6.3<br />
Uganda 10 50 17'477 5'600 200 0.2<br />
Westsahara 201 60<br />
Zentralafr. Republik 9 6 3'154 1'300 1'500 0.7<br />
Afrika 1<br />
5'981 17'420 651'317 441'655 343 1.4<br />
Deutschland 10'947 15'648 80'556 1'345'285 699 0.8<br />
Schweiz 7'064 12'600 6'868 147'400 560 4.8<br />
1 Zahlen aufgrund vorhandener Angaben berechnet<br />
8.1.7 Bananenproduktion in Schwarzafrika<br />
Obwohl Bananen für einige schwarzafrikanische auch als Exportprodukt wichtig sind, liegt die hauptsächliche<br />
Bedeutung der verschiedenen Sorten in der Verwendung als wichtiges Nahrungsmittel für die einheimische<br />
Bevölkerung.<br />
Tabelle: Bananenproduktion (in 1000 t)<br />
Angaben nach FAO, FAOSTAT 1998<br />
Anhang: Tabellen<br />
Land 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995<br />
Ägypten 65.71 64.01 82.00 112.00 133.30 203.00 415.50 498.68<br />
Angola 175.00 210.00 300.00 250.00 280.00 270.00 270.00 290.00<br />
Äquatorialguinea 11.50 12.00 13.50 9.00 10.50 14.50 16.00 17.00<br />
Äthiopien 31.00 44.00 52.50 65.00 72.50 74.50 78.00 80.00<br />
Benin 10.00 10.00 11.00 11.50 12.50 13.00 13.00 13.00<br />
Burundi 1'000.00 1'140.00 1'197.00 1'262.80 1'100.00 1'384.00 1'547.00 1'421.41<br />
Dem. Rep. Kongo 235.00 255.00 278.60 312.40 348.40 399.00 404.79 409.00<br />
Elfenbeinküste 98.00 138.30 178.85 192.00 170.20 163.01 146.07 194.96<br />
Gabun 10.00 5.00 6.00 8.00 8.00 8.00 9.00 10.00<br />
Ghana 20.00 13.90 16.30 6.80 2.50 4.00 4.00 4.00<br />
Guinea 95.00 87.00 85.00 94.82 99.60 104.70 121.23 150.00<br />
Guinea-Bissau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 3.00 4.00<br />
Kamerun 154.20 135.00 190.00 300.00 550.00 758.73 719.10 980.00<br />
Kap Verde 4.00 7.27 8.32 3.00 7.00 5.00 6.00 6.00<br />
Kenia 102.00 106.00 111.00 116.90 135.00 155.00 200.00 220.00<br />
Komoren 20.00 23.00 25.00 26.78 32.00 37.60 50.25 55.97<br />
Kongo 3.52 8.00 15.00 22.14 29.51 32.76 33.00 40.00<br />
Liberia 54.00 56.00 60.00 67.00 74.00 80.00 70.00 85.00<br />
Libyen 0.11 0.14 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Madagaskar 135.00 155.00 262.00 444.03 270.18 224.95 225.00 230.00<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 547
Land 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995<br />
Malawi 34.00 36.00 43.00 57.00 72.00 80.00 89.00 91.00<br />
Marokko 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 7.00 50.90 90.00<br />
Mauritius 1.68 10.32 7.95 3.70 2.63 7.15 6.14 9.44<br />
Mosambik 21.43 25.00 33.97 60.00 65.00 70.00 85.00 83.00<br />
Sambia 0.50 0.50 1.80 1.02 0.50 0.55 0.65 0.60<br />
São Tomé u. Princ. 4.34 2.89 1.85 2.18 2.60 5.30 7.09 13.00<br />
Senegal 3.00 2.28 4.00 4.60 5.50 6.00 6.00 7.50<br />
Seychellen 0.25 0.35 0.80 1.20 1.40 1.60 1.73 1.85<br />
Simbabwe 29.00 31.00 37.00 44.00 54.00 64.00 78.00 80.00<br />
Somalia 98.00 157.00 140.30 106.00 60.40 60.00 110.00 50.00<br />
Südafrika 55.03 28.94 57.62 98.00 111.55 150.83 226.14 134.98<br />
Sudan 65.00 70.00 65.00 70.00 49.01 60.00 45.00 21.00<br />
Swasiland 1.42 0.90 0.60 0.96 1.00 1.00 1.00 0.50<br />
Tansania 431.00 510.18 682.76 455.58 740.00 774.00 823.00 651.00<br />
Togo 8.60 9.40 11.00 12.50 14.00 16.00 16.00 16.10<br />
Uganda 200.00 200.00 332.00 330.00 369.00 430.00 560.00 580.00<br />
Zentralafr. Republik 42.00 50.00 56.00 70.00 77.00 83.00 92.00 100.00<br />
8.1.8 Baumwollproduktion in Afrika<br />
Obwohl die Baumwollproduktion Afrikas nur einen Bruchteil der Weltproduktion ausmacht, ist sie für die<br />
produzierenden Staaten doch von Bedeutung, sowohl im Hinblick auf Exporte als auch bei der Verarbeitung<br />
im Land selbst zum Eigengebrauch.<br />
<strong>Pro</strong>duktion von Baumwolle (in 1000 t)<br />
gekürzt nach Lötschert / Beese, Pflanzenbuch der Tropen, 1992, S. 244<br />
Land 1970 1975 1980 1990 1'995 1<br />
Ägypten ................................... ... 520 .... 382 ... 530 .... 330 ... 315<br />
Benin ....................................................................... ... 103<br />
Burkina Faso ................................................................. .... 67<br />
Elfenbeinküste ................................................................ .... 93<br />
Ghana ....................................................................... .... 37<br />
Mali ...................................... .... 22 ..... 39 .... 48 ..... 97 ... 110<br />
Nigeria .................................... .... 62 ..... 52 - ..... 27 ... 115<br />
Simbabwe ................................................................... .... 37<br />
Südafrika .................................. .... 19 ..... 35 .... 52 ..... 56 .... 22<br />
Sudan ..................................... ... 235 .... 229 ... 114 .... 125 ... 131<br />
Tansania ................................... .... 70 ..... 45 .... 51 ..... 59 .... 45<br />
Tschad .................................... .... 40 ..... 65 - - .... 45<br />
Welt ...................................... . 12'010 .. 12'362 . 14'391 .. 18'457 . 19'799<br />
1 Fischer Weltalmanach '98, Tabelle "Baumwollfasern"<br />
Anhang: Tabellen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 548
8.1.9 Eisenerzproduktion und Diamantenproduktion afrikanischer Staaten<br />
Die Tabelle zeigt für Liberia auf, wie sich die wirtschaftliche Situation eines Landes innert weniger Jahre<br />
drastisch ändern kann: Die einstmals bedeutende Eisenerzproduktion ist während der Bürgerkriegsjahre auf<br />
Null gesunken.<br />
Die Diamantenproduktion der schwarzafrikanischen Staaten ist nicht nur für die produzierenden Länder von<br />
Bedeutung, sie umfasst auch einen grossen Anteil der Weltproduktion.<br />
Tabelle: Eisenerz (Mio. t)<br />
nach Fischer Weltalmanach '98<br />
Tabelle: Diamanten (Mio. Karat)<br />
nach Fischer Weltalmanach '98<br />
Land 1990 1995 Land 1990 1994<br />
Liberia 0 Angola 1.28 0.13<br />
Marokko 0.1 Botswana 17.35 15.54<br />
Mauretanien 11.4 11.3 Dem. Rep. Kongo 18 16.25<br />
Südafrika 30.3 32.7 Ghana 0.52 0.74<br />
Tunesien 0.2 Namibia 0.75 1.31<br />
Welt 1'017.5 Südafrika 8.69 10.85<br />
8.1.10 Erdnussproduktion in Schwarzafrika<br />
Zentralafr. Republik. 0.5<br />
Welt 110.3<br />
Obwohl die Erdnussproduktion der schwarzafrikanischen Staaten oft im Zusammenhang mit der Exportpro-<br />
duktion genannt wird, hat der Anbau dieser Pflanze doch auch vor allem für die Ernährung der lokalen Bevöl-<br />
kerung grosse Bedeutung.<br />
Tabelle: Erdnussproduktion (mit Schalen in 1000 t)<br />
Angaben nach FAO, FAOSTAT 1998<br />
Anhang: Tabellen<br />
Land 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995<br />
Ägypten 25.00 49.88 40.00 28.00 25.54 23.00 26.26 130.64<br />
Algerien 0.00 1.88 3.09<br />
Angola 22.50 31.80 18.00 20.00 20.00 18.00 14.00 22.00<br />
Äthiopien 15.00 17.50 24.20 25.00 26.00 52.00 52.00 55.00 1<br />
Benin 26.34 33.00 47.25 34.65 62.84 66.08 63.93 103.34<br />
Botswana 3.45 0.40 3.63 2.50 1.40 0.80 0.54 0.30<br />
Burkina Faso 70.00 73.00 67.70 87.20 53.94 123.46 134.24 213.30<br />
Burundi 3.10 4.00 6.20 9.00 10.00 13.00 13.60 12.64<br />
Dem. Rep. Kongo 190.00 180.00 266.80 308.00 337.10 395.00 528.40 598.00<br />
Elfenbeinküste 19.60 32.00 42.50 48.80 81.00 108.00 130.00 147.00<br />
Eritrea 1.50<br />
Gabun 2.50 3.00 3.20 4.50 7.20 9.00 14.80 15.92<br />
Gambia 105.00 128.00 125.00 141.10 60.20 75.80 74.53 75.18<br />
Ghana 47.00 27.00 101.60 110.75 142.20 140.00 113.00 168.20<br />
Guinea 60.00 65.00 74.90 78.77 83.90 74.10 78.11 132.08<br />
Guinea-Bissau 65.00 42.00 38.00 37.00 30.00 27.00 18.17 18.00<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 549
Land 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995<br />
Kamerun 83.13 141.32 199.10 245.70 125.76 96.49 87.62 100.00<br />
Kap Verde 0.30 0.65 0.01 0.00 0.00 0.15 0.35 0.00<br />
Kenia 1.02 3.70 3.00 7.50 7.97 8.50 6.22 11.00<br />
Kongo 24.91 18.00 14.80 16.90 13.86 23.09 25.87 26.00<br />
Liberia 3.00 2.00 2.00 2.55 2.80 3.00 3.00 4.20<br />
Libyen 11.00 10.89 10.69 12.50 13.20 14.00 14.40 12.50<br />
Madagaskar 32.00 32.29 41.49 41.79 39.08 31.50 30.40 30.00<br />
Malawi 127.00 157.00 151.59 165.00 177.00 119.40 37.10 31.73<br />
Mali 110.00 153.20 158.00 205.00 144.10 85.07 179.92 166.18<br />
Marokko 1.00 1.00 2.61 18.82 34.84 29.04 14.76 14.24<br />
Mauretanien 0.70 0.78 3.00 2.00 0.70 1.70 2.10 1.80<br />
Mauritius 0.28 0.58 0.69 1.27 1.07 2.17 1.76 1.05<br />
Mosambik 60.00 120.00 140.00 140.00 133.00 100.00 113.00 102.00<br />
Niger 151.80 276.54 204.60 41.76 126.10 54.50 17.53 111.09<br />
Nigeria 1'565.00 1'978.00 1'581.00 458.00 471.00 621.00 992.00 1'579.00<br />
Ruanda 1.84 5.00 6.87 13.96 15.60 17.36 6.00 7.50<br />
Sambia 50.00 44.00 68.00 69.90 16.00 14.52 25.09 36.12<br />
Senegal 995.00 1'121.00 589.95 1'444.09 523.00 601.22 702.58 790.62<br />
Sierra Leone 22.00 23.00 20.60 15.00 10.00 13.60 20.10 35.80<br />
Simbabwe 78.55 60.76 120.00 127.35 77.68 70.94 119.09 52.30<br />
Somalia 2.25 4.20 9.00 2.60 3.00 5.00 1.90 3.00<br />
Südafrika 263.00 197.00 325.50 270.00 375.30 208.50 111.00 117.29<br />
Sudan 265.80 304.60 339.00 931.00 707.00 274.00 123.00 738.00<br />
Swasiland 2.80 3.00 2.80 2.50 1.27 1.45 5.00 4.71<br />
Tansania 40.00 48.84 33'817.00 46.00 54.00 59.00 60.00 72.00<br />
Togo 11.18 20.90 22.00 19.90 24.49 31.49 26.49 35.09<br />
Tschad 130.00 150.00 96.30 82.30 98.60 111.51 108.42 292.58<br />
Uganda 120.00 130.00 244.00 194.40 70.00 93.00 158.00 144.00<br />
Zentralafr. Republik 63.00 60.50 68.00 132.55 123.49 60.06 79.52 85.54<br />
1 ohne Eritrea<br />
8.1.11 Erdölproduktion in Afrika<br />
Anhang: Tabellen<br />
Der Grossteil des in den Ländern Afrikas geförderten Erdöls wird exportiert. Da vor allem vor der Küste<br />
Angolas noch immer neue Felder entdeckt werden, dürfte die <strong>Pro</strong>duktion in Zukunft eher noch ansteigen.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 550
Tabelle: Erdölförderung (in Mio. t)<br />
nach Fischer 1998<br />
Land 1980 1<br />
1990 1994 1995 1996<br />
Ägypten 30.1 44.9 44.8 44.2 46.9<br />
Algerien 51.5 56.7 55.8 56.6 58.4<br />
Angola 7.4 36.1<br />
Gabun 8.9 18.6<br />
Libyen 85.9 66 66.6 68.6 68.8<br />
Nigeria 101.8 90.7 102.1 101.7 111.3<br />
Welt 3'203 3'261 3'382.8<br />
1 Fischer Weltalmanach '94, S. 978<br />
8.1.12 Goldproduktion schwarzafrikanischer Staaten<br />
Seit Jahrhunderten gelangte afrikanische Gold über verschiedene Handelsrouten in weit entfernte Länder und<br />
noch immer sind einige Länder Afrikas bedeutende Goldproduzenten auf dem Weltmarkt.<br />
Tabelle: Goldproduktion (in t)<br />
nach Fischer Weltalmanach '98, Tabelle "Gold"<br />
Land 1989 1<br />
1990 1991 1992 1993 1994<br />
Ghana 24.5 31.04 39.23 44.51<br />
Simbabwe 14.8 20.51<br />
Südafrika 601.52 603 613.04 619.2 579.3<br />
Welt 1'919 1'950 2'235 2'258 2'220<br />
1 Fischer Weltalmanach '94, S. 983<br />
8.1.13 Kaffeeproduktion schwarzafrikanischer Länder<br />
Obwohl die Kaffeeproduktion der schwarzafrikanischen Länder prozentual rückläufig zur Weltproduktion ist,<br />
stellt sie für die Exportländer noch immer eine wichtige Einkommensquelle dar.<br />
Tabelle: Kaffeeproduktion (in 1000t)<br />
gekürzt nach Lötschert / Beese "Pflanzen der Tropen" 1992, S. 208<br />
Land 1970 1975 1980 1990 1'995 1<br />
Angola 216 68 40 5 3<br />
Äthiopien 172 179 193 195 198<br />
Dem. Rep. Kongo 69 83 90 98 60<br />
Kamerun 90 80 102 100 70<br />
Kenia 57 66 91 90 94<br />
Madagaskar 63 91 217 89 79<br />
Sierra Leone 25<br />
Tansania 49 52 52 50 40<br />
Uganda 215 213 123 168 22<br />
Welt 4'264 4'462 4'821 5'964 5'732<br />
1 Fischer Weltalmanach '98, Tabelle "Kaffee"<br />
Anhang: Tabellen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 551
8.1.14 Kakaoproduktion ausgewählter Länder<br />
Die Tabelle zeigt die grossen <strong>Pro</strong>duktionsverschiebungen zwischen den grossen Kakaoproduzenten der Welt<br />
im Laufe der Jahre.<br />
Tabelle: Kakaoernte (in 1000t)<br />
Angaben nach verschiedenen Quellen<br />
Land / Jahr 1938 1<br />
1966 2<br />
1973 3<br />
1974 4<br />
1975 5<br />
1976 6<br />
1978 7<br />
1980 8<br />
1980 9 1990 10 1991 11 1994 12 1995 13 1996 14<br />
Brasilien 125 159 239 265 233 260 294 318 356 320 340 344 282<br />
Ecuador 18 54 60 75 78 70 95 91 97 100 83 84 81<br />
Elfenbeinküste 50 121 185 210 241 190 280 325 400 815 750 804 809 860<br />
Ghana 285 416 416 343 382 320 320 255 250 295 265 240 270 325<br />
Indonesien 15 154 180 239 280 243<br />
Kamerun<br />
15<br />
79 107 125 118 102 90 110 117 115 105 97 100 100<br />
Malaysia 32 247 240 226 230 152<br />
Nigeria 100 16<br />
184 241 214 265 180 200 175 155 155 100 135 135 130<br />
Welt 740 1236 1406 1435 1457 1360 1500 1550 2576 2493 2564 2502<br />
1<br />
nach "Erdkunde: Die Erde als Natur und Lebensraum" (1968), Bd. 1, S.61<br />
2<br />
nach "Fahr mit in die Welt", Band (1972), S. 64<br />
3<br />
nach "Erdkunde: Die Erde als Natur und Lebensraum" (1968), Bd. 1, S.61<br />
4<br />
nach "Geographie thematisch 5/6" (1977), S. 145<br />
5<br />
nach "Dreimal um die Erde, Band 1: Menschen und ihre Welt" S. 95<br />
6<br />
nach "Geographie der Kontinente" (1984), S. 53<br />
7<br />
nach "Geographie der Kontinente" (1984), S. 53<br />
8<br />
nach "Mensch und Raum 5/6" (1983), S. 79 und "Geographie der Kontinente" (1984), S. 53<br />
9<br />
nach "Fischer '94" (1993), S. 954<br />
10<br />
nach "Fischer '94" (1993), S. 954<br />
11<br />
nach "Fischer '94" (1993), S. 954<br />
12<br />
nach "Fischer '98", Tabelle "Kakao/Kakaobohnen"<br />
13<br />
nach "Fischer '98", Tabelle "Kakao/Kakaobohnen"<br />
14<br />
nach "Fischer '98", Tabelle "Kakao/Kakaobohnen"<br />
15<br />
siehe die Angaben zu Nigeria<br />
16 zusammen mit Kamerun<br />
8.1.15 Kupferproduktion afrikanischer Staaten<br />
Die Kupferproduktion der meisten afrikanischen Staaten hat nur noch Bedeutung für diese Staaten selbst, der<br />
einstige grosse Anteil am Weltmarkt ist auf unter 10% gefallen. Nur gerade Sambia mit 4-5% der Weltproduk-<br />
tion besitzt eine gewisse Bedeutung. Aufgrund der sinkenden Kupferpreise und des schlechten Zustands der<br />
sambesischen Minen, dürfte dieser Anteil in den nächsten Jahren weiter abnehmen.<br />
Tabelle: Kupferförderung (in 1000 t)<br />
nach Fischer Weltalmanach '98, Tabelle "Kupfer" 1993-95; Fischer '94, S. 984 (1980, 1990-91) und<br />
USGS, 1997 (1986-1989)<br />
Land 1980 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1993 1994 1995<br />
Botswana 21.3 18.9 24.4 21.7 20<br />
Dem. Rep. Kongo 505 257.8 515.4 495.8 467.2 356 235 29<br />
Marokko 20.2 16.5 15.4 16 10<br />
Mosambik 0.3 0.2 0.1 0.1<br />
Anhang: Tabellen<br />
Namibia 49.6 37.6 40.9 32.8 25<br />
Sambia 596 462.4 463.2 431.8 451 496 423 431 384 342<br />
Simbabwe 21.4 19.8 16.9 16.4 8<br />
Südafrika 212 184.2 188.1 168.5 181.9 209 193 166 184 200<br />
Welt 8'319.3 8'617.4 8'681.1 9'036.6 9'040 9'112 9'455 9'600<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 552
8.1.16 Holzverbrauch ausgewählter schwarzafrikanischer Länder<br />
Der Holzproduktion der schwarzafrikanischen Länder weist grosse Unterschiede auf, doch bei fast allen ist die<br />
Rundholzproduktion für Bau, Handwerk und Export relativ gering im Vergleich mit den Mengen von Holz, die<br />
für den Eigenbedarf als Brennholz benutzt werden. So wird in Südafrika bei einem <strong>Pro</strong>-Kopf-Verbrauch von<br />
0.58 m 3 pro Jahr und Kopf nur etwa 30% der <strong>Pro</strong>duktion als Brennholz benutzt, während Gabun einen<br />
Verbrauch von 4.44 m 3 pro Jahr und Kopf aufweist, wovon 63% als Brennholz dienen. Da die Schwankungen<br />
für die meisten Länder aber innerhalb enger Grenzen liegen, kann zumindest für die Brennholzproduktion<br />
davon ausgegangen werden, dass der Verbrauch ungefähr proportional zu der Bevölkerungszahl ist. Die Anga-<br />
ben müssen allerdings mit Vorsicht betrachtet werden, da sie auf Schätzungen der jeweiligen Länder beruhen.<br />
Tabelle: <strong>Pro</strong>duktion (und Verbrauch) von Holz in ausgewählten Ländern<br />
nach FAO-Angaben von 1994 in Fische, 1998<br />
Land Rundholz 1 Anteil in % Brennholz 2 Anteil in % Population 3 Verbrauch 4<br />
Äthiopien 1.73 3.68 45.25 96.32 49.7 0.95<br />
Dem. Rep. Kongo 3.34 7.27 42.59 92.73 42.6 1.08<br />
Elfenbeinküste 3.29 22.71 11.2 77.29 13.8 1.05<br />
Gabun 1.63 36.71 2.81 63.29 1 4.44<br />
Ghana 1.95 7.18 25.19 92.82 16.9 1.61<br />
Kamerun 2.98 19.81 12.06 80.19 12.9 1.17<br />
Kenia 1.89 4.68 38.48 95.32 26 1.55<br />
Kongo 1.35 37.09 2.29 62.91 2.5 1.46<br />
Madagaskar 0.47 4.41 10.18 95.59 13.1 0.81<br />
Mosambik 1.02 6.36 15.02 93.64 16.6 0.97<br />
Nigeria 8.26 7.64 99.8 92.36 107.9 1<br />
Sambia 1.2 8.18 13.47 91.82 9.2 1.59<br />
Simbabwe 1.81 23.03 6.05 76.97 11 0.71<br />
Südafrika 17.01 70.23 7.21 29.77 41.6 0.58<br />
Sudan 2.29 9.26 22.45 90.74 27.4 0.9<br />
Tansania 2.12 5.93 33.63 94.07 28.8 1.24<br />
Uganda 2.22 13.31 14.46 86.69 18.6 0.9<br />
1 <strong>Pro</strong>duktion in Mio. m 3<br />
2 <strong>Pro</strong>duktion und Verbrauch von Brennholz inkl. Holzkohle in Mio. m 3<br />
3<br />
4<br />
in Mio.<br />
in m 3 pro Kopf und Jahr<br />
8.1.17 Sisalproduktion ausgewählter Länder<br />
Die einst bedeutende Sisalproduktion der schwarzafrikanischen Staaten, die für den Export gedacht war, ist in<br />
manchen Ländern, unter anderem aufgrund der fehlenden Nachfrage, auf einen Bruchteil der einstigen <strong>Pro</strong>duk-<br />
tion geschrumpft.<br />
Tabelle: Sisalproduktion (in 1000 t)<br />
gekürzt nach Lötschert / Beese "Pflanzen der Tropen 1992, S. 247<br />
Land 1970 1980 1990<br />
Angola 65 20 1<br />
Anhang: Tabellen<br />
Brasilien 229 254 270<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 553
Land 1970 1980 1990<br />
Kenia 46 48 36<br />
Madagaskar 26 19 18<br />
Mosambik 28 18 18<br />
Tansania 198 115 35<br />
Welt 645 516 512<br />
8.1.18 Teeproduktion schwarzafrikanischer Länder<br />
Obwohl die Teeproduktion der schwarzafrikanischen Staaten nur einen kleinen Anteil an der Welternte hat, ist<br />
sie für einige Länder von Bedeutung als Devisenbringer. In Ländern wie Kenia hat sich unterdessen auch ein<br />
Verbrauchermarkt innerhalb des Landes entwickelt.<br />
Tabelle: Teeproduktion (in 1000t)<br />
nach Angaben der FAO, FAOSTAT 1998<br />
Land 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995<br />
Äthiopien 0.08 0.3 0.5 0.7<br />
Burundi 0.15 0.82 1.45 4.15 4.04 5.3<br />
Dem. Rep. Kongo 7 8.5 7.3 6.7 6.1 4.84 3.11 3.42<br />
Kamerun 0.08 0.52 1.03 1.57 1.88 2.11 2.9 4.4<br />
Kenia 12.64 19.82 41.08 56.73 89.89 147.1 197 244.53<br />
Madagaskar 0 0.06 0.2 0.24 0.28 0.3<br />
Malawi 14.29 12.97 18.73 26.24 29.92 39.95 38.92 34.18<br />
Mali 0 0.08 0.06 0.09 0.16 0.2<br />
Mauritius 1.27 1.74 3.24 3.14 4.39 8.12 5.75 3.79<br />
Mosambik 8.1 10.75 16.97 13.14 19.5 7 4 2.1<br />
Ruanda 0.16 0.34 1.25 4 6.63 8.1 12.85 5.75<br />
Sambia 0 0.07 0.31 0.38 0.56 0.5<br />
Seychellen 0.01 0.02 0.02 0.05 0.04 0.12 0.22 0.23<br />
Simbabwe 1.1 1.61 3.95 6.88 9.66 14.09 17 15<br />
Südafrika 2 2 0.8 2.84 12 9.22 12.44 11.98<br />
Tansania 4.46 5.68 8.49 13.87 16.42 15.54 18.09 25<br />
Uganda 5.1 8.37 18.2 18.4 1.5 5.76 6.7 12.69<br />
8.1.19 Uranproduktion afrikanischer Staaten<br />
Die Uranförderung der afrikanischen Staaten beträgt rund einen Sechstel der Weltproduktion und ist vor allem<br />
für den Niger ein wichtiges Exportgut.<br />
Tabelle: Uranförderung (in t)<br />
nach Fischer Weltalmanach '98, Tabelle "Urangewinnung"<br />
Land 1990 1992 1993 1994<br />
Niger 2'831 3'071 2'910 2'975<br />
Südafrika 5'698 3'253 3'385 1'669<br />
Gabun 556<br />
Welt 35'801 32'171<br />
Anhang: Tabellen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 554
8.1.20 Verschiedene landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>dukte<br />
Die in der Tabelle aufgeführten <strong>Pro</strong>dukte "Taro", "Cashewnuss" und "Kolanuss" sind Kulturpflanzen, welche<br />
als typisch für gewisse Länder gelten können. Die Angaben zur Taroproduktion zeigen auch, welche Bedeu-<br />
tung eine für viele Länder wenig wichtige Pflanze für ein Land wie beispielsweise Ghana haben kann.<br />
Tabelle: Verschiedene landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>dukte (in 1000 t)<br />
Angaben nach FAO, FAOSTAT 1998<br />
Taro (Cocoyam) Cashew Kolanuss<br />
Land 1985 1990 1995 Land 1995 1995<br />
Ägypten 94.00 99.00 120.29 Angola 1.20<br />
Benin 1.14 3.41 3.03 Benin 10.00 0.50<br />
Burundi 112.00 128.30 102.01 Burkina Faso 1.00<br />
Dem. Rep. Kongo 34.80 38.78 42.00 Elfenbeinküste 20.00 74.70<br />
Elfenbeinküste 260.00 282.00 246.00 Ghana 0.50 13.00<br />
Gabun 64.00 54.00 56.60 Guinea-Bissau 35.00<br />
Ghana 900.00 815.00 1'408.10 Kamerun 35.00<br />
Guinea 32.10 34.00 26.00 Kenia 5.00<br />
Liberia 17.00 15.00 20.00 Madagaskar 4.60<br />
Madagaskar 93.50 110.00 140.00 Mosambik 33.42<br />
Mauritius 0.33 0.49 0.16 Nigeria 25.00 110.00<br />
Nigeria 232.00 731.00 1'182.00 Senegal 1.50<br />
Ruanda 39.00 78.00 20.00 Sierra Leone 4.00<br />
São Tomé u. Princ. 2.00 2.43 9.00 Tansania 63.40<br />
Sierra Leone 8.00 3.20 2.70 Togo 0.50<br />
Togo 15.00 13.68 11.12<br />
Tschad 18.00 28.00 38.00<br />
Zentralafr. Republik 35.00 50.00 90.00<br />
8.1.21 Tierbestände afrikanischer Staaten<br />
Die Tabelle zu den Tierbeständen soll einen Überblick über die wichtigsten in den einzelnen Länder gehalte-<br />
nen Haustiere geben und damit einen Einblick in die Subsistenzwirtschaft der betreffenden Gebiete ermögli-<br />
chen. Auffallend sind die grossen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, die teilweise klimatisch,<br />
sicher aber auch kulturell bedingt sind.<br />
Tabelle: Bevölkerung und Tierbestände (in Mio.)<br />
nach Fischer Weltalmanach 1998, Mittel der Jahre 1993-95<br />
Land Einwohner 1 Hühner Rinder Schafe Schweine Ziegen 2<br />
Anhang: Tabellen<br />
Kamele 3<br />
Ägypten 57.8 38 3.05 3.49 0.03 3.13 0.13<br />
Algerien 27.96 78 1.34 17.83 0.01 2.78 0.13<br />
Angola 10.77 6 3.27 0.26 0.82 1.46 -<br />
Äquatorialguinea 0.4 - 0.01 0.04 0.01 0.01 -<br />
Äthiopien 56.4 54 29.43 21.7 0.02 16.75 1.01<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 555
Land Einwohner 1 Hühner Rinder Schafe Schweine Ziegen 2<br />
Kamele 3<br />
Benin 5.48 23 1.18 0.94 0.55 1.2 -<br />
Botswana 1.45 2.5 2.77 0.34 0.02 1.9 -<br />
Burkina Faso 10.38 18.5 2.93 5.6 0.06 7.4 0.01<br />
Burundi 6.26 4 0.41 0.37 0.09 0.91 -<br />
Dschibuti 0.63 - 0.19 0.47 - 0.51 0.06<br />
Elfenbeinküste 13.98 26.5 1.23 1.24 0.4 1 -<br />
Eritrea 3.57 4 1.47 1.52 - 1.4 0.07<br />
Gabun 1.08 3 0.04 0.17 0.17 0.09 -<br />
Gambia 1.11 1 0.41 0.12 0.01 0.22 -<br />
Ghana 17.08 12 1.58 3.1 0.55 2.2 -<br />
Guinea 6.59 14 1.7 0.44 0.03 0.75 -<br />
Guinea-Bissau 1.07 1 0.48 0.26 0.31 0.27 -<br />
Kamerun 13.29 20 4.88 3.77 1.38 3.8 -<br />
Kap Verde 0.38 1 0.02 0.01 0.11 0.11 -<br />
Kenia 26.69 26 11.67 5.5 0.11 7.4 0.81<br />
Komoren 0.5 - 0.05 0.02 - 0.13 -<br />
Kongo 2.63 2 0.68 0.11 0.06 0.3 -<br />
Dem. Rep. Kongo 43.85 36 1.81 1 1.16 4.32 -<br />
Lesotho 1.98 1 0.65 1.68 0.08 0.75 -<br />
Liberia 2.73 4 0.04 0.21 0.12 0.22 -<br />
Libyen 5.41 16.5 0.07 3.75 - 0.8 0.13<br />
Madagaskar 13.65 22.5 10.3 0.74 1.56 1.4 -<br />
Malawi 9.76 9 0.98 0.2 0.24 1.1 -<br />
Mali 9.79 23 5.49 5.05 0.06 7.75 0.29<br />
Marokko 26.56 108.67 2.62 16.16 0.01 4.01 0.04<br />
Mauretanien 2.27 4 1.05 4.8 - 3.53 1.09<br />
Mauritius 1.13 3 0.03 0.01 0.02 0.09 -<br />
Mosambik 16.17 22 1.26 0.12 0.17 0.39 -<br />
Namibia 1.55 2 1.99 2.69 0.02 1.62 -<br />
Niger 9.03 20 1.98 3.64 0.04 5.72 0.38<br />
Nigeria 103.91 120 16.94 14.15 6.84 24.5 0.02<br />
Ruanda 6.4 1 0.56 0.4 0.13 0.92 -<br />
Sambia 8.98 21.5 3.27 0.07 0.29 0.57 -<br />
Sao Tomé u. Prin. 0.13 4<br />
Anhang: Tabellen<br />
- 0 0 0 0 -<br />
Senegal 8.47 36 2.8 4.5 0.33 3.25 0.01<br />
Seychellen 0.07 - 0 - 0.02 0 -<br />
Sierra Leone 4.2 6 0.36 0.3 0.05 0.18 -<br />
Simbabwe 11.01 12.5 4.33 0.54 0.28 2.62 -<br />
Somalia 9.49 3 4.73 12 0.01 12.5 6.1<br />
Südafrika 41.46 42 12.7 28.95 1.54 6.46 -<br />
Sudan 26.71 35 21.78 27.51 - 16.5 3<br />
Swasiland 0.9 1 0.61 0.03 0.03 0.44 -<br />
Tansania 29.65 26.33 13.35 3.91 0.34 9.68 -<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 556
Land Einwohner 1 Hühner Rinder Schafe Schweine Ziegen 2<br />
Kamele 3<br />
Togo 4.09 6 0.25 1.23 0.89 1.64 -<br />
Tschad 6.45 4 4.56 4.24 0.02 3.27 0.61<br />
Tunesien 8.99 39 0.69 7.11 0.01 1.2 0.23<br />
Uganda 19.17 20 5.17 1.87 0.89 3.5 -<br />
Westsahara - - - - - 0.17 0.1<br />
Ztrlafr. Republik 3.28 3 2.79 0.15 0.48 1.98 -<br />
Welt 12'175 1'292.07 1'091.36 881.83 - -<br />
1 Daten von 1995<br />
2 nach Angaben FAOSTAT, 1998 für 1995<br />
3 nach Angaben FAOSTAT, 1998 für 1995<br />
4 Angabe aus Encarta Weltatlas 97<br />
8.1.22 Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion in Afrika<br />
Die Tabelle zeigt, dass je nach Land gänzlich verschiedenen Anbauprodukte den Hauptbeitrag zur Ernährung<br />
der Bevölkerung leisten. Dies ist einer der Gründe, warum ein Vergleich zwischen afrikanischen Staaten und<br />
den Industrienationen nur bedingt möglich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten afrikanische Staa-<br />
ten nur über unzureichende Informationen über die tatsächlich erwirtschafteten Ertragsmengen verfügen, die<br />
Daten also oft auf groben Schätzungen beruhen.<br />
Tabelle: Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion 1995 (in 1000 t)<br />
nach Angaben der FAO, FAOSTAT 1998<br />
Land Weizen,<br />
Gerste<br />
Reis Mais Andere 1 Hirse Sorghum Erdnuss 2 Kassawa Yams<br />
Ägypten 6'090.74 4'788.10 4'535.18 661.24 130.64<br />
Algerien 2'084.90 1.50 0.42 53.10 0.38 3.09<br />
Angola 5.00 23.00 211.00 61.00 22.00 2'400.00<br />
Äquatorialguinea 47.00<br />
Äthiopien 3'067.00 2'500.00 1'752.00 248.00 1'600.00 55.00 264.00<br />
Benin 18.54 597.32 1.43 22.06 107.68 103.34 1'342.59 1'258.57<br />
Botswana 0.90 5.00 2.20 38.20 0.30<br />
Burkina Faso 84.03 212.49 11.81 733.70 1'266.36 213.30 2.00 40.00<br />
Burundi 8.93 26.82 153.02 14.43 65.84 12.64 501.00 7.94<br />
Dem. Rep. Kongo 9.30 441.00 1'225.00 38.69 52.00 598.00 19'378.00 299.00<br />
Djibouti 0.01<br />
Elfenbeinküste 1'045.45 792.00 12.00 56.00 25.00 147.00 1'641.00 1'701.00<br />
Eritrea 38.28 7.83 9.01 30.00 67.96 1.50<br />
Gabun 0.80 29.00 15.92 215.36 130.00<br />
Gambia 18.95 13.63 54.02 11.87 75.18 6.00<br />
Ghana 201.72 1'034.30 200.80 360.00 168.20 6'611.50 2'125.70<br />
Guinea 630.51 339.28 103.03 7.64 4.87 132.08 601.30 95.00<br />
Guinea-Bissau 133.27 15.34 2.00 34.70 15.53 18.00 14.72<br />
Anhang: Tabellen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 557
Land Weizen,<br />
Gerste<br />
Reis Mais Andere 1 Hirse Sorghum Erdnuss 2 Kassawa Yams<br />
Kamerun 0.40 62.00 654.00 66.00 460.00 100.00 1'400.00 110.00<br />
Kap Verde 8.17 3.20<br />
Kenia 373.00 60.00 2'699.00 4.00 40.00 94.00 11.00 840.00<br />
Komoren 17.00 3.71 49.00<br />
Kongo 0.95 21.00 26.00 790.00 13.00<br />
Lesotho 11.10 62.53 1.00<br />
Liberia 56.20 15.00 6.89 4.20 240.00 20.00<br />
Libyen 315.00 0.53 2.20 12.50<br />
Madagaskar 14.00 2'450.00 177.00 1.00 30.00 2'400.00<br />
Malawi 1.83 52.08 1'661.46 17.94 44.75 31.73 190.00<br />
Mali 6.15 426.60 286.08 22.28 815.05 807.31 166.18 1.22 11.00<br />
Marokko 1'698.40 3.47 50.49 21.58 8.00 2.53 14.24<br />
Mauretanien 0.70 54.00 1.00 8.00 156.50 1.80 2.50<br />
Mauritius 0.29 1.05 0.14<br />
Mosambik 2.00 112.98 734.00 35.00 243.00 1.02 4'178.00<br />
Namibia 2.70 13.10 37.10 4.00<br />
Niger 5.62 69.18 1.29 0.50 1'769.33 265.66 111.09 225.00<br />
Nigeria 43.60 2'920.00 7'623.00 58.00 4'952.00 6'184.00 1'579.00 31'404.00 22'818.00<br />
Ruanda 5.77 2.12 70.73 1.00 72.28 7.50 150.00 4.00<br />
Sambia 50.40 11.70 737.84 54.50 26.52 36.12 520.00<br />
São Tomé u. Princ. 3.00 2.50 1.10<br />
Senegal 155.15 106.51 3.58 666.80 127.33 790.62 55.52<br />
Seychellen 0.15<br />
Sierra Leone 355.50 7.70 2.00 23.80 21.80 35.80 219.20<br />
Simbabwe 96.00 0.40 839.60 0.40 21.16 29.48 52.30 150.00<br />
Somalia 1.00 2.00 146.00 136.00 3.00 45.00<br />
Südafrika 2'177.25 3.00 4'866.00 38.57 13.00 290.56 117.29<br />
Sudan 448.00 1.80 53.50 385.00 2'450.00 738.00 9.00 125.00<br />
Swasiland 0.45 1.00 76.05 1.43 4.71<br />
Tansania 58.00 722.70 2'594.10 411.00 838.80 72.00 5'968.80 10.00<br />
Togo 33.30 290.43 3.07 51.20 172.32 35.09 602.21 530.50<br />
Tschad 2.64 78.98 62.90 97.71 227.74 437.45 292.58 267.74 240.00<br />
Tunesien 611.10 10.70 1.00<br />
Uganda 9.00 77.00 913.00 632.00 399.00 144.00 2'224.00<br />
Westsahara 2.40<br />
Anhang: Tabellen<br />
Zentralafr. Republik 8.68 70.82 10.00 23.00 85.54 491.60 320.00<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 558
Land Weizen,<br />
1 Hafer, Buchweizen, Fonio, u.a.<br />
2 Gewicht mit Schale<br />
Gerste<br />
8.1.23 Landwirtschaftliche <strong>Pro</strong>duktion Tansanias<br />
Reis Mais Andere 1 Hirse Sorghum Erdnuss 2 Kassawa Yams<br />
Diese Tabelle soll anhand des Beispiellandes Tansania zeigen, wie sich die <strong>Pro</strong>duktion bestimmter Exportgüter<br />
im Laufe der Zeit verändern kann.<br />
Tabelle: Erzeugung agrarischer Exportprodukte in Tansania 1965 - 1990<br />
gekürzt, nach Engelhard: Tansania, 1994, S. 196<br />
<strong>Pro</strong>dukt / Jahr 1965 1970 1975 1985 1990<br />
Baumwolle (1000 t) 231 224 206 154 188.4<br />
Kaffee (1000 t) 44.3 44.6 52.1 49 59.7<br />
Sisal (1000 t) 214.2 202 128 32 41.6<br />
Tee (1000 t) 12.5 8.5 13.9 16 19.8<br />
Cashewnüsse (1000 t) 63.7 111.4 145 1<br />
32 22<br />
Tabak (1000 t) 11.3 11 14.2 13 12.2<br />
1 1.974<br />
8.1.24 Staatliche Gliederung Afrikas nach Erdkunde 1968<br />
Die Tabelle gibt die in "Erdkunde" 1968 gemachten Angaben zu den Staaten und Gebieten Afrikas Ende der<br />
sechziger Jahre wieder. (Siehe dazu auch die Besprechung des Lehrmittels ab der Seite 172 dieser Arbeit.)<br />
Tabelle: Staatliche Gliederung<br />
nach Erdkunde 1968<br />
Name Fläche in qkm Einwohner Einw.<br />
je qkm<br />
Äquatorialafrika und der Sudan<br />
Hauptstadt (E. in<br />
1000)<br />
Andere Städte (E. in<br />
1000)<br />
Kongo (Kinshasa) 2'345'000 16'000'000 7 Kinshasa 950 Lubumbashi 200<br />
Rep. Sudan 2'506'000 13'900'000 6 Khartum 110 Omdurman 200<br />
Zentralafr. Rep. 623'000 1'350'000 2 Bangi 77<br />
Tschad 1'284'000 3'400'000 3 Fort Lamy 50<br />
Kongo (Brazzaville) 342'000 900'000 3 Brazzaville 137<br />
Gabun 267'000 500'000 2 Libreville 31<br />
Kamerun 475'442 5'200'000 11 Jaunde 55 Duala 120<br />
Nigeria 923'768 57'500'000 62 Lagos 450 Ibadan 600, Kano 130<br />
Dahome 112'622 2'400'000 20 Porto Novo 32<br />
Togo 56'600 1'700'000 29 Lome 67<br />
Ghana 238'540 7'900'000 33 Akkra 350<br />
Elfenbeinküste 322'460 3'800'000 12 Abidjan 190<br />
Obervolta 274'200 5'000'000 18 Wagadugu 50<br />
Niger 1'267'000 3'400'000 3 Niamey 30<br />
Liberia 111'370 1'100'000 10 Monrovia 80<br />
Sierra Leone 71'740 2'400'000 33 Freetown 128<br />
Guinea 245'860 3'600'000 15 Konakry 115<br />
Anhang: Tabellen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 559
Name Fläche in qkm Einwohner Einw.<br />
je qkm<br />
Hauptstadt (E. in<br />
1000)<br />
Mali 1'201'600 4'700'000 4 Bamako 120<br />
Senegal 196'190 3'500'000 18 Dakar 367<br />
Gambia 11'290 300'000 30 Bathurst 28<br />
Abhängige Gebiete:<br />
Span.-Guinea 28'050 300'000 10 Bata 27<br />
Port -Guinea 36'125 600'000 15 Sao Jose de Bissao 19<br />
Ostafrika<br />
Andere Städte (E. in<br />
1000)<br />
Äthiopien 1'222'000 23'000'000 19 Addis Abeba 450 Asmara 130<br />
Somalia 638'000 2'500'000 4 Mogadischa 90<br />
Tanganjika 937'000 10'400'000 11 Daressalam 140 Tabora 30<br />
Sansibar 2'650 340'000 129 Sansibar 60<br />
Uganda 236'000 7'700'000 33 Entebbe 10<br />
Ruanda 26'000 3'100'000 118 Kigale 35<br />
Burundi 28'000 3'300'000 118 Usumbura 50<br />
Kenia 583'000 9'600'000 17 Nairobi 245<br />
Franz -Somaliland 22'000 80'000 4 Dschibuti 41<br />
Südafrika<br />
Republik Südafrika 1'223'000 18'300'000 15 Kapstadt 810 Johannesbg. 1150<br />
Botswana 570'000 576'000 1 Gaberones 6<br />
Lesotho (Basutoland) 30'000 860'000 28 Maseru 6<br />
Ngwana (Swasiland) 17'000 389'000 22 Mbabane 10<br />
Zambia 753'000 3'800'000 5 Lusaka 90<br />
Malawi 120'000 4'000'000 34 Zomba 8<br />
Abhängige Gebiete:<br />
Rhodesien 389'000 4'300'000 11 Salisbury 320<br />
(Südrhodesien) 28'000 3'300'000 118 Usumbura 50<br />
Südwestafrika 824'000 600'000 1 Windhuk 40<br />
Angola 1'246'000 5'100'000 4 Luanda 190<br />
Mosambik 783'000 6'900'000 9 Lourenço Marques<br />
100<br />
Anhang: Tabellen<br />
Pretoria 423<br />
Durban 681<br />
Port Elizabeth 425<br />
East London 116<br />
Kimberley 80<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 560
8.1.25 Entwicklung der Bevölkerungszahlen<br />
Die Tabelle gibt in Fünfjahresabständen Auskunft über die Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen afrika-<br />
nischen Staaten seit 1961.<br />
Tabelle: Geschätze Bevölkerungszahlen (in Mio.)<br />
Angaben nach FAO, FAOSTAT 1998<br />
Anhang: Tabellen<br />
Land 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995<br />
Ägypten 28.55 31.56 35.29 38.84 43.75 49.75 56.31 62.10<br />
Algeria 11.01 11.92 13.75 16.02 18.74 21.89 24.94 28.11<br />
Angola 4.89 5.18 5.59 6.12 7.02 8.00 9.23 10.82<br />
Äquatorialguinea 0.26 0.27 0.29 0.23 0.22 0.31 0.35 0.40<br />
Äthiopien 24.74 27.15 30.62 34.31 38.75 43.83 51.02 56.40 1<br />
Benin 2.27 2.43 2.71 3.05 3.46 4.03 4.68 5.41<br />
Botswana 0.49 0.55 0.64 0.76 0.91 1.08 1.27 1.45<br />
Burkina Faso 4.54 4.87 5.42 6.11 6.91 7.88 9.98 10.48<br />
Burundi 2.99 3.21 3.51 3.68 4.13 4.75 5.49 6.06<br />
Dem. Rep. Kongo 15.74 17.56 20.27 23.25 27.01 31.69 37.41 45.45<br />
Djibouti 0.09 0.11 0.15 0.21 0.28 0.39 0.52 0.60<br />
Elfenbeinküste 3.93 4.53 5.52 6.76 8.19 9.89 11.68 13.69<br />
Eritrea 3.17<br />
Gabun 0.49 0.50 0.50 0.59 0.69 0.80 0.94 1.08<br />
Gambia 0.36 0.40 0.46 0.54 0.64 0.75 0.92 1.11<br />
Ghana 6.99 7.83 8.62 9.84 10.81 12.84 15.02 17.34<br />
Guinea 3.20 3.49 3.90 4.15 4.46 4.99 5.76 7.35<br />
Guinea-Bissau 0.54 0.52 0.53 0.63 0.80 0.87 0.96 1.07<br />
Kamerun 5.40 5.88 6.61 7.53 8.65 9.98 11.48 13.19<br />
Kap Verde 0.20 0.23 0.27 0.28 0.29 0.31 0.34 0.39<br />
Kenia 8.59 9.75 11.50 13.74 16.63 19.87 23.48 27.15<br />
Komoren 0.22 0.24 0.28 0.32 0.38 0.45 0.52 0.61<br />
Kongo 1.01 1.11 1.26 1.45 1.67 1.92 2.23 2.59<br />
Lesotho 0.89 0.96 1.06 1.19 1.37 1.56 1.78 2.03<br />
Liberia 1.07 1.20 1.39 1.61 1.88 2.20 2.58 2.12<br />
Libyen 1.40 1.62 1.99 2.45 3.04 3.79 4.55 5.41<br />
Madagaskar 5.51 6.10 6.86 7.78 9.07 10.67 12.64 14.87<br />
Malawi 3.61 3.98 4.52 5.24 6.18 7.25 9.33 9.67<br />
Mali 4.48 4.92 5.48 6.17 6.86 7.92 9.21 10.80<br />
Marokko 11.95 13.32 15.31 17.31 19.38 21.65 24.04 26.52<br />
Mauretanien 1.01 1.10 1.22 1.37 1.55 1.77 2.00 2.27<br />
Mauritius 0.68 0.75 0.83 0.89 0.97 1.02 1.06 1.12<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 561
Land 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995<br />
Mosambik 7.62 8.34 9.40 10.50 12.10 13.54 14.18 17.26<br />
Namibia 0.64 0.70 0.79 0.90 1.03 1.18 1.35 1.54<br />
Niger 3.14 3.66 4.17 4.77 5.59 6.61 7.73 9.15<br />
Nigeria 43.52 48.68 55.07 62.77 72.02 83.07 96.15 111.72<br />
Ruanda 2.82 3.18 3.73 4.38 5.16 6.05 6.95 5.18<br />
Sambia 3.23 3.61 4.19 4.84 5.74 6.41 7.22 8.08<br />
São Tomé u. Princ. 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13<br />
Senegal 3.27 3.63 4.16 4.81 5.54 6.38 7.33 8.31<br />
Seychellen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07<br />
Sierra Leone 2.28 2.43 2.66 2.93 3.24 3.59 4.00 4.20<br />
Simbabwe 3.93 4.47 5.26 6.14 7.13 8.39 9.86 11.19<br />
Somalia 3.87 4.24 4.79 5.47 6.71 7.88 8.62 9.49<br />
Südafrika 17.86 19.83 22.46 25.67 29.17 33.04 37.07 41.47<br />
Sudan 11.39 12.36 13.86 16.01 18.68 21.46 24.06 26.71<br />
Swasiland 0.33 0.37 0.42 0.48 0.56 0.65 0.74 0.86<br />
Tansania 10.50 11.78 13.69 15.90 18.58 21.78 25.48 30.03<br />
Togo 1.53 1.63 2.02 2.29 2.62 3.03 3.52 4.09<br />
Tschad 3.11 3.33 3.65 4.03 4.48 5.02 5.55 6.34<br />
Tunesien 4.30 4.63 5.13 5.67 6.45 7.33 8.16 8.99<br />
Uganda 6.82 8.95 9.81 11.18 13.12 14.76 16.65 19.69<br />
Westsahara 0.04 0.05 0.08 0.08 0.14 0.17 0.21 0.25<br />
Zentralafr. Republik 1.56 1.68 1.85 2.06 2.31 2.60 2.93 3.27<br />
Total aller aufgeführten Länder 288.97 320.91 363.66 413.44 475.21 547.22 629.67 718.85<br />
1 ohne Eritrea<br />
Anhang: Tabellen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 562
8.2 Karten<br />
Die in diesem Anhang abgebildeten Karten, setzen teilweise die im Tabellenteil gemachten Aussagen grafisch<br />
um und sollen einen raschen Überblick über die Situation Schwarzafrikas Ende des 20. Jahrhunderts bieten. Da<br />
diese Karten farbig gestaltet wurden, können Farbkopien davon auch als Folien für den Hellraumprojektor im<br />
Unterricht Verwendung finden.<br />
8.2.1 Die europäischen Kolonien in Afrika von 1914<br />
Nachdem die europäischen Kolonisatoren den grössten Teil des afrikanischen Kontinentes erobert hatten, erga-<br />
ben sich nach Ende des Ersten und des Zweiten Weltkrieges weitere Veränderungen in der politischen Karte<br />
Afrikas.<br />
[Karte in der Datei KARTE01.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 563
8.2.2 Afrikakarten aus Schweizer Schulatlanten<br />
Die Afrikakarten ermöglichen einen Vergleich der Darstellung von Karten in den Schweizerischen Schulatlan-<br />
ten von 1950, 1962 und 1981. Neben der sich wandelnden Betrachtungsweise, zeigen die Karten auch einige<br />
der Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent nach.<br />
[Karte in der Datei KARTE02.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 564
8.2.3 Erlangung der Unabhängigkeit<br />
In der Karte wird für Simbabwe als Unabhängigkeitsjahr 1960 angegeben, da sich damals die weisse Regie-<br />
rung von Grossbritannien lossagte, diese wurde aber erst 1980, als die schwarze Mehrheit gleiche politische<br />
Rechte erlangte wie die weisse Minderheit, international anerkannt. Südafrika wird erst seit 1994 von einem<br />
Präsidenten und Parlament regiert, die von allen Bevölkerungsteilen gewählt werden konnte.<br />
[Karte in der Datei KARTE03.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 565
8.2.4 Einteilung Afrikas nach dem Fünf-Welten-System<br />
Nach der Erkenntnis, dass die Aufteilung in eine Erste, Zweite und Dritte Welt, den Unterschieden zwischen<br />
den Entwicklungsländern nicht genügend Rechnung trug, wurde das Fünf-Welten-System entworfen, welches<br />
die Entwicklungsländer in Schwellenländer (Dritte Welt), rohstoffreiche Entwicklungsländer (Vierte Welt)<br />
und rohstoffarme Entwicklungsländer (Fünfte Welt) aufteilte. Diese Aufteilung wurde später zugunsten ande-<br />
rer Unterscheidungskriterien aufgegeben.<br />
[Karte in der Datei KARTE04.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 566
8.2.5 Sicherheitssituation in den afrikanischen Staaten<br />
Die Karte gibt die sicherheitspolitische Situation der Staaten Afrikas für den Sommer 1998 wieder. Die Beur-<br />
teilung der Länder basiert neben verschiedenen anderen Quellen vor allem auf den Reisehinweise des Auswär-<br />
tigen Amtes in Deutschland. Länder geringer und mittlerer Kriminalität, sowie mit punktuellen Unruhen<br />
beeinträchtigen weder die Sicherheit der Reisenden noch der einheimischen Bevölkerung nachhaltig. In Südaf-<br />
rika hingegen hat die hohe Kriminalitätsrate zur Auswanderung von Mitgliedern vor allem weisser Bevölke-<br />
rungsschichten geführt. Die Unruhen vom September 1998 in Lesotho fanden in der Karte keine Berücksichti-<br />
gung mehr.<br />
[Karte in der Datei KARTE05.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 567
8.2.6 Bevölkerungsdichte<br />
Die Karte zur Bevölkerungsdichte vermittelt einen groben Überblick über die Verteilung der Bevölkerung in<br />
Afrika, dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese innerhalb eines Landes stark ausdifferenziert sein kann,<br />
besonders dann, wenn ein Land mehrere Klimaregionen umfasst, was für viele der Staaten der Fall ist.<br />
[Karte in der Datei KARTE06.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 568
8.2.7 Bruttosozialprodukt pro Kopf<br />
Die Karte zum BSP pro Kopf gibt das durchschnittliche <strong>Pro</strong>-Kopf-Einkommen in US-Dollar von 1995 für die<br />
einzelnen afrikanischen Staaten wieder. Beim Vergleich zwischen den verschiedenen Ländern ist zu berück-<br />
sichtigen, dass das BSP wegen der schlechten Erfassung der Subsistenzwirtschaft oft gerade bei ärmeren Staa-<br />
ten wenig Aufschluss über die tatsächliche Lebensqualität der Bevölkerung aussagt. Auch die Kaufkraft einer<br />
Geldeinheit und die Verteilung der Einkommen auf die verschiedenen Bevölkerungsschichten haben einen<br />
Einfluss auf die der Mehrheit einer Bevölkerung zur Verfügung stehenden Mittel.<br />
[Karte in der Datei KARTE07.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 569
8.2.8 Abhängigkeit von Exportprodukten<br />
Die meisten afrikanischen Staaten erwirtschaften ihre Devisen durch den Verkauf weniger Exportgüter Die<br />
Karte zeigt in den Kreisdiagrammen, welche Gütergruppen für die einzelnen Länder besonders wichtig sind.<br />
Da in den Gruppen nur jeweils wenige Einzelprodukte berücksichtigt wurden, kann der tatsächliche Anteil<br />
noch höher liegen, wird allerdings nicht allzusehr vom vermittelten Bild abweichen.<br />
Die in den einzelnen Exportgruppen zusammengefassten Güter sind aus der gleichnamigen Tabelle, die weiter<br />
vorne in der Arbeit abgedruckt wurde, ersichtlich.<br />
[Karte in der Datei KARTE08.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 570
8.2.9 Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika<br />
Die Karte gibt einen Überblick über die Analphabetenrate unter den Mädchen Schwarzafrikas, die für fast alle<br />
Länder Afrikas über denen der Knaben liegt. Besonders in den Staaten die Anteil an der Sahelzone haben und<br />
die teilweise von traditionellen Gesellschaften geprägt werden, in denen die Rollenverteilung zwischen Mann<br />
und Frau stark ausgeprägt ist, besuchen nur wenige Mädchen einen Schulunterricht.<br />
[Karte in der Datei KARTE09.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 571
8.2.10 Offizielle Amtssprachen<br />
Die Karte zeigt, dass sich für die Wahl der offiziellen Amtssprachen der meisten schwarzafrikanischen Staaten<br />
die Kolonialzeit als ausschlaggebend erwies. Nur wenige Staaten benutzen auch afrikanische Sprachen für<br />
Verwaltungszwecke. Diese sind: Äthiopien (Amharisch), Burundi (Ki-Rundi), Eritrea (Amharisch), Kenia<br />
(Swahili), Lesotho (Sotho), Madagaskar (Madagassisch), Malawi (Chichewa), Ruanda (Kinyarwanda),<br />
Seychellen (Kreolisch), Swasiland (Simbwati) und Tansania (Swahili).<br />
[Karte in der Datei KARTE10.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 572
8.2.11 Ethnische Differenzierung der schwarzafrikanischen Länder<br />
Die Karte zur ethnischen Differenzierung gibt Auskunft über die Anzahl der Volksgruppen eines Landes,<br />
welche einen Anteil von mehr als 10% der Gesamtbevölkerung ausmachen, sowie den Anteil der grössten<br />
Gruppe an der gesamten Bevölkerung. Auffallend ist, dass insbesondere in West-, Zentral- und Ostafrika die<br />
grössten Bevölkerungsgruppen in einem Land nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an der Gesamtbevölke-<br />
rung ausmachen. Die Republik Südafrika stellt insofern einen Spezialfall dar, weil die offizielle Statistik nicht<br />
zwischen den verschiedenen Volksgruppen der schwarzen Bevölkerung unterscheidet, sondern diese als eine<br />
einzige Gruppe aufführt.<br />
[Karte in der Datei KARTE11.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 573
8.2.12 Religionszugehörigkeit<br />
Die in der Karte visualisierten Angaben, die sich auf 100% aufsummieren (nach CIA 1996), sind mit Vorsicht<br />
zu betrachten, da in vielen schwarzafrikanischen Staaten eine Person nicht eindeutig einer Religion zugeordnet<br />
werden kann, denn oft praktizieren Schwarzafrikaner neben einer übernommenen Religion wie dem Christen-<br />
tum oder dem Islam ihren traditionellen Glauben. Ausserdem sind die Statistiken aus schwarzafrikanischen<br />
Ländern oft ungenau oder beruhen auf alten Erhebungen, die nicht mehr aktuell sind.<br />
[Karte in der Datei KARTE12.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 574
8.2.13 Verfügbares Trinkwasser<br />
Die Karte gibt die berechnete <strong>Pro</strong>-Kopf-Verfügbarkeit von erneuerbarem Wasser der afrikanischen Staaten<br />
bezogen auf die Bevölkerung von 1990 wieder (nach Geo 6/1993, S. 55) und zeigt auf, welche Länder nur über<br />
eine knappe theoretische Wasserversorgung (weniger als 2000 qm) verfügen. In der Praxis kann diese Wasser-<br />
menge für den einzelnen weit geringer ausfallen, so dass besonders die Stadtbevölkerung für die Wasserversor-<br />
gung durch private Händler weit mehr bezahlen muss, als der Staat für die gleiche Wassermenge aus der<br />
öffentlichen Versorgung verlangt.<br />
[Karte in der Datei KARTE13.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 575
8.2.14 Holzverbrauch ausgewählter schwarzafrikanischer Länder<br />
Das im Bau, Handwerk und für den Export verwendete Rundholz, macht nur einen kleinen Teil des Holzver-<br />
brauches schwarzafrikanischer Länder aus, die einen Grossteil ihres Energiebedarfes mit Brennholz oder Holz-<br />
kohle decken. (Zahlenangaben finden sich in der gleichnamigen Tabelle im Tabellenteil des Anhangs dieser<br />
Arbeit.)<br />
[Karte in der Datei KARTE14.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 576
8.2.15 Das neue Bild Afrikas: Der Aidskontinent<br />
Nach Angaben der UNAIDS betrug die Zahl der HIV-Infizierten in Afrika südlich der Sahara rund 21 Millio-<br />
nen (weltweit insgesamt 31 Millionen) Menschen. Damit ist Schwarzafrika dasjenige Gebiet, welches sowohl<br />
relativ als auch absolut gesehen am meisten Aidserkrankungen zu erwarten hat. Hinzu kommt, dass in grossen<br />
Teilen Schwarzafrikas die Infektionsraten noch immer ansteigen. (Die Zeit 25.06.98, S. 34)<br />
[Karte in der Datei KARTE15.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 577
8.2.16 Aussergewöhnliche Nahrungsmittelknappheit in afrikanischen Ländern<br />
Die Karte nach Angaben der FAO zeigt die Nahrungsmittelsitutation in den afrikanischen Ländern für 1997<br />
und 1998. Die hauptsächlichen Gründe für die Nahrungsmittelknappheit in den einzelnen Ländern - Bevölke-<br />
rungsverschiebungen (zumeist Flüchtlinge), Unruhen (Aufstände, Bürgerkriege) und deren Auswirkungen,<br />
schlechtes Wetter (zu viel oder zu wenig Niederschläge oder ungünstige Niederschlagsverteilung - werden<br />
durch entsprechende Symbole angegeben. Weitere Ursachen liegen in der Erschöpfung von Vorräten, schlech-<br />
ten Ernten und Wirtschaftssanktionen. (FAO/GIEWS 1997, 1998)<br />
[Karte in der Datei KARTE16.PDF]<br />
Anhang: Karten<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 578
8.3 Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Dieser Teil des Anhangs enthält Tagesabläufe und Ausschnitte aus typischen Lebenssituationen von Schwarz-<br />
afrikanern, die einen Einblick in das tägliche Leben der Menschen Schwarzafrikas ermöglichen und als Hinter-<br />
grundinformation bei der Nachvollziehung der Bewertung gewisser in den besprochenen Lehrmitteln gemach-<br />
ten Aussagen dienen sollen.<br />
8.3.1 Die Aufgaben der Frau im schwarzafrikanischen Alltag<br />
Bis in die achtziger Jahre fand die schwarzafrikanische Frau, wenn nicht gerade, wie in den sechziger Jahren<br />
auch in der Schweiz, das nigerianische Staatsballet mit barbusigen Tänzerinnen die Aufmerksamkeit der<br />
männlichen Bevölkerung der Industriestaaten, die sich so einen "Einblick" in die Kultur eines "Negerstaates"<br />
verschaffen wollten, auf sich zog, wenig Beachtung. In den achtziger Jahren aber begann das Interessen an der<br />
Rolle und der Aufgabe der schwarzafrikanischen Frau in ihrer Gesellschaft zu wachsen. Die Motivation dafür<br />
hatte vielfältige Gründe, die von der "Befreiung" der "unterdrückten" Schwarzafrikanerinnen aus der ihr zuge-<br />
schriebenen traditionellen Rolle, eine erneute Form eines Zivilisierungsversuches, bis hin zur Erkenntnis, dass<br />
Schwarzafrikanerinnen bei der Erziehung ihrer Kinder eine entscheidende Rolle spielen, und sich damit als<br />
Primärziel für diverse Entwicklungshilfeprojekte anbieten, sowie für den Grossteil der landwirtschaftlichen<br />
Agrarproduktion verantwortlich zeichnen, wodurch sie sich als Bevölkerungsgruppe für das Stopfen der "Hun-<br />
gerbäuche" Afrikas besonders zu eignen scheinen, reichte.<br />
8.3.1.1 One woman's day in Sierra Leone<br />
Der Tagesablauf einer Schwarzafrikanerin aus Sierra Leone, nach Angaben der FAO, zeigt nicht nur die grosse<br />
Arbeitsbelastung und den langen Arbeitstag, die für die Subsistenzproduktion in Schwarzafrika typisch sind, er<br />
soll auch dazu dienen, einen Vergleich mit den in einigen Lehrmitteln gemachten Angaben zu ermöglichen<br />
(FAO-Factfile, 1996):<br />
04:00 to 05:30 fish in local pond<br />
06:00 to 08:00 light fire, heat washing water, cook breakfast, clean dishes, sweep compound<br />
08:00 to 11:00 work in rice fields with four-year-old son and baby on back<br />
11:00 to 12:00 collect berries, leaves and bark, carry water<br />
12:00 to 14:00 process and prepare food, cook lunch, wash dishes<br />
14:00 to 15:00 wash clothes, carry water, clean and smoke fish<br />
15:00 to 17:00 work in the gardens<br />
17:00 to 18:00 fish in local pond<br />
18:00 to 20:00 process and prepare food, cook dinner<br />
20:00 to 21:00 clean dishes, clean children<br />
21:00 to 23:00 converse around fire while shelling seeds and making fishnets<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 579
8.3.1.2 Die Rolle der Frau bei den Joruba<br />
Die Yoruba, die etwa einen Fünftel der nigerianischen Bevölkerung ausmachen, leben vor allem im Süden<br />
Nigerias und Benins. Der folgende Text stammt aus dem zweibändigen Werk "Afrika", das 1983 in der<br />
10. Auflage erschien (Afrika 1983):<br />
"Die Joruba betreiben Ackerbau (etwa 3/4), sind Händler oder leben als Handwerker oder Angestellte. Sie sind<br />
Städter; Südwestnigeria war und ist ein Land der grossen Städte und Märkte. Europäische Technologie wurde<br />
übernommen, aber traditionelle Rollen wurden nicht unbedingt aufgegeben, sondern nach Bedürfnissen der<br />
Gesellschaft modifiziert.<br />
Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Jorubafrauen ist ungewöhnlich gross. Während in weiten Teilen Afri-<br />
kas Frauen einen grossen Teil der Feldarbeit ausführen, arbeiten Jorubafrauen nicht auf den Feldern ihrer<br />
Männer, sondern betreiben ein eigenes Handwerk (Töpferei, Spinnen, Färben, Weben, Nähen), verkaufen<br />
<strong>Pro</strong>dukte auf den Märkten, sind Händlerinnen und manchmal selbständige Unternehmerinnen, die sich in Inter-<br />
essenverbänden organisieren. Die meisten Frauen verdienen genug, um ihre eigenen Kleider zu kaufen und<br />
einen Teil der Nahrung für sich und ihre Kinder zu finanzieren. Viele sind von ihrem Ehemann finanziell<br />
völlig unabhängig, manche sind sogar wohlhabender als ihre Männer. Sie investieren ihren Gewinn in Immobi-<br />
lien oder erweitern ihren Handel oder ihr Gewerbe, während die Männer nach Ansehen und politischem Erfolg<br />
streben. Der Status einer Jorubafrau hängt nicht so sehr vom Status ihres Mannes ab, sondern von ihrer eigenen<br />
Stellung z. B. in der Marktgilde oder dem Klub, dem sie angehört. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit garan-<br />
tiert ihr Sicherheit bei einer Scheidung.<br />
Die Ehen sind polygam (ein Mann hat durchschnittlich zwei Frauen). Jede Frau hat einen eigenen Raum; dort<br />
schläft sie mit ihren kleinen Kindern und bewahrt ihren Besitz auf. Sie kocht für die Kinder und im Wechsel<br />
mit den anderen Frauen für den Mann. Mann und Frau essen nicht zusammen, die Frau serviert ihm das Essen<br />
in gebeugter Haltung. Sie trägt die Hauptlast der Kinderversorgung und -erziehung. Innerhalb der Familie<br />
kommt der Frau die Rolle der Ernährerin zu, dem Mann die des Erzeugers. Väter zeigen ihren Kindern gegen-<br />
über eher Distanz, Härte und Strenge<br />
Mütter sind nachsichtig. Es sind die Frauen, die sich um das Fortkommen ihrer Kinder bemühen, sie zur Schu-<br />
le schicken und manchmal ein Studium im Ausland finanzieren. Bei aller Selbständigkeit demonstrieren sie<br />
jedoch nach aussen hin Gehorsam und Unterwürfigkeit gegenüber dem Mann...."<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 580
8.3.2 Das Leben auf dem Land<br />
Nach wie vor leben die meisten Menschen Schwarzafrikas auf dem Land, meist in dörflichen Strukturen, wo<br />
sie ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft erzielen, sei dies durch reine Subsistenzproduktion oder den<br />
Anbau von Cash crops für den Export. Obwohl auch auf dem Land der westliche Einfluss, beispielsweise in<br />
der Form eines Fernsehgerätes oder der allgegenwärtigen Markenprodukte, längst Einzug gehalten hat, die<br />
Kinder allenfalls die Schule besuchen, bleiben doch die überlieferten Traditionen und Strukturen von grosser<br />
Bedeutung.<br />
8.3.2.1 Kakaoernte bei Adwoa Addae<br />
Dieser Text nach Eschenhagen, 1990, aus Schmidt-Kallert, 1994, S. 94 soll einerseits einen Vergleich mit den<br />
in den Lehrmitteln zu diesem Thema abgedruckten Texten ermöglichen, andererseits auch helfen, das von den<br />
Lehrmitteln vermittelte stereotype Bild des "Kakaobauern in Ghana" - der Mann ist für die Cash crops zustän-<br />
dig, während die Frau die Familie ernährt - aufzubrechen, da dieses längst einer weiter komplexeren Wirklich-<br />
keit gewichen ist:<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Adwoa Addae lebt als Bäuerin in einem kleinen Dorf im ghanaischen Regenwaldgebiet. Sie besitzt neben Feldern, auf<br />
denen reine Nahrungspflanzen wie Kochbananen, Maniok und Cocoyam wachsen, auch eine einen Hektar grosse<br />
Kakaopflanzung. Die kleinbäuerliche Anbauweise von Kakao ist typisch für Ghana. von der Strasse aus führt ein kleiner,<br />
versteckter Fusspfad zu Adwoa Addaes Kakaopflanzung. Auch alle anderen Bauern haben hier Kakaopflanzungen. Die<br />
Grenzen zwischen den Kulturen der einzelnen Bauern kann man an unregelmässig angelegten Reihen von Sisalsträuchern<br />
erkennen. Die Kakaopflanzungen sehen aus wie Sekundärwald; der Stockwerkaufbau des ungestörten tropischen Waldes<br />
ist ansatzweise noch erhalten. Kapokbäume, Kolabäume und Ölpalmen überragen die Kakaobüsche. Der Schatten, der<br />
durch den Baumüberbau entsteht, ist wichtig für das Wachstum der Kakaopflanzen, er hilft, die Bodenfruchtbarkeit zu<br />
erhalten und schützt gegen Erosion. Adwoa Addae lebt in einem Hofhaus aus Lehm, wie sie für diese Gegend typisch sind.<br />
Es ist November, die Haupterntezeit für Kakao. Adwoa Addae arbeitet zusammen mit ihren beiden Töchtern, ihrem<br />
Schwiegersohn und der Nachbarsfamilie in der Kakaopflanzung. Alle helfen bei der Ernte. Kakao wird immer<br />
gemeinschaftlich geerntet.<br />
Nach vielen Stunden gönnen sich Adwoa Addae und ihre Helfer eine Ruhepause. Adwoa erklärt, was sie beim<br />
Kakaoanbau alles berücksichtigen muss:<br />
"Kakao mag keine Sonne. Wächst er in der Sonne, braucht er mehr Nährstoffe als im Schatten. Besonders die ganz jungen<br />
Pflanzen werden niemals allein gepflanzt und damit der Sonne ausgesetzt. Zuerst pflanzen wir immer Maniok und<br />
Kochbananen. Erst wenn diese Pflanzen gross genug sind, dass sie Schatten spenden, setzen wir die jungen<br />
Kakaopflanzen. Das hat übrigens auch noch einen anderen Vorteil: Maniok und Kochbananen sind unsere<br />
Grundnahrungsmittel; daraus machen wir Fufu für unser Abendessen. Später wird der Kakao von noch höheren Bäumen<br />
überschattet, z. B. dem Kolabaum.<br />
In der ersten Zeit, wenn die Bäume noch keine Früchte tragen, ist ausser dem Unkrautjäten nicht viel zu tun. Die<br />
eigentliche Arbeit beginnt erst, wenn die ersten Früchte wachsen.<br />
Im Juli und August muss ich gründlich Unkraut jäten. Auch das schaffe ich nicht alleine, da müssen meine Kinder<br />
mithelfen. Zum Jäten nehmen wir unser grosses Buschmesser. In dieser Zeit entdecken wir meist schon die ersten<br />
Kakaofrüchte an den Stämmen.<br />
Bei uns sind zwei Kakaoernten im Jahr möglich, eine grosse und eine kleine Ernte. Die grosse Erntezeit beginnt bei uns im<br />
Oktober und kann bis in den Januar hineinreichen. Dann im Juni und Juli haben wir noch einmal eine kleine Nebenernte.<br />
Zwischen Januar und Juli habe ich nichts auf der Kakaopflanzung zu tun. Dann kümmere ich mich mehr um die Felder, auf<br />
denen ich vor allem Kochbananen und Maniok anbaue.<br />
An der Farbe der Kakaofrüchte erkenne ich, ob die Frucht schon reif ist. Bei der Ernte schlagen wir die reifen Früchte mit<br />
unseren Buschmesser vom Stamm und tragen sie dann an einen Sammelplatz. Dort werden sie geöffnet. Wir lösen die<br />
Samen aus der Fruchtschale heraus und legen sie in Körbe aus Bananenblättern. Die Samen beginnen durch die Hitze zu<br />
fermentieren. Danach werden die fermentierten Samen auf Bambusmatten, die auf Holzstelzen aufliegen, dünn ausgelegt.<br />
Sie trocknen bei guter Sonne ca. eine Woche, bei weniger Sonne entsprechend länger. Ich wende die Samen immer wieder<br />
vorsichtig und suche dabei die faserigen Stränge zwischen den Samen heraus. Schliesslich werden die getrockneten Samen<br />
bis zum Verkauf in Säcken gelagert.<br />
Letztes Jahr habe ich während der Haupternte etwa 20 Säcke geerntet. In der Nebenernte kamen noch einmal 3 Säcke dazu.<br />
Ein Sack wiegt ungefähr 27 kg. Ich hatte zum Glück keinen Verlust durch die hier vorherrschende Kakaokrankheit, den<br />
,swollen shoot'.<br />
Die Fruchtschalen, ohne Samen, sind auch noch zu gebrauchen. Ich benutze sie als Dünger für mein Feld. Oft mache ich<br />
aber auch aus einem Teil der Schalen Seife. Dazu verbrenne ich die Fruchtschalen. Die Asche vermische ich mit anderen<br />
Stoffen, wie z. B. Wasser und Palmöl. Meine Schafe mögen die Schalen auch sehr gern. Verfüttere ich die Schalen, dann<br />
zerbreche ich sie in Stücke, trockne sie und mische sie dem anderen Futter bei. Das Fruchtfleisch zwischen den Samen<br />
schmeckt mir selbst übrigens sehr gut. Es ist sehr süss."<br />
Von der Strasse aus werden die Säcke später von Lieferwagen eingesammelt und in die Lagerhallen des Cocoa Marketing<br />
Board in Kumasi gebracht, wo die Ernte gewogen und verpackt wird. Der grösste Teil wird anschliessend zum Export in<br />
den Hafen Tema gebracht.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 581
8.3.2.2 Aktivitätspfade ghanaischer Familien<br />
Die Weg-Zeit-Diagramme geben Auskunft über die Aktivitätspfade von drei verschiedenen Familien in Ghana<br />
(nach Schmidt-Kallert 1994, S. 79-81). Eine genauere Beschreibung folgt auf der nächsten Seite.<br />
Bauernhaushalt (Amankwakrom, Ghana)<br />
km<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
km<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
km<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22<br />
Mann<br />
Frau<br />
W<br />
Lehrerhaushalt (Amankwakrom, Ghana)<br />
H<br />
F<br />
(normaler Arbeitstag)<br />
(normaler Arbeitstag)<br />
Frau (Markttag)<br />
Kind (Schultag)<br />
M<br />
L<br />
L U<br />
F<br />
F = Feldarbeit<br />
H = Haushalt<br />
K = Kirchenbesuch<br />
R = Ruhen<br />
U = Unterrichten<br />
W = Wasser holen<br />
L = Lernen M = Kauf u. Verkauf<br />
F<br />
H K H<br />
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22<br />
Bauernhaushalt (Adeembra, Ghana)<br />
F<br />
W W<br />
S<br />
H<br />
4 5<br />
C H<br />
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22<br />
M<br />
B<br />
F<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
W<br />
R F<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 582<br />
F<br />
H C
1. Bauernhaushalt (Amankwakrom):<br />
Der Familienvater macht sich bereits um 5.00 Uhr in der Frühe, also vor Sonnenaufgang, auf den Weg zu seinem Feld, auf<br />
dem er Maniok und Mais anbaut. Er arbeitet dort den ganzen Tag, hauptsächlich ist er mit Unkrautjäten beschäftigt.<br />
Zwischendurch erntet er einzelne Maniokknollen. Er kehrt erst gegen 19.00 Uhr, also nach Sonnenuntergang, ins Dorf<br />
zurück. Ihm bleibt nach der Feldarbeit nur sehr wenig Zeit für reproduktive Aktivitäten. Er isst das Abendessen, das seine<br />
Frau für ihn zubereitet hat, danach bleibt noch etwas Zeit für soziale Aktivitäten.<br />
Auch die Ehefrau hilft ihrem Mann bei der Feldarbeit. Nachdem sie am Vormittag die notwendigsten Hausarbeiten erledigt<br />
hat, begibt sie sich auf das Maniokfeld ihres Mannes. Am Nachmittag folgen die Schulkinder, um ebenfalls beim Jäten zu<br />
helfen. Der Weg vom Wohnstandort zum jeweiligen Feld ist die wichtigste Einzelaktivität im Zeitbudget des Haushaltes.<br />
Es ist auch der Weg, der im Laufe eines Tages, aber auch im Jahresverlauf am häufigsten zurückgelegt werden muss.<br />
Während der Vegetationsperiode sind - bezogen auf den ganzen Haushalt - drei oder mehr Wege zwischen Wohnstandort<br />
und Feld erforderlich. Die Distanz zwischen Dorf und Feld beträgt im hier dargestellten Fall 4,5 km. Das entspricht auch in<br />
etwa dem Durchschnittswert für alle Bauernhaushalte in Amankwakrom. Obwohl das absolut gesehen noch kein<br />
überlanger Weg ist (es gibt in Ghana Dörfer, in denen die Wege zu den gerade bewirtschafteten Feldern 10 km<br />
übersteigen), stellt diese Distanz schon ein erhebliches Hemmnis für die effektivere Ausnutzung der Arbeitskraft dar.<br />
Dabei muss man vor allem berücksichtigen, dass ausser dem Haushaltsvorstand kein anderes Familienmitglied den ganzen<br />
Tag auf dem Feld verbringen kann. Das Verhältnis zwischen Zeit, die zur Distanzüberwindung gebraucht wird, und<br />
effektiver Arbeitszeit wird dadurch sehr ungünstig. Im Falle der Schulkinder, die ihrem Vater beim Jäten helfen, liegt die<br />
effektive Arbeitszeit bei weniger als zwei Stunden, während die Zeit für Hin- und Rückweg gute zwei Stunden ausmacht.<br />
Während der Vegetationsperiode wird auch die Frau jeden Tag bei der Feldarbeit gebraucht. Sie hat daher so gut wie keine<br />
Zeit mehr, Wasser zu holen und Feuerholz zu sammeln. Diese Bürde wird an die Kinder der Familie abgegeben, die mehr<br />
Stunden des Tages zu Fuss unterwegs sind (und dabei schwere Lasten tragen müssen) als irgend jemand anderes im<br />
Haushalt. Der Blick auf die grafische Darstellung der Aktivitätspfade des ersten Beispielhaushaltes macht eine<br />
erschreckende Überlastung der Kinder deutlich: Das Kind, dessen Tagesablauf hier aufgezeichnet ist, muss schon am<br />
frühen Morgen zu einer 4 km entfernten Wasserstelle aufbrechen. Nach der<br />
Rückkehr mit dem schweren Eimer zum Haus bleibt keine Ruhepause mehr; das Kind wechselt die Kleider und geht zur<br />
Schule. Dieselbe Situation wiederholt sich nach dem Ende des Unterrichts. Das Kind kommt nach Hause zurück, zieht die<br />
Schuluniform aus, zieht sich für die Feldarbeit um und folgt seinen Eltern auf das Feld.<br />
2. Lehrerhaushalt (Amankwakrom)<br />
Der Lehrerhaushalt steht in Bezug auf Belastungen durch lange Wege etwas besser da. Schon früh am Morgen geht der<br />
Haushaltsvorstand auf sein Feld, um den Wachstumszustand der Feldfrüchte in Augenschein zu nehmen, er hat auch noch<br />
etwas Zeit zum Jäten und zum Roden einiger Maniokknollen. Das Feld ist von seinem Haus aus so gut zu erreichen, dass er<br />
noch rechtzeitig zurück ist, um sich für den Arbeitstag in der Schule vorzubereiten. Kurz vor acht geht er wieder aus dem<br />
Hause, und pünktlich um 8.00 Uhr tritt er seinen Dienst in der Schule an. Seine Frau macht den grösseren Teil der<br />
Feldarbeit, während er in der Schule unterrichtet. Während der in der ersten Grafik dargestellte Bauernhaushalt Wasser von<br />
einem kleinen Flüsschen etwa 4 km vom Haus entfernt holen muss, holt dieser Haushalt sein Wasser aus einer der wenigen<br />
Handpumpen im Dorf. Der Haushalt verbraucht zwar täglich mehr Wasser als der Bauernhaushalt, aber trotzdem ist das<br />
Heranschaffen von Wassereimern im gesamten Zeitbudget des Haushaltes eine geringere Belastung.<br />
3. Bauernhaushalt (Adeembra)<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Die Aktivitätspfade des bäuerlichen Haushaltes in Adeembra zeigen ein ähnliches Muster wie die des Bauernhaushaltes in<br />
Amankwakrom. Es bestehen fast keine Unterschiede in Art und Dauer der wichtigsten Aktivitäten. Das ist auch nicht<br />
weiter verwunderlich, denn beide Dörfer haben dasselbe <strong>Pro</strong>duktionssystem in der Landwirtschaft (Mais und Maniok sind<br />
die wichtigsten Anbaufrüchte; Buschmesser und Hacke sind die beiden ausschliesslich verwendeten Geräte). Aber es<br />
besteht ein auffallender Unterschied: Die Distanzen sind in Adeembra generell kürzer. Das trifft vor allem auf die am<br />
häufigsten vorkommenden Wege zu; der tägliche Arbeitsweg (der Weg vom Haus zum Feld) und der Weg zur Wasserstelle<br />
sind erheblich kürzer. Im Falle unseres Beispielhaushaltes in Adeembra beträgt die Distanz zwischen Haus und<br />
Wasserstelle nur einen halben Kilometer. Die effektive Arbeitszeit ist nicht länger in Amankwakrom, aber weil die langen<br />
Fusswege zwischen den einzelnen Aktivitäten entfallen, haben die Mitglieder der bäuerlichen Familie etwas mehr Zeit, sich<br />
auszuruhen. Ausserdem ist zu vermuten, dass die Arbeitszeit selbst intensiver genutzt werden kann. Denn wer noch keinen<br />
langen Fussweg zu seinem Feld hinter sich hat, beginnt ausgeruhter mit der Arbeit.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 583
8.3.2.3 Mittel der Überlebenssicherung<br />
Die Tabelle zeigt, wie sich das Einkommen einer ausgewählten Familie aus Ghana zusammensetzt: Der Subsi-<br />
stenzanbau erwirtschaftet 29.6%, der kommerzielle Anbau 56.2% des Gesamteinkommens. Weitere 14.2%<br />
stammen aus dem Einkommen von in der Stadt lebenden Verwandten. Das Gesamteinkommen ist nur gerade<br />
zu 61.8% in der Form der lokalen Währung verfügbar, die anderen 38.2% werden in der Form von Naturalien<br />
und Tauschhandel umgesetzt. Dieser vielfach geringe Anteil der Geldwirtschaft an der Gesamtwirtschaft<br />
macht sich oft in den Angaben zum Bruttosozial- oder Bruttoinlandproduktes der betroffenen Länder<br />
bemerkbar.<br />
Tabelle Mittel der Überlebenssicherung einer Familie am Voltasee (Ghana)<br />
nach Schmidt-Kallert 1994, S. 73<br />
Ebene der ökonomischen<br />
Aktivität<br />
Einkommensquelle Anbaufrucht oder<br />
Einkommensform<br />
1. Subsistenzproduktion Ernte des Subsistenzfeldes Yams, Erdnüsse, Pfeffer,<br />
Bohnen, Tomaten<br />
2. <strong>Pro</strong>duktion des unteren<br />
Wirtschaftskreislaufes<br />
3. <strong>Pro</strong>duktion des oberen<br />
Wirtschaftskreislaufes<br />
4. Geldzahlungen und<br />
Geschenke<br />
Anteil am<br />
Gesamteinkommen<br />
in %<br />
15.4<br />
Ernte des kommerziellen Feldes Maniok und Mais 4.3<br />
Tausch der Ernte des Subsistenzfeldes<br />
gegen Fisch<br />
Tausch der Ernte des kommerziellen<br />
Feldes gegen Fisch<br />
Verkauf der Ernte des<br />
Subsistenzfeldes<br />
Verkauf der Ernte des kommerziellen<br />
Feldes<br />
Yams, Erdnüsse, Bohnen 12.3<br />
Maniok 6.2<br />
Erdnüsse 1.9<br />
Maniok und Mais 43.2<br />
Ölpalmen 2 Bäume zur Palmweinherstellung<br />
verkauft<br />
Geldeinkommen der Kinder in der<br />
Stadt<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
2.5<br />
Geldgeschenke 4.9<br />
1 Radiogerät 9.3<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 584
8.3.2.4 Tagesablauf einer ghanaischen Familie<br />
Der nach Angaben aus dem Buch "Ghana" (Schmidt-Kallert, 1994, S. 75-77) zusammengestellte Tagesablauf<br />
einer Familie, aus einem Gebiet Ghanas, das im Rahmen der durch den Bau des Akosombostaudamms nötigen<br />
Umsiedlungen neu erschlossen wurde, zeigt nicht nur die Arbeitsteilung innerhalb einer Akanfamilie in Ghana<br />
auf, sondern vermittelt auch einen Einblick in die wesentlichen Tätigkeiten eines von der Subsistenzproduk-<br />
tion geprägten Arbeitsalltages.<br />
Zeit Kwadwo A. 1<br />
Arbeitstag<br />
Afua N. 2<br />
Arbeitstag<br />
04.00 steht auf<br />
04.15 geht ins Gebüsch<br />
Afua N.<br />
Markttag (Auszug)<br />
04.30 wäscht ihr Gesicht wacht auf<br />
Abena A. 3<br />
Schultag (Auszug)<br />
04.45 geht in die Kapelle zu einer geht zum Brunnen, stellt sich in wacht auf<br />
stillen Morgenandacht der Schlange an und füllt den<br />
05.00 steht auf Eimer<br />
wäscht ihr Gesicht<br />
05.15 wäscht sein Gesicht und seinen<br />
Mund<br />
05.30 geht ins Gebüsch fegt den Hof und wäscht das<br />
Kochgeschirr<br />
05.45 kommt aus dem Gebüsch<br />
zurück<br />
kommt von der Kapelle zurück kommt von der Wasserstelle<br />
zurück<br />
geht zum Gemüsefeld ihres<br />
Ehemannes, dort trifft sie ihren<br />
Mann und hilft ihm dabei,<br />
Tomaten zu ernten; da das<br />
Gemüsefeld an dem Weg, der<br />
zum Markt führt, liegt, stellt sie<br />
den vollen Korb am Wegrand ab<br />
06.00 geht zur Kapelle, um an der macht Feuer an<br />
06.15<br />
Morgenandacht teilzunehmen<br />
stellt das Essen aufs Feuer ist mit dem Ernten fertig und<br />
06.30 geht zurück zu seinem Haus;<br />
auf dem Weg unterhält er sich<br />
kurz mit einem Verwandten an<br />
dessen Haus<br />
schürt die Glut<br />
geht nach Hause<br />
06.45 macht seine Arbeitskleidung<br />
zurecht<br />
07.00 nimmt seine Hacke und sein<br />
Buschmesser und geht zu<br />
seinem Jamsfeld<br />
nimmt das Essen von der<br />
Feuerstelle<br />
kommt zu Hause an und beginnt,<br />
das Essen für ihre Kinder<br />
vorzubereiten<br />
07.15 schaut auf dem Weg zum Feld teilt das Essen an die Kinder<br />
nach seinen Tierfallen aus und isst anschliessend<br />
07.30 selber<br />
wäscht sich selbst und ihre<br />
07.45 kommt auf sein Jamsfeld und geht zum Haus einer Freundin<br />
jüngeren Kinder<br />
schleift sein Buschmesser und unterhält sich mit ihr<br />
08.00 jätet unter den Jamspflanzen<br />
Unkraut<br />
zieht sich an und nimmt das<br />
Essen vom Feuer<br />
08.15 verteilt das Essen für Kinder und<br />
08.30 kommt nach Hause zurück, sie<br />
08.45<br />
macht sich selbst und drei ihrer<br />
Kinder für die Feldarbeit fertig<br />
Ehemann und isst anschliessend<br />
selbst<br />
09.00 packt Jamswurzeln und Maniok,<br />
die sie und ihr Ehemann am<br />
Vortag geerntet haben, zusam-<br />
09.15 macht sich auf den Weg zu<br />
ihrem Feld<br />
men, um sie zum Markt zu<br />
tragen<br />
09.30 macht sich auf den Weg nach<br />
Bubu, einem nahegelegenen<br />
Dorf, wo auf dem Markt Gemü-<br />
09.45<br />
10.00 macht eine Pause unter einem<br />
schattigen Baum<br />
10.15 holt eine Jamsknolle aus der<br />
Erde, die er für seine Mahlzeit<br />
braucht<br />
kommt am Feld an und macht<br />
eine kleine Pause<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
se und Knollenfrüchte gegen<br />
Fisch getauscht werden<br />
kommt am Gemüsefeld ihres<br />
Ehemannes vorbei und nimmt<br />
den Korb mit Tomaten auch<br />
noch auf den Kopf<br />
geht ins Gebüsch<br />
kommt aus dem Gebüsch<br />
zurück und fegt das Haus<br />
geht zum Brunnen und stellt<br />
sich nach Wasser an<br />
kommt mit dem vollen<br />
Eimer vom Brunnen zurück<br />
und wäscht sich selbst<br />
isst ihr Frühstück<br />
geht zur Schule<br />
Unterricht beginnt<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 585
Zeit Kwadwo A. 1<br />
Arbeitstag<br />
10.30 macht ein Feuer an und berei-<br />
10.45<br />
tet sein Essen vor<br />
11.00 nimmt das Essen von der<br />
Feuerstelle und beginnt zu<br />
essen<br />
11.15 macht noch eine Pause unter<br />
dem Baum<br />
11.30 schleift sein Buschmesser<br />
wieder<br />
11.45 fährt mit dem Unkrautjäten fort<br />
Afua N. 2<br />
Arbeitstag<br />
schleift ihre Arbeitsgeräte und<br />
beginnt zu jäten<br />
Afua N.<br />
Markttag (Auszug)<br />
kommt am Markt an und macht<br />
eine kleine Pause<br />
beginnt mit dem Tauschhandel;<br />
sie tauscht Tomaten, Maniok<br />
und Jams gegen Trockenfisch<br />
ein<br />
12.00 ist mit dem Jäten fertig kauft gegen Bargeld noch<br />
weiteren Fisch und Kenkey für<br />
12.15<br />
12.30<br />
beginnt, Maniokknollen zu<br />
ernten<br />
ihr Mittagessen<br />
isst zu Mittag<br />
12.45 packt die geernteten Knollen in<br />
einen Korb<br />
13.00 sammelt Feuerholz<br />
13.15<br />
13.30 macht eine Pause unter einem<br />
schattigen Baum<br />
13.45 fährt mit dem Unkrautjäten fort<br />
14.00<br />
14.15<br />
macht sich auf den Weg nach<br />
Hause<br />
14.30 kommt zu Hause an<br />
14.45 macht eine kleine Ruhepause<br />
und trinkt Wasser<br />
15.00 wäscht sich<br />
besucht einige befreundete<br />
Markthändlerinnen und<br />
verschafft sich nebenbei einen<br />
Überblick über Preise und Qualität<br />
des Fisches auf dem Markt<br />
Abena A. 3<br />
Schultag (Auszug)<br />
15.15 zieht bessere Kleider an geht mit ihren Brüdern und<br />
15.30 entzündet ein Feuer und<br />
fächelt es an<br />
15.45 stellt das Essen auf die<br />
Feuerstelle<br />
16.00 beendet die Feldarbeit und<br />
sucht geeignete Jamsknollen<br />
für das Abendessen aus, rodet<br />
einige Jamsknollen für das<br />
Abendessen der Familie<br />
Schwestern los, um Feuerholz<br />
zu holen<br />
kommt mit Feuerholz nach<br />
Hause zurück<br />
geht wieder zum Brunnen<br />
und stellt sich nach Wasser<br />
an<br />
16.15 macht noch eine Pause pumpt Wasser in ihren<br />
Eimer<br />
16.30 geht nach Hause zurück kommt nach Hause zurück<br />
16.45<br />
17.00 nimmt die gekochten Maniokknollen<br />
von der Feuerstelle<br />
17.15 kommt zu Hause an, trinkt<br />
Wasser und ruht sich aus<br />
17.30 wäscht sich mit einem Eimer<br />
Wasser<br />
wäscht das Kochgeschirr<br />
stampft Fufu hilft ihrer Mutter beim<br />
Kochen<br />
nimmt die Fufusosse von der<br />
Feuerstelle<br />
17.45 zieht sich bessere Sachen an verteilt das Essen an die<br />
Familienmitglieder<br />
18.00 geht zum Haus eines Freundes nimmt ihr Abendessen zu sich<br />
18.15 trifft seinen Freund und unterhält<br />
sich mit ihm<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
isst zu Abend<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 586
Zeit Kwadwo A. 1<br />
Arbeitstag<br />
18.30 geht nach Hause<br />
18.45 isst sein Abendessen<br />
Afua N. 2<br />
Arbeitstag<br />
19.00 geht an den Brunnen, stellt sich<br />
19.15 unterhält sich mit seiner Familie<br />
und erzählt<br />
19.30 Anansegeschichten<br />
in der Schlange an und holt<br />
Wasser<br />
Afua N.<br />
Markttag (Auszug)<br />
Abena A. 3<br />
Schultag (Auszug)<br />
wäscht sich<br />
19.45 wäscht ihre Kinder besucht Freunde in einem<br />
Nachbarhaus<br />
20.00<br />
20.15 hört der Unterhaltung der<br />
20.30 unterhält sich mit ihrer Familie<br />
20.45<br />
und hört den Anansegeschichten<br />
zu<br />
Eltern und den Anansegeschichten<br />
zu<br />
21.00 spricht sein Abendgebet spricht ihr Gebet und geht zu<br />
Bett<br />
21.15 geht zu Bett spricht ihr Abendgebet<br />
21.30 geht zu Bett<br />
1 Einwohner von Amankwakrom, 38 Jahre alt, Bauer<br />
2 Einwohnerin von Amankwakrom, 34 Jahre alt, Ehefrau von Kwadwo A.<br />
3 Einwohnerin von Amankwakrom, Tochter von Kwadwo A. und Afua N., 9 Jahre alt<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 587
8.3.2.5 Nandele, ein Mädchen vom Lande, erzählt<br />
Der Text aus Inga Nagels Buch "Die kleinen Frauen Afrikas - Mädchen in Burkina Faso" gibt einen Einblick<br />
in die Lebenswirklichkeit der jungen auf dem Lande lebenden Frauen Burkina Fasos. Der Text ist nicht nur<br />
bemerkenswert, weil er einen Einblick in das Leben einer jungen schwarzafrikanischen Frau gibt, sondern<br />
auch deshalb, weil sich diese über Vorlieben, Abneigungen und ihre eigene Zukunft äussern kann. (Nagel<br />
1996, S. 98-103; vergleiche diesen Text auch mit "Raketa, Obstverkäuferin in Ouagadougou, erzählt" auf der<br />
Seite 591 dieser Arbeit.)<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Ich heisse Nandele und bin aus dem Dorf Ya in der <strong>Pro</strong>vinz Sissili. Ich bin eine Nuni und 15 Jahre alt. Mein Vater hat zwei<br />
Frauen; meine Mutter ist seine erste. Fünf Kinder hat sie zur Welt gebracht: drei Mädchen und zwei Zwillingsbrüder Meine<br />
Schwestern sind schon verheiratet. Ich bin mit den Zwillingen übrig, die noch klein sind. Mein Vater ist Bauer, aber er<br />
verpasst kaum einen Markt in der Gegend, wo er Kola-Nüsse, Salz, Seife und Zucker verkauft.<br />
Meine Mutter hat mir früh das Arbeiten beigebracht. Seit meine grossen Schwestern aus dem Haus sind, habe ich deren<br />
Aufgaben übernommen. Das ist nicht einfach, aber ich habe mich daran gewöhnt, schliesslich bin ich das einzige<br />
Mädchen. Mit dem ersten Hahnenschrei stehe ich auf und rolle meine Matte zusammen. Als erstes laufe ich in den Stall,<br />
um den Hühnern ein paar Körner hinzuwerfen. Dann schnappe ich mir den Eimer und hole Wasser. Der Brunnen ist<br />
ungefähr 300 Meter weit weg. Ich muss mehrmals laufen, bis zwei Canaris voll sind.<br />
Danach hole ich die drei Schafe meiner Mütter aus ihrer Umzäunung und binde sie irgendwo draussen fest, wo sie<br />
genügend Grünzeug finden, aber nicht in die Höfe und die Felder der Nachbarn laufen können. Das gäbe sonst Streit.<br />
Wieder zurück, mache ich das Haus sauber, in dem ich mit meiner Mutter und meinen Brüdern; wohne. Dann kommt der<br />
Hof dran, der ist ziemlich gross. Wenn ich mit dem Fegen fertig bin, schaue ich nach, ob sich inzwischen der Schmutz in<br />
den Canaris gut abgesetzt hat. Erst dann fülle ich daraus den Krug in der Küche nach, der für das Trinkwasser reserviert ist.<br />
Schliesslich mache ich das Essen warm, vor allem wegen der Kinder. Sie kriegen, was am Abend vorher übriggeblieben ist.<br />
Das ist dann auch mein Frühstück. So gestärkt, sehe ich nach, ob genügend Holz da ist, um die Mahlzeit für den Tag zu<br />
kochen. Wenn nicht, laufe ich schnell auf die Felder in der Nähe und sehe zu, was ich an trockenen Hirse- oder<br />
Maisstengeln finde, damit das vorhandene Holz ausreicht, bis meine Mutter neues holt. Bevor ich ihr vorschlage, was wir<br />
kochen könnten, prüfe ich, was an Getreide und Zutaten da ist. Meine Eltern mögen am Liebsten Ro, ich aber Gerichte aus<br />
Bohnen oder mit Reis. Wenn ich also die Erlaubnis meiner Mutter dazu eingeholt habe, mache ich mich daran, zum<br />
Beispiel Krapfen aus Bohnenmehl zu backen. Zuerst muss ich aber das Geschirr spülen: die Teller, die Töpfe, die<br />
Kalebassen und die Schöpflöffel. Heutzutage bereitet man in den meisten Familien eine einzige Mahlzeit zu, aber in solch<br />
einer Menge, dass sie für morgens und abends reicht. Das spart Holz und Zeit.<br />
Mein Vater und seine zwei Frauen verlassen jeden Morgen das Haus und kommen erst abends wieder. Meine Mutter und<br />
ihre Mit-Ehefrau gehen Holz holen, Verwandte besuchen oder während der Regenzeit aufs Feld. Wenn die Sonne hoch am<br />
Himmel steht, nehme ich etwas für meine Brüder und mich von der Mahlzeit ab. Danach räume ich das schmutzige<br />
Geschirr zusammen, damit die Hunde nicht daran gehen. Ich putze meinen kleinen Brüdern den Mund und die Hände und<br />
schicke sie wieder zum Spielen, denn sie sind ziemlich aufgeweckt und könnten sonst die Kalebassen meiner Mutter kaputt<br />
machen, so gut ich auch achtgebe. Solange sie mit den Nachbarskindern beschäftigt sind, bringe ich den Schafen Wasser.<br />
Auf dem Rückweg inspiziere ich die Hecken um den Hof herum nach Eiern, denn nicht alle Hühner wollen im Stall legen.<br />
Ich muss mir auch schon über das Essen am nächsten Tag Gedanken machen. So schaue ich nach, ob noch genügend Mehl<br />
da ist. Wenn nicht, hole ich Hirse heraus und mache mich ans Stampfen, um die Kleie vom Korn zu trennen. Danach wird<br />
die Hirse gewaschen, getrocknet und zur Mühle getragen. Falls das Mehl noch reicht, schäle ich Erdnüsse, so dass immer<br />
welche da sind, wenn ich Erdnussosse machen will. Ausserdem braucht man sie als Saatgut. Fast immer bleibt das<br />
Erdnussschälen an mir hängen. An manchen Abenden hilft mir die Familie ein wenig dabei, aber das kommt nicht oft vor.<br />
Bevor die Eltern zurückkommen, fege ich nochmals den Hof durch, denn der grosse Karite-Baum verliert ständig Blätter.<br />
Ausserdem muss ich wieder Wasser nachfüllen, damit mir meine Mutter keine Vorwürfe macht. In ihren Augen schaffe ich<br />
nämlich nie genug. Schliesslich stelle ich das Essen für die Eltern aufs Feuer. Sobald sie zurück sind, hole ich den<br />
Holzstuhl für den Vater heraus, die Matten für die Frauen und Schemel für die Kleinen und mich. Dann trage ich die<br />
verschiedenen Schüsseln heraus: für den Vater, für die beiden Mütter, die Kinder und mich. Wahrend die Familie beim<br />
Essen zusammensitzt werde ich von meiner Mutter über den Tagesverlauf ausgefragt, über das Betragen der Brüder und<br />
eventuelle Besucher. Seit dem frühen Morgen ist das der erste Augenblick, wo ich mich in Ruhe hinsetzen kann und so viel<br />
essen wie ich will.<br />
So sehr ich mich auch mit der Hausarbeit beeile, um mich abends ein wenig auszuruhen, stelle ich jeden Tag aufs neue fest<br />
dass die Sonne bereits untergegangen ist, bis ich endlich fertig bin. Nach dem Abendessen habe ich etwas Luft, weil sich<br />
meine "kleine Mutter" um das Abräumen kümmert. Danach stehle ich mich noch für eine Weile davon, um meine<br />
Freundinnen zu treffen. Meine Brüder dürfen das nicht mitkriegen, sonst wollen sie mitgehen. Auf dem Dorfplatz<br />
schwätzen wir über unsere kleinen Geheimnisse und Sorgen, aber vor allem über jene Freundinnen, die nicht mehr mit uns<br />
reden, seit sie für einige Zeit in der Stadt waren. Wir finden es nicht gut, dass sie sich soviel darauf einbilden.<br />
Was ich gern mag:<br />
Ich lache furchtbar gern mit den Mädchen meines Alters. Dafür nehme ich mir auch Zeit, wenn wir uns morgens am<br />
Brunnen treffen. Unter meinen vielen Freundinnen mag ich Sala am liebsten. Seitdem wir uns angefreundet haben, erzählt<br />
sie mir bei jedem Treffen eine Geschichte, die sich vor ihrer Geburt im Dorf ereignet hat, und die niemals endet.<br />
Ausserdem macht es mir Spass, Heuschrecken zu fangen, Vogelnester zu suchen oder im Regen herumzulaufen.<br />
Meine Eltern erlauben mir nicht, auf die Märkte der umliegenden Dörfer zu gehen. Umso mehr ist dann der Markttag in<br />
unserem Dorf ein Fest für mich. Ich darf dann ausgehen und tue das nicht zu knapp. Ich mag auch die Treffen der jungen<br />
Leute bei Vollmond, wo wir auf dem Dorfplatz unsere traditionellen Tanze tanzen.<br />
Was ich nicht mag:<br />
Ich mag nicht, dass Heiraten unter den Familien arrangiert werden, ohne dass die Betroffenen um ihre Meinung gefragt<br />
werden. Das gleiche gilt für Hochzeiten zwischen einem jungen Mädchen und einem alten Mann. In den Städten sind die<br />
Mädchen geschützt, aber bei uns im Dorf, wenn du dich nicht mit dem, den du liebst, auf und davon machst, wirst du<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 588
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
einem Alten gegeben. Die Ehe auf dem Land ist eine traurige Angelegenheit, denn die Frau ist vor allem dazu da,<br />
möglichst viele Kinder zu machen, ohne zu wissen, was später aus ihnen werden soll. Ausserdem muss sie schuften wie<br />
meine Mutter, Holz holen, Karite-Nüsse sammeln, um daraus Butter zu bereiten, und Nere, um Soumbala zu machen.<br />
Während der Regenzeit fällt doppelt so viel Arbeit an. Denn dann kommt noch die Feldarbeit hinzu. Da ist dann noch die<br />
blinde Unterwerfung unter den Ehemann. Die Frau hat nicht das Recht, die Stimme zu erheben, auch wenn sie verärgert ist.<br />
Wenn ich mir jeden Tag sage, dass die Ehe mit einem Alten für mich nicht in Frage kommt, dann deshalb, weil ich Fälle<br />
kenne, die mich um den Schlaf gebracht haben. Der erste betrifft Kana, die so alt ist wie meine ältere Schwester. Mit einem<br />
Alten verheiratet, wurde sie zwei Jahre später Witwe mit zwei kränklichen Kindern. Sie wurde vom Bruder des<br />
Verstorbenen übernommen, wie das der Brauch ist. Von ihm hat sie noch zwei Kinder bekommen, die auch nicht besser<br />
sind als die ersten. Sie erträgt ihr Leiden in aller Stille, aber was hat sie schon vom Leben?<br />
Der zweite Fall betrifft Ayi: bei ihr ist alles noch schlimmer. Nicht nur, dass sie solche furchtbaren Lebensbedingungen für<br />
sich selbst akzeptiert: sie schickte auch noch ihre Mädchen zu der alten Hexe zur Beschneidung. Beide Mädchen sind<br />
daran gestorben. Meine Schwestern und ich sind auch beschnitten, aber wenigstens haben wir es überlebt.<br />
Man spricht heutzutage nicht mehr direkt von Zwangsheiraten, aber solche eingefädelten Ehen sind auch nicht besser. Ich<br />
will nicht, dass man mir meinen Ehemann aussucht, wie meinen Schwestern, die ich darum wirklich nicht beneide. Ihre<br />
Männer sind nicht gerade uralt, aber jung auch nicht mehr. Sie hängen sehr an ihrem Dorf. Keiner kennt die Stadt und ist<br />
auch gar nicht neugierig darauf. Es sind gute Bauern und damit hat es sich auch schon. Nur in der Tradition leben, ohne<br />
danach zu trachten, sie zu verbessern, bringt uns nicht weiter. Ich mache da nicht mit.<br />
Mein Vater kommt viel auf den Märkten herum, aber er redet immer nur davon, was sich im Dorf abspielt. Nie schneidet er<br />
etwas anderes an. Wie soll man da auf andere Ideen kommen? Solch ein Leben gefällt mir nicht.<br />
Wie ich die Zukunft sehe:<br />
Ich glaube, dass man, mit ein wenig Anstrengung, den Ehemann finden kann, den man liebt und den man sich ausgesucht<br />
hat. Die Existenz der Landschule bei uns ermöglicht es den jungen Leuten, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Dort lernen<br />
sie, wie man Strohmatten, Körbe und Hüte herstellt. Einen Garten gibt es auch, so dass wir in der Trockenzeit frisches<br />
Gemüse haben. Ausserdem bringt das gutes Geld ein.<br />
Wenn der richtige Moment gekommen ist, werde ich Boubie mein Einverständnis in die Heirat geben. Er ist so alt wie ich,<br />
hat die Landschule absolviert und weiss so viel wie ein Städter. Er ist gut gekleidet, besitzt ein Fahrrad, ist stark und<br />
interessiert sich für mich und meine Familie.<br />
Ich möchte mit meinen Auserwähltem nicht immer auf dem Dorf bleiben. Mir scheint, dass die Leute hier kaum für sich<br />
selbst leben. Sie müssen hart und unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Es fehlt ihnen das ganze Leben lang an immer<br />
den gleichen Dingen, sie altern schnell und sterben früh. Ich will wirklich leben, glücklich mit meinem Mann und meinen<br />
Kindern, die ich nicht einfach so in die Welt setzen will. Ich möchte lange leben und unter guten Bedingungen. Wenn ich<br />
Boubie heiraten möchte, dann weil ich weiss, dass er genug Geld auf bringt, um in die Elfenbeinküste zu gehen. Dort<br />
können wir ein besseres Leben führen. Wenn wir im Dorf bleiben, sind wir dem Brauchtum unterworfen: meinen Eltern<br />
gegenüber und natürlich auch seiner Verwandtschaft. Sogar was unsere eigene kleine Familie anbelangt, wären wir der<br />
Tradition unterworfen. Das ist übertrieben.<br />
In der Elfenbeinküste könnte ich meinem Mann und meinen Kindern besser helfen. Ich habe schon immer einen kleinen<br />
Handel beginnen wollen, aber zu Hause hat man mich nie gefragt, was ich denn in dieser Richtung unternehmen wollte.<br />
Wenn ich die Mittel dafür zusammen bekomme, kann ich vor unserem Hof ein paar Kleinigkeiten verkaufen. Allerdings<br />
kann ich mich nicht mit Leib und Seele auf den Handel einlassen, sonst würde ich den Haushalt und die Kinder<br />
vernachlässigen. Denn dann müsste ich länger von zu Hause weg und mein Mann könnte das als Ausrede benutzen, um<br />
sich eine zweite oder gar eine dritte Frau zu nehmen.<br />
Die, die von der Elfenbeinküste zu Besuch aufs Dorf kommen, bringen viele Geschenke mit. In der Fremde werde ich auch<br />
neue Freundinnen finden, und da ich nicht zur Schule gegangen bin, können sie mir neue Dinge beibringen, die ich noch<br />
nicht kenne. Ich würde ihnen aus meiner Kindheit erzählen und von meinen Erinnerungen aus dem Dorf. Durch diese<br />
Kontakte hoffe ich, eine aufgeschlossene und unabhängige Frau zu werden, die in ihrem Haushalt eine wirkliche Rolle<br />
spielt. Mit den Ersparnissen, die ich haben werden, werde ich alles kaufen, was ich möchte: schöne Pagnes und gutes<br />
Geschirr. Ich werde Geschenke an meine Eltern schicken, vor allem an meine Mutter und meine älteren Schwestern. Ich<br />
wünsche mir, viel Geld zu haben, um meiner Familie helfen zu können. Dann würde ich meine beste Freundin aus dem<br />
Dorf einladen, mich in der Elfenbeinküste zu besuchen und ihr alle Wünsche erfüllen.<br />
Schliesslich wünsche ich mir, dass, durch die Reisen der jungen Leute, das Dorf endlich aufwacht, damit es sich<br />
weiterentwickelt; damit alle Familien, dank ihrer Kinder, in Frieden und glücklich alt werden können.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 589
8.3.2.6 "Traditionelle" Lebensweise<br />
Als traditionelle Lebensweise muss mangels einer besseren Definition diejenige Art zu leben gelten, die sich<br />
im Laufe einiger Generationen herausgebildet hat. Nur noch sehr wenige Völker Schwarzafrikas, die durch<br />
ihre ganze Geschichte hindurch eine stetige Anpassung vollzogen, leben in einer rein "traditionellen" Gesell-<br />
schaft. Neuerungen werden fast immer zusammen mit Altbewährten zu einer Lebensweise kombiniert, die den<br />
Menschen im Hinblick auf ihre Überlieferungen und die Notwendigkeiten, denen sie gegenüberstehen, als<br />
nützlich erscheinen. Teilweise handelt es sich dabei um einen aktiven <strong>Pro</strong>zess, oft kommt es zu langsamen<br />
Veränderungen, die auf den ersten Blick kaum wahrgenommen werden. Einige wenige Volksgruppen haben<br />
sich dazu entschlossen, ihre "traditionelle" Lebensweise zu bewahren. Zu ihnen gehören die Pokot, ein in<br />
Kenia lebendes Volk, dessen Kultur Ähnlichkeit mit der der Massai aufweist. Einige Mitglieder der Pokot<br />
haben zwar damit begonnen, Ackerbau zu betreiben, der grösste Teil betreibt aber noch immer die Zucht von<br />
Rindern und Ziegen, daneben werden einige Feldfrüchte angebaut. Die meisten Mitglieder der Pokot haben<br />
sich dazu entschlossen, ihre alte Lebensweise soweit als möglich beizubehalten, sie sehen keinen Grund diese<br />
gegen eine andere, in ihren Augen weniger geeignete zu tauschen. Der folgende Text stammt aus dem Buch<br />
"Länder der Erde: Ostafrika" und wurde leicht bearbeitet (Ostafrika 1988, S. 131-133)<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Lokiorongolol, ein wohlhabender, etwa 50 Jahre alter Hirte aus dem Stamm der Pokot, lebt in der Nähe des Baringosees<br />
mit seinen fünf Frauen, den Kindern und einigen Verwandten; sein Gehöft besteht aus fünf oder sechs strohgedeckten<br />
Hütten, die von einer Dornenhecke umgeben sind, die auch die Ställe für die Rinder umgibt. Die Bedürfnisse dieser zwei<br />
oder drei Dutzend gepflegter, langhörniger Tiere bestimmen den Ablauf des täglichen Lebens der Familie. Bei<br />
Sonnenaufgang melken die Kinder die Kühe und sammeln den Dung, der als Brennmaterial getrocknet wird.<br />
Wie alle Dorfältesten bei den Pokot hilft auch Lokiorongolol mit, den Zyklus der Zeremonien zu gestalten, die die<br />
Übergänge von einem Lebensabschnitt zum nächsten markieren und die den einzelnen von der Jugend bis ins hohe Alter<br />
begleiten. Die Jungen werden mit etwa 15 Jahren beschnitten und als junge Krieger eingeführt; später, wenn sie verheiratet<br />
sind und ihre eigenen Gehöfte und Kinder haben, werden auch sie wieder Älteste werden. Die Mädchen müssen die<br />
Klitorisbeschneidung als Vorbereitung zur Ehe erdulden. Wenn sie das gebärfähige Alter überschritten haben, erreichen sie<br />
als respektierte, würdige Matronen einen neuen Status.<br />
Selbst heute noch lassen sich die Pokot von der Existenz des modernen Kenia kaum beeindrucken. Sie wissen genau<br />
Bescheid über die Waren, die nur wenige Kilometer entfernt feilgeboten werden, aber sie kaufen nichts aus den Städten<br />
ausser den Perlen, die sie in ihre Halsbänder einflechten, oder eiserne Werkzeuge oder Speerspitzen. Obwohl sie ihre<br />
Rinder sorgfältig hüten, züchten sie diese verhätschelten Tiere nicht für den Handel; die Pokot schätzen ihr Vieh als<br />
Symbole des Wohlstands - Sicherheiten, die beispielsweise für eine Heirat, die Familie des Mannes übergibt der Familie<br />
der Frau als "Entschädigung" für ihren Verlust eine Zahl von Kühen, unerlässlich sind und die sie nur bei zeremoniellen<br />
Anlässen schlachten. Verkauft wird das Vieh nur in äussersten Notlagen.<br />
Dennoch ist den Pokot die neue Welt durchaus nicht unbekannt. Sie haben immer bewusst versucht, mit dieser Welt<br />
Kontakt zu halten, und in jeder Generation schicken sie eines oder zwei ihrer intelligentesten Kinder auf die Schule, damit<br />
diese die modernen Lebensweisen erlernen und auf den neuesten Wissensstand gebracht werden. Diese Abgesandten<br />
übernehmen die Rolle der informierten Mittelsleute, wenn die Dörfer im Waldland von Amtspersonen besucht werden: von<br />
Steuereinziehern, Wildhütern, Polizisten, die geflohene Verbrecher suchen, oder einer ganzen Reihe von Leuten, die in<br />
Autos anreisen und den Pokot zeigen wollen, wie man anders und - wie diese Berater meinen besser lebt. Lokiorongolol<br />
und die anderen Dorfältesten empfangen diese verschiedenen Boten der zivilisierten Welt und hören, was sie ihnen zu<br />
sagen haben. Aber sie leben so weiter wie zuvor. Eine Welt mit einem Lebensstandard nach westlichem Muster scheint<br />
ihnen nicht erstrebenswert.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 590
8.3.3 Das Leben in der Stadt<br />
Während immer noch ein Grossteil der Bevölkerung Schwarzafrikas auf dem Land lebt, hat die Stadtbevölke-<br />
rung in den letzten Jahren enorm zugenommen. Schwarzafrika weist Ende der neunziger Jahre eine ganze<br />
Reihe von Millionenstädten auf, die noch zu Beginn des Jahrhunderts oft kleine unbedeutende Orte waren oder<br />
damals nicht einmal existierten.<br />
Zunehmende <strong>Pro</strong>bleme auf dem Land und die vor allem durch die Medien verbreiteten, verlockenden Bilder<br />
eines imaginären Lebensstiles nach westlicher Art, veranlassen immer mehr Menschen dazu, in die Städte zu<br />
drängen, wo sie sich meist mit Gelegenheitsarbeiten durchzuschlagen versuchen. Nur einigen wenigen, die<br />
meist eine erfolgreiche Schulkarriere aufweisen können, gelingt es, den "Traum" vom Leben umgeben von<br />
westlichen Konsumgütern, zu verwirklichen.<br />
8.3.3.1 Raketa, Obstverkäuferin in Ouagadougou, erzählt<br />
Der folgende Text stammt aus Inga Nagels Buch "Die kleinen Frauen Afrikas - Mädchen in Burkina Faso" und<br />
lässt eine Obstverkäuferin, wie sie in vielen Städten Westafrikas anzutreffen sind, aus ihrem Leben, welches<br />
für junge schwarzafrikanische Städterinnen aus Raketas Gesellschaftsschicht als typisch betrachtet werden<br />
kann, erzählen. (Nagel, 1996, S. 90-98)<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Ich bin 17 Jahre alt und Mossi. Meine Eltern leben seit vielen Jahren in Ouagadougou und hier bin ich auch geboren. Mein<br />
Vater, der als Fahrer arbeitet, ist polygam. Wir sind mehr als ein Dutzend Kinder und ich bin das älteste Mädchen meiner<br />
Mutter, der dritten der vier Frauen meines Vaters. Leider bin ich nur drei Jahre zur Grundschule gegangen. Nachdem ich<br />
das Klassenziel verfehlt hatte, gab mir mein Vater nie mehr eine Chance, es noch einmal zu versuchen. Ich glaube, es war<br />
für ihn eine gute Gelegenheit, sich dieser leidigen Angelegenheit zu entledigen. Von da an musste ich mich damit<br />
bescheiden, meiner Mutter im Haushalt zur Hand zu geben. Die war auch ganz zufrieden damit, denn ehrlich gesagt sorgte<br />
sie sich mehr um meine körperliche Entwicklung als um meine Schulbildung. Schon mit zwölf sah ich älter aus und ich<br />
vergesse nie die Vorwürfe, die sie mir machte: "Warum wächst du bloss wie ein Hirsestengel? Wenn du so weiter machst,<br />
wird sich dein Vater bald das Vergnügen machen, dich zu verheiraten." Für sie konnte ich das dadurch vermeiden, dass ich<br />
aufhörte zu wachsen.<br />
Mein Tag ist von früh bis spät angefüllt. Ich habe im Haushalt zu tun, muss Geld zu verdienen und ab und an habe ich auch<br />
ein wenig Zeit für mich. Morgens um fünf ist für mich die Nacht vorbei. Ich laufe in die Küche, um Waschwasser aufs<br />
Feuer zu setzen für meinen Vater, der immer als erster das Haus verlässt, für die Brüder, die zur Schule gehen, und für die<br />
Mütter. Bevor alle aufstehen, zweige ich ein wenig Wasser für mich ab, um mir wenigstens das Gesicht zu waschen und<br />
den Mund zu spülen. Wahrend sich mein Vater duscht, wecke ich reihum meine Brüder. Die Grossen waschen sich selber,<br />
um die Kleineren muss ich mich kümmern. Dann sehe ich schnell nach, was noch vom Abendessen übrig ist und mache es<br />
für meine Brüder warm. Egal, ob es sich um Hirsebrei oder Reis handelt, sie haben immer Appetit.<br />
Wenn alle weg sind, gehe ich ans Saubermachen. Der Hof ist ziemlich gross. Ebenso die Häuser für jede der Ehefrauen,<br />
und so nimmt das ganz schön viel Zeit weg. Noch vor dem Fegen räume ich die Zimmer der Kinder auf. Besonders die<br />
Jungens lassen alles kreuz und quer liegen: ihre Matten, Kleidung und Hefte. Sie kümmern sich um nichts, eben weil sie<br />
zur Schule gehen. Wenn alles in Ordnung gebracht ist, muss ich noch die Strasse vor dem Haus kehren. Zuletzt kommt die<br />
Küche dran. Ich fege sie schnell durch, spüle das Geschirr, räume alles auf und bringe schliesslich den Unrat zum<br />
Müllplatz an der Ecke. Da wir fliessend Wasser im Hof haben, genügt es, den Tonkrug für<br />
das Trinkwasser am Hahn aufzufüllen und ich kann mich schliesslich selber waschen gehen. Danach ziehe ich mich an und<br />
hole mir meinen Teil vom Frühstück, den ich mir vorher beiseite gestellt habe.<br />
Weil unser Vater das so bestimmt hat, verwaltet jede seiner Frauen der Reihe nach die Küche und die laufenden<br />
Familienangelegenheit jeweils sieben Tage lang. Meine Schwestern helfen ihnen dabei. Was mich angeht, so bin ich ein<br />
Sonderfall, weil mich meine Mutter mit einem Kleinhandel betraut hat. Da ich deswegen den ganzen Tag unterwegs bin,<br />
hat mein Vater verlangt, dass ich meinen Teil der Hausarbeiten vorher erledige. Erst danach kann ich mich ums<br />
Geldverdienen kümmern.<br />
Meine Mutter gibt mir jeden Morgen tausend Francs, mit denen ich Bananen, Mandarinen, Orangen oder Melonen<br />
einkaufe. Die Kooperative, wo ich die Früchte hole, ist ungefähr drei Kilometer von unserem Haus entfernt. Ungefähr um<br />
acht, wenn ich die Hausarbeit erledigt habe, gehe ich los und gegen 19 Uhr, wenn es dunkel geworden ist, kehre ich<br />
zurück. Bei der Kooperative ist immer jede Menge los. Sowohl Grosshändlerinnen als auch Einzelhändlerinnen wie ich<br />
kommen hierher und immer gibt es viel Geschubse und Diskussionen um die Preise. Gegen zehn habe ich alles<br />
ausgehandelt und ziehe zum Verkauf los. Ich gehe durch die Strassen und preise die Früchte an. Wenn mich die Kinder<br />
hören, die vor den Häusern spielen, machen sie Gezeter, damit ihnen die Eltern welche kaufen. Der Verkauf klappt ganz<br />
gut und sobald mein Tablett leer ist, hole ich Nachschub. Manchmal decke ich mich sogar dreimal am Tag bei der<br />
Kooperative ein. Es kommt auch vor, dass ich nur eine einzige Schüssel loswerde. Eines ist sicher: ich komme nie mit einer<br />
vollen heim. Irgendwelche Käufer finde ich immer. Dazu gehe ich dorthin, wo möglichst viel los ist: auf Baustellen,<br />
Märkte, in Schulen oder in Kneipen. Sich in dieses Milieu zu begeben, ist kein Honigschlecken. Oft muss ich mich mit<br />
Leuten auseinandersetzen, die schlecht erzogen sind und mich provozieren wollen. Dann musst du halt ordinäre<br />
Redensarten einstecken, aber was willst du schon machen?<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 591
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Meine Einnahmen schwanken von einem Tag auf den anderen. Aber man kann sagen, dass ich rund 500 Francs verdiene,<br />
wenn ich ein Tablett voller Früchte verkauft habe. Meine Arbeit bringt wirklich etwas ein, aber du brauchst ganz schön<br />
Kraft dazu. Den ganzen Tag durch die Stadt zu laufen mit einer kiloschweren Schüssel auf dem Kopf ist alles andere als<br />
einfach. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, weil ich kräftig gebaut bin. Höchstens wenn ich krank bin, bleibe ich zu<br />
Hause oder an muslimischen Feiertagen, wie am Ende des Ramadan oder an Tabaski. Das Früchteverkaufen bereitet mir<br />
weiter keine Schwierigkeiten. Ich fühle mich gleichzeitig frei und beschützt durch meine Mütter, die mir nie ihr Vertrauen<br />
verwehrt haben. Ich missbrauche es auch nicht und bin glücklich, dass mich meine Eltern als gehorsame und vorbildliche<br />
Tochter betrachten.<br />
Wenn ich am Abend nach Hause komme, stelle ich die Schüssel in eine Ecke, hole mir einen Schemel und setze mich zu<br />
meiner Mutter in ihr Zimmer, um ihr alles zu erzählen, was ich tagsüber erlebt habe mit allen Höhen und Tiefen. Ich höre<br />
ihren Ratschlägen zu, die sie mir gibt, und gebe ihr das ganze Geld, das ich verdient habe. Davon gibt sie mir die tausend<br />
Francs Kapital wieder, mit denen ich am nächsten Tag weiterarbeite. Später schliesse ich mich meinen Schwestern an, die<br />
schon mit dem Essen auf mich warten. Wir bleiben dann noch eine Weile zusammen und schwatzen darüber, was jede so<br />
erlebt hat. Allzu lange dauert das freilich nicht, weil sich der Hof bald leert: meine kleinen Brüder und Schwestern gehen<br />
zum Nachbarn fernsehen. Mich interessiert das nicht. Erstens bin ich müde und zweitens habe ich genug Bilder und Töne<br />
in mich aufgesogen bei meinen Touren durch die Stadt. Ich gönne mir lieber eine ausführliche Dusche, damit ich wieder zu<br />
Kräften komme und sich meine Füsse erholen. Mein Vater kann sich in der Zeit ungestört mit seinen Frauen unterhalten.<br />
Ich gehe höchstens noch zu meiner Tante, mit der ich offen über all meine Sorgen und Jungmädchenpläne reden kann.<br />
Meine Mutter, die nichts von unserer Vertrautheit weiss, beredet oft meine Aussteuer mit ihr. Da meine Tante meinen<br />
Geschmack kennt, kann sie meine Mutter so beeinflussen, dass ihre Wahl meinen Wünschen gerecht wird. Von meiner<br />
Tante bekomme ich auch Rat für das Leben zu zweit: das was gut für einen selbst ist, für seinen Ehemann und für die<br />
Kinder. Ich lerne sehr viel von ihr; besonders über Dinge, die ich mich meiner Mutter oder ihren Mit-Ehefrauen gegenüber<br />
nicht anzuschneiden traue. Zum Beispiel über unser Brauchtum bei der Heirat oder bei Begräbnissen. Sogar über die<br />
Beschneidung. Leider kann ich selten lange bei ihr bleiben. Gegen 22 Uhr gehe ich schlafen, weil ich bald schon wieder<br />
raus muss.<br />
Was ich gern habe:<br />
Es ist schwierig für mich, das so zu sagen, weil mich alles anzieht, was hübsch ist: schöne Stoffe zum Beispiel, egal, ob sie<br />
gewebt oder gedruckt sind, Hauptsache, sie haben harmonische Farben. Schöne Schuhe und schöner Schmuck, aber leider<br />
ist das alles schrecklich teuer. Ich habe modische Sachen gern. Aber von diesen Modeerscheinungen halte ich nichts:<br />
Kleider, die im Rücken weit ausgeschnitten sind, Miniröcke, die die Schenkel unbedeckt lassen und Klamotten, die so<br />
durchsichtig sind, als hättest du nichts am Leib. Ich finde, das erniedrigt die Frauen.<br />
Ich habe keine besonders langen Haare und ich behelfe mir deshalb mit künstlichen Zöpfen. Die halten eine ganze Weile,<br />
besonders wenn man sie mit einem Kopftuch gegen den Staub schützt. Die Frisuren, die mit den eigenen Haaren<br />
geflochten werden, sind nicht so dauerhaft. Manchmal verlangt meine Mutter von mir, dass ich sie frisiere. Ich teile ihre<br />
Haare in Felder ein und umwickle die Zöpfchen mit schwarzem Plastikfaden, so dass sie steif in die Luft stehen. So hat es<br />
mein Vater am liebsten und ich bin stolz, dass ich das so gut hinkriege.<br />
Ich esse auch sehr gerne. Wenn ein Fest ansteht, sehe ich zu, dass ich die Einkäufe selber machen kann und auch in der<br />
Küche das Sagen habe. Weil ich so oft unterwegs bin, komme ich selten zum Kochen. Wenn ich dann einmal die<br />
Gelegenheit dazu habe, will ich natürlich beweisen, dass ich meinen Schwestern in nichts nachstehe.<br />
Manchmal gibt es auch ein wenig Abwechslung mit den Leuten meines Alters in unserem Stadtteil: Geburtstagsfeiern, ein<br />
Fest, um einen Schulabschluss zu begiessen oder einen Tanzabend zu irgendeinem anderen Anlass. Vor den Festtagen<br />
bewundere ich gerne die Auslagen in den Geschäften und interessiere mich für die Preise; selbst wenn ich nichts einkaufe,<br />
macht mir das Spass.<br />
Was Menschen angeht, so mag ich am liebsten solche, die offen und geradeheraus sind, die das meinen, was sie sagen. Ich<br />
mag auch unheimlich gerne Kinder, wenn sie noch ganz klein sind. Da können sie noch nicht laufen und Unsinn anstellen.<br />
Ich kann sie auf dem Rücken tragen, sie waschen und ihnen Brei geben. Schliesslich ist noch das Verständnis zwischen<br />
den Leuten meines Berufs wichtig - Früchte verkaufen ist schliesslich auch ein Beruf! Darauf lege ich grossen Wert.<br />
Was ich nicht mag:<br />
Traurigkeit, kranke Leute, Misere und Bettler am Strassenrand, Verrückte in den Strassen, Strolche, die unter den Brücken<br />
schlafen. Ausserdem Kriege, die Bomben der Weissen, die alles zerstören. Alles Unglück, das durch den Regenmangel<br />
kommt und vor allem, dass es an Medikamenten und Geld fehlt. Und natürlich ist die Armut ganz generell furchtbar.<br />
Ich finde auch, dass unsere grossen Familien keine gute Sache sind. Da wird doch nie für alle gesorgt. Ich glaube fast, dass<br />
viele Väter eher quantitativ als qualitativ denken. Sie sagen sich, Hauptsache, es ist genug Getreide da, egal, ob es etwas<br />
dazu und manchmal auch eine Abwechslung gibt. Ich bin richtig neidisch auf die Kinder, die nicht mit so vielen teilen<br />
müssen. Die haben eher eine Chance, es zu etwas zu bringen.<br />
Ein anderes <strong>Pro</strong>blem ist das der Eifersucht zwischen den. Geschwistern und Halbgeschwistern. Wenn es die Erwachsenen<br />
schaffen, ihre <strong>Pro</strong>bleme zu verstecken, so gelingt das den Kindern einfach nicht. Wenn ich etwas von Verwandten<br />
geschenkt bekomme, so muss ich das vor den anderen verstecken, um Ärger zu vermeiden. Wenn ich eine Belohnung<br />
verdient habe, warum muss ich dann meine Freude vor anderen verbergen?<br />
Hinzu kommt die ungerechte Aufteilung der Arbeiten im Haushalt. Keiner der Brüder hat zu Hause je einen Besen zur<br />
Hand genommen, obwohl sie in der Schule auch saubermachen müssen wie alle anderen Kinder auch. Warum lässt man im<br />
Haushalt immer nur die Mädchen arbeiten? Etwa, weil das schon immer so war? Die Welt entwickelt sich schliesslich<br />
weiter, aber die Eltern behalten ihre altmodischen Ansichten, die den Faulpelzen ganz recht kommen.<br />
Wie ich die Zukunft sehe:<br />
Obwohl ich es nicht leicht habe, sehe ich ganz zuversichtlich in die Zukunft. Ich weiss, dass ich eine Wahl zu treffen habe<br />
und ich bin entschlossen, mein Glück zu machen. Ich bin in einer polygamen Familie geboren und darin gross geworden.<br />
Ich kenne also die Vorteile und Nachteile der Vielehe, die die Konservativen so verteidigen. Die Frage, die sich mir jetzt<br />
stellt ist: Werde ich, genau wie meine Mutter, gesenkten Hauptes in so etwas stolpern?<br />
Immerhin bin ich ein paar Jahre zur Schule gegangen. Ausschlaggebend ist jedoch das, was ich an meiner Mutter<br />
beobachtet habe. Dazu kommen die Ratschläge meiner Tante. Ich denke, dass ich trotz meiner Jugend schon einiges an<br />
Erfahrungen gesammelt habe, vor allem auf den Strassen, wenn ich meine Früchte verkaufe. Die Hauptsorge der meisten<br />
jungen Mädchen, nämlich einen gutaussehenden Mann zu finden, der ausserdem eine Beschäftigung hat, habe ich nicht<br />
mehr: Der junge Salam, der im gleichen Viertel wohnt wie meine Familie, hat nämlich insgeheim an meine Tante einen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 592
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Antrag gerichtet. Wir waren uns bei einigen Anlässen begegnet, die die jungen Leute organisiert hatten. Er hat sich mir<br />
gegenüber immer sehr respektvoll benommen und nie etwas durchblicken lassen bis zu dem Tag, als mich meine Tante<br />
über seinen Antrag informierte. Es durfte niemand etwas davon erfahren, bis er sich meinen Eltern vorstellte. Ehrlich, ich<br />
war unheimlich glücklich, als ich davon erfuhr. Salam stammt aus einer angesehenen Familie. Er hat einen kleinen Laden<br />
für Elektroartikel mit fünf Leuten. Später bin ich oft unangekündigt in seinem Laden im Stadtzentrum aufgetaucht, wenn<br />
ich mit meinen Früchten dort vorbeikam. Niemals habe ich ihn mit einem anderen Mädchen angetroffen. Es ist ja so selten,<br />
dass sich junge Männer, die ein wenig Geld haben, sich eine Gelegenheit entgehen lassen. Ich hänge sehr an ihm und<br />
würde dafür kämpfen, ihn auch zu behalten aber bis jetzt gibt es keinerlei <strong>Pro</strong>bleme. Allerdings hat er es nicht allzu gerne,<br />
dass ich meinen Handel weitermache. Doch meine Tante meint, ich solle auf keinen Fall damit aufhören, zumindest nicht<br />
vor unserer Heirat. Sie hat ganz recht, denn schliesslich ist es eine grosse Ehre für mich und meine Familie, wenn ich eine<br />
ordentliche Aussteuer mit in die Ehe bringe. Mein Vater muss für so viele Leute sorgen, er wird nicht viel dazu beitragen<br />
können. Der Gewinn aus dem Früchteverkauf, den ich meiner Mutter abliefere, wird diesen Mangel ausgleichen helfen. Im<br />
Augenblick geht alles seinen Gang. Er hat eine Abordnung in unser Dorf geschickt, so wie es der Brauch ist.<br />
Eines ist sicher: nach meiner Heirat werde ich nicht mehr auf die Strasse gehen. Salam hat es eilig damit. Ich werde ihm<br />
nämlich auch im Laden nützlich sein können. Keiner seiner fünf Leute ist in der Lage, eine einfache Buchhaltung zu<br />
führen. Das will er mir beibringen. Oft fährt er nach Togo oder Benin, um Waren einzukaufen. Eines Tages werde ich mit<br />
ihm fahren und er wird mir jede Menge Geschenke machen. Ich bereite mich ernsthaft auf dieses neue Leben vor. Die<br />
Ratschläge meiner Tante werden mir dabei helfen, eine glückliche Ehe zu führen. Wir beide kommen aus grossen<br />
Familien. Wir haben die Chance, die Irrtümer unserer Eltern zu vermeiden, zum Beispiel viele Kinder in die Welt zu<br />
setzen. Salam und ich sind uns einig, dass es besser ist, bloss vier Kinder zu haben, drei Jungen und ein Mädchen, die wir<br />
wirklich gut versorgen können. Ich sage nur ein Mädchen, weil es eine Frau dermassen schwer hat im Leben.<br />
Mein Vater hat immer meine Brüder bevorzugt, wenn es um die Schule ging, weil sie sein Werk fortführen werden, wenn<br />
er eines Tages zu den Ahnen geht. Salam und ich werden nicht so ungerecht sein. Wir werden all unsere Kinder gleich<br />
behandeln, solange wir die Möglichkeit dazu haben. Ich habe es immer bedauert, dass meine Eltern keinen Wert darauf<br />
gelegt haben, dass ich weiter zur Schule ging. Dabei kann man es als Frau genauso weit bringen, wenn nicht sogar weiter.<br />
Ich werde sehr glücklich mit Salam sein und den Kindern, die ich mit ihm haben werde.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 593
8.3.3.2 "Aber es ist auch alles sehr teuer hier"<br />
Das abgedruckte Interview nach Hofmann, 1989, aus Schmidt-Kallert, 1994, S. 149 zeigt einerseits die Bedeu-<br />
tung der auch in der Grossstadt noch wichtigen im Heimatdorf geknüpften Beziehungsgeflechte, andererseits<br />
kommen zwei Schwarzafrikaner zu Wort, die ihre Sorgen und Hoffnungen äussern. Kumasi, das ehemalige<br />
Zentrum des Aschantireiches, ist heute neben der Hauptstadt Accra die zweitgrösste Agglomeration Ghanas<br />
und ein wichtiges Handelszentrum, das auch über eine eigene Universität verfügt.<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Ismel, 22, und Abdul, 23, arbeiten auf dem Zentralmarkt der ghanaischen Stadt Kumasi. Mit grossen geflochtenen Körben<br />
transportieren sie Obst und Gemüse von den bunt bemalten Lkw, die täglich Ware aus dem Umland nach Kumasi bringen,<br />
zu den Ständen der Marktfrauen. Beide sind "Northerners", wie die Zuwanderer aus dem Norden Ghanas und den<br />
angrenzenden Sahelstaaten eher geringschätzig hier im Süden des Landes genannt werden.<br />
Frage: Wie lange seid ihr jetzt schon hier in der Stadt?<br />
Ismel: Ich bin seit etwa einem Jahr hier, Abdul schon etwas länger.<br />
Frage: Und wo kommt ihr ursprünglich her?<br />
Abdul: Wir sind beide aus dem gleichen Dorf. Es liegt in der Nähe von Bolgatanga.<br />
Frage: Warum seid ihr von zu Hause weggegangen?<br />
Abdul: Weil es dort kaum Arbeitsmöglichkeiten gibt. Ausser Landwirtschaft kann man im Norden nichts machen. Und in<br />
der Trockenzeit nicht einmal das.<br />
Ismel: Ja, das Leben dort ist wirklich sehr hart. Es gibt keine Arbeit, und du kannst nichts kaufen.<br />
Frage: Als ihr euch entschieden habt, nach Kumasi zu gehen, habt ihr da bestimmte Vorstellungen gehabt, was ihr hier<br />
machen könnt?<br />
Abdul: Eigentlich nichts Genaues. Ich wollte mich erst einmal umschauen. Ich war ja vorher noch nie hier gewesen.<br />
Ismel: Bei mir war's etwas besser. Nachdem Abdul den Job hier gefunden hatte, hat er mir eine Nachricht geschickt. dass<br />
ich bei ihm mitmachen könnte. Da bin ich natürlich sofort gekommen.<br />
Frage: Abdul bei dir war das wohl alles nicht ganz so einfach. Wie hast du dich am Anfang hier zurechtgefunden ?<br />
Abdul: Es war ganz schön hart. Kumasi ist eine teure Stadt. Und ich hatte fast kein Geld. Aber meine Freunde, bei denen<br />
ich gewohnt habe, haben mir sehr geholfen.<br />
Frage: Du hast also auch gewusst, wo du wohnen konntest?<br />
Abdul: O ja. Keiner aus dem Norden geht hierher, ohne zu wissen, wo er wohnen kann. Wir haben alle irgendwelche<br />
Freunde oder Verwandte in Kumasi, bei denen man fürs erste unterkommen kann. Wenn ich niemanden gekannt<br />
hätte, wäre ich nicht gekommen.<br />
Frage: War bei deinen Freunden überhaupt genug Platz für dich?<br />
Abdul: Viel Platz war nicht. Mein Freund hat zwei Zimmer gemietet. In einem davon wohnt er mit seiner Frau und den<br />
Kindern, im anderen sein Bruder und der Bruder seiner Frau. Mit den bei den habe ich das Zimmer geteilt.<br />
Frage: Und wie ging's dann weiter?<br />
Abdul: Tja, es war wichtig, so schnell wie möglich eine Arbeit zu finden, um etwas Geld zu haben. m Anfang habe ich<br />
alle möglichen Gelegenheitsarbeiten gemacht. Aber das war alles nur stundenweise. Bis dann eines Tages ein<br />
Freund mir diese Arbeit hier besorgt hat.<br />
Frage: Du konntest also nicht einfach so hier anfangen?<br />
Abdul: Nein, natürlich nicht. Die Aufnahmebedingungen für neue Lastenträger auf dem Markt sind sehr streng. Ich<br />
wurde genauestens auf meine Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit hin überprüft. Das ging sogar so weit, dass man<br />
Leute aus meinem Heimatdorf über mich befragt hat. Ausser dem musste ich eine Aufnahmegebühr zahlen. Erst<br />
dann war ich in die Gruppe aufgenommen und bekam mein eigenes Revier. Ich bin wirklich froh, dass alles so<br />
geklappt hat.<br />
Frage: Und wohnst du jetzt immer noch bei deinem Freund?<br />
Abdul: Nein, auf die Dauer war das zu eng. Kurz nachdem ich die Arbeit hier bekommen hatte, habe ich auch ein eigenes<br />
Zimmer gefunden. Kurz darauf ist dann Ismel nach Kumasi gekommen.<br />
Frage: Und jetzt wohnt ihr zusammen?<br />
Ismel: Ja, noch. Ich bin aber auch auf der Suche nach einem eigenen Zimmer. Es ist schon besser, wenn man sein<br />
eigenes Zimmer hat.<br />
Frage: Ihr seid jetzt etwa ein Jahr hier in Kumasi. Wie gefällt euch das Leben hier in der Stadt? Habt ihr euch das so<br />
vorgestellt?<br />
Ismel: Hm, das ist schwer zu sagen. Es ist schon angenehmer, hier zu leben, als im Dorf. Das ist klar. Es gibt Wasser und<br />
Strom, viele Geschähe. Aber es ist auch alles sehr teuer.<br />
Abdul: Und die Arbeit ist sehr hart. Ich bin abends todmüde, da unternehme ich nicht mehr viel. Die meiste Zeit verbringe<br />
ich mit Freunden bei uns im Viertel. Manchmal geh ich in den Videoclub und schaue mir einen Film an.<br />
Frage: Habt ihr schon Pläne für die Zukunft?<br />
Abdul: Eigentlich nicht. Vielleicht mal ins Ausland gehen. Da kann man mehr verdienen.<br />
Ismel: Ich möchte demnächst heiraten. Sobald ich genügend Geld gespart habe, um den Brautpreis bezahlen zu können.<br />
Und dann hole ich meine Frau nach Kumasi.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 594
8.3.3.3 Die Kenkey-Frauen<br />
Kenkey sind in Mais- oder Kochbananenblätter eingewickelte, etwa faustgrosse Klösse aus fermentiertem<br />
Mais. Sie sind ein Grundnahrungsmittel für einen grossen Teil der städtischen Bevölkerung im südlichen<br />
Ghana. Kenkey wird trocken oder mit etwas scharfer Sosse, vielleicht etwas Fisch gegessen. Es ist das Grund-<br />
nahrungsmittel insbesondere der ärmeren Bevölkerungsschichten. Umgekehrt ist die Kenkeyherstellung auch<br />
die Domäne von Frauen ohne Schulbildung, ohne Ausbildung, ohne Geld. Diese Arbeit wird vor allem von<br />
Frauen gemacht, die nach ihrer Scheidung, nach Todesfällen in der Familie oder sonstigen Lebenskrisen<br />
keinerlei Geld mehr in der Hand, aber viele Kinder zu ernähre haben; Frauen, denen keine andere Wahl bleibt.<br />
Noch deutlicher wird der Charakter der Kenkeyherstellens als Überlebensgewerbe der Armen in den Worten<br />
einer der betroffenen Frauen: "Kenkeyherstellen ist sehr mühsam. Damit fängt nur an, wer in Not ist und nicht<br />
ohne besonderen Grund. Kenkey kann man essen. Wenn du schnell etwas zum Essen brauchst, ist Kenkey<br />
richtig. Wer vom Verkauf anderer Nahrungsmittel nicht leben konnte, der wechselt zu Kenkey. Es ist eine der<br />
schwerste Arbeiten."<br />
Es ist eine Arbeit für Frauen ohne jegliches Startkapital. Für jede Art von Handel brauchen die Frauen ein<br />
Anfangskapital. Viele erhalten das von ihrem Mann. Kenkey-Frauen erhalten Kredit von den Maishändlerin-<br />
nen oder Maishändlern, sie brauchen keinerlei eigenes Geld.<br />
Die Kenkeyherstellung ist ein mühsame <strong>Pro</strong>zess, der sich über Tage hinzieht, bis die Frauen die fertigen Klös-<br />
se zum Verkauf feilbieten können. Fünf Arbeitsgänge sind erforderlich:<br />
- Das Einweichen. Die Frauen weichen den Mais mehrere Tage lang ein, häufig einen ganzen Sack auf<br />
einmal.<br />
- Das Mahlen. Der bereits aufgequollene Mais wird gewaschen, zur Maismühle getragen und gemahlen.<br />
Anschliessend türmen die Frauen den feuchten Brei in grossen Schüsseln auf.<br />
- Das Rühren. Die Hälfte des am Tag zu verarbeitenden Grundteigs zerreiben die Frauen mit den Händen<br />
und geben ihn auf offener Feuerstelle unter ständigem Rühren in einen grossen Topf mit Wasser. Der Teig<br />
quillt beim Aufkochen und muss ständig mit dem Rührlöffel verrührt und schliesslich geschlagen werden,<br />
bis ein klumpenfreier Teig entsteht. Das Rühren ist Schwerstarbeit. Den heissen Teig schöpft die Frau in<br />
einen Holztrog und vermengt ihn mit der unverkochten Hälfte des Grundteigs zur eigentlichen<br />
Kenkeymasse.<br />
- Das Verpacken. Anschliessend formt die Kenkey-Frau die Klösse und wickelt sie in zuvor eingeweichte<br />
Blätter von Maiskolben oder Kochbananen. Dieser Arbeitsgang ist besonders zeitaufwendig.<br />
- Das Kochen. Schliesslich werden die eingewickelten Klösse in einen grossen Topf gelegt und mit wenig<br />
Wasser mehrere Stunden gedämpft.<br />
Nur einer der fünf Arbeitsgänge, das Mahlen von Mais, wird heute nicht mehr von Hand gemacht. Dafür gibt<br />
es inzwischen motorgetriebene eiserne Mühlen.<br />
Im Vergleich zum aufwendigen Herstellungsprozess von Kenkey ist der Verkauf der Ware eine Kleinigkeit.<br />
Die Kenkeyproduktion eines ganzen Tages ist meist relativ schnell verkauft.<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
(verändert nach Schmidt-Kallert, 1994, S. 160-161)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 595
8.3.3.4 Das Leben am Rande der Stadt<br />
In vielen Ländern Schwarzafrikas führen die Schwierigkeiten auf dem Land und die durch die Medien verbrei-<br />
teten Vorstellungen über das Leben in den Städten zu einer Abwanderung ländlicher Arbeitskräfte in städtische<br />
Gebiete. Der Zustrom der arbeitssuchenden Menschen aus den ländlichen Gebieten überfordert die Infrastruk-<br />
tur der grossen Millionenstädte Schwarzafrikas, dementsprechend fallen die Bedingungen aus in denen die<br />
Zuwanderer leben müssen, wobei diese von ihnen nicht in allen Fällen als schlechter als auf dem Land<br />
betrachtete werden, da sie unter Umständen Zugang zu fliessendem Wasser und zur Elektrizität haben. Auch<br />
das Spital liegt, zumindest theoretisch, in erreichbarer Nähe. Wesentlich schlechter als auf dem Land fällt für<br />
die ärmsten Bevölkerungsschichten die Ernährung aus, da es oft keine Möglichkeit gibt, selbst Nahrungsmittel<br />
anzubauen. Der folgende Text aus "Länder der Erde: Ostafrika" schildert das Beispiels eines Zuwanderers in<br />
Kampala, der Hauptstadt Ugandas (Ostafrika 1988, S. 139-140):<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Musa, der als Bote arbeitet, lebt in einem solchen Slumviertel in Kampala. Er teilt sich eine winzige Hütte aus<br />
gehämmerten Blechwänden mit seiner Frau, vier Kindern, einer Nichte und einem Neffen. Ein Stück Sacktuch teilt das<br />
Innere der Hütte in einen Raum für Musa und seine Frau und einen für die Kinder. Die Familie kocht im Freien auf einem<br />
offenen Feuer und benutzt eine zugedeckte Grube als Latrine.<br />
Die Familie kam 1984 aus einem Dorf, das 40 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ist. Das Landstück von Musas Eltern<br />
war zu klein, als dass Musa seine Familie davon hätte ernähren können, und da Musa sieben Jahre Schulbildung hatte,<br />
beschloss er, sein Glück in der Stadt zu versuchen, wo sein Vetter einen Job in einer Registratur hatte. Der Vetter half<br />
ihnen, ihre erste winzige Hütte in einem Tal in der Nähe des Zentrums zu bauen, aber wenn es regnete, weichte der<br />
Lehmboden auf, so dass sie in die Aussenbezirke auf ein höher gelegenes Gelände umzogen. Hier hatten sie mehr Platz,<br />
mehr Luft zum Atmen.<br />
Die Arbeitsuche erwies sich als sehr schwierig und deprimierend. Musa ging von Tür zu Tür und fragte nach Arbeit, bat<br />
jeden, den er kannte, um Hilfe, aber ohne Erfolg. Verwandte gaben der Familie genügend zu essen, aber Musa begann<br />
schon zu befürchten, dass auch er letztlich dazu gezwungen sein würde, die Müllhalden nach Essbarem zu durchwühlen:<br />
Schon viele Menschen hatten dieses Schicksal erlitten und nach Jahren ohne Arbeit die Hoffnung ganz aufgegeben. Dann<br />
half ihm der Vetter wieder und empfahl Musa, als eine Stelle in seiner Firma frei wurde.<br />
Die Arbeit als Bote ist schlecht bezahlt, und Musa kann es sich nicht leisten, mit einem der überfüllten Busse oder<br />
kommunalen Taxis zur Arbeit zu fahren, die die Strassen ins Stadtzentrum verstopfen. Er ist ununterbrochen auf den<br />
Beinen, geht vier Kilometer zu Fuss ins Büro, trägt den ganzen Tag Briefe und Pakete aus und geht abends wieder zu Fuss<br />
nach Hause. Er ist ständig ausgepumpt und erschöpft. Die Familie kann von seinem bescheidenen Verdienst nur leben,<br />
weil sie ihre Ausgaben auf das absolute Minimum beschränkt. Diese Menschen tragen ihre Kleider, bis sie fast in Fetzen<br />
vom Leibe fallen, und die Kinder hatten noch nie Schuhe; Musas eigenes Paar ist immer wieder notdürftig vom Schuster<br />
geflickt worden.<br />
Auch ihre Ernährung ist äusserst bescheiden. Tag für Tag essen sie nur Bananen mit einer dünnen Sauce aus getrockneten<br />
Bohnen und Erdnüssen, die mit Wasser vermischt werden. Aber jeden Monat gelingt es Musa, genügend Geld zu sparen,<br />
um mit dem Bus in sein Heimatdorf zu fahren und seine Eltern zu besuchen. Er hilft, den Gemüsegarten zu bestellen, und<br />
bringt seiner Familie etwas zum Essen mit: Kürbis, Kartoffeln, vielleicht sogar ein Huhn.<br />
Musas Vetter verdient nur wenig mehr als Musa, aber er hat nur zwei Kinder, und seine Frau arbeitet als Kindermädchen<br />
bei der Familie eines Rechtsanwalts. Sie können sich drei- bis viermal in der Woche Fleisch oder Fisch leisten und essen<br />
Reis, Maismehl, Maniok, und andere Pflanzenkost. Manchmal gibt es sogar eine Flasche Bier oder Erfrischungsgetränke<br />
wie Coca Cola. Sie kaufen ihre Kleider in Läden und nicht bei den Schneidern in den Slumvierteln, und sogar die Kinder<br />
tragen Schuhe. Manchmal besucht die ganze Familie das Kino, und gelegentlich geht der Mann abends in ein Tanzlokal. Er<br />
hat Musa ein oder zweimal mitgenommen, aber das Bewusstsein seiner eigenen Armut war für Musa so deprimierend, dass<br />
ihm der Ausflug keinen Spass machte.<br />
Musa hofft, dass sich in Zukunft alles zum Besseren wenden wird. Wenn er seinen gegenwärtigen Arbeitsplatz behalten<br />
kann, wird er vielleicht später selbst in die Registratur versetzt: dann könnte er für immer aus dem Slumviertel ausziehen.<br />
Sein Name steht auf der Liste der Bewerber um eine Wohnung in einer Siedlung, die zugegebenermassen auch nicht<br />
grossartig ist.<br />
Die Toilette ist draussen, und das Bad ist ein Raum mit einem Eimer und einem Ablauf. Aber das Gebäude hat immerhin<br />
Betonwände und ein Wellblechdach, und jede Wohnung besteht aus zwei kleinen Schlafzimmern, einem Wohnzimmer und<br />
einer winzigen Küche; es gibt elektrisches Licht und kaltes fliessendes Wasser.<br />
Obwohl es in der Siedlung Wohnungen unterschiedlicher Grössen und sogar einige Einzelhäuser gibt, sehen sie alle gleich<br />
trostlos aus. Verglichen mit Musas gegenwärtiger Behausung jedoch wirken diese Häuser wie Paläste. Er weiss, dass er<br />
dem Vergleich mit Leuten mit einer guten Ausbildung nicht standhalten kann, die 12 Jahre die Schule besucht und<br />
akademische Grade erworben haben: Diese Leute haben ihre eigenen Häuser und fahren sogar vielleicht ein Auto. Mehr als<br />
eine Wohnung zu bekommen, kann Musa nicht erhoffen. In solchen Wohnsiedlungen lebt die überwiegende Mehrheit der<br />
Stadtbevölkerung.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 596
8.3.3.5 Die Oberschicht<br />
Obwohl im Zusammenhang mit Schwarzafrika gerne vom traditionellen Leben der dort lebenden Völker<br />
berichtet wird, leben in allen Städten Schwarzafrikas Menschen, die ein nach westlichen Kriterien sehr erfolg-<br />
reiches Leben führen. Neben Geschäftsleuten, die von Zürich bis Kapstadt tätig sein können und ihre Ferien in<br />
einem der bekannten Touristenorte verbringen, sind es vor allem höhere Regierungsbeamte und Fachärzte, die<br />
sich am westlichen Lebensstil orientieren und sich diesen auch leisten können. Dies sollte jedoch nicht darüber<br />
hinwegtäuschen, dass andere durchaus geachtete Berufsgruppen, wie beispielsweise Lehrkräfte aller Stufen<br />
oder in der Hierarchie tiefer stehende Beamte ein für europäische Verhältnisse äussert bescheidenes Auskom-<br />
men erzielen. Der folgende Text aus "Länder der Welt: Ostafrika" schildert das Beispiel eines erfolgreichen<br />
Arztes aus Nairobi, der Hauptstadt Kenias, das als für schwarzafrikanische Oberschichtverhältnisse typisch<br />
gelten kann (Ostafrika 1988, S. 133-134):<br />
Anhang: Beispiele schwarzafrikanischen Lebens<br />
Ein gutsituierter praktischer Arzt in Nairobi, der von seinen Freunden Dr. Paul genannt wird, hat keine Zweifel darüber,<br />
dass sich das Leben seit seiner Kindheit in einem kleinen Kikuyu-Dorf verbessert hat. Seine Frau führt einen gutgehenden<br />
Frisiersalon- zwei seiner Kinder studieren in England, zwei weitere besuchen das beste Internat in Kenia. Vor dem Haus<br />
der Familie in Muthaiga, dem exklusivsten Vorort der Hauptstadt, steht ein glänzender Mercedes, den der Arzt selbst fährt,<br />
ein Toyota für seine Frau und ein Kombiwagen für Familienausflüge aufs Land.<br />
Der heute 50jährige Paul war erst 13 Jahre alt, als das erste Donnergrollen des Mau-Mau-Aufstands bis in sein Dorf<br />
vordrang. Die Verwandten rieten ihm, seine Heimat zu verlassen und die Schule in Uganda zu besuchen, das zu jener Zeit<br />
für sein hochentwickeltes Bildungswesen bekannt war. Als er aufbrach, kannte er nur den Namen der 300 Kilometer<br />
entfernten Schule. Ab und zu gelang es Paul, als Anhalter in einem Lastwagen oder auf dem Gepäckträger eines Fahrrads<br />
mitgenommen zu werden. Den Rest des Weges legte er zu Fuss zurück. Die Reise dauerte eine Woche.<br />
Als er die Schule fand, war sie in einem armseligen, verkommenen Gebäude untergebracht, dessen strohgedecktes Dach<br />
leckte, wenn es regnete, und wie verfaultes Obst roch, wenn die Sonne darauf schien. Dennoch hatte Paul Glück. Der<br />
Schulleiter vom Volk der Ganda, dem die Schule gehörte, war bereit, jeden zu nehmen, der kam, und obwohl es kaum<br />
Bücher gab, gelang es ihm und seinen beiden Lehrern, in den über hundert Schülern einen beachtlichen Wissensdurst zu<br />
wecken.<br />
Paul wurde Diener des Direktors, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und erhielt ein Bett in einem Nebengebäude. Er<br />
stand vor Sonnenaufgang auf, um die Ziegen zur Weide zu bringen und dann das Gemüsebeet zu jäten oder neues Land<br />
umzugraben. Am Abend arbeitete er wieder, stach den Boden um oder jätete Unkraut. Zum Frühstück erhielt er eine Tasse<br />
Tee ohne Milch und ein Stück Jamswurzel, Banane oder Maniok, zubereitet von der Frau des Direktors, und das<br />
Abendessen war ebenso einfach.<br />
Es war eine harte Lehrzeit, aber Paul hielt durch. Nach drei Jahren schickte ihn der Direktor in eine grössere,<br />
weiterführende Schule nach Toro, weitere 200 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt. Paul verbrachte dort fünf Jahre<br />
und bekam dann ein Stipendium für das Medizinstudium an der Universität von Ostafrika in Makerere vor den Toren<br />
Kampalas, die die begabtesten Studenten aus der ganzen Region anzog. Inzwischen beherrschte er neben seiner eigenen<br />
Kikuyu-Sprache auch Englisch, Suaheli sowie die Toro- und die Ganda-Sprache. Als er schliesslich kurz vor seinem<br />
Doktorexamen stand, hatte er in der kosmopolitischen Atmosphäre von Makerere Freundschaft mit Studenten aus vielen<br />
Landesteilen und unterschiedlichster Herkunft geschlossen. Wenn sie sich später in<br />
Nairobi oder Daressalam oder sogar in Übersee wiedertrafen, sprachen diese Mitglieder einer neuen afrikanischen Elite<br />
gerne von ihren Tagen auf dem Campus oder ihren Nächten in Suzanna's Club oder dem White Nile - berühmten<br />
Tanzlokalen in Kampala, wo sie Bier tranken und mit den Barmädchen oder Krankenschwestern zur Musik von Bands<br />
tanzten, die den damals modernen kongolesischen Jazz spielten.<br />
Kenyatta wurde in dem Jahr aus dem Gefängnis entlassen, als Paul sein Studium abschloss, und als Kenia unabhängig<br />
wurde, bekam der junge Doktor eine Amtsarztstelle in Nairobi. Inzwischen hatte er eine junge Frau aus dem<br />
Kikuyu-Distrikt geheiratet, aus dem er selbst stammte. Sie zogen in eine Wohnung in einem armen Stadtviertel. In jenen<br />
Tagen konnten es sich überhaupt nur wenige Schwarze leisten, in den besten Stadtvierteln zu wohnen. Nach einigen Jahren<br />
eröffnete er jedoch eine Privatpraxis, die bald von vielen wohlhabenden Patienten aufgesucht wurde, und Paul konnte sich<br />
ein geräumiges Haus mit grossen Rasenflächen und Schwimmbad leisten. Nun werden seine elektrisch betriebenen Tore<br />
rund um die Uhr von einem Wachmann beaufsichtigt, und Dr. Paul beschäftigt auch drei Diener, die in einem kleinen<br />
Nebengebäude hinter der Garage wohnen - einen Koch, einen Gärtner und einen Hausboy, der als Butler und allgemeines<br />
Faktotum fungiert.<br />
Dr. Paul hält noch einen Abend in der Woche Sprechstunde in einem öffentlichen Krankenhaus, wo er neben<br />
überarbeiteten und schlecht bezahlten Kollegen seinen Dienst tut. Einen Nachmittag in der Woche fährt er zum Golfspielen<br />
in den Limuru-Club. Hier in der eleganten Umgebung, die einst den höchsten Kolonialbeamten vorbehalten war, kann er<br />
sich mit anderen Mitgliedern der kenianischen Oberschicht entspannen - Ministern, Staatssekretären, wohlhabenden<br />
Geschäftsleuten und Rechtsanwälten -, aber auch mit Akademikern aus dem Ausland. Wie sie gehört auch er zu einer<br />
Gesellschaft, die eher international als afrikanisch geprägt ist.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 597
8.4 Sonstige<br />
In diesem Teil der Arbeit werden Hintergrundtexte und -informationen zu Afrika wiedergegeben, die an keiner<br />
anderen Stelle einzuordnen waren, aber eine zusätzliche Sichtweise auf den Kontinent und seine Bewohner<br />
ermöglichen oder an anderer Stelle in dieser Arbeit gemachte Aussagen korrigieren oder kommentieren.<br />
8.4.1 Ernährungssituation auf den afrikanischen Kontinent<br />
Der Fischer Weltalmanach 1998 schreibt im Kapitel "Die Lage der Landwirtschaft und der Ernährung nach<br />
Staaten und Regionen" zu Afrika (Fischer 1998):<br />
Afrika ist bezüglich der Ernährungssituation deutlich zweigeteilt. Die Bevölkerung Nordafrikas - von Marokko bis<br />
Ägypten - ist im allgemeinen ausreichend ernährt (teils durch Eigenproduktion, teils durch Importe). Dagegen zeigte<br />
Afrika südlich der Sahara - mit Ausnahme des äussersten Südens - auch 1996 ein ähnlich katastrophales Bild wie in den<br />
Vorjahren. Von den 37 Staaten, in denen 30 % und mehr der Bevölkerung unterernährt sind, liegen allein 30 in Afrika.<br />
Insgesamt stagnierte hier die Nahrungsmittelproduktion pro Kopf 1995-96 auf etwa dem gleichen Wert, aber in 34<br />
afrikanischen Staaten ergab sich auch 1996 wieder ein Rückgang der <strong>Pro</strong>-Kopf-Erzeugung, da die Bevölkerungszahl<br />
schneller wuchs als die Nahrungsmittelproduktion. Die Zahl der Unter- oder Mangelernährten in "Schwarzafrika" wird von<br />
der FAO derzeit auf rund 215 Mio. Menschen geschätzt.<br />
Während der Kontinent noch bis zu Beginn der 60er Jahre Selbstversorger mit Exportüberschüssen war, mussten auch<br />
1996 grosse Mengen an Nahrungsmitteln importiert werden, soweit es die Devisenlage der einzelnen Staaten erlaubte. Die<br />
FAO schätzte den Netto-Importbedarf Afrikas an Getreide auf rund 30 Mio. t; über 20 Staaten benötigten Hilfslieferungen,<br />
da sie nicht imstande waren, mit eigenen Mitteln den Nahrungsmittel-Importbedarf zu decken.<br />
Die einzige Region mit ausreichender Ernährungsgrundlage war die Republik Südafrika mit Nachbarländern, die über eine<br />
relativ hochentwickelte Landwirtschaft verfügen. In den übrigen Teilen Afrikas südlich der Sahara lagen die Ursachen für<br />
die zu geringen Ernten teilweise in der Witterung, vor allem aber in wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit, Fehlern<br />
der Agrarpolitik, Bürger- und Stammeskriegen, Terror und dadurch bedingten Fluchtbewegungen.<br />
Dementsprechend war in Ländern wie Sudan, Somalia, Ruanda, Burundi, Dem. Rep. Kongo, Liberia und Sierra Leone, die<br />
durch kriegerische Auseinandersetzungen, Bürgerkriegswirren und Machtkämpfe erschüttert wurden, die<br />
Ernährungssituation für grosse Teile der Bevölkerung besonders ungünstig.<br />
An dieser Einschätzung des Fischer Weltalmanach hat sich bis zum Herbst 1998 nur wenig geändert, wie<br />
beispielsweise die Berichte der letzten Zeit aus dem Südsudan zeigen. Sie unterscheidet sich auch nicht allzu-<br />
sehr von vielen, in den besprochenen Lehrmitteln gemachten Aussagen. Trotz all dieser Negativmeldungen,<br />
die leider nur allzuoft der Wahrheit entsprechen, ist dieses negative Bild Afrikas nur ein Teil der Wahrheit auf<br />
einem riesigen Kontinent, in dem Menschen in unterschiedlichsten Verhältnissen leben.<br />
Anhang: Sonstige<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 598
8.4.2 Vorratslagerung in Schwarzafrika<br />
Entgegen immer wieder aufgestellten Behauptungen, "die fröhlich in den Tag hineinlebenden Neger" würden<br />
keine Vorratslagerung betreiben, kennen viele schwarzafrikanischen Völker, vor allem in den Savannengebie-<br />
ten, die Vorratslagerung seit vielen Jahrhunderten, und die von ihnen genutzten Kornspeicher prägen das Bild<br />
eines Dorfes wesentlich mit.<br />
[Bild der Speicher in Datei SPEICHER.PDF]<br />
Anhang: Sonstige<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 599
8.4.3 Der schwarzafrikanische Mensch in Charles Darwins Werk<br />
Die folgenden Ausschnitte aus Werken "The Descent of Man" (1871) und "The Expression of Emotions in<br />
Man and Animals" (1899) von Charles Darwin beleuchten verschiedene Aspekte des von ihm gezeichneten<br />
Bild des schwarzafrikanischen Menschen. Die Textstellen werden ohne weiteren Kommentar wiedergegeben<br />
und dienen der Vertiefung der im Teil "Vorwürfe an das von der Schule vermittelte Bild" dieser Arbeit zu<br />
Darwins Werk gemachten Aussagen.<br />
1. Physische Eigenschaften und Aussehen<br />
M. Houzeau... asserts that he repeatedly made experiments, and proved that Negroes... could recognise persons in the dark<br />
by their odour... I have, therefore, spoken in the text of the dark-coloured races having a finer sense of smell than the white<br />
races. (Descent of Man)<br />
***<br />
Schweinfurth, in speaking of a negress belonging to the Monbuttoos, who inhabit the interior of Africa a few degrees north<br />
of the equator, says, "Like all her race, she had a skin several shades lighter than her husband's, being something of the<br />
colour of half-roasted coffee." As the women labour in the fields and are quite unclothed, it is not likely that they differ in<br />
colour from the men owing to less exposure to the weather. (Descent of Man)<br />
***<br />
In regard to colour, the new-born negro child is reddish nut-brown, which soon becomes slaty-grey; the black colour being<br />
fully developed within a year in the Soudan, but not until three years in Egypt. The eyes of the negro are at first blue, and<br />
the hair chestnut-brown rather than black, being curled only at the ends. (Descent of Man)<br />
***<br />
With negroes the beard is scanty or wanting, and they rarely have whiskers; in both sexes the body is frequently almost<br />
destitute of fine down. (Descent of Man)<br />
***<br />
It seems at first sight a monstrous supposition that the jet-blackness of the negro should have been gained through sexual<br />
selection; but this view is supported by various analogies, and we know that negroes admire their own colour. With<br />
mammals, when the sexes differ in colour, the male is often black or much darker than the female; and it depends merely<br />
on the form of inheritance whether this or any other tint is transmitted to both sexes or to one alone. The resemblance to a<br />
negro in miniature of Pithecia satanas with his jet black skin, white rolling eyeballs, and hair parted on the top of the head,<br />
is almost ludicrous. (Descent of Man)<br />
2. Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten<br />
They likewise escape to a large extent the fatal intermittent fevers, that prevail along at least 2600 miles of the shores of<br />
Africa, and which annually cause one-fifth of the white settlers to die, and another fifth to return home invalided. This<br />
immunity in the negro seems to be partly inherent, depending on some unknown peculiarity of constitution, and partly the<br />
result of acclimatisation. Pouchet states that the negro regiments recruited near the Soudan, and borrowed from the Viceroy<br />
of Egypt for the Mexican war, escaped the yellow fever almost equally with the negroes originally brought from various<br />
parts of Africa and accustomed to the climate of the West Indies. (Descent of Man)<br />
***<br />
That the immunity of the negro is in any degree correlated with the colour of his skin is a mere conjecture: it may be<br />
correlated with some difference in his blood, nervous system, or other tissues...<br />
The late Dr. Daniell, who had long lived on the west coast of Africa, told me that he did not believe in any such relation. He<br />
was himself unusually fair, and had withstood the climate in a wonderful manner. When he first arrived as a boy on the<br />
coast, an old and experienced negro chief predicted from his appearance that this would prove the case. (Descent of Man)<br />
3. Schönheitsempfinden<br />
Anhang: Sonstige<br />
Burchell gives an amusing account of a bush-woman who used as much grease, red ochre, and shining powder "as would<br />
have ruined any but a very rich husband." She displayed also "much vanity and too evident a consciousness of her<br />
superiority." Mr. Winwood Reade informs me that the negroes of the west coast often discuss the beauty of their women.<br />
Some competent observers have attributed the fearfully common practice of infanticide partly to the desire felt by the<br />
women to retain their good looks. (Descent of Man)<br />
***<br />
It is well known that with many Hottentot women the posterior part of the body projects in a wonderful manner; they are<br />
steatopygous; and Sir Andrew Smith is certain that this peculiarity is greatly admired by the men. He once saw a woman<br />
who was considered a beauty, and she was so immensely developed behind, that when seated on level ground she could<br />
not rise, and had to push herself along until she came to a slope. Some of the women in various negro tribes have the same<br />
peculiarity; and, according to Burton, the Somal men are said to choose their wives by ranging them in a line, and by<br />
picking her out who projects farthest a tergo. Nothing can be more hateful to a negro than the opposite form." (Descent of<br />
Man)<br />
***<br />
With respect to colour, the negroes rallied Mungo Park on the whiteness of his skin and the prominence of his nose, both of<br />
which they considered as "unsightly and unnatural conformations." He in return praised the glossy jet of their skins and the<br />
lovely depression of their noses; this they said was "honeymouth," nevertheless they gave him food. The African Moors,<br />
also, "knitted their brows and seemed to shudder" at the whiteness of his skin. On the eastern coast, the negro boys when<br />
they saw Burton, cried out, "Look at the white man; does he not look like a white ape?" On the western coast, as Mr.<br />
Winwood Reade informs me, the negroes admire a very black skin more than one of a lighter tint. But their horror of<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 600
whiteness may be attributed, according to this same traveller, partly to the belief held by most negroes that demons and<br />
spirits are white, and partly to their thinking it a sign of ill-health.<br />
The Banyai of the more southern part of the continent are negroes, but "a great many of them are of a light coffee-and-milk<br />
colour, and, indeed, this colour is considered handsome throughout the whole country"; so that here we have a different<br />
standard of taste. With the Kaffirs, who differ much from negroes, "the skin, except among the tribes near Delagoa Bay, is<br />
not usually black, the prevailing colour being a mixture of black and red, the most common shade being chocolate. Dark<br />
complexions, as being most common, are naturally held in the highest esteem. To be told that he is light-coloured, or like a<br />
white man, would be deemed a very poor compliment by a Kaffir. I have heard of one unfortunate man who was so very<br />
fair that no girl would marry him." One of the titles of the Zulu king is, "You who are black." Mr. Galton, in speaking to me<br />
about the natives of S. Africa, remarked that their ideas of beauty seem very different from ours; for in one tribe two slim,<br />
slight, and pretty girls were not admired by the natives. (Descent of Man)<br />
***<br />
Mr. Winwood Reade, however, who has had ample opportunities for observation, not only with the negroes of the west<br />
coast of Africa, but with those of the interior who have never associated with Europeans, is convinced that their ideas of<br />
beauty are on the whole the same as ours; and Dr. Rohlfs writes to me to the same effect with respect to Bornu and the<br />
countries inhabited by the Pullo tribes. Mr. Reade found that he agreed with the negroes in their estimation of the beauty of<br />
the native girls; and that their appreciation of the beauty of European women corresponded with ours. They admire long<br />
hair, and use artificial means to make it appear abundant; they admire also a beard, though themselves very scantily<br />
provided. Mr. Reade feels doubtful what kind of nose is most appreciated; a girl has been heard to say, "I do not want to<br />
marry him, he has got no nose"; and this shows that a very flat nose is not admired. We should, however, bear in mind that<br />
the depressed, broad noses and projecting jaws of the negroes of the west coast are exceptional types with the inhabitants<br />
of Africa. Notwithstanding the foregoing statements, Mr. Reade admits that negroes "do not like the colour of our skin;<br />
they look on blue eyes with aversion, and they think our noses too long and our lips too thin." He does not think it probable<br />
that negroes would ever prefer the most beautiful European woman, on the mere grounds of physical admiration, to a<br />
good-looking negress. (Descent of Man)<br />
4. Psychische Eigenschaften und Gefühlsäusserungen<br />
Anhang: Sonstige<br />
Every one who has had the opportunity of comparison, must have been struck with the contrast between the taciturn, even<br />
morose, aborigines of S. America and the lighthearted, talkative negroes. (Descent of Man)<br />
***<br />
The expression of grief, due to the contraction of the grief-muscles, is by no means confined to Europeans, but appears to<br />
be common to all the races of mankind... With respect to negroes, the lady who told me of Fra Angelico's picture, saw a<br />
negro towing a boat on the Nile, and as he encountered an obstruction, she observed his grief-muscles in strong action,<br />
with the middle of the forehead well wrinkled. (Emotions in Man and Animal)<br />
***<br />
Several trustworthy observers have assured me that they have seen on the faces of negroes an appearance resembling a<br />
blush, under circumstances which would have excited one in us, though their skins were of an ebony-black tint. Some<br />
describe it as blushing brown, but most say that the blackness becomes more intense. An increased supply of blood in the<br />
skin seems in some manner to increase its blackness; thus certain exanthematous diseases cause the affected places in the<br />
negro to appear blacker, instead of, as with us, redder. The skin, perhaps, from being rendered more tense by the filling of<br />
the capillaries, would reflect a somewhat different tint to what it did before. That the capillaries of the face in the negro<br />
become filled with blood, under the emotion of shame, we may feel confident; because a perfectly characterized albino<br />
negress, described by Buffon, showed a faint tinge of crimson on her cheeks when she exhibited herself naked. Cicatrices<br />
of the skin remain for a long time white in the negro, and Dr. Burgess, who had frequent opportunities of observing a scar<br />
of this kind on the face of a negress, distinctly saw that it "invariably became red whenever she was abruptly spoken to, or<br />
charged with any trivial offence." The blush could be seen proceeding from the circumference of the scar towards the<br />
middle, but it did not reach the centre. Mulattoes are often great blushers, blush succeeding blush over their faces. From<br />
these facts there can be no doubt that negroes blush, although no redness is visible on the skin. (Emotions in Man and<br />
Animal)<br />
***<br />
Spitting seems an almost universal sign of contempt or disgust; and spitting obviously represents the rejection of anything<br />
offensive from the mouth... Captain Burton speaks of certain negroes "spitting with disgust upon the ground." Captain<br />
Speedy informs me that this is likewise the case with the Abyssinians. (Emotions in Man and Animal)<br />
***<br />
Nevertheless if we look to the various races of man, these signs [Bejaung und Verneinung, Anm. des Verfassers] are not so<br />
universally employed as I should have expected; yet they seem too general to be ranked as altogether conventional or<br />
artificial. My informants assert that both signs are used by the Malays, by the natives of Ceylon, the Chinese, the negroes of<br />
the Guinea coast, and, according to Gaika, by the Kafirs of South Africa, though with these latter people Mrs. Barber has<br />
never seen a lateral shake used as a negative... and the negroes on the West Coast of Africa, according to Mr. Winwood<br />
Reade, protrude their lips, and make a sound like "heigh, heigh". If the mouth is not much opened, whilst the lips are<br />
considerably protruded, a blowing, hissing, or whistling noise is produced. (Emotions in Man and Animal)<br />
***<br />
Mr. Winwood Reade has observed that the negroes on the West Coast of Africa, when surprised, clap their hands to their<br />
mouths, saying at the same time, "My mouth cleaves to me," i. e. to my hands; and he has heard that this is their usual<br />
gesture on such occasions. Captain Speedy informs me that the Abyssinians place their right hand to the forehead, with the<br />
palm outside. (Emotions in Man and Animal)<br />
***<br />
In Southern Africa with two tribes of Kafirs, especially with the women, their eyes often fill with tears during laughter.<br />
Gaika, the brother of the chief Sandilli, answers my query on this bead, with the words, "Yes, that is their common<br />
practice." Sir Andrew Smith has seen the painted face of a Hottentot woman all furrowed with tears after a fit of laughter.<br />
In Northern Africa, with the Abyssinians, tears are secreted under the same circumstances. (Emotions in Man and Animal)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 601
5. Umgang mit Musik<br />
We see that the musical faculties, which are not wholly deficient in any race, are capable of prompt and high development,<br />
for Hottentots and Negroes have become excellent musicians, although in their native countries they rarely practise<br />
anything that we should consider music. Schweinfurth, however, was pleased with some of the simple melodies which he<br />
heard in the interior of Africa. (Descent of Man)<br />
***<br />
The negro in Africa when excited often bursts forth in song; "another will reply in song, whilst the company, as if touched<br />
by a musical wave, murmur a chorus in perfect unison. (Descent of Man)<br />
6. Beziehungen zwischen Mann und Frau<br />
Turning to Africa: the Kaffirs buy their wives, and girls are severely beaten by their fathers if they will not accept a chosen<br />
husband; but it is manifest from many facts given by the Rev. Mr. Shooter, that they have considerable power of choice.<br />
Thus very ugly, though rich men, have been known to fail in getting wives. The girls, before consenting to be betrothed,<br />
compel the men to shew themselves off first in front and then behind, and exhibit their paces." They have been known to<br />
propose to a man, and they not rarely run away with a favoured lover. So again, Mr. Leslie, who was intimately acquainted<br />
with the Kaffirs, says, "it is a mistake to imagine that a girl is sold by her father in the same manner, and with the same<br />
authority, with which he would dispose of a cow." Amongst the degraded bushmen of S. Africa, "when a girl has grown up<br />
to womanhood without having been betrothed, which, however, does not often happen, her lover must gain her<br />
approbation, as well as that of the parents." Mr. Winwood Reade made inquiries for me with respect to the negroes of<br />
western Africa, and he informs me that "the women, at least among the more intelligent pagan tribes, have no difficulty in<br />
getting the husbands whom they may desire, although it is considered unwomanly to ask a man to marry them. They are<br />
quite capable of falling in love, and of forming tender, passionate, and faithful attachments." Additional cases could be<br />
given. (Descent of Man)<br />
7. Vermischung von Schwarzen und Weissen<br />
In the United States the census for the year 1854 included, according to Dr. Bachman, 405'751 mulattoes; and this number,<br />
considering all the circumstances of the case, seems small; but it may partly be accounted for by the degraded and<br />
anomalous position of the class, and by the profligacy of the women. A certain amount of absorption of mulattoes into<br />
negroes must always be in progress; and this would lead to an apparent diminution of the former. The inferior vitality of<br />
mulattoes is spoken of in a trustworthy work as a well-known phenomenon; and this, although a different consideration<br />
from their lessened fertility, may perhaps be advanced as a proof of the specific distinctness of the parent races. (Descent of<br />
Man)<br />
***<br />
Dr. Rohlfs writes to me that he found the mixed races in the Great Sahara, derived from Arabs, Berbers, and Negroes of<br />
three tribes, extraordinarily fertile. On the other hand, Mr. Winwood Reade informs me that the Negroes on the Gold Coast,<br />
though admiring white men and mulattoes, have a maxim that mulattoes should not intermarry, as the children are few and<br />
sickly. This belief, as Mr. Reade remarks, deserves attention, as white men have visited and resided on the Gold Coast for<br />
four hundred years, so that the natives have had ample time to gain knowledge through experience. (Descent of Man)<br />
8. Entwicklung der Menschheit<br />
At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilised races of man will almost certainly<br />
exterminate, and replace, the savage races throughout the world. At the same time the anthropomorphous apes... will no<br />
doubt be exterminated. The break between man and his nearest allies will then be wider, for it will intervene between man<br />
in a more civilised state, as we may hope, even than the Caucasian, and some ape as low as a baboon, instead of as now<br />
between the negro or Australian and the gorilla. (Descent of Man)<br />
***<br />
An observation by Vogt bears on this subject: he says, "It is a remarkable circumstance, that the difference between the<br />
sexes, as regards the cranial cavity, increases with the development of the race, so that the male European excels much<br />
more the female, than the negro the negress. Welcker confirms this statement of Huschke from his measurements of negro<br />
and German skulls." But Vogt admits... that more observations are requisite on this point. (Descent of Man)<br />
9. Unterschiede zwischen den Rassen<br />
Anhang: Sonstige<br />
Our naturalist would likewise be much disturbed as soon as he perceived that the distinctive characters of all the races were<br />
highly variable. This fact strikes every one on first beholding the negro slaves in Brazil, who have been imported from all<br />
parts of Africa... It may be doubted whether any character can be named which is distinctive of a race and is constant.<br />
Savages, even within the limits of the same tribe, are not nearly so uniform in character, as has been often asserted.<br />
Hottentot women offer certain peculiarities, more strongly marked than those occurring in any other race, but these are<br />
known not to be of constant occurrence. (Descent of Man)<br />
***<br />
If a naturalist, who had never before seen a Negro, Hottentot, Australian, or Mongolian, were to compare them, he would at<br />
once perceive that they differed in a multitude of characters, some of slight and some of considerable importance. On<br />
enquiry he would find that they were adapted to live under widely different climates, and that they differed somewhat in<br />
bodily constitution and mental disposition. (Descent of Man)<br />
***<br />
The American aborigines, Negroes and Europeans are as different from each other in mind as any three races that can be<br />
named; yet I was incessantly struck, whilst living with the Feugians on board the Beagle, with the many little traits of<br />
character, shewing how similar their minds were to ours; and so it was with a full-blooded negro with whom I happened<br />
once to be intimate. (Descent of Man)<br />
***<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 602
Some of these, such as the Negro and European, are so distinct that, if specimens had been brought to a naturalist without<br />
any further information, they would undoubtedly have been considered by him as good and true species. Nevertheless all<br />
the races agree in so many unimportant details of structure and in so many mental peculiarities that these can be accounted<br />
for only by inheritance from a common progenitor; and a progenitor thus characterised would probably deserve to rank as<br />
man. (Descent of Man)<br />
10. Kulturelles Erbe<br />
Anhang: Sonstige<br />
Again, when I looked at the statue of Amunoph III, I agreed with two officers of the establishment, both competent judges,<br />
that he had a strongly-marked negro type of features... (Descent of Man)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 603
8.4.4 Ein Selbstgespräch von Albert Wirz<br />
Albert Wirz ist <strong>Pro</strong>fessor für die Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität in Berlin und war von<br />
1988-1991 Chefredaktor des "Magazins" des "Tages Anzeigers". In einem Selbstgespräch, im "Magazin" vom<br />
19.9.1998 (S. 36-42) versucht er die Situation im Kongo zu erklären. Er ist der Meinung, dass Geschichte eine<br />
weit komplizierte Angelegenheit ist, als dies durch Zeitungsberichte und Schulbücher vermittelt wird.<br />
Der Text wird an dieser Stelle wiedergeben weil er erstens einen Einblick in die komplexen Strukturen Afrikas<br />
bietet, und zweitens dem Anliegen dieser Arbeit, verbreitete Vorstellungen über Schwarzafrika kritisch zu<br />
untersuchen, förderlich ist.<br />
Anhang: Sonstige<br />
Warum dieses Elend in der Welt? Und weshalb all die Kriege in Afrika? Erklär's mir.<br />
Nun, ich weiss nicht.<br />
Drucks nicht so rum. Jahrein, jahraus Bücher lesen und dann schweigen, wenn man was wissen möchte. Jetzt erklär mir:<br />
Warum führen die da unten im Kongo schon wieder Krieg? Die haben nichts. Und das wenige, das sie haben, schiessen sie<br />
auch noch kaputt, diese Tutsi. Da soll einer klug werden. Du warst doch auch mal da, oder?<br />
Jaja. Das ist eine lange Geschichte. Und wenn du wirklich etwas wissen willst, dann musst du dir schon etwas Zeit nehmen.<br />
Auch unterhaltend wird es nicht sein. Kein Spiel, kein Spass. Nur Geschichte, Blut und Tränen.<br />
Fang nur nicht bei Adam und Eva an!<br />
Erinnerst du dich? Im Frühjahr reiste Präsident Clinton unter grossem Getöse, aber mit leeren Taschen durch Afrika. In<br />
Kampala, der Hauptstadt von Uganda, lobte er die eigens zur Huldigung geladenen Staatschefs von Eritrea, Äthiopien,<br />
Uganda und Ruanda als Vertreter einer neuen Generation, welche Afrika zu einer Renaissance führen werden. Zudem<br />
verkündete er, dass der Kongress in Washington ein Gesetz zur Förderung des Handels mit Afrika verabschieden werde.<br />
Die Medien griffen die Neuigkeit begierig auf und frohlockten: Die USA haben Frankreich in Afrika den Rang abgelaufen.<br />
Vorbei die Zeit, als Paris afrikanische Diktatoren hofierte und nach Belieben manipulierte. Fortan werde es aufwärtsgehen<br />
mit dem Kontinent.<br />
Dass ich nicht lache.<br />
In der Tat brach wenig später ein Grenzstreit zwischen Äthiopien und Eritrea aus. Und nun auch noch dieser Krieg im<br />
Kongo. Die ganze Region ist erneut in Aufruhr. Laurent-Désiré Kabila, der erst vor zwei Jahren mit ruandischer Hilfe den<br />
todkranken Mobutu Sese-Seko aus dem Amt jagte, sieht sich mit einer Rebellion konfrontiert. Und wären ihm nicht<br />
Angola, Zimbabwe und Namibia mit Truppen zu Hilfe geeilt - wer weiss, dann sässe heute schon ein neuer Mann im<br />
Präsidentenpalast von Kinshasa, vielleicht sogar ein Geschichtsprofessor. Jedenfalls steht mit Ernest Wamba dia Wamba<br />
ein bekannter Historiker an der Spitze der Rebellenkoalition.<br />
Womit bewiesen wäre, dass auch aus Historikern was werden kann.<br />
In Afrika jedenfalls. Doch Spass beiseite. Ich wollte auf zwei wesentliche andere Dinge hinweisen. Erstens zeigt sich nun,<br />
dass die USA keine Afrikapolitik haben. Die Ereignisse der letzten Wochen im Kongo haben sie völlig überrascht.<br />
Zweitens haben Nachbarn Truppen entsandt. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein weiterer Schritt in Richtung Chaos. Ich<br />
denke aber, dass man gerade diese Intervention als Zeichen einer afrikanischen Renaissance nehmen kann.<br />
Habe ich richtig gehört, du bezeichnest Krieg als etwas Positives, als Fortschritt gar?<br />
Ich sehe insofern etwas Positives in dieser Intervention, als sie zeigt, dass die Afrikaner ihre politischen <strong>Pro</strong>bleme selbst<br />
lösen wollen, Handlungsfähigkeit gewonnen haben und keinen Vormund brauchen. Die Intervention ist ja auch von<br />
Gesprächen und diplomatischen Initiativen begleitet. Das ist etwas völlig Neues in der Region. Du erinnerst dich: Als der<br />
Kongo 1960 unabhängig wurde, brach sogleich das Chaos los. Die Armee meuterte, die <strong>Pro</strong>vinzen Katanga und Kasai<br />
sagten sich von Kinshasa los, das Land versank in einen jahrelangen blutigen Bürgerkrieg. Belgien entsandte<br />
Fallschirmjäger, die Uno stellte ein internationales Truppenkontingent zusammen, die USA schickten die CIA vor. Später<br />
war es dann Paris, das wiederholt militärisch intervenierte. Die Regierung des benachbarten Angola verdankt ihr Überleben<br />
kubanischen Truppen.<br />
Kabila seinerseits war von Anfang an auf fremde Hilfe angewiesen. Aber zum ersten Mal lag die Initiative bei<br />
afrikanischen Regierungen. Und wenn das auch nicht die ersehnte afrikanische Renaissance bedeutet, so ist es doch ein<br />
wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zu eigenverantwortlichem politischem Handeln, ein Schritt zurück zum<br />
Wiedergewinn jener Souveränität, welche den Afrikanern durch die Kolonialherrschaft genommen worden war.<br />
Mag sein. Aber welche Ziele verfolgen die Beteiligten? Was hat Zimbabwe im Kongo zu suchen?<br />
Und was hat die Nato in Bosnien zu suchen? Und was in Kosovo? Ich denke, da wie dort geht es darum, die Streithähne<br />
dazu zu bringen, ihre Differenzen mit friedlichen Mitteln auszutragen. Angola nutzt zudem ganz offensichtlich die<br />
Gelegenheit, der Unita die rückwärtigen Verbindungen abzuschneiden. Unita, das ist die von Jonas Savimbi, einem in<br />
Lausanne ausgebildeten Politologen, angeführte Bewegung, welche formell mit der Zentralregierung in Luanda<br />
zusammenarbeitet, in Wirklichkeit aber weiterhin grosse Teile Angolas beherrscht und namentlich die Diamantenfelder im<br />
Nordosten des Landes kontrolliert und auch weiterhin eine eigene Armee unterhält. Um als eigenständige Kraft überleben<br />
zu können, braucht die Unita offene Grenzen zum Kongo.<br />
Dann wäre die Unita in einer ähnlichen Lage wie jene Ruander, die von Nordostkongo aus operieren? Und die ruandische<br />
Regierung hat ähnliche Interessen wie Luanda?<br />
So ist's. Ruanda steht noch immer im Banne des Genozids von 1994. Damals sind in einem wochenlangen Gemetzel<br />
mehrere hunderttausend Tutsi und Hutu umgebracht worden, welche der Zusammenarbeit mit der Patriotischen Front<br />
verdächtigt wurden. Diese führte seit 1990 Krieg gegen die Regierung in Kigali. Ziel des Genozids war es, die<br />
Machtübernahme durch die Patriotische Front zu vereiteln. Das genaue Gegenteil trat ein. Worauf sich die abgesetzte<br />
Regierung und die ruandische Armee dem landesweiten Exodus Hunderttausender Hutu anschlossen. Mit Sack und Pack,<br />
mit Lastern, Waffen und auch schwerem Gerät flohen sie in den benachbarten Kongo, der damals noch Zaire hiess.<br />
Französische Truppen, die interveniert hatten, um weiteres Blutvergiessen zu verhindern, hielten ihnen den Rücken frei.<br />
Niemand nahm den Fliehenden beim Grenzübertritt die Waffen ab. Die zairischen Behörden waren dazu zu schwach,<br />
unfähig oder einfach nicht willens. Die Uno-Flüchtlingsorganisation sicherte mit massiven Hilfeleistungen das Überleben<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 604
Anhang: Sonstige<br />
der Flüchtlinge, baute Lager um Lager, einige so gross wie eine Stadt, und verteilte Nahrungsmittel. Aber auch sie<br />
unternahm keine ernsthaften Versuche, Täter von Opfern zu trennen. So konnten die Verantwortlichen des Genozids von<br />
1994 aus den Flüchtlingslagern heraus neue Terroranschläge in ihrer alten Heimat organisieren.<br />
Verständlich, dass Kigali das auf die Länge nicht dulden konnte und sich im Herbst 1996 mit jenen zusammentat, die im<br />
Kivu zum Aufstand gegen Mobutu aufriefen. Die Folgen sind bekannt. Ein Gutteil der Flüchtlinge kehrte darauf nach<br />
Ruanda zurück, andere aber zogen weiter nach Westen, in die Wälder am oberen Kongo. Bis heute ist unklar, wie viele von<br />
ihnen von den eigenen Leuten als Geiseln missbraucht wurden. Jedenfalls kam es zu neuen Massakern, diesmal verübt von<br />
den Soldaten der Rebellenallianz um Laurent Kabila. Die Terroranschläge im Nordwesten Ruandas fanden auch nach<br />
diesem Kriegszug kein Ende. Im Gegenteil, sie nahmen im Verlauf der letzten Monate eher noch zu. Kaum verwunderlich<br />
deshalb, dass Kigali das Heil erneut in einer verdeckten Intervention sucht und sich hinter die Anti-Kabila-Koalition stellt.<br />
Ganz ähnlich bietet sich die Lage für die Regierung in Kampala dar. Denn im nordöstlichen Kongo sitzen nicht nur Leute,<br />
welche einen Umschwung in Ruanda gewaltsam erzwingen wollen, sondern auch solche, welche Museveni, den<br />
ugandischen Präsidenten, stürzen möchten.<br />
Willst du damit sagen, dass die Grenzen das eigentliche <strong>Pro</strong>blem sind? Ich habe das schon immer gedacht. Sind doch alle<br />
künstlich, nicht? Ein Erbe der Kolonialherrschaft, am grünen Tisch in Europa gezogen, ohne Rücksicht auf die ethnischen<br />
Gegebenheiten. Geschah das nicht in Berlin, damals an der Kongo-Konferenz 1884/85?<br />
Das wird zwar immer wieder behauptet. Es stimmt aber nicht. An der Berliner Kongo-Konferenz wurden die Grundlagen<br />
der kolonialen Aufteilung Afrikas festgelegt, die Art und Weise, wie man vorzugehen habe, damit die Kolonien<br />
völkerrechtlich anerkannt werden. Einzig für den Kongo-Freistaat wurden in groben Zügen Grenzen benannt.<br />
Du verwirrst mich. Zuerst sagst du, es seien keine Grenzen festgelegt worden, dann wieder doch. Da soll einer klug<br />
werden.<br />
Ja, so ist das mit der Geschichte. Sie ist ein Flickenteppich aus lauter Besonderheiten, vielen Ausnahmen und einigen<br />
Widersprüchen. Ich wollte dir damit nur zeigen, dass man vorsichtig sein muss beim Verallgemeinern. In Afrika ganz<br />
besonders. Denn wenn uns Europa vielgestaltig erscheint, wie viel komplexer ist dann Afrika. Nur aus der Ferne betrachtet<br />
erscheint es einheitlich.<br />
Schon gut. Keine unnötigen Belehrungen. Sag mir jetzt lieber, was es mit den Grenzen auf sich hat. Sind sie künstlich oder<br />
nicht? Musste man sie nicht besser den ethnischen Gegebenheiten anpassen?<br />
Alle Grenzen sind künstlich. Oder empfindest du etwa die schweizerischen Grenzen als natürlich?<br />
Aber ganz gewiss.<br />
Mag sein, aber doch wohl nur, weil sie nun schon einige Zeit Bestand haben und deshalb als sinnvoll erfahren werden. Und<br />
weil die Menschen beidseits der Grenze gelernt haben, sich als etwas Eigenes zu verstehen. Aber du hast recht. Sehr oft<br />
haben die kolonialen Grenzen keine Rücksicht auf historisch gewachsene Zusammenhänge genommen. Und immer<br />
wieder liest man die Forderung, die afrikanischen Staatsgrenzen müssten den ethnischen Gegebenheiten besser angepasst<br />
werden.<br />
Ich halte wenig von diesem Vorschlag. Er erinnert an die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs unternommenen<br />
Versuche, die Völker im Südosten Europas auseinanderzudividieren. Es hat da nicht geklappt, und es wurde auch in<br />
Afrika nichts bringen. Denn die ethnischen Gegebenheiten sind viel zu komplex. Vor allem aber sind ethnische Grenzen<br />
nichts Festes. Es ist zwar richtig, dass die koloniale Grenzziehung beispielsweise das von Bakongo besiedelte Gebiet auf<br />
drei verschiedene Staaten aufgeteilt hat: Angola, Kongo-Kinshasa und Kongo-Brazzaville. Aber die Bakongo selbst<br />
haben erst im Gefolge der Kolonialherrschaft ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, ein Bewusstsein dafür, dass sie<br />
eine eigene Kultur und eine eigene Geschichte haben, welche sie von anderen unterscheidet.<br />
In Ruanda ist es noch extremer. Erst die Kolonialherrschaft hat Hutu und Tutsi als ethnische Gemeinschaften geschaffen,<br />
wobei die Regierung des unabhängigen Ruanda alles getan hat, um diese Zweiteilung zu vertiefen.<br />
Das kann ja wohl nicht stimmen. Sind die Tutsi nicht zugewanderte Viehhirten, welche die einheimischen Hutu-Bauern<br />
unterjochten? Hab' ich doch irgendwo gelesen. In einer Zeitung oder in einem Lexikon. Und unterscheiden sich die beiden<br />
Gruppen nicht sogar in ihrem Körperbau?<br />
Ja, so wie Appenzeller und Zürcher etwa. Nun, es trifft wohl zu, dass im Süden und im Zentrum des Landes im 19.<br />
Jahrhundert ein Königreich bestand, das von Tutsi-Aristokraten beherrscht wurde. Diese Tutsi monopolisierten den<br />
Viehbesitz und schrieben sich auch eine fremde Herkunft zu. Die Bauern wurden als Hutu bezeichnet. Die Europäer, erst<br />
die Deutschen, dann die Belgier, haben dieses streng hierarchische Sozialsystem für die eigenen Zwecke instrumentalisiert<br />
und aufs ganze Land ausgedehnt. Aus ihrer Sicht waren Hutu und Tutsi zwei verschiedene Stämme oder gar Rassen. Die<br />
Zugehörigkeit zur einen oder anderen Gruppe wurde in den Personalausweisen festgeschrieben. Vordem durchlässige<br />
soziale Grenzen wurden zu einer unüberwindlichen Mauer. Und als in den fünfziger Jahren erstmals Wahlen durchgeführt<br />
wurden, mobilisierten junge Hutu-lntellektuelle die ethnische Solidarität, welche ihnen automatisch zu einer Mehrheit<br />
verhalf. Politik wurde zu einem Wettstreit zwischen zwei Ethnien. Die jetzige Regierung ist die erste, welche dieses<br />
ethnische Denken zu überwinden versucht. Weil jedoch in entscheidenden Ämtern Tutsi sitzen, zweifeln Kritiker an der<br />
Glaubwürdigkeit der Regierung und bezeichnen sie als Tutsi-Diktatur.<br />
Ein Teufelskreis also.<br />
Genau. Und die aktuellen Ereignisse zeigen, dass in Zeiten der Unruhe und der Unsicherheit das ethnische Denken<br />
zusätzliche Bedeutung erlangt. Wem vertraut man am ehesten? Jenen, mit denen man ein Schicksal teilt. So hat Kabila<br />
seinen Sohn zum Oberbefehlshaber ernannt. Andere wichtige Posten hat er mit Leuten aus seiner Heimatprovinz Katanga<br />
besetzt. Das vermittelt den Eindruck von ungezügelter Vetternwirtschaft und von Stammesdenken. Übersehen wird dabei,<br />
dass Kabila seine Position nur sichern kann, wenn er die Loyalität von einflussreichen Männern aus der <strong>Pro</strong>vinz Katanga<br />
gewinnt. Denn die <strong>Pro</strong>vinz Katanga bildet mit ihren unermesslichen Bodenschätzen das wirtschaftliche Rückgrat des<br />
ganzen Landes. Gerade hier wurde immer wieder mal der Wunsch nach Sezession laut.<br />
Fallt der Kongo auseinander?<br />
Nein, ich denke eben nicht. Denn trotz allem Reden über die Künstlichkeit der kolonialen Grenzen haben diese über die<br />
Jahre hinweg eine ganz überraschende Stabilität gewonnen. Es hat zwar da und dort in Afrika Abspaltungsbewegungen<br />
gegeben. Die bedeutendste war die Sezession Biafras 1967. Doch letztlich siegte auch da der Einheitswille. Selbst im<br />
Kongo ist der Nationalismus zu einer ernstzunehmenden Kraft geworden, wie gerade die letzten Tage wieder zeigten, als<br />
aufgebrachte Bürger in der Hauptstadt Jagd auf Tutsi und vermeintliche Tutsi machten. Die Regierung hatte sie dazu<br />
aufgehetzt, indem sie den neu ausgebrochenen Konflikt um die Macht als einen Konflikt zwischen Kongolesen und<br />
Fremden, Kongolesen und Tutsi darstellte. Umgekehrt zielen die Aktionen der Rebellen weit über die <strong>Pro</strong>vinz Kivu<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 605
Anhang: Sonstige<br />
hinaus. Sie wollen eine Neuverteilung der Macht im ganzen Land erzwingen. Ruanda seinerseits hütet sich, den Kivu zur<br />
Sezession aufzufordern oder ihn gar zu annektieren. So stärkt der aktuelle Krieg paradoxerweise den nationalen<br />
Zusammenhalt. Was einen Historiker letztlich nicht überrascht, denn im Europa des 19. Jahrhunderts war es nicht anders.<br />
In einem Punkt allerdings unterscheidet sich der Kongo ganz deutlich von einem europäischen Staat.<br />
Und das wäre?<br />
Im Kongo ist der Staat bestenfalls ein Skelett. Die Jahre der Mobutu-Diktatur und die seit den siebziger Jahren anhaltende<br />
Wirtschaftskrise haben dazu geführt, dass die staatlichen Institutionen völlig zerrüttet sind. Wobei gleich anzufügen ist,<br />
dass in Afrika der moderne Staat, weil kolonialen Ursprungs, an vielen Orten ohnehin ein Fremdkörper geblieben ist. Nicht<br />
Ausdruck des politischen Willens der Bürgerinnen und Bürger und auch nicht eine zwischen den Interessengruppen<br />
vermittelnde Instanz, schon gar nicht die von Hegel erhoffte Verkörperung des Weltgeistes. Sondern eine Zwangsinstanz<br />
fremden Ursprungs und ein Sesam-öffne-dich zu den Reichtümern der Aussenwelt. Bürgersinn kann sich da nur schwer<br />
entwickeln. Kabila und seine bewaffneten Truppen haben anfangs von dieser Schwäche profitiert. Nirgends regte sich<br />
Widerstand gegen ihren Marsch auf Kinshasa. Doch was ursprünglich ein Vorteil war, entpuppte sich bald als neues<br />
Hindernis. Die neue Regierung hat, wie sich schnell zeigte, nur beschränkten Einfluss auf das Geschehen im weiten Land.<br />
Keine Rede von einem Gewaltmonopol. Je weiter man sich vom Zentrum entfernt, desto geringer ist ihr Einfluss. Die<br />
Grenzregionen sind gewaltoffene Raume, wie es schon die Grenzregionen in den Staaten des vorkolonialen Afrika waren.<br />
Du hast nun schon mehrmals auf die Kolonialherrschaft verwiesen. Ist das nicht etwas einfach, den Europäern für alles die<br />
Schuld zu geben? Immerhin liegt die Kolonialperiode bald 40 Jahre zurück.<br />
Habe ich von Schuld gesprochen? Bleiben wir bei den Fakten. Es ist richtig, dass die Kolonialherrschaft bestenfalls drei<br />
Generationen dauerte. Jacob Ade Ajayj, der grosse nigerianische Historiker, hat sogar gesagt, die Kolonialherrschaft sei<br />
nur eine Episode im grösseren Kontinuum der afrikanischen Geschichte, ein kurzer Atemzug. Trotzdem denke ich, dass sie<br />
eine wichtige Zäsur in der afrikanischen Geschichte bedeutet. Im übrigen sollten wir nicht vergessen, dass die jungen<br />
Staaten Afrikas auch über ihre Unabhängigkeit hinaus wirtschaftlich vom Norden abhängig blieben. So gesehen, war die<br />
Unabhängigkeit eher ein Stabwechsel als die Rückeroberung der Souveränität. Als wichtigste Neuerung der Kolonialzeit<br />
würde ich den Territorialstaat bezeichnen. Anzumerken ist allerdings, dass die Europäer auch eine Kultur der politischen<br />
Willkür und der Gewalt begründeten, die völlig im Widerspruch steht zu den eigenen Zivilisationsidealen.<br />
Haben die Europäer im Kongo denn nicht den Sklavenhandel bekämpft? Ich habe kürzlich in einer Zeitschrift gelesen,<br />
sogar der erste Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, ein Genfer, habe da mitgewirkt. Stimmt das?<br />
Du überraschst mich mit deinem Wissen. In der Tat betrachtete Gustave Moynier, der Weggefährte Henri Dunants und<br />
erste IKRK-Präsident, die koloniale Erschliessung des Kongo als aufklärerische Tat im Kampf gegen den "arabischen"<br />
Sklavenhandel. Gemeint war damit die Handelstätigkeit von Karawanenhändlern wie Tippu Tip, die in der zweiten Hälfte<br />
des 19. Jahrhunderts von der ostafrikanischen Küste bis an den oberen Kongo vorstiessen, um sich dort Elfenbein und<br />
Sklaven zu verschaffen. Als der Kongo auf der Berliner Kongo-Konferenz dem belgischen König als Privatkolonie<br />
zugesprochen wurde, begrüsste Moynier das begeistert, weil er glaubte, Leopold II. gehe es um ein humanitäres Werk. Als<br />
guter Bürger setzte Moynier Handel und Fortschritt in eins. Wie sich dann aber schnell zeigte, begann 1885 nicht eine Ära<br />
des Friedens im Kongo, sondern ein beispielloser Terror. Die Flussanrainer wurden mit Waffengewalt zum<br />
Kautschuksammeln in die Wälder getrieben. Wer nicht parierte, wurde verschleppt, verstümmelt oder hingerichtet.<br />
Und was sagte Moynier dazu?<br />
Er schwieg.<br />
Du meinst, er protestierte nicht?<br />
Nein, er hüllte sich vornehm in Schweigen. Und das, obwohl andere Zeitgenossen, englische Missionare, Journalisten und<br />
Schriftsteller wie Mark Twain und der Krimiautor Arthur Conan Doyle, ihre Betroffenheit hinausschrien. Auch in der<br />
Schweiz empörten sich einige christlich gesinnte Menschen. Schliesslich musste Leopold II. seine Kolonie an den<br />
belgischen Staat abtreten. Die schlimmsten Missstände wurden behoben. Doch es dauerte Jahre, bis die in der Zeit der<br />
Raubwirtschaft verbreitete Schlafkrankheit eingedämmt werden konnte. Wie viele Menschen damals starben, wird sich nie<br />
mit Sicherheit sagen lassen. Jan Vansina, der beste Kenner der Geschichte dieser Region und ein besonnener Mann, der es<br />
gewohnt ist, seine Worte zu wagen, schätzt, dass zwischen 1880 und 1920 vielleicht die Hälfte der Bevölkerung im Kongo<br />
umgekommen ist. Du siehst, der ruandische Genozid von 1994, Gewalt und Terror, haben Tradition in der Region.<br />
Und wie kommt das?<br />
Am besten liest du Joseph Conrads Roman "Herz der Finsternis" aus dem Jahre 1902. Aus eigenem Erleben geschrieben,<br />
zeigt Conrad einen Europäer, der im Urwald, getrieben von <strong>Pro</strong>fitgier, zur Bestie wird. Niemand ist da, der ihn zurückhält,<br />
weder vernünftige Freunde noch eine staatliche Ordnungsmacht. Diese Einsicht ist, wie mir scheint, heute so gültig wie<br />
damals: Ohne eine feste institutionelle Ordnung und ohne Recht ist kein Friede zu haben, weder in Afrika noch anderswo.<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 606
8.5 Quellenverzeichnis<br />
Das Quellenverzeichnis listet die zur Erstellung für diese Arbeit als Hintergrund- oder Untersuchungsmaterial<br />
benutzten Bücher und andere Medien auf. Bei einigen älteren Lehrmitteln wurden keine genauen Angaben<br />
gemacht, da diese auch nach Rücksprache mit dem verantwortlichen Verlag nicht mehr eruiert werden konn-<br />
ten. Das Verzeichnis ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:<br />
1.) Afrika in Atlanten und Geographiebüchern:<br />
In diesem Abschnitt finden sich alle Geographiebücher und -lehrmittel, die in der Arbeit besprochen wurden<br />
oder als Hintergrundinformation hinzugezogen wurden. Die besprochenen Bücher sind chronologisch, die<br />
Quellen für Hintergrundinformationen sind alphabetisch geordnet.<br />
2.) Afrikanische Musik in Musikbüchern:<br />
In diesem Abschnitt finden sich alle Musikbücher und -lehrmittel, die in der Arbeit besprochen wurden oder<br />
als Hintergrundinformation hinzugezogen wurden. Sie sind weitgehend chronologisch geordnet.<br />
Afrika in Lesebüchern:<br />
In diesem Abschnitt finden sich die in der Arbeit besprochenen Lesebücher und Sprachlehrmittel. Sie sind<br />
chronologisch geordnet.<br />
Afrika im Comic:<br />
In diesem Abschnitt finden sich die in der Arbeit besprochenen Comicbücher und -hefte. Sie sind chronolo-<br />
gisch geordnet.<br />
Geschichte Afrikas:<br />
In diesem Abschnitt finden sich die für den zweiten Teil der Arbeit "Überblick über die Geschichte Schwarzaf-<br />
rikas" und bei der Abklärung historischer Aussagen benutzen Geschichtsbücher.<br />
Sonstige Bücher:<br />
In diesem Abschnitt finden sich Romane, Nachschlagewerke, sowie alle weiteren Bücher, die sich nicht in eine<br />
der oben genannten Kategorien einordnen liessen. Sie sind innerhalb der einzelnen Unterabschnitte alphabe-<br />
tisch geordnet.<br />
Elektronische Medien:<br />
In diesem Abschnitt finden sich die zur Erstellung der Arbeit konsultierten CD-ROMs, wobei es sich vor allem<br />
um Nachschlagewerke aller Art handelt, sowie um am Fernsehen ausgestrahlte oder ansonsten erhältliche<br />
Videofilme zum Thema Schwarzafrika. Sie sind innerhalb der Unterabschnitte alphabetisch geordnet.<br />
Internet:<br />
In diesem Abschnitt finden sich die für die Arbeit verwendeten Quellen, vorwiegend Texte, aus dem Internet.<br />
Sie sind alphabetisch geordnet.<br />
Zeitungen und Zeitschriften:<br />
In diesem Abschnitt finden sich die zur Erstellung der Arbeit verwendeten Zeitungsartikel und Magazinbeiträ-<br />
ge. Sie sind nach den einzelnen Zeitungen und Zeitschriften gegliedert und innerhalb eines Medientitels chro-<br />
nologisch geordnet.<br />
Quellenverzeichnis:<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 607
8.5.1 Afrika in Atlanten und<br />
Geographiebüchern:<br />
8.5.1.1 Untersuchte Lehrmittel und Werke<br />
Lehr- und Lesebuch, 1912<br />
Lehr- und Lesebuch für die thurgauischen Volksschulen 7.- 9.<br />
Schuljahr<br />
Bearbeitet im Auftrag des Erziehungsdepartements<br />
Huber & Co, Frauenfeld 7. Auflage 1912<br />
Lesebuch für die Oberklassen, ca. 1930<br />
Lesebuch für die Oberklassen<br />
Bearbeitet von der Thurgauischen Lehrmittelkommission<br />
Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen, 1936<br />
Arbeits- und Lesebuch für Oberklassen<br />
Geschichte, Geographie<br />
Thurgauischer Lehrmittelverlag, 1936<br />
Hotz-Vosseler, 1934<br />
Leitfaden für den Geographieunterricht<br />
Hotz-Vosseler<br />
Verlag von Helbing & Lichtenhahn, Basel 22. Auflage 1934<br />
Sekundarschulatlas, 1950<br />
Schweizerischer Sekundarschulatlas<br />
Herausgegeben von der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich<br />
Kantonaler Lehrmittelverlag Zürich, 5. Auflage 1950<br />
Geographie ZH, 1953<br />
Geographie<br />
Verbindliches Lehrmittel für die Sekundarschulen des Kanton<br />
Zürich<br />
Verfasst von einer Arbeitsgemeinschaft zürcherischer<br />
Sekundarlehrer<br />
Erziehungsdirektion des Kanton Zürich, Kantonaler Lehrmittelverlag,<br />
3. Auflage 1953<br />
Aussereuropäische Erdteile, 1953<br />
Aussereuropäische Erdteile<br />
Geographische Bilder<br />
Verlag der Sekundarllehrerkonferenz des Kanton Zürich, 1953<br />
Harms, 1961<br />
Harms Erdkunde<br />
Die Welt in allen Zonen<br />
Ein Erdkundliches Lesebuch nach Quellen<br />
Paul List Verlag, München 1961<br />
Schweizerischer Mittelschulatlas, 1962<br />
Schweizerischer Mittelschulatlas<br />
herausgegeben von der Konferenz der kantonalen<br />
Erziehungsdirektoren<br />
Eduard Imhof<br />
Kantonaler Lehrmittelverlag Zürich, 13. Auflage, 1962<br />
Geographie TG, 1963<br />
Geographie<br />
Thurgauischer Lehrmittelverlag<br />
Huber & Co AG, Frauenfeld 1963<br />
Widrig, 1963/64<br />
Geographie<br />
Europa / Aussereuropa<br />
A. Widrig<br />
Logos Verlag Zürich, 6. erweiterte Auflage 1963/64 (1947)<br />
Weltatlas, 1965<br />
Der Grosse Reader's Digest Weltatlas<br />
Verlag Das Beste, Stuttgart 3. rev. Auflage 1965<br />
Widrig, 1967<br />
Geographie<br />
Europa / Aussereuropa<br />
A. Widrig<br />
Logos Verlag Zürich, 7. Auflage 1967 (1947)<br />
Seydlitz Realschulen, 1968<br />
Seydlitz für Realschulen<br />
Band 1: Deutschland<br />
Ferdinand Hirt, Kiel 1973<br />
Seydlitz für Realschulen<br />
Band 2: Europa<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1966<br />
Seydlitz für Realschulen<br />
Band 3: Afrika, Asien<br />
Ferdinand Hirt, Kiel 1968<br />
Seydlitz für Realschulen<br />
Band 4: Asien, Australien, Weltmerr, Polargebiete<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1969<br />
Seydlitz für Realschulen<br />
Band 5: Deutschland - Formende Kräfte der Erde<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1969<br />
Seydlitz für Realschulen<br />
Band 6: Menschliche Gemeinschaften gestalten die Erde<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1968<br />
Erdkunde, 1968<br />
Erdkunde 1: Deutsche Landschaften<br />
Ferdinand Schöningh, Paderborn 1964<br />
Erdkunde 2: Europäische Landschaften<br />
Ferdinand Schöningh, Paderborn 1965<br />
Erdkunde 3: Afrika, Asien<br />
Ferdinand Schöningh, Paderborn 1968<br />
Erdkunde 4: Amerika, Australien, Weltmeere, Polarländer<br />
Ferdinand Schöningh, Paderborn 1971<br />
Erdkunde 5: Mitteleuropa<br />
Ferdinand Schöningh, Paderborn 1974 (1965)<br />
Erdkunde: Oberstufe, 1968-1969<br />
Erdkunde: Die Erde als Natur- und Lebensraum<br />
Oberstufe Teil 1<br />
Ferdinand Schöningh, Paderborn 1968<br />
Erdkunde: Die Erde als wirtschaftlicher und politischer Raum<br />
Oberstufe Teil 2<br />
Ferdinand Schöningh, Paderborn 1968<br />
Erdkunde: Deutschland - wirtschaftliche, soziale und politische<br />
<strong>Pro</strong>bleme<br />
Oberstufe 3<br />
Fedinand Schöningh, Paderborn 1969<br />
Länder und Völker, ca. 60er Jahre<br />
(jeweils Ausgabe A, Bestellnummer 451-455)<br />
Quellenverzeichnis<br />
Länder und Völker<br />
Erdkundliches Unterrichtswerk<br />
Band 1: Deutschland und seine Nachbarländer im Süden und Osten<br />
Ernst Klett Verlag Stuttgart<br />
Länder und Völker<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 608
Erdkundliches Unterrichtswerk<br />
Band 2: Europa - Länder und Völker um uns<br />
Ernst Klett Verlag Stuttgart<br />
Länder und Völker<br />
Erdkundliches Unterrichtswerk<br />
Band 3: Die Ostfeste - mit Ozeanien und dem grossen Ozean<br />
Ernst Klett Verlag, Stuttgart<br />
Länder und Völker<br />
Erdkundliches Unterrichtswerk<br />
Band 4: Die Westfeste - mit dem Atlantischen Ozean und den<br />
Polargebieten<br />
Ernst Klett Verlag Stuttgart<br />
Länder und Völker<br />
Erdkundliches Unterrichtswerk<br />
Band 5: Deutschland - die Mitte Europas<br />
Ernst Klett Verlag Stuttgart<br />
Seydlitz für Gymnasien, 1963- ca. 1971<br />
Seydlitz für Gymnasien<br />
Band 1: Deutschland<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1966<br />
Seydlitz für Gymnasien<br />
Band 2: Europa<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1969<br />
Seydlitz für Gymnasien<br />
Band 3: Westfeste - Amerika, Ozeane, Polargebiete<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1963 (1960)<br />
Seydlitz für Gymnasien<br />
Band 4: Deutschland - <strong>Pro</strong>bleme der Gegenwart<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1971<br />
Seydlitz<br />
Band 5: Erde und Mensch<br />
Ferdinand Hirt Verlag, keine Jahreszahl<br />
Seydlitz<br />
Band 6: Das Weltbild der Gegenwart<br />
Verlag Ferdinand Hirt, keine Jahreszahl<br />
Fahr mit in die Welt, 1971-1974<br />
Fahr mit in die Welt<br />
1. Band: Deutschland<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 7. Auflage 1974<br />
Fahr mit in die Welt<br />
2. Band: Europa (einschliesslich Sowjetunion)<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 4. Auflage 1971<br />
Fahr mit in die Welt<br />
3. Band: Aussereuropäische Erdteile, Deutschland und die Welt<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 4. Auflage 1972<br />
Geographie Aargau, 1974-1977<br />
Das Leben<br />
Geografie für die oberen Klassen der Volksschule 2<br />
Kantonaler Lehrmittelverlag Aarau 1974<br />
Die Arbeit<br />
Geografie für die oberen Klassen der Volksschule 3<br />
Kantonaler Lehrmittelverlag Aarau 1976<br />
Die Kultur<br />
Geografie für die oberen Klassen der Volksschule 4<br />
Lehrmittelverlag des Kantons Aargau 1977<br />
List Geographie, erstmals 1972-1976<br />
List Geographie 5/6<br />
Mensch und Erde - Schülerband<br />
Paul List Verlag München 1976<br />
List Geographie 7/8<br />
Mensch und Erde - Schülerband<br />
Paul List Verlag, München 1972<br />
List Geographie 9/10<br />
Mensch und Erde - Schülerband<br />
Paul List Verlag, München 1972<br />
Neue Geographie, 1974-1976<br />
Neue Geographie 5/6<br />
Der Mensch in seiner Umwelt<br />
August Bagel verlag, Düsseldorf 1976<br />
Neue Geographie 7/8<br />
August Bagel Verlag, Düsseldorf 1974<br />
Neue Geographie 9/10<br />
August Bagel Verlag, Düsseldorf 1975<br />
Dreimal um die Erde, 1977-1980, erstmals 1968-1972<br />
Dreimal um die Erde<br />
Band 1, für das 5. und 6. Schuljahr - Menschen in ihrer Welt<br />
Geographische Verlagsgesellschaft Velhagen & Klasing, Berlin<br />
1977 (1968)<br />
Dreimal um die Erde<br />
Band 2- für das 7. und 8. Schuljahr - Räume und <strong>Pro</strong>bleme<br />
CVK und Schroedel Geographische Verlagsgesellschaft, Berlin<br />
1980 (1970)<br />
Dreimal um die Erde<br />
Band 3 - Unsere Welt im Wandel<br />
Geographische Verlagsgesellschaft Velhagen & Klasing, Berlin<br />
1977 (1972)<br />
Geographie thematisch, 1977-1980<br />
Geographie thematisch 5/6<br />
5./6. Schuljahr<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1977<br />
Geographie thematisch 7/8<br />
7./8. Schuljahr<br />
Verlag Ferdinand Hirt, Kiel 1978<br />
Geographie thematisch 9/10<br />
9./10. Schuljahr<br />
CVK Schroedel, Berlin 1980<br />
Silva Weltatlas 1978<br />
Grosser Silva Weltatlas<br />
Silva Verlag, Zürich 1978<br />
Terra Weltkunde, 1979<br />
Terra - Weltkunde 5<br />
für Badenwürtenberg 5. Schuljahr<br />
Ernst Klett, Stuutgart 1978<br />
Terra - Weltkunde 6<br />
für Badenwürtenberg, 6. Schuljahr<br />
Ernst Klett, Stuttgart 1978<br />
Terra Geographie, 1979<br />
Terra Geographie 7/8<br />
7. und 8. Schuljahr<br />
Ernst Klett Verlage, Stuttgart 1979<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 609
Terra Geographie 9/10<br />
9. und 10. Schuljahr<br />
Ernst Klett, Stuttgart 1979<br />
Unser Planet, 1979-1982<br />
Unser Planet 5/6<br />
Geographie für das 5. und 6. Schuljahr<br />
Georg Westermann Verlag, Braunschweig 1979<br />
Unser Planet 7/8<br />
Geographie für das 7. und 8. Schuljahr<br />
Georg Westermann Verlag, Braunschweig 1981<br />
Unser Planet 9/10<br />
Geographie für das 9. und 10. Schuljahr<br />
Georg Westermann Verlag, Braunschweig 1982<br />
Terra Erdkunde für Realschulen, 1980-1985<br />
Terra Erdkunde 7<br />
Realschule 7 für Baden-Würtenberg<br />
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1985<br />
Terra Erdkunde 8<br />
Realschule 8 für Baden-Würtenberg<br />
Ernst Klett, Stuttgart 1980<br />
Terra Erdkunde 9<br />
Realschule 9 für Baden-Würtenberg<br />
Ernst Klett, Stuttgart 1981<br />
Terra - Erdkunde 10<br />
für Badenwürtenberg, 10. Schuljahr<br />
Ernst Klett, Stuttgart 1982<br />
Schweizer Weltatlas, 1981<br />
Schweizer Weltatlas für die Volks- und Mittelschule<br />
Herausgegeben von der Konferenz der kantonalen<br />
Erziehungsdirektoren<br />
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1981<br />
Terra Erdkunde, 1982-1983<br />
Terra - Erdkunde 11<br />
für Bandenwürtenburg, 11. Schuljahr<br />
Ernst Klett, Stuttgart 1983<br />
Seydlitz: Mensch und Raum, 1983-1984<br />
Mensch und Raum 7/8<br />
Seydlitz<br />
Ausgabe für Realschulen<br />
CVK und Schrodel; Berlin 1983<br />
Mensch und Raum 9/10<br />
Seydlitz<br />
Ausgabe für die Realschule<br />
CVK Schroedel, Berlin 1984<br />
Mensch und Raum 11<br />
Seydlitz<br />
Ausgabe für Gymnasien<br />
CVK Schroedel, Berlin 1984<br />
Mensch und Raum 7/8<br />
Seydlitz<br />
Ausgabe für die Realschulen, Lehrerheft<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1984<br />
Mensch und Raum 9/10<br />
Seydlitz<br />
Ausgabe für die Realschule - Lehrerheft<br />
CVK Schroedel, Berlin 1985<br />
Geographie der Kontinente, 1984<br />
Geographie der Kontinente<br />
Oskar Bär<br />
Lehrmittelverlag des Kanton Zürich, 1984<br />
Geographie der Kontinente<br />
Lehrerkommentar<br />
Oskar Bär<br />
Lehrmittelverlag des Kanton Zürich, 1987<br />
Mensch und Raum - Dreimal um die Erde, 1983-1986<br />
Mensch und Raum 5/6<br />
Dreimal um die Erde<br />
CVK Schroedel, Berlin 1983<br />
Mensch und Raum 7/8<br />
Dreimal um die Erde<br />
CVK Schroedel, Berlin 1985<br />
Mensch und Raum 9/10<br />
Dreimal um die Erde<br />
CVK Schroedel, Berlin 1984<br />
Mensch und Raum 5/6<br />
Dreimal um die Erde<br />
Lehrerband<br />
CVK Schroedel, Berlin 1984<br />
Mensch und Raum<br />
Dreimal um die Erde<br />
Lehrerband 7/8<br />
CVK Schroedel, Berlin 1986<br />
Terra Erdkunde: Hauptschule, 1985-1987<br />
Terra Erdkunde 7<br />
Hauptschule 7 für Baden-Würtenberg<br />
Ernst Klett Verlage, Stuttgart 1985<br />
Terra Erdkunde 8<br />
Hauptschule 8 für Baden-Würtenberg<br />
Ernst Klett Verlage, Stuttgart 1986<br />
Terra Erdkunde 9<br />
Hauptschule 9 für Baden-Würtenberg<br />
Ernst Klett Verlage, Stuttgart 1987<br />
Seydlitz: Mensch und Raum, 1987<br />
Mensch und Raum<br />
Seydlitz - Gymnasiale Oberstufe<br />
CVK Schroedel, Berlin 1987<br />
Diercke Taschenatlas, 1992<br />
Diercke: Taschenatlas der Welt<br />
dtv, München 7. neubearbeitete und aktualisierte Auflage 1992<br />
Seydlitz Erdkunde, 1993-1995<br />
Seydlitz 2<br />
Erkunde<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1993<br />
Seydlitz 3<br />
Erkunde<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1994<br />
Seydlitz: Erdkunde 4<br />
Gymnasium<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1995<br />
Seydlitz Geographie, 1994-1996<br />
Seydlitz Geographie 1<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1994<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 610
Seydlitz Geographie 2<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1994<br />
Seydlitz Geographie 3<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1995<br />
Seydlitz Geographie 4<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1996<br />
Heimat und Welt, 1994-1996<br />
Heimat und Welt<br />
Baden-Württemberg Hauptschule Klasse 5<br />
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1994<br />
Heimat und Welt<br />
Baden-Württemberg Hauptschule Klasse 6<br />
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1994<br />
Heimat und Welt<br />
Baden-Württemberg Hauptschule Klasse 7<br />
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1995<br />
Heimat und Welt<br />
Baden-Württemberg Hauptschule Klasse 8<br />
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1995<br />
Heimat und Welt<br />
Baden-Württemberg Hauptschule Klasse 9<br />
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1996<br />
Geographie: Mensch und Raum, 1994-1996<br />
Geographie 5: Mensch und Raum<br />
Hauptschule Baden-Württemberg<br />
Cornelsen Verlag, Berlin 1994<br />
Geographie 6: Mensch und Raum<br />
Hauptschule Baden-Württemberg<br />
Cornelsen Verlag, Berlin 1995<br />
Geographie 7: Mensch und Raum<br />
Hauptschule Baden-Württemberg<br />
Cornelsen Verlag, Berlin 1996<br />
Geographie 8: Mensch und Raum<br />
Hauptschule Baden-Württemberg<br />
Cornelsen Verlag, Berlin 1996<br />
Geographie 9: Mensch und Raum<br />
Hauptschule Baden-Württemberg<br />
Cornelsen Verlag, Berlin 1995<br />
Diercke Erdkunde, 1995-1997<br />
Diercke Erdkunde 5<br />
für Gymnsasien in Baden-Württemberg<br />
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1995<br />
Diercke Erdkunde 6<br />
für Gymnasien in Baden-Württemberg<br />
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1996<br />
Diercke Erdkunde 7<br />
für Gymnasien in Baden-Württemberg<br />
Westermann Schulbuchverlag 1996<br />
Diercke Erdkunde 8<br />
für Gymnasien in Baden-Württemberg<br />
Westermann Schulbuchverlag 1997<br />
8.5.1.2 Hintergrundinformation<br />
Afrika, 1983<br />
Afrika 1<br />
Allgemeine Grundzüge, Länder des Nordens<br />
Paul List Verlag, München 10. Auflage1983<br />
Fischer, 1993<br />
Der Fischer Weltalmanach '94<br />
Zahlen - Daten - Fakten<br />
Fischer Taschenbuchverlag GmbH, Frankfurt am Main 1993<br />
Fundamente, 1990<br />
Fundamente<br />
Dritte Welt. Entwicklungsräume in den Tropen<br />
Ernst Klett Schulbuchverlag GmbH, Stuttgart 1990<br />
Leser, 1982<br />
Namibia<br />
Hartmut Leser<br />
Ernst Klett Stuttgart, 1982<br />
Meister, 1986<br />
Afrika, die verlorene Illusion<br />
Überlebensfragen eines Kontinents<br />
Ulrich Meister<br />
Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 1986<br />
Michler, 1991<br />
Weissbuch Afrika<br />
Walter Michler<br />
Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Bonn 1991 (1988)<br />
Nations of the World, 1994<br />
The Times Guide to the Nations of the World<br />
Times Books and Bartholomew 1994<br />
Reader, 1997<br />
Africa: A Biography of a Continent<br />
John Reader<br />
Hamish Hamilton, London 1997<br />
Schmidt-Kallert, 1994<br />
Ghana<br />
Einhard Schmidt-Kallert<br />
Justus Perthes Verlag Gotha, 1. Auflage 1994<br />
Vorlaufer, 1984<br />
Geographie: Ferntourismus und Dritte Welt<br />
Karl Vorlaufer<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1. Auflage 1984<br />
Vorlaufer, 1990<br />
Länderprofile: Kenia<br />
Geographische Strukturen, Daten, Entwicklungen<br />
Karl Vorlaufer<br />
Ernst Klett Verlag für Bildung und Wissen,<br />
Stuttgart 1. Auflage 1990<br />
Wodtcke, 1998<br />
Westafrika<br />
Band 2: Küstenländer<br />
Anne Wodtcke<br />
Reise Know-How Verlag, Hohentann 4. Auflage 1998<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 611
8.5.2 Afrikanische Musik in Musikbüchern:<br />
8.5.2.1 Fachliteratur<br />
Knaurs Weltgeschichte der Musik, 1979<br />
Knaurs Weltgeschichte der Musik<br />
Von den Anfängen bis zur Klassik<br />
Kurt Honolka<br />
Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München / Zürich<br />
1979 (1969<br />
480 Seiten<br />
Geschichte der Musik, 1980<br />
Geschichte der Musik<br />
Karl H. Wörner<br />
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 7. Auflage 1980 (1954)<br />
692 Seiten, ISBN 3-525-27809-8<br />
Geschichte der Musik, 1983<br />
Geschichte der Musik<br />
Ein Studien- und Prüfungshelfer<br />
Walter Kolneder<br />
Heinrichshofen's Verlag, Wilhelmshafen 12. Auflage 1983 (1961)<br />
Das grosse Buch der Musik, 1984<br />
Das grosse Buch der Musik<br />
Keith Spence / Giles Swayne<br />
Verlag Herder Freiburg im Preisgau 1984<br />
Musik-Geschichte im Überblick, 1985<br />
Musik-Geschichte im Überblick<br />
Jacques Handschin<br />
Heinrichshofen's Verlag Wilhelmshaven, 5. Auflage 1985<br />
Nachdruck der zweiten, ergänzten Auflage von 1964<br />
dtv-Atlas zur Musik, 1987<br />
dtv-Atlas zur Musik<br />
Band 1<br />
Deutscher Taschenbuchverlag GmbH, München 11. Auflage 1987<br />
(1977)<br />
dtv-Atlas zur Musik<br />
Band 2<br />
Deutscher Taschenbuchverlag GmbH, München 4. Auflage 1987<br />
(1985)<br />
Musikinstrumente der Welt, 1988<br />
Musikinstrumente der Welt<br />
Orbis Verlag für Publizistik GmbH, München 1988<br />
Diagramm Visual Information Ltd. 1976<br />
Die Musik, 1979<br />
Die Musik<br />
Menschen, Instrumente und Ereignisse in Bildern und Dokumenten<br />
Unipart-Verlag, Stuttgart 1983<br />
Harrow House Edition Limited, London 1979<br />
8.5.2.2 Schulbücher<br />
Musik um uns, 1981-1996<br />
Unser Liederbuch - Musik um uns<br />
Ein Buch zum Singen und Musizieren ab dem 5. Schuljahr<br />
Bernhard Binkowski / Albrecht Scheytt<br />
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung Stuttgart, Nachdruck 1986<br />
(1982)<br />
Musik um uns<br />
Klassen 5 und 6<br />
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 3. Auflage 1991<br />
Musik um uns<br />
Klassen 5 und 6<br />
Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer<br />
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 3. Auflage 1991<br />
Musik um uns 7.-10. Schuljahr<br />
Lehrerband<br />
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1975<br />
Musik um uns<br />
7. - 10. Schuljahr<br />
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung Stuttgart, 13. völlig neu<br />
bearbeitete Auflage 1979<br />
Musik um uns 3<br />
Schroedel Schulbuchverlag Gmbh, Hannover 1995<br />
Musik um uns 3<br />
Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1995<br />
Musik um uns<br />
11.-13. Schuljahr<br />
J. B. Metzlerscher Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 10. neubearbeitete<br />
Auflage 1981 (1973)<br />
Musik um uns<br />
11.-13. Schuljahr, 2. Auflage<br />
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1985 (1983)<br />
Musik um uns<br />
für den Kursunterricht in der Klasse 11<br />
Schroedel Schulbuchverlag GmbH, Hannover 1988<br />
Musik um uns<br />
für den Kursunterricht in der Klasse 11<br />
Lehrerband<br />
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1988<br />
Musik um uns<br />
für den Kursunterricht in den Klassen 12 und 13<br />
Lehrerband<br />
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1988<br />
Musik um uns<br />
Sekundarbereich II<br />
Schroedel Schulbuchverlag GmbH, Hannover 1996<br />
Musik um uns - Sekundarbereich II<br />
Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer<br />
Schroedel Schulbuchverlg GmbH, Hannover 1996<br />
Schweizer Singbücher, 1968-1988<br />
Schweizer Singbuch<br />
Liedersammlung für die Volksschule<br />
Mittelstufe<br />
Hug, Zürich 3. Auflage 1946<br />
Schweizer Singbuch Unterstufe<br />
Lehrmittelverlag des Kanton Zürich, 1988 (1980)<br />
Schweizer Singbuch Mittelstufe<br />
Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen, 1980<br />
Schweizer Singbuch Oberstufe<br />
Herausgegeben im Verlag der Sekundarlehrerkonferenzen der<br />
Kantone St. Gallen, Thurgau und Zürich, 2. Auflage1968<br />
Musik auf der Oberstufe - Liedteil<br />
Verlag Schweizer Singbuch Oberstufe, Amriswil 4. Auflage 1979<br />
Musik auf der Oberstufe - Lehrerheft 2<br />
Verlag Schweizer Singbuch Oberstufe, 1987<br />
Musik auf der Oberstufe - Lehrerband 1<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 612
Verlag Schweizer Singbuch Oberstufe, 1988<br />
Musik auf der Oberstufe - Lieder, Tänze, Musikstücke<br />
Verlag Schweizer Singbuch Oberstufe, Amriswil 1988<br />
Schulmusik konkret (1991)<br />
Schulmusik konkret 1 & 2<br />
Zytglogge Verlag Bern und AutorInnen, 1991<br />
250 Kanons, 1996<br />
250 Kanons<br />
Eine Sammlung für Schulen, Singgruppen und Chöre aller Art<br />
Verlag Musik auf der Oberstufe, Amriswil 1996<br />
1000 chants, 1975<br />
1000 chants<br />
Jean Edel Berthier<br />
Les Presses d'Ile de France, Paris 1975<br />
284 Seiten<br />
Musikunterricht, 1979<br />
Musikunterricht<br />
Sekundarstufe 1 - Band 1<br />
Schott, Mainz 1979<br />
Musikunterricht<br />
Sekundarstufe 1 - Band 1 (Lehrerband)<br />
B. Schott's Söhne, Mainz 1980<br />
Musikstudio, 1980-1982<br />
Musikstudio 1<br />
Arbeitsbuch für die Musikerziehung in der 9. und 10. Schulstufe<br />
Österreichischer Bundesverlag, Wien 1980<br />
Musikstudio 2<br />
Arbeitsbuch für die Musikerziehung in der 11. und 12. Schulstufe<br />
Österreichischer Bundesverlag, Wien 1982<br />
Lied international, 1982<br />
Lied international<br />
Ein Liederbuch für die Schule<br />
Karl Haus / Fran Möckl<br />
Bayrischer Schulbuchverlag, München 1982<br />
Erlebnis Musik, 1985<br />
Erlebnis Musik<br />
Musikkunde 3 für Hauptschulen und allgemeinbildende höhrere<br />
Schulen<br />
Verlag Ivo Haas, Salzburg 1985<br />
Musik-Kontakte (1983-1987)<br />
Musik-Kontakte Band 1<br />
Arbeitsbuch für den Musikunterricht<br />
5.-6. Schuljahr<br />
Hirschgrabenverlag, Frankfurt am Main 1983<br />
Musik-Kontakte Band 2<br />
Arbeitsbuch für den Musikunterricht<br />
7.-9./10. Schuljahr<br />
Hirschgraben-Verlag, Frankfurt am Main 1987<br />
Musicassette, 1990-1992<br />
Musicassette 7<br />
für die 7. Jahrgangsstufe<br />
Bayerischer Schulbuchverlag, München 1992<br />
Musicassette 8<br />
für die 8. Jahrgangsstufe<br />
Bayerischer Schulbuchverlag, München 2. Auflage 1989<br />
Musicassette 9<br />
für die 9.Jahrgangsstufe<br />
Bayerischer Schulbuchverlag, München 1990<br />
Musicassette 10<br />
für die 10. Jahrgangsstufe<br />
Bayerischer Schulbuchverlag, München 1991<br />
Singen Musik, 1992<br />
Singen Musik 1<br />
Lieder / Kanons Oberstufe<br />
Staatlicher Lehrmittelverlag Bern 1992<br />
Singen Musik 2<br />
Lieder / Chansons / Songs Oberstufe<br />
Staatlicher Lehrmittelverlag Bern 1992<br />
Singen Musik 3<br />
Rock und Pop Oberstufe<br />
Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1992<br />
Singen Musik 4<br />
Experimente Oberstufe<br />
Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1992<br />
144 Seiten<br />
Spielpläne Musik, 1992-1994<br />
Spielpläne Musik 7/8<br />
Lehrerband<br />
Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1992<br />
Spielpläne Musik 9/10<br />
Lehrerband<br />
Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1994<br />
@Literatur2@Klangwelt-Weltklang, 1991-1993<br />
Klangwelt-Weltklang 1<br />
Wir lernen Musik, 5. Band<br />
Doblinger Wien, 1991<br />
Klangwelt-Weltklang 2<br />
Wir lernen Musik, 6. Band<br />
Schwertberger, Schnürl, Wieninger<br />
Doblinger Wien, 1993<br />
111 / 222/ 333 Lieder, 1990-1995<br />
111 Lieder Songbook<br />
ab Klasse 7<br />
Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1993<br />
222 Lieder<br />
Liederbuch für die Hauptschule<br />
Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1990<br />
333 Lieder<br />
für die Sekundarstufe - Ausgabe Süd<br />
Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1995<br />
@Literatur2@Liedertreff, 1994<br />
Liedertreff<br />
Liederbuch für die Klassen 5 - 10<br />
Cornelsen Verlag, Berlin 1994<br />
Die Musikstunde, 1992-1997<br />
Die Musikstunde<br />
5. und 6. Schuljahr<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main1992<br />
Die Musikstuden<br />
7. und 8. Schuljahr (Lehrerband)<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1995<br />
Die Musikstunde 9/10<br />
9. und 10. Schuljahr<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1997<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 613
Hauptsache Musik, 1995<br />
Hauptsache Musik 7/8<br />
für den Musikunterricht in den Klassen 7 und 8 an allgemeinbildenden<br />
Schulen<br />
Werner Pütz / Rainer Schmitt<br />
Ernst Klett Schulbuchverlag Stuttgart, 1. Aufl. 1995<br />
Musik hören, machen, verstehen, 1990-1995<br />
Musik hören, machen, verstehen 1<br />
Arbeitsbuch für den Musikunterricht in den Klassen 5/6<br />
Metzler Schulbuchverlag, Hannover 1992<br />
Musik hören, machen, verstehen 2<br />
Arbeitsbuch für den Musikuntericht ab Klasse 7<br />
Metzler Schulbuchverlag, Hannover 1993<br />
Musik hören, machen verstehen 3<br />
Arbeitsbuch für den Musikunterricht ab Klasse 9<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1995<br />
Musik hören, machen, verstehen 1<br />
Arbeitsbuch für den Musikunterricht in den Klassen 5/6<br />
Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1990<br />
Musik hören, machen, verstehen 2<br />
Arbeitsbuch für den Musikunterricht ab Klasse 7<br />
Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1993<br />
Musik hören, machen, verstehen 3<br />
Arbeitsbuch für den Musikunterricht ab Klasse 9<br />
Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1995<br />
Canto, 1996<br />
Canto - unser Liederbuch<br />
ab Klasse 5<br />
Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1996<br />
Vom Umgang mit dem Fremden, 1996<br />
Vom Umgang mit dem Fremden<br />
Treffpunkte aussereuropäischer und europäischer Musik<br />
Materialienband für Schülerinnen und Schüler<br />
Ernst Klaus Schneider<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1996<br />
Vom Umgang mit dem Fremden<br />
Treffpunkte aussereuropäischer und europäischer Musik<br />
Anregungen für den Unterricht<br />
Ernst Klaus Schneider / Christoph Richter<br />
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1996<br />
8.5.2.3 Hintergrundliteratur<br />
Nketia, 1991<br />
Die Musik Afrikas<br />
Joseph H. Kwabena Nketia<br />
Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven 2. Auflage 1991 (1974)<br />
Schütz, 1992<br />
Musik in Schwarzafrika<br />
Arbeitsbuch für den Musikunterricht in den Sekundarstufen<br />
Volker Schütz<br />
Institut für Didaktik populärer Musik, Oldershausen 1992<br />
Koch, 1993<br />
Begegnungen mit afrikanischer Musik<br />
Materialien für den Unterricht<br />
Volker Koch<br />
Metzler Schulbuchverlag, Hannover 1993<br />
Quellenverzeichnis<br />
Konaté/Ott, 1997<br />
Rhythmen und Lieder aus Guinea<br />
Famoudou Konaté, Thomas Ott<br />
Institut für Didaktik populärer Musik, Oldershausen 1997<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 614
8.5.3 Afrika in Lesebüchern:<br />
Lehr- und Lesebuch, 1912<br />
(siehe Literaturverzeichnis Geographie)<br />
Lesebuch für die Oberklassen, ca. 1930<br />
(siehe Literaturverzeichnis Geographie)<br />
Arbeits- und Lesebuch für die Oberklassen, 1936<br />
(siehe Literaturverzeichnis Geographie)<br />
Lehr- und Lesebuch, 1943<br />
Lehr- und Lesebuch für das 7. und 8. Schuljahr der Primarschule<br />
des Kantons St. Gallen: Literatur und Geschichte<br />
Nach Vorlage der Lehrmittelkomission herausgegeben vom<br />
Erziehungsrate<br />
Fehr'sche Buchhandlung, St. Gallen 1943<br />
Heimat, 1962<br />
Heimat<br />
Lesebuch für das vierte Schuljahr<br />
Im Auftrag des Erziehungsdepartementes bearbeitet von der Lehrmittelkommission<br />
II<br />
Thurgauischer Lehrmittelverlag, Frauenfeld 1962<br />
Schöne weite Welt, 1966<br />
Schöne weite Welt<br />
Lesebuch für das dritte Schuljahr<br />
Staatlicher Lehrmittelverlag Bern 1966<br />
Sprachbüchlein, 1968<br />
Piff - Paff - Puff<br />
Sprachbüchlein für das zweite Schuljahr<br />
Max Hänsenberger<br />
Werner Egle, Gossau 1968<br />
Frohe Fahrt ins Land der Sprache<br />
Sprachbüchlein für das dritte Schuljahr<br />
Max Hänsenberger<br />
Lehrmittelverlag Egle, Gossau 5. Auflage 1968 (1961)<br />
Unsere Zeit, 1969<br />
Unsere Zeit<br />
Lesebuch für das 3. Schuljahr<br />
Lehrmittelverlag des Kanton St. Gallen, 2. Auflage 1969<br />
Wort und Bild<br />
Ein Sachlesebuch für das 8. und 9. Schuljahr<br />
Claudio Hüppi, Willy Brüschweiler<br />
SABE AG, Verlagsinstitut für Lehrmittel, Zürich, 2. unveränderter<br />
Nachdruck 1970<br />
Neues Schweizer Lesebuch, 1979-1980<br />
Neues Schweizer Lesebuch<br />
Band 1<br />
SABE AG, Zürich 4. Auflage 1979<br />
Neues Schweizer Lesebuch<br />
Band 2<br />
SABE AG, Zürich 1980 (1970)<br />
Lesebuch 4 (1980)<br />
Lesebuch 4<br />
Thurgauischer Lehrmittelverlag Frauenfeld, 1980<br />
Lesen 3 (1981)<br />
Lesen 3 - Band 1<br />
SABE Verlagsinstitut für Lehrmittel, 1981<br />
Sprachbuch 4.- 6. Klasse (1974-1983)<br />
Sprachbuch 4. Klasse - Lehrerausgabe<br />
Lehrmittelverlag des Kanton Zürich, 1982 (1976)<br />
Sprachbuch 5. Klasse - Lehrerausgabe<br />
Lehrmittelverlag des Kanton Zürich, 1983 (1977)<br />
Sprachbuch 6. Klasse - Lehrerausgabe<br />
Lehrmittelverlag des Kanton Zürich, 1. Ausgabe 1974<br />
Lesespiegel, 1984<br />
Lesespiegel - Lesebuch zum Lesekurs<br />
Kurt Meyers<br />
Klett und Balmer Verlag, Zug 1984<br />
Drei Schritte, 1984<br />
Riesenbirne und Riesenkuh<br />
Interkantonales Lesebuch für das zweite Schuljahr<br />
Band 1<br />
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, Ausgabe 1982, unverändert<br />
(1979)<br />
Der Zaubertopf<br />
Interkantonales Lesebuch für das dritte Schuljahr<br />
Band 1<br />
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1. Ausgab 1983<br />
Drei Schritte<br />
Interkantonales Lesebuch für das dritte Schuljahr<br />
Band 2<br />
Lehrmittelverlag des Kanton Zürich, 1. Ausgabe 1984<br />
Lesebuch 5. Klasse, 1985<br />
Lesebuch 5. Klasse<br />
Thurgauischer Lehrmittelverlag Frauenfeld, 1985<br />
Der Lesefuchs, 1988<br />
Der Lesefuchs 2<br />
Lesebuch für das 3. Schuljahr<br />
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1988<br />
Der Lesefuchs 3<br />
Lesebuch für das 3. Schuljahr<br />
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1988<br />
Der Lesefuchs 4<br />
Lesebuch für das 4. Schuljahr<br />
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1988<br />
Schaukelpferd, 1989<br />
Schaukelpferd - Lesebuch für Erstklässler<br />
Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen, 1989<br />
Fosch. Fusch, Fesch, 1990<br />
Fosch, Fusch, Fesch<br />
Interkantonales Lesebuch für das erste Schuljahr<br />
Staatlicher Lehrmitelverlag Bern, 1990<br />
Karfunkel, 1990<br />
Karfunkel: Lesebuch für das 5. Schuljahr<br />
sabe, Zürich 1990<br />
Die Welt ist reich, 1991<br />
Die Welt ist reich<br />
Eine Sammlung von Gedichten für die Mittelstufe der Primarschule<br />
Lehrmittelverlag des Kantons Aargau, 4. Auflage 1991 (1982)<br />
Das fliegende Haus, 1992<br />
Das fliegende Haus<br />
Interkantonales Lesebuch für das vierte Schuljahr<br />
Lehrmittelverlag des Kanton Zürich, 1992 (1990)<br />
Quellenverzeichnis<br />
Spürnase, 1993<br />
Spürnase: Interkantonales Lesebuch für das fünfte Schuljahr<br />
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1993 (1990)<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 615
Deutsch, 1995<br />
Deutsch - keine Hexerei<br />
Philippe Bucheli, Hugo A. Zimmermann<br />
Verlag des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes, Zürich 1.<br />
Auflage 1995<br />
Wörterbücher<br />
A-Z Wörterbuch<br />
zu den Sprachbüchern, Arbeits- und Merkblättern 4.-6. Klasse<br />
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1984 (1982)<br />
Der ABC-Drache<br />
Mein erstes Wörterbuch<br />
Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen, 1993<br />
Ungeheuer viele Wörter<br />
Wörterbuch 2./3. Klasse<br />
Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen, 1992<br />
Wort für Wort<br />
Schweizer Schülerwörterbuch zu den Sprachlehrmitteln der Mittelund<br />
Oberstufe<br />
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. 4. Ausgabe 1997 (1996)<br />
8.5.4 Afrika im Comic:<br />
Busch, 1879<br />
Wilhelm Busch Album - Humoristischer Hausschatz<br />
Wilhelm Busch<br />
Buchklub Ex Libris Zürich<br />
Little Nemo, 1905-1908<br />
McCay 1907<br />
Little Nemo - Band 1: 1905-1907<br />
Winsor McCay<br />
Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 1989<br />
McCay 1908<br />
Little Nemo - Band 2: 1907-1908<br />
Winsor McCay<br />
Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 1989<br />
Hergé, 1931<br />
Die Abenteuer von Tim und Struppi im Kongo<br />
Hergé<br />
Carlsen Verlag GmbH, 1992<br />
(Urfassung 5.6.1930 - 11.6.1931 in Kinderbeilage der belgischen<br />
Zeitschrift "Vingtième Siècle"<br />
Hergé, 1971<br />
Tintin au Pays de l'Or Noir<br />
Hergé<br />
Castermann, 1980 (1971)<br />
Franquin, 1974<br />
Tembo Tabou<br />
Rola / Franquien / Greg<br />
Editions Dupuis 1989 (1974)<br />
Franquin, 1989<br />
Das schwarze Marsupilami<br />
Fanquin / Yann<br />
Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 1989<br />
Uderzo, 1996<br />
Asterix und Obelix auf Kreuzfahrt<br />
R. Goscinny / A. Uderzo<br />
Ehapa Verlag, Stuttgart 1996<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 616
8.5.5 Geschichte Afrikas:<br />
Bertaux, 1995<br />
Fischer Weltgeschichte: Afrika<br />
Von der Vorgeschichte bis zu den Staaten der Gegenwart<br />
Pierre Bertaux<br />
Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1995 (1966)<br />
Braudel, 1979<br />
Sozialgeschichte des 15. - 18. Jahrhunders<br />
Aufbruch zur Weltwirtschaft<br />
Fernand Braudel<br />
Buchclub Ex Libris Zürich 1988<br />
Librairie Armand Colin, Paris 1979<br />
Sozialgeschichte des 15. - 18. Jahrhunders<br />
Der Handel<br />
Fernand Braudel<br />
Buchclub Ex Libris Zürich 1987<br />
Librairie Armand Colin, Paris 1979<br />
Sozialgeschichte des 15. - 18. Jahrhunders<br />
Der Alltag<br />
Fernand Braudel<br />
Kindler Verlag GmbH, München 1985<br />
Librairie Armand Colin, Paris 1979 ?<br />
Haarmann, 1990<br />
Universalgeschichte der Schrift<br />
Harald Haarmann<br />
Campusverlag GmbH, Frankfurt/Main 1990<br />
Lizenzausgabe für Buchklub Ex Libris Zürich 1991<br />
Harrer / Pleticha, 1973<br />
Entdeckungsgeschichte aus erster Hand<br />
Berichte und Dokumente von Augenzeugen und Zeitgenossen aus<br />
drei Jahrtausenden<br />
H. Harrer / H. Pleticha<br />
Arena Verlag, Würzburg 3. Auflage 1973 (1968)<br />
Hubschmid, 1961<br />
Die Neuzeit<br />
Von der Renaissance bis zum Beginn der Aufklärung<br />
Hans Hubschmid<br />
(Weltgeschichte - 3. Band)<br />
Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1961<br />
340 Seiten<br />
Ki-Zerbo, 1984<br />
Die Geschichte Schwarzafrikas<br />
Joseph Ki-Zerbo<br />
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1984 (1981)<br />
Pleticha, 1989<br />
Weltgeschichte - Alte Völker, neue Staaten<br />
Die aussereuropäische Welt im 17. und 18. Jahrhundert<br />
Heinrich Pleticha<br />
Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh 1989<br />
Putzger, 1961<br />
Historischer Atlas<br />
F. W. Putzger<br />
H. R. Sauerländer & Co, Aarau 4. Auflage, 1961 (1954)<br />
Weiss/Meyer, 1985<br />
Afrika den Europäern<br />
Ruth Weiss / Hans Meier<br />
Peter Hammer Verlag, Wuppertal, 2. korr. Auflage 1985<br />
8.5.6 Sonstige Bücher:<br />
8.5.6.1 Romane und Erzählungen<br />
Anan/Amonde, 1995<br />
Das Lied der bunten Vögel<br />
Kobna Anan, Omari Amonde<br />
Buchverlag Fischer, Münsingen-Bern 4. Auflage 1995 (1989)<br />
Bá, 1996<br />
Ein so langer Brief - Ein afrikanisches Frauenschicksal<br />
Maríama Bá<br />
Ullstein, Frankfurt/M 1996<br />
Edition Sven Erik Bergh 1980<br />
Bebey, 1995<br />
Das Alphabet der Sonne während des Regens<br />
Francis Bebey<br />
Peter Hammer Verlag GmbH, Wuppertal 1993, 2. Auflage 1995<br />
Djoleto, 1994<br />
Obodai und seine Freunde<br />
Amu Djoleto<br />
Verlag Nagel & Kimche AG, Zürich/Frauenfeld, 1994<br />
Frobenius, 1996<br />
Schwarze Sonne Afrikas<br />
Mythen, Märchen und Magie<br />
Leo Frobenius<br />
Heyne, München genehmigte Lizenzsausgabe 1996 (1980)<br />
Frommlet Hrsg., 1996<br />
Die Sonnenfrau<br />
Sechundzwanzig neue Geschichten aus Schwarzafrika<br />
Herausgegeben von Wolfram Frommlet<br />
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2. Auflage 1996 (1994)<br />
Hartmann, 1995<br />
Die Mohrin<br />
Lukas Hartmann<br />
Nagel & Kimche, Zürich/Frauenfeld 4. Auflage 1996<br />
Honke Hrsg., 1998<br />
Die Mondfrau<br />
Neue Geschichten aus dem frankophonen Afrika<br />
Herausgegeben von Gudrun Honke<br />
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1998<br />
Kouoh/Ehling, 1998<br />
Töchter Afrikas<br />
Schwarze Frauen erzählen<br />
Herausgegeben von Koyo Kouoh und Holger Ehling<br />
Piper, München 2. Auflage 1998 (1997)<br />
Lutz/Lutz-Marxer, 1993<br />
Muraho: Zu Besuch bei der Familie Sibomana<br />
Christoph Lutz, Kathrin Lutz-Marxer<br />
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2. Auflage 1993 (1986)<br />
Strugatzki, 1964<br />
Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein<br />
Arkadij & Boris Strugatzki<br />
Ullstein, Frankfurt am Main 1990 (1964)<br />
Vera, 1997<br />
Eine Frau ohne Namen<br />
Yvonne Vera<br />
Marino Verlag, München 1997<br />
Baobab Books 1994<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 617
8.5.6.2 Lexika und Wörterbücher<br />
Der Grosse Brockhaus (19. Auflage)<br />
Erster Band<br />
F. A. Brockhaus, Mannheim 1986<br />
17. Band<br />
F. A. Brockhaus, Mannheim 1992<br />
Duden, 1986<br />
Duden 8<br />
Die sinn- und sachverwandten Wörter<br />
Dudenverlag, Mannheim 2. neu bearbeitete Auflage 1986<br />
Lexikon, 1991<br />
Neues grosses Lexikon in Farben<br />
Sonderausgabe<br />
Deutschland, 1991<br />
Wahrig, 1994<br />
Der kleine Wahrig<br />
Wörterbuch der deutschen Sprache<br />
Gerhard Wahrig<br />
Lizenzausgabe Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh 1994<br />
Rechtschreibung, 1996<br />
Die aktuelle deutsche Rechtschreibung von A-Z<br />
Naumann & Göbel, 1996<br />
8.5.6.3 Verschiedene<br />
Beck, 1982<br />
Grosse Geographen<br />
Pioniere - Aussenseiter - Gelehrte<br />
Hanno Beck<br />
Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1982<br />
Bitterli, 1977<br />
Die "Wilden" und die "Zivilisierten"<br />
Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der europäischüberseeische<br />
Begegnung<br />
Urs Bitterli<br />
Buchclub Ex Libris Zürich 1977<br />
(C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1976)<br />
Engelhardt/Seidler, 1992<br />
Frauen in Afrika<br />
Materialien für den Unterricht<br />
Eva Engelhardt, Waltraut Seidler<br />
explizit Nr. 42<br />
Horlemann, Bad Honnef 1992<br />
@Literatur2@Francé, 1962<br />
Die Welt der Tiere<br />
R. H. Francé<br />
Südwest-Verlag, München 1962<br />
Fürnrohr Hrsg., 1982<br />
Afrika im Geschichtsunterricht europäischer Länder<br />
Von der Kolonialgeschichte zur Geschichte der Dritten Welt<br />
Herausgegeben von Walter Fürnrohr<br />
Minerva Publikation Saur, München 1982<br />
Goudie, 1994<br />
Mensch und Umwelt<br />
Andrew Goudie<br />
Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg 1994<br />
Hensel, 1986<br />
Spielplan - Band 1<br />
Schauspielführer von der Antike bis zur Gegenwart<br />
Georg Hensel<br />
Buchclub Ex Libris Zürich 1986 (1966)<br />
Jestel Hrsg., 1982<br />
Das Afrika der Afrikaner<br />
Gesellschaft und Kultur Afrikas<br />
Herausgeber: Rüdiger Jestel<br />
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1982<br />
Keating, 1993<br />
Erdgipfel 1992<br />
Agenda für eine nachhaltige Entwicklung<br />
Michael Keating<br />
Center for Our Common Future, Genf 1. Auflage 1993<br />
Lötschert / Beese, 1992<br />
Pflanzen der Tropen<br />
W. Lötschert, G. Beese<br />
BLV Verlagsgesellschaft, München 1992<br />
Nagel, 1996<br />
Die kleinen Frauen Afrikas<br />
Mädchen in Burkina Faso<br />
Inga Nagel<br />
Horlemann, Bad Honnef 1996<br />
Nentwig, 1995<br />
Humanökologie - Fakten, Argumente, Ausblicke<br />
Wolfgang Nentwig<br />
Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1995<br />
Quellenverzeichnis<br />
Partnerschaft für die Zukunft, 1997<br />
Partnerschaft für die Zukunft<br />
Die Zusammenarbeit der ETH Zürich mit Entwicklungsländern<br />
Schulleitung der ETH Zürich, 1997<br />
Schmutz, 1997<br />
Phantome und Phantasm in der neuzeitlichen Naturgeschichte<br />
Hans-Konrad Schmutz, Hrsg.<br />
Basilisken-Presse, Marburg an der Lahn 1997<br />
Vögele, 1995<br />
Hausa: Wort für Wort<br />
Hannelore Vögele<br />
Reise Know-How Verlag Peter Rump, Bielefeld 1. Auflage 1995<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 618
8.5.7 Elektronische Medien:<br />
8.5.7.1 CD-ROMs<br />
Geschichte, 1996<br />
Bertelsmann Lexion der Geschichte<br />
Bertelsmann Electronic Publishing, München 1996<br />
Compton, 1991<br />
Compton's Multimedia Encylopedia<br />
Windows Edition, 1991<br />
Britannica Software<br />
Digitale Bibliothek, 1997 (DB)<br />
Digitale Bibliothek<br />
Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka<br />
DirectMedia Publishing, Berlin 1997<br />
- Arnim: Dies Buch gehört dem König, S. 422. DB S. 3712, 1843<br />
- Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Busse der Gräfin Dolores,<br />
S. 250/277., DB S. 262/289<br />
- Fontane: Der Stechlin, S. 347, DB S. 16384<br />
- Forster: Ein Blick in das Ganze der Natur, S. 22. DB, S. 17549<br />
- Forster: Leitfaden zu einer künftigen Geschichte der Menschheit,<br />
S. 13. DB S. 17858<br />
- Forster: Noch etwas über die Menschenrassen, S. 21-27, 44-47,<br />
DB S. 17587-17593, 17610-17613<br />
- Forster: Über das Verhältniss der Mainzer gegen die Franken, S.<br />
4, DB S. 17999<br />
- Goethe: Italienische Reise, S. 569f.. DB S. 28525f.<br />
- Heine: Gedichte 1853 und 1854, S. 10, DB S. 38388<br />
- Heine: Geständnisse, S. 10, DB S. 40705<br />
- Heine: Ludwig Börne. Eine Denkschrift, S. 51, DB S. 40483<br />
- Heine: Reisebilder. Vierter Teil, S. 106, DB S. 39600<br />
- Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität, S. 97, 911, 944,<br />
DB S. 42273, 43087, 43120<br />
- Heym: Der Dieb, S. 52, DB S. 43458<br />
- Lessing: Nathan der Weise, S. 81. DB S. 66548, 1779<br />
- Lichtenberg: Über Physionomik; wider die Physiognomen, S.<br />
30-33f.., DB S. 69890-69893f.<br />
- Mörike: Maler Nolten, S. 556, DB S. 72713<br />
- Jean Paul: Flegeljahre, S. 679, DB S. 53153<br />
- Jean Paul: Dr. Katzenbergers Badereise, S. 242. DB S. 53647<br />
- Raabe: Abu Telfan, S. 38, 444, 460, DB S. 76944, 77350, 77366<br />
- Raabe: Der Schüdderump, S. 173. DB S. 77674<br />
- Raabe: Stopfkuchen, S. 7, DB S. 78790<br />
- Schiller: Die Räuber, S. 23, DB S. 82943<br />
- Seume: Mein Sommer, S. 254f., DB S. 87982f.<br />
- Tieck: Vittoria Accorombona, S. 222. DB S. 97074<br />
- Wedekind: Die Büchse der Pandora, S. 108, DB S. 99496<br />
- Wieland: Geschichte des Agathon, S. 124f., DB S. 10106f.,<br />
1766-67<br />
- Wieland: Geschichte der Abderiten, S. 52f./67, DB S.<br />
101735f./101750, 1774<br />
Encarta, 1996<br />
CD-ROM Encarta 96<br />
World English Edition<br />
Microsoft 1995<br />
Encarta, 1997<br />
Deutsche Version<br />
Microsoft, 1996<br />
Fischer, 1998<br />
Der Fischer Weltalmanach<br />
Zahlen, Daten, Fakten<br />
systhema, München 1998<br />
Grolier, 1993<br />
The New Grolier Multimedia Encyclopedia<br />
Release 6<br />
Grolier Inc., 1993<br />
Infopedia, 1996<br />
CD-Rom Infopedia 2.0<br />
English Edition<br />
CD-TOP, Ausgabe 6<br />
Infothek<br />
Die grosse CD-Rom Infothek<br />
Tandemverlag<br />
<strong>Pro</strong>jekt Gutenberg-DE 1996<br />
Die digitale Bibliothel<br />
Hille & Partner Internet-Dienste, 1996<br />
- Des Seefahrers Joachim Nettelbeck höchst erstaunliche Lebensgeschichte<br />
von ihm selbst erzählt<br />
Joachim Nettlebeck (1738-1824)<br />
Shakespeare, 1992<br />
The Complete Works of William Shakespeare<br />
Creative Multimedia Corperation, USA 1992<br />
Time Almanac<br />
Time Almanac of the 20th Century<br />
CD-Top, Ausgabe 2<br />
Weltatlas, 1993<br />
The Software Toolworks Weltaltlas-MPC<br />
Version 4.0.1<br />
The Software Toolworks Inc, 1993<br />
in "fast geschenkt", Ausgabe 14<br />
Weltatlas, 1997<br />
Microsoft Encarta Weltatlas<br />
Home Essentials 97<br />
Microsoft, 1997<br />
8.5.7.2 Videofilme<br />
Im Wald der Pygmäen, 1998<br />
Im Wald der Pygmäen (zweiteiliger Filmbericht)<br />
Hans-Jürgen Steinfurth<br />
SF DRS, 1998<br />
Tanja Blixen, 1985<br />
Tanja Blixen: Das Leben einer dänischen Erzählerin<br />
Peter Leippe<br />
ZDF, 1985<br />
Afrika, 1986<br />
Afrika: Verschiedenartig und doch ebenbürtig<br />
(Filmdokumentation in 6 Teilen)<br />
- Im Einklang mit der Natur<br />
- Wohlstand durch Handel<br />
- Das Königtum und seine Grenzen<br />
- Im Zeichen des Kreuzes<br />
- Das Zeitalter des Kolonialismus<br />
- Das neue Nationalgefühl<br />
RM Arts, 1986<br />
Kenia, ZDF 1998<br />
Der Kampf ums Wasser<br />
Teil 1: Kenia<br />
ZDF, 1998<br />
Kolonialgeschichte, 1992<br />
Frankreich: Kolonialsgeschichte als Erblast<br />
WDR, 1992<br />
Quellenverzeichnis<br />
194Yo Yo Ma, 1998<br />
Yo Yo Ma und die Kalahari-Buschmänner:<br />
Begegnung mit den Kung, Dokumentation von Robin Lough<br />
Channel 4, Arte, Skyline television, Frankreich 1998<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 619
8.5.7.3 Tondokumente<br />
Musik der Welt, 80er/90er Jahre<br />
Musik der Welt: Burikina Faso<br />
DRS 2, 60 min.<br />
Musik der Welt: Elfenbeinküste<br />
DRS 2, 60 min.<br />
Musik der Welt: Les percussion de Bouwake I+II<br />
DRS 2, 60 min.<br />
Musil der Welt: Der Makkanda-Epos<br />
DRS 2, 60 min.<br />
Musik der Welt: Mauretanien<br />
DRS 2, 60 min.<br />
Musik der Welt: Musik und Poesie aus Schwarzafrika I+II<br />
DRS 2, 120 min.<br />
Musik der Welt: Tansania I+II<br />
DRS 2, 120 min.<br />
Musik der Welt: Die Nacht der Griots, 1998<br />
Konzertmitschnitt Basler Münsterplatz 1998<br />
DRS 2, 240 min., 1998<br />
Musik der Welt: Senegal, 1998<br />
Konzertmitschnitt Penche Okt. 1997<br />
DRS 2, 60 min., 1998<br />
Musik der Welt: Südafrika, 1998<br />
Rainbow Nation - Südafrikanische Musik der Mandela Ära<br />
Peter Niklaas Wilson<br />
DRS 2, 60 min., 1998<br />
Musik der Welt: Musik aus Zentralafrika I+II, 1998<br />
Konzertmitschnitt Banda Linda u. Aka-Pygmäen<br />
Musikfestwochen Luzern 1997<br />
DRS 2, 120 min., 1998<br />
8.5.8 Internet:<br />
Adeleye, 1992<br />
Portraiture of the Black African by Caucasians in Both Antiquity<br />
and Modern Times<br />
Gabriel Adeleye<br />
http://pippin.monm.edu/academic/History/faculty_forum/AFRICA<br />
N.htm<br />
Africanus, 1526<br />
Leo Africanus<br />
Description of Timbuktu from The Description of Africa (1526)<br />
http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_rea<br />
der_2/leo_africanus.html<br />
Bergmann, 1993<br />
Ota Benga: The Story of the Pygmy on Display in a Zoo<br />
Jerry Bergmann<br />
http://www.serve.com/revev/otabenga.html<br />
Bierce, 1911<br />
The Devil's Dictionary<br />
Ambrose Bierce<br />
gopher://wiretap.area.com/00/Library/Classic/devils.txt<br />
(Zuerst als "Cynic's Wordbook" 1906 erschienen)<br />
Civilizations Past and Present, Book 1996<br />
Chapter 15:<br />
Emerging Civilizations In Sub-Sahara Africa And<br />
The New World<br />
Wallbank / Taylor / Bailkey / Jewsbury / Lewis / Hackett<br />
http://www.phs.princeton.k12.oh.us/Public/Lessons/kush.html<br />
Darwin, 1845<br />
The Voyage on the Beagle<br />
Charles Darwin<br />
http://www.bio.bris.ac.uk/resource/darwin/beagle.txt<br />
Darwin, 1859<br />
The Origin of Species<br />
Charles Darwin<br />
http://www.bio.bris.ac.uk/resource/darwin/dos.txt<br />
Darwin, 1871<br />
The Descent of Man<br />
Charles Darwin<br />
http://www.bio.bris.ac.uk/resource/darwin/darwindm.txt<br />
Darwin, 1899<br />
The Expression of Emotion in Man and Animals<br />
Charles Darwin<br />
ftp://uiarchive.cso.uiuc.edu<br />
Defoe, 1719<br />
Robinson Crusoe<br />
Daniel Defoe<br />
http://english-server.hass.cmu.edu/fiction/crusoe.txt<br />
Equiano, 1789<br />
Olaudah Equiano<br />
The Interesting Narrative of the Life<br />
http://www.bl.uk/collections/africa/equiano.html<br />
FAOSTAT 1998<br />
FAOSTAT Database<br />
Datenbank der Fao zu Tierbeständen und Erntemengen<br />
http://www.fao.org<br />
FAO Factfile, 1996<br />
A Woman's Day in Sierra Leone<br />
http://www.fao.org/NEWS/FACTFILE/Ff9719-e.pdf<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 620
FAO/GIEWS, 1997/1998<br />
Countries facing exceptional food emergencies<br />
Africa Report, August 1997<br />
http://fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECO...ENGLISH/EAF/eaf970<br />
8/af970801.htm<br />
Countries facing exceptional food emergencies<br />
Africa Report, March 1998<br />
http://fao.org/WAICENT/FOAINFO/ECO...GIEWS/ENGLISH/EAF<br />
/eaf9803/af980301.htm<br />
King, 1963<br />
"I have a Dream" by Martin Luther King Jr<br />
(Delivered on the steps at the Lincoln Memorial in Washington D.C.<br />
on August 28, 1963)<br />
Martin Luther King, Jr: The Peaceful Warrior, Pocket Books, NY,<br />
1968<br />
http://www.toptags.com/aama/voices/speeches/speech1.htm<br />
Lindsay, 1914<br />
The Congo and other Poems<br />
Nicholas Vachel Lindsay<br />
http://tom.cs.cmu.edu/cgi-bin/book/lookup?num=1021<br />
Livingstone, 1857<br />
Missionary Travels and Reasearches in South Africa<br />
David Livingstone<br />
London 1857<br />
http://tom.cs.cmu.edu/cgi-bin/book/lookup?num=1039<br />
Locke, 1690<br />
Letter concerning Toleration<br />
John Locke<br />
http://english-server.hss.cmu.edu/18th/toleration.txt<br />
Montaigne, 1575<br />
Essays<br />
Michel de Montaigne<br />
gopher://humanum.arts.cuhk.hk/00/humftp/E-text/Montaigne/monta<br />
ign.esy<br />
Nkruma 1961<br />
Modern History Sourcebook:<br />
Kwame Nkrumah:<br />
I Speak of Freedom, 1961<br />
http://www.fordham.edu/halsall/mod/1961nkrumah.html<br />
Der Standard 10.06.98, S. 3<br />
"Afrika erlebt Globalisierung nur als passiven Akt"<br />
Christoph Winder<br />
über www.paperball.de<br />
UNICEF, 1998<br />
The State of the World's Children 1998<br />
www.unicef.org<br />
http://www.unicef.org/sowc98/pdf.htm<br />
USGS, 1997<br />
U.S. Geological Survey Minerals Information<br />
Copper Statistical Compendium, 11/04/97<br />
http://minerals.er.usgs.gov/minerals/oubs/commodity/copper/stat/<br />
Wells, 1909<br />
Tono Bungay<br />
Herbert Georg Wells<br />
ftp://uiarchive.cso.uiuc.edu/pub/etext/gutenberg/etext96/tonob10.txt<br />
Wiley, 1981<br />
Using "tribe" and "tribalism" categories to misunderstand african<br />
societies<br />
David Wiley<br />
African Studies Center, Michigan State University 1981<br />
http://polyglot.lss.wisc.edu/afrst/tribe.html<br />
8.5.9 Zeitungen und Zeitschriften:<br />
Quellenverzeichnis<br />
8.5.9.1 Artikel aus "Geo - Das neue Bild der<br />
Erde"<br />
Geo 11/1976, S. 84f.<br />
Serengeti: Das gefährdete Paradies.<br />
Geo 9/1980, S. 8f<br />
Brot und Salz: Spuren in der Erde.<br />
Geo 9/1980, S. 136f.<br />
Senegal: Der Heilige von Sindian.<br />
Geo 9/1981, S. 52f.<br />
Buschmänner: Und keiner weint ihnen nach.<br />
Geo 2/1982, S. 28f.<br />
Ostafrika: Stirbt die Serengeti doch?<br />
Geo 3/1982, S. 8f.<br />
Tubu: Die Brüder des Windes<br />
Geo 3/1986, S. 10f.<br />
Die Diamantenstory: Das diskrete Geschäft mit den edelsten aller<br />
Steine<br />
Geo 8/1986, S. 36f.<br />
Auto kaputt? Es lebe der Schrott!<br />
Geo 10/1986, S. 102f.<br />
Eritrea: Flucht vor dem Hunger in den Krieg<br />
Geo 12/1986, S. 136f.<br />
Expedition zum Tschadsee<br />
Geo 9/1988, S. 12f.<br />
Zaire: Ein Chaos mit Musik<br />
Geo 3/1990, S. 38f.<br />
Regenwald: Reicher macht ein Wald, der wächst<br />
Geo 3/1990, S. 54f.<br />
Regenwald: Die Scharfrichter<br />
Geo 6/1993, S.38f.<br />
Die Menschheit vor dem grossen Durst<br />
Geo 4/1994, S. 130f.<br />
Reisforschung: Hoffnung für Milliarden<br />
Geo 8/1994, S. 159f.<br />
Meisterwerke aus frühen Jahren<br />
Geo 9/1994, S. 10, 30, 34f.<br />
Weltbevölkerung: Der volle Planet<br />
Geo 10/1994, S. 146f.<br />
Verhalten: Der Kannibalismus lebt<br />
Geo 1/1995, S. 6f.<br />
Evolution: Botschaft von den ersten Menschen<br />
Geo 2/1995, S. 38f.<br />
Mauretanien: Viel Sand um nichts<br />
Geo 3/1995, S. 42f.<br />
Schwarze Kirchen: Südafrikas schweigende Macht<br />
Geo 3/1995, S. 74f.<br />
Die Rückkehr der Seuchen<br />
Geo 9/1995, S. 38, 40, 70, 92f.<br />
Planet der Frauen<br />
Geo 11/1995, S. 162f.<br />
Afrika II: Kreuzfahrt durch das Waldmeer<br />
8.5.9.2 Artikel aus dem "Tages Anzeiger"<br />
TA 08.11.96, S. 73-80<br />
Kampf dem Hunger<br />
TA 22.11.96, S. 88<br />
Der Tourismus soll auch den Pygmäen zugute kommen<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 621
TA 25.11.96, S. 2<br />
Wie neun Milliarden Menschen ernähren?<br />
TA 24.12.97<br />
Burundi: Oma Maggies tausend Kinder<br />
TA,05.01.98, S. 5<br />
Überleben nach dem Ende des Staates<br />
TA 20.01.98<br />
Das Wetter ist nicht an allem schuld<br />
TA 21.01.98, S. 7<br />
Zimbabwe: Steigender Maispreis löst eine Revolte aus<br />
TA 29.01.98, S. 31<br />
El Niño bremst die Wirtschaft aus<br />
TA 30.01.98, S. 3<br />
Kenia: Tödliche Stammesfehde<br />
TA 03.02.98, S. 5<br />
Tschads Hoffnungen liegen im Boden<br />
TA 04.02.98, S. 7<br />
Zimbabwe: Essen kann man sich kaum leisten<br />
TA 09.02.98, S. 4<br />
Tschad: Über Panzer schieben sich langsam Dünen<br />
TA 16.02.98, S. 6<br />
Somalia: Ein Staat, den niemand akzeptieren will<br />
TA 17.02.98<br />
Sierra Leone wird entwaffnet<br />
TA 27.02.98, S. 36<br />
Affenschädel und Nagelkrokodil<br />
TA 21.03.98<br />
Die Frauen bringen das Geld<br />
TA 23.03.98, S. 2,<br />
"Der Run auf afrikanische Bodenschätze"<br />
TA 23.03.98, S. 5<br />
Nigeria: Freundentanz für den Papst<br />
TA 24.03.98, S. 3<br />
Ghana: Bill Clinton gerät in Panik<br />
TA 24.03.98, S. 44<br />
Tschad: Gummi arabicum - natürlich gut<br />
TA 24.03.98, S. 48<br />
Wenig Erfolg im Kampf gegen TB<br />
TA 28.03.98<br />
Südafrika: Mandela liest Clinton die Leviten<br />
TA 01.04.98<br />
Komplizenschaft am Völkermord<br />
TA 03.04.98, S. 48<br />
Ägypten: Astronomische Bauwerke<br />
TA 11.04.98, S. 4<br />
Somalier warten weiter<br />
TA 11.04.98, S. 4<br />
Südafrika: Ex-Staatsfeind wird Armeechef<br />
TA 14.04.98, S. 29<br />
Streit um Afrikas Euro-Anschluss<br />
TA 17.04.98, S. 44<br />
Tödliches Frostschutzmittel im Fiebersirup<br />
TA 23.04.98, S. 7<br />
Senegal: In der Casamance herrscht Sprachlosigkeit<br />
TA 23.04.98, S. 7<br />
Dem Rep. Kongo: Kabila erregt Ärger<br />
TA 23.04.98, S. 7<br />
Somalia: Die Clan-Ältesten sind blockiert<br />
TA 25.04.98, S. 5<br />
Somalia bleibt für Helfer gefährlich<br />
TA 25.04.98, S. 5<br />
Ruanda: Dass nicht ungestraft gemordet werden darf<br />
TA 14.05.98, S. 5<br />
Sudan: Blätter als Nahrung<br />
TA 18.05.98, S. 5<br />
Dem. Rep. Kongo: Ein anderer Chauffeur in Kinshasa<br />
TA 19.05.98, S. 11<br />
Senegal: In die Schule ging Dibou Faye nie<br />
TA 23.05.98, S. 6<br />
Senegal: Ohne den Rat des Kalifen geht gar nichts<br />
TA 25.05.98, S. 4<br />
Eritrea und Äthiopien: Frühere Brüder streiten um eine klare Grenze<br />
Quellenverzeichnis<br />
TA 25.05.98, S.21<br />
Zimbabwe: Zu sehr vom Tabak abhängig<br />
TA 26.05.98, S. 5<br />
"Die Dritte Welt war einmal auch bei uns"<br />
TA 26.05.98, S.44<br />
Kleinkredite nützlicher als Gentech-Mais<br />
TA 29.05.98, S. 16<br />
Dämme hielten nicht<br />
TA 03.06.98, S. 12<br />
Eritrea und Äthiopien: Gefahr am Horn von Afrika<br />
TA 03.06.98, S. 12<br />
Botswana: Schleichende Aidskrise in Afrikas Musterland<br />
TA 03.06.98, S. 69<br />
Kolonialzeit: Das andere Gesicht des Alltags<br />
TA 05.06.98, S. 48<br />
Unbekannte Wässer aus der Tiefe<br />
TA 06.06.98, S. 5<br />
Südafrika: Der Killer von einst packt aus<br />
TA 06.06.98, S. 5<br />
Senegal: Mädchen vom Lande als Mädchen für alles<br />
TA 06.06.98, S. 28<br />
Dem. Rep. Kongo: Bodenschätze machen begehrlich<br />
TA 09.06.98, S. 3<br />
Eritrea: Wild entschlossen auf dem Weg zur Front<br />
TA 09.06.98, S. 3<br />
Nigeria: Von der Macht wird das Militär kaum lassen<br />
TA 10.06.98, S. 3<br />
Nigeria: Man hofft auf Demokratie<br />
TA 10.06.98, S. 3<br />
Eritrea: Exodus<br />
TA 11.06.98, S. 3<br />
Äthiopien: Mit viel Applaus an die Front<br />
TA 15.06.98, S. 5<br />
Südafrika: Giftmischer im Dienste des Apartheidregimes<br />
TA 15.06.98, S. 4<br />
Guinea-Bissau: Ausländische Truppen gegen die Rebellen<br />
TA 15.06.98, S. 4<br />
Eritrea und Äthiopien: Mubarak will im Grenzkreig vermitteln<br />
TA 17.06.98, S. 7<br />
Nigerianer hoffen auf Demokratie und Aufschwung<br />
TA 18.06.98, S. 3<br />
Alltag in Äthiopien<br />
TA 24.06.98, S. 52<br />
Aids: Die Kluft zwischen Nord und Süd wird immer grösser<br />
TA 25.06.98, S. 37<br />
Öl im Überfluss - und niemand baut Dämme<br />
TA 26.06.98, S. 7<br />
Südan: Zerstrittene Rebellen - darbendes Volk<br />
TA 29.06.98, S. 29<br />
Südafrika: Mandela unter Druck<br />
TA 30.06.98, S. 5<br />
Angola: Das tödliche Ende einer Friedensmission<br />
TA 30.06.98, S. 44<br />
"Die beste Waffe gegen das Aidsvirus"<br />
TA 01.07.98, S. 3<br />
Dem. Rep. Kongo: Kabila für Massaker mitverantwortlich<br />
TA 08.07.98, S. 3<br />
Kein Geburtsschein - keine Chance<br />
TA 08.07.98, S. 3<br />
Nigeria: Abiola tot<br />
TA 09.07.98, S. 9<br />
Nigerias zweiter Herzinfarkt<br />
TA 09.07.98, S. 44<br />
Geimpftes Saatgut<br />
TA 15.07.98, S. 5<br />
Eine Mordserie empört Südafrika<br />
TA 18.07.98, S. 3<br />
Geburtstagskind im Vorruhestand<br />
TA 20.07.98, S. 5<br />
Nigeria: Warten auf General Abubakars Pläne<br />
TA 20.07.98, S. 5<br />
Südafrika: Zum Geburtstag die Hochzeit<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 622
TA 28.07.98, S. 32<br />
WHO: "Wir möchten präventiv arbeiten"<br />
TA 30.07.98, S. 2<br />
Südsudan: Hunger nach Essen, Hunger nach Frieden<br />
TA 30.07.98, S. 5<br />
Kenia: Bulldozer walzten Nairobis Souvenirlädeli platt<br />
TA 31.07.98<br />
Forscher betätigen sich als Brandstifter<br />
Das Magazin 14.2.98, S. 24-35<br />
Das Magazin Nr. 7/ 1998<br />
Im gelobten Land<br />
Erwin Koch<br />
Das Magazin 20.06.98, S. 24-30<br />
Das Magazin Nr. 25/1998<br />
Regiert dieser Schweizer bald zwei Millionen Afrikaner<br />
Gabriele Werffeli, Joel Chiziane<br />
Das Magazin 25.09.98, S. 36-42<br />
Das Magazin Nr. 38/1998<br />
Fiebriger Kongo<br />
Albert Wirz<br />
8.5.9.3 Artikel aus "The Economist"<br />
Economist 07.09.96<br />
A Survey of Sub-Saharan Africa<br />
Economist 21.12.96, S. 53<br />
Zaire Rwanda: A tale of two homecomings<br />
Economist 20.12.97, S.53-54<br />
South Africa's new men<br />
Economist 20.12.97, S. 54<br />
Nigeria: The general's new hat<br />
Economist 03.01.98, S.38<br />
Kenya: Vote, if you can find a ballot paper<br />
Economist 03.01.98, S. 38-39<br />
Zambia: Rough Justice<br />
Economist 10.01.98, S. 33-34<br />
Burundi: Pawns in the war<br />
Economist 10.01.98, S. 34<br />
South Africa: Cautionary tale of black business<br />
Economist 17.01.98, S. 39<br />
Angola: Savimbi's choice<br />
Economist 17.01.98, S. 40<br />
Kenya: Unpromising<br />
Economist 24.01.98, S. 47<br />
Zimbabwe: Populism awry<br />
Economist 24.01.98, S. 48<br />
South Africa: How impartial?<br />
Economist 24.01.98, S. 48<br />
Rwanda and Burundi: Spreading poison in the Great Lakes<br />
Economist 31.01.98, S. 47<br />
Sierra Leone: Disaster waits<br />
Economist 07.02.98, S. 54-55<br />
Nigeria: In a Trojan horse<br />
Economist 07.02.98, S. 55<br />
Kenia: Political cleansing<br />
Economist 07.02.98, S. 55-56<br />
Kenia in Kenya: Serial killer at large<br />
Economist 07.02.98, S. 99<br />
How Aids began<br />
Economist 14.02.98, S. 52<br />
Somalia: The warlords make peace at last<br />
Economist 14.02.98, S.52<br />
South Africa: Half bubbling<br />
Economist 21.02.98, S. 48-49<br />
Sierra Leone: Puttimg a country together again<br />
Economist 21.02.98, S.49<br />
South Africa: Old wine in new bottles<br />
Quellenverzeichnis<br />
Economist 28.02.98, S. 45<br />
South Africa's profligate provinces<br />
Economist 28.02.98, S. 46<br />
Cameroon: Hung over<br />
Economist 28.02.98, S. 47<br />
Mauritius: Miracle in trouble<br />
Economist 07.03.98, S. 55-56<br />
Zimbabwe: Staying home<br />
Economist 07.03.98, S. 56<br />
Angola: The rebels miss their deadline<br />
Economist 14.03.98, S. 51-52<br />
Zansibar: Political passion, tourist flesh-pots<br />
Economist 14.03.98, S. 52<br />
Seychelles: Serpent in the garden<br />
Economist 28.03.98, S. 43-44<br />
Sudan's rebels change their spot<br />
Economist 28.03.98, S. 44<br />
The pope in Nigeria: Touching faith<br />
Economist 04.04.98, S. 45<br />
Africa after Clinton: Happiness in the Bush<br />
Economist 04.04.98, S. 45-46<br />
Botswana: Diamond Country<br />
Economist 04.04.98, S. 46<br />
Against the return of Uganda tyrants<br />
Economist 11.04.98, S. 38-39<br />
Angola: Suddenly, without the excuse of war<br />
Economist 18.04.98, S.44<br />
Kenya: At the end of a long reign<br />
Economist 18.04.98, S. 45<br />
Senegal: All clap<br />
Economist 25.04.98, S. 48-49<br />
France and Rwanda: Humanitarian?<br />
Economist 25.04.98, S. 50<br />
Nigeria: Abacha, for ever, and ever<br />
Economist 02.05.98, S. 45-46<br />
New Congo, same old ways<br />
Economist 02.05.98, S. 46<br />
South Africa: Merging the first and third worlds<br />
Economist 09.05.98, S. 50<br />
Overpricing Zambia's family silver<br />
Economist 16.05.98, S.49-52<br />
South Africa: Hail a taxi and die<br />
Economist 16.05.98, S. 52<br />
France and Gabon: Black emirate<br />
Economist 16.05.98, S. 52<br />
When local farmers know best<br />
Economist 23.05.98, S. 43-44<br />
Africa: The new princes fall out<br />
Economist 23.05.98, S. 44<br />
Mozambique: Minus a party<br />
Economist 30.05.98, S.41-42<br />
Nigeria: Abacha's wobbly throne<br />
Economist 30.05.98, S. 42<br />
Lesotho: Close to heaven<br />
Economist 30.05..98, S. 42-43<br />
Tanzania: Time to wakeup<br />
Economist 06.06.98, S. 49<br />
White South Africa on the Wing<br />
Economist 06.06.98, S. 50<br />
African Development Bank: The Bank that likes to say no<br />
Economist 13.06.98, S. 47<br />
Nigeria's unexpected chance<br />
Economist 13.06.98, S. 48<br />
Ethiopia and Eritrea: Why are they fighting?<br />
Economist 20.06.98, S. 47-48<br />
Burundi on the brink of peace?<br />
Economist 20.06.98, S. 47<br />
Rwanda: On and on it goes<br />
Economist 20.06.98, S. 48<br />
Guinea-Bissau: Instant war<br />
Economist 20.06.98, S. 48-49<br />
Nigeria: Happier, already<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 623
Economist 27.06.98, S. 49<br />
Zimbabwe: Peasant's revolt<br />
Economist 27.06.98, S. 49<br />
Angola: Rebel without a cause<br />
Economist 04.07.98, S. 43-44<br />
South Africa: Down with the rand<br />
Economist 04.07.98, S. 44<br />
Togo: A test for France<br />
Economist, 11.07.98, S. 14-15<br />
Nigeria's loss<br />
Economist, 11.07.98, S. 45<br />
Nigeria: Abiola's dangerous death<br />
Economist 18.07.98, S. 40-41<br />
Southern Sudan's starvation<br />
Economist 18.07.98, S. 41<br />
South Africa: Past revisited?<br />
Economist 25.07.98, S. 41-42<br />
Angola on the way to war<br />
Economist 25.07.98, S. 42<br />
Nigeria: Job vacancies<br />
Economist 25.07.98, S. 43<br />
South Africa: Sun and showers<br />
Economist 25.07.98, S. 43<br />
Mozambique's little teaser<br />
Economist 01.08.98, S. 35-36<br />
South Africa's hurtful truth<br />
Economist 01.08.98, S. 36<br />
Kenya: Knocking the good guys<br />
Economist 01.08.98, S. 72-73<br />
Diet and disease: Lost without a trace<br />
Economist 01.08.98, S.73<br />
Malaria: Jamming the net work<br />
8.5.9.4 Weitere Artikel<br />
abenteuer & reisen, 1998<br />
abenteuer & reisen spezial Ausgabe 2<br />
Südliches Afrika<br />
Zeitmagazin 25/98, S. 18<br />
Die Zeit magazin, Nr 25 vom 10.6.98, S. 18<br />
Ruanda: Vater für 500 Kinder<br />
Brückenbauer 50/97<br />
10.12.97, S. 26-27<br />
Ghana: Ananas - an der Sonne gereift<br />
SLZ 5/98<br />
Schweizerische Lehrerinnen und Lehrer Zeitung<br />
Ausgabe 5/1998, S. 6-17, 28-31<br />
Die Zeit 25.06.98, S. 27-28<br />
Nr. 27<br />
Die Mythen des Tourismus<br />
Die Zeit 25.06.98, S. 27<br />
Nr. 27<br />
Telekommunikation: Die Leos kommen<br />
Die Zeit 25.06.98, S. 34<br />
Nr. 27<br />
Aids: Eine Seuche, zwei Welten<br />
Quellenverzeichnis<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 624
8.6 Glossar<br />
Das Glossar soll in der Arbeit immer wieder verwendete Begriffe definieren, sowie die wichtigsten Fachaus-<br />
drücke kurz erläutern.<br />
Afrika vom lat. Africa, nach dem "Land der Afri", einem Volksstamm in der Gegend von<br />
Karthago in der ehemaligen römischen <strong>Pro</strong>vinz "Africa proconsularis" (heute Tune-<br />
sien) benannt (Brockhaus, S. 175)<br />
Amtssprache "Als Amtssprache bezeichnet man die offizielle Sprache eines Staates. Sie ist die<br />
Sprache der Verwaltung, Gesetzgebung sowie der Rechtsprechung, Wirtschaft und<br />
Bildung. " (Weltatlas 1997)<br />
Animismus "Unter Animismus versteht man einen Glauben, der davon ausgeht, dass alle Lebe-<br />
wesen und leblosen Dinge beseelt sind." (Weltatlas 1997)<br />
Apartheid Der aus dem Afrikaans entlehnte Ausdruck "Apartheid" bezeichnet die ehemalige<br />
Politik der Rassentrennung in Südafrika. Hierbei wurde eine strikte Trennung in den<br />
Bereichen Wohnen, Arbeiten, Schulbesuch und Freizeit zwischen der weissen und<br />
schwarzen Bevölkerung angestrebt. (nach Weltatlas 1997)<br />
Batate Die Batate ist eine mehrjährige, kriechende Krautpflanze aus der Familie der<br />
Windengewächse. Die ursprünglich aus den amerikanischen Tropen stammende<br />
Pflanze wird in erster Linie wegen ihrer dicken, essbaren Wurzeln, der sogenannten<br />
Süsskartoffeln, deren Stärke auch kommerziell genutzt wird, angepflanzt (nach<br />
Encarta 1997)<br />
Bild Als "Bild" wird in dieser Arbeit die Gesamtheit der Vorurteile und Vorstellungen<br />
bezeichnet, die sich ein Mensch über einen Sachverhalt oder eine andere Person<br />
aufgrund seines Wissens und seiner Wert- und Weltvorstellung macht.<br />
cash crops Als "cash crop", also Ernten, die Geld einbringen, werden diejenigen Agrarprodukte<br />
bezeichnet, welche statt zur Deckung des Eigenbedarfs hauptsächlich zum Verkauf<br />
auf dem Markt angebaut werden. Typische cash crops in Afrika sind Kaffee, Kakao,<br />
Tee, Ölpalmenprodukte, Baumwolle und Sisal.<br />
Cashewnuss Der Cashewnussbaum, ein immergrüner, tropischer Baum, Verwandter des Mango-<br />
baumes, liefert Früchte, die als Cashewnüsse bezeichneten Früchte. Ursprünglich<br />
stammt der Cashewnussbaum aus Südamerika. In Afrika wird er wegen seiner vielen<br />
Nutzungsmöglichkeiten angebaut. (nach Encarta 1997)<br />
Glossar<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 625
Durra Die Durra, auch als "Mohrenhirse" oder "Sorghum" bezeichnet, ist ein Süssgras,<br />
welches als Getreide in trockenen Gebieten Afrikas und Asiens als Hauptnahrungs-<br />
mittel angebaut wird. Nach Weizen, Mais, Reis und Gerste ist sie weltweit die fünft-<br />
wichtigste Getreideart (mit zunehmender Tendenz). Da die Körner kaum Kleber<br />
enthalten, eignet sich die Durra nicht für das Backen von Broten, vielmehr stellt<br />
man aus den Körnern Breie und Fladenbrot her, verwendet sie aber auch zum Brau-<br />
en von Hirsebier. (nach Encarta 1997)<br />
Guineaküste siehe unter "Westafrika"<br />
Kaurimuschel "Die Kauris sind kleine, blau und rot gemusterte Schneckengehäuse, die zu Ketten<br />
aufgefädelt werden. Sie stammen aus dem Indischen Ozean und werden von den<br />
Malediven und Lakkadiven in ganzen Schiffsladungen nach Afrika, Nordostindien<br />
und Burma verfrachtet. Holland importierte sie im I7. Jahrhundert nach Amsterdam,<br />
um sie wohlüberlegt einzusetzen, und auch im alten China zirkulierten sie auf den<br />
Wegen, die der Buddhismus auf seinem Missionsfeldzug einschlug." (Braudel 1985,<br />
S. 482)<br />
Kultur Die "Gesamtheit der einer Kulturgemeinschaft eigenen Lebens- und Organisations-<br />
formen sowie den Inhalt und die Ausdrucksformen der vorherrschenden Wert- und<br />
Geisteshaltung, auf die diese sozialen Ordnungsmuster gründen". (Encarta 1997)<br />
Mango Der Mangobaum, ursprünglich aus Indien stammend, wird wegen seiner fleischigen<br />
Frucht, die einen hohen Vitamin C Gehalt aufweist, in den Tropen angebaut.<br />
Maniok Maniok, ursprünglich in Südamerika beheimatet, wird heute weltweit in den Tropen<br />
als wichtige Nahrungspflanze angebaut. Geerntet werden die stärkereichen, bis zu<br />
acht Zentimeter dicken und 90 Zentimeter langen Wurzelknollen. Da die Pflanze<br />
einen hohen Anteil an Giftstoffen aufweist, kann die Knolle, die als Grundlage für<br />
Fladenbrot, Brei, Sossen, Suppen und alkoholische Getränke, sowie die unter dem<br />
Namen "Tapiok" bekannte Stärke dient, erst nach entsprechender Behandlung<br />
genutzt werden. (nach Encarta 1997)<br />
matrilinear Mit matrilinear wird eine Gesellschaft bezeichnet, bei der sich die genealogischen<br />
Verwandschaftsbeziehungen und die soziale Stellung an der Abstammungslinie des<br />
weiblichen Geschlechts orientieren. In solchen Gesellschaften haben theoretisch die<br />
Frauen die politische Führung inne und gelten als Familienoberhaupt. Obwohl viele<br />
Völker Afrikas matrilinear organisiert sind, ist es in den meisten Fällen zu einer<br />
Aufweichung der einstigen Vormachtstellung der Frau gekommen. (nach Weltatlas<br />
1997)<br />
Nordafrika Als Nordafrika wird das Gebiet bezeichnet, welches die arabisierten Staaten Marok-<br />
ko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, sowie Teile von Mauretanien und Sudan<br />
umfasst.<br />
Glossar<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 626
Ostafrika Ostafrika umfasst in der engen Definition die Länder Uganda, Kenia und Tansania.<br />
Wird der Begriff etwas weiter gefasst, kommen Äthiopien, Eritrea, Djibouti, Soma-<br />
lia und Mosambik hinzu.<br />
Paradigmawechsel Nach dem Ausdruck Thomas S. Kuhns ein sich revolutionär vollziehender Wechsel<br />
von einem bisher vorherrschenden Erklärungsmodell zu einem neuen. (Beck 1982,<br />
S. 284f.)<br />
patrilinear Mit patrilinear wird eine Gesellschaft bezeichnet, bei der sich die genealogischen<br />
Verwandtschaftsbeziehungen und die soziale Stellung an der Abstammungslinie des<br />
männlichen Geschlechts orientieren. In solchen Gesellschaften hat der Mann eine<br />
vorherrschende Stellung in Staat und Familie inne. (nach Weltatlas 1997)<br />
Polygamie Polygamie ist eine Form der Ehe, bei der ein Ehepartner gleichzeitig mit mehr als<br />
einem Ehepartner verheiratet ist (Vielehe). Bei den Moslem darf ein vermögenden<br />
Mann sich mit bis zu vier Frauen verheiraten. Bei einigen traditionell lebenden<br />
Völkern Afrikas gibt es, was die Zahl der Frauen für einen Mann angeht, keine<br />
Beschränkungen. In den meisten Ländern Afrikas gerät die Polygamie jedoch zuse-<br />
hends unter Druck von Seiten der Frauen.<br />
Rassismus Der Glaube, dass die Rasse eines Menschen ausschlaggebend für dessen Eigenschaf-<br />
ten und Fähigkeiten ist, und dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen<br />
Rassen gezwungenermassen zur Überlegenheit einer Rasse über alle anderen führen.<br />
"Der Rassismus ist etwas Unglaubliches. Er ist wie ein dicker Nebel, der den Blick<br />
auf das Urteilsvermögen der intelligentesten Köpfe verschleiert." (Maraire 1996,<br />
S. 109)<br />
Schwarzafrika Als Schwarzafrika wird in dieser Arbeit das Gebiet des afrikanischen Kontinents<br />
südlich der Sahara bezeichnet. Eine klare Abgrenzung in Nordafrika ist nicht<br />
möglich, da das historische und das moderne Schwarzafrika nicht deckungsgleich<br />
sind.<br />
Schwarzafrikaner Als Schwarzafrikaner werden in dieser Arbeit diejenigen Männer, Frauen und<br />
Kinder bezeichnet, welche in Schwarzafrika leben und die typischen Merkmale der<br />
Schwarzafrikaner, d. h. dunkle Hautfarbe und meist krauses Haar, aufzeigen.<br />
Sorghum eine Hirsenart, siehe "Durra"<br />
Südafrika Als Südafrika wird, sofern damit nicht der Staat Südafrika angesprochen wird, das<br />
Gebiet des südlichen Afrikas verstanden, welches die Länder Angola, Namibia,<br />
Südafrika, Lesotho, Swasiland, Botswana, Simbabwe, Sambia, Malawi und Mosam-<br />
bik umfasst.<br />
Sudan (Gebiet) siehe unter "Westafrika"<br />
Glossar<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 627
Taro Eine tropische Kulturpflanze aus der Familie der Aronstabgewächse, deren bis zu<br />
4 kg schweren Wurzelknollen, die ca. 15-20% Stärke, Eiweiss und Zucker enthalten,<br />
gekocht oder zu Mehl verarbeitet werden. (Lötschert/Beese 1992, S. 193-194)<br />
Terms of Trade Die Terms of Trade sind eine Messgrösse für das Verhältnis der Exportpreise eines<br />
Landes zu dessen Importpreisen. Diese Verhältnis wird in <strong>Pro</strong>zentzahlen, bezogen<br />
auf ein Referenzjahr, angegeben und ist damit ein wichtiges Instrument zur Darstel-<br />
lung von Preisentwicklungen zwischen verschiedenen Ländern.<br />
traditionell Als "traditionell" wird in dieser Arbeit diejenige Lebensweise bezeichnet, die sich<br />
an den überlieferten Verhaltensnormen der Vorfahren orientiert oder zu orientieren<br />
glaubt.<br />
Tribalismus Das Wort wird vom englischen "tribe" und französischen "tribu" (Stamm) abgelei-<br />
tet. Tribalismus "bedeutet mithin Stammesbewusstsein, stammesgebundene Politik<br />
mit dem negativen Beigeschmack von Exzess und Aggressivität". (Meister 1986,<br />
S. 44)<br />
Westafrika Westafrika meint den Streifen von Senegal zum Tschadsee. Die Länder dieser<br />
Region sind Mauretanien, Senegal, Gambia, Mali, Guinea, Sierra Leone, Liberia,<br />
Elfenbeinküste, Ghana, Burkina Faso, Niger, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun. Der<br />
Küstenstreifen dieses Gebietes wird oft als Guinea Küste bezeichnet, während der<br />
Savannengürtel mit Sudan gleichgesetzt wird. (nach Nketia 1991, S. 15)<br />
Yams Yams ist die Bezeichnung einer Reihe von Stauden, die hauptsächlich in den Tropen<br />
wegen ihrer essbaren Wurzelknollen angebaut werden. Diese können bis zu<br />
2.4 Meter lang und 45 Kilogramm schwer werden. (nach Encarta 1997)<br />
Zentralafrika Zentralafrika umfasst das Gebiet des Kongobeckens mit den Ländern Zentralafrika-<br />
nische Republik, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Ruanda und Burundi.<br />
Glossar<br />
Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen Seite 628