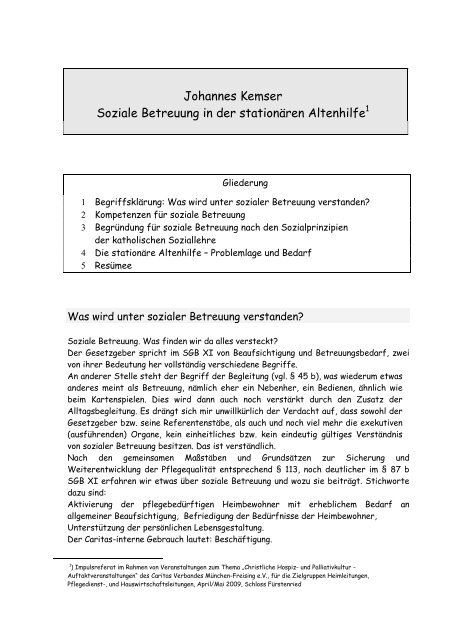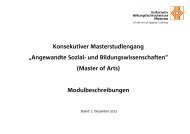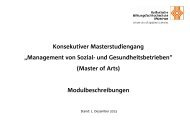Johannes Kemser Soziale Betreuung 2300709 - Katholische ...
Johannes Kemser Soziale Betreuung 2300709 - Katholische ...
Johannes Kemser Soziale Betreuung 2300709 - Katholische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Johannes</strong> <strong>Kemser</strong><br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong> in der stationären Altenhilfe 1<br />
Gliederung<br />
1 Begriffsklärung: Was wird unter sozialer <strong>Betreuung</strong> verstanden?<br />
2 Kompetenzen für soziale <strong>Betreuung</strong><br />
3 Begründung für soziale <strong>Betreuung</strong> nach den Sozialprinzipien<br />
der katholischen Soziallehre<br />
4 Die stationäre Altenhilfe – Problemlage und Bedarf<br />
5 Resümee<br />
Was wird unter sozialer <strong>Betreuung</strong> verstanden?<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong>. Was finden wir da alles versteckt?<br />
Der Gesetzgeber spricht im SGB XI von Beaufsichtigung und <strong>Betreuung</strong>sbedarf, zwei<br />
von ihrer Bedeutung her vollständig verschiedene Begriffe.<br />
An anderer Stelle steht der Begriff der Begleitung (vgl. § 45 b), was wiederum etwas<br />
anderes meint als <strong>Betreuung</strong>, nämlich eher ein Nebenher, ein Bedienen, ähnlich wie<br />
beim Kartenspielen. Dies wird dann auch noch verstärkt durch den Zusatz der<br />
Alltagsbegleitung. Es drängt sich mir unwillkürlich der Verdacht auf, dass sowohl der<br />
Gesetzgeber bzw. seine Referentenstäbe, als auch und noch viel mehr die exekutiven<br />
(ausführenden) Organe, kein einheitliches bzw. kein eindeutig gültiges Verständnis<br />
von sozialer <strong>Betreuung</strong> besitzen. Das ist verständlich.<br />
Nach den gemeinsamen Maßstäben und Grundsätzen zur Sicherung und<br />
Weiterentwicklung der Pflegequalität entsprechend § 113, noch deutlicher im § 87 b<br />
SGB XI erfahren wir etwas über soziale <strong>Betreuung</strong> und wozu sie beiträgt. Stichworte<br />
dazu sind:<br />
Aktivierung der pflegebedürftigen Heimbewohner mit erheblichem Bedarf an<br />
allgemeiner Beaufsichtigung, Befriedigung der Bedürfnisse der Heimbewohner,<br />
Unterstützung der persönlichen Lebensgestaltung.<br />
Der Caritas-interne Gebrauch lautet: Beschäftigung.<br />
1 ) Impulsreferat im Rahmen von Veranstaltungen zum Thema „Christliche Hospiz- und Palliativkultur -<br />
Auftaktveranstaltungen“ des Caritas Verbandes München-Freising e.V., für die Zielgruppen Heimleitungen,<br />
Pflegedienst-, und Hauswirtschaftsleitungen, April/Mai 2009, Schloss Fürstenried
Schöne Worte.<br />
Was aber meinen sie?<br />
Welches Menschenbild liegt dem zugrunde?<br />
Dies bleibt offen, auch in den Kommentaren. Auffällig ist allerdings die wiederholte<br />
Betonung der Aktivitäten 2 .<br />
Kompetenzen für soziale <strong>Betreuung</strong><br />
Ich greife auf die, wenn Sie so wollen, alten Methodenkompetenzen zurück. Dem<br />
Grunde nach keine pflegerischen, sondern ureigentliche sozialpädagogische<br />
Kompetenzen.<br />
1. Einzelfallhilfe oder Case-Management<br />
2. <strong>Soziale</strong> Gruppenarbeit oder Team-Management<br />
3. <strong>Soziale</strong> Gemeinwesenarbeit oder Community- Development<br />
Zu 1 Nach den Erkenntnissen über Einzelfallhilfe oder des Case-Managements ist<br />
entscheidend, den Menschen ganz zu erfassen.<br />
Wozu denn „ganz“ können Sie fragen. Es reicht doch wenn ich mit ihm<br />
- Mahlzeiten herrichte und einnehme,<br />
- wenn ich andere praktische hauswirtschaftliche Tätigkeiten ausführe,<br />
- mit ihm spazieren gehe,<br />
- koche und backe,<br />
- Fotos einklebe oder anschaue,<br />
- bastle, male oder singe....!<br />
Das mag schon stimmen, dass ich all diese Tätigkeiten tun kann. Ich muss mir aber<br />
darüber im Klaren sein, warum ich etwas tue – und das setzt mehr voraus, als es nur zu<br />
tun!<br />
Zu 2: Eine Gruppe oder ein Team zu leiten, kann jeder. Auch das mag schon sein,<br />
solange sich die Gruppe oder das Team auf Sport, Hobby oder auf sonstige<br />
g e m e i n s a m e Lieblingsbeschäftigungen bezieht. Wir haben es aber hier mit<br />
sozialer Gruppenarbeit, d.h. mit ungleichen Teilnehmern zu tun. Mindestens die Regeln<br />
über Gruppenprozesse, Gruppenphasen, Dynamik in Gruppen, gruppeneigene Führer, und<br />
ihre gruppenpädagogischen Prinzipien, sollten bekannt, verinnerlicht und eingeübt sein,<br />
um soziale <strong>Betreuung</strong> leisten zu können.<br />
Zu 3: Das Gleiche gilt sinngemäß auch für die soziale Gemeinwesenarbeit. Auch hier<br />
weist das Wörtchen „sozial“ aus, dass wir es mit einer besonderer Haltung zu tun<br />
haben, mit einem Arbeitsprinzip, das über die Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit hinaus<br />
und hinein in das Gemeinwesen, in die Nachbarschaft geht.<br />
2 ) Eine der nachhaltigsten gerontologischen Modelle ist die sogenannte Aktivitätstheorie von Havighurst/Tartler.<br />
Darin gilt die Aussage, dass die höchst mögliche Zufriedenheit bzw. erfolgreich Altern am ehesten unter<br />
Beibehaltung von Aktivitäten, verbunden mit der Fähigkeit der Anpassung an bestehende Normen zu erreichen sei.<br />
2
Wenn wir den Begriff der <strong>Betreuung</strong> genauer betrachten, dann fällt auf, dass es ein<br />
unklarer Rechtsbegriff ist, weil er vielfältig deutbar ist. So stecken in ihm andere<br />
Begriffe und Wortstämme, wie Treue, trauen, Vertrauen, Treuhand, etc.<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong> meint also: Menschen werden also mit Treue, mit Vertrauen und<br />
„treuhänderisch“ betreut.<br />
Ich fasse bis hierher zusammen:<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong> ist m e h r als nur <strong>Betreuung</strong>.<br />
Sozial meint mehr als gesellschaftlich oder gemeinsam.<br />
Das Wort sozial beschreibt einen Wert, eine Norm, eine Haltung, eine Lehre.<br />
Die katholische <strong>Soziale</strong>hre umfasst das alles.<br />
Begründung für <strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong> nach den Sozialprinzipien der<br />
katholischen Soziallehre<br />
Solidaritätsprinzip<br />
Nach dem Volksmund heißt es: Wir sitzen alle in einem Boot!<br />
Das gesellschaftliche Ganze und seine Glieder sind aufs engste schicksalhaft<br />
miteinander verbunden. Soll es dem Ganzen wohl ergehen, dann muss es allen seinen<br />
Gliedern wohl ergehen; soll es den Gliedern wohl ergehen, dann muss das Ganze in<br />
gutem Befund sein.<br />
Einzelwohl und Gemeinwohl sind wechselseitig aufeinander angewiesen; ihre<br />
Schicksale sind unlöslich miteinander verstrickt.<br />
So ist es. Das ist der tatsächliche Sachverhalt.<br />
Was bedeutet dies auf ein Alten- und Pflegeheim übertragen?<br />
Nun, zunächst legitimiert das Solidaritätsprinzip die Institution generell. Sie wurde<br />
eingerichtet, um im Sinne der „Gemeinverhaftung“ aus dem Einzelwohl das<br />
Gemeinwohl abzuleiten.<br />
Dann tritt das Solidaritätsprinzip für jeden Menschen ein, der sich selbst nicht<br />
mehr helfen kann. Der Bewohner eines Alten- und Pflegeheimes bezahlt nach seinen<br />
ihm eigenen Möglichkeiten seinen Anteil an den Heimkosten oder zahlt sie ganz. Im<br />
letzteren Fall ist er ein Selbstzahler und kann sich somit auch mittels selbständiger<br />
Heimkostenübernahme selbst helfen. Vor der Einführung der Pflegeversicherung im<br />
Jahr 1995 hat der Sozialhilfeträger die Kosten übernommen. Seit Einführung des<br />
PflegeVersG steuert die Pflegekasse zu und zahlt einen Teil, die Sozialhilfe zahlt im<br />
Bedarfsfall die Differenz.<br />
Die Finanzierung der sozialen <strong>Betreuung</strong> erfolgt durch die Kostenträger. Dieser<br />
erhält seine monatlichen Zuwendungen von Bewohnern, Kasse und Sozialhilfeträger.<br />
Nach dem Prinzip, dass das Ganze für das Wohl jedes einzelnen seiner Glieder<br />
verantwortlich ist und dafür aufzukommen hat, wäre es eigentlich Sache des<br />
Staates für soziale <strong>Betreuung</strong> zu zahlen. Nach dieser Logik gehört die Finanzierung<br />
der sozialen <strong>Betreuung</strong> nicht in den Pflegeschlüssel.<br />
3
Subsidiaritätsprinzip<br />
Für dieses Prinzip hat der Volksmund eine anschauliche Wendung: Die Kirche im Dorf<br />
lassen – oder nicht aus dem Dorf tragen! Was im Dorf, in der Ortsgemeinde<br />
geleistet werden kann, das trage man nicht an das große öffentliche Gemeinwesen<br />
Staat heran; was im engen Kreis der Familie erledigt werden kann, damit befasse<br />
man nicht die Öffentlichkeit; was man selbst tun kann, damit behellige man nicht<br />
andere. Das sind praktische Anwendungsfälle, aus denen unmittelbar abzulesen ist,<br />
worum es beim Subsidiaritätsprinzip geht.<br />
Man kann die Reihenfolge bilden:<br />
Selbsthilfe – Gemeinschaftshilfe (Nachbarschaft/Familie) – Fremdhilfe/Fernhilfe<br />
Man könnte auch sagen:<br />
Selbstzahler – Familien/Angehörigenunterstützung – Sozialhilfe, öffentliche Hilfe.<br />
Was der einzelne aus eigener Initiative und eigener Kraft leisten kann, darf die<br />
Gesellschaft ihm nicht entziehen und an sich reißen; ebenso wenig darf das, was das<br />
kleinere und engere soziale Gebilde zu leisten vermag, ihm entzogen und<br />
umfassenderen oder übergeordneten Sozialgebilden vorbehalten werden. Wo immer<br />
Gemeinschaftshilfe zur Selbsthilfe möglich ist, soll daher die Selbsthilfe<br />
unterstützt, Fremdhilfe dagegen nur dann und insoweit eingesetzt werden, wie<br />
Gemeinschaftshilfe zur Selbsthilfe nicht möglich ist oder nicht ausreichen würde.<br />
Nach allem erweist sich das Subsidiaritätsprinzip als Zuständigkeitsprinzip und ist<br />
als solches eindeutig ein Rechtsprinzip (z.B. in der Finanzierung geregelt); es sagt<br />
aus, wer im Verhältnis von Ganzem und Glied etwas zu tun, bzw. eine bestimmte<br />
Leistung zu erbringen hat.<br />
Personalität/Person<br />
Wollen wir mit einem Wort ausdrücken, dass für den Menschen seine Identität als<br />
Einzelwesen und sein gesellschaftliches Wesen g l e i c h wesentlich (wichtig) sind,<br />
dann sagen wir: er ist Person.<br />
Individualität und Sozialität z u s a m m e n machen seine Persönlichkeit aus. Zur<br />
Person gehört also einmal die Individualität, zum anderen die Sozialität.<br />
Ist diese Fähigkeit verloren gegangen, kommt es zur Fremdhilfe, um einerseits<br />
solidarisch und subsidiär zu helfen, aber andererseits zur Bewahrung oder<br />
Wiederherstellung der Personalität.<br />
Unter Persönlichkeit wird also jene Stufe seiner Identitätsentwicklung verstanden,<br />
die der Mensch durch die ihm verliehenen Anlagen und Kräfte zu erreichen vermag.<br />
Das ist gemeint mit ´Entfaltung der Persönlichkeit´. Darauf hat jeder Mensch kraft<br />
seiner Menschenwürde ein unverlierbares und unverzichtbares Recht.<br />
Deshalb soll in einer Institution Alten- und Pflegeheim immer und überall jeder das<br />
tun können, was er kann und was er will – letzteres selbstverständlich im Rahmen der<br />
„erlaubbaren“ Möglichkeiten.<br />
Diese Argumentationen begründet notwendigerweise soziale <strong>Betreuung</strong>.<br />
4
Exkurs: Institutionen<br />
Im Sinne der katholischen Soziallehre lassen sich Alten- und Pflegeheime als<br />
besonders bedeutsame und unabdingbare gesellschaftliche Institutionen aufzählen.<br />
Damit soll ausgedrückt werden, dass wegen ihrer hohen Bedeutung für eine soziale<br />
Gesellschaft und all ihrer Glieder, und wegen der professionellen und ehrenamtlichen<br />
Dienste, die sie leisten, diesen Institutionen ein ausnehmend hoher Wert<br />
zuzuerkennen ist.<br />
Im Umkehrschluss würde das heißen: wenn eine Familie funktioniert, braucht es<br />
keine Institution. Wäre dies der Fall, hätten wir so etwas wie die „vollkommene<br />
Gesellschaft“. Das Gegenteil ist die Regel: wir haben eher eine „unvollkommene<br />
Gesellschaft“, die die Institutionen zu ihrer Erhaltung braucht.<br />
Familie wird als die Urform sozialer <strong>Betreuung</strong> betrachtet; ist die Familie in Gefahr<br />
auseinander zu brechen oder kann aus irgendwelchen Gründen die Hilfe für ihre<br />
Mitglieder nicht mehr selbst leisten, treten Institutionen helfend ein, um den<br />
„unvollkommenen Zustand“ wieder in einen Austausch, und damit in ein Lot der<br />
Ausgeglichenheit zu bringen.<br />
Wie funktioniert der Austausch zwischen Person und Umwelt?<br />
Mit neueren sozialwissenschaftlichen Theorien, insbesondere den<br />
systemtheoretischen, lässt sich dieser Sachverhalt folgendermaßen darstellen:<br />
Idealzustand der<br />
„vollkommenen<br />
Gesellschaft“<br />
Transaktionen<br />
Hier funktioniert der Austausch zwischen Mensch und Umwelt uneingeschränkt, ungestört.<br />
Fremdhilfe ist nicht angezeigt.<br />
Normalzustand der<br />
„unvollkommenen<br />
Gesellschaft<br />
Person<br />
Freunde<br />
Familie<br />
Person<br />
Freunde<br />
Familie<br />
------ gestörte Transaktion ----<br />
Umwelt<br />
Ges. schaft<br />
Staat<br />
Umwelt<br />
Ges. schaft<br />
Staat<br />
Hier funktioniert der Austausch zwischen Mensch und Umwelt eingeschränkt,<br />
unterbrochen.<br />
Fremdhilfe ist angezeigt.<br />
Helfende soziale Institutionen treten ein. Im Fall gestörter oder zerstörter<br />
Transaktion legitimieren sich soziale Interventionen.<br />
5
Caritas<br />
Unmittelbare Folge der Menschenwürde ist das Recht auf freie Entfaltung der<br />
Persönlichkeit. Dieses Recht endet nicht automatisch mit Alter, Krankheit,<br />
Behinderung oder abweichendem Verhalten in einer Institution. Selbst bei<br />
gänzlicher <strong>Betreuung</strong> eines Menschen oder <strong>Betreuung</strong> in Teilen, soll das Recht auf<br />
freie Entfaltung der Persönlichkeit dadurch bestehen bleiben, dass immer und zu<br />
jeder Situation der mutmaßliche Wille der Person zu gelten hat. Im Zweifelsfall<br />
muss dieser angenommen oder vermutet werden. Denn: Spricht man dem Menschen<br />
seine Fähigkeit zur freien selbstverantwortlichen Selbstbestimmung ab, enthebt<br />
man ihn als P e r s o n.<br />
Wenn also beispielsweise Demenz Verlust der Persönlichkeit bedeutet, dann enthebt<br />
man ihn, den demenzkranken Menschen als Person. Ein Betreuer übernimmt<br />
sozusagen stellvertretend den nicht mehr vollkommenen Teil der Person, der<br />
verlorengegangen ist.<br />
Eine im Sinne der Caritas zu verstehende Soziallehre muss eine klare Antwort auf<br />
die Frage geben: was ist der Mensch und wie ist ihm zu begegnen?<br />
Das aber ist keine Frage, die Halt macht vor irgendwelchen Tabus, seien es Alter,<br />
Krankheit, Sterben oder Tod. Sie – die Caritas – muss also „aufs Letzte gehen“; d.h.<br />
sie muss auch zum Leiden, Sterben und Tod Antworten haben und<br />
Handlungsalternativen bereit stellen.<br />
Darin wird nun ganz deutlich, worin sich Caritas von jeder anderen Soziallehre<br />
unterscheidet: Es ist ihre spezielle Antwort auf die Frage „ Was ist der Mensch und<br />
wie ist ihm zu begegnen?“<br />
Für die (Be)Wertung des Lebens und des Arbeitens in einem Alte- und Pflegeheim als<br />
Institution, ist es grundlegend und entscheidend, ob wir das Alten- und Pflegeheim<br />
mehr in einem M a n g e l oder mehr in einem Ü b e r f l u ß unserer Gesellschaft<br />
begründet sehen.<br />
Im einen Fall, des Mangels, werden wir uns missmutig oder geduldig in das<br />
Unvermeidliche begeben und uns damit abfinden, in der Institution Alten- und<br />
Pflegeheim zu arbeiten, mit anderen zu leben und auf sie Rücksicht nehmen zu müssen;<br />
im anderen Fall, des Überflusses werden wir unsere Aufgabe in der gesellschaftlichen<br />
Institution Alten- und Pflegeheim nicht als Last empfinden, sondern sie als Chance zu<br />
unserer eigenen Entfaltung freudig begrüßen und wahrnehmen.<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong> trägt eher zur zweiten Sichtweise bei. Was bedeutet das im<br />
Alltag?<br />
Ich kann als Betroffener Angebote wahrnehmen oder kann sie nicht wahrnehmen.<br />
Ich kann mitmachen, mitreden in der „Bewohnervertretung“, kann am Gottesdienst<br />
teilnehmen, muss es aber nicht. Ich kann mich anregen lassen, bei<br />
unterschiedlichsten Aktivitäten teilzunehmen, ich kann es auch lassen.<br />
Selbstverständlich gibt es in jedem Haus nur eine begrenzte Anzahl an Angeboten.<br />
Wenn mir diese Angebotspalette nicht passt, habe ich halt keine Angebote.<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong> wäre nun ideal geeignet, um Menschen, die mit den im Heim<br />
existierenden Angeboten nichts anfangen können, möglicherweise dorthin zu<br />
bringen, wo ihre „Heimat“ ist, wo sie sich wohl und Zuhause fühlen, beispielsweise im<br />
gewohnten Krippenverein, dem Kaffeekränzchen oder dem Stammtisch.<br />
6
Auf diese Weise könnte ein Teil ihres sozialen Umfeldes bleiben oder Teil eines<br />
selbstgewählten Umfeldes werden. Solche Sicherheiten im sozialen Netz können den<br />
Heimaufenthalt durchaus zur Lust werden lassen, weil der Grad an<br />
Selbstbestimmung den höchsten Wert im Sinne der katholischen Soziallehre erfüllt.<br />
Das Bestreben der sozialen <strong>Betreuung</strong> liegt ja gerade darin begründet, den<br />
verlorengegangenen Teil der Persönlichkeit – nennen wir ihn Autonomieverlust -<br />
zumindest teilweise und zeitweise durch Nutzen von Kompetenzen und subjektiven<br />
Wünschen wieder herzustellen und auszugleichen.<br />
Die stationäre Altenhilfe - Problemlage und Bedarf<br />
Nichts ist so unbeliebt und gleichzeitig so notwendig wie ein Alten- und<br />
Pflegeheim<br />
Vor dem Hintergrund der seit langem bekannten und bereits in den siebziger Jahren<br />
vorhergesagten Bevölkerungsprognosen, ist das drängende Problem der<br />
Überalterung nach dem Verständnis katholischer Soziallehre kein wirkliches<br />
Problem, vielmehr liegt die Schwierigkeit in der grundlegend negativen Einstellung<br />
den altgewordenen Menschen gegenüber, die als soziale Last, als Ballast und<br />
gesellschaftliche Zeros betrachtet werden.<br />
Eine Unterbringung in der verbleibenden Lebenszeit im Heim wird oftmals<br />
zähneknirschend und als letzte Möglichkeit hingenommen, generell aber als<br />
verwerflich und als nicht würdevoll betrachtet. Niemand geht gerne und selten<br />
freiwillig in ein Alten- und Pflegeheim bei der gleichzeitigen Erkenntnis, dass mit<br />
zunehmendem Lebensalter, dementiellen Erkrankungen und bei steigender<br />
Pflegebedürftigkeit, für jeden ein Einzug in ein Heim immer wahrscheinlicher wird.<br />
Schon heute benötigt und erhält jeder zweite deutsche Bürger, der hochaltrig, also<br />
ab ca. dem 85. Lebensjahr, Pflege nach einer der drei Pflegestufen. Die<br />
Fachkraftquote in den Heimen richtet sich nach der Pflegeintensität bzw. dem<br />
Pflegebedarf, also nach dem Grad der körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen<br />
der Bewohner. Zufriedenheit im Sinne einer gelungenen Identität der Person<br />
orientiert sich aber an weit mehr Faktoren als nur an körperlichen und medizinisch<br />
Behandelbaren. Vielmehr können das Personal der Träger und ihrer Heime nur dann<br />
zufriedene Lebensabschlüsse der Bewohner gewährleisten, wenn auch soziale<br />
<strong>Betreuung</strong> in professioneller und fachlicher Kompetenz vorhanden, und<br />
selbstverständlich gleichzeitig auch mit der nötigen menschlichen Zuwendung<br />
ausgestattet ist.<br />
Vor diesem Hintergrund erhält die Lebensgestaltung, Alltagsorientierung und<br />
Sinnerfüllung eine hohe Bedeutung. Dies wirkt sich im auch auf ein würdiges Sterben<br />
aus.<br />
7
Demographische Veränderungen führen langfristig zu erhöhter Nachfrage im<br />
Bereich der stationären Altenhilfe<br />
Es muss davon ausgegangen werden, dass die Langlebigkeit weiterhin ansteigen wird<br />
und damit die Bedarfe im Bereich stationärer Pflege und <strong>Betreuung</strong> zunehmen<br />
werden. Dadurch wird es zu einer erhöhten Nachfrage an Heimplätzen kommen bei<br />
steigendem Bedarf auf soziale <strong>Betreuung</strong>. Die Tendenz dahin ist bereits in den<br />
letzten Jahren durch ständig steigendes Eintrittsalter in ein Heim zu beobachten.<br />
Exkurs: Dominanz von körperlicher Pflege<br />
Nicht die Ganzheit der Person, sondern ihre medizinisch diagnostizier- und<br />
therapierbaren Teile stehen im Mittelpunkt der Pflege. Dass dabei die<br />
alltagsnotwendigen und gesundheitserhaltenden Faktoren, wie beispielsweise das<br />
regelmäßige Lagern des Dauerliegenden, Flüssigkeitszufuhr oder<br />
Medikamenteneingabe selbstverständliche Pflegeleistungen sind, ist klar. Hingegen<br />
ist die soziale <strong>Betreuung</strong> wie sie bereits im Pflegeversicherungsgesetz von 1995<br />
verankert ist, im Pflegeweiterentwicklungs-Gesetz von 2008 ein fachliches<br />
Stiefkind geblieben. Möglicherweise haben die Auflagen des Medizinischen Dienstes<br />
der Krankenkassen (MdK) und der Heimaufsicht dazu beigetragen, dass eine<br />
eklatante Dominanz von körperlicher Pflege den Heimalltag mehr bestimmen als<br />
kommunikative, emotionale und soziale Komponenten.<br />
Denn letztlich werden nur die in Minuten am Körper vollzogenen Pflegehandlungen<br />
bezahlt und müssen in der Pflegedokumentation entsprechend niedergelegt sein.<br />
Schlechtes Image der Altenpflege und die Vernachlässigung sozialer<br />
Komponenten<br />
Generell ist in einem Alten- und Pflegeheim die Fortsetzung des bisherigen Lebens<br />
eine Illusion. Auf fremde Hilfe angewiesen, ist das Heim ein Ort zwischen<br />
Krankenhaus und Hotel. Beides aber sind Orte, die nicht auf Dauer, sondern<br />
freiwillig für eine überschaubare Zeit aufgesucht werden. Eine stationäre<br />
Altenhilfeeinrichtung ist dem Grunde nach weder das eine noch das andere, weil die<br />
Entscheidung keine vorübergehende ist, außer bei Tages- oder Nachtpflege, sondern<br />
eine meist für die verbleibende Lebenszeit. Das kann weder eine noch so aufwändige<br />
und teure Ausstattung, noch Kurzzeitpflege kaschieren.<br />
Das insgesamt gesehene schlechte Image der Altenpflege im Heim rührt von all<br />
diesen Komponenten her. Würde es gelingen, Lebensvollzüge und Lebensabläufe<br />
trotz vorhandener Einschränkungen als soziale Komponenten in die Alltagsroutine zu<br />
integrieren, würde vermutlich der freiwillige Einzug in ein Heim häufiger zu<br />
verzeichnen sein. Aber selbst im Heimalltag gibt es bereits denkbare Wege, um die<br />
Vernachlässigung der sozialen Faktoren zu vermeiden (vgl. Hausgemeinschaften oder<br />
Wohngruppenkonzepte).<br />
8
Es stimmt mich nachdenklich, dass es Pflegestufen aber beispielsweise keine<br />
Sozialstufen gibt.<br />
Hoher Zuwendungsbedarf vonseiten der Angehörigen<br />
In den meisten bekannten Fällen entscheiden über einen Heimaufenthalt nicht die<br />
Betroffenen selbst, sondern ihre Angehörigen. Dabei befinden sich Angehörige, ob<br />
Partner, Geschwister, Kinder oder Enkel, oftmals in einer für sie quälend<br />
dahinschleppenden und an den eigenen Kräften zehrenden hochsensiblen<br />
Entscheidungssituation. Ohne hier auf Detailfragen, wie etwa Mutter oder Vater-<br />
Tochter/Sohn-Konflikte oder auf die Genderproblematik näher eingehen zu können,<br />
bleibt bei allen noch so unterschiedlich gelagerten Problemlagen gleichermaßen das<br />
bohrende schlechte Gewissen bei den für den Heimaufenthalt verantwortlichen<br />
Angehörigen zurück. Die Folge sind oft Rationalisierungen, die den Heimeinzug<br />
rechtfertigen. Damit wird die Angst vor dem eigenen Älterwerden und dass man es<br />
s o auf keinen Fall will, verdrängt.<br />
Mit diesem tiefenpsychologischen Erklärungsansatz lässt sich nachvollziehen, warum<br />
Angehörige ihrerseits einen so hohen Zuwendungsbedarf besitzen, der in der Regel<br />
an das Heimpersonal gerichtet ist.<br />
Da aber der Grund für diese Bedürfnisse häufig weder erkannt noch ausgesprochen<br />
wird, steht eine meist verdeckte Spannung im Raum, die eine ausgewogene<br />
Kommunikation zwischen Fachkräften und Angehörigen erschwert.<br />
Forderung nach immer mehr Wirtschaftlichkeit<br />
Die Situation in der stationären Altenpflege hat sich in den letzten Jahren durch<br />
wachsende Pflegeintensität, steigenden Anteil demenziell erkrankter Menschen und<br />
drückender Forderung nach Wirtschaftlichkeit dramatisch verändert. Dass sich<br />
dabei Heime zugespitzt zu „Orten der Konzentration der Unerträglichen“ entwickeln<br />
(vgl. Dörner 2003; vgl. Gronemeyer 2004), kann als eine dieser Auswirkungen betrachtet<br />
werden. Obwohl in Fachkreisen bekannt ist, dass soziale <strong>Betreuung</strong> immer<br />
bedeutsamer wird, weil die natürlichen Ressourcen zwischenmenschlicher Kontakte<br />
zurückgedrängt werden, gibt es noch zu wenig kreative Ideen, ein qualifiziertes<br />
Angebot für soziale <strong>Betreuung</strong> zu finanzieren. Die seltenen Fälle der Umsetzung von<br />
sozialer <strong>Betreuung</strong> werden in die Heimkosten hineingerechnet und dem ebenso<br />
wichtigen Bereich der Pflege abgezogen oder zugerechnet. Zusätzliche finanzielle<br />
Aufwendungen müssen an den Vertragspartner, d.h. an die Kunden weitergereicht<br />
werden. Da sich bei fortschreitender Pflegebedürftigkeit die Pflegestufe erhöht,<br />
erhöhen sich damit auch die Einnahmen für das Heim. Die Folge ist, dass der<br />
Leistungserbringer vor diesem Hintergrund eher danach strebt, möglichst viele<br />
Bewohner mit möglichst hohen Pflegestufen zu haben, um der Forderung nach immer<br />
mehr Wirtschaftlichkeit nachzukommen. Eine eigentlich wünschenswerte<br />
9
Rückstufung von einer höheren in eine niedrigere Pflegestufe, als Folge einer<br />
erfolgreichen Rückkehr zu selbstbestimmten Leben, bleibt aus den genannten<br />
Gründen bisher unerwünscht.<br />
Das Problem, das sich auch im neuen Pflegeweiterentwicklungsgesetz von 2008 nicht<br />
geändert hat, zeigt nach wie vor folgendes Dilemma: Zwar bedeutet eine höhere<br />
Pflegestufe mehr Personal, aber gleichzeitig liegt die Fachkraftquote weiterhin bei<br />
50 %. Für den Bereich der sozialen <strong>Betreuung</strong> ist keine Fachkraftstelle vorgesehen,<br />
was im Falle einer „Dennoch-Einstellung“ zusätzlich zu finanzierende höhere<br />
Personalkosten bedeuten würde.<br />
Der Deutsche Caritasverband hat in seiner Stellungnahme zum neuen Pflegegesetz,<br />
resp. zum neuen § 45 b SGB XI darauf hingewiesen, dass „aufgrund der<br />
Nichtberücksichtigung der spezifischen Bedarfe an psychosozialer <strong>Betreuung</strong>,<br />
Begleitung und Kommunikation gerontopsychiatrisch veränderter Menschen bei der<br />
Einstufung in die Pflegeversicherung ... gerade diese Menschen meist nur in<br />
Pflegestufe I und II gelangen.“<br />
Fazit<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong> ist m e h r als Beschäftigung.<br />
Denn es geht nicht um Tätigkeiten, mit denen man sich die Zeit vertreibt; sondern<br />
um vielfältige, fächerartige Formen der Alltagsgestaltung vor dem Hintergrund der<br />
hier bereits ausführlich beschriebenen Kenntnis über Soziallehre.<br />
Selbstverständlich sind auch Aktivitäten scheinbar nutzloser Ausrichtung oftmals<br />
sinnvoll und motivationsfördernd. Selbstverständlich können und sollen<br />
Ehrenamtliche oder zusätzliche <strong>Betreuung</strong>skräfte (vgl. § 87 b SGB XI) solche<br />
Einzelaktivitäten ausführen dürfen. Entscheidend ist dabei aber, dass sie von<br />
kompetentem Fachpersonal in sozialer <strong>Betreuung</strong> geschult und angeleitet werden.<br />
Die Verantwortung für Ehrenamtliche und zusätzliche <strong>Betreuung</strong>skräfte muss in<br />
Händen der für die soziale <strong>Betreuung</strong> ausgewiesenen Mitarbeiter verbleiben.<br />
Ziel der sozialen <strong>Betreuung</strong> ist Gestaltung und Initiierung von Lernprozessen zum<br />
Erreichen subjektiver, zufriedenstellender Sinnerfüllung.<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Betreuung</strong> bezieht sich dabei selbstverständlich auch auf konkrete Dinge<br />
des Tagesablaufes. Ein gezieltes Gespräch, eine zielgerichtete Tätigkeit, ein<br />
Miteinandersein, ein freiwillig ausgewähltes Spiel, selbstgewolltes Musizieren oder<br />
ähnliches; auch ein Nichtstun, allein oder zu mehreren, ein die Sinne anregender<br />
Ausflug, der still eingeatmete Blütenduft, die aktive oder passive Teilhabe am<br />
Gemeinwesen, all diese - die Selbstbestimmung und Sinnhaftigkeit fördernden -<br />
Aktivitäten, tragen zur Zufriedenheit im Heim als Ort des Wohnens und Lebens bei.<br />
Das Schreckgespenst Alten- und Pflegeheim kann nur so zu einer echten Institution<br />
des „Überflusses“ werden, wenn alles Fremde, Fremdbestimmende, die Autonomie<br />
Gefährdende eliminiert und das Vertraute, Selbstbestimmte, Heimatgefühle<br />
Stärkende zugelassen, weiterentwickelt und aufgebaut wird.<br />
Dazu kann soziale <strong>Betreuung</strong> in erheblicher Weise beitragen.<br />
10