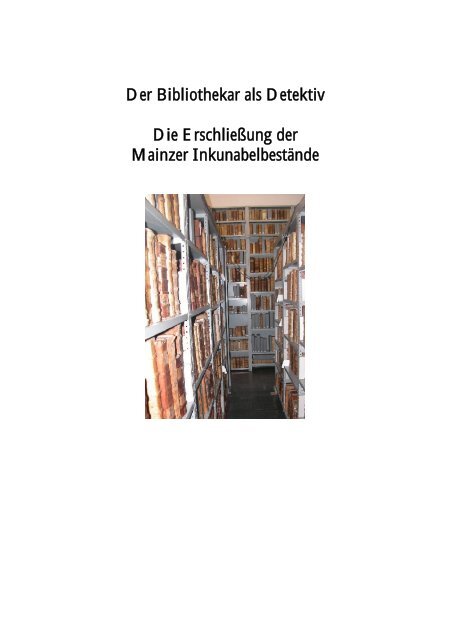Kurt Hans Staub. Unter Mitarbeit von André Horch - Gutenberg ...
Kurt Hans Staub. Unter Mitarbeit von André Horch - Gutenberg ...
Kurt Hans Staub. Unter Mitarbeit von André Horch - Gutenberg ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Bibliothekar als Detektiv<br />
Die Erschließung der<br />
Mainzer Inkunabelbestände
Vorbemerkung<br />
Die Ausstellung „Der Bibliothekar als Detektiv“, die im<br />
vergangenen Jahr (2006) in den Monaten Juli und August im<br />
<strong>Gutenberg</strong>-Museum Mainz gezeigt wurde, gab Einblicke in die<br />
Erschließungsarbeiten des Inkunabelbestandes des <strong>Gutenberg</strong>-<br />
Museums. Sie fand ein großes Interesse. Bemerkenswert war die<br />
Zahl auswärtiger Besucher, dafür waren die Sommermonate Juli<br />
und August besonders günstig. Es gibt offenbar immer mehr<br />
Menschen, die eine Ferienreise durch Deutschland machen, und<br />
wenn Mainz zu den Reisezielen gehört, dann ganz offensichtlich<br />
auch das <strong>Gutenberg</strong>-Museum. Bei Führungen und Gesprächen<br />
am Rande konnte festgestellt werden, daß nicht wenige schon<br />
mit Hilfe <strong>von</strong> entsprechenden Websites im Internet sich auf den<br />
Besuch im <strong>Gutenberg</strong>-Museum vorbereitet hatten und daher<br />
bereits <strong>von</strong> der Ausstellung wußten. Zusätzlich wurde innerhalb<br />
des Museums mit Hilfe einer Powerpoint Präsentation auf die<br />
Ausstellung aufmerksam gemacht. Es waren Besucher <strong>von</strong><br />
Füssen im Allgäu bis Bremen, selbstredend auch aus dem<br />
Ausland, darunter Lehrer, Bibliothekare, Professoren,<br />
Studenten. Wegen des exemplarischen und dokumentarischen<br />
Wertes der Ausstellung haben wir uns entschlossen, den Katalog<br />
hier in einer revidierten Fassung wiederzugeben, es ergaben sich<br />
kleinere Modifikationen und Ergänzungen, vor allem<br />
hinsichtlich der Einbandwerkstätten, und zwar infolge der<br />
strikten Nutzung der Einbanddatenbank (EBDB) für die<br />
Einbandbestimmung.<br />
Für den Nibelungenbinder (Fall 2), den Buchschmuck mit<br />
„Monstrous Clowns“ (Fall 8) und Bücher aus dem Besitz <strong>von</strong><br />
Johannes Ugelnheymer (Fall 7) wurden weitere Exemplare<br />
nachgewiesen, die alle hier aufgeführt werden.<br />
Inzwischen wurden <strong>von</strong> fast allen Bänden der Sammlung<br />
summarisch exemplarspezifische Daten gesammelt und in eine<br />
Datei eingegeben, die intern und für Auskunftszwecke genutzt<br />
wird, sie sind aber auch Grundlage und Materialsammlung für<br />
eine fortschreitende Tiefenerschließung des Bestandes.<br />
2
Die Datei enthält Angaben zu Provenienzen/Vorbesitzern,<br />
Einbänden, Buchschmuck, Makulatur etc. Neu bei den<br />
Provenienzen sind außer Mainzer Klöstern auch Klöster<br />
außerhalb <strong>von</strong> Mainz wie Worms oder Bensheim, zum ersten<br />
Mal werden Personen als Vorbesitzer notiert, darunter nicht<br />
wenige historisch belegbare. Nennen könnte man den<br />
Frankfurter Humanisten und Politiker Philip Fürtsenberg (1497<br />
– 1540) oder den Heidelberger Johannes Virdung aus Haßfurt,<br />
Mathematiker und Astrologe, Verfasser <strong>von</strong> vielen gedruckten<br />
Praktika. Der Band aus seinem Besitz hat zahlreiche<br />
Annotationen und handschriftliche Tabellen. Es sind Bücher,<br />
die erst über einen Zwischenbesitzer an Mainzer geistliche<br />
Institutionen kamen, bevor sie zur Zeit der Säkularisation in<br />
öffentlichen Besitz übergingen. Es wurden außerdem alle<br />
spätgotischen Einbände registriert, ferner alle Drucke mit<br />
auffälligem Buchschmuck, darunter Initialen mit Gold, Bände<br />
mit Handschriftenfragmenten (in Latein, Deutsch und<br />
Hebräisch), ebenso Druckmakulatur in den Spiegeln; erstaunt<br />
hat die relativ hohe Zahl <strong>von</strong> Bänden, die lediglich Abklatsche<br />
überliefern. Inhalt, Alter und Schrift zeigen, daß die Verluste auf<br />
Männer zurückgehen, die um den literarischen und kulturhistorischen<br />
Wert ihrer Beute wußten.<br />
An der Datenerhebung waren beteiligt außer <strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong>:<br />
Christian Richter, <strong>André</strong> <strong>Horch</strong> und Zeynep Yildiz.<br />
3
Der Bibliothekar als Detektiv.<br />
Die Erschließung der Mainzer Inkunabelbestände. Fundstücke.<br />
Eine Ausstellung im <strong>Gutenberg</strong>-Museum Mainz<br />
(1.7.-3.9. 2006)*<br />
Texte <strong>von</strong><br />
<strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong> unter Mitwirkung <strong>von</strong> Christian Richter.<br />
Einbandbestimmung:<br />
Zeynep Yildiz.<br />
Ausstellungskonzeption und Gestaltung:<br />
Claus Maywald und <strong>André</strong> <strong>Horch</strong>.<br />
Erstellung der Datenbank, Internet- und Videopräsentation:<br />
<strong>André</strong> <strong>Horch</strong>.<br />
Im Auftrag der Direktorin des <strong>Gutenberg</strong>-Museums,<br />
Eva-Maria Hanebutt-Benz.<br />
4
Vorbemerkung zu Fall 1 bis 16<br />
Grundlage der Ausstellung sind Funde und Beobachtungen, die<br />
K. H. <strong>Staub</strong> bei seinen Erschließungsarbeiten der Mainzer<br />
Inkunabelbestände im <strong>Gutenberg</strong>-Museum in den vergangenen<br />
Jahren gemacht hat. Die gezeigten Inkunabeln werden ergänzt<br />
durch einige Leihgaben der folgenden Bibliotheken: ULB<br />
Darmstadt, UB Freiburg im Br., Martinus-Bibliothek Mainz,<br />
Stadtbibliothek Mainz und Nicolaus-Matz-Bibliothek<br />
(Kirchenbibliothek) Michelstadt.<br />
Die wiedergegebenen Bilder stellen eine Auswahl dar.<br />
Die endgültigen Erschließungsergebnisse werden in eine<br />
Datenbank<br />
www.gutenberg-bibliothek.de/staub<br />
eingegeben.<br />
Die Website ist gedacht als Informationsmöglichkeit für ein<br />
Fachpublikum: Mediaevisten, Buch- und Bibliothekswissenschaftler<br />
aber ebenso für allgemein an Kunst und kultureller<br />
Überlieferung Interessierte.<br />
5
Einleitung<br />
Das alte Buch enthält weit mehr als nur einen gedruckten oder<br />
handgeschriebenen Text. Sehen wir uns das Buch genauer an,<br />
<strong>von</strong> außen oder blättern wir in ihm, dann begeben wir uns auf<br />
eine Entdeckungsfahrt. Nicht selten stoßen wir auf unserer Reise<br />
auf wirkliche Kriminalfälle, zu deren Lösung es detektivischen<br />
Spürsinnes bedarf.<br />
Das Buch hat einen alten Einband. Er besteht aus Holzdeckeln,<br />
die mit Leder überzogen sind, in das Leder sind Schmuckelemente<br />
eingeprägt, Metallbuckel oder Eckbeschläge sollen das<br />
Leder vor Abnutzung schützen. Schließen sollen verhindern, daß<br />
<strong>Staub</strong> eindringt. Vorrichtungen zur Anbringung einer Kette an<br />
der Deckelkante sollen vor Diebstahl schützen.<br />
Auf den Rücken, den Vorderdeckel oder den Buchschnitt sind<br />
alte Standortsignaturen oder Kurztitel des Buchinhaltes<br />
geschrieben.<br />
Schlagen wir das Buch auf, dann stoßen wir auf Fragmente alter<br />
Handschriften, die auf die Innendeckel geklebt worden sind, wir<br />
finden Vorbesitzereinträge, Kaufpreisangaben, Bücherflüche,<br />
chronikalische Einträge, eine Devise, eine Sentenz oder ein<br />
Sprichwort. Wir entdecken Buchschmuck, mitunter prachtvolle<br />
Initialen und bemalte Ränder, mit Tinte geschriebene<br />
Randbemerkungen, Textkorrekturen, die <strong>von</strong> einem<br />
aufmerksamen Leser stammen.<br />
Man stößt auf Kuriositäten aller Art, die aber durchaus in<br />
bestimmten Zusammenhängen für die Erforschung des Buches<br />
ihre Bedeutung haben können:<br />
Mäusefraß, Gänge <strong>von</strong> Bücherwürmern in den Holzdeckel oder<br />
quer durch den Buchblock, tote Fliegen und sonstiges Ungeziefer,<br />
Getreidekörner, Kräuterbeigaben gegen Schädlinge,<br />
ausgediente Lesezeichen wie gepresste Strohhalme oder Spuren<br />
<strong>von</strong> Flüssigkeiten, die vor Jahrhunderten auf den Blättern<br />
verschüttet wurden. Selbst die <strong>Gutenberg</strong>bibel bildet da keine<br />
Ausnahme.<br />
Eine Erfassung dieser Daten, die wir in einem bestimmten<br />
Exemplar finden, ist Grundvoraussetzung für eine weitere<br />
Erschließung des Bandes. Es sind exemplarspezifische Daten,<br />
die das eine Exemplar <strong>von</strong> allen anderen unterscheiden.<br />
6
Wenn wir jetzt die unterschiedlichen Beobachtungen mit<br />
Phantasie und detektivischem Spürsinn miteinander verknüpfen<br />
und kritisch bewerten, dann erhalten wir mitunter aufregende<br />
Einblicke in eine längst verflossene Zeit, Totes wird lebendig,<br />
Vergangenheit wird Gegenwart.<br />
Wir müssen uns nur daranmachen, Verstaubtes vom <strong>Staub</strong>e zu<br />
befreien, dann stoßen wir z. B. auf bisher unbekannte Blätter aus<br />
einer zerstörten mittelalterlichen Handschrift, die im 9. Jahrhundert<br />
in einem Mainzer Scriptorium geschrieben wurde, oder<br />
auf unbekannte Zeugnisse Mainzer Buchmalerei aus dem 15.<br />
Jahrhundert. – In einem anderen Band verrät uns ein Kleriker so<br />
viel über die Stationen seines Lebens, daß wir uns ein lebendiges<br />
Bild <strong>von</strong> ihm machen können und uns nicht auf die spärlichen<br />
Angaben in einer Universitätsmatrikel beschränken müssen.<br />
Besonders spannend ist es, wenn der Bearbeiter nachweisen<br />
kann, daß ein Buch oder Fragment vor mehr als 200 Jahren<br />
gestohlen wurden, und er obendrein den Namen des Diebes<br />
herausbekommt, und dies allein mit ein wenig kriminalistischem<br />
Sachverstand und ganz ohne Zuhilfenahme moderner Gentechnik.<br />
Für den Bibliothekar, der den historischen Buchbestand<br />
erforscht, sind Zettelkästen und Karteischränke früherer Zeiten<br />
passé. Selbst das moderne Buch als Hilfsmittel und Nachschlagewerk<br />
hat seine zentrale Bedeutung eingebüßt; an seine<br />
Stelle sind Computer und Internet getreten, die Ergebnisse<br />
seiner Forschungen hält er nicht mehr auf handgeschriebenen<br />
Zetteln fest, sondern er gibt sie gleich in eine Datenbank. Mit<br />
Wissenschaftlern und Kollegen kommuniziert er nicht mehr<br />
umständlich auf dem Postwege sondern via E-Mail.<br />
So hat sich das Bild vom verstaubten Bibliothekar und Buchforscher<br />
grundlegend gewandelt. Trotz dieser vielfältigen und<br />
beschleunigten Forschungsmöglichkeiten wird die Arbeit nicht<br />
weniger.<br />
7
Literatur:<br />
<strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong>, Mainzer Frühdrucke – was sie uns verraten.<br />
Quellenmaterial für viele Sparten der Wissenschaft /Daten werden<br />
erfaßt. In: Mainz. Vierteljahreshefte für Kultur, Wirtschaft,<br />
Geschichte 20 (2000) Nr. 2, S. 48-52<br />
Ursula Rautenberg, Artikel „exemplarspezifische Besonderheiten“, in:<br />
Reclams Sachlexikon des Buches, 2. Auflage, Stuttgart: Reclam 2003.<br />
8
Zu Fall 1 - 3<br />
Abklatsche <strong>von</strong> Literaturdenkmälern in den Einbänden Mainzer<br />
Inkunabeln und das Schicksal der Originale. Zu Abklatch<br />
allgemein s. am Schluß des Kataloges.<br />
Auf der Suche nach Literaturdenkmälern deutscher Vergangenheit.<br />
Zur Zeit der Romantik fühlten sich viele national gesinnte<br />
Deutsche dazu berufen, volkstümliche Literatur zu sammeln und<br />
zu bearbeiten, in der Absicht, die schöpferischen Kräfte des<br />
deutschen „Volksgeistes“ zu wecken.<br />
Die Finder gingen mit ihrer Beute recht sorglos, ja skrupellos<br />
um. Originalblätter <strong>von</strong> makulierten Handschriften, die sie<br />
fanden, nahmen sie an sich, verliehen sie oder verschenkten Teile<br />
da<strong>von</strong>, die <strong>von</strong> den neuen Besitzern wiederum verschenkt<br />
wurden. Viele da<strong>von</strong> sind spurlos verschwunden.<br />
In Mainz fühlten sich zu solcher Sammeltätigkeit u.a. berufen<br />
die Gelehrten und Bibliothekare:<br />
Gotthelf Fischer v. Waldheim (1771 – 1853)<br />
Franz Josef Bodmann (1754 – 1820).<br />
Die säkularisierten Buchbestände der Klöster boten ein reiches<br />
Betätigungsfeld für ihre Erkundungsreisen, die mitunter in<br />
Raubzüge ausarteten, besonders dann, wenn ihnen die<br />
klösterlichen Hinterlassenschaften ex Officio anvertraut waren.<br />
Einer der Fundorte waren die Einbände <strong>von</strong> Inkunabeln, frühen<br />
Drucken und mittelalterlichen Handschriften.<br />
Von drei solchen Fällen, auf die der Bearbeiter im Laufe seiner<br />
Erfassung der Mainzer Inkunabeln stieß, soll hier berichtet<br />
werden. Sie gehen alle auf das Konto der bereits genannten<br />
Fischer und Bodmann. Es sind Fragmente aus mittelalterlichen<br />
Handschriften und frühen Drucken, die die Täter <strong>von</strong> den<br />
Einbanddeckeln abgelöst haben. Die originalen Stücke sind ohne<br />
Ausnahme aus Mainz verschwunden, aber sie haben in den<br />
Trägerbänden als Abklatsche ihre Spuren hinterlassen.<br />
9
Zur Entschuldigung der Täter sei gesagt, daß ihnen wohl ein<br />
Unrechtsbewusstsein fehlte. Unser Verständnis stößt allerdings<br />
an Grenzen, wenn, wie geschehen, einer der beiden (Fischer)<br />
seine Beutestücke auf eigene Rechnung und unter falschem<br />
Namen verkaufte.<br />
Aber auch einige Zeitgenossen empfanden Fischers Verhalten<br />
als verwerflich. Er rühmte sich, 2000 Bände aus dem Pariser<br />
Literaturdepot ausgewählt und die Rückführung nach Mainz<br />
organisiert zu haben. Er dokumentierte dies mit einem<br />
gedruckten und eingeklebten Schildchen mit der Aufschrift:<br />
„Tiré du Dépot litteraire des école secondaire par G. Fischer.<br />
Professeur et Bibliothecaire“. Auf einem dieser Schildchen (in<br />
stb ink 133) fand sich der handschriftliche Zusatz: „unter dessen<br />
Klauen es (das Buch) stark gelitten hat“. Und tatsächlich wurde<br />
mindestens ein Druck aus diesem Sammelband recht unsanft<br />
herausgetrennt und entfernt. Verbleib unbekannt.<br />
Während Fischer aber niemals für seine Untaten zur Rechenschaft<br />
gezogen wurde, weil er 1804 einem Ruf des Zaren zur<br />
Errichtung eines naturhistorischen Museums in Moskau folgte,<br />
verbunden mit seiner Erhebung in den Adelsstand, wurde<br />
Bodmann 1814 seines Amtes als Bibliothekar enthoben und<br />
mußte für die entwedeten oder beschädigten Bücher soweit<br />
möglich aus seiner Privatbibliothek Ersatz leisten.<br />
A Kaiserchronik<br />
B Nibelungenlied<br />
C Donatgrammatik<br />
In allen drei Fällen waren Abklatsche (Leimabdrücke) auf den<br />
Holzdeckeln der Einbände verräterisch. Sie führten auf die Spur<br />
der Delinquenten.<br />
10
Fall 1<br />
Signatur: stb ink 1763<br />
Fragmente und Abklatsche <strong>von</strong> Blättern aus einer Handschrift<br />
(Mitte 12. Jahrhundert) mit Text aus der deutschen<br />
Kaiserchronik<br />
Die aus der Inkunabel herausgelösten Originalblätter wurden<br />
<strong>von</strong> Franz Josef Bodmann veruntreut und 1865 <strong>von</strong> der UB<br />
Freiburg aus dessen Nachlass angekauft. Sie wurden uns <strong>von</strong> der<br />
Freiburger Universitätsbibliothek freundlicher Weise für diese<br />
Ausstellung zur Verfügung gestellt.<br />
Die Inkunabel selbst (der Trägerband) wurde Ende des 15.<br />
Jahrhundert in Mainz gebunden und gehörte zur Bibliothek der<br />
Mainzer Kartause.<br />
Weitere Abklatsche aus diesem Codex sind in den Deckeln der<br />
Mainzer Handschrift I 127 enthalten. Die Originalblätter sind<br />
ebenfalls verschollen.<br />
Die Handschrift I 127, der Trägerband der verloren gegangenen<br />
Blätter, wurde Ende des 15. Jahrhunderts in Mainz geschrieben<br />
und in der berühmten Mainzer Werkstatt „M mit Krone“<br />
eingebunden.<br />
Beides zusammengenommen beweist, daß die ältere Handschrift<br />
des 12. Jahrhunderts mit dem Text der deutschen Kaiserchronik<br />
zum Zeitpunkt, als sie makuliert wurde, in Mainz für den<br />
Buchbinder greifbar war.<br />
Auch Fischer v. Waldheim besaß Blätter aus diesem zerschnittenen<br />
und makulierten Codex. Er verlieh sie an den<br />
Germanisten <strong>von</strong> der Hagen (1780-1856), der sie wiederum an<br />
den Dichter des Deutschlandliedes, Hoffmann <strong>von</strong> Fallersleben<br />
(1798-1874) weitergab. Von da an verliert sich jede Spur.<br />
Kurztitelaufnahme des Trägerbandes:<br />
Humbertus de Romanis, Expositio regulae S. Augustini.<br />
deutsch. [Ulm : Konrad Dinckmut, um 1488]<br />
(BSB-Ink H-0440)<br />
11
Bild 1: Abklatsch aus der deutschen Kaiserchronik, ungespiegelt<br />
Bild 2: Abklatsch aus der deutschen Kaiserchronik, gespiegelt<br />
12
Fall 2<br />
Signatur: stb ink 1634<br />
Abklatsche aus der Handschrift L des Nibelungenliedes<br />
37 mittelalterliche Handschriften, beginnend mit dem frühen<br />
13. Jahrhundert, überliefern uns das Nibelungenlied. Eine da<strong>von</strong><br />
erhielt den Namen „L“, <strong>von</strong> der wir hier traurige Trümmer<br />
zeigen.<br />
L entstand um 1350 im Rheinfränkischen. Sie wurde Ende des<br />
15. Jahrhunderts hier in Mainz zerschnitten und blattweise <strong>von</strong><br />
einem Buchbinder zum Binden <strong>von</strong> neuen Büchern verarbeitet.<br />
Die Geschichte der Wiederentdeckung <strong>von</strong> einzelnen Blättern<br />
oder auch gar nur Teilen da<strong>von</strong> begann 1816. Sie ist bis auf den<br />
heutigen Tag spannend und abenteuerlich und vermutlich noch<br />
nicht abgeschlossen.<br />
Die bis jetzt bekannten Überreste <strong>von</strong> L:<br />
a) Berlin, Staatsbibliothek, jetzt kriegsbedingt Krakau,<br />
Biblioteka Jagiellonska:<br />
1816 <strong>von</strong> Joseph Görres in Heidelberg gefunden, zwischenzeitlich<br />
in den Händen <strong>von</strong> Wilhelm Grimm, August Wilhelm<br />
Schlegel, Karl Lachmann, seit 1850 königliche Bibliothek<br />
Berlin.<br />
b) Mainz, Martinus-Bibliothek (ehemals Priesterseminar),<br />
Funde um 1910 <strong>von</strong> dem schwedischen Bibliothekar Isaak<br />
Collijn.<br />
c) Mainz, Martinus-Bibliothek, schmale Streifen, gefunden 1988<br />
<strong>von</strong> K. H. <strong>Staub</strong>. Die <strong>von</strong> Collin und <strong>Staub</strong> entdeckten Bruchstücke<br />
enstammen demselben Trägerband.<br />
d) Mainz, <strong>Gutenberg</strong>-Museum, Juni 2003 die hier gezeigten<br />
Abklatsche, ebenfalls gefunden <strong>von</strong> K. H. <strong>Staub</strong>.<br />
Die Blätter selbst wurden vermutlich <strong>von</strong> Fischer oder Bodmann<br />
herausgelöst, sie sind verschwunden.<br />
13
Kurztitelaufnahme <strong>von</strong> « b »/ »c »<br />
Mainz, Martinus-Bibliothek, Inc 712 :<br />
Bernardinus Senensis: Quadragesimale de christiana religione.<br />
[Basel : Johann Amerbach, nicht nach 1489] 2 0<br />
GW 3882. HC 2834. BSB-Ink B-298 .<br />
Kurztitelaufnahme des Trägerbandes <strong>von</strong> „d“ (insgesamt drei Drucke):<br />
Mainz, <strong>Gutenberg</strong>-Museum, stb ink 1634 :<br />
Johannes, Johannis, Concordantiae bibliae et canonum. Köln :<br />
Joh. Koelhoff d. Ä. , 1482 (BSB-Ink I-0603), ferner ein<br />
weiterer Druck <strong>von</strong> Koelhoff und ein Straßburger <strong>von</strong> Joh.<br />
Herolt, um 1478.<br />
Die Trägerbände in der Martinus-Bibliothek und im<br />
<strong>Gutenberg</strong>-Museum stammen aus dem Mainzer Kloster St.<br />
Jakob.<br />
Die beiden Einbände sind das Werk eines anonymen Meisters,<br />
der in Mainz oder der näheren Umgebung tätig war. Ihm wurde<br />
der Notname „Nibelungenbinder“ gegeben. Alle Bände sind mit<br />
nur zwei Stempeln verziert: Einem Schriftband „S mari“ und<br />
einer Lilie in der Raute.<br />
Bild 3:Schwenke/Schunke Schrift 192a<br />
Inzwischen sind weitere 12 Bände aus dieser Werkstatt bekannt<br />
geworden. In keinem fanden sich neue Fragmente aus L.<br />
14
Verzeichnis der 12 weiteren Bände:<br />
1. Mainz, <strong>Gutenberg</strong>-Museum: stb ink 245 (BSB-Ink H-31).<br />
Siehe K.H. <strong>Staub</strong> in: Nibelungen Schnipsel. Hrsg. <strong>von</strong> Helmut<br />
Hinkel, Mainz 2004, S. 51.<br />
2. Mainz, <strong>Gutenberg</strong>-Museum: stb ink 1507 (BSB-Ink G-<br />
182[3]; BSB-Ink C-728)<br />
3. Mainz, <strong>Gutenberg</strong>-Museum: stb ink 1910 (BSB-Ink G-<br />
182[2]; BSB-Ink I-363<br />
4. Mainz, <strong>Gutenberg</strong>-Museum: stb ink 2334 (BSB-Ink H-401;<br />
BSB-Ink C-113)<br />
5. Bamberg, Staatsbibliothek: D I 2 (BSB-Ink K-30)<br />
6. Frankfurt am Main, UB: Inc. qu. 1280 = Ohly-Sack Nr. 1204<br />
(pars 4) (BSB-Ink G-182)<br />
7. Frankfurt am Main, UB: Inc. qu. 1747 = Ohly-Sack Nr. 1747<br />
(BSB-Ink K-30)<br />
8. Leipzig, Deutsches Buch- und Schriftmuseum: Alte Klemm<br />
Signatur: II: 896, jetzt: II, 1, 5a (BSB-Ink K-30)<br />
9. München, BSB: 2 0 Inc.s.a. 239 a (BSB-Ink-30)<br />
10. Stuttgart, WLB: Inc. fol. 3727 (BSB-Ink-30)<br />
11. Würzburg, UB: Inc. Fol.I.t.f. 961 = Hubay 1009, 25,<br />
Werkstatt : Lore Sprandel-Krafft S. 298 (Egg. I.t.f. 961)<br />
12. Giessen, UB: Das Exemplar, das durch Schwenke/Schunke<br />
(Schrift 192a) bekannt wurde (Inc V 136), ist im Bestand nicht<br />
nachweisbar.<br />
15
Literatur:<br />
Joachim Heinzle u. <strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong>, Neue Bruchstücke der<br />
Handschrift L. des „Nibelungenliedes“. In: Zeitschrift für deutsches<br />
Altertum und deutsche Literatur 132, Heft 4 (2003), S. 443-452.<br />
<strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong>, Bruchstücke der Nibelungenhandschrift L. Auf der<br />
Suche nach weiteren Fragmenten. In: Einband-Forschung. 13, 2003,<br />
S. 49 –52.<br />
Nibelungen Schnipsel. Neues vom alten Epos zwischen Mainz und<br />
Worms, hrsg. <strong>von</strong> Helmut Hinkel. Mainz: <strong>von</strong> Zabern, 2004,<br />
(Neues Jahrbuch für das Bistum Mainz, Sonderband).<br />
Mit Arbeiten <strong>von</strong> Joachim Heinzle, Helmut Hinkel, Klaus Klein,<br />
Annette Lang-Edwards und <strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong>.<br />
16
Bild 4: Abklatsch des Fragmentes aus der Handschrift L des Nibelungenliedes,<br />
gespiegelt<br />
17
Bild 5: Abklatsch des Fragmentes aus der Handschrift L des Nibelungenliedes,<br />
ungespiegelt<br />
18
Fall 3<br />
Signaturen: stb ink 1784 u. 2322 (zweibändiges Werk unter zwei<br />
verschiedenen Signaturen). Für beide Bände: w000134 (s011123,<br />
s011113, s011122) und w000910 (s001852)<br />
Abklatsche aus einem Donat, gedruckt in der Type der 42<br />
zeiligen Bibel <strong>Gutenberg</strong>s.<br />
Zu den begehrten Objekten der damaligen Trophäenjäger<br />
gehörten Denkmäler der frühen Druckkunst <strong>von</strong> <strong>Gutenberg</strong> und<br />
seiner Zeit. Es war naheliegend, im Mainzer Buchbestand zu<br />
suchen, und die Suche der Sammler wurde belohnt.<br />
Zu den ältesten Druckerzeugnissen zählt die Grammatik des<br />
Donat, gesetzt und gedruckt in den Typen <strong>Gutenberg</strong>s. Die<br />
Donate waren Schulbücher für den Lateinunterricht, die viel<br />
benutzt wurden und in der Hand <strong>von</strong> Schülern damals wie heute<br />
leicht verschlissen. „Sie erreichten niemals den rettenden Hafen<br />
einer Bibliothek. Ihre Karriere endete bestenfalls bei einem<br />
Buchbinder“ (Severin Corsten). Reste da<strong>von</strong> fand man und<br />
findet sie immer noch in Bucheinbänden der damaligen Zeit.<br />
Teile der Originalblätter der hier gezeigten Abklatsche liegen in<br />
einer Bibliothek in St. Petersburg. Sie wurden <strong>von</strong> Fischer v.<br />
Waldheim entwendet und einem russischen Grafen „geschenkt“.<br />
Andere Teile sind verschwunden. Die Chance, sie wiederzufinden,<br />
ist sehr gering.<br />
Kurztitelaufnahme der Trägerbände:<br />
S. Bonaventura, Opuscula, 2 Bände. Straßburg: [Georg Husner]<br />
1495 (GW 4648). Provenienz: Mainzer Jesuiten.<br />
Literatur:<br />
<strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong> u. Alexandra Wiebelt, Neue Funde eines<br />
26zeiligen Donats in der B 42 Type. Leimabklatsche in Mainzer<br />
Inkunabeleinbänden. In: <strong>Gutenberg</strong>-Jahrbuch 2005, S. 106-112.<br />
19
Bild 6: Donatabklatsche in stb ink 1784, ungespiegelt<br />
Bild 7: Donatabklatsche in stb ink 1784, gespiegelt<br />
20
Fall 4<br />
Signatur: stb ink 379<br />
Reste (Fragmente) eines Druckes in einem Einband ermöglichen<br />
die Datierung eines unfirmierten (undatierten) Druckes<br />
Der Einband umschließt einen unfirmierten Ulmer Druck <strong>von</strong><br />
Konrad Dinckmut: (Humbertus de Romanis, Auslegung der<br />
Regel des hl. Augustinus.) In der Druckforschung wird<br />
angenommen, daß das Buch um 1487/88 in der Ulmer Offizin<br />
gedruckt wurde (BSB-Ink H-0440)<br />
Die Innendeckel des Einbandes sind mit Druckmakultur<br />
beklebt. Es sind Blätter aus einem datierten Druck der<br />
dinckmutschen Offizin, Blätter aus dem „deutschen Gart der<br />
Gesundheit“ mit Druckangabe 1487 (Hain 8952).<br />
„Ausschussblätter“ dieser datierten Ausgabe könnten 1487/88<br />
zur Verfügung gestanden haben. Ihre Verwendung für einen<br />
Einband mit einem undatierten Druck erlaubt Rückschlüsse auf<br />
die Entstehungszeit des Druckes ohne Druckdatum. In unserem<br />
Falle würde das bedeuten, daß der Druck des Humbertus de<br />
Romanis durchaus in dem folgenden Jahr 1488 oder um 1488<br />
erfolgt sein könnte.<br />
Dinckmut betrieb nicht nur eine eigene Druckerei sondern er<br />
band auch Teile seiner Produktion selber oder ließ sie in<br />
Werkstätten der Stadt einbinden. Was in Ulm selber nicht<br />
gebunden wurde, verkaufte er in losen Bögen.<br />
Es wäre naheliegend zu vermuten, daß wir in unserem Falle<br />
einen sogenannten Verlegereinband vor uns hätten, doch deuten<br />
die Rollen, mit denen die Einbanddecken verziert wurden, eher<br />
auf einen Nürnberger Einband (Augustiner?) (EBDB r000171;<br />
w000090). Der Titelaufdruck auf dem Vorderdeckel erinnert an<br />
die Koberger Einbandwerkstatt Kyriß 83. Wir haben hier den<br />
Fall, daß Druckmakulatur nicht am Ort des Druckes (Ulm) für<br />
einen Einband verwendet wurde, sondern in einem entfernteren<br />
Ort (Nürnberg). Provenienz unbekannt.<br />
21
Bild 8: Blatt aus dem Gart der Gesundheit, datiert<br />
22
Bild 9: Blatt 1 des undatierten Druckes<br />
23
Bild 10: Nürnberger Einband<br />
24
Fall 5<br />
Signatur: stb ink 229<br />
Zwei Blätter einer römischen Rechtshandschrift (Corpus Iuris<br />
civilis) als Spiegel im Vorder- und Hinterdeckel einer Inkunabel.<br />
Hier: Institutiones, Teile <strong>von</strong> Liber 1, Tit. 15,16 und 20.<br />
Die Ende des 15. Jahrhunderts zerschnittene Handschrift<br />
entstand um 1300. Der Gesetzestext, geschrieben in einer nicht<br />
sehr sorgfältigen Textualis, nimmt zweispaltig die Mitte des<br />
Blattes ein. Der Standardkommentar (die sogenannte Glossa<br />
ordinaria) umschließt den Gesetzestext klammerartig. Die<br />
Schrift, ebenfalls nicht sehr sorgfältig, ist eine Notula. Vereinzelt<br />
Glossen, die später hinzugefügt wurden.<br />
Zum Einband: EBDB w002176 (s014267)/Köln, Kartäuser<br />
Kloster, s.a. Kyriss 16, Nr. 2 und Schwenke/Schunke, Schwan<br />
Nr. 7 und w000134 (s011113).<br />
Kurztitelaufnahme des Trägerbandes:<br />
Guilelmus Alvernus, De sacramentis.<br />
[Nürnberg, Georg Stuchs, nicht nach 1497]<br />
(BSB-Ink G-0472).<br />
25
Bild 11: Das Fragment im Vorderdeckel<br />
26
Fall 6<br />
Signatur: stb ink 2210<br />
Ein venezianischer Druck, in Mainz zu Hause.<br />
Mit Mainzer Buchmalerei und Blättern aus einer Mainzer<br />
Handschrift um 1000.<br />
Die Inkunabel, 1479 in Venedig gedruckt, ist schon bald danach<br />
in Mainz nachweisbar und dort geblieben. Da<strong>von</strong> zeugen die<br />
Spuren, die der Band uns hinterlassen hat. Der Buchschmuck,<br />
insbesondere die hier gezeigte Initiale mit Verwendung <strong>von</strong><br />
Gold, ist ein Beispiel für die hohe Qualität Mainzer Buchmalerei<br />
im 15. Jahrhundert.<br />
Die Fragmente, die uns als Spiegel in dem Mainzer Einband<br />
erhalten sind, wurden nach dem Urteil <strong>von</strong> Hartmut Hoffmann<br />
“in Mainzer Schrift ca. 1000 geschrieben. Dafür sehr typisch die<br />
Hand, die im Vorderdeckel Sp. 2 Z. 5 Bene – Z. 11 geschrieben hat.<br />
Die andere Hand, die auf dem vorderen Spiegel zu sehen ist, könnte<br />
identisch sein mit der des Fragments in Koblenz, Landeshauptarchiv,<br />
Best. 701 Nr. 759,50 (siehe Hoffmann, Buchkunst und Königtum S.<br />
241). Es ist sogar möglich, daß das Mainzer Inkunabelfragment und<br />
das Koblenzer Fragment aus demselben Codex stammen; Zeilen- und<br />
Spaltenzahl und anscheinend auch die Größe stimmen überein. Die<br />
Blattzahl im Mainzer Rückendeckel ist vermutlich <strong>von</strong> derselben<br />
spätmittelalterlichen Hand geschrieben worden wie die Blattzahl des<br />
Koblenzer Fragments“ (Freundliche Mitteilung <strong>von</strong> Hartmut<br />
Hoffmann, Göttingen, vom 7.11.05).<br />
Der Codex enthielt Texte aus Werken <strong>von</strong> Ps. Leo dem Großen<br />
(gest. 461) und Beda Venerabilis (gest. 735). Der Text im<br />
Vorderspiegel: Ps. Leo Magnus, Migne PL 54,477 Asqq., im<br />
Hinterspiegel: Beda , Hom. Ev. 2, 18. I. 70-103 (Corp. Christ.<br />
122).<br />
Der Band gehörte zunächst dem Dominikanerkloster in Mainz<br />
(s. den Besitzeintrag auf dem <strong>Unter</strong>rand („Iste liber est<br />
conventus Moguntinensis ordinis Praedicatorum“) mit der<br />
Bibliothekssignatur E 14.<br />
27
Weitere Besitzeinträge: Mainz, Minoriten/Franziskaner und ein<br />
Personenname: Johannes Scheubel.<br />
Scheubel war Besitzer 5 weiterer Inkunabeln bzw. Postinkunabeln:<br />
stb ink 1023, stb ink 995, stb ink 1226, stb ink<br />
2145, stb ink 2379. Er bezeichnet sich Vicarius Maguntinus<br />
(Vikar) mit Nennung der Jahreszahlen: 1604 und 1621.<br />
Kurztitelaufnahme:<br />
Antoninus Florentinus, Summa theologica. Venedig: Nicolaus<br />
Jenson 1479 (Pars 2) (BSB-Ink A-0595, GW 2185).<br />
28
Bild 12: Mainzer Scriptorium um 1000<br />
29
Bild 13: Mainzer Scriptorium um 1000<br />
30
Bild 14: Mainzer Buchmalerei, nicht vor 1479<br />
31
Fall 7<br />
Zwei Gruppen <strong>von</strong> Inkunabeln, gedruckt in Venedig 1479/80<br />
<strong>von</strong> Nicolaus Jenson, mit unterschiedlichen Mainzer<br />
Schicksalen, alles Teile <strong>von</strong> GW 2185 (Antoninus Florentinus,<br />
Summa theologica)<br />
Erste Gruppe aus Fall 7<br />
Signatur: stb Ink 2159, 2212 und Darmstadt Inc IV 421 Bd 3.<br />
Der Darmstädter Band gehört zu insgesamt etwa 120<br />
Inkunabeln und 10 Handschriften, die Fischer <strong>von</strong> Waldheim<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts in Mainz veruntreute und an den<br />
Landgrafen <strong>von</strong> Hessen-Darmstadt unter falschem Namen verkaufte.<br />
Die drei Bände haben Mainzer Initialschmuck und wurden in<br />
der bekannten Mainzer Einbandwerkstatt mit dem Notnamen<br />
„M mit Krone“ (Kyriß 160) gebunden und gehörten zuletzt dem<br />
Mainzer Kapuzinerkloster.<br />
Alle drei Bände tragen einen Besitzeintrag <strong>von</strong> Johannes<br />
Ugelnheymer und einem Philips Kennicken (1619).<br />
Johannes Ugelnheymer ist kein Unbekannter: Er studierte in<br />
Leipzig (1460) und in Mainz (1477, 1479), war dann in Frankfurt<br />
zunächst Vikar und seit 1481 Kanoniker des Bartolomaeusstifts.<br />
Er starb 1502. Von Johannes Ugelnheymer sind bis jetzt<br />
neun weitere Bände mit Drucken und einer <strong>Hans</strong>chrift bekannt<br />
geworden:<br />
32
A. Einer in Darmstadt:<br />
Inc III ((BSB-Ink V-57 (?) und BSB-Ink M-341)).<br />
B. Vier im <strong>Gutenberg</strong> – Museum Mainz:<br />
stb ink 355 (BSB-Ink R-170);<br />
stb ink 1063 (BSB-Ink A-701);<br />
stb ink 1767(BSB-Ink A-798).<br />
C. Einer in Giessen UB:<br />
Ink V 10105 (BSB-Ink C 497) siehe Schüling Nr. 306<br />
D. Vier in Frankfurt/Main UB:<br />
Inc oct 62 (HC 8410 und BSB-Ink G-140), siehe Ohly-Sack<br />
Nr. 2645/1215;<br />
Inc fol 319 (BSB-Ink G-314) siehe Ohly-Sack Nr. 1288;<br />
Inc qu 635 (BSB-Ink P-451) siehe Ohly-Sack Nr. 2359;<br />
Inc qu 1219 (BSB-Ink T-266), siehe Ohly-Sack Nr. 2725; mit<br />
biographischer Notiz S. 721.<br />
Ferner eine Handschrift in Frankfurt/Main: Ms.Barth. 138<br />
(Theologica, 15. Jh. Mitte) s. Powitz-Buck: Handschriftenkatalog<br />
UB Frankfurt/M 2, S. 315-318.<br />
und eine Handschrift in Mainz, Stadtbibliothek: Hs I 45<br />
(0rigenes / Hieronymus, 15. Jh. Ende)<br />
s. List-Powitz: Handschriftenkatalog StB Mainz 1, S. 92f.<br />
Johannes Ugelnheymer war der Bruder des weitaus bekannteren<br />
Peter Ugelnheymer. Peter Ugelnheymer, gest. 1487 (1489?) in<br />
Mailand, war seit 1473 mit Nicolas Jenson geschäftlich verbunden<br />
und war Gesellschafter und Geschäftsführer der 1480 in<br />
Venedig gegründeten Verlags- und Buchhandelsgesellschaft.<br />
(Wertvolle Hinweise verdanke ich Lotte Hellinga und Gerh.<br />
Powitz.)<br />
33
Bild 15: Besitzeintrag <strong>von</strong> Johannes Ugelnheymer, stb ink 2212<br />
34
Bild 16: Mainzer Buchmalerei, nicht vor 1479, stb ink 2159<br />
Zweite Gruppe<br />
Signatur: stb ink 1908, 2617 und 2616<br />
Die drei Bände sind in einer unbekannten Mainzer Werkstatt<br />
gebunden, haben aber einen einheitlichen Mainzer<br />
Buchschmuck. Der dritte Band (stb ink 2617) ist noch zusätzlich<br />
mit einer Goldinitiale ausgestattet. Sie gehörten zuletzt dem<br />
Mainzer Karmeliterkloster.<br />
Die Fragmente in den Deckeln (Spiegel) stammen aus ein und<br />
derselben Handschrift, alle drei Bände waren angekettet (libri<br />
olim catenati).<br />
35
Bild 17: Goldinitiale R, Mainzer Buchmalerei, nicht vor 1479,<br />
stb ink 2617<br />
36
Fall 8<br />
Signatur: stb ink 560 und 1745<br />
Mainzer Buchmalerei, die Werkstatt “Monstrous Clowns”<br />
Mit dem Beginn <strong>von</strong> Buchdruck und Buchhandel gab es für<br />
Buchmaler und Buchillustratoren ein neues Betätigungsfeld.<br />
Auch in Mainz wurden die in den Drucken dafür vorgesehenen<br />
Stellen mit farbigen Initialen oder Miniaturen gefüllt.<br />
Einer dieser durchweg unbekannten Mainzer Maler hat den<br />
Namen „Monstrous Clowns“ erhalten. Charakteristisch sind die<br />
karnevalesken Figuren, die in die Initialen hineingemalt wurden.<br />
Der Name stammt <strong>von</strong> der Frühdruckforscherin Lotte Hellinga.<br />
Die hier gezeigten Beispiele kannte die Forscherin nicht, weil sie<br />
erst durch die augenblicklichen Erschließungsarbeiten verfügbar<br />
geworden sind.<br />
Zu stb ink 560: Auf den <strong>Unter</strong>rand <strong>von</strong> Blatt a2 ist ein<br />
bürgerliches Wappen eingemalt (noch nicht identifiziert). Sein<br />
letzter Aufenthaltsort war bis zur Säkularisation das Mainzer<br />
Kapuzinerkloster.<br />
Gebunden wurde die Inkunabel in der Mainzer Werkstatt mit<br />
dem Notnamen „M mit Krone“ (Kyriß 160).<br />
Die Werkstatt ist in der Fachliteratur seit Jahrzehnten bekannt;<br />
vor allem durch Arbeiten <strong>von</strong> Vera Sack und Lotte Hellinga; im<br />
Mainzer Inkunabelbestand gibt es eine bemerkenswerte Anzahl<br />
<strong>von</strong> Einbänden, die in dieser Werkstatt gebunden wurden, die<br />
aber größtenteils, weil noch unerschlossen, <strong>von</strong> der Forschung<br />
nicht wahrgenommen wurden.<br />
Kurztitelaufnahme des Bandes:<br />
Jodocus, Vocabular. Speyer: Peter Drach d.Ä.1478 (BSB-Ink<br />
I-0260)<br />
37
Zu stb ink 1745: Die Inkunabel stammt aus dem Karmeliterkloster<br />
Mainz.<br />
Zwischenbesitzer war u.a. der Jurist Dionysius Campius JVD, um<br />
1600. Campius nennt sich in insgesamt 18 Bänden. Zur Person:<br />
Universität Bologna 1606, Disputation pro licentia 1606 in<br />
Mainz, s. Filippo Ranieri u. Karl Härter, Biographisches<br />
Repertorium der Juristen im alten dt. Reich, Frankfurt/Main<br />
1997 (Ius-commune-CD-ROM , 1)<br />
Zum Einband: EBDB: w002881 (Werkstatt Ornament frei<br />
eiförmig / Süddeutschland), (s022821, s022825, s022826,<br />
s022831, s022836)<br />
Kurztitelaufnahme des Bandes:<br />
Homiliarius doctorum de tempore et de sanctis. [Köln] Konrad<br />
Winters [um 1478] (BSB-Ink H-0323)<br />
Weitere Nachweise <strong>von</strong> Monstrous Clowns, die mittlerweile<br />
bekannt wurden:<br />
Mainz, <strong>Gutenberg</strong>-Museum: stb ink 1894 auf Blatt a2 recto a.<br />
Vorbesitzer der Inkunabel, ehemals ein Kettenband (liber olim<br />
catenatus), waren die Mainzer Minoriten.<br />
Makulatur: In den Innendeckeln zwei Blätter aus einer Bibelhandschrift<br />
des 13. Jahrhunderts (Anfang) mit Interlinear- und<br />
Marginalglossen auf allen vier Rändern. Sie überliefern vorn den<br />
Text <strong>von</strong> Hiob 34, 20 Nocte bis Hiob 34, 37 inter nos in-, hinten<br />
<strong>von</strong> Hiob 39, 2 tempus partus earum bis Hiob 39, 22 super.<br />
Die beiden Blätter erinnern an Fragmente in der Frankfurter<br />
Universitätsbibliothek: Fragm. lat X 28, die aus dem Einband<br />
einer Inkunabel stammen, die zuvor nach einem Besitzeintrag<br />
aus dem 18. Jh. den Mainzer Dominikanern gehörte. (Den<br />
Hinweis verdanke ich Gerh. Powitz, s. seinen Katalog „mittelalterl.<br />
Fragmente in der Stadt- und Universitätsbibliothek<br />
Frankfurt“, 1994 S. 144 und Ohly-Sack Nr. 128.<br />
Kurztitelaufnahme des Mainzer Druckes:<br />
Capreolus, Johannes. Defensiones theologiae Thomae de<br />
Aquino in 4 libr. Sent. Nur pars 4. Venedig; Octavianus Scotus<br />
1483 – 1484 (BSB-Ink C-0101).<br />
38
Mainz, Stadtbibliothek: Hs III 25 in einer N-Initiale am<br />
Anfang, Provinzialstatuten der Diözese Mainz, Pergament, 15.<br />
Jh. Zur Geschichte der Handschrift: Vorbesitzer: Ursprünglich<br />
der Wormser Bisch. Johann v. Dalberg, dann: „Ex Bibl. Roemer<br />
JUD, Georg Kloß Frankfurt“, Sammlung Thomas Phillips, <strong>von</strong><br />
Gustav Binz am 7. III. 1916 <strong>von</strong> Ludwig Rosenthal in München<br />
für die Stadt Mainz gekauft.<br />
Lit: Peter Walter. In: Der Wormser Bischof Johann v. Dalberg<br />
(1482-1503) und seine Zeit, hrsg. <strong>von</strong> Gerold Bönnen und<br />
Burkard Keilmann. Mainz 2005, S. 136. mit Abb.<br />
Bild 18a: Bildvorlage: Der Wormser Bischof Johann v. Dalberg (1482-1503)<br />
und seine Zeit, hrsg. <strong>von</strong> Gerold Bönnen und Burkard Keilmann. Mainz 2005<br />
39
Bild 18b: Aus dem Privatbesitz <strong>von</strong> Dr. D. Mauss, Wiesbaden. Vorbesitzer:<br />
Solms-Laubach. Siehe Antiquariat Wölfle, München, Katalog 75, Nr. 151.<br />
Literatur:<br />
Lotte Hellinga, Illustration of fifteenth-century books. In: Bulletin du<br />
bibliophilie 1991, S. 58 mit Nennung der benutzten Inkunabeln und<br />
S. 59 mit Abb.<br />
40
Bild 19: Abbildung aus stb ink 560
Bild 20: Abbildung aus stb ink 1745<br />
42
Bild 21: Fragment in der Saliceto-Type<br />
Fall 9<br />
Signatur: stb ink 1231<br />
43<br />
Reste eines frühen niederländischen<br />
Druckes<br />
Der entscheidende und wichtigste<br />
Gewinn bei der Erfassung dieser<br />
Inkunabel war die Entdeckung<br />
weniger Pergamentschnipsel in der<br />
Lagenmitte. Es sind Bruchstücke aus<br />
einem frühen niederländischen Druck<br />
der Donatgrammatik in der sogenannten<br />
Saliceto-Type (Notname).<br />
Das Verbreitungsgebiet früher niederländischer<br />
Drucke war u.a. der Kölner<br />
Raum.<br />
Wo dieser Band gebunden wurde,<br />
läßt sich entgegen einer ersten Annahme<br />
„Köln“ nicht erweisen.<br />
Recherchen mit Hilfe der Einbanddatenbank<br />
ergab die sehr unspezifische<br />
Bezeichnung „Süddeutschland“:<br />
Ananas II, w003014“. Nachgewiesene<br />
Stempel: s024282, s024283, s024281,<br />
s024285, s024284, s024286.<br />
Der unscheinbare Fund ist ein weiteres<br />
Mosaiksteinchen in der Geschichte der<br />
niederländischen Prototypographie,<br />
die noch mancherlei Probleme offen<br />
läßt.<br />
Ein Vorbesitzer des Bandes: Johannes<br />
Rhall. Der Band kommt aus der<br />
Mainzer Kartause.<br />
Zwischenbesitzer war ein gewisser Johannes Rhall. Das bezeugt<br />
ein eigenhändiger Vermerk. Nach diesem wurde er in Aach im<br />
Landkreis Konstanz geboren und war Vikar am Konstanzer<br />
Münster. Der Eintrag erfolgte am 16. Mai 1571.
Ein zweites Mal erfahren wir Daten aus seinem Leben, ebenfalls<br />
eigenhändig, aus einer Darmstädter Inkunabel (Inc IV 345 d),<br />
die die Mainzer Eintragungen bestätigen und erweitern. So<br />
erhalten wir über diese Vermerke und Notizen ein Gerüst <strong>von</strong><br />
Lebensdaten eines bis jetzt unbekannten Mannes.<br />
Kurztitelaufnahme:<br />
Augustinus, Opuscula. Venedig: Octavianus Scotus 1483<br />
(BSB-Ink A-0895, GW 2863).<br />
Bild 22: Besitzeintrag des Johannes Rhall<br />
44
Bild 23: Einband Süddeutschland ? , stb ink 1231<br />
45
Fall 10<br />
Signatur: stb ink 2622<br />
Fragment einer mittelalterlichen Versdichtung: Marbod <strong>von</strong><br />
Rennes<br />
Auf einem schmalen Pergamentstreifen (13./14. Jhd.) zwischen<br />
Buchblock und Deckelkante werden Verse des Dichters und<br />
Schriftstellers Marbod <strong>von</strong> Rennes (um 1035 – 1123) aus seiner<br />
Versdichtung „De ornamentis verborum“ überliefert. Es ist ein<br />
Lehrgedicht für den Grammatikunterricht und es gehörte zu<br />
dem didaktischen Repertoire mittelalterlicher Schulen.<br />
Ob die Handschrift, aus der dieser Streifen stammt, das ganze<br />
Werk enthielt, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden.<br />
Die Identifizierung solcher Fetzen aus einem größeren Werk<br />
wird im Gegensatz zu früher, als das oft sehr schwierig war,<br />
heute mit Hilfe <strong>von</strong> Datenbänken und Internet wesentlich<br />
erleichtert.<br />
Der Einband der 1490 in Straßburg gedruckten Inkunabel<br />
deutet auf eine Erfurter Werkstatt: EBDB w000124 (Erfurt,<br />
Johannes-Johannes I, s010144, s010125, s010129, s010133,<br />
s010138, s010136, s010132, s010134, s010135, s010131,<br />
s010130)<br />
Provenienz: Mainz, Jesuiten, Geschenk des Mainzer Erzbischofs<br />
Daniel Brendel <strong>von</strong> Homburg, geb. 1522, gest. 1582, Erzb. 1555<br />
bis 1582. Exlibris im Vorderdeckel (siehe Bild Nr. 25).<br />
Kurztitelaufnahme des Trägerbandes:<br />
Thomas de Argentina, Scripta super quattuor libros<br />
sententiarum. Straßburg: Martin Flach 1490 (BSB-Ink T-<br />
0332).<br />
Bild 24: Marbod <strong>von</strong> Rennes, Fragment aus „De ornamentis verborum“<br />
46
Bild 25: Vorbesitzer 1) der Mainzer Erzbischof Daniel Brendel <strong>von</strong><br />
Homburg, 2) Jesuiten<br />
47
Fall 11<br />
Signatur: stb ink 1204a u. stb ink 32<br />
Koberger-Nachdruck der Fust und Schöfferschen 48 zeiligen<br />
Bibel<br />
Zu den berühmtesten Drucken <strong>von</strong> Fust und Schöffer gehört die<br />
48 zeilige Bibel (B 48) <strong>von</strong> 1462.<br />
13 Jahre später, 1475, druckte der geschäftstüchtige Nürnberger<br />
Drucker und Verleger Anton Koberger die Mainzer Ausgabe<br />
seitengetreu nach, offenbar mit viel Erfolg.<br />
Das hier gezeigte Exemplar des Nachdruckes ist mit üppiger<br />
Initialornamentik reich ausgestattet, teilweise unter Verwendung<br />
<strong>von</strong> Gold.<br />
Der Einband, mit Hilfe der Stuttgarter Einbandstempeldatenbank<br />
identifiziert, ist entstanden in der Werkstatt<br />
mit dem Notnamen „Erdbeere frei“. Der Meister der Werkstatt<br />
war vermutlich im süddeutschen Raum tätig. Dann würde auch<br />
der Buchmaler dort zu suchen sein, denn die Ausschmückung<br />
des Druckes erfolgte vor der Bindung. EBDB w003116<br />
(s025271, s025273, s025267, s025265, s025264, s025266,<br />
s025272, s025269, s025268, s025274).<br />
Dazu passt die Provenienz unserer Inkunabel:<br />
Frühester nachweisbarer Vorbesitzer waren die Heidelberger<br />
Jesuiten, dann die Bibliothek des Mainzer Noviziat und<br />
schließlich die alte Mainzer Universitätsbibliothek. Der Bestand<br />
<strong>von</strong> Frühdrucken im Mainzer <strong>Gutenberg</strong>-Museum aus<br />
Jesuitischen Besitz ist außerordentlich hoch. Von Brendel<br />
stammen mindestens 165 Bände.<br />
Kurztitelaufnahme der beiden Exemplar:<br />
Biblia. Nürnberg: Anton Koberger, 1475 (BSB-Ink B-0420,<br />
GW 4218)<br />
Biblia. Mainz: Joh. Fust u. Peter Schöffer, 1462 (BSB-Ink B-<br />
0410, GW 4204).<br />
48
Bild 26: Mainzer Exemplar der 48zeiligen Bibel <strong>von</strong> Fust u. Schöffer<br />
mit Mainzer Buchmalerei<br />
49
Bild 27: Koberger Nachdruck der 48zeiligen Bibel. Buchmalerei:<br />
Süddeutschland<br />
50
Fall 12<br />
Signatur: stb ink 238<br />
Gebunden in Seligenstadt am Main, gewandert nach Mainz.<br />
Die Einbandwerkstatt der Seligenstädter Benediktinerabtei<br />
Die Benediktiner in Seligenstadt am Main haben ihre Bücher in<br />
einer eigenen Hausbuchbinderei selbst gebunden. Nur wenige<br />
dieser Bände haben das Kloster verlassen, einer da<strong>von</strong> ist der hier<br />
gezeigte Band, denn er hat einen späteren Besitzeintrag der<br />
Mainzer Kartause. Warum der Band gewandert ist, das wissen<br />
wir nicht. Ein Kaufvermerk mit dem Datum 1715 (s.u.) in einer<br />
der drei aufgefundenen Inkunabeln läßt vermuten, dass die<br />
Kartause alle vier Bände erst zu diesem späten Zeitpunkt<br />
erworben hat.<br />
Die Bibliothek der Seligenstädter Benediktiner kam im Zuge der<br />
Säkularisation <strong>von</strong> 1803 nach Darmstadt und wurde<br />
verschmolzen mit der damaligen Hofbibliothek (jetzt<br />
Universitäts- und Landesbibliothek).<br />
Sie bot genug Material, um die Seligenstädter Einbandwerkstatt,<br />
die zwischen etwa 1480 und der Mitte des 16. Jahrhunderts<br />
gearbeitet hat, zu erforschen. Vor allem kennt man die insgesamt<br />
34 Blindstempel, mit denen die Mönchsbuchbinder der<br />
Seligenstädter Werkstatt ihre Einbände verziert haben. Die<br />
Ergebnisse wurden 1980 <strong>von</strong> K. H. <strong>Staub</strong> veröffentlicht.<br />
Aufgrund der Forschungsergebnisse kann man neu auftauchende<br />
Bände wie diesen hier gezeigten leicht identifizieren.<br />
In den Spiegeln dieses Seligenstädter Einbandes werden zwei<br />
Blätter eines zerschnittenen Codex überliefert. Das Besondere an<br />
diesen Blättern ist, daß es Palimpseste sind, d.h. die<br />
Erstbeschriftung wurde mit Milch, Bimstein oder dem<br />
Schabmesser getilgt, um einer Zweitbeschriftung Platz zu<br />
machen; dazu ist es aber nicht gekommen.<br />
So viel man mit bloßem Auge erkennen kann, war die<br />
Handschrift zweispaltig angelegt, die Schrift deutet auf 12./13.<br />
Jahrhundert, und auch Reste einer farbigen Initiale sind<br />
zurückgeblieben.<br />
Der Inhalt deutet auf einen Bibeltext.<br />
51
Grund für die Wanderung könnte sein, dass große Teile der<br />
Bestände der Seligenstädter Bibliothek im 30jährigen Krieg<br />
zerstreut wurden.<br />
Kurztitelaufnahme:<br />
Postilla Nicolai de Lyra super Bibliam. Memmingen: Albrecht<br />
Kunne 1492 (BSB-Ink R-0135).<br />
Literatur:<br />
<strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong>, Die Einbandwerkstatt der Benediktinerabtei<br />
Seligenstadt am Main im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert. In:<br />
Hellinga-Festschrift. Amsterdam 1980, S. 467-480 mit Abb. aller<br />
Stempel.<br />
<strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong>, Die Hausbuchbinderei der Benediktiner in<br />
Seligenstadt am Main (Zu S-S II, 238/239). In: Einband-<br />
Forschung, Heft 16, 2005, S. 57 – 59 mit Abb. aller Stempel.<br />
Nach Beendigung der Ausstellung wurden im Inkunabelbestand<br />
des <strong>Gutenberg</strong>-Museums drei weitere in Seligenstadt gebundene<br />
Frühdrucke gefunden, Vorbesitzer war die Mainzer Kartause.<br />
A: stb ink 603 (BSB-Ink G-525)<br />
B: stb ink 1178 (BSB-Ink B-1016). In den Spiegeln zwei Blätter<br />
aus einem Lektionar. Aus derselben Handschrift Blätter in der<br />
Darmstädter Inkunabel Inc III 171 sowie die Fragmente Hs<br />
4109 aus Seligenstadt. 9./10. Jhd., Anfang 10. Jhd ? Enstehung:<br />
Südwestdeutschland, Weißenburg? s. Bernh. Bischoff, Katalog<br />
der festländischen Handschriften des 9. Jhds. Wiesbaden 1998,<br />
S.215, Nr. 994 u. Hartmut Hoffmann, Schreibschulen des 10. u.<br />
11. Jahrhunderts im Südwesten des Dt.Reiches, Hannover 2004,<br />
S. 299.<br />
C: stb ink 2279 (BSB-ink A-535) mit Kaufvermerk aus dem<br />
Jahre 1715. Die Inkunabel hat einigen bemerkenswerten<br />
Buchschmuck: Initialen mit Verwendung <strong>von</strong> Gold, wohl in<br />
Seligenstadt selbst gemalt.<br />
52
Bild 28: Blindstempel der Seligenstädter Hausbuchbinderei Nr. 1-13,<br />
verkleinert<br />
53
Bild 29: Blindstempel der Seligenstädter Hausbuchbinderei Nr. 14-26,<br />
verkleinert<br />
54
Bild 30: Blindstempel der Seligenstädter Hausbuchbinderei Nr. 27-34,<br />
verkleinert<br />
55
Bild 31: Palimpsestblatt im Spiegel<br />
56
Fall 13<br />
Zeugen karolingischer Schreibtätigkeit in Mainz<br />
Wie so viele Klöster in karolingischer Zeit, beispielsweise<br />
Lorsch, Fulda, Würzburg (um nur die nächsten zu nennen), so<br />
hatte auch Mainz ein Scriptorium, in dem Texte kopiert wurden,<br />
die in Klöstern, Domschulen oder zur Verrichtung des Gottesdienstes<br />
gebraucht wurden.<br />
Wir kennen Handschriften, die in Mainz hergestellt wurden und<br />
heute über die Bibliotheken Europas und der Welt verstreut<br />
sind. Neue unbekannte Mainzer Handschriften werden kaum<br />
noch auftauchen, wohl aber wurden bis in jüngste Zeit<br />
Fragmente zerstörter Codices aufgefunden.<br />
Drei solcher Funde aus den letzten Jahrzehnten, bzw. Jahren<br />
(das letzte Fragment wurde vor gut einem Jahr entdeckt), werden<br />
hier gezeigt. Die Handschriften, <strong>von</strong> denen die Fragmente als<br />
traurige Trümmer übriggeblieben sind, wurden in der ersten<br />
Hälfte des 9. Jahrhunderts in einem Mainzer Scriptorium geschrieben.<br />
Alle drei Fragmente sind uns als Makulatur in Einbänden der<br />
Frühdruckzeit erhalten geblieben.<br />
A: Das Darmstädter Fragment in der Universitäts- und<br />
Landesbibliothek, Hs 4271<br />
Willibald, Vita S. Bonifatii, Fragment, Mainz um 820:<br />
57
Bild 32: Darmstädter Fragment, obere Hälfte des Doppelblattes<br />
Die Vita ist die älteste und bekannteste Lebensbeschreibung des<br />
heiligen Bonifaz, verfasst um 760 <strong>von</strong> dem Mainzer Kleriker <strong>von</strong><br />
St. Viktor Willibald.<br />
Literatur zum Fragment: <strong>Kurt</strong> <strong>Hans</strong> <strong>Staub</strong>, Ein neu aufgefundenes<br />
Fragment der Bonifatiusvita <strong>von</strong> Willibald in der Hessischen<br />
Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt. In: Von der<br />
Klosterbibliothek zur Landesbibliothek. Beiträge zum<br />
zweihundertjährigen Bestehen der Hessischen Landesbibliothek<br />
Fulda. Stuttgart: Hiersemann 1978. S. 164-171 mit Transkription<br />
u. Abb.<br />
58
B: Das Mainzer Fragment in der Stadtbibliothek, Hs frag 1<br />
Beda Venerabilis, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum,<br />
Fragment, Mainz, 2. Viertel des 9. Jahrhunderts.<br />
Die Werke des großen angelsächsischen Benediktiners,<br />
Theologen und Kirchenschriftstellers Beda Venerabilis (gest.<br />
735) fanden auf dem europäischen Festland schnell eine große<br />
Resonanz. Der heilige Bonifaz bat in Briefen an seine Freunde<br />
in England um Übersendung <strong>von</strong> Werken Bedas.<br />
59
Bild 33 : Bildvorlage: Philobiblon 42 (1988)<br />
Literatur zum Fragment: Annelen Ottermann, Das Beda-Fragment<br />
Hs frag 1 in der Stadtbibliothek Mainz: Ein Beitrag zum Mainzer<br />
Scriptorium des 9. Jahrhunderts. In: Philobiblon 42 (1998) S. 301 –<br />
307 mit Transkription u. Abb.<br />
60
C: Das Mainzer Fragment in der Martinus-Bibliothek, Inc 334.<br />
Eugippius, Excerpta ex operibus Sancti Augustini, Fragment,<br />
Mainz, 2. Viertel des 9. Jahrhunderts, allenfalls 2. Drittel.<br />
Eugippius, Abt des Severinsklosters bei Neapel, gest. nach 532.<br />
Bekannter als seine Auszüge aus den Werken des heiligen<br />
Augustinus ist seine Lebensbeschreibung des christlichen<br />
Asketen Severin in der römischen Provinz Noricum (östlich des<br />
Inns, heute etwa Österreich). Sie ist eine unschätzbare Quelle für<br />
die Zustände in Noricum in der Zeit der Völkerwanderung und<br />
des untergehenden Römischen Reiches.<br />
Für die Überlieferung seiner Excerpta hält das Mainzer<br />
Fragment seinen Wert, weil es die an sich schmale<br />
Überlieferungsbasis um einen weiteren Textzeugen vermehrt.<br />
Noch nicht veröffentlicht.<br />
(Bild 34: Mainz, Martinus Bibliothek, in Inc 334)<br />
61
Fall 14<br />
Signatur: stb ink 914<br />
Eine Schedula officiorum aus dem Mainzer Kloster St. Jakob<br />
Schedula, lateinisch, zu deutsch: ein Blättchen Papier.<br />
Ein solches Blatt oder Blättchen Papier diente damals wie heute<br />
für flüchtige Notizen oder kurze Mitteilungen, die nur<br />
vorübergehend <strong>von</strong> Bedeutung waren. Was danach, sozusagen<br />
nach dem Verfallsdatum, achtlos weggeworfen oder wie hier<br />
vom Buchbinder als Makulatur weiterverwendet wurde, kann für<br />
uns heute zur Quelle historischen Wissens werden.<br />
Unser Papierblättchen, jetzt im Einband einer in Mainz, vermutlich<br />
im St. Jakobskloster gebundenen Inkunabel überliefert<br />
eine Liste mit Namen <strong>von</strong> Mönchen, die für die liturgischen<br />
Dienste in der Karwoche eingeteilt waren. Einige Male wird<br />
auch die Herkunft der Personen angegeben: Mainz, Gerau,<br />
Oppenheim. Es ist uns bis heute keine weitere Schedula mit<br />
dieser Zweckbestimmung bekannt, so daß unser Blättchen Papier<br />
auch für die Liturgiegeschichte <strong>von</strong> Interesse ist.<br />
Dieser Fund, so unscheinbar er wirkt, dokumentiert eindringlich,<br />
ja handgreiflich die Bedeutung der exemplarspezifischen<br />
Erschließung <strong>von</strong> Drucken eines historischen Buchbestandes,<br />
hier der Mainzer Inkunabeln.<br />
Alle in dieser Austellung behandelten Fälle zeigen aber, daß es<br />
in einem historischen Buchbestand die sogenannten Dubletten<br />
nicht gibt, und man sollte deshalb entsprechend vorsichtig beim<br />
Verkauf oder der Abgabe <strong>von</strong> Zweitexemplaren sein.<br />
Kurztitelaufnahme des Trägerbandes:<br />
Johannes de Bitonto, Sermones dominicales per totum annum.<br />
Straßburg: Johann Grüninger 1496 (BSB-Ink A-0624).<br />
Literatur: Helmut Hinkel, Eine Schedula officiorum aus dem Mainzer<br />
Kloster St. Jakob, In: Mainzer Zeitschrift 100 (2005) S.183-<br />
187.<br />
62
Bild 35: Das Blatt im Vorderspiegel<br />
63
Fall 15<br />
Signatur: stb inc 1911<br />
Identifizierung mit Hilfe einer Datenbank<br />
Von der verschwundenen Originalseite ist auf dem Deckel wenig<br />
brauchbarer Text zurückgeblieben. Auch mit allen Kniffen<br />
digitaler Photographie ist es nicht gelungen, den Text zu<br />
identifizieren.<br />
So viel kann man aber sagen: es handelt sich um einen<br />
geistlichen Traktat, vielleicht eine Predigt.<br />
Die Seite ist wohl überlegt eingerichtet, zwei Spalten,<br />
Schriftspiegel ausgewogen, die Schrift eine sorgfältige Textualis,<br />
Mitte des 14. Jahrhunderts. All das deutet darauf hin, daß es sich<br />
um einen gewichtigen literarischen Text handelt, der in einem<br />
professionellen Scriptorium kopiert wurde.<br />
Ein Möglichkeit der Textidentifizierung ergibt sich mit Hilfe<br />
des Marburger Repertoriums deutschsprachiger Handschriften<br />
des 14. Jhs.<br />
Die Datenbank beruht darauf, daß bestimmte Daten eingegeben<br />
werden, die einem Dritten eine gezielte Recherche ermöglichen,<br />
wenn er ein ähnlich beschaffenes Dokument vor sich hat. Es<br />
sind: Blattgröße, Schriftspiegel, Zeilenzahl, Anzahl der Spalten,<br />
die Schreibsprache und ein Foto.<br />
Kurztitelaufnahme des Trägerbandes:<br />
Petrus de Herenthals, Collectarius sive expositio super librum<br />
psalmorum. [Köln] Johann Koelhoff d. Ältere 1487 (BSB-Ink<br />
P-0349).<br />
64
Bild 36: Der Abklatsch, ungespiegelt<br />
65
Bild 37: Der Abklatsch, gespiegelt<br />
66
Fall 16<br />
Signaturen: stb ink 1653, 2219 u. 2474<br />
Eberhardus Bethuniensis (Eberhardt <strong>von</strong> Béthune), Graecismus.<br />
Mit Interlinear- und Marginalglossen.<br />
Beeindruckende Fragmente aus einer Handschrift des 14.<br />
Jahrhunderts als Spiegel in den Einbänden einer dreibändigen<br />
Straßburger Ausgabe der Werke <strong>von</strong> Johannes Gerson.<br />
Gebunden wurde der Band in Ulm <strong>von</strong> Konrad Dinckmut:<br />
EBDB w000059 (Ulm: Konrad Dinckmut (s003747, s003748,<br />
s003784, s003786 s003785, s0021466)<br />
Provenienz: Mainz, Karmeliter.<br />
Kurztitelaufnahme der Trägerbände:<br />
Gerson, Johannes: Opera. 3 Bände [Straßburg: Johann Grüninger, z.T. mit<br />
Typen des Johann Prüss und Martin Flach] 1488 (BSB-Ink G-0183,<br />
GW 10714).<br />
67
Bild 38: Eberhardus Bethuniensis, Graecismus, stb ink 1653<br />
68
Bild 39: Eberhardus Bethuniensis, Graecismus, stb ink 1653<br />
69
Erklärung „Was ist ein Abklatsch?“<br />
Ein Abklatsch, auch Leimabdruck genannt, besteht aus<br />
spiegelbildlich erhaltenen Abdrücken eines Originaldokumentes,<br />
wie z.B. einer Handschrift, eines Druckes oder einer Zeichnung.<br />
Ein Abklatsch entsteht immer dann, wenn man ein<br />
beschriebenes oder bedrucktes Blatt, das auf einen Holz- oder<br />
Pappdeckel aufgeklebt ist, ablöst. Beim Ablösen bleiben, je nach<br />
Beschaffenheit des Deckels, der Tinte, der Druckerschwärze<br />
oder des Leimes Schriftreste des Textes spiegelschriftlich zurück.<br />
Mit Hilfe eines Spiegels kann man den noch verbliebenen Text<br />
entziffern. Den Buchbindern des 15./16. Jahrhunderts standen<br />
zahlreiche ausgesonderte mittelalterliche Handschriften oder<br />
Druckmakulatur zur Verfügung, mit denen sie blattweise die<br />
Innendeckel ihrer Einbände verkleideten. Ist nun das abgelöste<br />
Blatt auf immer verschwunden (was sehr häufig der Fall ist),<br />
dann muss der Abklatsch das Original ersetzen.<br />
Der Abklatsch tritt also an die Stelle des Originals. Dabei muss<br />
man aber bedenken, daß uns in solchen Fällen des Blattverlustes<br />
nur die eine Seite des verlorenen Blattes ersatzweise als<br />
Abklatsch erhalten bleibt, die uns zugewandte Textseite bleibt<br />
für immer verloren (<strong>Staub</strong>/<strong>Horch</strong>).<br />
Finis<br />
70