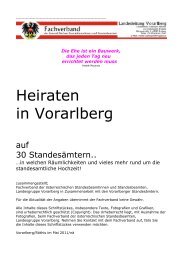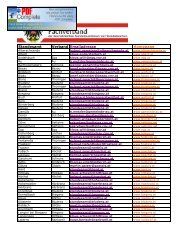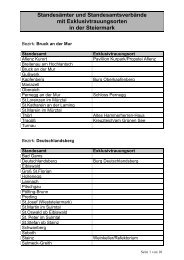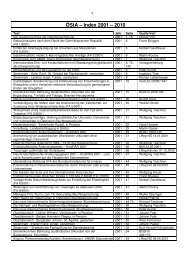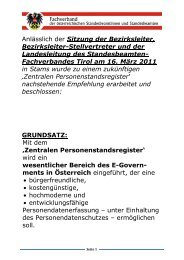Skriptum: Standesbeamten-Dienstprüfung
Skriptum: Standesbeamten-Dienstprüfung
Skriptum: Standesbeamten-Dienstprüfung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachverband der österreichischen<br />
<strong>Standesbeamten</strong><br />
S K R I P T U M<br />
für die<br />
<strong>Standesbeamten</strong> - <strong>Dienstprüfung</strong><br />
1. Personenstandsrecht (PStG, PStV, DA)<br />
2. Kindschaftsrecht (ABGB, PStG)<br />
3. Ehe- und Familienrecht (ABGB, EheG)<br />
4. Staatsbürgerschaftsrecht (StbG, StbV)<br />
5. Sonstige Bestimmungen (AVG, Gebühren, IPR-G,<br />
Gerichtsorganisation, Namensänderung)<br />
Stand: 24.4.2010
1. PERSONENSTANDSRECHT<br />
1.1 Historische Entwicklung des Matrikenwesens<br />
1.1.1 Altmatriken<br />
1563 Bereits in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung begannen Re-<br />
ligionsgemeinschaften auf freiwilliger Basis vereinzelt Matriken zu führen. Auf dem<br />
Konzil zu Trient im Jahre 1563 wurde den katholischen Pfarrern zur Pflicht gemacht,<br />
ein Trauungsbuch und ein Taufbuch zu führen und sorgfältig aufzubewahren.<br />
1784 Eine für den staatlichen Bereich wirksame Personenstandsverzeichnung wurde<br />
in Österreich durch das kaiserliche Patent vom 20. Februar 1784 eingeführt. Die<br />
Pfarrer hatten von nun an ein Trauungsbuch, ein Geburtenbuch und ein Sterbebuch<br />
zu führen. Dadurch wurden aus den bisher nur für kirchliche Zwecke geführten<br />
Matriken staatliche Personenstandsbücher. Die katholischen Pfarrer hatten die<br />
Bücher zunächst auch für die anderen christlichen Konfessionen zu führen.<br />
Für die Israeliten ordnete das Patent die Führung eigener Bücher durch die Orts-<br />
rabbiner an, denen die Beweiskraft allerdings erst ab 1869 zukam.<br />
Den anderen christlichen Konfessionen wurde mit ihrer gesetzlichen Anerken-<br />
nung nach und nach das Recht und die Pflicht zur Führung eigener Matriken einge-<br />
räumt.<br />
1870 Für Personen, die keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesell-<br />
schaft angehörten, wurden mit Gesetz vom 9. April 1870 Geburts-, Ehe- und Sterbe-<br />
register geschaffen und deren Führung den politischen Bezirksbehörden (Bezirks-<br />
hauptmannschaften bzw. Magistrate) übertragen.<br />
1877 Für Militärpersonen wurde eine eigene Matrikenführung eingerichtet. Die Militär-<br />
matriken werden seit dem 1. Jänner 1984 vom Österr. Staatsarchiv verwahrt, das<br />
auch Urkunden aus diesen Büchern ausstellt.<br />
1895 In dem damals zur ungarischen Reichshälfte gehörenden heutigen Burgenland<br />
war die Führung der Personenstandsbücher bereits seit 1. Oktober 1895 ausschließ-<br />
lich Aufgabe staatlicher Organe, nämlich der Matrikelführer der jeweiligen Gemein-<br />
de.<br />
Seite - 2 -
1.1.2 Staatliche Matrikenführung<br />
Mit der ständigen Weiterentwicklung des Rechtslebens wurde auch das Interesse des<br />
Staates an einer geordneten, überkonfessionellen, nach einheitlichen Richtlinien durchgeführ-<br />
ten Beurkundung der wichtigsten Personenstandsfälle ihrer Bürger, nämlich Geburt, Heirat und<br />
Tod, immer größer. In anderen Staaten wurde die staatliche Matrikenführung schon wesentlich<br />
früher eingeführt. In<br />
Frankreich 1792<br />
England 1836<br />
Italien 1865<br />
Deutschland 1875<br />
Schweiz 1876<br />
Auf dem Gebiet der heutigen Republik Österreich wurden allerdings erst am<br />
1. Jänner 1939 Standesämter errichtet (Ausnahme Burgenland), die von diesem Zeitpunkt an<br />
alle Personenstandsfälle in den Personenstandsbüchern (Geburtenbuch, Familienbuch, Ster-<br />
bebuch) zu beurkunden haben (deutsches Personenstandsgesetz vom 3. November 1937).<br />
Die Personenstandsverzeichnung war von nun an Aufgabe der Gemeinden bzw. der Standes-<br />
beamten als deren Organ.<br />
Die obligatorische (verpflichtende) Zivilehe wurde in Österreich allerdings bereits am<br />
1. August 1938 eingeführt. Zur Vornahme von Trauungen waren von diesem Zeitpunkt an bis<br />
zum 31. Dezember 1938 ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig, die<br />
auch heute noch die Eheregister für diesen Zeitraum verwahren (dt. Ehegesetz vom<br />
6. Juli 1938).<br />
Diese aus der NS-Zeit stammenden deutschen Gesetze wurden im Jahr 1945 als österrei-<br />
chische Rechtsvorschriften übernommen 1 und das nationalsozialistische Gedankengut ent-<br />
fernt. Dass sich aber das deutsche Personenstandsrecht nur mühsam mit den Grundsätzen<br />
der österr. Verfassungsrechtsordnung in Einklang bringen ließ, zeigte die Aufhebung mehre-<br />
rer Bestimmungen des (deutschen) Personenstandsgesetzes (PStG 1937) wegen Verfas-<br />
sungswidrigkeit. Beispiele dafür:<br />
§ 45 (Möglichkeit der Anrufung des Gerichts bei Ablehnung einer Amtshandlung durch den<br />
<strong>Standesbeamten</strong>);<br />
§ 47 Abs. 1 (Berichtigung einer abgeschlossenen Eintragung in einem Personenstands-<br />
buch nur durch das Gericht);<br />
1 Die Rechtskontinuität mit der Verfassungsordnung, wie sie am 5.3.1933 in Österreich bestanden hat, wurde durch das<br />
Verfassungs-Überleitungsgesetz vom 1.5.1945 (StGBl. 4/1945) wieder hergestellt.<br />
Seite - 3 -
§ 67 (Verbot der religiösen Feierlichkeiten einer Eheschließung vor der Ehe vor dem Stan-<br />
desbeamten).<br />
Trotzdem wurde das Vorhaben, das deutsche PStG aus dem Jahr 1937 durch eine öster-<br />
reichische Rechtsvorschrift zu ersetzen, bis zum Abschluss der Familienrechtsreform zurück-<br />
gestellt. Man begnügte sich mit Novellierungen. Am 1. Jänner 1984 jedoch war es soweit. In<br />
Kraft traten folgende Bestimmungen:<br />
� Personenstandsgesetz (PStG) vom 19. Jänner 1983 (BGBl. 1983/60)<br />
� Personenstandsverordnung (PStV) des Innenministers vom 14. November<br />
1983 (BGBl. 1983/629)<br />
� Dienstanweisung (DA) des Innenministers, Erlass vom 14. November 1983.<br />
Sowohl das Personenstandsgesetz, als auch die Personenstandsverordnung und die<br />
Dienstanweisung wurden inzwischen mehrfach (allerdings meist nur geringfügig) novelliert.<br />
Durch das am 1.1.1984 in Kraft getretene PStG 1983 und das gleichzeitig wirksam gewor-<br />
dene Bundesgesetz vom 11.11.1983 über Änderungen des Personen-, Ehe- und Kindschafts-<br />
rechts (BGBl. 1983/566) wurden die Aufgaben der Verwaltungsbehörden und deren Organe<br />
auf dem Gebiet des Eherechts dahingehend neu geregelt und geordnet, dass sich die dies-<br />
bezüglichen Vorschriften, von den grundlegenden Regelungen über die Form der Eheschlie-<br />
ßung (§§ 15 und 17 EheG) abgesehen, ausschließlich im Personenstandsrecht finden.<br />
Seite - 4 -
1.2 Die Führung der Personenstandsbücher<br />
Gemäß §§ 59, 59a Personenstandsgesetz sind die Personenstandsangelegenheiten ein-<br />
schließlich des Matrikenwesens von den Gemeinden bzw. Bezirksverwaltungsbehörden im<br />
übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen. Diese Angelegenheiten sind in Gesetzgebung<br />
und Vollziehung 2 Bundessache (Art. 10 B-VG). Vollzugsorgan der mittelbaren Bundesverwal-<br />
tung ist der Landeshauptmann, der dabei an die Weisungen der Bundesregierung sowie der<br />
einzelnen Bundesminister gebunden ist (Art. 103 (1) B-VG).<br />
Hinsichtlich der Gemeinden (Personenstandsbehörde erster Instanz) legt Art. 119 Abs. 1<br />
B-VG für diese Angelegenheiten - zwingend und ohne dass es einer gesetzlichen Wiederho-<br />
lung bedürfte - die Organkompetenz des Bürgermeisters fest.<br />
Der Bürgermeister hat sich bei Besorgung dieser Auftragsangelegenheiten eines Gemein-<br />
debediensteten (<strong>Standesbeamten</strong>) zu bedienen, der die notwendigen Fachkenntnisse besitzt<br />
und die nach landesgesetzlicher Vorschrift 3 erforderlichen <strong>Dienstprüfung</strong>en abgelegt hat,<br />
wenn er selbst nicht fachkundig und geprüft ist. (Nähere Details im Abschnitt „1.6. Behörden“)<br />
1.3 Personenstandsverzeichnung<br />
1.3.1 Personenstandsbücher<br />
1.3.1.1 Zweck und Arten der Personenstandsbücher<br />
Die Personenstandsbücher dienen der Beurkundung der Geburt, der Eheschließung, der<br />
eingetragenen Partnerschaft und des Todes von Personen und ihres Personenstandes. Unter<br />
Personenstand ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer<br />
Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens zu verstehen. Zu den<br />
Merkmalen des Personenstandes gehören insbesondere die Abstammung, die Legitimation,<br />
die Wahlkind(eltern)schaft, das Bestehen oder Nichtbestehen einer Ehe, das Geschlecht (im<br />
Hinblick auf die Ehefähigkeit), der Familienname/Nachname und die Vornamen.<br />
2 Auf Grund der seit langem geplanten Bundesstaatsreform sollte die Vollziehung der Personenstandsangelegenheiten<br />
bereits ab 1.1.1996 in die Kompetenz der Länder fallen. Dieses Vorhaben wurde jedoch bis heute nicht verwirklicht.<br />
3 Diese Vorschriften gibt es nicht in den Bundesländern Burgenland, Tirol, Vorarlberg und Wien.<br />
Seite - 5 -
Jede Personenstandsbehörde (Bezirksverwaltungsbehörde, Standesamt bzw. Standes-<br />
amtsverband) hat ein<br />
� Geburtenbuch,<br />
� Ehebuch<br />
� Partnerschaftsbuch und ein<br />
� Sterbebuch<br />
zu führen. Überdies besteht bei der Gemeinde Wien 4 ein Buch für Todeserklärungen. Die-<br />
ses Buch für Todeserklärungen wird für ganz Österreich vom Standesamt Wien-Innere Stadt<br />
geführt. Mehrere zu einem Standesamtsverband zusammengeschlossene Gemeinden haben<br />
nur je ein Geburten-, Ehe- und Sterbebuch.<br />
1.3.1.2 Örtlichkeitsgrundsatz<br />
Jeder im Inland eingetretene Personenstandsfall (Geburt, Eheschließung, Eingetragene<br />
Partnerschaft, Tod) ist in die Personenstandsbücher einzutragen 5 . Ein im Ausland eingetrete-<br />
ner Personenstandsfall ist auf Antrag einer Person, die ein rechtliches Interesse daran<br />
glaubhaft macht, in ein inländisches Personenstandsbuch (nur Standesamt Wien-Innere Stadt)<br />
einzutragen, wenn der Personenstandsfall betrifft<br />
� einen österreichischen Staatsbürger;<br />
� einen Staatenlosen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland;<br />
� einen Flüchtling im Sinne der Flüchtlingskonvention mit Wohnsitz oder Aufenthalt<br />
im Inland.<br />
Ein Bedürfnis nach Beurkundung eines Personenstandsfalles, der sich im Ausland ereignet<br />
hat, wird vor allem dann bestehen, wenn er in dem Staat, in dem er sich ereignet hat, über-<br />
haupt nicht beurkundet wurde, oder wenn Angaben, die nach österreichischem Recht als we-<br />
sentlich angesehen werden (z.B. was die einzutragenden Daten anlangt), fehlen. Auch wenn<br />
die Eintragung im Ausland zwar vollständig, nach österreichischem Recht aber unrichtig er-<br />
folgt ist, wird die nachträgliche Beurkundung eines Personenstandsfalles beim Standesamt<br />
Wien-Innere Stadt notwendig sein. Ebenso, wenn eine Personenstandsurkunde aus dem Aus-<br />
land gar nicht oder nur unverhältnismäßig schwer (z.B. unzumutbarer Zeitaufwand) beschafft<br />
werden kann oder wenn die ausländische Urkunde wesentlichen inländischen Grundsätzen<br />
(z.B. dem der Einarbeitung von Änderungen des Personenstandes, etwa nach einer Familien-<br />
namensänderung oder Adoption) widerspricht 6 .<br />
4 In der Gemeinde Wien sind derzeit 10 Standesämter eingerichtet.<br />
5 auf die Staatsangehörigkeit der Betroffenen kommt es dabei nicht an.<br />
6 Siehe Hintermüller in ÖStA 1989, Seite 48 „Die nochmalige Beurkundung im Ausland erfolgter Ehescchließungen in<br />
einem inländischen Ehebuch“.<br />
Seite - 6 -
1.3.1.3 Örtliche Zuständigkeit<br />
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Ort der Geburt, der Eheschließung, der<br />
Begründung der Eingetragenen Partnerschaft oder des Todes. Lässt sich der Ort der Geburt<br />
oder des Todes (z.B. bei einer Wasserleiche) einer aufgefundenen Person nicht ermitteln, gilt<br />
als Geburtsort bzw. Sterbeort der Ort der Auffindung.<br />
Lässt sich der Ort der Geburt oder des Todes einer in einem fahrenden Verkehrsmittel<br />
geborenen oder gestorbenen Person nicht bestimmen, gilt als Geburtsort bzw. Sterbeort der<br />
Ort, wo die Person aus dem Verkehrsmittel gebracht wird 7 .<br />
1.3.1.4 Anlegung und Aufbewahrung der Bücher und Akten<br />
Die Personenstandsbücher 8 (Format DIN A4) sind nach Kalenderjahren anzulegen. Wäh-<br />
rend eines Kalenderjahres ist unter fortlaufenden Nummern einzutragen. Die Blätter eines Ka-<br />
lenderjahres sind spätestens im folgenden Kalenderjahr zu einem oder mehreren Bänden zu<br />
binden.<br />
Die Personenstandsbücher sind so zu führen, dass die Benützung, Fortführung und Halt-<br />
barkeit der Eintragungen möglichst lange gewährleistet ist.<br />
Alle Schriftstücke, die die Grundlage der Eintragung und späterer Veränderungen sowie<br />
der Ermittlung der Ehefähigkeit gebildet haben, sind gesondert nach Jahrgang und Nummer<br />
der Eintragung aufzubewahren (Sammelakt 9 ). Der Sammelakt soll auch nach der Eintragung<br />
die Feststellung ermöglichen, wie der Standesbeamte zu ihr gekommen ist und ob ihm dabei<br />
allenfalls in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht ein Fehler unterlaufen ist.<br />
Urkunden sind, soweit sie nicht nur für die Eintragung oder die Ermittlung der Ehefähig-<br />
keit (z.B. Ehefähigkeitszeugnis) ausgestellt wurden, den Personen, die sie vorgelegt haben,<br />
zurückzugeben. Wenn eine zurückgegebene Urkunde nicht leicht wiederbeschaffbar ist, ist<br />
eine Kopie der Urkunde zum Sammelakt zu nehmen.<br />
Die Personenstandsbehörde hat für jeden Jahrgang jedes Personenstandsbuches ein Na-<br />
mensverzeichnis anzulegen. Gerade in größeren Standesämtern mit vielen Personenstands-<br />
fällen ist eine sorgfältige Führung der Namensverzeichnisse unerlässlich, um einen reibungs-<br />
losen Betrieb zu gewährleisten.<br />
7 Das Übereinkommen der Bodensee-Uferstaaten über die Beurkundung der Geburten und Sterbefälle auf dem Bodensee<br />
vom 16.3.1880 (!) bleibt unberührt. Inhalt siehe §§ 253 und 325 deutsche Dienstanweisung für Standesbeamte.<br />
Siehe auch Hintermüller in ÖStA 1984, Seite 98 „Die Beurkundung der Geburt bei Entbindung in einem Transportmittel“.<br />
8 Anlagen 3 (Geburtenbuch), 7 (Ehebuch), 10 (Sterbebuch) und 12 (Buch für Todeserklärungen) der PStV<br />
9 Den Sammelakten kommt jetzt die Funktion der früheren Personenstands-Zweitbücher zu.<br />
Seite - 7 -
Die Personenstandsbücher und die Sammelakten sind dauernd so aufzubewahren, dass<br />
sie vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung gesichert sind 10 . Die Aufbewahrung der Per-<br />
sonenstandsbücher obliegt der Personenstandsbehörde. Die Sammelakten jedes Jahrganges<br />
sind bis zum Ablauf des dritten auf das Jahr der Anlegung folgenden Kalenderjahres von der<br />
Personenstandsbehörde aufzubewahren und sodann der Bezirksverwaltungsbehörde zur wei-<br />
teren Aufbewahrung und Fortführung zu übermitteln.<br />
Sie können jedoch bei der Personenstandsbehörde verbleiben, wenn sie ausreichend ge-<br />
gen Vernichtung (z.B. bei Gefahr eines Brandes oder eines Hochwassers) gesichert sind. Eine<br />
dauernde Aufbewahrung der Sammelakten, die älter als 3 Jahre sind, im gleichen Raum<br />
mit den Personenstandsbüchern ist unzulässig. Die Sammelakten müssen in einem ande-<br />
ren (brandgeschützten) Gebäudeteil, in einem anderen Gebäude oder bei der Bezirksverwal-<br />
tungsbehörde untergebracht sein.<br />
Die sonst aus Platzgründen nach Ablauf einer bestimmten Zeit übliche „Skartierung“ (Ver-<br />
nichtung) von Aktenbeständen ist bei Personenstandsbüchern und Sammelakten nicht mög-<br />
lich.<br />
1.3.1.5 Verlust der Bücher und Akten<br />
Sind ein Personenstandsbuch oder ein Sammelakt in Verlust geraten, hat die Personen-<br />
standsbehörde ein neues Personenstandsbuch (bzw. einen neuen Sammelakt) anzulegen.<br />
Bei Verlust eines Personenstandsbuches ist auf Grund der Sammelakten ein neues Buch<br />
anzulegen. Bei Verlust eines Sammelaktes dient eine Kopie der Eintragung des Personen-<br />
standsbuches als Grundlage für den Aufbau eines neuen Sammelaktes.<br />
Ist sowohl das Personenstandsbuch als auch der dazugehörige Sammelakt in Verlust ge-<br />
raten, hat die örtlich zuständige Personenstandsbehörde den Fall auf Antrag oder von Amts<br />
wegen nach Feststellung des Sachverhaltes 11 in das Personenstandsbuch einzutragen, das<br />
zur Zeit der Neueintragung geführt wird. Diese Bestimmungen gelten auch für die alten Perso-<br />
nenstandsbücher vor dem 1.1.1984 und die kirchlichen Altmatriken.<br />
Auch ein Personenstandsfall, der ursprünglich in einer Altmatrik (Pfarramt) eingetragen<br />
war, ist in das zur Zeit der Neubeurkundung geführte Personenstandsbuch einzutragen.<br />
10 Diese Bestimmung gilt auch für die bis zum 31.12.1983 angelegten Personenstands-Zweitbücher.<br />
11 Die Hilfe anderer Verwaltungsbehörden bzw. Gerichte wird dazu notwendig sein.<br />
Seite - 8 -
1.3.1.6 Automationsunterstützter Datenverkehr und Mikroverfilmung<br />
Die in die Personenstandsbücher einzutragenden oder bereits eingetragenen Daten kön-<br />
nen automationsunterstützt ermittelt, verarbeitet und übermittelt werden. Die Pflicht der<br />
Personenstandsbehörde zur Anlegung von Personenstandsbüchern und zu deren dauernder<br />
Aufbewahrung wird durch die Speicherung von Daten nicht berührt. Es sind daher auch bei der<br />
Speicherung von Daten die Personenstandsbücher im üblichen Sinn (z.B. durch das Binden<br />
von papierenen Ausdrucken) herzustellen und neben den Datenträgern dauernd aufzubewah-<br />
ren.<br />
Der Bundesminister für Inneres kann durch Verordnung bestimmen, unter welchen Voraus-<br />
setzungen anstelle der Sammelakten Mikrofilme oder elektronische Informationsträger<br />
aufbewahrt werden können, die den Inhalt der Sammelakten wiedergeben; er hat dabei auf die<br />
zuverlässige dauerhafte Erhaltung, den leichten Zugang befugter Personen zu dem Aktenin-<br />
halt und dessen Schutz vor dem Zugang nicht befugter Personen zu achten.<br />
1.3.2 Eintragungen in die Personenstandsbücher<br />
1.3.2.1 Arten der Eintragung<br />
Eintragungen sind einerseits Beurkundungen, das sind Haupteintragungen und Vermerke<br />
und andererseits Hinweise.<br />
� Haupteintragungen sind Eintragungen über die Geburt, die Eheschließung, die<br />
eingetragene Partnerschaft und den Tod.<br />
� Vermerke sind Eintragungen, durch die die Haupteintragung nach ihrem Abschluss<br />
verändert (ergänzt, berichtigt oder geändert) wird.<br />
� Hinweise stellen den Zusammenhang zwischen verschiedenen Eintragungen<br />
her, die dieselbe Person oder deren unmittelbare Vorfahren betreffen.<br />
Die Hinweise gehören nicht zum Urkundenteil eines Personenstandsbuches. Sie haben<br />
daher auch nicht die Beweiskraft der Haupteintragung und der Vermerke.<br />
Eintragungen in den Personenstandsbüchern haben nur eine beurkundende, aber keine<br />
rechtsbegründende Wirkung. Das Recht zur Führung eines bestimmten Namens ist nicht<br />
Folge der Eintragung in den Personenstandsbüchern, sondern findet seinen Rechtsgrund in<br />
dem vom Gesetz über den Erwerb des Namens anerkannten Tatbestand, wie insbesondere<br />
Abstammung, Legitimation, Eheschließung, Annahme an Kindesstatt und Namensänderungen.<br />
Daher ist es auch nicht ausgeschlossen, den Nachweis zu erbringen, dass eine berichtigte Ein-<br />
tragung unrichtig ist, und die nochmalige Berichtigung durchzuführen ist. Der Eintragung als<br />
solcher kommt niemals Rechtskraftwirkung zu.<br />
Seite - 9 -
Ungeachtet der mangelnden Rechtskraft- und Bindungswirkung gilt die Beurkundung bis<br />
zum Beweis des Gegenteils als Beweis dessen, was darin von der Personenstandsbehörde<br />
bezeugt wird (§ 292 ZPO).<br />
Beispiel: Durch die Eintragung einer Eheschließung im Ehebuch wird demnach nicht nur<br />
bewiesen, dass eine Ehe geschlossen ist, sondern auch zwischen welchen Personen, an<br />
welchem Tag und an welchem Ort sie geschlossen ist. Die Beweiskraft der Eintragungen<br />
im Ehebuch im Hinblick auf die Angaben über Tag und Ort der Geburt der Eheschließenden<br />
ist allerdings nur eine eingeschränkte, hierfür ist das Geburtenbuch bestimmt.<br />
1.3.2.2 Grundlage der Eintragung<br />
Eintragungen sind auf Grund von Anzeigen, Anträgen, Erklärungen, Mitteilungen und von<br />
Amts wegen vorzunehmen. Vor der Eintragung ist der maßgebliche Sachverhalt von Amts<br />
wegen zu ermitteln. Hierzu sind Personenstandsurkunden und andere geeignete Urkunden<br />
(z.B. gerichtliche Entscheidungen) heranzuziehen 12 .<br />
Dadurch soll sichergestellt werden, dass in die Personenstandsbücher und folglich auch in<br />
die Personenstandsurkunden nur gesicherte Daten eingetragen werden. Dies ist in Anbetracht<br />
der Beweiskraft der Eintragungen und der daraus hergestellten Urkunden vor allem auch hin-<br />
sichtlich des Namens von großer Bedeutung.<br />
Erfahrungsgemäß stellen die in den Personenstandsurkunden aufscheinenden personen-<br />
bezogenen Daten die Grundlage für eine Reihe weiterer Urkunden (Staatsbürgerschaftsnach-<br />
weise, Reisepässe, Führerscheine usw.) dar. Es muss daher bei der Eintragung in die Perso-<br />
nenstandsbücher mit größter Sorgfalt vorgegangen werden.<br />
Ist die Heranziehung von Urkunden nicht möglich, so ist in der Eintragung darauf hinzuwei-<br />
sen. Tatsachen und Rechtsverhältnisse, die nicht durch Urkunden nachgewiesen wurden,<br />
müssen in der Eintragung durch die Beifügung von „laut Angabe“ gekennzeichnet werden. Auf<br />
den fehlenden Nachweis darf aber in der auf Grund der Eintragung ausgestellten Personen-<br />
standsurkunde nicht hingewiesen werden.<br />
Personen, die Beweismittel besitzen oder Auskünfte erteilen können, die zur Eintragung<br />
benötigt werden, sind verpflichtet, nach Aufforderung diese Beweismittel vorzulegen oder die<br />
verlangten Auskünfte zu geben.<br />
Wird auf Grund einer schriftlichen Anzeige eingetragen, so hat der Standesbeamte die An-<br />
gaben zu überprüfen und nötigenfalls zu ergänzen. Eine mündliche Anzeige ist vom Stan-<br />
desbeamten, nachdem er sich von der Persönlichkeit des Erschienenen überzeugt hat, auf<br />
12 im Ausland erstellte Urkunden bedürfen unter Umständen der Legalisierung (Beglaubigung) bzw. der Anbringung der<br />
Apostille. Näheres dazu in ÖStA 1999, Seite 38.<br />
Seite - 10 -
Grund dessen Angaben aufzunehmen und vom Anzeigenden unterschreiben zu lassen. Ist die<br />
Geburt oder der Tod einer Person nicht vom Leiter einer Krankenanstalt angezeigt worden,<br />
darf der Personenstandsfall nur eingetragen werden, wenn eine vom Arzt oder einer Hebamme<br />
ausgestellte Geburtsbestätigung (eine ärztliche Todesbestätigung) vorliegt oder die Geburt<br />
(der Tod) auf Grund anderer Umstände nicht zweifelhaft ist.<br />
Ist auf Grund einer fremdsprachigen Urkunde einzutragen, so hat die Partei eine von einem<br />
allgemein beeideten gerichtlichen Dolmetscher oder Übersetzer angefertigte Übersetzung 13<br />
vorzulegen. Kommt die Partei dieser Pflicht nicht nach, kann die Personenstandsbehörde<br />
selbst eine Übersetzung anfertigen lassen und die Kosten als Barauslagen der Partei verrech-<br />
nen.<br />
Die Abschrift oder Ablichtung (Kopie) einer Urkunde kann nur dann als urkundlicher Nach-<br />
weis angesehen werden, wenn auf ihr die Übereinstimmung mit dem Original von einer dazu<br />
befugten Behörde (bzw. Beglaubigungsstelle beim Bezirksgericht) oder Person (Notar) be-<br />
glaubigt wird.<br />
Abkürzungen dürfen nur im notwendigen Umfang und unter der Voraussetzung, dass<br />
dadurch die Verständlichkeit der Eintragung nicht beeinträchtigt wird, verwendet werden 14 .<br />
1.3.2.3 Nähere Angaben<br />
Die Person und das Ereignis sind durch nähere Angaben eindeutig zu bestimmen. Die<br />
Person ist jedenfalls durch Familiennamen und Vornamen zu bestimmen. Ein „unechter“ Dop-<br />
pelname, der nach österr. Namensrecht geführt wird 15 , ist anzuführen, wenn eine Verpflich-<br />
tung zu dessen Führung besteht; weiter ist anzuführen, welcher Bestandteil des Doppelna-<br />
mens „gemeinsamer Familienname“ (dieser Person) ist.<br />
Der Bezeichnung der Person dienen in erster Linie Familienname und Vornamen, daneben<br />
aber auch Angaben über das Geschlecht, die Eintragung der Geburt und über die Eltern (im<br />
Geburtenbuch).<br />
Auf Antrag kann ein akademischer Grad (auch die Standesbezeichnung „Ing.“), wenn der<br />
dementsprechende Nachweis vorgelegt wird, in die Personenstandsurkunden eingetragen<br />
werden. Die Eintragung in öffentliche Urkunden ist ab 2004 auf akademische Grade be-<br />
schränkt, die von Institutionen eines EU- oder EWR-Staates, eines Staates mit EU-<br />
Beitrittsstatus oder der Schweiz verliehen wurden.<br />
13 Zur mangelnden Beweiskraft der von ausländischen Dolmetschern angefertigten Übersetzungen ausländischer<br />
Personenstandsurkunden und Personaldokumente siehe Zeyringer in ÖStA 1998,29.<br />
14 Eine Liste der zugelassenen Abkürzungen enthält die Dienstanweisung (DA) im Punkt 11.7.<br />
15 nähere Erläuterung dazu im 3. Abschnitt „Ehe- und Familienrecht“.<br />
Seite - 11 -
Reichen die allgemein vorgesehenen Angaben zur sicheren Beurteilung der der Beurkun-<br />
dung zugrunde liegenden Sach- und Rechtslage nicht aus, sind die notwendigen erklärenden<br />
Angaben im Feld „Sonstige Angaben“ zu machen.<br />
Das Ereignis ist durch die Angabe der Zeit und des Ortes zu bestimmen. Die Zeit des Er-<br />
eignisses 16 ist durch Tag, Monat und Jahr, der Zeitpunkt durch die zusätzliche Anführung von<br />
Stunde und Minute anzugeben. Kann der Tag des Ereignisses nicht ermittelt werden 17 , ist der<br />
engstmögliche Zeitraum anzugeben.<br />
Orte sind so zu bezeichnen, dass sie später jederzeit ohne Schwierigkeiten ermittelt wer-<br />
den können. Besteht eine amtliche Gemeindebezeichnung, so ist diese zu verwenden.<br />
Als nähere Angabe zur Bezeichnung der Person ist auch die Zugehörigkeit zu einer gesetz-<br />
lich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft vorgesehen 18 .<br />
1.3.2.4 Personennamen in den Personenstandsbüchern<br />
Personennamen sind aus der für die Eintragung herangezogenen Urkunde buchstaben-<br />
und zeichengetreu, also inklusive allfälliger diakritischer Zeichen zu übernehmen 19 . Diakriti-<br />
sche Zeichen dienen der Aussprachebezeichnung. Zu ihnen gehören außer Akzenten und<br />
Häkchen auch Punkte über oder unter einem Buchstaben (z.B. Ç, å, Ð, ë, usw.). Fehlt für<br />
ein früheres deutsches Schriftzeichen ein entsprechendes lateinisches Zeichen, so ist eine<br />
Transliteration vorzunehmen. Eine sprachliche Abwandlung des Familiennamens nach<br />
dem Geschlecht ist der österreichischen Rechtsordnung fremd und daher bei österr. Staats-<br />
bürgern bei einer Neueintragung in die Personenstandsbücher auch nicht anzuwenden. Bei<br />
einer allfälligen Verleihung der österr. Staatsbürgerschaft geht eine schon bestehende sprach-<br />
liche Abwandlung auf Grund einer fremden Rechtsordnung allerdings nicht verloren.<br />
Beispiel: Der ledigen slowakischen Staatsangehörigen Elvira HANTUCHOVA wird die<br />
österr. Staatsbürgerschaft verliehen. Auch als österr. Staatsbürgerin führt sie weiter den<br />
Familiennamen HANTUCHOVA. Ein von ihr anschließend geborener Knabe würde ebenfalls<br />
den Familiennamen HANTUCHOVA bekommen.<br />
Zur Ermittlung des durch Abstammung erworbenen Familiennamens sind, soweit die Per-<br />
son nicht anderes beantragt, nur die Urkunden der Person(en) heranzuziehen, von der (denen)<br />
der Familienname unmittelbar abgeleitet wird. Sogenannte „Zwischennamen“ und „Vaters-<br />
16 Das Zeitzählungsgesetz (Sommer- bzw. Normalzeit) ist dabei zu beachten; siehe Punkt 14.4 der DA.<br />
17 Dies betrifft in erster Linie die Beurkundung von Sterbefällen.<br />
18 Eine Liste der derzeit gesetzlich anerkannten Kirchen ist im Punkt 16.4 der DA enthalten.<br />
19 Ist in der Urkunde ein nicht an erster Stelle stehender Vorname unterstrichen gilt dieser als sogenannter „Rufname“.<br />
Die Eintragung ist daher durch die Bezirksverwaltungsbehörde dahin zu berichtigen, dass der unterstrichene Vorname<br />
an die erste Stelle gesetzt wird, sofern die Partei dies beantragt. Bis zu einer solchen Berichtigung muss bei der Eintragung<br />
ebenso wie bei der Ausstellung einer Urkunde auf Grund der früheren Eintragung die ursprüngliche Reihenfolge<br />
und die Unterstreichung beibehalten werden (siehe P 17.1 DA).<br />
Seite - 12 -
namen“ (üblich u.a. in Marokko, Tunesien, Bulgarien und Russland) sind ebenfalls in die Per-<br />
sonenstandsbücher einzutragen 20 .<br />
Diese Bestimmung hat nur den Erwerb des Familiennamens durch Abstammung und den<br />
urkundlichen Nachweis darüber zum Gegenstand, berührt daher nicht andere für den Namen<br />
maßgebende Rechtsvorschriften wie das Adelsaufhebungsgesetz oder das IPR-Gesetz. Das<br />
Adelsaufhebungsgesetz aus dem Jahr 1919 untersagt österr. Staatsbürgern die Führung von<br />
Adelsbezeichnungen und gewisser Titel und Würden.<br />
Ist für den Familiennamen oder für den Vornamen einer Person eine vom rechtmäßigen<br />
Familiennamen (Vornamen) abweichende Schreibweise 21 gebräuchlich geworden, ist auf An-<br />
trag der Familienname (Vorname) in der gebräuchlich gewordenen Schreibweise einzutragen.<br />
Eine von der rechtmäßigen Namensform abweichende Schreibweise kann durch phonetische<br />
(anstelle der richtigen buchstabengetreuen) Schreibung des Namens, das Weglassen diakri-<br />
tischer Zeichen, unrichtige Transliteration oder Übertragungsfehler von einer in eine ande-<br />
re Urkunde entstanden sein. Als Nachweise der gebräuchlichen Schreibweise kommen alle<br />
Urkunden inländischer Behörden in Betracht, bei denen der Name nicht völlig untergeordne-<br />
te Bedeutung hat 22 . Als Nachweise geeignet sind daher Staatsbürgerschaftsnachweise, Reise-<br />
pässe, Heimatscheine, Schulzeugnisse u. dgl.<br />
Der Antrag auf Berücksichtigung einer abweichenden Schreibweise kann sowohl anlässlich<br />
einer Neueintragung 23 als auch außerhalb einer solchen durch Eintragung eines Vermerks zu<br />
einer bestehenden Eintragung gestellt werden. Besteht keine solche Eintragung im Inland, wä-<br />
re darin ein rechtliches Interesse auf nachträgliche Beurkundung des Personenstandsfalles<br />
beim Standesamt Wien-Innere Stadt zu erblicken.<br />
Wird die abweichende Schreibweise bei einer Beurkundung oder durch Eintragung eines<br />
Vermerks berücksichtigt, hat der Standesbeamte alle Personenstandsbehörden, die für die<br />
Eintragung eines gleichartigen Vermerks in Betracht kommen, zu verständigen.<br />
Dem Antrag auf Eintragung eines fremdsprachigen Vornamens in seiner deutschen Na-<br />
mensform (und umgekehrt) kann nur dann stattgegeben werden, soweit sich die Unterschiede<br />
auf die gebräuchlich gewordene Schreibweise beschränken. Ansonsten ist nur eine Vorna-<br />
mensänderung nach dem Namensänderungsgesetz (NÄG) möglich.<br />
20 näheres in der DA, Punkt 42.18<br />
21 z.B. „Dworschak“ statt „Dvorak“ bzw. „Josef“ statt „Joseph“.<br />
22 Um davon sprechen zu können, dass eine Schreibweise „gebräuchlich geworden“ ist, bedarf es nach dem Wortsinn<br />
der Annahme, dass die Verwendung dieses Namens im Verkehr des Betreffenden mit Behörden bereits allgemein<br />
üblich geworden ist, was seinen Niederschlag in entsprechenden Urkunden gefunden haben muss (VwGH vom<br />
20.5.1994, Zl. 93/01/1246).<br />
23 z.B. bei der Ermittlung der Ehefähigkeit (Beurkundung der Eheschließung) bzw. Beurkundung einer Geburt.<br />
Seite - 13 -
1.3.2.5 Abschluss der Eintragung<br />
Die Eintragungen im Geburten- und Sterbebuch sind ohne unnötigen Aufschub vorzu-<br />
nehmen, wenn die notwendigen Angaben ermittelt wurden. Die Eintragung der Eheschließung<br />
im Ehebuch muss unmittelbar im Anschluss an die Erklärung des Ehewillens vorgenommen<br />
werden.<br />
Ist eine vollständige Eintragung innerhalb angemessener Frist nicht möglich, so ist sie un-<br />
vollständig durchzuführen. Die unvollständige Eintragung ist in einem Aktenvermerk, der in<br />
den Sammelakt einzulegen ist, zu begründen und im Verzeichnis der unvollständigen Ein-<br />
tragungen zu vermerken, wenn der vollständige Sachverhalt voraussichtlich ermittelt werden<br />
kann.<br />
Beurkundungen sind durch die Unterschrift des <strong>Standesbeamten</strong> abzuschließen. Der Un-<br />
terschrift des <strong>Standesbeamten</strong> kommt in zweierlei Hinsicht Bedeutung zu. Einerseits wird die<br />
Eintragung erst dadurch zu einer Beurkundung, andererseits hängt die Zulässigkeit einer Er-<br />
gänzung, Berichtigung und Änderung der Eintragung durch den <strong>Standesbeamten</strong> selbst davon<br />
ab, ob es sich um eine durch die Unterschrift des <strong>Standesbeamten</strong> abgeschlossene Eintra-<br />
gung handelt oder nicht.<br />
Eine Bestimmung, dass auch die Hinweise durch den <strong>Standesbeamten</strong> zu unterschreiben<br />
sind, ist nicht vorgesehen. Das wäre wegen des beschränkten für Hinweise zur Verfügung ste-<br />
henden Raums schwierig und ist auch nicht notwendig, da die Hinweise nicht zum beweis-<br />
kräftigen Teil der Eintragung gehören.<br />
1.3.2.6 Veränderung und Ergänzung von Beurkundungen<br />
Werden Eintragungen vor ihrem Abschluss durch Zusätze und Streichungen verändert,<br />
sind diese als solche zu kennzeichnen. Vor dem Abschluss der Eintragung (durch die Unter-<br />
schrift des <strong>Standesbeamten</strong>) kann die Eintragung nach jeder Richtung hin geändert werden.<br />
Die vorgenommenen Streichungen 24 und Ergänzungen müssen jedoch erkennbar gemacht<br />
werden.<br />
Nach Abschluss der Eintragung dürfen Beurkundungen nur unter den Voraussetzungen<br />
der Ergänzung, Berichtigung und Änderung durch einen Vermerk verändert werden. Der Wort-<br />
laut der häufigsten Vermerke 25 ist dem <strong>Standesbeamten</strong> vorgeschrieben.<br />
24 Durch die Streichung darf die ursprüngliche Eintragung nicht unleserlich werden. Auch Radierungen oder die Verwendung<br />
korrekturfähiger Farbbänder sind unzulässig.<br />
25 siehe Anlage 17 der DA.<br />
Seite - 14 -
Die Personenstandsbehörde hat eine unvollständige Beurkundung zu ergänzen, sobald<br />
der vollständige Sachverhalt ermittelt worden ist. Ergänzungen, Berichtigungen und Änderun-<br />
gen sind am Rand der Eintragung zu vermerken.<br />
1.3.2.7 Berichtigung in den Personenstandsbüchern<br />
Eine Beurkundung 26 ist zu berichtigen 27 , wenn sie bereits zur Zeit der Eintragung unrich-<br />
tig gewesen ist. Die von der beabsichtigten Berichtigung Betroffenen müssen davon und von<br />
den ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten in Kenntnis gesetzt werden.<br />
Die Personenstandsbehörde hat selbst zu berichtigen:<br />
� offenkundige Schreibfehler 28 ;<br />
� Angaben, die auf einer Eintragung in einem inländischen Personenstandsbuch<br />
beruhen, die berichtigt wurde;<br />
� Angaben, deren Unrichtigkeit durch inländische Personenstandsurkunden<br />
nachgewiesen ist;<br />
� Geburtenbuch: Angaben über Wohnort, Eintragung der Geburt sowie Religion<br />
der Eltern;<br />
� Ehebuch: Angaben über Wohnort, Eintragung der Geburt sowie Religion der<br />
Verlobten; Angaben über die Zeugen;<br />
� Partnerschaftsbuch: Angaben über den Wohnort, Eintragung der Geburt sowie<br />
Religion der Partnerschaftswerber;<br />
� Sterbebuch: Angaben über letzten Wohnort, Eintragung der Geburt sowie Religion<br />
des Verstorbenen.<br />
In allen anderen Fällen hat über die Berichtigung einer Beurkundung die Bezirks-<br />
verwaltungsbehörde auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen zu entscheiden 29 .<br />
Parteien im Verfahren sind:<br />
1. die Person, auf die sich die Eintragung bezieht;<br />
2. sonstige Personen, deren Personenstand durch die Eintragung berührt wird;<br />
3. die Personenstandsbehörde, die die Berichtigung einzutragen hat.<br />
Hat außer der Personenstandsbehörde niemand Parteistellung kann die Berichtigung 30 oh-<br />
ne weiteres Verfahren angeordnet werden. Die Anordnung hat den Wortlaut der Berichtigung<br />
26 Dies betrifft daher sowohl den Haupteintrag als auch einen Vermerk.<br />
27 auch eine nochmalige Berichtigung ist möglich.<br />
28 Dieser Begriff sollte nicht zu eng ausgelegt werden. Auch Übertragungsfehler des <strong>Standesbeamten</strong> können unter<br />
diese Bestimmung fallen. Zur ähnlichen Rechtslage in Deutschland siehe den Beschluss des OLG Frankfurt am Main<br />
vom 6.9.1994, StAZ 1994, Seite 383; Bei Vornamen ist im Hinblick auf verschiedene mögliche Schreibweisen Vorsicht<br />
geboten und nur in Ausnahmefällen ein offenkundiger Schreibfehler anzunehmen (z.B. wenn der Name „Wilhelm“ als<br />
„Wihlelm“ geschrieben ist).<br />
29 Der Bescheid muss den Wortlaut der einzutragenden Berichtigung enthalten. Berichtigt darf erst nach Rechtskraft<br />
des Bescheides werden.<br />
Seite - 15 -
zu enthalten. Ebenso ist vorzugehen, wenn die Partei die Berichtigung selbst beantragt hat o-<br />
der keine Einwendungen erhebt. Die durchgeführte Berichtigung ist der Partei mitzuteilen.<br />
Zur Problematik der Berichtigung von nicht an erster Stelle stehenden unterstrichenen<br />
Vornamen, siehe die näheren Details in der Dienstanweisung Punkt 17.1.<br />
1.3.2.8 Änderung von Beurkundungen und Veränderung von Hinweisen<br />
Die Personenstandsbehörde hat eine Beurkundung zu ändern, wenn sie nach der Eintra-<br />
gung unrichtig geworden ist. Die Änderung ist am Rand der Eintragung zu vermerken.<br />
Ebenso hat die Personenstandsbehörde einen unvollständigen oder unrichtigen Hinweis zu<br />
ergänzen, zu berichtigen oder zu ändern. Berichtigt wird durch Streichen des ursprünglichen<br />
Hinweises, der aber leserlich bleiben soll, und Eintragung eines neuen Hinweises. Als Ände-<br />
rung eines Hinweises kommt nur die Änderung der Staatsangehörigkeit in Betracht. Eine Strei-<br />
chung des ursprünglichen Hinweises bei Änderung der Staatsangehörigkeit ist nicht vorgese-<br />
hen; die neue Staatsangehörigkeit ist in die nächste Zeile einzutragen und in Klammer der Tag<br />
der Änderung anzuführen.<br />
1.3.3 Geburtenbuch<br />
1.3.3.1 Anzeige der Geburt<br />
Das Personenstandsgesetz bestimmt, dass jede Geburt eines Kindes dem zuständigen<br />
<strong>Standesbeamten</strong> des Geburtsortes angezeigt werden muss. Im Hinblick auf das Territorial-<br />
prinzip bezieht sich diese Verpflichtung auf alle Kinder, die in Österreich geboren werden. Die<br />
Anzeigepflicht besteht ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Eltern des Kindes oder<br />
des Kindes selbst.<br />
Die Anzeige der Geburt 31 obliegt der Reihe nach<br />
1. dem Leiter der Krankenanstalt, in der das Kind geboren worden ist;<br />
2. dem Arzt oder der Hebamme 32 , die bei der Geburt anwesend waren;<br />
3. dem Vater oder der Mutter, wenn sie dazu innerhalb der Anzeigefrist imstande<br />
sind;<br />
4. der Behörde oder der Dienststelle der Polizeiinspektion, die Ermittlungen über die<br />
Geburt durchführt;<br />
30<br />
Musterbeispiele von Berichtigungsvermerken siehe ÖStA 1986, Seite 25 (Geburtenbuch), Seite 28 (Ehebuch) und<br />
Seite 35 (Sterbebuch).<br />
31<br />
Die Anzeige ist in doppelter Ausfertigung zu erstatten; der Durchschlag dient als Mitteilung der Geburt an die Statistik<br />
Austria.<br />
32<br />
Da die Hebamme jeden Geburtsfall anzuzeigen hat, muss sie eine Anzeige auch erstatten, wenn sie bei der Geburt<br />
nicht anwesend war, aber später hinzugezogen wurde.<br />
Seite - 16 -
5. sonstigen Personen, die von der Geburt auf Grund eigener Wahrnehmung Kenntnis<br />
haben.<br />
Diese Regelung geht davon aus, dass die Anzeige jenen Personen obliegen soll, die in der<br />
Regel als erste die Geburt eines Kindes erfahren (von der Mutter abgesehen, die für eine ra-<br />
sche Anzeige nicht in Betracht kommt). Damit wird auch berücksichtigt, dass ein Großteil der<br />
Kinder in Krankenanstalten (zu denen auch die Gebäranstalten und Entbindungsheime gehö-<br />
ren) geboren wird.<br />
Die Anzeigepflicht trifft die genannten Personen in der Reihenfolge ihrer Nennung. Eine<br />
später genannte Person darf sich aber nicht darauf verlassen, dass vor ihr andere Personen<br />
angeführt sind. Wenn nach den Umständen des Einzelfalls erkennbar ist, dass mit der Anzeige<br />
einer früher genannten Person nicht gerechnet werden kann, entsteht die Anzeigepflicht für die<br />
an nächster Stelle bezeichnete Person.<br />
Die Reihenfolge bedeutet auch nur, dass eine Pflicht zur Anzeigeerstattung für die später<br />
angeführte Person erst bei Ausfall der früher genannten entsteht. Für die Berechtigung zur<br />
Anzeigeerstattung ist dagegen die Reihenfolge ohne Bedeutung.<br />
Die Geburt ist der zuständigen Personenstandsbehörde innerhalb einer Woche anzuzei-<br />
gen 33 . Für die Anzeige der Geburt ist ausschließlich der Vordruck nach Anlage 1 der Perso-<br />
nenstandsverordnung zu verwenden. Örtlich zuständig ist die Personenstandsbehörde, in de-<br />
ren Bereich das Kind geboren wurde. Andere Umstände, etwa der Wohnsitz oder der gewöhn-<br />
liche Aufenthalt der Eltern oder der Kindesmutter, sind ohne Bedeutung.<br />
Die Anzeige hat alle Angaben zu enthalten, die für die Eintragungen in den Personen-<br />
standsbüchern benötigt werden. Folgende Dokumente sind vorzulegen:<br />
1. Die Heiratsurkunde der Eltern des ehelichen oder die Geburtsurkunde (gegebenenfalls<br />
auch die Heiratsurkunde/Partnerschaftsurkunde) der Mutter des unehelichen<br />
Kindes; gegebenenfalls den Nachweis der Auflösung der Ehe bzw. eingetragenen<br />
Partnerschaft;<br />
2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit der Eltern (der Mutter); (dies ist ausschließlich<br />
der „Staatsbürgerschaftsnachweis“ bei österr. Staatsbürgern)<br />
3. den Nachweis des Hauptwohnsitzes der Eltern (der Mutter) bzw. Einblick in das<br />
ZMR<br />
4. die schriftliche Erklärung über die Vornamensgebung;<br />
5. die Geburtsbestätigung (von Hebamme oder Arzt), wenn die Geburt nicht vom Leiter<br />
einer Krankenanstalt angezeigt worden ist.<br />
33 Die Verletzung der Anzeigepflicht stellt eine Verwaltungsübertretung dar (§ 57 PStG).<br />
Seite - 17 -
Bei einer sogenannten „anonymen Geburt“ 34 entfällt die Vorlage von Urkunden der Eltern<br />
bzw. der Mutter. Der Landeshauptmann hat für das Kind einen Vor- und einen Familiennamen<br />
festzulegen.<br />
Das Geschlecht des Kindes ist auf Grund der Anzeige der Krankenanstalt oder der Ge-<br />
burtsbestätigung der Hebamme einzutragen. Zwillings- und Mehrgeburten sind wie Einzelge-<br />
burten unter Beachtung der Zeitfolge zu beurkunden. In jedem Fall muss der Standesbeamte<br />
die Geburtsanzeigen überprüfen und notwendigenfalls auf Grund der Angaben des Anzeigen-<br />
den oder dritter Personen bzw. von amtswegigen Ermittlungen ergänzen.<br />
Kann die schriftliche Erklärung über die Vornamen des Kindes zur Zeit der Anzeige nicht<br />
beigebracht werden, haben die zur Vornamensgebung berechtigten Personen die Anzeige in-<br />
nerhalb eines Monates nach der Geburt zu ergänzen.<br />
Der Standesbeamte hat weitere Urkunden zu verlangen, wenn die angeführten Urkunden<br />
auf Grund der besonderen Umstände zur ordnungsgemäßen Beurkundung der Geburt nicht<br />
ausreichen. Vor allem eine Geburtseintragung mit Auslandsbezug erfordert manchmal die Vor-<br />
lage weiter Unterlagen durch die Eltern.<br />
1.3.3.2 Inhalt der Eintragung im Geburtenbuch<br />
Im Geburtenbuch ist nur die Geburt lebend geborener Kinder zu beurkunden 35 . Als le-<br />
bendgeboren gilt unabhängig von der Schwangerschaftsdauer eine Leibesfrucht dann, wenn<br />
nach dem vollständigen Austritt aus dem Mutterleib entweder die Atmung eingesetzt hat oder<br />
irgendein anderes Lebenszeichen erkennbar ist, wie Herzschlag, Pulsation der Nabelschnur<br />
oder deutliche Bewegung willkürlicher Muskel, gleichgültig, ob die Nabelschnur durchgeschnit-<br />
ten ist oder nicht oder die Plazenta ausgestoßen ist oder nicht 36 .<br />
Für den <strong>Standesbeamten</strong> wird, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, keine Veran-<br />
lassung bestehen, die Angabe der Hebamme oder der Krankenanstalt, dass eine Lebendge-<br />
burt oder Totgeburt vorliegt, zu überprüfen.<br />
In das Geburtenbuch sind einzutragen:<br />
1. der Familienname und die Vornamen des Kindes;<br />
2. der Zeitpunkt und der Ort 37 der Geburt des Kindes;<br />
34<br />
Erlass des BM für Justiz vom 27.7.2001, GZ: JMZ 4600/42-I 1/2001, abgedruckt in ÖStA 10/2001.<br />
35<br />
Die Personenstandsbehörde hat die Verpflichtung, alle Geburten, die sich im Inland ereignet haben, zu beurkunden,<br />
also auch die von Ausländern.<br />
36<br />
Definition nach dem Hebammengesetz, BGBl. 310/1994, in Kraft seit 29.4.1994.<br />
37<br />
Beurkundung der Geburt bei Entbindung in einem Transportmittel siehe ÖStA 1984,98<br />
Seite - 18 -
3. das Geschlecht 38 des Kindes;<br />
4. die Familiennamen/Nachname und die Vornamen der Eltern, ihr Wohnort, der Tag,<br />
der Ort und die Eintragung ihrer Geburt sowie ihre Zugehörigkeit zu einer gesetzlich<br />
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft. 39<br />
Der Doppelname eines Elternteiles, z.B. nach § 93 Abs. 2 ABGB, ist anzuführen, wenn ei-<br />
ne Verpflichtung zu dessen Führung besteht; weiter ist anzuführen, welcher Bestandteil die-<br />
ses Doppelnamens „gemeinsamer Familienname“ ist.<br />
Maßgeblich für den Inhalt der Eintragungen ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Geburt des<br />
Kindes. Dies gilt auch dann, wenn sich der Status des Kindes zwischen Geburt und Beurkun-<br />
dung geändert hat. 40 Das Geburtenbuch wird während des ganzen Lebens des Kindes fortge-<br />
führt. In ihm werden - mit gewissen Einschränkungen - alle personenstandsrechtlich bedeut-<br />
samen Ereignisse, die das Kind betreffen, aufgezeichnet.<br />
Die auf der Rückseite des Vordruckes Anlage 1a der Personenstandsverordnung vorgese-<br />
henen „Angaben der Hebamme“ sind nicht für die Eintragung im Geburtenbuch, sondern<br />
ausschließlich zur Weitergabe an die Statistik Austria bestimmt.<br />
Die Ehelichkeit oder Unehelichkeit der Geburt kann aus der Eintragung nur mittelbar<br />
durch den Hinweis auf die Eheschließung der Eltern bzw. das Fehlen eines solchen Hinweises<br />
ersehen werden.<br />
1.3.3.3 Personen ungeklärter Herkunft<br />
Kann die Personenstandsbehörde die Herkunft einer Person, die in ihrem Amtsbereich ih-<br />
ren gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht feststellen, hat sie das wahrscheinliche Alter 41 und das<br />
Geschlecht der Person sowie die sonstigen Ergebnisse ihrer Ermittlungen dem Landeshaupt-<br />
mann mitzuteilen.<br />
Der Landeshauptmann hat der Personenstandsbehörde eine Anzeige zu erstatten, die zu<br />
enthalten hat:<br />
1. den Familiennamen und den Vornamen;<br />
2. den Tag und den Ort der Geburt;<br />
3. das Geschlecht.<br />
Ein Vorgehen nach dieser Bestimmung kommt erst dann in Betracht, wenn die Ermittlun-<br />
gen der Sicherheitsbehörden zur Klärung der Herkunft der Person ergebnislos geblieben<br />
38<br />
Zur allfälligen Änderung des Geschlechts siehe ÖStA 1983,65<br />
39<br />
Angaben über die Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft sind nur im<br />
Zweifelsfall zu überprüfen.<br />
40<br />
z.B. Eheschließung oder Scheidung der Mutter einen Tag nach der Geburt des Kindes aber vor der Beurkundung der<br />
Geburt im Geburtenbuch des zuständigen Standesamtes.<br />
41<br />
Hiezu ist ein amtsärztliches Zeugnis einzuholen.<br />
Seite - 19 -
sind. Wird nachher die Herkunft der betreffenden Person ermittelt, so muss die Eintragung er-<br />
gänzt bzw. berichtigt werden. Ist eine andere Behörde zuständig, muss die Eintragung unter<br />
Hinweis auf die neue Eintragung durch Berichtigung gelöscht und eine neue Beurkundung<br />
durch die zuständige Personenstandsbehörde vorgenommen werden.<br />
1.3.3.4 Vornamensgebung<br />
Vor der Eintragung der Vornamen des Kindes in das Geburtenbuch haben die dazu be-<br />
rechtigten Personen schriftlich zu erklären, welche Vornamen sie dem Kind gegeben haben.<br />
Sind die Vornamen von den Eltern einvernehmlich zu geben, genügt die Erklärung eines El-<br />
ternteiles, wenn er darin versichert, dass der andere Elternteil damit einverstanden ist 42 .<br />
Die Anzahl der Vornamen ist gesetzlich nicht beschränkt. Allgemeine Ordnungsinteressen<br />
legen eine zahlenmäßige Beschränkung nahe; unklar ist freilich, wo die Grenze zu ziehen ist.<br />
Die Grenze dürfte vermutlich dort liegen, wo die ordnungsgemäße Führung von Registern oder<br />
Ausstellung von Urkunden beeinträchtigt wird 43 . Es besteht zwar ein Recht, jedoch keine Ver-<br />
pflichtung für eine Person, alle für sie im Geburtenbuch eingetragenen Vornamen auch tat-<br />
sächlich zu benützen 44 .<br />
Bei Kindern mit österreichischem Personalstatut muss zumindest der erste Vorname dem<br />
Geschlecht des Kindes entsprechen; Bezeichnungen, die nicht als Vornamen gebräuchlich<br />
oder dem Wohl des Kindes abträglich sind, dürfen nicht eingetragen werden 45 .<br />
Stimmen die Erklärungen mehrerer zur Vornamensgebung berechtigter Personen nicht<br />
überein, hat die Personenstandsbehörde vor der Eintragung der Vornamen das Pflegschafts-<br />
gericht zu verständigen 46 . Das gleiche gilt, wenn keine Vornamen oder solche gegeben wer-<br />
den, die nach Ansicht der Personenstandsbehörde nicht eingetragen werden können. Trifft das<br />
Pflegschaftsgericht in angemessener Zeit keine Maßnahmen, hat die Personenstandsbehörde<br />
über ihre Weigerung, die angezeigten Vornamen einzutragen, bescheidmäßig abzusprechen.<br />
Soll das Kind nach der Beurkundung der Vornamen im Geburtenbuch noch einen Vornamen<br />
erhalten, so kann dies nur im Wege der behördlichen Namensänderung durch die Bezirksver-<br />
waltungsbehörde geschehen.<br />
42<br />
Stellt sich heraus, dass die Vornamen nicht einvernehmlich angezeigt wurden, ist die Eintragung der Vornamen zu<br />
berichtigen.<br />
43<br />
ähnlich die Rechtslage in Deutschland: sieben Vornamen zulässig (OLG Köln), dreizehn Vornamen unzulässig (AG<br />
Hamburg).<br />
44<br />
Erkenntnis des OGH vom 1.9.1992, 4 Ob 43/92.<br />
45<br />
Diese Regelung verletzt nicht das Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz, auf Achtung des Privatund<br />
Familienlebens und auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (VfGH vom 26.2.1987).<br />
46<br />
Das Pflegschaftsgericht kann einem der Elternteile das Vornamenbestimmungsrecht entziehen (§ 176 ABGB) und<br />
den anderen allein entscheiden lassen.<br />
Seite - 20 -
Das Recht zur Vornamensgebung an ein Kind, dessen Personalstatut das österr. Recht ist,<br />
steht den Obsorgeberechtigten, das sind in der Regel bei ehelicher Abstammung die Eltern,<br />
bei unehelicher Abstammung die Mutter, zu. Kann eine schriftliche Erklärung über die Vorna-<br />
men nicht erlangt werden, ist eine unvollständige Eintragung vorzunehmen und das Pflegs-<br />
chaftsgericht zu verständigen.<br />
Als zweiter und folgender Vorname kann dem Kind auch ein Name gegeben werden, der<br />
seinem Geschlecht nicht entspricht. Dieses Recht ist nicht auf bestimmte Vornamen (z.B. „Ma-<br />
ria“ für Knaben) beschränkt. Im übrigen ist die Geschlechtsbezogenheit eines Vornamens nach<br />
seiner Gebräuchlichkeit als Vorname für das jeweilige Geschlecht zu beurteilen.<br />
Bei der Beurteilung der Gebräuchlichkeit eines Vornamens darf nicht auf das Inland allein<br />
abgestellt werden. Die zur Vornamensgebung berechtigten Personen können daher dem Kind<br />
auch Vornamen geben, die nur im Ausland gebräuchlich sind. Als Hilfsmittel zur Beurteilung<br />
der Gebräuchlichkeit von Vornamen im Inland werden von der Statistik Austria Verzeichnisse<br />
der im Inland gegebenen Vornamen veröffentlicht 47 . Zur Beurteilung der Gebräuchlichkeit von<br />
Vornamen im Ausland sind im Zweifel geeignete Nachschlagebehelfe (z.B. das „Internationale<br />
Handbuch der Vornamen“ 48 ) heranzuziehen.<br />
Wurden irrtümlich Vornamen gegeben, die nicht dem Geschlecht des Kindes entsprechen,<br />
oder wurde die Eintragung über das Geschlecht berichtigt, ist eine neuerliche Erklärung über<br />
die Vornamen zulässig. Bei einer Änderung des Geschlechts (durch eine geschlechtsändern-<br />
de Operation) ist eine Vornamensänderung nach dem Namensänderungsgesetz (NÄG) not-<br />
wendig.<br />
1.3.3.5 Vermerke im Geburtenbuch<br />
Ein Vermerk ist einzutragen, wenn der Personenstand 49 des Kindes mit allgemein verbindli-<br />
cher Wirkung festgestellt oder geändert worden ist. Das gleiche gilt, wenn der Familienname<br />
der Eltern oder eines Elternteiles mit allgemeinverbindlicher Wirkung geändert worden ist und<br />
sich die Wirkung der Feststellung oder Änderung auf das Kind erstreckt.<br />
Aus der Eintragung müssen die Rechtswirkungen des Vorganges auf den Personenstand<br />
und wenn notwendig, der Tag des Eintrittes der Rechtswirkungen hervorgehen.<br />
Änderungen des Familiennamens im Zusammenhang mit einer Ehe des Kindes wer-<br />
den im Geburtenbuch nicht eingetragen. Auch eine verwaltungsbehördliche Änderung<br />
des Familiennamens/Nachnamens in sinngemäßer Anwendung des § 93 ABGB bzw. die<br />
47<br />
Dieses Vornamensverzeichnis steht auf der Homepage des Fachverbandes (www.standesbeamte.at) im Download-<br />
Archiv zur Verfügung.<br />
48<br />
darin sind ca. 70.000 Vornamen aus dem europäischen Raum verzeichnet.<br />
49<br />
Änderungen, die nicht den Personenstand betreffen (z.B. Wohnort), sind daher nicht zu vermerken.<br />
Seite - 21 -
Wiederannahme eines früheren Familiennamens nach § 93a ABGB wird im Geburten-<br />
buch nicht vermerkt.<br />
Änderungen hinsichtlich der Zugehörigkeit eines Elternteiles zu einer gesetzlich anerkann-<br />
ten Kirche oder Religionsgesellschaft sind nur auf Antrag dieses Elternteiles einzutragen.<br />
Ein Vermerk ist vor allem in folgenden Fällen einzutragen:<br />
1. Feststellung der Vaterschaft zu dem Kind durch Anerkenntnis nach § 163c ABGB<br />
oder nach § 163e ABGB („qualifiziertes Vaterschaftsanerkenntnis“) oder durch Beschluss<br />
des Bezirksgerichtes; ggf. auch die Feststellung der Mutterschaft, wenn eine<br />
solche nach dem anzuwendenden ausländischen Recht Voraussetzung der<br />
rechtlichen Abstammung von der Mutter ist;<br />
2. Legitimation durch nachfolgende Ehe der Eltern;<br />
3. Ehelicherklärung;<br />
4. Feststellung der Abstammung des Kindes;<br />
5. Annahme an Kindesstatt;<br />
6. Änderung oder Festsetzung der Vornamen oder des Familiennamens (ausgenommen<br />
in sinngemäßer Anwendung des § 93 ABGB 50 ) des Kindes;<br />
7. Änderung des Geschlechts des Kindes 51 ;<br />
8. Änderung des Familiennamens der Eltern oder eines Elternteiles, wenn sich die<br />
Änderung auch auf den Familiennamen des Kindes erstreckt oder wenn ein Elternteil<br />
und das Kind auf Grund verschiedener Vorgänge den gleichen Familiennamen<br />
führen (z.B. ist die Änderung des Familiennamens der Mutter durch Eheschließung<br />
zu vermerken, wenn das Kind durch eine behördliche Namensänderung den gleichen<br />
Familiennamen wie die Mutter führt);<br />
9. Berichtigungen<br />
Die Eintragung der Vermerke erfolgt von Amts wegen auf Grund der Mitteilungen inlän-<br />
discher Behörden und ausländischer Behörden gemäß zwischenstaatlichen Übereinkommen,<br />
aber auch auf Grund von Anträgen der Partei, z.B. wenn die Personenstandsbehörde von dem<br />
zu vermerkenden Vorgang keine Kenntnis erlangt hatte.<br />
Ein Vermerk ist auch auf Antrag einzutragen, wenn der Vor- oder Familienname der Eltern<br />
oder eines Elternteiles mit allgemeinverbindlicher Wirkung geändert worden ist.<br />
Insoweit der Antragsteller in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, hat der gesetzliche Ver-<br />
treter den Antrag einzubringen. Minderjährige, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können<br />
den Antrag selbst stellen.<br />
Mit dieser Regelung kann nunmehr z.B. auch der Vornahme der Eltern oder eines Elterntei-<br />
les im Geburtenbuch des Kindes geändert werden. Diese Neuregelung dient vorwiegend der<br />
50 siehe P 26.1.6 DA bzw. Mitteilungspflichten gem. § 3 Abs.1 Z 1 NÄV.<br />
51 Voraussetzungen und Verfahrensablauf siehe Heuer in ÖStA 1995/49.<br />
Seite - 22 -
Erleichterung der Integration, da Vornamensänderungen der Eltern in das Geburtenbuch der<br />
Kinder bisher nicht eingetragen werden konnten.<br />
Vor Eintragung eines Vermerks ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Rechtswirk-<br />
samkeit des Vorgangs (z.B. Rechtskraft der Entscheidung oder Wirksamkeit einer ausländi-<br />
schen Entscheidung für den österreichischen Rechtsbereich) erfüllt sind. Bei einem diesbezüg-<br />
lichen Zweifel (z.B. über die Rechtswirksamkeit der Bewilligung einer Annahme an Kindesstatt<br />
durch eine ausländische Behörde) ist eine Rechtsauskunft des Landeshauptmannes einzu-<br />
holen.<br />
Die Übermittlung einer Erklärung, die zu ihrer Wirksamkeit der Entgegennahme durch den<br />
<strong>Standesbeamten</strong> bedarf, schließt den Antrag auf Eintragung eines Vermerkes ein. Das ist<br />
dann von Bedeutung, wenn nach Ansicht der Personenstandsbehörde die materiell- oder for-<br />
mellrechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Glaubt die Personenstandsbehörde,<br />
dem Antrag auf Eintragung eines Vermerkes mangels Vorliegens der Wirksamkeitsvorausset-<br />
zungen nicht entsprechen zu können, hat sie den Antrag mit Bescheid abzuweisen.<br />
Bei der Legitimation durch nachfolgende Ehe ist zu beachten, dass das Kind mit der Ehe-<br />
schließung der Eltern ehelich wird, sofern die Vaterschaft zum Kind festgestellt ist. Erhält<br />
daher die Personenstandsbehörde, die das Geburtenbuch führt, die Mitteilung über die Ehe-<br />
schließung der Eltern und ist die Vaterschaft festgestellt, so ist die Legitimation ohne weiteres<br />
zu vermerken. Ist letzteres nicht der Fall, so hat der Standesbeamte den (die) gesetzlichen<br />
Vertreter des nicht voll geschäftsfähigen Kindes, sonst das Kind selbst davon zu verständi-<br />
gen, dass die Legitimationswirkung erst nach Feststellung der Vaterschaft eintritt.<br />
Der Vermerk hat auch eine Angabe über die namensrechtliche Wirkung der Legitimation<br />
zu enthalten. Treten namensrechtliche Wirkungen (hinsichtlich des Legitimierten, dessen Ehe-<br />
gatten und Nachkommen) nur mit Zustimmung des Betroffenen ein, so muss die Personen-<br />
standsbehörde, die das Geburtenbuch des Legitimierten führt, die Zustimmungsberechtigten<br />
nachweislich 52 verständigen, soweit ihr die Zustimmungserklärungen nicht bereits vorliegen.<br />
Waren die Voraussetzungen für die Legitimation 53 bereits vor dem 1.1.1984 gegeben, ist nach<br />
altem Recht (§ 31 PStG 1937) ein Gerichtsbeschluss über den Eintritt der Legitimation herbei-<br />
zuführen.<br />
Auch bei der Annahme an Kindesstatt gelten hinsichtlich der namensrechtlichen Wirkung<br />
sinngemäß die gleichen Voraussetzungen wie bei der Legitimation.<br />
52 diese Verständigung hat daher zumindest mittels Rsb-Brief zu erfolgen.<br />
53 a) Anerkennung bzw. Feststellung der Vaterschaft bzw. b) Eheschließung der Eltern.<br />
Seite - 23 -
Als Hinweise sind einzutragen:<br />
� Die Eheschließung der Eltern;<br />
1.3.3.6 Hinweise im Geburtenbuch<br />
� die Staatsangehörigkeit des Kindes und jede Änderung derselben;<br />
� jede Eheschließung des Kindes<br />
� jede Begründung der eingetragenen Partnerschaft sowie<br />
� der Tod des Kindes.<br />
Den Hinweisen kommt keine Beweiskraft zu. Sie sollen die Verbindung zu den Eintra-<br />
gungen in anderen Personenstandsbüchern, die das Kind oder seine Eltern betreffen, herstel-<br />
len. Um der Pflicht zur Eintragung von Hinweisen nachkommen zu können, erhält die Perso-<br />
nenstandsbehörde des Geburtenbuches Mitteilungen der betreffenden Behörden.<br />
1.3.4 Ehebuch<br />
1.3.4.1 Inhalt der Eintragung im Ehebuch<br />
Die Eheschließung ist in Anwesenheit der beiden Verlobten und der beiden Trauzeugen<br />
zu beurkunden. In das Ehebuch sind einzutragen:<br />
1. Die Familiennamen 54 und alle Vornamen der Verlobten, ihr Wohnort, der Tag, der<br />
Ort und die Eintragung ihrer Geburt sowie ihre Zugehörigkeit zu einer gesetzlich<br />
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft;<br />
2. die Erklärung der Verlobten über den Ehewillen;<br />
3. der Ausspruch des <strong>Standesbeamten</strong>;<br />
4. der Tag und der Ort der Eheschließung 55 ;<br />
5. die Familiennamen und die Vornamen der Trauzeugen sowie ihr Wohnort;<br />
6. allfällige Erklärungen der Verlobten über die Bestimmung des gemeinsamen Familiennamens<br />
(Ehenamens) oder die Weiterführung des bisherigen Familiennamens<br />
durch einen Ehegatten, über die Voran- und Nachstellung des bisherigen Familiennamens<br />
und über die Bestimmung des Familiennamens der aus der Ehe stammenden<br />
Kinder;<br />
7. die Angabe, welchen Familiennamen die Ehegatten zu führen haben. Ein Doppelname<br />
ist anzuführen, wenn eine Verpflichtung zu dessen Führung besteht; weiter<br />
ist anzuführen, welcher Bestandteil des Doppelnamens „gemeinsamer Familienname“<br />
(der betreffenden Person) ist.<br />
Die Eintragung ist von den nunmehrigen Ehegatten, den beiden Trauzeugen, einem allen-<br />
falls zugezogenen Dolmetscher und dem <strong>Standesbeamten</strong> zu unterschreiben. Die Eintra-<br />
54 Hinsichtlich der Schreibweise ist ein allfälliger Antrag auf Berücksichtigung der „gebräuchlich gewordenen Schreibweise“<br />
sowohl beim Familiennamen als auch bei den Vornamen zu beachten.<br />
55 Als „Ort der Eheschließung“ ist nur die Ortsbezeichnung (Gemeinde), also nicht die genaue Anschrift, anzuführen.<br />
Seite - 24 -
gung im Ehebuch ist gleichzeitig die Beurkundung des Aktes der Eheschließung. Die Beurkun-<br />
dung ist 56 nur für den Beweis der Eheschließung, nicht aber für das wirksame Zustande-<br />
kommen der Ehe von Bedeutung.<br />
1.3.4.2 Vermerke im Ehebuch<br />
Ein Vermerk ist einzutragen, wenn der Personenstand eines oder beider Ehegatten mit<br />
allgemeinverbindlicher Wirkung festgestellt oder geändert worden oder wenn ein Vorgang ein-<br />
getreten ist, der sich auf den Bestand der Ehe auswirkt 57 . Im PStG wird in allgemeiner Form<br />
festgelegt, wann ein Vermerk einzutragen sein wird, nämlich bei Vorgängen, die den Bestand<br />
der Ehe betreffen (z.B. Nichtigerklärung der Ehe, Auflösung durch den Tod des anderen Ehe-<br />
gatten, Scheidung, Aufhebung usw.), sowie bei Feststellung oder Änderung des Personen-<br />
standes (einschließlich des Namens) eines oder beider Ehegatten (z.B. Änderung des Fami-<br />
liennamens, Änderung der Vornamen, Legitimation, Annahme an Kindesstatt usw.).<br />
Die Eintragung dieser Vorgänge im Ehebuch erfolgt von Amts wegen auf Grund von Mit-<br />
teilungen in- und ausländischer Behörden und Gerichte sowie auf Antrag der Partei, wenn die<br />
Personenstandsbehörde von dem zu vermerkendem Vorgang bislang keine Kenntnis hatte.<br />
Änderungen hinsichtlich der Zugehörigkeit eines Ehegatten zu einer gesetzlich anerkann-<br />
ten Kirche oder Religionsgesellschaft sind nur auf Antrag dieses Ehegatten einzutragen.<br />
Ein Vermerk ist vor allem in folgenden Fällen einzutragen:<br />
1. Festsetzung oder Änderung des Familiennamens (sowohl durch einen Namensänderungsbescheid<br />
als auch durch eine Erklärung) oder der Vornamen eines oder<br />
beider Ehegatten;<br />
2. Feststellung oder Änderung des Personenstandes in sonstiger Hinsicht; die Legitimation,<br />
die Annahme an Kindesstatt oder die Feststellung der Abstammung eines<br />
oder beider Ehegatten jedoch nur dann, wenn sich der Vorgang auf den Familiennamen<br />
eines oder beider Ehegatten auswirkt.<br />
3. Auflösung der Ehe durch Scheidung, Aufhebung oder Tod (Todeserklärung, Beweis<br />
des Todes) des anderen Ehegatten; Nichtigerklärung der Ehe und deren namensrechtliche<br />
Wirkungen 58 .<br />
4. Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der Ehe.<br />
56 abgesehen von § 15 Abs. 2 Ehegesetz<br />
57 Die wichtigsten Fälle, in denen ein Vermerk einzutragen ist, sind in P 27 DA angeführt.<br />
58 Zur Auswirkung einer Geschlechtsumwandlung auf das Bestehen einer Ehe siehe ÖStA 1983,65.<br />
Seite - 25 -
Nach Eintragung der Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe ist ein weiterer Vermerk<br />
im Ehebuch nur einzutragen, bei<br />
1. Wiederannahme eines früheren Familiennamens;<br />
2. über einen Vorgang, der auf die Zeit vor der Auflösung oder Nichtigerklärung der<br />
Ehe zurückwirkt (Berichtigung).<br />
Nach Auflösung der Ehe ist die Eintragung nur mehr unter Bedachtnahme auf den Zweck<br />
des Ehebuches fortzuführen. Es ist daher überflüssig, den Tod eines früheren Ehegatten zu<br />
vermerken, wenn die Ehe bereits durch den Tod (oder durch Scheidung) des anderen Ehegat-<br />
ten aufgelöst wurde.<br />
Vor Eintragung eines Vermerks ist jedenfalls zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die<br />
Rechtswirksamkeit des Vorgangs (z.B. Rechtskraft der Entscheidung oder Wirksamkeit ei-<br />
ner ausländischen Eheentscheidung [siehe § 50a PStG] für den österreichischen Rechtsbe-<br />
reich) erfüllt sind. Bei einem diesbezüglichen Zweifel (Ausnahme: ausländische Eheentschei-<br />
dung) ist eine Rechtsauskunft des Landeshauptmannes einzuholen.<br />
Die Übermittlung einer Erklärung, die zu ihrer Wirksamkeit der Entgegennahme durch den<br />
<strong>Standesbeamten</strong> bedarf (z.B. Wiederannahme eines früheren Familiennamens), schließt an<br />
diesen den Antrag auf Eintragung eines Vermerkes ein. Das ist dann von Bedeutung, wenn<br />
nach Ansicht der Personenstandsbehörde die materiell- oder formellrechtlichen Voraussetzun-<br />
gen nicht gegeben sind. Glaubt die Personenstandsbehörde, dem Antrag auf Eintragung eines<br />
Vermerkes mangels Vorliegens der Wirksamkeitsvoraussetzungen nicht entsprechen zu kön-<br />
nen, hat sie den Antrag mit Bescheid abzuweisen.<br />
Als Hinweise sind einzutragen<br />
1.3.4.3 Hinweise im Ehebuch<br />
1. die Staatsangehörigkeit der Verlobten;<br />
2. die letzte frühere und die erste spätere Eheschließung des (der) Ehegatten;<br />
3. die letzte frühere und die erste spätere Begründung einer eingetragenen Partnerschaft;<br />
4. jede Änderung der Staatsangehörigkeit der Ehegatten.<br />
Die in der Ziffer 2 vorgesehenen Hinweise sollen eine Verbindung zu früheren oder späte-<br />
ren Ehen eines Ehegatten herstellen. Den Hinweisen kommt keine Beweiskraft zu. Die Hin-<br />
weise auf die Staatsangehörigkeit der Verlobten sind deshalb nötig, da es besonders im Zu-<br />
sammenhang mit der Namensführung der Ehegatten auf deren Staatsangehörigkeit ankommt.<br />
Seite - 26 -
1.3.5 Sterbebuch und Buch für Todeserklärungen<br />
1.3.5.1 Anzeige des Todes<br />
Das Personenstandsgesetz bestimmt, dass der Tod jedes Menschen dem zuständigen<br />
<strong>Standesbeamten</strong> angezeigt werden muss. Diese Verpflichtung bezieht sich auf alle Sterbefäl-<br />
le, die in Österreich eingetreten sind. Die Anzeigepflicht besteht ohne Rücksicht auf die<br />
Staatsangehörigkeit des Verstorbenen. Der Tod muss zweifelsfrei feststehen, und der Anzei-<br />
gende muss in der Lage sein, hierüber eindeutige und glaubhafte Angaben zu machen. Das<br />
Verschwinden eines Menschen unter Umständen, die auf seinen Tod hindeuten, oder die Tat-<br />
sache, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit bei einer Katastrophe (Flugzeugabsturz,<br />
Schiffsuntergang) ums Leben gekommen ist, genügen nicht zur Beurkundung eines Sterbe-<br />
falls.<br />
In das Sterbebuch werden verstorbene Personen 59 sowie totgeborene Kinder 60 eingetra-<br />
gen. Als totgeboren oder in der Geburt verstorben gilt eine Leibesfrucht dann, wenn nicht ir-<br />
gendein Lebenszeichen erkennbar war (Herzschlag, Pulsation der Nabelschnur u.a.) und sie<br />
ein Geburtsgewicht von mindestens 500 Gramm aufweist (Anmerkung: Eine totgeborene<br />
Leibesfrucht unter 500 Gramm gilt als Fehlgeburt und wird in kein Personenstandsbuch ein-<br />
getragen).<br />
Für die Anzeige des Todes ist der Vordruck nach Anlage 9 und 9a, für die Anzeige der Ge-<br />
burt eines totgeborenen Kindes der Vordruck nach Anlage 2 und 2a der Personenstandsver-<br />
ordnung zu verwenden.<br />
Die Anzeige des Todes obliegt der Reihe nach<br />
1. dem Leiter der Krankenanstalt, in der die Person gestorben ist;<br />
2. dem Ehegatten oder sonstigen Familienangehörigen;<br />
3. dem letzten Unterkunftgeber;<br />
4. dem Arzt, der die Totenbeschau vorgenommen hat;<br />
5. der Behörde oder der Dienststelle der Bundesgendarmerie, die Ermittlungen über<br />
den Tod durchführt;<br />
6. sonstigen Personen, die vom Tod auf Grund eigener Wahrnehmungen Kenntnis<br />
haben.<br />
Die Reihenfolge bedeutet, dass eine Pflicht zur Anzeigeerstattung für die später angeführte<br />
Person erst bei Ausfall der früher genannten entsteht. Für die Berechtigung zur Anzeigeer-<br />
stattung ist dagegen die Reihenfolge ohne Bedeutung. Die Verletzung der Anzeigepflicht stellt<br />
59 Inhalt der Eintragung ist der Tod eines Menschen, nicht eine Todesvermutung.<br />
60 Bei einer Totgeburt handelt es sich sowohl um eine Geburt als auch um einen Sterbefall, wobei beide Ereignisse<br />
zusammenfallen. Das PStG verzichtet auf eine doppelte Beurkundung. Es begnügt sich mit der einmaligen Eintragung<br />
in das Sterbebuch, jedoch in der Form einer Geburtsbeurkundung.<br />
Seite - 27 -
eine Verwaltungsübertretung dar. Den Arzt, der die Totenbeschau vorgenommen hat, wird die<br />
Anzeigepflicht dann treffen, wenn der Tod nicht in einer Krankenanstalt eingetreten ist und<br />
wenn der Arzt weder Familienangehörige noch den Unterkunftgeber beim Toten angetroffen<br />
hat.<br />
Der Tod ist der zuständigen Personenstandsbehörde spätestens am folgenden Werktag 61<br />
anzuzeigen. Die Anzeige hat, soweit der Anzeigepflichtige dazu in der Lage ist, alle Angaben<br />
zu enthalten, die für Eintragungen in den Personenstandsbüchern benötigt werden.<br />
Ist der Tod in einer Krankenanstalt eingetreten, hat der Leiter dieser Anstalt, sonst der Arzt,<br />
der die Totenbeschau vorgenommen hat, der Personenstandsbehörde die Todesursache aus-<br />
schließlich zur Übermittlung an die Statistik Austria bekanntzugeben. Eine Eintragung der To-<br />
desursache im Sterbebuch und eine Aufbewahrung der diesbezüglichen Unterlagen im Sam-<br />
melakt kommen keinesfalls in Frage.<br />
gen:<br />
Bei der Anzeige des Todes hat der Anzeigepflichtige folgende Dokumente vorzulegen:<br />
1. die Geburtsurkunde;<br />
2. die Heiratsurkunde über die letzte Eheschließung; gegebenenfalls den Nachweis<br />
der Auflösung der Ehe;<br />
3. die Partnerschaftsurkunde über die letzte eingetragene Partnerschaft; gegebenenfalls<br />
den Nachweis der Auflösung der Partnerschaft;<br />
4. den Nachweis der Staatsangehörigkeit;<br />
5. den Nachweis des letzten Hauptwohnsitzes (bzw.Einblick in das ZMR);<br />
6. die Todesbestätigung, wenn der Tod nicht vom Leiter einer Krankenanstalt angezeigt<br />
worden ist.<br />
Bei der Anzeige einer Totgeburt hat der Anzeigepflichtige 62 folgende Dokumente vorzule-<br />
1. die Heiratsurkunde der Eltern des ehelichen oder die Geburtsurkunde der Mutter<br />
des unehelichen Kindes;<br />
2. den Nachweis des Hauptwohnsitzes der Eltern (der Mutter) bzw. Einblick in das<br />
ZMR;<br />
3. die Geburtsbestätigung und die Todesbestätigung, wenn die Totgeburt nicht vom<br />
Leiter einer Krankenanstalt angezeigt worden ist.<br />
4. Erklärung über die Vornamensgebung, wenn die Eintragung eines Vornamens 63<br />
gewünscht wird.<br />
61 Ein Samstag und der Karfreitag gelten in diesem Zusammenhang nicht als Werktag.<br />
62 dies wird in vielen Fällen die Hebamme sein<br />
63 neu ab 1.9.1999, BGBl. I Nr. 91/1999.<br />
Seite - 28 -
In das Sterbebuch sind einzutragen<br />
1.3.5.2 Inhalt der Eintragung im Sterbebuch<br />
1. der Familienname/Nachname, die Vornamen und das Geschlecht des Verstorbenen;<br />
2. sein letzter Wohnort, der Tag, der Ort und die Eintragung seiner Geburt, sowie<br />
3. seine Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft,<br />
4. der Zeitpunkt und der Ort des Todes 64 .<br />
Ein Doppelname ist anzuführen, wenn eine Verpflichtung zu dessen Führung bestand; wei-<br />
ter ist anzuführen, welcher Bestandteil des Doppelnamens „gemeinsamer Familienname“ war.<br />
Als „Zeitpunkt des Todes“ sind Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute anzugeben. Kann der<br />
Zeitpunkt nicht so genau angegeben werden, ist der engstmögliche Zeitraum anzugeben.<br />
Als „Ort des Todes“ ist die Anschrift der Krankenanstalt oder der Wohnung, in der der Tod<br />
eingetreten ist, anzuführen. In den übrigen Fällen ist der Todesort möglichst genau zu be-<br />
zeichnen.<br />
Bei der Eintragung des Familiennamens des Verstorbenen wird eine abweichende ge-<br />
bräuchliche Schreibweise (§ 11 Abs. 3 PStG) auch auf Antrag eines nahen Angehörigen zu<br />
berücksichtigen sein, da sich aus den unterschiedlichen Schreibweisen des Familiennamens<br />
des Verstorbenen und seiner Angehörigen für letztere Schwierigkeiten ergeben können.<br />
Wurde ein Kind tot geboren, sind das Geschlecht, wenn gewünscht der(die) Vorname(n),<br />
der Tag und der Ort der Geburt des Kindes sowie die Familiennamen, die Vornamen und der<br />
Wohnort der Eltern einzutragen.<br />
1. Seit 1.1.2006 kann auch der Mann, der die Vaterschaft zu dem Kind vor dessen<br />
Geburt anerkannt hat als Vater eingetragen werden.<br />
2. Seit 1.1.2006 kann der uneheliche Vater des totgeborenen Kindes innerhalb von 14<br />
Tagen die Eintragung im Sterbebuch begehren.<br />
Der Zeitpunkt der Totgeburt ist mit totgeboren am: (Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute), der Ort<br />
mit der genauen Ortsbezeichnung (Straße, Hausnummer) anzugeben. Diese Angaben sind im<br />
Feld „Zeitpunkt und Ort des Todes“ einzutragen.<br />
64 Siehe Hintermüller in ÖStA 1984, Seite 83 „Die Beurkundung des Todes, wenn der Todeszeitpunkt oder der Todesort<br />
nicht festgestellt werden kann“.<br />
Seite - 29 -
1.3.5.3 Inhalt der Eintragungen im Buch für Todeserklärungen<br />
Das Buch für Todeserklärungen dient nicht wie das Sterbebuch der Beurkundung des tat-<br />
sächlichen Todes, sondern der Eintragung der gerichtlichen Entscheidung, durch die eine Per-<br />
son für tot erklärt worden oder durch die der Beweis ihres Todes als hergestellt anzusehen ist.<br />
Das Gericht hat der Gemeinde Wien 65 jede Entscheidung über den Beweis des Todes oder<br />
die Todeserklärung anzuzeigen.<br />
In das Buch für Todeserklärungen sind einzutragen<br />
1. der Familienname/Nachname, die Vornamen und das Geschlecht;<br />
2. der letzte Wohnort, der Tag, der Ort und die Eintragung der Geburt sowie<br />
3. die Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft;<br />
4. der (mutmaßliche) Tag des Todes;<br />
5. das Gericht sowie der Tag und das Aktenzeichen der Entscheidung.<br />
Ein Doppelname ist anzuführen, wenn eine Verpflichtung zu dessen Führung besteht; wei-<br />
ter ist anzuführen, welcher Bestandteil des Doppelnamens gemeinsamer Familienname ist.<br />
Als Hinweise sind in das Sterbebuch und in das Buch für Todeserklärungen einzutragen<br />
1. die letzte Eheschließung, wenn der Verstorbene zur Zeit des Todes verheiratet<br />
war;<br />
2. die letzte Begründung der eingetragenen Partnerschaft, wenn der Verstorbene zur<br />
Zeit des Todes in eingetragener Partnerschaft lebend war;<br />
3. die Staatsangehörigkeit des Verstorbenen.<br />
Die Angaben nach Ziffer 1 und 2 stellen die Verbindung zu der Eintragung über eine allfälli-<br />
ge (letzte) Ehe/Partnerschaft des Verstorbenen her. Dies ist allerdings nur dann notwendig,<br />
wenn der Verstorbene zur Zeit seines Todes verheiratet/in eingetragener Partnerschaft lebend<br />
war, da nur in diesem Fall ein Vermerk im Ehebuch/Partnerschaftsbuch einzutragen ist.<br />
65 Die Führung des Buches für Todeserklärungen obliegt dem Standesamt Wien-Innere Stadt.<br />
Seite - 30 -
1.3.6 Personenstandsurkunden und Abschriften<br />
1.3.6.1 Personenstandsurkunden<br />
Personenstandsurkunden sind Auszüge 66 aus den Personenstandsbüchern, die den we-<br />
sentlichen Inhalt der Eintragung wiedergeben. Da die Personenstandsurkunden dazu be-<br />
stimmt sind, die in den Personenstandsbüchern enthaltenen Angaben zu beweisen, müssen<br />
diese Angaben im beurkundenden Teil der Eintragung (Haupteintragung und Vermerke) auf-<br />
scheinen; Angaben aus den Hinweisen werden daher nicht in die Personenstandsurkunden<br />
übernommen.<br />
Die Personenstandsbehörden haben folgende Personenstandsurkunden auszustellen:<br />
� Geburtsurkunden<br />
� Heiratsurkunden<br />
� Partnerschaftsurkunden (Bezirksverwaltungsbehörden)<br />
� Sterbeurkunden<br />
� Urkunde über Totgeburt<br />
Außer den angeführten Urkunden hat die Personenstandsbehörde auch andere Urkunden<br />
auszustellen, nämlich<br />
� Abschriften aus den Personenstandsbüchern (mit dem kompletten Inhalt<br />
der Eintragung)<br />
� Ehefähigkeitszeugnisse/Fähigkeitszeugnisse und<br />
� allenfalls Bestätigungen nach § 55 PStG. 67<br />
Im Bedarfsfalle sind Geburts-, Heirats-, Partnerschafts- und Sterbeurkunden ohne Vermerk<br />
der Religionszugehörigkeit zu verwenden.<br />
Unrichtige und unrichtig gewordene Personenstandsurkunden können unter bestimmten<br />
Voraussetzungen für verfallen erklärt werden. Für die Ausstellung von Personenstandsurkun-<br />
den sind Vordrucke nach den Anlagen der Personenstandsverordnung zu verwenden. Eine<br />
ordnungsgemäße Personenstandsurkunde liegt nur dann vor, wenn sie von dem Standesbe-<br />
amten ausgestellt ist, der das betreffende Personenstandsbuch führt. Unabdingbare Voraus-<br />
setzung ist auch, dass die Urkunde von dem <strong>Standesbeamten</strong> (Ausnahme Partnerschaftsur-<br />
66 Beachte die Begriffsbestimmung im Gegensatz zu § 36 PStG !<br />
67 kommt in der Praxis kaum vor, jedenfalls sind auf Grund der Unterlagen der Personenstandsbehörde keine sog.<br />
„Ledigkeitsbestätigungen“ auszustellen, da der Familienstand in Österreich nicht meldepflichtig ist und daher bei<br />
einer allfälligen Eheschließung im Ausland davon keine Kenntnis erlangt wird. Es kann lediglich bestätigt werden,<br />
dass im Geburtenbuch kein Hinweis auf eine Eheschließung eingetragen ist.<br />
Seite - 31 -
kunde – Beamter der Bezirksverwaltungsbehörde) unterschrieben und mit dem Amtssiegel<br />
versehen worden ist.<br />
Während die Personenstandsbücher, wenn auch in unterschiedlichem Maße, eine Fortfüh-<br />
rung durch Vermerke kennen, kann eine einmal ausgestellte Personenstandsurkunde nicht<br />
ergänzt oder berichtigt werden. Dies bedeutet, dass die Beweiskraft einer Personenstandsur-<br />
kunde im Zweifelsfall immer nur auf den Tag ihrer Ausstellung bezogen werden kann.<br />
Die sich aus zwischenstaatlichen Übereinkommen ergebende Pflicht zur Verwendung darin<br />
vorgesehener Vordrucke (mehrsprachige Personenstandsurkunden – Ausnahme Partner-<br />
schaftsurkunde) wird dadurch nicht berührt.<br />
Für Angehörige von Volksgruppen sind nach dem Volksgruppengesetz auf Verlangen<br />
Personenstandsurkunden als Übersetzung in der Sprache der Volksgruppe auszustellen. 68<br />
1.3.6.2 Berücksichtigung von Veränderungen<br />
Ist eine Eintragung berichtigt worden, sind in der Personenstandsurkunde nur die sich aus<br />
der Berichtigung ergebenden Tatsachen anzuführen.<br />
Das gleiche gilt, wenn sich aus der Eintragung ergibt, dass der Personenstand einer Per-<br />
son, die in der Urkunde anzuführen ist, mit allgemeinverbindlicher Wirkung festgestellt 69 wor-<br />
den ist, oder dass sich der Personenstand einer solchen Person oder ihre Zugehörigkeit zu ei-<br />
ner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft geändert hat.<br />
Die Berücksichtigung der Feststellung oder Änderung des Personenstandes bei der Aus-<br />
stellung einer Personenstandsurkunde setzt die Eintragung eines Vermerks über die Fest-<br />
stellung oder Änderung voraus.<br />
Auf Grund der Berücksichtigung von Änderungen bei Ausstellung einer Personenstandsur-<br />
kunde nach der Eintragung eines Vermerks in den Personenstandsbüchern kann ein begrün-<br />
detes Interesse an der Kenntnis der ursprünglichen Eintragung nur durch Beschaffung einer<br />
Abschrift der Eintragung befriedigt werden. 70<br />
68<br />
Nähere Details dazu im Punkt 34.3 DA<br />
69<br />
Nach Feststellung der Vaterschaft zu einem ue. Kind ist in der Geburtsurkunde des Kindes jedenfalls der Vater<br />
einzutragen.<br />
70<br />
z.B. die Kenntnis der leiblichen Eltern bei adoptierten Kindern.<br />
Seite - 32 -
1.3.6.3 Geburtsurkunde<br />
Die Geburtsurkunde hat die gleichen Angaben wie das Geburtenbuch mit Ausnahme jener<br />
über den Tag, den Ort und die Eintragung der Geburt der Eltern zu enthalten. Vermerke im<br />
Geburtenbuch sind in die Geburtsurkunde einzuarbeiten.<br />
Als Familienname des Kindes ist dessen Geschlechtsname 71 anzuführen, wie er am Tag<br />
der Ausstellung der Geburtsurkunde lautet.<br />
Ist ein Kind an Kindesstatt angenommen worden, sind als Eltern nur die Wahleltern anzu-<br />
führen. Ist es von einem Wahlvater (einer Wahlmutter) allein angenommen worden, ist die leib-<br />
liche Mutter (der leibliche Vater) dann anzuführen, wenn die familienrechtlichen Beziehun-<br />
gen zwischen ihr (ihm) und dem Kind aufrecht geblieben sind.<br />
Auf Antrag ist eine Geburtsurkunde auszustellen, die nur die Angaben über das Kind selbst<br />
enthält. Die Angaben über die Eltern scheinen nicht auf 72 .<br />
1.3.6.4 Heiratsurkunde<br />
Die Angaben in der Heiratsurkunde unterscheiden sich stärker von der Eintragung im Ehe-<br />
buch, als dies bei der Geburtsurkunde und der Sterbeurkunde der Fall ist, da die Eintragung im<br />
Ehebuch gleichzeitig die Beurkundung der Eheschließung darstellt und daher einzelne Anga-<br />
ben im Ehebuch (z.B. die Angaben über die Zeugen) nicht in die Heiratsurkunde übernommen<br />
werden müssen.<br />
Die Heiratsurkunde hat zu enthalten:<br />
1. die Familiennamen (allenfalls den „gemeinsamen Familiennamen“, wenn der<br />
Mann oder die Frau einen Doppelnamen nach § 93 ABGB führt) und alle Vornamen<br />
der Ehegatten, ihre Familiennamen vor der Eheschließung, ihren Wohnort,<br />
den Tag, den Ort und die Eintragung ihrer Geburt sowie die Zugehörigkeit zu einer<br />
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft;<br />
2. den Tag und den Ort der Eheschließung;<br />
3. an der für Vermerke vorgesehenen Stelle ist anzuführen:<br />
a) die Bestimmung des Familiennamens der aus der Ehe stammenden Kinder,<br />
wenn die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen)<br />
führen,<br />
b) die Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe,<br />
c) Wiederannahme eines früheren Familiennamens nach Auflösung der Ehe<br />
sowie Angaben über den Familiennamen des Mannes/der Frau auf Grund<br />
einer Erklärung nach § 72a Abs. 2 PStG.<br />
71<br />
Es ist daher die Geburtsurkunde einer Person, die infolge Eheschließung einen neuen Familiennamen führt, nicht zu<br />
ändern.<br />
72<br />
Die Verwendbarkeit einer derartigen Urkunde bei anderen Behörden ist jedoch meist nicht möglich bzw. zweckmäßig.<br />
Seite - 33 -
Bei der Angabe der Familiennamen vor der Eheschließung sind Änderungen, die nach der<br />
Eheschließung eingetreten sind, nicht zu berücksichtigen; das gilt nicht für Änderungen, die<br />
auf die Zeit vor der Eheschließung zurückwirken.<br />
Gehören beide Ehegatten keiner gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft an, ist eine<br />
Heiratsurkunde zu verwenden, die kein Feld für die Angabe der Religionszugehörigkeit auf-<br />
weist.<br />
1.3.6.5 Sterbeurkunde 73<br />
Die Sterbeurkunde hat die im Sterbebuch vorgesehenen Angaben zu enthalten. Daher sind<br />
folgende Angaben einzutragen:<br />
1. der Familienname/Nachname, alle Vornamen und das Geschlecht des Verstorbenen;<br />
2. sein letzter Wohnort, der Tag, der Ort und die Eintragung seiner Geburt, sowie<br />
3. seine Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft,<br />
4. der Zeitpunkt und der Ort des Todes.<br />
Ein Doppelname ist anzuführen, wenn eine Verpflichtung zu dessen Führung bestand; wei-<br />
ter ist anzuführen, welcher Bestandteil des Doppelnamens „gemeinsamer Familienname“ war.<br />
Für Personen, deren Tod im Buch für Todeserklärungen eingetragen ist wird nur eine Ab-<br />
schrift der Eintragung ausgestellt. In diesem Fall besteht kein Bedürfnis nach Ausstellung ei-<br />
ner Sterbeurkunde.<br />
1.3.6.6 Abschriften<br />
Abschriften aus den Personenstandsbüchern haben, soweit dem nicht das Gesetz über<br />
die Bereinigung von Schriftstücken wegen Aufhebung von aus sogenannten rassischen Grün-<br />
den erlassenen Vorschriften (Schriftstücke-Bereinigungsgesetz), entgegensteht, den vollen<br />
Wortlaut 74 der Eintragung wiederzugeben. Die Übereinstimmung mit der Eintragung ist zu be-<br />
glaubigen. Der Beglaubigungsvermerk ist mit Hilfe eines Stempels am rechten unteren Rand<br />
oder auf der Rückseite der Abschrift anzubringen.<br />
Abschriften aus Personenstandsbüchern sind vor allem dann von Bedeutung, wenn die<br />
Urkunde Auskunft über die ursprüngliche Eintragung und alle späteren Veränderungen ge-<br />
73<br />
Eine Sterbeurkunde ist nur auf ausdrückliches Verlangen auszustellen; sonst eine Abschrift aus dem Sterbebuch<br />
(§ 13 Abs. 3 PStV).<br />
74<br />
Ausnahmen bestimmt das Schriftstücke-Bereinigungsgesetz, BGBl. 1946/3. Demnach gelten die zwangsweise<br />
beigelegten Vornamen „Israel“ und „Sara“ als nicht beigesetzt und dürfen in Ausfertigungen, Auszügen und Abschriften<br />
(Ablichtung daher nicht möglich !) nicht aufscheinen.<br />
Seite - 34 -
en soll, oder wenn (über die Hinweise) der Zusammenhang zwischen verschiedenen die<br />
gleiche Person betreffenden Eintragungen hergestellt werden soll. 75<br />
1.3.7 Übermittlung von Daten aus den Personenstandsbüchern<br />
1.3.7.1 Einsicht und Ausstellung von Urkunden<br />
Das Recht auf Einsicht in die Personenstandsbücher und die zu diesen gehörigen Sam-<br />
melakten sowie auf Ausstellung von Personenstandsurkunden und Abschriften steht nur zu<br />
1. Personen, auf die sich die Eintragung 76 bezieht, sowie sonstige Personen, deren<br />
Personenstand durch die Eintragung berührt wird 77 ;<br />
2. Personen, die ein rechtliches Interesse daran glaubhaft machen, aber nur soweit<br />
kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Personen, auf die sich die Eintragung<br />
bezieht, entgegensteht;<br />
3. Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechtes im Rahmen der Vollziehung<br />
der Gesetze 78 .<br />
Diese Rechte sind im Fall einer sogenannten Inkognitoadoption auf die Wahleltern und<br />
das ehemündige Wahlkind beschränkt. Diese Beschränkung ist als „Sperrvermerk“ in der Ein-<br />
tragung im Geburtenbuch (allenfalls auch im Ehebuch) zu vermerken und verhindert, dass die<br />
leibliche Mutter bzw. die leiblichen Eltern sich Kenntnis über Namen und Anschrift der Adoptiv-<br />
eltern verschaffen und damit auf das Verhältnis zwischen Kind und Adoptiveltern störend ein-<br />
wirken können. Kann ein rechtliches Interesse nur hinsichtlich bestimmter Daten glaubhaft<br />
gemacht werden, dürfen nur diese Daten übermittelt werden, z.B. der Eintragungsstand zum<br />
Zeitpunkt der Geburt ohne Angaben über eine nachher erfolgte Adoption.<br />
Die Regelungen des § 37 PStG gewähren Privatpersonen nur ein eingeschränktes Recht<br />
auf Benutzung der Personenstandsbücher. Man hat ein Benutzungsrecht für die Einträge, die<br />
den eigenen Personenstand oder den des Ehegatten betreffen; ferner für Einträge über die ei-<br />
genen Vorfahren oder Abkömmlinge. Aus anderen Einträgen kann man als Privatperson Aus-<br />
künfte oder Urkunden nur bei Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses erhalten. Ein<br />
rechtliches Interesse ist nur anzuerkennen, wenn die Benutzung der Personenstandsbücher<br />
zur Verfolgung von Rechtsansprüchen oder zur Vermeidung von Rechtsnachteilen notwendig<br />
ist; es setzt also ein schon bestehendes Recht voraus. Institute für Erbenermittlung, Inkasso-<br />
büros etc. können sich bei der Urkundenanforderung erkennbar auf keinen eigenen Rechts-<br />
anspruch stützen.<br />
75 Z.B. die Pflicht zur Vorlage einer Abschrift aus dem Geburtenbuch im Verfahren zur Ermittlung der Ehefähigkeit.<br />
76 Auch die Auskunft über einen einzelnen Tatbestand, z.B. über die Geburtsstunde einer Person, fällt unter diese<br />
Bestimmung; siehe dazu Kraner in ÖStA 1990, Seite 77.<br />
77 Geschwister und noch entferntere Verwandte des Betroffenen kommen daher nicht in Betracht.<br />
78 Im Zweifelsfall haben daher Behörden den Zweck der Anfrage (gesetzliche Grundlage) anzugeben.<br />
Seite - 35 -
Der Standesbeamte muss sich, bevor er Einsicht in die Personenstandsbücher gewährt<br />
oder eine Personenstandsurkunde ausstellt, überzeugen, dass der Antragsteller Betroffener<br />
eines Eintrages ist 79 . Die Sorgfaltspflicht des <strong>Standesbeamten</strong> sollte jedoch im Interesse einer<br />
glatten Abwicklung der Standesamtsgeschäfte nicht überspannt werden. Es wird daher genü-<br />
gen, wenn der Standesbeamte nur in Zweifelsfällen einen Nachweis des behaupteten Benut-<br />
zungsrechts verlangt.<br />
Die Personenstandsbehörde hat auf Antrag wöchentliche Verzeichnisse der beurkundeten<br />
Personenstandsfälle zu übermitteln. Geburten dürfen in die Verzeichnisse nur mit ausdrückli-<br />
cher schriftlicher Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des Kindes, Eheschließungen mit<br />
der beider Ehegatten aufgenommen werden. Das Erfordernis der Zustimmung gilt nicht für<br />
das Sterbebuch, da nur allfällige Interessen naher Angehöriger in Betracht kämen und diese<br />
bei Abwägung gegen das Interesse der Öffentlichkeit auf Information zurückgestellt werden<br />
können.<br />
Die Angaben in den Verzeichnissen sind auf den Tag und den Ort des Ereignisses sowie<br />
auf den Familiennamen, die Vornamen und die Wohngemeinde 80 zu beschränken. Die Über-<br />
mittlung von Verzeichnissen liegt im Privatinteresse des Antragstellers und ist daher ver-<br />
waltungsabgaben- und gebührenpflichtig.<br />
Personen, deren Personenstand durch die Eintragung berührt wird, sind auf jeden Fall der<br />
Ehegatte, die Vorfahren und die Nachkommen der Person, auf die sich die Eintragung bezieht.<br />
Die Verwendung der Worte „rechtliches Interesse“ lässt die Absicht des Gesetzgebers er-<br />
kennen, den Zugang zu den Eintragungen zu erschweren. Ein rechtliches Interesse liegt jeden-<br />
falls nur dann vor, wenn die subjektive Rechtssphäre der betreffenden Person berührt wird; die<br />
bloße Berührung der wirtschaftlichen Interessensphäre reicht nicht aus 81 .<br />
Das wird sich dahin auswirken müssen, dass Personen, die die Einsicht in die Personen-<br />
standsbücher (für andere als die eigenen Vorfahren) aus Gründen der Familienforschung be-<br />
gehren, im allgemeinen einer Vollmacht der (einsichtsberechtigten) Personen bedürfen wer-<br />
den, in deren Auftrag sie tätig sind.<br />
Rechte der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften als Körperschaf-<br />
ten öffentlichen Rechts bleiben davon unberührt 82 .<br />
79<br />
Normalerweise wird die Vorlage eines Ausweises verlangt.<br />
80<br />
Die Angabe der genauen Wohnanschrift ist unzulässig; aus diesem Grund wird die Ausstellung derartiger Verzeichnisse<br />
nur selten beantragt.<br />
81<br />
siehe dazu Hintermüller in ÖStA 1988/78 und den Erlass des BMI vom 7.10.1988, ÖStA 1988/101.<br />
82<br />
Der Bedarf an Daten ist gegeben zur Vollziehung des Religionsunterrichtsgesetzes und des Kirchenbeitragsgesetzes.<br />
Seite - 36 -
1.3.7.2 Mitteilungen<br />
Personenstandsbehörden haben Vorgänge, deren Kenntnis für andere Verwaltungsbehör-<br />
den oder für Gerichte zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine<br />
wesentliche Voraussetzung bildet, diesen Behörden schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilungs-<br />
pflicht gegenüber der Statistik Austria schließt die Daten ein, die der Personenstandsbehörde<br />
auf Grund des Hebammengesetzes 1994, ausschließlich zur Übermittlung an dieses Amt be-<br />
kanntgegeben werden.<br />
Verwaltungsbehörden und Gerichte haben Vorgänge, die von der Personenstandsbe-<br />
hörde als Ergänzung oder Änderung der Haupteintragung oder als Hinweis einzutragen sind,<br />
der für die Eintragung zuständigen Personenstandsbehörde schriftlich mitzuteilen.<br />
Verwaltungsbehörden und Gerichte haben Zweifel an der Richtigkeit einer Personenstand-<br />
surkunde oder einer Eintragung in einem Personenstandsbuch der für die Eintragung zustän-<br />
digen Personenstandsbehörde schriftlich mitzuteilen.<br />
Sämtliche Mitteilungspflichten der Personenstandsbehörden sind in der Personen-<br />
standsverordnung (PStV) näher angeführt.<br />
Auf Grund einer Novellierung des Meldegesetzes (BGBl. I 10/2004) sind ab 1.1.2005<br />
folgende zusätzliche Verpflichtungen der Personenstandsbehörden zu beachten:<br />
1. Unmittelbar nach der Geburt eines Kindes kann anstelle einer „normalen“ Anmeldung<br />
(durch die Eltern des Kindes) bei der zuständigen Meldebehörde anlässlich der Anzeige der<br />
Geburt beim Standesamt und unter Anschluss eines entsprechend vollständig ausgefüllten<br />
Meldezettels das Kind im Wege der Personenstandsbehörde und bereits vor Unterkunft-<br />
nahme in der Wohnsitzgemeinde angemeldet werden. Die Personenstandsbehörde hat dies-<br />
falls für die für den Wohnsitz zuständige Meldebehörde die Meldedaten dem Bundesminister<br />
für Inneres im Wege eines Änderungszugriffes auf das ZMR zu überlassen. Die Anmeldung<br />
ist durch das Amtssiegel und die Unterschrift des <strong>Standesbeamten</strong> zu bestätigen.<br />
2. Personenstandsbehörden haben alle Änderungen hinsichtlich des Namens oder des<br />
Geschlechts von Menschen, die in Österreich angemeldet sind, dem Bundesminister für Inne-<br />
res im Wege eines Änderungszugriffes auf das ZMR zu übermitteln<br />
Seite - 37 -
1.3.8 Altmatriken<br />
1.3.8.1 Aufbewahrung und Fortführung<br />
Die von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften 83 im staatlichen Auf-<br />
trag vor dem 1. August 1938 zur Beurkundung der Eheschließungen und die vor dem 1. Jänner<br />
1939 zur Beurkundung der Geburten und Todesfälle geführten Personenstandsbücher sowie alle<br />
von den Verwaltungsbehörden vor dem 1. Jänner 1939 geführten Personenstandsbücher (Altmat-<br />
riken) sind von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sowie den Ver-<br />
waltungsbehörden, bei denen sie sich am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes befin-<br />
den, aufzubewahren und fortzuführen.<br />
Die Aufbewahrung und Fortführung der vor dem 1. August 1938 (1. Jänner 1939) geführten Mi-<br />
litär-Matrikel (Heeres-Matriken) obliegt dem Österreichischen Staatsarchiv 84 .<br />
Unter Fortführung ist die Eintragung von Vermerken auf Grund von Berichtigungen und Ände-<br />
rungen der ursprünglichen Eintragung zu verstehen.<br />
1.3.8.2 Ausstellung von Urkunden<br />
Die Verwahrer der Altmatriken haben auf Grund der Eintragungen in diesen Altmatriken Per-<br />
sonenstandsurkunden und Abschriften auszustellen. Für die Personenstandsurkunden sind die<br />
von den Personenstandsbehörden zu verwendenden Vordrucke zu benützen.<br />
Die ausgestellten Personenstandsurkunden und Abschriften aus den Altmatriken haben die<br />
gleiche Beweiskraft wie die von den Personenstandsbehörden ausgestellten Personenstandsur-<br />
kunden und Abschriften aus den Personenstandsbüchern.<br />
Die Organe der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften können für die<br />
Ausstellung von Personenstandsurkunden und Abschriften aus den Altmatriken sowie für die<br />
Einsichtgewährung in die Altmatriken Gebühren in der Höhe der Bundesverwaltungsabgaben<br />
(nicht Bundesabgabe) verlangen, die von den Personenstandsbehörden für gleichartige Amts-<br />
handlungen eingehoben werden.<br />
83 http://www.kirchen.net/links.htm<br />
84 http://www.oesta.gv.at/<br />
Seite - 38 -
1.4 Aufgaben der Personenstandsbehörden<br />
auf dem Gebiet des Eherechts<br />
1.4.1 Ermittlung der Ehefähigkeit<br />
Die Personenstandsbehörde hat vor der Eheschließung die Ehefähigkeit der Verlobten auf<br />
Grund der vorgelegten Urkunden in einer mündlichen Verhandlung zu ermitteln; hierüber ist eine<br />
Niederschrift 85 aufzunehmen. Die wichtigste Aufgabe des <strong>Standesbeamten</strong> vor einer Eheschlie-<br />
ßung ist also die Prüfung etwaiger Ehehindernisse. Welche Umstände Ehehindernisse darstel-<br />
len, d.h. die Eingehung einer Ehe verhindern, ergibt sich aus den Vorschriften des materiellen<br />
Eheschließungsrechts. 86 Das Personenstandsrecht enthält hierzu keine Bestimmungen.<br />
Das bis Ende 1983 vorgesehen gewesene Aufgebot (das war der Aushang an der Gemeinde-<br />
tafel) wurde durch ein Verfahren zur Ermittlung der Ehefähigkeit ersetzt. Es bedarf daher die<br />
Prüfung der Ehefähigkeit durch die Personenstandsbehörde besonderer Sorgfalt. In diesem Er-<br />
mittlungsverfahren ist die rechtliche Fähigkeit der Verlobten, eine Ehe miteinander eingehen zu<br />
können, auf Grund der Erklärungen der Verlobten und der vorzulegenden Urkunden, in der Regel<br />
in einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Für die Niederschrift und auch für die schriftliche<br />
Abgabe der Erklärungen der Verlobten ist der Vordruck nach der PStV zu verwenden.<br />
1.4.2 Erklärungen und Nachweise<br />
Die Verlobten haben die Erklärungen, vor allem Erklärungen über die Namensführung in der<br />
Ehe, bei der mündlichen Verhandlung abzugeben und die Urkunden vorzulegen, die für die Beur-<br />
teilung der Ehefähigkeit und für Eintragungen in den Personenstandsbüchern benötigt werden.<br />
Von der Vorlage von Urkunden kann abgesehen werden, wenn die Verlobten glaubhaft ma-<br />
chen, dass sie die Urkunden nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten beschaffen können,<br />
und wenn die Ehefähigkeit und die für Eintragungen notwendigen Angaben auf andere Weise<br />
ermittelt werden können.<br />
Die Beschaffung von Urkunden, zumal aus dem Ausland, ist manchmal mühevoll und vor allem<br />
mit einem entsprechenden Zeitaufwand verbunden. Es sind daher nur über das normale Ausmaß<br />
hinausgehende Schwierigkeiten gemeint. Von der Vorlage von Urkunden wird daher nicht abge-<br />
sehen werden können, wenn sich die Verlobten zu spät um die Beschaffung der Urkunden küm-<br />
mern. Sie müssen dann in Kauf nehmen, dass die Trauung erst stattfinden kann, wenn die erfor-<br />
derlichen Urkunden vorliegen 87 .<br />
85 Anlage 6 der PStV<br />
86 Ehegesetz (EheG) vom 6.7.1938 idgF.<br />
87 „Der Umstand, dass Ansuchen z.B. an jugoslawische Vertretungsbehörden für ihre Verfahren einen längeren Zeitraum<br />
(3-6 Monate) benötigen, stellt nach Ansicht der unterfertigenden Behörde keinen Grund dar, von erheblichen<br />
Seite - 39 -
Voraussetzung für den Verzicht ist daher auf jeden Fall, dass die Ehefähigkeit ermittelt wer-<br />
den kann. Dies wird möglich sein, wenn anstelle der fehlenden Urkunden sonstige Unterlagen<br />
vorgelegt werden, die die für die Ermittlung der Ehefähigkeit wichtigen Umstände erkennen las-<br />
sen. Nach den Bestimmungen des AVG kommt alles als Beweis in Betracht, was zur Feststellung<br />
des maßgeblichen Sachverhaltes geeignet ist, also auch die Angaben von Auskunftspersonen und<br />
der Verlobten selbst.<br />
Die Beurteilung, ob von der Vorlage von Urkunden abgesehen werden kann, obliegt der Per-<br />
sonenstandsbehörde. Aufgabe des Landeshauptmannes ist es, eine Rechtsauskunft zu ertei-<br />
len, wenn rechtliche Zweifel an der Ehefähigkeit der Verlobten bestehen, nicht aber, von der<br />
Vorlage von Urkunden zu befreien. Vermeint die Personenstandsbehörde, die Ehefähigkeit man-<br />
gels Urkunden 88 nicht beurteilen zu können, so hat sie, wenn trotzdem der Antrag auf Trauung<br />
gestellt wird, diesen Antrag bescheidmäßig abzuweisen.<br />
Verlobte, deren Personalstatut das österreichische Recht ist, haben zur Beurteilung ih-<br />
rer Ehefähigkeit folgende Urkunden 89 vorzulegen:<br />
wenn sie ledig und voll geschäftsfähig sind,<br />
1. eine Abschrift 90 aus dem Geburtenbuch, deren Ausstellung nicht länger als sechs<br />
Monate zurückliegt, oder eine einer solchen entsprechende Urkunde;<br />
2. den „Staatsbürgerschaftsnachweis“;<br />
3. den Nachweis des Hauptwohnsitzes (bzw. Einblick in das ZMR), gegebenenfalls<br />
auch des Aufenthaltes (z.B. Hotelbestätigung)<br />
wenn sie beschränkt geschäftsfähig oder nicht ehemündig sind, außerdem:<br />
1. männliche und weibliche Verlobte zwischen 16 und 18 Jahren den rechtskräftigen<br />
Gerichtsbeschluss über die Ehemündigerklärung;<br />
2. Verlobte unter 18 Jahren die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und der Erziehungsberechtigten<br />
oder den Gerichtsbeschluss, mit dem die Einwilligung ersetzt wird;<br />
3. Verlobte, denen ein Sachwalter nach § 273 ABGB bestellt worden ist, dessen Einwilligung<br />
91 oder den Gerichtsbeschluss, mit dem die Einwilligung ersetzt wird.<br />
Wenn die Verlobten bereits verheiratet waren, zusätzlich die Heiratsurkunden aller früheren<br />
Ehen und den Nachweis über deren (rechtskräftige) Auflösung oder Nichtigerklärung.<br />
Schwierigkeiten im Sinne des Personenstandsgesetzes zu sprechen.“ (Rechtsauskunft des Landeshauptmannes von<br />
Salzburg vom 28.12.1994)<br />
88 z.B. bei Fehlen eines rechtskräftigen Scheidungsurteils.<br />
89 Die allgemeinen Bestimmungen des § 47 AVG (z.B. Nachweis des Geburtsdatum und der österr. Staatsbürgerschaft<br />
durch den Reisepass) sind im Bereich des Personenstandswesens nicht anwendbar.<br />
90 der vielfach fälschlich verwendete Begriff „Auszug“ bezieht sich auf (mehrsprachige) Personenstandsurkunden im<br />
internationalen Format; siehe dazu die §§ 31 und 36 PStG.<br />
91 siehe Hintermüller in ÖStA 1986/42.<br />
Seite - 40 -
Wenn die Verlobten bereits in eingetragener Partnerschaft lebend waren, zusätzlich die Part-<br />
nerschaftsurkunden aller früheren Partnerschaften und den Nachweis über deren rechtskräftige<br />
Auflösung oder Nichtigerklärung.<br />
Verlobte, deren Personalstatut nicht das österreichische Recht ist (d.h. fremde Staats-<br />
angehörige), haben zusätzlich vorzulegen:<br />
1. Eine Bestätigung ihrer Ehefähigkeit (=Ehefähigkeitszeugnis), wenn sie nach dem<br />
Recht, das für sie nach ihrem Personalstatut maßgebend ist, eine solche Bestätigung<br />
erlangen können 92 ;<br />
2. Eine ausländische Eheentscheidung (Scheidung, Aufhebung, Nichtigerklärung) wird<br />
in Österreich anerkannt, wenn sie rechtskräftig ist und kein Grund zur Verweigerung<br />
der Anerkennung vorliegt. Bestehen jedoch Zweifel, so kann der Partei die Vorlage einer<br />
gerichtlichen Entscheidung über die Anerkennung aufgetragen werden.<br />
3. weitere Urkunden, die nach dem Recht, das für sie auf Grund ihres Personalstatutes<br />
maßgebend ist, für die Eheschließung erforderlich sind.<br />
Eine Pflicht zur Vorlage von Urkunden besteht nicht, wenn die zu beweisenden Tatsachen und<br />
Rechtsverhältnisse durch Einsicht in die bei der ermittelnden Behörde (Dienststelle) befindli-<br />
chen Personenstandsbücher und Sammelakten festgestellt werden können. Andererseits haben<br />
die Verlobten auf Verlangen weitere Urkunden oder Nachweise vorzulegen, wenn die allgemein<br />
verlangten Urkunden zur Beurteilung der Ehefähigkeit oder für Eintragungen in Personenstands-<br />
büchern im Zusammenhang mit der Eheschließung nicht ausreichen.<br />
Kann ein Verlobter ein Ehefähigkeitszeugnis nicht beibringen, obwohl er es erlangen könnte,<br />
so ist eine Rechtsauskunft des Landeshauptmannes einzuholen. Das gleiche gilt, wenn der<br />
Standesbeamte trotz der vorgelegten Urkunden rechtliche Zweifel an der Ehefähigkeit hat.<br />
Anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge<br />
(Genfer Konvention), nicht jedoch Personen, die um die Anerkennung als Flüchtling im Sinn dieser<br />
Vorschriften angesucht haben (sog. Asylwerber) sind von der Beibringung einer Bescheinigung<br />
ihrer Ehefähigkeit (Ehefähigkeitszeugnis) befreit. Asylwerber sind daher wie andere Ausländer<br />
unter den in § 21 Abs.2 PStV angeführten Voraussetzungen zur Vorlage eines Ehefähigkeits-<br />
zeugnisses anzuhalten 93 .<br />
Das beizubringende Ehefähigkeitszeugnis eines fremden Staatsangehörigen ersetzt übrigens<br />
nicht den gesonderten Nachweis der Staatsangehörigkeit, der Geburtsurkunde bzw. der Abschrift<br />
vom Geburtenbuch oder die allfällige Anerkennung einer im Ausland erfolgten Ehescheidung.<br />
Die Beweiswirkung des beigebrachten Ehefähigkeitszeugnisses wird erschüttert, wenn dem<br />
<strong>Standesbeamten</strong> Umstände bekannt werden, die die Richtigkeit des Ehefähigkeitszeugnisses in<br />
92 Von der Vorlage wird in solchen Fällen nur dann abgesehen werden können, wenn die Ausstellung eines Zeugnisses<br />
aus einem Grund verweigert wird, der dem österr. ordre public (§ 6 IPR-G) widerspricht.<br />
93 Erlass des BMI vom 15.6.1990, ÖStA 1990,57.<br />
Seite - 41 -
Frage stellen; dann ist die Ehefähigkeit des ausländischen Verlobten vom <strong>Standesbeamten</strong> um-<br />
fassend nachzuprüfen bzw. eine Rechtsauskunft des Landeshauptmannes einzuholen.<br />
1.4.3 Mündliche Verhandlung<br />
Bei der mündlichen Verhandlung müssen beide Verlobte anwesend sein. Kann einem Verlob-<br />
ten das Erscheinen zur mündlichen Verhandlung nicht zugemutet und die Ehefähigkeit der Verlob-<br />
ten auch in seiner Abwesenheit ermittelt werden, ist die mündliche Verhandlung ohne ihn durchzu-<br />
führen.<br />
Treffen die Voraussetzungen auf beide Verlobte zu, hat die mündliche Verhandlung zu entfal-<br />
len. In diesem Fall hat der betreffende Verlobte die für die Ermittlung der Ehefähigkeit und für<br />
Eintragungen in den Personenstandsbüchern erforderlichen Erklärungen schriftlich abzugeben.<br />
Die mündliche Verhandlung dient nicht nur der Prüfung der Ehefähigkeit der Verlobten und<br />
der Ermittlung der in die Personenstandsbücher einzutragenden Daten; sie ist auch zur Belehrung<br />
der Verlobten über mit der Eheschließung verbundene Rechtsfolgen und zur Beurkundung bzw.<br />
Beglaubigung damit im Zusammenhang stehender Erklärungen bestimmt.<br />
So sind die Verlobten insbesondere auf die Rechtsvorschriften hinsichtlich ihrer Namensfüh-<br />
rung nach der Eheschließung, vor allem auf Erklärungen, die nur vor oder bei der Eheschließung<br />
abgegeben werden können, hinzuweisen 94 .<br />
Weiter sind die Verlobten nach gemeinsamen vorehelichen Kindern zu befragen und auf die<br />
Voraussetzungen und Wirkungen der Legitimierung dieser Kinder, besonders hinsichtlich der<br />
Voraussetzung der Feststellung der Vaterschaft und der namensrechtlichen Wirkungen hinzuwei-<br />
sen. Da sich die namensrechtliche Wirkung der Legitimation auf weitere Personen erstrecken<br />
kann und in bestimmten Fällen die namensrechtliche Wirkung von der Zustimmung der betreffen-<br />
den Person abhängig ist, sind vom <strong>Standesbeamten</strong> auch darüber Fragen zu stellen.<br />
Schließlich gibt die mündliche Verhandlung auch Gelegenheit zur Erklärung der Einwilligung<br />
des gesetzlichen Vertreters und der Erziehungsberechtigten in die Eheschließung und der Errich-<br />
tung einer Urkunde darüber.<br />
Auf die Anwesenheit eines oder beider Verlobter bei der mündlichen Verhandlung wird nur<br />
verzichtet werden können, wenn dem oder den Verlobten das persönliche Erscheinen nicht zuge-<br />
mutet werden kann und die Ehefähigkeit beider Verlobter auch in seiner (ihrer) Abwesenheit<br />
feststellbar ist. Nicht zumutbar wird dem Verlobten das persönliche Erscheinen z.B. dann sein,<br />
94 Ein Aktenvermerk darüber (vor allem aber über die Möglichkeit der getrennten Namensführung in der Ehe) ist im<br />
Hinblick auf § 2 Abs. 1 Ziffer 7 NÄG sehr empfehlenswert.<br />
Seite - 42 -
wenn er sich für längere Zeit im Ausland oder doch in größerer Entfernung von dem Ort, wo die<br />
mündliche Verhandlung stattfindet, aufhält und erst zur Trauung anreist.<br />
1.4.4 Ehefähigkeitszeugnis<br />
Die Personenstandsbehörde hat einem österreichischen Staatsbürger (bzw. diesem Gleichge-<br />
stellten) auf Antrag 95 ein Ehefähigkeitszeugnis auszustellen 96 . Bestimmte Staaten verlangen eine<br />
sogenannte „Ledigkeitsbestätigung“, die es im österr. Recht allerdings nicht gibt. Mangels<br />
einer Meldepflicht des Personenstandes kann auch eine derartige Bestätigung von keiner österr.<br />
Behörde ausgestellt werden 97 . Auch in diesen Fällen ist daher, wenn sich die Notwendigkeit ergibt,<br />
ein Ehefähigkeitszeugnis für den oder die österr. Verlobten auszustellen.<br />
Vor der Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses ist die Ehefähigkeit des Antragstellers in<br />
gleicher Weise wie für das Eingehen einer Ehe im Inland zu ermitteln. 98 Besonders wichtig ist<br />
auch die Beratung in Bezug auf die namensrechtlichen Folgen einer Eheschließung im Ausland.<br />
Da die Eheschließenden vor einer ausländischen Personenstandsbehörde kaum die Möglichkeit<br />
haben, Erklärungen hinsichtlich der Namensführung abzugeben, sind diese bereits bei der<br />
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses in einer gesonderten Niederschrift (Anlage 15 der<br />
PStV) zu beurkunden, da namensrechtliche Erklärungen spätestens bei der Eheschließung<br />
abgegeben werden müssen. Nachträgliche Erklärungen zum Ehenamen (bzw. Bestimmung des<br />
Familiennamens der Kinder) sind nach österreichischem Recht nicht zulässig.<br />
Im Ehefähigkeitszeugnis ist zu bescheinigen, dass die darin angeführten Verlobten die Ehe<br />
schließen können. Das Ehefähigkeitszeugnis hat eine Gültigkeitsdauer von sechs Monaten,<br />
gerechnet vom Tag der Ausstellung an. Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer ist nicht zulässig;<br />
gegebenenfalls muss ein neues Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt werden. Die Ausstellung eines<br />
Ehefähigkeitszeugnisses ist in dem dafür vorgesehenen Verzeichnis zu vermerken 99 .<br />
Der Antragsteller hat für sich und den anderen Verlobten die gleichen Urkunden und<br />
Dokumente vorzulegen, wie sie für eine Eheschließung im Inland notwendig sind. Das Ehe-<br />
fähigkeitszeugnis soll den Verlobten in die Lage versetzen, im Ausland eine nicht nur der Form<br />
nach wirksame, sondern auch eine gültige Ehe zu schließen. Es muss daher vor Ausstellung des<br />
Ehefähigkeitszeugnisses die Ehefähigkeit in gleicher Weise geprüft werden wie für eine Ehe-<br />
schließung im Inland, also hinsichtlich beider Verlobter. Das gilt auch, wenn das Personalstatut<br />
des anderen Verlobten nicht das österreichische Recht ist. Die Ausstellung eines Ehefähigkeits-<br />
95<br />
Mit Deutschland, der Schweiz und Italien bestehen Übereinkommen über die amtswegige Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen.<br />
96<br />
Zur Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses ist das Formblatt gemäß BGBl. 1985/417 zu verwenden.<br />
97<br />
siehe auch Abschnitt 1.3.6.1 dieses <strong>Skriptum</strong>s<br />
98<br />
Aufnahme einer Niederschrift nach Anlage 6 der PStV oder Abgabe der notwendigen Erklärungen in schriftlicher<br />
Form.<br />
99 siehe Punkt 6.1.3 DA<br />
Seite - 43 -
zeugnisses muss selbst dann verweigert werden, wenn nur hinsichtlich des ausländischen Verlob-<br />
ten ein Ehehindernis festgestellt wurde.<br />
1.4.5 Zuständigkeit<br />
Die Ermittlung der Ehefähigkeit und die Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses obliegt der<br />
Personenstandsbehörde, in deren Amtsbereich einer der Verlobten seinen Wohnsitz 100 oder<br />
Aufenthalt 101 hat. Hat keiner der Verlobten seinen Wohnsitz oder Aufenthalt im Inland, ist die<br />
Personenstandsbehörde zuständig, in deren Amtsbereich einer der Verlobten seinen letzten<br />
Wohnsitz im Inland hatte. Ergibt sich auch danach keine Zuständigkeit, ist die Gemeinde Wien<br />
zuständig 102 .<br />
Die Ehe kann vor jeder Personenstandsbehörde 103 in Österreich vor dem zuständigen Stan-<br />
desbeamten geschlossen werden. Teilen die Verlobten im Ermittlungsverfahren mit, dass sie die<br />
Ehe vor einer anderen Personenstandsbehörde schließen wollen, sind die Unterlagen nach Durch-<br />
führung der Ermittlungen dieser Behörde abzutreten 104 . Die endgültige Beurteilung der Ehefähig-<br />
keit obliegt der Personenstandsbehörde, vor der die Ehe geschlossen werden soll.<br />
Reicht das Ermittlungsverfahren nach Ansicht der Behörde, vor der die Ehe geschlossen wer-<br />
den soll, zur Beurteilung der Ehefähigkeit nicht aus, so hat sie die notwendigen ergänzenden<br />
Ermittlungen durchzuführen oder durchführen zu lassen.<br />
Die Personenstandsbehörde, vor der die Ehe geschlossen werden soll, hat das Ergebnis des<br />
Ermittlungsverfahrens in einem Aktenvermerk festzuhalten. Sind keine Ehehindernisse festgestellt<br />
worden, so hat die Personenstandsbehörde dem Antrag auf Trauung oder Ausstellung des Ehefä-<br />
higkeitszeugnisses zu einem mit den Verlobten zu vereinbarenden Termin zu entsprechen. Soll<br />
die Trauung auf Wunsch der Verlobten erst später stattfinden, so sind sie darauf hinzuweisen,<br />
dass bei längerer Verzögerung 105 der Trauung ein neues Ermittlungsverfahren durchgeführt wer-<br />
den muss.<br />
1.4.6 Trauung<br />
Die Personenstandsbehörde hat die Trauung in einer Form und an einem Ort vorzunehmen,<br />
die der Bedeutung der Ehe entsprechen. Es obliegt der Personenstandsbehörde, den Ort zu<br />
bestimmen, wo eine Trauung stattfinden kann. Das wird in der Regel der allgemein für die Vor-<br />
nahme von Trauungen bestimmte Ort sein.<br />
100<br />
Definition siehe § 66 JN<br />
101<br />
Stets muss mit dem Aufenthalt auch eine Unterkunft verbunden sein (Kurnik in ÖStA 1995, Seite 34).<br />
102<br />
Standesamt Wien-Innere Stadt<br />
103<br />
Die Personenstandsbehörde, die das Ermittlungsverfahren nicht durchgeführt hat, bedarf daher keiner Ermächtigung.<br />
104<br />
Die Abtretung der Unterlagen ist in einem Verzeichnis zu vermerken. (P 6.3.2 DA)<br />
105<br />
Die Ermittlung der Ehefähigkeit gilt in der Regel für einen Zeitraum von 6 Monaten.<br />
Seite - 44 -
Weder dem Personenstandsrecht noch dem Eherecht kann ausdrücklich entnommen werden,<br />
ob eine Trauung öffentlich stattzufinden hat oder nicht. Es bleibt unter Berücksichtigung der räum-<br />
lichen Verhältnisse wohl der Entscheidung des <strong>Standesbeamten</strong> überlassen, ob er auf Wunsch<br />
der Eheschließenden anderen Personen, insbesondere Verwandten und Freunden der Brautleute,<br />
die Anwesenheit bei der Trauung gestattet. Unbeteiligten Zuschauern sollte der Standesbeamte<br />
den Zutritt zum Eheschließungsraum ausnahmslos verweigern 106 .<br />
Ausgefallene Sonderwünsche in Bezug auf den Trauungsort hat der Standesbeamte jeden-<br />
falls nicht zu erfüllen, da dies nicht mit der Form, die der Bedeutung der Ehe entspricht, in Ein-<br />
klang zu bringen ist 107 . Es kann jedoch von der Personenstandsbehörde auch für den Einzelfall<br />
ein anderer als der übliche Trauungsort bestimmt werden. Es soll z.B. nicht eine Trauung am<br />
Krankenbett ausgeschlossen sein, wenn ein Verlobter schwer erkrankt ist und die Trauung nicht<br />
aufgeschoben werden kann.<br />
Der Termin der Trauung ist zwischen den Verlobten und der Personenstandsbehörde zu ver-<br />
einbaren. Die Ehe kann jedoch nur geschlossen werden, wenn keine Ehehindernisse vorliegen.<br />
Beharren die Verlobten trotz Vorliegens eines Ehehindernisses auf Trauung, hat die Personen-<br />
standsbehörde den Antrag mit Bescheid abzuweisen.<br />
Der Standesbeamte hat sich vor der Trauung von der Persönlichkeit der Verlobten und der<br />
Trauzeugen (z.B. durch Vorlage der Reisepässe oder Personalausweise) zu überzeugen.<br />
Der Standesbeamte hat die Verlobten in Gegenwart von zwei Trauzeugen 108 einzeln und<br />
nacheinander zu fragen, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen, und nach Bejahung der<br />
Frage auszusprechen, dass sie rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Das Fehlen von Trauzeu-<br />
gen berührt allerdings ebenso wenig die Gültigkeit der Ehe wie der unterlassene Ausspruch des<br />
<strong>Standesbeamten</strong> 109 .<br />
Die Trauzeugen müssen mindestens 18 Jahre alt sein, die Sprache, in der die Trauung statt-<br />
findet, verstehen und dürfen nicht nach ihrer Körper- oder ihrer Geistesbeschaffenheit unvermö-<br />
gend sein, ein Zeugnis abzulegen 110 . Außer den Trauzeugen muss auch ein Dolmetscher anwe-<br />
send sein, wenn die Verlobten der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig sind. Ob ein<br />
Dolmetscher erforderlich ist, entscheidet der Standesbeamte, der die Amtshandlung vornimmt. Ein<br />
Dolmetscher ist auch hinzuzuziehen, wenn ein Beteiligter taub, stumm oder sonst am Sprechen<br />
verhindert und auch keine schriftliche Verständigung mit ihm möglich ist.<br />
106<br />
siehe dazu die Stellungnahme des BM für Justiz vom 25.1.1990 in ÖStA 1990,33<br />
107<br />
siehe dazu den Artikel von Hintermüller „Trauung auch unter Wasser ?“ in ÖStA 1985, 56<br />
108<br />
Zeugen können auch mit einem Verlobten oder dem <strong>Standesbeamten</strong> sowie auch untereinander verwandt oder<br />
verschwägert sein.<br />
109 2<br />
siehe Schwind, Ehegesetz , 132<br />
110<br />
Seit 1.9.1999 können aber auch blinde Personen als Trauzeugen fungieren; eine dementsprechende Änderung der<br />
PStV trat mit diesem Zeitpunkt in Kraft.<br />
Seite - 45 -
1.5 Sonstige Bestimmungen<br />
1.5.1 Sprache und Schrift<br />
Die Eintragung in die Personenstandsbücher und die Ausstellung von Urkunden hat in deut-<br />
scher Sprache 111 unter Verwendung lateinischer Schriftzeichen und arabischer Ziffern 112 zu<br />
erfolgen. Es besteht auch kein Anspruch auf Verwendung einer fremden Sprache im schriftlichen<br />
Verkehr mit der Personenstandsbehörde 113 .<br />
Bestimmungen in zwischenstaatlichen Übereinkommen über die Ausstellung mehrsprachiger<br />
Urkunden und die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Rechtsstellung von Volksgrup-<br />
pen 114 in Österreich (Volksgruppengesetz) bleiben unberührt.<br />
1.5.2 Frühere Familiennamen<br />
In den Vordrucken der Personenstandsbücher ist vorgesehen, dass außer den Familiennamen<br />
der Eltern des Kindes, der Verlobten und des Verstorbenen, wenn dies Doppelnamen im Sinne<br />
des § 93 ABGB sind, auch der „gemeinsame Familienname“ dieser Personen anzuführen ist.<br />
1. In der Geburtsanzeige und im Geburtenbuch ist der „gemeinsame Familienname“<br />
des Vaters oder der Mutter des Kindes anzuführen, wenn er für die Namensführung<br />
des Kindes von Bedeutung ist. Ein Doppelname nach § 93 Abs.2 letzter Satz ABGB<br />
und § 72a PStG ist jedoch nicht auf das Kind übertragbar.<br />
2. In der Niederschrift (den Erklärungen) zur Ermittlung der Ehefähigkeit und im Ehebuch<br />
ist der „gemeinsame Familienname“ der Verlobten anzuführen, wenn einer der<br />
beiden einen Doppelnamen führt.<br />
3. In der Todesanzeige und im Sterbebuch sowie im Buch für Todeserklärungen ist der<br />
„gemeinsame Familienname“ im Falle eines Doppelnamens des Verstorbenen anzuführen.<br />
Unter Umständen ist auch der Geschlechtsname anzuführen. Geschlechtsname ist der Fami-<br />
lienname, den eine Person zu führen hat, wenn von den namensrechtlichen Wirkungen einer Ehe<br />
abgesehen wird.<br />
Zusammenfassend: Ein Doppelname nach österreichischem Recht ist immer anzuführen,<br />
wenn eine Verpflichtung zu dessen Führung besteht 115 ; weiter ist anzuführen, welcher Bestand-<br />
teil des Doppelnamens „gemeinsamer Familienname“ ist.<br />
111<br />
Nach Art. 8 (1) B-VG ist die deutsche Sprache, von Minderheitenrechten abgesehen, die Staatssprache der Republik.<br />
112<br />
Zur Bezeichnung von Einträgen in einer kirchlichen Altmatrik sind weiterhin röm. Ziffern zu verwenden.<br />
113<br />
VwGH 23.4.1990, 87/04/0223 u.a.<br />
114<br />
siehe Punkt 34.3 DA.<br />
115<br />
Doppelnamen nach § 93 ABGB alte Fassung (d.h. bei Eheschließung vor dem 1.5.1995) können weiter geführt<br />
werden, es besteht jedoch keine Pflicht zur Führung; eine Eintragung in Personenstandsurkunden ist jedoch weiterhin<br />
ausgeschlossen.<br />
Seite - 46 -
1.5.3 Rechtsauskunft des Landeshauptmannes<br />
Die Personenstandsbehörde hat in einem Fall mit Auslandsberührung vor der Beurkundung<br />
eine Rechtsauskunft des Landeshauptmannes einzuholen. Das kann unterbleiben, wenn über die<br />
zu beurteilende Rechtsfrage kein Zweifel besteht oder wenn die damit verbundene Verzögerung<br />
wichtige Interessen der Person, auf die sich die Eintragung bezieht, beeinträchtigen würde.<br />
Eine Rechtsauskunft des Landeshauptmannes ist auch einzuholen, wenn sich in dem der Ehe-<br />
schließung oder der Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses vorausgehenden Ermittlungsverfah-<br />
ren Zweifel an der Ehefähigkeit der Verlobten ergeben. Jedenfalls ist eine Rechtsauskunft einzu-<br />
holen, wenn ein Verlobter eine Bestätigung seiner Ehefähigkeit (Ehefähigkeitszeugnis) nicht bei-<br />
bringt, obwohl er eine solche von der zuständigen Behörde des Staates, dem er angehört, erlan-<br />
gen könnte.<br />
Die Form der Einholung der Rechtsauskunft ist nicht festgelegt; sie wird in dringenden Fällen<br />
nicht nur schriftlich sondern auch telefonisch oder auf andere technisch mögliche Weise erfolgen<br />
können. Die Rechtsauskunft ist eine Auskunft, bindet daher die Behörde, an die sie erteilt wird,<br />
nicht. Es kann aber dem Landeshauptmann nicht verwehrt werden, eine Weisung zu erteilen. Es<br />
würde aber dem Sinn dieser Bestimmung widersprechen, wenn von dem Weisungsrecht übermä-<br />
ßig Gebrauch gemacht würde.<br />
1.5.4 Namensfestsetzung<br />
Kann die Herkunft und der Name einer Person nicht ermittelt werden, hat der Landeshaupt-<br />
mann einen gebräuchlichen Familiennamen und Vornamen festzusetzen. Ist die Person unter<br />
einem Namen bekannt, ist dieser auf Antrag als Familienname festzusetzen.<br />
Zuständig ist der Landeshauptmann, in dessen Amtsbereich die Person ihren gewöhnlichen<br />
Aufenthalt hat. Hat sie keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, ist der Landeshauptmann von<br />
Wien zuständig. Gegen den Bescheid des Landeshauptmannes steht kein ordentliches Rechtsmit-<br />
tel zu.<br />
Wird später die Herkunft oder der Name einer Person ermittelt, so ist die Festsetzung vom<br />
Landeshauptmann zu Gänze zu widerrufen, da die Voraussetzung für die getroffene Maßnahme<br />
weggefallen ist. Die Eintragung des Personenstandsfalles hat dann auf die sonst übliche Weise<br />
(allenfalls von Amts wegen) zu erfolgen. Fehlen einzelne Daten, so muss eine unvollständige<br />
Eintragung erfolgen.<br />
1.5.5 Form der Urkunden<br />
Die Personenstandsbehörde hat die von ihr ausgestellten Urkunden (Ausnahme Partner-<br />
schaftsurkunde) mit ihrer Behördenbezeichnung, dem Tag der Ausstellung, der Unterschrift<br />
Seite - 47 -
des <strong>Standesbeamten</strong> 116 und dem Amtssiegel 117 zu versehen. Das Amtssiegel ist bei Personen-<br />
standsurkunden im Feld, in dem der Standesbeamte unterschreibt, bei Abschriften neben oder<br />
über der Unterschrift des <strong>Standesbeamten</strong> anzubringen.<br />
Die Urkunden sind auf Verlangen von der Bezirksverwaltungsbehörde und dem Landes-<br />
hauptmann zu beglaubigen. Rechtsvorschriften über allfällige weitere Beglaubigungen bleiben<br />
unberührt. Bei der Beglaubigung einer Urkunde durch die Bezirksverwaltungsbehörde oder der<br />
Überbeglaubigung durch den Landeshauptmann ist die Echtheit der Unterschrift des Standesbe-<br />
amten und des Amtssiegels der Behörde, die die Urkunde ausgestellt oder beglaubigt hat sowie<br />
die Eigenschaft des Unterzeichners zu bestätigen.<br />
Die Beglaubigung von Urkunden ist für deren bestimmungsgemäßen Gebrauch in einigen<br />
Staaten (vornehmlich in Mittel- und Südamerika) auf Grund bestehender Vorschriften oder Ge-<br />
wohnheiten erforderlich. Mit verschiedenen Staaten sind jedoch zwei- oder mehrseitige Verträge<br />
in Kraft, wonach die Urkunden, die in diesen Staaten verwendet werden sollen, keiner Beglaubi-<br />
gung bedürfen. 118<br />
Die Personenstandsbehörde hat daher der Bezirksverwaltungsbehörde und die Bezirksverwal-<br />
tungsbehörde dem Landeshauptmann mitzuteilen, welche Personen zur Ausstellung oder zur<br />
Beglaubigung von Urkunden befugt sind und Unterschriftsproben dieser Personen zu übermit-<br />
teln 119 .<br />
1.5.6 Befugnis zur Beurkundung und Beglaubigung<br />
Jeder Standesbeamte (gleichgültig, ob er zur wirksamen Entgegennahme der Erklärung nach<br />
§ 54 PStG zuständig ist) hat zu beurkunden und zu beglaubigen 120 :<br />
1. die Erklärung über die Anerkennung der Vaterschaft und damit im Zusammenhang<br />
stehende Erklärungen (z.B. Anerkennung nach § 163e ABGB und die Zustimmung der<br />
Mutter und des Jugendwohlfahrtsträgers oder Anerkennung zu einem ausländischen<br />
Kind);<br />
2. die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und der Erziehungsberechtigten zur Eheschließung<br />
einer Person, die nicht voll geschäftsfähig ist;<br />
3. die Erklärungen der Verlobten über die Bestimmung ihres nach der Eheschließung zu<br />
führenden gemeinsamen Familiennamens oder die Weiterführung des bisherigen Familiennamens<br />
durch einen Ehegatten und über die Voran- und Nachstellung des bisherigen<br />
Familiennamens;<br />
116<br />
siehe dazu Zeyringer in ÖStA 1992,36, der eine Fertigungsklausel „Für den Bürgermeister“ ablehnt, sowie den<br />
Erlass des BMI vom 22.12.1992, ÖStA 1993,9.<br />
117<br />
Die Pflicht zur Beifügung eines Amtssiegels gilt sinngemäß auch für Altmatrikenführer (Pfarrsiegel usw.). Zur Verwendung<br />
des Amtssiegels siehe auch Kraner in ÖStA 1993,46.<br />
118<br />
Staatenübersicht bei Zeyringer, Personenstandsrecht (Abschnitt III A2) sowie im Internet unter<br />
www.standesbeamte.at im „Download-Archiv“.<br />
119<br />
siehe Punkt 35.2 DA<br />
120<br />
zu verwenden sind die Vordrucke nach den Anlagen 13 bis 18 der PStV<br />
Seite - 48 -
4. die Erklärungen der Verlobten über die Bestimmung des Familiennamens der aus der<br />
Ehe stammenden Kinder;<br />
5. die Erklärung, durch die ein Ehegatte, dessen Ehe aufgelöst ist, einen früheren Familiennamen<br />
wieder annimmt;<br />
6. Erklärungen, die für den Eintritt der namensrechtlicher Wirkungen bei einem Kind oder<br />
Ehegatten in bestimmten Fällen erforderlich sind;<br />
7. sonstige Erklärungen, die für die vollständige Eintragung eines Personenstandsfalles<br />
erforderlich sind 121 .<br />
Die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland haben die Anerkennung der Vater-<br />
schaft, wenn der Anerkennende oder das Kind österreichische Staatsbürger sind, zu beurkunden<br />
und allenfalls zu beglaubigen, die übrigen angeführten Erklärungen nur zu beglaubigen.<br />
Die in anderen Rechtsvorschriften eingeräumte Befugnisse für die Gerichte, die Verwal-<br />
tungsbehörden und die Notare zur Beurkundung und Beglaubigung der angeführten Erklärungen<br />
bleiben unberührt.<br />
Das Recht und die Pflicht auf Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen stehen , wie<br />
schon erwähnt, j e d e m <strong>Standesbeamten</strong> zu, nicht nur jenem, der die Erklärung wirksam entge-<br />
gennimmt oder für dessen Amtshandlungen die Erklärung sonst von Bedeutung ist. Ist eine Erklä-<br />
rung in ein Personenstandsbuch einzutragen, hat der Erklärende, wenn er dazu in der Lage ist, die<br />
für die Eintragung benötigten Urkunden und sonstigen Nachweise vorzulegen.<br />
1.5.7 Entgegennahme von Erklärungen<br />
Werden die Erklärungen nicht vor dem zuständigen <strong>Standesbeamten</strong> abgegeben 122 , sind sie<br />
diesem in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zu übermitteln.<br />
Zuständig zur wirksamen Entgegennahme ist bei<br />
� Anerkennung der Vaterschaft die Personenstandsbehörde, die das Geburtenbuch des<br />
Kindes führt;<br />
� Ehenamensbestimmung (Dop- die Personenstandsbehörde, in deren Ehebuch die Ehe<br />
pelname)<br />
eingetragen ist;<br />
� Bestimmung des Familienamens die Personenstandsbehörde, in deren Ehebuch die Ehe<br />
der ehelichen Kinder bei getrennter<br />
Namensführung der Ehegatten<br />
eingetragen ist;<br />
� Wiederannahme eines früheren die Personenstandsbehörde, in deren Ehebuch die<br />
Familiennamens<br />
(letzte) Ehe eingetragen ist;<br />
121 z.B. Anerkennung der Mutterschaft, Bestimmung des Familiennamens des Kindes.<br />
122 zu Namensbestimmungserklärungen anlässlich der Eheschließung von österr. Staatsbürgern im Ausland siehe<br />
Kurnik in ÖStA 2/1998.<br />
Seite - 49 -
� Erklärungen über namensrechtliche<br />
Wirkungen bei einem Kind<br />
oder Ehegatten in bestimmten<br />
Fällen<br />
a) Erklärungen eines legitimierten oder an Kindesstatt<br />
angenommenen Kindes sowie dessen Nachkommen<br />
die Personenstandsbehörde, in deren Geburtenbuch die<br />
Geburt des Kindes bzw. des Nachkommen des Kindes<br />
eingetragen ist;<br />
b) Erklärungen eines Ehegatten eines legitimierten oder<br />
an Kindesstatt angenommenen Kindes oder dessen<br />
Nachkommen die Personenstandsbehörde, in deren<br />
Ehebuch die Eheschließung eingetragen ist.<br />
Ist die Geburt oder die Eheschließung nicht in einem inländischen Geburtenbuch oder Ehe-<br />
buch eingetragen, ist die Gemeinde Wien 123 zuständig.<br />
Die Übermittlung obliegt, sofern nicht anderes angeordnet ist, der Person, die die Erklärung<br />
abgibt. Die Personenstandsbehörden und die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland<br />
haben Ausfertigungen der von ihnen beurkundeten oder ihnen hiefür übergebene beglaubigte<br />
Erklärungen der zuständigen Personenstandsbehörde zu übermitteln.<br />
Die zur Entgegennahme einer Erklärung über Anerkennung der Vaterschaft zuständige Per-<br />
sonenstandsbehörde hat die Widerspruchsberechtigten vom Anerkenntnis zu verständigen und<br />
auf ihr Widerspruchsrecht hinzuweisen 124 .<br />
Für die Wirksamkeit der Erklärung ist ein Tätigwerden des <strong>Standesbeamten</strong> nicht erforderlich;<br />
er muss jedoch im allgemeinen die wirksam gewordene Erklärung in dem von ihm geführten Per-<br />
sonenstandsbuch vermerken. Ist dies nicht möglich, so muss zumindest das Einlangen der Erklä-<br />
rung festgehalten (Einlaufstempel) und die Entgegennahme bestätigt werden. Sowohl der Eintra-<br />
gung eines Vermerks wie der Ausstellung einer Bestätigung muss die Prüfung vorangehen, ob<br />
die Wirksamkeitsvoraussetzungen im materiellrechtlichen und im formellen Sinn erfüllt sind.<br />
Sind die Wirksamkeitsvoraussetzungen nach Ansicht der Personenstandsbehörde nicht gege-<br />
ben, so muss die Eintragung eines Vermerkes oder die Ausstellung einer Bestätigung gegebenen-<br />
falls mit Bescheid abgelehnt werden.<br />
1.5.8 Bestätigungen<br />
Die Personenstandsbehörde hat auf Verlangen Bestätigungen auszustellen, wenn ein recht-<br />
liches Interesse daran glaubhaft gemacht wird und sich der zu bestätigende Sachverhalt aus den<br />
der Personenstandsbehörde zur Verfügung stehenden Unterlagen ergibt.<br />
Die Personenstandsbehörde hat derzeit regelmäßig Bestätigungen über die Geburt und den<br />
Tod einer Person zur Vorlage bei Trägern der Sozialversicherung auszustellen.<br />
123 Standesamt Wien-Innere Stadt<br />
124 Eine Verständigung (z.B. der Mutter) durch die nicht zur wirksamen Entgegennahme zuständige Personenstandsbehörde<br />
ist rechtlich völlig wirkungslos und hat daher zu unterbleiben.<br />
Seite - 50 -
Die früher übliche Ausstellung einer Geburtsbestätigung zur Vorlage bei den Finanzämtern ist<br />
durch Abschaffung der Geburtenbeihilfe mit 1.1.1997 hinfällig. Zur Beantragung der Familien-<br />
beihilfe ist daher eine Geburtsurkunde als Nachweis der Geburt des Kindes vorzulegen<br />
Die Bestätigung hat alle für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch notwendigen Angaben,<br />
soweit sie sich aus den der Personenstandsbehörde zur Verfügung stehenden Unterlagen erge-<br />
ben, zu enthalten; weiter einen Hinweis auf den ausschließlichen Verwendungszweck der Bestä-<br />
tigung und über deren allfällige Befreiung von Verwaltungsabgaben und Gebühren.<br />
Bestätigungen (für Sozialversicherungsträger ausgenommen) sollen nur ausgestellt werden,<br />
wenn ein rechtliches Interesse daran besteht, einen Sachverhalt bestätigt zu erhalten, der sich<br />
aus einer Personenstandsurkunde nicht, zumindest nicht mit der gebotenen Deutlichkeit ergibt.<br />
1.5.9 Echtheit von Unterschriften<br />
Schriftliche Anbringen an die Personenstandsbehörde bedürfen, soweit für sie nicht besondere<br />
Formerfordernisse nach den Bestimmungen des Personenstandsgesetzes oder nach anderen<br />
Rechtsvorschriften bestehen, keiner Beglaubigung der Unterschrift. Hat der Standesbeamte<br />
jedoch Zweifel an der Echtheit der Unterschrift und erfordert die Wichtigkeit der Anzeige oder des<br />
sonstigen Anbringens eine Klärung, kann er eine Beglaubigung der Unterschrift verlangen (z.B.<br />
bei der Beantragung einer Abschrift vom Geburtenbuch über eine „Inkognito-Adoption“), wenn der<br />
Zweifel nicht anders behoben werden kann.<br />
Im Interesse der Personen, die die Tätigkeit der Personenstandsbehörden in Anspruch neh-<br />
men, soll auf jede unnötige Formalisierung verzichtet werden. So soll etwa die Ausstellung eines<br />
Ehefähigkeitszeugnisses auch schriftlich beantragt werden können, ohne dass die Unterschrift<br />
auf dem Antrag beglaubigt werden muss.<br />
1.5.10 Strafen<br />
Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-<br />
digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet,<br />
1. wer einer Pflicht zur Anzeige einer Geburt oder des Todes nicht nachkommt oder in<br />
einer Anzeige, einem Antrag, einer Erklärung oder Auskunft einer Verwaltungsbehörde,<br />
die mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betraut ist, vorsätzlich unwahre<br />
oder unvollständige Angaben macht,<br />
2. wer eine Personenstandsurkunde oder eine Abschrift eines Personenstandsbuches<br />
gegenüber einer Verwaltungsbehörde zum Beweis seines derzeitigen Personenstandes<br />
verwendet, obwohl ihm bekannt ist oder bekannt sein müsste, die die Urkunde<br />
bereits zur Zeit ihrer Ausstellung unrichtig war oder nach ihrer Ausstellung unrichtig<br />
geworden ist.<br />
Seite - 51 -
Eine Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis € 218,00 ggf. auch mit dem Verfall der Ur-<br />
kunde zu bestrafen. Bezieht sich die Urkunde unmittelbar auf den Täter, ist der Verfall der Urkun-<br />
de auch dann zu verfügen, wenn sie nicht in dessen Eigentum steht.<br />
Die Ahndung von Verwaltungsübertretungen obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. Örtlich<br />
zuständig ist die Behörde, in deren Sprengel die Verwaltungsübertretung begangen worden ist.<br />
1.6 Behörden<br />
1.6.1 Aufgaben der Gemeinde<br />
Die in diesem Bundesgesetz geregelten Personenstandsangelegenheiten einschließlich des<br />
Matrikenwesens sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, von den Ge-<br />
meinden/Bezirksverwaltungsbehörden im übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen.<br />
„Übertragener Wirkungsbereich“ bedeutet, dass die Personenstandsangelegenheiten zwar von<br />
den Gemeinden/Bezirksverwaltungsbehörden zu besorgen sind, jedoch im Auftrag und nach den<br />
Weisungen des Bundes. 125<br />
Unter „Personenstandsbehörde“ ist die Personenstandsbehörde erster Instanz (Standesamt<br />
bzw. Standesamtsverband/Bezirksverwaltungsbehörde), unter „Standesbeamter“ das Organ der<br />
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes zu verstehen, das die Aufgaben besorgt, oder der von<br />
dem Organ dazu herangezogene Organwalter.<br />
Organ der Gemeinde ist der Bürgermeister, da dieser die Angelegenheiten des übertragenen<br />
Wirkungsbereichs zu besorgen hat 126 , Organ des Gemeindeverbandes (Standesamtsverbandes)<br />
der Verbandsobmann. 127<br />
Der Bürgermeister (Verbandsobmann) hat sich bei Besorgung der Aufgaben eines Gemeinde-<br />
bediensteten, der die für die Besorgung der Aufgaben notwendigen Fachkenntnisse besitzt und<br />
die nach landesgesetzlichen Vorschriften erforderlichen <strong>Dienstprüfung</strong>en abgelegt hat, zu<br />
bedienen, wenn es nicht selbst fachkundig und geprüft ist. <strong>Dienstprüfung</strong>en müssen daher nur<br />
dann als Voraussetzung der Ausübung der von den Gemeinden (Standesamtsverbänden) zu<br />
besorgenden Personenstandsangelegenheiten abgelegt worden sein, wenn die landesgesetzli-<br />
chen Vorschriften solche <strong>Dienstprüfung</strong>en vorsehen (bis auf Burgenland, Tirol, Vorarlberg und<br />
Wien in allen Bundesländern).<br />
„Herangezogen“ wird ein Organwalter bereits dadurch, dass das Organ (Der Bürgermeister<br />
bzw. Verbandsobmann) ihm die Besorgung der Personenstandsangelegenheiten aufträgt, einer<br />
125 Zeyringer in ÖStA 1994,46<br />
126 Art 119 Abs. 2 B-VG<br />
127 Art 116a Abs. 4 B-VG<br />
Seite - 52 -
förmlichen Bestellung zum <strong>Standesbeamten</strong> bedarf es dazu, zumindest aus der Sicht des PStG,<br />
nicht.<br />
Standesbeamte haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und ihre Vertretung zu<br />
veranlassen, wenn einer der in § 7 Abs.1 AVG angeführten Befangenheitsgründe vorliegt. Von<br />
§ 7 Abs. 2 AVG kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Amtshandlung keinen Aufschub<br />
verträgt (im Zusammenhang mit einer Trauung z.B., wenn ein Verlobter lebensgefährlich erkrankt<br />
ist oder wenn der unbefangene Standesbeamte, der die Trauung vornehmen sollte, daran aus<br />
unvorhergesehenen Gründen gehindert ist und eine Verschiebung der Trauung schwerwiegende<br />
Nachteile für die Verlobten mit sich brächte) und wenn die Amtshandlung nicht sogleich durch<br />
einen anderen <strong>Standesbeamten</strong> vorgenommen werden kann. 128<br />
Die Gemeinden (Standesamtsverbände) haben den Aufwand zu tragen, der ihnen aus der<br />
Besorgung der Aufgaben erwächst. Ihnen fließen die in Besorgung dieser Aufgaben einzuheben-<br />
den Verwaltungsabgaben zu.<br />
1.6.2 Standesamtsverbände<br />
Gemeinden können zur Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben durch Verordnung des<br />
Landeshauptmannes zu einem Gemeindeverband (Standesamtsverband) mit selbständiger<br />
Rechtspersönlichkeit vereinigt werden, wenn dadurch eine bessere Führung der Verwaltungsge-<br />
schäfte gewährleistet ist. 129 Mit der Bildung eines Standesamtsverbandes wird die Organzustän-<br />
digkeit seiner Organe im Sinn von Art. 83 Abs. 2 B-VG und gleichzeitig die Unzuständigkeit der<br />
bisher zuständigen Gemeindeorgane bewirkt; Rechtsakte (z.B. die bescheidmäßige Ablehnung<br />
der Vornahme einer Eheschließung) des Gemeindeverbandes sind diesem und nicht den betei-<br />
ligten Gemeinden zuzurechnen.<br />
Zur Regelung der Organisation von Standesamtsverbänden ist die Landesgesetzgebung<br />
zuständig (Art. 116a Abs. 4 B-VG). Die relevanten Bestimmungen finden sich in den Gemeinde-<br />
ordnungen (Gemeindegesetzen) 130 bzw. in besonderen Gemeindeverbandsgesetzen. 131 Sie sehen<br />
regelmäßig mindestens eine Verbandsversammlung (Verbandsausschuss) als kollegiales Or-<br />
gan, in dem Vertreter der beteiligten Gemeinden zusammengeschlossen sind, und einen Ver-<br />
bandsobmann als von der Verbandsversammlung zu wählendes monokratisches Organ vor.<br />
Generelle Angelegenheiten (Satzung, Geschäftsordnung, Tarifbestimmungen usw.) sind von der<br />
Verbandsversammlung zu beschließen. Bescheide sind vom Verbandsobmann zu erlassen.<br />
Soweit nicht eine eigene „Geschäftsstelle“ zu errichten ist, wird häufig eine Gemeinde als „ver-<br />
bandsführende Gemeinde“ mit der Führung der Verwaltungsgeschäfte des Verbandes betraut; die<br />
128 siehe Punkt 38a DA sowie den Erlass des BMI vom 8.6.1988, ÖStA 1988,75<br />
129 Art. 116a B-VG. Automatisch wird dadurch auch ein “Staatsbürgerschaftsverband“ gemäß § 47 StbG 1985 gebildet,<br />
auf den in organisatorischer Hinsicht die gleichen Regeln anzuwenden sind.<br />
130 §§ ff 14 Tiroler GemO, §§ 93 ff Vorarlberger GemeindeG.<br />
131 Salzburger GemeindeverbändeG, LGBl 105/1986 idF 8/1998.<br />
Seite - 53 -
Tätigkeit des Gemeindeamtes ist dann insoweit den Verbandsorganen und über diese dem Stan-<br />
desamtsverband zuzurechnen.<br />
Standesamtsverbände bilden Körperschaften des öffentlichen Rechts, nicht aber „Ge-<br />
bietskörperschaften“. Ihre Organe sind nicht „Organe der Gemeinden“ (Art. 22 B-VG). 132<br />
Vor der Erlassung der Verordnung des Landeshauptmannes zur Bildung von Standesamts-<br />
verbänden sind die beteiligten Gemeinden anzuhören.<br />
Die Verordnung hat jedenfalls zu bestimmen<br />
1. die verbandsangehörigen Gemeinden;<br />
2. die Bezeichnung des Standesamtsverbandes unter Hinweis auf seinen Sitz;<br />
3. den Sitz des Standesamtsverbandes.<br />
Werden Gemeinden, die nicht demselben Verwaltungsbezirk angehören, zu einem Standes-<br />
amtsverband vereinigt, ist in der Verordnung zu bestimmen, welcher Bezirksverwaltungsbehörde<br />
die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz obliegen. Als Tag des Inkrafttretens der Verordnung ist<br />
der Beginn eines Kalenderjahres festzulegen. Dem Standesamtsverband obliegt die Fortführung<br />
der bis zum Inkrafttreten der Verordnung von den Gemeinden geführten Personenstandsbücher.<br />
1.6.3 Auflösung und Umbildung<br />
Der Landeshauptmann kann durch Verordnung die Auflösung eines Standesamtsverbandes<br />
oder die Aufnahme (das Ausscheiden) einer Gemeinde in einen (aus einem) Standesamtsverband<br />
anordnen, wenn dadurch eine bessere Führung der Verwaltungsgeschäfte gewährleistet ist. In der<br />
Verordnung ist die Fortführung der vom früheren Standesamtsverband geführten Personen-<br />
standsbücher zu regeln. Werden Gemeinden in mehrere Gemeinden geteilt, hat der Landes-<br />
hauptmann durch Verordnung die Fortführung der von den früheren Gemeinden geführten Perso-<br />
nenstandsbücher zu regeln.<br />
1.6.4 Amtshilfe, Überprüfung, Rechtszug<br />
Die Organe der Standesamtsverbände sind zur gegenseitigen Hilfeleistung bei Besorgung<br />
der sich aus diesem Bundesgesetz ergebenden Aufgaben verpflichtet. Das gleiche gilt für die<br />
Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden.<br />
Die Bezirksverwaltungsbehörde 133 und der Landeshauptmann (Amt der Landesregierung) ha-<br />
ben durch regelmäßige Überprüfung besonders die ordnungsgemäße Führung und Fortführung<br />
der Personenstandsbücher und Sammelakten sicherzustellen.<br />
132 Amtshilfepflichten wurden daher mangels einer Bestimmung im B-VG ausdrücklich durch § 65 PStG angeordnet.<br />
Seite - 54 -
Es liegt im Wesen der Tätigkeit des <strong>Standesbeamten</strong>, dass nicht die Erlassung von Beschei-<br />
den, sondern die Errichtung von Urkunden, die Vornahme von Trauungen oder die Entgegennah-<br />
me von Erklärungen im Vordergrund stehen. Mit der Vornahme der beantragten oder von Amts<br />
wegen vorgenommenen Amtshandlung ist das Verfahren beendet und ein allenfalls gestellter<br />
Antrag erledigt. Zur Erlassung von Bescheiden wird es nur dann kommen, wenn der Standesbe-<br />
amte glaubt, dem Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung mangels der gesetzlichen Vorausset-<br />
zungen nicht nachkommen zu können. In solchen Fällen ist er aber verpflichtet, einen Bescheid zu<br />
erlassen 134 .<br />
Der Rechtszug geht auch unmittelbar von der Personenstandsbehörde an den Landes-<br />
hauptmann. Der Bezirksverwaltungsbehörde käme eine Zuständigkeit zum Einschreiten als Beru-<br />
fungsinstanz in Personenstandsangelegenheiten nämlich nur dann zu, wenn ihr eine solche Zu-<br />
ständigkeit ausdrücklich eingeräumt worden wäre 135 .<br />
Gegen Bescheide, die der Landeshauptmann als erste Instanz erlässt, steht ein ordentliches<br />
Rechtsmittel nicht zu. Gegen einen Bescheid des Landeshauptmannes kann nur die Beschwer-<br />
de an den Verwaltungsgerichtshof oder Verfassungsgerichtshof ergriffen werden.<br />
1.7 Übergangs- und Schlussbestimmungen<br />
Die nach dem Personenstandsgesetz 1937 in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes<br />
(PStG 1983, in Kraft ab 1.1.1984) geltenden Fassung geführten Personenstandsbücher (Erstbü-<br />
cher) sind Personenstandsbücher im Sinne dieses Bundesgesetzes.<br />
Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die ihr von der Personenstandsbehörde übermittelten<br />
Zweitbücher fortzuführen und dauernd aufzubewahren. Ist ein Erstbuch (Zweitbuch) in Verlust<br />
geraten, hat die Personenstandsbehörde ein neues Erstbuch (Zweitbuch) anzulegen. Ist sowohl<br />
das Erstbuch als auch das Zweitbuch, in denen ein Personenstandsfall eingetragen war, in Verlust<br />
geraten, hat die örtlich zuständige Personenstandsbehörde den Fall auf Antrag oder von Amts<br />
wegen nach Feststellung des Sachverhaltes in das Personenstandsbuch einzutragen, das zur Zeit<br />
der Neueintragung geführt wird.<br />
Die nach dem Personenstandsgesetz 1937 für mehrere Gemeinden gebildeten Standesamts-<br />
bezirke sind Standesamtsverbände im Sinne des Personenstandsgesetzes 1983. Mit dem Inkraft-<br />
treten dieses Bundesgesetzes (1. Jänner 1984) verlieren alle Rechtsvorschriften, die Gegenstän-<br />
de betreffen, die in diesem Bundesgesetz geregelt sind, ihre Wirksamkeit.<br />
133 Die Bezirksverwaltungsbehörde ist zwar nicht „instanzmäßig übergeordnete Behörde“ aber „sachlich in Betracht<br />
kommende Oberbehörde“ (siehe auch § 73 Abs. 2 AVG).<br />
134 Zeyringer in ÖStA 1994,48<br />
135 Erkenntnis des VwGH vom 30.10.1981<br />
Seite - 55 -
1.7.1 Zu den Anlagen (Vordrucken) der Personenstandsverordnung<br />
Bei der Auswahl der Materialien (Papiere, Farbbänder, Schreibmittel, Stempelfarbe, Amtssie-<br />
gel, Stempel u. dgl.) für die Anlegung der Personenstandsbücher, die Eintragungen in diese und<br />
die Ausstellung von Personenstandsurkunden und Abschriften ist darauf zu achten, dass die<br />
Personenstandsbücher möglichst unbegrenzt, die Urkunden während ihrer durchschnittlichen<br />
Lebensdauer haltbar und lesbar bleiben sollen. Farbbänder, die das Abheben von Schriftzeichen<br />
ermöglichen, auswaschbare Tinten und Filzstifte oder sonstige Materialien, die die Verfälschung<br />
von Urkunden erleichtern, dürfen nicht verwendet werden 136 .<br />
Einzutragen ist mit Schreibmaschine oder ähnlichen technischen Hilfsmitteln; in gebundene<br />
Bücher kann auch handschriftlich eingetragen werden. Personenstandsurkunden und Abschriften<br />
sind mit Schreibmaschine oder anderen technischen Hilfsmitteln auszustellen.<br />
Zwischenräume und nicht benützte Felder sind durch Striche auszufüllen. Anstelle des Striches<br />
kann an das Ende der Eintragung beziehungsweise an den Beginn eines unbenutzten Schreibfel-<br />
des das Schlusszeichen „-x-“ gesetzt werden. Bei Abschriften sind auch jene Teile des für die<br />
Eintragung von Vermerken bestimmten Randes, die nicht für diesen Zweck benützt werden, durch<br />
Striche auszufüllen. Reicht ein Feld für die Eintragung nicht aus, so ist sie unter Hinweis auf das<br />
entsprechende Feld am Rand der Eintragung vorzunehmen oder fortzusetzen.<br />
Zusätze und Streichungen der noch nicht abgeschlossenen Eintragung sind im Feld „Sonsti-<br />
ge Angaben“ so zu vermerken, dass kein Zweifel darüber besteht, welche Angaben zugesetzt<br />
oder gestrichen worden sind. Ergänzungen, Berichtigungen und Änderungen sind am Rand der<br />
Eintragung zu vermerken.<br />
Reicht der Platz am Rand der Eintragung nicht aus, so ist ein leeres Blatt in der Breite des<br />
Personenstandsbuches am unteren Rand anzukleben; an der Verbindungsstelle ist das Amtssie-<br />
gel anzubringen. Am rechten oberen Rand des leeren Blattes ist die Nummer der Eintragung<br />
anzuführen, zu der das Blatt gehört.<br />
Für Vermerke und für häufig vorkommende Eintragungen in das Feld „Sonstige Angaben“<br />
können Stempel und andere Hilfsmittel verwendet werden, wenn dadurch nicht die Sicherheit der<br />
Eintragung beeinträchtigt wird. Der Unterschrift des <strong>Standesbeamten</strong> ist dessen Name leser-<br />
lich 137 beizufügen.<br />
136<br />
Zur Verwendung von Laserdruckern siehe die Erlässe des BMI zu Punkt 42.2 der DA vom 11.12.1989 (ÖStA 1990,9)<br />
und vom 1.3.1990 (ÖStA 1990,34)<br />
137<br />
Die Unterschrift selbst muss nicht unbedingt lesbar sein, sondern es genügt die Zuordenbarkeit zu einer bestimmten<br />
Person. (VwGH vom 16.2.1994, 93/13/0025).<br />
Seite - 56 -
Die Behörde, die den Vordruck verwendet, ist durch die Anführung der Gemeinde (bzw. des<br />
Standesamtsverbandes) zu bezeichnen, die (der) die Aufgaben als Personenstandsbehörde be-<br />
sorgt (z.B. „Stadt Dornbirn“ oder „Standesamtsverband Bregenz“); bei Bestehen einer oder mehre-<br />
rer Dienststellen der Gemeinden, deren Bezeichnung auf die Besorgung der Personenstandsan-<br />
gelegenheiten hinweist („Standesamt“), ist diese Dienststelle hinzuzufügen (z.B. „Standesamt der<br />
Landeshauptstadt Klagenfurt“ oder „Landeshauptstadt Klagenfurt, Standesamt“ oder „Standesamt<br />
Wien Innere Stadt“). Bei Ausstellung einer Personenstandsurkunde durch eine andere Behörde<br />
als die, die den Personenstandsfall beurkundet hat, ist der Bezeichnung letzterer Behörde die der<br />
ausstellenden Behörde beizufügen (z.B. „Standesamt Viktring, jetzt Klagenfurt“).<br />
Die Staatsangehörigkeit ist in den Hinweisen durch die Nennung des Staates anzugeben; all-<br />
gemein übliche Kurzformen (z.B. „Schweiz“ statt „Schweizerische Eidgenossenschaft“) und Ab-<br />
kürzungen (z.B. USA) können verwendet werden.<br />
Seite - 57 -
2. KINDSCHAFTSRECHT<br />
Die Bestimmungen des österreichischen Kindschaftsrechtes sind zum größten Teil im ABGB zu finden<br />
und gelten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, für Kinder mit österreichischem Personalstatut.<br />
2.1 Die natürliche Person<br />
2.1.1 Beginn der Rechtsfähigkeit<br />
Die volle Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der vollendeten Geburt. Sie ist mit der na-<br />
türlichen oder künstlichen Trennung des Kindes vom Mutterleib vollendet. Die Rechtsfähigkeit tritt<br />
ohne Rücksicht darauf ein, ob das Kind lebensfähig ist. Es muss nur ein Lebenszeichen von sich<br />
gegeben haben. Bestehen Zweifel, ob ein Kind lebend oder tot geboren ist, so wird das erstere<br />
vermutet. 138<br />
Das Gesetz räumt allerdings dem bereits gezeugten, aber noch nicht geborenen Kind, dem<br />
„Nasciturus“, eine rechtlich bedeutsame Position ein. Die Vorschrift bestimmt zunächst, dass<br />
ungeborene Kinder von dem Zeitpunkte ihrer Empfängnis an einen Anspruch auf den Schutz der<br />
Gesetze haben. Daraus folgt allerdings weder eine Rechtsfähigkeit noch ein subjektives Recht<br />
des Ungeborenen. Gemeint ist bloß, dass zu seinen Gunsten verschiedene Schutzvorschriften<br />
bestehen.<br />
Darüber hinaus hat aber nach § 22 ABGB das noch ungeborene Kind eine bedingte und be-<br />
schränkte Rechtsfähigkeit: Es kann - unter der Voraussetzung, dass es lebend geboren wird -<br />
bereits Rechtsträger werden, soweit dies zu seinem Vorteil ist.<br />
2.1.2 Ende der Rechtsfähigkeit<br />
2.1.2.1 Der Tod<br />
Die Rechtsfähigkeit des Menschen endet erst mit seinem Tod. Der Beweis des Todes erfolgt<br />
regelmäßig durch den Totenschein. Der Tod wird im Sterbebuch eingetragen (§ 28 PStG).<br />
Kann kein Totenschein ausgestellt werden, weil der Leichnam des Verstorbenen nicht vorhan-<br />
den ist, so besteht die Möglichkeit des Todesbeweises. 139 In diesem Fall ist das Gericht im au-<br />
ßerstreitigen Verfahren vom Tod einer bestimmten Person zu überzeugen.<br />
138 siehe § 23 ABGB<br />
139 § 21 Todeserklärungsgesetz (TEG) 1950<br />
Seite - 58 -
Beispiel: Eine Person ist vor mehreren Zeugen von einem Schiff in das offene Meer gefallen<br />
und offensichtlich ertrunken. Der Leichnam konnte nie gefunden werden. Der Beschluss des<br />
Gerichtes ersetzt hier den Totenschein.<br />
Ist jedoch auch ein solcher Beweis des Todes nicht möglich, so kommt nur eine Todeserklä-<br />
rung in Frage.<br />
2.1.2.2 Die Todeserklärung<br />
In vielen Fällen kann der strenge Beweis des Todes nicht erbracht werden, obwohl Umstände<br />
vorliegen, die ihn sehr wahrscheinlich machen. Regelmäßig gibt es in solchen Fällen Personen,<br />
die an einer Klarstellung der Rechtslage interessiert sind, so in der Frage der Erbfolge oder daran,<br />
ob die Ehegattin des Verschollenen wieder heiraten darf. Den Antrag auf Todeserklärung kann<br />
jeder Interessent stellen.<br />
Erste Voraussetzung der Todeserklärung ist die Verschollenheit. Verschollen sind Personen,<br />
deren Aufenthalt während längerer Zeit unbekannt ist, eine nachrichtenlose Abwesenheit und<br />
ernsthafte Zweifel am Überleben. Die Verschollenheit muss eine bestimmte Dauer haben,<br />
wenn sie zur Todeserklärung ausreichen soll. Das Todeserklärungsgesetz hat hiefür komplizierte<br />
Fristenregelungen getroffen.<br />
Die Todeserklärung begründet die Vermutung, dass der Verschollene in dem im Gerichtsbe-<br />
schluss festgestellten Zeitpunkt gestorben ist. Der für tot Erklärte wird rechtlich als tot angesehen,<br />
so dass insbesondere die Erbfolge eintritt. Solange hingegen ein Verschollener nicht für tot erklärt<br />
ist, wird vermutet, dass er weiterlebt.<br />
2.1.3 Die Handlungsfähigkeit im allgemeinen<br />
Die Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit, durch eigenes Verhalten Rechte und Pflichten<br />
zu begründen. Diese erwirbt der Mensch nicht schon mit seiner Geburt. Sie wird vielmehr von der<br />
Rechtsordnung nur jenen Personen zuerkannt, die in der Lage sind, ihre Angelegenheiten in<br />
vernünftiger und sachgerechter Weise zu ordnen und sich dem Recht gemäß zu verhalten. Voll<br />
handlungsfähig ist der geistig gesunde Erwachsene. Personen, die wegen ihres geringen Alters,<br />
wegen ihrer geringen geistigen Fähigkeit oder wegen einer Bewusstseinsstörung die Folgen ihrer<br />
Handlungen nicht richtig abschätzen können, sind hingegen überhaupt nicht oder nur beschränkt<br />
handlungsfähig und stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze.<br />
Seite - 59 -
2.1.4 Die Geschäftsfähigkeit im Einzelnen<br />
2.1.4.1 Alter<br />
Um mit seiner Umwelt in Rechtsbeziehungen zu treten, bedarf ein Minderjähriger eines gesetz-<br />
lichen Vertreters, der in seinem Namen für ihn tätig wird. Seit dem 1.7.2001 unterscheidet § 21<br />
Abs. 2 ABGB folgende Gruppen:<br />
1. Unmündige Minderjährige: (Personen zwischen 0 und 14 Jahren)<br />
Unmündige Minderjährige zwischen 0 und 7 Jahren sind völlig geschäftsunfähig.<br />
Unmündige Minderjährige zwischen 7 und 14 Jahren sind beschränkt geschäftsfähig. Sie<br />
können ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen annehmen. Will sich der Unmündige<br />
verpflichten, so muss sein gesetzlicher Vertreter entweder für ihn kontrahieren 140 oder dem vom<br />
Unmündigen geschlossenen Geschäft zustimmen.<br />
Hat der Unmündige ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ein Geschäft geschlossen,<br />
das ihn verpflichten würde, so liegt ein hinkendes Geschäft vor. Es kann durch die nachträgli-<br />
che Zustimmung (Genehmigung) des gesetzlichen Vertreters volle Gültigkeit erlangen. In wichti-<br />
gen Fällen reicht die Einwilligung oder das alleinige Tätigwerden des gesetzlichen Vertreters nicht<br />
aus. Es ist die Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes einzuholen.<br />
2. Mündige Minderjährige: (Personen zwischen 14 und 18 Jahren)<br />
Hier gilt grundsätzlich das für die Unmündigen Ausgeführte. Darüber hinaus hat das Gesetz<br />
den Mündigen in gewissen Fällen eine erweiterte Geschäftsfähigkeit eingeräumt. Mündige<br />
Minderjährige können sich vertraglich zu Dienstleistungen verpflichten, z.B. einen Ferialjob an-<br />
nehmen. Ausgenommen sind allerdings Leistungen auf Grund eines Lehr- oder sonstigen Ausbil-<br />
dungsvertrages. Über sein Einkommen aus eigenem Erwerb und über Sachen, die ihm zur freien<br />
Verfügung überlassen worden sind, kann der Minderjährige so weit verfügen und sich verpflichten,<br />
als dadurch nicht die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse gefährdet wird.<br />
3. Volljährige: (Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 141 )<br />
Mit der Volljährigkeit erlöschen auch die zwischen Eltern und Kindern durch die Minderjährigkeit<br />
begründeten rein persönlichen Rechte und Pflichten sowie eine Vormundschaft. Eine gesetzliche<br />
Vertretung (jetzt als Obsorge bezeichnet) gibt es nicht mehr. Für die Unterhaltspflichten sind hin-<br />
gegen andere Kriterien, z.B. die Erreichung der Selbsterhaltungsfähigkeit, maßgebend. Der Un-<br />
terhaltsanspruch kann daher schon vor, aber auch erst nach der Volljährigkeit erlöschen.<br />
140 d.h. den Vertrag schließen<br />
141 Der Eintritt der Volljährigkeit wurde durch das Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 (BGBl. I 135/2000) vom<br />
vollendeten 19. Lebensjahr auf das vollendete 18. Lebensjahr mit Wirkung 1.7.2001 herabgesetzt.<br />
Seite - 60 -
Die vor dem 1.7.2001 mögliche Verkürzung bzw. Verlängerung der Minderjahrigkeit wurde<br />
abgeschafft.<br />
2.1.4.2 Geisteszustand<br />
Da das Rechtsgeschäft der sinnvollen Ordnung der rechtlichen Beziehungen zur Umwelt dient,<br />
bewirkt auch der Mangel entsprechender Verstandeskräfte bei Erwachsenen Geschäftsunfähig-<br />
keit. Der Geisteskranke oder Geistesschwache kann daher keine gültigen Geschäfte<br />
schließen. Dasselbe gilt für Personen, die auch nur vorübergehend nicht im Besitz ihrer geisti-<br />
gen Kräfte sind (kurzfristige Geistesstörungen, Trunkenheit, Einfluss von Rauschgift usw.), so<br />
lange dieser Zustand andauert. 142<br />
2.1.4.3 Sachwalterschaft<br />
Wird von jemanden mit Vollendung des 18. Lebensjahres nicht die erforderliche Einsichts- und<br />
Urteilsfähigkeit erreicht, so ist nun, statt der früheren „Verlängerung der Minderjährigkeit“ ein<br />
Sachwalter zu bestellen (§ 273 ABGB).<br />
Ein Sachwalter ist für eine Person zu bestellen, die an einer psychischen Krankheit leidet<br />
oder geistig behindert ist und die deshalb alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne<br />
Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu besorgen vermag.<br />
Hauptanliegen des Sachwalterschaftsgesetzes ist es daher, geistig Behinderten eine Hilfsper-<br />
son, nämlich den Sachwalter, zur Seite zu stellen, der nach Bedarf die Personen- und Vermö-<br />
genssorge übernimmt und Vertretungsakte setzt.<br />
Die Sachwalterbestellung erfolgt durch Beschluss des Außerstreitgerichtes. Die Krankheit al-<br />
lein (geistige Behinderung) reicht allerdings zur Sachwalterbestellung nicht aus. Es muss hinzu-<br />
kommen, dass der Behinderte seine Angelegenheiten ohne Gefahr eines Nachteils für sich<br />
selbst nicht besorgen kann.<br />
2.1.5 Vertretung nicht voll geschäftsfähiger Personen<br />
Vertreter des minderjährigen ehelichen Kindes und des minderjährigen Adoptivkindes ist, von<br />
bestimmten Angelegenheiten abgesehen, jeder Elternteil (Adoptivelternteil) für sich allein, so-<br />
fern nicht die Vertretung kraft Gesetzes oder gerichtlicher Verfügung einem Elternteil (Adoptiv-<br />
elternteil) allein zusteht oder das Gericht einen Vormund bzw. für einen Teilbereich einen Sach-<br />
walter bestellt hat.<br />
142 siehe dazu § 2 Ehegesetz: „Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht eingehen.“ Unfähig zur Erklärung des<br />
Ehewillens ist daher auch eine Person, die nur vorübergehend (z.B. infolge Alkohol- oder Drogeneinwirkung) den<br />
Gebrauch der Vernunft nicht hat (Schwind, Eherecht 2 , 98).<br />
Seite - 61 -
Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteiles, die wichtige Angelegenheiten<br />
betreffen, sind allerdings nur dann wirksam, wenn die Zustimmung des anderen Elternteiles<br />
vorliegt. Vertreter des minderjährigen nichtehelichen Kindes ist die (volljährige) Mutter.<br />
Ist ein Elternteil eines ehelichen, nichtehelichen oder adoptierten Kindes nicht voll geschäfts-<br />
fähig, hat er nicht das Recht, das Kind zu vertreten. Kommt danach die Vertretung keinem Eltern-<br />
teil zu, ist bis zu einer anderen Entscheidung des Gerichts der Jugendwohlfahrtsträger (Bezirks-<br />
verwaltungsbehörde) kraft Gesetzes Vormund des Kindes.<br />
2.2 Eheliche Kinder<br />
Ehelich ist ein Kind, das während der Ehe der Mutter mit seinem Vater oder, wenn die Ehe<br />
durch den Tod des Ehemannes aufgelöst wurde, innerhalb von 300 Tagen danach geboren wird<br />
(in allen anderen Fällen ist das Kind unehelich). Wird die Ehe der Eltern später für nichtig erklärt,<br />
so bleibt das Kind trotzdem ehelich (natürlich auch bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe).<br />
Die eheliche Abstammung kann gerichtlich im Wege der „Feststellung der Nichtabstammung<br />
vom Ehemann der Mutter“ bzw. durch eine „qualifizierte“ Vaterschaftsanerkennung nach § 163e<br />
ABGB widerlegt werden.<br />
Wird daher ein Kind nach der Eheschließung und vor Scheidung, Aufhebung oder Nichti-<br />
gerklärung der Ehe seiner Mutter geboren, so ist es ehelich. Ein Kind ist ebenfalls ehelich, wenn<br />
es vor Ablauf des 300. Tages nach dem Tod des Ehemannes der Mutter geboren wird. Der Stan-<br />
desbeamte hat daher bei Vorliegen dieser Voraussetzungen das Kind selbst dann als ehelich zu<br />
beurkunden, wenn offenkundig oder bekannt ist, dass der Ehemann der Mutter nicht der Vater<br />
des Kindes sein kann, z.B. weil er seit längerer Zeit unbekannten Aufenthaltes oder in Haft ist.<br />
Die Zeugung des Kindes vor der Eheschließung ist für die Ehelichkeit des Kindes allerdings<br />
unerheblich. Das Gesetz vermutet, dass es vom jetzigen Ehemann der Mutter abstammt, und<br />
gewährt somit eine „Vorweglegitimation“.<br />
Wird ein Kind innerhalb von 300 Tagen nach Scheidung oder Aufhebung oder Nichtigerklärung<br />
der Ehe geboren, so wird es ehelich, wenn der frühere Ehemann der Mutter die Vaterschaft aner-<br />
kennt oder durch Gericht als Vater festgestellt wird. Das Kind bzw. der Mann braucht hier nicht<br />
beweisen, dass die Zeugung während der Ehe erfolgte.<br />
Wird ein Kind nach Ablauf von 300 Tagen nach Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe ge-<br />
boren, so hat das Gericht auf Antrag des Kindes oder des früheren Ehemannes der Mutter die<br />
Abstammung von diesem und die Ehelichkeit des Kindes festzustellen, wenn bewiesen ist, dass<br />
das kind während der Ehe vom Ehemann der Mutter (oder durch medizinisch unterstützte Fort-<br />
pflanzung) gezeugt wurde. In diesem Fall ist die Zeugung während der Ehe zu beweisen.<br />
Seite - 62 -
Diese Kinder werden mit der rechtskräftigen Feststellung der Abstammung, der Abstammung<br />
und der Ehelichkeit bzw. mit der Wirksamkeit des Anerkenntnisses - rückwirkend im Zeitpunkt der<br />
Geburt – ehelich.<br />
Die Ehelichkeit kann auf 3 Arten beseitigt werden:<br />
1. durch eine gerichtliche Entscheidung (durch einen rechtskräftigen Beschluss), mit dem<br />
festgestellt wird, dass das Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt. Die eheliche Abstam-<br />
mung eines Kindes kann daher nicht in einem anderen Verfahren (etwa im Scheidungsverfahren<br />
der Eltern) als Vorfrage geprüft werden.<br />
2. durch ein „qualifiziertes“ Vaterschaftsanerkenntnis 143 , gegen das der als Vater vermutete<br />
Mann keinen Widerspruch erhoben hat.<br />
3. durch ein „Vätertauschverfahren“ auf Antrag des Kindes, egal aus welchem Rechtsgrund<br />
auch immer eine Vaterschaft bereits besteht.<br />
Künstliche Insemination (Befruchtung) ändert ebenfalls nichts an der Vermutung der Ehelich-<br />
keit, weil Beiwohnung (anders als bei der Anerkennung der Vaterschaft) nicht vorausgesetzt wird.<br />
Stammt der Samen nicht vom Ehemann, so kann die Ehelichkeit des Kindes bestritten werden.<br />
2.3 Nichteheliche Kinder<br />
War die Mutter nie verheiratet oder wird ein Kind nach Scheidung, Aufhebung oder Nichtiger-<br />
klärung der Ehe seiner Mutter geboren, ist es unehelich.<br />
Die Nichtehelichkeit kann, wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen nach Scheidung, Aufhe-<br />
bung oder Nichtigerklärung der Ehe geboren wird, durch das Gericht oder durch Anerkenntnis<br />
durch den früheren Ehemann der Mutter widerlegt werden. Mit Rechtskraft des Gerichtsbeschlus-<br />
ses bzw. mit Wirksamkeit des Anerkenntnisses wird das Kind rückwirkend zum Zeitpunkt der<br />
Geburt ehelich.<br />
Bei Geburt des Kindes nach Ablauf von 300 Tagen nach Eheauflösung oder Nichtigerklärung<br />
kann die Ehelichkeit nur mittels eines Gerichtsbeschlusses festgestellt werden. Hiefür ist zu be-<br />
weisen, dass während der Ehe das Kind vom Ehemann gezeugt worden ist.<br />
143 unter dem „qualifizierten“ Vaterschaftsanerkenntnis wird das Vaterschaftsanerkenntnis im Sinne des seit dem<br />
1.7.2001 neuen § 163e ABGB verstanden.<br />
Seite - 63 -
2.4 Familienname des Kindes<br />
2.4.1 Eheliches Kind<br />
Haben die Eltern einen gemeinsamen Familiennamen (einen sogenannten Ehenamen), so er-<br />
hält das Kind den gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) der Eltern. Ein gemeinsamer<br />
Familienname der Eltern liegt auch dann vor, wenn ein Elternteil von der Möglichkeit der Führung<br />
eines Doppelnamens im Sinne des § 93 ABGB Gebrauch gemacht hat. Führt ein Elternteil einen<br />
derartigen Doppelnamen, so kann der dem „gemeinsamen Familiennamen“ voran- oder nachge-<br />
stellte Familienname nicht auf das Kind übertragen werden.<br />
Haben die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen), so erhält das Kind den<br />
Familiennamen, den die Eltern dem <strong>Standesbeamten</strong> gegenüber spätestens vor oder bei der<br />
Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zum Familiennamen der aus<br />
der Ehe stammenden Kinder bestimmt haben. Hiezu können die Eltern aber nur den Familienna-<br />
men eines Elternteils bestimmen. Ein aus dem Familiennamen beider Elternteile zusammenge-<br />
setzter Familienname kann nicht als Familienname für das Kind bestimmt werden. Die Bestim-<br />
mung des Familiennamens der Kinder ist im Ehebuch und in der Heiratsurkunde einzutragen<br />
und aus diesen Urkunden ersichtlich.<br />
Mangels einer Bestimmung vor oder bei der Eheschließung erhält das Kind den Familienna-<br />
men des Vaters. Eine Bestimmung des Familiennamens des Kindes erst bei dessen Geburt ist<br />
bei Anwendung österr. Rechtes nicht möglich.<br />
Das Ziel des Gesetzgebers ist, dass sämtliche aus einer Ehe stammenden Kinder den glei-<br />
chen Familiennamen führen. Dieser Grundsatz kann aber durch eine verwaltungsbehördliche<br />
Namensänderung (zu beantragen bei der nach dem Wohnsitz des Kindes zuständigen Bezirks-<br />
verwaltungsbehörde) durchbrochen werden 144 .<br />
2.4.2 Uneheliches Kind<br />
Das uneheliche Kind erhält den Familiennamen der Mutter, den diese zum Zeitpunkt der<br />
Geburt führt. Führt die Mutter einen Doppelnamen nach § 93 Abs.2 ABGB, so kann der dem<br />
„gemeinsamen Familiennamen“ voran- oder nachgestellte Name nicht auf das Kind übertragen<br />
werden. Das Kind erhält nur den Teil des Doppelnamens der Mutter, der als „gemeinsamer Fami-<br />
lienname“ bestimmt wurde.<br />
Hier wird nur (wie auch beim ehelichen Kind) der Erwerb des Namens durch Abstammung ge-<br />
regelt, nichts aber über sein späteres Schicksal ausgesagt. Ein vor dem 1.5.1995 geborenes<br />
Kind behält daher den vom Geschlechtsnamen der Mutter abgeleiteten Familiennamen. Das Kind<br />
144 siehe § 2 Abs. 1 Z 8 NÄG<br />
Seite - 64 -
kann jedoch durch behördliche Namensänderung den Familiennamen der Mutter erhalten (Nach<br />
dem bis 1.5.1995 geltenden Recht erhielt das uneheliche Kind den Geschlechtsnamen der<br />
Mutter 145 ).<br />
Die früheren Bestimmungen (§§ 165a bis 165c ABGB) über die Namensgebung an ein unehe-<br />
lich geborenes Kind durch den Kindesvater oder den Ehemann der Mutter wurden mit Wirkung<br />
vom 1.5.1995 aufgehoben. Die gleichen Wirkungen können jetzt durch eine behördliche Namens-<br />
änderung nach dem Namensänderungsgesetz erreicht werden.<br />
2.5 Feststellung der Nichtabstammung<br />
vom Ehemann der Mutter<br />
(früher als „Bestreitung der Ehelichkeit“ bezeichnet)<br />
Stammt ein Kind, das während der Ehe der Mutter oder vor Ablauf von 300 Tagen nach dem<br />
Tod des Ehemannes der Mutter geboren worden ist, nicht von diesem ab, so hat das Gericht dies<br />
auf Antrag festzustellen 146 .<br />
den 147 .<br />
Der Antrag kann vom Kind gegen den Mann und von diesem gegen das Kind gestellt wer-<br />
Ein Antrag auf Feststellung der Nichtabstammung kann binnen zwei Jahren ab Kenntnis der<br />
hiefür sprechenden Umstände gestellt werden. Diese Frist beginnt frühestens mit der Geburt des<br />
Kindes, im Fall einer Änderung der Abstammung frühestens mit der Wirksamkeit der Änderung.<br />
Ein Antrag ist nicht zulässig, solange die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann<br />
feststeht.<br />
Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die antragsberechtigte Person nicht eigenberechtigt ist<br />
oder innerhalb des letzten Jahres der Frist durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares<br />
Ereignis an der Antragstellung gehindert ist.<br />
Später als 30 Jahre nach der Geburt des Kindes oder nach einer Änderung der Abstammung<br />
kann nur das Kind die Feststellung der Nichtabstammung begehren.<br />
Vom Bezirksgericht ist der Personenstandsbehörde, die das Geburtenbuch des Kindes führt<br />
eine rechtskräftige Beschlussausfertigung zu übersenden. Der stattgebende Beschluss auf<br />
Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter wirkt ex tunc, d.h. rückwirkend. Auch die Unterhalts-<br />
pflicht fällt rückwirkend fort.<br />
145 Vor allem bei der Ausstellung von Geburtsurkunden aus vor dem 1.1.1984 angelegten Geburtenbüchern ist<br />
dies zu beachten, weil in aller Regel der Familienname des Kindes nicht eingetragen wurde.<br />
146 § 156 ABGB, in Kraft seit 1.1.2005 (BGBl. I 58/2004).<br />
147 Die Mutter hat in diesem Verfahren jedenfalls Parteistellung.<br />
Seite - 65 -
2.6 Mutterschaft<br />
Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat 148 . Dies gilt auch für eine (in Österreich ohne-<br />
hin verbotene) medizinische Fortpflanzungshilfe unter Verwendung fremder Eizellen. Eine förmli-<br />
che Anerkennung der Mutterschaft ist daher der österreichischen Rechtsordnung fremd, ab-<br />
stammungsrechtlich überflüssig und ohne jede materiellrechtliche Wirkung.<br />
Eine Anerkennung der Mutterschaft kann daher nur in Fällen mit Auslandsbezug 149 eine Rolle<br />
spielen. Das Heimatrecht der Mutter entscheidet darüber, ob eine Mutterschaftsanerkennung<br />
notwendig ist oder nicht. Der Nachweis der, z.B. im Geburtenbuch, unrichtig beurkundeten<br />
Mutterschaft ist möglich; allerdings ist ein Zivilprozess hierüber als Hauptfrage deshalb ausge-<br />
schlossen, weil das Personenstandsgesetz hiefür abschließend den Verwaltungsweg vorsieht 150 .<br />
Der Vater eines Kindes ist der Mann,<br />
2.7 Vaterschaft<br />
2.7.1 Allgemeines<br />
1. der mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt des Kindes verheiratet ist oder als Ehemann<br />
der Mutter nicht früher als 300 Tage vor der Geburt des Kindes verstorben ist<br />
oder<br />
2. der die Vaterschaft anerkannt hat oder<br />
3. dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist.<br />
Der gesetzliche Vertreter des Kindes (die volljährige Kindesmutter oder das Jugendamt als<br />
Jugendwohlfahrtsträger) hat dafür zu sorgen, dass die Vaterschaft festgestellt wird, es sei denn,<br />
dass die Feststellung der Vaterschaft für das Wohl des Kindes nachteilig ist oder die Mutter von<br />
ihrem Recht, den Namen des Vaters nicht bekannt zu geben, Gebrauch macht. Dem Kindeswohl<br />
könnte z.B. entgegenstehen, wenn das Kind in Notzucht gezeugt wurde. Der Jugendwohlfahrts-<br />
träger hat jedenfalls die Verpflichtung, die Mutter darauf aufmerksam zu machen, welche Folgen<br />
es hat, wenn die Vaterschaft nicht festgestellt wird; so hat das Kind z.B. keinen Unterhaltsan-<br />
spruch und keinen Erbanspruch gegen seinen Vater. Die Vaterschaft wird durch einen rechtskräf-<br />
tigen Beschluss des Gerichtes oder durch ein (freiwilliges) Anerkenntnis festgestellt. Die Fest-<br />
stellung der Vaterschaft wirkt gegenüber jedermann 151 .<br />
148 § 137b ABGB<br />
149 u.a. Frankreich, Italien und einige südamerikanische Staaten.<br />
150 Berichtigung nach § 15 Abs. 3 PStG.<br />
151 Das so begründete Statusverhältnis bleibt bestehen, solange nicht das Urteil oder Anerkenntnis auf dem gesetzlich<br />
vorgesehenen Weg beseitigt werden.<br />
Seite - 66 -
2.7.2 gerichtliche Feststellung der Vaterschaft<br />
Als Vater hat das Gericht den Mann festzustellen, von dem das Kind abstammt. Der An-<br />
trag kann vom Kind gegen den Mann oder von diesem gegen das Kind gestellt werden<br />
(§ 163 Abs. 1 ABGB).<br />
Die Vaterschaftsfeststellung im Gerichtswege (außerstreitiges Verfahren) auf Antrag des Kin-<br />
des wird dann erfolgen, wenn der Vater sich weigert, die Vaterschaft anzuerkennen. Die Vater-<br />
schaftsfeststellung auf Antrag des Mannes wird dann erfolgen, wenn er sich über die biologische<br />
Verwandtschaft zum Kind im Unklaren ist. Ein Antrag des Mannes ist allerdings nur möglich, wenn<br />
noch keine Vaterschaft besteht. Vorteil: Durch den durchzuführenden Abstammungsbeweis erhält<br />
der Mann im Gegensatz zum freiwilligen Anerkenntnis Gewissheit über seine genetische Vater-<br />
schaft. Zur Führung dieses Verfahrens ist in I. Instanz das Bezirksgericht zuständig. Das Gericht<br />
hat eine rechtskräftige Beschlussausfertigung dem <strong>Standesbeamten</strong> zu übersenden, in dessen<br />
Geburtenbuch das Kind eingetragen ist.<br />
2.7.3 Anerkennung der Vaterschaft nach § 163c ABGB<br />
Die Anerkennung der Vaterschaft erfolgt dann nach § 163c ABGB, wenn noch nicht die Vater-<br />
schaft eines Mannes feststeht, also in aller Regel dann, wenn das Kind unehelich geboren<br />
wurde.<br />
2.7.3.1 Erklärung in öffentlicher oder öffentlich-beglaubigter Urkunde<br />
Die Vaterschaft muss durch den Anerkennenden in öffentlicher oder öffentlich-beglaubigter<br />
Urkunde anerkannt werden. Zur Beurkundung (und allenfalls zur Beglaubigung) der Erklärung<br />
sind zuständig: 152<br />
1. jede Personenstandsbehörde 153 ;<br />
2. jeder Jugendwohlfahrtsträger 154 ;<br />
3. die Gerichte;<br />
4. die Notare, sowie die<br />
5. Österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland, sofern der Anerkennende oder<br />
das Kind österreichischer Staatsbürger ist.<br />
Für die Beurkundung von Vaterschaftsanerkenntnissen durch die Personenstandsbehörde ist<br />
der Vordruck nach Anlage 18 der Personenstandsverordnung zu verwenden. Dieser Vordruck ist<br />
auch für die Beglaubigung von Anerkenntnissen geeignet, doch kann dessen Verwendung nicht<br />
152 Ein Vaterschaftsanerkenntnis ist auch dann zu beurkunden, wenn sich aus dem Geburtseintrag bereits die Vaterschaft<br />
eines anderen Mannes ergeben sollte; sie dazu Hintermüller in ÖStA 1995/37.<br />
153 Auch die Personenstandsbehörde (z.B. die des Wohnsitzes des Vaters), die nicht das Geburtenbuch des Kindes<br />
führt, ist zur Beurkundung der Erklärung des Anerkennenden zuständig. (§ 53 Abs. 1 Z 1 PStG)<br />
154 § 41 Abs. 1 Jugendwohlfahrtsgesetz; ein Wohnsitz im Bereich des Jugendamtes ist daher nicht erforderlich.<br />
Seite - 67 -
zur Voraussetzung der Beglaubigung gemacht werden. Bei Überreichung einer nicht mit Hilfe<br />
dieses Vordrucks schriftlich abgegebenen Erklärung zur Beglaubigung ist hiefür der in der Anla-<br />
ge 18 vorgesehene Wortlaut zu verwenden.<br />
Formgültig sind auch im Ausland erklärte Vaterschaftsanerkenntnisse, sofern sie nach den<br />
Formvorschriften des Staates (Ortsform) erfolgt sind, in dem sie abgegeben wurden.<br />
2.7.3.2 Persönliche Erklärung<br />
Die Vaterschaft muss durch eine persönliche Erklärung anerkannt werden. Damit ist eine<br />
Abgabe der Erklärung durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen Rechtsanwalt, oder durch den<br />
gesetzlichen Vertreter des in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkten Anerkennenden ausge-<br />
schlossen. Ist der Kindesvater jedoch verstorben, so können auch seine Erben das Vaterschafts-<br />
anerkenntnis abgeben 155 . Zulässig ist es auch, dass das Vaterschaftsanerkenntnis vor der Ge-<br />
burt abgegeben wird 156 . Es erfordert jedoch die Bezugnahme auf eine bestimmte bestehende<br />
Schwangerschaft 157 . Auch die Anerkennung der Vaterschaft zu einem bereits verstorbenen Kind<br />
ist möglich 158 .<br />
Im übrigen gibt es keine Frist, innerhalb der, nach der Geburt des Kindes, eine Vaterschaft<br />
anerkannt werden kann bzw. muss. Auch zu einem 50 Jahre alten „Kind“ kann die Vaterschaft<br />
anerkannt werden.<br />
Die Anerkennung kann nur ohne Bedingungen und unbefristet abgegeben werden. Bei ei-<br />
ner Erklärung mit so schwerwiegenden Folgen lässt das Gesetz die mit einer Bedingung oder<br />
Befristung verbundene Rechtsunsicherheit nicht zu. Aus den gleichen Erwägungen ist die Aner-<br />
kennung auch unwiderruflich. Der Mann (Vater) kann sich den Widerruf nicht vorbehalten.<br />
Nicht einsichts- und urteilsfähige Männer, gleichgültig, ob sie eigenberechtigt sind oder nicht,<br />
können die Vaterschaft nicht anerkennen. Einsichts- und urteilsfähige Personen können, wenn sie<br />
nicht eigenberechtigt sind, in Angelegenheiten ihrer Abstammung (z.B. Anerkennung der Vater-<br />
schaft) rechtswirksam handeln, sofern ihr gesetzlicher Vertreter zustimmt. Diese Zustimmung<br />
muss gleichfalls in öffentlicher oder öffentlich-beglaubigter Urkunde abgegeben werden. Im Zwei-<br />
fel wird das Vorliegen der Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen (= vollende-<br />
tes 14. Lebensjahr) vermutet. Im Zusammenhang mit der Einwilligung ist zu beachten, dass die<br />
Anerkennung der Vaterschaft zu jenen Angelegenheiten gehört, bei denen ein Elternteil eines<br />
ehelichen Kindes zur Einwilligung der Zustimmung des anderen Elternteils bedarf, sofern ihm<br />
155<br />
Keinesfalls kann aber der gesetzliche Vertreter eines Minderjährigen nach dessen Tod anerkennen (siehe Edlbacher,<br />
ÖStA 1956,28).<br />
156<br />
Es wird durch eine Totgeburt oder eheliche Geburt gegenstandslos.<br />
157<br />
Es kann daher nur nach Zeugung derart bedingt anerkannt werden.<br />
158<br />
siehe dazu Hintermüller in ÖStA 1992,76.<br />
Seite - 68 -
nicht die Obsorge allein zukommt 159 . Das gilt sinngemäß auch für jene Fälle, in denen die Obsorge<br />
auf Grund eines Gerichtsbeschlusses einem Großelternpaar oder den Pflegeeltern oder beiden<br />
Eltern eines unehelichen Kindes zukommt.<br />
2.7.3.3 Inhalt des Anerkenntnisses<br />
Das Anerkenntnis soll eine genaue Bezeichnung des Anerkennenden, der Mutter und des<br />
Kindes, sofern es bereits geboren ist, enthalten. Inhaltlich hängt die Wirksamkeit einer Vater-<br />
schaftsanerkennung nicht davon ab, dass der Anerkennende wirklich der biologische Vater des<br />
Kindes ist. Wird das Vaterschaftsanerkenntnis von der Personenstandsbehörde beurkundet, ist<br />
darauf zu achten, dass die Niederschrift alle Angaben enthält, die zur genauen Bezeichnung vor<br />
allem des Anerkennenden, aber auch der Mutter und des Kindes erforderlich sind. Der Anerken-<br />
nende wird darauf hinzuweisen sein, dass ein Vermerk über das Anerkenntnis erst eingetragen<br />
werden kann, wenn die ihn betreffenden Angaben vollständig und durch die Vorlage seiner Ge-<br />
burtsurkunde nachgewiesen sind.<br />
Bei der Beglaubigung eines Vaterschaftsanerkenntnisses ist dem <strong>Standesbeamten</strong> eine un-<br />
mittelbare Einflussnahme auf die Vollständigkeit der Angaben nicht möglich, da er nur die Echt-<br />
heit der Unterschrift des Anerkennenden bestätigt, doch wird er auf die Folgen hinzuweisen<br />
haben, die mit unvollständigen Angaben verbunden sein können (z.B. ist eine Zuordnung des<br />
Anerkenntnisses zu einem bestimmten Kind unter Umständen nicht möglich).<br />
2.7.3.4 Wirksamkeit des Vaterschaftsanerkenntnisses<br />
Das Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt der Erklärung 160 , sofern die Urkunde oder ihre öf-<br />
fentlich-beglaubigte Abschrift dem zuständigen <strong>Standesbeamten</strong> (Geburtsort bzw. Wien-Innere<br />
Stadt) zukommt. Angesichts der Bedeutung des Einlangens bei der zur Entgegennahme zustän-<br />
digen Personenstandsbehörde hat diese die Tatsache und den Zeitpunkt des Einlangens auf der<br />
Urkunde bzw. Abschrift festzuhalten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das ange-<br />
führte Wirksamkeitserfordernis (Entgegennahme durch den dazu zuständigen <strong>Standesbeamten</strong>)<br />
auch für den Fall der Beurkundung oder Beglaubigung des Vaterschaftsanerkenntnisses durch<br />
das Gericht oder den Jugendwohlfahrtsträger gilt.<br />
2.7.3.5 Übermittlung des Vaterschaftsanerkenntnisses<br />
Die Personenstandsbehörde, die das Vaterschaftsanerkenntnis beurkundet hat, ist verpflich-<br />
tet, eine Ausfertigung der von ihr beurkundeten oder der ihr für diesen Zweck übergebenen be-<br />
159 siehe § 154 Abs. 2 ABGB<br />
160 und nicht mit dem Einlangen beim zuständigen <strong>Standesbeamten</strong>.<br />
Seite - 69 -
glaubigten Erklärung der zur Entgegennahme zuständigen Personenstandsbehörde zu über-<br />
mitteln, sofern sie nicht selbst zur Entgegennahme zuständig ist 161 .<br />
Die angeführte Übermittlungspflicht trifft auch den Jugendwohlfahrtsträger und die österreichi-<br />
sche Vertretungsbehörde im Ausland hinsichtlich der von ihr beurkundeten oder beglaubigten<br />
Vaterschaftsanerkenntnisse, das Gericht nur hinsichtlich der von ihm beurkundeten Anerkenntnis-<br />
se. Eine Übermittlungspflicht des Gerichts für die von ihm beglaubigten und des Notars für die von<br />
ihm beurkundeten oder beglaubigten Anerkenntnisse besteht nicht. Die Übermittlung der Urkunde<br />
erfolgt in diesem Fall nur nach Auftrag des Anerkennenden 162 .<br />
Ist die Personenstandsbehörde, die das Vaterschaftsanerkenntnis beurkundet oder beglaubigt<br />
hat, nicht zu dessen Entgegennahme zuständig, hat sie die Übermittlung an die zuständige Be-<br />
hörde in einem Verzeichnis festzuhalten.<br />
2.7.3.6 Verständigung vom Vaterschaftsanerkenntnis - Widerspruch<br />
Um das Anerkenntnis den beiden anderen Beteiligten (Mutter und Kind) nicht gegen ihren Wil-<br />
len aufzuzwingen, gibt das Gesetz diesen die Möglichkeit, das Anerkenntnis durch einfache Erklä-<br />
rung zu Fall zu bringen. Wenn also Mutter oder Kind beim örtlich zuständigen Vormundschaftsge-<br />
richt innerhalb von zwei Jahren ab Kenntnis gegen das Anerkenntnis „Widerspruch“ erheben,<br />
muss es bei Vorliegen gewisser Umstände amtswegig gerichtlich für unwirksam erklärt wer-<br />
den. Der Widerspruch bedarf keiner Begründung.<br />
Zur Gewährleistung des Widerspruchsrechts ist die zur wirksamen Entgegennahme des Va-<br />
terschaftsanerkenntnisses zuständige Personenstandsbehörde verpflichtet, die Mutter und das<br />
Kind bzw. den gesetzlichen Vertreter des Kindes vom Vaterschaftsanerkenntnis nachweislich zu<br />
verständigen und auf ihr Widerspruchsrecht hinzuweisen 163 . Nur der Standesbeamte des Ge-<br />
burtenbuches hat diese Verständigung vorzunehmen, die Verständigung durch andere Stellen ist<br />
rechtlich nicht wirksam und daher überflüssig.<br />
Im Zusammenhang mit der Verständigung ist zu beachten, dass der voll geschäftsfähigen Mut-<br />
ter eines unehelichen Kindes ab 1.7.1989 kraft Gesetzes die Obsorge und damit die gesetzliche<br />
Vertretung des Kindes zukommt 164 . In diesem Fall genügt daher die Verständigung der Mutter in<br />
ihrer Eigenschaft als solche und als gesetzliche Vertreterin des Kindes. Ist die Mutter nicht voll<br />
geschäftsfähig, steht ihr das Recht zur Vertretung des Kindes nicht zu 165 . In diesem Fall wird der<br />
161 Die Niederschrift ist mit drei Abschriften zu übermitteln (siehe P 36.1 DA)<br />
162 § 163c Abs. 1 Satz 2 ABGB stellt allein darauf ab, ob die Urkunde oder ihre öffentlich-beglaubigte Abschrift dem<br />
<strong>Standesbeamten</strong> zukommt. Es kommt nicht darauf an, wer die Urkunde dem <strong>Standesbeamten</strong> übermittelt und ob der<br />
Übermittlung ein ausdrücklicher Auftrag des die Vaterschaft Anerkennenden zugrunde liegt (OGH 7.10.2003, 4 Ob<br />
197/03d).<br />
163 Die Verständigung wird zumindest mit Rsb-Brief zu erfolgen haben.<br />
164 siehe § 166 ABGB.<br />
165 siehe § 145a ABGB<br />
Seite - 70 -
Jugendwohlfahrtsträger kraft Gesetzes bis zu einer anderen Entscheidung des Gerichtes Vor-<br />
mund des Kindes 166 . Der gesetzliche Vertreter des Kindes muss dann ebenfalls verständigt und<br />
auf das Widerspruchsrecht hingewiesen werden.<br />
2.7.3.7 Vermerk über das Vaterschaftsanerkenntnis<br />
Voraussetzung der Eintragung eines Vermerks über das Vaterschaftsanerkenntnis ist dessen<br />
Wirksamkeit. Für die Eintragung des Anerkennenden als Vater sind wie bei jeder Eintragung<br />
Personenstandsurkunden als Grundlage heranzuziehen 167 . Es hat daher spätestens die zur Ent-<br />
gegennahme zuständige Personenstandsbehörde die Angaben des Anerkennenden zu seiner<br />
Person an Hand seiner vorgelegten Geburtsurkunde zu überprüfen.<br />
2.7.3.8 Vaterschaftsanerkenntnis vor der Geburt oder bei der Geburtsbeurkundung<br />
Die Vaterschaft zu einem Kind kann auch vor dessen Geburt anerkannt werden 168 . Ein sol-<br />
ches Anerkenntnis ist dem Standesamt Wien-Innere Stadt zu übermitteln. Das Standesamt Wien-<br />
Innere Stadt wird eine Verständigung der Widerspruchsberechtigten zweckmäßigerweise erst<br />
vornehmen, wenn es von der Geburt des Kindes Kenntnis erlangt, da vor der Geburt nur eine<br />
Verständigung der Mutter möglich wäre und im übrigen dem Vaterschaftsanerkenntnis rechtliche<br />
Bedeutung erst ab der Geburt des Kindes zukommt. Mehrlingsgeburten müssen als solche<br />
bereits im vorgeburtlichen Anerkenntnis enthalten sein, sonst wäre das Anerkenntnis bei solchen<br />
Geburten mangels Bestimmtheit unwirksam 169 .<br />
Die Wirksamkeit der Anerkennung hängt, wie schon erwähnt, naturgemäß auch davon ab,<br />
dass das Kind lebend geboren wird. Ein entsprechender Vorbehalt in der Erklärung stellt daher<br />
eine unschädliche Rechtsbedingung dar. Ebenso ist die Wirksamkeit davon abhängig, dass das<br />
Kind nichtehelich ist. Liegt zum Zeitpunkt der Beurkundung der Geburt des Kindes bereits ein<br />
Vaterschaftsanerkenntnis vor, so kann der Vater gleich in den Haupteintrag des Geburtenbuches<br />
eingetragen werden, sofern nicht weitere Erfordernisse (z.B. Einwilligung des gesetzlichen Vertre-<br />
ters) erfüllt werden müssen.<br />
2.7.3.9 Mitteilung des Vaterschaftsanerkenntnisses<br />
Jedes Vaterschaftsanerkenntnis, also auch das zu einem ausländischen Kind, ist dem nach<br />
dem Wohnsitz des Kindes zuständigen Jugendwohlfahrtsträger unverzüglich mitzuteilen, sofern<br />
das Kind minderjährig ist.<br />
166 siehe § 211 ABGB<br />
167 § 9 Abs. 2 zweiter Satz PStG.<br />
168 Das Anerkenntnis wird durch Fehlgeburt, Totgeburt oder eheliche Geburt für die Eintragung im Geburtenbuch ge-<br />
genstandslos.<br />
169 siehe Rummel, Kommentar zum ABGB, 226<br />
Seite - 71 -
2.7.4 Anerkennung der Vaterschaft nach § 163e ABGB<br />
Diese „erweiterte“ Variante der Vaterschaftsanerkennung 170 wurde durch das „Kindschafts-<br />
rechts-Änderungsgesetz 2001“ 171 mit Wirkung vom 1. Juli 2001 eingeführt.<br />
Die Anerkennung der Vaterschaft erfolgt dann nach § 163e ABGB, wenn zum Zeitpunkt der<br />
Anerkennung bereits die Vaterschaft eines anderen Mannes feststeht, also überwiegend dann,<br />
wenn das Kind ehelich geboren wurde.<br />
Durch ein unter bestimmten Voraussetzungen abgegebenes Anerkenntnis wird – ohne Be-<br />
seitigung der früheren Vaterschaftsfeststellung etwa im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens<br />
wegen Bestreitung der ehelichen Geburt – die bereits bestehende Vaterschaftsfeststellung durch-<br />
brochen.<br />
Unterschiede zum „normalen“ Vaterschaftsanerkenntnis:<br />
Die besonderen Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines späteren Anerkenntnisses sind,<br />
dass<br />
1. das Kind in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde dem Anerkenntnis zustimmt<br />
2. Ist das Kind nicht eigenberechtigt, so wird das Anerkenntnis überdies nur wirksam, wenn<br />
die Mutter selbst den Anerkennenden als Vater bezeichnet. Ist die Mutter nicht einsicht-<br />
und urteilsfähig, so gibt es keine Bezeichnung des Mannes durch die Mutter. Ein „durch-<br />
brechendes“ Anerkenntnis kann dann nur mehr mit Zustimmung des eigenberechtigten<br />
Kindes erfolgen.<br />
Für minderjährige Kinder muss der Jugendwohlfahrtsträger (Jugendamt) die Zustim-<br />
mung erteilen (§ 163e Abs. 4 ABGB).<br />
Das spätere Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt seiner Erklärung, sofern die Urkunden über<br />
das Anerkenntnis, die Bezeichnung des Anerkennenden als Vater durch die Mutter und die Zu-<br />
stimmung des Kindes zum Anerkenntnis dem <strong>Standesbeamten</strong> des Geburtenbuches des Kindes<br />
zukommen (§ 163e Abs. 2 ABGB). Die Mutter und das Kind (wenn minderjährig, das Jugend-<br />
amt) sind vom <strong>Standesbeamten</strong> vom Anerkenntnis zu verständigen, wenn deren Zustimmung<br />
noch nicht vorliegt.<br />
Der Mann, der als Vater feststand, oder die Mutter können gegen das Anerkenntnis bei Gericht<br />
Widerspruch erheben (§ 163e Abs. 3 ABGB). Der Standesbeamte des Geburtenbuches des<br />
Kindes hat daher die Widerspruchsberechtigten vom Anerkenntnis zu verständigen 172 und auf ihr<br />
170 zu beachten ist, dass diese Form der Anerkennung nur anwendbar ist, wenn das Personalstatut des Kindes das<br />
österr. Recht ist oder das ausländische IPR ausdrücklich auf österr. Recht verweist.<br />
171 BGBl. I Nr. 135/2000<br />
172 Zu diesem Zweck wurde der Vordruck nach Anlage 18a der PStV geschaffen.<br />
Seite - 72 -
Widerspruchsrecht hinzuweisen. Nach Einlangen aller erforderlichen Erklärungen sind Ver-<br />
merke 173 im Geburtenbuch über das Anerkenntnis der Vaterschaft und vorher schon die Feststel-<br />
lung, dass das Kind nicht vom bisher feststehenden Vater abstammt 174 , einzutragen. Auf die<br />
Wirksamkeit bereits mit dem Tag der Anerkennung wird ausdrücklich hingewiesen.<br />
2.8 Legitimation der unehelichen Kinder<br />
Ist die Vaterschaft zum Kind festgestellt und schließen Vater und Mutter des Kindes die Ehe,<br />
so wird das Kind zum Zeitpunkt der Eheschließung seiner Eltern ehelich. Es kommt dabei<br />
weder auf den Willen der Eltern noch auf den des Kindes an, denn die Legitimation tritt kraft<br />
Gesetzes zwingend ein. Die Legitimationswirkung besteht in der völligen Gleichstellung mit eheli-<br />
chen Kindern.<br />
Wird ein Kind innerhalb von 300 Tagen nach Scheidung oder Aufhebung oder Nichtigerklä-<br />
rung der Ehe geboren, so wird es ebenso ehelich, wenn der frühere Ehemann der Mutter die<br />
Vaterschaft anerkennt oder durch das Gericht als Vater festgestellt wird.<br />
Wird die Vaterschaft nach der Eheschließung festgestellt, so tritt die Legitimationswirkung mit<br />
der Vaterschaftsfeststellung, aber rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eheschließung ein. Die<br />
Wirkungen der Legitimation treten nur auf Grund eines Anerkenntnisses nach § 163e Abs. 2<br />
ABGB oder einer gerichtlichen Entscheidung außer Kraft, die in einem für die Beseitigung der<br />
Feststellung der Abstammung vorgesehenen Verfahren ergeht. Wird die legitimierende Ehe für<br />
nichtig erklärt, so bleibt das legitimierte Kind ehelich.<br />
Das legitimierte Kind erhält den gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) der Eltern. Führen<br />
die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen, so erhält das Kind den Familiennamen, den die<br />
Eltern vor oder bei der Eheschließung für die aus der Ehe stammenden Kinder bestimmt haben.<br />
Das kann entweder der Familienname des Vaters oder der der Mutter sein. Ein von einem Eltern-<br />
teil voran- oder nachgestellter Name ist auf das legitimierte Kind nicht übertragbar. Mangels einer<br />
Namensbestimmung erhält das Kind den Familiennamen des Vaters.<br />
Wird ein bereits mündiges Kind (über 14 Jahre) legitimiert, so ändert sich der Familienname<br />
nur, wenn das Kind 175 der Namensänderung ausdrücklich zustimmt 176 . Wird ein Ehegatte legiti-<br />
miert, so ändert sich der gemeinsame Familienname, den die Ehegatten führen, nur, wenn beide<br />
Ehegatten der Namensänderung zustimmen. Sonst ändert sich nur der Familienname des Legiti-<br />
mierten, wenn dieser zustimmt.<br />
173<br />
siehe Musterbeispiele nach Punkt 1.1 und 3 der Anlage 16 der DA<br />
174<br />
siehe Punkt 26.1.4 der DA<br />
175<br />
Mündige Minderjährige sind in Angelegenheiten der Namenszustimmung allein und selbständig handlungsfähig<br />
176<br />
Die Ausübung des Zustimmungsrechts ist zeitlich beschränkt auf drei Jahre nach nachweislicher Verständigung des<br />
Zustimmungsberechtigten von der Legitimation (§ 54 Abs. 4 PStG).<br />
Seite - 73 -
Führt ein Kind des Legitimierten einen von diesem allein abgeleiteten Familiennamen, so geht<br />
der vom Legitimierten erworbene Familienname auf das Kind über. Ist das Kind des Legitimierten<br />
im Zeitpunkt der Legitimation bereits mündig, so gilt dies nur, wenn das Kind der Namensände-<br />
rung zustimmt. Eine Zustimmung zum Namenswechsel ist dem <strong>Standesbeamten</strong> in öffentlicher<br />
oder öffentlich beglaubigter Urkunde zu erklären, Die namensrechtliche Wirkung tritt ein, sobald<br />
die Urkunde dem zuständigen <strong>Standesbeamten</strong> zukommt 177 . Eine Zustimmung ist unwirksam,<br />
wenn sie dem <strong>Standesbeamten</strong> später als drei Jahre nach der Verständigung des Zustimmungs-<br />
berechtigten vom Eintritt der Legitimation durch den <strong>Standesbeamten</strong> zugekommen ist.<br />
Der Standesbeamte, der das Geburtenbuch des Kindes führt, erhält vom Heiratsstandesbeam-<br />
ten eine Mitteilung über die erfolgte Eheschließung zusammen mit der Mitteilung über gemeinsa-<br />
me Kinder. Ist die Vaterschaft des nunmehrigen Ehemannes der Mutter im Geburtseintrag ver-<br />
merkt, hat der Standesbeamte den Legitimationsvermerk ohne weiteres am Rande des Ge-<br />
burtseintrages einzutragen 178 .<br />
Auch ein Kind, das adoptiert worden ist, kann durch nachfolgende Eheschließung der leibli-<br />
chen Eltern legitimiert werden. Im Verhältnis zu den Wahleltern gilt das Kind zwar schon durch<br />
die Adoption als eheliches Kind, im Verhältnis zu den leiblichen Eltern ist dazu jedoch die Legiti-<br />
mation erforderlich. Praktische Bedeutung kann in solchen Fällen die Legitimation etwa dann<br />
erlangen, wenn die Adoption widerrufen oder aufgehoben wird 179 .<br />
Die Legitimation durch Gnadenakt („Entschließung“) des Bundespräsidenten - auch<br />
„Reskriptenlegitimation“ genannt - ist in der Praxis den Fällen vorbehalten, in denen eine Heirat<br />
der leiblichen Kindeseltern nicht möglich oder nicht tunlich ist. Erforderlich ist ein Antrag.<br />
2.9 Annahme an Kindesstatt (Adoption)<br />
Die Annahme an Kindesstatt ist die künstliche Nachbildung des durch eheliche Geburt entste-<br />
henden Eltern-Kind-Verhältnisses durch einen rechtlichen Akt. Die Adoption unterscheidet sich<br />
von der Legitimation dadurch, dass für die Legitimation nur eigene leibliche uneheliche Kinder in<br />
Betracht kommen. Für die Adoption spielt der eheliche oder uneheliche Status des Kindes<br />
keine Rolle.<br />
2.9.1 Form und Eintritt der Wirksamkeit<br />
Voll geschäftsfähige Personen, die den ehelosen Stand nicht feierlich angelobt haben 180 , kön-<br />
nen an Kindesstatt annehmen. Durch die Annahme an Kindesstatt wird die Wahlkindschaft be-<br />
177 Es gibt daher keine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Eheschließung.<br />
178 Der früher notwendige Gerichtsbeschluss entfällt seit 1.1.1984.<br />
179 BM für Justiz vom 31.10.1991, ÖStA 1992,9.<br />
180 Der Ausschluss dieser Personen wird als verfassungswidrig angesehen; siehe Rummel, Kommentar zum ABGB,<br />
248.<br />
Seite - 74 -
gründet. Die Annahme an Kindesstatt kommt durch schriftlichen Vertrag zwischen dem Anneh-<br />
menden und dem Wahlkind und durch gerichtliche Bewilligung auf Antrag eines Vertragsteiles<br />
zustande. Sie wird im Fall ihrer Bewilligung mit dem Zeitpunkt der vertraglichen Willenseinigung<br />
(Vertragsabschluß) wirksam. Stirbt der Annehmende nach diesem Zeitpunkt, so hindert dies die<br />
Bewilligung nicht.<br />
Die Annahme eines Wahlkindes durch mehr als eine Person ist nur zulässig, wenn die An-<br />
nehmenden miteinander verheiratet sind. Ehegatten dürfen in der Regel nur gemeinsam anneh-<br />
men. Ausnahmen sind zulässig, wenn das leibliche Kind des anderen Ehegatten angenommen<br />
werden soll, wenn ein Ehegatte nicht annehmen kann, weil er die gesetzlichen Voraussetzungen<br />
für die Eigenberechtigung oder des Alters nicht erfüllt, wenn sein Aufenthalt seit mindestens einem<br />
Jahr unbekannt ist, wenn die Ehegatten seit mindestens drei Jahren die eheliche Gemeinschaft<br />
aufgegeben haben oder wenn „ähnliche und besonders wichtige Gründe“ die Annahme durch<br />
einen der Ehegatten rechtfertigen. Lehnt ein Ehegatte die vom anderen gewünschte Annahme<br />
eines Wahlkindes ausschließlich aus subjektiven Gründen ab, so kommt eine Adoption nicht in<br />
Betracht. 181<br />
Der Vertragsinhalt hat sich der beschränkten Vertragsfreiheit anzupassen. Das nicht eigen-<br />
berechtigte Wahlkind schließt den Vertrag durch seinen gesetzlichen Vertreter, dieser bedarf<br />
hiezu keiner gerichtlichen Genehmigung. Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung,<br />
so hat das Gericht sie auf Antrag des Annehmenden oder des Wahlkindes zu ersetzen, wenn<br />
keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen. Als Wahlkinder kommen auch Enkel-<br />
kinder und für den Mann eigene uneheliche Kinder in Betracht. Nach der neueren Rechtslage<br />
kann hingegen die Mutter nicht mehr ihr außereheliches Kind adoptieren. Die Rechte und Pflichten<br />
zwischen ihnen sind ohnehin dieselben wie zwischen einer Mutter und ihrem ehelichen Kind, so<br />
dass die Adoption nicht geeignet ist, dem Wohl des Kindes zu dienen.<br />
2.9.2 Alter<br />
Der Wahlvater muss das dreißigste, die Wahlmutter das achtundzwanzigste Lebensjahr<br />
vollendet haben. Nehmen Ehegatten gemeinsam an oder ist das Wahlkind ein leibliches Kind des<br />
Ehegatten des Annehmenden, so ist eine Unterschreitung dieser Altersgrenze zulässig, wenn<br />
zwischen dem Annehmenden und dem Wahlkind bereits eine dem Verhältnis zwischen leiblichen<br />
Eltern und Kindern entsprechende Beziehung besteht.<br />
Wahlvater und Wahlmutter müssen mindestens achtzehn Jahre älter als das Wahlkind sein;<br />
eine geringfügige Unterschreitung dieses Zeitraums ist unbeachtlich, wenn zwischen dem Anneh-<br />
menden und dem Wahlkind bereits eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern<br />
entsprechende Beziehung besteht. Ist das Wahlkind ein leibliches Kind des Ehegatten des An-<br />
181 OGH 20.12.1996, 1 Ob 2329/96y; JBl 1997,451)<br />
Seite - 75 -
nehmenden oder mit dem Annehmenden verwandt, so genügt ein Altersunterschied von sech-<br />
zehn Jahren.<br />
2.9.3 Bewilligung<br />
Die Annahme eines nicht eigenberechtigten Kindes ist zu bewilligen, wenn sie dessen Wohl<br />
dient und eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung<br />
besteht oder hergestellt werden soll.<br />
Ist das Wahlkind eigenberechtigt (volljährig), so ist die Annahme nur zu bewilligen, wenn die<br />
Antragsteller nachweisen, dass bereits ein enges, der Beziehung zwischen leiblichen Eltern und<br />
Kindern entsprechendes Verhältnis vorliegt, insbesondere wenn das Wahlkind und Annehmender<br />
während fünf Jahren entweder in häuslicher Gemeinschaft gelebt oder einander in einer ver-<br />
gleichbar engen Gemeinschaft Beistand geleistet haben.<br />
Die Bewilligung ist bei Fehlen dieser Voraussetzungen zu versagen, aber auch dann, wenn ein<br />
überwiegendes Anliegen eines leiblichen Kindes des Annehmenden entgegensteht 182 , insbeson-<br />
dere dessen Unterhalt oder Erziehung gefährdet wäre; im übrigen sind wirtschaftliche Belange<br />
nicht zu beachten, außer der Annehmende handelt in der ausschließlichen oder überwiegenden<br />
Absicht, ein leibliches Kind zu schädigen.<br />
Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn folgende Personen der Annahme zustimmen:<br />
1. die Eltern des minderjährigen Wahlkindes;<br />
2. der Ehegatte des Annehmenden;<br />
3. der Ehegatte des Wahlkindes.<br />
Das Zustimmungsrecht einer genannten Person entfällt, wenn sie als gesetzlicher Vertreter<br />
des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat; ferner, wenn sie zu einer verständigen<br />
Äußerung nicht nur vorübergehend unfähig oder ihr Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten<br />
unbekannt ist. Das Gericht hat die verweigerte Zustimmung auf Antrag eines Vertragsteiles zu<br />
ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.<br />
Ein Recht auf Anhörung haben:<br />
1. das nicht eigenberechtigte Wahlkind ab dem vollendeten fünften Lebensjahr, außer es<br />
hat bereits seit diesem Zeitpunkt beim Annehmenden gelebt;<br />
2. die Eltern des volljährigen Wahlkindes;<br />
3. die Pflegeeltern oder der Leiter des Heimes, in dem sich das Wahlkind befindet;<br />
182 Dies wird regelmäßig anzunehmen sein, wenn der Unterhaltsanspruch leiblicher Kinder schon vor der Adoption<br />
erheblich unter dem sog. Regelbedarf liegt (OGH 19.5.1994, 2 Ob 536/94).<br />
Seite - 76 -
4. der Jugendwohlfahrtsträger 183 .<br />
Das Anhörungsrecht eines genannten Berechtigten entfällt, wenn er als gesetzlicher Vertreter<br />
des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat; ferner, wenn er nicht oder nur mit unver-<br />
hältnismäßigen Schwierigkeiten gehört werden könnte.<br />
2.9.4 Wirkungen<br />
Zwischen dem Annehmenden und dessen Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und<br />
dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen anderer-<br />
seits entstehen mit diesem Zeitpunkt die gleichen Rechte, wie sie durch die eheliche Abstam-<br />
mung begründet werden. Durch die Adoption erlöschen alle familienrechtlichen (aber nicht die<br />
vermögensrechtlichen) Beziehungen zwischen dem Adoptivkind und seinen minderjährigen Nach-<br />
kommen einerseits und den leiblichen Eltern (bzw. einem Elternteil) und deren Verwandten ande-<br />
rerseits, ausgenommen die Tatsache der Verwandtschaft selbst 184 .<br />
Bei Adoption durch ein Ehepaar schlägt das Erlöschen der familienrechtlichen Beziehungen<br />
auf beide leiblichen Eltern und ihre Verwandten durch; bei Adoption durch eine Einzelperson aber<br />
nur auf den gleichgeschlechtlichen leiblichen Elternteil und seine Verwandten, beides kraft<br />
Gesetzes mit Wirksamkeit der Adoption. Dieses Erlöschen der familienrechtlichen Beziehungen<br />
findet auch darin seinen Ausdruck, dass in der Geburtsurkunde des Wahlkindes als seine Eltern<br />
bloß die Wahleltern anzuführen sind.<br />
2.9.5 Namensrechtliche Wirkungen 185<br />
Das Gericht hat ab 1.5.1995 nur mehr die Voraussetzungen der Annahme an Kindesstatt zu<br />
prüfen. Es ist nicht mehr Aufgabe des Gerichtes, im Beschluss über die Annahme an Kindes-<br />
statt Angaben über die namensrechtlichen Folgen der Adoption zu machen 186 . Es ist nunmehr<br />
Aufgabe der Personenstandsbehörde (des <strong>Standesbeamten</strong>), die entsprechenden Schritte, die zur<br />
Abgabe von Zustimmungen zu namensrechtlichen Folgen einer Annahme an Kindes Statt führen,<br />
zu setzen und selbständig zu beurteilen, welche namensrechtlichen Folgen eine Annahme an<br />
Kindes Statt mit sich bringt. Diese sind weitgehend gleich mit den namensrechtlichen Wirkungen<br />
nach der Legitimation eines Kindes.<br />
183 Der Jugendwohlfahrtsträger, und zwar des Aufenthaltsortes des minderjährigen Adoptivkindes, unabhängig von<br />
seiner allfälligen Stellung als Amtsvormund, Vormund oder Sachwalter.<br />
184 Diese Bestimmungen in § 182 Abs.2 ABGB überschreiten den dem Gesetzgeber nach Art. 8 MRK zur Verfügung<br />
stehenden Gestaltungsfreiraum nicht und verstoßen auch nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz (VfGH 2.12.1993 in<br />
ÖJZ 1995/277).<br />
185 Besonderheiten siehe Zeyringer in ÖStA 1995/65.<br />
186 Die Beurteilung der namensrechtlichen Wirkungen obliegt seit 1.5.1995 allein dem <strong>Standesbeamten</strong>.<br />
Seite - 77 -
a) Wird das Kind von Wahleltern an Kindesstatt angenommen und führen diese einen ge-<br />
meinsamen Familiennamen (Ehenamen), so erhält das Wahlkind diesen, das mündige (über 14<br />
Jahre alte) Kind nur mit seiner Zustimmung 187 .<br />
b) Führen die Wahleltern keinen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) so erhält das<br />
Wahlkind den Familiennamen, den die Wahleltern vor oder bei der Eheschließung zum Familien-<br />
namen der aus der Ehe stammenden Kinder (Wahlkinder) bestimmt haben, mangels einer Na-<br />
mensbestimmungserklärung den Familiennamen des Wahlvaters, ein mündiges Kind jedoch nur<br />
mit seiner Zustimmung.<br />
c) Bei Adoption des Kindes eines Ehegatten durch den anderen Ehegatten gelten die Aus-<br />
führungen nach a) und b) sinngemäß.<br />
d) Bei Adoption durch einen Wahlvater allein erhält das Kind den Familiennamen des Wahl-<br />
vaters, ein mündiges Kind nur mit seiner Zustimmung.<br />
e) Bei Adoption durch eine Wahlmutter allein erhält das Kind, falls die familienrechtlichen Be-<br />
ziehungen zum anderen Elternteil (leiblicher Vater) erloschen sind 188 , den Familiennamen der<br />
Wahlmutter (ein mündiges Wahlkind mit seiner Zustimmung), falls sie aufrecht geblieben sind,<br />
behält es jedoch auf jeden Fall den bisherigen Familiennamen, eine behördliche Namensän-<br />
derung kann jedoch beantragt werden.<br />
Die Staatsbürgerschaft des Wahlkindes wird übrigens durch die Adoption nicht berührt. Ein<br />
automatischer Erwerb ist nicht vorgesehen, jedoch stellt die Annahme an Kindesstatt unter be-<br />
stimmten Voraussetzungen einen begünstigten Verleihungstatbestand dar 189 .<br />
2.9.6 Widerruf und Aufhebung<br />
Die gerichtliche Bewilligung ist vom Gericht unter bestimmten Voraussetzungen von Amts we-<br />
gen oder auf Antrag mit rückwirkender Kraft zu widerrufen. Es tritt der Rechtszustand wieder ein,<br />
wie er vor Erteilung der Bewilligung bestanden hat. Ebenso kann die Adoption durch Gerichtsbe-<br />
schluss aufgehoben werden, wenn z.B. die Ehe zwischen einem Wahlelternteil und einem leibli-<br />
chen Elternteil aufgelöst wurde 190 . Die Aufhebung hat aber keine rückwirkende Kraft, sondern ist<br />
mit dem Eintritt der Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses wirksam.<br />
187 Die Ausübung des Zustimmungsrechts ist zeitlich beschränkt auf drei Jahre nach nachweislicher Verständigung des<br />
Zustimmungsberechtigten von der Annahme an Kindesstatt (§ 54 Abs. 2 Z 5 PStG).<br />
188 Das Erlöschen der familienrechtlichen Beziehungen zum anderen Elternteil geht aus dem gerichtlichen Bewilli-<br />
gungsbeschluss hervor.<br />
189 § 12 Z 4 StbG<br />
190 OGH 26.8.1993 (ÖJZ NRsp 1994/7)<br />
Seite - 78 -
2.9.7 Ausstellung der Geburtsurkunde<br />
Die Mitteilungen der Gerichte 191 an die Personenstandsbehörde sollen auch Angaben über die<br />
Zugehörigkeit der Wahleltern zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft<br />
sowie akademische Grade und Standesbezeichnungen enthalten 192 .<br />
In die Geburtsurkunde des Wahlkindes wird die Adoption eingearbeitet, daher wird das Wahl-<br />
kind, wenn dies zutrifft, mit seinem neuen Familiennamen bezeichnet, die Angaben über die<br />
Wahleltern treten an die Stelle der Angaben über die leiblichen Eltern. Ein Vermerk über die Adop-<br />
tion wird in die Urkunde nicht aufgenommen.<br />
Hat ein Mann allein adoptiert, treten seine Personalien an die Stelle der Angaben über den<br />
leiblichen Vater, daneben werden die Angaben über die leibliche Mutter angeführt, es sei denn,<br />
die familienrechtlichen Beziehungen zu ihr sind erloschen. Im letzteren Fall bleiben die Angaben<br />
über die Mutter in der Geburtsurkunde leer. Hat eine Frau allein adoptiert, ist es umgekehrt.<br />
Haben die Vertragsteile einen derartigen Verzicht erklärt, so spricht man von einer Inkogni-<br />
toadoption. Die Inkognitoadoption dient dazu, das Kind von schädlichen Einflüssen seiner Ver-<br />
wandten abzuschirmen. Der Standesbeamte hat am Ende des Adoptionsvermerkes im Geburten-<br />
buch darauf hinzuweisen. Urkunden und Abschriften dürfen in einem solchen Fall nur Behörden,<br />
dem gesetzlichen Vertreter des Wahlkindes und dem Wahlkind, das das 14. Lebensjahr vollendet<br />
hat, ausgestellt werden.<br />
191 Die Mitteilung erfolgt durch Übersendung eines rechtskräftigen Bewilligungsbeschlusses.<br />
192 Erlass des BM für Justiz vom 5.4.1995 (Amtsblatt der österr. Justizverwaltung 1995/67).<br />
Seite - 79 -
3. EHERECHT<br />
3.0.1 Historische Entwicklung des Eherechtes<br />
Die Familie ist eine zentrale Erscheinungsform der menschlichen Gesellschaft. Sie ist für jeden<br />
einzelnen bedeutungsvoll, weil er in eine Familienbeziehung „hineingeboren“ wird, und sie ist für<br />
die Gesellschaft wichtig, weil sie die Urform jeder sozialen Gemeinschaft darstellt.<br />
Historisch gesehen war die Familie zunächst Großfamilie (Sippe). Die Entwicklung der letzten<br />
Jahrhunderte hat immer mehr zur Auflösung dieser Großverbände geführt. An die Stelle der Ge-<br />
meinschaft der Verwandten ist die Kleinfamilie getreten.<br />
Nachdem in Österreich wie in allen anderen katholischen Ländern Europas durch mehr als ein<br />
halbes Jahrtausend das Eherecht von den kirchlichen Regelungen beherrscht war, setzte im<br />
18. Jahrhundert allmählich eine staatliche Ehegesetzgebung ein. Schon Maria Theresia hatte<br />
einzelne eherechtliche Bestimmungen erlassen. Kaiser Josef II. regelte mit dem Ehepatent von<br />
1783 das gesamte Eherecht und überwies, obwohl er die kirchliche Eheschließungsform beibe-<br />
hielt, die Ehestreitigkeiten der Gerichtsbarkeit des Staates. Doch wieder verdrängte, für wenige<br />
Jahre, die Kirche den Staat. Auf Grund des Konkordats wurden 1856 die eherechtlichen Bestim-<br />
mungen des ABGB wieder aufgehoben. Dieser Rechtszustand ließ sich nach Erlassung der<br />
Staatsgrundgesetze im Jahr 1867 nicht mehr aufrechterhalten. An der kirchlichen Form der<br />
Eheschließung hat das Gesetz festgehalten, aber die Zivilehe für den Fall gestattet, dass die<br />
Kirche ihre Mitwirkung versagt (Notzivilehe). Nach einem Gesetz von 1870 ist sie die regelmäßige<br />
Eheschließungsform der Konfessionslosen.<br />
Wiederholt hat sich der altösterreichische Reichsrat und ebenso das Parlament der ersten Re-<br />
publik mit Anträgen befasst, die entweder die völlige Loslösung des geltenden Eherechts von<br />
seiner konfessionellen Grundlage oder wenigstens die Aufhebung einzelner Bestimmungen ver-<br />
langten. Völlig verändert wurde die Struktur des österreichischen Eherechts durch die Einführung<br />
des deutschen Ehegesetzes (vom 6.7.1938), das am 1.8.1938 im ehemaligen Österreich in Kraft<br />
trat. Dem Geist seiner Entstehungszeit entsprechend, wurde das Gesetz auch mit nationalsozialis-<br />
tischem Gedankengut befrachtet, das dann 1945 aufgehoben wurde. Abgesehen von der erwähn-<br />
ten Bereinigung blieb das Ehegesetz in Österreich 35 Jahre unverändert in Geltung. In den siebzi-<br />
ger Jahren wurden allerdings zunächst mehr marginale, dann aber auch sehr entscheidende<br />
Veränderungen in der Struktur des Gesetzes vorgenommen.<br />
3.0.2 Familie und Verwandtschaft im Sinne des ABGB<br />
Das Gesetz geht von einem sehr weiten Begriff der Familie aus: „Unter Familie werden die<br />
Stammeltern mit allen ihren Nachkommen verstanden“. Darunter fallen alle durch Ehe oder Ver-<br />
Seite - 80 -
wandtschaft verbundenen Personen. Entsprechend weit ist die Umschreibung von Eltern (alle<br />
Vorfahren) und Kindern (alle Nachkommen). Der Sprachgebrauch fasst diese Begriffe überwie-<br />
gend enger. Unter Familie werden oft nur die Eltern und die unmittelbaren Nachkommen verstan-<br />
den. Mit „Eltern“ meint man meist Vater und Mutter, mit „Kindern“ Söhne und Töchter.<br />
Verwandtschaft heißt das Verhältnis zwischen den Stammeltern und allen ihren Nachkom-<br />
men sowie das Verhältnis dieser Nachkommen zueinander. In diesem Sinne verwandt sind alle<br />
Personen, die als Folge einer Zeugung oder Zeugungskette miteinander erbmassemäßig verbun-<br />
den sind (gleichgültig, ob die Abstammung ehelicher oder unehelicher Natur ist).<br />
Maßgebend ist an sich die Blutsverbundenheit (Blutsverwandtschaft), doch kann das rechtlich<br />
erhebliche Verhältnis auch künstlich nachgebildet werden (Adoption).<br />
Die Ehegatten begründen zwar die Familie, werden aber durch den Eheabschluss nicht mitei-<br />
nander verwandt. Das Verhältnis zwischen dem einen Ehegatten und den Verwandten des ande-<br />
ren heißt Schwägerschaft. Sie ist keine Verwandtschaft. Die Nähe der Verwandtschaft wird nach<br />
Graden gemessen. Der Grad ist nach der Zahl der sie vermittelnden Zeugungen zu berechnen.<br />
Die Verwandtschaft zwischen Vorfahren und Nachkommen ist eine solche in „gerader Linie“. Der<br />
Grad wird hier durch einfache Zählung der zwischen dem Vorfahren und seinem Deszendenten<br />
liegenden Zeugungen ermittelt. Der Grad der Verwandtschaft zwischen anderen Personen, die<br />
Verwandte in der „Seitenlinie“ heißen, wird nach der Zahl der Zeugungen gezählt, die zwischen<br />
den in Frage stehenden Personen und ihren gemeinsamen Stammeltern liegen. Der Grad der<br />
Schwägerschaft orientiert sich an der Verwandtschaft: Ein Gatte ist mit den Familienangehörigen<br />
des anderen in jenem Grad verschwägert, in dem dieser mit seinen Angehörigen verwandt ist.<br />
Beispiele: Eltern und Kinder oder Großeltern und Enkel sind in gerader Linie verwandt, Geschwister,<br />
Cousins oder Onkel und Nichten in der Seitenlinie. In der geraden Linie sind Kinder<br />
mit den Eltern im 1. Grad, Enkel mit Großeltern im 2. Grad verwandt. In der Seitenlinie<br />
sind Geschwister im 2. Grad, Tanten und Neffen im 3. Grad, Cousins im 4. Grad verwandt.<br />
3.1 Eherecht im engeren Sinn<br />
3.1.1 Allgemeines<br />
3.1.1.1 Die Ehe<br />
Die Familienverhältnisse werden durch den Ehevertrag gegründet. In dem Ehevertrage erklä-<br />
ren zwei Personen verschiedenen Geschlechtes 193 gesetzmäßig ihren Willen, in unzertrennlicher<br />
193 Eine zwischen Personen gleichen Geschlechts vorgenommene Trauung ist derzeit in Österreich eine Nichtehe. In<br />
vielen Staaten gibt es jedoch Rechtsinstitute, die eine eheähnliche Familienbildung für zwei Personen desselben Geschlechts<br />
möglich machen (z.B. Deutschland: Lebenspartnerschaftsgesetz).<br />
Seite - 81 -
Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich gegenseitigen Beistand zu<br />
leisten (§ 44 ABGB)<br />
Der erste Satz dieser Bestimmung des ABGB ist nicht wörtlich zu nehmen; es gibt auch Fami-<br />
lienverhältnisse außerhalb der Ehe. Das frühere wörtliche Verständnis ist durch die Rechtsent-<br />
wicklung, insbesondere hinsichtlich des unehelichen Kindes, überholt. Auch die übrigen Bestim-<br />
mungen des § 44 sind normativ ausgehöhlt. Der Gesetzgeber hat einen Ehebegriff aufrechterhal-<br />
ten, der mit den Vorschriften über die Ehewirkungen in Widerspruch steht 194 .<br />
Das Wesen der Ehe liegt in einer - grundsätzlich lebenslangen - umfassenden Gemein-<br />
schaft 195 . Wie nach allen Rechtsordnungen unseres Kulturkreises ist auch nach dem ABGB die<br />
Ehe eine E i n e h e . Die eheliche Gemeinschaft ist zwar auf Dauer angelegt, aber nach heutigem<br />
Recht nicht mehr schlechthin unzertrennlich. Das Zeugen von Kindern und ihre Erziehung ist nach<br />
den Vorstellungen des Gesetzes das erwünschte Ziel jeder Ehe, doch sind auch kinderlose Ehen<br />
voll gültig und erfüllen den wesentlichen Zweck des gegenseitigen Beistandes.<br />
Institutionell ist die Ehe die innerhalb der Rechtsgemeinschaft mit den vergleichsweise weitest-<br />
gehenden Rechtswirkungen ausgestattete Verbindung von Mann und Frau. Durch diese Höher-<br />
bewertung unterscheidet sich die Ehe von Abenteuer, Verhältnis, Verlöbnis und Lebensgemein-<br />
schaft.<br />
Das Verschwinden ehetragender Gesellschaftsstrukturen und der Verlust prägender Ideologien<br />
haben den Glauben an die Höherbewertung der Ehe erschüttert und das moderne Ehebild in die<br />
Krise geführt. Der Gesetzgeber hat zwar in verschiedenen Nachziehverfahren durch Liberalisie-<br />
rung des Eherechtes (Partnerschaftsprinzip, Auflösungserleichterung) die Entwicklung zu steuern<br />
versucht, den zunehmenden Bedeutungsverlust aber nicht aufhalten können. Heute hat die Ehe<br />
ihre gesellschaftlich dominierende Funktion, ihr Monopol unter den Gemeinschaftsformen verloren<br />
und ist nur mehr eine unter mehreren möglichen Formen des Zusammenlebens.<br />
Abschluss, Inhalt und Auflösung der Ehe werden allein vom staatlichen Recht geregelt. Eine<br />
Ehe liegt demnach nur dann vor, wenn bezüglich Voraussetzungen und Abschlussform die staatli-<br />
chen Vorschriften eingehalten wurden (Grundsatz der obligatorischen Zivilehe). Die jeweiligen<br />
kirchenrechtlichen Vorschriften sind zwar für die Mitglieder der kirchlichen Gemeinschaft intern<br />
verbindlich, haben aber heute im staatlichen Bereich keine Wirkung mehr.<br />
Die derzeit geltenden Eherechtsquellen sind aus historischen Gründen auf mehrere Gesetze<br />
verteilt:<br />
194 Das Eheschließungen auf dem Totenbett und unter Zeugungsunfähigen gültig sind, wurde nie bezweifelt. Auch die<br />
Vereinbarung, kinderlos zu bleiben, ist rechtlich verbindlich.<br />
195 Den vielfach verwendeten Begriff der „Scheinehe“ gibt es weder im Ehegesetz noch im Personenstandsgesetz; siehe<br />
dazu ÖStA 1990/25.<br />
Seite - 82 -
1. ABGB (Ehewesen, Rechte und Pflichten der Ehegatten, Verlöbnis, Ehegüterrecht)<br />
2. Ehegesetz (Eingehung und Auflösung der Ehe, Wirkungen der Eheauflösung)<br />
3. 1. Durchführungsverordnung zum Ehegesetz (einige Detailbestimmungen zum<br />
Ehegesetz)<br />
4. das Eheverfahrensrecht ist für Streitverfahren in der ZPO, für die einvernehmliche<br />
Scheidung im AußStrG geregelt<br />
5. verschiedene Ehesanierungsgesetze aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg sind<br />
mittlerweile praktisch bedeutungslos.<br />
3.1.1.2 Die nichteheliche Lebensgemeinschaft<br />
Neben der Ehe als der von der Rechtsordnung anerkannten Verbindung bestehen auch länger<br />
andauernde Wohnungs-, Wirtschafts- und Geschlechtsgemeinschaften von Mann und Frau, die<br />
nicht die Voraussetzungen einer anerkannten Ehe erfüllen und daher nicht die - von den Beteilig-<br />
ten teils erwünschten, teils unerwünschten - Wirkungen der Ehe hervorrufen. Die eherechtlichen<br />
Bestimmungen sind grundsätzlich auch nicht analog anzuwenden, da kein familienrechtliches<br />
Verhältnis begründet wird. Die Lebensgemeinschaften erzeugen z.B. keine Unterhaltspflichten<br />
und sind faktisch jederzeit von den Beteiligten formlos auflösbar (genauer: kein Partner ist zur<br />
Fortsetzung verpflichtet). Eine stärkere Annäherung der Lebensgemeinschaft an die Ehe wäre<br />
allerdings problematisch, da dadurch die von den strengeren Vorschriften des Eherechtes erstreb-<br />
ten Ziele vereitelt werden könnten. Ausdrückliche gesetzliche Rechtsfolgen hat die nichteheliche<br />
Lebensgemeinschaft nur in einigen Teilen des öffentlichen Rechts und im Mietrecht.<br />
3.1.2 Das Verlöbnis<br />
3.1.2.1 Rechtsnatur<br />
Nicht notwendiger Weise, aber im allgemeinen geht der Ehe ein Verlöbnis voraus; nämlich<br />
spätestens dann, wenn die Partner sich über die zukünftige Eheschließung geeinigt haben. Ver-<br />
löbnis ist die Vereinbarung zweier Personen verschiedenen Geschlechtes, einander künftig heira-<br />
ten zu wollen, also das wechselseitige Versprechen künftiger Eheschließung.<br />
Der Zeitpunkt der Eheschließung muss ebenso wenig vereinbart sein wie auch Einzelheiten<br />
der gemeinsamen Zukunft. Die herrschende Lehre betrachtet es als einen Vertrag. Da er auf den<br />
Abschluss eines anderen Geschäftes, nämlich der Ehe, gerichtet ist, ist er ein Vorvertrag. Im<br />
Gegensatz zu den schuldrechtlichen Vorverträgen ist aber die Verpflichtung zum Abschluss des<br />
Hauptvertrages nicht durchsetzbar. Die Willensfreiheit bei der Eheschließung muss in vollem<br />
Umfang gewahrt bleiben. Deshalb kann das Verlöbnis auch nicht durch Konventionalstrafe gesi-<br />
chert werden.<br />
Seite - 83 -
3.1.2.2 Abschluss<br />
Für das Verlöbnis gelten die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts, soweit sich nicht aus<br />
seiner familienrechtlichen Natur Abweichungen ergeben.<br />
Weil keine besondere Formvorschrift besteht, kann das Verlöbnis auch durch konkludentes<br />
(schlüssiges) Verhalten zustande kommen (z.B. Handanhalten bei Brauteltern, Ringwechsel u.ä.).<br />
Die Parteien müssen geschäftsfähig sein. Minderjährige bedürfen der Zustimmung des gesetzli-<br />
chen Vertreters; bis zur Genehmigung ist das Verlöbnis schwebend unwirksam. Eine Anfechtung<br />
wegen Willensmangels ist möglich. Der Abschluss durch Stellvertreter ist wegen der höchstper-<br />
sönlichen Natur des Geschäftes ausgeschlossen. Ist das Verlöbnis auf eine rechtlich nicht mögli-<br />
che Ehe gerichtet, so ist es ungültig; sittenwidrige Verlöbnisse sind nichtig. Unwirksam ist in der<br />
Regel auch das Verlöbnis einer verheirateten Person.<br />
3.1.2.3 Wirkungen<br />
Die versprochene Eheschließung ist nicht erzwingbar, jeder Partner kann stets - auch ohne<br />
besonderen Grund - vom Verlöbnis zurücktreten. Ein Verlöbnis ist dennoch nicht ohne jede recht-<br />
liche Wirkung. Es braucht zwar nicht erfüllt zu werden, doch besteht Anspruch auf Schadener-<br />
satz, wenn ein Teil ohne begründete Ursache vom Verlöbnis zurücktritt.<br />
Beispiele: Kosten der Verlobungsfeier; Kosten der Vorbereitung für die Hochzeit und die<br />
künftige Ehewohnung; Nachteile durch Verzicht auf Verdienstmöglichkeiten u.ä.<br />
Zu ersetzen ist also bloß der „wirkliche Schaden“ (Vermögensschaden). Nicht zu ersetzen sind<br />
immaterielle Schäden (etwa für verminderte Heiratsaussichten; sonstiges Schmerzensgeld) und<br />
entgangener Gewinn (z.B. versäumte Ersparnisse, Entgang von finanziellen Vorteilen aus der<br />
nicht zustande gekommenen Ehe oder aus einer wegen des Verlöbnisses abgelehnten anderwei-<br />
tigen Ehe).<br />
Hat ein Verlobter seinem Partner oder ein Dritter einem der beiden Teile im Hinblick auf die<br />
künftige Ehe etwas geschenkt, so kann die Schenkung widerrufen werden, wenn die Ehe ohne<br />
Verschulden des Geschenkgebers nicht zustande kommt.<br />
3.1.3 Die Eheschließung<br />
3.1.3.1 Die Voraussetzungen im allgemeinen<br />
Die Ehe wird durch einen Vertrag begründet, der eine fehlerfreie Einigung zwischen Braut und<br />
Bräutigam voraussetzt. Die Willenserklärungen der Brautleute müssen auf den Abschluss einer<br />
Ehe gerichtet sein; wegen des im Eherecht bestehenden Typenzwanges können die Parteien<br />
allerdings nicht bestimmen, welche Rechtsfolgen im einzelnen eintreten sollen. Die Ehe kommt<br />
Seite - 84 -
mit dem gesetzlichen Inhalt zustande. Der in der älteren Lehre geführte Streit um die Vertragsna-<br />
tur der Ehe ist daher relativ bedeutungslos, da die Rechtswirkungen der Ehe, wie erwähnt, vielfach<br />
zwingender Natur sind.<br />
Der Abschluss setzt die Ehefähigkeit der Parteien voraus und es dürfen keine sonstigen Hin-<br />
dernisse (Eheverbote) vorliegen. Überdies bedarf es der Einhaltung einer besonderen Form und<br />
der Mitwirkung des <strong>Standesbeamten</strong>. Dass dessen Beteiligung erforderlich ist, ändert nichts am<br />
Vertragscharakter.<br />
3.1.3.2 Die Ehefähigkeit<br />
Ehefähig ist, wer ehegeschäftsfähig und ehemündig ist. Die Ehegeschäftsfähigkeit bestimmt<br />
sich nach den allgemeinen Regeln über die Handlungsfähigkeit. Völlig geschäftsunfähige Perso-<br />
nen können keine Ehe schließen. Beschränkt Geschäftsfähige bedürfen der Zustimmung ihres<br />
gesetzlichen Vertreters (Obsorgeberechtigten) und des Erziehungsberechtigten.<br />
Verweigert der gesetzliche Vertreter oder der Erziehungsberechtigte die Einwilligung, so hat<br />
sie das Gericht auf Antrag des Verlobten, der der Einwilligung bedarf, zu ersetzen, wenn keine<br />
gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen. 196 Auch Personen, denen nur für eine ein-<br />
zelne Angelegenheit ein Sachwalter bestellt ist, gelten als beschränkt geschäftsfähig und benöti-<br />
gen daher für die Eheschließung die Zustimmung des Sachwalters 197 .<br />
Die Ehemündigkeit erreichen der Mann und die Frau mit dem vollendeten 18. Lebensjahr. 198<br />
Das Gericht hat aber eine Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, auf ihren Antrag für<br />
ehemündig zu erklären, wenn sie für die Ehe reif erscheint und der künftige andere Ehegatte<br />
volljährig ist. Für die Eheschließung bedarf sie aber auch der Zustimmung des gesetzlichen<br />
Vertreters, da sie nicht voll geschäftsfähig ist.<br />
3.1.3.3 Die Eheverbote<br />
Eheverbote im weiteren Sinn sind Umstände, bei deren Vorliegen der Standesbeamte nicht<br />
trauen darf. Es sind dies die Eheverbote im engeren Sinn (Blutsverwandtschaft, Adoption, Dop-<br />
pelehe) und die Verbote, die aus den Vorschriften über die Ehefähigkeit und über die Nichtigkeits-<br />
gründe ableitbar sind.<br />
196<br />
Eine bereits gegebene Einwilligung kann der Berechtigte bis zur Eheschließung widerrufen.<br />
197<br />
siehe Hintermüller in ÖStA 1986/42.<br />
198<br />
Änderung der Bestimmungen des § 1 Ehegesetz durch das KRÄG 2001 (BGBl. I Nr. 135/2000) mit Wirkung vom<br />
1.7.2001.<br />
Seite - 85 -
1. Blutsverwandtschaft<br />
Die Rechtsordnungen aller Kulturstaaten untersagen Eheabschlüsse zwischen Verwandten - je<br />
nach dem Grad der Verwandtschaft - überhaupt oder binden sie an eine besondere Erlaubnis<br />
(Verhinderung des Inzests). Unser Ehegesetz verbietet sie zwischen Blutsverwandten der gera-<br />
den Linie und zwischen voll- oder halbbürtigen Geschwistern, gleichgültig ob die Verwandtschaft<br />
auf ehelicher oder unehelicher Geburt beruht 199 .<br />
2. Annahme an Kindesstatt (Adoption)<br />
Da die Annahme an Kindesstatt die Blutsverwandtschaft nachbildet, steht sie ähnlich wie diese<br />
einer Eheschließung entgegen. Sie erzeugt allerdings ein weniger weitreichendes Verbot als die<br />
Blutsverwandtschaft. Es besteht nur zwischen dem angenommenen Kind und seinen Abkömmlin-<br />
gen einerseits und dem Annehmenden andererseits, und zwar nur so lange, als das durch die<br />
Annahme begründete Rechtsverhältnis aufrecht ist. Wird die Adoption beseitigt, so ist auch das<br />
Ehehindernis hinfällig.<br />
3. Doppelehe<br />
Entsprechend dem Prinzip der Einehe darf niemand zur gleichen Zeit mit mehr als einer Per-<br />
son verheiratet sein. Ist jemand schon verheiratet, so kann er eine neue Ehe erst dann eingehen,<br />
wenn seine frühere Ehe für nichtig erklärt oder aufgelöst worden ist.<br />
Die Wiederholung der Eheschließung mit dem selben Ehepartner ist keine Doppelehe. Sie be-<br />
deutet nur eine doppelte Eheschließung. Diese ist zulässig, wenn die Ehegatten Zweifel an der<br />
Gültigkeit oder an dem Fortbestand ihrer Ehe vermuten. Solche Zweifel können bestehen, wenn<br />
die Ehe mit Nichtigkeit bedroht ist oder wenn keine ordnungsgemäße Heiratseintragung besteht<br />
oder zwar besteht, es aber den Ehegatten so gut wie unmöglich ist, sich einen Auszug oder eine<br />
Abschrift davon zu beschaffen. 200<br />
4. Wirkungen der Eheverbote<br />
Die Eheverbote im weiteren Sinn sollen zwar alle den Eheabschluss verhindern und sind vom<br />
<strong>Standesbeamten</strong> wahrzunehmen, sie haben aber verschiedene Wirkung. Die Übertretung man-<br />
cher Verbote berührt die Gültigkeit der Ehe nicht, sie heißen „schlichte Eheverbote“. Zu diesen<br />
gehören die Verbote der Eheschließung wegen mangelnder Ehemündigkeit und mangelnder<br />
Zustimmung des Erziehungsberechtigten. Die Übertretung anderer Verbote hat die Nichtigkeit der<br />
Ehe zur Folge, was freilich hier nicht absolute Ungültigkeit, sondern bloße Vernichtbarkeit bedeu-<br />
tet. Nichtigkeit tritt ein, wenn die Ehe trotzt Vorliegens des Hindernisses der Verwandtschaft oder<br />
der Doppelehe geschlossen wird.<br />
199<br />
Nicht verwandt sind Stiefvater und Stieftochter, Schwiegervater und Schwiegertochter; sie sind in gerader Linie<br />
verschwägert.<br />
200<br />
OGH 10.4.1997, 6 Ob 2275/96v (ÖJZ 1997,828)<br />
Seite - 86 -
3.1.3.4 Die Form der Eheschließung<br />
Im Interesse der Offenkundigkeit und Rechtssicherheit ist die Eheschließung an strenge Form-<br />
vorschriften gebunden. Erste und unabdingbare Voraussetzung ist, dass der Ehevertrag vor dem<br />
<strong>Standesbeamten</strong>, der die Traubereitschaft zu erkennen geben muss, geschlossen wird (Grund-<br />
satz der obligatorischen Zivilehe). Für die Wirksamkeit der Trauung ist aber auch erforderlich,<br />
dass der Standesbeamte für seinen Tätigkeitssprengel wirksam bestellt ist (außerhalb seines<br />
Sprengels ist der Standesbeamte nicht trauungsermächtigt).<br />
Andernfalls ist der gesetzte Akt absolut nichtig (unwirksam), es bedarf keiner wie immer gear-<br />
teten „Vernichtung“ (sog. „Nichtehe“). Der „Scheinstandesbeamte“, der ohne Standesbeamter zu<br />
sein (z.B. wegen Bestellungsfehler oder bei Trauung außerhalb seines Sprengels) diese Funktion<br />
öffentlich ausübt, macht die Trauung erst mit ihrer Eintragung in das Ehebuch wirksam (§ 15<br />
Abs. 2 EheG). In den übrigen Fällen ist diese Eintragung nur deklarativ und berührt die Trauungs-<br />
gültigkeit ebenso wenig wie das Fehlen der Unterschriften von Ehegatten, Zeugen und Standes-<br />
beamten in der Ehebucheintragung. Das Fehlen des zuständigen <strong>Standesbeamten</strong> macht also die<br />
Trauung rechtsunwirksam, also zur Nichtehe.<br />
Beispiele: Alle in Österreich stattfindenden Trauungen durch andere Trauungsorgane (wie<br />
konfessionelle Trauungen, solche durch konsularische bzw. diplomatische Vertreter oder<br />
durch Schiffskapitäne u.ä.) sind aus österreichischer Sicht absolute Nichtehen. Ausnahme:<br />
In der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit nichtstandesamtlich durchgeführte Eheschließungen<br />
sind durch mehrere Spezialgesetze nachträglich saniert worden; diese Gesetze<br />
sind durch Ablauf der Antragsfristen längst gegenstandslos.<br />
Die Ehe selbst kann vor jeder Personenstandsbehörde in ganz Österreich geschlossen wer-<br />
den. Der Standesbeamte hat die Verlobten vor zwei Trauzeugen einzeln und nacheinander zu<br />
fragen, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Die Verlobten müssen persönlich - also nicht<br />
durch Stellvertreter - und bei gleichzeitiger Anwesenheit vor dem <strong>Standesbeamten</strong> erklären, die<br />
Ehe miteinander eingehen zu wollen. Die Erklärungen können weder unter einer Bedingung noch<br />
unter einer Befristung abgegeben werden. Geheimer Vorbehalt, Scheinerklärung und nicht er-<br />
kennbares Fehlen der Ernstlichkeit sind unerheblich.<br />
Eine Ehe wird fehlerfrei geschlossen, wenn ihr kein gesetzliches Verbot entgegensteht, keine<br />
Formvorschrift verletzt wird und kein Willensmangel vorliegt. Unterlaufen solche Fehler, so muss<br />
unterschieden werden. Die Übertretung der „schlichten Eheverbote“ berührt ebenso wenig die<br />
Gültigkeit der Ehe wie die Nichteinhaltung von Formerfordernissen, die bloße „Sollvorschriften“<br />
sind. 201 Die Vornahme von Trauungen ohne die Einhaltung dieser Formerfordernisse ist dem<br />
<strong>Standesbeamten</strong> allerdings verboten und macht ihn disziplinär strafbar.<br />
201 siehe auch den Abschnitt „Personenstandsrecht - Trauung“.<br />
Seite - 87 -
Sie sehen etwa vor, dass der Standesbeamte die Trauung feierlich zu gestalten, die Verlobten<br />
in Gegenwart zweier Trauzeugen nach ihrem Ehewillen zu befragen und nach Bejahung dieser<br />
Frage auszusprechen hat, dass die Verlobten „rechtmäßig verbundene Eheleute“ seien. Nach<br />
Beendigung der Zeremonie hat der Standesbeamte in Anwesenheit der Ehegatten und der Zeu-<br />
gen die Eintragung in das Ehebuch vorzunehmen, die von allen Anwesenden zu unterfertigen<br />
ist. Die Mitwirkung des <strong>Standesbeamten</strong> bei der Eheschließung beschränkt sich aber nicht auf die<br />
Entgegennahme der Erklärungen der Verlobten. Er muss insbesondere darauf achten, dass die<br />
Erklärungen, die von den Verlobten abgegeben werden, Eheschließungserklärungen im Sinne des<br />
Gesetzes sind. Mängel in dieser Hinsicht haben zur Folge, dass eine Ehe überhaupt nicht zustan-<br />
de kommt oder dass die geschlossene Ehe nichtig (vernichtbar) ist. Derartige mangelhafte Erklä-<br />
rungen (wie die schon erwähnte Beifügung einer Bedingung oder Befristung) muss der Standes-<br />
beamte sofort zurückweisen.<br />
Schwerwiegende Fehler bewirken hingegen die Mangelhaftigkeit der Ehe. Solche Fehler, die<br />
im Ehegesetz erschöpfend aufgezählt sind, können je nach ihrer Art zur Nichtigerklärung oder<br />
Aufhebung der Ehe führen, die beide durch richterliches Urteil erfolgen müssen. Bis dahin ist<br />
auch die mangelhafte Ehe voll wirksam. Das Klagerecht steht entweder einem oder beiden Ehe-<br />
gatten, allenfalls auch dem Staatsanwalt zu. Es bedarf allerdings keiner gerichtlichen Geltendma-<br />
chung der Ungültigkeit, wenn nicht einmal die elementarsten Voraussetzungen einer Eheschlie-<br />
ßung erfüllt sind (Nichtehe). Solche Akte sind generell unwirksam. Eine Nichtehe liegt vor allem<br />
dann vor, wenn der Standesbeamte bei der „Trauung“ nicht mitgewirkt hat oder bei der Gleichge-<br />
schlechtlichkeit der Partner.<br />
3.1.4 Auflösung der mangelhaften Ehe<br />
3.1.4.1 Allgemeines<br />
Nach geltendem Recht kann eine wirksam geschlossene Ehe zu Lebzeiten der Gatten grund-<br />
sätzlich nur mittels rechtsgestaltender Gerichtsentscheidung aufgelöst werden; das Eheband<br />
wird erst mit Rechtskraft der Auflösungsentscheidung beseitigt. Voraussetzung jeder Art einer<br />
Eheauflösung ist daher der Bestand einer wirksam geschlossenen Ehe.<br />
Je nach den Auflösungsgründen kann die gerichtliche Eheauflösung in verschiedenen Typen<br />
erfolgen: Schwere, im öffentlichen Interesse zu ahndende Abschlussfehler (z.B. Geschäftsunfä-<br />
higkeit, Blutsverwandtschaft) berechtigen zur Nichtigerklärung, nur für die Parteien relevante<br />
Abschlussfehler (Willensmängel) zur Aufhebung der Ehe. Die Rechtsfolgen der einzelnen Auflö-<br />
sungstypen sind teilweise verschieden.<br />
Seite - 88 -
3.1.4.2 Die Nichtigkeit der Ehe<br />
1. Nichtigkeitsgründe<br />
Eine Ehe ist nur in den Fällen nichtig, in denen dies in den §§ 21-25 des Ehegesetzes be-<br />
stimmt ist. Weitere Ehenichtigkeitsgründe gibt es nicht. Nichtigerklärung ist die (teilweise rückwir-<br />
kende) gerichtliche Beseitigung der Ehe wegen schwerer Eheschließungsmängel. Bis zur Nichti-<br />
gerklärung darf die Wirksamkeit des Ehebandes nicht bezweifelt werden (§ 27 EheG).<br />
a) Formmangel (§ 21 EheG)<br />
Eine Ehe ist nichtig, wenn die Eheschließung nicht in der durch das Ehegesetz vorgeschriebe-<br />
nen Form stattgefunden hat; also wenn die Eheschließenden nicht gleichzeitig persönlich anwe-<br />
send waren, durch Stellvertreter gehandelt haben oder die Ehe nur unter einer Bedingung bzw.<br />
Befristung eingegangen sind.<br />
Beachte: Das Fehlen des <strong>Standesbeamten</strong> (bzw. Scheinstandesbeamten) bei der Trauung<br />
ist kein Formfehler im Sinne des § 21 EheG, sondern verhindert wegen § 15 EheG das wirksame<br />
Zustandekommen der Ehe überhaupt, hat also eine Nichtehe zur Folge !<br />
b) Mangel der Geschäftsfähigkeit (§ 22 EheG)<br />
Nach den Bestimmungen des Ehegesetzes begründet es Nichtigkeit der Ehe, wenn auch nur<br />
einer der Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschließung geschäftsunfähig war oder sich im Zustand<br />
der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit befand. (z.B. Alkoholi-<br />
sierte, Geschockte u.ä.).<br />
c) Namens- und Staatsangehörigkeitsehe (§ 23 EheG)<br />
Wird eine Ehe ausschließlich oder vorwiegend zu dem Zwecke geschlossen, der Frau den<br />
Familiennamen des Mannes oder dessen Staatsbürgerschaft zu verschaffen, so ist sie nichtig (gilt<br />
analog auch für den Mann). Die Parteien wollen hier im gegenseitigen Einverständnis keine Ehe<br />
im Sinne einer Lebensgemeinschaft eingehen. Sie täuschen dem <strong>Standesbeamten</strong> den Eheab-<br />
schlusswillen nur vor, um Rechtsfolgen herbeizuführen, die sie sonst nicht oder nur schwer errei-<br />
chen können. Es handelt sich daher um ein Scheingeschäft.<br />
Der Fall der Staatsangehörigkeitsehe hat heute nicht mehr die Bedeutung früherer Jahre, als<br />
eine Fremde entweder bereits durch die Eheschließung mit einem Staatsbürger automatisch die<br />
Staatsbürgerschaft erwarb bzw. durch einfache Erklärung erwerben konnte.<br />
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat allerdings bereits mehrfach dargelegt, 202 dass die durch<br />
die Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 1983 geänderte staatsbürgerschaftsrechtliche Lage die<br />
Bestimmung des § 23 Abs. 1 Ehegesetz nicht gegenstandslos gemacht hat. Einem Fremden steht<br />
202 z.B. am 30.3.1994, 8 Ob 577/93 (ZfRV 1994, 210) und 26.5.1997, 6 Ob 65/97w (ÖJZ-LSK 1997/244); Demnach ist<br />
eine Ehe auch dann nichtig, wenn sie - ohne die Absicht, eine Lebensgemeinschaft zu begründen - allein oder überwiegend<br />
zu dem Zweck geschlossen wurde, dem Fremden den unbeschränkten Aufenthalt in Österreich zu ermöglichen.<br />
Seite - 89 -
im Falle der Eheschließung mit einem Inländer bei Vorliegen weiterer gesetzlich umschriebener<br />
Voraussetzungen ein Anspruch auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft nach<br />
gewisser Zeit zu. 203 Die Eheschließung ist damit staatsbürgerschaftserwerbsrechtlich erhebliches<br />
Tatbestandselement; sie „ermöglicht“ in diesem Sinn den Staatsbürgerschaftserwerb. Daher ist<br />
auch eine Ehe, die zumindest überwiegend dazu dient, dem Mann (der Frau) den Erwerb der<br />
österreichischen Staatsbürgerschaft zu ermöglichen, nichtig.<br />
Der Nichtigkeitsgrund der Namens- und Staatsangehörigkeitsehe ist für den allein klagslegiti-<br />
mierten Staatsanwalt allerdings oft nur schwer nachweisbar.<br />
d) Doppelehe (§ 24 EheG)<br />
Eine Doppelehe liegt dann vor, wenn auch nur ein Verlobter bei der Eheschließung noch an-<br />
derweitig wirksam verheiratet (d.h. die Vorehe nicht aufgelöst) ist.<br />
e) Blutsverwandtschaft (§ 25 EheG)<br />
Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Blutsverwandten gerader Linie und zwi-<br />
schen voll- oder halbbürtigen Geschwistern, gleichgültig, ob die Blutsverwandtschaft auf ehelicher<br />
oder unehelicher Geburt beruht.<br />
f) Wiederverheiratung bei Todeserklärung (§ 43 EheG)<br />
Bei Wiederverheiratung nach Todeserklärung besteht dann ein Nichtigkeitsgrund, wenn bei der<br />
Wiederverheiratung beide Partner der neuen Ehe wussten, dass der für tot erklärte Gatte der<br />
Vorehe eines Verlobten noch lebt.<br />
2. Die Heilung der Nichtigkeit<br />
In den meisten Fällen der Ehenichtigkeit ist eine Heilung möglich. Nur die Nichtigkeit wegen<br />
Blutsverwandtschaft und Doppelehe ist wegen der besonderen Schwere des Nichtigkeitsgrundes<br />
unheilbar. Wird der Tatbestand der Heilung erfüllt, so kann die Nichtigkeit nicht mehr geltend<br />
gemacht werden. Die Ehe ist als von Anfang an gültig zu betrachten.<br />
Die Nichtigkeit wegen eines Formmangels wird geheilt, wenn die Partner nach der Eheschlie-<br />
ßung fünf Jahre miteinander als Gatten gelebt haben. Es kommt dabei nicht darauf an, ob sie von<br />
der Nichtigkeit wussten. Die Heilung ist ausgeschlossen, wenn vor Ablauf der Frist die Nichtig-<br />
keitsklage erhoben wurde. Wird wegen des Formmangels der Eheabschluss wiederholt, so saniert<br />
dies die Ehe nicht rückwirkend. Die Namens- und Staatsangehörigkeitsehe ist in derselben Weise<br />
heilbar wie die wegen Formmangels nichtige Ehe.<br />
203 § 11a StbG idgF.<br />
Seite - 90 -
Fehlt beim Eheabschluss die Geschäftsfähigkeit, so ist die Ehe von Anfang an gültig, wenn der<br />
Ehegatte nach Wegfall der Geschäftsunfähigkeit zu erkennen gibt, dass er die Ehe fortsetzen<br />
will.<br />
Die Doppelehe ist unheilbar. Die Nichtigkeit bleibt auch bestehen, wenn die erste Ehe aufge-<br />
löst wurde. Es bleibt nur die Möglichkeit einer neuen Eheschließung nach Wegfall des Eheverbo-<br />
tes. Auch die Nichtigkeit der Ehe wegen Blutsverwandtschaft ist unheilbar.<br />
3. Geltendmachung der Nichtigkeit<br />
Niemand kann sich auf die Nichtigkeit berufen, solange die Ehe nicht durch gerichtliches Ur-<br />
teil für nichtig erklärt worden ist. Die Nichtigkeit im Eherecht ist also in Wahrheit eine bloße „Ver-<br />
nichtbarkeit“, die erst mit Rechtskraft eines stattgebenden richterlichen Gestaltungsurteiles eintritt.<br />
Zur Klage sind grundsätzlich die Ehegatten und der Staatsanwalt berechtigt.<br />
Bei der Namens- und Staatsangehörigkeitsehe ist nur der Staatsanwalt klagslegitimiert. Die-<br />
sem steht auch dann das alleinige Klagerecht zu, wenn die nichtige Ehe inzwischen (durch Tod<br />
oder Scheidung) aufgelöst wurde. Sind beide Ehegatten schon verstorben, so ist eine Nichtig-<br />
keitsklage überhaupt ausgeschlossen. Den Nichtigkeitsgrund der Doppelehe kann auch der Gatte<br />
aus der ersten (gültigen) Ehe geltend machen.<br />
4. Folgen der Nichtigerklärung<br />
Das richterliche Gestaltungsurteil vernichtet die Ehe rückwirkend, so dass die Gatten als von<br />
Anfang an nicht verheiratet gelten. Diese Rückwirkung (ex tunc-Wirkung) ist allerdings nicht voll-<br />
kommen, es gibt eine Reihe ausdrücklich vorgeschriebener Ausnahmen.<br />
a) Rechtliche Stellung der Kinder<br />
Ehelich geborene Kinder aus nichtigerklärten Ehen bleiben ehelich, behalten ihren Familien-<br />
namen und werden nach Nichtigerklärung so behandelt, wie Kinder aus anderen aufgelösten Ehen<br />
(§§ 138 und 177 ABGB).<br />
b) Vermögensrechtliche Beziehungen der Ehegatten<br />
Wegen der Rückwirkung der Nichtigerklärung haben die auf Grund der Ehe erbrachten gegen-<br />
seitigen Leistungen keinen Rechtsgrund und sind deshalb nach Bereicherungsrecht rückabzuwi-<br />
ckeln.<br />
Die Nichtigkeitsfolgen treten jedoch nur dann ein, wenn beide Ehegatten bei der Eheschlie-<br />
ßung die Nichtigkeit gekannt haben. Hat sie hingegen auch nur ein Gatte nicht gekannt, so richten<br />
sich die vermögensrechtlichen Beziehungen der Gatten nach Scheidungsrecht, so dass bloß<br />
eine ex nunc-Wirkung eintritt. Ein durch die Nichtigerklärung geschädigter schuldloser Gatte kann<br />
Seite - 91 -
vom anderen Schadenersatz begehren, wenn dieser beim Eheabschluss die Nichtigkeit kannte<br />
oder kennen musste.<br />
c) Sonstige Wirkungen der Nichtigerklärung<br />
Durch die Nichtigerklärung erhält jeder Gatte wieder seinen früheren Familiennamen. Ein<br />
Gatte, der durch die Eheschließung die Volljährigkeit erlangt hat 204 , büßt sie wieder ein, wenn die<br />
Ehe vor Vollendung seines 18. Lebensjahres für nichtig erklärt wird. Eine durch die Ehe erworbene<br />
Staatsangehörigkeit des Gatten ging früher durch die Nichtigerklärung wieder verloren.<br />
Gutgläubige Dritte werden im Vertrauen auf den Bestand der Ehe geschützt. Hat also z.B.<br />
der haushaltführende Gatte im Rahmen der Schlüsselgewalt Geschäfte getätigt, so kann der<br />
daraus verpflichtete andere Teil dem Dritten die Ungültigkeit der Ehe nur dann entgegenhalten,<br />
wenn sie beim Abschluss des Geschäftes schon für nichtig erklärt war oder der Dritte ihre Nichtig-<br />
keit gekannt hat.<br />
3.1.4.3 Die Aufhebung der Ehe<br />
1. Aufhebungsgründe<br />
Die Aufhebung der Ehe ist die gerichtliche Eheauflösung wegen bestimmter Willensmängel<br />
beim Eheabschluss (Aufhebungsgründe) mit Wirkung für die Zukunft. Die Ehe kann nur aus den<br />
im Gesetz taxativ aufgezählten Gründen aufgehoben werden.<br />
a) Mangelnde Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (§ 35 EheG)<br />
Ein Ehegatte kann die Aufhebung der Ehe begehren, wenn er zur Zeit der Eheschließung bloß<br />
beschränkt geschäftsfähig war und sein gesetzlicher Vertreter dem Abschluss nicht zugestimmt<br />
hat. Beschränkt geschäftsfähig sind Minderjährige über sieben Jahre und Personen, denen ein<br />
Sachwalter nach § 273 ABGB bestellt ist. Solange der Ehegatte in der Geschäftsfähigkeit be-<br />
schränkt ist, steht das Klagerecht dem gesetzlichen Vertreter zu. Die mangelnde Einwilligung des<br />
Erziehungsberechtigten stellt keinen Aufhebungsgrund dar, sondern bewirkt ein schlichtes Ehe-<br />
verbot.<br />
b) Irrtum (§§ 36 und 37 EheG)<br />
Das Ehegesetz kennt vier relevante Irrtumsfälle:<br />
1. Irrtum über den Charakter des Geschäftes (als Eheschließung),<br />
2. Irrtum darüber, dass eine Erklärung zum Eheabschluss abgegeben wird,<br />
3. Irrtum über die Identität des Partners und<br />
4. Irrtum über Umstände, die die Person des Partners betreffen und die den Irrenden bei<br />
Kenntnis der Sachlage und richtiger Würdigung des Wesens der Ehe von ihrer Eingehung<br />
abgehalten hätten.<br />
204 § 175 ABGB<br />
Seite - 92 -
In den ersten beiden Fällen handelt es sich um Arten des Erklärungsirrtums. Sie sind jedoch<br />
wie der Irrtum über die Identität des Partners praktisch ohne Bedeutung. Wichtig sind hingegen<br />
die Fälle des Irrtums über Eigenschaften des Partners.<br />
Beispiele für den letztgenannten Irrtum: Unkenntnis ehebelastender körperlicher oder charakterlicher<br />
Mängel wie Impotenz, Unfruchtbarkeit, schwere (insbesondere eine ansteckende<br />
oder ekelerregende) Krankheiten, Hang zur Kriminalität, Trunksucht, Untreue, Homosexualität,<br />
Nymphomanie; ferner Unkenntnis gerichtlicher Vorstrafen, Zugehörigkeit zu extremen<br />
Organisationen u.ä. Kein Aufhebungsgrund ist der Irrtum über Vermögensverhältnisse (§ 38<br />
Abs 3 EheG).<br />
c) Arglistige Täuschung und Drohung (§§ 38 und 39 EheG)<br />
Ein Ehegatte, der zur Heirat durch arglistige Täuschung oder durch widerrechtliche Drohung<br />
gedrängt worden ist, hat ein Recht auf Aufhebung der Ehe.<br />
Die Täuschung muss sich auf solche Umstände beziehen, die den Getäuschten bei Kenntnis<br />
der Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe von ihrer Eingehung abgehalten<br />
hätten. Meist wird die Täuschung in einem Verschweigen liegen. Da das Gesetz von arglistiger<br />
Täuschung spricht, ist stets Vorsatz erforderlich. Auch die Drohung gibt nur dann einen Aufhe-<br />
bungsgrund ab, wenn sie für den Eheabschluss „kausal“ war (d.h. der Bedrohte ohne sie die Ehe<br />
nicht geschlossen hätte). Von wem und womit gedroht wurde, ist dabei gleichgültig.<br />
2. Heilung der Aufhebbarkeit<br />
Der Mangel wird geheilt, wenn der Aufhebungsberechtigte nach Wegfall der die Aufhebbarkeit<br />
begründenden Umstände zu erkennen gibt, dass er die Ehe fortsetzen will. Hiezu ist die Kenntnis<br />
über die Tatsachen, welche die Aufhebung begründen, und über ihre Tragweite sowie die Kennt-<br />
nis des Aufhebungsrechtes erforderlich.<br />
Die Aufhebbarkeit der Ehe wegen Irrtums über Umstände, die die Person des anderen Ehegat-<br />
ten betreffen, kann auch durch die sog. Bewährung geheilt werden. Die Aufhebung ist ausge-<br />
schlossen, wenn das darauf gerichtete Verlangen mit Rücksicht auf die bisherige Gestaltung des<br />
ehelichen Lebens der Ehegatten sittlich nicht gerechtfertigt erscheint.<br />
3. Geltendmachung<br />
Auch das Vorliegen eines Aufhebungsgrundes führt nicht von sich aus zur Auflösung der Ehe.<br />
Der Mangel ist im Klagewege geltend zu machen. Die Ehe wird mit der Rechtskraft eines stattge-<br />
benden Urteils aufgelöst. Die Aufhebungsklage steht jeweils nur jenem Teil zu, dessen Willensbil-<br />
dung mangelhaft war, nicht seinem Partner. Das Klagerecht ist mit einem Jahr befristet.<br />
Seite - 93 -
4. Folgen der Aufhebung<br />
Im Gegensatz zur Nichtigerklärung führt die Aufhebung der Ehe nicht zu ihrer Beseitigung ex<br />
tunc, sondern bloß zu einer Auflösung ab jetzt (ex nunc-Wirkung). Insofern steht die Aufhebung<br />
der Scheidung gleich. Das Ehegesetz ordnet dementsprechend auch gleiche Rechtsfolgen an.<br />
Werden in demselben Rechtsstreit - etwa wegen einer Widerklage - Aufhebung und Scheidung<br />
begehrt und sind beide Begehren begründet, so ist nur auf Aufhebung der Ehe zu erkennen. Im<br />
Schuldausspruch ist jedoch auch die Scheidungsschuld zu berücksichtigen.<br />
3.1.5 Persönliche Wirkungen der Eheschließung<br />
3.1.5.1 Die Rechte und Pflichten im allgemeinen<br />
Die Ehe ist eine umfassende Lebensgemeinschaft der Gatten, die sich auch nach außen hin<br />
dokumentieren soll: Die Ehegatten sollen (müssen aber nicht) den gleichen Familiennamen füh-<br />
ren. Sie haben auch nicht zwingend einen gemeinsamen Wohnsitz. Die Erlangung einer gemein-<br />
samen Staatsbürgerschaft wird erleichtert, wenn ein Ehegatte Österreicher ist. Andere ehelichen<br />
Rechte und Pflichten sind zwingend geregelt, soweit sie sich auf unverzichtbare Prinzipien<br />
beziehen, wie auf den Beistand und die umfassende Lebensgemeinschaft.<br />
3.1.5.2 Namensführung der Ehegatten (§ 93 ABGB)<br />
Der Standesbeamte hat den beiden Verlobten bei der Verhandlung zur Ermittlung der Ehefä-<br />
higkeit (allenfalls auch bei der Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses) über die namensrecht-<br />
lichen Bestimmungen eine Rechtsbelehrung hinsichtlich der Namensführung in der Ehe zu ertei-<br />
len 205 . Aus österr. Sicht ist dabei die Führung des Namens einer Person nach deren jeweiligem<br />
Personalstatut zu beurteilen, auf welchem Grund immer der Namenserwerb beruht. Eine Rechts-<br />
wahl ist nach österr. IPR-Gesetz unzulässig und daher unwirksam.<br />
Verlobte, deren Personalstatut (§ 9 eventuell in Verbindung mit § 5 IPR-Gesetz) das österr.<br />
Recht ist, können vor oder bei der Eheschließung durch Erklärung gegenüber dem Standesbe-<br />
amten in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde ihren Familiennamen in der Ehe be-<br />
stimmen. 206 In der Regel werden die Erklärungen bei der Verhandlung zur Ermittlung der Ehefä-<br />
higkeit abgegeben und in der Niederschrift (Anlage 6 PStV) beurkundet. Wird die Namensbestim-<br />
mungserklärung nach der Verhandlung oder erst bei der Trauung abgegeben, ist sie auf Formular<br />
Anlage 15 PStV zu beurkunden.<br />
205 Zur Rechtsbelehrungspflicht des österr. <strong>Standesbeamten</strong> siehe § 22 Abs.1 PStV.<br />
206 Zur Namensführung bei einer Eheschließung von österr. Staatsbürgern im Ausland siehe den Erlass des BMI vom<br />
19.10.1997, ÖStA 1998, Seite 2.<br />
Seite - 94 -
Eine allenfalls bei der Ermittlung der Ehefähigkeit abgegebene Erklärung kann bis zur Ehe-<br />
schließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde auch widerrufen werden. Eine<br />
Bestimmung des Ehenamens (allenfalls eines Doppelnamens) innerhalb einer bestimmten Frist<br />
nach der Eheschließung (wie z.B. in Deutschland) ist nicht möglich und daher unwirksam, gleich-<br />
gültig, ob die Ehe in Österreich oder im Ausland geschlossen wurde. Gewisse Möglichkeiten be-<br />
stehen allerdings durch das Namensänderungsgesetz (NÄG).<br />
Die Bestimmung des „gemeinsamen Familiennamens der Ehegatten“ (ein gängiger Begriff da-<br />
für ist auch die Bezeichnung „Ehename“ obwohl der Gesetzgeber diesen Begriff nicht verwendet)<br />
kann aber auch entweder in einer Privaturkunde, die gerichtlich, notariell, vertretungsbehördlich<br />
oder standesamtlich beglaubigt ist, oder in einer öffentlichen Urkunde, aufgenommen von jedem<br />
<strong>Standesbeamten</strong> in Österreich oder Notar, erfolgen.<br />
a) Gemeinsamer Familienname der Ehegatten (§ 93 Abs.1 ABGB)<br />
Die Verlobten können zum gemeinsamen Familiennamen ausschließlich den aktuellen Famili-<br />
ennamen des Mannes oder den aktuellen Familiennamen der Frau bestimmen, also den unmit-<br />
telbar vor der Eheschließung geführten Familiennamen. Das kann daher mitunter auch ein Famili-<br />
enname aus einer früheren, durch Scheidung (Aufhebung) oder Tod aufgelösten Ehe sein, den<br />
einer der Verlobten zum Zeitpunkt der Eheschließung führt. War ein Verlobter mehrmals verheira-<br />
tet und wollen die Verlobten nicht den Namen der letzten, sondern aus einer früheren Vorehe zum<br />
gemeinsamen Familiennamen bestimmen, muss der betreffende Verlobte diesen Namen vorher<br />
rechtzeitig wieder annehmen 207 . Mangels einer Namensbestimmungserklärung wird der Famili-<br />
enname des Mannes automatisch gemeinsamer Familienname (Ehename).<br />
Abs.2)<br />
b) Voran- oder Nachstellung des bisherigen Familiennamens (Doppelname 208 gem. § 93<br />
Derjenige Verlobte, der den Familiennamen des anderen Verlobten als gemeinsamen Famili-<br />
ennamen in der Ehe zu führen hat, kann durch Erklärung gegenüber dem <strong>Standesbeamten</strong> vor<br />
oder bei der Eheschließung dem gemeinsamen Familiennamen seinen bisherigen (unmittelbar vor<br />
der Ehe geführten) Familiennamen voran- oder nachstellen. Will der (die) Verlobte nicht den durch<br />
die letzte, sondern durch eine frühere Ehe erworbenen Familiennamen voran- oder nachstellen,<br />
muss er (sie) diesen vor der Eheschließung rechtzeitig wieder annehmen. Bei mehrmaliger Ehe-<br />
schließung können nicht mehrere im Zusammenhang mit diesen Ehen entstandene Doppelnamen<br />
miteinander verbunden werden. Zur Führung dieses Doppelnamens ist dieser Ehegatte verpflich-<br />
207<br />
Ein Familienname aus einer Vorehe kann nur dann wieder angenommen werden, wenn aus dieser früheren Ehe<br />
lebende Nachkommenschaft vorhanden ist.<br />
208<br />
Der Wortteil „Doppel“ bezieht sich nur auf die Zusammensetzung des Namens aus dem gemeinsamen Familiennamen<br />
und dem früheren Familiennamen des Ehegatten. Der „Doppelname“ kann daher auch aus mehr als zwei Bestandteilen<br />
bestehen. Ausführliche Informationen dazu von Zeyringer in ÖStA 1995/63.<br />
Seite - 95 -
tet. Eine andere Person (Kind bzw. Wahlkind) kann ihren Namen aber nicht vom Doppelnamen<br />
ableiten, sondern nur vom gemeinsamen Familiennamen.<br />
c) Getrennte Namensführung der Ehegatten (§ 93 Abs.3 ABGB)<br />
Die Frau, die mangels Abgabe einer Namensbestimmungserklärung den Familiennamen des<br />
Mannes als gemeinsamen Familiennamen zu führen hätte, kann dem <strong>Standesbeamten</strong> gegenüber<br />
in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde vor oder bei der Eheschließung erklären, ihren<br />
bisherigen Familiennamen weiterzuführen. Das kann auch ein durch eine frühere, durch Tod<br />
oder Scheidung aufgelöste Ehe erworbener Familienname sein. Soll ein früherer Familienname<br />
geführt werden, muss dieser vor der Eheschließung wieder angenommen werden.<br />
Der Mann führt den zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Familiennamen in der Ehe<br />
ebenfalls weiter. Die Erklärung der Frau bewirkt auch, dass ein vor der Eheschließung verpflich-<br />
tend zu führender Doppelname auch in der neuen Ehe weiter zu führen ist.<br />
In diesem Fall haben die Verlobten den Familiennamen der aus der Ehe stammenden Kinder<br />
(Wahlkinder) zu bestimmen, doch kann die Eheschließung nicht davon abhängig gemacht werden.<br />
Wurde eine rechtzeitige Namensbestimmung nach den Punkten a-c ohne Verschulden oder<br />
bloß mit einem minderen Grad hiervon des Betroffenen unterlassen (z.B. bei Eheschließung im<br />
Ausland oder Fehlen ausreichender Informationen über die Rechtslage) ist in vielen Fällen eine<br />
fast kostenlose verwaltungsbehördliche Namensänderung möglich 209 .<br />
Erklärungsmöglichkeit von Personen, die infolge Eheschließung vor dem 1.5.1995<br />
den Familiennamen des anderen Ehegatten erworben haben (Übergangsrecht):<br />
In der Zeit vom 1. Mai 1995 bis zum 30. April 2007 konnten Personen, die durch eine vor dem<br />
1.5.1995 geschlossene Ehe den Familiennamen des anderen Ehegatten als gemeinsamen Fami-<br />
liennamen zu führen haben - auch wenn diese Ehe bereits durch Tod oder Scheidung (bzw. Auf-<br />
hebung) aufgelöst ist - durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Erklärung gegenüber dem<br />
zuständigen <strong>Standesbeamten</strong> die Eintragung der Voranstellung oder Nachstellung des früheren<br />
Familiennamens in das Ehebuch verlangen (in diesem Fall besteht dann eine Verpflichtung zur<br />
Führung des Doppelnamens) oder den bei Eingehung der Ehe geführten früheren Familiennamen<br />
wieder annehmen 210 .<br />
Personen, die vor dem 1.5.1995 die Ehe geschlossen haben, können auch weiterhin das<br />
„höchstpersönliche Recht“ in Anspruch nehmen, ihren bisherigen Familiennamen, sofern er<br />
nicht aus einer geschiedenen oder aufgehobenen Ehe stammt, mit Bindestrich anzuhängen. Diese<br />
209 siehe z.B. § 2 Abs.1 Z 7 NÄG (Erlangung oder Ablegung eines „Doppelnamens“).<br />
210 In beiden Fällen ist es möglich, § 93 ABGB in der alten Fassung auszuschließen oder anzuwenden. Bei Anwendung<br />
der Ausschließung werden Familiennamen aus geschiedenen od. aufgehobenen Ehen „übersprungen“.<br />
Seite - 96 -
Namensführung wird allerdings nicht, so wie bisher auch, in die Personenstandsbücher eingetra-<br />
gen. Eine Eintragung dieses Doppelnamens nach § 93 ABGB alte Fassung 211 in den Reisepass,<br />
Staatsbürgerschaftsnachweis, Führerschein usw. ist jedoch möglich.<br />
3.1.6 Die Ehescheidung<br />
3.1.6.1 Allgemeines<br />
Ehescheidung ist die gerichtliche Eheauflösung ab Rechtskraft der Entscheidung für die Zu-<br />
kunft. Das 1938 212 auch in Österreich eingeführte und seither in Geltung stehende deutsche Ehe-<br />
gesetz löste sich von konfessionellen Auffassungen früherer Zeiten und gestattet generell die<br />
Auflösung einer Ehe durch Scheidung. Die Scheidung kann nur unter gewissen Voraussetzungen<br />
begehrt werden.<br />
3.1.6.2 Scheidung wegen Verschuldens<br />
Das ist der in der Praxis am häufigsten geltend gemachte Verschuldensgrund. Danach ist es<br />
ein Scheidungsgrund, wenn ein Ehegatte durch eine sonstige schwere Eheverfehlung oder durch<br />
ehrloses oder unsittliches Verhalten die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat, dass die Wiederher-<br />
stellung einer ihrem Wesen entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann.<br />
Die Scheidung ist ausgeschlossen, wenn der verletzte Partner selbst eine Eheverfehlung began-<br />
gen hat und deshalb sein Scheidungsbegehren sittlich nicht gerechtfertigt ist.<br />
3.1.6.3 Scheidung aus anderen Gründen<br />
1. Geistige Störung<br />
Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn die Ehe infolge eines Verhaltens des Partners,<br />
das nicht als Eheverfehlung betrachtet werden kann, weil es auf einer geistigen Störung beruht,<br />
so tief zerrüttet ist, dass die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Le-<br />
bensgemeinschaft nicht erwartet werden kann.<br />
211 Der § 93 ABGB in der vor dem 1.5.1995 geltenden Fassung lautete wie folgt:<br />
„(1) Die Ehegatten haben den gleichen Familiennamen zu führen. Dieser ist der Familienname eines der Ehegatten,<br />
den die Verlobten vor oder bei der Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde als gemeinsamen<br />
Familiennamen bestimmt haben. Mangels einer solchen Bestimmung wird der Familienname des Mannes gemeinsamer<br />
Familienname.<br />
(2) Derjenige Ehegatte, der nach Abs.1 den Familiennamen des anderen Ehegatten als gemeinsamen Familiennamen<br />
zu führen hat, hat hiebei das höchstpersönliche Recht, seinen bisherigen Familiennamen unter Setzung eines Bindestrichs<br />
nachzustellen. Er hat das Recht zu verlangen, dass er in Urkunden aller Art mit diesem Doppelnamen bezeichnet<br />
wird. Die Führung der Personenstandsbücher und die Ausstellung von Personenstandsurkunden werden durch<br />
diese Anordnungen nicht berührt.<br />
(3) Ein Familienname, der von einem früheren Ehegatten aus einer geschiedenen oder aufgehobenen Ehe abgeleitet<br />
wird, darf weder im Sinn des Abs.1 als gemeinsamer Familienname bestimmt oder geführt noch im Sinn des Abs.2<br />
nachgestellt werden; dann beziehen sich die Abs.1 und 2 auf den zuletzt vor der Schließung der geschiedenen oder<br />
aufgehobenen Ehe geführten Familiennamen.“<br />
212 Das deutsche Ehegesetz vom 6.7.1938 trat am 1.8.1938 in Kraft.<br />
Seite - 97 -
2. Geisteskrankheit<br />
Die Geisteskrankheit ist als solche ein Scheidungsgrund, ohne dass es darauf ankommt, ob<br />
der Kranke besondere (objektive) Ehewidrigkeiten begangen hat. Die Krankheit muss allerdings<br />
einen solchen Grad erreicht haben, dass die geistige Gemeinschaft zwischen den Ehegatten<br />
aufgehoben ist und ihre Wiederherstellung nicht mehr erwartet werden kann.<br />
3. Ansteckende oder ekelerregende Krankheit<br />
Ein Ehegatte kann die Scheidung begehren, wenn der andere an einer schweren anstecken-<br />
den oder ekelerregenden Krankheit leidet und ihre Heilung oder die Beseitigung der Anste-<br />
ckungsgefahr in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. Nach überwiegender Meinung ist einseitige<br />
Zerrüttung der Ehe Voraussetzung.<br />
4. Auflösung der häuslichen Gemeinschaft<br />
Ist die Ehe vollkommen und unheilbar zerrüttet - mit oder ohne Verschulden der Gatten - und<br />
außerdem die häusliche Gemeinschaft seit mindestens drei Jahren aufgehoben, so kann jeder<br />
Ehegatte die Scheidung begehren. Mangels Zerrüttung wird das Scheidungsbegehren abgewie-<br />
sen, wenn die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Gemeinschaft zu<br />
erwarten ist. Dem Scheidungsbegehren ist aber jedenfalls stattzugeben, wenn die häusliche<br />
Gemeinschaft der Ehegatten seit sechs Jahren aufgehoben ist. Nach Ablauf dieser Zeit kommt<br />
es auf das Verschulden an der Zerrüttung und auf die Interessenabwägung nicht mehr an.<br />
3.1.6.4 Einvernehmliche Scheidung<br />
Die einvernehmliche Scheidung erfolgt im Außerstreitverfahren. Zum Schutz vor Übereilung ist<br />
die einvernehmliche Scheidung nach § 55a Ehegesetz von vier Voraussetzungen abhängig:<br />
1. Von der mindestens halbjährigen Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft, 213<br />
2. vom Zugeständnis der unheilbaren Zerrüttung durch die Gatten,<br />
3. von der Einigung über die wesentlichen Scheidungsfolgen und<br />
4. von einem gemeinsamen Scheidungsantrag (muss jedoch nicht gleichzeitig sein).<br />
Fehlt auch nur eine der vier Voraussetzungen des § 55 a Ehegesetz, so ist der Antrag auf ein-<br />
vernehmliche Scheidung abzuweisen.<br />
Die Vereinbarung (Vergleich) ist dem Gericht in Schriftform vorzulegen oder vor Gericht ab-<br />
zuschließen. Über die einvernehmliche Scheidung wird nach einem Antrag der Gatten im Verfah-<br />
ren außer Streitsachen mittels Beschluss entschieden. 214<br />
213 Es ist nicht entscheidend, ob die Ehegatten räumlich getrennt leben.<br />
214 Der Tod eines Ehegatten vor Zustellung des Scheidungsbeschlusses macht die Scheidung trotz Rechtsmittelverzicht<br />
unwirksam. LGZ Wien 6.9.1979 EFSlg 35.138<br />
Seite - 98 -
3.1.6.5 Folgen der Scheidung<br />
1. Grundsätzliches<br />
Die Ehe wird mit dem Eintritt der materiellen Rechtskraft 215 der gerichtlichen Entscheidung<br />
„ab jetzt“ (ex nunc-Wirkung) aufgelöst. Die materielle Rechtskraft tritt erst mit Zustellung des<br />
Beschlusses an beide Ehegatten ein, auch wenn bei der Verhandlung auf die Einbringung eines<br />
Rechtsmittels verzichtet wurde (formelle Rechtskraft) 216 .<br />
2. Name des geschiedenen Gatten<br />
Grundsätzlich behält die Person, deren Ehe geschieden oder aufgelöst ist, den Familienna-<br />
men bei (allenfalls auch den Doppelnamen nach § 93 ABGB neue Fassung bzw. nach der Über-<br />
gangsregelung des § 72a PStG), den sie in der Ehe geführt hat.<br />
Wenn die Ehe durch Tod oder Scheidung (bzw. Aufhebung) aufgelöst wurde, kann die Person<br />
gem. § 93a ABGB durch Erklärung gegenüber dem <strong>Standesbeamten</strong> 217 ihren früheren (oder einen<br />
ihrer früheren) Familiennamen, wieder annehmen. Die Wiederannahme eines von einem früheren<br />
Ehegatten aus geschiedener oder aufgehobener Ehe abgeleiteten Familiennamens ist jedoch nur<br />
dann möglich, wenn aus dieser früheren Ehe lebende Nachkommen (Kinder od. Enkelkinder,<br />
jedoch nicht Wahlkinder) vorhanden sind.<br />
Angenommen werden kann jeder zu Recht geführte frühere Familienname. Dies kann ein<br />
durch Abstammung erworbener oder irgendein anderer durch einen späteren namensrechtliche<br />
Wirkungen nach sich ziehenden Vorgang, wie Legitimation, Adoption, Ehe (nicht nur der letzten<br />
Ehe), Namensänderung, geänderter Familienname, aber auch ein verpflichtend geführter<br />
Doppelname (§ 93 Abs. 2 ABGB ab 1.5.1995).<br />
Bei Wiederannahme eines im Zusammenhang mit einer früheren Ehe entstandenen Doppel-<br />
namens wird im Vermerk über die Wiederannahme der in der früheren Ehe geführte gemeinsame<br />
Familienname ersichtlich zu machen sein, da eine andere Person (Kind, Wahlkind, späterer<br />
Ehegatte) ihren Familiennamen nur von diesem (gemeinsamen) Familiennamen ableiten kann. 218<br />
Bei mehreren früheren Ehen kann nicht nur ein aus der letzten Ehe, sondern auch ein aus ei-<br />
ner vorangegangenen Ehe abgeleiteter Familienname wieder angenommen werden. Ob die Erklä-<br />
rung über die Wiederannahme eines früheren Familiennamens nur einmal abgegeben werden<br />
kann ist zweifelhaft, jedenfalls kann bei Bejahung der Möglichkeit einer mehrmaligen Erklärung<br />
nur auf einen jeweils früheren Familiennamen zurückgegriffen werden.<br />
215 siehe dazu Hintermüller in ÖStA 1993,42<br />
216 Nach dem formellen Rechtsmittelverzicht kann daher der Scheidungsantrag nicht mehr zurückgenommen werden.<br />
217 Zuständig zur wirksamen Entgegennahme der Erklärung ist der Standesbeamte, in dessen Ehebuch die (letzte)<br />
Eheschließung eingetragen ist, bei Eheschließung im Ausland das StA Wien-Innere Stadt.<br />
218 siehe § 93 Abs. 1 letzter Satz ABGB<br />
Seite - 99 -
Die Wiederannahme eines früheren Familiennamens ist im Ehebuch der letzten Ehe zu ver-<br />
merken, eine daraufhin ausgestellte Heiratsurkunde ist der entsprechende Nachweis dafür.<br />
Seite - 100 -
4. STAATSBÜRGERSCHAFTSRECHT<br />
4.1 Einführung<br />
Kaum ein anderer Begriff der Rechtsordnung ist im allgemeinen Sprachgebrauch so verbreitet,<br />
wie jener der Staatsbürgerschaft; und doch ist es, wenn man die Literatur hierüber betrachtet,<br />
offenbar gar nicht so leicht, seinen vollen rechtlichen Gehalt eindeutig zu umschreiben. Mit<br />
„Staatsbürgerschaft“ bezeichnet man üblicherweise die rechtliche Zuordnung einer Person zu<br />
einem als „Staat“ qualifizierten rechtlichen Gebilde. Das staatliche Recht benutzt diese Zuordnung<br />
als Unterscheidungskriterium für die Zuerkennung von Rechten und Pflichten: so sind nach der<br />
österreichischen Rechtsordnung die politischen Rechte den österreichischen Staatsbürgern vor-<br />
behalten. In zahlreichen einfachen Gesetzen ist die Staatsbürgerschaft als Voraussetzung für die<br />
Ausübung bestimmter Rechte normiert: So steht z.B. nur Österreichern der Besuch von Universi-<br />
täten unbeschränkt offen, nur Österreichern ist das Recht der Einrichtung von Privatschulen ga-<br />
rantiert. Ausländern stehen diese Rechte - wenn überhaupt - nur unter besonderen Voraussetzun-<br />
gen zu.<br />
4.2 Geschichtliche Entwicklung<br />
Obwohl der Begriff „Staatsbürger“ schon den Griechen und Römern bekannt war, legten sie<br />
diesem keine besondere Bedeutung bei, so dass es an einer Begriffsauslegung fehlt. Beiden<br />
Völkern war das Bürgerrecht bedeutsamer als die Zugehörigkeit zum Staat. Den Germanen war<br />
dieser Begriff zunächst überhaupt fremd, da sie kein einheitliches Staatsgebilde hatten. Es kam<br />
lediglich zur Ausbildung einer Stammesangehörigkeit. In der Zeit des Absolutismus gab es ein<br />
Untertanenverhältnis zum König oder Lehensherren. Erst die Französische Revolution machte aus<br />
Untertanen freie Staatsbürger mit Rechten und Pflichten.<br />
Geschichtlicher Überblick der staatsbürgerschaftsrechtlichen Vorschriften<br />
in Österreich:<br />
1779 Das „Konskriptionspatent“ Maria Theresias unterschied „Inländer“ (Angehörige<br />
eines bestimmten Kronlandes) und „Ausländer“ voneinander. Geregelt war auch, wie<br />
ein „Ausländer“ die Inländereigenschaft erwerben konnte.<br />
1812 Im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch waren erstmals der Erwerb und Verlust der<br />
altösterreichischen Staatsbürgerschaft geregelt. Erwerb durch Abstammung (ius<br />
sanguinis). Verlust z.B. durch Auswanderung und Verehelichung einer Österreicherin<br />
mit einem Ausländer. Das Gesetz bezog sich nur auf die deutschen Erblande, da in<br />
Ungarn eine eigene Verfassung galt.<br />
Seite - 101 -
1849 Die Gemeinden werden erstmals verpflichtet, eine Heimatrolle zu führen, in der sie<br />
die Gemeindemitglieder zu verzeichnen hatten. Sie diente als Grundlage für die<br />
Ausstellung von Heimatscheinen, deren Gültigkeit auf vier Jahre beschränkt war.<br />
1863 Das Heimatgesetz bestimmte, dass nur Staatsbürger das Heimatrecht erwerben<br />
konnten. Ein Verzicht auf das Heimatrecht war nicht möglich. Bei Verlust der Staats-<br />
bürgerschaft ging auch das Heimatrecht verloren.<br />
1867 Zufolge der dualistischen Staatsform der österr.-ungarischen Monarchie besaßen alle<br />
Personen, die in einer Gemeinde der ungarischen Reichshälfte heimatberechtigt<br />
waren, seit 1867 die ungarische Staatsbürgerschaft. Sie wurden den übrigen Öster-<br />
reichern gegenüber als Ausländer behandelt. Eine Österreicherin verlor durch Ehe-<br />
schließung mit einem Ungarn die österr. Staatsbürgerschaft.<br />
1918 Nach dem Zerfall der österr.-ungarischen Monarchie und der Ausrufung der Republik<br />
Deutsch-Österreich waren alle Personen, die in einer Gemeinde der Republik hei-<br />
matberechtigt waren, auch deutsch-österreichische Staatsbürger.<br />
1920 Der Staatsvertrag von St. Germain brachte mit den Nachfolgestaaten der Monarchie<br />
Regelungen auf dem Gebiet des Staatsbürgerschaftsrechtes.<br />
1925 Durch ein Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust der Landes- und Bundesbür-<br />
gerschaft wurde das Staatsbürgerschaftsrecht neu geregelt.<br />
1929 Eine Heimatrechtsnovelle brachte die Klärung verschiedener Zweifelsfragen und<br />
grundsätzliche Vorschriften über die Führung der Heimatrollen. Als Nachweis über<br />
den Besitz des Heimatrechtes wurden Heimatscheine ausgestellt, die gleichzeitig<br />
den Besitz der Landes- und der Bundesbürgerschaft bewiesen.<br />
1938 Durch die Annexion Österreichs durch das Deutsche Reich ging die österr. Staats-<br />
bürgerschaft unter.<br />
1945 Das Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetz legte fest, welcher Personenkreis ab<br />
27.4.1945 als österr. Staatsbürger anzusehen ist. Daneben regelte das Staatsbür-<br />
gerschaftsgesetz 1945 den Erwerb und Verlust der österreichischen Staatsbürger-<br />
schaft.<br />
1949 Beide Gesetze wurden wiederholt novelliert und schließlich im Jahre 1949 wiederver-<br />
lautbart. Es war dies eine Zusammenfassung aller staatsbürgerschaftsrechtlichen<br />
Bestimmungen der jungen 2. Republik.<br />
1965 Die Notwendigkeit, an Stelle der im Jahr 1939 abgeschlossenen Heimatrollen eine<br />
neue Staatsbürgerschaftsevidenz aufzubauen und die Bedachtnahme auf mehrere<br />
UN-Konventionen führten zur Erlassung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 (in<br />
Kraft ab 1.7.1966).<br />
Seite - 102 -
1985 Nach einer größeren Zahl von Novellierungen erfolgte die Wiederverlautbarung des<br />
1998<br />
Staatsbürgerschaftsgesetzes. Gleichzeitig wurde eine neue Staatsbürgerschaftsver-<br />
ordnung erlassen.<br />
Dem Integrationsmerkmal „Deutschkenntnisse“ kommt besonderes Gewicht zu. Das<br />
Ausscheiden aus dem bisherigen Staatsverband bei Verleihung der Staatsbürger-<br />
schaft wird in Ausnahmefällen vermieden oder abgekürzt.<br />
2006 Einschränkung der Möglichkeit einer vorzeitigen Einbürgerung. Anpassung an das<br />
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG). Festlegung des Niveaus der erforder-<br />
lichen Sprachkenntnisse und Prüfung zum Nachweis der Grundkenntnisse der de-<br />
mokratischen Ordnung sowie Geschichte Österreichs und des jeweiligen Bundeslan-<br />
des.<br />
4.3 Gesetzliche Grundlagen<br />
4.3.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen<br />
Gemäß Art. 11 Abs. 1 Z 1 des derzeit aktuellen Bundesverfassungsgesetzes (B-VG) ist auf<br />
dem Gebiet der Staatsbürgerschaft die Gesetzgebung Bundessache und die Vollziehung Lan-<br />
dessache.<br />
Bezüglich der verfassungsrechtlichen Grundlagen des österreichischen Staatsbürgerschafts-<br />
rechtes ist zwischen der Zeit vor dem 13.März 1938 („Anschluss“) und der Zeit ab dem 27.April<br />
1945 („Befreiung“) zu unterscheiden. Bis zum 13.3.1938 bestand auf Grund des Art. 6 Abs. 1-3<br />
des B-VG für jedes Bundesland eine Landesbürgerschaft. Mit der Landesbürgerschaft wurde<br />
zugleich die Bundesbürgerschaft erworben. Voraussetzung der Landesbürgerschaft war das<br />
Heimatrecht in einer Gemeinde des Landes. Das Heimatrecht wurde mit Wirkung vom 30.6.1939<br />
abgeschafft 219 und nach der Wiedererrichtung der Republik Österreich im Jahre 1945 nicht wieder<br />
eingeführt.<br />
Das geltende StbG 1985 geht von der Verfassungsbestimmung des Art. 6 Abs. 1 B-VG aus,<br />
wonach für die Republik Österreich eine einheitliche (also nicht in Landes- und Bundesbürger-<br />
schaft unterteilte) Staatsbürgerschaft besteht; daneben enthält das B-VG aber auch den weiteren -<br />
allerdings rein programmatischen und kaum als durchführbar aufzufassenden - Grundsatz, dass<br />
219 Art. II der Zweiten Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit im Lande Österreich vom 30.6.1939, dRGBl. I,<br />
S. 1072 (GBlÖ 1939/840).<br />
Seite - 103 -
die Unterteilung in eine Bundes- und eine Landesbürgerschaft entsprechend dem Art. 6 des B-VG<br />
einer besonderen bundesverfassungsgesetzlichen Regelung vorbehalten bleibt.<br />
4.3.2 Einfachgesetzliche Grundlagen<br />
Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (StbG):<br />
Das mehrmals novellierte Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 wurde auf Grund der Kundmachung<br />
vom 19. Juli 1985 wiederverlautbart (BGBl. 311/1985). Diese Wiederverlautbarung berücksichtigt<br />
neben den vorstehenden Novellen zwischen 1973 und 1983 die Aufhebung des § 7 (4) StbG 1965<br />
durch den Verfassungsgerichtshof und die Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 1985 (BGBl.<br />
202/1985).<br />
StbG-Novelle 1986:<br />
Mit dieser Novelle wurden grundlegende Regelungen über die Bildung von Staatsbürger-<br />
schaftsverbänden erlassen. Gemäß den neuen Bestimmungen bilden Gemeinden, die nach dem<br />
Personenstandsgesetz (§ 60 PStG) zu einem Standesamtsverband vereinigt sind, einen Gemein-<br />
deverband zur Durchführung der Aufgaben nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz. Sitz des Ge-<br />
meindeverbandes ist jene Gemeinde, in der der Standesamtsverband seinen Sitz hat.<br />
Die Möglichkeit zur Abgabe der Artikel I - Erklärung nach dem Staatsbürgerschafts-<br />
Übergangsrecht 1985, welche ursprünglich bis 31.8.1986 befristet war, wurde bis zum 31.12.1988<br />
verlängert.<br />
StbG-Novelle 1993:<br />
Diese am 1. Juli 1993 in kraft getretene Novelle brachte den Wegfall des Anhörungsrechtes<br />
des Innenministers vor Staatsbürgerschaftsverleihungen gemäß § 10 (3) StbG. Auch der Erwerb<br />
der Staatsbürgerschaft für ehemals Verfolgte wurde erleichtert, da das Erfordernis der Begrün-<br />
dung eines Wohnsitzes in Österreich weggefallen ist.<br />
StbG-Novelle 1998 220 :<br />
Diese Novelle ist am 1.1.1999 in Kraft getreten und bringt eine teilweise Neufassung des für<br />
die Verleihung maßgeblichen § 10 StbG durch Ausrichtung der Bestimmung auf die Integrations-<br />
merkmale und Einfügung des Verleihungserfordernisses „Deutschkenntnisse“. Ebenso erfolgte<br />
eine Neufassung der Verfahrensvorschrift für die Verleihung und die Erstreckung der Verleihung<br />
an nicht eigenberechtigte Fremde sowie eine teilweise Neufassung der für das „Zusicherungsver-<br />
fahren“ maßgeblichen Bestimmungen.<br />
220 BGBl. I 1998/124<br />
Seite - 104 -
StbG-Novelle 2005:<br />
Diese Novelle ist am 23.3.2006 in Kraft getreten und bringt eine Anpassung an das Niederlas-<br />
sungs- und Aufenthaltsgesetz. Vom Erfordernis des Bestehens eines Hauptwohnsitzes wird zu-<br />
gunsten des Bestehens des rechtmäßigen Aufenthaltes abgegangen. Festlegung des Niveaus der<br />
erforderlichen Sprachkenntnisse und Erfordernis von Grundkenntnissen über die demokratische<br />
Ordnung sowie der Geschichte Österreichs und des jeweiligen Bundeslandes. Erleichterte Wie-<br />
dereinbürgerung von ehemaligen Staatsbürgern.<br />
Bestimmungen auf Vollzugsebene:<br />
Zur näheren Ausführung von Bestimmungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes wurde vom<br />
Bundesminister für Inneres die Staatsbürgerschaftsverordnung 1985 (BGBl. 329/1985, i.d.F.<br />
BGBl. 660/1993) erlassen (Durchführungsverordnung).<br />
a) mehrseitige Verträge:<br />
4.3.3 Internationale Übereinkommen<br />
1. UN-Konvention vom 30.8.1961 betreffend die Verminderung der Staatenlosigkeit 221 .<br />
Diese Konvention wurde durch das Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 in wesentlichen<br />
Teilen inhaltlich berücksichtigt. Österreichische Vorbehalte gibt es jedoch zugunsten<br />
der §§ 32 und 33 StbG.<br />
2. Europarat-Konvention vom 6.5.1963 über die Verminderung der Fälle mehrfacher<br />
Staatsangehörigkeit und die Militärdienstpflicht in Fällen mehrfacher Staatsangehörigkeit<br />
222 . Auch diese Konvention ist bereits im Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 im wesentlichen<br />
berücksichtigt.<br />
3. UN-Übereinkommen vom 20.2.1957 über die Staatsbürgerschaft der verheirateten<br />
Frau 223 . Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 trägt diesem Übereinkommen, insbesondere<br />
in seinen §§ 9, 16 und 29, Rechnung (BGBl. 238/1968).<br />
4. Europarat-Konvention vom 24.4.1967 über die Adoption von Kindern 224 .<br />
5. UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Von Österreich<br />
am 17.7.1980 im Rahmen der zweiten Weltfrauenkonferenz in Kopenhagen unterzeichnet.<br />
b) Zweiseitige Verträge:<br />
1. Vereinbarung zwischen Österreich und Deutschland über den Austausch von Mitteilungen<br />
in Staatsangehörigkeitssachen 225 .<br />
2. Vereinbarung zwischen Österreich und Dänemark über den Austausch von Einbürgerungsmitteilungen<br />
226 .<br />
3. Vertrag zwischen Österreich und Argentinien über die Ableistung des Militärdienstes<br />
von Doppelbürgern 227 .<br />
221 BGBl. 1974/538<br />
222 BGBl. 1975/471<br />
223 BGBl. 1968/238<br />
224 BGBl. 1980/341<br />
225 BGBl. 1959/45<br />
226 BGBl. 1964/40<br />
Seite - 105 -
4.3.4 Die Grundprinzipien des Staatsbürgerschaftsrechts<br />
Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 wird von fünf Grundprinzipien bestimmt:<br />
1. Grundsatz des „ius sanguinis“ oder Abstammungsprinzip. Durch Geburt und Legitimation<br />
wird die österreichische Staatsbürgerschaft des maßgeblichen Elternteils<br />
erworben. Eine Ausnahme bildet § 8 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 - es besteht die<br />
Rechtsvermutung des Erwerbes der Staatsbürgerschaft durch Abstammung bis zum<br />
Beweis des Gegenteils bei Findelkindern, die im Alter unter sechs Monaten im Gebiet<br />
der Republik gefunden werden. In Österreich gilt schon immer grundsätzlich das „ius<br />
sanguinis“. Im Gegensatz dazu steht das „ius soli“, die Ableitung der Staatsbürgerschaft<br />
aus der Tatsache der Geburt auf einem bestimmten Staatsgebiet (z.B. in den<br />
USA, in England und in den südamerikanischen Staaten)..<br />
2. Grundsatz der Vermeidung der Staatenlosigkeit. Staatenlose können die österr.<br />
Staatsbürgerschaft erleichtert erwerben, der Verlust der österr. Staatsbürgerschaft<br />
wird weitgehend von Besitz oder Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit abhängig<br />
gemacht. Ausnahmen von diesem Prinzip im StbG: Wiederaufnahme eines Verleihungsverfahrens<br />
(§ 24), Militärdienst (§ 32) und Entziehung (§ 33).<br />
3. Grundsatz der „Privatautonomie“. Darunter versteht man das durchgehende Bemühen<br />
des Gesetzgebers, dass Familienrechtsverhältnisse (Ehe, Kindschaftsverhältnisse)<br />
Erwerb oder Verlust der österr. Staatsbürgerschaft des maßgeblichen Familienmitgliedes<br />
(Auktors) nicht automatisch auf andere Familienmitglieder übertragen, sondern<br />
nur bei Einwilligung des Betroffenen.<br />
Es begann damit, dass die Verehelichung einer Ausländerin mit einem Österreicher<br />
nicht mehr ipso iure zum Erwerb der österr. Staatsangehörigkeit führte (wie früher),<br />
sondern nur mehr die Möglichkeit für den Erwerb durch Erklärung vorsah (bis zum<br />
31.8.1983). Ebenso erstreckt sich die Verleihung der österr. Staatsbürgerschaft nicht<br />
automatisch auf die Ehefrau oder die Nachkommen, sondern nur auf Antrag oder bei<br />
entsprechender Erklärung der Betroffenen, also mit deren Einwilligung. Ähnliches gilt<br />
bei anderen Erwerbstatbeständen (z.B. Legitimation, Dienstantritt als Universitätsprofessor<br />
an einer österr. Hochschule). Schließlich setzt der Verlust der österr. Staatsbürgerschaft<br />
durch Erwerb einer fremden die eindeutige Willensentscheidung für diesen<br />
Fremderwerb voraus. In allen diesen Fällen unterliegen Erwerb und Verlust der österr.<br />
Staatsbürgerschaft in gewissem Ausmaß der Selbstbestimmung („Privatautonomie“)<br />
der Betroffenen.<br />
4. Grundsatz der Familieneinheit. Es wird versucht, möglichst allen Familienmitgliedern<br />
dieselbe Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Dieser Grundsatz gehört zwar noch immer<br />
zu den Elementen des österr. Staatsbürgerschaftsrechtes, ist aber durch die weitgehende<br />
Einwilligungsbedürftigkeit staatsbürgerschaftsrechtlicher Veränderungen<br />
(Grundsatz der Privatautonomie) stark abgeschwächt worden. Immerhin schafft das<br />
Gesetz noch weiterhin die Möglichkeit, dass sich die Familienmitglieder - wenn sie wollen<br />
- unter der österr. Staatsangehörigkeit der Stammpersonen vereinigen.<br />
5. Grundsatz der Vermeidung mehrfacher Staatsangehörigkeit. Unter Doppelstaatsbürgerschaft<br />
versteht man die gleichzeitige Innehabung zweier (oder mehrerer)<br />
Staatsbürgerschaften. Es ist auch nach dem geltenden Staatsbürgerschaftsrecht möglich,<br />
Doppelstaatsbürger zu sein. Die österreichische Rechtsordnung sieht jedoch die<br />
Möglichkeit einer Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft bei gleichzeitiger<br />
weiterer Innehabung einer ausländischen Staatsangehörigkeit nur mit großen Einschränkungen<br />
vor (§ 10 (6) und § 34 StbG).<br />
227 BGBl. 1981/450<br />
Seite - 106 -
Auch die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft bei freiwilligem Erwerb einer<br />
fremden Staatsangehörigkeit ist nur schwer möglich (§ 28 StbG). Bereits anlässlich der Staatsbür-<br />
gerschaftsgesetz-Novelle 1983 wurde das Prinzip der Vermeidung der Doppelstaatsbürgerschaft<br />
zugunsten der Gleichstellung der Geschlechter (bei Vermittlung der österreichischen Staatsbür-<br />
gerschaft an die Kinder) zurückgedrängt.<br />
4.4 Allgemeine Bestimmungen<br />
4.4.1 Grundlegende Begriffe des StbG 1985<br />
4.4.1.1 Republik, Staatsbürgerschaft, Staatsbürger, Fremde<br />
Als „Republik“ gilt die Republik Österreich. Damit ist klargestellt, dass mit dem Wort „Repub-<br />
lik“ immer Österreich gemeint ist, ferner wird auch deutlich, dass damit immer nur der Gesamt-<br />
staat Österreich, nicht bloß einzelne Gebietskörperschaften (Bund oder Land) gemeint sind.<br />
Als „Staatsbürgerschaft“ gilt die „Staatsbürgerschaft der Republik Österreich (österreichi-<br />
sche Staatsbürgerschaft)“. Gemeint ist damit die „Zugehörigkeit“ eines Menschen zu dem vorhin<br />
umschriebenen Staat Österreich. Wenn es um die Zugehörigkeit zu anderen Staaten geht, spricht<br />
das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 nicht von Staatsbürgerschaft, sondern von Staatsangehörig-<br />
keit.<br />
Als „Staatsbürger“ gilt „ohne Unterschied des Geschlechts eine Person, welche die österrei-<br />
chische Staatsbürgerschaft besitzt“. Staatsbürger ist daher, wer entweder auf Grund des Staats-<br />
bürgerschaftsgesetzes 1965 (Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985) die Staatsbürgerschaft erwor-<br />
ben, oder wer diese im Zeitpunkt des Inkrafttretens des StbG. 1965 (1.7.1966) auf Grund der bis<br />
dahin geltenden Bestimmungen besessen, und seitdem nicht verloren hat.<br />
Als „Fremder“ gilt „ohne Unterschied des Geschlechts eine Person, welche die österreichi-<br />
sche Staatsbürgerschaft nicht besitzt“. Durch diese Formulierung soll klargestellt werden, dass als<br />
„Fremde“ sowohl die Angehörigen anderer Staaten wie auch die Staatenlosen und Flüchtlinge<br />
anzusehen sind. Personen, die neben der österreichischen Staatsbürgerschaft auch noch die<br />
Angehörigkeit zu einem anderen Staat besitzen, gelten nicht als Fremde.<br />
4.4.1.2 Staatenlosigkeit<br />
Eine Person, deren Staatsangehörigkeit nicht geklärt werden kann, ist, von Ausnahmen abge-<br />
sehen, wie ein Staatenloser zu behandeln. Es handelt sich jedoch lediglich um eine Vermutung<br />
der Staatenlosigkeit.<br />
Seite - 107 -
Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 ermächtigt die österreichischen Behörden weder, über<br />
die Staatenlosigkeit noch über die Zugehörigkeit zu einem anderen Staat verbindlich abzuspre-<br />
chen. Vielmehr hat jede Behörde selbst zu entscheiden, ob sie einen bestimmten Menschen als<br />
Angehörigen eines anderen Staates oder als staatenlos zu betrachten hat.<br />
4.4.1.3. Der Hauptwohnsitz<br />
Der Hauptwohnsitz eines Menschen ist an jener Unterkunft begründet, an der er sich in der<br />
erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, diese zum<br />
Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen zu machen; trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer<br />
Gesamtbetrachtung der beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensbeziehungen<br />
eines Menschen auf mehrere Wohnsitze zu, so hat er jenen als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu<br />
dem er das überwiegende Naheverhältnis hat 228 .<br />
In bestimmten Fällen gilt Wien als fiktiver Wohnsitz. Diese Festlegung hat vor allem Bedeutung<br />
für die örtliche Zuständigkeit zur Erlassung von Bescheiden.<br />
4.5. Erwerb der Staatsbürgerschaft<br />
Die österreichische Staatsbürgerschaft wird gem. § 6 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 erwor-<br />
ben durch:<br />
1. Abstammung und Legitimation (§§ 7, 7a und 8)<br />
2. Verleihung und Erstreckung der Verleihung (§§ 10 bis 24)<br />
3. Dienstantritt als Universitäts- bzw. Hochschulprofessor (§ 25 Abs. 1)<br />
4. Erklärung (§ 25 Abs. 2)<br />
5. Anzeige (§ 58 c)<br />
4.5.1 Abstammung und Legitimation<br />
§ 7 StbG<br />
Eheliche Kinder erwerben die Staatsbürgerschaft mit der Geburt, wenn<br />
� in diesem Zeitpunkt ein Elternteil Staatsbürger ist oder<br />
� ein Elternteil, der vorher gestorben ist, am Tage seines Ablebens Staatsbürger<br />
war, und zwar unabhängig davon, ob das Kind im Wege des anderen Elternteiles<br />
eine weitere Staatsbürgerschaft erwirbt („Doppelstaatsbürger“).<br />
228 Definition laut Hauptwohnsitzgesetz BGBl. 1994/505.<br />
Seite - 108 -
Weitere Voraussetzungen sieht das Gesetz nicht vor; insbesondere ist es irrelevant, ob die El-<br />
tern oder das Kind sich in Österreich aufhalten. Die Möglichkeit mehrfacher Staatsangehörigkeit<br />
wurde ausdrücklich in Kauf genommen.<br />
Hinsichtlich der ehelichen Kinder ist mit der Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 1983 mit<br />
1.9.1983 eine neue Regelung in Kraft getreten. Dadurch werden Vater und Mutter bei der Vermitt-<br />
lung der Staatsbürgerschaft an ihre ehelichen Kinder gleichberechtigt.<br />
Uneheliche Kinder erwerben die Staatsbürgerschaft mit der Geburt, wenn die Mutter in die-<br />
sem Zeitpunkt Staatsbürger ist. Die unehelichen Kinder eines österreichischen Vaters mit einer<br />
Fremden erlangen jedoch nicht die österreichische Staatsbürgerschaft 229 . Auch beim unehelichen<br />
Kind ist, wie beim ehelichen Kind, Geburt oder Aufenthalt im Gebiet der Republik nicht erforder-<br />
lich.<br />
Ein unehelich geborener Fremder, der legitimiert wird, erwirbt mit der Legitimation (und der<br />
Ehelicherklärung) die Staatsbürgerschaft, wenn sein Vater in diesem Zeitpunkt Staatsbürger ist<br />
oder - falls vorher verstorben - am Tag seines Ablebens Staatsbürger war. Der Legitimierte muss<br />
jedoch noch minderjährig und ledig sein. Hat der Legitimierte das 14. Lebensjahr bereits vollendet,<br />
so wird die Staatsbürgerschaft allerdings nur dann erworben, wenn der Legitimierte und sein<br />
gesetzlicher Vertreter dem Erwerb der Staatsbürgerschaft zustimmen. Die Zustimmungsfrist be-<br />
ginnt mit der schriftlichen Belehrung durch die Evidenzstelle zu laufen. Der Staatsbürgerschafts-<br />
erwerb tritt erst ein, wenn alle erforderlichen Zustimmungserklärungen der Evidenzstelle zuge-<br />
kommen sind, wirkt also nicht auf den Zeitpunkt der Legitimation zurück. Die Zustimmung ist<br />
allerdings unwirksam, wenn sie der Evidenzstelle nach der Eheschließung des Legitimierten oder<br />
später als drei Jahre nach Erteilung der schriftlichen Belehrung zugekommen ist. Die Zustimmung<br />
kann durch das Gericht ersetzt werden. Der Erwerb der Staatsbürgerschaft erstreckt sich auf<br />
uneheliche Kinder der legitimierten Frau.<br />
Die Adoption eines Fremden durch eine Person, die österr. Staatsbürger ist, bewirkt keinen<br />
Staatsbürgerschaftserwerb ex lege für das Wahlkind, jedoch hat der Gesetzgeber einen erleichter-<br />
ten Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft in Form eines Rechtsanspruches auf Verlei-<br />
hung vorgesehen 230 .<br />
4.5.2 Verleihung und Erstreckung der Verleihung<br />
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft sowie die Erstreckung der Verleihung der Staatsbürger-<br />
schaft bedarf eines schriftlichen Antrages der Partei. Minderjährige Fremde, die das 14. Lebens-<br />
jahr vollendet haben, können einen Antrag nur selbst stellen, bedürfen aber der Einwilligung des<br />
229 Es bestehen keine Bedenken gegen § 7 Abs.1 litt a und Abs.3 StbG (unterschiedliche Behandlung von ehelichen<br />
und unehelichen Kindern) unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (VwGH 25.6.1997, 96/01/1170).<br />
230 § 12 litt d in Verbindung mit § 17 Abs 1 Z 4 StbG.<br />
Seite - 109 -
gesetzlichen Vertreters. Die Verleihungsbehörde (Landesregierung) könnte hinsichtlich einer<br />
Verleihung nicht von sich aus tätig werden. Die Verleihung erfolgt mit schriftlichem Bescheid.<br />
Die Staatsbürgerschaft darf einem Fremden nur verliehen werden: (§ 10 Abs. 1 Z 1 – 8)<br />
1. Ununterbrochener zehnjähriger rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet. Davon muss der<br />
Fremde zumindest fünf Jahre niedergelassen gewesen sein.<br />
2. Keine rechtskräftige Verurteilung durch ein inländisches oder ausländisches Gericht wegen<br />
einer oder mehrerer Vorsatztaten zu einer Freiheitsstrafe. Die Verurteilung durch ein aus-<br />
ländisches Gericht muss in einem den Grundsätzen des Art. 6 der Europäischen Konventi-<br />
on zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) entsprechenden Ver-<br />
fahren ergangen sein. Die strafbaren Handlungen müssen auch nach inländischem Recht<br />
gerichtlich strafbar sein.<br />
3. Keine rechtskräftige Verurteilung eines inländischen Gerichtes zu einer Freiheitsstrafe we-<br />
gen eines Finanzvergehens.<br />
4. Kein anhängiges Strafverfahren bei einem inländischen Gericht wegen des Verdachtes ei-<br />
ner mit Freiheitsstrafe bedrohten Vorsatztat.<br />
5. Keine wesentliche Beeinträchtigung der internationalen Beziehungen Österreichs durch die<br />
Verleihung der Staatsbürgerschaft.<br />
6. Bejahende Einstellung zur Republik und keine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung<br />
und Sicherheit.<br />
7. Hinreichend gesicherter Lebensunterhalt.<br />
8. Keine Beziehungen mit fremden Staaten, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft die<br />
Interessen der Republik schädigen würde.<br />
Die Staatsbürgerschaft darf nicht verliehen werden (§ 10 Abs. 2 StbG):<br />
1. Wenn bestimmte Tatsachen des Fremdenpolizeigesetzes vorliegen<br />
Seite - 110 -
2. Mehr als eine schwerwiegende Verwaltungsübertretung mit besonderem Unrechtsgeh-<br />
alt<br />
3. Anhängiges Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung<br />
4. Aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich<br />
5. Bestehen eines Aufenthaltsverbotes in einem EWR-Staat<br />
6. Rechtskräftige Erlassung einer Ausweisung nach dem Fremdenpolizei- oder Asylgesetz<br />
in den letzten zwölf Monaten<br />
7. Naheverhältnis zu einer extremistischen oder terroristischen Gruppierung<br />
Erwerb der Staatsbürgerschaft für den Ehegatten eines österreichischen Staatsbürgers<br />
(§ 11a Abs. 1 StbG):<br />
1. Rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in Österreich von mindestens sechs<br />
Jahren.<br />
2. Fünfjährige aufrechte Ehe im gemeinsamen Haushalt.<br />
3. Die Ehe darf weder von Tisch und Bett noch sonst ohne Auflösung des Ehebandes ge-<br />
richtlich geschieden sein.<br />
4. Der Fremde darf nicht infolge Entziehung der Staatsbürgerschaft Fremder sein.<br />
Die Staatsbürgerschaft darf nicht verliehen werden, wenn<br />
1. Der Fremde mit dem Ehegatten das zweite Mal verheiratet ist und<br />
2. diesem Ehegatten die Staatsbürgerschaft nach Scheidung der ersten gemeinsamen<br />
Ehe auf Grund der Heirat mit einem Staatsbürger verliehen wurde.<br />
Verleihung der Staatsbürgerschaft nach einem rechtmäßigen und ununterbrochenen<br />
Aufenthalt von mindestens sechs Jahren im Bundesgebiet (§ 11a Abs. 4 StbG)<br />
1. Asylberechtigte<br />
Seite - 111 -
2. Staatsangehörige eines EWR-Staates<br />
3. Geburt im Bundesgebiet<br />
4. Verleihung der Staatsbürgerschaft auf Grund bereits erbrachter und noch zu erwarten-<br />
der außerordentlicher Leistungen auf wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, künstleri-<br />
schem oder sportlichem Gebiet im Interesse der Republik<br />
§ 10 Abs. 6 StbG:<br />
Die Voraussetzungen des zehnjährigen ununterbrochenen Aufenthaltes im Bundesgebiet, der<br />
Nachweis des gesicherten Lebensunterhaltes sowie des Ausscheidens aus dem bisherigen<br />
Staatsverband entfallen, wenn die Bundesregierung bestätigt, dass die Verleihung der Staatsbür-<br />
gerschaft wegen der vom Fremden bereits erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außeror-<br />
dentlichen Leistungen im besonderen Interesse der Republik liegt (Verleihung im Staatsinteresse).<br />
Die Staatsbürgerschaft ist weiters zu verleihen:<br />
1. Wenn der Fremde die österreichische Staatsbürgerschaft mindestens 10 Jahre unun-<br />
terbrochen besessen hat, sie anders als durch Entziehung verloren hat und im Bun-<br />
desgebiet den Aufenthalt hat (§ 10 Abs. 4 Z 1 StbG)<br />
2. Einem Angehörigen eines der Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Do-<br />
naumonarchie oder einem Staatenlosen, der seinen Hauptwohnsitz im Bundesgebiet<br />
hatte und sich auf Grund von Verfolgungen vor dem 9.5.1945 ins Ausland begeben hat<br />
(§ 10 Abs. 4 Z 2 StbG)<br />
3. Wenn der Fremde die Staatsbürgerschaft weder durch Entziehung noch durch Verzicht<br />
verloren hat und entweder<br />
a) seit mindestens 30 Jahren ununterbrochen den Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hat<br />
(§ 12 Z 1 lit. a StbG).<br />
b) seit mindestens 15 Jahren den rechtmäßigen ununterbrochenen Aufenthalt im Bun-<br />
desgebiet hat und eine nachhaltige persönliche und berufliche Integration nachweist (§<br />
12 Z 1 lit. b StbG).<br />
4. Die Staatsbürgerschaft zu einer Zeit, da er nicht eigenberechtigt war, anders als durch<br />
Entziehung verloren hat und die Verleihung der Staatsbürgerschaft binnen 2 Jahren<br />
nach Erlangung der Volljährigkeit beantragt (§ 12 Z 2 StbG).<br />
Seite - 112 -
5. Die Staatsbürgerschaft durch Erstreckung der Verleihung nur deshalb nicht erworben<br />
werden kann, weil der hiefür maßgebliche Elternteil (Wahlelternteil) bereits Staatsbür-<br />
ger ist und er zum Zeitpunkt der Antragstellung rechtmäßig niedergelassen war (§ 12 Z<br />
3 StbG).<br />
6. Einem Fremden ist die Staatsbürgerschaft wieder zu verleihen, wenn er die Staatsbür-<br />
gerschaft dadurch verloren hat, dass er einen Fremden geheiratet hat, gleichzeitig mit<br />
diesem dieselbe Staatsangehörigkeit oder während der Ehe mit einem Fremden des-<br />
sen Staatsangehörigkeit erworben hat, wenn er binnen 5 Jahren nach Auflösung der<br />
Ehe durch Tod oder sonst dem Bande nach erfolgten Auflösung die Verleihung der ös-<br />
terreichischen Staatsbürgerschaft beantragt (§ 13 StbG).<br />
7. Einem Fremden ist die Staatsbürgerschaft zu verleihen, wenn er im Gebiet der Repub-<br />
lik geboren ist und seit seiner Geburt staatenlos ist. Er muss seinen Hauptwohnsitz<br />
insgesamt mindestens 10 Jahre im Gebiet der Republik gehabt haben, wobei ununter-<br />
brochen mindestens 5 Jahre unmittelbar vor der Verleihung der Staatsbürgerschaft lie-<br />
gen müssen. Bestimmte Strafen dürfen nicht vorliegen. Die Verleihung der Staatsbür-<br />
gerschaft muss nach Vollendung des 18. Lebensjahres und spätestens 2 Jahre nach<br />
Eintritt der Volljährigkeit beantragt werden (§ 14 StbG).<br />
Lebensunterhalt<br />
Der für die Verleihung der Staatsbürgerschaft erforderliche gesicherte Lebensunterhalt ist<br />
dann hinreichend gesichert, wenn feste und regelmäßige eigene Einkünfte (Erwerb, Einkommen,<br />
gesetzliche Unterhaltsansprüche oder Versicherungsleistungen) für die letzten 3 Jahre nachge-<br />
wiesen werden. Die Höhe der Einkünfte muss den Richtsätzen des Allgemeinen Sozialversiche-<br />
rungsgesetzes entsprechen. Sozialhilfeleistungen dürfen in den letzten 3 Jahren nicht bezogen<br />
worden sein (§ 10 Abs. 5 StbG).<br />
Deutschkenntnisse<br />
Voraussetzung jeglicher Verleihung der Staatsbürgerschaft ist der Nachweis der Kenntnis der<br />
deutschen Sprache (§ 10a StbG).<br />
Als Nachweis gelten:<br />
Seite - 113 -
1. Bei Minderjährigen Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und positive<br />
Beurteilung des Unterrichtsgegenstandes „Deutsch“<br />
2. Die deutsche Sprache ist die Muttersprache<br />
3. Wenn der Fremde einen Nachweis bringt, dass er<br />
a) einen Deutsch-Integrationskurs besucht und erfolgreich abschließt<br />
b) einen 5-jährigen Besuch einer Pflichtschule in Österreich nachweist und das Unter-<br />
richtsfach „Deutsch“ positiv abgeschlossen hat<br />
c) positiver Abschluss des Unterrichtsfaches „Deutsch“ auf dem Niveau der 9. Schul-<br />
stufe<br />
d) Nachweis über entsprechende Deutschkenntnisse (Sprachdiplom nach Modul 2)<br />
e) Abschluss einer höheren Schule<br />
f) Abschluss einer berufsbildenen mittleren Schule<br />
g) Lehrabschlussprüfung<br />
Ausgenommen vom Nachweis der Deutschkenntnisse:<br />
1. Verleihung der Staatsbürgerschaft im Staatsinteresse<br />
2. Wiederverleihung der Staatsbürgerschaft<br />
3. Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Verfolgte<br />
4. Kinder vor der Schulpflicht<br />
5. Fremde mit hohem Alter, dauerhaft schlechtem Gesundheitszustand (Nachweis durch<br />
amtsärztliches Gutachten)<br />
6. selbst nicht handlungsfähige Fremde<br />
Nachweis von Grundkenntnissen der demokratischen Ordnung sowie der Geschichte<br />
Österreichs und des jeweiligen Bundeslandes (§ 10a StbG)<br />
Ausgenommen ist derselbe Personenkreis wie bei der Ausnahme vom Nachweis der Deutsch-<br />
kenntnisse.<br />
Seite - 114 -
Der Nachweis gilt als erbracht<br />
1. Bei Minderjährigen Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht<br />
2. Prüfung zum Nachweis der Grundkenntnisse der demokratischen Ordnung sowie der<br />
Geschichte Österreichs und des jeweiligen Bundeslandes.<br />
a) Diese Prüfung ist schriftlich bei der Landesregierung abzulegen.<br />
Der Prüfungsbogen hat 18 Fragen zu umfassen.<br />
b) Die Prüfung ist als bestanden zu beurteilen, wenn in jedem Prüfungsgebiet zumin-<br />
dest die Hälfte der vorgesehenen Punkte oder in Summe zumindest zwei Drittel der<br />
Punkteanzahl erreicht werden.<br />
c) Wiederholungsprüfungen sind möglich.<br />
Gesamtverhalten (§ 11 StbG)<br />
Bei den Entscheidungen ist das Gesamtverhalten des Fremden im Hinblick auf das allgemeine<br />
Wohl, die öffentlichen Interessen und das Ausmaß der Integration zu berücksichtigen. Dazu zählt<br />
insbesondere die Orientierung des Fremden am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen<br />
Leben in Österreich sowie an den Grundwerten eines europäischen demokratischen Staates und<br />
seiner Gesellschaft.<br />
Erstreckung der Verleihung<br />
Unter Erstreckung im Sinne des Staatsbürgerschaftsgesetzes versteht man die Ausdehnung<br />
der Verleihungswirkung der Staatsbürgerschaft in einem Rechtsakt an weitere Personen auf<br />
Grund eines Antrages anlässlich einer Verleihung.<br />
Die Erstreckung obliegt der jeweiligen Verleihungsbehörde auf Grund eines schriftlichen Antrages<br />
gleichzeitig mit der Verleihung.<br />
Gemäß § 16 StbG ist die Verleihung auf den jeweils anderen im gemeinsamen Haushalt lebenden<br />
Ehegatten zu erstrecken, wenn<br />
1. sich dieser seit mindestens 6 Jahren rechtmäßig und ununterbrochen im Bundesgebiet<br />
aufhält<br />
2. zum Zeitpunkt der Antragstellung<br />
a) rechtmäßig niedergelassen oder<br />
b) asylberechtigt oder<br />
c) Inhaber einer Legitimationskarte nach dem Fremdenpolizeigesetz ist<br />
Seite - 115 -
3. die Ehe weder von Tisch und Bett noch sonst ohne Auflösung des Ehebandes gerichtlich<br />
geschieden ist.<br />
4. der Ehegatte nicht infolge Entziehung der Staatsbürgerschaft Fremder ist und<br />
5. die Ehe seit mindestens 5 Jahren aufrecht ist<br />
Gemäß § 17 StbG ist die Verleihung der Staatsbürgerschaft auf folgenden minderjähri-<br />
gen und ledigen Personenkreis zu erstrecken:<br />
1. die ehelichen Kinder des Fremden (Vater oder Mutter);<br />
2. die unehelichen Kinder der Frau;<br />
3. die unehelichen Kinder des Mannes, wenn seine Vaterschaft festgestellt oder anerkannt<br />
ist und ihm die Pflege und Erziehung der Kinder zusteht;<br />
4. die unehelichen Kinder aller vorhin genannten Nachkommen, soweit diese weiblichen<br />
Geschlechtes sind und die Verleihung der Staatsbürgerschaft auf sie erstreckt wird<br />
(uneheliche Kinder einer Tochter eines Antragstellers);<br />
5. die erheblich behinderten Kinder, auch wenn sie nicht mehr minderjährig sind;<br />
6. die Wahlkinder des Fremden.<br />
4.5.3 Zusicherung der Verleihung<br />
Die Zusicherung der Verleihung geht einer Verleihung dann voraus, wenn dadurch dem<br />
Staatsbürgerschaftswerber das Ausscheiden aus dem bisherigen Staatsverband erleichtert oder<br />
überhaupt erst ermöglicht wird. Diese Zusicherung erfolgt durch schriftlichen Bescheid und be-<br />
gründet einen Anspruch auf Verleihung, wenn der Fremde binnen zwei Jahren das Ausscheiden<br />
aus seinem bisherigen Heimatstaat nachweist. Bei fruchtlosem Verstreichen dieser Frist wird der<br />
Zusicherungsbescheid wirkungslos, wenn der Einbürgerungswerber die für das Ausscheiden aus<br />
dem bisherigen Staatsverband erforderlichen Handlungen unterlässt, obwohl ihm diese möglich<br />
und zumutbar sind. Ebenso kann die Staatsbürgerschaft verliehen werden, wenn der Fremde<br />
glaubhaft macht, dass er für das Ausscheiden aus dem bisherigen Staatsverband übermäßig hohe<br />
Zahlungen zu leisten hätte. Die Zusicherung kann nicht verlängert werden, sie wäre allenfalls<br />
neuerlich auszustellen. Erfüllt der Fremde während der Zeit der Zusicherung auch nur eine Vo-<br />
raussetzung für die Verleihung (Erstreckung der Verleihung) nicht mehr, so ist die Zusicherung zu<br />
widerrufen. Für einen allenfalls endgültig negativen Ausgang des Verfahrens ist aber auch eine<br />
bescheidmäßige Abweisung des Antrages erforderlich.<br />
4.5.4 Dienstantritt als Universitätsprofessor<br />
Gemäß § 25 Abs. 1 StbG erwirbt ein Fremder, der nicht die Staatsangehörigkeit eines Staates<br />
des Europäischen Wirtschaftsraumes besitzt, die Staatsbürgerschaft durch seinen Dienstantritt<br />
als Universitäts- bzw. Hochschulprofessor an einer inländischen Universität, an der Akademie der<br />
Bildenden Künste in Wien oder an einer inländischen Kunsthochschule.<br />
Seite - 116 -
4.5.5 Erklärung<br />
Gemäß § 25 Abs. 2 Staatsbürgerschaftsgesetz erwirbt der Ehegatte (männlich oder weiblich)<br />
eines Universitäts- oder Hochschulprofessors die Staatsbürgerschaft durch Erklärung, der Re-<br />
publik als getreuer Staatsbürger angehören zu wollen, mit Wirkung ab dem Zeitpunkt des Dienst-<br />
antrittes, wenn die Ehe aufrecht und der Ehegatte nicht durch Entziehung (gem. § 33 StbG)<br />
Fremder ist.<br />
Die Kinder eines Universitäts- oder Hochschulprofessors erwerben die Staatsbürgerschaft<br />
durch Erklärung, der Republik als getreue Staatsbürger angehören zu wollen, mit Wirkung ab dem<br />
Zeitpunkt des Dienstantrittes. Die übrigen Voraussetzungen sind die gleichen wie bei der Erstre-<br />
ckung der Verleihung der Staatsbürgerschaft an minderjährige Kinder.<br />
Die Erklärung ist innerhalb eines Jahres nach Dienstantritt eines Universitäts- oder Hoch-<br />
schulprofessors in schriftlicher Form bei der Landesregierung abzugeben. Diese hat den Erwerb<br />
der Staatsbürgerschaft mit schriftlichem Bescheid festzustellen.<br />
4.5.6 Wiedererwerb durch Anzeige<br />
Ein Fremder erwirbt die Staatsbürgerschaft mit dem Zeitpunkt des Einlangens der Anzeige bei<br />
der Landesregierung bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen, wenn er der Behörde<br />
schriftlich anzeigt, sich als Staatsbürger vor dem 9. Mai 1945 in das Ausland begeben zu haben,<br />
weil er<br />
1. Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Dritten Reiches mit<br />
Grund zu befürchten hatte oder erlitten hat, oder<br />
2. weil er wegen seines Eintretens für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen<br />
ausgesetzt war oder solche zu befürchten hatte.<br />
Die Behörde hat den Erwerb der Staatsbürgerschaft mit Bescheid festzustellen (§ 58 c StbG).<br />
4.5.7 Ausscheidensnachweis<br />
Gemäß § 10 Abs. 3 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 darf einem Fremden, der eine fremde<br />
Staatsangehörigkeit besitzt, die Staatsbürgerschaft nicht verliehen werden, wenn er<br />
1. die für das Ausscheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforderlichen Handlungen<br />
unterlässt, obwohl sie ihm möglich und zumutbar sind, oder<br />
2. aufgrund seines Antrages oder auf andere Weise beabsichtigt, die Beibehaltung seiner<br />
bisherigen Staatsangehörigkeit zu erwirken.<br />
Darüber hinaus kann einem Fremden unter Beibehaltung der fremden Staatsangehörigkeit die<br />
Staatsbürgerschaft nur verliehen werden, wenn die Bundesregierung bestätigt, dass die Verlei-<br />
hung im Interesse der Republik liegt (§ 10 (6) StbG). Vor der Verleihung haben die Staatsbürger-<br />
Seite - 117 -
schaftswerber, sofern sie eigenberechtigt sind oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, ein Ge-<br />
löbnis abzulegen.<br />
Das Gelöbnis lautet: „Ich gelobe, dass ich der Republik Österreich als getreuer Staatsbürger<br />
angehören, ihre Gesetze stets gewissenhaft beachten und alles unterlassen werde, was den<br />
Interessen und dem Ansehen der Republik abträglich sein könnte“. (§ 21 StbG)<br />
Mit dem Gelöbnis soll den Bewerbern nachdrücklich und in feierlicher Form zum Bewusstsein<br />
gebracht werden, dass sie mit ihrer Aufnahme in den österreichischen Staatsverband in ein Treu-<br />
everhältnis zur Republik treten.<br />
4.6 Verlust der Staatsbürgerschaft<br />
Die österreichische Staatsbürgerschaft wird verloren 231 durch:<br />
1. freiwilligen Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit (§§ 27 und 29 StbG)<br />
2. freiwilligen Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates (§ 32 StbG)<br />
3. Entziehung (§§ 33 bis 36 StbG)<br />
4. Verzicht (§ 37 und 38 StbG)<br />
4.6.1 Freiwilliger Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit<br />
Der Verlust tritt ein, wenn der Staatsangehörige auf Grund seines Antrages, seiner Erklärung,<br />
oder seiner ausdrücklichen Zustimmung (d.h. auf Grund eigenen Willensentschlusses) eine<br />
fremde Staatsangehörigkeit erwirbt (Ausnahme: vorherige Zusicherung der Beibehaltung nach<br />
§ 28 StbG).<br />
Für Minderjährige muss eine Zustimmung zum freiwilligen Erwerb der fremden Staatsangehö-<br />
rigkeit durch den gesetzlichen Vertreter vorliegen. Ist der gesetzliche Vertreter eine andere<br />
Person als die Eltern, tritt der Verlust nur dann ein, wenn das Vormundschafts- oder Pflegschafts-<br />
gericht in die Willenserklärung des gesetzlichen Vertreters oder in dessen Zustimmung vor dem<br />
Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit eingewilligt hat (nachherige Zustimmung bedeutet<br />
Rechtsunwirksamkeit des Verlustes).<br />
Der Antritt eines Lehramtes an einer ausländischen Hochschule ist für sich allein keinesfalls<br />
als ausdrückliche Zustimmung im Sinne dieser Gesetzesstelle zu verstehen.<br />
231 Die Aufzählung der Verlusttatbestände in § 26 StbG ist keine erschöpfende. Insbesondere Fälle rückwirkenden<br />
Verlustes fehlen (VwGH 25.6.1997, 96/01/1170). Ein rückwirkender Verlust tritt etwa bei der nachträglichen Aufhebung<br />
eines Verleihungsbescheides (z.B durch Wiederaufnahme oder Aufhebung durch einen Gerichtshof des öffentlichen<br />
Rechts) oder beim ex tunc wirkenden Wegfall einer für den Erwerb ex lege erforderlichen Voraussetzung (eheliche<br />
Abstammung von einem Österreicher, stattgebendes Urteil im Ehelichkeitsbestreitungsverfahren).<br />
Seite - 118 -
Der Verlust tritt nur dann ein, wenn eine positive Willenserklärung zum Erwerb einer fremden<br />
Staatsangehörigkeit vorliegt.<br />
Die Bewilligung der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft ist in § 28 StbG nä-<br />
her geregelt: Die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft kann einem österreichischen Staatsbür-<br />
ger für den Fall des Erwerbes einer fremden Staatsangehörigkeit unter folgenden Bedingungen<br />
bewilligt werden:<br />
1. Bereits erbrachte und noch zu erwartende Leistungen oder ein besonders berücksichtigungswürdigen<br />
Grund im Interesse der Republik;<br />
2. Soweit Gegenseitigkeit besteht, der fremde Staat, dessen Staatsangehörigkeit angestrebt<br />
wird, der Beibehaltung zustimmt;<br />
3. Vorliegen von Voraussetzungen gemäß § 10 Abs. 1 (sinngemäß);<br />
4. Für Staatsbürger durch Abstammung genügt ein besonders berücksichtigungswürdiger<br />
Grund in ihrem Privat- und Familienleben;<br />
5. Es im Fall von Minderjährigen dem Kindeswohl entspricht<br />
Der Antrag auf Beibehaltung der Staatsbürgerschaft darf nur schriftlich eingebracht werden<br />
und ist unter der Bedingung zu bewilligen, dass die fremde Staatsangehörigkeit binnen zwei<br />
Jahren erworben wird.<br />
Der Bescheid über die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft hat schriftlich zu<br />
erfolgen.<br />
4.6.2 Freiwilliger Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates<br />
Die Staatsbürgerschaft verliert, wer freiwillig in den Militärdienst eines fremden Staates<br />
tritt 232 . Zu beachten ist jedoch das Übereinkommen über die Militärdienstpflicht in Fällen mehrfa-<br />
cher Staatsangehörigkeit, BGBl. 1975/471 233 . Der Eintritt in den „Dienst eines fremden Staates” ist<br />
kein Verlustgrund, wenn es sich nicht um einen Militärdienst handelt.<br />
4.6.3 Entziehung der Staatsbürgerschaft<br />
Die Staatsbürgerschaft ist jenem Staatsbürger zu entziehen, der im Dienste eines fremden<br />
Staates steht 234 und durch sein Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich<br />
schädigt 235 . Die Entziehung erfolgt schriftlich in Bescheidform.<br />
232<br />
Keine Erstreckung des Verlustes auf andere Familienmitglieder.<br />
233<br />
Daher kein Verlust, wenn ein Mehrstaater in einem seiner Heimatstaaten seiner gesetzlichen Militärdienstpflicht<br />
nachkommt.<br />
234<br />
Gemeint ist jede dienst- oder arbeitsrechtliche Bindung an den fremden Staat, auch in Privatwirtschaftsverwaltung<br />
und auch auf privatrechtlicher Basis (zB Konsulententätigkeit).<br />
235<br />
Entziehung der Staatsbürgerschaft nur bei Zusammentreffen von Dienst und Schädigung. Die Schädigung muss mit<br />
dem Dienst nicht zusammenhängen (zB Dienst als Kraftfahrer, Schädigung durch Spionage). Bei Vorliegen dieser<br />
Voraussetzungen ist die Behörde zur Entziehung verpflichtet.<br />
Seite - 119 -
Weiters ist die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn<br />
1. der Staatsbürger die Staatsbürgerschaft durch Verleihung oder Erstreckung der Verleihung<br />
vor mehr als zwei Jahren erworben hat;<br />
2. er trotz des Erwerbes der Staatsbürgerschaft seither aus Gründen, die er selbst zu<br />
vertreten hat, eine fremde Staatsangehörigkeit beibehalten hat.<br />
Der betroffene Staatsbürger ist mindestens sechs Monate vor der beabsichtigten Entziehung<br />
zu belehren. Die Entziehung ist nach Ablauf von sechs Jahren ab dem Zeitpunkt der Verleihung<br />
bzw. Erstreckung der Verleihung nicht mehr zulässig.<br />
Die Entziehung erfolgt von Amts wegen oder auf Antrag des Bundesministers für Inneres, der<br />
bei entsprechender Antragstellung in einem solchen Verfahren Parteistellung hat.<br />
4.6.4 Verzicht auf die Staatsbürgerschaft<br />
Ein Staatsbürger kann auf die Staatsbürgerschaft verzichten, wenn er<br />
�� eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt,<br />
�� gegen ihn weder ein Strafverfahren noch eine Strafvollstreckung infolge einer gerichtlich<br />
strafbaren Handlung, die mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist, anhängig<br />
ist,<br />
�� kein Angehöriger des Bundesheeres ist und, sofern männlichen Geschlechts<br />
1. das 16. Lebensjahr noch nicht oder das 36. Lebensjahr bereits vollendet hat oder<br />
2. den ordentlichen Präsenzdienst (Zivildienst) geleistet hat, oder<br />
3. von der Stellungskommission als untauglich oder vom zuständigen Amtsarzt als dauernd<br />
unfähig zu jedem Zivildienst festgestellt worden ist oder<br />
4. wegen geistiger Krankheit oder geistiger Schwäche von der Einberufung in das Bundesheer<br />
ausgeschlossen ist oder<br />
5. die Militärdienstpflicht in einem Staat, dem der Ausscheidende angehört, erfüllt hat.<br />
Die Voraussetzung des Fehlens einer entsprechenden gerichtlich strafbaren Handlung bzw.<br />
eines Strafvollzuges oder nicht Angehöriger des Bundesheeres zu sein entfällt, wenn der Verzich-<br />
tende seit mindestens fünf Jahren außerhalb des Gebietes der Republik seinen Hauptwohnsitz<br />
hat.<br />
Die Verzichtserklärung ist in schriftlicher Form bei der zuständigen Landesregierung abzuge-<br />
ben. Die Behörde stellt fest, ob die für den Verzicht vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind<br />
und Bejahendenfalls, mit welchem Zeitpunkt der Staatsangehörige die Staatsbürgerschaft verloren<br />
hat. Der Bescheid über den Verlust der Staatsbürgerschaft erfolgt in schriftlicher Form.<br />
Seite - 120 -
4.7 Behörden und Verfahren<br />
4.7.1 Bundesregierung<br />
Bestätigung, dass die Verleihung im besonderen Interesse der Republik liegt (§ 10 (6) StbG)<br />
4.7.2 Bundesminister für Inneres<br />
1. Bescheidbeschwerde gemäß Art. 131 Abs. 1 Z 2 B-VG<br />
2. Antrag auf Entziehung der Staatsbürgerschaft (§ 35 StbG) und Parteistellung in diesem<br />
Verfahren<br />
3. Erlassung der Staatsbürgerschafts - Verordnung<br />
4.7.3 Landesregierung<br />
Die Landesregierung ist zur Erlassung von Bescheiden in Angelegenheiten der Staatsbürger-<br />
schaft zuständig.<br />
Bescheide:<br />
1. über die Verleihung der Staatsbürgerschaft<br />
2. über die Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft<br />
3. über die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft<br />
4. über die Entziehung der Staatsbürgerschaft<br />
5. über die Feststellung der Staatsbürgerschaft<br />
6. über die Feststellung über den Verlust der Staatsbürgerschaft infolge Verzichts<br />
7. über die Feststellung über den Erwerb der Staatsbürgerschaft aufgrund einer Anzeige<br />
gemäß § 58 c StbG<br />
8. Berufungsbehörde bei Bescheiden der Bezirksverwaltungsbehörden und der österreichischen<br />
Vertretungsbehörden im Ausland.<br />
4.7.4 Bezirksverwaltungsbehörde<br />
als Berufungsbehörde für Entscheidungen über Berufungen gegen Bescheide der Gemeinden,<br />
Staatsbürgerschaftsverbände bzw. Evidenzstellen,<br />
als sachlich in Betracht kommende Oberbehörde bei Devolutionsanträgen in diesem Sinn und<br />
als Strafbehörde I. Instanz bei Übertretungen nach dem StbG.<br />
4.7.5 Gemeinde bzw. Staatsbürgerschaftsverband<br />
Gemeinden und Staatsbürgerschaftsverbände (=Gemeindeverbände) werden in Staatsbürger-<br />
schaftsangelegenheiten im übertragenen Wirkungsbereich tätig. Es sind dieselben Gemeinden,<br />
Seite - 121 -
die zur Besorgung von Personenstandsangelegenheiten zuständig und eventuell hiefür zusam-<br />
mengeschlossen sind (Standesamtsverband). Diese Festlegung nach § 47 Staatsbürgerschafts-<br />
gesetz 1985 ist eine formelle und organisatorische Querverbindung zum Personenstandsrecht.<br />
Nach dem Personenstandsgesetz können Gemeinden durch Verordnung des Landeshauptman-<br />
nes zu einem Gemeindeverband (Standesamtsverband) zusammengeschlossen werden.<br />
Zur Ausstellung von Bestätigungen in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft und zur Ent-<br />
scheidung über Anträge hinsichtlich Bestätigungen ist jene Gemeinde (jener Staatsbürgerschafts-<br />
verband) zuständig, in deren (dessen) Bereich die Person, auf die sich die Bestätigung bezieht,<br />
ihren Hauptwohnsitz hat.<br />
Den Gemeinden obliegen folgende Aufgaben:<br />
1. Ausstellung von Bestätigungen (§ 41 StbG) 236 , insbesondere des Staatsbürgerschaftsnachweises<br />
(§ 44 StbG);<br />
2. Bestätigung über das Ausscheiden aus dem Staatsverband (§ 30 StbG);<br />
3. Bestätigung über den Besitz oder „Nichtbesitz” der Staatsbürgerschaft zu einem bestimmten<br />
Zeitpunkt (§ 43 StbG);<br />
4. Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz gemäß §§ 49 bis 52 StbG und Vollziehung<br />
der einschlägigen Bestimmungen nach der Staatsbürgerschafts-Verordnung 1985;<br />
5. Mitteilungen an die Evidenzstelle.<br />
4.7.6 Berufskonsulat bzw. Vertretungsbehörde<br />
Bei einem Hauptwohnsitz außerhalb des Gebietes der Republik ist das österreichische Be-<br />
rufskonsulat, wo ein solches nicht besteht, die österreichische diplomatische Vertretungsbehörde,<br />
in deren Bereich diese Person ihren Hauptwohnsitz hat, zuständig.<br />
4.8 Staatsbürgerschaftsevidenz<br />
Die Staatsbürgerschaftsevidenz nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 ist ein seit<br />
1. Juli 1966 neu geschaffenes Verzeichnis aller Staatsbürger. 237 Früher gab es als Evidenzunter-<br />
lagen die Heimatrollen (begründet mit der Heimatrechtsgesetz-Novelle 1928, abgeschlossen am<br />
30. Juni 1939). Die Heimatrollen sind nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr weiter fortgeführt worden.<br />
Sie sind jedoch nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz von den Gemeinden weiterhin aufzubewah-<br />
ren, da aus ihnen staatsbürgerschaftsrechtlich relevante Tatsachen heute noch abgeleitet werden<br />
können.<br />
236 Gegenstand einer Bestätigung kann keinesfalls eine fremde Staatsangehörigkeit noch die Staatenlosigkeit sein.<br />
237 Die Staatsbürgerschaftsevidenz dient lediglich behördeninternen Zwecken. Auf Verzeichnung oder Nichtverzeich-<br />
nung in der Evidenz steht niemandem ein Anspruch zu.<br />
Seite - 122 -
Alle nach dem Abschluss der Heimatrollen geborenen Österreicher und alle Personen, die<br />
seither die österreichische Staatsbürgerschaft durch Eheschließung, Option oder Verleihung etc.<br />
erworben hatten, waren bis zum 1. Juli 1966 in keiner Evidenz erfasst, was sich bei der Beurtei-<br />
lung staatsbürgerschaftsrechtlicher Fragen immer hemmender ausgewirkt hatte. Ursprünglich war<br />
in der Regierungsvorlage zum Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 beabsichtigt, die Evidenz von der<br />
Geburtsgemeinde der zu verzeichnenden Person führen zu lassen. Diese Regelung hätte zu dem<br />
unerwünschten Ergebnis geführt, dass die Staatsbürgerschaftsevidenz zum größten Teil bei den<br />
sogenannten Spitalsgemeinden, das sind etwa 100 Gemeinden, konzentriert gewesen wäre, die<br />
übrigen derzeit rund 2400 Gemeinden aber - von wenigen Hausgeburten abgesehen - von der<br />
Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz ausgeschlossen worden wären. Durch die jetzige Rege-<br />
lung wird eine gleichmäßige Aufteilung der Staatsbürgerschaftsevidenz auf alle Gemeinden er-<br />
reicht. Darüber hinaus bringt sie auch den Vorteil, dass die Evidenzgemeinde im überwiegenden<br />
Teil der Fälle auch zur Ausstellung eines Staatsbürgerschaftsnachweises oder einer sonstigen<br />
staatsbürgerschaftsrechtlichen Bestätigung an das Kind zuständig sein wird, weil in der Regel der<br />
Wohnort der Mutter im Zeitpunkt der Geburt auch der Hauptwohnsitz des Kindes ist.<br />
Mit der Einführung der Staatsbürgerschaftsevidenz war eine allmähliche und organisch auf-<br />
bauende Erfassung aller Staatsbürger beabsichtigt. Eine sofortige Erfassung aller Staatsbürger<br />
wurde wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes nicht vorgesehen.<br />
Die Staatsbürgerschaftsevidenz, in der bereits mehr als 95 % der Österreicher erfasst sind, hat<br />
den Zweck, jederzeit Auskunft über die staatsbürgerschaftsrechtlichen Verhältnisse einer Person<br />
zu geben und zwar<br />
1. ob eine Person die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt;<br />
2. wann sie diese erworben hat;<br />
3. auf Grund welcher gesetzlichen Bestimmung;<br />
4. welche staatsbürgerschaftsrechtlichen Bestätigungen für sie ausgestellt, gegebenenfalls<br />
welche verloren oder eingezogen worden sind;<br />
5. ob der Verlust der Staatsbürgerschaft eingetreten ist;<br />
6. gegebenenfalls auf Grund welcher gesetzlichen Bestimmung.<br />
Die Gemeinden und Staatsbürgerschaftsverbände werden daher in den Fällen, in denen sie<br />
nicht selbst Evidenzstelle sind, vorher bei dieser anzufragen haben, was über den Antragsteller<br />
verzeichnet ist. Dasselbe gilt auch für die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland,<br />
soweit sie zur Ausstellung staatsbürgerschaftsrechtlicher Bestätigungen berufen sind.<br />
Seite - 123 -
4.8.1 Die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz<br />
4.8.1.1 Form und Inhalt der Evidenz<br />
Allgemeine Richtlinien<br />
Die Staatsbürgerschaftsevidenz wird in der Regel in Karteiform geführt. Die automationsun-<br />
terstützte Führung der Evidenz ist zulässig. Für jede zu verzeichnende Person ist ein Karteiblatt<br />
anzulegen und nach dem Familiennamen in die Kartei einzuordnen. Das Gesetz lässt sowohl die<br />
alphabetische als auch die phonetische Reihung zu. Letztere hat sich besonders in größeren<br />
Gemeinden bewährt. Bei automationsunterstützter Führung der Evidenz sind die erforderlichen<br />
Angaben auf Datenträgern zu speichern.<br />
Staatsbürgerschaftsverbände haben für jede der dem Verband angehörenden Gemeinden ei-<br />
ne eigene Evidenz zu führen. Bei Aufnahme einer Person in die Evidenz ist größte Sorgfalt gebo-<br />
ten. Die Eintragungen in die Evidenz dürfen daher nur auf Grund öffentlicher Urkunden, amtlicher<br />
Erhebungen oder amtlicher Mitteilungen vorgenommen werden. Die Eintragungen können mit<br />
Schreibmaschine, Tinte oder anderen die Schriftbeständigkeit gewährleistenden Mitteln vorge-<br />
nommen werden. Die Verwendung von Stempeln für häufig wiederkehrende Anmerkungen ist<br />
gestattet. Allgemeinverbindliche Abkürzungen sind zugelassen. Jeder Eintragung sind Datum und<br />
Handzeichen oder Unterschrift beizufügen. Die Eintragungen sollen in knapper, schlagwortartiger<br />
Form erfolgen. Radierungen in den Karteikarten sind unzulässig; ein allenfalls durchgestrichener<br />
Text soll leserlich bleiben. Die Kartei ist ständig unter Verschluss zu halten.<br />
Staatsbürgerschaftsevidenzstelle ist<br />
Zuständigkeitsvorschriften<br />
a) für Personen, die vor dem 1. Juli 1966 im Gebiet der Republik geboren sind:<br />
die Geburtsgemeinde (Gemeindeverband)<br />
b) für Personen, die nach dem 30. Juni 1966 im Gebiet der Republik geboren sind:<br />
die Gemeinde (Gemeindeverband), in der die Mutter im Zeitpunkt der Geburt der zu<br />
verzeichnenden Person laut Eintragung im Geburtenbuch ihren Wohnort hatte 238 ,<br />
wenn dieser aber im Ausland liegt, die Geburtsgemeinde (Gemeindeverband) der zu<br />
verzeichneten Person;<br />
c) für Personen, die im Ausland geboren sind oder bei denen sich nach lit. a oder b keine<br />
Zuständigkeit feststellen lässt:<br />
die Gemeinde Wien.<br />
Zur Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz ist sachlich die Gemeinde bzw. der Staatsbürger-<br />
schaftsverband zuständig. Für die örtliche Zuständigkeit gilt folgendes:<br />
238 Eine Berichtigung des Wohnortes der Mutter im Geburtenbuch bewirkt einen Wechsel in der Evidenzstelle !<br />
Seite - 124 -
E v i d e n z s t e l l e ist die Stelle, die die Evidenz führt, also die Gemeinde, wenn sie keinem<br />
Staatsbürgerschaftsverband angehört, oder der Staatsbürgerschaftsverband, wenn mehrere Ge-<br />
meinden zu einem solchen zusammengeschlossen sind.<br />
E v i d e n z g e m e i n d e ist jene Gemeinde, in deren Evidenz eine Person auf Grund der Zu-<br />
ständigkeitsvorschriften aufzunehmen ist oder aufzunehmen wäre, wenn diese Gemeinde nicht<br />
einem Staatsbürgerschaftsverband angehören würde. Die Staatsbürgerschaftsverbände haben die<br />
Evidenz jeder verbandsangehörigen Gemeinde getrennt zu führen.<br />
Bei Vereinigung einer Gemeinde mit einer anderen (Gemeindezusammenlegung) oder beim<br />
Ausscheiden einer Gemeinde aus einem Staatsbürgerschaftsverband ist die Staatsbürgerschafts-<br />
evidenz der betroffenen Gemeinde samt den dazugehörigen Sammelakten der neuen bzw. aus-<br />
geschiedenen Gemeinde zu übergeben.<br />
Bei Auflösung einer Gemeinde oder Aufteilung einer Gemeinde auf mehrere andere Gemein-<br />
den hat die Landesregierung über die Weiterführung der Evidenz eine Verfügung zu treffen.<br />
4.8.1.2 Evidenzblatt, Anlage und Fortführung<br />
Die Gemeinden, ausgenommen die Statutarstädte und die Gemeindeverbände, haben Kartei-<br />
blätter nach dem Muster Anlage 9 der StbV 1985 zu verwenden. Von dieser Verpflichtung kann<br />
die Landesregierung aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis befreien. In das<br />
Evidenzblatt sind an der hiefür vorgesehenen Stelle einzutragen:<br />
Alphabetreihe und freier Platz rechts daneben:<br />
Durch die Markierung des ersten Buchstabens des Familiennamens an der Kante des Evi-<br />
denzblattes (z.B. mit rotem Filzschreiber), kann eine unrichtige Einreihung des Blattes sofort ent-<br />
deckt werden. Wird auch der zweite Buchstabe des Namens in anderer Farbe gekennzeichnet,<br />
kann auch die Verreihung des Blattes innerhalb des Buchstabens vermieden werden. Bei Karteien<br />
mit größerem Umfang hat sich die zusätzliche Verwendung von Karteireitern bewährt.<br />
Bei Änderung des Namens werden die Markierungen abgeschnitten und die entsprechenden<br />
Buchstaben des neuen Namens gekennzeichnet. Auf dem freien Platz neben der Alphabetreihe ist<br />
die laufende Nummer einzusetzen oder mit Numerator anzubringen.<br />
Unter dieser Nummer werden alle Schriftstücke, die die Grundlage für die Anlegung und Fort-<br />
führung des Evidenzblattes bilden, abgelegt. Die Grundnummer ist auch für die Geltendmachung<br />
des Anspruches auf Kostenersatz für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz von Bedeu-<br />
tung. Bei Staatsbürgerschaftsverbänden ist für jede dem Verband angehörende Gemeinde eine<br />
eigene Grundnummernreihe zu führen.<br />
Seite - 125 -
Die rechte Ecke des freien Feldes neben der Alphabetreihe dient der Kennzeichnung verstor-<br />
bener Staatsbürger. Sie wird nach Eintragung der Todesdaten abgetrennt, ist daher freizuhalten.<br />
Rubrik Familienname<br />
Der Familienname ist auf der untersten Zeile dieser Rubrik einzutragen. Hat sich der Familien-<br />
name einer Person geändert (z.B. durch Legitimation, Adoption, Eheschließung, Doppelname<br />
nach dem Namensrechtsänderungsgesetz 239 ab dem 1.5.1995 etc.), sind auch sämtliche früher<br />
geführten Familiennamen einzutragen. In diesem Falle können in eine Zeile zwei Namen eingetra-<br />
gen werden. Der gegenwärtig geführte Name ist allein auf die nächsthöhere Zeile zu setzen.<br />
Jedem Namen ist eine Ordnungszahl anzufügen, unter der auf der Rückseite (obere Hälfte) der<br />
Grund und der Zeitpunkt der Namensänderung mit den erforderlichen näheren Angaben zu ver-<br />
merken ist.<br />
Stellt sich nach Anlage des Evidenzblattes heraus, dass ein früher geführter Familienname<br />
nicht verzeichnet ist, ist dieser und der Grund und der Zeitpunkt der Namensänderung unter der<br />
nächsten Ordnungszahl auf der Rückseite des Blattes einzutragen. Dieselbe Ordnungszahl ist in<br />
der Namensrubrik anzubringen.<br />
Reicht der Platz in dieser Rubrik für die Eintragung weiterer Namen nicht mehr aus, ist ein An-<br />
schlussblatt anzulegen, der neue Name auf die unterste Zeile der Namensrubrik einzutragen und<br />
das neue Blatt vorne an das Grundblatt anzuheften. Mit allen früher geführten Familiennamen ist<br />
ein Hinweisblatt anzulegen.<br />
Rubrik Vorname(n)<br />
Der Vorname ist auf die unterste Zeile dieser Rubrik einzutragen. Wurde der Vorname einer<br />
Person geändert, ist der neue Vorname auf die nächsthöhere Zeile zu setzen und mit der nächst-<br />
folgenden Ordnungszahl zu versehen. Unter derselben Zahl ist auf der Rückseite des Evidenzblat-<br />
tes der Grund und der Zeitpunkt der Vornamensänderung mit den erforderlichen näheren Anga-<br />
ben (z.B. Datum und Aktenzeichen des Namensänderungsbescheides) anzuführen.<br />
Rubrik Evidenzgemeinde, Geburtsdaten und Eintragungsstelle<br />
Die Evidenzgemeinde ist an der hiefür vorgesehenen Stelle unbedingt einzutragen, wenn die<br />
Evidenzgemeinde einem Staatsbürgerschaftsverband angehört.<br />
Die Geburtsangaben (Tag der Geburt, Geburtsort) und die Eintragungsstelle sind auf den Zei-<br />
len 2 bis 4 einzutragen. Geburtsort kann nur eine Gemeinde sein. Einzutragen ist die Gemeinde,<br />
in der das Geburtshaus zur Zeit der Anlegung des Evidenzblattes liegt.<br />
239 darunter fallen sowohl Erklärungen nach § 72a PStG als auch alle Namensänderungen nach dem NÄG.<br />
Seite - 126 -
Rubrik Erwerb der Staatsbürgerschaft<br />
In diese Rubrik ist der Erwerbsparagraph einzutragen. Der Erwerbszeitpunkt ist nur anzufüh-<br />
ren, wenn er sich nicht aus dem Erwerbsparagraphen ergibt. Welche sonstigen Angaben aufzu-<br />
nehmen sind, richtet sich nach Art und Zeitpunkt des Erwerbes (siehe § 14 StbV 1985). Wurde vor<br />
dem 1.7.1966 für eine Person ein Staatsbürgerschaftsnachweis ausgestellt, genügt es, die darin<br />
enthaltenen Angaben über den Erwerbsgrund in die Evidenz einzutragen, wenn weitere nach § 14<br />
StbV 1985 erforderliche Feststellungen nicht ohne weiteres getroffen werden können.<br />
Bei Eintritt des Verlustes der Staatsbürgerschaft ist deutlich sichtbar (am besten in roter Far-<br />
be) das Wort „Verlust“ oder „Staatsbürgerschaftsverlust“ mit einer Ordnungszahl einzutragen,<br />
unter der auf der Rückseite die näheren Angaben zu vermerken sind.<br />
Reicht der Platz in dieser Spalte für weitere Eintragungen nicht mehr aus, ist sie mit dem Hin-<br />
weis „Fortsetzung Rückseite“ abzuschließen. Auf der unteren Hälfte der Rückseite ist unter der<br />
Überschrift „Erwerb der Staatsbürgerschaft, Fortsetzung“ eine neue Rubrik zu eröffnen. Reicht<br />
auch dieser Platz nicht mehr aus, ist ein Anschlussblatt anzulegen. Die Spalte ist mit dem Hin-<br />
weis „Fortsetzung siehe Anschlussblatt“ abzuschließen.<br />
Rubrik Staatsbürgerschaftsnachweise<br />
Alle ausgestellten Staatsbürgerschaftsnachweise, ganz gleich, ob sie für die Partei gebühren-<br />
pflichtig oder gebührenfrei oder auf Antrag einer Behörde zum Amtsgebrauch ausgestellt worden<br />
sind, sind in diese Rubrik unter Angabe des Ausstellungsdatums, des Aktenzeichens und der<br />
ausstellenden Behörde einzutragen. Hierher gehören auch die von den Bezirksverwaltungsbe-<br />
hörden vor dem 1.7.1966 bzw. 31.12.1966 ausgestellten Staatsbürgerschaftsnachweise sowie<br />
Vermerke über Verlust, Einziehung oder Änderung eines Staatsbürgerschaftsnachweises.<br />
Reicht der Platz für weitere Eintragungen nicht aus, ist die Spalte mit dem Vermerk „Fortset-<br />
zung Rückseite“ abzuschließen. Im unteren Viertel der Rückseite ist unter dem Titel „Staatsbür-<br />
gerschaftsnachweise, Fortsetzung“ eine neue Rubrik zu eröffnen. Reicht auch diese für weitere<br />
Eintragungen nicht mehr aus, ist ein Anschlussblatt anzulegen und an das Grundblatt anzuheften.<br />
Rubrik Sterbedaten<br />
In diese Rubrik ist der Todestag und die Matrikenstelle, bei der der Tod beurkundet ist, ein-<br />
schließlich der Eintragungsnummer, bei Todeserklärung oder Beweisführung des Todes der fest-<br />
gestellte Todestag oder der Tag, den der für tot Erklärte nicht überlebt hat, sowie die Geschäfts-<br />
zahl des Gerichtsbeschlusses einzutragen. Die rechte obere Ecke des Karteiblattes und gegebe-<br />
nenfalls des Hinweisblattes sind abzutrennen, Karteiblatt und Hinweisblatt aber in der Kartei zu<br />
belassen. In größeren Gemeinden können die Karteiblätter, Anschlussblätter und Hinweisblätter<br />
Verstorbener mit Zustimmung der Landesregierung in einer gesonderten Ablage geführt werden.<br />
Seite - 127 -
Rückseite des Evidenzblattes<br />
obere Hälfte:<br />
Auf der Rückseite des Evidenzblattes sind einzutragen:<br />
1. der Grund und der Zeitpunkt der Änderung des Vornamens oder des Familiennamens;<br />
2. Anmerkungen über die Ausstellung sonstiger staatsbürgerschaftsrechtlicher Bestätigungen;<br />
3. Staatsbürgerschaftsbescheide, die nicht in die Rubrik „Erwerb der Staatsangehörigkeit“<br />
einzutragen sind (z.B. Feststellungsbescheide, Zusicherung über die Verleihung,<br />
Beibehaltungsbescheide, Verzichts- und Entziehungsbescheide); ferner Mitteilungen<br />
über den Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit, Eintritt in den Militärdienst eines<br />
fremden Staates, Staatsbürgerschaftsverlust oder vermutlicher Staatsbürgerschaftsverlust;<br />
4. die Wohnanschrift, soweit sie bekannt ist; die Gemeinde, in der eine verstorbene Person<br />
zuletzt ihren Hauptwohnsitz hatte. Nicht vorgeschrieben, aber im Hinblick auf einen<br />
etwaigen Staatsbürgerschaftsverlust zweckmäßig, ist die Anmerkung von Auslandswohnsitzen,<br />
die der Evidenzstelle bekannt werden;<br />
untere Hälfte, erstes Viertel:<br />
die Fortsetzung der Rubrik „Erwerb der Staatsbürgerschaft“;<br />
untere Hälfte, weites Viertel:<br />
Die Fortsetzung der Rubrik „Staatsbürgerschaftsnachweise“.<br />
Reicht der Platz auf der Rückseite für weitere Eintragungen nicht mehr aus, ist ein Anschluss-<br />
blatt anzulegen.<br />
4.8.1.3 Das Hinweisblatt<br />
Ändert sich der Familienname oder der Vorname einer Person, ist unter dem früheren Namen<br />
ein Hinweisblatt anzulegen, auf dem auch der neue Name aufscheint, so dass diese Person<br />
unter jedem von ihr geführten Namen zu finden ist. Bei neuerlicher Änderung des Familiennamens<br />
ist der neue Name auch auf allen Hinweisblättern unter Beisetzung des Datums und des Handzei-<br />
chens nachzutragen, damit über jedes Hinweisblatt sofort das unter dem jetzt geltenden Familien-<br />
namen eingeordnete Evidenzblatt gefunden werden kann.<br />
In das Feld neben der Alphabetleiste ist die Grundnummer des Evidenzblattes einzutragen.<br />
Der in Betracht kommende Buchstabe der Alphabetleiste ist zu markieren.<br />
4.8.1.4 Das Anschlussblatt<br />
Reicht der Platz auf der Rückseite des Evidenzblattes für weitere Eintagungen nicht mehr aus,<br />
ist die in Betracht kommende Rubrik mit dem Vermerk „Fortsetzung siehe Anschlussblatt“ abzu-<br />
Seite - 128 -
schließen und ein Anschlussblatt anzulegen. Die Anschlussblätter sind mit dem Grundblatt zu<br />
verbinden. Reicht der Platz auch auf dem Anschlussblatt nicht mehr aus, ist ein zweites An-<br />
schlussblatt anzufügen und als solches zu bezeichnen.<br />
Sinngemäß gilt das Gesagte auch, wenn die Rubrik „Familienname“ zur Eintragung weiterer<br />
Namen nicht mehr ausreicht. In diesem Fall ist das Anschlussblatt vorne an das Grundblatt anzu-<br />
heften.<br />
4.8.2 Sammelakten zur Staatsbürgerschaftsevidenz<br />
Die Unterlagen, auf Grund derer das Evidenzblatt angelegt oder fortgeführt wird, sind nach der<br />
Grundnummer abzulegen, bei Staatsbürgerschaftsverbänden für jede der dem Verband ange-<br />
hörenden Gemeinden separat.<br />
Tritt ein Wechsel in der Evidenzstelle ein, z.B. weil eine Gemeinde einem Gemeindeverband<br />
angeschlossen wird oder aus einem solchen ausscheidet, sind die hievon betroffenen Karteiblätter<br />
samt den dazugehörigen Unterlagen der nunmehr nach § 49 (2) StbG zuständigen Evidenzstelle<br />
zu übergeben (§ 13 StbV).<br />
4.8.3 Kostenersatz für die Staatsbürgerschaftsevidenz<br />
Das Land hat den Gemeinden (Staatsbürgerschaftsverbänden) die Kosten zu ersetzen, die<br />
ihnen aus der Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz erwachsen (§ 48 (1) StbG).<br />
Der Kostenersatz erfolgt jährlich in Pauschbeträgen, deren Höhe von der Landesregierung für<br />
jedes begonnene Hundert mit Verordnung festzusetzen ist. Maßgebend für die Höhe des Kosten-<br />
ersatzes ist die Anzahl der in der Evidenz am Ende des Rechnungsjahres erfassten Personen<br />
(§ 48 (2) StbG).<br />
Die Gemeinden (Staatsbürgerschaftsverbände) haben den Anspruch auf Kostenersatz binnen<br />
drei Monaten nach Ende des Rechnungsjahres bei sonstigem Verlust bei der Landesregierung<br />
geltend zu machen.<br />
Über Streitigkeiten, die sich auf Ersatzansprüche der Gemeinden beziehen, sowie über Beru-<br />
fungen gegen Entscheidungen des Verbandsausschusses über die Aufteilung der sonstigen Kos-<br />
ten auf die verbandsangehörigen Gemeinden, entscheidet die Landesregierung.<br />
Seite - 129 -
4.8.4 Mitteilungspflichten<br />
4.8.4.1 Mitteilungspflichten an die Staatsbürgerschaftsevidenzstelle<br />
Zwecks Aufnahme eines Staatsbürgers in die Evidenz und zur Fortführung des Evidenzblattes<br />
ist der Evidenzstelle gemäß § 53 StbG unverzüglich mitzuteilen:<br />
1. vom Amt der Landesregierung:<br />
1. jeder von der Landesregierung in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft erlassene<br />
Bescheid;<br />
2. vom Gericht:<br />
1. die Genehmigung nach § 27 Abs. 2 und § 29 Abs. 2 StbG;<br />
2. die Nichtigerklärung der Ehe, wenn bloß einer der Ehegatten am Tag der Eheschließung<br />
Staatsbürger war oder wenn am Tag der Nichtigerklärung mindestens einer der<br />
Ehegatten Staatsbürger ist oder bis dahin als solcher gegolten hat;<br />
3. die Feststellung der Ehelichkeit oder Unehelichkeit eines Kindes, wenn im Zeitpunkt<br />
seiner Geburt zumindest ein Elternteil Staatsbürger war, und<br />
4. der Beschluss, womit ein Staatsbürger für tot erklärt oder der Beweis seines Todes als<br />
hergestellt erkannt wird;<br />
3. vom Bundesministerium für Justiz:<br />
1. die Legitimation eines minderjährigen ledigen Fremden durch Entschließung des Bundespräsidenten;<br />
ist das legitimierte Kind weiblichen Geschlechts, so sind gegebenenfalls<br />
auch dessen uneheliche Kinder bekanntzugeben, und<br />
2. die Anerkennung eines ausländischen Urteils, das eine Ehe für nichtig erklärt, wenn<br />
die Voraussetzungen der Z 2 lit. b vorliegen;<br />
4. von der österreichischen Vertretungsbehörde im Ausland:<br />
1. jede von ihr in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft ausgestellte Bestätigung;<br />
5. von der Gemeinde (Gemeindeverband):<br />
1. die in ihrem Bereich beurkundete Geburt eines Staatsbürgers;<br />
2. jede von ihr in Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft ausgestellte Bestätigung;<br />
3. die Legitimation eines minderjährigen ledigen Fremden durch die beurkundete Eheschließung<br />
seiner Eltern, wenn der Vater des Kindes Staatsbürger ist; ist das legitimierte<br />
Kind weiblichen Geschlechts, so sind gegebenenfalls auch dessen uneheliche<br />
Kinder bekanntzugeben;<br />
4. die in ihrem Bereich beurkundete Änderung oder Berichtigung des Familiennamens<br />
oder Vornamens eines Staatsbürgers, sofern die Änderung oder Berichtigung nicht<br />
durch die Entscheidung einer inländischen Behörde bewirkt wurde, und<br />
5. das in ihrem Bereich beurkundete Ableben eines Staatsbürgers;<br />
6. von den im § 25 genannten Lehranstalten<br />
1. der Dienstantritt eines Fremden als Ordentlicher Universitätsprofessor oder als Ordentlicher<br />
Hochschulprofessor.<br />
Seite - 130 -
4.8.4.2 Mitteilungspflichten der Evidenzstelle<br />
Die Evidenzstelle hat der Personenstandsbehörde, die das Geburtenbuch des Kindes führt, je-<br />
de ihr bekannt werdende Änderung der Staatsangehörigkeit des Kindes mitzuteilen.<br />
(§ 20 (1) Z 4 PStV).<br />
Die Evidenzstelle hat ferner der Personenstandsbehörde, die das Ehebuch führt, jede ihr be-<br />
kannt werdende Änderung der Staatsangehörigkeit der Ehegatten mitzuteilen, wenn deren Geburt<br />
nicht in einem inländischen Geburtenbuch beurkundet ist.<br />
Die Evidenzstellen haben auch Änderungen (Erwerb, Verlust) hinsichtlich der Staatsbürger-<br />
schaft von Menschen, die in Österreich nach dem Meldegesetz angemeldet sind, dem Bundesmi-<br />
nister für Inneres im Wege eines Änderungszugriffes auf das ZMR (Zentrales Melderegister)<br />
zu übermitteln (§ 11 Abs. 1 Meldegesetz) 240 .<br />
4.8.4.3 Sonstige Mitteilungspflichten<br />
Jede Entscheidung, die den Familiennamen oder Vornamen einer Person beeinflusst, ist von<br />
der entscheidenden Behörde unverzüglich der Evidenzstelle mitzuteilen, wenn diese Entschei-<br />
dung eine Person betrifft, welche die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder besessen<br />
hat, und die Entscheidung nicht schon nach § 53 StbG mitzuteilen ist.<br />
Erhält das Amt der Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehörde, die österreichische Ver-<br />
tretungsbehörde im Ausland, die Gemeinde oder der Gemeindeverband Kenntnis von Umständen,<br />
die in der Staatsbürgerschaftsevidenz anzumerken und nicht schon nach den §§ 53 oder 54 StbG<br />
mitzuteilen sind, so sind sie der Evidenzstelle mitzuteilen, wenn anzunehmen ist, dass sie ihr noch<br />
nicht bekannt sind.<br />
4.8.5 Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben<br />
Für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstigen im Privatinteresse liegenden Amts-<br />
handlungen werden nach den bestehenden Vorschriften Verwaltungsabgaben und Bundesabga-<br />
ben eingehoben.<br />
Die Art der Entrichtung der Bundesabgaben ist einheitlich durch das Gebührengesetz gere-<br />
gelt. In der Regel ist ein Vermerk auf die der Partei auszuhändigende Bescheidausfertigung,<br />
Urkunde etc. zu anzubringen.<br />
Die Art der Entrichtung der Verwaltungsabgaben, gleich ob es sich um Bundes-, Landes- oder<br />
Gemeindeverwaltungsabgaben handelt, ist für die Staatsbürgerschaftsbehörden durch Verord-<br />
240 Siehe BGBl. I 10/2004, Artikel 5 (Änderung des Meldegesetzes 1991)<br />
Seite - 131 -
nung der Landesregierung geregelt. In der Regel sind die Verwaltungsabgaben zu Kontrollzwe-<br />
cken auf Bescheidkopien, Akten, Journale, die im Amt verbleiben, zu vermerken.<br />
Kann jemand die Bundesabgabe nicht entrichten, ist ein „Befund“ aufzunehmen und auf dem<br />
Dokument der Vermerk „Befund aufgenommen“ anzubringen, dem der Dienststempel der Behörde<br />
sowie Datum und Unterschrift beizusetzen sind.<br />
Verwaltungsabgaben sind nur einzuheben, wenn der notdürftige Lebensunterhalt der Beteilig-<br />
ten oder der Personen, für die sie zu sorgen haben, nicht gefährdet wird. Die Amtshandlung ist<br />
aber in jedem Fall unabhängig von der Gebührenfrage vorzunehmen.<br />
Zu beachten ist, dass der Bundesgesetzgeber nicht von der Entrichtung von Landes- oder<br />
Gemeindeverwaltungsabgaben befreien kann, der Landesgesetzgeber nicht von der Entrichtung<br />
von Bundesverwaltungsabgaben. Wird z.B. für Sozialversicherungszwecke ein Staatsbürger-<br />
schaftsnachweis ausgestellt, der nach § 110 ASVG Bundesgebührenfrei ist, ist trotzdem die Lan-<br />
desverwaltungsabgabe zu entrichten, da die Landesverwaltungs-Abgabenverordnungen keine<br />
Befreiungsbestimmung enthalten.<br />
Seite - 132 -
SONSTIGE BESTIMMUNGEN<br />
5.1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz - AVG<br />
Für das Verfahren vor den Personenstandsbehörden und den Staatsbürgerschaftsbehörden<br />
gelten, soweit in den von diesen Behörden anzuwendenden Rechtsvorschriften nicht besondere<br />
Verwaltungsvorschriften enthalten sind (u.a. PStG, StbG), die Bestimmungen des „Allgemeinen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991“, Kurzform „AVG“ in der geltenden Fassung.<br />
Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz zeichnet den Weg vom Antrag (auch Anzeige)<br />
eines Bürgers bis zur Entscheidung genau vor und zeigt auch auf, wie sich ein Antragsteller gegen<br />
die Entscheidung in Form eines Rechtsmittels wehren kann.<br />
5.1.1 Zuständigkeit<br />
Die Behörde ist dann sachlich zuständig, wenn sie nach dem Behördentyp (Bezirksverwal-<br />
tungsbehörde, Landesregierung usw.) entsprechend den relevanten Rechtsvorschriften (z.B.<br />
Personenstandsgesetz) eine bestimmte Rechtsvorschrift zu vollziehen hat.<br />
Andererseits muss beachtet werden, dass wegen einer örtlichen Beziehung in einer Verwal-<br />
tungssache (z.B. Ort der Geburt oder des Todes, Wohnsitz oder Aufenthalt der Verlobten) diese<br />
sachlich zuständige Behörde auch innerhalb ihres Wirkungskreises örtlich zuständig ist.<br />
Die Frage der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden ist bindend ge-<br />
regelt, die Verfahrensparteien können sich selbst nicht aussuchen, welche Behörde ihr Anliegen<br />
erledigt. Die Zuständigkeit ist dabei in jeder Phase des Verwaltungsverfahrens von den Behörden<br />
von Amts wegen wahrzunehmen.<br />
Langen bei der Behörde Anbringen ein, für deren Behandlung sie nicht zuständig ist, so ist der<br />
Einschreiter direkt an die richtige Behörde zu verweisen oder das Anbringen an die zuständige<br />
Behörde weiterzuleiten.<br />
tung:<br />
Für den <strong>Standesbeamten</strong> sind die in Folge angeführten Zuständigkeitsvorschriften von Bedeu-<br />
1. Personenstandsangelegenheiten<br />
§ 2 PStG (allgemeiner Örtlichkeitsgrundsatz – jeder im Inland eingetretene<br />
Personenstandsfall ist in die Personenstandsbücher einzutragen)<br />
§ 4 PStG (örtliche Zuständigkeit richtet sich grundsätzlich nach dem Ort der<br />
Geburt, der Eheschließung oder des Todes).<br />
§ 18 PStG Anzeige der Geburt<br />
§ 27 PStG Anzeige des Todes und der Totgeburt<br />
Seite - 133 -
§ 46 PStG (Ermittlung der Ehefähigkeit obliegt jener Personenstandsbehörde,<br />
in deren Amtsbereich einer der Verlobten seinen Wohnsitz oder<br />
Aufenthalt hat)<br />
§ 47 PStG Trauung<br />
§ 53 PStG Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen<br />
§ 55 PStG Ausstellung von Bestätigungen<br />
2. Staatsbürgerschaftsangelegenheiten:<br />
§ 30 StbG Bestätigung über Ausscheiden aus dem Staatsverband<br />
§ 39 StbG Landesregierung ist zur Erlassung von Bescheiden in<br />
Staatsbürgerschaftsangelegenheiten zuständig; örtlich zuständig ist<br />
dabei jene Landesregierung, in deren Bereich die Person, auf die<br />
sich der Bescheid bezieht, ihren Hauptwohnsitz hat, sonst in deren<br />
Bereich die Evidenzstelle liegt.<br />
§ 45 StbG Einziehung unrichtiger Staatsbürgerschaftsdokumente<br />
§ 49 StbG Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz<br />
§ 63 StbG Einziehung ausländischer Staatsbürgerschaftsdokumente<br />
5.1.2 Befangenheit von Verwaltungsorganen<br />
Nach § 7 AVG hat sich das Verwaltungsorgan (z.B. der Standesbeamte oder der Staatsbür-<br />
gerschaftsreferent) der Ausübung seines Amtes zu enthalten:<br />
� in Sachen, an denen es selbst oder der Ehegatte, ein Verwandter oder Verschwägerter<br />
(in gerader Linie unbeschränkt, in der Seitenlinie bis zu den Geschwisterkindern) betei-<br />
ligt ist;<br />
� in Sachen der Wahl- oder Pflegeeltern, der Wahl- oder Pflegekinder und der Mündel<br />
oder Pflegebefohlenen;<br />
� in Sachen, in denen das Verwaltungsorgan Bevollmächtigter einer Partei war oder noch<br />
ist;<br />
� im Berufungsverfahren, wenn das Verwaltungsorgan an der Erlassung des angefochte-<br />
nen Bescheides in unterer Instanz mitgewirkt hat.<br />
Außerdem hat sich der Beamte seiner Amtstätigkeit zu enthalten, wenn seine Unbefangenheit<br />
aus anderen wichtigen Gründen in Zweifel gezogen werden kann. Wird das Organ trotzdem tätig,<br />
sind die gesetzten Verwaltungsakte nicht nichtig; die Befangenheit kann für das Organ disziplinäre<br />
oder strafrechtliche (Amtsmissbrauch) Folgen haben und außerdem von der Partei als Mangelhaf-<br />
tigkeit des Verfahrens mit Rechtsmittel geltend gemacht werden. Parteien sind jedoch nicht be-<br />
rechtigt ein Organ wegen Befangenheit abzulehnen.<br />
Doch hat bei Gefahr im Verzuge auch das befangene Organ die unaufschiebbare Amtshand-<br />
lung vorzunehmen, wenn seine Vertretung nicht zeitgerecht bewirkt werden kann.<br />
Seite - 134 -
5.1.3 Beteiligte, Parteien, Bevollmächtigte<br />
Von den Beteiligten, das sind Personen, die die Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen<br />
oder auf die sich die Tätigkeit der Behörde bezieht, sind die Parteien, die an der Sache auf Grund<br />
eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind (§ 8 AVG) zu unterschei-<br />
den. Die Unterscheidung zwischen „Partei“ und „Beteiligtem“ ist wichtig, da nur der „Partei“ die<br />
typischen Parteienrechte zukommen. Diese sind:<br />
� Akteneinsicht (Parteien haben das Recht auf Einsicht und Abschriftnahme von Akten;<br />
von der Akteneinsicht sind Aktenbestandteile ausgenommen, wenn die Einsichtnahme<br />
eine Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen, oder eine<br />
Gefährdung der Aufgaben der Behörden herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens<br />
beeinträchtigen würde; eine etwaige Versagung der Akteneinsicht wäre im Rechtsmit-<br />
telweg als Verfahrensmangel zu rügen.)<br />
� Parteiengehör (Wenn die Behörde ein Ermittlungsverfahren durchgeführt hat, ist sie<br />
verpflichtet vor Erlassung des Bescheides das Ergebnis dieses Verfahrens den Partei-<br />
en zwecks Geltendmachung ihrer Rechte zur Kenntnis zu bringen. Gegenstand des<br />
Parteiengehörs ist der festzustellende maßgebende Sachverhalt.)<br />
� Recht auf Amtsdolmetscher<br />
� Ablehnung von nichtamtlichen Sachverständigen<br />
� Verkündigung oder Zustellung des Bescheides<br />
� Erhebung ordentlicher Rechtsmittel und außerordentlicher Rechtsmittel (Wiederauf-<br />
nahme des Verfahrens, Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, Beschwerde an<br />
Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof)<br />
� Geltendmachung des Anspruchs auf Erlassung eines Bescheides (Devolutionsantrag)<br />
Die gewillkürte Vertretung der Beteiligten und der Parteien durch einen Bevollmächtigten (ei-<br />
genberechtigte natürliche Personen oder juristische Personen) ist möglich, wenn die Verwaltungs-<br />
vorschriften nicht anderes bestimmen (§ 10 AVG). Die Behörde kann von einer ausdrücklichen<br />
Vollmacht absehen, wenn es sich um amtsbekannte Familienmitglieder etc. handelt und Zweifel<br />
über Bestand und Umfang der Vertretungsbefugnis nicht bestehen. Bei Rechtsanwälten oder<br />
Notaren ersetzt die Berufung auf die ihnen erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis.<br />
Bei der mündlichen Verhandlung zur Ermittlung der Ehefähigkeit haben die Verlobten persön-<br />
lich anwesend zu sein (§ 44 PStG). Kann einem Verlobten das Erscheinen nicht zugemutet wer-<br />
den (z.B. wegen längerer beruflicher Tätigkeit im Ausland), ist die Verhandlung ohne ihn durchzu-<br />
Seite - 135 -
führen. Dies sollte jedoch nur in wirklich begründeten Fällen geschehen. Trifft dies auf beide Ver-<br />
lobte zu, entfällt die mündliche Verhandlung. In diesem Fall haben beide Verlobte die erforderli-<br />
chen Erklärungen schriftlich abzugeben.<br />
Die Vertretung eines Verlobten bei der Eheschließung durch einen Bevollmächtigten (soge-<br />
nannte Handschuhehe) ist in Österreich nicht möglich.<br />
Die Einbringung eines Antrages auf Ausstellung eines Staatsbürgerschaftsnachweises ist da-<br />
gegen mit Vollmacht zulässig.<br />
Als gesetzliche Vertreter kommen u.a. jeder Elternteil für seine mj. ehelichen Kinder und der<br />
Sachwalter für psychisch kranke oder geistig behinderte Personen in Betracht.<br />
5.1.4 Verkehr zwischen Behörden und Beteiligten<br />
Anträge, Ansuchen, Anzeigen und sonstige Mitteilungen können schriftlich, mündlich oder tele-<br />
fonisch eingebracht werden, es sei denn, in den Verwaltungsvorschriften ist darüber etwas ande-<br />
res bestimmt. Schriftliche Anbringen können nach Maßgabe der technischen Mittel auch auf jede<br />
technisch mögliche Weise (Telefax, EDV) eingebracht werden.<br />
Weist eine Eingabe Mängel (fehlende Dokumente oder Nachweise u.a.) auf, hat die Behörde<br />
die Behebung der Mängel binnen angemessener Frist aufzutragen, wenn nicht von Amts wegen<br />
eine Mängelbehebung auf andere Art bewirkt werden kann. Nach ungenutztem Ablauf der Frist<br />
wäre das Anbringen mit Bescheid zurückzuweisen. Wenn hingegen der Mangel rechtzeitig beho-<br />
ben wird, gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht.<br />
Rechtsmittel und Eingaben, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist<br />
bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen.<br />
Im standesamtlichen Verfahren ist meist die mündliche und schriftliche Form zugelassen. So<br />
kann die Anzeige einer Geburt und des Todes sowohl mündlich als auch schriftlich erstattet wer-<br />
den, es muss zur schriftlichen Anzeige allerdings der vorgeschriebene Vordruck verwendet wer-<br />
den. Die Ausstellung von Personenstandsurkunden kann mündlich (telefonisch) oder schriftlich<br />
beantragt werden. Über mündliche Anbringen ist erforderlichenfalls eine Niederschrift aufzuneh-<br />
men. Bei mündlicher Beantragung einer Personenstandsurkunde (Abschrift) ist eine Niederschrift<br />
jedenfalls entbehrlich.<br />
Über alle Verhandlungen ist eine Verhandlungsschrift, die Ort, Zeit, Gegenstand und Verlauf<br />
der Verhandlung, die Benennung der Behörde, die Namen des Leiters der Amtshandlung und<br />
sonst mitwirkenden Amtsorgane, der Parteien, Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen zu<br />
enthalten hat, anzufertigen. Die Niederschrift ist den Beteiligten vorzulesen, wenn sie nicht darauf<br />
Seite - 136 -
verzichten. Die Niederschrift ist von den Beteiligten und den Amtsorganen auch zu unterfertigen.<br />
Die Niederschrift hat volle Beweiskraft als öffentliche Urkunde (§ 15 AVG). Der Gegenbeweis ist<br />
zulässig.<br />
Im Gegensatz dazu dient der Aktenvermerk der Festhaltung von Wahrnehmungen usw. telefo-<br />
nischer oder mündlicher Art, für die keine Niederschrift notwendig ist. Er ist vom Amtsorgan durch<br />
Beisetzung von Datum und Unterschrift zu bestätigen.<br />
Gesetzliche Fristen (z.B. die Berufungsfrist) können von der Behörde nicht abgeändert werden.<br />
Bei Fristen, die von der Behörde selbst festgesetzt werden, kann die Behörde auch eine Verlänge-<br />
rung vornehmen (z.B. Frist zur Behebung von Mängeln einer Eingabe).<br />
Bei Fristen, die nach Tagen berechnet werden, wird der Tag des fristauslösenden Ereignisses<br />
(z.B. Bescheidzustellung) nicht mitgezählt.<br />
Bei Wochen-, Monats- und Jahresfristen endet die Frist mit Ablauf jenes Tages, der in der Be-<br />
nennung oder der Zahl dem Tag des Fristbeginns entspricht.<br />
Beginn und Lauf von Fristen werden durch Sonn- und Feiertage nicht gehindert. Fällt das Ende<br />
einer Frist auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag (Festlegung durch Feiertagsruhe-<br />
gesetz – 1. und 6. Jänner, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleich-<br />
nam, 15. August, 26. Oktober, 1. November, 8./25./26. Dezember) oder den Karfreitag, ist der<br />
darauf folgende Werktag als Ende der Frist anzusehen.<br />
Die Zeit des Postenlaufes wird in die Frist nicht eingerechnet.<br />
5.1.5 Bescheide, Entscheidungspflicht<br />
Vor Erlassung eines Bescheides ist ein Ermittlungsverfahren durchzuführen, in welchem der<br />
für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt festgestellt und den Parteien Gelegenheit zur<br />
Geltendmachung ihrer Rechte gegeben wird.<br />
Als Beweismittel stehen u.a. die Einvernahmen von Sachverständigen und Zeugen, die Vorla-<br />
ge von Urkunden und die Durchführung von Ortsaugenscheinen zur Verfügung.<br />
Es ist Aufgabe des die Amtshandlung leitenden Organs dafür zu sorgen, dass die Amtshand-<br />
lung in Ruhe und Ordnung abgewickelt werden kann und nicht gestört wird. Wer dagegen ver-<br />
stößt, ist zunächst vom Verhandlungsleiter zu ermahnen. Bleibt die Ermahnung wirkungslos,<br />
können verschiedene Zwangsmaßnahmen (Wortentzug nach vorheriger Androhung, Entfernung<br />
des Betroffenen und Auftrag zur Bestellung eines Bevollmächtigten oder Verhängung einer Ord-<br />
nungsstrafe) angeordnet werden.<br />
Seite - 137 -
Auch gegen Personen, die sich in schriftlichen Eingaben einer beleidigenden Schreibweise be-<br />
dienen, kann eine Ordnungsstrafe verhängt werden. Gegen öffentliche Organe und gegen be-<br />
rufsmäßige Parteienvertreter, die einem Disziplinarrecht unterstehen, wird die Verhängung einer<br />
Ordnungsstrafe durch die Anzeige an die Disziplinarbehörde ersetzt. Bei offenbar mutwilliger<br />
Inanspruchnahme der Tätigkeit einer Behörde sowie dem Vorbringen unrichtiger Angaben, in<br />
Absicht die Angelegenheit zu verschleppen, kann von der Behörde eine Mutwillensstrafe ver-<br />
hängt werden.<br />
Der Bescheid stellt den Verwaltungsakt dar, mit welchem die Behörde das Verfahren in einer<br />
bestimmten Verwaltungsangelegenheit zum Abschluss bringt.<br />
Jeder Bescheid ist ausdrücklich als solcher zu bezeichnen und hat den Spruch und die<br />
Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. Bescheide sind zu begründen, wenn dem Standpunkt der<br />
Partei nicht vollinhaltlich Rechnung getragen wird. Bescheide können mündlich oder schriftlich<br />
erlassen werden, wenn nicht die Verwaltungsvorschriften bindend die eine oder andere Form<br />
vorschreiben.<br />
Die Rechtswirkung eines Bescheides tritt erst mit dessen tatsächlicher Erlassung ein.<br />
Als erlassen gilt ein schriftlicher Bescheid im Zeitpunkt der rechtswirksamen Zustellung der<br />
Ausfertigung. Mündlich verkündete Bescheide gelten mit der Verkündung (muss beurkundet wer-<br />
den) als erlassen.<br />
Ausnahmsweise braucht der Bescheiderlassung kein Ermittlungsverfahren vorausgehen:<br />
� wenn es sich um eine Ladung handelt<br />
� wenn der für die Entscheidung maßgebende Sachverhalt von vornherein klar gegeben<br />
ist und bei Bescheiden im Mandatsverfahren (Vorschreibung von Geldleistungen nach<br />
einem feststehenden Maßstab oder bei Maßnahmen, die wegen Gefahr in Verzug un-<br />
aufschiebbar sind)<br />
Weitere wesentliche Bestandteile eines Bescheides sind die Unterfertigung durch den Geneh-<br />
migenden unter leserlicher Beifügung seines Namens 241 , die Bezeichnung der Behörde und der<br />
Adressat.<br />
Mit einem Berichtigungsbescheid können Schreib- und Rechenfehler oder offenbar auf einem<br />
Versehen oder auf einem technisch mangelhaften Betrieb einer EDV-Anlage beruhende Unrichtig-<br />
keiten in Bescheiden von Amts wegen korrigiert werden.<br />
241 Mangelt es einem Bescheid an diesem Merkmal, so ist dieser absolut nichtig (VwGH vom 16.2.1994, OÖ Gemeindezeitung<br />
1995/220). Auch das Hinzufügen einer Funktionsangabe ist kein Ersatz für die unleserliche Unterschrift bei<br />
Bescheiderlassung (VwGH vom 28.6.1995, OÖ Gemeindezeitung 1995/309).<br />
Seite - 138 -
Im standesamtlichen Verfahren werden u.a. folgende Angelegenheiten mit Bescheid zu erle-<br />
digen sein:<br />
� Ablehnung einer Eheschließung bzw. der Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses;<br />
� Berichtigung einer Personenstandseintragung nach § 15(3) PStG;<br />
� Ablehnung der Eintragung eines Vornamens bei der Geburt eines Kindes;<br />
� Ablehnung eines Antrages auf Einsichtnahme bzw. Ausstellung einer Urkunde aus ei-<br />
nem Personenstandsbuch<br />
In Vollziehung des Staatsbürgerschaftsgesetzes durch die Gemeinden kommen u.a. folgen-<br />
de bescheidmäßige Erledigungen in Betracht:<br />
� Ablehnung eines Antrages auf Ausstellung eines Staatsbürgerschaftsnachweises;<br />
� Ablehnung eines Antrages auf Ausstellung einer sonstigen staatsbürgerschaftsrechtli-<br />
chen Bestätigung.<br />
Die Behörden sind verpflichtet, über Parteianträge 242 ohne unnötigen Aufschub, spätestens<br />
aber sechs Monate nach deren Einlangen, zu entscheiden 243 . Erhält die Partei innerhalb dieses<br />
Zeitraumes keine Erledigung, geht auf ihr schriftliches Verlangen (Devolutionsantrag) die Zustän-<br />
digkeit zur Entscheidung an die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde über, wenn die<br />
Verzögerung ausschließlich auf ein Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. Ein solcher<br />
Antrag ist unmittelbar bei dieser Behörde einzubringen (§ 73 AVG).<br />
5.1.6 Rechtsmittel<br />
Das ordentliche Rechtsmittel gegen einen Bescheid ist die Berufung, die von der Partei binnen<br />
zwei Wochen schriftlich bei der Behörde einzubringen ist, die den Bescheid in I. Instanz erlassen<br />
hat. Rechtsmittelverzicht nach Zustellung oder Verkündung des Bescheides ist möglich244. Die<br />
rechtzeitig eingebrachte Berufung hat aufschiebende Wirkung.<br />
Der Hauptzweck eines Rechtsmittels ist die Entscheidung einer Behörde der Überprüfung<br />
durch die im Instanzenzug gegebenenfalls noch vorgesehene übergeordnete Behörde offen zu<br />
halten, also die Rechtskraftwirkung bis zur oberinstanzlichen Entscheidung aufzuschieben. Wenn<br />
242<br />
Parteianträge können in jeder Lage des Verfahrens (auch noch im Berufungsverfahren) zurückgezogen werden<br />
(VwGH vom 28.1.1994, OÖ Gemeindezeitung 1995/219).<br />
243<br />
Eine Entscheidungspflicht besteht immer nur gegenüber dem Antragsteller (VwGH vom 16.11.1993, OÖ Gemeindezeitung<br />
1996/26).<br />
244<br />
Ein einmal ausgesprochener Berufungsverzicht kann nicht mehr zurückgenommen werden (VwGH vom 10.3.1994,<br />
Steirische Gemeindenachrichten 5/96, S. 12)<br />
Seite - 139 -
eispielsweise die vorzeitige Vollstreckung im Interesse einer Partei dringend geboten ist, kann<br />
die Behörde die aufschiebende Wirkung einer Berufung ausschließen.<br />
Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet, und einen begrün-<br />
deten Berufungsantrag zu enthalten. Die bescheiderlassende Behörde kann binnen zwei Monaten<br />
nach Einbringung einer zulässigen Berufung den von ihr erlassenden Bescheid im Sinne des<br />
Berufungsbegehrens abändern, ergänzen oder aufheben (Berufungsvorentscheidung).<br />
Im Verfahren vor den Personenstandsbehörden endet der Instanzenzug in jedem Falle beim<br />
Landeshauptmann, selbst in den Fällen, in denen der Landeshauptmann in I. Instanz entscheidet.<br />
Der Instanzenzug geht von der Personenstandsbehörde unmittelbar an den Landeshauptmann.<br />
Der Bezirksverwaltungsbehörde käme eine Zuständigkeit zum Einschreiten als Berufungsinstanz<br />
in Personenstandsangelegenheiten nämlich nur dann zu, wenn ihr eine solche Zuständigkeit<br />
ausdrücklich eingeräumt worden wäre.<br />
Unter Rechtskraft versteht man die Unanfechtbarkeit eines Bescheides durch weitere ordentli-<br />
che Rechtsmittel. Rechtskraft kommt nur dem Spruch, nicht jedoch der Begründung eines Be-<br />
scheides zu.<br />
Vollstreckbarkeit bedeutet, dass die im Spruch eines Bescheides auferlegte Leistung durch<br />
Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden kann.<br />
5.1.7 Die Zustellung<br />
Die Zustellung von Dokumenten ist im Zustellgesetz geregelt. Dieses Bundesgesetz regelt die<br />
Zustellung der von Gerichten und Verwaltungsbehörden in Vollziehung der Gesetze zu übermit-<br />
telnden Dokumente sowie die durch sie vorzunehmende Zustellung von Dokumenten ausländi-<br />
scher Behörden.<br />
Dokumente werden durch<br />
� die Post oder andere Zustelldienste,<br />
� die Behörde selbst oder<br />
� durch die Gemeinden in deren Gebiet die Abgabestelle liegt,<br />
zugestellt.<br />
Die Zustellorgane handeln bei ihrer Tätigkeit als Organe der Behörde, für die sie zustellen.<br />
Die Zustelladresse kann entweder eine Abgabestelle (bei schriftlichen Zustellungen) oder eine<br />
elektronische Zustelladresse (für Zustellungen auf elektronischem Weg) sein.<br />
Seite - 140 -
darf.<br />
Abgabestelle ist der Ort, an dem die schriftliche Sendung dem Empfänger zugestellt werden<br />
Als Abgabestelle kommen in Frage:<br />
� Wohnung oder sonstige Unterkunft<br />
� Betriebsstätte<br />
� Sitz eines Unternehmers<br />
� Geschäftsraum<br />
� Kanzlei<br />
� Arbeitsplatz<br />
� Ort der Amtshandlung<br />
� vom Empfänger der Behörde in einem laufenden Verfahren bekannt gegebener Ort.<br />
Elektronische Zustellungen erfolgen an jene Zustelladresse, die vom Empfänger der Behörde<br />
gegenüber in einem laufenden Verfahren angegeben worden ist.<br />
Bei der Anordnung der Zustellung eines Dokuments (Zustellverfügung) hat die Behörde wie<br />
folgt zu bestimmen:<br />
� den Empfänger<br />
� die Zustelladresse<br />
� Zustellung mit oder ohne Zustellnachweis<br />
� ob Zustellung zu eigenen Handen erfolgen soll<br />
� Sonstiges (Ausschluss der Aushändigung an gewisse Personen, Zustellung an Anstaltsleiter<br />
oder militärischen Kommandanten)<br />
Wird das gleiche Schriftstück mehrmals gültig zugestellt → erste Zustellung ist maßgebend.<br />
Zustellmängel (z.B. Zustellversuch an eine nicht vorgesehene Zustelladresse) gelten mit der<br />
tatsächlichen Übernahme des Schriftstückes durch den Adressaten als behoben.<br />
Eine Partei, die während eines Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat, ihre bisherige Abgabe-<br />
stelle ändert, hat dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen, andernfalls wird das Schriftstück ohne<br />
vorausgehenden Zustellversuch hinterlegt, falls die Feststellung der neuen Abgabestelle nicht<br />
ohne Schwierigkeiten möglich ist.<br />
Seite - 141 -
Einem von Parteien oder Beteiligten der Behörde gegenüber namhaft gemachten Zustellungs-<br />
bevollmächtigten (natürliche oder juristische Personen mit Hauptwohnsitz im Inland) ist zuzustel-<br />
len. Der Zustellbevollmächtigte ist von der Behörde in der Zustellverfügung als Empfänger zu<br />
bezeichnen.<br />
Einer Person, die sich nicht nur vorübergehend im Ausland aufhält, kann von der Behörde un-<br />
ter Fristsetzung die Namhaftmachung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten aufgetra-<br />
gen werden; sonst erfolgt die Zustellung durch Hinterlegung.<br />
Zustellungen im Ausland sind nach bestehenden internationalen Vereinbarungen oder nach<br />
den jeweiligen Vorschriften des Landes erforderlichenfalls unter Mitwirkung der österreichischen<br />
Vertretungsbehörde zuzustellen. Die Annahme fremdsprachiger Schriftstücke kann durch den<br />
Empfänger binnen drei Tagen nach Zustellung verweigert werden, wenn keine beglaubigte<br />
deutschsprachige Übersetzung angeschlossen ist. Schriftstücke ausländischer Behörden werden<br />
nur bei Gegenseitigkeit zugestellt.<br />
Zustellung an eine Abgabestelle:<br />
Die Sendung wird dem Empfänger an der Abgabestelle zugestellt, außerhalb der Abgabestelle<br />
nur dann, wenn die Annahme der Sendung nicht verweigert wird. Zustellungen an berufsmäßige<br />
Parteienvertreter dürfen an jeden in dessen Kanzlei anwesenden Angestellten erfolgen. Zustellun-<br />
gen in Haftanstalten erfolgen im Wege der Anstaltsleitung.<br />
Zustellung an Präsenzdiener und Personen, die im Rahmen von Auslandseinsätzen zu Einhei-<br />
ten zusammengefasst sind, erfolgen im Wege des jeweiligen Kommandanten der Einheit.<br />
Wenn wichtige Gründe vorliegen, ist eine schriftliche Ausfertigung mit Zustellnachweis zuzu-<br />
stellen. Bei Vorliegen besonders wichtiger Gründe oder wenn es gesetzlich vorgesehen ist, ist die<br />
Zustellung zu eigenen Handen des Empfängers zu bewirken.<br />
Ersatzzustellung:<br />
Erfolgt in Fällen, in denen dem Empfänger nicht zugestellt werden kann und an der Abgabe-<br />
stelle ein Ersatzempfänger anwesend ist.<br />
Ersatzempfänger kann sein: jede erwachsene Person, die an derselben Abgabestelle wie der<br />
Empfänger wohnt oder der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber des Empfängers.<br />
Nur Ersatzempfänger, die mit dem Empfänger im gemeinsamen Haushalt leben, sind zur An-<br />
nahme solcher Sendungen verpflichtet.<br />
Der Empfänger und auch die Behörde können bestimmte Personen von der Ersatzzustellung<br />
ausschließen. Wohnungsnachbarn oder Hausbesorger sind keine Ersatzempfänger.<br />
Seite - 142 -
Ersatzzustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass der Empfänger wegen Abwesen-<br />
heit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte; doch<br />
wird in solchen Fällen die Zustellung mit dem der Rückkehr folgenden Tag wirksam.<br />
Hinterlegung:<br />
Kann die Sendung an der Abgabestelle nicht zugestellt werden und besteht kein Grund zur An-<br />
nahme, dass der Empfänger sich nicht regelmäßig an der Abgabestelle aufhält, so ist das Schrift-<br />
stück beim Postamt zu hinterlegen. Von dieser Hinterlegung ist der Empfänger schriftlich zu ver-<br />
ständigen. Die hinterlegte Sendung ist mindestens zwei Wochen zur Abholung bereitzuhalten; der<br />
Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag an dem die Sendung erstmals zur Abholung bereitgehalten<br />
wird.<br />
Hinterlegte Sendungen gelten mit dem ersten Tag dieser Frist als zugestellt, doch bei Abwe-<br />
senheit von der Abgabestelle erst mit dem der Rückkehr folgenden Tag.<br />
Nachsendung:<br />
Wenn sich der Empfänger nicht regelmäßig an der Abgabestelle aufhält, wird die Sendung an<br />
eine gegebenenfalls bekannte andere Abgabestelle nachgesendet. Sendungen, die nicht zuge-<br />
stellt werden können oder bei Hinterlegung nicht abgeholt werden, sind der Behörde zurückzustel-<br />
len.<br />
Verweigerung der Annahme:<br />
Wenn die Annahme grundlos verweigert wird, ist die Sendung an der Abgabestelle zurückzu-<br />
lassen (gilt damit als zugestellt) oder ohne schriftliche Verständigung zu hinterlegen.<br />
Zustellung zu eigenen Handen:<br />
Bei dieser gewählten Zustellart ist eine Zustellung an einen Ersatzempfänger ausgeschlossen.<br />
Wenn die Sendung beim ersten Zustellversuch nicht zugestellt werden kann, wird der Empfänger<br />
schriftlich unter Hinweis auf die sonstige Hinterlegung ersucht, zu einer bestimmten Zeit an der<br />
Abgabestelle zur Annahme des Schriftstücks anwesend zu sein.<br />
Die Verständigung wird an der Abgabestelle zurückgelassen, bei Erfolglosigkeit des zweiten Zu-<br />
stellversuchs wäre die Sendung zu hinterlegen.<br />
Zustellnachweis:<br />
Die Zustellung ist auf dem Zustellnachweis zu beurkunden und sodann an die Behörde zurück-<br />
zusenden. Der Übernehmer hat unter Beifügung des Datums zu unterfertigen.<br />
Unmittelbare Ausfolgung bei der Behörde:<br />
Seite - 143 -
Ein bereits versandbereites Schriftstück oder eine von der erlassenen Behörde einer anderen<br />
Dienststelle, unter Einsatz automationsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen<br />
technisch möglichen Weise mitgeteilte Erledigung, kann dem Empfänger unmittelbar bei der<br />
Dienststelle gegen eine Übernahmebestätigung ausgefolgt werden. Die erfolgte Ausfolgung ist zu<br />
beurkunden.<br />
Zustellung ohne Zustellnachweis:<br />
Das zuzustellende Schriftstück gilt als zugestellt, wenn es sich in den für die Abgabestelle be-<br />
stimmten Briefkasten eingelangt oder an der Abgabestelle zurückgelassen wurde, solche Zustel-<br />
lungen gelten als mit dem dritten Werktag nach der Übergabe an den Zusteller bewirkt.<br />
5.2 Gebührenrecht<br />
5.2.1 Allgemeines<br />
An Kosten können im Verwaltungsverfahren Barauslagen und Verwaltungsabgaben anfallen.<br />
Die Verwaltungsabgaben dürfen nicht mit den Gebühren nach dem Gebührengesetz, die von den<br />
Verwaltungsbehörden namens den Finanzbehörden eingehoben werden, verwechselt werden.<br />
Als Barauslagen gelten beispielsweise die Gebühren, die Sachverständigen und Dolmetschern<br />
zustehen.<br />
Für die Verleihung von Berechtigungen oder für sonstige wesentlich im Privatinteresse einer<br />
Partei liegenden Amtshandlung können durch Verordnung besondere Verwaltungsabgaben aufer-<br />
legt werden. Die Verwaltungsabgaben sind dabei von der Behörde erster Instanz einzuheben und<br />
fließen jener Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand dieser Behörde zu tragen hat.<br />
Die Art der Entrichtung der Bundesgebühren ist einheitlich durch das Gebührengesetz gere-<br />
gelt. Die festen Gebühren sind durch Barzahlung, durch Einzahlung mit Erlagschein, mittels Euro-<br />
chequekarte mit Bankomatfunktion oder Kreditkarte zu entrichten. Jede Behörde hat diese Ent-<br />
scheidung für sich zu treffen und im Amtsgebäude entsprechend bekanntzumachen.<br />
Die Entrichtung der Gebühr ist im Verwaltungsakt in nachprüfbarer Weise festzuhalten.<br />
Die Gebührenschuld entsteht<br />
� bei Eingaben und Beilagen im Zeitpunkt in dem das Verfahren in einer Instanz durch<br />
die Zustellung einer schriftlichen Erledigung abgeschlossen wird,<br />
� bei amtlichen Ausfertigungen mit deren Hinausgabe (Aushändigung, Übersendung),<br />
Seite - 144 -
� bei Protokollen im Zeitpunkt der Unterzeichung,<br />
� bei Amtshandlungen mit deren Beginn<br />
� bei Protokollen im Zeitpunkt der Unterzeichnung,<br />
� bei Zeugnissen im Zeitpunkt der Unterzeichnung; bei im Ausland ausgestellten Zeug-<br />
nissen sobald davon im Inland amtlicher Gebrauch gemacht wird sowie bei Unter-<br />
schriftsbeglaubigungen im Zeitpunkt der Unterzeichnung durch die Urkundsperson.<br />
Als Gebührentarife gibt es beispielsweise Abschriften, amtliche Ausfertigungen, Auszüge und<br />
Beilagen und Eingaben sowie Protokolle und Zeugnisse<br />
Anfragen über das „Bestehen von Rechtsvorschriften oder deren Anwendung“ (Rechtsaus-<br />
künfte) sind von der Eingabegebühr befreit. Unter Rechtsauskünften sind solche Anfragen zu<br />
verstehen, in den Rechtssuchende den Weg zur richtigen Rechtsanwendung finden sollen. Nicht<br />
von der Befreiung umfasst sind Ansuchen um „Tatsachenauskünfte“.<br />
Entrichtet jemand trotz Aufforderung die vorgeschriebene Bundesgebühr nicht, ist eine Be-<br />
fundaufnahme an das zuständige Finanzamt zu erstatten. Ungeachtet dessen ist aber das Verfah-<br />
ren einzuleiten oder fortzuführen.<br />
Die Höhe der Entrichtung der Verwaltungsabgaben ist für die Personenstandsbehörden in der<br />
Bundesverwaltungsabgabenverordnung geregelt.<br />
Verwaltungsabgaben sind nur dann einzuheben, wenn der notdürftige Lebensunterhalt der Be-<br />
teiligten nicht gefährdet wird. z.B. wird von der Einhebung von Verwaltungsabgaben abzusehen<br />
sein, wenn für Sozialhilfeempfänger oder mittellose Kinder in Kinderdörfern Urkunden ausgestellt<br />
werden. Von der Entrichtung der Bundesgebühren kann allerdings nur das Finanzamt befreien.<br />
Auslagen der Personenstandsbehörde<br />
Ein Ersatz der Barauslagen kann von der Personenstandsbehörde nur begehrt werden, wenn<br />
die Aufwendungen über den sonstigen und allgemeinen Aufwand der Behörde hinausgehen. Für<br />
Portospesen kann kein Barauslagenersatz gefordert werden (ÖStA 1973,81). Von den Behörden<br />
verwendete Drucksorten gehören nicht zu den Barauslagen im Sinn des § 76 AVG. Das gilt auch<br />
für die vom Anzeigenden zu verwendenden Drucksorten, da es sich bei der Geburts- und Todes-<br />
anzeige nicht um eine Amtshandlung handelt, um die eine Partei angesucht hat.<br />
Kosten für Übersetzungen nach dem Volksgruppengesetz sind von Amts wegen zu tragen.<br />
Seite - 145 -
5.2.2 Gebührenbefreiungsbestimmungen<br />
� Verwaltungsabgaben und Gebühren (im Sinne des Gebührengesetzes) sind in Perso-<br />
nenstandsangelegenheiten nicht zu entrichten (sachliche Befreiungsbestimmungen):<br />
� für Urkunden und vor allem für Bestätigungen (gemäß § 33 PStV), die zur Geltendma-<br />
chung von Leistungsansprüchen bei Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung be-<br />
nötigt werden (§ 110 ASVG; § 44 BSVG; § 46 GSVG);<br />
� für die Erteilung von Personenstandsurkunden an bedürftige Personen (Art 1 IZK-<br />
Übereinkommen über die kostenlose Erteilung von Personenstandsurkunden, BGBl.<br />
1965/276);<br />
� für auf amtlichen Weg beschaffte Ehefähigkeitszeugnisse (Deutschland siehe BGBl.<br />
1982/127 und Schweiz siehe BGBl. 1962/320);<br />
� für die Erteilung von Übersetzungen von Personenstandsurkunden, Abschriften aus<br />
den Personenstandsbüchern und Bestätigungen an Angehörige der Volksgruppen<br />
(BGBl. 1976/396);<br />
� für die Ausstellung von Urkunden nach Maßnahmen im Sinne des Schriftstücke-<br />
Bereinigungsgesetz, BGBl. 1946/3;<br />
� für ausschließlich zur Bestimmung des gemeinsamen Familiennamens der Ehegatten<br />
erforderliche Schriften und Amtshandlungen (BGBl. 1986/97);<br />
� für Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kind<br />
(BGBl. 1990/740).<br />
Zu beachten ist, dass der Bundesgesetzgeber nicht von der Entrichtung von Landes- oder<br />
Gemeindeverwaltungsabgaben befreien kann, der Landesgesetzgeber nicht von der Entrichtung<br />
von Bundesverwaltungsabgaben. Wird z.B. für Sozialversicherungszwecke ein Staatsbürger-<br />
schaftsnachweis ausgestellt, der nach § 110 ASVG bundesgebührenfrei ist, ist trotzdem die Lan-<br />
desverwaltungsabgabe zu entrichten, da die Landesverwaltungsabgaben-Verordnungen keine<br />
Befreiungsbestimmungen enthalten.<br />
Neben den sachlichen Befreiungsbestimmungen (oben beispielhaft angeführt) gibt es auch<br />
noch persönliche Befreiungstatbestände gemäß § 2 Gebührengesetz. Danach sind von der Ent-<br />
richtung von Gebühren befreit:<br />
1. Der Bund, die von ihm betriebenen Unternehmungen sowie öffentlich-rechtliche Fonds,<br />
für die er Abdeckungspflicht hat;<br />
Seite - 146 -
2. die übrigen Gebietskörperschaften im Rahmen ihres öffentlich-rechtlichen Wirkungsbe-<br />
reiches;<br />
3. sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Vereinigungen, die ausschließlich<br />
wissenschaftliche, Humanitäts- oder Wohltätigkeitszwecke verfolgen, hinsichtlich ihres<br />
Schriftverkehrs mit den öffentlichen Behörden und Ämtern;<br />
4. die als Gesandte fremder Mächte bestellten Angehörigen auswärtiger Staaten (ausge-<br />
nommen Rechtsgeschäfte über unbewegliche im Inland gelegene Sachen).<br />
Seite - 147 -
5.2.3 Bundesverwaltungsabgaben und Bundesgebühren<br />
in Personenstandsangelegenheiten (Auszug)<br />
(Stand 1.1.2002)<br />
Bundesverwaltungs-abgaben<br />
€<br />
Bundesgebühren<br />
€<br />
Höhe Tarif- Höhe Tarifpostpost<br />
Ausstellung<br />
(§ 31 PStG)<br />
einer Personenstandsurkunde 2,10 20 6,60 4(1)2<br />
Neubeurkundung eines Personenstandsfalles<br />
(§ 6 Abs. 2 PStG)<br />
6,50 2 - -<br />
Bescheide und Amtshandlungen im Interesse<br />
der Partei, wenn nicht andere TP anzuwenden<br />
ist<br />
6,50 2 - -<br />
Beglaubigung (Überbeglaubigung) von Urkunden<br />
Erteilung einer Abschrift<br />
aus Personenstandsbuch od. Altmatrik (§ 36<br />
- - 13,20 14(1)<br />
PStG)<br />
2,10 21 6,60 4(1)2<br />
b) aus Familienbuch (§ 61 PStG 1937)<br />
3,20 22 6,60 4(1)2<br />
Eingaben (ausgenommen allg. Rechtsauskünfte)<br />
- - 13,20 6(1)<br />
Beilagen 245 (je Bogen); u.a. Urteile, Übersetzungen<br />
- - 3,60 5(1)<br />
Ausstellung einer Bestätigung (§ 55 PStG) 2,10 31 6,60 4(1)2<br />
Beurkundung (Beglaubigung) von Erklärungen,<br />
ausgenommen Vaterschaftserklärungen<br />
3,20 29 13,20 6(1)<br />
Entgegennahme von Erklärungen, ausge- 3,20 30 - -<br />
nommen Vaterschaftserklärungen<br />
Trauung durch den <strong>Standesbeamten</strong> (§ 47<br />
PStG)<br />
5,45 27 -<br />
-<br />
im Amtsraum während der Dienststunden<br />
10,90 27 -<br />
-<br />
im Amtsraum außerhalb der Dienststunden<br />
außerhalb Amtsraum bei gefährlicher Krankheit<br />
d) außerhalb Amtsraum in allen anderen Fällen<br />
5,45<br />
54,50<br />
28<br />
28<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses 7,60 26 13,20 14(1)<br />
Ermittlung der Ehefähigkeit bei Abtretung 5,45 25 - -<br />
Erteilung von wöchentlichen Verzeichnissen 1,80 24 13,20 14(1)<br />
Änderung des Familien- od. Vornamens bei<br />
den sogenannten „Wunschnamen“, sonst gebührenfrei<br />
163,00 32 352,50 2(1)10<br />
Ausländische Personenstandsurkunden, wenn<br />
von ihnen amtlichen Gebrauch gemacht wird<br />
- - 6,60 4(1)2<br />
Beglaubigte Übersetzungen je Bogen 246 - - - -<br />
Berücksichtigung abweichender Namens- 3,20 19 - -<br />
schreib-weise (§ 11 Abs.3 und 4 PStG)<br />
245 Zur Gebührenpflicht von Beilagen im Personenstandsrecht siehe Kraner in ÖStA 1993,78.<br />
246 aufgehoben durch das Abgabenänderungsgesetz 2001 (BGBl. I 144/2001); jetzt nur als Beilage gebührenpflichtig<br />
Seite - 148 -
5.3 Internationales Privatrecht Österreichs<br />
5.3.1 Allgemeines<br />
Das Internationale Privatrecht (IPR) wird in den verschiedenen Rechtsordnungen sehr ver-<br />
schieden verstanden. Im österreichischen Rechtssystem versteht man unter Internationalem Pri-<br />
vatrecht:<br />
Das Internationale Privatrecht ist der Inbegriff aller in einem Staat geltenden Normen, die für<br />
privatrechtliche Sachverhalte mit Auslandsberührung vorschreiben, welche Privatrechtsordnung<br />
für die Beurteilung des Falles heranzuziehen ist.<br />
Das IPR dient als reines Kollisionsrecht somit nur dazu, das auf den Fall anzuwendende Sach-<br />
recht (materielle Privatrecht) zu ermitteln.<br />
Der Name „Internationales Privatrecht“ ist eigentlich missverständlich; weder handelt es sich<br />
um internationales Recht noch um Privatrecht im eigentlichen Sinn, am allerwenigsten um interna-<br />
tional einheitliches Privatrecht. Der Name rührt vielmehr daher, dass das IPR die privatrechtliche<br />
Seite internationaler Sachverhalte behandelt. Trotzdem hat sich der Name in allen Staaten einge-<br />
bürgert.<br />
Bei Österreichs geographischer und politischer Situation inmitten einer Fülle von Staaten mit<br />
sehr verschiedener politischer und wirtschaftlicher Struktur und einer starken Bevölkerungsmobili-<br />
tät spielt das IPR eine vergleichsweise große Rolle, von der anzunehmen ist, dass sie sich in<br />
Zukunft noch vergrößern wird. Insbesondere die österreichischen <strong>Standesbeamten</strong> sind immer<br />
häufiger, nicht zuletzt auch durch die Öffnung der Ostgrenzen, mit Fällen mit Auslandsberührung<br />
befasst. Um solche Fälle mit Beziehung zu ausländischen Rechtsordnungen lösen zu können,<br />
sind gewisse Normen nötig, die bestimmen, welches Recht anzuwenden ist.<br />
Die das Familienrecht betreffenden, bis zum 31.12.1978 gültig gewesenen Verweisungsnor-<br />
men waren in der 4. Durchführungsverordnung zum Ehegesetz (4.DVEheG) zusammengefasst.<br />
Sie waren oft lückenhaft und meist einseitig gefasst. Nach umfangreichen Vorarbeiten, die im<br />
Auftrag des BM für Justiz bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begonnen worden<br />
sind, wurde der Entwurf eines Bundesgesetzes ausgearbeitet, der am 15.6.1978 vom Parlament<br />
verabschiedet worden und am 1.1.1979 in Kraft getreten ist.<br />
Rechtsquellen<br />
Das österr. IPR ist teils in autonomen Gesetzen, teils in Staatsverträgen niedergelegt. Staats-<br />
vertragliches IPR geht dem autonomen vor (§ 53 IPRG), spezielles dem allgemeinen.<br />
Seite - 149 -
Das österr. autonome IPR ist umfassend kodifiziert im IPR-Gesetz (BGBl. 304/1978, abgekürzt<br />
„IPRG“; in Kraft seit 1.1.1979), abgeändert durch BGBl. 89/1993 (EWR-Bestimmungen) und durch<br />
das KRÄG 2001 (BGBl. I Nr. 135/2000).<br />
Das autonome IPR wird weitgehend verdrängt durch staatsvertraglich vereinheitlichtes IPR.<br />
Am wichtigsten sind die mehrseitigen IPR-Staatsverträge (Genfer Flüchtlingskonvention, Unter-<br />
haltsstatutabkommen, Minderjährigenschutzabkommen, Straßenverkehrsabkommen u.a.). Die<br />
meisten der zweiseitigen IPR-Staatsverträge behandeln Fragen des Vormundschaftsrechtes und<br />
des Erbrechtes.<br />
5.3.1.1 Der Anknüpfungsbegriff<br />
Um das anzuwendende Recht zu finden, bedarf es der Anknüpfung. Unter Anknüpfung ver-<br />
steht man die Beziehung auf ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal, welches dafür maßgeblich ist,<br />
ob die inländische oder eine (und welche) ausländische Rechtsordnung anzuwenden ist. Im Per-<br />
sonenrecht kommen als Anknüpfungspunkte die Staatsangehörigkeit, der Wohnsitz oder der<br />
gewöhnliche Aufenthalt einer Person in Betracht.<br />
Die auf Grund eines dieser Anknüpfungspunkte gefundene Rechtsordnung wird Personalstatut<br />
genannt. Je nachdem, ob an die Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz (Domizil) angeknüpft<br />
wird, spricht man vom Staatsangehörigkeits- oder vom Domizilprinzip. Während in Österreich, wie<br />
in den meisten europäischen Staaten das Staatsangehörigkeitsprinzip herrscht, besteht das (älte-<br />
re) Wohnsitzprinzip in den USA, in den meisten südamerikanischen und in wenigen europäischen<br />
(GB, Dänemark, Norwegen) Staaten. Darüber hinaus wird in letzter Zeit als Anknüpfungsbegriff<br />
immer öfter der gewöhnliche Aufenthalt empfohlen.<br />
Das österreichische IPR geht vom Grundsatz der stärksten Beziehung aus. Sachverhalte mit<br />
Auslandsberührung sind in privatrechtlicher Hinsicht nach der Rechtsordnung zu beurteilen, zu der<br />
die stärkste Beziehung besteht. Die für die Anknüpfung an eine bestimmte Rechtsordnung maß-<br />
gebenden tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen sind von Amts wegen festzustellen,<br />
ebenso die Ermittlung fremden Rechts, dessen Anwendung sich nach den Normen des Ur-<br />
sprungslandes richtet, d.h. fremdes Recht ist wie in seinem ursprünglichen Geltungsbereich an-<br />
zuwenden. Es kommt daher in erster Linie auf die dort von der Rechtsprechung geprägte Anwen-<br />
dungspraxis an 247 . Grundsätzlich gilt für den <strong>Standesbeamten</strong>, dass zur Feststellung des fremden<br />
Rechtes die dazu zur Verfügung stehenden Arbeitsbehelfe wie<br />
„Standesamt und Ausländer“ von Brandhuber-Zeyringer und<br />
„Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht“ von Bergmann-Ferid<br />
247 OGH 26.1.1994 (ÖJZ NRsp 1994/103)<br />
Seite - 150 -
heranzuziehen sind. Verfügt der Standesbeamte nicht über solche Arbeitsbehelfe, so wird er<br />
sich an die nächsthöhere Aufsichtsbehörde, die die benötigten Behelfe besitzt, zu wenden haben.<br />
Kann trotz eingehendem Bemühen innerhalb angemessener Frist das fremde Recht nicht er-<br />
mittelt werden, ist das österreichische Recht anzuwenden.<br />
5.3.1.2 Rück- und Weiterverweisung<br />
Wiederholt kommt es vor, dass das von der inländischen Verweisungsnorm zur Anwendung<br />
berufene fremde Recht auf den betreffenden Sachverhalt gar nicht seine eigenen Sachnormen<br />
anwenden will, sondern seinerseits eine andere Rechtsordnung für maßgebend erklärt. Ist dies<br />
andere Rechtsordnung die österreichische, so spricht man von einer „Rückverweisung“, handelt<br />
es sich um das Recht eines dritten Staates, so liegt eine „Weiterverweisung“ vor. Die Verwei-<br />
sungsnormen des IPR-G sind daher Gesamtverweisungen, umfassen daher auch die Verwei-<br />
sungsnormen des fremden IPR. Weiterverweisungen und Rückverweisungen sind demnach vom<br />
<strong>Standesbeamten</strong> zu beachten (§ 5).<br />
Die Gründe für eine solche unterschiedliche kollisionsrechtliche Betrachtungsweise können<br />
verschieden sein. Die häufigsten Fälle sind die, in denen eine Rechtsordnung, deren internationa-<br />
les Privatrecht vom Staatsangehörigkeitsgrundsatz geprägt ist, auf eine Rechtsordnung mit Domi-<br />
zilgrundsatz verweist.<br />
5.3.1.3 Vorbehaltsklausel (ordre public)<br />
Vom IPR berufenes fremdes Recht ist im Inland grundsätzlich ungeachtet seines Inhaltes an-<br />
zuwenden, also auch dann, wenn es vom österr. Recht erheblich abweicht, weil die Rechtsanwen-<br />
dung eben durch die Beachtung der „stärksten Beziehung“ zum Ausland gerechtfertigt ist.<br />
Eine Bestimmung des fremden Rechtes ist allerdings nicht anzuwenden, wenn ihre Anwen-<br />
dung zu einem Ergebnis führen würde, das mit den Grundwertungen der österreichischen Rechts-<br />
ordnung unvereinbar ist. An ihre Stelle tritt die entsprechende Bestimmung des österreichischen<br />
Rechtes.<br />
Die Vorbehaltsklausel dient nur dem Schutz vor dem Eindringen von fremden Rechtsgedan-<br />
ken, die mit wesentlichen österreichischen Rechtsgrundsätzen unvereinbar sind und das österrei-<br />
chische Rechtsempfinden in unerträglichem Ausmaß verletzen. Als ordre public Verstöße wurden<br />
in Österreich z.B. das Eingehen von Mehr- oder Kinderehen, Ehenichtigkeit aus Gründen der<br />
Religion, ein Verbot der Legitimation von Ehebruchskindern und extrem kurze Verjährungsfristen<br />
anerkannt.<br />
Seite - 151 -
Von dieser Ausnahmebestimmung ist daher sparsamer Gebrauch zu machen, weil sie eine<br />
systemwidrige Ausnahme darstellt.<br />
Beispiel: Die ägyptische Staatsangehörige AB heiratete den österr. Staatsbürger CD. AB ist<br />
Angehörige des muslimischen Glaubens. Hinsichtlich der sachlichen Ehevoraussetzungen der AB<br />
verweist § 17 Abs.1 IPRG in Form einer Gesamtverweisung in das ägyptische Kollisionsrecht<br />
(Personalstatut der AB), das gemäß § 12 ägyptisches Zivilgesetzbuch in das ägyptische materielle<br />
Recht verweist. Nach diesem liegt ein Ehenichtigkeitsgrund vor, da die Ehegatten verschiedenen<br />
Religionen angehören. Der (ägyptische) Nichtigkeitsgrund der Religionsverschiedenheit wird aber<br />
in Österreich nicht angewendet, da Ehenichtigkeit aus Gründen der Religion mit dem österr. „ordre<br />
public“ (Säkularität des Staates) nicht in Einklang zu bringen ist. Die Ehe ist daher mangels ande-<br />
rer Ehemängel wirksam 248 .<br />
Durch die Anwendung der Vorbehaltsklausel wird nicht das gesamte fremde Recht ausge-<br />
schlossen, sondern nur der einzelne Rechtssatz, der dem österreichischen ordre public wider-<br />
spricht.<br />
5.3.1.4 Statutenwechsel<br />
Die nachträgliche Änderung der für die Anknüpfung an eine bestimmte Rechtsordnung maß-<br />
gebenden Voraussetzungen wird als Statutenwechsel bezeichnet; er hat auf bereits vollendete<br />
Tatbestände keinen Einfluss. Im Gegensatz zu der bisher vertretenen Rechtsansicht gilt dies auch<br />
für die Namensführung (Erkenntnis des VwGH vom 28.6.1989, ÖStA 1989,69). Durch den Erwerb<br />
der österreichischen Staatsbürgerschaft tritt daher keine Änderung des vor dem Statutenwechsel<br />
im Zusammenhang mit einer Eheschließung nach dem damals maßgebenden Recht erworbenen<br />
Familiennamens ein. Aus dieser Entscheidung des VwGH ist auch abzuleiten, dass ein Statuten-<br />
wechsel keine Änderung des mit der Geburt oder durch eine andere Personenstandsänderung<br />
erworbenen Familiennamens bewirkt (ÖStA 1989,85).<br />
5.3.1.5 Form<br />
Die Form einer Rechtshandlung ist nach demselben Recht zu beurteilen wie die Rechtshand-<br />
lung selbst; es genügt jedoch auch die Einhaltung der Formvorschriften des Staates, in dem die<br />
Rechtshandlung vorgenommen wird. Bei der Prüfung der Frage der Form einer Rechtshandlung<br />
ist als Ausnahme eine Rück- oder Weiterverweisung nicht zu beachten, weil sonst der Sinn der<br />
Verweisung auf das Ortsrecht verloren ginge.<br />
248 (Erkenntnis des VwGH in ZfRV 1992,224)<br />
Seite - 152 -
5.3.1.6 Personalstatut einer natürlichen Person<br />
Das Personalstatut einer natürlichen Person ist das Recht des Staates, dem die Person ange-<br />
hört (Grundsatz Heimatrecht). Ist eine natürliche Person Angehöriger mehrerer Staaten - also<br />
Mehrstaater -, so ist gemäß IPR-Gesetz zu differenzieren:<br />
Verfügt der Mehrstaater auch über die österreichische Staatsangehörigkeit, so ist nur<br />
diese maßgebend.<br />
Für andere Mehrstaater ist jene Staatsangehörigkeit ausschlaggebend, zu der die stärkste Be-<br />
ziehung besteht.<br />
Bestimmte Regeln, wie die Staatsangehörigkeit des Staates, zu dem die stärkste Beziehung<br />
besteht, festzustellen ist, können nicht aufgestellt werden. Es müssen daher die Tatsachen, durch<br />
die die Enge der Beziehungen der Person zu den in Betracht kommenden Staaten bestimmt wird<br />
(Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, Zeitpunkt des Erwerbes der einzelnen Staatsangehörigkeiten,<br />
wirtschaftliche Bindungen, Erziehung, Sprache, Ausübung öffentlich-rechtlicher Befugnisse oder<br />
Funktionen wie Wahlrecht oder Wehrdienst), festgestellt und in ihrer Bedeutung für die Lebens-<br />
verhältnisse der Person gegeneinander abgewogen werden.<br />
Ist eine Person staatenlos oder kann ihre Staatsangehörigkeit nicht geklärt werden, so ist ihr<br />
Personalstatut das Recht des Staates, in dem sie den Wohnsitz (bei Fehlen eines solchen den<br />
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Sinngemäß trifft dies auch auf die anerkannten Konventionsflüchtlin-<br />
ge zu. Beim „Wohnsitz“ muss zur tatsächlichen Anwesenheit die Absicht auf bleibenden Aufenthalt<br />
treten.<br />
5.3.1.7 Rechtswahl<br />
Nach dem österreichischen IPR ist eine Rechtswahl im Personenrecht, z.B. bei der Frage der<br />
Namensführung der Ehegatten, ausgeschlossen (Nach den IPR-Vorschriften in Deutschland kann<br />
sich z.B. eine Österreicherin dem deutschen Namensrecht unterwerfen. Entspricht das Ergebnis<br />
aber nicht auch österr. Recht, wird dies in Österreich nicht anerkannt).<br />
5.3.2 Personenrecht<br />
5.3.2.1 Rechts- und Handlungsfähigkeit<br />
Die Rechts- und Handlungsfähigkeit einer Person sind nach deren Personalstatut zu beurtei-<br />
len. Diese Verweisungsnorm ist für die Personenstandsbehörden vor allem im Zusammenhang mit<br />
Seite - 153 -
der Volljährigkeit von Bedeutung. Es kommt auf das jeweilige Personalstatut an, wann die Volljäh-<br />
rigkeit eintritt. Die einmal erlangte Volljährigkeit geht auch durch einen Statutenwechsel nicht<br />
wieder verloren.<br />
5.3.2.2 Name<br />
Die Führung des Namens einer Person ist nach deren jeweiligem Personalstatut zu beurteilen,<br />
auf welchem Grund auch immer der Namenserwerb beruht. Ein Statutenwechsel ist allerdings kein<br />
namensrechtlicher Tatbestand, der Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft wirkt sich<br />
nicht auf die Namensführung des Eingebürgerten aus (siehe auch oben „Statutenwechsel“).<br />
Ein Rück- oder Weiterverweisung muss beachtet werden. Es kann sich daher die Maßgeblich-<br />
keit eines anderen Statuts als des Personalstatuts für die Namensführung einer Person, etwa des<br />
Ehewirkungsstatuts ergeben.<br />
5.3.3 Eherecht<br />
5.3.3.1 Voraussetzungen der Eheschließung<br />
Die Voraussetzungen der Eheschließung sind für jeden der Verlobten getrennt (unter Berück-<br />
sichtigung einer allfälligen Rück- oder Weiterverweisung) nach seinem eigenen Personalstatut<br />
(Staatsangehörigkeit) zu beurteilen. Die Ehevoraussetzungen müssen im Zeitpunkt der Ehe-<br />
schließung gegeben sein. Durch einen Statutenwechsel werden daher weder Ehehindernisse<br />
geheilt noch entstehen solche.<br />
In den Anwendungsbereich dieser Verweisungsnorm fallen die sachlichen Voraussetzungen<br />
der Eheschließung, vor allem das erforderliche Alter (Ehemündigkeit), das Nichtvorhandensein<br />
von Ehehindernissen, die Zustimmung Dritter (z.B. des gesetzlichen Vertreters).<br />
5.3.3.2 Form der Eheschließung<br />
Die Form einer Eheschließung im Inland ist nach den inländischen Formvorschriften zu beurtei-<br />
len. Nur die vor dem <strong>Standesbeamten</strong> geschlossene Ehe hat bürgerlich-rechtliche Wirkungen;<br />
dies auch dann, wenn das Personalstatut der Verlobten eine andere Eheschließungsform zulas-<br />
sen sollte. Derzeit bestehen keine Staatsverträge über die Anerkennung von Eheschließungen vor<br />
diplomatischen oder konsularischen Vertretern fremder Staaten in Österreich.<br />
Die Form der Eheschließung im Ausland ist zwar grundsätzlich nach dem Personalstatut jedes<br />
der Verlobten zu beurteilen. Es genügt jedoch die Einhaltung der Formvorschriften des Ortes der<br />
Seite - 154 -
Eheschließung. Alle sachlichen, also nicht zur Form der Eheschließung gehörenden Ehevoraus-<br />
setzungen sind hingegen für jeden der Verlobten nach seinem Personalstatut zu beurteilen.249<br />
So ist eine zwischen zwei Österreichern in Spanien in kirchlicher Form geschlossene Ehe<br />
ebenso gültig, wie eine von zwei katholischen Spaniern vor einem Schweizer Zivilstandsbeamten<br />
geschlossene Ehe. Nicht anzuerkennen wäre jedoch z.B. die in kirchlicher Form geschlossene<br />
Ehe eines Griechen mit einer Österreicherin in Frankreich oder in der Schweiz: Hier wurde die<br />
Heimatform eines der Verlobten (der Österreicherin) und die Ortsform verletzt.<br />
5.3.4 Kindschaftsrecht<br />
5.3.4.1 Eheliche Abstammung<br />
Die Voraussetzungen der Ehelichkeit eines Kindes sind nach dem Personalstatut zu beurteilen,<br />
das die Ehegatten im Zeitpunkt der Geburt des Kindes oder bei vorheriger Auflösung der Ehe zu<br />
diesem Zeitpunkt gehabt haben. Bei verschiedenem Personalstatut der Ehegatten ist das Perso-<br />
nalstatut des Kindes zum Zeitpunkt der Geburt maßgebend.<br />
Da an das Personalstatut der „Ehegatten“ angeknüpft wird, muss die Mutter im maßgeblichen<br />
Zeitpunkt verheiratet sein; die „Erstfrage“ nach dem wirksamen Eheabschluß ist unbestritten nach<br />
den §§ 16,17 zu beurteilen. Fehlt danach eine Ehe, so ist die Ehelichkeit nach herrschender Mei-<br />
nung nach jener Rechtsordnung zu beurteilen, die gemäß §§ 16 oder 17 die Eheunwirksamkeit<br />
ausgesprochen hat.<br />
5.3.4.2 Legitimation<br />
Der Anwendungsbereich der Bestimmungen des § 22 IPR-G war sehr gering. Der § 22 wurde<br />
daher mit 1.7.2001 aufgehoben250. Kollisionsrechtlich ist diese Materie im Übereinkommen vom<br />
10.9.1970 über die Legitimation durch nachfolgende Eheschließung, BGBl. Nr. 102/1976, gere-<br />
gelt.<br />
5.3.4.3 Wirkungen der Ehelichkeit und der Legitimation<br />
Die Wirkungen der Ehelichkeit und der Legitimation eines Kindes sind nach dessen Personal-<br />
statut zu beurteilen, eine allfällige Rück- oder Weiterverweisung muss jedoch beachtet werden.<br />
Verweist daher das Heimatrecht des Kindes z.B. auf das Heimatrecht des Vaters oder auf das für<br />
die persönlichen Rechtswirkungen der Ehe maßgebende Recht, so ist dieses Recht maßgebend.<br />
249 OGH 26.5.1997, 6 Ob 65/97w (ÖJZ-LSK 1997/246)<br />
250 BGBl. I Nr. 135/2000<br />
Seite - 155 -
Da das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern ein Dauerverhältnis ist, kommt es auf<br />
das jeweilige Personalstatut des Kindes an.<br />
5.3.4.4 Uneheliche Abstammung und deren Wirkungen<br />
Die Voraussetzungen der Feststellung und der Anerkennung der Vaterschaft zu einem unehe-<br />
lichen Kind sind nach dessen Personalstatut im Zeitpunkt der Geburt zu beurteilen. (Gibt z.B. ein<br />
Mann ein Vaterschaftsanerkenntnis zu einem portugiesischen Kind in einem in Österreich hand-<br />
schriftlich errichteten Testament ab, so ist dieses Anerkenntnis formwirksam, weil es den Former-<br />
fordernissen des für das Anerkenntnis berufenen portugiesischen Rechtes entspricht)<br />
Sie sind jedoch nach einem späteren Personalstatut zu beurteilen, wenn die Feststellung (An-<br />
erkennung) nach diesem, nicht aber nach dem Personalstatut im Zeitpunkt der Geburt zulässig ist.<br />
5.3.4.5 Annahme an Kindesstatt<br />
Die Voraussetzungen der Annahme an Kindesstatt und der Beendigung der Wahlkindschaft<br />
sind nach dem Personalstatut jedes Annehmenden und dem Personalstatut des Kindes zu beur-<br />
teilen. Ist das Kind nicht eigenberechtigt, so ist sein Personalstatut nur hinsichtlich der Zustim-<br />
mung des Kindes oder eines Dritten, zu dem das Kind in einem familienrechtlichen Verhältnis<br />
steht, maßgebend. Ein späterer Statutenwechsel ist hinsichtlich der Voraussetzungen, da es sich<br />
um einen vollendeten Tatbestand handelt, unbeachtlich.<br />
Die Wirkungen der Annahme an Kindesstatt sind nach dem Personalstatut des Annehmenden,<br />
bei Annahme durch Ehegatten nach dem für die persönlichen Rechtswirkungen der Ehe maßge-<br />
benden Recht, zu beurteilen.<br />
Das für die Wirkungen maßgebliche Statut ist wandelbar, da es sich bei der Wahlkindschaft<br />
um ein Dauerrechtsverhältnis handelt. Die Namensführung des Wahlkindes bestimmt sich nach<br />
seinem Personalstatut.<br />
5.3.5 Sonstige Bestimmungen<br />
Sonstige Bestimmungen des IPR-Gesetzes, die für die Personenstandsbehörden noch von<br />
Bedeutung sein können, sind jene über die Todeserklärung und Beweisführung des Todes (§ 14),<br />
die Entmündigung (§ 15), die persönlichen Rechtswirkungen der Ehe (§ 18), die Ehescheidung<br />
(§ 20) und das Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht (§ 27). Da der Standesbeamte diese Best-<br />
immungen eher selten oder gar nicht anzuwenden hat, konnte eine Behandlung im Rahmen dieser<br />
Zusammenstellung entfallen. Diese Bestimmungen sind jedoch im Gesetzestext enthalten.<br />
Seite - 156 -
5.4 Gerichtsorganisation<br />
Gerichte sind mit verfassungsgesetzlichen Garantien ausgestattete Behörden, welche berufen<br />
sind, Recht zu sprechen und bei der Durchsetzung der rechtlichen Ansprüche behilflich zu sein.<br />
Den Gerichten obliegt die Vollziehung in Zivil- und Strafsachen ausgenommen Verwaltungsstraf-<br />
sachen. Die Zivilgerichtsbarkeit ist auf den Schutz privater Rechte gerichtet, die Strafgerichtsbar-<br />
keit auf die Verwirklichung des staatlichen Strafrechts. Träger der Gerichtsbarkeit ist der Bund, es<br />
gibt daher keine Gerichte der Länder. 251 Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist geregelt in:<br />
� Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)<br />
� Jurisdiktionsnorm (JN)<br />
� Zivilprozessordnung (ZPO)<br />
� Strafprozessordnung (StPO)<br />
Die Verfassung bestimmt, dass die Justiz von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt ist.<br />
Es gibt daher keinen Instanzenzug von einer Verwaltungsbehörde an ein Gericht oder umgekehrt.<br />
Die Vollziehung bei den Gerichten obliegt in erster Linie den Richtern, die unabhängig, unabsetz-<br />
bar und unversetzbar agieren. Weitere Organe sind die Rechtspfleger und die Mitwirkenden aus<br />
der Bevölkerung (Geschworene und Schöffen).<br />
In nichtstreitigen Rechtsangelegenheiten (z.B. einvernehmliche Scheidung) entscheidet das<br />
Gericht nach dem „Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer<br />
Streitsachen“ kurz genannt „Außerstreitgesetz“ (AußStrG). (Am 1.1.2005 ist ein vollkommen neu-<br />
es Außerstreitgesetz in Kraft getreten: siehe BGBl. I 111/2003). Es handelt sich dabei um ein<br />
formloses Verfahren ohne Anwaltszwang. Anträge müssen nicht schriftlich eingebracht werden,<br />
sondern können auch mündlich zu Protokoll gegeben werden. Die Entscheidung im Verfahren<br />
außer Streitsachen heißt Beschluss. Der Beschluss wird nach Ablauf von 14 Tagen nach Zustel-<br />
lung rechtskräftig, wenn dagegen kein Rechtsmittel eingebracht wird. Wird innerhalb der Rechts-<br />
mittelfrist Zulassungsvorstellung erhoben, kann das Gericht seine Entscheidung überprüfen und<br />
auch aufheben. Wird gegen den Beschluss Rekurs erhoben, so entscheidet über diesen der über-<br />
geordnete Gerichtshof II. Instanz (Landesgericht). Gegen die Entscheidung dieses Gerichtshofes<br />
steht, soweit gesetzlich nicht beschränkt, das Rechtsmittel des Revisionsrekurses an den Obers-<br />
ten Gerichtshof offen.<br />
Das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozess) ist ein nach strengen Form-<br />
vorschriften geregeltes Gerichtsverfahren (Zivilprozessordnung von 1895). Die Klage ist schriftlich<br />
einzubringen. In vielen Fällen müssen sich die Parteien durch Rechtsanwälte vertreten lassen. Die<br />
251 Art. 82 Abs.1 B-VG<br />
Seite - 157 -
Streitverhandlung wird mündlich geführt. In ihr erfolgt die Beweisaufnahme durch Vernehmung<br />
von Zeugen und Sachverständigen. In jedem Fall ist ein Verhandlungsprotokoll anzufertigen. Nach<br />
freier Beweiswürdigung entscheidet das Gericht mit Urteil. Die Urteilsverkündung erfolgt in der<br />
Regel nach Schluss der mündlichen Verhandlung. Das verkündete Urteil ist in schriftlicher Ausfer-<br />
tigung jeder Partei zuzustellen. Das Rechtsmittel gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz ist<br />
die Berufung. Die Berufungsfrist beträgt vier Wochen und beginnt für jede Partei mit der an sie<br />
erfolgten Zustellung des Urteiles. Der Instanzenzug geht, soweit nicht beschränkt, bis zum Obers-<br />
ten Gerichtshof. Durch die rechtzeitig eingebrachte Berufung (bzw. Revision an den OGH) wird<br />
der Eintritt der Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Urteils gehemmt.<br />
Die ordentlichen Gerichte (zur Zivil- und Strafrechtspflege) sind wie folgt organisiert:<br />
5.4.1 Bezirksgerichte<br />
Bei den Bezirksgerichten werden die Entscheidungen von Einzelrichtern gefällt. Praktisch alle<br />
Angelegenheiten des Ehe- und Kindschaftsrechtes sowie Vormundschaftsangelegenheiten fallen<br />
in die sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes. Auszugsweise seien die wichtigsten Angele-<br />
genheiten genannt (sachliche Zuständigkeit):<br />
Einvernehmliche und streitige Ehescheidung sowie Aufhebung und Nichtigerklärung der Ehe;<br />
Ehemündigerklärung;<br />
Feststellung der Vaterschaft (durch Anerkenntnis oder Beschluss);<br />
Feststellung der Rechtsunwirksamkeit eines Vaterschaftsanerkenntnisses;<br />
Feststellung der Nichtabstammung des Kindes vom Ehemann der Mutter;<br />
Bewilligung, Aufhebung und Widerruf der Annahme an Kindesstatt;<br />
Bestellung eines Vormundes, Kurators oder Sachwalters;<br />
Beschluss über die Todeserklärung bzw. die Beweisführung des Todes (und der Aufhebung).<br />
Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften.<br />
Die örtliche Zuständigkeit ist die Zugehörigkeit einer Rechtssache zu dem sachlich zuständi-<br />
gen Gericht eines bestimmten Ortes. Sie bestimmt sich nach dem allgemeinen Gerichtsstand<br />
einer Person. Für die Bestimmung des allgemeinen Gerichtsstandes einer Person ist der Wohnsitz<br />
(ersatzweise der gewöhnliche Aufenthalt) maßgebend. Ein minderjähriges Kind teilt den allgemei-<br />
nen Gerichtsstand seines gesetzlichen Vertreters. Sind beide Eltern gesetzliche Vertreter, so teilt<br />
Seite - 158 -
es deren gemeinsamen allgemeinen Gerichtsstand, haben sie keinen solchen, den allgemeinen<br />
Gerichtsstand des Elternteils, dessen Haushalt es zugehört252.<br />
5.4.2 Gerichtshöfe<br />
Landesgericht: Bei den Gerichtshöfen I. Instanz (diese historische Bezeichnung ist irreführend;<br />
vielfach entscheiden sie nämlich als zweite Instanz) werden die Entscheidungen von Einzelrichtern<br />
oder Senaten (Vorsitzender, 2 Beisitzer) gefällt. Dem Landesgericht obliegt die Überprüfung der<br />
erstinstanzlichen Entscheidungen der Bezirksgerichte. Landesgerichte bestehen in den Landes-<br />
hauptstädten sowie in weiteren größeren Städten (z.B. Wels, Krems, Leoben usw.).<br />
Oberlandesgericht: Diesem obliegt in II. Instanz die Überprüfung der erstinstanzlichen Ent-<br />
scheidungen der Landesgerichte in Zivil- und Strafsachen. Sie üben die Gerichtsbarkeit durch<br />
Senate (in der Regel Dreiersenate) aus. Oberlandesgerichte bestehen in Wien (für Wien, Nieder-<br />
österreich, Burgenland), Graz (für Steiermark, Kärnten), Innsbruck (für Tirol und Vorarlberg) und<br />
Linz (für Oberösterreich, Salzburg).<br />
Oberster Gerichtshof (OGH): Der Oberste Gerichtshof hat seinen Sitz in Wien. Ihm obliegt<br />
nach der Bundesverfassung die Überprüfung der Entscheidungen der Landesgerichte und der<br />
Oberlandesgerichte in letzter Instanz. Der OGH entscheidet grundsätzlich durch Senate. Sie be-<br />
stehen in der Regel aus 5 Mitgliedern.<br />
5.4.3 Sondergerichtshöfe<br />
Die Sondergerichtshöfe mit dem Sitz in Wien sind der Verwaltungsgerichtshof und der Verfas-<br />
sungsgerichtshof. Sie stehen grundsätzlich in keinem Zusammenhang mit den Zivil- und Strafge-<br />
richten und können daher Akte der „ordentlichen Gerichte“ nicht überprüfen.<br />
Verwaltungsgerichtshof: Der VwGH überprüft die gesamte Verwaltung auf die Gesetzmäßig-<br />
keit. Er erkennt über Beschwerden, womit Rechtswidrigkeit von Bescheiden (nach Erschöpfung<br />
des Instanzenzuges) oder Verletzung der Entscheidungspflicht einer Verwaltungsbehörde behaup-<br />
tet wird.<br />
Verfassungsgerichtshof: Der VfGH erkennt über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen,<br />
Verordnungen und Staatsverträgen, über die Anfechtung von Wahlen, über Beschwerden gegen<br />
Bescheide, durch welche der Beschwerdeführer in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten<br />
Recht verletzt zu sein behauptet usw.<br />
252 Besondere Gerichtsstände bestehen in Streitigkeiten aus dem Eheverhältnis (§ 76 JN), in sonstigen Streitigkeiten<br />
einschließlich jener über den gesetzlichen Unterhalt (§ 76a JN) und für Klagen aus dem Eheverhältnis (§ 100 JN).<br />
Seite - 159 -
Die Mitglieder des Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshofes sind ebenfalls unabhängige,<br />
unabsetzbare und unversetzbare Richter, die vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundes-<br />
regierung, des Nationalrats oder des Bundesrats ernannt.<br />
Seite - 160 -
5.5 Namensänderung<br />
Rechtsquellen sind das Namensänderungsgesetz (NÄG) vom 22.3.1988, BGBl. 195/1988, zu-<br />
letzt geändert durch BGBl. 25/1995 und die Namensänderungsverordnung 1997 (NÄV) des Bun-<br />
desministers für Inneres, BGBl. II 387/1997.<br />
Die Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat) hat auf Antrag die<br />
Änderung des Familiennamens oder Vornamens eines österreichischen Staatsbürgers (eines<br />
Staatenlosen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland oder eines Konventionsflüchtlings mit Wohn-<br />
sitz, mangels eines solchen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland) mittels Bescheid zu bewilli-<br />
gen, wenn ein Grund dafür vorliegt und ein Versagungsgrund nicht gegeben ist.<br />
Zuständig ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Wirkungsbereich der Antragsteller sei-<br />
nen Hauptwohnsitz, mangels eines solchen seinen Aufenthalt (bzw. letzten Aufenthalt) hat, sonst<br />
der Magistrat der Stadt Wien.<br />
Ein Grund für die Änderung des Familiennamens ist z.B. gegeben, wenn<br />
der bisherige Familienname „lächerlich“ oder „anstößig“, schwer auszusprechen oder zu<br />
schreiben ist;<br />
der Antragsteller ausländischer Herkunft ist und einen Familiennamen erhalten will, der ihm die<br />
Einordnung im Inland erleichtert (wichtig für die Integration ehemaliger „Gastarbeiter“ !); innerhalb<br />
von 2 Jahren nach Verleihung der Staatsbürgerschaft zu beantragen;<br />
die Vor- und Familiennamen sowie der Tag der Geburt des Antragstellers mit den entspre-<br />
chenden Daten einer anderen Person derart übereinstimmen, dass es zu Verwechslungen der<br />
Personen kommen kann;<br />
der Antragsteller einen Familiennamen erhalten will, den er durch Abgabe einer rechtzeitigen<br />
namensrechtlichen Erklärung erhalten hätte, jedoch unverschuldet die Erklärung mangels Rechts-<br />
belehrung nicht abgegeben hat;<br />
der Antragsteller in sinngemäßer Anwendung des § 93 Abs. 2 ABGB einen („unechten“) Dop-<br />
pelnamen wünscht oder ablegen möchte; bei Bewilligung eines Doppelnamens ist im Bescheid<br />
zwingend anzuführen, welcher Bestandteil des Doppelnamens gemeinsamer Familienname<br />
(§ 93 Abs. 1 ABGB) ist; 253<br />
253 Die Bewilligung in einen „echten“, weitergebbaren, zusammengesetzten Familiennamen wie z.B. nach § 2 Abs. 1 Z 7<br />
NÄG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Z 1 lit. b NÄG ist rechtswidrig.<br />
Seite - 161 -
der Antragsteller den Familiennamen seiner Eltern oder eines Elternteils (z.B. bei unehelicher<br />
Geburt den Familiennamen des Vaters) erhalten will;<br />
der Antragsteller glaubhaft macht, dass die Änderung des Familiennamens zur Abwehr wirt-<br />
schaftlicher oder sozialer Nachteile notwendig ist;<br />
der Antragsteller aus sonstigen Gründen einen anderen Familiennamen wünscht (sogenannter<br />
„Wunschname“).<br />
Die Bewilligung einer Namensänderung nach den Ziffern 1 bis 7 erfolgt gebührenfrei. Lediglich<br />
der Antrag ist mit € 13,00 nach dem Gebührengesetz zu stempeln. Die Bewilligung einer Na-<br />
mensänderung nach Ziffer 8 ist gebührenpflichtig (€ 348,00 Bundesgebühr und € 163,00 Verwal-<br />
tungsabgabe).<br />
Eine Änderung des Familiennamens ist vor allem dann zu verwehren, wenn die Änderung die<br />
Umgehung von Rechtsvorschriften ermöglichen würde oder der beantragte Familienname<br />
lächerlich, anstößig oder für die Kennzeichnung von Personen im Inland nicht gebräuchlich ist.<br />
Damit soll u.a. verhindert werden, dass jemandem durch eine Namensänderung die Weiterführung<br />
aufgehobener Adelsbezeichnungen ermöglicht wird 254 .<br />
Für die Erlangung eines früheren Familiennamens nach einer Eheauflösung (z.B. Scheidung)<br />
ist als Rechtsgrundlage § 93a ABGB heranzuziehen; für die Anwendung des NÄG ist hier kein<br />
Platz.<br />
Bei der Vornamensänderung kommen zu einigen der oben angeführten Gründen noch weite-<br />
re Gründe hinzu, so etwa, wenn<br />
das minderjährige Wahlkind andere als die bei der Geburt gegebenen Vornamen erhalten soll<br />
(Möglichkeiten für die Wahleltern, die von den leiblichen Eltern gegebenen Vornamen durch ande-<br />
re Vornamen zu ersetzen);<br />
der Antragsteller nach Änderung seiner Religionszugehörigkeit einen zur nunmehrigen Religi-<br />
onsgemeinschaft in besonderer Beziehung stehenden Vornamen erhalten soll (wichtig bei Ände-<br />
rung des Religionsbekenntnisses);<br />
ein Vorname nicht dem Geschlecht des Antragstellers entspricht.<br />
Welche Personen in einem Namensänderungsverfahren Parteistellung genießen, ist zumindest<br />
für die wichtigsten Fälle im NÄG geregelt. Parteistellung kommt danach jedenfalls folgenden<br />
Personen zu:<br />
254 siehe dazu das die geschlechtsspezifische Abwandlung (von „Freiin.von ...“ in „Freiherr von ...“) betreffende Erkenntnis<br />
des VwGH vom 20.12.1995, Zahl 95/01/0516, ÖStA 1996/64.<br />
Seite - 162 -
dem Antragsteller;<br />
dem „Kind“, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat<br />
einer Person, die in ihren berechtigten Interessen berührt ist 255 ;<br />
Ein Antrag auf Namensänderung ist, wenn der Antragsteller in seiner Geschäftsfähigkeit be-<br />
schränkt ist, von seinem gesetzlichen Vertreter 256 einzubringen und bedarf der persönlichen Zu-<br />
stimmung des Antragstellers, wenn dieser das 14. Lebensjahr vollendet hat.<br />
Der Standesbeamte, in dessen Personenstandsbuch eine Namensänderung einzutragen ist,<br />
erhält von der entscheidenden Bezirksverwaltungsbehörde eine rechtskräftige Bescheidausferti-<br />
gung oder eine Mitteilung über die erfolgte Namensänderung zugestellt und hat am Rande der in<br />
Betracht kommenden Eintragung einen entsprechenden Vermerk einzutragen. In die Personen-<br />
standsurkunden wird eine erfolgte Änderung des Familiennamens oder des Vornamens eingear-<br />
beitet257.<br />
Verwaltungsbehördliche Änderungen des Familiennamens im Zusammenhang mit einer Ehe-<br />
schließung (z.B. Bewilligung eines „unechten“ Doppelnamens in sinngemäßer Anwendung des<br />
§ 93 ABGB) sind nur dem Ehebuch, nicht aber dem Geburtenbuch desjenigen, dessen Familien-<br />
name geändert wurde, mitzuteilen.258<br />
Der Rechtszug geht im Namensänderungsverfahren von der Bezirksverwaltungsbehörde an<br />
den Landeshauptmann und endet bei diesem259. Gegen die Entscheidung des Landeshaupt-<br />
mannes kann die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und an den Verfassungsgerichtshof<br />
ergriffen werden. Darauf ist im Bescheid hinzuweisen.<br />
255 zu den Personen mit Parteistellung zählt jedenfalls auch der Vater des ehelich und unehelich geborenen Kindes<br />
gem. § 178 Abs.1 in Verbindung mit § 154 Abs.2 ABGB (Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 4.12.1996, B<br />
1481/96; ÖStA 1997,19; im Hinblick auf den „ue.“ Vater siehe Erlass des BMI vom 29.4.2003, GZ 36120/181-IV/7/03 -<br />
ÖStA 2003,58). Auf die Äußerung des Vaters ist Rücksicht zu nehmen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem<br />
Wohl des Kindes besser entspricht (VwGH 30.4.1997, 96/01/0910).<br />
256 Selbst wenn der vertretungsbefugte Elternteil allenfalls auch Eigeninteressen verfolgen sollte, ist für eine wirksame<br />
Antragstellung die Beiziehung eines Kollisionskurators nicht gesetzlich erforderlich (VwGH 16.12.1998, 98/01/0212).<br />
257 siehe § 32 PStG.<br />
258 § 3 Abs. 1 Z 1 NÄV (BGBl II 1997/387).<br />
259 siehe Artikel 103 Abs. 4 B-VG.<br />
Seite - 163 -
Literaturverzeichnis<br />
Bergmüller-Poier, Lernbehelf für die beim Amt der Salzburger Landesregierung durchgeführten<br />
Grundausbildungslehrgänge, Salzburg 1994<br />
Brandhuber-Zeyringer, Standesamt und Ausländer, Loseblattausgabe, Verlag für Standesamtswesen<br />
GmbH, Frankfurt am Main 1993<br />
Edlbacher, Namensrecht, Manz-Verlag, Wien 1978<br />
Goldemund-Ringhofer-Theuer, Staatsbürgerschaftsrecht, Manz-Verlag, Große Gesetzesausgabe<br />
Nr. 19, Wien 1969<br />
Hepting/Gaaz; (deutsches) Personenstandsrecht; Verlag für Standesamtswesen GmbH, Frankfurt<br />
am Main 1994<br />
Hintermüller, Personenstands-, Ehe- und Staatsbürgerschaftsrecht, Sonderdruck der Zeitschrift<br />
„Österreichisches Standesamt“, Wien 1994<br />
Koziol-Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Band I: Allgemeiner Teil und Schuldrecht<br />
Manz-Verlag, Wien 1992<br />
Koziol-Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Band II: Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht<br />
Manz-Verlag, 12. Auflage, Wien 2002<br />
Orac - Rechtsskripten; Bürgerliches Recht - Familienrecht; Verlag Orac, Wien<br />
ÖStA, „Österreichisches Standesamt“, Fachzeitschrift, monatlich herausgegeben vom Fachverband<br />
der österreichischen <strong>Standesbeamten</strong> Wien<br />
Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht, Springer-Verlag, Wien New York, 1998<br />
Rummel, Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Manz-Verlag, Wien 1990<br />
Schwimann, Internationales Privatrecht mit Beispielen, Manz-Verlag, Wien 1993<br />
Statistik Austria, Wien; (statistische Angaben)<br />
Thienel, Österreichische Staatsbürgerschaft, Band I und II, Wien 1990<br />
Wielinger-Gruber, Einführung in das österreichische Verwaltungsverfahrensrecht, Leykam-<br />
Verlag Graz 1991<br />
Zeyringer, Das österreichische Personenstandsrecht, Manz-Verlag Sonderausgabe Nr. 67,<br />
Wien 1992 in der Fassung der 10. Lieferung (1.7.2003)<br />
Seite - 164 -