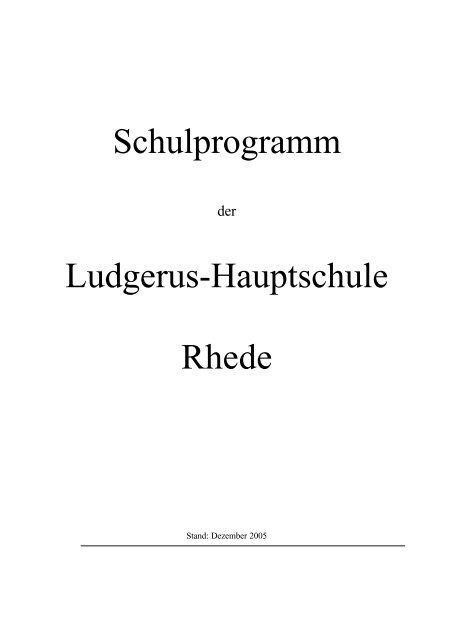Schulprogramm Ludgerus-Hauptschule R h e d e
Schulprogramm der Ludgerusschule als .pdf - Friedensschule Rhede
Schulprogramm der Ludgerusschule als .pdf - Friedensschule Rhede
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Schulprogramm</strong><br />
der<br />
<strong>Ludgerus</strong>-<strong>Hauptschule</strong><br />
R h e d e<br />
Stand: Dezember 2005
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
1 Situation und Rahmenbedingungen . . . . . . . . . . . . ............................................... 4<br />
2 Leitlinien für die pädagogische Arbeit an unserer Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
A ) Positives Lernklima als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen ....... 7<br />
B) Transparenz .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
C) Selbstgesteuertes Lernen ............................................................................ 12<br />
D ) Öffnung nach außen ................................................................................... 13<br />
3 Schulische Arbeitsfelder ............................................................................... 14<br />
A ) Förderung des Sprechens, Lesens und Schreibens ..................................... 14<br />
B) B e r u f s w a h l v o r b e r e i t u n g ............................................................................. 16<br />
C) Musische Bildung ....................................................................................... 17<br />
D ) Streitschlichtung ......................................................................................... 19<br />
E ) Verkehrserziehung ...................................................................................... 20<br />
F) Gesundheit und Sport ................................................................................. 22<br />
G) Meditation für Stille und religiöse Besinnung ........................................... 22<br />
H ) Informationstechnische Grundbildung und Medienkompetenz ................. 23<br />
4 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 30<br />
5 Mittelfristige Ziele für die Entwicklung der schulischen Arbeit .... 32<br />
6 Planung zur Evaluation ................................................................................ 32<br />
7 Anhang ................................................ ............................................................... 34<br />
Vorwort<br />
- 2 -
Leitbild: Wir vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern eine wertorientierte Bildung<br />
und Erziehung, damit sie erfolgreich und selbstständig in der Gesellschaft bestehen<br />
können.<br />
Im weiteren Text wird auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet um die Lesbarkeit<br />
nicht unnötig zu erschweren. Eine Diskriminierung ist damit keineswegs beabsichtigt.<br />
Aufgrund der starken Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt tritt zune h m e n d d e r E r w e r b<br />
personaler und sozialer Kompetenzen in den Vordergrund. Die Vermittlung von Fakten und<br />
Fachwissen reicht nicht mehr aus, um unsere Schüler auf ihre Zukunft angemessen vorzubereiten.<br />
Es wird verstärkt Wert gelegt auf die Grundlegung und da s Erreichen von Teamfähigkeit,<br />
Kooperationsfähigkeit, Kreativität, Selbstständigkeit, Problemlösefähigkeit, Lernbereitschaft,<br />
Lernfähigkeit, Flexibilität, Entscheidungs fähigkeit und Konzentrationsfähigkeit. Durch unsere<br />
bisherige und die weitere Arbeit am <strong>Schulprogramm</strong> unserer Schule wollen wir unsere Schüler in<br />
den erwähnten Bereichen so weit wie möglich fördern.<br />
Grundlage aller Bemühungen bleiben Richtlinien, Lehrpläne und Kernlehrpläne sowie<br />
schulrechtliche Bestimmungen, also Vorgaben des Landes. Hinzu kommt die Ausprägung<br />
unserer Schule durch die schuleigenen Lehrpläne und durch das <strong>Schulprogramm</strong>. Mit der<br />
Vorlage ihres <strong>Schulprogramm</strong>s beschreibt die <strong>Ludgerus</strong>- <strong>Hauptschule</strong> den gegenwärtigen Stand<br />
ihrer Arbeit und entwickelt Aspekte für die Weiterarbeit.<br />
L ehrer begleiten ihre Schüler unter anderem auch in ihrer emotionalen Entwicklung,<br />
orientieren sich über ihr Leistungsvermögen und führen sie an gesellschaftlich verbindliche<br />
Normen heran mit dem Ziel, ihnen Handlungskompetenz zu vermitteln. Dazu ist die<br />
Förderung eines positiven Lernklimas nötig, das den Jugendlichen hilft, sich heimisch zu<br />
fühlen und positive Beziehungen zueinander aufzubauen. Dies soll durch verstärkte<br />
Transparenz in allen Bereichen unterstützt werden.<br />
Lehrer bestärken Schüler in deren Leistung, geben ihnen Zuversicht und Vertrauen in die<br />
eigenen Möglichkeiten und erschließen ihnen außerschulische Zusammenhänge. Zusätzlich<br />
werden gezielt Fördermaßnahmen durchgeführt, Methoden und Medien kompetenzen vermittelt.<br />
Es werden Verhaltensmuster in d e n B e r e i c h e n G e s u n d h e i t s- und Umwelterziehung,<br />
Drogenprävention, Gewaltverhinderung eingeübt. An unserer Schule ist die Streitschlichtung<br />
seit 2001 eine feste Einrichtung. Ebenso ist in den letzten Jahren die Berufswahlvorbereitung<br />
u n d B e r u f s o r i e n t i e r ung zu einem wesentli chen Ausbildungsinhalt geworden.<br />
Das <strong>Schulprogramm</strong> will unsere pädagogische Grundorientierung widerspiegeln und soll zu<br />
einer Entwicklung beitragen, die eine persönliche Identität, Selbstvertrauen und Lebensfreude,<br />
Verantwortungsbewus stsein, Engagement und Hilfsbereitschaft beinhaltet.<br />
Alle Mitglieder der Schulgemeinde sind daher aufgerufen, an der Weiterentwicklung dieses<br />
<strong>Schulprogramm</strong>s nach ihrem Ermessen und ihren Fähigkeiten mitzuwirken.<br />
1 Situation und Rahmenbedingungen<br />
- 3 -
Standort, Schülerschaft und Kollegium der <strong>Ludgerus</strong>-<strong>Hauptschule</strong><br />
Die <strong>Ludgerus</strong>- <strong>Hauptschule</strong> ist eine der beiden katholischen <strong>Hauptschule</strong>n in Rhede.<br />
Der Schulname erinnert an den heiligen Liutger, aus dessen Missionsgebiet im wesentlichen<br />
das Bistum Münster geworden ist.<br />
Die Lage der Schule nahe dem Stadtzentrum und die gleichzeitig ländliche Umgebung<br />
ermöglicht, schulortbezogenes Lernen in den Unterricht zu integrieren.<br />
Das Einzugsgebiet unserer Schule ist das südliche Rheder Stadtgebiet. Die innerörtliche<br />
Grenze der Schulbezirke verläuft entlang der ehemaligen Bahnlinie Bocholt - Borken.<br />
Rhede ist eine ländlich geprägte Kleinstadt im Westen des Münsterlandes, von deren früherer<br />
Abhängigkeit von der Textilindustrie nichts mehr zu spüren ist. Das jetzige Bild der Stadt<br />
wird geprägt durch neu angesiedelte, verschiedenartigste Industriezweige. Von daher sind die<br />
Familien, aus denen unsere Schüler stammen, handwerklich, kleinindustriell oder bäuerlich<br />
bestimmt.<br />
Ein vielfältiges, reichhaltiges Vereinsleben prägt die Stadt auf kulturellem und<br />
sportlichem<br />
Gebiet.<br />
Im Rheder Schulzentrum sind zwei <strong>Hauptschule</strong>n und eine Realschule untergebracht.<br />
Jede dieser Schulen ist als selbstständige Einheit ausgestattet. Als Schulträger sorgt die Stadt<br />
Rhede für eine gute Ausstattung der ö rtlichen Schulen. So gehören zur <strong>Ludgerus</strong>-<strong>Hauptschule</strong><br />
neben 12 Klassenräumen modern ausgestattete Fachräume für Technik, Physik,<br />
Hauswirtschaft, Musik, Biologie und Informatik, eine Schülerbücherei, Lehrmittelräume und<br />
Räume für Schulleitung und Sekretaria t. Es fehlen uns leider noch Fachräume für<br />
Textilgestaltung und Kunst. Darüber hinaus ist die räumliche Situation im<br />
Verwaltungsbereich sehr beengt.<br />
Unsere Schule verfügt über einen eigenen Skistall. In den letzten Jahren erfreuen sich als<br />
Skifreizeiten konzipierte Klassenfahrten großer Beliebtheit unter den Schülern. Zwei<br />
Kollegen sind als Skilehrer ausgebildet und besitzen somit die vorgeschriebene Qualifikation<br />
für die Durchführung der Skikurse.<br />
Die Schülerzahl der <strong>Ludgerus</strong> - <strong>Hauptschule</strong> lag in den let zten Jahren bei etwa 300 Schülern.<br />
Etwa 10% unserer Schüler kommen aus den Ortsteilen Krommert und Büngern und sind<br />
damit Fahrschüler mit einem etwa dreiviertelstündigen Schulweg.<br />
- 4 -
Der Anteil der ausländischen Schüler liegt ebenfalls seit Jahren konstant bei etwa 10%.<br />
Dem Kollegium der <strong>Ludgerus</strong>- <strong>Hauptschule</strong> gehören 18 Lehrer und Lehrerinnen an, von denen<br />
drei Lehrkräfte Teilzeitkräfte sind.<br />
A l t e r s g r u p p e Anzahl der Lehrkräfte<br />
20- 30 Jahre 0<br />
31- 40 Jahre 4<br />
41- 50 Jahre 1<br />
51- 60 Jahre 11<br />
Über 60 Jahre 2<br />
Summe 18<br />
Zu dem nicht -pädagogischen Personal gehören die Schulsekretärin und der Hausmeister.<br />
Bisherige <strong>Schulprogramm</strong>arbeit<br />
Die Lehrer der LHS beschäftigen sich mit Einzelthemen des <strong>Schulprogramm</strong>s schon seit dem<br />
Jahr 1994. Seit Januar 1995 war die Entwicklung des <strong>Schulprogramm</strong>s stets ein Thema der<br />
Lehrerkonferenzen.<br />
Die beiden ersten großen Abschnitte der <strong>Schulprogramm</strong>arbeit bezogen sich auf die schriftliche<br />
Fixierung des Schulprofils der LHS und auf eine Neufassung der bestehenden Richtlinien und<br />
L ehrpläne. Als besondere Schwerpunkte unserer <strong>Schulprogramm</strong>arbeit wurden in der Folgezeit<br />
unter anderem folgende Themen in den Vordergrund gerückt:<br />
• Organisatorische Neuplanung und Intensivierung der Berufswahlvorbereitung<br />
einschließlich einer zeitlichen Ne u o r d n u n g d e r P r a k t i k a i m 8 . , 9 . u n d 1 0 . S c h u l j a h r<br />
• Informationstechnische Grundbildung und Medienkompetenz<br />
• Beratung und Konfliktlösung (Mediation)<br />
• Ausrichtung an den neuen Kernlehrpläne<br />
- 5 -
2 Leitlinien für die pädagogische Arbeit an unserer Schule<br />
Schüler<br />
Gegenseitige Achtung<br />
und Toleranz<br />
LHS<br />
Lernfreude<br />
Eigenverantwortung<br />
Selbstwertgefühl<br />
Teamfähigkeit<br />
Selbstständigkeit<br />
Gutes<br />
Lernklima<br />
Gewaltfreie<br />
Schule<br />
Lehrer<br />
Stärken<br />
fördern<br />
Einander<br />
ernst<br />
nehmen<br />
Öffnung von<br />
Schule<br />
Eltern<br />
Mit der zunehmenden Veränderung der Arbeitswelt und den vielfältigen Umbrüchen in der<br />
Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler ändern sich auch die Wege, die die Schülerinnen<br />
und Schüler befähigen sollen, verantwortlich und sinnerfüllt handeln zu kön n e n .<br />
Nur wenn Schülerinnen und Schüler Problem lösendes Denken, entdeckendes Lernen und Projekt<br />
orientiertes Handeln verinnerlicht haben, können sie sich in der sich stetig verändernden<br />
Gesellschaft<br />
zurechtfinden.<br />
- 6 -
A) Positives Lernklima als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen<br />
Zur Förderung und Erhaltung eines positiven Lernklimas gehört eine Fülle von Maßnahmen.<br />
Ganz besonders wesentlich sind:<br />
Äußere Voraussetzungen:<br />
1. Klassengestaltung<br />
2. Schulgebäude<br />
3. Schulhof<br />
Schulleben:<br />
Gestaltet durch das Miteinander<br />
von:<br />
? Eltern<br />
? Schülern<br />
? Lehrern<br />
Die LHS ist der Arbeitsplatz für Schüler und Lehrer. Jeder hat eine spezifische Aufgabe zu<br />
verr ichten (s. Transparenz).<br />
Erfolgreiche Arbeit zu verrichten heißt vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen<br />
Beteiligten.<br />
Die Lehrer betrachten sich als im Dienst für ihre Schüler stehend, sie zu unterstützen, zu<br />
fördern, für sie – nicht gegen sie – da zu sein, ihnen zu helfen.<br />
Das kann aber nur gelingen, wenn Schüler sich darauf einlassen und ihre Eltern beide<br />
Gruppen unterstützen.<br />
Ein von Vertrauen zueinander geprägtes Arbeiten hat natürlich als Grundlage eine sprachliche<br />
E b e n e , d i e v o n F r e u n d l i c h k eit, Höflichkeit, Verständnis (Toleranz) und Großzügigkeit geprägt<br />
ist.<br />
MITEINANDER ARBEITEN – EINANDER HELFEN.<br />
L ehrer(n)<br />
H e l f e n<br />
S chüler(n)<br />
- 7 -
B) Transparenz<br />
Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Schüler, Eltern und Lehrern kann nur funktionieren,<br />
wenn alle Beteiligten wissen, we lche Erwartungen sie haben können und was von ihnen selbst<br />
geleistet werden muss.<br />
Wir wollen offen legen, also transparent machen, wie das funktioniert.<br />
Folgendes soll dazu beitragen:<br />
Lehr- und Lernvereinbarung:<br />
• Vereinbarung zwischen Schüler, Eltern und Lehrern, die Anforderungen und<br />
Erwartungen dokumentieren, und zu der sich alle Beteiligten durch Unterschriften<br />
verpflichten.<br />
Mitteilungsheft:<br />
• schriftliche Kommunikationsbrücke zwischen Schule und Eltern<br />
o Verhaltensregeln für eine erfolgreiche Zeit an der LHS<br />
o Mitteilung der Erziehungsberechtigten wegen Schulversäumnis<br />
o Mitteilung zwischen Schule und Elternhaus<br />
o Zensurenübersicht in den Hauptfächern<br />
o Schulordnung der LHS<br />
Alle Kolleginnen und Kollegen, die für die Erziehung und Bildung der Kinder zuständig<br />
und verantwortlich sind, freuen sich, wenn die Erziehungsberechtigten regelmäßig in das<br />
Mitteilungsheft hineinschauen und eventuelle Eintragungen von schulischer Seite zur<br />
Kenntnis nehmen und diese Kenntnisnahme durch ihre Unterschrift bestätigen.<br />
Portfolio:<br />
• Lerntagebuch, Sammlung selbst erarbeiteter Ergebnisse<br />
• Klassenarbeiten und Tests, Merkblätter<br />
• Eigene Lernstandseinschätzung<br />
- 8 -
Kriterien für E-Kurse und Klasse 10B<br />
Grundsätzliche Haltung<br />
• Aufgeschlossenheit für das Fac h und das Lernen insgesamt.<br />
• Bereitschaft Hilfen und Korrekturen anzunehmen.<br />
• Fähigkeit, Gelerntes auf andere Situationen zu übertragen.<br />
• Zielstrebigkeit.<br />
Arbeitshaltung<br />
• Bereitschaft zu mündlichem und schriftlichem Handeln (Mitarbeit).<br />
• Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer.<br />
• Entwicklung von Eigenverantwortung und Selbständigkeit.<br />
• Bereitschaft zum zügigen Erledigen von gestellten Aufgaben.<br />
• Regelmäßiges Erledigen von Hausaufgaben.<br />
Fachspezifische Anforderungen<br />
• Englisch:<br />
o Verfügbark eit von sprachlichen Mitteln ( Aussprache, Wortschatz,<br />
Grammatik, Redemittel)<br />
o Verständlichkeit und Korrektheit bei der<br />
Sprachverwendung<br />
• Mathematik: E- Kurse<br />
Schüler können Rechenoperationen im bekannten Zahlenraum sicher anwe nden, nutzen<br />
mathematische Modelle und wenden Strategien zur Problemlösung an. Sie sind in der<br />
Lage, ihre Lösungen zu überprüfen und ihre Ergebnisse zu bewerten und darzustellen.<br />
• Klasse 10 Typ B<br />
Sie vergleichen und bewerten verschiedene mathematische M odelle in Realsituationen<br />
und sind in der Lage, ihre Problemlösungsstrategie in einer angemessenen Fachsprache zu<br />
erläutern. Sie sind in der Lage, mit symbolischen, formalen und technischen Elementen<br />
der Mathematik umzugehen und Hilfsmittel (u. a. TR und P C-Software) sinnvoll<br />
einzusetzen.<br />
• Klassenarbeiten<br />
Ergebnisse schriftlicher Arbeiten sind keine alleinige Entscheidungsgrundlage für die<br />
Zugehörigkeit zu einem E- Kurs.<br />
Erwartungen an Schüler – Eltern -Lehrer:<br />
- 9 -
- 10 -
Bewertung von Schülerleistungen<br />
• Im Unterricht erbrachte Leistungen<br />
o Hausaufgaben<br />
o Heftführung<br />
o Tests<br />
o Leistungsbereitschaft und Sozialverhalten (z.B. kooperative Leistungen im<br />
Rahmen einer Gruppen -, Partner-, Projektarbeit)<br />
o Arbeitshaltung<br />
o aktive und passive Mitarbeit<br />
o freiwillige Arbeiten<br />
o Klassenarbeiten<br />
Inhalts-, Lernweg- und Lernzieltransparenz<br />
• was, wie, warum<br />
• Den Schülern Unterrichtsabläufe transparent machen:<br />
o Thematisch – inhaltlich<br />
o Auf welchem Lernweg<br />
o Begründung des Themas<br />
Maßnahmen bei Verstößen gegen Vereinbarungen:<br />
• Elternbenachrichtigung bei Hausaufgabenversäumnissen (Mitteilungsheft)<br />
• Elterninformationen<br />
• Beratungsgespräche Schüler – Eltern – Klassenlehrer – Fachlehrer bei Problemen<br />
• Programm eigenverantwortliches Denken und Handeln (Trainingsraum)<br />
o Geltende Regeln verbindlicher machen<br />
o Einen hilfreichen Denkprozess bei störenden Schülern einleiten<br />
o Die Wahrnehmung des eigenen Verhaltens schulen<br />
o Dazu beitragen, dass auch die Rechte der anderen gewahrt bleiben.<br />
- 11 -
C) Selbstgesteuertes Lernen<br />
Ein wichtiger Punkt unserer schulischen Arbeit ist das selbstständige und kooperative Lernen.<br />
Ausgehend von der Erkenntnis, dass Lernen lebenslanges Lernen bedeutet, ist es zwingend<br />
notwendig, dass unsere Schüler das Lerne n l e r n e n .<br />
Ziel ist mehr Verantwortung und Selbstständigkeit.<br />
• Die Schüler sammeln gelungene und besonders aussagekräftige Arbeiten<br />
• Sie dokumentieren anhand von Arbeitsproben ihren Lernfortschritt<br />
• Sie schätzen ihren Lernstand selbst ein<br />
• Sie betrachten ihren gesamten Lernprozess<br />
• Sie erkennen ihre eigenen Stärken und Schwächen<br />
• Sie setzen neue Lernziele fest<br />
• Sie probieren verschiedene Lern- und Arbeitstechniken aus und bewerten diese<br />
• Sie entwickeln basierend auf ihren Lernerfahrungen eine n e i g e n e n L e r n s t i l<br />
• Sie entscheiden selbst über weitere Lernschritte<br />
• Sie übernehmen Verantwortung für das eigene Lernen<br />
• Sie haben Mitspracherecht bei der Auswahl der Lerninhalte und der Festlegung<br />
von Zeitrahmen<br />
Aufgabe der Lehrer ist es, den Sc hülern dafür die Voraussetzungen zu schaffen durch:<br />
Förderung - der Kommunikationsfähigkeit<br />
- methodischer Kompetenzen, Lern- und<br />
Arbeitstechniken<br />
Stärkung - der Anwendungsorientierung<br />
Gemeinsame Planung -fächerübergreifender Themen<br />
Bereitstellung -verschiedener Unterrichtsformen<br />
- 12 -
D) Öffnung der Schule nach außen<br />
Unter Öffnung von Schule nach außen verstehen wir, die Grenzen der herkömmlichen<br />
Unterrichtsgestaltung auszuweiten und neue Anregungen in die unsere Arbeit einzubeziehen.<br />
Dabei werden folgende Ziele verfolgt:<br />
Vorhaben:<br />
• Neue soziale Erfahrungen in Schule und im schulischen Umfeld zu ermöglichen.<br />
• Wirklichkeit selbstständig zu erschließen.<br />
• Produktorientiert zu lernen und zu arbeiten.<br />
• Kreative Gestaltungskräfte zu wecken.<br />
• I n d i v iduelle Fähigkeiten und Interessen zu fördern.<br />
• Sich mit unterschiedlichen Standpunkten und Erfahrungen auseinander zusetzen,<br />
sie auch aus der Perspektive des anderen wahrzunehmen und differenziert<br />
aufzuarbeiten.<br />
• Beruf / Arbeitswelt<br />
• Kultur<br />
S i e h e Berufswahlvorbereitung<br />
o Besuch von Musik - und Theateraufführungen<br />
o Selbstaufführung von Musik - und Theaterstücken<br />
o Schulfeste und religiöse Veranstaltungen<br />
o Beteiligung an Kunstausstellungen in Rhede und Umgebung<br />
o Beteiligung an Kult ur- Guuut der Stadt Rhede<br />
o Beteiligung an Schülerwettbewerben<br />
o Besuch von Museumsausstellungen<br />
o Film AG<br />
• Aufsuchen außerschulischer Lernorte<br />
z.B.<br />
o Besuch einer Imkerei<br />
o Besuch einer Moschee<br />
o Waldexkursionen<br />
o Betriebsbesichtigungen.<br />
• Externe Qualifikationen<br />
z.B.<br />
o Angelschein<br />
o Mofaführerschein<br />
o Maschinenschreiben<br />
o Streitschlichtung<br />
- 13 -
3 Schulische Arbeitsfelder<br />
A) Förderung des Lesens und Schreibens<br />
Da Denken und Sprechen in wechselseitigem Zusammenhang stehen, ist es nach w ie vor wichtig,<br />
die Sprache als Mittel und Ziel bewusst und differenziert zu fördern.<br />
Die<br />
Sprechk<br />
u l t u r<br />
Die<br />
Gesprächsk<br />
u l t u r<br />
Der Schüler soll<br />
bei jedem Beitrag<br />
und in allen Fächern<br />
laut und deutlich sprechen<br />
möglichst in ganzen Sätzen<br />
antworten<br />
standardisierte<br />
Formulierungen<br />
e i n ü b e n u n d s o s e i n a k t i v e s<br />
Sprachrepertoire<br />
erweitern<br />
Der Schüler soll<br />
durch<br />
bedachte<br />
Sprachanwendung<br />
seine<br />
Sozialkompetenz<br />
ausbauen<br />
zuhören<br />
können<br />
den anderen ausreden lassen<br />
sich auf den Vorredner<br />
b e z i e h e n<br />
durch Wortwahl und<br />
Sachlichkeit Fairness und<br />
Rücksicht<br />
üben<br />
Zusammenhängendes<br />
vortragen (z.B. Referate)<br />
Der Lehrer soll<br />
selbst in allen Unterrichtsstunden<br />
ein gutes Vorbild geben<br />
durch variierte Impulsgebung<br />
immer neue Sprechanlässe geben und<br />
transparent machen, dass es um die<br />
Automatisierung<br />
von<br />
(mdl.) Sprachgebrauch zur<br />
Förderung der Kommunikationsfähigkeit<br />
geht<br />
Der Lehrer soll<br />
Gesprächsregeln erarbeiten und einüben<br />
lassen<br />
Ruhe und Aufmerksamkeit einfordern<br />
Partnerschaftliche<br />
Gesprächsführung<br />
a n s t r e b e n<br />
Zur Art i k u l a t i o n d e r e i g e n e n M e i n u n g<br />
motivieren<br />
Vorleben, dass Blickkontakte für<br />
Gespräche wichtig sind<br />
Durch Partner - , Gruppenarbeit,<br />
Projektunterricht u.ä. intensive Übungen<br />
zur „Absprache“ anbieten<br />
In vielerlei Weise können Übungen im Bereich Lesen und Schreiben zur punktuellen und<br />
langfristigen Konzentrationsförderung eingesetzt werden. Konzentrationsfähigkeit als<br />
unabdingbare Lernvoraussetzung sollte daher in den Nebenfächern mit sinnvollen Lese - und<br />
Schreibaufgaben genau so trainiert werden wie im Deutsc h u n t e r r i c h t .<br />
S c h r e i b e n Der Schüler soll Der Lehrer soll<br />
- 14 -<br />
selbst in allen Unterrichtsstunden
L e s e n Der Schüler soll<br />
durch Abschreiben die<br />
Rechtschreibsicherheit erhöhen und<br />
seinen Wortschatz erweitern<br />
auf Schönschrift und eine sorgfältige<br />
Heftführung<br />
achten<br />
Grammatik- und Orthographieregeln in<br />
allen schriftlichen Arbeiten a nwenden<br />
und nicht zwischen dem Fach Deutsch<br />
und anderen Fächern Unterschiede<br />
machen<br />
sich darin üben, wichtige Inhalte<br />
möglichst schnell aus dem Kontext zu<br />
erschließen (sinnerfassend)<br />
im sinnbetonten Vorlesen sicher<br />
we r d e n<br />
die Welt der Unterhaltungsliteratur<br />
kennen und in ihrer Qualität zu<br />
unterscheiden lernen<br />
das Lesen von Büchern als entspannende,<br />
Phantasie anregende und<br />
informative Freizeitgestaltung schätzen<br />
lernen<br />
ein gutes Vorbild geben<br />
durch variierte Impulsgebung<br />
immer neue Sprechanlässe geben und<br />
transparent machen, dass es um die<br />
Automatisierung<br />
von<br />
(mdl.) Sprachgebrauch zur<br />
Förderung der Kommunikations -<br />
fähigkeit geht<br />
Der Lehrer soll<br />
verschiedene Arten von Info r m a t i-<br />
onstexten (möglichst lebensnahe<br />
Gebrauchstexte) auswählen<br />
motivierende<br />
Vorleseübungen<br />
veranstalten<br />
auch in Nebenfächern Kerntexte<br />
mehrfach laut vorlesen lassen<br />
an angebotenen Vorlesewettbewerben<br />
teilnehmen und einen schulinternen<br />
Lesewettbewerb<br />
durchführen<br />
mit allen Mitteln die Leselust der<br />
Schüler wecken und ausbauen (z.B.<br />
Anlegen<br />
eines<br />
Lesetagebuches) die Möglichkeiten<br />
der eigenen Weiterbildung durch<br />
Lesen ausgesuchter Texte propagieren<br />
sorgfältig nacharbeiten lassen<br />
Unsere Schule besitzt eine gut sortierte, moderne Schülerbücherei. Ein regelmäßiger Besuch<br />
sollte fester Bestandteil des Deutschunterrichtes sein.<br />
• Die Schüler sollen angeleitet werden Bücher zu lesen als Teil der Freizeitgestaltung.<br />
• Bücher Mitschülern vorzustellen und zu empfehlen.<br />
• Sachbücher für den Fachunterricht zu nutzen<br />
• Ein Besuch der öffentlichen Bücherei im Ort ist in die Leseförderung einzubinden.<br />
B) Berufswahlvorbereitung<br />
Viele Schüler treffen bereits am Ende des 8. Schuljahres eine Berufswahl, ohne die Vielfalt der<br />
- 15 -
Ausbildungsberufe kennen gelernt zu haben. Sie wählen häufig aus nicht mehr als 10<br />
verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Hier setzt die Schule mit einer gezielten<br />
Berufswahlvorbereitung<br />
an.<br />
Erfolgreich war auch das Konzept, Eltern und ehemalige Schüler in die Klasse einzuladen, die<br />
dann über ihre Berufe sprachen. Die Schüler empfanden diese Informationen authentischer, weil<br />
sie durch Praktiker vermittelt wurden und nicht durch Theoretiker (Lehrer).<br />
Klasse 8<br />
1. Zu Beginn des Schuljahres werden die Schüler auf eigenständige Betriebser kundungen<br />
vorbereitet. Sie erarbeiten schriftliche Anfragen und lernen im Rollenspiel telefonische<br />
und persönliche Anfragen.<br />
2. Schüler lernen Wissenswertes aus der Arbeitswelt in Informationsstunden mit einigen<br />
Eltern als Referenten kennen.<br />
3. Schüler stellen eine Liste der von ihnen gewünschten Berufe bzw. Betriebe auf. Diese<br />
Liste wird durch Anregungen des Klassenlehrers und/oder Fachlehrers für<br />
Wirtschaftslehre<br />
ergänzt.<br />
4. Schüler bilden anhand dieser Liste je nach Berufsinteresse kleine Gruppen von bis zu 6<br />
Personen. Diese Gruppen erkunden nach Voranmeldung einzelne Betriebe. Sie nehmen<br />
dabei die Hilfe von Eltern bei der Organisation dieser Betriebserkundungen in Anspruch.<br />
Die Schülerinnen und Schüler legen bei diesen Betriebserkundungen vor allem Wert<br />
darauf, die einzelnen Berufsbilder kennen zu lernen. Zusätzlich werden vorbereitete<br />
Betriebsbesichtigungen mit der ganzen Klasse durchgeführt.<br />
5. Die einzelnen Berufsbilder werden aufgeschrieben und über das „Mini- BIZ“ d e n a n d e r e n<br />
Schülern zur Verfügung gestellt.<br />
Klasse 9<br />
1. Schüler melden sich endgültig zum ersten 2- wöchigen Schülerbetriebspraktikum an. Vor<br />
Beginn des Praktikums sprechen sie noch einmal in den Betrieben vor, um evtl.<br />
Einzelheiten zum Ablauf des Praktikums zu klären.<br />
2. Während des Praktikums schreiben die Schüler Tagesberichte. Außerdem stellen sie<br />
wenigstens 2 Tätigkeiten ausführlich dar.<br />
3. Die Schüler werden während des Praktikums vom Klassenlehrer betreut. Betreuer oder<br />
Betriebsinhaber werden gebeten, sich für ein kurzes Gespräch mit dem Betreuungslehrer<br />
Zeit zu nehmen. Die Beurteilung der Schüler seitens des Betriebes ist für weitere Hilfen<br />
bei der Berufswahl sehr wichtig.<br />
4. In der Zeit von Februar bis Mai ist wenigstens eine weitere Betriebse rkundung in<br />
Kleingruppen vorgesehen. Den Schülern wird geraten einen Betrieb zu erkunden, in dem<br />
ein ihnen bisher völlig unbekannter Beruf ausgeübt wird.<br />
5. Im April findet das zweite 2 -wöchige Schülerbetriebspraktikum statt. Die Vorbereitung,<br />
Durchführung u nd Nachbereitung erfolgt wie beim ersten Praktikum.<br />
Klasse 10<br />
1. Die Schüler bewerben sich um eine Ausbildungsstelle. Dabei helfen ihnen u.a. die<br />
Erfahrungen im 2- wöchigen Schülerbetriebspraktikum sowie individuelle Hilfen des<br />
Klassenlehrers.<br />
- 16 -
2. Zu Beginn des Schuljahres findet das dritte Schülerbetriebpraktikum mit<br />
entsprechender Dokumentation der Ergebnisse statt.<br />
3. Im Deutschunterricht wird noch einmal das Verfassen (und richtige Formatieren) von<br />
Bewerbungsschreiben und Lebensläufen geübt.<br />
4. V o r s t e l l u ngsgespräche werden geübt (Video) und beispielhafte Eignungstests vorgestellt<br />
und geübt.<br />
5. Die zuständigen Mitarbeiter des Arbeitsamtes führen Einzelberatungen durch.<br />
6. Weiterhin findet ein Bewerbungstraining mit außerschulischen Fachkräften statt.<br />
7. Weitergeführt werden auch die Informationsveranstaltungen durch Lehrkräfte der<br />
Berufskollegs Bocholt, die über Anforderungen und Möglichkeiten an den Berufsschulen<br />
informiert.<br />
C) Musische Bildung<br />
Ziel der musischen Bildung ist es, bei unseren Schülern kreatives Handeln zu fördern. Dieses<br />
fließt in die Unterrichtsarbeit sämtlicher Fächer ein. Der musische Bereich hat hier einen<br />
besonderen Stellenwert.<br />
Musikunterricht<br />
Die musikalische Gestaltung von Festen im Verlauf eines Schuljahres hat eine lange Tradition.<br />
Im Rahmen des Musikunterrichtes erhalten die Schüler neben einer vokalen Anleitung auch eine<br />
instrumentale Grundbildung. Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts und freiwilliger<br />
Arbeitsgemeinschaften werden instrumentale Fertigkeiten auf den Instrumenten Keyboard,<br />
Schlagzeug, Percussion, Gitarre und Bass vermittelt; Möglichkeiten zum Proben und zum<br />
Zusammenspiel werden ermöglicht. Darüber hinaus formieren sich aus diesen unterschiedlichen<br />
Veranstaltungen eigene Schülerbands. Als Gelegenheiten zur Prä sentation im Laufe eines<br />
Schuljahres bieten sich folgende:<br />
Entlassfeier der 10.- Klässler<br />
Begrüßung der 5.- Klässler<br />
Musikalische Untermalung des Schulgottesdienstes<br />
Teilnahme an städtischen Veranstaltungen<br />
(Kultur Guuuut, Schulkultur, Sportlerehrung)<br />
Theater -AG<br />
Nach jahrelang erfolgreicher Arbeit findet zur Zeit keine Theater- AG statt. Ein Wiederaufbau<br />
wird angestrebt.<br />
Teilnahme an Wettbewerben und Veranstaltungen.<br />
Im Rahmen des Deutschunterrichts des 6. Schuljahres nimmt unsere Schule regelmäßig a m<br />
Lesewettbewerb des Kreises Borken teil. Sinnerfassendes und - gestaltendes Lesen wird so<br />
schwerpunktmäßig gefördert.<br />
- 17 -
Jedes Jahr findet in Rhede ein Malwettbewerb statt, der von einer Bank zu einem bestimmten<br />
Motto ausgeschrieben wird. Daran haben schon zahlreiche Schüler unserer Schule im Rahmen<br />
des Kunstunterrichtes mit Erfolg teilgenommen.<br />
Alle zwei bis drei Jahre beteiligen sich die Schüler im Rahmen des Kunstunterrichts an der<br />
Ausstellung „ Rhede kreativ“ im Museum für das Apotheker und Ärztewesen.<br />
Jährlich findet, durchgeführt von der Stadt Rhede, die Veranstaltung „ Kultur Guuut“ statt.<br />
Hieran nimmt die Schule regelmäßig mit verschiedenen Kulturbeiträgen teil.<br />
Verteilung der musischen Schwerpunkte auf die Klassen 5 bis 10<br />
6. Schuljahr: Teilnahme am Lesewettbewerb des Kreises Borken und an dem Vorlesewettbewerb<br />
des Deutschen Buchhandels.<br />
7. Schuljahr: Musik- AG, evtl. freiwillige AG Keyboard bzw. Gitarrenschulung<br />
9./10. Schuljahr: Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts Musizieren in der Schüler b a n d .<br />
Begleitung von Schulentlassungen und weiteren Schulveranstaltungen.<br />
Schüler aller Jahrgänge nehmen jährlich an dem Malwettbewerb der Volksbanken teil.<br />
Einzelnen Klassen und Schülergruppen sollte der Besuch von kulturellen Veranstaltungen<br />
möglich gemacht werden. ( Theateraufführungen, Konzerte, Museumsbesuche...). Jeder Schüler<br />
sollte während seiner Schulzeit wenigstens einmal eine solche Veranstaltung besucht haben.<br />
Film-AG<br />
Seit dem Schuljahr 2002/2003 gehört eine Film- AG zum festen Angebot der<br />
Arbeitsgemeinschaften der Jahrgangsstufen 7 und 8.<br />
Inhaltlich werden dort schüler- und schulbezogene Themen mit dem Medium Film aufgearbeitet.<br />
Folgende Themen wurden und werden als Schwerpunkte gesetzt: Allgemeine schulbezogene<br />
Themen, Mobbing, Ausgrenzu ng, alterspezifische und pubertätsbezogene Themen. Kritische<br />
Auseinandersetzung mit dem Medium TV (z.B. Talkshows).<br />
Durch den „spielerischen“ und aktiven Umgang mit dem Medium Film werden unterschiedlichste<br />
Formen des mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauchs eingeübt und durch Selbstreflektion<br />
kritisch betrachtet. Viele Formen des schriftlichen Sprachgebrauchs , wie das Schreiben von<br />
Drehbüchern, Dialogen, Aufsätzen und Szenen werden geübt.<br />
Der mündliche Sprachgebrauch, wie freies und geplantes Reden ist Bestandteil der<br />
„schauspielerischen“ Tätigkeiten der teilnehmenden Schüler. Hier entsteht durch das Betrachten<br />
des Produzierten ein hohes Maß an Selbstkontrolle. Dieses bezieht sich auch auf den Gebrauch<br />
von Körpersprache (Gestik/Mimik).<br />
D u r c h d e n a ktiven Gebrauch des Mediums Film/Video erhält der Schüler Einblicke in die Welt<br />
- 18 -
des Films und er ist nicht nur passiver Konsument, sondern kritischer Begleiter.<br />
Im technischen Bereich wird der Umgang mit Kamera und Equipment eingeübt. Die Bedeutung<br />
von Mus ik zur Unterstützung von Szenen, Gefühlen und Eindrücken wird deutlich.<br />
D) Streitschlichtung<br />
Angebot von Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt in der Erprobungsstufe<br />
Zunächst versucht jeder Lehrer, den gerade bestehenden Konflikt sofort zu lösen. Bei<br />
Ergebnislosigkeit wird im Regelfall der Klassenlehrer zu einem Gespräch mit dem Schüler und<br />
dem Fachlehrer eingeschaltet. Als weitere Möglichkeit wird der Schülerin/dem Schüler die<br />
Möglichkeit aufgezeigt, den Konflikt mit Hilfe des SV-Lehrers, des Beratungslehrers oder der<br />
Streitschlichter zu lösen.<br />
Im Januar 2001 wurden 12 Schülerinnen und Schüler sowie 6 Lehrerinnen/Lehrer zu<br />
Streitschlichtern ausgebildet. Die Schülerinnen und Schüler sollen nach ihrer Ausbildung<br />
Schülerkonflikte ohne Mithilfe der Lehrer in Teamarbeit lösen. Die ausgebildeten<br />
Lehrerinnen/Lehrer bilden in Projektarbeit in Klasse 9 neue Streitschlichter aus, die in Klasse 10<br />
die Streitschlichtungsarbeit übernehmen.<br />
Ziele der Streitschlichtung sind:<br />
• Lösen der Konflikte<br />
• Erlernen von Konf liktlösungsmodellen<br />
• Verringerung von Streitigkeiten<br />
• Schaffung einer angstfreieren Atmosphäre als Grundlage zur Verbesserung des<br />
Lernklimas<br />
Dieser Maßnahmenkatalog soll die Erreichung der in der pädagogischen Grundorientierung<br />
angesprochenen Ziele f ördern.<br />
E) Verkehrserziehung<br />
Vorbemerkungen<br />
In den Empfehlungen für die Verkehrserziehung in der Schule (Beschluss der KM Konferenz<br />
vom 17.06. 1994) heißt es in der Vorbemerkung:<br />
”Verkehrserziehung ist der Schule als Teil ihres Unterrichts- und Er ziehungsauftrages<br />
zugewiesen.” In der Verkehrserziehung geht es aber nicht nur darum, den Schülern<br />
- 19 -
verkehrsspezifische theoretische Kenntnisse zu vermitteln. So wichtig dieses Wissen um die<br />
bestehenden Verkehrsverhältnisse und -regeln auch ist, es sollte vor allem darum gehen, den<br />
Schülern die richtige Einstellung zu vermitteln und sie durch möglichst viele verkehrsnahe<br />
praktische Übungen in die Lage zu versetzen, durch sicheres und gekonntes Verhalten<br />
mitverantwortlich am Straßenverkehr teilzunehmen. Neben dem Wissen um die Gefahren und<br />
Risiken im heutigen Straßenverkehr muss das richtige Verhalten im Verkehr durch gezielte<br />
Beobachtungen und möglichst viele praktische Übungen trainiert werden.<br />
Schwerpunkte<br />
Dies gilt ganz besonders für die Verkehrserziehung in Klasse 5 wegen des Schulwechsels und<br />
den damit verbundenen Risiken des neuen Schulweges. Ein weiterer Schwerpunkt des<br />
Verkehrsunterrichtes an unserer Schule ist der Mofakurs in Klasse 9. Dieser wird im Rahmen des<br />
Wahlpflichtunterrichtes angeboten, um den Jugendlichen den Übergang zur motorisierten<br />
Teilnahme am Straßenverkehr zu erleichtern. Ziel der theoretischen und praktischen Ausbildung<br />
soll sein, dass sich die Einstellung der Jugendlichen zum Mofa- und Rollerfahren im Hinblick auf<br />
die Inhalte der Verkehrssicherheit und Gefahrenlehre im Sinne einer größeren<br />
Verantwortungsbereitschaft<br />
ändert.<br />
Klasse 5<br />
Projekt „Der sichere Schulweg”<br />
Der Schüler soll seinen neuen Schulweg unter dem Aspekt der Sicherheit und unter<br />
ökonomischen und verkehrspolitisc hen Erwägungen wählen, gefährliche Situationen<br />
erkennen und sich auf ständige Veränderung der Verkehrssituation einstellen lernen.<br />
Er soll den neuen Schulweg angemessen und gefahrlos bewältigen und bereit sein, sich als<br />
Partner im Straßenverkehr zu verhalten.<br />
Der zeitliche Rahmen des Projektes sollte 10 Unterrichtsstunden nicht unterschreiten. Am ersten<br />
Schultag erhalten die Eltern bei der Einschulung ihrer Kinder einen Schulwegplanvorschlag mit<br />
dem sichersten Schulweg ihres Kindes. Diesen Weg sollten dann alle Eltern mit ihren Kindern<br />
möglichst „eintrainieren”.<br />
Ergänzend dazu werden besondere Gefahrenpunkte des Schulweges besichtigt. Die Schüler<br />
werden auf Risiken (z.B. Überqueren der B 67) hingewiesen. Richtiges Verhalten soll in<br />
Kleingruppen eingeübt werden. Dazu wird erneut die Mithilfe der Eltern erforderlich.<br />
Eine mögliche Projektkonzeption findet sich in den Handreichungen für Verkehrserziehung.<br />
Radfahraufbaukurs<br />
In den Grundschuljahrgängen 3 und 4 ist der Grundkurs Radfahren längst Bestandte il des<br />
”normalen” Unterrichts geworden. Die Schüler schließen diesen Kurs mit der Radfahrprüfung<br />
unter Mitarbeit von Eltern, Lehrern und Polizeibeamten ab. Neue Schulwege stellen die Kinder<br />
jedoch oft vor neue, viel größere Verkehrsprobleme als in der Grun dschule. Deshalb halten wir es<br />
an unserer Schule für sehr wichtig, die Kenntnisse aus der Grundschule aufzufrischen, sie neu<br />
bereit zu stellen und zu erweitern. Im theoretischen Teil werden u. a. folgende Themen<br />
abgehandelt:<br />
- 20 -
- das verkehrssichere Fahrrad<br />
- Verhalten auf Radwegen und Fahrbahnen<br />
- Vorfahrtsregelungen<br />
- Verkehrsschilder<br />
- Lebensretter Fahrradhelm<br />
Im ersten Schulhalbjahr findet außerdem ein Verkehrsprojekttag statt, der von den zuständigen<br />
örtlichen Polizeibeamten durchgeführt wird. Nach einer theoretischen Einweisung erfolgen in<br />
Kleingruppen fahrpraktische Übungen im örtlichen Straßenverkehr. Besonders einbezogen sind<br />
hier die Schulwege der Teilnehmer. Auch hier ist erneut die Einbindung von Eltern<br />
wünschenswert. Der zeitliche Rahme n des ge samten Radfahraufbaukurses beträgt wenigstens 10<br />
Unterrichtsstunden.<br />
Klasse 9<br />
Mofakurs<br />
Neben der Radfahrausbildung als verpflichtendem Bestandteil werden in der Sekundarstufe I<br />
auch Mofakurse angeboten. Eine kritische Distanz gegenüber dem unreflektierten Gebrauch des<br />
Verkehrsmittels Mofa soll gestärkt werden. Der Kurs will außerdem erreichen, dass nicht<br />
weiterhin alljährlich Jugendliche in großer Zahl ungeschult zu motorisierten Verkehrsteilnehmern<br />
werden. Zudem ist die Ausbildung Grundvoraussetzung für den Erwerb der Mofa<br />
Prüfbescheinigung gemäß §4a der Straßenverkehrs- Zulassungs- Ordnung (StVZO).<br />
Zur Zeit verfügt die <strong>Ludgerus</strong>- <strong>Hauptschule</strong> über fünf einsatzfähige Ausbildungsfahrzeuge<br />
(vier Mofas und ein Mofaroller).<br />
Der Kurs umfasst wenigstens 20 Unterrichtsstunden. Davon entfallen jeweils 10 Stunden auf die<br />
theoretische und praktische Ausbildung.<br />
F) Gesundheit und Sport<br />
Eine gesunde Ernährung und körperliche Bewegung sind Grundvoraussetzungen für<br />
effektives Lernen. Deshalb ist Gesundheitserziehung fester Bestandteil des Unterrichts.<br />
Für das Schulfrühstück der Schüler sind 5 Minuten der großen Pause fest eingeplant. Das<br />
Angebot des Kioskes sollte entsprechend abgestimmt werden.<br />
Ein Kurs „Gesundes Frühstück“ durch eine(n) Ernährungsberater(in) ist wünschenswert.<br />
Ab dem 6. oder 7. Schuljahr nehmen die Schüler am Anti- R a u c h e r-Wettbewerb „ Be smart -<br />
Don’t start“ als Bestandteil des Biologieunterrichtes teil.<br />
- 21 -
In den großen Pausen gibt es Gelegenheit für Ball- und Bewegungsspiele.<br />
Jährlich finden Bundesjugendspiele für alle Schüler und Leichtathletik - Stadtmeisterschaften<br />
statt. Zusätzlich nehmen gute Sportler am Wettbewerb „ Jugend trainiert für Olympia“ teil.<br />
G) Meditation für Stille und religiöse Besinnung<br />
Seit kurzem wird den Schüler n aller Jahrgänge während der Advents- u n d F a s t e n z e i t e i n m a l p r o<br />
Woche vor dem Unterricht eine ca. 15- minütige „Frühschicht“ angeboten. Bei leiser Musik und<br />
ausgewählten Impulsen oder Gebeten können die Jungen und Mädchen ihren Sehnsüchten<br />
n a c h s p ü r e n , t r a gende Spiritualität und neue Achtsamkeit empfinden.<br />
Die Zahl der Teilnehmer hat bisher ständig zugenommen und weist auf ein Bedürfnis der<br />
Jugendlichen nach solchen religiösen Ritualen hin.<br />
H) Informationstechnische Grundbildung und Medienkompetenz<br />
Konzept Informatik<br />
GRIN7<br />
Modul Inhalte Europäischer Computer Führerschein<br />
Betriebssystem<br />
Windows<br />
- Verwendung der Verzeichnisse des<br />
Servers<br />
- Ändern des Passwortes<br />
- Anlegen von Ordnern und<br />
Verzeichnissen<br />
- Kopieren von Dateien zur<br />
Druckerausgabe<br />
- Verwendung der Maustasten<br />
Betriebssysteme (Modul 2)<br />
Grundlegende Funktionen von Computer<br />
und Betriebssystem<br />
In der Desktop- Umgebung arbeiten<br />
Verwaltung von Dateien und Ordnern<br />
(organisieren, kopieren, verschieben,<br />
löschen)<br />
Mit Icons arbeiten<br />
Mit Fenstern arbeiten/Fenster bearbeiten<br />
Druckmanagement<br />
Suchfunktionen<br />
Einfaches Editieren<br />
- 22 -
Textverarbeitung<br />
MS Word<br />
Oo Writer<br />
- Eingeben von Texten<br />
- Markieren<br />
- Zeichenformatierung<br />
- Speichern, Öffnen von Dateien<br />
- Ausschneiden, Kopieren, Einfügen<br />
von Textteilen<br />
- Manuelle Korrekturen<br />
- Umbrüche<br />
- Rechtschreibprüfung<br />
- Grafiken und Bilder einsetzen<br />
- Einfache Schreib- und<br />
Gestaltungsregeln (DIN 5008)<br />
Textverarbeitung (Modul 3)<br />
Grundeinstellungen<br />
im<br />
Textverarbeitungsprogramm<br />
Grundschritte der Textverarbeitung<br />
(kopieren, verschieben, löschen, suchen etc.)<br />
Erstellen, Formatieren und Fertigstellen<br />
eines Textdokuments<br />
Druckvorbereitung<br />
Präsentation<br />
MS PowerPoint<br />
Oo Impress<br />
WP Presentations<br />
- Erstellen von Präsentationen<br />
- Auswahl der AutoLayout-Folien<br />
- Gestaltung der Hintergründe<br />
- Rahmen, WordArt- Objekte<br />
- Fülleffekte, Cliparts<br />
- Diagramme<br />
Präsentation (Modul 6)<br />
Grundlagen der Präsentation<br />
Erstellen, formatieren und vorbereiten einer<br />
Präsentation<br />
Grafiken und Diagramme verwenden<br />
Präsentation drucken<br />
Einsatz von Effekten bei<br />
Folienpräsentationen<br />
GRIN8<br />
Modul Inhalte Europäischer Computer Führerschein<br />
Tabellenkalkulation<br />
MS Excel<br />
Oo Calc<br />
WP QuattroPro<br />
- Texteingabe<br />
- Zahleneingabe<br />
- Einfache Berechnungen<br />
- Zellbezüge<br />
- Arithmetische Operatoren,<br />
Vergleichsope<br />
ratoren<br />
- Formeln<br />
- Diagramme<br />
Tabellenkalkulation (Modul 4)<br />
Grundeinstellungen<br />
im<br />
Tabellenkalkulationsprogramm<br />
Dateneingabe und - auswahl<br />
Erstellen, Formatieren und Fertigstellen<br />
einer Kalkulationstabelle<br />
Datenverwaltung (kopieren, löschen, suchen,<br />
sortieren<br />
etc.)<br />
Formeln verwenden<br />
Druckvorbereitung Kurven und Diagramme<br />
erstellen<br />
- 23 -
Textverarbeitung<br />
MS Word<br />
Oo Writer<br />
- Zeichenformatierung<br />
- Einfache Textgestaltung<br />
- Einbinden von Grafiken<br />
Textverarbeitung (Modul 3)<br />
Grundeinstellungen<br />
im<br />
Textverarbeitungsprogramm<br />
Grundschritte der Textverarbeitung<br />
(kopieren, verschieben, löschen, suchen etc.)<br />
Erstellen, Formatieren und Fertigstellen<br />
eines Textdokuments<br />
Druckvorbereitung<br />
Präsentation<br />
MS PowerPoint<br />
Oo Impress<br />
WP Presentations<br />
- Erstellen von Präsentatione n<br />
- Einfügen von Objekten<br />
- Folienübergänge<br />
- Folienanimationen<br />
Präsentation (Modul 6)<br />
Grundlagen der Präsentation<br />
Erstellen, formatieren und vorbereiten einer<br />
Präsentation<br />
Grafiken und Diagramme verwenden<br />
Präsentation drucken<br />
Einsatz von Effekten bei<br />
Folienpräsentationen<br />
Projekt 9<br />
Modul Inhalte Europäischer Computer Führerschein<br />
Textverarbeitung<br />
MS Word<br />
Oo Writer<br />
- Erstellen einer Rechnung: Texte<br />
in Word, Tabelle in Excel<br />
Zahlenformate, Anwendung der<br />
Grundrechenarten,<br />
Summenfunkt ion<br />
Textverarbeitung (Modul 3)<br />
Grundeinstellungen<br />
im<br />
Textverarbeitungsprogramm<br />
Grundschritte der Textverarbeitung<br />
(kopieren, verschieben, löschen, suchen etc.)<br />
Erstellen, Formatieren und Fertigstellen<br />
eines Textdokuments<br />
Druckvorbereitung<br />
- 24 -
Tabellenkalkulation<br />
MS Excel<br />
Oo Calc<br />
WP QuattroPro<br />
- Absolute und relative Bezüge<br />
- Zellenformate<br />
- WENN- DANN - Funktion<br />
- Kalkulation von Einnahmen und<br />
Ausgaben:<br />
Haushaltsplan<br />
Unterhaltskosten eines Autos<br />
Energieabrechnung<br />
der<br />
Stadtwerke<br />
- Prozentrechnung mit grafischer<br />
Da rstellung:<br />
Sparbuch<br />
Ratenkredit<br />
Kalkulation eines<br />
Verbraucherkredits<br />
mit<br />
begrenzter Laufzeit<br />
- Kalkulation der<br />
Ertragsmaximierung<br />
eines<br />
Unternehmens,<br />
grafische<br />
Darstellung der Optimierung:<br />
Autovermietung zu Paus chalund<br />
Einzelkonditionen<br />
Betriebskosten eines Hotels<br />
Transport von Waren in<br />
Abhängigkeit<br />
von<br />
Gebindegrößen<br />
- Simulation: Kettenbrief als<br />
Schneeballsystem<br />
Tabellenkalkulation (Modul 4)<br />
Grundeinstellungen<br />
im<br />
Tabellenkalkulationsprogramm<br />
Dateneingabe und - auswahl<br />
Erstellen, Formatieren und Fertigstellen<br />
einer Kalkulationstabelle<br />
Datenverwaltung (kopieren, löschen,<br />
suchen, sortieren etc.)<br />
Formeln und Funktionen verwenden<br />
Mathematische und logische<br />
Standardoperationen<br />
Druckvorbereitung<br />
Objekte einfügen<br />
Kurven und Diagramme erstellen<br />
Projekt 10<br />
Modul Inhalte Europäischer Computer Führerschein<br />
Textverarbeitung<br />
MS Word<br />
Oo Writer<br />
- Grafiken und Bilder formatieren<br />
- Rechtschreibung und Grammatik<br />
- Thesaurus<br />
- Verwendung von Tabulatoren<br />
- Aufzählungen und<br />
Nummerierungen<br />
- Gestalten von Texten mit<br />
Tabellen<br />
- Erstelle n von Grafiken mit<br />
WordArt<br />
Textverarbeitung (Modul 3)<br />
Erstellen von Tabellen im Textdokument<br />
Verwendung von Bildern und Grafiken<br />
Importieren von Objekten<br />
Serienbrieffunktionen<br />
- 25 -
Präsentation<br />
Internet<br />
MS Publisher<br />
l o- net<br />
iexplorer<br />
- Spaltensatz - Autotext<br />
- Formatvorlagen<br />
- Erstellen von Serienbriefen<br />
- Dokumentvorlagen<br />
- Verwendung des Formeleditors<br />
- Erstellen von<br />
Hypertextdokumenten<br />
unter<br />
V e r w e ndung der<br />
Textverarbeitung Word und der<br />
Tabellenkalkulation<br />
Excel<br />
- Entwerfen von Struktogrammen<br />
der<br />
Dokumente<br />
- Verwenden von Rahmen<br />
- Einfügen der Objekte<br />
- Hintergrund und Publikation –<br />
Navigationselemente<br />
- Setzen von Hyperlinks<br />
Internet (Modul 7)<br />
Grundkenntnisse über Informations- und<br />
Kommunikationsnetze (Internet, E- Mail etc.)<br />
Verwendung einer E- M a i l- Software<br />
E- Mail- Management (Nachrichtenordner,<br />
Adressverzeichnis etc.)<br />
Senden und Empfangen von Nachrichten<br />
Senden von Attachments<br />
Verwendung eines Web- Browsers<br />
Verwendung von Suchmaschinen<br />
Lesezeichen setzen<br />
Webpages und Suchberichte drucken<br />
Präsentation<br />
MS PowerPoint<br />
Oo Impress<br />
WP Presentations<br />
- Erstellen von Präsentationen<br />
- Folienanimationen<br />
- Organigramme<br />
- D i a g r a m m e a n i m i e r e n<br />
- Gliederung, Notizblatt<br />
P r ä s e ntation (Modul 6)<br />
Grundlagen der Präsentation<br />
Erstellen, formatieren und vorbereiten einer<br />
Präsentation<br />
Grafiken und Diagramme verwenden<br />
Präsentation drucken<br />
Einsatz von Effekten bei Folienpräsentationen<br />
Modul Inhalte Europäischer Computer Führerschein<br />
- 26 -
Tabellenkalkulation<br />
MS Excel<br />
Oo Calc<br />
WP QuattroPro<br />
- Formeln<br />
- Zielwertsuche<br />
- Funktionen<br />
- Auswertung von Statistiken<br />
- Zahlenreihen<br />
Tabellenkalkulation (Modul 4)<br />
Grundeinstellungen<br />
im<br />
Tabellenkalkulationsprogramm<br />
Dateneingabe und - auswahl<br />
Er stellen, Formatieren und Fertigstellen einer<br />
Kalkulationstabelle<br />
Datenverwaltung (kopieren, löschen, suchen,<br />
sortieren etc.)<br />
Formeln und Funktionen verwenden<br />
Mathematische und logische<br />
Standardoperationen<br />
Druckvorbereitung<br />
Objekte<br />
einfügen<br />
Kurven und Diagramme erstellen<br />
Datenbank<br />
MS<br />
Access<br />
Oo Base<br />
- Anlegen einer Adressdatenbank<br />
- Erstellen eines Formulars zur<br />
Erfassung<br />
- Auswertung der Datenbank<br />
durch Berichte<br />
- Zuweisen von Kategorien<br />
- Abfragen unter Verwendung<br />
von Kategorien<br />
Datenbank (Modul 5)<br />
Grundl agen von Datenbanken<br />
Erstellen einer einfachen Datenbank unter<br />
Verwendung eines Standardprogramms<br />
Verwenden von Formularen<br />
Informationsabfrage mit Such-, Auswahl - und<br />
Sortierfunktionen<br />
Erstellen und modifizieren von Berichten<br />
Präsentation<br />
im<br />
Internet<br />
Studio MX<br />
- Anlegen einer Site<br />
- Gestalten von Webseiten<br />
- Entwurfsansicht und<br />
Codeansicht<br />
- Hyperlinks<br />
- Die Sitemap<br />
- Veröffentlichen der Site<br />
- HTML- Tags<br />
- Verwenden von Frames -<br />
Layouttabellen<br />
und<br />
L a y o u t z e l l e n<br />
- Erstellen von Vorlagen -<br />
Gestalten von Rollover - B i l d e r n<br />
- Ge stalten einer<br />
Navigationsleiste<br />
- Impressumspflicht<br />
Internet (Modul 7)<br />
Grundkenntnisse über Informations- und<br />
Kommunikationsnetze (Internet, E- Mail etc.)<br />
Verwendung einer E- Mail-Software<br />
E- Mail- Management (Nachrichtenordner,<br />
Adressverzeichnis etc.)<br />
Sende n und Empfangen von Nachrichten<br />
Senden von Attachments<br />
Verwendung eines Web - Browsers<br />
Verwendung von Suchmaschinen<br />
Lesezeichen setzen Webpages und<br />
Suchberichte drucken<br />
Medienkonzept der <strong>Ludgerus</strong>-<strong>Hauptschule</strong> Rhede<br />
Pädagogische Ausgangslage der LHS Rhede<br />
Die von jeder Schule zu leistende Medienerziehung bezieht sich sowohl auf die alten, seit Jahren<br />
bekannten und entsprechend im Unterricht eingesetzten Medien, als auch auf die „Neuen<br />
Medien“, die bereits seit über zehn Jahren Ihren Platz im Unterricht haben, aber auch weiter<br />
einer stetigen Veränderung unterworfen sind.<br />
Die alten Medien haben nur zum Teil Eingang in die Schule gefunden. Im günstigsten Fall<br />
- 27 -
wurden sie in Arbeitsgemeinschaften gepflegt wie die Schwarz-W e i ß -Fotografie, um dann<br />
bereits vor Jahren durch die technische Entwicklung überholt zu werden.<br />
Die Schmalfilm- und die Videotechnik haben aus Mangel an geeigneter Ausstattung nur<br />
selten und meistens mit persönlichem Interesse des Lehrers verbunden sich im Unterricht<br />
wiederfinden<br />
lassen.<br />
Z iel des Unterrichtes ist unter anderem die Vermittlung von Medienkompetenz. Diese umfasst<br />
sowohl die alten, wie die neuen Techniken, unterzieht sie einer kritischen Betrachtung im Bezug<br />
auf Kosten und Nutzen, zeigt die Möglichkeiten der Manipulation auf wie a u c h d i e<br />
Notwendigkeit, aber auch die Grenzen des Datenschutzes.<br />
Die Neuen Medien überschwemmen mit ständig neuen Produkten die Konsumenten jeden Alters.<br />
Junge Menschen haben einen viel leichteren Zugang zu den elektronischen Medien und<br />
Techniken, nicht nur weil sie mit ihnen aufgewachsen sind, sondern auch weil sie den<br />
angstfreien Umgang gelernt haben.<br />
Die früher unterstellten geschlechtsspezifischen Unterschiede lassen sich bei den Schülern<br />
seit Jahren nicht mehr feststellen.<br />
Ein größeres Problem ist das schnelle Veralten der Technik in den Schulen wie auch zu Hause.<br />
Der jüngste und damit leistungsfähigste Rechner gehört in die Hände der Schüler, die leicht<br />
überholten Geräte in die der Eltern. Damit sind in der Schule vorhandene Rechner mit einer<br />
Lebensdauer von sechs Jahren generell nicht auf dem letzten Stand der Technik der<br />
Informations- und Kommunikationstechnologie. Bei der Auswahl des Unterrichtsstoffes ist<br />
dieser Tatsache generell Rechnung zu tragen.<br />
Nach wiederholter Nachfrage ist davon auszugehen, dass so gut wie alle unsere Schüler<br />
Zugang zu einem Rechner haben, zum größten Teil zu Hause am Rechner der Eltern, zum<br />
Teil am eigenen Rechner, zum Teil an einem Rechner im Freundeskreis.<br />
Medienkompetenz der Schüler<br />
Nach dem hemmungslosen Konsum von Videos vor einigen Jahren, der folgenden<br />
Daddelsucht, die immer wieder durch die Produzenten von Spielkonsolen anzufachen<br />
versucht wird, ist nach der allgemeinen Verfügbarkeit des Handys zum Spielen wie zum<br />
Kommunizieren zwar nicht unbedingt eine Markt sättigung bei den jungen Konsumenten<br />
erreicht, es fehlt eher an der notwendigen Freizeit.<br />
Mit dem sinnvollen Gebrauch des Videorecorders und des DVD - Spielers muss sich die<br />
Schule im Unterricht nicht mehr beschäftigen, außer vielleicht bei der Analyse von<br />
Spielfilmen. Der Umgang mit diesen Geräten fällt den Schülern ebenso leicht wie der mit<br />
einem Handy oder einer Konsole.<br />
Die Schule sollte also die Themen und Techniken vermitteln, die zukunftsrelevant sind, aber sich<br />
nicht im Vorübergehen erlernen lassen. Der Rechner selbst und seine Geschichte ist kein<br />
- 28 -
Unterrichtsgegenstand, sondern hat nur die Funktion eines technischen Hilfsmittels zum<br />
Erreichen des Unterrichtsziels. Medienkompetenz bedeutet immer auch den qualifizierten<br />
Umgang mit den alten Medien.<br />
Bau s t e i n : Nutzung von Medien Neue Medien<br />
Einsatz von Lernprogrammen Publisher -Lernprogramme, Dreamweaver- L e h r-<br />
gänge, Fireworks-L e h r g ä n g e , F l a s h-Tutorials<br />
Internet - Recherche online und offline InternetExplorer<br />
Kommunikation über eMail lo -net, web .de<br />
Baustein: Medienerstellung Neue Medien<br />
Textproduktion und Publikation MS Word, MS Publisher, WordPerfect<br />
Kalkulation und Simulation MS Excel<br />
Aufbau einer Datenbank MS Access<br />
Erstellen von Grafiken CorelDraw, CorelDesigner, Studio MX<br />
Bildproduktion und -bearbeitung Studio MX<br />
Text /Bildkombinationen: MS Word, MS Publisher, MS PowerPoint,<br />
Zeitung, Internetseite, Präsentation Studio MX<br />
Audioverarbeitung<br />
Noch nicht entschieden<br />
Videobearbeitung/Videoschnitt<br />
Noch nicht entschiede n<br />
Baustein: Medien kritisch reflektieren<br />
Analyse von Internetseiten, Printmedien, Filmen<br />
Veröffentlichungsbedingungen des Internets, Impressunpflicht, Zustimmungspflicht<br />
Nachricht und Kommentar<br />
Intertainment und Information<br />
Datenschutz und Nutzerprofil<br />
Ankopplung an die Unterrichtsfächer<br />
- 29 -
medienpädagogische Aufgabe beteiligte Fächer<br />
Lernen und Üben mit Lernprogrammen D, E, M, Bi, Ge, Ek, Al<br />
Recherche (online, offline) D, Ek, Ge, Al, Rel, E, Ph, Ch, Bi<br />
Kommunikation D, E, Al, Ek<br />
Medienproduktion<br />
D , E k , G e , M , A l , B i , P h , C h , R e l , E , M u ,<br />
Ku,<br />
Inf<br />
Medien kritisch reflektieren D, Ek, Ge, Al<br />
4 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung<br />
Bei der Überarbeitung des <strong>Schulprogramm</strong>s ergab sich unter dem Aspekt der<br />
Qualitätsverbesserung unserer pädagogischen und unterrichtlichen Arbeit das ausführliche<br />
Arbeitsfeld 3 (S. 14 bis S. 30) mit der Darlegung von Grundvoraussetzungen und Eckdaten für<br />
erfolgreiches Lernen, wie sie Schülern, Eltern und Lehrkräften gleichermaßen bewusst sein<br />
sollten. Daher werden diese auch zur Einschulung der neuen Fünften in einer Schulbegleitmappe<br />
ausgehändigt.<br />
In der Schwerpunktsetzung des Kapitels 3 findet sich implizit ebenfalls die Fokussierung auf die<br />
in den neuen Kernlehrplänen geforderten Fachkompetenzen und prozessorientierten<br />
Kompetenzen.<br />
Die Fachkonferenzen haben die neuen schulinternen Curricula erstellt und richten ihre Arbeit fast<br />
schon gänzlich danach aus, um alle Schüler frühzeitig auf die andersartigen Aufgabenstellungen<br />
d e r L e i s t u n g s ü b e r p r ü f u ngen und zentralen Abschlussprüfungen vorzubereiten. Auf einen<br />
umfassenden Arbeitsplan für die nächsten Jahre wurde im Hinblick auf die Schließung unserer<br />
Schule<br />
verzichtet.<br />
Die Effektivitätsüberprüfung der neuen Zielsetzung und Methodenwahl erfolgt in zune hmendem,<br />
Maße durch die P o r t f o l i o s. Qualitätsüberprüfung geschieht somit viel regelmäßiger und<br />
b e w u s s t e r a l s f r ü h e r .<br />
Durch mehr projektorientierte und fächerübergreifende Unterrichtskonzeptionen, durch mehr<br />
selbstgesteuertes Lernen in Wochenplanarbeit und an Lernstationen ergibt sich für die Schüler<br />
eine größere Handlungskompetenz und motivierenderes Qualitätsbewusstsein.<br />
In Zukunft muss noch verstärkt daran gearbeitet werden, wie dieser Positivtrend auch in der<br />
pubertätsüberlagerten Mittelstufe au f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k a n n .<br />
Förderkonzept<br />
- 30 -
Wir setzen neben der äußeren Differenzierung auf zusätzliche Binnendifferenzierung.<br />
Ausländische Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, werden durch zusätzliche<br />
Aufgaben in Deutsch gefördert.<br />
E in systematisches LRS-Training in Kleingruppen wird von einer Fachkraft durchgeführt, die<br />
Lernstrategien optimiert, Schwächen abbaut und auch Stärken gezielt fördert. Doch leider gibt<br />
die Unterrichtsverteilung nicht immer die gewünschten Lehrerstunden her.<br />
Efit: ein ergänzendes Förderangebot im Fach Englisch<br />
Zum 22. August 2005 wurde uns die Genehmigung zur Teilnahme am Modellprojekt Efit.nrw<br />
seitens des MSW im Fach Englisch erteilt.<br />
Ziel dieses Projektes ist die Erprobung und Weiterentwicklung digitaler Medien und<br />
Diagnosewerkzeuge für eine verbesserte individuelle Förderung und Stärkung der Schüler in der<br />
E r p r o b u n g s s t u f e .<br />
Die von zwei Verlagen online bereitgestellten Module unterstützen die Fachlehrkräfte bei der<br />
Planung und Durchführung binnendifferenzierender Lernprozesse.<br />
Nach automatisierten Diagnosetests können bedarfsbezogene Förderangebote erstellt werden.<br />
Auch wenn diese neue Lehr- und Lernform für den Schuladministrator und die beteiligten<br />
Fachlehrer noch große medientechnische und organisatorisc he Herausforderungen darstellt,<br />
bildet die Teilnahme an diesem Projekt bis 2008 einen wesentlichen Schwerpunkt unserer<br />
Fördermaßnahmen.<br />
Die Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen gerät noch stärker in den Blick.<br />
Durch die Bemerkungen zum Arbeit s- und Sozialverhalten auf den Zeugnissen erhalten sie einen<br />
neuen Stellenwert und stoßen bei der Schülerschaft und Elternschaft auf größere Akzeptanz.<br />
Zur intensiveren Aufarbeitung von Sozialisierungsdefiziten wurde bei der Kreisjugendhilfe ein<br />
Antrag auf die Errichtung einer Schulsozialarbeitsstelle gestellt. Er wurde erfreulicherweise<br />
genehmigt. Am 1. März 2006 wird eine Fachkraft für die sogenannte Sozialraumarbeit,<br />
fallbezogene Einzelbratung und Projekt- und Gruppenarbeit tätig werden, die in ganzheitlicher<br />
und kooperativer Vorgehensweise der Schule und dem Einzelschüler dienen soll.<br />
Ergänzend zu den oben umrissenen Punkten sieht die Fortbildungsplanung F o l g e n d e s v o r :<br />
• Weitere Teilnahme an „Lion`s Quest“ - FB (Hilfe beim“Erwachsen-W e r d e n “ )<br />
• FB zum professionellen Umgang mit lernschwierigen Schülern<br />
• FB zur Optimierung von Methodenkompetenz<br />
• Schulbuchbezogene Informationsveranstaltungen unter besonderer Berücksichtigung der<br />
„ N e u e n M e d i e n “ .<br />
5 Mittelfristige Ziele für die Entwicklung der schulischen Arbeit<br />
- 31 -
Unter dem Begriff "mittelfristig" verstehen wir einen Zeitraum von 3 Jahren.<br />
Folgende Ziele sollen erreicht werden:<br />
• Es wird angestrebt das Programm Lion’s Quest „ Erwachsen werden“ mit einer<br />
Wochenstunde im 5. und 6. Schuljahr fest einzuricht en.<br />
• Die Fördermaßnahme „ Lernen lernen“ in Kleingruppen soll fester Bestandteil in der<br />
Erprobungsstufe werden. Eine dafür ausgebildete Lehrkraft führt nach vorhergehender<br />
Diagnose ein Programm zur Wahrnehmungs - und Konzentrationsschulung durch.<br />
• Die Ve rnetzung der Schule ist abgeschlossen. Die Nutzung der Möglichkeiten muss<br />
gewährleistet sein und erweitert werden.<br />
• Der Besuch der Schülerbücherei soll verstärkt werden. Zur Betreuung soll eine Lehrkraft<br />
mit einer Funktionsstunde eingesetzt und von Schülern unterstützt werden.<br />
• U n s e r A b f a l l-und Ordnungskonzept ( Müllvermeidung, Ordnung in den Klassen,<br />
Energiesparmaßnahmen, „Abfallassistenten“) wird fortgeschrieben.<br />
• Aktionen „ Gesunde Schule “-bedarfsgerechte Ernährung in Kombination mit Bewegung<br />
zur Steigerung des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit werden durchgeführt.<br />
• ITG<br />
• Lions Quest<br />
• Ausbildung eines Drogenexperten<br />
• „Lernen lernen“<br />
In folgenden Bereichen ist die Teilnahme von Lehrern unserer Schule an Fortbildungen<br />
erforderlich bzw. wünschenswert:<br />
6 Planung zur Evaluation<br />
An der <strong>Ludgerus</strong> -<strong>Hauptschule</strong> erfolgt eine kontinuierliche Evaluation durch:<br />
• Durchführung und Ergebnisanalyse von Parallelarbeiten (Klasse 7: Parallelarbeiten in<br />
Mathematik, Englisch und Deutsch, Klasse 9: Zentrale Lernstandserhebung, Klasse10: ab<br />
2006 zentrale Abschlussprüfung)<br />
• Zusammenarbeit mit der Nachbarhauptschule<br />
• Rückmeldung durch Ehemalige<br />
• schriftliche Befragungen bei Schülern, Eltern und Lehrern<br />
Die seit dem Schuljahr 1999/2000 vorgeschriebenen Parallelarbeiten in den Hauptfächern führen<br />
wir mit der benachbarten Gudula- <strong>Hauptschule</strong> durch.<br />
Gemäß Vorgaben der BASS ist eine Evaluation mit folgenden Punkten durchzuführen:<br />
• Parallelarbeiten<br />
• auf einen bedeutsamen Entwicklungsschwerpunkt bezogene Evaluation<br />
• Rückmeldung von Elternmeinungen<br />
- 32 -
Eine Planung zur Evaluation dieses <strong>Schulprogramm</strong>s kann erst geschrieben werden, wenn die<br />
Leitziele, die mittelfristigen Ziele und der für das erste Jahr anzugehende<br />
Entwicklungsschwerpunkt festgelegt sind. Hier schon mal einige Anregungen:<br />
Ziel: Vergleichbare Qualitätsstandards<br />
Evaluation durch Parallelarbeiten<br />
Ziel: Transparenz<br />
Evaluation durch Schülerbefragung<br />
Ob unser Unterricht (Ziele, Methoden, Bewertungskriterien, ...) für die Schüler transparent<br />
ist, können uns diese am besten selbst sagen. Dazu schlagen wir eine anonyme Befragung<br />
mit Fragebogen vor. Möglich ist eine allgemeine, eine fach- und / oder lehrkraftspezifische<br />
oder eine exemplarische Befragung zu einzelnen Unterricht s s t u n d e n .<br />
Dieser Punkt erscheint unserer Gruppe geeignet, um als erster Entwicklungsschwerpunkt<br />
angegangen zu werden. Zur Anregung liegen daher einige Schülerfragebogen bei.<br />
(Gerd Lohmann: Mit Schülern klarkommen, Cornelsen 2003 und Andrea s Helmke:<br />
Unterrichtsqualität, Kallmeyer 2004)<br />
Ziel: Stärkung der Kommunikationsfähigkeit<br />
Evaluation durch Beobachtungsbögen<br />
Hierzu sollen kommunikative Kompetenzen (Ausdrucksfähigkeit, Fähigkeit zur<br />
Zusammenarbeit,...) in die Beobachtungsbögen, die über die einzelnen Schüler angelegt werden,<br />
explizit aufgenommen werden. In den Jahrgangsstufenkonferenzen können die Beobachtungen<br />
dann ausgetauscht und daraus resultierende Möglichkeiten zur Stärkung diskutiert werden.<br />
Ziel: Stärkung der methodischen Kompetenzen<br />
Evaluation durch Selbstevaluation der Lehrkräfte<br />
Hierzu ist es sinnvoll, kollegiumsintern eine Liste zusammenzustellen, welche<br />
Methodenkompetenzen in welchen Jahrgangsstufen eingeführt sein sollen (siehe z.B.<br />
Kernlehrplan NW, auch z. B. Gruppenarbeit, Präsentationsmethoden, u.v.m.) und in welchen<br />
Fächern sie vermittelt werden. Jede Lehrerin und jeder Lehrer kann Vermittlung und<br />
Überprüfung diese Kompetenzen dann entsprechend in die Unterrichtsplanung einbauen.<br />
Außerdem wissen die Fachlehrer, worauf sie zurückgreifen können.<br />
7 Anhang<br />
1. Informationstechnologische Grundbildung<br />
- 33 -
• Ausstattungsanforderungen<br />
• Fortbildungsplan<br />
• Beschaffungsbedarf und – folge<br />
• Wartungskonzept<br />
• Auszug aus den Plänen der Fachkonferenzen<br />
2. Fragebogen zur Evaluation von Unterricht<br />
Ausblick<br />
Die Stadt Rhede plant zum nächsten Schuljahr 2006/2007 eine Zusammenlegung beider<br />
bestehenden <strong>Hauptschule</strong>n, da der Rektor unserer Schule, Volker Grote Westrick, Ende Januar<br />
2006 pensioniert wird.<br />
Laut Information der Stadt gefährden zurückgehende Schülerzahlen mittelfristig die Existenz<br />
zweier <strong>Hauptschule</strong>n. Daher wird die Schulleiterstelle nicht neu besetzt.<br />
Vorgesehen ist die Auflösung der beiden katholischen <strong>Hauptschule</strong>n und die gleichzeitige<br />
Gründung einer neuen Gemeinsch a f t s - <strong>Hauptschule</strong>.<br />
Langfristig gibt es außerdem Überlegungen, diese neue <strong>Hauptschule</strong> in eine Ganztagsschule<br />
umzuwandeln.<br />
D i e S c h u l- Neugründung soll von einem Gremium mit Lehrer -Vertretern beider Schulen im<br />
zweiten Schulhalbjahr 2005/2006 vorbereitet werden. Im Rahmen dieser schwierigen Aufgabe<br />
wird es auch zu einer Zusammenfügung und Überarbeitung der beiden <strong>Schulprogramm</strong>e<br />
Kommen.<br />
Nähere Informationen zur Zusammenlegung sind bei Redaktionsschluss (15. 12. 2005) nicht<br />
bekannt.<br />
Informationstechnologische Grundbildung<br />
Ausstattungsanforderungen<br />
PC-Raum<br />
An der <strong>Ludgerus</strong> -<strong>Hauptschule</strong> ist ein Rechnerraum mit 15 Arbeitsplätzen eingerichtet. An die<br />
vorhandenen wie an einzurichtende Computerarbeitsplätze sind folgende Anforderungen zu<br />
- 34 -
stellen:<br />
- multimediafähige Rechner (mit Panel zum Anschluss für Ohrhörer und Maus)<br />
- vor Manipulationen zuverlässig gesicherte Rechner (in Klassenräumen unter Verschluss)<br />
- pädagogisches Netz im Rechnerraum: Demonstration des Bildschirms des Lehrerrechners,<br />
Supervision der Schüleraktivität en, Interaktion Lehrer/Schüler, SurfLock usw.Lehrerplatz<br />
mit zusätzlichem Scanner<br />
- j e e i n L a s e r-und ein schneller Tintenstrahldrucker im Rechnerraum<br />
- Laserdrucker in den Klassen -und Fachräumen<br />
Klassen-und Fachräume<br />
Sämtliche Klassenräume und die Fachräume der <strong>Ludgerus</strong>- <strong>Hauptschule</strong> sind in die<br />
Vernetzung des Gebäudes einbezogen und mit je einer Datendose versehen. Damit können<br />
ohne weiteren konstruktiven Aufwand zwei Rechner pro Raum betrieben werden. Auf jeder<br />
Etage ist ein fahrbarer Medienwagen mit Rechner u n d M o n i t o r v o r h a n d e n . W e i t e r e r i n d a s<br />
Netz eingebundene Rechner befindet sich im Lehrerzimmer, im Physikraum, im<br />
Biologieraum.<br />
Die im Hausmeisterraum stehende zentrale Verteilung des Intranets der Schule besteht außer<br />
den Patchfeldern (3x24, 1x16) aus vi er Switchen. A1le vorhandenen Räume (24) und beide<br />
Anschlüsse in den Datendosen (2x34) sind gepatcht.<br />
An das Netz angeschlossene Fachräume: 12:<br />
Rechnerraum (11 Datendosen), Lehrerzimmer, Lehrerzimmer R, Schülerbücherei, MiniBIZ,<br />
Medienraum, Sekretariat, Küche, Biologieraum, Musikraum, Werkraum, Physikraum.<br />
Klassenräume: 12.<br />
Die Vernetzung der Schule ist für den Anschluss von zwei Rechnern pro Raum ausgelegt.<br />
Anstelle eines Rechners kann auch pro Raum ein Switch angeschlossen werden. Damit<br />
könnten in Zukunft auch in den Klassen- und Fachräumen mehrere Rechner/Schüler oder<br />
Arbeitsgruppen auf das Intranet und das Internet zugreifen. Ein kabelloses Funknetz, für das<br />
Sichtkontakt Voraussetzung ist, ist als Alternative wegen des langsamen Datentransportes<br />
nicht empfehlenswert.<br />
Eine Ausstattung der Klassenräume mit Medienecken, wie für Grundschulen vorgesehen, ist<br />
für die Schulen der Sekundarstufe I nicht sinnvoll. Alle Schüler und Lehrer der Schule haben<br />
einen persönlichen Account und ein persönliches Verzeichnis auf dem Server. Es ist nicht<br />
anzunehmen, dass in den kommenden Jahren die Schüler mit persönlichen Notebooks<br />
ausgestattet werden, um selbstständig auf das Netz zugreifen können.<br />
Bis auf weiteres kann das Netz durch die Ausstattung aller Räume mit je einem Rechner und<br />
eventuell einem Drucker im Unterricht genutzt werden. Die in den Klassenräumen stehenden<br />
Anlagen müssen vor Diebstahl, Beschädigung und Manipulation durch einen passenden,<br />
abschließbaren Schrank gesichert werden. Dieser Rechner dient auch zur Ansteuerung von<br />
Beamern, mit denen die Inhalte für alle Schülerinnen und Schüler sichtbar gemacht werden<br />
können.<br />
Ausstattung der Arbeitsplätze<br />
- 35 -
Ausstattung nach dem Stand 2001: 1000MHz -Prozessor, aktuelle Grafikkarte, 128MB RAM,<br />
Soundkarte, 100MBit/s- Ne t z w e r k k a r t e , C D- ROM -Laufwerk zur Installation, 17“-M o n i t o r e<br />
Mögliche Ausstattung nach dem Stand 2005: aktueller Prozessor, aktuelle Grafikkarte,<br />
512MB RAM (erforderlich für CAD), Soundkarte, 100MBit/s-N e t z w e r k k a r t e , C D- ROM-<br />
Laufwerk zur Installation, 19“ -Monitore<br />
Erweiterung des bestehenden Netzes<br />
Das 2001 aufgebaute Netz besteht aus der zentralen Verteilung im Hausmeisterraum, den Fach -<br />
und den Klassenräumen mit je einer Datendose und dem Rechnerraum mit 10 Datendosen für<br />
15+1 Arbeitsplätze, dem Netzwerkdrucker, dem Netzwerkserver. Die Verteilung erfolgt über<br />
vier Patchpanel und die Switche in der Zentrale. Im gleichen Verteilerschrank befindet sich<br />
Modem, Splitter und Router für den Zugang zum Internet über den dort installierten ISDN -<br />
Anschluss (LNB).<br />
Im Rechnerraum steht in einem Verteilerschrank der Netzwerkserver. Der Server hat zwei<br />
Festplatten, die eine Spiegelung der installierten Programme und der Daten ermöglichen. Bei<br />
einem Ausfall einer der beiden Festplatten wären somit die Daten weiter vorha nden, mögliche<br />
Fehler infolge einer Störung werden aber auch direkt gespiegelt.<br />
Ein Ausfall dieses Servers macht das gesamte Netz funktionsunfähig. Unter der verwendeten<br />
Netzwerksoftware ist der Betrieb von drei separaten Servern mit versetzter Speicherun g<br />
möglich, so dass beim Ausfall eines Servers das System weiter stabil laufen würde.<br />
Mit dem weiteren Ausbau der Vernetzung der Schule ist eine Ergänzung um einen weiteren<br />
Server bei der nächsten Beschaffung von Rechnern sinnvoll und erforderlich. Beim Au sfall<br />
eines dieser Server müsste der defekte dann ersetzt werden, um die Sicherheit weiter zu<br />
garantieren.<br />
Über den vorhandenen, kostenlosen ISDN - Anschluss ist nach Einrichtung des DSL - Zugangs<br />
auch bei mehreren Benutzern ein gleichzeitiger Zugriff auf das Internet in akzeptabler<br />
Geschwindigkeit möglich. Eine intensivere parallele Nutzung nach weiterer Ausstattung mit<br />
Rechnern erfordert einen weiteren DSL -Zugang.<br />
Software<br />
Als Netzwerksoftware ist Windows 2000 Server incl. 25 Clients angeschafft worden. Bei der<br />
kompletten Ausstattung der Räume mit je einem Rechner wird diese Lizenz nicht ausreichen.<br />
Die Schule besitzt noch alte, aber updatefähige Betriebssysteme: 15mal Windows 3.1 und 5mal<br />
Windows 95. Für die noch betriebsbereiten Lifetec-Rechner, drei im MiniBiz, einer als<br />
alternativer Internet- Zugang im Rechnerraum sind ebenfalls Softwarepakete (Betriebssystem und<br />
WorksSuite) vorhanden. Die für die alten Rechner angeschaffte Software und die Windows 95<br />
Pakete befinden sich wie die Windows 2000- Software incl. der Lizenzen und der Unterlagen zum<br />
Internet - Zugang im Physikraum in den Stahlschränken und im Projektorschrank.<br />
Außerdem sind 15mal Word (= Klassenraumlizenz), 15mal Works (= Klassenraumlizenz),<br />
5mal Works/Word, eine Klassenraumlizenz CorelDraw3 vor h a n d e n .<br />
Die vorhandenen MSOffice-Pakete enthalten jeweils eine Schullizenz für 15 Arbeitsplätze.<br />
Auf den in der Schule eingesetzten Rechnern ist MSOffice 2000 wegen des geringeren<br />
Speicherbedarfes installiert. Alternativ kann auf bis zu 15 Rechnern das P rogramm<br />
WordPerfect, Bestandteil der Corel-Schultüte, eingesetzt.<br />
Die Grafikprogramme der Corel- Schultüte, CorelDraw und CorelDesigner, sind auf den<br />
- 36 -
Rechnern im Rechnerraum installiert.<br />
Mitte des Jahres 2003 wurde zur Erstellung und Pflege der Homepage der Schule das<br />
Programmpaket Macromedia StudioMX ebenfalls als Klassenraumlizenz erworben und auf<br />
den Rechnern im Computerraum installiert.<br />
Fachspezifische Software ist bisher kaum angeschafft, weil die Software unter<br />
fachdidaktischen Gesichtspunkten noch nicht ausgewählt oder deren Netzwerktauglichkeit<br />
unter Windows 2000 nicht gesichert ist. Die installierte Berufsfindungssoftware des<br />
Arbeitsamtes ist trotz entsprechender Bezeichnung nicht netzwerkfähig, sondern lokal<br />
installiert.<br />
Im Fach Technik ist für den Unterricht im Bereich Technisches Zeichnen der Einsatz von<br />
AutoCad als Klassenraumlizenz vorgesehen, wenn sich das Programm nach Prüfung einer<br />
Demoversion als pädagogisch sinnvoll und von Schülern bedienbar erweist.<br />
Als pädagogisches Netzwerk ist im Rechnerraum das Programm MasterEye installiert. Das<br />
Programm SurfLock ermöglicht das Freischalten des Internetzuganges für die Rechner im<br />
Rechnerraum. Das Problem der Belästigung der Schüler in Chats durch Pädosexuelle erscheint<br />
Lehrern ebenso wenig problematisch wie die Veröffentlichung von Schülerdaten auf<br />
Internetseiten.<br />
Medienkompetenz der Kolleginnen und Kollegen<br />
Die Lehrer der <strong>Ludgerus</strong>- <strong>Hauptschule</strong> verfügen momentan über sehr unterschiedliche<br />
Qualifikationen, von keinen Kenntnissen bis zur Einsatzkompetenz im Unterricht.<br />
Im Jahr 2003 hat eine schulinterne Fortbildung bezüglich der Tabellenkalkulation Excel<br />
stattgefunden. Eine Gruppe von Kolleginnen hat sich in die Grundlagen der<br />
Homepagegestaltung<br />
eingearbeitet.<br />
Für das in Folge angeschaffte Macromedia -Paket hat sich in Ermangelung eines entsprechenden<br />
Fortbildungsangebotes bisher keine Lösung gefunden. Vor Unterrichtseinsatz eines Programms<br />
aus diesem professionellen Paket sollte eine methodisch - didaktische Aufbereitung durchgeführt<br />
und eine Strate gie für unterschiedliche Schülergruppen entwickelt werden.<br />
Die wiederholte Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen bewirkt in erster Linie ein persönlich<br />
sichereres Umgehen mit dem Rechner, erzeugt aber nicht die Qualifikation zum unterrichtlichen<br />
Einsatz. Der Wissensstand eines Teils der Schüler und entsprechend deren Eigeninitiative beim<br />
Entwickeln von Strategien zum Lösen von Aufgaben sind deutlich besser ausgeprägt als die<br />
vieler Kollegen.<br />
Entsprechend werden viele von den Schülern hervorgerufenen Probleme und aus der Struktur<br />
des Internets stammende Störungen von vielen Lehrern nicht in ihrer Bedeutung erkannt.<br />
Beispiele sind das mangelnde Rechtsbewusstsein im Umgang mit Programmen, mit der<br />
Internetpräsentation der Schule, mit dem trotz vorhandenen SurfLoc ks unbemerkten und damit<br />
unkontrollierten Surfen, mit Popups etc.<br />
Qualifizierende Fortbildungen können weder im bisherigen zeitlichen Rahmen, noch von im<br />
System eingebundenen Moderatoren bei der vorliegenden Bandbreite der Vorkenntnisse und<br />
Einstellungen und der Diskrepanz zu den technischen Möglichkeiten und der ständig<br />
fortschreitenden Entwicklung mit zufrieden stellendem Ergebnis durchgeführt werden.<br />
Schulungen sollten mit den bereitgestellten Landesmitteln von kommerziellen Unternehmen<br />
eingekauft werden .<br />
Die für die Sicherung des First Level Supports notwendige Schulung im Umgang mit dem<br />
Betriebssystem ist weder durchgeführt, noch angekündigt worden.<br />
- 37 -
Fortbildungsplan<br />
Grundkenntnisse e -card (VHS) VHS Bocholt<br />
auf Anfrage<br />
MS Excel 2002 k o llegiumsintern<br />
Homepage 2003 kollegiumsintern<br />
Fortbildung zu 2003 Online- Fortbildung des<br />
Windows und Innenministeriums<br />
MS Office<br />
Einsatzkompetenz<br />
Intel – Lehren für<br />
die<br />
2001 e -team Fortbildung<br />
im Unterricht Zukunft Teilnahme vo n 7 Kollegen<br />
zusätzliche fachspezifische nicht angeboten<br />
Qualifizierungs - Fortbildung<br />
maßnahmen<br />
maßnahmen<br />
lehrwerkbezogene nicht angeboten<br />
Fortbildung<br />
First Level Support WIN2000 Administratoreneinweisung<br />
nicht angeboten<br />
Beschaffungsbedarf und –folge<br />
Mit der im Jahre 2001 angeschafften Ausstattung ist es möglich, folgende, zum Teil auch im<br />
Stundenplan ausgewiesenen Lehrveranstaltungen regelmäßig durchzuführen:<br />
feste Belegung des Rechnerraumes variable Belegung des Rechnerraumes<br />
Schreibmaschinen- AG Wirtschaftslehre10 Börsenspiel<br />
Grundbildung Informatik 7 Technik 9<br />
Grundbildung Informatik 8 Englisch 6/7/8/9/10<br />
- 38 -
Grundbildung Informatik 9 Biologie 10<br />
Projekt Informatik 9 Mathematik7/ 8/9/10<br />
Projekt Informatik 10<br />
Bei fester Belegung ist die Gruppengröße der Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze angepasst, bei<br />
variabler Belegung handelt es sich zumeist um Kurse oder halbe Klassen. Die Nutzung des<br />
Rechnerraumes in kompletter Klassen stärke ist nicht möglich.<br />
Das aufgebaute Netz muss in den nächsten Jahren ständig erweitert werden, um den<br />
Rechnereinsatz, wie geplant, in der gesamten vernetzten Schule zu gewährleisten.<br />
Gerät vorhanden 2002 2003 2004 2005<br />
Rechner im 15+1<br />
R echnerraum AMD750/1000<br />
Rechner<br />
in<br />
Fachräumen<br />
Lehrerzimmer Biologie Physik<br />
Rechner in<br />
Klassenräumen<br />
Server<br />
1 Netzwerkserver<br />
1 CD-R o m-Server<br />
Router TDSL<br />
3 mobile<br />
Rechner<br />
Vernetzung 2 Switches<br />
Drucker<br />
1<br />
Netzwerkdrucker<br />
Scanner 1 Scanner<br />
Beamer 1<br />
Digitalkamera 1<br />
2006 (nach<br />
Gerät<br />
Möglichkeit)<br />
Rechner im<br />
Neuausstattung<br />
d e s<br />
Rechnerraum Rechnerraumes<br />
Rechner in Mobile Rechner: Lehrerz. R.<br />
Fachräumen Technik Medien<br />
Küche MiniBIZ<br />
2007 2008 2009<br />
- 39 -
Musik<br />
Rechner in 12 aus dem<br />
Klassenräumen Rechnerraum<br />
Server 1 Netzwerkserver<br />
Vernetzung<br />
Drucker 6 (Klassen)<br />
Scanner<br />
Beamer 1<br />
Digitalkamera<br />
Wartungskonzept<br />
First Level Support<br />
Der First Level Support durch einen Lehrer kann ohne intensive Einweisung und Schulung nicht<br />
gewährleistet werden. Obwohl das Netz bisher nur auf den Rechnerraum beschränkt und keine<br />
gravierenden Probleme aufgetreten si nd, wird der zur Verfügung stehende zeitliche Rahmen um<br />
ein Vielfaches überschritten.<br />
Bei der weiteren Ausstattung der Schule ist das vorgesehene Wartungskonzept nicht<br />
durchführbar.<br />
Second Level Support<br />
Der Second Level Support durch einen Techniker der Stadt, Herrn Teichmann, läuft<br />
problemlos.<br />
Der Einbau von PCWächter-Karten war beabsichtigt, aber bisher nicht erforderlich, weil sich die<br />
Verwendung von Gruppenrichtlinien als geeigneter erwiesen hat. Mit der weiteren Ausstattung<br />
der Schule könnte der Einsatz notwendig sein, wenn die bisher gesperrten Zugänge geöffnet<br />
werden.<br />
- 40 -
Auszug aus den Plänen der Fachkonferenzen<br />
Fach medienpädago -<br />
gische Aufgabe<br />
D Nutzung von<br />
Medien<br />
alte Medien Neue Medien: einsetzbare<br />
Programme<br />
U- Software zu „wortstark“ “Von<br />
Wort zu Wort“ – elektronisches<br />
Schülerwörterbuch Diktattrainer<br />
D Medienerstellung Planen, Schreiben und<br />
Produzieren<br />
eines<br />
Hörspiels Schreiben des<br />
Drehbuchs<br />
eines<br />
Theaterstücks<br />
E Nutzung von<br />
Medien<br />
M Nutzung von<br />
Medien<br />
M Medienerstellung<br />
AT<br />
Nutzung<br />
von<br />
Medien<br />
AT Medienerstellung<br />
Ph Nutzung von<br />
Medien<br />
Zeichnen<br />
von<br />
Diagrammen<br />
auf<br />
Millimeterpapier<br />
Technisches Zeichnen mit<br />
dem Zeichenbrett<br />
Tool Box (Cornelsen)<br />
Multimedia English Coach<br />
(Cornelsen)<br />
Online-P r o g r a m m e<br />
der Verlage<br />
MS<br />
Exel<br />
DynaGeo<br />
MS Excel<br />
Ecad Startcad<br />
AutoCad, Solidworks<br />
Offline<br />
Recherche:<br />
InternetExplorer<br />
www.physikschule.de<br />
www.physicsnet.at/<br />
physik/ index.html<br />
Fach medienpädago -<br />
gische Aufgabe<br />
alte Medien Neue Medien: einsetzbare<br />
Programme<br />
- 41 -
Ch Nut zung von<br />
Medien<br />
Offline<br />
Recherche:<br />
InternetExplorer<br />
Ch6<br />
Salzgewinnung<br />
Ch6<br />
Kristallisation Ch8 Hochofen –<br />
Eisen Ch8 Hochofen – Stahl Ch8<br />
Legierungen Ch9 Neutralisation<br />
Ch9 Ionengitter Ch10<br />
Alkoholische Gärung Ch10<br />
Erdölentstehung<br />
Ch10<br />
Erdölverarbeitung Ch 10 Kohle<br />
Al<br />
Nutzung<br />
von<br />
Medien<br />
Berufsbilder im MiniBIZ Berufsberatung: Mach’s richtig<br />
GRIN Nutzung von MS Office, CorelSchultüte,<br />
Medien Macromedia StudioMX,<br />
Projekte<br />
GRIN Medienerstellung MS Publisher, MS PowerPoint,<br />
St u d i o M X , l o -n e t<br />
Projekte<br />
GRIN Medien kritisch Diagramme/Excel<br />
reflektieren<br />
Bi<br />
Online Recherche: und Training:<br />
Eduvinet<br />
Nutzung<br />
von<br />
M e n d e l<br />
Medien<br />
Bi<br />
Referate<br />
erstellen<br />
Ku<br />
Ku<br />
Medienerstellung<br />
Nutzung<br />
von<br />
Medien<br />
Medien<br />
kritisch<br />
reflektieren<br />
Fotomontage, Core l ,Corel Draw<br />
Photo<br />
Draw<br />
Vergleich mit dem Computer<br />
erstellter Bilder und gemalter<br />
Bilder<br />
- 42 -
Fragebogen zur Evaluation von Unterricht<br />
Aus: Lohmann, Gert: Mit Schülern klarkomme n<br />
2003 Cornelsen Scriptor, Berlin<br />
- 43 -
Aus: Lohmann, Gert: Mit Schülern klarkommen<br />
2003 Cornelsen Scriptor, Berlin<br />
- 44 -