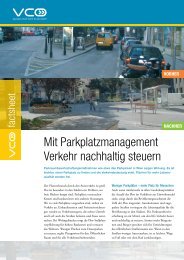Fachtag Zehn Jahre Berliner Härtefallkommission Rückblick Ausblick
dokumentation_berliner_haertefallkommission.pdf?start&ts=1442503243&file=dokumentation_berliner_haertefallkommission
dokumentation_berliner_haertefallkommission.pdf?start&ts=1442503243&file=dokumentation_berliner_haertefallkommission
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Fachtag</strong><br />
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong><br />
<strong>Rückblick</strong>, <strong>Ausblick</strong><br />
Veranstaltung der Mitglieder der <strong>Härtefallkommission</strong> Berlin<br />
4. Juni 2015, Rotes Rathaus, Louise-Schroeder-Saal
Begrüßung<br />
Saron Hailu Tekiu<br />
Sehr geehrte Frau Kolat, sehr geehrter Herr Henkel,<br />
sehr geehrte Mitglieder der <strong>Härtefallkommission</strong>,<br />
sehr geehrte Damen und Herren,<br />
ich möchte Sie ganz herzlich zum <strong>Fachtag</strong> „<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong><br />
<strong>Härtefallkommission</strong>“ hier im Roten Rathaus willkommen<br />
heißen.<br />
In den letzten 10 <strong>Jahre</strong>n hat die <strong>Härtefallkommission</strong> dazu<br />
beigetragen, dass mehr als 3.000 Menschen ein Bleiberecht in<br />
Berlin erhalten haben. Hinter dieser Zahl stehen viele Einzelund<br />
Familienschicksale, viele unterschiedliche Gesichter, und<br />
meines ist eines davon. Ich heiße Saron Hailu Tekiu, bin 19<br />
<strong>Jahre</strong> alt, komme aus Äthiopien und bin Ende 2010 als unbegleitete<br />
Minderjährige nach Berlin gekommen. Zurzeit absolviere<br />
ich einen zweifach qualifizierenden Bildungsgang mit<br />
einer Ausbildung und dem Abitur als Abschluss.<br />
den Traum von einem besseren Leben wahr zu machen und<br />
unsere Kräfte auszubilden. Unser Ziel ist es, nicht einfach<br />
nur versorgt zu werden, sondern die neue Sprache zu lernen,<br />
uns in die Gesellschaft zu integrieren, uns zu engagieren,<br />
einen konstruktiven Beitrag zu leisten und irgendwann etwas<br />
zurückgeben zu können für die Hilfe, die wir am Anfang bekommen<br />
haben.<br />
Es ist nicht einfach, bei all den unterschiedlichsten Hindernissen,<br />
die sich uns in den Weg stellen, zu beweisen, dass wir es<br />
schaffen können und dabei nicht den Mut zu verlieren, immer<br />
weiter daran zu glauben und immer weiter für seine Ziele zu<br />
kämpfen – besonders dann, wenn man vielleicht allein und<br />
noch sehr jung ist, oder wenn man die Verantwortung für eine<br />
Familie trägt.<br />
Die <strong>Härtefallkommission</strong> ist dabei für uns ein wichtiger<br />
Rettungsanker geworden, nämlich dann, wenn aus unter-<br />
Die Tatsache, dass ich jetzt hier stehe und meine Worte an Sie<br />
richten kann, verdanke ich dem Engagement der <strong>Härtefallkommission</strong><br />
und einer Entscheidung des Innensenators. Sie<br />
haben mir dabei geholfen, heute hier als Titelinhaberin der<br />
<strong>Härtefallkommission</strong> zu stehen, das heißt, mit einem Bleiberecht<br />
in Deutschland. Diese Entscheidung hat mir die Sorge um<br />
meine Zukunft genommen und die Frage beantwortet, ob ich<br />
hier in Berlin meine Ausbildung beenden, ein Leben in Freiheit<br />
führen kann und eine sichere Zukunftsperspektive habe.<br />
Hinter uns liegen schwierige Überlegungen, lange Wege,<br />
viele Hindernisse und komplizierte persönliche Situationen.<br />
Wir machen es uns nicht leicht mit der Entscheidung, unsere<br />
Heimatländer zu verlassen und in einem Land, in dem wir oft<br />
unerwünscht sind, komplett neu anzufangen. Da es aber in der<br />
Regel keine Alternative dazu gibt, unser Land zu verlassen, in<br />
dem wir Freunde und Familien haben, aber keine Perspektive<br />
– und zusätzlich meist auch Gefahr für unser Leben besteht<br />
– entscheiden wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt in<br />
eine zunächst unsichere Zukunft.<br />
Wilhelm von Humboldt hat einmal gesagt:<br />
„Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden<br />
noch die Frucht derselben zu genießen, denn ohne<br />
Sicherheit ist keine Freiheit.“<br />
Wir entscheiden uns dafür, unser Schicksal in die Hand zu<br />
nehmen und außerhalb unserer Heimatländer in Sicherheit,<br />
2
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong> — Begrüßung<br />
schiedlichen Gründen ein Asylantrag<br />
abgelehnt oder ein Bleiberecht verwehrt<br />
wird. Besonders problematisch<br />
ist die Situation für Familien, wenn<br />
plötzlich die Nachricht kommt, dass ein<br />
Familienmitglied wieder ins Herkunftsland<br />
zurückgeschickt werden soll, obwohl<br />
alle nach einer längeren Aufenthaltszeit<br />
schon hier verwurzelt sind.<br />
Oder wenn man eine Schule besucht,<br />
oder eine Ausbildung begonnen hat,<br />
und diese vielleicht nicht abschließen<br />
kann. In dieser oder ähnlichen ausweglos<br />
erscheinenden Situationen bleibt<br />
zumindest die Hoffnung, mit Unterstützung<br />
der <strong>Härtefallkommission</strong><br />
einen Ausweg zu finden.<br />
Die Kommission gibt uns die Möglichkeit,<br />
zusätzlich zu den bürokratischen und gesetzlichen Erfordernissen<br />
zu zeigen, wie ernst es uns ist mit unserem<br />
Wunsch, in Deutschland zu bleiben, und was wir alles dafür<br />
tun, um uns in die Gesellschaft zu integrieren.<br />
Wir möchten auf eigenen Füßen stehen, uns hier zu Hause<br />
fühlen, die Normen, Regeln und Werte dieser Gesellschaft<br />
respektieren, bewahren und schützen. Nicht nur der unsichere<br />
Aufenthaltsstatus und die unsichere finanzielle Situation,<br />
sondern vor allem auch die enorme psychische Belastung<br />
und der Druck, der auf uns lastet, führen zu Verzweiflung,<br />
Hoffnungs- und Mutlosigkeit. Außerdem besteht die Gefahr,<br />
dass man traumatisiert und antriebslos wird, statt seine Ziele<br />
konsequent weiter zu verfolgen.<br />
Das alles kenne ich aus eigener Erfahrung, und auch aus den<br />
Berichten anderer Titelinhaber. Ich möchte ein Beispiel anführen:<br />
Ein Mädchen, das wie ich allein nach Deutschland gekommen<br />
ist und dessen Asylantrag abgelehnt wurde, hätte<br />
die Schulausbildung abbrechen müssen. Sie war jedoch entschlossen,<br />
weiter ihren Weg zu verfolgen und hat sich an die<br />
<strong>Härtefallkommission</strong> gewandt. Am Ende hat sie ein Bleiberecht<br />
erhalten, im letzten Jahr ein Abitur mit der Durchschnittsnote<br />
1,9 abgelegt und vor ein paar Monaten ein Pharmazie-Studium<br />
aufgenommen, alles dank des Einsatzes der Kommission.<br />
Leider ist die Zahl der positiven Bescheide in den letzten beiden<br />
<strong>Jahre</strong>n stark zurückgegangen; fast doppelt so viele Anträge<br />
sind abgewiesen worden wie in den <strong>Jahre</strong>n zuvor. Das heißt<br />
in der Realität, dass die Hoffnungen von sehr, sehr vielen<br />
Menschen auf einen Verbleib hier in Berlin/Deutschland zunichte<br />
gemacht worden sind.<br />
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass diese Bewegung wieder<br />
in die andere Richtung führt, und viele Menschen, die unter<br />
Beweis gestellt haben, dass sie hoch motiviert sind, in Deutschland<br />
zu leben und sich zu integrieren, ein Bleiberecht erhalten<br />
werden.<br />
Positive Entscheidungen der <strong>Härtefallkommission</strong> sind ein<br />
Signal dafür, weiter zu kämpfen, und haben eine positive<br />
Wirkung auf viele Menschen in meiner Situation.<br />
Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich in den letzten <strong>Jahre</strong>n in<br />
Berlin ein Zuhause und viel Unterstützung gefunden habe und<br />
eine Schule besuchen konnte, die ich hoffentlich demnächst<br />
mit der Abiturprüfung abschließen werde. Das verdanke ich der<br />
<strong>Härtefallkommission</strong>, die mir die Sicherheit gegeben hat, mich<br />
nicht nur mit Problemen beschäftigen zu müssen, sondern<br />
mich auch auf Positives konzentrieren zu können.<br />
Ich wage gar nicht mir vorzustellen, was passiert wäre, wenn<br />
die Entscheidung des Senators negativ ausgefallen wäre.<br />
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das<br />
Wort hiermit an den Senator für Inneres und Sport, Herrn<br />
Frank Henkel.<br />
3
Grußwort Frank Henkel<br />
Senator für Inneres und Sport<br />
Allerdings sehe ich nicht in jedem Ersuchen eine unerträgliche<br />
Härte. Und wenn ich mir so manches Strafregister ansehe,<br />
dann will ich an Sie, die Mitglieder der <strong>Härtefallkommission</strong>,<br />
doch auch appellieren, manchen angemeldeten Fall noch einmal<br />
zu überprüfen. Das haben wir ja auch schon bei dem einen<br />
oder anderen Treffen besprochen.<br />
Und auch wenn ich mir die Ersuchen der letzten anderthalb<br />
<strong>Jahre</strong> geordnet nach den Herkunftsstaaten anschaue, dann<br />
wundere ich mich schon darüber, dass rund die Hälfte der Fälle<br />
aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt. In der Rückkehr in<br />
diese Länder kann ich keine besondere Härte erkennen. Immerhin<br />
sind unter diesen Ländern auch EU-Beitrittskandidaten<br />
und die Länder sind teilweise als sichere Herkunftsstaaten eingestuft.<br />
Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen das Jubiläum „10<br />
<strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong>“ feiern kann.<br />
Ich freue mich deshalb, weil mit der Einrichtung der <strong>Härtefallkommission</strong><br />
vor 10 <strong>Jahre</strong>n eine gute Grundlage geschaffen<br />
wurde, um Härtefälle bei der Anwendung des Ausländerrechts<br />
überprüfen zu können.<br />
Und das ist auch notwendig. Denn selbst das beste Gesetz<br />
schafft es nicht, jeden komplizierten Sachverhalt abstraktgenerell<br />
so zu erfassen, dass die jeweiligen Rechtsfolgen in<br />
jedem Einzelfall als gerecht empfunden werden.<br />
So kann es bei Anwendung des Gesetzes in Einzelfällen zu unerträglichen<br />
Härten kommen.<br />
Diese Härten zu korrigieren, ist eine Aufgabe, die ich als Innensenator<br />
gemeinsam mit Ihnen, den Mitgliedern der <strong>Härtefallkommission</strong>,<br />
wahrnehme.<br />
Und ich will auch mit einer Mär aufräumen. Ich höre gelegentlich,<br />
ich sei so hart bei meinen Entscheidungen.<br />
Ja, ich lege sehr wahrscheinlich an einen Härtefall strengere<br />
Maßstäbe an, als Sie das tun. Doch waren wir uns im Schnitt in<br />
den ersten drei <strong>Jahre</strong>n meiner Amtszeit bei mehr als der Hälfte<br />
der Fälle einig. So habe ich mehr als jedes zweite Ersuchen aufgegriffen<br />
und positiv beschieden. Das heißt im Klartext: Wir<br />
stimmen mehr überein, als wir auseinanderliegen.<br />
Ich will an dieser Stelle aber noch einmal ganz deutlich sagen,<br />
dass es mir bei den Härtefällen darum geht, unerträgliche<br />
Härten abzumildern und nicht das Ausländerrecht durch die<br />
Hintertür aufzuweichen.<br />
Zum Schluss meines Grußwortes bleibt mir, Ihnen für die Zusammenarbeit<br />
zu danken und Ihnen für Ihren heutigen <strong>Fachtag</strong><br />
einen erfolgreichen Verlauf und gute Gespräche zu wünschen.<br />
Herzlichen Dank.<br />
Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass wir in der Bewertung<br />
der Fälle auch mal zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.<br />
Und ich verstehe Sie durchaus, wenn Sie, sehr geehrte Mitglieder<br />
der <strong>Härtefallkommission</strong>, enttäuscht und manchmal<br />
auch verärgert sind, wenn ich einem Ihrer Ersuchen nicht folge.<br />
Doch ist die Entscheidung über die Ausnahme eines<br />
humanitären Bleiberechts mir als dem Innensenator übertragen.<br />
Und Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage,<br />
diese Entscheidung mache ich mir in jedem einzelnen Fall nicht<br />
einfach. Im Gegenteil, jedes einzelne Schicksal bewegt mich.<br />
4
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong> — Grußworte<br />
Grußwort Dilek Kolat<br />
Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen<br />
Ich gratuliere der <strong>Härtefallkommission</strong> zu ihrem zehnjährigen<br />
Geburtstag. Jedoch gibt es die <strong>Härtefallkommission</strong> in Berlin<br />
schon viel länger! Bereits seit 25 <strong>Jahre</strong>n hat Berlin ein Härtefallgremium,<br />
wobei die Arbeit erst seit zehn <strong>Jahre</strong>n eine rechtliche<br />
Basis hat. Berlin ist Vorreiter und wir sollten stolz sein.<br />
Denn der <strong>Berliner</strong> Ansatz war auch Vorbild für die Regelung im<br />
Zuwanderungsgesetz 2005, die zur bundesweiten Einrichtung<br />
von <strong>Härtefallkommission</strong>en führte.<br />
Die Arbeit der <strong>Härtefallkommission</strong> ist eine besondere Arbeit.<br />
Sie setzen sich für Menschen ein, die in Not sind, weil sie ihr<br />
Aufenthaltsrecht verloren haben. Auch setzen Sie sich für<br />
Menschen ein, die niemals ein Aufenthaltsrecht hatten, aber<br />
lange in Berlin leben. Sie korrigieren das Aufenthaltsrecht, indem<br />
Sie aufzeigen, dass Gesetze nicht perfekt sind. Sie machen<br />
sichtbar, dass es Menschen gibt, die ein Recht haben sollen, in<br />
Berlin zu sein und ihr Leben zu gestalten, die aber dieses Recht<br />
nicht bekommen, weil sie nicht in das Raster passen, das das<br />
Aufenthaltsrecht vorgibt.<br />
Gesetze geben Rechtssicherheit, einen festen Rahmen, aber<br />
schließen auch aus. Um der Lebenswirklichkeit gerecht zu<br />
werden, sind Entscheidungsspielräume im Recht nötig, und auch,<br />
dass sie genutzt werden. Aber auch hier bestehen Grenzen. Und<br />
deshalb ist eine Härteregelung so wichtig, um mit Augenmaß zu<br />
handeln und Ausnahmen von der Regel zu ermöglichen.<br />
Mit dem Verfahren der <strong>Härtefallkommission</strong> und der Entscheidung<br />
des Senators im Einzelfall übernimmt das Land<br />
Berlin Verantwortung für Menschen, die in der Stadt leben, für<br />
<strong>Berliner</strong>innen und <strong>Berliner</strong>.<br />
In der aktuellen Situation des Zuzugs von geflüchteten<br />
Menschen ist der Senat intensiv damit beschäftigt, für eine<br />
humane Aufnahme der Einreisenden zu sorgen. Wir wollen den<br />
Menschen ein Ankommen erleichtern. Wir wollen ihnen die Tore<br />
in die Gesellschaft möglichst weit öffnen und sie dabei unterstützen,<br />
hier ein neues Leben aufzubauen. Berlin rechnet mit<br />
26.000 Menschen, die dieses Jahr mit einem Asylgesuch neu in<br />
die Stadt kommen und Schutz suchen. Die Menschen brauchen<br />
ein Dach über dem Kopf, und zwar nicht in Turnhallen. Sie<br />
wollen Deutsch lernen, vielleicht arbeiten oder eine Ausbildung<br />
machen. Zugleich haben sie einen schweren Weg hinter sich<br />
und benötigen Zeit und Hilfe, ihre Erlebnisse zu verarbeiten.<br />
Zugleich ist es mir als Senatorin für Integration und Frauen<br />
sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, Verantwortung zu übernehmen<br />
für diejenigen, die bereits lange hier sind. Aktuell<br />
leben ca. 8.200 Menschen mit Duldung in Berlin, und eine<br />
Duldung ist kein Dauerzustand! Wir wissen nicht genau, wie<br />
viele Menschen ohne Papiere in Berlin leben, aber auch für sie<br />
kann das Härtefallverfahren im Einzelfall eine Lösung sein. Ich<br />
denke besonders auch an diejenigen, die hier sozialisiert sind,<br />
vielleicht sogar hier geboren wurden oder in zweiter und dritter<br />
Generation in Berlin leben. Unser Aufenthaltsrecht ermöglicht,<br />
dass selbst ein lebenslanger Verbleib in Deutschland zum Verlust<br />
des Aufenthaltsrechts oder zur Abschiebung führen kann.<br />
Denn alle Bleiberechtsregelungen, die es bisher gab und die<br />
in Planung sind, verlangen eine möglichst gerade Biographie.<br />
Das Leben ist aber anders, und es gibt Menschen, die es nicht<br />
schaffen oder nur über Umwege. Menschen, die weder Schulabschluss<br />
noch Ausbildung vorweisen können, die vielleicht in<br />
der Vergangenheit Straftaten begangen haben oder für ihren<br />
Lebensunterhalt nicht aufkommen konnten. Hierfür gibt es<br />
vielfältige Gründe und Erklärungsmöglichkeiten. Vielleicht<br />
haben die Menschen Gewalt in der Familie erlebt oder sind als<br />
Kind nicht gefördert worden. Vielleicht sind sie vor Krieg oder<br />
Armut geflohen und konnten in Deutschland nicht so schnell<br />
Fuß fassen. Vielleicht aber auch einfach, weil die gesellschaftlichen<br />
Chancen ungleich verteilt sind.<br />
Ihre wichtige Aufgabe, liebe Mitglieder der <strong>Härtefallkommission</strong>,<br />
ist es, die Biographien der von Ihnen vertretenen Menschen verständlich<br />
zu machen und zu transportieren. Ihnen, lieber Kollege<br />
Henkel wiederum obliegt die schwere Entscheidung, ob dieser<br />
Mensch eine Aufenthaltserlaubnis bekommt. Für die Betroffenen<br />
bedeutet Ihre Entscheidung eine letzte Chance auf ein Bleiberecht.<br />
Der Tag heute soll die erfolgreiche Arbeit der Kommission<br />
würdigen – aber auch Herausforderungen zur Sprache bringen.<br />
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Austausch und neue Impulse<br />
für weitere 25 <strong>Jahre</strong>.<br />
5
Bleiberecht als Menschenrecht<br />
Vortrag Tim Kliebe, Rechtsanwalt<br />
I. Einleitung<br />
Die Möglichkeit, eine <strong>Härtefallkommission</strong> anzurufen, wird<br />
häufig als Gnadenrecht angesehen. Dieser Begriff mag die<br />
rechtliche Entstehungsgeschichte zutreffend beschreiben 1 ,<br />
den Betroffenen wird mit dieser Beschreibung der Besitz eines<br />
Anspruchs abgesprochen.<br />
Wie anders würde sich das Bild darstellen, wenn der Betroffene<br />
nicht mehr Bittsteller sondern Inhaber eines Anspruchs wäre?<br />
Zumindest in zwei Fallkonstellationen ist dies zu prüfen: zum<br />
einen kann aus einem langjährigen Aufenthalt aus Art. 8 Abs.<br />
1 EMRK ein rechtliches Abschiebungshindernis entstehen. Zum<br />
anderen lässt sich hiesiger Ansicht nach aus Art. 8 Abs. 1 EMRK<br />
auch ein Anspruch auf Legalisierung eines Aufenthaltes durch<br />
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis herleiten.<br />
II. Rechtliche Grundlagen<br />
Art. 8 Abs. 1 EMRK lautet: Jede Person hat das Recht auf<br />
Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und<br />
ihrer Korrespondenz.<br />
Die Prüfung verläuft bei Grund- wie Menschenrechten vereinfacht<br />
wie folgt: zunächst ist herauszuarbeiten, welche tatsächlichen<br />
Lebensverhältnisse durch das Menschenrecht geschützt<br />
werden sollen (Schutzbereich). Dann ist zu prüfen, ob eine beabsichtigte<br />
staatliche Maßnahme in die Ausübung der Rechte<br />
im Rahmen dieses Schutzbereichs eingreift (Eingriff). Schließlich<br />
ist die Verhältnismäßigkeit zu beurteilen, also ob aufgrund<br />
des staatlichen Interesses der Eingriff gerechtfertigt ist (Verhältnismäßigkeit).<br />
Wenn eine Aufenthaltsbeendigung oder die fortgesetzte Verwehrung<br />
einer Aufenthaltserlaubnis ein unverhältnismäßiger<br />
Eingriff in das Privatleben wären, folgte daraus ein rechtliches<br />
Abschiebungshindernis im Sinne des § 25 Abs. 5 AufenthG<br />
bzw. eine Ermessensreduzierung „auf Null“ hinsichtlich der Erteilung<br />
des Aufenthaltstitels.<br />
Der Schutzbereich des Privatlebens wurde durch den EGMR<br />
wie folgt definiert: „Die Gesamtheit der sozialen Bindungen<br />
zwischen den niedergelassenen Einwanderern und der Gemeinschaft,<br />
in der sie leben“ 2 . Im Einzelnen umfasst dies<br />
z.B. folgende Schutzgüter: die Identität, die körperliche und<br />
psychische Integrität, den gute Ruf, die Privatsphäre, den Datenschutz,<br />
die Berufsausübung und vor allem sämtliche soziale<br />
Beziehungen, die nicht schon unter das Familienleben fallen 3 .<br />
Das Familienleben schützt insbesondere die Beziehungen von<br />
Familienmitglieder der klassischen Kernfamilie (also Ehe- und<br />
Lebenspartner untereinander und zu minderjährigen Kindern).<br />
Zwischen volljährigen Familienmitgliedern (nicht: den Ehe- und<br />
Lebenspartnern selbst) besteht ein geschütztes Familienleben<br />
nur dann, wenn besondere Umstände wie z.B. Pflegebedürftigkeit<br />
hinzukommen. Die Rechtsprechung des EGMR 4 hat sich<br />
insbesondere in Fällen entwickelt, in denen Straftäter aufgrund<br />
der strafrechtlichen Verfehlungen ausgewiesen und/<br />
oder abgeschoben werden sollten. In dieser Konstellation dient<br />
der Schutz des Privatlebens als Abwehrrecht. Wenn aus dem<br />
Schutz des Privatlebens ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis<br />
erwachsen soll, handelt es sich dagegen um<br />
ein Gewährleistungsrecht. In der europäischen Rechtsprechung<br />
werden diese beiden Ansprüche allerdings nahezu identisch behandelt<br />
5 . Den ersten Entscheidungen des EGMR 6 , die sich mit<br />
der Frage eines Bleiberechts befassten, lagen Fälle zugrunde, die<br />
der Zerfall des „Ostblocks“ mit sich gebracht hatte. Russische<br />
Volkszugehörige, die viele <strong>Jahre</strong> in Lettland gelebt hatten bzw.<br />
serbische Volkzugehörige, die viele <strong>Jahre</strong> in Slowenien gelebt<br />
hatten und nach der (Wiederherstellung der) Selbständigkeit<br />
der Aufenthaltsstaaten erstmalig eine Legitimierung ihres Aufenthalts<br />
benötigten. Der langjährige Aufenthalt führte zu der<br />
Feststellung, dass im Falle einer Aufenthaltsbeendigung ein<br />
Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegen würde.<br />
III. Praxis in Deutschland<br />
1. Rechtmäßigkeit des Voraufenthalts<br />
Eine besonders in der deutschen Rechtsprechung behandelte<br />
Frage ist, ob der Voraufenthalt des Betroffenen rechtmäßig<br />
gewesen sein muss, damit die während des Aufenthaltes entstandenen<br />
sozialen Bindungen schutzwürdig sind. Dieser Auf-<br />
1 z.B. Göbel-Zimmermann, „<strong>Härtefallkommission</strong>en als letzter Ausweg aus einem<br />
prekären Aufenthalt?“, ZAR 2008, 47<br />
2 EGMR, Urt. v. 18.10.20006 – 46410/99 – Rs. Üner, NVwZ 2007, 1279<br />
3 Frowein/ Peukert, Kommentar zur EMRK, 3. Aufl., Art. 8 Rn. 3 ff.<br />
4 EGMR, Urt. v. 26.3.1992 – 22/1990/246/317 – Rs. Beldjoudi; Urt. v. 13.7.1995 –<br />
18/1994/465/564 – Rs. Nasri; Urt. v. 28.11.1996 – 73/1995/579/665 –<br />
Rs. Ahmut; Urt. v. 30.11.1999 – 34374/97 – Rs. Baghli;<br />
Urt. v. 2.8.2001 – 54273/00 – Rs. Boultif; alle abzurufen auf der Internetpräsenz<br />
des EGMR<br />
5 Maierhöfer, „Bleiberecht für langjährig Geduldete nach Art. 8 EMRK – Wege zur<br />
menschenrechtskonformen Auslegung des Aufenthaltsgesetzes“, ZAR 2014, 370,<br />
m.w.N.<br />
6 EGMR, Urt. v. 16.6.2005 – 60654/00 – Rs. Sisojeva, InfAuslR 2007, 140; Urt. v.<br />
13.7.2000 – 26828/06 – Rs. Kuric<br />
6
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong> — Bleiberecht als Menschenrecht<br />
fassung ist entgegen zu treten. Für andere Grundrechte – z.B.<br />
dem Schutz des Familienlebens – ist die Frage der Rechtmäßigkeit<br />
des Voraufenthaltes unerheblich. Wenn z.B. eine drittstaatsangehörige<br />
Frau sich ohne Aufenthaltstitel in Deutschland<br />
aufhält und eine Beziehung mit einem Mann beginnt,<br />
der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, so wird ein gemeinsames<br />
Kind die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.<br />
Schon während der Schwangerschaft hat die Frau einen Anspruch<br />
auf Aussetzung der Abschiebung, nach der Geburt wird<br />
in der Regel richtiger Weise völlig unproblematisch die Aufenthaltserlaubnis<br />
gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG erteilt.<br />
Die Beziehung zu dem Kind deutscher Staatsangehörigkeit ist<br />
also schutzwürdig. Und das, obwohl die Frau in diesem Beispiel<br />
weder bei Zeugung noch bei Geburt im Besitz eines rechtmäßigen<br />
Aufenthaltstitels gewesen ist. Dass auch unrechtmäßige<br />
Voraufenthaltszeiten ein schutzwürdiges Privatleben<br />
entstehen lassen, hat in den vergangenen <strong>Jahre</strong>n als eines<br />
der wenigen Gerichte der Verwaltungsgerichtshof Baden-<br />
Württemberg anerkannt. 7<br />
2. Rechte der Kinder<br />
Insbesondere für die Rechte der Kinder hat die Ignoranz des<br />
Schutzes des Privatlebens der Kinder fatale Folgen. Die Rechte<br />
von minderjährigen Kindern werden in der deutschen Rechtsprechung<br />
unzureichend berücksichtigt. Nach ständiger Rechtsprechung<br />
einer Vielzahl von Obergerichten „teilen minderjährige<br />
Kinder aufenthaltsrechtlich grundsätzlich das Schicksal<br />
ihrer Eltern (sog. familienbezogene Gesamtbetrachtung). Steht<br />
den Eltern etwa wegen deren mangelnder Integration in die<br />
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland über Art.<br />
8 EMKR i.V.m. § 25 Abs. 5 AufenthG kein Aufenthaltsrecht zu,<br />
so ist davon auszugehen, dass auch ein Minderjähriger, der<br />
im Bundesgebiet geboren wurde oder dort lange Zeit gelebt<br />
hat, grundsätzlich auf die von den Eltern nach der Rückkehr im<br />
Familienverband zu leistenden Integrationshilfen im Heimatland<br />
verwiesen werden kann“. 8<br />
Das klingt beinah so, als würden die Grundrechte aufgrund<br />
der Minderjährigkeit nur eingeschränkte Geltung haben. Dass<br />
7 VGH BW, Urt. v. 13.12.2010 – 11 S 2359/10, abzurufen unter: www.asyl.net<br />
8 zitiert nach: OVG Lüneburg, Beschl. v. 9.11.2010 – 8 PA 265/10 – S. 2, abzurufen<br />
unter: www.asyl.net<br />
7
Dienstags und Donnerstags ist<br />
Fußballtraining, am Wochenende<br />
häufig noch ein Spiel. Das<br />
Kind ist regelmäßig zu Kindergeburtstagen<br />
eingeladen, lädt<br />
selbst jedes Jahr 4 oder 5 Kinder<br />
ein. Wenn dieses Kind (und<br />
seine Eltern) lediglich im Besitz<br />
einer Bescheinigung über die<br />
Aussetzung der Abschiebung<br />
(Duldung) ist, soll dieses Privatleben<br />
nicht selbständig Geltung<br />
beanspruch können? Das kann<br />
nicht richtig sein. Die Entscheidungspraxis<br />
der Obergerichte<br />
steht im Widerspruch<br />
zum völkerrechtlichen Verständnis<br />
der Menschenrechte.<br />
Diese sind als Individualrechte<br />
ausgestaltet, die nicht in Abhängigkeit<br />
zum Alter oder dem<br />
Bestehen z.B. von familiären<br />
Verbindungen stehen. 10<br />
dies nicht zutrifft, ist unstreitig. Zur Verdeutlichung sei an die<br />
Diskussionen in Deutschland angesichts der Neuregelung des<br />
§ 218a StGB (straffreier Schwangerschaftsabbruch) erinnert.<br />
Selten hat ein Gesetz 9 solch ein mediales Echo erfahren und<br />
wurden die Beratungen so ausführlich in den Medien dargestellt.<br />
Für die Abstimmung wurde gar der Fraktionszwang<br />
aufgehoben. Letztlich wurde geregelt, dass ein straffreier<br />
Schwangerschaftsabbruch – in der Regel – nur bis zum dritten<br />
Schwangerschaftsmonat möglich sei. Weshalb: Weil danach das<br />
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit des Nasciturus<br />
das Recht der – werdenden – Mutter auf Selbstbestimmung über<br />
ihren Körper überwiegt. Sobald sich die befruchtete Eizelle in<br />
der Gebärmutter eingenistet hat und die Zellteilung begonnen<br />
hat, ist dieser Zellhaufen Träger von Rechten.<br />
Um im Bild zu bleiben: Sieben <strong>Jahre</strong> später ist dieser Zellhaufen<br />
ein Schulkind. Stellen wir uns das Privatleben des Kindes vor:<br />
Es ist über sechs <strong>Jahre</strong> in diesem Stadtteil aufgewachsen, hat<br />
drei <strong>Jahre</strong> den Kindergarten besucht. Das Kind spricht natürlich<br />
fließend die deutsche Sprache, kennt jeden Spielplatz in einem<br />
Radius von 5 km um die eigene Wohnung herum und wird von<br />
der Verkäuferin in der Bäckerei mit Namen begrüßt (ab und<br />
zu bekommt es auch ein Croissant geschenkt). Die Frau, die<br />
Parterre wohnt, passt ab und zu auf das Kind auf, wenn die<br />
Mama arbeiten gehen muss und wird von dem Kind „Oma“<br />
genannt. Die wirklichen Großeltern kennt es nur vom Telefon.<br />
IV. Folgen<br />
In jedem Fall der Eröffnung des Schutzbereiches von Art. 8<br />
Abs. 1 EMRK ist das tatsächlich gelebte Privatleben aus der<br />
Perspektive des Kindes zu ermitteln. Nur dann kann die gem.<br />
Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Verhältnismäßigkeit geprüft<br />
werden. Noch einmal sei auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes<br />
Baden-Württemberg verwiesen. Hinsichtlich des<br />
Privatlebens der Tochter der klagenden Familie, der Klägerin<br />
zu 3, wurde festgestellt: „Auch im Übrigen lebt die Klägerin zu<br />
3 – wie ihre Angaben in der mündlichen Verhandlung verdeutlicht<br />
haben – in einer Weise, wie sie auch unter Gleichaltrigen<br />
deutscher Herkunft praktiziert wird. Sie erhält mittlerweile<br />
Klavierunterricht und hört am liebsten Musik der Richtung „Hip<br />
hop“. Sie schaut in ihrer Familie oder gemeinsam mit Freunden<br />
und Freundinnen Fernsehsendungen deutscher Privatsender.<br />
Die Klägerin zu 3 kleidet sich in einer Art, wie sie auch unter<br />
jungen deutschen Mädchen üblich ist. Sie geht mit einem Bikini<br />
ins Schwimmbad und trägt kurze Hosen sowie dekolletierte<br />
Oberbekleidung“. 11<br />
Erst wenn das Privatleben aller Betroffenen umfassend eruiert<br />
wurde, kann in die Verhältnismäßigkeitsprüfung eingetreten<br />
werden. An dieser Stelle ist die Frage zu entscheiden, ob die<br />
Betroffenen als „faktische Inländer“ zumutbar nur noch im<br />
9 BT-Drs. 13/285; 13/27; 13/1850<br />
10 vgl. Maierhöfer, a.a.O., S. 373<br />
11 VGH BW, s. Fn. 7<br />
12 EGMR, s. Fn. 6, S. 141<br />
8
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong> — Bleiberecht als Menschenrecht<br />
Bundesgebiet leben können. Wenn dies der Fall ist, muss den<br />
Betroffenen der weitere Aufenthalt im Bundesgebiet ermöglicht<br />
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere<br />
der Begriff der „faktischen Inländer“ im Zusammenhang mit<br />
Ausweisungsfällen entwickelt wurde. In diesen Fällen lag in der<br />
Regel ein besonderes öffentliches Interesse an der Aufenthaltsbeendigung<br />
aufgrund massiver Straffälligkeit vor. In dem oben<br />
gebildeten Beispielfall des sechsjährigen Schulkindes bestünde<br />
ein solch massives Interesse an einer Aufenthaltsbeendigung<br />
nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Das bedeutet insbesondere:<br />
es muss nicht immer eine Unmöglichkeit der (Re-)<br />
Integration in das Herkunftsland (der Eltern) vorliegen, um zu<br />
dem Ergebnis zu kommen, dass der Schutz des Privatlebens<br />
das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung überwiegt.<br />
Und schließlich: Ja, nach hiesiger Ansicht lässt sich aus Art. 8<br />
Abs. 1 EMRK ein menschenrechtlicher Anspruch auf Erteilung<br />
einer Aufenthaltserlaubnis ableiten! In der Rs. Sisojeva hatte<br />
der EGMR eben diese Frage zu entscheiden. Dabei wurde durch<br />
das Gericht entschieden, dass es für das Gericht nicht zu entscheiden<br />
sei, welche Art von Aufenthaltstitel die Betroffenen<br />
erhalten würden. Dann führt das Gericht aus: „Soweit dieser<br />
[Aufenthaltstitel, Anm. des Verfassers] dem Inhaber gestattet,<br />
im Staatsgebiet des Aufnahmestaats zu wohnen und dort<br />
seine Rechte auf Achtung des Privat- und Familienleben frei<br />
auszuüben, stellt die Erteilung dieses Titels grundsätzlich eine<br />
hinreichende Maßnahme zur Erfüllung der Anforderungen des<br />
Art. 8 EMRK dar“. 12 Eine Bescheinigung über die Aussetzung<br />
der Abschiebung (Duldung) ermöglicht den Betroffenen aber<br />
gerade nicht, das Privatleben frei auszuüben. Diese wird –<br />
bei nicht ausreichender Sicherung des Lebensunterhaltes<br />
– mit wohnsitzbeschränkender Auflage erteilt und ermöglicht<br />
keinen Grenzübertritt. Familienbesuche im Ausland sind<br />
nicht möglich. Der Familiennachzug ist völlig ausgeschlossen.<br />
Visumerteilungen an Familienangehörige bei Einladung durch<br />
Betroffene, die lediglich im Besitz einer Bescheinigung über<br />
die Aussetzung der Abschiebung sind, sind eine seltene Ausnahme.<br />
Der Bezug von Kindergeld ist ausgeschlossen und<br />
weitere Sozialleistungen, die zu einer Verbesserung der<br />
Integration führen würden, sind ausgeschlossen. Das bedeutet:<br />
die Betroffenen können ihr Privat- und Familienleben<br />
nicht uneingeschränkt ausleben, wenn sie lediglich im Besitz<br />
einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung<br />
sind. Die Stellung wäre mit Aufenthaltserlaubnis eine völlig<br />
andere. Schließlich wird in § 60a Abs. 3 AufenthG gesetzlich<br />
festgestellt: Die Duldung lässt die Ausreisepflicht fortbestehen.<br />
Personen, denen aus Art. 8 Abs. 1 EMRK ein Bleiberecht zusteht,<br />
sind nicht ausreisepflichtig.<br />
Es gibt eine menschenrechtliche geschützte Rechtsposition –<br />
der Schutz des Privatlebens im Sinne des Art. 8 Abs. 1 EMRK<br />
kann in bestimmten Konstellationen ein Bleiberecht und einen<br />
Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels vermitteln.<br />
Bleiberecht als Menschenrecht.<br />
Nach der Pause gab der Beitrag<br />
der Violinistin Gloria Marcela Diaz<br />
Dits, Titelinhaberin über die HFK<br />
Berlin, der Veranstaltung einen<br />
festlichen Rahmen. In einem<br />
bewegenden Vortrag spielte sie<br />
den 2. Satz aus dem Violinkonzert<br />
e-moll op. 64 von Felix Mendelssohn<br />
Bartholdy, die „Meditation Thaïs“<br />
von Jules Massenet sowie ein<br />
kolumbianisches Volksstück.<br />
9
Podium<br />
„Geschichtsstunde“<br />
Moderation: Nina Amin, Journalistin<br />
Teilnehmer_innen:<br />
Barbara John, Ausländerbeauftragte Berlin von 1981 bis 2003<br />
Traudl Vorbrodt, ehemaliges Mitglied der<br />
<strong>Härtefallkommission</strong> Berlin<br />
Michael Hampel, ehemaliger Leiter der Geschäftsstelle der<br />
<strong>Härtefallkommission</strong><br />
Peter Marhofer, Referatsleiter SenInnSport und<br />
Leiter der Geschäftsstelle der <strong>Härtefallkommission</strong><br />
Bayleen Villanueva, Jagtar Singh, Titelinhaber_innen über die<br />
<strong>Härtefallkommission</strong> Berlin<br />
Auf dem ersten Podium, das sich der Geschichte der <strong>Berliner</strong><br />
<strong>Härtefallkommission</strong> (HFK) widmete, berichtete Barbara John<br />
von ihrer Arbeit als erste Ausländerbeauftragte des <strong>Berliner</strong><br />
Senats. Zu ihrem Amtsantritt machte sie zur Bedingung, dass<br />
ihr Büro, zwar als Stabsstelle gedacht, auch als Anlaufstelle für<br />
Menschen mit aufenthaltsrechtlichen Problemen fungierte.<br />
Grundlegend dafür war die Einsicht, dass die Lebenswirklichkeit<br />
der Zugewanderten, gerade im familiären Bereich – Kindernachzug,<br />
Ehebestandsjahr und die Folgen – in der Ausländergesetzgebung<br />
von 1965 nicht vorgesehen war. Außerdem<br />
waren die Ermessenspielräume der Beamtinnen und Beamten<br />
sehr groß. Dabei wurden – der damaligen Stimmung entsprechend<br />
– die öffentlichen Interessen gegenüber den persönlichen<br />
Notlagen der antragstellenden Person bevorzugt.<br />
„Zuwanderung war ein subversives Wort“, so beschrieb Frau<br />
John das vorherrschende Politikkonzept, das einen Verbleib<br />
in Deutschland damals vorrangig von der Arbeitssituation<br />
abhängig machte und die Sachbearbeitung der Ausländerbehörde<br />
einzige Ansprechperson für die Hilfesuchenden<br />
werden ließ.<br />
Deshalb brauchte ein rückständiges Ausländergesetz eine<br />
Härtefallbetrachtung, weil, so Frau John, „die Probleme der<br />
Menschen sich nicht nach Parteiprogrammen richten“. So<br />
wurde verhindert, dass jeder Fall einzeln mit der Sachbearbeitung<br />
ausgehandelt werden musste und man nur mit<br />
Glück an eine verständige Person geriet, die letztlich einen<br />
positiven Bescheid ausstellte.<br />
In einem engagierten Vortrag widmete sich Traudl Vorbrodt<br />
anschließend der 30-jährigen Entstehungsgeschichte der<br />
Härtefallregelung. Viel kompetente Geburtshilfe u. a. vom<br />
Flüchtlingsrat, von Amnesty International, der Alternativen<br />
Liste sowie der SPD war nötig, um eine als ungerecht und unmenschlich<br />
empfundene Gesetzgebung zu verbessern.<br />
Mitte der 80er <strong>Jahre</strong> kamen viele Flüchtlinge über die DDR<br />
nach West-Berlin mit der Folge, dass sie ohne Ansehen des<br />
individuellen Schicksals im Zuge von Massenabschiebungen<br />
vom Flughafen Tegel aus in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt<br />
wurden. Diese Massenabschiebungen sorgten unter<br />
anderem bei der Kirchenasylbewegung für Entsetzen und<br />
ließen den Wunsch nach einer Härtefallregelung laut werden.<br />
Der damalige Innensenator Heinrich Lummer erkaufte stattdessen<br />
bei der Regierung der DDR die Visapflicht für tamilische<br />
Schutzsuchende sowie von nicht bekannter Stelle Rückreisedokumente<br />
für Menschen aus dem Libanon. Da die Ausländergesetze<br />
in der Würdigung einzelner Schicksale Mängel zeigten<br />
und die Behörden Sonderfälle als Belastung empfanden, beschloss<br />
der rot-grüne Senat den Einsatz einer HFK, die am<br />
05.07.1990 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammentrat,<br />
jedoch noch keine gesetzliche Grundlage besaß.<br />
Nach einem kurzfristigen Aus der HFK unter der folgenden<br />
großen Koalition, die die Arbeit einer nicht-gewählten Gruppe<br />
als Ausgrenzung demokratischer Institutionen empfand,<br />
leistete die <strong>Berliner</strong> HFK bis 2004 „gesetzlose Härtefallarbeit“,<br />
die Frau Vorbrodt oft als frustrierend und ärgerlich<br />
empfand. Besonders der Umgang mit Menschen, die Straftaten<br />
begangen hatten, die nach Verbüßung ihrer Gefängnisstrafe<br />
quasi automatisch abgeschoben wurden, wurde als<br />
doppelte Bestrafung angesehen. Die Tätigkeit zeigte ihr aber<br />
auch, dass humanitäre Schutzgewährung mit dem Mut und<br />
10
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong> — Podium „Geschichtsstunde“<br />
Interesse der Entscheidungsträger und politischen Parteien<br />
steht und fällt.<br />
Dennoch konnte die HFK Berlin von 1990 bis 2004 knapp 2.000<br />
Menschen helfen, ohne gesetzliche Grundlage einen Aufenthaltstitel<br />
zu erlangen. 2005 schließlich wurde unter Innenminister<br />
Otto Schily die Härtefallregelung mit § 23a des Aufenthaltsgesetzes<br />
bundesweit legitimiert.<br />
Michael Hampel begrüßte diesen Schritt, weil es seitdem<br />
leichter ist, einen Fall positiv zu entscheiden.<br />
Die Titelinhaberin Bayleen Villanueva berichtete dann von ihrem<br />
Leben als in Deutschland geborene Tochter philippinischer<br />
Eltern. Sie lebte 21 <strong>Jahre</strong> ohne Papiere in Deutschland und<br />
konnte deshalb kein Abitur machen. Nach ihrer mittleren Reife<br />
erlangte sie über die <strong>Härtefallkommission</strong> einen Aufenthaltstitel.<br />
Erst mit Erteilung des Titels vier <strong>Jahre</strong> nach ihrem Schulabschluss<br />
konnte sie eine Ausbildung beginnen. Sie machte<br />
ihren Führerschein und konnte trotz der schwer erklärbaren<br />
Lücke in ihrem Lebenslauf eine Ausbildung abschließen, seit<br />
2014 absolviert sie zusätzlich ein BWL-Studium.<br />
Peter Marhofer bezeichnete als Vorteil des § 23a den vergrößerten<br />
Handlungsspielraum der HFK und der Innenministerien,<br />
die die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und<br />
Humanität nun auf gesetzlicher Grundlage berücksichtigen<br />
können. Dennoch sieht er nach wie vor das Problem der Messbarkeit,<br />
was gerecht und humanitär ist, weil es keine objektiv<br />
überprüfbaren Wahrheiten in der Einzelfallbetrachtung<br />
gibt. Selbst das Kriterium der Lebensunterhaltssicherung<br />
ist individuell unterschiedlich zu gewichten. Ebenso die Bewertung<br />
von Straftätern, deren Abschiebung in einem rechtlichen<br />
und sozialen Spannungsfeld zum Resozialisierungsauftrag<br />
im Strafvollzugsgesetz und den im Vollzug hierfür<br />
entstehenden Kosten steht. Als Problem empfindet er, dass<br />
seit dem Arbeitsbeginn des neuen <strong>Berliner</strong> Senats nur noch ein<br />
Drittel der Fälle vom Innensenator positiv beschieden werden,<br />
unter seinem Vorgänger waren es noch zwei Drittel.<br />
In diesem Zusammenhang widmete sich Herr Marhofer auch<br />
der hohen Ablehnungsquote von Balkanflüchtlingen, deren<br />
Rückkehr in ein vermeintlich sicheres Herkunftsland nach<br />
politischer Vorgabe per se zumutbar ist. In den Augen der<br />
HFK ist das eine Verallgemeinerung, die Menschen aus diesen<br />
Ländern benachteiligt.<br />
Herr Marhofer betonte ungeachtet dessen den hohen Stellenwert<br />
der Arbeit der HFK für die Innenverwaltung.<br />
Im Folgenden machte Frau John deutlich, dass das damals<br />
sehr rudimentäre Ausländergesetz beim Ehegattennachzug<br />
noch gar nicht berücksichtigen konnte, was alles regelungsbedürftig<br />
war. Beispielsweise ein notwendiges eigenständiges<br />
Aufenthaltsrecht für nachgezogene Ehefrauen. Die Gesetzeslage<br />
machte es bis zu einer <strong>Berliner</strong> Härtefallregelung möglich,<br />
dass die ABH Ehemännern half, ihre unerwünschten Frauen in<br />
deren Herkunftsländer zurückzuschicken.<br />
Nina Amin<br />
Herr Jagtar Singh schilderte, dass er 2002 von Indien nach<br />
Berlin kam und erst 2015 im zweiten Anlauf einen Titel mit<br />
Hilfe der HFK erwirken konnte. Nach 13 <strong>Jahre</strong>n ist er nun endlich<br />
in der Lage, seine Eltern in Indien zu besuchen.<br />
Die folgende Diskussion widmete sich dem Problem der langen<br />
Dauer von bis zu einem Jahr oder sogar länger zwischen Antragstellung<br />
und Verhandlung, die für die Antragsteller eine<br />
große Belastung ist. Herr Marhofer wies darauf hin, dass<br />
Stellenanmeldungen beim Finanzsenator erfolglos waren, obwohl<br />
ein beschleunigtes Verfahren in jedem Fall Kosten spart.<br />
Nach dem neuesten Stand besteht aber Aussicht auf eine<br />
zusätzliche Stelle im gehobenen Dienst. Er machte zudem<br />
deutlich, dass das neue Bleiberecht auch weiterhin Härtefälle<br />
produzieren wird.<br />
Insbesondere die Situation unbegleiteter Minderjähriger bedarf<br />
besonderer Beachtung. Wie Herr Kliebe in seinem Vortrag<br />
ausführte, müsste die UN-Kinderrechtskonvention, die<br />
von Deutschland ebenfalls ratifiziert wurde, Minderjährigen<br />
in bestimmten Situationen den Status sichern. In der Praxis<br />
erkennen jedoch die Behörden nicht an, dass Kinder eigene<br />
Rechte haben und ihre Fälle gesondert vom Status der Eltern<br />
betrachtet werden müssten.<br />
Auf die Forderung von Canan Bayram, integrationspolitische<br />
Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im <strong>Berliner</strong> Abgeordnetenhaus,<br />
nach einer schriftlichen Begründung von Ablehnungen<br />
durch den Innensenator erwiderte Herr Marhofer,<br />
dass eine solche aus Sicht der HFK und der Betroffenen zwar<br />
wünschenswert wäre, aber im Ermessen des Senators liegt,<br />
weil seine Entscheidung nicht justitiabel ist. Herr Hampel<br />
merkte an, dass die Konzeption des § 23a eine solche schriftliche<br />
Begründung nicht zulässt.<br />
11
Impulsvortrag<br />
Peter Marhofer zu 10 <strong>Jahre</strong>n Arbeit der HFK seit 2005<br />
Sehr geehrte Frau Senatorin Kolat,<br />
sehr geehrter Herr Senator Henkel,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
liebe Gäste,<br />
was haben uns Frau John und Herr Hampel hier für einen ungewöhnlichen<br />
Prozess geschildert.<br />
Da finden sich im Umgang mit ausreisepflichtigen Migranten<br />
in Berlin hoch engagierte Vertreter des Staates und der Zivilgesellschaft<br />
zusammen und stellen übereinstimmend fest, dass<br />
es in den gesetzlichen Regelungen des Ausländerrechts Lücken<br />
gibt, die bei strikter Anwendung der Gesetze zu subjektiv als<br />
ungerecht empfundenen Ergebnissen führen und suchen nach<br />
gerechten Lösungen am Rande geltenden Rechts.<br />
Rechtsstaatlich betrachtet eine kritische Grauzone.<br />
Seit Schaffung des § 23a ist unser Handlungsspielraum größer<br />
geworden und vor allem gesetzlich abgesichert – ein Riesenfortschritt.<br />
Die Regelung ermöglicht nun offiziell die Berücksichtigung und<br />
Gewichtung von Aspekten der Gerechtigkeit im Einzelfall.<br />
Die Einbeziehung der Regelung in den Abschnitt der<br />
humanitären Aufenthaltstitel zeigt zudem aus meiner Sicht die<br />
innere Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Humanität auf.<br />
Ein in unserem rechtsstaatlich orientierten System sehr ungewöhnlicher<br />
Vorgang.<br />
Warum?<br />
Dies wird deutlich, wenn man den Versuch unternimmt, das<br />
Verhältnis zwischen Recht und Gerechtigkeit in unserem<br />
liberalen rechtstaatlichen System zu analysieren:<br />
Meines Erachtens können drei grundsätzliche Positionen unterschieden<br />
werden:<br />
Die erste Extremposition würde beinhalten, dass ein Gesetz, das<br />
von Mehrheiten in der Gesellschaft als ungerecht empfunden<br />
wird, nicht befolgt werden muss.<br />
Rechtsstaatlich betrachtet ein unhaltbares Ergebnis.<br />
Die direkte extreme Gegenposition würde beinhalten, dass<br />
ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Wahrnehmungen zur<br />
Frage der Gerechtigkeit jedes Gesetz als abschließend und verbindlich<br />
anerkannt werden muss, solange es von einem hierzu<br />
berufenen Gesetzgeber in Kraft gesetzt worden ist.<br />
Rechtsstaatlich betrachtet ein gewünschtes und gefordertes<br />
Ergebnis.<br />
Die rechtssystematisch in der Mitte zwischen beiden Extrempositionen<br />
angesiedelte Position akzeptiert geltendes Recht,<br />
sucht aber in als extrem ungerecht empfundenen Einzelfällen<br />
nach Lösungen außerhalb des Rechts.<br />
An dieser Stelle standen wohl Herr Hampel und Frau Vorbrodt<br />
in den 90er <strong>Jahre</strong>n.<br />
Ich verstehe in diesem Zusammenhang Humanität als einen<br />
Aspekt von Gerechtigkeit im Sinne eines Ausgleichs sozialer<br />
Benachteiligung im Einzelfall.<br />
Und doch zeigt die Ausgangslage dieser drei Positionen das Dilemma<br />
auf, dass auch durch die Schaffung des § 23a AufenthG<br />
bis zum heutigen Tage nicht aufgelöst werden konnte:<br />
Zwar haben wir jetzt mit § 23a einen gesetzlichen Rahmen,<br />
der das Spannungsfeld zwischen der gesetzlich normierten Beendigung<br />
von Aufenthaltsrechten und gerechten humanitären<br />
Aspekten, trotzdem in Deutschland bleiben zu dürfen, auflösen<br />
oder reduzieren soll.<br />
Aber wer bewertet und wer kontrolliert, was gerecht und<br />
humanitär ist und dass Betroffene in vergleichbarer persönlicher<br />
Situation auch wirklich gleich behandelt werden?<br />
Die Anwendung des § 23a AufenthG ist nicht justitiabel.<br />
12
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong> — Impulsvortrag<br />
Und dies hat seinen Grund sicherlich auch darin, dass es bis<br />
zum heutigen Tag keine sicheren und vor allem gesellschaftlich<br />
einheitlichen Maßstäbe dafür gibt, Gerechtigkeit und<br />
Humanität zu messen und zu bewerten.<br />
Einigkeit dürfte nur darüber bestehen, dass in jedem freiheitlichen<br />
Rechtsstaat Raum sein sollte, neben den gesetzlichen<br />
Regelungen auch Ideen der Gerechtigkeit in die Lösung von<br />
Einzelfällen einzubeziehen und § 23a AufenthG lässt ja auch<br />
genau diese Erwägungen zu.<br />
Sogar mancher Kirchenasylfall konnte in diesem Rahmen einer<br />
für alle Beteiligten annehmbaren Lösung zugeführt werden.<br />
Aber die Kernfrage ist geblieben: Was ist gerecht?<br />
Von Aristoteles bis heute gibt es hierzu keine klaren Antworten.<br />
Bei Aristoteles bedeutet Gerechtigkeit, jeder Person frei von<br />
Willkür das ihr Zustehende zukommen zu lassen.<br />
In der Neuzeit wird Gerechtigkeit häufig daran gemessen, ob<br />
die gesetzlichen Regeln inhaltlich gerecht erscheinen.<br />
Beides hilft im Kontext des § 23a AufenthG , also bei der Einzelfallbetrachtung<br />
unter dem Blickwinkel von humanitärem gerechten<br />
Denken nicht weiter.<br />
Es gibt hier keine objektiv überprüfbaren Wahrheiten, sondern<br />
nur unsichere und uneinheitliche Vorstellungen als Ausdruck<br />
subjektiven Fühlens und Wahrnehmens.<br />
Zwei Gedanken hierzu aus den letzten 10 <strong>Jahre</strong>n:<br />
Der Anteil positiver Entscheidungen der angemeldeten und in<br />
der HFK beratenen Fälle betrug in der Amtszeit von Senator Dr.<br />
Körting ca. zwei Drittel der Fälle, aktuell in der Amtszeit von<br />
Senator Henkel nur noch ca. ein Drittel der Fälle.<br />
Dies ist allerdings nur teilweise auf grundsätzlich unterschiedliche<br />
Vorstellungen der beiden Senatoren zurück zu führen,<br />
in welchen Fallkonstellationen ein Bleiberecht gerecht erscheint,<br />
z.B. bei der Bewertung der Bedeutung der Lebensunterhaltssicherung,<br />
teilweise auch hinsichtlich der Bewertung<br />
und Gewichtung von Straftaten in Abwägung zu positiven<br />
Integrationsleistungen in der Gesamtbiografie der Betroffenen.<br />
Die negative Entwicklung der Zahlen hat – wie Sie wissen –<br />
jedoch auch noch ganz andere Gründe.<br />
Diese bestehen darin, dass anders als in früheren <strong>Jahre</strong>n<br />
in deutlich höherer Zahl Fälle zur Beratung in der HFK angemeldet<br />
worden sind, in denen Menschen sich erst so kurze<br />
Zeit in Deutschland aufgehalten haben, dass die in der Regel<br />
für jede positive Entscheidung vorausgesetzten Integrationsleistungen<br />
von den Betroffenen schon aus zeitlichen Gründen<br />
gar nicht erbracht werden konnten.<br />
Dies gilt zu einem hohen Prozentsatz für die Menschen aus<br />
dem Westbalkangebiet, bei denen wir mit Ihnen darum streiten,<br />
ob die unstreitig bestehenden rechtlichen und sozialen Benachteiligungen<br />
im Herkunftsland in Verbindung mit häufig<br />
erheblichen Erkrankungen ein ausreichender Grund sind, allen<br />
hiervon betroffenen Menschen ein Bleiberecht nach § 23a<br />
AufenthG einzuräumen.<br />
Hier vertritt der Senator, aber auch die Geschäftsstelle der<br />
HFK die Auffassung, dass es für Menschen aus dem Westbalkangebiet,<br />
die erst kurze Zeit in Deutschland sind, in aller<br />
Regel nach Ablehnung ihres Asylantrags zumutbar ist und<br />
bleiben muss, in ihre Heimat zurück zu kehren, wenn keine Abschiebungshindernisse<br />
bestehen, während Sie dies auf Grund<br />
der massiven wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und persönlichen<br />
Benachteiligung dieser Menschen in den Westbalkanstaaten<br />
für inhuman und damit ungerecht halten.<br />
Uns bewegt hierbei, dass es auf der Welt sehr viele Menschen<br />
mit vergleichbarer rechtlicher und sozialer Benachteiligung<br />
gibt, die nicht alle in den Genuss des § 23a kommen können.<br />
Dies gilt heute umso mehr im Hinblick auf die immer weiter zunehmende<br />
Zuwanderung von Flüchtlingen nach Berlin, die hier<br />
als anerkannte Flüchtlinge eine Aufenthaltsperspektive haben<br />
und untergebracht und versorgt werden müssen.<br />
Sie bewegt unter dem Gerechtigkeitsaspekt stärker der persönliche<br />
Eindruck und die persönliche Betroffenheit gegenüber<br />
dem Schicksal der Menschen, die Sie beraten.<br />
Ich verstehe das, und trotzdem kommen wir an diesem Punkt<br />
nicht zusammen, wie Sie wissen.<br />
Ungeachtet dessen sollten wir zuversichtlich bleiben.<br />
§ 23a hat sich als unverzichtbares Instrument humanitärer<br />
Entscheidungen im Ausgleich von Recht und Gerechtigkeit erwiesen<br />
Es lohnt immer, um Gerechtigkeit im Einzelfall zu streiten.<br />
Es geht nicht um das Auffinden fester objektivierbarer Wahrheiten,<br />
sondern um die Suche nach humanitär motivierter Gerechtigkeit<br />
in unseren Beratungen – in jedem Einzelfall neu.<br />
Für Ihre Impulse, die Sie in diesem Prozess in jedem Einzelfall<br />
neu zur Verfügung stellen und mit Geduld, Beharrlichkeit<br />
und großem humanitären Engagement uneigennützig immer<br />
wieder neu verteidigen, bin ich Ihnen dankbar. Lassen Sie da<br />
nicht locker! Dieser Prozess lohnt es, immer wieder neu gegenseitig<br />
voneinander und miteinander zu lernen, den Ausgleich<br />
zwischen Recht und Gerechtigkeit zu finden.<br />
Vielen Dank!<br />
13
Podium „Die Rolle der HFK in einer sich weiterentwickelnden<br />
Einwanderungsgesellschaft“<br />
Moderation: Nina Amin, Journalistin<br />
Teilnehmer_innen:<br />
Bettina Nickel, Stellv. Leiterin des Katholischen Büros Bayern<br />
und Mitglied der Bayer. <strong>Härtefallkommission</strong><br />
Dr. jur. Petra Follmar-Otto, Leiterin der Abteilung<br />
Menschenrechtspolitik Inland/Europa, Deutsches Institut<br />
für Menschenrechte<br />
Dr. Michael Maier-Borst, Arbeitsstab der Beauftragten der<br />
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration<br />
Engelhard Mazanke, Leiter der <strong>Berliner</strong> Ausländerbehörde<br />
Merdjan Jakupov, Amaro Drom e.V.<br />
Das zweite Podium begann mit einem Bericht von Bettina<br />
Nickel über ihrer Arbeit in der Bayerischen HFK, wo eine<br />
Erfolgsquote von 100% erreicht wird. Schon im Vorfeld sind in<br />
einzelnen Fällen Klärungen mit dem Innenministerium möglich,<br />
so dass weniger Fälle verhandelt werden müssen. Die<br />
Vorbereitung der Fälle, die schließlich dem Innenminister vorgelegt<br />
werden, ist so sorgfältig und zeitintensiv, dass sie nach<br />
einer Bearbeitungszeit von einem halben Jahr ausschließlich<br />
positiv beendet werden. Dabei betonte sie, dass anders als<br />
in Berlin sichere Herkunftsländer kein „Ausschlussgrund“ für<br />
einen positiven Bescheid sind.<br />
Engelhard Mazanke erläuterte, dass der von ihm als „Gnadenrecht“<br />
betitelte § 23a für seine Behörde insofern nicht von Bedeutung<br />
ist, als er bei den Entscheidungen vor einem Härtefallersuchen<br />
keine Rolle spielt. Im Falle eines Härtefallantrages<br />
wird durch seine Behörde automatisch eine Duldung ausgesprochen.<br />
Auch schon eingeleitete Abschiebungsverfahren<br />
werden umgehend gestoppt. Nach Ende des Härtefallverfahrens<br />
wird die dann getroffene Entscheidung der Senatsverwaltung<br />
für Inneres umgesetzt.<br />
Dr. Petra Follmar-Otto hob hervor, dass Menschenrechte jedem<br />
Menschen allein aufgrund seines Menschseins zustehen. Die<br />
Inanspruchnahme beispielsweise des Rechts auf Privatleben<br />
aus Art. 8 EMRK ist daher unabhängig vom Aufenthaltsstatus.<br />
Die Menschenrechte machen Vorgaben für nationale Gesetze,<br />
ein nationales Aufenthaltsrecht darf diese nicht übergehen.<br />
Sie wies darauf hin, dass Kinder eigene individuelle Rechtspositionen<br />
haben; sie dürfen deshalb bei Bleiberechtsentscheidungen<br />
nicht unter dem Blickwinkel des Verhaltens ihrer<br />
Eltern betrachtet werden. Das Kindeswohl ist ein vorrangiger<br />
Aspekt besonders in Bezug auf eine tragfähige Aufenthaltsperspektive.<br />
An den existierenden Bleiberechtsregelungen kritisierte Frau<br />
Dr. Follmar-Otto, dass diese nach wie vor einen Schwerpunkt<br />
auf Fragen von (wirtschaftlicher) Nützlichkeit haben. Wenn der<br />
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dagegen beim<br />
Recht auf Privatleben für die Beurteilung der Verwurzelung<br />
einer Person prüft, ob die Person berufstätig ist, geht es dabei<br />
um Berufstätigkeit als zentralen Ort sozialer Eingebundenheit<br />
und persönlicher Verwirklichung.<br />
Die schon im ersten Podium angesprochene schwierige<br />
Situation von Balkanflüchtlingen machte Merdjan Jakupov anschaulich.<br />
Deutschland hat eine wichtige wirtschaftliche und<br />
politische Stellung in der Welt und sollte Verantwortung für<br />
die Roma-Minderheiten in den Balkanstaaten übernehmen.<br />
Anders als nach der Einschätzung der Bundesregierung<br />
bzw. des Gesetzgebers sind die Länder Serbien, Bosnien und<br />
Herzegowina und Mazedonien laut Herrn Jakupov keine<br />
sicheren Herkunftsländer für Roma, weil sie die Roma-Rechte<br />
nicht anerkennen und die wirtschaftlichen Probleme der Mehrheit<br />
der Roma-Minderheiten an den gesellschaftlichen Rand<br />
drängen. Daher ist eine grundsätzliche Ablehnung von Flüchtlingen<br />
aus diesen Balkanstaaten falsch.<br />
Auch in seinem Fall hat die HFK geholfen. Herr Jakupov kam<br />
zur Aufnahme eines Freiwilligendienstes nach Deutschland<br />
und erhielt anschließend einen Aufenthaltstitel zur Studienvorbereitung.<br />
Die vorbereitenden Maßnahmen für das Studium<br />
14
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong> — Podium „Die Rolle der HFK in einer sich weiterentwickelnden Einwanderungsgesellschaft“<br />
Einbeziehung muslimischer Organisationen als Mitglieder der<br />
HFK.<br />
Dr. Michael Maier-Borst, Merdjan Jakupov<br />
konnte er aber, auch wegen seiner Arbeit bei Amaro Drom,<br />
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist abschließen. Die<br />
Auseinandersetzung mit der Ausländerbehörde führte nach<br />
der Einbeziehung der HFK zu einem positiven Ende, er bekam<br />
einen Aufenthaltstitel zur Beschäftigung.<br />
Herr Dr. Maier-Borst skizzierte kurz die systematischen<br />
Änderungen zwischen dem Ausländergesetz von 1990 und<br />
dem Aufenthaltsgesetz, das 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz<br />
in Kraft trat. Die klaren, aber im Ergebnis – gerade im<br />
humanitären Bereich – zu strengen Regelungen des Ausländergesetzes<br />
wurden durch das Aufenthaltsgesetz etwas gelockert.<br />
Gleichwohl haben diese Änderungen, wie auch die Einführung<br />
der Härtefallregelung in § 23a AufenthG, nicht verhindern<br />
können, dass „Kettenduldungen“ auch nach 2005 in der Praxis<br />
eine große Rolle spielen.<br />
Es ist absehbar, dass die geplanten Änderungen bei der<br />
Bleiberechtsregelung für gut integrierte Jugendliche (§ 25a<br />
AufenthG) und die stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung<br />
(§ 25b AufenthG) weitere Verbesserungen für Geduldete<br />
bringen werden. Diese wird auch die <strong>Härtefallkommission</strong>en<br />
der Länder entlasten.<br />
Darauf erwiderte Herr Mazanke, dass das Aufenthaltsrecht<br />
Deutschlands schon heute als eines der fortschrittlichsten Zuwanderungsgesetze<br />
weltweit gilt. Für Berlin führte er an, dass<br />
im letzten Jahr 110.000 anerkannten Aufenthalten lediglich<br />
280 Ausweisungen und 602 Abschiebungen gegenüberstanden.<br />
Er forderte ausdrücklich, Zugewanderte aus dem prekären<br />
Status herauszuholen, was in der Konsequenz bedeutet, dass<br />
es schnellere Entscheidungen über Bleiben oder Gehen geben<br />
muss. Dabei ist die HFK zwar eine „segensreiche Institution“,<br />
die aber zu lange Laufzeiten von bis zu einem Jahr aufweist.<br />
Zudem empfahl er eine größere Öffnung der HFK, z.B. durch<br />
die Einrichtung einer eigenen Homepage sowie eine verstärkte<br />
Den Einwurf einer Sozialarbeiterin aus dem Publikum, dass<br />
die Mitarbeitenden der Ausländerbehörde teilweise nicht<br />
qualifiziert sind und zudem den Gedanken der Behörde als<br />
kundenorientierte Dienstleistungseinrichtung vermissen<br />
lassen, beantwortete Herr Mazanke, indem er auf die hohe<br />
Transparenz der Entscheidungskriterien sowie die großzügige<br />
Rechtsanwendung der Behörde verwies. Auch er erwartet<br />
von seinen Mitarbeitenden Kundenorientierung,<br />
machte aber darauf aufmerksam, dass bei 60 Fällen pro Tag<br />
und Mitarbeiter_in Empathie zwar wünschenswert, aber nicht<br />
immer machbar ist.<br />
Seiner Einschätzung nach erfüllen von den über 10.000 Ausreisepflichtigen<br />
im Land Berlin ca. 1.600 das Kriterium der<br />
Aufenthaltsdauer mit Duldung und können somit von der erwarteten<br />
neuen Bleiberechtsregelung profitieren, wobei die<br />
weiteren Voraussetzungen natürlich erfüllt sein müssen.<br />
Den von Herrn Mazanke erhobenen Vorwurf der langen Bearbeitungszeiten<br />
durch die HFK konterte Frau Nickel, indem sie<br />
auf das große Engagement der ehrenamtlichen Mitglieder der<br />
HFK hinwies, die trotz hoher Belastungen schneller arbeiten als<br />
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Aber auch hier<br />
gilt, dass mehr Mitarbeiter in den Geschäftsstellen die Wartezeiten<br />
deutlich verkürzen können.<br />
Eine Mitarbeiterin des Flüchtlingsrates forderte eine grundsätzliche<br />
Nachbesserung im neuen Bleiberecht. Sie wünschte<br />
sich statt der HFK, die sie als bürokratisch schwer und lediglich<br />
als „Nadelöhr“ für Hilfesuchende empfindet, eine bessere<br />
Bleiberechtsregelung, die die Anrufung einer HFK überflüssig<br />
macht.<br />
Herr Dr. Maier-Borst machte in diesem Zusammenhang noch<br />
einmal auf die substantielle Verbesserung der bevorstehenden<br />
Bleiberechtsregelung aufmerksam. Zukünftig ist es stichtagsunabhängig<br />
möglich, durch eine gesicherte Arbeit den Aufenthaltstitel<br />
zu erlangen. Auch wenn die Voraussetzungen zunächst<br />
nicht vorliegen, könnte man, wenn eine Abschiebung<br />
weiterhin nicht möglich sei, „nachbessern“ und einen neuen<br />
Antrag stellen.<br />
Zum Abschluss des Podiums stellte Frau Dr. Follmar-Otto die<br />
Frage, wie die HFK entlastet werden kann. Dabei erhob sie erneut<br />
die Forderung, dass in Fällen, in denen sich Bleiberechtsansprüche<br />
aus den menschenrechtlichen Verpflichtungen<br />
Deutschlands ableiten, ein Aufenthaltsrecht von Behörden und<br />
Gerichten zuerkannt wird. Würden diese Fälle nicht bei den<br />
HFK landen, wäre die Antragslage deutlich entspannter. Dafür<br />
braucht es eine verstärkte menschenrechtliche Qualifikation<br />
von Behörden und Justiz.<br />
15
Schlussbetrachtung<br />
von P. Frido Pflüger SJ<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
wir sind am Ende unserer <strong>Fachtag</strong>ung angelangt, und ich soll<br />
nun noch einen <strong>Ausblick</strong> wagen.<br />
Ich mache zunächst noch einen ganz kurzen persönlichen<br />
<strong>Rückblick</strong>:<br />
Bis 2012 habe ich einige <strong>Jahre</strong> in den großen Flüchtlingslagern<br />
mit Hunderttausenden von Flüchtlingen in Kenia, Äthiopien<br />
und im Sudan gearbeitet. Die Flüchtlingsbewegungen hatten<br />
ganz andere Dimensionen als hier in Deutschland. Manchmal<br />
waren es Tausende, die an einem Tag dazukamen. Und das erstaunlichste<br />
war, dass kaum jemand von ihnen daran dachte,<br />
nach Europa zu gehen. Heim wollten sie, in ihre Heimat, und<br />
darauf warten sie oft 10, 15, 20 <strong>Jahre</strong>.<br />
Als ich hierherkam, fand ich eine sehr große geistige Enge vor,<br />
was Flüchtlinge betraf, und eine totale Unkenntnis der weltweiten<br />
Lage. Und ich musste mich an ganz kleine Zahlen gewöhnen.<br />
Über die Aufnahme von 5.000 Syrern wurde jahrelang<br />
diskutiert. Diese kleinen Zahlen auch in der HFK. Das juristische<br />
Denken war für mich neu. Aber wenn ich auf manchen internationalen<br />
Konferenzen über unsere deutsche Härtefallregelung<br />
sprach, dann waren meine Kolleg_innen immer sehr<br />
überrascht, weil so etwas in keinem anderen Land bekannt war.<br />
Und eigentlich ist es ja eine tolle Sache, dass Unzulänglichkeiten<br />
des Gesetzeswerkes durch eine vielseitig besetzte Kommission<br />
gemildert werden können. Nie wird es eine völlige Identität von<br />
Recht und Gerechtigkeit geben können, weil Gesetzte mit ihren<br />
verallgemeinerten Aussagen immer einen Raum offen lassen<br />
werden, wo man dann sagen kann: Eine Entscheidung ist zwar<br />
rechtens, aber sie ist nicht gerecht und tut Menschen Unrecht.<br />
Die Härtefallregelung versucht genau dies auszugleichen. Und<br />
es gelingt uns auch immer wieder.<br />
Heute würde ich es aber nicht mehr so formulieren, denn ich<br />
habe jetzt den Eindruck, dass unsere Gesetzeslage so sehr unvollkommen<br />
ist, dass wir dringend Verbesserungen schaffen<br />
16
<strong>Zehn</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong> — Schlussbetrachtung<br />
müssten. Solange dies nicht geschieht, ist die HFK dringend<br />
nötig. Frau Kolat sagt zurecht, dass es nicht nur gerade Biographien<br />
gibt, und diese komplexen Biographien werden zunehmen<br />
bei all den gegenwärtigen Flucht- und Migrationsbewegungen.<br />
Wir tun uns z.B. sehr schwer mit der Regularisierung<br />
von nicht legalisierten Aufenthalten. Und die sicheren Herkunftsländer<br />
des Balkan sind alles andere als sicher für Roma,<br />
die ja oft auch eine lange Vorgeschichte in Deutschland hatten.<br />
Darüberhinaus sind wir alle gespannt, was denn jetzt wirklich<br />
herauskommen wird bei der neuen Bleiberechtsregelung mit<br />
all dem Beiwerk. Wir haben da ja die Befürchtung, dass wir im<br />
schlimmsten Fall eine Regelung erhalten, die auf niemanden<br />
mehr zutrifft.<br />
Und unsere eigene Geschichte in der HFK ist ja auch nicht<br />
rosig mit den sehr schlechten Umsetzungsergebnissen. In sehr<br />
vielen Fällen ist mir – wahrscheinlich auch meinen Kolleginnen<br />
und Kollegen – die Ablehnung vollkommen unverständlich.<br />
Und so wundere ich mich, dass der Herr Senator sich wundert<br />
über Fälle, die wir ihm vorlegen. Wir setzen uns ja vorher sehr<br />
intensiv mit sehr vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeitern oft über lange Zeit mit den Fällen auseinander,<br />
und wir formulieren ja höchstens in einem Drittel der Fälle<br />
einen Antrag. Da bewirkt diese hohe Ablehnung zumindest bei<br />
mir eine hohe Frustration, ja sogar die Frage, ob es überhaupt<br />
Sinn macht, sich hier einzubringen, wenn 70 % der Eingaben<br />
abgelehnt werden. Da würde ja wahrscheinlich Würfeln noch<br />
zu gerechteren Ergebnissen führen.<br />
Eine andere Überlegung möchte ich noch andeuten, ob wir uns<br />
nicht zu sehr nach den Kriterien allgemein für einen Aufenthalt<br />
orientieren: Vollständige Sicherung des Lebensunterhaltes,<br />
Straflosigkeit, Gesundheit usw. Aber es geht ja um Härtefälle,<br />
wo vielleicht das gerade nicht mehr gegeben sein kann, und<br />
der Mensch trotzdem einen moralischen Anspruch hat, hier<br />
sein Leben leben zu können. Wir haben darüber gehört bei der<br />
Frage nach den humanitären Aufenthalten. Und da frage ich<br />
mich oft, ob die Behörden wirklich ihre Entscheidungsspielräume<br />
ausnutzen.<br />
Ein Punkt, der mir manchmal so durch den Kopf geht: Wieviel<br />
staatliches Geld verschleudern wir durch unsere Auflagen,<br />
z.B. durch die Verschleppung der Fälle oder durch das Arbeitsverbot<br />
– es ist mir übrigens noch nie verständlich gewesen,<br />
was das Arbeitsverbot mit der Passbeschaffung zu tun haben<br />
soll. Und welchen Personalaufwand brauchen wir, um unsere<br />
Regelungen durchzusetzen. Ich glaube, das rechnet niemand<br />
nach.<br />
Am Schluss möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie sich für<br />
dieses Thema interessieren, für’s Mitdiskutieren, Mitdenken.<br />
Ich danke allen, die zum Gelingen beigetragen haben durch<br />
Ihre Beiträge, allen, die diese gelungene Tagung so gut vorbereitet<br />
haben. Und ich möchte hier auch einmal öffentlich<br />
herzlich danken für die gute Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung,<br />
wo sehr schnell und effektiv reagiert wird auf<br />
unsere Anträge und Anfragen, unkompliziert und immer<br />
freundlich. Danke.<br />
Ich wünsche uns allen einen langen Atem, denn unser Ziel ist<br />
doch, eine Gesellschaft zu gestalten, in der wir miteinander<br />
friedlich und zufrieden leben können, als freie Menschen, in<br />
Gerechtigkeit, mit Respekt vor der Würde jedes einzelnen.<br />
17
Mitglieder der <strong>Berliner</strong> <strong>Härtefallkommission</strong><br />
Herausgeber:<br />
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen<br />
Beauftragte des Senats von Berlin<br />
für Integration und Migration<br />
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin<br />
Fax: +49 30 9017-2320<br />
Koordination:<br />
Diane Schöppe, dia° Netzwerk für Kommunikation,<br />
www.diaberlin.de<br />
Text:<br />
Barbara Baumgärtel<br />
Redaktion:<br />
Frauke Steuber<br />
Fotos:<br />
Barbara Dietl, www.dietlb.de<br />
Layout:<br />
Oliver Miersch, www.oliver-miersch.de<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Stand 2015