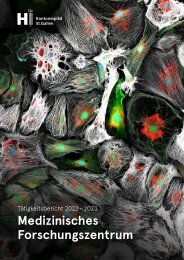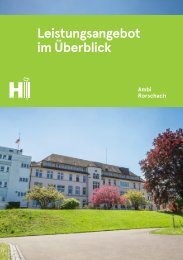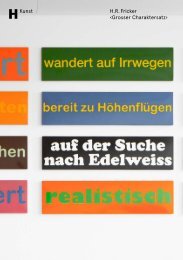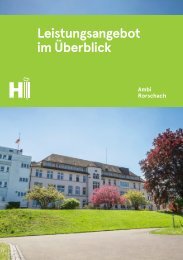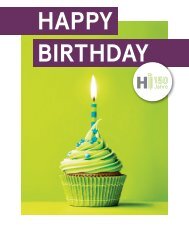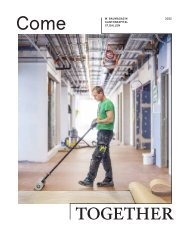DUO_10
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>DUO</strong><br />
Nr. <strong>10</strong><br />
Zuweisermagazin des<br />
Kantonsspitals St.Gallen
3<br />
Editorial<br />
Jubiläum<br />
4<br />
Fokus<br />
Das Ostschweizer Gefässzentrum:<br />
Kreislauf in Perfektion<br />
8<br />
12<br />
18<br />
24<br />
26<br />
Kader im Profil<br />
Kurznews zum Thema<br />
Renommierter Experte auf dem Gebiet<br />
der Dickdarmchirurgie<br />
Innovation und Entwicklung<br />
Kurznews zum Thema<br />
Jederzeit bestens im Bilde mit dem PACS<br />
Prozesse und Organisation<br />
Kurznews zum Thema<br />
Epilepsiezentrum am Kantonsspital St.Gallen<br />
Agenda<br />
Veranstaltungen Dezember 2016 bis April 2017<br />
Perspektivenwechsel<br />
PERFORMANCE<br />
neutral<br />
Drucksache<br />
01-16-880296<br />
myclimate.org<br />
Impressum<br />
Ausgabe Nr. <strong>10</strong>, 2016<br />
Herausgeber Unternehmenskommunikation Kantonsspital St.Gallen<br />
Gestaltung VITAMIN 2 AG, St.Gallen<br />
Druck Cavelti AG, Gossau<br />
Anregungen zum <strong>DUO</strong> nehmen wir gerne per E-Mail entgegen:<br />
redaktion@kssg.ch
Editorial 3<br />
Jubiläum<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
4<br />
14<br />
Das Zuweisermagazin <strong>DUO</strong> feiert ein kleines Jubiläum<br />
– Sie erhalten bereits die <strong>10</strong>. Ausgabe. Was als Idee<br />
begann, konnte erfolgreich umgesetzt werden und<br />
deckt die Informationsbedürfnisse grösstenteils ab,<br />
wie uns die zahlreichen Rückmeldungen zeigen.<br />
Solche Feedbacks freuen uns und bestätigen uns auf<br />
dem Weg, mit unseren Zuweisern einen aktiven und<br />
konstruktiven Austausch zu suchen. Dieser soll nicht<br />
nur auf medizinischer, fachlicher Ebene geschehen,<br />
sondern auch Themen der Zusammenarbeit und<br />
des Informationsaustausches betreffen. Diesbezüglich<br />
ist sicherlich auch das Angebot des PACS View der<br />
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin interessant,<br />
das in der vorliegenden Ausgabe näher vorgestellt<br />
wird. Was ebenfalls als Idee begann, ist im Fokus-Artikel<br />
zum Ostschweizer Gefässzentrum nachzulesen.<br />
Gerne geben wir Ihnen dort einen Überblick zum<br />
Leistungsangebot, das verschiedene Kliniken<br />
unter einem Dach vereint.<br />
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre<br />
und möchte es nicht unterlassen mich für die gute<br />
Zusammenarbeit zu bedanken. Ich freue mich auf<br />
den weiteren Austausch und Ihre konstruktiven Rückmeldungen,<br />
sodass wir weiterhin unsere gemeinsamen<br />
Patientinnen und Patienten bestmöglich abklären,<br />
behandeln und betreuen können.<br />
20<br />
Herzliche Grüsse<br />
Dr. Daniel Germann<br />
Direktor und Vorsitzender<br />
der Geschäftsleitung
4 Fokus<br />
Das Ostschweizer<br />
Gefässzentrum:<br />
Kreislauf in Perfektion<br />
Das Ostschweizer Gefässzentrum ist ein einzigartiger Verbund<br />
von Spezialkliniken, der das Know-how bündelt, die Organisation<br />
vereinfacht und für eine unkomplizierte Kommunikation steht.<br />
Es beschäftigt vierzehn Fachärzte und führt jährlich rund zwölftausend<br />
Duplex-Untersuchungen, sechshundert interventionelle<br />
Eingriffe sowie gegen tausend Operationen im Bereich der Gefässmedizin<br />
durch.<br />
Gefässerkrankungen nehmen stark zu. Verantwortlich<br />
sind die demografische Entwicklung mit stetig<br />
zunehmender Lebenserwartung, die ungesunde<br />
Ernährung, der Bewegungsmangel und das Rauchen.<br />
Aber auch die Veranlagung spielt eine Rolle. Um mit<br />
einer bestmöglichen Versorgung auf die steigende<br />
Zahl an Gefässerkrankungen zu reagieren, wurde das<br />
interdisziplinäre Ostschweizer Gefässzentrum geschaffen.<br />
Das federführende Team besteht aus dem<br />
Angiologen Dr. Ulf Benecke, dem Gefässchirurgen<br />
Prof. Dr. Florian Dick und dem interventionellen Radiologen<br />
Dr. Lukas Hechelhammer.<br />
Im Bereich der Gefässerkrankungen verfolgen<br />
viele Spitäler im In- und Ausland noch das veraltete<br />
Konzept der Trennung von Angiologie, Gefässchirurgie<br />
und (interventioneller) Radiologie. Mit seinem<br />
wegweisenden Zentrumsmodell beschreitet das<br />
Ostschweizer Gefässzentrum des KSSG den umgekehrten<br />
Weg, indem es medizinisch auf allen Ebenen<br />
interdisziplinär arbeitet und seine gesamte Organisation<br />
unter einem Dach vereint.<br />
Auf den Zuweiser zugeschnitten<br />
Die gemeinsame Organisation bringt dem Zuweiser<br />
zahlreiche Vorteile. So muss er sich nicht mehr<br />
mit drei Anlaufstellen abmühen, sondern gelangt<br />
über eine zentrale Disposition direkt an den richtigen<br />
medizinischen und/oder organisatorischen<br />
Ansprechpartner. Durch die vereinfachte Anmeldung<br />
spart der Zuweiser künftig Zeit und administrativen<br />
Aufwand. Zugleich hat er es nicht mehr mit<br />
vereinzelten Ärzten zu tun, sondern mit einem<br />
zusammengehörigen Team, das ihn in den Entscheidungsprozess<br />
einbezieht und stets umfassend informiert.<br />
Da sich das Ostschweizer Gefässzentrum<br />
grundsätzlich nach international anerkannten Behandlungsstandards<br />
richtet, geben die Fachärzte<br />
immer nur Empfehlungen zu Therapie, medikamentöser<br />
Sekundärprophylaxe und Nachsorge ab, die<br />
wissenschaftlich etabliert sind.<br />
Drei Fachgebiete –<br />
ein Team –<br />
eine Organisation<br />
Der Patient in besten Händen<br />
Die gemeinsame Sprechstunde von Angiologie, Gefässchirurgie<br />
und Radiologie bildet die Basis für eine<br />
erfolgreiche Behandlung. In diesem Ansatz steht<br />
der Patient im Vordergrund und nicht systembedingte<br />
individuelle finanzielle Treiber. Dem Kantonsspital<br />
St.Gallen als Referenzspital stehen jederzeit<br />
alle diagnostischen und therapeutischen Methoden<br />
zur Verfügung. Dadurch kann für jeden Patienten,<br />
auch im Notfall, jeweils die optimale Diagnostik und<br />
das bestmögliche Behandlungskonzept individuell<br />
massgeschneidert werden. Dr. Hechelhammer erklärt<br />
dies so: «Wir spielen nicht Methoden gegeneinander<br />
aus, sondern suchen für jeden Patienten<br />
die beste Therapie, indem wir sein Alter, seinen Ge-
Fokus<br />
5<br />
Schnell<br />
Das Ostschweizer Gefässzentrum fasst die Kliniken<br />
für Angiologie, Gefässchirurgie und Radiologie unter<br />
einem Dach zusammen. Die Vorteile dieser innovativen<br />
Struktur: stark vereinfachte Abläufe, eine zentrale<br />
Anlaufstelle, ein herausragender medizinischer<br />
Wissenspool und eine direkte, interdisziplinäre<br />
Kommunikation. Ein überzeugendes Zentrumsmodell<br />
mit hohem Nutzen für Patienten und Zuweiser.<br />
sundheitszustand, seine persönlichen Vorstellungen<br />
und die Empfehlungen seines Hausarztes in die Entscheidung<br />
einbeziehen.»<br />
Kompetenzzentrum<br />
Auch fachlich sticht das Ostschweizer Gefässzentrum<br />
heraus. Als einziges nichtuniversitäres Zentrum<br />
bildet es angehende Fachärzte auf dem höchsten<br />
Niveau aus und zieht als Zentrumsspital der Ostschweiz<br />
im gefässmedizinischen Bereich zahlreiche<br />
komplexe Spezialfälle aus der gesamten Region an.<br />
Abgesehen davon, dass das Zentrum sowohl diagnostisch<br />
als auch therapeutisch auf universitärer<br />
Stufe steht, besitzt es die notwendige Grösse, um<br />
einen Stab versierter Subspezialisten zu beschäftigen.<br />
Dass die Chemie zwischen den Fachärzten<br />
stimmt, ist im Ostschweizer Gefässzentrum spürbar.<br />
Natürlich hat jeder sein Spezialgebiet, aber durch<br />
die fächerübergreifende Arbeit profitieren die Partner<br />
gegenseitig – ein weiterer Grund für das hohe<br />
medizinische Niveau und die aussergewöhnlich gute<br />
Versorgung. Dr. Benecke meint dazu: «Durch das<br />
enge Zusammenspiel und die direkte Kommunikation<br />
kennen wir uns genau.» Prof. Dr. Dick ergänzt:<br />
«Wir sind in jeder Beziehung gleichberechtigte<br />
Partner und schätzen uns darum umso mehr.»<br />
Zu jeder Zeit gut informiert<br />
Eine abgestimmte Kommunikation und ständige Verfügbarkeit<br />
gehören zur Kultur des Hauses. So nimmt<br />
man sich für die Patienten und Zuweiser Zeit und<br />
ist während sieben Tagen rund um die Uhr erreichbar.<br />
Die gemeinsame Sprechstunde findet täglich<br />
statt, zu den Fallbesprechungen und zur Zentrumskoordination<br />
trifft man sich mehrmals wöchentlich.<br />
Diese Art des Austausches ist essentiell, denn sie<br />
verhindert Doppelspurigkeiten und kommunikative<br />
Leerläufe. Transparenz und Offenheit sind weitere<br />
Pfeiler. So stehen interessierten Ärzten unter anderem<br />
auch die Kolloquien und Gefässkonferenzen<br />
offen. Prof. Dr. Dick: «Wir suchen ständig den Kontakt<br />
mit unseren Patienten und Zuweisern. Der<br />
zwischenmenschliche Umgang – das ist definitiv<br />
eine unserer zentralen Stärken.»<br />
Von links nach rechts: Dr. Lukas Hechelhammer, Dr. Ulf Benecke,<br />
Prof. Dr. Florian Dick<br />
Dr. Lukas Hechelhammer<br />
Der Radiologe mit Schwerpunkt Interventionelle<br />
Radiologie (EBIR) führt das Interventionalisten-<br />
Team der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin.<br />
Seine Kenntnisse erwarb er am endovaskulären<br />
Aortenzentrum des Universitätsspitals Zürich und<br />
am Institut Gustave Roussy in Frankreich. Sein<br />
klinischer Schwerpunkt liegt in der endovaskulären<br />
Therapie obliterierender und dilatativer Gefässerkrankungen.<br />
Dr. Ulf Benecke<br />
Der Angiologe ist gleichzeitig Facharzt für innere<br />
Medizin und verfügt über eine Weiterbildung<br />
in den Bereichen Radiologie und interventionelle<br />
Therapie. Dieser Hintergrund ermöglicht dem<br />
Diagnostiker einen umfassenden Blick auf alle<br />
Gefässerkrankungen. Als Inhaber eines Wundarztdiploms<br />
leitet er zudem die interdisziplinäre<br />
«Wound Care» am KSSG.<br />
Prof. Dr. Florian Dick<br />
Der Gefässchirurg ist wie seine Stellvertreterin PD<br />
Dr. R. von Allmen auf komplexe Aortenchirurgie,<br />
Carotis-Chirurgie und schwere Durchblutungsstörungen<br />
an den Beinen spezialisiert. Ausgebildet<br />
wurden beide Spezialisten am Inselspital Bern,<br />
dem grössten Schweizer Zentrum für Gefässchirurgie,<br />
und am Imperial College in London. Mit<br />
ihrem Antritt erhielt die Klinik den A-Status. Prof.<br />
Dick ist Senior Editor der wichtigsten europäischen<br />
Fachzeitschrift für Gefässchirurgie.
6<br />
Editorial<br />
Gefässkrankheiten sind komplex, da sie<br />
oft den gesamten Organismus und verschiedene<br />
Organsysteme betreffen. Deshalb<br />
wird im Ostschweizer Gefässzentrum der<br />
Mensch als Ganzes betrachtet und<br />
viel Wert auf eine massgeschneiderte<br />
Behandlung des Patienten gelegt.<br />
Eine Aufstellung des medizinischen<br />
Leistungsangebots<br />
finden Sie im Innenteil dieser<br />
Ausklappseiten.
Editorial 7
8 Fokus<br />
Die richtige Medizin für<br />
alle Gefässerkrankungen<br />
Die Grundpfeiler des Ostschweizer Gefässzentrums bilden Diagnose,<br />
Therapie (konservativ, interventionell-minimalinvasiv oder operativ)<br />
und Nachsorge. Hauptstandort mit dem gesamten Spektrum ist<br />
St.Gallen, für Dialysechirurgie und Krampfadern sind die Spitäler<br />
Rorschach und Flawil zuständig. Die Behandlung wird dabei stets durch<br />
das Spezialistenteam des Gefässzentrums vorgenommen, was eine<br />
gleichbleibende Qualität an allen drei Standorten garantiert. Das Einzugsgebiet<br />
des Ostschweizer Gefässzentrums umfasst die Kantone<br />
St.Gallen, die beiden Appenzell sowie Teile von Thurgau, Graubünden<br />
und Liechtenstein. Das sind über achthunderttausend Personen.<br />
Das Zentrum verfügt über eine komplette und hochmoderne Infrastruktur,<br />
und sein Leistungskatalog deckt sowohl diagnostisch<br />
als auch therapeutisch das gesamte Spektrum der Gefässmedizin ab,<br />
sofern keine Herz-Lungen-Maschine benötigt wird.<br />
Carotis<br />
Oberstes Ziel ist die Verhinderung eines Schlaganfalls.<br />
Die Federführung liegt beim neurovaskulären<br />
Kolloquium und bei der Stroke Unit. Schlüssel zum<br />
Erfolg ist die enge Zusammenarbeit aller Spezialisten,<br />
insbesondere der Neurologie, der Neuroradiologie<br />
sowie der Gefässchirurgie. Die duplexsonographische<br />
Diagnostik obliegt bei neurologischer Symptomatik<br />
und Frage nach Indikation zur Operation der<br />
Neurologie. Angiologie und Neurologie führen Carotisduplexsonographien<br />
im Rahmen der Arteriosklerosediagnostik<br />
und zum Ausschluss von höhergradigen<br />
Stenosen im allgemeinen präoperativen<br />
Setting durch.<br />
• Carotisduplexsonographie<br />
• TEA der Arteria carotis interna
Fokus<br />
9<br />
Aortenaneurysma und<br />
periphere Aneurysmata<br />
Das Aortenaneurysma wird auch als «Silent Killer»<br />
bezeichnet, da es oft asymptomatisch heranwächst,<br />
bis es platzt – oder zufällig erkannt wird wie etwa<br />
durch eine Ultraschall- oder klinische Untersuchung<br />
des Bauches. Bei den häufigsten Todesursachen<br />
von Männern in der westlichen Welt steht es an<br />
15. Stelle. Rechtzeitig erkannt, kann es heutzutage<br />
aber sehr sicher durch einen Gefässersatz behandelt<br />
werden. Beim peripheren Aneurysma droht<br />
oft die Amputation einer Gliedmasse. Diese Erkrankung<br />
ist der häufigste Grund für Amputationen<br />
bei Nichtdiabetikern.<br />
• Duplexsonographie zur Beurteilung und zum<br />
Screening der Aorta und der Becken-Bein-Strombahn<br />
• Computertomographie des Abdomens<br />
• Angiographie der Aorta abdominalis, der<br />
Becken-Bein-Strombahn<br />
• Endovaskuläre Embolisation<br />
• Endovaskuläre Stentgraftversorgung<br />
• Operative Aneurysmaausschaltung<br />
• EVAR (Endovaskuläres Aortenrepair)<br />
Baucharterien (Viszero-renale Strombahn)<br />
In diesen Bereich gehören die Atherosklerose und<br />
entzündliche Gefässerkrankungen, die zu einer<br />
Einengung oder Erweiterung der Nierenarterien,<br />
zuweilen auch der Magen- oder Darmarterien<br />
führen können. Die Fallbesprechung erfolgt in der<br />
interdisziplinären Gefässkonferenz, oft auch in<br />
Anwesenheit weiterer Spezialisten wie etwa den<br />
Kollegen der Nephrologie oder Rheumatologie.<br />
• Duplexsonographie der Nieren- und Bauchgefässe<br />
• Endovaskuläre PTA und Stentimplantation<br />
der viszeralen Gefässe<br />
• Endovaskuläre PTA und Stentimplantation<br />
der Nierenarterien<br />
• TEA der Bauch- oder Nierengefässe<br />
• Implantation einer Y-Prothese<br />
• Reimplantationen oder Debranching von<br />
Bauch- oder Nierengefässen<br />
• Bypassoperationen
<strong>10</strong> Fokus<br />
Venen, Krampfadern,<br />
tiefe Venenthrombosen<br />
Krampfadern sind eines der grössten gesundheitsökonomischen<br />
Probleme, da rund ein Viertel der<br />
Schweizer Bevölkerung darunter leidet. Im Ostschweizer<br />
Gefässzentrum wird jeder Fall genau untersucht,<br />
um festzustellen, ob eine Behandlung<br />
einen medizinischen Vorteil bringt oder nicht. Man<br />
geht hier vorsichtig ans Werk, da die betroffenen<br />
Venen auch wichtiges Ersatzmaterial für Bypässe am<br />
Herzen oder am Bein liefern. Aufgrund der engen<br />
interdisziplinären Zusammenarbeit stehen alle drei<br />
wichtigen Therapieprinzipien abgestimmt zur Verfügung:<br />
Operation, Sklerotherapie sowie endovenöse<br />
Intervention (Laser oder Radiofrequenz).<br />
Ob beim Patienten eine Venenthrombose vorliegt, ist<br />
in der heutigen Medizin nicht nur in Bezug auf die<br />
Beinvenen eine wichtige Fragestellung. Durch die hervorragende<br />
Geräteausstattung sowie die Erfahrung<br />
der untersuchenden Fachärzte kann diese Frage<br />
auch für die Arme, Halsregion, Nierenvenen sowie<br />
andere abdominelle Venen beantwortet werden.<br />
• Thrombose-Diagnostik<br />
• Venenmapping<br />
• Sklerotherapie<br />
• Varizenstripping<br />
• Endovenöse Laser- und Radiofrequenzablation<br />
• TEA der Becken- und Beinarterien<br />
• Bypassoperationen<br />
• Hybrideingriffe<br />
Wir machen es<br />
Ihnen einfach -<br />
eine Adresse für<br />
alle Fachbereiche<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Ostschweizer Gefässzentrum<br />
Haus 09, 1. Stock<br />
Rorschacher Strasse 95<br />
CH-9007 St.Gallen<br />
Tel. +41 71 494 19 19, Fax +41 71 494 64 45<br />
gefaesszentrum@kssg.ch
Fokus<br />
11<br />
Becken- und<br />
Beinarterien<br />
Hauptanteil der Erkrankungen bilden das Raucherbein<br />
und die Schaufensterkrankheit, welche die<br />
Bewegungs- und damit die Lebensqualität stark einschränken.<br />
Dieses Fachgebiet ist extrem komplex,<br />
da es internistische, endokrinologische und chirurgisch-interventionelle<br />
Kompetenzen benötigt. Es ist<br />
damit ein wichtiger Teil des Hybridprogramms (Kombination<br />
von chirurgischen und interventionellen<br />
Verfahren im gleichen Eingriff). Der grösste Teil ambulanter<br />
Abklärungen im Gefässzentrum entfällt<br />
auf die Becken- und Beinarterien.<br />
• Transcutane Sauerstoffpartialdruckmessung<br />
• Oszillographien und arterielle Druckmessung<br />
• CT- und MR-Angiographie der Becken- und<br />
Beingefässe<br />
• Gehtraining<br />
• Endovaskuläre PTA und Stentimplantation<br />
der Becken- und Beinarterien<br />
• TEA der Becken- und Beinarterien<br />
• Bypassoperationen<br />
• Hybrideingriffe<br />
Weitere Spezialgebiete des<br />
Ostschweizer Gefässzentrums<br />
Die Diagnostik und Therapie chronischer Wunden,<br />
auch seltener Genese, ist tägliche Routine und wird<br />
zusammen mit dem Team der Wundexpertinnen<br />
und anderen wichtigen Fachdisziplinen in der Wound<br />
Care des Kantonsspitals St.Gallen durchgeführt.<br />
Dabei werden zahlreiche modernste Verfahren wie<br />
CelluTome, Apligraf ® , Plasmabehandlung sowie<br />
Ultraschalldebridement angewendet.<br />
Weitere laufende Kooperationen des Ostschweizer<br />
Gefässzentrums mit anderen Kliniken des Kantonsspitals<br />
St.Gallen umfassen:<br />
• Ambulante vaskuläre Rehabilitation<br />
• Shunt-Sprechstunden mit der Nephrologie<br />
• Diabetische Fusssprechstunde mit der<br />
Endokrinologie/Diabetologie
8 Editorial Kader im Profil<br />
Neuer Chefarzt der Zentralen<br />
Notfallaufnahme gewählt<br />
an, der Ende Februar 2017 nach mehrjähriger<br />
erfolgreicher Tätigkeit am Kantonsspital St.Gallen<br />
in Pension geht.<br />
Dr. med. Robert Sieber<br />
Der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons<br />
St.Gallen hat auf Antrag der Geschäftsleitung des<br />
Kantonsspitals St.Gallen Dr. med. Robert Sieber auf<br />
den 1. März 2017 zum Chefarzt der Zentralen Notfallaufnahme<br />
gewählt. Robert Sieber tritt damit die<br />
Nachfolge von Prof. Dr. med. Joseph Osterwalder<br />
Der neu gewählte Chefarzt schloss sein Medizinstudium<br />
und die Dissertation 1987 an der Universität<br />
Bern ab und arbeitete danach als Assistenz- und<br />
Oberarzt in Bern (Zieglerspital und Inselspital). Von<br />
1999 bis 2001 nutzte Robert Sieber einen Auslandaufenthalt<br />
in Manchester (England) für eine notfallmedizinische<br />
Weiterbildung am Salford Royal<br />
Hospital. Anschliessend wechselte er als Generalist<br />
und Notfallmediziner ein erstes Mal ans Kantonsspital<br />
St.Gallen, bevor er von 2003 bis 20<strong>10</strong> die Leitung<br />
der Notfallstation des Regionalspitals Lugano<br />
übernahm und im Jahre 2006 den Weiterbildungstitel<br />
«Klinische Notfallmedizin SGNOR» erlangte.<br />
Am 1. Oktober 20<strong>10</strong> zog es Robert Sieber zurück in<br />
die Ostschweiz ans Kantonsspital St.Gallen, wo er<br />
seither als Leitender Arzt der Zentralen Notfallaufnahme<br />
(ZNA) tätig ist und am 1. März 2017 seine<br />
neue Funktion als Chefarzt übernehmen wird.<br />
Zum Titularprofessor ernannt<br />
Die Universität Zürich hat auf Antrag der Medizinischen<br />
Fakultät PD Dr. med. Sebastian Leschka,<br />
Leitender Arzt in der Klinik für Radiologie und<br />
Nuklearmedizin am Kantonsspital St.Gallen, per<br />
25. Juli 2016 zum Titularprofessor ernannt.<br />
Professor Leschka studierte Humanmedizin an der<br />
Freien Universität Berlin. Anschliessend arbeitete er<br />
als Assistenzarzt an der Charité Universitätsmedizin<br />
Berlin, am Universitätsspital Zürich und am Kantonsspital<br />
St.Gallen sowie als Oberarzt am Universitätsspital<br />
Zürich. Seit 20<strong>10</strong> ist Professor Leschka als<br />
Leitender Arzt am Kantonsspital St.Gallen tätig und<br />
leitet die Bereiche Computertomographie und<br />
Notfallradiologie. Professor Leschka hat sich 2009<br />
an der Universität Zürich habilitiert. Seine Forschungsschwerpunkte<br />
sind die kardiale Bildgebung,<br />
Niedrigdosistechniken bei der Computertomographie,<br />
die Notfallradiologie und die abdominale<br />
Radiologie. Professor Leschka ist Gutachter bei<br />
Dr. med. Sebastian Leschka<br />
zahlreichen medizinischen Fachzeitschriften (u.a<br />
The Lancet und Circulation) und hat mehr als<br />
20 nationale und internationale Forschungspreise<br />
gewonnen.
Kader im Profil<br />
9<br />
Weitere Ernennungen, Wahlen<br />
und Pensionierungen<br />
KLINIK FÜR RADIOLOGIE UND NUKLEARMEDIZIN<br />
Ernennung<br />
per 25.07.2016<br />
Prof. Dr. Sebastian Leschka<br />
Leitender Arzt<br />
Titularprofessor durch die Universität Zürich<br />
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN<br />
Wahl<br />
per 01.01.2017<br />
Dr. Munira Haag-Dawoud<br />
Leitende Ärztin<br />
KLINIK FÜR GEFÄSSCHIRURGIE<br />
Ernennung<br />
per 20.09.2016<br />
PD Dr. Regula Sybille von Allmen<br />
Leitende Ärztin<br />
Privatdozentin für das Fach Gefässchirurgie<br />
KLINK FÜR PSYCHOSOMATIK<br />
Wahl<br />
per 01.01.2017<br />
Dr. Dagmar Schmid<br />
Leitende Ärztin<br />
INSTITUT FÜR PATHOLOGIE<br />
SPITALAPOTHEKE<br />
Wahl<br />
per 01.<strong>10</strong>.2016<br />
Dr. phil. nat. Daniel Fetz<br />
Leiter Spitalapotheke, DIM<br />
Beförderung<br />
per 01.<strong>10</strong>.2016<br />
AUGENKLINIK<br />
Beförderung<br />
per 01.01.2017<br />
Dr. Regulo Rodriguez<br />
Leitender Arzt<br />
Dr. Marco Alder<br />
Leitender Arzt<br />
25 Jahre<br />
Palliative Care<br />
Dem Patienten einen Mantel der Fürsorge umhängen,<br />
wenn keine Aussicht mehr auf Heilung besteht:<br />
Das ist, bildlich gesprochen, Palliative Care.<br />
1991 wurde in der Klinik für Onkologie des Kantonsspitals<br />
St.Gallen eine Palliativstation mit 11 Betten<br />
eröffnet und 15 Jahre später wurde mit dem Palliativzentrum<br />
ein eigener, interdisziplinärer Fachbereich<br />
geschaffen. Unter der aktuellen Leitung von<br />
Dr. Daniel Büche fördert das Palliativzentrum die<br />
Qualität in der Betreuung von Schwerkranken<br />
und Sterbenden am Kantonsspital St.Gallen und in<br />
den Regionen. Mit einem Jubiläumsanlass im<br />
Zentralen Hörsaal blickten die Verantwortlichen<br />
am 15. September 2016 zusammen mit vielen<br />
Gästen zurück auf die letzten 25 Jahre Palliative<br />
Care am Kantonsspital St.Gallen. Zum Programm<br />
gehörten verschiedene Kurzreferate zu Themen<br />
wie «Kultur des Sterbens» oder «Die Menschlichkeit<br />
in der Medizin». Die Grussworte der Geschäftsleitung<br />
überbrachte Nicole Mösli, Leiterin<br />
Departement Pflege.<br />
Renommierter<br />
Experte<br />
Aufgrund der hohen Expertise in der Dickdarmchirurgie<br />
und in der minimalinvasiven Chirurgie ist<br />
Dr. Walter Brunner nicht nur im Operationssaal<br />
gefragt, sondern auch als internationaler Referent.<br />
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite <strong>10</strong>.
<strong>10</strong> Kader im Profil<br />
Renommierter Experte<br />
auf dem Gebiet der<br />
Dickdarmchirurgie<br />
Dr. Walter Brunner leitet die Chirurgie in Rorschach sowie die Dickdarm-<br />
und Mastdarmchirurgie in St.Gallen. Zusammen bilden die<br />
beiden Zentren mit knapp 500 Dickdarmeingriffen jährlich das grösste<br />
Dickdarmchirurgiezentrum der Schweiz. Dr. Walter Brunner<br />
hat die «narbenfreie» Chirurgie am KSSG eingeführt und ist auch<br />
als Referent sehr gefragt.<br />
Dr. Walter Brunner<br />
Kurzporträt von Dr. Walter Brunner<br />
Nach seinem Studium an der Universität in<br />
Innsbruck und der Universität in Wien promovierte<br />
Walter Brunner im Jahre 1994. Die<br />
Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie und<br />
Viszeralchirurgie absolvierte er bis 2003<br />
an den Universitätskliniken Salzburg. 2011 kam<br />
er als Leitender Arzt zum Kantonsspital<br />
St.Gallen und ist Leiter der Chirurgie im Spital<br />
Rorschach. 2013 wurde ihm der «Fellow of<br />
the Royal College of Surgeons (FRCS)», London<br />
verliehen und seit 2014 ist er Präsident<br />
des österreichischen Hernienforums.<br />
Das Kantonsspital St.Gallen führt seit längerem<br />
das grösste Dickdarmzentrum der Schweiz. Hier<br />
wurde auch der weltgrösste Kongress zu diesem<br />
Thema, der European Colorectal Congress (ECC),<br />
ins Leben gerufen. Was motivierte Sie, dem Ruf<br />
nach St.Gallen zu folgen?<br />
Der neubestellte Chefarzt der Klinik für Chirurgie,<br />
Prof. Bruno Schmied, hat mich 2011 aufgrund meiner<br />
Erfahrung in der Dickdarmchirurgie und in der minimalinvasiven<br />
Chirurgie nach St.Gallen berufen. Es<br />
war für mich eine schöne Aufgabe und Herausforderung<br />
, diesen Fachbereich und den Standort Rorschach<br />
zu übernehmen. Damals wurden in St.Gallen<br />
die meisten Dickdarmoperationen offen durchgeführt,<br />
vor allem Eingriffe bei malignen Erkrankungen.<br />
Heute sind wir eines der wenigen Zentren, das mit<br />
den neusten Operationsmethoden auch die Krebschirurgie<br />
so schonend wie möglich betreibt. Rund<br />
70 Prozent aller Dickdarmoperationen am KSSG erfolgen<br />
heute minimalinvasiv – inklusive aller Notfälle.<br />
Mit der sogenannten «narbenfreien Chirurgie»<br />
bezeichnet man eine Operationsmethode, die<br />
Zugänge noch stärker minimiert. Wie funktioniert<br />
die Technik?<br />
Die «narbenfreie» Chirurgie (Single-Port- bzw.<br />
NOTES-Operationen) ist eine Weiterentwicklung<br />
der minimalinvasiven Chirurgie, mit dem Ziel, das<br />
Trauma an der Bauchdecke so weit wie möglich<br />
zu reduzieren. Dabei werden der Nabel als natürliche<br />
Narbe oder natürliche Körperöffnungen wie<br />
die Scheide oder der Mastdarm als Zugang genutzt,<br />
womit keine oder kaum zusätzliche sichtbare
Kader im Profil<br />
11<br />
Schnell<br />
Die moderne Chirurgie wird immer schonender,<br />
sicherer und wirksamer, was z. B. die minimalinvasive<br />
bzw. «narbenfreie» Operationsmethode zeigt.<br />
Die Methode wird in der Chirurgie sowohl am KSSG<br />
als auch am Standort Rorschach erfolgreich angewandt.<br />
Von dieser fachmedizinischen Kompetenz<br />
sowie von den mehrsprachigen Sprechstunden profitieren<br />
sowohl die Patienten als auch die Zuweiser.<br />
Narben entstehen. Diese Technik funktioniert<br />
bei verschiedensten Operationen wie Gallenblase,<br />
Blinddarm, Leisten- oder Narbenbrüchen, Dünndarm-<br />
oder eben bei der Dickdarmchirurgie. Mit<br />
über 2500 Eingriffen in den letzten fünf Jahren<br />
sind wir schweizweit das Haus mit der grössten Expertise<br />
auf diesem Gebiet.<br />
Welche Vorteile bietet diese «narbenfreie»<br />
Chirurgie gegenüber der ebenfalls schonenden<br />
minimalinvasiven Chirurgie?<br />
Für den Patienten ist immer das Gesamtergebnis<br />
einer Operation entscheidend, da darf es natürlich<br />
keine Abstriche geben. Die minimalinvasive<br />
Chirurgie bietet gegenüber der offenen Chirurgie<br />
bekanntlich bereits entscheidende Vorteile: Die<br />
Patienten sind schneller erholt, haben weniger<br />
Schmerzen, Verwachsungen oder Narbenprobleme,<br />
die Lungenfunktion kommt schneller in Gang usw.<br />
Bei der «narbenfreien» Chirurgie reduzieren wir das<br />
Trauma an der Bauchdecke noch einmal markant,<br />
indem wir bereits vorhandene Zugänge wählen. Damit<br />
lassen sich Nebeneffekte wie das Wundinfektrisiko<br />
und Schmerzen weiter minimieren und die<br />
Kosmetik verbessern. Zusätzlich haben wir vor allem<br />
bei Mastdarmkrebs mit dem Zugang «von unten»<br />
die bisher besten Ergebnisse betreffend der krebschirurgischen<br />
Qualitätsmerkmale. Das ist neben<br />
dem Einsatz des Roboters die grösste Revolution in<br />
der Mastdarmchirurgie seit 30 Jahren.<br />
Bei welchen Patienten ist die «narbenfreie»<br />
Chirurgie nicht möglich?<br />
Es gibt natürlich weiterhin Notfälle oder Ausgangsbefunde,<br />
die man nur offen operieren kann. Bei<br />
bereits voroperierten Patienten hängt es vom<br />
Befund und der Expertise der Operateurs ab, ob<br />
überhaupt minimalinvasiv operiert werden kann.<br />
Als Experte ist Ihr Fachwissen auch in der<br />
Ausbildung gefragt.<br />
In der minimalinvasiven und speziell narbenfreien<br />
Operationstechnik sind wir als Team wirklich führend<br />
und bieten entsprechende Kurse an, in denen wir<br />
Chirurgen, aber auch Pflegefachpersonal – beispielsweise<br />
in Workshops, Mini-Fellowships oder durch die<br />
Teilnahme an Live-Operationen – an Körperspendern<br />
trainieren und ausbilden. Zudem werde ich<br />
immer wieder zu internationalen Kongressen und<br />
Workshops eingeladen.
12 Innovation und Entwicklung<br />
Dr. Susanne Hartmann-Fussenegger<br />
Stationäre multimodale<br />
Schmerztherapie<br />
Dank langjähriger Erfahrung in der multimodalen stationären<br />
Schmerztherapie im Spital Flawil konnte nun auch am Standort<br />
St.Gallen ein in der Ostschweiz einmaliges stationäres Therapiekonzept<br />
entwickelt und im Oktober 2016 gestartet werden.<br />
Erstmals können Patienten in geschlossenen Gruppen<br />
an einem strukturierten Therapieprogramm<br />
teilnehmen. Dadurch können ineinandergreifende<br />
Therapieinhalte von verschiedenen Professionen<br />
nach einem gemeinsam erarbeiteten Behandlungsplan<br />
vermittelt werden. Die hohe Therapiedichte,<br />
die individuellen Zielvereinbarungen, das interprofessionelle<br />
Team sowie das bewusste Hinzuziehen<br />
der Mitpatienten als Co-Therapeuten gewährleisten<br />
die Nachhaltigkeit dieses Programmes. Übergeordnetes<br />
Ziel der multimodalen Schmerztherapie ist die<br />
Steigerung der Selbstwirksamkeit und eine Verbesserung<br />
der Alltagsfunktion der Betroffenen. Diese<br />
Überziele und das biopsychosoziale Schmerzmodell
Innovation und Entwicklung<br />
13<br />
dienen als Basis der interdisziplinären und interprofessionellen<br />
Zusammenarbeit. Die Angehörigen,<br />
die mit den Betroffenen deutlich mehr Zeit verbringen<br />
als die Therapeuten, werden dabei aktiv in<br />
die Therapie eingebunden. Sie werden darauf<br />
sensibilisiert, wie ihr Verhalten den Schmerz der<br />
Betroffenen im positiven wie im negativen Sinn<br />
beeinflussen kann.<br />
Diese Therapieform ist für Patienten mit langanhaltenden<br />
oder wiederkehrenden Schmerzen sinnvoll,<br />
vor allem wenn die Arbeitsfähigkeit und damit<br />
die Lebensqualität beeinträchtigt bzw. bedroht sind.<br />
Am meisten profitieren Patienten, die Risikofaktoren<br />
für eine Chronifizierung, sogenannte «Yellow Flags»,<br />
aufweisen. Die Therapie wirkt hier präventiv,<br />
sodass eine (weitere) Chronifizierung im besten Fall<br />
verhindert werden kann.<br />
Die Patienten werden zu einem Vorgespräch eingeladen.<br />
Dabei wird die Motivation geprüft, realistische<br />
Therapieziele formuliert und das Konzept erörtert.<br />
Kontakt<br />
Andrea Portmann<br />
Tel. +41 71 494 31 56<br />
Fax +41 71 494 65 35<br />
mmst@kssg.ch, www.schmerzzentrum.kssg.ch<br />
Therapiekonzept<br />
Die multimodale Schmerztherapie wird von<br />
einem interprofessionellen Behandlungsteam<br />
erbracht. Es besteht aus Physiotherapeuten,<br />
Ergotherapeuten, Psychologen, Ärzten und spezialisierten<br />
Pflegefachkräften (Pain Nurses).<br />
Das strukturierte Programm zeichnet sich durch<br />
vorwiegend aktive Therapieformen, inhaltlich<br />
abgestimmte Therapieinhalte und individuelle<br />
Zielformulierungen ab. Es gliedert sich in<br />
drei Therapiephasen:<br />
1. Phase: Wissensvermittlung<br />
In drei stationären Wochen werden theoretische<br />
Grundlagen zur Schmerzentstehung und<br />
Chronifizierung vermittelt und Techniken zur<br />
Schmerzlinderung sowie zur Alltagsbewältigung<br />
erlernt.<br />
2. Phase: praktische Umsetzung im Alltag<br />
Auf die erste intensive stationäre Therapiephase<br />
folgt eine sechsmonatige ambulante Periode.<br />
Während dieser Zeit werden die Verhaltensänderungen<br />
in den Alltagsroutinen, im Familien- und<br />
Arbeitsleben habituiert. Umfang und Form der<br />
ambulanten Begleitung werden für jeden Teilnehmer<br />
individuell festgelegt.<br />
3. Phase: Booster-Refresherwoche<br />
Die vierte stationäre Woche, ebenfalls eine intensive<br />
Therapiewoche, dient zur Auffrischung der<br />
theoretischen und praktischen Therapieinhalte<br />
sowie zur Überprüfung der Umsetzung im Alltag.<br />
Diese Phase bietet ausserdem die Möglichkeit,<br />
korrigierend einzuwirken.<br />
Jederzeit bestens im Bilde<br />
mit dem PACS View<br />
Gemeinsam mit Agfa HealthCare hat die Klinik für<br />
Radiologie und Nuklearmedizin des Kantonsspitals<br />
St.Gallen den Webviewer PACS View (Picture Archiving<br />
and Communication System) entwickelt. Das<br />
sophistizierte Tool zur Übermittlung radiologischer<br />
und nuklearmedizinischer Bilder und Befunde ist<br />
ganz auf die individuellen Bedürfnisse von Zuweisern,<br />
Patienten und Spitälern ausgerichtet. Es<br />
arbeitet extrem schnell, ist einfach zu bedienen und<br />
trumpft mit einer ungewöhnlich hohen Bildqualität<br />
und zahlreichen Betrachtungsmodi auf, die den Ärzten<br />
völlig neue Dimensionen eröffnen.<br />
Mehr zur «PACS View» erfahren Sie auf Seite 14.
Innovation und Entwicklung<br />
15<br />
Jederzeit bestens im<br />
Bilde mit dem PACS View<br />
Der massgeschneiderte Webviewer PACS<br />
View setzt in der Verarbeitung und<br />
Übermittlung radiologischer und nuklearmedizinischer<br />
Bilder und Befunde<br />
neue Massstäbe.<br />
Hinter dem PACS View (Picture Archiving and Communication<br />
System) stehen der Chefarzt der Klinik<br />
für Radiologie und Nuklearmedizin des Kantonsspitals<br />
St.Gallen, Prof. Dr. Simon Wildermuth, der<br />
Applikationsmanager Bernhard Asendorf und ein<br />
engagiertes Team aus Fachärzten und Informatikern.<br />
Entwickelt wurde das innovative Zugriffsportal gemeinsam<br />
mit Agfa HealthCare, einer der wenigen<br />
Firmen, die überhaupt in der Lage sind, ein derart<br />
komplexes Tool praxisnah umzusetzen. Entstanden<br />
ist ein zentrales IT-System, das bereits heute für<br />
die Zukunft gerüstet ist.<br />
Technologischer<br />
Alleskönner<br />
Das PACS View ist so aufgebaut, dass es die spezifischen<br />
Bedürfnisse von Zuweisern, Patienten und<br />
Klinikern gleichermassen abdeckt. Damit erleichtert<br />
es die Arbeit aller Beteiligten, vereinfacht den Austausch<br />
und stärkt die Regionen mit teleradiologischer<br />
Fachkompetenz. Nicht umsonst profitieren<br />
inzwischen zwölf Spitäler – darunter auch drei<br />
nicht kantonale – sowie Hunderte von Zuweisern<br />
von dieser innovativen Lösung.<br />
Auf die Zuweiser zugeschnitten<br />
Bei der Entwicklung dieses Systems standen von<br />
Anfang an ganz besonders auch die Zuweiser im<br />
< Prof. Dr. Simon Wildermuth, Bernhard Asendorf<br />
3<br />
1 Kantonsspital St.Gallen,<br />
Geriatrische Klinik St.Gallen,<br />
Kinderspital St.Gallen<br />
2 Spitalregion Rheintal,<br />
Werdenberg, Sarganserland<br />
3 Spital Linth<br />
4 Spitalregion Fürstenland<br />
Toggenburg<br />
4<br />
Zentrum. Heute, nachdem das PACS View erfolgreich<br />
gestartet ist, freut man sich über die breite<br />
Akzeptanz. Doch wie genau funktioniert dieser<br />
Webviewer? Ein Beispiel: Ein Patient wird von einem<br />
Zuweiser zur radiologischen Untersuchung in ein<br />
Spital in der Nähe überwiesen. In den meisten Fällen<br />
wird die Untersuchung teleradiologisch durch einen<br />
Facharzt Radiologie am Kantonsspital St.Gallen mitbeurteilt<br />
und ein schriftlicher Befund erstellt. Noch<br />
am selben Tag erhält der Zuweiser via HIN-Account<br />
eine E-Mail mit einem hochverschlüsselten Link. Ein<br />
Klick darauf, und schon erscheinen Bilder und Befund<br />
auf seinem Computer (PC, Mac, Surface, iPad).<br />
Das geht ganz ohne Passwörter und Logins, ein<br />
Internet-Browser genügt. So ist der Arzt umgehend<br />
informiert und kann seinem Patienten unnötige<br />
Wartezeiten ersparen. Bilder als auch Berichte wer-<br />
1<br />
2
16 Innovation und Entwicklung<br />
Zehnmal einmalig:<br />
das PACS View<br />
des Kantonsspitals<br />
St.Gallen<br />
1. Schnelligkeit<br />
Übermittlung radiologischer Bilder und<br />
Befunde an den Zuweiser noch am Tag der<br />
Untersuchung<br />
2. Einfache und sichere Handhabung<br />
E-Mail mit verschlüsseltem Link zum<br />
Anklicken – kein Login, kein Passwort<br />
3. Wichtige Features<br />
3-D-Modus, Vergleichsansicht, Vergrösserungs-<br />
und Ausmessfunktionen<br />
4. Breite Vernetzung<br />
Professionalisierung und Stärkung der<br />
Spitäler in der Region<br />
5. Medizinisches Know-how<br />
Zugriff auf zahlreiche Fachspezialisten der<br />
Radiologie des Kantonsspitals St.Gallen<br />
6. Technisches Know-how<br />
Entwicklung und Wartung des RIS/PACS<br />
durch eigene Fachspezialisten<br />
7. Service und Support RIS/PACS<br />
Helpdesk für externe Anwender bei Fragen<br />
rund um das PACS<br />
8. Zukunftsorientierte Lösung<br />
Ausbau des Systems zu einem umfassenden<br />
Dienstleistungstool<br />
9. Dienstleistung<br />
Nutzung ist für die Zuweiser und die<br />
Patienten kostenlos<br />
<strong>10</strong>. Verfügbarkeit<br />
Bilder und Befund jederzeit online verfügbar<br />
den vom System automatisch aktualisiert, etwa im<br />
Falle eines Nachbefundes. Das garantiert, dass<br />
alle, die mit diesem Webviewer arbeiten, stets auf<br />
dem neusten Stand sind und vom Gleichen reden.<br />
Doch das PACS View kann noch mehr.<br />
Intelligente Funktionen<br />
Neben einer schnellen und sicheren Abwicklung<br />
punktet das IT-Instrument mit besonderen Features.<br />
So lassen sich die hochauflösenden CT- und MR-<br />
Bilder auch im 3-D-Modus betrachten, Details können<br />
vermessen, Ausschnitte vergrössert, die PDF-<br />
Befunde abgespeichert und ausgedruckt und Befundtexte<br />
mittels Copy-and-Paste in andere Dokumente<br />
eingefügt werden. Eine weitere Besonderheit<br />
ist die vergleichende Darstellung von Bildern oder<br />
Bildserien aus unterschiedlichen Untersuchungen.<br />
Das Herunterladen geschieht rasch, da das System<br />
die Daten verlustfrei komprimiert, die Ansicht erfolgt<br />
on the fly, und bei jedem Wiederaufschalten<br />
werden die Bilder neu geladen. Da das PACS View<br />
orts- und systemunabhängig ausgelegt ist, spielt es<br />
keine Rolle, in welchem Spital der Untersuch und in<br />
welchem der Befund gemacht wird und welches<br />
Betriebssystem der Anwender auf seinem Computer<br />
installiert hat. Eine aufwändige Archivierung fällt<br />
weg, sämtliche Daten sind für den Zuweiser während<br />
13 Monaten per Link abrufbar. Benötigt ein Arzt<br />
Zugriff auf ältere Informationen, reicht ein Anruf,<br />
und er erhält via E-Mail einen neuen Link. Ein leicht<br />
anderes Prozedere gilt für den Patienten. Da aus<br />
rechtlichen Gründen der E-Mail-Weg ausgeschlossen<br />
ist, wird ihm ein USB-Stick mit dem PDF-Dokument<br />
und dem Link übergeben. Auch diese Daten<br />
werden laufend aktualisiert.<br />
Führend in allen<br />
Bereichen<br />
Kommunikation ohne Umwege<br />
Auf dem Untersuchungsbericht ist jeweils der Name<br />
des verantwortlichen Radiologen oder Nuklearmediziners<br />
aufgeführt. Gerade bei Rücksprachen<br />
zeigt sich, wie genial das PACS View aufgebaut ist.<br />
Da das System ortsunabhängig ausgelegt ist, kann<br />
das Bildmaterial gleichzeitig in der Klinik und in der<br />
externen Praxis abgerufen werden. Hierzu wird<br />
lediglich einen HIN-Mail-Account benötigt. Prof. Dr.<br />
Wildermuth: «Dieser Art des elektronischen Bildaustausches<br />
haben sich bereits Hunderte Zuweiser<br />
angeschlossen.»
Innovation und Entwicklung<br />
17<br />
Schnell<br />
Das zentrale PACS View der Klinik für Radiologie und<br />
Nuklearmedizin des Kantonsspitals St.Gallen bietet<br />
den Zuweisern enorme Vorteile. So erfolgt die Übermittlung<br />
radiologischer und nuklearmedizinischer<br />
Bilder und Befunde noch am Untersuchungstag via<br />
E-Mail. Das Abrufen geschieht einfach mit einem<br />
Klick auf den verschlüsselten Link. Zudem erleichtert<br />
das System die Kommunikation zwischen Zuweiserärzten,<br />
Radiologen und Klinikern. Besondere<br />
Fähigkeiten wie etwa der 3-D-Betrachtungsmodus<br />
sind weitere Punkte, die für das System sprechen.<br />
Stark in Technologie und Service<br />
Radiologie und Nuklearmedizin sind immer IT-lastiger<br />
geworden. Deshalb bilden Ärzte und Informatiker<br />
ein Team, denn die Entwickler müssen genau<br />
verstehen, was die Mediziner heute und morgen<br />
brauchen. Zudem halten sie das System fit und sorgen<br />
so dafür, dass die radiologischen und nuklearmedizinischen<br />
Bilder und Daten jederzeit und überall<br />
abrufbar sind – sei es im OP, in der Praxis des<br />
Zuweisers, beim Patienten oder in den anderen<br />
Spitälern. Externe Anwender können sich bei Problemen<br />
über das Servicecenter-Team direkt an die<br />
IT-Fachleute des Service und Support RIS/PACS<br />
wenden. Der Applikationsmanager Bernhard Asendorf:<br />
«Unsere Gruppe für Service und Support<br />
besteht aus vier Fachspezialisten, die das System<br />
warten und die PACS-Anwender in allen Regionen<br />
unterstützen, oft auch vor Ort.»<br />
Kompetenz und flächendeckende<br />
Professionalisierung<br />
Hinter dem RIS/PACS-System steht nicht nur eine<br />
technisch ausgereifte zentrale Infrastruktur, sondern<br />
auch ein gebündeltes medizinisches Knowhow.<br />
Mit über fünfzig Fachärzten gehört die Klinik<br />
für Radiologie und Nuklearmedizin des Kantonsspitals<br />
St.Gallen schweizweit zu den grössten ihrer<br />
Art. Das immense Erfahrungspotenzial, das hier<br />
zusammenkommt, ist für die Qualität der Befundung<br />
entscheidend. Prof. Dr. Wildermuth: «Im Gegensatz<br />
zu kleinen Spitälern oder Privatspitälern, die oft<br />
nur einen Radiologen beschäftigen, können wir auf<br />
eine viel breitere Fachkompetenz zugreifen. So<br />
wird beispielsweise ein Tumorbild je nach Fall auch<br />
mit einem Neuro- oder Kinderradiologen besprochen.»<br />
Aus diesem Grund haben sich bereits zwölf<br />
Spitäler dem RIS/PACS angeschlossen. Durch diese<br />
Zusammenarbeit hat die Professionalität im teleradiologischen<br />
Bereich auch in den Regionen stark<br />
zugenommen. Dazu der Chefarzt: «Die Möglichkeit,<br />
andere zu unterstützen, ist eine grosse Errungenschaft.»<br />
Auf der Überholspur<br />
Zurzeit werden rund doppelt so viele Bilder wie<br />
noch vor zehn Jahren erstellt. Mit dem alten Bildbewirtschaftungssystem<br />
wäre diese Flut gar nicht<br />
mehr zu bewältigen. Das RIS/PACS verarbeitet<br />
jährlich rund eine Viertelmillion radiologische und<br />
nuklearmedizinische Bildstudien und erfasst täglich<br />
rund sechshundert neue Untersuchungen. Obwohl<br />
das PACS View längst eine Vorreiterrolle innehat,<br />
arbeiten Prof. Dr. Simon Wildermuth und sein<br />
Team bereits an der Zukunft. Ein Projekt ist die<br />
«E-Zuweisung». Bernhard Asendorf: «Mit einer<br />
elektronischen Erfassung gestaltet sich der gesamte<br />
Anmeldeprozess für den Zuweiser noch einfacher<br />
und eleganter, ausserdem wird er auf elektronischem<br />
Weg automatisch über alle Schritte der Untersuchung<br />
informiert.» Ein anderes Projekt, das<br />
bereits weit fortgeschritten ist, betrifft die zentrale<br />
Anlaufstelle (Servicecenter). Unabhängig davon,<br />
welches Anliegen externe Ärzte oder Patienten<br />
haben, sie müssen sich nur noch an eine Stelle wenden.<br />
«Wir wollen nicht nur fachlich gegenüber<br />
Privatspitälern überzeugen, sondern auch mit unseren<br />
Dienstleistungen», formuliert der Chefarzt<br />
und Stv. Direktor des Kantonsspitals St.Gallen seine<br />
Strategie.<br />
Ohne Umwege zur Klinik für<br />
Radiologie und Nuklearmedizin:<br />
www.radnuk.kssg.ch<br />
anmeldung.radiologie@kssg.ch<br />
Tel. +41 71 494 66 66<br />
Technische Unterstützung<br />
Service und Support RIS/PACS<br />
via Servicecenter Tel. +41 71 494 66 66<br />
oder www.radnuk.kssg.ch
18 Prozesse und Organisation<br />
Öffentliche Vorträge:<br />
Start der neuen Serie<br />
Am Dienstag, 25. Oktober 2016 startete am Kantonsspital<br />
St.Gallen die neue Serie 2016/17 der öffentlichen<br />
Vorträge. Wiederum konnte ein sehr interessantes<br />
und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt<br />
werden. Die Vorträge richten sich an<br />
ein Laienpublikum. Beginn der jeweils rund einstündigen<br />
Vorträge mit anschliessender Fragerunde<br />
ist jeweils um 19.30 Uhr im Zentralen Hörsaal. Eine<br />
Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.<br />
Auf der Internetseite www.kssg.ch ist das gesamte<br />
Programm aufgeführt.<br />
Gedruckte Exemplare können via E-Mail bei der<br />
Unternehmenskommunikation des Kantonsspitals<br />
St.Gallen bestellt werden:<br />
unternehmenskommunikation@kssg.ch<br />
Fachsymposium Gesundheit<br />
zum Thema Atmung<br />
Das <strong>10</strong>. Fachsymposium Gesundheit, welches vom<br />
25. bis 26. Januar 2017 in den Hallen 2.1 und 3.1 der<br />
Olma Messen St.Gallen stattfindet und vom Departement<br />
Pflege des Kantonsspitals St.Gallen organisiert<br />
wird, steht unter dem Motto «Atmung – lebensbegleitender<br />
Rhythmus». Die Vielfalt der Thematik wird<br />
an dieser Jubiläumsveranstaltung umfassend beleuchtet<br />
und diskutiert. Fachkompetente Referentinnen<br />
und Referenten tragen mit interessanten Vorträgen<br />
dazu bei, den Wissensstand des Publikums<br />
zum spannenden Thema Atmung zu erweitern.<br />
Anmeldung, Programm und weitere<br />
Informationen unter www.fachsymposium.ch<br />
Save the date:<br />
Zuweiser-Event am<br />
9. Februar 2017<br />
Herzlichen Dank an alle, die an der diesjährigen<br />
Zuweiser-Befragung teilgenommen haben.<br />
Am Zuweiser-Event vom 9. Februar 2017 informieren<br />
wir über die Resultate der Umfrage und<br />
zeigen uns von einer anderen Seite.<br />
Wir freuen uns, wenn Sie sich diesen Termin<br />
jetzt schon vormerken. Die persönliche Einladung<br />
erhalten Sie in Kürze.
Prozesse und Organisation<br />
19<br />
Innovationen aus Rorschach<br />
Das Spital Rorschach fühlt den Puls der Zeit und<br />
bietet neu Sprechstunden in verschiedenen Sprachen<br />
an. Hausärzte oder Patienten wenden sich<br />
für eine Terminvereinbarung direkt an das Sekretariat<br />
der Chirurgie Rorschach.<br />
Kontakt<br />
Tel. +41 71 858 14 30<br />
Fax +41 71 855 75 63<br />
chirurgie.rorschach@kssg.ch<br />
Dr. Joanna Janczak<br />
Dr. Önder Ögredici<br />
Kurzporträt von Dr. Joanna Janczak<br />
Dr. Joanna Janczak hat in Polen und Italien<br />
Medizin studiert und schloss ihre Ausbildung<br />
2009 am Kantonsspital St.Gallen ab. Ab 2013<br />
war sie Oberassistenzärztin im Kantonsspital<br />
St.Gallen und seit 2015 ist sie Oberärztin und<br />
stellvetretende Leiterin der Chirurgie im<br />
Spital Rorschach. Sie hat sich spezialisiert auf<br />
Allgemeinchirurgie mit Fokus auf bauchchirurgische<br />
Eingriffe (u. a. Gallenblase, Blinddarm,<br />
Hernien, Dickdarm), die sie wenn immer möglich<br />
minimalinvasiv durchführt. Sie führt ihre<br />
Sprechstunden je nach Bedarf auf Polnisch<br />
(Montag und Dienstag oder nach Vereinbarung),<br />
Deutsch, Italienisch oder Englisch<br />
durch.<br />
Kurzporträt von Dr. Önder Ögredici<br />
Dr. Önder Ögredici hat in Düsseldorf Medizin<br />
studiert, 2006 startete er in Basel mit der<br />
Chirurgieausbildung. 2012 wechselte er ans<br />
Kantonsspital St.Gallen und ist seit 2015<br />
Facharzt für Chirurgie im Spital Rorschach. Er<br />
ist spezialisiert auf Allgemeinchirurgie und<br />
leitet gemeinsam mit Dr. Lukas Marti die Proktologie<br />
am Standort Rorschach. Er bietet<br />
montags, mittwochs oder nach Vereinbarung<br />
auch Sprechstunden auf Türkisch an.<br />
Epilepsiezentrum<br />
Bei einigen Epilepsiesyndromen stellt sich die Frage<br />
nach der Möglichkeit eines epilepsiechirugischen<br />
Eingriffs. Das Epilepsiezentrum am Kantonsspital<br />
St.Gallen trägt unter anderem dazu bei, diese<br />
Patienten frühzeitig zu erkennen und nach einer<br />
nichtinvasiven Abklärung entweder direkt einer<br />
Operation zuzuführen oder zur weiteren invasiven<br />
Diagnostik mittels intrakranieller Tiefenelektroden<br />
an einen Kooperationspartner zu überweisen.<br />
Mehr zum «Epilepsiezentrum» erfahren Sie<br />
auf Seite 20.
20 Prozesse und Organisation<br />
Epilepsiezentrum am<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Für die Ostschweiz bietet das Epilepsiezentrum<br />
am Kantonsspital St.Gallen<br />
eine umfassende Betreuung von Epilepsiepatienten.<br />
Neben der notfallmässigen<br />
sowie stationären Betreuung und der ambulanten<br />
Epilepsie-Spezialsprechstunde<br />
kommt neu eine EEG Monitoring Unit (EMU)<br />
hinzu, in der Patientinnen und Patienten<br />
mit bekannter Epilepsie oder zur Abklärung<br />
einer möglichen Epilepsie durch ein<br />
erweitertes Epilepsie-Team betreut<br />
und durch ein neues Telemetriesystem<br />
überwacht werden.
Prozesse und Organisation 21<br />
Schnell<br />
Das erweiterte Epilepsie-Team betreut Epilepsiepatienten<br />
in der ambulanten Epilepsiesprechstunde,<br />
der EEG Monitoring Unit (EMU) und bei Bedarf<br />
auf den Bettenstationen inkl. Intensivstationen und<br />
Zentraler Notfallaufnahme. Es wird unterstützt<br />
durch ein Netzwerk an interdisziplinären Diensten,<br />
das ein an die Bedürfnisse des Patienten angepasstes<br />
Betreuungsangebot sicherstellt. Die neue EEG<br />
Monitoring Unit erweitert das Dienstleistungsangebot<br />
des Kantonsspitals St.Gallen um die Möglichkeit,<br />
eine intensive EEG-Diagnostik im abgesicherten<br />
Umfeld durchzuführen.<br />
Epileptische Anfälle respektive Epilepsie sind ausgesprochen<br />
häufig. So erleiden etwa 5 % der Bevölkerung<br />
in ihrem Leben einen epileptischen Anfall,<br />
0,5 % bis 1 % der Bevölkerung haben eine Epilepsie,<br />
leiden also unter wiederkehrenden epileptischen<br />
Anfällen. Folglich muss eine beachtliche Anzahl<br />
Menschen hausärztlich und neurologisch betreut<br />
werden.<br />
Unklare Bewusstlosigkeit, epileptischer<br />
Anfall oder sogar Epilepsie?<br />
Die Diagnose einer Epilepsie hat erhebliche Auswirkungen<br />
auf das soziale und berufliche Leben<br />
eines Betroffenen (Beispiel Fahreignung) und muss<br />
aufgrund der dann oft lebenslangen Behandlungsbedürftigkeit<br />
besonders gut gesichert sein. Bei unklarer<br />
Bewusstlosigkeit wird deshalb häufig abgeklärt,<br />
ob vielleicht ein epileptischer Anfall oder zum<br />
Beispiel eine Synkope die Ursache gewesen sein<br />
könnte. Mit den verfügbaren Epilepsiemedikamenten<br />
sind etwa zwei Drittel der Patienten anfallsfrei,<br />
bei ungefähr einem Drittel der Patienten kommt es<br />
jedoch zu einem therapierefraktären Verlauf.<br />
Die Bestandteile des Epilepsiezentrums<br />
Patienten, die ungeplant aufgrund eines epileptischen<br />
Anfalls oder einer unklaren Bewusstlosigkeit<br />
ins Kantonsspital St.Gallen (KSSG) über die<br />
Zentrale Notfallaufnahme eintreten, werden auf den<br />
Bettenstationen oder auf der Intensivstation betreut.<br />
Mittels mobiler EEG-Geräte können auf allen<br />
Stationen EEGs oder sogar Langzeit-EEGs durchgeführt<br />
werden. Bei einem erstmaligen Anfall folgt<br />
eine gründliche Abklärung möglicher Ursachen und<br />
gegebenenfalls die Einleitung einer adäquaten<br />
Therapie.<br />
Bei bekannter Epilepsie und etablierter Therapie<br />
kann der Patient häufig auch ambulant bleiben.<br />
Die ambulante Betreuung von Epilepsiepatienten<br />
erfolgt in der Epilepsie-Spezialsprechstunde, in<br />
der zum Beispiel auch schwierige Fragestellungen<br />
rund um das Thema Epilepsie und Schwangerschaft<br />
beantwortet werden.<br />
Elektiv geplante Hospitalisationen erfolgen meist<br />
für eine intensive EEG-Diagnostik in der neuen EEG<br />
Monitoring Unit (EMU). Die Betreuung der Patienten<br />
wird nun durch ein erweitertes Epilepsie-Team sowie<br />
ein interdisziplinäres Netzwerk an supportiven<br />
Diensten (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie,<br />
Sozialdienst, Psychosomatik und Neuropsychologie)<br />
sichergestellt. Via Fortbildungskonzept sind die<br />
betreuenden Pflegefachpersonen auf dem Gebiet<br />
der Epilepsie geschult.<br />
Wann ist eine Langzeit-EEG-Ableitung sinnvoll?<br />
Schon kurz nach Beendigung eines epileptischen<br />
Anfalls kann ein einfaches EEG von in der Regel<br />
Zuweisung – wen,<br />
wann, wohin?<br />
Notfallmässige Zuweisungen<br />
Unverändert über die Zentrale Notfallaufnahme.<br />
Eine Anmeldung erfolgt<br />
über den neurologischen Dienstarzt (via<br />
Telefonzentrale KSSG: +41 71 494 11 11).<br />
Ambulante Abklärungen<br />
(Epilepsiesprechstunde, EEG, EMU)<br />
Anmeldung im Ambulatorium für Neurologie<br />
Elektive Hospitalisation<br />
Anmeldung im Ambulatorium für Neurologie<br />
für EEG-Intensivdiagnostik<br />
Ambulatorium Neurologie<br />
Tel. +41 71 494 16 69<br />
Fax +41 71 494 28 95
22 Prozesse und Organisation
Prozesse und Organisation<br />
23<br />
20 bis 30 Minuten Ableitezeit wieder völlig normal<br />
sein. Ein unauffälliges EEG kann also die Epilepsie<br />
oder den epileptischen Anfall nicht sicher ausschliessen.<br />
Im Langzeit-EEG ist aufgrund der längeren<br />
Aufzeichnungsdauer von mehreren Tagen bis<br />
zu zwei Wochen die Wahrscheinlichkeit deutlich<br />
grösser, epileptische Aktivität, einen klinischen oder<br />
auch subklinischen epileptischen Anfall aufzuzeichnen.<br />
Steht nach einer unklaren Bewusstlosigkeit die<br />
Fahrtauglichkeit auf dem Spiel, kann mittels Langzeit-EEG<br />
besser beurteilt werden, ob diese wieder<br />
erteilt werden kann. Gerade bei nächtlichen Auffälligkeiten<br />
können schlafgebundene epileptische<br />
Anfälle von Schlafstörungen abgegrenzt werden.<br />
Nicht selten können auch nichtepileptische, dissoziative<br />
Anfälle vorliegen, die im Langzeit-EEG gut von<br />
epileptischen Anfällen abgegrenzt werden können.<br />
Möglichkeit einer Epilepsiechirurgie<br />
Bei manchen Epilepsiesyndromen und bei therapierefraktären<br />
Patienten stellt sich ausserdem die<br />
Frage nach der Möglichkeit einer Epilepsiechirurgie.<br />
Ein Patient gilt als therapierefraktär, wenn zwei<br />
Versuche mit ausreichend hoch dosierten und für<br />
die Epilepsieart richtig gewählten Medikamenten<br />
versagen und der Patient weiterhin epileptische<br />
Anfälle hat. Therapierefraktäre Epilepsien sind nicht<br />
so selten. Mit den verfügbaren Medikamenten<br />
können etwa zwei Drittel der Patienten gut eingestellt<br />
werden, ein Drittel bleibt therapierefraktär.<br />
Ein grosser Teil dieser Patienten wird, je nach<br />
Ursache und Lage des epileptogenen Fokus, nach<br />
einem epilepsiechirurgischen Eingriff dauerhaft<br />
anfallsfrei. Vor allem Patienten mit Temporallappenepilepsien<br />
sind häufig therapierefraktär und können<br />
von einem epilepsiechirurgischen Eingriff profitieren.<br />
Oft wird aber erst sehr spät evaluiert, ob ein<br />
Patient für einen epilepsiechirurgischen Eingriff in<br />
Betracht kommt.<br />
Das Epilepsiezentrum am Kantonsspital St.Gallen soll<br />
dazu beitragen, diese Patienten frühzeitig zu erkennen<br />
und nach einer nichtinvasiven Abklärung, entweder<br />
direkt einer Operation zuzuführen, oder, falls<br />
die Ursache der Epilepsie nicht ausreichend geklärt<br />
werden konnte, an einen Kooperationspartner zur<br />
weiteren Diagnostik, z.B. mittels invasiver Abklärung<br />
mit intrakraniellen Tiefenelektroden, zu überweisen.<br />
Die neue EEG Monitoring<br />
Unit (EMU) auf einen Blick<br />
Im Rahmen der baulichen Erneuerungen der<br />
Bettenstationen im Haus 04 wurde eine neue,<br />
grosszügige EEG Monitoring Unit (EMU) erstellt,<br />
um die im Haupttext aufgeführten Fragestellungen<br />
mittels Langzeit-EEG Ableitung abklären<br />
zu können. Ein erweitertes Epilepsie-Team<br />
steht für die Betreuung der Epilepsie-Patienten<br />
sowohl in der EMU als auch auf den anderen<br />
Stationen inkl. Intensivstationen bereit. Eingebettet<br />
sind aber auch die Physiotherapie, Ergotherapie,<br />
Logopädie, Sozialdienst, Neuropsychologie<br />
und Psychosomatik, um den Patienten<br />
ein umfassendes, individuell angepasstes Betreuungsangebot<br />
anbieten zu können.<br />
ohne zeitliche Verzögerung reagiert werden<br />
kann und die Sicherheit der Patienten jederzeit<br />
gewährleistet wird.<br />
Indikation für Langzeit-EEG-Ableitung:<br />
– Verdacht auf epileptischen Anfall<br />
oder Epilepsie bei normalem EEG<br />
– Abgrenzung nichtepileptischer, dissoziativer<br />
Anfälle von epileptischen Anfällen<br />
– Lokalisation des Anfallsursprungs im Hinblick<br />
auf eine mögliche Epilepsiechirurgie<br />
– Therapieoptimierung bei Pharmakoresistenz<br />
– Abgrenzung schlafgebundener epileptischer<br />
Anfälle von Schlafstörungen.<br />
Mit einem neuen Telemetriesystem wird sichergestellt,<br />
dass auf einen epileptischen Anfall<br />
< Dr. Dominique Flügel, Dr. Dominik Zieglgänsberger,<br />
Prof. Dr. Barbara Tettenborn (v.l.n.r.); Nicht auf dem Foto: Dr. Philip Siebel
24 Agenda<br />
Veranstaltungen<br />
Dezember 2016 bis April 2017<br />
DEZEMBER<br />
Mo 05.12.2016 Mentales Training für Chirurgen<br />
Schulungs- und Trainingszentrum<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
12.30 – 17.00 Uhr<br />
Raum 401, Haus 81, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 05.12.2016 Hepatologie-Kolloquium<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
17.30 – 18.45 Uhr<br />
Raum 045, Haus 11, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 05.12.2016 46. St.Galler Anästhesiesymposium<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungsund<br />
Schmerzmedizin<br />
17.00 – 19.30 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, Kantonsspital St.Gallen<br />
Di 06.12.2016 Öffentlicher Vortrag: Hirntumore –<br />
ein fachübergreifender Behandlungsweg<br />
Klinik für Neurologie/Neurochirurgie, Radio-Onkologie<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 12.12.2016 Lernen, Motivation und Gedächtnis –<br />
eine Einführung<br />
Schulungs- und Trainingszentrum Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
08.00 – 12.30 Uhr<br />
Raum 014, Haus 33, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 12.12.2016 Rheumatologie-Seminar: Imaging in spondyloarthritis<br />
in clinical practice – how to do according<br />
to EULAR recommendations<br />
Prof. Dr. Mikkel Ostergaard MD, PhD, DMSc,<br />
Copenhagen Center for Arthritis Research (DK)<br />
Klinik für Rheumatologie<br />
17.45 – 19.15 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik, Haus 06, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 12.12.2016 SASL-School of Hepatology<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
17.30 – 19.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Di 13.12.2016 Öffentlicher Vortrag: Erektile Dysfunktion –<br />
Mythen und Fakten<br />
Klinik für Urologie<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mi 14.12.2016 Interdisziplinäre Viszeralmedizin<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
18.30 – 20.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Mo 19.12.2016 Symptom- und Beschwerdevalidierung<br />
versicherungsmedizinisch und praktisch<br />
Klinik für Neurologie<br />
Ab 17.30<br />
Kursraum, Haus 04, 14. Stock, Kantonsspital St.Gallen<br />
JANUAR<br />
Mo 09.01.2017<br />
Dermatologie-Fokus:<br />
Lyme Borreliose – Schlaglöcher bei Diagnose<br />
und Therapie<br />
Klinik für Dermatologie<br />
19.00 – 19.45 Uhr<br />
Raum 045, Haus 11, Kantonsspital St.Gallen<br />
Di <strong>10</strong>.01.2017 21. St.Galler IPS-Symposium 2017<br />
Di <strong>10</strong>.01.2017<br />
Mo 16.01.2017<br />
Di 17.01.2017<br />
Do 19.01.2017<br />
Do 19.01.2017 –<br />
Fr 20.01.2017<br />
Di 24.01.2017<br />
Di 24.01.2017<br />
Mi 25.01.2017<br />
Mi 25.01.2017 –<br />
Do 26.01.2017<br />
Klinik für Anästhesiologie-, Intensiv-, Rettungs-<br />
und Schmerzmedizin<br />
<strong>10</strong>.00 – 17.45 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, 9000 St.Gallen<br />
Öffentlicher Vortrag:<br />
Multiple Sklerose – Diagnose und Therapie<br />
Klinik für Neurologie<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Limbische Anfälle und Funktionen<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kantonsspital St.Gallen<br />
Öffentlicher Vortrag: Neues zum<br />
Thema Magenkrebs<br />
Klinik für Allgemein-, Visezeral- und Endokrin-<br />
und Transplantationsmedizin<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
<strong>10</strong>. Post-SABCS Fortbildungsveranstaltung<br />
Brustzentrum St.Gallen<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Einstein Congress-Hotel, 9000 St.Gallen<br />
(mit Live-Stream nach Zürich und Basel)<br />
Provider ACLS-01<br />
REA2000 – Zentrum für Reanimations-<br />
und Simulationstraining<br />
Fürstenlandstrasse <strong>10</strong>0, 9014 St.Gallen<br />
Öffentlicher Vortrag: Rund ums Blutzuckermessen<br />
Klinik für Endokrinologie/Diabetologie<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Auftaktveranstaltung der Sensibilisierungskampagne<br />
zum Thema Demenz der Stadt St.Gallen 2017<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.00 Uhr<br />
Pfalzkeller St.Gallen<br />
Swiss Neurology Webinars – Videokonferenz<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.00 Uhr<br />
Bibliothek, Raum 403, Haus 04, 4. Stock,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Fachsymposium Gesundheit<br />
Departement Pflege<br />
jeweils 09.00 Uhr – 17.30 Uhr<br />
Olma Messen, St.Gallen, Halle 2.1
Agenda<br />
25<br />
FEBRUAR<br />
Di 07.02.2017<br />
Do 09.02.2017<br />
Do 09.02.2017<br />
Mo 13.02.2017<br />
Di 14.02.2017<br />
Do 16.02.2017 –<br />
Sa 18.02.2017<br />
Sa 18.02.2017<br />
Mo 20.02.2017<br />
Öffentlicher Vortrag: Ambulante pulmonale<br />
Rehabilitation – Training für lungenkranke<br />
Patienten<br />
Klinik für Pneumologie/Ergo- und Physiotherapie<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Zuweiser-Event<br />
<strong>10</strong>. Update Neurologie<br />
Klinik für Neurologie<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Das zentral-vestibuläre System und seine<br />
Plastizität bei Gleichgewichtserkrankungen<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 Uhr<br />
Kursraum, Haus 04, 14. Stock<br />
Öffentlicher Vortrag: Das 1 x 1 der Medikamenteneinnahme<br />
– was können Ärzte, Apotheker und<br />
Patienten gemeinsam zur Medikamentensicherheit<br />
beitragen?<br />
Klinik für AIM/Hausarztmedizin, Spitalapotheke<br />
17.30 Uhr<br />
Haus 04, 14. Stock, Kantonsspital St.Gallen<br />
27. Ärzte-Fortbildungskurs in Klinischer Onkologie<br />
Klinik für Onkologie und Hämatologie<br />
08.00 – 18.30 Uhr (Sa: 08.00 – 12.30 Uhr)<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
St.Galler Ultraschall-Workshop<br />
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-,<br />
Rettungs- und Schmerzmedizin<br />
08.30 – 18.00 Uhr<br />
Hörsaal Frauenklinik (Haus 06/Raum 434)<br />
PAS (Haus 23B)<br />
Dermatologie-Fokus:<br />
Pädiatrische Dermatologie<br />
Klinik für Dermatologie<br />
19.00 – 19.45 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Di 21.02.2017 Öffentlicher Vortrag: Arthrose im Handgelenk –<br />
Do 23.02.2017<br />
Mo 27.02.2017<br />
Di 28.02.2017<br />
und trotzdem schmerzfrei bewegen<br />
Klinik für HPW<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
22. St.Galler Infekttag<br />
Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene<br />
08.30 – 17.50 Uhr<br />
Würth Haus, Churerstrasse <strong>10</strong>, 9400 Rorschach<br />
Die innere Uhr und Schlaf<br />
Klinik für Neurologie<br />
17.30 Uhr<br />
Kursraum, Haus 04, 14. Stock, Kantonsspital St.Gallen<br />
Öffentlicher Vortrag: Chronisch entzündliche<br />
Darmerkrankungen – wann Medikamente und<br />
wann operieren?<br />
Klinik für Allgemein-, Viszeral und Transplantationsmedizin,<br />
Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
MÄRZ<br />
Do 02.03.<br />
Mo 06.03.2017–<br />
Di 07.03.2017<br />
Di 07.03.2017<br />
Mi 08.03.2017<br />
Di 14.03.2017<br />
Do 16.03.2017<br />
Mo 20.03.2017<br />
Di 21.03.2017<br />
Do 23.03.2017–<br />
Fr 24.03.2017<br />
Zuweiser-Event mit Fortbildung: Kreislauf in<br />
Perfektion<br />
Ostschweizer Gefässzentrum<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Provider ACLS-05<br />
REA2000 – Zentrum für Reanimations-<br />
und Simulationstraining<br />
Fürstenlandstrasse <strong>10</strong>0, 9014 St.Gallen<br />
Öffentlicher Vortrag COPD – heute und morgen<br />
Klinik für Pneumologie<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Refresher ACLS-R-02<br />
REA2000 – Zentrum für Reanimations-<br />
und Simulationstraining<br />
Fürstenlandstrasse <strong>10</strong>0, 9014 St.Gallen<br />
Öffentlicher Vortrag: Wenn das Gehen zur<br />
Qual wird – Durchblutungsstörungen am Bein<br />
Klinik für Angio, Gefässchir, Rad/Nuk<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Ostschweizer Notfallsymposium<br />
Zentrale Notfallaufnahme<br />
09.00 – 17.30 Uhr<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Dermatologie-Fokus:<br />
Orphan drugs in der Dermatologie<br />
Klinik für Dermatologie<br />
19.00 – 19.45 Uhr<br />
Haus 11, Raum 045, Kantonsspital St.Gallen<br />
Öffentlicher Vortrag: Heuschnupfen und allergisches<br />
Asthma – von Pollen bis zur Hausstaubmilbe<br />
Klinik für Derma/Allergo, HNO, Pneumo<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Provider PALS-02<br />
REA2000<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Di 28.03.2017 Öffentlicher Vortrag: Palliative Care –<br />
APRIL<br />
Mo 24.04.2017 –<br />
Di 25.04.2017<br />
Mi 26.04.2017<br />
die Betreuung von Menschen zwischen Medizin,<br />
Sozial- und Geisteswissenschaft<br />
Palliativzentrum<br />
19.30 – 21.00 Uhr<br />
Zentraler Hörsaal, Haus 21, Kantonsspital St.Gallen<br />
Provider ACLS-12<br />
REA2000 – Zentrum für Reanimations- und<br />
Simulationstraining<br />
Fürstenlandstrasse <strong>10</strong>0, 9014 St.Gallen<br />
Refresher ACLS-R-04<br />
REA2000 – Zentrum für Reanimations- und<br />
Simulationstraining<br />
Fürstenlandstrasse <strong>10</strong>0, 9014 St.Gallen<br />
Mehr Veranstaltungen und<br />
Informationen unter: www.kssg.ch
Kantonsspital St.Gallen<br />
Rorschacher Strasse 95<br />
CH-9007 St.Gallen<br />
Tel. +41 71 494 11 11<br />
Spital Rorschach<br />
Heidenerstrasse 11<br />
CH-9400 Rorschach<br />
Tel. +41 71 858 31 11<br />
Spital Flawil<br />
Krankenhausstrasse 23<br />
CH-9230 Flawil<br />
Tel. +41 71 394 71 11<br />
www.kssg.ch