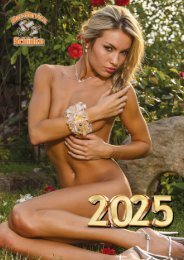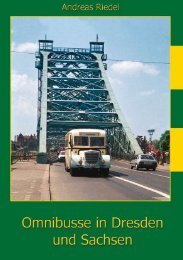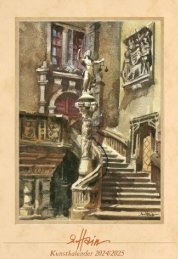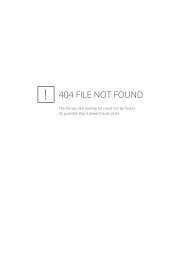08_august_217
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(Wieder-) Eröffnung Kulturforum Görlitzer Synagoge am 12. Juli 2021. © Pawel Sosnowski
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
Vorwort<br />
die gute Nachricht ist, dass mit einem abgestimmten<br />
und durch die Gesundheitsbehörde<br />
des Landkreises Görlitz genehmigten<br />
Hygiene- und Sicherheitskonzept das diesjährige<br />
Stadthallengarten-Görlitz- Open-Air-<br />
Festival am 13. und 14. August stattfinden<br />
kann. Für Sie als StadtBILD-Leser haben wir<br />
eine Treue-Aktion mit 22% Rabatt beim<br />
Festivalticket-Sofortkauf ins Leben gerufen.<br />
Dieser Treuerabatt von 22% auf den Ticketpreis<br />
ist gedacht für 22 Jahre StadtBILD, das<br />
historische Magagzin der Oberlausitz.<br />
Lassen Sie uns gemeinsam bei einem kühlen<br />
Landskronbier und Gegrilltem vom Barbecue<br />
Görlitz Livemusik im Sommer-Open Air-<br />
Flair genießen. Wir freuen uns auf Sie!<br />
Das Konzert am Samstag widmen wir meiner<br />
geliebten Mutter, Dr. Ingrid Oertel, die<br />
uns leider am Freitag, dem 30. Juli 2021, für<br />
immer verlassen hat. Sie war stets motiviert,<br />
trug zu zahlreichen Beiträgen im StadtBILD<br />
bei und übernahm dazu etliche Lektorate.<br />
Aber sie hätte nicht gewollt, das auch bei<br />
ihr beliebte Stadthallengarten-Open-Air aus<br />
privaten Gründen abzusagen.<br />
Chris Harp und Pedda Schmidt widmen ihr<br />
am Samstag deshalb auch einen ganz eigenen<br />
Song, der sie in unserer Erinnerung behalten<br />
lässt.<br />
Wir werden sie aufrichtig sehr vermissen.<br />
Darüber hinaus hält dieser Kultursommer<br />
hochkarätige musikalische Höhepunkte<br />
für uns bereit. Mit dem „Kammermusikfest<br />
Oberlausitz“ startet Sachsens jüngstes<br />
Klassikfestival, das sich ganz der Kultur im<br />
ländlichen Raum, der musikalischen Nachwuchsförderung,<br />
dem gesellschaftlichen<br />
Zusammenhalt und bürgerlichem Engagement<br />
verschrieben hat. Gemeinden und<br />
Städte im Landkreis Bautzen und im Landkreis<br />
Görlitz werden Gastgeber der geplanten<br />
Konzerte sein. Festspielorte werden die<br />
Ev.-Luth. Kirche Baruth, das Schloss Milkel,<br />
das Schloss Berthelsdorf, C. Bechstein Pianofortemanufaktur<br />
Seifhennersdorf, Schloss<br />
Kuppritz, Barockschloss Königshain, Barockschloss<br />
Oberlichtenau und das Schloss Gröditz.<br />
Besonders empfehlenswert ist ein Besuch<br />
des Museums der Fotografie in Görlitz. In<br />
Kooperation mit dem Schlesischen Museum<br />
findet dort vom 22. Juli bis zum 31. Oktober<br />
2021 die Fotoausstellung „Streifzüge /<br />
Wedrówki“ im Rahmen des Projektes<br />
„SATELLITEN – Begegnungen mit zeitgenössischer<br />
Kunst in und aus Schlesien“ statt.<br />
Genießen Sie mit Ihren Liebsten den Kultursommer<br />
in der Oberlausitz.<br />
Ihr Andreas Christian de Morales Roque<br />
anzeige<br />
Einleitung<br />
3
„Ein starkes Zeichen“<br />
Görlitzer Synagoge<br />
In den Jahren 1909-1911 errichteten Walther<br />
William Lossow und Max Hans Kühne<br />
das Synagogengebäude in der Otto-Müller-Straße<br />
in Görlitz. Die Architekten sollten<br />
später auch zwei weitere bedeutende<br />
Gebäude dieser Zeit verantworten: den<br />
Leipziger Hauptbahnhof und das Dresdner<br />
Schauspielhaus. Nachdem der vormalige<br />
Synagogenbau für die stetig wachsende<br />
Gemeinde in Görlitz zu klein geworden<br />
war, setzte das jüdische Bürgertum<br />
mit dem Neubau im Herzen der Stadt ein<br />
repräsentatives Zeichen seines Selbstbewusstseins<br />
und seiner wichtigen Funktion<br />
in der Stadtgesellschaft der Blütezeit der<br />
Stadtentwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts.<br />
In der Zeit des Nationalsozialismus erlitt<br />
auch in Görlitz die jüdische Bevölkerung<br />
unmenschliche Grausamkeit.<br />
Ihr Gotteshaus jedoch blieb als eines der<br />
wenigen in ganz Deutschland verschont.<br />
Zwar wurde in der Pogromnacht am 9. November<br />
1938 auf die Görlitzer Synagoge<br />
ein Brandanschlag verübt. Jedoch rückte<br />
die Feuerwehr aus und löschte den Brand,<br />
eine außergewöhnliche Rettung, deren<br />
Umstände bis heute nicht endgültig geklärt<br />
sind. Nachdem es bereits 1939 Überlegungen<br />
gegeben hatte, das Gebäude in<br />
städtisches Eigentum zu überführen, diente<br />
die Synagoge zwischenzeitlich unter<br />
Missbilligung ihrer Eigentümer als Lager<br />
für das Görlitzer Theater. In der Nachkriegszeit<br />
bot die Jüdische Gemeinde Dresden<br />
der Stadt Görlitz das Gebäude zur kostenlosen<br />
Übernahme für eine angemessene<br />
Nutzung an.<br />
Auch wenn die heutige Nutzung der Synagoge<br />
säkular ist, soll der Ursprung des Gebäudes<br />
im zukünftigen Betrieb stets mitgedacht<br />
und reflektiert werden. An oberster<br />
Stelle steht dabei der Dialog mit der jüdischen<br />
Gemeinde. Seit Beginn der Planungsarbeiten<br />
erfolgte ein kontinuierlicher<br />
Austausch mit der Gemeinde in Dresden zu<br />
Aspekten der Restaurierungsarbeiten und<br />
des Nutzungskonzeptes. Die Einbeziehung<br />
eines Raums für jüdische Gottesdienste in<br />
Form der Wochentagssynagoge sowie das<br />
Angebot der jüdischen Gemeinde in Dresden,<br />
hierfür einen Rabbiner, eine Thora<br />
anzeige<br />
4 Geschichte
(Wieder-) Eröffnung Kulturforum Görlitzer Synagoge<br />
Görlitzer Grundsteinlegung der Synagoge, um 1909. © Robert Scholz, Ratsarchiv<br />
und weitere notwendige Ausstattung zur<br />
Verfügung zu stellen, sind für das derzeitige<br />
Konzept von zentraler Bedeutung. Diese<br />
Zusammenarbeit ist wertvoll und trägt<br />
dazu bei, dass das Gebäude zukünftig angemessen<br />
genutzt werden kann.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
5
„Ein starkes Zeichen“<br />
Görlitzer Synagoge<br />
Bau der Synagoge, um 1910. © Robert Scholz, Ratsarchiv<br />
Die nachhaltige Unterstützung<br />
der Bundesrepublik<br />
Deutschland machte es möglich,<br />
das Gebäude am 12. Juli<br />
2021 nach rund achtzig Jahren<br />
mit zeitgemäßer Ausstattung<br />
in Betrieb zu nehmen.<br />
Die festliche Musik von Brückepreisträgerin<br />
Bente Kahan<br />
bildete den angemessenen<br />
musikalischen Rahmen für<br />
die feierliche Eröffnung. Grußworte<br />
vom Görlitzer Oberbürgermeister<br />
Octavian Ursu, der<br />
Staatministerin für Kultur und<br />
Medien Monika Grütters, dem<br />
Ministerpräsidenten des Freistaates<br />
Sachsen Ministerpräsident<br />
Michael Kretschmer, dem<br />
Vorsitzenden der Jüdischen<br />
Gemeinde Dresden Michael<br />
Hurshell und dem Geschäftsführer<br />
der Ostdeutschen Sparkassenstiftung<br />
Friedrich-Wilhelm<br />
von Rauch unterstrichen<br />
die Bedeutung dieses Tages.<br />
anzeige<br />
6 Geschichte
(Wieder-) Eröffnung Kulturforum Görlitzer Synagoge<br />
Görlitzer Einweihung um 1911. © Robert Scholz, Ratsarchiv<br />
Das Kulturforum Görlitzer Synagoge<br />
soll zukünftig ein regional<br />
wie überregional wirksamer<br />
Ort der gesellschaftlichen<br />
Begegnung, des kulturellen<br />
Angebots und des Gesprächs<br />
sein, dessen religiöse Ursprünge<br />
und wechselvolle Geschichte<br />
auch bei der nun säkularen<br />
Nutzung nie in Vergessenheit<br />
geraten. Sie sind vielmehr Verpflichtung<br />
und Fundament<br />
zugleich. Auch bei der Auswahl<br />
der Veranstaltungen im<br />
Kulturforum wird dieser großen<br />
Verantwortung Rechnung<br />
getragen. Verkaufs- oder etwa<br />
Parteiveranstaltungen finden<br />
im Kulturforum nicht statt. Andere<br />
Veranstaltungsformate<br />
und -inhalte sind im Allgemeinen<br />
nicht ausgeschlossen.<br />
Ab sofort können Besucher das<br />
Kulturforum Görlitzer Synagoge<br />
besichtigen und werden<br />
mit Videos und Guides (auch<br />
speziell für Kinder) barrierefrei<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
7
„Ein starkes Zeichen“<br />
Görlitzer Synagoge<br />
Die Synagoge von Görlitz nach der Restaurierung. © Pawel Sosnowski<br />
durch die Räume und die Geschichte des<br />
Hauses geführt. Das Haus ist täglich von<br />
10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Aufgrund von<br />
Veranstaltungen im Haus kann es jedoch<br />
zu verkürzten Öffnungszeitung kommen.<br />
Wir bitten Sie daher darum, sich im Vorfeld<br />
anzeige<br />
8 Geschichte
„Ein starkes Zeichen“<br />
Görlitzer Synagoge<br />
Ihres geplanten Besuches aktuell<br />
über die Öffnungszeiten<br />
des Hauses zu informieren: Tel.<br />
03581-672410, und unter:<br />
www.kulturforum-goerlitzer<br />
synagoge.de<br />
Interessante und vielfältige<br />
Veranstaltungen stehen auch<br />
schon auf dem Spielplan:<br />
Am 10. August stellt Fritz Pleitgen<br />
sein neustes Buch „Eine<br />
unmögliche Geschichte - Als<br />
Politik und Bürger Berge versetzten“<br />
vor.<br />
Ab dem 12. August ist die<br />
Wanderausstellung „Im Fluss<br />
der Zeit: jüdisches Leben an<br />
der Oder“ im Haus zu sehen.<br />
Giora Feidman & Alina Kabanova, KLEZMER & more - Konzert<br />
zum 85. Geburtstag! © Mehran Montazer<br />
Am 09. September ist der weltbekannte<br />
Klarinettist Giora<br />
Feidman zu Gast.<br />
anzeige<br />
10<br />
Geschichte
(Wieder-) Eröffnung Kulturforum Görlitzer Synagoge<br />
Görlitzer Am 19. September liest und<br />
singt Andre Herzberg, Sänger<br />
der Berliner Band „Pankow“,<br />
Lieder und Texte aus dem Roman<br />
und dem Album „Was aus<br />
uns geworden ist“, rund um<br />
die Vorführung des 45-minutigen<br />
Films „Schalom neues<br />
Deutschland“.<br />
Am 24. September tritt Bettina<br />
Wegner auf mit Karsten<br />
Troyke, obwohl es nach ihrer<br />
Abschiedstournee 2007 keine<br />
Tourneen und Solokonzerte<br />
gibt.<br />
Am 28. September liest Joachim<br />
Gauck aus seiner neuesten<br />
Veröffentlichung „Toleranz<br />
- einfach schwer“. Mehr dazu<br />
unter: www.kulturforum-goerlitzer-synagoge.de/veranstaltungen<br />
Andre Herzberg „Schalom, neues Deutschland! – Was aus uns<br />
geworden ist”. © Lutz Müller-Bohlen<br />
Quelle: Kultur Service Görlitz<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
11
Streifzüge / Wędrówki – Fotografien von Jacek Jaśko<br />
/ Wędrówki<br />
Kopaniec. Fotografie von Jacek Jaśko<br />
Das Schlesische Museum zu Görlitz hat<br />
das Museum der Fotografie in Görlitz als<br />
Präsentationsort einer faszinierenden Fotoausstellung<br />
ausgesucht: Bis zum 31. Oktober<br />
2021 ist hier die Schau „Streifzüge /<br />
Wędrówki“ zu sehen, in der Schwarz-Weiß-<br />
Aufnahmen von Jacek Jaśko präsentiert<br />
werden.<br />
Thematische Schwerpunkte bilden das Riesengebirge<br />
und das Dorf Kopaniec (Seifershau),<br />
wo der Künstler 20 Jahre lang gelebt<br />
hat und heute immer wieder zurückkehrt.<br />
Die Fotografien stammen aus drei Bilderzyklen:<br />
„Riesengebirge 20./21. Jahrhundert“,<br />
„Kopaniec 1955-2005“ und „Kopaniec. Im<br />
Gehen“. Einerseits entführen sie den Be-<br />
anzeige<br />
12<br />
Sonderausstellung
Schlesischen Museum zu Görlitz<br />
Streifzüge / Wędrówki<br />
Kopaniec. Fotografie von Jacek Jaśko<br />
trachter in eine zeitlose Landschaft der Berge,<br />
andererseits in die veränderbare Welt<br />
eines Dorfes. Für seine Aufnahmen wurde<br />
der Fotograf mehrfach auf der Biennale der<br />
Bergfotografie in Jelenia Góra (Hirschberg)<br />
ausgezeichnet.<br />
Begleitend zur Ausstellung veröffentlicht<br />
das Schlesische Museum zu Görlitz einen<br />
Katalog (72 Seiten, 8 Euro) mit Textbeiträgen<br />
vom Künstler, der Ausstellungskuratorin<br />
Romy Czimmernings und der Projektleiterin<br />
Agnieszka Bormann sowie mit einer<br />
großen Auswahl an Fotografien von Jacek<br />
Jaśko.<br />
Jacek Jaśko, geb. 1955 in Jelenia Góra<br />
(Hirschberg), verbrachte seine Kindheit<br />
anzeige<br />
Sonderausstellung<br />
13
Streifzüge / Wędrówki – Fotografien von Jacek Jaśko<br />
/ Wędrówki<br />
Schneekoppe. Fotografie von Jacek Jaśko<br />
in der Hampelbaude (poln. Schronisko<br />
Strzecha Akademicka) im Riesengebirge<br />
– eine prägende Erfahrung fürs Leben. Er<br />
war mehrere Jahre Journalist der „Gazeta<br />
Wyborcza“, „Nowiny Jeleniogórskie“ und<br />
Chefredakteur der Zeitschrift „Karkonosze“.<br />
Seine fotografische Ausbildung erhielt er<br />
an der Hochschule für Fotografie in Jelenia<br />
Góra. 20<strong>08</strong>/2009 leitete er in Kooperation<br />
mit der Stadtbibliothek „Książnica<br />
Karkonoska“ das Fotoprojekt „Jelenia Góra.<br />
Pamięć Miasta“ (Hirschberg. Gedächtnis<br />
einer Stadt). Seine Werke wurden zum Beispiel<br />
auch in Aarhus (Dänemark), Berlin,<br />
Dresden und Weißwasser gezeigt. Heute<br />
lebt Jaśko in Prag und immer wieder auch<br />
in Kopaniec.<br />
SATELLITEN – Begegnungen mit zeitgenössischer<br />
Kunst in und aus Schlesien<br />
Die Ausstellung „Streifzüge / Wędrówki“<br />
eröffnet das Projekt SATELLITEN zur Präsentation<br />
zeitgenössischer Kunst in und<br />
aus Schlesien. Es wird vom Kulturreferat<br />
für Schlesien am Schlesischen Museum zu<br />
Görlitz durchgeführt. Mit einer Reihe von<br />
geplanten Ausstellungen ermöglicht das<br />
Vorhaben eine Auseinandersetzung mit<br />
ausgewählten künstlerischen Positionen,<br />
die aktuell in Schlesien sichtbar sind.<br />
Diese Annäherung findet im zweiten Teil<br />
von SATELLITEN ihre Fortsetzung durch<br />
Exkursionen zu den Künstlerinnen und<br />
Künstlern an den Orten ihres Lebens und<br />
Schaffens. Hier steht neben der Kunst auch<br />
die Region im Fokus.<br />
14<br />
Sonderausstellung
Streifzüge / Wędrówki – Fotografien von Jacek Jaśko<br />
/ Wędrówki<br />
Ausstellungssaal im Museum der Fotografie. Foto: Jacek Jankowski<br />
Denn durch die Begegnungen mit den<br />
Kunstschaffenden in ihren Ateliers lernt<br />
man nicht nur ihre künstlerische Handschrift<br />
und konkrete Werke kennen, sondern<br />
auch ihre Lebenswirklichkeit, ihre<br />
Bezüge zu ihren Wirkungsorten, ihrer Geschichte<br />
und Gegenwart, die sie nicht selten<br />
aktiv beeinflussen und gestalten.<br />
anzeige<br />
16<br />
Sonderausstellung
Schlesischen Museum zu Görlitz<br />
Streifzüge / Wędrówki<br />
Jacek Jaśko im Gespräch. Foto: Jacek Jankowski<br />
Das Projekt „SATELLITEN – Begegnungen<br />
mit zeitgenössischer Kunst aus und in<br />
Schlesien“ wird gefördert aus Mitteln der<br />
Beauftragten der Bundesregierung für<br />
Kultur und Medien und der Stiftung für<br />
deutsch-polnische Zusammenarbeit. Weitere<br />
Informationen unter<br />
www.satelliten.eu.<br />
Präsentation im Museum der Fotografie<br />
Görlitz, Löbauer Str. 7<br />
22.07. – 31.10.2021<br />
geöffnet:<br />
Di-Do 12-16 Uhr<br />
Fr-So 12-18 Uhr<br />
anzeige<br />
Sonderausstellung<br />
17
Stadthallengarten-Görlitz-Open-Air<br />
Seit 2014 begeistern die Stadthallengarten-Open-Airs ein breites Publikum. © Wehnert<br />
Wir laden Sie ein, mit Abstand und Sicherheit,<br />
zwei großartige Konzerttage mit<br />
hochkarätiger Live-Musik in der idyllischen<br />
Kulisse des Stadthallengartens in Görlitz zu<br />
genießen. Dank eines ganzheitlichen abgestimmten<br />
Hygiene- und Sicherheitskonzeptes<br />
darf, trotz COVID-19-Pandemie, das<br />
diesjährige Stadthallengarten Görlitz Open<br />
Air am 13. und 14. August stattfinden.<br />
Den Auftakt zum diesjährigen Sommer-<br />
Open-Air-Festival wird am 13. August die<br />
Rockband „RamRoad“ aus Zittau geben.<br />
Nach diesem fulminanten Auftakt erobert<br />
die wohl bekannteste Rolling Stones Tribute<br />
Show Deutschlands, mit der Band „Starfucker“<br />
aus Berlin, die Bühne.<br />
anzeige<br />
Ausblick | Anzeige<br />
19
Stadthallengarten-Görlitz-Open-Air<br />
Bereits 2017 rockte die Rolling-Stones-Tribute-Show der Band Starfucker die Bühne. © Wehnert<br />
Die Ostrock Legende Mike Kilian und Band<br />
werden den Stadthallengarten zum Beben<br />
bringen.<br />
Seit 1998 sind die Starfucker mit über 800<br />
erfolgreichen Konzerten in Deutschland,<br />
der Schweiz, Österreich und Belgien die<br />
meist gebuchteste Rolling Stones Tributeband<br />
Deutschlands und gehören zweifelsohne<br />
zu den Hochkarätern der deutschen<br />
Rocklandschaft, mit langjähriger Bühnenund<br />
Tourneerfahrung in ganz Europa.<br />
Sie teilten sich bereits die Bühne mit Eric<br />
Clapton, Tom Jones, Robin Gibb, Bryan<br />
Adams, Jennifer Rush, Sweet, Slade, Mar-<br />
anzeige<br />
20<br />
Ausblick | Anzeige
ein Musikspektakel für jedes Alter an zwei Tagen im August<br />
Stadthallengarten<br />
malade, Equals und vielen anderen. Bei<br />
Konzerten von Starfucker spürt das Publikum<br />
den Geist von Jagger, Richards und<br />
Co. hautnah. Mit den großen Hits wie Angie,<br />
Ruby Tuesday, Paint it Black, Satisfaction<br />
und vielen mehr.<br />
Dabei lässt die Band kaum Wünsche offen,<br />
um das Herz jedes Stones-Fan‘s höher<br />
schlagen zu lassen.<br />
Der charismatische Frontmann Mike Kilian<br />
(Ex-Rockhaus) ist selten um einen frechen<br />
Spruch verlegen und heizt das Publikum so<br />
an, dass die Band stets nur nach Zugaben<br />
von der Bühne gelassen wird.<br />
anzeige<br />
Ausblick | Anzeige 21
Stadthallengarten-Görlitz-Open-Air<br />
Walter Mitty Bluesband gastiert am Samstagabend, sie setzen auf einen mächtigen Sound – natürlich<br />
handgemacht.<br />
Der Höhepunkt dieses Open-Air-Festivals<br />
ist ohne jeden Zweifel die lange Bluesnacht<br />
am Sonnabend den 14. August „Chris Harp<br />
& Friends present Blues, Barbecue & Bourbon“.<br />
Mit von der Partie sind neben Chris<br />
Harp auch die Walter Mitty Bluesband und<br />
Peter (Pedda) Schmidt mit seiner Big Block<br />
Bluesband zu einer langen Nacht am Start.<br />
Für kulinarische Begeisterung wir das Team<br />
um Andreas Nixdorf vom Barbecue Görlitz<br />
mit leckeren Grillspezialitäten sorgen.<br />
Dazu dürfen sicher ein kühles Landskron-<br />
Bier vom Fass und Jack Daniel’s Whiskey<br />
-Shots nicht fehlen.<br />
anzeige<br />
22<br />
Ausblick | Anzeige
ein Musikspektakel für jedes Alter an zwei Tagen im August<br />
Stadthallengarten<br />
Big Block (Peter (Pedda) Schmidt & Adrian Dehn) ...sind die beiden Gitarristen und Sänger der Band<br />
East Blues Experience, die schon mit Größen, wie z.B. Luther Allison, Carey Bell, Jerry Donahue, John<br />
Mayall, Jethro Tull, Procol Harum oder ZZ Top weltweit unterwegs waren.<br />
Der online Festivalticketsvorverkauf hat<br />
bereits begonnen.<br />
Infos dazu bei www. incaming.de/Stadthallengarten<br />
Görlitz Open Air/Zu den Tickets.<br />
Für Sie liebe Leser, haben wir in diesem<br />
Jahr eine Treueaktion eingeführt, um auch<br />
Ihnen für die zahlreiche Unterstützungen<br />
in den vergangenen Monaten zu danken.<br />
„22 Jahre StadtBILD = 22% Rabatt für Stadthallengarten-Open-Air<br />
Festivaltickets“!<br />
Diese ermäßigten Konzertkarten können<br />
Sie ganz einfach kontaklos und personalisiert<br />
als e-Ticket im Sofortkauf erwerben!<br />
anzeige<br />
Ausblick | Anzeige<br />
23
Stadthallengarten-Görlitz-Open-Air<br />
Und so funktioniert es: einfach den untenstehenden<br />
QR-Code mit der Kamera ihres<br />
Handys scannen!<br />
Für Rückfragen diesbezüglich aber auch<br />
bei allen anderen Fragen steht das Stadt-<br />
BILD-Team Ihnen gern zur Verfügung!<br />
Tel. 03581 878787,<br />
Fax 03581 401341<br />
mail: info@incaming.de|<br />
Dann kommen Sie auf die Ticketseite des<br />
Stadthallengarten-Open-Airs bei eventbrite.de.<br />
Dann ganz oben beim „promo code“<br />
eingeben, verwenden Sie bitte das Codewort:<br />
StadtBild und dann nur noch die<br />
Tickets ordern.<br />
Mit viel Live-Musik an der frischen Luft,<br />
dem richtigen Abstand und einem ausgefeilten<br />
Hygiene- und Sicherheitskonzept<br />
– so präsentiert sich das Stadthallengarten-<br />
Open-Air in diesem denkwürdigen<br />
Jahr. Dabei dient der extra für das Open-Air<br />
hergestellte Stadthallengarten Mund- und<br />
Nasenschutz nicht nur als Eintrittsticket,<br />
sondern gern auch als Erinnerung an diese<br />
turbolente Zeit.<br />
Das umfangreiche Festivalprogramm, sowie<br />
alle hilfreichen Informationen finden<br />
Sie unter: www.incaming.de<br />
24<br />
Ausblick | Anzeige
Unkonventionell, vielfältig und verbindend<br />
Kommen Gehen<br />
Das Andromeda Mega Express Orchestra folgt der Einladung von „Kommen und Gehen” und<br />
Fokus Festival.<br />
„Kommen und Gehen“ - Das Sechsstädtebundfestival!<br />
hat sich längst in der Region<br />
etabliert und findet bereits zum vierten Mal<br />
vom 12. bis 22. August 2021 statt. Hans<br />
Narvas‘ Idee, den historischen Zusammenschluss<br />
der Städte Bautzen, Görlitz, Kamenz,<br />
Löbau, Lauban (heute Lubań in Polen) sowie<br />
Zittau mit einem breit gefächerten Festival<br />
anzeige<br />
30 Jahre<br />
Sonnen-Apotheke<br />
in Görlitz<br />
Apothekerin<br />
Monika Wendrich<br />
Gersdorfstraße 17<br />
02828 Görlitz<br />
Tel./Fax.: 03581 31 40 50<br />
Sonnen-Apotheke<br />
Ihr kompetenter Gesundheitspartner<br />
in Görlitz-Königshufen seit 1991.<br />
26<br />
Ausblick | Anzeige
4. Sechsstädtebundfestival feiert 675. Jubiläum und<br />
Kommen 1700 Jahre jüdisches Leben und in der Oberlausitz Gehen<br />
von Popkultur bis klassischer Musik und<br />
zahlreichen Kooperationen in der Region<br />
neu zu beleben, ist aufgegangen. Der Sechsstädtebund<br />
jährt sich zum 675. Mal und wird<br />
am Gründungstag, dem 21. August, mit einem<br />
bunten „Geburtstagsjahrmarkt“ in Löbau<br />
gefeiert.<br />
Eröffnet wird das Festival am 12. August im<br />
Klosterhof Zittau mit dem Duo OMG Schubert.<br />
Das viel gelobte Programm „WTF 1700“<br />
entstand im Beethovenjahr 2020 und erkundet<br />
neue Wege für die traditionsreiche Gattung<br />
Lied. Konstantin Dupelius und Justus<br />
Wilcken stellen sich die Frage, wie ein nie<br />
stattgefundener Briefwechsel zwischen Ludwig<br />
van Beethoven und Friedrich Hölderlin<br />
geklungen haben könnte. Neben klassisch<br />
konzipierten Konzerten stehen dieses Jahr<br />
Projekt-Workshops, Musikalische Gesprächssalons<br />
und ein Symposium über das Verhältnis<br />
Deutsche und Sorben an Spielstätten<br />
wie dem kürzlich eröffneten Kulturforum<br />
Görlitzer Synagoge, im Klosterhof Zittau,<br />
in der Haftanstalt Bautzen, in malerischen<br />
Schlössern und stolzen Trutzburgen auf<br />
dem Programm. Die Schlosskonzerte am<br />
8. und 22. August sowie 12. September – veranstaltet<br />
in Kooperation mit dem Via Regia<br />
Begegnungsraum Landesverband Sachsen<br />
e.V. die Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund<br />
gGmbH. Sie setzen idyllisch gelegene<br />
Schlösser und die Burg Czocha in<br />
Polen mit Kammermusikprogrammen zwischen<br />
Klassik und ‚minimal music‘ musikalisch<br />
in Szene. Höhepunkt des Festivals wird<br />
der erstmals stattfindende Städtebundtag<br />
am 21. August in Löbau sein: „Wir laden die<br />
Bürger:innen der Region und Entdeckungsfreudige<br />
aus allen Himmelsrichtungen zu<br />
einem ‚Geburtstagsjahrmarkt‘ in die Gründungsstadt<br />
des Städtebundes ein: Auf der<br />
Festwiese erwartet Sie ein vielfältiges Angebot<br />
von Kulturakteuren aus der Region. Die<br />
Bühne gehört Ensembles aus den Städten<br />
des Bundes und Gästen von außerhalb, wir<br />
freuen uns unter anderem auf die polnische<br />
Band ‘Echo Bukowiny‘, das Streichquartett<br />
‘Continuo’ aus Wrocław und das Projekt (L)<br />
OST POETS der bekannten Spoken Word-<br />
Künstlerin Jessy James LaFleur.“ – „Ich kann<br />
mir nicht vorstellen, dass sich am 21. August<br />
jemand in Löbau langweilt!“ schiebt Hans<br />
Narva hinterher.<br />
anzeige<br />
Ausblick | Anzeige 27
Unkonventionell, vielfältig und verbindend<br />
Kommen Gehen<br />
Impressionen „Kommen und Gehen”. © Veronica Lagos Hidalgo<br />
Einen ganz eigenen Schwerpunkt setzt dieses<br />
Jahr die Veranstaltungsreihe „Oberlausitzer<br />
Perspektiven, auf 1700 Jahre jüdisches<br />
Leben in Deutschland“. Der „Kommen und<br />
Gehen“-Verein hat anlässlich des Festjahrs,<br />
das der ersten urkundlichen Erwähnung<br />
einer jüdischen Gemeinde im heutigen<br />
deutschsprachigen Raum im Jahr 321 n. Chr.<br />
in Köln mit einem bundesweiten Programm<br />
Rechnung trägt, Kooperationspartner:innen<br />
aus der Region eingeladen. In Konzerten,<br />
Spaziergängen und Führungen, Workshops,<br />
Lesungen und Theaterstücken werden vom<br />
1. August bis 21. November 2021 viele Facetten<br />
einer Kulturgeschichte sichtbar und<br />
hörbar gemacht, die im Alltag oft übersehen<br />
werden. Schauplätze der Reihe sind u.a. der<br />
Klosterhof in Zittau, die Neue ebenso wie die<br />
Alte Synagoge in Görlitz, das Schloss Gröditz<br />
und die Wissenschaftliche Bibliothek.<br />
„675 Jahre Sechsstädtebund und 1700 Jahre<br />
Jüdisches Leben in Deutschland – diesen<br />
beiden Themen als Veranstalter gerecht zu<br />
werden, das ist schon eine Herausforderung,“<br />
sagt Hans Narva wenige Wochen vor<br />
dem Start der beiden Reihen. „Das wunderbare<br />
Engagement unserer Kooperationspartner,<br />
die Bereitschaft der Künstler:innen<br />
auch zu kleinen Wagnissen und ganz neuen<br />
Konzertkonzepten – und natürlich auch<br />
die finanzielle Unterstützung von mehr als<br />
15 Förderern der öffentlichen und privaten<br />
Hand ermöglichen uns aber, wieder ganz<br />
viel Live-Kultur in die Oberlausitz zu bringen.“<br />
Das Engagement von Hans Narva und<br />
dem Verein „Kommen und Gehen“ - Das<br />
Sechsstädtebundfestival! wird auch über die<br />
Grenzen der Oberlausitz hinaus gewürdigt:<br />
Dr. Thomas Feist, Beauftragter der Sächsischen<br />
Staatsregierung für das Jüdische<br />
Leben, übernahm die Schirmherrschaft für<br />
die „Oberlausitzer Perspektiven“ und Barbara<br />
Klepsch zollte dem umfangreichen Programm<br />
durch die Erneuerung ihrer Schirmherrschaft<br />
als Sächsische Staatsministerin<br />
für Kultur und Tourismus Anerkennung: „Für<br />
viele Menschen waren die langanhaltenden<br />
Einschränkungen und der Verzicht auf<br />
28<br />
Ausblick | Anzeige
Unkonventionell, vielfältig und verbindend<br />
Kommen Gehen<br />
Konstantin Dupelius und Benedikt ter Braak im Schloss Königshain. © Veronica Lagos Hidalgo<br />
das Live-Erleben von Kunst, Kultur und Musik<br />
ein großer und nachhaltiger Einschnitt.<br />
Und deshalb soll es auch und besonders in<br />
diesem Jahr für das Publikum wieder Begegnungen<br />
geben: Musik, Erlebnisse, Gemeinsamkeiten<br />
und Unterschiede in der<br />
kulturell und landschaftlich reichen Region<br />
der Oberlausitz, mit denen Brücken zwischen<br />
Menschen, Generationen, Ländern<br />
und Kulturen geschlagen werden können.“<br />
anzeige<br />
30<br />
Ausblick | Anzeige
4. Sechsstädtebundfestival feiert 675. Jubiläum und<br />
Kommen 1700 Jahre jüdisches Leben und in der Oberlausitz Gehen<br />
Corona-konformes Konzert in Schloss Königshain. © Veronica Lagos Hidalgo<br />
Im Programm des Sechsstädtebundfestivals<br />
und der „Oberlausitzer Perspektiven“ finden<br />
sich dazu vielzählige Gelegenheiten ab August<br />
2021.<br />
Das ausführliche Programm der beiden Projekte,<br />
Informationen zu den Künstler:innen<br />
und Veranstaltungsorten finden sich unter<br />
kommenundgehen.org. und<br />
oberlausitzerperspektiven.org.<br />
anzeige<br />
Ausblick | Anzeige<br />
31
Weltklasse-Stars der Klassik kommen in die Oberlausitz<br />
Kammermusikfest<br />
Renommierte Künstler musizieren in sechs<br />
Schlössern der Region: Das Kammermusikfest<br />
findet 2021 erstmals in der gesamten<br />
Oberlausitz statt.<br />
Sachsens jüngstes Klassikfestival, das Kammermusikfest<br />
Oberlausitz, wird nach seiner<br />
erfolgreichen Premiere im Jahr 2020<br />
vom 10. bis 17. September 2021 eine zweite<br />
Auflage erleben. Über 30 internationale<br />
Klassikstars werden in 7 Konzerten in<br />
6 verschiedenen Schlössern und Kirchen<br />
der Landkreise Bautzen und Görlitz auftreten.<br />
Dazu kommen Manufakturführungen<br />
durch das Bechstein-Werk in Seifhennersdorf<br />
und eine hochkarätig besetzte kulturpolitische<br />
Podiumsdiskussion.<br />
Zum Stelldichein der Künstlerstars gehören<br />
u. a. der weltberühmte Bratschist Nils<br />
Mönkemeyer, der Konzertmeister des Hessischen<br />
Rundfunkorchesters Florin Iliescu,<br />
das international gefeierte Klavierduo<br />
Ariane Haering & Ardita Statovci, der aus<br />
Ebersbach-Neugersdorf stammende Organist<br />
Prof. Lucas Pohle, ein Vokalensemble<br />
mit ehemaligen Mitgliedern des Dresdner<br />
Kreuzchores sowie die beiden renommierten<br />
Kammerorchester Thüringer Bach Collegium<br />
und l’arte del mondo.<br />
„Das Festivalmotto „Begegnungen“ steht<br />
für musikalische Entdeckungsreisen mit<br />
seltener aufgeführten Kompositionen,<br />
musiziert von außergewöhnlichen Künstlern<br />
in ganz unterschiedlichen Ensembles“,<br />
sagt Festivalintendant Dr. Hagen W. Lippe-<br />
Weißenfeld.<br />
Festspielorte sind die kulturhistorischen<br />
„Perlen der Oberlausitz“, u. a. die Schlösser<br />
Milkel (Gemeinde Radibor), Gröditz<br />
(Stadt Weißenberg), Kuppritz (Gemeinde<br />
Hochkirch) und Königshain (Gemeinde<br />
Königshain), das Barockschloss Oberlichtenau<br />
(Stadt Pulsnitz), das Zinzendorf-<br />
Schloss Berthelsdorf (Stadt Herrnhut) sowie<br />
die Ev.-luth. Kirche Baruth (Gemeinde<br />
Malschwitz). Darüber hinaus öffnet die berühmte<br />
sächsische Klavier- und Flügelmanufaktur<br />
C. Bechstein (Gemeinde Seifhennersdorf)<br />
ihre Tore für zwei Führungen.<br />
Das Kammermusikfest Oberlausitz wird<br />
durch Kooperationen mit dem internationalen<br />
Kammermusik-Festival Krzyzowa-<br />
Music (Kreisau/Polen), dem Kommen und<br />
anzeige<br />
32<br />
Ausblick
Kammermusikfest Oberlausitz – Sachsens jüngstes Klassikfestival<br />
Konzertmeister des Hessischen Rundfunkorchesters Florin Iliescu. Foto: © Agatha Kronberg<br />
Gehen – Sechsstädtebundfestival, dem<br />
Sächsischen Musikrat, dem Sorbischen<br />
National-Ensemble und der Carl Bechstein<br />
Stiftung musikalisch bereichert.<br />
Das Eröffnungskonzert am Freitag, dem<br />
10. September 2021, um 19.00 Uhr wird<br />
das renommierte Kammerorchester Thüringer<br />
Bach Collegium gemeinsam mit<br />
dem Konzertmeister des Hessischen Rundfunkorchesters,<br />
dem rumänischen Geiger<br />
Florin Iliescu sowie dem ehemaligen Leipziger<br />
Nikolaikantor Prof. Lucas Pohle (Orgel)<br />
in der Ev.-luth. Kirche Baruth gestalten.<br />
Am Samstag, dem 11. September, um<br />
19.00 Uhr werden Streichquartette der<br />
Staatskapelle Weimar und des Sorbischen<br />
National-Ensembles Delikatessen klassi-<br />
Ausblick<br />
33
Weltklasse-Stars der Klassik kommen in die Oberlausitz<br />
Kammermusikfest<br />
scher und sorbischer Kammermusik-Literatur<br />
auf Schloss Milkel darbieten. Dort<br />
wird auch noch einmal der Geiger Florin<br />
Iliescu, Konzertmeister des Hessischen<br />
Rundfunkorchesters, solistisch zu hören<br />
sein.<br />
Das international bekannte Klavier-Duo<br />
„ariadita“ mit der schweizerischen Pianistin<br />
Ariane Haering und der kosovarisch-österreichischen<br />
Pianistin Ardita Statovci wird<br />
am 12. September um 17.00 Uhr in der<br />
Kulturscheune des Zinzendorf-Schlosses<br />
Berthelsdorf an zwei großen Bechstein-<br />
Konzertflügeln auftreten.<br />
Für Montag, den 13. September, sind um<br />
11.00 Uhr zwei Führungen durch die berühmte<br />
Klavier- und Flügelmanufaktur<br />
C. Bechstein in Seifhennersdorf geplant.<br />
Ein Highlight wird das Konzert eines Vokalensembles,<br />
u.a. mit ehemaligen Mitgliedern<br />
des Dresdner Kreuzchores am Montag,<br />
dem 13. September um 19.00 Uhr in der<br />
Musikakademie Schloss Kuppritz. Deren Eigentümer<br />
Sebastian Flämig war einst selbst<br />
Kruzianer.<br />
Am Dienstag, dem 14. September, um<br />
19.00 Uhr wird das Barockschloss Königshain<br />
Schauplatz einer hochkarätig besetzten<br />
kulturpolitischen Podiumsdiskussion<br />
zur Frage „Quo vadis Kultur in der Oberlausitz?“.<br />
Mit dabei sind Barbara Klepsch<br />
(Sächsische Staatsministerin für Kultur<br />
und Tourismus), Elisabeth Motschmann<br />
(MdB, Kulturpolitische Sprecherin der<br />
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag),<br />
Dr. Claudia Maicher (MdL, Vorsitzende<br />
des Kulturausschusses im Sächsischen<br />
Landtag), Joachim Mühle (Kultursekretär<br />
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien),<br />
Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld (Vorstand<br />
Kulturpolitische Gesellschaft) und MDR<br />
KULTUR-Moderatorin Heike Schwarzer.<br />
Das Preisträgerkonzert am Mittwoch, dem<br />
15. September, um 19.00 Uhr richtet sich<br />
insbesondere an interessierte junge Nachwuchsmusiker:<br />
Sächsische Bundespreisträger<br />
des Wettbewerbs „Jugend musiziert“<br />
werden gemeinsam mit den Stipendiatinnen<br />
der renommierten Carl Bechstein Stiftung,<br />
Adele-Marie Schäfer und Wilhelmine<br />
Freytag, im Barockschloss Oberlichtenau<br />
zu erleben sein.<br />
Am Donnerstag, dem 16. September, findet<br />
im Schloss Gröditz ein Sonderkonzert<br />
anzeige<br />
34<br />
Ausblick
Kammermusikfest Oberlausitz – Sachsens jüngstes Klassikfestival<br />
Zu den Akteuren gehört auch der aus der Region stammende Nikolaikantor Lucas Pohle.<br />
Foto: © Gert Mothers<br />
als Beitrag zum deutsch-jüdischen Festjahr<br />
„1.700 Jahre jüdisches Leben in der<br />
Oberlausitz“ statt, in dessen Rahmen es<br />
um 18.00 Uhr ein Gespräch mit Musikern<br />
von Krzyzwa-Music und ab 19.00 Uhr ein<br />
anschließendes Kammerkonzert u. a. mit<br />
dem Klavierquintett des aus Polen stammenden,<br />
jüdischen Komponisten Mieczy-<br />
anzeige<br />
Ausblick<br />
35
Weltklasse-Stars der Klassik kommen in die Oberlausitz<br />
Kammermusikfest<br />
Der international bekannte Bratschist Nils Mönkemeyer ist 2021 beim Kammermusikfest Oberlausitz zu<br />
Gast. Foto: © Irène Zandel<br />
slaw Weinberg geben wird.<br />
Zum krönenden Festivalabschluss wird am<br />
Freitag, dem 17. September, um 19.00 Uhr<br />
der international gefeierte Bratschist Nils<br />
Mönkemeyer mit dem Kammerorchester<br />
l’arte del mondo in der Ev.-luth. Kirche Baruth<br />
auftreten.<br />
anzeige<br />
36<br />
Ausblick
Kammermusikfest Oberlausitz – Sachsens jüngstes Klassikfestival<br />
Für Festival-Intendant Dr. Hagen W. Lippe-<br />
Weißenfeld ergänzen sich beim Kammermusikfest<br />
Oberlausitz die Schätze aus Kultur<br />
und Tourismus auf ideale Weise: „Der<br />
kulturelle und kulturhistorische Reichtum<br />
des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien<br />
manifestiert sich unter anderem in<br />
der Vielzahl und Qualität der herausragend<br />
schönen Schlösser und Kirchen, von<br />
denen wir einen Teil mit unserem Festival<br />
zum Klingen bringen dürfen. Diese Symbiose<br />
aus Musik, architektonischer und<br />
landschaftlicher Schönheit macht das<br />
Kammermusikfest Oberlausitz in der geographischen<br />
Mitte Europas unverwechselbar<br />
und einmalig!“<br />
Wie wichtig die große Gemeinschaft der<br />
Festivalunterstützer mit über 100 ehrenamtlichen<br />
Helfern, rund 40 prominenten<br />
Botschaftern aus Sachsen und ganz<br />
Deutschland - mit Ministerpräsident Michael<br />
Kretschmer an der Spitze - und der<br />
frühen Zusage zahlreicher internationaler<br />
Künstlerstars ist, zeigt auch die prominente<br />
Schirmherrschaft: „Es ist ein großartiges<br />
Zeichen der Einigkeit, dass das Land und<br />
beide Landkreise bei der Unterstützung<br />
dieses Festivals Hand in Hand gehen und<br />
gemeinsam den Kulturraum Oberlausitz-<br />
Niederschlesien kulturell weiterentwickeln<br />
und dadurch auch zur Erhaltung wichtiger<br />
Kulturstätten beitragen. Ich danke<br />
Kulturministerin Barbara Klepsch und den<br />
Landräten Michael Harig (Bautzen) und<br />
Bernd Lange (Görlitz) für die Übernahme<br />
der Schirmherrschaft, die Ausdruck großer<br />
Wertschätzung für dieses große bürgerschaftliche<br />
Kulturprojekt auf dem Land ist“,<br />
äußerte sich Intendant Hagen Lippe-Weißenfeld,<br />
dessen Familiengeschichte eng<br />
mit beiden Landkreisen und der Herrnhuter<br />
Brüdergemeine verbunden ist, und<br />
ergänzt: „Das große Besucherinteresse im<br />
letzten Jahr - über 650 Besucher, die teils<br />
aus ganz Deutschland angereist waren,<br />
strömten zu 6 umjubelten Konzerten-,<br />
zeigt, welche Anziehungskraft die Oberlausitz<br />
als geschichtsträchtiger Kulturraum<br />
besitzt. Dieses Festival lebt von seiner familiären,<br />
bodenständigen, heiteren Atmosphäre<br />
und ist beste touristische Werbung<br />
für die Landkreise Bautzen und Görlitz.“<br />
www.kammermusikfest-oberlausitz.de<br />
Den Festivalbesuchern stehen vier Preiskategorien zur Auswahl. Das Standard-Einzelticket für alle Konzerte<br />
kostet 15,- EUR (ermäßigt 12,- EUR). Als besonderes „Bonbon“ bieten die Veranstalter ein Festivalticket<br />
für alle 7 Konzerte für 90,- EUR (ermäßigt 72,- EUR) an, bei dessen Erwerb dem Käufer ein Konzertticket<br />
geschenkt wird („6 + 1“).<br />
Preisstufe 1: Einzelticket 15,- EUR (zzgl. 1,50 EUR VVK-Gebühr)<br />
Preisstufe 2: Einzelticket ermäßigt* 12,- EUR (zzgl. 1,20 EUR VVK-Gebühr)<br />
Preisstufe 3: Festivalticket (6 + 1) 90,- EUR (zzgl. 5,00 EUR VVK-Gebühr)<br />
Preisstufe 4: Festivalticket (6 + 1) erm.* 72,- EUR (zzgl. 5,00 EUR VVK-Gebühr)<br />
(*Ermäßigung gilt für: Jugendliche bis 18 Jahre, Rentner, Studenten, Auszubildende, ALG II–Empfänger, Arbeitslose, FSJ,<br />
Inhaber Behindertenausweis, Zivildienstleistende, Bundeswehrangehörige usw.)<br />
Tickets können in den DDV-Lokalen der Sächsischen Zeitung oder im Online-Ticketshop unter<br />
www.kammermusikfest-oberlausitz.de erworben werden.<br />
Ausblick<br />
37
3. bis 5. September die 28. Turisedischen Festspiele der Neuzeit<br />
FOLKLORUM<br />
Als einziges Festival weit und breit ohne Corona-Unterbrechung<br />
findet es wie immer<br />
am ersten Septemberwochenende statt!<br />
Der Wald unweit des östlichsten Dorfes von<br />
Deutschland wird an diesem Wochenende<br />
für tausende Liebhaber von Folk- und Weltmusikfans<br />
zum Nabel der Welt.<br />
Das wohl schönste Festivalgelände<br />
Deutschlands westlich, östlich und in der<br />
Mitte vom Grenzfluss Neiße, ist dann noch<br />
viel bunter als es ohnehin im Alltag als<br />
„grüngeringelter Abenteuerpark“ schon ist.<br />
Neben einer gewohnt extrem vielseitigen<br />
Musikmischung auf 15 Bühnen, wird gespielt<br />
und mitgesungen, getanzt, gehandelt<br />
und die vielen Leckereien werden ausprobiert.<br />
Ganz so wie es das Volk der alten<br />
Turiseder vor mehr als 1.000 Jahren hier tat.<br />
Turisedes. So wurde auch die alte Tradition<br />
wiederbelebt, dass sich jeder um die Würde<br />
eines „Ehrenturiseders“ bewerben kann.<br />
Das setzt allerdings die erfolgreiche Bewältigung<br />
einer Menge ausgefallenster Wettkämpfe<br />
voraus. Zum eigenen Spaß und zur<br />
Belustigung der Zuschauer jeden Alters…<br />
Die Nacht wird zum Tag gemacht, es wird in<br />
großen Kannibalenkesseln gebadet, und ab<br />
Mitternacht darf der reich gefüllte Schatzacker<br />
durchwühlt werden.<br />
Apropos Nachtaktivitäten: Wer nachweisen<br />
kann, dass sein Kind zum Folklorum gezeugt<br />
wurde, erhält für seinen Sprössling<br />
eine lebenslang gültige Freikarte!<br />
Preise und Einzelheiten zum Programm<br />
verdichten sich nach und nach unter<br />
www.turisede.com<br />
Die Gastgeber vom Verein „Kulturinsel<br />
Einsiedel“, bis die „Geheime Welt von Turisede“<br />
wie auch die hinter allem stehende<br />
Firma „Künstlerische Holzgestaltung Bergmann<br />
GmbH“, verstehen sich als die Erben<br />
Und wer zu den Sparfüchsen gehört, der<br />
sollte seine Karten schnell noch selbst an<br />
der Parkkasse erwerben. Bis zum 15. August<br />
winkt dort noch ein Selbstabholbonus von<br />
20 Prozent!<br />
38<br />
Ausblick | Anzeige
Buntes Völkerspektakel in der Oberlausitz<br />
Völkerspektakel<br />
Schon knapp zwei Wochen vorher warf<br />
das große bevorstehende Spektakel seine<br />
Schatten in den Zittauer Tageszeitungen<br />
voraus. „Buffalo Bill’s Wild West […] die<br />
grösste und lehrreichste Schaustellung<br />
der Welt. Vereinigung der verwegensten<br />
Reiter aller Nationen. […] Einzige und konkurrenzlose<br />
Vorstellung der eingeborenen<br />
Reiter Europas, Asiens, Afrikas u. Amerikas;<br />
aus den Gebirgen des Kaukasus, den Steppen<br />
Russlands, den Wüsten Afrikas, den<br />
Kordilleren Mexikos, den Anden und den<br />
Felsengebirgen Amerikas. […] Das grossartige<br />
Wild-West und Wild-Ost vereinigt.“,<br />
hieß es in einer halbseitigen Anzeige in<br />
den „Zittauer Nachrichten“ erstmals am<br />
4. August 1906. Und weiter: „Zittau, nur einen<br />
Tag! Mittwoch den 15. August: Schützenplatz.“<br />
Wer war nun dieser Buffalo Bill und was war<br />
seine Wild-West-Show?<br />
Der Mann der sich Buffalo Bill nannte, hieß<br />
eigentlich William Frederick Cody und wurde<br />
am 26. Februar 1846 in der Nähe von Le<br />
Claire (Iowa/ USA) geboren. Aufgewachsen<br />
ist er dann in der Umgebung von Fort Leavenworth<br />
(Kansas). Der Goldrausch führte<br />
ihn als junger Mann nach Colorado. Danach<br />
war er Kurier-Reiter beim legendären<br />
Pony-Express und später Kundschafter im<br />
amerikanischen Bürgerkrieg. Den Namen<br />
Buffalo Bill „verdiente“ er sich als Büffeljäger.<br />
Im Jahr 1872 gründete er die Wild-<br />
West-Show, mit der er zunächst erfolgreich<br />
durch die USA und dann durch die ganze<br />
Welt tourte. Cody starb am 10. Januar 1917<br />
in Denver (Colorado).<br />
In Deutschland gastierte „Buffalo Bill’s Wild<br />
West“ zweimal. Die zweite Tournee führte<br />
1906 durch 45 Städte in Deutschland und<br />
Österreich-Ungarn. Auf dieser Tour kamen<br />
Buffalo Bill und seine Mitstreiter auch in die<br />
Oberlausitz.<br />
Die Ankunft des großen Eisenbahntrosses<br />
von „Buffalo Bill’s Wild West“ wurde in den<br />
„Zittauer Nachrichten“ vorab genau angekündigt.<br />
Die drei Sonderzüge trafen aus<br />
Reichenberg (Liberec) kommend am Vorabend<br />
des Veranstaltungstages auf dem<br />
Zittauer Bahnhof ein. Für jeden der Züge<br />
wurde die Anzahl der Achsen der Waggons<br />
anzeige<br />
40<br />
WEINKEHR<br />
Öffnungszeiten:<br />
Mittwoch - Freitag ab 15.00 Uhr<br />
Samstag ab 18.00 Uhr<br />
im Sommer ab 17.00 Uhr<br />
Inh. Gabriele Lode<br />
Johannisstraße 15<br />
02763 Zittau<br />
Genießen Sie bei uns ausgewählte Weine im<br />
historischen Ambiente und entspannen Sie im<br />
romantischen Garten der Weinkehr in Zittau.<br />
Dem Weinliebhaber stehen über 50 verschiedene<br />
Weinspezialitäten zur Auswahl. Passend dazu<br />
bieten wir leichte mediterrane Gerichte an. Gern<br />
erfüllen wir Ihre speziellen Wünsche für Familienund<br />
Betriebsfeiern sowie Weinproben.<br />
www.weinkehr.de<br />
Geschichte
„Buffalo Bill’s Wild West“<br />
Buntes gastierte vor 115 Völkerspektakel<br />
Jahren in Zittau und Bautzen<br />
und das Gewicht in Zentnern angegeben.<br />
Umgerechnet belief sich die Gesamtmasse<br />
auf 1.102 t. Ausführlich wurde die Eisenbahntechnik<br />
beschrieben. Ebenfalls wurde<br />
erwähnt, dass die Züge nicht schneller als<br />
30 km/h fahren durften.<br />
Das Ausladen der Züge und die Transporte<br />
zur Schießwiese begannen am Veranstaltungstag<br />
4 Uhr morgens. Der Aufbau der<br />
Zelte und der Zuschauertribünen für bis<br />
zu 12.000 Mann erfolgten in relativ kurzer<br />
Zeit, denn schon 14 Uhr begann die erste<br />
Veranstaltung. Die zweite Veranstaltung<br />
fand 20 Uhr statt.<br />
„Wahre Menschenströme“ hatten sich laut<br />
der „Zittauer Morgen-Zeitung“ vor den Veranstaltungen<br />
durch die Stadt gewälzt „und<br />
die elektrische Straßenbahn hatte zeitweise<br />
nicht Wagen genug, um all diejenigen<br />
zu fassen, die nicht eilig genug zur Schießwiese<br />
gelangen konnten“.<br />
Die etwa 9-10.000 Besucher bei jeder der<br />
beiden Veranstaltungen hier erlebten eine<br />
rund anderthalbstündige Show ohne Pause.<br />
Die „Zittauer Nachrichten“ berichteten<br />
geradezu euphorisch: „Ein so buntes Völkergemisch<br />
und dito Sprachengewirr hat<br />
unsere altehrwürdige Schießwiese, die<br />
während der Schützenfeste schon manch<br />
liebes mal ein kosmopolitisches Gepräge<br />
zeigte, wohl noch nie gesehen und gehört,<br />
als gestern, da Buffalo Bills Reiterscharen<br />
auf ihr in weiter Arena sich produzierten.<br />
[…] Und nun zur Vorstellung, wenn man so<br />
sagen darf. Eigentlich ist dieser Ausdruck<br />
nicht richtig. Das, was zur Aufführung gelangt,<br />
hat mit einer gewöhnlichen Zirkus-<br />
Vorstellung nichts gemein. Es sind ganz<br />
eigenartige Bilder, die sich dem überraschten<br />
Auge des Zuschauers zeigen, Bilder voll<br />
Geschichte<br />
41
Buntes Völkerspektakel in der Oberlausitz<br />
Völkerspektakel<br />
wilder Schönheit und natürlichem Reiz,<br />
nicht abgeschwächt durch künstlichen<br />
Drill, durch die einengende Manege. […]<br />
Den Anfang machte eine Revue der ganzen<br />
Reiterschar unter Führung Buffalo Bills,<br />
der vom Publikum lebhaft begrüßt wurde.<br />
Er ist eine interessante Erscheinung, mit<br />
grauem Knebelbart und wallendem Kopfhaar.<br />
[…] Das meiste Interesse erweckten<br />
natürlich die Indianer, die aufregende Akte<br />
aus dem Prärieleben, mit dem Reiz der<br />
Lederstrumpf-Romantik inszenierten. […]<br />
Den Indianern folgten Cowboys mit breiten<br />
Hüten und flatternden Blusen, Kosaken<br />
mit Pelzmützen und langen Röcken, englische<br />
und amerikanische Kavallerie, Artillerie<br />
mit zwei Geschützen, Araber, Japaner<br />
und auch einige Mädchen, die mit ihren<br />
Pferden wie verwachsen erschienen.“<br />
Am Schluss bekamen Buffalo Bill und seine<br />
Mitstreiter von den Besuchern in Zittau<br />
sehr viel Beifall. Beide Veranstaltungen waren<br />
äußerst gut besucht. Zahlreiche Schaulustige<br />
beobachteten nach der zweiten<br />
Veranstaltung dann auch noch den Abbau<br />
der Zeltstadt und der Manege, sowie den<br />
Transport zum Zittauer Bahnhof.<br />
Von dort aus reiste „Buffalo Bill’s Wild West“<br />
noch am Abend nach Bautzen, wo am folgenden<br />
Tag ebenfalls zwei Veranstaltungen<br />
stattfanden.<br />
Heutzutage sind Veranstaltungen wie „Buffalo<br />
Bill’s Wild West“ oder die früher ebenso<br />
erfolgreichen Völkerschauen undenkbar.<br />
Im Sommer 1906 jedenfalls war Buffalo<br />
Bill’s Wild in Zittau und Bautzen ein Erlebnis<br />
für die zahlreichen Besucher.<br />
Uwe Kahl, Zittau<br />
42<br />
Geschichte
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955<br />
Berzdorf<br />
Abb.: 1 + 2 März 1946, Zufahrt zum künftigen Grubengelände von Tauchritz aus.<br />
Nach Beendigung des 2. Weltkrieges und<br />
der Zerschlagung des Faschismus fehlte es<br />
der Bevölkerung nicht nur an Nahrungsmitteln,<br />
sondern auch an Brennstoffen für den<br />
Hausbedarf und für die im Wiederaufbau<br />
befindliche Industrie.<br />
Bereits am 9. August 1945 beauftragte die<br />
Stadt Görlitz den Ingenieur Ignatz Willim,<br />
sich über die Verhältnisse des stillgelegten<br />
Tagebaues zu informieren, um die große<br />
Brennstoffnot zu lindern. Die Verwaltung<br />
des Bundeslandes Sachsen traf unter<br />
gleichzeitiger Gestellung finanzieller Mittel<br />
(3 Millionen RM) eine Anordnung über die<br />
Bildung eines Zweckverbandes zur Bearbeitung<br />
des Braunkohlentagebaues Berzdorf,<br />
Lausitz. Das Kernstück der Anordnung hat<br />
folgenden Wortlaut:<br />
….„Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,<br />
dem Stadtbezirk und dem Landkreis Görlitz<br />
sowie dem Landkreis Löbau Arbeitsmög-<br />
Wir haben ganzjährig täglich<br />
von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet<br />
auch an Sonn -und Feiertagen.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
www.schmetterlingshaus.info<br />
Rufen Sie uns an:<br />
035844 76420<br />
Schmetterlinge, Reptilien,<br />
Seewasseraquarium,<br />
Cafeteria, Souvenirshop,<br />
Kinderspielecke<br />
43
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955<br />
Berzdorf<br />
Abb.: 3 Baracke für die Trafostation<br />
Abb.: 4 Aufbau der 1. Pumpstation<br />
lichkeiten und eine Verbesserung der dringend<br />
notwendigen Kohleversorgung zu sichern,<br />
werden die Stadt Görlitz, der Landkreis Görlitz,<br />
der Landkreis Löbau sowie die Aktiengesellschaft<br />
Sächsischer Werke Dresden hinsichtlich<br />
ihres Tagebaues und Braunkohlevorkommens<br />
in Berzdorf zu einem Zweckverband zusammengeschlossen.“<br />
Am 18. März 1946 waren die Vorbereitungen<br />
soweit abgeschlossen, dass die ersten<br />
15 Arbeiter unter der Anleitung der Bergbau<br />
erprobten Firma Lindebauer mit den<br />
„Aufschlussarbeiten“ beginnen konnte.<br />
Ende März waren bei der Fa. Lindemann bereits<br />
80 Beschäftigte angestellt. Der Zweckverband<br />
Görlitz / Löbau wurde am 5.4.1946<br />
gegründet.<br />
Die ersten Arbeiten konzentrierten sich<br />
auf das Abpumpen der ca. 800 000 m³<br />
Wasser aus dem 1927 gefluteten Tagebau.<br />
Das Herstellen eines Planums für Errich-<br />
anzeige<br />
44<br />
Geschichte
Der schwere Neubeginn 1946<br />
Tagebau Berzdorf<br />
tung einer Baracke für den Transformator.<br />
(Abb.: 3) war eine der ersten Aufgaben. Über<br />
die besonderen Schwierigkeiten aus den<br />
Tagen im März 1946 berichten Zeitzeugen<br />
unter Punkt 4. Der Aufbau der 1. Pumpstation<br />
und die fortlaufenden Umbauten entsprechend<br />
Sümpfungsstand waren eine<br />
ständige Materialfrage und eine körperliche<br />
Herausforderung. Die Errichtung der Wasserhaltung<br />
erfolgte an der Nordostecke des<br />
Tagebaurandes auf der Höhe + 201,85 m<br />
NN. Der 1. Pumpe ging am 11.4.1946 in Betrieb.<br />
Die 2. Pumpe folgte am 16.4.1946 und<br />
bereits am 22.4.1946 betrug die Absenkung<br />
des Wasserspiegels 4,20 m.<br />
Am 23.6.1946 konnten die Sümpfarbeiten<br />
beendet werden. Danach erfolgte die Weiterführung<br />
der Wasserhaltung für die Hebung<br />
von Druck- und Oberflächenwasser<br />
von der Fördersohle aus. Ein besonderes<br />
Ereignis war das Auftauchen eines Kohlerückens,<br />
der in den Apriltagen aus dem Wasser<br />
sichtbar wurde. Die wichtigsten Vorbereitungsarbeiten<br />
konnten nach nur 3 Monaten<br />
so weit abgeschlossen werden, dass bereits<br />
am 27. Juni 1946 die Kohle-förderung beginnen<br />
konnte. Der Verkauf erfolgte nach<br />
Abb.: 5 Pumpstation im Mai 1946. Motor arbeitet<br />
mit einer Spannung von 5000 V.<br />
Hektoliter, infolge Fehlens von Waagen. Bei<br />
allen Fahrzeugen musste der Rauminhalt<br />
ausgemessen werden.<br />
Der erste bergmännische Kohleabbau galt<br />
vor allen Dingen den freiliegenden Kohlen<br />
der ehemaligen Grube „Hoffnung Gottes“.<br />
Der Abbau erfolgte im „Handschurrenbetrieb“.<br />
Die Kohlen wurden von einem Häuer<br />
mittels Haue an einer Kohleflanke gelöst<br />
und über eine „Schurre“ in 0,5 m³ Handkip-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
45
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955<br />
Berzdorf<br />
Abb.: 6 Pumpstation Mai 1946. Über drei Rohrleitungen<br />
wird das Wasser abgeleitet.<br />
per abgezogen. Per Handkraft brachte der<br />
„Schlepper“ die Handkipper bzw. „Hunte“<br />
bis zur Haspelstation.<br />
Das z. T. noch vorhandene Schienennetz<br />
wurde von 500 mm- auf 600 mm-Spurweite<br />
umgerüstet und erneuert. Über die sogenannte<br />
„Osthaspel“ (Abb.: 8) wurden gleichzeitig<br />
mehrere gefüllte Muldenkipper zur<br />
Rasensohle hochgezogen. Da die „Schiefe<br />
Ebene“ mit 2 parallelen Gleisen ausgerüstet<br />
Abb.: 7 Sümpfung im Wesentlichen abgeschlossen.<br />
Im Hintergrund ist der Kohlerücken zu<br />
erkennen, an dem die Kohleförderung aufgenommen<br />
werden konnte.<br />
war, konnte die Kraft der nach unten fahrenden<br />
leeren Muldenkipper effektiv genutzt<br />
werden. Die „Kopfstation“ auf der Rasensohle<br />
lag ca. 300 m westlich des „Hochbunkers“,<br />
der als „Wahrzeichen“ noch heute weithin<br />
sichtbar ist. Von der „Kopfstation“ der Haspel<br />
wurde die Kohle von den Muldenkippern<br />
in (3,5) m³ Holzkipper 900 mm Spur umgeladen<br />
und diese durch die Dampflok Nr 10,<br />
anzeige<br />
46<br />
Geschichte
Der schwere Neubeginn 1946<br />
Tagebau Berzdorf<br />
eine Ohrenstein, zum Hochbunker transportiert.<br />
Aufgrund der fehlenden Transportkapazität<br />
war ein Direktversturz von der<br />
Kopfstation auch in Pferdefuhrwerke, die<br />
Haupttransportmittel der Nachkriegszeit,<br />
möglich. Bis Ende 1946 musste diese Transportmöglichkeit<br />
auch für die Zuführung<br />
der Rohbraunkohle zur „Ziegelei“ genutzt<br />
werden. In der alten Ziegelei wurden ab<br />
Juli 1946 „Nasspresssteine“ oder Berzdorfer<br />
„Batzen“ produziert. Die in „Ziegelformen“<br />
nass gepresste Klarkohle stellte zwar eine<br />
große Hilfe für viele Haushalte und die Kleinbetriebe<br />
dar, war aber absolut kein Ersatz<br />
für Briketts, denn oft zerfielen sie schon auf<br />
dem Weg zu den Verbrennungsanlagen. Im<br />
August 1946 wurden bereits 167.120 Stück<br />
Naßpreßsteine hergestellt, wobei der Kreis<br />
Löbau 79.200 Stück und der Kreis Görlitz<br />
48.000 Stück erhielten.<br />
Im Monat August 1946 wurden 2027 t Rohkohle<br />
gefördert. Am 31. August waren beim<br />
Aufbau der Grube 542 Personen beschäftigt,<br />
davon 32 beim Zweckverband. Am<br />
1. September 1946 wurden fast alle der am<br />
Werk Beschäftigten in den Zweckverband<br />
übernommen.<br />
Abb.: 8 Gleise der Osthaspelanlage zum Hochbunker<br />
Der „Zweckverband“ wurde im April 1946<br />
gebildet und stellte quasi die Vorstufe eines<br />
„Volkseigenen Betriebes“ dar. Die Kohlegewinnung,<br />
der Transport und Verkauf sowie<br />
die „Batzen“- Produktion und die umfangreichen<br />
Entwässerungsarbeiten wurden<br />
vom „Zweckverband“ organisiert und überwacht.<br />
Unter der Leitung des „Zweckverbandes“<br />
wurden für die Erledigung weiterer<br />
bergmännischer und betriebstechnischer<br />
Arbeiten und Teilaufgaben Handwerker<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
47
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955<br />
Berzdorf<br />
und „Fremdfirmen“ einbezogen.<br />
Die ersten Betriebsräte wurden bereits im<br />
April 1946 gewählt. Der Dreischichtbetrieb<br />
wurde ab dem 18.11.1946 eingeführt. Auszüge<br />
aus einem Protokoll<br />
„Aufgabe der Nachtschicht sind die Vorbereitungsarbeiten<br />
für den nächsten Tag (Ausfahren<br />
von Ton- und Schlammadern, anfallende<br />
Kohle auf Vorrat kippen, Umbauten der Gleisanlage).<br />
Zur Durchführung der Nachtschicht<br />
ist es erforderlich, von der Fa. Lindebauer 22<br />
Mann in den Zweckverband zu übernehmen.“<br />
Eine wesentliche Verbesserung des Kohleabsatzes<br />
in den ostsächsischen Raum, bis<br />
hin nach Dresden, trat mit der Fertigstellung<br />
und Inbetriebnahme des Anschlussbahngleises<br />
am 24.10.1946 zum Bahnhof<br />
Hagenwerder ein. Die von der „Haspel“ zum<br />
„Hochbunker“ transportierte Kohle konnte<br />
mittels Förderbänder in Reichsbahn-Wagen<br />
verladen werden. Diese Verladearbeiten<br />
mussten teilweise auch von Hand erfolgen.<br />
Besondere Bedeutung bei dem Wiederaufschluss<br />
hatten dabei die Firmen Lindebauer<br />
und Holzmann, da beide auf eine lange<br />
Abb.: 9 Blick in den Tagebau im 1. Halbjahr 1946,<br />
links Wasserhaltung, rechts Beginn der Haspelanlage,<br />
Vordergrund Abbauort am ehemaligen<br />
Kohlerücken.<br />
Bergbautradition, schon im „Vorkriegs-<br />
Deutschland“ zurückblicken konnten. Der<br />
Firma Holzmann wurde u. a. der Aufbau<br />
und die Organisation des Abraumbetriebes<br />
übertragen, eine äußerst komplizierte Aufgabe,<br />
da weder Gewinnungsgeräte noch<br />
Loks und Abraumwagen vorhanden waren.<br />
Diese mussten unter großen Mühen aus anderen<br />
stillgelegten Tagebauen umgesetzt<br />
anzeige<br />
48<br />
Geschichte
Der schwere Neubeginn 1946<br />
Tagebau Berzdorf<br />
werden. Die Notwendigkeit des Aufbaus<br />
eines wirksamen Abraumbetriebes war besonders<br />
für die Sicherung der gewinnbaren<br />
Kohle im Grubenbetrieb erforderlich,<br />
zumal die Bestände aus dem „Altbergbau“<br />
zur Neige gingen und die Kohleförderung<br />
aufgrund des hohen Bedarfs an Rohbraunkohle<br />
und „Naßpreßsteinen“ ständig stieg.<br />
Eine weitere Maßnahme zur Sicherung der<br />
Kohleförderung war die Einführung des<br />
3-Schicht-Betriebes im Grubenbetrieb und<br />
den angeschlossenen Abteilungen ab dem<br />
18. November 1946. Der Abraumbetrieb<br />
begann im 2. Halbjahr 1946 mit den ersten<br />
2 Dampflöffelbaggern auf Raupen (0,75<br />
m³ und 1,5 m³ Löffelinhalt) und Dampfloks<br />
(160-220 PS) sowie 5,3 m³ Eisenkastenkippern.<br />
Erster Einsatzbereich der Löffelbagger<br />
war im Deckgebirge westlich des alten<br />
Tagebaues. Für den Transport der Abraummassen<br />
und innerbetriebliche Transportaufgaben<br />
wurde ein 900-mm-Gleisnetz eingerichtet.<br />
Die gewonnenen Abraummassen<br />
wurden zur Herstellung eines Verbindungsdammes<br />
zwischen dem Hochbunker zur<br />
„Wache West“ und weiter bis zur „Ziegelei“<br />
genutzt.<br />
Nach Inbetriebnahme der Pließnitzbrücke<br />
konnte die gleistechnisch erforderliche<br />
Verbindung zwischen dem Hochbunker<br />
und der „Ziegelei“ errichtet werden. Der<br />
aufwendige Transport der Kohle mit Pferdefuhrwerken<br />
entfiel, und zum anderen<br />
konnte die Gleisanlage zum Auffahren und<br />
Betreiben der sogenannten „Bruchkippen“<br />
südlich des ehemaligen Ortsteiles „Neuberzdorf“<br />
genutzt werden.<br />
Für die mittelfristige Kippenentwicklung,<br />
zur Abnahme der Abraummassen, wurden<br />
im Bereich der Tauchritzer Teiche die ersten<br />
3 Trocken- bzw. Handkippen eingerichtet.<br />
Die Verkippungsarbeiten gestalteten sich<br />
sehr kompliziert, da direkt in den morastigen<br />
Untergrund verstürzt werden musste. Zum<br />
anderen stand nur ein Anhängepflug zum<br />
Abziehen der zu verkippenden Abraummassen<br />
zur Verfügung.<br />
Für das Jahr 1946 ist eine Kohleförderung<br />
von Hand mit 14607 t überliefert. Die Abraumbewegung<br />
erreichte nur 6000 m³. Im<br />
November 1946 wurden über den Bahnversand<br />
1018 t Kohle und im Dezember 1275 t<br />
Kohle zum Absatz gebracht. Im November<br />
1946 wurden insgesamt 3400 t gefördert.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
49
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955<br />
Berzdorf<br />
Abb.: 10 Dampflöffelbagger der Fa. Holzmann<br />
Abschrift aus Broschüre: „IM WANDEL DER<br />
ZEIT“ ZUR GESCHICHTE DES BKW BERZ-<br />
DORF a. d. EIGEN<br />
„Das Jahr 1946 geht zu Ende. Monate<br />
schwerer Arbeit liegen hinter uns. Als wir am<br />
18. März 1946 mit nur 15 Mann das schwere<br />
Werk begannen, hatten wir alle den festen<br />
Willen in, uns alles daranzusetzen, unserem<br />
Volke zu helfen, und wenn wir schon im Juni<br />
mit der Förderung beginnen konnten, dann<br />
ist es im wahrsten Sinne des Wortes nur unserer<br />
Hände Arbeit zu verdanken, denn maschinelle<br />
Hilfe stand uns so gut wie keine zur<br />
Verfügung. Wenn wir heute am Jahresende<br />
bei 310 Mann Belegschaft auf eine Förderzahl<br />
von über 3400 Tonnen im November zurückblicken<br />
können, dann dürfen wir darauf<br />
bestimmt stolz sein. Wir wollen und müssen<br />
aber auch im kommenden Jahr alles daransetzen,<br />
um die an uns gestellten Aufgaben zu<br />
erfüllen, um so unseren Teil zum Aufbau eines<br />
neuen, demokratischen Deutschland beizutragen.<br />
Nach alter Bergmannsart beginnen<br />
wir das neue Jahr mit einem ‚Glückauf für<br />
1947“.<br />
Für den Gesamtbetriebsrat: SCHMIDT - Tost“<br />
Auszug aus dem Jahresbericht des Zweckverbandes<br />
Görlitz – Löbau für 1946 beinhaltet<br />
u.a. folgendes:<br />
„Dem Aufbau des Werkes aus dem Nichts<br />
stellten sich erhebliche Schwierigkeiten entgegen.<br />
Nur dadurch, daß von allen Seiten<br />
der Werkverwaltung weitgehende Hilfe zuteil<br />
wurde, insbesondere durch die Direktion der<br />
Brennstoffindustrie, der sowjetischen Kom-<br />
anzeige<br />
50<br />
Geschichte
Der schwere Neubeginn 1946<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Abb.: 11 Die erste Werkstattbesatzung am Kran.<br />
mandantur, der ASW und der Stadt Görlitz,<br />
war es möglich, die Arbeiten auf den jetzigen<br />
Stand zu bringen. Zu den zeitbedingten<br />
Hemmungen trat die Ungunst der Witterung.<br />
Die Frostperiode brachte die Bauarbeiten<br />
lange Zeit zum Stillstand. Der Bodenfrost<br />
von anderthalb Meter Tiefe verhinderte die<br />
Inganghaltung der Bagger. Das Hochwasser<br />
bei Eintritt des Tauwetters unterbrach den<br />
Landabsatz, da die Zufahrtsstraße gesperrt<br />
wurde. Durch Ausfallen der eingesetzten Omnibusse<br />
fielen mehrfach die Schichten der Arbeiter,<br />
die von weither transportiert werden<br />
mußten, aus. Durch das Ausbleiben der Brikettversorgung<br />
traten Unterbrechungen im<br />
Abraum- und Baggerbetrieb ein.<br />
Die Wiedereröffnung des Tagebaues Berzdorf<br />
sollte nach der Satzung des Zweckverbandes<br />
zwei Aufgaben erfüllen: Die Schaffung<br />
zusätzlicher Arbeitsplätze und die Behebung<br />
großer Kohlennot der umliegenden Städte<br />
und Dörfer. Die erste Aufgabe ist erfüllt. Zur<br />
Bekämpfung der Kohlennot hat die Arbeit<br />
des ersten Betriebsjahres naturgemäß nur im<br />
bescheidenen Maße beitragen können. Die<br />
Grundlage dafür, daß in Zukunft ständig eine<br />
steigende Förderung wirksame Hilfe bringen<br />
wird, ist jedoch geschaffen.“<br />
Joachim Neumann und Klaus Krische<br />
Aus: Berzdorfer Hefte<br />
Die technologische Entwicklung<br />
Tagebau Berzdorf<br />
1946-1955.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
51
Zwei mittelalterliche Heilverträge aus dem Ratsarchiv Görlitz<br />
Ratsarchiv Görlitz<br />
Im Ratsarchiv Görlitz finden sich in den<br />
Stadtbüchern, den sog. „Libri actorum“, in<br />
die Verträge jeder Art eingetragen wurden,<br />
zwei Vereinbahrungen zwischen einem<br />
Arzt und Patienten. Dies sind zwei<br />
außergewöhnliche Dokumente, wie sie<br />
uns sonst kaum für das Mittelalter überliefert<br />
sind. An ihnen kann man unter anderem<br />
sehen, dass auch im Mittelalter die<br />
Beziehungen zwischen Ärzten und Patienten<br />
nicht nur rein medizinischer, sondern<br />
immer auch geschäftlicher Natur waren.<br />
Nur wer mit barem Geld bezahlen konnte,<br />
wurde behandelt. Es gab jedoch Fälle, in<br />
denen die Stadtkasse beispielsweise die<br />
Behandlung von Brandverletzten nach einem<br />
größeren Brand übernahm.<br />
Das erste hier abgedruckte Dokument aus<br />
den „Libri actorum“ zeigt uns, wer in erster<br />
Linie zu medizinischen Behandlungen<br />
aufgesucht wurde – nämlich die Betreiber<br />
von Badehäusern, die sog. Bader oder<br />
Barbiere. Das zweite Beispiel belegt, dass<br />
man sich gegen eventuelle Misserfolge<br />
des Arztes abzusichern versuchte und bei<br />
Misslingen der ersten Behandlung eine<br />
zweite kostenlose vertraglich vereinbarte.<br />
Die Texte werden zuerst im original Wortlaut<br />
wiedergegeben und danach in einer<br />
sinngemäßen Übertragung.<br />
Hans Schubert aus Kießlingswalde und<br />
Hans Ochsener verpflichten sich gegenüber<br />
dem Bader Nicze, ihm alles zurückzuerstatten,<br />
was sie verzehrt haben oder er<br />
ihnen geliehen hatte, als sie krank (wund)<br />
bei ihm lagen. Das Geld wollen sie ihm bis<br />
zum Bartholomäustag (24. August) zurückzahlen.<br />
Dieser Vertrag wurde öffentlich<br />
vor den Schöppen niedergeschrieben<br />
und ist somit rechtsgültig.<br />
2) Anno 1412: „Schonberg der arczt resignavit<br />
Nicze, Lindeners son, von Mengelstorff<br />
eyn beyn zcuheilen; heilt er im<br />
des beynes nicht, so sal man im des 8 ½ fl.<br />
nicht gebin, vnd breche im das beyn wedir<br />
off im jare, dovor sal im der arzt wandel<br />
thun, vnd sals im heilen ab das not wurde<br />
in den selbin jare.“<br />
Der Arzt Schönberg verpflichtet sich gegenüber<br />
dem Nicze, des Lindeners Sohn,<br />
aus Mengelsdorf, ein Bein zu heilen. Gelingt<br />
es dem Arzt nicht das Bein zu heilen,<br />
so soll er auch nicht die vereinbarten 8 ½<br />
Gulden bekommen. Wenn das geheilte<br />
Bein aber innerhalb eines Jahres erneut<br />
aufbricht, soll der Arzt es abermals behandeln,<br />
und zwar noch innerhalb des selben<br />
Jahres.<br />
Christian Speer<br />
1) Anno 1409: „Hans Schuwert von Kezelingswalde<br />
und Hans Ochsener resignaverunt<br />
Nicze bader, was sy verczeren adir er in<br />
gelegen, dy weile sy wunt zcu im legin, das<br />
sy im das gelden wellen termino Bartholomei.<br />
Tamquam peractus coram scabini.“<br />
52<br />
Geschichte
Die historischen Apfelsorten der Oberlausitz –<br />
In diesem Beitrag werden Namen von<br />
historischen Apfelsorten des 19. Jahrhunderts<br />
aus der Oberlausitz aufgeführt,<br />
denen ihre pomologisch gebräuchlichen<br />
Bezeichnungen zugeordnet wurden. Von<br />
diesen unterschiedlichen Sorten sind<br />
heute noch 114 Sorten vorhanden, 66<br />
davon unter einem anderen Namen. 46<br />
Sorten gelten als verschollen, das sind<br />
29 Prozent. Die noch vorhandenen 114<br />
historischen Apfelsorten werden bis auf<br />
vier Sorten in den Sammlungen der Oberlausitz-Stiftung<br />
in Ostritz erhalten. Diese<br />
Stiftung bemüht sich derzeit darum, auch<br />
die noch fehlenden Sorten in Ostritz anzupflanzen.<br />
Zudem wurde begonnen,<br />
diese historischen Sorten an weiteren<br />
Standorten in Sachsen anzupflanzen, um<br />
damit zur dauerhaften Existenz dieser<br />
Sorten beizutragen.<br />
Im Jahre 2006 wurde in Ostritz (Sachsen)<br />
die Oberlausitz-Stiftung errichtet. Ein<br />
zentrales Ziel der Stiftung ist der Erhalt<br />
historischer Obstsorten der Oberlausitz.<br />
Gleich zu Beginn der Arbeit der Stiftung<br />
stellte sich dabei die Frage, welche Obstsorten<br />
denn früher in der Oberlausitz<br />
verbreitet waren. In diesem Zusammenhang<br />
ist zunächst einmal festzustellen,<br />
dass in der Oberlausitz zu unterschiedlichen<br />
Zeiten unterschiedliche Obstsorten<br />
angebaut wurden. So waren im frühen<br />
19. Jahrhundert andere Sorten vorherrschend<br />
als später im 20. oder 21. Jahrhundert.<br />
Dies lässt sich gut anhand der<br />
Baumschulkataloge aus der Oberlausitz<br />
und den dort aufgeführten Obstsortimentslisten<br />
verfolgen. Dabei vollzog sich<br />
der Wandel der zur jeweiligen Zeit bevorzugten<br />
Obstsorten nicht abrupt, sondern<br />
allmählich. Nur wenige Apfelsorten wie<br />
z. B. Danziger Kantapfel, Gravensteiner,<br />
Rheinischer Bohnapfel und Goldparmäne<br />
finden sich durchgehend im 19. und 20.<br />
Jahrhundert in den Baumschulkatalogen.<br />
Apfelsorten der Oberlausitz zu Beginn<br />
des 19. Jahrhunderts<br />
Eine Grundlage für diejenigen Apfelsorten,<br />
die zu Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
in der Oberlausitz verbreitet waren, war<br />
hierfür das „Das Obstbüchlein. Ein Le-<br />
anzeige<br />
54<br />
Geschichte
Eine Spurensuche<br />
Apfelsorten<br />
sebuch für die deutschen Bürger- und<br />
Landschulen“, das der „Verein zur Beförderung<br />
des Obstbaues in der Oberlausitz“<br />
mit Sitz in Zittau im Jahr 1840 herausbrachte<br />
(Abb.: 1). Diese Schrift erschien<br />
in zwei Auflagen mit mehr als 10.000 (!)<br />
Exemplaren (Verein zur Beförderung des<br />
Obstbaues in der Oberlausitz 1844). Unter<br />
anderem wurden hier 109 Apfelsorten<br />
kurz beschrieben und zum Anbau in der<br />
Oberlausitz empfohlen. Man kann davon<br />
ausgehen, dass dieser Empfehlung viele<br />
Oberlausitzer gefolgt sind.<br />
Eine weitere Grundlage für die Suche<br />
nach den historischen Apfelsorten der<br />
Oberlausitz war eine Zusammenstellung<br />
der 54 Apfelsorten, die vom gleichen Verein<br />
von den Oberlausitzer Chausseen zu<br />
einer Ausstellung 1834 eingesandt wurden<br />
(Verein 1835). Einige dieser Sorten<br />
wurden später auch im oben genannten<br />
„Obstbüchlein“ aufgeführt.<br />
Die meisten der in den beiden genannten<br />
Sortenzusammenstellungen des „Vereins<br />
zur Beförderung des Obstbaus in der<br />
Oberlausitz“ genannten Apfelsorten haben<br />
Namen, die nicht den heute pomolo-<br />
Abb.: 1 Titelseite der ersten Auflage des „Obstbüchleins“.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
55
Die historischen Apfelsorten der Oberlausitz –<br />
gisch gebräuchlichen Sortenbezeichnungen<br />
entsprechen. Zudem sind bei älteren<br />
Sorten oft zahlreiche Synonyme bekannt.<br />
Daher bestand die zentrale Aufgabe bei<br />
der Suche nach den historischen Apfelsorten<br />
aus den genannten Auflistungen<br />
in deren genauer Identifizierung durch<br />
Vergleiche mit historischer und zeitgenössischer<br />
Literatur, wobei insbesondere<br />
Synonymverzeichnisse gesichtet wurden.<br />
Wichtige Hilfsmittel hierbei waren<br />
die Veröffentlichungen von Rolff (2002),<br />
Votteler (1993, 1996), Smith (1971) und<br />
Mathieu (1889) sowie das Illustrirte Handbuch<br />
der Obstkunde (Lucas & Oberdieck<br />
1875). Zudem wurden die in der „Deutschen<br />
Genbank Obst“ (www.deutschegenbankobst.de)<br />
genannten Sortenbezeichnungen<br />
berücksichtigt.<br />
Verschollene historische Apfelsorten<br />
der Oberlausitz<br />
Folgende Apfelsorten, die zu Beginn des<br />
19. Jahrhunderts zum Anbau in der Oberlausitz<br />
empfohlen wurden, gelten somit<br />
als verschollen: Aerndteapfel, Alebacher<br />
Riesenapfel, Anhänger, Bieberischer<br />
Weinapfel, Brauner Sommer-Käsapfel,<br />
Dachapfel, Deutscher Glasapfel, Frühe<br />
rothgefleckte Marktreinette, Gelbe Erfurter<br />
Herbstreinette, (Gelbe) Erfurter<br />
Sommerreinette, Gelbe Reinette, Gelber<br />
Pallasapfel, Gelber Wettich, Gestreifter<br />
Schwanapfel, Goldmohr, Grüner fruchtbarer<br />
Calville, Grüner Winter-Atlasapfel,<br />
Herbstglockenapfel, Juliusapfel, Kleiner<br />
Mauerapfel, Kleiner Mutterapfel, Königlicher<br />
Streifling, Kräuterreinette, Langdauernder<br />
rother Hartapfel, Lange rotgestreifte<br />
grüne Renette, Langscheider,<br />
Mönchsapfel, Mönchsferse, Münchhausens<br />
Glockenapfel, Paarling, Papageiapfel,<br />
Polnischer weißer Pauliner, Rheinischer<br />
Naberling, Rötliche Reinette, Roter Polsterapfel,<br />
Roter Winterrambur, Säuerlicher<br />
Köberling, Safranreinette, Scheuernapfel,<br />
Schöner von Oybin, Schwarzer englischer<br />
Gulderling, Superintendentenapfel,<br />
Waitzapfel, Weiße Wachsreinette, Winter<br />
Karthäuser, Winterquittenapfel.<br />
anzeige<br />
56<br />
Geschichte
Eine Spurensuche<br />
Apfelsorten<br />
Apfelsorten der Oberlausitz seit Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts<br />
Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt,<br />
wurden in der Oberlausitz zu unterschiedlichen<br />
Zeiten unterschiedliche<br />
Obstsorten angebaut. So wären ähnliche<br />
Übersichten wie im 2. Abschnitt für den<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts nun über die<br />
in den Jahrzehnten ab Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
angebauten Apfelsorten zu erstellen.<br />
Dies bleibt jedoch weiterführenden<br />
Arbeiten vorbehalten. Im Folgenden<br />
werden lediglich einige Sorten benannt,<br />
die aus der Oberlausitz stammen:<br />
1. Bischofshut<br />
(Abb.: 2) O. Erwähnt wurde die Sorte bereits<br />
im Jahr 1899 in der Zeitschrift „Gartenflora“.<br />
2. Lausitzer Nelkenapfel<br />
O. Erstmals beschrieben wurde diese Sorte<br />
als „Görlitzer Nelkenapfel“ 1875.<br />
3. Oberlausitzer Muskatrenette<br />
(Abb.: 3) O. Die Sorte wurde um 1880 bei<br />
Großschönau in der Oberlausitz gefunden.<br />
4. Schöner aus Herrnhut<br />
O. Der aus dem Ort „Herrnhut“ in der<br />
Oberlausitz stammende Apfel wurde um<br />
das Jahr 1880 von A. Heintze gefunden.<br />
5. Schöner von Oybin<br />
V. Die Sorte stammte aus Oybin bei Zittau<br />
und wurde erwähnt in einem Katalog der<br />
Baum schule Neumann (Wendisch-Paulsdorf,<br />
Sachsen) aus den 1930er Jahren.<br />
6. Sohlander Streifling<br />
(Abb.: 4) O. Die Sorte stammt aus Sohland<br />
am Rotstein (Oberlausitz). Erwähnt wurde<br />
diese Sorte erstmals 1886 in der „Zeitschrift<br />
für Obst- und Gartenbau“.<br />
Die in der Sammlung historischer Apfelsorten<br />
der Oberlausitz-Stiftung in Ostritz<br />
derzeit vorhandenen Sorten sind mit „O“<br />
gekennzeichnet (Stand: Juli 2019). Bei den<br />
anderen heute noch vorhandenen Sorten<br />
wird jeweils der Ort angegeben, an dem<br />
sie erhalten werden. Die verschollenen<br />
Sorten werden mit „V“ gekennzeichnet.<br />
Geschichte<br />
57
Die historischen Apfelsorten der Oberlausitz –<br />
Abb.: 2´Bischofshut´<br />
Abb.: 3´Oberlausitzer Muskatrenette´<br />
Aktuelle Bestandssituation<br />
Von den 160 historischen Apfelsorten der<br />
Oberlausitz sind heute noch 114 Sorten<br />
vorhanden, 66 davon unter einem anderen<br />
Namen. 46 Sorten gelten als verschollen,<br />
das sind 28,75 Prozent der aufgeführten<br />
historischen Apfelsorten der<br />
Oberlausitz. Trotz mehr als zwölfjähriger<br />
Suche unter Mithilfe von Baumschulen,<br />
Natur- und Umweltschutzgruppen sowie<br />
mehrerer Pomologen ist es nicht gelungen,<br />
diese 46 Sorten zu finden. Man<br />
kann davon ausgehen, dass einige der<br />
verschollenen Sorten noch unerkannt in<br />
der Landschaft der Oberlausitz oder in<br />
58<br />
Geschichte
Eine Spurensuche<br />
Apfelsorten<br />
Abb.: 4 ´Sohlander Streifling´<br />
Gärten vorhanden sind, möglicherweise<br />
auch unter einem anderen Namen. Sachsenweit<br />
gibt es jedoch nur noch vier oder<br />
fünf Personen, die in der Lage sind, historische<br />
Apfelsorten zu bestimmen. Daher<br />
sind vermutlich so gut wie alle dieser 46<br />
Sorten für immer verschwunden.<br />
Zahlreiche lokale und regionale Erhebungen<br />
belegen einen Rückgang der Streuobstwiesen<br />
in Deutschland und Mitteleuropa<br />
zwischen 1965 und 2010 um 70–75<br />
Prozent. Dies gilt sowohl für die Fläche<br />
als auch für die Anzahl der Obstbäume.<br />
Diese Zahlen dürften in etwa auch auf<br />
die Streuobstwiesen der Oberlausitz zutreffen.<br />
Die verbliebenen Bestände sind<br />
in Teilen lückig und vergreist, da bestehende<br />
Bestände immer seltener gepflegt<br />
werden. Diese Bestände werden in der<br />
Regel von etwa 20 verschiedene Apfels-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
59
Die historischen Apfelsorten der Oberlausitz –<br />
Abb.: 5 Obstsortengarten der Oberlausitz-Stiftung in Ostritz, Ortsteil Leuba<br />
orten aus den Sortimenten des 20. Jahrhundert<br />
dominiert. Hierzu gehören unter<br />
anderem folgende Sorten: Schöner aus<br />
Herrnhut, Lausitzer Nelkenapfel, Kaiser<br />
Wilhelm, Schöner aus Boskoop, Danziger<br />
Kantapfel und Landsberger Renet-<br />
anzeige<br />
Liebe Gäste, die Vierradenmühle hat<br />
für Sie wieder geöffnet und freuen uns<br />
auf Ihre Reservierungen!<br />
Mittwoch-Montag von 11.00-22:00 Uhr.<br />
Hotherstraße 20-21 | 02826 Görlitz<br />
Telefon: 03581 8787344<br />
vierradenmuehle@gmail.com<br />
60<br />
Geschichte
Eine Spurensuche<br />
Apfelsorten<br />
te. Auch in den Hausgärten werden nur<br />
noch vereinzelt historische Apfelsorten<br />
angepflanzt.<br />
Der allergrößte Teil der anderen historischen<br />
Apfelsorten der Oberlausitz ist nur<br />
noch in wenigen Exemplaren in Sachsen<br />
vorhanden. Diese Sorten werden insbesondere<br />
in den Sammlungen des Julius-<br />
Kühn-Instituts (Dresden), der Baumschule<br />
Schwartz (Löbau), der Sächsischen Landesstiftung<br />
Natur und Umwelt (Dresden)<br />
und der Oberlausitz-Stiftung (Ostritz) erhalten.<br />
Die Oberlausitz-Stiftung hat in den vergangenen<br />
Jahren 110 der derzeit vorhandenen<br />
114 historischen Apfelsorten<br />
der Oberlausitz in Ostritz (Abb.: 5) angepflanzt.<br />
Die noch fehlenden vier historischen<br />
Apfelsorten werden 2019 und 2020<br />
noch ergänzt. Zudem ist die Oberlausitz-<br />
Stiftung seit dem Jahr 2016 zusammen<br />
mit der Sächsischen Landesstiftung Natur<br />
und Umwelt (Dresden) dabei, die historischen<br />
Obstsorten Sachsens an verschiedenen<br />
Standorten in Sachsen in Form<br />
von hochstämmigen Bäumen zu pflanzen<br />
und damit langfristig zu erhalten.<br />
Dr. Michael Schlitt<br />
Impressum:<br />
Herausgeber (V.i.S.d.P.):<br />
StadtBILD-Verlag<br />
eine Unternehmung der<br />
incaming media GmbH<br />
vertreten durch den Geschäftsführer<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Mitglied im Deutschen Fachjournalistenverband<br />
Carl-von-Ossietzky-Straße 45 | 02826 Görlitz<br />
Tel. 03581 87 87 87 | Fax: 03581 40 13 41<br />
E-Mail: info@stadtbild-verlag.de<br />
Shop: www.stadtbild-verlag.de<br />
Bankverbindung:<br />
IBAN: DE21 8504 0000 0302 1979 00<br />
BIC: COBADEFFXXX<br />
Geschäftszeiten:<br />
Mo. - Fr. von 9.00 bis 16.00 Uhr<br />
Druck:<br />
Graphische Werkstätten Zittau GmbH<br />
Erscheinungsweise: monatlich<br />
Redaktion & Inserate:<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Kathrin Drochmann<br />
Dipl. - Ing. Eberhard Oertel<br />
Bertram Oertel<br />
Layout:<br />
Kathrin Drochmann<br />
Lektorat:<br />
Wolfgang Reuter, Berlin<br />
Teile der Auflage werden kostenlos verteilt, um<br />
eine größere Verbreitungsdichte zu gewährleisten.<br />
Für eingesandte Texte & Fotos übernimmt der Herausgeber<br />
keine Haftung. Artikel, die namentlich<br />
gekennzeichnet sind, spiegeln nicht die Auffassung<br />
des Herausgebers wider. Anzeigen und redaktionelle<br />
Texte können nur nach schriftlicher Genehmigung<br />
des Herausgebers verwendet werden.<br />
Redaktionsschluss:<br />
Für die nächste Ausgabe (September)<br />
ist am 20.<strong>08</strong>.2021<br />
Geschichte<br />
61
Überbrückungshilfe geht in die vierte Verlängerung<br />
ETL-Steuerberatung<br />
62<br />
Corona-Hilfen auch für Zeiträume ab 1. Juli 2021 – Überbrückungshilfe III Plus<br />
Auch wenn sich das Leben langsam normalisiert und zahlreiche Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden,<br />
haben viele Unternehmen mit den Folgen der Schließungen zu kämpfen. Die Corona-Krise hat überall ihre Spuren<br />
hinterlassen. Den Unternehmen fehlt es an Liquidität und oft, vor allem bei kleinen Unternehmen, ist auch das<br />
Eigenkapital verbraucht.<br />
Das zeigt auch eine Sonderauswertung des DIHK unter https://go.nwb.de/4gtgo.<br />
Bereits Anfang Juni hat die Bundesregierung daher eine Verlängerung der Corona-Hilfen angekündigt. Mit der<br />
Überbrückungshilfe III Plus für die Fördermonate Juli bis September 2021 geht die Überbrückungshilfe bereits in<br />
die vierte Verlängerung. Mehr Unterstützung gibt es auch bei den Personalkosten: Mit der Restart-Prämie können<br />
die Unternehmen einen höheren Personalkostenzuschuss erhalten als bei den bisherigen Überbrückungshilfen.<br />
Auch Soloselbständige werden bis Ende September 2021 unterstützt. Die Neustarthilfe wird als Neustarthilfe Plus<br />
weitergeführt.<br />
Überbrückungshilfe III Plus weitgehend wie Überbrückungshilfe III ausgestaltet<br />
Die Überbrückungshilfe III Plus ist nicht nur inhaltlich weitgehend deckungsgleich zur Überbrückungshilfe III ausgestaltet.<br />
Auch die Voraussetzungen und der Verfahrensablauf sind identisch. Dies gilt insbesondere für das dreistufige<br />
Antragsverfahren (1. Antragsberechtigung prüfen, 2. Antrag (Prognose), 3. Schlussabrechnung/Nachweis<br />
der tatsächlichen Umsätze und Fixkosten), für die zwingende Beantragung der Überbrückungshilfe durch einen<br />
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt in einem vollständig digitalisierten<br />
Verfahren sowie für die Bescheidung und Auszahlung über die Bewilligungsstellen der einzelnen Bundesländer.<br />
Antragsberechtigt sind Unternehmer, die in einem Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im<br />
Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben. Es werden Zuschüsse zu den Fixkosten gezahlt, monatlich<br />
maximal in Höhe von 10 Millionen Euro (bisher 1,5 Million Euro). Abhängig von der Höhe des Umsatzeinbruchs<br />
im jeweiligen Fördermonat (Juli 2021 bis September 2021) in Bezug zum Vergleichsmonat des Jahres 2019 wird ein<br />
Anteil der Fixkosten erstattet:<br />
Umsatzeinbruch<br />
Erstattung Fixkosten<br />
> 70 % 100 %<br />
zwischen 50 % und 70 % 60 %<br />
mindestens 30 % und unter 50 % 40 %<br />
Bei Umsatzeinbrüchen von mehr als 50 % werden wie bei der Überbrückungshilfe III weitere Zuschläge in Form<br />
von Eigenkapitalzuschüssen gezahlt. Für besonders betroffene Branchen wie die Reisewirtschaft, Veranstaltungsbranche<br />
sowie den Einzelhandel gibt es zusätzliche Regelungen. Neu ist, dass Anwalts- und Gerichtskosten für<br />
die insolvenzabwendende Restrukturierung von Unternehmen in einer drohenden Zahlungsunfähigkeit mit bis zu<br />
20.000 Euro pro Monat gefördert werden.<br />
Restart-Prämie soll Beschäftigung fördern<br />
Mit der sogenannten Restart-Prämie soll die Beendigung von Kurzarbeit bzw. die Neueinstellung von Personal<br />
gefördert werden. Unternehmen, die nach der Wiedereröffnung ihr Personal aus der Kurzarbeit zurückholen oder<br />
neues Personal einstellen, erhalten ein Wahlrecht. Sie können wie bisher einen pauschalen Zuschuss zur bestehenden<br />
Personalkostenpauschale erhalten oder einen Zuschuss („Restart-Prämie“) zu den steigenden Personalkosten.<br />
Diese „Restart-Prämie“ ermittelt sich als Differenz zwischen den Personalkosten im Fördermonat Juli 2021 und den<br />
Personalkosten im Mai 2021. Der Zuschuss beträgt 60 % dieser Differenz im Juli 2021, 40 % im August 2021 und<br />
20 % im September 2021.<br />
Neustarthilfe für Soloselbständige wird verlängert und ausgebaut<br />
Auch Soloselbständige, die mangels hoher Fixkosten keine oder nur eine geringe Überbrückungshilfe erhalten<br />
können, werden für die Monate Juli bis September 2021 unterstützt. Mit der Neustarthilfe Plus erhalten sie unabhängig<br />
von der Höhe ihrer Fixkosten einen Zuschuss. Die monatlichen Zuschüsse werden auf 1.500 Euro erhöht<br />
(von Januar bis Juni 2021 monatlich bis zu 1.250 Euro).<br />
Autor: Ulf Hannemann, Freund & Partner GmbH (Stand: 01.07.2021)<br />
Ratgeber | Anzeige