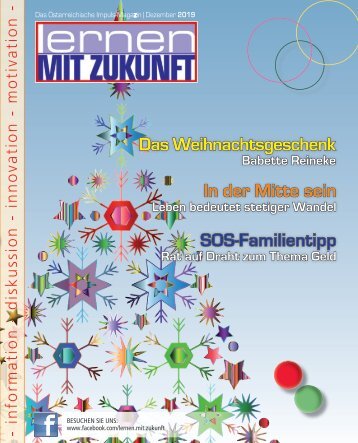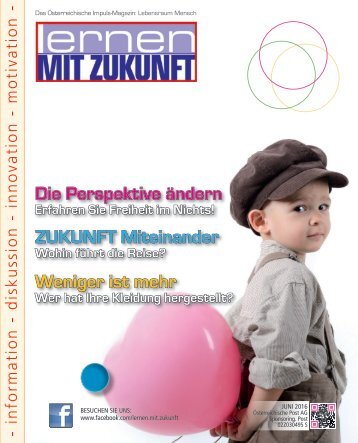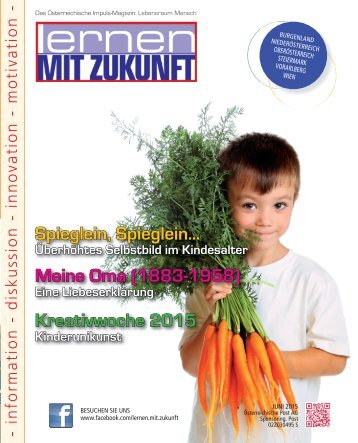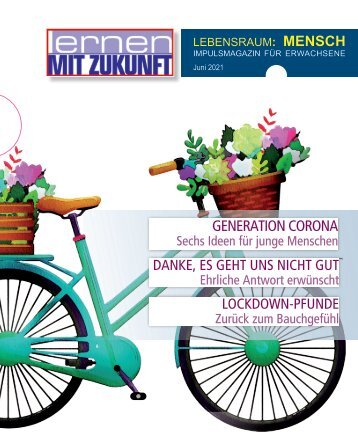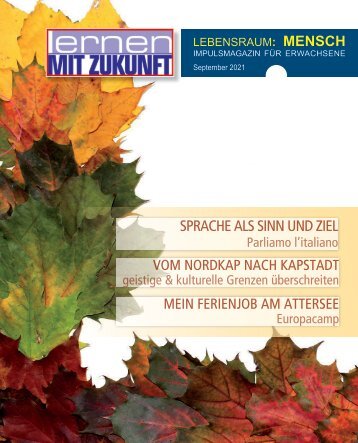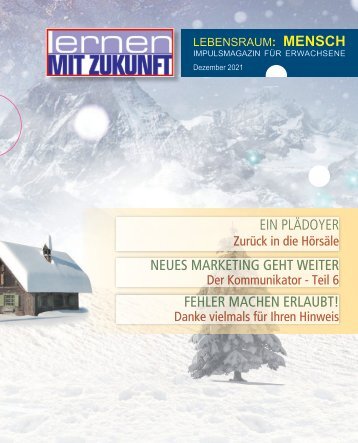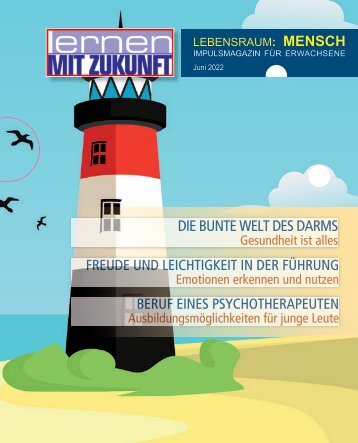LERNEN MIT ZUKUNFT September 2014
- Text
- Kinder
- September
- Welt
- Menschen
- Wien
- Wiener
- Kindern
- Zukunft
- Bildung
- Lissabon
information &
information & entwicklung information & entwicklung ■ ■ Der kleine Rechthaber: Erziehung ist (k)ein Kinderspiel VERANTWORTUNG FÜR SICH SELBST ÜBERNEHMEN Mag.a Maria Neuberger- Schmidt Autorin und Gründerin Verein Elternwerkstatt www.elternwerkstatt.at Julian, 8, hat es mit der Rechthaberei. Seine Mutter nervt es, dass er immer das letzte Wort haben muss – besonders dann, wenn er im Unrecht ist. Vor einigen Tagen entspannte sich das folgende Gespräch: Mutter: „Julian, nimm die Turnsachen und die Sportschuhe, wir müssen zum Training.“ Als er im Vorzimmer erscheint, fragt die Mutter: „Und wo sind deine Sportsachen? Ich hab dir doch gesagt....“ Julian: „Hast du nicht!“ Mutter: „Hab ich doch!“ Julian: „Das ist nicht wahr!“ Beide steigern sich hinein. UNFRUCHTBARE DEBATTEN Es gibt einfach Situationen, wo die Frage, wer denn wohl Recht habe, nur in Streit und unfruchtbaren Debatten endet. Natürlich ist jeder von seiner Sicht der Dinge überzeugt. Wenn sich die Debatte im Kreis zu drehen beginnt (Aussage gegen Aussage), ist es besser auszusteigen, z.B. so: „Also, du bist davon überzeugt, dass du Recht hast und be- ich bin es auch.“ (Wertfrei schreiben, was Sache ist). „Findest du, dass ICH dafür verantwortlich bin, dass du deine Sachen packst, wenn du zum Training gehst?“ (Die Sache auf den Punkt bringen). Oder, ohne beleidigt zu sein: „Ich habe keine Lust, dafür verantwortlich zu sein, ob du deine Sachen eingepackt hast – um mich dann womöglich auch noch anschnauzen zu lassen...“ (Ich-Botschaft). Dann können Sie zielorientiert fragen: „Was kann helfen, dass das nicht so leicht wieder passiert?“ Meist lenkt das Kind ein, denn es will groß sein und Verantwortung übernehmen. LIEBER NACH DER LÖSUNG STATT NACH DEM SCHULDIGEN SUCHEN Das Kind soll sich selber Lösungen für sein Problem einfallen lassen. Ich bin dafür, Kinder schon früh in die Eigenverantwortung hineinzunehmen, ohne aber auf die nestwärmende, elterliche Fürsorglichkeit zu verzichten. Welche Lösung in einer konkreten Situation, bei einem ganz bestimmten Kind mit seinen Stärken und Schwächen passt, kann in der Praxis sehr unterschiedlich sein. Auch wenn es nicht immer so scheinen mag: Sie haben immer die Wahl, wie Sie auf „dumme Bemerkungen“ oder auf Vorwürfe reagieren. Die Sach-Frage nach dem objektiv Richtigen, nach dem Recht haben, führt oft am Wesentlichen vorbei: Keiner mag gerne zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Da ist es klüger, den anderen, insbesondere das emotionale Kind, ohne Gesichtsverlust „aussteigen“ zu lassen. Und ist es nicht fruchtbarer, das Kind in die Eigenverantwortung zu nehmen und nach Lösungen zu suchen, anstatt es durch fruchtlose Debatten in seiner „Rechthaberei“-Manie zu fixieren und womöglich immer mehr Machtkämpfe auszufechten? Illustration: © Eugen Kment 18 | SEPTEMBER 2014 ONLINEZEITUNG: http://aktuell.LmZukunft.at
■ Inklusion: ■ Altbekannt, oder eine ganz neue Idee? WAS VERBIRGT SICH HINTER DEM PÄDAGOGISCHEN SCHLAGWORT DES JAHRZEHNTS? information & bewusstseininformation & bewusstsein Als Schlagwort hat die Inklusion eindeutig einen Platz in der Top 10 Liste der pädagogischen Begriffe des 21. Jahrhunderts erobert, denn sie ist in aller Munde, sei es nun mit deutscher oder mit englischer Aussprache. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Wort, welches anscheinend nicht nur mit Begeisterung, sondern auch teilweise mit einem gewissen Maß an Angst ausgesprochen wird? Vorerst einmal ein Blick zu den Wurzeln: das lateinische Verb includere bedeutet sowohl einschließen, als auch beinhalten. Daraus leitet die Inklusive Pädagogik ihren prägnanten Ansatz ab, welcher davon ausgeht, dass Wertschätzung und die Anerkennung von Diversität das grundlegende Prinzip jedes pädagogischen Handelns sein sollten. SO WEIT - SO GUT! Doch halt, wie steht das jetzt im konkreten Zusammenhang mit unserem Schulsystem, oder anders formuliert: bedeutet der inklusive Ansatz, dass wir etwas anders machen sollen? Na ja, ganz so einfach ist es nun doch nicht, denn hier beginnt sich schon die erste Hürde aufzubäumen. Derzeit gibt es an den österreichischen Pflichtschulen das sogenannte Integrationsmodell. Dieses basiert auf einem Teamteaching- System. Dabei betreuen LehrerInnen mit sonderpägagogischer Ausbildung Kinder, welche nach Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs explizit als Integrationskinder ausgewiesen sind, in Regelschulklassen. Die anderen SchülerInnen dieser Klassen werden von den entsprechenden PädagogInnen für die jeweilige Altersklasse im gleichen Klassenzimmer parallel unterrichtet. Zusätzlich gibt es noch die Sonderschulen, deren Klassen vollständig mit Kindern mit Sonderpädagogischen Förderbedarf besetzt sind, welche auch immer von SonderschullehrerInnen unterrichtet werden. Die Inklusion sieht im Gegensatz dazu allerdings vor, dass jeder Pädagoge über Grundkenntnisse der Inklusiven Pädagogik verfügt und diese auch in seiner Unterrichtszeit aktiv umsetzt, was bedeutet, dass er Kinder mit verschiedensten Lernmöglichkeiten bestmöglich fördert. Welche Änderungen die Umsetzung der Inklusion nun für das österreichische Schul- und LehrerInnenbildungssystem bedeutet wird deshalb die zentrale Frage des zweiten Teils dieses Artikels im nächsten Magazin sein. FORTSETZUNG FOLGT IN DER DEZEMBER-AUSGABE Dr. Patrizia Fiala Sonderschullehrerin VS Gloggnitz Integrationsklasse PH Baden und PH Eisenstadt Foto: © Brocreative - Fotolia.com ONLINEZEITUNG: http://aktuell.LmZukunft.at SEPTEMBER 2014 | 19
- Seite 1 und 2: - information - diskussion - innova
- Seite 3 und 4: editorial & informationeditorial &
- Seite 5 und 6: information & verantwortunginformat
- Seite 7 und 8: information & lerneninformation & l
- Seite 9 und 10: ■ ■ Kinder für das Lernen bege
- Seite 11 und 12: information & freizeit information
- Seite 13 und 14: ■ ■ Allergeninformation: Schulu
- Seite 15 und 16: information & persönlichkeitinform
- Seite 17: Ozeanarium Lissabon VIDEO Portugal
- Seite 21 und 22: information & verantwortunginformat
- Seite 23 und 24: ■ ■ Immobilienkauffrau/-mann: L
- Seite 25 und 26: ■ ■ Für Sie gelesen: Lesen, Er
- Seite 27 und 28: information & kindheitinformation &
- Seite 29 und 30: & verantwortunginformation verantwo
- Seite 31 und 32: information & emotioninformation &
- Seite 33 und 34: Je weiter nördlich, desto feuchter
- Seite 35 und 36: Täglich neue Meldungen unserer Onl
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...