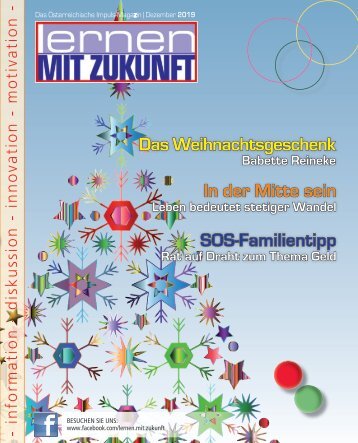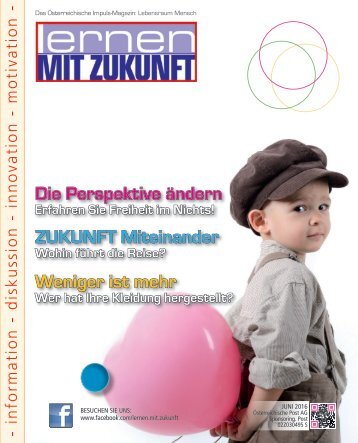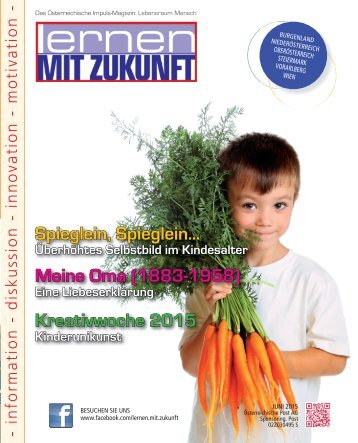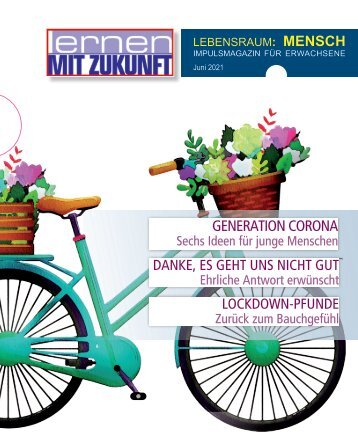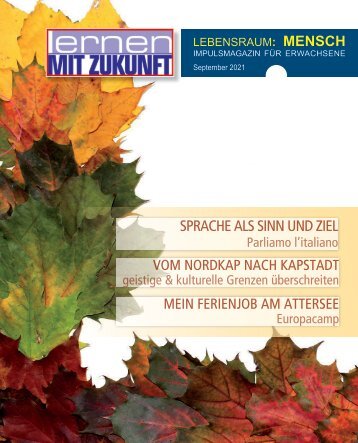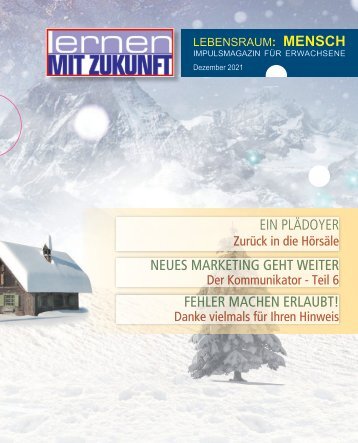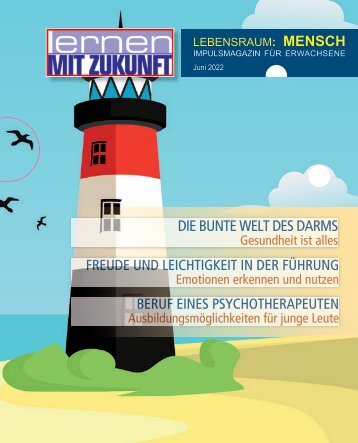LERNEN MIT ZUKUNFT September 2014
- Text
- Kinder
- September
- Welt
- Menschen
- Wien
- Wiener
- Kindern
- Zukunft
- Bildung
- Lissabon
information &
information & gesundheitinformation & gesundheit ■ Der Fall H.A.Se. - Teil 3: ■ Wahnsinn ICH BIN DOCH NICHT KRANK Prof. Franz W. Strohmer med. Journalist Gefühle (Befindlichkeiten) die sich als Reaktion auf äußere oder innere Reize (Vorstellungen, Wahrnehmungen im Körper) zeigen, benötigen zur völligen Ausprägung ein funktionierendes zentrales (Gehirn, Rückenmark) somatisches (bewußte Wahrnehmung von Umweltreizen und Reizen aus dem Körper, bewußte Steuerung von Bewegung und Nachrichtenverarbeitung) Nervensystem, zusätzlich zum vegetativen (unbewußte Steuerung von Organfunktionen) Nervensystem. Neuroleptika bewirken eine ruhigstellende, narkobiotische (Bezeichnung von Psychiatern) Wirkung, was eigentlich nichts anderes bedeutet als "Betäubung". Es kann aber auch zu außergewöhnlichen Erregungszuständen kommen. Die Benennung "Antipsychotikum" ist eigentlich eine Fehldefinition, da diese Psychopharmaka nicht direkt auf die Psychose (Wahn) einwirken, sondern über Gehirnstrukturen in das gesamte Nervensystem eingreifen und daher alle möglichen negativen körperlichen und psychischen Folgeerscheinungen auszulösen imstande sind. Die Nervenreizungen sind Signale mechanischer, chemischer, elektrischer oder thermischer Art, welche über Nervenfasern, wie der Strom in Drähten von Zelle zu Zelle geleitet werden. Die Übertragung erfolgt durch Botenstoffe (Neurotransmitter = hormonähnliche Substanzen), welche von der Ausgangsstelle einer Zelle über den sogenannten synaptischen Spalt zu einer Andockstelle (Rezeptor) der benachbarten Zelle geleitet werden und so weiter. Wichtige Botenstoffe sind das Azetylcholin (beruhigend für das Herz), das Noradrenalin (stimmungshebend, blutdrucksteigernd), das Adrenalin (Sauerstoffverbrauchregulierung, Blutzuckerspiegelerhöhung) und das Dopamin (Steuerung der Muskelspannung). Neuroleptika werden auch als Dopaminrezeptorenblocker bezeichnet. Die entscheidenden Ergebnisse einer Behandlung mit solchen ist nicht die Heilung der psychischen Grunderkrankung, sondern lediglich die Verhinderung einer drastischen Auswirkung derselben, allerdings unter erheblichen anderen gesundheitlichen Störungen, wie Fehlhaltungen, Bewegungsanomalie (Starrheit, Muskelzittern, Sitzunruhe), Grimassieren, Hypersalivation (gesteigerter Speichelfluß), Schmatzen, Zungen- Schlund und Kehlkopfkrämpfe, Stoffwechselstörungen, Sauerstoffunterversorgung u.s.w. Nach einem lebensbedrohenden Zungen-Schlundkrampf verweigert unser Patient A. H.Se. die weitere Einnahme des zurzeit hochpotentesten Neuroleptikums. FOLGE: Vorläufige Verwahrung in einem Beruhigungsraum. (Versperrte Türe, Fensterschlitz für Tageslicht in unerreichbarer Höhe, Eisenbett mit Matratze ohne Bettzeug, WC und Waschmuschel im Raum, dunkelbraun gestrichene Wände, Ausgang im Freien täglich 1 Stunde in Begleitung, Gemeinsamdusche mit anderen Patienten unter Aufsicht). "Wie soll ich so gesund werden? Ich bin ja gar nicht krank", sagt A.H. Se. und hofft auf die Freilassung. 6 | SEPTEMBER 2014 Foto: © vali_111 - Fotolia.com ONLINEZEITUNG: http://aktuell.LmZukunft.at
information & lerneninformation & lernen ■ ■ Stress lass nach: Tipps im Umgang mit Ihrem Stress DEM STRESS MIT EINEM AUGENZWINKERN BEGEGNEN Hoffentlich sind nicht nur die Schüler frisch vergnügt und gut erholt von den Sommerferien, sondern auch Sie liebe PädagogInnen. Damit das auch so bleibt und Ihr Stress Sie nicht überrollt, hier ein paar Tipps für Sie. ERKENNEN SIE IHREN STRESS? Der erste Schritt ist immer, die eigenen Stressauslöser wahrzunehmen. Was ist es, das Sie konkret stresst? Manche Menschen leiden unter Termindruck, andere wieder laufen dabei zur Höchstform auf, sind jedoch gestresst, wenn ihr Aufgabenbereich zu eintönig wird. Wiederum ein Dritter lässt sich durch ein bestimmtes Verhalten eines Schülers auf die Palme bringen. Wissen Sie erst einmal Ihre typischen Stresssituationen, gilt es nun, sich bewusst zu machen, wie Sie ganz konkret auf diese Auslöser reagieren. Und zwar auf mehreren Erlebensebenen: körperlich, gedanklich, gefühlsmäßig und mit ihrem Verhalten. Das klingt jetzt vielleicht banal für Sie, ist es aber nicht. Sie werden sehen, dass diese Selbstbeobachtung am Anfang sogar ungewohnt ist. Denn wenn wir sagen „Ich bin im Stress“ ist das eine sehr allgemeine Aussage, die noch nichts bekannt gibt, über mögliche konkrete Ansatzpunkte, was Sie tun können, um diesen zu reduzieren oder damit umzugehen. Diese erhalten Sie automatisch, wenn Sie die ersten zwei Schritte der Selbstbeobachtung und –reflexion gehen. DEM STRESS AUF MEHREREN EBENEN BEGEGNEN Denn dann wird es Ihnen immer öfter gelingen, auch schon in Ihren typischen Stresssituationen gegenzusteuern. Neigen Sie etwa unter Zeitdruck dazu, flach zu atmen, die Schultern hochzuziehen und sich hektisch zu verhalten, werden Sie ab dem Moment, wo Sie sich das einmal bewusst gemacht haben, dies öfters im Alltag beobachten und können unterschiedliche Stressbewältigungsarten ausprobieren. Beispielsweise auf der Verhaltensebene nach dem Motto „Wenn ich es eilig habe, gehe ich langsam“ – also bewusst entschleunigen. Oder ein paar Mal tief in den Bauch atmen oder einfache Körperübungen machen (Schulterkreisen oder Dehnübungen). Sie könnten sich aber auch bewusst machen, welche Gedanken Sie in solchen Situationen im Kopf haben. Sind das etwa stressverschärfende Botschaften wie: „Das schaffe ich nie“ oder „Ich bin zu langsam, ich muss schneller sein“? Auch hier können Sie dann ansetzen und beginnen, anders mit sich selbst zu sprechen. Denn auch die sogenannte intrapersonelle Kommunikation spielt bei unserem Stressempfinden eine große Rolle. Mag. Eva Maria Sator Lebensberaterin, Unternehmensberaterin, Coach, Teamentwicklerin, www.evasator.at Foto: © koya979 - Fotolia.com ONLINEZEITUNG: http://aktuell.LmZukunft.at SEPTEMBER 2014 | 7
- Seite 1 und 2: - information - diskussion - innova
- Seite 3 und 4: editorial & informationeditorial &
- Seite 5: information & verantwortunginformat
- Seite 9 und 10: ■ ■ Kinder für das Lernen bege
- Seite 11 und 12: information & freizeit information
- Seite 13 und 14: ■ ■ Allergeninformation: Schulu
- Seite 15 und 16: information & persönlichkeitinform
- Seite 17 und 18: Ozeanarium Lissabon VIDEO Portugal
- Seite 19 und 20: ■ Inklusion: ■ Altbekannt, oder
- Seite 21 und 22: information & verantwortunginformat
- Seite 23 und 24: ■ ■ Immobilienkauffrau/-mann: L
- Seite 25 und 26: ■ ■ Für Sie gelesen: Lesen, Er
- Seite 27 und 28: information & kindheitinformation &
- Seite 29 und 30: & verantwortunginformation verantwo
- Seite 31 und 32: information & emotioninformation &
- Seite 33 und 34: Je weiter nördlich, desto feuchter
- Seite 35 und 36: Täglich neue Meldungen unserer Onl
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...