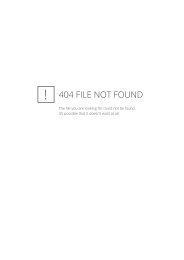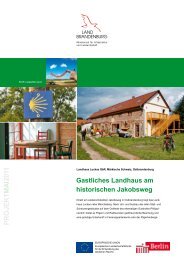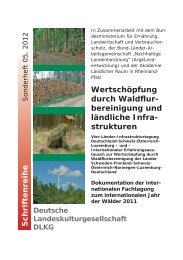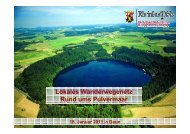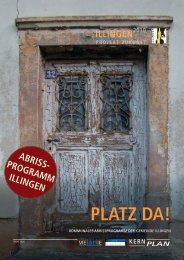Strategiepapier
Strategiepapier
Strategiepapier
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
56 <strong>Strategiepapier</strong> für die Entwicklung der ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz<br />
<strong>Strategiepapier</strong> für die Entwicklung der ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz<br />
57<br />
III. Strategien für die Entwicklung ländlicher Räume<br />
Es ist nicht aussichtsreich, Cluster ohne Vorliegen<br />
von ersten Netzwerkstrukturen von au s sen<br />
aufzubauen. Rolle der Politik muss es deshalb<br />
vor allem sein, Ansatzpunkte für Cluster zu identifi<br />
zieren um dort für geeignete Rahmenbedingungen,<br />
ein innovationsfreundliches Klima und<br />
eine Vernet zung der Wirt schaftsunternehmen<br />
und Hochschulen zu sorgen. Für diese Aufgabe<br />
bieten sich die regio nalen ILE- und Leader-Prozesse<br />
an.<br />
Dieses Strategiepa pier emp fi ehlt dabei folgende<br />
Vorgehensweise für die Impuls-Regionen:<br />
► Die in jedem Entwicklungskonzept obligatorische<br />
Stärken-Schwächen-Chancen-<br />
Risi ken-Analyse soll die re gio nale Wirtschaftsstruktur<br />
sehr sorgfältig auf Ansätze<br />
für Cluster und po ten tielle Wachstumsbranchen<br />
untersuchen. Dabei sind<br />
die Betäti gungsfelder der Wirtschaftsunternehmen,<br />
die Qualität der Wertschöpfungsketten<br />
und das Potenzial der Bevölkerung<br />
genauso interessant wie die natürlichen<br />
und wirt schaftsgeografi schen Standortvorteile<br />
der Region.<br />
► Die Wirtschaftsunternehmen, Kammern<br />
und sonstigen Partner in den identifi zierten<br />
Branchen sind gezielt, gegebenenfalls<br />
durch Vorgespräche, zu den Tagungen<br />
und Workshops eines Arbeitskreises<br />
„Wirtschaft“ im Rahmen der integrierten<br />
Bottom-up-Prozesse (Entwicklung von<br />
unten) einzuladen. Den Regional managements<br />
kommt da bei die Aufgabe zu,<br />
diese Ver anstaltungen zielgerichtet zu<br />
moderieren.<br />
► Zwischen den Wirtschaftsunternehmen,<br />
Bildungseinrichtungen und öffentli chen<br />
Stel len ist frühzeitig die Bildung von Netzwerken<br />
(Unternehmerstammti schen) anzusto<br />
ßen. Dies kann in den Impuls-Regionen<br />
aber bei landesweiter Bedeutsamkeit<br />
auch auf der Ebene einer Planungsregion<br />
oder des Landes Rheinland-Pfalz nach<br />
den Vor schlägen dieses <strong>Strategiepapier</strong>s<br />
geschehen.<br />
4.1.2 Kooperationen<br />
Im Gegensatz zu Netzwerken sind Kooperationen<br />
durch gezielte Zusammenarbeit weniger<br />
Partner bei konkreten Vorhaben gekennzeichnet.<br />
Als Kooperationspartner sind dabei Öffentliche<br />
Stellen wie Kommunen, Verwaltungen und<br />
Kammern ebenso denkbar wie Private Ak teure,<br />
z.B. Wirtschaftsunternehmen, Verbände oder<br />
einzelne Bürgerinnen und Bürger. Die in III.4.1.1<br />
be schrie benen Netzwerke eignen sich besonders<br />
als Startbasis für Kooperationen, da sich<br />
hier Part ner gleicher Interessen oder Branchen<br />
begegnen und Vertrauen zueinander fassen.<br />
Im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben<br />
entstehen Kooperationen immer dann, wenn Aufgaben<br />
aufgrund ihrer Größe, ihrer Kosten oder<br />
ihrer Komplexität von einzelnen Akteuren nicht<br />
bewältigt werden können. Oftmals ist der wichtigste<br />
Schritt zu einer neuen Kooperation bereits<br />
getan, wenn sich die potentiellen Partner kennen<br />
gelernt haben. Bei Le ader-Prozessen oder<br />
ILE-Prozessen begegnet sich eine Viel zahl unterschiedlichster<br />
Ak teure und lernt sich kennen.<br />
Deshalb sind diese Instru mente in hohem Maße<br />
dazu geeignet, Ko operationen auf den Weg zu<br />
bringen und zu unterstützen.<br />
Die Moderatoren in den Impuls-Regionen müssen<br />
deshalb Aufgaben identifi zieren, zu deren<br />
Bewältigung sich Kooperationen eignen, die<br />
potentiellen Partner in Workshops oder Arbeitsgruppen<br />
zusammenbringen und die geeigneten<br />
rechtlichen und organi satorischen Instru mente<br />
bereithalten.<br />
Im Zuge der Regionalkonferenzen wurde deutlich,<br />
dass sich zur Bewältigung von Aufgaben<br />
im ländlichen Raum als spezielle Kooperationsformen<br />
beson ders eignen:<br />
► Interkommunale Zusammenarbeit<br />
► Öffentlich-Private-Partnerschaften<br />
III. Strategien für die Entwicklung ländlicher Räume<br />
Interkommunale Zusammenarbeit bietet sich<br />
vor allem an, wenn Gemeinden be stimmte Aufgaben<br />
aufgrund von deren Größe und Komplexität<br />
nicht alleine oder gemeinsam besser lösen können.<br />
Zudem werden öffentliche Infrastruktureinrichtungen<br />
bei schrumpfender Be völkerung aufgrund<br />
schwächer werdender Auslastung unrentabler.<br />
Vor allem in struktur schwachen Regionen<br />
empfi ehlt sich regelmäßig eine Koordination im<br />
Flä chenmanagement, da die Konzentration von<br />
Flächenausweisungen auf strategisch günstigen<br />
Standorten die Ressourcen bündelt und größere<br />
Erfolge für alle beteiligten Gemeinden verspricht.<br />
Fort schrittliche Gemeinden haben diese Chance<br />
bereits er kannt und arbeiten in den Bereichen<br />
Gewerbefl ächenausweisung, Infrastrukturnutzung<br />
(Abwasser, Bauhof), Hochwasserschutz<br />
oder Standortmarketing zu sammen. In den Impuls-Regionen<br />
gilt es, die kommunalen Ver treter<br />
zu vernetzen und ent spre chend zu sensibilisieren,<br />
um die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben<br />
durch inter kom munale Zusam menarbeit anzustreben.<br />
Hierzu ein Beispiel:<br />
► Mobilisieren vorhandener innerörtlicher<br />
Baufl ächenpotenziale (Baulücken,<br />
Brachfl ä chen, leer stehende oder minder<br />
genutzte Gebäude).<br />
► Gemeinsame Handlungsfelder für interkommunale<br />
Zusammenarbeit festlegen.<br />
► Gemeinsames Leitbild für nachhaltige<br />
Siedlungspolitik im Rahmen von Workshops<br />
ent wickeln.<br />
► Interkommunale Gewerbegebietsentwicklung<br />
(Gewerbefl ächenpool, Gewerbeimmobi<br />
lienbörse).<br />
► Aufbau eines Gemeinde übergreifenden<br />
Ökokontos.<br />
► Individuelle Handlungsvorschläge für die<br />
teilnehmenden Gemeinden.<br />
► Vertragsausgestaltungen für gerechte<br />
Kosten- / Nutzenverteilung<br />
Öffentlich-Private-Partnerschaften (Public-<br />
Private-Partnership) sind neuartige Ansätze<br />
zur Erfüllung kommunaler Aufgaben unter Beteiligung<br />
der privaten Wirt schaft. Die Gemeinden<br />
und Unternehmen der Privatwirtschaft kooperieren<br />
dabei vor allem bei der Finanzierung,<br />
aber auch bei der Ausführung von Projekten.<br />
So können die Kommunen auch in Zeiten knapper<br />
Kassen öffentliche Aufgaben wahrnehmen,<br />
die private Wirtschaft profi tiert durch langfristige<br />
Einnahmen. Öffentlich-Privater-Partnerschaften<br />
können sehr vielfältig sein, z.B. bei Schwimmhallen<br />
und Schulen, energetischen Sanierungen,<br />
Bau von Dorfgemeinschaftshäusern, öffentlichen<br />
Parkplät zen in Innenstädten oder der<br />
Verkehrsinfrastruktur.<br />
Ziel ist es, Investitionen in ländlichen Räumen<br />
verstärkt durch Öffentlich-Private-Partnerschaften<br />
zu ermöglichen. Dazu sollen in den Impuls-Regionen<br />
zwischen Kommunen regio nalen<br />
Akteuren, Handwerkern, örtlichen Banken und<br />
anderen denk baren Partnern Modelle erprobt<br />
werden (Kontraktingmodelle), um Projekte der<br />
Da seinsvorsorge mittels Öffentlich-Privater-Partnerschaften<br />
zu realisieren.