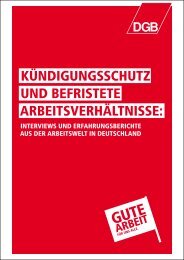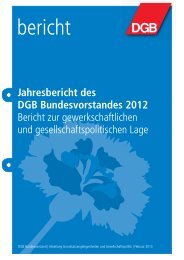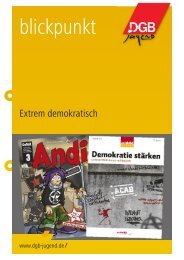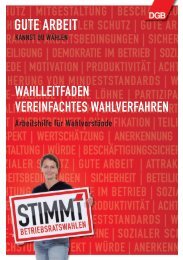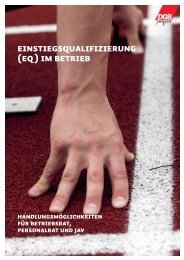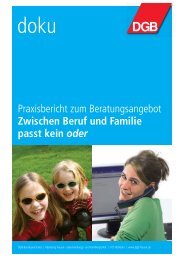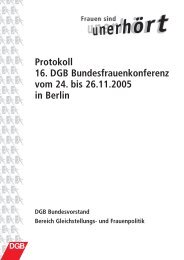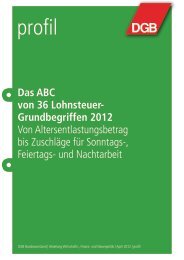fraueninfo-3-2011 - 05.qxd - DGB Bestellservice
fraueninfo-3-2011 - 05.qxd - DGB Bestellservice
fraueninfo-3-2011 - 05.qxd - DGB Bestellservice
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
INFO-BRIEF N°3<br />
SEPTEMBER <strong>2011</strong><br />
FRAU GEHT VOR<br />
03/<strong>2011</strong><br />
WENN FRAUEN<br />
DAS GELD VERDIENEN<br />
FAMILIENERNÄHRERINNEN:<br />
HERAUSFORDERUNG AN POLITIK UND GESELLSCHAFT
INHALT<br />
SCHWERPUNKT: FAMILIENERNÄHRERINNEN<br />
Frischer Wind aus Europa! ------------------------------------------ 2<br />
Wechsel in der Frauenpolitik – Vom <strong>DGB</strong> zum EGB nach Brüssel<br />
Grußwort Dr. Kristina Schröder ----------------------------------- 3<br />
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend<br />
Frauenpolitische Forderungen in neuem Licht -------------- 4<br />
Familienernährerinnen brauchen geschlechtergerechte Arbeitswelt<br />
Wer ernährt die Familie? --------------------------------------------- 5<br />
<strong>DGB</strong>-Projekt entwickelt politische Handlungsansätze<br />
INTERVIEW ---------------------------------------------------------------- 7<br />
Umdenken muss früher anfangen<br />
Neue Rollenbilder:<br />
Herausforderung an Frauen, Männer und die Politik<br />
Verantwortungslast oder Verlustängste?------------------------ 9<br />
Vom Lösen und Festhalten am männlichen Ernährermodell<br />
Doppelt belastet und am Limit ---------------------------------- 12<br />
Familienernährerinnen: Spagat zwischen Arbeit und Privatleben<br />
Hochqualifizierte Familienernährerinnen -------------------- 14<br />
Unabhängig und doch in alten Rollenmustern verhaftet<br />
Haushaltsnahe Dienstleistungen ------------------------------- 15<br />
Chance oder Zementierung der Geschlechterverhältnisse<br />
Lösungsvorschläge aus der Praxis ----------------------------- 18<br />
Online-Diskussion zeigt vielfältige Ergebnisse<br />
INTERNATIONALER FRAUENTAG ------------------------------- 20<br />
Die wichtigsten Stationen der Gleichberechtigung<br />
IV. Teil – Von den 68ern bis zur Wiedervereinigung<br />
AUSBLICK -------------------------------------------------------------- 24<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
2<br />
FRISCHER WIND AUS EUROPA<br />
WECHSEL IN DER FRAUENPOLITIK<br />
VOM <strong>DGB</strong> ZUM EGB NACH BRÜSSEL<br />
CLAUDIA MENNE IST SEIT JUNI <strong>2011</strong> IM BUNDES-<br />
SEKRETARIAT DES EUROPÄISCHEN GEWERK-<br />
SCHAFTSBUNDES UNTER ANDEREM ZUSTÄNDIG<br />
FÜR GLEICHSTELLUNGS- UND SOZIALPOLITIK. SIE<br />
LEITETE DEN BEREICH GLEICHSTELLUNGS- UND<br />
FRAUENPOLITIK BEIM <strong>DGB</strong> BUNDESVORSTAND<br />
VON 2005 BIS <strong>2011</strong>.<br />
Nach mehr als sechs Jahren als Herausgeberin des Infobriefes<br />
möchte ich mich in dieser Ausgabe von meinen LeserInnen und der<br />
Redaktion verabschieden und mich für die gute Zusammenarbeit in<br />
dieser Zeit bedanken. Wir haben in den vergangenen Jahren viele<br />
politische Themen bewegt und dabei einiges in Bewegung<br />
gebracht.<br />
Seit Juni <strong>2011</strong> arbeite ich nun für die deutschen und europäischen<br />
Gewerkschaften in Brüssel. Dabei bleibe ich der Gleichstellungspolitik<br />
und der Antidiskriminierungsarbeit treu. Daher ist es vielmehr<br />
ein Wechsel und kein wirklicher Abschied. Gerade das Thema dieser<br />
Ausgabe, die wachsende Zahl von Familienernährerinnen, soll auch<br />
Eingang in die Arbeit des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB)<br />
finden. Während des EGB Kongresses im Mai in Athen haben wir<br />
damit begonnen, auf dieses Phänomen aufmerksam zu machen.<br />
Leider kommen aus Brüssel derzeit eher schlechte (Krisen-)Nachrichten,<br />
die auch das Vertrauen in eine gemeinsame europäische<br />
Zukunft erschüttern. Gerade jetzt kommt es darauf an, die Segel<br />
richtig zu setzen – hin auf eine wirkliche europäische Gemeinschaft,<br />
in der sozialer Fortschritt und nicht der Rotstift regiert.<br />
Ich erinnere mich noch gut an eine Ausgabe des Fraueninfobriefes<br />
aus dem Jahr 2006 mit dem Titel „Frischer Wind oder Flaute? Neue<br />
Gleichstellungspolitik für Europa“. So hoffe ich, bald vom frischen<br />
Wind aus Europa berichten zu können.<br />
Herzliche Grüße<br />
Claudia Menne
Grußwort<br />
der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,<br />
Dr. Kristina Schröder<br />
Sonderpublikation des <strong>DGB</strong> zum Thema Familienernährerinnen<br />
Unsere Arbeitswelt hat mit den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht Schritt gehalten. Sie ist zugeschnitten auf den männlichen<br />
Hauptverdiener, dem eine Frau den Rücken frei hält. Aktuelle Forschungen zeigen aber, dass bereits heute in jedem fünften Mehrpersonenhaushalt<br />
Frauen das Haupteinkommen beziehen. Damit sind sie die Familienernährerinnen. Die Hälfte von ihnen leben<br />
mit ihren Kindern allein, bei der anderen Hälfte handelt es sich um Frauen, deren<br />
(Ehe-)Partner nicht erwerbstätig ist oder deutlich weniger verdient.<br />
Das weibliche Haupternährermodell ist aber kein männliches Alleinernährermodell mit umgekehrtem Vorzeichen. Denn während<br />
bei Vätern ganz selbstverständlich unterstellt wird, dass sie mit ihrem Einkommen eine Familie ernähren, reagiert bei Müttern das<br />
soziale Umfeld häufig so, als sei der Beruf nur ein „Zuverdienst“. Hinzu kommt: Familienernährerinnen leiden häufig unter einer<br />
Doppelbelastung aus Einkommenssicherung und Fürsorgeaufgaben. Oft fehlen verlässliche Partner: zuhause, in ihrem Umfeld und<br />
im Arbeitsleben.<br />
Das Bundesfamilienministerium sucht deshalb gemeinsam mit dem <strong>DGB</strong> nach Möglichkeiten, Familienernährerinnen stärker als<br />
bisher zu unterstützen. Der besseren Förderung von haushaltsnahen Dienstleistungen muss dabei in meinen Augen eine zentrale<br />
Rolle zukommen. Denn sie entlasten erwerbstätige Frauen, eröffnen ihnen neue Möglichkeiten und geben ihnen – ob als Wiedereinsteigerin,<br />
Führungskraft oder als Familienernährerin – Zeit für Verantwortung in Familie und Beruf. Die bessere Förderung<br />
haushaltsnaher Dienstleistungen erleichtert den Alltag von Frauen, die im Beruf und in der Familie stark gefordert sind.<br />
Darüber hinaus muss es darum gehen, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitregelungen zu entwickeln, die nicht länger auf den<br />
männlichen Alleinernährer und die weiblichen Zuverdienerin zugeschnitten sind. Dazu brauchen wir eine Arbeitswelt, die es beiden<br />
Elternteilen ermöglicht, eine Auszeit nach der Geburt zu nehmen, in Teilzeit oder flexiblen Arbeitszeitmodellen zu arbeiten,<br />
ohne dadurch ihre berufliche Entwicklung zu gefährden. Erst dadurch bekommen Frauen und Männer die Chance, sich familiäre<br />
Fürsorgeaufgaben partnerschaftlich zu teilen und für sich selbst abseits der klassischen Rollenmuster Wege der Vereinbarkeit von<br />
Beruf und Familie zu finden. Dafür setze ich mich auch im Rahmen des Unternehmensprogramms „Erfolgsfaktor Familie“ und der<br />
Initiative „Familienbewusste Arbeitszeiten“ ein.<br />
Ich begrüße und unterstütze das <strong>DGB</strong>-Projekt zur Verbesserung der Situation der Familienernährerinnen. Es wird helfen,<br />
die Situation der Familienernährerinnen bekannt zu machen und neue Handlungsansätze zu entwickeln, um Frauen als Haupternährerinnen<br />
zu entlasten. Unser gemeinsames Ziel sollte es dabei sein, faire Chancen und Familienfreundlichkeit zu<br />
Markenzeichen der deutschen Wirtschaft zu machen!<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Dr. Kristina Schröder
FRAUENPOLITISCHE<br />
FORDERUNGEN IN NEUEM LICHT<br />
FAMILIENERNÄHRERINNEN BRAUCHEN<br />
GESCHLECHTERGERECHTE ARBEITSWELT<br />
INGRID SEHRBROCK, STELLVERTRETENDE<br />
VORSITZENDE DES DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTS-<br />
BUNDES, IST UNTER ANDEREM ZUSTÄNDIG FÜR<br />
DIE ABTEILUNGEN FRAUEN, GLEICHSTELLUNGS-<br />
UND FAMILIENPOLITIK, BILDUNGSPOLITIK UND<br />
BILDUNGSARBEIT.<br />
Immer mehr Frauen verdienen 60 Prozent und mehr des<br />
Haushaltseinkommens und ernähren damit sich selbst sowie<br />
Partner und/oder Kinder. Diese Frauen sind Familienernährerinnen.<br />
Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass<br />
Frauen unter ganz anderen Bedingungen Familienernährer<br />
sind, als dies Männern möglich ist – denn nach wie vor<br />
haben Frauen mit strukturellen Benachteiligungen und<br />
Hürden auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Das Politikentwicklungsprojekt<br />
„Familienernährerinnen“, das vom <strong>DGB</strong><br />
Bundesvorstand, Abteilung Frauen-, Gleichstellungs- und<br />
Familienpolitik initiiert sowie vom Bundesfrauenministerium<br />
finanziert wird, widmet sich dieser Gruppe Frauen. Dieses<br />
Schwerpunktheft ist Teil der Arbeit im Projekt.<br />
Dass heute zunehmend Frauen die Familie ernähren, ist ein Ergebnis<br />
des Umbruchs, in dem Deutschland sich nach wie vor befindet.<br />
Dabei spielt die größere Rolle nicht etwa das gestiegene<br />
Qualifikationsniveau der Frauen, wie man zunächst vermuten<br />
könnte. Vielmehr sind insbesondere die Reformen des Sozial- und<br />
Unterhaltsrechts sowie die Ausweitung prekärer und atypischer<br />
Beschäftigung ausschlaggebend.<br />
Verliert der männliche Ernährer des Haushalts seine Erwerbstätigkeit<br />
durch Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit, so wird die Partnerin<br />
zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verpflichtet. Ebenso wird<br />
heute im Fall einer Scheidung die Frau bereits nach den ersten drei<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
GRUSSWORT<br />
4<br />
Lebensjahren des jüngsten Kindes auf ihre Eigenverantwortung<br />
verwiesen. In beiden Fällen kann die Frau schnell zur Ernährerin der<br />
Familie werden. Und das, obwohl weder die Gesellschaft noch der<br />
Arbeitsmarkt auf Familienernährerinnen eingestellt sind. Denn<br />
Frauen, die die Familie ernähren, sind kein Rollenmodell. Vielmehr<br />
gilt das Gehalt der Frau meist als Zuverdienst, wohingegen das<br />
Haupteinkommen vom Mann zu erwirtschaften ist.<br />
Familienernährerinnen sprengen also viele Konventionen. Und es<br />
bedeutet auch: Familienernährerinnen bündeln wie in einem Brennglas<br />
alle existierenden strukturellen Benachteiligungen und Hürden,<br />
die ‚frau’ als Erwerbstätige haben kann. Und: diese wirken sich<br />
heute, in Zeiten in denen das Einkommen der Frau immer wichtiger<br />
für die Familie wird, umso gravierender aus. Entsprechend schwierig<br />
ist oft die Situation von Familienernährerinnen und ihren Familien.<br />
Da sind beispielsweise hochqualifizierte Familienernährerinnen, die<br />
zwar oft ein hinreichendes Einkommen erwirtschaften, jedoch<br />
gleichzeitig ohne feste Arbeitszeiten ihren Job machen und dennoch<br />
zusätzlich den Haushalt „schmeißen“. Da ist die flexibilisierte<br />
Arbeitswelt, die kaum Rücksicht auf familiäre Belange nimmt. Und<br />
da sind die Partner der Familienernährerinnen, die sich oft schwer<br />
tun mit der Rolle als Hausmann, die ihnen dann schwer fällt –<br />
zumal dies so in ihrem Leben nie geplant war. Diese und noch<br />
weitere Facetten des Themas „Familienernährerinnen“ sollen in<br />
dieser Ausgabe des Infobriefs näher beleuchtet werden. Wir danken<br />
allen Beteiligten für ihre Beiträge!<br />
Uns Frauenpolitikerinnen gibt das Thema „Familienernährerinnen“<br />
jedoch die Chance, alte Forderungen in einem neuen Licht zu diskutieren<br />
sowie mit einer neuen Dringlichkeit zu unterfüttern. Mit der<br />
Etablierung des Politikentwicklungsprojekts „Familienernährerinnen“<br />
sowie dem Eingehen der Strategischen Partnerschaft mit<br />
dem Bundesfrauenministerium wollen wir <strong>DGB</strong>-Frauen diesem Ziel<br />
gerecht werden. Es ist nun endlich Zeit für eine geschlechtergerechte<br />
Arbeitswelt – für eine Welt in der Familienernährerinnen<br />
selbstverständlich sein können!<br />
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht<br />
Ingrid Sehrbrock
WER ERNÄHRT DIE FAMILIE?<br />
<strong>DGB</strong>-PROJEKT ENTWICKELT<br />
POLITISCHE HANDLUNGSANSÄTZE<br />
Wie werden Frauen Familienernährerinnen? Unter welchen<br />
Bedingungen leben und arbeiten sie? Fragen, denen das von<br />
der Abteilung Frauen-, Gleichstellungs- und Familienpolitik<br />
des <strong>DGB</strong> initierte Politikentwicklungsprojekt „Modell der<br />
Familienernährerin“ nachgeht. Unter der Prämisse, die oft<br />
schwierigen Arbeits- und Lebensbedingungen der Familienernährerinnen<br />
zu verbessern, sollen neue politische Handlungsansätze<br />
entwickelt und eine gesellschaftspolitische<br />
Diskussion angestoßen werden.<br />
Die Ergebnisse der beiden von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten<br />
Forschungsprojekte „Flexible Familienernährerinnen“ machen es<br />
deutlich: immer mehr Frauen verdienen das Hauptfamilieneinkommen.<br />
Sie verdienen mindestens 60 Prozent des Familieneinkommens und<br />
werden als „Familienernährerin“ bezeichnet. In rund 18 Prozent aller<br />
Erwerbspersonenhaushalte in Deutschland nehmen Frauen diese Rolle<br />
ein. In neun Prozent der Paarhaushalte sind sie Hauptverdienerinnen,<br />
weitere 8,8 Prozent sind alleinerziehende Mütter.<br />
Dabei gibt es zwischen den neuen und den alten Bundesländern<br />
deutliche Unterschiede. In den neuen Bundesländern verdienen die<br />
Frauen häufiger das Haupteinkommen (15,2%) als in den alten<br />
Bundesländern (9,3%). Beinahe doppelt so viele Paare wie in den<br />
alten Bundesländern verdienen im Osten zudem gemeinsam das Geld<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
5<br />
(37,3% gegenüber 21,1%). Im Westen dagegen dominiert das<br />
männliche Ernährermodell immer noch deutlich, während es im Osten<br />
nur knapp 50 Prozent der Paarhaushalte prägt. Eine vom Bundesministerium<br />
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend <strong>2011</strong> in Auftrag<br />
gegebene Studie „Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspektiven“<br />
kommt zu dem Ergebnis, dass rund 23 Prozent der Mütter<br />
zwischen 25 und 60 Jahren Familienernährerinnen sind. Die Daten<br />
zeigen eindrucksvoll: Familienernährerinnen sind längst eine arbeitsmarkt-,<br />
familien- und gleichstellungspolitisch wichtige, aber oft unterschätzte<br />
Gruppe.<br />
Auch weitere Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten sind nicht<br />
ohne gesellschaftliche Brisanz. So werden Frauen meist unfreiwillig zu<br />
Familienernährerinnen, verdienen oftmals keinen ausreichenden Lohn,<br />
um die Familie zu ernähren, arbeiten in unsicheren und prekären Jobs<br />
und tragen zusätzlich die Verantwortung für die Familienarbeit. Dabei<br />
ist die Familienernährerin kein fixierter Status oder lebenslanges<br />
Schicksal, sondern eine potenzielle und realistische Phase weiblicher<br />
Lebensbiografie. Analog gilt dies auch für Männer, die aufgrund eines<br />
modernen Partnerschaftskonzepts oder ökonomischer Rahmenbedingungen<br />
nicht mehr allein die Last des Familienernährers tragen wollen<br />
oder können. Damit gewinnt weibliches Einkommen eine Bedeutung,<br />
die ihm bis heute abgesprochen wird. Es ist in weiten Teilen der<br />
Gesellschaft kein Zuverdienst mehr. Viele Familien können nicht mehr<br />
darauf verzichten.<br />
Die veränderten Lebensformen und Geschlechterrollen bringen neue<br />
Herausforderungen an Politik und Gesellschaft mit sich, die im <strong>DGB</strong>-<br />
Politikentwicklungsprojekt diskutiert werden. Den Auftakt bildete die<br />
<strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz im Januar 2010 mit der Vorstellung der<br />
ersten Forschungsergebnisse. Mitte Juli 2010 folgte in Leipzig eine
zweite große Fachtagung, auf der mit VertreterInnen aus Wissenschaft,<br />
Politik und Zivilgesellschaft die ersten qualitativen Ergebnisse<br />
diskutiert wurden.<br />
Das Politikentwicklungsprojekt bietet neben einer Internetpräsenz<br />
(www.familienernaehrerin.de), die Ergebnisse aus den Forschungsprojekten<br />
und Publikationen aus Wissenschaft und Medien vorstellt,<br />
auch eine interaktive Online-Diskussion (Seite 18). Darüber hinaus<br />
werden in Workshops anhand konkreter Fragen Lösungen erarbeitet,<br />
aus denen notwendige politische Handlungsansätze entwickelt<br />
werden. Aus allen im Laufe der Projektzeit gewonnenen Erkenntnissen,<br />
Vorschlägen und Meinungen wird am Ende der Projektlaufzeit<br />
ein Fahrplan (Road Map) entwickelt. Er soll Wege aufzeigen, die zu<br />
einer Verbesserung und Erleichterung der Situation von Familienernährerinnen<br />
führen. Und das ist dringend notwendig, denn die<br />
Lebensituation von weiblichen Familienernährerinnen unterscheidet<br />
sich deutlich von der des männlichen Familienernährers.<br />
75 Prozent der Familienernährerinnen sind auch als Hauptverdienerin<br />
zusätzlich für Haushaltsführung und Kindererziehung zuständig und<br />
damit doppelt belastet (Seite 15). Darüber hinaus ist die Betreuungsquote<br />
für Kinder unter drei Jahren vor allem in Westdeutschland mit<br />
17 Prozent nach wie vor gering. Die schwierige Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf führt zusätzlich zu Stress und Rollenkonflikten, die<br />
sich auch negativ auf die Gesundheit von Familienernährerinnen<br />
auswirken (Seite 12). Im Zuge dieser Entwicklung ist auch die Bedeutung<br />
materieller Motive für die Berufstätigkeit von Frauen gestiegen<br />
(Seite 10). So geht es Frauen zum Beispiel bei einem beruflichen<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
6<br />
Wiedereinstieg um die finanzielle Sicherung im Alter (81%), um die<br />
Existenzsicherung der Familie (81%), um die Absicherung der Familie,<br />
wenn der Partner arbeitslos wird (77%) oder um die eigene Unabhängigkeit<br />
im Falle einer Scheidung (77%). Vor diesem Hintergrund ist es<br />
politisch zwingend notwendig, den Wiedereinstieg auch nach längerer<br />
Erwerbsunterbrechung zu erleichtern und zu fördern.<br />
Zusammenfassend ist festzustellen: Familienernährerinnen sind eine<br />
heterogene Gruppe von Frauen, denen gemeinsam ist, dass sie in<br />
voller Verantwortung den Lebensunterhalt für sich, ihre Kinder und<br />
gegebenenfalls ihren Partner erwirtschaften. Jedoch mehrheitlich<br />
nicht unter den gleichen Bedingungen wie der männliche Familienernährer.<br />
Stattdessen sind es oft eher schwierige, fragile und unfreiwillige<br />
Arrangements, in denen Frauen unter prekären Bedingungen<br />
die Familie versorgen, weil sie in der Regel weniger Geld verdienen.<br />
Zusätzlich tragen sie gleichzeitig – neben ihrem Haupteinkommensbezug<br />
– in den allermeisten Fällen weiterhin die Hauptverantwortung<br />
für die familiale Fürsorgearbeit. Allerdings gibt es auch eine kleine<br />
hochqualifizierte Gruppe von Familienernährerinnen, die durch ihre<br />
Arbeitsmarktposition, in Absprache mit ihrem bewusst beruflich<br />
weniger stark orientierten Partner, neue, bisher noch ungewöhnliche<br />
Geschlechterarrangements leben (Seite 14).<br />
Ob Arbeitsmarkt-, Sozialpolitik, Frauen- oder Männerpolitik - die<br />
immer größer werdende Gruppe von Familienernährerinnen machen<br />
eine gleichstellungspolitische Reform notwendig. Dazu sind neben<br />
politischen Veränderungen auch neue Frauen- und Männerleitbilder<br />
nötig (Seite 7). Für die Förderung eines gleichberechtigten Geschlechtermodells<br />
und die Beseitigung bestehender, widersprüchlicher sozialpolitischer<br />
Signale setzt sich das <strong>DGB</strong>-Politikentwicklungsprojekt ein.<br />
<strong>DGB</strong>-POLITIKENTWICKLUNGSPROJEKT UNTER:<br />
WWW.FAMILIENERNAEHRERIN.DE<br />
DIE FORSCHUNGSPROJEKTE „FLEXIBLE FAMILIENERNÄHRERINNEN“<br />
WURDEN IN DEN JAHREN 2008–2010 AM WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL-<br />
WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGSINSTITUT IN DER HANS-BÖCKLER-<br />
STIFTUNG SOWIE AN DER UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN<br />
DURCHGEFÜHRT. IN DEN PROJEKTEN WURDEN ZUNÄCHST AUF DER<br />
GRUNDLAGE DES SOZIOÖKONOMISCHEN PANELS DER ANTEIL DER<br />
VERSCHIEDENEN EINKOMMENSKONSTELLATIONEN BERECHNET UND<br />
ANSCHLIEßEND RUND 90 FRAUEN, DIE FAMILIENERNÄHRERINNEN<br />
SIND, IN OST- SOWIE WESTDEUTSCHLAND IN PERSÖNLICHEN INTER-<br />
VIEWS ZU IHRER LEBENSSITUATION BEFRAGT.<br />
WW.WSI.DE
UMDENKEN MUSS<br />
FRÜHER ANFANGEN<br />
NEUE ROLLENBILDER: HERAUSFORDERUNG<br />
AN FRAUEN, MÄNNER UND DIE POLITIK<br />
MARLIES BROUWERS IST SEIT 2003<br />
VIZEPRÄSIDENTIN DES KATHOLI-<br />
SCHEN DEUTSCHEN FRAUENBUNDES<br />
(WWW.FRAUENBUND.DE)<br />
UND SEIT 2008 VORSITZENDE<br />
DES DEUTSCHEN FRAUENRATES<br />
(WWW.FRAUENRAT.DE).<br />
MARTIN ROSOWSKI IST VORSTANDS-<br />
VORSITZENDER DES BUNDESFORUMS<br />
MÄNNER (WWW.BUNDESFORUM-<br />
MAENNER.DE) UND HAUPTGE-<br />
SCHÄFTSFÜHRER DER MÄNNERAR-<br />
BEIT DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN<br />
DEUTSCHLAND.<br />
Immer mehr Frauen tragen in entscheidendem Maße zum<br />
Haushaltseinkommen bei. Das bringt neue Herausforderungen<br />
an Politik und Gesellschaft mit sich und macht ein<br />
verändertes Rollenverständnis notwendig. Über eine<br />
moderne Frauen- und Männerpolitik, neue Rollenleitbilder<br />
und politisches Umdenken sprach „Frau geht vor“ mit<br />
Marlies Brouwers, Vorsitzende des Deutschen Frauenrates<br />
und Martin Rosowski, Vorstandsvorsitzender des Bundesforums<br />
Männer.<br />
Wenn Frauen für das Haupteinkommen in der Familie<br />
sorgen, so geschieht das meist nicht freiwillig. Warum fällt es<br />
Frauen schwer, sich auf diese neue Rolle einzulassen?<br />
Brouwers: Frauen sind traditionell Zuverdienerinnen und sehen<br />
sich auch in dieser Rolle. Sie gehen meist einer Teilzeitarbeit nach<br />
oder einem Minijob, beides mit geringem Einkommen. Da ist es<br />
doppelt schwer, ein gesamtes Haushaltseinkommen zu stemmen.<br />
Zusätzlich bleiben die Hausarbeit und die Versorgung der Kinder in<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
INTERVIEW<br />
7<br />
der Regel weiter an ihnen hängen. Prekäre Beschäftigung, geringes<br />
Einkommen und die Doppelbelastung machen diese neue Aufgabe<br />
nicht unbedingt attraktiv. Darüber hinaus führen neue Rollenmuster<br />
in Familien zu Spannungen. Das Familiengefüge gerät durcheinander,<br />
das bedeutet eine weitere Mehrbelastung. Und wenn der<br />
Partner noch unterstützt werden muss, weil er mit seiner Rolle<br />
hadert, übernimmt die Frau auch noch die Aufgabe einer Psychologin.<br />
Rosowski: Es stimmt, die klassische Haushaltsaufteilung ist noch<br />
nicht geschlechtergerecht verteilt. Ich sehe aber auch Veränderungen.<br />
Immer mehr Männer wollen ihre Rolle nicht nur auf die<br />
Erwerbsarbeit reduzieren lassen, sie streben ebenfalls eine Balance<br />
von Familie und Job an.<br />
Dennoch fällt es Männern schwer, sich von der Rolle des<br />
Alleinernährers zu verabschieden?<br />
Rosowski: Viele Männer haben die ihnen zugewiesene Verantwortung,<br />
die Familie zu ernähren, verinnerlicht und kommen aus dem<br />
klassischen Rollentypus des Ernährers nicht so leicht heraus. Zu ihrer<br />
Identität gehört vielfach das Bewusstsein, hauptverantwortlich für<br />
den Erwerb der Familie zu sein. Wenn das plötzlich wegfällt, nicht<br />
weil das Paar ein besseres Arrangement gefunden hat, sondern weil<br />
zum Beispiel der Mann seinen Job verliert, kann das zu einer Identitätskrise<br />
führen. Aus dieser Entwertungssituation eine positive<br />
Einstellung zu der neuen Rolle zu entwickeln, ist schwierig. Und:<br />
Männer sind in ihrer Wertschätzung oft auf Entgelt fixiert. Es ist<br />
ein Symbol dafür, dass man integriert ist mit seiner Tätigkeit, eingebunden<br />
in den Produktionsprozess.<br />
Brouwers: Frauen finden da eher andere Dinge, aus der sie ihre<br />
Wertschätzung beziehen, ob Kindererziehung oder Ehrenamt. Aber<br />
für beide ist es eine Herausforderung. Oft kommen die Paare aus<br />
Familien, in denen ein klassisches Familienbild gelebt wird. Sie<br />
müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie diesem Bild nicht<br />
mehr entsprechen. Zusätzlich entsteht sozialer Druck. Wie wird das<br />
neue Arrangement von der Gesellschaft, von Familie und Freunden<br />
bewertet? Wir sind dabei noch sehr in geschlechtsspezifischen<br />
Zuschreibungen gefangen.
Da sind wohl neue Rollenleitbilder für Männer und Frauen<br />
gefragt?<br />
Rosowski: Beide Seiten werden sich bewegen müssen. Männer<br />
sollten dabei lernen, sich nicht ausschließlich auf die Ernährerrolle<br />
zu fixieren, sondern einen Beruf wählen, der ihren Fähigkeiten und<br />
Neigungen entspricht. Dann ist es auch möglich, das Berufsspektrum<br />
zu erweitern und zum Beispiel Erzieher oder Altenpfleger<br />
zu werden. Die Reproduktionsarbeit und die Erwerbsarbeit müssen<br />
in einer Partnerschaft auf beider Schultern verteilt werden. Ein<br />
neues männliches Rollenbild darf nicht die Übernahme der alten<br />
Frauenrolle bedeuten. Da sind kreative Arrangements gefragt, die<br />
gemeinsam entwickelt werden müssen.<br />
Brouwers: Und Frauen dürfen sich nicht mit prekären Arbeitssituationen,<br />
mit Teilzeit und Minijobs zufriedengeben. Sie müssen<br />
Vollzeitbeschäftigung einfordern oder einen Job, in dem sie ausreichend<br />
verdienen. Umdenken muss viel früher anfangen. Auch<br />
wenn das Gehalt des Mannes im „normalen“ Leben ausreicht,<br />
reicht die Rente des Mannes auch noch für beide? Außerdem<br />
sollten Frauen sich Gedanken machen, ob sie sich im Falle einer<br />
Trennung ernähren können und wie ihre eigene Rente aussieht.<br />
Es ist wichtig, dass Frauen an ihre Altersversorgung denken. Da ist<br />
noch ganz viel Nachholbedarf.<br />
Wie kann ein neues Verständnis von Familie und Partnerschaft<br />
auf den Weg gebracht werden?<br />
Brouwers: Ich würde bei der Elternzeit anfangen. Mann und Frau<br />
bekommen jeweils sieben Monate, die sie nehmen müssen. Aber<br />
auch in der Werbung muss Schluss sein mit den klassischen Rollenbildern.<br />
Auch das hat Vorbildfunktion. Und: wir müssen den Mehrwert<br />
stärker herausstellen, der sich aus einer anderen Verteilung der<br />
Familien- und Erwerbsarbeit ergibt. Die wertvolle Zeit, die man zum<br />
Beispiel mit Kindern verbringt, das wird viel zu wenig thematisiert.<br />
Rosowski: Auf der anderen Seite darf auch Erwerbsarbeit nicht als<br />
notwendiges Übel angesehen werden. Arbeit gehört als wichtiger<br />
Bestandteil zum Leben. Es muss selbstverständlich werden, dass ein<br />
Vater nicht nur arbeitet, sondern vielfältige Optionen hat, die im<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
INTERVIEW<br />
8<br />
Lebensverlauf wechseln können. Der Vorschlag, die Elternzeit<br />
paritätisch aufzuteilen, kann nur gelingen, wenn wir auch das<br />
Thema Entgelt mit einbeziehen. Da ist Politik gefragt, denn solange<br />
sich Nachteile in der Einkommenssituation ergeben, fällt auch die<br />
Entscheidung für eine längere Elternzeit anders aus.<br />
Welche Konsequenzen und Forderungen für eine moderne<br />
Frauen- und Männerpolitik ergeben sich daraus?<br />
Rosowski: Es geht nicht nur um Männer- und Frauenpolitik,<br />
sondern insgesamt wird die aktuelle Sozial- und Familienpolitik<br />
dieser veränderten Situation nicht mehr gerecht. Das fängt schon<br />
beim Ehegattensplitting an, hier wird einseitig das Alleinverdienermodell<br />
gefördert – das ist ein Unding.<br />
Brouwers: Das sehen wir vom Deutschen Frauenrat genauso und<br />
fordern seit Jahren die Abschaffung des Ehegattensplittings.<br />
Darüber hinaus dürfen Frauen auch nicht länger 23 Prozent weniger<br />
verdienen als Männer. Es müssen endlich politische Voraussetzungen<br />
geschaffen werden, die den Entgeltunterschied nicht<br />
mehr zulassen. Auch die Abschaffung von Minijobs ist ein wichtiger<br />
Punkt. Wir brauchen Arbeitsplätze, die ab dem ersten Euro versicherungspflichtig<br />
sind. Für die bessere Vereinbarkeit brauchen wir mehr<br />
Kindertageseinrichtungen mit längeren Öffnungszeiten, zum<br />
Beispiel auch an Wochenenden. Wir wollen alles rund um die Uhr<br />
nutzen, aber wie Arbeitnehmerinnen mit Kindern das hinbekommen,<br />
kümmert uns wenig. Hier ist gesamtgesellschaftliche<br />
Verantwortung gefragt, insbesondere im Hinblick auf Alleinerziehende.<br />
Rosowski: Moderne Frauen- und Männerpolitik muss neben den<br />
genannten Forderungen aber noch viel mehr. Es ist eine Querschnittsaufgabe,<br />
die einen geschlechtsspezifischen Blick auf Lebensumstände<br />
und Lebenssituationen wirft. Die Frage, wie unterschiedlich<br />
Frauen und Männer von bestimmten Lebensumständen und<br />
politischen Entscheidungen betroffen sind, geht nicht nur die<br />
Familienpolitik an, sondern genauso die Arbeitsmarkt-, Sozial und<br />
Finanzpolitik. Wir müssen das Prinzip des Gender Mainstreaming<br />
wieder auf die Agenda setzten. Leider stellt die Frauen- und<br />
Männerpolitik auch im Bundesfamilienministerium „nur“ eine
INTERVIEW<br />
Ressortfrage dar. Darum brauchen wir auch geschlechtsspezifische<br />
Referate, die die Genderperspektive in alle Politikbereiche als Querschnittsaufgabe<br />
einbringen. Wir brauchen beide Blickwinkel, sonst<br />
geht es nicht.<br />
Mehr Frauen in Führungspositionen und gut bezahlten Jobs,<br />
mehr Männer, die Haushalt und Kinderbetreuung übernehmen.<br />
Wie muss eine Jungen- und Mädchenarbeit<br />
aussehen, die diese Entwicklung fördert?<br />
Brouwers: Für die Mädchen wünsche ich mir, dass sie mehr in<br />
männliche Berufe vordringen. Aber auch wenn Mädchen typische<br />
Frauenberufe anstreben, sollten sie lernen, dort Verantwortung zu<br />
übernehmen. Zum Beispiel ihren Meister machen oder sich in<br />
Führungs- und Leitungspositionen hocharbeiten. Mädchen müssen<br />
die Konsequenzen deutlicher werden. Was passiert, wenn eine Frau<br />
zum Beispiel über längere Zeit zu Hause bleibt. Eine längere Kinderzeit<br />
bedeutet leider immer noch einen Karrierebruch. Es geht um die<br />
Risiko-Folgen-Abschätzung. Mädchen müssen sich fragen, was<br />
bedeutet es für mich in zehn Jahren, wenn ich mich jetzt so<br />
entscheide. Welche Konsequenzen ergeben sich für die Zukunft?<br />
Rosowski: Ich denke, in diesem Bereich besteht auch bei Jungen<br />
Beratungsbedarf. Doch wenn wir von Förderung sprechen, müssen<br />
wir bei einer genderbewussten Arbeitsmarktpolitik ansetzen.<br />
Mädchen muss man unterstützen, ihre tatsächlichen Fähigkeiten zu<br />
entwickeln und deutlich machen, welche Verdienst- und Aufstiegschancen<br />
sie in bestimmten Berufen haben. Jungen muss man<br />
aufzeigen, welche Gefahren damit verbunden sind, rein männlich<br />
besetzte Berufe zu ergreifen. 90 Prozent aller männlichen Hauptschulabgänger<br />
wollen Kfz-Mechatroniker werden. Dort gibt es aber<br />
nur ganz geringe Kapazitäten bei höchsten Qualitätsanforderungen.<br />
Das Scheitern des Berufswunsches ist somit vielfach vorprogrammiert.<br />
Wenn wir Jungen für andere Berufe sensibilisieren wollen,<br />
müssen wir gute Vorbilder bieten. Lebensbereiche, in denen Empathie<br />
und Fürsorge eine Rolle spielen, müssen an Männerherzen<br />
herangetragen werden. Jungenarbeit auf Haushaltskurse zu reduzieren,<br />
wäre zu kurz gedacht.<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
9<br />
SCHWERPUNKT<br />
VERANTWORTUNGSLAST<br />
ODER VERLUSTÄNGSTE?<br />
VOM LÖSEN UND FESTHALTEN AM<br />
MÄNNLICHEN ERNÄHRERMODELL<br />
Von Carsten Wippermann<br />
CARSTEN WIPPERMANN IST PROFESSOR FÜR SOZIO-<br />
LOGIE AN DER KATHOLISCHEN STIFTUNGSFACH-<br />
HOCHSCHULE MÜNCHEN UND GRÜNDER DES DELTA-<br />
INSTITUTS FÜR SOZIAL- UND ÖKOLOGIEFOR-<br />
SCHUNG. VON 2000 BIS 2010 WAR ER DIREKTOR<br />
DER SOZIALFORSCHUNG IM INSTITUT SINUS SOCIO-<br />
VISION IN HEIDELBERG.<br />
Obwohl Frauen immer häufiger die Rolle der Familienernährerin<br />
einnehmen, gibt der männliche Partner sein<br />
bisheriges Selbstverständnis als Familienernährer meist<br />
nicht auf und sieht sich weiterhin in dieser Pflicht. Oft<br />
geschieht dies aus einem tieferliegenden Motiv: der<br />
Verdrängung der eigenen unsicheren und auch prekären<br />
Erwerbssituation und der Abwehr von Aufgaben im Haushalt<br />
und bei der Kinderversorgung.<br />
Frauen, die nach einer oft längeren familienbedingten Erwerbsunterbechung<br />
(für Kinderversorgung, Schulbegleitung, Pflege) in den<br />
Arbeitsmarkt einsteigen, haben heute eine existenzielle Funktion für<br />
die finanzielle Sicherung der Familie. Es steigt der Anteil von Familienernährerinnen,<br />
die heute mehr als 18 Prozent aller Erwerbspersonenhaushalte<br />
ausmachen, etwa die Hälfte Alleinerziehende, die Hälfte mit<br />
einem Partner. Die zunehmende ökonomische Bedeutung von Wiedereinsteigerinnen<br />
und Familienernäherinnen macht deutlich, dass das<br />
Konzept des männlichen Haupternährers, mit dem die Verwaltung,<br />
Schulen, Gesundheitsvorsorger, Arbeitgeber und andere Dienstleister<br />
die Familien immer noch selbstverständlich konfrontiert und dieses als<br />
normales Modell voraussetzt, nur noch für einen Teil gilt und eigentlich<br />
„outdated“ ist.
Berufstätigkeit als Existenzsicherung<br />
Bei Frauen ist in den vergangenen Jahren die Bedeutung materieller<br />
Motive für ihre Berufstätigkeit gestiegen. Das ist zum einen auf ein<br />
verändertes Rollenbild von Frauen zurückzuführen, vor allem die<br />
Bedeutung ihrer Berufstätigkeit für die aktuelle und zukünftige<br />
Existenzsicherung ihrer Familie und ihres Lebens im Alter. Zum<br />
anderen war – mit katalysatorischer Wirkung – die globale Finanzund<br />
Wirtschaftskrise 2008/2009 ein entscheidendes Ereignis. In dieser<br />
Phase verloren vor allem Vollzeit beschäftige Männer ihren Arbeitsplatz<br />
(oder waren zur Kurzarbeit gezwungen), so dass ein erheblicher<br />
Teil der Frauen – oft unfreiwillig aufgrund ökonomischer Zwänge – zu<br />
Familienernährerinnen wurden bzw. sich erstmals mit dieser Perspektive<br />
ernsthaft auseinandersetzten: Eine Alltagserfahrung und Strukturveränderung<br />
nicht nur am unteren Rand der Gesellschaft, sondern<br />
auch die soziale Mitte der Gesellschaft.<br />
Männer unterschätzen Motivation der Partnerin<br />
Dabei unterschätzen Männer meist die materielle Motivation ihrer<br />
Partnerin! Wenn Männer über die Erwerbsmotive ihrer Partnerin nachdenken,<br />
dann meinen sie primär, dass erstens der Beruf vor allem für<br />
das Selbstwertgefühl ihrer Partnerin wichtig sei; zweitens, dass ihr<br />
überwiegender Beitrag für das Familieneinkommen zwar aktuell hilfreich<br />
und vielleicht sogar notwendig sei, aber insgesamt eine vorübergehende<br />
Phase, etwas Abweichendes, Deviantes außerhalb<br />
„normaler“ Verhältnisse.<br />
������� ���� ��� ���� ���<br />
��������� ��������������������������������������<br />
�������������� ��� ��� ����������������� �����������<br />
��������������������� ��� ��������������������<br />
������� ���������������������<br />
����� ��� ������������ ��� ������ ������������ ������<br />
���� ��� ��� ��������� ��� ���������� �������� �����<br />
�������������������� ��������<br />
�������� ��� ���������������������� ������ ��� ����������<br />
���<br />
��� ��� ������� ���� ����������������� ������������������<br />
�� ����������� �����������<br />
����� ���� ������ ���� ���������� ��� ����������� �������<br />
���������� ����������������� ������<br />
��<br />
������ ����<br />
������ ����<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
SCHWERPUNKT<br />
����<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
10<br />
Die zwei wichtigsten Erwerbsmotive von Frauen (finanzielle<br />
Absicherung im Alter, finanzielle Existenzsicherung der Familie)<br />
rangieren in der Projektion der Männer 2010 deutlich hinter der<br />
Selbstwert-Hypothese. Die Männer gehen 2010 sogar davon aus, dass<br />
bei Frauen die Bedeutung des Motivs „Existenzsicherung der Familie“<br />
im Vergleich zu 2008 leicht abgenommen habe. Wenn die Frau in<br />
einer Partnerschaft faktisch die Rolle der Familienernährerin übernimmt,<br />
gibt der männliche Partner sein bisheriges Selbstverständnis<br />
als Familienernährer keineswegs auf, sondern sieht sich weiterhin in<br />
dieser Pflicht.<br />
������� ���� ��� ��������<br />
Erwerbsmotive von Frauen – aus Sicht des Partners<br />
Der Beruf ist wichtig für das Selbstwertgefühl<br />
Etwas tun für die finanzielle Sicherung im Alter<br />
Geld verdienen für die finanzielle Existenzsicherung der Familie<br />
Eigenes Geld verdienen wollen<br />
Nicht nur als Hausfrau und Mutter wahrgenommen werden<br />
Geld für die Erfüllung von besonderen Wünschen haben<br />
Mit dem Partner eine gleichberechtigte Aufgabenverteilung in<br />
Familie und Beruf haben<br />
Haushalt und Kindererziehung allein füllen die Frau nicht aus<br />
��<br />
��<br />
Wenn Männer die „Freiwilligkeit“ und persönliche Sinnhaftigkeit des<br />
Wiedereinstiegs der Frau betonen (Selbstwertgefühl, Selbstverwirklichung,<br />
nicht nur als Hausfrau und Mutter wahrgenommen werden),<br />
ist das tieferliegende Motiv die Verdrängung der eigenen unsicheren<br />
und auch prekären Erwerbssituation, sowie Abwehr von Aufgaben im<br />
Haushalt und bei der Kinderversorgung. Die Beharrung auf die eigene<br />
Rolle als Haupternährer ist Ausdruck eines Nicht-sehen- und Nichtanerkennen-wollens,<br />
dass die Partnerin (bzw. Frauen) die Funktion<br />
und Rolle als Haupternährer „natürlich“ erfüllen.<br />
Männliche Rollenmuster noch immer zu schmal<br />
Es ist zugleich Ausdruck dafür, dass die gesellschaftlichen Rollenmuster<br />
für Männer auch heute noch sehr schmal (fast eindimensional)<br />
sind und ihnen kaum attraktive Optionen bieten für den Fall, dass sie<br />
eines der standardisierten Rollenmuster (wie des Haupternährers)<br />
aufgrund äußerer Umstände nicht bedienen können. Sie kommen vor<br />
��<br />
Väter 2010<br />
Väter 2008<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
����<br />
8
sich selbst, vor Freunden, Nachbarn und der Öffentlichkeit in erhebliche<br />
und nur schwer lösbare Legitimationsnöte. Hier ist ein Wandel<br />
von Männerbildern dringend notwendig – nur kann er nicht verordnet<br />
werden. Wenn der berufliche Wiedereinstieg einer Frau von ihrem<br />
Partner wie von der Gesellschaft primär als ihr persönliches Plus<br />
betrachtet wird, dann wird ihr auch reflexhaft zugewiesen, die alten<br />
und neuen Aufgaben für die Familie alleine zu erfüllen oder zu organisieren.<br />
Wie sehr Männer an ihrem Rollenbild als „Haupternährer der<br />
Familie“ festhalten, wird an folgenden Befunden deutlich:<br />
• Selbst wenn Männer nicht erwerbstätig sind, haben sie von sich<br />
das Selbstbild, jemand zu sein, der Karriere machen möchte.<br />
Daraus leiten sie dann mitunter Ansprüche und Freistellungen<br />
(Dispensen) innerhalb des Haushalts und der Familie ab.<br />
• Nicht erwerbstätige Männer bekunden zwar mehrheitlich<br />
(57 Prozent), dass sie gern Zeit mit ihrer Familie verbringen<br />
möchten – aber sehr viel seltener als Frauen (71 Prozent).<br />
So bieten die meisten Männer ihren Anteil zur Entlastung ihrer Partnerin<br />
meist nicht offensiv an, noch seltener gehen sie in Vorleistung.<br />
Die Gründe für dieses passive, nur reaktive Verhalten sind vor allem<br />
Orientierungsunsicherheit und Verlustsorgen, die auf eigene Rollenambivalenzen<br />
zurückzuführen sind und im Kern ihre Identität als<br />
„Haupternährer der Familie“ betreffen: Einerseits fühlen sie sich von<br />
der Last dieser Verantwortung in zunehmendem Maße unter Druck<br />
gesetzt; andererseits halten sie an dieser Rolle fest.<br />
Gleichstellungspolitische Konsequenzen gefordert<br />
Das muss Konsequenzen haben für die Gleichstellungspolitik in der<br />
Lebenslaufperspektive: Eine vordringliche Aufgabe ist es, das Thema<br />
Familienernährerin in der Weise zu stärken und die Rahmenbedingungen<br />
zu schaffen (endlich Entgeltgleichheit), dass Frauen<br />
phasenweise oder kontinuierlich die Hauptverdienerin sein können<br />
und dass die Dynamik von Lebensverläufen im Sinne der „linked<br />
lives“ es vordringlich erscheinen lässt, sich dieser Tatsache bewusst<br />
zu werden. Das erfordert Entlastung durch den Partner und echte<br />
Verantwortungsteilung – somit auch ein Umdenken von Erwerbszeit<br />
in gemeinsamer Lebenslaufperspektive: Frauen unterschätzen meist<br />
das Entlastungspotenzial ihres Partners und überschätzen ihren<br />
eigenen Kräftehaushalt. Das führt sehr häufig zu Selbstausbeutung<br />
oder zu Unzufriedenheit.<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
SCHWERPUNKT<br />
11<br />
Notwendig für Frauen – und insbesondere für Familienernährerinnen<br />
– sind daher zeitliche Neuverteilungen der häuslichen und Familienaufgaben<br />
zwischen den Partnern. Dazu wäre auch darüber nachzudenken,<br />
neue Wege zu gehen. In einer repräsentativen Befragung von<br />
Müttern und Vätern haben wir gefragt, ob sie sich vorstellen könnten,<br />
dass der Partner vorübergehend die eigene Arbeitszeit reduziert und<br />
hierfür einen Entgeltausgleich erhält, um den beruflichen Wiedereinstieg<br />
der Frau zu erleichtern. Das könnte zum Beispiel eine Reduzierung<br />
auf 70 Prozent der Arbeitszeit sein. Für den 30-prozentigen<br />
Lohnwegfall würde der Mann ein anteiliges staatliches Partnergeld<br />
erhalten. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Nur 14 Prozent der<br />
Mütter und 17 Prozent der Väter zwischen 25 und 60 sagen, dass<br />
sie diese Idee nicht gut finden. Ein Viertel der Mütter und sogar ein<br />
Drittel der Väter halten die Idee hingegen ausdrücklich für gut und<br />
könnten sich vorstellen sie zu nutzen.<br />
Haushaltsnahe Dienstleistungen als Entlastung<br />
Eine ergänzende und in der Alltagspraxis hochwirksame Option sind<br />
haushaltsnahe Dienstleistungen zur zeitlichen Entlastung von<br />
erwerbstätigen Frauen. Doch gegenüber haushaltsnahen Dienstleistungen<br />
bestehen noch Vorbehalte und Hemmnisse, gerade weil<br />
man noch nicht wieder erwerbstätig ist und dieses „gegenfinanziert“<br />
ist. Die meisten Mütter haben nur wenige Informationen über den<br />
Markt der Anbieter und das Angebotsspektrum; und groß sind<br />
Unsicherheiten bezüglich der Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit, der<br />
individuellen Passung und Qualität der haushaltsnahen Dienstleister,<br />
die aber vonnöten wären, damit man sich selbstverständlich auf diese<br />
stützten könnte.<br />
Oft erst dann, wenn der berufliche Wiedereinstieg vollzogen ist oder<br />
der Kräftehaushalt der Frau aufgebraucht ist, erkennen die Frauen<br />
(und Männer), wie wichtig haushaltsnahe Dienstleistungen schon zu<br />
einem früheren Zeitpunkt gewesen wären, wie wichtig eine stärkere<br />
Teilung der Aufgaben in Haushalt und Erziehung mit dem Partner<br />
gewesen wäre – und ist.<br />
Studien:<br />
· Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspektiven<br />
· Haushaltsnahe Dienstleistungen – Bedarfe und Motive<br />
beim beruflichen Wiedereinstieg<br />
Untersuchungen vom DELTA-Institut für das Bundesministerium<br />
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Mai <strong>2011</strong><br />
www.bmfsfj.de
DOPPELT BELASTET<br />
UND AM LIMIT<br />
FAMILIENERNÄHRERINNEN IM SPAGAT<br />
ZWISCHEN ARBEIT UND PRIVATLEBEN<br />
Von Christina Stockfisch<br />
DR. CHRISTINA STOCKFISCH IST LEITERIN DES<br />
PROJEKTES „VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND<br />
BERUF GESTALTEN!“ BEIM <strong>DGB</strong>-BUNDES-<br />
VORSTAND.<br />
In Haushalten von Familienernährerinnen werden neue<br />
Alltagspraktiken familialer Lebensführung möglich und<br />
nötig. Die „Normalfamilie“ und das „Normalarbeitsverhältnis“<br />
existieren immer seltener. Die damit verbundene<br />
doppelte Entgrenzung von Arbeit und Privatleben/Familie<br />
birgt vielerlei Risiken und Belastungen für<br />
Familienernährerinnen, aber auch neue Gestaltungschancen<br />
.<br />
Das Normalarbeitsverhältnis hat in den letzten Jahrzehnten insgesamt<br />
stark an Bedeutung verloren, da „atypische“ Beschäftigungsformen<br />
wie Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, Befristungen<br />
und Leiharbeit zunehmen. Damit einher geht eine massive Flexibilisierung<br />
in Lage, Dauer und Verteilung von Arbeitszeiten. Aber auch<br />
die räumliche Entgrenzung von Arbeit nimmt zu. Gefordert sind<br />
Mobilität und Erreichbarkeit rund um die Uhr. Diese Verfügbarkeitskultur<br />
greift in das Familienleben der Beschäftigten ein und<br />
erschwert das Zusammensein der Familienmitglieder. So wird das<br />
Familienleben immer komplexer, die räumliche und vor allem zeitliche<br />
Eingebundenheit der Eltern als auch der Kinder wächst.<br />
Gemeinsam verbrachte Zeit – geplant oder „beiläufig“ – ist jedoch<br />
für intakte Familienbeziehungen wichtig. Familien brauchen<br />
gemeinsame Routinen, wie gemeinsame Mahlzeiten, um miteinander<br />
ins Gespräch zu kommen, Konflikte zu lösen und den Alltag<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
12<br />
zu organisieren. Durch Erwerbsarbeit zu unsozialen und familienunfreundlichen<br />
Zeiten wird dies jedoch zunehmend schwieriger.<br />
Widersprüchliche Anforderungen<br />
führen zu Rollenkonflikten<br />
Familienernährerinnen erleben diese gesellschaftlichen Veränderungen<br />
durch ein Brennglas gebündelt. Sie versuchen, die teilweise<br />
widersprüchlichen Anforderungen von Familie und Beruf zu vereinbaren.<br />
Die Folge sind Rollenkonflikte und Spannungen in der Partnerschaft<br />
und im Familienleben. Nicht zuletzt wird bei diesem<br />
täglichen Spagat die eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Die<br />
entgrenzten Anforderungen an zeitliche und räumliche Verfügbarkeit<br />
im Job und in der Familie gehen häufig auf Kosten der Eigenzeit.<br />
Meist bleibt den Familienernährerinnen kaum Zeit und Kraft für<br />
eigene Interessen und ausreichende Erholungsphasen. Meist fehlt<br />
zudem die Entlastung durch den Partner.<br />
Dieser Balanceakt kann im Alltag und im Lebensverlauf kaum allein<br />
bewältigt werden, da gerade familiale Anforderungen oft nicht<br />
verlagert werden können. Viele Familienernährerinnen arbeiten in<br />
Berufen, deren Arbeitszeitanforderungen nicht mit den üblichen<br />
Kita-Öffnungszeiten übereinstimmen. Sie brauchen soziale Netzwerke,<br />
damit keine Betreuungslücken entstehen. Der Organisationsaufwand,<br />
um Großeltern, Verwandte, Freunde und Nachbarn aktiv<br />
mit einzuspannen, ist groß aber alternativlos. Die doppelte Entgrenzung<br />
in Beruf und Familienleben bleibt jedoch nicht ohne<br />
Folgen: Überforderung, Anspannung, schlechtes Gewissen und das<br />
Gefühl, in beiden Bereichen nicht zu genügen, belasten die<br />
Familienernährerinnen.<br />
Familienernährerinnen in zeitlich belastenden Jobs<br />
Darüber hinaus sind Familienernährerinnen zumeist in Dienstleistungsberufen<br />
(Altenpflegerinnen, Krankenschwestern, Hebammen,<br />
Erzieherinnen, Verkäuferinnen) tätig, die durch schwierige<br />
Arbeitsbedingungen gekennzeichnet sind. Sie gehören außerdem zu<br />
den zeitlich am intensivsten belasteten Beschäftigtengruppen. Sie<br />
arbeiten im Schichtdienst und Berufen mit atypischen Arbeitszeiten<br />
(abends, nachts, Wochenende).<br />
Hinzu kommen Belastungen durch vom Arbeitgeber geforderte und<br />
meist nur kurzfristig angekündigte Überstunden. Die oftmals nur<br />
teilweise oder nur nach Protest durch die Betroffenen ausbezahlt
oder in Freizeit entgolten werden. Auch bei der Arbeitszeitfestlegung<br />
sind viele Arbeitgeber ignorant gegenüber der besonderen<br />
Situation von Familienernährerinnen, die meist neben dem<br />
Beruf noch für Fürsorgeaufgaben (Kindererziehung, Pflege) hauptverantwortlich<br />
sind. Viele Familienernährerinnen leiden auch unter<br />
den erwerbsbedingten Mobilitätsanforderungen, vor allem im<br />
ambulanten Pflegedienst.<br />
Überarbeitung führt zu Erschöpfungszuständen<br />
All diese Belastungen kumulieren und führen zu Überarbeitung und<br />
Erschöpfungszuständen. Insbesondere alleinerziehende Mütter und<br />
vollzeiterwerbstätige Frauen sind deshalb gesundheitlich „am<br />
Limit“. Es ist zu befürchten, dass die aktuellen Erwerbsbedingungen<br />
und die daraus resultierende Vereinbarkeitsproblematik für viele<br />
Familienernährerinnen ein Aushalten der Belastungen bis zum<br />
Rentenalter unmöglich machen. Viele Familienernährerinnen<br />
betrachten ihr gegenwärtiges Lebensarrangement als auf Dauer<br />
nicht tragbar.<br />
Das gilt jedoch nicht für alle Familienernährerinnen. Einige von<br />
ihnen – meist mit hoher Qualifikation und entsprechender Arbeitsmarktposition<br />
- leben in Absprache mit ihrem bewusst beruflich<br />
weniger orientierten Partner in veränderten Geschlechterarrangements.<br />
Diese Arbeitsteilung trägt zur Feminisierung der Erwerbswelt<br />
bei und zeigt neue Rollenbilder für Männer – jenseits der Ernährerfunktion.<br />
Hierin liegt das emanzipatorische Potenzial der Familienernährerinnen,<br />
das viel zu selten zur Geltung kommt.<br />
Partnerschaftliche Arrangements sind gefragt<br />
Doch in den meisten Paarhaushalten, in denen die Frau den Großteil<br />
zum Familieneinkommen beiträgt, werden trotz veränderter<br />
Erwerbskonstellation nach wie vor eher „klassische“ Rollen in der<br />
Fürsorge und im Haushalt gelebt. Das führt nicht zu egalitärer<br />
Arbeitsverteilung, sondern nur zu mehr Arbeit und Verantwortung<br />
für die Frauen. Hier gilt es, die Geschlechterrollen in der Erwerbswelt<br />
und in der Fürsorgearbeit aufzuweichen, damit Frauen nicht<br />
länger nur als Hinzuverdienerin wahrgenommen werden. Auch in<br />
der Fürsorgearbeit müssen partnerschaftliche Arrangements<br />
entstehen, die neue Leitbilder und Rollenzuweisungen für Frauen<br />
und Männer umsetzen.<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
SCHWERPUNKT<br />
13<br />
Doch ob weibliches oder männliches Ernährermodell – egalitäre<br />
Einkommenskonstellationen von Partnern weisen in jedem Fall<br />
deutliche Vorteile auf. Sie geben beiden Partnern Teilhabe- und<br />
Entfaltungschancen in Beruf und Familie und sind mit höheren<br />
Einkommen und Zufriedenheit verbunden. Dann spielt das<br />
Geschlecht nicht mehr die entscheidende Rolle bei der Gestaltung<br />
der familialen Lebensführung – Arbeits- und Familienzeiten werden<br />
für Männer und Frauen besser vereinbar.<br />
Ute Klammer, Christina Klenner und Svenja Pfahl:<br />
Frauen als Ernährerinnen der Familie: Politische<br />
und rechtliche Herausforderungen, Policy Paper 2010<br />
www.familienernaehrerin.de<br />
Karin Jurczyk, Michaela Schier, Peggy Szymenderski, Andreas<br />
Lange, G. Günter Voss: Entgrenzte Arbeit – entgrenzte Familie:<br />
Grenzmanagement im Alltag als neue Herausforderung,<br />
Edition Sigma 2009<br />
Kontakt: <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand<br />
Projekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />
gestalten! Familienbewusste Arbeitszeiten“<br />
Dr. Christina Stockfisch<br />
Tel. 030-24060-565<br />
christina.stockfisch@dgb.de<br />
www.familie.dgb.de
HOCHQUALIFIZIERTE<br />
FAMILIENERNÄHRERINNEN<br />
UNABHÄNGIG UND DOCH IN<br />
ALTEN ROLLENMUSTERN VERHAFTET<br />
Von Melitta Kühnlein<br />
MELITTA KÜHNLEIN IST PROJEKTLEITERIN<br />
DES <strong>DGB</strong>-POLITIKENTWICKLUNGSPROJEKTES<br />
„MODELL DER FAMILIENERNÄHRERIN“.<br />
Eine kleine Gruppe von Familienernährerinnen hat sich in<br />
Absprache mit dem Partner für die Übernahme der finanziellen<br />
Hauptverantwortung entschieden. In diesen Haushalten<br />
zeigen sich neue Wege im familiären Zusammenleben.<br />
Doch gerade diese Haushalte greifen zu ihrer<br />
Entlastung auf gering entlohnte Helferinnen zurück und<br />
bestärken damit das alte Rollenbild der Zuverdienerin.<br />
In den alten wie in den neuen Bundesländern findet sich, unter<br />
den in den beiden Forschungsprojekten „Flexible Familienernährerinnen“<br />
befragten Familienernährerinnen, eine kleine<br />
Gruppe Frauen, die den Status der Familienernährerin freiwillig<br />
übernommen haben. Sie haben in der Regel eine hohe Qualifikation,<br />
eine hohe berufliche Position und verfügen über ein überdurchschnittliches<br />
Einkommen.<br />
Hochqualifizierte Familienernährerinnen in den alten Bundesländern<br />
haben eine überdurchschnittlich starke Erwerbsorientierung<br />
und verfolgen eigene berufliche Ziele. Ein Zurückfallen in<br />
alte Rollenmuster wird von diesen Familienernährerinnen abgelehnt.<br />
Da die Frau über ein hohes Einkommen verfügt, sind die<br />
Haushalte in der Regel finanziell gut gestellt – unabhängig vom<br />
Einkommen des Mannes. Vielmehr sind die Partner beruflich<br />
weniger engagiert. Oft ist es beiden Partnern früh klar, dass die<br />
Frau die besseren beruflichen Chancen hat. Mit der Entscheidung,<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
14<br />
das Modell ‚Familienernährerin’ zu leben, erfüllen sie sich ihre<br />
Voraussetzung für die Verwirklichung der von ihnen geplanten<br />
familiären Arbeitsteilung und oft den Wunsch, die Betreuung der<br />
Kinder in der Familie zu belassen. Dementsprechend sind ihre<br />
Partner hoch familienorientiert.<br />
Alle Familienernährerinnen in Ostdeutschland zeichnen sich<br />
dadurch aus, dass sie sehr deutlich erwerbsorientiert sind und fast<br />
ausnahmslos eine Erwerbstätigkeit beider Partner anstreben. Auch<br />
hier gibt es Familienernährerinnen, die hoch qualifiziert sind und<br />
gegenüber ihrem Partner über einen Karrierevorsprung verfügen.<br />
Der Status als Familienernährerin wird von ihnen geschätzt und<br />
viele von ihnen wissen seit Beginn der Partnerschaft (wie in den<br />
alten Bundesländern auch), dass der Haushalt durch eine<br />
Familienernährerin versorgt werden wird. Der Partner ist oft ebenfalls<br />
berufstätig, verfügt jedoch über ein niedrigeres Einkommen.<br />
Familienernährerinnen und ihre Familien, die dieser kleinen Gruppe<br />
angehören, haben damit einen in Deutschland bislang unüblichen<br />
Weg eingeschlagen: eine hoch qualifizierte, beruflich gut positionierte<br />
Frau sorgt für das finanzielle Auskommen der Familie,<br />
während der Partner zugunsten der Familie beruflich kürzer tritt.<br />
Doch selbst in diesen Familien finden sich weiterhin geschlechtsspezifische<br />
Muster der Haus- und Fürsorgearbeit: zwischen den<br />
beiden Partnern kommt es nicht zu einem generellen Rollentausch.<br />
Für alle Familienernährerinnen – auch für die Hochqualifizierten –<br />
gilt, dass sie in der Regel weiterhin einen Gutteil der unbezahlten<br />
Arbeit rund um Haus und Familie übernehmen.
Die in den Forschungsprojekten zunächst angenommene Vermutung,<br />
dass Familienernährerinnen mit einem höheren<br />
Einkommen auch eine größere Verhandlungsmacht in der Familie<br />
erreichen, hat sich nicht bestätigt. Was ausschlaggebend für die<br />
gelebten Rollen in der Partnerschaft ist, sind dagegen die Rollenmuster<br />
in den Köpfen beider Partner. Viele Familienernährerinnen<br />
können sich trotz Hauptverdienerstatus nicht einfach von ihren<br />
traditionellen Rollenbildern lösen. Sie stellen deshalb oft nur<br />
wenige Ansprüche an den Partner im Hinblick auf die Übernahme<br />
unbezahlter Haus- und Fürsorgearbeit. Was jedoch eingebunden<br />
wird, sind weibliche Haushalts- und Betreuungshilfen. Diese<br />
Frauen haben jedoch ihrerseits, aufgrund der geringen Entlohnungsstruktur<br />
als Tagesmutter oder Haushaltshilfe, nicht die<br />
Chance einer eigenständigen Existenzsicherung.<br />
Einerseits etablieren damit also einige hoch qualifizierte und<br />
gut verdienende Familienernährerinnen eine stärkere Einbindung<br />
ihrer Männer in die anfallenden Haus- und Fürsorgearbeiten.<br />
Andererseits wird durch das Zurückgreifen auf haushaltsnahe<br />
Dienstleistungen in anderen Haushalten das traditionelle<br />
Ernährermodell mit einer Frau als Zuverdienerin befördert.<br />
Familienernährerinnenhaushalte forcieren damit unter den herrschenden<br />
Begebenheiten sowohl neue Paarbeziehungen als<br />
auch alte Rollenmuster.<br />
Wolfram Brehmer, Christina Klenner und Ute Klammer:<br />
Wenn Frauen das Geld verdienen – eine empirische Annäherung<br />
an das Phänomen der „Familienernährerin“<br />
WSI-Diskussionspapier Nr. 170, Juli 2010<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut<br />
in der Hans-Böckler-Stiftung<br />
www.familienernaehrerin.de<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
15<br />
HAUSHALTSNAHE<br />
DIENSTLEISTUNGEN<br />
CHANCE ODER ZEMENTIERUNG<br />
DER GESCHLECHTERVERHÄLTNISSE?<br />
JENNY HUSCHKE IST REFERENTIN IN DER<br />
ABTEILUNG FRAUEN-, GLEICHSTELLUNGS- UND<br />
FAMILIENPOLITIK BEIM <strong>DGB</strong> BUNDESVORSTAND<br />
UND DORT INSBESONDERE FÜR DIE THEMEN<br />
ARBEITSMARKT- UND BILDUNGSPOLITIK<br />
ZUSTÄNDIG.<br />
Das bisschen Haushalt … ist doch manchmal ganz<br />
schön viel. Zu der Erkenntnis kommen Frauen schnell,<br />
wenn sie Familie und Job unter einen Hut bringen<br />
müssen. Ob und wie haushaltsnahe Dienstleistungen<br />
Familienernährerinnen unterstützen können,<br />
erläutert Jenny Huschke, Referentin in der Abteilung<br />
Frauen-, Gleichstellungs- und Familienpolitik beim <strong>DGB</strong><br />
Bundesvorstand.<br />
Die Zahl der Familienernährerinnen steigt stetig. Doch ihre<br />
Arbeits- und Lebensbedingungen sind häufig wenig geeignet, um<br />
auch noch Kinder oder pflegebedürftige Angehörige gut zu<br />
betreuen und den Haushalt zu regeln. Sind sie in Teilzeit beschäftigt,<br />
dann oft unfreiwillig. Sie kombinieren nicht selten mehrere<br />
Jobs, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Vielleicht würden sie<br />
gerne weniger arbeiten, aber das können sie sich finanziell nicht<br />
leisten. In jedem Fall ist Teilzeit für sie kein Instrument für eine<br />
gute Work-Life-Balance. Egal unter welchen Bedingungen sie das<br />
Familieneinkommen auch erwirtschaften, der Haushalt lastet<br />
meist nach wie vor auf ihren Schultern. Zwischen den Haushaltsangehörigen<br />
wird die Haus- und Sorgearbeit noch lange nicht<br />
gerecht verteilt. Im Gegenteil: Frauen müssen meist „alles“<br />
managen.
Hoher Bedarf an Unterstützung<br />
Familienernährerinnen haben ohne Frage einen hohen Bedarf an<br />
Unterstützung und Entlastung. Die Arrangements, diese oft<br />
komplexen Anforderungen zu managen, sind vielfältig. Häufig sind<br />
sie nur mit einem ausgefeilten sozialen Netzwerk überhaupt zu<br />
bewältigen. Ob haushaltsnahe Dienstleistungen Familienernährerinnen<br />
unterstützen und entlasten können oder eher alte Rollenverteilungen<br />
zementieren, kommt auf die Ausgestaltung an. Aus Sicht<br />
der Haushalte, in denen Frauen die Familie (hauptsächlich) ernähren,<br />
können haushaltsnahe Dienstleistungen eine Unterstützung sein. Die<br />
zentrale Frage dabei lautet: wie werden haushaltsnahe Dienstleistungen<br />
angeboten und sind sie bezahlbar? Einige Familienernährerinnen<br />
sind hoch qualifiziert und arbeiten in gut oder sehr gut<br />
bezahlten Jobs. Sie leben zum Beispiel in Einkommensverhältnissen,<br />
in denen die PartnerInnen ein weiteres Einkommen beisteuern. Für<br />
zwei gut verdienende PartnerInnen – mit und ohne Kinder – ist es<br />
machbar, Dienstleistungen einzukaufen.<br />
Eine Frage des Einkommens und der Prioritätensetzung<br />
Wieder andere Frauen leben das traditionelle Ernährermodell nur mit<br />
„vertauschten“ Rollen, wenn der Partner kein oder kaum eigenes<br />
Einkommen hat und das Einkommen der Frau für den Lebensunterhalt<br />
ausreicht. Hier sind haushaltsnahe Dienstleistungen eine Frage<br />
der Prioritätensetzung, wofür im Haushalt Geld ausgeben wird.<br />
Denn: in Haushaltskonstellationen mit der „vertauschten“ Alleinernährerrolle<br />
übernimmt der Partner in der Regel nicht im gleichen<br />
Maße Haushalt- und Sorgearbeit wie im „klassischen“ männlichen<br />
Alleinverdienermodell.<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
16<br />
Es kommt also wesentlich darauf an, wie die Kosten für haushaltsnahe<br />
Dienstleistungen getragen und gefördert werden.<br />
Grundsätzlich müssten Kosten arbeitgebender Haushalte auch<br />
von der Steuerschuld absetzbar sein. Haushalten mit geringer<br />
oder keiner Steuerschuld (z.B. aufgrund niedriger Einkommen)<br />
sind aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit andere Entlastungswege<br />
zu eröffnen.<br />
Wachsende Schicht unsichtbarer Dienstbotinnen<br />
Aus Sicht der Beschäftigten in Haushalten ist die Frage, ob haushaltsnahe<br />
Dienstleistungen Familienernährerinnen entlasten oder<br />
ob sie alte Rollenbilder festschreiben, schon schwieriger zu beantworten.<br />
Denn hier gerät allzu schnell aus dem Blick, dass auch<br />
Beschäftigte im Haushalt ein Recht auf gute und existenzsichernde<br />
Arbeit, auf Tariflöhne und Arbeitsschutz haben. Erfahrungen<br />
zeigen, dass die steigende Erwerbstätigkeit vieler Frauen<br />
mit einer wachsenden Schicht „unsichtbarer Dienstbotinnen“<br />
einhergeht. Dies bedeutet eine steigende Migration insbesondere<br />
weiblicher Arbeitskräfte, die oft ebenfalls Familie haben, die sie an<br />
ihren Heimatorten zurücklassen. Nicht selten sind diese Beschäftigten<br />
im Haushalt sogar selbst Familienernährerinnen. Hier wird<br />
die traditionelle Arbeitsteilung auf Frauen im Niedriglohnsektor<br />
(mit und ohne Migrationsgeschichte) verlagert.<br />
Rechte und Pflichten für Haushalte als Arbeitgeber<br />
Haushalte sind Arbeitgeber und haben damit Rechte und<br />
Pflichten. Zwischen Arbeitgebern in Privathaushalten und in der<br />
Wirtschaft sollte lediglich hinsichtlich des Anmelde- und Abrech-
nungsverfahren unterschieden werden. Obwohl sie sich in der<br />
Praxis häufig vermischen, müssen haushalts- und personenbezogene<br />
Dienstleistungen differenziert betrachtet werden. Als<br />
Grundsatz gilt: Tätigkeiten, die eine fachliche Qualifikation erfordern<br />
und/oder für die es eine professionelle Ausbildung gibt (z.B.<br />
Gesundheitsversorgung, Hauswirtschaft oder Gebäudereinigung),<br />
müssen adäquat vergütet werden. Auch Beschäftigte im Haushalt<br />
haben Anspruch auf geltende Arbeits- und Lohnstandards wie<br />
Tarifverträge und Arbeitsnormen.<br />
Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung benennt als<br />
zentralen Ansatz zur Förderung regulärer Beschäftigung im Haushalt<br />
den Ausbau einer kostengünstigen und bedarfsgerechten<br />
Infrastruktur für die Betreuung von Kindern und älteren<br />
Menschen. Ergänzend sollten Dienstleistungsunternehmen (kleinere)<br />
Jobs im Haushalt zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung<br />
bündeln – und zwar in Dienstleistungsagenturen. Diese<br />
funktionierten aber, so die Studie, nur mit staatlicher Unterstützung<br />
und müssten subventioniert werden. Dies ist eine Frage politischer<br />
Willensbildung.<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
17<br />
Ausbau und Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Frauen haben sich in den vergangenen Jahren für den<br />
Ausbau und die Förderung haushaltsnaher Dienstleitungen<br />
ausgesprochen. Wir präferieren Pool- oder Agenturlösungen als<br />
Anbieter von Dienstleistungen und damit als Arbeitgeber für<br />
DienstleisterInnen. Diese sind ohne finanzielle Förderung aber<br />
nicht oder nur vereinzelt marktfähig. Ob und wie eine Subventionierung<br />
sozial gerecht gestaltet werden kann, muss diskutiert<br />
werden. Wahlmöglichkeiten zwischen Dienstleistungen im Haushalt<br />
und/oder in der öffentlichen Infrastruktur müssen gegeben<br />
sein, wie zum Beispiel die Pflege zu Hause oder in entsprechenden<br />
Pflegeeinrichtungen. Anforderungen an haushaltsnahe<br />
Dienstleistungen müssen konkret beschrieben werden und die<br />
Bedarfe der KundInnen sowie der Beschäftigten berücksichtigen.<br />
Familienernährerinnen als Katalysator<br />
Bei der Debatte um Wahlfreiheit gilt es auch, gesellschaftliche<br />
Rahmenbedingungen zu diskutieren und einzufordern: Was<br />
verstehen wir mit Blick auf das Thema unter gesellschaftlicher<br />
Verantwortung, unter guter öffentlicher Daseinsvorsorge? Und wie<br />
treten wir, bei aller Wahlfreiheit<br />
und dem gebotenen Respekt für<br />
Menschen und ihre individuellen<br />
Bedürfnisse, einer Verlagerung<br />
von Aufgaben der öffentlichen<br />
Daseinsvorsorge zurück in die<br />
Haushalte entgegen? Denn wir<br />
wissen, die Aufgaben in den Haushalten<br />
liegen bis heute mehrheitlich<br />
in den Händen von Frauen,<br />
als Töchter, Schwiegertöchter,<br />
Ehefrauen. Hier hat die Diskussion<br />
erst begonnen. Der Blick auf die<br />
Familienernährerinnen mit ihren<br />
sehr unterschiedlichen Lebenssituationen<br />
und Bedarfen kann<br />
als Katalysator wirken.<br />
Karin Gottschall, Manuela Schwarzkopf: Irreguläre<br />
Arbeit in Privathaushalten. Rechtliche und institutionelle<br />
Anreize zu irregulärer Arbeit in Privathaushalten in<br />
Deutschland. Bestandsaufnahme und Lösungsansätze.<br />
Reihe: Arbeitspapier, Arbeit und Soziales, Nr. 217.<br />
Düsseldorf 2010, Hrsg.: Hans-Böckler-Stiftung
LÖSUNGSVORSCHLÄGE<br />
AUS DER PRAXIS<br />
ONLINE-DISKUSSION ZEIGT<br />
VIELFÄLTIGE ERGEBNISSE<br />
KATRIN MENKE IST MITARBEITERIN IM <strong>DGB</strong>-<br />
POLITIKENTWICKLUNGSPROJEKT „MODELL DER<br />
FAMILIENERNÄHRERIN“.<br />
Was bedeutet es, wenn Frauen die Familie ernähren?<br />
Dieser Frage ist das Politikentwicklungsprojekt „Modell<br />
der Familienernährerin“ des <strong>DGB</strong> auf seiner Internetplattform<br />
nachgegangen und hat zum Mitdiskutieren aufgerufen.<br />
Hautnah berichten Betroffene über Rollenkonflikte,<br />
Belastungen des Alltags und bieten praktische Verbesserungsvorschläge.<br />
Projektmitarbeiterin Katrin Menke stellt<br />
erste Ergebnisse einer qualitativen Auswertung vor.<br />
Wie sich der Alltag als Familienernährerin gestaltet, lässt sich aus<br />
vielen Beiträgen im Internet ablesen. Unabhängig davon, ob der<br />
Status der Alleinerziehenden oder die besseren Karriereaussichten<br />
Frauen zur Ernährerin der Familie machen, Familienernährerinnen<br />
kämpfen stets (mindestens) an zwei Fronten. An der beruflichen<br />
Front gegen schlechte Arbeits(zeit)bedingungen und geringe Bezahlung<br />
sowie an der privaten Front gegen eine tradierte Hausarbeitsteilung<br />
und stereotype Erwartungen von Dritten. Auf der Internetplattform<br />
drückt eine Frau dies so aus: „Als Familienernährerin<br />
habe ich brutal wenig Zeit, zwei Kinder und zwei Jobs, um so viel<br />
Geld zu haben, dass wir gerade mal so leben können. Ich mache die<br />
Erziehung, den Haushalt, Kontakt zur Schule, Elternabende“.<br />
Es fehlt an Rollenalternativen<br />
Doch auch die gesellschaftliche und familiale Rolle der Partner von<br />
Familienernährerinnen bzw. von Männern insgesamt wird diskutiert.<br />
So gibt ein Mann zu bedenken: „Viele Partner sind (…) unfreiwillig<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
18<br />
Nicht-Familienernährer und empfinden die zahllosen Ausschlüsse<br />
und Entfunktionalisierungen schlicht als demütigend“. Das<br />
Problem: Eine alternative Rolle zu der des Familienernährers gibt es<br />
für Männer bis dato kaum. So wissen einige (männliche) Teilnehmer<br />
der Online-Diskussion zu berichten, dass der Mann nur als „Vollerwerbstier“<br />
und nicht „in der Versorgungsrolle“ akzeptiert werde.<br />
„Vereinbarkeit der Familie und des Berufes bei den Männern<br />
scheint in der Gesellschaft ein Tabuthema zu sein.“<br />
Egal ob Frau oder Mann, Familienernährerin oder Hausmann – sie<br />
alle bringen die gleichen Themen und dieselben Forderungen auf<br />
den virtuellen Tisch. Diese sind breit gefächert und beginnen bei A<br />
wie Arbeitszeiten, über H wie Hausarbeitsteilung und E wie Entlohnung<br />
bis hin zu R wie Rollenbilder. Dass es in Deutschland noch<br />
immer viel zu tun gibt, darüber sind sich alle auf der Plattform<br />
einig. Eine Frau bringt das Problem auf den Punkt: „Obwohl sich<br />
schon viel verbessert hat, fehlen in der BRD noch immer die nötigen<br />
Rahmenbedingungen“.<br />
Forderungen an Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften<br />
Die meisten, die sich an der Online-Diskussion beteiligen, haben<br />
konkrete Verbesserungsvorschläge, die Familienernährerinnen, ihre<br />
Kinder und Partner unterstützen und entlasten würden. Diese<br />
betreffen in vielen Aspekten nicht nur die Politik, sondern auch<br />
Arbeitgeber und Gewerkschaften.<br />
Neue Arbeitszeitmodelle gewünscht<br />
Unter dem Stichwort „Zeit“ fordern DiskutantInnen einerseits<br />
verbindliche familienfreundliche und selbst- bzw. mitbestimmte<br />
Arbeitszeitmodelle von Seiten der Arbeitgeber. „Besonders größere<br />
Betriebe müssen gesetzlich dazu verpflichtet werden, damit Eltern<br />
überhaupt arbeiten können.“ Andererseits wünschen sich viele<br />
mehr Zeit und sprechen mit ihren Forderungen nach „einer Verringerung<br />
der wöchentlichen Arbeitszeit“ oder „zusätzliche freie Tage<br />
für erwerbstätige Elternteile“ direkt die Gewerkschaften an.<br />
Ebenfalls thematisiert wird die unzureichende Integration von<br />
Frauen in den Arbeitsmarkt. „Frauen arbeiten vor allem Teilzeit und<br />
im Niedriglohnsektor, bzw. werden sogar schlechter bezahlt für die<br />
gleiche Arbeit.“ Die Mindestforderungen der DiskutantInnen lauten<br />
daher „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und ein „Mindestlohn“.
Betreuungsmöglichkeiten auf Erwerbstätige ausrichten<br />
Als verbesserungswürdig deklarieren viele in der Online-Diskussion<br />
nach wir vor die unzureichende Betreuungsinfrastruktur in Deutschland.<br />
So berichtet eine Diskutantin: „Ich habe meine beiden Kinder<br />
in Frankreich großgezogen und von dem guten Betreuungssystem<br />
profitiert“. Der Wunsch nach verlässlicher Ganztagsbetreuung von<br />
Kindern schwingt in vielen Beiträgen mit. Es sind jedoch nicht nur<br />
die reinen Öffnungszeiten der staatlichen Schul- und Betreuungseinrichtungen,<br />
die sich stärker auf erwerbstätige Mütter und fürsorgende<br />
Väter einstellen müssten. So ärgert sich eine Diskutatin<br />
über Schul- und Kitaveranstaltungen während der Kernarbeitszeiten,<br />
bei denen „dann natürlich erwartet wird, dass Mütter<br />
kommen“, während eine andere beklagt, dass in der Elternsprechstunde<br />
die LehrerInnen ihrer Kinder am liebsten stets mit ihr und<br />
nicht mit ihrem Partner sprechen wollen.<br />
Die Überwindung traditioneller männlicher und weiblicher Rollenleitbilder<br />
ist der Online-Diskussion zufolge eine weitere Baustelle. In<br />
der häuslichen Arbeitsteilung müssten sich Männer mehr engagieren<br />
und Frauen ihren Partnern auch mehr zutrauen. Eine Diskutantin<br />
glaubt, dass Frauen oft an ihrem Partner herummäkelten,<br />
„weil diese die häuslichen Aufgaben nicht nach ihren weiblichen<br />
Vorstellungen erledigen“ und sich so die Doppelbelastung aus<br />
Beruf und Familie auch selbst aufbürdeten. „Warum“, fragt die<br />
Diskutantin, „gibt es keinen Kurs für Frauen und Paare, die auf den<br />
Rollentausch vorbereiten, wo es doch ansonsten alle möglichen<br />
Seminare für neue Lebenslagen gibt?“<br />
Gleichstellung verschiedener Lebensformen<br />
Insgesamt gilt es, auch von Seiten der Politik zu erkennen, dass<br />
Deutschland „eine freie, multikulturelle pluralistische Gesellschaft“<br />
ist, in der „klassische Familien, Regenbogenfamilien, Hausmänner,<br />
Alleinerziehende, muslimische Großfamilien, Patchworkfamilien“<br />
gleichgestellt sein müssen. Vor diesem Hintergrund wird im Online-<br />
Forum konkret eine Modernisierung der Steuerklassen mit der klaren<br />
Vorgabe gefordert: „Die günstigste Steuerklasse gehört dorthin, wo<br />
Kinder leben!“ Für viele DiskutantInnen ist unbegreiflich, warum<br />
Ehepaare ohne Kinder durch das Ehegattensplitting steuerliche<br />
Vorteile erhalten, nicht aber unverheiratete Paare mit Kindern.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer klare Vorschläge zur Verbesserung der Arbeits- und<br />
SCHWERPUNKT<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
19<br />
Lebensbedingungen von Familienernährerinnen mitbringen, die sie als<br />
„Selbstverständlichkeiten“ ansehen und die es endlich umzusetzen<br />
gilt. In ihnen stecken viele aktuelle frauenpolitische Forderungen.<br />
Lust, mit zu diskutieren?<br />
Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter:<br />
www.familienernaehrerin.de/diskussion<br />
Alle Zitate sind Beiträgen der Online-Diskussion<br />
entnommen und auf der Website einsehbar.
DIE WICHTIGSTEN STATIONEN<br />
DER GLEICHBERECHTIGUNG<br />
IV. TEIL – VON DEN 68ERN<br />
BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG<br />
Von Claudia Menne<br />
Die stetige Zunahme der weiblichen Erwerbstätigkeit seit<br />
dem Zweiten Weltkrieg brachte keine tief greifende<br />
gesellschaftliche Neubewertung der Frauenarbeit mit sich.<br />
Obwohl in den Jahren der Arbeitskräfteknappheit die stille<br />
Reserve der Hausfrauen für den Arbeitsmarkt immer<br />
wieder rekrutiert wird, kann von einer Gleichberechtigung<br />
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht die Rede sein.<br />
Durch die Verantwortung für Haushalt und Familie bleiben<br />
die Zeit- und Kraftreserven für die Erwerbsarbeit nach wie<br />
vor eingeschränkt.<br />
In der zweiten Hälfte der 60er Jahre machen Frauen mehr als ein<br />
Drittel aller Erwerbstätigen in der Bundesrepublik aus, über<br />
70 Prozent sind in schlecht bezahlten Stellen beschäftigt,<br />
50 Prozent üben ihre Tätigkeit als angelernte Beschäftigte aus.<br />
Durch die Eingruppierung in so genannte Leichtlohngruppen<br />
werden sie zusätzlich diskriminiert.<br />
Frauenbeschäftigung nach wie vor unterbezahlt<br />
Vieles bleibt bis heute unverändert. So kommt es Mitte der 60er<br />
Jahre zu einem Pflegenotstand in den bundesdeutschen Krankenhäusern.<br />
Trotz Erhöhung des Pflegepersonals um etwa 30.000<br />
Personen seit 1960 werden weiterhin 25.000 Stellen benötigt.<br />
Niedrige Gehälter und miserable Arbeitsbedingungen, wie ständig<br />
wechselnde Arbeitszeiten, massive Überstunden, Dauerschichten<br />
und geringe Aufstiegsmöglichkeiten, zeichnen die Arbeit in der<br />
Pflege aus. Der Beruf der Krankenschwester wird – damals wie<br />
heute - in erster Linie von Frauen ausgeübt.<br />
Geschlechterverhältnisse werden öffentlich diskutiert<br />
Die erste deutsche Frauenbewegung brachte im 19. Jahrhundert die<br />
Frauenfrage erstmals an die Öffentlichkeit. Das Ende der 60er Jahre<br />
wird zur Geburtsstunde der neuen zweiten Frauenbewegung, die im<br />
Zuge der 68er Bewegung nicht ohne den Impuls der Studenten-<br />
100 JAHRE INTERNATIONALER FRAUENTAG<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
20<br />
bewegung zu denken ist. Sie rückt in den USA und in Westeuropa<br />
die bis dato als „privat“ tabuisierten Themen und Probleme der<br />
persönlichen Paarbeziehungen und des Geschlechterverhältnisses<br />
ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Sie bildet die Basis<br />
der Kritik und des Widerstandes. Liebe, Sexualität, Kinderwunsch,<br />
Hausarbeit, Beziehungsmuster galten bis zu diesem Zeitpunkt als<br />
naturhaft fixiert, als privat nicht veränderbar. Die geschlechtsspezifische<br />
Arbeitsteilung, ihre Diskriminierung und die Verfügung über<br />
den weiblichen Körper sind zentrale Themen der Frauenbewegung.<br />
Die Kritik der Feministinnen an den patriarchalen Strukturen<br />
verfolgt einen universalistischen Ansatz. Die Diskriminierung und<br />
Entwertung von Weiblichkeit und Frauenarbeit wird in einem weltweiten<br />
Zusammenhang gesehen und in Beziehung zur Ausbeutung<br />
und Entmündigung von Frauen in der so genannten Dritten Welt<br />
und in den angeblich emanzipationsfreundlichen sozialistischen<br />
Staaten gesetzt. Diese Aufbruchstimmung geht einher mit dem<br />
Regierungswechsel von 1969. Willy Brandt wird zum Bundeskanzler<br />
gewählt. Unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ sollen nun<br />
auch die ungleichen Lebenslagen von Frauen und Männern verändert<br />
werden.<br />
Bildungsreform stärkt Frauen<br />
Die Bildungsreformen in den 70er Jahren kommen insbesondere<br />
Frauen zugute. Dem Arbeitsmarkt sollen neue qualifizierte Kräfte<br />
zugeführt werden. Insgesamt profitierten Frauen in allen westlichen<br />
Industrienationen von diesem Wandel. Mit dem Erfolg, dass wir im<br />
Jahr 2010 von der am besten ausgebildeten Frauengeneration aller<br />
Zeiten sprechen können.
<strong>DGB</strong> verabschiedet Programm für Arbeitnehmerinnen<br />
Auch der <strong>DGB</strong> beschließt 1969 auf seinem 8. Ordentlichen Bundeskongress<br />
in München sein Programm für Arbeitnehmerinnen. Dieses<br />
Programm bildet die Grundlage für alle weitergehenden Forderungen<br />
des <strong>DGB</strong> zur Situation der Frauen im Arbeitsleben. Hervorgerufen<br />
durch die Erfahrungen der ersten Rezession von 1966/67<br />
und der damit verbundenen Verdrängung der Frauen aus dem<br />
Erwerbsleben, fangen Arbeitnehmerinnen an, sich gegen frauenfeindliche<br />
Arbeitsbedingungen und Diskriminierung zu wehren.<br />
In ihrem Programm heißt es: „Die Frauen sichern durch ihre berufliche<br />
Tätigkeit nicht nur ihre Existenz. Sie entwickeln durch sie ihre<br />
Fähigkeiten und erhalten Impulse zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit.<br />
Die Volkswirtschaft kann auf die Leistung der Frauen heute<br />
weniger denn je verzichten. Technische und strukturelle Veränderungen<br />
haben den Beitrag der Frauen unentbehrlich gemacht. Die<br />
Gesellschaft ist auf die Fähigkeiten und Leistungen der Frauen im<br />
Arbeitsleben angewiesen, damit eine fortschrittliche und humane<br />
Politik durchgesetzt werden kann. Deshalb müssen Staat, Gesellschaft<br />
und Wirtschaft in ihrem eigenen Interesse und aus der<br />
Verpflichtung zur sozialen Gerechtigkeit auch den Frauen die<br />
Grundrechte der Menschen, insbesondere das Recht auf Arbeit,<br />
garantieren. Dazu bedarf es in erster Linie der Aufhebung der sozialen<br />
Schranken, der Beseitigung aller Diskriminierungen und des<br />
Abbaus der gesellschaftlichen Vorurteile.“<br />
Die gesellschaftspolitische Diskussion in Westdeutschland spiegelt<br />
wider, was im anderen Teil Deutschlands als selbstverständlich gilt.<br />
Denn in der DDR ist das Recht auf Arbeit in der Verfassung verankert.<br />
Auch der Streit darüber, ob Kinderbetreuung außerhalb des<br />
Elternhauses sinnvoll und notwendig ist, ist vor diesem Hintergrund<br />
zu sehen, hatte doch die DDR die Kinderbetreuung zur staatlichen<br />
Aufgabe gemacht.<br />
„Kinderfrage“ wird zur Triebfeder<br />
Gerade durch das Engagement der 68er Frauen entstehen vor allem<br />
in Berlin und später in vielen anderen Städten der Bundesrepublik<br />
antiautoritäre Kinderläden als Gegenentwurf zur familiären oder<br />
staatlichen Betreuungssituation. Die „Kinderfrage“ hat ab 1968<br />
eine zentrale Bedeutung in der neuen Frauenbewegung. Die Unzufriedenheit<br />
darüber, dass Frauen allein die Verantwortung für die<br />
Kindererziehung tragen, während sich ihre Männer politisch enga-<br />
100 JAHRE INTERNATIONALER FRAUENTAG<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
21<br />
gieren, wird zur Triebfeder für die Frauen, die ihren Weg aus dem<br />
Mütterghetto suchen. Es geht ihnen dabei nicht nur um Selbsthilfe,<br />
um mehr Zeit für politische Arbeit und Bildung, sondern auch um<br />
ein emanzipatorisches Gegenmodell.<br />
Die Frauenbewegung setzt sich auch für die Stärkung der Rechte<br />
lesbischer Frauen ein. Sie unterstützt den Kampf der Lesben und<br />
Schwulen gegen Diskriminierung und unterstützt ihre Forderung<br />
nach Respektierung der Homosexualität und Gleichberechtigung im<br />
Sinne der Menschenrechte.<br />
Selbstbestimmung über den eigenen Körper<br />
Die Forderung der Frauenbewegung über die Selbstbestimmung des<br />
eigenen Körpers ist verknüpft mit der Forderung nach einem Schwangerschaftsabbruch<br />
ohne Bestrafung (Debatte um den § 218). Die<br />
Liberalisierung und Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs<br />
wird vehement geführt. 1971 erfährt dieser Kampf einen vorläufigen<br />
Höhepunkt mit der Stern-Aktion „Wir haben abgetrieben“. An dieser<br />
Selbstbezichtigungskampagne, die auf konservativer und katholischer<br />
Seite auf massive Kritik stößt und zu Strafanzeigen führt, beteiligen<br />
sich 374 Frauen. Mehr als 3.000 Unterschriften werden vom Sozialistischen<br />
Frauenbund Berlin, den Roten Frauen aus München und der<br />
Frauenaktion 70 aus Frankfurt am Main gesammelt.<br />
In Italien tobt zur gleichen Zeit ein heftiger Streit um das Scheidungsrecht.<br />
Aber nicht nur in Italien, sondern auch in anderen europäischen<br />
Ländern gilt 1970 noch die Unauflösbarkeit der Ehe.<br />
Eine eigenständige Frauenkultur entsteht<br />
Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen auch in sexueller Hinsicht<br />
geht einher mit Aufklärungskampagnen, einer neuen Mode und mit<br />
massiver Kritik an der Werbung und der Frauenverachtung in den<br />
Medien. 1976 wird das erste Frauenhaus gegründet, im gleichen<br />
Jahr findet die erste Sommeruniversität für Frauen zum Thema
Frauen und Wissenschaft statt. Ende der 70er Jahre entwickeln sich<br />
die ersten autonomen Frauenprojekte, Frauenbuchläden öffnen ihre<br />
Pforten, überregionale Zeitschriften von Frauen für Frauen entstehen,<br />
die bekanntesten sind Emma und Courage.<br />
Gerichtlicher Sieg um die Entgeltgleichheit<br />
Ende der 70er Jahre entscheiden auch die ersten Gerichte zugunsten<br />
der Frauen bei der Frage nach gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit,<br />
denn die Verdienste der Frauen liegen im Schnitt ein Drittel unter denen<br />
der Männer. Auch im Angestelltenbereich gibt es deutliche<br />
Einkommensgefälle zwischen Männern und Frauen. In Essen klagen die<br />
ersten 29 Arbeiterinnen eines Fotolaborbetriebs, in Hamm wird ihre<br />
Klage vor dem Landesarbeitsgericht in 2. Instanz abgewiesen. Dieser<br />
skandalöse Umgang mit dem Problem löst eine Welle von Solidaritätsbezeugungen<br />
aus. Mehr als 90.000 Solidaritätsunterschriften werden<br />
gesammelt, Demonstrationen und Kundgebungen unterstützen den<br />
Arbeitskampf der Frauen. Zwei Jahre später gewinnen die Arbeiterinnen<br />
schließlich ihren Prozess vor dem Bundesarbeitsgericht in Kassel.<br />
Wiederbelebung des Internationalen Frauentages<br />
Die UNO deklariert das Jahr 1975 zum Jahr der Frau und der Gleichberechtigung<br />
der Geschlechter, der 8. März als Internationaler Tag<br />
der Frau wird wiederbelebt. Dies hat auch Konsequenzen in Deutschland.<br />
Die 10. Bundesfrauenkonferenz des <strong>DGB</strong> fordert 1981 den<br />
<strong>DGB</strong>-Bundesvorstand auf, den Internationalen Frauentag zu fördern.<br />
So sollen die <strong>DGB</strong>-Kreise die Kreisfrauenausschüsse bei der Durchführung<br />
von Aktionen zum 8.März unterstützen. Die Begründung:<br />
Der Internationale Frauentag eigne sich besonders gut dafür, die<br />
Probleme der erwerbstätigen Frauen öffentlich darzustellen und auf<br />
immer noch bestehende Widersprüche zwischen Verfassungsgebot<br />
und Wirklichkeit hinzuweisen.<br />
100 JAHRE INTERNATIONALER FRAUENTAG<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
22<br />
1982 folgt der 12. Ordentliche Bundeskongress der Forderung der<br />
Frauen und beschließt: „Der 8. März wird als Internationaler Frauentag<br />
des <strong>DGB</strong> in allen seinen Gliederungen begangen. Dabei sollen<br />
insbesondere die aktuellen Probleme der arbeitenden Frauen dargestellt<br />
und die Forderungen der Gewerkschaften formuliert werden.“<br />
Die in den eigenen Reihen kontrovers geführte Diskussion, ob die<br />
Durchführung des Internationalen Frauentages eine organisationspolitische<br />
Aufgabe ist, wird mit dieser Beschlusslage beendet. Auf<br />
130 Veranstaltungen in den <strong>DGB</strong>-Kreisen zum Internationalen Frauentag<br />
1983, machen Frauen und ihre Familien auf ihre Wünsche und<br />
Forderungen aufmerksam, die sich mit Blick auf die bevorstehende<br />
Bundestagswahl an Politiker und Arbeitgeber richten.<br />
Kampf um Mitbestimmung<br />
Angelehnt an das Motto des Internationalen Frauentages 1983<br />
„Frauen kämpfen für Mitbestimmung“ lautet der Aufruf des <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesvorstandes: „Wir kämpfen für Mitbestimmung – gegen<br />
Unternehmerwillkür und Sozialabbau. Wir kämpfen für Frieden und<br />
Abrüstung. Wir wollen keinen Frauendienst in der Bundeswehr.<br />
Gewerkschaftsfrauen wollen mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz,<br />
im Betrieb und in der Verwaltung, im Unternehmen, in der Wirtschaft,<br />
in der Politik, weil Frauenlöhne immer noch geringer sind,<br />
Frauenarbeitsplätze in großem Umfang vernichtet werden, Ausbildungsplätze<br />
für Mädchen Mangelware sind, Frauen Beruf und<br />
Familie noch immer schwer miteinander vereinbaren können,
Frauenarbeit durch Rationalisierung immer mehr zur Hetze wird und<br />
Frauen durch Sozialabbau ihre Rechte immer schwerer durchsetzen<br />
können. Frauen sind im Interesse der Erhaltung des Friedens gegen<br />
Aufrüstung und gegen ihren Einsatz in der Bundeswehr. Deshalb:<br />
Frauen traut Euch! Macht mit! Nicht ducken, mitbestimmen! Mitbestimmen<br />
in Beruf und Gesellschaft!“<br />
1983 beschließt der <strong>DGB</strong>, jedes Jahr ein eigenes Motto zum Internationalen<br />
Frauentag herauszugeben und Plakate für die verschiedenen<br />
<strong>DGB</strong>-Gliederungen zu drucken, um das Motto bekannt zu<br />
machen. Von diesem Zeitpunkt an erscheint jeweils zum 8. März ein<br />
<strong>DGB</strong>-Reader, in dem zentrale Forderungen und Themen des Internationalen<br />
Frauentages aufbereitet werden. Zum ersten Mal werden<br />
diese Materialien als Ausgabe 2/1983 der Zeitschrift „Frauen und<br />
Arbeit“ herausgegeben.<br />
Protest der Gewerkschaftsfrauen<br />
1983 kommt es auf dem Bonner Münsterplatz zu einer Abschlusskundgebung<br />
nach einem Protestmarsch von 30.000 Gewerkschafterinnen.<br />
Auf dieser größten Frauendemonstration nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg protestieren die Gewerkschafterinnen gegen<br />
Sozialabbau, Verschlechterung des Mutterschutzes und der Renten.<br />
Diese Kundgebung gegen die frauen- und familienfeindliche Politik<br />
der Bundesregierung in Bonn ist ein markantes Beispiel für den<br />
Anspruch einer eigenständigen Frauenpolitik innerhalb der Gewerkschaften.<br />
Die Gewerkschafterinnen wollen Frauenfragen stärker in der<br />
Gesamtorganisation verankern und machen mit gezielten Aktionen<br />
auf die vielfältigen Formen der Diskriminierung aufmerksam. Zum<br />
100 JAHRE INTERNATIONALER FRAUENTAG<br />
INFO-BRIEF 3/11<br />
23<br />
Teil ist der Frauenprotest von Erfolg gekrönt. Im Jahr 1986 tritt eine<br />
Neuregelung der gesetzlichen Rentenversicherung in Kraft, wonach<br />
demjenigen Elternteil, der sich der Erziehung eines Kindes in dessen<br />
erstem Lebensjahr widmet, diese zwölf Monate als Pflichtversicherungszeit<br />
für die Rente anerkannt werden.<br />
Internationaler Frauentag im vereinten Deutschland<br />
Im wiedervereinten Deutschland und insbesondere in den neuen<br />
Bundesländern findet der 8. März zunächst nur wenig öffentliche<br />
Beachtung. Auch in den alten Bundesländern sind die Befürworterinnen<br />
durch die neue Situation eher entmutigt. Doch schon 1993<br />
kündigt sich in den ostdeutschen Städten und Gemeinden eine<br />
Wiederbesinnung auf diesen Tag an. Die Erkenntnis, dass der Internationale<br />
Frauentag auch nach dem Untergang des Staatssozialismus<br />
seine Berechtigung hat, setzt sich durch. Er wird erneut<br />
zum Anlass genommen, Frauen zu mobilisieren und aufzufordern,<br />
sich für ihre Rechte einzusetzen.<br />
Zu den Themen des Internationalen Frauentages gehören nach wie<br />
vor der Kampf gegen den §218, die Verdrängung der Frauen auf<br />
dem Arbeitsmarkt sowie Forderungen nach konkreten Gleichstellungsgesetzen,<br />
echter Frauenförderung und Eigenständigkeit.<br />
Verstärkt rücken auch Menschenrechtsverletzungen in den Blickpunkt<br />
sowie Diskriminierungen und Gewalt gegen ausländische<br />
Frauen.
AUSBLICK<br />
WORKSHOPS UND VORTRÄGE<br />
Um das Thema Familienernährerinnen weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, bietet das <strong>DGB</strong>-<br />
Politikentwicklungsprojekt „Modell der Familienernährerin“ Workshops, Vorträge und Tagungen<br />
an. Dabei werden Diskussionen um Geschlechterrollen angestoßen sowie konkrete Schritte erarbeitet,<br />
welche politischen und gesellschaftlichen Veränderungen notwendig sind, um die Lebensund<br />
Arbeitsbedingungen von Familienernährerinnen zu verbessern. Einen Vortrag zur Erwerbssituation<br />
von Frauen und Familienernährerinnen hält Projektleiterin Melitta Kühnlein am 3. November<br />
auf der Tagung zum Welttag des Mannes des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung<br />
der Universität Leipzig und dem FraGes-Verein Leipzig e.V. in Kooperation mit LEmann e.V..<br />
Am 15. November ist das <strong>DGB</strong>-Politikentwicklungsprojekt in der Agentur für Arbeit in<br />
Memmingen zu Gast und lädt zu einem Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde ein.<br />
Im Dezember gibt es einen Open Space Workshop in Berlin unter dem Titel „(Alles) anders als<br />
gedacht“. Vertreterinnen und Vertreter aus Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Frauen- und<br />
Männerorganisationen, Kirchen und Sozialverbänden sowie betroffene Frauen sind eingeladen,<br />
Strategien und Wege zu diskutieren, wie die (Arbeits- ) Welt zu gestalten ist, damit Familienernährerinnen<br />
die nötige Unterstützung erfahren und selbstverständlich werden. Nähere Informationen<br />
zum Projekt und den Veranstaltungen unter: www.familienernaehrerin.de<br />
ABONNEMENT-BESTELLUNG<br />
HIERMIT BESTELLE ICH EIN ABONNEMENT DES INFO-BRIEFES „FRAU GEHT VOR“<br />
ZUM PREIS VON 13 EURO • DER INFO-BRIEF ERSCHEINT VIERTELJÄHRLICH.<br />
NAME<br />
VORNAME<br />
FUNKTION<br />
ORGANISATION<br />
POSTFACH/STRASSE<br />
PLZ + ORT<br />
PRINTNETWORK PN GMBH<br />
ABONNEMENTSERVICE<br />
STRALAUER PLATZ 33 – 34<br />
10243 BERLIN<br />
IMPRESSUM<br />
HERAUSGEBERIN<br />
INGRID SEHRBROCK<br />
<strong>DGB</strong> BUNDESVORSTAND<br />
V.I.S.D.P.: ANJA WEUSTHOFF<br />
ABTEILUNG FRAUEN-,<br />
GLEICHSTELLUNGS- UND<br />
FAMILIENPOLITIK<br />
HENRIETTE-HERZ-PLATZ 2<br />
10178 BERLIN<br />
FAX: 030 – 240 60 -761<br />
REDAKTION<br />
BRITTA JAGUSCH<br />
FRANKFURT<br />
GRAFIK<br />
PRINTNETWORK PN GMBH<br />
BERLIN<br />
DRUCK + VERTRIEB<br />
PRINTNETWORK PN GMBH<br />
BERLIN<br />
ENTGELT BEZAHLT, POSTVERTRIEBSSTÜCK A 14573