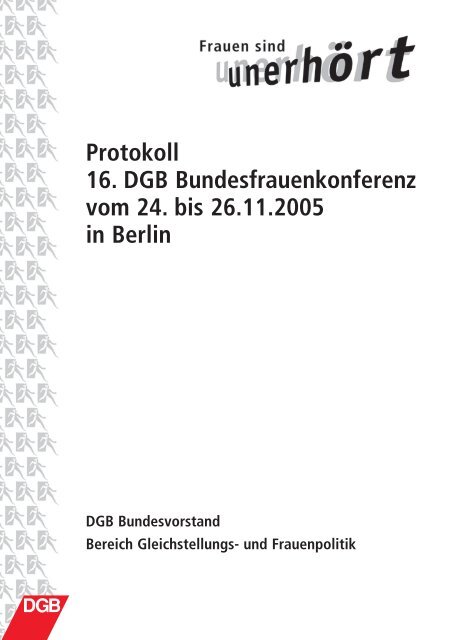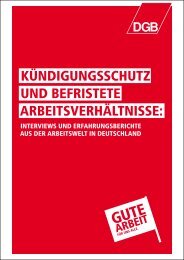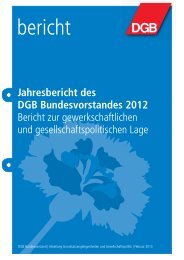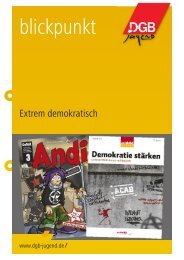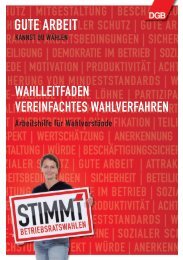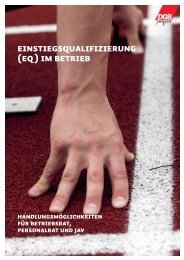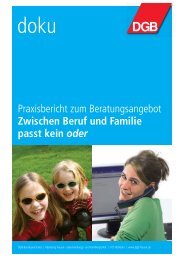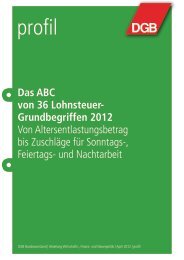Sachgebiet E: Sozialstaat / Soziale Sicherung - DGB Bestellservice
Sachgebiet E: Sozialstaat / Soziale Sicherung - DGB Bestellservice
Sachgebiet E: Sozialstaat / Soziale Sicherung - DGB Bestellservice
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Protokoll<br />
16. <strong>DGB</strong> Bundesfrauenkonferenz<br />
vom 24. bis 26.11.2005<br />
in Berlin<br />
<strong>DGB</strong> Bundesvorstand<br />
Bereich Gleichstellungs- und Frauenpolitik
„Frauen sind unerhört“<br />
Protokoll<br />
16. <strong>DGB</strong> Bundesfrauenkonferenz<br />
vom 24. bis 26.11.2005<br />
in Berlin<br />
<strong>DGB</strong> Bundesvorstand<br />
Bereich Gleichstellungs- und Frauenpolitik
Impressum<br />
Herausgeber <strong>DGB</strong> Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand<br />
Bereich Gleichstellungs- und Frauenpolitik<br />
Postfach 110372<br />
10833 Berlin<br />
Telefon 030 - 24060 728<br />
Fax 030 - 24060 761<br />
Internet http://www.dgb.de<br />
Druck Printnetwork pn GmbH<br />
Satz + Layout Karin Pütt<br />
Bildnachweis Anne Graef
Inhalt<br />
Eröffnung und Begrüßung 5<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer, stellvertretende Vorsitzende des <strong>DGB</strong><br />
Konstituierung der Bundesfrauenkonferenz 7<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer, stellvertretende Vorsitzende des <strong>DGB</strong><br />
Mündlicher Geschäftsbericht 9<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer, stellvertretende Vorsitzende des <strong>DGB</strong><br />
Aussprache zum mündlichen Geschäftsbericht 15<br />
Podiumsdiskussion: “Perspektiven der Frauen- und Gleichstellungspolitik” 21<br />
Strategien für eine gleichstellungsorientierte Arbeits- und Beschäftigungspolitik 22<br />
Zentrale Botschaften aus den Workshops 28<br />
Samstag – 26.11.2005 32<br />
Bericht der Mandatsprüfungskommission 33<br />
Antragsberatung 34<br />
Schlusswort 54<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer, stellvertretende Vorsitzende des <strong>DGB</strong><br />
Verzeichnis der Anträge und Entschließungen 55<br />
Anträge und Entschließungen im Wortlaut dokumentiert:<br />
<strong>Sachgebiet</strong> A: Gleichstellungspolitik 57<br />
<strong>Sachgebiet</strong> B: Entgelt / Einkommen 70<br />
<strong>Sachgebiet</strong> C: Beschäftigungspolitik 77<br />
<strong>Sachgebiet</strong> D: Arbeitzeit / Arbeitsbedingungen 83<br />
<strong>Sachgebiet</strong> E: <strong>Sozialstaat</strong> / <strong>Soziale</strong> <strong>Sicherung</strong> 91<br />
<strong>Sachgebiet</strong> F: Organisationspolitik 102<br />
Verzeichnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 106<br />
Anhang: Ergebnisse der Workshops 110
Eröffnung und Begrüßung<br />
zur 16. Bundesfrauenkonferenz<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer, stellvertretende Vorsitzende des <strong>DGB</strong><br />
Liebe Kolleginnen, liebe Delegierte, liebe Gäste,<br />
ihr seid mit verschiedenen Erwartungen zur Bundesfrauenkonferenz<br />
angereist. Es geht darum, die Weichen für die<br />
künftige gewerkschaftliche Frauenpolitik festzulegen. Aber<br />
bevor wir in die Zukunft blicken, lasst mich gerade in dieser<br />
Begrüßungseinleitung ein wenig in die Vergangenheit<br />
schauen. Denn wir befinden uns 2005 in einem Jubiläumsjahr.<br />
Gewerkschaftliche Frauenpolitik gibt es seit 100 Jahren.<br />
1905 wurde bei der Generalkommission der Gewerkschaften<br />
– das ist der Vorläufer des Allgemeinen Deutschen<br />
Gewerkschaftsbundes – ein Arbeiterinnensekretariat eingerichtet<br />
und mit Ida Altmann besetzt. Kurz zuvor war ein<br />
diesbezüglicher Antrag auf dem 5. Gewerkschaftskongress<br />
noch sang- und klanglos gescheitert. Viele Männer in den<br />
Gewerkschaften waren nicht davon überzeugt, dass es notwendig<br />
sei, die Arbeiterinnen zu organisieren.<br />
Bereits 1904 haben Frauen in Berlin ein gewerkschaftsübergreifendes<br />
Komitee zur Agitation der Arbeiterinnen gebildet.<br />
Dieses Komitee erhielt von der Generalkommission ein Zimmer<br />
zugewiesen. Der schärfste Kritiker – Cohen vom Metallarbeiterverband<br />
– bemängelte bei einer Konferenz der<br />
Zentralvorstände die Eigenmächtigkeit der Generalkommission<br />
unter anderem mit den Worten: „Ein Zimmer bedeutet<br />
offizieller Anstrich“ und es werde sich „mit dem Frauenkomitee<br />
eine Art Nebenregierung bilden.“ Der Vorsitzende der<br />
Generalkommission der Gewerkschaften Carl Legien argumentierte<br />
aber anderes. Er sagte nämlich: „Die Frauenarbeit<br />
dringt heute in verschiedene Berufe ein und für die männlichen<br />
Arbeiter liegt eine große Gefahr in der geringen Bezahlung<br />
der weiblichen Arbeiter.“ Daraus zog er den<br />
Schluss, dass in der Organisation auch Arbeiterinnen vonnöten<br />
seien. Nach dem Kongress schlug er dem Gewerkschaftsausschuss<br />
im Juli 1905 vor, ein Frauensekretariat<br />
einzurichten und mit Ida Altmann zu besetzen. Nur mit List<br />
und Taktik wurde die Einstellung dann tatsächlich beschlossen,<br />
denn Carl Legien hatte erklärt, dass man nur ein halbes<br />
Gehalt zahlen müsse, die andere Hälfte bekäme Ida Altmann<br />
schon als Übersetzerin vom internationalen Gewerkschaftssekretariat.<br />
Ida Altmann hatte eine klare Perspektive<br />
für die gewerkschaftliche Frauenarbeit und forderte, dass<br />
Frauen Zugang zu planvoll geregelter Arbeit haben müssen.<br />
Arbeiterinnen und Arbeiter ungleich gestellt in der Gesellschaft<br />
und im Recht war in ihren Augen eine Spaltung der<br />
Arbeiterklasse. Sie führte dazu im Einzelnen aus:<br />
„Nur unter dem Losungswort völliger Gleichberechtigung<br />
und Gleichverpflichtung beider Geschlechter als Arbeiter<br />
innerhalb der Gewerkschaft und in dem, was durch sie<br />
erstrebt wird, ist der Sieg der Arbeit über die Ausbeutung,<br />
der Sieg der Kultur, des Fortschritts über vermorschte und<br />
vermoderte Verwesung hauchende Zustände möglich, ja<br />
unbedingt sicher.“<br />
Wir werden am kommenden Sonntag gemeinsam mit der<br />
Freireligiösen Gemeinde Berlin, in der Ida Altmann nach<br />
ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit sehr aktiv war, zu ihrem<br />
70. Todestag einen Gedenkstein setzen.<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Delegierte, was vor hundert Jahren<br />
galt, gilt im Prinzip auch noch heute. Der Stand der Gleichberechtigung<br />
der Geschlechter ist ein Gradmesser über den<br />
Fortschritt der Gesellschaft. Für diesen Fortschritt haben<br />
sich bereits viele Frauen engagiert. An dieser Stelle möchte<br />
ich daher die ehemaligen Kolleginnen des <strong>DGB</strong> Bundesfrauenausschusses<br />
recht herzlich in unserer Mitte begrüßen:<br />
Christiane Bretz, Elisabeth Bothfeld, Frauke Dittmann, Hedwig<br />
Göbel, Gudrun Hamacher, Waltraud Hessedenz, Elfriede<br />
Hoffmann und Ruth Köhn, ein herzliches Willkommen von<br />
dieser Stelle aus.<br />
5
6<br />
Gerne hätte ich auch meine Vorgängerin in der <strong>DGB</strong><br />
Frauenpolitik, Irmgard Blättel, hier begrüßt. Sie ist leider<br />
aus gesundheitlichen Gründen verhindert und lässt alle<br />
recht herzlich grüßen. Auch von hier senden wir Irmgard<br />
Blättel die besten Genesungswünsche.<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Delegierte, in diesem Jubiläumsjahr<br />
erlaube ich mir, mit einigen wenigen Stichworten an vergangene<br />
frauenpolitische Kämpfe zu erinnern. Gleiches<br />
Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit hat viele<br />
Gewerkschafterinnen ein ganzes Leben lang begleitet.<br />
In den 60er Jahren haben die Frauen erreicht, dass die<br />
Lohnabschlagsklauseln abgeschafft wurden. Dann ging<br />
es den Leichtlohngruppen an den Kragen und heute<br />
gibt es immer noch die Debatte um die gerechte<br />
Bewertung von Arbeit. In der Auseinandersetzung um<br />
den § 218 haben die Gewerkschafterinnen an vorderster<br />
Front mitgekämpft. Und die Anerkennung der<br />
Erziehungszeiten in der Rentenversicherung wäre ohne<br />
das Engagement der Gewerkschaftsfrauen nicht durchgesetzt<br />
worden. Die seit Jahrzehnten von den Gewerkschaftsfrauen<br />
geforderten besseren Rahmenbedingungen<br />
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die<br />
Elternzeit mit Lohnersatzleistungen sind mittlerweile in der<br />
Politik angekommen. Auch die Arbeitszeitgestaltung gehörte<br />
und gehört noch immer zu den zentralen Aufgaben der<br />
gewerkschaftlichen Frauenpolitik.<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Gäste, selbstverständlich brauchen<br />
wir zur Umsetzung unserer Ziele und Forderungen Bündnispartnerinnen<br />
und Bündnispartner. Ich freue mich daher,<br />
dass als Vertreterinnen von Verbänden und Organisationen,<br />
mit denen wir vernetzt sind und zusammenarbeiten, einige<br />
namhafte Vertreterinnen unter uns sind. Ich begrüße daher<br />
Birgit Zenker, die Bundesvorsitzender der KAB und Henny<br />
Engels vom Deutschen Frauenrat – herzlich willkommen.<br />
Ich freue mich ganz besonders, dass auch eine namhafte<br />
Vertreterin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes an<br />
unserer Bundesfrauenkonferenz teilnimmt. Herzlich willkommen,<br />
Renate Csörgits.<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Gäste, mit einer anderen Geste, als<br />
gewohnt, möchten wir all derer gedenken, die vor uns in<br />
der Frauenpolitik gekämpft haben und heute nicht mehr<br />
unter uns sind. Mit dieser Geste wollen wir auch allen danken,<br />
die sich in der Vergangenheit für die Gleichberechtigung<br />
eingesetzt haben und dieses Ziel jetzt an anderer<br />
Stelle verfolgen. Wir wollen uns auch gegenseitig Mut und<br />
deutlich machen, es lohnt sich zu engagieren. Deshalb wol-<br />
len wir jetzt gemeinsam das Lied „Brot und Rosen“ singen.<br />
Ich freue mich, dass dieses Symbol von der Geschäftsführerin<br />
des Deutschen Frauenrates, nicht in ihrer amtlichen<br />
Funktion, sondern ganz persönlich mit ihrer Gitarre unterstützt<br />
wird.<br />
Gemeinsames Singen von „Brot und Rosen“<br />
Schönen Dank, Frau Engels.<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die 16. <strong>DGB</strong> Bundesfrauenkonferenz<br />
ist eröffnet.
Konstituierung der Bundesfrauenkonferenz<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer, stellv. Vorsitzende des <strong>DGB</strong><br />
Ich möchte jetzt zur Konstituierung kommen. Wir verabschieden<br />
die Tagesordnung. Der Vorschlag für die Tagesordnung<br />
wurde euch mit den Unterlagen zugeschickt. Ich bitte<br />
diejenigen um das Kartenzeichen, die dieser Tagesordnung<br />
zustimmen.<br />
Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist die Tagesordnung<br />
angenommen.<br />
Wir kommen zweitens zur Verabschiedung der Geschäftsordnung<br />
und bitte auch hier um das Kartenzeichen. Wer ist<br />
mit der Geschäftsordnung einverstanden, wie sie den<br />
Unterlagen beigefügt ist? Wer ist dagegen? Wer enthält<br />
sich? Auch dies ist eine einstimmige Unterstützung dieser<br />
Geschäftsordnung.<br />
Drittens wählen wir die Konferenzleitung. Hierzu sind vorgeschlagen:<br />
Monika Lersmacher, IG Metall, Marianne Malkowski,<br />
IG BCE, Ellen Maurer, ver.di, und Birgit Pitsch, NGG.<br />
Ich bitte um das Kartenzeichen für die Bestätigung der Konferenzleitung.<br />
Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand? So<br />
ist auch die Konferenzleitung einvernehmlich gewählt und<br />
ich bitte die genannten Kolleginnen auf die Bühne und das<br />
Amt zu übernehmen. Herzlichen Dank.<br />
Konferenzleitung<br />
Liebe Kolleginnen, auch von unserer Seite noch mal herzlich<br />
willkommen und vielen Dank für den Vertrauensvorschuss,<br />
den ihr uns gegeben habt. Wir hoffen, dass wir euch gut<br />
durch die Konferenz führen werden.<br />
Wir fahren in der Konstituierung fort und kommen zur<br />
Bestätigung der Antragskommission. Der Bundesfrauenausschuss<br />
hat vorgeschlagen, dass alle Mitgliedsgewerkschaften<br />
vertreten sind. In euren Konferenzunterlagen habt ihr<br />
die Namensliste der vorgeschlagenen Kolleginnen der<br />
Antragskommission, die schon getagt und gearbeitet hat,<br />
vorliegen.<br />
Ich bitte um das Kartenzeichen für die Bestätigung der<br />
Antragskommission – danke. Gibt es Gegenstimmen,<br />
Stimmenthaltungen? Somit ist die Antragskommission einstimmig<br />
gewählt worden.<br />
Wir kommen zur Wahl der Mandatsprüfungs- und Zählkommission.<br />
Auch hier liegt euch ein Vorschlag vor. Wundert<br />
euch nicht, dass nur Kolleginnen aus drei Gewerkschaften<br />
vertreten sind. Hier hat auch der Bundesfrauenausschuss<br />
vorgedacht und schlägt vor, die Kolleginnen aus den drei<br />
großen Delegationen zu benennen, damit die kleineren<br />
Delegationen damit arbeitsentlastet sind.<br />
Die Namen liegen euch vor und ich bitte um das Kartenzeichen,<br />
wenn ihr mit diesem Vorschlag einverstanden seid –<br />
danke. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen<br />
– auch nicht. Dann ist die Mandatsprüfungsund<br />
Zählkommission einstimmig gewählt.<br />
Hinweis für die Einreichung von Initiativ- oder Änderungsanträgen:<br />
Mit der beschlossenen Geschäftsordnung wurde<br />
der Termin für die Abgabe von Initiativ- und Änderungsanträgen<br />
bei der Konferenzleitung auf den 25.11.05 um<br />
12.00 Uhr festgelegt. Alle Initiativ- oder Änderungsanträge<br />
müssen mit mindestens 20 Unterschriften von ordentlichen<br />
Delegierten versehen sein. Für die Initiativanträge gilt, dass<br />
die betreffende Sache erst nach dem 25.08.05 bekannt<br />
sein konnte. Die Initiativ- oder Änderungsanträge werden<br />
im Tagungsbüro in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr von<br />
der Kollegin Ellen Maurer entgegen genommen. Ich bitte<br />
das zu beachten und die Kollegin dementsprechend im<br />
Büro aufzusuchen.<br />
7
8<br />
Geschäftsordnung<br />
❚ Die Konferenz wählt vier Moderatorinnen, die die Konferenz<br />
leiten.<br />
❚ Die vom Bundesfrauenausschuss gewählte, aus acht<br />
Mitgliedern bestehende Antragsberatungskommission<br />
ist durch die ordentlichen Delegierten der Gewerkschaften<br />
zu bestätigen.<br />
❚ Zur Prüfung der Mandate wird eine Mandatsprüfungsund<br />
Zählkommission gewählt. Diese besteht aus fünf<br />
Mitgliedern. Über die Gültigkeit der Mandate entscheidet<br />
die Konferenz. Mitglieder der Antrags-, Mandatsund<br />
Zählkommission müssen ordentliche Delegierte der<br />
Gewerkschaften sein.<br />
❚ Wortmeldungen werden erst nach der Eröffnung der<br />
Debatte entgegengenommen und haben schriftlich zu<br />
erfolgen. Die Rednerinnen und Redner erhalten nach<br />
der Reihenfolge der Meldungen das Wort.<br />
❚ Die Redezeit beträgt für jede Diskussionsrednerin,<br />
jeden Diskussionsredner höchstens zehn Minuten.<br />
❚ Mitglieder des <strong>DGB</strong>-Bundesvorstandes und Sachverständige<br />
des Bundesvorstandes können auf Verlangen<br />
außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen sprechen.<br />
Mitglieder des Bundesfrauenausschusses und<br />
Delegierte der Landesbezirke sind berechtigt, an der<br />
Diskussion teilzunehmen.<br />
❚ Bei Anträgen zur Geschäftsordnung erhält eine Rednerin<br />
bzw. ein Redner für und eine Rednerin bzw. ein<br />
Redner gegen den Antrag das Wort. Das Wort zu<br />
Geschäftsordnungsanträgen wird außerhalb der Reihenfolge<br />
der vorgemerkten Rednerinnen bzw. Redner<br />
erteilt. Persönliche Bemerkungen sind erst am Schluss<br />
der Debatte zulässig.<br />
❚ Spricht eine Rednerin, bzw. ein Redner, nicht zur Sache,<br />
so hat die Konferenzleitung sie/ihn zur Sache zu rufen.<br />
Nach zweimaliger vergeblicher Mahnung der Konferenzleitung<br />
ist der Rednerin/dem Redner das Wort zu<br />
entziehen.<br />
❚ Initiativanträge und Änderungsanträge, außer solchen<br />
zur Geschäftsordnung, sind schriftlich einzureichen und<br />
müssen mit mindestens 20 Unterschriften von ordentlichen<br />
Delegierten der Gewerkschaften versehen sein<br />
und spätestens bis 12.00 Uhr am 25. November 2005<br />
bei der Ta-gungsleitung eingereicht sein. Als Initiativanträge<br />
werden nur solche Anträge zugelassen, deren<br />
Antragsbegehren bis zum Termin der Antragstellung<br />
25. August 2005 noch nicht bekannt sein konnte. Bei<br />
der Diskussion über einen Antrag erhält zunächst eine<br />
Vertreterin des Antragstellers das Wort. Die Redezeit<br />
hierfür beträgt höchstens zehn Minuten. Über die Empfehlung<br />
der Antragskommission wird zuerst abgestimmt.<br />
❚ Ein Antrag auf Schluss der Debatte kann nur von einer/<br />
einem ordentlichen Delegierten der Gewerkschaften<br />
gestellt werden, die/der zum anstehenden Diskussionspunkt<br />
noch nicht gesprochen hat. Wird ein Antrag auf<br />
Schluss der Debatte oder Vertagung gestellt, erhält<br />
eine Rednerin bzw. ein Redner für und eine Rednerin<br />
bzw. ein Redner gegen den Antrag das Wort.<br />
❚ Die Redezeit kann auf Antrag auf drei Minuten begrenzt<br />
werden.<br />
❚ Die Konferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens die<br />
Hälfte der ordentlichen Delegierten anwesend ist.<br />
Abstimmungen erfolgen durch Handaufheben mit der<br />
Stimmkarte. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit<br />
gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Enthaltungen<br />
gelten als nicht abgegebene Stimmen.
Mündlicher Geschäftsbericht<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer, stellv. Vorsitzende des <strong>DGB</strong><br />
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Delegierte,<br />
liebe Gäste,<br />
ich glaube, der Termin für diese Bundesfrauenkonferenz<br />
hätte gar nicht besser gelegt werden können. Denn wir<br />
haben ja seit zwei Tagen eine neue Bundesregierung. CDU-<br />
CSU und SPD haben sich nun endlich auf einen Koalitionsvertrag<br />
geeinigt und der Deutsche Bundestag hat zum<br />
ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine Frau<br />
zur Bundeskanzlerin gewählt.<br />
Ich selbst – und viele von euch wahrscheinlich auch –<br />
werde häufig gefragt: Ist das eine Chance, dass die Gleichstellung<br />
von Frauen in allen Lebensbereichen endlich durchgesetzt<br />
wird?<br />
Realistisch müssen wir hierzu feststellen: Eine Frau an der<br />
Spitze garantiert allein natürlich noch keinen Erfolg in der<br />
Frauen- und Gleichstellungspolitik.<br />
Entscheidend ist, welche Politik Frau Merkel als Bundeskanzlerin<br />
der Großen Koalition verfolgen wird. Hohe Erwartungen<br />
dürften fehl am Platz sein; hier wie überall ist der<br />
Koalitionsvertrag gemischt zu bewerten: Positiv ist die<br />
erklärte Bereitschaft zur Ausweitung der Kinderbetreuung<br />
sowie die Einführung des Elterngeldes.<br />
Hierbei brauchen wir unser Licht nicht unter den Scheffel zu<br />
stellen. Wesentliche Vorarbeiten sowohl zum Ausbau der<br />
Kinderbetreuung wie zur Einführung des Elterngeldes<br />
haben wir gemacht und in die Politik der vorherigen Bundesregierung<br />
eingebracht. Wir freuen uns über den Erfolg,<br />
dies auch der CDU/CSU nahe gebracht zu haben.<br />
Bedauerlich ist jedoch, dass wieder einmal jegliche Bereitschaft<br />
beider großen Parteien fehlt, einen verbindlichen<br />
gesetzlichen Rahmen für die Gleichstellung in der privaten<br />
Wirtschaft zu schaffen. So muss es vielen von euch, die sich<br />
tagtäglich für die Gleichstellung in Betrieben und Verwaltungen<br />
einsetzen, wie ein „Placebo“ vorkommen, wenn im<br />
Koalitionsvertrag steht: Die freiwillige Vereinbarung der vorherigen<br />
Bundesregierung mit der Wirtschaft soll ein weiteres<br />
Mal bilanziert werden. Schon die erste so genannte<br />
Bilanz zeigte nur die wenigen bekannten Leuchttürme. In<br />
der Fläche – das wisst ihr am allerbesten – ist nach wie vor<br />
Fehlanzeige. Die zweite Bilanz bedeutet lediglich ein weite-<br />
res Ausweichmanöver. Wir als Frauen in den Gewerkschaften<br />
erwarten, dass eine Bilanz Auskunft gibt über den tatsächlichen<br />
Fortschritt der Gleichstellung in den Betrieben.<br />
Wir wollen endlich ein Gleichstellungsgesetz für die private<br />
Wirtschaft. Unsere Vorschläge hierzu liegen seit vier Jahren<br />
vor. Sie müssen endlich in die Politik umgesetzt werden.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
lasst mich zunächst einige generelle Anmerkungen<br />
machen zur Koalitionsvereinbarung und ihre Auswirkungen<br />
auf die Gleichstellung von Frauen, insbesondere auf dem<br />
Arbeitsmarkt und zur <strong>Soziale</strong>n <strong>Sicherung</strong>. Es ist ein großer<br />
Erfolg, vor allem für uns als Gewerkschaften, dass die Tarifautonomie,<br />
die Mitbestimmung und die Betriebsverfassung<br />
unangetastet bleiben sollen. Allerdings sollten wir uns keinen<br />
Illusionen hingeben: Die neoliberalen Kräfte in der<br />
CDU/CSU Der Druck auf die Regierung wird zunehmen,<br />
solange sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht bessert.<br />
Wir werden wachsam bleiben müssen.<br />
Teuer erkauft ist der Erhalt der Tarifautonomie allerdings<br />
durch die vereinbarte Lockerung des Kündigungsschutzes.<br />
Die geplante Ausdehnung der Wartezeit auf zwei Jahre<br />
erhöht die Unsicherheit vieler Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmer und schwächt die Durchsetzung ihrer Rechte<br />
weiterhin. Das Argument, dies träfe nur die Neueingestellten<br />
auf dem Arbeitsmarkt, ist nicht stichhaltig:<br />
Wie wollen wir gerade von jüngeren Menschen erwarten,<br />
dass sie die Verantwortung für eine Familie und Kinder auf<br />
sich nehmen, wenn gleichzeitig die Gefahr der Entlassung<br />
noch größer wird. Bei 7 – 8 Millionen Menschen, die jährlich<br />
gezwungen oder freiwillig ihren Arbeitsplatz wechseln,<br />
kann sich jeder ausrechnen, dass in wenigen Jahren ein<br />
großer Teil der Erwerbstätigen von dieser Aushöhlung des<br />
Kündigungsschutzes betroffen sein wird. Frauen, die nach<br />
wie vor die hauptsächliche, wenn nicht alleinige Verantwortung<br />
für die Kindererziehung leisten, und bei Einstellungen<br />
benachteiligt sind, werden einmal mehr unter dieser Unsicherheit<br />
ihres Arbeitsplatzes leiden müssen.<br />
9
10<br />
Wir sollten dies der neuen Regierungskoalition und beiden<br />
Koalitionsparteien, auch als Frauen in den Gewerkschaften,<br />
deutlich vor Augen halten.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
wenig klar erkennbar ist der rote Faden bei den erklärten<br />
Zielen: mehr Wachstum und Beschäftigung und Stabilisierung<br />
der <strong>Soziale</strong>n <strong>Sicherung</strong>ssysteme. Zu unterstützen<br />
ist in jedem Fall das Programm zur Ausweitung öffentlicher<br />
und privater Investitionen in Höhe von 25 Milliarden Euro<br />
über vier Jahre sowie die Förderung von Mittelstand und<br />
Handwerk. Für uns als Frauen und Arbeitnehmerinnen ist es<br />
entscheidend, ob und inwieweit hiermit neue Arbeitsplätze<br />
auch für Frauen geschaffen werden und die soziale Infrastruktur<br />
für Kinderbetreuung, Pflege und Bildung verbessert<br />
werden kann.<br />
Eine Wachstumsbremse droht dagegen die Erhöhung der<br />
Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent ab 2007 zu werden.<br />
Dies wird die ohnehin schwache Binnennachfrage drastisch<br />
einschränken – zumal die Steuererhöhung nur zu einem<br />
geringen Teil zur Senkung der Sozialabgaben genutzt werden<br />
soll. Familien, Alleinerziehende und Arbeitslose werden<br />
die Leidtragenden sein. Noch gravierender ist, dass die notwendigen<br />
Steueranteile in der gesetzlichen Renten- und<br />
Krankenversicherung massiv gekürzt werden. Das ist finanzpolitische<br />
Wilderei in der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung.<br />
Dies führt dazu, dass die Beiträge steigen<br />
und die Leistungen weiter eingeschränkt werden. Dies trifft<br />
Frauen, Arbeitslose, Kranke und Rentnerinnen besonders<br />
hart. Wenn in Zukunft der Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung<br />
für das Arbeitslosengeld II von 78 Euro auf<br />
40 Euro beinahe halbiert wird, bedeutet dies Ausfälle bei<br />
der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 2 Mrd.<br />
Euro und für Langzeitarbeitslose, darunter viele Frauen,<br />
noch mehr Armut im Alter. Wenn in Zukunft der Bundeszuschuss<br />
zur gesetzlichen Krankenversicherung eingefroren<br />
werden soll, bedeutet dies erhebliche Steigerungen der Beiträge<br />
und eine weitere Senkung der Rentenleistungen.<br />
Dies steht im krassen Widerspruch zu der erklärten Zielsetzung<br />
der Stabilisierung der sozialen <strong>Sicherung</strong>ssysteme. Hier<br />
müssen wir als Männer und Frauen in den Gewerkschaften<br />
die neue Bundesregierung in ihre Verantwortung nehmen.<br />
Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr steuerlichen<br />
Ausgleich für die soziale <strong>Sicherung</strong>. Zunehmende Ausfälle<br />
an Beiträgen durch staatlich geförderte Mini-Jobs, Ich-AGs<br />
und Ein-Euro-Jobs müssen durch steuerliche Zuschüsse ausgeglichen<br />
werden. Ebenfalls gilt dies für Erziehungs- und<br />
Pflegeleistungen. Die Armutsfalle im Alter – die immer mehr<br />
Frauen trifft – darf nicht noch weiter ausgedehnt, sondern<br />
muss endlich geschlossen werden. Die Heraufsetzung des<br />
Rentenalters auf 67 führt zu einem Rentenkürzungsprogramm.<br />
Es fehlen schlichtweg Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer. Über 40 Prozent der<br />
Betriebe beschäftigen niemanden, der oder die älter als<br />
50 Jahre alt ist. Notwendig ist vielmehr eine Anhebung des<br />
faktischen Renteneintrittsalters. Und dafür ist aber eine<br />
alters- und alternsgerechte Erwerbsarbeit erforderlich. Hierbei<br />
ist zuallererst die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt<br />
zu verbessern.<br />
Dazu zunächst einige Fakten: Die Quote der erwerbstätigen<br />
Frauen in Deutschland stieg bis Ende 2004 auf fast 60 Prozent.<br />
Damit hat Deutschland die EU-weite Zielquote von<br />
57 Prozent für das Jahr 2005 bereits leicht überschritten.<br />
Das hört sich wie ein Erfolg an. Doch der Teufel liegt im<br />
Detail: Mit dem Anstieg der Frauenbeschäftigung geht nämlich<br />
kein Anstieg des Arbeitsvolumens einher.<br />
Das Gegenteil ist der Fall: Immer mehr Frauen müssen sich<br />
ein immer kleineres Stück vom Erwerbskuchen teilen. Auf<br />
Vollzeitarbeitsplätze umgerechnet wären Frauen nur zu<br />
rund 39 Prozent am Erwerbsleben beteiligt. 84 Prozent aller<br />
Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Und jede zehnte Frau ist<br />
geringfügig beschäftigt – und das bedeutet: niedriges Einkommen,<br />
hohe Gefahr der Arbeitslosigkeit, Armut im Alter.<br />
Wir müssen leider feststellen: Frauen sind alles andere als<br />
die Gewinnerinnen auf dem Arbeitsmarkt. Völlig unerträglich<br />
ist es, wenn Arbeitgeber und ihre Verbände – aber auch<br />
und vor allem die öffentlichen Arbeitgeber – mehr und<br />
mehr pauschale Verlängerungen der Arbeitszeit verlangen.<br />
Dies ist eine phantasielose Verschärfung der Arbeitsbedingungen<br />
– vor allem zu Lasten von Frauen und Kindern. Dies<br />
müssen wir immer wieder deutlich machen.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und<br />
Kollegen,<br />
unser Kernproblem am Arbeitsmarkt ist der ungebremste<br />
Abbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Und<br />
diese Entwicklung wird immer mehr zur Nagelprobe. Es<br />
muss uns gelingen, diesen Negativtrend zu stoppen und<br />
umzudrehen. Dazu brauchen wir auch und vor allem eine<br />
Begrenzung der Mini-Jobs. Wir brauchen Rückkehrrechte<br />
auf Vollzeit oder vollzeitnahe Arbeitplätze nach einer Elternzeit.<br />
Daneben ist richtig und wichtig, dass der generelle<br />
Teilzeitanspruch auch nach dem neuen Koalitionsvertrag<br />
erhalten bleiben soll.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
zentrale Auseinandersetzungen gab es in den letzten<br />
Jahren um die Reformen am Arbeitsmarkt. Für Frauen hat<br />
sich mit den vier Hartz-Gesetzen vieles geändert – Verbesserungen<br />
gibt es aber nur für wenige. Denn diese Gesetze<br />
begünstigen ein Ausufern des Niedriglohnsektors. Nach<br />
Hartz IV dürfen Langzeitarbeitslose eine Arbeit nur noch<br />
ablehnen, wenn sie sittenwidrig ist – und dies ist sie erst<br />
dann, wenn der Lohn um 30 Prozent unter dem Tarif oder<br />
den ortsüblichen Löhnen liegt, und auch geringfügige<br />
Beschäftigungen ohne Existenz sichernden Verdienst gelten<br />
als zumutbar. Dies verdient nicht den Namen Reform, sondern<br />
ist der Weg in die Armut und zu schlechten Arbeitsbedingungen.<br />
Eine Spirale nach unten, die wir unbedingt<br />
beenden müssen.<br />
Ein Weiteres: Durch die verschärfte Anrechnung des Partnereinkommens<br />
werden Frauen in die Abhängigkeit des<br />
Mannes als Familienernährer zurückverwiesen. Eine unerträgliche<br />
Entwicklung ist der massenhafte Einsatz von Ein-<br />
Euro-Jobs. Gerade im Bereich der humanen Dienstleistungen<br />
geraten schon jetzt typische Frauenarbeitsplätze immer<br />
mehr unter Druck.<br />
Wir bleiben auch gegenüber der neuen Bundesregierung<br />
bei unseren Forderungen zur Korrektur von Hartz IV. Einige<br />
unserer Forderungen konnten wir in die Koalitionsvereinbarungen<br />
hineinbringen.<br />
Wir wollen die Rücknahme der stärkeren Anrechnung des<br />
Partnereinkommens.<br />
Wir wollen den Zugang von Nichtleistungsempfängerinnen<br />
zu Fördermaßnahmen mit einem verbindlichen Finanzrahmen.<br />
Nach dem Koalitionsvertrag können wir an dieser<br />
Stelle mit Verbesserungen rechnen.<br />
Bundesregierung und Bundesagentur müssen geschlechtsspezifische<br />
Daten zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung vorlegen,<br />
damit sichtbar wird, wie sich die Regelungen ganz<br />
konkret auf Frauen auswirken.<br />
Endlich haben dies auch die großen Parteien erkannt und in<br />
der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben.<br />
Ein-Euro-Jobs dürfen nicht ausgeweitet werden, sozialversicherungspflichtige<br />
Beschäftigung muss erhalten bleiben.<br />
Lohndumping muss bekämpft werden!<br />
Dabei ist das Arbeitnehmerentsendegesetz ein wirksames<br />
Instrument.<br />
Auf unsere nachhaltige Initiative hatte die vorige Bundesregierung<br />
einen Gesetzentwurf zur Ausweitung des<br />
Arbeitnehmerentsendegesetzes auf alle Wirtschaftsbereiche<br />
eingebracht. Leider ist dieser von der Mehrheit<br />
der unionsgeführten Länder im Bundesrat blockiert<br />
worden. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung<br />
wird eine Ausweitung auf den Bereich der Gebäudereinigung<br />
angekündigt und die Ausweitung auf weitere<br />
Branchen wird geprüft. Hier werden wir weitere Initiativen<br />
ergreifen.<br />
Wir begrüßen die Angleichung des ALG II Ost an das Westniveau.<br />
Ebenfalls eine nachhaltige Initiative der Gewerkschaften.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewinnt<br />
zunehmend an Bedeutung. Dies ist ein Erfolg, den sich die<br />
gewerkschaftliche Frauenpolitik maßgeblich auf die Fahnen<br />
schreiben kann. Viele Konzepte zur besseren Vereinbarkeit<br />
haben wir eingebracht. Zur Vereinbarkeit von Familie und<br />
Beruf gehört aber nicht allein die Kindererziehung, sondern<br />
auch der immer wichtiger werdende Bereich der Pflege.<br />
Viele Pflegearbeit leistende Frauen geben ihre Berufstätigkeit<br />
auf. Wir brauchen Veränderungen in Betrieben und Verwaltungen,<br />
vor allem bei den Arbeitszeiten. Auch Pflegearbeit<br />
und Erwerbsarbeit müssen miteinander vereinbar<br />
sein.<br />
Und wir müssen Konzepte entwickeln:<br />
❚ Wie wollen wir im Alter leben?<br />
❚ Wie soll das Unterstützungsnetz von ambulanter und stationärer<br />
Pflege aussehen?<br />
❚ Wie sollen haushaltsnahe Dienstleistungen im Bereich der<br />
häuslichen Pflege gestaltet werden und – nicht zuletzt –<br />
was sind sie uns wert?<br />
Hier müssen auch die Gewerkschaften einen Beitrag leisten.<br />
Entsprechende Anträge liegen der Bundesfrauenkonferenz<br />
vor.<br />
11
12<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
wir wissen: Wer Verantwortung in einer Familie übernimmt,<br />
erleidet Nachteile am Arbeitsmarkt und in der sozialen<br />
<strong>Sicherung</strong>. Dies betrifft vor allem Frauen. Männer sind<br />
dagegen fast kontinuierlich in Vollzeit erwerbstätig. Eine<br />
Schlüsselstelle ist auch hier die Frage der Arbeitszeit. Familien<br />
brauchen stabile Arbeitszeiten, die gleichzeitig ein hohes<br />
Maß an Flexibilität beinhalten. Sie müssen sich an den<br />
Bedürfnissen von Familien orientieren und eine verlässliche<br />
und planbare Größe in der Organisation des Alltags sein.<br />
Dazu gehört auch die Möglichkeit zur vollzeitnahen Teilzeitarbeit<br />
und zur Teilzeitarbeit in Führungspositionen. Aber<br />
eine familienfreundliche Gestaltung von Arbeitszeit entfaltet<br />
nur dann Wirkung, wenn die öffentlichen Betreuungsangebote<br />
vorhanden sind. Und da hinken wir in Deutschland<br />
noch immer hinterher!<br />
Für den <strong>DGB</strong> sind der Ausbau und die Verbesserung der<br />
Tageseinrichtungen für Kinder – auch für die unter Dreijährigen<br />
– eine besondere gesellschaftspolitische Aufgabe. Sie<br />
müssen bedarfsgerecht und wohnortnah, pädagogisch qualifiziert<br />
und bezahlbar sein.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
einen wichtigen Schritt für den Ausbau der Kinderbetreuung<br />
haben wir bereits erreicht. Das Tagesbetreuungsausbaugesetz<br />
aus der letzten Legislaturperiode haben wir<br />
aktiv begleitet. Endlich wurde eine gesetzliche Grundlage<br />
für die Verbesserungen in diesem viel zu lange vernachlässigtem<br />
Bereich geschaffen. Das Ziel des Tagesbetreuungsausbaugesetzes<br />
ist es, ein qualifiziertes und bedarfsgerechtes<br />
Betreuungsangebot für unter dreijährige Kinder bis<br />
2010 zu schaffen. Die Koalitionspartner der neuen Regierung<br />
haben sich klar zu diesem Gesetz bekannt. Wir werden<br />
uns auch weiterhin aktiv in die Politik zum Ausbau der<br />
Kinderbetreuung einmischen.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
die Berufstätigkeit von beiden Elternteilen hat auch<br />
auf die öffentlichen Haushalte und auf die Sozialversicherungen<br />
positive Auswirkungen: Einnahmen fließen in den<br />
Staatshaushalt und die Sozialversicherungen. Und: Kinderbetreuung<br />
schafft Arbeitsplätze.<br />
Wir wollen anständige Arbeitsplätze und keine Billigjobs.<br />
Gerade hier dürfen keine neuen prekären Beschäftigungsverhältnisse<br />
für Frauen entstehen!<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
die Frage der Vereinbarkeit darf aber nicht länger<br />
hauptsächlich ein Problem der Mütter bleiben. Elterngeld<br />
und Erziehungsgeld reichen nicht aus, die traditionelle<br />
Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern zu überwinden.<br />
Wichtig ist, dass die Koalitionsparteien unseren Vorschlag,<br />
ein Elterngeld in Höhe des Arbeitslosengeldes vorzusehen,<br />
aufgegriffen haben. Notwendig sind Regelungen<br />
der verbindlichen Inanspruchnahme auch durch Väter. Wir<br />
werden die weitere praktische Umsetzung konstruktiv kritisch<br />
begleiten.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,wir<br />
reden nicht nur über eine bessere Vereinbarkeit,<br />
wir helfen und beraten auch bei der Umsetzung. In den vergangenen<br />
Jahren haben wir in Zusammenarbeit mit der<br />
Stiftung Walter Hesselbach ein erfolgreiches Beratungsprojekt<br />
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in<br />
kleinen und mittelständigen Unternehmen durchgeführt.<br />
So wurde in einem mittelständischen Unternehmen in der<br />
Metall- und Elektroindustrie eine Art Notfallkoffer entwickelt.<br />
Dieser Notfallkoffer enthält alle Adressen wohnortnaher<br />
Anlaufstellen, die helfen, wenn in der Kinderbetreuung<br />
oder in der Pflege von Angehörigen Notfälle auftreten.<br />
Ein weiteres Beispiel aus einem mittelständischen Unternehmen<br />
der Ernährungsindustrie mit Produktion und etlichen<br />
Verkaufsfilialen: Das Unternehmen befindet sich in<br />
einem umfangreichen Veränderungsprozess. Viele der Beschäftigten<br />
sind aufgrund von Familienpflichten an die Zeiten<br />
von regionalen Betreuungsangeboten gebunden. Das<br />
führt zu zeitlichen Engpässen. Außerdem kehren viele Beschäftigte<br />
aus der Elternzeit nicht mehr in den Betrieb<br />
zurück. In diesem Unternehmen wurden Lösungsansätze<br />
entwickelt, die die betrieblichen Bedingungen und die Familienaufgaben<br />
der Beschäftigten möglichst optimal miteinander<br />
verknüpfen. Zu diesen Ideen gehören z.B. eine zusätzliche<br />
Mittelschicht in den Verkaufsfilialen zu Zeiten mit<br />
besonderem Kundenandrang und eine kritische Überprüfung<br />
der Arbeitsabläufe in der Produktion sowie eine Veränderung<br />
der Arbeitszeiten für einzelne Arbeitsplätze und die<br />
Qualifizierung der Beschäftigten.<br />
An diesen beiden Beispielen wird deutlich, dass es in diesem<br />
Projekt oft um so genannte kleine Schritte geht, die<br />
aber letztendlich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
von großer Bedeutung sind.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,seit<br />
Jahren streiten wir für gesetzliche Regelungen<br />
und setzen uns gleichzeitig für eine gute betriebliche Praxis<br />
ein. Die Einführung der Quote für die Betriebsratsmitglieder<br />
hat uns ein ganzes Stück weitergebracht: Der Anteil der
Frauen in den Betriebsräten ist durchschnittlich um fünf<br />
Prozent gestiegen.<br />
Bei der letzten Bundesfrauenkonferenz wurden Grundzüge<br />
und Handlungsfelder für ein Aktionsprogramm des <strong>DGB</strong><br />
und der Gewerkschaften zur Chancengleichheit von Frauen<br />
und Männern entwickelt. Das sollte eine Aufgabe des <strong>DGB</strong><br />
insgesamt werden. Besonders uns Gewerkschaftsfrauen ist<br />
es gelungen, das Programm mit Leben zu füllen. Es gibt<br />
vielfältige Aktivitäten der <strong>DGB</strong>-Regionen und Bezirke. Eine<br />
Dokumentation aller von uns geförderten Projekte findet ihr<br />
in den Tagungsunterlagen.<br />
Nur ein Beispiel:<br />
Netzwerke von Betriebs- und Personalräten, die an der<br />
Chancengleichheit in den Betrieben arbeiten, wurden unterstützt,<br />
begleitet und auch neu gegründet. Diese Netzwerke<br />
haben wir gemeinsam mit den Mitgliedsgewerkschaften zu<br />
einem Austauschtreffen eingeladen. Wir werden weiterhin<br />
diese Arbeit unterstützen – demnächst auch über einen<br />
neuen Internet-Auftritt unserer Abteilung.<br />
Daneben gibt es weitere Projekte:<br />
Mit dem „Kompetenzzentrum für Chancengleichheitspolitik<br />
in der Arbeits- und Dienstleistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“<br />
konnten wir in betrieblichen Beratungsprozessen,<br />
in branchenbezogenen und regionalen Aktivitäten die<br />
Chancengleichheit von Frauen und Männern voranbringen.<br />
Auch aus diesem Projekt kann ich nur exemplarische Beispiele<br />
kurz aufzeigen.<br />
Die BARMER hat erkannt, dass Männer Präventionsmuffel<br />
sind und dass sie ihre Präventionsangebote gendern muss.<br />
In Kürze unterbreitet die Regionalstelle Bergisch-Gladbach<br />
ihren Versicherten (62 Prozent sind Frauen) ein wohnortnahes<br />
Präventionsangebot. Die Angebote wurden hinsichtlich<br />
ihrer Inanspruchnahme und Wirkung auf beide Geschlechter<br />
überprüft und angepasst. Dies erfolgte im Rahmen des Projekts.<br />
Interessant dabei ist, dass die Gleichstellung der<br />
Geschlechter beim Produktangebot eine Rolle spielt und<br />
nicht in Bezug auf die Beschäftigten der BARMER.<br />
Beim DB-Fernverkehr, Regionalbereich Nord, ist ein Pilotvorhaben<br />
noch in Planung. Im Rahmen eines Seminars für<br />
Betriebsratsmitglieder wurde die Gleichstellung der Geschlechter<br />
in den Schwerpunktthemen Potenzialerfassung<br />
und Gesundheitsförderung beraten. Im Anschluss an diesen<br />
Workshop hat der Betriebsrat beschlossen, in einem kleinen<br />
Bereich der DB-Fernverkehr Nord (Speisewagen-Logistik)<br />
mit einem Anteil von 20 Prozent Frauen eine Befragung zu<br />
den Arbeitsbedingungen durchzuführen. Ziel ist es, mittelfristig<br />
die Arbeitsplätze so zu gestalten, dass Frauen und<br />
Männer dort gesund arbeiten und darüber hinaus der Frauenanteil<br />
stabilisiert und gesteigert werden kann.<br />
Mit diesen Projekten, die alle in enger Abstimmung mit den<br />
Gewerkschaften durchgeführt werden, zeigen wir, dass eine<br />
Politik für Chancengleichheit in Unternehmen möglich,<br />
erfolgreich und unverzichtbar ist.<br />
In dieser praktischen Arbeit haben wir zudem männliche<br />
Betriebsratsmitglieder, Personalverantwortliche, den einen<br />
oder anderen Arbeitsdirektor und auch Gewerkschaftssekretär<br />
für die Chancengleichheit gewinnen können.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
in der vergangenen Legislaturperiode haben wir uns<br />
erfolgreich für den Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes<br />
eingesetzt und ihn maßgeblich mitgestaltet. Leider ist<br />
dieser Gesetzentwurf von der Mehrheit der unionsgeführten<br />
Länder im Bundesrat blockiert worden. Wir werden nicht<br />
locker lassen, die Verabschiedung eines Antidiskriminierungsgesetzes<br />
in der neuen Legislaturperiode durchzusetzen.<br />
Besonders wichtig ist uns, dass wir als Gewerkschaften<br />
und Betriebsräte selbst Klage bei Diskriminierungen von<br />
Frauen erheben können. Für diejenigen, die keinen Betriebsrat<br />
und keine Gewerkschaft im Betrieb haben, wollen wir<br />
eine gut ausgestattete unabhängige Antidiskriminierungsstelle.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,die<br />
von den Koalitionsparteien geplante Erhöhung<br />
des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre ist nicht nur angesichts<br />
der hohen Arbeitslosigkeit – insbesondere Älterer –<br />
ein Hohn. Auch aus gesundheitspolitischer Perspektive ist<br />
dies nicht vertretbar. Welche Frau soll denn z. B. in der Produktion<br />
oder bei Dienstleistungen noch mit 67 Jahren volle<br />
Leistung erbringen können? An welche Arbeitnehmerinnen<br />
denkt denn die Politik, wenn sie solche Beschlüsse fasst?<br />
Einem solchen Rentenkürzungsprogramm müssen wir eine<br />
entschiedene Absage erteilen. Wir werden uns deshalb auch<br />
in den kommenden Jahren mit alternativen Modellen zur<br />
Verbesserung der Renten für Frauen in die Politik einmischen.<br />
In jedem Fall müssen die Leistungen der Kindererziehung<br />
und Pflegearbeit erheblich besser bewertet werden.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
im Herbst 2001 beschloss der <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss,<br />
das Thema Frauengesundheit stärker zu bearbeiten.<br />
Denn noch immer gilt „der Mann in den besten Jahren“<br />
als die Norm in der Medizin. Die daraus für Frauen,<br />
Kinder und Alte erwachsenden gesundheitlichen Gefahren<br />
bis hin zu tödlichen Risiken werden in jüngster Zeit mehr<br />
13
14<br />
und mehr erkannt. Wir fordern in allen Bereichen des<br />
Gesundheitswesens – von der Forschung über die Prävention<br />
und Früherkennung bis hin zur Therapie und Nachsorge<br />
– das Prinzip des Gender-Mainstreaming in der Gesundheitspolitik.<br />
Der Entwurf eines Gesundheitspräventionsgesetzes,<br />
mit dem die Gesundheitsvorsorge erstmals stärker in<br />
den Blick genommen wird als die Heilung von Krankheiten,<br />
ist von uns begrüßt und maßgeblich mitgestaltet worden.<br />
Auch diesen Gesetzesentwurf haben die unionsgeführten<br />
Länder im Bundesrat scheitern lassen. Wir werden nicht lokker<br />
lassen und weiter auf die Verabschiedung dieses Gesetzes<br />
drängen.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
soweit im Kurzdurchgang unsere Arbeit der vergangenen<br />
vier Jahre. Auch in den nächsten Jahren werden uns<br />
die Probleme auf dem Arbeitsmarkt ebenso begleiten wie<br />
die Fragen nach einer guten sozialen Absicherung von Frauen<br />
und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn wir<br />
uns hier im Saal umsehen, sehen wir viele erfolgreiche und<br />
gestandene Gewerkschaftsfrauen. – Eure Arbeit und euer<br />
Engagement bleiben unsere Grundlage in den nächsten<br />
Jahren. Auf uns alle kommt eine weitere Aufgabe zu: mehr<br />
junge Frauen für unsere gemeinsamen Anliegen zu gewinnen.<br />
Unsere Konferenz ist ein erster Schritt dafür: Wir haben<br />
gezielt einige jüngere Kolleginnen eingeladen. Hier möchten<br />
wir noch stärker werden. Daher werden wir ein Konzept zur<br />
Gewinnung und Mitarbeit von jungen Frauen in den<br />
Gewerkschaften, vor allem auch für die gewerkschaftliche<br />
Frauenarbeit, entwickeln und umsetzen. Wir haben das Wissen<br />
und die Erfahrung, Konzepte zur Frauen- und Gleichstellungspolitik<br />
zu entwickeln und die Hartnäckigkeit, diese<br />
in Politik und Praxis einzubringen. Unsere Bundesfrauenkonferenz<br />
ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und ich<br />
wünsche uns allen den besten Erfolg! Herzlichen Dank.<br />
Konferenzleitung:<br />
Herzlichen Dank, Ursula. Ich darf an dieser Stelle den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesvorsitzenden Michael Sommer recht herzlich begrüßen.<br />
Michael, herzlich willkommen bei uns Frauen.<br />
Ursula, du hast nicht nur den Geschäftsbericht ergänzt,<br />
sondern hast auch ganz aktuell Punkte aus dem Koalitionsvertrag<br />
mit eingeflochten. An vielen Ecken hast du uns<br />
Frauen da aus der Seele gesprochen.<br />
Ich rufe den Tagesordnungspunkt „Aussprache zum<br />
Geschäftsbericht“ auf und bitte um Wortmeldungen.
Aussprache zum mündlichen Geschäftsbericht<br />
Monika Zimmermann – ver.di, Del.Nr. 0075/01:<br />
Die Ausführungen von Ursula Engelen-Kefer kann ich nur<br />
unterstützen. Ich finde es sehr gut, dass sie die Bezeichnung<br />
„starke Gewerkschaftsfrauen” genannt hat. Mir<br />
gefällt natürlich als Rheinländerin auch hervorragend, dass<br />
sie die Begrifflichkeit „Hacken abgelaufen” benutzt hat.<br />
Hinzu kommt, dass sie das Projekt von meinem Arbeitgeber,<br />
von der Barmer, benannt hat, weil es aus meiner Sicht auch<br />
eine Frauenkrankenkasse ist – von den Mitarbeiterinnen her<br />
und auch von den Mitliedern. Ich hätte gerne die Forderungen,<br />
die wir an die Gesellschaft haben, explizit an die Männer<br />
haben, noch ein bisschen ergänzt. Aus meiner Sicht<br />
erwarte ich, dass unsere männlichen verantwortlichen Gewerkschaftsvorsitzenden<br />
die Anliegen des <strong>DGB</strong>, die Anliegen<br />
der Frauen als Selbstverständnis aufnehmen und mit<br />
uns gemeinsam jetzt und in der Zukunft zusammenarbeiten.<br />
Da vermisse ich einiges. Und da ich dieses Konferenzmotto<br />
Frauen sind unerhört einfach genial finde, bin ich<br />
natürlich auch so unerhört, und zwar in der anderen Bedeutung,<br />
dass ich klar formulieren möchte, dass mir an der<br />
einen oder anderen Stelle das Feuer fehlt. Mir fehlt das<br />
Feuer der <strong>DGB</strong>-Männer, die in den Medien diskutieren. Mir<br />
fehlt, dass dadurch die Menschen nicht aufgeweckt werden,<br />
dass sie ganz offensichtlich nicht begeistert werden<br />
können, sich politisch zu betätigen. Daher hoffe ich inständig,<br />
dass von dieser Konferenz ein kämpferisches Signal<br />
nach innen und nach außen geht, damit wir dann gemeinsam<br />
die Gestaltung unserer Gesellschaft übernehmen – das<br />
sage ich mal so. Das ist, was ich zu dem Geschäftsbericht<br />
sagen möchte. Vielen Dank.<br />
Heide Langguth – <strong>DGB</strong> Bayern, Del.Nr. 0012/02:<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin froh über diesen<br />
umfassenden Geschäftsbericht, der auch noch einmal die<br />
Probleme aufgezeigt hat, die wir in den letzten Jahren hatten,<br />
und auch, wie wir darauf reagiert haben und wo wir<br />
auch kleinere und größere Erfolge gehabt haben. Wir haben<br />
aber auch kleinere und größere Niederlagen gehabt, wenn<br />
ich beispielsweise daran denke, dass dieses Gleichstellungsgesetz<br />
für die private Wirtschaft von der ersten Legislaturperiode<br />
auf die zweite geschoben worden ist. Ich glaube,<br />
dass wir uns als Frauen nach wie vor zu viel gefallen lassen.<br />
Es ist auch relativ leicht gewesen das zu verschieben.<br />
Auch in anderen Bereichen, wo wir uns mit unseren Forderungen<br />
nicht haben durchsetzen können, fällt es eben<br />
immer deshalb so leicht, weil wir halt in unseren Frauenzimmern<br />
sitzen bleiben und es wird gar nicht groß in der<br />
Öffentlichkeit wahrgenommen, dass wir eigentlich andere<br />
Forderungen und auch andere Ansprüche haben.<br />
Wenn ich jetzt lese, dass diese freiwillige Vereinbarung mit<br />
der Wirtschaft noch mal evaluiert werden soll oder noch<br />
mal eine Bilanz erstellt werden soll, so ist das einfach eine<br />
Unverschämtheit. Ich finde, wir können uns das so nicht<br />
gefallen lassen. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht<br />
wieder mit einer Resolution reagieren, sondern dass wir uns<br />
da mal etwas Öffentlichkeitswirksames überlegen. Ich habe<br />
keinen direkten Vorschlag, aber wir sollten uns da einmal<br />
etwas anderes ausdenken, damit das auch – wir sind ja<br />
eine Mediengesellschaft – in den Medien einmal ein bisschen<br />
deutlicher wird und damit auch in breiteren Kreisen<br />
unserer Bevölkerung.<br />
Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass hier kein Fernsehen<br />
da ist. Das ist die Frauenkonferenz einer der größten<br />
Organisationen in unserer Gesellschaft. Dass hier das Fernsehen<br />
fehlt, finde ich geradezu irre. Wir müssen selber überlegen,<br />
wie wir es machen, damit wir mit unseren Forderungen,<br />
unseren Ansprüchen besser wahrgenommen werden.<br />
Eins ist auch klar, Kolleginnen und Kollegen, es reicht uns<br />
langsam, dass wir immer wieder hingehalten werden. Da<br />
muss noch mal bilanziert und noch mal evaluiert werden.<br />
Es ist in dieser Hinsicht genug getan worden. Was wir jetzt<br />
brauchen, sind wirklich ganz konkrete Veränderungen.<br />
Danke.<br />
Konferenzleitung:<br />
Zur Presseschelte kann ich nur sagen, die Presse ist rechtzeitig<br />
und umfangreich eingeladen worden. Warum die<br />
nicht gekommen ist, liegt sicherlich auch daran, dass die<br />
staatstragenden Eingeladenen leider alle abgesagt haben.<br />
Dann ist das offensichtlich eben nicht so wichtig, was wir<br />
hier zu sagen haben. Es ist schade, aber dazu wird Ursula<br />
sicher auch gleich noch mal etwas sagen können.<br />
15
16<br />
Ingrid Bäumer-Möhlmann – ver.di, Del.Nr. 102/01:<br />
Ich bin als Beraterin in einer Beratungsstelle für Arbeitslose<br />
beschäftigt. Ich berate arbeitslose Männer und Frauen. Das<br />
heißt, ich habe in letzter Zeit auch sehr viel mit den Kolleginnen<br />
und Kollegen zu tun, die Ein-Euro-Jobs ausführen<br />
müssen. Da ist mir wirklich die Formulierung in dem mündlichen<br />
Geschäftsbericht von Ursula ein bisschen mau ausgedrückt.<br />
„Ein-Euro-Jobs dürfen nicht ausgeweitet werden,<br />
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung muss erhalten<br />
werden“, das ist mir ein bisschen zu defensiv. Ich habe<br />
Erfahrungen mit Kolleginnen, die Bahnhofstoiletten putzen<br />
müssen für einen Euro. Ich bin der Meinung, wenn das ein<br />
zusätzlicher Job ist, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was<br />
versicherungspflichtige Beschäftigung ist. Ich finde, wir als<br />
Gewerkschaftsfrauen müssen ein klares Signal dafür setzen,<br />
dass diese Ein-Euro-Jobs wirklich Tür und Tor öffnen, dass<br />
damit Missbrauch betrieben wird.<br />
Erdmute Rehwald – GEW, Del.Nr. 0021/01:<br />
Was mir gefehlt hat, ist im Zusammenhang mit dem Antidiskriminierungsgesetz<br />
die Tatsache, dass wir höchstwahrscheinlich<br />
nur ein Antidiskriminierungsgesetz light bekommen<br />
und der Begriff der sexuellen Orientierung nicht vorkommt.<br />
Ich kann euch nur ganz dringend bitten, und ich<br />
bitte meine Gewerkschaften ganz dringend, an die lesbischen<br />
Kolleginnen zu denken, die vorrangig gemobbt werden<br />
und die tagtäglich mit großen Ängsten an ihre Arbeitsplätze<br />
gehen und ganz dringend ein Antidiskriminierungsgesetz<br />
brauchen. Und da muss die sexuelle Orientierung<br />
rein. Danke.<br />
Ute Maier – ver.di, Del.Nr. 0063/01:<br />
Mich bewegt die Gremienentsendung zum einen innerhalb<br />
des <strong>DGB</strong> selber, innerhalb unserer eigenen Organisation,<br />
und dort jeweils der Anteil der Frauen, und natürlich auch<br />
nach außerhalb. Wir haben jetzt seit langem auch das<br />
Gleichstellungsgesetz in der Privatwirtschaft gefordert. Wir<br />
haben von der Bundesregierung das Bundesgremiengesetz.<br />
Aber ich habe in den verschiedensten Gremien die Erfahrung<br />
gemacht, sei es bei Sozialwahlen, bei anderen Dingen,<br />
dass wir uns als Gewerkschafterinnen dort ab und an die<br />
Butter vom Brot nehmen lassen, dass wir dort nicht entsprechend<br />
unseres Anteils an der Mitgliedschaft vertreten<br />
sind. Ich fordere auch Michael auf, dass du hier ganz konkret<br />
auch unsere Kollegen ansprichst und denen sagst, ihr<br />
habt den Anteil zu bringen, so dass zukünftig in den Gremien<br />
wir Frauen genauso gut vertreten sind, wie wir Mitglieder<br />
sind, sei es innerhalb unserer Organisation oder sei<br />
es auch nach außen, wo wir das Entsendungsrecht als<br />
Gewerkschafter haben. Michael, ich hoffe, du kannst das<br />
mit uns gemeinsam durchsetzen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Zumindest hat Michael jetzt schon geklatscht. Das ist<br />
Zustimmung und ich denke, dein Anliegen ist angekommen.<br />
Ingelore Pilwousek – <strong>DGB</strong> Bayern, Del.Nr. 0005/03:<br />
Das, was mich in letzter Zeit so ungeheuer empört, ist die<br />
Einführung der Bedarfsgemeinschaften. Das ist doch eine<br />
Festlegung des Gesetzgebers, die hauptsächlich Frauen<br />
trifft. Ich verstehe nicht, dass da nicht ein großer Aufschrei<br />
derjenigen erfolgt, die betroffen sind. Ich bitte den <strong>DGB</strong><br />
und seine Gewerkschaften ganz dringend, hiergegen vorzugehen,<br />
natürlich die Politiker ebenso. Ich finde es eine maßlose<br />
Ungerechtigkeit.<br />
Ursula Engelen-Kefer:<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die erste Frage passte<br />
ganz gut mit der zweiten zusammen. Natürlich ist es sehr<br />
richtig, dass wir unsere Anliegen nur dann durchsetzen<br />
können, wenn wir sie nicht alleine vertreten müssen, sondern<br />
wenn uns die Männer in den Gewerkschaften dabei<br />
unterstützen. Ich habe, wie ihr wisst, schon ein klein bisschen<br />
Erfahrung im <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand, erst einmal auf<br />
der fachlichen und seit 1990 auch auf der politischen<br />
Ebene als Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen<br />
Gewerkschaftsbundes. Ich bin auch nicht dafür bekannt,<br />
dass ich mit Kritik hintern Berg halte. Aber eines muss ich<br />
ganz deutlich sagen: Mit Michael Sommer haben wir wirklich<br />
einen Vorsitzenden, der die Gleichstellung nicht nur in<br />
Sonntagsreden betont, sondern der auch versucht alles zu<br />
tun, was er kann, um uns dabei behilflich zu sein. Ich<br />
möchte das auch nutzen, Michael, mich bei dir zu bedanken.<br />
Denn infolge meiner unterschiedlichen Erfahrungen<br />
kann ich sagen, dass dies schon ein beachtlicher Quantensprung<br />
an Verbesserung ist und dass wir mit unseren Anliegen<br />
Gehör finden und auch die Chancen haben, das eine<br />
oder andere umzusetzen. Insofern, glaube ich, wird den<br />
Anliegen gut Rechnung getragen. Herzlichen Dank, Michael.<br />
Das würde ich mit der Bitte verbinden, die hier auch von<br />
einigen geäußert wurde. Es ist im Grunde genommen entwürdigend,<br />
wenn ich das mal so deutlich sagen kann,<br />
wenn ich mir mal die Geschichte vor Augen halte, wie wir<br />
ausgetrickst wurden, um es vorsichtig auszudrücken, was<br />
das Gleichstellungsgesetz für die private Wirtschaft anbelangt.<br />
Wir hatten es bereits im Koalitionsvertrag der vorherigen<br />
Regierungskoalition. Wir haben dazu Vorschläge entwickelt,
die durchaus realistisch sind. Die Vorschläge konzentrieren<br />
sich auf die Notwendigkeit der Einführung eines Verbandsklagerechtes,<br />
so dass Gewerkschaften in der Lage wären,<br />
Interessen von Kolleginnen so zu vertreten, dass die einzelne<br />
Kollegin nicht vor Gericht auftreten muss. Denn wir wissen<br />
doch, was das Problem ist. Wir können noch so viele<br />
schöne Erklärungen abgeben, in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit<br />
und auch noch der prekären Beschäftigung, befristeter<br />
Beschäftigung, Leiharbeit, geringfügiger Beschäftigung werden<br />
doch viele Kolleginnen gar nicht in der Lage sein, offen<br />
einzutreten, wenn sie nachweislich benachteiligt und<br />
drangsaliert werden. Das ist doch eure tagtägliche Erfahrung<br />
in den Betrieben. Das Mobbing gegen Frauen in den<br />
Betrieben hat ja ein enormes Ausmaß angenommen. Unsere<br />
Seminare gegen Mobbing sind voll wie nie zuvor. Unsere<br />
Broschüren werden uns aus den Händen gerissen. Das ist<br />
doch ein Problem, mit dem ihr tagtäglich zu kämpfen habt,<br />
abgesehen von den klaren Übertretungen tariflicher Regelungen,<br />
Nichtzahlung von Löhnen, Nichteinhaltung von<br />
Arbeitszeiten, unwürdigen Arbeitsbedingungen, Nichtberücksichtigung<br />
bei Aufstiegsmöglichkeiten, bei Weiterbildung<br />
und was man auch immer nennt aus der gesamten<br />
Palette der Benachteiligungen von Frauen.<br />
Wenn es uns nicht gelingt, hier ein Verbandsklagerecht für<br />
die Gewerkschaften zu bekommen, dann werden wir nicht<br />
in der Lage sein, wirksam gegen diese Benachteiligungen<br />
vorzugehen. Das kann nur im Rahmen eines solchen<br />
Gleichstellungsgesetzes für die private Wirtschaft gelingen.<br />
Deshalb haben wir das auch so eingebracht und sind dann<br />
leider eben ausgetrickst worden. Ich habe das damals mit<br />
den zuständigen Ministerinnen und Ministern rauf und runter<br />
erörtert. Alle fanden, dass wir sehr realitätsnahe Vorschläge<br />
haben. Dann wurde mir gesagt, das ist alles wunderbar,<br />
und es ging dann erst mal um das Betriebsverfassungsgesetz.<br />
Dann wurde im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes<br />
gesagt, dann nehmen wir doch die Regelung<br />
für eine bessere Gleichstellung der Frauen raus und das tun<br />
wir dann alles in das Gleichstellungsgesetz für die private<br />
Wirtschaft. Wir haben dann also relativ still gehalten, haben<br />
unsere besseren Wahlverfahren, haben die Quote bekommen,<br />
aber haben da nicht weiter drauf gedrungen. Dann ist<br />
das Gesetz verabschiedet worden. Kaum war es verabschiedet,<br />
dann hieß es auf einmal, es gäbe keine Mehrheiten<br />
mehr für ein Gleichstellungsgesetz für die private Wirtschaft.<br />
Die Arbeitsmarktlage sei so schlecht und ob wir<br />
denn nichts Besseres zu tun hätten, als uns für ein solches<br />
Gleichstellungsgesetz einzusetzen. Da habe ich auch<br />
manchmal die Unterstützung der Männer bei uns vermisst.<br />
Aber ich glaube, das wird jetzt anders. Es wäre schön,<br />
wenn Michael uns helfen könnte, ich weiß, dass er auch<br />
keine Wunder vollbringen kann, und ihr euch auch in euren<br />
Gewerkschaften bei euren Vorständen und Vorsitzenden<br />
dafür einsetzt, dass wir vielleicht gemeinsam gegenüber der<br />
neuen Regierungskoalition auftreten und vielleicht hier ein<br />
Stückchen weiterkommen.<br />
Der erste Ansatz wäre, das Antidiskriminierungsgesetz<br />
durchzusetzen. Denn da haben wir die Unterlassungsklage<br />
der Betriebsräte drin. Das heißt zwar immer noch, dass bei<br />
einer solchen Unterlassungsklage die Betroffenen mit auftreten,<br />
zumindest ihren Namen nennen müssten. Sie könnten<br />
also nicht anonym bleiben. Aber es wäre zumindest<br />
schon ein Schritt weiter, als wenn eine Frau eine Einzelklage<br />
machen muss und dann mit dem Rechtsschutz des <strong>DGB</strong><br />
durch alle Distanzen gehen muss. Das wird kaum einer tun.<br />
Das werden wir auch kaum einer empfehlen können. Aber<br />
das wäre der erste Schritt, mitzuhelfen, dass das Antidiskriminierungsgesetz<br />
so und vor allem in diesem Teil umgesetzt<br />
wird und wir dann weiterhin gemeinsam eine Bresche dafür<br />
schlagen, dass wir auch tatsächlich ein Gleichstellungsgesetz<br />
in der privaten Wirtschaft bekommen. Da ist jeder<br />
dazu aufgerufen mitzuhelfen und möglichst viele Kollegen<br />
auch mit an unsere Seite zu bringen.<br />
Dann zu den Ein-Euro-Jobs: Ich glaube, da bin ich etwas<br />
missverstanden worden oder habe wieder etwas zu schnell<br />
geredet. Ich habe nie gesagt, wir sollen nur verhindern,<br />
dass Ein-Euro-Jobs in Zukunft ausgeweitet werden. Wir<br />
müssen auch diesen Riesenboom, der ja heute schon da ist,<br />
wieder in Grenzen halten und wieder auch da zurückdrehen,<br />
wo nämlich die Ein-Euro-Jobs sozialversicherungspflichtige<br />
Beschäftigung verdrängen. Das wisst ihr aus<br />
euren Wirtschaftsbereichen, Dienstleistungsbereichen am<br />
allerbesten, dass diese Entwicklung in höchstem Maße<br />
gefährlich ist. Das betrifft die Kommunen, die Erziehungsberufe,<br />
das betrifft die Betreuungsberufe, natürlich auch Forstwirtschaft,<br />
Landwirtschaft. Es gibt eine breite Palette, wo<br />
inzwischen die Ein-Euro-Jobs Einzug gefunden haben. Wir<br />
dürfen nicht vergessen, wir hatten auf auch vorher einen<br />
Wirtschafts- und Arbeitsminister, vor allem einen Wirtschaftsminister,<br />
der damit Reklame gemacht hat, er wolle<br />
600.000 Ein-Euro-Jobs in Deutschland haben. Wir sind<br />
schon auf dem Wege dahin. Deshalb reicht es nicht aus, zu<br />
sagen, keine Dynamik mehr nach oben, sondern dieses Ausmaß<br />
muss reduziert werden, echt auf das reduziert werden,<br />
was überhaupt noch erträglich ist. Im Gesetz steht auch<br />
drin, dass Ein-Euro-Jobs immer nur die letzte Möglichkeit<br />
sind. Auch bei öffentlich geförderter Beschäftigung – und<br />
die brauchen wir bei der Langzeitarbeitslosigkeit – muss es<br />
zuerst darum gehen, öffentliche Arbeitsplätze mit Sozialver-<br />
17
18<br />
sicherungspflicht und tariflichen oder ortsüblichen Löhnen<br />
anzubieten. Das muss unsere Devise sein und die Priorität,<br />
mit der wir auch gegenüber der neuen Bundesregierung<br />
antreten. Ich habe mich immer dafür eingesetzt und werde<br />
das auch weiterhin tun, dass bei den Arbeitsgemeinschaften<br />
Beiräte gegründet werden, in denen auch die Gewerkschaften<br />
sind, so dass wir verhindern können, dass überhaupt<br />
Ein-Euro-Jobs gemacht werden und die Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer dazu gezwungen werden.<br />
Gremienbesetzung in den Gewerkschaften: Ich habe gerade<br />
wieder das Spielchen hinter mich gebracht mit der Besetzung<br />
der Gremien für die Selbstverwaltungen in der Renten-,<br />
Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Das ist<br />
immer dasselbe Spielchen. Wir haben leider keine verbindliche<br />
Quote. Wir haben eine Sollvorschrift. Wir sind immer<br />
damit angetreten und haben immer die Gewerkschaften<br />
darauf hingewiesen und gebeten, nun benennt uns doch<br />
auch entsprechend Kolleginnen. Wir haben auch in einigen<br />
Fällen versucht zu revidieren. Aber jetzt überlegt mal selber,<br />
wie das in euren Bereichen aussieht, wie schwer es durchzusetzen<br />
ist, dass hier auch entsprechend Kolleginnen benannt<br />
werden. Wir können als <strong>DGB</strong> doch nicht den Gewerkschaften<br />
vorschreiben, wen sie für die Selbstverwaltungen<br />
der einzelnen Gremien benennen. Das ist Sache der<br />
Mitgliedsgewerkschaften. Das muss auch so bleiben. Es ist<br />
auch immer so, dass das die Vorstände gemeinsam mit den<br />
Bezirken, mit den Regionen machen. Wir besetzen ja nicht<br />
nur Spitzenfunktionen, wir besetzen ja auch die Funktionen<br />
in den Regionen oder auf lokaler Ebene. Ich kann nur sagen,<br />
wir müssen uns weiterhin kontinuierlich darum bemühen.<br />
Wenn wir einige Männer an der Spitze der Gewerkschaftsbewegung<br />
haben, die bereit sind, mit uns gemeinsam<br />
dafür zu streiten, hoffe ich, dass wir dies langsam verbessern<br />
können. Aber hier kann man keine Wunder erwarten,<br />
sondern hier braucht es der gemeinsamen Aktion von<br />
Männern und Frauen in den Gewerkschaften. Was wir dazu<br />
beitragen können, werden wir weiterhin tun und hoffentlich<br />
effizienter als in der Vergangenheit. Aber wir brauchen<br />
dabei eure Mithilfe.<br />
Thema Bedarfsgemeinschaften: Ich glaube, dass der gesamte<br />
ALG II-Bereich eines der verquersten Ergebnisse eines<br />
Vermittlungsausschusses ist. Angetreten war man bei dieser<br />
Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, um<br />
hier mehr Langzeitarbeitslose in Arbeit zu bringen und um<br />
Kosten zu sparen. Was wir erreicht haben: steigende<br />
Arbeitslosigkeit und steigende Ausgaben. Und diejenigen,<br />
die am meisten Anspruch haben auf Arbeitslosenunterstützungsleistungen<br />
sind diejenigen, die am meisten gekniffen<br />
sind. Das sind vor allem unsere Kolleginnen und Kollegen,<br />
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die oft jahrzehntelang<br />
gearbeitet haben, die Beiträge, die Steuern gezahlt<br />
haben, die unverschuldet in Langzeitarbeitslosigkeit geraten<br />
sind und dann zum großen Teil riesige Abschläge an ihren<br />
Leistungen im Übergang von Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld<br />
hinnehmen müssen oder gar nichts mehr bekommen.<br />
Die neueste Statistik zeigt, dass bei den Langzeitarbeitslosen<br />
der über 50-Jährigen 17 % gar kein ALG II und über<br />
die Hälfte erheblich weniger als vorher bekommen. Eine<br />
solche Gesetzgebung, solche Formen von Bedarfsgemeinschaften<br />
sind für uns nicht hinnehmbar und auch nicht<br />
zukunftsfähig. Das müssen wir immer wieder deutlich<br />
machen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Herzlichen Dank, Ursula. Ich glaube, du hast alle Fragen,<br />
alle Anmerkungen kommentiert bzw. beantwortet. Ich sehe<br />
aber zwei Kolleginnen, die noch etwas sagen wollen.<br />
Marga Nießing – ver.di, Del.Nr. 0106/01:<br />
Ich war in der letzten Woche auf dem Parteitag der SPD in<br />
Karlsruhe und habe dem Koalitionsvertrag nicht zugestimmt,<br />
weil mir einfach zwei wichtige Punkte gefehlt<br />
haben. Es fehlt mir der ganze Bereich der Gesundheit, z.B.<br />
der Bürgerversicherung. Ich möchte, dass wir weiterhin – so<br />
wie das bis jetzt auch vom <strong>DGB</strong> gesagt wurde – für diese<br />
Bürgerversicherung auch streiten. Das ist ein ganz großer<br />
Placken, der noch vor uns liegt, der mir aber sehr wichtig<br />
ist. Ursula hat von Gesundheitsprävention gesprochen. Ich<br />
möchte aber, dass in der Bürgerversicherung alle einbezogen<br />
werden.<br />
(Anmerkung der Redaktion: Bandwechsel des Protokollmitschnitts<br />
ohne korrekten Anschluss, es nicht mehr ermittelbar,<br />
welche Delegierte gesprochen hat)<br />
Kollegin N.N.:<br />
... Es muss auch in Zukunft so sein, dass der <strong>DGB</strong> die Vorgaben<br />
bei der Besetzung von Vertreterversammlungen, von<br />
Selbstverwaltungsorganen und sonstigen Gremien macht.<br />
Da müssen sich die Gewerkschaften untereinander einigen.<br />
Der Druck muss aber vom <strong>DGB</strong> kommen.<br />
Eine zweite Sache, die mir im Magen liegt: Der Stellenwert<br />
der Frauen wurde dadurch deutlich, dass keine Presse und<br />
damit keine Öffentlichkeit hier ist. Wir sehen es, dass die<br />
Politik den Frauenzielen nicht mehr folgt. Das spielt kaum<br />
noch eine Rolle im Koalitionsvertrag. Familienpolitik wird<br />
oft mit Frauenpolitik verwechselt. Es wird auch in Sonntagsreden<br />
viel darüber geredet, dass man da etwas tun muss
und wenn man dann die tatsächliche Praxis sieht, erschrickt<br />
man. Ein Beispiel ist, dass immer mehr Frauen in der Erziehungszeit<br />
und während ihrer Schwangerschaft gekündigt<br />
werden und dass die Behörden, das heißt, die Gewerbeaufsichtsämter<br />
oder die Arbeitsministerien, die dafür zuständig<br />
sind, die Zustimmung erteilen. Da frage ich mich: Was<br />
machen wir dort als Gewerkschaften? Das können wir doch<br />
nicht hinnehmen und sagen, o.k., es ist halt so. Da müssen<br />
wir genau nachfragen und uns Strategien überlegen, dass<br />
nicht Frauen, die wirklich noch den Mut haben heute Kinder<br />
zu kriegen, so aus dem Arbeitsverhältnis rausgedrängt<br />
werden.<br />
Ursula Engelen-Kefer:<br />
Antidiskriminierungsgesetz und sexuelle Orientierung: Wir<br />
haben uns immer dafür eingesetzt, bleiben auch dabei,<br />
dass die sexuelle Orientierung mit in das Antidiskriminierungsgesetz<br />
hinein soll, dass hier eine Gleichstellung hergestellt<br />
werden soll. Es war bislang im arbeitsrechtlichen Teil<br />
nicht strittig, aber es war im zivilrechtlichen Teil strittig. Ich<br />
habe bei allen Anhörungen gesagt, dass diejenigen, die<br />
dies herausnehmen wollen, erst einmal begründen müssen,<br />
warum sie dies tun und ob sie jetzt eine Benachteiligung<br />
gegen Menschen anderer sexueller Orientierung damit<br />
begründen wollen. Ich glaube, dass es auch dabei bleibt<br />
und wir uns entsprechend dafür einsetzen, dass die sexuelle<br />
Orientierung mit ein Element für die Notwendigkeit einer<br />
Gleichstellung im Arbeitsrecht wie auch im zivilrechtlichen<br />
Teil wird.<br />
Der zweite Punkt war die Gesundheitspolitik. Es ist richtig,<br />
ich habe hier nicht die Notwendigkeit der Reformen in der<br />
Gesundheitspolitik und Pflegesicherung im Einzelnen dargelegt.<br />
Es ist und bleibt dabei: Für uns gilt die Zukunft in<br />
Form der Bürgerversicherung. Wir brauchen nicht weniger,<br />
sondern wir brauchen mehr Solidarität. Diese Solidarität<br />
bedeutet, dass wir mehr Personengruppen mit einbeziehen<br />
müssen, also auch die höher Verdienenden, die Selbständigen,<br />
die neu hinzukommenden Beamten, wenn ihre Arbeitgeber<br />
einen Anteil leisten und sie es wollen. Wir wollen<br />
auch die bessere Zusammenarbeit zwischen gesetzlicher<br />
und privater Krankenversicherung. Für uns ist es unerträglich,<br />
dass in Zukunft diese künstliche Grenze bestehen<br />
bleibt, jetzt bei 3.850 Euro im Monat. Wer drüber ist, kann<br />
sich privat versichern, wer drunter ist, wird gesetzlich versichert.<br />
Und in den Arztpraxen und Krankenhäusern gibt es<br />
dann eine Zweiklassenmedizin. Dafür gibt es keine Berechtigung.<br />
Deshalb haben wir ja die Vorstellungen entwickelt,<br />
wie wir dies durch die Bürgerversicherung überwinden. Das<br />
bleibt dabei. Hier haben wir ja auch in der Zwischenzeit<br />
eine gemeinsame Auffassung und Linie mit allen Gewerkschaften<br />
im Deutschen Gewerkschaftsbund hinkriegen können.<br />
Wir haben im Übrigen auch entsprechende gemeinsame<br />
Eckpunkte mit der vorherigen Bundesregierung vereinbaren<br />
können. Wir bleiben dabei und werden in Kürze hierzu<br />
eine riesige Auseinandersetzung führen müssen, weil wir<br />
wissen, dass sich die beiden Koalitionspartner nicht einigen<br />
konnten und dass es erhebliche Kontroversen gibt zwischen<br />
der Kopfpauschalen-Regelung von der CDU-CSU und der<br />
Bürgerversicherung der SPD. Wir werden alles tun, um eine<br />
Privatisierung mit Kopfpauschale und damit den Weg aus<br />
der Solidarität hinaus zu verhindern. Wir brauchen eher<br />
mehr Solidarität und werden uns weiter dafür einsetzen.<br />
Ich hatte vorhin angesprochen, dass ich in der Mehrwertsteuererhöhung<br />
eine große Gefahr sehe, dass wir hier die<br />
Binnenkonjunktur weiter abwürgen. Wir haben ja gerade<br />
die letzten wirtschaftlichen Daten mitgeteilt bekommen –<br />
hervorragender Export und gleichzeitig eine immer schwächer<br />
werdende Binnenkonjunktur. Das wird natürlich noch<br />
weiter beeinträchtigt, wenn die Mehrwertsteuer ab 2007<br />
um drei Prozentpunkte steigen soll. Im Übrigen wird ein<br />
Ausgleich in Richtung Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge<br />
nur bei der Arbeitslosenversicherung vorgenommen<br />
und nur in Höhe von einem Beitragsprozentpunkt.<br />
Zwei Beitragsprozentpunkte sollen dann zum Stopfen der<br />
Haushaltslöcher verwendet werden. Und das schwächt die<br />
Binnenkonjunktur. Das müssen wir immer wieder deutlich<br />
machen. Das ist ja eben das große Risiko, das in dieser<br />
Koalitionsvereinbarung steckt. Die positiven Impulse, die<br />
von mehr Investitionen ausgehen, auch von mehr Investitionen<br />
in öffentliche Dienstleistungen, die für Frauen wichtig<br />
sind, können wieder durch eine derartig drastische Erhöhung<br />
der Mehrwertsteuer zunichte gemacht werden. Das ist<br />
ein Programm zur Einkommenssenkung für die in den unteren<br />
Einkommenskategorien, für Familien, für Rentner, für<br />
Arbeitslose, für die Schwachen. Das ist nicht der richtige<br />
Weg und das müssen wir auch entsprechend deutlich<br />
machen.<br />
Gremienbesetzung: Ich nehme das gerne auf. Ich bin die<br />
Letzte, die sagen würde, ich setze mich hin und warte ab,<br />
was da passiert. Ich bin der Meinung, wir als <strong>DGB</strong> sind verpflichtet,<br />
aktiv auf die Gewerkschaften zuzugehen. Wir<br />
haben auch einen Riesenstreit mit Gewerkschaften gehabt.<br />
Das ging wochen-, monatelang. Das werden wir auch weiterhin<br />
tun. Aber ich habe die dringende Bitte, helft uns auch<br />
ein bisschen mit in euren eigenen Gewerkschaften, denn<br />
auch unser Arm ist – wie ihr wisst – durchaus begrenzt.<br />
Ich möchte gern noch ein abschließendes Wort sagen und<br />
mich zuallererst bei denjenigen bedanken, die gerade auch<br />
19
20<br />
mit mir und für mich in der Abteilung Frauenpolitik des<br />
<strong>DGB</strong> die letzten vier Jahre die Frauenpolitik des <strong>DGB</strong> gestaltet<br />
haben und auch die Vorbereitung dieser Konferenz vorgenommen<br />
haben und all die Dinge, die ich versucht habe<br />
darzustellen, mit großen Mühen versucht haben mit auf<br />
den Weg zu bringen, natürlich mit vielen von euch gemeinsam.<br />
Hier sitzt eine Kollegin unter uns, der ich ganz besonders<br />
danken möchte. Das ist Anne Jenter. Sie hat<br />
bis zum April dieses Jahres die Frauenarbeit<br />
des <strong>DGB</strong> geleitet und maßgeblichen Anteil<br />
an dem, was wir hier erreichen und wofür<br />
wir streiten konnten. Anne Jenter ist inzwischen<br />
Mitglied im Hauptvorstand der<br />
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.<br />
Wir freuen uns darüber, dass es gelungen<br />
ist, aus einer solchen Position heraus in eine<br />
noch höhere Führungsposition des <strong>DGB</strong> hineinzukommen.<br />
Anne, wir wünschen dir alles<br />
Gute, viel Erfolg und vor allem auch gute<br />
Zusammenarbeit.<br />
Gleichzeitig möchte ich hiermit die Nachfolgerin<br />
von Anne Jenter vorstellen. Das ist<br />
Claudia Menne. Claudia Menne kommt vom<br />
Hauptvorstand der TRANSNET und hat sich<br />
viele Jahre mit Frauenarbeit, mit internationaler Arbeit<br />
beschäftigt. Ich bin sicher, sie wird die Arbeit von Anne weiterführen<br />
und auch die gute Zusammenarbeit mit den<br />
Gewerkschaften in der Frauenpolitik des <strong>DGB</strong> weiter voranbringen.<br />
In dem Sinne freuen wir uns auf die gemeinsame<br />
Zusammenarbeit.<br />
Schließlich und letztlich möchte ich auch nicht unerwähnt<br />
lassen, dass in der Zeit des Interregnums Helga Nielebock<br />
die Frauenpolitik des <strong>DGB</strong> geführt hat und sehr viel Hilfe<br />
geleistet hat, übrigens auch mit einem ganz enormen Engagement<br />
von Maria Kathmann, die ja – so lange wir keine<br />
Abteilungsleiterin hatten – besonders ihre Arbeit mit einbringen<br />
musste. Wie wir alle wissen, Maria ist ja immer der<br />
gute Geist hinter allen Konferenzen, daher auch hinter dieser<br />
Bundesfrauenkonferenz. Herzlichen Dank und einen<br />
guten weiteren Verlauf dieser Bundesfrauenkonferenz.<br />
Konferenzleitung:<br />
Herzlichen Dank an Ursula und alle anderen Diskutantinnen.<br />
Kaffeepause<br />
Claudia Menne,<br />
die neue Leiterin des Bereichs<br />
Gleichstellungs- und Frauenpolitik
Podiumsdiskussion: “Perspektiven<br />
der Frauen- und Gleichstellungspolitik“<br />
Elke Ferner (SPD), Claudia Roth<br />
(Bündnis 90/Die Grünen), Ronald<br />
Pofalla (CDU) und Michael Sommer<br />
(<strong>DGB</strong>) diskutierten die Perspektiven<br />
der Frauen- und Gleichstellungspolitik<br />
unter der Moderation<br />
von Petra Schwarz.<br />
Schwerpunkt der Debatte war die<br />
gerade abgeschlossene Koalitionsvereinbarung<br />
und hier insbesondere<br />
das ADG, die Vereinbarkeit<br />
von Beruf und Familie, die<br />
Vorstellungen zum Elterngeld, die<br />
aus frauenpolitischer Sicht erforderliche<br />
Reform der Hartz-Gesetze,<br />
Kündigungsschutz, Rente,<br />
Pflege und Gleichstellung in der privaten Wirtschaft.<br />
Konferenzleitung:<br />
Ich möchte mich für die Podiumsdiskussion bedanken, ganz<br />
besonders bei der Moderatorin Petra Schwarz, die das toll<br />
gemacht hat.<br />
Organisatorische Hinweise:<br />
Wir haben draußen einen Stand, da geht um die Materialauslage<br />
mit Hinweis auf eine AIDS-Kampagne. Über 70<br />
deutsche Organisationen der AIDS- und Entwicklungszusammenarbeit<br />
haben sich zu einem Aktionsbündnis gegen<br />
AIDS zusammengeschlossen. Getragen wird die Aktion<br />
überwiegend von den Kirchen und von kirchlichen Organisationen.<br />
Es soll erreicht werden, die Auswirkungen der<br />
weltweiten Epidemie auf die Agenda der Politik und Wirtschaft<br />
zu bringen. Wir bitten euch deshalb diese Aktion zu<br />
unterstützen. Das geht ganz einfach und kostet euch höchstens<br />
eine Briefmarke. Draußen auf dem Materialtisch liegen<br />
Medikamentenschachteln aus mit der Forderung drauf,<br />
die Medikamente zum Produktionspreis in die ärmeren Länder<br />
zu verkaufen, auch für Kinder zu dosieren – das gibt es<br />
nämlich bisher nicht – und die Patentrechte freizugeben.<br />
Nehmt euch bitte jeweils eine Schachtel, unterschreibt sie<br />
und schickt sie zurück ans Aktionsbündnis. Wer die Aktion<br />
von zu Hause aus gerne weiter unterstützen möchte, kann<br />
weitere Schachteln bei den Initiatorinnen bestellen.<br />
Ende des ersten Konferenztages<br />
21
22<br />
Freitag, 25.11.05<br />
Strategien für eine gleichstellungsorientierte<br />
Arbeits- und Beschäftigungspolitik<br />
Konferenzleitung:<br />
Guten Morgen liebe Kolleginnen, ich begrüße euch zum<br />
zweiten Konferenztag. Wir wollen heute Strategien für eine<br />
gleichstellungsorientierte Arbeits- und Beschäftigungspolitik<br />
entwickeln. Und dazu möchte ich einige Gedanken mit in<br />
die Beratungen geben.<br />
Der <strong>DGB</strong> Bundesfrauenausschuss (BFA), in dem ich für die<br />
NGG Mitglied bin, hat im vergangenen Jahr mit der Debatte<br />
begonnen, wie wir uns frauenpolitisch besser aufstellen<br />
können – wie wir uns mehr Gehör verschaffen können<br />
in der Politik, in den eigenen Organisationen und in den<br />
Betrieben – kurzum: wie wir mehr erreichen können. Wir<br />
sind der Auffassung, dass es notwendig ist, das frauen- und<br />
gleichstellungspolitische Profil der Gewerkschaften und des<br />
<strong>DGB</strong> zu schärfen. Dann kann es uns auch gelingen, mehr<br />
Frauen und vor allem junge Frauen für eine Mitgliedschaft<br />
und aktive Mitarbeit in den Gewerkschaften zu gewinnen.<br />
Die Debatte ist auch deshalb notwendig, weil wir zurzeit<br />
eine Politik erleben, die die Fraueninteressen der Familienpolitik<br />
unterordnet. Wenn Frauen- und Gleichstellungspolitik<br />
einen größeren Stellenwert bekommen soll, müssen wir<br />
daran arbeiten – und zwar auf allen Ebenen des <strong>DGB</strong> und<br />
in den Gewerkschaften. Der heutige Strategietag soll dazu<br />
einen wesentlichen Beitrag leisten und ich möchte euch<br />
stellvertretend für den Bundesfrauenausschuss ermutigen,<br />
mit uns in den nächsten Stunden neue Strategien zu entwickeln.<br />
Dabei müssen wir darauf achten, dass diese Strategien<br />
betriebs- und mitgliedernah sind. Unsere Mitglieder<br />
und die, die wir werben wollen, müssen erkennen können,<br />
was wir wollen und was wir tun.<br />
Wir haben daher für den heutigen Tag geplant, das Thema<br />
Arbeit in all seinen Facetten in mehreren Workshops zu<br />
bearbeiten. Besonders wichtig ist uns, dass in den Workshops<br />
die Diskussionen zwischen den Generationen geführt<br />
wird, damit die unterschiedlichen Bedürfnisse und Sichtweisen<br />
von jüngeren und älteren Kolleginnen einbezogen werden.<br />
Deshalb haben wir zum heutigen Tag junge Kolleginnen<br />
eingeladen, die ich an dieser Stelle herzlich begrüße.<br />
Wir freuen uns nun auf spannende ergebnisreiche Diskussionen.<br />
Und bevor ich nun der Moderatorin des Tages, Claudia<br />
Hartwich, das Wort erteile noch eine ganz andere Ansage,<br />
bzw. Bitte: die japanische Firma JVC, stellt Videogeräte her<br />
und will ihr Werk in Berlin schließen. Die Produktion soll<br />
nach Malaysia verlagert werden, hier werden 225 Menschen<br />
arbeitslos, davon weit über 50 % Frauen – überwiegend<br />
Migrantinnen. Die Verlagerung ist offensichtlich eine<br />
politische Entscheidung und deshalb demonstriert die IGM<br />
heute um 13.30 Uhr vor der japanischen Botschaft. Ursula<br />
Engelen-Kefer wird dort eine Solidaritätsadresse der <strong>DGB</strong><br />
Bundesfrauenkonferenz abgeben. Es wäre gut, wenn Ursula<br />
von einer Delegation begleitet wird. Wir können und wollen<br />
die Konferenz nicht unterbrechen und schlagen vor, dass ihr<br />
in den Workshops klärt, welche Kolleginnen mitgehen. Die<br />
Delegation trifft sich um 13.15 Uhr vor dem Hotel.<br />
Wir treffen uns heute um 17.00 Uhr wieder hier im Plenum.<br />
Und nun wird Claudia Hartwich die Moderation übernehmen<br />
und uns durch den Tag führen.<br />
Claudia Hartwich, Moderatorin:<br />
Wir haben eine Methode gewählt, die eine Anleihe an<br />
Großgruppenmethoden, wie z.B. die Zukunftskonferenz,<br />
bedeutet. Ich sage, eine Anleihe, weil man so etwas natürlich<br />
nicht in Originalform an einem Tag machen kann. Aber<br />
man kann einige Elemente daraus nehmen und damit<br />
arbeiten. Wir werden in fünf Schritten arbeiten. Der erste<br />
Schritt ist immer, dabei die Vergangenheit wertzuschätzen<br />
und zu gucken, was ist eigentlich entstanden. Denn oft<br />
steht man vor der Gegenwart und den Problemen und sieht<br />
gar nicht mehr, was schon erkämpft worden ist.<br />
Der zweite Teil ist die Gegenwart wahrzunehmen, zu gukken,<br />
in welcher aktuellen Situation befinden wir uns, was<br />
gibt es für Trends. Dann kommt eine kurze Zukunftsphase,<br />
und zwar Zukunft als Kompass und als Motor für die<br />
Gegenwart, weil wir unsere Strategien daran festmachen<br />
müssen, was wir wollen. Wir gehen davon aus, dass wir<br />
unterscheiden zwischen den Sachen, wo wir eine gemeinsame<br />
Basis haben und wo es Kontroversen gibt. Die Kontroversen<br />
und offenen Fragen wollen wir ausdrücklich festhalten.<br />
Die Strategien wollen wir auf Basis der Gemeinsamkeiten<br />
entwickeln, und zwar insbesondere Strategien aufgrund
der veränderten politischen Situation für die Politik, für den<br />
Betrieb und für die gewerkschaftliche Arbeit.<br />
Es wird so ablaufen, dass ihr euch zwischen elf thematischen<br />
Arbeitsgruppen entscheiden könnt. Ihr werdet dort<br />
einem weiblichen Dreigestirn begegnen – auf der einen<br />
Seite einer Moderatorin, die dafür zuständig ist, dass das<br />
strukturiert und konsequent abgearbeitet wird, dass wir<br />
Bei der Kundgebung der IGM in Berlin –<br />
Grund: die drohende Verlagerung des<br />
JVC-Werks nach Japan<br />
heute Abend auch mit Ergebnissen rechnen können. Zweitens<br />
wird eine inhaltliche Expertin da sein. Ihr seid Expertinnen<br />
für den Betrieb, für den Bezirk, für die gewerkschaftliche<br />
Arbeit, aber wir haben auch aus Beratungsinstituten<br />
oder aus der Wissenschaft Kolleginnen gewinnen können,<br />
die uns als inhaltliche Expertinnen in der Diskussion zur<br />
Verfügung stehen. Drittens haben wir Kolleginnen gewonnen,<br />
die bereit sind, einen Bericht zu erstellen, das Wichtigste<br />
festzuhalten, so dass ihr das morgen früh in schriftlicher<br />
Form zur Verfügung habt.<br />
Fangen wir mit dem ersten Punkt an, nämlich einer kleinen<br />
Zeitreise. Überlegt: Wann bin ich in meinem Leben zum<br />
ersten Mal in Kontakt mit gewerkschaftlicher Frauenarbeit<br />
gekommen? Wann war das? Was waren da für politische<br />
Ereignisse? Was gab es da für gewerkschaftspolitische Themen?<br />
Was ist im Laufe der Zeit passiert?<br />
Wir beginnen mit der Zukunft – Blick zurück in die Zukunft.<br />
Wir haben ein paar Stellwände 2005 plus. Da möchte ich<br />
insbesondere die jungen Gastdelegierten bitten, eure<br />
Bedürfnisse, Interessen und Visionen festzulegen. Ich möch-<br />
te euch, insbesondere die jungen Kolleginnen so unter 30,<br />
bitten, hierher zu kommen und daran zu arbeiten. Die Adoleszenz<br />
geht heute bis unter 30.<br />
Ich bitte euch, mal hier zu den Stellwänden zu gehen, euch<br />
zehn Minuten Zeit zu nehmen, mal aufzuschreiben, was es<br />
an den unterschiedlichen Zeitpunkten für politische Ereignisse<br />
und für Ereignisse in der Gleichstellungspolitik in der<br />
politischen und gewerkschaftlichen Frauenarbeit gab.<br />
Geht da mal in Kontakt zu euch selber und in Kontakt<br />
zu anderen. Was gab es, was ist passiert?<br />
Ich bitte jetzt die Kolleginnen nach vorn, die sich bereit<br />
erklärt haben, mit mir eine kleine Auswertung zu den<br />
einzelnen Bereichen zu machen. Die erste ist Julia.<br />
Julia Herting:<br />
Ich bin 28 Jahre alt, stehe deshalb vor dieser Wand<br />
und bin in der IG BCE.<br />
Moderatorin:<br />
Julia, dein kurzer Eindruck: Was sind eure Interessen,<br />
Bedürfnisse, Visionen? Was ist dir da aufgefallen, vielleicht<br />
im Gegensatz oder gemeinsam zu anderen<br />
Tafeln?<br />
Julia Herting:<br />
Ich hatte leider noch keine Zeit, mich mit den anderen<br />
Tafeln zu beschäftigen, kann aber unsere gerne mal kurz<br />
vorstellen, also die Zukunftsriege.<br />
Ein Bedürfnis der jungen Frauen ist sicherlich, mehr Frauen<br />
in die aktive Gewerkschaftsarbeit auf allen Ebenen zu bringen,<br />
um auch leichter Ideen aus der Frauenarbeit, die in der<br />
frauenpolitischen Schiene der Gewerkschaften entstanden<br />
sind, in die Hauptvorstände und in die Entscheidungsgremien<br />
zu bringen.<br />
Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für uns<br />
auf jeden Fall auch ein Thema. Dann ist da der Wunsch<br />
nach mehr selbstbewussten Frauen, die ihre Rechte durchsetzen<br />
und nicht ständig jammern. Wir haben uns weiterhin<br />
vorgestellt, dass man über die Grenze zwischen Jugendarbeit,<br />
von der aus junge Frauen dann weiter zur Frauenarbeit<br />
gehen, den Spaßfaktor, der in der Jugend- und Auszubildendenvertretung<br />
weitestgehend vorherrscht, auch in die Frauenarbeit<br />
weiter trägt. Denn ich denke, das ist das Problem,<br />
warum man viele junge Frauen an dem Punkt verliert.<br />
Wir wünschen uns auch, wie es in vergangenen Jahrzehnten<br />
war, mehr politische Aktionen und Demonstrationen,<br />
mehr politische Festivals, mehr Frauen auf der Straße, die<br />
für ihre Rechte eintreten. Denn dann kann man uns nicht<br />
so leicht übersehen.<br />
23
24<br />
Jana Traue:<br />
Ich bin die Bundesjugendleiterin von der TRANSNET-Jugend,<br />
bin fast 26 Jahre alt. Wie ihr seht, haben wir vier Tafeln voll<br />
geschrieben, ich nehme mal die dritte.<br />
Julia hat es angesprochen, die Vereinbarkeit von Familie<br />
und Beruf ist es wichtig. Auch mir macht das Probleme. Ich<br />
bin Triebfahrzeugführerin bei der Deutschen Bahn AG und<br />
wenn ich meinen Schichtplan, meine Dienstpläne angucke,<br />
frage ich mich, wie und warum sollte ich Kinder in die Welt<br />
setzen. Arbeitsbezogene Kindereinrichtungen sind das<br />
nächste Thema, gleichberechtigte Teilhabe an Führungspositionen<br />
für gleiches Geld und gleichwertige Arbeit. Thema<br />
Jugend: Uns beschäftigt die Schaffung von Ausbildungsplätzen.<br />
Wenn mein Kind später keinen Ausbildungsplatz kriegt,<br />
warum sollte ich Kinder in die Welt setzen? Weg mit sturer<br />
Sozialauswahl! Ich weiß, da stoße ich jetzt vielleicht auf<br />
einige taube Ohren. Wir haben Sozialauswahl in Altersscheiben<br />
angeregt, also weg von dieser sturen Sozialauswahl.<br />
Denkt mal drüber nach. Das Gesetz ermöglicht das.<br />
Katrin Dornheim, TRANSNET:<br />
Ich bin gerade noch so 29 Jahre, insofern kann ich noch<br />
hier stehen. Wir haben uns die Ausweitung des Familienbegriffs<br />
vorgestellt, weil wir ja gestern von Herrn Pofalla auch<br />
gehört haben, dass das Antidiskriminierungsgesetz mit dieser<br />
Regierung nicht kommt. Insofern also nicht weg von<br />
Vater, Mutter, Kind, sondern auch ein bisschen hin zur<br />
Patchworkfamilie.<br />
Wir haben uns Unisextarife nicht nur in der Riesterrente<br />
vorgestellt. Das Problem wird dabei natürlich sein, dass die<br />
Versicherungsgesellschaften die Unisextarife nicht an die<br />
niedrigere, sondern wahrscheinlich eher an die höhere Tarifgestaltung<br />
angleichen werden. Insofern müsste man da den<br />
Kampf ausweiten. Eine Kollegin hat dann den Studiengebühren<br />
den Kampf angesagt, die ab 2010 flächendeckend<br />
eingeführt werden sollen.<br />
Wir haben auch noch etwas für die nahe Zukunft dabei. Wir<br />
haben gestern von Michael Sommer gehört, 2005, 2006<br />
Kampf der EU-Dienstleistungsrichtlinie, die ja vorgestern<br />
durch den EU-Binnenausschuss durchgewinkt wurde, insofern<br />
also im Januar, Februar wieder auf der Agenda steht.<br />
Wir wissen, dass viele Frauen in den Dienstleistungsberufen<br />
tätig sind, insofern ist das also eine ganz wichtige<br />
Geschichte.<br />
Wir haben noch: Volkswirtschaftlichen Wandel unterstützen,<br />
hin zu nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik, Binnennachfrage<br />
stärken! Wir haben hier seit zehn Jahren die angebotsorientierte<br />
Politik. Eigentlich müsste die Reaktion sein,<br />
es funktioniert nicht, man kann damit die Binnennachfrage<br />
nicht stärken. Aber die Reaktion ist: Es funktioniert nicht,<br />
wir wollen mehr davon. Das sollte man ändern.<br />
Moderatorin:<br />
Blick zurück in die Zukunft – jetzt sind wir bei 2005.<br />
Britta Wortmann:<br />
Ich bin Jugendsekretärin beim <strong>DGB</strong> für die Region Düsseldorf,<br />
mittlerer Niederrhein. Ich stelle jetzt die Wände 2000<br />
bis 2005 vor und fasse das kurz zusammen.<br />
Als Negativbeispiele wird hier immer der Rückzug der Frauen<br />
in der gewerkschaftlichen Arbeit genannt. Das heißt,<br />
raus aus den Gremien und weniger Sekretärinnen bei den<br />
Gewerkschaften sowie auch Mitgliederverlust gerade im<br />
Frauenbereich.<br />
Als positiv tauchen auf den Wänden die verschiedenen Projekte<br />
zur Umsetzung in den Betrieben auf, also konkrete<br />
betriebliche Projekte z.B. zu den Themen Entgelt und Vereinbarkeit,<br />
was hier jetzt auch im Zusammenhang mit dem<br />
Abschluss des Entgelttarifvertrages der IG Metall aufgeführt<br />
ist. Ansonsten gibt es noch von ver.di ganz viel auf diesen<br />
Wänden, und zwar eigentlich zu dem Thema Erhalt der<br />
Frauenstrukturen, gerade im ver.di-Bereich.<br />
Raja Nejedlo, <strong>DGB</strong> Köln:<br />
Ich möchte euch kurz vorstellen, was in den Jahren 1990<br />
bis 2000 passiert ist. Da ich zu der Zeit selbst in der Abteilung<br />
Frauenpolitik war, freue ich mich, dass das eigentlich<br />
eine sehr ereignisreiche Zeit war. Ich möchte das jetzt kurz<br />
zusammenfassen.<br />
Im Mittelpunkt stand die Durchsetzung der Gleichberechtigung,<br />
Chancengleichheit, sprich, die Frauenquote in den<br />
Gewerkschaften, die in der Zeit durchgesetzt wurde; dann<br />
die Diskussion um den § 218, der in dieser Zeit auch geändert<br />
wurde; dann, was hier sicherlich viele noch gut in Erinnerung<br />
haben, 1994 der Frauenstreiktag, der auch noch<br />
mal die gewerkschaftliche Frauenbewegung ein stückweit<br />
vorangebracht hat; die Durchsetzung der 35-Stunden-<br />
Woche in einigen Bereichen und, was mir noch sehr gut in<br />
Erinnerung ist, sind die Kontakte und Diskussionen damals<br />
mit den Kolleginnen aus der ehemaligen DDR und über die<br />
Strategien zur Gleichberechtigung, Chancengleichheit usw.<br />
Ich denke, das waren die zentralen Punkte in dieser Zeit.<br />
Clarissa Zissen, Jugendbildungsreferentin <strong>DGB</strong><br />
NRW:<br />
Ich habe in der Zeit 1980 bis 1990 noch nicht viel von der<br />
Frauenbewegung mitbekommen und auch nicht von den
Ergebnissen, die hier zu großen Teilen aufgeschrieben sind.<br />
Ich nenne nur ein paar Stichpunkte. Aufgeführt sind hier<br />
Dinge wie Streichung des § 218, mein Bauch gehört mir;<br />
der GEW-Bundesfrauenausschuss ist gegründet worden;<br />
die Frauenquote ist in Gewerkschaften und Parteien eingeführt<br />
worden. In der IG BAU ist die Frauenarbeit in der Satzung<br />
verankert worden. Dann geht es hier weiter mit einem<br />
schönen Motto: Wir wollen fünf Stunden mehr für Liebe<br />
und Verkehr. Oder auch die Lila-Latzhosen-Generation: Feministinnen<br />
verbünden sich, Zusammenarbeit der autonomen<br />
Frauenbewegung mit Gewerkschafterinnen, dazu ganz<br />
viele Stichpunkte, wie Wiederbelebung des 8. März oder<br />
auch die Debatte um den Hausarbeitstag, so weit aus 1980<br />
– 1990.<br />
Moderatorin:<br />
Jetzt zu jemandem, der auch schon viel miterlebt hat.<br />
Karin, du hast dir 1960 bis 1980 vorgenommen.<br />
Karin (?):<br />
Es ist fast fahrlässig, diese 20 Jahre zusammenzupacken.<br />
Ich fange mal mit den 70er Jahren an, weil diese Zeit auch<br />
gewerkschaftlich ganz wichtig war. 1975 haben vor dem<br />
<strong>DGB</strong>-Bundeskongress im „Jahr der Frau“ Frauen demonstriert,<br />
weil es nicht genügend Delegierte auf dem <strong>DGB</strong>-<br />
Bundeskongress gab. Es wird auch meistens in der Gewerkschaftsgeschichte<br />
gar nicht erwähnt, aber hier wird es<br />
erwähnt.<br />
1970 gab es die Einführung von Bafög. Es gab Friedensdemonstrationen,<br />
an denen auch Gewerkschafterinnen aktiv<br />
beteiligt waren. Und dann gab es natürlich, das kennen<br />
noch einige von euch, die Frage: Dürfen wir denn den<br />
Internationalen Frauentag feiern oder dürfen wir das nicht?<br />
Damit haben wir in den 70er Jahren angefangen. In den<br />
80ern war das keine Diskussion mehr, sondern selbstverständlich.<br />
Das Lied von gestern „Brot und Rosen“ hat ja<br />
damals auch Einzug in unsere Veranstaltungen gefeiert.<br />
Am Wochenende gehört Papa uns, ich glaube, das ist ein<br />
bisschen früher, in den 50er Jahren. Aber gegen Frauen in<br />
die Bundeswehr haben wir damals gearbeitet. Das hat sich<br />
heute auf nicht so gute Art und Weise erledigt. Für viele,<br />
die das Thema gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit<br />
bearbeiten, sind die Heintze-Frauen aus Gelsenkirchen aus<br />
dieser Zeit noch in guter Erinnerung, die für den gleichen<br />
Lohn gekämpft haben. Das internationale Jahr der Frau<br />
habe ich schon erwähnt. Es fiel die Betitelung Fräulein. Es<br />
war übrigens Herr Genscher, der als Innenminister Ende der<br />
70er Jahre das Fräulein abgeschafft hat. Wir hatten das für<br />
uns natürlich schon vorher links abgeschafft.<br />
Die APO, jetzt sind wir schon bei den 60er Jahren. Es gab<br />
damals Vollbeschäftigung. Die Frauen strebten Anfang der<br />
70er Jahre in die Betriebe. Da gab es auch keine Diskussion<br />
über Teilzeit oder so, obwohl die Teilzeitdiskussion in den<br />
Gewerkschaften damals langsam anfing, aber erst in den<br />
80ern gab es die ersten Tarifverträge. § 218, das Bundesverfassungsgerichtsurteil<br />
haben wir auch alle noch in Erinnerung;<br />
Tarifabschluss öffentlicher Dienst 11 %, der angeblich<br />
Willy Brandt gestürzt hat. Ob das stimmt, darüber sind<br />
sich aber die Historiker uneinig. Hier steht ganz viel zur<br />
DDR in diesem Zeitraum: Anfang der 70er Jahre 40-Stundenwoche<br />
für alle, Krippenplätze für alle Kinder, wovon wir<br />
auch heute immer noch träumen. Ein zinsloser Kredit von<br />
5.000 DDR-Mark für Ehepaare bis 27 Jahre, Babybegrüßungsgeld<br />
von 1.000 DDR-Mark, Mutterschutzverordnung,<br />
38-Stundenwoche für Mütter von zwei Kindern, also eine<br />
ganze Menge Dinge, die die Frauen im Westen sich damals<br />
nur erträumen konnten; Haushaltstag, auch etwas, was es<br />
nur in einigen Bundesländern in Westdeutschland gab. Am<br />
Beginn der höheren Partizipation von Frauen am Bildungssystem<br />
steht ein Herr, nämlich der Herr Picht mit seiner Bildungskatastrophe.<br />
Das ist 1963. Er hat festgestellt, dass im<br />
deutschen Bildungssystem am meisten das katholische<br />
Mädchen vom Land benachteiligt ist. Das ist der Beginn<br />
der Diskussion: Schick dein Kind länger auf bessere Schulen.<br />
Es ist im Grunde dabei rausgekommen: Schicke deine<br />
Tochter länger auf bessere Schulen. Davon profitieren<br />
heute die jungen Frauen.<br />
Moderatorin:<br />
Wunderbar elegant gelöst. Jetzt kommen wir zu der Periode<br />
1949 bis 1960. Da haben wir überlegt, wer diese Zeit<br />
miterlebt hat. Da gibt es jemanden, die seit 1949 dabei<br />
war, jemand, die hier ein Beispiel für viele andere verdiente<br />
Kollegen ist, die Kollegin Ruth Köhn.<br />
Ruth Köhn:<br />
Ich weiß nicht, ob ich das alles aufzählen soll, was hier<br />
steht, aber aus meinem persönlichen Erleben möchte ich<br />
sagen: Es wiederholt sich alles. Ich bin als 17-Jährige aus<br />
der Schule und aus dem Krieg entlassen worden und habe<br />
dann, nachdem ich berufstätig wurde, 1948 als Mitglied<br />
der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten angefangen.<br />
In dieser Zeit bis heute hat sich sehr viel ereignet,<br />
aber als erstes war damals für die Älteren die Rente wichtig.<br />
Und die ist heute wiederum für die Älteren sehr wichtig.<br />
Damals waren die Frauen Witwen oder ihre Männer<br />
waren in Kriegsgefangenschaft. Es kam darauf an, eine<br />
Möglichkeit der Ernährung für sich und für die Kinder zu<br />
25
26<br />
haben. Manche Frauen waren vorher Hausfrauen. Die<br />
haben eigentlich nicht daran gedacht, dass sie sich mal auf<br />
eigene Beine stellen müssen.<br />
So war unsere erste Forderung nach dem Krieg: Frauen, ihr<br />
müsst eine eigenständige Rente haben. Ihr müsst sehen,<br />
dass es möglich ist, dass ihr euch unabhängig von eurem<br />
Ehemann ernähren könnt, denn es gibt immer Zeiten, mit<br />
denen man nicht rechnet. Bis heute ist es also für uns wichtig,<br />
die Renten zu sichern.<br />
Das Zweite, das auch nicht unwesentlich war, war natürlich,<br />
den Sprung von Jung zu Alt herzustellen. Ich war in der<br />
Jugendarbeit der Gewerkschaft tätig und wir hatten natürlich<br />
Illusionen und Vorstellungen die Welt zu verbessern. Da<br />
kam es darauf an wieder Frieden zu haben. Da kam es<br />
darauf an, das, was wir als außenpolitisch für wichtig hielten,<br />
in den Vordergrund unserer Bemühungen zu stellen,<br />
damit wir eine Zukunft haben. Auch heute stehen wir wieder<br />
als junge Generation vor vielen Fragen der Unsicherheit<br />
in der Welt. Deshalb meine ich, dass auch die junge Generation,<br />
die jungen Gewerkschafterinnen sich darum kümmern<br />
sollen, so wie wir es damals gemacht haben.<br />
Schließlich hatten wir seinerzeit natürlich auch den Mutterschutz<br />
im Sinn. Die Frauen, die sich in den Betrieben abrakkerten<br />
und alles machen mussten, was früher Männer<br />
machten, mussten jetzt – oftmals alleinstehend – die Arbeit<br />
übernehmen. Und wir hatten keine 40-Stundenwoche, sondern<br />
es wurde von Montag bis Sonnabend gearbeitet. Die<br />
paar Stunden am Sonntag reichten oft nicht aus, um alles<br />
in der Familie zu ordnen. So war es auch wichtig, dass der<br />
Arbeitsschutz für Frauen hergestellt wird. So war Mutterschutz<br />
ein wichtiges Thema, vielleicht auch heute wieder,<br />
weil es nämlich heißt, Frauenarbeitsschutz ist ein Gegner<br />
für Gleichberechtigung. Da müssen wir aufpassen, dass uns<br />
nicht wegen der Gleichberechtigung, die wir fordern,<br />
Schutzrechte aberkannt werden.<br />
Noch ein Punkt, obwohl es viele andere auch gibt, der mir<br />
sehr wichtig erscheint – es steht auch auf den Tafeln: die<br />
Entwicklung der Lohngleichheit für Frauen. Die Lohngleichheit<br />
war zu Anfang wirklich nur Lohngleichheit – gleicher<br />
Lohn für gleiche Arbeit. Wir kämpften um Lohn für gleichwertige<br />
Arbeit. Dazu gibt es einen sehr langwierigen Prozess,<br />
der von 1950 bis in die heutige Zeit reicht. Dazwischen<br />
– es wurde eben schon darauf hingewiesen – gab es<br />
auch Prozesse, die leider nicht erfolgreich abgeschlossen<br />
sind. Das heißt, sie waren theoretisch erfolgreich, aber sie<br />
haben im Grunde genommen nach wie vor eine Nivellierung<br />
der Bewertung der Frauenarbeit mit sich gebracht. Wir<br />
haben schon seit 1987 ein BAG-Urteil. Wir haben das internationale<br />
Arbeitsabkommen (IAO)100. Wir haben einen<br />
EWG-Artikel 119. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wenn<br />
wir uns bemühen aktiv in der Tarifpolitik, in<br />
„<br />
der Tarifkommission<br />
mitzuwirken, eventuell eines Tages zum Erfolg zu<br />
kommen.<br />
Moderatorin:<br />
Jetzt habt ihr die Qual der Wahl zwischen elf Arbeitsgruppen.<br />
Ich bitte jetzt alle Moderatorin-nen, alle Expertinnen<br />
nach vorn, damit wir euch informieren können, wofür ihr<br />
euch entscheiden könnt.<br />
Es wird jetzt so laufen, dass wir bis heute Nachmittag<br />
17.00 Uhr in diesen thematischen Arbeitsgruppen zum<br />
Thema Beschäftigung in verschiedenen Facetten von Gleichstellungs-<br />
und Beschäftigungspolitik arbeiten. Wir werden<br />
euch nun vorstellen, was euch in den einzelnen Arbeitsgruppen<br />
erwartet und ihr könnt euch dann entscheiden.<br />
Wir fangen mit der ersten Arbeitsgruppe – Alternativen zur<br />
Arbeitslosigkeit – an.<br />
Jutta Reiter:<br />
Guten Morgen, ich komme vom <strong>DGB</strong>-Bezirk NRW. Unser<br />
Thema ist: Alternativen für Arbeitslosigkeit. Wir wollen uns<br />
damit befassen, welche Politik Frauen brauchen, und zwar<br />
speziell Frauen, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder um<br />
aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen. Da geht es um<br />
Wiedereingliederung, um Existenz sichernde Arbeit, um die<br />
Frage der Arbeitsplatzsicherheit. Mir zur Seite steht Silke<br />
Bothfeld, die sich ganz kurz selbst vorstellt. Silke Bothfeld:<br />
ich komme vom WSI – Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches<br />
Institut in der Hans-Böckler-Stiftung, ein langer<br />
Name. Wir haben – wie gestern schon erwähnt – den WSI-<br />
Frauendatenreport gerade neu aufgelegt. Viele von Ihnen<br />
werden ihn kennen. Wir setzen uns sozusagen grundsätzlich<br />
und immer wieder auch mit den Problemen, die damit<br />
zusammenhängen, auseinander. Ich freue mich auf spannende<br />
Diskussionen.<br />
Kristin Bauer:<br />
Ich bin die Moderatorin für den Hartz-IV-Workshop. Unser<br />
Dreigestirn besteht aus unserer Protokollantin Bettina Altesleben,<br />
als Expertin ist bei uns Christel Degen vom Bundesvorstand<br />
des <strong>DGB</strong>.<br />
Anja Schultz:<br />
Ich moderiere den Workshop „Ist die Ausbildung ein Mädchenproblem?“<br />
Als Expertin steht mir Helga Ostendorf zur<br />
Seite. In diesem Workshop wird es u.a. darum gehen, Aspekte<br />
anzusprechen wie Zugang zu Ausbildungsstellen,<br />
Wahl von Ausbildungsberufen, Studiengang, überbetriebli-
che und betriebliche Ausbildung und wie wir die Übernahme<br />
bzw. den Übergang in den Beruf schaffen, also von der<br />
Ausbildung oder vom Studium, oder aber auch in einen<br />
neuen Beruf.<br />
Helga Ostendorf:<br />
Ich bin Politikwissenschaftlerin und habe mich immer wieder<br />
mit dem Thema Ausbildung von Mädchen beschäftigt.<br />
Zuletzt habe ich ein ganz dickes Buch zur Mädchenpolitik<br />
der Berufsberatung des Arbeitsamtes. Die Werbung liegt<br />
draußen.<br />
Clarissa Zissen:<br />
Ich bin Jugendbildungsreferentin in NRW und moderiere<br />
zusammen mit Britta Wortmann, auch NRW, den Workshop<br />
„Zugang zu Berufstätigkeit“, also sowohl den Einstieg als<br />
auch den Wiedereinstieg in Berufstätigkeit. Uns zur Seite ist<br />
die Expertin Gabriele Thiesbrummel. Gabriele Thiesbrummel:<br />
Ich arbeite seit 15 Jahren in einer Regionalstelle Frau und<br />
Beruf und mache dort u.a. die Beratung, aber auch die Politik<br />
für Wiedereinsteigerinnen.<br />
Anneli Rüling:<br />
Ich bin vom SowiTra-Institut Berlin und moderiere den<br />
Workshop zu Vereinbarkeit. Wir wollen uns mit der Frage<br />
auseinandersetzen, wie wir Kinderwunsch, Berufstätigkeit<br />
und das sonstige Leben miteinander vereinbaren können.<br />
Die Expertin in unserem Workshop ist Susanne Dalkmann<br />
von ISA Consult in Bochum. Ich würde mich freuen, wenn<br />
viele teilnehmen. Danke.<br />
Sophie Stratemeier:<br />
Ich bin IG Metall Mitglied und freiberufliche Bildungsarbeiterin.<br />
Wir haben das Thema „Wie schaffen wir den beruflichen<br />
Aufstieg?“ Stichwort: Barrieren im Beruf für Frauen,<br />
gläserne Decke, Diskriminierung am Arbeitsplatz usw. Als<br />
Expertin ist Monika Huesmann von der FU Berlin mit dabei.<br />
Dort arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im<br />
Bereich Personalpolitik.<br />
Sandra Bodewei:<br />
Ich bin Jugendbildungsreferentin in NRW im östlichen Ruhrgebiet.<br />
Ich moderiere zusammen mit Claudia Hartwich den<br />
Wortshop „Zeit“. Darin wird es um Arbeitszeit, Teilzeit und<br />
Elternzeit gehen. Wir werden da viele Fragen ansprechen.<br />
Unsere Expertin ist dafür Svenja Pfahl, Arbeitszeitforscherin.<br />
Karin Derichs-Kunstmann:<br />
Ich komme vom FIAB in Recklinghausen. Ich moderiere den<br />
Workshop zum Thema „Entgelt“, wie wir auch eben schon<br />
gehört haben, ein uraltes Thema bei den Gewerkschaftsfrauen.<br />
Es geht also um gleiches Entgelt für gleichwertige<br />
Arbeit, aber auch um Leistungsbewertung, also auch die<br />
neuen Lohn- und Entgeltsysteme. Es geht auch um Fragen<br />
des Existenz sichernden Einkommens für Frauen. Unsere<br />
Expertin ist Karin Tondorf. Karin Tondorf: Ich mache Forschung<br />
und Beratung zu Entgelt- und Gleichstellungspolitik.<br />
Die Themen hat Karin gerade schon umrissen.<br />
Raja Nejedlo:<br />
Ich komme aus der <strong>DGB</strong>-Region Köln-Leverkusen-Erft-Berg.<br />
Ich moderiere das Thema „Gesundheit“, was ja viele Facetten<br />
hat. Neben mir steht die Expertin Antje Ducki, die uns<br />
in diesem Forum beraten wird.<br />
Kerstin Baumgart:<br />
Ich bin Personalreferentin beim <strong>DGB</strong> in der Bundesvorstandsverwaltung<br />
und moderiere den Workshop „Absicherung<br />
im Alter“. Die Expertin ist Ute Klammer von der Universität<br />
Niederrhein. Ute Klammer: Wer mich kennen lernen<br />
will, muss wohl in die Arbeitsgruppe kommen.<br />
Susanne Saliger:<br />
Ich moderiere den Workshop „Qualifizierung“ und stelle als<br />
erstes die Expertin Claudia Dunst von ISA Consult vor. In<br />
dem Workshop geht es um Qualifizierung – betrieblich,<br />
außerbetrieblich – und Weiterbildung.<br />
Moderatorin:<br />
Ihr habt jetzt die Aufgabe euch zu überlegen, wo ihr hingehen<br />
wollt. Ich wünsche euch viel Freude und Erfolg bei den<br />
Beratungen. Wir treffen uns hier um 17.00 Uhr und hören<br />
aus jedem Workshop zwei zentrale Botschaften.<br />
27
28<br />
Zentrale Botschaften aus den Workshops<br />
Workshop 1: „Alternativen<br />
zur Arbeitslosigkeit“<br />
Die Umverteilung von Arbeit war ein Kernthema in unserer<br />
Diskussion. Wir haben die Botschaft – Frauen sind unerhört<br />
– wörtlich genommen und haben gesagt, wir verschaffen<br />
uns Gehör durch eine kreative Wortschöpfung, durch<br />
Selbstermächtigung; wir stellen die männlich dominierten<br />
Werte in dieser Arbeitsgesellschaft infrage und wir werden<br />
sie verändern. Wir haben eine zweite Botschaft, die da<br />
heißt: Wir brauchen als gesellschaftliche Gegenmacht ein<br />
gewerkschaftliches Fernsehen, denn wir wollen nicht nur<br />
mit dem gehört werden, was wir sagen, sondern wir wollen<br />
auch gesehen werden.<br />
Workshop 2: „Hartz IV“<br />
Unsere Botschaften aus unserer Arbeit sind, endlich wieder<br />
eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, statt Sanktionen<br />
anzudrohen und durchzusetzen. Schließlich heißt es ja<br />
auch, fördern und fordern und nicht nur fordern. Mittelfristig<br />
müssen wirksame Integrationsmaßnahmen her und es<br />
muss die Entwicklung aktiver existenzsichernder Instrumente<br />
her, die zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung<br />
führen und die uns nicht ausschließlich in Mini-Jobs<br />
oder Ein-Euro-Jobs treiben. Wir haben als zweite Botschaft<br />
eine Vision entwickelt. Wir möchten den Auftrag an den<br />
<strong>DGB</strong> und seine Einzelgewerkschaften übermitteln, ein garantiertes<br />
voraussetzungsloses Grundeinkommen zu diskutieren,<br />
und zwar von unten nach oben und nicht von oben<br />
nach unten.<br />
Workshop 3: „Qualifizierung“<br />
Wir haben uns dann mit den Trends und Anforderungen<br />
beschäftigt, die neue Herausforderungen an das Thema<br />
Qualifizierung bringen wie z.B.: Globalisierung, Europäisierung,<br />
aber auch, dass bedarfsbezogene, betriebsbezogene,<br />
branchenbezogene Qualifizierung. Wir haben diskutiert,<br />
dass es nicht nur um die fachbezogene Qualifizierung geht,<br />
sondern um die Persönlichkeitsentwicklung und dass Qualifizierung<br />
ohne Berücksichtigung des Gender-Mainstreaming<br />
nicht greifen erfolgreich sein kann. Wir haben zwei Anforderungen<br />
formuliert: Die Gesellschaft und die Herausforderungen<br />
ändern sich und bestimmen die Qualifizierung. Aus<br />
diesem Grunde müssen wir Qualifizierung neu diskutieren,<br />
mit völlig neuen Methoden und Instrumenten untersetzen<br />
und sie angehen. Wir schlagen euch vor, dass es eine gewerkschaftsübergreifende<br />
Diskussion und einen gewerkschaftsübergreifenden<br />
Austausch zum Thema Qualifizierung<br />
unter Gender-Mainstreaming-Aspekten gibt. Hierzu sollte es<br />
eine Konferenz geben u.a. mit dem Ziel, Netzwerke zu bilden<br />
und eine Kampagne zum Thema Frauen, Karriere,<br />
Lebensweg auf den Weg bringen.<br />
Workshop 4: „Absicherung<br />
im Alter“<br />
Wir haben uns auf zwei Schwerpunkte verständigt: Das<br />
eine ist allgemeine Versicherungs- und Beitragspflicht und<br />
der zweite Schwerpunkt sind frauengerechte Modelle für<br />
betriebliche und private Vorsorge. Unter dem ersten Punkt<br />
haben wir uns auf einen Solidarausgleich innerhalb des<br />
Systems verständigt, jeder erwachsene, arbeitsfähige<br />
Mensch, egal welches Einkommen erzielt wird, soll Beiträge<br />
bezahlen bzw. für ihn sollen Beiträge abgeführt werden und<br />
es soll ein Ausgleich innerhalb des Systems erfolgen. Wir<br />
fordern den Wegfall der allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze.<br />
Für den zweiten Punkt – frauengerechte Modelle für die<br />
betriebliche Altersversorgung – fordern wir keine Bindung<br />
an Beschäftigungszeiten, eine allgemeine Versicherungspflicht<br />
in der betrieblichen Altersversorgung, unabhängig<br />
von Befristungen oder sonstigen Ausschlusstatbeständen.<br />
Und wir sagen, die Modelle dürfen die gesetzliche Rentenversicherung<br />
nicht schwächen.
Workshop 5: „Zugang zur<br />
Berufstätigkeit“<br />
Wir haben als erstes das Thema geändert haben. Wir haben<br />
statt Berufseinstieg den Wiedereinstieg diskutiert und dabei<br />
als gefragt, warum eigentlich Wiedereinstieg? Denn wenn<br />
man wieder einsteigt, heißt das ja, man ist irgendwann<br />
ausgestiegen. Unsere zwei zentralen Forderungen: Eine<br />
ganz wichtige ist die schnelle Einführung des geplanten<br />
Elterngeldes als Lohnersatzleistung, verbunden mit einem<br />
Rechtsanspruch auf einen qualitativ hochwertigen, bezahlbaren,<br />
flexiblen Platz in einer Betreuungseinrichtung für alle<br />
Kinder im Alter von null bis mindestens zehn Jahren. Nur so<br />
ist es möglich, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen<br />
auf Erwerbstätigkeit und Karriere haben. Zweitens fordern<br />
wir für den Prozess des lebensbegleitenden Lernens<br />
und Arbeitens die Beibehaltung des Kündigungsschutzes,<br />
einen Rechtsanspruch auf Bildung und Weiterbildung ohne<br />
Altersbegrenzung, die Entwicklung und Weiterentwicklung<br />
von qualitativ hochwertigen Bildungs- und Qualifizierungsangeboten,<br />
einen Grundanspruch auf kostenfreie Bildung<br />
und Weiterbildung. Ganz wichtig: Die Inanspruchnahme von<br />
Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen darf keine negativen<br />
Auswirkungen auf die Rente und Sozialleistungen<br />
haben.<br />
Workshop 6: „Ausbildung und<br />
Übernahme“<br />
Liebe Kolleginnen, wir haben uns viel gestritten, vor allem<br />
über die Quote. Unser erster Punkt ist, dass der Bildungssektor<br />
vollständig in die Zuständigkeit des Bundes fallen<br />
muss, um eine Einheitlichkeit und eine vernünftige Finanzierung<br />
zu gewährleisten. Zweitens fordern wir eine kostenfreie<br />
Bildung und die Finanzierung qualifizierter Aus- und<br />
Weiterbildung durch den Bund. Dabei möchten wir eine<br />
anteilige Aufteilung der Finanzierung auf Mädchen gewährleistet<br />
haben. Anteilig haben wir gesagt, weil ein<br />
50%-Anteil nicht immer stimmen kann. Es kann ja auch<br />
sein, dass es mal mehr Frauen als Männer gibt, die Finanzierung<br />
bekommen müssen, denen diese Finanzierung<br />
zusteht. Drittens – das ist unser strittiger Punkt gewesen –<br />
haben Teile der Gruppe dafür plädiert, eine Chancengleichheit<br />
durch Quotierung bei der Ausbildungsplatzvergabe zu<br />
erreichen. Da sind wir uns noch nicht einig geworden, ob<br />
wir da eine Quotierung haben möchten.<br />
Arbeitsgruppe 7: „Vereinbarkeit“<br />
Wir haben zwei Facetten der Vereinbarkeitsfrage diskutiert:<br />
Kinderbetreuung und Pflege und zwei zentrale Forderungen<br />
an die Politik herausgearbeitet. Erstens müssen die<br />
Rahmenbedingungen gegeben sein. In Bezug auf Kinderbetreuung<br />
heißt das, dass Bildung und Betreuung garantiert<br />
werden müssen für Kinder von null bis 14 Jahren. Die zweite<br />
Forderung war, mehr staatliche Anreize für familienfreundliche<br />
Betriebe und die, die es werden wollen, zu setzen,<br />
und zwar mit einem Controlling anhand eines Kriterienkataloges.<br />
Wir haben aber daneben konkrete betriebliche<br />
und auch gewerkschaftliche Handlungsfelder definiert,<br />
z.B. im Zusammenhang des Anreizsystems, die Kriterienkataloge<br />
zu spezifizieren. Und wir brauchen betriebliche<br />
Bündnisse in Ergänzung zu den lokalen Bündnissen, die<br />
auch ausgeweitet und fortgeführt werden müssen.<br />
Workshop 8: „Beruflicher Aufstieg“<br />
In unserer Arbeitsgruppe haben wir am Schluss festgestellt,<br />
dass unsere Botschaften doch sehr triviale sind, die wir<br />
eigentlich schon sehr oft gehört haben. Nichtsdestotrotz<br />
möchte ich euch ganz kurz unsere vier Forderungen übermitteln.<br />
Bis zur mittleren Führungsebene, bis zur mittleren<br />
Managementebene gibt es durchaus Verbesserungen was<br />
die Anteile der Frauen anbelangt. Dann kommt aber diese<br />
berühmte gläserne Decke, die schwer durchbrochen werden<br />
kann. Dann haben wir überlegt, woran es hakt und was<br />
man tun muss. Die Prioritäten und Forderungen richten sich<br />
nicht nur an die Politik, sondern auch an unsere eigenen<br />
Organisationen und auch an die Vertretung in den Betrieben:<br />
Die gesetzlichen Grundlagen zur Gleichstellung von Frauen<br />
in der Arbeitswelt müssen erhalten und ausgebaut werden;<br />
Gleichstellungsgesetze auf Länderebene, Gleichstellungsgesetz<br />
für die private Wirtschaft, aber auch Gesetze wie das<br />
Antidiskriminierungsgesetz oder auch das Gesetz zum<br />
Elterngeld sind zügig zu erlassen. Darüber hinaus ist die<br />
geschlechter-paritätische Besetzung aller Gremien, aller<br />
Aufsichtsräte, Vorstände, Verwaltungsausschüsse etc. erforderlich.<br />
Wir müssen als Frauen darauf achten, dass diese<br />
Positionen nicht überwiegend in Männerhand bleiben.<br />
Dann haben wir als weiteres Problem ausfindig gemacht,<br />
das Frauen in den letzten Jahren wieder unsichtbar geworden<br />
sind, sowohl in der eigenen Organisation als auch in<br />
der Politik und in der Öffentlichkeit. Wir denken, da muss<br />
29
30<br />
ganz viel geschehen, dass sich das wieder ändert. Eine<br />
Möglichkeit ist folgende: Wir brauchen eine bessere, differenziertere<br />
Datenerhebung, um dann so darauf reagieren zu<br />
können, und dass wir diese Defizite in die Öffentlichkeit tragen,<br />
und zwar in die Gewerkschaftsöffentlichkeit wie in die<br />
politische Öffentlichkeit. Dort müssen wir auch durch Aktionen<br />
und Kampagnen wieder präsenter werden.<br />
Viertens sollten wir schauen, wie wir als<br />
Frauen zu mehr Macht kommen, um unsere<br />
Forderungen durchsetzen zu können.<br />
Das heißt, wir wollen an die Macht und wir<br />
wollen dazu auch einiges tun. Wir denken,<br />
dass wir da auch z.B. heute und morgen<br />
schon anfangen können, indem wir beispielsweise<br />
den Bundesfrauenausschuss<br />
beauftragen, noch entsprechende Anträge<br />
zu stellen, die bislang für den <strong>DGB</strong>-Bundeskongress<br />
vielleicht noch nicht gestellt<br />
worden sind. Generell denken wir, dass<br />
unser Hauptziel sein muss, intern und<br />
extern sichtbarer zu werden. Dazu brauchen<br />
wir Aktionen. Dazu brauchen wir Mut<br />
und den Willen zu mehr Macht und Durchsetzungsvermögen.<br />
Workshop 9: „Entgelt“<br />
Euch ist bekannt, dass Frauen in der Regel<br />
immer noch 25% weniger verdienen als<br />
Männer.<br />
Unser Hauptthema war der Mindestlohn.<br />
Ich weiß, dass das ein sehr diffiziles und<br />
schwieriges Thema ist. Deswegen hat sich<br />
die Arbeitsgruppe auch inhaltlich nicht<br />
positioniert bis auf die Aussage, dass wir<br />
einen Existenz sichernden Mindestlohn aus<br />
zwei Gründen befürworten, zum einen,<br />
weil sehr viele Frauen davon betroffen<br />
sind, und zum anderen, weil die Tarifflucht der Arbeitgeber<br />
anhält.<br />
Ich habe aber aus der Arbeitsgruppe den Auftrag mitgenommen,<br />
hier zu sagen, dass sich die Arbeitsgruppe<br />
wünscht, dass es morgen eine sachliche und faire Diskussion<br />
in der Bundesfrauenkonferenz gibt und die Delegierten<br />
mit einer klaren Botschaft in Sachen Mindestlohn nach<br />
Hause gehen.<br />
Die zweite Botschaft ist, dass wir gerne wollen, dass es diskriminierungsfreie<br />
Tarifverträge gibt. Das hat auch etwas<br />
mit Bezahlung und Einstufung zu tun. Da gibt es einen<br />
ganzen Katalog von Anforderungen. Eine halbe Botschaft<br />
habe ich euch auch noch mitgebracht. Wir haben auch kurz<br />
über die explosionsartige Ausweitung der so genannten<br />
prekären Beschäftigung geredet. Früher waren das die<br />
berüchtigten 630-Mark-Jobs. Heute sind es die 400-Euro-<br />
Jobs. Unsere Forderung dazu lautet: Wir möchten gern wie-<br />
der zu unserer alten Forderung zurück, die da lautete: Jede<br />
Arbeit muss von der ersten Stunde an und vom ersten Euro<br />
an sozialversicherungspflichtig sein. Ich glaube, mit dieser<br />
Botschaft können wir gut leben.<br />
Workshop 10: „Zeit“<br />
Die Seite 1 der Konferenzzeitung<br />
Wir haben in der Arbeitsgruppe nicht nur über Arbeitszeit,<br />
sondern Zeitfragen und Zeitpolitik insgesamt diskutiert.
Deshalb haben wir eine alte Diskussion noch mal aufgegriffen,<br />
dass das „Private eigentlich politisch ist“. Nicht unser<br />
Leben muss sich an die Arbeitszeit und an Arbeit anpassen,<br />
sondern die Arbeitszeit muss dem Leben angepasst werden<br />
und das auch den verschiedenen Lebensphasen. Darauf<br />
haben wir über verschiedene Arbeitszeitmodelle wie z.B.<br />
Lebensarbeitszeit, Teilzeit gesprochen und sind zu dem<br />
Ergebnis gekommen, dass alle diese Modelle analysiert,<br />
berechnet und geregelt werden müssen.<br />
Unsere Botschaften sind; dass <strong>DGB</strong> und Gewerkschaften<br />
Kampagnen starten sollen, die auch mit Witz daher kommen.<br />
Arbeitszeit sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern<br />
es sollte mit anderen aktuellen Themen verknüpft werden,<br />
wie demographischer Wandel, Geschlechtergerechtigkeit.<br />
Arbeitszeitgestaltung, egal mit welchen Kampagnen<br />
wir nach vorne gehen, muss Optimismus verbreiten. Es<br />
muss Lust machen. Wir dürfen nicht in eine Abwehrhaltung<br />
reinkommen. Wir wollen nicht nur eng auf die Arbeit<br />
gucken, sondern auf unser ganzes Leben insgesamt, her mit<br />
dem ganzen Leben, und wir auf alle Lebensphasen achten<br />
wollen. Da kam noch einmal dieser alte Slogan von heute<br />
Morgen: Fünf Stunden mehr für Liebe und Verkehr! Das<br />
fanden wir in der Arbeitsgruppe wunderbar. Den würden<br />
wir gerne aufleben lassen. Ansonsten haben wir auch noch<br />
darüber diskutiert, dass in den Niederlanden Arbeit ganz<br />
anders definiert wird. Bei uns heißt es immer, Vollzeitarbeit<br />
ist das, was uns ausmacht. Wir wollen, dass Arbeit anders<br />
definiert wird. Es ist egal, ob ich 30, 20 oder 40 Stunden<br />
arbeite. Jeder und jede arbeitet – mehr nicht. Ob Teilzeit,<br />
Vollzeit, wie auch immer: Wir gehen arbeiten!<br />
Workshop 11: „Gesundheit“<br />
Wir haben uns in der Arbeitsgruppe sehr schnell auf den<br />
Bereich Betrieb und betriebliche Gesundheitsförderung,<br />
betriebliches Gesundheitsmanagement konzentriert und auf<br />
die Frage der Arbeitszeit. Was hat Arbeitszeit mit Gesundheit<br />
zu tun? Wir möchten euch eine zentrale Botschaft vermitteln,<br />
die lautet:<br />
Wir fordern ein ganzheitliches, geschlechtergerechtes betriebliches<br />
Gesundheitsmanagement, das auch und gerade<br />
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit zum Thema<br />
macht. Wir sind nämlich der Meinung, dass die Zeitfrage,<br />
die Verteilung der Arbeitszeit zwischen den Geschlechtern<br />
auch eine ganz große Bedeutung für die Gesundheit von<br />
Frauen und Männern hat. Dazu gehört natürlich auch, dass<br />
wir uns darum kümmern, dass Arbeitsbedingungen verbessert<br />
werden und nicht Menschen durch Stresskurse fit für<br />
die schlechteren Arbeitsbedingungen gemacht werden.<br />
Dazu gehören generell Arbeitszeitmodelle, die eine Vereinbarkeit<br />
nicht nur von Familie und Beruf, sondern auch von<br />
Lebenszeit und Beruf zulassen. Die möchten wir gerne mit<br />
den Beschäftigten in den Betrieben gemeinsam entwickeln,<br />
weil nur die ihre eigenen Bedürfnisse kennen und dann entsprechende<br />
Modelle mit uns entwickeln können.<br />
Konferenzleitung:<br />
Liebe Kolleginnen, wir haben nun die Berichte aus den einzelnen<br />
Arbeitsgruppen gehört. Die Ergebnisse aus den einzelnen<br />
Foren werdet ihr morgen früh bei euch auf dem<br />
Tisch vorfinden. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei<br />
Claudia Hartwich bedanken, die heute Morgen die schwierige<br />
Aufgabe hatte, die Konferenz in Bewegung zu bringen<br />
und uns heute den ganzen Tag zu begleiten. Claudia, ganz<br />
herzlichen Dank an dich.<br />
Eine der Berichterstatterinnen hat es auch eben schon<br />
gemacht, aber ich möchte es noch mal stellvertretend für<br />
alle tun und mich ganz besonders bei den Moderatorinnen<br />
und Expertinnen bedanken, die heute den ganzen Tag einen<br />
supertollen Job in den einzelnen Foren geleistet haben.<br />
Abschließend bedanke ich mich auch schon bei den Kolleginnen,<br />
die nachher noch ganz viel arbeiten müssen, nämlich<br />
bei den Protokollantinnen, die noch alle Ergebnisse fein<br />
schreiben müssen, damit wir sie auch morgen früh vorfinden.<br />
Auch an sie einen ganz herzlichen Dank noch mal.<br />
Jetzt bleibt mir nur noch, euch allen einen schönen erholsamen<br />
Abend zu wünschen.<br />
31
32<br />
Samstag – 26.11.2005<br />
Konferenzleitung:<br />
Ich denke, wir sind jetzt nach dem Frühsport fit für ein<br />
nächstes Event. Wir haben nämlich heute zwei Geburtstagskinder.<br />
Von dem einen Geburtstagskind haben wir heute<br />
Nacht erst erfahren, aber nur die, die so lange noch wach<br />
waren. Das ist einmal die Lisa Kotschi, die hat heute<br />
Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Sie hat auch gestern<br />
Abend oder heute Morgen von den Kolleginnen schon ein<br />
paar Blümchen bekommen. Ein weiteres Geburtstagskind<br />
ist Julia Cuntz. Die feiert heute einen runden Geburtstag. In<br />
dem Alter darf man das noch sagen. Julia wird 30. Herzlichen<br />
Glückwunsch!<br />
Kolleginnen, jetzt kommt das zweite warm-up. Wir singen<br />
jetzt gemeinsam Happy Birthday. Das war doch schon mal<br />
ganz gut, da sind wir uns schon mal einig. Wollen wir mal<br />
sehen, wie das heute mit den Anträgen so laufen wird.<br />
Jetzt will euch Birgit Pitsch noch etwas zu einer Streikaktion<br />
bei der Firma Gate Gourmet sagen.<br />
Birgit Pitsch – NGG, Del.Nr. 0052/01:<br />
Liebe Kolleginnen, wir haben bei der NGG zur Zeit die<br />
Situation, dass in einem unserer Betriebe, bei der Firma<br />
Gate Gourmet, einem Airline-Caterer in Düsseldorf, jetzt seit<br />
sieben Wochen gestreikt wird. Heute ist der 51. Streiktag.<br />
Gate Gourmet ist ein kleiner Betrieb in Düsseldorf mit ungefähr<br />
80 Beschäftigten. Es geht hier eigentlich um eine<br />
ganz stinknormale Tarifrunde, Entgeltrunde. Aber wie das so<br />
ist, der Arbeitgeber hat gekontert mit massiven Forderungen<br />
zu Einschnitten im Manteltarifvertragsbereich. Daran<br />
sind die Tarifverhandlungen gescheitert und die Kolleginnen<br />
und Kollegen streiken seit sieben Wochen. Hinter Gate<br />
Gourmet steckt eine so genannte Heuschrecke, nämlich<br />
Texas Pacific Union. Die Amerikaner haben klipp und klar<br />
gesagt, es wird hier keinen Tarifabschluss auf der Basis der<br />
Forderungen der Gewerkschaft geben. Das heißt, die Kolleginnen<br />
und Kollegen befinden sich auch in einer sehr<br />
schwierigen Situation, aber sie sind wild entschlossen, diesen<br />
Arbeitskampf erfolgreich zu beenden und setzen ihren<br />
Streik auch weiterhin fort.<br />
Ich würde es schön finden, wenn wir von dieser Konferenz<br />
eine Soli-Adresse schicken könnten. Es wäre noch schöner,<br />
wenn wir alle eine kleine Spende für die Kolleginnen und<br />
Kollegen übrig hätten. Sonja hat schon einen Spendenbeutel<br />
vorbereitet. Ihr seht, man kann viel mit den Taschen der<br />
IG Metall machen. Und wir haben dort eine Wandzeitung<br />
angehängt. Wenn ihr in der Pause da unterschreibt, würden<br />
wir uns sehr freuen. Wir würden dann beides nächsten<br />
Samstag mit nach Düsseldorf mitnehmen, wenn von Berlin<br />
aus eine NGG-Delegation da hinfährt. Dankeschön.<br />
Konferenzleitung:<br />
Auch dir danke, Birgit. Wir kommen jetzt zum Rückblick auf<br />
den gestrigen Tag und zu Strategien für eine gleichstellungsorientierte<br />
Arbeits- und Beschäftigungspolitik. Ursula<br />
Engelen-Kefer wird den gestrigen Tag zusammenfassen und<br />
mit einigen Anmerkungen versehen. Ursula bitte.<br />
Ursula Engelen-Kefer:<br />
Auch von mir einen herzlichen guten Morgen, liebe Kolleginnen,<br />
liebe Frauen, liebe Delegiertinnen, auch wenn der<br />
Frühsport uns eben mit Tempo mitten in die Arbeit hineingebracht<br />
hat, glaube ich, wäre es etwas vermessen, wenn<br />
ich den gestrigen Tag hier zusammenfassen wollte. Deshalb<br />
wollte ich eigentlich Folgendes tun:<br />
Ich wollte mich zunächst einmal bei all denjenigen, die in<br />
elf Arbeitsgruppen zu dem hervorragenden Ergebnis beigetragen<br />
haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Ich finde, ihr<br />
habt eine tolle Arbeit geleistet. Dafür herzlichen Dank.<br />
Bedanken möchte ich mich aber auch bei denjenigen, die<br />
gestern Abend und heute Nacht eine Extraschicht eingelegt<br />
und all das zu Papier gebracht haben, was ihr da gestern<br />
produziert habt. Ich denke, auch denen gebührt unser ganz<br />
herzlicher Dank. Wenn es schon keine Nacht- und Schichtzuschläge<br />
gibt, dann gibt es wenigstens ein warmes Händeklatschen.<br />
Das ist doch mindestens etwas.<br />
Lasst mich ganz kurz drei wesentliche Punkte festhalten,<br />
die uns besonders deutlich geworden sind, als wir uns die<br />
zusammengefassten Ergebnisse einmal näher angesehen<br />
haben. Natürlich werden wir die Gesamtergebnisse in den<br />
nächsten Tagen und Wochen sehr sorgfältig analysieren und<br />
dann auch entsprechende strategische Konsequenzen daraus<br />
ziehen, aber drei Dinge waren besonders hervorhebenswert.<br />
Das würde ich zuallererst mit zwei Zitaten belegen
wollen. Da haben sich einige Kolleginnen über die Frage<br />
der strategischen Verbesserung der Zusammenarbeit in den<br />
Gewerkschaften geäußert. Sie sagten, dass sie erst jetzt auf<br />
der Bundesfrauenkonferenz verstanden haben, wie wichtig<br />
es ist, über die Probleme in den anderen Gewerkschaften<br />
etwas zu hören und gemeinsam darüber nachzudenken,<br />
welche Strategien künftig zum Erfolg führen können. Es<br />
gibt gleiche Ziele. Aus diesem Grunde können gemeinsame<br />
strategische neue Ansätze gefunden werden, was die branchenspezifische<br />
Untersetzung nicht ausschließen würde.<br />
Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge. Sie klingen zwar<br />
sehr selbstverständlich, wenn wir uns die Realität angukken,<br />
sind wir leider oft weit davon entfernt. Deshalb wollte<br />
ich das ganz besonders hervorheben. Es gibt eine weitere<br />
Botschaft. Diese Botschaft besteht darin, dass wir uns in<br />
Zukunft noch mehr als bisher darum bemühen müssen,<br />
nicht nur Konzepte und allgemeine Forderungen zu entwikkeln,<br />
sondern auch eine möglichst gute Balance zwischen<br />
derartigen allgemeinen Forderungen und ganz praktischen<br />
Beispielen zu finden. Hierzu ein Zitat aus den Protokollen:<br />
Wichtig war der Arbeitsgruppe, die vorhandenen Instrumente<br />
zur Durchsetzung und Umsetzung im Betrieb zu nutzen.<br />
Das ist ein weiterer Auftrag an uns alle, hier eine bessere<br />
Balance zwischen allgemeinen Forderungen und praktischen<br />
Beispielen zu finden.<br />
Schließlich hat mich etwas sehr gefreut, denn das Motto<br />
der diesjährigen Bundesfrauenkonferenz hat offensichtlich<br />
doch gut eingeschlagen und eine Menge an Begeisterung<br />
hervorgerufen. Deshalb wollen wir dies auch in den zukünftigen<br />
Arbeiten, Kampagnen und Initiativen von unserer<br />
Seite aufgreifen und entsprechend umsetzen und werden<br />
euch da auch entsprechende Materialien und sonstige Hilfestellung<br />
anbieten. Dazu ein Zitat: Frauen sind unerhört<br />
und verschaffen sich Gehör durch Selbstermächtigung. Wir<br />
brauchen als gesellschaftliche Gegenmacht ein gewerkschaftliches<br />
Fernsehen. Wir wollen nicht nur gehört, sondern<br />
auch gesehen werden. Ich finde, mit diesem schönen<br />
Zitat sollten wir heute unsere Arbeit beginnen. Herzlichen<br />
Dank.<br />
Konferenzleitung:<br />
Vielen Dank Ursula. Die Papiere liegen euch schon vor. Das<br />
ist eine Wahnsinnsarbeit, die die Kolleginnen gestern Abend<br />
und heute Nacht gemacht haben. Die Papiere sind sicher<br />
für uns auch Arbeitsgrundlage in den Einzelgewerkschaften,<br />
in den Bezirken, in den Landesbezirken.<br />
Als nächster Punkt war ein Grußwort der Bundesfrauenministerin<br />
angekündigt. Dieser Punkt muss leider entfallen, da<br />
die Bundesfrauenministerin abgesagt hat. Wir werden ihr<br />
aber unsere Arbeitsergebnisse zukommen lassen, damit sie<br />
weiß, was sie hier verpasst hat und welche Chance sie<br />
gehabt hätte, mit uns zu diskutieren.<br />
Kolleginnen, dann kommen wir jetzt zum<br />
Bericht der<br />
Mandatsprüfungskommission<br />
Sprecherin der Mandatsprüfungskommission:<br />
Die Mandatsprüfungskommission hat gestern getagt. Von<br />
122 gemeldeten Delegierten sind 118 anwesend. Wir sind<br />
zu 100 % eine Frauenkonferenz, wie der Name es sagt,<br />
also 118 weibliche Delegierte. Jetzt komme ich zu dem Teil,<br />
den wir nicht so positiv fanden. Wir haben zwei Delegierte<br />
bis 30 Jahre und wir haben elf Delegierte bis 40 Jahre.<br />
Damit haben wir ein Durchschnittsalter der Delegierten von<br />
50 Jahren.<br />
33
34<br />
Antragsberatung<br />
Konferenzleitung:<br />
Vielen Dank an die Mandatsprüfungskommission. Wir kommen<br />
nun zu dem nächsten Tagesordnungspunkt, dem<br />
Tagesordnungspunkt 9: Antragsberatung. Zunächst habe ich<br />
einige Hinweise zum Verfahren zu geben.<br />
Die Anträge werden in der Reihenfolge aufgerufen, wie sie<br />
euch auch vorliegen. Zuerst erhält die Antragstellerin das<br />
Wort, wenn sie es denn will. Sie muss allerdings den Antrag<br />
nicht begründen, weil in der Regel der Antrag aus dem Text<br />
schon ersichtlich ist. Wortmeldungen zu den Anträgen sind<br />
nur mit Hilfe der Wortmeldekarten möglich. Ich bitte euch,<br />
das zu beachten. Zunächst steht die Empfehlung der Antragskommission<br />
zur Abstimmung. Findet diese keine Mehrheit,<br />
wird über den Ur-Antrag abgestimmt. Liegt zu einem<br />
Antrag ein Änderungsantrag vor, wird zunächst darüber<br />
abgestimmt und dann über den Gesamtantrag.<br />
Wir kommen also zu den Anträgen Block A – Gleichstellungspolitik.<br />
Sprecherin der Antragskommission ist Sandra<br />
Temmen. Im Block A gibt es einen Initiativantrag.<br />
Ich rufe auf<br />
Antrag 001:<br />
Frauenpolitische Offensive statt<br />
„Lila Pause“<br />
Sprecherin der Antragskommission --<br />
Sandra Temmen – GdP, Del.Nr. 0057/01<br />
Dankeschön, auch von mir guten Morgen, liebe Kolleginnen.<br />
Der Antrag A 001 beschäftigt sich mit der frauenpolitischen<br />
Offensive statt „Lila Pause“. Wir haben in der<br />
Antragsberatungskommission eine Empfehlung. Die lautet:<br />
Annahme mit Änderungen, wobei ich hier noch erwähnen<br />
möchte, dass diese Änderungen keine inhaltlichen Änderungen<br />
darstellen, sondern rein redaktionell sind. Das heißt,<br />
wir haben Teile aus dem eigentlichen Antrag mit in die<br />
Begründung übernommen.<br />
Wir hatten auch jetzt noch mal eine kleine Veränderung,<br />
und zwar unter der Nr. 5 in dem Antrag zu dem Boys’ Day.<br />
Verbessert wollten wir gern in Anführungsstrichen haben.<br />
Das wäre es, was unter Nr. 5, Seite 2, noch hinzukäme.<br />
Konferenzleitung – Marianne Malkowski – IG BCE,<br />
Del.Nr. 0012/01:<br />
Ihr habt die Empfehlung der Antragskommission zu diesem<br />
Antrag gehört. Wünscht die Antragstellerin das Wort?<br />
Marita Eilrich – <strong>DGB</strong>-Bezirk Hessen/ Thüringen,<br />
Del.Nr. 0015/02:<br />
Wir sind Antragstellerin zu dieser frauenpolitischen Offensive.<br />
Ich hätte nicht so gern, dass verbessert in Anführungszeichen<br />
steht. Es ist nämlich wahrscheinlich ein Schreibfehler,<br />
ein Übermittlungsfehler. Wir wollten eigentlich damit<br />
sagen, dass er nicht verwässert werden darf. Denn ihr kennt<br />
alle die Diskussion in den Bundesländern. Es gibt auch<br />
Bestrebungen seitens der Kultusministerinnen, dieses zu<br />
verändern und einen Tag für die Jungs am gleichen Tag, an<br />
dem auch der Girls Day stattfindet, einzurichten. Dagegen<br />
wollen wir uns wenden.<br />
Kerstin Spendel – IG BCE, Del.Nr. 0008/01:<br />
Liebe Kolleginnen, ich möchte kurz zu dem Antrag Stellung<br />
nehmen. Leider sind in dem Antrag viele Themen zusammengepackt<br />
worden, wozu wir in einem Punkt eine andere<br />
Meinung vertreten. Die IG BCE spricht sich gegen eine<br />
generelle Quotierung von Ausbildungsplätzen aus, was ich<br />
hier auch kurz begründen möchte.<br />
In der IG BCE haben wir bereits seit vielen Jahren über<br />
Tarifverträge eine jährliche Ausbildungsplatzerhöhung vereinbart.<br />
Bilanzen beweisen, dass sich dieser Weg bewährt<br />
hat und wir sogar in vielen Bereichen mehr Ausbildungsplätze<br />
verbuchen können, die darüber hinausgehen.<br />
Zum Antrag selber stellt sich mir die Frage, was denn mit<br />
den Ausbildungsplätzen passieren wird, die durch die Quotierung<br />
von 50 % Frauenanteil, aus welchen Gründen auch<br />
immer, nicht mit genügend Frauen besetzt werden. Zum<br />
anderen glaube ich nicht, dass aufgrund einer Quotierung<br />
Frauen ihre Berufswahl verändern werden.<br />
Ich bin hier eher der Meinung, dass wir durch weitere<br />
Aktionen Frauen begeistern müssen, beispielsweise einen<br />
Ausbau das Girls Day vorantreiben müssen, um junge Frauen<br />
für gewerblich-technische Berufe zu gewinnen. Aus diesem<br />
Grund sprechen wir uns gegen eine Quotierung aus
und fordern euch auf, den Antrag in dem Punkt abzulehnen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Zu diesem Antrag liegen keine weiteren Wortmeldungen<br />
vor. Somit kommen wir zur Abstimmung.<br />
Die Antragsberatungskommission hat ihren Vorschlag<br />
gemacht. Sie empfiehlt mit der Änderung, verbessert in<br />
Anführungsstriche zu setzen, diesen Antrag so anzunehmen.<br />
Die Antragsberatungskommission empfiehlt also<br />
Annahme des Antrages. Wer dem Antrag so zustimmen<br />
möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Danke.<br />
Wer ist dagegen? Nein Gegenstimmen. Wer enthält sich?<br />
Niemand. Somit ist der Antrag angenommen.<br />
Wir kommen als nächstes zum<br />
Initiativantrag I:<br />
„Beibehaltung und Umsetzung des<br />
ganzheitlichen Konzepts zum bundesweiten<br />
Girls Day an den allgemeinbildenden<br />
Schulen“<br />
Ich bitte die Antragskommission um Ihre Empfehlung.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Antragsberatungskommission empfiehlt die Annahme<br />
des Antrages.<br />
Konferenzleitung:<br />
Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wir<br />
stimmen ab. Wer mit diesem Initiativantrag einverstanden<br />
ist, bitte ich um sein Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen?<br />
Stimmenthaltungen? Somit ist der Antrag einstimmig angenommen,<br />
danke.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag 002:<br />
„Progressive Frauenpolitik“<br />
Sprecherin der Antragskommission:<br />
Wir empfehlen die Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss<br />
mit dem Auftrag, ein frauen- und<br />
gleichstellungspolitisches Programm, auch unter Berücksichtigung<br />
anderer Anträge, C 001, Wirtschaftspolitik, und E<br />
001, <strong>Sozialstaat</strong>, zu erarbeiten und zur Diskussion zu stellen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke. Wünscht die Antragstellerin dazu das Wort? Das ist<br />
nicht der Fall. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich<br />
darf bitten, über diesen Antrag abzustimmen. Wer mit dem<br />
Vorschlag der Antragskommission einverstanden ist, bitte<br />
ich um sein Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?<br />
Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.<br />
Danke.<br />
Antrag A 003:<br />
„Geschlechterspezifische Datenerhebung<br />
und Statistiken“<br />
Sprecherin der Antragskommission:<br />
Hier empfehlen wir die Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort? Gibt es Wortmeldungen?<br />
Das ist nicht der Fall. Wir stimmen über den Vorschlag<br />
der Antragskommission ab. Wer damit einverstanden ist,<br />
den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen?<br />
Stimmenthaltungen. Somit ist dieser Antrag ebenfalls<br />
einstimmig angenommen.<br />
Es folgt<br />
Antrag A 004:<br />
„Gleichstellungsgesetz für die<br />
Privatwirtschaft“<br />
Sprecherin der Antragskommission:<br />
Hier empfehlen wir ebenfalls die Annahme des Antrages.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht hier die Antragstellerin das Wort? Das ist nicht der<br />
Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Der Vorschlag ist: Annahme.<br />
Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen.<br />
Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Einstimmige<br />
Annahme, danke.<br />
Ich rufe den auf<br />
Antrag A 005:<br />
„Für nachhaltige Verbesserung im<br />
Landesgleichstellungsrecht“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Hier empfiehlt die Antragsberatungskommission die Annahme<br />
mit Änderungen, wobei auch hier wieder gesagt sei,<br />
35
36<br />
dass die Änderungen nicht inhaltlicher, sondern rein redaktioneller<br />
Art sind.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin dazu das Wort? Das ist nicht<br />
der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dafür ist, den<br />
bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen?<br />
Stimmenthaltungen? Somit ist auch dieser Antrag einstimmig<br />
angenommen.<br />
Antrag A 006:<br />
Entschließung zu „Keine Auflösung der<br />
Konferenz der Gleichstellungs- und<br />
Frauenministerinnen“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Hier empfehlen wir die Annahme, ebenfalls mit Änderungen.<br />
Auch hier sei wieder gesagt, es sind keine inhaltlichen<br />
Änderungen, sondern redaktionelle. Der mittlere Teil des<br />
Antrages wurde als Begründung aufgenommen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort? Wir kommen zur<br />
Abstimmung. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, den<br />
bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen?<br />
Stimmenthaltungen? Somit ist der Antrag einstimmig<br />
angenommen. Vielen Dank.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Ich bedanke mich auch.<br />
Konferenzleitung:<br />
Ab jetzt ist Frauke Gützkow Sprecherin der Antragsberatungskommission.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission –<br />
Frauke Gützkow, GEW, Del.Nr. 0018/01:<br />
Guten Morgen, liebe Kolleginnen, auch zu diesem Antrag<br />
empfiehlt die Antragsberatungskommission Annahme mit<br />
redaktionellen Änderungen. Auch hier haben wir einige<br />
Antragstextpassagen in die Antragsbegründung genommen.<br />
Deshalb unsere Empfehlung: Annahme in dieser Form.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht hier die Antragstellerin das Wort? Das ist nicht der<br />
Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung des Antrags A 007.<br />
Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen.<br />
Danke. Stimmenthaltungen? Gegenstimmen? Der<br />
Antrag ist einstimmig angenommen. Danke.<br />
Die A 008 und A 009 wurden von der Antragsberatungskommission<br />
zusammengefasst beraten. Wir bitten euch,<br />
diese beiden Anträge jetzt gemeinsam zu behandeln.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Das Thema „Ausweitung der Umlagefinanzierung der<br />
Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld durch die Arbeitgeber auf<br />
alle Betriebe“ wurde von zwei Antragstellerinnen gemacht.<br />
Die Anträge sind fast wortgleich. Der A 008 ist etwas präziser,<br />
indem es nicht nur „<strong>DGB</strong>“, sondern „<strong>DGB</strong>-Bundesvorstand“<br />
heißt. Deshalb empfehlen wir die Annahme von<br />
Antrag A 008 und der Antrag A 009 wäre damit erledigt.<br />
Konferenzleitung:<br />
Gibt es hier Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann<br />
steht der Vorschlag der Antragskommission zur Abstimmung.<br />
Wer sich damit einverstanden erklären kann, den<br />
bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen?<br />
Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall – einstimmig<br />
angenommen.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag A 010: „Antidiskriminierungsgesetz“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Als wir den Antrag im Sommer beraten hatten, waren die<br />
politischen Entscheidungen oder Weichenstellungen noch<br />
nicht ganz abgeschlossen. Mittlerweile ist es so, dass es ein<br />
komplett neues Gesetzgebungsverfahren geben muss. Wir<br />
haben uns deshalb entschieden, unsere Empfehlung von<br />
der Sitzung im Sommer noch mal zu ändern und euch einen<br />
neuen Vorschlag vorgelegt, den Antrag mit folgenden<br />
Änderungen anzunehmen:<br />
Die Änderungen liegen euch vor. Wir empfehlen Annahme<br />
einschließlich dieser ausgedruckten Änderungen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Haben alle den Änderungsvorschlag zur Hand? Wünscht zu<br />
diesem Punkt die Antragstellerin das Wort? Das scheint<br />
nicht der Fall zu sein. Wir kommen zur Abstimmung über<br />
den Antrag A 010, wie die Antragskommission vorgeschlagen<br />
hat. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um das Kartenzeichen.<br />
Danke. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?<br />
Das sehe ich nicht. Somit ist der Antrag angenommen.
Wir kommen unter dem Punkt A zu einem Initiativantrag,<br />
der euch auch vorliegt. Er heißt:<br />
„Rote Karte gegen Zwangsprostitution,<br />
Unterstützung und Beteiligung an der Kampagne<br />
des Deutschen Frauenrates anlässlich<br />
der Fußballweltmeisterschaft 2006“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Antragskommission hat die Begründung für den Initiativantrag<br />
geprüft und festgestellt, das ist ein Initiativantrag.<br />
Wir empfehlen euch den Antrag zur Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Gut. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall.<br />
Ich bitte daher um Abstimmung des Initiativantrags „Rote<br />
Karte gegen Zwangsprostitution“. Gibt es Gegenstimmen?<br />
Stimmenthaltungen? Somit ist der Antrag einstimmig angenommen.<br />
Ich bin jetzt mit meinem Block durch. Ellen Maurer macht<br />
weiter. Schönen Dank, Frauke, für die Arbeit.<br />
Konferenzleitung – Ellen Maurer, ver.di,<br />
Del.Nr. 0068/01:<br />
Wir beginnen mit Block B. Ich begrüße eine neue Sprecherin<br />
der Antragskommission. Das ist Gabriele Ulbrich, herzlich<br />
willkommen. Ich hoffe, wir werden das gemeinsam meistern.<br />
Wir haben im Antragsblock B einen Änderungsantrag zu B<br />
002 bis 005 und einen Initiativantrag zum Thema Abfindungen.<br />
Das vorab für euch, damit ihr schon ein bisschen eure<br />
Unterlagen sortieren könnt.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag B 001: „Entschließung zur<br />
diskriminierungsfreien Tarifpolitik,<br />
Weiterentwicklung einer geschlechterdemokratischen<br />
Tarifpolitik“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission –<br />
Gabriele Ulbrich, IG Metall, Del.Nr. 0043/01:<br />
Wir empfehlen die Annahme des Antrags als Material, weil<br />
der erste Teil des Antrages die EU-Rechtsprechung wiedergibt.<br />
Die Forderungen beginnen im Grunde genommen bei<br />
den Ziffern, nämlich 1 bis 4. Davon sind einige schon erledigt.<br />
Es gibt also schon Checklisten, beispielsweise durch<br />
das Projekt vom <strong>DGB</strong> erstellt, einige noch nicht. Deswegen<br />
empfehlen wir, dass der Antrag zur weiteren Bearbeitung<br />
an den <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss geht.<br />
Konferenzleitung:<br />
Dankeschön. Wortmeldungen liegen mir dazu nicht vor.<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort? Das ist nicht der Fall.<br />
Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragskommission<br />
folgen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen.<br />
Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann<br />
ist das so beschlossen.<br />
Wir kommen zum Änderungsantrag zu den<br />
Anträgen B 002 bis B 005: „Für einen<br />
gesetzlichen Mindestlohn“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Wir empfehlen die Annahme des Änderungsantrages, der<br />
euch auf dem Tisch ausliegt. Die anderen Anträge, die<br />
gleichzeitig aufgerufen worden sind, gehen als Material zu<br />
diesem Antrag.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort?<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Ich werde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich<br />
das natürlich korrekt machen muss. Wir haben ja den Änderungsantrag<br />
noch mal geändert. Insofern empfehlen wir die<br />
Änderung der Änderung, also Abänderung zu B 002.<br />
Konferenzleitung:<br />
Jetzt hat für die Antragstellerin die Kollegin Rademacher<br />
mit der Teilnehmernummer 034 von der IG Metall das Wort.<br />
Lilo Rademacher – IG Metall, Del.Nr. 0034/01:<br />
Liebe Frauen, ich denke, die Frage des gesetzlichen Mindestlohns<br />
ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer gewerkschaftlichen<br />
Diskussion. Deswegen möchte ich auch nachdrücklich<br />
für den Änderungsantrag hier auf dieser Konferenz<br />
werben. Wir wollen alle, und das ist auch die Botschaft,<br />
die an die große Koalition gehen muss, dass wir<br />
einen gesetzlichen Mindestlohn in einer Höhe, die oberhalb<br />
der Armutsgrenze liegt, fordern.<br />
Kolleginnen und Kollegen, es gibt viele unterschiedliche<br />
Branchen, wo Frauen unter ganz schlimmen Arbeitsbedingungen,<br />
unter ganz schlimmen Verdiensten arbeiten müssen.<br />
Hinzu kommt, das ist auch besonders ein Thema, was<br />
37
38<br />
Frauen angeht, dass insbesondere auch in den prekären<br />
Arbeitsverhältnissen, ich meine die ganzen Leiharbeitsverhältnisse,<br />
zunehmend auch Frauen beschäftigt werden. Hier<br />
haben wir auch Verdienstregelungen, die einem die Schamesröte<br />
ins Gesicht treiben. Wir wissen auch, dass viele<br />
Frauen in Branchen arbeiten, wo die Betriebe nicht verbandsgebunden<br />
sind und von daher auch keine tarifliche<br />
Regelungen Anwendung finden.<br />
Deswegen noch mal nachdrücklich mein Werben für diesen<br />
Antrag. Aber ich möchte euch auch bitten, wenn wir hier in<br />
diesem Antrag den <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand, den <strong>DGB</strong>-Frauenausschuss<br />
und die Mitgliedsgewerkschaften auffordern,<br />
einen Gesetzentwurf zur gesetzlichen Mindestlohnregelung<br />
vorzulegen, in die politische Diskussion zu bringen, dass wir<br />
dabei auch berücksichtigen, was die tarifvertraglichen<br />
Regelungen in Einzelgewerkschaften sind. Deswegen, Kolleginnen<br />
und Kollegen, stimmt diesem Änderungsantrag zu.<br />
Ich glaube, dass wir – gemäß unserem Motto: Wir sind<br />
nicht unerhört, sondern wir schaffen uns Gehör – mit diesem<br />
Antrag auch eine wegweisende Regelung anstoßen<br />
können. Danke.<br />
Heidrun Strüwing – IG BCE, Del.Nr. 0007/01:<br />
Liebe Kolleginnen, die Debatte und die Anträge über den<br />
gesetzlichen Mindestlohn stimmen uns sehr nachdenklich,<br />
denn es geht hierbei auch um die Zukunft unserer Gewerkschaftsarbeit.<br />
Ein großes Pfund der Gewerkschaftsarbeit ist<br />
es doch, dass Tarifverträge abgeschlossen werden können,<br />
Tarifverträge unterschiedlicher Facetten und Themen, so<br />
auch Entgelttarifverträge. Ließen wir uns dieses mit einem<br />
Gesetz zu Mindestlöhnen nicht total aus der Hand nehmen?<br />
Die Arbeitgeber werden sich bei Verabschiedung<br />
eines solchen Gesetzes dem selbstverständlich anpassen<br />
mit der Entgelthöhe, auch wenn sie vorher mehr als den<br />
vereinbarten Mindestlohn gezahlt haben, nämlich nach<br />
Tarif. Forcieren wir hier nicht auch die Flucht aus dem<br />
Arbeitgeberverband? Organisieren wir es uns hierbei nicht<br />
selber, dass unsere Mitglieder in Scharen aus der Gewerkschaft<br />
austreten, wenn kein tariftreuer Lohn mehr gezahlt<br />
wird. Für einen nicht geringen Teil unserer Mitglieder würde<br />
ein gesetzlicher Mindestlohn bedeuten, dem bisher erreichten<br />
Standard den Rücken zu kehren und einen Rückschritt<br />
in Kauf zu nehmen. Wollen wir das mit diesen Anträgen<br />
wirklich erreichen?<br />
Es ist ja einzusehen, dass es in anderen Branchen der<br />
Gewerkschaften anders gelagerte Probleme gibt als in der<br />
IG BCE. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir besser<br />
den Gewerkschaften den Rücken stärken können in den<br />
Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern, damit auf dieser<br />
Strecke Erfolge gemeldet werden können. Es gibt doch in<br />
jeder Region die Möglichkeit, sich über eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung<br />
an einen geltenden Tarif anzulehnen.<br />
Wir können diesen Anträgen jedenfalls nicht zustimmen.<br />
Danke.<br />
Margret Mönig-Raane – ver.di, Del.Nr. 0008/02:<br />
Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Zum Thema Mindestlohn:<br />
Wie schaffen wir es, Arbeit in Würde – und dazu gehört ein<br />
existenzsicherndes Einkommen durch Arbeit – zu realisieren?<br />
Selbstverständlich ist für uns als Gewerkschaften der<br />
allererste Weg, gute Tarifverträge abzuschließen. Der Blick<br />
rundherum in diesem Land zeigt aber, dass es zunehmend<br />
Bereiche gibt, die nicht mehr tarifvertraglich geschützt sind,<br />
und dass Arbeitgeber zu dem Trick greifen, dort, wo wir<br />
hohen Organisationsgrad, gute Tarifverträge haben, Teile<br />
der Belegschaft, auch der Kernbelegschaft, auszugründen,<br />
sie als unternehmensinterne Leiharbeitsfirma zu deklarieren<br />
und diese Beschäftigen zu einem Drittel weniger Lohn und<br />
Gehalt zu vermieten, Arbeitnehmerüberlassung zu machen.<br />
Leider ist das auch seit der letzten Gesetzesänderung unbefristet<br />
möglich.<br />
Das ist nur ein Beispiel dafür, wie Löhne und Gehälter nach<br />
unten gedrückt werden, wie Tarifeinkommen der anderen<br />
Beteiligten wahnsinnig unter Druck kommen. Ihr kennt alle<br />
den Einzelhandel. Wir haben Beispiele, wo Unternehmen<br />
ganze Kassenzonen ausgliedern und dort Leiharbeitnehmerinnen<br />
beschäftigen zu einem Tarifvertrag, der – wenn es<br />
sehr gut geht – ein Tarifvertrag ist, der mit den <strong>DGB</strong>-<br />
Gewerkschaften abgeschlossen wurde. Wir haben aber<br />
zunehmend die Beobachtung, dass die so genannten christlichen<br />
Gewerkschaften Tarifverträge abschließen, die nach<br />
dem Motto gehen: Die Arbeitgeber schicken denen einen<br />
Tarifvertrag zu und sagen, das hätten wir gerne von euch<br />
unterschrieben. Dann kriegen die das unterschrieben<br />
zurückgeschickt. Die haben kein Mitglied im Betrieb, aber<br />
es ist egal, das formale Erfordernis eines Tarifvertrages ist<br />
gegeben.<br />
Ich glaube, das zeigt, dass wir ehrlich konzedieren müssen:<br />
Wir als Gewerkschaften sind nicht in der Lage, im Augenblick<br />
auch nur die Standards zu verteidigen. Wenn das so<br />
ist, dann suche ich doch nach Instrumenten, wie wir das<br />
schaffen. Das eine ist, dass wir wirklich mit viel Phantasie<br />
gucken, wie machen es andere erfolgreiche Gewerkschaften,<br />
Terrain zurückerobern. Diese Forderung geht an uns<br />
selber und ist auch durch nichts abzubedingen. Aber darüber<br />
hinaus müssen wir ja sehen, wie wir diese Strategie<br />
stärken können.
Ich war viele, viele Jahre Gegnerin eines gesetzlichen Mindestlohns,<br />
weil ich gesagt habe, wir Gewerkschaften, wir<br />
regeln das selber. Aber wirklich ein Blick ringsum, auch in<br />
unsere gut organisierten Bereiche zeigt, wir schließen die<br />
Augen vor der Wirklichkeit.<br />
Natürlich nehme ich die Sorgen sehr ernst, die sagen, drükken<br />
oder ziehen wir damit nicht das Lohn- und Gehaltsniveau<br />
nach unten? Geben wir damit nicht den Arbeitgebern<br />
sozusagen das Entree zu sagen, na ja, also, diese astronomischen<br />
Löhne und Gehälter oder Stundenlöhne zahlen wir<br />
jetzt nicht mehr. Wir müssen ja nur so viel bezahlen. Diese<br />
Gefahr besteht, das ist richtig. Und die Arbeitgeber werden<br />
das überall dort machen, wo wir nicht in der Lage sind,<br />
durch eigene Kraft Besseres durchzusetzen. Aber da verweise<br />
ich auf meine ersten Ausführungen. Ohne Mindestlohn<br />
haben wir diese Kraft auch nicht, entsprechend bessere<br />
Tarifverträge durchzusetzen. Insofern bin ich tief davon<br />
überzeugt, dass Tarifautonomie und Mindestlohn sich nicht<br />
ausschließen, sondern gesetzlicher Mindestlohn sozusagen<br />
zur Stabilisierung von tarifvertraglichen Niveaus beiträgt<br />
und beitragen kann. Wenn ich mich umgucke, wie es den<br />
Gewerkschaften in Großbritannien ergangen ist, die viele,<br />
viele Jahre diskutiert haben, ob sie das gut oder schlecht<br />
finden. Erst mal fanden sie es mehrheitlich schlecht und<br />
wollten es nicht, dann hat die Labour-Regierung – hört,<br />
hört, die Labour-Regierung – es 1999 eingeführt und inzwischen,<br />
glaube ich, die sechste oder siebte Erhöhung gehabt.<br />
Und wir haben in Großbritannien, also mit wirklich neoliberaler<br />
Wirtschaftspolitik par excellence, inzwischen einen<br />
Mindestlohn, der bei 7,60 Euro liegt. Davon sind wir in<br />
Deutschland in vielen Bereichen weit entfernt, übrigens<br />
auch in tariflich fixierten Bereichen weit entfernt.<br />
Die Kraft der Gewerkschaften und der Tarifverträge ist nicht<br />
1:1 vergleichbar, das ist richtig, aber klar ist: Die englischen<br />
Gewerkschaften sehen, es hat die Lohn- und Einkommensentwicklung<br />
stabilisiert und diesen Fall nach unten<br />
gestoppt. Es gibt keine Beschäftigten mehr, die unterhalb<br />
dieses Lohnes und Einkommens beschäftigt werden. Auch<br />
die Sorge, dass damit Arbeitsplätze wegfallen, ist weg. Und<br />
es ist ein probates Rezept gegen das, was Angela Merkel<br />
gestern Abend bei der Kommunalen Vereinigung erzählt<br />
hat, nämlich wir brauchen die Einführung eines Niedriglohnsektors.<br />
Das brauchen wir genau nicht. Das ist Gift für<br />
die Menschen, die dort arbeiten, Gift für diese Volkswirtschaft<br />
und Gift für die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.<br />
Ich glaube also, das Konzept Mindestlohn ist eine Chance,<br />
die wir wahrnehmen sollten, die nicht im Gegensatz zu<br />
Tarifautonomie steht, sondern im Gegenteil diese stabilisiert.<br />
Aber auch dort kommt von nichts nichts, das ist klar.<br />
Also, unsere eigene Kraft weiterentwickeln und stärken, das<br />
ist ein Konzept, was wir in jedem Fall brauchen und wo ich<br />
auch zuversichtlich bin, dass wir nach Jahren des Rückgangs<br />
eine ganze Menge Anhaltspunkte haben, ein paar in<br />
meiner eigenen Gewerkschaft, ich sehe sie bei der IG<br />
Metall, bei anderen Gewerkschaften, wirklich ganz hoffnungsvolle<br />
Zeichen, dass wir diese Talsohle auch wieder<br />
durchschreiten können. Da ist der Mindestlohn eine Hilfe<br />
und kein kontraproduktives Mittel.<br />
In dem Sinn bitte ich euch, damit alle Kolleginnen zustimmen<br />
können, den Änderungsantrag anzunehmen. Lieber<br />
wäre mir eine ganz klare Forderung, das ist klar, aber wir<br />
wollen es ja gemeinsam voranbringen. Darum, denke ich,<br />
ist der Änderungsantrag der richtige Weg, hier zu einer<br />
gemeinsamen Willensbildung zu kommen. Ich danke euch.<br />
Monika Zimmermann – ver.di, Del.Nr. 0075/01:<br />
Das ist jetzt nicht mehr so erforderlich, weil dem eigentlich<br />
nichts mehr hinzuzufügen ist. Ich wollte nur mit Nachdruck,<br />
auch mal leidenschaftlich sagen: Instrumente, die uns zur<br />
Verfügung stehen, sollen wir benutzen. Ich würde mich riesig<br />
freuen, wenn wir hier vielleicht auch Einstimmigkeit<br />
schaffen könnten, damit die anderen Gewerkschaften<br />
sehen, perspektivisch kann ihnen genau das Gleiche passieren,<br />
was derzeit in bestimmten Bereichen in unserem Land<br />
passiert.<br />
Birgit Pitsch – NGG, Del.Nr. 0052/01:<br />
Liebe Kolleginnen, wir haben den Antrag B 002 eingereicht,<br />
Margret, in der klaren Formulierung, die du dir gewünscht<br />
hättest. Wir sind natürlich ein bisschen traurig, dass dieser<br />
Antrag nun abgeändert wird, aber wir haben uns genauso<br />
jetzt auf den Änderungsantrag eingestellt, weil ich der Meinung<br />
bin – Margret hat es gesagt –, wir sollten hier mit<br />
einer wirklich breiten Mehrheit zu dieser Problematik Mindestlohn<br />
aus der Konferenz herausgehen.<br />
Margret hat von einem Niedriglohnsektor gesprochen, den<br />
die neue Bundeskanzlerin fordert. Kolleginnen, ich bin der<br />
Meinung, wir haben ihn bereits. Die Zahlen sagen es auch<br />
ganz deutlich. Über 7,7 Mio. Menschen arbeiten im sogenannten<br />
Niedriglohnbereich. Das sind Einkommen zwischen<br />
50 und 75 % des so genannten Durchschnittseinkommens.<br />
2,5 Mio. Menschen, auch Vollzeitbeschäftigte, verdienen<br />
sogar unter 50 % des Durchschnittseinkommens und haben<br />
somit schon Einkommen unterhalb der Armutsgrenze, denn<br />
die Armutsgrenze beginnt bei 50 %. Ein Großteil dieser<br />
Beschäftigten sind Frauen. Das heißt, dieser Antrag ist wirklich<br />
in unserem ureigensten Interesse.<br />
39
40<br />
Margret hat schon alles gesagt, warum also soll ich das<br />
noch groß ergänzen. Aber noch mal aus der Sicht der NGG:<br />
Wir organisieren die unterschiedlichsten Bereiche. Wir sind<br />
hier in einem völlig neuen Hotel. Ihr habt sicherlich gestern<br />
Abend gemerkt, wir sind hervorragend betreut worden. Es<br />
war sehr viel Personal hier im Saal. Aber habt ihr auch mal<br />
gefragt, ob sie Beschäftigte dieses Hauses sind? Habt ihr<br />
gefragt, was sie verdienen? Ich denke, dann sagt das<br />
Thema schon alles. Das ist die Realität, mit der wir zu tun<br />
haben, dass wir auf der einen Seite immer öfter fragen, sind<br />
es eigentlich noch Beschäftigte, wann haben wir es mit outgesourcten<br />
Abteilungen zu tun? Ein Haus wie dieses wird<br />
wahrscheinlich gar nicht viel mehr als 100, 150 Stammbeschäftigte<br />
haben. Das ist eben unser Problem.<br />
Viel häufiger haben wir das Problem, dass wir für Mitglieder,<br />
die Tariflöhne nach dem Tarifvertrag einklagen und<br />
dann vor dem Arbeitsgericht erfahren, dass der Arbeitgeber<br />
schon lange nicht mehr Mitglied im Arbeitgeberverband ist.<br />
Das heißt, es entsteht gar keine Tarifbindung und wir können<br />
nicht einmal mehr die Tariflöhne einklagen. Mit einem<br />
gesetzlichen Mindestlohn hätten wir hier diese Auffanglinie,<br />
die wir wirklich dringend brauchen.<br />
Oder in der privaten Hauswirtschaft sind auch Arbeitgeber,<br />
häufig die berühmt-berüchtigte Putzhilfe. Da schließen wir<br />
Tarifverträge ab. Die meisten Kolleginnen werden schwarz<br />
beschäftigt. Und wenn sie dann mal zu uns kommen,<br />
haben wir ganz häufig das Problem, dass der Arbeitgeberhaushalt<br />
– häufig Menschen wie du und ich – eben nicht<br />
im Deutschen Hausfrauenbund organisiert ist und wir keinen<br />
Tariflohn einklagen können, obwohl es einen gibt.<br />
Liebe Kolleginnen von der BCE, da nützt uns auch die Allgemeinverbindlichkeit<br />
nicht. Das haben meine Vorgängerinnen<br />
alle leidlich versucht. Wir sind alle kläglich gescheitert.<br />
Wir können einfach die Voraussetzungen nicht erfüllen, das<br />
heißt, in diesem Fall der Deutsche Hausfrauenbund. Wir<br />
kriegen die Allgemeinverbindlichkeit nicht. Wir kriegen sie<br />
auch schon lange nicht mehr für das Hotel- und Gaststättengewerbe.<br />
Da bin ich selber leidgeprüft. In Niedersachsen<br />
haben wir es gerade noch mal durchgekriegt, aber in allen<br />
anderen Bundesländern sind wir damit gescheitert. Von<br />
daher, Kolleginnen, haben wir gar keine Alternative zu<br />
einem gesetzlichen Mindestlohn, zumindest in der heutigen<br />
Situation.<br />
Noch etwas: Menschen, die zu wenig verdienen, haben<br />
auch keine Kaufkraft. Die können die Binnennachfrage nicht<br />
ankurbeln. Menschen, die zu wenig verdienen, zahlen in<br />
der Regel keine oder nur ganz geringe Steuern. Die können<br />
auch die Haushaltslöcher nicht stopfen helfen. Und sie zahlen<br />
ganz geringe Sozialversicherungsbeiträge. Das bedeutet,<br />
entweder keine Leistung, keine Ansprüche aus der Sozialversicherung,<br />
oder aber später Armut im Alter, weil die<br />
Rente kläglich gering ist. Insofern haben wir uns in der<br />
NGG entschieden. Wir werden dem Abänderungsantrag<br />
zustimmen. Ich bitte euch ganz herzlich, macht das auch.<br />
Dankeschön.<br />
Konferenzleitung:<br />
Liebe Kolleginnen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen<br />
vor. Wir kommen deshalb zur Abstimmung. Wer für die<br />
Empfehlung der Antragskommission – Annahme des Änderungsantrags<br />
zu B 002 in der abgeänderten Fassung –<br />
stimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.<br />
Danke. Gibt es Gegenstimmen? Das sind neun Gegenstimmen.<br />
Gibt es Enthaltungen? Dann ist der Antrag mit großer<br />
Mehrheit angenommen.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag B 006, „Kampagne gegen<br />
Niedriglohn“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Auch diesen Antrag haben wir nicht sinngemäß verändert,<br />
sondern wir haben die Beschlussteile und die Begründungsteile<br />
getrennt, und empfehlen die Annahme dieses Antrags<br />
mit den entsprechenden Änderungen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort. Das ist nicht der Fall.<br />
Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer für die<br />
Empfehlung der Antragskommission stimmen möchte, bitte<br />
ich jetzt ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen?<br />
Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen.<br />
Wir kommen zum Antrag<br />
B 007: „Abschaffung des Ehegattensplittings<br />
und der Lohnsteuerklasse V<br />
sowie Einführung einer geschlechtergerechten<br />
Individualbesteuerung“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Ich möchte euch zu Beginn eine Stelle des <strong>DGB</strong>-Grundsatzprogramms<br />
vorlesen. Seite 19 steht: „Außerdem begünstigt<br />
das Steuersystem das veraltete Modell eines Familienernährers.<br />
Gewerkschaften setzen sich für die Individualbesteuerung<br />
der Einkommen ein. Die Steuervorteile des Ehegattensplittings<br />
müssen begrenzt und schrittweise zugunsten
eines Familienlastenausgleichs abgeschafft werden.“ Es<br />
gibt auch noch einen Beschluss. Den lese ich jetzt nicht vor,<br />
weil ich finde, der Satz reicht. Insofern behaupten wir, dieser<br />
Antrag hat sich durch die Beschlusslage erledigt.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin dazu das Wort? Das ist nicht<br />
der Fall. Wortmeldungen liegen mir ebenfalls nicht vor.<br />
Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der Empfehlung<br />
der Antragskommission zustimmen möchte, den bitte ich<br />
jetzt ums Kartenzeichen. Enthaltungen? Neinstimmen? Bei<br />
sechs Enthaltungen ist diese Empfehlung so beschlossen.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag B 008: „Individuelle Besteuerung“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Ich habe den Satz gerade vorgelesen. Der beinhaltete auch<br />
die individuelle Besteuerung. Deswegen finden wir, auch<br />
dieser Antrag hat sich erledigt durch Beschlusslage.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort? Das ist nicht der Fall.<br />
Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer für die<br />
Empfehlung ist, den bitte ich ums Kartenzeichen. Gegenstimmen?<br />
Enthaltungen? Sechs Enthaltungen.<br />
Wir kommen jetzt zum<br />
Initiativantrag Nr. 3: „Keine Verschlechterung<br />
der Besteuerung von Abfindungen“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Empfehlung ist kurz und schlicht: Wir empfehlen<br />
Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin noch das Wort? Das ist nicht<br />
der Fall. Wortmeldungen liegen ebenfalls nicht vor. Wir<br />
kommen zur Abstimmung des Initiativantrages Nr. 3 mit der<br />
Empfehlung Annahme. Wer dafür stimmen möchte, den<br />
bitte ich ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen?<br />
Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Antrag einstimmig<br />
beschlossen.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag B 009: „Gegen die Einführung von<br />
Studiengebühren“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Hier haben wir darauf verzichtet, euch ein neues Papier vorzulegen,<br />
aber wir müssen unsere Beschlussempfehlung<br />
ändern. Den Antrag, auf den wir uns bezogen haben, der<br />
unter Nr. 82 beim <strong>DGB</strong>-Bundeskongress beschlossen wurde,<br />
bezieht sich ausschließlich auf die Erstsemester, so dass wir<br />
jetzt nicht einfach sagen können, dass dieser Antrag durch<br />
die Beschlusslage erledigt wurde. Da wir natürlich durch<br />
unsere ursprüngliche Empfehlung nicht mehr genau die<br />
Worte in dem Antrag überprüft haben, müssen wir jetzt<br />
natürlich auch noch streichen, und zwar erste, zweite Zeile:<br />
wie auch der <strong>DGB</strong>-Bezirksvorstand Hessen-Thüringen. Das<br />
muss gestrichen werden. Dann wird aus dem haben ein<br />
hat. Wir finden, es ist nur eine redaktionelle Änderung und<br />
ändern unsere Empfehlung in Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Ist das allen klar geworden oder gibt es noch Nachfragen?<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort? Weitere Wortmeldungen<br />
liegen ebenfalls nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung<br />
über den Antrag B 009 mit einer Änderung und<br />
geänderter Empfehlung, nämlich Annahme des Antrags.<br />
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen.<br />
Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist dieser<br />
Antrag so einstimmig angenommen.<br />
Wir sind gut in der Zeit und können noch den Block C vor<br />
der Kaffeepause bearbeiten. Da wird mich Hannelore Buls<br />
als Sprecherin der ABK unterstützen.<br />
Wir haben den ersten<br />
Antrag C 001: „Wirtschaftspolitik“<br />
Hierzu hat die Sprecherin der Antragskommission das Wort.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission –<br />
Hannelore Buls, ver.di, Del.Nr. 0071/01:<br />
Die Antragskommission hat drei Anträge als Material an<br />
den Bundesfrauenausschuss des <strong>DGB</strong> verwiesen, um daraus<br />
ein frauenpolitisches Programm zu erstellen. Dieser Antrag<br />
C 001 gehört dazu.<br />
Konferenzleitung:<br />
Es hat das Wort die Antragstellerin Monika Brandl.<br />
41
42<br />
Monika Brandl – ver.di, Del.Nr. 0064/01:<br />
Liebe Kolleginnen, ich möchte darum bitten, dass die Empfehlung<br />
der Antragsberatungskommission als Annahme<br />
Material geändert wird in Annahme.<br />
Warum wollen wir das? Wir sind der Meinung, dass aufgrund<br />
der aktuellen politischen Verhältnisse – sprich, der<br />
Koalitionsvertrag ist beschlossen – es ganz wichtig ist, dass<br />
dieser Antrag nicht auf die lange Bank geschoben wird,<br />
sondern dass wir den jetzt annehmen. Der Koalitionsvertrag<br />
heißt für uns: Verschlechterungen, Verschlechterungen. Von<br />
daher müssen wir jetzt entgegensetzen: Wir brauchen eine<br />
feministische Neuausrichtung von Wirtschaft und Beschäftigung.<br />
Und wir brauchen auch eine entsprechende Antiarmutsdiskussion<br />
und eine Antiarmutspolitik und nicht eine<br />
Armutspolitik. Unter den konkreten Handlungsebenen steht<br />
genau, was wir wollen, und das jetzt und nicht erst in<br />
einem Programm. Wir brauchen nicht – so wie es im Koalitionsvertrag<br />
steht – eine zweijährige Probezeit. Wir brauchen<br />
keine Verschlechterung bei Hartz IV. Das ist schon<br />
schlecht genug. Und wir brauchen kein Anlegen neuer<br />
struktureller Armut, insbesondere keine Wiederkehr der<br />
Altersarmut – da sind wir dabei, die ganz stark zu bekämpfen<br />
– und nicht, dass die Armut weiblich bleibt. Von daher<br />
bitte ich euch ganz herzlich, die Empfehlung Annahme des<br />
Antrags. Ich denke, es wäre auch eine erste Positionierung<br />
aus der <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz heraus, zu sagen,<br />
nein, das unterstützen wir nicht. Von daher bitte ich euch<br />
um Annahme des Antrags. Danke.<br />
Konferenzleitung:<br />
Weitere Wortmeldungen liegen mir dazu nicht vor. Damit<br />
kommen wir zur Abstimmung über die Empfehlung der Antragskommission,<br />
nämlich Annahme als Material. Wer der<br />
Empfehlung der Antragskommission zustimmen möchte,<br />
den bitte ich ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Das müssen<br />
wir auszählen lassen. Wir bitten die Mitglieder der<br />
Mandatsprüfungs- und Zählkommission sich links und<br />
rechts in den Gängen aufzustellen. Wenn ihr alle bereit<br />
seid, dann stimmen wir jetzt noch mal ab über die Empfehlung<br />
der Antragskommission, Annahme als Arbeitsmaterial.<br />
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich ums Kartenzeichen.<br />
Wer dieser Empfehlung nicht folgen will, den bitte ich jetzt<br />
ums Kartenzeichen.<br />
Wir kommen noch zu den Enthaltungen. Wer möchte sich<br />
enthalten? Ich sehe zwei Kolleginnen. Das Ergebnis: Wir<br />
haben 45 Stimmen für die Annahme der Empfehlung der<br />
ABK und 65 Neinstimmen und zwei Enthaltungen. Damit ist<br />
die Empfehlung der Antragskommission abgelehnt.<br />
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Ursprungsantrag.<br />
Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich<br />
jetzt ums Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es<br />
Enthaltungen? Bei 15 Gegenstimmen und sieben Enthaltungen<br />
ist der Antrag angenommen.<br />
Wir haben nun die Anträge C 002 und C 003 zusammengefasst<br />
zu beraten. Dazu kommt der Änderungsantrag zu<br />
C 002: „Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Ich habe es so verstanden, dass wir jetzt erst über den<br />
Änderungsantrag abstimmen und möchte den im Auftrag<br />
der Antragstellerinnen kurz erläutern. Zum einen geht es<br />
hier um eine Ergänzung im Absatz unter 1. Da soll eingefügt<br />
werden, „für Arbeitslose, die aufgrund der Partnereinkommensanrechnung<br />
aus dem Leistungsbezug ausscheiden<br />
(Nichtleistungsempfängerinnen) sowie für Frauen, die aufgrund<br />
von vorheriger Kindererziehungs- und Pflegezeiten<br />
keinen Leistungsanspruch haben, (Berufsrückkehrerinnen)<br />
ist der Zugang zu Vermittlung und Arbeitsförderung sicherzustellen,<br />
insbesondere durch Verfügbarkeit der dazu notwendigen<br />
Finanzmittel.“<br />
Dieser Ergänzungsantrag wurde deshalb gestellt, weil hier<br />
unter 1. auf die Leistungsbezieher und -bezieherinnen<br />
abgestellt wurde. Das ist hier erkennbar an den Klammern<br />
ALG I und ALG II. Es wurde nicht erwähnt, dass es auch<br />
einen nennenswert großen Personenkreis gibt, denen diese<br />
Leistungen aufgrund des nicht vorhandenen Leistungsanspruches<br />
nicht zugänglich sind. Das soll hiermit geändert<br />
werden.<br />
Es gibt eine zweite Ergänzung im Absatz 4. Hier soll eingefügt<br />
werden: „Die Verfügbarkeit darf bei Erziehung und<br />
Pflege nicht aufgehoben werden. Der Zugang zu Vermittlung<br />
und Arbeitsförderung ist auch für diese Personengruppe<br />
sicherzustellen.“ Diese Einfügung soll erfolgen, weil im<br />
Moment durch die Verfügbarkeitsprüfungen wieder für<br />
einen größer werdenden Personenkreis wieder eine Situation<br />
entsteht, wie wir sie früher auch im Bundessozialhilferecht<br />
hatten, dass nämlich Leistungen gewährt werden,<br />
ohne dass diese Personen als arbeitslos gelten. Denn der<br />
Status der Arbeitslosigkeit ist nach dem SGB III von der Verfügbarkeit<br />
abhängig. Das würde bedeuten, dass wir hier<br />
wieder dazu zurückkehren, solange die Regelungen im § 16<br />
SGB III nicht ausgeführt werden. Das bedeutet, die Verfügbarkeit<br />
der Kinderbetreuung und auch Hilfestellung zur<br />
Pflege.
Es hätte weiterhin den Effekt, dass Frauen, die nicht Leistungsempfängerinnen<br />
sind und sich arbeitslos melden wollen,<br />
wenn ihnen diese Verfügbarkeit aberkannt wird, auch<br />
nicht mehr ihre Rentenansprüche weiterschreiben können.<br />
Deswegen soll hier diese Einfügung erfolgen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Für die Antragstellerin hat jetzt Ute Maier mit der Delegiertennummer<br />
063 das Wort.<br />
Ute Maier – ver.di, Del.Nr. 0063/01:<br />
Liebe Frauen, ich bitte euch im Namen der ver.di-Frauen<br />
dem Änderungsantrag zuzustimmen. Die Begründung ist ja<br />
geliefert worden. Wir bitten euch aber anderseits den<br />
Antrag C 002, den ursprünglichen Antrag, nicht anzunehmen<br />
vor dem Hintergrund, dass im Punkt 3 im ursprünglichen<br />
Antrag stand: „Die Anrechnung von Partnerfamilieneinkommen<br />
und Haushaltseinkommen ist aufzuheben.“<br />
Jetzt stand da nur noch: „... insbesondere die verschärfte<br />
Anrechnung...“ Ursula hat ausgeführt, dass die verschärfte<br />
Anrechnung mittlerweile eine Forderung ist. Aber wir Frauen<br />
waren immer im Rahmen unserer Frauenpolitik dafür, für<br />
Frauen eine eigenständige individuelle Existenzgrundlage zu<br />
sichern. Das sollte hier auch im Rahmen der Hartz-Gesetze<br />
entsprechend gewährleistet werden.<br />
Deshalb bitten wir euch, die Änderung in der Ziffer 3 nicht<br />
mit anzunehmen, insgesamt also den Antrag anzunehmen,<br />
ohne die Ziffer 3, sondern dort den Ursprungsantrag zu<br />
gewährleisten, damit wir Frauen auch unerhört sind, so wie<br />
wir das auf unserer Delegiertentagung haben, damit wir<br />
unsere eigenständige Existenzsicherung – auch mit unseren<br />
langjährigen Beschlüssen, die wir dazu haben – weiter<br />
festigen und untermauern.<br />
Claudia Chirizzi – ver.di, Del.Nr. 0114/01:<br />
Ich möchte nicht zur Verwirrung beitragen. Wir bitten darum,<br />
die Empfehlung der Antragskommission abzulehnen<br />
und den Antrag in seiner Ursprungsfassung anzunehmen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Noch mal zur Debatte. Wir diskutieren gerade über mehrere<br />
Anträge. Das muss von Anfang an klar sein. Abgestimmt<br />
wird separat. Da aber die einzelnen Anträge miteinander<br />
verquickt sind, wir entweder Änderungsanträge zu einem<br />
Antrag haben oder aber mit der Empfehlung entsprechende<br />
Auswirkungen haben, werden sie gemeinsam diskutiert.<br />
Das sieht das Regularium so vor. Bei der Abstimmung kommen<br />
wir dann zu getrennten Abstimmungen.<br />
Die Empfehlung der Antragskommission lautet: Annahme<br />
des Änderungsantrages zu C 002, der euch vorliegt, heute<br />
Morgen ausgeteilt. Die Empfehlung der Antragskommission<br />
zu C 002 lautet: Annahme mit Änderungen, dann auch mit<br />
der eingefügten Formulierung, die bereits mit dem Änderungsantrag<br />
ggf. beschlossen wurden. Die Empfehlung der<br />
Antragskommission zu C 003 lautet: Erledigt durch Annahme<br />
des Antrages C 002. Das ist der Hintergrund, warum die<br />
Anträge gemeinsam diskutiert werden müssen, sonst würden<br />
sie sich ggf. bereits erledigt haben, bevor sich eine Kollegin<br />
dazu zu Wort melden kann.<br />
Mir liegen im Moment keine weiteren Wortmeldungen vor.<br />
Wir kommen deshalb zur Abstimmung über den Änderungsantrag<br />
zu C 002. Die Empfehlung der Antragskommission,<br />
die Hannelore vorhin noch einmal begründet hat, lautet:<br />
Annahme. Wer dieser Empfehlung zustimmen möchte,<br />
den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen?<br />
Enthaltungen? Bei einigen wenigen Enthaltungen ist<br />
dieser Änderungsantrag angenommen.<br />
Noch mal der Hinweis, wir haben jetzt nur über den vorliegenden<br />
Änderungsantrag abgestimmt. Das ist der Änderungsantrag<br />
zu dem Antrag C 002. Dieser Änderungsantrag,<br />
der heute Morgen auf euren Tischen lag, ist jetzt<br />
angenommen. Antragsteller waren die ver.di-Frauen. Das<br />
war nur noch mal zur Erläuterung, weil ich einige komische<br />
Gesichter sehe.<br />
Jetzt kommen wir zum Antrag C 002, bisher haben wir<br />
lediglich über den Änderungsantrag abgestimmt.<br />
Also, noch mal zu den Regularien: Der Antrag C 002 steht<br />
jetzt zum Aufruf an. Beschlossen haben wir bisher lediglich<br />
zwei Einfügungen, eine im Absatz 1 und eine im Absatz 4.<br />
Denn die Empfehlung der Antragskommission hatte keinen<br />
anderen Charakter, als lediglich die Annahme des vorliegenden<br />
Änderungsantrags, der nur zwei kleine Kapitel ergänzt<br />
bzw. Einfügungen vorgenommen hat.<br />
Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Antrag C 002.<br />
Dort sind bereits zwei Änderungen beschlossen worden.<br />
Und die Antragskommission empfiehlt darüber hinaus weitere<br />
Änderungen, wie ihr sie rechts ausgedruckt neben dem<br />
Ursprungsantrag findet. Dazu hat jetzt die Sprecherin der<br />
Antragskommission noch mal das Wort.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Wir sind uns im Moment etwas uneinig. Da muss gerade<br />
noch eine Beratung stattfinden.<br />
Konferenzleitung:<br />
O.k., dann sind wir sowieso bei der ursprünglichen Pausenzeit<br />
angelangt. Das ist wunderbar. Ich schlage also vor, dass<br />
wir jetzt die halbe Stunde Pause machen und danach ggf.<br />
43
44<br />
mit einer geänderten Empfehlung der Antragskommission<br />
oder was auch immer weitermachen.<br />
Jetzt habe ich einen Antrag zur Geschäftsordnung vorliegen.<br />
Irmgard Eifel – ver.di, Del.Nr. 0103/01:<br />
Diese Anträge sind aufgerufen und es ist für mich schlechterdings<br />
unmöglich, dass wir jetzt eine Pause machen und<br />
die aufgerufenen Anträge einfach in der Schwebe hängen<br />
lassen. Ich denke, die sind zur Abstimmung aufgerufen und<br />
jetzt müssen wir abstimmen. Das ist meine Meinung.<br />
Konferenzleitung:<br />
Gibt es dazu Gegenrede?<br />
Monika Brandl – ver.di, Del.Nr. 0064/01:<br />
Ich spreche dagegen, denn die Antragskommission braucht<br />
eine Auszeit, um sich zu beraten. Von daher beantrage ich<br />
eine Pause.<br />
Konferenzleitung:<br />
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag.<br />
Wer für den Antrag ist, die Anträge<br />
jetzt weiter zu beraten und nicht erst nach der Pause, den<br />
bitte ich jetzt ums Kartenzeichen. Das ist eine Ja-Stimme.<br />
Gegenstimmen? Das ist die deutliche Mehrheit. Deshalb<br />
gehen wir jetzt in die Kaffeepause, die um Punkt 11.00 Uhr<br />
endet.<br />
Kolleginnen, nutzt bitte die Pause, zum Zimmer Auschecken<br />
und außerdem gibt es drüben auch noch einen kleinen<br />
Stand, wo vom Sozialforum T-Shirts und einige andere<br />
Dinge angeboten werden. Es wäre schön, wenn die eine<br />
oder andere von euch sich darauf noch besinnen würde.<br />
Und die Kollegin, die für eine Schule in Afghanistan und für<br />
Bildung für Mädchen in Afghanistan etwas tun will, steht<br />
hier in der Mitte und würde gerne ihre CD’s loswerden.<br />
Da drüben gibt es auch noch den Aushang für die Kolleginnen<br />
von Gate Gourmet. Es wäre schön, wenn ihr das große<br />
Plakat unterschreiben würdet und auch noch eine kleine<br />
Spende dazu tun würdet, damit die Kolleginnen in ihrem<br />
Streik weiter unterstützt werden. Dankeschön.<br />
Kaffeepause<br />
(Anmerkung der Redaktion: erneute Störung beim Protokollmitschnitt,<br />
somit wurden die Diskussionsbeiträge nicht<br />
erfasst. Die Entscheidungen der Konferenz über die Anträge<br />
wurden mitgeschrieben)<br />
Die Änderungsanträge zu C 002 wurden angenommen und<br />
der Antrag C 002 in der geänderten Fassung wurde von der<br />
Konferenz angenommen.<br />
Antrag C 003 ist durch die Annahme C002 erledigt.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Empfehlung für den Antrag C 004 lautet Annahme mit<br />
diesen Änderungen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort? Das ist nicht der Fall.<br />
Wortmeldungen liegen mir hierzu nicht vor. Wir kommen<br />
zur Abstimmung über die Empfehlung der Antragskommission.<br />
Wer dieser folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Kartenzeichen.<br />
Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann<br />
ist der Antrag einstimmig angenommen.<br />
Hannelore, vielen Dank. Das war auch der letzte Antrag<br />
zum Block C, den ich beraten habe. Ich gebe jetzt weiter an<br />
meine Kollegin Birgit Pitsch.<br />
Konferenzleitung – Birgit Pitsch, NGG, Del.Nr.<br />
0052/01:<br />
Danke, Ellen. Ich rufe jetzt den Antragsblock D auf. Die<br />
Sprecherin der Antragskommission ist Martina Schulte. Ich<br />
rufe auf den Antrag D 001: „Arbeitszeit“.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission – Martina<br />
Schulte, NGG, Del.Nr. 0050/01:<br />
Liebe Kolleginnen, hier empfiehlt die Antragsberatungskommission:<br />
Annahme des Antrags.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke, Martina. Wünscht die Antragstellerin das Wort? Das<br />
ist nicht der Fall. Wortmeldungen liegen hier auch nicht vor.<br />
Wir kommen zur Abstimmung. Wer für die Empfehlung ist,<br />
den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenprobe,<br />
wer ist dagegen? Danke. Wer enthält sich? Damit ist der<br />
Antrag einstimmig angenommen.<br />
Wir kommen zu Antrag<br />
D 002: „Arbeitszeit“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Darüber brauchen wir eigentlich nicht mehr abstimmen,<br />
denn hier lautet unsere Empfehlung ja Annahme als Material<br />
zu D 001, was mit der Annahme des Antrags D 001 ja<br />
schon erledigt ist.
Konferenzleitung:<br />
Das war mein Fehler. Ich hätte sie zusammen aufrufen müssen.<br />
Wir korrigieren das jetzt dadurch, dass wir die Empfehlung<br />
der ABK noch mal hier bestätigen. Also, wer ist für die<br />
Empfehlung der ABK? Dankeschön. Gegenprobe? Wer enthält<br />
sich? Damit ist diese Empfehlung auch einstimmig<br />
angenommen. Dankeschön.<br />
Zum Antrag<br />
D 003: „Gesundheitsschutz und Arbeitszeit“<br />
Martina, du hast das Wort.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Auch hier empfiehlt die Antragsberatungskommission<br />
Annahme des Antrages.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort? Das ist nicht der Fall.<br />
Hier liegen keine Wortmeldungen vor. Kommen wir also<br />
auch hier zur Abstimmung. Wer für die Annahme ist, den<br />
bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenprobe? Enthaltungen?<br />
Beides nicht der Fall, somit einstimmig angenommen.<br />
Ich rufe dann den<br />
Antrag D 004 auf, „Verschlechterung des<br />
Ladenschlussgesetzes“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Empfehlung der Antragsberatungskommission lautet<br />
hier: Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss.<br />
Konferenzleitung:<br />
Es ist eine Wortmeldung eingegangen. Sprichst du für die<br />
Antragstellerin? Wünscht die Antragstellerin das Wort? Das<br />
ist nicht der Fall. Dann hat jetzt Gisberta Pirner das Wort.<br />
Gisberta Pirner – ver.di, Del.Nr. 0083/01:<br />
Liebe Kolleginnen, zu dem Antrag möchte ich uns aktuelle<br />
Informationen mit auf den Weg geben. Wie ihr wisst, macht<br />
die Begehrlichkeit der Deregulierer auch vor den Samstagen<br />
nicht Halt. Wir möchten euch deshalb bitten, auf die anstehenden<br />
Aktionen des ver.di-Bereichs Handel aufmerksam zu<br />
machen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Unser Ziel ist, dass<br />
zu den jetzt schon möglichen vier öffnungsfreien Sonntagen<br />
im Jahr keine weiteren mehr hinzukommen. Da sind wir uns<br />
sicher einig. Dafür danke ich euch, danke.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke Kollegin. Weitere Wortmeldungen?<br />
Marita Eilrich – Del.Nr. 0015/02:<br />
Als Antragstellerin für diesen Antrag glaube ich nicht, dass<br />
wir ihn ablehnen sollten, wenn ich mir vor Augen halte,<br />
dass allein in Frankfurt jetzt der 1. Adventssonntag offen<br />
ist, die Kirchen protestieren, die Gewerkschaften protestieren,<br />
und uns im Zuge der Fußballweltmeisterschaft nächstes<br />
Jahr ganze Wochen mit Rund-um-die-Uhr-Ladenöffnungszeiten<br />
drohen, denke ich schon, wäre es gerechtfertigt, diesen<br />
Antrag – entgegen der Empfehlung der Antragsberatungskommission<br />
– anzunehmen. Danke.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der<br />
Fall. Dann noch mal zur Klarstellung: Die Antragsberatungskommission<br />
hat nicht Ablehnung empfohlen, sondern<br />
Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss.<br />
Über diese Empfehlung stimmen wir jetzt ab. Wer für die<br />
Empfehlung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke.<br />
Gegenprobe? Dankeschön. Enthaltungen? Keine Enthaltung<br />
und 17 Neinstimmen, damit ist die Empfehlung der<br />
Antragsberatungskommission angenommen. Danke.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag D 005: „Verschlechterung der<br />
Arbeitsbedingungen von Frauen durch<br />
Veränderungen des Arbeitsrechts verhindern“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Empfehlung der Antragsberatungskommission lautet:<br />
Annahme des Antrages.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke. Wird das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall.<br />
Wortmeldungen liegen hier auch nicht vor. Wir kommen zur<br />
Abstimmung. Wer für die Empfehlung ist, den bitte ich um<br />
das Kartenzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Enthaltungen?<br />
Somit einstimmig angenommen.<br />
Jetzt rufe ich erst mal den Initiativantrag Nr. 4 auf, „Keine<br />
Verschlechterung des Kündigungsschutzes“.<br />
45
46<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Antragsberatungskommission empfiehlt Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann<br />
kommen wir zur Abstimmung. Wer für die Empfehlung ist,<br />
den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer ist<br />
dagegen? Enthaltungen? Somit einstimmig angenommen.<br />
Jetzt rufe ich gemeinsam die Anträge D 006 und D 007 auf.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Beim Antrag D 006 empfiehlt die Antragsberatungskommission<br />
Annahme und bei dem Antrag D 007 lautet unsere<br />
Empfehlung: Material zu Antrag D 006.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke Martina. Für die Antragstellerinnen wird jetzt Isolde<br />
Ries sprechen.<br />
Isolde Ries (Gastteilnehmerin NGG):<br />
Ich rede jetzt zum Antrag, der zur Annahme empfohlen ist,<br />
weil sich eine neue Entwicklung aufgetan hat. Michael<br />
Sommer hat vorgestern gesagt, dass er Briefe unterschrieben<br />
hat, weil sich in der EU was getan hat. Das hat sich<br />
bezogen auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie. Wir hatten es<br />
geschafft – gerade NGG war da federführend, in dem wir<br />
die Zustände in der Fleischwarenindustrie durch die osteuropäischen<br />
Arbeiter deutlich machen konnten – die Regierung<br />
dazu zu bewegen, diese Dienstleistungsrichtlinie abzulehnen,<br />
vor allem das Herkunftslandprinzip rauszuholen.<br />
Evelyn Gebhard, die Sprecherin des Binnenmarktausschusses<br />
hat auch einen Vorschlag vorgelegt, der hätte voll<br />
unterstützt werden können. Jetzt haben vorgestern EVP<br />
und die Liberalen diesen Vorschlag gekippt und einen<br />
marktgängigen Vorschlag vorgelegt. Das heißt, das Herkunftslandprinzip<br />
soll in der Regel gelten.<br />
Wir haben nichts gegen Markt und Wettbewerb. Jeder<br />
Dienstleister soll auch in jedem EU-Land tätig werden können,<br />
aber bitteschön immer nach dem Arbeitsortprinzip. Wir<br />
müssen dafür kämpfen, dass Gewerkschaftsrechte, Tarifautonomie,<br />
Sozial- und Arbeitsrecht von uns und von jedem<br />
einzelnen Land erhalten bleibt. Jetzt besteht die große<br />
Gefahr, dass durch diese Stärkung der Konservativen das<br />
von uns fast nicht mehr abgewendet werden kann. Im<br />
Oktober sollte ursprünglich eine Großkundgebung in Brüssel<br />
stattfinden. Die hat man verschoben. Jetzt findet sie am<br />
14. Januar statt. Ich kann nur jetzt schon mal aufrufen,<br />
dass sich alle an dieser Aktion beteiligen. Das geht an die<br />
Substanz der Gewerkschaften, wenn das durchkommt.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke Isolde. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht<br />
der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die<br />
Empfehlung der Antragsberatungskommission. Wer für die<br />
Empfehlung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke.<br />
Gegenprobe, wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen?<br />
Auch niemand, somit ist die Empfehlung einstimmig<br />
angenommen. Die Anträge D 006 und D 007 sind damit<br />
erledigt.<br />
Das war dann auch der Part von Martina, herzlichen Dank.<br />
Wir kommen jetzt zum nächsten Block „<strong>Sozialstaat</strong> und<br />
soziale <strong>Sicherung</strong>“. Für die Antragsberatungskommission<br />
spricht jetzt Irene Merklein-Lempp.<br />
Ich rufe den Antrag auf:<br />
E 001: „<strong>Sozialstaat</strong>sdiskussion“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission –<br />
Irene Merklein-Lempp, IG BAU, Del.Nr. 0001/01:<br />
Die Empfehlung der Antragsberatungskommission lautet:<br />
Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss,<br />
ähnlich wie Antrag A 002 beschlossen wurde. Wir sehen<br />
diese beiden Anträge im Zusammenhang.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke, Irene. Wünscht die Antragstellerin das Wort? Das ist<br />
nicht der Fall. Weitere Wortmeldungen liegen auch nicht<br />
vor, wir können also gleich zur Abstimmung kommen. Wer<br />
für die Empfehlung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen.<br />
Danke. Wer spricht dagegen? Niemand. Enthaltung? Auch<br />
keine, einstimmig angenommen. Dankeschön.<br />
Wir kommen zu den Anträgen E 002 und E 003, die ich<br />
zusammen aufrufe.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Antragsberatungskommission empfiehlt die Annahme<br />
des Antrags E 002. Damit erledigt sich der Antrag E 003,<br />
der fast wortgleich ist.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der<br />
Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für die Annahme<br />
der Empfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält<br />
sich? Dann ist auch diese Empfehlung einstimmig angenommen.<br />
Danke.
Wir kommen zum Antrag<br />
E 004: „Gleichstellung aller Mütter bei der<br />
Anrechnung der Erziehungszeiten für die<br />
Rente“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Empfehlung der Antragsberatungskommission lautet:<br />
Dieser Antrag ist durch die Beschlusslage der <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz<br />
von 2001 erledigt.<br />
Konferenzleitung:<br />
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur<br />
Abstimmung. Wer für die Empfehlung ist, den bitte ich um<br />
das Kartenzeichen. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand.<br />
Wer enthält sich? Bei einer Enthaltung ist die Empfehlung<br />
somit angenommen. Danke.<br />
Die nächsten Anträge werden wieder zusammen aufgerufen.<br />
Es geht um<br />
E 005: „Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis<br />
für Migrantinnen für die Dauer von<br />
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten“,<br />
und E 006: gleichlautend.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Empfehlung der Antragsberatungskommission lautet:<br />
Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke. Die Antragstellerin möchte sich dazu äußern. Irene,<br />
du hast jetzt das Wort als Antragstellerin.<br />
Irene Merklein-Lempp – IG BAU, Del.Nr. 0001/01:<br />
Ich wollte nur noch mal an ein paar wenigen Beispielen<br />
verdeutlichen, welche Zustände in diesem Bereich herrschen<br />
und was uns dazu gebracht hat, diesen Antrag zu<br />
stellen.<br />
Ein Beispiel ist, dass im Bereich der Agrarwirtschaft im Gartenbau<br />
Erntehelfer aus überwiegend osteuropäischen Staaten<br />
eingesetzt werden, die für sechs oder acht Wochen angeheuert<br />
werden, und wo von vornherein für den Arbeitgeber<br />
klar ist, dass er die letzten zwei Wochen oder die letzte<br />
Woche nicht mehr bezahlt. Es ist also gang und gäbe, dass<br />
die Leute für sechs Wochen angeheuert werden, die ersten<br />
vier Wochen bezahlt und die letzten zwei Wochen nicht<br />
bezahlt bekommen.<br />
Ein zweites Beispiel ist, dass sich Arbeitgeber durch Selbstanzeige<br />
dem entziehen, ihre illegalen Beschäftigten überhaupt<br />
bezahlen zu müssen. Durch die Selbstanzeige werden<br />
diese illegalen Beschäftigten sofort nach Hause geschickt.<br />
Die Bezahlung können sie nicht mehr einklagen. Und wenn<br />
die Leute dann in ihren Heimatländern sitzen, haben sie<br />
hier keine Lobby, die sich für sie einsetzt. Deswegen sind<br />
wir der Meinung, dass die ein Aufenthalts- und ein Arbeitserlaubnisrecht,<br />
um den Aufenthalt überhaupt finanzieren zu<br />
können, haben müssen, um ihre Forderungen durchsetzen<br />
zu können.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke, Irene. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht<br />
der Fall. Dann stimmen wir ab. Wer ist für die Empfehlung?<br />
Dankeschön. Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer enthält<br />
sich? Danke. Damit ist der E 005 einstimmig angenommen<br />
und E 006 erledigt.<br />
Danke, Irene, für deine Arbeit. Für die Antragskommission<br />
spricht jetzt die Kollegin Petra Adolph.<br />
Ich rufe auf:<br />
Antrag E 007: „Für eine solidarische und<br />
geschlechtergerechte Bürgerversicherung“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission –<br />
Petra Adolph, IG BCE, Del.Nr. 0014/01:<br />
Hier lautet die Empfehlung der Antragsberatungskommission:<br />
Annahme in der vorliegenden Form.<br />
Konferenzleitung:<br />
Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall.<br />
Dann bitte ich um die Abstimmung. Wer ist für die Empfehlung?<br />
Danke. Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer enthält<br />
sich? Bei zwei Enthaltungen ist die Empfehlung somit<br />
angenommen.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag E 008: „Gesundheitspolitik für<br />
Frauen“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Da geht es um die Gesundheitspolitik für Frauen und insbesondere<br />
um den Gender-Gedanken in der Gesundheitspolitik.<br />
Wir haben da eine Änderung vorgenommen, die lediglich<br />
redaktioneller Art ist, also ein Teil des Antrages ist in<br />
47
48<br />
die Begründung gewandert. Wir empfehlen Annahme mit<br />
den Änderungen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke, Petra. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der<br />
Fall. Dann bitte ich um Abstimmung. Wer ist für die Empfehlung?<br />
Danke. Enthaltungen? Keine. Wer ist dagegen?<br />
Niemand. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.<br />
Danke.<br />
Ich rufe jetzt gemeinsam die Anträge E 009 und E<br />
010 auf mit dem Abänderungsantrag zu E 009 und E<br />
010, wobei wir jetzt zunächst über die Empfehlung der<br />
Antragsberatungskommission zum Abänderungsantrag<br />
abstimmen werden.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Wir haben uns beide Anträge und den Änderungsantrag<br />
vorgenommen und haben gesehen, dass es ein Extrakt ist<br />
aus dem, was in E 009 und in E 010 formuliert ist. Punkte<br />
sind dort weitgehend berücksichtig. Ich werde versuchen,<br />
das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, weil das ja<br />
relativ viel ist.<br />
Neu ist z.B., was unter 3. eingefügt ist, nämlich dieser<br />
zweite Spiegelstrich, dass ein ärztliches Attest erforderlich<br />
ist, und unter 4. der erste Spiegelstrich, nämlich die<br />
bezahlte Freistellung und auch die Verwendung angesparter<br />
Mehrarbeit sowie den Gender-Gedanken auch in der<br />
Pflege zu berücksichtigen. Was in diesem Änderungsantrag<br />
fehlt, ist das, was in E 010 beschrieben ist, nämlich die<br />
Ankündigungsfristen.<br />
Wir sind jetzt mit den Anträgen so verfahren, dass wir<br />
sagen, wir empfehlen Annahme des Änderungsantrages<br />
und sagen dann, dass das, was E 009 und in E 010<br />
beschrieben ist, praktisch als Material als Anhang an diesen<br />
Änderungsantrag angehangen wird.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke Petra. Wir haben jetzt zwei Wortmeldungen.<br />
Zunächst Kollegin Kirsten Rölke von der IG Metall als<br />
Antragstellerin zu E 009 und anschließend Anne Jenter, die<br />
zum Änderungsantrag sprechen wird.<br />
Kirsten Rölke – IG Metall, Del.Nr. 0036/01:<br />
Liebe Kolleginnen, wir wollen alles. Das sagen wir seit<br />
Jahrzehnten. Wir wollen qualifiziert lernen, wollen qualifizierte<br />
und entwicklungsfähige Arbeitsplätze. Auch das Wort<br />
Karriere sollte für uns kein Fremdwort sein – oft geschrie-<br />
ben, oft beschlossen. Wir wollen leben mit Partnern, mit<br />
Partnerinnen, mit Kindern in Familien oder in anderen Formen.<br />
Wir wollen eben selbstbestimmt leben. Und wir wollen<br />
dieses Leben auch gesellschaftlich flankieren mit sozialversicherungspflichtigen<br />
Arbeitsplätzen in allen außerhäuslichen<br />
Bereichen, nämlich für die Kinderbetreuung ab<br />
null, wie wir es gestern aus den Arbeitsgruppen gehört<br />
haben, oder auch im Pflegebereich, wie es in unserem<br />
Antrag E 009 formuliert ist. Und da Unfälle und Herzinfarkte<br />
etc. sich nicht planen lassen, ergänzt der Antrag E<br />
010 die zu schaffenden notwendigen Zeiten, um Pflege<br />
auch organisieren zu können.<br />
Kolleginnen, wir wollen eben nicht das Familienmodell, in<br />
dem die Frau für alles zuständig ist, nur nicht für sich<br />
selbst und für ihre Entwicklungsmöglichkeiten, und damit<br />
in der Falle landet. Deshalb lehnen wir den Änderungsantrag<br />
ab und bitten euch, ebenfalls diesen Änderungsantrag<br />
abzulehnen, weil wir in diesem Antrag eben auch widersprüchliche<br />
Tendenzen sehen.<br />
Es ist uns nicht ganz klar, warum unser Antrag E 009 umformuliert<br />
worden ist. Es mag sein, dass der Satz, der<br />
gleich oben zu Beginn bei uns steht, irgendwo anders<br />
schöner ist. Das ist die eine Umformulierung. Die zweite<br />
Umformulierung unten hat uns erst recht verwundert, dass<br />
nämlich der <strong>DGB</strong> in seiner Unterstützungsfunktion überhaupt<br />
nicht mehr gefragt ist, weil wir die Frage Demenzkranker<br />
ja bereits im E 009 drin hatten. Ihr habt unten<br />
gesehen unter unserer Auflistung von 1 bis 6, der <strong>DGB</strong><br />
unterstützt die Mitgliedsgewerkschaften bei der Vereinbarung<br />
tarifvertraglicher Regelungen. Gut, wir sind eine <strong>DGB</strong>-<br />
Frauenkonferenz, da ist es – glaube ich – wenig sinnvoll,<br />
solche Sachen rausfallen zu lassen. Wir sehen, dass wir mit<br />
dem E 010 ebenfalls die ganzen Möglichkeiten der Arbeitszeitregelung<br />
ordnungsgemäß auf die Reihe bringen, weil<br />
wir da ja in einer Entwicklungsgeschichte sind.<br />
Kolleginnen und Kollegen, für uns aber ganz unverständlich<br />
ist die Formulierung, dass wir oben unseren Eingangssatz<br />
zum Teil ja übernommen bekommen, wo wir sagen,<br />
wir sind gegen die Einführung einer Pflegezeit analog der<br />
Elternzeit, aber unten unter 3. dieses dann konterkarieren<br />
mit der Forderung nach gesetzlichen Regelungen für eine<br />
entsprechende Lohnersatzleistung.<br />
Kolleginnen, genau das ist aber dann die Pflegezeit. Das<br />
ist nur anders formuliert. Das finde ich dann doch etwas<br />
trickreich. Wir würden gerne unseren Antrag so durchsetzen,<br />
weil wir eben nicht in dieser Falle landen wollen. Deswegen<br />
bitte ich euch den Änderungsantrag abzulehnen<br />
und E 009 und E 010 in ihrer Ursprungsfassung anzunehmen.
Kolleginnen, wir wollen nicht ständig vom skandinavischen<br />
Modell mit seinen vielen sozialversicherungspflichtigen qualifizierten<br />
Arbeitsplätzen rund um den Menschen reden. Wir<br />
wollen es so machen. Deswegen bitte ich euch, so zu verfahren.<br />
Dankeschön.<br />
Anne Jenter – GEW, Del.Nr. 0020/01:<br />
Liebe Kolleginnen, ich spreche für den Änderungsantrag,<br />
sage aber gleich vorweg, wir haben uns aufgrund der Diskussion<br />
heute Morgen darauf geeinigt, dass wir den Änderungsantrag<br />
als Änderungsantrag zurückziehen, dass aber<br />
dieser Text als Material zu den Anträgen E 009 und 010<br />
genommen wird und an den <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss<br />
gerichtet wird. Ich möchte es jetzt auch begründen.<br />
Ich möchte nicht, dass die Diskussion heute zugemacht<br />
wird über dieses letzte Thema, was Kirsten Rölke gerade<br />
auch angeschnitten hat. Wir sind völlig mit euch der gleichen<br />
Meinung. Wir wollen nicht, dass das traditionelle<br />
Arbeitsverteilungsmodell zwischen Männern und Frauen<br />
zementiert wird. Genau deswegen brauchen wir, so wie es<br />
bei uns, wie es bei der IG Metall drin steht, die Verbesserung<br />
und den Ausbau der professionellen Pflege. Wir brauchen<br />
auch die Demenzkranken in der Pflegeversicherung<br />
drin. Das steht bei uns auch so drin und das soll auch weiterhin<br />
unterstützt werden.<br />
Jetzt komme ich zu den Arbeitszeitregelungen. Die kurzfristige<br />
Freistellung für Notfälle, das ist der eine Fall, der eintritt,<br />
ist sehr wichtig. Aber es gibt, und das wissen wir<br />
schon jetzt aus Statistiken, immer mehr Pflegefälle. Und<br />
solange wir nicht tatsächlich die professionelle Pflege ausgebaut<br />
haben, wissen wir, dass viele pflegende Angehörige<br />
es nicht leisten können, gleichzeitig berufstätig zu sein und<br />
zu pflegen. In der jetzigen Situation, wo es für die keine<br />
Schutzregelungen gibt, fliegen die ganz aus der Berufstätigkeit<br />
raus. Von den Männern weiß ich es nicht, es sind sicher<br />
auch verschwindend wenige, aber es sind derzeit 16 % der<br />
Frauen, die zwischen 40 und 64 Jahre alt, erwerbsfähig<br />
sind und unfreiwillig ganz draußen sind. Ich finde, es ist<br />
wichtig, dass wir uns darüber noch mal unterhalten. Ich<br />
halte es für notwendig, dass Gewerkschaft für die Frauen<br />
ein Schutzrecht einzieht. Ich sage auch nicht, dass die drei<br />
Jahre raus sollen, sondern da kann man sich drüber unterhalten.<br />
Deswegen steht auch Lohnersatzleistung drin. Ich<br />
denke an etwas Ähnliches wie beim Elterngeld. Da geht es<br />
um ein Jahr. Ich möchte auch deswegen, dass es eine Lohnersatzleistung<br />
ist, weil damit klar ist, dass es eine Fortdauer<br />
des Beschäftigungsverhältnisses ist und die wieder zurückkommen.<br />
In der Zeit, in der es Lohnersatzleistungen gibt,<br />
laufen auch die Sozialversicherungen alle weiter.<br />
Wir haben da offensichtlich noch Diskussionsbedarf. Ich<br />
möchte deshalb jetzt auch niemanden mit einem Änderungsantrag<br />
über den Tisch ziehen, sondern das als Material<br />
zu den vorliegenden Anträgen – an den Bundesfrauenausschuss<br />
gerichtet – nehmen. Ich denke, dann kommen<br />
wir in der Sache etwas weiter. Unser Ziel muss weiterhin<br />
sein: keine Zementierung der Geschlechterrollen. Da müssen<br />
wir weiter dran arbeiten und wir dürfen das Arbeitszeitfeld<br />
nicht anderen Kräften überlassen. Denn die CDU denkt<br />
auch über so etwas nach, aber die wollen keine Lohnersatzleistung,<br />
sondern die wollen eine Auszeit, in der dann die<br />
Pflegeleistung vergütet wird. Genau das will ich nicht.<br />
Deswegen bitte ich euch um Zustimmung in der Form, dass<br />
es Material zu den Anträgen wird und an den BfA-Frauenausschuss<br />
geht. Danke.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke, Anne. Es liegt eine weitere Wortmeldung vor.<br />
Monika Lersmacher – IG Metall, Del.Nr. 0032/01:<br />
Liebe Kolleginnen, ich finde es ganz gut, dass wir den<br />
Änderungsantrag jetzt als Material dazunehmen. Ich denke<br />
mir ganz einfach, wir müssen darüber nachdenken, was wir<br />
wirklich wollen. Wir haben im Bereich der Metall- und Elektroindustrie<br />
bei uns einen neuen Tarifvertrag zu Arbeitszeiten<br />
abgeschlossen. Bei der Frage, ob wir Langzeitkonten für<br />
Kindererziehungszeiten nutzen, haben die Arbeitgeber nein<br />
gesagt, bei der Frage Pflege haben sie ja gesagt. Das ist<br />
ganz erklärlich, weil sie so alt sind, die da auf der anderen<br />
Seite sitzen.<br />
Ich muss sagen, ich bin selber dabei immer total emotional,<br />
einfach aus eigenem Erleben. Wenn ich eine Pflegezeit in<br />
Anspruch genommen hätte, wüsste ich nicht, nachdem ich<br />
bei Kindererziehungszeiten ausgestiegen bin, in dem Fall<br />
dann auch noch mal, als ich meinen Mann gepflegt habe,<br />
wie meine Berufschancen heute aussehen würden. Von<br />
daher finde ich es gut, dass wir die Diskussion weiterführen.<br />
Und wir sollten darüber nachdenken, wenn wir solche Modelle<br />
machen, ob wir nicht wieder weiterhin in diesem traditionellen<br />
Modell denken. Ich glaube, dass die Beschäftigten<br />
in der Industrie einfach keine Chance haben, wieder<br />
zurückzukehren. Wir kennen kaum eine Kollegin, die nach<br />
der Elternzeit wirklich eine Chance hat, auf ihren Arbeitsplatz<br />
zurückzukommen. Von daher finde ich es einfach<br />
wichtig, dass wir in dem Bereich noch mal nachdenken, wo<br />
wollen wir frauenpolitisch wirklich hin. Dass es vielleicht für<br />
den Einzelfall eine Regelung geben kann und geben muss,<br />
sei dahingestellt. Dafür würde ich mich auch aussprechen,<br />
49
50<br />
aber ich denke mir, die große Masse der Kolleginnen wird<br />
keine Chance haben, wenn ich sehe, dass allein im Bereich<br />
Baden-Württemberg über 80 % der Pflegebedürftigen von<br />
Frauen in häuslicher Gemeinschaft gepflegt werden. Damit<br />
wird nur noch fest zementiert, was wir demnächst tun sollen.<br />
Die Hartz-Gesetze haben ja schon gezeigt, welcher<br />
Vater des Gedankens dahinter steckt. Man will uns in traditionelle<br />
Rollen zurück und aus dem Arbeitsmarkt drängen.<br />
Deshalb sollten wir wirklich darüber nachdenken, was wir<br />
in der Arbeitszeitpolitik wirklich wollen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke, Monika. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist<br />
nicht der Fall. Ihr seht, die Antragsberatungskommission<br />
tagt. Ich schlage vor, wir machen eine ganz kurze Pause.<br />
Frauke Gützkow – GEW, Del.Nr. 0018/01:<br />
(Störung Band-Mitschnitt)… Gerade mit der Umstrukturierung<br />
in dem Pflegebetrieb ist das in den letzten Jahren sehr<br />
viel schlechter geworden. Wir stützen diese Frauen, die ihre<br />
individuelle humane Verantwortung ihren Eltern gegenüber<br />
wahrnehmen und das nicht mit einem Ausscheiden aus<br />
dem Erwerbsleben bezahlen sollen. Aus diesem Grunde<br />
bitte ich euch, die Diskussion fortzusetzen und nicht abzubrechen,<br />
indem ihr Weiterleitung an den Bundesfrauenausschuss<br />
zustimmt.<br />
Konferenzleitung:<br />
Dankeschön. Als nächstes hat Norma Gertz das Wort, auch<br />
GEW.<br />
Norma Gertz – GEW, Del.Nr. 0016/01:<br />
Liebe Kolleginnen, ich bin seit gestern das erste Mal auf<br />
einer Bundesfrauenkonferenz, vor allem gestern in den<br />
Arbeitsgruppen, richtig spannend und konstruktiv. Jetzt bin<br />
ich gerade – wie meine Vorrednerin – eher enttäuscht, wie<br />
das hier abgewürgt wird. Gerade der Bereich Pflege ist nun<br />
mal ein Frauenbereich, ob wir es wollen oder nicht. Wir<br />
können uns eine andere Gesellschaft wünschen, im Moment<br />
ist sie aber so, es ist ein Frauenthema. Wir müssen<br />
auch den Tatsachen ins Auge sehen. Viele Frauen wollen<br />
auch zu Hause pflegen. Da können wir die professionelle<br />
Pflege anbieten, wie viel wir wollen. Ich bin selber im Moment<br />
noch im Pflegeberuf tätig und ich spreche sehr viel<br />
mit den Frauen, die ihre Angehörigen pflegen. Viele machen<br />
es freiwillig und finden es auch gut so. Ich finde, so eine<br />
wichtige Arbeit, die diese Frauen zu Hause machen, muss<br />
auch entsprechend bewertet werden. Das geht nun mal<br />
übers Geld und nicht, indem wir ihnen erzählen, sie müss-<br />
ten eigentlich eine andere Rolle einnehmen. Deswegen<br />
finde ich, wir sollten den Frauen helfen, die zu Hause tätig<br />
sind. Sie haben sich selber dafür entschieden, zu Hause in<br />
der Pflege tätig zu sein. Und wir helfen ihnen nicht, wenn<br />
wir mit ihnen über ihre Rolle diskutieren, sondern wir helfen<br />
ihnen direkt, indem wir ihnen Schutzmaßnahmen<br />
anbieten. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir noch mal<br />
weiter über den Antrag sprechen. Danke.<br />
Hanne Reich-Gerick – GEW, Del.Nr. 0022/01:<br />
Ich schließ mich natürlich meinen beiden Vorrednerinnen<br />
an, unterstütze sie auch ausdrücklich und muss hinzufügen,<br />
dass ich – in Kenntnis vieler Bekannter, die nicht im Bereich<br />
des öffentlichen Dienstes sind – die Situation sehr genau<br />
mitbekommen habe, in eigener Situation auch als Alleinerziehende,<br />
zwei Elternteile begleitet zu haben. Ich weiß, was<br />
das heißt und was das bedeutet für Kolleginnen und Kollegen,<br />
die die Arbeitssicherheit, die ich hatte als Beamtin,<br />
nicht haben.<br />
Ich finde es unglaublich, wenn wir nicht mal bereit sind, als<br />
Gewerkschafterinnen deren Probleme zu diskutieren. Das<br />
ist unverantwortlich. Ich fordere deshalb wirklich alle auf,<br />
diese Diskussion in den Bundesfrauenausschuss zu geben<br />
und dort auch weiter zu diskutieren. Wir brauchen wirklich<br />
den Schutz derjenigen, die die bisherige professionelle Pflege<br />
nicht bezahlen können, die sie vielleicht auch selber aus<br />
menschlichen Gründen übernehmen wollen. Denn ich weiß,<br />
was es heißt, die eigenen Angehörigen zu begleiten, wie<br />
wichtig das für die Angehörigen ist. Das kann keine professionelle<br />
Pflege ersetzen. Bei diesen Dingen, die auf uns alle<br />
– gerade mit dem Durchschnittalter 50 – zukommen, müssen<br />
wir als Gewerkschaft auch die menschliche Seite mit<br />
beachten, die Prozesse, die bei einer solchen Begleitung<br />
ablaufen.<br />
Deshalb bitte ich noch mal um Ablehnung des Vorschlags<br />
der Antragskommission.<br />
Konferenzleitung:<br />
Dankeschön. Wir haben noch Wortmeldungen.<br />
Ursula Engelen-Kefer:<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin erst einmal sehr<br />
froh, dass wir dieses Thema Frauen und Gesundheit und<br />
Frauen und Pflege aufgreifen, dass wir dazu detaillierte Anträge<br />
vorliegen haben und uns hier so ausführlich damit<br />
befassen. Ich glaube, das ist ein Thema, das betrifft nicht<br />
nur den Verstand, sondern das betrifft vor allem das Herz.<br />
Und viele, die hier sitzen, werden das eigene Erleben<br />
haben, wie es aussieht, gerade was die Pflegeleistungen
anbelangt. Ich selber habe eine Mutter von 90 Jahren, die<br />
bei uns im Haushalt lebt. Vor meiner Mutter haben wir<br />
meine Großmutter gehabt, die ebenfalls bis knapp 90 Jahren<br />
bei uns im Haushalt gelebt hat. Ich weiß also, was es<br />
heißt, Pflegeleistungen zu erbringen. Ich bin auch der Meinung,<br />
dass man es sich nicht leicht machen und sagen<br />
kann, das sind alles professionelle Dienste, die machen das<br />
schon, da kann man sich der Verantwortung entziehen. Das<br />
ist nicht der Fall. Emotional wird sich keiner, der ein Herz<br />
hat, dieser Verantwortung entziehen können.<br />
Aber ich weiß auch, dass Frauen – genauso wie Männer –<br />
den Anspruch haben, ihre Ansprüche an die Erwerbsarbeit<br />
erfüllen zu wollen. Ich weiß aus eigenem Erleben, wie<br />
schwer das ist. Meine Mutter hat sehr lange gearbeitet und<br />
ich versuche, dies auch zu tun, und zwar nicht nur in Teilzeit,<br />
sondern sehr engagiert. Hier kommt es darauf an,<br />
beide Bereiche einigermaßen zufriedenstellend unter einen<br />
Hut zu bringen, und zwar zufriedenstellend für die Person,<br />
die gepflegt werden soll und muss, wie auch für die Person,<br />
die pflegt.<br />
Jetzt denke ich, wenn wir die beiden Anträge angucken, die<br />
uns vorliegen, der E 009 und E 010, diese beiden Anträge<br />
enthalten beide wesentliche Themen, die wir aufgreifen<br />
müssen. Der erste Antrag enthält berechtigte Forderungen<br />
zu den Pflegeleistungen, die erbracht werden müssen, die<br />
verbessert werden müssen und Aufwandsentschädigungen<br />
für diejenigen, die die Pflegeleistungen erbringen. Das<br />
muss besser werden, überhaupt keine Frage. Ich bin auch<br />
der Meinung, wir müssen dabei versuchen, die stationäre<br />
Pflege so weit wie möglich zu reduzieren und den Menschen<br />
das Verbleiben in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen,<br />
also die ambulante Pflege entsprechend auszuweiten<br />
und die häusliche Pflege, so weit es geht, zu ermöglichen.<br />
Der Antrag E 010 enthält doch all das, was im Arbeitsverhältnis<br />
nötig ist. Ihr müsst mal reingucken. Da steht doch<br />
alles bezüglich Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit, all die nötigen<br />
Bedingungen, die in den Betrieben bei den Arbeitsbedingungen<br />
geregelt werden müssen. Man kann sagen, das<br />
reicht uns noch nicht aus, aber das heißt doch nicht, wenn<br />
wir hier einen solchen Antrag verabschieden, dass damit<br />
ein- für allemal keine weitere Diskussion erfolgt. Das ist<br />
doch der Beginn. Wir sind doch noch nicht am Ende, wir<br />
sind doch hier am Beginn und wir werden dies natürlich<br />
weiter diskutieren.<br />
Nach der Debatte, die wir hier heute hatten, werde ich das<br />
auch zu meinem ganz persönlichen Anliegen machen,<br />
meine Verantwortung wahrnehmen, so dass wir dies zu<br />
einem ganz besonderen Feld der Weiterbearbeitung im<br />
<strong>DGB</strong> und natürlich auch im Bundesfrauenausschuss<br />
machen. Das ist doch nicht so, dass die Diskussion hier auf<br />
einmal damit abgeschnitten ist und wir uns überhaupt<br />
nicht mehr mit diesen Fragen beschäftigen.<br />
Nur ich habe ein Problem. Dieses Problem lautet: Ich möchte<br />
nicht, dass in Zukunft Frauen im Grunde genommen in<br />
die Leistungen der Erziehungen und Pflege abgedrängt<br />
werden. Ich möchte hier nicht provozieren, aber ich habe<br />
selber zwei Kinder. Ich hatte meine Großmutter, ich habe<br />
meine Mutter und ich habe eine volle Erwerbstätigkeit. Ich<br />
weiß also, wovon ich rede. Wenn ich nicht in der Lage<br />
wäre, hier einigermaßen gut durchzukommen, dann müsste<br />
ich erst mal meine beiden Kinder erziehen, das wären ja<br />
schon mal 16 bis 17 Jahre. Dann müsste ich meine Großmutter<br />
pflegen, meine Mutter pflegen und dazwischen<br />
auch noch meine Schwiegereltern. Das ist nicht immer so,<br />
aber wir müssen deutlich machen, dass das nicht die Richtung<br />
ist, die hier die Bundesfrauenkonferenz auf die Schiene<br />
bringen will. Das ist die Aufgabe der Bundesfrauenkonferenz.<br />
Das können wir nicht als Material an irgendjemanden<br />
geben. Wir müssen ganz klar sagen: Wir wollen die<br />
Vereinbarkeit, so dass die Frauen das in Zukunft auch mit<br />
ihrem Gewissen, mit ihrem Herzen vereinbaren können,<br />
ohne die Leidtragenden bei ihrer beruflichen Tätigkeit zu<br />
sein.<br />
Wir müssen noch ein Weiteres sehen: Geld ist nicht beliebig<br />
vermehrbar. Wenn wir hier für die vielfältigen Pflegeleistungen<br />
Lohnersatzleistungen verlangen, müssen wir davon<br />
ausgehen, dass dieses Geld an anderer Stelle nicht mehr<br />
zur Verfügung steht. Wir brauchen aber mehr Geld für bessere<br />
Pflegeleistungen, für bessere Entschädigungen der<br />
pflegenden Personen und für bessere Vereinbarkeit von<br />
Beruf und Familie und für bessere ambulante Pflegedienste<br />
und Pflegeleistungen. Da sind die großen Defizite, die<br />
behoben werden müssen. Dafür sollten wir uns einsetzen.<br />
Deshalb empfehle ich, soweit ich überhaupt eine Empfehlung<br />
aussprechen darf, der Antragsberatungskommission zu<br />
folgen. Herzlichen Dank.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke, Ursula. Als nächste hat Helga Petersen von TRANS-<br />
NET das Wort.<br />
Helga Petersen –TRANSNET, Del.Nr. 0062/01:<br />
Es ist jetzt schwer was zu sagen nach dem sehr guten<br />
inhaltlichen Vortrag. Ich möchte sagen, warum wir diesen<br />
Antrag formell nicht annehmen können. Es wäre ein Abänderungsantrag,<br />
wenn wir jetzt sagen würden, es wäre<br />
Material. Damit geht das nicht mehr. Es ist einfach formal<br />
nicht mehr möglich.<br />
51
52<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke, Helga, für den Hinweis. Gibt es weitere Wortmeldungen.<br />
Das ist nicht der Fall. Petra, sagst du noch einmal<br />
die Empfehlung der Antragskommission?<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Wenn ich recht informiert bin, stimmen wir jetzt zuerst über<br />
den Änderungsantrag ab. Da lautet unsere Empfehlung:<br />
Ablehnung.<br />
Konferenzleitung:<br />
Dankeschön. Wir stimmen also zunächst über die Empfehlung<br />
zum Abänderungsantrag zu E 009 und E 010 ab. Wer<br />
für die Empfehlung der Antragskommission ist, den bitte ich<br />
um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Elf<br />
Gegenstimmen. Wer enthält sich? Keine Enthaltung. Damit<br />
ist die Empfehlung der Antragskommission angenommen.<br />
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Anträge E 009<br />
und E 010, wie sie auch in euren Unterlagen ausgedruckt<br />
sind. Ich rufe den Antrag E 009 auf.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Wir bleiben bei der ursprünglichen Empfehlung für den<br />
Antrag E 009. Die lautet Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke. Wer ist für die Empfehlung? Dankeschön. Wer ist<br />
dagegen? Wer enthält sich? Bei fünf Gegenstimmen ist<br />
damit die Empfehlung angenommen. Danke.<br />
Wir kommen zum<br />
Antrag E 010<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Die Empfehlung der Antragsberatungskommission lautet<br />
ebenfalls Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Danke. Wer ist für die Empfehlung? Danke. Gegenstimmen?<br />
Enthaltungen? Danke. Bei einer Enthaltung ist die Empfehlung<br />
angenommen.<br />
Ich bedanke mich bei Petra für ihren Job in der Kommission.<br />
Die Konferenzleitung übernimmt Monika Lersmacher.<br />
Konferenzleitung – Monika Lersmacher, IG Metall,<br />
Del.Nr. 0032/01:<br />
Liebe Kolleginnen, wir wollen im Antragsbereich F – Orga-<br />
nisationspolitik – weitermachen. Für die Antragsberatungskommission<br />
spricht die Kollegin Kornelia Munkelt.<br />
Ich rufe den<br />
Antrag F 001 auf.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission –<br />
Kornelia Munkelt, Del.Nr. 0060/01:<br />
Der F 001 beschäftigt sich mit Politik für junge Frauen im<br />
Deutschen Gewerkschaftsbund. Hier lautet die Empfehlung<br />
der Antragsberatungskommission Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wer der Empfehlung der Antragsberatungskommission<br />
Folge leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen mit<br />
der roten Delegiertenkarte. Dankeschön. Wer ist dagegen?<br />
Stimmenthaltungen? Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.<br />
Ich rufe den<br />
Antrag F 002 auf,<br />
„Netzwerke für innovative Strategien für<br />
mehr Chancengleichheit“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Auch bei diesem Antrag empfiehlt die Antragsberatungskommission<br />
Annahme.<br />
Konferenzleitung:<br />
Wünscht die Antragstellerin das Wort? Weitere Wortmeldungen<br />
liegen uns nicht vor, dann können wir zur Abstimmung<br />
kommen. Wer der Antragsberatungskommission folgen<br />
möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gegenstimmen?<br />
Stimmenthaltungen? Dankeschön, die Empfehlung<br />
der Antragskommission ist angenommen.<br />
Ich rufe den<br />
Antrag F 003 auf:<br />
„Anwendung des Gender-Mainstreaming-<br />
Prinzips im Deutschen Gewerkschaftsbund“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Hierzu lautet die Empfehlung der Antragsberatungskommission<br />
Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss.
Konferenzleitung:<br />
Mir liegt eine Wortmeldung der Antragstellerin vor.<br />
Marina Eilrich, <strong>DGB</strong> Hessen/Thüringen, Del.Nr.<br />
0015/02:<br />
Ich bin ja im Grunde genommen dafür, dass dieser Antrag<br />
als Material angenommen wird. Aber wir alle wissen, dass<br />
Die guten Geister<br />
speziell im <strong>DGB</strong> in Sachen Gender-Mainstreaming so gut<br />
wie gar nichts passiert. Wir im <strong>DGB</strong> Hessen-Thüringen hatten<br />
ein Tagesseminar und haben uns in diesem Jahr mal<br />
einen halben Tag mal in einer Klausur mit dem Thema<br />
beschäftigt, aber wirklich passiert ist danach auf allen Ebenen<br />
des <strong>DGB</strong> nichts. Deswegen möchte ich euch bitten oder<br />
gebe es sozusagen hiermit zu Protokoll, dass wir gerne hätten,<br />
dass der Bundesfrauenausschuss diesen Antrag übernimmt,<br />
damit der an den Bundeskongress weitergeleitet<br />
werden kann. Denn nicht die Abteilung Frauen beim Bundesvorstand<br />
ist dafür verantwortlich, dass dieses Prinzip<br />
durchgesetzt wird, sondern die Spitze, sprich, Michael Sommer.<br />
Danke.<br />
Konferenzleitung:<br />
Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor.<br />
Somit kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Vorschlag<br />
der Antragsberatungskommission folgt, den bitte ich um<br />
das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?<br />
Bei 23 Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung<br />
so angenommen.<br />
Ich rufe den Antrag F 004 auf.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Beim Antrag F 004, „Entwicklung von Logo und Materialien<br />
für den 8. März, dem Internationalen Frauentag“, wird von<br />
der Antragsberatungskommission Annahme an den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesfrauenausschuss empfohlen.<br />
Konferenzleitung:<br />
Uns liegen keine Wortmeldungen vor. Wir kommen zur<br />
Abstimmung. Ihr habt die Empfehlung der Antragsberatungskommission<br />
gehört. Wer der Empfehlung der Antragsberatungskommission<br />
zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen.<br />
Dankeschön. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?<br />
Somit ist der Antrag einstimmig angenommen.<br />
Ich rufe den<br />
Antrag F 005 auf,<br />
„Internationaler Frauentag“<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Beim Antrag F 005 geht es um Redebausteine zum Internationalen<br />
Frauentag. Auch hier empfiehlt die Antragsberatungskommission<br />
Annahme des Antrages als Material an<br />
den <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss.<br />
Uns liegen keine Wortmeldungen vor, somit kommen wir<br />
zur Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragsberatungskommission<br />
zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen.<br />
Dankeschön. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?<br />
Bei zwei Gegenstimmen so angenommen.<br />
Sprecherin der Antragsberatungskommission:<br />
Ich möchte nicht versäumen, allen für die Aufmerksamkeit,<br />
auch im Namen der Antragsberatungskommission, zu danken<br />
und vor allem für die Disziplin bei der Abstimmung. Ich<br />
danke euch.<br />
Konferenzleitung:<br />
Vielen Dank, Kornelia, dass du schon den Dank an die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer ausgesprochen hast.<br />
Wir möchten uns als Konferenzleitung bei euch ganz herzlich<br />
bedanken, dass ihr so diszipliniert wart und es uns<br />
leicht gemacht habt, euch die zwei Tage durch die Konferenz<br />
zu leiten. Jetzt würde ich gern der Kollegin Ursula<br />
Engelen-Kefer das Wort erteilen zum Abschluss der Konferenz.<br />
53
54<br />
Schlusswort<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer<br />
stellv. Vorsitzende des <strong>DGB</strong><br />
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sofern überhaupt noch<br />
einer drin ist, zuallererst wollte ich euch sagen, dass ich<br />
finde, dass ihr fantastisch hier mitgemacht habt, sowohl<br />
vorgestern, gestern wie auch heute. Ich glaube, dass wir<br />
eine ganz interessante und auch zukunftsweisende Konferenz<br />
hinter uns gebracht haben.<br />
Damit das nicht alles verloren geht, wollen wir die wichtigsten<br />
Ergebnisse dessen, was hier beraten wurde – sowohl<br />
in den Arbeitsgruppen wie auch bei den Anträgen – in<br />
einem offenen Brief an die neue Ministerin für Familie und<br />
Frauen, Frau von der Leyen, schicken. Ihr werdet alle diesen<br />
Brief bekommen, könnt ihn mitnehmen und vielleicht auch<br />
für eure weitere politische Arbeit verwenden.<br />
Zweitens ist selbstverständlich, dass wir im <strong>DGB</strong> und natürlich<br />
dann nachher im Bundesfrauenausschuss sowohl die<br />
Ergebnisse der Arbeitsgruppen wie auch das, was jetzt hier<br />
beraten wurde, nicht nur die beschlossenen Anträge, sondern<br />
auch das, was an Problemen aufgeworfen wurde,<br />
gerade in Bezug auf die Pflege oder auf den Mindestlohn,<br />
weiter behandeln werden und dass hier kein Stillstand ist,<br />
sondern dass wir hier sehen müssen, wie wir in Zukunft<br />
diese wesentlichen Fragen weiter entwickeln.<br />
Drittens bleibt mir nur, dass ich mich ganz herzlich bedanke.<br />
Ich möchte zuallererst Dank an die Konferenzleitung sagen.<br />
Ich finde, ihr habt eine hervorragende professionelle Arbeit<br />
geleistet und auch in schwierigen Zeiten die Konferenz hervorragend<br />
durchgesteuert. Herzlichen Dank.<br />
Ich bedanke mich ebenfalls bei der Mandatsprüfungskommission<br />
und auch ganz besonders bei der Antragskommission.<br />
Ich finde, ihr habt eine tolle Arbeit geleistet, auch in<br />
schwierigen Fragen, und gerade die Antragsberatung überhaupt<br />
zu dem gemacht, was sie sein konnte, und auch zu<br />
den Ergebnissen maßgeblich beigetragen.<br />
Ich darf mich bedanken beim Redaktionsteam der Konferenzzeitung<br />
„einblick“. Das Produkt habt ihr auf dem Tisch<br />
liegen. Auch hier herzlichen Dank für eure engagierte<br />
Arbeit. Schließlich geht ein ganz, ganz herzliches Dankeschön<br />
an die Abteilung Gleichstellungs- und Frauenpolitik<br />
im <strong>DGB</strong>. Helga Nielebock, Audrey Podann, Claudia Menne,<br />
Ines Grabner-Drews und Maria Kathmann, ganz herzlichen<br />
Dank für eure hervorragende Arbeit.<br />
Natürlich möchte ich auch nicht versäumen, mich bei dem<br />
guten Geist unserer Konferenz und der Konferenzorganisation<br />
zu bedanken, dem zeitweilig einzigen männlichen Wesen,<br />
der sich in diese große Frauengemeinschaft gewagt<br />
hat, nämlich Karl Ehmke, und mit ihm Nicole Wagner, herzlichen<br />
Dank für hervorragende Betreuung.<br />
Ebenfalls ein Dankeschön an das Konferenzbüro – Simone<br />
Zurek, Lilo Collm, Uschi Georgi, Inken Müller und Ines<br />
Quant. Ihr habt eine hervorragende engagierte Arbeit geleistet.<br />
Ich war ja mehrfach in eurem Büro. Das war wie ein<br />
Taubenschlag und es ging immer durch ohne Pause bis spät<br />
in die Nacht hinein. Ich denke, die Ergebnisse können sich<br />
sehen lassen. Herzlichen Dank.<br />
Natürlich auch ein Dankeschön an Ute Teichmann, den<br />
guten Geist, die am Hackeschen Markt alles für uns<br />
gedruckt haben, denn sonst läge das nicht vor. Herzlichen<br />
Dank.<br />
Jetzt habe ich gerade noch einen Zettel zugeschoben<br />
bekommen und will euch den vorlesen: „Wir von der NGG<br />
bedanken uns bei euch für eure Spende für Gate Gourmet<br />
in Höhe von 684,98 Euro“. Ich denke, das kann sich sehen<br />
lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank.<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Delegierte, ich<br />
bedanke mich und ich möchte hiermit die 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz<br />
beschließen. Ich wünsche euch allen einen<br />
guten Nachhauseweg. Ich bin sicher, wir werden die gute<br />
Kooperation auf jedem uns möglichen Wege fortsetzen.<br />
Herzlichen Dank, alles Gute, schönes Wochenende.
Verzeichnis der Anträge und Entschließungen<br />
der 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz<br />
A – Gleichstellungspolitik<br />
A 001Frauenpolitische Offensive statt „Lila Pause“<br />
I 1 Initiativantrag Nr. 1: Beibehaltung Girls’ Day<br />
und Umsetzung des ganzheitlichen Konzeptes<br />
vom bundesweiten Girls’ Day in allen allgemeinbildenden<br />
Schulen<br />
A 002Progressive Frauenpolitik<br />
A 003Geschlechterspezifische Datenerhebungen<br />
und Statistiken<br />
A 004Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft<br />
A 005Für nachhaltige Verbesserungen im<br />
Landesgleichstellungsrecht<br />
A 006Keine Auflösung der Konferenz der Gleichstellungs-<br />
und Frauenminister/innen<br />
A 007Geschlechtergerechte Bildung von Anfang an<br />
A 008Ausweitung der Umlagefinanzierung der<br />
Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld durch die<br />
Arbeitgeber auf alle Betriebe<br />
A 009Ausweitung der Umlagefinanzierung der<br />
Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld durch die<br />
Arbeitgeber auf alle Betriebe<br />
A 010Antidiskriminierungsgesetz<br />
I 2 Initiativantrag Nr. 2: Unterstützung der Kampagne<br />
gegen Zwangsprostitution bei der WM<br />
2006 und Forderung verbesserter Zeugenschutzprogramme<br />
B – Entgelt / Einkommen<br />
B 001 Entschließung zur diskriminierungsfreien<br />
Tarifpolitik - Weiterentwicklung einer<br />
geschlechterdemokratischen Tarifpolitik<br />
B 002 Für einen gesetzlichen Mindestlohn<br />
B 003 Gesetzlicher Mindestlohn<br />
B 004 Entschließung zu Niedrigeinkommen und zur<br />
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns<br />
B 005 Existenzsicherndes Einkommen<br />
B 006 Kampagne gegen Niedriglohn<br />
B 007 Abschaffung des Ehegattensplittings und der<br />
Lohnsteuerklasse V sowie die Einführung<br />
einer geschlechtergerechten Individualbesteuerung<br />
B 008 Individuelle Besteuerung<br />
I 3 Initiativantrag Nr. 3: Gegen Besteuerung von<br />
Abfindungen<br />
B 009 Gegen die Einführung von Studiengebühren<br />
C – Beschäftigungspolitik<br />
C 001 Wirtschaftspolitik<br />
C 002 Neuausrichtung Arbeitsmarktpolitik<br />
C 003 Bedarfsgemeinschaft Hartz IV<br />
C 004 Gender Mainstreaming bei Hartz IV<br />
D – Arbeitszeit /<br />
Arbeitsbedingungen<br />
D 001Arbeitszeit<br />
D 002Arbeitszeit<br />
D 003Gesundheitsschutz und Arbeitszeit<br />
D 004Verschlechterung des Ladenschlussgesetzes<br />
D 005Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen<br />
von Frauen durch Änderungen des Arbeitsrechts<br />
verhindern<br />
I 4 Initiativantrag Nr. 4: Keine Verschlechterungen<br />
beim Kündigungsschutz<br />
D 006Für ein soziales Europa – NEIN zur Dienstleistungsrichtlinie<br />
D 007Für ein soziales Europa – NEIN zur Bolkestein-Richtlinie<br />
55
56<br />
E – <strong>Sozialstaat</strong> / <strong>Soziale</strong> <strong>Sicherung</strong><br />
E 001 <strong>Sozialstaat</strong>sdiskussion<br />
E 002 Abschaffung der Sonderregelungen für Mini-<br />
Jobs<br />
E 003 Abschaffung der Sonderregelungen für Mini-<br />
Jobs<br />
E 004 Gleichstellung aller Mütter bei der Anrechnung<br />
der Erziehungszeiten für die Rente<br />
E 005 Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für MigrantInnen<br />
für die Dauer von arbeitsrechtlichen<br />
Streitigkeiten<br />
E 006 Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für MigrantInnen<br />
für die Dauer von arbeitsrechtlichen<br />
Streitigkeiten<br />
E 007 Für eine solidarische und geschlechtergerechte<br />
Bürgerversicherung!<br />
E 008 Gesundheitspolitik für Frauen<br />
E 009 Vereinbarkeit von Pflege und Beruf<br />
E 010 Vereinbarkeit von Beruf und Familie für pflegende<br />
Angehörige<br />
F - Organisationspolitik<br />
F 001 Politik für junge Frauen im Deutschen<br />
Gewerkschaftsbund<br />
F 002 Netzwerke als innovative Strategie für mehr<br />
Chancengleichheit<br />
F 003 Anwendung des Gender-Mainstreaming-Prinzips<br />
im Deutschen Gewerkschaftsbund<br />
F 004 Entwicklung von Logo und Materialien für<br />
den 8. März – Internationaler Frauentag<br />
F 005 Internationaler Frauentag
Anträge und Entschließungen im Wortlaut<br />
<strong>Sachgebiet</strong> A: Gleichstellungspolitik<br />
A 001 Frauenpolitische Offensive statt<br />
„Lila Pause“<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-<br />
Thüringen<br />
Beschluss: Annahme mit Änderungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Im öffentlichen Dienst und auch in der Privatwirtschaft fehlen<br />
wirksame Gesetze zur Herstellung von Chancengleichheit.<br />
1. Wir fordern deshalb gesetzliche Maßnahmen, die die Verpflichtung<br />
zu Frauenförderplänen, zu transparenter und<br />
geschlechtsdemokratischer Personalentwicklung ebenso<br />
enthalten, wie die Kombination von Ziel- und Entscheidungsquote.<br />
Die Frauenbeauftragten im öffentlichen<br />
Dienst, die die Umsetzung dieser Gesetze zu begleiten<br />
haben, müssen das Recht auf Klage haben und ebenso<br />
zu Sanktionen bei Nichtumsetzung der Gesetze.<br />
2. Wir fordern ein Gesetz zur Herstellung von Chancengleichheit<br />
in der Privatwirtschaft. Wir wollen eine echte<br />
Gleichstellung im Beruf: bei Einstellung und Beförderungen<br />
in Führungspositionen, bei der Bezahlung für gleichwertige<br />
Arbeit. Dazu gehört auch, Beschäftigungshemmnisse<br />
für Frauen durch das Steuer- und Sozialversicherungsrecht<br />
abzubauen. Frauen dürfen nicht auf die unbezahlte<br />
Hausarbeit oder auf Mini-Jobs für 400,00 Euro<br />
abgeschoben werden.<br />
3. Wir fordern die Verabschiedung des Antidiskriminierungsgesetzes.<br />
In diesem Instrument sehen wir Gewerkschaftsfrauen<br />
ein wirkungsvolles Instrument gegen Benachteiligung<br />
und Diskriminierung in der Arbeitswelt sowie gegen<br />
sexuelle Belästigung. Zum Handeln aufgefordert sind<br />
auch Gewerkschaften und Betriebsräte, die eine entsprechende<br />
Antidiskriminierungskultur aufbauen müssen.<br />
4. Wir fordern ein Auftragsvergabegesetz, sowohl für die<br />
Länder, als auch für den Bund, dass neben dem Kriterium<br />
der Tariftreue auch das der Frauenförderung enthält. Die<br />
Vergabe öffentlicher Aufträge muss damit verbunden<br />
sein, dass die Förderung von Chancengleichheit nachgewiesen<br />
wird.<br />
5. Wir fordern die Quotierung von Ausbildungsplätzen:<br />
jeweils die Hälfte für junge Frauen und für junge Männer.<br />
Damit sich das Berufswahlverhalten von jungen Frauen<br />
verändert, muss weiterhin der jährliche Girls' Day veranstaltet<br />
werden. Dieser darf nicht durch einen sogenannten<br />
Boys' Day „verbessert“ werden: denn er findet ohnehin<br />
an 364 Tagen des Jahres statt.<br />
6. Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide Elternteile<br />
setzt voraus, dass ein qualitativ hochwertiges und quantitativ<br />
ausreichendes, bezahlbares Betreuungsangebot für<br />
den Nachwuchs sichergestellt ist.<br />
Begründung:<br />
Mit Sorge beobachten die Gewerkschaftsfrauen in Hessen<br />
und Thüringen eine bundesweite Entwicklung, bei der<br />
Frauenpolitik gegen Familienpolitik ausgespielt wird. Wir<br />
sehen die Gefahr: durch die Konzentration auf Familienpolitik<br />
wird das tradierte Rollenbild von Männern und Frauen<br />
wieder zementiert, den Frauen bleibt als Alternative zum<br />
Beruf nur noch die Familie. Um diese Entwicklung zu stoppen,<br />
fordern wir eine frauenpolitische Offensive, die sich<br />
nicht nur auf die Bundesländer Hessen und Thüringen<br />
beschränken darf, sondern bundesweit eingefordert werden<br />
muss. Wir wollen ein Ende der frauenpolitischen „Lila<br />
Pause“.<br />
Das Prinzip des Gender Mainstreaming, das für die gesamte<br />
Europäische Union gilt, wird bei politischen Maßnahmen,<br />
sowohl der Länder als auch des Bundes, weitgehend außer<br />
Acht gelassen. Zwar verkünden Politiker, dass sie sich dem<br />
Gedanken der Förderung der Chancengleichheit verpflichtet<br />
sehen. In der Praxis wird aber versäumt darauf zu schauen,<br />
welche Auswirkungen die Umsetzung von politischen Maßnahmen<br />
jeweils auf Frauen und Männer hat.<br />
Während Frauen in den Vorständen der großen deutschen<br />
Unternehmen nur Spurenelemente sind, arbeiten dagegen<br />
die meisten Frauen in unteren Hierarchienebenen. Ihre<br />
Fähigkeiten und Qualifikationen führen nicht dazu, dass<br />
Frauen die gläserne Decke durchstoßen.<br />
57
58<br />
Frauen sind die Hauptverliererinnen der als Arbeitsmarktreformen<br />
deklarierten Hartz-Gesetze. Die verschärften Anrechnungsregeln<br />
für Partnereinkommen haben dazu geführt,<br />
dass viele Frauen den Antrag auf Arbeitslosengeld II gar<br />
nicht mehr stellen. Sie geraten deshalb ohne Unterstützungsleistungen<br />
durch die Arbeitsagenturen in eine komplette<br />
finanzielle Abhängigkeit von ihrem Partner. Sie haben<br />
zudem nur noch einen stark eingeschränkten Anspruch auf<br />
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Die neuen Zumutbarkeitsregelungen<br />
haben zur Folge, dass viele Frauen<br />
in Mini-Jobs abgeschoben werden oder sich mit den Ein-<br />
Euro-Jobs begnügen müssen. Wir fordern konkrete Änderungen,<br />
die diesen Teufelskreis von Arbeitslosigkeit und<br />
Abhängigkeit durchbrechen.<br />
Überproportional viele junge Frauen sind Verliererinnen in<br />
der Ausbildungsrunde 2004. Vom Anstieg der Ausbildungsverträge<br />
profitieren zu 78,5 % junge Männer, auf Mädchen<br />
fallen nur 21,5 %. Der Anteil von jungen Frauen im dualen<br />
System ging seit 2002 von 43,4 % auf 41,8 % zurück.<br />
Obwohl die Befragung von Schulabgängern im Herbst 2004<br />
u. a. gezeigt hat, dass Mädchen bei der Ausbildungsplatzsuche<br />
sowohl flexibler als auch mobiler sind.<br />
In den öffentlichen Verwaltungen sind längere Arbeitszeiten<br />
eingeführt worden. Dies bedeutet, dass Menschen mit<br />
Familienaufgaben noch mehr Probleme haben, dieses mit<br />
einer Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. Längere Arbeitszeiten<br />
sind deshalb geschlechter- und familienpolitischer Unsinn.<br />
Hinzu kommt, dass Frauen immer noch weniger verdienen<br />
als Männer und ihnen durch Arbeitszeitverlängerung auf<br />
kaltem Wege eine Einkommensabsenkung verordnet wird.<br />
Die Bundesrepublik befindet sich europaweit auf dem letzten<br />
Platz, wenn es um Ganztagsangebote zur Kinderbetreuung<br />
geht. Auch die Unternehmen haben in dieser Frage<br />
eine gesellschaftspolitische Verantwortung, Müttern und<br />
Vätern die Vereinbarkeit zu ermöglichen, indem sie ihnen<br />
vielfältige Angebote (z. B. Familien-Service) machen und für<br />
eine familienfreundliche Unternehmenskultur sorgen. Bei<br />
der Frage eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungssystems<br />
geht es nicht nur um die Erwerbsbeteiligung von Frauen,<br />
sondern es ist auch für die Entwicklung und Sozialisation<br />
von Kindern notwendig. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.<br />
I 001<br />
Initiativantrag Nr. 1<br />
Beibehaltung und Umsetzung des<br />
ganzheitlichen Konzeptes vom<br />
bundesweiten Girls’ Day an den<br />
allgemein bildenden Schulen<br />
Antragsteller/in: Angela Drescher (GEW) u.a.<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert die Beibehaltung<br />
des bundesweiten Girls’ Day als Mädchenzukunftstag an<br />
jedem vierten Donnerstag im April für die Schuljahrgänge<br />
5 bis 10 und die vollständige konzeptionelle Umsetzung<br />
des ganzheitlichen Projektgedankens vom Girls’ Day für alle<br />
Schülerinnen und Schüler an den allgemein bildenden Schulen<br />
in der Praxis.<br />
Begründung:<br />
Die Bestrebung, den Girls’ Day zu einem allgemeinen<br />
„Zukunftstag“ umzubenennen, den alle Schülerinnen und<br />
Schüler der Sekundarstufe I als allgemeinen Berufserkundungstag<br />
nutzen können, widerspricht den Intentionen des<br />
bundesweiten Girls’ Day.<br />
Ziel ist es zum einen, das Interesse der Mädchen an technischen<br />
Berufen zu wecken, zum anderen sollen Öffentlichkeit<br />
und Wirtschaft auf die Stärken von Mädchen aufmerksam<br />
gemacht werden. Der Girls’ Day kann dazu beitragen, die<br />
bestehende Benachteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt<br />
abzubauen und auf die bestehende Ungleichbehandlung<br />
von Frauen in der Berufswelt aufmerksam zu machen. Dieser<br />
Aktionstag wendet sich bewusst gezielt an die Mädchen<br />
und junge Frauen der Klassen 5 bis 10, um sie zu motivieren,<br />
sich stärker für frauenuntypische und zukunftsträchtige<br />
Berufe zu interessieren und um Frauen in Führungspositionen<br />
kennen zu lernen.<br />
Aktuelle bundesweite Umfragen ergeben, dass mehr als<br />
90% der teilnehmenden Mädchen sehr zufrieden oder<br />
zufrieden mit diesem Mädchenzukunftstag waren. Auch an<br />
den Schulen und bei den Unternehmen ist entgegen der<br />
populistischen konservativen Stimmungsmache in einigen<br />
Parteien und Medien die Zufriedenheit mit dem Konzept<br />
des Girls’ Day stark gestiegen. Immer mehr weitet sich der<br />
Girls’ Day zu einem Projekt zur Schaffung von Zukunftsperspektiven<br />
für Mädchen und junge Frauen in Europa aus. Die<br />
umfangreichen Broschüren, Handreichungen, Projektvorschläge,<br />
Filme, Anmeldeformulare, Elternbriefe geben Antwort<br />
insbesondere auch auf folgende Fragen:
Warum ein Zukunftstag speziell für Mädchen?<br />
Welche Ziele verfolgt der bundesweite Aktionstag?<br />
Was lernen die Jungen am Girls’ Day?<br />
A 002 Progressive Frauenpolitik<br />
Antragsteller/in: ver.di Bundesfrauenrat<br />
Beschluss: Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesfrauenausschuss<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Frauenpolitik wieder in die Offensive bringen, strategische<br />
Aspekte einbringen, neue Richtlinien für die Politik<br />
entwickeln<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand wird aufgefordert, dafür Sorge<br />
zu tragen, dass folgende Ziele und Grundsätze in der<br />
Politik des <strong>DGB</strong> umgesetzt werden:<br />
Stichworte für eine strategische Neuorientierung der<br />
Frauenpolitik des <strong>DGB</strong> und seiner Einzelgewerkschaften<br />
sind:<br />
Politik und Gesellschaft müssen ein neues Frauenleitbild,<br />
aber auch ein neues Männerleitbild etablieren. Materielle<br />
und soziale Eigenständigkeit für Frauen werden dabei zum<br />
Leitbild politischen Handelns. Gesellschaftliche Werte sind<br />
neu zu etablieren, die Frauen gleichberechtigten Zugang zu<br />
Ökonomie und Gesellschaft gewährleisten.<br />
Die Gewerkschaftsarbeit muss neue Kernbereiche formulieren<br />
und annehmen. Stichworte sind: Frauenpolitik, die<br />
gleichzeitig Dienstleistungspolitik ist, gleicher Lohn für<br />
gleichwertige Arbeit, Neudefinition des Arbeitsbegriffs einschließlich<br />
neuer Grenzen zwischen Produktion und Reproduktion,<br />
öffentliche Daseinsvorsorge, mehr kommunale<br />
Beschäftigung, neue emanzipatorische Männerpolitik.<br />
Die Politik muss neue Verhaltensgrundsätze entwickeln, um<br />
Frauen- und Männerinteressen gleichberechtigt umzusetzen:<br />
Entschleunigung der Politik für mehr Demokratie,<br />
Frauen an die Macht in Politik und Gewerkschaften, Re-<br />
Regionalisierung der politischen und ökonomischen Macht<br />
und mehr gelebte Verantwortung, mehr gesamtwirtschaftliche<br />
Betrachtung.<br />
Verantwortungen müssen festgelegt werden, AkteurInnen<br />
müssen mit dem Ziel handeln, sich der Vision einer für Frauen<br />
und Männer gerechten Gesellschaft anzunähern. Die<br />
dabei zwischen Frauen und Männern geteilte Verantwortung<br />
verlangt von Frauen, ihren Anteil selbstbewusst für<br />
sich in Anspruch zu nehmen, und von Männern, die bei<br />
ihnen konzentrierte Macht auch zur Umsetzung von Fraueninteressen<br />
einzusetzen.<br />
Auch in den Gewerkschaften ist ein neues Selbstverständnis<br />
der Frauen umzusetzen. Fraueninteressen dürfen nicht länger<br />
dem vermeintlichen Gesamtinteresse geopfert werden,<br />
denn sonst kann ein wirkliches Gesamtinteresse nie erfüllt<br />
werden.<br />
Neues Frauenleitbild in Politik und Gesellschaft implementieren<br />
und verankern<br />
Ziel gewerkschaftlicher Frauen- und Gesamtpolitik muss es<br />
sein, ein Leitbild der gesellschaftlich gleichberechtigten, im<br />
Beruf mit gleichen Chancen und realen Möglichkeiten versehenen<br />
Frau zu verankern, für die Familie ein Lebensbereich<br />
ist, aber nicht länger der einzig wichtige bzw. mögliche.<br />
Zentraler Bestandteil dieses Frauenbildes muss es sein,<br />
dass Frauen die gleichberechtigte Teilhabe an allen Teilen<br />
des gesellschaftlichen, politischen und beruflichen Lebens<br />
nicht nur grundgesetzlich zusteht, sondern dass diese Zielsetzung<br />
auch in allen Politikbereichen nachhaltig als Zielund<br />
Maßnahmenleitbild umgesetzt wird. Den gewerkschaftlichen<br />
AkteurInnen kommt dabei die Aufgabe zu, dieses Ziel<br />
insbesondere vor Ort und in den unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen<br />
wirksam werden zu lassen.<br />
Bisher und wieder aktualisiert geht in nahezu allen Politikbereichen<br />
(Beschäftigung, <strong>Soziale</strong> <strong>Sicherung</strong>, Familie, Unternehmen)<br />
die herrschende Meinung von einem traditionellen<br />
Frauenbild aus, das für die Frau in erster Linie die Familie<br />
als Lebensmittelpunkt definiert. Teilzeitarbeit und Zuverdienst,<br />
vom Ehepartner abgeleitete soziale <strong>Sicherung</strong>, steuerliche<br />
Bevorteilung der Einverdienstehe, die Darstellung<br />
von Familienpolitik als Frauenpolitik, „gläserne Decken“ für<br />
Frauen in betrieblichen Hierarchien, dies alles sind Beispiele<br />
für die wirksame Umsetzung dieses Frauenbildes, das dringend<br />
durch eine modernere Zielsetzung ersetzt werden<br />
muss.<br />
Wenn Frauen unter bisherigen Bedingungen den gleichberechtigten<br />
Zugang zu Ökonomie und Gesellschaft sowie die<br />
gerechte Verteilung von Einkommen, Macht und Zukunftsperspektiven<br />
anstreben, so unterliegen sie derzeit einem<br />
Herrschaftsverhältnis, das in der vorrangigen Beteiligung<br />
von Männern in diesen Systemen und in ihrer eigenen teilweisen<br />
oder vollständigen Ausgrenzung daraus begründet<br />
liegt. Beispielsweise spiegelt sich dies in der fortgesetzten<br />
Zuschreibung der Haus- und Subsistenzarbeit (Reproduktion)<br />
an Frauen wider.<br />
Bei einer Neuorientierung gewerkschaftlicher Frauen- und<br />
Gesamtpolitik gilt es deshalb auch, dieses Herrschaftsverhältnis<br />
erneut in den Mittelpunkt zu rücken und für eine<br />
59
60<br />
bessere und geschlechtergerechte Verteilung der Beteiligungsfaktoren<br />
zu sorgen – und nicht etwa angesichts angeblich<br />
knapper Kassen und fehlender politischer und ökonomischer<br />
Lösungen immer wieder zum traditionellen Frauenbild<br />
als vermeintlicher Lösung zurückzukehren. Nur so<br />
wird es auf Dauer möglich sein, Frauen als nicht nur selbstverständlichen,<br />
sondern auch selbstverständlich gleichberechtigten<br />
Teil der Organisation zu halten.<br />
Neue Kernbereiche für die Gewerkschaftsarbeit formulieren<br />
und annehmen.<br />
Gewerkschaft versteht sich künftig als gesellschaftliche<br />
Kraft, bei der Tarifarbeit eine Standardaufgabe ist, die sich<br />
aber auch der Lebensbereiche der Menschen annimmt. Das<br />
bedeutet:<br />
❚ Weg von der „Zurück-zu-den-klassischen-Kernaufgaben-<br />
Strategie“, die auch in Unternehmen zurzeit angesichts<br />
angeblich leerer Kassen an- und umgesetzt wird. Von<br />
dieser Strategie ist anzunehmen, dass sie eine Zukunftsorientierung<br />
eher verhindert, weil sie wegen der Konzentration<br />
auf alte und bekannte und in der Zahl beschränkte<br />
Kernpunkte inhaltlich zu sehr festgelegt ist. Fraueninteressen<br />
geraten durch die Konzentration auf diese<br />
„Kernaufgaben“ stets ins Hintertreffen, da sie bisher<br />
nicht als Kernaufgabe definiert sind. Will Gewerkschaft<br />
künftig Frauen ansprechen, ist hier Umdenken erforderlich.<br />
❚ Das Aufgreifen der Anliegen von Mitgliedern erfordert<br />
eine breitere Aufgabenpalette und das Einverständnis,<br />
einen politischen Auftrag für sie und für die potentiellen<br />
Mitglieder zu erfüllen, der sich nicht mehr allein auf die<br />
Verbesserung bestehender Normalarbeitsverhältnisse<br />
richten kann, von denen bisher vornehmlich Männer profitieren.<br />
Wenn schwindende Kernbelegschaften nicht zum Verschwinden<br />
der Gewerkschaften führen sollen, müssen sie<br />
neue Kernbereiche ihrer Aktivitäten formulieren, mit denen<br />
sie näher an den Bedarf von Mitgliedern und Bevölkerung,<br />
von Männern und Frauen heranrücken. Dazu gehören dringend<br />
❚ Frauenpolitik, die gleichzeitig Dienstleistungspolitik ist,<br />
weil die Industriegesellschaft bereits zur Dienstleistungsgesellschaft<br />
geworden ist und weiterer gesellschaftlicher<br />
Wandel bevorsteht, der die Auflösung alter Strukturen<br />
mit sich bringt und das traditionelle Frauenbild auch in<br />
der Praxis zum Anachronismus werden lässt. Frauenarbeit<br />
und Dienstleistungsarbeit stehen in enger Verbindung.<br />
❚ Die Durchsetzung gleichen Lohnes für gleichwertige<br />
Arbeit, denn es ist schon ein beinahe irreparabler Schaden<br />
für die ökonomische Integration der Dienstleistung in<br />
die bestehende Wirtschaft eingetreten, wenn hier Niedriglöhne<br />
als opportun gehandelt werden. Die Tatsache,<br />
dass Dienstleistung meist als nur ergänzender Bestandteil<br />
der Wirtschaft zur vorrangigen Industrieproduktion<br />
betrachtet wird, trifft hier mit der Verteilung der Dienstleistung<br />
an die Frauen zusammen. Die Herrschaft der<br />
Produktion in der Wirtschaft und die dort vorherrschende<br />
Männerarbeit führen so zu einer Unterbewertung der<br />
Dienstleistung und der hier von Frauen erbrachten Arbeit.<br />
❚ Eine Neudefinition des Arbeitsbegriffs, mit in der Konsequenz<br />
veränderten Ansprüchen auf Bewertung und<br />
Bezahlung von Arbeit, die klassischerweise der Produktion<br />
oder der Reproduktion zugerechnet werden. Ein-Euro-<br />
Jobs, die Verlagerung personenbezogener Dienste in die<br />
ehrenamtliche Arbeit (innerhalb oder außerhalb der Familie)<br />
und die Tatsache, dass Niedriglohnarbeit heute mehr<br />
eine Konsequenz des sozialen Status (z.B. Arbeitslosigkeit)<br />
als der Qualifikation wird, machen deutlich, dass<br />
auch die un- und schlecht bezahlte Arbeit in den gewerkschaftlichen<br />
Fokus rücken muss.<br />
❚ Öffentliche Daseinsvorsorge, weil Privatisierung und<br />
Marktmacht zum Rückzug des Staates nicht nur aus der<br />
sozialen <strong>Sicherung</strong>, sondern längerfristig auch aus der<br />
Grundversorgung der Bevölkerung führen. Eine gleichberechtigte<br />
Teilhabe von Frauen und Männern an Staat,<br />
Gesellschaft und Wirtschaft setzt insbesondere für Familienverantwortliche<br />
voraus, dass Leistungen der öffentlichen<br />
Daseinsvorsorge wie beispielsweise Wasser, Energie,<br />
Bildung, Kinderbetreuung, Kultur, Kommunikation in ausreichendem<br />
und bezahlbarem Umfang vorhanden sind.<br />
Gerade für Frauen sind die schlecht ökonomisierbaren<br />
Leistungen, z.B. die Kinderbetreuung, als Leistung des<br />
Staates besonders wichtig, insbesondere, da eine Ökonomisierung<br />
aus gesellschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist.<br />
❚ Mehr kommunale Beschäftigung als Teil der öffentlichen<br />
Daseinsvorsorge, denn nicht nur die aktuelle Arbeitsmarktpolitik<br />
(z.B. Ausmaß der Ein-Euro-Jobs) macht deutlich,<br />
dass kommunale und soziale Arbeit vorhanden ist,<br />
sie jedoch derzeit nicht bezahlt, sondern billig oder<br />
umsonst insbesondere von Frauen geleistet werden soll.<br />
Auch die Notwendigkeit der Erbringung öffentlicher Leistungen,<br />
die nicht oder schlecht ökonomisierbar sind und<br />
deren Deckung gleichzeitig ein unverzichtbares Grundbedürfnis<br />
zum Funktionieren unserer Gesellschaft ist, sind<br />
zukünftig stärker in den Vordergrund zu stellen.<br />
❚ Eine neue Männerpolitik, denn auch Männer, die bisher<br />
in gesicherten Industriepositionen tätig waren, müssen<br />
ein Eigeninteresse am Wandel entwickeln. Sie können<br />
nicht länger davon ausgehen, der Ausgrenzung und
Abwertung der Arbeit, die bisher den Frauen zugeschrieben<br />
wurden, auf Dauer zu entgehen. Die Umwälzungen<br />
in Wirtschaft und Gesellschaft sind grundlegender, als<br />
dass mit einer überwiegenden Mehrheit von „Verschonten“<br />
noch gerechnet werden kann. Zu einer neuen Männerpolitik<br />
gehört auch, dass Männer sich neu über ihre<br />
Rolle in der Familie verständigen müssen.<br />
Neue Verhaltensgrundsätze für die Politik entwickeln<br />
Entschleunigung der Politik für mehr Demokratie<br />
Je kleiner der Zirkel der Beteiligten unter unveränderten<br />
gesellschaftlichen Bedingungen ist und je schneller Entscheidungen<br />
getroffen werden (müssen), umso weniger<br />
Frauen sind an Entscheidungen beteiligt, umso unwahrscheinlicher<br />
wird es, dass Fraueninteressen einfließen. Ohne<br />
die zwar länger dauernde, aber auf Beteiligung angelegten<br />
demokratischen Willensbildungsprozesse werden „allgemeine“<br />
Entscheidungen immer stärker wieder nur zu Entscheidungen<br />
von Einzelnen und Männern. Deshalb: Keine Kompromisse<br />
im stillen Kämmerlein und unter Zeitdruck mehr,<br />
sonst sind demokratische Prozesse nicht mehr möglich.<br />
Die Politikverdrossenheit der Bevölkerung erklärt sich zu<br />
einem erheblichen Teil aus diesen Vorgängen, denn das<br />
Defizit an wirklicher und relevanter Information und ihre<br />
immer wieder erkennbare und zunehmende Einflusslosigkeit<br />
wird in der Bevölkerung wachsamer zur Kenntnis genommen,<br />
als es oberflächlich betrachtet den Anschein hat. Dies<br />
als erträglichen Nebeneffekt hinzunehmen, sollten Politiker<br />
sich hüten.<br />
Frauen an die Macht<br />
Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen ist real und<br />
erkennbar umzusetzen. Die Verteilung gesellschaftlich notwendiger<br />
Arbeit muss bei der Arbeit selbst künftig ein<br />
ebenso gleichmäßiges Ergebnis hervorbringen wie bei der<br />
Verteilung der Früchte dieser Arbeit:<br />
❚ In der Ökonomie: Führungspositionen, Aufsichtsgremien,<br />
Aufsichtsratssitze für Frauen<br />
❚ In der Politik: Frauen in Entscheidungspositionen, nicht<br />
nur an der Basis<br />
❚ In der gesellschaftlichen Verteilung: Mehr Einkommen<br />
und Besitz für Frauen<br />
❚ In der außerökonomischen Arbeitsteilung: Nicht nur die<br />
ehrenamtliche Arbeit, auch das Ehrenamt künftig für die<br />
Frauen.<br />
Re-Regionalisierung der politischen und ökonomischen<br />
Macht<br />
❚ Die Identifikation der Bevölkerung mit Entscheidungen,<br />
die mit zunehmender Politikverdrossenheit verloren geht,<br />
ist erneut zu fördern. Nur so kann die Politik sich den<br />
Menschen wieder annähern und in der Bevölkerung verankern.<br />
❚ Persönliche Verantwortung muss für den Bürger und die<br />
Bürgerin zum selbstverständlichen Staatsverständnis gehören.<br />
Es gilt, dieses Politikverständnis auch in Unternehmenskreisen<br />
(wieder) zu initiieren.<br />
❚ Einfluss- und Beteiligungsmöglichkeiten müssen für mehr<br />
Menschen wieder hergestellt werden.<br />
❚ Mehr Verantwortung in den Kommunen: Gerade für<br />
Frauen ist die direkt wirksame Ebene der Politik, z.B. Auswirkungen<br />
kommunalpolitischer Entscheidungen zur Daseinsvorsorge,<br />
von großer Bedeutung.<br />
Mehr gesamtwirtschaftliche Betrachtung<br />
❚ Weiterhin die rein betriebswirtschaftliche Ökonomie in<br />
den Vordergrund zu stellen, ist nicht ausreichend, um der<br />
geänderten Wirtschafts- und Gesellschaftslage zu entsprechen,<br />
denn auch gesamtwirtschaftliche Vorsorge und<br />
Folgenabschätzung sind dazu erforderlich.<br />
❚ Mehr ganzheitliche Betrachtung und Behandlung ist der<br />
einzig mögliche Ansatz auch für die globalen Fragen, insbesondere<br />
wichtig sind auch der Schutz von Umwelt und<br />
Naturressourcen, gesunde Ernährung für alle Menschen,<br />
Weltgesundheit.<br />
Verantwortung festlegen und handeln, um sich der Vision<br />
anzunähern<br />
Männer und Frauen sind für die Umsetzung des neuen<br />
Frauenleitbildes und die Gestaltung einer solidarischen und<br />
geschlechterdemokratischen Gesellschaft gleichermaßen<br />
verantwortlich. Dabei gibt es jedoch eine geteilte Verantwortung:<br />
Frauen müssen das bereits entwickelte Leitbild der gleichberechtigten<br />
und gleichbeteiligten Frau selbstbewusst vertreten<br />
und sich für dessen Umsetzung ständig neu einsetzen.<br />
Sie müssen ihre eigenen Ziele entwerfen und verfolgen<br />
– wissen, was sie wollen. Dazu brauchen sie keine Erlaubnis<br />
oder Ermutigung, auch keine Qualifizierung mehr. Frauen<br />
sind an der Schwelle zur „Selbstermächtigung“ angekommen.<br />
Es ist nur ein kleiner Schritt, der den Weg eröffnet.<br />
Frauen müssen ihre Verantwortung annehmen für sich<br />
selbst, für andere Frauen, in der Politik.<br />
Frauen fordern ein, wahrgenommen zu werden, als Hälfte<br />
der Gesellschaft, als diejenigen, die den größten Teil gesellschaftlich<br />
notwendiger Arbeit leisten, als gleichberechtigte<br />
Wesen in der Gesellschaft. Fraueninteressen und -belange<br />
müssen in Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar gemacht<br />
61
62<br />
werden. Frauen erwarten Respekt für ihre Person und für<br />
ihre Anliegen.<br />
Frauen müssen sich mit BündnispartnerInnen vernetzen,<br />
innerhalb und außerhalb der klassischen Frauenorganisationen.<br />
Dabei ist auch die Bereitschaft weiterzuentwickeln,<br />
sich über (auch selbst gesetzte) Grenzen erneut zu verständigen<br />
und diese bei Bedarf zu ändern.<br />
Männer sind schon in entscheidenden Positionen und müssen<br />
ihre Verpflichtungen im hier beschriebenen Kontext<br />
annehmen. Wenn sie in Machtpositionen sind, müssen sie<br />
Politik, Gesetze, Unternehmenspolitik einschließlich der<br />
Fraueninteressen umsetzen. Sie müssen bereit werden,<br />
Macht zu teilen und das Positive an geteilter Macht zu<br />
erkennen.<br />
Männer sind verantwortlich, sich ihr eigenes neues und<br />
emanzipiertes Leitbild des Mannes und des Zusammenlebens<br />
zu entwerfen, denn sie sind nicht nur für Ökonomie<br />
und Herrschaft verantwortlich, sondern auch für die außerökonomischen<br />
Bestandteile der Gesellschaft, insbesondere<br />
wenn diese von der Ökonomie abhängen. Beispielsweise<br />
darf eine Verantwortung für die demografische Entwicklung<br />
und deren Folgen nicht den Frauen zugewiesen werden. Die<br />
„Wahlfreiheit“ für oder gegen Kinder, die bisher den Frauen<br />
auferlegt wurde, erfolgt zwar in der Familie, also im außerökonomischen<br />
Bereich. Unterschlagen wird dabei jedoch,<br />
dass diese im Prinzip persönlichen Entscheidungen durch<br />
Bedingungen in der Ökonomie und Verhaltensweisen der<br />
dort Verantwortlichen herbeigeführt, zumindest stark beeinflusst<br />
worden sind. Erste Schritte eines Umdenkens sind<br />
schon erreicht. Im Verhältnis zu den frühen Jahren der Bundesrepublik<br />
zeigen die langsam steigenden realen Zahlen<br />
von Vätern im Elternurlaub ein zunehmendes Interesse der<br />
Väter.<br />
Für die Zukunft fordern wir Frauen eine gerechter geteilte<br />
Verantwortung. Dazu gehören die Besetzungsquotierung in<br />
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und die partnerschaftliche<br />
Gestaltung von Ehe und Familie, einschließlich der Neubewertung<br />
von Produktion und Reproduktion.<br />
Neues Selbstverständnis der Frauen in den Gewerkschaften<br />
umsetzen<br />
Frauen in den Gewerkschaften müssen sich neu in Bezug<br />
auf die Frage positionieren, ob und inwieweit sie sich weiterhin<br />
in die „Politik für Alle“, in „das Allgemeine“ einordnen<br />
wollen, also ob und inwieweit weiterhin Kompromisse<br />
zu Gunsten vermeintlich allgemeiner Zielsetzungen gemacht<br />
werden, wobei die Aufgabe oder das Verschieben<br />
frauenpolitischer Interessen in Kauf zu nehmen ist. Sehr oft<br />
sind frauenpolitische Ziele so ins Hintertreffen geraten, auch<br />
weil sie nicht umsonst zu haben sind (z.B. wenn bei Tarif-<br />
runden Forderungsbestandteile dafür angerechnet werden).<br />
Die Gewerkschaften als gemischt-geschlechtliche Organisationen<br />
müssen dabei insgesamt überdenken, was dies für<br />
sie und ihre Mitgliederentwicklung bedeutet, wie das Zahlen-<br />
und Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen<br />
künftig sein soll und was die bisherigen Kompromisslinien<br />
für beide bedeuten.<br />
❚ Frauen, die integrativer Bestandteil einer demokratischen<br />
Organisation sein wollen, werden nicht länger hinnehmen,<br />
dass sie ihre Interessen öffentlich nicht vertreten,<br />
dass sie Forderungen nicht stellen können, ohne damit<br />
immer wieder vor die Entscheidung gestellt zu werden,<br />
sich mit der Vertretung ihrer Anliegen gegen Entscheidungen<br />
der Gesamtorganisation oder ein vermeintliches<br />
Gesamtinteresse wenden zu müssen. Dieser Konflikt ist<br />
auf Dauer unerträglich.<br />
❚ Die Gesamtorganisation muss deshalb bedenken, ob sie<br />
es sich weiterhin leisten kann und will, über „das Ganze“<br />
(aus männlicher Sicht) zu entscheiden, mit Gesamtentscheidungen<br />
zur Wirkungslosigkeit von Frauenpolitik beizutragen<br />
und ob sie so die Interessen der Frauen an den<br />
Rand stellen will.<br />
❚ Die gegenderte Besetzung in den gewerkschaftlichen Leitungen<br />
– z.B. an den Spitzen immer im „Doppelpack“ –<br />
wird zu einer der wesentlichen Voraussetzungen zur<br />
gleichberechtigten Umsetzung der Interessen von Männern<br />
und Frauen in der Organisation werden.<br />
Die bisherige Situation bindet nicht nur Energie und Kräfte,<br />
die sinnvoller eingesetzt werden können. Sie ist auch eine<br />
unerträgliche Situation, die aus Gründen der Gleichberechtigung<br />
zu verändern ist.<br />
A 003 Geschlechterspezifische Datenerhebungen<br />
und Statistiken<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Bayern<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong> wird aufgefordert, überall dort, wo er seinen Einfluss<br />
geltend machen kann, dafür zu sorgen, dass Datenerhebungen<br />
nach Geschlechtern getrennt erhoben werden,<br />
insbesondere beim Bundesamt für Statistik oder bei den<br />
Arbeitsmarktdaten.<br />
Begründung:<br />
Immer wieder werden Vorschläge zur Verbesserung der<br />
Situation von Frauen und Mädchen in der Arbeitswelt
dadurch erschwert, dass aktuelle und präzise Daten ihrer<br />
Situation fehlen und häufig, wenn überhaupt, viel zu spät<br />
geliefert werden.<br />
Zum Beispiel bei den Nachvermittlungsaktionen auf dem<br />
Ausbildungsstellenmarkt wurden nur geschlechterunspezifische<br />
Zahlen verwendet. Hier ist aber seit ein paar Jahren<br />
eine rückläufige Tendenz bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen<br />
durch Mädchen bzw. junge Frauen zu beobachten.<br />
A 004 Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft<br />
Antragsteller/in: IG Metall-Frauenausschuss beim Vorstand<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand setzt sich, nach dem Scheitern<br />
der am 2. Juli 2001 getroffenen „Vereinbarung zwischen<br />
der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der deutschen<br />
Wirtschaft zur Förderung der Chancengleichheit von<br />
Frauen und Männern in der Privatwirtschaft“, bei der Bundesregierung<br />
offensiv für ein Gleichstellungsgesetz für die<br />
Privatwirtschaft ein.<br />
Gleichzeitig fordern die Delegierten den Bundesvorstand<br />
des <strong>DGB</strong> auf, diese Forderung mit entsprechenden Aktivitäten<br />
und Aktionen zu unterstützen.<br />
Begründung:<br />
Bereits auf der 15. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz haben die<br />
Delegierten mit der Annahme des Antrages Nr. 15, trotz<br />
Abschluss der freiwilligen Vereinbarung, an der Forderung<br />
nach einer verbindlichen gesetzlichen Regelung zur Gleichstellungspolitik<br />
in der Privatwirtschaft festgehalten.<br />
Die damalige Aussage, dass eine solche Vereinbarung „ein<br />
Muster ohne Wert ist“, hat sich jetzt, mehr als 4 Jahre nach<br />
der Unterzeichnung, auch in der Praxis bestätigt.<br />
Nach Abschluss der Vereinbarung sollte es alle zwei Jahre –<br />
erstmalig 2003 – eine Bestandsaufnahme geben. Vom<br />
Ergebnis dieser Bestansaufnahme bzw. von der erfolgreichen<br />
Umsetzung hatte die Bundesregierung abhängig<br />
gemacht, ob sie Aktivitäten unternimmt, „um die Chancengleichheit<br />
von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft<br />
auf gesetzlichem Wege zu erreichen“.<br />
Auch wenn die von der Bundesregierung und der Wirtschaft<br />
vorgelegte Bilanz 2003 wenig verlässliche Zahlen bietet<br />
und eher einem Werbeprospekt gleicht, so gibt es doch<br />
andere Studien, die zeigen, an einer gesetzlichen Regelung<br />
führt kein Weg vorbei.<br />
Dazu gehört die Anfang 2004 vorgestellte Unternehmensbefragung<br />
im Auftrag des <strong>DGB</strong> und der Hans-Böckler-Stiftung:<br />
Nur die Hälfte der 500 befragten Unternehmen hatte überhaupt<br />
Kenntnis von der Vereinbarung. In 70 Prozent der<br />
befragten Unternehmen hatte sich der Frauenanteil in den<br />
letzten zwei Jahren nicht verändert, auch nicht beim Anteil<br />
von Frauen in Führungspositionen. In 12,6 Prozent der<br />
Unternehmen gab es gar keine Maßnahmen zur Förderung<br />
der Chancengleichheit; in mehr als 70 Prozent der Unternehmen<br />
waren keine weiteren Maßnahmen geplant.<br />
Auch eine erste Auswertung des Betriebspanels 2002 durch<br />
das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)<br />
zeigte ähnlich negative Ergebnisse:<br />
Nur in 9 Prozent aller Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten<br />
gab es betriebliche oder tarifliche Vereinbarungen zur<br />
Chancengleichheit. Freiwillige Vereinbarungen gab es nur in<br />
5,3 Prozent der Unternehmen.<br />
Die Untersuchungen belegen eindeutig, dass eine freiwillige<br />
Vereinbarung völlig unzureichend ist. Damit das Thema<br />
Chancengleichheit in Unternehmen nicht weiter im Schnekkentempo<br />
vorandümpelt, bedarf es also dringend einer<br />
neuen Initiative für ein Gleichstellungsgesetz in der Privatwirtschaft.<br />
A 005 Für nachhaltige Verbesserungen im<br />
Landesgleichstellungsrecht<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenausschuss der GEW<br />
Beschluss: Annahme mit Änderungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Landesgleichstellungsrecht verbessern, Rechte der<br />
Gleichstellungsbeauftragten stärken<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz setzt sich für nachhaltige<br />
Verbesserungen im Gleichstellungsrecht ein, damit Chancengleichheit<br />
und Gleichwertigkeit der Geschlechter als<br />
gesellschaftspolitische Ziele aktiv gefördert werden und<br />
Gleichstellungsbeauftragte die Interessen der weiblichen<br />
Beschäftigten wirksam vertreten können. Dafür sind verbindliche<br />
und ergebnisorientierte Gleichstellungsgesetze<br />
erforderlich, in deren Zielsetzungen ein Diskriminierungsverbot<br />
aufgrund des Geschlechts verankert ist und somit die<br />
individuellen Rechte der Frauen gestärkt werden.<br />
63
64<br />
Im Einzelnen fordert die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz:<br />
❚ Alle öffentlichen Einrichtungen, auch solche in privater<br />
Trägerschaft, sollen durch Landesgleichstellungsgesetze<br />
erfasst werden, wenn sie aus öffentlichen Mitteln finanziert<br />
werden.<br />
❚ Auf allen Entscheidungsebenen ist auch eine wirksame<br />
Interessenvertretung von Frauen durch Gleichstellungsbeauftragte<br />
verpflichtend zu regeln.<br />
❚ Auf jeder Ebene ist die in Bezug auf die Aufgabenstellung<br />
notwendige Freistellung der Gleichstellungsbeauftragten<br />
mit einer Staffelung in Abhängigkeit von der Zuständigkeit<br />
und mit einer Rechtssicherheit abzusichern.<br />
❚ Klage- und Widerspruchsrechte der Gleichstellungsbeauftragten<br />
sind in allen Landesgleichstellungsgesetzen einzuführen<br />
bzw. auszubauen und ihre Einwirkungsmöglichkeiten<br />
zu verbessern.<br />
❚ Eine optimale Interessenvertretung für die weiblichen<br />
Beschäftigten erfordert eine bessere Abstimmung der Personalvertretungsgesetze<br />
und Landesgleichstellungsgesetze<br />
in Bezug auf Mitbestimmungs-, Informations- und Mitwirkungsrechte.<br />
❚ Es sind klare Verbindlichkeiten in Bezug auf die Berichtspflichten<br />
der Dienststelle, die Erfolgskontrolle und die<br />
Erhöhung der Transparenz vorzugeben. Zu Analysen der<br />
Ausgangssituation, Frauenförder- und Gleichstellungsplänen,<br />
Zielvereinbarungen und Evaluationen der Zielerreichung<br />
sind Stellungnahmen der Gleichstellungsbeauftragten<br />
einzuholen.<br />
❚ Die Verantwortung der Führungskräfte für die Umsetzung<br />
der Gesetzesziele ist verbindlich zu regeln.<br />
Gegen den bedrohlich um sich greifenden Abbau der<br />
Geschlechterdemokratie in den Ländern<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert Landesregierungen<br />
und Parlamente auf, bei Verwaltungsreformen und anderen<br />
Umstrukturierungen sicherzustellen, dass die Vertretungsrechte<br />
der Gleichstellungsbeauftragten erhalten bleiben und<br />
ausgebaut werden. Dem Trend, mit der „Verschlankung“<br />
der Verwaltungsstrukturen auch die Mitbestimmungsrechte<br />
zu untergraben, muss entgegengewirkt werden. Es ist dringend<br />
geboten, die Auswirkungen für die weiblichen Beschäftigten<br />
zu analysieren und die Gleichstellungsbeauftragten<br />
frühzeitig in die Gestaltung der Prozesse einzubeziehen.<br />
Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst müssen auch nach<br />
einer Verwaltungsreform eine funktionsfähige Institution<br />
der Gleichstellungsbeauftragten haben, die auf allen Ebenen<br />
für Frauenförderung kompetent und wirksam agieren<br />
kann und damit auch ihren Einfluss gegen die Verschlechte-<br />
rung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten geltend<br />
machen kann.<br />
Gewerkschafts-Aktivitäten für Gleichstellungsbeauftragte<br />
ausbauen<br />
Um das Gleichstellungsrecht im Sinne der gewerkschaftlichen<br />
Interessenvertretung und der Förderung des gesellschaftspolitischen<br />
Ziels der Geschlechtergerechtigkeit zu<br />
fördern, sind eine enge Zusammenarbeit von Gewerkschafts-Gremien<br />
und Gleichstellungsbeauftragten sowie der<br />
Ausbau des Serviceangebots notwendig. Gewerkschaftlich<br />
organisierte Gleichstellungsbeauftragte sind eine wichtige<br />
Zielgruppe für Gewerkschafts-Aktivitäten, indem sie ihren<br />
Sachverstand in die Gewerkschafts-Politik einbringen und<br />
als Multiplikatorinnen für die Gewerkschaften vor Ort agieren.<br />
Der <strong>DGB</strong> und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes<br />
❚ beziehen die Expertise von Gleichstellungsbeauftragten in<br />
ihre Arbeit ein,<br />
❚ verstärken bzw. stabilisieren ihre Schulungs- und Informationsangebote<br />
für Gleichstellungsbeauftragte,<br />
❚ unterstützen ihre Netzwerke in den Gewerkschaften,<br />
❚ fördern die Zusammenarbeit zwischen Gleichstellungsbeauftragten<br />
und Personal- und Betriebsräten,<br />
❚ treten dafür ein, dass die Gleichstellungsbeauftragten<br />
stärker in die <strong>DGB</strong>-Aktivitäten zur Mitbestimmung einbezogen<br />
werden.<br />
Begründung:<br />
Die unbestreitbar vorhandenen Erfolge in der Gleichstellung<br />
von Männern und Frauen im öffentlichen Dienst in den vergangenen<br />
25 Jahren sind insbesondere auf die Wirkung der<br />
Landesgleichstellungsgesetze und auf das engagierte Handeln<br />
von Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten* zurückzuführen.<br />
Gleichstellungsbeauftragte nehmen vielfältige<br />
Aufgaben zur Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung<br />
von Männern und Frauen in Bildungsreinrichtungen<br />
und in öffentlichen Verwaltungen wahr. Sie nutzen ihre Mitbestimmungs-,<br />
Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte im<br />
Interesse der Frauen mit dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit.<br />
Dennoch sind die Standards der Landesgleichstellungsgesetze<br />
in den meisten Bundesländern noch nicht ausreichend.<br />
Hinzu kommt, dass ihre Wirksamkeit zurzeit durch<br />
zwei Entwicklungen ernsthaft bedroht ist: Novellierungen<br />
der Gleichstellungsgesetze und Verwaltungsreformen.<br />
Dennoch sind die Standards der Landesgleichstellungsgesetze<br />
in den meisten Bundesländern noch nicht ausreichend.<br />
Hinzu kommt, dass ihre Wirksamkeit zurzeit durch
zwei Entwicklungen ernsthaft bedroht ist: Novellierungen<br />
der Gleichstellungsgesetze und Verwaltungsreformen.<br />
Gleichstellungsgesetze der Länder in Verbindung mit Kommunalverfassungen,<br />
Schulgesetzen, Hochschulgesetzen,<br />
Gesetzen für die Polizei und das Richteramt und weitere<br />
Regelungen sind die Grundlagen für die Umsetzung des<br />
politischen Auftrags der Gleichstellung der Geschlechter im<br />
öffentlichen Dienst. Sie regeln die Zielsetzungen und Handlungsfelder<br />
in Bezug auf Frauenförderung und Gleichstellung<br />
sowie die Rechte und Pflichten der Gleichstellungsbeauftragten.<br />
Veränderungen in der gesamten Verwaltungsstruktur unterhöhlen<br />
die Vertretungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten<br />
– wie auch der Personal- und Betriebsräte. Mit Novellierungen<br />
der Gleichstellungsgesetze wird ihre Wirksamkeit<br />
zum Teil eingeschränkt. So entfällt z. B. in Hessen bei<br />
Anwendung einer Experimentierklausel die Pflicht, einen<br />
Frauenförderplan zu erstellen; in Niedersachsen soll das<br />
Gleichstellungsgesetz von einem Gesetz über die Vereinbarkeit<br />
von Erwerbs- und Familienarbeit abgelöst werden.<br />
Aktuelle Entwicklungen, wie Verwaltungsreformen, die Einführung<br />
neuer Steuerungsinstrumente oder auch allgemeine<br />
Sparmaßnahmen verändern die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten<br />
und gefährden die Mitbestimmungsrechte ihrer<br />
Interessenvertretungen. Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung<br />
erhalten mehr Eigenständigkeit in der Personalentwicklung<br />
und Mittelbewirtschaftung, die gesamte Verwaltungsstruktur<br />
wird verändert, u.a. werden Mittelbehörden<br />
in größere Einheiten eingegliedert (z. B. in Baden-Württemberg<br />
und Sachsen-Anhalt).<br />
Die aktuellen Entwicklungen im Gleichstellungsrecht und in<br />
der Gleichstellungspolitik und die absehbaren Folgen von<br />
Verwaltungsreformen und neuen Steuerungsinstrumenten<br />
machen es erforderlich, dass der <strong>DGB</strong> und die Gewerkschaften<br />
des öffentlichen Dienstes Position beziehen gegen<br />
den Abbau der Geschlechterdemokratie in den Ländern und<br />
für die Verbesserung des Landesgleichstellungsrechts und<br />
die Stärkung der Rechte der Gleichstellungsbeauftragten<br />
eintreten.<br />
Im Text wird aus Vereinfachungsgründen der Begriff Gleichstellungsbeauftragte<br />
verwendet. Die Bezeichnung für die<br />
Interessenvertretung der weiblichen Beschäftigten ist von<br />
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich – Gleichstellungsbeauftragte,<br />
Frauenbeauftragte, Frauenvertreterin,<br />
Ansprechpartnerin oder Vertrauensperson für die Gleichstellung<br />
von Frau und Mann.<br />
A 006 Keine Auflösung der Konferenz der<br />
Gleichstellungs- und Frauenminister/innen<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss West<br />
Beschluss: Annahme mit Änderungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Delegierten der 16. ordentlichen <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz<br />
stellen fest:<br />
Eigenständige Frauenpolitik muss erhalten bleiben – die<br />
Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister/innen<br />
darf nicht aufgelöst werden.<br />
Sie fordern deshalb die Ministerpräsidenten der Länder auf,<br />
sich für die Rücknahme des Beschlusses der 15. Konferenz<br />
der Gleichstellungs- und Frauenminister/innen (GFMK) einzusetzen.<br />
Die Delegierten der <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordern<br />
eine eigenständige und offensive Frauenpolitik, die nicht<br />
der Familienpolitik untergeordnet ist.<br />
Begründung:<br />
Am 3. Juni 2005 hat die GFMK mit den Stimmen der unionsgeführten<br />
Länder beschlossen, sich selbst aufzulösen.<br />
Ab 2007 soll dann dieses Thema nur noch gemeinsam mit<br />
der JugendministerInnenkonferenz unter dem Schwerpunkt<br />
Familienpolitik länderübergreifend behandelt werden.<br />
Die Auflösung dieses wichtigen koordinierenden Gremiums<br />
für Frauenpolitik auf Bundesebene ist ein verheerendes<br />
Signal.<br />
In keinem Bundesland ist die Gleichstellung von Frauen und<br />
Männern tatsächlich erreicht. Gleichstellungs- und Frauenpolitik<br />
braucht deshalb die bundesweite Zusammenarbeit<br />
und Koordinierung.<br />
A 007 Geschlechtergerechte Bildung von<br />
Anfang an<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenausschuss der GEW<br />
Beschluss: Annahme mit Änderungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die bildungspolitisch Verantwortlichen des Bundes und der<br />
Länder sind aufgefordert,<br />
❚ Voraussetzungen für eine geschlechtergerechte Bildung<br />
und Erziehung durch die Gestaltung von Gesetzen<br />
(KJHG, Schulgesetze, HRG, BBiG u.a.), durch Bildungs-<br />
65
66<br />
standards, Rahmenpläne, Curricula, Ausbildungsordnungen<br />
und organisatorische Vorgaben zu schaffen. Dabei<br />
sind das Ziel Geschlechterdemokratie und die Strategie<br />
des Gender Mainstreaming zu verfolgen und die<br />
geschlechterrelevante pädagogische Forschung zu stärken.<br />
Alle bildungspolitischen Maßnahmen sind auf den<br />
Geschlechteraspekt hin zu überprüfen;<br />
❚ eine geschlechtergerechte frühkindliche Pädagogik zu fördern.<br />
Dazu gehört, entsprechende Bildungsprogramme zu<br />
entwickeln, die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher<br />
auf Hochschulniveau zu heben und dabei die geschlechtersensible<br />
Aus- und Fortbildung voranzutreiben;<br />
❚ die Umsetzung einer spezifischen Jungenpädagogik im<br />
Bildungsalltag voranzutreiben und den Einsatz männlicher<br />
Pädagogen, insbesondere in Kindertageseinrichtungen<br />
und Grundschulen, zu forcieren;<br />
❚ die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen und<br />
Pädagogen für alle Bildungsstufen so zu gestalten, dass<br />
die Professionellen im Bildungsbereich für die Ausgestaltung<br />
einer geschlechtergerechten Bildung befähigt werden.<br />
Ausbildungsgegenstände sind u.a. die Reflexion der<br />
eigenen Geschlechterrolle, der Umgang mit geschlechterdifferenten<br />
Selbstkonzepten, die Diagnosefähigkeit und<br />
die Anwendung von Gender Mainstreaming in der inhaltlichen<br />
und organisatorischen Gestaltung von Bildungsprozessen;<br />
❚ Maßnahmen zur Überwindung der fächer- bzw. berufsbildbezogenen<br />
Verteilung der Geschlechter in der Berufsausbildung<br />
zu ergreifen (z.B. durch die Aufwertung von<br />
sog. Frauenberufen und die Ausweitung des Spektrums in<br />
der dualen Berufsausbildung);<br />
❚ das Studienangebot an Hochschulen an den Studieninteressen<br />
und Berufswünschen von Frauen auszurichten und<br />
die Ergebnisse der Frauen- und Geschlechterforschung in<br />
Lehre und Studium einzubeziehen.<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert die Bildungsforschung<br />
auf, deutlich mehr geschlechterdifferenzierte Expertisen<br />
zur Verfügung zu stellen und geschlechtsbezogene<br />
Fragen stärker in künftige Leistungsstudien sowie in die<br />
Entwicklung von Bildungsstandards zu integrieren.<br />
Bildungseinrichtungen – von Kindertagesstätten und Schulen<br />
über Ausbildungsbetriebe und Hochschulen bis zur Weiterbildung<br />
– haben die Aufgabe, mit ihren Möglichkeiten<br />
für die Aufhebung einengender Rollenzuschreibungen bei<br />
Mädchen und Jungen, Frauen und Männern hinzuwirken.<br />
Angesichts der gravierenden Unterschiede in den Bildungsbiografien<br />
von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern<br />
müssen die strukturellen Probleme in der Berufsausbildung<br />
und an Hochschulen sowie beim Übergang aus dem Bil-<br />
dungs- in das Beschäftigungssystem gelöst werden. Mädchen<br />
und junge Frauen können ihre Potenziale und Qualifikationen<br />
in der Berufsausbildung und im Studium nicht<br />
adäquat nutzen, die Trennung in „typisch männliche“ und<br />
„typisch weibliche“ Ausbildungs-, Studien- und Arbeitsmärkte<br />
versperrt ihnen viele Wege auf dem Arbeitsmarkt<br />
und im Beruf.<br />
Begründung:<br />
Die geschlechtsbezogenen Erkenntnisse aus den internationalen<br />
und nationalen Schulleistungsstudien zeigen, dass<br />
Bildung und Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland<br />
Geschlechterstereotype reproduziert – und dies wesentlich<br />
stärker als in anderen Ländern. Die Schlussfolgerung kann<br />
nur lauten: Eine geschlechtergerechte Bildung und Erziehung<br />
muss verwirklicht werden, damit Frauen und Männer<br />
die Chance haben, ihre Kompetenzen in Beruf und Gesellschaft<br />
zu entfalten!<br />
Die zu beobachtenden Geschlechterdifferenzen in der Kompetenzentwicklung<br />
und in der Bildungsbeteiligung von<br />
Mädchen und Jungen sind das Ergebnis eines komplexen<br />
Zusammenspiels vieler Faktoren. Einen wesentlichen Anteil<br />
daran haben Bildungs- und Erziehungsprozesse. Geschlechterrollen<br />
sind Ergebnisse von Sozialisationsprozessen, sie<br />
werden durch soziale Interaktion ‚gelernt’ und können folglich<br />
als veränderbar begriffen werden.<br />
Geschlechtergerechte Bildung erfordert, dass Pädagoginnen<br />
und Pädagogen und alle für Bildung Verantwortlichen sich<br />
ihrer jeweiligen Rolle bewusst sind und sich mit ihrem Vorbildcharakter<br />
als Frau bzw. als Mann auseinandersetzen.<br />
Gerade in der frühen Kindheit werden durch das Rollenverhalten<br />
(‚doing gender’) der Eltern bzw. der Bezugspersonen<br />
und des pädagogischen Personals in den Kindertageseinrichtungen<br />
Geschlechterrollen gelernt. Darum muss die<br />
geschlechtergerechte Erziehung und Bildung im frühesten<br />
Alter der Kinder beginnen. In Schulen ist der Bildungsprozess<br />
so zu gestalten, dass er die genderbezogenen Benachteiligungen<br />
und ebenso die genderbezogenen Stärken von<br />
Mädchen und Jungen reflektiert, differenzierende Methoden<br />
berücksichtigt und vielfältige Unterrichts- und Förderangebote<br />
enthält.<br />
Der internationale Schulleistungsvergleich PISA hat in<br />
besonderer Art und Weise das Thema Bildung und<br />
Geschlecht in die öffentliche Diskussion gebracht und den<br />
bildungspolitischen Handlungsdruck aufgezeigt. In keinem<br />
Land ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft<br />
und Schulleistungen so groß wie in Deutschland. Darüber<br />
hinaus hat die Studie Deutschlands Bildungswesen eine<br />
ausgeprägt hohe Geschlechterdifferenz bescheinigt.
Der wohl alarmierendste Befund: Ein Viertel der deutschen<br />
Jungen verfügt gegen Ende ihrer Schulpflicht über eine so<br />
geringe Lesekompetenz, dass ihre Chancen für die Beteiligung<br />
an Gesellschaft, Erwerbsarbeit und weiterer Bildung<br />
sehr schlecht sind; aber auch jedes 6. Mädchen gehört zu<br />
dieser Risikogruppe. Mehr als die Hälfte der Jungen in<br />
Deutschland lesen nicht zum Vergnügen bzw. „nur, wenn<br />
ich muss“. Dies gilt auch für ein knappes Drittel der Mädchen.<br />
Dabei sind sie auf ihre Lesefreude extrem angewiesen,<br />
bieten doch die Ganztagsschulen der anderen Länder<br />
den Jugendlichen wesentlich mehr Lesegelegenheiten als<br />
die deutsche Halbtagsschule. Dies durch Familie und soziales<br />
Umfeld auszugleichen, kann nur bei wenigen Jugendlichen<br />
gelingen.<br />
Auch bezüglich der mathematischen Kompetenz verdeutlicht<br />
PISA den pädagogischen und bildungspolitischen<br />
Handlungsbedarf, deutsche Jugendliche erreichen nur einen<br />
schlechten Rang.<br />
Der Abstand zur internationalen Spitze ist bei den deutschen<br />
Mädchen besonders groß: Zwischen den Mittelwerten<br />
der japanischen und der deutschen Mädchen liegt eine<br />
ganze Kompetenzstufe. Darüber hinaus haben die Mädchen<br />
einen überproportionalen Anteil an den ganz schwachen<br />
Mathematikleistungen. Leistungen in Mathematik sind<br />
auch eine Frage des Selbstvertrauens. In den TIMSS-Untersuchungen<br />
wurde zuvor schon (von Baumert u. a.) festgestellt,<br />
dass sich Mädchen und Jungen in einer unterschiedlichen<br />
motivationalen Lage befinden: Mädchen seien verstärkt<br />
Selbstzweifeln und Leistungsängsten ausgesetzt und<br />
vertrauten weniger auf die eigenen allgemeinen schulischen<br />
Fähigkeiten. In den Fächern Mathematik und Physik<br />
bestehen große Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen<br />
hinsichtlich Interessen und Selbstkonzept. Diese Differenzen<br />
sind nicht nur durch Leistungsunterschiede zu erklären.<br />
Im Fach Biologie treten dagegen kaum bedeutsame<br />
Geschlechtsunterschiede auf.<br />
Das Selbstkonzept ist eine multifunktionale Größe. Die subjektiven<br />
Theorien, die eine Person über das Lernen entwickelt,<br />
enthalten Annahmen über die eigene Kompetenz<br />
und über die Effektivität von Anstrengungen. Mitglieder<br />
von Gruppen, über die ein negatives Stereotyp in Bezug auf<br />
ihre Kompetenz besteht („Mädchen sind nicht begabt für<br />
Mathematik, Physik“), werden allein durch das Wissen um<br />
die Existenz dieses Vorurteils in ihren Leistungen beeinträchtigt.<br />
Mädchen verlieren im Verlaufe ihrer Schulzeit –<br />
insbesondere in der Phase der Pubertät/Adoleszenz – insgesamt<br />
an Selbstvertrauen, sie entwickeln z. B. trotz guter<br />
Leistungen im Fach Mathematik kein angemessenes Selbstvertrauen.<br />
Während für Mädchen in reinen Mädchenklassen das<br />
Erwachsensein und folglich auch Leistung im Vordergrund<br />
steht, ist für Mädchen in gemischten Klassen vor allem die<br />
Geschlechtszugehörigkeit und damit die Anerkennung beim<br />
anderen Geschlecht wichtig.<br />
Dies führt in männlich dominierten Fächern in einen Konflikt,<br />
weil die weibliche Geschlechtsorientierung im Widerspruch<br />
zu guten Leistungen in „männlichen“ Domänen gilt<br />
und vom anderen Geschlecht – aber auch von der eigenen<br />
peer-group! – nicht geschätzt wird.<br />
<strong>Soziale</strong> Kompetenzen wie Kooperation und Kommunikation<br />
werden für eine erfolgreiche Lebensführung immer wichtiger.<br />
Sie werden als ‚Schlüsselqualifikationen’ am häufigsten<br />
gefordert. Dabei handelt es sich aber um eine komplexe<br />
Handlungskompetenz, die kognitive, emotionale und motivationale<br />
Aspekte sowie Werthaltungen einschließt. Laut<br />
PISA 2000 sind Mädchen stärker sozial orientiert und zeigen<br />
mehr Hilfsbereitschaft. Jungen zeigen dagegen wesentlich<br />
stärker aggressives Verhalten als Mädchen; aggressives<br />
Verhalten wird allerdings auch bei Jungen weniger sanktioniert<br />
als bei Mädchen. Besonders ausgeprägt sind die<br />
Geschlechterunterschiede im Bereich Empathie und Unterstützung<br />
Gleichaltriger. Für diese Ergebnisse spielt die<br />
Schulform eine bedeutende Rolle, nicht aber Migrationshintergrund<br />
oder deutsche Herkunftsfamilie.<br />
Die Bildungsbeteiligung der Mädchen hat enorm zugenommen.<br />
Bei Mädchen wird früher als bei Jungen die Schulreife<br />
festgestellt (bzw. unterstellt); Jungen sind bei Klassenwiederholungen<br />
stärker beteiligt; in den Hauptschulen sind<br />
Mädchen unterrepräsentiert, in den Gymnasien sind sie<br />
überproportional beteiligt. Je höher der Schulabschluss,<br />
desto höher der Anteil von Mädchen. Auch für Jugendliche<br />
mit Migrationshintergrund sieht es ähnlich aus. Es gelingt<br />
bislang nicht, Jungen in gleichem Maße wie Mädchen<br />
Gymnasien und Realschulen zuzuweisen, und es gelingt<br />
nicht, innerhalb der Schulformen Mädchen und Jungen<br />
angemessen zu fördern. Für Frauen und Mädchen bestehen<br />
trotz besserer schulischer Abschlüsse eine ganze Reihe von<br />
Benachteiligungen: Fehlende Umsetzung der schulischen<br />
Erfolge in berufliche Erfolge, sexualisierte Gewalt, sozialer<br />
Druck aufgrund von Geschlechtsrollen oder Geschlechtsrollenstereotype<br />
und die mangelnde Repräsentanz von Frauen<br />
in Führungspositionen des Bildungswesens. Der insgesamt<br />
größere Erfolg der Mädchen im allgemein bildenden Schulwesen<br />
setzt sich in der Berufsausbildung und im Arbeitsleben<br />
n i c h t fort. Die typischen Frauenberufe finden sich<br />
vor allem im Dienstleistungssektor, sie umfassen als charakteristische<br />
Tätigkeiten „Verkaufen, Assistieren und Helfen“.<br />
Weiterhin nimmt ein großer Anteil Frauen trotz entspre-<br />
67
68<br />
chender Qualifikation kein Hochschulstudium auf, was u.a.<br />
auch an den strukturellen Defiziten im Studienangebot<br />
liegt.<br />
Jahrzehntelang galten Mädchen als das schwächere – zu<br />
fördernde, zu unterstützende – Geschlecht. Haben sich jetzt<br />
die Verhältnisse umgekehrt?<br />
Als Schulversager entpuppen sich die Jungen; sie sind überdurchschnittlich<br />
anfällig für Krankheiten, sind psychisch<br />
weniger belastbar als Mädchen, begehen häufiger Selbstmord,<br />
sie stellen den weitaus größeren Anteil der ADHS-<br />
Patienten und der jugendlichen Gewalttäter bzw. Rechtsextremisten.<br />
Die Entwicklung und Umsetzung einer spezifischen<br />
Jungenpädagogik ist notwendig. Jungen brauchen<br />
Unterstützung in so wichtigen Bereichen wie Kommunikations-<br />
und Kooperationsfähigkeit und im sozialen Verhalten.<br />
Dies ist allerdings nicht herausgelöst aus einer unreflektierten<br />
koedukativen Bildung denkbar, sondern ist nur möglich<br />
unter den Vorzeichen einer geschlechtergerechten Bildung<br />
und Erziehung, die Mädchen und Jungen optimal fördern<br />
will und sie in der Entwicklung ihrer Potenziale unterstützt.<br />
A 008 Ausweitung der Umlagefinanzierung<br />
der Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld<br />
durch die Arbeitgeber auf alle<br />
Betriebe<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenvorstand der IG BAU<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Bundesfrauenkonferenz fordert die Einbeziehung aller<br />
Betriebe in die Umlagefinanzierung der Zuschüsse zum<br />
Mutterschaftsgeld.<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand möge auf den Gesetzgeber einwirken,<br />
eine entsprechende Regelung, wie auch das Bundesverfassungsgericht<br />
vorschlägt, zu schaffen.<br />
Begründung:<br />
Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem veröffentlichten<br />
Beschluss vom 18. November 2003 festgestellt, dass die<br />
derzeitige Belastung der Arbeitgeber durch die Verpflichtung<br />
zur Zahlung eines Zuschusses zum Mutterschaftsgeld<br />
ein Einstellungshindernis für Frauen im „gebärfähigen<br />
Alter“ darstellt. Der Gesetzgeber ist deshalb gehalten, die<br />
finanzielle Belastung der Arbeitgeber bis Ende 2005 so auszugestalten,<br />
dass eine faktische Diskriminierung von Frauen<br />
vermieden wird. Dies könnte durch ein auf alle Betriebe<br />
ausgedehntes Ausgleichs- und Umlageverfahren geschehen,<br />
wobei jedes Unternehmen pro Kopf der Belegschaft einen<br />
Umlagebetrag zahlt und dafür die Kosten für das Mutterschaftsgeld<br />
erstattet bekommt. Dieses Verfahren gilt derzeit<br />
nur für kleine Betriebe mit maximal 30 Beschäftigten und<br />
hat sich bewährt.<br />
A 009 Ausweitung der Umlagefinanzierung<br />
der Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld<br />
durch die Arbeitgeber auf alle<br />
Betriebe<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Bayern<br />
Beschluss: Erledigt durch Annahme von Antrag<br />
A 008<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die <strong>DGB</strong> Bundesfrauenkonferenz fordert die Einbeziehung<br />
aller Betriebe in die Umlagefinanzierung der Zuschüsse zum<br />
Mutterschaftsgeld.<br />
Der <strong>DGB</strong> möge auf den Gesetzgeber einwirken, eine entsprechende<br />
Regelung, wie sie auch das Bundesverfassungsgericht<br />
vorschlägt, zu schaffen.<br />
Begründung:<br />
Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem veröffentlichten<br />
Beschluss vom 18. November 2003 festgestellt, dass die<br />
derzeitige Belastung der Arbeitgeber durch die Verpflichtung<br />
zur Zahlung eines Zuschusses zum Mutterschaftsgeld<br />
ein Einstellungshindernis für Frauen im "gebärfähigen<br />
Alter" darstellt. Der Gesetzgeber ist deshalb gehalten, die<br />
finanzielle Belastung der Arbeitgeber bis Ende 2005 so auszugestalten,<br />
dass eine faktische Diskriminierung von Frauen<br />
vermieden wird. Dies könnte durch ein auf alle Betriebe<br />
ausgedehntes Ausgleichs- und Umlageverfahren geschehen,<br />
wobei jedes Unternehmen pro Kopf der Belegschaft einen<br />
Umlagebetrag zahlt und dafür die Kosten für das Mutterschaftsgeld<br />
erstattet bekommt. Dieses Verfahren gilt derzeit<br />
nur für kleine Betriebe mit maximal 30 Beschäftigten und<br />
hat sich bewährt.
A 010 Antidiskriminierungsgesetz<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss West<br />
Beschluss: Annahme mit folgenden Änderungen:<br />
Die Delegierten der <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordern<br />
die Umsetzung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinien in<br />
nationales Recht mit den Inhalten des Gesetzentwurfes für<br />
ein Antidiskriminierungsgesetz, wie es der Bundestag am<br />
17.06.2005 in der letzten Legislaturperiode bereits<br />
beschlossen hatte.<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Delegierten der <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz begrüßen<br />
den Gesetzentwurf des Antidiskriminierungsgesetzes,<br />
beschlossen im Bundestag am 17.06.2005.<br />
Begründung:<br />
Am 17. Juni wurde das Gesetz im Bundestag verabschiedet.<br />
Nun droht das Gesetz im Bundesrat zu scheitern, weil die<br />
unionsregierten Länder den Vermittlungsausschuss anrufen<br />
wollen.<br />
Diese Verzögerung hätte mehrere Millionen Euro an Strafgeldern<br />
zur Folge!<br />
Das Antidiskriminierungsgesetz ist ein Anfang auf dem Weg<br />
zur Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft.<br />
Die Sensibilisierung unserer Gesellschaft für die immer noch<br />
bestehenden Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht,<br />
ethnischer Herkunft, sexueller Identität, Behinderung, Alter<br />
oder Religion/Weltanschauung, halten die Delegierten für<br />
äußerst wichtig.<br />
Die geringe Anzahl von Frauen in Führungspositionen, die<br />
Ergebnisse des Einkommensberichts, wonach selbst bei<br />
gleichwertiger und gleicher Arbeit Frauen häufig bis zu 20<br />
% weniger verdienen als Männer sowie die Schwierigkeiten<br />
für berufstätige Mütter bei der – ihnen zugeschriebenen –<br />
Vereinbarkeit von Beruf und Familie belegen sehr deutlich,<br />
dass Deutschland in dieser Frage immer noch keine diskriminierungsfreie<br />
Zone ist.<br />
Die Angriffe gegen das Antidiskriminierungsgesetz, insbesondere<br />
durch die Stimmungsmache der Arbeitgeber, weisen<br />
die Delegierten aufs schärfste zurück.<br />
Die Delegierten fordern den Bundesrat auf, das überfällige<br />
Antidiskriminierungsgesetz nicht zu blockieren.<br />
I 002 Initiativantrag Nr. 2<br />
Rote Karte gegen Zwangsprostitution<br />
Unterstützung und Beteiligung an der<br />
Kampagne des Deutschen Frauenrates<br />
anlässlich Fußball-WM 2006<br />
Antragsteller/in: Vera Morgenstern (ver.di) u.a.<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die <strong>DGB</strong>-Frauen unterstützen und beteiligen sich an der<br />
Kampagne des Deutschen Frauenrates gegen Menschenhandel<br />
und Zwangsprostitution, insbesondere anlässlich der<br />
Fußball-Weltmeisterschaft 2006, und fordern den <strong>DGB</strong> und<br />
seine Gewerkschaften auf, sich an der Kampagne zu beteiligen.<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert die nationalen und<br />
internationalen Verbände der Fußballweltmeisterschaft,<br />
Spielervereinigungen, Hotel- und Gaststättenverbände,<br />
Stadtverwaltungen, u. a. Sportdezernate, und Medien auf,<br />
das ihre dazu beizutragen, dass die Fußballweltmeisterschaft<br />
kein Anlass für Menschenhandel und Zwangsprostitution<br />
wird. Vielmehr sind die Organisatoren und Beteiligten<br />
der WM aufgefordert, ihre besondere Verantwortung<br />
darin zu sehen, den Fußball auch in dieser Angelegenheit<br />
„clean“ zu halten.<br />
Gleichzeitig bekräftigt die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz die<br />
Forderung auch der Gewerkschaften nach deutlich verbesserten<br />
Maßnahmen zum Schutz der Opfer von Menschenhandel.<br />
Dazu gehören u. a. verbesserte Zeuginnenschutzprogramme,<br />
ein sicheres Bleiberecht auch über die für eine<br />
Prozessführung notwendige Anwesenheit hinaus, falls den<br />
Betroffenen in ihren Herkunftsländern kein sicherer Aufenthalt<br />
garantiert ist, großzügige psychosoziale Hilfen, die<br />
finanzielle Absicherung entsprechender Beratungsstellen<br />
sowie die Gewährung von Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten.<br />
Begründung:<br />
Auf seiner Mitgliederversammlung hat der Deutsche Frauenrat<br />
am 6.11.05 beschlossen, seine bisherigen Aktivitäten<br />
gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution im Rahmen<br />
der Fußball-WM 2006 mit einer Kampagne fortzusetzen.<br />
Hintergrund ist die zu erwartende Zunahme von Prostitution<br />
an den Austragungsorten der Spiele. In diesem<br />
Zusammenhang befürchten Menschenrechts- und Frauenorganisationen<br />
eine Ausweitung von Menschenhandel und<br />
Zwangsprostitution.<br />
69
70<br />
Für die Kampagne soll ein breites Bündnis aus Frauen- und<br />
Menschenrechtsorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften<br />
und Einzelpersonen geschlossen werden. Als Unterstützer<br />
angefragt werden auch noch einmal die nationalen und<br />
internationalen Organisatoren der Fußball-Weltmeisterschaft,<br />
der Deutsche Fußballbund, die Nationalspieler und<br />
die Oberbürgermeisterinnen der zwölf Spielstätten. Die meisten<br />
dieser Adressaten haben auf einen ersten Appell des<br />
Deutschen Frauenrates, als „Männer gegen Menschenhandel<br />
und Zwangsprostitution“ öffentlich Stellung zu beziehen,<br />
bislang gar nicht oder ablehnend reagiert.<br />
<strong>Sachgebiet</strong> B: Entgelt / Einkommen<br />
B 001 Entschließung zur diskriminierungsfreien<br />
Tarifpolitik – Weiterentwicklung<br />
einer geschlechterdemokratischen<br />
Tarifpolitik<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Bayern<br />
Beschluss: Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesfrauenausschuss<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Bundesfrauenkonferenz bekräftigt folgende Grundsätze:<br />
Diskriminierungsfreie Tarifverträge sind auf Grund ihres<br />
demokratischen Grundverständnisses sowie aus rechtlichen<br />
Gründen geboten. Es gilt darauf zu achten, dass niemand<br />
aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, Rasse, ethnischen<br />
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, des<br />
Alters und der sexuellen Ausrichtung benachteiligt wird.<br />
Das grundrechtliche Gebot der Gleichbehandlung von Frauen<br />
und Männern in Tarifverträgen bedeutet im Einzelnen:<br />
❚ Gewährleistung des Grundsatzes des gleichen Entgelts<br />
für gleiche und gleichwertige Arbeit (vgl. Artikel 141 des<br />
EG-Vertrages).<br />
❚ Dies beinhaltet, dass tarifliche Entgeltsysteme Tätigkeiten<br />
von Frauen und Männern nach "gemeinsamen Kriterien"<br />
bewerten. Sie müssen so beschaffen sein, dass "Diskriminierungen<br />
auf Grund des Geschlechts ausgeschlossen<br />
werden" (vgl. Richtlinie 75/117/EWG).<br />
❚ Diskriminierungen in tariflichen Entgeltsystemen können<br />
ausgeschlossen werden, wenn folgende weitere Grundsätze<br />
des Europäischen Gerichtshofes berücksichtigt werden:<br />
❚ Durchschaubarkeit<br />
❚ Verwendung von Differenzierungskriterien, die<br />
a) einen Bezug zur Tätigkeit haben (objektive Kriterien)<br />
b) diskriminierungsfrei ausgelegt sind<br />
c) die für die zu verrichtende Arbeit charakteristisch sind,<br />
❚ gerechte Berücksichtigung aller Kriterien, die für Tätigkeiten<br />
im Tarifbereich bedeutsam sind,<br />
❚ und diskriminierungsfreie Gewichtung der Kriterien.<br />
Die vorgenannten Grundsätze beziehen sich gemäß Artikel<br />
141 EG-Vertrag auf sämtliche Entgeltbestandteile, die<br />
Beschäftigten in bar oder in Sachleistungen gezahlt werden.<br />
Als tariflich geregelte Entgelte sind insbesondere angesprochen:<br />
Grundentgelte, leistungsbezogene Komponenten,<br />
Zuschläge, Zuschüsse, Urlaubsgeld, Sonderzahlungen, soziale<br />
Leistungen, Besitzstandsregelungen, geldwerte Zeitäquivalente<br />
etc. Jeder Entgeltbestandteil muss für sich betrachtet<br />
dem Grundsatz des gleichen Entgelts genügen.<br />
Diskriminierungen sind nicht nur in Entgelttarifverträgen,<br />
sondern auch in Manteltarifverträgen möglich. Auch sie<br />
müssen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Geschlechter<br />
berücksichtigen, so etwa bei Regelungen, die<br />
Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Freistellungen, Qualifizierungen<br />
oder den Geltungsbereich betreffen (vgl. Richtlinie<br />
2002/73/EG).<br />
Zur weiteren Umsetzung einer diskriminierungsfreien Tarifpolitik<br />
sind folgende Maßnahmen sinnvoll:<br />
1. Bestandsaufnahme<br />
Es ist ein Bericht über die bisherigen Aktivitäten zur<br />
geschlechtergerechten Tarifpolitik zu erstellen. Dieser<br />
Bericht dient auch der Entwicklung einer tarifpolitischen<br />
Umsetzungsstrategie.<br />
2. Erarbeitung von Instrumenten<br />
Unter der Federführung des <strong>DGB</strong> Bundesfrauenausschusses<br />
werden Instrumente (Checklisten, Prüffragen und<br />
andere) für die Einzelgewerkschaften zur Überprüfung<br />
von Tarifverträgen auf ihr Diskriminierungspotential entwickelt.<br />
Sie sollen den Tarifverantwortlichen in den Einzelgewerkschaften<br />
eine Analyse der Tarifverträge und<br />
eine Einschätzung des gleichstellungspolitischen Handlungsbedarfs<br />
ermöglichen.<br />
3. Dokumentation<br />
Ausgehend von der Bestandsaufnahme müssen die Entwicklungs(fort)schritte<br />
auf dem Weg zu diskriminierungsfreien<br />
Tarifverträgen systematisch erfasst und dokumentiert<br />
werden. Dem <strong>DGB</strong> Bundesvorstand ist darüber<br />
regelmäßig zu berichten.<br />
4. Entwicklung von Strategien zur Durchsetzung<br />
Um die tarifpolitischen Ziele zu erreichen, bedient sich<br />
der <strong>DGB</strong> in der Umsetzung folgender Ansätze:
❚ Durch eine Informations- und Qualifizierungsoffensive<br />
sollen das Wissen über die Gleichstellungsproblematik<br />
und die Sensibilität für das Problem erhöht werden. Der<br />
<strong>DGB</strong> erarbeitet hierzu einen Aktionsplan für eine entsprechende<br />
Kampagne.<br />
❚ Parallel dazu ist die Diskussion auf rechtspolitischer<br />
Ebene, innerhalb und außerhalb des <strong>DGB</strong> zu intensivieren.<br />
Hierzu gehört es, gestützt auf die Ergebnisse des<br />
IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung),<br />
sowohl Tarifkommissionsmitglieder als auch betriebliche<br />
Interessenvertretungen über das Gleichbehandlungsrecht<br />
zu informieren und zu qualifizieren.<br />
❚ In Tarifbereichen, in denen die Rahmenbedingungen<br />
dies zulassen, werden gleichstellungspolitsche Tagungen<br />
für Ehren- und Hauptamtliche durchgeführt, in<br />
denen diskriminierungsfreie Tarifverträge entwickelt<br />
werden. Zu konkreten tarifpolitischen Forderungen werden<br />
Schritte zur Durchsetzung erarbeitet und systematisch<br />
weiterverfolgt.<br />
❚ Zusammen mit den frauen- und tarifpolitischen Gremien<br />
der Einzelgewerkschaften sind beispielhaft Veränderungen<br />
durchzusetzen, zu dokumentieren, auszuwerten<br />
und zu veröffentlichen, um eine Veränderung in<br />
Richtung diskriminierungsfreier Regelungen zu erreichen.<br />
B 002 Für einen gesetzlichen Mindestlohn<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenausschuss der Gewerkschaft<br />
Nahrung-Genuss-Gaststätten<br />
Beschluss: Annahme des Abänderungsantrages<br />
(G 001):<br />
Die Delegierten der 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordern<br />
die Bundesregierung auf, einen gesetzlichen Mindestlohn,<br />
der deutlich über der Armutsgrenze liegt, einzuführen.<br />
Wir fordern den <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand unter Einbeziehung<br />
des <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschusses bei Beteiligung aller<br />
Mitgliedsgewerkschaften auf, die konkrete Ausgestaltung<br />
eines Gesetzentwurfes zu diskutieren und zu koordinieren.<br />
Hierbei sind tarifliche Regelungen der Gewerkschaften des<br />
<strong>DGB</strong> zu berücksichtigen.<br />
Es ist von der Bundesregierung sicherzustellen, dass Verstöße<br />
gegen das Mindestlohngesetz wirksam sanktioniert werden.<br />
Eine Maßnahme wäre, das Verbandsklagerecht der<br />
Gewerkschaften gegen Verstöße gegen Tarifverträge um<br />
Verstöße gegen gesetzliche Mindeststandards zu erweitern.<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Delegierten der 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordern<br />
die Bundesregierung auf, einen gesetzlichen Mindestlohn,<br />
der deutlich über der Armutsgrenze liegt, einzuführen.<br />
Es ist von der Bundesregierung sicherzustellen, dass Verstöße<br />
gegen das Mindestlohngesetz wirksam sanktioniert werden.<br />
Eine Maßnahme wäre, das Verbandsklagerecht der Gewerkschaften<br />
gegen Verstöße gegen Tarifverträge um Verstöße<br />
gegen gesetzliche Mindeststandards zu erweitern.<br />
G 001 Abänderungsantrag zu B 002<br />
Antragsteller/in: Birgit von Garrel (IGM) u.a.<br />
Beschluss: Annahme<br />
Antrag B002 wird mit dem Abänderungsantrag<br />
G001 angenommen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Delegierten der 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordern<br />
die Bundesregierung auf, einen gesetzlichen Mindestlohn,<br />
der deutlich über der Armutsgrenze liegt, einzuführen.<br />
Wir fordern den <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand unter Einbeziehung<br />
des <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschusses bei Beteiligung aller<br />
Mitgliedsgewerkschaften auf, die konkrete Ausgestaltung<br />
eines Gesetzentwurfes – ob bundeseinheitlich oder orientiert<br />
an tariflichen Regelungen von Branchen – zu diskutieren<br />
und zu koordinieren. Hierbei sind tarifliche Regelungen<br />
der Gewerkschaften des <strong>DGB</strong> zu berücksichtigen.<br />
Es ist von der Bundesregierung sicherzustellen, dass Verstöße<br />
gegen das Mindestlohngesetz wirksam sanktioniert werden.<br />
Eine Maßnahme wäre, das Verbandsklagerecht der Gewerkschaften<br />
gegen Verstöße gegen Tarifverträge um Verstöße<br />
gegen gesetzliche Mindeststandards zu erweitern.<br />
B 003 Gesetzlicher Mindestlohn<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Baden-<br />
Württemberg<br />
Beschluss: Annahme als Material zu Antrag<br />
B 002<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
dass an den <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand der Auftrag erteilt wird,<br />
sich für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes,<br />
soweit vorhanden mindestens auf Basis der Flächentarifverträge<br />
der jeweiligen Branche an Stelle oder in Ergänzung<br />
71
72<br />
zur reinen Ausweitung des bestehenden Entsendegesetzes,<br />
einzusetzen.<br />
Begründung:<br />
❚ Immer mehr Arbeitnehmer/innen sind nicht mehr in der<br />
Lage, mit einem Vollzeitarbeitsverhältnis ihren Lebensunterhalt<br />
zu sichern. Dies betrifft zurzeit vor allem Arbeitnehmer/innen<br />
in Kleinst- und Mittelbetrieben bzw. in<br />
einem starken Maß den Dienstleistungssektor. In diesen<br />
Bereichen trifft es überproportional Frauen.<br />
❚ Die tarifliche Landschaft ist gekennzeichnet durch Tarifflucht<br />
und Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden<br />
ohne Tarifbindung. Ganze Branchen, insbesondere auch<br />
in den neuen Bundesländern, unterliegen keinen Tarifverträgen<br />
mehr.<br />
❚ In bestehenden Tarifbereichen erhöht sich der Druck auf<br />
Einführung von Niedriglohngruppen. Ängste aufgrund<br />
der EU-Osterweiterung üben hier einen erheblichen<br />
Druck aus.<br />
❚ Ein gesetzlicher Mindestlohn muss eine Grundsicherung<br />
deutlich über der Armutsgrenze bieten. Erwerbstätigkeit<br />
muss den Lebensunterhalt der Arbeitnehmer/in auf<br />
Grundlage unseres gesellschaftlichen Standards sichern.<br />
❚ Die reine Ausweitung des Entsendegesetzes birgt angesichts<br />
der tariflichen Landschaft die Gefahr, dass Mindeststandards<br />
festgelegt werden, die aufgrund des Kräfteverhältnisses<br />
zu Ungunsten für die Arbeitnehmer/in<br />
keine Grundsicherung bieten.<br />
❚ Mindeststandards müssen so angelegt sein, dass Bestrebungen<br />
zur Ausgliederung oder Fremdvergabe und damit<br />
der Aufweichung bestehender Tarifbereiche zunehmend<br />
unattraktiv werden.<br />
B 004 Entschließung zu Niedrigeinkommen<br />
und zur Einführung eines gesetzlichen<br />
Mindestlohns<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Bayern<br />
Beschluss: Annahme als Material zu Antrag<br />
B 002<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
In der Bundesrepublik steigt die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse<br />
mit Niedrigeinkommen. Mittlerweile erhalten<br />
bereits ein Drittel aller Vollzeitbeschäftigten Entgelte, die<br />
weniger als 75 % des durchschnittlichen Vollzeitverdienstes<br />
betragen (= prekäre Löhne), gut 12 % der Vollzeitbeschäf-<br />
tigten müssen sich gar mit weniger als 50 % der Durchschnittslöhne<br />
(= Armutslöhne) begnügen.<br />
Diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren zunehmend<br />
verschärft: obwohl die Zahl der Vollzeitbeschäftigten<br />
in Westdeutschland seit 1980 um 1,4 Millionen gesunken<br />
ist, hat sich der Niedriglohnsektor für Vollzeitbeschäftigte<br />
ausgeweitet (um 400.000 seit 1980!). Frauen sind von dieser<br />
negativen Entwicklung besonders betroffen – rund 70<br />
% der Personen mit Armutslöhnen sind weiblich.<br />
Über die letzten Jahrzehnte haben sich ganze Branchen,<br />
Berufe oder Regionen als Niedriglohnbereiche herausgebildet.<br />
Typische Niedriglohnbranchen sind die Gastronomie,<br />
der Einzelhandel, die Textilindustrie oder die Gebäudereinigung<br />
– überwiegend Frauenbranchen. Die Männerdomänen<br />
Bewachungsgewerbe und Sicherheitsdienste gehören allerdings<br />
auch dazu.<br />
Unsere Tarifverträge haben diese Entwicklung nicht verhindern<br />
können. Es ist nicht geglückt, die materielle Absicherung<br />
der Menschen im Dienstleistungssektor flächendekkend<br />
sicherzustellen, von einer eigenständigen Existenzsicherung<br />
der Frauen sind wir weiter entfernt denn je.<br />
Tarifliche und gesetzliche Mindeststandards haben die Ausweitung<br />
von Arbeitsmarktsegmenten mit Niedrigeinkommen<br />
nicht aufhalten können. Die neuen Zumutbarkeitsregelungen<br />
nach ALG II (Verdienste bis zu 30 % unter dem<br />
jeweiligen Tarifentgelt bzw. dem ortsüblichen Entgelt gelten<br />
als zumutbar) erzeugen zusätzlich Druck auf Lohngefüge<br />
und Tarifverträge.<br />
Hier werden die Grenzen der Tarifpolitik deutlich, hier wird<br />
klar, dass wir weitere Instrumente brauchen, um gerade in<br />
strukturschwachen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, in<br />
Branchen mit klein- und mittelbetrieblicher Prägung und in<br />
Bereichen mit Frauenarbeitsplätzen, die tendenziell unterbewertet<br />
werden, Lösungsansätze zu schaffen.<br />
Notwendige Maßnahmen:<br />
❚ Als Gegenmaßnahme halten es die Delegierten für dringend<br />
erforderlich, dass ein einheitliches, gesetzlich definiertes<br />
Mindesteinkommen über alle Branchen hinweg<br />
vereinbart wird, das den Beschäftigten – Männern wie<br />
Frauen – eine Existenzgrundlage bietet, die für Vollzeitarbeit<br />
angemessen und notwendig ist. Das gesetzliche<br />
Mindesteinkommen muss vom Niveau her so gestaltet<br />
werden, dass damit ein menschenwürdiges Leben und<br />
ein Lebensstandard finanziert werden kann, der eine<br />
aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.<br />
Ein gesetzliches Mindesteinkommen unterhalb der<br />
Schwelle von 1.500,- Euro erfüllt diese Anforderungen<br />
nicht.
❚ Ein weiteres Instrument ist eine Verbesserung und Erleichterung<br />
des Verfahrens zur Erreichung der Allgemeinverbindlichkeit.<br />
Landes- bzw. Bundesministerien haben<br />
die Möglichkeit, den Geltungsbereich von Tarifverträgen<br />
unter bestimmten Voraussetzungen auszuweiten. Für<br />
Branchen mit einem tariflichen Regelwerk oberhalb der<br />
Niedriglohnschwelle ist dies ein guter Ansatzpunkt, den<br />
es weiter zu entwickeln und auszubauen gilt.<br />
❚ Vielen unserer Mitglieder sind die gesellschaftliche<br />
Bedeutung und die rechtlichen Voraussetzungen für die<br />
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes nicht<br />
geläufig. Die Debatte wurde bislang als ExpertInnendiskussion<br />
auf Vorstandsebene und über die Presse geführt.<br />
Es ist daher dringend erforderlich, eine breite Debatte<br />
unter unseren Mitgliedern anzustoßen.<br />
❚ Innerhalb der <strong>DGB</strong>-Gewerkschaften gibt es keine einheitliche<br />
Haltung zum Thema "Materielle Grundsicherung".<br />
So ist bei einigen Gewerkschaften die Forderung nach<br />
einem gesetzlichen Mindestlohn sowohl vom Grundsatz<br />
wie von der Höhe her strittig. Seit November wird unter<br />
ExpertInnen eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle diskutiert:<br />
der Tariflohn für Leiharbeit als Grundlage ebenso<br />
wie die Festsetzung für einzelne Branchen über die<br />
unterste Entgeltgruppe einzelner Tarifverträge. Es ist deshalb<br />
notwendig, innerhalb der <strong>DGB</strong>-Gremien zu einer<br />
einheitlichen Haltung zu kommen – das kann nur<br />
geschehen, wenn offen und vorbehaltlos die verschiedenen<br />
Modelle mit ihren Vor- und Nachteilen diskutiert<br />
werden. Ziel muss sein zu informieren und aufzuklären,<br />
die verschiedenen Modelle für eine materielle Grundsicherung<br />
zu vereinheitlichen und die Höhe dieser Grundsicherung<br />
festzulegen.<br />
❚ Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Verschärfung<br />
der Zumutbarkeitsregelungen im Rahmen des ALG II per<br />
Rechtsverordnung zurückzunehmen. Jobs sollen für<br />
Erwerbslose erst dann zumutbar sein, wenn die Bezahlung<br />
auf ortsüblichem oder tariflichem Niveau liegt. Die<br />
Tatsache, dass Arbeitsangebote auch dann noch zumutbar<br />
sein sollen, wenn sie bis zu 30 % unter diesem<br />
Niveau liegen, verschärft das Lohndumping und damit<br />
das Armutsrisiko breiter Bevölkerungsschichten zusätzlich.<br />
B 005 Existenzsicherndes Einkommen<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenvorstand der IG BAU<br />
Beschluss: Annahme als Material zu Antrag<br />
B 002<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Vorstände und die Tarifkommissionen der Gewerkschaften<br />
werden aufgefordert, ihre tarifpolitischen Schwerpunkte<br />
so zu setzen, dass die Löhne/Gehälter aller Tarifbereiche<br />
existenzsichernd werden.<br />
Es gilt, eine Lohnhöhe von derzeit mindestens 1500 Euro<br />
pro Monat (für Vollzeit) zu erreichen.<br />
Das heißt, insbesondere die momentan noch unterdurchschnittlich<br />
entlohnten Bereiche sind als Schwerpunktbereiche<br />
besonders zu fördern und durch die gesamte Organisation<br />
solidarisch zu unterstützen.<br />
Begründung:<br />
Trotz ständig steigender Produktivität ist der Niedriglohnsektor<br />
in den letzten Jahren weiterhin angestiegen, während<br />
gleichzeitig die Gesamtzahl der Vollzeitbeschäftigten<br />
drastisch gesunken ist.<br />
Die Folgen von Niedriglöhnen sind ungenügende soziale<br />
Absicherung, geringere Ersatzleistungen bei Krankheit oder<br />
Arbeitslosigkeit und Altersarmut.<br />
Frauen sind überproportional von Niedriglohn betroffen.<br />
Dies führt zu finanzieller Abhängigkeit vom Ehepartner, der<br />
Familie oder von staatlichen Leistungen.<br />
Wir setzen uns für existenzsichernde Einkommen aller<br />
Beschäftigten ein.<br />
B 006 Kampagne gegen Niedriglohn<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenvorstand der IG BAU<br />
Beschluss: Annahme mit Änderungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand wird aufgefordert, eine Kampagne<br />
gegen Niedriglohn zu starten. Diese Kampagne soll<br />
Öffentlichkeit und Unrechtsbewusstsein schaffen für die<br />
Lebenssituation von Menschen im Niedriglohnbereich.<br />
Begründung:<br />
In persönlicher Ansprache durch haupt- und ehrenamtliche<br />
Kollegen/innen werden Umfragen gestartet, um die Lebenssituationen<br />
von Menschen im Niedriglohnbereich aufzuzei-<br />
73
74<br />
gen. Daraus werden anschauliche Beschreibungen von Einzelfällen<br />
erstellt. Diese sollen sich nicht nur auf die Lohnund<br />
Arbeitssituation beschränken, sondern auch die daraus<br />
resultierenden familiären Probleme beschreiben.<br />
Die so veranschaulichten Einzelschicksale werden dann veröffentlicht<br />
und an maßgebliche Persönlichkeiten aus der<br />
Politik und den Arbeitgeberverbänden weitergegeben mit<br />
der Aufforderung: „Tauschen Sie doch einmal für ein Jahr<br />
und versuchen Sie, von einem solchen Einkommen zu<br />
leben!”<br />
Diese Materialien sollen darüber hinaus auch den Mitgliedern<br />
der Tarifkommissionen aus den entsprechenden Bereichen<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
Bei den Politikern fast aller Parteien und Arbeitgebervertretern<br />
gibt es zurzeit einen starken Trend, immer mehr auf die<br />
Ausweitung der Niedriglohnbereiche zu drängen. Dies zeigt<br />
sich schon jetzt in vielen politischen Entscheidungen, insbesondere<br />
in den Hartz-Gesetzen. Die Zumutbarkeitsregelungen<br />
bei der Vermittlung von Arbeitslosen und die Förderung<br />
von Zeitarbeit sind nur zwei Beispiele.<br />
Niedriglöhne schaffen jedoch keine Arbeitsplätze, sondern<br />
wirken sich persönlich und volkswirtschaftlich negativ aus.<br />
Nahezu täglich sind in den Medien Äußerungen von Spitzenpolitikern<br />
zu hören, die noch weitere Niedriglohnsektoren<br />
oder eine weitere generelle Öffnung der Tarifverträge<br />
nach unten fordern. Diejenigen, die Niedriglöhne propagieren,<br />
müssen jedoch nicht davon leben!<br />
Immer mehr Menschen in Deutschland leben am Rande<br />
oder sogar unter der Armutsgrenze. Menschen, die immer<br />
längere Arbeitszeiten, den Zwang zu Schwarzarbeit oder<br />
mehrere Jobs gleichzeitig in Kauf nehmen müssen. Durch<br />
die mangelhafte soziale <strong>Sicherung</strong> wird die Altersarmut<br />
weiter zunehmen.<br />
Als GewerkschafterInnen werden wir dies nicht kampflos<br />
hinnehmen und setzen uns immer wieder mit aller Kraft für<br />
existenzsichernde und menschenwürdige Arbeitsverhältnisse<br />
ein.<br />
B 007 Abschaffung des Ehegattensplittings<br />
und der Lohnsteuerklasse V sowie<br />
die Einführung einer geschlechtergerechten<br />
Individualbesteuerung<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Bayern<br />
Beschluss: erledigt durch Beschlüsse<br />
(<strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz 1997 und<br />
<strong>DGB</strong>-Grundsatzprogramm)<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der Bezirksfrauenausschuss des <strong>DGB</strong> Hessen-Thüringen fordert<br />
die Bundesregierung und die Landesregierungen zu<br />
entsprechenden Gesetzesinitiativen in Bundestag und Bundesrat<br />
auf.<br />
Begründung:<br />
Durch das Ehegattensplitting wird einseitig die Einverdiener-Ehe<br />
gefördert. Haben beide Ehepartner in etwa das<br />
gleiche Einkommen, gibt es keinen Splittingvorteil. Diesen<br />
gibt es nur, wenn das Einkommen der Ehepartner ungleich<br />
verteilt ist. Je größer der Gehaltsunterschied ist, umso größer<br />
ist der Splittingvorteil: Bei einem zu versteuerndem Einkommen<br />
(ZVE) von 30.000 Euro im Jahr und bei einer Verteilung<br />
von 70:30 ergibt sich ein Splittingvorteil von 212<br />
Euro, bei einer 80:20 Verteilung von 733 Euro und bei einer<br />
90:10 Verteilung von 1.703 Euro. Wenn nur einer der beiden<br />
Ehepartner verdient, beträgt der Splittingvorteil gar<br />
2.712 Euro im Jahr (bei 30.000 ZVE)<br />
Dies hat negative Anreizwirkungen für die Erwerbstätigkeit<br />
von Ehefrauen. Schließlich steigt das Familieneinkommen<br />
erst dann, wenn der Verdienst größer als der Splittingvorteil<br />
ist. Dies führt dazu, dass viele Ehepartner, überwiegend<br />
Ehefrauen, sich um einen „Zuverdienst“ unterhalb der<br />
Geringfügigkeitsgrenze bemühen. Ist eine Frau aber erst<br />
einmal aus der Erwerbstätigkeit ausgeschieden oder<br />
beginnt mit einer niedrigen Wochenstundenzahl, verfestigt<br />
sich diese Beschäftigungsart durch die negative Anreizwirkung<br />
durch das Ehegattensplitting. Gleichzeitig mit dem<br />
niedrigen Arbeitslohn sinken aber auch die Ansprüche auf<br />
eine Vielzahl von Lohnersatzleistungen, die sich am Nettolohn<br />
orientieren. Das Steuersystem mit dem Ehegattensplitting<br />
stützt also das patriarchale Ernährermodell, in dem die<br />
Frau individuell vom Ehemann abhängig ist.<br />
Verstärkt wird die Wirkung des Ehegattensplittings durch<br />
die Lohnsteuerklasse V. Ehepartner können entweder, wenn<br />
beide ungefähr das Gleiche verdienen, beide die Lohnsteuerklasse<br />
IV wählen oder, wenn der Verdienst der Ehepartner<br />
unterschiedlich ist, wählt derjenige mit dem höheren Verdienst<br />
die Lohnsteuerklasse III und diejenige mit dem gerin-
geren Verdienst die Lohnsteuerklasse V. Laut Lohn- und Einkommenssteuerstatistik<br />
1989 beträgt der Anteil von Frauen<br />
in der Lohnsteuerklasse V 91 % und in der Lohnsteuerklasse<br />
III 17 %. Bei der Lohnsteuerklassenkombination III/V<br />
werden sämtliche Freibeträge, die dem Ehepaar zustehen<br />
bei der Steuer desjenigen mit der Lohnsteuerklasse III<br />
berücksichtigt.<br />
Dies führt dazu, dass der monatliche Lohnsteuerabzug in<br />
der Lohnsteuerklasse V unverhältnismäßig höher ist als der<br />
Abzug in den Lohnsteuerklassen III und IV. Da auch der<br />
Grundfreibetrag der Ehefrau in der Lohnsteuerklasse III des<br />
Ehemannes mitberücksichtigt wird, verbleibt der Ehefrau,<br />
die ihr Einkommen in der Lohnsteuerklasse V versteuert,<br />
nicht einmal das steuerlich freizustellende Existenzminimum.<br />
Ehegattensplitting und die Lohnsteuerklassenkombination<br />
III/V fördern die Einverdienerehe und damit die Nichterwerbstätigkeit<br />
von Frauen bzw. die Beschäftigung von Frauen<br />
in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Durch den Verzicht<br />
auf ein eigenes Einkommen geraten Frauen in die<br />
finanzielle Abhängigkeit ihres Ehemannes. Gleichzeitig verzichten<br />
sie auf eine eigenständige soziale Absicherung. Die<br />
finanzielle Abhängigkeit wird so zu einer völligen Abhängigkeit.<br />
Sind Frauen erst einmal aus dem Erwerbsleben ausgeschieden,<br />
haben sie kaum noch Chancen wieder einen ihrer<br />
Qualifikation entsprechenden Erwerbsarbeitsplatz zu erhalten.<br />
Diese Steuerpolitik des Staates ist nicht mit dem<br />
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes gem. Art. 3 vereinbar.<br />
Wir fordern die Abschaffung des Ehegattensplittings<br />
sowie der Lohnsteuerklasse V und stattdessen die Einführung<br />
einer geschlechtergerechten Individualbesteuerung.<br />
B 008 Individuelle Besteuerung<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Bayern<br />
Beschluss: Erledigt durch Beschlüsse<br />
(<strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz 1997 und<br />
<strong>DGB</strong>-Grundsatzprogramm)<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong> möge auf den Gesetzgeber einwirken, die Gleichstellung<br />
der Geschlechter im Steuerrecht zu schaffen und<br />
die faktische, indirekte Diskriminierung von Frauen zu beenden.<br />
Das Gleiche gilt auch für das Ehegattensplitting.<br />
Begründung:<br />
Die von der Bundesregierung versprochene Gleichstellung<br />
in der Steuergesetzgebung ist ausgeblieben. Im Gegenteil:<br />
Der Haushaltsfreibetrag für Alleinerziehende wurde gestrichen.<br />
Sie werden wie Singles behandelt, während selbst<br />
kinderlose Ehepaare Steuervorteile genießen.<br />
Die Lohnsteuerklasse V, in der überwiegend Frauen sind,<br />
schmälert nicht nur den Wert ihrer Arbeit, sondern kürzt<br />
deutlich die Sozialleistungen bei Arbeitslosigkeit. Das Arbeitslosengeld<br />
richtet sich nach dem Nettolohn.<br />
Immer wieder erleben wir die Frustration gerade bei Teilzeitbeschäftigten,<br />
wenn sie ihre Arbeitszeit und ihren Lohn<br />
mit dem quasi „Brutto-für-Netto” der Mini-Jobberinnen vergleichen.<br />
Anstatt dass die Regierung einen Anreiz für eigenständige<br />
soziale <strong>Sicherung</strong> schafft, bittet sie die Ehefrauen<br />
mit dem geringen Einkommen ganz besonders steuerlich<br />
zur Kasse und bietet ihnen als Alternative den Ausschluss<br />
aus den Leistungen der Sozialversicherung.<br />
In keinem Land der Erde gibt es ein so kompliziertes Steuerrecht<br />
wie in Deutschland. Ein Steuerrecht, das sich überwiegend<br />
diskriminierend auf Frauen auswirkt. Der Spruch „Wer<br />
das Geld hat, hat die Macht” gilt auch in Beziehungen.<br />
Frauen sind häufig in der Position derjenigen, die nur einen<br />
geringeren Beitrag zum Familieneinkommen leisten. Wenn<br />
wir den Wert der Arbeit am Lohn messen, der bei Frauen<br />
meist sowieso niedriger ist, wird ihre Leistung durch die<br />
Steuerregelung doppelt entwertet. Es gibt in anderen Ländern,<br />
zum Beispiel in Skandinavien, individuelle Besteuerung,<br />
die Vergünstigungen nur für Kinder vorsieht. Diese<br />
Regelungen können als Vorbild dienen.<br />
I 003 Initiativantrag Nr. 3<br />
Keine Verschlechterung der<br />
Besteuerung von Abfindungen<br />
Antragsteller/in: Martina Schulte, NGG, u.a.<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Delegierten der 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz erwarten<br />
von der Bundesregierung, auf die geplante vollständige<br />
Besteuerung von Abfindungen bei Verlust des Arbeitsplatzes<br />
zu verzichten.<br />
Begründung:<br />
Der Verlust eines Arbeitsplatzes ist insbesondere dann,<br />
wenn die Betroffenen 50 Jahre oder älter sind, ein Abschied<br />
75
76<br />
vom Arbeitsleben für immer. Die Folgen für Beschäftigte<br />
sind insbesondere seit Inkrafttreten des so genannten Hartz<br />
IV – Gesetzes schlichtweg als katastrophal zu bezeichnen.<br />
Zu dem Verlust des Selbstwertgefühles und gesellschaftlicher<br />
Akzeptanz kommt in immer größerem Umfang Armut<br />
hinzu.<br />
Daran kann auf Dauer auch eine Abfindung in einer üblichen<br />
Höhe nichts ändern, sie kann jedoch den Zeitpunkt<br />
der Verarmung hinauszögern. Dem hat der Gesetzgeber<br />
dadurch Rechnung getragen, dass – abhängig von Alter<br />
und Betriebszugehörigkeit – bis zu 11.000 Euro der Abfindungssumme<br />
unversteuert bleiben. Auch ein überschießender<br />
Betrag wird bislang unter bestimmten Bedingungen<br />
geringer besteuert als das übrige Einkommen.<br />
Der Wegfall dieser Steuerprivilegien wird den so genannten<br />
sozialverträglichen Abbau von Arbeitsplätzen erschweren<br />
und die Betroffenen, die absehbar zukünftig mit jedem Euro<br />
rechnen müssen, um Anteile ihrer Abfindung bringen.<br />
Das ist umso schwerer verständlich als die Reichen in diesem<br />
Lande nach wie vor nur einen bemerkenswert geringen<br />
zusätzlichen Beitrag zur Finanzierung der Bundesrepublik<br />
beisteuern müssen.<br />
B 009 Gegen die Einführung von Studiengebühren<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-<br />
Thüringen<br />
Beschluss: Annahme (mit redaktioneller Änderung)<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand hat sich eindeutig gegen die Einführung<br />
von Studiengebühren zu positionieren. Gleiches gilt<br />
für die Einführung und Umsetzung von Langzeitstudiengebührenmodellen<br />
und für Gebühren für Masterstudiengänge.<br />
Mit dem Antrag soll der FZS (Freiwilliger Zusammenschluss<br />
der Studierendenschaften) und damit der Kampf der Studierenden<br />
gegen die Einführung von Studiengebühren unterstützt<br />
werden. In einer Wissensgesellschaft sollte sowohl<br />
Kindergarten als auch Schule, Ausbildung und Studium<br />
kostenfrei sein.<br />
Begründung:<br />
Mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, das<br />
das allgemeine Studiengebührenverbot des Bundes für die<br />
Länder aufgehoben hat, steht deren Einführung kurz bevor.<br />
Alle bisher diskutierten Modelle berücksichtigen in keiner<br />
Weise, dass Studiengebühren in den Ländern, in denen sie<br />
bereits eingeführt wurden – wie Österreich oder Australien<br />
–, nicht zur Verbesserung der Lehre oder Hochschulen beigetragen,<br />
sondern im Gegenteil zu massiver sozialer Selektion<br />
geführt haben.<br />
Selbst nachgelagerte Studiengebühren bürden den Studierenden<br />
eine zusätzliche Belastung von mehr als 20.000<br />
Euro neben der obligatorischen Bafög-Rückzahlung auf. Das<br />
führt dazu, dass sich noch weniger Studierende aus Arbeiterfamilien<br />
und Familien von Alleinerziehenden für ein Studium<br />
entscheiden. Für Frauen und Alleinerziehende, die studieren<br />
wollen, wäre die Wirkung noch selektiver, da sie<br />
ohnehin schon siebenmal häufiger einem Armutsrisiko<br />
unterliegen als Männer.<br />
Das Argument, man müsse das Studium auch bezahlen, da<br />
der Kindergartenplatz auch bezahlt wird, ist eine Verdrehung<br />
der Tatsachen. In einer Wissensgesellschaft sollte<br />
sowohl Kindergarten als auch Schule, Ausbildung und Studium<br />
kostenfrei sein. Dass dies geht, zeigen die Beispiele in<br />
den skandinavischen Ländern.<br />
In einer Situation, in der über eine Millionen Kinder in<br />
Deutschland in Armut leben und deren Zahl durch Hartz IV<br />
auf fast zwei Millionen ansteigen wird, bedeuten Studiengebühren<br />
vor allem für alleinerziehende Mütter praktisch<br />
den Ausschluss von einer höheren Bildung.<br />
Mit Blick darauf, dass schon heute, ohne Studiengebühren,<br />
60 % der westdeutschen und über 70 % der ostdeutschen<br />
Studierenden neben dem Studium einer Erwerbsarbeit<br />
nachgehen müssen, wird deutlich, dass durch den Mehraufwand<br />
von 500,- Euro Minimum bis zu bisher diskutierten<br />
5.000,- Euro Maximum – Studiengebühren je Semester für<br />
Kinder aus zum Beispiel von Hartz IV betroffenen Haushalten<br />
ein Studium, wenn, dann allenfalls an den „Billig-Unis“<br />
der neuen Bundesländer möglich sein wird.<br />
Die Aussage eines FDP-Abgeordneten in der Bildzeitung,<br />
dass „... die Falschen, nämlich die sozial Schwachen die<br />
meisten Kinder bekommen...“ zeigt neben einer neoliberalen<br />
Grundeinstellung den selektiven Gedanken offen.<br />
Studiengebühren, ob nachgelagert oder durch einen Kredit<br />
von der KFW-Bank mit 5 % Verzinsung finanziert, sind<br />
daher für ein Erststudium vor allem im Sinne unserer ver.di<br />
Kolleginnen, Alleinerziehenden, Studentinnen, Arbeiterinnen<br />
und Jugendlichen in jedem Falle abzulehnen.
<strong>Sachgebiet</strong> C: Beschäftigungspolitik<br />
C 001 Wirtschaftspolitik<br />
Antragsteller/in: ver.di Bundesfrauenrat<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Frauenpolitische Stichworte: Für die Abkehr von einer<br />
neoliberalen Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand wird aufgefordert, dafür Sorge<br />
zu tragen, dass folgende Ziele und Grundsätze mit der<br />
Politik des <strong>DGB</strong> umgesetzt werden:<br />
Wir brauchen für Deutschland eine Neuausrichtung der<br />
Wirtschafts- und der Beschäftigungspolitik,<br />
eine Ökonomie, deren Wesen die Förderung substantieller<br />
Freiheiten und der Lebensqualität ist, die der Marktwirtschaft<br />
neue, menschenorientierte Regeln verleiht, die die<br />
Sozialverpflichtung des Eigentums umsetzt und die Menschen,<br />
Männer und Frauen auf gleicher Höhe, in den Mittelpunkt<br />
stellt.<br />
Wir brauchen dazu auch eine feministische Neuausrichtung<br />
von Wirtschaft und Beschäftigung,<br />
die nicht von dem „Männlichen“ als Kern und Zielpunkt der<br />
Wirtschaftstätigkeit ausgeht. Die Polarisierung und Hierarchisierung<br />
zwischen männlichen und weiblichen Arbeitsfeldern<br />
ist zu beseitigen, so dass menschengerechte Verteilung<br />
und Entgeltgleichheit sich als Grundwesen unserer Wirtschaft<br />
und Beschäftigung manifestieren.<br />
Wir wollen eine Politik, die Antiarmuts- und Antidiskriminierungspolitik<br />
ist und soziale und Gendergerechtigkeit<br />
als Kriterien anwendet.<br />
Die internationalen Arbeitsnormen und Menschenrechte<br />
(der Internationalen Arbeitsorganisation IAO) müssen überall<br />
als zwingend einzuhaltende Grundlage gelten, und zwar<br />
auch wenn die deutsche Wirtschaft sich außerhalb des Landes<br />
betätigt und dort Beschäftigung schafft.<br />
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik müssen sich einer<br />
gesamtwirtschaftlichen Betrachtung und Handlungsweise<br />
zuwenden<br />
und von der rein einzelwirtschaftlichen Sichtweise, die in<br />
der Regel nur die Gewinnerwartung im Blick hat, verabschieden.<br />
Das Verhindern negativer (volks-) wirtschaftlicher<br />
Effekte muss zum Ziel politischen Handelns erhoben werden.<br />
Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung muss erneuert<br />
werden, so dass negative externe Effekte (wie etwa die<br />
Ausgrenzung von Frauen aus dem Arbeitsmarkt) erkennbar<br />
und behandelbarer werden. Prävention muss in diesem<br />
Sinne als positiver Wirtschaftsfaktor behandelt werden.<br />
Wir brauchen für Deutschland eine eigenständige, nicht<br />
nur an der Globalisierung ausgerichtete Beschäftigungspolitik.<br />
Der politische Wille, Arbeitsplätze hier zu erhalten und zu<br />
schaffen, muss wieder erkennbar und in der Wirtschaft<br />
durchgesetzt werden. Das heutige Modell für die „optimale<br />
Arbeitskraft“ im Sinne einer kapitalistischen Verwertung ist<br />
nicht länger der männliche Arbeitnehmer in seinem Normalarbeitsverhältnis,<br />
sondern die junge Frau in den Sweatshops<br />
(Produktionsstätten, die keine der Grundforderungen für<br />
menschenwürdige Arbeit erfüllen, deren Lohn kaum zum<br />
Leben reicht und wo die ArbeiterInnen oft in direkter<br />
Abhängigkeit vom Besitzer leben müssen) und „freien Produktionszonen“<br />
(Regionen, für die Arbeits-, Steuer- und/<br />
oder Umweltgesetze außer Kraft gesetzt werden.) in den<br />
Ländern des Südens, die weder durch Arbeitsschutzgesetze<br />
noch durch Gewerkschaften geschützt ist. Mit diesen Bedingungen<br />
zu konkurrieren, tritt derzeit die aktuelle Arbeitsmarktpolitik<br />
in Deutschland an. Mit der Ausweitung des<br />
Niedriglohnsektors durch Unternehmen, der neuen informellen<br />
und in den Privatbereich verschobenen Arbeit durch<br />
die Anwendung neuer, niedrigerer Grenzen in der Subsidiarität<br />
der Familie sowie der Pflicht zur Annahme jeder Arbeit<br />
in den neueren Arbeitsmarktgesetzen wird von verschiedenen<br />
Seiten aus das Ziel verfolgt, die Deregulierung der bisher<br />
geschützten Arbeitsplätze auch bei uns voranzutreiben.<br />
Die aktuell betriebene Zerschlagung des <strong>Sozialstaat</strong>es ist<br />
Voraussetzung und Beschleunigung für diese Entwicklung.<br />
Dieser Weg ist für die Entwicklung einer auf zukünftigen<br />
Erfolg ausgerichteten Wirtschaft ein Irrweg, der dringend zu<br />
verlassen ist.<br />
Wir wollen die Aufhebung der grundsätzlichen und die<br />
Frauen benachteiligenden geschlechtsspezifischen<br />
Arbeitsteilung,<br />
die in Verbindung mit dem Erhalt der Massenarbeitslosigkeit<br />
ein Mittel für die Durchsetzung neoliberaler Arbeitsmarktpolitik<br />
ist. Die auch geschlechtsspezifisch hierarchisierte<br />
Verteilung von Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsmarktzugang,<br />
ungleicher Entlohnung auch bei gleichwertiger Arbeit<br />
zu Ungunsten von Frauen, beispielsweise bei der Entwicklung<br />
zur Dienstleistungsökonomie, ist dazu geeignet, die<br />
Abwärtsspirale bei Löhnen und Arbeitsbedingungen zu<br />
beschleunigen. Denn: Streben Frauen aus der ihnen bisher<br />
zugeteilten Rolle heraus die neu entstehende Arbeit an, so<br />
wird diese so konzipiert, dass das der geschlechtsspezifischen<br />
Arbeitsteilung zugehörige Rollenverständnis erfüllt<br />
wird: Sozialversicherungsfreie Beschäftigung, Arbeit mit<br />
niedriger ökonomischer Wertschätzung, beschränkte Ver-<br />
77
78<br />
dienstmöglichkeiten – dies kennzeichnet typische Frauenarbeit<br />
auch heute und lässt sie im Zuverdienstbereich bleiben.<br />
Dienstleistungsökonomie wird so – ob ökonomisch gerechtfertigt<br />
oder nicht – zur Zuverdienstökonomie. Für eine positive<br />
Wirtschaftsentwicklung, die heute eindeutig in Richtung<br />
Dienstleistungen geht, ist das nicht akzeptabel.<br />
Wir brauchen eine Dienstleistungspolitik mit mehr Selbstbewusstsein,<br />
die die Entwicklung zukunftsgerichteter Dienstleistungswirtschaft<br />
nicht mit Mitteln aus der Vergangenheit vom wirtschaftlichen<br />
Fortschritt ausschließt. Die derzeitige Arbeitsmarkt-<br />
und Beschäftigungspolitik wirkt jedoch darauf hin,<br />
dass für neue Arbeit immer weniger gezahlt wird. Da aber<br />
immer mehr Arbeit zu Niedrigkonditionen im ökonomischen<br />
Prozess verwertet werden kann, (z.B. durch Förderung der<br />
Niedriglohnsektoren und durch die (fast) kostenlose Abschöpfung<br />
von Arbeitsleistung in Ein-Euro-Jobs, „ehrenamtlicher“<br />
Arbeit als Ersatz für staatliche Bildung oder institutionalisierte<br />
Pflege, Erwerb von Beschäftigungsfähigkeit<br />
durch „Eigenleistungen“), haben die so sinkenden Löhne<br />
auch eine Wirkung auf die Gesamtwirtschaft.<br />
Davon profitieren derzeit die Unternehmen. Eine so interpretierte<br />
vermeintliche Standortpolitik, die nur die billigste<br />
Produktion anstrebt und zur Senkung der nationalen Löhne<br />
droht, in Länder mit noch niedrigeren Löhnen auszuweichen,<br />
schadet dem Land und langfristig auch den Unternehmen.<br />
Kurzfristig produzieren sie sich mit dieser Politik<br />
und Wirtschaftsführung aber bereits höchst lukrative<br />
Gewinnerwartungen im Inland – auch indem Frauen durch<br />
mehr Angebote billiger Dienstleistungsarbeit vermeintlich<br />
bessere Arbeitsmarktchancen erhalten – bis hin zur ausländischen<br />
Haushaltshilfe oder Altenpflegerin in Schwarzarbeit.<br />
Die Lasten der Wirtschaftsentwicklung dürfen nicht einfach<br />
„durchgereicht“ werden.<br />
Die Zuschreibung der Reproduktionsarbeit an Frauen verstärkt<br />
die beschriebene Entwicklung noch. Hausarbeit, Kindererziehung,<br />
Pflege und andere unentgeltlich geleistete<br />
Reproduktionsarbeit bilden sozusagen die untere Stufe in<br />
der geschlechtsspezifischen Hierarchie der Entlohnung und<br />
der sozialen <strong>Sicherung</strong>, die hier nur noch in Abhängigkeit<br />
von anderen erreichbar ist.<br />
Die vermeintliche „Unbezahlbarkeit“ grenzt Familien- und<br />
soziale Arbeit aus der „bezahlbaren“, weil schon verwertbaren<br />
Sphäre der Ökonomie aus und macht sie zur „natürlichen<br />
Ressource“, welche die Ökonomie als Basis stützt und<br />
ihr zur Verwertung jederzeit zur Verfügung steht. Die<br />
Arbeitskraft von Frauen wird so zu einem der Pfeiler des<br />
ökonomischen Systems, welches ohne diese (in allen Ländern<br />
der Erde vorhandene) „natürliche“ Basis unzähliger<br />
unbezahlt geleisteter und jederzeit billig abrufbarer Arbeitsstunden<br />
schon längst zusammengebrochen wäre. Schon<br />
immer wurden auch in Deutschland Frauen in die Arbeit<br />
„berufen“, wenn die Wirtschaft ihre Fähigkeiten und Leistungen<br />
brauchte. Der Weg zurück an den Herd ist dabei<br />
gleichermaßen vorprogrammiert, wenn die Wirtschaft die<br />
weibliche Arbeitskraft wieder „ausatmet“.<br />
War in der Vergangenheit das „Durchreichen“ schlechter<br />
Arbeitsbedingungen an Frauen nicht möglich, so wurden<br />
MigrantInnen beschäftigt. Auch die heutige Situation in der<br />
Pflege, im Gesundheitswesen, in den Haushalten und vielen<br />
anderen Bereichen zeigt, dass – bis hin zur illegalen<br />
Beschäftigung – unsichere und schlecht bezahlte Jobs an<br />
Ausländerinnen und Ausländer vergeben werden, deren<br />
Arbeitskonditionen nicht etwa von der Qualifikation abhängig,<br />
sondern einzig von ihrem Status bestimmt sind.<br />
Dies ist in einer menschenwürdigen Arbeitswelt nicht hinnehmbar.<br />
Wir brauchen gleichberechtigten Zugang von Frauen und<br />
Männern zur Arbeit.<br />
Auch wenn heute nicht nur Männer, sondern auch Frauen<br />
durch die Entwicklung zur Dienstleistungsökonomie Zugang<br />
zum Arbeitsmarkt erlangen, ist dennoch festzuhalten, dass<br />
vor allem an Frauen die Niedriglohnjobs, verstärkt die hausund<br />
familiennahen Arbeiten und überwiegend die unregulierten<br />
Dienstleistungsarbeiten, vergeben werden, deren<br />
Nähe zur bisher typischen Frauenarbeit gleichzeitig eine<br />
„Begründung“ für niedrigste Entlohnung und schlechteste<br />
soziale <strong>Sicherung</strong> liefert. Nicht zu vergessen die Hunderttausende<br />
Arbeitslosen ohne Leistungsbezug, die in die subsidiäre<br />
Versorgung durch die Familie entlassen werden und<br />
nun dem privaten Haushalt voll und ganz wieder zur Verfügung<br />
stehen. Mindestens zwei Drittel davon sind Frauen.<br />
Über die stärkeren Wirkungen für Frauen hinweg täuscht<br />
auch nicht, dass Männer ebenfalls arbeitslos werden,<br />
jedoch verlieren sie ihre Arbeitsplätze in der ihnen angestammten<br />
industriellen Produktion, ohne dass diese Arbeit<br />
an Frauen überginge. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor<br />
geteilt und Frauen gewinnen nur Arbeitsplätze, weil sie<br />
„ihre“ Arbeit neu unter sich verteilen.<br />
Solidarität der Bessergestellten mit den Benachteiligten<br />
erfolgt in deren eigenem Interesse.<br />
Der Abbau der industriellen Produktion in Deutschland, vornehmlich<br />
aber der Abbau von Arbeitsplätzen in einer durch<br />
höhere Produktivität nach wie vor real wachsenden Produktion,<br />
bedroht in erster Linie die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen<br />
von Männern. Der Wunsch, alte Zustände wieder<br />
herstellen zu können, zeigt sich dabei als Illusion. Die<br />
Gewissheit über deren Unerreichbarkeit lässt den Umbau
zur Dienstleistungsökonomie mit ihren unsicheren Arbeitskonditionen,<br />
mit den durch Frauenlöhne bestimmten Verdiensten<br />
und der ständigen Möglichkeit der Auslagerung<br />
der Produktion oder des Imports von Dienstleistungen zur<br />
existenziellen Bedrohung werden. Der Verteilungskampf um<br />
Positionen, Verdienste und soziale Sicherheit „ganz oben“<br />
in der Verteilungshierarchie greift auf Machtmechanismen<br />
zurück – auch auf die angeblich so natürliche geschlechtsspezifische<br />
Arbeitsteilung.<br />
Begreifen müssen diejenigen, die von bisheriger Arbeitsteilung<br />
profitieren, aber, dass sie dennoch nicht verschont<br />
bleiben werden. Sie haben allerdings die Möglichkeit, entweder<br />
die Lasten dieser Entwicklung weiter nach unten<br />
„durchzureichen“, sich abzugrenzen, um selbst möglichst<br />
lange besser gestellt zu bleiben. Oder sie sorgen selbst mit<br />
dafür, dass die Abwärtsspirale sofort beendet wird und<br />
nicht erst in der Nichtbezahlung und im Nicht-abgesichertsein<br />
endet. Solidarität und gemeinsame Gegenwehr gegen<br />
die Umverteilung von unten nach oben, von der Südhalbkugel<br />
zur Nordhalbkugel unseres Globusses, ist nötig. Solidarität<br />
derjenigen, die noch sozial und tariflich abgesicherte,<br />
existenzsichernde Arbeit und Perspektiven haben, mit denen<br />
am unteren Ende und mit denen am Rand der Belegschaft<br />
ist mittel- und langfristig im eigenen Interesse.<br />
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen von Frauen<br />
durch Änderungen des Arbeitsrechts verhindern<br />
Der bestehende Schutz vor Kündigungen und Kettenarbeitsverträgen<br />
sowie der Anspruch auf Teilzeitarbeit darf nicht<br />
verschlechtert werden. Eingriffe in die Tarifautonomie durch<br />
gesetzliche Öffnungsklauseln, die untertarifliche Bedingungen<br />
durch Betriebsvereinbarung oder Einzelverträge zulassen,<br />
darf es nicht geben. Frauen wären von diesen Maßnahmen<br />
noch stärker betroffen als Männer.<br />
Frauen mit Familienverantwortung, Kindererziehung oder<br />
Pflege, werden in vielen Betrieben noch immer als „Risikogruppe“<br />
angesehen, deren Ausgrenzung bei weiter verringerter<br />
Arbeitsplatzsicherheit und betrieblich absenkbaren<br />
Löhnen umso leichter würde. Der Gesetzgeber ist aber verpflichtet,<br />
Regelungen der Arbeitsbedingungen so zu gestalten,<br />
dass sie nicht zu einer mittelbaren Benachteiligung von<br />
Frauen führen. Dies fordern wir dringlich ein. Beispielsweise<br />
kämen Frauen mit ihren Patchworkbiografien bei verändertem<br />
Kündigungsschutz und weiter uneingeschränkter Befristungsmöglichkeit<br />
kaum noch in den Bereich gesicherter<br />
Beschäftigung. Im Dienstleistungsbereich, wo Frauen in den<br />
Betrieben kleiner und mittlerer Größe arbeiten, würden<br />
nicht nur überproportional viele weibliche Beschäftigte herausfallen,<br />
es entfalten sich auch unerwünschte wirtschaftsstrukturelle<br />
Vor- und Nachteile. Dies gilt es zu verhindern.<br />
Auch für das Angebot an Teilzeitarbeit gilt es, den Bedarf<br />
der Familie mit dem des Betriebes sinnvoll abzustimmen.<br />
Um Teilzeit attraktiver zu gestalten, auch um Teilzeit von<br />
Männern zu fördern, müssen die Rahmenbedingungen weiter<br />
verbessert werden, unter anderem mit einer Befristungsmöglichkeit<br />
für die Ausübung von Teilzeit bzw. einem<br />
gewährleisteten Rückkehrrecht und die Beschränkung sozialversicherungsfreier<br />
Teilzeit auf einen Bagatellebetrag.<br />
Einer einseitigen Beschränkung des Teilzeitanspruchs für<br />
Beschäftigte (z.B. bei Kindererziehung, Pflege) wird eine<br />
Absage erteilt, u.a. auch, da die Teilzeit in verschiedenen<br />
Branchen aus betrieblichen Gründen bereits zur Regelarbeitszeit<br />
geworden ist. Hier können nur beidseitig wirksame<br />
Regeln greifen. Dazu gehört auch, dass Teilzeit als normale<br />
Arbeitszeitform im Betrieb anerkannt wird und nicht länger<br />
zu Karrierenachteilen für Teilzeitbeschäftigte führt.<br />
Der Wille, wieder Arbeit in Deutschland zu schaffen, muss<br />
wieder belebt werden. Der Wille, diese gerecht zwischen<br />
Männern und Frauen zu verteilen, ist weiter zu entwickeln.<br />
Dies ist und bleibt eine politische Entscheidung, für die die<br />
Voraussetzungen zu schaffen sind. Nicht nur die Politik,<br />
sondern vor allem auch die Unternehmen der Produktion<br />
und der Dienstleistung stehen in der Verantwortung. Auch<br />
die Beschäftigten und potentiellen Beschäftigten sind<br />
selbstverständlich AkteurInnen der Wirtschaft und der Politik<br />
– nicht jedoch in dem Sinne, für Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung<br />
oder schlechte Arbeitsbedingungen allein die Verantwortung<br />
tragen zu müssen. Die Arbeitsmarktpolitik der<br />
vergangenen Jahre muss in dem Zusammenhang gründlich<br />
überdacht werden.<br />
Auf der konkreten Handlungsebene brauchen wir<br />
a) eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, die sich am tatsächlichen<br />
Bedarf – an den Bedürfnissen und Wünschen – von<br />
Frauen und Männern sowie der Gesellschaft orientiert<br />
und nicht an schneller Rendite auf den Finanzmärkten.<br />
Das impliziert insbesondere, dass die Belange von Frauen<br />
gleichberechtigt einfließen.<br />
b) kommunale Beschäftigung, die dazu führt, dass Menschen<br />
sich in ihrer unmittelbaren Lebensumwelt wohlfühlen<br />
und engagieren; dazu sind wieder erheblich mehr<br />
Investitionen in Kultur-, Bildungs-, Kinderbetreuungs-,<br />
Freizeit- und soziale Einrichtungen sowie eine gesunde<br />
Umwelt dringend nötig;<br />
c) eine Steuer- und Verteilungspolitik, die Frauen nicht<br />
benachteiligt und ausreichende Mittel für Investitionen in<br />
die vernachlässigten Bereiche zur Verfügung stellt;<br />
d) eine eigenständige Wirtschafts- und Beschäftigungspoli-<br />
79
80<br />
tik, die nicht die negativen Effekte globalisierter Arbeitsteilung<br />
als vermeintliche Standortpolitik importiert;<br />
e) eine Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich<br />
nicht einseitig an Exportfähigkeit und Standortpflege<br />
ausrichtet, sondern den Binnenmarkt wieder nachhaltig<br />
stärkt;<br />
f) eine Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, die Frauen<br />
und Männern gleichberechtigten und gleichwertigen<br />
Zugang zu Erwerbstätigkeit, Familienarbeit und Freizeit<br />
nicht nur ermöglicht, sondern gewährleistet;<br />
g) eine Innovationspolitik, die Bildung und Forschung ausbaut<br />
und so nachhaltig der Qualitätssicherung dient.<br />
h) eine Gesetzgebung für Betriebe, die im Sinne einer Perspektive<br />
„Lebensplanung“ auch übergeordnete Politikbereiche,<br />
in Bezug auf die Arbeitsbedingungen insbesondere<br />
familienpolitische Aspekte, einfließen lässt.<br />
i) eine Politik für und von Unternehmen, die den Bedarf<br />
der Unternehmen nach Beschäftigungsflexibilisierung mit<br />
dem Bedarf der Familien nach Arbeitsplatz- und sozialer<br />
Sicherheit abwägt und, angesichts der schon jetzt feststellbaren<br />
Folgen der Unsicherheit für die demografische<br />
Entwicklung, der Familie künftig einen Vorrang einräumt.<br />
Insgesamt ist die Qualität unseres Staatswesens in den<br />
Vordergrund zu stellen.<br />
Der Würde des Menschen ist vor den Aktionsmöglichkeiten<br />
des Kapitals Vorrang einzuräumen. Der grundgesetzlichen<br />
Sozialverpflichtung des Eigentums ist zu entsprechen, und<br />
zwar nicht nur von natürlichen, sondern auch juristischen<br />
Personen. Dem Lohn- und Sozialdumping und der Steuerflucht<br />
sind eindeutige und wirksame Absagen zu erteilen.<br />
Ein Maßstab für die Erreichung des Qualitätsstandards wird<br />
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an<br />
den Ergebnissen unserer Wirtschaft und an der Gesellschaft<br />
sein.<br />
C 002 Neuausrichtung Arbeitsmarktpolitik<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-<br />
Thüringen<br />
Beschluss: Annahme mit den im Änderungsantrag<br />
(G 002) aufgeführten Änderungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand wird aufgefordert, sich konsequent<br />
für eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik einzusetzen.<br />
Ziele des <strong>DGB</strong> sind:<br />
1. Arbeitslose, insbesondere Arbeitslose mit erschwerten<br />
Vermittlungschancen, sind unabhängig eines bestehenden<br />
Leistungsbezugs (ALG I, ALG II) durch öffentlich<br />
geförderte Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote<br />
zu unterstützen, um eine Integration in reguläre Beschäftigung,<br />
aber auch ihre soziale Absicherung und persönliche<br />
Stabilisierung zu ermöglichen. Für Arbeitslose, die<br />
aufgrund der Partnereinkommensanrechnung aus dem<br />
Leistungsbezug ausscheiden (Nicht-LeistungsempfängerInnen)<br />
sowie für Frauen, die aufgrund von vorheriger<br />
Kindererziehungs- und Pflegezeiten keinen Leistungsanspruch<br />
haben (Berufsrückkehrerinnen) ist der Zugang zur<br />
Vermittlung und Arbeitsförderung sicherzustellen, insbesondere<br />
durch Verfügbarkeit der dazu notwendigen<br />
Finanzmittel. Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung<br />
müssen tariflich vergütet werden und eine Absicherung<br />
in allen Zweigen des Sozialversicherungssystems beinhalten.<br />
Zu finanzieren ist dies durch eine sozial ausgewogene<br />
Besteuerung aller Einkommens- und Vermögensarten.<br />
2. Die jüngeren Arbeitsmarktreformen, insbesondere die<br />
sog. Hartz-Gesetze, sind in ihren zentralen Elementen<br />
zurückzunehmen. Dazu zählen insbesondere Leistungskürzungen<br />
für Arbeitslose bzw. Leistungsentzug, Ausweitung<br />
der Zumutbarkeit anzunehmender Arbeitsverhältnisse,<br />
die sog. Ein-Euro-Jobs sowie die Beschneidung der<br />
gewerkschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten in der<br />
Agentur für Arbeit.<br />
3. Alle Arbeitslosen müssen unabhängig von Familienstand<br />
und Lebensform eine eigenständige menschenwürdige<br />
Existenzsicherung erhalten. Die Leistungen insbesondere<br />
nach ALG II sind zu erhöhen. Insbesondere die verschärfte<br />
Anrechnung von Partner-, Familien- und Haushaltseinkommen<br />
ist aufzuheben und die Anrechnung von eigenen<br />
Vermögensbeständen und Vorsorgeleistungen (für<br />
Alterssicherung, Ausbildung der Kinder, „harte Zeiten“<br />
etc.) ist deutlich zu lockern.<br />
4. Von der Zumutbarkeit anzunehmender Arbeitsverhältnisse<br />
sind u.a. auszunehmen: Arbeiten unterhalb tariflicher,<br />
mindestens aber ortsüblicher Vergütung, was ggf. durch<br />
die Agentur für Arbeit nachzuweisen ist, geringfügige<br />
Beschäftigung. Die Verfügbarkeit darf bei Erziehung und<br />
Pflege nicht aufgehoben werden, der Zugang zu Vermittlung<br />
und Arbeitsförderung ist auch für diese Personengruppe<br />
zu sichern. (ist erledigt durch Rechtslage)<br />
5. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen,<br />
die sog. Ein-Euro-Jobs, sind umgehend abzuschaffen.<br />
Solange es weiterhin solche Ein-Euro-Jobs gibt, leisten<br />
<strong>DGB</strong> und Einzelgewerkschaften Unterstützung für
die Betroffenen, prüfen, ob hierdurch reguläre Arbeitsplätze<br />
vernichtet wurden/werden, und leiten ggf. rechtliche<br />
oder sonstige Interventionsschritte ein. <strong>DGB</strong> und Einzelgewerkschaften<br />
verpflichten sich, keine Ein-Euro-Jobberinnen<br />
oder durch sie erbrachte Leistungen einzusetzen.<br />
Begründung:<br />
Die Zugangs- und Anrechnungsvorschriften, die für das neu<br />
eingeführte ALG II nochmals deutlich verschärft wurden,<br />
führten vielfach zu Leistungskürzungen und Leistungsentzug<br />
für Arbeitslose. Hiervon sind v.a. Frauen negativ betroffen,<br />
soweit sie mit einem erwerbstätigen Ehemann oder<br />
Partner zusammenleben. Dies stellt die Rückkehr zu einem<br />
patriarchalen Ehe- und Familienmodell dar, in dem Frauen<br />
auf die ökonomische und damit auch persönliche Abhängigkeit<br />
von einem „Versorger“ verwiesen werden: So stieg<br />
vor Inkrafttreten des ALG II die Zahl der Eheschließungen<br />
u.a. deshalb, um zumindest die Krankenversicherung arbeitsloser<br />
Frauen zu sichern, die keine Ansprüche an ALG II<br />
zu erwarten hatten. Zusammen mit der Ausweitung von<br />
geringfügiger Beschäftigung und der umfangreichen Einführung<br />
von Ein-Euro-Jobs, die insbesondere in sozialen<br />
Dienstleistungen eingerichtet werden und damit v.a. reguläre<br />
Frauenarbeitsplätze gefährden, wird damit Frauen die<br />
gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben beschnitten.<br />
Stattdessen werden Frauen auf solche Zuverdienstmöglichkeiten<br />
verwiesen. Ohne Leistungsansprüche besteht für<br />
erwerbsarbeitslose Frauen auch kaum Zugang zu Maßnahmen<br />
der aktiven Arbeitsförderung. Für BerufsrückkehrerInnen<br />
sind diese als „Soll-Leistung“ vorgesehen. Die neue<br />
Geschäftspolitik der Agentur für Arbeit ermöglicht mit ihrer<br />
Orientierung am Kosten-Nutzen-Prinzip keine zielgruppenorientierte<br />
Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung<br />
mehr, die an dem Unterstützungsbedarf der Arbeitlosen<br />
statt an der Höhe ihrer Leistungsansprüche ansetzt. Insoweit<br />
Ansprüche an ALG II bestehen, sind diese mit 331<br />
Euro in den NBL und 345 Euro in den ABL für den Lebensunterhalt<br />
in keiner Weise ausreichend. Die jüngsten Arbeitsmarktreformen<br />
zielen im Wesentlichen darauf, die Leistungen<br />
für Arbeitslose zu reduzieren, um den Bundeshaushalt<br />
zu sanieren, Arbeitslose durch Leistungsentzug aus der<br />
Arbeitslosenstatistik herauszudrängen und Druck auf das<br />
Lohnsystem auszuüben. Die Positivaspekte, die die Hartz-<br />
Gesetze enthalten, sind demgegenüber nebenrangig. Deshalb<br />
müssen die Hartz-Gesetze zurückgenommen und nicht<br />
nur punktuell geändert werden. Die drastisch ausgeweiteten<br />
Zumutbarkeitsregeln, die eine Niedrigst-Vergütung bis<br />
zu 30 Prozent unterhalb der ortsüblichen Entgelte ermögli-<br />
chen und die neu eingeführten sog. Ein-Euro-Jobs gefährden<br />
massiv die erreichten und erkämpften sozialen Standards<br />
und (Tarif) Einkommen. Reguläre Arbeitsplätze werden<br />
im Bereich von bzw. für Kommunen erbrachte Leistungen<br />
durch „preiswerte“ Arbeitslose ersetzt, auch wenn dies<br />
von der Bundesregierung ausdrücklich nicht intendiert ist.<br />
Durch den Zwang zur Annahme auch schlechter Arbeitsbedingungen<br />
werden prekäre, niedrigentlohnte Arbeitsverhältnisse<br />
künftig massiv ausgeweitet (Lohndumping etc.)<br />
Durch die Legalisierung und damit Aufhebung der Sittenwidrigkeit<br />
des Berufs der Prostitution im Jahr 2002 gibt es<br />
derzeit keine gesetzliche Regelung, die arbeitslose Frauen<br />
und Männer davor schützt, ohne leistungsrechtliche Sanktionen<br />
zu solchen Tätigkeiten gegen ihren Willen vermittelt<br />
zu werden. Dabei geht es nicht nur um die Ausübung sexueller<br />
Dienstleistungen im engeren Sinne, sondern auch um<br />
Umfeld-Tätigkeiten, insofern z.B. Kellnerinnen in Striptease-<br />
Bars oder Bordellen vermittelt und dort gezwungen werden<br />
könnten, für sie nicht akzeptable Kleidung zu tragen.<br />
Für die bestehende Massenarbeitslosigkeit tragen nicht die<br />
Arbeitslosen die Verantwortung, sondern im Wesentlichen<br />
ein Unterangebot existenzsichernder Arbeitsplätze auf dem<br />
regulären Arbeitsmarkt.<br />
G 002 Änderungsantrag zum Antrag C 002:<br />
Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik<br />
Antragsteller/in: Elke Möller (ver.di) u.a.<br />
Beschluss: Annahme mit den Änderungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Einfügung im Absatz 1:<br />
"… und persönliche Stabilisierung zu ermöglichen. Für<br />
Arbeitslose, die aufgrund der Partnereinkommensanrechnung<br />
aus dem Leistungsbezug ausscheiden (Nicht-LeistungsempfängerInnen)<br />
sowie für Frauen, die aufgrund<br />
von vorheriger Kindererziehungs- und Pflegezeiten keinen<br />
Leistungsanspruch haben (Berufsrückkehrerinnen) ist<br />
der Zugang zur Vermittlung und Arbeitsförderung sicherzustellen,<br />
insbesondere durch Verfügbarkeit der dazu notwendigen<br />
Finanzmittel. Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung…"<br />
Einfügung im Absatz 4:<br />
"…geringfügige Beschäftigung. Die Verfügbarkeit darf bei<br />
Erziehung und Pflege nicht aufgehoben werden, der<br />
81
82<br />
Zugang zu Vermittlung und Arbeitsförderung ist auch für<br />
diese Personengruppe zu sichern."<br />
Begründung:<br />
Zu 1: Aus dem bisherigen Wortlaut lässt sich schließen,<br />
dass keine Unterschiede zwischen den EmpfängerInnen von<br />
ALG I und ALG II gemacht werden sollen. Es ist unklar, ob<br />
auch die durch Partnereinkommensanrechnung aus dem<br />
Leistungsbezug ausgeschiedenen Arbeitslosen und die<br />
Berufsrückkehrerinnen gemeint sind.<br />
Zu 4: Derzeit kann die Verfügbarkeit aberkannt werden,<br />
wenn Kinder und Pflegebedürftige nicht „versorgt“ sind.<br />
Das führt dazu, dass es im SGB II wieder einen Personenkreis<br />
gibt, der dem alten Status der Sozialhilfe gleichkommt:<br />
Die Personen erhalten Leistungen, ohne als arbeitslos<br />
zu gelten. Nicht Arbeitslose haben jedoch keinen Anspruch<br />
auf Vermittlung und Arbeitsförderung. Solange die<br />
Kinder- und Pflegebetreuung nicht sichergestellt werden<br />
kann, sind hiervon in erheblichem Umfang Frauen betroffen.<br />
C 003 Bedarfsgemeinschaft Hartz IV<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Baden-<br />
Württemberg<br />
Beschluss: Erledigt durch Annahme von Antrag<br />
C002<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
dass an den <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand der Auftrag erteilt wird,<br />
die Bundesregierung aufzufordern, die Regelungen des<br />
Sozialgesetzbuches II, Hartz IV-Gesetze, insbesondere in<br />
Bezug auf die Bedarfsgemeinschaften, zurückzunehmen.<br />
Begründung:<br />
Angesichts der Tatsache, dass Hartz IV Millionen in Armut<br />
stürzen wird, dass ein menschenunwürdiges Leben sowie<br />
Arbeit in Würde, wie es in unserer Verfassung verankert ist,<br />
nicht mehr möglich ist und zudem insbesondere Frauen<br />
benachteiligt und wieder Frauen in patriarchale Abhängigkeiten,<br />
insbesondere durch die Einführung der Bedarfsgemeinschaften<br />
zwingt, muss dieses Gesetz zurückgenommen<br />
werden.<br />
C 004 Gender Mainstreaming bei Hartz IV<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Baden-Württemberg<br />
Beschluss: Annahme mit folgenden Änderungen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand wird aufgefordert,<br />
eine Kommission zu gründen,<br />
die die Einhaltung des Prinzips Gender<br />
Mainstreaming im SGB II, in den Antragsformularen<br />
für Arbeitslosengeld II und den<br />
Bescheiden für Arbeitslosengeld II überprüft.<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
dass an den <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand der Auftrag erteilt wird,<br />
eine Kommission zu gründen, die auf Grundlage des Gender<br />
Mainstreaming im SGB II, den Antragsformularen auf<br />
Arbeitslosengeld II und den Bescheiden für Arbeitslosengeld<br />
II überprüft. Die Bundesregierung muss aufgefordert werden,<br />
umgehend dafür Sorge zu tragen, die bestehende Diskriminierung<br />
der Frauen im SGB II, den Antragsformularen<br />
und Bescheiden zum Arbeitslosengeld II zu beseitigen bzw.<br />
deren Beseitigung zu veranlassen. Sie hat für die Zukunft in<br />
weiteren Gesetzen und Gesetzesänderungen Diskriminierungen<br />
der Frauen auf jeden Fall zu unterlassen.<br />
Begründung:<br />
1. „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der<br />
Gleichstellung von Frauen und Männern und wirkt auf<br />
die Beseitigung bestehender Nachteile hin“ (GG § 3,2)<br />
2. „Gender Mainstreaming“ ist Kernaufgabe des <strong>DGB</strong> und<br />
seiner Mitgliedsgewerkschaften.<br />
3. „Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist als<br />
durchgängiges Prinzip zu verfolgen“, SGB II Kapitel 1, §<br />
1, Absatz 1, Satz 3.<br />
3.1 Bereits im gleichen Abschnitt dieses Gesetzes unter Ziffer<br />
2 wird dieses Prinzip wieder verworfen und nur die<br />
„...Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen“ in Betracht<br />
gezogen. In jedem der nachfolgenden Kapitel dieses so<br />
genannten „Jahrhundertwerkes“ wird die weibliche<br />
Form missachtet und die Rede ist nur noch von dem<br />
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, dem Antragsteller,<br />
dem Bezieher, dem Erben, dem Leistungsempfänger,<br />
den Vermietern und dem Bevollmächtigten einer<br />
Bedarfsgemeinschaft.<br />
3.2 Eines von den vielen diskriminierenden Beispielen im<br />
SGB II soll hier dargestellt werden:<br />
§ 10 – Zumutbarkeit – Absatz (1) Dem erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn,<br />
dass 1. er zu der bestimmten Arbeit ... 2. die Ausübung<br />
der Arbeit ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen<br />
überwiegenden Arbeit wesentlich erschweren würde... ,<br />
3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kindes<br />
oder des Kindes seines Partners gefährden würde, ... 4.<br />
die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen<br />
nicht vereinbar wäre ... Der Absatz (2) setzt den<br />
diskriminierenden Sprachgebrauch fort.<br />
3.3 Anzuführen ist noch § 12 – zu berücksichtigendes Vermögen<br />
–, das in diesem Fall rein männlich zugeordnet<br />
ist – ... soweit der Inhaber das Altersvorsorgevermögen<br />
..., ... geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen,<br />
soweit der Inhaber sie vor ..., des erwerbsfähigen<br />
Hilfebedürftigen und seines Partners ..., wenn der<br />
erwerbsfähige Hilfebedürftige oder sein Partner von der<br />
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
befreit ist. Hier ist zudem nur die rein männliche<br />
gleichgeschlechtliche Partnerschaft akzeptiert.<br />
Die diskriminierenden Formulierungen des Gesetzestextes<br />
werden in dem meist 20-seitigen Antragsformular für<br />
das Arbeitslosengeld II einschließlich seiner Zusatzblätter<br />
und zusätzlichen Zusatzblätter fortgeführt. Dem<br />
nicht genug wird in den Bescheiden für das Arbeitslosengeld<br />
II die Missachtung der Frauen in rein männlichen<br />
Formulierungen wie „der Empfänger“ und „der<br />
Antragsteller“ usw. fortgesetzt.<br />
<strong>Sachgebiet</strong> D: Arbeitzeit /<br />
Arbeitsbedingungen<br />
D 001 Arbeitszeit<br />
Antragsteller/in: IG Metall-Frauenausschuss beim Vorstand<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert den <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand<br />
auf, eine breite gesellschaftliche Diskussion um<br />
die zukünftige Arbeitszeitgestaltung zur <strong>Sicherung</strong> und<br />
Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland zu initiieren.<br />
Im Rahmen dieser Kampagne ist es Aufgabe des <strong>DGB</strong>-Bundesvorstandes,<br />
die Interessen der Mitgliedsgewerkschaften<br />
zu koordinieren und zu bündeln. Es gilt, die bereits vorhandenen<br />
alternativen Vorstellungen und Vorschläge zu einer<br />
differenzierten Arbeitszeitpolitik, wie z. B. Arbeitszeitverkür-<br />
zung, systematisch zu erfassen und überzeugende kollektive<br />
Lösungsstrategien zu entwickeln.<br />
Begründung:<br />
Bei fehlenden Arbeitsplätzen von 7 Millionen ist es dringender<br />
denn je, dass sich Gewerkschaften wieder wahrnehmbar<br />
und gestaltend in die Diskussion von Lösungsstrategien<br />
einmischen.<br />
Gewerkschaften haben mit Arbeitszeitpolitik immer den<br />
Anspruch verbunden, Arbeit umzuverteilen. In einer anderen<br />
Verteilung von Arbeitszeit wurde ein wichtiges Mittel gesehen,<br />
Erwerbslosigkeit zu verhindern oder zumindest abzubauen.<br />
Viele engagierte Kolleginnen und Kollegen haben für<br />
die Verkürzung der Arbeitszeiten hart gekämpft. Mit der<br />
Verkürzung der Arbeitzeiten wurden flexiblere betriebliche<br />
Arbeitszeitmodelle eingeführt. Parallel dazu haben sich<br />
infolge von Individualisierungsprozessen, des Wandels von<br />
Familien- und Lebensformen und veränderter kultureller<br />
Geschlechtsrollenbilder die Arbeitszeit und Arbeitszeitpräferenzen<br />
der Beschäftigten ausdifferenziert.<br />
In der gegenwärtigen Diskussion um Arbeitszeiten geht es<br />
jedoch ausschließlich um Wirtschaftswachstum, verbesserte<br />
Investitions-, Gewinn- und Ertragsbedingungen für Unternehmen<br />
sowie eine neoliberale Angebotsstrategie des<br />
erhöhten Drucks auf Erwerbslose (durch den Abbau von<br />
Lohnersatzleistungen). Arbeitszeitverlängerung scheint in<br />
der Öffentlichkeit gegenwärtig der einzig mögliche Weg.<br />
In dieser Schlussfolgerung wird schlicht außer Acht gelassen,<br />
dass Regelungen zur Arbeitszeit nicht nur Betriebskosten<br />
beeinflussen, sondern dass sie Auswirkungen auf das<br />
gesamte gesellschaftliche Zusammenleben haben.<br />
Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit, und Lebenszeit bedeutet<br />
nicht nur Ökonomie. Es ist die Zeit, in der die Menschen ihr<br />
Leben eigenverantwortlich und solidarisch gestalten können<br />
sollten. Frauen und Männer, Mütter und Väter, Ältere und<br />
Jüngere, Kinder und Erwachsene. Es kann keine Perspektive<br />
sein, dass einige Menschen möglichst ununterbrochen rund<br />
um die Uhr erwerbstätig sind, während andere keine<br />
Erwerbsarbeit finden und ihr Leben von Sozialhilfe bestreiten<br />
müssen. Ebenso wenig kann es unsere Perspektive sein,<br />
dass Vater wieder ausschließlich Geld verdient, während<br />
Mutter sich um Küche und Kinder kümmert. „Samstags<br />
gehört Vati mir“ hieß es in einem Slogan 1956, der nach<br />
einem Spiegelartikel nur noch für die Geschichtsbücher<br />
taugt. Es gerät aus dem Blick, dass zu einer „gerechten“<br />
zukunftsfähigen Gesellschaft eine andere Verteilung von<br />
Erwerbsarbeit und nicht bezahlter Arbeit gehört, dass sich<br />
die tatsächlichen Arbeitszeiten von Frauen und Männern in<br />
beiden Bereichen einander annähern müssen.<br />
83
84<br />
Arbeitszeiten und das damit verbundene Einkommen prägen<br />
den sozialen Status eines Menschen in unserer Gesellschaft.<br />
Das ist einer der Gründe, warum junge hoch qualifizierte<br />
Frauen auf Kinder verzichten. Gesellschaftlich höchst<br />
fatal.<br />
Nur selten berücksichtigen Arbeitszeitmodelle die Anforderungen<br />
von Müttern und Vätern. Studien zur Arbeitszeitpolitik<br />
belegen, dass sich Beschäftigte eine Arbeitszeit wünschen,<br />
die zwar flexibel ist, aber auch beeinflussbar, gestaltbar<br />
und individuell planbar. Die Unternehmen dagegen wollen<br />
flexible Arbeitszeiten, um Schwankungen der Auftragslage<br />
aufzufangen und Neueinstellungen zu vermeiden.<br />
In der Konsequenz heißt das: Die Beschäftigungsquote von<br />
Frauen nach der Geburt von Kindern sinkt dramatisch.<br />
Mit einer generellen Verlängerung der Arbeitszeit würden<br />
insbesondere Mütter vermehrt aus der Erwerbsarbeit herausgedrängt<br />
oder auf Teilzeitarbeitsverhältnisse verwiesen.<br />
In den sog. niedrig qualifizierten und natürlich auch gering<br />
bezahlten Bereichen soll möglichst kurz, in den höher qualifizierten<br />
Bereichen jedoch erheblich länger gearbeitet werden.<br />
Da allerdings die Mehrheit der erwerbstätigen Frauen<br />
in sog. niedrig qualifizierten und gering bezahlten Bereichen<br />
zu finden sind, wird auch auf diesem Wege eine<br />
gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen am<br />
Erwerbsleben verhindert.<br />
Für die Männer bedeuten längere Arbeitszeiten, dass sie<br />
sich wieder aus der Familien- und Hausarbeit zurückziehen<br />
können oder müssen. Soll es in dieser Welt allerdings<br />
gerecht zugehen, müssen u.a. auch die Arbeitszeiten in<br />
Beruf und Privatsphäre zwischen Männern und Frauen<br />
gerecht geteilt werden.<br />
Eine veränderte Sichtweise auf Arbeitszeitpolitik bedeutet<br />
neben der Schaffung und <strong>Sicherung</strong> von Arbeitsplätzen<br />
ebenso die bewusste Gestaltung solcher im Sinne existenzsichernder,<br />
sozial abgesicherter qualifizierter Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für beide Geschlechter. Die Etablierung<br />
eines Niedriglohnsektors durch vermehrte Mini-Jobs widerspricht<br />
einer solchen qualitäts- und gleichstellungsorientierten<br />
Arbeitszeitpolitik völlig.<br />
D 002 Arbeitszeit<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss West<br />
Beschluss: Annahme als Material zu Antrag<br />
D 001<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Delegierten der 16. ordentlichen Bundesfrauenkonferenz<br />
fordern den <strong>DGB</strong> auf, eine mittel- und langfristige<br />
Kampagne zu starten, die darauf zielt, die Zeitinteressen<br />
der Beschäftigten öffentlich wahrnehmbar zu machen und<br />
die Beschäftigten zu ermutigen, Zeitinteressen im Arbeitsleben<br />
offensiv einzufordern.<br />
Im Mittelpunkt dieser Kampagne sollen stehen:<br />
❚ das Recht auf existenzsichernde Arbeit für alle,<br />
❚ eine gerechtere Verteilung der Arbeit, z.B. durch allgemeine<br />
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich,<br />
Begrenzung der Lebensarbeitszeit und Entwicklung<br />
arbeitnehmerInnenorientierter Arbeitszeitmodelle ( z.B.<br />
Sabbatzeiten).<br />
Die aktuell dominierenden, vor allem mit wirtschaftspolitischen<br />
Argumenten vertretenen Arbeitgeberinteressen sollen<br />
in der gesellschaftlichen Debatte um Arbeitszeit zurückgedrängt<br />
werden, damit Arbeitszeit über tarifliche Auseinandersetzungen<br />
wieder erfolgreich im Interesse der Beschäftigten<br />
gestaltet werden kann.<br />
Zeit ist Leben<br />
❚ Arbeitszeitverlängerung erschwert für die Mehrheit der<br />
Beschäftigten die Balance zwischen Leben und Arbeit.<br />
❚ Arbeitszeitverlängerung erhöht die Zeitnot, insbesondere<br />
der Beschäftigten, deren „Freizeit“ durch Kindererziehung,<br />
Pflege und andere soziale Arbeit aufgefressen<br />
wird.<br />
❚ Lange Arbeitszeiten, fehlende Pausen bzw. Verfügungszeiten<br />
und hoher Zeitdruck im Arbeitsleben sind gesundheitsschädlich,<br />
teuer für die Sozialversicherungskassen<br />
und unproduktiv für die Wirtschaft.<br />
❚ Individuelle Arbeitszeitverkürzung (Teilzeit) ist in allen<br />
Funktionen möglich – für Frauen und Männer.<br />
❚ Arbeitszeiten, die nach Lage und Dauer gesundheitsschädlich<br />
oder aus anderen Gründen belastend sind, sind<br />
nicht selbstverständlich und müssen ausgeglichen werden.<br />
❚ Die Gestaltung der Arbeitszeit muss demokratisches<br />
Engagement und die Teilhabe am gesellschaftlichen und<br />
kulturellen Leben ermöglichen.
Zeit ist Geld<br />
❚ Arbeitszeit muss ordnungsgemäß erfasst und adäquat<br />
bezahlt werden.<br />
❚ Wer verkürzt arbeitet, hat gleiche Rechte und darf nicht<br />
benachteiligt werden.<br />
❚ Arbeitszeitverlängerung senkt die Karrierechancen und<br />
damit auch die Verdienstmöglichkeiten von Frauen und<br />
Männern, die aufgrund sozialer und familiärer Arbeit<br />
nicht in der Lage sind, ihre Erwerbszeiten im Interesse<br />
von Unternehmen beliebig zu erhöhen oder zu verlegen.<br />
❚ Arbeitszeitverlängerung für gleichen Lohn bedeutet<br />
Lohnsenkung und Arbeitsplatzvernichtung.<br />
❚ Weiterbildung und Qualifizierung sollen während der<br />
Arbeitszeit stattfinden.<br />
Zeit ist Macht<br />
❚ ArbeitnehmerInnen wollen/brauchen mehr Einfluss auf<br />
die Gestaltung ihrer individuellen Arbeitszeit.<br />
❚ Arbeitszeitkonten sind kein Freibrief für Unternehmer:<br />
Beschäftigte wollen und brauchen gesicherte Entnahmerechte<br />
für Arbeitszeitkonten.<br />
❚ Unrealistische, nicht selbst zu steuernde Zielvereinbarungen<br />
und Zielvorgaben sind das Gegenteil von Zeitsouveränität.<br />
Begründung:<br />
Viele Kolleginnen und Kollegen trauen sich im momentanen<br />
gesellschaftlichen Klima nicht, ihre legitimen Bedürfnisse<br />
nach kürzeren Arbeitszeiten gegenüber ihrem Arbeitgeber<br />
einzufordern oder nehmen stillschweigend Benachteiligungen<br />
hin, wenn sie dies tun.<br />
Deshalb brauchen wir eine neue Arbeitszeitinitiative, die<br />
nicht nur wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch für Arbeitszeitverkürzung<br />
argumentiert, sondern mehr als bisher die<br />
verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse der Beschäftigten<br />
artikuliert und zum gesellschaftlich wahrnehmbaren und<br />
relevanten Thema macht und damit auch die Einzelnen<br />
ermutigt, für diese Interessen im Betrieb einzustehen.<br />
In den Unternehmen und Verwaltungen werden Betriebsund<br />
Personalräte täglich mit neuen Formen der Arbeitszeitgestaltung,<br />
mit Zeitkonten- oder Vertrauensarbeitszeit-<br />
Modellen, mit Fragen von Projektarbeit und Zielvereinbarungen<br />
und nicht zuletzt mit realen – verdeckten oder offenen<br />
– Arbeitszeitverlängerungen konfrontiert.<br />
Seit einiger Zeit setzen sich Arbeitgeberverbände und Politiker<br />
auch öffentlich immer massiver für Arbeitszeitverlängerung<br />
ein.<br />
Im Leben der Beschäftigten sind die privaten Zeitbedürfnisse<br />
und -erfordernisse widersprüchlichen Tendenzen ausgesetzt:<br />
Einerseits wird die reale Arbeitszeit immer länger. Die Kluft<br />
zwischen tariflichen und tatsächlichen Arbeitszeiten wird<br />
immer größer. Die Überstunden nehmen zu und haben sich<br />
im Dienstleistungsbereich in den letzten zehn Jahren gar<br />
verdoppelt.<br />
Das Phänomen Arbeitssucht ist längst nicht mehr nur auf<br />
Hochqualifizierte begrenzt.<br />
Andererseits wachsen die Bedürfnisse nach kürzeren<br />
Arbeitszeiten, nach einer ausgeglichenen „Work-Life-Balance“,<br />
nach geschlechtergerechten Chancen für die Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf. Teilzeit ist da oft ein pragmatischer<br />
individueller Ausweg aus dem Vereinbarkeitsdilemma,<br />
ein Weg, der nach wie vor fast ausschließlich für Frauen<br />
gilt.<br />
Diese Entwicklung führt zunehmend zur Spaltung zwischen<br />
lange arbeitenden, gutverdienenden Männern mit sicheren<br />
Arbeitsplätzen und beruflich marginalisierten Frauen mit<br />
kürzeren Arbeitszeiten, geringerem Einkommen in prekären<br />
Beschäftigungsverhältnissen. Die länger werdenden Arbeitszeiten<br />
der Männer rechtfertigen dann obendrein noch, dass<br />
die ganze Bürde der Familienarbeit wieder den Frauen<br />
obliegt.<br />
Die offiziell häufig geforderte 40-Stunden-Woche ist längst<br />
Realität: Während die tarifliche Arbeitszeit in Deutschland<br />
bei durchschnittlich 37,7 Stunden liegt, beträgt die tatsächliche<br />
durchschnittliche Arbeitszeit längst 40 Stunden<br />
(2002), ein guter Mittelwert in der (alten) europäischen<br />
Union. Je nach Branche werden die 40 Stunden allerdings<br />
erheblich überschritten.<br />
Die Arbeitszeitflexibilisierung, die mittlerweile für die Hälfte<br />
der ArbeitnehmerInnen in Deutschland gilt, führt zum Beispiel<br />
dazu, dass in Zeiten betrieblicher Auslastungsstärken<br />
wesentlich längere Arbeitszeiten gelten. Und die vertraglich<br />
vorgesehenen Ausgleichszeiträume werden nur von 14 %<br />
der Betriebe eingehalten. Jede Woche leistet jeder Arbeitnehmer<br />
und jede Arbeitnehmerin im Durchschnitt eine<br />
Stunde Mehrarbeit ohne Freizeitausgleich oder Bezahlung.<br />
Durchschnittlich verfallen pro Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin<br />
außerdem 2,2 Urlaubstage pro Jahr.<br />
Gleichzeitig steigt die durchschnittliche Arbeitszeitdifferenz<br />
zwischen Frauen und Männern: von 6,4 Stunden in 1985<br />
auf 9,6 Stunden in 2001. Im Durchschnitt arbeiten Männer<br />
also immer länger und Frauen immer kürzer.<br />
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung am Gesamtarbeitsvolumen<br />
wuchs zwischen 1991 und 2000 in Westdeutschland<br />
von 9,2 auf 13, 2 %, in Ostdeutschland von 5,3 auf 10,3<br />
%.<br />
Im Dienstleistungssektor (West) beträgt der Anteil der Teilzeitarbeit<br />
am Gesamtarbeitsvolumen bereits 30,1 % (Ost:<br />
85
86<br />
21,4 %). In Ost und West ist Teilzeitarbeit hauptsächlich<br />
Frauensache: Nur 5 % der Männer arbeiten Teilzeit, aber<br />
45% der erwerbstätigen Frauen im Westen und 26 % der<br />
Frauen im Osten.<br />
Auch der Anteil der geringfügig Beschäftigten hat zugenommen:<br />
Immerhin arbeiten mittlerweile 31,7 % aller teilzeitbeschäftigten<br />
Frauen im Westen als geringfügig<br />
Beschäftigte, im Osten sind es 20,7 %. Wichtiges Motiv im<br />
Westen ist die Familienarbeit, im Osten hauptsächlich der<br />
Mangel alternativer Angebote.<br />
Viele Studien zeigen: Die tatsächlichen Arbeitszeiten entsprechen<br />
in der Regel nicht den Wünschen der Beschäftigten.<br />
Personen mit langen Arbeitszeiten wollen eher reduzieren,<br />
Teilzeitbeschäftigte wollen ihre Stundenzahl eher aufstocken.<br />
Zunehmend klagen Beschäftigte über Zeitdruck und Stress<br />
in der Arbeit. Gesundheitliche Folgen sind abzusehen und<br />
werden die Sozialversicherungssysteme zusätzlich belasten.<br />
Die alltäglichen Erfahrungen der Beschäftigten bieten also<br />
eine ganze Reihe von konkreten Anknüpfungspunkten für<br />
eine offensive Arbeitszeitdebatte – jenseits wirtschaftspolitischer<br />
Schaufensterkämpfe, die für die Betroffenen oft nur<br />
begrenzt nachvollziehbar sind.<br />
D 003 Gesundheitsschutz und Arbeitszeit<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Baden-<br />
Württemberg<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
dass die Mitgliedsgewerkschaften aufgefordert werden, das<br />
Thema Gesundheitsschutz bei ihren Arbeitszeitdebatten und<br />
-beschlüssen zu berücksichtigen.<br />
Begründung:<br />
Folgende Lösungsansätze für gesundheitsfördernde Arbeitszeiten<br />
sind aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes<br />
dringend notwendig:<br />
Debatte über gesundheits-, alters- und familiengerechte<br />
sowie lebenssituative Arbeitszeiten.<br />
Reduzierung der tatsächlichen Arbeitszeiten auf die tarifliche<br />
Arbeitszeit mit der 30-Stunden-Woche als Ziel.<br />
Weitere Arbeitszeitverkürzung für besonders belastete<br />
Beschäftigtengruppen.<br />
Tarifliche Zeitkontenregulierung:<br />
Regulierung der Höchstarbeitszeit zum Schutz vor Überfor-<br />
derung: regelmäßige tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeit<br />
8 bzw. 40 Stunden.<br />
Planbarkeit durch angemessene Ankündigungsfristen für<br />
Arbeitszeitschwankungen sicherstellen und individuelle Verfügungsrechte<br />
regeln.<br />
Belastungsnahe Zeitausgleiche ermöglichen.<br />
Entdichtung der Arbeit durch tarifliche und betriebliche Leistungsregulierung.<br />
Schicht- und Wochenendarbeit eindämmen.<br />
Humanere Schichtplangestaltung.<br />
Keine Dauernachtschichten, sondern kurze Nachtschichtblöcke.<br />
Kurze rollierende Schichtrhythmen.<br />
Darüber hinaus ist eine breite gesellschaftliche Debatte<br />
über Arbeits- und Lebensarbeitszeit unter Berücksichtigung<br />
der Fragestellung:<br />
❚ wer definiert die Anforderungen des Marktes,<br />
❚ wer die Leistungsfähigkeit und die Zeitbedürfnisse der<br />
Menschen<br />
dringend erforderlich.<br />
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gesundheit auch<br />
durch die Arbeitszeit beeinflusst wird. Dabei spielen Dauer<br />
der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit, die Lage und<br />
Verteilung der Arbeitszeit, die Arbeitszeitflexibilisierung und<br />
die Arbeitsintensität eine Rolle.<br />
Die zunehmende Rückkehr zur 40-Stunden-Woche und die<br />
Einführung von Flexi- und Langzeitkonten haben dazu<br />
geführt, dass in vielen Bereichen die tägliche sowie die<br />
wöchentliche Arbeitszeit über die tarifvertraglich vereinbarte<br />
hinaus verlängert wurde. Dies ist nicht nur ein arbeitszeitpolitisches<br />
Problem, sondern auch ein Problem der Leistungsbedingungen<br />
bzw. des Leistungsdrucks. Für viele<br />
Beschäftigte gilt: Je stärker der Leistungsdruck, desto länger<br />
die Arbeitszeit. Dies lässt sich durch Arbeitszeit-Studien<br />
belegen.<br />
Durch die Verlängerung der Arbeitszeit steigt auch die Belastung<br />
des/der Einzelnen. Eine Erholungsphase im Laufe<br />
eines 24-Stunden-Rhythmus ist von zentraler Bedeutung,<br />
um krankmachende Faktoren einer langen Arbeitszeit abzuwenden.<br />
Bei berufstätigen Frauen, vor allem mit Kindern, ist<br />
an eine Erholungsphase im 24-Stunden-Rhythmus häufig<br />
nicht zu denken. Regeneration kann – wenn überhaupt –<br />
nur am Wochenende erreicht werden.<br />
Die meisten gesundheitlichen Beschwerden von Beschäftigten<br />
nehmen bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 45 und<br />
mehr Stunden im Verhältnis zu denen, die nur 35 bis 40<br />
Stunden arbeiten, um einige Prozentpunkte zu. Am häufig-
sten sind Beschwerden des Rückens, danach folgen Nervosität<br />
und Kopfschmerzen. Aufgrund dieser Untersuchungen<br />
empfehlen ArbeitswissenschaftlerInnen, dass die regelmäßige<br />
Arbeitszeit 8 Stunden täglich nicht überschreiten sollte.<br />
Ab einem Lebensalter von ca. 50 Jahren sind 8 Stunden<br />
täglich eigentlich für alle zuviel. Denn mit zunehmendem<br />
Alter steigt der Bedarf an kürzerer Arbeitszeit.<br />
In Mittel- und Großbetrieben nimmt der Anteil an Samstags-<br />
und Sonntagsarbeit drastisch zu. Schichtarbeit ist in<br />
allen Großbetrieben weit verbreitet. Zusätzliche Schichtmodelle,<br />
wie Dauernachtschicht und Wochenendschicht, haben<br />
in den letzten Jahren zugenommen.<br />
Dadurch nehmen aber auch die gesundheitlichen<br />
Beschwerden zu. Auffällig erhöht ist der Anteil von Nervosität,<br />
Schlafstörungen, psychischer Erschöpfung und Rückenschmerzen.<br />
Das Wochenende ist zur Regeneration und zur<br />
Stressbewältigung durch die Pflege sozialer Kontakte wichtig.<br />
Schicht- und Nachtarbeit können zu schweren gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen führen. Sie haben negative Auswirkungen<br />
auf die Schlafdauer und -qualität. Damit wird<br />
die Erholungsfähigkeit des Menschen stark eingeschränkt.<br />
Die zur Stressbewältigung benötigte sozial wertvolle Zeit ist<br />
bei Nacht- und Schicht-Beschäftigten verkürzt, insbesondere<br />
dann, wenn auch noch am Wochenende gearbeitet wird.<br />
Die Fehl- und Überbeanspruchung des Organismus in<br />
Nachtarbeit versetzt die Betroffenen in einen sich selbst<br />
verstärkenden Teufelskreis von Überanstrengung und chronischer<br />
Ermüdung, der sich in Beeinträchtigungen und Störungen<br />
von Gesundheit und Leistungsvermögen niederschlägt.<br />
Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Folge der Überforderung<br />
und nervöse Störungen (z.B. Reizbarkeit, Abgeschlagenheit)<br />
als Resultat ständiger Müdigkeit sind daher typische<br />
Krankheiten bei Nacht- und SchichtarbeiterInnen.<br />
Ergebnisse einer dänischen Untersuchung haben ergeben,<br />
dass bereits nach 6 Monaten Nachtarbeit bei Frauen das<br />
Brustkrebsrisiko um 50 Prozent steigt.<br />
Bei Nachtarbeit ist die Widerstandsfähigkeit des Organismus<br />
gegenüber weiteren Arbeitsbelastungen herabgesetzt,<br />
z.B. gegenüber Lärm, Gefahrstoffen (Grenzwerte richten<br />
sich nach max. 8-stündiger Arbeit am Tag), Klimaeinflüssen,<br />
Stress- und Arbeitsintensität.<br />
In der Nachtschicht sind die Unfallquoten doppelt so hoch.<br />
D 004 Verschlechterung des Ladenschlussgesetzes<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-<br />
Thüringen<br />
Beschluss: Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesfrauenausschuss<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong> sieht als einen der Hauptschwerpunkte der<br />
gewerkschaftspolitischen Arbeit den Kampf gegen eine<br />
noch weitere Verschlechterung des Ladenschlussgesetzes in<br />
seiner jetzt gültigen Fassung. Es dürfen nur solche Vorschläge<br />
zu Veränderungen unterstützt werden, die eine<br />
weitere Flexibilisierung der Öffnungszeiten einschränken.<br />
Der Schutzcharakter dieses Gesetzes muss erhalten und<br />
wieder ausgedehnt werden. Das Ladenschlussgesetz muss<br />
unter der Maßgabe des Erhaltes von Frauenarbeitsplätzen<br />
und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestaltet werden.<br />
Wir Delegierte fordern:<br />
1. die betriebliche Mobilisierung zum Erhalt des Ladenschlussgesetzes<br />
voranzutreiben,<br />
2. eine offene Auseinandersetzung mit Ladenschlussgegnern<br />
im Arbeitgeberlager,<br />
3. Formulierung von Anforderungen an die Politik, das<br />
Ladenschlussgesetz zu erhalten,<br />
4. die Bundesregierung aufzufordern, die Kompetenz zur<br />
Gesetzgebung nicht den Ländern zu übertragen,<br />
5 die Debatte über Arbeitszeitflexibilisierung intensiver zu<br />
führen und dabei in den Mittelpunkt die Interessen der<br />
Menschen, der ArbeitnehmerInnen und deren Familien<br />
zu stellen.<br />
Begründung:<br />
Die Änderung des Gesetzes in den Jahren 1996 und 2002<br />
hat nicht zur Anhebung der Beschäftigungsquote im Einzelhandel<br />
beigetragen. Ganz im Gegenteil sehen wir derzeit<br />
eine Entwicklung, die für Beschäftigte in dieser Branche<br />
ständig nachteiliger wird:<br />
Seit 1996 sind 215.000 Stellen im Einzelhandel abgebaut<br />
worden. Die Einzelhandelsumsätze stiegen seit dieser Zeit<br />
um 18,49 Mrd. Euro. Besonders dramatisch zeigt sich der<br />
Stellenabbau bei den Vollzeitbeschäftigten um ca. 200.000<br />
Stellen, aber auch im Teilzeitbereich wurden ca. 30.000<br />
Stellen abgebaut.<br />
Aber auch in den Betrieben zeigt sich die Deregulierung<br />
der Arbeitszeiten. So werden zunehmend MitarbeiterInnen<br />
87
88<br />
in hochflexiblen Teilzeit- oder prekären Beschäftigungsverhältnissen<br />
beschäftigt.<br />
Die Freizeitphasen werden durch ständige „Arbeitsbereitschaft“<br />
mehr und mehr eingeschränkt und für die meisten<br />
Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel wird Familienleben,<br />
ehrenamtliche Tätigkeit oder die Ausführung eines<br />
Hobbys unmöglich gemacht.<br />
Dies alles passiert in einem Bereich, wo Einkommen am<br />
unteren Durchschnitt liegen und der größte Teil der Beschäftigten<br />
Frauen sind.<br />
D 005 Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen<br />
von Frauen durch Änderungen<br />
des Arbeitsrechts verhindern<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong> möge sich dafür einsetzen:<br />
Der bestehende Schutz vor Kündigungen und Kettenarbeitsverträgen<br />
sowie der Anspruch auf Teilzeitarbeit darf nicht<br />
verschlechtert werden. Eingriffe in die Tarifautonomie durch<br />
gesetzliche Öffnungsklauseln, die untertarifliche Bedingungen<br />
durch Betriebsvereinbarung oder Einzelverträge zulassen,<br />
darf es nicht geben.<br />
Frauen wären von all diesen Maßnahmen noch stärker betroffen<br />
als Männer.<br />
Begründung:<br />
Benachteiligungen von Frauen in der Arbeitswelt sind Tatsachen.<br />
Frauen werden beim Zugang zur Beschäftigung<br />
benachteiligt, ihre Vergütung ist im Durchschnitt deutlich<br />
niedriger als die Vergütung von Männern, ihnen obliegt es,<br />
Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, oftmals auf<br />
Kosten des beruflichen Weiterkommens.<br />
Mit den Vorschlägen von CDU/CSU und FDP u.a. in ihren<br />
Programmen, das Arbeitsrecht weiter „zu reformieren“,<br />
werden sich die Arbeitsbedingungen vor allem auch von<br />
Frauen drastisch verschlechtern. Frauen werden gezwungen<br />
sein, mit weniger Sicherheit, schlechter bezahlt und mit<br />
geringeren Möglichkeiten, Familienarbeit und Erwerbsarbeit<br />
zu verbinden, auszukommen. Deshalb ist diesen Vorschlägen<br />
eine klare Absage zu erteilen.<br />
1. Kein verringerter Schutz vor Kündigungen<br />
Keiner der diskutierten Vorschläge, die zur Änderung des<br />
Kündigungsschutzes gemacht werden, wird eine positive<br />
Auswirkung auf den Arbeitsmarkt haben. Empirisch nachgewiesen<br />
ist, dass die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen<br />
von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und<br />
nicht vom Kündigungsschutz abhängt.<br />
Tatsächlich wird sich durch die Änderungen des Kündigungsschutzes<br />
die Situation für Frauen am Arbeitsmarkt<br />
deutlich verschlechtern. Eine Heraufsetzung der Schwelle,<br />
ab der der Kündigungsschutz gilt, auf 20 oder gar 50 Arbeitnehmer<br />
wird dazu führen, dass 90 % der Betriebe in<br />
Deutschland nicht mehr vom Kündigungsschutz erfasst werden.<br />
Vor allem im Dienstleistungsbereich, wo Frauen häufig<br />
in Betrieben dieser Größenklassen arbeiten, werden damit<br />
überproportional viele weibliche Beschäftigte in diesen<br />
Betrieben aus dem Kündigungsschutz herausfallen.<br />
Noch verheerender wird sich die Regelung auswirken, dass<br />
der Kündigungsschutz erst nach zwei Jahren (bzw. nach<br />
fünf, wenn es nach der FDP geht) Beschäftigungszeit gelten<br />
soll. Frauen sind schon bisher bei befristeter Beschäftigung<br />
überproportional vertreten. Wird nun nicht einmal mehr<br />
ordnungsgemäß die Befristung eines Arbeitsverhältnisses<br />
nötig sein, sondern wird die Probezeit einfach auf zwei<br />
Jahre ausgedehnt, dann ist die Perspektive „Lebensplanung“<br />
kaum noch vorhanden. Letztlich wird es dadurch<br />
gerade für Frauen immer schwerer, wenn sie berufstätig<br />
sein wollen, auch gleichzeitig den Kinderwunsch zu realisieren.<br />
Denn ohne die Perspektive, auch nach Schwangerschaft<br />
und Elternzeit wieder in ein gesichertes Arbeitsverhältnis<br />
zurückkehren zu können, ist die Entscheidung für eine<br />
Familie kaum zu treffen.<br />
Ebenso wird die Tatsache, dass der Kündigungsschutz durch<br />
eine Abfindungsregelung abgekauft werden kann, sich für<br />
Frauen besonders nachteilig auswirken. Besonders jüngere<br />
Frauen werden bei Einstellungen häufig als „Risikogruppe“<br />
angesehen.<br />
Wäre es möglich, den Kündigungsschutz bei Abschluss des<br />
Arbeitsvertrages gegen eine Abfindung abkaufen zu können,<br />
werden solche Vereinbarungen sicherlich vor allem mit<br />
jungen Frauen geschlossen werden. Heirat und Schwangerschaft,<br />
der Wunsch nach Teilzeit, Notwendigkeit der Betreuung<br />
eines erkrankten Kindes, all dies kann den Arbeitgeber<br />
dann dazu veranlassen, eine Kündigung auszusprechen,<br />
wenn er sich ausrechnet, dass dies für ihn finanziell, trotz<br />
der Zahlung der Abfindung, günstiger ist, als die Schutzrechte<br />
der Arbeitnehmerinnen zu wahren.<br />
Damit werden diese Schutzrechte ausgehöhlt, denn sie sind<br />
mit dem Kündigungsschutz untrennbar verbunden. Kündigungsschutz<br />
muss deshalb gestärkt und nicht geschwächt<br />
werden.
2. Keine Verschlechterung beim Teilzeitanspruch<br />
Der seit 2001 geltende Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung<br />
hat sich für Frauen und Männer positiv ausgewirkt. Eltern<br />
können auch nach der Elternzeit Teilzeit arbeiten. Männer<br />
haben den Teilzeitanspruch stärker genutzt. Dagegen ist es<br />
weder zu den prognostizierten Klagefluten gekommen noch<br />
hat die Umsetzung des Teilzeitanspruches zu betrieblichen<br />
Belastungen geführt.<br />
Tatsächlich hat sich die Teilzeitquote deutlich erhöht. Dazu<br />
hat auch der Teilzeitanspruch für den Einzelnen beigetragen<br />
und die Entscheidungsmöglichkeiten in bestehenden<br />
Arbeitsverträgen erweitert. Dabei soll es bleiben. Heute<br />
kann von Arbeitnehmerinnen zur besseren Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf, zur Qualifizierung oder auch zur<br />
altersgerechten Arbeitsplatzgestaltung der Teilzeitanspruch<br />
genutzt werden – ohne Angabe eines Grundes.<br />
Beschränkt man, wie es die CDU/CSU vorschlagen hat, den<br />
Teilzeitanspruch auf die Versorgung von Kindern und Familienangehörigen,<br />
wird damit ein positives Potenzial für die<br />
Entscheidungsfreiheit beseitigt.<br />
Darüber hinaus wird sich dadurch der begonnene Trend der<br />
Erhöhung der Teilzeitquote auch bei Männern, der sich indirekt<br />
auf die Beschäftigungssituation der Frauen positiv auswirkt,<br />
ins Gegenteil verkehren, denn noch immer sind die<br />
Betreuungspflichten in der Familie in erster Linie Aufgabe<br />
der Frauen.<br />
Um Teilzeit attraktiver zu gestalten und damit auch Teilzeit<br />
von Männern zu fördern, wäre es vielmehr richtig, die Rahmenbedingungen<br />
der Teilzeitarbeit etwa durch die Möglichkeit<br />
einer befristeten Teilzeitbeschäftigung sowie einen<br />
Rückkehranspruch auf Vollzeit oder längere Teilzeit zu verbessern.<br />
3. Befristungsregelungen nicht aufweichen<br />
Frauen werden bereits jetzt überproportional befristet beschäftigt.<br />
Immerhin konnte verhindert werden, dass nach<br />
Inkrafttreten des Teilzeit- und Befristungsgesetzes weiterhin<br />
Kettenarbeitsverträge durch das Aneinanderreihen von<br />
sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen mit kurzen Unterbrechungen<br />
möglich sind. Dieses Verbot soll nun aufgehoben<br />
und zur alten Rechtslage zurückgekehrt werden. Dies<br />
wird zur Folge haben, dass für viele Frauen der Weg in eine<br />
unbefristete Beschäftigung dauerhaft verschlossen bleibt.<br />
Nicht die Zahl der Arbeitsverhältnisse insgesamt wird<br />
zunehmen, sondern der Trend vom unbefristeten Arbeitsverhältnis<br />
zum befristeten Arbeitsverhältnis wird sich rasant<br />
verstärken.<br />
Lebensplanung, auch der familiären Situation, braucht<br />
Sicherheit. Deshalb sollten die Bemühungen dahin gehen,<br />
nicht befristete Beschäftigung auszubauen, sondern verlässliche<br />
Rahmenbedingungen und Sicherheit zu vermitteln.<br />
4. Untertarifliche Arbeitsbedingungen nicht gesetzlich<br />
zulassen<br />
Wenn durch Betriebsvereinbarung oder Einzelvertrag untertarifliche<br />
Arbeitsbedingungen rechtlich zulässig werden,<br />
sind Bewerberinnen, Beschäftigte und Betriebsräte erpressbar;<br />
die Arbeitsbedingungen für Frauen werden sich<br />
dadurch generell verschlechtern. Die Durchsetzungsfähigkeit<br />
der Interessenvertretungen, Betriebsrat und Gewerkschaften,<br />
werden geschwächt. Das darf nicht eintreten.<br />
I 004 Initiativantrag Nr. 4<br />
Keine Verschlechterung des<br />
Kündigungsschutzes<br />
Antragsteller/in: Suzann Schmitz, NGG, u.a.<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Delegierten der 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz verurteilen<br />
die im Koalitionsvertrag vereinbarte Verschlechterung<br />
des Kündigungsschutzes. Sie ist eine sinnlose Verbeugung<br />
vor den sozialfeindlichen Wünschen der Wirtschaft und<br />
schädlich sowohl für die Beschäftigten, aber auch für die<br />
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Delegierten fordern die<br />
Bundestagsfraktionen und die Bundesregierung dringend<br />
auf, keine Verschlechterungen beim Kündigungsschutz zuzulassen.<br />
Begründung:<br />
Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass die ersten 24<br />
Monate eines Beschäftigungsverhältnisses in Zukunft als<br />
„Probezeit“ behandelt werden, in der ohne Angabe von<br />
Gründen unter Einhaltung gesetzlicher oder tarifvertraglicher<br />
Fristen von Seiten des Arbeitgebers gekündigt werden<br />
kann. Erst mit Ablauf dieser Frist greift der reguläre Kündigungsschutz.<br />
Für die Beschäftigten bedeutet dies, dass sie erst nach<br />
Ablauf dieser Frist vor dem Arbeitsgericht überprüfen lassen<br />
können, ob eine Kündigung sozial gerechtfertigt ist.<br />
Auch wenn im Gegenzug nun die Möglichkeit, für neue<br />
MitarbeiterInnen das Arbeitsverhältnis für bis zu zwei Jahre<br />
zu befristen, aufgehoben werden soll, verschlechtert sich<br />
die Situation für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gravierend,<br />
da sie für 24 Monate den Entscheidungen der<br />
89
90<br />
Arbeitgeber ausgesetzt sind, ohne sich gegen diese wehren<br />
zu können.<br />
Es gibt keinerlei Belege dafür, dass eine Verschlechterung<br />
des Kündigungsschutzes neue Arbeitsplätze schafft. Diese<br />
Erfahrung haben schon die alte Bundesregierung unter<br />
CDU-Kanzler Helmut Kohl und die rot-grüne unter der<br />
Federführung von Wolfgang Clement machen müssen.<br />
Mehrere empirische Untersuchungen haben nach Prof. Dr.<br />
Heide Pfarr belegt, dass es keinen Zusammenhang zwischen<br />
Lockerung des Kündigungsschutzes und dem Ausmaß<br />
der Arbeitslosigkeit gibt.<br />
Es gilt also, schon frühzeitig die verantwortlichen Politikerinnen<br />
und Politiker zu sensibilisieren und zu motivieren,<br />
dem unstillbaren Verlangen der Wirtschaft hin zu einer<br />
neuen Art von Manchesterkapitalismus im Sinne eines neoliberalen<br />
„hire and fire“ entschiedenen Widerstand entgegenzusetzen<br />
und der Ausweitung ungesicherter Arbeitsverhältnisse<br />
Einhalt zu gebieten.<br />
D 006 Für ein soziales Europa – NEIN zur<br />
Dienstleistungsrichtlinie<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenausschuss der Gewerkschaft<br />
Nahrung-Genuss-Gaststätten<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die Delegierten der 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordern<br />
die Bundesregierung auf,<br />
1. sich für eine soziale Änderung der EU-Richtlinie zur<br />
Dienstleistungsfreiheit einzusetzen, die Lohn- und Sozialdumping<br />
ausschließt und die Belange der Arbeitnehmer-<br />
Innen berücksichtigt,<br />
2. die EU-Richtlinie zur Dienstleistungsfreiheit abzulehnen,<br />
wenn diese ausschließlich durch den Effekt der Unternehmer-Dienstleistungsfreiheit<br />
geprägt ist.<br />
Begründung:<br />
Der EU-Richtlinienvorschlag über Dienstleistungen im Binnenmarkt<br />
zielt darauf ab, dass die in der EU noch bestehenden<br />
Hindernisse im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr<br />
abgebaut werden.<br />
Die Erbringung von Dienstleistungen soll nur noch den Gesetzen<br />
und Standards unterliegen, die am Sitz des Dienstleistungsunternehmens<br />
gelten. Für Kontrollen soll der Staat<br />
verantwortlich sein, in dem die Firma ihren Sitz hat.<br />
Durch die Einführung des „Herkunftslandprinzips“ würde<br />
die neoliberale Umgestaltung Europas durch den Abbau<br />
von Regulierungen und die Entfesselung eines unbegrenzten<br />
Lohn- und Sozialdumpings radikal vorangetrieben werden.<br />
Der Richtlinienentwurf ist eine Abkehr vom Weg, unter<br />
Wahrnehmung und Anerkennung sozialer Interessen der<br />
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen eine EU-weite Harmonisierung<br />
voranzutreiben.<br />
Die grundlegende Einführung des Herkunftslandprinzips für<br />
alle Dienstleistungstätigkeiten dient dabei als Instrument,<br />
um Mindeststandards bei Löhnen und Arbeitsbedingungen<br />
auszuhebeln, den Standortwettbewerb zu intensivieren und<br />
einen verschärften Unterbietungswettbewerb der Löhne<br />
und Arbeitsbedingungen einzuleiten. Dies führt zu Sozialdumping<br />
und Deregulierung und steht im Widerspruch zu<br />
den Interessen der ArbeitnehmerInnen und ihrer Gewerkschaften.<br />
Das steht ebenso im Widerspruch zu den Zielen und Aufgaben<br />
der EU, die sich im Artikel 2 des Vertrages für den wirtschaftlichen<br />
und sozialen Fortschritt verpflichtet.<br />
Nationale Gesetzgebungen oder Tarifverträge über Löhne<br />
und Arbeitsbedingungen sowie der Sicherheit und des<br />
Gesundheitsschutzes müssen für alle Beschäftigten gelten,<br />
die im Hoheitsgebiet des jeweiligen Landes tätig sind.<br />
Das Herkunftslandprinzip darf für Arbeits- und Sozialbeziehungen<br />
nicht gelten.<br />
Beschäftigung und Arbeitsbedingungen müssen in allen der<br />
Richtlinie unterliegenden Bereichen ausnahmslos dem<br />
Arbeitsprinzip entsprechen.<br />
Die Einhaltung zwingender nationaler Mindestarbeitsbedingungen<br />
ist zu sichern. Dies muss sich sowohl auf die<br />
Rechtsnormen als auch auf die Kontrollmöglichkeiten beziehen.<br />
Die Kontrolle muss der Verantwortung des Staates<br />
unterliegen, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Die<br />
Bedingungen der Kontrolle dürfen nicht von der Richtlinie<br />
über Dienstleistungen betroffen werden.<br />
D 007 Für ein soziales Europa – NEIN zur<br />
Bolkestein-Richtlinie<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-<br />
Thüringen<br />
Beschluss: Erledigt durch Annahme von Antrag<br />
D 006<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-Thüringen fordert<br />
die Bundesregierung auf:
1. auf eine Zurücknahme der Bolkestein-Richtlinie hinzuarbeiten<br />
und die Kommission aufzufordern, den Vorschlag<br />
zurückzuziehen.<br />
2. Sollte die Kommission den Entwurf nicht zurückziehen,<br />
wird die Bundesregierung aufgefordert, gegen die Richtlinie<br />
zu stimmen und sich Verbündete in der Europäischen<br />
Union zu suchen.<br />
3. Die Europäische Kommission wird aufgefordert, den bisherigen<br />
Vorschlag zurückzuziehen und einen neuen Vorschlag<br />
vorzulegen.<br />
Begründung:<br />
Der EU-Richtlinienvorschlag über Dienstleistungen im Binnenmarkt<br />
soll darauf abzielen, alle in der Europäischen<br />
Union noch bestehenden Hindernisse im grenzüberschreitenden<br />
Dienstleistungsverkehr zu beseitigen. Richtig ist,<br />
dass es in vielen Bereichen immer noch eine Vielzahl von<br />
bürokratischen und rechtlichen Barrieren gibt.<br />
Die EU-Binnenmarktpolitik blieb bei den Dienstleistungen<br />
deutlich hinter der Integration der Gütermärkte zurück.<br />
Kern des Kommissionsvorschlages ist nun die Einführung<br />
des Herkunftslandprinzips. Dieses Prinzip besagt, dass der<br />
Dienstleistungserbringer nur den Rechtsvorschriften des<br />
Herkunftsstaates unterliegt. Das bedeutet:<br />
1. Sollte die jetzige Form des Richtlinienentwurfs so bestehen<br />
bleiben, würde sie zu Sozialdumping und Deregulierung<br />
führen, einhergehend mit äußerst negativen Reaktionen<br />
der europäischen Bürgerinnen und Bürger auf den<br />
Integrationsprozess.<br />
2. Der Richtlinienvorschlag stellt nicht sicher, dass alle<br />
Dimensionen der Lissabonner Strategie umgesetzt und<br />
insbesondere Qualität von Beschäftigung und lebenslanges<br />
Lernen erreicht werden können.<br />
3. Nationale Gesetzgebung oder Tarifverträge über Löhne,<br />
Arbeitsbedingungen sowie Sicherheit und Gesundheitsschutz<br />
müssen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
gelten, die im Hoheitsgebiet des jeweiligen Landes<br />
tätig sind. Lücken müssen beseitigt werden.<br />
4. Der Richtlinienentwurf über Dienstleistungen im Binnenmarkt<br />
muss im Hinblick auf die Arbeitsbeziehungen<br />
genau geprüft werden. Die Delegierten wenden sich<br />
gegen alle Initiativen oder Auslegungen des Herkunftslandprinzips,<br />
welche die nationalen auf Tarifverträgen<br />
beruhenden Gepflogenheiten auf dem Arbeitsmarkt<br />
direkt oder indirekt unterwandern und gleichzeitig zu<br />
einem dramatischen Anstieg der Gefahr des Sozialdumpings<br />
führen würden.<br />
5. Beschäftigung und Arbeitsbedingungen müssen in allen<br />
der Richtlinie unterliegenden Bereichen ausnahmslos<br />
dem Arbeitsortprinzip entsprechen.<br />
6. Die Kontrolle muss der Verantwortung des Landes unterliegen,<br />
in dem die Dienstleistung erbracht wird, und die<br />
Bedingungen dieser Kontrolle dürfen nicht von der Richtlinie<br />
über Dienstleistungen betroffen werden.<br />
Da alle diese Anforderungen eine vollkommene Überarbeitung<br />
erforderlich machen würden, erscheint es konsequent,<br />
dass die Kommission ihren bisherigen Vorschlag zurücknimmt.<br />
<strong>Sachgebiet</strong> E: <strong>Sozialstaat</strong> /<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Sicherung</strong><br />
E 001 <strong>Sozialstaat</strong>sdiskussion<br />
Antragsteller/in: ver.di Bundesfrauenrat<br />
Beschluss: Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesfrauenausschuss<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Frauenpolitische Stichworte für eine <strong>Sozialstaat</strong>s-Diskussion<br />
Der <strong>DGB</strong> Bundesvorstand wird aufgefordert, dafür Sorge<br />
zu tragen, dass folgende Ziele und Grundsätze mit der<br />
Politik des <strong>DGB</strong> umgesetzt werden:<br />
Der in Zeiten starken Wirtschaftswachstums gefundene<br />
Konsens über die Aufgaben des <strong>Sozialstaat</strong>es ist ins Wanken<br />
geraten. Eine neoliberale Wirtschaftsordnung, die<br />
(gesamt)deutsche Entwicklung der letzten Jahre, die Verlagerung<br />
von Wirtschaftstätigkeit ins Ausland, der Versuch der<br />
Unternehmen, mit den Arbeits- und Sozialbedingungen in<br />
Billiglohnländern zu konkurrieren, Massenarbeitslosigkeit<br />
und Sozialabbau verunsichern die Menschen. Diese Unsicherheit<br />
ist dringend aufzufangen, um den Bürgerinnen und<br />
Bürgern wieder ein Zeichen der Sicherheit zu geben, die<br />
notwendige Voraussetzung ist, um den Mut und die Risikobereitschaft<br />
für Veränderungen aufzubringen. Neue Regeln<br />
und Übereinkünfte zu den Aufgaben des Staates, der Wirtschaft<br />
und der Einzelpersonen müssen gefunden werden.<br />
Der Tendenz zur Rückkehr zu einem traditionellen Frauenund<br />
Familienbild muss Einhalt geboten werden, denn zu<br />
schnell geben sich Politik und Wirtschaft aktuell mit dem<br />
Rückverweis familiärer und sozialer Aufgaben in die kostenlose<br />
Erledigung durch Frauen als vermeintlicher Lösung von<br />
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Finanzierungsproblemen zufrie-<br />
91
92<br />
den. Diesem geschlechterpolitischen „Roll-Back“ ist dringend<br />
Einhalt zu gebieten. Der Staat hat hier in Erfüllung<br />
des Grundgesetzes und europäischer Vorgaben eine originäre<br />
Aufgabe, die mit den Mitteln sozialstaatlicher Regelungen<br />
umgesetzt werden kann.<br />
Dem sozial-, steuer- und beschäftigungspolitischen Familienbild<br />
liegt traditionell (und jetzt wiederbelebt) die Versorgerehe<br />
zugrunde. Die aktuelle Sparpolitik verfolgt sie ebenso<br />
wie die Arbeitsmarktpolitik – mit entsprechenden Folgen<br />
für die Renten- und Krankenversicherung. Die staatlich auferlegten<br />
Unterhalts- und Mitversorgungspflichten werden<br />
ausgeweitet. Beschäftigungspolitik für Frauen stellt weiterhin<br />
die Teilzeitarbeit in den Vordergrund, wobei dies gleichzeitig<br />
immer noch die (unfreiwillige) Entscheidung zwischen<br />
eigenständiger sozialer <strong>Sicherung</strong> und Abhängigkeit in der<br />
Familie beinhaltet. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik<br />
sowie Familien- und Bildungspolitik führen dazu, dass die<br />
Frauenerwerbsquote immer noch bei nur 60 % liegt, wobei<br />
die geringfügige Beschäftigung von inzwischen mehr als 7<br />
Millionen Beschäftigten (zwei Drittel Frauen) bereits mitgerechnet<br />
ist. Erwerbsunterbrechungen, Teilzeitarbeit, geringfügige<br />
Beschäftigung und das unfreiwillige Verharren in der<br />
stillen Reserve sind typisch für Erwerbsbiografien von Frauen<br />
mit Familienaufgaben (Kindererziehung und Pflege) und<br />
führen nicht zu einer regelmäßig eigenständigen sozialen<br />
<strong>Sicherung</strong>. Der betrieblichen, am männlichen Erwerbsmuster<br />
orientierten Einstellungs- und Beförderungspraxis wird<br />
durch Politik und Gesetzgebung bis jetzt nichts Wirkungsvolles<br />
entgegengestellt.<br />
Die <strong>DGB</strong>-Frauen folgen diesem Modell der scheinbaren<br />
Wahlfreiheit nicht, welches in der konkreten Umsetzung auf<br />
die Versorgerehe zuführt. Um den frauenpolitischen Ziel-<br />
Grundsatz „eigenständige Existenzsicherung für Frauen,<br />
einschließlich der sozialen <strong>Sicherung</strong>“ zu erreichen, verfolgt<br />
die Frauenpolitik des <strong>DGB</strong> die Zielsetzung der Vereinbarkeit,<br />
bei der die versicherte Berufstätigkeit von Frauen selbstverständlicher<br />
Bestandteil ist und eine eigenständige soziale<br />
<strong>Sicherung</strong> gewährleistet wird. Dies wird auch für eine Neuorientierung<br />
des <strong>Sozialstaat</strong>es eingefordert. Insbesondere<br />
bei grundlegenden Änderungen der sozialen <strong>Sicherung</strong>, wie<br />
der Ergänzung der gesetzlichen Rente durch betriebliche<br />
und private Altersvorsorge oder der möglichen Einführung<br />
einer Erwerbstätigenversicherung, ist zu gewährleisten, dass<br />
für alle Frauen der eigenständige Zugang möglich ist und<br />
sie vergleichbare Leistungen wie Männer erhalten.<br />
Nachdem der gesellschaftliche Konsens über den <strong>Sozialstaat</strong><br />
und seine Funktionen in der Reformdebatte der vergangenen<br />
Jahre heftig erschüttert wurde, sind die Grund-<br />
aufgaben des Staates dringend erneut zu definieren. Gerade<br />
Frauen sind auf eine kommunale Grundversorgung<br />
angewiesen, da sie immer noch erheblich weniger verdienen<br />
als Männer und sie durch prekäre Beschäftigung und<br />
unterbrochener Erwerbsbiografien wegen Kindererziehung<br />
einen schlechteren Zugang zu sozialen <strong>Sicherung</strong>ssystemen<br />
haben und somit ihr Armutsrisiko erheblich höher ist. Die<br />
staatliche Regulation bestimmter Leistungen wird so entscheidend<br />
für ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe.<br />
Die Aufgaben der Reproduktion müssen in die Überlegungen<br />
zu einem neuen Leitbild für den <strong>Sozialstaat</strong> mit aufgenommen<br />
werden. Die Demografiedebatte darf nicht mehr<br />
ausschließlich vor dem Hintergrund leerer Kassen geführt<br />
werden, sondern sie muss künftig den Begriff der gesellschaftlich<br />
notwendigen Arbeit erweitern, diese neu bewerten<br />
und ihr einen Stellenwert zumessen, der die für unsere<br />
Zukunft gewünschte Gesellschaftsstruktur widerspiegelt.<br />
Als Grundaufgaben hat deshalb der moderne <strong>Sozialstaat</strong><br />
❚ die Daseinsvorsorge zu übernehmen und den Zugang zur<br />
(kostenlosen) Grundversorgung mit „Gütern im öffentlichen<br />
Interesse“ zu sichern.<br />
❚ Aufgaben der Qualitätsverbesserung für die Lebensqualität<br />
der BürgerInnen (wieder) zu übernehmen. Dazu<br />
gehören z.B. Ganztagskinderbetreuung, um die Erwerbsbeteiligung<br />
für Frauen besser als bisher zu ermöglichen,<br />
und ein umfassender Bildungsauftrag, um Kinder und<br />
Jugendliche von Anfang an zu beteiligungsfähigen und<br />
chancengleichen Menschen zu qualifizieren.<br />
❚ die Risikoverteilung zwischen den BürgerInnen solidarisch<br />
zu organisieren. Zu diesen Risiken gehören nicht<br />
nur die Arbeitswelt, sondern auch die Reproduktion, d.h.<br />
Kindererziehung, Familienleistungen, Pflegeaufgaben<br />
usw., die ebenfalls in Gestaltungsvorschläge zu integrieren<br />
sind.<br />
Der <strong>Sozialstaat</strong> zieht sich aktuell jedoch aus der Verantwortung<br />
für den Ausgleich ungleicher Ergebnisse, auch der<br />
Marktergebnisse, zurück. Dies ist wieder rückgängig zu<br />
machen.<br />
Zu diskutieren ist weiterhin, was soziale Marktwirtschaft<br />
künftig beinhalten und insbesondere, was sie für Frauen leisten<br />
soll.<br />
Das Wesen der Ökonomie, des wirtschaftlichen Handelns<br />
und einer Wirtschaftspolitik, die wir Frauen wollen, muss<br />
Antiarmuts- und Antidiskriminierungspolitik sein und die<br />
Förderung substantieller Freiheiten und Lebensqualität<br />
beinhalten. <strong>Soziale</strong> und Gendergerechtigkeit müssen ihre<br />
Bewertungskriterien sein. Die Polarisierung und Hierarchi-
sierung zwischen männlichen und weiblichen Arbeitsfeldern<br />
ist zu beseitigen und eine menschengerechte Verteilungspolitik<br />
und Entgeltgleichheit müssen ihr Grundwesen sein. Der<br />
Prävention als positivem Wirtschaftsfaktor ist Vorrang einzuräumen,<br />
oder anders gesagt: Schäden durch Nicht-Prävention<br />
als (volks-)wirtschaftlicher Schaden sind als solche<br />
künftig zu deklarieren. Präventionsmaßnahmen sind zu<br />
gendern. Internationale Arbeitsnormen und Menschenrechte<br />
(IAO) müssen zwingend einzuhaltende Grundlage der<br />
Wirtschaftspolitik sein.<br />
Aus frauenpolitischer Sicht ist deshalb insgesamt die Politik<br />
mit einer feministischen Komponente zu ergänzen. Steuer-,<br />
Finanz- und Wirtschaftspolitik sind dahingehend zu reformieren,<br />
dass eine Einnahme- und Ausgabenpolitik betrieben<br />
wird, die nicht nur quantitatives Wachstum fördert,<br />
sondern auch Chancengleichheit zum Ziel hat und Arbeitsplätze<br />
schafft, auch beispielsweise durch Verbesserung<br />
kommunaler Strukturen oder über Investitionsförderung für<br />
insbesondere die soziale und ökologische Wirtschaft.<br />
Im Hinblick auf eine veränderte Gesellschaftsstruktur und<br />
die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt sollte kommunale<br />
Beschäftigung einen neuen Stellenwert, neue Aufgaben und<br />
die dazu erforderlichen Mittel erhalten. Hier können mit<br />
Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik zusätzliche<br />
Stellen geschaffen werden, die einen Teil der heute nur<br />
noch privat oder ehrenamtlich erledigten öffentlichen und<br />
das Gemeinwesen unterstützende Arbeiten übernehmen.<br />
Der Bedarf an kommunaler, pflegerischer, an Erziehungsund<br />
Bildungsarbeit ist vorhanden, um viele, auch gut qualifizierte<br />
Arbeitslose regulär zu beschäftigen (wie auch am<br />
Beispiel des flächendeckend geplanten Einsatzes der Ein-<br />
Euro-Jobs erkennbar ist). Wenn den Kommunen heute das<br />
Geld dazu fehlt, so ist hier eine neue Einnahme- und Ausgabenverteilung<br />
anzustreben.<br />
In der <strong>Sozialstaat</strong>sdebatte ist eine neue Interpretation bzw.<br />
der Anwendungsgrad der Subsidiarität (als Vorrang der<br />
Eigenleistung/Eigenverantwortung vor dem sozialstaatlichen<br />
Ausgleich) auf den Prüfstand zu stellen. Dieser Vorrang trifft<br />
bei Frauen und Männern auf unterschiedliche Ausgangsbedingungen,<br />
da Frauen häufiger auf die familiäre Versorgung<br />
verwiesen werden, und hält so dem Anspruch auf Chancengerechtigkeit<br />
nicht stand. Hier sind Ziele für eine bessere<br />
Verteilung zu formulieren und die Grenzen der Subsidiarität<br />
neu zu definieren.<br />
Angesichts der in neuem Ausmaß und mit weitgehender<br />
Ersatzwirkung auf die Systeme sozialer <strong>Sicherung</strong> zugewiesenen<br />
Unterhaltspflichten außerhalb sowie innerhalb der<br />
Ehe müssen die unterhaltsbegründenden Familienkonstellationen<br />
überdacht und neu definiert werden. Schnittstellen<br />
zwischen sozialer <strong>Sicherung</strong>, Steuerrecht und Arbeitsrecht<br />
sind neu zu formulieren. Da Unterhaltspflicht grundsätzlich<br />
staatlich auferlegt wird und damit selbst langjährige Anwartschaften<br />
außer Kraft gesetzt werden können, muss<br />
künftig der Zugang zur eigenständigen Existenzsicherung<br />
auf geeignete Weise innerhalb der Beschäftigung und der<br />
Sozialsysteme, nicht nur innerhalb der Familie, eröffnet werden.<br />
In der Diskussion um die Zukunft der Sozialversicherung in<br />
Deutschland führt derzeit die Demografiedebatte zu<br />
Reformvorschlägen, die sich eher negativ auf die soziale<br />
<strong>Sicherung</strong> von Frauen auswirken. Hier ist, solange Frauen<br />
und Männer im Beruf nicht wirklich die gleichen Bedingungen<br />
haben, ein sozialstaatlicher Ausgleich erforderlich. Ein<br />
neuer Blick auf die soziale <strong>Sicherung</strong> von Frauen durch<br />
Erwerbstätigkeit, welches auch das Ziel der Frauen in den<br />
Gewerkschaften ist, darf weder die bisherige Ausgrenzung<br />
von Frauen fortschreiben noch sie gar verschärfen.<br />
Die eigenständige Einbeziehung von Frauen in die Sozialversicherung<br />
anstelle der abgeleiteten <strong>Sicherung</strong> über die<br />
Versorgerehe muss künftig die Regel sein. Das heißt vorrangig,<br />
jede/r BürgerIn sollte grundsätzlich eine eigene Sozialversicherung<br />
haben, die entweder durch eigene Beiträge<br />
oder in besonderen, gesellschafts- bzw. familienpolitisch<br />
bedingten Situationen öffentlich finanziert wird.<br />
Erziehungs- und Pflegeleistung sind gesellschaftlich wertvolle<br />
Beiträge – keine Privatsache, für die Einzelpersonen<br />
oder die Familie die Kosten zu tragen haben. Die Finanzierung<br />
von Beiträgen bzw. Leistungen der Sozialversicherung,<br />
die wegen Familienarbeit entstehen, soll aus Steuermitteln<br />
oder aus einer unabhängigen Familienkasse erfolgen. Sie<br />
sind nicht allein der Versichertengemeinschaft aufzuerlegen.<br />
Für Kinder muss die kostenlose Familienmitversicherung<br />
erhalten bleiben.<br />
Die Sozialversicherung muss insgesamt gewährleisten, dass<br />
aufgrund unterschiedlicher biologischer Bedingungen und<br />
gesellschaftlich bedingter geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung<br />
für Frauen keine Nachteile entstehend. Beiträge und<br />
Leistungen dürfen aufgrund von Schwangerschaft, Kindererziehung<br />
und Pflegeleistung nicht unterschiedlich für Frauen<br />
und Männer ausfallen. Die Hinterbliebenenrente ist für<br />
einen angemessenen Zeitraum des Systemwechsels noch zu<br />
erhalten, wobei der Ausgleich durch Bundeszuschuss (Steuern<br />
oder Familienkasse) beizubehalten ist. Die kinderbezogenen<br />
Vergünstigungen in der Rentenversicherung sind aufrechtzuerhalten<br />
und zu verbessern. Der <strong>DGB</strong> setzt sich für<br />
den Unisex-Tarif ein.<br />
93
94<br />
E 002 Abschaffung der Sonderregelungen<br />
für Mini-Jobs<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenvorstand der IG BAU<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz hält an ihrer Beschlusslage<br />
fest, bis auf eine Bagatellegrenze alle Arbeitsverhältnisse<br />
gleich zu behandeln und in die gesetzlichen Sozialversicherungen<br />
einzubeziehen.<br />
Der Bundesvorstand des <strong>DGB</strong> möge massiv auf den Gesetzgeber<br />
einwirken, die Sonderregelungen für Mini-Jobs abzuschaffen<br />
und statt dessen Anreize zu sozial geschützter<br />
Arbeit zu schaffen. Alle Nebenbeschäftigungen sind wie<br />
Überstunden beim Hauptarbeitgeber anzurechnen.<br />
Begründung:<br />
Die Gewerkschaften setzen sich seit langem für die Gleichbehandlung<br />
aller Arbeitsverhältnisse und die Einbeziehung<br />
in die soziale <strong>Sicherung</strong> ein. Die gesetzliche Reform der rotgrünen<br />
Koalition von 1999 war ein erster Schritt.<br />
Mit der Einführung der Mini-Jobs zum 1. April 2003 ging<br />
die gleiche Regierung noch hinter die Regelung vor 1999<br />
zurück. Die Anzahl prekärer Beschäftigungen ist drastisch<br />
gestiegen, auf Kosten sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze,<br />
die dadurch zunehmend vernichtet werden.<br />
Entgegen der im Grundgesetz verankerten Aufgabe zur Förderung<br />
der Gleichstellung der Geschlechter, werden insbesondere<br />
Frauen durch die Mini-Jobs von einer eigenständigen<br />
Existenzsicherung sowie einer eigenen sozialen <strong>Sicherung</strong><br />
ausgeschlossen. Sie werden damit in die finanzielle<br />
Abhängigkeit vom Partner, von Sozialleistungen und in die<br />
Altersarmut getrieben.<br />
E 003 Abschaffung der Sonderregelungen<br />
für Mini-Jobs<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Bayern<br />
Beschluss: Erledigt durch Annahme von Antrag<br />
E 002<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert die Einbeziehung<br />
aller Arbeitsverhältnisse in die gesetzlichen Sozialversicherungen<br />
und die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse.<br />
Der <strong>DGB</strong> möge auf den Gesetzgeber einwirken, die Sonderregelungen<br />
für geringfügig Beschäftigte abzuschaffen<br />
Begründung:<br />
Die IG BAU setzt sich seit langem für die Gleichbehandlung<br />
aller Arbeitsverhältnisse und die Einbeziehung in die soziale<br />
<strong>Sicherung</strong> ein. Die gesetzliche Reform der rot-grünen Koalition<br />
von 1999 war ein erster Schritt.<br />
Mit der Einführung der Mini-Jobs zum 1. April 2003 ging<br />
die gleiche Regierung noch hinter die Regelung vor 1999<br />
zurück. Die Anzahl prekärer Beschäftigungen steigt auf<br />
Kosten sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze, die<br />
dadurch zunehmend vernichtet werden.<br />
Entgegen der im Grundgesetz verankerten Aufgabe zur Förderung<br />
der Gleichstellung der Geschlechter, werden insbesondere<br />
Frauen durch die Mini-Jobs von einer eigenständigen<br />
Existenzsicherung sowie einer eigenen sozialen <strong>Sicherung</strong><br />
ausgeschlossen.<br />
Sie werden damit in die finanzielle Abhängigkeit vom Partner,<br />
von Sozialleistungen und in die Altersarmut getrieben.<br />
E 004 Gleichstellung aller Mütter bei der<br />
Anrechnung der Erziehungszeiten<br />
für die Rente<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-Thüringen<br />
Beschluss: Erledigt durch Beschlusslage<br />
(<strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz 2001)<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand fordert die Bundesregierung auf,<br />
dafür Sorge zu tragen, dass alle Mütter rentenrechtlich<br />
gleichgestellt werden. Alle Mütter sollen pro Kind drei Jahre<br />
Erziehungszeit für ihr Rentenkonto angerechnet bekommen.<br />
Begründung:<br />
Nach geltendem Recht bekommen Frauen, die vor 1992 ein<br />
Kind geboren haben, pro Kind nur ein Jahr Erziehungszeit<br />
für die Rente angerechnet.
E 005 Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis<br />
für MigrantInnen für die Dauer von<br />
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten<br />
Antragsteller/in: Bundesfrauenvorstand der IG BAU<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand wird aufgefordert, dahingehend<br />
auf den Gesetzgeber einzuwirken, dass MigrantInnen für<br />
die Dauer von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten eine Aufenthalts-<br />
und Arbeitserlaubnis erhalten.<br />
Begründung:<br />
Wenn ausländische ArbeitnehmerInnen eine befristete<br />
und/oder an einen Arbeitgeber gebundene Arbeits- und<br />
Aufenthaltserlaubnis haben (z. B. Saisonarbeiter für Ernteeinsätze<br />
in der Landwirtschaft), wird es ihnen nahezu<br />
unmöglich, berechtigte Forderungen auf dem Klagewege<br />
einzutreiben, da mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses Aufenthalts-<br />
und Arbeitserlaubnis erlöschen und sie das Verfahren<br />
nicht begleiten und ihm Nachdruck verleihen können.<br />
E 006 Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis<br />
für MigrantInnen für die Dauer von<br />
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Bayern<br />
Beschluss: Erledigt durch Annahme von Antrag E 005<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert den <strong>DGB</strong> auf, auf<br />
den Gesetzgeber einzuwirken, dass MigrantInnen für die<br />
Dauer von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten eine Aufenthaltsund<br />
Arbeitserlaubnis erhalten.<br />
Begründung:<br />
Wenn ausländische ArbeitnehmerInnen eine befristete<br />
und/oder an einen Arbeitgeber gebundene Arbeits- und<br />
Aufenthaltserlaubnis haben (z. B. Saisonarbeiter für Ernteeinsätze<br />
in der Landwirtschaft), wird es ihnen nahezu unmöglich,<br />
berechtigte Forderungen auf dem Klagewege einzutreiben,<br />
da mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses Aufenthalts-<br />
und Arbeitserlaubnis erlöschen und sie das Verfahren<br />
nicht begleiten und ihm Nachdruck verleihen können.<br />
E 007 Für eine solidarische und geschlechtergerechte<br />
Bürgerversicherung!<br />
Antragsteller/in: IG Metall-Frauenausschuss beim Vorstand<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert den <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand<br />
auf, sich für den Systemwechsel zu einer solidarischen<br />
Bürgerversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung<br />
einzusetzen. Ziel der Bürgerversicherung muss<br />
sein, dass eine Teilhabe aller Menschen am medizinischtechnischen<br />
Fortschritt für die Zukunft gewährleistet ist.<br />
Die Einführung der Bürgerversicherung ist kein Selbstzweck.<br />
Messlatte der Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung<br />
müssen folgende Zielstellungen sein:<br />
❚ Die Bürgerversicherung funktioniert nur als allgemeine<br />
Pflichtversicherung.<br />
❚ Die Beitragsbemessungsgrenze muss mindestens auf die<br />
Beitragsbemessungsgrenze der GRV erhöht werden.<br />
❚ Andere Einkommensarten unter Beachtung von Freibeträgen<br />
müssen mit einbezogen werden.<br />
❚ Gering Verdienende dürfen nicht zusätzlich belastet werden.<br />
❚ Jedes Erwerbseinkommen soll eine eigenständige Versicherung<br />
begründen.<br />
❚ Die Bürgerversicherung darf das Modell der Alleinverdienerehe<br />
nicht bevorzugen. Zu prüfen sind verschiedene<br />
Lösungen.<br />
❚ Kinder sollen in der Bürgerversicherung beitragsfrei mitversichert<br />
bleiben. Allerdings dürfen Kinderlose nicht diskriminiert<br />
werden, etwa durch einen Beitragsaufschlag<br />
wie in der Pflegeversicherung.<br />
Begründung:<br />
I. Ausgangslage<br />
Den Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) geht (zumindest<br />
mittelfristig) – allen Reformen zum Trotz – das Geld aus.<br />
Gründe sind auch hier die Massenarbeitslosigkeit und der<br />
Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.<br />
Außerdem besteht für Beschäftigte mit Einkommen oberhalb<br />
der Beitragsbemessungsgrenze die Möglichkeit, sich<br />
dem Solidarsystem zu entziehen: Sie können in die private<br />
Krankenversicherung wechseln.<br />
Die Privaten Krankenversicherungen (PKV) dürfen sich ihre<br />
Versicherten zudem aussuchen: Da sie Menschen mit<br />
schwer wiegenden Risikofaktoren oder bereits bestehenden<br />
Krankheiten nicht aufnehmen müssen, verbleiben in der<br />
GKV alle Personengruppen mit Risiken – niedrige Einkom-<br />
95
96<br />
men, Ältere, kranke und behinderte Menschen und Familien.<br />
Denn: Durch die kostenlose Familienversicherung bleiben<br />
Familien in der GKV, Singles hingegen verlassen das<br />
Solidarsystem.<br />
Aufgrund der Zweiteilung des Systems verfestigt sich eine<br />
Zwei-Klassen-Medizin: Während die privat Versicherten teilweise<br />
schon als überversorgt zu betrachten sind, werden<br />
selbstverständliche Behandlungen der gesetzlich Versicherten<br />
nicht mehr von den Kassen übernommen. Die Trennung<br />
zwischen GKV, in der 89 % der Bevölkerung versichert sind,<br />
und PKV mit einem Anteil von 11 % an der Bevölkerung<br />
beschreibt daher eine grundsätzliche Gerechtigkeitslücke.<br />
Eine Minderheit (jeder 9.) nimmt bevorzugt Leistungen in<br />
Anspruch, auf die eine Mehrheit (9 von 10) keinen Zugriff<br />
hat.<br />
Um die Einnahmen der GKV zu stabilisieren, werden zwei<br />
Alternativen diskutiert: Die Bürgerversicherung und das<br />
Kopfpauschalenmodell der CDU/ CSU.<br />
Die „Gesundheitspauschale“ sieht vor, dass jeder Erwachsene<br />
einen Pauschalbetrag in die Krankenversicherung einzahlt,<br />
nicht mehr jedoch als 7 % des Einkommens. Der<br />
Arbeitgeberanteil an der Krankenversicherung soll hingegen<br />
auf 6,5 % des beitragspflichtigen Einkommens festgeschrieben<br />
werden.<br />
Dieses Modell lehnen wir als unsozial ab. Außerdem sehen<br />
wir in der Aufhebung der paritätischen Beitragsfinanzierung<br />
die endgültige Verabschiedung der Arbeitgeber aus ihrer<br />
sozialpolitischen Verantwortung und ihrer Bereitschaft,<br />
arbeitsbedingt verursachte Krankheitskosten nachhaltig zu<br />
reduzieren.<br />
Die Bürgerversicherung ist hingegen der Weg zu einer solidarischen<br />
Finanzierung der Krankenversicherung: Alle Personengruppen,<br />
nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br />
sondern auch Beamte, Selbständige oder Höherverdienende,<br />
zahlen ein. Neben Erwerbseinkommen werden<br />
auch andere Einkommensarten, etwa Zinsen, Mieten oder<br />
Pacht berücksichtigt.<br />
II. Grundsystem: Erweiterung des Kreises der Versicherten<br />
und der Beitragsgrundlage<br />
Grundüberlegung der solidarischen Bürgerversicherung ist,<br />
dass alle Versicherten in ein System einzahlen. Es werden<br />
also neben den Arbeitnehmer/innen auch Beamte und Selbständige<br />
und Gutverdienende einbezogen.<br />
Doch nicht nur auf Arbeitseinkommen sollen Beiträge geleistet<br />
werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist das einzige<br />
Land, dass sich (noch) ein Sozialsystem erlaubt, das nur<br />
aus den Einkünften der Arbeitnehmer/innen bezahlt wird.<br />
In Zukunft sollen daher die Krankenversicherungsbeiträge<br />
auch auf Miet-, Zins- und Kapitaleinkünfte erhoben werden.<br />
Dabei werden Freibeträge auf diese Einkünfte dafür<br />
sorgen, dass die Ersparnisse der kleinen Einkommen nicht<br />
in unzumutbarer Weise zur Finanzierung des Gesundheitssystems<br />
herangezogen werden.<br />
E 008 Gesundheitspolitik für Frauen<br />
Antragsteller/in: ver.di Bundesfrauenrat<br />
Beschluss: Annahme mit Änderungen<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand wird aufgefordert, dafür Sorge<br />
zu tragen, dass folgende Ziele und Grundsätze mit der<br />
Politik des <strong>DGB</strong> umgesetzt werden:<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz stellt folgende Forderungen<br />
an die Gesundheitspolitik: Frauenspezifische Aspekte in<br />
der Gesundheitspolitik, im Gesundheitswesen und der diesbezüglichen<br />
Beschäftigungssituation müssen zu tragenden<br />
Säulen in der Diskussion um unser Gesundheitssystem und<br />
dessen Umgestaltungsentwürfen werden. Der <strong>DGB</strong> wird<br />
sich auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass<br />
1. öffentliche Gesundheitseinrichtungen nicht weiter privatisiert<br />
werden.<br />
2. Standards qualitativ verbessert werden. Das heißt unter<br />
anderem:<br />
π • Verbindliche Qualitätsstandards für die medizinische<br />
Behandlung, Pflege, Vor- und Nachsorge sind zu<br />
gewährleisten.<br />
• Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern<br />
bei der Gesundheitsversorgung, der Forschung,<br />
der Qualifikation und Zusammensetzung des Personals<br />
im Gesundheitswesen und bei der Gesundheitsberichterstattung<br />
selbstverständlich und verbindlich beachtet<br />
werden.<br />
• Eine ganzheitliche, frauen- und männerspezifische Diagnostik<br />
und Therapie löst eine nur auf Apparate und<br />
Medikation setzende Medizin und Pflege ab.<br />
• Betreute und behandelte Personen werden umfassend<br />
und korrekt informiert, damit Partnerschaft in Behandlung<br />
und Pflege möglich wird.<br />
• Die Rechte von betreuten und behandelten Personen<br />
werden verbessert.<br />
• Frauen als Opfer von Gewalt werden besser versorgt.<br />
• Ambulante Pflege zur Entlastung von pflegenden Angehörigen<br />
wird ausgebaut und muss bezahlbar sein.<br />
• Für ärztliche und pflegerische Tätigkeiten werden Vergütungssysteme<br />
etabliert, die eine ganzheitliche, frau-
en- und männerspezifische Diagnostik und Therapie<br />
fördern, z.B. indem sie Leistung am zu erzielenden<br />
Ergebnis der Heilung und nicht nach Mengengerüsten<br />
jedweder Art messen.<br />
3. Frauen eine umfassende eigene Interessenvertretung für<br />
ihre Gesundheit ausüben können, um nicht zum „Spielball“<br />
wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Interessengruppen<br />
des Gesundheitswesens zu werden. Frauen in<br />
Gesundheitspolitik, medizinischer Forschung und Lehre,<br />
sowie in den Einrichtungen des Gesundheitswesens sowohl<br />
im administrativen, wie im medizinischen Bereich<br />
müssen (z.B. entsprechend ihrem Anteil an den Beschäftigten)<br />
in politische, administrative Entscheidungsfunktionen<br />
des Gesundheitswesens eingebunden werden.<br />
Gesundheitsdienstleistungen vor Ort müssen unter Beteiligung<br />
von Frauenorganisationen (u.a.) mitgeplant, vernetzt<br />
und mitgestaltet werden.<br />
4. die Ausbildung sowie berufsbezogene Qualifizierung und<br />
Weiterbildung für pflegende Berufe und Hebammen verbessert<br />
werden, weil es mehr Technikeinsatz in Krankenhäusern,<br />
neue Behandlungsmethoden und -formen, integrierte<br />
Versorgung und neue Organisationskonzepte in<br />
den verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens<br />
gibt. Dies verlangt zusätzliche Kompetenzen im sozialpflegerischeren<br />
Bereich, im Management und in der Prozessorganisation.<br />
5. Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen so zu verbessern<br />
sind, dass physische und psychische Belastungsfaktoren<br />
verringert werden. Dabei sind die wegen dieser<br />
Belastungen und erforderlicher flexibler Arbeitszeitgestaltung<br />
eingerichteten Teilzeitarbeitsplätze mit hohem Stundenvolumen<br />
mit einem Ausgleich für die höhere Produktivität<br />
zu versehen.<br />
6. mittelbare Diskriminierungen insgesamt aus den Entgelttarifverträgen<br />
für pflegende Berufe entfernt werden. Insbesondere<br />
ist damit die Aufforderung an die Arbeitgeberseite<br />
verknüpft, das durch Tarifabschluss im öffentlichen<br />
Dienst in Gang gesetzte laufende Verfahren der<br />
Erarbeitung diskriminierungsfreier Eingruppierungsmerkmale<br />
und Arbeitsplatzbewertung zum Abbau mittelbarer<br />
Diskriminierung auch auf Tarifbereiche außerhalb des<br />
öffentlichen Dienstes zu übertragen und so für Diskriminierungsfreiheit<br />
in den frauendominierten Bereichen der<br />
Gesundheitsberufe in privaten und Wohlfahrtseinrichtungen<br />
zu sorgen.<br />
7. Einkommenskürzungen durch Besteuerung von Nachtund<br />
Schichtarbeit gemeinsam entschieden entgegengetreten<br />
wird.<br />
Begründung:<br />
Die zunehmende Privatisierung von Einrichtungen, die<br />
Gesundheitsdienstleistungen erbringen, unterwirft Gesundheit<br />
den Profitinteressen einzelner. Werden weitere Dienstleister<br />
im Gesundheitswesen privatisiert, geraten die Sicherstellung<br />
des Versorgungsauftrages und die solidarische<br />
Finanzierung des Gesundheitswesens zunehmend unter<br />
Druck.<br />
Frauen haben in unserer Gesellschaft deutlich geringere<br />
Einkommen als Männer. Gesundheit wird für sie und ihre<br />
Kinder als erstes unbezahlbar, wenn Gesundheitsrisiken privatisiert<br />
werden. Die Gesundheit ist ein hohes Gut. Die<br />
zunehmende Privatisierung von Einrichtungen, die Gesundheitsdienstleistungen<br />
erbringen, unterwirft Gesundheit den<br />
Profitinteressen einzelner. Werden weitere Dienstleister im<br />
Gesundheitswesen privatisiert, gerät die solidarische Finanzierung<br />
des Gesundheitswesens zunehmend unter Druck:<br />
Das Interesse an einer höchstmöglichen Verwertbarkeit des<br />
eingesetzten Kapitals droht das Gesundheitswesen unbezahlbar<br />
zu machen oder wird früher oder später im Leistungsbereich<br />
eine Zweiklassenmedizin hervorbringen.<br />
Da Frauen und Männer biologisch unterschiedlich konstituiert<br />
sind, brauchen sie eine geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung<br />
und damit das möglich ist, eine entsprechende<br />
Erforschung und Dokumentation der Unterschiede<br />
und eine entsprechende Qualifizierung des Personals. Frauen,<br />
die Gewalt erleiden, müssen besser versorgt werden.<br />
Noch immer werden pflegende und medizinisch-technische<br />
Tätigkeiten als typisch weibliche Tätigkeiten niedriger bewertet<br />
als beispielsweise Tätigkeiten, die technische Kenntnisse<br />
und Fertigkeiten erfordern. Dies hat negative Folgen<br />
für die Einkommen der im Gesundheitswesen beschäftigten<br />
Frauen. Es hat aber auch negative Folgen für die medizinische<br />
Behandlung, Pflege, Vorsorge, Nachsorge. Technik und<br />
Medikation haben einen größeren Stellenwert als Gespräch<br />
und Zuwendung. Dies prägt alle Vergütungssysteme im<br />
Gesundheitswesen.<br />
Eine Partnerschaft zwischen Behandelten und Behandelnden<br />
ist heute nur schwer möglich: Der Gesundheitsmarkt ist<br />
sehr unübersichtlich, der Anteil interessengeleiteter Fehlinformationen<br />
hoch, die Rechte der Behandelten sind wenig<br />
ausgeprägt und kaum durchsetzbar. Insbesondere vor Ort,<br />
wo Gesundheitsdienstleistungen erbracht und nachgefragt<br />
werden, gibt es wenig demokratische Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten.<br />
Da Frauen in Entscheidungsfunktionen<br />
so gut wie nicht vorkommen, sind die Möglichkeiten,<br />
Frauen betreffende Interessen einzubringen, sehr stark eingeschränkt.<br />
97
98<br />
E 009 Vereinbarkeit von Pflege und Beruf<br />
Antragsteller/in: IG Metall-Frauenausschuss beim Vorstand<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert den Bundesvorstand<br />
auf, sich gegen die Einführung einer Pflegezeit<br />
analog der Elternzeit einzusetzen. Stattdessen prüft und<br />
unterstützt er Maßnahmen, die bezahlbare und qualitativ<br />
hochwertige Pflegedienstleistungen ausbauen.<br />
Zu diesen Maßnahmen gehören:<br />
1. Schaffung von Angeboten der Prävention für ältere Menschen,<br />
um Pflege zu vermeiden bzw. hinauszuzögern,<br />
2. Einführung eines Entlassungs- und Überleitungsmanagements<br />
und Nutzung der Leistung Kurzzeitpflege, um<br />
gerade bei kurzfristig anfallendem Pflegebedarf die Pflegepersonen<br />
zu entlasten,<br />
3. Verbesserung der Möglichkeiten, unterschiedliche Pflegeleistungen<br />
zu kombinieren und insbesondere der Förderung<br />
bezahlbarer ambulanter Dienstleistungen sowie der<br />
Kurzzeitpflege,<br />
4. Förderung alternativer Wohnformen, die eine vollstationäre<br />
Pflege unnötig machen oder zumindest hinauszögern<br />
könnten,<br />
5. Förderung von Vernetzungsstrukturen häuslich Pflegender,<br />
6. Unterstützung der Vernetzung professioneller, familiärer<br />
und ehrenamtlicher Pflege, Hilfen und Dienste, die individuelle<br />
Bedürfnisse passgenauer bedienen.<br />
Der <strong>DGB</strong> unterstützt die Mitgliedsgewerkschaften bei der<br />
Vereinbarung tarifvertraglicher Regelungen, die den Beschäftigten<br />
kurzfristig die Übernahme von Pflegetätigkeiten<br />
ermöglichen (bspw. nach einem Schlaganfall).<br />
Der Katalog der Leistungen muss um Demenzerkrankungen<br />
erweitert werden.<br />
Begründung:<br />
Die erst 1995 eingeführte soziale Pflegeversicherung steht<br />
auf dem Prüfstand. Im Rahmen der Umsetzung der Entscheidung<br />
des Bundesverfassungsgerichts zum Familienausgleich<br />
in der sozialen Pflegeversicherung (3.4.2001, 1 BvR<br />
1629/94) müssen kinderlose Erwachsene nun einen um<br />
0,25 % erhöhten Beitrag zahlen. Das spült zwar zusätzliches<br />
Geld in die Kassen, eine notwendige umfassende<br />
Reform der Pflegeversicherung gelang jedoch nicht.<br />
Insbesondere gelang es aufgrund der angespannten Finanzsituation<br />
der sozialen Pflegeversicherung nicht, auch<br />
Demenzerkrankungen in den Leistungskatalog der Versicherung<br />
aufzunehmen. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB<br />
XI ist insofern einschränkend, als er keinen bedürfnisorientierten<br />
Ansatz zugrunde legt, sondern sich ausschließlich<br />
auf einen Hilfebedarf bei den im Gesetz definierten Verrichtungen<br />
des täglichen Lebens in den Bereichen Körperpflege,<br />
Mobilität, Ernährung und hauswirtschaftliche Versorgung<br />
bezieht.<br />
Der durch psychische oder kognitive Einschränkungen verursachte<br />
Hilfebedarf liegt insbesondere in Anfangsstadien in<br />
der allgemeinen Beaufsichtigung und Betreuung der betroffenen<br />
Menschen.<br />
Der rein tatsächlich existierende allgemeine Betreuungsund<br />
Beaufsichtigungsbedarf für Demenzkranke muss daher<br />
weiterhin allein von den Familien aufgefangen werden, das<br />
heißt in der Praxis zumeist: den Frauen.<br />
Häusliche Pflege ist für die Pflegeversicherung deutlich<br />
preiswerter als die Übernahme von Kosten ambulanter oder<br />
stationärer Pflege. Es verwundert daher nicht, dass häusliche<br />
Pflege schon nach den gesetzlichen Vorgaben als vorrangig<br />
zu anderen Formen der Pflege angesehen wird. Vielfach<br />
lässt sich darüber hinaus feststellen, dass die Kosten<br />
insbesondere ambulanter Dienstleistungen nur zu Teilen<br />
erstattet wird, so dass häusliche Pflege für viele Familien<br />
die einzig finanzierbare Möglichkeit ist.<br />
Darüber hinaus stellen wir fest, dass unter dem Stichwort<br />
„menschenwürdiges Altern“ eine Drucksituation – insbesondere<br />
auf Frauen – aufgebaut wird, indem unterstellt<br />
wird, dass ein menschenwürdiges Altern außerhalb der<br />
Familie nicht gegeben sei.<br />
Ähnlich der Rabenmutter wird das Bild der Rabentochter<br />
aufgebaut, wobei zwei (falsche) Grundannahmen verschwiegen<br />
werden: Zum einen wird davon ausgegangen,<br />
dass nicht-familiale Betreuungsstrukturen per se menschenunwürdig<br />
sind, zum anderen wird angenommen, dass Frauen<br />
aus ihrer Natur heraus gute Pflegepersonen sein müssten.<br />
Wer pflegt und wird gepflegt?<br />
Es gibt 1,4 Mio. Pflegebedürftige in Privathaushalten,<br />
(davon über die Hälfte mit Pflegestufe 1, 461.000 mit Pflegestufe<br />
2 und 153.000 mit Pflegestufe 3). Dazu kommen<br />
weitere Personengruppen, die vorrangig hauswirtschaftliche<br />
Unterstützung benötigen, nämlich 1.361.000 täglich,<br />
1.064.000 wöchentlich und 564.000 eher selten.<br />
Beinahe zwei Drittel der Pflegebedürftigen sind Frauen.<br />
Gepflegt wird überwiegend von Frauen, so sind 73 % der<br />
Hauptpflegepersonen Frauen.<br />
Da beinahe 50 % der Hauptpflegepersonen zwischen 40
und 64 Jahre alt sind, korreliert ihre Pflegetätigkeit auch<br />
mit beruflichen Anforderungen.<br />
Dies lässt sich alleine daran festmachen, dass 14 % der<br />
Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen Alter ihre Erwerbsarbeit<br />
eingeschränkt und 16 % ganz aufgegeben haben.<br />
Pflege wird also überwiegend von Frauen übernommen,<br />
wobei sich feststellen lässt, dass auch Pflegekarrieren entstehen<br />
(eigene und Schwiegereltern), die sich an Zeiten der<br />
Kindererziehung anschließen.<br />
Pflegeurlaub als Stein der Weisen?<br />
Mit Sorge sehen wir die Pläne konservativer Landesregierungen,<br />
eine Pflegezeit analog der Elternzeit einzuführen.<br />
Zum einen sehen wir keine Vergleichbarkeit zwischen der<br />
Erziehung eines Kindes mit der Pflege eines alten Menschen.<br />
So ist zum Zeitpunkt der Übernahme der Pflege ihr<br />
zeitliches Ende nicht absehbar, so dass eine zeitliche Begrenzung<br />
auf drei Jahre eher zynisch erscheint.<br />
Zum anderen befürchten wir, dass mit einer gesetzlichen<br />
Möglichkeit der Beurlaubung nicht nur der Druck auf Frauen<br />
zunimmt, ihre Erwerbstätigkeit zur Übernahme von Pflege<br />
aufzugeben. Durch die Einführung von Pflegezeiten<br />
sehen wir die Gefahr, dass die bereits existierenden „Familien-Karrieren“<br />
von Frauen, die teilweise nahtlos aus Kindererziehungszeiten<br />
in die Rolle der Pflegenden wechseln,<br />
gefördert werden.<br />
Die gesetzliche Einführung einer Pflegezeit lehnen wir<br />
daher ab.<br />
E 010 Vereinbarkeit von Beruf und Familie<br />
für pflegende Angehörige<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert den Gesetzgeber<br />
auf, bessere Teilzeitregelungen für pflegende Angehörige<br />
zu schaffen. Dazu gehören:<br />
1. Rechtsanspruch auf kurzfristige, kurzzeitige Freistellungen<br />
für Not- und Härtefälle innerhalb eines bestimmten<br />
Zeitkorridors,<br />
2. Rechtsanspruch auf Arbeitszeitreduzierungen mit Kündigungsschutz<br />
und Rückkehrrecht auf einen gleichwertigen<br />
Vollzeitarbeitsplatz für pflegende Angehörige.<br />
Ankündigungsfristen für die Inanspruchnahme der Freistellungen<br />
bzw. des Arbeitszeitreduzierungswunsches, wie sie<br />
im Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelt sind, kann es für<br />
diese Bedarfe nicht geben. Schwellenwerte für die Größen-<br />
ordnung der Betriebe, für die ein solches Gesetz gelten soll,<br />
kann es ebenso wenig geben.<br />
Eine völlige Freistellung analog der Elternzeit lehnt die<br />
<strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz ab.<br />
Begründung:<br />
Für pflegende Angehörige besteht dringender Handlungsbedarf<br />
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Pflegetätigkeiten.<br />
Alle Studien belegen, dass die Pflege von Angehörigen,<br />
insbesondere der häuslichen Pflege, künftig zunehmen<br />
wird. Andererseits sinkt aber die Bereitschaft, hierfür<br />
die Erwerbsarbeit aufzugeben. Die Pflege von Angehörigen<br />
ist mit Kindererziehung nicht vergleichbar. Pflege ist nicht,<br />
wie Elternschaft und Elternzeit, planbar, weder in ihrer<br />
Gesamtdauer noch in ihrem konkreten Verlauf. Meist sind<br />
die physischen und psychischen Anforderungen im Zeitverlauf<br />
der Pflege steigend. Pflegende Angehörige, die ihre<br />
Erwerbsarbeit unterbrechen, verlieren den Kontakt nach<br />
außen / den ständigen Kontakt zu den Kolleginnen und<br />
Kollegen. Aufgrund der enormen Belastungen durch die<br />
Pflegetätigkeit sind aber diese Kontakte wichtig. Deshalb<br />
streben wir Regelungen an, die eine Parallelität von Pflegetätigkeit<br />
und Erwerbstätigkeit möglich machen. Hinzu<br />
kommt, dass für pflegende Angehörige der Wiedereinstieg<br />
nach einer Unterbrechung der Erwerbstätigkeit kaum möglich<br />
sein wird (50 % der Hauptpflegepersonen sind zwischen<br />
40 und 64 Jahre alt). Für Not- und Härtefälle können<br />
kurzfristige, kurzzeitige Freistellungen hilfreich sein, um z.B.<br />
den akuten Pflegebedarf zu organisieren oder Sterbebegleitung<br />
leisten zu können.<br />
G 003 Abänderungsantrag zu E 009 und E<br />
010: Vereinbarkeit von Beruf und<br />
Familie für pflegende Angehörige<br />
Antragsteller/in: Inken Biehl (ver.di) u.a.<br />
Beschluss: Ablehnung<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Vorbemerkungen zur Frage „Warum stellen wir einen<br />
Änderungsantrag“:<br />
Bisher liegen zu dieser Thematik die beiden Anträge E 009<br />
und E 010 vor. Diese konnten erst Ende September in der<br />
GEW-Bundesfrauenausschuss-Sitzung beraten werden und<br />
ein entsprechender Beschluss gefasst werden.<br />
Der Änderungsantrag fasst die beiden Anträge E 009 und E<br />
010 zusammen. Damit kann ein in sich geschlossener<br />
99
100<br />
Antrag in der <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz zur Thematik<br />
„Vereinbarkeit von Beruf und Familie für pflegende Angehörige“<br />
zur Abstimmung gestellt werden, der vorliegende<br />
Aspekte und Forderungen zusammenführt und einen neuen<br />
Aspekt mit aufnimmt.<br />
Im Änderungsantrag werden in Ziff. 1 die Forderungen aus<br />
dem IGM-BFA-Antrag nach Verbesserung der professionellen<br />
Pflege und deren Rahmenbedingungen übernommen.<br />
Im Änderungsantrag wird in Ziff. 2 die Forderung aufgenommen,<br />
die Pflegeversicherung so weiterzuentwickeln,<br />
dass an Demenz Erkrankte vom Leistungskatalog umfasst<br />
sind.<br />
Der Änderungsantrag enthält einen Zusatz in Ziff. 3, 1.<br />
Spiegelstrich: Die Forderung nach einer gesetzlichen Regelung<br />
für die Verringerung der Arbeitszeit mit einem Rückkehrrecht<br />
auf mindestens einen gleichwertigen Arbeitsplatz<br />
zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.<br />
Die rechtliche Absicherung des Rückkehrrechts ist ein notwendiger<br />
Schutz für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br />
weil sonst weiterhin viele ihren Arbeitsplatz aufgeben<br />
müssen bzw. verlieren, wenn sie Angehörige pflegen<br />
müssen. Derzeit geben nämlich 16 % der Frauen ihre<br />
Erwerbstätigkeit ganz auf, die zwischen 40 und 64 Jahre alt<br />
und erwerbsfähig sind, wenn sie die Aufgabe der Hauptpflegeperson<br />
übernommen haben. Nach der Pflegezeit<br />
haben sie kaum eine Chance, wieder in ihren qualifizierten<br />
Beruf zurückkehren zu können. Diese Situation trägt ganz<br />
enorm zur Verfestigung des traditionellen Geschlechterverhältnisses<br />
bei.<br />
Im Änderungsantrag wird in Ziff. 3, 2. Spiegelstrich die Forderung<br />
aus dem <strong>DGB</strong>-BFA-Antrag nach kurzfristiger Freistellung<br />
für „Pflegenotfälle“ übernommen.<br />
Im Änderungsantrag wird in Ziff. 4 die Aufforderung an die<br />
Tarifpartner formuliert, über die gesetzlichen Regelungen<br />
hinaus tarifliche Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von<br />
Pflege und Beruf zu vereinbaren.<br />
Antrag:<br />
Die 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Die 16. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert den Bundesvorstand<br />
auf,<br />
1. sich gegen die Einführung einer Pflegezeit analog der<br />
Elternzeit einzusetzen. Stattdessen werden Maßnahmen<br />
geprüft und unterstützt, die bezahlbare und qualitativ<br />
hochwertige Pflegedienstleistungen ausbauen. Zu diesen<br />
Maßnahmen gehören:<br />
❚ Schaffung von Angeboten der Prävention, um Pflege<br />
zu vermeiden bzw. hinauszuzögern,<br />
❚ Einführung eines Entlassungs- und Überleitungsmanagements<br />
und Nutzung der Leistung Kurzzeitpflege, um<br />
gerade bei kurzfristig anfallendem Pflegebedarf die<br />
Pflegepersonen zu entlasten,<br />
❚ Verbesserung der Möglichkeiten, unterschiedliche Pflegeleistungen<br />
zu kombinieren und insbesondere der<br />
Förderung bezahlbarer ambulanter Dienstleistungen<br />
sowie der Kurzzeitpflege,<br />
❚ Förderung alternativer Wohnformen, die eine vollstationäre<br />
Pflege unnötig machen oder zumindest hinauszögern<br />
könnten,<br />
❚ Förderung von Vernetzungsstrukturen häuslich Pflegender,<br />
❚ Unterstützung der Vernetzung professioneller, familiärer<br />
und ehrenamtlicher Pflege, Hilfen und Dienste, die<br />
individuelle Bedürfnisse passgenauer bedienen.<br />
2. sich für die Erweiterung des Leistungskatalogs der<br />
gesetzlichen Pflegeversicherung für die speziellen Anforderungen<br />
von Demenzkranken einzusetzen.<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz fordert folgende Maßnahmen<br />
zur Verbesserung der Situation pflegender Angehöriger:<br />
3. gesetzliche Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von<br />
Pflege und Beruf durch Arbeitszeitregelungen, die den<br />
Bedürfnissen pflegender Angehöriger Rechnung tragen,<br />
mit einer entsprechenden Lohnersatzleistung insbesondere<br />
❚ durch den Erhalt und die Weiterentwicklung des Teilzeit-<br />
und Befristungsgesetzes, insbesondere durch<br />
einen Rechtsanspruch auf Verringerung der Arbeitszeit<br />
unabhängig von der Zahl der Beschäftigten und Rückkehrrecht<br />
auf den gleichen, zumindest gleichwertigen<br />
Arbeitsplatz,<br />
❚ einen Anspruch auf kurzfristige Freistellung für die<br />
durch ärztliches Attest nachgewiesene erforderliche<br />
Dauer der Betreuung oder Pflege eines/r Angehörigen;<br />
4. tarifliche Regelungen zu Ansprüchen für die Pflege Angehöriger,<br />
insbesondere durch<br />
❚ bezahlte Freistellung, insbesondere bei kurzfristig<br />
erforderlicher Übernahme von Pflegetätigkeiten,<br />
❚ Verwendung angesparter Mehrarbeit – mit entsprechendem<br />
Insolvenzschutz.<br />
Die gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen zur Verbesserung<br />
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für pflegende<br />
Angehörige müssen so ausgestaltet werden, dass<br />
Frauen und Männern die Aufgabe als pflegende Angehörige<br />
wahrnehmen und die rollenspezifische Arbeitsteilung nicht<br />
verfestigt wird.
Der Bundesvorstand und die Gewerkschaften werden aufgefordert,<br />
diese Forderungen zu unterstützen.<br />
Begründung:<br />
I.<br />
Es gibt 1,4 Mio. Pflegebedürftige in Privathaushalten<br />
(davon über die Hälfte mit Pflegestufe 1, 461.000 mit Pflegestufe<br />
2 und 153.000 mit Pflegestufe 3). Dazu kommen<br />
weitere Personengruppen, die vorrangig hauswirtschaftliche<br />
Unterstützung benötigen, nämlich 1.361.000 täglich,<br />
1.064.000 wöchentlich und 564.000 eher selten.<br />
Beinahe zwei Drittel der Pflegebedürftigen sind Frauen.<br />
Gepflegt wird überwiegend von Frauen. So sind 73 % der<br />
Hauptpflegepersonen Frauen. Da beinahe 50 % der Hauptpflegepersonen<br />
40 und 64 Jahre alt sind, korreliert die Pflegetätigkeit<br />
der Hauptpflegepersonen auch mit beruflichen<br />
Anforderungen. Dies lässt sich alleine daran festmachen,<br />
dass 14 % der Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen<br />
Alter ihre Erwerbsarbeit eingeschränkt und 16 % ganz aufgegeben<br />
haben.<br />
Pflege wird überwiegend von Frauen übernommen, wobei<br />
sich feststellen lässt, dass auch Pflegekarrieren entstehen<br />
(eigene und Schwiegereltern), die sich an Zeiten der Kindererziehung<br />
anschließen. Die gesetzlichen und tarifvertraglichen<br />
Regelungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf für pflegende Angehörige müssen deshalb<br />
so gestaltet sein, dass Frauen und Männer die Aufgabe<br />
als pflegende Angehörige wahrnehmen und wahrnehmen<br />
können. Die Schutzregelungen für Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer und Anreize für Männer müssen entsprechend<br />
ausgestaltet sein.<br />
Für pflegende Angehörige besteht dringender Handlungsbedarf<br />
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Pflegetätigkeiten.<br />
Alle Studien belegen, dass die Pflege von Angehörigen,<br />
insbesondere der häuslichen Pflege, künftig zunehmen<br />
wird. Andererseits sinkt aber die Bereitschaft, hierfür<br />
die Erwerbsarbeit aufzugeben.<br />
Meist sind die physischen und psychischen Anforderungen<br />
im Zeitverlauf der Pflege steigend. Pflegende Angehörige,<br />
die ihre Erwerbsarbeit unterbrechen, verlieren den Kontakt<br />
nach außen. Aufgrund der enormen Belastungen durch die<br />
Pflegetätigkeit sind aber diese Kontakte wichtig. Das muss<br />
bei der Weiterentwicklung der professionellen Pflegedienstleistungen<br />
mitberücksichtigt werden.<br />
II.<br />
Deshalb ist eine gesetzliche Regelung erforderlich, die ein<br />
Rückkehrrecht auf mindestens einen gleichwertigen Arbeitsplatz<br />
garantiert, weil sonst weiterhin viele ArbeitnehmerIn-<br />
nen ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen bzw. verlieren,<br />
wenn sie Angehörige pflegen müssen. Derzeit geben nämlich<br />
16 % der Frauen ihre Erwerbstätigkeit ganz auf, die<br />
zwischen 40 und 64 Jahre alt und erwerbsfähig sind, wenn<br />
sie die Aufgabe der Hauptpflegeperson übernommen<br />
haben. Nach einem Ausstieg aus dem Beruf wegen der<br />
Pflege Angehöriger haben sie kaum eine Chance, wieder in<br />
ihren qualifizierten Beruf zurückkehren zu können. Diese<br />
Situation trägt ganz enorm zur Verfestigung des traditionellen<br />
Geschlechterverhältnisses bei. Mit dem Erhalt des Teilzeit-<br />
und Befristungsgesetzes streben wir Regelungen an,<br />
die eine Parallelität von Pflegetätigkeit und Erwerbstätigkeit<br />
möglich machen. Für Not- und Härtefälle können kurzfristige<br />
Freistellungen von kurzer Dauer hilfreich sein, um z.B.<br />
den akuten Pflegebedarf zu organisieren oder Sterbebegleitung<br />
leisten zu können.<br />
Die erst 1995 eingeführte soziale Pflegeversicherung steht<br />
auf dem Prüfstand. Rahmen der Umsetzung der Entscheidung<br />
des Bundesverfassungsgerichts zum Familienausgleich<br />
in der sozialen Pflegeversicherung (3.4.2001, 1 BvR<br />
1629/94) müssen kinderlose Erwachsene nun einen um<br />
0,25 % erhöhten Beitrag zahlen. Das spült zwar zusätzliches<br />
Geld in die Kassen, eine notwendige umfassende<br />
Reform der Pflegeversicherung gelang jedoch nicht.<br />
Insbesondere gelang es aufgrund der angespannten Finanzsituation<br />
der sozialen Pflegeversicherung nicht, auch<br />
Demenzerkrankungen in den Leistungskatalog der Versicherung<br />
aufzunehmen. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB<br />
XI ist insofern einschränkend, als er keinen bedürfnisorientierten<br />
Ansatz zugrunde legt, sondern sich ausschließlich<br />
auf einen Hilfebedarf bei den im Gesetz definierten Verrichtungen<br />
des täglichen Lebens in den Bereichen Körperpflege,<br />
Mobilität, Ernährung und hauswirtschaftliche Versorgung<br />
bezieht.<br />
Der durch psychische oder kognitive Einschränkungen verursachte<br />
Hilfebedarf liegt insbesondere in Anfangsstadien in<br />
der allgemeinen Beaufsichtigung und Betreuung der betroffenen<br />
Menschen.<br />
Der rein tatsächlich existierende allgemeine Betreuungsund<br />
Beaufsichtigungsbedarf für Demenzkranke muss daher<br />
weiterhin allein von den Familien aufgefangen werden, das<br />
heißt in der Praxis zumeist: den Frauen.<br />
Häusliche Pflege ist für die Pflegeversicherung deutlich<br />
preiswerter als die Übernahme von Kosten ambulanter oder<br />
stationärer Pflege. Es verwundert daher nicht, dass häusliche<br />
Pflege schon nach den gesetzlichen Vorgaben als vorrangig<br />
zu anderen Formen der Pflege angesehen wird. Vielfach<br />
lässt sich darüber hinaus feststellen, dass die Kosten<br />
insbesondere ambulanter Dienstleistungen nur zu Teilen<br />
101
102<br />
erstattet werden, so dass häusliche Pflege für viele Familien<br />
die einzig finanzierbare Möglichkeit ist.<br />
Darüber hinaus stellen wir fest, dass unter dem Stichwort<br />
„menschenwürdiges Altern“ eine Drucksituation – insbesondere<br />
auf Frauen – aufgebaut wird, indem unterstellt<br />
wird, dass ein menschenwürdiges Altern außerhalb der<br />
Familie nicht gegeben sei. Ähnlich dem Bild der Rabenmutter<br />
wird das Bild der Rabentochter aufgebaut, wobei<br />
zwei (falsche) Grundannahmen verschwiegen werden:<br />
Zum einen wird davon ausgegangen, dass nicht-familiale<br />
Betreuungsstrukturen per se menschenunwürdig<br />
sind, zum anderen wird angenommen, dass Frauen aus<br />
ihrer Natur heraus gute Pflegepersonen sein müssten.<br />
Diese Situation und der Druck auf die Frauen müssen<br />
durch den Ausbau und die Weiterentwicklung der professionellen<br />
Pflegedienstleistungen und deren Rahmenbedingungen<br />
dringend und nachhaltig verbessert werden.<br />
<strong>Sachgebiet</strong> F: Organisationspolitik<br />
F 001 Politik für junge Frauen im Deutschen<br />
Gewerkschaftsbund<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschuss<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong> und seine Mitgliedsgewerkschaften werden aufgefordert,<br />
die Bedürfnisse und Interessen von jungen Frauen<br />
(bis 35 Jahre) in ihrer Arbeit intern und extern verstärkt zu<br />
berücksichtigen. Um dies zu erreichen, entwickelt der <strong>DGB</strong><br />
Strategien und Maßnahmen für die verstärkte Beteiligung<br />
von jungen Frauen in den Gewerkschaften und sorgt für<br />
deren Umsetzung. Der Förderung von jungen Frauen in<br />
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Funktionen und dem<br />
schwierigen Übergang von der Jugend- in die Erwachsenenarbeit<br />
wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In einem<br />
ersten Schritt werden die entwickelten Maßnahmen in Pilotprojekten<br />
erprobt. Dabei werden die Arbeitsbereiche Frauen-<br />
und Gleichstellungspolitik und die Arbeitsbereiche<br />
Jugend kooperieren.<br />
Die Vertretung der Interessen von jungen Frauen und die<br />
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse in der Öffentlichkeit wird<br />
verstärkt in die gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit integriert.<br />
In den gewerkschaftlichen Publikationen sollen The-<br />
men und Probleme von jungen Frauen gezielt angesprochen<br />
und passende Angebote für junge Frauen entwickelt werden.<br />
Begründung:<br />
Junge Frauen bis 35 Jahre sind für den <strong>DGB</strong> eine wichtige<br />
Zielgruppe. Ihre starke Einbindung in die Gewerkschaften<br />
ist ein unverzichtbarer Baustein für die Zukunftsfähigkeit<br />
der Gewerkschaften.<br />
1. Präsenz von Frauen in den Gewerkschaften:<br />
Der Mitgliederanteil von Frauen im Jugendbereich liegt<br />
insgesamt noch unter dem Frauenanteil im <strong>DGB</strong> (27,2 %<br />
Frauenanteil im Jugendbereich zu 31,9 % Frauenanteil<br />
im <strong>DGB</strong>). Besonders der Übergang von der Jugend- in<br />
die Erwachsenenarbeit gelingt bei vielen Frauen nicht<br />
und bedarf besonderer Aufmerksamkeit. In der Frauenarbeit<br />
und den Frauengremien der Gewerkschaften sind<br />
junge Frauen deutlich unterrepräsentiert. Es muss nach<br />
neuen Wegen und Arbeitsformen gesucht werden, um<br />
junge Frauen für die gewerkschaftliche Frauenarbeit zu<br />
gewinnen.<br />
2. Die besonderen Bedürfnisse und Interessen von jungen<br />
Frauen:<br />
Junge Frauen sind nach wie vor von struktureller<br />
Benachteiligung betroffen. Dies zeigt sich vor allem bei<br />
der Ausbildungsplatzsuche, der Übernahme nach der<br />
Ausbildung, der Entgeltproblematik und nicht zuletzt in<br />
der Berufswahl, die noch immer stark von der<br />
Geschlechtszugehörigkeit und der entsprechenden Sozialisation<br />
abhängt. Darüber hinaus müssen junge Frauen<br />
bis 35 die mangelhaften Vereinbarkeitsmöglichkeiten von<br />
Familie und Beruf und die daraus entstehenden Probleme<br />
in ganz besonderem Maße bewältigen. Es kann<br />
davon ausgegangen werden, dass junge Frauen in der<br />
Familienphase auch aus diesem Grund in den Gewerk-
schaften unterrepräsentiert sind. Entweder steigen sie<br />
ganz oder zeitweise aus der Erwerbsarbeit aus oder es<br />
bleibt keine Zeit für gewerkschaftliches Engagement in<br />
den klassischen gewerkschaftlichen Arbeitsformen und<br />
Strukturen. Die Themen und die damit einhergehenden<br />
Interessen und Bedürfnisse von jungen Frauen müssen<br />
stärker auf die Agenda gewerkschaftlicher Politik gesetzt<br />
und in der gewerkschaftlichen Praxis umgesetzt werden,<br />
damit die bestehende Organisationslücke endlich<br />
geschlossen werden kann.<br />
3. Neue Wege der Ansprache junger Frauen:<br />
Es müssen neue Wege der Ansprache junger Frauen entwickelt<br />
und ausprobiert werden. Die Thematisierung von<br />
Diskriminierung und Benachteiligung erweist sich zunehmend<br />
als kontraproduktiv bei der Ansprache junger Frauen.<br />
Diese erleben sich in der Regel nicht als diskriminiert,<br />
machen aber gleichzeitig Erfahrungen mit strukturell<br />
bedingten Benachteiligungen, die oft als individuelle Probleme<br />
wahrgenommen werden. Es werden neue Strategien<br />
und Maßnahmen benötigt, die geeignet sind, das<br />
Maß an Selbstbestimmung und Autonomie im (Arbeits-<br />
)Leben junger Frauen zu erhöhen und die sie in die Lage<br />
versetzen, ihre Belange zu vertreten und zu gestalten.<br />
Die Gewerkschaften müssen in der Entwicklung von<br />
Strategien und Maßnahmen für junge Frauen deutlich<br />
eigene Akzente setzen, um für junge Frauen attraktiv zu<br />
werden. Berücksichtigt werden sollte dabei, dass junge<br />
Frauen keine in sich homogene Gruppe darstellen. Die<br />
Vielfalt unter den jungen Frauen und die damit einhergehenden<br />
unterschiedlichen Interessen müssen sich in der<br />
gewerkschaftlichen Politik widerspiegeln.<br />
F 002 Politik für junge Frauen im Deutschen<br />
Gewerkschaftsbund<br />
Antragsteller/in: IG Metall-Frauenausschuss beim Vorstand<br />
Beschluss: Annahme<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand setzt die bereits im Rahmen des<br />
Aktionsprogramm Chancen!Gleich mit der 1. <strong>DGB</strong>-Netzwerkkonferenz<br />
begonnene Arbeit fort. Dafür ist die Unterstützung<br />
der bestehenden Netzwerke notwendig sowie der<br />
Aufbau und die Erweiterung von Strukturen für die gewerkschaftsübergreifende<br />
Netzwerkarbeit von Betriebsrätinnen<br />
zu prüfen.<br />
Dazu gehören u. a.:<br />
Ein Internetauftritt, in dem alle gewerkschaftlichen Netzwerke<br />
zum Thema Chancengleichheit verlinkt werden,<br />
regelmäßige bundesweite und regionale Netzwerkkonferenzen<br />
sowie Angebote von Seminaren und Handreichungen<br />
zum Aufbau von Netzwerken.<br />
Das Logo des Aktionsprogramm Chancen!Gleich sollte<br />
dabei zukünftig für die Netzwerke zur Chancengleichheitspolitik<br />
genutzt werden. Da das Ziel des Aktionsprogramms<br />
mehr Chancengleichheit in den Betrieben war, wird damit<br />
auch die betriebliche Orientierung der Netzwerkarbeit deutlich<br />
gemacht.<br />
Begründung:<br />
„Netzwerke sind ein innovativer Ansatz, um Politik aus<br />
unterschiedlichen Sichtweisen zu beleuchten, die verschiedenen<br />
Erfahrungen einzubringen und mit einer Kompetenzvielfalt<br />
zu gestalten“, so Ursula Engelen-Kefer zur Begrüßung<br />
auf der 1. <strong>DGB</strong>-Netzwerkkonferenz im November<br />
2004.<br />
Dass dies so ist, zeigen auch unsere Erfahrungen mit den<br />
zahlreichen Betriebsrätinnen-Netzwerken in der IG Metall,<br />
wie z. B. dem Netzwerk „Chancengleichheit“, „Frauen in<br />
der Automobilindustrie“ und die Netzwerke auf Konzernbzw.<br />
Unternehmensebene.<br />
Häufig sind die Betriebsrätinnen beim Thema Chancengleichheit<br />
im Betrieb Einzelkämpferinnen. Die Netzwerke<br />
ermöglichen ihnen einen Erfahrungsaustausch untereinander<br />
und informieren gleichzeitig über aktuelle gleichstellungspolitische<br />
Fragen, Strategien und rechtliche Entwicklungen.<br />
Es stärkt die Position der einzelnen Kollegin und<br />
ihre Handlungsfähigkeit. Durch die vernetzten Strukturen<br />
werden individuelles Wissen und Erfahrungen eingebracht<br />
und neues Wissen entsteht durch die gemeinsame Arbeit.<br />
Für funktionierende Netzwerke ist es wichtig, dass personelle<br />
und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.<br />
Auch muss ein sozialer Zusammenhang, z. B. durch<br />
regelmäßige Treffen, hergestellt werden. Ebenso notwendig<br />
ist, dass die Netzwerke als ein wichtiges Instrument angesehen<br />
werden und die entsprechende Unterstützung des<br />
<strong>DGB</strong> bzw. der Einzelgewerkschaften bekommen.<br />
Bereits bestehende Netzwerke haben gezeigt, dass sie eine<br />
moderne und erfolgreiche Strategie für mehr Chancengleichheit<br />
von Frauen und Männern sind. Denn der direkte<br />
Austausch mit anderen AkteurInnen über Erfahrungen,<br />
Methoden, Strategien und gute Praxis kann ein wesentlicher<br />
Erfolgsfaktor für eine gleichstellungspolitische Initiative<br />
im Betrieb werden und damit die betriebliche Gleichstellungspolitik<br />
vorantreiben.<br />
103
104<br />
Darüber hinaus bieten Netzwerke durch ihre Flexibilität,<br />
Transparenz und Partizipation auch gewerkschaftspolitisch<br />
neue Möglichkeiten Kolleginnen, die durch bisherige Organisationsformen<br />
nicht angesprochen wurden, zu erreichen.<br />
F 003 Anwendung des Gender Mainstreaming<br />
Prinzips im Deutschen<br />
Gewerkschaftsbund<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-<br />
Thüringen<br />
Beschluss: Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesfrauenausschuss<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der geschäftsführende Bundesvorstand und die Bezirksvorsitzenden<br />
des Deutschen Gewerkschaftsbundes bekennen<br />
sich ausdrücklich und öffentlich zur Umsetzung des Prinzips<br />
Gender Mainstreaming im Deutschen Gewerkschaftsbund<br />
nach dem Top Down-Prinzip.<br />
Weiter wird der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand verpflichtet, entsprechende<br />
finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung<br />
zu stellen, um das Prinzip Gender Mainstreaming im Deutschen<br />
Gewerkschaftsbund zu verwirklichen.<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand beauftragt hierzu die Grundsatzabteilung,<br />
einen Steuerkreis zu installieren, deren Aufgabe<br />
es ist, u.a. mit externer Fachberatung den Prozess der Verankerung<br />
zu konkretisieren, zu koordinieren und zu steuern.<br />
So muss eine verbindliche Verankerung des Gender Mainstreaming-Prinzips<br />
im Deutschen Gewerkschaftsbund auf<br />
allen Ebenen erfolgen. Weiter müssen kontinuierliche Gender<br />
Mainstreaming-Fortbildung und so genannte Gender-<br />
Trainings im Rahmen der Hauptamtlichen-Qualifizierung des<br />
Deutschen Gewerkschaftsbundes stattfinden. Gender Mainstreaming<br />
muss Bestandteil der Personalentwicklung und –<br />
führung werden.<br />
Der Steuerkreis bei der Grundsatzabteilung des <strong>DGB</strong> erstattet<br />
dem geschäftsführenden Bundesvorstand regelmäßig<br />
Bericht zum Stand der Umsetzung des Prinzips Gender<br />
Mainstreaming. Darauf hin entscheidet der Bundesvorstand<br />
nach dem Prinzip Top Down über weitere Schritte der<br />
Umsetzung des Prinzips Gender Mainstreaming in der<br />
Organisation.<br />
Begründung:<br />
Zur Begründung wird auf die Anträge zur 15. <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz<br />
verwiesen. Nach der klaren Antragslage<br />
der letzten <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz müssen nunmehr<br />
entsprechend erste Umsetzungsschritte beim <strong>DGB</strong> auf allen<br />
Ebenen erfolgen und entsprechende Strukturen geschaffen<br />
werden.<br />
F 004 Entwicklung von Logo und<br />
Materialien für den 8. März –<br />
Internationaler Frauentag<br />
Antragsteller/in: <strong>DGB</strong>-Bezirksfrauenausschuss Hessen-<br />
Thüringen<br />
Beschluss: Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesfrauenausschuss<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Der <strong>DGB</strong>-Bundesvorstand wird beauftragt, jährlich, rechtzeitig<br />
vor dem jeweiligen 8. März eine Arbeitsgruppe, bestehend<br />
aus haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen sowie<br />
einer professionellen Werbeagentur, einzuberufen, um die<br />
Materialien, Motto und Logo zum Internationalen Frauentag<br />
abzustimmen bzw. zu entwerfen. Weiter sollten in dieser<br />
Arbeitsgruppe Vorschläge für Aktionen am 8. März erarbeitet<br />
werden.<br />
Begründung:<br />
In den letzten Jahren ist es leider nicht gelungen, die Materialien<br />
zum Internationalen Frauentag so zu gestalten, dass<br />
sie vor Ort bzw. in den Betrieben uneingeschränkt verwendet<br />
werden konnten. Dies lag zum einen daran, dass sie<br />
optisch nicht ankamen bzw. das Motto politisch nicht entsprechend<br />
vor Ort praktisch eingesetzt werden konnte und<br />
die Kolleginnen das Gefühl hatten, es sei nicht von ihnen.<br />
Dies hat leider dazu geführt, dass oftmals andere Materialien<br />
verwendet worden sind. Wir halten es aber gerade für<br />
erforderlich, dass die Frauen des <strong>DGB</strong> am Internationalen<br />
Frauentag mit einheitlichen Materialien auftreten und so<br />
bundesweit erkennbar sind. Daher auch die Erarbeitung von<br />
Aktionsvorschlägen, die dann an den verschiedenen Orten<br />
der Bundesrepublik umgesetzt werden könnten. Wir haben<br />
in unseren Reihen so kreative ehrenamtliche Kolleginnen,<br />
die sich sicher freuen würden, sich an der Ausgestaltung<br />
des Internationalen Frauentages in Form eines Brainstorming<br />
beteiligen zu können bzw. auch dann die Materialien
zu entwerfen. Hier ist es dann sicher sehr hilfreich, eng mit<br />
der beauftragten Werbeagentur zusammen zu arbeiten,<br />
damit die „Profis“ die Gedanken und Ideen der Kolleginnen<br />
besser umsetzen können bzw. Ratschläge zu einer professionellen<br />
Umsetzung erteilen können.<br />
F 005 Internationaler Frauentag<br />
Antragsteller/in: ver.di Bundesfrauenrat<br />
Beschluss: Annahme als Material an den <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesfrauenausschuss<br />
Die <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz möge beschließen:<br />
Redebausteine für Internationalen Frauentag<br />
Anlässlich des Internationalen Frauentages, dem 8. März,<br />
finden alljährlich bundesweit Aktivitäten und Veranstaltungen<br />
statt.<br />
Um die Bedeutung des Tages für die Frauen noch stärker<br />
hervorzuheben und um die Gemeinsamkeit zu verdeutlichen,<br />
beantragt der ver.di-Bundesfrauenrat, dass der <strong>DGB</strong>-<br />
Bundesvorstand, die Abt. Gleichstellungs- und Frauenpolitik,<br />
jährlich zum 8. März Redebausteine für die Mitgliedsgewerkschaften<br />
und ihre Frauenreferate zur Verfügung stellt.<br />
Begründung:<br />
Derzeit müssen wir feststellen, dass Frauenpolitik in politischen,<br />
gesellschaftlichen und betrieblichen Bereichen<br />
zurückgedrängt oder in Familienpolitik umgewandelt wird<br />
und somit untergeht.<br />
Umso wichtiger ist es, frauenpolitische Positionen verstärkt<br />
bundesweit zu artikulieren. Einheitliche Reden und Aussagen<br />
zur Frauenpolitik am 8.März können das Gewicht und<br />
die Bedeutung eigenständiger politischer Forderungen hervorheben<br />
und betonen.<br />
105
106<br />
Verzeichnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Delegierte<br />
IG Bauen-Agrar-Umwelt<br />
Diethe-Hollis, Ursula, Nürnberg<br />
Honsberg, Sylvia, Frankfurt<br />
Janisch, Cornelia, Forst<br />
Merklein-Lempp, Dr. Irene, Halle<br />
Müller, Angelika, Stutensee<br />
IG Bergbau, Chemie, Energie<br />
Adolph, Petra, Hannover<br />
Blümel, Karin, Hannover<br />
Carl, Edith, Weimar<br />
Knauer, Doris, Roedental<br />
Krause, Jutta, Mettlach<br />
Malkowski, Marianne, Marl<br />
Spendel, Kerstin, Krefeld<br />
Strüwing, Heidrun, Schwedt<br />
Wippel-Zoller, Elvira, Karlsruhe<br />
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
Blass-Graf, Ursula, Saarbrücken<br />
Drescher, Angela, Hannover<br />
Emig, Hilke, Bremen<br />
Groneberg, Caren, Berlin<br />
Gützkow, Frauke, Frankfurt/M.<br />
Haas, Barbara, Stuttgart<br />
Rehwald, Erdmute, Ratingen<br />
Reich-Gerick, Hanne, Hamburg<br />
Tepe, Marlis, Hüttblek<br />
IG Metall<br />
Berghold, Petra, Landau<br />
Cuntz, Julia, Frankfurt/M.<br />
Ehlers, Jutta, Berlin<br />
Fischer, Daniela, Bruckmühl<br />
Gößling-Quast, Antje, Recklinghausen<br />
Hagenlocher, Ulrike, Vaihingen/Enz<br />
Held, Karin, Bielefeld<br />
Kauzmann, Beate, Riedberg<br />
Keller, Marlies, München<br />
Knüttel, Astrid, Frankfurt/M.<br />
Lersmacher, Monika, Stuttgart<br />
Nötzel, Silke, Frankfurt/M.<br />
Oswald, Waltraud, Greifswald<br />
Overkott, Andrea, Dillenburg<br />
Pfleghar, Sabine, Uhldingen-Mühlhofen<br />
Rademacher, Lilo, Friedrichshafen<br />
Rohrbach, Marion, Sprockhövel<br />
Schwarz, Sabine, Uetze<br />
Schwitzer, Helga, Hannover<br />
Ulbrich, Dr. Gabriele, Frankfurt/M.<br />
von Garrel, Birgit, Landshut<br />
Wegner, Manuela, Berlin<br />
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten<br />
Kaspar, Christa, Waiblingen<br />
Pitsch, Birgit, Langenhagen<br />
Reilein-Wedekin, Rita, Hannover<br />
Ruschel, Monika, Rostock<br />
Schmitz, Suzann, Bottrop<br />
Schulte, Martina, Schwielowsee<br />
Würtele , Rosemarie, Kassel<br />
Gewerkschaft der Polizei<br />
Fendl, Ursula, Elisabethszell<br />
Müller, Anne, Ribnitz-Damgarten<br />
Rensch, Heike, Bremerhaven<br />
Temmen, Sandra, Taunusstein-Neuhof<br />
TRANSNET<br />
Albers, Erika, Berlin<br />
Giebeler, Dagmar, Hofheim<br />
Munkelt, Kornelia, Prittitz
Neufert, Angelika, Chemnitz<br />
Petersen, Helga, Hamburg<br />
ver.di<br />
Albrecht, Brunhilde, Köthen<br />
Alles, Ursula, Kronshagen<br />
Ballhause, Roswitha, Stralsund<br />
Bäumer-Möhlmann, Ingrid, Bielefeld<br />
Berns, Stephanie, Hagen<br />
Berz, Doris, Schweinfurt<br />
Biehl, Inken, Schmalfeld<br />
Bierkämper-Braun, Heidi, Lünen<br />
Böttcher, Angelika, Hamburg<br />
Brandl, Monika, Obertraubling<br />
Brodersen, Susanna, Berlin<br />
Broer, Almut, Hamburg<br />
Büker, Brigitte , Detmold<br />
Buls, Hannelore, Berlin<br />
Chirizzi, Claudia, Stuttgart<br />
Demmler, Maja, Köln<br />
Ehinger, Roswitha, Stuttgart<br />
Eifel, Irmgard, Trier<br />
Etzold, Elke, Apolda<br />
Follert, Ruth, Hamburg<br />
Geese, Christa, Wuppertal<br />
Giesel, Ingrid, Halle<br />
Henke, Barbara, Bonn<br />
Herzig, Edith, Duisburg<br />
Kammer, Barbara, Lübeck<br />
Komisar, Evelyn, Nürnberg<br />
Kopp, Marion, Markkleeberg<br />
Kösling, Edith, Stuttgart<br />
Kotschi, Lisa, München<br />
Lindner, Angelika, Varel<br />
Luttmann, Bärbel, Bremen<br />
Maès, Petra, Saarbrücken<br />
Maier, Ute, Dresden<br />
Maurer, Ellen, Idstein-Walsdorf<br />
Möller, Elke, Bischofsheim<br />
Morgenstern, Vera, Berlin<br />
Nießing, Marga, Mörfelden-Walldorf<br />
Nowak, Claudia, Salzgitter<br />
Peterhof, Herma, Stuttgart<br />
Petzold, Kathrin, Lengenfeld<br />
Pirna, Gisberta, Nürnberg<br />
Rauch, Elisabeth, Furth im Wald<br />
Robert, Ingeborg, Kassel<br />
Ruhe, Gabriela, Burgdorf<br />
Schmidt, Almut, Bremen<br />
Schmuck, Karin, Magdeburg<br />
Schwendler, Karin, Bremen<br />
Schwitalla, Gabi, Weimar<br />
Senft, Heike, Enkensbach-Alsenborn<br />
Smykalla, Barbara, Cottbus<br />
Teller, Elke, Chemnitz<br />
Tiefenbeck, Sabine, Mahlow<br />
Tippmann, Barbara, Rodenbach<br />
Torjus, Petra, Neuruppin<br />
Treis, Renate , Brühl<br />
Troedel, Monique , Bremen<br />
Ungers, Gabriele, Saarbrücken<br />
Vooren, Anita, Friedrichshafen<br />
Baumann, Yvonne, Leipzig<br />
Zimmermann, Monika, Kaarst<br />
Bundesfrauenausschuss<br />
Altesleben, Bettina, Saarbrücken<br />
Eilrich, Marita, Frankfurt/M.<br />
Engelen-Kefer, Dr. Ursula, Berlin<br />
Engelhardt, Uta, Stuttgart<br />
Feltrini, Bärbel, Frankfurt/M.<br />
Glänzer, Edeltraud, Hannover<br />
Groß, Birgit, Mainz<br />
Kloppich, Iris, Dresden<br />
Körner, Alberdina, Berlin<br />
Kutz, Bettina, Brehna<br />
Langguth, Heide, München<br />
Meyer, Petra, Berlin<br />
Mönig-Raane, Margret, Berlin<br />
Papendick-Apel, Helga, Hannover<br />
Richter, Petra, Magdeburg<br />
Rölke, Kirsten, Frankfurt<br />
Rosenberger, Michaela, Hamburg<br />
Rusch-Ziemba, Regina, Frankfurt/M.<br />
Tietjen, Carmen, Düsseldorf<br />
Gastteilnehmerinnen<br />
der Gewerkschaften und der<br />
<strong>DGB</strong>-Bezirke<br />
IG Bauen-Agrar-Umwelt<br />
Großer, Elvira, Gifhorn<br />
Wapenhensch, Renate, Kaiserslautern<br />
107
108<br />
IG Bergbau, Chemie, Energie<br />
Leunig, Cornelia, Hannover<br />
Gew. Erziehung und Wissenschaft<br />
Gertz, Norma, Berlin<br />
Greim, Diana, Berlin<br />
Martinek, Hanne, Berlin<br />
Poetzsch, Dagmar, Berlin<br />
Poetzsch, Maxi, Berlin<br />
Thöne, Wanda, Berlin<br />
Wiesenäcker, Ute, Oldenburg<br />
Gew. Nahrung, Genuss, Gaststätten<br />
Dorn, Sabine, Leipzig<br />
Hofmann, Sonja, Kerken<br />
Martens, Nicole, Hannover<br />
Ries, Isolde, Gersweiler<br />
Schwalbe, Petra, Berlin<br />
Wellen, Simone, Dortmund<br />
Zima, Irmtraud, Berlin<br />
Gewerkschaft der Polizei<br />
Uzunoglu, Elisabeth, Bremerhaven<br />
TRANSNET<br />
Bruchmann, Jessica-Danielle, Wuppertal<br />
Conte, Manuela, Karpen<br />
Dornheim, Kathrin, Berlin<br />
Hertwig, Antje, Berlin<br />
Menne, Claudia, Berlin<br />
Traue, Jana, Uhlstädt-Kirchhasel<br />
ver.di<br />
Brutzki, Ute, Berlin<br />
Wolfstädter, Alexa, Berlin<br />
Gastteilnehmerinnen der<br />
<strong>DGB</strong>-Bezirke<br />
Baden-Württemberg<br />
Blickle-Behl, Eva, Göppingen<br />
Breymaier, Leni, Stuttgart<br />
Schaaf, Marion, Mannheim<br />
Bayern<br />
Heitzer, Anneliese, Regensburg<br />
Pilwousek, Ingelore , München<br />
Berlin-Brandenburg<br />
Bischoff, Helga, Berlin<br />
Bogs, Angelika, Schwedt<br />
Hessen-Thüringen<br />
Bemmann, Silke, Erfurt<br />
Füllgrabe, Ute, Meißner<br />
Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt<br />
Höckmann, Barbara, Halle<br />
Martin, Dr. Elisabeth, Halberstadt<br />
Preissig, Sigrid, Nienburg<br />
Truelsen, Christa, Hannover<br />
Zoll-Grubert, Elisabeth, Bremen<br />
Nord<br />
Heldt, Perke, Heide<br />
Kranig, Petra, Schwerin<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Grosse, Brigitte, Düsseldorf<br />
Hannack, Elke, Gummersbach<br />
Kühn, Antonia, Düsseldorf<br />
Herting, Julia, Bergheim<br />
West<br />
Wolter, Dorit, Saarbrücken<br />
Sachsen<br />
Becherer, Heidi, Chemnitz<br />
Zimmermann, Sabine, Zwickau<br />
Gäste und Referentinnen/<br />
Moderatorinnen<br />
Adamowsky, Barbara, Berlin<br />
Bättermann, Gisela, Koblenz<br />
Bauer, Kristin, Wuppertal<br />
Baumgart, Kerstin, Berlin<br />
Baumgartner, Wolfgang, Berlin<br />
Beck, Annett, Berlin<br />
Beck, Dorothee, Frankfurt<br />
Beck, Klaus, Berlin<br />
Bodewei, Sandra, Dortmund<br />
Bothfeld, Elisabeth, Skaerbaek<br />
Bothfeld, ‚Dr. Silke, Düsseldorf<br />
Bratzke, Dr. Petra, Dessau
Bretz, Christiane, Berlin<br />
Clausen, Lena, Berlin (einblick)<br />
Csörgits, Renate, Wien<br />
Dalkmann, Susanne, Bochum<br />
Degen, Dr. Christel, Berlin<br />
Derichs-Kunstmann, Dr. Karin, Recklingh.<br />
Dittmann, Frauke, Hamburg<br />
Ducki, Dr. Antje, Berlin<br />
Dunst, Claudia, Berlin<br />
Ehlers, Jutta, Berlin<br />
Engels, Henny, Berlin<br />
Erfmann, Britta, Berlin<br />
Ferner, Elke, Berlin<br />
Geschonke, Carola, Berlin<br />
Göbel, Hedwig, Aschaffenburg<br />
Graef, Anne, Berlin (einblick)<br />
Hamacher, Gudrun, Karben<br />
Hartwich, Claudia, Wuppertal<br />
Hessedenz, Waltraud, Oerlinghausen<br />
Hoffmann, Elfriede, Datteln<br />
Huesmann, Monika, Berlin<br />
Johst, Brigitte, Berlin<br />
Kaufmann, Eva, Berlin (einblick)<br />
Klammer, Dr. Ute, Mönchengladbach<br />
Klinzing, Dr. Larissa, Berlin<br />
Köhn, Ruth, Berlin<br />
Kopel, Mechthild, Berlin<br />
Möllenberg, Franz-Josef, Hamburg<br />
Nahles, Andrea, Berlin<br />
Nejedlo, Raja, Köln<br />
Ostendorf, Dr. Helga, Berlin<br />
Pape, Karin, Genf<br />
Pfahl, Svenja, Berlin<br />
Pofalla, Roland, Berlin<br />
Reiter, Jutta, Düsseldorf<br />
Roth, Karin, Berlin<br />
Roth, Claudia, Berlin<br />
Rüling, Anneli, Berlin<br />
Salinger, Susanne, Berlin<br />
Schultz, Anja-Kathrin, Berlin<br />
Sehrbrock, Ingrid, Berlin<br />
Seyboth, Marie, Berlin<br />
Sommer, Michael, Berlin<br />
Stratemeier, Sophia, Bad Driburg<br />
Thiesbrummel, Gabriele, Recklinghausen<br />
Tondorf, Dr. Karin, Seddiner See<br />
vom Stein, Krimhilde, Kettig<br />
Wortmann, Britta, Düsseldorf<br />
Yuki, Masako, Tokio<br />
Zenker, Birgit, Köln<br />
Zissen, Clarissa, Hagen<br />
Konferenzorganisation<br />
Collm, Lilo, Berlin<br />
Ehmke, Karl, Berlin<br />
Georgi, Uschi, Ratingen<br />
Grabner-Drews, Ines, Berlin<br />
Kathmann, Maria, Berlin<br />
Nielebock, Helga, Berlin<br />
Podann, Audrey, Berlin<br />
Schmidt, Marco, Berlin<br />
Schulz, Bernhard, Berlin<br />
Stegmüller, Gunnar, Neustetten<br />
Wagner, Nicole, Berlin<br />
Zurek, Simone, Berlin<br />
109
110<br />
Anhang: Ergebnisse der Workshops<br />
Workshop Alternativen zur Arbeitslosigkeit<br />
Stichworte zu Phase 2 Diagnose Arbeitslosigkeit, Umstrukturierung in Unternehmen, Arbeitgeber wollen mehr<br />
Flexibilisierung, Privatisierung im ÖD, Fusionen, Outsourcing, schwache Binnenkonjunktur,<br />
Ranbedingungen, Arbeitszeit, Vereinbarkeit, Finanzen, Zugang zu Bildung und<br />
Weiterbildung, Verdrängung (Ein-Euro-Jobs, Mini-Jobs),<br />
Frauen zurück an den Herd, Ellenbogen gebrauchen<br />
Stichworte zu Phase 3 Noch mehr Flexibilisierung, längere Arbeitszeit, 7-Tage-Woche, Arbeiten bis 67, aktiver<br />
Arbeitsplatzabbau, mehr Arbeitslose, nie mehr Vollbeschäftigung, „Drittelgesellschaft“,<br />
regionale und berufliche Mobilität, Stellenwert Bildung wächst, Bildung wird aber teurer,<br />
„Kastengesellschaft“, Abhängigkeit von sozialen Leistungen wird steigen, Niveau der<br />
Leistungen wird aber geringer werden, Veränderung Frauenbild (Rüschengesellschaft)<br />
Phase 4 Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4 Schaffung von gesellschaftlichem Bewusstsein für Umverteilung – Änderung der Programmatik<br />
in der Arbeitszeitpolitik auf 30 Stunden<br />
Solidarisierung<br />
Innergewerkschaftliche Diskussion um Leistungsgerechtigkeit<br />
Gesundheitspolitik<br />
Bildung auf Mitgliedsebene diskutieren<br />
Definition von Mindeststandards<br />
Recht auf abgesicherte „Auszeit“<br />
Wichtigste Forderungen Bewusstsein schaffen von Umverteilung von Arbeit, Änderung der Programmatik<br />
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden,<br />
Bildung auf Mitgliedsebene diskutieren, Vernetzung mit Jugend, weg von Funktionärsebene,<br />
innergewerkschaftliche Diskussion um Leistungsgerechtigkeit<br />
Welche Prioritäten wurden Für die Themen Umverteilung von Arbeit, Bildung und innergewerkschaftliche Diskussion<br />
gesetzt? gab es folgende Prioritäten:<br />
❚ Bewusstsein schaffen<br />
❚ innergewerkschaftliche Diskussion leistungsgerecht mit geschlechterspezifischem Blick<br />
❚ Bildung auf betrieblicher Ebene<br />
Anmerkungen Schneller Konsens in der Gruppe, Ziele und Prioritäten waren schnell gefunden, lag evtl.<br />
an der Größe der Gruppe (10 Personen) und Altersstruktur (keine Generationsdiskussion<br />
möglich, da keine unterschiedlichen Generationen vertreten)<br />
Phase 5 Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft
Inhalte der Arbeitsphase 5 In moderierter Gruppenarbeit wurden für die Themenschwerpunkte der Phase 4<br />
mögliche Strategien diskutiert. Fragestellungen waren, welche Strategien sind erfolgreich,<br />
wie wollen wir unsere Ziele erreichen, was können wir beitragen.<br />
(Themen: Bewusstseinsentwicklung/Programmatik in der Arbeitszeitpolitik, Bildung,<br />
„Selbstermächtigung“/Leistungsgerechtigkeit)<br />
Welche Durchsetzungs- Bewusstseinsentwicklung und Bildung:<br />
strategien wurden Ist-Beschreibung vorgenommen, klare Benennung der Situation (wenn ein Arbeitsplatz<br />
entwickelt? weg ist, dann ist er weg), in die Schulen gehen, was hat Person davon?, Mitglieder<br />
befragen<br />
Leistungsgerechtigkeit: neue Risiken, Transferleistungen, Wertigkeit von Berufen, Lohngerechtigkeit<br />
(ERA), Rentengerechtigkeit und BBG.<br />
Im Betrieb? Bewusstseinsentwicklung:<br />
andere Work-Life-Balance transportieren, fachspezifische Personalversammlung,<br />
Überstundenproblem lösen, Aufklären in Betriebsversammlung.<br />
Bildung:<br />
Bedeutung verdeutlichen, Prävention vor Arbeitslosigkeit, gegenderte Bildung, Bewerben<br />
bei Equality.<br />
Leistungsgerechtigkeit:<br />
Sozialplan, Familienzeit<br />
In der Politik? Bewusstseinsentwicklung:<br />
Maßnahmen, die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen – Gewinne und Entlassungen,<br />
Weiterentwicklung Arbeitszeitgesetz, gegen Überstunden, Steuern auf Überstunden<br />
Bildung:<br />
Bildungsurlaub einheitlich gestalten, Prädikate Equality,<br />
Schulen – Förderung von klein auf, Bildungsgerechtigkeit ist notwendig.<br />
Leistungsgerechtigkeit:<br />
Abfindungsregelung Österreich, BBG – Ausweitung der Einkünfte,<br />
Wertigkeit von Berufen, Absicherung biografischer Lücken, Individualisierung sozialer<br />
Leistungen.<br />
In der Gewerkschaft? Bewusstseinsentwicklung:<br />
Kollektive Sichtweise für Gesamtbevölkerung, im <strong>DGB</strong> übergreifend powern, Basis<br />
befragen.<br />
Bildung:<br />
In die Schulen gehen, Tarifverträge zur betrieblichen Bildung, Bildungs- und Karriereplanung,<br />
Girls’ Day, Kinderuni, Produktionstage.<br />
Leistungsgerechtigkeit:<br />
Wertigkeit von Berufen prüfen, Transfers, Familienzeit<br />
Welche zentralen „Frauen sind unerhört“ – und verschaffen sich Gehör durch Selbstermächtigung,<br />
Botschaften hat die stellen die männlich dominierten Werte in dieser Arbeitsgesellschaft in Frage und werden<br />
Arbeitsgruppe entwickelt? sie verändern,<br />
wir brauchen als gesellschaftliche Gegenmacht ein gewerkschaftliches Fernsehen, wir<br />
wollen nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden.<br />
Anmerkungen Die strategischen Botschaften finden sich in den Arbeitsphasen 4 und 5.<br />
111
112<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4 / Inhalte<br />
35/30-Stunden-Woche<br />
schaffen bzw. erhalten<br />
Elternzeit<br />
Nachbesserung TZ-Gesetz<br />
Gutes Arbeitsklima,<br />
Gestaltung von Arbeitszeitbedingungen,Lebensarbeitszeitmodelle,<br />
z.B. NL, B<br />
Landzeitkonto<br />
„Lebensarbeitszeit“<br />
verkürzen<br />
Pflegezeit<br />
BürgerInnengeld / bürgerschaftliches<br />
Engagement<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Phase 5<br />
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Arbeitszeit<br />
Vereinbarkeit, Elternzeit, Pflege<br />
Gestaltung von Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle, Teilzeit, Arbeitszeitverlängerung<br />
Zeit für das Ehrenamt, gewerkschaftliche Arbeit (bürgerschaftliches Engagement),<br />
Arbeitsplätze sichern<br />
Arbeitszeitverlängerung (teilweise ohne Bezahlung)<br />
Arbeitsplatzflexibilisierung/Arbeitsverdichtung<br />
Teilzeit/geringfügige Arbeitsverhältnisse<br />
Zunahme der Samstagsarbeit<br />
Polarisierung: zuviel – zuwenig Zeit<br />
Neue „Härte“ beim Thema Zeit von der Arbeitgeberseite<br />
Zeit für bürgerschaftliches Engagement<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Lebensdurchschnitt, finanzielle Absicherung, Arbeitsbedingungen, Pensum<br />
Teilzeitregelungen erhalten, über drei Jahre erweitern, Qualifizierung in Elternzeit,<br />
Rechtsanspruch ganztägige Betreuung<br />
Dringende betriebliche Gründe, Rückkehrrecht festschreiben,<br />
Zwei-Jahresfrist soll gestrichen werden<br />
Spannende Vision? Positive Modelle zum Kennenlernen, <strong>Sicherung</strong> von Arbeitsplätzen,<br />
Kombination 35/30-Stunden-Woche und Langzeitarbeitskonten, Insolvenzsicherung,<br />
gesellschaftliches Umdenken notwendig, positive Modelle zum Kennenlernen, nicht nur<br />
verschiebbar and das Lebensende, die Möglichkeit eines Vorschusses auf die zukünftige<br />
gesamte Lebensarbeitszeit, Vertrauen in den Staat,<br />
Abhängig von Person, Tätigkeit, betriebliches Umfeld, variabel gestalten<br />
Ansatzpunkte aus dem Positionspapier <strong>DGB</strong> müssen berücksichtigt werden, Voraussetzung<br />
klären! Thema wird zunehmend wichtiger, Gefahr für Frauen!!!<br />
Hoher Klärungsbedarf, für was setze ich mich ein? Wer zahlt? Anrechnung auf Arbeitszeit?<br />
Arbeitsauftrag!!!<br />
Lebensarbeitszeitmodelle/Langzeitarbeitskonten<br />
35/30-Stunden-Woche schaffen bzw. erhalten Elternzeit<br />
Nachbesserung TZ-Gesetz<br />
„Lebensarbeitszeit“ verkürzen<br />
BürgerInnengeld / bürgerschaftliches Engagement berücksichtigen<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft<br />
Langzeitarbeitskonten/Lebensarbeitszeitmodelle<br />
30/35-Stunden-Woche<br />
Nachbesserung Teilzeit
Im Betrieb?<br />
In der Politik?<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften<br />
hat die Arbeitsgruppe<br />
entwickelt?<br />
Langzeitarbeitskonten/Lebensarbeitszeitmodelle<br />
Insolvenzsicherung, Freizeitausgleich bei AZ-Konten/Langzeitkonten stärken, Sensibilisierung,<br />
Erfahrungsberichte/Akzeptanz, Information für BR/PR, Qualifizierung aller ArbeitnehmerInnen<br />
30/35-Stunden-Woche<br />
Einhaltung der Tarifverträge, Abfrage der Beschäftigten, Arbeitsplatzsicherung<br />
Nachbesserung Teilzeit<br />
Solidarität zwischen TZ und VZ im Betrieb anstreben, Dienstvereinbarungen abschließen,<br />
Männer für TZ gewinnen: Vorbildväter in den Betrieben aufzeigen<br />
Langzeitarbeitskonten/Lebensarbeitszeitmodelle<br />
konkrete Beispiele/Versicherungsverläufe durchrechnen, gesetzliche Regelungen, gesellschaftliches<br />
Verständnis, Studien über Auswirkung auf Staat, Familie und Gesellschaft,<br />
Beratungsinfrastruktur für BR/PR bereitstellen, Anregung aus dem Ausland holen<br />
30/35-Stunden-Woche<br />
Änderung des AZ-Gesetzes, Arbeitslosigkeit beseitigen bzw. verringern<br />
Nachbesserung Teilzeit<br />
gesellschaftliches Verständnis vom Arbeitsplatz verändern<br />
Langzeitarbeitskonten/Lebensarbeitszeitmodelle<br />
wissenschaftliche Untersuchungen vorhandener ähnlicher Modelle, Frauenkonferenzen,<br />
Beispiele aus anderen Ländern, WinWin-Beispiele von Wissenschaft entwickeln lassen,<br />
positive/negative Beispiele aus TV/BV, Öffentlichkeitsarbeit<br />
30/35-Stunden-Woche<br />
Aufklärungskampagne, Thema verkoppeln mit: demografischer Wandel, Geschlechtergerechtigkeit,<br />
Kinderwünsche/Familienwünsche, Kampagne „Her mit dem ganzen<br />
Leben“, „5 Stunden mehr für Liebe und Verkehr“, öffentliche Diskussionen<br />
Nachbesserung Teilzeit<br />
Kampagne: „Hätt’ er Teilzeit könnt’ er länger“, Betriebe mit guten Regelungen/Praxis<br />
groß, positiv und öffentlich herausstellen<br />
kein Gegensatz „Vollzeit – Teilzeit“, fließender Übergang<br />
Auch das Private ist politisch<br />
Arbeitszeit an Lebensphasen anpassen<br />
Arbeitszeitkampagnen mit anderen aktuellen Themen verbinden, z.B. demografischer<br />
Wandel, Geschlechtergerechtigkeit usw. und dabei Optimismus verbreiten und „Lust“<br />
auf das Thema machen<br />
Blick weiten – nicht nur Arbeit, sondern das ganze Leben einbeziehen, „Her mit dem<br />
ganzen Leben“, „Hätt’ er Teilzeit könnt’ er länger“, „5 Stunden mehr für Liebe und<br />
Verkehr“,<br />
Arbeit anders definieren (keine Unterscheidung in Vollzeit und Teilzeit)<br />
113
114<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Anmerkungen<br />
Phase 5<br />
Entgelt<br />
Ausgangspunkt: Frauen verdienen nach wie vor 25 % weniger. Aktuell sehen wir die<br />
Chance, diskriminierungsfreie Tarifverträge zu bekommen (ERA, Tarifvertrag ÖD), die<br />
„Gerechtigkeitslücke“ zugunsten von Frauen schließen zu können, u.a. durch eine andere<br />
Arbeitsbewertung (Stichworte: weiche Kriterien, wie etwa soziale Kompetenz). Wichtig<br />
war der Arbeitsgruppe, die vorhandenen Instrumente zur Durchsetzung und Umsetzung<br />
im Betrieb zu nutzen. Nicht diskutiert wurde die künftige Rolle der Politik etwa in<br />
der Frage des Mindestlohns.<br />
Wir haben uns vorgestellt, wo wir im Jahr 2009 zur nächsten <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz<br />
stehen werden. Bis dahin soll es einen Existenz sichernden gesetzlichen Mindestlohn<br />
ebenso wie diskriminierungsfreie Tarifverträge geben. Dazu gehört auch, dass in<br />
den Tarifkommissionen künftig das Prinzip des Gender Mainstreaming berücksichtigt<br />
wird.<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Zu ERA und ÖD-Tarifvertrag wurde von der automatischen Umsetzung ausgegangen.<br />
Die Debatte drehte sich daher ausschließlich um einen Existenz sichernden Mindestlohn<br />
und auf welchem Wege dieses erreicht werden kann. Dazu gab es drei Vorschläge: ein<br />
einheitliches Votum der <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenkonferenz dazu, die bereits vorhandenen<br />
tarifvertraglichen Regelungen umzusetzen, während die gesetzliche Reglung am Ende<br />
der Skala steht.<br />
Das zweite Thema war der Wunsch nach diskriminierungsfreien Tarifverträgen, an dritter<br />
Stelle steht die Forderung nach Abschaffung aller prekären Beschäftigungsverhältnisse<br />
und Umwandlung in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse.<br />
Die Forderungen richten sich in der Tarifpolitik in erster Linie an die Gewerkschaften. Wir<br />
fordern die konsequente Umsetzung des GM-Prinzips und Mitspracherecht der Frauen<br />
bis hin zum Veto-Recht, ferner eigene Tarifkommissionen. Wir selbst wollen tarifpolitische<br />
Netzwerke aufbauen und eigene Frauentarifkommissionen gründen. Tarifpolitiker<br />
müssen sensibilisiert werden für die anhaltende Diskriminierung von Frauen, dazu gehören<br />
auch Schulungen für Betriebs- und Personalräte. Um Lohnungleichheit zu beseitigen,<br />
fordern wir ein Klagerecht der einzelnen Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber.<br />
Informationsbedarf besteht zudem über die geltende Rechtslage der EU in der Frage<br />
Lohnungleichheit.<br />
Verabredet wurde, sofort mit der Arbeit zu beginnen und auch junge Frauen aufzuklären<br />
und zu informieren, welche Vorteile es hat, bei den Gewerkschaften mitzuarbeiten.<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Welche Durchsetzungsstrategien<br />
wurden entwickelt?<br />
Im Betrieb?<br />
In der Politik?<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften<br />
hat die Arbeitsgruppe<br />
entwickelt?<br />
Anmerkungen<br />
Da nur noch wenige Kolleginnen der Arbeitsgruppe anwesend waren, wurden drei kleine<br />
Unterarbeitsgruppen gebildet, die zu folgenden Ergebnissen kamen: Aufbau von<br />
Frauennetzwerken gegen boy-groups. Wir wollen für unsere Themen in der Gewerkschaft,<br />
aber auch an unserem Arbeitsplatz sensibilisieren und Kampagnen zu unseren<br />
Themen durchführen, z.B. zur Umsetzung des ERA-Vertrages. Junge Frauen wollen wir<br />
gezielt ansprechen, sie mit anderen Mitteln versuchen zu interessieren und für die Mitarbeit<br />
gewinnen. Hier wurde auf die Workshops des <strong>DGB</strong>-Bundesfrauenausschusses verwiesen,<br />
ohne eigene konkrete Vorschläge zu machen.<br />
Es soll verstärkt über die EU-Rechtsgrundlagen informiert werden (s. Darstellung von<br />
Karin Tondorf).<br />
Zu denken gibt der Satz einer Kollegin, die feststellte, dass sie erst jetzt auf der Bundesfrauenkonferenz<br />
verstanden habe, wie wichtig es ist, über die Probleme in den anderen<br />
Gewerkschaften etwas zu hören und gemeinsam darüber nachzudenken, welche Strategien<br />
künftig zum Erfolg führen könnten.<br />
Fazit: Der gewählte Strategietag wurde von allen Kolleginnen positiv bewertet. Einige<br />
nehmen eine Art Aufbruchstimmung mit in ihren Alltag.<br />
115
116<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Anmerkungen<br />
Phase 5<br />
Welche Absicherung brauchen wir im Alter?<br />
Zukunft der Rente, Rentenminderung, Altersteilzeit, Frauensolidarität, Rente bei Niedriglöhnen,<br />
private Altersvorsorge (wovon?), Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten,<br />
ist Armut weiblich?, Unterschiede Ost-West, keine Mindestrente, Schweizer System,<br />
mehr Umverteilung in der 1. Säule, Hinterbliebenenrente, Versorgungsausgleich, Tarifverträge<br />
zu Teilzeit, Betriebsrente, Genderfokus, Informationsaustausch über Systeme und<br />
Möglichkeiten<br />
Eigenständige Alterssicherung für Frauen, bedarfsorientierte Mindestrente,<br />
Lebens”arbeits“zeit verlängern, Vertrauensschutz (Betriebsrente, Ausbildungszeiten),<br />
starre Altersgrenze (alternsgerechtes Arbeiten), Steuerfinanzierung?<br />
Ferner wurde diskutiert: Rente und Jugendliche, Frauen mit Kindern ↔ Frauen ohne Kinder,<br />
Spannungsfeld Schutzrechte ↔ Individualisierung, staatl. Förderung von Eigeninitiative,<br />
keine Anrechnung von Eigeninitiative auf gesetzl. Rente, Rente mit 60, Mindestrente<br />
(80 % Grundsicherung, 20 % beitragsabhängige Versichertenrente)<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Billig-Jobs = unsozial => beitragspflichtige Beschäftigung<br />
Flexible Altersgrenze<br />
Zahlende Institution ist beitragspflichtig<br />
Mindestrente (Ausgleich im System)<br />
Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit<br />
Allgemeine Versicherungspflicht<br />
Frauengerechte Modelle in betrieblicher und privater Vorsorge<br />
Eigenständige Alterssicherung von Frauen<br />
Neuverteilung der Lebens“arbeits“zeit (Dekompression)<br />
Allgemeine Versicherungs- und Beitragspflicht<br />
Solidarausgleich – Abschwächung der Beitragsäquivalenz „Schweizer Modell“<br />
Frauengerechte Modelle in betrieblicher und privater Vorsorge<br />
Eigenständige Alterssicherung von Frauen<br />
Neuverteilung der Lebens“arbeits“zeit (Dekompression)<br />
Portabilität von Betriebsrenten<br />
Wegfall der allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze<br />
Modelle der Tarifpartner unter Mitwirkung von Frauen<br />
Keine Bindung von Unverfallbarkeit an Mindestbeschäftigungszeiten<br />
Andere Bildungspolitik<br />
Allgemeine Versicherungspflicht in der betrieblichen Altersvorsorge<br />
Pro Riester contra Eichel -> Modelle dürfen GRV nicht aushöhlen<br />
Flexible Sparmodelle bezüglich Beitragseinzahlung<br />
Partnerabhängigkeit reduzieren bei Hinterbliebenenrenten<br />
Anrechnung von Ehrenamt?<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Welche Durchsetzungsstrategien<br />
wurden entwickelt?<br />
Im Betrieb?<br />
In der Politik?<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften hat<br />
die Arbeitsgruppe entwickelt?<br />
Anmerkungen<br />
Aufklärungskampagne in Betrieb, Gewerkschaft und Politik<br />
Betriebsversammlungen<br />
Beratung durch Betriebsräte<br />
Gespräche Betriebsrat – Arbeitgeber<br />
Informationen durch GewerkschaftsvertreterInnen im Betrieb<br />
Lobbyarbeit<br />
Forderungen an die Politik zur Verabschiedung entsprechender Gesetze<br />
BündnispartnerInnen suchen<br />
Fernsehspots<br />
Überzeugungsarbeit in der Gewerkschaft<br />
Informationsmaterial<br />
Handlungshilfen<br />
Veranstaltungen<br />
Einbringung von Fraueninteressen in die Tarifpolitik<br />
Allgemeine Versicherungs- und Beitragspflicht für alle arbeitsfähigen Menschen, unabhängig<br />
von Einkommensart<br />
- Solidarausgleich im System<br />
Frauengerechte Modelle für betriebliche und private Vorsorge<br />
117
118<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Anmerkungen<br />
Phase 5<br />
Hartz IV<br />
Beschreibung persönlicher Schicksale und Erfahrungen im Umgang mit Hartz IV<br />
Es wird gefordert, nicht gefördert<br />
Ein-Euro-Jobs werden missbräuchlich angewandt<br />
So genannte Integrationsinstrumente greifen nicht<br />
Aktive Arbeitmarktpolitik findet nicht statt.<br />
Wegfall der Ein-Euro-Jobs<br />
Wegfall der Anrechnung des Partnereinkommens<br />
Besserer und passgenauerer Zugang zu Qualifizierung<br />
Existenzsicherndes Einkommen für alle<br />
Bezahlte Arbeit für alle<br />
Regelungen zur Kinderbetreuung umsetzen und auf das SGB III erweitern<br />
Geschlechtsspezifische Erfassung aller Arbeitsmarktdaten und gleichberechtigter Zugang<br />
zu den Instrumenten<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
In der Phase 3 wurden unter dem Punkt „zukünftige Erwartungen und Visionen“ bereits<br />
Zielvorstellungen formuliert, die in der Diskussion vertieft wurden.<br />
Die einzelnen Diskussionspunkte wurden in „griffige“ Forderungen eingebracht, dabei<br />
konnten aufgrund der Zeit nicht alle andiskutierten Themen ausgearbeitet werden.<br />
Aktive Arbeitsmarktpolitik statt Sanktionen<br />
Wirksame Integrationsmaßnahmen und Entwicklung aktiver existenzsichernder Instrumente<br />
hin zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung statt Ein-Euro-Jobs und Mini-<br />
Jobs<br />
Auftrag an <strong>DGB</strong> und Einzelgewerkschaften: „garantiertes, voraussetzungsloses Grundeinkommen“<br />
diskutieren<br />
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung<br />
Kinderbetreuung wie SGB II vorgesehen umsetzen und auf SGB III erweitern<br />
Massive Investitionen in Humandienstleistungen<br />
Nach dem Punktesystem stand die aktive Arbeitsmarktpolitik mit Priorität 1 fest. Die<br />
wirksamen Integrationsmaßnahmen und das Grundeinkommen waren gleich gepunktet<br />
und wurden in die Präsentation aufgenommen.<br />
Nächste Priorität erhielten die Forderungen zur Kinderbetreuung.<br />
Das Thema Hartz IV ist mit vielen Emotionen besetzt, was auch in der Arbeit der Arbeitsgruppe<br />
deutlich wurde. Viele Positionen wurden sehr kontrovers diskutiert. Die ausgearbeiteten<br />
Forderungen sind nach den entsprechenden Diskussionsprozessen im Konsens<br />
verabschiedet worden. Die Diskussion hat gezeigt, dass gerade Themen wie die Ein-<br />
Euro-Jobs aus Betroffenheit heraus nochmals besorgter diskutiert wurden als am „grünen<br />
Tisch“. Schneller und dringend notwendiger Handlungsbedarf wird von allen gesehen!<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Welche Durchsetzungsstrategien<br />
wurden entwickelt?<br />
Im Betrieb?<br />
In der Politik?<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften hat<br />
die Arbeitsgruppe entwickelt?<br />
Anmerkungen<br />
Entsprechend der Vielfalt der Forderungen schlugen die Kolleginnen vielfältige, den einzelnen<br />
Themen angemessene Strategien vor.<br />
Zusätzlich neue Partner/Partnerinnen zur Mitarbeit mobilisieren und gewinnen<br />
Medien einbinden und sensibilisieren.<br />
Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen im Betrieb<br />
Auswirkungen diskutieren<br />
Einmischen in Gesetzgebungsverfahren<br />
Diskussion mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten<br />
Diskussionsprozess von unten nach oben organisieren<br />
Betriebs- und Personalräte mit einbinden<br />
Demonstrationen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit<br />
Lokale und regionale Projekte entwickeln in Kooperationen mit Trägern, Unternehmen,<br />
Bundesagentur usw.<br />
Eigene Forderungen formulieren und durchsetzen<br />
Aktive Arbeitsmarktpolitik statt Sanktionen<br />
Wirksame Integrationsmaßnahmen und Entwicklung aktiver existenzsichernder Instrumente<br />
hin zu szialversicherungspflichtiger Beschäftigung<br />
Auftrag an <strong>DGB</strong> und Einzelgewerkschaften: „garantiertes voraussetzungsloses Grundeinkommen“<br />
diskutieren!<br />
Aufgrund der gemachten Erfahrungen der Vergangenheit sollten die Forderungen nicht<br />
nur an die Frauenministerin weitergeleitet werden, sondern auch dem Arbeitsminister<br />
vorgelegt werden<br />
119
120<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Anmerkungen<br />
Aufstieg<br />
Aufstieg von Frauen heute eher möglich, aber häufig verbunden mit Verzicht auf Kinder<br />
Gesetzliche Grundlagen vorhanden, bei schulischen und beruflichen Abschlüssen sind<br />
Frauen mit Männern gleichgezogen<br />
Mittlerweile sind Frauen auf der mittleren betrieblichen Hierarchie- und Managementebene<br />
besser vertreten als früher<br />
Aber: „gläserne Decke“ bei den Spitzenpositionen in Gesellschaft und in der Arbeitswelt<br />
Zu wenig Frauennetzwerke<br />
Unprofessionalität bei der Personalauswahl<br />
Konkurrenz- und Aufstiegsdenken bei Frauen noch zu wenig verankert und zielgerichtet<br />
Verteidigung des Erreichten<br />
Demographische Entwicklung und Globalisierung führen zu veränderten Bedingungen<br />
der Frauenerwerbstätigkeit<br />
Veränderungen des Frauenbildes<br />
Ausweitung der Berufsauswahl und Aufwertung von sog. Frauenspezifischen Berufen<br />
Kinderbetreuung flächendeckend als Voraussetzung für Berufstätigkeit und Karriere<br />
Teilhabe der Männer an Familie und Kindern<br />
Aufstieg und Familie als gelebte Selbstverständlichkeit<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Konsens: Weitere gesetzliche Absicherung und Begleitung der Gleichstellung, Ausbau<br />
von Netzwerken, paritätische Besetzung von Gremien und Anstreben von Machtpositionen<br />
Kontroverse Diskussionen: Sinn von Quoten (wie Lange) und Arbeitszeiten (Teilzeit)<br />
Flächendeckende Kinderbetreuung und gesetzliche Teilung der Elternzeit auf Vater und<br />
Mutter<br />
Gleichstellungsgesetz für die private Wirtschaft und Landesgleichstellungsgesetze<br />
Paritätische Gremienbesetzung und Genderprüfung in allen Bereichen auch in Bildung<br />
und Wissenschaft<br />
Quotierung der Spitzenpositionen (auch Wahlfunktionen) im <strong>DGB</strong>/Einzelgewerkschaften<br />
Mehr Frauen in technisch-naturwissenschaftlichen Berufen und Studiengängen<br />
Gesetzliche Grundlagen erhalten und ausbauen (die Gleichstellungsgesetze, Antidiskriminierungsgesetz,<br />
Elterngeld usw.)<br />
Paritätische Besetzung der Gremien in:<br />
Politik<br />
Gewerkschaften<br />
Unternehmen/Betriebe<br />
Sichtbarmachung von Defiziten<br />
Datenerhebung und Zeitreihen (Politik, Gewerkschaften und Betriebe)<br />
Präsenz in interner und externer Öffentlichkeit<br />
Mehr Machtpositionen
Phase 5<br />
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Welche Durchsetzungsstrategien<br />
wurden entwickelt?<br />
Im Betrieb?<br />
In der Politik?<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften hat<br />
die Arbeitsgruppe entwickelt?<br />
Anmerkungen<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft<br />
Sichtbar machen<br />
Datenerhebung, Datensammlung, Datenaufbereitung, Öffentlichkeitswirksame Aktionen<br />
Gremienbesetzung verändern<br />
Strategien zur Erreichung von Machtpositionen<br />
Besetzung von Aufsichtsräten und Vorständen öffentlich machen<br />
Verdienste und Gewinne öffentlich machen<br />
Frauenförderung in den Betrieben<br />
Mentoring, Empowerment, Coaching<br />
Einflussnahme auf Gesetzgebung (Stellungnahmen etc., aber auch mehr Aktionen)<br />
Veröffentlichung der Gremienbesetzungen und rechtzeitige Information und Vorbereitung<br />
Zeile festlegen und Verantwortlichkeiten schaffen und delegieren, Evaluation und Controlling<br />
Rekrutierung aus Frauennetzwerken<br />
Informationen über Termine, Amtsperioden zur besseren Planung<br />
Mindestquoten umsetzen (Antrag des Bundesfrauenausschusses für den <strong>DGB</strong>-Kongress:<br />
Quotierung verpflichtend in allen Bereichen des <strong>DGB</strong> und der Einzelgewerkschaften),<br />
aktive Suche nach geeigneten Kandidatinnen<br />
121
122<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Phase 5<br />
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Themenblöcke<br />
Im Betrieb?<br />
In der Politik?<br />
Berufseinstieg/Wiedereinstieg<br />
Arbeitsauftrag geändert in: Wiedereinstieg<br />
Der Begriff „Wiedereinstieg“ ist problematisch, weil Wiedereinstieg einen Ausstieg voraussetzt.<br />
Es wurden in Zweier-AGs Visionen für das Jahr 2009 erarbeit.<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Sammeln von Kernforderungen und Hauptthemen<br />
Umverteilung der Arbeit<br />
Elternzeit<br />
Gender Mainstreaming intern und extern (Gewerkschaften)<br />
Kinderbetreuung<br />
Qualifizierung für Wiedereinstieg<br />
Prozess von lebensbegleitedem Arbeiten und Lernen<br />
„Ausstieg“ versus Anschluss halten<br />
Kündigungsschutz<br />
Übernahme nach der Ausbildung<br />
Gewerkschaften zusammen (jung und alt)<br />
Prozess von lebensbegleitendem Lernen und Arbeiten<br />
Umverteilung der Arbeit<br />
Elternzeit und Kinderbetreuung<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft<br />
Es wurden Forderungen an Politik, Betrieb und Gewerkschaften erarbeitet<br />
Elternzeit und Kinderbetreuung<br />
Prozess von lebensbegleitendem Arbeiten und Lernen<br />
Zu 1.<br />
Anspruch auf individuelle Personalentwicklung<br />
Betriebliche Beteiligung an Kinderbetreuung<br />
Zielgrößen in Betrieben einführen für Anzahl der Männer, die Elternzeit nehmen<br />
Zu 2.<br />
Mehr Qualifikation im Betrieb (Angebote für alle Arbeitnehmer)<br />
Betriebsräte sollen ihr Recht auf Mitbestimmung wahrnehmen<br />
Mehr Ausbildung durch Betriebe und mindestens 1 Jahr Übernahme<br />
Zu 1.<br />
Umsetzung der Forderung von Elterngeld als Lohnersatzleistung (begleitet durch Öffentlichkeitskampagne)<br />
Rechtsanspruch auf qualitativ hochwertige, bezahlbare, wohnortnahe Kinderbetreuung<br />
für alle Kinder im Alter von 0 bis mind. 10 Jahre
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften<br />
hat die Arbeitsgruppe entwickelt?<br />
Zu 2.<br />
Verbesserung des Kündigungsschutzes für ArbeitnehmerInnen<br />
Anspruch Bildung/Weiterbildung ohne Altersbegrenzung<br />
Entwicklung/Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen Qualifizierungsangeboten<br />
Keine negativen Auswirkungen auf Rente und Sozialleistung<br />
Zu 1.<br />
Forderungen offensiv vertreten (Stellenwert erhöhen)<br />
Positive Beispiele vorleben<br />
Zu 2.<br />
Politische Bildungsangebote vermehrt anbieten<br />
Trainingsangebote (persönliches Coaching für Personen in „Veränderung“)<br />
Weiterentwicklung/Entwicklung von Konzepten<br />
Schnelle Einführung des geplanten Elterngeldes als Lohnersatzleistung verbunden mit<br />
einem Rechtsanspruch auf einen qualitativ hochwertigen bezahlbaren wohnortnahen<br />
Platz in einer Betreuungseinrichtung für alle Kinder im Alter von 0 bis mind. 10 Jahren,<br />
damit Frauen und Männer die gleichen Chancen auf Erwerbstätigkeit und Karriere<br />
haben.<br />
Für den Prozess des lebensbegleitenden Lernens und Arbeitens fordern wir<br />
Die Beibehaltung des Kündigungsschutzes<br />
Einen Rechtsanspruch auf Bildung und Weiterbildung ohne Altersbegrenzung<br />
Die Entwicklung und Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen Bildungs- und Qualifizierungsangeboten<br />
Einen Grundanspruch auf kostenfreie Bildung und Weiterbildung<br />
Die Inanspruchnahme von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen darf keine negativen<br />
Auswirkungen auf die Rente und Sozialleistungen haben<br />
123
124<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Anmerkungen<br />
Phase 5<br />
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Welche Durchsetzungsstrategien<br />
wurden entwickelt?<br />
Im Betrieb?<br />
Qualifizierung<br />
Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis<br />
Widersprüchlichkeiten, z.B. Anforderungen zum lebenslangen Lernen und trotzdem<br />
hohe Arbeitslosigkeit<br />
Fehlende Nachhaltigkeit<br />
Differenziertes Herangehen ist nötig<br />
Bewusstsein für Qualifizierung schaffen, Motto: Frauen-Karriere-Lebensweg<br />
Bedarfsorientierte Qualifizierungsangebote schaffen<br />
Qualifizierungsverträge in Branchen<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Prioritätensetzung wie in Phase 3<br />
Gesamtgesellschaftlich:<br />
Von der Bundesregierung ein Bundesbildungsurlaubsgesetz mit freizügigen Regelungen;<br />
von den Landesregierungen die Qualifizierung von Lehrkräften zur Vermittlung<br />
von geschlechterspezifischen Berufsbildern: von Arbeitgebern problemlose Freistellung,<br />
insbesondere auch für politische Bildung<br />
Die Mitgliedsgewerkschaften verankern unter dem Dach des <strong>DGB</strong> die geschlechterspezifische<br />
Sicht der Qualifizierung im Bewusstsein von Betriebs- und Personalräten;<br />
gewerkschaftsübergreifende Bildungsangebote sollten entwickelt werden; die Überprüfung<br />
der Satzungen der Mitgliedsgewerkschaften auf geschlechterspezifische Interessenvertretung<br />
sollte vorgenommen werden; Qualifizierungskonferenzen im <strong>DGB</strong> sollten<br />
die Analyse des Themas Qualifizierung unter dem Gesichtspunkt des Gender Mainstreaming<br />
vornehmen.<br />
Die Mitgliedsgewerkschaften sollten sich stärker „als eine Gewerkschaft verstehen“<br />
(<strong>DGB</strong>)<br />
Es gibt gleiche Ziele, aus diesem Grunde könnten gemeinsam strategische neue Ansätze<br />
zum Thema „geschlechtsspezifische Qualifizierung“ gefunden werden, was die branchenspezifische<br />
Umsetzung nicht ausschließen würde.<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft<br />
Gewerkschaft: Alle sollen Anspruch auf Qualifizierung haben. Im Mittelpunkt sollte<br />
Qualifizierung von Schlüsselkompetenzen, gesellschaftspolitische und kulturelle Bildung<br />
stehen. Bildung braucht moderne Instrumente und Methoden ebenso ein solches<br />
Umfeld/Rahmenbedingungen und muss Spaß machen.<br />
In der Politik: Über die Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalvertretungsgesetzes<br />
müssen Betriebs- und Dienstvereinbarungen geschlechterspezifische<br />
Qualifizierung ermöglichen und eine Evaluierung dazu erfolgen.<br />
Sind in den Inhalten enthalten
In der Politik?<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften hat<br />
die Arbeitsgruppe entwickelt?<br />
Anmerkungen<br />
Neue gesellschaftliche Herausforderungen, Trends erfordern neue Qualifizierung unter<br />
dem Gesichtspunkt Gender Mainstreaming.<br />
Gewerkschaftsübergreifende strategische Diskussion zur Qualifizierung unter<br />
geschlechterspezifischen Gesichtspunkten ist nötig.<br />
Mögliche Ergebnisse könnten sein, eine gewerkschaftsübergreifende Konferenz zum<br />
Thema, die Bildung eines Netzwerkes sowie eine gemeinsame Kampagne unter dem<br />
Dach des <strong>DGB</strong> mit dem Motto „Frauen-Karriere-Lebensweg“.<br />
125
126<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Gegenwart<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Zukunft<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4:<br />
Forderungen und Prioritäten, die<br />
wir umgesetzt haben wollen<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Anmerkungen<br />
Phase 5<br />
Durchsetzungskriterien für:<br />
Im Betrieb?<br />
Ausbildung/Übernahme<br />
Mädchen – Konzentration auf Frauenberufe gegenwärtig sehr stark.<br />
Große Abwanderungssituation<br />
Prekäre Beschäftigung stark verbreitet<br />
Gute Schulabschlüsse besonders bei Mädchen – keine Garantie für gute Ausbildungschancen<br />
Verdrängung in Berufen von Mädchen durch Jungen<br />
Wichtig ist Berufsvorbereitung in Schulen qualifizieren<br />
Übernahmechancen müssen auf Leistungskriterien aufbauen<br />
Ausbildungskoordinatoren im Betrieb notwendig<br />
Geschäftsführungen erwarten multifunktionale Berufe<br />
<strong>Soziale</strong> Berufe = schlechte Bezahlung<br />
Traditionelle Rollenbildung in der Ausbildung dominant<br />
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausbauen<br />
zur Vision von Ausbildung brauchen wir Ausbildungsplätze<br />
mehr Mädchen in technisch-gewerbliche Berufe<br />
Akzeptanz zwischen den Geschlechtern wird gelebt<br />
Niedriglohnsektor ist abgeschafft<br />
30-Stunden-Arbeitstag für alle<br />
Jeder hat den Beruf, der seinen Fähigkeiten entspricht<br />
Tarifierte Übernahme und Einstellung der Auszubildenden<br />
Chancengleichheit ist umgesetzt<br />
Das Jahr 2020 wurde als Zukunftsjahr angesetzt.<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Kostenfreie Bildung und Qualifizierung im Lebenslangen Lernen<br />
Qualifizierte Ausbildung für alle<br />
Geschlechtergerechte Umlagefinanzierung<br />
Erhaltung und Ausweitung des Dualen Systems<br />
siehe oben<br />
Die Finanzierung des Bildungssektors muss vollständig in der Zuständigkeit des Bundes<br />
liegen.<br />
Die Übernahmechancen für Mädchen und Jungen müssen an Leistungskriterien<br />
gebunden sein. Die Gewerkschaften übernehmen mit den JAV’en die Festlegung auf<br />
die Leistungskriterien.<br />
Die Forderungen wurden von den Kolleginnen kontrovers diskutiert. Es gab bezüglich<br />
der Quotierung unterschiedliche Prioritäten.<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft<br />
Ausbildungsplatzvergabe quotiert nach Geschlecht und Abschluss<br />
Der Finanzplan für Ausbildung muss so eingestellt sein, dass der größere Anteil für die<br />
gewerblich-technische Ausbildung für Mädchen und junge Frauen zur Verfügung steht.
Durchsetzungskriterien für:<br />
In der Politik?<br />
Durchsetzungskriterien für:<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften hat<br />
die Arbeitsgruppe entwickelt?<br />
Anmerkungen<br />
Bildungsbereich muss Aufgabe des Bundes bleiben und werden.<br />
Die Gesamtfinanzierung für Bildung und Qualifizierung ist auf die anteilige Quotierung<br />
der Mädchen und jungen Frauen auszurichten.<br />
Schulung, Weiterbildung, Qualifizierung im Hinblick auf Quotierung für Gewerkschafterinnen<br />
organisieren<br />
Gewerkschaften müssen Vorreiter bei der Einführung von quotierten Ausbildungskriterien<br />
sein<br />
Aufwertung der klassischen Frauenberufe durch eine entsprechende Tarifpolitik der<br />
Gewerkschaften notwendig<br />
Der Azubi-TÜV (z. Zt. in Sachsen praktiziert) muss bundesweit umgesetzt werden<br />
Der Ausbildungssektor muss vollständig in die Zuständigkeit des Bundes eingebunden<br />
sein.<br />
Die kostenfreie Bildung und Finanzierung qualifizierter Aus- und Weiterbildung muss<br />
gewährleistet werden. Das Finanzvolumen des Bundes und der Betriebe müssen<br />
geschlechtergerecht verteilt werden.<br />
Die Chancengleichheit im Bereich Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung muss<br />
auch durch Quotierung garantiert werden können. (Ausbildungsplatzvergabe?)<br />
Die Quotierung zur Ausbildungsplatzvergabe war ein kontroverser Diskussionspunkt.<br />
Die anderen Schwerpunkte entsprechen einem gemeinsamen Konsens.<br />
127
128<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Phase 5<br />
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Welche Durchsetzungsstrategien<br />
wurden entwickelt?<br />
Im Betrieb?<br />
Gesundheit<br />
Arbeitsschutzbestimmungen gesetzlich verankert, aber es fehlt die Kontrolle/<br />
Umsetzung;<br />
Verschlechterung durch Europa?<br />
Psychosoziale Belastungen steigen, aber es gibt schon gute Ansätze beim betrieblichen<br />
Gesundheitsmanagement;<br />
Angst vor Arbeitslosigkeit produziert Selbstausbeutung<br />
gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen<br />
Geschlechtersensibilität<br />
Gesundheit und Arbeitszeit (-gestaltung)<br />
gesundes Arbeitsklima und Führungsverhalten<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Arbeitsbedingungen müssen sich an Lebensphasen orientieren<br />
Altersteilzeit – alternsgerechtes Arbeiten<br />
Verhaltensprävention – Verhältnisprävention<br />
Arbeitszeit als wichtiger Einflussfaktor auf die Gesundheit<br />
geschlechtergerechtes betriebliches Gesundheitsmanagment<br />
Veränderung der Arbeitsbedingungen<br />
Arbeitszeitmodelle, die Leben und Arbeiten miteinander vereinbaren<br />
Altersteilzeitmodelle, die nicht zu Personalabbau führen<br />
geschlechtergerechtes betriebliches Gesundheitsmanagment<br />
veränderte Gefährdungsbeurteilung<br />
Qualifizierung aller betrieblichen Akteure<br />
Sensibilisierung der Betriebs- und Personalräte<br />
Arbeitszeitmodelle<br />
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch eine Frage der Gesundheit<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft<br />
Was heißt geschlechtergerechtes Gesundheitsmanagement?<br />
Reagieren Frauen und Männer unterschiedlich auf Belastungen?<br />
Welche Arbeitszeitmodelle brauchen wir?<br />
Gesundheit als Frage der Verteilung von (Arbeits-)zeit zwischen Männern und Frauen<br />
siehe unten<br />
Gefährdungsbeurteilung Gender, Altersgruppen differenziert, mit Erfassung psychosozialer<br />
Belastungen, Ergebnisse dokumentieren und innerbetrieblich veröffentlichen<br />
Gesundheitszirkel – Beschäftigte als Experten ihrer eigenen Situation<br />
Qualifizierung
In der Politik?<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften hat<br />
die Arbeitsgruppe entwickelt?<br />
Standards, Instrumentarien und Sanktionsmöglichkeiten für geschlechtergerechtes<br />
Gesundheitsmanagement<br />
Vereinbarkeit mit Gesundheit verknüpfen<br />
Ressourcen für Gesundheitsmanagement zur Verfügung stellen<br />
Frauengesundheitsberichterstattung<br />
Grundlage für die Mitbestimmung bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen und<br />
Arbeitszeit verbessern<br />
Arbeitszeitdebatte und betriebliches Management verknüpfen<br />
Ganzheitliches geschlechtergerechtes betriebliches Gesundheitsmanagement<br />
Berücksichtigung der Vereinbarkeit<br />
Veränderung der Arbeitsbedingungen<br />
Arbeitszeitmodelle, die die Bedürfnisse der Beschäftigten einbeziehen<br />
129
130<br />
Workshop<br />
Stichworte zu Phase 2<br />
Stichworte zu Phase 3<br />
Phase 4<br />
Inhalte der Arbeitsphase 4<br />
Wichtigste Forderungen<br />
Welche Prioritäten wurden<br />
gesetzt?<br />
Anmerkungen<br />
Phase 5<br />
Inhalte der Arbeitsphase 5<br />
Welche Durchsetzungsstrategien<br />
wurden entwickelt?<br />
Im Betrieb?<br />
Vereinbarkeit<br />
Kinderbetreuung, Pflege und Freizeit<br />
Qualität von Arbeit und Leben<br />
Unterscheidung verschiedener Ebenen: individuelle, betriebliche, politische, gesellschaftliche<br />
und gewerkschaftliche Erfahrungen<br />
Familienfreundliche Gesellschaft, die Rollenbilder sind verändert, Familienpolitik betrifft<br />
Männer wie Frauen<br />
Kinderbetreuung flächendeckend für alle Altersgruppen<br />
Unternehmen sind an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beteiligt und verantwortlich,<br />
flexible Arbeitszeitmodelle<br />
Vereinbarkeit ist in TV und Betriebsvereinbarungen fixiert und wird im Betrieb gelebt<br />
Gemeinsamkeiten: Ziele und Prioritäten<br />
Kinderbetreuung<br />
Informationen über Vereinbarkeit als betriebliche Aufgabe<br />
Garantierte Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder von 0 – 14 Jahren mit<br />
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, Ehrenamt ist kein Ersatz für qualifiziertes<br />
Personal<br />
Verbindliche betriebliche Regelungen zur Vereinbarkeit (BV, Geschäftsprozesse etc.)<br />
Qualifizierung während der Elternzeit<br />
Flexible Arbeitszeitmodelle<br />
Vereinbarkeit als fester Bestandteil in Führungskräfteseminaren<br />
Kinderbetreuung<br />
Familienfreundliche Gesellschaft<br />
Verbindliche betriebliche Regelungen<br />
Keine Einigung wurde erzielt bei der Frage, ob die Kinderbetreuung kostenfrei für die<br />
Eltern sein muss.<br />
Entwickeln von Strategien in Betrieb, Politik und Gewerkschaft<br />
Bildung, Betreuung und Pflege<br />
Wiedereinstieg in den Beruf<br />
Betriebliche Qualifizierung während der Arbeitspause (Elternzeit, Pflegezeit, Weiterbildung)<br />
Gesetze umsetzen und einfordern: ADG, Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft<br />
Zielorientierte Durchsetzungsstrategien je nach Adressat<br />
Pflegende Angehörige müssen in Betriebsvereinbarungen berücksichtigt werden<br />
Betriebliche Bündnisse<br />
Spezifizierung des Kriterienkatalogs (Checkliste familienfreundlicher Betrieb) und Überprüfung
In der Politik?<br />
In der Gewerkschaft?<br />
Welche zentralen Botschaften<br />
hat die Arbeitsgruppe entwickelt?<br />
Anmerkungen<br />
Förderung der familienfreundlichen Betriebe anhand einer zu erfüllenden Checkliste<br />
Anreizsysteme schaffen (Monetär, etc.) speziell für niedrigschwellige Angebote, z. B.<br />
Krankheitsvertretungen<br />
Fortführung und Ausweitung der lokalen Bündnisse<br />
Projekt „Allianz für Familie“ ausbauen<br />
Beispielkatalog für gute Praxismodelle<br />
Ansprechpartner sein in Elternzeit, Pflegezeit etc.<br />
An die Politik<br />
Die Rahmenbedingungen sind zu schaffen:<br />
Flächendeckende und qualifizierte Bildung und Betreuung müssen garantiert werden bis<br />
2008 (TAG + Ganztagsschulen).<br />
Mehr staatliche Anreize mit Controlling müssen für familienfreundliche Betriebe<br />
geschaffen werden.<br />
Lokale Bündnisse müssen ausgeweitet und ergänzt werden durch betriebliche Bündnisse<br />
Netzwerke ausbauen und gründen<br />
131
132