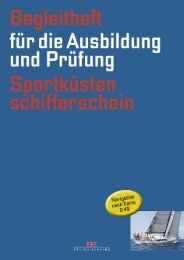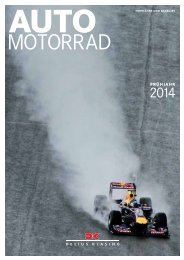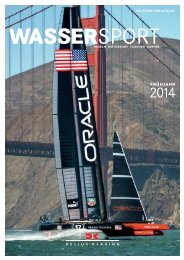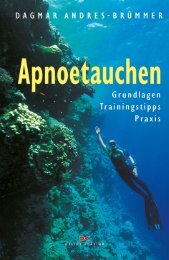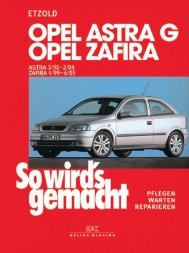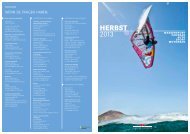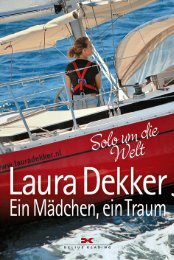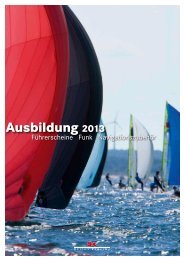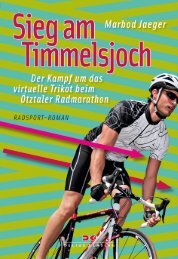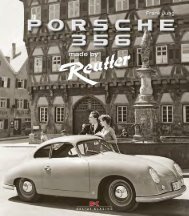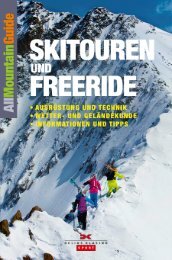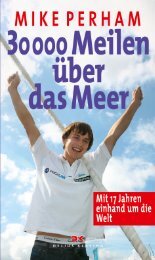Leseprobe - Delius Klasing
Leseprobe - Delius Klasing
Leseprobe - Delius Klasing
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
lasse Johannsen Tatjana Pokorny ulrike schreiber<br />
125 Jahre<br />
segel<br />
sPorT<br />
<strong>Delius</strong> <strong>Klasing</strong> Verlag<br />
in Deutschland
6<br />
8<br />
28<br />
64<br />
78<br />
102<br />
120<br />
140<br />
125 Jahre Deutscher segler-Verband … und in 50 Jahren?<br />
Die stunde null: Momentaufnahmen aus der gründungszeit<br />
• Es begann in einer Bretterbude: Zwölf Vereine gründen den DSV 17<br />
• Verein, was heißt das eigentlich? (von Rolf Bähr) 20<br />
• Konkurrenz für den DSV: Segler organisieren sich auch anderweitig 21<br />
• Die Klassikerszene heute: Renaissance und Rennerei (von Wilfried Horns) 27<br />
segeln vor der Haustür: die deutschen reviere<br />
• Segelatlas Deutschland 28<br />
• Bilderbuchrevier Bodensee: 130 Wassersportvereine, 130 Regatten (von Reinhard Heinl) 30<br />
• Wie es Euch gefällt: Berliner Segelglück ist hausgemacht 40<br />
• Starker Strom und dicke Pötte: die Unterelbe – ein anspruchsvolles Segelrevier<br />
(von Jürgen Chr. Schaper) 50<br />
• Nicht nur bei Kaiserwetter exzellent: die Ostseeküste 58<br />
• Die Zukunft liegt im Osten: neue Segelreviere dank altem Tagebau (von Jens Tusche) 60<br />
landratten ahoi: segelsport auf eis, land und strand<br />
• Eissegeln: heißer Ritt auf schmalen Kufen 64<br />
• Strandsegeln: himmlische Fahrt zwischen Düne und Meer 70<br />
• Modellsegeln: Hightech im Miniformat 74<br />
Die Kieler Woche: »Mutter und Vater aller regatten«<br />
• Ein Hoch auf den Kaiser: Die Kieler Woche beginnt 78<br />
• Deutschlands Segelwochen: die attraktiven Schwestern der Kieler Woche 92<br />
• Eine Klasse für sich: die Deutsche Meisterschaft 94<br />
• Klassenvereinigungen im Deutschen Segler-Verband 100<br />
Dem Horizont entgegen: Fahrtensegler auf dem Vormarsch<br />
• Als der Skipper noch Kapitän war: die Ahnen der sportlichen Seefahrt 102<br />
• Romantik Fahrtensegeln: Ist das eigentlich ein Sport? 116<br />
• Frauen erobern die See 118<br />
Hakenkreuz am Heck: der segelsport im nationalsozialismus<br />
• Strukturwandel: der organisierte Segelsport nach der »Machtergreifung« 123<br />
• Segler auf Abwegen: Spionage mit Yachten 134<br />
• Ein Mann, ein Mast: Walter »Pimm« von Hütschler 137<br />
ein sport kämpft sich frei: segeln in der nachkriegszeit<br />
• Aufbruchstimmung in Ost und West: Schicksale und Anekdoten 140
olympisch gut: der deutsche segelsport im Zeichen der fünf ringe<br />
• Ein Name geht um die Welt: Willy Kuhweide 151<br />
• Sieger mit System: Jochen Schümann 154<br />
• Eine Klasse für sich: Kröger & Kroker 155<br />
• Die neue Kraft: Sailing Team Germany 158<br />
• Eine glänzende Bilanz: deutsche Medaillengewinner bei<br />
olympischen Segelregatten seit 1900 160<br />
im Westen viel neues: segeln wird zum Volkssport<br />
• Meilensteine des Bootsbaus: die ersten Jollen und Küstenkreuzer aus GFK 166<br />
• Großer Spaß auf kleinen Booten: Varianta, Conger & Co 168<br />
• König Kunststoff regiert den Bootsbau und das Chartergeschäft 172<br />
• Erst hipp, dann olympisch: Windsurfen 173<br />
segeln in der DDr: die Freiheit, die ich meine<br />
• Die DDR-Seeseglerfamilie: eine eigene Welt 176<br />
• Die Improvisationskünstler: aus Alt mach’ Boot 184<br />
• Die zweite Stunde null: Ost und West wachsen zusammen 187<br />
• Von kleinen und großen Freiheiten: ein Leben lang Leistungssportler<br />
(von Jochen Schümann) 188<br />
Blauwassersegeln: zwischen Paradies und Teufels Küche<br />
• Auf der Clubyacht um die Welt 194<br />
• Junge Helden und Hippies zur See 208<br />
• Medaillen für den Breitensport: die Kreuzer-Abteilung und ihre Fahrtenwettbewerbe 218<br />
sternstunden der Bootsbaukunst<br />
• Genie und Perfektionist: Konstrukteur Max Oertz 224<br />
• DBSV-Präsident Torsten Conradi: »Nicht mitschwimmen, sondern engagieren« 229<br />
aufbruch an die spitze: Deutschlands Hochseesegler greifen an<br />
• Salzränder, die mich an den Cup erinnern (von Hans-Otto Schümann) 232<br />
• Der Traum vom America’s Cup wird wahr: »I am sailing« 236<br />
• Die Welt ist nicht genug: deutsche Spuren im Ocean Race 242<br />
Willkommen im Club: Deutschlands starke Vereine<br />
• Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden 248<br />
• Kleines Boot ganz groß: der Optimist 257<br />
• Schöner Schein: die Lizenz zum Segeln 260<br />
anhang<br />
• Vorsitzende/Präsidenten des Deutschen Segler-Verbandes 264<br />
• Danksagungen 265<br />
• Textquellen, Bildquellen 266<br />
148<br />
164<br />
176<br />
194<br />
222<br />
230<br />
248<br />
264
6<br />
125 Jahre Deutscher<br />
segler-Verband …<br />
... und in 50 Jahren?<br />
___ Stellt Euch vor, es ist 2063 und der Segelsport in aller<br />
Munde! Nicht, weil er höher, schneller oder weiter kann.<br />
Sondern, weil er noch mehr Menschen begeistert als heute.<br />
Wie wir das erreichen?<br />
Der Segelsport hat sich in 125 Jahren unter dem Dach des<br />
Deutschen Segler-Verbandes immer wieder neu erfunden.<br />
Er war und ist viel mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Die<br />
Leidenschaft für Wind und Wellen steht für eine Lebenseinstellung<br />
und bietet dabei nach dem Shakespeare-Motto »Wie<br />
es Euch gefällt« eine größere Palette an Aktivitäten als viele<br />
andere Sportarten. Der Segelsport wird immer bleiben, was<br />
er ist: eine Quelle der Inspiration, ein Kraftwerk aus Tradition<br />
und Vision.<br />
Sein Reiz besteht darin, die natürliche Energie des Windes<br />
zu nutzen. Generationen von Bootsbauern und Nautikern<br />
haben diese Kunst immer weiter verfeinert. Unsere modernen<br />
Yachten spiegeln diese Ideen in vielen Details wider.<br />
Segeln bleibt aber auch in seinen Werten unschlagbar. Fairness,<br />
Teamgeist und Verantwortung sind an Bord ebenso<br />
gefragt wie Wissen und Können. In Segel-Crews zieht man<br />
an einem Strang. Das prägt die Menschen und ihr Gemeinschaftsgefühl.<br />
In Vereinen zusammengeschlossen, entstehen<br />
Steganlagen und Clubhäuser. Die Projekte stiften oft Freundschaften,<br />
die ein Leben lang halten.<br />
Diese besondere Art des maritimen Lebensstils finden wir<br />
heute in vielen deutschen Binnen- und Seerevieren vor, oft<br />
verbunden mit internationalen Begegnungen und sozialem<br />
Engagement. Wer hier mitmacht, findet schnell Anschluss,<br />
egal wo er herkommt. Diese Kultur weiterzuentwickeln, wird<br />
auch in kommenden Jahrzehnten Ziel und Ehrgeiz unserer<br />
Vereine, Landesseglerverbände und Klassenvereinigungen im<br />
Deutschen Segler-Verband bleiben.<br />
Der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt hat einmal<br />
so wunderbar gesagt: »Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen,<br />
ist, sie zu gestalten.« Es wird an uns selbst liegen, wie<br />
der Segelsport in 50 Jahren aussieht. Wir können und werden
mit unserem Engagement von heute Einfluss auf das Gesicht<br />
des Segelsports von morgen nehmen!<br />
Die vergangenen 125 Jahre des Segelsports in Deutschland<br />
haben fantastische Entwicklungen hervorgebracht, nachzulesen<br />
in diesem Buch und tagtäglich erlebbar in den Clubs, die<br />
sich unter dem starken Dach des Deutscher Segler-Verbandes<br />
zusammengeschlossen haben.<br />
Das macht Lust auf mehr. Auf eine ausgedehnte Reise<br />
unter Segeln oder auf die nächste Regatta. Es motiviert aber<br />
auch, sich für dieses Hobby stark zu machen. Dafür, dass junge<br />
Menschen Gelegenheit bekommen, die Welt des Wassers<br />
kennenzulernen, sich selbst und andere an Bord zu erfahren.<br />
Wir Segler sind überzeugt: Segeln ist eine gute Schule für das<br />
Leben. Wer in jungen Jahren gelernt hat, eine Segelyacht eigen-<br />
verantwortlich zu steuern und sicher von Hafen zu Hafen<br />
zu bringen, wird auch sonst erfolgreich sein. Einige werden<br />
Ihnen in diesem Buch vorgestellt. Vor allem solche, die sich<br />
neben ihrer Freude am Segeln auch der Verbesserung seiner<br />
Rahmenbedingungen gewidmet haben.<br />
Segeln ist gelebte Freiheit. Sie zu genießen, ist unsere Passion;<br />
sie zu erhalten und weiterzuentwickeln, ist unser Ehrgeiz<br />
für die Zukunft. Die Kraft dafür schöpft der Deutsche Segler-<br />
Verband aus seiner 125-jährigen Tradition.<br />
Unsere Vision für die nächsten 50 Jahre sind Kinder, die<br />
mit ihren Erlebnissen auf dem Wasser glücklich werden. Eltern,<br />
die ihnen dies ermöglichen. Chefs, die erkennen, dass<br />
ihre Mitarbeiter im Sport an Bord Kraft zur Leistung schöpfen.<br />
Athleten, die ihren Traum vom olympischen Gold verfolgen.<br />
Und Vereine und Verbände, die sich gemeinsam mit uns dafür<br />
einsetzen, dass auch künftige Generationen an dieser besonders<br />
schönen Seite des Lebens teilhaben können.<br />
Ihnen wünsche ich einen belebenden Törn durch die 125-jährige<br />
Geschichte des deutschen Segelsports und viel Freude<br />
an der Mitgestaltung seiner Zukunft!<br />
Rolf Bähr<br />
DSV-Präsident<br />
7
164<br />
im Westen viel neues:<br />
segeln wird<br />
zum Volkssport<br />
___ Papa, Mama, Kind und Hund auf Tour in einem Segelboot?<br />
Dieses Vergnügen ist bis zu Beginn der 1960er-Jahre vergleichsweise<br />
wenigen Deutschen vorbehalten. Es sind zwar entgegen<br />
hartnäckigen Vorurteilen nicht nur reiche Herren, die sich<br />
regelmäßig einen Ausflug auf die oder auf den See gönnen,<br />
allerdings handelt es sich bis dahin um eine überschaubare<br />
Gruppe von Seglern, die sich – ob wohlhabend oder nicht –<br />
Tradition und Seemannschaft verpflichtet fühlen und meistens<br />
einem Mitgliedsverein des Deutschen Segler-Verbandes<br />
angehören. Sie segeln gepflegte hölzerne Schiffe und setzen<br />
auf Yachtgebräuche.<br />
»Der SpieGeL«: Die Zeitschrift<br />
widmet im August 1965 ihre<br />
Titelgeschichte der neuen Lust der<br />
Deutschen am Wassersport.<br />
In den 1960er- und 1970er-Jahren boomt der Segelsport in Westdeutschland<br />
wie nie zuvor. Der neue Werkstoff GFK ermöglicht die Serienfertigung im<br />
großen Stil und damit die Herstellung preiswerter Jollen und Kielboote für<br />
eine breite Käuferschicht. Ebenfalls im Trend: Windsurfen und Urlaub auf<br />
der Charteryacht.<br />
Und nun das! Ab Mitte der 1960er-Jahre werden immer mehr<br />
»wilde« Segler gesichtet, unterwegs auf Jollen und Kielbooten,<br />
deren aus dem neuen Werkstoff GFK gefertigten Rümpfe<br />
nicht selten in den Farben Orange, Rot oder Gelb leuchten. Auf<br />
manchen Booten kleben sogar bunte Rallye-Streifen! Die Neu-<br />
Wassersportler machen Picknick an der Pinne und lassen dabei<br />
keinen Tümpel und keine Talsperre aus. Sie trailern ihre Boote<br />
quer durch die noch junge Republik und erobern in wenigen<br />
Jahren die westdeutschen Binnen- und Küstengewässer.<br />
Nicht jeder alteingesessene Segler ist erfreut über diese<br />
neue Dominanz der Massen auf dem Wasser. Man möchte
166<br />
unter sich bleiben, doch stattdessen treibt die gestiegene Zahl<br />
der Wassersportler die Kosten für die Liegeplätze in die Höhe.<br />
In manchen Kreisen nennt man die GFK-Boote »Joghurtbecher«<br />
oder »Hostalenschüsseln«. Mit hohen Aufnahme- und<br />
Mitgliedsbeiträgen versuchen einige Clubs, den Ansturm auf<br />
ihr Refugium zu verhindern. Das wiederum erzürnt ein paar<br />
junge Segler, die ganz im Sinne der Zeit gegen das Establishment<br />
revoltieren. Spontan gründen einige der »Rebellen«<br />
eigene Vereine. In Hamburg entsteht die Regatta-Vereinigung<br />
Elbe und in Berlin das Segler-Kollektiv Roter Anker, das nach<br />
einer 1906 gegründeten Gewerkschaft benannt wird, die damals<br />
Vorschotern zu mehr Recht verhelfen sollte.<br />
Doch weder Revolte noch Widerstand halten die riesige<br />
Wassersport-Welle auf. Der glasfaserverstärkte Kunststoff, kurz<br />
GFK genannt, setzt seinen Siegeszug durch den internationalen<br />
und den nationalen Bootsbau fort. Binnen weniger Jahre<br />
gibt es mehr GFK- als Holzboote, und auch die Segeltücher<br />
werden nun nicht mehr aus Baumwolle (Mako), sondern aus<br />
dem Kunststoff Dacron gefertigt. Währenddessen etabliert<br />
sich Otto Normalbürger mehr und mehr in der Segelszene:<br />
Viele der zunächst »wilden« Segler gründen eigene Clubs, die<br />
oft kurz darauf in den Deutschen Segler-Verband eintreten.<br />
Ein Blick in die Statistik verdeutlicht diese Entwicklung: Im<br />
Jahr 1963 sind im DSV 310 Vereine mit 32 000 Mitgliedern<br />
organisiert, 1973 zählt der Verband bereits<br />
741 Vereine mit 86 010 Mitgliedern. 1983 ist<br />
die Zahl der DSV-Vereine auf 1107 Clubs mit<br />
153 468 Seglerinnen und Seglern aus Westdeutschland<br />
angestiegen.<br />
Dieser enorme Mitgliederzuwachs führt<br />
zu einer erheblichen Mehrbelastung der<br />
Geschäftsstelle des Deutschen Segler-Verbandes, die ihren<br />
Aufgaben Anfang der 1970er-Jahre personell und materiell<br />
kaum noch gewachsen ist. Ein weiteres Problem dieser Zeit:<br />
Der DSV-Vorstand ist mit 30 Mitgliedern zu groß, um schnell<br />
genug auf die ständig steigenden Anforderungen reagieren zu<br />
können. Bei dem 1971 in Lübeck-Travemünde veranstalteten<br />
Deutschen Seglertag äußern die Delegierten eine massive Unzufriedenheit<br />
mit der Verbandsarbeit. Das muss schnell besser<br />
werden, sonst droht der Bruch mit den Vereinen! Noch vor<br />
Ort wird ein elfköpfiger Konzeptions-Ausschuss zur Erarbeitung<br />
eines neuen DSV-Grundgesetzes gebildet. Dem gehört<br />
unter anderen der spätere DSV-Präsident Rolf Bähr an. Die<br />
Leitung übernimmt der damalige Vorsitzende des Berliner<br />
Segler-Verbandes Peter-Robert Richter.<br />
Schon beim nächsten Deutschen Seglertag 1973 in Düsseldorf<br />
legt der Ausschuss den Entwurf einer modernen Verbandssatzung<br />
vor. Zwei Tage lang wird eifrig über dieses neue<br />
DSV-Grundgesetz debattiert, dann nehmen es – in fast unveränderter<br />
Form – 90 Prozent der Delegierten an. Das DSV-Präsidium<br />
und der neu initiierte Seglerrat werden in Düsseldorf<br />
gemäß dieser Satzung gewählt. An der Spitze des Deutschen<br />
Segler-Verbandes steht jetzt Dr. Kurt Pochhammer vom Ver-<br />
Weder Revolte<br />
noch Widerstand<br />
halten die<br />
riesige Wassersport-Welle<br />
auf<br />
ein Seglerhaus am Wannsee, den Seglerrat leitet Peter-Robert<br />
Richter vom Tegeler Segel-Club. Pochhammer veranlasst, dass<br />
die in Hamburg beheimatete DSV-Geschäftsstelle mehr qualifiziertes<br />
Personal und größere Räumlichkeiten erhält. Diese<br />
Umstrukturierungen der Führungs- und Verwaltungsebene<br />
des Verbandes führen schon bald zum gewünschten Erfolg:<br />
Der Großdampfer DSV läuft wieder auf Kurs.<br />
Meilensteine des Bootsbaus:<br />
die ersten Jollen und<br />
Küstenkreuzer aus GFK<br />
Welcher Bootsbauer wann genau das erste Segelboot aus glasfaserverstärktem<br />
Kunststoff fertigte, lässt sich heute kaum<br />
nachvollziehen – zu viele Werften und Selbstbauer experimentieren<br />
Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit und unabhängig<br />
voneinander mit dem neuen Material. Fest steht aber, dass<br />
der Werkstoff schon viel früher als im Wassersport in anderen<br />
Fertigungsbereichen Verwendung findet. Die ersten Glasfasern<br />
werden 1929 in Deutschland hergestellt, Anfang der 1930er-<br />
Jahre beginnt man in den USA, sie industriell<br />
zu fertigen. Hochwertiges Epoxidharz gibt es<br />
seit 1938, und 1943 wird erstmals Balsaholz<br />
zur Fertigung von Sandwichlaminaten eingesetzt.<br />
Vorreiter in der Nutzung von GFK sind die<br />
USA, die ab 1942 Autos, Boote und Flugzeuge<br />
aus Polyesterharz fertigen. Auch die Deutsche<br />
Kriegsmarine verwendet während des Zweiten Weltkriegs GFK<br />
für den Schiffbau.<br />
In den 1940er-Jahren hält der Wunderwerkstoff GFK erstmals<br />
in den Segelsport Einzug. Der US-Amerikaner Ray Greene<br />
baut bereits 1942 eine vier Meter lange Jolle aus Polyesterharz<br />
und Glasfasern. Ab 1947 stellt er die GFK-Jollen »Tuby Dink«<br />
und »Rebel« in Serie her. 1957 baut Greene den 7,60 Meter<br />
langen Seekreuzer »New Horizons« – die erste von Sparkman<br />
& Stephens entworfene Kunststoffyacht.<br />
Die deutschen Segler entdecken etwa Mitte der 1950er-<br />
Jahre den Werkstoff GFK für sich. Unter der Überschrift »Boote<br />
aus der Retorte« berichtet die »Yacht« in ihrer Ausgabe 1/1955:<br />
»Im vergangenen Jahr erschienen in Deutschland die ersten kleinen Probeboote<br />
aus Kunstharz für Segel und Motor. Im Ausland werden bereits<br />
Gebrauchsboote von 15 m Länge und mehr aus Glasharz gegossen, man<br />
beginnt nationale und internationale Einheitsboote aus Glasharz in<br />
Serien herzustellen [...] Es ist an der Zeit, daß wir uns etwas gründlicher<br />
mit der ›Materie‹, dem Glasharz und seinen Verwendungsmöglichkeiten,<br />
beschäftigen.« Damit haben bereits einige experimentierfreudige<br />
Herren begonnen – zum Beispiel der Hamburger Bauingenieur<br />
Walter Vehstedt, der 1955 die Jolle »Aquamarin« aus Kunststoff<br />
und Glasfasermatten baut. Aus der Urform dieses Bootes wer
den insgesamt 18 Jollen gefertigt, die recht schnell sind, bei<br />
Regatten aber außer Konkurrenz segeln müssen, weil sie vom<br />
Deutschen Segler-Verband nicht anerkannt werden.<br />
1957 stellt die in Oehningen am Bodensee beheimatete<br />
Ceha-Werft bereits 500 GFK-Boote pro Jahr her. Im Angebot<br />
ist unter anderem eine 4,05 Meter lange Jolle, die die Werft<br />
segelfertig für 1200 DM liefern will »wenn eine genügend<br />
große Serie zustande kommt« (»Yacht« 1/1957). Im Jahr 1958<br />
kommt in Deutschland erstmals eine GFK-Serienyacht auf<br />
den Markt. Es ist der von dem US-Amerikaner Philip Rhodes<br />
gezeichnete und von der Amsterdamer Schiffswerft de Vries<br />
Lentsch gebaute 33-Fuß-Kielschwerter »Swiftsure«. Im selben<br />
Jahr baut Hans-Jürgen Vorbau von der Segler-Vereinigung<br />
Altona-Oevelgönne in Eigenregie seinen Jollenkreuzer »Caribe«.<br />
1959 entwirft der Niederländer E. G. van de Stadt die neun<br />
Meter lange europäische Serien-Yacht »Pionier«.<br />
In den 1960er-Jahren greift der GFK-Virus weiter um sich.<br />
Die Segler erkennen nach und nach den Nutzen der preiswerten<br />
und pflegeleichten Boote, und die Werften wittern<br />
im Serienbau ein profitables Geschäft. So entstehen in den<br />
USA und in Europa zahlreiche Jollen und Yachten aus dem<br />
neuen Werkstoff. Einen großen Erfolg feiert zum Beispiel die<br />
niederländische Victoria-Werft mit der von Dick Koopmans<br />
entworfenen Victoire 22. Das 6,60 Meter lange Kajütboot wird<br />
von 1961 bis 1980 rund 1500-mal produziert.<br />
Auf dem deutschen Markt macht 1963 die auf der Lübecker<br />
Werft von Werner Muffler gebaute »Fähnrich« von sich<br />
reden. Dieser 9,55 Meter lange, von Kurt W. Schröter gezeichnete<br />
Seekreuzer gilt als erste deutsche GFK-Serienyacht, die<br />
aufgrund der damals noch sehr massiven Laminatstärke – sie<br />
soll zwischen 8 und 33 Millimeter schwanken – äußerst stabil<br />
ist. Ein weiterer deutscher GFK-Klassiker ist die 9,65 Meter lange<br />
»Hanseat« von Willy Asmus. Sie läuft 1964 auf seiner Werft in<br />
Glückstadt an der Unterelbe erstmals vom Stapel, 1965 startet<br />
der Tischlermeister die Serienproduktion. Die ersten Versionen<br />
werden mit Kurzkiel oder als Kielschwerter gebaut, ihr auffälligstes<br />
Merkmal sind die Fenster im Niedergangsbereich, die<br />
manchen Betrachter an Schießscharten denken lassen. Seinen<br />
größten Erfolg feiert Asmus aber mit einem Nachfolgemodell,<br />
der erstmals 1970 gebauten 10,50 Meter langen »Hanseat 70«.<br />
WerftGrünDer WiLLY<br />
DehLer: Ihm gelingt mit<br />
der Varianta (links) sein<br />
erster Massenabsatz.<br />
167
168<br />
Großer Spaß auf kleinen Booten:<br />
Varianta, Conger & Co<br />
Der enorme Segelboom der 1960er- und 1970er-Jahre gründet<br />
weniger auf den Bau hochwertiger GFK-Kreuzer wie »Fähnrich«<br />
und »Hanseat«, sondern mehr auf der Massenproduktion preiswerter<br />
Jollen und kleiner Kajütboote. In der Zeitschrift »Yacht«<br />
verdeutlicht ein Berichterstatter von der interboot 1969 die<br />
Vielfalt des Angebots: »Wer glaubt, den Küstenkreuzer seiner Wahl<br />
bereits gefunden zu haben, könnte sich irren. Er war zumindest nicht<br />
in Friedrichshafen, wo mehr neue Familienkreuzer zwischen 10 000<br />
und 20 000 Mark zu sehen waren, als je auf einer Ausstellung zuvor.«<br />
In dem »Yacht«-Artikel werden 42 Jollen- und Kielboote vorgestellt,<br />
die meisten sind zwischen vier und sieben Meter lang.<br />
18 der Modelle stammen aus deutscher Produktion. Einige<br />
dieser Bootstypen sind bis heute als Touren- und Regattaboote<br />
verbreitet und werden von aktiven Klassenvereinigungen<br />
betreut. Dazu zählen zum Beispiel das Zweihand-Kielboot<br />
Dyas, der Jollenkreuzer Fam, die Trapezjolle Jeton und der<br />
Kielschwerter Neptun 22.<br />
Die WerbefotoS für Die<br />
Varianta: Sie zeigen bewusst<br />
Frauen und Kinder. Die Zielgruppe<br />
der Werft sind junge Familien.<br />
Wie groß die Bandbreite der deutschen Hersteller ist, die sich<br />
Anfang der 1960er-Jahre an das Experiment Serienbootsbau<br />
wagen, zeigt ein Blick auf zwei Extreme – auf die zunächst<br />
noch kleine Bastelbude von Willy Dehler und auf die Hamburger<br />
Großschiffswerft Blohm + Voss, die in dieser Zeit die<br />
Conger-Jolle auf den Markt bringt.<br />
Kaum ein anderes Unternehmen dokumentiert so gut die<br />
Geschichte des deutschen GFK-Serienbootsbaus wie die Anfang<br />
der 1960er-Jahre gegründete Dehler-Werft. Die ersten Dehler-<br />
Boote messen kaum mehr als drei Meter, und heute, rund<br />
50 Jahre später, sind Yachten der Marke Dehler als geräumige<br />
Cruiser/Racer auf fast allen Segelrevieren Europas und auf<br />
zahlreichen Regatten zu bewundern. Willy Dehler, Inhaber<br />
eines Rundfunkgeschäfts und passionierter Segler, begeistert<br />
sich Ende der 1950er-Jahre zunächst rein privat für das neue<br />
Bootsbaumaterial GFK und experimentiert damit. Nach ein paar<br />
erfolgreichen Einzelbauten mietet er ein ehemaliges Kino in
Dortmund und baut dort zwei kleine Autodachjollen in Serie:<br />
die 3,95 Meter lange »Pfeil-Jolle« sowie die nur 3,05 kurze »Winnetou«,<br />
die er in der »Yacht« segelfertig für 1195 DM anbietet.<br />
Die Geschäftsidee ist erfolgreich: Rund 400 Jollen bringt Willy<br />
Dehler in seinen ersten Jahren als Produzent an den Mann.<br />
Nun will es der Sauerländer wissen. Willy Dehler verkauft<br />
sein Rundfunkgeschäft und gründet zusammen mit<br />
seinem Bruder Heinz das Unternehmen Dehler Bootsbau in<br />
Freienohl an der Ruhr. 1966 zeigen die beiden auf der Hamburger<br />
Bootsschau ihren ersten Kielkreuzer, die von E. G. van<br />
de Stadt gezeichnete 6,40 Meter lange Varianta. Das Publikum<br />
ist begeistert von dem familientauglichen Bötchen, und die<br />
»Yacht« schreibt von einem »Schaf mit fünf Pfoten«, weil es<br />
so vielseitig ist. Und in der Tat, die Varianta ist mit 550 Kilogramm<br />
Gewicht gut trailerbar, hat bei aufgeholtem Schwert<br />
einen binnentauglichen Tiefgang von 70 Zentimetern und<br />
verfügt über ausreichend Schlafgelegenheiten. Der Clou des<br />
Schiffchens ist der Kajütaufbau, der wahlweise auf- oder abgesetzt<br />
werden kann. Kostenpunkt: 6850 DM segelfertig plus<br />
750 DM für die Kajüte. Das überzeugt viele Wassersportbegeisterte,<br />
die bis dahin das Wandersegeln auf geschlossenen<br />
Booten für unerschwinglich hielten.<br />
Die Varianta avanciert zum VW Käfer des Segelsports. Bis<br />
zum Produktionsende im Jahr 1982 verkauft Dehler insgesamt<br />
4250 Stück. Das Design wird über die Jahre leicht modifiziert<br />
und der Aufbau später fest montiert, aber der Erfolg<br />
bleibt dem Schiffchen lange treu. Noch heute gibt es eine<br />
aktive Klassenvereinigung, deren Mitglieder jährlich bei rund<br />
30 Ranglistenregatten und bei einer Internationalen Deutschen<br />
Meisterschaft starten.<br />
Während Woche für Woche Variantas aus der Werfthalle<br />
rollen, lassen die Brüder Dehler in den folgenden Jahren weitere<br />
Jollen und Kielboote entwickeln. Zu ihren großen Erfolgen<br />
zählen die Familienkreuzer Delanta, Duetta und Optima sowie<br />
die Regattaklasse Sprinta Sport. Im Jahr 1976 gewinnen Frank<br />
Hübner und Harro Bode olympisches Gold im 470er von Dehler.<br />
1979 verlässt Heinz Dehler das Unternehmen. Willy führt<br />
die Werft allein weiter, die nun auch größere Schiffe wie die<br />
Dreivierteltonner DB 1 und DB 2 sowie weitere Regatta- und<br />
Fahrtenyachten produziert. Trotz des großen Ansehens, dass<br />
Dehler damit gewinnt, gerät die Werft wirtschaftlich immer<br />
wieder in unruhiges Fahrwasser. Nach zwei Insolvenzen 1998<br />
und 2007/08 wird sie 2009 schließlich von der HanseYacht AG<br />
in Greifswald übernommen.<br />
Fast zeitgleich mit der Varianta, aber unter gänzlich anderen<br />
Vorzeichen wird 1965 die Conger-Jolle auf den Markt<br />
gebracht. Verantwortlich zeichnet Blohm + Voss. Auf der 1877<br />
gegründeten Großschiffswerft lief 1914 der Riesendampfer<br />
»Bismarck« in Anwesenheit seiner Majestät Kaiser Wilhelm II.<br />
vom Stapel, 1933 wurde dort das Schulschiff »Gorch Fock« für<br />
die Reichsmarine gebaut. Und nun fertigt diese traditionsreiche<br />
Hamburger Werft eine Kunststoffjolle namens Conger –<br />
das heißt übersetzt Meeraal – von nur 5,30 Meter Länge. Der<br />
Telegramm vom<br />
Bundeskanzler<br />
Der prominenteste Conger-Segler der 1970er-Jahre war Bundeskanzler Helmut Schmidt.<br />
1977 sandte er der Klasse das folgende Telegramm:<br />
»Es freut mich, daß es der ›CONGER‹ inzwischen zur Anerkennung durch den Deutschen<br />
Segler-Verband gebracht hat, und wünsche der vom Segel-Club Frankenau Lembruch<br />
ausgerichteten ersten Deutschen Meisterschaft guten Verlauf. Leider kann ich selbst an<br />
der Regatta nicht teilnehmen. Entgegen anderslautenden Presseberichten möchte ich<br />
jedoch klarstellen, daß ich mit meinem ›CONGER‹ manche steife Brise auch trockenen<br />
Fußes überstanden habe. Allen Teilnehmern an der 1. Deutschen ›CONGER‹-Meisterschaft<br />
wünsche ich Mast- und Schotbruch.<br />
Helmut Schmidt, Bundeskanzler<br />
Bau solch kleiner Vergnügungsboote ist ein absolutes Novum<br />
in der Firmengeschichte.<br />
Zunächst erwirbt Blohm + Voss die Baulizenz der USamerikanischen<br />
»Hawk«. Doch es stellt sich rasch heraus,<br />
dass diese Jolle ungeeignet für den Massenabsatz ist. Sie läuft<br />
schnell aus dem Ruder und kentert leicht. Also heuert die<br />
Werft den späteren Olympiamedaillengewinner Ulli Libor an,<br />
unter dessen Federführung das Design der »Hawk« gründlich<br />
überarbeitet wird. Karl-Heinrich Lehmann, der damalige Leiter<br />
der Kunststoffsparte von Blohm + Voss, zeichnet das Deck neu<br />
und Klaus Feltz den Rumpf. So entsteht die Conger-Jolle, die<br />
im Vergleich zum Vorgängermodell sehr stabil und gut zu<br />
segeln ist. Auf der Bootsausstellung in Hamburg 1965 wird sie<br />
erstmals vorgestellt. Zusätzlich betreibt Blohm + Voss einen<br />
bis dahin unüblichen Werbeaufwand: In der ganzen Republik<br />
werden Vorführboote zur Verfügung gestellt, und bei einigen<br />
Regatten starten gleich mehrere Werftcrews im Conger.<br />
Das Konzept geht auf. Schon drei Jahre nach der Markteinführung<br />
wird der 1000. Conger verkauft. Im Januar 1971<br />
wird in Hamburg eine Klassenvereinigung gegründet und 1977<br />
die erste Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Zu ihrem 40.<br />
Bestehen im Jahr 2011 zählt die Conger-Klassenvereinigung<br />
mehr als 300 Mitglieder und rund 140 Mannschaften in der<br />
Rangliste. Bis heute sind 3940 Conger aus den Werkshallen<br />
gerollt – nicht alle bei Blohm + Voss, denn 1978 übernahm<br />
die Fiberglas Technik GmbH die Baulizenz, aber alle im fast<br />
unveränderten Design. Der Conger ist bei Fahrten- und Regattaseglern<br />
so beliebt, dass er noch immer produziert wird.<br />
169
170<br />
Der conGer iM WerftproSpekt<br />
Der 1960er-Jahre:<br />
ein gemütliches Familienboot …
… und ein treuer Gefährte<br />
für den harten Männertörn.<br />
171
264<br />
anhang<br />
Vorsitzende/Präsidenten des<br />
Deutschen Segler-Verbandes<br />
1888–1912 Adolph Burmester, Norddeutscher Regatta Verein<br />
1913–1928 Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Ing. Carl Busley, Marine-Regatta-Verein, Norddeutscher Regatta Verein,<br />
Verein Seglerhaus am Wannsee<br />
1928 Dr. Wilhelm Rakenius (kommissarisch), Verein Seglerhaus am Wannsee<br />
1929–1932 Dr. Wilhelm Rakenius, Verein Seglerhaus am Wannsee<br />
1932 Stellvertreter von Dr. Rakenius: Dr. A. Mendelssohn, Bonner Yacht-Club<br />
1932–1933 Dr. Edmund Koebke, Potsdamer Yacht Club<br />
1933–1934 Oberstleutnant Erich Kewisch, Kaiserlicher Yacht-Club, Potsdam<br />
1934–1935 Reichsbankrat Carl Unfug, Segler-Club »Tegelsee« (Spandauer Yacht-Club)<br />
1935–1939 Oberstleutnant Erich Kewisch, Kaiserlicher Yacht-Club, Potsdam<br />
1936–1940 Stellvertreter von Erich Kewisch: Adolf Hain, Verein Seglerhaus am Wannsee<br />
1940–1943 Adolf Hain, Geschäftsführer des Verbandes (mit der Führung des Verbandes beauftragt),<br />
Verein Seglerhaus am Wannsee<br />
1946–1948 Carl Georg Gewers und Erich F. Laeisz lösen sich als Vorsitzende in der Besatzungszone ständig ab<br />
1949–1956 Carl Georg Gewers, Hamburger Segel-Club<br />
1956–1972 Dietrich Fischer, Norddeutscher Regatta Verein<br />
1972 Dr. Kurt Pochhammer (kommissarisch), Verein Seglerhaus am Wannsee<br />
1973–1985 Dr. Kurt Pochhammer, Verein Seglerhaus am Wannsee<br />
1985–1993 Hans-Otto Schümann, Hamburger Segel-Club<br />
1993–2001 Hans-Joachim Fritze, Norddeutscher Regatta Verein<br />
2001–2005 Dierk Thomsen, Kieler Yacht-Club<br />
seit 2005 Rolf Bähr, Verein Seglerhaus am Wannsee
Die Autoren bedanken<br />
sich bei …<br />
Ralf Abratis<br />
Michael Amme<br />
Jörg Besch<br />
Martin Birkhoff<br />
Jörn Bock<br />
Wibke Borrmann<br />
Gudrun Calligaro<br />
Volker Christmann<br />
Torsten Conradi<br />
Sabine <strong>Delius</strong><br />
Svante Domizlaff<br />
Anton Dreher<br />
Wilfried Erdmann<br />
Hannes Ewerth<br />
Thomas Gade<br />
Angelika und Rollo Gebhard<br />
Hans Glasneck<br />
Wolfgang Goeken<br />
Dr. Dieter Goldschmidt<br />
Dr. Gesa Gruber<br />
Fridtjof Gunkel<br />
Carsten Hark<br />
Rachel Hibberd<br />
Franz Hoof<br />
Sönke Hucho<br />
Sönke Jessen<br />
Saskia Jöhnk<br />
Sebastian Kalabis<br />
Beate Kammler<br />
Otto Kasch<br />
Martin Kauffmann<br />
Landeshauptstadt Kiel<br />
Klaus Kinast<br />
Andreas Krause<br />
Nico Krauss<br />
Tim Kröger<br />
Alexander Lauterwasser<br />
Hannes Lindemann<br />
Bernd Luetgebrune<br />
Achim Mende<br />
… der »Yacht«-Redaktion und der DSV-Geschäftsstelle<br />
… ihren Familien und Freunden für ihre Geduld und ihr Verständnis<br />
Besonderer Dank gilt unseren Gastautoren<br />
Alois Mühlegger<br />
Lutz-Henning Müller<br />
Dietrich Onnasch<br />
Dr. Jochen Orgelmann<br />
Michael Oswald<br />
Klaus Pollähn<br />
Manuela Preinbergs<br />
Uwe Rafoth<br />
Jochen Rieker<br />
Henning Rocholl<br />
Burkhard Rosenberg<br />
Calle Schmidt<br />
Ivo Schuppe<br />
Gerhard Philipp Süß<br />
Norbert Suxdorf<br />
Wolfgang Tarrach<br />
Gerd Trulsen<br />
Uwe Wenzel<br />
Nigel Winkley<br />
Klaus Zapf<br />
Rolf Bähr, Präsident des Deutschen Segler-Verbandes<br />
Reinhard Heinl, Präsident des Landes-Segler-Verbandes Baden-Württemberg<br />
Wilfried Horns, Erster Vorsitzender des Freundeskreises Klassische Yachten<br />
Jürgen Chr. Schaper, Kommodore der Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne<br />
Jochen Schümann, erfolgreichster deutscher Olympiasegler und zweimaliger America’s-Cup-Gewinner<br />
Dr. Jens Tusche, Präsident des Segler-Verbandes Sachsen<br />
265
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der<br />
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten<br />
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.<br />
1. Auflage<br />
ISBN 978-3-7688-3569-5<br />
© by <strong>Delius</strong>, <strong>Klasing</strong> & Co. KG, Bielefeld<br />
Lektorat: Felix Wagner<br />
Schutzumschlaggestaltung: Jörg Weusthoff, Weusthoff Noël, Hamburg<br />
Layout: Susann Pechtstein, Weusthoff Noël, Hamburg<br />
Lithografie: scanlitho.teams, Bielefeld<br />
Druck: Kunst- und Werbedruck, Bad Oeynhausen<br />
Printed in Germany 2013<br />
Alle Rechte vorbehalten!<br />
Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett<br />
noch teilweise reproduziert, übertragen oder kopiert werden, wie z. B.<br />
manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive<br />
Fotokopieren, Bandaufzeichnung und Datenspeicherung.<br />
<strong>Delius</strong> <strong>Klasing</strong> Verlag, Siekerwall 21, D-33602 Bielefeld<br />
Tel.: 0521/559-0, Fax: 0521/559-115<br />
E-Mail: info@delius-klasing.de<br />
www.delius-klasing.de