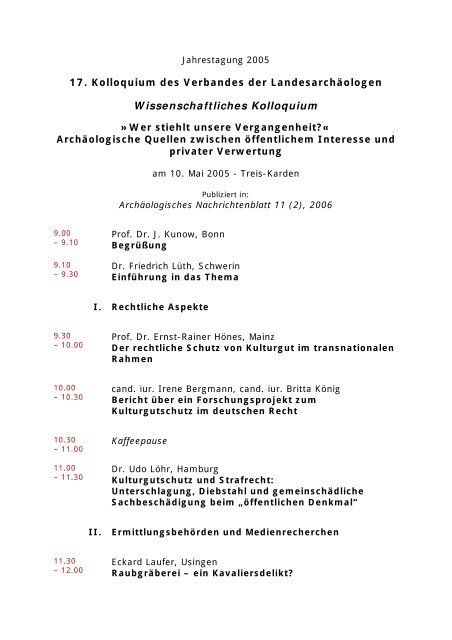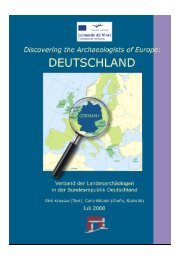Auszug "Wer stiehlt unsere Vergangenheit?" - Verband der ...
Auszug "Wer stiehlt unsere Vergangenheit?" - Verband der ...
Auszug "Wer stiehlt unsere Vergangenheit?" - Verband der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Jahrestagung 2005<br />
17. Kolloquium des <strong>Verband</strong>es <strong>der</strong> Landesarchäologen<br />
Wissenschaftliches Kolloquium<br />
»<strong>Wer</strong> <strong>stiehlt</strong> <strong>unsere</strong> <strong>Vergangenheit</strong>?«<br />
Archäologische Quellen zwischen öffentlichem Interesse und<br />
privater Verwertung<br />
9.00<br />
– 9.10<br />
9.10<br />
– 9.30<br />
9.30<br />
– 10.00<br />
10.00<br />
– 10.30<br />
10.30<br />
– 11.00<br />
11.00<br />
– 11.30<br />
11.30<br />
– 12.00<br />
am 10. Mai 2005 - Treis-Karden<br />
Publiziert in:<br />
Archäologisches Nachrichtenblatt 11 (2), 2006<br />
Prof. Dr. J. Kunow, Bonn<br />
Begrüßung<br />
Dr. Friedrich Lüth, Schwerin<br />
Einführung in das Thema<br />
I. Rechtliche Aspekte<br />
Prof. Dr. Ernst-Rainer Hönes, Mainz<br />
Der rechtliche Schutz von Kulturgut im transnationalen<br />
Rahmen<br />
cand. iur. Irene Bergmann, cand. iur. Britta König<br />
Bericht über ein Forschungsprojekt zum<br />
Kulturgutschutz im deutschen Recht<br />
Kaffeepause<br />
Dr. Udo Löhr, Hamburg<br />
Kulturgutschutz und Strafrecht:<br />
Unterschlagung, Diebstahl und gemeinschädliche<br />
Sachbeschädigung beim „öffentlichen Denkmal“<br />
II. Ermittlungsbehörden und Medienrecherchen<br />
Eckard Laufer, Usingen<br />
Raubgräberei – ein Kavaliersdelikt?
12.00<br />
– 12.30<br />
12.30<br />
– 13.00<br />
13.00<br />
– 14.00<br />
14.00<br />
– 15.00<br />
15.00<br />
– 16.00<br />
16.00<br />
– 16.30<br />
16.30<br />
– 17.00<br />
Wolfgang Schönleber, Stuttgart<br />
Das Phänomen „Raubgräberei“ und die daraus<br />
resultierenden Probleme <strong>der</strong> Strafverfolgungsorgane<br />
Thomas Claus, Berlin<br />
Bericht über Kontakte zur Raubgräberszene bei den<br />
Recherchen zur Filmdokumentation „Schatzsucher –<br />
das Geschäft mit <strong>der</strong> <strong>Vergangenheit</strong>“<br />
Mittagspause<br />
III. Fallstudien<br />
Dr. Harald Meller, Halle/Saale<br />
Die Mondscheibe von Nebra<br />
Aus <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Bodendenkmalpflege:<br />
Dr. Jörg Biel, Esslingen<br />
Situation in Baden-Württemberg<br />
Dr. Daniel Bérenger, Bielefeld<br />
Situation in Westfalen<br />
Dr. Detlef Jantzen, Neustrelitz<br />
Situation in Mecklenburg-Vorpommern<br />
Kaffeepause<br />
Diskussion<br />
ab 17.00 Dr. Franz Schopper, Wünsdorf<br />
Zusammenfassung und Schlusswort<br />
gegen 17.30 Ende
<strong>Auszug</strong> aus:<br />
Henning Haßmann, Bericht über die Tagung des <strong>Verband</strong>es <strong>der</strong> Landesarchäologen in<br />
<strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland vom 9. bis 11. Mai 2005 in Treis-Karden.<br />
Archäologisches Nachrichtenblatt 11 (2), 2006.<br />
[...]<br />
Koloquium<br />
Das wissenschaftliche Kolloquium in <strong>der</strong> „Alten Knabenschule“ im Ortsteil Treis am Dienstag,<br />
den 10. Mai hatte den Titel „<strong>Wer</strong> <strong>stiehlt</strong> <strong>unsere</strong> <strong>Vergangenheit</strong>? Archäologische Quellen<br />
zwischen öffentlichem Interesse und privater Verwertung“. Das Thema Sondengänger,<br />
Raubgrabungen und illegale Archäologie sollte aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet<br />
1<br />
werden. Da die meisten Vorträge und die Diskussion im Anschluss an diesen Bericht abgedruckt<br />
werden, folgt hier nur eine knappe Zusammenfassung des Kolloquiums.<br />
Das Programm glie<strong>der</strong>te sich in drei Blöcke. Zunächst wurden rechtliche Aspekte erörtert. Der<br />
zweite Block konzentrierte sich auf die Perspektive <strong>der</strong> Ermittlungsbehörden, die durch<br />
Medienrecherchen verdichtet wurde. Schließlich rundeten Fallstudien das Bild ab, das sich allein<br />
durch die verschiedenen Landesgesetze recht unterschiedlich darstellt.<br />
Nach dem Grußwort des <strong>Verband</strong>svorsitzenden Prof. Dr. Jürgen Kunow, Bonn, und <strong>der</strong><br />
Einführung in das Thema durch Dr. Friedrich Lüth, Schwerin leitete Prof. Dr. Ernst-Rainer<br />
Hönes, Mainz, den Block zu den rechtlichen Aspekten ein. In seinem Referat beleuchtete er aus<br />
einer internationalen Perspektive den rechtlichen Schutz von Kulturgut im transnationalen<br />
Rahmen. Nach ausführlicher Erläuterung völkerrechtlicher Aspekte z.B. anhand <strong>der</strong> Haager<br />
Konvention, von UNESCO-Abkommen und –Koventionen, <strong>der</strong> Charta von Lausanne und<br />
Konventionen des Europarates formulierte Hönes, <strong>der</strong> auch Vorsitzen<strong>der</strong> des DNK-<br />
Arbeitskreises „Recht- und Steuerfragen“ ist, einige Anregungen an Denkmalpfleger und<br />
Gesetzgeber.<br />
Die beiden Trierer Jura-Examenskandidatinnen Irene Bergmann und Britta König berichteten<br />
über ein DFG-Forschungsprojekt zum Kulturgutschutz im deutschen Recht, das unter Leitung<br />
von Prof. Dr. Kerstin Odendahl, jetzt Sankt Gallen, an <strong>der</strong> Universität Trier angesiedelt war. In<br />
dieser komplexen Zusammenschau wurde deutlich, dass die rechtliche Situation des<br />
Kulturerbes gar nicht so schwach ist, wie häufig eingeschätzt.<br />
Bei dem Referat des Hamburger Strafrechtlers Dr. Udo Löhr, Oberstaatsanwalts i.R., über<br />
Kulturgutschutz und Strafrecht schwang seine große Praxiserfahrung, die er in <strong>der</strong> engen
Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen hat, mit.<br />
Nach einer Abgrenzung des deutschen Rechts in die drei Teilrechtsgebiete „öffentliches Recht“,<br />
„Zivil- o<strong>der</strong> Privatrecht“ und „Strafrecht“ stellte er auf die Straftatbestände Diebstahl,<br />
Unterschlagung, Hehlerei, einfache und gemeinschädliche Sachbeschädigung sowie<br />
Verwahrungsbruch scharf und nannte noch einige weitere Delikte, denen sich Raubgräber<br />
möglicherweise strafbar machen könnten, so z.B. Störung <strong>der</strong> Totenruhe o<strong>der</strong> Verstöße gegen<br />
Waffengesetze. Deutlich abgrenzbar ist das Ordnungswidrigkeitenrecht, dass jedoch durch<br />
beachtliche Bußgel<strong>der</strong> effektiver sein kann, als das Strafrecht. Löhr, <strong>der</strong> die Denkmalpfleger<br />
ermutigte, Raubgräber ernsthaft zu verfolgen, rundete seinen Vortrag mit Hinweisen für die<br />
Alltagspraxis im Umgang mit illegaler Archäologie ab.<br />
Auch <strong>der</strong> Stuttgarter Kriminalbeamte Wolfgang Schönleber vom Landeskriminalamt Baden-<br />
Württemberg griff auf einen breiten Erfahrungsschatz in <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung mit<br />
Raubgräbern zurück und bezog Beispiele aus ganz Deutschland und aller Welt mit ein. Sein<br />
Vortrag über das Phänomen „Raubgräberei“ und die daraus resultierenden Probleme <strong>der</strong><br />
Strafverfolgungsorgane lieferte einen spannenden Einblick in die Arbeit <strong>der</strong><br />
Ermittlungsbehörden.<br />
Polizeioberkommissar Eckhard Laufer aus Usingen lieferte einen detaillierten Bericht mit dem<br />
Titel „Tatort Bodendenkmal: Polizeiliches Einschreiten gegen Raubgräber in Hessen“. Das<br />
Referat zeigte nicht nur seine große Fachkenntnis auf dem Gebiet <strong>der</strong> polizeilichen Ermittlungen<br />
im Umfeld illegaler Archäologie, son<strong>der</strong>n auch seine grundlegenden Erfahrungen als<br />
ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger im hessischen Hochtaunuskreis. Laufer hat seine private<br />
Leidenschaft und sein dienstliches Interesse als Polizist verknüpft und gilt als einer <strong>der</strong> besten<br />
Spezialisten und Kenner <strong>der</strong> Raubgräberszene in Deutschland. Mit seinen<br />
Aufklärungsveranstaltungen hat er wesentlich dazu beigetragen, das Problembewusstsein bei<br />
Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften und Gerichten zu schärfen. Laufer machte deutlich,<br />
dass es sich bei Raungrabungen keineswegs um ein Kavaliersdelikt handelt und for<strong>der</strong>t eine<br />
zentralisierte Bekämpfung durch sachkundige Polizeibeamte. Prävention und Repression in<br />
intensiver Zusammenarbeit mit Denkmalpflege, Forschungseinrichtungen, Museen, loyalem<br />
Antikenhandel und loyalen Sondengängern und Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden<br />
seien erfor<strong>der</strong>lich, um die irreversible Zerstörung des Kulturerbes zu bremsen.<br />
Der Berliner Filmemacher Thomas Claus, <strong>der</strong> in Fachkreisen durch eine Reihe archäologischer<br />
Dokumentarfilme auch zum Thema Raubgrabungen bekannt geworden ist, berichtete über<br />
Kontakte zur Raubgräberszene bei den Recherchen zur Filmdokumentation „Schatzsucher –<br />
2
das Geschäft mit <strong>der</strong> <strong>Vergangenheit</strong>“, die im Auftrag des RBB entstanden ist und inzwischen in<br />
mehreren öffentlich-rechtlichen Programmen gezeigt wurde. Durch die intensiven Recherchen<br />
im direkten Raubgräber-, Detektor- und Kunsthändlermilieu und <strong>der</strong>en Umfeld konnte er ein<br />
detailliertes Bild <strong>der</strong> Szene zeichnen, bei dem den Archäologen angst und bange werden<br />
konnte. Für die meisten Kollegen war das von Claus skizzierte Ausmaß des „Geschäftes mit <strong>der</strong><br />
<strong>Vergangenheit</strong>“ ernüchternd und verstörend.<br />
Der sachsen-anhaltische Landesarchäologe Dr. Harald Meller, Halle, fokussierte seinem Bericht<br />
über die spektakuläre Entdeckung <strong>der</strong> Mondscheibe von Nebra auf die Aspekte illegale Suche,<br />
Raubgrabung und illegaler Antikenhandel. Die Himmelsscheibe eignet sich beson<strong>der</strong>s dazu,<br />
dieses vielschichtige Thema exemplarisch zu erörtern.<br />
Dr. Jörg Biel, Esslingen, begründete die recht restriktive Haltung gegenüber Sondengängern in<br />
Baden-Württemberg, die auf die Einschränkung <strong>der</strong> Tätigkeit <strong>der</strong> Sondengänger einerseits und<br />
die gezielte Austrocknung ihrer Absatzgebiete zielt. Biel schätzt den Schaden durch<br />
Detektorgänger höher ein als den Erkenntnisgewinn. Er appellierte an die an<strong>der</strong>en<br />
3<br />
Bundeslän<strong>der</strong>, bei <strong>der</strong> Verfolgung <strong>der</strong> hochprofessionellen Raubgräber und Händler vom Kaliber<br />
„Berliner Goldhut“ o<strong>der</strong> „Scheibe von Nebra“ ebenso professionell und vernetzt dagegen<br />
vorzugehen.<br />
Eine differenzierte Sichtweise vertrat Dr. Daniel Bérenger, Bielefeld, <strong>der</strong> über die Situation in<br />
Westfalen informierte. Seiner Einschätzung nach ist das Problem des Sondengehens durch ein<br />
reines Verbot nicht mehr beherrschbar. Daher schlägt er aus ganz pragmatischen Gründen eine<br />
Zusammenarbeit mit „gutwilligen“ Sondengängern unter hohen Auflagen bei gleichzeitigem<br />
harten Vorgehen gegen jene, die ohne Sucherlaubnis auf Schatzsuche gehen.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Erfahrungen in Mecklenburg-Vorpommern fand Dr. Detlef Jantzen, Neustrelitz,<br />
deutliche Worte gegen Plün<strong>der</strong>er und Raubgräber und for<strong>der</strong>te die konsequente Strafverfolgung.<br />
Ehrlich an <strong>der</strong> Bewahrung und Erforschung des kulturellen Erbes Interessierten böten sich<br />
vielfältige Möglichkeiten. Voraussetzung sei aber die Integration in das System <strong>der</strong><br />
ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege, was den Erwerb nötiger Kenntnisse und die Bereitschaft<br />
zur Anerkennung des beson<strong>der</strong>en Schutzes archäologischer Denkmäler als gemeinsames<br />
kulturelles Erbe voraussetze.<br />
In <strong>der</strong> Abschlussdiskussion (in diesem Heft abgedruckt) wurden einige Aspekte aus den<br />
Referaten hervorgehoben und bewertet, einige Punkte wie die Zusammenarbeit mit den<br />
Munitionsbergungsdiensten ergänzt. Der umfangreiche Diskussionsbeitrag des bei <strong>der</strong>
Luxemburger Straßenbaubehörde beschäftigten Archäologen André Schoellen findet sich in<br />
diesem Heft in Form eines ausgearbeiteten Aufsatzes wie<strong>der</strong>.<br />
Im Wesentlichen zeichnete sich ein Konsens im Sinne <strong>der</strong> Schlusseinschätzung des letzten<br />
Vortrages von Detlef Jantzen ab: Eingeschränkte Sucherlaubnis für Diejenigen, die sich den<br />
Regeln <strong>der</strong> ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege verpflichtet fühlen und hartes Vorgehen gegen<br />
diejenigen, die sich am gemeinsamen archäologischen Erbe vergehen. Alle waren sich einig<br />
darüber, dass eine bundesweit einheitlich Lösung anzustreben sei. Vor allem müsse erhebliche<br />
Lobbyarbeit geleistet werden, nicht nur zur Optimierung <strong>der</strong> Gesetze, son<strong>der</strong>n vor allem, um die<br />
Akzeptanz <strong>der</strong> Position <strong>der</strong> archäologischen Denkmalpflege zu verbessern, bzw. das<br />
Problembewusstsein in <strong>der</strong> Öffentlichkeit und im Partnerfeld zu schärfen.<br />
[...]<br />
Dr. Henning Haßmann<br />
Nie<strong>der</strong>sächsisches Landesamt für Denkmalpflege<br />
Scharnhorststraße 1<br />
30175 Hannover<br />
henning.hassmann@nld.nie<strong>der</strong>sachsen.de<br />
4