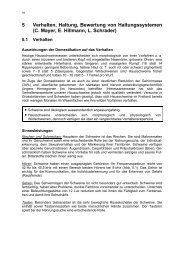Schlussfolgerungen - vTI - Bund.de
Schlussfolgerungen - vTI - Bund.de
Schlussfolgerungen - vTI - Bund.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landbauforschung – Son<strong>de</strong>rheft 330 (2009) 183<br />
9 <strong>Schlussfolgerungen</strong><br />
Dr. Walter Dirksmeyer 1<br />
Über alle gartenbaulichen Produktionssparten<br />
hinweg vollzieht sich <strong>de</strong>r Strukturwan<strong>de</strong>l mit einer<br />
Reduktion <strong>de</strong>r Anzahl <strong>de</strong>r Betriebe hin zu<br />
immer größeren Betrieben, welche eine insgesamt<br />
ansteigen<strong>de</strong> gartenbauliche Produktionsfläche<br />
bewirtschaften. Auf Ebene <strong>de</strong>r einzelnen<br />
Anbausparten <strong>de</strong>s Produktionsgartenbaus weicht<br />
das Bild jedoch hin und wie<strong>de</strong>r von diesem<br />
grundsätzlichen Muster ab. Außer<strong>de</strong>m erfolgt die<br />
Erzeugung gartenbaulicher Produkte immer stärker<br />
in darauf spezialisierten Gartenbaubetrieben.<br />
Zwar gibt es nach wie vor eine beträchtliche Anzahl<br />
von landwirtschaftlichen Betrieben, die auch<br />
<strong>de</strong>r Herstellung von Gartenbauprodukten nachgehen,<br />
doch sinkt <strong>de</strong>ren Anzahl und Flächenanteil.<br />
Im Gemüsebau ist die Entwicklung zu immer<br />
weniger aber dafür immer größeren Betrieben,<br />
die eine in <strong>de</strong>r Summe aller Gemüsebaubetriebe<br />
ansteigen<strong>de</strong> Produktionsfläche bewirtschaften,<br />
am stärksten ausgeprägt. Als Grund für diese<br />
Entwicklungen können die Nachfragemacht <strong>de</strong>s<br />
Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>ls, über <strong>de</strong>n mehr als<br />
75 % <strong>de</strong>r Frischware vermarktet wer<strong>de</strong>n, und <strong>de</strong>r<br />
international steigen<strong>de</strong> Wettbewerb genannt<br />
wer<strong>de</strong>n. Bei<strong>de</strong>s führt dazu, dass hauptsächlich<br />
die Betriebe, die eine gewünschte hohe Qualität<br />
in großen und einheitlichen Mengen zu vergleichsweise<br />
geringen Kosten produzieren können<br />
(Stichwort Kostenführerschaft), im Markt eine<br />
wichtige Rolle spielen. Diese Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
erfüllen hauptsächlich große und sehr große Betriebe,<br />
die Skaleneffekte realisieren können, wofür<br />
eine stark mechanisierte Produktion eine<br />
Voraussetzung ist. So zeigen auch die betriebswirtschaftlichen<br />
Analysen <strong>de</strong>s Zentrums für Betriebswirtschaft<br />
im Gartenbau e. V., ausgehend<br />
von steuerlichen Buchabschlüssen gartenbaulicher<br />
Produktionsbetriebe, dass die flächenstarken<br />
Betriebe unter <strong>de</strong>n erfolgreichen Gemüsebaubetrieben<br />
einen hohen Anteil einnehmen.<br />
Dies gilt sowohl für die auf <strong>de</strong>n Freilandanbau<br />
als auch für die auf die Produktion unter Glas<br />
spezialisierten Betriebe. Auch mittelgroße Gemüsebaubetriebe,<br />
die einem schlagkräftigen Absatzmittler,<br />
unabhängig davon, ob privatwirt-<br />
1<br />
schaftlich o<strong>de</strong>r als Erzeugerorganisation aufgestellt,<br />
angeschlossen sind, können diese Voraussetzungen<br />
erfüllen. Allerdings ist es für diese<br />
Betriebe erfor<strong>de</strong>rlich, sich auf eine o<strong>de</strong>r sehr wenige<br />
Kulturen zu spezialisieren, da sie an<strong>de</strong>rnfalls<br />
keine Größenvorteile ausnutzen können und<br />
folglich zu teuer produzieren wür<strong>de</strong>n. Eine solche<br />
Strategie <strong>de</strong>r starken Spezialisierung auf<br />
sehr wenige Kulturen, im Extremfall nur eine,<br />
birgt allerdings immer ein hohes Risiko, da ein<br />
Misserfolg bei einer Kultur, sei er produktionstechnisch<br />
o<strong>de</strong>r marktseitig bedingt, nur schwer<br />
auszugleichen ist, wenn einen großer Anteil an<br />
<strong>de</strong>r Produktionsfläche eines Betriebes auf sie<br />
entfällt. Alternativ können sich kleinere und mittelgroße<br />
Betriebe jedoch auf <strong>de</strong>n Anbau von beson<strong>de</strong>ren<br />
Qualitäten o<strong>de</strong>r Spezialitäten konzentrieren,<br />
bei <strong>de</strong>nen eine Produktion mit hohem<br />
Maschineneinsatz nicht möglich o<strong>de</strong>r unrentabel<br />
ist. Dadurch kann in diesen Betrieben die Produktpalette<br />
breiter gehalten wer<strong>de</strong>n, wodurch<br />
das Risiko sinkt.<br />
Im Obstbau zeichnet sich eine an<strong>de</strong>re Entwicklung<br />
ab als im Gemüsebau. In <strong>de</strong>n spezialisierten<br />
Obstbaubetrieben mit <strong>de</strong>m Schwerpunkt Erzeugung<br />
ist parallel zur Anzahl <strong>de</strong>r Betriebe auch<br />
die Produktionsfläche um etwa <strong>de</strong>nselben Anteil<br />
gesunken. Im Gegensatz dazu ist die gesamte<br />
zur Obsterzeugung genutzten Fläche gestiegen.<br />
Zwar ist die durchschnittliche Betriebsgröße im<br />
spezialisierten Obstbau gewachsen, doch ist<br />
dies, im Gegensatz zum Gemüsebau, nicht nur<br />
<strong>de</strong>n großen und sehr großen Betrieben zuzuschreiben.<br />
Im Obstbau gibt es einen relativ geringen<br />
Anteil von sehr großen Betrieben, was unter<br />
an<strong>de</strong>rem damit zu begrün<strong>de</strong>n ist, dass die<br />
Mechanisierungsmöglichkeiten im Obstbau geringer<br />
sind als beispielsweise im Gemüsebau.<br />
Dadurch fallen mögliche Skaleneffekte vergleichsweise<br />
gering aus. Aus diesem Grund wird<br />
Obst auch noch viel häufiger im Nebenerwerb<br />
produziert, als das in <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren drei Produktionssparten<br />
<strong>de</strong>r Fall ist.<br />
Dr. Walter Dirksmeyer, Institut für Betriebswirtschaft, Johann Heinrich von Thünen-Institut (<strong>vTI</strong>), <strong>Bund</strong>esforschungsinstitut für Ländliche<br />
Räume, Wald und Fischerei, <strong>Bund</strong>esallee 50, 38116 Braunschweig, walter.dirksmeyer(at)vti.bund.<strong>de</strong>
184 Walter Dirksmeyer: <strong>Schlussfolgerungen</strong><br />
Mehr als drei Viertel <strong>de</strong>r Produktionsmenge von<br />
Obst und Gemüse wer<strong>de</strong>n über <strong>de</strong>n Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>l<br />
abgesetzt. Die For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s<br />
Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>ls nach großen und einheitlichen<br />
Partien von Obst und Gemüse, die hohen<br />
Qualitätsansprüchen genügen, wird in bei<strong>de</strong>n<br />
Sparten überwiegend durch gut aufgestellte<br />
Erzeugerorganisationen und private Absatzmittler<br />
sichergestellt. Allerdings gibt es insbeson<strong>de</strong>re<br />
im Gemüsebau einige sehr große Betriebe, die<br />
diese Anfor<strong>de</strong>rungen auch ohne eine Bün<strong>de</strong>lung<br />
<strong>de</strong>r Produktion mehrerer Erzeuger erfüllen können.<br />
In <strong>de</strong>r Nahrungsmittelproduktion haben Systeme<br />
zum Qualitätsmanagement eine beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung.<br />
Sie dienen <strong>de</strong>r nachhaltigen Sicherung<br />
<strong>de</strong>s Qualitätsniveaus gartenbaulicher Produkte.<br />
Sie helfen dadurch vorbeugend die Anfälligkeit<br />
gegenüber Lebensmittelskandalen zu verringern.<br />
Ergänzend können Systeme zur Rückverfolgbarkeit<br />
dazu beitragen, <strong>de</strong>n Ursprung eines Skandals<br />
schnell zu i<strong>de</strong>ntifizieren und somit <strong>de</strong>n möglichen<br />
Scha<strong>de</strong>n für unbeteiligte Betriebe einzudämmen.<br />
Zwar hat insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>l<br />
ein großes Interesse an Rückverfolgbarkeitssystemen,<br />
doch aus einer an<strong>de</strong>ren<br />
Motivation heraus. Ihm geht es eher darum, gelten<strong>de</strong><br />
Vorschriften einzuhalten und darüber hinaus<br />
ein positives Image zu bekommen, in<strong>de</strong>m<br />
auf die Fähigkeit hingewiesen wird, dass die angebotenen<br />
Produkte bis zum Erzeuger zurückverfolgt<br />
wer<strong>de</strong>n können. Wenn jedoch ein Lebensmittelskandal<br />
eintritt, geht es <strong>de</strong>m Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>l,<br />
wie auch <strong>de</strong>r Rucola-Skandal<br />
zeigte, nur noch darum, eine saubere Weste zu<br />
behalten – o<strong>de</strong>r sie so schnell wie möglich wie<strong>de</strong>r<br />
zu bekommen – um nicht o<strong>de</strong>r nicht mehr mit<br />
negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht<br />
zu wer<strong>de</strong>n. Der einfachste Weg dahin führt für<br />
<strong>de</strong>n Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>l über die temporäre<br />
Auslistung von betroffenen Produkten, wie es<br />
im Rucola-Skandal viele unbeteiligte Gärtner<br />
schmerzlich erfahren mussten. Ein dadurch<br />
plötzlich wegbrechen<strong>de</strong>r Absatzmarkt kann insbeson<strong>de</strong>re<br />
für Betriebe, die auf <strong>de</strong>n Anbau dieser<br />
Kultur spezialisiert sind, massive Liquiditätsengpässe<br />
zur Folge haben. Es ist davon auszugehen,<br />
dass solche Lebensmittelskandale <strong>de</strong>n<br />
Gartenbau immer wie<strong>de</strong>r treffen wer<strong>de</strong>n. Die<br />
Frage dabei ist nur, wann <strong>de</strong>r nächste Fall eintritt<br />
und welche Kultur davon betroffen sein wird.<br />
Im Vergleich zur indirekten Vermarktung ist das<br />
Absatzpotenzial bei <strong>de</strong>m Direktabsatz grundsätzlich<br />
begrenzt, da <strong>de</strong>r Einkauf für Verbraucher in<br />
Hoflä<strong>de</strong>n, auf Wochenmärkten o<strong>de</strong>r ähnlichen<br />
Stätten relativ zeitaufwändig ist. Dies gilt prinzipiell<br />
für alle Produktionssparten. Bei <strong>de</strong>n Nahrungsmittel<br />
erzeugen<strong>de</strong>n Sparten aber ist <strong>de</strong>r<br />
zusätzliche Zeitaufwand für einen Einkauf beim<br />
Erzeuger beträchtlich, da <strong>de</strong>r Einkauf von Obst<br />
und Gemüse parallel zum Lebensmitteleinkauf<br />
im Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>l erfolgen kann. Daher<br />
ist <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>s Absatzes über <strong>de</strong>n Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>l<br />
in <strong>de</strong>n Sparten Obstbau<br />
und Gemüsebau auch beson<strong>de</strong>rs hoch. Der<br />
Grund für Konsumenten, <strong>de</strong>nnoch beim Direktvermarkter<br />
einzukaufen, ist neben <strong>de</strong>m Einkaufserlebnis<br />
insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Wunsch, die<br />
Produkte direkt beim Erzeuger zu erwerben, wofür<br />
Grün<strong>de</strong> wie Frische, Freiheit von Schadstoffen<br />
und Vertrauen zum Produzenten genannt<br />
wer<strong>de</strong>n. Allerdings ist die Eigenproduktion für einen<br />
Direktvermarkter wegen <strong>de</strong>s Anbaus von<br />
vielen Produkten in kleinen Partien häufig teurer<br />
als <strong>de</strong>r Zukauf von Ware, was auch die vergleichsweise<br />
schlechten wirtschaftlichen Ergebnisse<br />
<strong>de</strong>r direkt absetzen<strong>de</strong>n Gemüsebaubetriebe<br />
zeigen. Analog gilt dies ebenfalls für an<strong>de</strong>re<br />
Betriebe, die vom Marktvolumen eher kleinere<br />
Absatzkanäle bedienen. Für solche Betriebe bieten<br />
sich Absprachen im Anbauprogramm mit Kollegen<br />
an, was bis hin zu Kooperationen gehen<br />
kann.<br />
Die Struktur <strong>de</strong>s Zierpflanzenbaus weicht verhältnismäßig<br />
stark von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Obst- o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
Gemüsebaus ab, was mit <strong>de</strong>m hohen Anteil an<br />
geschützter Produktion zu erklären ist. Die Produktion<br />
im Gewächshaus ist in spezialisierten<br />
Zierpflanzenbaubetrieben mit <strong>de</strong>m Schwerpunkt<br />
Erzeugung zwar insgesamt zurückgegangen,<br />
doch sind die Flächen unter Glas bei <strong>de</strong>n kleineren<br />
Betrieben bis 3 ha gärtnerischer Nutzfläche<br />
im Durchschnitt größer gewor<strong>de</strong>n. Dadurch entfällt<br />
auch ein verhältnismäßig großer Anteil <strong>de</strong>r<br />
für die Zierpflanzenproduktion genutzten Fläche<br />
auf die kleinen und mittelgroßen Betriebe <strong>de</strong>s<br />
spezialisierten Zierpflanzenbaus. Im Vergleich zu<br />
<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Produktionssparten ist <strong>de</strong>r Flächenanteil<br />
<strong>de</strong>r großen und sehr großen Betriebe<br />
im Zierpflanzenbau sehr klein. Da es jedoch im<br />
Zierpflanzenbau Betriebe mit mehreren Hektar<br />
Fläche unter Glas gibt, kann davon ausgegangen<br />
wer<strong>de</strong>n, dass auch hier die Richtung <strong>de</strong>s<br />
Strukturwan<strong>de</strong>ls vorgezeichnet ist. Unterstützend<br />
für die Entwicklung hin zu größeren Betrieben in<br />
<strong>de</strong>r geschützten Produktion wirkt, dass auch zukünftig<br />
von einem weiter wachsen<strong>de</strong>n Topfpflanzenmarkt<br />
in Deutschland ausgegangen wer<strong>de</strong>n<br />
kann, was Wachstumsschritte in <strong>de</strong>n Betrieben
Landbauforschung – Son<strong>de</strong>rheft 330 (2009) 185<br />
ten<strong>de</strong>nziell erleichtert, auch wenn sich das<br />
Wachstum dieses Marktes im Vergleich zur jüngeren<br />
Vergangenheit verlangsamen wird. Bremsend<br />
auf <strong>de</strong>n Strukturwan<strong>de</strong>l im Bereich <strong>de</strong>r<br />
Produktion unter Glas wirkt jedoch <strong>de</strong>r hohe Kapitalbedarf<br />
bei Investitionen in neue Produktionskapazitäten<br />
in Gewächshäusern. Außer<strong>de</strong>m wird<br />
<strong>de</strong>r strukturelle Wan<strong>de</strong>l dadurch verzögert, dass<br />
<strong>de</strong>r Markt für Schnittblumen, die ebenfalls vielfach<br />
unter Glas erzeugt wer<strong>de</strong>n, in Deutschland<br />
seit Jahren rückläufig ist. Daher ist in diesem<br />
Segment nicht mit einer Aus<strong>de</strong>hnung von Produktionsflächen<br />
zu rechnen. Von <strong>de</strong>n großen<br />
und sehr großen Zierpflanzenbaubetrieben haben<br />
sich viele auf die Produktion im Freiland<br />
spezialisiert. Von diesen Betrieben gibt es zwar<br />
noch relativ wenige, doch sind sie nach <strong>de</strong>n<br />
ZBG-Analysen vergleichsweise erfolgreich, weshalb<br />
davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n kann, dass die<br />
Betriebe dieser Gruppe weiter wachsen wer<strong>de</strong>n<br />
und ihre Anzahl zunehmen wird. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
vor <strong>de</strong>m Hintergrund steigen<strong>de</strong>r Energiepreise<br />
besteht eine Ten<strong>de</strong>nz zur Aus<strong>de</strong>hnung <strong>de</strong>r Freilandproduktion.<br />
Bei <strong>de</strong>n Baumschulen haben sich aus struktureller<br />
Sicht die geringsten Verän<strong>de</strong>rungen ergeben.<br />
Die Anzahl <strong>de</strong>r Betriebe und die Produktionsfläche<br />
sind bei <strong>de</strong>n spezialisierten Baumschulen<br />
mit <strong>de</strong>m Schwerpunkt Erzeugung nur geringfügig<br />
gesunken. Auffällig ist, dass die Verän<strong>de</strong>rungen<br />
keinem klaren Muster zu folgen scheinen. Dennoch<br />
ist die durchschnittliche Betriebsfläche <strong>de</strong>r<br />
baumschulischen Großbetriebe am stärksten<br />
gewachsen, im Vergleich zu <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Produktionssparten<br />
aber in geringerem Ausmaß.<br />
Auffällig ist <strong>de</strong>r Unterschied zwischen <strong>de</strong>n durchschnittlichen<br />
Betriebsgrößen in <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Anbauzentren<br />
Ammerland und Pinneberg: in<br />
Schleswig-Holstein sind die Betriebe <strong>de</strong>utlich<br />
größer. Von einer Fortsetzung <strong>de</strong>s Strukturwan<strong>de</strong>ls<br />
in <strong>de</strong>r Baumschulsparte hin zu größeren Betrieben<br />
kann daher insbeson<strong>de</strong>re in Nie<strong>de</strong>rsachsen<br />
ausgegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
Der Biogartenbau besteht fast ausschließlich aus<br />
<strong>de</strong>r Erzeugung von Gemüse und Obst. Das<br />
Wachstum <strong>de</strong>s Marktes für Bioware, das zwischen<br />
2002 und 2007 enorm war, verlangsamt<br />
sich zurzeit <strong>de</strong>utlich. Der Grund dafür ist, dass<br />
mittlerweile alle regelmäßig von <strong>de</strong>n Konsumenten<br />
aufgesuchten Einkaufstätten mit Bioware<br />
versorgt sind. Allerdings kann davon ausgegangen<br />
wer<strong>de</strong>n, dass die Nachfrage nach biologisch<br />
erzeugten Obst- und Gemüseprodukten weiterhin<br />
hoch bleibt. Seit<strong>de</strong>m neben <strong>de</strong>m Naturkost-<br />
han<strong>de</strong>l auch <strong>de</strong>r Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>l ein<br />
breites Spektrum an Bioprodukten anbietet,<br />
schreitet die Globalisierung von Produktion und<br />
Einkauf im Biosegment voran, ebenso wie das<br />
bei konventionell erzeugten Gartenbauprodukten<br />
<strong>de</strong>r Fall ist. Für die etablierten <strong>de</strong>utschen Produzenten<br />
von Bioprodukten erhöht diese Entwicklung<br />
<strong>de</strong>n Wettbewerbsdruck und kann Marktanteile<br />
kosten. An<strong>de</strong>rerseits bieten sich durch die<br />
zunehmen<strong>de</strong>n internationalen Märkte Chancen<br />
im Export, die allerdings noch vergleichsweise<br />
unsicher sind. Im Biogartenbau ist ein Strukturwan<strong>de</strong>l<br />
unter ähnlichen Vorzeichen wie bei <strong>de</strong>n<br />
konventionell wirtschaften<strong>de</strong>n Betrieben zu erkennen.<br />
Die Entwicklung hin zu größeren und<br />
stärker spezialisierten Betrieben wird sich in Zukunft<br />
verstärken.<br />
Im konventionellen und im biologischen Anbau<br />
haben Produktinnovationen das Potenzial, eigentlich<br />
als gesättigt eingestufte Märkte weiter<br />
zu vergrößern. Beispiele dafür sind Produkte <strong>de</strong>r<br />
Bereiche Convenience Food und Functional<br />
Food, Clubsorten beim Obst o<strong>de</strong>r Neuzüchtungen<br />
von Blumen und Pflanzen. Solche Produktinnovationen<br />
können zur Erschließung neuer<br />
Käuferschichten o<strong>de</strong>r, wenn durch die Innovationen<br />
vorhan<strong>de</strong>ne Produkte am Markt substituiert<br />
wer<strong>de</strong>n, zur Verschiebung <strong>de</strong>r Nachfrage hin<br />
zum neuen Produkt führen.<br />
Im Wettbewerb <strong>de</strong>r Unternehmen sind Verän<strong>de</strong>rungen<br />
festzustellen. Der Wettbewerb besteht<br />
heute nicht mehr primär zwischen <strong>de</strong>n einzelnen<br />
Unternehmen, son<strong>de</strong>rn fin<strong>de</strong>t eher zwischen <strong>de</strong>n<br />
verschie<strong>de</strong>nen Wertschöpfungsketten statt, <strong>de</strong>nen<br />
die Unternehmen angeschlossen sind. Dies<br />
gilt für alle Ebenen <strong>de</strong>r Wertschöpfung, d. h. für<br />
die gartenbauliche Produktion ebenso wie für die<br />
verschie<strong>de</strong>nen Han<strong>de</strong>ls- und Verarbeitungsstufen.<br />
Vor diesem Hintergrund hat die Steuerung<br />
von Wertschöpfungsketten die Aufgabe, die<br />
Summe <strong>de</strong>r Kosten in einer Wertschöpfungskette<br />
zu senken und sie gleichzeitig flexibel genug zu<br />
halten, um auf verän<strong>de</strong>rte Anfor<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>r<br />
Zukunft reagieren zu können. Das führt zu <strong>de</strong>n<br />
Fragen, wer Wertschöpfungsketten steuern kann<br />
und wie sie zu steuern sind, um <strong>de</strong>ren Wettbewerbsfähigkeit<br />
zu erhöhen. Ein wichtiger Aspekt<br />
dabei ist die Verteilung <strong>de</strong>s Nutzens aus <strong>de</strong>r Zusammenarbeit<br />
<strong>de</strong>r Unternehmen innerhalb von<br />
Wertschöpfungsketten. Die Nutzenverteilung darf<br />
nicht <strong>de</strong>rart einseitig sein, dass die Motivation<br />
einzelner Akteure in einer Wertschöpfungskette<br />
sinkt, sich engagiert in sie einzubringen, o<strong>de</strong>r<br />
dass sogar die Zusammenarbeit in Frage gestellt
186 Walter Dirksmeyer: <strong>Schlussfolgerungen</strong><br />
wird. Bisher überwiegt bei <strong>de</strong>r Verteilung <strong>de</strong>s<br />
Nutzens jedoch weitgehend das Prinzip <strong>de</strong>r<br />
Stärke, was auch in <strong>de</strong>r vielfach von Erzeugern<br />
und Angebotsbündlern beklagten Nachfragemacht<br />
<strong>de</strong>s Lebensmitteleinzelhan<strong>de</strong>ls zum Ausdruck<br />
kommt. Es sind jedoch einige eher kooperativ<br />
gestaltete Ansätze <strong>de</strong>r Zusammenarbeit zu<br />
beobachten. Auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s Funktionierens<br />
und Optimierens von Wertschöpfungsketten sind<br />
noch viele Forschungsfragen offen. Mit <strong>de</strong>n Fragen<br />
nach <strong>de</strong>r Art wirksamer Steuerungsmechanismen<br />
und <strong>de</strong>ren Optimierung sowie einer sinnvollen<br />
Nutzenverteilung zwischen <strong>de</strong>n Akteuren<br />
einer Wertschöpfungskette wur<strong>de</strong>n schon zwei<br />
sehr wichtige angesprochen. Für die Analyse <strong>de</strong>r<br />
Wettbewerbsfähigkeit <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Produktionsgartenbaus<br />
wäre daher neben einem län<strong>de</strong>rübergreifen<strong>de</strong>n<br />
Vergleich von Produktionskosten<br />
auch die Untersuchung <strong>de</strong>r Leistungsfähigkeit<br />
von international konkurrieren<strong>de</strong>n Wertschöpfungsketten<br />
ein wertvoller Beitrag.<br />
Aus <strong>de</strong>m Klimawan<strong>de</strong>l sind nach heutigem<br />
Kenntnisstand keine beson<strong>de</strong>ren Probleme für<br />
<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Produktionsgartenbau zu erwarten.<br />
Verän<strong>de</strong>rungen, beispielsweise im Befallsdruck<br />
von Scha<strong>de</strong>rregern und -pilzen, gehören<br />
zum routinemäßigen Geschäft gartenbaulicher<br />
Produzenten. Die zu erwarten<strong>de</strong>n Verschiebungen<br />
im Nie<strong>de</strong>rschlag können zwar zu steigen<strong>de</strong>n<br />
Bewässerungskosten führen, wer<strong>de</strong>n jedoch keine<br />
größeren Probleme aufwerfen, da gartenbauliche<br />
Produktionsflächen normalerweise auch<br />
jetzt schon bewässert wer<strong>de</strong>n. Allerdings wer<strong>de</strong>n<br />
aus <strong>de</strong>n klimatischen Verän<strong>de</strong>rungen regionale<br />
Verschiebungen im Anbau von gartenbaulichen<br />
Kulturen resultieren. Dies gilt national wie international.<br />
Höhere Durchschnittstemperaturen und<br />
geringere Sommernie<strong>de</strong>rschläge wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n<br />
Anbau einiger Kulturen, die in Vergangenheit nur<br />
in Süd<strong>de</strong>utschland produziert wur<strong>de</strong>n, weiter in<br />
<strong>de</strong>n Nor<strong>de</strong>n Deutschlands verschieben. Im Gegensatz<br />
dazu können einige Kulturen aus <strong>de</strong>n<br />
Mittelmeerlän<strong>de</strong>rn auch in Süd<strong>de</strong>utschland anbauwürdig<br />
wer<strong>de</strong>n. Aus diesem Hintergrund resultiert<br />
die Frage nach geeigneten neuen Gartenbauerzeugnissen,<br />
mit <strong>de</strong>nen das bisherige<br />
Anbauspektrum erweitert wer<strong>de</strong>n kann. Eine gezielte<br />
Suche danach kann sich als äußerst sinnvoll<br />
erweisen. Durch die zu erwarten<strong>de</strong>n Verschiebungen<br />
beim Anbau von gartenbaulichen<br />
Produkten wäre es als Folge <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls<br />
nicht überraschend, wenn die Mitte und <strong>de</strong>r Nor<strong>de</strong>n<br />
Europas, und damit auch Deutschland, im<br />
Vergleich zu Sü<strong>de</strong>uropa Marktanteile gewännen.<br />
In <strong>de</strong>r Berufsausbildung im Produktionsgartenbau<br />
sowie bei <strong>de</strong>n gartenbaulichen Fachschulen<br />
sinkt die Anzahl <strong>de</strong>r jeweiligen Absolventen seit<br />
Jahren. Die Prognose zeigt, dass die Absolventenzahlen<br />
<strong>de</strong>utlich geringer sind als <strong>de</strong>r Bedarf<br />
an Fach- und Führungskräften in <strong>de</strong>n gartenbaulichen<br />
Produktionsbetrieben. Daher sind die Absolventenzahlen<br />
nicht nachhaltig. Es bestehen<br />
<strong>de</strong>rzeit in vielen <strong>Bund</strong>eslän<strong>de</strong>rn bereits Lücken<br />
zwischen <strong>de</strong>m Bedarf und <strong>de</strong>m Angebot von insbeson<strong>de</strong>re<br />
Meistern und Technikern. In Ansätzen<br />
ist dies regional sogar schon bei <strong>de</strong>n Fachkräften<br />
<strong>de</strong>r Fall. Wenn <strong>de</strong>r Berufsstand nicht<br />
massiv an <strong>de</strong>r Verbesserung <strong>de</strong>s gärtnerischen<br />
Berufsbil<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>s Images <strong>de</strong>s Gartenbaus in<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft arbeitet, kann sich <strong>de</strong>r Fach-<br />
und Führungskräftemangel <strong>de</strong>rart verschärfen,<br />
dass er zu einer existenziellen Bedrohung für<br />
<strong>de</strong>n Fortbestand und das Wachstum <strong>de</strong>r Betriebe<br />
im Produktionsgartenbau wird.<br />
Als Sektor ist <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche Produktionsgartenbau<br />
relativ gut aufgestellt. Der Strukturwan<strong>de</strong>l<br />
wird sich fortsetzen, was in allen Produktionssparten<br />
insbeson<strong>de</strong>re zu Lasten <strong>de</strong>r kleinen und<br />
mittelgroßen Erzeuger gehen wird. Maßgeblichen<br />
Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit <strong>de</strong>s<br />
Produktionsgartenbaus hat die Weiterentwicklung<br />
<strong>de</strong>r Zusammenarbeit entlang <strong>de</strong>r Wertschöpfungsketten.<br />
Soweit es <strong>de</strong>rzeit abschätzbar<br />
ist, wer<strong>de</strong>n als Folge <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls die daraus<br />
resultieren<strong>de</strong>n Chancen die Probleme mehr<br />
als ausgleichen. Eine große Gefahr droht <strong>de</strong>m<br />
Produktionsgartenbau jedoch durch <strong>de</strong>n Mangel<br />
an Nachwuchs bei Fachkräften und vor allem bei<br />
Führungskräften, so dass <strong>de</strong>r Berufsstand dieses<br />
wichtige Problem vorrangig lösen muss.