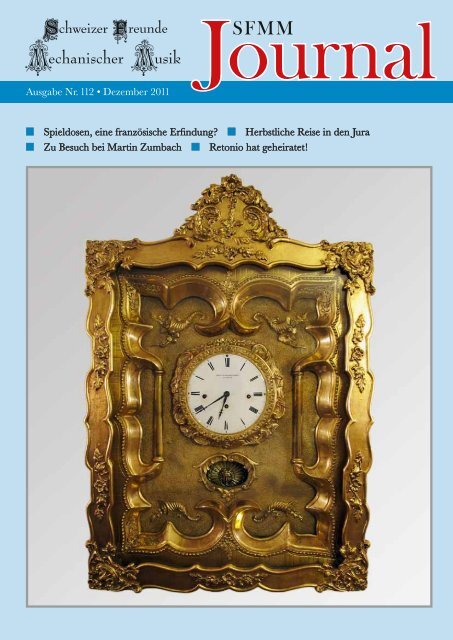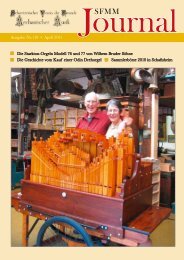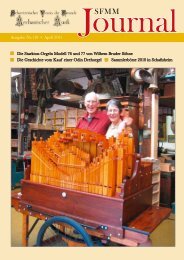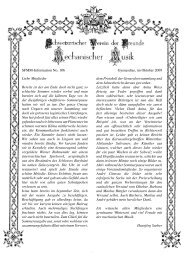Dezember - SFMM
Dezember - SFMM
Dezember - SFMM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
echanischer usik<br />
Ausgabe Nr. 112 • <strong>Dezember</strong> 2011<br />
Schrift: Bernhard Modern Std, Roman<br />
Überarbeitete Variante, eingemittet<br />
4. Juli 2011<br />
chweizer reunde<br />
Journal<br />
<strong>SFMM</strong><br />
■ Spieldosen, eine französische Erfindung ? ■ Herbstliche Reise in den Jura<br />
■ Zu Besuch bei Martin Zumbach ■ Retonio hat geheiratet !
2<br />
echanischer usik<br />
VORsTAND<br />
Schrift: Bernhard Modern Std, Roman<br />
Überarbeitete Variante, eingemittet<br />
4. Juli 2011<br />
IMPREssuM<br />
chweizer reunde<br />
Präsident<br />
André Ginesta<br />
Seestrasse 356, 8708 Männedorf<br />
Tel. 044 920 38 57<br />
E-mail: info@ginesta.ch<br />
Vizepräsident<br />
Max Gautschi<br />
Erlenweg 1, 5503 Schafisheim<br />
Tel. 062 891 96 07<br />
E-mail: max.gautschi@kakteen.ch<br />
Aktuar<br />
Edi Niederberger<br />
Rankweg 13, 4410 Liestal<br />
Tel. 061 921 48 64<br />
E-mail: info@drehorgel-werkstatt.ch<br />
Kassiererin<br />
Barbara Bürgler<br />
Zehntenstr. 31, 8800 Thalwil<br />
Tel. 044 720 78 09<br />
E-mail: barbara.buergler@bluewin.ch<br />
Redaktion<br />
Irina Selivanova, Hansjörg Surber<br />
Hunyadi köz 28, HU-8315 Gyenesdiás<br />
Tel. 0036 83 311 376<br />
E-mail: redaktion@sfmm.ch<br />
info@musikautomaten-ungarn.eu<br />
Druck<br />
Gutenberg Druck AG<br />
Mittlere Bahnhofstrasse 6<br />
8853 Lachen SZ<br />
Tel. 055 451 28 11<br />
Fax 055 451 28 12<br />
E-mail: info@gutenberg.ag<br />
Adressverwaltung<br />
Markus Bürgler<br />
Zehntenstr. 31, 8800 Thalwil<br />
Tel. 044 720 78 09<br />
E-mail: info@drehorgel.ch<br />
www.sfmm.ch<br />
Postadresse<br />
c/o André Ginesta<br />
Seestrasse 356, 8708 Männedorf<br />
Tel. 044 920 38 57<br />
E-mail: info@sfmm.ch<br />
Internet / E-mail<br />
Markus Bürgler<br />
Zehntenstrasse 31, 8800 Thalwil<br />
Tel. 044 720 78 09<br />
E-mail: info@drehorgel.ch<br />
1. Beisitzer<br />
Paul Fricker<br />
Rummelring 8, 5610 Wohlen<br />
Tel. 056 621 97 01<br />
E-mail: pmfricker@bluewin.ch<br />
2. Beisitzer<br />
Raphael Lüthi<br />
Kirchstrasse 7, D-79183 Waldkirch<br />
Tel. 0049 7681 493 70 27<br />
E-mail: dingdong5378@gmx.de<br />
Ehrenpräsident<br />
Fredy Künzle<br />
Bürgistrasse 5, 9620 Lichtensteig<br />
Tel. 071 988 37 66<br />
E-mail: musikmuseum@gmx.ch<br />
Bankverbindung<br />
Postcheckkonto : 85-667192-3<br />
IBAN : CH28 0900 0000 8566 7192 3<br />
BIC : POFICHBEXXX<br />
Redaktions- und Anzeigenschluss<br />
15.3.; 15.7.; 15.11.<br />
Inserate<br />
Privatinserate für Mitglieder : gratis<br />
Geschäftsinserate :<br />
1 Seite : CHF 180.–<br />
1/2 Seite : CHF 100.–<br />
1/4 Seite : CHF 60.–<br />
Beilagen : CHF 180.–<br />
Jährliche Mitgliederbeiträge<br />
Einzelmitglieder CHF 60.–<br />
Doppelmitglieder CHF 80.–<br />
Aufnahmebeitrag CHF 50.– / 60.–
Liebe Mitglieder<br />
Schon neigt sich wieder ein Jahr dem Ende<br />
zu, dabei hat es doch eben erst so richtig<br />
begonnen ! Geht es Euch manchmal auch<br />
so? Die Jahre scheinen immer mehr zu<br />
fliegen, je älter man wird, desto schneller.<br />
Dies hängt sicher damit zusammen, dass<br />
ein einzelnes Jahr in Relation des erlebten<br />
Lebens immer einen kleineren Prozentsatz<br />
ausmacht. Aber seien wir ehrlich, wir<br />
haben auch immer so viel vor, haben dauernd<br />
Termine, aber auch immer neue<br />
Ideen, die wir unbedingt verwirklichen<br />
müssen!<br />
Nun, hoffentlich geben die Feiertage uns<br />
die Möglichkeit, einen Moment innezuhalten<br />
und uns am Erreichten zu freuen. War<br />
da dieses Jahr nicht die erste Ausgabe des<br />
neuen Journals, die GV im Rebberg, viele<br />
Drehorgeltreffen bei tollem Wetter im<br />
Frühjahr und Herbst? Konnte der Vorstand<br />
Eure Erwartungen erfüllen? Wenn ja, dann<br />
ist dies Ansporn, auch das nächste Jahr<br />
mit Elan in Angriff zu nehmen.<br />
Nicht vergessen sei der Fernsehfilm der<br />
SRG in der Reihe NZZ Format. Frau<br />
Bischof schreibt mir, dass am 23. <strong>Dezember</strong><br />
2010 139 000 Personen die Sendung<br />
gesehen haben, was beachtlich sei, erfolgte<br />
die Ausstrahlung doch knapp vor<br />
Mitternacht. Auf 3Sat wurde die Sendung<br />
von 100 000 Deutschen und 20 000 Österreichern<br />
mitverfolgt!<br />
Der Vorstand ist gewillt, das Journal auszubauen,<br />
d. h. vermehrt Fachbeiträge zu<br />
publizieren. Ganz besonders wollen wir<br />
das Augenmerk auch auf Musikdosen richten.<br />
Es ist doch erstaunlich, wie in den<br />
USA, in Frankreich und vor allem in Grossbritannien<br />
geforscht wird hinsichtlich<br />
Schweizer Musikdosen. Zahlreiche Artikel<br />
und Bücher wurden über dieses Thema<br />
schon geschrieben. Und in der Schweiz ?<br />
Hier gibt es kaum eine Publikation neueren<br />
Datums, geschweige denn eine Diskussion.<br />
Editorial<br />
Wir haben uns bewusst die Erlaubnis geben<br />
lassen, einen Artikel, der dieses Jahr im<br />
Journal des englischen Vereins erschienen<br />
ist, zu übersetzen und in dieser Ausgabe<br />
abzudrucken. Er ist sicher etwas kontrovers,<br />
aber gerade dies sollte uns dazu bringen,<br />
uns mit der Materie zu beschäftigen<br />
und eine Diskussion auszulösen.<br />
Seit Jahren beobachte ich, dass sich die<br />
Engländer wirklich intensiv mit den Musikdosen<br />
befassen, aber auch einen Komplex<br />
haben, weil sie als Land der Ingenieure<br />
wirklich nichts mit der Erfindung und<br />
Entwicklung der Musikdose zu tun hatten.<br />
Sie waren wohl die besten Kunden, können<br />
es aber offenbar nicht verwinden, dass die<br />
kleine Schweiz hier führend war. Daher<br />
wird immer wieder versucht zu beweisen,<br />
dass nicht ein Schweizer der Erfinder gewesen<br />
sei, vor allem daher nicht Antoine<br />
Favre! Dabei wird von den Engländern ein<br />
ganz kleines Detail vergessen, nämlich<br />
dass Genf erst 1815 zur Schweiz kam, also<br />
Favre logischerweise Franzose war und<br />
die Musikdose tatsächlich keine « Schweizer<br />
Erfindung » war! Man rennt also offene<br />
Türen ein, ganz abgesehen davon, dass die<br />
Frage der Nationalität wohl das Uninteressanteste<br />
ist an der Geschichte und Entwicklung<br />
dieses schönen Instruments.<br />
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie<br />
gerne über ein neues Buch informieren,<br />
das eben in Ste-Croix herausgekommen ist<br />
über die Sammlung Hr. Dr. Wyss. Er sammelte<br />
nicht Musikdosen, sondern die Apparate,<br />
die für deren Herstellung benutzt<br />
wurden. Diese Sammlung muss einmalig<br />
sein und ausserordentlich wertvoll für die<br />
Geschichte der Musikdose. Das Buch beschreibt<br />
sehr klar und verständlich die<br />
Herstellung der Musikdosen, in diesem Zusammenhang<br />
natürlich auch deren Entwicklungsgeschichte<br />
und vor allem die<br />
verschiedenen Fabrikations-Apparate, die<br />
ja meinst speziell für Musikdosen hergestellt<br />
wurden. Das Buch ist ausserordentlich<br />
informativ und für Liebhaber von Walzenmusikdosen<br />
ein « Muss », leider aber<br />
nur in französischer Sprache erhältlich<br />
3
4<br />
(L’atélier du Dr. Wyss, Edition : Mon Village<br />
S. A., Case Postale 126, Ste-Croix,<br />
Tel. +41 24 454 46 80, CHF 25.–, ISBN<br />
2-88194-213-X).<br />
In Seewen fand Ende Oktober die Eröffnung<br />
der neuen Sonderausstellung über<br />
« 100 Jahre Welte-Philharmonie-Orgel »<br />
statt. Die Veranstaltung verlief im üblichen<br />
Rahmen mit interessanten Ansprachen,<br />
welchen viele neue und interessante Informationen<br />
entnommen werden konnten.<br />
Etwas enttäuschend waren die Vorführungen<br />
der Instrumente im Orgelsaal. Diese<br />
waren kaum hörbar, was wohl nicht nur<br />
auf die zahlreichen Besucher zurückzuführen<br />
war. Mir scheint, dass dieser Saal ein<br />
akustisches Problem hat. Vielleicht am<br />
eindrucksvollsten waren die über 1500<br />
Musikrollen der Welte Philharmonie, die<br />
für die Besucher attraktiv aufgebaut wurden.<br />
Als sensationell möchte ich die begleitende<br />
Publikation « Wie von Geisterhand »<br />
bezeichnen. Noch hatte ich nicht die Mög-<br />
13. Internationales Karussell- und<br />
Drehorgel-Festival in Winterthur<br />
vom 29. september bis 1. Oktober 2011<br />
Winterthur verfügt über eine sehr geeignete<br />
Altstadt für ein Orgeltreffen. Sie ist<br />
flach und hat nicht so enge Gassen wie<br />
viele andere Städte. Natürlich gibt es Gässchen,<br />
aber die Hauptgassen sind sehr breit.<br />
Zusammen mit dem ebenfalls grosszügigen<br />
Kirchenplatz könnte man am Graben<br />
und an der Steinberggasse daher gut je vier<br />
bis sechs Karussellorgeln gruppieren, welche<br />
nacheinander je 1 Stück (wirklich nur<br />
ein Stück) spielen würden. Dies wäre sicher<br />
im Sinne der Besucher, die Abwechslung<br />
lieben und den Klang der Orgeln vergleichen<br />
könnten.<br />
Leider waren die 11 Grossorgeln doch sehr<br />
verstreut aufgestellt und forderten die Besucher<br />
zum vielen Gehen. Irgendwie kam<br />
durch diese Entfernungen keine richtige<br />
lichkeit, dieses Buch im Detail zu lesen,<br />
aber mir scheint, dass wohl für Welte noch<br />
nie so ein umfassendes Wert erschienen<br />
ist mit Schwergewicht auf der Musikinterpretation<br />
und nicht so sehr auf den reinen<br />
historischen Daten. Freunde von Orchestrionen,<br />
Konzertorgeln und Reproduktionsklavieren<br />
müssen dieses Buch erwerben<br />
oder es sich zu Weihnachten schenken lassen<br />
! (Bezug im Museum für Musikautomaten,<br />
Seewen SO, Tel. +41 61 915 98 80,<br />
CHF 39.–)<br />
Allen Mitgliedern wünsche ich ein schönes,<br />
von mechanischer Musik begleitetes Weihnachtsfest,<br />
einige ruhige, erholsame Feiertage<br />
im Kreise der Familie und auch Lust,<br />
das Jahr 2012 dynamisch in Angriff zu<br />
nehmen.<br />
Euer Präsident<br />
André Ginesta<br />
Stimmung auf, mindestens am Samstag,<br />
als zudem die Stadt das Spielen über die<br />
Mittagszeit verbot! Dies bedeutet im<br />
Herbst dann doch eine gesamthaft kurze<br />
Spielzeit.<br />
Erfreulicherweise zog das schöne Karussell<br />
viele Zuschauer an. Es war toll zu beobachten,<br />
wie viele junge Familienväter<br />
ihren Zöglingen das Karussellfahren beibrachten!<br />
In der Altstadt könnten sicher 40 bis 50<br />
Drehorgelspieler in Grüppchen aufspielen,<br />
ohne einander musikalisch « auf die Füsse<br />
zu treten ». Erstaunlicherweise waren nur<br />
17 oder 19 Teilnehmer anwesend, davon 12<br />
Teilnehmer aus Berlin. Diese spielten zusammen<br />
in einer Gruppe, so dass leider die
Drehorgeln von der Bevölkerung kaum<br />
wahrgenommen wurden. Schade, auch hier<br />
kaum Stimmung.<br />
Aber es war schön, die alten Freunde aus<br />
Berlin zu treffen, vor allem auch Margot<br />
Wolf, die es sich trotz ihres hohen Alters<br />
von 96 Jahren nicht nehmen liess, in die<br />
« Schweizer Provinz » zu reisen und ihre<br />
20er-Holl zu spielen. Herzlichen Dank<br />
Margot!<br />
Wie könnte dieses Festival zum wahren<br />
Event und prägend für die Bevölkerung<br />
werden? Mir scheint, das konzentrierte,<br />
abwechselnde Spielen der Karussellorgeln<br />
an einem bis drei Standorten und mehr<br />
Drehorgelspieler mit vielen verschiedenen,<br />
interessanten Instrumenten würden den<br />
Anlass eher zum Fest der Bevölkerung machen<br />
und Stimmung vermitteln. Auch<br />
sollte man eventuell den Sonntag einbeziehen,<br />
dann kommen nämlich im Allgemeinen<br />
wirklich die Besucher an ein Treffen,<br />
die mechanische Musik hören wollen!<br />
Wenn die meisten Festivals zu viele Teil-<br />
nehmer in Relation zur Grösse der Stadt<br />
haben, trifft in Winterthur das genaue Gegenteil<br />
zu. Schade!<br />
Dies sind die gut gemeinten<br />
Betrachtungen des Zaungastes,<br />
André Ginesta<br />
5
6<br />
Zum Titelbild :<br />
Wiener Rahmenuhr mit spielwerk<br />
Hansjörg Surber<br />
Kürzlich konnten wir in Keszthely, Ungarn,<br />
diese schöne Wiener Rahmenuhr mit<br />
Musik erwerben.<br />
Wiener Rahmenuhren galten als luxuriöse<br />
Uhren und waren in der Zeit ab etwa 1830<br />
bis 1865 sehr populär. Der Aufbau der<br />
Uhrwerke war immer ähnlich: 24 Stunden<br />
Laufwerk, 4/4 Schlagwerk mit Angabe der<br />
Stunden auf zwei Tonfedern, sogenannter<br />
Beispiel einer Wiener Portaluhr mit Musik (Sammlung Irina und Hansjörg<br />
Surber)<br />
Wienerschlag. Von der gleichen Art waren<br />
die Werke der Wiener Portaluhren, welche<br />
auch etwa im gleichen Zeitraum hergestellt<br />
wurden. Vereinzelt wurden sowohl<br />
die Rahmen- wie auch die Portaluhren mit<br />
Musikwerken ausgestattet, welche jede<br />
volle Stunde ausgelöst wurden.<br />
Bei den Musikwerken handelte es sich<br />
durchwegs um solche österreichischer<br />
Herkunft. Die bekanntesten Hersteller<br />
waren Rebícek in Prag (Tschechien gehörte<br />
damals zu Österreich) und die Gebrüder<br />
Olbrich in Wien.<br />
Wiener Portal- und Rahmenuhren wurden<br />
jedoch nicht nur in Wien hergestellt. Es<br />
gab auch zahlreiche Produzenten dieser<br />
Uhren in Prag, Pressburg (Bratislava) und<br />
Budapest. Naheliegender Weise aus geographischen<br />
Gründen findet man in den in<br />
Prag hergestellten Uhren mit Musikwerken<br />
fast nur Werke von Rebícek, Uhren aus<br />
Wien sind mit Musikwerken von Rebícek,<br />
Olbrich und anderen ausgerüstet. In Uhren<br />
aus Budapest hingegen findet man praktisch<br />
ausnahmslos Musikwerke von Olbrich.<br />
Die meisten österreichischen Kammspielwerke<br />
wurden für den Einbau in Uhren gebaut.<br />
Die Mehrzahl davon hat zwei Melodien.<br />
Die Werke sind von guter Qualität,<br />
die Geschwindigkeit der Walzen ist langsamer<br />
als bei den Schweizer Spielwerken,<br />
so dass die Bestiftung äusserst präzise erfolgen<br />
musste. Österreichische Musikwerke<br />
mit mehr als zwei Melodien sind<br />
heute selten zu finden.<br />
Unsere Rahmenuhr misst 47 x 69 cm und<br />
ist teilweise blattvergoldet. Durch die<br />
kleine Öffnung sieht man das schöne Sonnenpendel.<br />
Auf dem Emailzifferblatt findet<br />
man die Aufschrift « Martin Niederlander<br />
in Pesth ». Pest ist die östlich der Donau<br />
gelegene Stadthälfte von Budapest. Der<br />
Name des Uhrmachers lässt auf österreichische<br />
oder Wiener Herkunft schliessen.<br />
In der auf den Holzrahmen aufgeschraubten<br />
Halterung für die Tonfedern ist der
Spieldose mit 4 Melodien von Gustav Rebícek in Prag (Sammlung Irina und Hansjörg Surber)<br />
Name « F. Kunz in Wien » eingraviert. Die<br />
Tonfedern wurden meistens nicht von den<br />
Uhrmachern hergestellt sondern von spezialisierten<br />
Produzenten bezogen.<br />
Das Kammspielwerk umfasst 83 Tonzungen,<br />
wovon leider eine im Bassbereich abgebrochen<br />
ist. Aussergewöhnlich ist die<br />
Walze mit drei Melodien, deren Titel ich<br />
nicht eruieren konnte, sowie die auf dem<br />
Tonkamm eingravierte Schrift « In Wien<br />
Jos. Olbrich ». Auf der Gussplatte ist die<br />
Fabrikationsnummer « No. 3647 19395 »<br />
eingraviert.<br />
Josef Olbrich betrieb zusammen mit seinem<br />
Bruder Anton ab den zwanziger Jahren<br />
des 19. Jahrhunderts in Wien an verschiedenen<br />
Adressen eine « Stahlfedern-<br />
Spielwerk-Fabrik ». Anton Olbrich verstarb<br />
7
8<br />
wohl um 1860 herum, worauf sein Sohn<br />
Anton jr. die Fabrik weiterführte. 1864 zog<br />
Josef Olbrich an die Mariahilferstrasse 103,<br />
was bedeuten könnte, dass er nach dem<br />
Tod seines Bruders umgezogen ist. Josef<br />
arbeitete bis zu seinem Tod im Jahre 1875.<br />
Nicht bekannt ist, ob er lediglich als Uhrmacher<br />
oder auch als Spielwerkefabrikant<br />
so lange gearbeitet hat. (Quelle: Luuk<br />
Goldhoorn: Die Österreichische Spielwerkemanufaktur<br />
im 19. Jahrhundert). Ebenso<br />
wenig kann ich aus der Fabrikationsnummer<br />
irgendwelche Schlüsse ziehen. Das<br />
Spielwerk ist nicht nachträglich eingebaut<br />
worden, die Uhr ist mit einem originalen<br />
Auslöser für die Musik versehen. Sicher ist<br />
somit nur, dass das Spielwerk nach 1864<br />
hergestellt wurde, die Uhr möglicherweise<br />
später als das Spielwerk.<br />
Dies ist bereits die zweite blattvergoldete<br />
Wiener Rahmenuhr mit Musik, welche wir<br />
in Ungarn erwerben konnten. Beide Stücke<br />
funktionieren tadellos.
Evelyne Ginesta<br />
Reto Breitenmoser, Gründungsmitglied<br />
unseres Vereins hat in 2. Ehe seine langjährige<br />
Lebenspartnerin Nathalie am Freitag,<br />
den 11. November 2011 geheiratet! Mit<br />
einem rauschenden Fest in der Dreamfactory<br />
mit vielen Freunden, Bekannten und<br />
Verwandten wurde die Ehe besiegelt.<br />
Reto war schon immer sehr aktiv im Show<br />
Business, aber auch in der mechanischen<br />
Musik tätig. Unvergessen sind seine Auktionen,<br />
Ausstellungen und das einmalige<br />
Magic Casino, mit dessen Realisation er<br />
der Zeit weit voraus war.<br />
Auch heute sprüht er immer noch voller<br />
Ideen und in der Dreamfactory in Degersheim<br />
sind Innovationen und Überraschungen<br />
immer wieder anzutreffen. Ihm und<br />
Nathalie wünschen wir alles Gute bei der<br />
Realisation ihrer vielen Träume!<br />
Retonio hat geheiratet !<br />
9
10<br />
Die Verhunzung der Bahnhofautomaten<br />
Etienne Blyelle, CH-1205 Genf<br />
(Übersetzung aus dem Französischen)<br />
Im Jahr 2005 hat Herr Christoph E. Hänggi<br />
im Namen des Schweizerischen Nationalmuseums<br />
und in Zusammenarbeit mit der<br />
SBB eine sehr gute, illustrierte, dreisprachige<br />
Broschüre publiziert. Diese begleitete<br />
eine Ausstellung von Bahnhofautomaten<br />
in Seewen.<br />
Erinnern wir uns daran, dass im Deutschen<br />
alle Apparate mit Münzeinwurf als Automaten<br />
bezeichnet werden. Notieren wir<br />
auch einen Fehler des Artikels: das Plakat<br />
der Seite 5 konnte nicht 1890 publiziert<br />
worden sein, da der Simplontunnel erst<br />
1906 eingeweiht wurde.<br />
Andererseits hat Herr Hänggi sicher recht,<br />
wenn er glaubt, dass die 1883 eingeweihte<br />
Bahnlinie Yverdon-Ste. Croix die Idee<br />
gebar, Musikdosen in den Wartesälen der<br />
Bahnhöfe der Romandie zu installieren,<br />
danach aber auch in anderen Bahnhöfen<br />
und an weiteren öffentlichen Orten wie<br />
Cafés, Restaurants und Souvenirläden, mit<br />
dem Ziel, reiche Privatpersonen zu animieren,<br />
Musikdosen zu kaufen.<br />
Durch die Verkehrszunahme hatten die<br />
Schalterbeamten in den Bahnhöfen keine<br />
Zeit mehr, die Musikdosen in den Wartesälen<br />
regelmässig aufzuziehen. In der Folge<br />
haben die SBB die Bahnhofautomaten elektrifiziert.<br />
So wurde einerseits die Beleuchtung<br />
der Automaten installiert und andererseits<br />
die Walzen mit Strom betrieben.<br />
Aber dadurch wurde der Gang der Walze<br />
so verändert, dass der musikalische Rhythmus<br />
unnatürlich wurde. Man hätte einen<br />
kleinen Motor installieren können, der mit<br />
einem Riemen die Steuerung hätte antreiben<br />
können (und eventuell gleichzeitig den<br />
Windregulator eliminieren können).<br />
Dadurch hätte man einen regelmässigen<br />
Gang erreicht, ohne abhängig zu sein von<br />
der Kraft, welche die Zähne hebt und vor<br />
allem nicht durch den Exzenter, der die<br />
Puppen tanzen lässt. Aber es hätte natürlich<br />
ein Risiko des Reissens dieses Riemens<br />
bestanden. Dazu kommt, dass man<br />
so kleine Motoren erst noch finden musste.<br />
Allerdings hatte man ja schon gute Motoren<br />
bei Grammophonen, denen man ein<br />
Reduktionsventil anhängte.<br />
Hätte man diesen Typ Motor akzeptiert,<br />
hätte man ihn über das Rad des Zylinders<br />
arbeiten lassen können, aber es war leider
einfacher, diesen Antrieb über das Zahnrad<br />
des Zylinders zu installieren, trotz der musikalischen<br />
Nachteile! Ich höre noch Fredy<br />
Baud sagen: « man ist ja nicht in einem<br />
Konzert, es geht nur darum, die Kinder zu<br />
amüsieren ». Oh, wenn Vidoudez, der Konstrukteur<br />
dieser Musik, dies gehört hätte,<br />
er hätte sich im Grab umgedreht!<br />
Man hat also die Arretierung, die Aufziehvorrichtung<br />
und die Schnecke, sowie den<br />
Windregulator abmontiert, ohne daran zu<br />
denken, dass man den alten Zustand je<br />
wieder herstellen könnte oder möchte. Ausserdem<br />
kam dazu, dass die automatische<br />
Abstellvorrichtung nicht mehr richtig<br />
funktionierte. So kam es, dass die Musik<br />
manchmal während Stunden spielte, was<br />
die Stifte und vor allem die Zähne abnützte,<br />
die so zu oft spielten. Nämlich so oft, dass<br />
heute Reparaturarbeiten nötig sind, um<br />
den Originalzustand wiederherzustellen.<br />
Was für ein Unsinn!<br />
Um die Musikdosen zudem zu « verjüngen<br />
», wurden die schwarz lackierten Holzteile<br />
mit grünem Filz bedeckt, wie ein<br />
Glasschrank für Ostereier! Andererseits ist<br />
festzustellen, dass die Puppen mit « Tutus »<br />
bekleidet wurden, die aber zum Glück, obschon<br />
sie der Sonne nie ausgesetzt waren,<br />
durch ein halbes Jahrhundert gealtert sind.<br />
Hoffentlich findet man die Mittel, um wenigstens<br />
den einen oder anderen dieser Automaten<br />
– Repräsentanten unserer Vergangenheit<br />
– korrekt zu restaurieren!<br />
11
Fig. 1.: Musikalische Gleichungsuhr<br />
von Janvier. Der<br />
Musikteil ist mit 1775<br />
datiert. (Foto von Hayard<br />
mit Erlaubnis des Verlages.)<br />
12<br />
Die Erfindung der Musikdose<br />
Paul Bellamy, Joint Vice-President der<br />
« Musical Box Society of Great Britain »<br />
(Übersetzung aus dem Englischen)<br />
Vorwort<br />
Die Erfindung der Musikdose ist immer<br />
noch umstritten. Die allgemeine Meinung,<br />
dass Antoine Favre der Erfinder der « Musikwerke<br />
ohne Glocken und Hämmer » sei,<br />
wird angezweifelt !<br />
Favre benutzte seine « Erfindung » bei kleinen<br />
Schnupftabakdosen und es dauerte<br />
etwa zehn weitere Jahre, bevor Andere<br />
diese Entwicklung für eine Vielzahl von<br />
musikalischen Neuheiten wie z. B. Uhrenschlüssel,<br />
Siegelringe, usw. gebrauchten.<br />
Favres Erfindung mag indirekt die Entwicklung<br />
der Schweizer Spieluhrenindustrie<br />
beeinflusst haben, da Uhrmacher ihre<br />
Aufmerksamkeit auf musikalische Neuheiten<br />
richteten, wie die musikalisch anspruchsvollen<br />
Schnupftabakdosen und<br />
dann auch auf grössere, in Kaminuhren<br />
verwendete Zylindermusikdosen, die als<br />
« Cartels » bekannt wurden.<br />
Die Verwendung des Wortes « Cartel » ist<br />
nicht überraschend, weil es von der Uhrenmanufaktur<br />
hergeleitet wurde. Heutzutage<br />
wird es nur für französische Wanduhren<br />
verwendet. In der Vergangenheit, als<br />
die Uhrenherstellung einen wichtigen<br />
Wirtschaftszweig darstellte, hatten sich die<br />
Fabrikanten mit gemeinsamen wirtschaftlichen<br />
Interessen vereint und sich « Cartels »<br />
genannt. Für Glockenspieluhren wurde<br />
ganz einfach der Beiname « Cartel » gebraucht.<br />
Alfred Chapuis schrieb, dass die Entwicklung<br />
der Musikdosen zwei Wege nahm. Der<br />
erste war eine Bereicherung der Uhrenindustrie<br />
mit musikalischen Taschenuhren,<br />
Novelties, sowie kleinen Schnupftabakdosen<br />
(alles ziemlich unmusikalische Produkte).<br />
Der andere war ein Nebenzweig<br />
dieser Industrie mit Fabrikanten wie François<br />
Nicole, François Lecoultre mit seinen<br />
Söhnen David und Henri Lecoultre sowie<br />
andere frühe Musikdosenproduzenten.<br />
Die Musikwerke in den Tabatièren besassen<br />
einen ganz anderen Aufbau als die<br />
Musikwerke der Cartels (zum Einbau in<br />
eine Wanduhr). Der wesentliche Unterschied<br />
lag in der Anordnung der Federwerke<br />
(senkrechte Achsen für Tabakdosen,<br />
waagrechte Antriebsfeder für den Einbau<br />
in Wanduhren). Die Bauart der « Cartels »<br />
ersetzte bald diejenige der Tabatièren, sie<br />
kam ungefähr um 1828 in Mode. Es bleibt<br />
die Frage: Gab es eine separate Entwicklung<br />
für Cartel-Werke, welche sich zum<br />
Einbau in Wanduhren eigneten und waren<br />
diese die Vorgänger der Zylinder-Musikdosen?<br />
Christian Eric und viele andere<br />
glauben, dass dies der Fall war. Sein Artikel<br />
: « Carillon, Immediate predecessor of<br />
the musical Box ? » (Carillon, unmittelbarer<br />
Vorgänger der Musikdose?) ist nachstehend<br />
zusammengefasst :<br />
« Musikwerke mit direkt gezupften, einzeln<br />
aufgeschraubten Zähnen, welche durch<br />
einen gestifteten Zylinder zum Klingen ge-
acht werden, vergleichbar mit der Beschreibung<br />
der Favre-Erfindung, scheinen<br />
viel früher existiert zu haben als jene von<br />
Nicole und Lecoultre. Es ist jedoch nicht<br />
bewiesen, ob diese vor oder nach der<br />
Favre-Erfindung existierten. Es gibt allerdings<br />
eine Ausnahme, nämlich eine vom<br />
Franzosen Antide Janvier hergestellte<br />
Spieluhr, die ein datiertes Spielwerk aufweist<br />
mit einem Kamm, der direkt von einer<br />
gestifteten Walze gezupft wird. » Wenn das<br />
Datum stimmt, wäre dieses Werk um etwa<br />
21 Jahre älter als die Favre-Erfindung.<br />
Genau an diesem Punkt beginnt der Streit<br />
und dies ist auch der Grund, weshalb dieser<br />
Artikel publiziert wurde.<br />
Warum? Das Janvier-Spielwerk wurde von<br />
mehreren Publizisten erwähnt, inklusive<br />
Chapuis und Tardy. Natürlich könnte der<br />
eine Bericht vom anderen kopiert worden<br />
sein, aber keiner bezog sich auf das eingravierte<br />
Datum auf dem Spielwerk – mit<br />
einer Ausnahme, nämlich Hayard. In seiner<br />
ersten Publikation berichtete dieser<br />
über die Details der Janvier-Uhr und hielt<br />
diese fest. Durch einen eigenartigen Zufall<br />
liess sich Hayard durch einen anderen, bedeutenden<br />
und angesehenen Historiker<br />
überzeugen, diese Details in einer 2. Edition<br />
nicht mehr zu erwähnen, da ja Chapuis<br />
den unumstösslichen Beweis erbracht<br />
habe, dass Favre 1796 der Erfinder war!<br />
Der Autor glaubt, dass es falsch ist, Informationen<br />
auf diese Weise zu unterdrücken.<br />
Diese müssen einem grösseren Kreis von<br />
Fachleuten bekannt gemacht werden. Wenn<br />
die Datierung von Janvier falsch war,<br />
braucht es Erklärungen. Wenn sie stimmt,<br />
muss sie erhärtet werden.<br />
Wenn Darwin überredet worden wäre, der<br />
religiösen Rechtgläubigkeit nachzugeben,<br />
hätte sein Werk « Die Entstehung der<br />
Arten » nicht das Licht der Welt erblickt,<br />
aber er hätte dann vielleicht ein ruhigeres<br />
Leben geführt!<br />
Beim Schreiben dieses Artikels habe ich<br />
mich deshalb auf die Werke von anderen<br />
Spieldosen-Historikern bezogen, indem<br />
ich ihre Beobachtungen und ihre Daten zusammengetragen<br />
habe, um meine Zweifel<br />
ebenso wie diejenigen von anderen aufzuzeigen<br />
hinsichtlich der Erfindung von<br />
Favre. Antworten mit nachprüfbaren Informationen,<br />
welche diese Zweifel unterstützen<br />
oder entkräften, sind willkommen.<br />
Falls keine solchen Informationen vorliegen,<br />
lassen wir doch die Janvier-Daten als<br />
ungeklärte Tatsache bestehen.<br />
Paul Bellamy<br />
Es bestreiten heute wenige den durch Alfred<br />
Chapuis erbrachten Beweis, dass Antoine<br />
Favre (1734–1820), der Glocken durch<br />
gestimmte Stahlfedern ersetzt hat, als der<br />
Erfinder der Musikdose angesehen werden<br />
kann. Chapuis nannte dies « mit einem<br />
Kamm gespielte Musik ». Favre ist in Genf<br />
geboren. Seine Gattin war Marie Salomon<br />
und er übernahm den Familiennamen seiner<br />
Frau als Favre-Salomon. Im Verzeichnis<br />
der « Société des Arts de Genève », datiert<br />
vom Februar 1796, erscheinen Details<br />
seiner Erfindung, zitiert als Musikwerke<br />
ohne Glocken und Hämmer. Das passt zur<br />
Beschreibung von einem direkt gezupften<br />
Stahlzahn (d. h. nicht durch einen Hammer<br />
oder Klöppel geschlagen wie in den Glockenspielen).<br />
Trotz der klaren Aussage<br />
von Chapuis ist es offensichtlich, dass der<br />
Fig. 2.: Englische Konsolenuhr<br />
mit Spielwerk von<br />
Stephen Rimbault, London,<br />
etwa 1790. (Foto mit<br />
Erlaubnis des Ashmoleon<br />
Museums Oxford.)<br />
Fig. 3.: Walze einer<br />
Konsolenuhr mit musikalischem<br />
Glockenspiel<br />
mit 12 Glocken und 10<br />
verschiedenen Melodien<br />
von Thwaites und Reed,<br />
London, etwa 1802.<br />
(Foto mit Erlaubnis der<br />
Herausgeber.)<br />
13
Fig. 4 a.: Glockenspielwerk<br />
mit 10 Glocken und<br />
9 Melodien, unsigniert,<br />
etwa 1790.<br />
(Foto mit Erlaubnis von<br />
Christian Eric.)<br />
Fig. 4 b.: Das Melodien-<br />
Wechselsystem des<br />
musikalischen Werkes mit<br />
9 Melodien. (Foto<br />
mit Erlaubnis von Christian<br />
Eric.)<br />
14<br />
gestimmte Stahlkamm, der direkt von<br />
einem gestifteten Zylinder gezupft wurde,<br />
bereits in einem früheren Musikwerk verwendet<br />
worden war. Es scheint, dass nur<br />
ein einziges datiertes Exemplar erfasst<br />
wurde, das einem Franzosen, Antide Janvier,<br />
wie in Fig. 1 illustriert, zugeschrieben<br />
ist. Dieser war der Sohn von Claude<br />
Etienne Janvier und wurde 1751 in Lavanslez-St-Claude<br />
im französischen Jura geboren,<br />
nur ungefähr 60 km von Genf entfernt.<br />
Das Werk von Janvier ist weiter unten beschrieben.<br />
Chapuis deutet an, dass Pierre Jaquet-<br />
Droz und sein Sohn Henri-Louis wahrscheinlich<br />
die ersten waren, die um etwa<br />
1753 Spieluhren in La Chaux-de-Fonds<br />
produziert hatten. Das mag vielleicht für<br />
die Schweiz zutreffen, aber Chapuis bestätigt<br />
auch, dass andere, wie Nicholas Vallin<br />
von London, Musikwerke bauten. überra-<br />
schenderweise bezieht er sich in seinem<br />
Text auf kein Datum, jedoch scheint die<br />
Illustration (Piquet, MBSI Version, Seiten<br />
14 und 15) 1578 dies zu zeigen. Diese<br />
13-Glocken-Uhr befand sich zu einem früheren<br />
Zeitpunkt in der Ilbert Kollektion,<br />
heute im British Museum. Sie ist illustriert<br />
in « A book of English Clocks » von<br />
R. W. Symonds, Penguin 1947, unter anderen<br />
Quellen.<br />
Englische Glockenspieluhren waren somit<br />
Spitzenprodukte. Ein anderes feines Beispiel<br />
bezieht sich auf eine Uhr von Stephen<br />
Rimbault 3, Fig. 2. Das effektive Datum ist<br />
unbekannt, aber er war Uhrmacher zwischen<br />
1744 und 1835. Diese Uhr enthält<br />
alle Elemente der Zylindermusikdose (Typ<br />
Cartel), aber mit 12 abgestimmten Glocken,<br />
jede mit zwei Klöppeln (Hämmern),<br />
angetrieben mittels einer gestifteten Messingwalze,<br />
welche 12 Stücke spielte. Die<br />
Walze (unsichtbar) ist ziemlich identisch<br />
in Durchmesser und Länge mit den Standard<br />
« 13-Inch-Modellen », die in der<br />
Schweiz so populär wurden. Darüber hinaus<br />
ist bekannt, dass praktisch alle in der<br />
Schweiz gebauten Uhren aus englischem<br />
Stahl angefertigt wurden und man kann<br />
berechtigterweise davon ausgehen, dass<br />
die Schweizer Musikkämme auch aus englischem<br />
Stahl gefertigt waren. Andere<br />
Engländer, wie Thwaites & Reed aus London,<br />
fabrizierten gleichartige 12-Glocken-<br />
Glockenspielen 3, etwa 1802, Fig. 3.<br />
Die Geschichte von anderen als englischen<br />
Glockenspielen, welche durch gestiftete<br />
Trommeln funktionieren, beginnt um Mitte<br />
1300. Es handelte sich um riesige Instrumente<br />
mit dem Tonumfang einer Tonleiter,<br />
welche vor allem für religiöse Zwecke in<br />
Kirchenuhren Verwendung fanden. Um<br />
1600 kamen die ersten englischen Glockenspiele<br />
in Mode. Durch ihre Entwicklung<br />
wurden sie in England, Nordfrankreich<br />
und der ehemaligen Grafschaft Flandern<br />
(heute zwischen Belgien, Frankreich<br />
und Holland aufgeteilt) bekannt. Die Skala<br />
war nicht unbedingt chromatisch, jedoch<br />
abgestimmt auf die Folge einer Melodie<br />
oder einer Auswahl von Melodien. Glockenspieluhren<br />
waren ebenfalls mit anderen<br />
Musikinstrumenten bestückt, wie Orgelpfeifen<br />
(bekannt als Flötenuhren) und<br />
Saiteninstrumenten.
Fig. 5 a.: Kaminuhr aus der Empire-Periode<br />
mit abnehmbarer Taschenuhr und Musikwerk<br />
von Breguet. (Foto « La Pendule<br />
Française », Tardy, 1965)<br />
Christian Erics Artikel 2 zeigt den Übergang<br />
von den Glockenspieluhren mit Hämmern<br />
zu solchen mit einem direkt gezupften,<br />
abgestimmten Stahlkamm. Er legt dar,<br />
wie die grundlegenden Komponenten eines<br />
Musikwerkes mit 9 Melodien eines unbekannten<br />
Herstellers mit 10 Glocken, etwa<br />
1790, dem Basisaufbau eines gleichwertigen<br />
Kamm-Spielwerkes entsprachen,<br />
Fig. 4 A. Die Glocken waren folgendermassen<br />
gestimmt, vom Bass bis zu den hohen<br />
Tönen: C, D, E, F, G#, A, B, C#, D#, F. Jede<br />
Glocke hat zwei Schläger, mit Ausnahme<br />
vom Bass C mit nur einem Schläger. Der<br />
Motor ist schneckenförmig angeordnet,<br />
was einen konstanten Antrieb gewährt,<br />
während das Federwerk abläuft. Die kettengetriebene<br />
Aufwickeltrommel hat ein<br />
Stirnradgetriebe, das mittels eines grösseren<br />
Zahnrades den Zylinder antreibt. Der<br />
Geschwindigkeitsregler ist charakteristisch<br />
für spätere Cartelwerke, verfügt er<br />
doch über einen Regulator mit 2 Weinblättern.<br />
Die Neigung der Flügel ist verstellbar,<br />
was eine grobe Abstimmung der Rotation<br />
ermöglicht und damit die Drehgeschwindigkeit<br />
der Walze beeinflusst. Die Walze<br />
ist mit Messingstiften versehen, während<br />
spätere Cartelwerke mit Stahlstiften bestückt<br />
waren. Die seitliche Verschiebung<br />
der Walze zum Melodienwechsel wurde<br />
durch eine abgestufte Schnecken-Nocken-<br />
Steuerung, ähnlich derjenigen in späteren<br />
Musikdosen, ermöglicht. Ein federbetätigter<br />
Hebel dreht dabei die Nockenwelle in<br />
9 Schritten, was einen unmittelbaren Melodienwechsel<br />
bei den Stellrillen (der ungestiftete<br />
Bereich, wo der Zylinder an die<br />
nächste Melodienstelle fährt) bewirkt.<br />
Dies entspricht nicht der späteren Praxis,<br />
wo der Melodienschalthebel entweder gelöst<br />
ist (um die Melodie zu wiederholen)<br />
oder fest bleibt (langsames Drehen der<br />
Nocke bis zur nächsten Tonspur, jedoch im<br />
Bereich der Zylinderlücke). Der Vorgang<br />
des Melodienwechsels ist in den zwei Ansichten<br />
Fig. 4 B dargestellt. Er wird gegen<br />
die Federkraft mittels eines Rades mit vier<br />
Stiften ausgeführt. Beim Drehen des Rades<br />
hebt dieses einen Nocken am Hebel (linkes<br />
Bild) und führt diesen dann unmittelbar in<br />
die nächste Stellrille (rechts). Der Hebel<br />
Fig. 5 b.: Das Musikwerk<br />
der Breguet-Kaminuhr.<br />
(Foto « La Pendule<br />
Français », Tardy, 1965.)<br />
15
Fig. 5 c.: Das Schlag- und<br />
Repetierwerk der Breguet-<br />
Kaminuhr. (Foto « La<br />
Pendule Française », Tardy,<br />
1965.)<br />
16<br />
rastet ein, in einen der 9-eckigen Ausschnitte<br />
des Kronrädchens, um die nächste<br />
Melodienspur zu starten. Nachdem der gestiftete<br />
Zylinder eine volle Umdrehung getätigt<br />
hat, beginnt der nächste Stift auf dem<br />
4-stiftigen Rad den Nocken anzuheben.<br />
David Evans brachte die Aufmerksamkeit<br />
des Autors auf den Franzosen Antide Janvier<br />
(1751–1835). Er produzierte die musikalische<br />
« Kammregulator-Uhr » 4 , wie in<br />
Fig. 1 oben dargestellt. Diese verzichtet auf<br />
Glocken und Schläger, da sie über einen<br />
gestimmten Kamm verfügt, der direkt von<br />
einem gestifteten Zylinder aktiviert wird.<br />
Es handelt sich um sein Werk 181, 1775 in<br />
Verdun begonnen und kurz vor seinem<br />
Umzug nach Paris vervollständigt. Es ist<br />
datiert und signiert, wie all seine Anfertigungen:<br />
Janvier No. 181 9/1784 (d. h. September<br />
1784) auf der rückwärtigen Platte<br />
des Uhrwerks und Janvier 1775 am Fusse<br />
des Musikwerkes. Das Spielwerk entspricht<br />
dem Stil der Cartel-typischen<br />
Spieluhren und sein Kamm verfügt über<br />
75 Zähne in 8 Sektionen, wobei die Anzahl<br />
der Zähne von einigen wenigen bis zu ungefähr<br />
16 variiert. Janvier hat dem Spielwerk<br />
keine Seriennummer zugeteilt, da er<br />
vermutlich (wie aus den beiden leicht abweichenden<br />
Daten ersichtlich) zu jenem<br />
Zeitpunkt noch nicht die ganze Uhr gefertigt<br />
hatte. Das Spielwerk wird bei Bedarf<br />
aktiviert oder aber dem Stundenschlag der<br />
Uhr überlassen, der zwischen 8 Uhr vormittags<br />
und 10 Uhr abends arbeitet. Es<br />
werden abwechselnd zwei Musikstücke<br />
gespielt. Die beiden Datierungen auf der<br />
Uhr zeigen auf, dass diese Uhr ein in Verdun<br />
hergestelltes Jugendwerk war und<br />
1784 (kurz vor seiner Ankunft in Paris) fertiggestellt<br />
wurde, vielleicht um das Uhrwerk<br />
an eine Zylindermusikdose anzupassen,<br />
für die er vorher noch keine Verwendung<br />
hatte. Es ist wichtig festzuhalten, wie<br />
genau das Datum angegeben ist, mit dem<br />
Monat (September) und auch dem Jahr.<br />
Das Datum auf dem Werk liegt somit um<br />
21 Jahre vor Favres « Erfindung »! Falls<br />
diese Datierung stimmt, dürfte es schwierig<br />
sein, diese mit dem Bericht von Chapuis<br />
über Favre in Einklang zu bringen.<br />
Janvier lernte die Grundlagen der Mechanik<br />
von seinem Vater und setzte seine Studien<br />
bei Abbot Tournier in Besançon fort.<br />
Die Familie zog 1762 nach Besançon,<br />
kehrte aber um 1771 nach Lavans zurück.<br />
Im Alter von 15 Jahren baute er eine astronomische<br />
Kugel, die an der Akademie der<br />
Wissenschaften in Besançon präsentiert<br />
wurde, als er 17 war. Zu diesem Zeitpunkt<br />
war er in der Lehre als Uhrmacher und zog<br />
später um 1771 nach Paris, wo er ein grosses<br />
Planetarium baute, welches König<br />
Ludwig XV. im Jahre 1773 präsentiert<br />
wurde. Im Jahre 1774 kehrte er nach Verdin<br />
im französischen Jura zurück, wo er<br />
alsdann astronomische Werke konstruierte.<br />
Er war vermutlich der weltweit wichtigste<br />
und innovativste Uhrmacher, sozusagen<br />
das Pendant zu Abraham-Louis Breguet für<br />
Taschenuhren.<br />
Janvier hatte eine höhere Bildung in Latein,<br />
Griechisch, Mathematik und Astronomie.<br />
Er erntete grosses Ansehen für sei-
nen Einfallsreichtum was astronomische<br />
Uhren und die Entwicklung von einwandfrei<br />
klingenden Doppel-Pendeluhren betraf.<br />
Janvier war Royalist, der von Louis<br />
XVI. zum königlichen Uhrmacher ernannt<br />
wurde, und wurde somit ein Opfer der<br />
Französischen Revolution, während der er<br />
gefangen genommen wurde. Nach seiner<br />
Freilassung litt er unter Armut und Not.<br />
Seine Frau verstarb 1792 und in der Folge<br />
verkaufte er seine Waren, Geräte und Pläne<br />
an Breguet. Nachdem die Monarchie wieder<br />
hergestellt war, wurde er mit einer kleinen<br />
Pension belohnt, starb jedoch in Armut<br />
und Vergessenheit.<br />
Sein Lebenswerk ging jedoch nicht verloren,<br />
sondern überlebte durch seine schriftlichen<br />
Arbeiten:<br />
– Essai sur les horloges publiques, pour les<br />
Communes de la campagne, publiziert<br />
durch Doublet in Paris 1811.<br />
– Des revolutions des corps célséstes par le<br />
mécanisme des rouages, wurde durch<br />
P. Didod der Ältere 1812 publiziert.<br />
– « Manuel Chronometrique ou précdis de<br />
ce qui conerne le temps, ses divisions,<br />
ses mesures, leurs usages, usw. », publiziert<br />
1821 durch Firmin Didot von Paris.<br />
– « Recueil des machines composées et<br />
executées » publiziert durch Jules Didot<br />
der Ältere 1828.<br />
Kopien all dieser Publikationen befinden<br />
sich in der Bibliothek der « Worshipful<br />
Company of Clockmakers » in der Guildhall<br />
in London.<br />
Ord-Hume 5 schrieb, dass in Paris die Verwendung<br />
von « Stahlfedern » in Musikwerken<br />
schon mindestens seit 50 Jahren bekannt<br />
war, bevor Favre diese bei Uhren<br />
anwandte. Er konnte aber keine Quellenangabe<br />
liefern, um diese Aussage zu untermauern.<br />
In der Tat schrieb er auch einen<br />
Artikel: Wer erfand die Musikdose 6 ? Er<br />
wies richtigerweise darauf hin, dass die gestifteten<br />
Zylinder « das natürliche Mittel<br />
waren, um ein musikalisches Programm zu<br />
programmieren ». Es gibt Verweise zu<br />
Tardy, indem er bei zwei Uhren Bemerkungen<br />
anbrachte, welche in « La Pendule<br />
Française « abgebildet sind. Bei der ersten<br />
Uhr, im Louis XVI.-Abschnitt beschrieben,<br />
handelt es sich effektiv um Janvier<br />
No. 181, obschon Tardy sie weder Janvier<br />
zugeschrieben hat noch ihre Daten genannt<br />
hat. Bei der zweiten schrieb er, sie datiert<br />
ohne Zweifel aus dem Empire (etwa 1804–<br />
05), eine verglaste Uhr von Breguet. Sie<br />
wird durch eine abnehmbare Taschenuhr<br />
gesteuert, welche Szenen eines türkischen<br />
Marktes zeigt. Fig. 5 A, Fig. 5 B zeigen den<br />
Tonkamm mit 50 Zähnen, jedes Segment<br />
mit 2 Zähnen. Fig. 5 C zeigt den Uhrenmechanismus.<br />
Es ist unwahrscheinlich, dass<br />
Breguet das Spielwerk gemacht hat, denn<br />
er war absolut unmusikalisch, selbst seine<br />
Repetitionsglocken sind verstimmt und er<br />
erhob nie Anspruch darauf, Musikwerke<br />
produziert zu haben. Offenbar stellte er<br />
auch keine Musikdosen her. Ord-Hume argumentiert,<br />
möglicherweise richtig, dass<br />
Favre wohl der erste war, der die Stahlfedern<br />
so verkleinern konnte, dass sie in eine<br />
Uhr oder ein anderes Objekt ähnlicher<br />
Grösse passten.<br />
Es stellen sich die folgenden Fragen:<br />
Warum hat es so viele Jahre gedauert, bis<br />
die Hämmer und Glocken der glockenspielenden<br />
Musikwerke durch den gestimmten<br />
Kamm ersetzt wurden und geschah dies<br />
vor 1796, dem Datum von Favres Erfindung?<br />
Die Einführung des gestimmten (sektionalen)<br />
Stahlkamms gegen Ende des 18. Jahrhunderts,<br />
ob durch Favre oder jemand anderen,<br />
war vielleicht nicht allgemein bekannt<br />
oder es war nicht klar, dass ein Markt<br />
bestand für diese « verbesserte » Version<br />
von Glockenspielen. Die Idee, dass ein<br />
« verbessertes Glockenspiel » ein Eigenleben<br />
als Musikinstrument und eine eigene<br />
Daseinsberechtigung entwickeln könnte,<br />
scheint von den frühen Herstellern von<br />
Cartels während vieler Jahre ignoriert<br />
worden zu sein. War die Verwendung von<br />
Gewichten für die Basstöne und von Federdämpfern<br />
eine unerlässliche Voraussetzung<br />
für die Entwicklung der Musikdose?<br />
Falls die Erfindung einer Person zugeschrieben<br />
werden kann, sagen wir Janvier,<br />
war die Tatsache, dass er Franzose und<br />
praktisch mittellos war, ein Hindernis für<br />
die Schweizer, das Marktpotenzial auszunutzen?<br />
All jene, die damals behaupteten,<br />
dass Favre der Erfinder war, hatten sicherlich<br />
ein wesentliches, wirtschaftliches Interesse,<br />
damit « Musique de Genève » zu<br />
einem weltweit bekannten Marketingbe-<br />
Zu VERKAuFEN<br />
Holländische strassenorgel<br />
Verkaufe (schweren Herzens)<br />
– wegen Platzmangel<br />
meine einzigartige Holländische<br />
Strassenorgel<br />
DE FLIEREFLUITER, Carl Frei,<br />
1923, 36 Tonstufen,<br />
in bestem Zustand, kürzlich<br />
von Martin Wyss revidiert.<br />
Mit zahlreichen Original-<br />
Notenbüchern (Volkslied-<br />
Melodien), auf stilvollem<br />
Dreiradwagen, falls erwünscht<br />
auch mit Mass-<br />
Transportanhänger.<br />
Preis auf Anfrage.<br />
Roland Jeanneret,<br />
Postfach 216, 3000 Bern 13,<br />
Telefon 079 348 88 88<br />
17
18<br />
griff wurde. Wer hätte es gewagt, diesen<br />
bedeutenden Schweizer Fabrikanten zu<br />
widersprechen? Hat Favre damals von<br />
Janvier’s Kamm-Glockenspiel Kenntnis<br />
gehabt? Schliesslich lebten sie nur wenige<br />
Kilometer von einander entfernt. Hätte in<br />
diesem Fall Favre das Registre de la Société<br />
des Arts de Genève informiert und behauptet,<br />
es wäre seine Idee gewesen? Die<br />
Spieluhren, wie auch andere kleine, aber<br />
kostbare musikalische Neuheiten hatten<br />
damals bestimmt Marktpotential und<br />
könnten ihn, wie Ord-Hume vermutete,<br />
dazu gebracht haben, sie in miniaturisierter<br />
Art zu verwenden, eher als sie als eigenständige<br />
Musikinstrumente zu betrachten?<br />
Können wir überdies spekulieren, dass die<br />
Cartel-Werke einen ganz anderen Ursprung<br />
hatten? Die Cartel-Spielwerke in Uhren erscheinen<br />
sehr früh als eine separate Art, die<br />
sich abhebt von den früheren Kaminuhren<br />
mit Glockenspiel und die Entwicklung<br />
scheint parallel zu den Werken der Tabatièren<br />
zu verlaufen. Aber es dauerte nicht<br />
lange, bis der Aufbau der Cartel-Werke<br />
verändert wurde, um den Zweck einer Musikdose<br />
zu erfüllen. Damit wurde der sehr<br />
musikalische, aber viel kleinere und leisere<br />
Vetter, die Schnupftabakdose, konkurrenziert.<br />
Musikarran gements für Glockenspielwerke<br />
waren generell viel einfacher<br />
als z. B. jene Arran gements für die gleich<br />
grossen « Standard-13-Inch »-Musikdosen.<br />
Vielleicht war es notwendig, Erfahrungen<br />
Zum Gedenken : Jan van Dinteren<br />
An seinem Wohnort Geleen ist Jan L. M. van<br />
Dinteren am 22. November 2011 im 81. Lebensjahr<br />
verstorben.<br />
Jan van Dinteren war von grosser Bedeutung<br />
für den Erhalt der Drehorgelkultur in<br />
Holland. Seine grosse Vorliebe waren die<br />
Kirmesorgeln. Für die Erhaltung dieser<br />
Ins trumente hat er sich speziell eingesetzt.<br />
mit der Entwicklung der Tabatièrenwerke<br />
zu sammeln, um dadurch die Programmierkenntnisse<br />
zu verbessern. Aber es wurden<br />
auch sehr komplizierte Stücke für Orgeluhren<br />
geschaffen, so dass dieser Gedanke<br />
eher fallen gelassen werden kann. War es<br />
also eine Sache des technologischen Fortschrittes<br />
und nicht die Geschicklichkeit<br />
des Arrangeurs? Bedurfte es der Entwicklung<br />
grösserer Schneidemaschinen und<br />
Antriebe für Bohrmaschinen zum Bau dieser<br />
grossen Cartel-Werke? Die Idee passt<br />
gut zu François Nicoles einzigartigem, mit<br />
Linien überzogenen Zylinder und zu der<br />
Tatsache, dass er wahrscheinlich der erste<br />
war, der die musikalischen Möglichkeiten<br />
von Cartel-Spielwerken voll ausnutzte.<br />
Man kann hier nur spekulieren, bis weitere<br />
Tatsachen bekannt werden. Also lassen wir<br />
Janvier und seine Daten neben all diesen<br />
Fragen so stehen, bis vernünftige und einleuchtende<br />
Erklärungen mehr Klarheit<br />
bringen.<br />
Literaturhinweise<br />
1 Chapuis, The History of the Musical box<br />
and of Mechanical Music, MBSI version,<br />
Seiten 128–131.<br />
2 Eric, MBSI Journal Vol. XXXVI/2.<br />
3 The Music Box, Vol. 23/8, Seiten 253/4.<br />
4 La Pendule Français’ durch Tardy<br />
5 Ord-Hume, The Musical Clock – 1995<br />
S. 199.<br />
6 Ord-Hume, The Music Box Vol. 7/2.<br />
Vierzig Jahre lang war er im Vorstand des<br />
« Kring van Draaiorgelvrienden ». Lange 21<br />
Jahre war er Redaktor des Quartalsblattes<br />
« Het Pierement ». Er hat dieses Blatt zu<br />
einer, auch international, massgebenden<br />
periodischen Fachzeitschrift gemacht.<br />
Sein Hinschied ist ein grosser Verlust für<br />
die Drehorgelwelt.
Hansjörg Surber<br />
Auf der Rückreise von der Sammlerbörse<br />
in Rüdesheim nahm ich die Gelegenheit<br />
wahr, dem Museum mechanische Klangfabrik<br />
in Haslach einen Besuch abzustatten.<br />
Haslach liegt in Oberösterreich in einem<br />
landschaftlich wunderschönen Teil des<br />
Böhmerwaldes. Leider sah ich auf der Anreise<br />
am Sonntagabend von der Landschaft<br />
gar nichts, da es bereits stockdunkel war.<br />
Ohne Navi hätte ich wohl das in dieser Jahreszeit<br />
verschlafene Haslach bis zum Morgengrauen<br />
nicht gefunden.<br />
Frau Marianne Kneidinger vom Tourismusbüro<br />
Haslach und Frau Else Hofer,<br />
welche die Führungen leitet, haben sich<br />
Zeit genommen, mit mir einen Rundgang<br />
durch das im Winter geschlossene Museum<br />
zu machen und all meine Fragen zu<br />
beantworten. Zufälligerweise fand gleichzeitig<br />
eine Führung einer angemeldeten<br />
Gruppe statt, so dass die Räume nicht ganz<br />
unbelebt aussahen.<br />
Seit Juni 2007 beherbergt eine ehemalige<br />
Haslacher Textilfabrik einen Teil der<br />
Sammlung des Haslachers Erwin Rechberger.<br />
Insgesamt sind 160 Objekte ausgestellt,<br />
welche fast die gesamte Bandbreite<br />
der mechanischen Musik, inklusive Grammophonen<br />
und frühen Radios, abdecken.<br />
Hervorzuheben ist die grosszügige Ausstellungsfläche<br />
von 600 m2, wodurch die<br />
einzelnen Instrumente schön zur Geltung<br />
kommen. Zu erwähnen ist auch der ansprechend<br />
gestaltete Marktplatz im Innern des<br />
Gebäudes, wo man in Schaufenster einiger<br />
« Geschäfte » gucken kann und zum Beispiel<br />
Kinderspielzeuge, Grammophone<br />
oder Uhren entdeckt. Auf dem Marktplatz<br />
selbst steht eine holländische Strassenorgel<br />
und ein Drehorgelspieler hinter einer –<br />
leider unrestaurierten – grossen Molzer<br />
Drehorgel. Erwin Rechberger selbst betreibt<br />
nun seine « Mechanische Wunderwelt<br />
», wo nebst mechanischen Musikinstrumenten<br />
auch mechanisches Spielzeug,<br />
mechanische Reklame, Marionettentheater<br />
und vieles mehr bewundert werden kann.<br />
Museum Mechanische Klangfabrik,<br />
Haslach an der Mühl, Österreich<br />
Eine interessante Xylophonuhr von 1680<br />
Ein schönes Exemplar einer Schwarzwälder<br />
Flötenuhr<br />
19
20<br />
Das Museum ist professionell gestaltet, einige<br />
Instrumente werden vorgeführt. Frau<br />
Hofer gibt sehr gute und unterhaltsam vorgetragene<br />
Informationen zu den Instrumenten<br />
ab. An den Wänden findet man Informationstafeln<br />
zur mechanischen Musik.<br />
Meines Erachtens zu bemängeln ist die<br />
dürftige und zum Teil falsche Beschriftung<br />
der Instrumente. Es fehlt auch ein wenig<br />
das Drum und Dran, das Ambiente, wie<br />
z. B. historische Bilder, Stiche, passendes<br />
Mobiliar. Dies ist aber meine persönliche<br />
Ansicht. Das Museum und auch Haslach<br />
selbst sind auf jeden Fall einen Besuch<br />
wert. Man kann noch weitere Museen besichtigen,<br />
einiges ist noch im Aufbau.<br />
Museum mechanische Klangfabrik<br />
Marktplatz 45, 4170 Haslach, Österreich<br />
Tel. +43 7289 71557 oder +43 7289 72300<br />
www.mechanischeklangfabrik.at<br />
www.haslach.at<br />
Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober,<br />
Dienstag bis Sonntag, 10.30 bis 15.00 Uhr<br />
Führungen um 11.00 Uhr und 14.00 Uhr,<br />
für Gruppen nach Voranmeldung<br />
1. November bis 30. März,<br />
Führungen nach Voranmeldung<br />
Blick in die Grammophon Ausstellung<br />
Harmonika Orchestrion von Louis Cecovi,<br />
Frankreich<br />
Kalliston Organette Orchestrion Kuhl und Klatt von 1925 Interessantes automatisches Glockenspiel<br />
Im Vordergrund ein Lösche<br />
Orchestrion<br />
Blick in das Spielzeuggeschäft<br />
Der Marktplatz
Herbstreise 2011<br />
Hansjörg Surber<br />
Einen Reisebericht schreibt man ja immer<br />
für Leser, die nicht dabei waren. Die Teilnehmer<br />
brauchen ja keinen Bericht zum<br />
Selbsterlebten. Da an dieser sehr interessanten<br />
Schweizer Reise lediglich 24 Mitglieder<br />
teilgenommen haben, lohnt es sich<br />
besonders, einen Bericht zu verfassen.<br />
Damit auch die 24 Teilnehmer etwas davon<br />
haben, hole ich diesmal etwas weiter aus:<br />
Die diesjährige Herbstreise führte uns am<br />
Wochenende vom 17. und 18. September in<br />
den Jura. Die Wetteraussichten waren<br />
nicht gerade rosig, zum Glück hielten sich<br />
dann zumindest die Niederschläge in<br />
Grenzen. Treffpunkt war der Bahnhof Biel,<br />
wo die 24 Teilnehmer in einen Reisebus<br />
umstiegen.<br />
Auf dem Programm standen diesmal Uhren,<br />
vor allem natürlich Musik- und Automatenuhren,<br />
und am Sonntag als Höhepunkt<br />
die sensationellen Automaten aus dem<br />
18. Jahrhundert von Pierre Jaquet-Droz,<br />
welche im Musée d’art et d’histoire in<br />
Neuchâtel ausgestellt sind.<br />
Château des Monts<br />
Nach dem Mittagessen führte uns der Reisebus<br />
in die Anhöhen von Le Locle zum<br />
Château des Monts aus dem Jahre 1790,<br />
welches das Musée d’Horlogerie du Locle<br />
beherbergt. Hier konnte man während der<br />
sachkundigen Führung die wahren Schätze<br />
der Schweizer Automaten-, Spieldosen-<br />
und Uhrmacherkunst vom 16. bis ins<br />
19. Jahrhundert bestaunen, viele davon aus<br />
der Sammlung Sandoz. Wenn Sie die Bilder<br />
betrachten, verstehen Sie, wie ich das<br />
meine.<br />
Spitzenklöpplerin<br />
21
22<br />
Interessant und wahrscheinlich nicht so<br />
bekannt ist die Geschichte von le Locle:<br />
Die Stadt entwickelte sich im frühen<br />
18. Jahrhundert vom Bauerndorf zur Industriegemeinde.<br />
Sie gilt als Wiege der<br />
schweizerischen Uhrenindustrie, die ab<br />
1705 hier ihren Anfang nahm. Auch die<br />
Spitzenklöppelei hatte zu dieser Zeit eine<br />
wichtige Bedeutung im Neuenburger Jura.<br />
Einige Stücke werden auch im Château des<br />
Monts gezeigt. Während mehr als 250 Jahren<br />
war die Wirtschaft von Le Locle zur<br />
Hauptsache auf die Uhrenindustrie ausgerichtet,<br />
weswegen die Stadt von der Krise<br />
in dieser Branche um 1970 besonders<br />
schwer getroffen wurde. Seither fand eine<br />
Diversifizierung der Industrie statt. Noch<br />
immer hat die Uhrenindustrie jedoch eine<br />
gewisse Bedeutung in Le Locle. Dabei<br />
sind insbesondere die Unternehmen Certina,<br />
Tissot, Ulysse Nardin und Zenith zu<br />
nennen. Das Stadtbild von Le Locle ist<br />
durch den von Charles-Henri Junod entworfenen<br />
Schachbrettgrundriss mit zahlreichen<br />
modernen Industrie-, Gewerbe-<br />
und Geschäftsbauten, Wohnblöcken und<br />
den typischen kubischen Mietshäusern aus<br />
dem 19. Jahrhundert geprägt.<br />
Anschliessend fuhren wir nach La Chauxde-Fonds<br />
ins Musée internationale de<br />
l’Horlogerie. In diesem unterirdisch gebauten<br />
Museum liegt der Schwerpunkt der<br />
Ausstellung in der Entwicklung der Zeitmessung.<br />
Von der Sonnen- und Wasseruhr<br />
bis zum modernsten Zeitmessgerät fürs<br />
Handgelenk bietet das Museum für jede<br />
Zeitepoche einige interessante Ausstellungsstücke.<br />
Uns interessierten natürlich<br />
auch hier die Musik- und die Automatenuhren,<br />
mich persönlich auch die schöne<br />
Sammlung von mechanischen Singvögeln<br />
in Käfigen und schmucken Döschen.
Die Geschichte von La Chaux-de-Fonds ist<br />
ähnlich derjenigen von Le Locle:<br />
Der eigentliche wirtschaftliche Aufschwung<br />
begann auch hier im 18. Jahrhundert mit der<br />
Einführung der Spitzenklöppelei, die sich<br />
neben dem traditionellen Handwerk etablierte.<br />
Ebenfalls im frühen 18. Jahrhundert<br />
fasste die Uhrmacherei, die im nahe gelegenen<br />
Le Locle begründet wurde, in La<br />
Chaux-de-Fonds Fuss. Sowohl die Spitzenherstellung<br />
als auch die Fertigung der Uhrenteile<br />
geschah zunächst überwiegend in<br />
Heimarbeit. Mit den neuen technischen<br />
Möglichkeiten entwickelte sich La Chauxde-Fonds<br />
Ende des 18. Jahrhunderts rasch<br />
zu einer Industriegemeinde. Es entstanden<br />
zahlreiche Fabriken. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
stieg La Chaux-de-Fonds zum<br />
Zentrum der blühenden Uhrenindustrie auf.<br />
Anders als Le Locle, das in einem engen<br />
Talkessel liegt, hatte La Chaux-de-Fonds<br />
genügend Möglichkeiten zur Ausdehnung.<br />
Auch das Stadtbild von La Chaux-de-Fonds<br />
ist geprägt durch das Schachbrettmuster.<br />
Nach dem Dorfbrand von 1794 wurde Platz<br />
frei, um diesen Stadtgrundriss nach Plänen<br />
von Moïse Perret-Gentil einzuführen. Die<br />
grossen Stadterweiterungen von 1835 bis<br />
1841 erfolgten wie in Le Locle nach einem<br />
Plan des Architekten Charles-Henri Junod.<br />
Aus diesem Grund wurde La Chaux-de-<br />
Fonds, wie Le Locle und auch Glarus, eine<br />
Reissbrettstadt, das heisst, die Strassen<br />
verlaufen parallel und rechtwinklig. Die<br />
zentrale Achse bildet die breite Hauptstrasse,<br />
die gemäss der Orientierung des Hochtals<br />
von Südwesten nach Nordosten ausgerichtet<br />
ist. Parallel dazu verlaufen etwa 15<br />
Längsstrassen unterschiedlicher Länge.<br />
Senkrecht dazu und damit quer zur Talrichtung<br />
sind rund 20 Querstrassen orientiert,<br />
die an den Hängen zum Teil starke Steigungen<br />
aufweisen. Die Strassenzüge werden<br />
von Jugendstilhäusern und wie in Le Locle,<br />
den typischen kubischen Mietshäusern aus<br />
dem 19. Jahrhundert geprägt.<br />
Im Jahr 2009 wurden La Chaux-de-Fonds<br />
und Le Locle zum UNESCO-Weltkulturerbe<br />
erklärt.<br />
Zum Zimmerbezug und Nachtessen führte<br />
uns der Reisebus wieder zurück nach Le<br />
Locle ins Hotel Trois Rois, einem interes-<br />
santen Bau wohl aus den 70er-Jahren.<br />
Nach dem feinen Nachtessen blieb noch<br />
Zeit, um zu plaudern und Erfahrungen auszutauschen.<br />
In Anbetracht der frühen Abfahrt<br />
am Sonntagmorgen zogen sich jedoch<br />
die meisten Teilnehmer relativ früh<br />
auf ihre Zimmer zurück.<br />
Hotel Trois Rois<br />
Am Sonntagvormittag war eine Schifffahrt<br />
entlang der französischen Grenze auf dem<br />
Doubs zu den Wasserfällen geplant. Als<br />
man jedoch vor dem Hotel auf die Strasse<br />
trat, hatte man den Eindruck, die Wasserfälle<br />
wurden nach Le Locle ausgelagert.<br />
Auf dem Doubs<br />
23
Gruppenbild ohne Wasserfall<br />
24<br />
Beim Aufwärmen<br />
Das Wetter besserte sich dann aber zusehends<br />
und als wir am Doubs anlangten,<br />
konnten wir das Schiff trockenen Fusses<br />
erreichen. Auf der Fahrt zu den Wasserfällen<br />
erklärte uns der Kapitän die Geographie<br />
und Geschichte dieses interessanten<br />
Landstriches und ergänzte beides mit Anekdoten.<br />
Ein kurzer Fussmarsch zu den<br />
Wasserfällen, ein paar Fotoaufnahmen,<br />
und schon zog es alle Teilnehmer zurück<br />
ins warme Restaurant bei der Schiffsanlegestelle.<br />
Nach äusserer und innerer Erwärmung<br />
ging die Fahrt mit dem Schiff wieder<br />
zurück nach Les Brenets, wo wir auch das<br />
Mittagessen einnahmen.<br />
Über den Vue des Alpes (1283 m ü. M.)<br />
fuhren wir auf der gut ausgebauten Strasse<br />
hinunter nach Neuchâtel zum Musée d’art<br />
et d’histoire, wo uns die berühmten Androiden<br />
des genialen Konstrukteurs Pierre<br />
Jaques-Droz ausführlich und detailliert<br />
vorgeführt wurden. Die drei Androiden<br />
gelangten 1909 in den Besitz des Museums.<br />
Dort stellen sie seither trotz ihres<br />
Alters von über 200 Jahren nach wie vor<br />
ihre Fähigkeiten unter Beweis. Trotz des<br />
Verschleisses und der Nachlässigkeit,<br />
unter der sie manchmal während ihren<br />
Aufenthalten und ihrer Reisen durch ganz<br />
Europa zu leiden hatten, funktionieren sie,<br />
nicht zuletzt wegen der fachkundigen und<br />
liebevollen Betreuung nach der Rückkehr<br />
in ihr Geburtsland, noch fast wie am ersten<br />
Tag.<br />
Pierre Jaquet-Droz wurde als Sohn eines<br />
Bauern und Uhrmachers 1721 in La Chauxde-Fonds<br />
geboren und starb 1790 in Biel.<br />
Er war einer der bedeutendsten Schweizer<br />
Uhren- und Automatenbauer, der Stutzuhren<br />
und Prunk-Pendeluhren herstellte und<br />
spezialisiert war auf Automaten wie Singvogeluhren,<br />
Tabakdosen mit Singvögeln<br />
und Luxusuhren. Er entwickelte u. a. einen<br />
automatischen Aufzug für Taschenuhren.<br />
Die Brüder Jaquet-Droz und ihre Mitarbeiter<br />
Jean-Frédéric Leschot, Henri Maillardet<br />
und Jacob Frisard begannen 1770<br />
mit dem Bau von drei Androiden, die 1774<br />
dem Publikum vorgestellt wurden. Der<br />
Erfolg muss unglaublich gewesen sein,<br />
zumindest schreibt ein Zeitgenosse, dass<br />
die Menschen regelrecht dorthin pilgerten<br />
und Gärten und Plätze voller Kutschen<br />
waren. Während mehr als einem Jahrhundert<br />
reisten die Androiden durch Europa<br />
und konnten gegen Eintrittsgeld besichtigt<br />
werden.<br />
Die Figuren sind etwa 70 cm hoch, Köpfe,<br />
Arme und Augen sind beweglich. Sie wirken<br />
sehr jung, fast wie Kinder. Sie gehören<br />
wahrscheinlich zu den schönsten Androiden<br />
die je geschaffen wurden. Jacques de<br />
Vaucanson, selbst ein Pionier und Meister<br />
des Automatenbaus, soll nach ihrer Besichtigung<br />
gegenüber Henri-Louis Jaquet-<br />
Droz ausgerufen haben: « Junger Mann,<br />
Sie beginnen dort, wo ich abzuschliessen<br />
gedenke! »
Die Androiden<br />
Eine kurze Beschreibung der drei Automaten:<br />
Der Schreiber : Wird der Schreiber in Gang<br />
gesetzt, taucht er die Feder in die Tinte,<br />
schüttelt sie leicht ab, legt seine Hand oben<br />
auf die Seite und hält an. Wenn ein weiterer<br />
Hebel bedient wird, beginnt er zu schreiben.<br />
Dabei setzt er wie ein richtiger Schreiber<br />
ab, beachtet die Auf- und Abstriche,<br />
die Leerzeichen und die Zeilen, setzt einen<br />
Punkt an das Ende und hält wieder an. Der<br />
Schreiber kann dabei jeden beliebigen<br />
Text mit bis zu 40 Zeichen schreiben. Dieser<br />
wird auf einer Scheibe mit auswechselbaren<br />
Nocken eingegeben.<br />
Der Zeichner : Der Mechanismus des<br />
Zeichners wird durch einen Satz von Nockenscheiben<br />
gesteuert, auf dem sich das<br />
Programm der Zeichnungen befindet. Mit<br />
drei auswechselbaren Nockenscheibensätzen<br />
können vier verschiedene Zeichnungen<br />
angefertigt werden:<br />
• ein Porträt von Louis XV. und der Hund<br />
« Toutou » (beide Bilder auf den gleichen<br />
Scheibensätzen),<br />
• König Georg von England und seine Gemahlin,<br />
• das romantische Motiv des von einem<br />
Schmetterling gezogenen Wagens<br />
Die Organistin : Die Musikerin wird von<br />
einer Stiftwalze und von damit verbundenen<br />
Nockenscheiben gesteuert, mit der die<br />
Finger der Hände bewegt werden. Die Finger<br />
schlagen die Tasten der Orgel an. Damit<br />
wird die Orgel wirklich von Hand gespielt<br />
und nicht wie oft üblich, durch eine Stiftwalze<br />
gesteuert. Sie kann fünf verschiedene<br />
Stücke spielen, die eigens für sie<br />
Die Organistin Der Zeichner<br />
Fingerbewegungen<br />
komponiert wurden. Im Körper ist ein Mechanismus<br />
eingebaut, der die Brust bewegt,<br />
so dass es aussieht, als atme sie.<br />
Weniger bekannt ist, dass die Jaquet-Droz<br />
und ihr Geschäftspartner Jean-Frédéric<br />
Leschot offenbar zusätzlich begannen,<br />
Prothesen für amputierte Gliedmassen herzustellen.<br />
Jean-Frédéric Leschot spezialisierte<br />
sich auf diese Aktivität und sein Ruf<br />
in diesem Bereich brachte ihm zahlreiche<br />
Aufträge auch aus dem Ausland ein. Anders<br />
als die damals üblichen Prothesen die<br />
mehr ästhetischen Wert hatten, waren diese<br />
anscheinend sogar funktionstüchtig, d.h.<br />
Knie konnten gebeugt und Gegenstände<br />
gehalten werden.<br />
Die anschliessende Fahrt nach Biel haben<br />
wohl verschiedene Teilnehmer nicht mitbekommen,<br />
da man sich von den erlebnisreichen<br />
zwei Tagen bei einem kleinen<br />
Schläfchen erholte. Am Bahnhof Biel fand<br />
unsere Herbstreise ein Ende und es ist zu<br />
hoffen, dass viele gute Erinnerungen geblieben<br />
sind. Die Organisation hat reibungslos<br />
funktioniert, den Organisatoren<br />
wird empfohlen, auch die Herbstreise 2012<br />
wiederum so erlebnisreich zu gestalten.<br />
Der Schreiber<br />
Mechanismus des Schreibers<br />
25
Lydia Baur mit der<br />
Violinopan<br />
26<br />
Martin Zumbach<br />
Walzenorgelbauer und Hersteller von stiftwalzen<br />
Paul Fricker<br />
Fotos: Madeleine und Paul Fricker<br />
Die Entdeckung<br />
An der Ecke eines kleinen Strässchens in<br />
Carouge unweit von Genf hörte ich von<br />
weitem schöne, bunte Drehorgeltöne, die<br />
ein grosses Interesse in mir weckten. Es<br />
war « Unter den Brücken von Paris », dieses<br />
unsterbliche Musikstück, von einer Drehorgel<br />
mit Panflöte und Violine gespielt,<br />
fantastisch arrangiert und von Bässen begleitet.<br />
Die schöne, elegante Lydia drehte<br />
strahlend die Kurbel vor einem begeisterten<br />
Publikum dieses kleinen Strassenkonzerts.<br />
Sie bat mich ein Stück ihrer schönen<br />
Musik zu wählen, welche die drei Repertoirezettel<br />
im Innern der Orgel vorschlagen,<br />
und welch grosse Überraschung, ich<br />
entdeckte im Innern des Instruments eine<br />
Walze mit Schneckenrad sowie einer grossen<br />
Anzahl von kleinen Drahtstiften und<br />
-Bögen, die über den Walzenumfang systematisch<br />
angeordnet sind und diese fantastischen<br />
Töne steuern!<br />
Der aufgeklappte Deckel gibt den Blick frei auf die Pfeifen des Registers<br />
Violine. Die tiefsten Pfeifen sind aus Platzgründen gedeckt, die grössten<br />
offenen sind gekröpft.<br />
Unter 24 Musiktiteln, die auf drei Walzen<br />
geschlagen sind, konnte ich wählen. Die<br />
Walzen sind einfach auszuwechseln, eine<br />
ist in Spielposition, zwei sind in dem kleinen<br />
Wagen untergebracht und warten auf<br />
ihren Einsatz. « Wenn der weisse Flieder<br />
wieder blüht » von Franz Doelle erklang,<br />
wundervolle Technik und harmonische<br />
Töne, ungewohnt für eine moderne Drehorgel!<br />
Ein reines Vergnügen – Verzückung<br />
für den Ingenieur!<br />
Martin Zumbach, Walzenorgelbauer<br />
und Musiker aus Leidenschaft<br />
Wer kann solch ein musikalisches und<br />
handwerkliches Meisterwerk professionell<br />
verwirklichen? Martin Zumbach, geboren<br />
1932, ein leidenschaftlicher Orgelbauer<br />
und ein Virtuose an der Kirchenorgel. Er<br />
wohnt in einer schönen Gegend der<br />
Schweiz, in der Nähe der Berge und des<br />
Zuger Sees. Von Jugend an bis heute begleitet<br />
er die Pfarrgemeinde seines Dorfes<br />
an der Kirchenorgel.<br />
Martin Zumbach hat eine Möbelschreinerlehre<br />
absolviert und diese Ausbildung bei<br />
dem Kirchenorgelbauer Walter Graf in<br />
Sursee ergänzt. Ab 1959 bis zu seiner Pensionierung<br />
arbeitete er als Schreiner bei<br />
den Wasserwerken von Zug. Diesen Beruf<br />
hat er 40 Jahre ausgeübt, aber seine Leidenschaft<br />
für die Musik und für den Bau<br />
von kleinen Drehorgeln ist während seiner<br />
Freizeit aufgelebt. Geeignete technische<br />
Dokumente über den Drehorgelbau fehlten<br />
und so hat sich Martin selbst geholfen und<br />
alles autodidaktisch gelernt. Diese moderne<br />
Arbeitsmethode ist in der Industrie<br />
bestens unter dem Schlagwort « learning<br />
by doing » bekannt.<br />
Anfang 1958 restaurierte Martin erstmals<br />
eine Drehorgel und errichtete eine kleine<br />
Werkstatt in seinem neuen Haus. Der Antiquitätenhändler<br />
Paul Döbeli fragte ihn<br />
nämlich zu dieser Zeit, ob er Drehorgeln<br />
restaurieren und reparieren könne. Martin<br />
hat mit solchen Aufträgen seine besten<br />
Lehrstunden erhalten und Bacigalupo,
Zwei Austauschwalzen sind im Sockel des<br />
Orgelwagens geschützt aufbewahrt.<br />
Frati, Bruder, Holl, usw. wurden seine Vorbilder.<br />
Sein Ziel war immer, die Orgeln in<br />
ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.<br />
Es ist nicht selbstverständlich, wenn es gelingt,<br />
wieder Leben in die alten Instru-<br />
mente zu bringen, und zu erreichen, dass<br />
die Pfeifen wieder in tadellosem Zusammenklang<br />
spielen.<br />
1975 zeichnete und bestiftete Martin Zumbach<br />
seine erste Walze, sie war jedoch für<br />
eine Wandflötenuhr. Bestärkt durch seine<br />
gewonnenen Erfahrungen und angetrieben<br />
von seiner grossen Begeisterung baute er<br />
1982 seine erste Walzenorgel. Auf der<br />
Grundlage eines Instruments des Meisters<br />
Bacigalupo baute er selbständig alle notwendigen<br />
Einzelteile, einschliesslich der<br />
Pfeifen und der Walze. Sein Streben nach<br />
Perfektion machte ihn schnell zu einem<br />
grossen Handwerker. Fast noch wichtiger<br />
als seine Handwerkskunst ist aber seine<br />
Virtuosität als Organist, die ihm beim Arrangieren<br />
der Musik und beim Bestecken<br />
der Walzen seiner Drehorgeln zu gute<br />
kommt. Seine Musikarrangements differenzieren<br />
insbesondere die Begleitung, die<br />
Bässe und Tremolos. Man könnte glauben,<br />
Die Werkstatt des Künstlers mit einer Orgel, deren Walze gezeichnet werden soll.<br />
27
Martin Zumbach überträgt Musik auf eine Walze<br />
Der Spielsteller<br />
28<br />
die Anzahl der Pfeifen habe sich erhöht.<br />
Das ist eine besondere Qualität von Martin<br />
Zumbach, das Erkennungszeichen eines<br />
sehr ruhigen und sorgenfreien Mannes, der<br />
sein Wesen in die warmen Töne seiner Instrumente<br />
und in seine Arrangements überträgt.<br />
In ihm entdeckt man die Seele des<br />
Musikuhrmacherhandwerks von damals<br />
wieder, das die wunderschönen Musikdosen<br />
der Jura-Region hervorgebracht hat.<br />
Der Walzenmusikzeichner<br />
Treten wir in die kleine Werkstatt von Martin<br />
ein. Welch ein Leckerbissen, welch<br />
eine Begeisterung! Alles ist ruhig und hell,<br />
jedes Werkzeug hat seinen Platz. Auf der<br />
Werkbank eine Walze, montiert in einer<br />
alten Drehorgel, vorbereitet für das Musikzeichnen<br />
nach der « direkten Teilung » mit<br />
Teilscheibe auf der Walzenachse. Ein langer<br />
auf der Teilscheibe befestigter Hebel<br />
erhöht die Auflösung der Teilung. Nach<br />
jedem Takt wird dieser Hebel entsprechend<br />
versetzt. Die Walze ist dabei in der Orgel<br />
platziert. Bei dieser Methode gibt es keinen<br />
Computer und keine Musiksoftware,<br />
es gibt keine Möglichkeit, die Musik vor<br />
dem Bestecken der Walze zu hören! Es<br />
gibt auch keine computergesteuerte Maschine,<br />
um die Stifte und Bügel auf der<br />
Walze exakt zu platzieren. Hier wird alles<br />
handwerklich gemacht, mit der Hand des<br />
Musikzeichners und Walzenstechers.<br />
Martin arrangiert seine Musik zunächst auf<br />
Notenpapier und spielt sie zur Überprüfung<br />
auf seiner grossen Orgel mit 566 Pfeifen<br />
und 10 Registern eigener Produktion.<br />
Anschliessend muss die Musik « berechnet<br />
» werden, das bedeutet, die Noten in<br />
Zahlenwerte umzuwandeln, um diese<br />
Werte über den Umfang der Walze von<br />
200 mm Durchmesser in entsprechende<br />
Strecken aufzuteilen. Jedes Musikstück,<br />
Note für Note, Takt für Takt, wird mit<br />
höchster Präzision über den Walzenmantel<br />
positioniert. Jedes Musikstück dauert bei<br />
72 Kurbeldrehungen etwa 1½ Minuten.<br />
Und Martin hört im Geiste jeden Ton bereits<br />
während er die Musik auf die Walze<br />
zeichnet. Welch ein Künstler!<br />
Die Länge der Töne wird durch die Dicke<br />
und Höhe von Drahtstiften bestimmt, bis<br />
zur Achtelnote reichen Stifte, für längere<br />
Notenwerte benutzt man Drahtbügel (Brücken),<br />
welche jeweils über Clavis und Stecher<br />
ihr Tonventil mehr oder weniger lang<br />
öffnen. Pro Walze sind etwa 10 000 bis<br />
15 000 Messingdrahtstifte und -Bügel zu<br />
setzen und Martin, der diese hochpräzise<br />
Arbeit perfekt beherrscht, braucht mehr als<br />
einen Monat, um einen solchen Toninformationsträger<br />
zu verwirklichen. Dabei<br />
muss die Bestiftung Ton für Ton exakt auf<br />
dem Umkreis erfolgen, dem die Clavis auf<br />
der Walzenoberfläche folgt. Durch die 8
Violinopan « Zumbach #11 » mit Walzenschlitten und Blick auf die Panflöte<br />
Musikstücke, die auf der Walze zwischen<br />
zwei Claves nebeneinander notiert werden,<br />
ergeben sich regelmässige Abstände von<br />
nur 1,7 mm zwischen den Spuren, Präzision<br />
ist also oberstes Gebot!<br />
Nach Engramelle 1 , Dom Bédos 2 und Ignaz<br />
Blasius Bruder 3 hat meines Wissens kein<br />
Walzenzeichner Literatur zu dieser Kunst<br />
hinterlassen. Weil man sein Know-How<br />
leider nicht an andere weitergeben wollte,<br />
hat jeder seine eigene Methode und seine<br />
Herstellungsgeheimnisse lieber mit ins<br />
Grab genommen. Glücklicherweise erstellt<br />
Martin für jede Walze eine sehr gute Dokumentation<br />
zur musikalischen Ausführung.<br />
Die Violinopan<br />
Martin Zumbach hat in den 90er-Jahren 11<br />
Violinopan-Orgeln hergestellt. Er ist der<br />
Auffassung, dass eine Orgelkonzeption mit<br />
36 Claves für Drehorgelspieler, die kleine<br />
Konzerte geben, ein guter Kompromiss<br />
zwischen musikalischen Möglichkeiten,<br />
Grösse und Gewicht des Instruments darstellt.<br />
Dementsprechend besitzt die Violinopan-<br />
Orgel 36 Claves und 72 Pfeifen, davon 20<br />
gedeckte zylindrische Panflöten-Pfeifen in<br />
8'-Lage aus Bambus, angeblasen wie die<br />
klassische Panflöte, und 26 Violin-Pfeifen<br />
in 4'-Lage. Aus dieser Diskantregister-<br />
Kombination leitet sich der Name Violinopan<br />
ab. Im Sockel liegen unter dem Bodenbrett<br />
16 Bourdon 8'-Pfeifen und die drei<br />
tiefsten gedeckten Pfeifen der 4'-Lage, die<br />
wegen ihrer Grösse im Kasten nicht unterzubringen<br />
sind. Daraus ergibt sich folgender<br />
Aufbau:<br />
29
30<br />
36 Pfeifen in 8’-Lage :<br />
F, G, ab c° diatonisch (mit b°) bis c' und<br />
chromatisch weiter bis f ' = 16 gedeckte<br />
Bourdonpfeifen, als Bodenpfeifen montiert,<br />
fis' bis c''' chromatisch und d''' = 20<br />
gedeckte Panflöten auf der Lade in der Fassade<br />
stehend.<br />
36 Pfeifen in 4’-Lage :<br />
F, G und e° = 3 gedeckte Bodenpfeifen, c°<br />
und d° = 2 gedeckte Pfeifen, liegend über<br />
dem Balg montiert, f°, g°, a°, b° und h° = 5<br />
gedeckte Pfeifen, auf der Lade stehend, c'<br />
bis c''' chromatisch und d''' = 26 offene Violinpfeifen,<br />
auf der Lade stehend, die 6<br />
längsten gekröpft.<br />
Der tiefste Ton ist F, der höchste d''', die<br />
Tonleiter ist von a° bis c''' chromatisch<br />
(cis''' fehlt). Der Stimmton a' ≈ 490 Hz liegt<br />
etwa einen Ganzton über dem heutigen<br />
Kammerton (440 Hz). Ein Winddruck von<br />
145 mm Wassersäule sorgt für sehr laute<br />
Töne, wie sie für ein Strasseninstrument<br />
erforderlich sind. Die Orgel hat einen tragenden<br />
Klang, der für das Publikum oft<br />
überraschend wirkt. Sie zeichnet sich aus<br />
durch die Qualität und Originalität der<br />
Zumbach-Arrangements und durch die<br />
schillernden Töne der Panflöte, ergänzt<br />
durch die Violine. Für den Zuhörer ist dieses<br />
Instrument ein artistisches Zusammenspiel<br />
von Violine, Panflöte und Bourdon.<br />
Heute beschäftigt sich Martin Zumbach in<br />
erster Linie mit der Restaurierung von<br />
Walzenorgeln und mit der Walzenherstellung,<br />
Fertigkeiten, die er meisterhaft beherrscht!<br />
Seine Restaurationen geben den<br />
historischen Instrumenten neues Leben<br />
und erstaunen die glücklichen Eigentümer.<br />
Es ist nach getaner Arbeit für Martin immer<br />
ein Erfolgserlebnis der Drehorgel zuzuhören<br />
und eine grosse Freude, wenn er die<br />
Bestätigung seiner zufriedenen Kunden<br />
erhält.<br />
Martin Zumbach glaubt, dass man mit<br />
einer gut klingenden Drehorgel auch in<br />
Zukunft den Leuten Freude bereiten kann.<br />
Er stellt immer wieder fest, dass Senioren,<br />
aber auch junge Eltern mit Kindern, von<br />
individuell arrangierter Musik aus einer<br />
anderen Zeit fasziniert sind.<br />
schlusswort<br />
Oh, ich höre den « Frühlingsstimmenwalzer<br />
» von J. Strauss, natürlich ist es eine<br />
VIOLINOPAN! Und man glaubt eine Bacigalupo<br />
zu hören! Mit welch fantastischer<br />
musikalischer und handwerklicher Leidenschaft<br />
widmet sich Martin dieser besonderen<br />
Drehorgelmusik und erfreut<br />
damit nicht nur seine persönlichen Freunde,<br />
sondern auch die Passanten auf der Strasse,<br />
die eine kurze Zeit in der Nähe des Drehorgelspielers<br />
innehalten! Martin Zumbach<br />
ist ein grosser Künstler mit zahlreichen<br />
Facetten, der in unserer Zeit – nur zu seiner<br />
und unserer Freude und Zufriedenheit – in<br />
unermüdlichem Einsatz aussergewöhnliches<br />
leistet!<br />
Anmerkungen<br />
1 Père Marie Dominique Joseph Engramelle,<br />
Physiker und Musiker, Mitglied<br />
am Hof von König Stanislaus von<br />
Nancy, beschreibt in seinem Buch La tonotechnie<br />
où l’art de noter les cylindres,<br />
Paris 1775, drei sehr interessante Musikzeichnungsmethoden.<br />
2 Der Benediktiner Dom Bédos de Celles<br />
beschreibt im vierten Band (Paris 1778)<br />
seines Standardwerks L’art du facteur<br />
d’orgues den Bau von Orgel-Sonderformen,<br />
darunter im 3. Kapitel auch Serinetten<br />
und Walzenorgeln. Das vierte Kapitel,<br />
in dem das Walzenzeichnen behandelt<br />
wird, greift ausdrücklich auf Engramelles<br />
Werk zurück.<br />
3 Ignaz Blasius Bruder hinterliess seinen<br />
Nachkommen ein Werkstattbuch (1829),<br />
in dem er seine Techniken festhielt. Eine<br />
kommentierte Fassung veröffentlichte<br />
Karl Bormann: Orgel- und Spieluhrenbau,<br />
Aufzeichnungen des Orgel- und Musikwerkmachers<br />
Ignaz Bruder von 1829<br />
und die Entwicklung der Walzenorgeln,<br />
Zürich 1968. Hermann Brommer gab<br />
2006 mit der Waldkircher Orgelstiftung<br />
in einer auf 100 Exemplare limitierten<br />
Auflage das Handbuch der Orgelbaukunst<br />
von Ignaz Blasius Bruder heraus, in<br />
dem Bruders handschriftliches Werkstattbuch<br />
für den heutigen Leser erschlossen<br />
wird.
Seppi Arnold-Gyr<br />
Fotos: Martha Arnold-Gyr<br />
Am 13. Juni erfolgt bereits von der Marktkommission<br />
Lachen die herzliche Einladung<br />
zur 28. Drehorgelmatinee. Umgehend<br />
melde ich mich an und versende das<br />
Formular am 16. Juni 2011. Diese Anmeldung<br />
gilt als definitiv. Den Termin trage<br />
ich im Familienkalender ein.<br />
So fährt mich heute Martha im Laguna<br />
samt den Utensilien nach Lachen an die<br />
St. Gallerstrasse. Es ist 9.00 Uhr. Auf dem<br />
Parkplatz vis a vis von der Kapelle buchen<br />
wir am Automaten für den ganzen Tag,<br />
sicher ist sicher. Auf der Hinfahrt hält sich<br />
das Wetter ordentlich, es ist bewölkt, aber<br />
trocken. Rasch stellen wir gemeinsam die<br />
Drehorgel zusammen und packen vorsichtshalber<br />
zusätzlich den grossen Regenschutz<br />
für das Gefährt ein. Man kann ja<br />
nie wissen!<br />
Sind die Baden-Würtenberger wohl an<br />
ihrem richtigen Platz ?<br />
Auszug : Tagebuch einer Raffin<br />
mini Pfeifendrehorgel<br />
28. Drehorgelmatinee an der Lachner Chilbi,<br />
sonntag, 4. september 2011<br />
Aber diese zwei sind es bestimmt !<br />
Pünktlich um 9.15 Uhr treffen wir im Restaurant<br />
Schützenhaus ein. Wir werden von<br />
den zwei Delegierten der Marktkommission<br />
willkommen geheissen und erhalten<br />
den diesjährigen Spielplan, die Wagennummer<br />
17 sowie die Festplakette. Diesmal<br />
sind 23 Nummern aufgeführt. Ab<br />
10.00 Uhr darf gespielt werden. Ich bin,<br />
wie im vergangenen Jahr, am Spielort<br />
Parkplatz CS vorgesehen. Die Spielplätze<br />
Nummer 16, 17 und 18 sind wenige Meter<br />
aufeinander, dass ich mich einer Zweiergruppe<br />
anschliesse, welche ebenfalls einen<br />
Ausweichplatz sucht. Es sind dies Alice<br />
und Hans Egli aus Herrliberg. Mit ihnen<br />
musizierte ich bereits im vergangenen Jahr.<br />
Gemeinsam finden wir einen idealen Platz<br />
vor dem Zugang zur Chilbi. Martha macht<br />
sich mit der Digitalkamera auf den Weg,<br />
bevor sie auf Mittag bei Onkel und Tante,<br />
wie vereinbart, aufkreuzt. So bin ich diesmal<br />
ohne meine Assistentin!<br />
31
Walzendrehorgel –<br />
Bacigalupo Berlin<br />
26 Tonstufen, Walze von<br />
Max Gewecke mit<br />
8 Musik stücken:<br />
Erzherzog-Albrecht-Marsch,<br />
Mariechen sass weinend<br />
im Garten,<br />
Nordseewalzer,<br />
Berliner Luft,<br />
Hochzeit der Winde,<br />
Schneewalzer,<br />
Hoch auf dem gelben Wagen,<br />
So ein Tag<br />
Gehäuse im traditionellen<br />
Prospekt und Mahagonibauweise,<br />
einwandfreier Zustand<br />
Grösse 48/35/65 cm<br />
Baujahr : Ende der 70er-Jahre,<br />
Erbauer : Curt Baum<br />
Orgel aus erster Hand<br />
Walzendrehorgel –<br />
Niemuth Berlin<br />
12 Tonstufen; Walze mit<br />
10 Musikstücken; Gehäuse,<br />
Mechanik und Tonsystem<br />
speziell sorgfältige Ausführung<br />
und Verarbeitung<br />
Grösse 29.5/24.5/33.5 cm<br />
Baujahr: 1992 aus Kleinserie<br />
direkt vom Hersteller<br />
Alfred und Margrit Enz,<br />
Zürich<br />
E-Mail: a.m.enz@bluewin.ch<br />
http://www.drehorgel.ch/<br />
pinwand/<br />
32<br />
Zu VERKAuFEN<br />
Martha entdeckt diesen schönen<br />
Brunnen . . .<br />
Hier drehen wir abwechslungsweise an unseren<br />
Instrumenten, Alice an einer Göckel<br />
Violinpan, Hans an einer Heiniger und zwischen<br />
ihnen stehe ich mit einer Mini Raffin<br />
Drehorgel. Nur von Ferne hört man andere<br />
Spieler. Hier wahren wir die Festung, bis<br />
gemäss Auftritt der eine oder andere zum<br />
Eventzelt anzutreten hat. Immer wieder<br />
lauschen Passanten unseren Klängen. Kinder<br />
bleiben stehen und haben Fragen über<br />
Fragen. Und ein Tröpsli ist ihnen gewiss.<br />
Unsere Melodien kommen beim Publikum<br />
gut an. Aus einem Fenster wird gerufen.<br />
Eine ältere Dame stellt sich vor und erzählt,<br />
dass sie Handharmonika spiele. Unsere<br />
Musik gefalle ihr, darum habe sich in<br />
einem Briefumschlag sämtliches Münz<br />
eingepackt. Sie wirft mir das Couvert zu<br />
und ich bedanke mich sehr. Alice spielt<br />
Kinderlieder, bei Hans erklingen volkstümliche<br />
Melodien und bei mir ertönen<br />
alte Schlager und Gassenhauer. Bald ist es<br />
halb Zwölf Uhr. Hans fährt seine schwere<br />
Drehorgel zum Eventzelt auf dem Chilbiareal,<br />
nahe vom Riesenrad.<br />
Alice und ich drehen weitere Drehorgelkurbelrunden.<br />
Immer öfters schlendern<br />
Kilbibesucher vorbei. Sie bestaunen die<br />
hübschen mechanischen Musikinstrumente.<br />
Bereits mache ich mich auf den<br />
Weg zum Zelt, wo die einzelnen Drehorgelspieler<br />
mit ihren Instrumenten vorgestellt<br />
werden, gemäss Auftrittsplan für<br />
mich um 12.10 Uhr. Auf dem Hinweg begegnet<br />
mir Hans. Er bemerkt, dass ich<br />
mich nicht beeilen solle. Das ganze Programm<br />
sei um einiges verspätet. Wirklich,<br />
da steht eine lange Reihe von Drehorgelwagen<br />
vor dem Zelteingang. Nun geht es<br />
zügig voran. Es erklingen kurze Melodien<br />
auf den verschiedenen Instrumenten.<br />
Schon bin ich an der Reihe. Clemens<br />
Columberg stellt mich beim Publikum<br />
kurz vor und erkundigt sich nach dem zu<br />
spielenden Stück. Hierauf lasse ich meine<br />
Drehorgel erschallen. Zügig an der Kurbel<br />
drehend, erklingt, meist zusammen mit<br />
dem zweiten Register, eine volkstümliche<br />
Melodie aus Appenzell. Bereits ist Peter<br />
Bürgisser mit seiner Raffin Konzertorgel<br />
R31/100, Baujahr 1975, auf der Bühne. Ich<br />
verlasse das Zelt und durchquere den Kil-<br />
. . . und später Hildegard Oberholzers<br />
einmalig geschaffene Figurendrehorgel
Otto Furrers Standplatz, immer bei der<br />
Metzgerei<br />
biplatz Richtung Schützengarten. Das heimelige<br />
Restaurant wird heute von den<br />
hungrigen Drehorgelleuten in Beschlag<br />
genommen.<br />
Uns erwartet ein leckeres Mittagessen inkl.<br />
Mineralwasser und Wein, offeriert von der<br />
Marktkommission Lachen. Herzlichen<br />
Dank! An den Tischen wird laut diskutiert,<br />
geheimnisvoll verhandelt, munter erzählt,<br />
aufmerksam zugehört, öfters gelacht oder<br />
geschmunzelt. Eine einmalige Geräuschkulisse!<br />
Schon wird der Nachtisch offeriert.<br />
Draussen spannen die Kilbibesucher<br />
ihre Schirme auf. Am Nachmittag steht<br />
leider Dauerregen statt heiteres Drehorgelspiel<br />
auf dem Programm. Schade!<br />
Gegen 14.30 Uhr verlasse ich das Lokal,<br />
um Martha zu telefonieren. Wir vereinbaren,<br />
dass ich mit dem Drehorgelwagen<br />
zum Parkplatz fahre und sämtliche Utensilien<br />
im Laguna verstaue. Jetzt kommt mir<br />
der grosse Regenschutz zu Nutzen. So<br />
bringe ich Instrument und Wagen samt Notenbänder<br />
ins Trocken.<br />
Anschliessend kreuze ich bei Tante Anna<br />
und Onkel Karl auf. Als wir uns von ihnen<br />
verabschieden, weint der Himmel immer<br />
noch. Bei allen vergangenen Lachner<br />
Drehorgeltreffen, in denen ich teilnehmen<br />
Am Vormittag ist noch gut lachen in Lachen !<br />
durfte, erlebte ich stets eine strahlende<br />
Sonne. Aber eben, für den Kilbibetrieb ist<br />
die Marktkommission zuständig, für das<br />
Wetter der Dorfpfarrer mit seinem Wettersegen!<br />
Auf der Heimfahrt nach Emmenbrücke ist<br />
der Scheibenwischer ständig in Aktion.<br />
Aber interessant und abwechslungsreich<br />
ist das 28. Drehorgelmatinee trotzdem. Besonders,<br />
wenn man neue Teilnehmer kennenlernen<br />
darf.<br />
33
34<br />
Termine 2012<br />
22. Januar Internationales Drehorgel-Wintertreffen in Lausen BL<br />
Kontakt: Daniel Widmer, Neubadrain 2, CH-4015 Basel,<br />
Postfach 458, Telefon +41 +61 302 52 17,<br />
daniel.widmer@drehorgelfreunde.ch<br />
21./22. April 6. Int. Karussell- und Drehorgeltreffen in Waldshut-Tiengen (D)<br />
5. Mai 18. Drehorgelfestival anlässlich der 33. LUGA in Luzern<br />
13. Mai Generalversammlung des <strong>SFMM</strong> in Schafisheim<br />
3. Juni Drehorgeltreffen in Lichtensteig<br />
30. Juni Drehorgeltreffen in Burgdorf<br />
7. Juli Drehorgeltreffen auf der Engstligenalp<br />
8. Juli Drehorgeltreffen in Adelboden<br />
24. August Drehorgelkonzert in der Reformierten Kirche von Bad Zurzach<br />
25. August 24. Drehorgeltreffen in Bad Zurzach<br />
2. September Drehorgelmatinée in Lachen<br />
14./16. September Vereinsreise nach Paris<br />
14. Oktober 24. Drehorgeltreffen in Laufenburg CH anlässlich der HELA<br />
Wiederkehrende Anlässe<br />
Am letzten Sonntag Leichte Klassik am Sonntagnachmittag jeweils um 17.00 Uhr bei<br />
im Monat Kurt und Ursula Matter. Im Osthaus Wichterheer, Oberhofen.<br />
Eintritt frei. Kollekte.<br />
Jeden 4. Donnerstag Drehorgel-Stamm. Hogg der Basler Drehorgelfreunde um 19.45 Uhr<br />
im Restaurant Ysebähnli, Utengasse 22, 4058 Basel.<br />
Wir freuen uns auf Gäste, die sich unter<br />
Tel. (+41) 61 681 71 24; Mobil Tel. (+41) 78 683 48 95 anmelden.
Walter Dahler<br />
Werkstatt für mechanische<br />
Musikinstrumente<br />
An meine geschätzte Kundschaft :<br />
Nach fast 30-jähriger Restauratorentätigkeit in Brugg, habe ich<br />
meine Werkstatt nach Unterbözberg (3 km nach Westen)<br />
verschoben.<br />
Alles Wichtige ist wieder hier :<br />
Maschinen, Werkzeuge, Material und nicht unwichtig für meine<br />
anspruchsvolle Kundschaft : meine Erfahrung, die ich in über<br />
40 Jahren mit mechanischen Musikinstrumenten erworben habe.<br />
Auch Ihre Puppenautomaten sind bei mir in guten Händen,<br />
sowohl was die Mechanik anbelangt als auch die Kleider und die<br />
Dekora tionen, die meine erfahrene Partnerin wieder zu rekonstruieren<br />
versteht.<br />
Neue Adresse: Oberer Rebhügel 427<br />
CH-5224 Unterbözberg<br />
Tel. 056 441 71 55<br />
Siehe auch:<br />
www.mechanischemusikinstrumente.ch<br />
www.musikautomatenwerkstatt.ch<br />
Die spezialisten für «Technische Antiquitäten»<br />
AuCTION TEAM BREKER<br />
Postfach 50 11 19, 50971 Köln,<br />
Otto-Hahn-Straße 10, 50997 Köln<br />
Tel. +49 2236 38 43 40, Fax +49 2236 38 43 430<br />
auction@breker.com, www.breker.com<br />
Auktionstermine 2012<br />
24. März Photographica & Film<br />
26. Mai (Pfingsten) Science & Technology<br />
Büro-Antik<br />
Fine Toys & Automata<br />
22. September Photographica & Film<br />
17. November Science & Technology<br />
Büro-Antik<br />
Fine Toys & Automata<br />
35