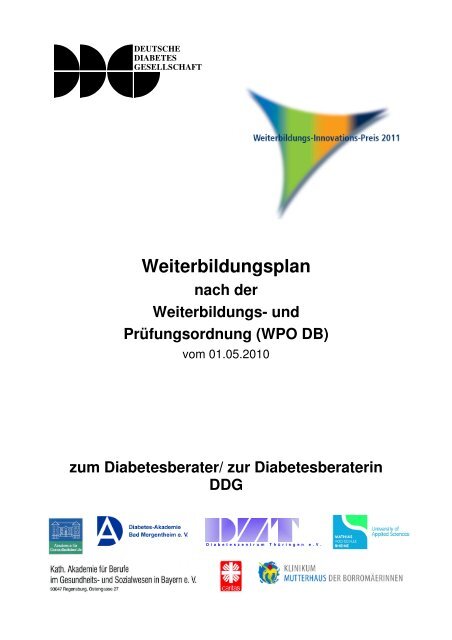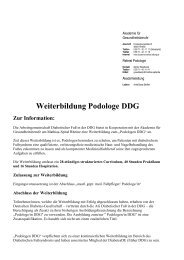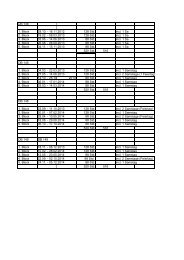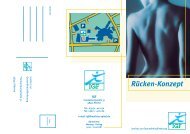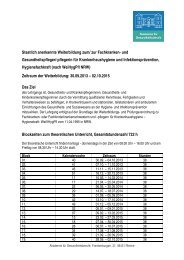Weiterbildungsplan nach der Weiterbildungs - Die Mathias Stiftung
Weiterbildungsplan nach der Weiterbildungs - Die Mathias Stiftung
Weiterbildungsplan nach der Weiterbildungs - Die Mathias Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
<strong><strong>Weiterbildungs</strong>plan</strong><br />
<strong>nach</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Weiterbildungs</strong>- und<br />
Prüfungsordnung (WPO DB)<br />
vom 01.05.2010<br />
zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin<br />
DDG<br />
D i a b e t e s z e n t r u m T h ü r i n g e n e . V .
Der Weiterprüfungsplan <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>- und Prüfungsordnung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin<br />
DDG ist entsprechend dem Europäischen und Deutschen Qualifikationsrahmen<br />
(EQR & DQR)<br />
neu bearbeitet von den Mitarbeitern <strong>der</strong><br />
<strong>Weiterbildungs</strong>stätten <strong>der</strong> DDG ©<br />
für die Akademie für Gesundheitsberufe Rheine als In-Institut <strong>der</strong> <strong>Mathias</strong> Hochschule Rheine<br />
Dr. phil. Brigitte Osterbrink<br />
Dipl.-Krschw./Dipl. Pflegepäd. (FH) Ethel Narbei<br />
Angelika Meier, Diabetesberaterin DDG<br />
Doris Schöning, M.Sc. Diabetes Studies, Diabetesberaterin DDG<br />
für das Klinikum Mutterhaus gGmbH Karl Borromäus Schule Trier<br />
Herbert Schmitt, Lehrer für Pflegeberufe<br />
Brigitte Jaeger, Lehrerin für Pflegeberufe<br />
Birgit Pfeifer, Dipl.-Ing. für Ernährungstechnik (FH), Diabetesberaterin DDG<br />
Karin Heinz, Diabetesberaterin DDG<br />
für die Diabetes Akademie Bad Mergentheim e. V.<br />
Kathrin Boehm, Diabetesberaterin DDG<br />
Dr. oec. troph. Astrid Tombek<br />
für das Diabeteszentrum Thüringen e.V. Jena<br />
Dr. rer. nat. Nicolle Müller<br />
für die Katholische Akademie für Gesundheits – und Sozialwesen in Bayern e.V.<br />
Regensburg<br />
Ernst Lesser, Bildungsreferent<br />
Elke Ploessl, Diabetesberaterin DDG<br />
Seite 2 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Bewerbungsgespräch...............................................................................................................................5<br />
Modulübersicht .........................................................................................................................................9<br />
Zeitschiene und Arbeitsplanung .............................................................................................................10<br />
Module incl. Wissens- und Kompetenzerwerb zur Selbstreflexion ........................................................11<br />
Zielorientierungsgespräche innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/<br />
zur Diabetesberaterin DDG ....................................................................................................................18<br />
Hinweise zu schriftlichen Ausarbeitungen..............................................................................................19<br />
Artikulationsschema ...............................................................................................................................26<br />
Einverständniserklärung Videoaufzeichnung .........................................................................................26<br />
Nachweisheft für den berufspraktischen Wissens- und Kompetenzerwerb...........................................26<br />
Nachweise <strong>der</strong> Praxiszeit (mindestens 544 Stunden exklusive Hospitationen) innerhalb <strong>der</strong><br />
Weiterbildung zum Diabetesberater/zur Diabetesberaterin DDG ..........................................................26<br />
Nachweise <strong>der</strong> Hospitation (40 Stunden) innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum<br />
Diabetesberater/zur Diabetesberaterin DDG .........................................................................................26<br />
Nachweise über 10 Schulungssequenzen innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/zur<br />
Diabetesberaterin DDG ..........................................................................................................................26<br />
Nachweise über 10 (Einzel-)Beratungen innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/zur<br />
Diabetesberaterin DDG ..........................................................................................................................26<br />
Seite 3 von 38
Name:<br />
Vorname:<br />
Geburtsdatum:<br />
Berufsabschluss:<br />
Kurs:<br />
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
<strong>Weiterbildungs</strong>stätte:<br />
Liebe(r) <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer(in),<br />
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Entschluss, sich in <strong>der</strong> Berufsdomäne <strong>der</strong> Diabetesberatung weiterzuqualifizieren<br />
und damit die Arbeits- und Geschäftsprozesse in Ihrem Tätigkeitsfeld kompetenter<br />
ausführen zu wollen und letztendlich die Beratungs- und Versorgungsqualität in <strong>der</strong> Diabetologie qualitätssichern<strong>der</strong>,<br />
d.h. auf fundiertem Grundwissen zu gestalten.<br />
<strong>Die</strong>ser <strong><strong>Weiterbildungs</strong>plan</strong> 1 basiert auf <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>- und Prüfungsordnung zum Diabetesberater/<br />
zur Diabetesberaterin <strong>der</strong> Deutschen Diabetes-Gesellschaft vom ... <strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>- und Prüfungsordnung<br />
wurde neu gestaltet, <strong>nach</strong> den:<br />
- Empfehlungen des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Einrichtung eines Europäischen<br />
Qualifikationsrahmens (EQR) für ein lebenslanges Lernen (Kommission <strong>der</strong> Europäischen<br />
Gemeinschaft (2006)) und des Deutschen Qualifikationsrahmens (2010)<br />
- Län<strong>der</strong>gemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und<br />
Masterstudiengänge (Beschluss <strong>der</strong> Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom<br />
04.02.2010).<br />
Damit entspricht die <strong>Weiterbildungs</strong>struktur den aktuellen bildungspolitischen Anfor<strong>der</strong>ungen. Zweck<br />
<strong>der</strong> Neustrukturierung war u.a. die Schaffung eines horizontalen durchlässigen Bildungskonzeptes für<br />
die beratenden Berufe in <strong>der</strong> Diabetologie. Resultierend kann man studieren ohne sein Wissen und<br />
seine Kompetenzen doppelt unter Beweis stellen zu müssen, z.B. den Bachelor-Studiengang Diabetes<br />
Care und Management, B.Sc. . <strong>Die</strong>se sogenannte pauschale Anrechnung ermöglicht es Ihnen,<br />
ggf. weniger Zeit für ein affines Studium zu verwenden.<br />
Mit dem <strong><strong>Weiterbildungs</strong>plan</strong> wollen wir Ihnen ein Instrument in die Hand geben, welches:<br />
- Ihnen einen Überblick über den Ablauf Ihrer Weiterbildung gibt,<br />
- die wesentlichen Dokumente beinhaltet,<br />
- Ihren Wissens- und Kompetenzerwerb dokumentiert. Daher füllen Sie bitte schon vor dem<br />
Bewerbungsgespräch das Formular „Selbstbewertungsbogen zum Wissens- und Kompetenzerwerb“<br />
aus.<br />
Der <strong><strong>Weiterbildungs</strong>plan</strong> ist Ihr „Begleiter“ während <strong>der</strong> Weiterbildung. Sie bringen Ihn bitte zum Bewerbungsgespräch<br />
an <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>stätte mit und geben ihn vor <strong>der</strong> Modulprüfung 3.1 bei Ihrer<br />
Kursleitung ab. Ziel ist die Sicherung des <strong>Weiterbildungs</strong>erfolges und die Dokumentation <strong>der</strong> zu<br />
erbringenden Leistungen innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung.<br />
Einige Termine werden Ihnen zu Beginn <strong>der</strong> Weiterbildung bekanntgegeben.<br />
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Weiterbildung, welche Ihnen neben zusätzlicher Arbeit auch<br />
Freude bereitet, so dass Sie insgesamt eine angenehme Zeit haben.<br />
Ihr Team <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>stätte <strong>der</strong> DDG<br />
Ich habe die <strong>Weiterbildungs</strong>- und Prüfungsordnung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin<br />
DDG vom 01.05.2010 gelesen.<br />
Datum Unterschrift<br />
1 PG <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>stätten für Diabetesberater(innen) DDG ©<br />
Seite 4 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Selbstbewertungsbogen zum Wissens- und Kompetenzerwerb<br />
Liebe(r) <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer(in),<br />
wir möchten gerne in Erfahrung bringen, wie Sie ihren Wissens und Kompetenzstand vor und <strong>nach</strong><br />
<strong>der</strong> Weiterbildung einschätzen. Als Reflexionsmatrix dienen die Ziele <strong>der</strong> Weiterbildung <strong>nach</strong> § 4 <strong>der</strong><br />
<strong>Weiterbildungs</strong>- und Prüfungsordnung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterinnen DDG.<br />
Bitte beurteilen Sie mit einem Kreuz (d.h. ich habe das Wissen bzw. die Kompetenz) Ihren Wissens-<br />
und Kompetenzstand. Wir möchten Sie bitten, dieses zu zwei Zeitpunkten zu tun:<br />
1. Vor Beginn <strong>der</strong> Weiterbildung, d.h. bringen Sie bitte zum Bewerbungsgespräch ihre erste Selbstbewertung<br />
mit,<br />
2. und vor dem Ablegen <strong>der</strong> letzten Prüfung (Mündlichen Prüfung).<br />
Sie haben die Möglichkeit unter <strong>der</strong> Rubrik „Bemerkung“, Ihre Einschätzung zu begründen, Hinweise<br />
o<strong>der</strong> Standpunkte zu vermerken.<br />
Ihr Team <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>stätte <strong>der</strong> DDG<br />
Wissen<br />
Fertigkeiten<br />
Fachkompetenz 1. 2.<br />
Er/Sie verfügt über ein sehr breites und integriertes Wissen und Verstehen zu:<br />
- medizinisch – diabetologische Grundlagen<br />
- Methoden <strong>der</strong> Analyse und Prozesse <strong>der</strong> Beurteilung von Situationen bezüglich<br />
<strong>der</strong> Beratung und Schulung von zu Beratenden<br />
- unterschiedlichen Möglichkeiten <strong>der</strong> Planung und Gestaltung von Beratungs<br />
- und Schulungssituationen für zu Beratende und kann kriteriengeleitet<br />
seine/ihre Auswahl begründen<br />
- den Grenzen des Fachgebietes und des beruflichen Tätigkeitsfeldes.<br />
Er/Sie verfügt über ein fachtheoretisches Wissen bezüglich eines kritischen<br />
Verständnisses relevanter Informationen:<br />
- zur Qualitätssicherung<br />
- zur Bedeutung <strong>der</strong> evidenzbasierten Medizin<br />
- des Case Managements.<br />
Er/Sie kann aufgrund seines/ihres breiten Spektrums an spezialisierten kognitiven<br />
und praktischen Fertigkeiten:<br />
- die Situation von zu Beratenden analysieren und beurteilen, um eigenständig<br />
individualisierte Beratungen und Schulungen zu gestalten, zu evaluieren<br />
und die gewonnen Erfahrungen und Ergebnisse für künftige Situationen<br />
nutzbar machen.<br />
- Beratende aller Altersstufen in den verschiedenen Krankheitsphasen unter<br />
Berücksichtigung ihrer körperlichen, sozialen, kulturellen, geistigen und<br />
seelischen Bedürfnisse beraten, schulen und sie angemessen begleiten<br />
und in ihrem Selbstmanagement unterstützen.<br />
- kreativ individuelle Problemlösungen bezogen auf spezifische therapeutische,<br />
ethische und soziale Situationen mit den Beratenden erarbeiten.<br />
- Arbeitsprozesse disziplin- und institutionsübergreifend planen und unter<br />
umfassen<strong>der</strong> Einbeziehung von Handlungsalternativen und Wechselwirkungen<br />
mit be<strong>nach</strong>barten Bereichen beurteilen und umfassende Transferleistungen<br />
erbringen.<br />
- weiterführende Versorgungsprozesse interdisziplinär abstimmen und in<br />
Kooperation das Case Management gestalten.<br />
- ein wirtschaftliches, qualitätssicherndes Arbeiten im diabetologischen<br />
Fachbereich sicherstellen.<br />
Seite 5 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Personale Kompetenz 1. 2.<br />
Sozialkompetenz<br />
Selbständigkeit<br />
Er/Sie verfügt für die Beziehungsgestaltung über eine Grundhaltung <strong>der</strong> Wertschätzung,<br />
Empathie und Kongruenz.<br />
Er/Sie versteht die Bedeutung <strong>der</strong> Chronizität für die zu Beratenden im systemischen<br />
Kontext Ihrer Alltagssituationen und <strong>der</strong> gesellschaftlichen Bedingtheit.<br />
Er/Sie unterstützt und begleitet die zu Beratenden bei <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
und Bewältigung <strong>der</strong> Krankheit im Sinne von Empowerment und Selbstmanagement.<br />
Er/Sie leitet zu Beratende und Teammitglie<strong>der</strong> an und unterstützt diese mit<br />
fundierter Lernberatung.<br />
Er/Sie gestaltet auch in heterogenen Gruppen Arbeitsprozesse kooperativ,<br />
för<strong>der</strong>t das Miteinan<strong>der</strong> im Team und die interdisziplinäre Zusammenarbeit.<br />
Er/Sie stellt fachübergreifend komplexe Sachverhalte strukturiert, zielgerichtet<br />
und adressatenbezogen dar.<br />
Er/Sie kann:<br />
- eigene und fremd gesetzte Lern- und Arbeitsziele reflektieren<br />
- bewerten<br />
- selbstgesteuert verfolgen<br />
- verantworten<br />
- sowie Konsequenzen für die Arbeitsprozesse im Team ziehen.<br />
Er/Sie kann:<br />
- eigenständig individualisierte Beratungen und Schulungen gestalten und<br />
evaluieren<br />
- gewonnene Erfahrungen und Ergebnisse nutzbar machen:<br />
- für künftige Situationen für die zu Beratenden<br />
- und den Fachbereich<br />
- im Beson<strong>der</strong>en unter Einbezug seines/ihres Wissens und <strong>der</strong> Fertigkeiten:<br />
- aus <strong>der</strong> Qualitätssicherung<br />
- dem Case Management<br />
- <strong>der</strong> Evidenzbasierten Medizin.<br />
Seite 6 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Bewerbungsgespräch<br />
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,<br />
zur optimalen Vorbereitung zum <strong>Weiterbildungs</strong>lehrgang Diabetesberater/In DDG möchten wir Ihnen<br />
folgende<br />
Empfehlungen mitgeben:<br />
Auflagen erteilen:<br />
Hospitation eines Behandlungs- und Schulungsprogramms für Menschen<br />
mit Typ 1 Diabetes mellitus<br />
mit Typ 2 Diabetes mellitus mit/ohne Insulin<br />
Hospitationsbericht einreichen bis________________<br />
Durchführung von weiteren Schulungsthemen am Arbeitsplatz<br />
(z. B. als Diätassistentin nicht nur Ernährungsthemen)<br />
Teilnahme an Teambesprechungen o<strong>der</strong> interdisziplinären Visiten<br />
Teilnahmen an anerkannten Fortbildungen <strong>der</strong> DDG<br />
(Nachweis einzureichen bis______________)<br />
Lesen von Fachliteratur<br />
Sonstiges:<br />
Ort: Datum:<br />
Stempel: Unterschrift:<br />
Seite 7 von 38
Bewerbungsgespräch (Exemplar für den Arbeitgeber)<br />
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,<br />
zur optimalen Vorbereitung zum <strong>Weiterbildungs</strong>lehrgang Diabetesberater/In DDG möchten wir Ihnen<br />
folgende<br />
Empfehlungen mitgeben:<br />
Auflagen erteilen:<br />
Hospitation eines Behandlungs- und Schulungsprogramms für Menschen<br />
mit Typ 1 Diabetes mellitus<br />
mit Typ 2 Diabetes mellitus mit/ohne Insulin<br />
Hospitationsbericht einreichen bis________________<br />
Durchführung von weiteren Schulungsthemen am Arbeitsplatz<br />
(z. B. als Diätassistentin nicht nur Ernährungsthemen)<br />
Teilnahme an Teambesprechungen o<strong>der</strong> interdisziplinären Visiten<br />
Teilnahmen an anerkannten Fortbildungen <strong>der</strong> DDG<br />
(Nachweis einzureichen bis______________)<br />
Lesen von Fachliteratur<br />
Sonstiges:<br />
Ort: Datum:<br />
Stempel: Unterschrift
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Modulübersicht<br />
Lernbereich I. II. III.<br />
Lernbereich<br />
Behandlungsprozess sichern<br />
– Eruieren und beurteilen <strong>der</strong><br />
Patientenvitalität -<br />
Anleiten, Coachen, Beraten und Schulen Interdisziplinär professionell Arbeiten<br />
Modul Nr. 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2<br />
Modul<br />
Diabetologische<br />
Grundlagen und<br />
Therapieschemata<br />
Analysieren und<br />
Beurteilen <strong>der</strong><br />
Patientensituation<br />
Planung, Gestaltung<br />
und<br />
Reflexion von<br />
Beratungssituationen<br />
als<br />
biopsychosozialerVermittlungsprozess<br />
Planung, Organisation,Durchführung<br />
und<br />
Evaluation von<br />
Schulungen<br />
Seite 9 von 38<br />
Praxis<br />
<strong>der</strong> Beratung und<br />
Schulung<br />
<strong>Die</strong> Rolle des<br />
Diabetesberaters/<br />
<strong>der</strong> Diabetesberaterin<br />
in<br />
den Versorgungsstrukturen <br />
Qualitätssicherung,<br />
Case Management<br />
und<br />
Evidencebasierung<br />
als Teil<br />
des<br />
Qualitätsmanagements<br />
DQR-Niveau 4 4 5 5 5 5 4<br />
Ergebniskontrolle<br />
60 min Klausur<br />
(1/3);<br />
120 min. Klausur<br />
(2/3)<br />
Hausarbeit<br />
- Erhebung einer<br />
Patientenanamnese<br />
-<br />
(2000 Wörter)<br />
Hausarbeit<br />
- Fallstudie zu<br />
einer Beratungssituation<br />
-<br />
(2000 Wörter)<br />
Hausarbeit<br />
- Reflexion einer<br />
Schulungs-<br />
Videosequenz -<br />
(2000 Wörter)<br />
Mündliche<br />
Prüfung<br />
(15 min)<br />
Fachvortrag<br />
(20 min)<br />
Prüfungstermine<br />
Theorie-Std. 170 80 70 70 16 50 60 516<br />
Praxis-Std. 50 150 80 70 234 0 0 584<br />
SLZ 80 70 150 160 50 100 90 700<br />
Workload 300 300 300 300 300 150 150 1800<br />
Pauschalen An-<br />
rechnungsmöglichkeit<br />
auf den Studiengang<br />
Diabetes<br />
Care und Management,<br />
B.Sc.<br />
anrechungsfähig anrechungsfähig anrechungsfähig anrechungsfähig anrechungsfähig anrechungsfähig<br />
keine<br />
nicht<br />
anrechnungsfähig<br />
insgesamt
PräsensphasePräsenzwoche<br />
Module<br />
1.1<br />
1.2<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
3.1<br />
3.2<br />
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Zeitschiene und Arbeitsplanung<br />
1. Block 2. Block 3.Block 4.Block 5.Block<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.<br />
Klausur<br />
60min*<br />
HA: Patientenanamnese<br />
Än<strong>der</strong>ungen vorbehalten! Seite 10 von 38<br />
HA:<br />
Fallstudien<br />
Klausur<br />
120min*<br />
HA: Schulungsvideo<br />
Fachvortrag<br />
Aktivitäten<br />
zwischen<br />
Module<br />
Block 1. und 2. Block 2. und 3. Block 3. und 4. Block 4. und 5.<br />
1.1 Nacharbeiten: Theorie Nacharbeiten: Theorie Vorbereiten: Theorie (Klausur)<br />
1.2 Vorbereitung: Hausarbeit<br />
- Patientenanamnese -<br />
Abgabe <strong>der</strong> Hausarbeit:<br />
4 Wochen vor 3.Block<br />
2.1 Vorbereitung: Hausarbeit<br />
Vorbereitung: Hausarbeit<br />
Abgabe <strong>der</strong> Hausarbeit:<br />
- Fallstudie -<br />
- Fallstudie -<br />
lt. <strong>Weiterbildungs</strong>stätte<br />
2.2 Vorbereitung: Hausarbeit<br />
Vorbereitung: Hausarbeit<br />
Abgabe <strong>der</strong> Hausarbeit:<br />
- Schulung-Video -<br />
- Schulung-Video -<br />
4 Wochen vor Block 4<br />
2.3 Hospitation & Durchführung von Hospitation & Durchführung von Hospitation & Durchführung von Vorbereitung: Mündliche Prüfung:<br />
Schulung und Beratungen Schulung und Beratungen Schulung und Beratungen<br />
Fallbeispiele<br />
3.1 Vorbereitung: Fachvortrag Vorbereitung: Fachvortrag Vorbereitung:<br />
Fachvortrag in <strong>der</strong> 12. Woche<br />
3.2<br />
Selbstlernzeit<br />
Mündliche<br />
Prüfung
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Selbstbewertungsbogen zum Wissens- und Kompetenzerwerb in den Modulen<br />
Lieber <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer, liebe <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmerin,<br />
wir möchten Sie bitten, Ihren Wissens- und Kompetenzerwerb pro Modul zu beurteilen. Ziel ist es<br />
nicht, dass Sie mit einem Kreuz überall dokumentiert, dass Sie alle Lehr-, Lernziele erreicht haben. In<br />
kritischer Selbstreflexion soll für Sie und für uns in Erfahrung gebracht werden, ob die Weiterbildung<br />
es auch ermöglicht. Daher trauen Sie sich bitte, auch mal kein Kreuz zu machen. Unter <strong>der</strong> Rubrik<br />
„Bemerkung“ haben Sie auch die Möglichkeit Ihre Einschätzung zu begründen, Hinweise o<strong>der</strong> Standpunkte<br />
zu vermerken.<br />
Bitte bewerten Sie zwei Mal Ihren Wissens- und Kompetenzstand:<br />
1. Bewertung: Nach dem Sie die Prüfungsleistung für ein Modul erbracht haben (vor dem Erhalt<br />
des Ergebnisses),<br />
2. Bewertung: Vor <strong>der</strong> mündlichen Prüfung, d.h. vor Abgabe des <strong><strong>Weiterbildungs</strong>plan</strong>s.<br />
Ihr Team <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>stätte <strong>der</strong> DDG<br />
Lernbereich I. Behandlungsprozess sichern – Eruieren und beurteilen <strong>der</strong> Patientenvitalität<br />
Modul 1.1 Diabetologische Grundlagen und Therapieschemata<br />
Modulbeschreibung<br />
Lehr-/<br />
Lernergebnis<br />
Ergebniskontrolle<br />
Bemerkungen:<br />
Das Modul vermittelt medizinisch-diabetologischen Grundkenntnisse<br />
für die Beratung und Schulung von Menschen mit Diabetes mellitus.<br />
Im Detail werden die komplexen Zusammenhänge <strong>der</strong> Ätiologie,<br />
Pathophysiologie, Prävention und Therapie <strong>der</strong> Erkrankung besprochen.<br />
<strong>Die</strong> Teilnehmenden erhalten die Befähigung im Rahmen <strong>der</strong><br />
Schulungs- und Beratungspraxis zentrale medizinische Inhalte zu<br />
analysieren, zu erklären und diese zum eigenständigen Wissenserwerb<br />
zu nutzen.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer/-innen:<br />
- haben ein vertieftes und verbreitetes fachspezifische Wissen<br />
<strong>der</strong> medizinisch-diabetologischen Grundlagen und des<br />
Einflusses von spezifischen Lebenssituationen auf die Therapieschemata.<br />
- können professionell bei diagnostischen und therapeutischen<br />
Maßnahmen mitwirken und <strong>der</strong>en Durchführen eigenverantwortlich<br />
überwachen.<br />
- können vorausschauend therapeutische Maßnahmen und<br />
<strong>der</strong>en Nebenwirkungen analysieren und gegebenenfalls intervenieren.<br />
- können relevante Fachinformationen sammeln, bewerten<br />
und interpretieren.<br />
- können das Fachwissen systematisch patientenorientiert<br />
vermitteln.<br />
- können sich selbstständig aktuelle fachrelevante Erkenntnisse<br />
aneignen.<br />
- Können auf Grund <strong>der</strong> Fachkompetenz eigene Entscheidungen<br />
treffen und sichern damit ihre Handlungsfähigkeit.<br />
- können in einem Notfall lebensrettende Maßnahmen einleiten.<br />
60 min Klausur (1/3), 120 min. Klausur (2/3)<br />
Seite 11 von 38<br />
Selbstbewertung<br />
des<br />
Wissens und<br />
Kompetenzerwerbs<br />
1. 2.
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Lernbereich I. Behandlungsprozess sichern – Eruieren und Beurteilen <strong>der</strong> Patientenvitalität<br />
Modul 1.2 Analysieren und Beurteilen <strong>der</strong> Patientensituation<br />
Modulbeschreibung<br />
Lehr-/<br />
Lernergebnis<br />
Ergebniskontrolle<br />
Bemerkungen:<br />
<strong>Die</strong> Teilnehmer/innen sind in <strong>der</strong> Lage, relevante medizinischdiabetologische<br />
Fachinformationen zur Bewältigung komplexer Patientensituationen<br />
zu erheben, zu analysieren und diese systematisch<br />
für die Schulungs- und Beratungspraxis zu bewerten. Sie verfügen<br />
über ein vertieftes Verständnis <strong>der</strong> multifaktoriellen Einflussbedingungen<br />
auf die jeweilige Patientensituation sowie die Bedeutung von<br />
individuellen präventiven Maßnahmen und können relevante medizinische<br />
Informationen für die Beratung extrahieren.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer:<br />
- verfügen über detaillierte theoretische und praktische Fachkenntnisse<br />
zum Beurteilen <strong>der</strong> Komplexität und Folgen von<br />
Behandlungssituationen,<br />
- können umfassend alle relevanten Parameter zur Patientenvitalität<br />
erheben,<br />
- haben ein vertieftes Verständnis gängiger Screeningverfahren,<br />
- erschließen systematisch bedarfsgerechte und alterspezifische<br />
Selbstkontrollmöglichkeiten mit hoher Alltagspraktikabilität,<br />
- entwickeln umfassend Lösungen zur Bewältigung individueller<br />
Therapieprobleme,<br />
- analysieren systematisch unvorhersehbare Verän<strong>der</strong>ungen in<br />
therapeutischen Setting und können an diesen situationsgerecht<br />
therapeutisch mitwirken.<br />
Hausarbeit (2000 Wörter): Erhebung einer Patientenanamnese<br />
Seite 12 von 38<br />
Selbstbewertung<br />
des<br />
Wissens<br />
und<br />
Kompetenzerwerbs<br />
1. 2.
Lernbereich II.<br />
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Anleiten, Coachen, Beraten und Schulen<br />
Modul 2.1 Planung, Gestaltung und Reflexion von Beratungssituationen<br />
als biopsychosozialer Vermittlungsprozess<br />
Modulbeschreibung<br />
Lehr-/<br />
Lernergebnisse<br />
Ergebniskontrolle<br />
Bemerkungen:<br />
<strong>Die</strong> Teilnehmer/-innen können auf <strong>der</strong> Basis eines biopsychosozialen<br />
Krankheitsverständnisses Beratungssituationen planen, gestalten<br />
und reflektieren. Sie gestalten Beratung als einen dialogischen, ergebnisoffenen<br />
Prozess, in dessen Verlauf personenorientierte, d.h.<br />
individuell tragbare Vereinbarungen getroffenen werden. Unter Berücksichtigung<br />
salutogener Aspekte sowie <strong>der</strong> Copingprozesse <strong>der</strong><br />
Betroffenen werden Unterstützungsangebote für ein effektives<br />
Krankheitsmanagement erarbeitet.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer:<br />
- haben ein vertieftes Verständnis für den biopsychosozialen<br />
Charakter <strong>der</strong> Erkrankung und vorhandene gesellschaftliche<br />
Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse,<br />
- können die Bedürfnisse <strong>der</strong> Erkrankten und ihrer Bezugspersonen<br />
angemessen wahrnehmen und eine tragfähige professionelle<br />
Beziehung aufbauen,<br />
- verfügen über eine vertiefte Kenntnis relevanter beratungspsychologischer<br />
Konzepte und wenden hieraus Strategien in<br />
<strong>der</strong> Beratungsarbeit an,<br />
- Wissen um den Unterschied zwischen informieren, anleiten,<br />
beraten, coachen, schulen.<br />
- können die Beratungsarbeit unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Lebensphase<br />
des Menschen mit Diabetes mellitus gestalten,<br />
- können die Menschen mit Diabetes mellitus und ihre Bezugspersonen<br />
beim Bewältigen <strong>der</strong> Erkrankung im Sinne von<br />
Salutogenese, Empowerment und Selbstmanagement unterstützen<br />
und beraten,<br />
- entwickeln Flexibilität und Offenheit für individuelle Problemlösungen,<br />
- können über Selbsthilfeorganisationen informieren.<br />
Hausarbeit (2000 Wörter): Fallstudie zu einer Beratungssituation<br />
Seite 13 von 38<br />
Selbstbewertung<br />
des<br />
Wissens<br />
und<br />
Kompetenzerwerbs<br />
1. 2.
Lernbereich II.<br />
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Anleiten, Coachen, Beraten und Schulen<br />
Modul 2.2 Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Schulungen <br />
Modulbeschreibung<br />
Lehr-/<br />
Lernergebnisse<br />
Ergebniskontrolle<br />
Bemerkungen:<br />
<strong>Die</strong> Teilnehmer/-innen erwerben lernpädagogische und –<br />
psychologische Fähigkeiten, sie kennen spezifische Schulungsprogramme<br />
für Menschen mit Diabetes mellitus und Programme zur<br />
Prävention <strong>der</strong> Erkrankung. Sie planen Schulungen unter didaktischen<br />
Gesichtspunkten eigenständig, führen sie durch und evaluieren<br />
diese. Im ersten Teil <strong>der</strong> Weiterbildung erlernen die Teilnehmer/innen,<br />
kleine Unterrichtssequenzen unter Videoeinsatz durchzuführen,<br />
zu beobachten und Teile ihres Unterrichtsverhaltens gezielt zu<br />
verän<strong>der</strong>n. Im zweiten Teil erlernen die Teilnehmer/-innen ihre<br />
Grundkenntnisse und Erfahrungen auf reale Schulungssituationen zu<br />
übertragen und zu reflektieren. Durch Selbstbeobachtungserfahrungen<br />
und Einbeziehen von Evaluationsergebnissen erwerben die Teilnehmer/-innen<br />
erweiterte Kompetenzen Schulungen situationsspezifisch<br />
zu gestalten.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer:<br />
- kennen zielgruppenspezifische Schulungsprogramme für<br />
Menschen mit Diabetes mellitus und Programme zur Prävention<br />
<strong>der</strong> Erkrankung,<br />
- haben ein vertieftes Verständnis für lernpsychologische und<br />
–pädagogische Zusammenhänge verschiedener Altersgruppen,<br />
- können Schulungen unter pädagogischen Gesichtspunkten<br />
planen, verschriften (Schulungsentwürfe) und durchführen,<br />
- haben ein tiefes Verständnis für den Nutzen von Reflektionen<br />
wie videogestützte Unterrichtsanalysen, Evaluationen,<br />
- kennen Verfahren zur Evaluationen und nutzen diese aktiv,<br />
- können ihr eigenes Interaktionsverhalten und die verbalen<br />
und nonverbalen Kommunikationsstrukturen hinterfragen und<br />
gegebenenfalls modifizieren.<br />
Hausarbeit (2000 Wörter): Reflexion einer Schulung-Videosequenz<br />
Seite 14 von 38<br />
Selbstbewertung<br />
des<br />
Wissens<br />
und<br />
Kompetenzerwerbs<br />
1. 2.
Lernbereich II.<br />
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Anleiten, Coachen, Beraten und Schulen<br />
Modul 2.3 Praxis <strong>der</strong> Beratung und Schulung<br />
Modulbeschreibung<br />
Lehr-/<br />
Lernergebnisse<br />
Ergebniskontrolle<br />
Bemerkungen:<br />
<strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer/-innen erwerben Wissen und Kompetenzen<br />
in den originären Aufgaben <strong>der</strong> Diabetesberatung, wie Planen<br />
und Durchführen von Beratungen und Schulungen, sowie in <strong>der</strong> Arbeitsorganisation.<br />
Zudem werden durch Hospitationen vertiefte und<br />
erweiterte Kenntnisse im Fachbereich <strong>der</strong> Diabetologie erlangt.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer:<br />
- haben in Praxissituationen beraterische Handlungsmöglichkeiten<br />
für die einzelnen Phasen des Schulungs- und Beratungsprozesses,<br />
kennen diese und können sie in ihrer Wirkung<br />
abschätzen,<br />
- haben vertiefte Einblicke in praxisrelevante Beratungs- und<br />
Schulungsstrukturen und können diese mit den theoretisch<br />
erworbenen Kenntnissen abgleichen,<br />
- können Zeitmanagement und Organisationsabläufe effektiv<br />
strukturieren,<br />
- entwickeln ein vertieftes Verständnis über die Anwendungsmöglichkeiten<br />
und Grenzen spezifischer Schulungs- und Beratungskonzepte,<br />
- verfügen über einen verweiterten Einblick in den Berufsalltag<br />
<strong>der</strong> Hospitationsstätte.<br />
Mündliche Prüfung (15 min)<br />
Seite 15 von 38<br />
Selbstbewertung<br />
des<br />
Wissens<br />
und<br />
Kompetenzerwerbs<br />
1. 2.
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Lernbereich III. Interdisziplinär professionelles Arbeiten<br />
Modul 3.1 <strong>Die</strong> Rolle des Diabetesberaters/ <strong>der</strong> Diabetesberaterin in den<br />
Versorgungsstrukturen<br />
Modulbeschreibung<br />
Lehr-/<br />
Lernergebnisse<br />
Ergebniskontrolle<br />
Bemerkungen:<br />
<strong>Die</strong> Teilnehmer erhalten vertiefte und verbreitete Kenntnisse über die<br />
Geschichte <strong>der</strong> Diabetologie und <strong>der</strong> Versorgungsstrukturen in<br />
Deutschland. Als Versorgungsstrukturen werden vorinstitutionelle<br />
private Hilfen, soziale <strong>Die</strong>nste und Einrichtungen und institutionelle<br />
Unterstützungsformen thematisiert. Aufgaben und Ziele <strong>der</strong> einschlägigen<br />
Fachgesellschaften und –gremien werden aufgezeigt.<br />
Über diese Kenntnis und den Einblick in die Historie <strong>der</strong> eigenen<br />
Berufsrolle wird das Aufgabenfeld und die Organisation <strong>der</strong> Diabetesberatung<br />
als Team- und Führungsarbeit sowie hinsichtlich administrativer<br />
und rechtlicher Fragen analysiert. Weiterer integraler Bestandteil<br />
des Moduls sind Fragen <strong>der</strong> persönlichen Psychohygiene<br />
sowie <strong>der</strong> Zusammenarbeit vom therapeutischen Team mit dem<br />
Menschen mit Diabetes mellitus. Auf <strong>der</strong> Basis kommunikationstheoretischer<br />
Inhalte Grundlagen <strong>der</strong> Rede- und Gesprächsrhetorik werden<br />
eingeübt.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer:<br />
- können vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Kenntnis <strong>der</strong> eigenen Berufsrolle<br />
Diabetesberatung als Team- und Führungsarbeit<br />
verstehen und adäquat mit Fachgremien und Fachgesellschaften<br />
kooperieren,<br />
- verfügen über eine vertiefte Kenntnis rechtlicher Fragen in<br />
<strong>der</strong> Diabetesberatung,<br />
- können berufliche Überlastungen erkennen und zu einer Bewältigung<br />
beitragen,<br />
- entwickeln effektive Formen kooperativer Zusammenarbeit<br />
mit Patienten und an<strong>der</strong>en Berufsgruppen,<br />
- können zielgruppenspezifische Fachvorträge unter Berücksichtigung<br />
medienwissenschaftlicher Erkenntnisse durchführen,<br />
- können im fachlichen Diskurs argumentativ Problemlösungen<br />
erarbeiten und Positionen vertreten,<br />
- besitzen eine Problemlösungsfähigkeit, um aufgrund <strong>der</strong><br />
Fachkompetenz eigene Entscheidungen zu treffen und handlungsfähig<br />
zu sein,<br />
- können bei <strong>der</strong> Einarbeitung neue Mitarbeiter und <strong>der</strong>en Beurteilung<br />
mitwirken,<br />
- haben vertiefte Kenntnisse in Administration und Abrechnungspraxis<br />
Fachvortrag (20 min)<br />
Seite 16 von 38<br />
Selbstbewertung<br />
des<br />
Wissens<br />
und<br />
Kompetenzerwerbs<br />
1. 2.
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Lernbereich III. Interdisziplinär professionelles Arbeiten<br />
Modul 3.2 Qualitätssicherung, Case Management und Evidencebasierung<br />
als Teil des Qualitätsmanagements<br />
Modulbeschreibung<br />
Lehr-/<br />
Lernergebnisse<br />
Ergebniskontrolle<br />
Bemerkung:<br />
Das Modul befähigt zur aktiven Mitarbeit bei Qualität sichernden<br />
Maßnahmen, wie Zertifizierung, Umsetzen von Leitlinien. <strong>Die</strong> Bedeutung<br />
von EBM/EBN und <strong>der</strong>en Einfluss auf die Beratungs- und Schulungspraxis,<br />
dazu werden forschungsrelevante Grundkenntnisse<br />
vermittelt. <strong>Die</strong> Teilnehmer erhalten Hinweise, wo sie Evidence basierte<br />
Informationen einholen können, z.B. IQWIG. Wirtschaftlichkeitsaspekte,<br />
einschließlich abrechnungsrelevanter Kenntnisse. Grundlagen<br />
des Case Management und <strong>der</strong> Disease Management–Programme<br />
(DMP) werden vermittelt, im Kontext mit <strong>der</strong> Bedeutung <strong>der</strong> Qualitätssicherung<br />
des Versorgungssystems.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer:<br />
- haben ein vertieftes und verbreitetes Wissen über die Notwendigkeit<br />
von qualitätssichernden Maßnahmen und unterstützen<br />
aktiv <strong>der</strong>en Durchführung,<br />
- haben ein Verständnis für die Bedeutung <strong>der</strong> EBM/EBN in ihrem<br />
Fachgebiet und<br />
- kommunizieren dieses gegenüber Laien und Fachvertretern<br />
- besitzen Grundkenntnisse zum Forschungsdesign und -<br />
prozess<br />
- organisieren die Abläufe entsprechend dem Wirtschaftlichkeits-<br />
und Qualitätsprinzip,<br />
- verfügen über eine vertiefte Verfahrenssicherheit in <strong>der</strong><br />
Fallsteuerung.<br />
keine<br />
Seite 17 von 38<br />
Selbstbewertung<br />
des<br />
Wissens<br />
und<br />
Kompetenzerwerbs<br />
1. 2.
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Zielorientierungsgespräche innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/zur Diabetesberaterin<br />
DDG<br />
Datum: von bis<br />
Zielvereinbarung:<br />
Unterschriften<br />
Zielorientierungsgespräche (fakultativ) innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/zur<br />
Diabetesberaterin DDG<br />
Datum: von bis<br />
Zielvereinbarung:<br />
Unterschriften<br />
Datum: von bis<br />
Zielvereinbarung:<br />
Unterschriften<br />
Seite 18 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Hinweise zu schriftlichen Ausarbeitungen<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Allgemeine Hinweise ………………………………………………………………....... ...19<br />
1 Hinweise zu den formalen Anfor<strong>der</strong>ungen an die Seitengestaltung……... ...21<br />
2 Hinweise zum Titelblatt ……………………………………………………….....22<br />
3 Strukturierung <strong>der</strong> Arbeit ……………………………………………………... ...23<br />
4 Hinweise zur Glie<strong>der</strong>ung ………………..……………………………………. ...23<br />
5 Hinweise zu den Zitierregeln und Quellenangaben ……………………….. ...24<br />
5.1 Literaturangaben im Text …………………………………………………….. ...24<br />
5.1.1 Das indirekte Zitat ……………………………………………………….............25<br />
5.1.2 Das direkte (wörtliche) Zitat ………………………………………….……........25<br />
5.1.3 Das Sekundärzitat …………………………………………………………….. ...25<br />
5.2 Angaben im Literatur- und Quellenverzeichnis …………………………….....25<br />
Allgemeine Hinweise<br />
Eine Hausarbeit (2000/4000 Wörter) o<strong>der</strong> schriftliche Ausarbeitung ist das Ergebnis<br />
eines selbstständigen Bearbeitungsprozesses eines Themas in einem festgelegten<br />
Zeitraum mit angemessener, regelgeleiteter Dokumentation. So eine Prüfungsleis-<br />
tung ist keine beliebige Darstellung bereits vorgefertigter Inhalte, son<strong>der</strong>n muss ei-<br />
ne persönliche Leistung darstellen.<br />
In geeigneten Fällen können, in Absprache mit den Prüfern, diese Leistungen auch<br />
in Form von Gruppenarbeiten erbracht werden. Der Beitrag <strong>der</strong> jeweiligen Verfasse-<br />
rin/ des jeweiligen Verfassers muss als individuelle Leistung durch Angabe von Ab-<br />
schnitten, Seitenzahlen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar von<br />
einan<strong>der</strong> für die Bewertung erkennbar sein. Sie haben die Möglichkeit Vorschläge<br />
für die Aufgabenstellung mit dem Kursleiter/ Modulverantwortlichen abzustimmen.<br />
Eine Hausarbeit wird von zwei Prüfern/ Prüferinnen bewertet und ist somit in dop-<br />
pelter Ausführung abzugeben. Als Abgabedatum gilt <strong>der</strong> Eingangs- o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Post-<br />
stempel.<br />
Für das Layout sollte man sich Zeit nehmen. Eine schriftliche Leistung ist als Druck-<br />
Version abzugeben. Neben <strong>der</strong> mangelnden Zeiteinteilung kann aufgrund mangeln-<br />
<strong>der</strong> Praxis die noch nicht so weit fortgeschrittene Sicherheit im Umgang mit <strong>der</strong><br />
Seite 19 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Textverarbeitung zu einem umso wesentlicheren Stressfaktor werden, je näher <strong>der</strong><br />
Abgabetermin rückt. Am besten werden vorher alle Optionen durchgegangen und<br />
die Möglichkeiten <strong>der</strong> Software erforscht.<br />
Es erscheint dem Anwen<strong>der</strong> oftmals, als gehe <strong>der</strong> Computer (beson<strong>der</strong>s ältere Mo-<br />
delle) seine eigenen Wege, v.a. was das Verschwinden von Text anbelangt. Um die<br />
dadurch entstehende Katastrophe wenigstens in überschaubaren Grenzen zu hal-<br />
ten, gibt es drei goldene Regeln, an die bei <strong>der</strong> Textverarbeitung zu denken ist:<br />
1. Speichern!<br />
2. <strong>nach</strong> je<strong>der</strong> Seite speichern!<br />
3. und immer wie<strong>der</strong> zwischendurch speichern!<br />
Es sollte lieber einmal zu oft als einmal zu wenig eine Datensicherung durchgeführt<br />
werden; sowohl auf Festplatte als auch (für den Fall eines Totalabsturzes) auf USB-<br />
Stick, in gebrannter Form auf CD o<strong>der</strong> auf externer Festplatte. Auch <strong>der</strong> Ausdruck<br />
auf Papier zwischendurch dient <strong>der</strong> Datensicherung. In jedem Fall ist sinnvoll meh-<br />
rere Methoden zur Datensicherung und -wie<strong>der</strong>herstellung zu beherrschen, so dass<br />
im Notfall sichergestellt ist, wie die Situation und <strong>der</strong> Text zu retten ist.<br />
Auf folgende Kriterien sollten Sie daher achten:<br />
- Korrektheit und Objektivität in <strong>der</strong> Darstellung von Sachverhalten<br />
- Systematik und Plausibilität in <strong>der</strong> Themenbehandlung (Logik <strong>der</strong> Argumen-<br />
tation)<br />
- Verwertbarkeit und Verständlichkeit dargestellter Erkenntnisse, z.B. Praxisre-<br />
levanz.<br />
Am Anfang einer Themenbearbeitung sollten Sie sich folgende Fragen stellen:<br />
- Welches Thema möchte ich bearbeiten?<br />
- Welche Inhalte sollen aufgenommen werden? Wie grenze ich das Thema<br />
ein?<br />
- Wie müssen die Inhalte geglie<strong>der</strong>t werden?<br />
Seite 20 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
1 Hinweise zu den formalen Anfor<strong>der</strong>ungen an die Seitengestaltung<br />
Bei <strong>der</strong> Anfertigung einer schriftlichen Studien- und Prüfungsleistung gelten folgen-<br />
de Normen:<br />
- Alle Blätter einseitig zu beschriften.<br />
- <strong>Die</strong> Arbeit ist gelocht und mit einem Heftstreifen zusammengeheftet.<br />
- Seitenbezifferung: in arabischen Ziffern (ohne Deckblatt und Inhaltsverzeich-<br />
nis) beginnt mit <strong>der</strong> ersten Seite <strong>der</strong> Einleitung, endet mit <strong>der</strong> letzten Seite<br />
des Literaturverzeichnisses. Der Anhang ist neu zu nummerieren und mit ei-<br />
nem Verzeichnis zu versehen.<br />
- <strong>Die</strong> Arbeit muss bezüglich des Umfangs den Vorgaben aus <strong>der</strong> Modulbe-<br />
schreibung entsprechen. In <strong>der</strong> Erklärung zur selbstständigen Anfertigung<br />
<strong>der</strong> schriftlichen Studien- und Prüfungsleistungen ist die Anzahl <strong>der</strong> Worte zu<br />
vermerken. <strong>Die</strong> Addition <strong>der</strong> Worte beginnt mit <strong>der</strong> Einleitung und endet mit<br />
dem Schlusssatz.<br />
- Für die Einrichtung <strong>der</strong> DIN A4 Seite in Hochformat gelten folgende Anga-<br />
ben:<br />
Oben 3,5 cm<br />
Unten 2,5 cm<br />
Links 3,0 cm<br />
Rechts 3,0 cm<br />
- Als Schriftart ist in Arial 12 zu wählen.<br />
- Als Zeilenabstand ist 1,5 vorgeschrieben.<br />
- Das Literaturverzeichnis, Fußnoten und Legenden sollten einen einfachen<br />
Zeilenabstand haben.<br />
- Der Absatz (zwischen den Absätzen) beträgt 6 pt.<br />
- Als Layout ist linksbündig zu wählen.<br />
- Alle Tabellen und Abbildungen müssen nummeriert und an sinnvollen Stellen<br />
im Text positioniert sein, sowie eine sinnvolle Beschriftung und Legende ha-<br />
ben.<br />
- Kopf- und Fußzeilen dienen in erster Linie dem Leser zur Orientierung. In ei-<br />
ner Arbeit mit einem Umfang von weniger als 15 Seiten empfiehlt es sich,<br />
Seite 21 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
wenn überhaupt lediglich den Titel <strong>der</strong> Arbeit anstatt <strong>der</strong> Kapitelüberschriften<br />
in die Kopfzeile aufzunehmen.<br />
- Fußnoten dienen entwe<strong>der</strong> für Literaturangaben o<strong>der</strong> für notwendige inhaltli-<br />
che Ergänzungen zum besseren Verständnis bzw. für ergänzende Literatur-<br />
hinweise. Grundsätzlich gilt: Unwichtige und nebensächliche Informationen<br />
sollten besser komplett weggelassen werden.<br />
- Details <strong>der</strong> statistischen Analyse müssen in Legenden und im Text kenntlich<br />
gemacht werden.<br />
- <strong>Die</strong> Arbeit hat folgenden Aufbau:<br />
- Titelblatt (Anlage 1)<br />
- Abstract<br />
- Inhaltsverzeichnis<br />
- ggf. Tabellenverzeichnis<br />
- ggf. Abbildungsverzeichnis<br />
- ggf. Abkürzungsverzeichnis<br />
- Einleitung<br />
- Hauptteil<br />
- Diskussion/Fazit<br />
- ggf. Glossar<br />
- Literaturverzeichnis<br />
- Quellenverzeichnis<br />
- Anhang<br />
- Eidesstattliche Erklärung (Anlage 2)<br />
2 Hinweise zum Titelblatt<br />
Das Deckblatt sollte dem beigefügten Muster entsprechen (Anlage 1).<br />
Seite 22 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
3 Strukturierung <strong>der</strong> Arbeit<br />
<strong>Die</strong> schriftliche Studien- und Prüfungsleistung glie<strong>der</strong>t sich in folgen<strong>der</strong> Weise.<br />
<strong>Die</strong> Einleitung/das Abstract <strong>der</strong> schriftlichen Arbeit beinhaltet im Allgemeinen:<br />
- Vorbemerkungen<br />
- Einführung in die Thematik (z.B. aktuelle, historischer, problemorientierter<br />
Bezug)<br />
- Rechtfertigung und Abgrenzung des Themas<br />
- Problemstellung und Ziel <strong>der</strong> Arbeit einschließlich <strong>der</strong> Fragestellung<br />
- Definition grundlegen<strong>der</strong> Begriffe<br />
- Überblick über Aufbau und Argumentationsfolge <strong>der</strong> Arbeit<br />
- Begründung <strong>der</strong> Vorgehensweise.<br />
Der essentielle Teil dient <strong>der</strong> inhaltlichen Bearbeitung des Themas. <strong>Die</strong>ser Punkt<br />
ergibt sich aus folgenden Inhalten:<br />
- Beschreibung <strong>der</strong> Ausgangssituation (<strong>der</strong> Sach- und Bedingungsanalyse)<br />
- ggf. konkretisierende Fragestellung (Zielbeschreibung)<br />
- Beschreibung des Vorgehens (Methodenbeschreibung)<br />
- Ergebnisdarstellung.<br />
<strong>Die</strong> Diskussion/ das Fazit fast noch einmal die wesentlichen Punkte <strong>der</strong> Arbeit zu-<br />
sammen, reflektiert und bewertet diese. Außerdem sollen auf potentielle zukünftige<br />
Entwicklungen eingegangen werden und Resultate, einschließlich noch zu beant-<br />
worten<strong>der</strong> Fragen, formuliert werden.<br />
4 Hinweise zur Glie<strong>der</strong>ung<br />
<strong>Die</strong> Einleitung und Diskussion/Fazit gehören als Glie<strong>der</strong>ungspunkt in das Inhalts-<br />
verzeichnis. Geglie<strong>der</strong>t werden kann bis in die dritte Ebene. Verwendet werden soll-<br />
ten arabische Ziffern, z.B.<br />
1 …<br />
1.1 …<br />
1.1.1 …<br />
1.1.2 …<br />
1.2 …<br />
Seite 23 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Unterglie<strong>der</strong>ungen sind nur dann vorzunehmen, wenn mindestens zwei Gliede-<br />
rungspunkte vorhanden sind.<br />
5 Hinweise zu den Zitierregeln und Quellenangaben<br />
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten Ansichten von an<strong>der</strong>en zu zitieren (Siehe<br />
Literaturangaben im Text). Alle Literaturangaben o<strong>der</strong> Quellen sind im Literatur-<br />
und/o<strong>der</strong> Quellenverzeichnis alphabetisch aufzulisten.<br />
5.1 Literaturangaben im Text<br />
Alle im Text genannten Ansichten, bei denen es sich um fremde Ansichten handelt,<br />
bzw. um eine Ansicht des Verfassers, die in einer an<strong>der</strong>en als <strong>der</strong> vorliegenden Ar-<br />
beit schon einmal geäußert worden ist, müssen zitiert werden. Das heißt, die Her-<br />
kunft aller verwendeten Gedanken, Ergebnisse und Zitate, welche aus an<strong>der</strong>en Ar-<br />
beiten (wie zum Beispiel Veröffentlichungen in Form von Aufsätzen o<strong>der</strong> Texte aus<br />
Monographien) stammen, müssen eindeutig belegt und im Text kenntlich gemacht<br />
werden.<br />
Allgemein gilt:<br />
- Bei zwei Autoren eines Textes werden beide Autoren zitiert (Meier/Schmidt,<br />
1991).<br />
- Ab 3 Autoren eines Textes werden alle Autoren beim ersten Mal zitiert, da-<br />
<strong>nach</strong> wird lediglich <strong>der</strong> erste Autor vermerkt und die Abkürzung „u.a.“ hinzu-<br />
gefügt. Beispiel: (Heineberg u.a., 2002: 120)<br />
- Bei mehreren Quellen werden die verschiedenen Quellen durch ein „;“ ge-<br />
trennt. Beispiel: Mehrere Studien (Smith u.a., 1990: 122; Murray, 1997: 127)<br />
belegen, dass …<br />
- Hat ein Autor in einem Jahr mehrere Artikel publiziert, die in <strong>der</strong> Arbeit zitiert<br />
werden, so werden die gleichen Jahreszahlen zur genaueren Kennzeichnung<br />
im Literaturverzeichnis mit einer alphabetischen Zählung versehen, die in <strong>der</strong><br />
Reihenfolge dem Erscheinen <strong>der</strong> Literaturangaben im Fließtext entspricht,<br />
also zum Beispiel (2003a), (2003b) und (2003c).<br />
Seite 24 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
5.1.1 Das indirekte Zitat<br />
Eine sinngemäße Übernahme von Gedanken an<strong>der</strong>er steht nicht in Anführungszei-<br />
chen, es folgt jedoch, wie bei einem wörtlichen Zitat, ein Text<strong>nach</strong>weis, z.B. die<br />
konstruierte Wirklichkeit … (Hard, 1993: 118).<br />
5.1.2 Das direkte (wörtliche) Zitat<br />
Wenn eine Aussage o<strong>der</strong> ein Gedanke eines Autors wörtlich übernommen wird, so<br />
muss diese in Anführungsstrichen stehen und somit als direktes Zitat kenntlich ge-<br />
macht werden. Außerdem muss die Fundstelle des Zitats exakt angegeben werden.<br />
Beispiel: …, sei die „Summe erweiterter materieller und ideeller Lebenschancen“<br />
(Wehler, 1980: 127).<br />
Zitate die länger als drei Zeilen sind, sollten optisch abgesetzt werden, z.B.<br />
„Wer einen fremden Text wörtlich o<strong>der</strong> inhaltlich übernimmt und ihn als seinen ei-<br />
genen ausgibt, betrügt den Leser und macht sich des Plagiats schuldig. Mann sollte<br />
vermuten, dass so etwas nur ganz selten vorkäme.“ (Sandop/Meyer, 2008: 193)<br />
5.1.3 Das Sekundärzitat<br />
Bei einem Sekundärzitat handelt es sich um ein sogenanntes Zitat im Zitat, bzw. um<br />
ein zitiertes Zitat. <strong>Die</strong>se Zitate sind kenntlich zu machen. Beispiel: „texttexttext“<br />
(Müller, Jahr: Seite, zitiert <strong>nach</strong> Meier, Jahr: Seite)<br />
5.2 Angaben im Literatur- und Quellenverzeichnis<br />
Im Literatur- und Quellenverzeichnis werden alle vom Verfasser gelesenen und ex-<br />
plizit verwendeten Materialien <strong>nach</strong> Autorennahmen alphabetisch aufgeführt.<br />
Generell gilt:<br />
- Bei einem Herausgeberwerk wird vor <strong>der</strong> Jahreszahl die Klammer (Hrsg.) mit<br />
anschließendem Punkt vor <strong>der</strong> Klammer eingefügt.<br />
- Wird statt einer Autorin/ eines Autors eine Körperschaft/ ein Verein genannt,<br />
so nennt man diese an Stelle des Autors in ausgeschriebener Form.<br />
- Ist das Dokument noch nicht veröffentlicht, dann wird „in Druck“ an Stelle des<br />
Datums hinzugefügt.<br />
Seite 25 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
- Ist ein Untertitel vorhanden, wird dieser durch einen Doppelpunkt vom Haupt-<br />
titel getrennt und vollständig angefügt.<br />
- Sollte es Zusatzinformationen zum Titel geben, wie z.B. „(2. Auflage)“ o<strong>der</strong><br />
„(3. Band)“, so werden diese Angaben hinter dem Titel <strong>nach</strong> dem Punkt ge-<br />
setzt. Es werden ausschließlich arabische Zahlen verwendet.<br />
- Wenn mehrere Verlagsorte im Buch angegeben werden, wird immer nur <strong>der</strong><br />
erste Ort <strong>der</strong> Aufzählung genannt.<br />
- Den Verlag in vollen Buchstaben ausschreiben. Alle unnötigen Informationen<br />
wie „Verlag“, „Editionen“ usw. nicht hinzufügen.<br />
- <strong>Die</strong> Seitenangaben in dem Literaturverzeichnis erfolgt, <strong>nach</strong> <strong>der</strong> Nennung<br />
des Verlages, <strong>nach</strong> folgendem Beispiel: S. 2335-2338<br />
a) Monographien<br />
Name, V. (Erscheinungsjahr): Titel. Auflage (falls nicht die erste Auflage), Verlag:<br />
Verlagsort.<br />
b) Kapitel (o<strong>der</strong> Artikel) eines herausgegebenen Werks<br />
Name, V. (Erscheinungsjahr): Titel des Kapitels. In: Name, V. (Hrsg.): Titel des<br />
Werks. (Ausgabe), Verlagsort: Verlag, Seitenangabe.<br />
c) Zeitschriftenartikel<br />
Name, V. (Erscheinungsjahr): Titel. In: Zeitschriftentitel, Verlagsort: Verlag, Jahr-<br />
gang o<strong>der</strong> Bandnummer: Seitenangabe.<br />
d) Studienabschlussarbeiten<br />
Name, V. (Erscheinungsjahr): Titel <strong>der</strong> Studienabschlussarbeit. Nicht veröffentlichte<br />
Studienabschlussarbeit, Schule/Universität, Ort.<br />
e) Online Angaben<br />
Name, V. [nur falls kein Autor benannt: Organisation] (Jahr): Titel. Webad-<br />
resse (Datum).<br />
Artikel aus einer elektronischen Zeitschrift, welche inhaltlich mit <strong>der</strong> Papier-<br />
version identisch ist:<br />
Name, V. (Erscheinungsjahr): Titel [Electronic Version]. Zeitschriftentitel,<br />
Bandnummer, Seitenangabe.<br />
Seite 26 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Artikel aus einem nur online verfügbaren Journal:<br />
Name, V. (Erscheinungsjahr, Monat Tag): Titel. Titel des Journals, Band-<br />
nummer, Artikelnummer. Datum. Verfügbar unter [URL].<br />
Seite 27 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Anlage 1 Titelblattgestaltung<br />
Adresse/Kopf <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>stätte<br />
Name <strong>der</strong> Weiterbildung<br />
Kurs-Nr.<br />
Modulnummer:<br />
Modultitel:<br />
Titel<br />
von<br />
Vorname Nachname<br />
Geb.<br />
Wohnort<br />
Prüfer(in):<br />
Seite 28 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Anlage 2 Eidesstattliche Erklärung<br />
Eidesstattliche Erklärung<br />
Ich erklären hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und<br />
ohne Benutzung an<strong>der</strong>er als <strong>der</strong> angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. <strong>Die</strong> aus<br />
fremden Quellen direkt o<strong>der</strong> indirekt übernommenen Gedanken sind als solche<br />
kenntlich gemacht. <strong>Die</strong> Abgabe des Leistungs<strong>nach</strong>weises erfolgt unter Kenntnis-<br />
nahme <strong>der</strong> akademischen Universitätsregelungen gegen Plagiarismus. <strong>Die</strong> Arbeit<br />
wurde bisher in gleicher o<strong>der</strong> ähnlicher Form keiner an<strong>der</strong>en Prüfungsbehörde vor-<br />
gelegt und auch noch nicht veröffentlicht.<br />
Wortanzahl <strong>der</strong> Hausarbeit:<br />
Ort, Datum Vor- und Zunahme<br />
Unterschrift<br />
Seite 29 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Vorlagen für die Hausarbeit Modul: WB-DB 2.2 (Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Schulungen)<br />
Name: Kurs:<br />
Thema <strong>der</strong> Stunde:<br />
Zeit Lernziele<br />
Artikulationsschema<br />
Unterrichtsverhalten<br />
des <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmers<br />
/<strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmerin<br />
Seite 30 von 38<br />
Erwartetes<br />
Teilnehmerverhalten<br />
Methoden, Medien
Hinweis<br />
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Liebe(r) <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer(in),<br />
Einverständniserklärung zur Videoaufzeichnung<br />
bitte bedenken Sie, dass diese Einverständniserklärung für jeden zu Beratenden ausgestellt sein<br />
muss, <strong>der</strong> in Ihrer Videoaufnahme zu sehen sein wird. Beratende haben das Recht nicht an <strong>der</strong> Videoaufzeichnung<br />
teil zu nehmen. Weiter bedenken Sie bitte, Ihre Videoaufzeichnung möglichst nur mit<br />
voll geschäftsfähigen Personen zu machen, d.h. z.B. nicht mit Kin<strong>der</strong>n, wo <strong>der</strong> Erziehungsberechtigte<br />
nur einwilligen kann o<strong>der</strong> älteren Menschen, <strong>der</strong>en Hirnleistungsfunktion ggf. eingeschränkt ist. Sollten<br />
Sie ausschließlich Kin<strong>der</strong> schulen, so müssen die erziehungsberechtigten Personen unterzeichnen<br />
und die Einwilligungserklärung ist entsprechend zu än<strong>der</strong>n.<br />
Sehr geehrte Patientin,<br />
Sehr geehrter Patient,<br />
Einverständniserklärung<br />
Frau/ Herr ………. nimmt zurzeit an einer Weiterbildung zur Diabetesberaterin/ zum Diabetesberater<br />
<strong>der</strong> Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) teil.<br />
In diesem Zusammenhang wird auch das Schulungsverhalten <strong>der</strong> <strong>Weiterbildungs</strong>teilnehmer beurteilt.<br />
Zu diesem Zweck werden reale Patientenschulungen auf Video aufgenommen.<br />
Wenn Sie mit einer solchen Videoaufnahme einverstanden sind, bitten wir Sie, die <strong>nach</strong>folgende Einwilligungserklärung<br />
zu unterzeichnen.<br />
Falls Sie nicht mit <strong>der</strong> Erstellung einer Videoaufnahme einverstanden sind, entstehen ihnen dadurch<br />
keine Nachteile.<br />
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass<br />
am ..................................................................<br />
in......................................................................<br />
eine Videoaufnahme meiner Person während <strong>der</strong> Patientenschulung erstellt werden darf und dass die<br />
erstellte Videoaufnahme meiner Person im Rahmen <strong>der</strong> Weiterbildung zur Diabetesberaterin/ zum<br />
Diabetesberater DDG zum Zweck <strong>der</strong> Erstellung einer Prüfungsleistung (Modul 2.2 im Modulhandbuch<br />
<strong>der</strong> WPO DB DDG) genutzt werden darf.<br />
<strong>Die</strong> Videoaufnahme wird im Rahmen <strong>der</strong> genannten Prüfung zur Unterrichtsanalyse <strong>der</strong> gezeigten<br />
Schulungssequenz genutzt.<br />
Eine an<strong>der</strong>e Nutzung als die genannte, das Erzeugen von mehr als einer Kopie o<strong>der</strong> eine Veröffentlichung<br />
<strong>der</strong> Videoaufnahme meiner Person ist nicht zulässig.<br />
Ein Wi<strong>der</strong>ruf <strong>der</strong> Einverständniserklärung ist bis zur Nutzung im oben genannten Sinne je<strong>der</strong>zeit möglich.<br />
Mir wurde zugesichert, dass die Video-Aufzeichnungen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt<br />
werden, spätestens jedoch <strong>nach</strong> einem Jahr.<br />
Name: .......................................................<br />
Vorname: ..................................................<br />
Straße: ......................................................<br />
Postleitzahl: ...............................................<br />
Wohnort: ....................................................<br />
Telefon: .....................................................<br />
Ort, Datum Unterschrift<br />
Seite 31 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Nachweisheft für den berufspraktischen Wissens- und Kompetenzerwerb<br />
Nachweisheft<br />
für den berufspraktischen<br />
Wissens- und Kompetenzerwerb<br />
innerhalb <strong>der</strong><br />
Weiterbildung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin<br />
DDG<br />
vom 01.05.2010<br />
Seite 32 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Nachweise <strong>der</strong> Transferzeit (mindestens 544 Stunden exklusive Hospitationen)<br />
innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/zur Diabetesberaterin DDG<br />
Adresse <strong>der</strong> Klinik/ Diabetesschwerpunktpraxis:<br />
Datum von: bis:<br />
Stunden:<br />
Datum<br />
Adresse <strong>der</strong> Klinik/ Diabetesschwerpunktpraxis:<br />
Datum von: bis:<br />
Stunden:<br />
Datum<br />
Adresse <strong>der</strong> Klinik/ Diabetesschwerpunktpraxis:<br />
Datum von: bis:<br />
Stunden:<br />
Datum<br />
Seite 33 von 38<br />
Unterschrift des Vorgesetzten/ <strong>der</strong> Vorgesetzten<br />
Stempel<br />
Unterschrift des Vorgesetzten/ <strong>der</strong> Vorgesetzten<br />
Stempel<br />
Unterschrift des Vorgesetzten/ <strong>der</strong> Vorgesetzten<br />
Stempel
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Nachweise <strong>der</strong> Hospitation (40 Stunden) innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/zur<br />
Diabetesberaterin DDG<br />
Institution:<br />
Fachabteilung:<br />
Datum: von bis<br />
Stunden:<br />
Datum Unterschrift/Stempel<br />
Institution:<br />
Fachabteilung:<br />
Datum: von bis<br />
Stunden:<br />
Datum Unterschrift/Stempel<br />
Institution:<br />
Fachabteilung:<br />
Datum: von bis<br />
Stunden:<br />
Datum Unterschrift/Stempel<br />
Institution:<br />
Fachabteilung:<br />
Datum: von bis<br />
Stunden:<br />
Datum Unterschrift/Stempel<br />
Seite 34 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Nachweise über 10 Schulungssequenzen innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/zur<br />
Diabetesberaterin DDG<br />
Institution:<br />
Fachabteilung:<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Seite 35 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Schulungsdauer:<br />
Teilnehmerzahl:<br />
Thema <strong>der</strong> Schulung:<br />
Unterschrift<br />
Seite 36 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Nachweise über 10 (Einzel-)Beratungen innerhalb <strong>der</strong> Weiterbildung zum Diabetesberater/zur<br />
Diabetesberaterin DDG<br />
Institution:<br />
Fachabteilung:<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Seite 37 von 38
DEUTSCHE<br />
DIABETES<br />
GESELLSCHAFT<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Datum: von bis Beratungsdauer:<br />
Beratung bei:<br />
Thema <strong>der</strong> Beratung:<br />
Unterschrift<br />
Seite 38 von 38