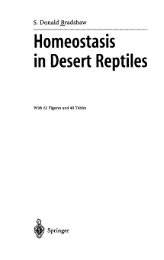KUNSTFORM - Rezensionen zur Kunstgeschichte - 2 (2001), Nr. 1
KUNSTFORM - Rezensionen zur Kunstgeschichte - 2 (2001), Nr. 1
KUNSTFORM - Rezensionen zur Kunstgeschichte - 2 (2001), Nr. 1
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>KUNSTFORM</strong> - <strong>Rezensionen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Kunstgeschichte</strong> - 2 (<strong>2001</strong>), <strong>Nr</strong>. 1 http://www.kunstform.historicum.net/<strong>2001</strong>/01/5606.html<br />
Ausgabe 2 (<strong>2001</strong>), <strong>Nr</strong>. 1<br />
Kerstin Petermann: Bernt Notke. Arbeitsweise und Werkstattorganisation<br />
im späten Mittelalter, Berlin: Dietrich Reimer Verlag 2000, 273 S., 18<br />
Farbtafeln, 196 s/w Abb., zugl. Diss. Kiel 1997, ISBN 3-496-01217-X, DEM<br />
128,00.<br />
Rezensiert von:<br />
Ulrike Wolff-Thomsen<br />
Institut für <strong>Kunstgeschichte</strong>, Universität Kiel<br />
In ihrer Kieler Dissertation geht Kerstin<br />
Petermann der 1996 im Rahmendes<br />
Hildesheimer Kolloquiums "Malerei und<br />
Skulptur des späten Mittelaltersund der frühen<br />
Neuzeit in Norddeutschland" von dem Berliner<br />
RestauratorEike Oellermann <strong>zur</strong> Diskussion<br />
gestellten These nach, ob nicht Bernd<br />
Notkeausschließlich als Tafel- und Fassmaler<br />
gearbeitet habe und nicht- wie noch von J.<br />
Roosval (1906ff.) und W. Paatz (1939)<br />
vertreten - alsBildschnitzer anzusprechen sei.<br />
Glückliche Voraussetzungen füreine<br />
Neubewertung schufen die in den vergangenen<br />
Jahren erfolgten<br />
umfangreichenRestaurierungen und<br />
technischen Untersuchungen an den<br />
Hauptwerken Notkes:Das sind zum einen die<br />
drei urkundlich gesicherten Werke, zu denen<br />
dasTriumphkreuz und die Lettnerverkleidung im Lübecker Dom von 1477,das<br />
Hochaltarretabel im Dom zu Århus von 1479 und das Hochaltarretabelin der<br />
Heilig-Geist-Kirche in Reval/ Tallinn von 1483 zählen, zumanderen die beiden<br />
zugeschriebenen Arbeiten, womit der Totentanz in Reval /Tallinn und die große<br />
St. Jürgen-Gruppe in der Nikolaikirchein Stockholm von 1489 gemeint sind.<br />
Warum die Flügel des Johannesretabelsder Schonenfahrer im Lübecker St.<br />
Annen-Museum, die im Hauptteil zuRecht als sechstes Werk vorgestellt werden,<br />
weder im Klappentext noch imVorwort Erwähnung finden, ist unverständlich.<br />
Auf der Grundlage der bislang publizierten oder als<br />
Dokumentationsmappenzugänglichen Restaurierungsberichte untersucht<br />
Petermann den kunsttechnologischenBefund und führt die Einzelergebnisse<br />
vergleichend zusammen, um Aufschlüsseüber die Arbeitsweise und Organisation<br />
der Werkstatt Notkes zu gewinnen.Dabei sind auch die den Figuren<br />
beigegebenen, authentischen schriftlichenZeugnisse herangezogen worden, die<br />
im Falle der Lübecker Triumphkreuzgruppedie Namen der Mitarbeiter und deren<br />
künstlerischen Anteil überliefern.<br />
So wertvoll diese Zusammenstellung der Ergebnisse der<br />
Restaurierungsberichteunter der genannten Fragestellung auch ist, flankierende<br />
Untersuchungenüber den stilistischen und ikonographischen Befund werden<br />
leider nichtin ausreichendem Maße durchgeführt, obwohl sie zahlreiche<br />
Anhaltspunkteauch für die von Petermann verfolgte Frage nach der Datierung<br />
undEinordnung der Werke und der künstlerischen Herkunft Notkes hättegeben<br />
können.<br />
In der Arbeit nehmen die exakten Beobachtungen der<br />
Oberflächengestaltungeinen wichtigen Platz ein. Die präzise Autopsie der<br />
technologischenEinzelbefunde führt zu der Erkenntnis, dass zwar eine Vielzahl<br />
unterschiedlicherHände arbeitsteilig in enger Abstimmung an der Ausführung<br />
derGroßaufträge beteiligt war und dass aus diesem Umstand der<br />
1 von 3 16.09.2005 15:51
<strong>KUNSTFORM</strong> - <strong>Rezensionen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Kunstgeschichte</strong> - 2 (<strong>2001</strong>), <strong>Nr</strong>. 1 http://www.kunstform.historicum.net/<strong>2001</strong>/01/5606.html<br />
spürbareStilpluralismus resultiert, doch der Entwurf und die ästhetische<br />
Gesamtauffassung,die sämtliche Einzelteile erst zu einem kohärenten Ganzen<br />
verbindetund künstlerisch auszeichnet, dem Werkstattleiter oblag.<br />
Der genauen Beschreibung der schnitz- und fasstechnischen Merkmale<br />
gehtleider keine Analyse der Figurenkonzeption, des Retabelaufbaus oder<br />
desikonographischen Programms voraus. Deshalb wird der Leser oft durch<br />
dieBeschreibungen der sicherlich gut beobachteten Details ermüdet, under läuft<br />
Gefahr, die eigentliche Fragestellung aus den Augen zu verlieren.Um nur ein<br />
Beispiel zu nennen: Ohne dass das Programm zuvor genau analysiertwurde,<br />
arbeitet sich der Leser durch Detailbeschreibungen wie diese hindurch:"Das<br />
Weiße des Augapfels schimmert bläulich und umschließtentweder eine<br />
dunkelblaue Iris bei blonden oder grauhaarigen Figuren odereine braune bei<br />
dunkelhaarigen. Die Iris ist durch einen dunklen Umrissstrichvom Augenweiß<br />
geschieden, die schwarze Pupille weist punktförmigeGlanzlichter - so z.B. am<br />
Auge der hl. Gertrud einen weißen Punktauf der Pupille - und an einigen Figuren<br />
eine weiße Kontur auf."(S. 106)<br />
Dies sind Spezialforschungen, die auf einen Laien trotz leicht eingängigerDiktion<br />
ermüdend wirken.<br />
Kommen wir zu den Ergebnissen: Es überrascht sicherlich nicht,dass sich hinter<br />
dem Fassmaler und dem Bildschnitzer nicht ein und dieselbePerson verbirgt.<br />
Auch dass die Werke arbeitsteilig geschaffen wurden, beispielsweiseder Bau des<br />
Schreins einer anderen Werkstatt überantwortet wurde,und dass Notke<br />
angesichts dieser Großaufträge mehr als die vonder Zunft vorgegebene Anzahl<br />
an Mitarbeitern beschäftigt hat, leuchtetein. Sehr klar und nachvollziehbar hat<br />
Petermann die Leistung der einzelnenMitarbeiter und die Dauer ihrer Tätigkeit in<br />
Notkes Werkstatt bestimmt.Festzustehen scheint nun, dass dort neben einem<br />
Maler und einem Bildschnitzerdrei Zubereiter gearbeitet haben. Das noch von<br />
Paatz vertretene Urteil,die stilistischen Unterschiede zwischen den Lübecker und<br />
Århuserund den späteren Revaler und Stockholmer Werken seien auf einen<br />
Stilwandel<strong>zur</strong>ückzuführen, ist damit obsolet geworden. Spannend ist zudemder<br />
Blick auf die Finanzierung der Aufträge, d.h. in welchem Umfangvom<br />
Auftraggeber ein Vorschuß geleistet wurde und in welchem UmfangNotke die<br />
außerordentlich aufwändigen Arbeiten selbst vorfinanzierenbzw. durch<br />
Bürgschaften absichern musste.<br />
Worin besteht nun die Leistung Notkes? Ist er nur - so Moltke - alsUnternehmer<br />
anzusprechen? Petermann stimmt Oellermann in vollem Umfangzu: Notke stand<br />
als Maler der Werkstatt vor, in seiner Gesamtverantwortungwurden die Werke<br />
gefertigt. Die Unterschiede zwischen den Unterzeichnungenund der ausgeführten<br />
Malerei im Århuser und Revaler Retabelbeweisen, dass seine Mitarbeiter auch<br />
die Formfindung relativ selbstständig,wohl aber unter den Vorgaben des von<br />
Notke gelieferten Gesamtentwurfs gestaltenkonnten. Als selbstständige Leistung<br />
eines Mitarbeiters könnendie von Petermann als von der niederländischen<br />
Tafelmalerei beeinflusstenAußenflügel mit der Darstellung des<br />
Schmerzensmannes und derhl. Elisabeth des Revaler Retabels bestimmt<br />
werden.<br />
Sicherlich zu einseitig geht jedoch die Autorin die Untersuchung zuNotkes<br />
künstlerischer Herkunft an, wenn sie sich erneut fast ausschließlichauf die<br />
technologischen Befunde beruft, nicht jedoch nach den<br />
ikonographischenVorbildern für seine Bildfindungen fragt. Der schon von Hasse<br />
verfolgtenThese nach einer Schulung in Nähe der Tapisseriewerkstätten<br />
vonTournai, vielleicht in derjenigen von Pasquier Grenier, schließtsich Petermann<br />
mit dem Paatzschen Hinweis auf die "an einen Bildteppicherinnernde<br />
Komposition" an. Im Rückgriff auf die Forschungen von CharlesSterling schlägt<br />
die Autorin eine Orientierung an einer von NicolasFroment bestimmten Richtung<br />
der nordfranzösischen Tafelmalerei vor,die wiederum dem Stil der Tapisserien<br />
von Arras und Tournai nahe steht.<br />
Doch m.E. offenbaren auch die Tafeln des Århuser Retabels<br />
eineMotivverwandtschaft mit der deutschen Graphik, beispielsweise mit den<br />
2 von 3 16.09.2005 15:51
<strong>KUNSTFORM</strong> - <strong>Rezensionen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Kunstgeschichte</strong> - 2 (<strong>2001</strong>), <strong>Nr</strong>. 1 http://www.kunstform.historicum.net/<strong>2001</strong>/01/5606.html<br />
zeitgleichentstandenen Holzschnitten bzw. Kupferstichen von Martin Schongauer<br />
undIsrahel van Meckenem - Bezüge, die einer genaueren Untersuchung<br />
wertwären.<br />
Zu Recht weist Petermann den Vorschlag Hasses nach einer Vorbildlichkeitvon<br />
Meister Arnt von Kalkar (besser: Arnt van Wesel oder Zwolle) <strong>zur</strong>ück,obwohl<br />
sicherlich Parallelen in der Wahl der breiten Möglichkeitender mittelalterlichen<br />
Fassmalerei gerade unter Einbeziehung unterschiedlichsterMaterialien wie Leder,<br />
Pergament, bemaltem Papier, Schnüren aus Hanfbestehen - für die Werkstatt<br />
Notkes ist darüber hinaus charakteristischder Einsatz von Elchgeweihen (!) und<br />
Glas- und Metallapplikationen.<br />
Ein etwas trauriges Kapitel der sonst soliden Buchgestaltung bildender Farb- und<br />
der sehr umfangreiche Schwarzweißabbildungsteil: DieFarbtafeln sind durchweg<br />
sehr rotstichig, die Schwarzweißabbildungenhingegen ausgesprochen flau.<br />
Trotz einzelner kritischer Anmerkungen ist die Arbeit durch die Neubewertungder<br />
künstlerischen Leistungen Bernt Notkes <strong>zur</strong> Lektüre zu empfehlen.<br />
Empfohlene Zitierweise:<br />
Ulrike Wolff-Thomsen: Rezension von: Kerstin Petermann: Bernt Notke. Arbeitsweise und<br />
Werkstattorganisation im späten Mittelalter, Berlin: Dietrich Reimer Verlag 2000, in:<br />
<strong>KUNSTFORM</strong> 2 (<strong>2001</strong>), <strong>Nr</strong>. 1, URL:<br />
<br />
3 von 3 16.09.2005 15:51