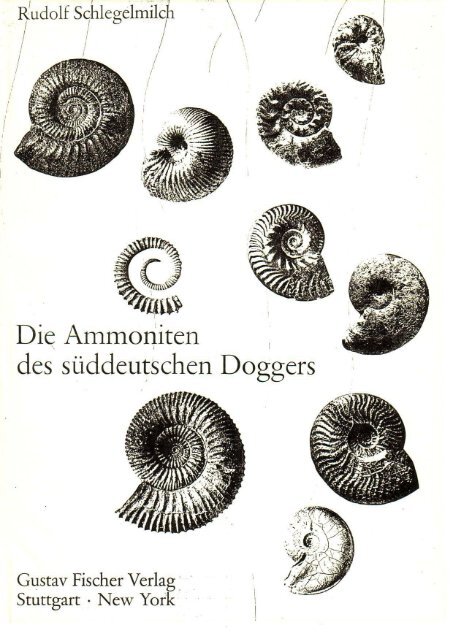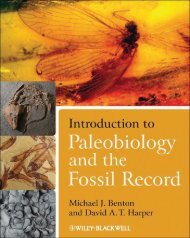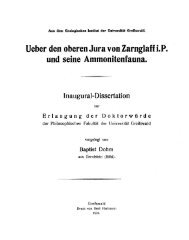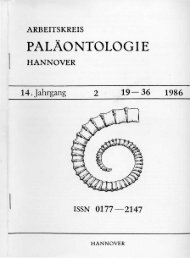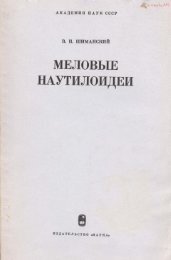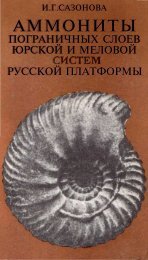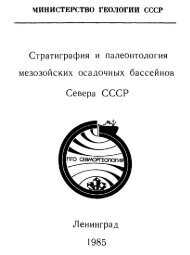Schlegelmilch,1985 Ammoniten des sudeutschen doggers
Schlegelmilch,1985 Ammoniten des sudeutschen doggers
Schlegelmilch,1985 Ammoniten des sudeutschen doggers
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anschrift <strong>des</strong> Verfassers:<br />
Dr.-Ing. Rudolf <strong>Schlegelmilch</strong><br />
Hermelinstraße 36/6<br />
D-7080 Aalen<br />
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek<br />
<strong>Schlegelmilch</strong>, Rudolf:<br />
Die <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> süddeutschen Doggers :<br />
e. Bestimmungsbuch für Fossiliensammler u. Geologen<br />
von Rudolf <strong>Schlegelmilch</strong>.<br />
Stuttgart ; New York : Fischer, <strong>1985</strong>.<br />
ISBN 3-437-30488-7<br />
© Gustav Fischer Verlag • Stuttgart • New York • <strong>1985</strong><br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Satz: Typobauer Filmsatz GmbH, Ostfildern-Schamhausen<br />
Druck und Einband: Friedrich Pustet, Regensburg<br />
Printed in Germany<br />
ISBN 3-437-30488-7
Inhalt<br />
1 Einführung<br />
2 Zum System der Doggerammoniten 3<br />
2.1 Allgemeines, Großgliedeaing 3<br />
2.2 Gliederung der Hammatocerataceae 4<br />
2.3 Gliederung der Haplocerataceae 4<br />
2.4 Gliederung der Stephanocerataceae 6<br />
2.5 Gliederung der Perisphinctaceae 6<br />
3 Über heteromorphe Doggerammoniten 9<br />
4 Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Doggers in Süddeutschland .. 13<br />
4.1 Das Aalenium 13<br />
4.2 Das Bajocium 15<br />
4.3 Das Bathonium 16<br />
4.4 Das Callovium 17<br />
5 Erläuterungen zu den Bestimmungstabellen 19<br />
6 Bestimmungstabellen 23<br />
Phylloceratina 23<br />
Phyllocerataceae 23<br />
Phylloceratidae 23<br />
Lytoceratina 25<br />
Lytocerataceae 25<br />
Lytoceratidae 25<br />
Ammonitina 27<br />
Hammatocerataceae 27<br />
Hammatoceratidae 27<br />
Hammatoceratinae 27<br />
Tmetoceratidae 29<br />
Oppeliidae 30<br />
Oppeliinae 30<br />
Hecticoceratinae 34<br />
Taramelliceratinae 45<br />
Distichoceratinae 47<br />
Phlycticeratidae 48<br />
Haplocerataceae 50<br />
Graphoceratidae 50<br />
Graphoceratinae 50<br />
Sonniniinae 59<br />
Strigoceratinae • 66<br />
Haploceratidae 68<br />
Haploceratinae 68<br />
Stephanocerataceae 69<br />
Stephanoceratidae ^ 69<br />
Otoitidae 78<br />
Sphaeroceratidae 80<br />
Parkinsoniidae 84<br />
Parkinsoniinae 84<br />
Spiroceratinae 98<br />
Parapatoceratinae 99<br />
Morphoceratidae 101<br />
Macrocephalitidae 104<br />
Kosmoceratidae 107<br />
Cardioceratidae 114<br />
Perisphinctaceae 117<br />
Perisphinctidae 11/<br />
Leptosphinctinae 117<br />
Zigzagiceratmae 120<br />
Grossouvriinae 127<br />
Tulitidae 132<br />
Pachyceratidae 137<br />
Reineckeiidae 139<br />
Peltoceratidae 144<br />
7 Bildtafeln 151<br />
8 Literatur 271<br />
9 Abkürzungen 277<br />
10 Register 279
2 Zum System der Doggerammoniten<br />
2.1 Allgemeines, Großgliederung<br />
Ebenso wie im Lias werden die <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> Doggers in die<br />
Unterordnungen Phylloceratina, Lytoceratina und Ammonitina<br />
gegliedert. Die beiden «Konservativstämme» der Phylloceraten<br />
und Lytoceraten bleiben weiterhin mit wenigen Gattungen und<br />
Arten Randgruppen der im übrigen vielfältig verzweigten Entwicklung.<br />
So durchlaufen sie nicht nur den Dogger, sondern den<br />
gesamten Jura ohne wesentliche äußere und innere Veränderunnen.<br />
Die Ammonitina hingegen erfahren nach merklicher Dezimierung<br />
gegen Ende der Liaszeit eine neue Entfaltung im Dogger.<br />
Daneben wurde bei den Doggerformen ein Sexualdimorphismus<br />
zunehmend erkennbar, nachdem er im oberen Lias erstmals sporadisch<br />
und zunächst schwach ausgeprägt aufgetreten war. Die Formenfülle<br />
der Ammonitina wurde außerdem erstmals im Dogger<br />
durch das Auftreten von deren heteromorphen Vertretern bereichert.<br />
Relativ wenigen Gruppen der Ammonitina gelang die Überschreitung<br />
der Lias/Doggergrenze. Nach heutiger Auffassung (72)<br />
sind dies die Gattungen Pseudolioceras, Pleydellia, Erycites und<br />
Tmctoceras. Ihre Vertreter sind demnach als Wurzeln aller Ammonitina<br />
von Dogger, Malm und auch Kreide zu betrachten.<br />
Alle bestehenden systematischen Gliederungen der Doggerammoniten<br />
sind unter teilweise sehr unterschiedlichen Aspekten aufgestellt<br />
worden und können nur als Arbeitsgrundlagen angesehen<br />
werden. Bereits in der Großgliederung sind die bestehenden<br />
Systeme von subjektiven Ansichten geprägt. So unterscheiden<br />
DONOVAN, CALLOMON und HOWARTH 1981 im Dogger die<br />
Superfamilien Stephanocerataceae, Haplocerataceae, Perisphinctaceae,<br />
Spirocerataceae und Hildocerataceae, wobei ausschließlich<br />
die letztere die Lias/Doggergrenze überschreitet. SCHINDEWOLF<br />
f 211), der suturontogenetische Betrachtungen in den Vordergrund<br />
seiner umfangreichen stammesgeschichtlichen Untersuchungen<br />
stellte, schloß sich dieser Gliederung nur dort an, wo er sie aufgrund<br />
seiner Befunde bestätigt fand. So schlug er 1964 zusätzlich<br />
eine Superfamilie Hammatocerataceae vor, die ihm als «wichtiger<br />
Knotenpunkt für die Herleitung anderer Superfamilien» erschien,<br />
und deren Aufstellung er, wie noch erläuten werden soll, suturontogenetisch<br />
rechtfertigte. Andererseits hatte SCHINDEWOLF<br />
>\Tnis l l<br />
).s > in Übereinstimmung mit anderen Autoren (73, 259,<br />
~ti k<br />
h die Gruppe der heteromorphen Spiroceraten als von den<br />
Ammonitina iStroioarjs) zwanglos ableitbar betrachtet, worauf-<br />
•"» er 1961 die Superfamilie Spirocerataceae einzuziehen nähere.<br />
Dieser Empfehlung folgend, fügte DIETL (51) eine Unterfa-<br />
" !<br />
ir Viroa-ratinae in die Stephanocerataceae ein.<br />
in «Jen letzten Jahrzehnten ermöglichten Suturuntersuchungen<br />
_> ••:\!-.e Erkenntnisse in der Evolution der <strong>Ammoniten</strong> (272,<br />
, ' ,Nt<br />
^"tni diese Methodik unentbehrlich für eine durchgrei-<br />
X . (<br />
K i ; l K<br />
"' ' '' k n i n<br />
' - l i l ll<br />
ie Sutur den üblicherweise die Untersu-<br />
^ eiern beherrschenden Skulpturmerkmalen ein ganzes Bündel<br />
jrBcfrr. „oeh d.mi beständigerer Indizien zur Seite stellt. Aus die-<br />
1 0 11IS l l n<br />
•wT* ' " G m n J c c i n c s<br />
nahtlosen Anschlusses an die<br />
^T"""«' süddeutschen Lias» (214) wurde auch im vorlie-<br />
Werke das Suu.soiw<br />
i'OLi-sche System bevorzugt. Darin<br />
w<br />
fcta dc^r ' U<br />
' r l n s d l u l l l c h t<br />
' ' - die 1<br />
wesentlichen Superfami-<br />
W m , h m<br />
> äußeren Gehäusemerkmalen noch<br />
durch die folgenden Besonderheiten der Lobenlinie und ihrer Ent<br />
wicklung am Individuum voneinander geschieden:<br />
Hammatocerataceae<br />
(Hecticoceras)<br />
Haplocerataceae<br />
(Sonninia)<br />
Stephanocerataceae<br />
(Stemmatoceras)<br />
Perisphinctaceae<br />
{Reineckeia)<br />
Abb. 1: Grandlegeilde Besonderheiten der Lobenfolge in den Suturen<br />
der vier Superfamilien der Doggeramoniten (nach SCHINDEWOLF 1964-<br />
1966)<br />
Hammatocerataceae<br />
Frühontogenctisch gespaltener Umbilikallobus U) mit stärker zerschlitzter<br />
Dorsal wand, keine Suturallobenbildung. Zahl derUmbilikalloben<br />
von vier bei den älteren, eigentlichen Hammatoceraten<br />
im phylogenetischen Verlauf bis 13 ansteigend, U 4 außerhalb der<br />
Windungsnaht gelegen, U 5 dorsal von ihm gebildet.<br />
Haplocerataceae<br />
Umbilikallobus U] ungespalten, zahlreiche Umbilikalloben, keine<br />
Suturallobenbildung. U A innnerhalb der Windungsnaht gelegen,<br />
U,- ventral von ihm gebildet.<br />
3
Stephanocerataceae<br />
Frühontogenetische Bildung eines die übliche Bildungsfolgc<br />
durchbrechenden, im Alter sehr oft dominierenden Umbilikallo<br />
bus U n auf dem Sattel U]/l.<br />
Perisphinctaceae<br />
Frühontogenetisch gespaltener Umbilikallobus U b insgesamt<br />
meist nur 4 Umbilikalloben, Suturallobenbildung in U3 oder U 4.<br />
Diese Kriterien hatten eine Umgruppierung mehrerer Taxa von<br />
Familien- und tieferem Rang gegenüber der bis dahin gebrauchlichen<br />
ARKEi.i.schen Gliederung (8) zur Folge, in der die Suturentwicklung<br />
kaum Beachtung gefunden hatte. Daß die konsequente<br />
Anwendung <strong>des</strong> ScHlNDEWOLFschen Systems stellenweise<br />
Schwierigkeiten nicht ausschließt, und auch Lücken offenläßt,<br />
liegt neben der allgemeinen Problematik phylogenetischer Untersuchungen<br />
zum Teil auch an den präparativen Anforderungen bei<br />
der Registrierung von Jugendsuturen, deren grundlegende Voraussetzung<br />
eine brauchbare Fossilerhaltung ist.<br />
2.2 Gliederung der<br />
Hammatocerataceae<br />
Die Gliederung der Superfamilie Hammatocerataceae, wie sie<br />
1964 von SCHINDEWOLF vorgeschlagen und hier angewandt<br />
wurde, ist aus Abb. 2 ersichtlich. Den ursprünglichen Kern der<br />
Superfamilie bilden die Hammatoceratidae, deren typische Vertre<br />
ter im Toarcium auftreten, noch kaum mehr als 5 Umbilikalloben<br />
besitzen und sich bis ins Bajocium fortsetzen. Die von SCHINDE<br />
WOLF hauptsächlich wegen ihres tiefgespaltenen Uj in die Superfa<br />
milie einbezogenen Oppelien zeigen bereits im Mittel-Bajocium<br />
eine sehr große Zahl von Umbilikalloben (Oppelia subradiata wird<br />
mit 13 Umbilikalloben wiedergegeben), was das Verständnis <strong>des</strong><br />
phyletischen Zusammenhanges erschwert. Der Modus ihrer<br />
Lobenentwicklung findet sich aber - von einigen «Unstimmigkei<br />
ten» innerhalb der Oppeliinae abgesehen - in auffallend gleicher<br />
Weise bei den Hecticoceraten, Distichoceraten und Taramellicera-<br />
ten wieder, was die von der englischen Schule (8, 72) angenom<br />
mene Herkunft dieser Gruppen aus den Oppeliinae bekräftigt und<br />
weshalb sie von SCHINDEWOLF ebenfalls den Hammatocerataceae<br />
eingegliedert wurden. Im Gegensatz dazu wird von den englischen<br />
Autoren eine Entwicklungsreihe Bradfordia - Oppelia zusammen<br />
mit den darin wurzelnden, oben erwähnten Unterfamilien in die<br />
Superfamilie Haplocerataceae einbezogen. DONOVAN (72, S. 120)<br />
räumt dabei jedoch ein, daß diese vier Gruppen zusammen mit<br />
einigen anderen, auf die bei späterer Gelegenheit noch einzugehen<br />
ist, vermutlich von den Hammatoceratinae abstammen.<br />
Die außergewöhnlich skulptierte Gattung Phlycticeras wurde in<br />
der Vergangenheit in sehr unterschiedliche Beziehungen gesetzt.<br />
Neuerdings wird sie - hauptsächlich wegen ihrer Spiralstreifung -<br />
als «the direct and only <strong>des</strong>cendent of Strigoceras» (72, S. 144)<br />
betrachtet und ihr <strong>des</strong>halb sogar die gleichnamige, monogene<br />
tische Unterfamilie streitig gemacht. SCHINDEWOLF hingegen<br />
bezog Phlycticeras, wegen der bei Strigoceras völlig verschiedenen<br />
Suturentwicklung (273, S. 244), innerhalb einer eigenen Familie<br />
Phlycticeratidae ebenfalls in seine Superfamilie Hammatocerata<br />
ceae ein und neigte zur Ableitung der Phlycticeraten aus den Oppe<br />
lien, speziell den Hecticoceraten.<br />
Neuerdings wird die Heteromorphengattung Oecoptychius als<br />
4<br />
Mikroconch von Phlycticeras angesehen (72, S. 144), während sie<br />
SCHINDEWOLF ZU den Tulitidae stellte, da ihr Lobus U, ungesp ,|<br />
ten bleibt. Die erste der beiden Deutungen ist nur dann aufrecht /u<br />
halten, wenn man SCHINDEWOLFS suturontogenetische Auslegung<br />
von Phlycticeras (211, S. 393) in Frage stellt.<br />
Zu verschiedenen Spekulationen gab seither die Gattung T/ W_<br />
toceras Anlaß, die nach neueren Erkenntnissen vom Obcr-Toarcium<br />
bis ins Ober-Aalenium nachzuweisen ist. HAL'G leitete sie<br />
1888 von Dumortieria ab, SALFELD 1924 von den Lytoceraten und<br />
DONOVAN 1981 von Catulloceras. Wegen seiner außergewöhnlichen<br />
Skulptur und Sutur wird Tmetoceras hier eine eigene Familie<br />
zugestanden, die aufgrund <strong>des</strong> anscheinend frühontogenetisch<br />
gespaltenen Umbilikallobus U) bevorzugt in den Hammatocerataceae<br />
einzuordnen ist.<br />
2.3 Gliederung der Haplocerataceae<br />
Die im vorliegenden Werk angewandte Gliederung der Superfa<br />
milie Haplocerataceae ist wiederum aus Abb. 2 ersichtlich. Im<br />
Sinne ihrer oben formulierten Definition zeigt im SCHINDEWOLF-<br />
schen System die Sutur ihrer basalen Vertreter, nämlich der Leioce-<br />
raten innerhalb der Unterfamilie Graphoceratinae, den (bereits)<br />
nahezu ungespaltenen Uj und die Bildung <strong>des</strong> U 5 ventral von U 4<br />
bei maximal 6 Umbilikalloben. Bei den nachfolgenden Gruppen<br />
der Staufenien und Ludwigien wird die zuvor noch angedeutete<br />
Zweiteilung <strong>des</strong> Uj vollständig rückgebildet, und die Zahl der<br />
Umbilikalloben erhöht sich innerhalb einer flach gedehnten Nabel<br />
nahtregion der Sutur, ohne daß es zum Modus der Suturralloben-<br />
bildung kommt. Die Graphoceratinae erlöschen bereits mit<br />
Hyperlioceras und anderen Gattungen im unteren Unter-Bajo-<br />
cium.<br />
Die große Ähnlichkeit der Lobenentwicklung zwischen Gra-<br />
phoceraten und Sonninien veranlaßte SCHINDEWOLF, beide als<br />
Unterfamilien innerhalb der Graphoceratidae nebeneinanderzu<br />
stellen. Er nahm bei den Sonniniinae eine gesonderte Herleitung<br />
an, die auf indirektem Wege aus den frühen Hammatoceraten<br />
erfolgt sein könnte. Eine eindeutige Zunahme der Lobenelemente<br />
im Entwicklungsverlauf der Sonniniinae scheint nicht vorzuliegen.<br />
Neben Witchellia, Pelekodites und Dorsetensia ist in die Unterfami<br />
lie hier auch wegen ihrer sonniniiden Suturentwicklung die Gat<br />
tung Clydoniceras eingegliedert worden, die von den englischen<br />
Autoren neuerdings wieder im Rahmen einer eigenen Unterfamilie<br />
in den Oppeliidae geführt wird, wogegen sie bei Arkell 1957 sogar<br />
Familienrang innerhalb der Stephanocerataceae genoß.<br />
Im hier gewählten System bilden die Strigoceratinae die dritte<br />
Unterfamilie der Graphoceratidae, da auch sie sich in der Suturent<br />
wicklung eng an die beiden anderen Gruppen anschließen und von<br />
ähnlicher Gestalt und Berippung sind. Die relativ große, bis 12-—<br />
ansteigende Zahl der Umbilikalloben und die gattungstypische<br />
Spiralstreifung von Strigoceras rechtfertigen die Eigenständigkeit<br />
der Gruppe, die im englischen System sogar eine eigene Familie<br />
innerhalb der Haplocerataceae bildet.<br />
DONOVAN, CALLOMON und HOWARTH betrachten 1981 Gra-<br />
phoceraten und Sonninien als Gruppen von Familienrang inner<br />
halb der von ihnen bis ins Mittel-Bajocium ausgedehnten Superfa<br />
milie Hildocerataceae. Sie halten eine Entwicklung der Graphoce-<br />
raten aus den Leioceraten - im Gegensatz zu SCHINDEWOLF - für<br />
wenig wahrscheinlich, weshalb im englischen System eine sepa<br />
rate Unterfamilie Leioceratinae in den Hildoceratidae eingefügt<br />
ist.
nmg der l), )ggorainmoniten nach den Vorschlägen von SCHINDEWOLF, HAHN, WIEDMANN und KULI.MANN<br />
5
2.4 Gliederung der<br />
Stephanocerataceae<br />
Die Stephanocerataceae stellen die umfangreichste und vielfäl<br />
tigste Superfamilie der Doggerammoniten dar (s. Abb. 2), die<br />
sowohl planulate als auch sphärocone Formen mit meist den Ven-<br />
ter querenden, aber auch unterbrochenen, unbedornten bis kräftig<br />
bedornten Rippen umfaßt. SCHINDEWOLF versuchte auch hier,<br />
durch Heranziehung einer Besonderheit in der Suturentwicklung<br />
eine übergreifende Gemeinsamkeit dieses großen Formenkreises<br />
zu gewinnen. Das Auftreten <strong>des</strong> von ihm mit besonderer Aufmerk<br />
samkeit analysierten, markanten Umbilikallobus U n ist in der Tat<br />
geeignet, über die Zugehörigkeit bestimmter Gruppen zu den Ste<br />
phanocerataceae zu entscheiden. Die innere Gliederung der Super<br />
familie bedarf jedoch weiterer Kriterien.<br />
Eine Komplizierung der Verhältnisse entsteht dadurch, daß vom<br />
Ober-Bajocium an differenzierte Faunen in drei verschiedenen<br />
Gebieten der Erde entstanden (285), die zu unterschiedlichen, sich<br />
nur unbedeutend überlappenden Entwicklungsreihen führten.<br />
Auch in den Stephanocerataceae verursachten Einwanderer aus<br />
anderen Faunen Diskontinuitäten, die erst seit einigen Jahren in<br />
den Erkenntnisbereich rücken. So könnte beispielsweise das plötz<br />
liche Auftreten der Macrocephalen, Kosmoceraten und Cardioce<br />
raten im Callovium Europas stark durch derartige Prozesse beein<br />
flußt sein (72, S. 121).<br />
Das Auftreten <strong>des</strong> besagten Umbilikallobus U n in der Sutur der<br />
Ammonitina fällt mit der bisherigen unteren Grenzziehung der<br />
Stephanocerataceae aufgrund gehäusemorphologischer Kriterien<br />
zusammen. So erscheint U n fast gleichzeitig bei den Otoitidae, den<br />
Sphaeroceratidae und den Stephanoceratidae im unteren Bajo-<br />
cium. Eine mehr oder weniger gemeinsame Wurzel der drei Fami<br />
lien wird vielfach - ebenso wie die der Perisphincten - in der Ham-<br />
matoceratengattung Erycites angenommen, die noch keinen U n<br />
zeigt, aber den Kiel der Hammatoceraten bereits verloren hat.<br />
SCHINDEWOLF war nun bemüht, sekundäre Besonderheiten in<br />
der Entwicklung der Sutur, insbesondere im Bereich Ui-U n, zur<br />
Unterscheidung der drei Familien heranzuziehen. So zeigte er an<br />
Vertretern der Otoitidae, daß der Lobus U n oft auf dem Dorsalab<br />
fall <strong>des</strong> Sattels Ui/I entsteht, danach zum Sattelscheitel wandert<br />
und gemeinsam mit einem spätontogenetisch gespaltenen Uj auf<br />
tritt. Bei den Sphaeroceraten ist das Verhalten <strong>des</strong> U n ähnlich,<br />
jedoch ist er hier mit einem ungespaltenen Uj vergesellschaftet.<br />
Bei den eigentlichen Stephanoceraten schließlich ist Ui ebenfalls<br />
ungespalten, doch U n beginnt und verbleibt auf dem Ventralabfall<br />
<strong>des</strong> Sattels und bleibt in seiner Größe - im Gegensatz zu den ande<br />
ren beiden Familien - hinter der von Ui zurück. Ob letztere Eigen<br />
heit bei den unmittelbar folgenden Teloceraten noch beibehalten<br />
wird, ist noch nicht gesichert.<br />
Im Gefolge der Sphaeroceras-Chondroceras- Gruppe stehen im<br />
hier gewählten System suturontogenetisch begründet die Macro-<br />
cephalitidae, Kosmoceratidae und Cardioceratidae. In der CALLO-<br />
MONSchen Gliederung werden zwar die Cardioceraten ebenfalls<br />
aus den Sphaeroceratidae abgeleitet, die Kosmoceraten dagegen<br />
aus den Stephanoceratidae, was vielleicht gehäusemorphologisch<br />
verständlicher erscheint.<br />
Die Tulitidae und die nachfolgenden Pachyceratidae wurden von<br />
SCHINDEWOLF als "Regressivformen» der Sphaeroceratidae<br />
gedeutet, in denen zunächst U n und später auch U? rückgebildet<br />
werde. Ihre kugelige Gehäuseform hatte bereits früher eine<br />
Abstammung aus den gleichgestaltigen Sphaeroceraten nahege<br />
legt (6, 259). HAHN (114) stellte jedoch die Tulitidae zusammen<br />
6<br />
mit Morrisiceras wegen ihrer den Perisphincten <strong>des</strong> Unter-Ii;]^<br />
niums sehr ähnlichen Parabelrippenbildung zu den Pcrisphin ai<br />
ceae, wo sie auch im englischen System eingeordnet sind.<br />
Eingehende Untersuchungen zeigten, daß auch Vertreter der<br />
Gattung Parkinsonia den Lobus U n in der für die Stephanoceratidae<br />
typischen Weise ausbilden. Dagegen werden die Ergebnisse in<br />
Garantiana von SCHINDEWOLF selbst als «wenig eindeutig und<br />
schwer durchschaubar» bezeichnet. Ein Lobus U„ scheint bei ihnen<br />
nur in Ausnahmefällen nachweisbar. Diesem Befund widersprechend<br />
hat CALLOMON 1981 aufgrund äußerer Gehäusemerkirule<br />
die Parkinsonien in der Superfamilie Perisphinctaceae, und die<br />
Garantianen einschließlich der Strenoceraten dagegen in den Stephanocerataceae<br />
untergebracht. Im hier gewählten System soll<br />
dagegen vorerst die Geschlossenheit der Gruppe in Form der<br />
Unterfamilie Parkinsoniinae beibehalten werden, ohne damit<br />
einen Anspruch auf eine phyletische Abfolge ihrer Gattungen verknüpfen<br />
zu wollen. Der Entscheidung DIETLS folgend (53), wird<br />
auch die Gattung Caumontisphinctes, obwohl bisher noch nicht<br />
sicher begründbar, in die Unterfamilie einbezogen. Die systematische<br />
Stellung der heteromorphen Spiroceratinae, die hier den<br />
Parkinsoniinae angeschlossen sind, wurde bereits kommentiert;<br />
die jüngere Heteromorphengruppe der Parapatoceratinae könnte<br />
über Epistrenoceras ebenfalls aus den Parkinsoniidae hervorgegangen<br />
sein (51).<br />
Eine weitere Familie der Stephanocerataceae bilden die Morphoceratidae,<br />
die sich ebenfalls durch einen markanten U n auf dem<br />
Ventralabfall <strong>des</strong> Sattels Ui/I auszeichnen und demzufolge durch<br />
SCHINDEWOLF eng mit den Stephanoceratidae verbunden wurden.<br />
CALLOMON, der die Gruppe auf «cryptogenic appearance as<br />
fully-fledged Dimorphinites», einer Untergattung von Morphoceras,<br />
zurückführt, bezieht sie in die Perisphinctaceae ein. Er räumt<br />
andererseits ein, daß ein Ursprung in den Stephanoceratidae nicht<br />
ganz auszuschließen ist (72, S. 151).<br />
2.5 Gliederung der Perisphinctaceae<br />
Innerhalb der Familie Perisphinctidae (Abb. 2), die sich bis in den<br />
oberen Malm erstreckt, ist die Spaltung <strong>des</strong> Umbilikallobus Ui in<br />
zwei selbständige Teiläste und die Suturallobenbildung mit solcher<br />
Beständigkeit zu verzeichnen, daß sie kaum für eine Gliederung<br />
niederen Ranges benutzt werden kann. Bei den Dogger-Peri-<br />
sphinetaceae gilt dieser Bildungsmodus der Sutur außerdem für die<br />
Reineckeidae, während die Tulitidae (vergl. oben), die Pachycerati<br />
dae und die Peltoceratidae einschließlich der Euaspidoceraten<br />
einen einfachen Uj aufweisen, was bei letzteren von SCHINDE<br />
WOLF als Rückbildung der Zweiteilung gedeutet wird.<br />
Die ältesten Perisphincten sind in der Subfamilie Leptosphincti-<br />
nae zusammengefaßt und setzen mit der gleichnamigen Gattung,<br />
deren südwestdeutsche Vertreter von DIETL (54) bearbeitet wur<br />
den, im oberen Mittel-Bajocium ein. Leptosphinctes wird von den<br />
übrigen Gattungen der Subfamilie vorwiegend durch den Win<br />
dungsquerschnitt und die ventrale Rippenunterbrechung getrennt,<br />
die bei Vermisphinctes nicht und bei Bigotites mit alternierenden<br />
Rippenenden auftritt.<br />
In der weiteren Gliederung der Perisphinctidae wird hier im<br />
wesentlichen den Vorschlägen MANGOLDS gefolgt (155), der die<br />
Perisphincten <strong>des</strong> Bathoniums und <strong>des</strong> Calloviums revidierte und<br />
gemäß Abb. 3 auf die Unterfamilien Zigzagiceratinae und Gros-<br />
souvriinae verteilte. Als Kriterium dieser Teilung werden die bei<br />
den Grossouvriinae fehlenden «Zickzackrippen» herangezogen.
Parabelbildungen treten in der Skulptur beider Gaippen gleicher<br />
maßen auf. Die zahlreichen, von MANGOLD benutzten oder neu<br />
aufgestellten Taxa haben unter Einbeziehung <strong>des</strong> nicht immer<br />
offensichtlichen Dimorphismus die Unterscheidungskriterien auf<br />
oft geringfügige Skulpturmodifikationen herabgenötigt. Zusätz<br />
lich dürften auch hier regional begrenzte Entwicklungen mit gele<br />
gentlichem Faunenaustausch die Deutung der phyletischen<br />
Zusammenhänge erschwert haben.<br />
Die Reineckeiidae wurden 1967 von BOURQUIN revidiert (22).<br />
1980 wurde dieser Systematik eine stark abweichende von<br />
CARIOU (43) gegenübergestellt, der auch die Evolution der Rei-<br />
neckiidae aufzuhellen bestrebt war, und die Aufteilung in die Gat<br />
tungen Rehmannia, Reineckeia und Collotia vorschlug (Abb. 4).<br />
Im hier gewählten System wird, insbesondere hinsichtlich <strong>des</strong><br />
Dimorphismus, eine Kombination der Vorschläge BOURQUINS<br />
und MANGOLDS vorgenommen, die im einzelnen aus dem Tabel<br />
lenteil hervorgeht.
3 Über heteromorphe Doggerammoniten<br />
Neben den üblichen, mit einander berührenden oder umfassen<br />
den Windungen in einer Planspirale gerollten <strong>Ammoniten</strong>gehäu-<br />
sen existierten in mehreren Abschnitten der Erdgeschichte auch<br />
sogenannte heteromorphe (gr.: heteros = anders, morphe =<br />
Gestalt) oder aberrante Formen (lat.: aberrare = abweichen).<br />
Andeutungen einer Heteromorphie bzw. Aberration finden sich<br />
häufig artspezifisch in Form einer plötzlichen Veränderung <strong>des</strong> Spi<br />
ralwachstums im Bereich der Alterswohnkammer; doch die<br />
eigentlichen Sonderlinge unter den Ammonshörnern sind jene,<br />
deren Windungen sich voneinander gelöst oder gar die Ebene ihrer<br />
Spirale verlassen haben. Man kann sie als Spielarten der Evolution<br />
betrachten, deren Auftreten ebenso unerwartet wie kurzzeitig war.<br />
Ihrer zerbrechlichen Gestalt gemäß war ihr Lebensbereich mit<br />
Sicherheit eingeschränkt und ihre Beweglichkeit stark reduziert.<br />
Es ist offensichtlich, daß sie sich aus normal gerollten <strong>Ammoniten</strong><br />
entwickelt haben. Nicht selten wurde die Spiralkrümmung völlig<br />
reduziert, so daß stabförmig gestreckte Gehäuse entstanden. Auch<br />
axiale, d. h. in die Spiralachse gerichtete Entrollungen traten auf,<br />
derart, daß dreidimensionale Gebilde verschiedenster Art entwik-<br />
kelt wurden, von der regelmäßigen konischen Schraube bis hin<br />
zum ungeordneten Windungsknäuel.<br />
In Abb. 5 sind die Bezeichnungen der für den Dogger wesentli<br />
chen heteromorphen <strong>Ammoniten</strong>-Grundformen zusammenge<br />
stellt. Die criocone Form (gr.: krios = Widder) ist durch schwache<br />
radiale Entrollung der gesamten Spirale aus der serpenticonen<br />
Form (s. Abb. 10) hervorgegangen. Wird durch weitere Entrollung<br />
insgesamt keine volle Windung erreicht, so liegt die cyrtocone<br />
oder toxoeone Form vor (gr.: kyrtös = krumm, gewölbt, töxon =<br />
(Schieß-) Bogen). Beschränkt sich die Aberration auf die (adulte)<br />
Wohnkammer, so nennt man Formen mit kurzem entrolltem Sta<br />
dium und abermaliger Einkrümmung scaphicon (gr.: scaphos =<br />
Kahn). Ist ein crioconer Phragmocon nach stabförmigem Endsta<br />
dium mit einer um etwa 180 Grad rückgebogenen Wohnkammer<br />
gekoppelt, so liegt das ancylocone Gehäuse vor (gr.: angkylos =<br />
gekrümmt). Bei vollständiger, lediglich die Anfangswindung aus-<br />
2ir# cyrtocon<br />
(toxoeon)<br />
Am- <<br />
.icu 1 icon<br />
xiocerac id)<br />
*,r.;.- ;,i, (,.,,, ni | H. u. r„ m o n,| u. r Do^j-crammoniteii<br />
trochücon<br />
(trochocero id)<br />
nehmende Streckung spricht man vom baculiconen Typ (lat.:<br />
baculum = Stab). Weist die Planspirale statt radialer eine axiale<br />
Entrollung ähnlich den Schnecken auf, so wird sie bei einander<br />
nicht berührenden Windungen als trochocon oder trochoceroid<br />
bezeichnet. Daß auf diese Weise extrem starke axiale Entrollung<br />
ebenfalls zum gestreckten Stab führen konnte, zeigt Abb. 6.<br />
Entrollung in der Windungsebene (radiale Entrollung)<br />
Abb. 6: Entrollungsmodi eines crioconen Gehäuses zur Stabforn<br />
Im Jura treten die ältesten Heteromorphen vorübergehend im<br />
Oberbajocium, also im mittleren Dogger auf (192), während sich<br />
ihre Existenz im Lias als Irrtum erwies (73). Die nächst jüngere<br />
Gruppe erscheint im Ober-Bathonium und erreicht nach gegenwärtigem<br />
Kenntnisstand nicht die Dogger/Malmgrenze. Erst im<br />
Tithonium treten bei Protancyloceras wieder Entrollungen auf.<br />
Die heteromorphen Dogger-<strong>Ammoniten</strong> wurden in jüngster<br />
Zeit durch G. DIETL umfassend revidiert (47,49, 51,56). Gestützt<br />
auf die Untersuchung von über 2500 in- und ausländischen Exemplaren<br />
konnte die Zahl der bestehenden Arten von 38 auf 17 reduziert<br />
werden, die sich nun auf vier Gattungen verteilen. Sie werden<br />
in den Unterfamilien Spiroceratinae und Parapatoceratinae zusammengefaßt<br />
(vergl. Abb. 2). Die ursprünglich große Artenzahl war
durch hohe Variabilität (125) und fragmentäre Erhaltung der sehr<br />
anfälligen Gehäuse vorgetäuscht worden. In Abb. 6 wird beispielsweise<br />
das Variationsspektrum zweier Entrollungsmodi eines crioconen<br />
Gehäuses veranschaulicht. Der größte Teil dieses Spektrums<br />
ist in mehreren Fällen innerhalb einer einzigen Doggerart<br />
wiederzufinden. Die Reihe a-c zeigt ein Zwischenstadium und das<br />
Endstadium <strong>des</strong> radialen Entrollungsmodus, die Reihe d-g zeigt<br />
den Übergang zur Stabform bei axialer Entrollung. Der so entstandene<br />
Stab besitzt schraubenförmig gedrehte Suturen und Skulpturelemcntc.<br />
Neben radialen und axialen Entrollungen treten bei<br />
Dogger-Heteromorphen aber auch solche entlang schräger Achsen<br />
auf.<br />
Bei heteromorphen <strong>Ammoniten</strong> versagt naturgemäß das<br />
gewohnte System der Gehäusemaße und Gehäuseproportionen.<br />
Der Durchmesser d, auf den die Relativwerte der Nabelweite N<br />
und der Windungshöhe H bezogen sind (vergl. Abb. 15), verliert<br />
ebenso wie die Rippenzahl pro Windung bei starker Entrollung<br />
jeglichen Sinn. Als Bezugsgröße wird <strong>des</strong>halb bei den Heteromorphen<br />
grundsätzlich die Windungshöhe h benutzt, da auch sie - von<br />
Ausnahmen im Bereich adulter Wohnkammern abgesehen - ähnlich<br />
wie der Windungsdurchmesser normal gerollter Gehäuse,<br />
monoton mit dem Gehäusealter zunimmt. Auch bei völlig<br />
gestreckten Gehäusen kann die Orientierung der Höhe h im Querschnitt<br />
bei fehlender Skulptur anhand der Sutur festgestellt wer-<br />
o ad)<br />
rädi sie proradiate retr^rsd i ate<br />
ßerippung<br />
Abb. 7: Zur Terminologie der Heteromorphe'nskulptur. V = Ventralregion,<br />
D = Dorsalregion, Wachstum in Pfeilrichtung<br />
den. Ebenso ist eine Bestimmung der Extern- und Internseite eines<br />
Windungsfragmentes auf diese Weise möglich.<br />
In den modifizierten Maßtabellen der Heteromorphen gelten<br />
die Angaben einer bestimmten Zeile für die in der ersten Spalte<br />
angegebene Windungshöhe h. Die Nabelweite muß entfallen; der<br />
Querschnitt Q = h, b (vergl. Abb. 7a) behält seine Bedeutung. Die<br />
normalerweise auf eine volle Windung bezogene Rippenzahl Z<br />
wird bei den Heteromorphen auf die Einheit 1 cm der Gehäuse<br />
länge bezogen (Abb. 7b). Sie wird in diesem Falle mit R bezeichnet.<br />
Der Rippenverlauf an heteromorphen Gehäusen wird mittels<br />
der bei normal gerollten <strong>Ammoniten</strong> gebräuchlichen Terminolo<br />
gie erläutert, jedoch mit dem Unterschied, daß als Bezugsrichtung<br />
nicht der durch die Embryonalkammer gehende Radius, sondern<br />
das Lot auf der Windungsachse gilt. Gemäß Abb. 7c bis 7e lassen<br />
sich dann in gewohnter Weise radiale, proradiate und retroradiate<br />
Rippen unterscheiden. Die Begriffe konvex und konkav gelten ent<br />
sprechend (vergl. Abb. 13).<br />
Da die Gestalt der Heteromorphen nicht in dem Maße wie bei<br />
normalen <strong>Ammoniten</strong> durch Maßzahlen wiedergegeben werden<br />
10<br />
kann, sind in der sonst der Skulpturbeschreibung v<br />
«rk-ha| tniU)<br />
Spalte der Tabellen zusätzliche Hinweise auf die Gehäuselorin uif<br />
genommen worden.<br />
Vollständige heteromorphe Dogger-<strong>Ammoniten</strong> werden sehr<br />
selten gefunden, ebenso Fragmente mit vollständiger adulter<br />
Mundöffnung. Das größte, in der Monographie DIHTI.S (5|,<br />
erwähnte Bruchstück weist knapp 40 mm Windungshöhe auf. D, ls<br />
süddeutsche Material besteht fast ausschließlich aus Stein- h nv.<br />
Pvritkernen ohne Schalenerhaltung. So sind die häufig auftretenden<br />
Stacheln der Heteromorphen nur als Knoten erhalten. Die<br />
Rippen sind im Gegensatz zu vielen normalen Doggerammoniien<br />
stets einfach, nie gespalten. Vor der Altersmündung wird die<br />
Skulptur schwächer und unregelmäßig.<br />
Die Sutur der Heteromorphen <strong>des</strong> Doggers ist den Stabilitätsbedingungen<br />
<strong>des</strong> entrollten Gehäuses weitgehend angepaßt. Während<br />
im Bereich der normal gerollten ein bis zwei Anfangswindungen<br />
noch die typische, ammonitische Primär- bzw. Frühsutur mit<br />
ausgeprägtem Intern-, Extern- und Laterallobus, sowie zwei flachen<br />
Umbilikalloben dominiert, wandeln sich die Verhältnisse mit<br />
Beginn der Entrollung. Bei Spiroceras und annähernd auch bei<br />
Aaiariceras bleiben der Lateral- und der Umbilikallobus Uj stark in<br />
der Entwicklung zurück (Abb. Sa-d), und U 2 wird zum beherrschenden<br />
Flankenlobus. Eine derartig vereinfachte Sutur ist verknüpft<br />
mit einem optimalen Stützsystem <strong>des</strong> Röhrenquerschnittes<br />
Abb. S: Sutur und Septen von Dogger-Heteromorphen<br />
a-d Suturentwicklung von Spiroceras orbignyi, nach SCHINDEWOLF<br />
1951<br />
e vereinfachtes Altersseptum von Spiroceras \<br />
tachDiETL 1978<br />
f vereinfachtes Altersseptum von Parapatoccras )
durch vier, im rechtwinkligen Kreuz angelegte Septalfalten (Abb.<br />
Se). Bei Parapatoceras (Abb. 8f) besteht dieses Stiitzsystem aus<br />
sechs Septalfalten, die unter je 60° zueinander angeordnet sind<br />
und durch die Loben I, E, L und UT repräsentiert werden.<br />
Die Symmetrie <strong>des</strong> Septums geht verloren, wenn eine axiale<br />
Entrollung im Spiele ist. In diesen Fällen kann sogar eine Drehung<br />
<strong>des</strong> Septums und damit der Sutur gegen die Skulptur auftreten. So<br />
kann mitunter der Lobus U 2 zur Ventralfurche wandern, die nor<br />
malerweise mit dem Externlobus E korreliert. Derartige Verdre<br />
hungen werden meist beibehalten, wenn sich ein geradliniges<br />
Gehäusewachstum anschließt. Der Externlobus E ist im allgemei<br />
nen, im Gegensatz zum Internlobus I, zweispitzig breitgedehnt.<br />
11
4 Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Doggers in Süddeutschland<br />
Noch immer genießt die von F. A. QUEXSTEDT in der zweiten<br />
Hälfte <strong>des</strong> vorigen Jahrhunderts nach vorwiegend lithostratigra-<br />
phischen Gesichtspunkten aufgestellte Schichtgliederung <strong>des</strong><br />
Juras große Beliebtheit. Ebenso wie den Unteren und Oberen Jura<br />
teilte der Altmeister schwäbischer Geologie auch den Mittleren<br />
Jura in 6 Unterstufen auf und bezeichnete sie mit den ersten 6<br />
Buchstaben <strong>des</strong> griechischen Alphabets. Dieser Gliederung steht<br />
die internationale Stufengliederung gegenüber, deren vertikale<br />
Grenzziehungen auf das Auftreten bestimmter ammonitischer<br />
Leitarten begründet werden. In dieser biostratigraphischen Glie<br />
derung tragen die Stufen die Namen von Orten, die nach Meinung<br />
ihrer Autoren die betreffende Stufe in typischer Ausbildung auf<br />
weisen. Die Typuslokalitäten <strong>des</strong> Doggers sind die Städte Aalen in<br />
Ostwümcmberg, Bayeux an der französischen Nordwestküste,<br />
Bath in Südengland und die Ortschaft Kellaway in Südengland.<br />
Nachfolgende Bearbeiter wandelten aber sowohl die vertikalen<br />
Grenzen <strong>des</strong> Aaleniums, Bajociums, Bathoniums und <strong>des</strong> Callo-<br />
viums als auch die geographischen Geltungsbereiche von Typuslo<br />
kalitäten vielfach ab. Eine eindeutige Positionierung der Stufen<br />
grenzen in den süddeutschen lithologischen Schichten ist wegen<br />
deren bereichsweiser Fossilarmut, ihrer faziellen Verschiedenhei<br />
ten und ihrer stark unterschiedlichen Mächtigkeiten problema<br />
tisch. Da QUENSTEDTS Braunjura zeta über die Obergrenze der<br />
obersten Doggerstufe, <strong>des</strong> Calloviums, hinausreicht, sind Braun<br />
jura und Dogger, streng genommen, nicht identisch.<br />
4.1 Das Aalenium<br />
Die 1864 von CHR. MAYER-EYMAR für die unterste Doggerstufe<br />
vorgeschlagene und 1874 revidierte «Etage aalenien» gilt<br />
nach dem Jura-Colloquium 1962 in Luxemburg und nach zögernder<br />
Anerkennung im Ausland nahezu exakt als Äquivalent für den<br />
Braunjura alpha und beta QUENSTEDTS. Das Aalenium erstreckt<br />
sich über die Zonen <strong>des</strong> Leioceras opalimim, der Ludwigia murchisonae<br />
und <strong>des</strong> Graphoceras concavum (vergl. Tab. 1).<br />
Die Sedimente <strong>des</strong> Unter-Aaleniums sind durchweg monoton<br />
schwarzgraue, schiefrige Tonmergel, die in Bezug auf das Zonentossil<br />
als Opalinus-Tone bezeichnet werden. Für den Fränkischen<br />
Iura wird der Name Neumarkt-Schichten vorgeschlagen (282). Im<br />
f'ereich der Typuslokalität ist der Opalinus-Ton etwa 100 m, im<br />
Kaum Coburg nur noch 20 m mächtig. Durch das spärliche und<br />
sporadische Auftreten von Makrofossilien ist er ebensowenig wie<br />
mittels der stellenweise nachweisbaren Mergelkalkbänke durchgehend<br />
(einer zu gliedern. Das Liegende bilden die fossilreichen,<br />
-ur.uien Jurensis-Mergel mit ihren für die Aalener Sehwellenfa-<br />
^•«•s upisehen, harten, phosphatischen <strong>Ammoniten</strong>breccien, in<br />
1<br />
' K<br />
' Gattung Duinortieria vorherrscht. Bei von unten nach<br />
'^"'i zunehmendem Sand- und Kalkgehalt wird die Obergrenze<br />
l t s<br />
'<br />
palmus-Lines durch eine oder mehrere, verwittert fahlrote<br />
^•dmergeihanke. die sogenannten Wasserfallbänke, gebildet,<br />
ClnvT hs /U 20 m M ; i c n t i<br />
- Qu N s Tin rs Grenzregion alpha/beta entsprechen und bei<br />
k e i t<br />
8 erreichen. In der südlichen<br />
hi\b ,<br />
, l c n A l h u i r d oi<br />
"e- maximal etwa 2 m über den Wasser-<br />
*5phj ' U , t r c t c l K l e<br />
' ''clemuitenbreccie noch zum Braunjura<br />
«Knl! ;tTl<br />
' dlnCt<br />
'<br />
X V l l t a c h r c , o n<br />
." ' w<br />
» ^ Wasserfallbänke<br />
v<br />
' wie die Bclcmnitenbreccie fehlen, bereitet die lithostrati-<br />
graphische Grenzziehung alpha/beta Schwierigkeiten (202).<br />
Der Braunjura beta ist im Untersuchungsgebiet von unter<br />
schiedlicher Facies. In der Frankenalb - dort wurde der Begriff Rei<br />
fenberg-Schichten vorgeschlagen - und der schwäbischen Ostalb<br />
wird er durch eine Folge von Sand- und Tonsteinen gebildet, in<br />
denen abbauwürdige, silikatreiche Flöze von öoidischem Nadelei<br />
senerz (Aalen, Geislingen/Steige) eingelagert sind. Dem gegen<br />
über steht, mit der größten Beta-Mächtigkeit von 70 m, die vor<br />
wiegend tonige Beckenfazies <strong>des</strong> Reutlinger Raumes, in die sich<br />
zunehmend nach Südwesten ammonitenreiche, meist graue bis<br />
graugrüne Mergelkalke bei steigendem Sandgehalt einschalten.<br />
Über der etwa 30 cm mächtigen Wasserfallbank der Typusloka<br />
lität liegen weitere 2 m dunkelgraue, sandflaserige Tonsteine<br />
(252), die ihre maximale Mächtigkeit mit 14 m in der Boller<br />
Gegend erreichen. An der Obergrenze dieser sehr fossilarmen<br />
Zwischentone erscheinen glimmerreiche Kalksandstein-Platten,<br />
die nach ihren zopfförmigen Kriechspuren von Gyrochorda<br />
comosa (HEER) als Zopfplatten bezeichnet werden und häufig mit<br />
Sandsteinbänken wechseln. Vereinzelte Fossilfunde deuten darauf<br />
hin, daß ihr Alter örtlich variiert und sie <strong>des</strong>halb zur Parallelisie-<br />
rung ungeeignet sind. In der schwäbischen Südwestalb folgen im<br />
Hangenden, abermals durch mehrere Meter Zwischentone<br />
getrennt, schließlich ein oder mehrere chamositoolithische, grau<br />
grüne oder verwittert rotbraune Bänke, in denen erstmals das Sub-<br />
zonen-Leitfossil Leioceras comptum in großer Häufigkeit auftritt.<br />
In der Ostalb treten eigentliche Comptum-Bänke dieser Art nicht<br />
mehr auf. Leioceras comptum erscheint hier bereits vereinzelt in<br />
der Zopfplattenregion (252), über der sich, nach einer Serie von<br />
Ton- und Sandsteinschichten, der früher technisch genutzte<br />
«Untere Donzdorfer Sandstein» mit dem Unteren Erzflöz einstellt.<br />
Während der Braunjura alpha mit den Wasserfallbänken bzw.<br />
der Belemnitenbreccie abschließt, werden Zopfplattenregion und<br />
Comptum-Bänke noch zum Unter-Aalenium gerechnet. Das<br />
Ober-Aalenium beginnt mit der Zone der Ludwigia murchisonae<br />
und diese wiederum mit dem Einsetzen von Staufenia sinon und<br />
Staufenia opalinoi<strong>des</strong> im Unteren Flöz von Aalen-Wasseralfingen<br />
bzw. in den Sinon-Bänken <strong>des</strong> Wutachgebietes, 7 m über der<br />
Comptum-Bank. In der Südwestalb ist Staufenia sinon selten. Der<br />
markanteste Horizont <strong>des</strong> südwestdeutschen Ober-Aaleniums ist<br />
die mächtige Staufensis-Bank mit der in der Ostalb sehr seltenen<br />
Staufenia staufensis im oberen Teil und Staufenia sehndensis im<br />
unteren Teil der Bank.<br />
Die obere Zone <strong>des</strong> Ober-Aaleniums ist die <strong>des</strong> Graphoceras<br />
concavum. Besonders guten Leitwert besitzt zwischen Rottweil<br />
und Reutlingen die sehr harte, rostig verwitterte Concavum-Bank<br />
mit ihren dunkel berindeten, mittelgrauen Kalkgeröllen. Die Leit<br />
art wurde nordöstlich von Geislingen Steige, wo sie sich noch im<br />
tonig-sandigen Komplex <strong>des</strong> Oberen Donzdorfer Horizontes<br />
nachweisen ließ, bisher nicht gefunden.<br />
In Franken wird die Aufstellung einer strengen Zonengliede<br />
rung im Doggersandstein durch das gänzliche Fehlen von Leitarten<br />
in vielen Horizonten verhindert. Einige Bänke der im Nordosten<br />
bis auf 100 m anschwellenden Folge von Ton- und Sandsteinen<br />
sind jedoch durch ihren hohen Gehalt an Inoceramen und anderen<br />
Mollusken sehr horizontbeständig (219). Für eine Gliederung in<br />
nicht genauer fixierbare <strong>Ammoniten</strong>-'Schichten» wurde Leioceras<br />
costosum, Ludwigia tolutaria, Ludwigia murchisonae und Gra<br />
phoceras concavum vorgeschlagen (2~8).<br />
13
Tab. 1: Schicht- und Zonengliedemng <strong>des</strong> südwestdeutsehen Doggers. In Klammem gesetzte Leitarten sind im Untersuchungsgebiet bishi<br />
oder nur selten nachgewiesen.<br />
Populäre Schichtbczciehnungen,<br />
markante<br />
Horizonte<br />
Unterstufe<br />
QUENSTEDTS<br />
Internationale<br />
Stufengliederung<br />
Kurzzeichen<br />
Oxford in m ox la (Oueustedtoceras mariac)<br />
Zonen-Leitart Subzonen-Leitart<br />
Lamberti-Knollen cl 3 b Ouenstedtoceras lamberti Quenstcdtoccras lamberti '<br />
Ouenstedtoceras henrici<br />
obere Ornaten-Tone<br />
Anceps-Oolith<br />
c Callovium ittel-<br />
untere Ornaten-Tone<br />
Jnter-<br />
Macrocephalen-Oolith<br />
Aspidoi<strong>des</strong>-Oolith<br />
cl 3 a (Peltoceras (Peltoceras) atblcta)<br />
cl 2b F.iymnoceras coronatwn (Kosinnceras (Kosm.) grossouvret<br />
Kostnoceras (Zugok.) obduetum<br />
% cl 2a Kosmoceras (Zugokosm.) Jason Kosmoceras (Zugok.) Jason<br />
(Kostnoceras (Zugok.) medca)<br />
^<br />
cl 1b Sigaloccras (Sig.) callovicnse Sigaloccras (Sig.) enodatum<br />
Sigaloccras (Sig.) callovicnse<br />
Proplanulitcs koenigi<br />
cl la A \acrocepbalitcs (M.)<br />
macroeepbalus<br />
Macrocephalites (K.) kamptus<br />
Macrocephalites (M.) macroeepbalus<br />
bt 3 c Clydoniceras discus Clydoniceras discus<br />
(Clydoniceras bollandi)<br />
bt 3b Oxycerites orbis GIEBEL 1852 Oxycerites orbis<br />
Oecotraustes paradoxus<br />
Oecotraustcs densecostatus<br />
Lagenalis-Bank bt 3a Prohecticaceras retrocostatum<br />
Varians-Schichten<br />
Fuscus-Bank<br />
Dentalien-Tone<br />
Parkinsoni-Oolith<br />
Hamiten-Tone<br />
Subfurcaten-Oolith<br />
Ostreenkalke<br />
Humphriesianum-Oolith<br />
£<br />
Bathonium<br />
Bajocium<br />
Mitti<br />
Unter-<br />
Ober-<br />
Giganteus-Ton<br />
Mittel-<br />
Spathulatus-Bank<br />
[<br />
bt 2c Morrisiceras (Morris.) morrisi<br />
bt 2b Tulites (Tulites) subcontractus<br />
bt 2a Procerites progracilis<br />
bt la Ztgzagiceras (Zigz.) zigzag Aspbinctites (Asph.) temtiplicatus<br />
Oxycerites yeovilensis<br />
Morphoceras (Morph.) macrescens<br />
Parkinsonia (Gonolkites) convergens<br />
bj 3c Parkinsonia (Park.) parkinsoni Parkinsonia (Park.) bomfordi<br />
Parkinsonia (Park.) densicosta<br />
Parkinsonia (Park.) acris<br />
bj 3b Garantiana (Garantiana)<br />
garantiana<br />
Garantiana (Hlawiceras) tetragona<br />
?<br />
Garantiana (Pseudogarant.) dichotoma<br />
bj 3a Strenoceras niortense Garantiana (Garantiana) baculata<br />
Caumontisphinctes (Caum.) polygyralis<br />
Tcloceras banksii<br />
bj 2a Stcphanoceras bumphriesianum Teleceras blagdeni<br />
Stcphanoceras bumphriesianum<br />
Dorsetensia pinguis<br />
Blaukalke bj lc (Emileia (Otoitcs) sauzei) (Dorsetensia bebridica Morton)<br />
(Emileia (Otoitcs) sauzei)<br />
Wedelsandsteine 7 bj lb Witchellia laeviusada Witchellia laci 'iuscula<br />
Sonninia ovalis (QU.)<br />
Sowerbyi-Oolith bj la Hyperlioccras discites<br />
Concavum-Bank<br />
Ober-<br />
al 2b Graphoceras (Graphoceras)<br />
concavum<br />
Graphoceras (Ludivigella) cornu<br />
Graphoceras (Graphoceras) concavum<br />
Personaten-Sandstein<br />
(tonige Beckentacies)<br />
al 2a Ludwigia (Ludwigia)<br />
Ludwigia (Ludwigia) bradfordensis<br />
murchisonae<br />
Staufenia diseoidea<br />
ß Aalenium<br />
Staufenia sebndensis<br />
Comptum-Bänke<br />
Staufenia sinon<br />
Zopfplattenregion i al lb Leioceras opalinum Leioceras comptum<br />
Opalinus-Ton a al la<br />
Leioceras opalinum<br />
14<br />
Toareium
4.2 Das Bajocium<br />
Im Jahre 1851 wurde von A. D'ORBIGNY die Umgebung der<br />
nordwestfranzösischen Stadt Bayeux mit ihren damaligen Stein<br />
brüchen und ihren Küstenkliffen als Typuslokalität im Dogger vor<br />
geschlagen. Während sich D'ORBIGNY'S «Bajocien» von der heuti<br />
gen hiunphriesianum-Zone bis zur Subzone <strong>des</strong> Oxycerites yeovi-<br />
lensis, also in das heutige Bathonium hinein erstreckte, sind die<br />
Stufengrenzen <strong>des</strong> Bajociums nach den Vorschlägen von A. OPPEL<br />
1855 (6) und <strong>des</strong> Luxemburger Jura-Colloquiums 1962 tiefer zu<br />
ziehen. Danach beginnt das Bajocium über der concarum-Zone<br />
<strong>des</strong> Aaleniums mit der Zone <strong>des</strong> Hyperlioceras discites und endet<br />
mit der Zone der Parkinsonia parkinsoni unterhalb der zigzag-<br />
Zone <strong>des</strong> Bathoniums.<br />
Das lange Zeit gültige Zonenfossil <strong>des</strong> Unter-Bajociums, Sonni-<br />
nia sowerbyi, erwies sich als ein vermutlich der sauzei-Zone ent<br />
stammender, fragmentärer Phragmocon aus der Gruppe der Son-<br />
ninia mesacantha (176,181). Demzufolge wurde für den entspre<br />
chenden Zeitabschnitt zwischen discites- und sauzei-Zone (vergl.<br />
Tab. 1) neuerdings die Zone der Witchellia laeviuscula vorgeschla<br />
gen (65).<br />
Die älteste Zone <strong>des</strong> Bajociums, die discites- Zone, scheint in<br />
der Wutachregion, wo die Gattung Hyperlioceras am eingehend<br />
sten untersucht wurde (11), mit dem unteren Teil <strong>des</strong> Sowerbyi-<br />
Ooliths identisch zu sein. Dieser bildet überall die teilweise eisen-<br />
oolithische Sowerbyi-Bank aus grauem bis gelbbraunem Mergel<br />
kalk. Sie folgt im Südwesten fast unmittelbar über der Concavum-<br />
Bank; im Nordosten über dem Oberen Donzdorfer Sandstein,<br />
wobei sich dort aber meist mehrere Meter Zwischentone einschie<br />
ben. Im Filsgebiet scheint die etwa 40 cm mächtige, an Sonninien<br />
reiche Sowerbyi-Bank insgesamt zur laeviitscula-Zone zu gehören<br />
und die discites-Zone im Oberen Donzdorfer Sandstein <strong>des</strong> Braun<br />
jura beta zu liegen (65,176), wo demzufolge auch die Grenze Aale-<br />
nium/Bajocium anzunehmen wäre. Die Grenze zwischen Braun<br />
jura beta und gamma wurde von QUENSTEDT nicht genauer defi<br />
niert, wird aber im allgemeinen der Untergrenze der Sowerbyi-<br />
Bank zugeordnet.<br />
Für den mittleren Braunjura gamma sind die nach ihren Spuren<br />
fossilien benannten Wedelsandsteinplatten charakteristisch, bei<br />
c<br />
» '^mchonella- varians SCHL.<br />
Abb s (},. ,<br />
a) «Dentalium» parkinsoni QU.<br />
• MMeriMisdie l-ossilien der populären Sehiehtnüedenm«<br />
d) Ornithella lagenalis (SCHL.)<br />
denen im Südwesten ein unterer und oberer Komplex unterschie<br />
den wird. <strong>Ammoniten</strong> sind in ihnen äußerst selten, wodurch ihre<br />
biostratigraphische Stellung noch ungewiß ist. Auch die Wedel<br />
spuren sind zur durchgehenden Horizontierung allein ungeeignet,<br />
da sie stellenweise bereits im Braunjura beta auftreten. Im Liegen<br />
den und Hangenden der Wedelsandsteine befinden sich meist<br />
mehrere Meter dunkelgraue Gammatone.<br />
Über den Wedelschichten folgt ein Komplex harter, verwittert<br />
bräunlicher Kalksandsteinbänke, die nach ihrer bergfrisch blau<br />
grauen Färbung als Blaukalke bezeichnet werden. Sie erreichen<br />
ihre größte Mächtigkeit mit 4 Metern bei Reutlingen und sind in<br />
der Ostalb ausgekeilt. Im Raum Gosheim unterscheidet man<br />
untere und obere Blaukalke, die dort durch 9 Meter Tone von<br />
einander getrennt sind. Es wird angenommen, daß die relativ _<br />
ammonitenreichen Blaukalke zur Zone der Emileia sauzei gehö<br />
ren, obwohl die Leitart bisher in Südwestdeutschland nicht sicher<br />
nachgewiesen wurde und die Zonengrenzen nur in Ausnahmen<br />
bekannt sind (71). So liegt die obere Zonengrenze bei Gosheim im<br />
unteren Humphriesianum-Oolith (52), im Wutachgebiet dagegen<br />
an der Obergrenze <strong>des</strong> dort nur einen halben Meter mächtigen<br />
Blaukalks (64). Eine Aufteilung der sauzei-Zone in Subzonen liegt<br />
für Süddeutschland bisher nicht vor. Manches spricht dafür, daß<br />
die Verhältnisse im tieferen Humphriesianum-Oolith ähnlich<br />
denen in Westschottland sind, wo kürzlich Dorsetensia hebridica<br />
MORTON als Subzonen-Leitart für die obere sanzei-Zom vor<br />
geschlagen wurde (52, 167).<br />
Dicht über den Blaukalken folgt eine feinsandige, blaugraue<br />
Kalkbank mit feinkörnigen, hellbraunen Eisenooiden. Nach der<br />
darin häufigen flachen Muschel Pecten spatulatus (s. Abb. 9e) wird<br />
sie als Spatulatus-Bank bezeichnet. Ihre Untergrenze im Raum<br />
Gosheim bildet die Grenze Braunjura gamma/delta. Im Hangen<br />
den der Bank folgen bei Gosheim und südwestlich davon unmittel<br />
bar der mergelige, rostrote Humphriesianum-Oolith, in der übri<br />
gen Schwabenalb die zwischen 0,2 und 7 m mächtigen Giganteus-<br />
Tone mit Muschelknollen- und Laibsteinlagen und dem groß-<br />
wüchsigen Belemniten Megateuthis giganteus (SCHLOTHEIM). Sie<br />
werden nach Nordosten wieder zunehmend durch eisenooli-<br />
thische Kalkmergel verdrängt.<br />
In den Giganteus-Tonen beginnt die Zone <strong>des</strong> seltenen Stepha-<br />
noceras humphriesianum <strong>des</strong> Mittel-Bajociums. Die gleichnami-<br />
b) Catinula knorri (VOLTZ)<br />
e) Entolium demissum (PHILLIPS),<br />
= Pecten spatulatus QU.<br />
15
gen Oolithe fehlen in der mittleren Schwabischen Alb; hier erstrecken<br />
sich Tonschichten einer Gesamtmächtigkeit von fast 30 m bis<br />
zum Subfurcaten-Oolith <strong>des</strong> Ober-Bajociums. Ihre oberen<br />
Bereiche werden wegen der austernreichen Kalkbänke als<br />
Ostreenkalke oder, wegen <strong>des</strong> Auftretens von Tcloccms blagdeni,<br />
auch als Blagdeni-Schichten bezeichnet.<br />
Der Subfurcaten-Oolith ist ein wichtiger, von der Wutach bis zur<br />
östlichsten Schwabenalb durchgehender Komplex auffallend<br />
braunroter Bänke. Die Leitart Ammonites subfurcatus ZIETEN<br />
wurde neuerdings der Gattung Garantiana zugeordnet und die<br />
Umbcnennung der gleichnamigen Zone in niortcnse-Zone vorgeschlagen<br />
(57). Der Subfurcaten-Oolith, der im wesentlichen mit<br />
der niortense-Zone zusammenfällt, besitzt seine größte Mächtigkeit<br />
von 2,5 m in der Zollernalb und ist 10 km weiter nördlich<br />
bereits wieder auf SO cm und bei Beuren sogar auf 30 cm<br />
geschrumpft (60). An die Obergrenze <strong>des</strong> Subfurcaten-Ooliths<br />
wird die Grenze Braunjura delta/epsilon gelegt (67); örtliche<br />
Schwankungen der Oolith-Sedimentation erfordern Modifizierungen<br />
der Parallelisierung mit der niortense-Zone.<br />
Uber dem Subfurcaten-Oolith folgen in der mittleren Schwabenalb<br />
die mächtigen Hamiten-Tone, benannt nach den darin auftretenden<br />
Spiroceraten, die QUENSTEDT noch der Gattung Haniites<br />
aus der Unterkreide zuordnete. Zunehmend nach Nordosten<br />
zieht sich die niortense-Zone noch in die unteren Hamiten-Tone<br />
hinein, während die garantiana-Zont innerhalb der Tone zu liegen<br />
scheint und nur schwer abgrenzbar ist. Der im Hangenden folgende<br />
Parkinsoni-Oolith ist eine etwa 1 bis 1,5 m mächtige Folge<br />
von splittrigen Kalkmergelbänken geringen Ooidgehaltes von verwittert<br />
hellbrauner Farbe. Im allgemeinen ist die Zone Parkinsonia<br />
parkinsoni auf sie beschränkt, doch gibt es starke lokale<br />
Unterschiede. Am Plettenberg gehören die 1 m mächtigen Tone<br />
zwischen Subfurcaten-Oolith und Parkinsoni-Oolith, ebenso wie<br />
der untere Teil der hangenden, nach der Rohrschnecke «Dentaliitm»<br />
parkinsoni (QU.) (s. Abb. 9a) benannten Dentalien-Tone<br />
noch zur parkinsoni- Zone. In der Wutachregion erreichen die weit<br />
überwiegend tonigen Parkinsoni-Schichten eine Mächtigkeit von<br />
36 Metern. In der Ostalb sind Subfurcaten-Oolith und Parkinsoni-<br />
Oolith relativ ooidreich und die Zwischentone durch Kalke und<br />
Mergel ersetzt. Der gesamte Komplex ist insgesamt nur 1 bis 2 m<br />
mächtig (16).<br />
Das Bajocium Frankens besteht über der Sowerbyi-Bank aus<br />
meist nur wenigen Metern teilweise oolithischer Mergel, Mergelkalke<br />
und Sandmergel mit vereinzelten kleinen Eisenoolith-Bänken.<br />
Eine neuere, biostratigraphische Bearbeitung steht noch aus<br />
und dürfte wegen der spärlichen Fossilführung problematisch sein.<br />
4.3 Das Bathonium<br />
Die Definition einer "Etage bathonien» geht auf D'OMALIUS<br />
D'HALLOY im Jahre 1S43 zurück und bezieht sich auf eine Schich<br />
tenfolge <strong>des</strong> oberen Doggers in der Umgebung der südenglischen<br />
Stadt Bath. Sie wurde später von D'ORBIGNY, OPPEL, MAYER-<br />
EY.MAR und anderen Autoren modifiziert. Der heute gebräuch<br />
liche Umfang der Stufe (s. Tab. 1) entspricht der Gliederung durch<br />
ARKELL und DONOVAN aus dem Jahre 1952.<br />
Während die älteren Doggerstufen ebenso wie das jüngere Cal-<br />
lovium ihre größte Mächtigkeit in der mittleren Alb aufweisen,<br />
nimmt die <strong>des</strong> Bathoniums kontinuierlich nach Südwesten zu, wo<br />
sie fast 40 m erreicht.<br />
Das Unter-Bathonium beginnt in der mittleren Schwäbischen<br />
Alb und im Wutachgebiet unmittelbar über dem Parkinsoni-Oolith<br />
16<br />
mit einer Folge dunkelgrauer Tonsteine, die in der mittlen-i<br />
wie bereits erwähnt, als Dentalientone, im Süden daL-ri'r,,, ' '<br />
ren Teil als Wucrttembergica-Schichten (nach Parkinsoni, '(><br />
ceras) wucrttembergica) und im oberen Teil als Knorri-Tone • '"'V<br />
Ostrea (Catinula) knorri VOI.TZ, s. Abb. 9b) bezeichnet /<br />
Ebenfalls zum Unter-Bathonium dieses Gebietes gehört die hart<br />
hellgraue Kalkbank, die nach Oecotraustcs fuscus als Fusciii-ij an||<br />
bezeichnet wird (117). Im Gebiet <strong>des</strong> Plettenbergs bei Balinj^<br />
wo die Dentalien-Tone insgesamt über 30 m mächtig sind, gelu>.<br />
ren die unteren 15 m noch zum Bajocium. Die Grenze BajoeuinV<br />
Bathonium wird dort von einer limonitischen, 2 cm mächtievj,<br />
Mergellage gebildet (68). In der Ostalb sind die mächtigen Tom,,],<br />
gen einem nur wenige Dezimeter umfassenden braunen Kalk mu<br />
relativ kleinen, gelben Ooiden, dem Varians-Oolith (nach<br />
«Rhyncbonella» varians SCHL., S. Abb. 9c) gewichen (16, 70). Er<br />
verkörpert hier das gesamte Bathonium, während die gleichnamigen<br />
Varians-«Schichten» der Südalb (s. u.) nur etwa das Mittel-<br />
Bathonium umfassen. In der Ostalb wurde die convcrgens-Sübzone<br />
(vergl. Tab. 1) bereits im obersten Parkinsoni-Oolith nachgewiesen<br />
(58).<br />
Die Mächtigkeit <strong>des</strong> Mittel-Bathoniums ist im Wutachgebiet<br />
mit etwa sechs Metern maximal (114) und nimmt nach Nordosten<br />
schnell ab. So beträgt sie bei Thalheim am Lupfen nur noch 2,6 m<br />
(61), und zwischen Gosheim und Geislingen/Steige konnte Mittel-Bathonium<br />
bisher gar nicht nachgewiesen werden. Im südlichen<br />
Bereich wird es vom Tonmergelkomplex der Varians-Schichten<br />
repräsentiert, in den häufig Kalkmergel- und Laibsteinlagen<br />
eingeschaltet sind. Die Obergrenze <strong>des</strong> Mittel-Bathoniums bildet<br />
die nach dem Brachiopoden Omitbella lagenalis (SCHL.) (S. Abb.<br />
9d) benannte, etwa 30 cm mächtige, harte Lagenalis-Bank, die<br />
bereits dem Ober-Bathonium angehört. In der Ostalb wurden<br />
jüngst in Oberdorf am Ipf alle drei Subzonen <strong>des</strong> Mittel-Bathoniums<br />
innerhalb <strong>des</strong> insgesamt 60 cm mächtigen Varians-Ooliths<br />
nachgewiesen. 18 km westlich davon, in Aalen, waren die Nachweisbemühungen<br />
bisher erfolglos (70).<br />
Die bisherige Zonenleitart <strong>des</strong> mittleren Ober-Bathoniums,<br />
Ammonites aspidoi<strong>des</strong> OPP., stammt aufgrund neuester Untersuchungen<br />
aus dem Grenzbereich Bajocium/Bathonium. An ihrer<br />
Stelle ist Oxycerites orbis (GIEBEL) als neues Indexfossil vorgeschlagen<br />
worden (58).<br />
Das Ober-Bathonium beginnt, wie bereits erwähnt, im südlichen<br />
Untersuchungsgebiet mit der Lagenalis-Bank, die auch aufgespalten<br />
sein kann. Darüber folgen am Eichberg die etwa 1 m<br />
mächtigen, graubraunen bis grünlichen Mergelkalke <strong>des</strong> «Aspidoi<strong>des</strong>»-Ooliths<br />
mit relativ großen, schwärzlichen Eisenooiden (113).<br />
Beim Fortschreiten nach Nordosten ist eine schnelle Reduktion<br />
<strong>des</strong> «Aspidoi<strong>des</strong>»-Ooliths festzustellen. Bei Thalheim am Lupfen<br />
scheint er bis auf Aufarbeitungsspuren im hangenden Macrocephalen-Oolith<br />
<strong>des</strong> Calloviums reduziert (61). In der Zollernalb ließen<br />
sich wieder einige Dezimeter «Aspidoi<strong>des</strong>^-Oolith nachweisen,<br />
in deren oberen Teil sogar Frühformen der Gattung Macrocephalites<br />
gefunden wurden, was die Verhältnisse zusätzlich kompliziert<br />
(55).<br />
Über die discits-Zone <strong>des</strong> Ober-Bathoniums liegen in Süddeutschland<br />
nur spärliche Hinweise vor. Von der Zonenleitart<br />
wurden bisher insgesamt nur zwei Exemplare bekannt. Sie stammen<br />
aus dem Gebiet <strong>des</strong> Eyachtals der Baiinger Alb und tragen<br />
Reste eines Gesteins, das dort eine sehr geringmächtige disens-<br />
Zone repräsentieren könnte (58).<br />
In der Ostalb scheint das Ober-Bathonium lediglich durch die<br />
obersten 10 cm <strong>des</strong> Varians-Ooliths vertreten und auf die orbis-<br />
Zone beschränkt zu sein (70).
Das geringmächtige fränkische Bathonium wird in die Schich<br />
ten der Parkinsonia cf. ferruginea und der Parkinsonia (Oraniceras)<br />
wucrttembergica, die beide dem Unter-Bathonium angehören, und<br />
in die «Aspidoi<strong>des</strong>»-Schichten gegliedert. Letztere konnten auf<br />
grund detaillierterer Untersuchungen bei Schwandorf/Oberpfalz<br />
dem Mittel-Bathonium zugeordnet werden (5). Während die «Fer-<br />
ruginea»-Schichten, dort wo sie existieren, durch graue, eisenooli-<br />
thischeTone oder Tonmergel repräsentiert werden, sind die «Aspi-<br />
doi<strong>des</strong>>'-Schichten durch blau- bis gelbgraue, bisweilen auch rot<br />
braune, oolithische Kalkmergel von nicht mehr als 40 cm Mächtig<br />
keit vertreten.<br />
4.4 Das Callovium<br />
Die ursprüngliche Typuslokalität der Stufe ist der Ort Kellawav<br />
bei Chippenham/Wiltshire in Südengland. Bei der Definition <strong>des</strong><br />
Callovien durch D'ORBIGNY im Jahre 1846 bezog sich dieser aber<br />
dann auf den von PHILLIPS 1829 in Yorkshire beschriebenen «Kellawav<br />
Rock», der dort über dem Macrocephalen-Horizont folgt.<br />
1852 bezog D'ORBIGNY auch die macrocephalus-Zone in die Stufe<br />
ein. ARKELL erkannte daraufhin Yorkshire als Typuslokalität an,<br />
während CALLOMON 1962 auf dem Luxemburger Juracolloquium<br />
ganz England als Typusgebiet <strong>des</strong> Calloviums vorschlug.<br />
Als Grenzfossil gegen das Oxfordium schlug OPPEL 1857<br />
Ouenstedtoceras lamberti vor. In England gehören <strong>des</strong>halb das<br />
Mittel- und Ober-Callovium lithologisch bereits dem «Oxford<br />
Clav» an. QUENSTEDTS Braunjura zeta reicht darüber hinaus bis in<br />
die plicatilis-Zone <strong>des</strong> eigentlichen Oxfordiums hinein.<br />
Auch das Callovium weist enorme Mächtigkeitsunterschiede im<br />
Lntersuchungsgebiet auf. In den Bohrungen für die Bodenseewasserleitung<br />
wurden unter der Zollernalb 37 m gemessen, was etwa<br />
dem Maximalwert entsprechen dürfte. Nach Süden und Norden<br />
herrscht bis in die Wutachregion bzw. den Reutlinger Raum eine<br />
starke Mächtigkeitsabnahme. Bei Kandern im Oberrheintal wurden<br />
dann wieder über 50 m gemessen (124), und eine Beckenbildung<br />
im Reutlinger Raum hinterließ etwa 28 m Callovium. Bei<br />
Boptingen in der Schwäbischen Ostalb kamen schließlich noch<br />
etwa 3 m Callovium zur Ablagerung.<br />
Das Unter-Callovium beginnt mit der Untergrenze <strong>des</strong> Macroci'pnalen-Ooliths,<br />
der insgesamt noch dem Braunjura epsilon<br />
Q
5 Erläuterungen zu den Bestimmungstabellen<br />
Die Bestimmungstabellen, die den Kern dieses Buches bilden,<br />
enthalten charakterisierende Merkmale aller Taxa der Doggeram<br />
moniten. Auf die Heteromorphen war oben bereits speziell einge<br />
gangen worden. Die benutzten Begriffe für die Gehäuseformen der<br />
normal gerollten Ammonoideen sind in Abb. 10 veranschaulicht,<br />
die der Windungsquerschnitte in Abb. 11.<br />
In der ersten Spalte enthalten die Bestimmungstabellen neben<br />
dem abgekürzten Gattungsnamen den Artnamen und Hinweise<br />
auf <strong>des</strong>sen Ursprung, sowie Hinweise auf den Typus der Art und<br />
gerundet<br />
( fotundus)<br />
••'•'.pscc-<br />
MS<br />
: / u r<br />
'' ''<br />
serpenticon coronat platycon<br />
quadratisch dreieckig<br />
(triangulär)<br />
seinen Verbleib. Dann folgen wesentliche Synonyme, die bevor<br />
zugt auf die gängige Regionalliteratur verweisen, und eine kurze<br />
Differentialdiagnose zwecks Herausstellung der morphologischen<br />
Unterschiede zu ähnlichen, meist zuvor aufgeführten Arten.<br />
In den beiden folgenden Tabellenspalten sind, soweit sie greif<br />
bar waren, Suturen und Windungsquerschnitte für bestimmte<br />
Windungshöhen h bzw. bestimmte Gehäusedurchmesser d wie<br />
dergegeben. Der Pfeil in den Suturen kennzeichnet die Mitte <strong>des</strong><br />
Externlobus, der kurze Bogen die Windungsnaht. Die Herkunft<br />
cadicon oxycon sphärocon<br />
Abb. 10: Gehäusetypen normal gerollter Doggerammoniten<br />
trapezoid<br />
lanzettlich spitzbogenförmig hochrechteckig<br />
breitrechteckig breiltrapezoid<br />
Terminologie der Windungsqucrschnittc<br />
Außenbug<br />
Flanke<br />
Nabelwand,'' /i<br />
Nabelabfall<br />
Innenwindungen<br />
Venler oder<br />
Externseite<br />
Dorsalteil<br />
(der Außenwindung)<br />
Innenbug<br />
Windungsnaht<br />
Windungsursprung<br />
(Embryonalkammer)<br />
Abb. \Z: Bezeichnung wesentlicher Teile <strong>des</strong> <strong>Ammoniten</strong>gehäuses<br />
19
fibulat Schattrippe Bündelrippe bifurkat trifurkat potygyrat polyplok virgalipartit<br />
Parabelrippen<br />
Spaltrippe n<br />
Abb. 13: Bezeichnungen von Rippenverlauf und Rippentyp. Der Punkt symbolisiert den Windungsursprung; das Gehäusewachstum ist im Bild nach<br />
rechts gerichtet.<br />
der Sutur ist in den Literaturangaben der letzten Tabellenspalte<br />
enthalten. Alle Querschnitte sind so dargestellt, daß sie bei radialer<br />
Ausdehnung durch den Windungsursprung verlaufen würden.<br />
Die Spalte «Skulptur' enthält nähere Erläuterungen der gesamten<br />
Gehäuseskulptur und ihrer Entwicklung einschließlich der verschiedenen<br />
Kielbildungen. Zur Lokalisierung der einzelnen Skulpturelemente<br />
dienen die in Abb. 12 definierten Begriffe. Die<br />
Bezeichnungsweise verschiedener Rippentypen und ihrer Verzweigungen<br />
findet sich in Abb. 13. Bei den sehr verbreiteten Spaltoder<br />
Gabelrippen unterscheidet man zwischen der einfachen Primär-<br />
oder Flankenkomponente (Primärrippe) und den Sekundäroder<br />
Externkomponenten (Sekundärrippen), die die Spaltäste bilden.<br />
Sind Rippen insgesamt nach vorn oder hinten geneigt, werden<br />
sie als provers bzw. als retrovers bezeichnet. Bezugsrichtung ist<br />
stets der vom Windungsursprung ausgehende Radialstrahl. Eine<br />
besondere Bedeutung für die Systematik der Perisphincten <strong>des</strong><br />
oberen Doggers besitzen die in Abb. 13 ebenfalls dargestellten<br />
Parabclbildungen. Die verschiedenen Kielformen zeigt Abb. 14.<br />
fastigat<br />
(Firslkiet)<br />
sxjcot<br />
(Medianrille)<br />
nicht abgesetzt abgesetzt Fadenkiel<br />
bicarinat tricarinat<br />
und bisulcat<br />
krenelieri<br />
(Zopfkiet)<br />
Abb. N: Ausbildungsformen <strong>des</strong> Kieles von <strong>Ammoniten</strong>eehäusen<br />
20<br />
N =-§--100%, H =-§--100%, B =-§--100%, Q=-£<br />
Abb. 15: Die wichtigsten Gehäusemaße und Proportionen<br />
Die Spalten 5 bis 9 der Bestimmungstabellen enthalten artty<br />
pische Maßzahlen gemäß ihrer Definition in Abb. 15. Nach den<br />
Maßen <strong>des</strong> Typus, die jedoch nicht immer erhältlich waren, folgen<br />
meist nach zunehmendem Gehäusedurchmesser geordnete Maß<br />
zeilen anderer Exemplare. Sind verschiedene Gehäusedurchmes<br />
ser d durch Klammern zusammengefaßt, gehören die gesamten<br />
Zeilen zum gleichen Exemplar. Kleine Buchstaben bezeichnen<br />
dimensionsbehaftete Abmessungen, große Buchstaben dimen<br />
sionslose Relativwerte. Im allgemeinen sind die Maße mit Einbe<br />
ziehung der Skulptur und <strong>des</strong> Kiels gewonnen worden, zwischen<br />
den Rippen entnommene sind durch einen Apostroph gekenn<br />
zeichnet. Werte in Klammern sind aus Gründen der Überlieferung<br />
oder der Erhaltung <strong>des</strong> Stückes unsicher.
Soweit möglich, wurden die angegebenen Proportionen der<br />
Maßspalten durch Mittelwertbildung aus einer größeren Zahl von<br />
Einzelwerten bestimmt. Sie sind dann durch einen Querstrich<br />
gekennzeichnet. Bei besonders großen Streuungen der Einzelwerte<br />
sind die Maximalabweichungen von den Mittelwerten hinzugefügt.<br />
Die Rippenzahl Z gilt für eine volle Windung <strong>des</strong> in gleicher<br />
Zeile angegebenen Gehäusedurchmessers d. Meist wird zwischen<br />
Primärrippen PR und Sekundärrippen SR unterschieden. Manchmal<br />
ist auch die Angabe der Knotenzahl Kn pro Windung vorteilhaft.<br />
Die letzte Spalte der Tabellen enthält als oberste Angabe den<br />
vertikalen Lebensbereich der Art mit Hilfe der in Tab. 1 enthaltenen<br />
Kurzzeichen. Darunter findet sich der Hinweis auf die Tafelabbildung.<br />
Schließlich folgen an dritter Stelle Angaben der der Kenntnis<br />
der betreffenden Art dienlichen Literatur.<br />
21
6 Bestimmungstabellen<br />
PHYLLOCERATINA A<br />
R K E L L 1 9 5 0<br />
VORWIEGEND ENGNABLIGE, HOCHMÜNDIGE FORMEN MIT SCHWACHER ODER VÖLLIG FEHLENDER SKULPTUR. DURCHGREIFEND GEKENNZEICHNET DURCH EINEN LITUIDEN INTERNLOBUS, PHYLLOIDE (GROßBLÄT<br />
TRIGE) ZERSCHLITZUNG DER SUTURSÄTTE! UND EINE GROßE ZAHL VON SUTURCLEMCNTEN (SUTURALLOBENBILDUNG).<br />
Phyllocerataceae Z I T T E L 1SS4<br />
AUS DEN FAMILIEN USSURITIDAE H Y A T T , DISCOPHYLHTIDAE S P Ä T H UND PHYLLOCERATIDAE Z I T T E L BESTEHENDE GRUPPE DER PHYLLOCERATINA MIR FEINER SCHALENSRREIFUNG, FALTENARTIGEN RIP<br />
PEN ODER VEREINZELTEN EINSCHNÜRUNGEN. TRIAS BIS KREIDE.<br />
Phylloceratidae Z<br />
I T T E L 1SS4<br />
VERMUTLICH VON DEN MONOPHYLLITINAE S M I T H ABSTAMMENDE GRUPPE DER PHYLLOCERATACEAE MIT DER GEMEINSAMEN LOBENFORMEL E L IN U3 (ODER U4) = S UJ I (VERGL. W I E D M A N N<br />
1970). AUF EINE GLIEDERUNG IN UNTERFAMILIEN WIRD HIER VERZICHTET.<br />
Partschiceras F Ü C I N I 1 9 2 3 ; DN: P. P A R T S C H , 1 7 9 1 - 1 8 5 6 , VORSTAND DES NATURHIST. MUSEUMS WIEN; T A Ammonites partschi S T U R 1 8 5 1 , = P monestieri B R E I S T R O F F E R 1 9 4 7 .<br />
SEHR ENGNABLIGE, DICKSCHEIBIGE GEHÄUSE VON MEIST HOCHOVALEM WINDUNGSQUERSCHNITT. GEGENÜBER DER GATTUNG Phylloceras, DEREN SKULPTUR SICH AUF ANWACHSLINIEN BESCHRÄNKT,<br />
ZUSÄTZLICH MIT STUMPFEN RIPPEN AUF DER ÄUßERSTEN WINDUNGSHÄLFTE VERSEHEN. SUTUR MIT ZWEI-, MANCHMA! AUCH VIERBLÄTTRIGEN SÄTTELN. J O L Y SCHLUG 1 9 7 6 DIE GATTUNG Adabofoloceras<br />
FÜR DIE PARTSCHICERATEN DES DOGGERS VOR. SINEMURIUM BIS UNTERKREIDE.<br />
ART SUTUR BEI H =<br />
P, esulcatum (QU. 1887), DN:<br />
LAT. E-SULCATUS = UN-EINGE-<br />
SCHNÜRT. (nl<br />
H T IST Am. heterophyllus<br />
csulcatus Q U . 1 8 8 " , TAF. 86,<br />
FIG. 2 8 (VOLLST, GEKAMMERTER<br />
STEINKERN!.<br />
= Am. viator D ' O R B . 1 8 4 7 ?<br />
QUER<br />
SCHNITT<br />
BEI D =<br />
SKULPTUR D<br />
A M H T TRETEN AB H = 9 M M r\ SEHR FLACHE WULSTRIPPEN AUF, DIE<br />
ETWA AUF DER FLANKENMITTE<br />
BEGINNEN UND LEICHT<br />
GESCHWÄCHT DIE EXTERNSEITE<br />
U<br />
2 CM<br />
QUEREN. DIE FLANKENMITTE<br />
ERSCHEINT IN FORM EINES BANDES<br />
ABGEFLACHT.<br />
IN CM<br />
N<br />
IN %<br />
H<br />
IN R<br />
!'O<br />
Q<br />
Z<br />
ZONE<br />
TAF.<br />
LIT.<br />
H T 2,0 6 5 4 1,36 (45) CL 3<br />
Cdlliphylloceras S P Ä T H 1 9 2 7 ; DN: GR. CALÖS = SCHÖN, PHYLLON = BLATT (SUTURSATTEL), CERAS = HORN; T A Phylloceras dispuLihik' Z I T T E L 1S6S. SEHR ENGNABLIGE, DICKSCHEIBIGE FORMEN<br />
VON HOCHOVALEM WINDUNGSQUERSCHNITT. STEINKERNE TRAGEN EINIGE SINUSFÖRMIGE EINSCHNÜRUNGEN, DIE AUF DER SCHALE FEHLEN ODER DURCH WÜLSTE VERTRETEN WERDEN. KEINE BERIPPUNG,<br />
SCHALE MIT ANWACHSSTREIFUNG. UNTERSTER LIAS BIS UNTERKREIDE.<br />
C. hajoaense (POMP. 1 8 9 3 ) ,<br />
DN: BAJOCIUM. URSPR. UNTERSTE<br />
STUFE DER INTERNAT. DOGGER-<br />
GHEDERUNG.<br />
H T IST .4/1!. heteroplnllus<br />
"pjlini Q U . 1 8 8 6 , TAF. 56.<br />
FIT:. 10.<br />
BEZIEHUNGEN ZUM SEHR ÄHNLI<br />
CHEN C. nihsimi H E B E R T<br />
«"SEKL.IRT.<br />
''• J'.-puubiU. ( Z I T T E L<br />
'•••'-.LAEND.<br />
IN: LAT. DISPUTABILIS =<br />
" '"»• MM,-:,,- P U S C H IN<br />
M<br />
'' !<br />
H N A T S T . H IS52. L T<br />
" L-I-. 1 U. 2 N.<br />
"••'
Holycopbylloceras SPÄTH 192"; du: gr. holcös = Furche, Phylloccras = Blauhorn, TA Am. zignodianwn D'ORB. 1K4K. Sehr engnablige Gehäuse mii hochelÜptisehcm Wind,<br />
querschnitt, geschwungenen (im Alter mehrfach) oder gewinkelten F.inschnürungen und häufig iadenarügen Kippen in der Vcntralregion. Sutur mit zwei- und dreiblättrige:! S ,<br />
Abgrenzung gegen Sowcrbyccras (s. u.), als deren Subgeuus es WIEDMANN 1964 betrachtete, schwierig. Toari_mm bis Unterkreide.<br />
Art<br />
H. zi-uoJumim 'D'ORB.<br />
1S4S), dn: M. de ZIGNO,<br />
franz. Sammler.<br />
= PhxHoceras mediterraneum '<br />
NHIMAYR 1871, = Pbylio- I<br />
ms Y-rtdcna Auyiitl POMP. |<br />
1H9 S;<br />
= Am. tortisulcatus ornati<br />
QU. 1 SS", Taf. 86, Fig. 32 i<br />
Skulptur<br />
Bei Schalcnexemplaren feine,<br />
dichte, retrokonkave Rippchen<br />
vorwiegend aut der äußeren<br />
Windungshälfte und extern.<br />
Etwa 5 Einschnürungen pro<br />
Windung, bis Flankenmine<br />
prokonkav, dort zu reuokonka-<br />
vem Verlauf nach hinten knik-<br />
kend, extern gerade überge<br />
hend, aut der Schale schwacher<br />
und vorn durch Kragen<br />
begrenzt. Durch die Einschnü<br />
rungen gleicht der Nabel oft<br />
einem Fünfeck.<br />
1.5<br />
4.2 14<br />
Sowerbyceras PARONA u. BONARELLI 1895; dn;j. SOWERBY, engl. Konchylioioge, 1757-1822, gr. ceras = Horn; TA .4;». tortisulcatus D'ORB. 1848. Formen mit engem, im<br />
phylogenetischen Verlauf weiter werdendem Nabel, mit zunächst hochovalem, bei geologisch jüngeren Arten hochrechteckigem Windungsquerschnitt. Außer Anwachsstreifung<br />
herrschen sinusförmige Einschnürungen auf dem Steinkern vor, die etwa auf der 3. Wändung einsetzen und im Alter - im Gegensatz zu Calliphylloceras - zweiwellig verlaufen sowie<br />
bei Schalenerhaltung ebenfalls als Einschnürungen ausgebildet sind. Im Bathonium einsetzend.<br />
S. antecedens (POMP. 1893),<br />
dn: lat. = vorhergehend.<br />
= Am. heterophyllus ornati<br />
QU. 1887, Taf. 86. Fig. 24-<br />
Laut POMP, das häufigste<br />
Pbylloceras <strong>des</strong> württ. Callo-<br />
S. ovale [VOMV. 1893), dn: mit<br />
ovalem Querschnitt.<br />
5. transiens (POMP. 1893) ist<br />
nicht von ovale zu unter<br />
scheiden; beide "Arten» wer<br />
den unter S. ovale (Seiten-<br />
pnorität) zusammengefaßt.<br />
= Am tortisulcatus ornati<br />
QU. 1887, Taf. 86, Fig. 30 u.<br />
31.<br />
Von antecedens durch kleine<br />
res Q und externe Fortset<br />
zung der Einschnürungen<br />
seschieden.<br />
5. subtortisukatum (POMP.<br />
1893), dn: lat. tortus =<br />
gedreht, sulcatus = gefurcht,<br />
sub = untergeordnet, neben.<br />
HT (im SMXS) teilweise zer<br />
stört.<br />
= Am. tortisulcatus ornati<br />
QU. 18S~, Taf. 86, Fig. 34 u.<br />
Non vorstehenden Arten<br />
durch größeres N und flache<br />
Ranken geschieden.<br />
24<br />
11 mm<br />
3,5 mm 2,5 cm<br />
11 mm<br />
' u, U, U, J<br />
4,5 cm<br />
5-6 Einschnürungen, die auch<br />
auf der Schale noch deutlich<br />
sind, gehen vom Nabel, wo sie<br />
am tiefsten sind, bis zur Flan-<br />
keurnitte proradiat und knicken<br />
dann leicht nach hinten ab.<br />
Extern sind sie kaum noch<br />
wahrzunehmen. Zwischen<br />
ihnen treten manchmal sehr<br />
feine Falten auf. Schale mit<br />
gleichmäßiger Anwachsstrei<br />
fung, die extern kräftiger ist.<br />
5-6, leicht sinusförmige Ein<br />
schnürungen verlaufen prora<br />
diat tangential zum Nabel, wo<br />
sie am tiefsten sind. Extern<br />
sind sie verbreitert und konvex<br />
vorgezogen. Bei Schalenbedek-<br />
kung sind die Einschnürungen<br />
etwas abgeschwächt; die feine<br />
Anwachsstreifung verläuft<br />
parallel zu ihnen.<br />
Maximal 6 Einschnürungen<br />
knicken am ausgeprägten<br />
Innenbug stark nach vorn und<br />
auf 2/3 Flankenhöhe wieder<br />
nach hinten. Am Aulsenbug<br />
schwingen sie abermals vor<br />
und erlöschen extern.<br />
1.7<br />
2.3<br />
HT 4,5<br />
2,4<br />
14<br />
11<br />
15<br />
Ts<br />
16<br />
46<br />
54<br />
51<br />
53<br />
51<br />
54<br />
19 53<br />
21<br />
20<br />
21<br />
45<br />
47<br />
47<br />
1.27<br />
1,61<br />
1,58<br />
1,62<br />
1.4S<br />
1.20<br />
1,23<br />
1.2<br />
1,14.<br />
1,20<br />
1.21
LYTOCERATINA H<br />
Y A T T 1 8 8 9<br />
EVOLUTE BIS CRIOCONE FORMEN VON GEWÖHNLICH KREISRUNDEM WINDUNGSQUERSCHNITT. BERIPPUNG SCHWACH ODER VÖLLIG FEHLEND, REGELMÄßIGE EINSCHNÜRUNGEN HÄUFIG. SUTUR DURCH WENIGE<br />
ABER STARK ZERSCHLITZTE ELEMENTE AUSGEZEICHNET, INRERNLOBUS ALS SEPTALTOBUS AUSGEBILDET (MIT AUSNAHME DER FRÜHEN VERTRETER).<br />
Lytocerataceae N<br />
E U M A Y R IS'5<br />
AUS DEN FAMIÜCN TRACHYPHYLLITIDAE W I E D M A N N , LYTOCERATIDAE N E U M A Y R , PLEUROACANTHITIDAE H Y A T T UND ANALYTOCERATIDAE S P Ä T H BESTEHENDE GRUPPE DER LYTOCERATINA MIT<br />
DER GEMEINSAMEN LOBENFORME! E L Ui UI I. OBERTRIAS BIS OBERKREIDE.<br />
LytOCeratidae N E U M A Y R 1 8 7 5 ( = DEROLYTOCERATIDAE S P Ä T H 1 9 2 7 , = PROTETRAGONLTIDAE S P Ä T H 192")<br />
EVOLUTE FORMEN OHNE BESONDERE GEMEINSAMKEITEN DER SKULPTUR. SUTUR MIT ZWEIGETEILTEM UI, KREUZFÖRMIGEM, SEPTALEM 1 UND VORWIEGEND BIFIDEM L UND LH. SINEMURIUM BIS UNTERE<br />
OBERKREIDE.<br />
I.vtoceras S U E S S 1 8 6 5 ( = Lobolytoceras B U C K M . 1 9 2 3 ) ; DN: = LÖSEHORN (TEILWEISE VONEINANDER GELÖSTE WINDUNGEN); T A Am. fimbrütus S O W . 1 8 1 7 (AUS DEM MITTLEREN LIAS).<br />
MÄßIG EVOLUTE BIS ADVOLUTE FORMEN. QTJERSEHNITT RUND BIS IFRAL. FEINE POPPEN, GEKRÄUSELTE N'ETZSKULPTUR ODER LEDIGLICH ANWACHSSTREIFUNG BEI SCHALENERHALTUNG, MANCHMAL IN<br />
BESTIMMTEN WJCHSTUMSBEREICHEN PERIODISCHE EINSCHNÜRUNGEN.<br />
ART SUTUR BEI H =<br />
/.. pemcllitum (QU. 1886;,<br />
DU: LAT. PENICILLUS = PINSEL<br />
H T IST Am. lineatus penicill.ims<br />
Q U . 1 8 8 6 , TAF. 56, FIG. 7,<br />
ORIG. IM IGPT. 0<br />
VON NACHSTEHENDEN ARTEN<br />
VOR ALLEM DURCH GRÖßERES Q<br />
GESCHIEDEN.<br />
/-. ümplum (OPP. 1862), DN:<br />
LAT. AMPLUS = WEIR, GERÄUMIG<br />
OR.G. DES H T IN DER B S P G .<br />
Am. Imvjius ferrjttts Q U .<br />
1SS6, TAF. 60, FIG. 1 (REPRÄ-<br />
VCNTIEN NACH P O M P . 1 S 9 6<br />
EINE FORMENREIHE MIT HÖHE<br />
REM QUERSCHNITT)<br />
IM ALTER AUFFALLEND HREITMÜN-<br />
'• TJ'iw.um D'ORL',.<br />
:<br />
I ' « ' . in LT D F S - D E S .<br />
H \ M I ' V INN;. C E O -<br />
!" I,!i:!i.<br />
"..V".<br />
* - '<br />
- ' -' S, I ... , U J<br />
M :<br />
" ^ " 1 L . , V L , ,<br />
QUER<br />
SCHNITT<br />
BEI D =<br />
3 0 CM<br />
8 0 M M 2 2 CM<br />
ca. 2(1 NUN<br />
V<br />
t<br />
14 CM<br />
SKULPTUR D<br />
AUF DER DICKEN, WEIßEN SCHALE<br />
LEDIGLICH FEINE, NUR LEICHT<br />
GEKRÜMMTE ANWACHSSTREIFEN<br />
(BEI Leioceras opalinum AUS<br />
DEM GLEICHEN LAGER SCHWINGEN<br />
SIE EXTERN STARK vor).<br />
Nur P O M P , BEOBACHTETE AUF"<br />
DER SCHALE "ZIEMLICH DICHTSTE<br />
HENDE, RADIALE, NIEDRIGE RIPPEN,<br />
WELCHE SICH GEGEN vom UND<br />
HINTEN GLEICHMÄßIG ABDACHEN".<br />
ZWISCHEN DEN RIPPEN SEHR<br />
DICHTE, ÄUßERST FEINE ANWACHS<br />
STREIFEN. EINSCHNÜRUNGEN SCHEI<br />
NEN VÖLLIG ZU FEHLEN.<br />
FEINE, LEICHT RETRORADIATC<br />
ANWACHSSTREILEN auf DER SCHALE<br />
WERDEN von 2 0 - 3 0 KRAGENARTI<br />
GEN ALTEN MUNDRÄNDERN ÜBERLA<br />
GERT, DEREN Form ZWISCHEN<br />
einer ANEINANDERREIHUNG von<br />
ca. 12 KONVEXEN BOGEN PRO<br />
RÖHRENUMFANG ( H T ) UND einer<br />
WESENTLICH DICHTEREN KRÄUSE<br />
LUNG 'QU. 1 8 8 6 , TAF. 6 8 . FIG.<br />
2; VARIIERT. STEINKERNE GLEICH<br />
MÄßIG GLATT.<br />
IN CM<br />
< 3<br />
H T 21<br />
6<br />
31<br />
H T 1 9 . 7<br />
1<br />
8<br />
1.5<br />
4 6<br />
N<br />
IN N<br />
'O<br />
4<br />
2 2<br />
3 7<br />
4 2<br />
3 8<br />
3 9<br />
Ts<br />
3.<br />
3 5<br />
H<br />
IN %<br />
5 1<br />
(47)<br />
4 0<br />
4 0<br />
3 8<br />
4 6<br />
3 8<br />
3 9 •<br />
3 9<br />
4 3<br />
Q<br />
Z<br />
ZONE<br />
TAF.<br />
LIT.<br />
(1,4) AL 1<br />
0 , 6 7<br />
0,9<br />
0 , 9 7<br />
1,0<br />
0 . 9 8<br />
(1, 2)<br />
1; 8<br />
1 9 7<br />
AL 2A<br />
1; 9<br />
1 7 8<br />
1 8 9<br />
1 9 7<br />
bj 2<br />
- BT 1<br />
2; 1<br />
7 4<br />
9 5<br />
1 8 9<br />
1 9 4<br />
1 9 7<br />
25
PjcbylxtocerusYAK'.KM. 1905; du: gr. pachys - dick. Lxtoceniss. o.;TA Am. torulosus ZIETEN 1 85 I. Evolute Gehäuse von vorwiegend rundem Windungsquerschnitt in der Jug n ij<br />
und teilweise hochmündigem Altersquerschnitt, mit charakteristischen feinen Rippchen, die oft durch regelmäßige Einschnürungen antypisch gruppiert sind. Bei derTA schaffen die<br />
Einschnürungen eine kräftige Wulstskulptur.<br />
Art Sutur bei h :<br />
P. torulosum 'Z1ETEN 1851<br />
dn: lat. torulus = Wulst,<br />
torulosu-. = wulstig.<br />
Hl in ZIETEN lxii.Tjf.<br />
1-1. Fi«, l.<br />
= Am. lr.li'rruptlts struitus<br />
QU. ISSN Taf. 48, Fig. 10.<br />
P. äihtcidum (OPP. 1856), dn:<br />
lat. dilucidus = deutlich, klar.<br />
OPP. 1856 gibt keine Abb.,<br />
bezieht sich auf Am. fimbriatus<br />
opalinus QU. 1845, S.<br />
103, ebenfalls nicht abgebil<br />
det. POMP, bildet 1896 das<br />
••Orig. OPPELs» (in der<br />
BSPG) als Fig. 8, Taf. 12 ab,<br />
das als HT gilt.<br />
Von torulosum durch kleine<br />
res N und fehlende Ein<br />
schnürungen geschieden.<br />
P. taeniatum (POMP. 1896),<br />
dn: lat. taenia = Band (band<br />
artig gruppierte Rippen).<br />
Das in der BSPG vorhandene<br />
Orig. zu POMP. 1896, Taf.<br />
12, Fig. ~ ist als LT etiket<br />
tiert.<br />
Von torulosum durch feh<br />
lende Wulstbildung, von dilu-<br />
a'dum durch Einschnürungen<br />
geschieden.<br />
P. Ir.ipe;j QU. 1886), dn:<br />
von trapezförmigem Quer<br />
schnitt.<br />
HT ist Am. trjpczi QU.<br />
1SS6. Taf. 62, Fig. 4, Origi<br />
nal nicht auffindbar, weitere<br />
Exemplare unbekannt.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch weiten Nabel und<br />
hohe Endgröße geschieden.<br />
Innen« in Jungen nicht<br />
tx-Linnt.<br />
26<br />
16 mm<br />
1 7<br />
,5 mm<br />
7.6 cm<br />
4,8 cm<br />
4 cm<br />
50 cm<br />
Skulptur<br />
Auf den innersten Windungen HT "<br />
sehr leine, radiale bis schwach<br />
geschwungene Leistenrippen 1,6<br />
auf Schale und Stetnkern, ab d<br />
= 0,3 durch ca. 12 radiale Fin-<br />
schnürungen pro Windung<br />
i etwa in lOer-Gruppen geteilt. 4<br />
j Die Einschnürungen nehmen<br />
! besonders ab d « 3 an Tiefe 4,S<br />
j und Dichte zu und erhalten am<br />
i Innenbug eine konvexe Bie- 8,8<br />
gung. So entstehen bis 40<br />
Wülste pro Umgang mit extern<br />
größter Höhe.<br />
Die leinen, scharfen Leistenrip<br />
pen paaren sich ab d = 1, so<br />
daß sie an der Naht bifurkie-<br />
renden, leicht sinusförmigen<br />
Rippen gleichen. Die wulstigen<br />
Rippenpaare, auf Schale und<br />
Kern sichtbar, gehen ab d ~ 4<br />
in scharfe, niedrige Einzelrip<br />
pen über, die auf dem Kern<br />
erlöschen. Durch feine Grüb<br />
chen zwischen den Rippen<br />
erscheinen diese am Hinterrand<br />
schwach gefranst (fimbriate<br />
Skulptur).<br />
Die inneren Windungen tragen<br />
die gleichen feinen Leistenrip<br />
pen wie P. torulosum. Ebenso<br />
werden die Einschnürungen<br />
dichter; im Gegensatz zu toru<br />
losum werden sie jedoch nicht<br />
tiefer und breiter, sondern fla<br />
cher und schmaler. Bei d = 3<br />
liegen zwischen ca. 40 Ein<br />
schnürungen pro Windung je<br />
2-4 feine Leistenrippchen.<br />
Nach QU. sieht man -nirgends<br />
eine Spur von Sicheln noch<br />
Streifen». POMP. 1896 berich<br />
tet vom HT über "Reste grober<br />
Anwachsstreifen oder relativ<br />
feiner Rippen im vorderen Teil<br />
der letzten Windung".<br />
HT 13<br />
1,8<br />
LT 4,4<br />
2,9<br />
3,4<br />
3,7<br />
5,6<br />
23p<br />
24<br />
26<br />
31<br />
45<br />
45<br />
43<br />
41<br />
(40)<br />
46<br />
47<br />
48<br />
51,6<br />
48<br />
46<br />
43<br />
46<br />
HT 50 32<br />
1,14<br />
1,0<br />
1,1<br />
1,0<br />
1,18<br />
1,11<br />
1,26<br />
1,1<br />
1,0<br />
1,0<br />
1,1
AMMONITINA HYATT 1889<br />
Im allgemeinen planspiralig gerollte Ammonoidea von verschiedenster Windungsgestalt und vorwiegend ausgeprägter Skulptur. Zerschlitzter, nicht septaler Internlobus gestattet<br />
durchgreifende Unterscheidung von den beiden Konsen anvstämmen Lyroceratina und Phylloceratina. Im mittleren Dogger treten erstmalig Entrollungen bei den Ammonitina auf,<br />
die bis zur gestreckten Stabform fortschreiten, aber nur kurzlebig sind. Karnium bis Kreide.<br />
Hammatocerataceae BUCKM. 1SS~ sensu SCHINDEWOLF 1964<br />
Ammonitina mit Kiel oder auch Medianturche, mit geschwungenen oder auch geraden Rippen und zweiklappigem Aptychus. Sutur mit breit rechteckigem Mediansattel, zweifach<br />
gespaltetem Ui und anscheinend ohne Suturallobenbildung. Im Gegensatz zu den Haplocerataceae tritt U> fast immer dorsal von Ui auf.<br />
Hammatoceratidae BUCKM. ISS", sensu SCHINDEWOLF 1964<br />
Aus den Unterfamilien Dumortieriinae (Toarcium und Hammatoceratmae bestellende Gruppe der Flammatocerataceae.<br />
Hammatoceratinae BUCKM. ISS-, sensu SCHINDEWOLF 1964<br />
Meist dünnschetbige Formen mit Spaltrippen, deren Spaltpunkte oft beknotet oder bedornt sind. Rippen und Kiel erlöschen vielfach im Alter. Toarcium bis Bajocium.<br />
Hammatoceras HYATT 1867 (= Pachammatoccras BUCKM. 1921;; dn: gr. ammos = Knoten, Schlinge, ceras - Horn; TA Am. insignis ZIETEN 1831. Sowohl evolute als invoiute<br />
Gehäuse mit vorwiegend gerundet dreieckigem bis trapezoiden Querschnitt. Abgesetzter Kiel und wulstige, oft kräftige Rippen auf die Jugendwindungen beschränkt, im Alter meist<br />
ülatt und fastigat. Bedornte Rippenspaltpunkte zwischen Innenbug und Flankenmitte; die Gruppe der letzteren wurde 1963 von ELMI als Pscudammatoccras klassifiziert. In Anleh<br />
nung an GECZY 1966 und RIEßER 1963 wird Hammatoceras hier relativ weit gefaßt.<br />
II sicboldi (OPP. 1862)<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
Art Sutur bei h :<br />
Am. sieboldi QU. 1886, Taf.<br />
59, Fig. 13, ist kein Mammatoecras.<br />
H. dudematoidcs (MAYER<br />
18"1), dn: gr. diadema =<br />
Kopfschmuck.<br />
Onp. <strong>des</strong> HT (zuletzt Univ.<br />
Zürich nicht auffindbar.<br />
'AcM-mlich weitnabhger und<br />
r<br />
'i A.ter grober berippt als<br />
"<br />
!t<br />
^K^o,M QU. |SS6,<br />
Ut. msipi,^ = kenntlich.<br />
>1, hg.<br />
^V^^rals je sie*,<br />
{"««•ä !•. 1 I j t M<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
26 i 10 cm<br />
ca. 20 mm<br />
11.5 cm<br />
Skulptur d<br />
Pro Innenwindung etwa 15 nie<br />
drige, breite Primärrippen, in<br />
Stacheln an der Windungsnaht<br />
vorwiegend zu konkaven<br />
Sekundärrippen triturkierend<br />
oder bifurkierend.<br />
Auf den Alterswindungen sind<br />
die Dornen zu radialen Wül<br />
sten ausgezogen, wodurch die<br />
Spaltpunkte etwas nach außen<br />
wandern. Altersskulptur<br />
geschwächt, niedriger, leicht<br />
verletzlicher Hohlkiel.<br />
Innere Primärrippen zu stump<br />
fen Knoten angeschwollen, von<br />
denen, später etwas innerhalb<br />
der Flankenmitte, 2-4 etwa<br />
radiale, grobe Sekundärrippen<br />
ausgehen, die fischgrätenartig<br />
auf den gerundet fadenförmi- -<br />
gen Kiel stoßen. Durch Schah<br />
rippen wächst TZ auf etwa 4.<br />
Weitständige, radiale, auf den<br />
Innenwindungen kräftige Pri<br />
märrippen bifurkieren bei etwa<br />
30"o Flankenhohe. Zwischen 2<br />
Spaltrippen jeweils 2 Schaltrip<br />
pen. Bei d = ~ Reduktion der<br />
Primärrippen zu Wülsten, spä<br />
ter Ericischen der Gesamt-<br />
skulptur. Hoher, schmaler Kiel,<br />
meist abgebrochen.<br />
in cm<br />
HT10,9 2.5 46,4 1,63<br />
HT3.4<br />
4,8<br />
5,6<br />
41<br />
36<br />
36<br />
39<br />
39<br />
38<br />
'0,9)<br />
1,0<br />
1,2<br />
(1,05!<br />
LT 11.. '1,85)<br />
16 PR<br />
80 SR<br />
13 PR<br />
52 SR<br />
18 PR<br />
13 PR<br />
15 PR<br />
60 SR<br />
20 PR<br />
1.63) SR<br />
27
Platunmutocenis BUCKM. 1922; dn: hu. planus = flach, /hnmutocerjs s. o.; TA PI. plmiforme BUCKM. 1922. Scheibenförmige Gehäuse mit in allen Altersstadien feiner IV<br />
pung. Knoten an den Rippenspaltpunkten fehlen (ARKEI.L 195";. Spaltpunkte in oder über der Flankenmitte, Mundsaum glatt, ohne Ohren.<br />
Art Sutur bei h —<br />
PI. piimfomie BUCKM. i R<br />
1922, dn: lat. planus = eben. ' ^^^^^<br />
PL (?) auerbacbense (DORN<br />
1935), dn: Fundon Auerbach,<br />
nördliche Frankenalb.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im IG PEN.<br />
Von pimiforme durch kleineres<br />
N geschieden; knotenartige<br />
Verdickungen machen<br />
die Gattungszugehörigkeit<br />
ungewiß.<br />
ca. 2S mm<br />
Querschnitt<br />
hei d -<br />
9 10 cm<br />
v. J<br />
11 cm<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
Auf den Außenwindungen<br />
dichte, leicht sinusförmige Rippen,<br />
die ohne Knotenbildung<br />
auf Flankenmitte oder davor<br />
bifurkieren. Schaltnppen relativ<br />
selten. Rippen erstrecken sich<br />
bis an den abgesetzten Hohlkiel.<br />
Auf den Innenwindungen<br />
grobe, radiale Primärrippen, die<br />
gegen die Naht anschwellen<br />
und bis d Ä<br />
7 bei ca. 40%<br />
Flankenhöhe knotig verdickt<br />
sind. Auf den Außenwindungen<br />
Skulptur abgeschwächt, auf<br />
Flankenmitte bi- oder trifurkierende<br />
Rippen nur leicht<br />
geschwungen, gegen unscheinbaren<br />
Kiel vorschwingend.<br />
8.5<br />
11<br />
15<br />
N<br />
m ft<br />
E. eiuptetum (BUCKM.<br />
1922)<br />
Art Sutur bei h =<br />
Orig. <strong>des</strong> HT zuletzt im<br />
Manchester-Museum (England;<br />
Durch später einsetzende<br />
Zunahme von H bzw.<br />
Abnahme von N von amplec-<br />
'.ens geschieden.<br />
Querschnitt<br />
bei d =<br />
( \<br />
9,5 cm<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
Der stark erodierte HT zeigt<br />
auf dem äußeren Flankendrittel htL<br />
dichte, regelmäßige, konkave<br />
Rippenbögen. U. BAYER<br />
berichtet von wulstartig angeschwollenen<br />
Rippenstielen bei<br />
d =-= 8, die sich anschließend<br />
schwächen, wobei sich die<br />
Flanken konkav einwölben.<br />
Schwund der Sekundärrippen<br />
bei d - 13.<br />
14<br />
Der stark erodierte HT zeigt<br />
auf dem äußeren Flankendrittel htL - 11,5<br />
dichte, regelmäßige, konkave<br />
Rippenbögen. U. BAYER '16,5 32<br />
berichtet von wulstartig angeschwollenen<br />
Rippenstielen bei 4 28<br />
d =-= 8, die sich anschließend<br />
schwächen, wobei sich die 7 23<br />
Flanken konkav einwölben.<br />
Schwund der Sekundärrippen 11 20<br />
bei d - 13.<br />
14<br />
14<br />
Der stark erodierte HT zeigt<br />
auf dem äußeren Flankendrittel htL - 11,5<br />
dichte, regelmäßige, konkave<br />
Rippenbögen. U. BAYER '16,5 32<br />
berichtet von wulstartig angeschwollenen<br />
Rippenstielen bei 4 28<br />
d =-= 8, die sich anschließend<br />
schwächen, wobei sich die 7 23<br />
Flanken konkav einwölben.<br />
Schwund der Sekundärrippen 11 20<br />
bei d - 13.<br />
14<br />
14<br />
- 11,5<br />
'16,5 32<br />
4 28<br />
7 23<br />
11 20<br />
14<br />
H<br />
in %<br />
53<br />
41<br />
43<br />
4~<br />
49<br />
Q z Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
1,93<br />
1,2<br />
1,55<br />
T73<br />
T7SS<br />
92 SR al 2b<br />
Tmetoceratidae SPÄTH 1936<br />
Evolute, dünnscheibenförmige Hammatocerataceae mit Externfurche, tiefen Einschnürungen und geraden, ungespaltenen Rippen. Sutur auf zwei Umbilikalloben reduziert, von<br />
denen Uj gespalten ist und außen Hegt, schwach zerschlitzt, Internlobus zweispitzig. Abstammung und systematische Stellung umstritten.<br />
Tmetoceras BUCKM. 1892; TA Am. scissus BENECKE 1865. Einzige Gattung der Familie. WEST, stellte 1964 die mikroconche Untergattung Tmetoitessui. Oberes Toarcium bis<br />
Oher-Aalenium.<br />
Tm. sassiim (BENECKE<br />
IS65), dn: lat. scissus = zerrissen<br />
Ä<br />
Am. rrglex-i DUMORTIER<br />
IS"4<br />
6,4 cm<br />
Scharfe, regelmäßige, radiale HT 6,5 49 31 1,25 51<br />
Rippen enden an einer medianen<br />
Unterbrechung in schwa 3,2 42 34 41<br />
chen Verdickungen. Im Alter<br />
können sie leicht konkav wer 6,5 51 26 1,04 42<br />
den. 4 bis 5 Einschnürungen<br />
pro Windung, die meist erst im<br />
Alter markant werden.<br />
4; 3<br />
10<br />
36<br />
al la<br />
3; 5<br />
206<br />
211<br />
264<br />
29
Oppelüdae BONARELLI 1S94<br />
Vorwiegend involute, planulate bis oxyconc Formen mit Kiel und Sichelrippen. Wegen <strong>des</strong> geteilten Lobus U | - zumin<strong>des</strong>t der alteren Oppelicn - werden sie hier gemäß SCHIN'I )|<br />
\X OLF 1964 den Hammatocerataceae eingegliedert und vorerst willkürlich aut die Umerfamilien Oppeliinae, Heciicoceratinae, Taramelliceratinae, und Distichoeeratui ie<br />
beschränkt.<br />
OPPELIINAE BONARELLI 1894<br />
Im Alter meist oxycon und glatt werdende Gehäuse mit zahlreichen Umbilikalloben. Vertikale Reichweite umstritten,<br />
Oppelia WAAGEN' 1869; dn: A. OPPEL, deutscher Geologe, 185 1 -1 865; TA Am. sitbradiatus SOW. 1823. Flach scheibige, involute Formen mit meist gerundetem, schwach bekiel<br />
tum Vcnter und sichelförmigen, weitständigen Primär- sowie dichten Sekundärnppen, die am Außenbug besonders deutlich und provers auftreten. Bajocium.<br />
Art Sutur bei h =<br />
Op. subradiata :SOW. 1823),<br />
dn: lat. radiatus = strahlend,<br />
sub- = untergeordnet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im BN INR<br />
34 mm<br />
v llS U<br />
j.<br />
' " v<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
A<br />
1<br />
1<br />
< V<br />
5 cm<br />
Skulptur d<br />
Weitständige Sichelrippen mir<br />
sehr schwachen Stielen knicken<br />
etwas über der Flankenmitte<br />
nach hinten und schwingen am<br />
Aulsenbug stark nach vorn.<br />
Extern laufen sie abge<br />
schwächt, durch Schaltrippen<br />
zu großer Dichte vermehrt,<br />
unter ca. 45 3<br />
unter ca. 45 gegen den sehr<br />
3<br />
unter ca. 45 gegen den sehr<br />
3<br />
gegen den sehr<br />
schwachen, fadenförmigen<br />
Kiel.<br />
m cm<br />
N<br />
in n/<br />
o<br />
H<br />
in "o<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
L.t.<br />
HT 5,0 10 55 2,4 (98) SR bj lc<br />
Oxycerites KOLLIER 1909;dn: gr. oxys = scharf; TA Am. aspidoi<strong>des</strong> OPP. 1857. Oxycone Gehäuse mit spitzwinkligem, auch im Alter scharfem Kiel. Sichelrippen erloschen im Alter<br />
bis auf schwach angedeutete, weitständige Reste auf der äußeren Flankenhälfte. Einfacher Altersmundsaum ohne Fortsätze. Zu den von WEST. 1958 benutzten Untergattungen<br />
siehe HAHN 1968.<br />
O. aspidoi<strong>des</strong> (OPP. 1857),<br />
dn: gr. aspis = Schild, -ei<strong>des</strong><br />
= -artig.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG-<br />
Lange Zeit irrtümlicherweise<br />
in das Oberbathonium<br />
gestellt.<br />
Wesentlich häufiger als das<br />
sehr seltene und sehr ähnliche<br />
Clydoniceras discus.<br />
Unterscheidbar durch Jugend<br />
querschnitt und Sutur.<br />
O. yeovilensis ROLL1ER<br />
1911, dn: Yeovil, Stadt in<br />
Südengland.<br />
HT ist Oppelia fusca WAA<br />
GEN 1869, Taf. 16, Fig. 6,<br />
Orig. in der BSPG.<br />
-= Am. fuscus QU. 1886,<br />
Taf. 75, Fig. 1, 10 u. 20.<br />
Von O. aspidoi<strong>des</strong> durch grö<br />
ßeres N und Z und etwas<br />
andere Skulptur geschieden.<br />
30<br />
7 cm<br />
Ab d = 2 leicht retroverse,<br />
weitständige Sichelrippen,<br />
deren Stiele nur angedeutet<br />
sind und die später insgesamt<br />
undeutlich werden. Schwaches<br />
Spiralband bei etwa 40% der<br />
Flankenhöhe. Der zunächst<br />
ovale Querschnitt erhält bei d<br />
~ 2 einen Kiel mit schwachen<br />
Nebenkielen, die hei d ~ 4<br />
wieder verschwunden sind.<br />
Innere Flankenhälfte - von<br />
Anwachslinien abgesehen -<br />
skulpturlos. Bis d =- 4 sind die<br />
leicht retroversen Sichelbögen<br />
auf der äußeren Flankenhälfte<br />
dichtstehend und trifurkieren<br />
am Außenbug. Dann nimmt<br />
der Rippenabstand zu, und d;t*<br />
Spaltrippchcn verschwinden.<br />
Ebenfalls bis d = 4 zeigt der<br />
scharfe Kiel beidseitig schmale<br />
Externbänder.<br />
O. limosus (BUCKM. 1925)<br />
aus gleichem Horizont hat bei<br />
gleichen Maßen kleineres Z<br />
und schwächere Skulptur<br />
^Unterart?).<br />
HT 13<br />
8<br />
13<br />
HT V<br />
3,8<br />
4,9<br />
5,9<br />
l /,<br />
J_l_<br />
7,6<br />
10<br />
8<br />
57<br />
60<br />
57<br />
56<br />
57,3<br />
58<br />
2,3<br />
2^9<br />
2^46<br />
2^4Ü<br />
2,67<br />
2,85<br />
2,56<br />
18<br />
17<br />
17<br />
18<br />
22<br />
36<br />
bis 3a<br />
4; 4<br />
6<br />
SO<br />
110<br />
211
Art Sutur bei h =<br />
O. seebachi (YX'ETZEL<br />
1950), dn: K. von SEE<br />
BACH, deutscher Geologe,<br />
1839-18S0.<br />
HT ist Oppelhi (Oxycerites!<br />
fusej seetuehi «'ETZEL, Taf.<br />
9, Fig. 9; Orig. im Geol. Inst.<br />
Gottingen (Nr. 561-8).<br />
Durch größeres N' von vorstehenden<br />
Arten geschieden.<br />
Innenwindungen gleichen<br />
denen von Occotrjiustes fus-<br />
O. oxus (BUCKM. 1926), dn:<br />
s. Gattung<br />
Orig. <strong>des</strong> HT unter Nr.<br />
4 -<br />
841 im Geol. Survey-<br />
Museum, London.<br />
Durch unregelmäßige Berippung<br />
ausgezeichnet.<br />
O. orbis (GIEBEL 1852), dn:<br />
l.it. Orbis = Rundscheibe.<br />
HI ist Arn. disctts complana-<br />
:•
Oecotrjusles WAAGEN 1869; dn: gr. ik«>> - H.rov, thwustcs - Brecher; TA GV. genicitlaris WAAG EN 1S69. Klcimvücmsigc bis mittelgroße, engnablige Formen mii fastig.item Ki v-|<br />
sichelähnlichen Rippen und mehr oder weniger ausgeprägter .Spiralfurche. Altersmundsaum mit schlanken, langen Ohren. Innenwindungen sehr ähnlich denen von Oxycerites, M*t<br />
weitnabliger; Scxualdimorphismus zwischen den beiden Gattungen in einigen Fällen sehr wahrscheinlich. Ober-Bajocium bis Unter-Callovium.<br />
Untergattung Oecotraustes s. str.; Nabelwelte N unter 20%, Spiralfurche fehlend oder nur angedeutet, Bcrippung relativ schwach.<br />
An<br />
()c. /Oe.) niveniensts (DE<br />
GROSSOUVRE 1918), du:<br />
Nivcrnais, mittelfranz. Pro-<br />
vinz.<br />
Sehr ähnlich Oxycerites limo-<br />
sus (siehe unter O. yeovilen-<br />
sis), der größer wird und im<br />
Alter die Ventralflächcn ver<br />
liert.<br />
Oe. (Oe.) bradleyi ARKELL<br />
1951, dn: P. C. SYLVESTER-<br />
r BRADLEY, engl. Geologe.<br />
HT unter J 29004 im Sedg-<br />
wick-Museum, Cambridge<br />
(England).<br />
Weitnabliger als nwernensis<br />
und ohne Spiralfurche, sehr<br />
ähnlich Oe. bomfordi<br />
ARKELL, der wenig stärker<br />
benppt ist.<br />
Oe. [Oe.) pygmaens<br />
(ARKELL 1951), dn: lat.<br />
pygmaeus = zwergenhaft.<br />
HT im Sedgwick-Museum,<br />
Cambridge, unter J 29006.<br />
Kleinwüchsig, Nabelweite<br />
zwischen der von nwernensis<br />
und bradleyi.<br />
Oe. (Oe.) deeiptens (DE<br />
GROSSOUVRE 1919), dn:<br />
lat. deeipio = täuschen. 1<br />
LT ist nach ZEISS 1959 .Vn~'•<br />
subradiatus SCHLOEN- ;<br />
BACH 1865. Taf. 30, Fig. 3;<br />
Orig. verschollen.<br />
Ähnlich weitnablig wie brad-<br />
leyi und bomfordi, aber stär<br />
ker berippt und im Alter dik-<br />
ker.<br />
32<br />
Sutur bei h =<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
r \<br />
\ V<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
Sehr undeutliche, fast radiale<br />
Sichelrippen, deren Stiele auf<br />
Wohnkammer proradiat, und<br />
1<br />
deren Sicheln retrovers werden.<br />
Im Sichelknick, d. h. etwas<br />
außerhalb Flankenmitte,<br />
schwache Spiralfurche. Der<br />
zunächst scharfe Kiel und der<br />
scharfe Außenbug runden sich<br />
im Alter unter Verbreiterung<br />
der Ventralflächen. Spiralfurche<br />
\J<br />
serzt sich in sehr schlankem<br />
Ohr fort.<br />
5 cm<br />
Auf den Innenwindungen<br />
dichte, schwache Sichelrippen,<br />
deren Stiele kaum sichtbar und<br />
0<br />
4,1 cm<br />
A Ähnlich<br />
A<br />
4 cm<br />
A<br />
\<br />
( H V<br />
ü<br />
4,4 cm<br />
)<br />
deren Sicheln nur im proversen<br />
Externabschnitt deutlich sind.<br />
Auf der Wohnkammer werden<br />
die Außensicheln weitständiger.<br />
Spiralrille nur auf dem schma<br />
len Ohr ausgebildet. Kantiger<br />
Außenbug rundet sich erst kurz<br />
vor der Altersmündung.<br />
Ähnlich wie bei bradleyi sind<br />
nur die proversen Externab<br />
schnitte der sehr schwachen<br />
Sicheln deutlich. Auf der adul-<br />
ten Wohnkammer runden sich<br />
Kiel und Außenbug. Gestielte<br />
Ohren.<br />
Stiele der Sichelrippen<br />
schwach, Bögen stärker als bei<br />
vorstehenden Arten, auf den<br />
Innenwindungen etwa radial,<br />
später retrovers, am Außenbug<br />
fast rechtwinklig nach vorn<br />
knickend mit verdickter Knick<br />
stelle. Steinkerne zeigen sehr<br />
flache Spiralfurche, auf der<br />
Schale manchmal als Wulst.<br />
Der kantige Außenbug rundet<br />
sich vor der Altersmündung.<br />
Ohrlöffel relativ groß, Stiel<br />
gefurcht.<br />
HT 6.4<br />
5<br />
N<br />
in %<br />
12.5<br />
675<br />
H<br />
in %<br />
49<br />
7)675<br />
Q<br />
2.25<br />
27T±0,2<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bt la<br />
5; 6<br />
6<br />
104<br />
110<br />
HT 4,0 22 46 2,3 bt la<br />
2,6 175 5T 271 52 5; 7<br />
3,3<br />
3,9<br />
5<br />
15<br />
15,5<br />
20<br />
51<br />
47<br />
45<br />
2,2<br />
27Ö<br />
2,25<br />
46<br />
44<br />
34<br />
6<br />
110<br />
238<br />
HT 3,1 10 51 2,5 bt la<br />
1,9 13 50 1,9 5; 8<br />
2,5 II 50 Ifi 6<br />
110<br />
LT 5,8 17 50 32 bt la<br />
2,5 20 50 173 40 5; 9<br />
4<br />
5<br />
19<br />
18<br />
50<br />
50<br />
T75<br />
T77<br />
36<br />
33<br />
110
Untergattung Paroecotraustes SPÄTH 1928; dn:gr. para = neben, Oecotraitstess. o.;TA Oe. serrigerus WAAGEN 1869. NabehveiteN größer als 20%, Spiralfurche ausgeprägt, Berippung<br />
relativ kräftig. Ähnlich Hectiococeras (Brightia) aus dem Mittel- und Ober-Callovium, von ELM1 1967 mit der TA P. waageni STEPHANOW ais mikroconche Gattung in die<br />
Hectiococeratinae einbezogen.<br />
Art Sutur bei h =<br />
Oe. (P.) fuscus (QU. 1846),<br />
dn: lat. fuscus = gelblich.<br />
LT ist Am. canaliculatus fuscus<br />
QU. 1846, Taf. 8, Fig. 7<br />
(nach ROLLIER 1911); Orig.<br />
verschollen.<br />
= Oe. subfuscus WAAGEN<br />
1869:<br />
= Am. fuscus QU. 1886, Taf.<br />
'S, Fig. 6, 8 u. 9.<br />
Oe. (P.) splendens ARKELL<br />
1951 hat bei gleichen Maßen<br />
weniger dichte, Oe. (P.) formosus<br />
ARKELL 1951 schwächere,<br />
gestrecktere Rippen<br />
.Unterarten?).<br />
Oe. (F.) maubeugei<br />
STEPHANOV 1966, dn:<br />
P. L. MAUBEUGE, Luxemburger<br />
Geologe.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst.<br />
Sofia, Bulgarien.<br />
Relativ große Art mit egredierender<br />
Wohnkammer und<br />
undeutlichen Rippenstielen.<br />
Oe. (P.) waageni STEPHA<br />
NOV 1961 (HT verschollen)<br />
ist kaum unterscheidbar.<br />
Querschnitt<br />
bei d =<br />
A<br />
0<br />
ö<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
Sichelnppen durch stark vorgezogenen<br />
Sicheiknick in Flankenmitte,<br />
wo besonders auf<br />
der letzten Windung eine deutliche<br />
Spiralfutche verläuft, entartet;<br />
Stiele stark proradiat,<br />
Bögen statk retroradiat; Spaltund<br />
Schaltrippen auf äußerer<br />
Flankenhälfte. Auf den Externbändern<br />
kurze, den Kiel nicht<br />
erreichende, proverse Ausläufer.<br />
Dichte, kräftige Berippung<br />
erlischt vor dem Altersmundsaum.<br />
o<br />
2,8 cm<br />
Berippung setzt erst vor dem<br />
letzten Umgang mit nahezu<br />
radialen Sicheln ein, deren<br />
Stiele undeutlich sind und<br />
deren Bögen stark retrovers<br />
werden. Spiralfurche auf dem<br />
Phragmokon undeutlich, auf V der Alterswohrkammer breit<br />
und flach, in die Rille <strong>des</strong> Ohrstieles<br />
mündend. Schärfe <strong>des</strong><br />
Mediankiels nimmt bis zur<br />
Altersmündung kaum ab,<br />
Nebenkiele runden sich.<br />
0<br />
4,8 cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
LT 1,8 27 44 (2,4) 33 bt la<br />
2 29 46 T77 |<br />
3 29 44 T7J<br />
HT 5,3<br />
3,5<br />
H,2<br />
|4,8<br />
26<br />
26<br />
20<br />
22<br />
44<br />
4T<br />
48<br />
44<br />
1,8<br />
1,95<br />
18 PR<br />
45 SR<br />
42<br />
(37)<br />
30<br />
2,29<br />
1,91 34<br />
•""'VIF.VOEERJS SPÄTH 1928; dn: Hecticoceras = Gattung aus dem Callovium (s. dort), pro- = vor-; TA Am. retrocostatus DE GROSSOUVRE 1888. Mittelgroße Oppeliinae mit<br />
ixKseucn um N = 20%. ausgeprägten Sichelrippen mit Verdickungen am Außenbug, meist flachem Venter und Mediankiei. Altersmundsaum einfach, ohne Ohren. Bathonium.<br />
'' ••"""> osurum DF<br />
'•KOI S S O U V R E 1888,, dn:<br />
>'• SOMJTU, = benppt. atro<br />
' • " I H M I N iu h!i W U R J L . N<br />
' •ct:;:,i:v" "<br />
"•"iUiTI 1-V.S u<br />
Stark proverse, leicht konkave<br />
Pnmärrippen knicken bei ca.<br />
40% Flankenhöhe nach hinten<br />
und laufen, durch Schaltrippen<br />
vermehrt, retroradiat zum<br />
Außenbug, wo sie knotig verdickt<br />
enden, Der niedrige,<br />
abgesetzte Mediankiel überragt<br />
die Knoten erst im späten<br />
Alter (gattungstypisch , in dem<br />
die Skulptur schwächer wird.<br />
HT 2,i<br />
1,5<br />
29<br />
26<br />
26<br />
43 1,1<br />
1,4<br />
5; 10<br />
70<br />
110<br />
195<br />
bt3a<br />
5; 11<br />
70<br />
110<br />
238<br />
33
Eohecticoccras ZEISS 1959 (= Zeissoceras ELM! 1967); dn: gr. Eos ~ Morgenröte, Hecticoccras s. u.; TA Oppelia costata ROEMER 1911. Discoidale, engnablige, hochniuiulij> c<br />
Gehäuse mi: hocheilipnschcm Querschnitt und retroversen Sichclrippen mit teilweise ausgeprägtem Rückwärtsknick. Knotenartige Verdickungen am Außenbug (bezeichnend für<br />
Prohccv.coceras fehlen. Bathonium.<br />
Art Sutur bei h =<br />
E. prmucvum DE GROS-<br />
SOL'YRE 1919 . dm bt. pnimis<br />
= erster, a-vum = Zeitalter.<br />
= Am. p:ts::ih:us ;.A r<br />
= Am. p:ts::ih:us ;.A kinsom<br />
r<br />
kinsom<br />
Ql'. 1 SS -<br />
Ql'. 1 SS . TV. 86. Fig. "-9.<br />
-<br />
. TV. 86. Fig. "-9.<br />
E. biflexuoiun: D'ORB.<br />
1846'. d.-.: :a:. b:- = zweifach.<br />
fSevacs^s = z-ikrümmt.<br />
Querschnitt<br />
bei d =<br />
Q<br />
fach. fSevacs^s = z-ikrümmt. / \<br />
Von gröberer S.cjiptur als<br />
pTt'r.jevw:.<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
An einer flachen Furche über<br />
dem Innenbug entspringen<br />
HT 5,9 17 50,5 2,08 33 PR bt l.i<br />
schwache, leicht konkave Rippenstiele,<br />
die auf Flankenmitte,<br />
wo die Rippenhöhe maximal<br />
ist, in retrokonkave Sekundärrippen<br />
bifurkieren. Diese<br />
schwingen am Außenbug nur<br />
wenig vor, so daß sie senkrecht<br />
auf ein glattes Kielband stoßen,<br />
welches mit dem Alter breiter<br />
wird.<br />
1 16<br />
P<br />
4S<br />
54<br />
TS PR 5; 13<br />
U |<br />
42 SR<br />
104<br />
22 PR<br />
TJ5 |<br />
115<br />
675 SR 197<br />
2 cm<br />
A Wulstige, konkave Rippenstiele<br />
bifurkieren größtenteils im<br />
Rückwärtsknick auf Flankenmitte<br />
zu retrokonkaven Bögen,<br />
die am scharfen bis fastigaten<br />
Kiel erlöschen.<br />
9,5 cm<br />
LT 9,6 14 51<br />
(16) PR<br />
,9 ( bt 3<br />
'28) SR<br />
6; 1<br />
Hecticoceratinae spath 1925<br />
Mittelwei: bis tr.z genabelte, platycone Gehäuse mit meist markanten, oft stark differenzierten und teilweise beknoteten Sichelrippen, einfach gekieltem oder schwach tricarinatem<br />
Yenter; z. T. m:: Spiralfurche. Callovium bis Oxfordium.<br />
HCV.'.VOCLT-O 50NARELL1 1893; dn: gr. hecticos = brustkrank, ceras = Horn; TA Nautilus becticusREVS'ECKE 1S18. Hecticoceratinae mit trapezoidem, spitzbogenförmigem oder<br />
vereinzelt cv^— Querschnitt, deren großes Formen- und Skulptur c<br />
pektrum im folgenden auf sechs Untergattungen verteilt ist. Die von ZEISS 1959 aufgeführten bzw. aufgestellten<br />
Arten und l'rr.t73s:tr. lassen sich bei eingehender Revision voraussichtlich stark reduzieren.<br />
L'ntergartiir:;' h-:-.r.:c r<br />
Jceras s. Str.; relativ evolute Gehäuse mit trapezoidern Querschnitt und im allgemeinen schwach abgesetztem Kiel. Berippung relativ gestreckt, Knötchen - im<br />
Gegensatz :u H. Sr.z'otia) und H. [Puteaüceras) - am Außenbug, Primärnppen teilweise zu Knoten oder Haken reduziert.<br />
H. K. hecr..-..»-. RELVECKE<br />
ISIS . dn: s. Ga—ng.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT v trs;hollen,<br />
ELMI 196" ha): T:z. 2. Taf. 9 in<br />
pisch. Die ir. Ql". ISS unter<br />
Am. rwticus abgebüderen<br />
Stücke gehören"gemäß ZEISS<br />
1959 sämtlich "deren Arten<br />
an.<br />
IIA H. H, fei-a«: bogtw;:-v<br />
PETDrCLERC 1915,<br />
dn: Fundon Boccr.. Ostrrankreich.<br />
\'on der Nomir.arj-tsran<br />
durch Jicntere unc .-L-arrisere<br />
Benppung cescbcec^r..<br />
34<br />
2,7 mm<br />
0<br />
0<br />
5 cm<br />
0<br />
10 cm<br />
Die Abb. <strong>des</strong> HT zeigt runde<br />
Knoten am Innenbug und auf<br />
Flankenmitte einsetzende,<br />
anfangs proradiate, später<br />
radiale Rippen, die am Außenbug<br />
in tangential vorspringenden<br />
Knoten enden. BeiJEAN-<br />
NETs Exemplar setzen die<br />
wulstigen Rippen schwach an<br />
den Internknoten ein u.<br />
schwellen bei 2/3 Flankenhöhe<br />
vorrübergehend an. Fastigater<br />
Mediankiel.<br />
Kräftige Knoten bei 25-30%<br />
der Windungshöhe, ohne<br />
wesentliche Spiraiabschwächung<br />
in radiale bis retrokonkave,<br />
wulstige Sekundärrippen<br />
bifurkierend, die am Außenbug<br />
in knotigen Verdickungen<br />
enden. Fastigater Venter mit<br />
fadenförmig feinem Kiel.<br />
HT 3,3<br />
5,2<br />
HT 5,1<br />
3<br />
(42) (33)<br />
37<br />
40<br />
33<br />
39<br />
40<br />
(1,4) )<br />
1,36 |<br />
(15) PR<br />
(35) SR<br />
19 PR<br />
39 SR<br />
18 PR<br />
1,7 j (28) SR<br />
1,7<br />
74<br />
277<br />
cl
Art Sutur bei h =<br />
UA H. (H.) hecticum poste<br />
rius ZEISS 1959, dn: lat.<br />
posterior = der jüngere.<br />
HT ist Am. ct. bipartitus QU.<br />
ISS" 7<br />
ISS" 7<br />
ISS" 7<br />
, Taf. 85, Fig. 14; Orig.<br />
im SMNS.<br />
Von hecticum s. str. durch<br />
Fehlen <strong>des</strong> glatten Flanken<br />
ban<strong>des</strong> u. durch bifurkiercnde<br />
Sekundärrippen geschieden.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
W<br />
3 cm<br />
Skulptur d<br />
Primärrippen zu knotenartigen<br />
Wülsten über dem Innenbug<br />
reduziert, woraus retrokonkave<br />
Sekundärrippen bifurkieren. die<br />
in je einem Knötchen am<br />
Außenbug enden. Grober,<br />
schwach abgesetzter Kiel.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
HT 3,1 36 39 i<br />
Q<br />
z<br />
16 Kn<br />
35 SR<br />
Untergattung Zieteniccras ZEISS 1956; dn: K. H. v. ZIETEN, vvürtt. Major u. Amateurgeologe. 1785-1846; TA HecticoceraszieteniDE TSYTOVITCH 1911. Relativ weitnablige<br />
Gehäuse mit trapezoidem, niedrigem Querschnitt, proversen Primär- und rctroversen Sekundärrippen und fast stests mit deutlichen Knoten am Außenbug, die vom fastigaten Kiel<br />
überragt werden. Abgrenzung gegen Cbanasia z. T. problematisch (ELMI 1967 betrachtet Zietemceras als Synonym von frohecücoceras SPÄTH).<br />
H. (Z.) zwteni DE TSYTO<br />
VITCH 1911, dn: s. Unter<br />
gattung.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Mus. der<br />
Naturgesch. Genf.<br />
ri. (Z.) Luberculatitm ZEISS<br />
1956, dn: lat. tubercuiatus =<br />
beknotet.<br />
= H. cracoviense var. tuberai<br />
lata DE TSYTOVITCH<br />
1911 (ohne Abb., daher<br />
ungültig).<br />
v<br />
on zietenl vor allem durch<br />
größere Nabelweite geschie<br />
den.<br />
"• "'••) aoUüum LEE 1905.<br />
"ii: cvolut = weitnablig.<br />
<strong>des</strong> HT im Mus. der<br />
V l I<br />
"rccsch. Genf.<br />
"" i<br />
> T<br />
i':
Art<br />
//. (Z.) sjrasmt DE TSYTO<br />
VITCH 19U, dn: CH.<br />
SARASIN, Direktor d. Geol.<br />
Inst. Genf um 19)0.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Mus. der<br />
Naturgesch. Genf.<br />
Durch besonders breite<br />
Externseite und an der Naht<br />
einsetzende Rippen aus<br />
gezeichnet.<br />
H. (Z.) karfwiskyi DE TSY<br />
TOVITCH 191 i.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Mus. der<br />
Naturgesch. Genf.<br />
Vermittelt zwischen zietem<br />
und saras'ini.<br />
H. (Z.) balmense BONA-<br />
RELLI 1894, dm Fundon<br />
Baiin (Südwestpolen).<br />
HT ist Harpoceras hecticum<br />
NEUMAYR 1871, Taf. 9,<br />
Fig. 6.<br />
= H. hecticum REUTER<br />
1908, = H. reuteri ZEISS<br />
1956.<br />
H. (Z.f) inflatum DE TSY<br />
TOVITCH 1911, dn: lat.<br />
inflatus = aufgebläht.<br />
HT ist H. pümpeckyi var.<br />
inflata DE TSYTOVITCH<br />
1911, Taf. 8, Fig. 9; Orig. im<br />
Mus. der Naturgesch. Genf.<br />
Durch glatte Innenwindun<br />
gen, dichte Berippung und<br />
fehlende Nebenkiele aus<br />
gezeichnet.<br />
Sutur bei h *=<br />
0<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
4 cm<br />
Skulptur d<br />
Proradiate Primärnppen ent<br />
springen an der Nabelnaht und<br />
enden in spitzen Knötchen auf<br />
1/3 Flankenhöhe. Sekundärrip<br />
pen, anfangs retrokonkav, spa<br />
ter fast konkav, gabelnd oder<br />
eingeschaltet, enden in spitzen<br />
Knötchen am Auisenbug, die<br />
den relativ breiten Venter<br />
begrenzen. Dieser trägt neben<br />
dem uberragenden, am HT<br />
leicht krenelierten Hauptkiel 2<br />
Nebenkiele.<br />
Die leicht retroversen Sichelrip<br />
pen sind nur schwach<br />
gekrümmt und bei ca. 30%<br />
Flankenhöhe durch Schaltrip<br />
pen vermehrt. Sie enden in<br />
Verdickungen am Außenbug.<br />
Ab d ~ 4 werden die Sichel<br />
stiele schwächer. Stumpfer, nie<br />
driger Kiel auf flachem Venter.<br />
Wulstige Primärrippen ziehen<br />
prokonvex über den Innenbug,<br />
wo sie in Verdickungen bifur<br />
kieren oder manchmal auch<br />
einzeln bleiben. Jede der retro-<br />
konkaven bis konkaven Sekun<br />
därrippen ender in einem<br />
stumpfen Knötchen am Außen<br />
bug. Niedriger, feiner Kiel auf<br />
fastigatem Venter.<br />
Auf den Innenwindungen <strong>des</strong><br />
HT bis d 2,5 keine Berip<br />
pung erkennbar, darüber prora<br />
diate, gegen den Spaltpunkt auf<br />
1/3 Flankenhöhe wulstig ver<br />
dickte Primärrippen, die vor<br />
wiegend in gleichmäßige, retro-<br />
konkave Sekundärrippen bifur<br />
kieren. Fastigater Mediankiel,<br />
Nebenkiele fehlen, Knoten am<br />
Außenbug sind nicht erwähnt.<br />
in cm<br />
HT 3,7<br />
H<br />
in %<br />
HT 3,5 37 38 1,3<br />
25 PR<br />
32 SR<br />
20 PR<br />
38 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Ltt.<br />
6; 8<br />
146<br />
249<br />
cl 2<br />
6; 9<br />
146<br />
249<br />
HT 7,0 29 34 SR cl 1<br />
HT 3,3<br />
4,1<br />
39<br />
40 39<br />
Untergattung Cbanasia ROLLIER 1922 '= Jeanneticeras ZEISS 1956 pars, = jeanetia COLLIGNON 1958); dn: Chanaz/Dep. Savoie (Südfrankreich). TA Hecäcoceras cbanasiense<br />
• KUNA u. BONARELLI 1895. .Mittelweit bis relativ eng genabelte Formen mit trapezoidem Querschnitt, fastigatem Kiel, Spiralfurche oder Spiralband auf der Flanke und retro-<br />
a m<br />
n en,<br />
Außenbug beknoteten Sekundärrippen.<br />
"• > cl<br />
'> aureum ZEISS 1959,<br />
dn: lat. aureus = golden<br />
(Gold-Schnecke-).<br />
HT ist I.unubceras sp<br />
KRUMBECK 1936. Abb. 5<br />
Ong. im IGPEN, Nr. 1 500.'<br />
36<br />
Proverse Primärrippen auf den<br />
Innenwindungen am Innenbug<br />
beginnend, mit zunehmendem<br />
Alter kürzer werdend. Retro-<br />
konkave bis konkave Sekundär<br />
rippen tragen am HT bis d —<br />
1,7 markante Exteruknötchen,<br />
die bereits bei d — 2,3 erlo<br />
schen sind (Übergangserschei<br />
nung zur Untergattung Brigb-<br />
tia). Zwischen Innenbug und<br />
Flankenmitte flache Spiral<br />
furche.<br />
1,4<br />
1,4<br />
HT 5,7 44? 1,76?<br />
27 PR<br />
47 SR<br />
2' PR<br />
55 SR<br />
19 PR<br />
41 SR<br />
6; 10<br />
87<br />
148<br />
170<br />
cl 1/2<br />
6: 11<br />
249<br />
276<br />
cl lb<br />
6; 12<br />
142<br />
277
Art Sutur bei h = Quer<br />
bei schnit d = Skulptur d in N % H Q Z<br />
in cm in %<br />
Zone Taf. Lit.<br />
H. (Ch.) perhtum dn: Perlknoten (QU tragend. 18S7), Prokonkave springen Primäripe n ent<br />
gabeln unregelmäßi am Inenbug g in LT retro- u. 3 32 40 1.38 2 j PR cl 1<br />
LT ist Am. heeticus perlitus QU. [nach ZEIS 187, Taf. 1956 82, u. Fig. 1959; 1 konkave, im Alter konkave 6; 13<br />
Orig. im IGPT. Q<br />
Sekundäripen, chen am Außenbug die in enden. Knöt<br />
Flache Furche auf" Flanken 36 SR 197<br />
2~7<br />
Von aureitm N und bestandige durch größeres mite.ten<br />
geschieden. Externkno<br />
H. (Ch.j keilhergense 1939, dn: Fundort KUHN<br />
bei Regensburg. Keilber g<br />
Orig. Exemplar <strong>des</strong> der HT Art) (einziges<br />
findbar. nicht auf<br />
Extrem skulptierte engnablige, Art. Sehr schwach<br />
aber dichter beript ist ähnlich, H.<br />
Ch.) modelt KUHN 1939.<br />
NECKE lelen Flanken. 1818), dn: mit paral<br />
=<br />
HT<br />
H.<br />
verscholen.<br />
pMtper BONARELI 1S95 PARONA u.<br />
Maße wie perlatum, anderer Skulptur und aber Quer von<br />
schnitsform.<br />
H. (Ch.?) pjraUelum (REI<br />
S m<br />
"<br />
U'i~.<br />
Ch.<br />
dn: Ancirmjht.i<br />
. „>,.,/.„<br />
t der<br />
EI.MI<br />
bir.cnberipung<br />
n<br />
' <strong>des</strong> 1 .<br />
'"• IT im Geol. Inst.<br />
1<br />
" ,s 1<br />
yon Frankreich<br />
'"' 'QU. INS".<br />
^"'luiptur .hwa.herl'r, „ :l| i| n„ . l. rc|I1<br />
3 cm<br />
durch Primäripe n unscheinbar,<br />
zu feinen Schalenverlust Strichen am reduziert. HT HT 3,3 23 48 1,78 (35) PR cl 1<br />
Sekundäripen konkav, breit, leicht flach retro- 6; 14<br />
und scharf,<br />
0 am geschwolen. Außenbug «Spiralinienbil ohrförmig an 145<br />
dung" in Flankenmite . 27<br />
3 cm<br />
Jugendstadium Nach einem beschränkt skuipturlosen sich HT 2,2<br />
Q<br />
die Flankenhälfte Beripung , wo auf sie die aus 2,4 äußere<br />
schwachen, däripen besteht, konkaven die Sekun<br />
Außenbug leicht beknotet am sind.<br />
2,2 cm<br />
(36)<br />
38 (37;<br />
38 (!,6i (28) SR cl 1<br />
(3) SR 6; 15<br />
87<br />
145<br />
280<br />
Bei stark streifendem Licht sind<br />
chen prokonkave oberhalb <strong>des</strong> Pnmamp- Inenbuges HT|<br />
erkenbar. Einsenkung auf<br />
0 , Flankenmit e oft unscheinbar.<br />
meist Retrokonkave Sekundarnpen<br />
Außenbug zu Anschwelunge n am<br />
scharfer Kiel. reduziert. Fastigater,<br />
i<br />
u<br />
1<br />
i<br />
3,2 cm<br />
3 4<br />
'30<br />
30<br />
40<br />
38 1 26 16 SR PR cl 7 1<br />
32 SR ; 1<br />
3,9 32 i 4375<br />
2.3<br />
1,7<br />
28 43<br />
16 PR<br />
87 7<br />
19<br />
3,S ! 30 43 "1 30 SR<br />
4,4<br />
28 SR<br />
i 1.28 14 i<br />
PR<br />
1 28 SR<br />
j<br />
1<br />
37<br />
i
Untergattung Hrightu ROLLIHK 1922; TA Am.becticus nodosus (WOSAKELLl 1 895). Mittel weit genabelte Gehäuse mit spitzbogenförmigem Querschnitt, oft zu Knoten oder Wül<br />
sten reduzierten Primärnppen und am Außcnhug unbeknoteten, meist dicht an den Kiel heranreichenden Sekundärrippen. Spirairinne aut der Hanke manchmal mit Knötchen<br />
besetzt.<br />
Art<br />
H. (Hr.j nodosum ;BONA-<br />
RLLLI 1S-M;. dn: lat. nodo- A<br />
sus = beknotet.<br />
HT ist Arn. becticus nodosus<br />
QU. 1846. Taf. 8. Fig. 4;<br />
Orig. verschollen.<br />
= .4m. becticus nodosus QU.<br />
18S". Taf. 82, Fig. 10.<br />
UA H. (Br.) nodoswn reeur-<br />
Sutur bei h =<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
( )<br />
V /<br />
3,1 cm<br />
i'um ZEISS 1956, dn: lat.<br />
recurvus = zurückgebogen. / \<br />
HT ist Am. becticus nodosus<br />
QU. 1887, T.if. 82, Fig. 11;<br />
Orig. im SMN'S.<br />
Extrem retroverse Rippen<br />
und niedrigerer Querschnitt.<br />
UA H. (Br.) nodoswn thalbei-<br />
mense ZEISS 1959, dn:<br />
Fundon Thalheim am Lup<br />
fen, Württemberg.<br />
HT ist Am. becticus nodosus<br />
QU. 1S58, Taf. 71, Fig. 22;<br />
Orig. verschollen.<br />
Von nodosum s. str. durch<br />
besondere Primärrippen<br />
geschieden.<br />
H. (Br.} solinopborum<br />
BONARELL1 1894 A<br />
HT ist Am. becticus canaliculatusQÜ.<br />
1858, Taf. 71, Fig.<br />
23; Orig. verschollen.<br />
Durch unscheinbare Knoten<br />
in markanter Spiralfurche<br />
ausgezeichnet. Exemplar mit<br />
stark retrokonkaven Rippen<br />
(QU. 1887, Taf. 82, Fig. 20)<br />
wurde von ZEISS 1959 als<br />
UA solinopborum reversum<br />
bestimmt.<br />
UA H. (Br.) solinopborum<br />
prorsosinuatum ZEISS 1959,<br />
dn: lat. prorsus ~ vorwärts-<br />
gerichtet, sinuatus = gebuch<br />
tet.<br />
HT ist Am. becticus canalicubius<br />
QU. 1887, Taf. 82, Fig.<br />
19; Orig. verschollen.<br />
Durch besondere Altersskulp<br />
tur ausgezeichnet.<br />
38<br />
6.5 cm<br />
ü<br />
2; 6 cm<br />
Skulptur d<br />
In einer flachen Furche auf 1/3<br />
Flankenhöhe liegen perlartige<br />
Knoten von relativ großem<br />
Abstand, die auf dem Wohn<br />
kammerende verschwinden.<br />
Pro Knoten entspringen fast<br />
tangential am äußeren Fnrchen-<br />
rand 4-6 retrokonkave Rippen,<br />
die. extern stark vorschwin<br />
gend, in den erhabenen Kiel<br />
münden.<br />
Flankcnkanal und weitständige<br />
Knoten (das eine oder andere<br />
manchmal schwach ausgebil<br />
det) bei etwa 40% Flanken<br />
höhe; Rippen stark retrovers<br />
und meist senkrecht sich dem<br />
weniger erhabenen Kiel<br />
nähernd.<br />
Äußerst proradiate, leistenartig<br />
verdickte Primärrippen setzen<br />
am Innenbug ein und enden<br />
vor der Spiralrinne in Flanken<br />
mitte. Außere Flankenhälfte<br />
mit konkaven bis retrokonka<br />
ven, stark gekrümmten Sekun<br />
därrippen besetzt, die gegen<br />
den niedrigen, kaum abgesetz<br />
ten Kiel vorschwingen.<br />
Die inneren 35% der Flanke<br />
sind glatt; daran grenzt eine<br />
tiefe Spiralfurche, die an Hildo-<br />
ceras bifrons (Lias) erinnert,<br />
und in der Knoten bis zur<br />
UndeutHchkeit zu "zerfließen"<br />
scheinen. Sekundärrippen auf<br />
Innenwindungen retrokonkav,<br />
auf Außenwindungen konkav,<br />
gegen den niedrigen Kiel vor<br />
strebend.<br />
Ab d =* 2 erscheinen extrem<br />
proverse Primärrippen auf der<br />
inneren Flankenhälfte, die mit<br />
den stark konkaven Sekundär<br />
rippen zipfelartige Bogen in der<br />
Spiralfurche auf Flankenmitte<br />
bilden.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
FI<br />
in %<br />
HT 2,0 43 37 1,3<br />
3.5 58 38<br />
4,7 38 38<br />
Q<br />
1.66 j<br />
1,50 j<br />
Z<br />
Zone<br />
T.if.<br />
Lit.<br />
cl 3<br />
cl 3<br />
Tl) Kn<br />
54 SR 7; 2<br />
11 Kn 197<br />
44 SR 249<br />
11 Kn<br />
HT 2 " 40 37 1.23 1<br />
1 47 SR<br />
cl<br />
7; 3<br />
17 Kn<br />
6.5 38 37 1,23 |<br />
45 SR 197<br />
276<br />
HT 3,1 36 36 57 SR cl 2<br />
HT 2,7<br />
2,6<br />
40<br />
32<br />
35<br />
42 2,0<br />
cl 3<br />
7; 4<br />
196<br />
277<br />
57 SR cl 2<br />
cl 3<br />
7; 5<br />
196<br />
197<br />
277<br />
HT 2,4 40 37 51 SR cl 2<br />
c.3<br />
7; 6<br />
19 7<br />
2~7
An 5utur bei h =<br />
H. (Br.) temdnodosum ZEISS<br />
1956, dn: lat. tenuis = dünn,<br />
nodosus = beknotet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
Besondere engnablig und<br />
Querschnitt<br />
bei d =<br />
hochmündig. Vi 17<br />
H, (Br.) difforme DE TSY<br />
TOVITCH 1911, dn: lat. difformis<br />
= mißgestaltet.<br />
LT (ZEISS 1956) ist H.<br />
hmula var. difformis DE<br />
TSYTOVITCH 1911, Taf. 7,<br />
Fig. 5; Ong. im Mus. der<br />
Naturgesch. Genf.<br />
Ähnlich nodosum thalheimense.<br />
H. (Br.) salvadom (PA RON A<br />
u. BONARELLI 1895)<br />
NT ist gemäß ZEISS 1956<br />
das Exemplar in DE TSYTO<br />
VITCH 1911, Taf. 4, Fig. 4;<br />
Orig. im Mus. der Naturgesch.<br />
Genf.<br />
Von vorstehenden "Arten"<br />
durch grobe Altersskulptur<br />
geschieden.<br />
15 mm<br />
0<br />
7 cm<br />
4,3 cm<br />
0<br />
5 cm<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q Z Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
Auf der nahezu glatten inneren HT 6,4 24 46 2,19 51 SR cl 2a<br />
Flankenhälfte <strong>des</strong> HT lediglich<br />
8 flache Buckel bei ca. 35%<br />
7; 7<br />
Flankenhöhe. Spiralfurche<br />
angedeutet; niedrige, konkave<br />
276<br />
Rippen auf äußerer Flankenhälfte.<br />
Am Innenbug (20% Seitenhöhe)<br />
entspringen proverse, 2,7<br />
weitständige Primärrippen, die LT<br />
sich zu Knoten bei ca. 30%<br />
4,8<br />
Flankenhöhe verdicken.<br />
Anschließende Spiralfurche<br />
schwach ausgeprägt; konkave,<br />
im Alter fast radiale Sekundärrippen,<br />
gegen den fastigaten<br />
Kiel vorschwingend. Pnmärrippen<br />
im Alter erlöschend.<br />
40<br />
32<br />
37<br />
43<br />
1,23 |<br />
11 PR cl 2<br />
47 SR cl 3<br />
16 PR<br />
(1,7) |<br />
66 SR 7; 8<br />
249<br />
2^6<br />
Proverse Primärrippen entspringen<br />
über der Nabelnaht und<br />
NT 5,5 33 40 1,83 )<br />
(15! PR cl 2<br />
gen über der Nabelnaht und<br />
NT 5,5 33 40 1,83 )<br />
(15! PR<br />
gen über der Nabelnaht und<br />
NT 5,5 33 40 1,83 )<br />
(15! PR<br />
45 SR<br />
schwellen breit-wulstig bis zur<br />
7; 9<br />
flachen Spiralfurche bei 45%<br />
Flankenhöhe an. Retrokonkave<br />
134<br />
Sekundärrippen schwängen am<br />
249<br />
Außenbug stark vor (TZ = 3)<br />
276<br />
und werden im Alter grob und<br />
weitständig, während die Primärrippen<br />
erlöschen.<br />
Untergattung PutealicerasüUCKM. 1922 (= Rossiensiceras GERARD u. CONTAUT 1936, gemäß ARKELL 1957); dn: lat. putealis = brunnenähnlich, ceras = Horn; TA Am. putealis<br />
LECKEN'BY 1859. Mittelweit genabelte Gehäuse mit vorwiegend spitzbogenförmigem, vereinzelt auch ovalem Querschnitt, meist mit nahezu gestreckten, kräftigen, teilweise auch<br />
sichelförmigen Spalt- (und Schalt-) Rippen, deren Stiele, ähnlich wie bei Brightia, zu Knoten reduziert sein können. Von Bnghtia manchmal nur durch Fehlen einer durchgehenden<br />
Spiralrinne unvolkommen abgrenzbar.<br />
"• '»'.) pimciatum (STAHL<br />
' 824 , dn: lat. punetatus =<br />
punktiert, heknotet.<br />
(><br />
og. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
I mfangrcichc Svnonvmie 5<br />
f\ ISS 1959.<br />
«»>/\ ISS ,, s . '"'oLu-murnug.<br />
'V.,<br />
Hl Mi der BSPG.<br />
«~nh er,,',',-,,., •'•"iniii.ituuier.irt<br />
. _ >• ircs (j und , retro-<br />
'roppen<br />
i'..K,c. ici,.<br />
4 cm<br />
4 cm<br />
Kräftige, meist radiale Primärrippen<br />
schwellen zum Gabel HT 2.2<br />
punkt bei anfangs 20, zuletzt<br />
40% Flankenhöhe firstartig an<br />
und bifurkieren zu retroradiaten,<br />
unregelmäßigen Sekundärrippen,<br />
die nahezu senkrecht<br />
auf feine, dicht am niedrigen 3.1 48<br />
Mediaukiel liegende Nebenkiele<br />
stoßen. Einzelrippen sporadisch<br />
zwischengeschaltet.<br />
1,6 45<br />
Abgesehen von geringfügig<br />
dichterer Berippung weisen die HT 3.8<br />
Sekundärrippeu gegenüber<br />
puncUUum s. str. einen deutlich<br />
retrokonkaven Verlauf auf und<br />
stoßen provers auf die Nebenkiele.<br />
1<br />
39<br />
33 0,86<br />
1.00<br />
0.S4<br />
1.18<br />
18 PR<br />
30 SR<br />
1" PR<br />
26 SR<br />
Ii 18 PR<br />
1 ;<br />
34 SR<br />
21 PR<br />
33 SR<br />
21 PR<br />
39 SR<br />
19 PK<br />
3" SR<br />
39
Art<br />
UA H. (P.) punctatum cxile<br />
ZEISS 1956, dn: Int. exile =<br />
dürr.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
Von vorstehenden Unterarten<br />
durch anderen Querschnitt<br />
bzw. kleineres H geschieden.<br />
H. (P.) jrkeili ZEISS 1956,<br />
dn: W.J. ARKELL, englischer<br />
Geologe.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
Ähnlich punctatum cxile, aber<br />
von anderem Querschnitt<br />
und kräftigerer Berippung.<br />
H. (P.) douvillei (JEANNET<br />
1951). dn: R. DOUVTLLE<br />
franz. Geologe.<br />
LT ist H. punctatum DOU-<br />
VILLE 1914, Taf. 1, Fig. 2<br />
Durch engen Nabel ausgezeichnet.<br />
H. (P.) svevum BONARELLI<br />
1894, dn: lat. suebus =<br />
schwäbisch.<br />
HT ist Am. becticus QU.<br />
1S46, Taf. 8, Fig. 1; Orig. im<br />
SMNS.<br />
= Am. becticus QU. 1887,<br />
Taf. 82, Fig. 3-5.<br />
Durch tnfurkierende Rippen<br />
ausgezeichnet. Sehr ähnlich<br />
in Form u. Skulptur (Schaltstatt<br />
Spaltrippen) ist H. (P.)<br />
scbakbt ZEISS 1956.<br />
H. (P.) krakoviense (NEU<br />
MAYR 1871), dn: Fundort<br />
Krakow in Polen.<br />
= Am. becticus QU. 1887,<br />
Taf. 82, Fig. 8 u. 9<br />
Form u. Skulptur ähnlich svevum,<br />
jedoch bifurkierende<br />
Rippen. Ausgeprägt serpenticon;<br />
UA krakoviense ogivale<br />
DE TSYTOVITCH 1911 hat<br />
trapezoid-fastigaten Querschnitt<br />
mit Q » 1,5.<br />
40<br />
Sutur hei h =<br />
14 mm<br />
Querschnitt<br />
bei d =<br />
;,8 cm<br />
3,2 mm 2.8 cm<br />
ca. 10 mm<br />
Skulptu d<br />
in cm<br />
Proradiate Primärrippen, bei<br />
40% Flankenhöhe knotig verdickt,<br />
bifurkieren zu retroradiaten<br />
Sekundarnppcn. Einzelrippen<br />
zwischengeschaltet.<br />
Dicht über der Naht einsetzende,<br />
wulstig breite, schwach<br />
proradiate Primärrippen<br />
schwellen am Spaltpunkt bei<br />
35% Flankenhöhe an und bifurkieren<br />
zu retroradiaten Sekundarnppcn,<br />
die extern zu<br />
schwachen Nebenkielen vorschwingen.<br />
Schwach proradiate Primärrippen<br />
spalten bei 35% Flanken<br />
LT 6,3<br />
höhe in spitzen Knötchen in<br />
zwei leicht retroverse Sekundärnppen,<br />
die in schwach 2.8<br />
angedeutete Nebenkiele vorschwingen.<br />
Der hintere Gabelast<br />
gleicht fast einer Schaltrippe.<br />
Stets erhabener Mediankiel.<br />
HT 4,1 43 1,24<br />
HT 3,8 44 1,35<br />
28<br />
31 40<br />
43<br />
1,47<br />
1,38<br />
1,45<br />
Auf den Innenwindungen stark<br />
konvexe, später mehr gestreckte HT 3.2 51 28 1,34<br />
Primärrippen, die bei ca. 40%<br />
Flankenhöhe in meist 3, vereinzelt<br />
2. retrokonkave, relativ feine<br />
1,32<br />
Sekundärrippen spalten. Sehr<br />
dicht am fastigaten Kiel liegen<br />
zarte, ebenfalls fastigate Neben 49 i 30<br />
kiele.<br />
Von radialen bis prokonvexen,<br />
scharfen Primärrippen gehen HT 5,;<br />
unter vorwiegender Bifurkation<br />
stark retroradiate Sekundärrippen,<br />
durch Schaltrippen ver 1,8<br />
mehrt, unter ca. 110° nach hinten<br />
und verlieren sich am<br />
Außenbug. Venter glatt gerundet.<br />
ZEISS 1956 trennt eine UA<br />
krakoviense transicns mit radial<br />
werdenden Sekundärrippen ab.<br />
46,6<br />
1,01<br />
0,S7<br />
28 PR cl 1<br />
48 SR cl 2<br />
22 PR 7; 16<br />
36 SR<br />
197<br />
2-6<br />
277
Art Sutur bei h =<br />
H. (P.) injequifurcatum<br />
ZEISS 1959, dn: lat. inaequus<br />
= ungleich, furcatus =<br />
gegabelt.<br />
HT ist Am. cf. becticus<br />
lunula QU. 1887, Taf. 82,<br />
Fig. 40, Orig. im SMNS.<br />
Durch großen, gerundet quadratischen<br />
Querschnitt ausgezeichnet.<br />
Sehr ähnlich ist<br />
H. (P.) mathavensc (KILIAN<br />
1S90).<br />
H. (P.) robustum DE TSY<br />
TOVITCH 1911, dn: lat.<br />
robustus = stark.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Mus. der<br />
Naturgesch. Genf.<br />
Großwüchsig und von sehr<br />
grober Skulptur. Nur durch<br />
stärker geneigte Flanken<br />
schmäleren Venter) unterscheidet<br />
sich H. {?.) tril'meatum<br />
(WAAGEN 1S75).<br />
H. ,r.i rossiense (TEISSEYRE<br />
1SS.V<br />
LT ist. nach ZEISS 1956, Fig.<br />
6, Taf. 1 in TEISSEYRE<br />
1883.<br />
Sehr ähnlich robustum, vielleichi<br />
sogar artgleich, Icdignch<br />
von etwas größerem N.<br />
!-Uor,!cb.,e ZEISS 1956 hat<br />
•'» \licr weitständige Primär-<br />
' ''Pen.<br />
" '' n<br />
''' !<br />
"»'/>hjlum BONA- (V, _ .<br />
'•' v<br />
- ! ;<br />
' r. s<br />
s o . i n. 9.<br />
\^ ' 1,<br />
UA H. {?.) metompbalum<br />
An Sutur bei h =<br />
mitlticostatum DE TSYTO<br />
VITCH 1911, dn: lat. mulri<br />
= viel, cos tat us = henppt.<br />
LT ist, nach ZEISS 1956, Fig.<br />
•14, Taf. 5 in DE TSYTO<br />
VITCH; Orig. im Mus. der<br />
Naturgesch. Genf.<br />
Größeres Z ;SRl und größere<br />
TZ sowie etwas kleineres N<br />
als die Nominat-UA. Nahezu<br />
gleiche Skulptur haben<br />
metomphalum acuticosta DE<br />
TSYTOVITCH u. metomphalum<br />
savoiense, ZEISS<br />
1956 (N = 36, Q = 1,3 bis<br />
1,6).<br />
H. (P.) subnodoswn DE TSY<br />
TOVITCH 1911, dn: lat.<br />
sub- = untergeordnet, nodo<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
^^^^^^^<br />
4,6 cm<br />
sus = beknotet. / \<br />
LT ist, nach ZEISS 1956, Fig.<br />
8, Taf. 6 in DE TSYTO<br />
VITCH; Orig. im Mus. der<br />
Naturgesch. Genf.<br />
Durch extreme Rippendichte<br />
ausgezeichnet.<br />
W<br />
4,8 cm<br />
Skulptur d<br />
Anfangs dichte Primärrippen<br />
werden durch teüweises Ver<br />
schwinden auf dem letzten<br />
Umgang weitständig. Ihr<br />
Ursprung, anfangs an der Naht,<br />
verschiebt sich zum Innenbug,<br />
wodurch der Nabelabfall glatt<br />
wird. Aus den schließlich zu<br />
proradiat gedehnten Knoten<br />
bei 35V' Flankenhöhe entarte<br />
ten Primärrippen gabeln kon<br />
kave, dichte, regelmäßige<br />
Sekundärrippen, die an ihrer<br />
Wurzel geschwächt sind.<br />
Bei 35% Flankenhöhe grobe,<br />
spitze Knoten aus denen meist<br />
3 schwach konkave bis retro<br />
konkave Sekundärrippen ent<br />
springen. Zwischen diesen<br />
Bündeln 1-2 Schaltrippen. Alle<br />
Rippen nähern sich provers<br />
dem erhabenen Kiel.<br />
in cm<br />
LT 5,6<br />
3,4<br />
4.6<br />
N<br />
in %<br />
29<br />
32<br />
H<br />
in %<br />
46<br />
42<br />
44<br />
Q<br />
1. 7<br />
5 j<br />
1,91 J<br />
LT 4,5 36 38 1,46 |<br />
Z<br />
18 PR<br />
52 SR<br />
19 PR<br />
53 SR<br />
11 PR<br />
53 SR<br />
Untergattung Lumdoceras BONARELLI 1 894 (= Sublunuloceras SPÄTH 1928); dn: lat. lunula = halbmondförmiges Halsband; TA Hecticoceras {Lumdoceras) fallax ZEISS 1959,=<br />
Am, lunula ZIETEN 1830; nicht REINECKE 1818 (vergl. ZEISS 1956, S. 31 u. 99 sowie ZEISS 1959, S. 34), der von ELMI 1967 zu <strong>des</strong>sen neuer Gattung Eulunulites (Oppeliinae)<br />
gestellt wurde. Planulate, engnablige, hochmündige Gehäuse mit spitzbogenförmigem bis hochelliptischem Querschnitt und sichelförmigen Spaltrippen, deren Stiele meist<br />
geschwächt, aber auch knotig verdickt sein können. Teilweise auch schwache Knoten am Außenbug.<br />
H. (L.) fallax ZEISS 1959,<br />
dn: lat. fallax = trügerisch.<br />
HT ist Am. lunula ZIETEN<br />
1S30; Orig. nicht auffindbar.<br />
= Am. becticus gigas QU.<br />
1887, Taf. 82, Fig. 36; =<br />
Hecticoceras pseudopuneta-<br />
tum-suevum KUHN 1939,<br />
Taf. 56, Fig. 9.<br />
H. (L.) pseudopwic^jtum<br />
(LAHUSEN 18831, dn: lat.<br />
pseudo- = falsch, punctatum<br />
= punktiert (bez. auf puncta<br />
tum STAHL).<br />
LT ist, nach ZEISS 1956, Fig.<br />
11, Taf. 11 in LAHUSEN.<br />
= Am. becticus lunula QU.<br />
1S46, Taf. 8, Fig. 2.<br />
Von fallax durch kleineres Z<br />
(SR) und etwas kleineres N<br />
geschieden.<br />
42<br />
9 mm<br />
21 mm<br />
Weitständige, schmale, prora<br />
diate bis prokonkave Primärrip<br />
pen sind bei ca. 50% Flanken<br />
höhe schwach verdickt und<br />
gabeln dort in anfangs retro<br />
konkave, später konkave<br />
Sekundärrippen, die durch<br />
Schaltrippen vermehrt, eine<br />
regelmäßige, dichte Folge bil<br />
den.<br />
HT 3,4<br />
3<br />
3,8<br />
6<br />
(27)<br />
Nach glatten Innenwindungen LT 4 8 26<br />
ab d ~ 1,5 erst sinusförmige,<br />
dann sichelförmige Rippen, bei<br />
ca. 40% Flankenhöhe bifurkie-<br />
rend. Proradiate Stiele bis zum<br />
Spaltpunkt etwas verdickt, 33 29<br />
retroverse Sicheln nur wenig<br />
gekrümmt, auf 2 Spaltäste<br />
etwa je eine Schaltrippe; mäßig 5 g 3Q<br />
hoher, abgesetzter Kiel.<br />
34<br />
2S<br />
43<br />
41<br />
39<br />
42<br />
45<br />
40<br />
43<br />
46<br />
(1,8)<br />
1,5<br />
1,3<br />
1.1<br />
1,7<br />
(2)<br />
13 Kn<br />
63 SR<br />
Zone<br />
T.,f.<br />
Lit.<br />
cl 1<br />
cl 2<br />
8; 3<br />
249<br />
2~6<br />
cl2<br />
cl 3<br />
8; 4<br />
249<br />
276
Art Sutur bei h - Quer<br />
bei schnit d = Skulptur d N H Q Z<br />
in cm in % in °/'o<br />
Zone Taf. Lit.<br />
H. (L.) brigbtii (PRAT A stäbchenartige Weitständige , leicht Primäripe proradiate,<br />
vergrößern ihre Stärke n<br />
vor Flankenmite , wo bis sie kurz<br />
trifurkieren. Die leicht retro- meist<br />
konkavenzen bei Sekundäiripen d set<br />
Ä<br />
(NT;2, 4 34 43 1,8-1 75 13 SR PR cl<br />
1841)<br />
A<br />
ihre Maximalhöh e 1 am ein, Außen ereichen<br />
14 PR<br />
LT, gemäß BUCKM. 1925, bug, schwach. bleiben Leicht aber abgesetzter, imme r sehr<br />
feiner Kiel. 71 SR<br />
Weitständige stäbchenartige , leicht Primäripe proradiate,<br />
vergrößern ihre Stärke n<br />
vor Flankenmite , wo bis sie kurz<br />
trifurkieren. Die leicht retro- meist<br />
konkavenzen bei Sekundäiripen d set<br />
Ä<br />
(NT;2, 4 75 13 SR PR<br />
Fig. Orig. 3, zerstört. Taf. 6 in PRAT,<br />
1<br />
ihre Maximalhöh e 1 am ein, Außen ereichen<br />
14 PR 8: 7<br />
Der 191 von aufgestelte DE NT TSYTOVITCH in<br />
1 v<br />
Taf. D'ORB . 1845 (Fig. 1-12, bug, schwach. bleiben Leicht aber abgesetzter, imme r sehr<br />
unzuläsig. 3) ist nomenklatorisc h feiner Kiel. 71 SR<br />
\<br />
v<br />
stäbchenartige Weitständige , leicht proradiate,<br />
vergrößern Primäripe n<br />
vor Flankenmite ihre , Stärke wo bis sie kurz meist<br />
U trifurkieren. konkaven Sekundäiripen Die leicht retrozen<br />
bei d set<br />
Ä<br />
75 13 SR PR<br />
ihre Maximalhöh e 1 am ein, Außen 2.1 ereichen 32 42 TJs j<br />
14 PR 134<br />
276 179<br />
bug, schwach. bleiben Leicht aber abgesetzter, imme r sehr<br />
feiner Kiel. 71 SR<br />
PALFRAMAN Art als dimorph. erkante die<br />
däripen Durch sehr augezeichnet schwache . Sekun<br />
7 m 2,1 cm<br />
H. (L.) g'gas dm Gigas (BORNE = Riese 1891), der gr. Radiale, schwache Radiale, stelenweise Primäripe n sehr<br />
etwa schwache stelenweise sehr<br />
auf Flankenmit e enden<br />
schwachen, spirahgen Erhö in LT einer 4,1 2 46 2.1 59 SR cl 2<br />
etwa auf Primäripe Flankenmit n e enden in einer cl 3<br />
Mythologie .<br />
hung. schwachen,<br />
Sekundäripen, Dichte, spirahgen<br />
nur regelmäßige Erhö<br />
LT ist, nach ZEIS 1959, gekrümmt Sekundäripen, Dichte, regelmäßige<br />
gekrümmt und vorwiegend wehig<br />
retrovers, Schalt- den erscheinen und nur vorwiegend wehig 8: 8<br />
als Gabelripen eher als<br />
Am. becticus gigas QU. 18", Taf. SMNS. 82, Fig. 35; Orig. im<br />
retrovers,<br />
und Schalt- erscheinen eher als<br />
schwach und biegen den<br />
abgesetzten extern als Gabelripen<br />
Kiel gegen vor. den 27 197<br />
Durch retroradiate schwach Sicheln gestielte, schwach abgesetzten Kiel vor.<br />
gezeichnet.aus 4 cm<br />
R (L.) lunuloi<strong>des</strong> 1S87), dn: lunula (KILIAN<br />
gatung, -i<strong>des</strong> = ähnlich. s. Unter Von ripen den sind sichelförmige die Stiele n HT nur Spalt 2.9 ange 2 48 1,9 cl<br />
deutet<br />
HT ist Am. becticus compressus<br />
Ong. QU. im 1846, SMNS. Taf. ^<br />
Sichelknick und bei nicht 40% abzählbar. Flanken 3,1 26 45 2 62 SR cl 2 3<br />
8, Fig. 3; \ v r<br />
^ Q<br />
höhe, am Außenbug, konkave Sicheln der einem enden 3,2<br />
deuteten Nebenkiel ähnelt. ange 23 4S 1,96 57 SR 8;<br />
Venter gerundet fastigat. 134<br />
9<br />
197<br />
= Am. becticus compressus QU. 4S. 1S87, Taf. 82. Fig. 31 u.<br />
276 27<br />
1 otm gleicht der von gigas, Beripung unterschiedlich.<br />
' \ il- ].. tunulni<strong>des</strong> sinui- •'•"-•'•"« j:<br />
-ms ZKIS = Bogen, 1959, cosi.us dn:<br />
HI 1,. /,.,.<br />
- 1<br />
• 'u.':,us compres-<br />
'>•• QU. 18«-, Tai. S2, Fig.<br />
' '" ;<br />
( ^omin.itunter.irt<br />
-<br />
c. :m SMNS.<br />
i , J<br />
' "Ji'izicrte Beripung i<br />
9 mm 3,2<br />
cm<br />
Bei Sichelstiele, Bei Sichelstiele, d ~ die 2 zusammen deutliche, mit proradiate<br />
vorgezogene rctroversen Sichelbogen die 2 zusammen deutliche, HT mit proradiate 2.6 30 43 2,2 52 SR cl<br />
erzeugen, vorgezogene rctroversen Sichelbogen<br />
welche Ripenkuicke<br />
zunehmendem erzeugen, Ripenkuicke<br />
zunehmendem welche d mehr sich mit<br />
mehr strecken. d mehr und 8; 27 197 10<br />
43
Art Sutur bei h =<br />
H. IL.) lunuh !REINECKE<br />
IS IX) dn: s. Untergattung.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
Form wie liimtloi<strong>des</strong>, aber<br />
•von dichterer Berippung und<br />
mit völlig glatter innerer<br />
Flankenhälfte.<br />
H. iL.) pauloiri DE TSYTO<br />
VITCH 1911.<br />
LT ist, nach ZEISS 1956, Fig.<br />
10, Taf. 7 in DE TSYTO<br />
VITCH 1911; Orig. im Mus.<br />
der Naturgesch. Genf.<br />
Sehr ähnlich pseudvpuncta-<br />
tum, von dem es nur durch<br />
andere Skulpturentwicklung<br />
geschieden ist.<br />
H. (L.) miebailowense ZEISS<br />
1956, dn: Fundort Michailow<br />
(UdSSR).<br />
HT in der BSPG unter Nr.<br />
1950 XXX 39.<br />
= H. nodosulcatum KUHN<br />
1939.<br />
Ähnlich pseudopuncUtum<br />
LAHUSEN und paidoivi,<br />
aber dichter berippt und von<br />
anderem Altersquerschnitt.<br />
H. (L.) schloenbachi DE TSY<br />
TOVITCH 1911, dn: U.<br />
SCHLOENBACH, Geologe<br />
in Prag, 1841-1870.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Mus. der<br />
Naturgesch. Genf.<br />
= Am. cf. fuscus QU. 1887,<br />
Taf. 82, Fig. 45.<br />
Durch kräftige Sichelrippen<br />
ausgezeichnet.<br />
H. (L.) submatheyi LEE 1905<br />
Orig. <strong>des</strong> HT nicht auffind<br />
bar.<br />
Durch äußerst schwache<br />
Skulptur ausgezeichnet.<br />
H. (L) nudum ZEISS 1959,<br />
= Am. becticus parallelus<br />
QU. 1887, Taf. 82, Fig. 50<br />
(HT), ist durch seinen gerun<br />
deten Venter geschieden.<br />
44<br />
ca. 25 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
inJ<br />
5,1 cm<br />
3,5 cm<br />
3; 5 cm<br />
0<br />
Skulptur d<br />
Während die Stiele der Sichel<br />
rippen fehlen, bedecken die<br />
konkaven Bogen gleichmäßig<br />
die Region <strong>des</strong> Außenhuges<br />
oder der äußeren Flankenhälfte.<br />
Zarter, abgesetzter Kiel.<br />
Schwache, proradiate Primär<br />
rippen beginnen bis d = 1 an<br />
der Naht, später bei ca. 1 '3<br />
Flankenhöhe und trifurkieren<br />
vorwiegend. Während dieser<br />
Entwicklung rücken die leicht<br />
retrokonkaven Sekundärrippen<br />
auseinander und bilden mit den<br />
Primärrippen z. T. Einzelrippen,<br />
die manchmal im inneren Flan<br />
kendrittel ineinanderlaufen.<br />
Proradiate, keilförmige Primär<br />
rippen beginnen an der Naht<br />
und spalten vereinzelt bereits<br />
dort. Bei ca. 45% Flankenhöhe<br />
gabeln sie in hur schwach<br />
gekrümmte, leicht retroverse<br />
Sekundärrippen, die in kurzem,<br />
proversen Bogen 1-2 mm vor<br />
dem leicht abgesetzten Kiel<br />
enden.<br />
Stark proradiate bis prokon<br />
kave Sichelstiele gabeln vorwie<br />
gend 2-fach bei 30 bis 40%<br />
Flankenhöhe in Sekundärrip<br />
pen, die beim HT anfangs<br />
retrokonkav, im Alter konkav<br />
sind. Sichelknick stellenweise<br />
90° oder sogar schwach spitz<br />
winklig.<br />
Die Innenwindungen zeigen im<br />
streifenden Licht Andeutungen<br />
von gegen die Flankenmitte<br />
verdickten Primärrippen. Die<br />
Sekundärrippen lassen sich nur<br />
auf den Außenwindungen stel<br />
lenweise im streifenden Licht<br />
erkennen, sie sind leicht retro<br />
konkav.<br />
in cm<br />
HT .3.:<br />
3.8<br />
LT 5,1<br />
3. 7<br />
6<br />
HT 3,5<br />
3,6<br />
i31) (-40)<br />
31.5<br />
HT 3,6 31<br />
40~5<br />
2S 44<br />
35<br />
HT 2,C 40<br />
41.5<br />
51<br />
43<br />
45<br />
47<br />
47<br />
44<br />
39<br />
35<br />
34<br />
(1,8)<br />
T787<br />
(2,0)<br />
1,86<br />
1,6<br />
1,93<br />
1,73<br />
1,23<br />
1.6<br />
1,6<br />
Zone<br />
iTaf.<br />
l.it.<br />
37 SR • d<br />
59 SR 8:11
Art Sutur bei h :<br />
H. (L.) (redend ZEISS 1959,<br />
dn: latinisierter Vorname<br />
QUENSTEDTs.<br />
HT ist Am. becticus lunula<br />
QU. 1887, Taf. 82, Fig. 22;<br />
Orig. im SMNS.<br />
Plumbe Form mit ellipti<br />
schem Querschnitt und<br />
wenig differenzierten Rippen.<br />
H. (L.) orbignyi DE TSYTO<br />
VITCH 1911, dn: A. D'OR<br />
BIGNY, franz. Geologe,<br />
1802-1857.<br />
LT ist, nach ZEISS 1956, H.<br />
pseudopunetatum LAH. var.<br />
orbignyi DE TSYTOVITCH<br />
1911, Taf. 4, Fig. 10; Orig.<br />
nicht auffindbar.<br />
Vermittelt durch knotig ent<br />
artete Primärrippen zu Pittealiceras<br />
(Rossiensiceras).<br />
H. (L.) nodosulcatum<br />
(LAHUSEN 1883), dn: lat.<br />
nodus = Knoten, sulcatus =<br />
gefurcht.<br />
LT ist, nach ZEISS 1956, Fig.<br />
18, Taf. 11 in LAHUSEN.<br />
= Am. becticus gigas QU.<br />
1S8-, Taf. 82, Fig. 37.0)<br />
Durch knotenartig verdickte<br />
Sekundärnppen am Außen-<br />
bug ausgezeichnet.<br />
Taramelliceratinae spath 1928<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
10 i<br />
3,4 cm<br />
Skulptur d<br />
Retroverse, schwach gesichelte<br />
Spaltrippen beginnen an der<br />
Naht und spalten vorwiegend<br />
in Flankenmitte, manchmal<br />
aber auch am Innenbug. Feiner<br />
Kiel auf gerundetem Venter<br />
wird von dicht benachbarten,<br />
zarten Nebenkielen begleitet.<br />
Leicht proradiate, weitstandige,<br />
kräftige Pnmärnppen rücken<br />
im Wachstumsverlauf von der<br />
Naht ab und schrumpfen zu<br />
breit-wulstigen Knoten inner<br />
halb der Flankenmitte. Kon<br />
kave Sekundärrippen beginnen<br />
in Flankenmitte anfangs mehr<br />
als Spalt-, später mehr als<br />
Schaltrippen mit TZ 3.<br />
Skulptur insgesamt mäßig kräf<br />
tig-<br />
Schwache Primärrippen erlö<br />
schen bei d 3. Sie bifurkieren<br />
bei 35% Flankenhöhe in<br />
schwache, konkave Sekundär<br />
rippen, die durch Schaltrippen<br />
vermehrt sind, so daß TZ ^<br />
2,8 entsteht. Nach Erlöschen<br />
der Primärrippen rücken die<br />
Sekundärrippen auseinander<br />
und beginnen zart auf dem<br />
inneren Flankendrittel. Rippen<br />
am Außenbug leicht knotig<br />
in cm<br />
H<br />
in %<br />
HT 3,7 34 40 1,33<br />
Oppehen mit unterschiedlich entwickelten, sägezahnartigen Dornenreihen am Außenbug und median, von denen erstere oder letztere fehlen kann oder auch beide verkümmert sind.<br />
verdickt.<br />
\orw legend bedecken Sinus- oder Sichelrippen die gesamte Flanke. Callovium bis oberer Malm.<br />
laramelhcerjs DEL CAMPANA 1904; dmTARAMELLI, italienischer Paläontologe; TA Am. traclnnotu: OPP. 1863. Engnablige, vorwiegend hochmündige, aber auch kugelige For<br />
men mit Sichel- oder Sinusrippen, die auf der äußeren Flankenhälfte durch Schaltrippen vermehrt sind. Maximal drei externe Reihen meist sehr feiner Knötchen. Von einer Teilung in<br />
1 "icrgattungen wird hier abgesehen, solange eine Revision der Gruppe aussteht.<br />
' •••J-~ilnuUtum • QU.<br />
' - •:•)• ;<br />
.ll. c.uulis =<br />
h ; i<br />
"' Spiralfurche'.<br />
'•>"C ;<br />
e:chheit mit Ocbeloceras<br />
'•"•'«•uLium v. BUCH) aus<br />
"Morduim ist nicht<br />
••-""•whliehcn.<br />
, u<br />
W llcxuosus cana-<br />
•^
Art Sutur hei h :<br />
T. inerme (QU. 1887), dn:<br />
lat. inermis = unbewaffnet.<br />
Fig. 52, Taf. 85 in QU. 1887<br />
muß als LT gelten. Orig. im<br />
SMNS.<br />
Von ••canalicuhtum- durch<br />
andere Skulptur geschieden.<br />
T. episcopalc (LORIOL<br />
1898), dn: lat. episcopium =<br />
Bistum (Basel, Fundgebiet).<br />
= Am flcxuosus inflatus QU.;<br />
= A?n. suevicus OPP. 1857<br />
.'beide präokkupiert).<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch andere Skulptur<br />
geschieden.<br />
T. flexispmatum (OPP. 1857),<br />
dn: lat. flexüis = biegsam,<br />
geschwungen, spinatus =<br />
bedornt.<br />
HT ist Am. flcxuosus globulus<br />
QU. 1846, Taf. 9, Fig. 6,<br />
Orig. verschollen.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch weniger dichte Berip<br />
pung (und kleineres Q?)<br />
geschieden.<br />
T. punetuhtum (QU. 1887),<br />
dn: lat. punctulum = Pünkt<br />
chen.<br />
Ong. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
Bmtmündige berippte Art<br />
mit einer Knötchcnreihc.<br />
T. '?1 tvlox OPP. 1862), dn:<br />
lat. velox - schnell, behende.<br />
Gl.mc, kugelige Art mit nur<br />
einer Knöuhcnrohe. TA von<br />
Acinlfuecttes ROI.L1ER<br />
190*9.<br />
•46<br />
4 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
4,6 cm<br />
2,6 (<br />
1,3 mm 2 cm<br />
0,7 cm<br />
Skulptur d<br />
Undeutliche Sichelrippen, deren<br />
Stiele sich kaum von tlen<br />
Anwachslinien abheben. Sichel<br />
bögen am Außenbug schwach<br />
sichtbar, Spiralfurche fehlt völ<br />
lig. Mediankiel sehr schwach,<br />
Außenbug wird mit breiter<br />
werdender Externseite im Alter<br />
kantig.<br />
Scharfe, unregelmäßige, leicht<br />
sinusförmig geschwungene<br />
Hauptrippen bifurkieren spora<br />
disch in Flankenmitte und sind<br />
auf äußerer Flankenhälfte durch<br />
Schaltrippen vermehrt. Median<br />
kiel zu Knötchen aufgelöst, die<br />
mit dem Alter gröber und<br />
distanzierter werden.<br />
Am Außenbug, wo die Rippen<br />
auslaufen, erst runde, später<br />
mehr tangentiale, gröbere<br />
Knötchen.<br />
Leicht sinusförmige Rippen<br />
spalten in Nabelnähe in relativ<br />
weitständige Teiläste, die sich<br />
z. T. in den weitständigen<br />
Knötchen <strong>des</strong> Außenbugs ver<br />
einen oder zwischen ihnen hin<br />
durchlaufen, wobei sie extern<br />
geschwächt sind. Auf zart<br />
geschärftem Venter kleinere<br />
Knötchen, meist wechselstän<br />
dig mit den vorgenannten.<br />
Etwa 6 Paare von sinusförmi<br />
gen Einzelrippen werden durch<br />
gleichmäßig dichte, feine<br />
Sekundärrippen auf äußerer<br />
Flankenhälfte ergänzt. Alle tref<br />
fen sich wenig geschwächt<br />
unter stumpfem Winke! im zart<br />
gepunkteten, sehr schwachen<br />
Mediankiel.<br />
Das ansonsten völlig skulptur<br />
lose Gehäuse trägt lediglich<br />
weitständige, sägezahnartige<br />
kleine Zacken in der Median<br />
ebene, die auf der Alterswohn<br />
kammer der sehr kleinwüchsi<br />
gen Gehäuse verschwänden.<br />
in cm<br />
LT 4,6<br />
2,6<br />
3,1<br />
HT 1,8<br />
1,2<br />
2<br />
HT 2,0<br />
N H<br />
in %<br />
(26) j 41<br />
S ! 58<br />
13 50<br />
HT 1,1 16) i 48<br />
1 1 62<br />
58 1,5<br />
1,3<br />
(1,4)<br />
1,08<br />
1,1<br />
15 PR<br />
53 SR<br />
1,03 62 SR<br />
0,9<br />
1,1
Creniceras MUNIER-CHALMAS 1892; dn: lat. crena = Kerbe; TA Am. renggeri OPP. 1863. Kleinwüchsige, engnablige, flache und skulpturlose Gehäuse, die in bestimmten<br />
Altersabschnitten einen teilweise kräftig gezahnten Mediankiel tragen. Die An Cr. dentatum (REINECKE), deren Name QU. für alle seine Dogger-Exemplare benutzte, setzt nach<br />
ZIEGLER 1956 erst im "Malm gamma 3" ein.<br />
An Sutur bei h :<br />
Cr. crenatum (D'ORB. 1848),<br />
dn: s. Gattung.<br />
= Am. dentatus QU. 1S57,<br />
Taf. 76, Fig. 6 und 1887, Taf.<br />
85, Fig. 31-33<br />
Durch in allen Altersstadien<br />
relativ große Nabelweite<br />
gekennzeichnet.<br />
Cr. renggeri (OPP. 1862)<br />
HT ist Am. cristatus SOW.<br />
1823.<br />
= Am. dentatus QU. 1857,<br />
Taf. 76, Fig. 8.<br />
Von crenatum durch engeren<br />
Nabel <strong>des</strong> Phragmocons<br />
geschieden.<br />
Vorkommen im Callovium<br />
erwähnt von MUNIER-<br />
CHALMAS, LISSAJOUS und<br />
MAIRE 1908, vergl.<br />
ARKELL 1940) zweifelhaft.<br />
Cr. auritulus (OPP. 1862), dn:<br />
lat. auritulus = Langohr.<br />
= Am. dentatus inermis QU.<br />
18S", Taf. 85, Fig. 34.<br />
Durch fehlenden Zahnkiel<br />
gekennzeichnet.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
ca. 7 i 1; 5 cm<br />
ca. 7 mm<br />
1,5 mm<br />
2 cm<br />
Skulptur d<br />
Auf den Flanken manchmal<br />
äußerst schwache Sichelskulp<br />
tur, selten flache Spiralrinne.<br />
Kiel der Alterswohnkammer<br />
trägt gröber werdende scharfe<br />
Zähne, die vor der Altersmün<br />
dung wieder verschwinden,<br />
welche schmal gestielte Ohren<br />
trägt.<br />
Die sehr variable Zahnung <strong>des</strong><br />
Mediankiels setzt bei d ~ l ein<br />
und setzt sich meist - im<br />
Gegensatz zu crenatum - bis<br />
zum Altersmundsaum fort, der<br />
(nach ZIEGLER 1956) Ohren<br />
zu tragen scheint.<br />
ARKELL 1940 benennt die<br />
grobgezahnten Formen, zu<br />
denen kontinuierliche Über<br />
gänge bestehen, als Cr. renggeri<br />
var. woodhamense.<br />
Auf den Innenwindungen<br />
schwache Andeutungen sichel<br />
artiger Rippen, Wohnkammer<br />
glatt. Mediankiel sehr dünn<br />
und ohne Zähne. Breite Ohr<br />
lappen an sehr schmalen Stie<br />
Distichoceratinae hyatt 1900<br />
A ^kömmlinge der Hecticoceratinae, deren Kiel stark reduziert oder ganz verschwunden ist, wogegen markante Knotenreihen den Charakter von Nebenkielen annehmen. Callovium<br />
"••> 'Ktordium.<br />
^ttxhncerjs MUNIER-CHALMAS 1892; dn: gr. di- = zweifach, stichos = Reihe, ceras = Horn; TA Am. bipartitus ZIETEN 1831. Engnablige Gehäuse mit hochtrapezoidem bis<br />
••-'^elliptischem Windungsquerschnitt, deren Innenwindungen nur in Wachstumsrichtung ausgezogene Knoten oder Dornen am Außenbug tragen. Bereits frühzeitig wurden grö-<br />
• *c -<br />
.-enppte Formen und kleinere unberippte mit Ohren als geschlechtsdimorphe Gruppen gegenübergestellt.<br />
•'•ericumiiig Disticboceras s. str.; makroconchc Formen mit proversen Primär- und retroversen Sekundärrippen, die am Außenbug meist paarweise in Knoten enden. Rippenspal-<br />
''K n.iutig an einer lateralen spiraligen Erhöhung.<br />
•/ J 1<br />
* l<br />
>wt>stMitm 'STAHL<br />
• :,Ü. hi- =- zwei-<br />
' - - -"st.iiiis = berippt.<br />
'urittus ZIETEN<br />
4 cm<br />
len.<br />
Innenwindungen glatt, säge<br />
zahnartige, Wechsel ständige<br />
Dornen am Auisenbug, Spiral-<br />
furche angedeutet. Ab d ~~ 1,5<br />
retrokonkave Rippenpaare über<br />
einer sehr schwachen Spiral<br />
furche, die von einem ebenso<br />
schwachen erhabenen Saum<br />
begrenzt wird. Rippenvereini<br />
gung in den Externknoten, die<br />
den zarten Mediankiel überra<br />
gen. Prokonkave Primärrippen<br />
undeutlich, Skulpturschwund<br />
im Alter.<br />
in cm<br />
1<br />
1,5<br />
?<br />
HT i;<br />
1<br />
1,5<br />
2,1<br />
2,2<br />
3,6<br />
N<br />
in %<br />
25,ä<br />
2575<br />
24<br />
1675<br />
+7<br />
24<br />
25,6<br />
(23)<br />
4,1 20,1<br />
H<br />
in %<br />
49<br />
47<br />
43<br />
47<br />
52<br />
44<br />
44<br />
45<br />
48<br />
1,6<br />
TT?<br />
T76<br />
1,65<br />
1,9<br />
1,90<br />
(30)<br />
47
Art Sutur bei h =<br />
UA D. f<br />
D.) bicostatum nodu-<br />
losum QU. 1846). dn: lat.<br />
nodulosus = beknotet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
Von der Nominat-Unterart<br />
durch spiralige Knotenreihe<br />
und stärkere Skulptur<br />
geschieden.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
4 cm<br />
Skulptur d<br />
In der Fkmkenmitte, wo die<br />
Rippen wie hei bicostatum s.<br />
str. einen VC'mkel von 90-110°<br />
bilden, sind sie zu kleinen,<br />
bogenförmigen Knötchen ver<br />
dickt. Primärrippen deutlich,<br />
Sekundärrippen meist einzeln,<br />
am Außenhug in knotigen<br />
Häkchen endend.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
HT 4.0 22 47 l.~T |<br />
Q<br />
Zone<br />
Z ; Taf.<br />
Untergattung Uorioceras MUNIER-CHALMAS 1892; dn: gr. horizo = begrenzen, ceras — Horn; TA Am. bidentatus QU. 1846; Mikroconche Formen ohne Berippung, Skulptur nur<br />
aus Dornen am Außenbug und einer Spiralfurche bestehend, Ohren am Altersmundsaum.<br />
D. (H.) bidentatus (QU. 1 L A Die wechselständigen Dornen HT 1,9 27 39 1,5<br />
( f \<br />
1846), dn: lat. bi- = zwei i l _ U, U. U, U, _)Z_ J , am Außenbug haben noch stärfach,<br />
dentatus = gezahnt.<br />
ker als bei Distichoceras bico- 1,8 26 46 1,68<br />
statum den Charakter von<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen. Sägezähnen, verlieren sich aber<br />
= Am. baugieri D'ORB.<br />
1847?<br />
MV \ *<br />
4,8 mm 1,8 cm<br />
im Alter. Deutliche Spiralfurche<br />
auf Flankenmitte, Rippen höch<br />
stens angedeutet.<br />
Phlycticeratidae SPÄTH 1928<br />
Eigenartige kleine Gruppe, deren Spiralstreifung eine Verwandtschaft mit den Strigoceratinae nahelegt, deren Suturentwicklung jedoch einen Anschluß an die Oppelien gebietet<br />
(WIEDMANN u. KULLMANN 1981.. Callovium.<br />
Phlycticeras HYATT 1900; dn: Phlyktäne = Pustel; TA Nautilus pustulatus REINECKE 1818. Involute, kugelige Gehäuse mit gerundet dreieckigem Querschnitt, deren Skulptur<br />
durch mehrere Knotenreihen und Spiralstreifung beherrscht wird, aberauch aus Rippen bestehen kann. Kiel meist kreneliert. SCHEURLEN 1928 faßt alle schwäbischen Formen als<br />
verschiedene Wachstumsstadien unter der Art pustulatum zusammen, was aber aufgrund sehr unterschiedlicher Skulpturen gleichgroßer Exemplare unhaltbar scheint.<br />
Phl. pustulatum (REINECKE Bei den in Limoniterhaltung HT 2,3 (10) (52) (0,63) cl 2<br />
1818), dn: lat. pustula =<br />
Bläschen.<br />
< / - N ><br />
n/Y/<br />
vorliegenden fränkischen<br />
Exemplaren sind, wie dies bei<br />
der UA pustulatum nodosum<br />
1.6 15 51 0,71 9; 9<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen. nachweisbar ist, die spitzen<br />
197<br />
Dornen zu stumpfen, niedrigen<br />
209<br />
= Am. pustulatus franconicus Knoten erodiert. An der Stelle 280<br />
QU. 1S87, Taf. 86. größter Windungsbreite (35%<br />
Seitenhöhe) sitzen ca. 8 (d =<br />
Gemäß REINECKEs Figur 1,6), auf dem Kiel ca. 16 und<br />
durch besonders engen Nabel dazwischen ca. 12 Knoten pro<br />
ausgezeichnet.<br />
UA Phl. pustulatum nodosum<br />
(QU. 188"), dn: lat. nodosus<br />
i ' * "i —iL<br />
ca. 2,3 cm<br />
Windung. Auf der gesamten<br />
Oberfläche ist feine Spiralstrei<br />
fung angedeutet. Eine Varietät<br />
mit größerem Q neigt zur Bil<br />
dung grober Rippen im Alter.<br />
= beknotet. 35% und 75% Seitenhöhe und<br />
18 PR<br />
46 SR<br />
L , t<br />
i -<br />
Bis d ~ 0,5 skulpturlos, dann LT 2,4 25 .48 0,74 cl 1<br />
Auftreten spitzer Dornen bei u. 2<br />
eines messerscharfen, gezahn<br />
1,9 24 49 0,85<br />
LT ist Fig. 13, Taf. 86 in QU. ten Hohlkieles bei guter Scha 2,7 22 50 0,82<br />
18S -<br />
: Orig. im SMNS. lenerhaltung. Bei Stein- oder<br />
Kieskernen statt Dornen flache<br />
209<br />
= Am. pustulatus QU. 1887, Knötchen, am Kiel elliptisch. 211<br />
Taf. 86, Fig. 2, 3 u. 5. Zwischen den Dornen feine<br />
radiale Rippchen, unregelmäßig<br />
Durch weiteren Nabel von und teilweise gebündelt, im<br />
der Nominatunterart geschie Alter kräftiger und wulstig<br />
den.<br />
48<br />
6 mm<br />
werdend. Alles überzogen von<br />
sehr feiner Spiralstreifung.<br />
cl 2<br />
U.5<br />
9; ~<br />
19s<br />
19-<br />
9; 10<br />
197<br />
-
Phl. polygonium (ZIETEN<br />
1830}, dn: gr. Polvgön =<br />
Vieleck.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT scheint verschollen.<br />
An Sutur bei h =<br />
= Am. pustulatus suevicus<br />
QU. 1887, Taf. 86, Fig. 10 u.<br />
11.<br />
Mit nur einer Knotenreihe<br />
versehene Art. Phl. cristagalli<br />
D'ORB. hat kraftigere Dornen<br />
und gewellten Kiel.<br />
UA Phl. polygonium laevigatum<br />
(QU. 1887), dn: lat. laevigatus<br />
= geglättet.<br />
Durch gänzlich fehlende<br />
Knoten von der Nominatunteran<br />
geschieden.<br />
Phl. giganteum (QU. 1887),<br />
dn: tat. giganteus = riesig.<br />
HT ist Am. pustulatus giganteus<br />
QU. 1887, Taf. 86, Fig.<br />
6: Orig. im 1GPT.<br />
Da Zwischenstadien fehlen,<br />
ist vorerst ungewiß, ob der<br />
HT (einziges Exemplar dieser<br />
Größe; das Altersstadium<br />
einer vorstehenden Art ist.<br />
Querschnitt<br />
bei d =<br />
( \<br />
ca. 3 cm<br />
1,8 cm<br />
/ \<br />
w<br />
15 cm<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in % Q Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
Schwache dichte, radiale bis HT 2,7 20 45 (0,8) cl 2<br />
proradiate Rippen, oft auf Flankenmitte<br />
bifurkierend und am<br />
Spaltpunkt sporadisch bedornt,<br />
3,1 21 49 1,06 3S SR 9; 11<br />
bilden mit der Spiralstreifung<br />
ein Netzwerk. Messerscharfer,<br />
krenelierter Kiel ist bei Steinkernen<br />
ebenso wie die Dornen<br />
zu einem Band flacher Knoten<br />
reduziert.<br />
4,8 19,5 50 1,1" 45 SR 19~<br />
286<br />
Vorherrschend ist. die über die 1,8 17 53 1,0 cl 1<br />
gesamte Flanke verteilte Spiralstreifung,<br />
überlagert von sehr<br />
u. 2<br />
feinen, etwa radialen Rippchen.<br />
Knoten oder Dornen fehlen<br />
9; 12<br />
völlig. 197<br />
209<br />
Niedrige, retrokonkave, wul<br />
HT14,7<br />
stige Primärrippen enden in<br />
19 51<br />
25 PR cl 1<br />
stige Primärrippen enden in<br />
1,6 1 l (80 SR)<br />
knotigen Verdickungen auf ca.<br />
9; 13<br />
40% Seitenhöhe. Dort entspringen<br />
mit leichtem Rück<br />
197<br />
wärtsknick ebenso retrokon<br />
209<br />
kave Sekundärrippen, die sich<br />
bis auf den hohen scharfen Kiel<br />
(meist verloren) erstrecken. Am<br />
kantigen Innenbug treten ab d<br />
5 perlschnurartige Verdikkungen<br />
der Primärrippen auf.<br />
Spiralstreifung nur stellenweise<br />
angedeutet.<br />
49
Haplocerataceae Z<br />
I T T E L 1 8 8 4<br />
VERTRETER DER AMMONITINA MIT VORWIEGEND SCHARF GEKIELTER EXTERNSEITE UND MEHR ODER WENIGER AUSGEPRÄGTEN SINUS- BIS SICHELRIPPEN. PLATYCONE UND OXYCOUE FORMEN HEI WEITERN \,<br />
HERRSCHEND, NAHELWEITE KLEIN BIS MITTELGROß, SUTUR MIT ZAHLREICHEN UMBILIKALLOBEN UND UNGCSPALTENEM UI. SOWIE INNERHALB DER NAHT LIEGENDEM U4. EINTEILUNG NACH S C H L N D F<br />
W O L F IN DIE FAMILIEN GRAPHOCERATIDAE UND HAPLOCERATIDAE. UNTERER DOGGER BIS UNTERKREIDC.<br />
Graphoceratidae B<br />
U C K M . 1 9 0 5<br />
INVOLUTE, GEKIELTE HAPLOCERATEN MIT UNTERSCHIEDLICHER BERIPPUNG ODER SPIRALSTREIFUNG (STRIGOCERATINAE), HÄUFIG IM ALTER GLATT.<br />
Graphoceratinae B<br />
U C K M . 1 9 0 5 FIND. LEIOCERATINAE S P Ä T H 1 9 5 6 )<br />
SEHR .SCHMAIMÜNDIGE, oft OXYCONE GEHÄUSE mit SCHWACHEN BIS KRÄFTIGEN SICHELRIPPEN IN DER JUGEND UND FAST STESTS KANTIGEM INNENBUG. LINTER-AALENIUM BIS UNTERSTES Bajocium<br />
Leioceras H Y A T T 1 S6~; DN: GR. LEIOS = GLATT, CERAS = HORN; T A Nautilus opalinus R F . 1 N E C K E 1 8 1 8 , NACHTRÄGLICH BESTIMMT DURCH B U C K M A N N 1 887. KLEINE BIS MITTELGROßE, verein<br />
ZELT BIS 2 0 CM DURCHMESSER ERREICHENDE FORMEN VON LANZETTLICHEM WINDUNGSQUERSCHNITT. MÄßIG STEILER NABELWAND UND PHYLOGENETISCH ZUNEHMEND KANTIGEM INNENBUG. SKULP:UR<br />
UNTERSCHIEDLICH UND ONTOGENETISCH VARIABEL; FEINSTE HAARRIPPEN (ANWACHSLINIEN) EBENSO HÄUFIG WIE SCHWACHE WULSTRIPPEN, KRÄFTIGE RIPPEN SELTEN. AALENIUM.<br />
L. opalinum ( R E I N E C K E<br />
1 8 1 8 ) , DN: OPALARTIG SCHIL<br />
LERNDE SCHALE.<br />
ORIG. DES H T VERSCHOLLEN,<br />
EBENSO DER 1 8 9 9 VON<br />
ART SUTUR BEI H :<br />
B U C K M . UNZULÄSSIGERWEISE<br />
AUFGESTELLTE «LT» AUS Q U .<br />
1 8 4 6 .<br />
C O N T I N I TRENNT 1 9 6 9 3<br />
VARIANTEN UND ORDNET IHNEN<br />
L. opaliniforme UND lineatum,<br />
BEIDE B U C K M . 1S99, ALS<br />
MAKROCONCHE PARTNER ZU.<br />
U. B A Y E R LIEFEN 1 9 7 2 STATI<br />
STISCHE HINWEISE FÜR DIMOR<br />
PHISMUS. DER BIPOLAREN FOR<br />
MENFÜLLE SOLL HIER DIE TREN<br />
NUNG IN 2 U A GERECHT WER<br />
DEN.<br />
U A L. opalinum lineatum<br />
B U C K M . 1 8 9 9 , DN: LAT. LINEA-<br />
TUS = GESTREIFT.<br />
H T IN B U C K M . 1 8 9 9 , TAF.<br />
8, FIG. 1.<br />
= Cypholioceras opaliniforme<br />
B U C K M . 1 8 9 9 , = Lioceras<br />
grave B U C K M . 1 8 9 9 .<br />
VERMUTLICH MAKROCONCHER<br />
SEXUALPARTNER VON L. opali<br />
num S. STR.; GEGENÜBER JENEM<br />
HÖHERE ENDGRÖßE BEI FEHLEN<br />
DEN OHREN, DAGEGEN MIT<br />
EXTERNFORTSATZ AM ADUTTEN<br />
MUNDRAND. JUGCNDEXCMPLARE<br />
NICHT VON L. opalinum S. STR.<br />
ZU TRENNEN.<br />
i. costosum ( B E N E C K E<br />
1905), DN: LAT. COSTOSUS<br />
(COSTATUS) = BERIPPT.<br />
L T IN Q U . 1SS6, TAL. 5 5 , FIG.<br />
2 0 (BESTIMMT D. B U C K M .<br />
1S99); ORIGINAL VERSCHOLLEN<br />
(•')•<br />
VON VORSTEHENDEN UNTERARTEN<br />
DURCH GROBE BERIPPUNG<br />
ECSCHICDEN.<br />
50<br />
2 5 M M<br />
QUER<br />
SCHNITT<br />
BEI D =<br />
7 M M 2,4 1<br />
2 8 M M 12 CM<br />
SKULPTUR D<br />
DEUTLICHE SKULPTUR FRÜHESTENS<br />
AB 4. WINDUNG. ÄUßERST FEINE,<br />
SINUSFÖRMIGE HAARRIPPEN, AUF<br />
DER MEIST WEIßEN SCHALE SCHARF,<br />
AUF DEM STEINKERN GERUNDET<br />
UND IN NABELNAHE UNDEUTLICH.<br />
BESONDERS DIE INNERE FLANKEN<br />
HÄLFTE WULSTIG GEWELLT, SO DAß<br />
RIPPENBÜNDELUNG VORGETÄUSCHT<br />
WARD. STETS SCHARFER, NUR<br />
SCHWACH ABGESETZTER KIEL.<br />
WACHSTUMSENDE (MAXIMAL<br />
GRÖßE: DN ^ 6 CM) GEKENN<br />
ZEICHNET DURCH AUFTRETEN LAN<br />
GER, SCHMALER OHREN IN HALBER<br />
HÖHE DES MUNDSAUMES.<br />
SEHR FEINE, SINUSFÖRMIGE HAAR<br />
RIPPEN, GLEICH DENEN VON L.<br />
opalinum S. STR., EBENSOLCHE<br />
FLANKENWELLUNG. SKULPTUR<br />
BESONDERS IM ALTER VARIABEL.<br />
MANCHMAL VERSCHWINDET DER<br />
SCHARFE KIEL AUF ADULTEN WOHN<br />
KAMMERN. AUSGEWACHSENE<br />
EXEMPLARE ZEIGEN EINEN AUS<br />
GEPRÄGTEN EXTERNFORTSARZ, DER<br />
ABER NICHT DIE LÄNGE DER OHREN<br />
VON L. opalinum S. STR. ERREICHT.<br />
IN AUSNAHMEFÄLLEN TRETEN<br />
OHREN UND EXTERNFORTSATZ AM<br />
GLEICHEN EXEMPLAR AUF (!)<br />
RELATIV GROBE, WEITSTÄNDIGE,<br />
UNREGELMÄßIGE UND LEICHT RETRO-<br />
VERSE SINUSRIPPEN, HÄUFIG<br />
GABELND, MIT GRÖßTET HÖHE AUF<br />
FLANKENMITTE, AUF ÄUßERER FLAN-<br />
KCNHÄLFTE OFT DURCH SCHALTRIP<br />
PEN VERMEHRT. RIPPENDICHTE<br />
VARIABEL. SEHR SCHARFER KIEL, NUR<br />
WENIG ABGESETZT, INNENBUG<br />
GERUNDET. G. H O F F M A N N<br />
1 9 1 3 BEOBACHTETE OHREN AM<br />
ALTERSMUNDSAUM BIS D ~ 5.<br />
IN CM<br />
H T<br />
H T 1 0<br />
7<br />
1 0<br />
13<br />
L T 4,9<br />
2,8<br />
3<br />
3,7<br />
4,2<br />
6,4<br />
N<br />
IN %<br />
3,4 (19)<br />
(17)<br />
2 T ± 3<br />
2 2 ± 4<br />
2 2 ± 5<br />
21<br />
2 0<br />
2 0<br />
2 4<br />
(28)<br />
2 8<br />
31<br />
2 S ± 3<br />
2 7<br />
2 8<br />
H<br />
IN %<br />
(46)<br />
(49)<br />
5 0<br />
4 9<br />
4 6<br />
4 5<br />
4 7<br />
4 7<br />
4 3<br />
(43)<br />
4 5<br />
4 0<br />
4 6<br />
4 5<br />
(2,8)<br />
T/8<br />
2~3<br />
274<br />
2,1<br />
274<br />
274<br />
T T<br />
1,6<br />
1.7<br />
2,0<br />
.21)<br />
2 8<br />
4 5 ± 1 5<br />
(51)
ART SUTUR BEI H :<br />
L. comptum {REINECKE<br />
ISIS), DN: LAT. COMPTUS —<br />
ZIERLICH.<br />
ORIG. DES HT VERSCHOLEN:<br />
ZEISS STELTE 1972 FIG. 3,<br />
TAF. 26 IN DORN 1935<br />
(ORIG. IM IG PEN) ALS NT<br />
AUF.<br />
Ludwigia goetzendorfens'is<br />
DORN 193S HEGT IM VARIA<br />
TIONSBEREICH VON comptum.<br />
L. striatum BUCK\TTL899<br />
(OHREN, D < 5), DAS IM<br />
JUGENDSTADIUM KAUM VON<br />
comptum UNTERSCHEIDBAR IST,<br />
KÖNNTE ALS DESSEN MIKRO-<br />
CONCH GELTEN.<br />
VON opalinum DURCH GRÖßE<br />
RES N UND GRÖBERE SKULPTUR,<br />
VON costosum DURCH FEINERE<br />
SKULPTUR GETRENNT.<br />
L. pauacostatum RIEBER<br />
1963. DN: LAT. PAUCI =<br />
WENIGE, COSTATUS = BERIPPT.<br />
KLEINWÜCHSIGE ART (D < 5^<br />
MIT WENIGEN GROBEN RIPPEN.<br />
BEGLEITER VON comptum U.<br />
striatum, VOM ÄLTEREN costosum<br />
DURCH SCHÄRFEREN INNEN<br />
BUG UND DEUTLICHEN AUßEN<br />
BUG GETRENNT; MIKROCONCHE<br />
-AN>.<br />
L G<br />
•' ^rassicostatum RIEBER<br />
63. DN: LAT. CRASUS = DICK,<br />
Status = BERIPPT.<br />
M^cl-roße ART (D < 9) MIT<br />
^E:.. WEITSTÄNDIGEN RIP-<br />
•' • -^ENDEXEMPLJRE MIT<br />
• r.atum U. comptum<br />
' rrv,i<br />
'-" ,(<br />
-'!t\IR; ÄHNLICH DEN<br />
• ' ' "'. V.;;±0,4<br />
24±7 44±6 2~Ö<br />
(202<br />
|211<br />
1232<br />
280<br />
32<br />
32<br />
30±3<br />
26,3<br />
25,6<br />
28±4<br />
40,7<br />
38,5<br />
47<br />
1,5<br />
1,6<br />
(40<br />
40<br />
45<br />
•AL LB<br />
I 10;<br />
45<br />
1202<br />
45,5<br />
45,4 1,54<br />
1,62 34 AL LB<br />
10: 3<br />
45<br />
202<br />
51
Staufenia POMPECKJ 1906 (= Costileioccras MAUBEUGE 1950); dn: 'Hohen-) Staufen, Fundort, Stammburg <strong>des</strong> gleichnamigen Kaisergeschlechtes bei Göppingen AX'urt- X<br />
Staufenia staufensis OPP. 1858. Mittel- bis großwüchsige, scheibenförmige Gehäuse mit lanzettlichcm bis dreieckigem Altersquerschnitt und niittclweitem bis engem \<br />
Schwache bis ausgeprägte, sinusförmige Spaltrippen erlöschen meist im Alter; der scharfe Kiel ist oft schwach abgesetzt. Die Gattung Costileioccras, die RIFBER 1963 (ohne l>v- r<br />
dung) noch als Untergattung beibehielt, wird hier zwecks Vermeidung unnötiger Komplizierung eingezogen, da ihre eindeutige Abgrenzung (durch Rippenstärke, Nabel wen c<br />
Querschnitt) fragwürdig ist. Phylogenetische Wandlung erfahrt besonders der Nabelabfall der Staufenien in seiner Entwicklung von mäßig steil bis überhängend. Unterschiede L<br />
Ludwigia s. dort. Unteres Obcr-Aalenium.<br />
Art Sutur bei h :<br />
St. sinon :'BAYLE 1878), dn:<br />
Gestalt der gr. Mythologie.<br />
LT ist Ludwigia sinon<br />
BAYLE 1878, Taf. 83, Fig.l.<br />
— Am. murchisonae acutus<br />
QU. 1S87, Taf. 59, Fig. 1<br />
und 14.<br />
(TA von Costileioccras MAU<br />
BEUGE)<br />
Sit. opalinoi<strong>des</strong> (MAYER<br />
1864), dn: ähnlich Leioceras<br />
opalinum (s. o.).<br />
HT ist Am. murchisonae acutus<br />
QU. 1S58, Taf. 46, Fig.<br />
4; = QU. 1886, Taf. 59, Fig.<br />
5, Orig. im IGPT.<br />
Von sinon durch schwächere<br />
und dichtere Rippen und grö<br />
ßeres Q geschieden. Von<br />
SPIEGLER 1966 zu Leioceras<br />
gestellt.<br />
St. sebndensis (G. HOFF<br />
MANN 1913), dn: Fundort<br />
Sehnde bei Hannover.<br />
LT ist Fig. 3, Taf. 4 in<br />
HOFFMANN 1913; Orig. im<br />
Geol. Inst, der Univ. Göttin<br />
gen.<br />
= Am. discus latumbilicus<br />
QU. 1886, Taf. 57, Fig. 8;<br />
= Am. discoideus QU. 18S6,<br />
Taf. 58, Fig. 5.<br />
Durch Querschnitt und steile<br />
Nabelkante von vorstehen<br />
den Arten geschieden.<br />
52<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
35 mm 9 cm<br />
35 mm<br />
23 mm<br />
4,5 cm<br />
Skulptur H<br />
Auf den Innenwindungen<br />
grobe, wulstige, etwa radiale<br />
Rippenstiele, die bei 30 n<br />
'o Flan<br />
kenhöhe in retroverse Sinus<br />
bögen bifurkieren. Durch<br />
Schaltrippcn wird TZ auf ca.<br />
2,5 erhöht. Skulpturschwä<br />
chung ab d = 7<br />
, scharfer Kiel<br />
anfangs stärker, später weniger<br />
abgesetzt.<br />
Regelmäßige Sinusrippen hoher<br />
Dichte aber von unterschiedli<br />
cher Intensität, Stiele meist<br />
schwach, Bifurkation bei ca.<br />
30%, später bei 50% Flanken<br />
höhe. Häufig Schaltrippen,<br />
scharfer Kiel fein und abge<br />
setzt.<br />
Die sehr ähnliche St. subacuta<br />
BUCKM. hat etwas kräftigere<br />
und beständigere Skulptur und<br />
behält ihren spitzbogigen<br />
Querschnitt bei (von SPIEG<br />
LER zu Leioceras gestellt).<br />
Schwache, weitständige Sinus<br />
rippen mit meist unscheinbaren<br />
Stielen, bipartit, einfach oder<br />
eingeschaltet, ericischen bei d =<br />
8 bis 12. Schalter Kiel auf<br />
spitzwinkliger Externregion nur<br />
schwach abgesetzt.<br />
Besonders bei kleinen Exem<br />
plaren variiert die Rippenstärke<br />
individuell sehr.<br />
LT 10<br />
2<br />
6,6<br />
11,2<br />
15,4<br />
HT 4,3<br />
6,7<br />
26<br />
29<br />
30<br />
34<br />
19<br />
20<br />
in %<br />
42<br />
47<br />
43<br />
44<br />
37<br />
46<br />
47,5<br />
1,9<br />
M<br />
1,9<br />
1,96<br />
2.03<br />
2,15<br />
2,5<br />
58 SR<br />
1<br />
Zone<br />
Taf.<br />
10: 4<br />
19"<br />
VP<br />
10; 5<br />
197<br />
202<br />
232<br />
LT13,0 44,8 2,23 al 2a<br />
10; 6<br />
197<br />
202
Art Sutur bei h =<br />
St. discotdea (QU. 1886'., dn:<br />
gr. diskos = Wurfscheibe,<br />
-ei<strong>des</strong> = -gestaltig.<br />
LT ist, gemäß HOFFMANN<br />
1913, Fig. 3, Taf. 58 in QU.<br />
1886; Orig. im IGPT.<br />
= Am. discus QU. 1886, Taf.<br />
57, Fig. 6.<br />
Von kleinerer Nabelweite als<br />
sehndensis, Zwischenform<br />
zwischen dieser und staufen-<br />
St. staufensis (OPP. 1S58),<br />
dn: s. Gattung<br />
HT ist Am. discus QU. 1S46.<br />
Taf. 8, Fig. 13, Orig. ver<br />
schollen.<br />
= Am. discus QU. 18S6, Taf.<br />
5~, Fig. 3-5, 12 u. 13:<br />
= Am. discus densiseptus QU.<br />
1SS6. Taf. 57, Fig. 1, 2 u. 9;<br />
= Am. discus dai'ilobus QU.<br />
1SS6, Taf. 57, Fig. 10 u. 11.<br />
Engnabligste Art der Gattung<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
17 cm<br />
Skulptur d<br />
Die lnnenwändungen der bis zu<br />
d w<br />
25 erreichenden Art sind<br />
mit schwachen, meist bifurkie-<br />
renden Sinusrippen bedeckt,<br />
die aber bei ausgewachsenen<br />
Stücken nicht in Erscheinung<br />
treten. Scharfer Kiel nur in der<br />
Jugend noch abgesetzt, später<br />
fastigat.<br />
Nabeiwand senkrechr oder<br />
wenig verschieden davon.<br />
in cm<br />
LT 7,9<br />
15,9<br />
Neben glatten Innenwindungen jHT 8,4<br />
kommen fein- und grobnppige i<br />
Varianten mit weniger 2<br />
geschwungenen Sinusrippen I<br />
vor, die nur in frühester Jugend , 6<br />
spalten und ab d ^ 3,5 einzeln,<br />
aber zu 2 oder 3 gebündelt i 12<br />
sind. Die meisten Stücke sind<br />
jedoch bereits sehr früh völlig i 19,5<br />
glatt.<br />
Messerscharfer Kiel niemals<br />
abgesetzt.<br />
Nabeiwand fast immer über<br />
hängend.<br />
iMJuigia BAYLE 18~8; dn: R. A. B. S. LUDWIG, Fabrikinspektor und Geologe, 1812-1880; TA Ludwigia murchisonae 'SOW. 1S29 . Klein- bis großwüchsige Formen mit mittel<br />
weitem, seltener engem Nabel und meist hochrechteckigem bis hochtrapezoidem, seltener spitzbogigem Querschnitt. Flanken m derjugend stets mit sinusförmigen Rippen, im Alter<br />
meist glatt, Externseite kaum berippt, mit abgesetztem Kiel versehen. Von Leioceras und Staufenia durch kleineres Q bei gleichem d und stärker zerschlitzte Suturen geschieden.<br />
Graphoceras hat retroverse Sichelrippen und konkave Flankenpartien. Während CALLOMON 1963 Ludwigina als mikroconchen Panner von Ludwigia betrachtet, ward hier dem<br />
Beispiel von CONTENT 1969 gefolgt. Ober-Aalcnium.<br />
1<br />
"lergattung Ludwigia s. str. '= Brasilia BUCKM. 1898); großwüchsige und mittelgroße Vertreter der Gattung ohne Ohren am Altersmundsaum.<br />
•' • /- bangt DOUVILLE<br />
18S5. dn: E. HAUG. Geo-<br />
"ge in Straßburg und Paris,<br />
IS61-1927.<br />
HT ist Am. murchisonae<br />
obtusus QU. 1846. Taf. ~,<br />
'• 1 2. Orig. verschollen.<br />
3-''.\ murcl'isonae obtusus<br />
'•!''• IsSh. T.if. 59. Fig. 2<br />
"0. Em. 9.<br />
ca. 40 nun<br />
Kräftige, scharfe Sichelrippen<br />
mit leicht proradiaten, manch<br />
mal knotig verdickren Stielen<br />
spalten auf der inneren Flan<br />
kenhälfte in 2 retrokonkave<br />
Bogen, die extern gegen den<br />
abgesetzten, scharfen Kiel vor<br />
schwingen. Sporadisch Schait-<br />
und Einzelnppen, Skulptur<br />
schwächung im Alter. /.. oh'.u-<br />
sifornus BUCKM. 1899 hat<br />
geringfügig dichtere Rippen<br />
(HTi und wenig größeres Q.<br />
18<br />
18,5<br />
(lO'i<br />
22±5<br />
T4±5<br />
9±4<br />
HT 4,2 2~<br />
H<br />
in %<br />
50<br />
48<br />
5l±4<br />
58<br />
58<br />
56<br />
30 45<br />
1,87<br />
2,17<br />
2,27<br />
Ü9<br />
27?<br />
275<br />
2,5<br />
1,26<br />
T738<br />
T742<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
al 2a<br />
10:<br />
197<br />
202<br />
al 2a<br />
11; 1<br />
197<br />
202<br />
211<br />
232<br />
53
L. IL.) bullifera (BUCKM.<br />
Art Sutur bei h =<br />
1899), dn: lat. Bulla = Blase,<br />
fero — tragen.<br />
= L. crassa HORN 1909<br />
'gemäß SP1EGLER 1966)<br />
Breitmündige, grob skulp-<br />
tierte Art mit kräftigen Kno<br />
ten.<br />
L. (L.) murchisonae (SOW.<br />
1825), dn: Gattin von R. I.<br />
MURCHISON, engl. Geo<br />
loge, 1792-1871.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Bristol City<br />
Museum, England, abgebildet<br />
in ARKELL 1956, Taf. 34,<br />
Fig. 3<br />
Von hangt durch etwas grö<br />
ßeres N und anderen Rippen-<br />
verlauf, von bullifera durch<br />
dichtere Berippung und grö<br />
ßeres Q geschieden.<br />
L. murchisonae fakifera RIE<br />
BER wird von SPIEGLER in<br />
murchisonae s. str. einbezo<br />
gen. L. subtabulata (BUCKM.<br />
1898) hat etwas kleineres N.<br />
L. (L.) latecostata ALTHOFF<br />
1940, dn: lat. latus = breit,<br />
costatus = berippt.<br />
LT ist L. obtusa latecostata<br />
ALTHOFF 1940, Taf. 2, Fig.<br />
5 (gemäß SPIEGLER 1966}.<br />
= Am. murchisonae obtusus<br />
QU. 18S6, Taf. 58, Fig. 9.<br />
Sehr ähnlich murchisonae,<br />
lediglich von gröberer Skulp<br />
tur.<br />
L. (L.) bradfordensis<br />
(BUCKM. 1887), dn:<br />
Bradford Abbas, Fundon in<br />
Dorset (England).<br />
LT ist Fig. 5 u. 6, Taf. 4 in<br />
BUCKM. 1887.<br />
= Am. murchisonae planatus<br />
QU. 18S6, Taf. 59, Fig. 16.<br />
Ahnlich murchisonae, aber<br />
von dichterer Berippung,<br />
mehr spitzbogigem Quer<br />
schnitt und kleinerem N.<br />
54<br />
1 /^n ^ _ —<br />
26 mm<br />
4,5 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
6,4 cm<br />
Skulptur d<br />
Der HT zeigt leicht proradiate<br />
Rippenstiele, die bei ca. 40%<br />
Seitenhöhe in stumpfen Knoten<br />
zu retrokonkaven Sekundärrip<br />
pen bifurkieren. Im Alter riik-<br />
ken die Spaltpunkte nach<br />
außen, die Rippen werden<br />
zunehmend wulstig und verfla<br />
chen. Kiel nur in der Jugend<br />
leicht abgesetzt, später fastigat.<br />
Proradiate, kräftige Rippen<br />
stiele, oft knotig verdickt, spal<br />
ten innerhalb der Flankenmitte<br />
mit markantem Rückwärts<br />
knick in 2, selten 3, stark<br />
retroradiate bis retrokonkave<br />
Sekundärrippen auf. Dazwi<br />
schen Einzelrippen ohne Kno<br />
ten. Im Gegensatz zu L. baugi<br />
streben die Rippen senkrecht<br />
gegen den abgesetzten Kiel,<br />
ohne ihn zu erreichen,<br />
wodurch glatte Kielbänder ent<br />
stehen. Die Skulptur schwändet<br />
im Alter.<br />
o<br />
24 mm 8 cm<br />
Kräftige, weitständige, radiale<br />
bis proradiate Rippenstiele,<br />
meist wulstig verdickt, bifurkieren<br />
unter Rückwärtsbiegung<br />
auf Flankenmitte; später herrschen<br />
sichelförmige Einzel- und<br />
Schaltrippen vor. Am Außenbug<br />
Rippenüberhöhung, Ausläufer<br />
schwängen gegen den<br />
abgesetzten, niedrigen Kiel vor.<br />
34 mm<br />
Ü<br />
5,8 cm<br />
41 mm 13 cm<br />
Berippung ähnelt weitgehend<br />
der von murchisonae, ist<br />
jedoch dichter. Abweichend<br />
von murchisonae schwingen<br />
die Sekundärrippen am Außen<br />
bug, wo sie auch am bestän<br />
digsten sind, stärker vor, so<br />
daß sie stark provers in das<br />
glatte Kielband münden. Skulp<br />
tur erlischt sehr früh. Formen<br />
mit beständigerer Skulptur<br />
wurden von SPIEGLER als<br />
L. baylü, von CONTENT als<br />
L. bradfordensis baylei<br />
(BUCKM. 1887) bestimmt.<br />
in cm<br />
HT 3,3<br />
2<br />
6<br />
12<br />
15,5<br />
HT 20<br />
2<br />
6<br />
12<br />
16<br />
LT 5,7<br />
3,5<br />
5,1<br />
8<br />
LT 13,6<br />
2<br />
6<br />
12<br />
15,5<br />
N<br />
in %<br />
43<br />
40<br />
39<br />
28<br />
39<br />
30<br />
33<br />
33<br />
32<br />
35<br />
32<br />
41<br />
39<br />
32<br />
23<br />
32<br />
28<br />
27+4<br />
26<br />
H<br />
in %<br />
35<br />
36<br />
4Ü<br />
45<br />
40<br />
39<br />
39<br />
41<br />
42<br />
46<br />
42<br />
41<br />
36,5<br />
42<br />
47<br />
45<br />
44<br />
44<br />
44<br />
Q<br />
0,8<br />
Ü~8<br />
T76<br />
1,62<br />
1,59<br />
Ü<br />
"I<br />
T~85<br />
2,03<br />
1,56<br />
1,26<br />
0,98<br />
1,5<br />
2,1<br />
176<br />
T79 j<br />
271<br />
2,23<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
(30) SR al 2a<br />
20 PR<br />
38 SR<br />
22 PR<br />
45 SR<br />
24 PR<br />
33 SR<br />
11; 3<br />
45<br />
202<br />
232<br />
al 2a<br />
11; 4<br />
45<br />
202<br />
232<br />
36 SR 1<br />
33 PR<br />
60 SR<br />
al 2a<br />
11; 5<br />
45<br />
232<br />
al 2a<br />
12; 1<br />
45<br />
197<br />
202<br />
232
UA L. (L.) bradfordensis<br />
An Sutur bei h =<br />
deleta (BUCKM. 1899), dn:<br />
Quer<br />
schnitt<br />
beid =<br />
lat. deleo = auslöschen. f \<br />
= L. intrahei'is RIEBER<br />
1963, Taf. 6, Fig. 5 u. 6 (?).<br />
Von der Nominatunteran<br />
durch extrem feine Berip<br />
pung geschieden; nur mittel<br />
groß werdend.<br />
L. (L) gigantea (BUCKM.<br />
1888), dn: lat. giganteus =<br />
riesig.<br />
Jugendexemplare schwer von<br />
bradfordensis deleta zu tren<br />
nen; etwas kleinere Nabel<br />
weite und höhere Endgröße,<br />
strarigraphisch jünger<br />
(Gigantea-Honxont CONTI-<br />
NIs).<br />
23 mm<br />
lA<br />
6,7 cm<br />
Skulptur d<br />
Der HT zeigt eine feine, leicht<br />
unregelmäßige Streifung, beste<br />
hend aus konkaven Stielen, die<br />
in Flankenmitte abrupt nach<br />
hinten biegen und, anfangs<br />
retroradiat, am Außenbug<br />
leicht vorschwingen. Während<br />
die streifigen Rippchen oft<br />
gebündelt erscheinen, kommen<br />
auch Stadien mit regelmäßigen,<br />
sehr feinen Rippen vor.<br />
^\ Wie bei bradfordensis deleta<br />
fehlen ab d 2 eigentliche<br />
9 cm<br />
Rippen u. sind durch dichte,<br />
sichelförmige, retroverse Strei<br />
fung ersetzt, die bis zum abge<br />
setzten Kiel auf fastigatem<br />
Venter vordringt.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf,<br />
Lit.<br />
HT 5,7 27 44 2,11 al 2a<br />
8,7 23 46 1,8 (120) 12; 2<br />
1 24,a<br />
2<br />
6<br />
12<br />
20<br />
18 47<br />
Untergattung Pseudograpboceras BUCKM. 1899; dn: gr. pseudo- = falsch, Graphoceras $. u.;TA Ps. literatnm BUCKM. 1899. Gemäß dem Vorschlag CONTINIs werden alle mikro-<br />
conchen Arten der Gattung Ludwigia unter Pseudograpboceras zusammengefaßt.<br />
L. (Ps.) subtuberculata RIE<br />
BER 1963, dn: lat. sub =<br />
unter (-geordnet), tubercula-<br />
tus = beknotet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im 1GPT.<br />
SPIEGLER 1966 betrachtet<br />
die Art als Synonym zu<br />
anguliferum BUCKM. (ohne<br />
das englische Material gese<br />
hen zu haben).<br />
/-. (Ps.) umbilicata BUCKM.<br />
1899, dn: lat. umbilicatus =<br />
genabelt. (<br />
Von größerem Q und etwas<br />
anderer Skulptur als subtu-<br />
bcraihtd. Das Exemplar in<br />
RIEBER 1963 ist eine fein-<br />
rippigc Varietät.<br />
'• Ts.: Mvetka (HORN<br />
. dn: lat. helveticus =<br />
schweizerisch.<br />
Durch leine, unregelmäßige<br />
''•crippung von vorstehenden<br />
Arten geschieden. Jugende-<br />
•senipl.ut nur schwer von L.<br />
' hrjjfurdensis zu trennen.<br />
1 1<br />
5,6 cm<br />
/~N<br />
\<br />
w<br />
3,2 cm<br />
InJ<br />
5 cm<br />
Kräftige, proradiate, unregel<br />
mäßig knotig verdickte Rippen<br />
stiele bifurkieren bei ca. 35%<br />
Flankenhöhe zu retroradiaten<br />
bis leicht retrokonkaven Sekian-<br />
därrippen, die fast senkrecht<br />
gegen den abgesetzten, niedri<br />
gen Kiel auf flachem Venter<br />
streben. Ohren am Alters<br />
mundsaum.<br />
Besonders die stark proversen,<br />
erst am Innenbug einsetzenden<br />
Primärrippen zeichnen sich<br />
durch große Unregelmäßigkeit<br />
aus. Bifurkation bereits auf<br />
dem innersten Flankendrittel<br />
sporadisch, häufig Schalt- und<br />
Einzelrippen, alle bei ca. 30°-o<br />
Seitenhöhe stark nach hinten<br />
biegend. Sekundärrippen retro<br />
radiat und am Außenbug stark<br />
vorschwingend. Kiel niedrig<br />
und abgesetzt.<br />
In Stärke und Abstand unregel<br />
mäßige Sinusrippen, teils<br />
gebündelt, im Alter durch<br />
Schaltrippen auf äußerer Flan<br />
kenhälfte vermehrt. Schwacher,<br />
abgesetzter Mediankiel, Ohren<br />
am Altcrsmundsaum.<br />
27±5<br />
2T±4<br />
21<br />
25<br />
43<br />
48<br />
46<br />
43<br />
2,1<br />
176<br />
2ß<br />
Iß<br />
2,1<br />
27 PR<br />
HT 4,7 37 36,4 1,54 |<br />
54 SR<br />
3,6<br />
5<br />
40<br />
36<br />
36<br />
Jf<br />
22 PR<br />
T748 |<br />
44 SR<br />
32<br />
45<br />
202<br />
al 2a<br />
12; 3<br />
45<br />
232<br />
al 2a<br />
12; 4<br />
20 PR<br />
1,3 |<br />
40 SR 45<br />
202<br />
HT 3,2 38 35 1,6 40 SR al 2a<br />
40 PR<br />
3.2 31 40 ü 1 52 SR<br />
4,3 34 39<br />
28 PR<br />
50 SR<br />
12; 5<br />
32<br />
45<br />
202<br />
232<br />
HT 4.5 26 44 1,77 al 2a<br />
3,5 26 44 T768 12; 6<br />
4,6 27 4" T779 45<br />
128<br />
202<br />
55
Graphoceras BUCKM. 1898; dn: gr. grapho = schreiben, ceras = Horn; TA Lioceras concavum var. v~scriptum BUCKM. 1888. Flach-scheibenförmige Gehäuse, die große Ähnlich<br />
keit mit Ludwigia aufweisen und sich nur durch schärferen Rippenknick, abgeschwächte Stiele und oft konkav eingezogenes inneres Flankendrittel unterscheiden. Concavum-'Louti<br />
<strong>des</strong> Ober-Aaleniums.<br />
Untergattung Graphoceras s. str., makroconche Vertreter der Gattung, ohne Ohren am Altersmundsaum.<br />
Gr. (Gr.) concavum (SOW.<br />
1815), dn: lat. coneavus —<br />
hohl.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im BMNH.<br />
Art Sutur bei h =<br />
= Lucyaf cavata, = Gr. flac-<br />
cidum, = Gr. mclusum, alle<br />
BUCKM. 1904.<br />
Gr. (Gr.) decorum BUCKM.<br />
1904, dn: lat. decorus =<br />
stattlich.<br />
Dichter berippt als concavum<br />
und engnabliger in der<br />
Jugend. Von RJEBER als<br />
Varietät von concavum ange<br />
sehen.<br />
Gr. (Gr.) fallax (BUCKM.<br />
1888), dn: lat. fallax = trüge<br />
risch.<br />
= Ludwigia lucyi BUCKM.<br />
1889, Taf. 21, Fig. 7-11.<br />
Von größerer Nabelweite und<br />
weitständigerer Berippung als<br />
vorstehende Arten.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
45 mm 8,5 cm<br />
14 mm 4,5 cm<br />
Pf<br />
15 i 18 cm<br />
Skulptu d<br />
Weitständige, konkave bis pro<br />
konkave Rippenstiele bifurkie<br />
ren mit starkem Rückwärts<br />
knick bei manchmal knotiger<br />
Verdickung in Flankenmitte zu<br />
auffallend retrokonkaven<br />
Sekundärrippen. Bei d « 4<br />
erlöschen die Stiele, bei d = 8<br />
die Sichelbogen. Relativ hoher,<br />
abgesetzter Kiel.<br />
Die Stiele der dichten, aber in<br />
ihrer Dichte dennoch variablen<br />
Sichelrippen schwellen zur<br />
Flankenmitte an und biegen<br />
dort stark nach hinten. Manch<br />
mal sind die prokonkaven<br />
Stiele bis zur Unkenntlichkeit<br />
geschwächt. Abgesetzter, nicht<br />
hoher Mediankiel.<br />
Auf den Innenwindungen rela<br />
tiv weitständige, proradiate<br />
Rippenstiele, über dem kanti<br />
gen Innenbug beginnend. Im<br />
Alter schwache, wulstige, pro<br />
konkave Primärrippen, die auf<br />
Flankenmitte zu retrokonkaven<br />
Sicheln nach hinten knicken,<br />
dabei bifurkierend oder auch<br />
einzeln bleibend. Während die<br />
Stiele erlöschen, bleiben die<br />
Sicheln noch erkennbar. Abge<br />
setzter Kiel.<br />
Untergattung Ludwigella BUCKM. 1904; dn: s. Ludwigia; TA L. arcitenens BUCKM. 1902. Mikroconche Vertreter der Gattung mit Ohren am Altersmundsaum.<br />
Gr. (L.) cornu (BUCKM.<br />
1887), dn: lat. cornu =<br />
Horn.<br />
LT ist, gemäß SPIEGLER<br />
1966, Fig. 1-2, Taf. 4 in<br />
BUCKM. 1887.<br />
56<br />
15 mm 3,7 cm<br />
Schwache, stark proradiate<br />
Rippenstiele knicken bei ca.<br />
40% Flankenhöhe zu retrover-<br />
sen Bogen nach hinten, die,<br />
durch Schaltrippen vermehrt,<br />
provers an glatten Kielbändern<br />
enden. Sichelknicke im Alter in<br />
die langen, schmalen Ohren<br />
<strong>des</strong> Mundsaums hineingezo<br />
gen. Scharfer, schwach abge<br />
setzter Kiel.<br />
in cm<br />
HT 6,4<br />
12<br />
HT 17<br />
2,8<br />
5,6<br />
11<br />
LT 6,4<br />
2<br />
5<br />
17<br />
32<br />
20<br />
16<br />
22<br />
21<br />
25<br />
29<br />
27<br />
26<br />
27,5<br />
30<br />
26<br />
51<br />
43<br />
47<br />
51<br />
48<br />
50<br />
42<br />
44<br />
46<br />
46<br />
41,5<br />
46<br />
44 .<br />
2,3<br />
ZT<br />
1,9<br />
21<br />
2,1 '<br />
1,7<br />
1,81<br />
1,82<br />
2,15<br />
Ü67<br />
IM<br />
50 SR<br />
20 PR<br />
40 SR
Gr. (L.) rudis (BUCKM.<br />
Art Sutur bei h =<br />
1889), dn: lat. rudis = roh.<br />
LT ist, gemäß SPIEGLER<br />
1966 (abweichend von CON<br />
TENT 1969), Fig. 13, Taf. 15<br />
in BUCKM. 1889.<br />
= Ludwigia impolita RIEBER<br />
1963 (?).<br />
Gr. (L.) apertum BUCKM.<br />
1888), dn: lat. apertus =<br />
offen, entblößt.<br />
LT ist, gemäß SPIEGLER<br />
1966, Fig. 7-8, Taf. 15 in<br />
BUCKM. 1888.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch etwas kleineres N,<br />
etwas größeres Q und besoi<br />
dere Berippung geschieden.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d -<br />
9,4 mm 3,5 cm<br />
A<br />
8,1 mm 3 cm<br />
Skulptur<br />
Kräftige Rappen mit proradia-<br />
ten Stielen knicken bei ca. 40%<br />
Flankenhöhe unter etwa 120°<br />
nach hinten bei teilweiser<br />
Bifurkation zu retroradiaten,<br />
am Außenbug mäßig vor<br />
schwingenden Sekundärrippen.<br />
Niedriger, abgesetzter Kiel.<br />
Rippenstiele stark provers, nur<br />
auf Innenwindungen sichtbar,<br />
abd w<br />
4 beim HT durch<br />
Anwachsstreifung ersetzt (auf<br />
Schale), die dem gattungstypi<br />
schen Sichelknick folgt. Auf<br />
äußerer Flankenhälfte auch im<br />
Alter stark retroradiate Sekun<br />
därrippen, die am Außenbug<br />
nur wenig vorschwingen und<br />
dort erlöschen. Niedriger abge<br />
setzter Kiel.<br />
LT 4,5 32<br />
Hyperlioceras BUCKMAN 1889; dn: Lioceras = Leioceras, s. d., gr. hyper- = über; TA Am. discites WAAGEN 1867. Mittelgroße, 20 cm wenig übersteigende Graphoceratidae von<br />
hochdreieckigem bis hochrechteckigem Querschnitt mit steiler, oft sogar überhängender Nabeiwand. Extemseite stets durch ausgeprägten Außenbug abgesetzt, scharfer Kiel<br />
scheint dem fastigaten Venter aufgesetzt. Die oft bifurkierenden Sichelrippen erlöschen zunächst auf der inneren Flankenhälfte; ab d = 5 bis 8 sind die Flanken glatt. Unterstes Bajo<br />
cium.<br />
H. <strong>des</strong>ori (MOESCH 1867), A Neben feinen Anwachslinien HT12.4 11 54 2,23 al 2b<br />
dn: Prof. E. DESOR, Neuchätel,<br />
19. Jh.<br />
/<br />
/<br />
\<br />
\<br />
auf der Schale tragen die<br />
Innenwindungen gattungstypische,<br />
flach wulstige Sichelrip<br />
2 30 4475 174<br />
bj la<br />
13; 6<br />
HT (Foto <strong>des</strong> Nachgusses) in<br />
U. BAYER 1969, Taf. 1, Fig.<br />
/ /N \<br />
pen mit stark proradiatem 4 22 497J T79<br />
2. durch Schaltrippen vermehrt.<br />
2<br />
3,4<br />
7,6<br />
37<br />
32<br />
26<br />
27<br />
23<br />
40<br />
40<br />
42<br />
44<br />
42<br />
46<br />
1,3<br />
1,6<br />
Ü8<br />
1,9<br />
2,5<br />
24 PR<br />
36 SR<br />
17 PR<br />
27 SR<br />
19 PR<br />
30 SR<br />
f\ \ Stiel. Die Sichelbögen sind 11<br />
Bei d 6 verlöschen die Rip<br />
8 12 52 ITT 45<br />
= Am. discoideus QU. 1886, pen. Zwischen d = 1 u. d = 4 14 TT 52 271 232<br />
Taf. 58, Fig. 4; = Hyperlioce jk entsteht die fastigate Extem-<br />
ras deflexum BUCKM. 1904.<br />
(vi<br />
Nabeiwand - im Gegensatz 1 1<br />
zu discites u. subsectum - \ /<br />
steil bis senkrecht (MOESCH<br />
18721.<br />
" d'xita (WAAGEN 1867), /<br />
\ 1<br />
ca. 50 mm 9 cm<br />
\ Nur<br />
fläche mit dem fadenförmig<br />
aufgesetzten Kiel.<br />
in: Diskus-ähnlich. / \ gen Sichelrippen, die ab d == 2<br />
HT m der BSPG nicht auf-<br />
j<br />
•••
Art Sutur hei h =<br />
H. subsectum (BUCKM.<br />
1905), dn: lat. suhsectus =<br />
ahgeschnitten.<br />
HT ist H. discoideum QU. in<br />
BUCKM. 1889, Taf. 19, Fig.<br />
3 u. 4.<br />
= H. staeschei U. BAYER<br />
1969.<br />
Von discites durch kleineres<br />
Q, von <strong>des</strong>ori durch meist<br />
überhängende Nabelwand<br />
geschieden.<br />
H. rudidiscites BUCKM.<br />
1904, dn: lat. rudis = roh,<br />
grob, discites s. o.<br />
HT ist H. discites BUCKM.<br />
1889, Taf. 17, Fig. 3 u. 4.<br />
= H. liodiscites BUCKM.<br />
1904; = Ludwigia tencra<br />
DORN 1935<br />
Von allen vorstehenden<br />
Arten durch hochrechteckigen<br />
Querschnitt geschieden,<br />
von der folgenden durch<br />
engeren Nabel.<br />
H. subdiscoidea BUCKM.<br />
1889, dn: gr. diskos - Wurfscheibe,<br />
sub- = untergeordnet.<br />
LT in BUCKM. 1889, Taf.<br />
19, Fig. 5 u. 6 (nach BAYER<br />
1969).<br />
Ähnlich rudidiscites durch<br />
hochrechteckigen Querschnitt<br />
ausgezeichnet, von<br />
jenem jedoch durch größeres<br />
N getrennt.<br />
58<br />
V<br />
80 .<br />
Querschnitt<br />
hei d =<br />
70 mm 13 cm<br />
60 i<br />
9 cm<br />
Skulptu d<br />
in cm<br />
Neben feiner Anw achsstreifung<br />
existieren bis d 5,5 feine,<br />
schwach sichelförmige Rippen.<br />
Die Ausbildung von Kiel und<br />
Externseite ähnelt der von H.<br />
discites.<br />
Die gattungstypischen Sichelrippen<br />
erlöschen w ie bei den<br />
anderen Arten im Alter. Die<br />
breite Externseite mit dem aufgesetzten<br />
Kiel ist ab d = 2 ausgebildet<br />
und wird bis ins Alter<br />
beibehalten.<br />
Die Sichelrippen der Innenwindungen<br />
sind meist sehr kräftig<br />
und gehen wie bei den anderen<br />
Arten frühzeitig verloren. Ab d<br />
" 1 tritt der Kiel auf, ab d « 2<br />
markiert sich der Außenbug,<br />
der im Alter kantig wird. Die<br />
flache oder schwach fastigate<br />
Externseite trägt den leistenartig<br />
aufgesetzten Kiel bis ins<br />
Alter.<br />
HT 1:<br />
14<br />
20<br />
HT 10<br />
2<br />
4<br />
8<br />
14<br />
LT 8,(<br />
2<br />
4<br />
12<br />
IT<br />
IT<br />
TT<br />
TT3<br />
TT<br />
13<br />
26<br />
IÖ<br />
TT<br />
T4<br />
18<br />
33<br />
TS<br />
IÖ<br />
T8<br />
H<br />
in %<br />
53<br />
43<br />
49<br />
54<br />
53<br />
JT<br />
50<br />
45<br />
4875<br />
5T<br />
5T75<br />
49<br />
43<br />
47<br />
48<br />
4675<br />
2.05<br />
T75Ü<br />
TTsö<br />
Ifi<br />
1X5<br />
1725<br />
2,6<br />
T765<br />
ITT<br />
1745<br />
2765<br />
2,2<br />
1,5<br />
TT?<br />
27Ö<br />
ITT
SOIininiinae BUCKM. 1892, incl. Clydonicerarinae BUCKM. 1924.<br />
Involute bis evolute Graphoceratidae mit oft beknoteten oder bedornten Rippen, vorwiegend auf jüngere Altersstadien beschränkt. Abgesetzter Kiel meist als Hohlkiel ausgebildet,<br />
teilweise von Nebenfurchen begleitet und manchmal im Alter erlöschend. Bajocium und Bathonium.<br />
Sonrnma BAYLE 1878; TA W'aagenia propinquans^ AYLE 1878. Heterogene Gruppe mittel- und grofiwüchsiger Sonniniinae, inzwischen auf etwa 250 Arten angewachsen (MOR<br />
TON 1975). Von BUCKM. in zahlreiche umstrittene Gattungen aufgesplittert und später wieder (HILTERMANN 1939, OECHSLE 1958) extrem zusammengefaßt. Mangels einer<br />
umfassenden Revision der Großgruppe werden auch hier alle Arten vorläufig in eine einzige «Gattung» Sonninia einbezogen. Ober-Aalenium bis Unter-Bajocium (s. DIETL u.<br />
HAAG 1980).<br />
5. propinquans (BAYLE<br />
An Sutur bei h =<br />
1878), dn: lat. propinquans =<br />
nahestehend, benachbart.<br />
Gemäß WEST. u. RICCARDI<br />
1972, S. 47, ist Abb. 3-4,<br />
Taf. 84 in BAYLE 1878 der<br />
LT; Orig. verschollen.<br />
S. -trigonata* (QU. 1886),<br />
dn: lat. trigonatus = drei<br />
eckig.<br />
LT ist nach OECHSLE Am.<br />
sowerbyi trigonatus QU.<br />
1886, Taf. 61, Fig. 14; Orig.<br />
im IGPT.<br />
Durch dreiecksähnlichen<br />
Querschnitt mit senkrechter<br />
Nabelwand und gröbere<br />
Skulptur von propinquans<br />
geschieden.<br />
S. berckhemeri DORN 1935,<br />
dn: F. BERCKHEMER,<br />
Leiter <strong>des</strong> Geol.-Paläont.<br />
Museums Stuttgart<br />
von 1925-1953.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
Weitnabliger als vorstehende<br />
Arten.<br />
V pu-udotuberculata DORN<br />
U''\ dn: tuherculatus =<br />
"cJ.imt, pseudo = unecht.<br />
1 1<br />
1" nicht auffindbar.<br />
durch die regelmäßige<br />
s<br />
"ilptur von vorstehenden<br />
Ancn untcrscheidbar.<br />
ca. 20 mm<br />
40 mm<br />
45 mm<br />
0<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
0<br />
7,5 cm<br />
6<br />
0<br />
U cm<br />
ö<br />
11 cm<br />
4/) mm 19 cm<br />
Skulptur d<br />
Auf den Innenwindungen <strong>des</strong><br />
LT ist jede 5. bis 6. der unre<br />
gelmäßigen, z. T. in Nabelnähe<br />
bifurkierenden Rippen mit<br />
einem rundlichen Knoten<br />
besetzt, der sich an die Naht<br />
anlegt. Knoten erlöschen bei d<br />
4; die bis dahin konkaven<br />
Rippen werden dann leicht<br />
sinusförmig und erlöschen bei<br />
d «* 12. Hoher Hohlkiel.<br />
Auf den Innenwindungen kräf<br />
tige, schwach sinusförmige<br />
Rippen, auf äußerem Flanken<br />
drittel undeutlich. Auf jeder 2.<br />
oder 3. Rippe kräftiger,<br />
gedrungener Knoten (ca. 8 pro<br />
Windung , in die Nabel wand<br />
der folgenden Windung einge<br />
drückt. Knoten zerfließen spä<br />
ter radial und erlöschen bei d<br />
= 7; Rippen erlöschen kurz<br />
danach. Niedriger Hohlkiel.<br />
Auf den innersten Windungen<br />
ist jede 3. bis 4. der groben,<br />
wulstigen Rippen beknotet; ab<br />
d Ä<br />
3 verschwinden die Rippen<br />
und die Knoten fließen radial<br />
über die Flanken. Bei d === 7<br />
verschwinden die Knoten; nur<br />
einzelne sehr schwache Rippen<br />
bleiben angedeutet. Ab d ~ 10<br />
sind die Flanken glatt.<br />
Auffallend regelmäßige, kräf<br />
tige Radialrippcn besitzen<br />
Maximalstärke auf Flanken<br />
mitte, so daß sie wulstigen<br />
Knoten ähneln. Bei d Ä<br />
10<br />
werden die Flanken <strong>des</strong> HT<br />
glatt. Abgesetzter Hohlkiel.<br />
in cm<br />
LT 5,2<br />
ß<br />
LT 11,5<br />
10<br />
N<br />
in %<br />
32<br />
29<br />
27<br />
29<br />
29<br />
H<br />
in %<br />
42<br />
44<br />
45<br />
44<br />
45<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
(1,3) (40) bj<br />
1,35<br />
T739<br />
±0,15<br />
lb-lc<br />
14; 4<br />
77<br />
121<br />
131<br />
176<br />
bj lb<br />
15; 2<br />
77<br />
176<br />
197<br />
HT 12 35 40 1,46 19 bj lb<br />
H l<br />
31 41 1,6<br />
1,8<br />
15; 3<br />
77<br />
bj lb<br />
16; 1<br />
176<br />
59
Art Sutur bei h =<br />
S. jugifera (WAAGEN 1867).<br />
dn: lat. jugum — Joch, ferre<br />
= tragen.<br />
HT in der BSPG.<br />
= Am. sowerbyi insignoidcs<br />
QU. 1886, Taf. 61, Fig. 11.<br />
Von pseudotuberculata nur<br />
durch feinere Rippen und<br />
wenig anderen Querschnitt<br />
geschieden.<br />
5. mesacantha (WAAGEN<br />
1867), dn: gr. acantha —<br />
Dorn, mesos = mitten (auf<br />
der Flanke).<br />
HT in der BSPG.<br />
Durch arttypische Knötchen<br />
auf der Flankenmitte der<br />
Alterswindungen ausgezeich<br />
net. Der HT der populären<br />
«Art» S. sowerbyi ist vermut<br />
lich ein Jugendexemplar von<br />
mesacantha.<br />
S. arenata (QU. 1886), dn:<br />
lat. arenatus = sandig.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im IGPT.<br />
Wie mesacantha auf den<br />
Alterswindungen bedornt,<br />
jedoch von wesentlich zarte<br />
rer Jugendskulptur. Sehr ähn<br />
lich S. patella, als deren UA<br />
sie OECHSLE 1958 ansah.<br />
S. adicra (WAAGEN 1867),<br />
dn: lat. a-dicrus = ungespal<br />
ten.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
= Am. sowerbyi costosus<br />
QU. 1886, Taf. 62, Fig. 3.<br />
WEST. 1966 vereinigt unter<br />
Sonninia adicra 75 "Arten»,<br />
lediglich getrennt in 4 For<br />
mengruppen.<br />
60<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
ca. 50 mm 11 cm<br />
39 mm 13,5 cm<br />
70 mm 28 cm<br />
40 mm 11 cm<br />
Skulptu d<br />
Auf den Innenwindungen<br />
dichte, regelmäßige, scharfe,<br />
leicht sinusförmige Rippen,<br />
manchmal gabelnd, andere als<br />
kurze Schaltrippen. Verdickun<br />
gen in den Gabelpunkten<br />
unscheinbar. Ab d = 5 am<br />
Innenbug Beginn der Skulptur-<br />
abschwächung, völliges Ver<br />
löschen in unterschiedlichem<br />
Alter. Wenig hoher, gerundeter<br />
Hohlkiel.<br />
Auf den Innenwindungen <strong>des</strong><br />
HT maximal 12 weitständige,<br />
kräftige Rippen, mit starken<br />
Knoten besetzt, die sich an die<br />
Nabelwand der nächsten Win<br />
dung anlehnen. Im Altersver<br />
lauf werden die schwach kon<br />
kaven Rippen schwächer und<br />
dichter und erlöschen im äuße<br />
ren Flankendrittel. Die Knoten<br />
bleiben auf Flankenmitte bis ins<br />
Alter deutlich (zuletzt etwa 50<br />
pro Windung).<br />
Auf den Innenwindungen leicht<br />
konkave bis sinusförmige Rip<br />
pen, die bei d ^ 6 undeutlich<br />
und weitständiger werden. Auf<br />
der Schale ungewöhnlich kräf<br />
tige, unregelmäßige Anwachsli<br />
nien. Auf Alterswindungen<br />
etwas oberhalb der Flanken<br />
mitte regelmäßige spitze Knöt<br />
chen. Niedriger Hohlkiel.<br />
Leicht retroradiate, regelmä<br />
ßige Rippchen der innersten<br />
Windungen werden allmählich<br />
undeutlich. Jede 2. oder 3. bil<br />
det Dornen aus, die radial zer<br />
fließen und ab d Ä<br />
6 weitstän<br />
digen Wulstrippen weichen, die<br />
in Flankenmitte Maximalhöhe<br />
besitzen und bis ins Alter<br />
beständig sind. Niedriger,<br />
gerundeter Hohlkiel.<br />
in cm<br />
HT<br />
HT<br />
HT<br />
10<br />
10<br />
17<br />
HT 13<br />
10<br />
17<br />
N<br />
in %<br />
31<br />
36<br />
30<br />
29<br />
27<br />
32<br />
30<br />
36<br />
39<br />
35±3<br />
38±3<br />
H<br />
in %<br />
43<br />
38<br />
44<br />
42<br />
42<br />
38<br />
42<br />
33<br />
35<br />
38<br />
38<br />
1,9<br />
2,1<br />
(2)<br />
2.2<br />
ITT<br />
i\9<br />
1,17<br />
1,33<br />
±0,1<br />
1,43<br />
29 PR<br />
14 Kn<br />
24 Kn<br />
19
An Sutur bei h :<br />
S. polyacantba (WAAGEN<br />
1867), dn: gr. acantha =<br />
Dorn, polys = viel.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
= Sonninia mayeri DORN<br />
1935 (von WAAGEN 1867<br />
beschrieben aber nicht abge<br />
bildet).<br />
Von adicra nur geringfügig<br />
durch schwächere Knoten<br />
und gleichmäßigere Berip<br />
pung der mittleren Windun<br />
gen geschieden.<br />
S. «ovalis» (QU. 1886), dn:<br />
von ovalem Windungsquer<br />
schnitt.<br />
LT ist, lt. OECHSLE 1958,<br />
Fig. 1, Taf. 62 in QU. 1886;<br />
Orig. im IGPT.<br />
Nach OECHSLE die häu<br />
figste süddeutsche Sonninien-<br />
art.<br />
OECHSLEs Unteranen ovalis<br />
s. Str., gracililobata und<br />
rudis werden hier zusammen<br />
gefaßt. S. gingensis WAA<br />
GEN liegt in der Variations<br />
breite von oualis.<br />
S. fissilobata (WAAGEN<br />
1867), dn: lat. fissilobatus =<br />
mit geschlitzten Loben.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
Nur durch etwas anderen<br />
Querschnitt, wenig kleineres<br />
N und beständigere Flanken-<br />
wellung von oualis geschie<br />
den.<br />
5. patella (WAAGEN 1867),<br />
dn: lat. patella = Schüssel.<br />
OECHSLE wählte WAA-<br />
GENs Fig. 2, Taf. 25, zum<br />
IT; Orig. in der BSPG.<br />
" -4 m. sowerby, caritiodiscus<br />
's'" 1SS6, Taf. 63, Fig. 3;<br />
'essomanus falcatus<br />
Q 1<br />
' 18X6, Taf. 63, Fig. 9.<br />
v<br />
'»n gleichem Querschnitt<br />
»•* AntWwj, aber durch<br />
^rL.,„ere Jugendskulptur<br />
u n J c , w<br />
- 1<br />
'" größeres N von<br />
geschieden.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
14 cm<br />
24 i<br />
69 mm 17 cm<br />
40 i 14 cm<br />
Skulptur d<br />
Auf den innersten Windungen<br />
z.T. unregelmäßige, sporadisch<br />
schwach bedornte, retrocostate<br />
Rippen, teilweise gabelnd.<br />
Nach Erlöschen der Dornen bei<br />
d -~ 4 Vorherrschen von regel<br />
mäßigen Rippen, deren<br />
Abstand sich zum gleichen<br />
Adultstadium wie bei adicra<br />
vergrößen.<br />
Auf den innersten Windungen<br />
schwache, radiale bis leicht<br />
retroradiate Rippen, von denen<br />
jede 3. ein feines, run<strong>des</strong> Knöt<br />
chen trägt. Während die Rip<br />
pen erlöschen, werden die<br />
Knoten kräftiger und zerfließen<br />
radial in weitständige Wülste,<br />
die im Bereich d = 4 bis 10<br />
ebenfalls erlöschen. Niedriger,<br />
breiter Hohlkiel.<br />
Skulptur der Innenwindungen<br />
meist nur aus Knötchen beste<br />
hend, die bald erlöschen.<br />
MORTON erwähnt Rippen,<br />
die schnell unregelmäßig wer<br />
den und spätestens bei d = 4<br />
verschwinden. Auf den Alters<br />
windungen radiale Flanken<br />
wülste, die auf der Wohnkam<br />
mer erlöschen. Niedriger Hohl<br />
kiel.<br />
Auf den Jugendwindungen<br />
markante radiale bis leicht<br />
sinusförmige Rippen, in radia<br />
len Wülsten am Innenbug bi-<br />
oder trifurkierend; kürzere Rip<br />
pen zwischengeschaltet.<br />
Abschwächung und Verlöschen<br />
der Skulptur bei wachsender<br />
Größe. Hohlkiel auf mittelgro<br />
ßen Windungen schmal und<br />
hoch, im Alter breiter und nie<br />
driger.<br />
in cm<br />
HT 27<br />
HT 8,5<br />
mayeri<br />
10<br />
17<br />
LT(27)<br />
10<br />
17<br />
24<br />
39<br />
HT 16,5<br />
23,5<br />
12<br />
17<br />
20<br />
LT|<br />
14<br />
10<br />
17<br />
24<br />
N<br />
in %<br />
43<br />
39<br />
38<br />
40<br />
21<br />
22<br />
22<br />
23<br />
19<br />
17<br />
17<br />
25<br />
IT<br />
18<br />
(25)<br />
26<br />
25<br />
25<br />
T<br />
32<br />
37<br />
38<br />
34<br />
47<br />
50<br />
48<br />
46<br />
42<br />
50<br />
50<br />
47<br />
49<br />
50<br />
(45)<br />
43<br />
46<br />
43<br />
(1,4)<br />
1,27<br />
Ü<br />
I~3<br />
1,71<br />
1,5<br />
1,7<br />
±0,1<br />
1,7<br />
1,9<br />
1,93<br />
1,7<br />
TT?<br />
1,9<br />
1,96<br />
2,03<br />
1,85<br />
ITT<br />
173<br />
26<br />
33<br />
31<br />
36<br />
61
Art Sutur bei h =<br />
S. stcphani (BUCKM. 1882),<br />
dn: DARELL STEPHENS,<br />
engl. Fossiliensammler im<br />
19. Jh.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in BUCKM.<br />
1882, Taf. 1, Fig. 1.<br />
= Dorsetensia oviformis<br />
DORN 1935 (?)<br />
Von ausgeprägt dreieckigem<br />
Querschnitt.<br />
S. tessoniana (D'ORB. 1845),<br />
dn: M. TESSON, franz.<br />
Sammler.<br />
Stests diskusförmig mit lanzettlichem<br />
Querschnitt u.<br />
außergewöhnlich kurzen<br />
Loben. Trennung von S. stephani<br />
oft schwierig.<br />
OECHSLE zählt auch relativ<br />
engnablige Stücke (abweichend<br />
vom HT) zu tessoniana.<br />
S. pseudotrigonata MAU<br />
BEUGE 1951, dn: pseudo =<br />
unecht, trigonata s. o.<br />
Im Gegensatz zu den meisten<br />
Sonninien relativ breitmündig.<br />
S. furticartnata (QU. 1856),<br />
dn: lat. furtus = Diebstahl,<br />
carinatus = gekielt, nach QU.<br />
= "Verstecktkieler», weil Kiel<br />
mit Schale verlorengeht.<br />
LT ist (lt. OECHSLE) Fig. 6,<br />
Taf. 14, QU. 1856, = Fig. 2,<br />
Taf. 20, DORN 1935.<br />
Sehr ähnlich der älteren S.<br />
ovalis, nur durch steilere<br />
Nabelwand (deutlicher Innenbug)<br />
von jener unterscheidbar.<br />
S. grandiplex OECHSLE<br />
1958, dn: bezogen auf das<br />
ähnliche Lithacoceras grandiplex<br />
QU. aus dem Malm.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im IGET (Nr.<br />
Ce 1054/25).<br />
S. rno<strong>des</strong>ta BUCKM. nahestehende<br />
"Art», jedoch mit<br />
gewellten Hanken im Alter.<br />
Von der ebenfalls gewellten<br />
S. fissilobata durch größeres<br />
N geschieden.<br />
62<br />
SO mm<br />
40 mm<br />
fi<br />
Querschnitt<br />
bei d =<br />
17,6 cm<br />
w<br />
0<br />
10 cm<br />
10 cm<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
Skulptur <strong>des</strong> HT besteht nur<br />
aus angedeutet sinusförmigen<br />
Anwachslinien, die im Alter<br />
konkav werden und am<br />
Außenbug stets stark vorschwingen.<br />
OECHSLE 1958<br />
erwähnt sichelförmige Rippen<br />
bis d * 2.<br />
Bis d *= 5 gabeln wulstige Rippen<br />
in länglichen Knoten auf<br />
innerer Flankenhälfte in 2-3<br />
Äste, die gleichmäßig fein<br />
gegen den abgesetzten Hohlkiel<br />
vorschwingen. Ab d 6<br />
sind die Flanken praktisch<br />
glatt.<br />
Auf den Innenwindungen<br />
dichte, nahezu radiale Rippen,<br />
von denen jede 4. bis 5. einen<br />
kleinen, spitzen Knoten trägt;<br />
Bifurkation und einzelne<br />
Schaltrippen häufig. Die Rippen<br />
verschwinden bei d w<br />
5,<br />
die Knoten bereits früher.<br />
Mäßig hoher Hohlkiel.<br />
Nur die innersten Windungen<br />
zeigen schwache, dichte Rippen,<br />
auf denen bisher keine<br />
Knoten oder Dornen beobachtet<br />
wurden. Manchmal ist<br />
Bifurkation dicht über dem<br />
Innenbug bei schwacher Verdickung<br />
angedeutet. Ab d = 8<br />
sind die Rippen zu sehr schwacher,<br />
unregelmäßiger Flankenwellung<br />
abgeschwächt, die<br />
nach etwa 1/2 Umgang verschwindet.<br />
60 mm 19 cm<br />
0<br />
Bis d = 5 dichte, leicht sinusförmige,<br />
schwache Rappen, die<br />
im Altersverlauf schnell erlöschen.<br />
Ab d = 18 Auftreten<br />
von flachen Wellen mit größter<br />
Höhe auf Flankenmitte und<br />
gegenseitigem Abstand von ca.<br />
4 cm. Niedriger Hohlkiel.<br />
90 mm<br />
24 cm<br />
< 6<br />
10<br />
15<br />
20<br />
26<br />
HT 10<br />
10<br />
17<br />
24<br />
26<br />
HT 6,7<br />
5<br />
7<br />
10<br />
HT 19<br />
11<br />
15<br />
HT<br />
I23 17<br />
22<br />
N<br />
in %<br />
13<br />
15<br />
T9<br />
IÖ<br />
IT<br />
22<br />
(22)<br />
11<br />
14<br />
T6<br />
19<br />
25<br />
31<br />
28<br />
23<br />
23<br />
23,4<br />
31<br />
33<br />
28<br />
31<br />
H<br />
in % Q Z<br />
53<br />
49<br />
49<br />
49<br />
48<br />
46<br />
(47)<br />
55<br />
53<br />
50<br />
47<br />
46<br />
43<br />
46<br />
45<br />
47<br />
46,8<br />
42<br />
39<br />
42<br />
37<br />
(2.1)<br />
1,6<br />
1,75<br />
1,75<br />
Ü6<br />
1,44<br />
(1,9)<br />
2,4<br />
in<br />
ITT<br />
1,96<br />
1,27<br />
1,30<br />
1,44<br />
1,2<br />
2,0<br />
1,78<br />
1,88<br />
1,75<br />
1,70<br />
1,56<br />
1,48<br />
Zone<br />
Tal.<br />
Lit.<br />
bj lb<br />
18; 3<br />
30<br />
1-6<br />
bj lb<br />
18; 4<br />
74<br />
119<br />
176<br />
bj lb<br />
18; 5<br />
157<br />
176<br />
bj lc<br />
19; 1<br />
77<br />
176<br />
197<br />
bj lb<br />
19; 2<br />
176
Witchellia BUCKM. 1889; dn: E. WITCHELL, Freund BUCKMANs; TA Am. laeviusculus SOW. 1824. Scheibenförmige, involute Sonniniinae mit meist glatten Altersflanken.<br />
Wegen ungenügender und z. T. widersprüchlicher Diagnose BUCKMANs («schw acher Hohlkiel, von zwei auf der Schale unsichtbaren Furchen begleitet») umstrittene Gattung, die<br />
mehrfach (HILTERMANN 1939, OECHSLE 1958, HUF 1968) abgelehnt wurde. Ihre ursprünglichen Arten wurden einerseits von BUCKM. selbst zu von ihm nachträglich auf<br />
gestellten Gattungen (Dorsetensia u. a.) gestellt oder ließen sich zwanglos den Sonninien eingliedern.<br />
U 7<br />
U 7<br />
U 7<br />
An Sutur bei h =<br />
. laeviuscula (SOW. 1824),<br />
dn: lat. laevis = glatt, lae<br />
viusculus = ein wenig glatt.<br />
LT ist Fig. 1, Taf. 451 in<br />
SOW. 1824, Orig. im<br />
BMNH.<br />
Sehr seltene Art, vermutlich<br />
auf Franken beschränkt, wo<br />
sie DORN in den unteren<br />
«Humphrisianumschichten»<br />
gefunden zu haben glaubte.<br />
W. sutneri (BRANCO 1879)<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
Evoluter als laeviuscula und<br />
mit Kielfurchen versehen.<br />
WEST. 1969 faßt die mor<br />
phologische Folge von W.<br />
sutneri über falcata, laevius<br />
cula u. andere bis patefactor<br />
als Superart auf.<br />
ca. 25 mm<br />
Querschnitt<br />
Skulptur d N H Q Z<br />
0<br />
bei d =<br />
Der LT zeigt auf den Innenwindungen<br />
unregelmäßige, teilweise<br />
gebündelte Rippen, die<br />
kleine Knötchen verschiedener<br />
Stärke tragen. Die Außenw indung<br />
trägt schwache, leicht<br />
sinusförmige Rippen, geteilt in<br />
7 Primärrippen und 23 auf die<br />
äußere Flankenhälfte<br />
beschränkte Schaltrippen.<br />
Hoher, stumpfer Hohlkiel, von<br />
in cm<br />
LT 6,8<br />
in %<br />
18<br />
in %<br />
48,5<br />
14 PR<br />
1," j 46 SR<br />
7 cm<br />
Q<br />
6 cm<br />
glatten Bändern, aber nicht von<br />
Furchen begleitet. DORNs 3<br />
schwäbische Exemplare zeigen<br />
im Gegensatz zum LT einheit<br />
liche Rippen bis zum Innenbug.<br />
Auf den Innenwändungen<br />
gleichmäßige, einfache oder<br />
bifurkierende Rippen; auf den<br />
Außenvvindungen entsprechen<br />
wulstigen Rippenstielen auf<br />
dem inneren Fiankendrittel<br />
jeweils mehrere Sekundärrip<br />
pen von prokonkavem Verlauf.<br />
Kielfurchen ab d = 2 (HT)<br />
deutlich.<br />
14 PR<br />
HT6,1 30 44 1,52 |<br />
44 SR<br />
Pelekodites BUCKM. 1923; dn: gr. pelekys = Beil; TA P. pelekusBUCKM. 1923. Kleinwüchsige, evolute Sonniniinae mit geschwungenen Rippen, Kiel und Ohren am adulten Mund<br />
saum. Die Zuordnung als mikroconche Sexualpartner ist bei Witchellia am wahrscheinlichsten, aber auch bei einigen Sonninien'möglich. Pelekodites wird <strong>des</strong>halb vorerst als Gattung<br />
beibehalten (vergl. WEST. 1969, S. 115). Abgrenzung gegen Poecilomorphus umstritten.<br />
f. zurcheri (DOUV1LLE<br />
1885;, dn: M. ZÜRCHER,<br />
franz. Geologe <strong>des</strong> 19. Jh.<br />
IT ist Fig. 6, Taf. 1 in DOUv<br />
" LI. 188 5 (nach BUCKM.<br />
1923:.<br />
MORTON 19-5 vereinigt<br />
'••4er diesem Artiumen unter<br />
»orhehah moisyi BRAS1I .<br />
BUCKM., costidatus<br />
R<br />
l CKM. und Poecilomor-<br />
*" u<br />
> '»wvn HUF<br />
A7 f \ p s ^ S \j<br />
5,8 mm 3 cm<br />
Abb. <strong>des</strong> LT zeigt regelmäßige,<br />
retroverse Sinusrippen und<br />
einen wenig erhabenen Kiel mit<br />
schwachen Nebenfurchen.<br />
LT 2,9 (38) 1,0<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bj lb<br />
19; 3<br />
65<br />
77<br />
166<br />
264<br />
bj lb<br />
19; 4<br />
24<br />
264<br />
63
Art Sutur bei h :<br />
P. scblumbergeri (HAUG<br />
1893), dn: CH. SCHLUM-<br />
BERGER, Zeitgenosse<br />
HAUGs.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in Sig.<br />
SCHLU.MBERGER, Sorbonne,<br />
Paris.<br />
= Witchellia sayni DORN<br />
1935, Taf. 10, Flg. 3.<br />
Vermutlich ebenfalls mit zurcheri<br />
synonym, nur wenig<br />
größeres N und weniger<br />
retroverse Rippen als jener.<br />
P. buckmam (HAUG 1893),<br />
dn: S. S. BUCKMAN, engl.<br />
Geologe, 1860-1929.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in Sig.<br />
SCHLU.MBERGER, Sorbonne,<br />
Paris.<br />
= Witchellia pinguis DORN<br />
1935, Taf. 12, Fig. 4.<br />
Gegenüber vorstehenden<br />
Arten Berippung feiner und<br />
schwächer oder fehlend,<br />
Flanken eben, N etwas kleiner.<br />
P. punctatissimus (HAUG<br />
1893), dn: Punktierung der<br />
Schale mit winzigen Grübchen<br />
in konzentrischer Spirale.<br />
LT in HAUG 1893, Taf. 9,<br />
Fig. 6.<br />
Sehr ähnlich buckmani, <strong>des</strong>sen<br />
Rippen etwas weitständiger<br />
sind und etwas früher<br />
erlöschen (Typusexemplare).<br />
Querschnitt<br />
bei d =<br />
3 cm<br />
3,8 cm<br />
2,8 cm<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
Gleichmaßige, leicht sinusförmige<br />
Einzelrippen, am Außenbug<br />
oft keulenförmig leicht<br />
verdickt, in schwachen Nebenkielen<br />
endend. Halbkreisförmiger<br />
Vollkiel von schwachen<br />
Furchen begleitet. Adulter<br />
Mundsaum mit kurzen, schmalen,<br />
manchmal etwas spitzen<br />
Ohren.<br />
Feine, schwache Sichelrippen<br />
verschwinden meist auf den<br />
Außenwindungen und sind oft<br />
nur auf Steinkernen sichtbar.<br />
Rippenabstand frühontogenetisch<br />
sehr variabel, Bifurkation<br />
vorwiegend auf äußeren Windungen.<br />
Niedriger Vollkiel auf<br />
abgeflachtem Venter, manchmal<br />
mit schwachen Seitenfurchen,<br />
Kiel auf adulter Wohnkammer<br />
erlöschend. Manchmal<br />
feine Spiralstreifung. Schmale<br />
Ohren.<br />
Auf den Innenwindungen proradiate<br />
Rippen, auf den Außenwindungen<br />
feine, schwach<br />
sinusförmige abgeflachte Einzelrippen,<br />
am LT teilweise in<br />
Zweiergruppen und von<br />
abschnittsweise wechselnder<br />
Dichte. HAUGs namensgebende<br />
Grübchen (s. dn) wurden<br />
von HUF 1968 nicht<br />
erwähnt, ebensowenig (die am<br />
LT deutlichen) Furchen neben<br />
dem niedrigen, scharfen Kiel.<br />
Dorsetensia BUCKM. 1892; dn: Dorsel, südenglische Grafschaft; TA Am. edouardianusD'OKB. 1845. Flachsch eibige Formen mit hochovalem bis hochdreieckigem Windungsquerschnitt<br />
und sehr schwachen Sinusrippen. Der Voll- oder Hohlkiel ist nicht von Furchen begleitet, Knoten und Dornen fehlen. Lobenlinie im allgemeinen weniger zerschlitzt als bei<br />
Sonninia, dennoch ist die Abgrenzung gegen Sonninia und Witchellia problematisch. PAVIA 1983b schlägt Nannina BUCKM. 1927 als mikroconchen Partner von Dorsetensia vor.<br />
D. hannoverana (HILTER<br />
MANN 1939), dn: nach der<br />
Stadt Hannover.<br />
LT (nach HUF 1968) in HIL<br />
TERMANN 1939, Taf. 11,<br />
Fig. 8; Orig. im Roemer-<br />
Museum Hil<strong>des</strong>heim.<br />
= Witchellia edouardiana<br />
DORN 1935, Taf. 6, Fig. 6.<br />
64<br />
9 mm<br />
2,5 cm<br />
Vorwiegend schmale, scharfe,<br />
leicht konvexe bis sinusförmige<br />
Rippen, am Außenbug vorschwingend,<br />
in den Nebenkielen<br />
endend. Oft perlartige<br />
Knötchen auf der Mitte jeder<br />
oder jeder 2. Rippe. Ab d<br />
1,5 häufige Bifurkation am<br />
Innenbug bei leichter Verdikkung<br />
<strong>des</strong> Gabelpunktes. Scharfer<br />
bis schwach gerundeter<br />
Kiel, von deutlichen Nebenfurchen<br />
begleitet.<br />
HT<br />
HT<br />
LT 2,8<br />
1,2<br />
2<br />
2,5<br />
N<br />
in %<br />
39<br />
40<br />
37<br />
38<br />
28<br />
31<br />
30<br />
33<br />
29<br />
29<br />
28<br />
H<br />
in %<br />
35<br />
34<br />
36<br />
38<br />
43<br />
41<br />
42<br />
TT<br />
38<br />
44±5<br />
45±4<br />
45<br />
0,94<br />
1,1<br />
ÖT9<br />
T7T4<br />
1,23<br />
1,32<br />
1,15<br />
T725<br />
(1,34)<br />
Tjj<br />
T72<br />
Tc4<br />
31<br />
35<br />
(36)<br />
(46)<br />
37<br />
LTI 1<br />
' 8<br />
'2,6<br />
33 '<br />
36<br />
36<br />
38<br />
0,87<br />
0,99 27<br />
1,4 32 38 ÖT9<br />
2 32 40 T7Ö<br />
3 JT TT T7T5 25<br />
4 3T 44 U 30
Art Sutur bei h =<br />
D. pinguis (ROEMER 1836),<br />
dn: lat. pinguis = dick.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Roemer-<br />
Museum Hil<strong>des</strong>heim.<br />
Von schmälerem Windungsquerschnitt<br />
als hannoverana,<br />
durch Übergänge verbunden.<br />
D. dettafalcata (QU. 1S58),<br />
dn: lat. falcatus = sichelförmig;<br />
im ßraunjura delta auftretend.<br />
LT (nach HUF 1968) in QU.<br />
1858, Taf. 53, Fig. 8; Orig.<br />
im IGPT.<br />
= Witchellia romanoi<strong>des</strong><br />
DORN, Taf. 20, Fig. 3.<br />
QU. 1886, Taf. 68, Fig. 9-14<br />
u. OECHSLE 1958, S. 112-<br />
113 u. Taf. 14, Fig. 4, gehören<br />
nicht zu dettafalcata.<br />
D. romani (OPP. 185?) dn:<br />
Dr. ROMAN, Freund<br />
OPPELs.<br />
Ong. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
= D. complanata BUCKM.<br />
1892; = Am. deltafalcatus<br />
QU. 1886, Taf. 68, Fig. 14;<br />
= Am. deltafalcatus acutus<br />
QU. 1886, Taf. 68, Fig. 11;<br />
= Am. cf. jugosus QU. 1886,<br />
Taf. 60, Fig. 4; = D. pulchra<br />
DORN 1935; = D. complanata<br />
DORN 1935.<br />
Von dettafalcata durch deutlich<br />
größeres Q aber nur<br />
wenig kleineres N unterscheidbar.<br />
D. hostraca BUCKM. 1892,<br />
dn: gr. Iis = glatt, östreon =<br />
Schale.<br />
IT ist Fig. 3, Taf. 55 in<br />
'•UCKM. 1892 (nach HUF);<br />
( 1<br />
1<br />
"K. im Sedgwick Mus.<br />
•'••"bridge.<br />
- Am. lessonianus QU. 1 886,<br />
Taf- 6S, Fig. ""; = Am. furti- fi<br />
Art Sutur bei h =<br />
D. sttbtecta BUCKM. 1892,<br />
dn: lat. tcctus = bedeckt,<br />
sub-= unter (-geordnet).<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Scdgwick-<br />
Müs. Cambridge. 0<br />
= Witchellia tessoniana<br />
DORN 1935. HUF 1968 faßt<br />
D. subtecta als UA von Hostraca<br />
auf.<br />
Von D. liostraca nur durch<br />
größeres N getrennt. Sehr<br />
ähnlich ist Sonninia tessoniana. <br />
Querschnitt<br />
Skulptur d<br />
bei d —<br />
in cm<br />
Die Skulptur ist der von D. liostraca<br />
sehr ähnlich. < 2<br />
5<br />
10<br />
Y<br />
16<br />
23<br />
14 cm<br />
Clydoniceras BLAKE 1905; dn; gr. clydon = Wogenschlag, ceras = Horn; TA Am. discus SOW. 1813. Oxycone, sehr engnablige Gehäuse, deren scharfer Kiel z.T. in der<br />
Jugend von Furchen begleitet sein kann. Radiale Rippen erlöschen meist im Alter. Sutur sehr einfach und kaum zerschlitzt (im Gegensatz zum ähnlichen Oxycerites). Wegen häufigen<br />
Fehlens der discus-Zone in Württemberg sehr selten. Die Untergattung Delecticeras ARKELL 1951 (kleinwüchsig mit Ohren) wurde bisher in Süddeutschland noch nicht nachgewie<br />
sen. Oberstes Bathonium.<br />
Untergattung Clydoniceras s. Str.; großwüchsige Formen mit glattem Altersmundsaum.<br />
Cl. (Cl.) discus (SOW. 1813),<br />
dn: gr. Wurfscheibe, Diskus.<br />
HT in ARKELL 1951, Taf. 2,<br />
Fig. 2.<br />
= Am. bochstetteri OPP. 1862<br />
(von ARKELL 1951 als eine<br />
von insgesamt 5 Varietäten<br />
klassifiziert).<br />
50 i<br />
L Ui U 3 U< U, J<br />
4,5 mm 10,5 cm<br />
Auf den Innenwindungen feine,<br />
dichte Radialrippen, die im<br />
äußeren Flankenviertel stark<br />
vorschwängen und bei d « 7<br />
erloschen sind. Schwache<br />
Nebenfurchen <strong>des</strong> scharfen<br />
Kiels verschwinden zwischen d<br />
= 1 und 3.<br />
Strigoceratinae BUCKM. 1924<br />
Sehr engnablige, meist oxycone Graphoceratidae, vorwiegend mit Kiel und Spiralskulptur, mit unbeknoteten schwachen Sichelrippen, Bajocium und Bathonium.<br />
Strigoceras QU. 1886; dn: lat. striga = Strich (gestreift), ceras = Horn; TA Am. truellci D'ORB. 1845. Oxycone Formen mit Hohlkiel, Spiralstreifung und Spiralfurchen. Überaus stark<br />
zerschlitzte Sutur.<br />
Str. tmellei (D'ORB. 1845),<br />
dn: M. TRUELLE, franz.<br />
Sammler.<br />
LT in D'ORB. 1845, Taf.<br />
117.<br />
= Am. truellci tr'tfitrcatus QU.<br />
1886, Taf. 69, Fig. 8 u. 9.<br />
Am. truellci gracilis QU.<br />
1886 scheinen die Spiralfur<br />
chen völlig zu fehlen.<br />
66<br />
70 mm<br />
3,8 mm 14 <<br />
3 flache Spiralfurchen erzeugen<br />
4 konzentrische^erhabene Flan<br />
kenbereiche, von denen der:<br />
äußere breiter als alle anderen<br />
ist und die konkaven Bögen<br />
der schwachen Sichelrippen<br />
trägt, während die Stiele kaum<br />
angedeutet sind. Das Ganze ist<br />
von feiner Spiralstreifung - oft<br />
nur sehr schwach sichtbar -<br />
überzogen. Abgesetzter Hohl<br />
kiel.<br />
HT 9,8<br />
4,5<br />
6,3<br />
6,9<br />
9<br />
HT 11<br />
14,8<br />
11<br />
21<br />
N<br />
in %<br />
25<br />
24<br />
27<br />
24<br />
24<br />
25<br />
(3)<br />
14<br />
8<br />
975<br />
5,5<br />
H<br />
in %<br />
45<br />
45<br />
TT<br />
44<br />
43<br />
43<br />
59<br />
53<br />
59<br />
57<br />
60<br />
56<br />
57<br />
ää<br />
57<br />
Q<br />
2,0<br />
2,15<br />
T77<br />
2JT5<br />
27T<br />
2,15<br />
2,38<br />
1,56<br />
1,79<br />
T79T<br />
1,88<br />
2,1<br />
1,85<br />
2,1<br />
Z<br />
(63)<br />
31<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
hj lc<br />
- bj 2a<br />
20; 3<br />
64<br />
~7<br />
131<br />
bj 3a3<br />
20; 5<br />
74<br />
209<br />
211
Str. dorsocavatum (QU.<br />
1857}, dn: lat. dorsum =<br />
Rücken, cavatus = hohl. A<br />
HT in QU. 1886, Taf. 69,<br />
Fig. 6; Orig. verschollen.<br />
Art Sutur bei h =<br />
Von etwa doppelt so großem<br />
N wie truellei und von ande<br />
rem Querschnitt.<br />
5fr. septicarinatum BUCKM.<br />
1924, dn: lat. septum =<br />
Scheidewand, carinatus =<br />
gekielt.<br />
Vereinigt den engen Nabel<br />
vom truellei mit dem lanzett<br />
lichen Querschnitt von dorsocavatum.<br />
= Am. truellei QU. 1886,<br />
Taf. 69, Fig. 13?<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
lAi<br />
8 cm<br />
A<br />
A<br />
N Y<br />
8,5 cm<br />
Skulptur d<br />
Unmittelbar am Nabeirand<br />
deutliche Spiralwulst, zwei wei<br />
tere, wesentlich schwächere,<br />
etwa auf Flankenmitte. Auf der<br />
papierdünnen Schale feine Spi<br />
ralstreifung und feine Radial<br />
streifung, die manchmal den<br />
Charakter feiner Radialrippen<br />
annimmt, die nahezu senkrecht<br />
den hochdreieckigen, gezahn<br />
ten Hohlkie! der Schale treffen.<br />
Der HT zeigt nur eine einzige<br />
ausgeprägte Spiralfurche, etwa<br />
auf Flankenmitte. Während die<br />
innere Flankenhälfte nur Spiral<br />
streifen trägt, sind auf der<br />
äußeren retroverse, z. T. unre<br />
gelmäßig gebündelte bzw.<br />
gabelnde Sichelbögen. Niedri<br />
ger, schmaler, glatter Hohlkiel.<br />
in cm<br />
HT 7,9<br />
9<br />
N<br />
in %<br />
14<br />
9<br />
H<br />
in %<br />
54<br />
50<br />
Q<br />
2,25<br />
2,5<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bt 1<br />
21; 1<br />
197<br />
209<br />
260<br />
HT 7,5 4 60 2,6 (49) bt 2<br />
8,5 4 49 2,5 (53) 21; 2<br />
36<br />
260<br />
67
Haploceratidae zittel i884<br />
Gemäff der Empfehlung von SCHINDEWOLF 1964 werden die Mazapilitinae (Malm) und die Aconeceratinae (Unterkreide} als zur Familie gehörig betrachtet.<br />
Involute, planulatc Gehäuse mit meist gerundeter oder abgeflachter Externseite und mit nur schwacher Skulptur.<br />
Haploceratinae zittel iss4<br />
Haploceratidae mit gerundeter Externseite, ohne Kiel, meist skulpturlos. Bajocium bis Unterkreide.<br />
Lissoceras BAYLE 1879 (= Lissocerdtot<strong>des</strong> SPÄTH 1923); dn: gr. lissös = glatt, ceras = Horn; TA Am. psi/odwcHsSCHLOENBACH 1865. Kleine bis mittelgroße Formen mit hoch<br />
ovalem Windungsquerschnitt, ohne Benppung und ohne Kiel; Sutur mit außergewöhnlich tiefem Laterallobus. Bajocium bis Bathonium.<br />
L. psilodiscus (SCHLOEN-<br />
Art Sutur bei h =<br />
BACH 1865), dn: gr. psilos<br />
= nackt, discus = Scheibe.<br />
= Am. complanatoi<strong>des</strong> QU.<br />
1886, Taf. 75, Fig. 27;<br />
= L. inflatum WETZEL<br />
1950.<br />
L. oolithicum (D'ORB.<br />
1845), dn: Oolith, aus kuge<br />
ligen Elementen bestehen<strong>des</strong><br />
Gestein.<br />
Breirmündiger als psilodiscus,<br />
stratigraphisch älter.<br />
L. ferrifex (ZITTEL 1868)<br />
HT ist Am. erato D'ORB. in<br />
KUDERNATSCH 1852, Taf.<br />
2, Fig. 4-6.<br />
= Am. oolithicus QU. 1886,<br />
Taf. 69, Fig. 5; = L. oolithi<br />
cum DORN 1927.<br />
Von wesentlich kleinerem Q<br />
als vorstehende Arten.<br />
68<br />
15 mm<br />
ca. 23 mm<br />
1,8 mm<br />
11,5 mm<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
5 cm<br />
6 cm<br />
Ü<br />
6,8 cm<br />
Skulptur d<br />
Nur sichelförmige Anwachs<br />
streifen bei Schalenerhaltung.<br />
Nur sinusförmige Anwachs<br />
streifen. DORN 1927 erwähnt<br />
Andeutungen von breiten, kur<br />
zen Ohren.<br />
Bis auf Anwachsstreifung bei<br />
Schalenerhaltung ebenfalls<br />
skulpturlos.<br />
in cm<br />
HT 3,2<br />
2,6<br />
2,9<br />
4,9<br />
LT 6,4<br />
3<br />
HT 6,8<br />
3<br />
4,3<br />
5<br />
12<br />
N<br />
in %<br />
22<br />
25<br />
26<br />
20<br />
20<br />
20<br />
24<br />
23<br />
23±3<br />
27<br />
H<br />
in %<br />
48<br />
47<br />
45<br />
52<br />
50<br />
53<br />
44<br />
45<br />
48<br />
48+3<br />
49<br />
Q<br />
2,1<br />
1785<br />
1,67<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,72<br />
1,26<br />
1,25<br />
1,22<br />
T722<br />
1,21<br />
><br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bt la<br />
21; 3<br />
6<br />
110<br />
197<br />
217<br />
bj 3<br />
21; 4<br />
74<br />
95<br />
164<br />
211<br />
bj 3<br />
bt 1<br />
21; 5<br />
76<br />
95<br />
197<br />
255<br />
287
ÜOCCrSteCCäC NEUMAYR 1875, sensu SCHINDEWOLF 1965<br />
Serpenticone bis coronate, platycone und sphaerocone Formen ohne Kiel mit vorwiegend spaltenden und oft beknoteten Rippen. Gemeinsam - zumin<strong>des</strong>t bei den primären Familien<br />
Stephanoceratidae, Otoitidae und Sphaeroceratidae - ist die frühontogenetische Bildung <strong>des</strong> neuartigen Umbilikallobus U n zwischen Ui und I. Mit den auf Vorschlag von SCHIN<br />
DEWOLF 1965 einbezogenen Parkinsoniidae werden auch die aberranten Formen der Spiroceratinae und der Parapatoceratinae den Stephanocerataceae angeschlossen. Die Gruppe<br />
Tulitidae - Pachyceratidae wird auf Vorschlag von HAHN 1971 in die Perisphincten übernommen.<br />
Stephanoceratidae NEUMAYR 1875<br />
Serpenticone bis ausgeprägt coronate Stephanocerataceae mit extern kontinuierlich übergehenden Spaltrippen. Sutur mit schräg hängendem, relativ kurzem U tl.<br />
Kumatostephanus BUCKM. 1922; TA K. kitmaterus BUCKM. 1922. Weitnablige, meist serpenticone Formen mit grober, perisphinctoider Skulptur mit höchstens schwacher Bedor-<br />
nung der Rippenspaltpunkte. Abgrenzung gegen Stephartoceras schwierig. Unteres Bajocium.<br />
Art Sutur bei h —<br />
K. turgidulus (QU. 1886), dn:<br />
lat. turgidulus = geschwol<br />
len, mit Wülsten versehen.<br />
Orig. <strong>des</strong> LT (QU. 1886, Taf.<br />
66, Fig. 2) im IGPT.<br />
K. triplicatus (RENZ 1904),<br />
dn: lat. plicatus = gefaltet, tri<br />
plicatus = dreifach gefaltet.<br />
HT ist Am. bumpbriesianus<br />
plamda QU. 1886, Taf. 66,<br />
Fig. 13; Orig. im IGPT.<br />
= K. perjucundus BUCKM.<br />
1927; = Am. bumpbriesianus<br />
crassicosta QU. (?).<br />
Von turgidulus vor allem<br />
durch breiteren Querschnitt<br />
geschieden.<br />
36 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d —<br />
o<br />
16 cm<br />
o<br />
11,5 cm<br />
Skulptur d<br />
Radiale, weitständige, wulstige<br />
Primärrippen spalten auf Flan<br />
kenmitte in schwachen Knöt<br />
chen meist in 2 schwach prora<br />
diate Sekundäräste, die durch<br />
Schaltrippen vermehrt werden.<br />
TZ ~ 3,4 beim LT.<br />
Auffallend grobe, etwa radiale<br />
Rippen, die auf Flankenmitte<br />
bi- oder trifurkieren und auch<br />
extern außergewöhnlich kräftig<br />
sind.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
29 PR bj 1<br />
LT 16 55 22 0,83 |<br />
(98) SR<br />
25 PR<br />
HT11.5 49 29 « 1 54 SR<br />
lU'pb.iHoceras WAAGEN 1869; dn: gr. stephanos = Kranz, ceras = Horn; TA Am. humphriesianus SOW. 1825 (seltene Übergangsform zur synonymen, "stratigraphischen-Gattung<br />
ikmoccrjs). Mäßig evolute, serpenticone bis leicht coronate Formen mit vorwiegend breitelliptischem, aberauch rundem und breittrapezoidem Querschnitt. Primärrippen spalten in<br />
snoten auf der Flanke in 2 bis 4 Externrippen. Mittleres Bajocium.<br />
- ntergattung Stephafiocerus s. str. (18 synonyme "Gattungen" s. MORTON 1971, ergänzt wird hiermit: Stemmütoceras MASCKE 1907 pars); großwüchsige Formen mit glattem<br />
M'crsniundsaum ohne Ohren; Zunahme von N und Abnahme von H im Breich der adulten Wohnkammer.<br />
1 1<br />
M , V v<br />
*>•' l'umphriesunum<br />
1825:. dn: GEORGE<br />
MPHRIES, engl. Sammler<br />
1". |h.<br />
bestimmt durch<br />
'«'< KM. ivos) i„ ARKELL<br />
, < H 4<br />
-.35.Fig.3;Or,g.<br />
••n I5MNH.<br />
11,6 cm<br />
Kräftige, schmale Primärrippen,<br />
radial bis leicht retrokonkav,<br />
gabeln in stumpfen Knoten bei<br />
ca. 40% der Flankenhöhe vor<br />
wiegend dreifach. TZ der<br />
letzten Windung = 3,1. Extern<br />
rippen dicht, radial und gleich<br />
mäßig.<br />
LT'<br />
16<br />
47<br />
50<br />
53<br />
30<br />
26<br />
26<br />
0,82<br />
35 PR<br />
109 SR<br />
35 PR<br />
104 SR<br />
21; 6<br />
181<br />
197<br />
bj 1<br />
21; 7<br />
181<br />
197<br />
bj 2a<br />
22; 1<br />
7<br />
34'<br />
253<br />
69
Art Sutur bei h =<br />
UA St. (St.) bumphriesianum<br />
zieteni (QU. 1886), dn: C. H.<br />
von ZIETEN, württ. Major<br />
u. Amateurgeologe, 1785—<br />
1846.<br />
HT in QU. 1886, Taf. 66,<br />
Fig. 10 u. WEISERT 1932,<br />
Taf. 17, Fig. 1; Orig. im<br />
IGPT.<br />
Außer geringfügig größerem<br />
N und schwächeren Knoten<br />
durch andere TZ von der<br />
Nominat-UA geschieden.<br />
St. (St.) auerbachense<br />
SCHMIDTILL u. KRUM<br />
BECK 1938, dn: Auerbach,<br />
Fränkische Alb.<br />
Fig. 5, Taf. 13 in SCHMID<br />
TILL u. KRUMBECK wird<br />
hiermit zum LT bestimmt;<br />
Orig. im 1GPEN.<br />
St. bumphriesianum sehr<br />
nahestehende Art (UA?) mit<br />
Rippenspaltpunkten in<br />
Nabelnähe.<br />
St. (St.) scalare LOEWE<br />
1913, dn: lat. scalae = Leiter.<br />
HT ist Am. bumpbriesianus<br />
QU. 1886, Taf. 65, Fig. 15;<br />
Orig. im IGPT. (Erstautor:<br />
MASCKE 1903, ungültig,<br />
weil unveröffentlicht).<br />
Außer geringfügig kleinerem<br />
Q durch größeres Z und<br />
anderen Querschnitt von<br />
bumphriesianum geschieden.<br />
St. (St.) subzieteni SCHMID<br />
TILL u. KRUMBECK 1938,<br />
dn: ähnlich zieteni.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im IGPEN.<br />
Form ähnlich der von<br />
bumphriesianum zieteni, aber<br />
mit auffallend groben Primär<br />
rippen.<br />
70<br />
1<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
15 cm<br />
C )<br />
12 cm<br />
C )<br />
26 mm 12 cm<br />
Skulptur d<br />
Abgesehen von der TZ, die bei<br />
etwa 2,5 liegt, entspricht die<br />
Skulptur im wesentlichen der<br />
von bumphriesianum s, str..<br />
Leicht retrokonkave Primärrip<br />
pen gabeln bei = 35% Flankcn-<br />
höhe in radial ausgezogenen<br />
Knoten in die schwach prora-<br />
diaten, gleichmäßigen und<br />
scharfen Externrippen.<br />
Radiale Rippen spalten dicht<br />
über dem Innenbug in meist<br />
drei Sekundäräste, die beim LT<br />
leicht konvex sind. TZ liegt<br />
etwa bei 3.<br />
Der guterhaltene HT zeigt rela<br />
tiv dichte, leicht retrokonkave<br />
Primärrippen, die bei 30% Flan HT<br />
kenhöhe in deutlichen Knoten<br />
in radiale bis proradiate, sehr<br />
dichte gleichmäßige Externrip<br />
pen spalten. TZ liegt bei 3.<br />
Weitständige, wulstig gerun<br />
dete, leicht konkave Primärrip<br />
pen schwellen zu groben Kno<br />
ten bei ca. 30% Flankenhöhe<br />
an, aus denen je etwa 4<br />
schwach prokonkave, kräftige<br />
Sekundärnppen entspringen.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
14,5 53,5 25,3 0,73 |<br />
Z<br />
38 I'R<br />
97 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bj 2a<br />
HT<br />
1 Q 1 56.2 24,3 0,8<br />
22; 2<br />
46 I'R<br />
|<br />
112 SR<br />
197<br />
221<br />
2.53<br />
LX12,7 50 27 0,8 (92) SR bj 2a<br />
9,2 43 34~5 Ö778 fTÖTTSR 22; 3<br />
10 45 34<br />
27 PR 221<br />
0,79 J 84 SR<br />
41 PR bj 2a<br />
10,7 47,9 23,9 0,70 J 126 SR<br />
13,1<br />
20<br />
39 PR<br />
111 SR<br />
22; 4<br />
45 PR<br />
51,2 25,7 (0,7) |<br />
124 SR 197<br />
1<br />
221<br />
253<br />
HT18.2 56 26 0,91<br />
29 PR bj 2a<br />
1 115 SR<br />
23; 1<br />
221
Art Sutur bei h :<br />
St. (St.) macTum (QU. 1886),<br />
dn: lat. macer = dünn.<br />
LT ist nach BUCKM. 1921,<br />
Taf. 248, Am. humphriesianus<br />
macer QU. 1886, Taf.<br />
65, Fig. 11; Orig. im IGPT<br />
Von außergewöhnlich gro<br />
ßem N, 1907 von MASCKE<br />
als TA der serpenticonen<br />
«Gattung» Skirroceras<br />
bestimmt.<br />
St. (St.) «nodosum^ (QU.<br />
1858), dn: lat. nodosus =<br />
beknotet.<br />
HT ist Am. butnpbriesianus<br />
nodosus QU. 1858, Taf. 54,<br />
Fig. 4, = Fig. 17, Taf. 65 in<br />
QU. 1886; Orig. im IGPT.<br />
Durch sehr grobe Flanken<br />
skulptur (geringere Primärrip-<br />
penzahl und höhere Teilungs<br />
ziffer TZ) ausgezeichnete<br />
Art.<br />
St. (St.) latidorsum WEISERT<br />
1932, dn: lat. latus = breit,<br />
dorsum = Rücken.<br />
HT ist Am. bumpbriesianus<br />
QU. 1886, Taf. 65, Fig. 9;<br />
Orig. im IGPT.<br />
Durch relativ weitständige,<br />
kaum bedornte Rippen und<br />
flachen Venter von vorste<br />
henden Arten geschieden.<br />
St. (St.) pyrilosum (QU.<br />
1886), dn: das pyritisierte.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
= St. zogenreuthense<br />
SCHMIDTILL u. KRUM<br />
BECK 1938.<br />
Engnabliger als alle vorste<br />
henden Arten, gedrungen.<br />
V. .St.; hoffnunni SCHMID-<br />
Tl I. u. KRUMBECK 1938.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im 1GPEN.<br />
K'e.lmundigc, schwach<br />
'^knotete Art.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
2,8 mm 15,8 cm<br />
21 mm 7,2 cm<br />
28 mm 8 cm<br />
10 cm<br />
12,5c<br />
Skulptur d<br />
Primärrippen auf den innersten<br />
Windungen scharf, später<br />
stumpf und breiter werdend.<br />
Knoten etwa auf Flankenmitte<br />
bleiben lange spitz, zuletzt nur<br />
noch niedere Buckel. Extern<br />
rippen oft sehr schwach, TZ<br />
etwa 4,2.<br />
Breite und weitständige, im<br />
Alter leicht retroradiate Primär<br />
rippen enden in kräftigen,<br />
meist gerundeten Knoten bei<br />
anfangs 50%, im Alter 33% der<br />
Windungshöhe. Externrippen<br />
meist in den Knoten 2- bis 5-<br />
fach gabelnd, dazwischen<br />
Schaltrippen, TZ im Alter 4,3<br />
bis 4,8.<br />
Weitständige, vorwiegend<br />
radiale Rippen spalten bei ca.<br />
40% Windungshöhe meist<br />
zweifach ohne deutliche Kno<br />
tenbildung. Vor der verengten<br />
adulten Mündung, die einen<br />
externen Vorsprung trägt, riik-<br />
ken die Rippen auseinander.<br />
Relativ dichte, auf den Innen<br />
windungen radiale, später<br />
retrokonkave Primärrippen<br />
gabeln in radial ausgezogenen<br />
Verdickungen bei 40%, später<br />
30% Windungshöhe in feine,<br />
sehr schwach geschwungene<br />
in cm<br />
LT 25<br />
HT<br />
12,5<br />
15,7<br />
19,4<br />
8,3<br />
18<br />
Externrippen. TZ ca. 3,5. 11<br />
Skulptur sehr ähnlich der von<br />
pyritosum, aber weniger dicht:<br />
Bi- oder Trifurkation radialer<br />
Rippen bei ca. 40"^ Windungs<br />
höhe in leichten Verdickungen.<br />
9,6<br />
N<br />
in %<br />
61,5<br />
58<br />
61<br />
63<br />
54<br />
55<br />
47<br />
53±5<br />
53+6<br />
H<br />
in %<br />
19,5<br />
22<br />
19,5<br />
19<br />
25,5<br />
24,5<br />
31<br />
26<br />
25±5<br />
(1)<br />
0,67<br />
0,61<br />
0,62<br />
TTT<br />
±0,2<br />
079<br />
HT 14, 56,6 23,4 0,73<br />
15,4<br />
24,8<br />
HT12.5<br />
14,6<br />
37<br />
44<br />
40<br />
43<br />
44<br />
51<br />
49<br />
50<br />
34<br />
30<br />
34<br />
33<br />
31<br />
27<br />
26,5<br />
28<br />
0,95<br />
0,95<br />
0,76<br />
0,59<br />
0,63<br />
49 PR<br />
(138)SR -<br />
24 PR<br />
105 SR<br />
31 PR<br />
129 SR<br />
24 PR<br />
114 SR<br />
25 PR<br />
TT_PR<br />
91 SR<br />
21 PR<br />
92 SR<br />
36 PR<br />
83 SR<br />
33 PR<br />
121 SR<br />
27 PR<br />
115 SR<br />
36 PR<br />
123 SR<br />
37 PR<br />
43 PR<br />
85 SR<br />
30 PR<br />
69 SR<br />
71
St. (St.) subzogenreuthense<br />
SCHMIDTILL u. KRUM<br />
Art Sutur hei h =<br />
BECK 1938, dn: der An St.<br />
zogenreuthense (s. pyritosum)<br />
aus Zogenreuth bei Auer<br />
bach/Oberpfalz untergeord-<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im IGPEN.<br />
= St. weiserti, = St. leoniae,<br />
beide SCHMIDTILL u.<br />
KRUMBECK 1938.<br />
Engnabliger als boffmanni,<br />
breitmündiger als pyritosum.<br />
St. (St.) masekei SCHMID<br />
TILL u. KRUMBECK 1938.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im IGPEN.<br />
Von geringfügig größerem N<br />
und kleinerem Q sowie von<br />
etwas gröberer Berippung als<br />
subzogenreuthense.<br />
St. (St.) mutabile (QU. 1886),<br />
dn: lat. mutabilis = veränder<br />
lich.<br />
HT ist Am. bumpbriesianus<br />
mutabilis QU. 1S86, Taf. 66,<br />
Fig. 5; Orig. im IGPT.<br />
Von vorstehenden Anen<br />
durch kleineres N und kleine<br />
res Q geschieden (vergl. St.<br />
umbilicus).<br />
St. (St.) umbilicus (QU.<br />
1886), dn: lat. umbilicus =<br />
Nabel.<br />
HT ist Am. bumpbriesianus<br />
umbilicus QU. 1886, Taf. 66,<br />
Fig. 6; Ong. im IGPT.<br />
Ausgezeichnet durch schnel<br />
les Wachstum <strong>des</strong> Windungs<br />
querschnittes (Trichternabei).<br />
Skulptur, N und Q ähnlich<br />
St. mutabile.<br />
72<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d -<br />
11 cm<br />
7,5 cm<br />
22 mm 8 cm<br />
Skulptur d<br />
Auf den Innenwindungen lie<br />
gen die Gabelpunkte det radia<br />
len bis leicht konkaven, dichten<br />
Rippen fast an der Nabelnaht,<br />
so daß dort die Sekundärnppen<br />
nicht sichtbar sind. Auf den<br />
Außenwindungen liegen die<br />
leicht heknoteten Gabelpunkte<br />
bei etwa 33% Windungshöhe.<br />
TZ ist etwa 2,65.<br />
Grobe, deutlich retrokonkave<br />
Pnmärrippen gabeln in kleinen<br />
spitzen Dornen an der Naht<br />
bzw. auf der inneren Flanken<br />
hälfte. Sekundärrippen (gröber<br />
als bei subzogenreuthense aber<br />
weniger grob als bei boff<br />
manni) haben etwa radialen<br />
Verlauf.<br />
Auf den Innenwindungen kräf<br />
tige, zunächst schwach prokon<br />
kave Primärrippen, die bei 28<br />
bis 50% Windungshöhe in spit<br />
zen Knötchen durchschnittlich<br />
3fach gabeln und auf den<br />
Außenwändungen leicht retro-<br />
konkav werden. Gleichmäßig<br />
feine Externrippen werden auf<br />
der Wohnkammer leicht kon<br />
vex, so daß der gesamte Rip<br />
penzug sinusförmig erscheint.<br />
TZ «3.<br />
Anfangs radiale, auf den<br />
Außenwindungen retrokonkave<br />
Primärrippen spalten zwei-<br />
oder dreifach in niedrigen Kno<br />
ten in prokonkave Externrip<br />
pen, die durch Schaltrippen<br />
vermehn sind, so daß sich TZ<br />
= 3,2 ergibt. Eine Varietät mit<br />
gestreckten Altersrippen wurde<br />
1932 von WEISERT zur «Art-<br />
St. rectecostatum erhoben.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
HT 9,1 41 34<br />
32,5<br />
0,81<br />
0~82<br />
HT11.0 46 30 0,67<br />
HT<br />
HT<br />
7,6<br />
8,S<br />
9,9<br />
6<br />
7,6<br />
10<br />
37<br />
42<br />
40<br />
41<br />
39<br />
(39)<br />
37<br />
36<br />
38<br />
36<br />
32 0,65<br />
(35)<br />
37<br />
36<br />
Ö~56<br />
0,67<br />
40 PR<br />
104 SR<br />
37 PR<br />
97 SR<br />
30 PR<br />
: SR<br />
30 PR<br />
91 SR<br />
30 PR<br />
1 SR<br />
33 PR<br />
0,62 (92)<br />
32 PR<br />
108 SR<br />
29 PR<br />
93 SR<br />
32 PR<br />
103 SR
Untergattung NormannitesMUNIER-CHALMAS 1892 (Synonymie siehe ARKELL 1957, S. L289); dn: NORMANN,<br />
engl. Zoologe <strong>des</strong> 19. Jahrh.; TA N. orbignyi BUCKM. 1908.<br />
Mikroconche Formen mit langen Ohren an der Altersmündung, die manchmal vier getrennte Mundöffnungen bilden.<br />
Am adulten Wohnkammerende deutliche Zunahme von N und Stagnation der Windungsbreite. Als Sexualpartner der<br />
makroconchen Untergattung Stephanoceras s. Str. betrachtet.<br />
Art<br />
St. (N.) orbignyi BUCKM.<br />
1908, dn: A. D'ORBIGNY,<br />
franz. Paläontologe, 1802-<br />
1857.<br />
NT in BUCKM. 1927, Taf.<br />
734 (bestimmt durch<br />
ARKELL 1951); Orig. im<br />
Geological Survey Museum<br />
London.<br />
Die von WEST. 1954 auf<br />
gestellten 5 UA werden hier<br />
zusammengefaßt; N. masckei<br />
WEST. 1954 läßt sich<br />
zwanglos einfügen (vergl. N.<br />
tnackenzii).<br />
St. (N.) braikenridgii (SOW.<br />
1818)<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im City-<br />
Museum Bristol (England),<br />
Nachguß in WEST. 1954,<br />
Taf. 9, Fig. 1.<br />
Von N. orbignyi nur durch<br />
dichtere Berippung geschie<br />
den.<br />
UA St. (N.) braikenridgii ven-<br />
triplanum (WEST. 1954), dn:<br />
Venter = Externseite, planus<br />
= eben.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Amt für<br />
Bodenforschung Hannover.<br />
Von der Nominatunterart<br />
durch kleineres Q getrennt.<br />
1 A St. Oi.) braikenridgii<br />
auenstedti ROCHE 1939, dn:<br />
!'• A- QUENSTEDT, Geologe<br />
St. (N.) vulgaricostatum<br />
Art Sutur bei h :<br />
(WEST. 1954), dn: vulgaris =<br />
gemein, costatus = berippt.<br />
HT ist Am. braikenridgii<br />
macer in QU. 18S6, Taf. 65,<br />
Fig. 4; Orig. im IGPT.<br />
Knotenlose "Art 1<br />
'. Eine Varie<br />
tät mit teilweiser Trifurkation<br />
benannte WEST. 1954 als<br />
UA ,V. vulgaricostatus pfaffi.<br />
St. (N.) turgidum (WEST.<br />
1954), dn: lat. turgidus =<br />
dick.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Univ. Göttingen.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch außergewöhnlich<br />
große Windungsbreite<br />
geschieden. UA turgidum<br />
densum WEST. 1954 besitzt<br />
10% mehr Externrippen.<br />
St. (N.) latumbilicatum<br />
(WEST. 1954), dn: lat. latus<br />
= breit, umbilicus = Nabel,<br />
d. h. außergewöhnlich weit-<br />
nablige ".Art».<br />
HT ist das Orig. zu WEST.<br />
1954, Taf. 13, Fig. 3, Geol.<br />
Inst, der Univ. Göttingen.<br />
UA St. (N.) latumbilicatum<br />
bentzi (WEST. 1954), dn: A.<br />
BENTZ, Geologe aus Hei<br />
denheim/Brenz, 1897-1964.<br />
HT ist das Orig. zu WEST.<br />
1954, Taf. 13, Fig. 5, Amt<br />
für Bodenforschung Hanno-<br />
Von der Nominat-UA durch<br />
andere Ontogenie von Z<br />
geschieden.<br />
St. (N.j platystoma (WEST.<br />
1954), dn: gr. platys = breit,<br />
Stoma = Mund.<br />
HT in WEST. 1954, Taf. 17,<br />
Fig. 6; Orig. im Geol. Inst.<br />
Braunschweig.<br />
Von allen vorstehenden For<br />
men durch trapezoiden Quer<br />
schnitt <strong>des</strong> Phragmocons<br />
geschieden (ähnlich der Gat<br />
tung Epalxites).<br />
74<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
11 mm 4,4 cm<br />
11 mm 5,3 cm<br />
4,4 cm<br />
10 mm 4,5 cm<br />
6 mm 4,4 cm<br />
Skulptur d<br />
Scharfe, auf den Innenwindun-<br />
gen dichte, proradiate, später<br />
prokonkave, seltener auch<br />
retrokonkave Primärrippen. Im<br />
Birfurkationspunkt (Flanken<br />
mitte) Rückbiegung, so daß<br />
insgesamt schwach sinusförmi<br />
ger Verlauf entsteht. Knötchen<br />
höchstens auf der Wohnkam<br />
mer angedeutet. Sekundärrip<br />
pen ziehen regelmäßig gerade<br />
über den Venter.<br />
Skulptur unterscheidet sich<br />
kaum von der der vorstehen<br />
den Arren. Primärrippen der<br />
Außenwändungen leicht kon<br />
kav, Gabelpunkte mit kleinen<br />
Knoten matkiert, Trifurkation<br />
selten.<br />
Radiale bis proradiate Primär<br />
rippen der Innenwindungen,<br />
etwas schwächer als bei vorste<br />
henden .Arten, auf den Außen<br />
windungen schwach sinusför<br />
mig. Regelmäßige Bifurkation,<br />
die nur auf der Wohnkammer<br />
von deutlichen Knötchen<br />
betont ward.<br />
Die Skulptur ist etwas kräftiger<br />
als bei latumbilicatum s. Str.,<br />
wogegen Z ab d *= 2 langsa<br />
mer zunimmt als bei jenem.<br />
Vereinzelt Trifurkation.<br />
Leicht proradiate Primärrippen<br />
der innersten Wändungen errei<br />
chen ab d = 1 die Naht. All<br />
mählich radial werdend, teilen<br />
sie sich in spitzen, kleinen<br />
Knötchen durchweg 2fach<br />
dicht vor der Nahr bzw. am<br />
Außenbug. Die Externrippen<br />
überziehen gleichmäßig und<br />
gerade den nur schwach<br />
gewölbten Venter. Vor dem<br />
adulten Mundsaum progressive<br />
Vorneigung von Primär- u.<br />
Externrippen.<br />
in cm<br />
HT|<br />
5,1<br />
HT<br />
3<br />
3,"<br />
4,7<br />
5,8<br />
3,1<br />
4,4<br />
5,2<br />
6,8<br />
HT 3,5<br />
3,5<br />
5,4<br />
H T | -<br />
3,4<br />
4.2<br />
6<br />
HT|<br />
2.6<br />
4,1<br />
44<br />
47,5<br />
42<br />
43<br />
42<br />
45<br />
42<br />
45<br />
43<br />
42<br />
45<br />
46<br />
48<br />
50<br />
49<br />
50<br />
47<br />
49<br />
47<br />
47<br />
49<br />
44 .<br />
47<br />
43<br />
45<br />
30<br />
26<br />
3T<br />
32<br />
28,5<br />
28<br />
31<br />
29<br />
31<br />
30<br />
29<br />
28<br />
27<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
25<br />
28<br />
28<br />
27<br />
29<br />
31<br />
30<br />
31<br />
0.61<br />
0,71<br />
9761<br />
0,63<br />
0,61<br />
0,"4<br />
0,57<br />
0,71<br />
0,56<br />
0,56<br />
0,69<br />
0,~6<br />
0,56<br />
0,67<br />
0,56<br />
0,69<br />
0,59<br />
0,69<br />
0,57<br />
0,56<br />
0,71<br />
0,51<br />
0,71<br />
0,50<br />
0,"1<br />
31 PR<br />
33 PR<br />
30 PR<br />
30 PR<br />
27 PR<br />
33 PR<br />
29 PR<br />
34 PR<br />
27 PR<br />
31 PR<br />
34 PR<br />
37 PR<br />
35 PR<br />
37 PR<br />
33 PR<br />
35 PR<br />
30 PR<br />
31 PR<br />
30 PR<br />
28 PR<br />
31 PR<br />
31 PR<br />
32 PR<br />
25 PR<br />
27 PR
St. (N.) antiquum (WEST.<br />
Art Sutur bei h :<br />
1954), dn: lat. antiquus = alt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Univ. Göttingen.<br />
Von vorstehenden Formen<br />
durch annähernd breitrecht<br />
eckigen Querschnitt u. durch<br />
abnehmen<strong>des</strong> Z bei zuneh<br />
mendem d geschieden<br />
(Wohnkammer).<br />
St. (N.) mackenzü (MC<br />
LEARN 1929), dn: Macken-<br />
zie Bay, Fundort <strong>des</strong> HT in<br />
NW-Kanada.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Surv.<br />
Museum, Ottawa (Kanada).<br />
Sehr ähnlich orbignyi, jedoch<br />
andere Ontogenie der Rip<br />
penteilung (vergl. Skulptur).<br />
St. (N.) gracile (WEST. 1954),<br />
dn: lat. gracilis = fein, zart.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst.<br />
Braunschweig.<br />
Nur durch wesentlich höhere<br />
Rippendichte von mackenzü<br />
qeschieden.<br />
St. (N.) formomm (BUCKM.<br />
1920), dn: lat. formosus =<br />
wohlgebildet, schön.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Survey Mus. London.<br />
Außergewöhnlich kleines Q,<br />
streckenweise reine Trifurkation.<br />
V A St. -\.) fonnosttm varie-<br />
.otuf.mt WEST. 1954), dn:<br />
-it. vanc- = mannigfaltig,<br />
-UM.UUS = berippt.<br />
''• '• • s<br />
' l'r.likcnrntgii QU.<br />
l^N 1.11. 65, Fig. 3; Orig.<br />
•~i IGI'I.<br />
N u f , m Rl<br />
Ppenverlauf gcrmg-<br />
•uR'K von der Nomjnatunter-<br />
*n verschieden.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
ca. 7 mm 5,4 cm<br />
3,5 cm<br />
13 mm 5,5 cm<br />
12 i<br />
6,3 cm<br />
Skulptur d<br />
Auf innersten Windungen<br />
zarte, niedrige Flankenrippen,<br />
von proradiatem zu radialem<br />
Verlauf übergehend. Bi- und<br />
auch Trifurkation meist bereits<br />
vor Erreichen der max. Win<br />
dungsbreite, vorwiegend ohne<br />
Knötchen. Flankenrippen spä<br />
ter höher und schmäler wer<br />
dend, Sinusform z. T. angedeu-<br />
Skulptur entspricht weitgehend<br />
der von orbignyi. Anteil der<br />
Trifurkation ist jedoch bei mak-<br />
kenzii und allen folgenden<br />
Arten höher als bei allen vor<br />
stehenden, meßbar durch die<br />
Teilungsziffer TZ. Während bei<br />
vorstehenden Arten TZ stets<br />
kleiner als 2,3 ist, ist bei tnak-<br />
kenzii TZ maximal = 2,5 (bei<br />
d = 2,5) und nimmt auf der<br />
adulten Wohnkammer wieder<br />
stark ab.<br />
Auf den Innenwindungen<br />
dichte, radiale Flankenrippen.<br />
Außenwindung <strong>des</strong> Phracmo-<br />
cons zeigt auf Flankenmitte<br />
etwas häufiger Tri- als Bifurka<br />
tion mit kleinen Knötchen, TZ<br />
2,6. Gesamtrippenverlauf<br />
angedeutet sinusförmig. Auf<br />
adulter Wohnkammer reduziert<br />
sich TZ im Extremfall auf 2,1.<br />
Auf den Außenwindungen <strong>des</strong><br />
HT konkave bis leicht retro<br />
konkave Flankenrippen. Bis<br />
d 1,5 Zwei- und Dreireilung,<br />
danach schnelle Reduktion von<br />
TZ auf ^ 2. Externrippen<br />
meist deutlich provers. Tei<br />
lungspunkte bedornt.<br />
Flankenrippen gegenüber for-<br />
ntosum s. str. weniger stark<br />
konkav; Maximum der TZ<br />
erreicht nur etwa 2.7 gegen<br />
über 3,0 bei fonnosttm s. Str..<br />
in cm<br />
HT<br />
HT<br />
3 ,5<br />
4. ,9<br />
3,3<br />
5<br />
3,2<br />
4,5<br />
HT 14,3<br />
HT<br />
HT<br />
3,6<br />
5,3<br />
3,2<br />
4,7<br />
2,1<br />
3,2<br />
4,7<br />
N<br />
in %<br />
44<br />
49<br />
43<br />
47<br />
44<br />
45<br />
43<br />
47<br />
43<br />
(47)<br />
42<br />
45<br />
42<br />
45<br />
H<br />
in °/o<br />
28<br />
27<br />
29<br />
28<br />
32<br />
24<br />
30<br />
30<br />
30<br />
28<br />
31<br />
30<br />
32<br />
28<br />
33<br />
27<br />
0,59<br />
0,67<br />
0,63<br />
0,71<br />
0,59<br />
0,69<br />
0,59<br />
0,74<br />
0,61<br />
0,77<br />
0,61<br />
0,8<br />
0,54<br />
0,69<br />
0,53<br />
0,65<br />
42 31 0.56<br />
44 1~ 0,"4<br />
40 31 0.56<br />
42 30 0.54<br />
45 2S 0,"4<br />
34 PR<br />
31 PR<br />
31 PR<br />
29 PR<br />
21 PR<br />
23 PR<br />
17 PR<br />
20 PR<br />
32 PR<br />
34 PR<br />
33 PR<br />
32 PR<br />
25 PR<br />
29 PR<br />
25 PR<br />
26 PR<br />
(27) PR<br />
30 PR<br />
25 PR<br />
27 PR<br />
27 PR<br />
25 PR<br />
75
Art Sutur bei h =<br />
St (N.) latansatum (BUCKM.<br />
1920), dn: lat. latus = breit,<br />
ansatus = mit Griff (Ohren)<br />
versehen.<br />
HT in WEST. 1954, Taf. 22,<br />
Fig. 1; Orig. im Manchester-<br />
Museum (England).<br />
Von den vier, TZ größer als<br />
2,3 aufweisenden, vorstehen<br />
den Arten durch kleineres N<br />
geschieden; ähnlich grobe<br />
Skulptur wie bei mackenzü.<br />
St. (N.) mitis (WEST. 1954),<br />
dn: lat. mitis = weich, zart<br />
(Berippung).<br />
HT im Geol. Inst, der Univ.<br />
Freiburg i. Br..<br />
Von ähnlicher Form (N, H,<br />
Q) wie latansatum, aber von<br />
höherer Primärrippendichte<br />
und kleinerer TZ.<br />
St. (N.) «aneeps» (QU. 1886),<br />
dn: lat. aneeps = doppelköp<br />
fig (bez. auf breite Mundöff<br />
nung).<br />
HT ist Am. contractu* aneeps<br />
QU. 1886, Taf. 64, Fig. 20;<br />
Orig. im IGPT.<br />
Nautilus aneeps REINECKE<br />
s. u. Reineckeia.<br />
Durch mehr trapezoiden<br />
Querschnitt von vorstehen<br />
den Formen geschieden (TA<br />
von Epalxites MASCKE<br />
1907).<br />
9 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
4,6 cm<br />
ca. 9 mm 4,4 cn<br />
Skulptur d<br />
Ab d 0,7 erreichen abge<br />
flachte, beknotete Primärrippen<br />
die Naht; Externrippen werden<br />
deutlich, noch herrscht Zwei<br />
teilung vor. Ab d = 2 über<br />
wiegt Dreiteilung, proradiate<br />
Primärrippen werden schmal<br />
und scharf. Bei d « 4 wird TZ<br />
= 3, vereinzelt tritt Vierteilung<br />
auf. Auf der Wohnkammer fällt<br />
TZ auf 2,3; Primärrippen wer<br />
den retroradiat, dornartige<br />
Knoten sind beständig.<br />
Leicht konkave, auf der adulten<br />
Wohnkammer retrokonkav<br />
werdende Primärrippen teilen<br />
sich in Dornen an der Stelle<br />
größter Windungsbreite. Bis<br />
d Ä<br />
4 sind Zwei- und Dreitei<br />
lung etwa gleich häufig (TZ =<br />
2,5), danach fällt TZ auf 2,3,<br />
manchmal sogar auf 2. Sekun<br />
därrippen auf der Flanke<br />
schwach konvex.<br />
Auf innersten Windungen<br />
zunächst nur Knoten an der<br />
Naht, ab d » 0,7 flache Flan<br />
kenrippen, die in den spitz<br />
werdenden Knoten zunächst<br />
gleichoft 2- und 3-fach gabeln.<br />
Kräftige Externrippen zunächst<br />
konvex, später fast gerade. TZ<br />
steigt schnell über 3 und fällt<br />
erst vor dem adulten Mund<br />
saum auf 2,3 ab. Flankenrippen<br />
verflachen auf der Wohnkam<br />
mer in Nahtnähe.<br />
in cm in %<br />
leioceras MASCKE 1907 (= Stemmatoceras MASCKE 1907, pars); dn: gr. telos = Ende, Vollendung, ceras = Horn; TA Am. blagdeni SOW. 1818. Großwüchsige, auffallend coro<br />
nate Formen mit weitem, meist trichterförmig eingesenktem Nabel, wulstig-breiten Primärrippen, die in Dornen an der Stelle größter Flankenbreite in gleichmäßig über den Venter<br />
gehende Extemrippen spalten. Sutur ähnlich der von Stephanoceras.<br />
T. blagdeni (SOW. 1818), dn:<br />
Sir CHARLES BLAGDEN,<br />
Zeitgenosse SOWERBYs.<br />
HT in BUCKM. 1908, Taf. 2<br />
u. 3; Orig. im BMN'H.<br />
T. multinodum (QU. 1886),<br />
Taf. 67, Fig. 2 hat stärker<br />
gewölbten Venter und <strong>des</strong><br />
halb vor der Naht liegende<br />
Knoten bei sonst gleichen<br />
Maßen.<br />
76<br />
(Teloceras sp.)<br />
CO<br />
18 cm<br />
Auf den Innenwindungen<br />
grobe, kräftige, zunächst<br />
schwach konkave, dann retro<br />
konkave Primärrippen, deren<br />
Knoten erst am Auslauf <strong>des</strong><br />
Nabels (HT) unter der Naht<br />
hervortreten. Auf Außenwän-<br />
dung Primärrippen breit wul<br />
stig, Knoten ebenfalls stumpfer.<br />
Externrippen dicht, schwach<br />
konvex und im Alter<br />
geschwächt. TZ 4.<br />
HT .<br />
3,2<br />
1<br />
3,4<br />
HT (2,7)<br />
3,3<br />
5,2<br />
HT, 18,2<br />
37<br />
41,5<br />
38<br />
37<br />
42,5<br />
42<br />
34<br />
40<br />
36<br />
46<br />
43"<br />
44,5<br />
48<br />
50<br />
H<br />
in %<br />
35<br />
30<br />
34<br />
35<br />
29<br />
29<br />
36<br />
31<br />
36<br />
(32)<br />
(30)<br />
30<br />
27<br />
29<br />
30<br />
0,59<br />
0,75<br />
0,60<br />
0,61<br />
0,74<br />
0,76<br />
0,64<br />
0,78<br />
0,64<br />
0,54<br />
0,65<br />
0~54<br />
0,67<br />
0,65<br />
28 0,34<br />
20 PR<br />
24 PR<br />
21 PR<br />
26 PR<br />
24 PR<br />
28 PR<br />
27 PR<br />
32 PR<br />
28 PR<br />
(17)PR<br />
167/5 PR<br />
20 PR<br />
16 PR<br />
23 PR<br />
91 SR
Art Sutur bei h —<br />
T.parvum WEISERT 1932,<br />
dn: lat. parvum = klein,<br />
wenig.<br />
HT ist Am. coronatus QU.<br />
1886, Taf. 67, Fig. 7; Orig.<br />
im IGPT.<br />
Von blagdeni durch geringe<br />
res Z und TZ geschieden,<br />
vermutlich artgleich mit sparsinodum<br />
QU. 1886, S. 548,<br />
<strong>des</strong>sen Name wegen fehlen<br />
der Abb. ungültig ist.<br />
T. subcoronatum (OPP.<br />
1856), dn: lat. sub = unter<br />
geordnet, coronatum =<br />
gekrönt.<br />
HT ist Am. coronatus oolithicus<br />
QU. 1847, Taf. 14,<br />
Fig. 4; = QU. 1886, Taf. 67,<br />
Fig. 8; Orig. im IGPT.<br />
Kleinwüchsige (?) Art mit<br />
weniger coronater Form, <strong>des</strong><br />
halb oft unter «Stemmatoce-<br />
ras» eingeordnet.<br />
T. Utiumbilicatum SCHMID<br />
TILL u. KRUMBECK 1938,<br />
dn: lat. latus = breit, umbili<br />
cus = Nabel.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im IGPEN.<br />
Ahnlich T. subcoronatum<br />
w-eniger coronat, aber von<br />
größerer Nabelweite (= acu-<br />
ticostatum WEISERT?).<br />
T. subblagdeni SCHMIDTILL<br />
u. KRUMBECK 1938, dn:<br />
lat. sub = untergeordnet,<br />
blagdeni s. o..<br />
Orig. <strong>des</strong> LT im IGPEN.<br />
Ahnlich T. subcoronatum,<br />
aber mit kleinerer TZ.<br />
T frechi (RENZ 1904)<br />
'tt ist Am. hiimphricsiamis<br />
•'•'••'uras QU. 1886, Taf. 66,<br />
h<br />
R- U; Orig. im IGPT.<br />
"*hr ähnlich latiumbHicatum.<br />
"ur von etwas anderer Skulp-<br />
Art Sutur bei h :<br />
T. (?) triplex WEISERT 1932,<br />
dn: lat. triplex = dreifältig.<br />
LT ist Fig. l.Taf. 16 in WEI<br />
SERT 1932; Ong. im IGPT.<br />
'Erstautor: MASCKE 1903,<br />
ungültig, weil unveröffent<br />
licht.)<br />
Nur mäßig coronate Über<br />
gangsform zwischen Stepbanoceras<br />
und Telocerjs.<br />
T. banksii (SOW. 1818), dn:<br />
SirJ. BANKS, 1744-1820,<br />
Präsident der Royal Society,<br />
London.<br />
HT in BUCKM. 1908, Taf. 1<br />
u. 3; Orig. im BMNH.<br />
Außergewöhnliche Art mit<br />
kräftigen Dornen auf<br />
schwach berippten Hanken.<br />
Otoitidae MASCKE 1907<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
11 cm<br />
24 cm<br />
Skulptur d<br />
Niedrige, weitständige Primär<br />
rippen enden in kräftigen,<br />
gerundeten Knoten bei ca. 35%<br />
der Windungshöhe, wo sie bi-<br />
oder trifurkieren. Zusätzliche<br />
Schaltrippen ergeben eine TZ<br />
von etwa 3.<br />
Auf den Flanken der Innen-<br />
und Außenwindungen kräftige,<br />
meist nicht bis in die Spitzen<br />
erhaltene Dornen, die von der<br />
Nabelnaht deutlich entfernt<br />
sind und im Alter zu unregel<br />
mäßigen Buckeln reduziert sein<br />
können. Externrippen wie bei<br />
vorstehenden Arten, aber<br />
schwächer, im Alter unschein<br />
bar.<br />
in cm<br />
LT<br />
HT<br />
N<br />
in %<br />
44<br />
46<br />
46<br />
50<br />
H<br />
in %<br />
30<br />
31<br />
29<br />
0,63<br />
0,72<br />
27 0,5<br />
Von SCHINDEWOLF 1965 auf Otoites und Emileia beschränkt (vergl. WEST. 1969), die inzwischen als Dimorphenpaar gelten und von WEST, und RICCARDI 1979 sogar zu<br />
Synonymen gemacht wurden.<br />
Mäßig bis stark involute Stephanocerataceae mit cadiconen Innen- und breit gerundeten Außenwindungen und vorwiegend beknoteten Spaltrippen. Sutur mit zweigeteiltem Ui und<br />
lang herabhängendem U n, der der inneren Flanke <strong>des</strong> Sattels U-i/I entspringt.<br />
Emileia BUCKM. 1898; TA Am. broccbiiSOW. 1818. Makro-und mikroconche Otoitidae mit mittlerer Nabelweite und rundem bis breittrapezoidem Windungsquerschnitt. Unteres<br />
Bajocium.<br />
Untergattung Emileia s. Str., makroconche Gehäuse mit egredierender Alterswohnkammer und glattem Mundsaum ohne Ohren. Altersskulptur manchmal erlöschend.<br />
E. (E.) polyscbi<strong>des</strong> (WAA<br />
GEN 1867), dn: gr. polyei<strong>des</strong><br />
= mannigfaltig.<br />
LT 1964 von WEST, aus Sig.<br />
OPP. in der BSPG bestimmt<br />
und erstmals abgebildet.<br />
= Am. gert'illii grandis QU.<br />
1886, Taf. 64, Fig. 9.<br />
E. (E.) brocchii (SOW. 1818),<br />
dn: G. B. BROCCHI, ital.<br />
Paläontologe, 1772-1826.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (Wohnkammer<br />
fehlt) im BMNH.<br />
Nur geringfügig von poly<br />
scbi<strong>des</strong> durch größere Win<br />
dungsbreite geschieden; art<br />
liche Trennung fragwürdig.<br />
78<br />
2,7 (7) mm 10 cm<br />
43 mm 12,5 cm<br />
Weitständige, scharfe, radiale<br />
bis leicht konkave Flankenrip<br />
pen mit größter Höhe auf<br />
innerer Hankenhälfte, bifurkie<br />
ren am Außenbug und werden<br />
dort zusätzlich durch Schaltrip-<br />
pen zur feinen, gleichmäßigen<br />
Externberippung vermehrt, die<br />
am Ende der adulten Wohn<br />
kammer häufig erlöscht. Mund<br />
saum mit stark proradiater Ein<br />
schnürung und externem Fort-<br />
Niedrige, schwach konkave,<br />
wulstige Flankenrippen, die auf<br />
Flankenmitte von ca. je 6 fei<br />
nen, leicht proradiaten Extem-<br />
rippen abgelöst werden.<br />
LTj<br />
10<br />
12<br />
14<br />
16<br />
HT 10<br />
12,5<br />
22<br />
24<br />
37<br />
42<br />
39<br />
23<br />
27<br />
45<br />
45<br />
37<br />
30<br />
32<br />
42<br />
40<br />
0,74<br />
0,94<br />
0/75<br />
0,68<br />
0,70<br />
27 PR<br />
81 SR<br />
12 Kn<br />
(14) Kn<br />
16 PR<br />
18 PR<br />
22 PR<br />
24 PR<br />
21 PR<br />
18 PR<br />
21 PR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bj 2a<br />
27; 7<br />
164<br />
253<br />
bj 3a<br />
28; 1<br />
34<br />
bj lc<br />
28; 2<br />
50<br />
71<br />
197<br />
211<br />
261<br />
bj lc<br />
28; 3<br />
34<br />
261
£. (E.) quenstedti WEST.<br />
1964, dn: F. A. QUEN-<br />
Art Sutur bei h :<br />
STEDT, Geologe in Tübin<br />
gen, 1809-1889.<br />
HT ist Am. geri'illü macroeepbalus<br />
QU. 1886, Taf. 64,<br />
Fig. 13; Otig. im IGPT.<br />
Von kleinerem N und höhe<br />
rer Endgröße als vorstehende<br />
Arten.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
betd =<br />
12 cm<br />
Skulptur d<br />
Der HT zeigt grobe, stark<br />
retroradiate Wulstrippen auf<br />
dem Nabelabfall, die sich an<br />
der Stelle maximaler Win<br />
dungsbreite verlieren und<br />
durch die etwa 6-fache Zahl<br />
von feinen, radialen Schaltrip<br />
pen abgelöst werden, welche<br />
gerade über den Venter ziehen.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
HT 12 19 45 0,7<br />
Untergattung Otoites MASCKE 190/, mikroconche Gehäuse mit verengter Alterswohnkammer und langen Ohren am Altersmundsaum. Gilt als Sexualpartner von Emileia s. str.<br />
£. (O.) sauzei (D'ORB.<br />
1846), dn: M. SAUZE, franz.<br />
Geologe <strong>des</strong> 19. Jhd.<br />
NT 1954 durch WEST,<br />
bestimmt und auf Taf. 1, Fig.<br />
1 abgebildet; Orig. in Sig.<br />
D'ORB. <strong>des</strong> CEPP inzwi<br />
schen verschollen.<br />
In Süddeutschland selten,<br />
von WEST. 1964 als UA,<br />
1979 als Synonym von O.<br />
contractus betrachtet.<br />
E. (O.) contractus (SOW.<br />
1825), dn: lat. contractus =<br />
zusammengezogen.<br />
NT in BUCKM. 1920, Taf.<br />
158, bestimmt u. neuabgebil<br />
det in WEST. 1954.<br />
= O. pinguissimus WEST.<br />
1954.<br />
Gegenüber sauzei geringfügig<br />
kleineres N und Z, artliche<br />
Trennung fragwürdig (s. o.).<br />
'•• 'O.; pauper WEST. 1954,<br />
d<br />
"- lat- pauper = arm<br />
»"ige Rippen).<br />
II-,<br />
1"'<br />
<strong>des</strong> 1 IT im IGPT (Ce<br />
•'"«Ucre Rippenzahl als bei<br />
'"'stehenden Arten.<br />
3,3 cm<br />
4 cm<br />
4,7 cm<br />
Kräftige, radiale Flankenrippen M T |2,5<br />
teilen sich in kleinen, stumpfen<br />
M T |2,5<br />
NT<br />
17 PR<br />
99 SR<br />
(40) (0,6) bj lc<br />
I I4,1 4,1 4,1 32 32 0,7 21 PR<br />
Knötchen der Flankenkante in 28; 4<br />
3 bis 4 Externrippen. Auf 3 24 41 0,6 22 PR<br />
Wohnkammer zuletzt nur noch 257<br />
Zweiteilung bei leichtem Vor 4 27 37 Ö763 23 PR 261<br />
wärtsknick. Externrippen zie 266<br />
hen gleichmäßig gerade über 7 29 39 0,76<br />
den Venter und erreichen am<br />
adulten Mundsaum ihre maxi<br />
male Stärke. Abb. <strong>des</strong> HT in<br />
D'ORB. 1846 zeigt gattungsty<br />
pische Ohren.<br />
Radiale oder leicht retroradiate,<br />
N T | ^<br />
ziemlich kräftige Flankenrippen b,l<br />
23<br />
32<br />
45<br />
31<br />
0,6<br />
0,65<br />
21 PR<br />
18 PR<br />
bi lc<br />
(Nabelabfall) teilen sich in 28; 5<br />
schwachen, z. T. spitzen Knöt 3 20 45" Ö~6T 20 PR<br />
chen der Flankenkante 4- oder 102<br />
3-fach, auf der Wohnkammer 4 24 39 5T63 T9 PR 257<br />
3- oder 2-fach. Externrippen 261<br />
meist proradiat, gegen den 5 29 34 ÖM T8 PR 266<br />
adulten Mundsaum oft retrora<br />
diat werdend. Lange Ohren bil 5,7 32 27 0,65 18 PR<br />
den vom offenen Ring, <strong>des</strong>sen<br />
Achse einen Gehäuseradius bil<br />
det.<br />
Innere Umgänge tragen auf<br />
HT \ 3<br />
(25) (42) (0,6) 13 PR b] lc<br />
HT \3 A dem Nabelabfall grobe, radiale 5,5 38 29 0,7 14 PR<br />
Rippen, die auf der Flanken 29: 2<br />
kante in unregelmäßigen Kno 60 40 13 PR<br />
ten 3- oder 4-fach zu kräftigen, 25"<br />
retroradiaten Externrippen auf<br />
spalten. Auf der Wohnkammer<br />
werden die Hankenrippen breit<br />
wulstig und verllachen beson<br />
ders in Nahtnähe. Am Ende<br />
herrscht Bifurkation vor. Die<br />
Ohren sind ca. 2.5 mm lang<br />
und ca. 10 mm breit.<br />
79
SphaerOCeratidae BUCKM. 1910, sensu SCHINDEWOLF 1965 (incl. Cadomites MUNIER-CHALMAS 1892)<br />
Äußerlich heterogene, nur durch gleichartige Suturentwicklung verbundene Gruppe von sphaeroconen und stephanocerasartigen Gehäusen<br />
mit sehr engem bis mittelweitem Nabe! und gemeinsamer Skulptur aus Spaltrippen. Alterswohnkammer egredierend und im Querschnitt<br />
modifiziert. Die durch starke Altersverengung <strong>des</strong> Nabels charakterisierte Gattung Spbaeroceras ist in Süddeutschland noch nicht sicher<br />
nachgewiesen. Bajocium und Bathonium.<br />
Chondroceras MASCKE 1907 (incl. Schmidtacerjs WEST. 1956; zur Existenzberechtigung weiterer Untergattungen s. WEST. u. RIC-<br />
CARDI1979, S. 150); dn: gr. Chondros = Korn, Knorpel, ceras = Horn; TA Am. gervilliiSOW. 1818. Kleinwüchsige, sphärocone Formen mit<br />
Nabelweiten zwischen 8 und 37% und Gehäusedicken zwischen B = 50 und 45%. Wändungsquerschnitt halbkreisförmig bis elliptisch, im<br />
Adultstadium je nach Art zu mehr oder weniger starker Verbreiterung, aber auch zu Verengung neigend. Die niedrige, manchmal unschein<br />
bare Berippung besitzt Maximalhöhe an der Stelle größter Windungsbreite, wo die Flankenrippen ohne Dornbildung 2- oder mehrfach<br />
gabeln. Sutur mit langem, schmalem U n, Mundsaum ohne Ohren, aber mit Einschnürung und extern vorspringenden Wülsten (s. Abb.). Zur<br />
Ähnlichkeit mit einigen Vertretern der Tulitidae s. dort. Man beachte die geänderte Bedeutung det dritten Spalte der Maßtabellen.<br />
Ch. gervillii (SOW. 1818).<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im BMNH<br />
Art Sutur bei h :<br />
Ch. evolvescens (WAAGEN<br />
1867), dn: lat. evolvo = aus<br />
einanderrollen.<br />
Tvpus (Autohyle) erstmals<br />
durch WEST. 1956, Taf. 1,<br />
Fig. 7 abgebildet.<br />
= Am. gervillii QU. 1886,<br />
Taf. 64, Fig. 3; = Ch. grandi-<br />
forme BUCKM. 1922; = Ch.<br />
wrighti und Ch. delphinus<br />
BUCKM. 1923<br />
Von gervillii nur durch etwas<br />
gröbere Flankenrippen und<br />
größere TZ geschieden.<br />
Ch. densicostatum WEST.<br />
1956, dn: lat. densus = dicht,<br />
costatus = berippt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Museum<br />
Basel.<br />
Durch Vergrößerung von H<br />
im adulten Wohnkammerbe<br />
reich nimmt N im Alter wie<br />
bei keiner anderen Art ab.<br />
80<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
4,6 i 2,3 cm<br />
6,5 mm 2,9 cm<br />
1,5 cm<br />
Skulptu d<br />
Niedrige, dichte, stark prora<br />
diate Rippen bifurkieren regel<br />
mäßig an der Stelle größter<br />
Windungsbreite oder leicht<br />
außerhalb derselben. Besonders<br />
in der Jugend erlöschen sie all<br />
mählich gegen die Nabelnaht,<br />
extern gehen sie regelmäßig<br />
und ungeschwächt über.<br />
Wohnkammerberippung deut<br />
lich gröber, adulte Mündung<br />
gattungstypisch. TZ = 2,0.<br />
Verläßlich unterscheidet sich<br />
die Berippung nur durch die<br />
TZ von Ch. geri'illii. Die Zahl<br />
der Externrippen kann infolge<br />
TZ = 2,4 bis 3 die von gervillii<br />
überschreiten. Gabelung der<br />
Rippen weit außerhalb der<br />
Steile größter Windungsbreite.<br />
Steinkernskulptur wesentlich<br />
schwächer als Schalenskulptur,<br />
Steinkerne im Alter oft glatt.<br />
Sehr feine, dichte und prora<br />
diate Rippen bi-oder trifurkie-<br />
ren auf, oder leicht obethalb,<br />
der größten Windungsbreite.<br />
Berippung auch auf dem Stein<br />
kern deutlich. TZ = 2,4.<br />
in cm<br />
HT 1,8<br />
12,7<br />
1,0<br />
1,8<br />
11,5<br />
|2,3<br />
HT 2,3<br />
12.3<br />
13,5<br />
2,8<br />
1 4,1<br />
22<br />
25<br />
19<br />
30<br />
20<br />
30<br />
20<br />
29<br />
22<br />
28<br />
20<br />
29<br />
18<br />
25<br />
67<br />
45<br />
83<br />
57<br />
87<br />
53<br />
71<br />
47<br />
47<br />
86<br />
66<br />
11,6 73<br />
HT<br />
72<br />
31<br />
0,53<br />
0,58<br />
0,60<br />
0,69<br />
0,48<br />
0,61<br />
0,55<br />
0,64<br />
0,59<br />
0,77<br />
0,56<br />
0,74<br />
0,56<br />
0,62<br />
0,58<br />
0,61<br />
0,49<br />
0,60<br />
36 PR<br />
35 PR<br />
(40) PR<br />
28 PR<br />
67 SR<br />
27 PR<br />
66 SR<br />
30 PR<br />
83 SR<br />
28 PR<br />
84 SR<br />
38 PR<br />
95 SR<br />
40 PR<br />
94 SR
An Sutur bei h =<br />
Ch. schmidti WEST. 1956,<br />
dn: Prof. H. SCHMIDT, Göt<br />
tingen<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Univ. Göttingen (Gzn<br />
108).<br />
= Ch. arkelli gerzense WEST.<br />
1956 (=C/J. evolutum W E S T<br />
1956?)<br />
Gegenüber vorstehenden<br />
Arten durch größeres N,<br />
Zunahme von N mit d und<br />
anderen Querschnitt aus<br />
gezeichnet.<br />
Ch. orbignyanum (WRIGHT<br />
1859), dn: D'ORBIGNY,<br />
franz. Paläontologe, 1802-<br />
1857.<br />
HT ist Am. brongniarti<br />
D'ORB. 1846, Taf. 137, Fig.<br />
3 u. 4; Orig. unauffindbar.<br />
NT bestimmt durch WEST.<br />
1956; Orig. unter Nr. 1909<br />
im CEPP.<br />
Neben relativ kräftigen Rip<br />
pen (ähnlich schmidti) nimmt<br />
Q im Alter nur wenig zu.<br />
Ch. tiiuic WEST. 1956, dn:<br />
Ijt. tcnuis = fein, zart.<br />
On s. J c s HT unter Gzn 128<br />
im Geol. Inst, der Univ. Göt<br />
tinnen.<br />
!>urm»tc und zugleich wcit-<br />
^häi'-te Art. '<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
ca. 6 mm 2,3 cm<br />
2,1 cm<br />
2,2 mm 1,6 cm<br />
Skulptur d<br />
Berippung ähnlich der von Ch.<br />
evolvescens relativ grob. Spal<br />
tung der proradiaten Rippen an<br />
der Stelle größter Windungs-<br />
breite mit TZ ==* 2,2. Stein<br />
kerne manchma] im Alter glatt.<br />
Die im Vergleich zu anderen<br />
Arten kräftigeren, meist stark<br />
proradiaten Rippen sind auch<br />
auf dem Steinkern ausgeprägt.<br />
Teilung an der Stelle größter<br />
Flankenbreite mit TZ zwischen<br />
2,0 und 2,5. WEST, teilt 1956<br />
in 3 UA mit verschiedener Rip<br />
pendichte. Der Gesamtbereich<br />
von Z entspricht dem von Ch.<br />
scbindewolfi s. Str., das er 1954<br />
in die Synonymie einbezieht.<br />
Die extrem feine, dichte Berip<br />
pung ähnelt oft einer Anwachs-<br />
strcifung. Gabelung <strong>des</strong>halb<br />
meist erst auf Wohnkammer<br />
ende deutlich (bifurkat'. Stein<br />
kerne fast immer glatt. Wachs<br />
tumsbereiche mit deutlichen,<br />
regelmäßigen Rippen treten<br />
sporadisch auf.<br />
in cm<br />
HT ,1,6<br />
12,6<br />
11,0<br />
11,6<br />
1.3<br />
'2,0<br />
1,5<br />
12,8<br />
NT 2,5<br />
,HT<br />
|2,1<br />
13,4<br />
1,2<br />
1,7<br />
12,2<br />
13,2<br />
11.8<br />
0,8<br />
1.3<br />
N<br />
in %<br />
30<br />
35<br />
32<br />
34<br />
32<br />
37<br />
29<br />
30<br />
25<br />
29<br />
28<br />
32<br />
28<br />
35<br />
30<br />
(34)<br />
36<br />
37<br />
36,5<br />
38<br />
36<br />
37<br />
60<br />
44<br />
55<br />
47<br />
60<br />
(50)<br />
60<br />
45<br />
73<br />
(59)<br />
67<br />
47<br />
71<br />
50<br />
(52)<br />
50<br />
46<br />
50<br />
45<br />
50<br />
39<br />
0,67<br />
0,77<br />
0,67<br />
0,79<br />
0,63<br />
(0,66)<br />
0,67<br />
0,78<br />
0,59<br />
0,68<br />
0,60<br />
0,66<br />
0,58<br />
0,68<br />
0,59<br />
(0,69)<br />
0,72<br />
0,70<br />
0,74<br />
0,76<br />
0,76<br />
0,92<br />
29 PR<br />
64 SR<br />
26 PR<br />
56 SR<br />
26 PR<br />
62 SR<br />
30 PR<br />
66 SR<br />
27 PR<br />
51 SR<br />
32 PR<br />
64 SR<br />
23 PR<br />
51 SR<br />
27 PR<br />
66 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bj 2a<br />
29: 6<br />
258<br />
bj 2a<br />
29; 7<br />
258<br />
261<br />
bj 2a<br />
29; 8<br />
211<br />
258<br />
81
Cadomitcs MUNIER-CHALMAS 1892; dn: lat. cadus = Weinkrug; TA Am. <strong>des</strong>iongebampsi DEFRANCE in D'ORB. 1846. Den Stephrmoccraten (Teloccratcn) ähnliche, oft o» n>.<br />
nate, mittelweit und meist tief genabelte Arten mit Primärrippen, die in Knötchen oder Dornen 2- bis 6fach in feine Sekimdärrippen gabeln, die ununterbrochen den Venter queren.<br />
Ober-Bajocium und Bathonium.<br />
Untergattung Cadomites s. str.; mittelgroße Formen (bis d = 13) mit egredierender Alterswohnkammer, die ihren Querschnitt rundet und verengt. Altersmundsaum meist einge<br />
schnürt, aber ohne Ohren. Wird als makroconcher Sexualpartner der folgenden Untergattung Polyplectites angesehen.<br />
C. (C.) <strong>des</strong>iongebampsi<br />
(D'ORB. 1846)<br />
Art Sutur bei h :<br />
Abb. <strong>des</strong> LT in DOUVILLE<br />
1909.<br />
C. (C.) extinetus (QU. 1886),<br />
dn: lat. extinetus = gelöscht<br />
(wegen <strong>des</strong> Fehlens der Kiel<br />
furche im Vergleich zur ähnlichen<br />
Reineckeia aneeps).<br />
LT ist Am. aneeps extinetus<br />
QU. 1886, Taf. 74, Fig. 30;<br />
Orig. im IGPT (verdrückt).<br />
Anscheinend nur durch<br />
geringere Endgröße und<br />
etwas gerundeteren Quer<br />
schnitt von <strong>des</strong>longchampsi<br />
geschieden.<br />
C. (C.) recteiobatus (HAUER<br />
1857), dn: lat. recte =<br />
gerade, lobatus = mit Loben<br />
versehen.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT unter Nr.<br />
1854-1-796 im Naturhist. ^<br />
Museum Wien.<br />
Durch fehlende Mundsaum-<br />
Einschnürung, breiteren<br />
Querschnitt und kleinere TZ<br />
von extinetus geschieden'.<br />
82<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
6 cm<br />
Skulptur d<br />
Scharfe, am Innenbug retro-<br />
verse und auf der Flanke etwa<br />
radiale Primarrippen trifurkie-<br />
ren in Dornen auf dem Außen<br />
bug. Im Alter werden die Rip<br />
pen provers, Altersmundsaum<br />
durch breite Lippe berandet.<br />
C4 Schwach sinusförmige, auf den<br />
6 cm<br />
ca. 15 mm 8,7 cm<br />
Innenwindungen leicht pro<br />
verse Primarrippen, die an der<br />
Stelle größter Windungsbreite<br />
in spitzen Dornen bis zu 6fach<br />
(TZ = 5 ± 0,5) in sehr feine<br />
Externrippen gabeln. Die Dor<br />
nen der Innenwindungen liegen<br />
an der folgenden Nabelwand<br />
an. Die Skulptur der Alters<br />
wohnkammer ist kaum<br />
geschwächt.<br />
Schwach sinusförmige Primär<br />
rippen sind schmal und hoch<br />
und spalten am Außenbug 2-<br />
bis 4fach in spitzen Dornen.<br />
Externrippen sehr fein, konvex<br />
und gleichmäßig. TZ 3 bis 4.<br />
in cm<br />
LT<br />
LT 5,6<br />
3,4<br />
N<br />
in %<br />
34<br />
n<br />
H<br />
in %<br />
39<br />
(44) 31<br />
(31)<br />
(39)<br />
38<br />
39<br />
40<br />
HT 5 32<br />
Z<br />
40<br />
37<br />
39<br />
37<br />
35<br />
36<br />
(32)<br />
41<br />
36<br />
38<br />
40<br />
41<br />
41<br />
43<br />
48<br />
0,7<br />
(0,6)<br />
0,73<br />
0,67<br />
0,70<br />
0,72<br />
0,60<br />
0,52<br />
0,57<br />
0,57<br />
0,67<br />
0,57<br />
0,63<br />
38 PR<br />
31 PR<br />
(1S0)SR<br />
24 PR<br />
110 SR<br />
28 PR<br />
Zone<br />
i Tat".<br />
Tit.<br />
29; 9<br />
bj 3c<br />
bt la<br />
29; 10<br />
114<br />
197<br />
122 SR 211<br />
32 PR<br />
174 SR<br />
32 PR<br />
168 SR<br />
36 PR<br />
26 PR<br />
104 SR<br />
26 PR<br />
102 SR<br />
29 PR<br />
34 PR<br />
137 SR<br />
32 PR<br />
120 SR<br />
34 PR<br />
124 SR<br />
bj 3c<br />
bt la<br />
29; 11<br />
95<br />
114<br />
139
Untergattung Polyphänes MASCKE 1907; dn: gr. poly- = vielfach, plectos = geflochten; TA Am. linguiferus D'ORB. 1846 (NT in GROS-<br />
SOUVRE 1930, Taf. 40, Fig. 10). Kleinwüchsige Formen (bis d «* 5), die sich von der Nominatuntergattung nur durch geringere Modifikation<br />
der Alterswohnkammer und die Existenz schmaler Ohren (s. Abb.) unterscheiden. Polyplectites wird als mikroconcher Sexualpartner von<br />
Cadomites s. str. angesehen.<br />
C. (P.) linguiferus (D'ORB.<br />
1846), dn: lat. lingua =<br />
Zunge, ferre = tragen.<br />
Orig. <strong>des</strong> LT (D'ORB., Taf.<br />
AN Sutur bei h :<br />
136, Fig. 4 u. 5; verschollen<br />
NT gemäß WEST. 1954 in<br />
CROSSOUVRE 1930, Taf.<br />
40, Fig. 10; Orig. im Geol.<br />
Museum der Univ. Lyon<br />
= Cadomites äff. orbignyi<br />
SCHMIDTILL u. KRUM<br />
BECK 1938<br />
C. (R) globosus WEST. 1954,<br />
dn: lat. globosus = kugelig.<br />
HT ist Normannites (Polyplectites)<br />
linguiferum DORN<br />
1927, Taf. 6, Fig. 2 (ohne<br />
Wohnkammer, geschätzte<br />
Endgröße d = 5,5 cm); Orig.<br />
im Geol. Inst. Braunschweig.<br />
Engnabliger und etwas breit<br />
mündiger als linguiferus.<br />
G. II'., domi (ROCHE 1939),<br />
dn: P DORN, fränkischer<br />
Geologe<br />
IT TS: \omuniutes (Polyplec-<br />
1<br />
h<br />
"Z't'ferum DORN<br />
'"- • Taf. 5, Fig. 6; Orig. im<br />
Inst. Braunschweig.<br />
*e:i:uhliger und von gerint-c-t:<br />
1als vorstehende<br />
Arten.<br />
u, ü s u,v<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
3,4 mm 2,4 cm<br />
2 mm 3,1 cm<br />
10 mm<br />
Skulptur d<br />
Scharfe, am Nabelabfall retro-<br />
verse, dann leicht proradiate<br />
Primärrippen, die auf Seiten<br />
mitte drei-oder vierfach in klei<br />
nen Dornen gabeln. Feine,<br />
regelmäßige, schwach prora<br />
diate Sekundärrippen. Der NT<br />
hat etwa 12 mm lange und<br />
3 mm breite Ohren.<br />
Schwach konkave, schmale,<br />
hohe Flankenrippen gabeln an<br />
der Stelle größter Windungs<br />
breite (Außenbug) in spitzen,<br />
langen aber kleinen Dornen mit<br />
TZ 3,1 in die ebenfalls<br />
hohen Externrippen.<br />
Schwach proradiate, später<br />
schwach retroradiate, sehr<br />
hohe, schmale und scharfe<br />
Flankenrippen gabeln in klei<br />
nen, spitzen Dornen an der<br />
Stelle größter Wmdungsbreite<br />
(nahe Außenbug: mit TZ =<br />
2.". Auch die gleichmäßigen<br />
Externnppen sind schmal und<br />
scharf. Ohren <strong>des</strong> LT sind<br />
4 mm breit und 12 mm lang.<br />
in cm<br />
LT 2,2<br />
NT 3,4<br />
(31}<br />
(32)<br />
36<br />
HT 3,6 26<br />
LT<br />
28<br />
38<br />
44<br />
41<br />
(40)<br />
(40)<br />
38<br />
36<br />
36<br />
32<br />
28<br />
37<br />
37<br />
(0,87)<br />
(0,73)<br />
0,61<br />
0,55<br />
0,64<br />
0,74<br />
0,69<br />
(77) SR<br />
34 PR<br />
120 SR<br />
29 PR<br />
(90)SR<br />
26 PR<br />
(Sl)SR<br />
23 PR<br />
30 PR<br />
24 PR<br />
64 SR<br />
0,66 31 PR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bj 3c<br />
bis<br />
bt 2<br />
29; 12<br />
139<br />
211<br />
257<br />
bt la<br />
29; 13<br />
139<br />
211<br />
257<br />
bt 1<br />
30; 1<br />
139<br />
257<br />
83
Parküisoniidae buckm. 1920<br />
Meist scharf berippte Stephanocerataceae mit externer Rippenunterbrechung und einer oder mehreren Knotenreihen an Spaltpunkten bzw. Rippenenden. Einziges verbinden<strong>des</strong> Ele<br />
ment der sonst verschiedenen Unterfamilien ist die Skulptur. Wegen der Ausbildung eines Lobus U„ bei den eigentlichen Parkinsonien wurden die Parkinsoniidae von SCHINDE<br />
WOLF 1965 in die Stephanocerataceae übernommen. Die vielfach unterschiedliche Suturontogenie erschwert die stammesgeschichtliche Zuotdnung der einzelnen Gruppen. Neue<br />
Vorschlage zur Grolsgliederung der Parkinsonien und Garantianen wurden 1982 von BESNOSOV u. KUTUZOVA gemacht.<br />
Parkinsoninae buckm. 1920<br />
In normaler, ebener Spirale aufgerollte Parkinsoniidae.<br />
Caumontisphinctcs BUCKM. 1920 {-Praebigotites WETZEL 1936, = Infragarantiana WEST. 1956); dn: A. DE CAUMONT, franz. Archäologe und Geologe, 1802-1873; TA C.<br />
polygyralis BUCKM. 1920. Evolute, perisphinctenähnliche Gehäuse mit ausgeprägten, vorwiegend bifurkierenden Rappen. Rippenenden an externer Unterbrechung überwiegend<br />
stumpfwinklig, z. T. alternierend, gegenüberstehend. Abgrenzung gegen Parkinsonia schwierig; Caumontisphinctcsisi meist von geringerer Endgröße und zeigt breitere externe Rip<br />
penunterbrechung. Sehr ähnliche Vertreter von Leptosphinctes haben deutlichere Einschnürungen und relativ schwache Adultskulptur. Unteres Ober-Bajocium {niortense-Zonc,.<br />
Untergattung Caumontisphinctes s. Str.. Makroconche Formen mit glattem Adult-Mundsaum ohne Ohren.<br />
Art Sutur bei h = schnitt<br />
Quer Zone<br />
bei d =<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q z Taf.<br />
C. (C.) diniensis PAVIA 1973. Radiale bis schwach proradiate HT 8 55 26 (1,4) 45 PR bj 3al<br />
HT ist C. (C.) aplous diniensis<br />
PAVIA 1973, Taf. 21, Fig.<br />
5; Orig. im Geol. Inst. Turin.<br />
= Leptosphinctes garniert<br />
IT ff<br />
/ \ oder leicht konkave Flankenrip<br />
/ \<br />
pen mäßiger Dichte bifurkieren<br />
\ / • — \ J etwas oberhalb der Flankenmitte.<br />
Knötchen sind höchstens<br />
X 1 angedeutet. Glattes Medianband<br />
wird im Alter breiter,<br />
2<br />
6<br />
50<br />
52<br />
21<br />
26<br />
ö\55<br />
Tjäs<br />
29 PR 30; 2<br />
1 (38) SR<br />
53<br />
| 40+5PR<br />
68 SR<br />
PAVIA 1973 (geringe Unter Rippenenden stehen sich im<br />
schiede im juvenilen Win<br />
dungsquerschnitt sind für<br />
Trennung ungenügend).<br />
12 mm<br />
^\|<br />
w<br />
8,2 mm ca. 4 cm<br />
stumpfen Winkel alternierend<br />
gegenüber. Schwache Ein<br />
schnürungen sporadisch.<br />
C. (C.) nodatus BUCKM.<br />
1921, dn: lat. nodatus = N * ) /v f ^-s<br />
Auf den Innenwindungen<br />
schwach konkave bis prokon<br />
HT 5 49,5 29 1,0<br />
41 PR bj 3al<br />
1 70 SR<br />
be knotet. kave, im Alter schwach retro 30; 3<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. SurrcTV-~\<br />
,<br />
konkave Flankenrippen, die<br />
wenig oberhalb der Flanken<br />
3 51 26 0,86<br />
r<br />
33 PR<br />
63 SR 53<br />
vey Museum, London. mitte in kleinen Knötchen<br />
Durch Beknotung von<br />
diniensis geschieden.<br />
UA C. (C.) nodatus bisingen-<br />
sis DIETL 1980, dn: Bisin<br />
11 mm<br />
1 \<br />
bifurkieren. Sporadisch Einzel<br />
rippen. Sekundärrippen erlö<br />
schen extern unter Bildung<br />
eines relativ breiten, glatten<br />
Ban<strong>des</strong>, an dem sie stumpf<br />
winklig alternierend gegenüber<br />
stehen.<br />
Die ansonsten der Nominatun<br />
terart gleichende Berippung<br />
41 PR<br />
4,5 53 27 | 72 SR<br />
HT 3,6 52 28<br />
gen, Fundort in der Zollern [ ) zeigt eine abruptere Externun 3ÖT"<br />
alb, Württ.<br />
1 J<br />
terbrechung bei deutlich<br />
28 PR<br />
2 5 53 28 0,80<br />
schmälerem glatten Band.<br />
56 SR 53<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
Von der Nominatunterart nur<br />
durch schmaleres Ventral<br />
band geschieden.<br />
84<br />
2,5 cm<br />
34 PR<br />
66 SR<br />
Lit.<br />
bj 3al
C. (C.) hennigi (BENTZ<br />
1924), dn: E. HENNIG,<br />
deutscher Geologe.<br />
LT ist Bigotites hennigi<br />
An Sutur bei h =<br />
BENTZ 1924, Taf. 9, Fig. 1<br />
(nach PAVIA 1973); Orig.<br />
verschollen.<br />
Von vorstehenden Arten vor<br />
allem durch größeres Q<br />
geschieden:<br />
C. (C.) rata (BENTZ 1924),<br />
dn: lat. rota — Rad<br />
Typusmaterial verschollen,<br />
Lectotyp wurde nicht<br />
bestimmt.<br />
Etwas kräftiger berippt als<br />
hennigi, deutlich beknotet<br />
und von trapezoidem Quer<br />
schnitt der Innenwindungen.<br />
C. (C.) bifurcus BUCKM.<br />
1920, dn: lat. bi- = zweifach,<br />
furca = Gabel.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Sur-<br />
vey Museum, London.<br />
Relativ weitnablige und breit<br />
mündige Art.<br />
C (C.) polygyralis BUCKM.<br />
1920, dn: gr. polys = viel,<br />
gyralis = gekrümmt.<br />
Von außergewöhnlich hoher<br />
Rippendichte.<br />
(<br />
>(..t) prorsicostatus STU-<br />
RANI 19"1, dn: lat. prorsi-=<br />
vorgeneigt, costatus =<br />
IxTippt.<br />
<strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Universität Padua, Italien.<br />
vorstehenden Arten<br />
durch recht- bis spitzwinklig<br />
gegenüberstehende Rippen<br />
Kcschicdcn.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
13 mm 7 cm<br />
• Radiale<br />
ca. 3 cm<br />
0 Der<br />
Skulptur d<br />
Radiale bis leicht proradiate<br />
Flankenrippen bifurkieren im<br />
äußeren Flankendrittel bei spo<br />
radischer Einschaltung von<br />
Einfachrippen, besonders auf<br />
den Außenwindungen. In den<br />
Gabelpunkten können, beson<br />
ders auf den Innenwindungen,<br />
Knötchen angedeutet sein. Rip<br />
penenden am breiten Ventral<br />
band sehr stumpfwinklig und<br />
oft nur schwach alternierend<br />
gegenüberstehend.<br />
Kräftige, radiale bis proradiate<br />
Flankenrippen bifurkieren in<br />
deutlichen Knötchen im äuße<br />
ren Flankendritte!. Einzelrippen<br />
selten. Rippenenden am breiten<br />
Ventralband stumpfwinklig<br />
alternierend gegenüberstehend.<br />
bis proradiare Rippen<br />
spalten in auffallenden Knöt<br />
chen am Außenbug. Einzelrip-<br />
pen sporadisch nur auf den<br />
Außenwindungen. Rippenen<br />
den am mittelbreiten Ventral<br />
band stumpf- bis nahezu recht<br />
winklig, mäßig alternierend<br />
gegenüberstehend.<br />
HT zeigt leicht prokon<br />
kave, feine Rippen, die hin und<br />
wieder auf 2/3 Flankenhöhe<br />
bifurkieren. Das glatte Median<br />
band, an dem sich die Rippen- '<br />
enden alternierend stumpfwink<br />
lig gegenüberstehen, ist von<br />
mittlerer Breite. Schwäbisches<br />
Exemplar (D1ETL 1980) besitzt<br />
radiale Rippen.<br />
Auf den Innenwindungen aus<br />
geprägt proradiate Rippen, auf<br />
den Außenwindungen radial<br />
und weitständig werdend, am<br />
Außenbug in schwachen Kno<br />
ten bifurkierend. Die Sekundär<br />
rippen stehen an sehr schmaler<br />
Medianunterbrechung alternie<br />
rend unter ca. 90° gegenüber.<br />
in cm<br />
LT 7,3<br />
4,1<br />
5,4<br />
6,4<br />
7,9<br />
4,6<br />
5,2<br />
7,9<br />
HT 3,4<br />
1,5<br />
3,1<br />
5,4<br />
HT 6,7<br />
4,2<br />
HT 1,2<br />
4,2<br />
49<br />
52<br />
56<br />
52<br />
54<br />
56<br />
52<br />
56<br />
56<br />
53<br />
61<br />
51<br />
51<br />
52,5<br />
54<br />
H<br />
in %<br />
28<br />
26<br />
25<br />
26<br />
25<br />
25<br />
25<br />
24<br />
24<br />
21,5<br />
24<br />
25<br />
28<br />
27<br />
26<br />
27<br />
1,2<br />
1,0<br />
1,1<br />
1,04<br />
1,1<br />
0,72<br />
0,64<br />
ÖT78<br />
1,24<br />
(1,3)<br />
37 PR<br />
47 PR<br />
43 PR<br />
49 PR<br />
47 PR<br />
41 PR<br />
34 PR<br />
54 SR<br />
26 PR<br />
l SR<br />
34 PR<br />
53 SR<br />
37 PR<br />
62 SR<br />
70 PR<br />
86 SR<br />
56 PR<br />
0,65 30 PR<br />
(37) PR<br />
85
Untergattung Infraparkinsonia WEST. 1956; dn: lat. infra- = unterhalb, Parkinsonia = <strong>Ammoniten</strong>gattung <strong>des</strong> oberen Bajociums (s. dort); TA Parkinsonia inferior BENTZ 1 1<br />
'24.<br />
Mikroconche Formen mit Mündungsohren.<br />
C. (I) inferior (BENTZ<br />
Art Sutur bei h :<br />
1924), dn: lat. inferus = der<br />
Orig. <strong>des</strong> HT i chollen.<br />
Kaum unterscheidbar von<br />
Jugendwindungen von C.<br />
(C.) rota. Maximalgröße ca.<br />
3,6 cm.<br />
C. (I.) pbaulus BUCKM.<br />
1922, dn: gr. phaulos =<br />
schwach, gering.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Sur-<br />
vey Museum, London.<br />
Von inferior durch anderen<br />
Innenwindungsquerschnitt<br />
und geringere Endgröße<br />
geschieden.<br />
C. (I.) debilis (WETZEL<br />
1937), dn: lat. debilis = ent<br />
kräftet, schwach.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Universität Kiel.<br />
Von inferior und pbaulus<br />
durch andere Skulpturent<br />
wicklung unterscheidbar.<br />
C. (f.) grmbingensis DIETL<br />
1980, dn: Gruibingen, Kreis<br />
Göppingen/Württ.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS, Nr.<br />
2588S.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch relativ grobe Rippen<br />
mit markanten Knötchen<br />
geschieden.<br />
86<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
2,8 cm<br />
6,3 mm 2,1 cm<br />
Skulptur d<br />
Stark ausgeprägte, radiale bis<br />
konkave Rippen, die im äuße<br />
ren Flankendrittel in feinen<br />
Knötchen häufig bifurkieren.<br />
Externe Rippenenden noch<br />
stumpfwinklig, alternierend an<br />
schmalem Medianband gegen<br />
überstehend. Mündungsohren<br />
an schwäbischen Exemplaren<br />
bisher nicht nachgewiesen.<br />
Proradiate bis prokonkave Rip<br />
pen spalten mit seltenen Aus<br />
nahmen in Flankenmitte unter<br />
gelegentlichen Andeutungen<br />
von Knötchen. Die an schma<br />
lem Ventralband sehr stumpf<br />
winklig gegenüberstehenden<br />
Sekundärrippen alternieren nur<br />
auf den Innenwindungen deut<br />
lich, im Wohnkammerbereich<br />
nicht immer.<br />
Radiale bis konkave Rippen<br />
bifurkieren auf den Innenwin<br />
dungen immer, zur Altersmün<br />
dung hin stetig abnehmend, im<br />
äußeren Flankendrittel. Auf den<br />
Innenwindungen im Gabel<br />
punkt angedeuteter Knoten<br />
verliert sich im Alter. Externe<br />
Rippenenden stehen sich auf<br />
den Innenwindungen stumpf<br />
winklig alternierend gegenüber;<br />
auf der Alterswohnkammer<br />
häufig externe konvexe Rip<br />
penbögen.<br />
Die relativ weitständigen,<br />
schwach konkaven Rippen<br />
spalten in feinen Dornen auf<br />
Flankenmitte fast regelmäßig<br />
zweifach. Am mittelbreiten<br />
Ventralband stehen die Rippen<br />
enden stumpfwinklig und nur<br />
schwach alternierend gegen<br />
über.<br />
in cm<br />
HT 3,6 55<br />
53±2<br />
53<br />
HT 2,3 51<br />
52<br />
25<br />
24<br />
34,5<br />
HT 2,0 56 28<br />
1,14<br />
0,96<br />
34,5 1,10<br />
26,5 1,02<br />
HT 2,4 53 1,03<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
42 PR bj 5a2<br />
39 PR<br />
44 PR<br />
30 PR<br />
58 SR<br />
31 PR<br />
60 SR<br />
(55) PR<br />
(80) SR<br />
44 PR<br />
28 PR<br />
56 SR<br />
30: 10<br />
bj 3a2<br />
30; 11<br />
53<br />
bj 3al<br />
bj 3a2<br />
30; 12<br />
53<br />
269<br />
bj 3a<br />
30; 13<br />
53
Strenoceras HYATT 1900; TA Am. niortensis D'ORB. 1846. Mikroconche, mittelweit genabelte Gehäuse mit anfangs breitelliptischem, im Alter manchmal hochelliptischem, über<br />
den Rippen meist hexagonalem Windungsquerschnitt. Auf den Innenwindungen überwiegen Gabel-, auf den Außenwändungen Einfachrippen, die alle kräftige Externknoten und<br />
weniger kräftige Lateralknoten tragen und extern unterbrochen sind, ohne zu alternieren. Die sehr ähnliche Untergattung Pseudogarantiana (s. unter Garantiana), in die nach DIETL<br />
1981 auch der populäre Am. subfurcatus ZIETEN gehört, unterscheidet sich von Strenoceras durch überwiegende Gabelrippen und schwächere Extern knoten. Makroconche Partner<br />
von Strenoceras wurden vorgeschlagen (Garantiana), halten jedoch den Kriterien nicht stand. Ober-Bajocium (niortense-Zone).<br />
Art Sutur bei h =<br />
Str. bentzi DIETL 1983, dn:<br />
A. BENTZ, deutscher Geo<br />
loge.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS<br />
unter Nr. 26599.<br />
= 5rr. latidorsatum BENTZ<br />
1924, Taf. 4, Fig. 10 und 12.<br />
Breitmündig und grob skulp-<br />
tiert; B' stets größer als N<br />
Str, latidorsattan BENTZ<br />
1924, dn: lat. latus = breit,<br />
dorsum = Rücken.<br />
LT ist nach DIETL 1983:<br />
Fig. 11, Taf. 4 in BENTZ<br />
1924; Orig. verschollen.<br />
Im Gegensatz zu bentzi ist<br />
N stets größer als B', und die<br />
Rippen sind dichter.<br />
5fr. quenstedti DIETL 1983,<br />
dn: F. A. QUENSTEDT,<br />
Geologe in Tübingen, 1809-<br />
1889.<br />
LT ist, gemäß DIETL 1981,<br />
Am. bifurcatus oolithicus QU.<br />
1886, Taf. 70, Fig. 1; Orig.<br />
im IGPT.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch höheren Querschnitt<br />
geschieden.<br />
Die UA quenstedti spinosum<br />
DIETL 1983 trägt stellen<br />
weise runde Externstacheln.<br />
Str. niortense (D'ORB. 1846),<br />
dn: Niort, Fundort in West<br />
frankreich.<br />
LT ist, gemäß DIETL 1981,<br />
P'". r<br />
u. 8, Taf. 121 in<br />
D'ORB. 1H46; Orig. vermut-<br />
;<br />
'': verschollen.<br />
" : c J<br />
°° 6<br />
erreichende Art<br />
"vsuzi f. lst ^ l M n L. Gabelrippen<br />
'm Alter.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
o Grobe,<br />
11,5 mm 3,3 cm<br />
10 mm<br />
v-<br />
5,8 mm<br />
o Die<br />
ca. 10 mm 4,4 cm<br />
Skulptur d<br />
auf den'Innenwindun<br />
gen proverse, im Alter leicht<br />
konkave Rippen biegen in<br />
rundlichen Dornen am Außen<br />
bug leicht nach hinten,<br />
wodurch ein sinusförmiger Ein<br />
druck entsteht. Nur wenige<br />
bifurkieren (TZ « 1,4). Alle<br />
Externrippen enden in gegen<br />
ständigen, radial gedehnten<br />
Extemdornen an nicht sehr<br />
breiter Rippenunterbrechung.<br />
Die Berippung unterscheidet<br />
sich von derjenigen von bentzi<br />
durch etwas größere Dichte,<br />
schwächer ausgeprägte Sinus<br />
form und etwas schwächere<br />
Lateral knötchen.<br />
Diese, vermutlich häufigste<br />
südwestdeutsche Strenoceras-<br />
Art trägt im allgemeinen<br />
schwach prokonkave Primärrip<br />
pen, die zum geringeren Teil<br />
am Außenbug in kleinen Dor<br />
nen mit runder Basis bifurkie<br />
ren. Die überwiegend einfachen<br />
Rippen tragen diesen Dorn<br />
dort ebenfalls und biegen darin<br />
zu konkaven Externkomponen<br />
ten [eicht nach hinten, die an<br />
der Medianunterbrechung in<br />
radial ausgezogenen Dornen<br />
enden. Skulprur insgesamt sehr<br />
variabel.<br />
fast ausnahmslos ungespal<br />
tenen Rippen sind nur schwach<br />
I gekrümmt und variieren zwi-<br />
| sehen konkav, prokonkav,<br />
sinusförmig und radial.<br />
Schwache Flankendornen erhe<br />
ben sich bei 60-80% Hanken-<br />
| höhe, kräftigere Evremknoten<br />
j in einigem Abstand von der<br />
schmalen, medianen Rippenun<br />
terbrechung, die zur Furche<br />
vertieft sein kann.<br />
in cm<br />
HT 3,3<br />
3,2<br />
LT 3,1<br />
3.4<br />
LT 3,5<br />
LT 5.4<br />
3S<br />
37,5<br />
45<br />
41,4<br />
42,3<br />
44,3<br />
3,9 46.6<br />
43,5<br />
43<br />
H'<br />
in °/o<br />
33<br />
35<br />
32<br />
34<br />
31,5<br />
32<br />
33<br />
33<br />
32,5<br />
34<br />
30<br />
30<br />
0,79<br />
0,90<br />
0,67<br />
(1)<br />
17Ö7<br />
1,06<br />
(1,1)<br />
0,96<br />
T7Ö3<br />
1,00<br />
23 PR<br />
31 SR<br />
23 PR<br />
34 SR<br />
24 PR<br />
38 SR<br />
28 PR<br />
36 SR<br />
31 PR<br />
41 SR<br />
33 PR<br />
32 PR<br />
42 SR<br />
33 PR<br />
43 SR<br />
30 PR<br />
32 SR<br />
34 PR<br />
35 SR<br />
31 PR<br />
33 SR<br />
87
Art Sutur bei h =<br />
Str. bajoccnse (DE BLAIN-<br />
YTLLE 1840), dn: Fundort<br />
Bayeux in Nordwestfrank<br />
reich.<br />
HT abgebildet in DOUV1LLE<br />
1909, Taf. 133.<br />
= Am. bifurcatus oolithicus<br />
QU. 1886, Taf. 70, Fig. 4.<br />
Von mortense nur durch die<br />
größere TZ, von allen ande<br />
ren Strenoceraten durch die<br />
hohe Endgröße geschieden<br />
Str. bigott (BRASIL 1894),<br />
dn: A. BIGOT, franz. Geo<br />
o loge, geb. 1863.<br />
Durch fibulate Rippen von<br />
allen anderen Strenoceraten<br />
geschieden.<br />
Str. serpens (ZATWOR-<br />
NITZKY 1914), dn: lat. ser<br />
pens = Schlange.<br />
Große Ähnlichkeit in Form<br />
und Skulptur besteht zu lati-<br />
dorsatum, das lediglich etwas<br />
weniger Spaltrippen aufweist.<br />
5fr. suevicum DIETL 1983,<br />
dn: lat. suevicus = schwa<br />
bisch.<br />
HT ist Am. bifurcatus latisuicatus<br />
QU. 1886, Taf. 70, Fig.<br />
2; Orig. im SMNS.<br />
Größte Ähnlichkeit besteht<br />
zu quenstedti, das jedoch eine<br />
schmälere Rippenunterbre<br />
chung besitzt.<br />
Str. rotundum BENTZ 1928,<br />
dn: lat. rotundus = gerundet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen,<br />
Nachguß im NLABH.<br />
Durch nahezu kreisförmigen<br />
Querschnitt ausgezeichnet.<br />
88<br />
8,5 mm<br />
6,3 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Die<br />
5 cm<br />
( )<br />
3,9 cm<br />
Z~N<br />
C;<br />
5 cm<br />
Skulptur d<br />
Bei erheblicher individueller<br />
Variation der Berippungsdichte<br />
unterscheidet sich die Skulptur<br />
von derjenigen von mortense<br />
nur durch einen höheren<br />
Gabelrippenanteil im Alter.<br />
Häufig treten im 1. Drittel der<br />
Alterswohnkammer spir.alige<br />
Stege zwischen den Lateralkno<br />
ten auf.<br />
Nur durch eine breitere ventra<br />
le Rippenunterbrechung unter<br />
scheidet sich Str. robustum<br />
BENTZ 1928.<br />
Die leicht proradiaten Einzel-<br />
rippen tragen am Außenbug<br />
schwache Dornen. Oft laufen<br />
die Externrippen zweier<br />
benachbarter Dornen zum glei<br />
chen Externknoten, wodurch<br />
diese streckenweise etwa halbe<br />
Dichte zeigen. Sie sind kräfti<br />
ger als die Flankenknoten.<br />
Auf den Innenwindungen pro<br />
verse, gerade oder geschwun<br />
gene Rippen wechselnder<br />
Dichte. Auf der Außenwindung<br />
radiale bis prokonvexe Primär<br />
rippen, die in feinen Dornen<br />
am Außenbug bifurkieren oder<br />
ungeteilt zum kräftigeren<br />
Externknoten laufen.<br />
Leicht prokonkave Primärrip<br />
pen sind, wie bei der Gattung<br />
üblich, am Außenbug bedornt<br />
und enden, teilweise bifurkie-<br />
rend, an radial ausgezogenen<br />
Ventraldornen. Die glatte<br />
mediane Rippenunterbrechung<br />
ist bei d = 3,8 etwa 3,5 mm<br />
breit.<br />
Grobe, meist radiale Rippen,<br />
die nur zum kleinen Teil bei<br />
2/3 Hankenhöhe bifurkieren<br />
und dort, auch wenn sie ein<br />
zeln bleiben, kleine Knötchen<br />
tragen. An der breiten Extern<br />
unterbrechung enden die Rip<br />
pen in groben Knoten. Auf der<br />
Alterswohnkammer verschwin<br />
den die Gabelrippen manchmal<br />
völlig.<br />
in cm<br />
HT 4,7<br />
4,1<br />
5,6<br />
6,7<br />
N<br />
in %<br />
43<br />
41<br />
39,5<br />
43,7<br />
H'<br />
in %<br />
32<br />
35,4<br />
29<br />
31<br />
Q'<br />
Z<br />
j<br />
0,97 33 PR<br />
27 PR<br />
0,98<br />
34 SR<br />
1,0 j<br />
34 I'R<br />
43 SR<br />
37 PR<br />
45 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
l.it.<br />
bj 3a2<br />
h] 3a3<br />
31; 1<br />
59<br />
Sl<br />
197<br />
HT 4,2 43 33 1,0 (34) PR bj 3a<br />
4,7 44 29 1,08 38 PR 31; 2<br />
HT 2,4 37 35 0,78 bj 3a3<br />
2,9 41 29~5 Ö~85 |<br />
±3,5<br />
25<br />
59<br />
28 PR 31; 3<br />
40 SR<br />
HT 3,9 (37) (38)<br />
29 PR bj 3a3<br />
(1,1) 1<br />
1 (38)SR<br />
31; 4<br />
3,8 44 3174 1,02<br />
I<br />
32 PR<br />
41 SR 59<br />
59<br />
197<br />
HT 4,9 45 30 0,79 28 PR bj 3a3<br />
4 43 31 0,78 27 PR 31; 5<br />
17<br />
59
Orthogarantiana BENTZ 1928; dn: gr. orthos = gerade, Garantianas, gleichnamige Gattung; TA Garantiaschroederi BENTZ 1924. Evolute Vorläufer der eigentlichen Garantianen<br />
mit kreisförmigem oder hochovalem Windungsquerschnitt, geraden Rippen mit lateralen und/oder ventralen Knötchen und einer seichten Medianfurche, an der die Rippenenden<br />
gegenständig im gestreckten Winkel gegenüberstehen. STURANT 1971 führt im Gegensatz zu ARKELL 1957 Orthogarantiana im Gattungsrang mit dem mikroconchen Subgenus<br />
Torrensia STURANI 1971. Ober-Bajocium.<br />
Orth, schroederi (BENTZ<br />
1924).<br />
LT ist Fig. 2 auf Taf. 5 in<br />
BENTZ 1924.<br />
"N<br />
= Am. garanüanus QU.<br />
Art Sutur bei h =<br />
1886, Taf. 71, Y^rl, 3 u. 7<br />
Orth, conjugata (QU. 1886),<br />
dn: lat. conjugatus = gekop<br />
pelt (Externrippen an der<br />
Furche).<br />
HT ist Am. garantianus conjugatus<br />
QU. 1886, Taf. 71,<br />
Fig. 10; Orig. im IGPT.<br />
Durch kaum merkliche<br />
Externfurche ausgezeichnet,<br />
relativ breitmündig.<br />
Orth, densicostata (QU.<br />
1886), dn: lat. densus =<br />
dicht, costatus = berippt.<br />
LT ist Am. garantianus densicostatus<br />
QU. 1886, Taf. 71,<br />
Fig. 9; Orig. im IGPT.<br />
Von außergewöhnlich dichter<br />
Berippung.<br />
Orth, bifurcata (ZIETEN<br />
1830), dn: lat. bifurcatus =<br />
zweifach gegabelt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT nicht auffind<br />
bar.<br />
\on leicht hochmündigem<br />
Querschnitt.<br />
Or:h. crassa (BENTZ 1924;,<br />
'1": lat. crassus = dick.<br />
= Am. garantianus QU.<br />
'«6. Taf. 71, Fig. 8.<br />
\cm außergewöhnlich grober<br />
Skulptur.<br />
lA J<br />
Ar o<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Innenwindungen<br />
4,5 mm 5 cm<br />
o<br />
Die<br />
6 cm<br />
6,6 cm<br />
7 cm<br />
5,4 cm<br />
Skulptur d<br />
tragen dichte,<br />
bi- oder trifurkierende Radial<br />
rippen, an den Spaltpunkten<br />
deutlich bedornt, manchmal<br />
auch an den Enden beidseitig<br />
der schmalen Medianfurche.<br />
Auf der Alterswohnkammer<br />
werden die Rippen weitständi<br />
ger, Bifurkation überwiegt, die<br />
Externknoten schwänden.<br />
fast ausschließlich bifurka-<br />
ten Rippen sind an der Gabe<br />
lung leicht bedornt und nur in<br />
der Jugend durch eine Median<br />
rinne unterbrochen. Später tra<br />
gen sie nur eine schwache,<br />
schmale Medianschwächung.<br />
Die Gabelpunkte liegen erst<br />
wenig innerhalb der Flanken<br />
mitte, später etwas außerhalb.<br />
Feine, schmale, regelmäßige<br />
Rippen bi- oder trifurkieren in<br />
kleinen Dornen und sind wie<br />
bei conjugata nur in der Jugend<br />
extern unterbrochen. Im Alter<br />
überqueren sie eine schmale,<br />
seichte Medianfurche leicht<br />
abgeschwächt. BENTZ 1924<br />
unterscheidet eine Varietät mit<br />
«starker» Skulptur.<br />
Die radialen Rippen gabeln<br />
stets zweifach etwas über der<br />
Flankenmitte ohne merkliche<br />
Knoten. Extern enden sie in<br />
kleinen Dornen an einer mehr<br />
oder weniger breiten Furche.<br />
Auf den Innenwindungen<br />
grobe, scharfe Radialrippen, die<br />
in Knoten gabeln und extern<br />
breit leistenförmig werden. Auf<br />
der Wohnkammer rücken die<br />
Gabelpunkte auf das äußere<br />
Flankendrittel, und die Sekun<br />
därrippen enden ohne Verdik-<br />
kung an einer mittelbreiten fla<br />
chen Medianfurche.<br />
in cm in %<br />
LT 8,7<br />
4<br />
7<br />
10<br />
41<br />
39<br />
39<br />
45<br />
H<br />
in %<br />
33<br />
34<br />
34<br />
26<br />
0,94<br />
Ö~82<br />
Ü793<br />
Ö797<br />
HT 6,0 41 33 0,80<br />
HT 6,6 36 (34) (0,8)<br />
HT 7,0<br />
3,5<br />
LT 5,0<br />
4,0<br />
5,4<br />
5,8<br />
6,9<br />
(39)<br />
38<br />
38<br />
27<br />
33,5<br />
37<br />
43<br />
(35)<br />
37<br />
36<br />
42<br />
37<br />
34<br />
28<br />
(1,1)<br />
1,0<br />
0,84<br />
0,89 j<br />
0.75<br />
0,91<br />
0,80<br />
31 PR<br />
30 PR<br />
59 SR<br />
41 PR<br />
(100)SR -<br />
(47) PR<br />
(94) SR -<br />
20 PR<br />
52 SR<br />
24 PR<br />
46 SR<br />
(28) PR<br />
(54) SR<br />
89
Art Sutur bei h =<br />
Orth, inflata (BENTZ 1924),<br />
dn: lat. inflatus = aufgebläht.<br />
LT ist Fig. 3, Taf. 7 in<br />
BENTZ 1924.<br />
Breitmündigste ailer Arten<br />
mit trichterförmigem, tiefem<br />
Nabel.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
C )<br />
7 cm<br />
Skulptur d<br />
Radiale bis konkave Rippen<br />
bifurkieren bei etwa 70% Sei<br />
tenhöhe, durch einige Schalt<br />
rippen vermehrt. Spaltpunkte<br />
besonders bis etwa d = 3 mar<br />
kant bedornt. Schmale, nicht<br />
tiefe Medianfurchc, an der die<br />
Rippenenden leicht vor<br />
geschwungen ohne Anschwel<br />
lung enden.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
LT 7,3 40 35 0,81 bj 3a<br />
2,5 32 36 0,50 48 SR 31; 11<br />
Garantiana MASCKE 1907; TA Am. garantianus D'ORB. 1846. Weit bis mittelweit genabelte Gehäuse mit meist hochelliptischem Querschnitt und radialen oder mehr oder weniger<br />
proversen Spaltrippen, die an einer Medianfurche, welche auf der Alterswohnkammer überbrückt sein kann, in stumpfem Winkel gegenständig in Knötchen enden. Ober-Bajocium<br />
(Bathonium?).<br />
Untergattung Garantiana s. Str.; makroconche Garantianen ohne Ohren am Altersmundsaum.<br />
G. (G.) garantiana (D'ORB.<br />
1846), dn: s. Gattung<br />
Orig. <strong>des</strong> LT im MHNP;<br />
abgeb. in ARKELL 1956,<br />
Taf. 35, Fig. 2.<br />
G. (G.) baculata (QU. 1857),<br />
dn: lat. baculatus = stabför-<br />
mig (vergesellschaftet mit<br />
«Hamites baculatus» QU.)<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen; als<br />
NT wird Fig. 7, Taf. 70 in<br />
QU. 1886 vorgeschlagen;<br />
Orig. im SMNS.<br />
Breitmündiger und von höherer<br />
TZ als garantiana. G.<br />
althoffi BENTZ 1928 steht<br />
zwischen beiden Arten.<br />
G. (G.f) longidens (QU.<br />
1846), dn: lat. longus = lang<br />
dens = Zahn (lange Loben).<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
= Parkinsonia praecursor<br />
MAYER 1864;<br />
= Am. parkinsoni longidens<br />
QU. 1886, Taf. 71, Fig. 6.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch engen Nabel und<br />
«langzähnige Loben in der<br />
Nahtgegend» geschieden.<br />
90<br />
ca. 30 mm<br />
11 mm 5,2 cm<br />
4,1 cm<br />
Schwach proradiate bis<br />
schwach konkave Rippen bifur<br />
kieren bei ca. 70% Seitenhöhe,<br />
wobei sie ganz leicht nach vorn<br />
schwingen und demzufolge<br />
extern in sehr stumpfem Win<br />
kel unter Knötchenbildung an<br />
der mittelbreiten, glatten<br />
Medianfurche gegenüberstehen.<br />
Leicht proradiate, weitständige<br />
Primärrippen trifurkieren bei<br />
anfangs 40, später 60% Flan<br />
kenhöhe in Dornen. Durch<br />
sporadische Schaltrippen steigt<br />
TZ auf über 3. Extern stehen<br />
die Rippenenden unter sehr<br />
stumpfem Winkel, in kleinen<br />
Dornen endend, an breiter,<br />
flacher Furche gegenüber, in<br />
die die Dornen kleine Fortsätze<br />
strecken.<br />
Berippung ähnelt der von bacu<br />
lata; die Primärrippen bifurkie<br />
ren vorwiegend, so daß sich<br />
mit einigen Schaltrippen TZ<br />
2,7 ergibt. Rippenform insge<br />
samt leicht konkav, Median<br />
furche relativ schmal.<br />
3,5<br />
4,5<br />
LT 7,9<br />
7<br />
NT 5,2<br />
4,5<br />
HT 3,4<br />
4,0<br />
31<br />
36<br />
41<br />
36<br />
33<br />
37<br />
30<br />
33<br />
42<br />
35<br />
34<br />
37<br />
40<br />
35<br />
44<br />
40,5<br />
0,71<br />
Ö778<br />
1,12<br />
L27<br />
0,93<br />
0,S9<br />
0,9<br />
0,96<br />
41 PR<br />
76 SR<br />
25 PR<br />
73 SR<br />
24 PR<br />
64 SR<br />
25 PR<br />
65 SR<br />
15
An<br />
G. (GJ) dubia (QU. 1846),<br />
dn: lat. dubius = zweifelhaft.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
= Am. dubius QU. 1886,<br />
Taf. 71, Fig. 30.<br />
Durch niedrige TZ bei relativ-<br />
großer Nabelweite aus<br />
gezeichnet.<br />
G. (GJ) wetzeli TRAUTH<br />
1923.<br />
HT ist Am. parkinsoni densicostaQU.<br />
1886, Taf. 72, Fig.<br />
1 (nicht 2); Orig. im IGPT.<br />
Außergewöhnlich dicht<br />
berippte An.<br />
G. (G.) coronata WETZ EL<br />
1911, dn: lat. coronatus =<br />
gekrönt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Univ. Göttingen.<br />
Besonders kräftig berippt und<br />
von schnellem Höhenwachs<br />
tum.<br />
Sutur bei h =<br />
) t i ^ f V/^Vf Li<br />
3,7 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Q<br />
2 cm<br />
Q<br />
5,4 cm<br />
ü<br />
6 cm<br />
Skulptur d<br />
Radiale, z. T. sogar leicht<br />
retroradiate Primärrippen tra<br />
gen auf Flankenmitte kleine<br />
Domen, in denen sie häufig<br />
bifurkieren. Die Sekundärrip<br />
pen haben am Gabelpunkt<br />
einen leichten Vorwänsknick,<br />
enden in kleinen Dornen an<br />
der anfangs mittelbreiten, spä<br />
ter schmäleren Medianfurche.<br />
Sehr dichte Primärrippen sind<br />
auf den Innenwindungen stark<br />
proradiat und bifurkieren teil<br />
weise auf der äußeren Flanken<br />
hälfte. Spaltpunkte unbedornt,<br />
in der Jugend kleine Dornen an<br />
mittelbreiter Medianfurche, an<br />
der die Rippenenden auf der<br />
Außenwindung <strong>des</strong> HT unter<br />
ca. 120° gegenüberstehen.<br />
Grobe, hohe, scharfe und leicht<br />
proradiate Rippen bifurkieren<br />
zunächst bei 50, zuletzt bei<br />
40% Seitenhöhe. Die schwa<br />
chen Dornen der Spaltpunkte<br />
verschwinden ab d ^ 1,5, die<br />
Erhöhungen an den externen,<br />
unter ca. 130° gegenüberste<br />
henden Rippenenden sind<br />
beständig. Furche kaum einge<br />
tieft.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
HT 3,6 41 37<br />
Q<br />
Z<br />
35 PR<br />
48 SR<br />
56 PR<br />
HT 5,1 38,3 37 1,10 j 82 SR<br />
31 PR<br />
HT 6,0 34 40 1,16 J 60 SR<br />
Untergattung Pseudogarantiana BENTZ 1928; TA G. (Ps.) dicbotoma BENTZ 1928. Mikroconche Formen der Gattung Garantiana mit Ohren am Altersmundsaum.<br />
G. (Ps.) dicbotoma BENTZ<br />
1928; dn: dichotomus =<br />
zweischneidig.<br />
= Am. dubius QU. 1857,<br />
Taf. 55, Fig. 18 u. Taf. 72,<br />
Fig. 3.<br />
BENTZ unterscheidet 4<br />
\ arietäten je nach Flanken-<br />
wrilbung und Rippendichte.<br />
G .Ps., minima VX'ETZEL<br />
1911. dn: lat. minimus =<br />
«hr kiein<br />
^ I TZEL bezeichnet seine<br />
Fl<br />
R- 11 u. 16 als -Extreme-,<br />
daß Fig. 13, Taf. 11 als<br />
!
An Sutur bei h =<br />
C. (Ps.?) subfurcata (ZIETEN<br />
1830), dn: lat. sub-= unter-,<br />
furcatus = gegabelt<br />
LT ist, gemäß DIETL 1981,<br />
Fig. 6a, b, Taf. 7 in ZIETEN<br />
1830; Orig. vermutlich ver<br />
schollen. Der von ARKELL<br />
1956 aufgestellte LT ent<br />
spricht nicht den Nomenkla<br />
turregeln.<br />
= G. (Ps.) dicbotoma nodosa<br />
BENTZ 1928?<br />
Gegenüber minima gröber<br />
berippt.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
o Die<br />
3,7 cm<br />
Skulptur d<br />
Die Abb. <strong>des</strong> LT zeigt leicht<br />
konkave Rippen, die oberhalb<br />
der Flankenmitte bifurkieren<br />
oder einzeln bleiben. Während<br />
die Gabelpunkte unbedornt<br />
sind, enden die Rippen unter<br />
stumpfem Winkel an der aus<br />
geprägten Medianfurche in<br />
kleinen Knötchen. Ohren sind<br />
nicht erkennbar.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
LT 3,7 41 36 (1,0) |<br />
Q<br />
z<br />
31 PR<br />
48 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
hl 3<br />
32; 9<br />
HT<br />
dich,<br />
17<br />
nodosa<br />
3,4 41 35 1,1<br />
57<br />
33 PR<br />
|<br />
220<br />
50 SR<br />
Untergattung Hlau 'iceras BUCKM. 1921 (—Subgarantiana BENTZ 1928); TA Hl. platyrrymum. Gruppe "jüngerer" Garantianen mit stets ausgeprägt proversen Spaltrippen, Extern<br />
knoten an verschieden breiter Medianfurche und früh erlöschenden Flankenknoten. Ober-Bajocium {garantiana- und parkinsoni-Zone).<br />
G. (Hl.) alticosta WETZEL<br />
1911, dn: lat. altus = hoch,<br />
costa = Rippe.<br />
= Am. parkinsoni QU. 1886,<br />
Taf. 71, Fig. 18.<br />
G. (Hl.) suevica WETZEL<br />
1911, dn: lat. suevicus =<br />
schwäbisch.<br />
LT ist Am. garantianus QU.<br />
1886, Taf. 71, Fig. 15; Orig.<br />
im IGPT.<br />
Sehr ähnlich alticosta, Rip<br />
penenden stehen stumpf<br />
winkliger gegenüber, TZ<br />
etwas kleiner.<br />
G. (Hl.) quenstedti WETZEL<br />
1911, dn: F. A. QUEN-<br />
STEDT, Geologe in Tübin<br />
gen, 1809-1889.<br />
HT ist Am. parkinsoni longidens<br />
QU. 1857, Taf. 63, Fig.<br />
7, = QU. 1886, Taf. 72, Fig.<br />
3; Orig. im IGPT.<br />
Von auffallend konkaver<br />
Berippung.<br />
92<br />
12 mm<br />
5,3 1<br />
Auf den Innenwindungen pro<br />
verse Rippenstiele, danach<br />
leicht proradiate, etwas unre<br />
gelmäßige Rippen, die auf Flan<br />
kenmitte bifurkieren und die<br />
Gabelknötchen abd = 1 verlie<br />
ren. Altersrippen an der Naht<br />
retrovers, auf Flankenmitte<br />
konvex gebaucht, extern kon<br />
vex über die Rinne laufend.<br />
Meist radiale, manchmal auch<br />
schwach sinusförmige Rippen<br />
bifurkieren auf Flankenmitte,<br />
wobei Gabelknötchen höch<br />
stens angedeutet sind. An der<br />
relativ breiten Medianfurche<br />
enden sie in deutlichen Knöt<br />
chen, sehr stumpfwinklig<br />
gegenüberstehend.<br />
Konkave, besonders auf der<br />
Alterswohnkammer stark pro<br />
verse Rippen spalten etwa auf<br />
Flankenmitte und enden in<br />
Knötchen an der ausgeprägten<br />
Medianrinne. Auf der Alters<br />
wohnkammer überwiegen Ein<br />
zelrippen gegenüber Schaltrip<br />
pen, deren Tendenz zur unbe-<br />
dornten, konvexen L'berque-<br />
rung der .Medianrinne gegen<br />
den Mundsaum zunimmt.<br />
3,6<br />
6,4<br />
7,6<br />
37,5<br />
34~5<br />
34<br />
40<br />
3875<br />
3975<br />
0,82<br />
0792<br />
T7Ö5<br />
LT 5,5 37 38 1,04<br />
HT 3,3<br />
12,8<br />
15,8<br />
36<br />
36<br />
40<br />
38<br />
42<br />
42<br />
0,88<br />
0,93<br />
1,11<br />
30 PR<br />
63 SR<br />
34 PR<br />
60 SR<br />
37 PR<br />
76 SR<br />
bj 3c<br />
32; 10<br />
95<br />
197<br />
267<br />
bj3<br />
32; 11<br />
267<br />
271<br />
bj 3b<br />
32; 12<br />
196<br />
267<br />
271<br />
1
Art Sutur bei h =<br />
C. (Hl) tetragomi WETZEL<br />
1911, dn: lat. tetragonus =<br />
viereckig.<br />
LT ist Fig. 8 u. 9, Taf. 11 in<br />
WETZEL 1911; Orig. nicht<br />
auffindbar.<br />
Durch dichte Berippung und<br />
Querschnitt ausgezeichnet.<br />
32 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
ö<br />
10 cm<br />
Skulptur d<br />
Wie bei vielen Garantianen<br />
werden die Spaltrippen im<br />
Alter zunehmend durch Einzel-<br />
und Schaltrippen abgelöst; die<br />
Rippendichte nimmt kaum ab.<br />
Anfangs proradiate Stiele ent<br />
springen im Alter retrokonkav<br />
und werden auf Flankenmitte<br />
bauchig konvex. Extern verlie<br />
ren die Rippen auf der Alters<br />
wohnkammer jegliche Unter<br />
brechung, Lateralknoten fehlen,<br />
Exrernknoten erlöschen sehr<br />
früh.<br />
in cm<br />
LT 10,3<br />
6,5<br />
8,5<br />
N<br />
in %<br />
36<br />
38<br />
4ÖT5<br />
H<br />
in %<br />
36<br />
41<br />
3775<br />
Q<br />
1,1<br />
1,03<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bj 3<br />
33; 1<br />
ÖT95 267<br />
Parkinsonia BAYLE 1878; dn:J. PARKINSON, englischer Geologe; TA Am. parkinsoni SOW. 1821. Meist scheibenförmige, evolute, aber auch involute Formen mit kräftigen, bifur-<br />
katen Rippen, die auf der Externseite unterbrochen stumpfwinklig und alternierend gegenüberstehen und deren Spaltpunkte in derjugend bedornt sind. Der Sexualdimorphismus<br />
beschränkt sich auf Größenunterschiede, eigentliche Ohren sind laut HAHN 1970 nicht bekannt.<br />
Untergattung Parkinsonia s. Str.; planulate Formen mit meist hochtrapezoidem Querschnitt und scharfen, bis ins Alter beständigen Spaltrippen. Ober-Bajocium und Unter-Batho<br />
nium.<br />
P. (P.) arktis WETZEL 1911,<br />
dn: gr. aries = Widder (ähn<br />
liche Gattung Arietites aus<br />
dem unteren Lias)<br />
= Am. parkinsoni planulatus<br />
QU. 1886, Taf. 71, Fig. 20<br />
'• ,!„ x„ x a, u<br />
!"11.<br />
WETZEL<br />
"ivhier berippt als jrictis,<br />
von BESNOSOV u<br />
k l<br />
'H/.OV.\ zur TA der<br />
"• Gattung Raremstites<br />
gewählt.<br />
5,7 cm<br />
Kräftige radiale bis leicht pro<br />
radiate, scharfe Primärrippen<br />
werden im Alter weitständig<br />
und bifurkieren bei 60 bis 80%<br />
der Windungshöhe in schwa<br />
chen Knoten zu proversen<br />
Sekundärrippen, die, unter ca.<br />
90° zueinander, alternierend<br />
auf die skulpturlose Median<br />
rinne stoßen. Hin und wieder<br />
Einzelrippen.<br />
Vorwiegend proradiate oder<br />
prokonkave Primarrippen,<br />
deren Schärfe im Alter<br />
abnimmt, bifurkieren bei 3/4<br />
Flankenhöhe unter jugendlich<br />
schwach bedorntem Vorwärts<br />
knick, oder bleiben einzeln.<br />
Extern enden sie unter 90°<br />
alternierend am schmalen, glat<br />
ten Medianband. Auf der<br />
Alterswohnkammer Skulptur<br />
schwächung, vor dem Alters<br />
mundsaum verstärkte Vor<br />
wärtsneigung der Stiele.<br />
HT 6,7<br />
13,9<br />
16,7<br />
5,9<br />
Art Sutur bei h :<br />
P. (P.) radiata RENZ 1904,<br />
dn: lat. radiatus = strahlig.<br />
HT, ein Jugendexemplar in<br />
Steinkemcrhaltung, ist Am.<br />
parkinsoni plannlatliS QU.<br />
1886, Tat. 71, Fig. 19; Orig<br />
im IGPT.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch Breitmündigkeit<br />
geschieden.<br />
P. (P.) acris WETZEL 1911,<br />
dn: lat. acer = scharf<br />
(berippt).<br />
Form und Hankenberippung<br />
ähnlich rarecostata, aber von<br />
anderer Externskulptur<br />
(undeutliche Medianrinne). P.<br />
acris wetzeli SCHMIDTILL<br />
u. KRUMBECK fällt in den<br />
Variationsbereich der Art.<br />
P. (P.) parkinsoni (SOW.<br />
1821), dn: s. Gattung.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im BMNH<br />
unter Nr. 43925.<br />
Engnabliger und dichter<br />
berippt als alle vorstehenden<br />
Arten. P. pseitdoparkinsoni<br />
WETZEL 1911 dürfte im -<br />
Variationsbereich von parkin<br />
soni Hegen.<br />
P. (P.) densicosta NICO-<br />
LESCO 1928, dn: lat. densus<br />
= dicht, costa = Rippe.<br />
LT ist Am. parkinsoni densicosta<br />
QU. 1886, Taf. 72, Fig.<br />
2; Ong. im IGPT.<br />
P. friedericiaugasti WETZEL<br />
1911 basiert auf verscholle<br />
nem, im Querschnitt unbe<br />
kannten HT [Am parkinsoni<br />
plamdatus QU. 1858, Taf.<br />
63, Fig. 8), weshalb seine<br />
.Artgleichheit (NICOLESCO<br />
1928) bezweifelt werden<br />
muß.<br />
Jugendlich höheres Z und<br />
adult meist kleineres Q als<br />
parkinsoni.<br />
94<br />
Quer<br />
schnitt<br />
hei d =<br />
6,6 cm<br />
6 mn 1,6 cm<br />
9 cm<br />
Skulptu d<br />
Kräftige, radiale Rippenstiele<br />
wechseln fast regelmäßig mit<br />
Einzelrippen. Bifurkation der<br />
Stiele bei 2/3 Flankenhöhe in<br />
schwachen Knoten zu prora<br />
diaten Asten, die sich extern<br />
an schmaler Medianrinne alter<br />
nierend unter ca. 120° gegen<br />
überstehen. Rippen vor dem<br />
Altersmundsaum provers.<br />
Auf den Jugendwändungen<br />
gleichviel bipartite und Einzel<br />
rippen, vorwiegend proradiat,<br />
bei 2/3 der Windungshöhe mit<br />
leichtem Knick gabelnd. Rip-<br />
penstiete werden radial, der<br />
Spaltpunkt rückt auf 3/4 Win<br />
dungshöhe. Extern bilden die<br />
alternierenden Enden der pro<br />
versen Aste Winkel zwäschen<br />
120 u. 100°, zwischen den<br />
Enden liegt keine eigentliche<br />
Rinne.<br />
Leicht prokonkave Rippenstiele<br />
bifurkieren bei ca. 65 % Win<br />
dungshöhe und gehen ohne<br />
Knick, aber unter verstärkter<br />
Krümmung in die Gabeläste<br />
über. Beknotung der Spalt<br />
punkte undeutlich, im Alter<br />
erloschen. Rippenenden wenig<br />
alternierend, unter 90-120° an<br />
ausgeprägter .Medianrinne<br />
gegenüberstehend.<br />
Proradiate Primärrippen der<br />
Innenwändungen werden später<br />
radial bis konkav und bifurkie<br />
ren bei 3/4 Wändungshöhe<br />
unter schwachem Vorwärts<br />
knick; Knötchen nur schwach<br />
auf Schalenexemplaren sicht<br />
bar. Rippenenden bilden Win<br />
kel von 120° bei schwach aus<br />
geprägter .Medianrinne. Schalt<br />
rippen und Einzelrippen beson<br />
ders auf dem letzten Umgang.<br />
in cm<br />
HT 2,6<br />
3,4<br />
15,3<br />
HT [4,3<br />
17,6<br />
3,2<br />
9,4<br />
12,9<br />
HT 9,4<br />
10,5<br />
LT 9,1<br />
N<br />
in %<br />
55<br />
54<br />
49<br />
45<br />
45<br />
48<br />
46<br />
41<br />
42<br />
4~i~5<br />
43<br />
6,3 40<br />
H<br />
in %<br />
26<br />
26<br />
33<br />
31<br />
32<br />
31<br />
28<br />
33<br />
34<br />
31<br />
34<br />
35<br />
34<br />
0,95<br />
0,81<br />
1,06 |<br />
1,24<br />
1,0<br />
1.11<br />
1,17<br />
1,44 ]<br />
U<br />
1,42<br />
1,12<br />
1,21<br />
31 PR<br />
(45! SR •<br />
35 PR<br />
54 SR<br />
42 PR<br />
64 SR<br />
52 PR<br />
97 SR<br />
54 PR<br />
(90) SR<br />
i) PR<br />
;) SR
Art Sutur bei h =<br />
P. (E) subplanulata WETZEL<br />
1911, dn: sub- = untergeord<br />
f net, planus = eben.<br />
HT ist Am. parkinsoni planulatits<br />
QU. 1S49, Taf. 11, Fig.<br />
2; Orig. verschollen.<br />
= P. planulata SCHMIDTILL<br />
u. KRUMBECK 1931, Taf.<br />
88, Fig. 2 und Taf. 91, Fig. 1.<br />
Durch sehr stumpfwinklig<br />
gegenüberstehende Rippen<br />
enden von vorstehenden<br />
Arten getrennt.<br />
P. (P.) scbloenbachi<br />
SCHLIPPE 1888, dn: U.<br />
SCHLÖNBACH, Geologe in<br />
Prag, 1841-1870.<br />
LT ist, gemäß ROLLIER<br />
1911, SCHLIPPEs Fig. 4.<br />
Sehr ähnlich zu P. acris, aber<br />
von etwas anderer Berippung<br />
und Querschnittsform.<br />
P. (P.) bomfordi ARKELL<br />
1956, dn: Brigadier BOM-<br />
FORD, engl. Sammler (<br />
HT ist Haselburgites scbloen<br />
bachi BUCKM. 1924; Orig.<br />
unter Nr. 47534 im Geologi-<br />
ca! Survey-Museum, London.<br />
Von anderem Querschnitt als<br />
scbloenbachi SCHLIPPE.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
Skulptur d<br />
bei d =<br />
)<br />
Auffallend konkave, leicht proverse<br />
Rippen bifurkieren unbedornl<br />
bei 60% Windungshöhe<br />
und verlieren an Schärfe.<br />
Sekundärrippen nicht nach<br />
11 cm<br />
n Prokonkave,<br />
7,5 cm<br />
|<br />
L J<br />
11 cm<br />
vorn abgeknickt und sehr<br />
stumpfwinklig an ausgeprägter<br />
Medianrinne alternierend<br />
gegenüberstehend. Rjppenab-<br />
schwächung im Alter.<br />
Prokonkave, kräftige Rippen<br />
bifurkieren auf Fiankenmitte<br />
ohne wesentlichen Knick,<br />
anfangs in Knötchen. Die Rip<br />
penenden stehen sich an der<br />
Medianfurche stumpfwinklig<br />
gegenüber.<br />
Auf den Innenwindungen pro<br />
konkave, später schwach kon<br />
kave Rippen, die bifurkieren<br />
und durch Schaltrippen TZ ~<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
HT 5,1 41 35 1,13 bj 3c<br />
4,6 43 36 1,20 (86)SR 34; 2<br />
1 8,4<br />
110,9<br />
11,7<br />
LT 7,0<br />
7<br />
8,6<br />
35<br />
38<br />
38<br />
43<br />
46<br />
42<br />
36<br />
36<br />
34<br />
33<br />
34<br />
34<br />
1,38 ,<br />
1,08<br />
1719<br />
1,0 j<br />
0,92<br />
' 1<br />
37 PR<br />
85 SR<br />
33 PR<br />
(61) SR<br />
31 PR<br />
(68) SR<br />
2,5 erreichen. 6<br />
171<br />
195<br />
220<br />
240<br />
267<br />
bt la<br />
33; 8<br />
6<br />
240<br />
260<br />
(36) PR bj 3c3<br />
HT 10 (40) 36 1,24 1 1 (90) SR<br />
34; 3<br />
Lntergattung Durotrigensia BUCKM. 1928; dn: Durotriges = romische Provinz in Südengland; TA Am. dorsetensis WRIGHT 1856. Teilweise sehr großwüchsige Gehäuse mit<br />
scharf berippten Innenwändungen, mittelweitem Nabel und glatten Alterswindungen von meist ovalem Querschnitt. Ober-Bajocium und Unter-Bathonium.<br />
11.:) nmffensis (OPP.<br />
1857i, dn: Fundort Neuffen,<br />
mittlere Schwäbische Alb.<br />
HT ist Am. parkinsoni gtgas<br />
Q 1<br />
'- '849, Taf. 11, Fig. 1; =<br />
Ql'. 188", Taf. 72, Fig. 9;<br />
[ )<br />
:-:. im IGPT.<br />
ca. 50 mm ca. 20 cm<br />
In der Jugend wechseln<br />
HT{27)<br />
Q<br />
schwach proverse bipartite Rippen<br />
mit Einzel- und Schaltrip 44<br />
pen, die im Gabelpunkt bei ca.<br />
2/3 Windungshöhe nicht<br />
wesentlich vorknicken. Im<br />
Gegensatz zur TA sind die Rippen<br />
gerundet, extern alternie<br />
45 30<br />
ren sie unter stumpfem Win<br />
kel. Im Alter beginnt die Rip<br />
penschwächung zuerst in der<br />
Gabelungszone.<br />
1,45<br />
1,5<br />
bj 3c<br />
bt la<br />
34; 4<br />
6<br />
197<br />
267<br />
269<br />
95
Untergattung Gonolkitcs BUCKM. 1925; TA Gonolkitcs convergens BUCKM. 1925. Mittel weit genabelte Formen verschiedener Endgrößc mit hochtrapezoidcm Querschnitt, deren<br />
scharfe Rippen im Alter von der Flankenmitte ausgehend verflachen. Unter-Bathonium.<br />
Art Sutur bei h =<br />
P. !G.) convergens (BUCKM.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d '<br />
1925). dn: lat. convcrgo =<br />
angleichen. / \<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geologic.il<br />
Survey Museum, London<br />
= Parkinsonia eimensis<br />
SCHMIDTILL u. KRUM-<br />
BECK 1931<br />
12,5 cm<br />
Skulptur d<br />
Proradiate Rippcustiele bifur<br />
kieren anfangs auf Flanken<br />
mitte, spater auf der inneren<br />
Flankenhälfte. Spaltpunkte bis<br />
d 1,5 bedornt. Prokonkave<br />
Sekundärrippen durch Schalt<br />
rippen vermehrt, ventral durch<br />
relativ breites Band unterbro<br />
chen. Rippensch wach Ltng ab<br />
d Ä<br />
d Ä<br />
d Ä<br />
7an den Spaltpunkten, bei<br />
d = 10 glatte Flanken.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
HT 10 40 1,33 (30) I'R bt 1<br />
7,5 39 37 1,16 35; 1<br />
8,5 34 38 1,19 6<br />
Untergattung Oraniccras FLAMAND 1911; dn: Oran, Departement in Algerien, Fundgebiet; TA Oraniceras /wwnwnfnseFLAMAND 1911. Relativ engnablige Formen verschiede<br />
ner Endgröße mit sehr hochmündigem Querschnitt und schmaler bis zugeschärfter Externseite. Skulptur im Alter geschwächt bis erloschen. Unter-Bathonium.<br />
P. (O.) gyrumbilicus (QU.<br />
1886), dn: Gyrus = Kreis,<br />
Windung, Umbilikus =<br />
Nabel.<br />
HT ist Am. parkinsoni compressus<br />
gyrumbilicus QU.<br />
1886, Taf. 72, Fig. 15; Orig.<br />
im IGPT.<br />
P. (O.) wuerttembergica (OPP.<br />
1857), dn: Fundgebiet Würt<br />
temberg<br />
HT ist Am. parkinsoni compressits<br />
QU. 1847, Taf. 11,<br />
Fig. 4; Orig. im IGPT.<br />
= Am. parkinsoni compressus<br />
QU. 1886, Taf. 71, nur Fig.<br />
34; — Am. parkinsoni QU.<br />
1886, Taf. 71, nur Fig. 26 u.<br />
27; = P. cf. ferruginea<br />
SCHMIDTILL u. KRUM<br />
BECK 1931 pars.<br />
Wesentlich kleinwüchsiger als<br />
gyrumbilicus.<br />
96<br />
18 cm<br />
ca. 3 mm 7 cm<br />
Bis d 5 leicht proradiate Rip<br />
penstiele, die sich in der Flan<br />
kenmitte regelmäßig zweifach<br />
teilen; Schaltrippen sporadisch.<br />
Am Außenbug knicken die<br />
Sekundärrippen leicht nach<br />
vorn und lassen eine schmale<br />
Externfurche frei. Ab d ~ 5<br />
werden die Stiele geschwächt;<br />
bei d = 15 ist die Skulptur<br />
nahezu erloschen.<br />
Scharfe, proverse Rippenstiele,<br />
oft am Innenbug nach vorn<br />
gekrümmt, bifurkieren auf der<br />
äußeren Flankenhälfte, werden<br />
vor der Alterswohnkammer<br />
geschwächt und erscheinen auf<br />
dem letzten Wohnkammerdrit<br />
tel wieder hi- und trifurkierend.<br />
Einzelrippen sporadisch. Pro-<br />
konkave Sekundärrippen an der<br />
schmalen Externfurche nach<br />
vorn geknickt.<br />
Unterscheidung von jugendli<br />
chen P. (O.) gyrumbilicus durch<br />
frühere Tendenz zur Altersent-<br />
rollung möglich.<br />
HT 23<br />
13<br />
16,3<br />
27,8<br />
ht{ 5<br />
< (<br />
L,t<br />
15<br />
16<br />
17<br />
25<br />
26<br />
32<br />
29<br />
48<br />
50<br />
49<br />
41<br />
46<br />
47<br />
41<br />
43<br />
42<br />
2,0<br />
1,79<br />
1,69<br />
1,95<br />
1,70 '<br />
1,74<br />
TTÜ<br />
T~6 •<br />
32 PR<br />
108 SR<br />
34 PR<br />
116 SR<br />
34 PR<br />
80 SR<br />
96 SR<br />
38 PR<br />
64 SR<br />
36 PR<br />
77 SR<br />
34 PR<br />
84 SR<br />
112<br />
bt 1<br />
35; 2<br />
112<br />
197<br />
bt 1<br />
35; 3<br />
76<br />
112<br />
197<br />
211<br />
220
P. (O.) fretensis VX'ETZEL<br />
An Sutur bei h :<br />
1950, dn: lat. fretensis = zur<br />
Meerenge gehörig.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Universität Kiel.<br />
= Am. parkinsoni laevis QU.<br />
1886, Taf. 73, Fig. 3.<br />
Ähnlich großwüchsig wie<br />
gyrumbilicus, aber von grö<br />
ßerem N und anderem Quer<br />
schnitt.<br />
P. (O.) pseudomacrocephalns<br />
WETZEL 1950; dn: gr.<br />
pseudo = falsch, macroce-<br />
phalus = Art aus dem Unter-<br />
Callovium (s. d.)<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Nieder-<br />
sächs. Lan<strong>des</strong>amt f. Boden<br />
forschung.<br />
Ähnlich kleinwüchsig wie<br />
wnerttembergica, aber von<br />
kleinerem N und ohne<br />
Altersentrollung; von macro-<br />
cephaloidem Querschnitt.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
11,7 cm<br />
7,2 cm<br />
Skulptur N<br />
Auf den Innenwindungen sind<br />
proradiate Rippenstiele sicht<br />
bar, die ab d 4 erlöschen.<br />
Sekundärrippen nur am Außen<br />
bug noch bis d Ä<br />
10 sichtbar,<br />
danach völliger Skulpturverlust.<br />
Der HT zeigt auf der Außen<br />
windung lediglich auf dem<br />
äußeren Flankendrittel und<br />
extern regelmäßige, konkave<br />
Rippen, die an einer Medianun<br />
terbrechung sehr stumpfwinklig<br />
und schwach alternierend<br />
gegenüberstehen.<br />
HT10.4<br />
6,5<br />
8,2<br />
10<br />
13<br />
16<br />
HT 8,.<br />
13,8<br />
15,0<br />
57<br />
7,3<br />
in %<br />
28<br />
24<br />
23<br />
26<br />
19<br />
21<br />
20<br />
1"<br />
18<br />
44<br />
42<br />
45<br />
44<br />
43<br />
41<br />
46<br />
47<br />
49<br />
49<br />
48<br />
(1,4)<br />
1,45<br />
1,61<br />
17<br />
•17<br />
L8<br />
1,35<br />
1,47<br />
1,63<br />
1,58<br />
1,66<br />
(75) SR<br />
104 SR<br />
112 SR<br />
(75) SR<br />
82 SR<br />
84 SR<br />
88 SR<br />
84 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bt 1<br />
35; 4<br />
112<br />
197<br />
270<br />
bt 1<br />
35; 5<br />
112<br />
270<br />
97
Spiroceratinae hyatt 1900<br />
Heteromorphcngnippe kurzer Lebensdauer, vorerst aus der einzigen Gattung Spiroceras bestehend, sehr wahrscheinlich aus Strenoceras hervorgegangen. Criocone bis cyrtoconc<br />
Gehäuse, z. T. mit trochoconen Innenwindungen und baculiconen Wachstumsstadien. Skulptur aus einfachen Rippen bestehend, die zwei Dornenreihen tragen können und dnrs.il<br />
konvex verlaufen. Primär-und Alterssutur ausgeprägt quinquelobat (E L Ui U] I), Altcrssutur stark zerschlitzt. Beschränkt auf das obere Bajocium.<br />
Spiroceras QU. 1856 {= Apsorroceras HYATT 1900); dn: lat. spira — Windung, gr. ceras = Horn; TA Toxocaras orbignyi BAUGIER u. SAUZE 1843, = Hamites bifurcati QU. 1846<br />
Einzige Gattung der Spiroceratinae mit den dort aufgeführten Merkmalen.<br />
Sp. orbignyi (BAUGIER u.<br />
Art Sutur bei h =<br />
SAUZE 1843), dn: A. D'OR<br />
BIGNY, franz. Paläontologe<br />
1802-1857.<br />
LT in BAUGIER u. SAUZE<br />
1843, Taf. 1, Fig. 1 (mittlerer<br />
Teil), Orig. im Museum<br />
Niort, Dep. Charente (Frank<br />
reich).<br />
= Hamites bifurcati QU.<br />
1886, Taf. 70, Fig. 15, 27 u.<br />
29-44; = Hamites enodus<br />
QU. 1886, Taf. 70, Fig. 26.<br />
Sp. obliquecostatum (QU.<br />
1886), dn: lat. obliquus =<br />
seitlich, schief, costatus =<br />
berippt.<br />
= Hamites bifurcati obliquecostatus<br />
QU. 1886, Taf. 70,<br />
Fig. 28 (= HT, Orig. im<br />
SMNS).<br />
Sehr seltene Art, von Sp.<br />
orbignyi hauptsächlich durch<br />
auffallend proradiate, unbe-<br />
knotete Rippen, von allen<br />
Spiroceras-Arten durch klei<br />
neres Q geschieden.<br />
Sp. sauzeanum (D'ORB.<br />
1850), dn: M. SAUZE, franz.<br />
Geologe.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in Sig. BAU<br />
GIER, Museum Niort, Dep.<br />
Charente (Frankreich).<br />
= Hamites baculatus QU.<br />
1886, Taf. 70, Fig. 12-14.<br />
Von 5p. orbignyi im allge<br />
meinen durch baculicone<br />
Form geschieden, schwach<br />
gekrümmte Fragmente jedoch<br />
von jenem schwer zu trennen.<br />
Von Sp. obliquecostatum<br />
und Sp. annulatum durch<br />
weitständigere Rippen<br />
geschieden.<br />
98<br />
12 mm<br />
ca. 0,4 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei h =<br />
0<br />
(Ende <strong>des</strong> eingerollten Abschnitts) 10 mm<br />
O Die<br />
4,3 mm 5 mm<br />
10 mm<br />
8,8 mm 15 mm<br />
Form, Skulptur h<br />
Spiralform individuell und<br />
ontogenetisch sehr variabel.<br />
Nur die ersten 1 1/2 Windun<br />
gen (d Ä<br />
0,1 cm) normal<br />
gerollt, die folgenden meist<br />
criocon, häufig aber auch tro-<br />
chocon entrollt. Mit zuneh<br />
mendem Alter nimmt Entrol<br />
lung zu, oft stückweise Stab<br />
form, hakenähnliche Gehäu<br />
seenden sind selten.<br />
Spätestens bei h 1 mm Ein<br />
setzen zunächst dichter, leicht<br />
proradiater Rippen, ventral<br />
eine durch Knötchen begrenzte<br />
Unterbrechung zeigend. Später<br />
auf oberem Flankendrittel eine<br />
weitere Knotenreihe. Rippen<br />
dorsal stets in konvexem<br />
Bogen abgeschwächt. Ab h 4<br />
mm z. T. sporadisch unbekno-<br />
tete Rippen oder Verschmel<br />
zung von Hanken- mit Ventral<br />
knoten.<br />
wenigen bekannten Exem<br />
plare sind stark cyrtocon ent<br />
rollt. Der HT zeigt dichte,<br />
regelmäßige Rippen von auffal<br />
lend proradiatem Verlauf. Sie<br />
scheinen knotenlos, enden aber<br />
an der ventralen Unterbre<br />
chung mit sehr schwachen Ver<br />
dickungen. Dorsal sind sie gat<br />
tungstypisch konvex und stark<br />
abgeschwächt.<br />
Die stets unvollständig gefun<br />
denen Gehäuse zeigten beson<br />
ders adult (längste W f<br />
ohnkam-<br />
mer 26 cm) vorwiegend baculi<br />
cone Streckung, besonders<br />
juvenil manchmal auch leichte<br />
Krümmung. Embryonalwin<br />
dungen vermutlich normal<br />
gerollt.<br />
Leicht proradiate, nur juvenil<br />
dichte Rippen tragen anfangs<br />
beidseits ihrer ventralen<br />
Abschwächung sowie im äuße<br />
ren flankenviertel Knötchen;<br />
dorsal sind sie gattungstypisch<br />
konvex und abgeschwächt. Im<br />
Alter werden Rippen und<br />
Knötchen undeutlich und unre<br />
gelmäßig. Der HT zeigt dorsal<br />
feinste Zwischenrippen.<br />
in mm<br />
LT 22<br />
3<br />
5<br />
7,5<br />
10<br />
14<br />
19<br />
23<br />
HT<br />
HT<br />
(1)<br />
1,0<br />
1,02<br />
1,05<br />
1,07<br />
1,04<br />
0,94<br />
1,0<br />
1,1<br />
1,07<br />
1,06<br />
2,2<br />
10<br />
5<br />
4<br />
33<br />
2,3<br />
1,4<br />
1,8<br />
13<br />
2,0<br />
1,8<br />
3,5<br />
2,6
Art Sutur bei h =<br />
Sp. annulatum (DESHAYES<br />
1831), dn: lat. annulatus =<br />
beringt.<br />
HT in DIETL 1978, Taf. 6,<br />
Fig. 3; Orig. in der Ecoie <strong>des</strong><br />
Mines, Paris.<br />
= Hamites bifurcati QU.<br />
1886, Taf. 70, Fig. 31, dicker<br />
Teil.<br />
Innenwindungen bis h 2<br />
nicht von Sp. orbignyi zu<br />
trennen, adulte Fragmente<br />
von jenem durch fehlende<br />
Flankenknoten, von Sp. sau-<br />
zeanum zusätzlich durch<br />
regelmäßigere und meist<br />
auch dichtere Rippen<br />
geschieden.<br />
5p. laevigalum (D'ORB.<br />
1850), dn: lat. laevigatus =<br />
geglättet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Museum<br />
Niort, Dep. Charente (Frank<br />
reich)<br />
= Hamites cf. baculatus QU.<br />
1886, Taf. 70, Fig. 17.<br />
Von allen anderen Spiroceras-<br />
Arten durch fehlende Skulp<br />
tur geschieden.<br />
Parapatoceratinae buckm. 1926<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei h =<br />
Form, Skulptur h<br />
O<br />
Regelmäßig-criocone Innenwin<br />
14 mm<br />
0<br />
15 mm<br />
Regelmäßig-criocone Innenwin<br />
dungen bis h Ä<br />
dungen bis h 5, danach<br />
Ä<br />
dungen bis h 5, danach<br />
Ä<br />
5, danach<br />
ancylocone Streckung mit 1<br />
oder 2 Knickstellen in Spiral<br />
nähe und einer weiteren am<br />
Ende der gestreckten bis leicht<br />
gekrümmten adulten Wohn<br />
kammer. Axiale Entrollung<br />
kann der radialen überlagen<br />
sein.<br />
Anfangs stets radiale, später<br />
vereinzelt auch proradiate,<br />
regelmäßige Rippen, beidseitig<br />
einer schmalen, adult oft<br />
undeutlichen Ventralunterbre<br />
chung leicht verdickt, dorsal<br />
konvex und stark geschwächt.<br />
Vorliegende Fragmente stabför-<br />
mig gestreckt, frühe Jugendsta<br />
dien anscheinend unbekannt.<br />
Skulptur fehlend, bis auf kon<br />
vexe, haarfeine Streifung im<br />
Dorsalbereich.<br />
in mm<br />
HT 5<br />
9<br />
10<br />
12<br />
14<br />
HT 15<br />
16<br />
Q<br />
1,1<br />
1,1<br />
1,05<br />
1,04<br />
1,0<br />
1,15<br />
R<br />
5,3<br />
4,3<br />
372<br />
3,3<br />
3,0<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bj 3b<br />
36; 2<br />
51<br />
197<br />
bj 3a<br />
1,08<br />
36; 3<br />
Den Spiroceratinae ähnliche Heteromorphengruppe, nach DIETL 1978 aus den Gattungen Parapatoceras, Paracuariceras und Acuariceras bestehend und von Epistrenoceras (Ober-<br />
Bathonium) abzuleiten. Criocone bis baculicone Eormen, z. T. mit einfachen Rippen und Domen versehen. Neben der quinquelobaten Primärsutur von Paracuariceras scheint auch<br />
die quadrilobate (E L U I) bei Acuariceras und teilweise sogar bei Parapatoceras zu existieren (HOLDER 1978). Adultsuturen bei stark reduziertem Ui allgemein geringer zerschlitzt<br />
als bei gleichgroßen Spiroceraten oder (bei Acuariceras) goniatitisch glatt. Ober-Bathonium bis Mittel-Callovium.<br />
Parapatoceras SPÄTH 1924 (= Metapatoceras SCHINDEWOLF 1963, = Infrapatoceras OCHOTERENA 1966); dn: gr. patho- = krank, ceras = Horn, para = neben (Patoceras); JA<br />
Ancyloceras distans BAUGIER u. SAUZE 1843. Kleinwüchsige, gewöhnlich criocone Gehäuse, teilweise mitbaculiconen Stadien. Die einfachen Rippen können zwei Dornenreihen<br />
tragen und sind ventral unterbrochen. Dorsal bilden sie - im Gegensatz zu Spiroceras - keine konvexen Bogen.<br />
P distans (BAUGIER u.<br />
SAUZE 1843), dn: lat.<br />
distare = entfernt sein.<br />
HT in 3AUGIER u. SAUZE<br />
I S 4<br />
"'. Taf. 3, Fig. 8-10; Orig.<br />
»erschollen.<br />
= Hjm::es macrocephali QU.<br />
I s s<br />
=<br />
". Tat. -(), Fig. 20-25;<br />
l".fJpj:
Quer Zone<br />
Art Sutur bei h = schnitt<br />
Form, Skulptur h Q R Taf.<br />
bei h =<br />
in mm<br />
Lit.<br />
P. tuberculatum (BAUGIER u. U<br />
1 ' 2 "l/^) 1<br />
SAUZE 1843), dn: lat. tuher- r<br />
culum = Höckerchen.<br />
/ A\ l) \j u ( )<br />
A Jugendwindungen nicht HT 12 1,2 (2,2) cl labekannt,<br />
Alterswindungen cyr- cl 2a<br />
\ tocon bis baculicon. 4 7<br />
Orig. <strong>des</strong> HT nicht auffind v V) N ' Stark proradiate, individuell 6 5<br />
bar. unterschiedlich dichte, regelmä<br />
ßige Rippen, ventral unterbro 8 1,15 4<br />
— Ancyloccras callovicnse chen, in oft spitzen Knötchen i 16S<br />
MORRIS 1845; = Hamites endend; zweites Knötchen am 197<br />
baculatus densicosta QU. Außenbug. jedoch schwächer<br />
1886, Taf. "0, Fig. 19; als das ventrale. Rippen dorsal<br />
= Metapatoceras semiserra- leicht abgeschwächt, aber<br />
tum SCHINDEWOLF 1963. gerade.<br />
Von P. distans durch auffal<br />
lend proradiate Rippen u.<br />
stärkere Entrollung geschie<br />
den.<br />
5.5 mm 10 mm<br />
Paracuariceras SCHINDEWOLF 1963; dn: lat. aeuo = spitzen, para = neben; TA Paracuariceras incisum SCHINDEWOLF 1963. Die kleinen bis mittelgroßen, baculiconen Gehäuse<br />
unterscheiden sich in Gestalt und Skulptur kaum von denen der folgenden Gattung Acuariceras. Nur die Zerschlitzung der Sutursättel veranlaßte SCHINDEWOLF zur Aufstellung<br />
von Paracuariceras. Neues, französisches Matena! zeigt in<strong>des</strong>sen stärker zerschlitzte Suturen, die wiederum von denen der obenstehenden Gattung Parapatoceras kaum zu trennen<br />
sind. Paracuariceras wird aus Kontinuitätsgründen zunächst aufrechterhalten, obwohl der Gattungsrang dieser Formen nicht mehr gerechtfertigt erscheint.<br />
P. incisum SCHINDEWOLF<br />
1963, dn: lat. incisum = ein<br />
geschnitten.<br />
= Baculites acuarius QU.<br />
1851, Taf. 30, Fig. 4;<br />
= 1856, Taf. 69, Fig. 19,<br />
= HT; Orig. im IGPT.<br />
Unterschiede zu Acuariceras<br />
acuarius siehe dort.<br />
P. giganteum DIETL 1981,<br />
dn: lat. giganteus = riesig.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
Von incisum durch dichtere<br />
Skulptur, wesentlich höhere<br />
Endgröße und Krümmung<br />
geschieden.<br />
Meist im harten Kalkmergel<br />
verborgen.<br />
P. aeuforme DIETL 1981, dn:<br />
lat. acus = Nadel, -forme =<br />
-förmig.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im SMNS.<br />
Ahnlich großwüchsig wie<br />
giganteum, aber nicht<br />
gekrümmt; von rundem<br />
Querschnitt und von geringe<br />
rem Dickenwachstum.<br />
100<br />
4,7 mm 6,2 mm<br />
Baculicone Formen, oft mit<br />
gekrümmtem Anfangsteil. Die<br />
ausgewachsenen Gehäuse<br />
erreichen kaum mehr als 3 mm<br />
Windungshöhe; der HT ist<br />
etwa 45 mm lang.<br />
Eine eigentliche Skulptur<br />
besteht nicht. Unregelmäßige,<br />
proradiate Wülste mit ebenso<br />
breiten Zwischenräumen sind<br />
angedeutet.<br />
Baculicone Gehäuse mit leich<br />
ter Krümmung im Jugend- und<br />
Altersbereich in dorsaler Rich<br />
tung. Maximalgröße ca.<br />
100 mm.<br />
Schwache, stark proverse, wul<br />
stige Rippen sind stellenweise<br />
unregelmäßig. Im seitlichen<br />
Licht wird feine Längsstreifung<br />
auf der Alterswohnkammer<br />
sichtbar.<br />
L IL Baculicone Gehäuse, mit Ausnahme<br />
der Anfangswindung<br />
völlig gestreckt. Maximalgröße<br />
ca. 100 mm.<br />
Schwache, stark proverse, aber<br />
im Gegensatz zu giganteum<br />
meist scharfe Rippen. Ebenso<br />
wie bei giganteum feine Längs<br />
streifung.<br />
HT'<br />
HT 6,2<br />
3<br />
HT 5,4<br />
3<br />
1,05<br />
1.10<br />
1,20<br />
1,3<br />
(15)<br />
1,0 6<br />
(12)<br />
56; 5<br />
! 9<br />
51<br />
cl la<br />
-cl 2a<br />
36; 6<br />
51<br />
168<br />
197<br />
212<br />
cl la<br />
36; 7<br />
56<br />
cl la<br />
36;<br />
56
Acuariceras SPÄTH 1933; dn: siehe Paracuariceras;!A Acuariceras acuarius (QU. 1848), zugleich einzige Art der Gattung. Stabförmige Gehäuse einer geschätzten Maximalgröße<br />
von 100 bis 150 mm bei einer Windungshöhe von nur wenigen mm. Durch völlig unzerschlitzte Sutur vor allen anderen Dogger-Heteromorphen ausgezeichnet. Skulptur unauffällig.<br />
Acuariceras acuarius (QU.<br />
Art Sutur bei h =<br />
1848), dn: lat. acuarius = der<br />
Gespitzte. o<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen; als<br />
NT wurde nach Angabe von<br />
DIETL 1981b das Orig. zu<br />
QU. 1887, Taf. 90, Fig. 31<br />
durch SCHINDEWOLF 1963<br />
bestimmt (?).<br />
Von Paracuariceras incisum<br />
nur durch unzerschlitzte<br />
Alterssutur zu trennen; grö<br />
ßere Suturabstände u. langsa<br />
meres Dickenwachstum<br />
(SCHINDEWOLF 1963)<br />
nicht allgemeingültig.<br />
Morphoceratidae HYATT 1900<br />
2,6 mm<br />
1,4 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei h =<br />
Stabförmig<br />
v y<br />
8 mm<br />
Form, Skulptur h<br />
gestreckte Gehäuse<br />
mit unbekanntem jüngsten Sta<br />
dium.<br />
Eigentliche Rippen fehlen wie<br />
bei Paracuariceras incisum. Die<br />
meisten Exemplare tragen sehr<br />
schwache, proradiate, unregel<br />
mäßige Wülste, die von etwas<br />
tieferen, ebenfalls proradiaten<br />
Einschnürungen im Abstand<br />
der 4- bis 6fachen Windungs<br />
höhe überlagen sind. Oft ist<br />
ein zarter externer Mediankiel<br />
mit feinen Seitenfurchen deut<br />
Kurzlebige, kleine, aber dennoch vielgestaltige Gruppe, deren Gemeinsamkeit in mehr oder weniger stark ausgeprägten, proversen Einschnürungen besteht, die die unregelmäßigen,<br />
tief spaltenden Rippen schneiden. Aufgrund der gemeinsamen Suturentwäcklung (Ausbildung eines Lobus U n) werden die Morphoceratidae, gemäß SCHINDEWOLF und HAHN<br />
1970, den Stephanocerataceae eingegliedert. Sie umfassen die Gattungen Dimorphinites, Morpboceras, Ebrayiceras, Aspbinctites und Polysphinctites, die durch ausgeprägten Dimor<br />
phismus verknüpft sind. Ober-Bajocium und Unter-Bathonium.<br />
Morpboceras DOUV1LLE 1880; dn: gr. morphe = Gestalt, ceras = Horn; TA AI. multiforme ARKELL 1955, = Am. polymorphus D'ORB. 1846. Kleinwüchsig-evolutebis mittelgroß-<br />
involute Formen, die kurzstielige Spaltrippen sowie eine scharfe Externfurche gemein haben. Unter-Bathonium.<br />
Untergattung Morpboceras s. str.; mittelgroße Gehäuse mit dreieckigem bis ovalem Querschnitt, engem bis mittelweitem Nabel und einfachem Altersmundsaum; starke Entrol-<br />
lungstendenz im Alter.<br />
Art Sutur bei h =<br />
AI- f.VI.J multiforme ARKELL<br />
195]; lat. multus = viel,<br />
forma = Gestalt.<br />
LT ist Am. polymorphus<br />
D'ORB. 1846, Taf. 124,<br />
Fig. 4.<br />
= Am. parkinsoni in flatus<br />
QL. 184" und 1886, Taf. 73,<br />
>':g- 19 und 20.<br />
i~f r<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
lich.<br />
in mm<br />
Skulptur d<br />
Kurze, leicht verdickte Rippen<br />
stiele entspringen am Innenbug<br />
radial bis leicht retrovers und<br />
bifurkieren sogleich unter Vor<br />
biegung. Zwischen den prover<br />
sen Sekundärnppen entsprin<br />
gen weitere, kürzere Spaltrip<br />
pen, während sich erstere<br />
manchmal am Außenbug noch<br />
mals teilen (polyplokV Maxi<br />
mal 6 Einschnürungen pro<br />
Windung verlaufen stärker pro<br />
konkav als die (proradiaten)<br />
Sekundärrippen, die sich an der<br />
Medianunterbrechung paarig<br />
oder alternierend gegenüberste<br />
hen.<br />
in cm<br />
Q<br />
><br />
LT 3,4 21<br />
26<br />
19<br />
R<br />
—<br />
49<br />
48<br />
0,83<br />
1,03<br />
61 SR<br />
19 PR<br />
80 SR<br />
19 PR<br />
72 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl 2a<br />
36; 9<br />
51<br />
168<br />
197<br />
212<br />
101
Art Sutur bei h :<br />
AI. (M) macrescens BUCKM.<br />
1923); dn: lat. macresco =<br />
abmagern.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Survey Museum London.<br />
= Am. parkinsoni inflatus<br />
QU. 1886, Taf. 73, Fig. 18 u.<br />
21.<br />
Von größerem Q und N als<br />
multiforme.<br />
AI. (M.) patescens (BUCKM.<br />
1922; dn; lat. patesco = sich<br />
öffnen.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Survey Museum London.<br />
= Am. parkinsoni inflatus<br />
QU. 1886, Taf. 73, Fig. 23.<br />
Q liegt zwischen denen von<br />
multiforme u. macrescens;<br />
von macrescens außerdem<br />
durch kleineres Z (SR)<br />
geschieden.<br />
AL (M.) egrediens WETZEL<br />
1937; dn: lat. egredior ~ hin<br />
ausgehen, abschweifen.<br />
HT ist Am. parkinsoni inflatus<br />
QU. 1886, Taf. 74, Fig.<br />
1; Orig. im SMNS.<br />
Durch besonders großes Q<br />
und Skulpturverlust aus<br />
gezeichnet.<br />
AI. (AI.) jactatum (BUCKM.<br />
1928)<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Survey Museum London.<br />
= Am. parkinsoni inflatus<br />
QU. 1886, Taf. 73, Fig. 22.<br />
Besonders dicht berippt und<br />
anscheinend kleinwüchsig.<br />
102<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
4,5 cm<br />
4,5 cm<br />
3;3 cm<br />
Skulptur d<br />
Skulptur ähnelt weitgehend<br />
derjenigen von multiforme, ist<br />
jedoch auf den Flanken etwas<br />
schwächer und erlischt manch<br />
mal nahezu auf der Alters<br />
wohnkammer. Die Zahl der<br />
Einschnürungen beträgt im<br />
Durchschnitt nur drei.<br />
Primär- und Sekundärrippen<br />
bilden stark konkave Züge,<br />
deren Stiele im Wachstumsver<br />
lauf länger werden. Extern ste<br />
hen sich die Rippen leicht<br />
gewinkelt alternierend gegen<br />
über. Einschnürungen verrin<br />
gern und verflachen sich mit<br />
zunehmendem Alter.<br />
Kurze, konkave Rippenstiele,<br />
im wesentlichen auf den Innen<br />
bug beschränkt, Flankenmitte<br />
mit den Spaltpunkten frühzeitig<br />
glatt werdend. Stark proradiate<br />
Sekundärnppen auf äußerem<br />
Flankendrittel, extern<br />
geschwächt. Etwa 5 schmale,<br />
geschwungene Einschnürungen<br />
pro Umgang.<br />
Sehr feine, konkave Rippen<br />
spalten anfangs über dem<br />
Außenbug, zuletzt nahe Flan<br />
kenmitte. Sie stehen alternie<br />
rend an der schmalen Extern<br />
furche, die im Alter undeutlich<br />
ward, gegenüber. Proverse Ein<br />
schnürungen nur schwach aus<br />
geprägt.<br />
in cm<br />
HT| 5<br />
-'<br />
6,«<br />
{ 8,2<br />
26<br />
33<br />
41<br />
34<br />
40<br />
34<br />
27<br />
32<br />
43<br />
37<br />
43<br />
47<br />
31<br />
37<br />
32<br />
42<br />
40<br />
1.30 ,<br />
(1,48)<br />
6v6<br />
US<br />
T746<br />
1,19<br />
1,23<br />
5772<br />
1702<br />
T72Ö<br />
26 FR<br />
86 SR<br />
92 SR<br />
20 PR<br />
82 SR<br />
22 PR<br />
86 SR<br />
89 SR<br />
30 PR<br />
86 SR<br />
40 PR<br />
84 SR<br />
20 PR<br />
64 SR<br />
22 PR<br />
74 SR<br />
25 PR<br />
i SR<br />
HT 4,7 24 43 1,6 (82) SR<br />
HT<br />
r<br />
4,0<br />
13,2<br />
38<br />
32<br />
28<br />
36<br />
25<br />
41<br />
1,44<br />
0,57<br />
1,14<br />
108 SR<br />
22 PR<br />
68 SR<br />
24 PR<br />
78 SR
Untergattung Ebrayiceras BUCKM. 1920; dn: C.-H.-T. EBRAY, schweizer. Geologe, 1823-1879; TA Ebrayiceras ocellatum BUCKM. 1920 (= E. sukatum (ZIETEN 1830)). Klein<br />
wüchsige, vorwiegend evolute Gehäuse mit großen Ohren am Altersmundsaum, welche die Mündung fast völlig verschließen. Querschnitt hochoval, Skulptur aus Spaltrippen mit<br />
kurzen, oft überhöhten Stielen. Innenwindungen von denen der Nominatuntergattung kaum unterscheidbar.<br />
M. (E.) sulcatum (ZIETEN<br />
1830), dn: lat. sulcatus =<br />
gefurcht.<br />
Art Sutur bei h =<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
= Am. pseudo-anceps EBRAY<br />
1864.<br />
= E. ocellatum BUCKM.<br />
1920.<br />
M. (E.) rursum BUCKM.<br />
1927; dn: lat. rursus = rück<br />
wärts.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Survey Museum London.<br />
Durch große Nabelweite aus<br />
gezeichnete Art mit außerge<br />
wöhnlich wenig proverser<br />
Berippung.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
1,4 mm 2,2 cm<br />
Skulptur d<br />
Sehr kurze Rippenstieie zu<br />
Knötchen verdickt, bereits auf<br />
dem Innenbug in proradiate<br />
Sekundärrippen bi- oder trifur-<br />
kierend. Im Alter verlängern<br />
sich die Stiele und spalten<br />
schließlich bei 30% Flanken<br />
höhe. An scharf begrenzter<br />
Externfurche Rippen anfangs<br />
gegenüberstehend, spater alter<br />
nierend. 5 bis 6 proverse Ein<br />
schnürungen pro Umgang. c:<br />
Rippenstiele auf den Innenwin<br />
dungen zu kleinen Knötchen<br />
reduziert, aus denen 2, seltener<br />
3 radiale oder schwach retrora<br />
diate Sekundärrippen entsprin<br />
gen, die an der markanten<br />
Externfurche geradlinig gegen<br />
überstehen. Auf allen Umgän<br />
gen je 3-5 schwache Einschnü<br />
rungen, nur schwach provers.<br />
in cm<br />
39<br />
39<br />
42<br />
46<br />
40<br />
43<br />
Asphinctites BUCKM. 1924; TA Asphinctites reänctus BUCKM. 1924. Planulate, perisphinctoide Formen, die wegen ihrer polyploken und virgatipartiten Berippung von den eigent<br />
lichen Morphoceraten abgeleitet werden können (HAHN 1970), deren Flanken- und Externfurchen sie aber wieder verlieren. Oberes Unter-Bathonium.<br />
HT 2,6<br />
Untergattung Asphinctites s. str.; makroconche Formen mit hochelliptischem bis hochovalem Querschnitt und einfachem Altersmundsaum.<br />
A. (A.) temtiplicatus<br />
(BRAUNS 1865), dn: lat.<br />
lenuis = zart, plicatus =<br />
gefaltet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen;<br />
NT in WESTERMANN<br />
1958, Taf. 45, Fig. 3; Orig.<br />
im Geol. Inst, der Univ. Göt<br />
tingen.<br />
= Sieinirackkia bajaafomus<br />
ARKELL 1951; = Asphincti<br />
tes hjthonicus WEST. 1958.<br />
patrulii HAHN 1970,<br />
!>• PATRULIUS, rumäni-<br />
^her Geologe.<br />
n<br />
»s. <strong>des</strong> HT unter Nr.<br />
- !<br />
" ;<br />
: im SMNS.<br />
\"ii icnwplicatus durch grö-<br />
l-eres Z geschieden. A. pm-<br />
gw IDE GROSSOUVRE) ist<br />
•'linhch henppt, hat aber fast<br />
! m r<br />
>'•>!" so großes Q.<br />
2,5 mm 5,8 cm<br />
Innenwindungen bis d Ä<br />
0,7<br />
glatt, danach unregelmäßige,<br />
anfangs sehr feine, leicht prora<br />
diate Primarrippen, in verschie<br />
densten Moden und in ver<br />
schiedener Höhe spaltend. Auf<br />
den Flanken der Wohnkammer<br />
Rippenschwächung, auf den<br />
Innenwindungen 2-3 proverse<br />
Einschnürungen pro Umgang,<br />
im Alter undeutlich werdend.<br />
Leicht proverse, feine Primar<br />
rippen, auf vielfältige Weise auf<br />
der inneren Fiankenhälfte in<br />
noch feinere Sekundärrippen<br />
spaltend, den Venter ohne<br />
Unterbrechung querend.<br />
Innerste Windungen fast glatt,<br />
je 2-3 tiefe, stark proverse Ein<br />
schnürungen, die auf der<br />
Wohnkammer verschwunden<br />
sind.<br />
HT<br />
1<br />
[2,7<br />
U,4<br />
42<br />
JT<br />
46<br />
37<br />
36<br />
H<br />
in %<br />
39<br />
37<br />
34<br />
35<br />
34<br />
33<br />
(35)<br />
JT<br />
38 35<br />
32<br />
34<br />
40<br />
38<br />
43<br />
38<br />
31<br />
40<br />
0,87<br />
1,03<br />
0,92<br />
1,13<br />
1,10<br />
1,18<br />
(1,15)<br />
09<br />
1,16<br />
1,15<br />
T7J6<br />
u<br />
1,3<br />
1,05<br />
1,11<br />
0,83<br />
20 PR<br />
62 SR<br />
24 PR<br />
68 SR<br />
26 PR<br />
58 SR<br />
32 PR<br />
70 SR<br />
32 PR<br />
66 SR<br />
36 PR<br />
76 SR<br />
20 PR<br />
40 SR<br />
22 PR<br />
46 SR<br />
24 PR bt 1<br />
118 SR<br />
24 PR 36; 17<br />
94 SR<br />
5<br />
24 PR 112<br />
94 SR 211<br />
26 PR<br />
TÖ2 SR<br />
36 PR<br />
94 SR<br />
30 PR<br />
130 SR<br />
32 PR<br />
140 SR<br />
40 PR<br />
144 SR<br />
28 PR<br />
103
Untergattung Polysphinctites BUCKM. 1922; TA Polysphinctitcs polysbinetus BUCKM. 1922. Mikroconche Formen mit Ohren .im Altcrsmuntjsaum, Phrncmoconc von Inncnwn».<br />
düngen der Untergattung Asphinctites s. str. nicht unterscheidbar.<br />
A. (P.) polvsphinctus<br />
(BUCKM. 1922)<br />
Art Sutur bei h =<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Q Survey Museum London. u<br />
= (?) Am. triplicatus fuscus<br />
QU. 1887, Taf. 79, Fig. 19 u.<br />
20.<br />
A. (P.) secundus (WETZEL<br />
1950), dn: lat. secundus =<br />
der folgende. CO<br />
LT ist, gemäß HAHN 1970,<br />
Am. lenuiplicatus<br />
SCHLOENBACH 1865, Taf.<br />
29, Fig. 3; Orig. verschollen.<br />
Von polyspbinctus durch grö<br />
bere Rippenstiele geschieden.<br />
Macrocephalitidae BUCKM. 1922<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Skulptur d<br />
Ab d ~ 0.7 sehr feine, proradiate<br />
Primärrippen, die unregelmäßig<br />
und in verschiedener Art<br />
spalten. 2-3 Einschnürungen<br />
auf allen Windungen, nicht<br />
immer sehr ausgeprägt.<br />
ö<br />
3,7 cm<br />
Ausgeprägte proradiate Primärrippen<br />
folgen den skulpturlosen<br />
innersten Windungen und<br />
teilen sich, gattungstypisch<br />
unregelmäßig, in je 4-5 sehr<br />
1,7 cm<br />
feine Sekundärrippchen, die<br />
den Venter ungeschwächt que<br />
ren. Pro Umgang 1-2 Ein<br />
schnürungen, den Rippen<br />
parallel.<br />
in cm<br />
HT|J?<br />
N<br />
in %<br />
49<br />
49<br />
53<br />
50<br />
51<br />
52<br />
H<br />
in %<br />
29<br />
30<br />
27<br />
27<br />
31<br />
29<br />
Q<br />
0,87<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
1,04 6<br />
1,11<br />
1,12<br />
bt 1<br />
37; 2<br />
112<br />
LT 1,8 39 30 1,0 20 PR bt 1<br />
Involute, kugelige bis dickscheibige Formen mit gleichmäßig dichten Spaltrippen, die ununterbrochen den kiellosen Venter queren. Oftmals Rippenschwächung bis zur völligen<br />
Glätte im Alter, Alterswohnkammer nur unwesentlich modifiziert.<br />
Macrocephalites ZITTEL 1884; dn: gr. makros = groß, kephale = Kopf; TA Am. macrocephalusSCHL. 1813 (bestimmt durch LEMOINE 1910.S. 15). Mittelgroße bis große Formen<br />
mit trichterförmig engem Nabel und halbkreisförmigem bis halbelliptischem oder gerundet dreieckigem Querschnitt. THIERRY betrachtet 19 7<br />
8 - im Gegensatz zu Kamptokephali-<br />
tes - Formen mit Q größer als 1 und abgeflachten Flanken als gattungstypisch, da er gemäß bisherigem Trend Am. macroeepbalus ZITTEL als TA beibehielt. Durch CALLO-<br />
MONs Aufstellung eines NT für macrocephalusSCHL. trifft diese Diagnose nicht mehr zu (s. u.). Bis zur Konsolidierung einer Lösung werden hier alle großsvüchsigen Arten in der<br />
Untergattung Macrocephalites s. Str. und alle kleinwüchsigen in der Untergattung Dolikephalites zusammengefaßt. Unter-Callovium.<br />
Untergattung Macrocephalites s. Str.; mittel- bis großwüchsige Gehäuse<br />
AI. (M.) macroeepbalus<br />
(SCHL. 1813), dn: s. Gat<br />
tung<br />
CALLOMON bestimmte<br />
1971 (mit ausführlicher<br />
Begründung) einen NT; Orig.<br />
in der SCHLOTHEIM-SIg.<br />
der Humboldt-Univ. Berlin.<br />
SCHL. hatte sich auf eine<br />
Abb. in BAIER 1757 bezo<br />
gen, deren Orig. verschollen<br />
104<br />
U. U Pitt Feine, dichte, proradiate Pri<br />
14 cm<br />
märrippen erlöschen bei d =<br />
10. Auf der Nabeiwand der<br />
Innenwindungen sind sie sehr<br />
schwach sichtbar. Ihre Spalt<br />
punkte liegen undeutlich bei<br />
geringer Flankenhöhe. Die<br />
Sekundärrippen bilden ventral<br />
schwach konvexe Bogen und<br />
sind dort am kräftigsten.<br />
|1,2<br />
Ii,6<br />
11,3<br />
Ii ,9<br />
NT<br />
41<br />
45<br />
46<br />
47<br />
16<br />
16<br />
33<br />
32<br />
33<br />
31<br />
51<br />
51<br />
0,89<br />
0,94<br />
1,03<br />
0,75<br />
20 PR<br />
20 PR<br />
26 PR<br />
0,76 (120)SR-<br />
37; 3<br />
112<br />
217
An<br />
AI. (M.) transitorius (SPÄTH<br />
1928), dn: lat. transitorius =<br />
vorübergehend, überleitend.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (SPÄTH, Taf.<br />
24, Fig. 6) im BMNH, Sig.<br />
SMITH.<br />
= Am. macroeepbalus tumidus<br />
QU. 1886, Taf. 76,<br />
Fig. 10.<br />
Anderer Querschnitt als<br />
macroeepbalus, größeres Q.<br />
AI (M.) madagascariensis<br />
LEMOINE 1910; dn: Fund<br />
ort Madagaskar im Ind.<br />
Ozean.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im MHNP, Sig.<br />
Kapitän COLCANAP.<br />
= AI. (M.) veriis BUCKM.<br />
1922; = AI. (M.) macroeepba<br />
lus ZITTEL 1884 (nicht<br />
SCHL.!)<br />
Hochmündiger und engnabli-<br />
ger als vorstehende Arten.<br />
AI. fAl.J «compressus" (QU.<br />
1846), dn: lat. compressus =<br />
(flach-) gedrückt.<br />
HT identisch mit Am.<br />
macroeepbalus compressus<br />
QU. 1886, Taf. 76, Fig. 14;<br />
Orig. im SMNS.<br />
Sehr dicht berippte Art mit<br />
abermals größerem Q.<br />
(AI.) diadematus (WAA-<br />
v.KN 1875;, dn: lat. diadema<br />
~ Koiugskrone.<br />
Sehr breit- und niedermündige<br />
Art.<br />
Sutur bei h =<br />
tS?V"<br />
fr?-<br />
72 :<br />
91 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
15,5 cm<br />
14 cm<br />
60 mm 8,6 cit<br />
8,8 .<br />
Skulptur<br />
Grobe, weniger dichte, retro<br />
konkave Primärrippen spalten<br />
3- bis 4fach in schwach kon<br />
vexe Sekundärrippen, mit<br />
denen sie eine Sinuskurve bil<br />
den. Durch Schaltrippen ward<br />
TZ ~* 4. Am Ende <strong>des</strong> adulten<br />
Phragmocons werden die Pri<br />
märrippen schwächer, auf der<br />
Alterswohnkammer (d = 20-<br />
24) sind sie erloschen; die<br />
Sekundärrippen sind noch stei<br />
lenweise wahrnehmbar.<br />
Die Berippung ähnelt weitge-<br />
hend der von transitorius, die<br />
Sekundärrippen sind lediglich<br />
weniger gekrümmt, die Spal<br />
tung ist 2-bis 3fach, die Schalt<br />
rippen sind etwas häufiger. Vor<br />
der Alterswohnkammer werden<br />
die Primärrippen durch Weitun<br />
gen der Flanke abgelöst. AI.<br />
formosus SOW. unterscheidet<br />
sich nur durch früher erlö<br />
schende Primärrippen.<br />
Die insgesamt seht schwach<br />
konkaven, proversen, feinen<br />
Rippen spalten vorwiegend<br />
2fach zwischen 30 und 50%<br />
Flankenhöhe. Mit sporadischen<br />
Schaltrippen ergibt sich eine<br />
Teilungsziffer zwischen 2 und<br />
3. Am Ende <strong>des</strong> adulten Phrag<br />
mocons (d = 12-15) sind die<br />
Rippen nur noch ventral und<br />
auf äußerer Flankenhälfte<br />
wahrnehmbar.<br />
Auf mittleren Windungen<br />
herrscht Bifurkation der vor<br />
wiegend radialen Rippen am<br />
Innenbug vor. Auf der Außen<br />
windung erhöht sich die Ten<br />
denz zur Bündelung und zur<br />
Bildung von Schaltrippen. wes<br />
halb TZ zunimmt. Primäre<br />
Altersrippen schwingen retro-<br />
konkav über den Innenbug.<br />
HT<br />
HT<br />
d<br />
in cm<br />
5<br />
10<br />
15<br />
j<br />
14,3<br />
17,1<br />
10<br />
15<br />
12,3<br />
15,5<br />
I<br />
18,5<br />
10<br />
15<br />
N<br />
in %<br />
14,6<br />
16,3<br />
17<br />
14<br />
TT<br />
12<br />
11<br />
17<br />
14<br />
12<br />
14,5<br />
13<br />
17<br />
l~6<br />
r°<br />
H<br />
in %<br />
49<br />
50,7<br />
JT<br />
JT<br />
JT<br />
51<br />
55<br />
J2<br />
53<br />
J3<br />
4S<br />
48<br />
47<br />
0,90<br />
1,07<br />
Ö79T<br />
Ö793<br />
Ö797<br />
1,07<br />
1,18<br />
T7JÖ<br />
T U<br />
1714<br />
1,17<br />
1,27<br />
T~2Ö<br />
I7JÖ<br />
T734<br />
LT S,S 44 0,53<br />
0,50<br />
0,58<br />
38 PR<br />
138 SR<br />
36 PR<br />
144 SR<br />
28 PR<br />
108 SR<br />
26 PR<br />
136 SR<br />
50 PR<br />
128 SR<br />
72 PR<br />
150 SR<br />
146 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl la<br />
37; 5<br />
197<br />
243<br />
cl 1<br />
37; 6<br />
40<br />
243<br />
288<br />
cl lb<br />
38; 1<br />
197<br />
243<br />
(88) SR cl 1<br />
38; 2<br />
105
AJ. (M.t) '•rotundus- (QU.<br />
Art Sutur bei h =<br />
1847), dn: lat. rotundus =<br />
gerundet.<br />
HT ist Am. macroeepbalus<br />
rotundus QU. 1847, Taf. 15,<br />
Fig. 2; = 1886, Taf. 7<br />
6, Fig.<br />
lf; Orig. im IGPT.<br />
Form ähnlich macroeepbalus,<br />
Rippen aber weniger dicht<br />
und stärker gekrümmt. Im<br />
Alter Tendenz zur Kugel<br />
form. <br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Skulptur d<br />
(Po<br />
Ausgeprägte, prokonkave Rip<br />
9,4 cm<br />
pen mit geringer Differenzie<br />
rung in Primär- und Sekundär<br />
komponenten, bilden extern<br />
gleichmäßige, konvexe Bogen.<br />
Altersschwund der Skulptur<br />
beim HT noch nicht bemerk<br />
bar.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
(40) PR cl 1<br />
HT 9,4 16 49 0,69 |<br />
90 SR<br />
Untergattung Dolikepbalites BUCKM. 1923; dn: lat. dolium = Weinfaß; TA D. dolius BUCKM. 1922. Mikroconche Formen mit beständiger Skulptur, deren geschlechtstypischer<br />
Altersmundsaum (Ohren) jedoch nur in Ausnahmefällen nachgewiesen wurde.<br />
.Vf. (DJ) subtrapezmus (WAA<br />
GEN! 1875), dn: lat. sub- =<br />
unter(-geordnet), trapezinus<br />
= trapezförmig.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Survey Museum Kalkutta<br />
'Indien), unter \r. 2016.<br />
Endgröße bei d = 10.<br />
AI. (DJ) lamellosus (SOW.<br />
1840), dn: lat. lamellosus =<br />
blätterig.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im BMNH<br />
unter Nr. C 33412.<br />
Endgröße bei d 12. Von<br />
subtrapezmus kaum zu unter<br />
scheiden; lt. TH1ERRY 19"S<br />
stratigraphisch getrennt.<br />
AI. (D.) rKm/^rrTREINECKE<br />
1818), dn: lat. tumidus = :<br />
aufgebläht, geschwollen.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
Abb. leicht perspektivisch.<br />
Unkenntnis <strong>des</strong> Alterssta<br />
diums erschwert Zuordnung<br />
zu anderen Arten. Sehr ähn<br />
lich ist folliformis BUCKM.<br />
(vergl. CALLOMON 1971)<br />
106<br />
30 mm<br />
9 cm<br />
10 cm<br />
4,5 cm<br />
Grobe, insgesamt schwach<br />
sinusförmige Rippen, die etwa<br />
auf Flankenmitte bi- oder auch<br />
manchmal trifurkieren. Schalt<br />
rippen sporadisch. Rippen<br />
schwächung im Alter nicht<br />
bekannt, Verdichtung der Rip<br />
pen vor dem Altersmundsaum.<br />
Grobe, insgesamt schwach<br />
konkave Rippen spalten etwas<br />
unterhalb der Flankenmitte fast<br />
ausschließlich 2fach, Schaltrip<br />
pen selten. Berippung bis an<br />
den Altersmundsaum unge<br />
schwächt. AI. (D.) uetzinguensis<br />
THIERRY 1978, mit gleichen<br />
Maßen aus gleichem Horizont,<br />
hat etwas anderes Skulpturbild<br />
(mehr proradiat), ähnlich subtrapezinus.<br />
Konkave Rippen bifurkieren<br />
häufig auf Flankenmitte. Durch<br />
sporadische Einzelrippen liegt<br />
TZ unter 2, wodurch sich die<br />
Art von lamellosus unterschei<br />
det.<br />
HT<<br />
HT<br />
18,7<br />
10<br />
5<br />
10<br />
9,1<br />
10,8<br />
19,5<br />
19,4<br />
22<br />
21<br />
19<br />
IT<br />
20<br />
45<br />
50<br />
49<br />
4775<br />
48<br />
46<br />
51<br />
47<br />
1,03<br />
1,11<br />
0797<br />
u<br />
U 2 |<br />
1,12 |<br />
079<br />
T7J5<br />
HT 4,2 (50) (0,9)<br />
34 PR<br />
82 SR<br />
42 PR<br />
94 SR<br />
27 PR<br />
66 SR<br />
36 PR<br />
104 SR<br />
40 PR<br />
) SR<br />
38 PR<br />
SO SR<br />
(35) PR<br />
(52) SR '<br />
38: .1<br />
19"
Art<br />
AI (D.) perseverans KUHN<br />
1939, dn: lat. perseverans -=<br />
beharrlich, ausdauernd.<br />
HT in JEANNET 1955, Taf.<br />
25, Fig. 4; Orig. z. Zt. unauf<br />
findbar.<br />
= AI. sphaericus JEANNET<br />
1955.<br />
Extrem breitmündige Art.<br />
AI (DJ) grantamts (OPP.<br />
1857).<br />
HT ist Am. berveyi D'ORB.<br />
1846, Taf. 150.<br />
Außergewöhnlich grobrippige<br />
Art.<br />
AI. fD^Jp^ NIKITIN 1885,<br />
dn: lat. pila = Ball.<br />
Kosmoceratidae HAUG 1887<br />
Sutur bei h =<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
5 cm<br />
9 cm<br />
5,7 cm<br />
Skulptur d<br />
Leicht konkave Rippen bifur<br />
kieren etwa auf Flankenmitte<br />
unter schwacher Erhöhung und<br />
überqueren den Venter leicht<br />
konvex.<br />
Am Innenbug kräftige, retro<br />
konkave Rippenstiele, die meist<br />
im inneren Flankendrittel bifur<br />
kieren. Sekundärrippen<br />
schwach prokonvex und extern<br />
gerade übergehend.<br />
Die leicht proradiaten, nur<br />
ganz schwach sinusförmigen<br />
Rippen tri- oder bifurkieren bei<br />
ca. 30% Flankenhöhe.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
HT 5 44 0,50 cl 1<br />
3,2 28 44 0,50<br />
4<br />
5<br />
25<br />
26<br />
42<br />
44<br />
0,45<br />
0,48<br />
HT 8,8 25 46 0,8 |<br />
28 PR<br />
1 62 SR<br />
24 PR<br />
54 SR<br />
39; 3<br />
40<br />
135<br />
145<br />
cl 1<br />
39; 4<br />
74<br />
177<br />
(22) PR cl 1<br />
HT 5,7 17 49 0,64 j (60) SR<br />
Kugelige bis planulate, mäßig involute Stephanocerataceae mit gerundetem, abgeflachtem oder gefurchtem Venter und dichten Spalt- oder Bündelrippen. Häufig ein- bis dreireihige<br />
Bedornung an der Ventralkante, dem Rippenspaltpunkt oder (und) dem Innenbug. U n ward zum beherrschenden Umbilikallobus der Alterssutur. Callovium.<br />
Kepplerites NEUMAYR u. UHLIG 1892 (= Gowerkeras BUCKM. 1921, weitere Synonyme s. TINTANT 1963, S. 66); dmjohannes Kepler (OPP. irrte in der Schreibweise), Astro<br />
nom und Physiker, 1571-1630; TA Am. keppleri OPP. 1862. Dickplanulate Formen mir angenähert kreisrundem Windungsquerschnitt und abgeflachtem bis gefurchten jugendven-<br />
ter, der sich im Alter rundet. Externberippung sehr fein, den Venter querend, schwache Dornen nur einreihig oder fehlend. Unrer-Callovium.<br />
Untergattung Kepplerites s. Str.; relativ großwüchsig, mit einfach gewelltem Mundsaum ohne Ohren.<br />
*>'• keppleri (OPP. 1862),<br />
dn: s. Gattung.<br />
•T ist nach TINTANT 1963<br />
das OI'PEI.sche Exemplar in<br />
•SL'CKM. 1922. Taf. 289;<br />
° r<br />
'g- in der BSPG. OPP. fc.il-<br />
-*«•• die Art nicht ab.<br />
" Am. macroeepbalus evolu-<br />
""QU. 1886, Taf. 77, Fig.<br />
1-5.<br />
h<br />
45 mm 12 (<br />
Kräftige, retrokonkave Primär<br />
rippen variabler Dichte spalten<br />
dicht oberhalb <strong>des</strong> Innenbugs<br />
in zahlreiche, regelmäßig dichte<br />
Sekundärrippen, die nach leich<br />
ter Rückbiegung oberhalb <strong>des</strong><br />
Spaltpunktes proradiat verlau<br />
fen und gerade den Venter<br />
queren. Rippenspaltpunkte<br />
manchmal verdickt. TZ in der<br />
Jugend 3-4, später 4-7.<br />
39; 5<br />
(17) PR cl 1<br />
f6,7 18 50 0,96 |<br />
(70) SR<br />
U3 30 39 0,94<br />
7 19 4= TTöI 18 PR<br />
±4<br />
10 23 42 5793 24 PR<br />
±5<br />
14 32 39 Ö7S6 31 PR<br />
±5<br />
79<br />
39; 6<br />
178<br />
197<br />
246<br />
107
K. (K.) gowenanus (SOW.<br />
182").<br />
Orig. <strong>des</strong> HT unter Nr.<br />
Art Sutur hei h<br />
43.VI" im BMNH, London.<br />
= Am. macroeepbalus evolutus<br />
QU. 1886, Taf. 76, Fig. 9.<br />
Weitnabliger als keppleri und<br />
bedornt 'relativ selten).<br />
K. (K.r) toricellii (OPP. 1862),<br />
dn: E. Torricelli, itai. Physi<br />
ker u. Mathematiker, 1608-<br />
1647.<br />
LT in BUCKM. 1922, Taf.<br />
292, nicht von OPP. abgebil<br />
det; Orig. nicht auffindbar.<br />
= Toricclliceras subrotunJum<br />
BUCKM. 1922.<br />
Von gowerianus durch abge<br />
plattete Flanken, größeres Z<br />
und längeren Larerallobus<br />
geschieden.<br />
18 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
hei d =<br />
6,6 cm<br />
18 mm 5;3 cm<br />
Skulptur d<br />
Kräftige radiale bis leicht pro<br />
radiate Primärrippen spalten in<br />
kleinen Dornen etwa auf Fian-<br />
kenmitte. die auf der zweiten<br />
Hallte der Wohnkammer erlö<br />
schen. Radiale Sekundärrippen<br />
entspringen paarweise den<br />
Dornen, jeweils vermehrt Lim 1<br />
bis 2 Schaltrippen.<br />
Vorwiegend radiale, nur mäßig<br />
gekrümmte Primärrippen spal<br />
ten vielfach innerhalb der Flan<br />
kenmitte in sehr feine, auf dem<br />
Steinkern nur schwach sicht<br />
bare, etwa radiale Sekundärrip<br />
pen. BUCKMANs Abb. <strong>des</strong> LT<br />
zeigt 2 Reihen feiner ventraler<br />
Knötchen auf der Innenwin<br />
dung; OPP. berichtet von<br />
jugendlicher Ventralunterbre<br />
chung der Rippen. Im Wachs<br />
tumsverlauf steigt TZ auf 4 bis<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
34<br />
TT<br />
3J<br />
3S<br />
0,72<br />
0,85<br />
40 0,85<br />
Untergattung Toricellites BUCKM. 1922; dn: s. K. (K.) toricellii; TA Toricellites approximatus BUCKM. 1922. Relativ kleinwüchsig, Altersmundsaum mit Ohren.<br />
K. (T.j labuseni PARONA u.<br />
BONARELLI 1895, dn: j.<br />
LAHUSEN, Geologe <strong>des</strong> 19.<br />
Jh.<br />
HT ist Cosmoceras goweria-<br />
num LAHUSEN 1887, Taf.<br />
6, Fig. 8; Orig. zuletzt in<br />
Leningrad.<br />
= Kosmoceras ttbligi<br />
PARONA u. BONARELLI<br />
1895; = Kepplerites<br />
bexagonus LOEWE 1913.<br />
108<br />
7 mm 4 cm<br />
Dichte, radiale bis leicht unre<br />
gelmäßig geschwungene Rip<br />
pen bifurkieren etwa auf Flan<br />
kenmitte, manchmal dort<br />
schwach bedornt. An den Kan<br />
ten <strong>des</strong> abgeplatteten Venters<br />
hin und wieder ebenfalls<br />
Andeutung von Dornen, die<br />
auf der Alterswohnkammer<br />
verschwinden.<br />
31<br />
33<br />
34<br />
34<br />
43<br />
39<br />
HT 5.1,5 39<br />
I4 3<br />
37<br />
0,8<br />
±0.2<br />
ÜUS<br />
0,92<br />
0,91<br />
0786'<br />
öTsl<br />
1.19<br />
1,00<br />
0,94<br />
1,13<br />
. Zone<br />
Tat.<br />
! U.<br />
25 I'R |cl lb<br />
29 I'R<br />
116 SR ! 40; 1<br />
22 PR | 197<br />
±6<br />
(38) PR<br />
145<br />
:<br />
246<br />
i<br />
cl lb<br />
(160) SR 40; 2<br />
3T PR<br />
82 SR<br />
37 PR<br />
156 SR<br />
35<br />
178<br />
246<br />
cl lb<br />
38 PR I<br />
88 SR<br />
24 PR-<br />
46 SR<br />
M_ PR<br />
75 SR<br />
40; 3<br />
246
Sigaloceras HYATT 1900; dn: gr. sigalöeis = glänzend, ceras = Horn; TA Am. calloviensis SOW. 1815. Von ähnlichem Wuchs und ähnlicher Skulptur wie Kepplerites, aber mit Abplat<br />
tung <strong>des</strong> Ventcrs, die bis zum Altersmundsaum bestehen bleibt. Letzte Windung neigt zur Entrollung. Generischer Rang fragwürdig. TINTANT ordnete 1963 Culielmina BUCKM.<br />
der «Gattung" als mikroconchen, dimorphen Partner unter. Unter-Callovium.<br />
Untergattung Sigaloceras s. str.; relativ großwüchsige Gehäuse mit nur leicht gewelltem Altersmundsaum ohne Ohren.<br />
5. (S.) calloviense (SOW.<br />
1S15), dn: aus dem Callo<br />
Art Sutur bei h :<br />
vium (oberste Doggerstufe).<br />
LT ist gemäß ARKELL 1933<br />
das Orig. zu Fig. 1, Taf. 104<br />
in SOW. 1815 (BMNH).<br />
== Am. galilaeii OPP. 1862.<br />
S. (S.j enodatmn (NTK1T1N<br />
1881), dn: lat. enodatus =<br />
unbeknotet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Naturhist.<br />
Museum Leningrad/UdSSR.<br />
Von schmälerem Querschnitt<br />
als callovicnse; wegen ähnli<br />
cher Skulptur der gleichen<br />
Gattung zugeordnet.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
25 mm 6 cm<br />
16 mm 4,6 cm<br />
Etwa radiale, schwach<br />
Skulptu d<br />
geschwungene Primärrippen<br />
durchlaufen ein Dichtemaxi<br />
mum bei d = 4,5 und werden<br />
danach sehr weitständig.<br />
Schwache Knötchen können<br />
bis d Ä<br />
2 an den Bifurkations-<br />
steilen auf dem inneren Flan<br />
kendrittel auftreten, ebenso am<br />
Außenbug. Durch zahlreiche<br />
Sekundär-Schaltrippen steigt<br />
TZ im Alter stark an. Letzter<br />
Teil der Alterswohnkammer<br />
glatt.<br />
Skulptur der Innenwindungen<br />
gleicht der von calloviense.<br />
Beim HT steigt TZ im Wachs<br />
tumsverlauf durch Schaltrippen<br />
von 2 auf über 4. Lateralknöt-<br />
chen verschwinden bei d ~= 1,<br />
Ventralknötchen bei d ~= 3,5,<br />
Sekundärrippen erlöschen auf<br />
der Alterswohnkammer.<br />
Kosmoceras WAAGEN 1869; dn: gr. kösmos = Ordnung, Schmuck, ceras = Horn; TA Am. spinosus SOW. 1826. ARKELL 1957 und TINTANT 1963 stellen, im Gegensatz zu<br />
BRINKMANN 1929, Kosmoceras generisch Sigaloceras und Kepplerites gegenüber. TINTANT gibt folgende Diagnose: Makro- und mikroconche Formen mit komprimiertem bis<br />
"ziemlich" breitem Querschnitt. Nabel eng bis «ziemlich" weit, Skulptur nach Stärke und Form sehr variabel. Primärrippen im allgemeinen ziemlich lang (1/3 bis 1 '2 der Fianken-<br />
höhe), Sekundärrippen gerade oder gekrümmt, einfach oder gegabelt, maximal 3 Reihen Knötchen, oft reduziert zu 2 oder einer Reihe, manchmal auch ganz fehlend. Callovium.<br />
Untergattung Kosmoceras s. str. {=Lobokosmokeras BUCKM. 1923, = Bikosmokeras BUCKM. 1926'; makroconche, relativ evolute Formen ohne Ohren, mit gut ausgebildeten Flan-<br />
ken-und Externknoten und oft jugendlich glattem Yentralband zwischen letzteren.<br />
K. (K.) duncani (SOW. 1816),<br />
dn: j. und P. DUNCAN,<br />
Sammler aus Südengland zur<br />
Zeit SOWERBYs.<br />
NT gemäß BRINKMANN<br />
1929 entspricht nicht den<br />
Nomenklaturregeln;<br />
ARKELL bildet 1940, Taf.<br />
1 1. Fig. 6. gültigen NT ab.<br />
5 cm<br />
Bei d ~= 1,5 entspringen aus<br />
Knörchen am Innenbug stark<br />
proradiate Primärrippen, bei ca.<br />
45% der Flankenhöhe in unre<br />
gelmäßigen Knötchen mit TZ<br />
3 spaltend. Dichte, leicht<br />
konkave Spaltäste bündein zu<br />
2-3 in wechselständigen Kno<br />
ten am Außenbug, zwischen<br />
diesen sehr schwache Ventral-<br />
rippen. Ab d ~ 4 Schwächung<br />
der Primärrippen, später Erlö<br />
schen aller Knoten, Rückgang<br />
von TZ und Bündelung.<br />
in cm<br />
f5,8<br />
L<br />
i-, 9<br />
10<br />
p,4<br />
HT<<br />
14,7<br />
N<br />
in °/o<br />
24<br />
24<br />
30<br />
19<br />
21,5<br />
19<br />
26<br />
H<br />
in %<br />
44<br />
47<br />
45<br />
44<br />
40<br />
±5<br />
49<br />
43,5<br />
47<br />
42<br />
0,94<br />
1,00<br />
1,05<br />
1,11<br />
1,05<br />
±0,1<br />
1,38 '<br />
1,32<br />
1,4<br />
T73<br />
NT 5,1 30 44 1,57<br />
25 PR<br />
62 SR<br />
22 PR<br />
30 PR<br />
114 SR<br />
18 PR<br />
143 SR<br />
23 PR<br />
170 SR<br />
26 PR<br />
116 SR -<br />
24 PR<br />
24 PR<br />
90 SR<br />
(20) PR<br />
(40) PR<br />
106 SR -<br />
109
K. (KJ) rowlstonense<br />
Art Sutur bei h =<br />
(YOUNG u. BIRD 1822), dn:<br />
Fundort Rowlston Scar,<br />
Yorkshire (England).<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Museum<br />
Whitby/Yorkshire (England).<br />
= Arn. Jason QU. 1887, Taf.<br />
83, Fig. 22; = Am. omatus<br />
compressus QU. 1887, Taf.<br />
83, Fig. 26.<br />
Etwas kleinere Nabelweite<br />
und wesentlich schwächere<br />
Externknoten als duncani.<br />
K. (K.) spinosum (SOW.<br />
1826), dn: lat. spinosus =<br />
bedornt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
= Am. decoratus ZIETEN<br />
1831; = Am. omatus rotundus<br />
QU. 1849, Taf. 9, Fig. 19<br />
und QU. 1887, Taf. 84, Fig.<br />
7, 10 u. 11.<br />
Breitmündiger als vorsrehen-<br />
de Arten und von anderer<br />
Skulptur<br />
K. (K.) annulatum (QU.<br />
1887), dn: lat. anulus =<br />
Ring, annulatus = beringt.<br />
LT ist gemäß ARKELL 1940,<br />
Fig. 17, Taf. 84 in QU. 1887;<br />
Orig. im SMNS.<br />
Von spinosum u. folgenden<br />
Arten durch weitständige<br />
Knoten geschieden.<br />
K. (K.) tidmoorense ARKELL<br />
1940, dn: Tidmoor Point,<br />
Fundort bei Weymouth<br />
(Südengland).<br />
= Am. ornatus QU. 1887,<br />
Taf. 84, Fig. 25; = Am. ornatus<br />
rotundus QU. 1887, Taf.<br />
84, Fig. 1 u. 28.<br />
Von spinosum durch breitere<br />
Windungen und dichtere<br />
Beknotung geschieden.<br />
110<br />
u<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei cl =<br />
3 mm 3,2 cm<br />
2,5 i<br />
3 cm<br />
Skulptu d<br />
Der schlecht erhaltene HT<br />
zeigt sehr feine, unregelmäßige,<br />
Seicht sinusförmig gebogene<br />
Rippen, die in sehr schwachen<br />
Knötchen innerhalb Flanken<br />
mitte gabeln oder einzeln blei<br />
ben und am Außenbug meist<br />
paarweise in kleinen, wechsel<br />
ständigen Knötchen enden.<br />
Auf den Innenwindungen feine,<br />
radiale bis leicht prokonkave<br />
Primärrippen, die langsam grö<br />
ber werden und auf Flanken<br />
mitte in leicht rückgebogene,<br />
unregelmäßig gekrümmte,<br />
zuletzt ebenfalls grobe Sekun<br />
därrippen bifurkieren. Spalt<br />
punkte nur sporadisch bedornt,<br />
weitere Dornen meist wechsel<br />
ständig an der ventralen Rip<br />
penschwächung, etwa halb so<br />
zahlreich wie die Sekundärrip<br />
pen. Ab d = 5 Schwächung<br />
von Knoten und Ventralrinne.<br />
Flankenknoten nur auf jeder 5.<br />
bis 7. Primärrippe, im Jugend<br />
stadium etwa doppelte Zahl<br />
von Externknoten. Im Alter<br />
sind Flanken- und Externkno<br />
ten paarweise durch fibulate<br />
Sekundärrippen verbunden,<br />
wodurch der Eindruck einer<br />
Knoten-Beringung entsteht.<br />
Einzelrippen, im Alter auch<br />
Paare, enden in schwachen<br />
Verdickungen am glatten Ven<br />
tralband.<br />
Im Gegensatz zu spinosum sind<br />
alle Rippen durch Flankenkno<br />
ten unterbrochen, in denen sie<br />
häufig spalten. Die leicht retro-<br />
radiaten Sekundärrippen laufen<br />
zu verschiedenen Externkno<br />
ten, so daß stellenweise eine<br />
Art Mäandermuster entsteht.<br />
Externknoten beim HT wech<br />
selständig an glattem Median<br />
band.<br />
in cm<br />
HT 5<br />
N<br />
in %<br />
4,3 26<br />
LT 2,5<br />
4<br />
12<br />
LT 2,4<br />
2,7<br />
HT 2,4<br />
2,9<br />
26<br />
(32)<br />
33<br />
35<br />
39<br />
39<br />
38<br />
37<br />
38<br />
H<br />
in %<br />
44<br />
45<br />
45<br />
(42)<br />
40<br />
37<br />
34<br />
43<br />
38,5<br />
39<br />
39<br />
1,59<br />
1,56<br />
(1,0)<br />
hl<br />
u i<br />
1,38<br />
1,13<br />
0,86<br />
(135) SR<br />
(40) I'R<br />
(119) SR<br />
(120JSR<br />
20 Kn<br />
35 PR<br />
74 SR<br />
36 PR<br />
84 SR<br />
40 PR<br />
86 SR<br />
43 PR<br />
182) SR<br />
(0,95) 35 PR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.
Axt Sutur bei h =<br />
K. (K.) gemmatum (PHILLIPS<br />
1829), dn: lat. gemmatus =<br />
mit Perlen besetzt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (d = 16!) ver<br />
schollen; NT aufgest. durch<br />
ARKELL 1940; Orig. im<br />
Sedgwick-Museum Cam<br />
bridge (England).<br />
Form gleicht der von spino<br />
sum, Skulptur abweichend.<br />
K. (K.) «compressum» (QU.<br />
1849), dn: lat. compressus =<br />
zusammengedrückt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
Ähnlich rowlstonense, aber<br />
von kleinerem Q und Z.<br />
K. (K.f) spoliatum (QU.<br />
1858), dn: lat. spoliatus =<br />
ausgeplündert, der Stacheln<br />
beraubt.<br />
HT ist Am. omatus spoliatus<br />
QU. 1858, Taf. 70, Fig. 9, =<br />
QU. 1887, Taf. 84, Fig. 3;<br />
Orig. im SMNS.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch früh erlöschende Flan<br />
kenknoten und sehr<br />
schwache Externknoten<br />
geschieden.<br />
(K.r; diiplicosta (QU.<br />
lS.S" 1<br />
, dn: lat. dupius =<br />
'weitjch, costa = Rippe.<br />
°ng. <strong>des</strong> HT zerstört.<br />
Auherst feinrippig und<br />
nahezu knotenlos.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
0<br />
4,6 cm<br />
0<br />
5,3 cm<br />
0<br />
4 cm<br />
Skulptur d<br />
Auffallend weitständige, radiale<br />
Primärrippen enden auf Flan-<br />
kcnmitte in runden Knoten,<br />
aus denen unregelmäßige,<br />
sinusförmige Sekundärrippen<br />
stark nach hinten schwingen.<br />
Sie münden einzeln oder paar<br />
weise in Dornen am Außen<br />
bug, zwäschen denen gerade<br />
Rippen den Venter queren.<br />
Feine, sinusförmige, gleichmä<br />
ßige Primärrippen bifurkieren<br />
in kleinen Knötchen auf Flan<br />
kenmitte in leicht retrokon<br />
kave, dünne Spaltäste, die<br />
extern völlig gerade übergehen<br />
und dabei weit voneinander<br />
entfernte Reihen von sehr<br />
schwachen Knötchen durchlau<br />
fen.<br />
Skulptur der Innenwindungen<br />
gleicht der von spinosum mit<br />
gebündelten Rippen, kräftigen<br />
Flanken- und Externknoten. Ab<br />
d ^ 2 entsteht Altersskulptur<br />
aus gleichmäßigen, radialen bis<br />
leicht geschwungenen Spalt-<br />
und Schaltrippen ohne Flan<br />
kenknoten, jede einzeln in<br />
einem kleinen, gegenständigen<br />
Externknötchen endend. Letz<br />
tere durch schwache Brücken<br />
rippen verbunden.<br />
Sehr feine, leicht konvexe bis<br />
leicht sinusförmige Rippen, bei<br />
ca. 15% Flankenhöhe ohne<br />
jede Dornenbildung mehrfach<br />
gabelnd, vereinigen sich paar<br />
weise in feinen Externknöt<br />
chen, zwischen denen feine<br />
Brückenrippchen übergehen.<br />
in cm<br />
NT 4,6<br />
HT 16<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
34 39 1,13 22 PR<br />
Q<br />
Z<br />
17 PR<br />
56 PR<br />
HT 5,3 30 44 1,2 j 97 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl 3<br />
40; 11<br />
4<br />
27<br />
cl 3b<br />
40; 12<br />
4<br />
27<br />
195<br />
197<br />
(44) PR cl 3<br />
HT 4,0 38 35 1,27 |<br />
(60) SR<br />
40; 13<br />
197<br />
HT 7,2 29 41 (160)PR cl 3<br />
41; 1<br />
197<br />
111
Untergattung Zugokosmoceras BUCKM. 1923; TA Z. zugium BUCKM. 1923. TINTANT vereinigt Z. mit Catasigaloccras und Gulielmites BUCKM., wodurch die Ahgren/un^.<br />
gegen Kosmocerass. str. keineswegs an Problematik verliert und wie folgt lauten konnte: Hochmündiger und etwas engnabligerals Kosmoceras s. str.; Knoten am Innen- und AuKen-<br />
bug vorherrschend, dagegen Flankenknotcn unscheinbar. Makroconche Formen ohne Ohren mit oft skulpturloser Alterswohnkammer.<br />
An Sutut bei h =<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Skulptur d<br />
K. (Z.) Jason (REINECKE<br />
1-818), dn: Jason, Gestalt der<br />
gr. Mythologie.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen;<br />
NT gemäß BRINKMANN<br />
1929b (in BUCKM. 1924,<br />
Taf. 503) widerspricht den<br />
Nomenklaturregein (anderes<br />
Fundgebiet).<br />
In niedrigen, radial gedehnten<br />
A N HT 2,7<br />
Knötchen am kantigen Innenbug<br />
beginnen schwache, radiale<br />
/ \ Primarrippen, bei ca. 35%<br />
(NT) 2,4<br />
U<br />
Flankenhöhe in undeutlichen<br />
Knötchen zu dichten, leicht<br />
sinusförmigen Sekundärrippen<br />
4<br />
spaltend. Am Außenbug pro<br />
Sekundärrippe 1 Knötchen,<br />
durch schwache Externrippe<br />
7<br />
mit dem Knötchen der Gegen<br />
(26)<br />
29<br />
26<br />
24<br />
(48)<br />
44<br />
46<br />
46<br />
(28) I'R cl 2a<br />
(1,9) 1 1 (57) SR<br />
41; 2<br />
r 23 PR<br />
65 SR 77<br />
i<br />
35<br />
28 PR 37<br />
90 SR 246<br />
2S0<br />
22 PR<br />
n | 0 SR<br />
Sehr variable, im Alter (d bis<br />
15) glatte Art.<br />
seite geradlinig verbunden. Im<br />
Alter nur noch weitständige<br />
Buckel am Innenbug mit pro<br />
10 27 40<br />
20 PR<br />
27Ö j 0 SR<br />
K. (Z.) obduetum BUCKM.<br />
1925 ist erst im Alter durch<br />
beständigere Skulptur im<br />
versen Primärrippen; Sekundärrippen<br />
erlöschen zunächst im<br />
Bereich Flankenmitte, dann<br />
12 38 34<br />
20 PR<br />
175 1 0 SR<br />
Ventralbereich unterscheid<br />
völlig.<br />
bar.<br />
K. (Z.) pollucinum TEIS<br />
SEYRE 1884.<br />
LT (nach BRINKMANN<br />
1929b) ist Fig. 30, Taf. 5 in<br />
TEISSEYRE 1884; Orig. im<br />
Paläont. Inst. Wien.<br />
30 mm<br />
2,4 cm<br />
/ \<br />
6 cm<br />
Innenwindungen mit groben,<br />
weitständigen, radialen Primär<br />
rippen, die an der Naht an<br />
knotigen Erhöhungen enden.<br />
Außenwindung mit unregelmä<br />
ßigen, leicht geschwungenen<br />
Sekundärrippen, jede dritte in<br />
einem Knötchen bei 40% Flan<br />
kenhöhe entspringend; jede<br />
zweite in einem Knötchen am<br />
Außenbug endend, dazwischen<br />
Hegende erlöschen bei ca. 80%<br />
Flankenhöhe. Primärrippen auf<br />
Außenwindung verschwunden,<br />
dafür weitständige Knoten am<br />
Innenbug. Gerade, externe<br />
Brückenrippen.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
LT (6,2) 28 (45) 1,44 (100)SR cl 2b<br />
Untergattung Gulidmkeras BUCKM. 1921 (= Anakosmoceras BRINKMANN 1929); TA Am. gidielmü SOW. 1821. Mikroconche, hochmündige Gehäuse mit feinen Rippen und<br />
meist 3 Reihen dichter Knötchen. Ohren am Altersmundsaum.<br />
K. fC.j gulielmü (SOW.<br />
1821), dn: s. Untergattung.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im BMNH.<br />
Vom jugendlichen K. (Z.)<br />
Jason nur durch etwas größe<br />
res N und stärkere Flanken<br />
dornen unterscheidbar.<br />
112<br />
12 mm 5 cm<br />
Leicht proradiate bis radiale<br />
Primarrippen entspringen<br />
scharfen Verdickungen am<br />
Innenbug und tragen Dornen<br />
bei 40% Hankenhöhe. Dort<br />
entspringen gabelnd oder ein<br />
geschaltet mit TZ = 2,5 (d =<br />
3) bis TZ = 4 (d = 6) sinusför<br />
mige Sekundärrippen, die in je<br />
einem Externknötchen enden.<br />
Letztere durch schwache Brük-<br />
kenrippen ventral verbunden.<br />
HT<br />
3,5 34<br />
36<br />
30<br />
3T<br />
41<br />
40<br />
40<br />
38<br />
1,87<br />
1,81<br />
1,6<br />
1,8<br />
26 PR<br />
90 SR<br />
26 PR<br />
65 SR<br />
41; 3<br />
27<br />
85<br />
162<br />
276
Art Sutur bei h =<br />
K. (G.) complanatum TIN<br />
TANT 1963, dn: lat. compla-<br />
natus = geebnet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst.<br />
Dijon (Frankreich).<br />
= Am. Jason QU. 1887, Taf.<br />
83, Fig. 17<br />
Von gulielmii durch früh<br />
erlöschende Flankenknoten,<br />
kleineres N und wenig grö<br />
ßeres Q, voffujüngen Jason<br />
dagegen kaum unterscheid<br />
bar. <br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
16 mm 6 cm<br />
Skulptur d<br />
Skulptur gleicht im wesentli<br />
chen der von gulielmii, Flan<br />
kenknoten erlöschen jedoch<br />
bereits bei d » 2 völlig.<br />
in cm<br />
J4,2<br />
H T<br />
l<br />
16,0<br />
24<br />
26,5<br />
25<br />
28<br />
45<br />
42<br />
42<br />
2,1<br />
2,3<br />
2~2<br />
24 PR cl 2b<br />
110 SR<br />
22 PR 41; 5<br />
100 SR<br />
197<br />
(20) PR 246<br />
Untergattung Spinikosmoceras BUCKM. 1924; dn: lat. Spina = Dorn, Kosmoceras s. Gattung; TA Spinikosmoceras acutistriatum BUCKM. 1924. Mikroconche Gehäuse mit weit<br />
ständiger Berippung, kräftigen Flanken- und Externknoten und teilweise weniger kräftigen Knoten am Innenbug. Ausgeprägte Ohren am Altetsmundsaum.<br />
K. (Sp.) castor (REINECKE<br />
1818), dn: Kastor = Zwil<br />
lingssohn <strong>des</strong> Zeus.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen;<br />
NT gemäß BRINKMANN<br />
1929b widerspricht den<br />
Nomenklaturregeln.<br />
K. (Sp.) castor fasciculatum<br />
TINTANT 1963 trägt stel<br />
lenweise fibulate Sekundär<br />
rippen.<br />
K. (Sp.) pollux (REINECKE<br />
ISIS), dn: Pollux = Zwil<br />
lingssohn <strong>des</strong> Zeus.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen;<br />
NT gemäß BRINKMANN<br />
1929b widerspricht den<br />
Nomenklaturregeln.<br />
= Am. omatus QU. 188",<br />
Taf. 84, Fig. 19 u. 20<br />
Von castor durch kleineres Q<br />
und Z, anderen Querschnitt<br />
und dominierende Beknotung<br />
geschieden.<br />
K. (Sp.) ornatum (SCHL.<br />
1820), dn: lat. ornatus =<br />
geschmückt.<br />
1 L bestimmt und erstmals<br />
•ihgebildet durch BRINK<br />
MANN 1929b; Orig. i m<br />
Zentralen Geol. Inst, der<br />
"DR. Berlin (?).<br />
V>n pollux durch paarweise<br />
an den Externknoten verbun<br />
dene Sekundärrippen geschie<br />
den (von TINTANT als UA<br />
pollux eingestuft).<br />
13 mm 1,8 cm<br />
ca. 13 i 2,2 cm<br />
1.5 cm<br />
Leicht konkave, am Innenbug<br />
verdickte Primärrippen münden<br />
geschwächt an der Stelle maxi<br />
maler Windungsbreite in Flan<br />
kendornen. Kräftigere, retro<br />
konkave Sekundärrippen, meist<br />
zwäschengeschaltet, seltener<br />
gabelnd, enden, nach außen<br />
erhöht, einzeln in je einem<br />
Externdorn. Externseite fast<br />
glatt, nur im Alter von Brük-<br />
kenrippen gequert. Ohren am<br />
Altersmundsaum ca. 20 mm<br />
lang.<br />
Primärrippen zu radial ausgezo<br />
genen Knötchen am Innenbug<br />
entartet, die, stark abge<br />
schwächt, kräftige Hohldotnen<br />
auf Flankenmitte nicht immer<br />
erreichen. Dort Beginn niedri<br />
ger, retroverser Sekundärrip<br />
pen, in kräftigen, meist azimu<br />
tal gedehnten Hohldomen am<br />
Außenbug gipfelnd, die oft<br />
wechselständig und durch<br />
schwache Zickzack-Brückenrip<br />
pen verbunden sind. Ohrlänge<br />
bis zu 0.7 d.<br />
Im Gegensatz zu pollux gehen<br />
sehr schwache, retroverse<br />
Sekundärrippen von den auf<br />
3/5 Flankenhöhe stehenden<br />
Dornen aus oder sind zwi<br />
schengeschaltet und vereinigen<br />
sich paarweise (fibulat) in den<br />
kräftigen Externdomen,<br />
wodurch manchmal auch Zick-<br />
zackberippung auf der äußeren<br />
Flankenhäifte entsteht. Ohr<br />
länge bis zu 0,8 d.<br />
HT 2,0 (34)<br />
33<br />
33<br />
HT 2,1 (36)<br />
36<br />
32<br />
LT 1.5 36<br />
36<br />
34~5<br />
(37)<br />
41 1,2<br />
(43)<br />
37<br />
40<br />
40<br />
37<br />
383<br />
1,5<br />
(1,2)<br />
1,2<br />
0,9<br />
0,94<br />
(58) SR<br />
(20) PR<br />
(76) SR<br />
14 PR<br />
(28) SR •<br />
17 PR<br />
38 SR<br />
16 PR<br />
29 SR<br />
12 PR<br />
)17) SR-<br />
TJ PR<br />
20 SR<br />
14 PR<br />
14 SR<br />
12 PR<br />
(20) SR •<br />
13 PR<br />
(18) SR<br />
113
Quer Zone<br />
An Sutur bei h = schnitt<br />
Skulptur d N H Q z Tat'.<br />
bei d =<br />
in cm in % in %<br />
La.<br />
K. (Sp.) aculeatum (EICH Radiale bis leicht proverse, am TJ PR<br />
2 cl 3<br />
32 41 ü l 42 SR<br />
WALD 1830), dn: lat. acu- Innenbug verdickte Primärrip<br />
leus = Stachel. pen enden in kräftigen Han 41; 9<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (Königsberg)<br />
scheint verschollen; zum NT<br />
kendomen. Ab d = 0,7 beginnt<br />
die Bündelung der Sekundärnppen<br />
in den Flankendomen,<br />
4 33 4T<br />
IT PR<br />
68 SR 26<br />
T7I j 27<br />
s. TINTANT 1963, S. 401. die TZ = 4-5 erreicht. Die<br />
besonders zuletzt auffallend<br />
= Am. omatus QU. 1887, retroradiaten Sekundärrippen<br />
Taf. 84, Fig. 26. münden meist paarweise in<br />
Externdomen beidseitig eines<br />
Gegenüber vorstehenden leicht konkav vertieften, glatten<br />
Arten durch mehrfache Rip Medianban<strong>des</strong>. Sekundärrippen<br />
penbündelung in den Knoten gelegentlich im Zickzack zwi<br />
geschieden. schen Hanken- und Externdor-<br />
K. (Sp.) trartsitionis NIKI TIN<br />
1881, dn: lat. transitio =<br />
hinübergehen. 1 )<br />
Gegenüber aculeatum zusätz<br />
nen gespannt.<br />
Die Abb. <strong>des</strong> HT zeigt auf den<br />
34 PR cl 3<br />
r\ HT 4,2 33 40 u |<br />
Innenwindungen feine Radial 1 (80) SR<br />
rippchen, die sporadisch an der 41; 10<br />
1 / Naht rund beknotet sind. Von<br />
V s—^ J<br />
N/~\y<br />
den häufiger werdenden Kno 27<br />
lich Bündelung der Primarrip ten, zuletzt bei ca. 50% Han 141<br />
pen.<br />
Cardioceratidae SIEMIRADZKI 1891<br />
4 cm<br />
kenhöhe, gehen zunächst meh<br />
rere, dann je 2 Spaltäste aus,<br />
die sich in wechselständigen<br />
Externknötchen fibulat vereini<br />
gen. Die auf der Außenwin<br />
dung sinusförmigen Primärrip<br />
pen sind am Innenbug über<br />
Jüngste Familie der Stephanocerataceae von verschiedenartigster Form wie cadicon, planulat oder oxycon, verbunden durch die den Venter provers querenden, meist gespaltenen<br />
Rippen. Der den Stephanocerataceae eigene Umbilikallobus U„ scheint auch bei den Cardioceratidae noch durchweg aufzutreten. Auf eine Unterteilung in Subfamilien wird hier ver<br />
zichtet (vergl. MELEDINA 1981 und SCHINDEWOLF 1965, S. 191). Oberes Bathonium bis Kimmeridgmm.<br />
Cadoceras HSCHER 1882; dn: lat. cadus = Weinkrug, gr. ceras = Horn; TA Am. sublaevis SOW. 1814. Cadicone Gehäuse mit Spaltrippen, die im Alter erlöschen und teilweise<br />
beknotet sind. Im Untersuchungsgebiet nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Zur problematischen Ähnlichkeit der älteren Gattung Tulites s. dort. Callovium.<br />
C. sublaeve (SOW. 1814), dn:<br />
lat. laevis = glatt, sub =<br />
untergeordnet.<br />
Als Richtmaß gilt häufig der<br />
«Chorotyp» in BUCKM.<br />
1922, Taf. 275.<br />
C. elatmae NTKITIN 1878,<br />
dn: Fundon Elatma in der<br />
UdSSR.<br />
= Am. sublaevis QU. 1887,<br />
Taf. 79, Fig. 3 (?).<br />
Weitnabliger als sublaeve und<br />
von anderem Querschnitt.<br />
114<br />
W<br />
6,5 cm<br />
Chamoussetia R. DOUVILLE 1912; dn: M. Chamousset, franz. Geologe; TA Am. chamusseti D'ORB. 1846. Engnablige, eigentümlich dickbäuchige Formen mit zugeschärfter<br />
Externseite, die von proversen Rippenausläufern kreneliert ist. Die Flankenberippung ist im Alter erloschen. Callovium.<br />
Ch. chamusseti (D'ORB.<br />
1846), dn: s. Gattung.<br />
= Am. chamousseti QU.<br />
1887, Taf. 90, Fig. 18.<br />
Art Sutur bei h =<br />
Ch. crobyloi<strong>des</strong> (QU. 1887),<br />
dn: gr. krobyios = Haarge<br />
\ flecht.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (verdrückt) im<br />
IGPT.<br />
Durch andere Skulptur und<br />
andere Sutur von chamusseti<br />
geschieden.<br />
ca. 50 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
A<br />
' A<br />
' ' " 0<br />
'• '• < /'<br />
11 cm<br />
Der<br />
A 3<br />
8 cm<br />
Skulptur d<br />
Ab d == 4 scheinen die Hanken<br />
schon weitgehend glatt zu sein;<br />
nur am sehr schmalen, aber<br />
gerundetem Venter verbleiben<br />
stark proradiate bis prokon<br />
vexe Rippen, die auf dem Kiel<br />
am kräftigsten sind. Ein<br />
Jugendexemplar (DOUVILLE<br />
1912) zeigt konvexe, feine Rip<br />
pen, die besonders im äußeren<br />
Flankendrittel stark vorschwin<br />
gen.<br />
Der HT (Phragmocon und<br />
Ansatz der Wohnkammer)<br />
zeigt glatte Flanken und, bei<br />
Schalenerhaltung, einen wulstig<br />
krenelierten, komprimierten<br />
Kiel. Seine knotenartigen Rip<br />
penausläufer beginnen erst im<br />
äußeren Fünftel der Flanke.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
HT10,0 12 53 1,06 (72) cl<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
6,6 13 49 1,12 76 SR 41; 13<br />
HT 8,2 6 56 1,35 40 SR cl<br />
Quenstedtoceras HYATT 1877; dn: F. A. QUENSTEDT, Geologe in Tübingen, 1809-1889; TA Am. leachiSOW. 1819. Eng bis mittelweit genabelte Formen mit hochovalem, gerun-<br />
det-fastigatem oder lanzettlichem Querschnitt, mit sinusförmigen oder konkaven Spaltrippen ohne abgesetzten Kiel. CALLOMON deutete 1962 Quenstedtoceras s. str. als mikro-<br />
und Lamberticeras als makroconche Untergattung, wies aber 1981 auf gewisse Schwierigkeiten dieser Deutung hin. Auf eine derartige Gliederung wird hier verzichtet (vergl.<br />
GYGI u. MARCHAND). Ober-Callovium.<br />
Qu. intermissum BUCKM.<br />
1922, dn: lat. intermissio =<br />
Unterbrechung.<br />
-- Am. lamberti macer QU.<br />
1887, Taf. 90, Fig. 21 (breit<br />
mündige Varietät).<br />
Kleinwüchsige, variable An.<br />
Von GYGI u. MARCHAND<br />
1962 als Sexualpartner von<br />
u<br />
Qu. lamberti eingestuft.<br />
Qu. lamberti (SOW. 1819),<br />
dn: A. B. LAMBERT, Zeitge<br />
r\ nosse SOWERBYs.<br />
= Am. flexicostatus PHILLIPS<br />
1835, = Qu. postflexicosta-<br />
QU. henna 'DOUVILLE<br />
1932,<br />
An Sutur bei h =<br />
= Am. lamberti macer QU.<br />
1S87, Tat. 90. Fig. 20.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch gerundeten Venter<br />
geschieden.<br />
Qu. leachi 'SOW. 1819), dn:<br />
Dr. W. E. LEACH, Zeitge<br />
o nosse SOWERBYs.<br />
HT ist ein Jugendexemplar<br />
mit d = 2,4; Ong. verschol<br />
len; NT in ARKELL 1940,<br />
Taf. 10, Fig. 5.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch anderen Querschnitt<br />
und Sichelrippen geschieden.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Skulptur d<br />
Zwischen den bis Flankenmitte r\ leicht proradiat verlaufenden<br />
und dann vorschwingenden<br />
/ \<br />
3,7 cm<br />
Die<br />
N^"-\/<br />
3 cm<br />
Hauptrippen sind ab Flankcn-<br />
mitte je eine, manchmal auch 2<br />
Kurzrippen eingeschaltet. Alle<br />
queren in recht-bis stumpf<br />
winkligem Bogen den gerunde<br />
ten Venter.<br />
Die deutlich proradiaten Pri<br />
marrippen biegen in ihrem<br />
ßifurkationspunkt nach hinten<br />
in meist 2 retrokonkave Spalt<br />
äste, so daß sichelförmige<br />
Gesamtrippen entstehen, die in<br />
der Medianebene unter sehr<br />
stumpfem Winkel übergehen.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q z<br />
4,1 27 45 » 1<br />
31 PR<br />
64 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl 3b<br />
5,0 29 43 1.4<br />
42; 3<br />
i<br />
35 PR<br />
|<br />
63 SR 4<br />
82<br />
116<br />
.9-<br />
NT 3,0 36 39 0,98 31 PR cl 3b<br />
Goliatbiceras BUCKM. 1919 [=Goliathites ARKELL 1943); dn: Goliath, Riese der bibl. Geschichte; TA Am. ammonoi<strong>des</strong> YOUNG u. BIRD 1828. Engnablige, breitmündige For<br />
men mit halbkreisförmigem Querschnitt bei manchmal fastigatem Venter, mit feinen Spaltrippen, die meist nur noch in der Jugend den medianen, konvexen Bogen besitzen und oft<br />
im Alter erlöschen. Oberstes Callovium bis Oxfordium.<br />
G. goliathus fD'ORB. 1848),<br />
dn: Goliath = biblischer<br />
Riese.<br />
= Am lamberti inflatus QU.<br />
18S7, Taf. 90, Fig. 17 (?)<br />
G.f «pingue» (QU. 1887), dn:<br />
lat. pinguis = dick.<br />
Artname präokkupiert.<br />
Windungsquerschnitt schmäler<br />
als der von goliathus.<br />
116<br />
10 cm<br />
( )<br />
5 cm<br />
Aus konvexen, kurzen Rippen<br />
stielen, am Innenbug leicht<br />
erhöht, entspringen 2 oder 3<br />
leicht retrokonkave Sekundär<br />
rippen, die extern wiederum<br />
einen schwach konvexen<br />
Bogen bilden, <strong>des</strong>sen Krüm<br />
mung im Alter abnimmt.<br />
Durch Schaltrippen entsteht<br />
TZ » 3.<br />
Leicht proradiate Primärrippen,<br />
am Innenbug knotig verdickt,<br />
knicken auf Flankenmitte zu<br />
Sichelbögen nach hinten, durch<br />
Schaltrippen vermehrt. Extern<br />
konvexe Rippenbögen, Venter<br />
gerunder.<br />
HT 8,2 (21) (47) (0,6) |<br />
17 PR<br />
54 SR<br />
22 PR<br />
6,8 29 42 0,68 |<br />
62 SR 8<br />
4,9 25.2 45,4 0,90<br />
18 PR<br />
42; 4<br />
4<br />
286<br />
cl 3b<br />
42; 5<br />
74<br />
197<br />
cl 3b<br />
l 40 SR<br />
42; 6<br />
197
P e r i s p h i n c t a c e a e<br />
STEINMANN 1890, sensu SCHINDEWOLF 1966 und HAHN 1971<br />
Platycone bis coronate, sowie ; cadicone i und sphärocone Formen mit vorwiegend ununterbrochen den Venter querenden Spaltrippen. Gemeinsames Merkmal ist das Fehlen <strong>des</strong> (die<br />
Stephanocerataceae auszeichnenden) Umbilikallobus U n und das Vorherrschen eines frühontogenetisch zweigeteilten Umbilikallobus Ui. Mittleres Bajocium bis Kreide.<br />
Perisphinctidae STEINMANN 1890<br />
Vorwiegend platycone Gehäuse mit Spaltrippen, die im Alter erlöschen können, teilweise leicht beknotet, teilweise mit ventraler Rippenunterbrechung. Als vorläufige Arbeitsgrund<br />
lage für eine systematische Gliederung wird hier das System von MANGOLD 1970, S. 219 angewandt.<br />
Leptosphinctinae ARKELL 1950<br />
Perisphincten <strong>des</strong> Ober-Bajociums mit durchweg ausgeprägtem Dimorphismus (näheres bei GALACZ 1980).<br />
Leptosphinctes BUCKM. 1920 {— Ktibanoceras KACHADZE 1955j; dn: gr. leptos — dünn, sphingo = einschnüren; TA Leptosphinctes leptus BUCKM. 1920. Evolute Perisphincten<br />
mit breitelliptischem Innenwindungs-'und hochelliptischem bis runden Außenwindungsquerschnitt. Die meist bifurkaten Rippen sind im Spaltpunkt manchmal durch Knötchen<br />
markiert und oft extern bis zur Unterbrechung geschwächt. Sporadische Einschnürungen auf den Außenwindungen bei vielen Arten. Die sehr ähnlichen Vermisphincten besitzen<br />
selbst im Alter keine externe Rippenunterbrechung und haben «krhochelliptisehen Altersquerschnitt. Bigotites unterscheidet sich (ebenso wie der den Stephanocerataceae angehö<br />
rende Caumontisphinctes) durch extern stumpfwinklig gegenüberstehende und meist alternierende Rippenenden. Mittleres und oberes Bajocium.<br />
Untergattung Leptosphinctes s. Str.; makroconche Leptosphincten mit glattem, proversem Altersmundsaum nach einer Einschnürung.<br />
Art Sutur bei h :<br />
L. (L.) leptus BUCKM. 1920,<br />
dn: s. Gattung.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Sur-<br />
vey-Mu5eum London.<br />
Die schwäbischen Exemplare<br />
zeigen gegenüber dem HT<br />
etwas kleineres Z und etwas<br />
größeres Q.<br />
L. (L.) davidsom BUCKM.<br />
1881.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Manche<br />
ster-Museum, England.<br />
Großwüchsig und von leptus<br />
durch größeres Q und frühe<br />
res Erlöschen der Skulptur<br />
geschieden.<br />
L. (L.) festonensis PAVIA<br />
1973, dn: Ravin de Feston<br />
bei Digne. Frankreich.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im geol. Inst,<br />
der Universität Turin.<br />
Ähnlich davidsom, aber von<br />
noch größerem Q und mit<br />
deutlichen Einschnürungen.<br />
7..; schmieren (BENTZ<br />
1924 . dn: Prof. Th.<br />
SCHMIERER, württ. Samm-<br />
1-T nach DIETL 1980 in<br />
RENTE 1024, Taf. 9, Fig. 7;<br />
°rig. verschollen.<br />
^•>n vorstehenden Arten<br />
durch coronate Innenwindun-<br />
*c"i geschieden. Der sonst<br />
g:e:v:ie L. subenronatus<br />
'"> V<br />
1A 19"3 hat ca. 10%<br />
^•:::cres N.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
ca. 6 cm<br />
14 mm 14 cm<br />
ca. 2ä mm<br />
6 cm<br />
Skulptur d<br />
Radiale bis schwach prokon<br />
kave Flankenrippen bifurkieren<br />
mit wenigen Ausnahmen etwas<br />
oberhalb der Flankenmitte.<br />
Extern schwach konvexe Rip<br />
penbögen, deren Abschwä-<br />
chung mit dem Alter bis zu<br />
breiter Unterbrechung<br />
zunimmt. 1-2 Einschnürungen<br />
pro Windung.<br />
Auf den Innenwindungen stark<br />
prokonkave, zuletzt konkave<br />
Rappen, etwas oberhalb der<br />
Flankenmitte bifurkierend.<br />
Spaltpunkte auf den Innenwin<br />
dungen durch zarte Knötchen<br />
markiert. Abschwächung der<br />
Skulptur ab d ^ 5, bereits vor<br />
her mediane Schwächung der<br />
externen, leicht konvexen Rip<br />
penbögen.<br />
Prokonkave, überwiegend<br />
bifurkierende Rippen mit oft<br />
undeutlichen und unbeknoteten<br />
Spaltpunkten. Skulptur erlöscht<br />
relativ früh, zunächst extern,<br />
danach lateral. 3-4 deutliche<br />
Einschnürungen pro Wändung.<br />
Der sehr ahnliche L. stomphits<br />
BUCKM. besitzt beständigere<br />
Skulptur.<br />
Konkave bis leicht prokonkave<br />
Rippen spalten im äußeren<br />
Flankendnttel vorwiegend in 2.<br />
seltener in > Externrippen.<br />
Durch anfängliche Beknotung<br />
der Spaltpunkte und Überhö<br />
hung der Rippen auf Flanken-<br />
nuttc entstehen coronate<br />
Innenwindungen bis d = 1,5.<br />
Im Alter Rippenschwächung<br />
zunächst extern, dann auch<br />
lateral, manchmal 2-3<br />
schwache Einschnürungen.<br />
in cm<br />
HT<br />
HT<br />
6,8<br />
8,2<br />
14<br />
20<br />
LT 10<br />
47<br />
8,2<br />
12,6<br />
15<br />
46<br />
46<br />
46<br />
44<br />
46<br />
46<br />
52<br />
52<br />
52<br />
50<br />
50<br />
48<br />
28<br />
31<br />
30<br />
32,5<br />
2975<br />
29<br />
25<br />
27<br />
25<br />
29<br />
30<br />
(30;<br />
31<br />
30<br />
29<br />
1,05<br />
(1,2)<br />
1,34<br />
1,33<br />
1,53<br />
1,3<br />
'1,76;<br />
0,9-<br />
1,22<br />
1,1S<br />
1.28<br />
68 PR<br />
55 PR<br />
46 PR<br />
50 PR<br />
53 PR<br />
42 PR<br />
46 PR<br />
(63) PR<br />
3S PR<br />
44 PR<br />
117
L (L.) stcphanoccratoi<strong>des</strong><br />
Art Sutur hei h =<br />
(KACHADZE u. ZESASVILI<br />
1956), dn: ähnlich Stcphanoceras.<br />
Der HT stammt aus Geor<br />
gien, UdSSR.<br />
Durch breitelliptischen<br />
Altersqucrschnitt ausgezeichnet.<br />
L. ultimum<br />
(KACHADZE u. ZESAS-<br />
VILI) hat kreisförmigen<br />
Altersquerschnitt und teil<br />
weise trifurkate Rippen.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
hei d =<br />
o<br />
Prokonkave,<br />
5 cm<br />
Skulptur d<br />
etwas oberhalb<br />
der Flankenmitte bifurkierende<br />
Rippen, bis zu mittleren Win<br />
dungen leicht beknotet, extern<br />
unterbrochen. Innenwindungen<br />
erscheinen coronat. 2-3 Ein<br />
schnürungen pro Windung.<br />
Untergattung Cleistosphinctes ARKELL 1953; TA Leptosphinctes deistus BUCKM. 1920. Mikroconche Leptosphincten mit Mündungsohren. Skulptur im Alter kaum geschwächt,<br />
externe Rippenunterbrechung bei Schalenerhaitung wenig ausgeprägt, Einschnürungen höchstens angedeutet.<br />
L. (Cl.) deistus BUCKM.<br />
1920, dn: gr. cleistos = ver<br />
schließbar.<br />
Sehr ähnlich den Innenwin<br />
dungen von L. (L.) davidsoni.<br />
L. (CL?) perspieuus<br />
(PARONA 1896), dn: lat.<br />
perspieuus = durchsichtig.<br />
LT ist (nach STURANT 19-1)<br />
Fig. 5, Taf. 2 in PARONA<br />
1896.<br />
Ausgezeichnet durch außer<br />
gewöhnlich starke Flanken<br />
wölbung, sehr ähnlich L. leptus.<br />
L. (Cl.) paucicosta<br />
KACHADZE u. ZESASVILI<br />
1956, dn: lat. pauci ~<br />
wenige, costa = Rtppe.<br />
LT ist (nach DIETL 1980}<br />
Fig. 4, Taf. 5 in KACHADZE<br />
u. ZESASVILI 1956.<br />
Ausgezeichnet durch coro<br />
nate Innenwindungen und<br />
ktäftigere Rippen.<br />
118<br />
5,6 cm<br />
4 cm<br />
4,5 cm<br />
Leicht konkave Rippen bi- oder<br />
trifurkieren in Flankenmitte.<br />
Externe Rippenunterbrechung<br />
nicht immer ausgeprägt. Lange<br />
Ohren am Altersmundsaum<br />
schmiegen sich an die Flanken<br />
der vorhergehenden Windung.<br />
Leicht prokonkave Primärrip<br />
pen bi- oder trifurkieren wenig<br />
außerhalb der Flankenmitte.<br />
Sekundärrippen extern abge<br />
schwächt oder unterbrochen.<br />
Drei deutliche Einschnürungen<br />
pro Wändung. Mikroconcher<br />
Charakter nicht völlig gesi<br />
chert.<br />
Die innersten 4 Wändungen<br />
zeigen coronaten Querschnitt,<br />
die mittleren tragen spitze<br />
Knötchen wenig innerhalb <strong>des</strong><br />
Rippenspaltpunktes. Rippen<br />
verlauf der Außenwändungen<br />
insgesamt konkav, vorwiegend<br />
Bifurkation in Flankenmitte.<br />
Extern schmales Venrralband,<br />
große Ohren am Altersmund-<br />
in cm<br />
HT 4,7<br />
5<br />
HT 4,4<br />
3,6<br />
4,1<br />
LT 3,0<br />
4<br />
LT 4,3<br />
3,4<br />
4,4<br />
N<br />
in %<br />
42,5<br />
44<br />
45<br />
48<br />
51,5<br />
46<br />
44<br />
46,5<br />
50<br />
47<br />
H<br />
in %<br />
34<br />
33<br />
33<br />
(34)<br />
27<br />
33<br />
32<br />
28<br />
29,4<br />
Q<br />
0,89<br />
1<br />
(0,96)<br />
1,11<br />
Z<br />
39 PR<br />
41 PR<br />
47 PR<br />
36 PR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
L„.<br />
bj 3a<br />
43; 5<br />
54<br />
137<br />
bj 3a<br />
35 PR 43; 4<br />
(1,2) I (70) SR<br />
0,95<br />
1,03<br />
1,09<br />
1,0<br />
1,20<br />
40 PR<br />
42 PR<br />
31 PR<br />
32 PR<br />
(75) SR<br />
bj 3a<br />
43; 5<br />
54<br />
241<br />
bj 3a<br />
43; 6<br />
54<br />
137
Art Sutur bei h =<br />
L (CL) minor DIETL 1980,<br />
dn: lat. minor = gering, klein<br />
Ong. <strong>des</strong> HT im S.MN'L.<br />
Bisher kleinstwüchsige Art<br />
der Untergattung. L. (Cl.) kil-<br />
lertalensis DIETL 1981 unter<br />
scheidet sich nur durch etwas<br />
höhere Endgröße.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
( )<br />
2,6 cm<br />
Skulptur d<br />
Leicht proradiate Rippen<br />
gabeln etwa in Flankenmitte<br />
meist 2-fach, auf der letzten<br />
Windung vereinzelt Einfachrip<br />
pen. Auf den Innenwindungen<br />
Spaltpunkt durch kleinen Dorn<br />
markiert; extern schmale Rip<br />
penunterbrechung, bei Schalen<br />
erhaltung weniger deutlich.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
in<br />
H<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
HT 2,6 52 29 1,07 38 PR bj 3a<br />
(32) PR 43; 7<br />
2,3 (53) (24. • (0,85! j<br />
(57) SR<br />
Vermisphinctes BUCKM. 1920; dn: gr. vermes = Wurm, sphingo = einschnüren; TA V. vermiformis BUCKM., = Am. martinsi [irrtümliche Schreibweise: martiusi) D'ORB. 1845,<br />
Taf. 125, Fig. 1 u. 2. Kleine bis große, serpenticone Formen mit proversen Spaltrippen, die den Venter - im Gegensatz zu Bigotites und Leptosphinctes - ununterbrochen queren. Spo<br />
radische, relativ tiefe Einschnürungen; keine Dornen auf den Innenwindungen. Neuerdings werden die mikroconchen Formen unter Vermisphinctes s. str. und die makroconchen<br />
unter der Untergattung Prorsisphinctes BUCKM. 1920 getrennt. Oberes Bajocium.<br />
L. martiusi (SCHMIDTILL<br />
u. KRUMBECK 1931)<br />
Orig. im IGPEN.<br />
Nach GALÄCZ 1980 nicht<br />
identisch mit martinsi<br />
D'ORB.<br />
( )<br />
6 cm<br />
Leicht proverse, konkave Rip<br />
pen spalten etwa auf Flanken<br />
mitte, sind extern zunächst<br />
wenig, später stärker<br />
geschwächt und tendieren zur<br />
Wechselständigkeit, Einzelrip<br />
pen selten, einige Einschnürun<br />
gen nur schwach ausgeprägt.<br />
6,4 47 30<br />
45 PR bj 3c(=)<br />
1,06 1 1 (75) SR<br />
43; 8<br />
Bigotftes NICOLESCO 1917; dn: A. BIGOT, Geologe in Caen,Normandie,geb. 1863;TAB/gote//ap#n'NICOLESCO 1917. Planulate Formen verschiedener Größe mit kreisrun<br />
dem bis hochovalem Querschnitt und kräftiger Berippung, an deren externer Unterbrechung die Rippenenden - im Gegensatz zu Leptosphinctes - alternierend gegenüberstehen. In<br />
der Nahe sporadischer, schwacher Einschnürungen können die externen Rippenenden vorübergehend auch paarig gegenüberstehen (Unterschied zur sehr ähnlichen Gattung Parkin<br />
sonia). Oberes Bajocium.<br />
B. lenki SCHMIDTILL u.<br />
KRUMBECK 1931, dn: H.<br />
LENK, Geologe in Erlangen.<br />
B. tiiberciilatus (NICO-<br />
t-ESCO 1916), dn: lat. tuber-<br />
culatus =- mit Knötchen ver-<br />
' 'H kleinerem Q als lenkt.<br />
4.5 cm<br />
Radiale bis schwach konkave<br />
Primarrippen-bifurkieren wenig<br />
außerhalb der Flankenmitte<br />
ohne Knoten in bedeutend<br />
schwächere Sekundärrippen,<br />
die durch Schaitrippen ver<br />
mehrt sind. Rippenenden alter<br />
nieren stellenweise an der fla<br />
chen, deutlich begrenzten<br />
Externfurche, die im Alter<br />
undeutlich wird. Mittlere Win<br />
dungen mit wenigen flachen,<br />
aber deutlichen Einschnürun-<br />
Auf den Innenwindungen pro<br />
verse. schwach coronate. aut<br />
der letzten Windung <strong>des</strong><br />
vollständig gekammerten HT<br />
dagegen stellenweise sogar<br />
leicht retroradiate Primarrip<br />
pen. die vorwiegend bifurkie<br />
ren. Spaltpunkte beim HT stets<br />
schwach bedornt. An sehr<br />
schmaler Medianrinne stehen<br />
die Rippenenden sehr stumpf<br />
winklig gegenüber.<br />
HT<br />
HT 4,6 :<br />
43<br />
43<br />
55<br />
1,06<br />
1,20 34 PR<br />
33 PR<br />
60 SR<br />
54<br />
6<br />
95<br />
220<br />
b,3<br />
bt 1<br />
43; 9<br />
220<br />
269<br />
bj 3 b<br />
44; 1<br />
95<br />
269<br />
119
ZigZagiceratinae BUCKM. 1920, sensu MANGOLD 19?0 (mcl. Psi-udorHwpr.mclin.u- SCHINDKWOLF 1925 pars)<br />
Abkömmlinge der Leptosphinctinae mit "zickzackartig- skulptierten Innenwindungen, meist mit anschließendem Prabelrippenstadium und oft perishinetoid beripptem Alters-<br />
stadium.<br />
Pbnispbinclcs BUCKM. 1922; dn: bt. planus = eben, gr. sphingo = einschnüren; TA /'/. plamMms BUCKM. 1922. Mikroconche. evolute Formen mit nahezu kteisrundem Quer<br />
schnitt und bifurkierenden oder einzelnen Rippen. Zeitlich zwischen Mgotiles :Ober-B.i|ocium) und Zivz.igicerjs bzw. Simür.idzku (Unter-Bathonium) auftretend, zeigt die "Gat<br />
tung" auch entsprechende Ubergangsmerkmal c wie teilweise Einschnürungen und ventrale Rippen Unterbrechung einerseits als auch Andeutungen der Zick/ack-Benppung anderer<br />
seits. ARKELL 1958 und STEPHANOV 1972 betrachten sie als Untergattung von SiemirMi;kij.<br />
PL tenuissimus (SIEMI-<br />
RADZK1 1898, dn: lat.<br />
tenuissimus = der zarteste.<br />
STURANI 1966 betrachtet<br />
Perisphwctcs perspieuus<br />
DORN 1927, Taf. 7, Fig. 2<br />
Art Sutur bei h =<br />
als artgleich; s. PL incognitus.<br />
PI. gredingensis (DORN<br />
1927), dn: Fundort Greding<br />
in der Fränkischen Alb.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im IGPEN.<br />
Weitnabliger als tenuissimus.<br />
PL? incognitus (STEPHA<br />
NOV 1972), dn: lat. incogni<br />
tus = unbekannt.<br />
HT ist Perisphinctes perspi<br />
euus PARONA in DORN<br />
1927, Taf. 7, Fig. 2; Orig. im<br />
IGPEN.<br />
Durch sehr feine, teilweise<br />
trifurkate Rippen von ande<br />
ren Arten geschieden (Gat<br />
tungszugehörigkeit ungewiß).<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
0<br />
6 cm<br />
Skulptur d<br />
Dichte, feine, schwach prora<br />
diate Rippen bifurkieren bei ca.<br />
60% der Flankenhohe. Primär-<br />
und Sekundärkomponenten<br />
wenig differenziert, letztere<br />
ungeschwächt über den Venter<br />
ziehend.<br />
O<br />
Über einem schmalen, glatten<br />
5 cm<br />
0<br />
6 cm<br />
Über einem schmalen, glatten<br />
Nabelband setzen leicht proradiate<br />
Rippen ein, die auf der<br />
äußeren Flankenhälfte bifurkie<br />
ren oder einzeln bleiben (TZ ~<br />
1,8). Durch externe Rippen<br />
schwächung besonders auf den<br />
Innenwindungen bandartige<br />
Medianfurche, an der die Rip<br />
penenden leicht verdickt sind.<br />
Im Alter werden Furche und<br />
Verdickungen undeutlich. Zwei<br />
Einschnürungen pro Windung.<br />
Sehr feine, proradiate Primär<br />
rippen, im Altersverlauf gröber<br />
und schwächer werdend. Sie<br />
bifurkieren vorwiegend auf<br />
Flankenmitte; selten trifurkie<br />
ren sie, so daß TZ ^ 2,2 wird.<br />
Spaltäste oft isoliert, im Alter<br />
starke Skulpturschwächung,<br />
keine Ventral Unterbrechung.<br />
in cm<br />
N H<br />
in (<br />
M j' in 0,<br />
o<br />
Q<br />
! Zone<br />
Z Taf.<br />
Lit.<br />
HT 4,0 49 30 1,3 54 PR b| 3c<br />
HT|.'?<br />
58 23 0,85<br />
bt la<br />
-14; 2<br />
228<br />
240<br />
47 PR . bt la<br />
44; 3<br />
6<br />
"6<br />
239<br />
55 PR bt la<br />
HT 6,1 45 32 1,1 j 112 SR<br />
Zigzagiceras BUCKM. 1920; dn: zickzackartiger Rippenverlauf; TA Am. zigzag D'ORB. 1846. Evolute Perisphincten, nachstehend gemäß MANGOLD 1970 in die mikroconche<br />
Nominatuntergattung (vergl. GALÄCZ 1980) und die rrukroconche Untergattung Proccrozigz^ig ARKELL gegliedert. Unter-Bathonium.<br />
Untergattung Zigzagiceras s. Str.; mikroconche Formen von rechteckigem, im Wachstumsverlaufsich rundendem Querschnitt mit kräftigen, weitständigen Primärrippen, die in Para<br />
belknoten am Außenbug in 3-4 Sekundärrippen spalten, welche den Venter ohne Unterbrechung konvex queren. Altersskulptur der letzten Windung teilweise stark modifiziert;<br />
Ohren am Altersmundsaum.<br />
Z. (Z.) euryodos (SCHMIDT<br />
1846), dn: gr. eurys = breit,<br />
odos = Weg.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
Z. zigzag (D'ORB.) ist ver<br />
mutlich eine Varietät von<br />
curvados.<br />
120<br />
2,4 i<br />
V - K<br />
(—\ W'citständige. scharfe, konkave 1 2,4 52 30 0,S6<br />
bis retrokonkave Primärrippen<br />
51 30 0,81<br />
{ J<br />
3 cm<br />
enden am Außenbug in gat<br />
1-3,0<br />
tungstypischen, hakenartigen j 3,6 47 31 0,86<br />
Parabelknoten, aus denen je 3-<br />
4 proverse Sekundärrippen ent<br />
springen, die ab d = 3 ebenso<br />
wie die Knoten erlöschen.<br />
14,5<br />
44 33 0,94<br />
44; 4<br />
76<br />
239
Art<br />
Z. (Z.) plenuni ARKELL<br />
1958, dn: lat. plenus = voll,<br />
dick.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Sedgwick-<br />
Museum Cambridge (Eng<br />
land).<br />
Von euryodos durch noch<br />
breitere Windungen geschie<br />
den.<br />
Sutur bei h =<br />
O<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
4 cm<br />
Skulptur d<br />
Skulptur ähnelt weitgehend der<br />
von euryodos. Verbunden mit<br />
etwas höherer Endgröise wird<br />
die Externskulptur erst bei d -=<br />
4 abgeschwächt, beim HT<br />
sogar noch später.<br />
Untergattung Procerozigzag ARKELL 1953; dn: lat. procerus = schlank, Zigzagicerass. o.; TA Stcphanoceras crassizigzagBUCKM. 1S92. Mittelgroße bis großwüchsige Formen mit<br />
dickleibigem Habitus, einfachem Altersmundsaum und erlöschender Altersberippung.<br />
Z. (Pr.) pseudoprocentm<br />
BUCKM. 1892, dn: gr.<br />
pseudo = falsch, procerus<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (leicht ver<br />
drückt) im Geol. Museum<br />
Manchester (England).<br />
\<br />
V<br />
ca. 25 mm 8,8 ,<br />
Primarrippen gleichmaßig weit<br />
ständig, streckenweise variie<br />
rend zwäschen leicht prokon<br />
kav und leicht retrokonkav.<br />
Vorwiegend Bifurkation mit<br />
leichtem Vorwärtsknick auf<br />
Flankenmitte, sporadisch<br />
Schaltrippen. Rippenschwä<br />
chung am HT bis d ^ 12<br />
gering.<br />
in cm<br />
H S<br />
2.6<br />
4<br />
: HT 12<br />
178<br />
N<br />
in %<br />
50<br />
48<br />
4S<br />
46=3<br />
46<br />
31,5<br />
41<br />
H<br />
in %<br />
31<br />
32<br />
35<br />
3 5 ±3<br />
3=<br />
40<br />
34<br />
36<br />
33<br />
Q<br />
0,70<br />
0,76<br />
0,78<br />
Ö777<br />
0772<br />
Z<br />
16 PR<br />
16 PR<br />
18 PR<br />
i 36 PR<br />
0,96 '<br />
96 SR<br />
Procerites SIEMIRADZK1 1898; dn: lat. procerus = schlank; TA Procerites scbloenbachi DE GROSSOUVRE 190 . Vorwiegend evo'ute Formen mit kreisähnlichem Querschnitt der<br />
Anfangswindungen und kurzem «Zickzackrippen"-Stadium, gefolgt von einem vorwiegend bifurkat berippten Stadium. MANGOLD 19"0 betrachtet die Untergattungen Procerites<br />
s. Str. und Siemiradzkia HYATT als Dimorphenpaar. Bathonium.<br />
Untergattung Procerites s. str. (=Gracilispbinctes BUCKM. 1920); sehr großwüchsige Gehäuse mit einfach gewelltem Altersmundsaum. Nach dem. beiden Untergattungen mehr<br />
oder weniger gemeinsamen, bifurkaten Berippungsstadium erscheinen meist trifurkate Rippen mit gleichstarken Primär-und Sekundärkomponenten, von denen die primären im<br />
W'achstumsverlauf früher erlöschen. Alterswohnkammer meist völlig glart.<br />
Pr. (Pr.) laeviplex (QU. 1887),<br />
dn: lat. levis = glatt, plexus<br />
= Geflecht (von Serpein).<br />
LT, gemäß HAHN 1969, ist<br />
Am. laeviplex QU. 1887, Taf.<br />
SO. Fig. 10; Orig. im SMNS.<br />
Artcharakterisrisch sind relativ<br />
involute Innenwindungen.<br />
Pr. (Pr.) stephanovi HAHN<br />
1969, dn: J. STEPHANOV,<br />
bulgarischer Paläontologe,<br />
1912-1966.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Lan-<br />
ces.imt Freiburg 'Br.<br />
^on laeviplex durch kleineres<br />
Q und wenig kleineres N<br />
geschieden.<br />
12 cm<br />
Die am LT ab d = 4 erhaltene<br />
Skulptur zeigt bis d *= 16 erst<br />
proradiate, zuletzt schwach<br />
konkave Primärrippen, die im<br />
Wachstumsveriauf zu flachen,<br />
breiten Erhebungen abge<br />
schwächt werden. Sekundärrip<br />
pen bis d ~ 20 im äußeren<br />
Flankendrittel und extern sicht<br />
bar.<br />
Primarrippen bis d = 1 radial<br />
und weitständig, danach dich<br />
ter und proradiat. Sekundärnp<br />
pen bis d ^ 2 am Spaltpunkt<br />
provers abgeknickt, extern<br />
konvex. Ab d = 4.5 Übergang<br />
zur groben "Proceritesskulptur •<br />
mit 2-4 Sekundärrippen pro<br />
Stiel, deren Spalipunkte immer<br />
undeutlicher werden.<br />
LT 16.5<br />
25.4<br />
39:<br />
16 ;<br />
[11.5.<br />
41<br />
45<br />
16.2 34<br />
HT<br />
36<br />
36<br />
32<br />
32<br />
32<br />
37,5<br />
35<br />
34<br />
39<br />
34<br />
40<br />
0,8<br />
1,0<br />
0,94<br />
1,28<br />
1,33<br />
T7T7<br />
1,25<br />
1,36<br />
1,08<br />
1,16<br />
1,21<br />
0,94<br />
TToT<br />
30 PR<br />
1,11 2" PR<br />
1,14<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bt la<br />
44; 6<br />
6<br />
111<br />
bt la<br />
44; 7<br />
6<br />
95<br />
115<br />
121
Pr. [Pr.) qucramts (TER-<br />
Art Sutur bei h =<br />
QUEM u. JOURDY 1869),<br />
dn: kit. querceus = Eichen<br />
kranz.<br />
LT ist, gemäß ARKELL<br />
195S. Fig. 10, Taf. 1 in TER-<br />
QUEM u. JOURDY 1S69;<br />
Orig. verschollen.<br />
Form ähnlich laeviplex, aber<br />
feiner und weniger beständig<br />
berippt.<br />
Pr. (Pr.) imitator (BUCKM.<br />
1922), dn: lat. imitator =<br />
Nachahmer.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Survey-Museum London.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch breiteren Querschnitt<br />
und kräftige Jugendskulptur<br />
geschieden.<br />
Pr. (Pr.) inhabilis ARKELL<br />
1958, dn: lat. mirabilis =<br />
wunderbar, sonderbar.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Sedgwick-<br />
Museum Cambridge (Eng<br />
land).<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch größeres Q, flache<br />
Skulptur und Einschnürungen<br />
geschieden.<br />
Pr. (Pr.) hodsoni ARKELL<br />
1958, dn: F. HODSON, engl.<br />
Geologe.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Univ. Reading (England).<br />
Von allen anderen Arten<br />
durch dichte, spät erlö<br />
schende Altersberippung<br />
geschieden.<br />
122<br />
0 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
19 cm<br />
27 cm<br />
23 cm<br />
29 cm<br />
Bis d Ä<br />
Skulptur d<br />
4 feine, dichte, prora<br />
diate Primarrippen, die danach<br />
gröber und weitständig werden<br />
und spätestens bei d = 1 5 ver<br />
schwinden. Sekundärnppen bei<br />
streifendem Licht noch bis d =<br />
20 wahrnehmbar.<br />
Schwach konkave bis leicht<br />
retroradiate, bis d = 15 an<br />
Wagnericeras erinnernde, kräf<br />
tige Rippenstiele bifurkieren<br />
vorwiegend. Schaltrippen ver<br />
mehren die ohne Unterbre<br />
chung den Venter querenden<br />
Sekundärrippen, die, später als<br />
die Stiele, bei d Ä<br />
sind.<br />
25 erloschen<br />
Bei d ~ 10 dichte, feine, leicht<br />
proradiate Primärrippen, die im<br />
Wachstumsverlauf proverser,<br />
flacher und breiter werden.<br />
Durch 3-4 Einschnürungen pro<br />
Windung wärkt die Skulptur<br />
unregelmäßig. Primärrippen<br />
erloschen bei d 13, Sekun<br />
därrippen bei d = 20.<br />
Dichte, radiale bis leicht pro<br />
konkave Rippen, die bei 50-<br />
70% Flankcnhöhe bi- oder tri<br />
furkieren und den Venter<br />
gerade queren. Berippungs-<br />
srärke <strong>des</strong> HT bei d = 20 noch<br />
unvermindert.<br />
in cm<br />
LT<br />
3<br />
10<br />
18,4<br />
28.1<br />
10<br />
14<br />
19,4<br />
HT17.2<br />
9<br />
12,1<br />
17<br />
14,1<br />
16,6<br />
28,7<br />
HT 36<br />
34,2<br />
12,5<br />
27,3<br />
30,6<br />
57<br />
HT 15<br />
7<br />
22,3<br />
29<br />
21<br />
28<br />
33,2<br />
N<br />
in %<br />
40<br />
41<br />
34<br />
39<br />
37<br />
34<br />
37<br />
38<br />
41<br />
39<br />
43<br />
41<br />
47<br />
30<br />
34<br />
32<br />
35<br />
H<br />
in %<br />
39<br />
39<br />
40<br />
36<br />
36<br />
34<br />
30<br />
33<br />
32<br />
35<br />
31<br />
30<br />
(37)<br />
40<br />
38<br />
38<br />
36<br />
1.21<br />
1.32<br />
0,86<br />
0,98<br />
1,08<br />
1,06<br />
1,13<br />
1,52<br />
1,52<br />
1,48<br />
1,48<br />
1,52<br />
1,52<br />
1,64<br />
Z.m,<br />
JTai.<br />
Ln.<br />
59 PR ! bt la<br />
33 PR ! bis<br />
bt 5.,<br />
53 PR 45; 1<br />
53 PR ;<br />
29 PR<br />
25 PR<br />
' 6<br />
;<br />
111<br />
155<br />
bt la<br />
bt 2a<br />
27 PR 45; 2<br />
29 PR<br />
31 PR<br />
(85) SR<br />
45 PR<br />
31 PR<br />
47 PR<br />
47 PR<br />
51 PR<br />
116 SR<br />
51 I'R<br />
39 PR<br />
61 PR<br />
6<br />
36<br />
61<br />
111
Art<br />
Pr. (Pr.) eichbergensis HAHN<br />
1969, dn: Fundort am Eich<br />
berg bei Blumberg/Baden.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Lan<br />
<strong>des</strong>amt Freiburg'Br.<br />
Von noch geringerer Nabel<br />
weite als bodsoni und von<br />
früh erlöschender Skulptur.<br />
Pr. (Pr.) siibprocerits<br />
(BUCKM. 1892), dn: lat.<br />
sub- = untergeordnet, proce<br />
rus = schlank.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Manche<br />
ster-Museum (England).<br />
Häufigste Art der Zigzag-<br />
Zone Englands, in Süd<br />
deutschland anscheinend sehr<br />
selten.<br />
Sutur bei h :<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d —<br />
30 cm<br />
15 cm<br />
Skulptur<br />
Bis d 14 schwach proverse,<br />
anfangs kräftige Primärrippen<br />
von konstanter Dichte, die bei<br />
d = 18 nahezu erloschen sind.<br />
Sekundärrippen bei streitendem<br />
Licht noch bis d ~ 20 erkenn<br />
bar.<br />
Regelmäßige, schwach konkave<br />
Rippen bi- oder trifurkieren auf<br />
Flankenmitte und ziehen<br />
gerade über den Venter. Skulp<br />
turschwächung setzt bei d ^ 8,<br />
zuerst an den Spaltpunkten ein,<br />
dann von außen her an den<br />
Primärrippen. Bei d ^ 20 sind<br />
die Flanken glatt; Restskulptur<br />
am Außenbug.<br />
4,5<br />
17,5<br />
HT<br />
24,1<br />
HT<br />
4<br />
13,1<br />
16,9<br />
30,"<br />
8<br />
14<br />
20<br />
10<br />
30<br />
2"<br />
29<br />
31.5<br />
32.5<br />
30<br />
36<br />
H<br />
in %<br />
41<br />
38<br />
43<br />
42<br />
40<br />
41<br />
42<br />
39<br />
36<br />
1,41<br />
1,52<br />
1,19<br />
1,40<br />
1,13 j<br />
29 PR<br />
27 PR<br />
31 PR<br />
25 PR<br />
1,22 | 44 PR<br />
Untergattung Siemtradzkia HYATT 1900 (= Pbaidozigz.ig BUCKM. 1926); dn: J. v. SIEMIRADZK1, 1858-1933. Paläontologe in Lemberg; TA Am. aungerus OPP. 1857. Micro-<br />
conche Gehäuse mit Ohren am Altersmundsaum. Altersberippung vorwiegend bifurkar mit sporadischen Einzel- und Schaltrippen; seltener sind bis zur Wohnkammer beständige<br />
Parabelknoten. Die ähnliche Untergattung Homoeophmilites (Ober-Bathonium) unterscheidet sich durch völlig fehlende Parabelknoten.<br />
Pr. (S.) aurigem (OPP. 185"),<br />
dn: lat. auriger = goldtra<br />
gend.<br />
LT ist, gemäß ARKELL<br />
1958, Am. bakeriae D'ORB.<br />
1847, Taf. 149, Fig. 1; Orig.<br />
verschollen; NT, aufgestellt<br />
von ARKELL 1959, ist Grossouvreia<br />
aurigera DE GROS-<br />
SOUVRE 1919, Taf. 15, Fig.<br />
6; Orig. nicht auffindbar.<br />
Pr (S.) maüsconensis (LISSA-<br />
JOUS 1923), dn: Matisco,<br />
alter Name für Mäcon, Süd-<br />
trankreich.<br />
LT ist Fig. 3, Taf. 5 in LIS-<br />
S MOUS 1923; Orig. im<br />
Geol. Institut Lyon.<br />
:!'.:.-ch höhere TZ im Alter<br />
'CK! unregelmäßigere Skulp-<br />
•'.:r \on aungera geschieden.<br />
7,6 cm<br />
Typische «Zickzackskulptur'<br />
bis d = 0,5, danach leicht pro<br />
verse, bifurkate Rippen, von<br />
denen jede dritte ungespalten<br />
bleibt; nach 3-10 Rippen eine<br />
Parabelrippe eingeschaltet.<br />
Sekundärrippen am Spaltpunkt<br />
provers abknickend, extern<br />
konvexe Bogen bildend. Auf<br />
der Alterswohnkammer sinkt<br />
TZ auf etwa 1,5; die Parabeln<br />
nehmen ab. Gegenüber folgen<br />
den Arten relativ lange Ohren.<br />
Dichte, schwach sinusförmige<br />
Rippen, meist etwas provers,<br />
besonders auf der vorletzten<br />
Halbwändung unregelmäßig.<br />
Vor der letzten Halbwindung<br />
dominieren bifurkate und<br />
einige Einzelrippen, während<br />
zuletzt durch einige trifurkate<br />
und Reduktion der einzelnen<br />
TZ auf ca. 2.3 steigt. Alle Rip<br />
pen extern unterbrochen, kurze<br />
Ohren am Altersmundsaum.<br />
|5,3<br />
NT<br />
16,3<br />
2,9<br />
1 3.6<br />
LTP'? 1<br />
I 6,j<br />
16.2<br />
8,4<br />
43<br />
43<br />
4S<br />
4"<br />
42<br />
41<br />
40<br />
41<br />
39<br />
43<br />
28<br />
34<br />
39<br />
36<br />
T7i3<br />
T73Ö<br />
T~5Ö<br />
0,85<br />
1,03<br />
1,21<br />
1,31<br />
1,1<br />
49 PR<br />
47 PR<br />
39 PR<br />
41 PR<br />
PR<br />
PR<br />
1,14 (45) PR<br />
1.3 j<br />
1.4 I 46 PR<br />
,1.24 i 35 PR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
bt 3a<br />
46; 1<br />
111<br />
bt la<br />
46;<br />
6<br />
115<br />
123
Art Sutur bei h :<br />
Pr. ,S. proccrj v. SEHBACH<br />
1S64 . dn: s. Gattung.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst,<br />
der Uno. Gottingen.<br />
Von aurigerj durch schmalen<br />
Altcrsventcr und früher erlö<br />
schende Parabeln geschieden.<br />
Pr. 'S. lochenensts HAHN<br />
1969. dn: Fundon am Berg<br />
Lochen bei Balingen Württ.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Lan<br />
<strong>des</strong>amt Freiburg Br.<br />
Durch deutlich breiteren<br />
Querschnitt von procerj<br />
geschieden.<br />
3,6 cm<br />
6,7 cm<br />
Skulptur d<br />
"Zick/ackskulptur" bis d 0,5,<br />
danach zwischen 2 Parabeln 5-<br />
8 leicht proverse, bifurkate<br />
odet Einzelrippcn; mittlere<br />
Windungen ohne Parabeln.<br />
Erst auf der Alterswohnkam<br />
mer wieder sporadisch einzelne<br />
wenige Parabeln. Ohren kleiner<br />
als bei jurigerj.<br />
Zickzackskulptur dauert nur<br />
bis d ~ 0,4 an, Parabelknoten<br />
treten auf den mittleren und<br />
äußeren Windungen nicht<br />
mehr auf. Bifurkate, leicht pro<br />
radiate Rippen herrschen vor;<br />
Spaltpunkte variieren zwäschen<br />
Flankenmitte und Außenbug.<br />
Kurze, breite Ohren.<br />
HomoeophmditesUVCKM. 1922: dn: homöo- = ähnlich, gleichartig, ~/jKi
An Sutur bei h =<br />
H. (H.) pseudoannuiaris LI5-<br />
SAJOUS 1923, dn: pseudo =<br />
unecht, annularis = beringt<br />
(An der Gattung Bitutisphinctes).<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im geol. Inst.<br />
Lyon (Nr. Ü482).<br />
H. (H.?) bitchbergensis<br />
(HAHN 1972), dn: Fundort<br />
Buchberg bei Blumberg/<br />
Baden.<br />
Sehr ähnlich homoeomor<br />
phus, aber von gröberer<br />
Skulptur der Innenwindun<br />
gen. <br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
9<br />
2,7 cm<br />
11,4 cm<br />
Skulptur d<br />
Dichte, radiale bis leicht prora<br />
diate Rippen bifurkieren fast<br />
regelmäßig bei nur geringer<br />
Differenzierung zwischen Pri<br />
mär- und Sekundärkomponen<br />
ten. Letztere queren gerade<br />
und regelmäßig den Venter. An<br />
den schwachen Einschnürun<br />
gen der Alterswohnkammer<br />
steigt Q sprunghaft an. Schwä<br />
bisches Exemplar zeigt 4 weit<br />
ständige Rippen vor der Mün<br />
dung mit Ohren.<br />
Relativ grobe, leicht proverse<br />
Rippenstiele mit größter Hohe<br />
über dem Innenbug. werden im<br />
Alter weitständiger und spalten<br />
meist in 3 schwach prokonkave<br />
Sekundärnppen, die ab d «= 8<br />
erlöschen. Stiele noch bis d ~<br />
10 sichtbar, 2-3 Einschnürun<br />
gen pro Windung.<br />
in cm<br />
HT 2,"<br />
5,3<br />
HT/ S<br />
< 8<br />
HT/ S<br />
< 8<br />
HT/ S<br />
< 8<br />
II 1.4<br />
3.5<br />
6<br />
N<br />
in %<br />
56<br />
(46}<br />
45<br />
46<br />
[<br />
H Q<br />
in % |<br />
26<br />
(32<br />
32<br />
31<br />
0,88<br />
Z<br />
48 PR<br />
(1,3) |<br />
96 SR<br />
1,41<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
(44) PR bt 2b<br />
30 PR<br />
26 PR<br />
bis<br />
bt 3a<br />
47; 2<br />
u. 3<br />
61<br />
150<br />
155<br />
32 PR bt 2b<br />
1,23 |<br />
100 SR<br />
(40) PR 47; 4<br />
Untergattung Parachoffatia MANGOLD 19"0; gr. para- = neben, Choffatias. unten; TA Am subbakenae'D'ORü. 1846. Makroconche, mäßig evolute Gehäuse mit einfachem Alters<br />
mundsaum und vorwiegend rechteckigem Querschnitt, Jugendskulptur noch ungewiß, auf mittleren Windungen bifurkate Rippen, von Schaltrippen ergänzt, deren Zahl sich im<br />
Wachstumsverlauf erhöht, während die Primärrippen kräftiger werden und die Externskulptur früher erlischt. Choffatia (Mittel-Bathonium bis Ober-Callovium) besitzt nach MAN<br />
GOLD nebst fehlendem Zigzag-Jugendstadium mehr trapezähnlichen Querschnitt, früher kräftig (weitständig' werdende Primarrippen und einfachere Sutur.<br />
H. (P.) suhhakeriae (D'ORB.<br />
1846), dn: Mr. BAKER, engl.<br />
Geologe.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (D'ORB. Taf.<br />
14S) im CEPP.<br />
Innenwindungen von H. (H.)<br />
homoeomorphus kaum unter<br />
scheidbar.<br />
". (P.) furutus (OPP. 1857),<br />
sin: lat. funatus = umschnürt.<br />
HT ist Am. Iriplicatus QU.<br />
184-, Taf. 13. Fig. 7, Orig.<br />
m IGPT.<br />
^ suhhjkeriae nur durch<br />
-lermcerc Sckundärrippen-<br />
1<br />
'ishte geschieden.<br />
V J<br />
25 cm<br />
14 cm<br />
Auf den Innenwindungen feine,<br />
dichte, radiale Rippenstiele. die<br />
HT 15 46 31<br />
38 PR bt 3<br />
1,19 |<br />
160 SR<br />
ab d = 12 kräftiger und weit<br />
47; 5<br />
ständiger werden, während die 12 44 JT T~f9<br />
Sekundärrippen (Bi- und Trifurkation';<br />
schwächer werden und<br />
zuerst ventral erloschen.<br />
15 44 32<br />
6<br />
37 PR<br />
T~28 J<br />
111<br />
127 SR<br />
155<br />
Auf den Innenwindungen<br />
dichte, stark proradiate Rippen,<br />
die im Wachstumsverlauf weit<br />
ständiger und radial werden.<br />
Bi- und Trifurkation in<br />
schwache Sekundäräste. die ab<br />
d ~ 10 erlöschen, wogegen die<br />
Primärkomponenten dann<br />
Wülste auf dem inneren Flan-<br />
kcndnttel bilden.<br />
21,2<br />
45<br />
30<br />
1,20<br />
HT 9.3 47 29 1,00 |<br />
9<br />
15<br />
44<br />
45<br />
44<br />
35<br />
32<br />
^ i<br />
(35) PR<br />
39 PR<br />
95 SR<br />
29 PR<br />
86 SR<br />
T704 |<br />
35 PR<br />
84 SR<br />
T7T9 j<br />
115<br />
cl 1<br />
47; 6<br />
32 PR<br />
9b SR 155<br />
T7J j<br />
195<br />
228<br />
125
Indosphhtctes SPÄTH 1950; dn: besonders in Indien 'Ratsch) häufige Pensphinetcngattuiig; TA Am. calvus SOW. 1840. Mäßig evolute Gehäuse mit anfangs kreisrundem, sp;i: lT<br />
ovalem Querschnitt und zickzackähnlicher Anfangsskulptur. MANGOLD 1 9~0 teilt in die, seiner Auffassung nach, dimorphen Untergattungen tndosphinetes s. str. und EJatmiu-s,<br />
deren weitere Suturentwicklung unterschiedlich verlauft. Unter- bis Mittel-Callovium.<br />
Untergattung Ehtmitcs SHEVYREV i960; dn: Elatma, Fundort in der zentralen UdSSR; TA Pcnspbmctcs submutatus NIKITIN 1881. Mikroconche Formen mit Ohren am Alters<br />
mundsaum. Nach dem Zickzack-Stadium folgen unregelmäßig gekrümmte Einzel- oder bifurkate Rippen; Parabeln fehlen in diesem Stadium. Schaltrippen bestimmen zunehmend<br />
die Externskulptur, die median abgeschwächt Nein kann. Auf der Alterswohnkammer erhöhen sich die Rippcnstiele über dem Innenbug.<br />
I. (E.) rcrtlt MANGOLD<br />
An Sutur bei h :<br />
1970, dn: j. REYIL, Geologe<br />
in Savovcn Ost trankreich;.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Naturhist,<br />
Museum Chamber.' (Ost<br />
frankreich}.<br />
= Am. convoluttis auritulus<br />
QU. 1887, Taf. 81, Fig. 30<br />
lenger berippte Varietät).<br />
U (E.f) citnicosU (OPP.<br />
1857), dn: lat. curvus =<br />
gekrümmt, Costa = Rappe.<br />
HT ist Am. corirolutiis pcirabolis<br />
QU. 1847, Taf. 13, Fig.<br />
2; Orig. im SMNS.<br />
= Perisphmctes fischeriamis<br />
KUHN 1939.<br />
Von rei'ili durch anderen<br />
Querschnitt und andere<br />
Skulptur geschieden. Gleich<br />
namige Stücke in QU. 1S87<br />
weichen stark vom HT ab.<br />
/. (E.) grjeiosus rSIEMI-<br />
RADZKI 1894), dn: graziös,<br />
anmutig.<br />
= Perispbinctes cf. kontkiewiczi<br />
KUHN 1939; = Perisphmctes<br />
cf. pseitdjurigerits<br />
KUHN 1939.<br />
Von größerer Nabelweite<br />
und gröberer Skulptur als<br />
vorstehende Arten.<br />
/. (E.) comptoni (PRATT<br />
1841)<br />
HT (sehr stark verdrückt) in<br />
BUCKM. 1921, Taf. 485.<br />
SIEMIRADZKI 1898<br />
betrachtet Am. convolutits<br />
jurituhis QU. 1887, Taf. 81,<br />
Fig. 31, 33 u. 34 als art<br />
gleich.<br />
126<br />
Li mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
5,4 cm<br />
Skulptur d<br />
Primarrippen aut den Innen<br />
windungen zunächst dicht und<br />
leicht proradiat, Sekundärrip<br />
pen, soweit sichtbar, fein und<br />
retrovers, TZ 2. Am HT<br />
entfällt bei d = 2 eine Parabel<br />
rippe auf 2 Primärrippen. Auf<br />
der Alterswohnkammer Primär<br />
rippen weitständig und<br />
schwach sinusförmig, Sekun<br />
därrippen meist eingeschaltet,<br />
Parabeirippen verschwunden,<br />
TZ ~ 4.<br />
Schwach proverse bis radiale<br />
Primärrippen vergrößern ihre<br />
Abstände nur wenig und spal<br />
ten sehr unregelmäßig auf<br />
Flankenmitte in retroverse<br />
Sekundärrippen, die median<br />
stumpfwinklig aufeinandersto<br />
ßen, im Alter durch ein<br />
Medianband geschwächt. Auf<br />
dem letzten Umgang <strong>des</strong> HT<br />
10 Parabelrippen, Innenwin<br />
dungen am Original nicht<br />
erhalten (PIETZCKER 1911,<br />
S. 1961, <strong>des</strong>halb Gattungszuge<br />
hörigkeit ungewiß.<br />
Auf den Innenwindungen kräf<br />
tige, proradiate, später radiale<br />
Primärrippen, anfangs bi-, spä<br />
ter trifurkierend in retroverse<br />
Sekundärrippen, die leicht<br />
geschwächt den Ventet konkav-<br />
queren. Sporadisch auftretende<br />
Parabelrippen maximal aus<br />
gebildet bei d ^ 6 (Anfang der<br />
Alterswohnkammer), wo eine<br />
auf 5 Primärrippen entfällt.<br />
Alle Windungen tragen ziem<br />
lich gleichartig radiale Rippen<br />
mittlerer Dichte, die oft auf<br />
Flankenmitte bifurkieren oder<br />
durch dort einsetzende Schalt-*<br />
rippen vermehrt sind. Auf dem<br />
letzten Windungsviertel wer<br />
den die Poppen weitständig<br />
und schwächer. Lange schmale<br />
Ohren.<br />
in cm<br />
f u<br />
HT
. (E.) pseudoscopinensis<br />
Art Sutur bei h =<br />
KUHN 1939, dn: pseudo- =<br />
unecht, scopinensis = ähn<br />
liche Art der Gattung Binatisphinctes.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT nicht auffind<br />
bar.<br />
/. (E.) leptoi<strong>des</strong> (TILL 1911),<br />
dn: gr. lepros = fein, zart,<br />
-oi<strong>des</strong> = ähnlich.<br />
Durch unregelmäßige Skulp<br />
tur charakterisiert.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
o<br />
3 cm<br />
Skulptur d<br />
Unregelmäßige Rippen auf den<br />
Innenwindungen stärker, auf<br />
den Außenlandungen weniger<br />
proradiat, bei etwa 60% Sei<br />
tenhöhe bifurkierend, manch<br />
mal auch trifurkierend. In den<br />
Gabelpunkten biegen die<br />
Sekundärrippen gruppenweise<br />
leicht nach vorn oder nach hin<br />
ten, median verlaufen sie bei<br />
schmaler Schwächung meist<br />
leicht konkav. Parabeln in unre<br />
gelmäßigen Abständen, manch<br />
mal den Einschnürungen<br />
zugeordnet.<br />
Der stark korrodierte HT zeigt<br />
radiale Primärrippen, die am<br />
Innenbug wulstig erhöht sind,<br />
auf der Außenwindung weit<br />
ständig werden und auf der<br />
äußeren Flankenhälfte durch<br />
leicht rerroverse Schaltrippen<br />
stark vermehrt sind (TZ =<br />
2,5). Extern Rippen Unterbre<br />
chung, sporadisch Parabelkno<br />
ten.<br />
in cm<br />
HT 3,0<br />
3,2<br />
HT 8<br />
9<br />
N<br />
in %<br />
50<br />
48<br />
46<br />
44<br />
H<br />
in %<br />
32<br />
31<br />
31<br />
30<br />
Q<br />
0,95<br />
0,95<br />
1,24<br />
1,1<br />
Z<br />
39 PR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl lb<br />
(45) PR 48; 5<br />
145<br />
155<br />
(35) PR cl<br />
Grossouvriinae SPÄTH 1930, sensu MANGOLD 19 0<br />
(~ Pseudoperisphinctinae SCHINDE WOLF 1925, gleichnamige Gattung vom Autor 1966 eingezogen). Evolute Abkömmlinge der Gattung Wagnericems, im Gegensatz zu den Zig-<br />
zagiceratinae ohne Zigzag-Jugendstadium (Zuordnung bei nicht erhaltenen Innen Windungen wegen stratigraphischer Überlappung sehr erschwert). Spaltrippen mit frühzeitiger und<br />
oft sehr ausgeprägter Differenzierung zwischen Primär- und Sekundärkomponenten. Parabelrippen besonders auf den Außenwindungen der Mikroconche gut sichtbar, häufig<br />
einige Einschnürungen. Unter-Bathonium bis Oxfordium.<br />
Wugnericeras BUCKM. 1921 {—Suspensites BUCKM. 1922); dn: J. A. WAGNER, Zoologe u. Paläontologe in München, 1797-1861; TA Am. wagneri O??. 1857 (= Am. planula ZIE<br />
TEN in D'ORB. 1846, Taf. 144). Großwüchsige Gehäuse mit evoluten Innen- und mäßig bis stark involuten Außen Windungen mit gerunde t-dreieckigem Querschnitt. Jugend Win<br />
dungen mit sinusähnlich geknickten Spaltrippen, deren grobe Primärkomponenten den trichterförmigen Nabel zieren, und deren Sekundärkomponenten extern nicht unterbrochen<br />
sind. Altersskulptur ähnlich wie bei Procerites s. str. erlöschend. Oberstes Unter-Bathonium bis Mittel-Bathonium.<br />
W. suspensum (BUCKM.<br />
1922), dn: lat. suspensus =<br />
emporgehoben, ungewiß. / \<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geological<br />
Survey-Museum London.<br />
= Am. cf. jrbustigertts QU.<br />
18S7, Taf. 80, Fig. 8 und 9.<br />
fnrtccostjtum (DE GROS-<br />
MM'YRE 1950), du: lat. for-<br />
i • j<br />
= kräftig, costatus = 1 \<br />
l i<br />
V J<br />
•vnppt.<br />
\'>r allem weitnabliger als<br />
Suspension.<br />
IO. -<br />
cm<br />
9,5 cm<br />
Im tiefen Nabel sind nur prora<br />
diate, gleichmäßige, weitständi<br />
ger werdende Primärrippen<br />
sichtbar. Sie spalten im inneren<br />
Flankendrittel in 3-4 Sekundär<br />
rippen, die zunächst stark pro<br />
vers, im äußeren Flankendrittel<br />
weniger provers verlaufen. Rip<br />
penschwund ab d ^ 10 auf<br />
innerer, danach auf äußerer<br />
Flankenhälfte.<br />
Radiale bis schwach sinusför<br />
mige Rippen tnturkieren vor<br />
wiegend etwa auf Flanken<br />
mitte. Beim HT tritt bei d = 9<br />
noch keine Skulpturab_.chwä-<br />
ehung auf.<br />
6,5<br />
33<br />
28<br />
(42;<br />
(40)<br />
1,0 |<br />
(0,9)<br />
12,3 25 45 1,15<br />
15,5<br />
13<br />
16,2<br />
25<br />
23<br />
24<br />
45<br />
4"<br />
44<br />
HT 9,4 35 40<br />
9,6<br />
9,9<br />
> 1<br />
32<br />
41<br />
38<br />
1,29<br />
1,18<br />
1,22<br />
1.05<br />
1<br />
23 PR<br />
61 SR<br />
48; 6<br />
155<br />
245<br />
276<br />
bt la<br />
bis<br />
bt 2b<br />
17 PR 48; 7<br />
'68) SR<br />
21 PR<br />
70<br />
95<br />
111<br />
197<br />
(24) PR bt 2<br />
48; S<br />
6<br />
70<br />
105<br />
111<br />
127
Choffatia SIF.MIRADZKI 1S98 = Pscud',pe':svh:.2)<br />
(
Untergattung Grossouvria SIEMIRADZKI 1898; dn; A. DE GROSSOUVRE, franz. Geologe, 1849-1932; TA Am. sulciferus OPP. 1857, = Am. convalutus ornatiQÜ. 1847. Mikro<br />
conche Formen von maximal etwa 10 cm Größe mit ausgeprägten Ohren am Altersmundsaum. Spaltrippen ab d 0,3 regelmäßig bis unregelmäßig, anfangs bifurkat, später auch tri<br />
oder quadrifurkat, niemals völlig erlöschend. Einschnürungen und Parabeln mehr oder weniger zahlreich.<br />
Ch. (Gr.) sulafera (OPP.<br />
1857), dn: lat. sulcus =<br />
Furche, ferre = tragen.<br />
An Sutur bei h :<br />
HT ist Am. conrolutus ornati<br />
QU. 1847, Taf. 13, Fig. 1;<br />
Orig. im SMNS.<br />
= Am. subtilis NEUMAYR<br />
1870, nicht NEUMAYR<br />
1871.<br />
Ch. (Gr.) evexa (QU. 1887),<br />
dn: lat. evexus = nach oben<br />
gerundet (hochmündig).<br />
LT ist, nach MANGOLD<br />
1970, Am. conrolutus evexus<br />
QU. 1887, Taf. 81, Fig. 16;<br />
Orig. im IGPT.<br />
Trennung von sulcifera frag<br />
würdig, da nur etwas größe<br />
res Q. In die Variationsbreite<br />
von evexa!sulcifera fallen fer<br />
ner: Gr. plana SIEMI<br />
RADZKI (= QU. 1887, Taf.<br />
81, Fig. 18), Gr tenella TEIS<br />
SEYRE (= QU. 1887, Taf.<br />
81, Fig. 19) und vermutlich<br />
Gr. teisseyre: PARONA u.<br />
BONARELLI.<br />
Ch. (Gr.) dilatata (QU.<br />
1887), dn: lat. dilatatus =<br />
verbreitert.<br />
Gemäß QU., S. 688, muß<br />
Fig. l.Taf. 81 als LT<br />
betrachtet werden; Orig. im<br />
SMNS.<br />
Durch größere Windungs<br />
breite ausgezeichnet. Identität<br />
mit recitperoi GEMM.<br />
(gemäß SIEMIRADZKI)<br />
wurde von P1ETZCKER<br />
1911 widerlegt.<br />
Ch. (Cr.) crassa (SIEMI<br />
RADZKI 1894 , dn: lat. cras-<br />
sus = dick.<br />
=<br />
Am. tnplicalus paraholis<br />
QU. 1886, Taf. "9, Fig. 39<br />
und iS?'.<br />
Ähnlich dilatata, aber von<br />
'»ehr quadratischem Quer<br />
schnitt und etwas anderer<br />
Berippung.<br />
1 ü. U> O.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d -<br />
7,4 mm 3,5 cm<br />
7,4 i<br />
3,1 cm<br />
1.6 i<br />
Skulptur d<br />
Innerste Umgänge bis d ~ 0,5<br />
glatt; danach spalten proverse<br />
Rippenstiele in leicht rückgebo<br />
gene Sekundärrippen, die den<br />
Venter unterbrochen queren.<br />
Auf dem Phragmocon 3 bis 4<br />
Einschnürungen pro Windung,<br />
auf Alterswohnkammer feh<br />
lend, wogegen don Extern<br />
skulptur geschwächt und spo<br />
radische Parabeln am Außen<br />
bug. Schwache, schmale<br />
Medianrinne auf den letzten<br />
Kammern.<br />
Primärrippen anfangs provers,<br />
dann radial, zuletzt schwach<br />
retrovers, auf dem letzten<br />
Umgang bei 2/3 Flankenhöhe<br />
Bi-, selten Trifurkation in retro<br />
verse Sekundärrippen, die<br />
extern konkave Bogen bilden.<br />
Einschnürungen und Parabeln<br />
wäe bei sulcifera, Skulptur<br />
schwächung aber mehr lateral.<br />
Bisweilen schmale Median<br />
furche, angeblich nicht artty-<br />
pisch.<br />
Prokonkave Primärrippen spal<br />
ten bei 65 bis 75% Flanken<br />
höhe vorwiegend in 2 rückge<br />
bogene Sekundäräste, die<br />
extern manchmal durch eine<br />
schwache Medianrinne unter<br />
brochen sein können. Pro<br />
Umgang 2 bis 3 proverse Ein<br />
schnürungen, die manchmal<br />
schon vor Einsetzen der Berip<br />
pung bei d = 0,5 auftreten.<br />
Parabelbildungen scheinen völ<br />
lig zu fehlen.<br />
Leicht sinusförmige bis radiale<br />
Rippen, am Außenbug konvex<br />
rückbiegend, erhalten durch<br />
eingeschaltete Sekundärrippen<br />
auf dem Phragmocon TZ = 2,<br />
auf der Alrerswohnkammer<br />
wird TZ = 3. Glattes Median<br />
band, schwache Parabeln am<br />
Wo h n ka m m e r e n d e.<br />
in cm<br />
HT< 2,3<br />
2<br />
2,7<br />
3,7<br />
LT 4,0<br />
4<br />
14,7<br />
LT<br />
43,5<br />
4~,5<br />
45<br />
48<br />
43<br />
48<br />
45<br />
45<br />
46<br />
4",5<br />
30,4<br />
30<br />
35<br />
33<br />
32<br />
29<br />
36<br />
33<br />
31<br />
30<br />
0,83<br />
1,0<br />
0,88<br />
1,0<br />
1,2<br />
1,2<br />
1,09<br />
1,36<br />
1.43<br />
( 0,S<br />
i 0.82<br />
HT 4,2: 45 0.91<br />
30 PR<br />
65 SR<br />
41 PR<br />
39 PR<br />
3" PR<br />
3" PR<br />
(77) SR<br />
(40) PR<br />
38 PR<br />
74 SR<br />
34 PR<br />
(68) SR<br />
| 49; 8<br />
129
Art<br />
Ch. (Cr.) pohnica (SIEMI<br />
RADZKI 1894), dn: Fundge-<br />
hiet Polen.<br />
= Perisphmctes pohmicus<br />
KUHN 1939.<br />
Von außergewöhnlich feiner<br />
Berippung. kleinwüchsig.<br />
Ch. {Gr.) kontkiewiezi (SIE<br />
MIRADZKI 1894).<br />
Ähnlich sulcifera bzw. ei'exa,<br />
lediglich von etwas anderer<br />
0<br />
Skulptur.<br />
Ch. (Gr.) ei-olutesccns<br />
(KUHN 1939), dn: evolut =<br />
schwach umfassend gerollt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT nicht auffind<br />
bar.<br />
Sehr ähnlich sulcifera, aber<br />
Berippung weniger provers<br />
und schwächere Einschnü<br />
rungen.<br />
Quer-<br />
Sutur he; r. = schnitt<br />
' bei d -<br />
!<br />
0<br />
2,5 cm<br />
• 6 cm<br />
p<br />
3,6 cm<br />
Skulptur d<br />
in cm<br />
Feine, prokonkave Primärrip<br />
pen werden etwas weitständi<br />
ger und bifurkieren aul Flan<br />
kenmitte in konvexe, sehr feine<br />
Sekundärnppen, die auf der<br />
Alterswohnkammer durch<br />
Schaltrippen so vermehrt wer<br />
den, daß TZ = 3 wird, Parabel-<br />
nppen ohne Knoten auf der<br />
Wohnkammer äquidistant,<br />
mehrere schmale Einschnürun<br />
gen, am Vorderrand überhöht.<br />
Auf den Innenwindungen<br />
radrale, auf der Außenwindung<br />
mehr retroverse Primarrippen,<br />
die auf den Innenwindungen<br />
unregelmäßig bifurkieren und<br />
teilweise Parabelknoten tragen.<br />
Letztere verschwinden ab Mitte<br />
Wohnkammer, wogegen tri*<br />
und quadripartite Rippen auf<br />
treten. Mit zunehmendem Alter<br />
verringert sich der (konkave)<br />
Externknick de.- Rippen zum<br />
geraden Übergang.<br />
Auffallend unregelmäßige, auf<br />
den Flanken grobe Berippung,<br />
nur auf den Innenwindungen<br />
provers, dann radial. Spaltung<br />
nahe dem Außenbug, strecken<br />
weise mit leichtem Rückwärts<br />
knick, in feine Sekundärrippen.<br />
Auf Außenwindung 7 außerge<br />
wöhnlich kräftige Rippen,<br />
dazwischen je ein Parabelkno<br />
ten.<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
m %<br />
30 PR<br />
HT 2,7 44 33 1,14 j 90 SR<br />
33 PR cl<br />
HT 5,0 48 30 1,22 j (90) SR<br />
Q<br />
Z<br />
Zoiiv<br />
Taf.<br />
In.<br />
cl<br />
49; 9<br />
145<br />
49; 10<br />
145<br />
155<br />
227<br />
34 PR cl 1<br />
HT 4,0 49 30 0,92 j (85) SR<br />
Binatisphbictes BUCKM. 1921; dn: lat. binar = aus zwei Teilen bestehend, sphingo = einschnüren; TA Am. biiutus BEAN-LECKENBY 1859. Planulate, weitnablige Perisphincten<br />
mit kreisrundem Jugendquerschnitt und proversen, meist geraden Schaltrippen mit gelegentlichen Parabeln und schmaler Ventralunterbrechung. Mittleres Callovium bis Oxfor<br />
dium.<br />
Untergattung Binatisphinctes s. Str.: makroconche Vertreter der Gattung mit meist gerundet-hochrechteckigem Altersquerschnitt und weitständig werdenden Primärrippen bei ent<br />
sprechendem Anstieg der Teilungsziffer.<br />
ß. (B.) rossicus (SIEMI<br />
RADZKI 1S99), dn: lat. ros<br />
sicus = russisch.<br />
= Pcrisphinctes mosquensis<br />
LAHUSEN' (nicht FISCHER)<br />
1883, Taf. 9, Fig. 4 bis 6.<br />
130<br />
10 i<br />
4,3 cm<br />
Innenwindungen tragen pro<br />
konkave bis radiale, z. T. auch<br />
leicht sinusförmig gekrümmte<br />
Rippen, die auf Flankenmitte<br />
bifurkieren und extern durch<br />
glattes Band unterbrochen<br />
sind. Parabeln ab d = 2,5, im<br />
Alter wieder verschwunden.<br />
Alterswindungen tragen retro<br />
verse, unregelmäßig<br />
gekrümmte, weitständige Pri<br />
märrippen mit Schaltrippen in<br />
Außenbuggcgend (TZ 4).<br />
10,7<br />
50<br />
(40) •(36)<br />
1,2<br />
1,34<br />
47 PR<br />
(72) SR •<br />
(33) PR<br />
(140) SR-<br />
49; 11<br />
145<br />
155
Untergattung Okaites SASONOV 1961; dn: Oka, russischer Fluß, Fundgebiet; TA Am. mosquensis FISCHER 1843. Mikroconche Binatisphincten mit Ohren am Altersmundsaum,<br />
manchmal trapezoidem Altersquerschnitt und vorwiegend bifurkaten Rippen, die extern erst im Alter leicht tetrovers werden können. Auch Parabeln werden erst spat entwickelt.<br />
Die sehr ähnliche Untergattung Elatmites (s. o.) neigt dagegen in der Jugend zu retroversen Rippen und Parabeln (MANGOLD 1970).<br />
An Sutur bei h =<br />
B. (Ob.?) subaurigerus (TEIS<br />
SEYRE 1883), dn: lat. sub- =<br />
untergeordnet, auris — Ohr,<br />
gero = tragen.<br />
Das von KUHN 1939 abge<br />
bildete, gleichnamige Stück<br />
hat geringere Primärrippen-<br />
dichte. <br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
f \<br />
i<br />
6,2 cm<br />
1<br />
Skulptur d<br />
Feine, anfangs dichte und<br />
wenig in Primär- und Sekun<br />
därkomponenten differenzierte<br />
Rippen sind zunächst tadia!<br />
und später leicht sinusförmig<br />
gekrümmt. Im Wachsrumsver<br />
lauf werden die Primärkompo<br />
nenten weitständiger, und auf<br />
äußerer Flankenhälfte mehren<br />
sich Schaltrippen. Schmale,<br />
ziemlich tiefe Medianfutche.<br />
in cm<br />
N<br />
in °/o<br />
H<br />
in %<br />
3,7 43 35 1,25 j<br />
6,3 40 34<br />
Q<br />
Z<br />
4S PR<br />
81 SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl 2(?)<br />
50; 3<br />
35 PR<br />
105 SR 145<br />
1,26 j<br />
242<br />
ProplanuUtes TEISSEYRE 1887; dn: pro- = vor, Planulites• morphologisch ähnliche Gattung aus dem Devon; TA Am. koenigi SOW. 1820. Involute, planulate Perisphincten mit<br />
groben, stumpfen Primarrippen und ventral geschwächter Skulptur. Sutut relativ schwach zerschlitzt. Von ARKELL 1957 einer Untetfamilie Proplanulitinae BUCKM. 1921 einge<br />
fügt und als Abkömmlinge von Wagnericeras bzw. Choffatia betrachtet. Callovium.<br />
Pr. koenigi (SOW. 1820)<br />
TORNQUIST 1894 hält die<br />
Abb. in NEUMAYR 1871 für<br />
die erste "unzweifelhafte".<br />
BUCKM. 1921 bestimmt<br />
einen LT. abgeb. in ARKELL<br />
1956, Taf. 37; Orig. im<br />
BMNH.<br />
Pr. teisseyrei TORNQUIST<br />
1894, dn: W. TEISSEYRE,<br />
Geologe in Lemberg, 19. Jhd.<br />
Als LT gilt TORNQUISTs<br />
Abb. 1 auf Taf. 45.<br />
Von koenigi durch kleineres<br />
N und größeres Q geschie<br />
den.<br />
Pr. reuten, pinguis und para-<br />
bolicus, alle KUHN 1939,<br />
sind unvergleichbare Jugend-<br />
exemplare.<br />
29 mm 12 cm<br />
29 i<br />
Auf den Innenw indungen .<br />
grobe, weitständig werdende<br />
Primärrippen, die schließlich zu<br />
Wülsten über dem Innenbug<br />
entarten. Auf äußerer Flanken<br />
hälfte mäßig dichte, radiale<br />
Sekundärrippen, die extern<br />
durch glattes Band unterbro<br />
chen sind. Adult-Wohnkam-<br />
mern sind meist völlig glatt.<br />
Am Innenbug entspringen wul<br />
stige, auf den innersten Wän<br />
dungen dichte, proradiate, spä<br />
ter weitständige, radiale Pri<br />
märrippen, die auf dem inner<br />
sten Flankendrittel ihre größte<br />
Höhe erreichen und dabei<br />
meist trifurkieren. Durch<br />
Schaltrippen erreicht TZ knapp<br />
4; die Sekundätäste schwängen<br />
gegen den Venter vor, wo sie<br />
stark geschwächt sind.<br />
LT 5,7<br />
LT<br />
2<br />
3,7<br />
6,7<br />
12<br />
12,5<br />
3,6<br />
32<br />
41<br />
37<br />
40<br />
2.4) 33<br />
4,", 29<br />
8,7.' 26<br />
39<br />
37<br />
38<br />
36<br />
35<br />
36<br />
38<br />
40<br />
40<br />
44<br />
1,23<br />
1,15<br />
1,16<br />
1,25<br />
1,38<br />
1.39<br />
17 PR<br />
(64) SR<br />
70 SR<br />
1" PR<br />
)'.:! 19 PR<br />
1 , 3 4 1<br />
1,41<br />
72 SR<br />
cl lb<br />
50: 4<br />
24"<br />
50; 5<br />
u. 6<br />
(18) PR<br />
(64) SR 247<br />
131
Tulitidae BUCKM. 1921<br />
Cadicone oder sphärocone bis kugelige Gehäuse, deren adulte Wohnkammer zu Entrollung i'Egression) und Verengung neigt. Berippung schwach und im Alter meist erlöschend<br />
Suturentwicklung wenig bekannt. Suturallobenbildung scheint vorzuherrschen. Die Tulitidae wurden 19~1 aufgrund ihrer Skulpturontogenese und <strong>des</strong> fehlenden Un von HAI IN m<br />
die Perisphinctaceae eingegliedert und um die Gattung Morristceras erweitert. Große Ähnlichkeit mit Vertretern von Cbondroceras, deren Berippung jedoch erst am 4. oder *<br />
Umgang auftritt und im allgemeinen kräftiger und noch auf der Alterswohnkammer beständig ist. Bathonium und Callovium. Man beachte die teilweise geänderte Bedeutun-<br />
der dritten Spalte der Maßtabellen.<br />
Tulites BUCKM. 1921; TA Tulites tuh BUCKM. 1921. Cadicone Formen mit halbkreisförmigem Windungsquerschnitt. mittel weitem Nabel und evoluten (nahezu serpenticone:! ,<br />
fein berippten Anfangswindungen. Primärrippen auf dem Nabelabfall spalten, oft in knotenartigen Verdickungen, in mehrere Externrippen. Sehr ahnliche Vertreter der lungeren<br />
Gattung Cadoceras lassen sich nur durch ihr Lacer. schwieriger durch ihre cadiconen Innenwindungen und proradiaten Rippen unterscheiden. Subcontractus-Zonc <strong>des</strong> Oher-Bathi<br />
niums.<br />
Untergattung Tulites s. str.; mittel- bis crobwüchsige makroconche^ Gattungsvertreter mit einfachem Mundsaum ohne Ohren. Da nicht eindeutig abgrenzbar, wird Ru^tcius<br />
BUCKM. 1921 in die Untergattung einbezogen.<br />
Quer Zone<br />
Art Sutur bei h = schnitt<br />
Skulptur d X B Q Z T.it.<br />
bei d —<br />
in cm in % in %<br />
Lit.<br />
T. (T) modiolaris .'SMITH Schwache, wulstige Primarrip NT 8 32 77 0,57 bi 2b<br />
1817). dn: gr. modios = Schef pen gabeln am deutlichen<br />
fel. Schöpfgefäß. Innenbug in leichten Verdikkungen<br />
zwei-bis dreifach zu<br />
6 29 79 Ö762<br />
12 I'R 50; ~<br />
l 27 SR<br />
NT in ARKELL 1952, Taf. 11, schwach konkaven Externrip 6<br />
Fig. 4; Orig. im Sedgwick-<br />
Museum Cambridge (Engpen,<br />
die auf dem Venter konvexe<br />
Bogen bilden. Skulpturab-<br />
( 6, R<br />
I Ö,o<br />
37 72<br />
13 PR<br />
0,69 |<br />
25 SR<br />
114<br />
197<br />
land). schwächung im Alter, adulte 1.8,0 38 66 0,62<br />
=- Am. sublaevis QU. 1886,<br />
Wohnkammern stets glatt;<br />
anstelle der Rippen manchmal 111,4 29 76 0,61<br />
Taf. "9, Fig. 2 (ausschließ einsetzende Wellung. Il3,2 32 64 0,67<br />
lich). Sehr variable Art.<br />
1~ mm 11 cm<br />
T. (T.) cadus BUCKM. 1921, Die sehr steile Nabelwand ist<br />
dn: lat. cadus = Weinkrug.<br />
in der Tiefe glatt; erst dicht<br />
HT in ARKELL 1952, Abb.<br />
28; Orig. im Geol. Survey<br />
i \<br />
unter der Nabelkante setzen<br />
Rippenstiele ein, die auf der<br />
Kante in Form von kleinen<br />
Museum London. Wülsten Maximalhöhe errei<br />
chen und dicht darüber 2- oder<br />
35<br />
T. (T.) ritgifer (BUCKM.<br />
Art Sutur bei h =<br />
1922), dn: lat. ruga = Run<br />
zel, Falte, ferre — tragen.<br />
HT in ARKELL 1954, Taf.<br />
13, Fig. 1; Orig. im Geol.<br />
Survey Museum London.<br />
Durch gerundeten Quer<br />
schnitt bei relativ kleinem B<br />
ausgezeichnet.<br />
T. (T.) polypleurus (BUCKM.<br />
1923), dn: gr. polys = viel,<br />
pleura = Rippe.<br />
HT in ARKELL 1954, Taf.<br />
13, Fig. 2; Orig. im Geol.<br />
Survev Museum London.<br />
Ahnlich gerundet wie rugifer,<br />
aber dichter berippt und brei<br />
ter.<br />
T. (T.l piomhis ARKELL<br />
1954, dn: lat. pumilus =<br />
zwerghaft.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Sedgwick-<br />
M us cum Cambridge, Eng<br />
land.<br />
Sehr ahnlich subcontr Actos,<br />
aber von geringerer End<br />
größe und etwas kleinerem<br />
B.<br />
1<br />
1<br />
I<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
9 cm<br />
9 cm<br />
~ cm<br />
1<br />
1<br />
Skulptur d<br />
Nabelabfall, laufen konkav auf<br />
die Flanke, in deren Mitte sie<br />
2- oder 3fach ohne wesentliche<br />
Knotenbildung gabeln. Wäh<br />
rend sie auf dem letzten halben<br />
adulten Umgang verschwunden<br />
sind, erkennt man die konve<br />
xen Externrippen bis zuletzt.<br />
in cm<br />
Niedrige Primärrippen entsprin ,0<br />
HT<br />
gen auf dem sanft gerundeten 9,0<br />
N<br />
in °*<br />
29<br />
35<br />
ß<br />
in %<br />
67<br />
8 34 42<br />
Q<br />
50 0,78<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
13 PR bt 2b<br />
51; 2<br />
16 PR<br />
32 SR 6<br />
0,90 J 70<br />
Auf der Nabelwand bis d 3,5<br />
feine Primarrippen, die auf<br />
Flankenmitte 2- oder Stach<br />
spalten. Rippenverlauf auf der<br />
Flanke durchgehend konkav,<br />
extern dichte, konvexe Bögen.<br />
~,5 28<br />
HT<br />
9,0 7-<br />
r 32<br />
30<br />
70<br />
58<br />
"8<br />
16 PR bt 2<br />
0 „ |<br />
1 44 SR<br />
16 PR 51; 3<br />
15 PR 6<br />
0.62 j 39 SR 61<br />
15 PR 70<br />
0.5" j 39 SR 114<br />
i-t.i<br />
("6,0<br />
2"<br />
83<br />
11 PR<br />
0.64 j 30 SR<br />
16,9 26<br />
28 SR<br />
Bis d ~ 4 wulstige Primärrip<br />
pen, an der Stelle größter Win<br />
dungsbreite verdickt, kurz<br />
darüber in proverse Äste auf<br />
spaltend, die regelmäßig kon<br />
vex den Venter queren. Im<br />
Alter glatt, einige wenige Ein<br />
schnürungen angedeutet,<br />
Anwachslinien.<br />
HT 5,3<br />
6,5 34<br />
31 4 7<br />
6~ 0,"5<br />
Untergattung Trollieeras TORRENS 1971 {=Krunibeckui ARKELL 195 1); dn: Troli = Name einer Farm und eines Steinbruchs bei Thornford. Südengland: TA Krumbeckia reuteri<br />
ARKELL 195 1. Kleinwüchsige (mikroconche) Vertreter der Gattung Tulites mit Ohren am Altersmundsaum. Verwechslungsgefahr besteht mit der mikroconchen Untergattung Bul~<br />
Idtimorpbites (Spbaeroptyehius), die etwas engnabliger und sphärocon ist.<br />
T. ;Tr.) reuten (ARKELL<br />
1951).<br />
Orig. <strong>des</strong> HT nicht auffind<br />
bar.'<br />
Vs eitgefalste Art, diverse<br />
\ anationen einschließend.<br />
Auf den Innenwindungen zu<br />
schwachen Knoten verdickte<br />
Primarrippen, mit TZ ~ 2 m<br />
etwa radiale Externrippen<br />
gabelnd. Die Primarrippen kön<br />
nen auf der Alters\sohnkam-<br />
mer erloschen oder auch bis<br />
zum Endmundsaum beständig<br />
sein. Die beiden letzten aduhe:i<br />
Exteninppen sind außerge<br />
wöhnlich kräftig und durch<br />
eine Einschnürung getrennt.<br />
HT 3.1<br />
40<br />
42<br />
40<br />
42<br />
5"<br />
51<br />
40,5<br />
50<br />
)S<br />
0."8<br />
0.84<br />
0,"6<br />
0,89<br />
0.80<br />
0."8<br />
o.9s<br />
16 PR<br />
17 PR<br />
114<br />
bt 2b<br />
51; 4<br />
6<br />
61<br />
35 SR 5<br />
29 SR<br />
12 PR<br />
25 SR<br />
14 PR<br />
2" SR<br />
15 I'R<br />
2" SR<br />
bt 2b<br />
1.33
Bullatimorphites BUCKM. 1921; dn: lat. bullatus = blasenartig, gr. morphe = Gestalt; TA B. bullatimorpbuslWCKW. 1921. Mittelgroße und kleinwüchsige, sphäroconcFormen um<br />
teilweise stark egredierender. z. T abknickender Alterswohnkammer. perisphinctoiden Spaltrippen und Parabelknoten auf den Innenwindungen. Die ähnliche Gattung Tulites unter<br />
scheidet sich durch mehr cadicone, anfangs weitnab'ngere Gehäuse mit verdickten Primarrippen und fehlende Parabelknoten. Auch Morrisiccras hat cadicone Gehäuse und wesent<br />
lich früher erlöschende Primärrippen. Unter-Bathonium bis Ober-Callovium.<br />
Untergattung Bulhtimorphites s. str.; mittelgroße Formen mit einlachem Altersmundsaum und nur wenig verengter, nicht abgeknickter Alterswohnkammer.<br />
B. i'B.j latecentratus (QU.<br />
An Sutur bei h =<br />
1SS6), dn: lat. latus ~ weit,<br />
centratus = zentriert, gena<br />
belt.<br />
HT ist Am. bullatus latecentratus<br />
QU. 1S86, Taf. 77,<br />
Fig. 6; Orig. im IGPT.<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Skulptur d<br />
w<br />
Auf dem Nabelabfall der Innenwindungen<br />
leicht retroverse<br />
Primarrippen, auf den sichtbaren<br />
Flanken konkav bis retro-<br />
y y<br />
konkav, etwa auf Flankenmitte<br />
vorwiegend zweifach gabelnd.<br />
11 cm<br />
Die gleichmäßig über den Ven<br />
ter ziehenden Sekundärrippen<br />
sind durch Schaltrippen ver<br />
mehrt und kurz vor der Alters<br />
mündung gröber.<br />
B. (B.) u-eigelti (KUHN 1939, Retrokonkave Primärrippen am<br />
Orig. <strong>des</strong> HT ("Spbaeroceras-<br />
weigelti) im IGPEN.<br />
Größere Nabelweite (bei glei<br />
chem d) als latecentratus und<br />
anscheinend kleinwüchsiger.<br />
Anfang der Außenwindung <strong>des</strong><br />
HT noch dicht, am Ende der<br />
selben weitständig, wulstig und<br />
geschwächt, erst über dem<br />
Innenbug beginnend. Sekundär<br />
rippen leicht konvex, TZ ^ 2.<br />
in cm<br />
HT 8<br />
HT 8<br />
- 4<br />
{"<br />
U0,8<br />
N<br />
in %<br />
B<br />
in %<br />
- 4 24 55<br />
31<br />
20<br />
30<br />
47<br />
52<br />
45<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
L.t.<br />
0,8 |<br />
31 PR<br />
0,83<br />
82 SR<br />
bt la<br />
52; 2<br />
38 PR<br />
0,92 j 90 SR<br />
34 PR<br />
0,87 | 82 SR<br />
114<br />
197<br />
HT 4.0 24 55 0,82 cl lb<br />
Untergattung Kberaiceras SPÄTH 1924; TA Spbaeroceras cosmopolita PARONA u. BONARELLI 1897. Mittelgroße Formen mit stark verengter, stark egredierender und dabei<br />
abknickender Alterswohnkammer; Mundsaum ohne Ohren.<br />
B. (K.j bullatus (D'ORB.<br />
1846), dn: s. Gattung.<br />
LT in ARKELL 1954, Abb.<br />
34.<br />
= Am. plar\'stomits QU.<br />
1886, Taf. 78, Fig. 22-25,<br />
28-30; = Am. platystomus<br />
globulatus QU. 1886, Taf.<br />
"8, Fig. 2.<br />
Wohnkammer einmal deut<br />
lich, ein zweites Mal weniger<br />
deutlich gerundet abknik-<br />
kend.<br />
B. (KJ) dornt (KUHN 1939).<br />
dn: P. DORN, fränkischer<br />
Geologe.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT («Spbaeroceras»<br />
dornt) im IGPEN.<br />
Wesentlich breitmiindiger als<br />
bullatus.<br />
134<br />
-<br />
Q Die<br />
ca. 2,5 mm (7,2 mm) 8,7 cm<br />
Die gekammerten Innenwin<br />
dungen, bei ausgewachsenen<br />
Exemplaren unsichtbar, tragen<br />
sehr feine, z. T. bifurkierende<br />
Rippen, die bis d Ä<br />
Rippen, die bis d 1,5 häufig<br />
Ä<br />
Rippen, die bis d 1,5 häufig<br />
Ä<br />
1,5 häufig<br />
Parabelknoten auf den Flanken<br />
aufweisen. Flanken der Alters<br />
wohnkammer fast immer glatt,<br />
relativ grobe Externrippen auf<br />
der ersren Wohnkammerhälfte,<br />
zur Mündung hin feiner wer<br />
dend; manchmal Skulptur ins<br />
gesamt undeutlich.<br />
Auf dem letzten Umgang <strong>des</strong><br />
HT sind rerrokonkave, weit-<br />
ständige, schwache Primärrip<br />
pen sichtbar, die gegen die<br />
Mitte <strong>des</strong> breiten Venters all<br />
mählich verlöschen und dort<br />
durch Schaltrippen vermehrt<br />
sind.<br />
! 7 4<br />
LT<br />
1 9,5<br />
15,8<br />
17,5<br />
17,3<br />
1 8,8<br />
I 7<br />
' 9<br />
19,6<br />
(15)<br />
29<br />
11<br />
25<br />
TT<br />
19±3<br />
12<br />
25<br />
73<br />
57<br />
76+9<br />
57<br />
73<br />
56<br />
(0,7)<br />
0,81<br />
0,77<br />
Ö~8<br />
0,8<br />
Ö~78<br />
0,80<br />
54 SR<br />
52; 3<br />
145<br />
(bt 3a)<br />
bis<br />
cl 1<br />
44 SR 52; 4<br />
54 SR<br />
52 SR<br />
44 SR<br />
45 SR<br />
6<br />
114<br />
197<br />
211<br />
HT 4,8 (6) 106 0,5 19 PR cl 1<br />
52; 5<br />
145
Untergattung Sphaeroptychius LISSAJOUS 1923 (= Schwandorfia ARKELL 1951;; dn: lat. sphaera = Kugel.gr. ptyche = Falte; TA Sphaewptychius buckmani LISSAJOUS 1923.<br />
Kleinwüchsige, mit langen Ohren und einem Externhöcker vor der Altersmündung versehene Vertreter der Gattung. Alterswohnkammer nicht abgeknickt, aber mit kantig werden<br />
dem Innenbug. Vermutlich als Mikroconch der makroconchen Untergattung Bullatimorphites s. Str. zuzuordnen.<br />
B. (Sph.) marginatus<br />
(ARKELL 1951), dn: lat.<br />
margino = einfassen (bezo<br />
An Sutur bei h =<br />
gen auf den kantigen Innen<br />
bug).<br />
Orig. <strong>des</strong> HT nicht auffind<br />
bar. <br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Q<br />
u<br />
2,.- cm<br />
Skulptur d<br />
Feine, auffallend proradiate<br />
Rippen bifurkieren vorwiegend<br />
und erlöschen manchmal vor<br />
dem Altersmundsaum. Stein<br />
kerne können insgesamt fast<br />
völlig frei von Skulptur sein.<br />
Innenbug außergewöhnlich<br />
Untergattung Bomburites ARKELL 1952 \~1reptoceras ENAY 1959,1; TA Am. devauxi GROSSOL'VRE 1891. Kleinwüchsige, mit abgeknickter Alterswohnkammer, Einschnü<br />
rung vor dem Mundsaum und kurzen Ohren versehene Gehäuse. Vermutlich mikroconche Partner der Untergattung Kheraiceras.<br />
B. (B.) suevicus (ROEMER<br />
1911), dn: lat. suebicus =<br />
schwäbisch.<br />
LT in ROEMER 1911, Taf.<br />
7, Fig. 20; Orig. unter Nr.<br />
461-S5 im Geol. Inst, der<br />
Univ. Göttingen.<br />
= Am. microstoma QU.<br />
1886, Taf. 78, Fig. 5.<br />
B. (B.) microstoma (D'ORB.<br />
1S46), dn: gr. mikros =<br />
klein. Stoma = Mund.<br />
HT in D'ORB. 1846, Taf.<br />
142, Fig. 3 u. 4.<br />
= Am. microstoma QU.<br />
18S6, Fig. 3, 4 u. 6.<br />
Von kleinerem B als sucuicus.<br />
3 mm<br />
4 cm<br />
kantig.<br />
Schwache, leicht retrokonkave<br />
Flankenrippen bifurkieren etwa<br />
zur Hälfte, an unterschiedli<br />
chen Stellen. Einem schwa<br />
chen, extern stark vorgezoge<br />
nen Wulst an der Altersmün<br />
dung folgt eine Einschnürung.<br />
Der HT zeigt auf den Innen<br />
windungen konkave, auf der<br />
letzten Windungshälfte<br />
schwach sinusförmige Flanken<br />
rippen, die häufig in Nabelnähe<br />
bifurkieren. An den extern<br />
stark vorstrebenden Mün<br />
dungswulst schließen sich nach<br />
sehr kurzer Einschnürung<br />
kurze, relativ weit außen ste<br />
hende Ohren an.<br />
in cm<br />
HT<br />
2,8<br />
N<br />
in »b<br />
_ i<br />
(3<br />
32<br />
19<br />
33<br />
3,7 25<br />
4,1<br />
23<br />
B<br />
in %<br />
79<br />
46<br />
(46;<br />
62<br />
60<br />
83<br />
58<br />
66<br />
36 (40)<br />
(42'<br />
Q<br />
0,'S<br />
0,77<br />
0,92<br />
0,65<br />
0,66<br />
0.74<br />
0,74<br />
(0,85)<br />
(0.86'<br />
z<br />
26 PR<br />
62 SR<br />
30 PR<br />
68 SR<br />
34 PR<br />
68 SR<br />
30 PR<br />
66 SR<br />
22 PR<br />
52 SR<br />
(65) SR -<br />
(55) SR •<br />
Morrisiceras BUCKM. 1920; dn: J. MORRIS, engl. Geologe <strong>des</strong> 19. Jh.; TA Morrisiceras sphaera BUCKM. 1920. Engnablige Tulitidae mit serpenticonen Anfangs- und cadiconen<br />
Alterswindungen von starker Umfassung. Die knotenlosen Spaltrippen zeigen frühzeitiges Erlöschen der Rippenstiele, wahrend die Externrippen beständiger sind. Von sehr ähnli<br />
cher Form sind manche Macrocephaliten (Unter-Callovium), die jedoch beständigere Rippenstiele und höhere Endgröße aufweisen. Mittel-Bathonium.<br />
Untergattung Morrisiceras s. str.; mittelgroße Formen, deren En dm und säume wenig bekannt sind, an denen jedoch keine Ohren beobachtet wurden. "Arten-. die nur bei außerge<br />
wöhnlich großem Durchmesser (d über 7) Entrollung und Verengung der Wohnkammer zeigten, wurden 1953 von ARKELL als Untergattung Lycetttceras abgespalten, was nicht<br />
gerechttenigt scheint. Vermutlich Partner der folgenden, mikroconchen Untergattung Holzbergia.<br />
AI. 'AI. sphaera BUCKM.<br />
^'2". dn: lat. sphaera =<br />
Ku-cl.<br />
HT unter Nr. 32018 im<br />
Geol. Survev Museum l.or<br />
den.<br />
Xahclahtall und innere Flankenhäifte<br />
skuipturlos. auf der<br />
!HT<br />
i'' ' Mo.O; 1 1<br />
Exteruselte wulstige, niedrige,<br />
schwach pro\erse Rippen. j 6.5<br />
gegen die Mündung stark I 8..<br />
abgeschwächt aber noch<br />
erkennbar. ] ~,2 | 11<br />
9<br />
0.-3<br />
0.S4<br />
0,86<br />
58 SR<br />
56 SR<br />
46 SR<br />
46 SR<br />
52 SR<br />
bi 2c<br />
53; 1<br />
"0<br />
114<br />
1.35
AI. AI. murr-.i, OPPEL<br />
1 S5 -<br />
. dn: s. Gattung.<br />
Art Sutur bei h =<br />
HT ist Am. macroeepbalus<br />
MORRIS u. LYCETT 1851.<br />
Tat. 2. Fig. 5: Orig. unter Nr.<br />
2561" ;m Geo;. Survev<br />
Museum London.<br />
Artliche Trennung von<br />
sphaera tra^ss urdig. da nur<br />
wenig kleineres Ii und genn-<br />
cere End:iroßc.<br />
AI. AI. co..:»;.: BUCKM.<br />
1^21: dn: bt. comma = klei<br />
ner Abschnitt.<br />
HT in ARKELL 1954. Abb.<br />
44: Orig. unter Nr. C 41 "20<br />
im BMNH.<br />
Exemplare unter d = 8 sind<br />
von sphaera kaum zu tren<br />
nen. Ab d = S ...9 starke ;<br />
Egression und Verengung der<br />
\\ bhnkammer.<br />
AI. 'AI. bulbosum (ARKELL<br />
1954», dn: lat. bulbosus =<br />
knollig.<br />
HT ist Pionoceras morrisi<br />
LISSAJOUS 1923, Taf. 22,<br />
Fig. 1; Orig. verschollen.<br />
Große Exemplare zeigen<br />
ähnliche Egression wie<br />
comma; doch ist bnlbosum<br />
breiter und von beständigerer<br />
Skulptur. Sehr selten.<br />
AI. 'AI.) krumbecki ARKELL<br />
1951, dn: L. KRUMBECK,<br />
Geologe in Franken<br />
HT nicht auffindbar.<br />
Gegenüber vorstehenden<br />
Arten höherer Windungs-<br />
querschnitt und dichtere<br />
Berippung. Wohnkammer<br />
wachstum unbekannt.<br />
136<br />
p(l7Vt^<br />
ca. 20 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
hei d =<br />
10 cm<br />
5,6 cm<br />
Skulptur d<br />
Wie bei sphaera setzen die<br />
Externrippen aut den Außen-<br />
windungen in Fbnkenmitte ein<br />
, und lauten wulstig und leicht<br />
provers über den Venter. Ab d<br />
~ 6 werden sie undeutlich.<br />
I Auch die Externskulptur<br />
1 erlischt bei dieser "Art- sehr<br />
j früh, so daß bei ausgewachse<br />
nen Stücken nur einige wenige<br />
Wulstrippen am Beginn der<br />
letzten Windung schwach<br />
sichtbar sind.<br />
Relativ zu den anderen Arten<br />
kraftigere, wulstige Externrip<br />
pen von radialem bis prover-<br />
sem Verlauf, erst kurz vor der<br />
Altersmündung völlig ver<br />
löschend.<br />
Feine, radiale Externrippen sind<br />
bis an das Ende <strong>des</strong> vollständig<br />
gekammerten HT gut aus<br />
geprägt.<br />
in cm<br />
HT 6,1<br />
HT<br />
4,5<br />
.1.2<br />
6,5<br />
9,0<br />
I ',9<br />
I 9,6<br />
12<br />
HT 10,3<br />
j 8,4<br />
|l0,S<br />
N<br />
in %<br />
15<br />
17 65<br />
60<br />
06)<br />
21<br />
11<br />
14<br />
14<br />
16<br />
11<br />
18<br />
16<br />
20<br />
18<br />
MS 20<br />
18<br />
62<br />
62<br />
61<br />
51<br />
5S<br />
45<br />
42<br />
43<br />
o.-x<br />
O.SS<br />
0,84<br />
(0,9)<br />
0,94<br />
0,93<br />
0,98<br />
0,97<br />
1,02<br />
1,19<br />
1,05<br />
25 50 1,0<br />
16 74 0,S2<br />
20 56 0,94<br />
47<br />
50<br />
1,11<br />
1,06<br />
Zone<br />
T.K.<br />
58 SR ; bt 2c<br />
4S SR ; 5<br />
44 SR :<br />
6<br />
I 53; 2<br />
;<br />
~o<br />
52 SR 114<br />
54 SR<br />
44 SR<br />
75 SR<br />
bt 2,<br />
53: )<br />
6<br />
114<br />
bt 2c<br />
53; 4<br />
114<br />
150<br />
bt 2c<br />
54; 1
Untergattung Holzbergu TORRENS 1971 (= Vraesittneria SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1931, S. 851 (Nomen nudum)); dn: Holzberg bei Schwandorf.'Nordbayem; TA Berberke-<br />
ras schwandorfense ARKELL 1951 (in Dissen. ENGELMANN 1924, unveröffj. Kleinwüchsige, relativ evolute Formen mit berippter Alterswohnkammer und Altersmundsaum mit<br />
langen Ohren,<br />
M. (H.) schwandorfense<br />
(ARKELL 1951), dn:<br />
Schwandorf, Fundon in<br />
Nordbayern.<br />
HT nicht auffindbar.<br />
Art Sutur bei h :<br />
Bisher sehr weit gefaßte Art,<br />
mehrere Varianten einschlie<br />
ßend.<br />
s<br />
4 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d -<br />
Skulptur d<br />
Auf den Innenwindungen<br />
retroradiate Primärrippen, die<br />
am Innenbug nach vorn biegen<br />
und auf Flankenmitte wieder<br />
radial werden. Unregelmäßige<br />
Spaltung in zwei oder drei<br />
Exrernrippen, die fast unge<br />
schwächt bis zur Altersmün<br />
dung beständig sind.<br />
in cm<br />
HT 2,4<br />
l<br />
3,0<br />
Oecoptycbhu NEUMAYR 18-8; dn: gr. oecos = Haus, ptychios = gefaltet; TA Nautilus refractus REINECKE 1818. Kleinwüchsige «Spezialisten- mit auffallend exzentrischem<br />
Wachstum und anschließendem Einwärtsknick der Alterswohnkammer und stark modifizierter Altersmündung. Von SCHINDEWOLF 1965 aufgrund der Suturentwicklung den<br />
Tulitidae angeschlossen. Mittleres Callovium.<br />
Oec. refractus (REINECKF<br />
1818'!, dn: lat. refractus =<br />
gebrochen.<br />
LT ist. gemäß ZEISS 19"2,<br />
Art Sutur bei h =<br />
Fig. 29 in REINECKE 1818;<br />
Orig. verschollen.<br />
Wegen der schwierigen Defi<br />
nition entsprechender Para<br />
meter muß auf Maßangaben<br />
verzichtet werden.<br />
Pachyceratidae BUCKM. 19 IS<br />
3,4 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Skulptur<br />
Nach glatten tnnenwindungen<br />
treten feine, dichte Rippen auf,<br />
die schwach und unregelmäßig<br />
geschwungen sind und an einer<br />
feinen schmalen Medianfurche<br />
meist alternierend, manchmal<br />
aber auch gegenständig gegen<br />
überstehen. Manchmal ist die<br />
Medianfurche auch durch eine<br />
feine Kante ersetzt. Neben<br />
schmalen, löffelanigen Ohren<br />
hängt eine mediane «Kapuze"<br />
über der Altersmündung.<br />
2.2<br />
2,S<br />
I 2,6<br />
I 3,3<br />
N<br />
in %<br />
52,j<br />
33<br />
35<br />
3S<br />
3<br />
il 5<br />
3"<br />
32<br />
34<br />
34<br />
30<br />
40<br />
34<br />
1,24<br />
1,40<br />
0,71<br />
1,06<br />
1,0<br />
1.07<br />
1,0<br />
1,08<br />
72 SR<br />
68 SR<br />
56 SR<br />
70 SR<br />
67 SR<br />
85 SR<br />
j Zone<br />
Gehäusebeschreibung Taf.<br />
Nach dem Beginn der Alterswohn<br />
kammer wächst das Gehäuse etwa<br />
1'3 Umgang lang linear, kehn dann<br />
im spitzen \X inkel um und bildet ins<br />
gesamt eine Herzform mit sehr<br />
engem, länglich ausgezogenem<br />
Nabel. Mehrere Autoren unterschei<br />
den eine weniger spitzwinklig abge<br />
knickte Varietät [refractus macrocephali<br />
QU. 1887, Taf. 86 .<br />
Abkömmlinge der Tulitidae mit coronaten, cadiconen oder auch macrocephalitiden Innenwindungen und Mornsicerjs-ähnlichen Außenwändungen von unterschiedlicher Nabel<br />
weite. Den Venter querende Spaltrippen am Innenbug knotig verdickt.<br />
F.rxmnaceras HYATT 1900; dn: gr. erymnos = fest, kompakt, ceras = Horn; TA Am. coronatus BRUGUIERE in D'ORB. 1847. Coronate, mittelweit genabelte Formen (ähnlich leio<br />
ceras mit anfangs kräftigen Spaltrippen. Außenwindungen können glatt und im Alter eingeschnürt sein. CALLOMON betrachrete 1963 Roffierft«JEANNET 1951 als Sexualpart-<br />
ner von Erymnoccras. Mittel- und Ober-Callovium.<br />
•' ' • "•nalum D'ORB.<br />
• w<br />
. dn: lat. coronatus =<br />
-'.eKt >:u.<br />
•Vs R:chtmaß gilt, gemäß<br />
Art Sutur bei h =<br />
ARKELL 195-, Fig. 1, Taf.<br />
'"9 :n D'ORB. 1847.<br />
= .1"!. t-nrrtnniJes ei'jas QU.<br />
1^Tal". 8-, Fig.' )-<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
34 cm<br />
Skulptur<br />
Die Außenwindungen der sehr<br />
großwüchsigen Gehäuse tragen<br />
kräftige, weitständige, konkave<br />
Primärrippen mit größter Höhe<br />
bei 30% Seitenhöhe. 2-3<br />
Sekundärrippen sind ab Flan<br />
kenmitte eingeschaltet und zie<br />
hen leicht geschwächt über den<br />
Venter. Skulpturschw und bei d<br />
« 20.<br />
r~<br />
d<br />
in cm<br />
LT- 34<br />
10<br />
25<br />
N<br />
in %<br />
35<br />
30<br />
(29'-<br />
H Q<br />
in n<br />
Art Sutur bei h =<br />
Er. coronoi<strong>des</strong> (QU. 1887).<br />
dn: gr. - ei<strong>des</strong> = -gestaltig<br />
(ähnlich coronatum, s. o.).<br />
LT ist Fig. 35, Taf. 87 in QU.<br />
1887; Orig. im IGPT.<br />
= Am. coronatus D'ORB.<br />
1847, Taf. 168, Fig. 3, 6 u. "<br />
(nach LEWY 1983).<br />
Kleinwüchsiger als Corona-<br />
tum, anderer Querschnitt ();.<br />
Er. doliforme SAYN u.<br />
ROMAN 1930, dn: lat.<br />
doliaris = dick.<br />
Fig. 2, Taf. 13 in SAYN u.<br />
ROMAN ward zum LT<br />
bestimmt; JEANNET 1951<br />
bez. irrtümlich Fig. 1 als HT.<br />
= Am. parkinsoni inflatus<br />
QU. 1887, Taf..87, Fig. 26 u.<br />
30.<br />
22 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
betd =<br />
<br />
7,5 cm<br />
(D'ORB.)<br />
r\<br />
N./ J<br />
LT 5,5 cm<br />
(verdrückt)<br />
4,5 cm<br />
Skulptur d<br />
Auf dem Nabelabfall <strong>des</strong> LT<br />
schwache, wellig-weitständige<br />
Primärrippen, die an der Stelle<br />
der Maximalbreite zu Knoten<br />
verdickt sind, aus denen 2-3<br />
Sekundärrippen provers ent<br />
springen und konvex den Ven<br />
ter queren. (Der Rippenknick<br />
auf dem LT ist durch Verdrük-<br />
kung vorgetäuscht).<br />
Wulstige Flankenrippen enden<br />
in Knoten auf breitester Stelle<br />
der ausgeptägt coronaten Win<br />
dungen. Zwischen den Knoten<br />
überspannen leicht konvexe<br />
Rippenpaare den nur mäßig<br />
gewölbten Venter.<br />
in cm<br />
LT 5,4<br />
7,5<br />
N<br />
in %<br />
30,5<br />
36<br />
H<br />
in %<br />
41,5<br />
36<br />
Q<br />
(0,8)<br />
0,45 |<br />
Z<br />
(32) SR<br />
15 PR<br />
30 SR<br />
LT 4,5 (43) 28 0,31 cl<br />
Pachyceras BAYLE 1878; dn: gr. paehys = dick, ceras = Horn; TA Am. lalandeanus D'ORB. 1848. Engnablige Gehäuse mit hochovalem Querschnitt, Spaltrippen am gerundeten<br />
Innenbug nur in der Jugend verdickt und auf der externen Flankenhälfte kräftiger und beständiger. Trennung von der sehr ähnlichen Gattung Morrisiceras bei Unkenntnis <strong>des</strong><br />
Fundniveaus problematisch. Als mikroconche Untergattung ward oft Pachyerymnoceras BREISTROFFER 1947 betrachtet. Mittleres und oberes Callovium.<br />
P. lalandeanum (D'ORB.<br />
1847), dn: M. CHAUVTN-<br />
LALANDE, Zeitgenosse<br />
D'ORBIGNYs.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (stark ver<br />
drückt) im MHNP.<br />
CHARPY scheidet 19"6<br />
unter gleichem Artnamen<br />
mikroconche Formen bis<br />
d « 12 gegenüber makrocon-<br />
chen bis d ^ 22.<br />
P. jarryi DOUVILLE 1912;<br />
dn: JARRY, franz. Sammler<br />
<strong>des</strong> 19.Jhd.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen;<br />
NT aufgestellt durch<br />
CHARPY 1976 (als Mikro-<br />
conch gedeutet).<br />
Die von lalandeanum form<br />
verschiedene Art (TA von<br />
Pachyerymnoceras) wurde in<br />
Süddeutschland noch nicht<br />
sichet nachgewiesen.<br />
138<br />
5 \<br />
4,8 mm 12 cm<br />
16 mm 7 cm<br />
Kräftige, leicht konkave, wel<br />
lige Einzelrippen werden durch<br />
Schaltrippen im äußeren Flan<br />
kendrittel vermehrt, wobei TZ<br />
« 3 ist. Ventral bilden sie<br />
schwach konvexe Bogen. Auf<br />
der Alterswohnkammer werden<br />
die Rippen weitständig und<br />
schließlich geschwächt. Der<br />
Venter verschmälert sich im<br />
Alter.<br />
Leicht proradiate, am Innenbug<br />
unregelmäßig einsetzende Rip<br />
pen sind durch Spaltäste und<br />
Schaltrippen vermehrt und zie<br />
hen leicht konvex und nur<br />
wenig geschwächt über den<br />
Venter. Im trichterförmigen<br />
Nabel erscheinen knotige Ver<br />
dickungen am Innenbug der<br />
Jugendwündungen.<br />
HT 11,5<br />
13,8<br />
10<br />
20<br />
HT 7,6<br />
NT 6,8<br />
14,5<br />
16<br />
16±3<br />
16±6<br />
26<br />
28<br />
48<br />
51<br />
TT+4<br />
5Ö±5<br />
50<br />
44<br />
40<br />
1,12<br />
1,23<br />
0,77<br />
0,76<br />
12 PR<br />
38 SR<br />
11 PR<br />
37 SR<br />
38 SR<br />
(30) SR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl 3<br />
54; 6<br />
74<br />
134<br />
149<br />
29~<br />
54; T -<br />
134<br />
197<br />
207<br />
cl 3<br />
54;<br />
44<br />
74<br />
82<br />
211<br />
cl 3<br />
54; 9
Reineckeiidae HYATT 1900<br />
Evolute, teilweise großwüchsige Formen mit breitem bis kreisähnlichem Querschnitt, derprinzipiell im Wachstumsverlauf schmäler wird. Vorwiegend coronatesjugendstadium und<br />
perisphinctide Altersberippung, die extern dicht und - für die Familie typisch - durch eine Furche unterbrochen ist. Meist eine (laterale) Knotenreihe, manchmal auch zwei oder drei,<br />
Windungen sporadisch eingeschnürt. CARIOU 1980 unterscheidet die Unterfamilien Nequeniceratinae und Reineckeiinae, von denen die erstere auf die Anden-Region und Mexiko<br />
beschränkt sein soll. Callovium.<br />
Rehmannia SCHIRARDIN 1956 (Synonymie s. CARIOU 1980); TA Am. rehmanni OPR 1857. Makro- und mikroconche Reineckeiidae mit relativ breitem Jugendquerschnitt und<br />
gerundet breit- oderhochtrapezoidem Altersquerschnitt. Gegenüber der Gattung Reineckeia relativ feine Rippen von vorwiegend perisphinctidem Charakter mit oft im Wachstums<br />
verlauf abnehmender Primärrippendichte. Laterale Dornenreihe zunächst schwach oder in bestimmtem (Jugend) Stadium geschwächt und im Alter - im Gegensatz zu Collotia - an<br />
Stärke zunehmend. Bei einigen Arten zum Wachstumsende Auftreten einer zweiten Dornenreihe. CARIOU trennt die Untergattungen Kebmannia s. str. und Loczyceras BOUR-<br />
QUIN 1968, die er vorwiegend nach skulpturontogenetischen Merkmalen unrerscheider und von denen erstere im Unter-, letztere im Mittel- und Ober-Callovium auftritt. Auf<br />
eine derartige Trennung ward hier verzichtet.<br />
An Sutur bei h =<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
Skulptur d<br />
Rebm. rehmanni (OPP. 1857) Auf den Innenwindungen<br />
HT ist Am. rehmanni OPP.<br />
1862, Taf. 48, Fig. 1; Orig.<br />
verschollen.<br />
mäßig dichte, proradiate Rippen,<br />
die auf 40% Seitenhöhe<br />
|^<br />
bis d = 7 bifurkieren und im<br />
Spaltpunkt gratartig überhöht<br />
sind. Dann folgt ein Stadium<br />
mit zunehmenden Schaltrippen<br />
und runden Knötchen, in dem<br />
die Primärrippen kräftiger und<br />
weitständig werden. Im Alter<br />
kräftige Dornen bei 33% Seitenhöhe<br />
und proverse Sekun<br />
därrippen, ventral unterbro<br />
chen.<br />
30 mm<br />
15,5 cm<br />
Rehm. revilt (PARONA u.<br />
BONARELLI 1897)<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Museum<br />
Turin (Italien).<br />
= Reineckeia postgreppini<br />
KUHN 1939?<br />
Mikroconche Art, von 1<br />
Durchweg hohe, fast ausnahmslos<br />
bifurkierende,<br />
schwach sinusförmige Rippen,<br />
wie im Jugendstadium von rehmanni<br />
mit schwachen Knötchen<br />
an den Spaftpunkten.<br />
Altersstadium mit kräftigen<br />
Knoten und weitständigen Primarrippen<br />
im Gegensatz zu<br />
rehmanni nicht ausgebildet.<br />
CARIOU in rehmanni einbezogen;<br />
unter d = 5 nicht von j 1<br />
jener trennbar, später von<br />
etwas größerem Q.<br />
Rehm. flexuasa CARIOU<br />
1980, dn: lat flexuosus =<br />
(sinusförmig) gekrümmt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT im Geol. Inst.<br />
Poiticrs (Frankreich), Sig.<br />
CARIOU.<br />
= Am. aneeps QU. 1887, Taf.<br />
Hg. 1 (?)<br />
Kleinere Nahelweite u.<br />
andere Skulptur als vorste<br />
hende Arten. ö<br />
11 cm<br />
prokonvexe<br />
14,7 cm<br />
Die anfangs konkaven, bald<br />
jedoch auffallend retrokonka<br />
ven Primärrippen trifurkieren<br />
auf den Innenwindungen in<br />
sehr kleinen Knötchen, zuerst<br />
spitz, dann stumpf. Vor der<br />
Alterswohnkammer kurzes<br />
unbedorntes Stadium, zuletzt<br />
kräftige Knoten über dem<br />
Inncnbug, hohe TZ und leicht<br />
Sekundärrippen.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf. ;-<br />
Lit.<br />
HT (13) (54) (28) 0,8 cl la<br />
5 48 30 33 PR 55; 1<br />
10<br />
11<br />
32<br />
49<br />
50<br />
51<br />
30<br />
28<br />
27<br />
i~5<br />
Tft<br />
1<br />
35 PR<br />
27 PR<br />
23 PR<br />
(78) SR<br />
46 PR<br />
HT 7,9 49 29 1,0 |<br />
1 80 SR<br />
H T<br />
5<br />
10<br />
13<br />
48<br />
50<br />
46<br />
30<br />
30<br />
31<br />
Q~9<br />
Tä<br />
{ H 38 36 1,29<br />
10<br />
18<br />
40<br />
42<br />
35<br />
33<br />
36 PR<br />
44 PR<br />
43<br />
177<br />
178<br />
cl la, b<br />
55; 2<br />
22<br />
43<br />
145<br />
46 PR 180<br />
1,34 |<br />
108 SR<br />
[<br />
22 PR<br />
35 PR<br />
cl 2a<br />
112 SR 55; 3<br />
T~13 29 PR<br />
22 PR<br />
U36)SR<br />
43<br />
197<br />
139
Rehm. britannica (ZEISS<br />
1956), dn: lat. britannica,<br />
Quer Zone<br />
Art Sutur bei h — schnitt Skulptur d N H Q Z Tal.<br />
bei d = in cm in % in % U.<br />
Coronates Anfangsstadium bis<br />
d*3 mit kräftigen Primärrip<br />
HT 5.5 40 37 1,03 |<br />
Fundgebiet Großbritannien pen, die meist trifurkieren und 55; 4<br />
<strong>des</strong> HT. beknotet sind. Mittleres Sta 5,4 42 36 1,06 36 PR<br />
40 PR<br />
96 SR<br />
dium mit reduzierten Knoten 43<br />
HT ist Kellawaysites multico-
Art Sutur bei h —<br />
R. (R.) aneeps {REINECKE<br />
ISIS), dn: lat. aneeps = dop<br />
pelköpfig.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen,<br />
Abb. perspektivisch, Maße<br />
ungewiß; <strong>des</strong>halb Deutung<br />
willkürlich. JEANNET 1951<br />
und ZEISS 1972 befürworten<br />
Aufrechterhaltung der Art bei<br />
ungewissem Variabilitätsum-<br />
fang. Vergl. hierzu CARIOU<br />
1980, S. 380.<br />
R. (R.) kiliani PARONA u.<br />
BONARELLI 1895.<br />
LT ist Fig. 3, Taf. 6 in<br />
PARONA u. BONARELLI<br />
1895 (nach CARIOU).<br />
= Am. parkinsoni coronatus<br />
QU. 1886, Taf. 74, Fig. 16-<br />
19 u. 21; = Am. aneeps QU.<br />
1887, Taf. 87, Fig. 1 u. 2; =<br />
Reineckeia franconica KUHN<br />
1939, Taf. 2, Fig. 16.<br />
Hochmündiger als vorstehen<br />
de Arten, von CARIOU als<br />
Makroconch von R. stnebeli<br />
bestimmt.<br />
R. (R.f) poly'Costa KUHN<br />
1939, dn: gr. polys = viel,<br />
tat. costa = Rippe.<br />
Der HT ist ein pyritisiertes<br />
Jugendexemplar von reichlich<br />
2 cm Größe, so daß die<br />
Zuordnung eines Adult-<br />
Exemplares (von d = 25 in<br />
CARIOU 1980) problema<br />
tisch ist.<br />
^ J<br />
^ J<br />
^ J<br />
^jyy\ß<br />
4,8 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
"ilt-M<br />
3,2 mm 10 cm<br />
ca. IS mm 19 cm<br />
20 cm<br />
(cf.<br />
polycosta)<br />
Skulptur d<br />
Auf innersten Windungen tri-<br />
furkate Radialrippen mit klei<br />
nen Knötchen. Adultstadium<br />
mit kräftigen, pyramidenartigen<br />
Domen, aus denen, oft fächer<br />
artig, je 4 bis 6 Sekundärrippen<br />
entspringen, die meist provers<br />
verlaufen. Einige proverse Ein<br />
schnürungen.<br />
Rippen, mit spitzen Knötchen<br />
besetzt. Ab d = 3 bis 7 Run<br />
dung det Primärrippen und<br />
Anstieg von TZ auf 4 bis 6 mit<br />
proversen Sekundärrippen;<br />
Knoten zu kräftigen Pyramiden<br />
auseinanderfließend. Endsta<br />
dium (d > 20) mit TZ S 3;<br />
Einschnürungen besonders bei<br />
d = 10 deutlich.<br />
in cm<br />
HT 2<br />
5<br />
10<br />
15<br />
5<br />
10<br />
15<br />
N<br />
in %<br />
(48)<br />
48<br />
48<br />
48<br />
Jugendstadium mit bi- oder tri<br />
LT 1<br />
furkierenden, leicht proradiaten<br />
5<br />
' 8<br />
Jugendstadium mit bi- oder tri<br />
(52)<br />
LT 1<br />
furkierenden, leicht proradiaten 1 6,3 (53)<br />
5<br />
' 8<br />
Jugendstadium mit bi- oder tri<br />
(52)<br />
LT 1<br />
furkierenden, leicht proradiaten 1 6,3 (53)<br />
5<br />
' 8 (52)<br />
1 6,3 (53)<br />
1 '3 Seitenhöhe in 3 oder auch<br />
4, leicht prokonkave Sekundär<br />
rippen spalten, die durch<br />
Schaltrippen noch vermehrt<br />
sein können. Das ausgewach<br />
sene cf.-Exemplar in CARIOU,<br />
Taf. 42, trägt auf der Außen<br />
windung 16 große Buckel bei<br />
45% Seitenhöhe, auf die sich<br />
ca. 50 ptokonkave niedrige<br />
Sekundärrippen verteilen.<br />
47<br />
47<br />
47<br />
H<br />
in %<br />
(30)<br />
32<br />
37<br />
30<br />
(26)<br />
(35)<br />
33<br />
30<br />
30<br />
Q<br />
(0,4)<br />
Ö77T<br />
(5789<br />
Ö796<br />
Tfi<br />
Tfi?<br />
I7f3<br />
Z<br />
27 PR<br />
18 PR<br />
TJ PR<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
(16) Kn cl lb<br />
bis<br />
cl 2a<br />
56; 3<br />
u. 4<br />
43<br />
134<br />
211<br />
280<br />
23 PR<br />
43<br />
19 PR 180<br />
18 PR<br />
Auf den Innenvvindungen hohe<br />
20 PR<br />
HT 2,3 (43) 34 0,75 |<br />
Radialrippen, die in Dornen bei<br />
71 SR<br />
Untergattung Reineckeites BUCKM. 1924; TA Reineckeites duplex BUCKM. 1924. Mikroconche Formen der Gattung Reineckeia mit Ohren am Altersmundsaum, die nur selten<br />
erhalten sind.<br />
R. ;'R.) eiisadpta TILL 1911,<br />
du; gr. eu- = wohl, lat. sculp-<br />
tus = skulptiert.<br />
= R. fr.mamtci KUHN' 1959,<br />
In. 4, Fig. 14. = R. sav.iren-<br />
-«•< BOURQUIN 196S pars.<br />
Ähnlich Relmunnu rcuili.<br />
Kleine Dornen erlöschen bei d<br />
~ 2.5; radiale Rippen spalten<br />
bei ca. 45% Flankenhöhe fast<br />
alle in 2. seltener in 3 Sekun<br />
därnppen. Im Alter gehen die<br />
Spaltrippen zunehmend in<br />
Schaltrippen über; die Dornen<br />
«erden zu grat.irtigen Erhö<br />
hungen, die auf der Alters<br />
wohnkammer verschwinden.<br />
HT 5,3<br />
2,9<br />
5<br />
10<br />
(40)<br />
47<br />
43<br />
47<br />
(36)<br />
30<br />
33<br />
29<br />
1,0<br />
0792<br />
T7Ö5<br />
32 PR<br />
26 PR<br />
54 SR<br />
34 PR<br />
38 PR<br />
cl 2a<br />
56; 5<br />
cl 2b<br />
57; 1<br />
u. 2<br />
43<br />
145<br />
141
Quer Zone<br />
Art Sutur bei h = schnitt<br />
Skulptur d N H Q z Taf.<br />
bei d =<br />
in cm in % in %<br />
I it.<br />
R. (R.) corroy,'ZEISS 1956, , r Coronates Jugendstadium mit<br />
"'S<br />
49 28 1,00,<br />
dn: G. CORROY, franz. i ). I
Art<br />
C. fCJ fraasi (OPP. 1857),<br />
dn: O. FRAAS, württ. Geo<br />
loge, 1824-1897.<br />
LT ist (nach SPÄTH 1929)<br />
Fig. 4 auf Taf. 48 in OPP.<br />
1862; Orig. in der BSPG.<br />
Durch zwei kräftige Dornen<br />
reihen im Alter ausgezeich<br />
net.<br />
CJ (Cf) alemannica (ZEISS<br />
1956), dn: Fundpunkt im ale<br />
mannischen Siedlungsbereich.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
Sutur bei h =<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
4 cm<br />
ca. 14 mm 4 cm<br />
Skulptur d<br />
Innenwindungen bis d = 4 bis<br />
8 mit feinen, dichten, proradia<br />
ten Rippen, zunächst bi-, dann<br />
trifurkat. Anfangs jeder Spalt<br />
punkt schwach bedornt, dann<br />
größere Dornenabstände. Ab d<br />
= 3 (am LT) Auftreten zusätzli<br />
cher Dornen bei ca. 70% Sei<br />
tenhöhe. Beide Flankendornen<br />
bleiben noch klein und erlö<br />
schen vorübergehend. Bei d =<br />
8 bis 16 werden beide Dornen<br />
reihen kräftig, die Rippen zie<br />
hen sich auf die Ventralregion<br />
zurück, wo sie an der Median<br />
unterbrechung eine (dritte)<br />
Reihe kleiner Knötchen tragen<br />
können. Tiefe schmale Ein<br />
schnürungen auf mittleren<br />
Windungen.<br />
Konkave bis leicht prokonkave<br />
Rippen bifurkieren in spitzen<br />
Knötchen bei 40 bis 50% Win<br />
dungshöhe. Ab d 2 tritt auch<br />
Trifurkation auf. Ab d Ä<br />
3<br />
Knotenschwächung und Ver<br />
schiebung der Spaltpunkte<br />
nach 30% Windungshöhe.<br />
in cm<br />
LT 3,8<br />
5<br />
10<br />
18<br />
35<br />
44<br />
45<br />
48<br />
JÖ<br />
58<br />
H<br />
in %<br />
33<br />
34<br />
30<br />
23<br />
HT 4 42 36<br />
Untergattung Kellawaysia BOURQUIN 1968; dn: Kellaway(s), Typuslokalität <strong>des</strong> Calloviums; TA Kellawaysia spatbi BOURQUW 1968. Mikroconche Formen der Gattung Collo<br />
tia mit Ohren am Altersmundsaum.<br />
C. (K.) hereticus (MAYER<br />
1865)<br />
= Am. fraasi OPP. 1862, Taf.<br />
48, Fig. 6; = Am. parkinsoni<br />
aneeps QU. 1887, Taf. 87,<br />
Fig. 12, 13, 17 und 19.<br />
Von CARIOU 1980 als<br />
mikroconcher Partner von C.<br />
(C.) fraasi betrachtet.<br />
3,4 <<br />
Feine, dichte, proradiate bis<br />
prokonkave Rippen bifurkieren<br />
oder trifurkieren bei 1/3 Flan<br />
kenhöhe oder bleiben einzeln.<br />
Spaltpunkte bis d = 4 bedornt,<br />
im Alter Zunahme der Einzel<br />
rippen und Verlagerung der<br />
Spaltpunkte zum Innenbug. Ca.<br />
5 Einschnürungen pro Win<br />
dung, sehr ausgeprägt.<br />
1,0<br />
1,25<br />
1,07<br />
5,9 47 30 (1,25) 82 SR<br />
143
Peltoceratidae SPÄTH 1924, sensu SCHINDEWOLF 1966<br />
Evolute Planulatcn mit perisphinctoidcn Innenwindungen; im Alter mit meist zwei, teilweise einer oder drei Reihen kraftiger Dornen bis knotenartiger Verdickungen, Altersqucr-<br />
schnitt vorwiegend quadratisch. Abweichend von den übrigen Perisphincten ist Li ungespalten und die Zahl der Umbilikalloben auf drei beschrankt (<strong>des</strong>halb schloß SCHINDF.<br />
WOLF 1966 die Euaspidoceraten hier an). Oberes Callovium bis Oxfordium.<br />
Peltoceras WAAGEN 1871; dn: gr. peltc = Schild, ceras = Horn; TA Am. athleta PHILLIPS 1 829. Klein- bis großwüchsige Formen mit breitelliptischem Querschnitt der Innenwin<br />
dungen, scharfen, bi- oder trifurkierenden Rippen, die in derjugend knotenlos sind und im Alter weitständig werden. Zwischen den Rippen wird der Altersquerschnitt meist trape-<br />
zoid; durch vorwäegend am Außenbug einsetzende knotige Verdickungen der Rippen erscheinen die Außenwändungen quadratisch. Zusätzliche Knotenreihen am Innenbug oder/<br />
und auf dem Venter; Außenknoten durch Rippen verbunden. Bis heute ist die Aufteilung in eine Vielzahl von Gattungen bzw. Untergattungen unbefriedigend geblieben. Gemäß<br />
PRIF.SER 193" erfolgt hier, unter Berücksichtigung von CALLOMON 1962. die Beschränkung auf die beiden makroconchen Untergattungen Peltoceras s. str. und Peltoccratoi-<br />
<strong>des</strong> sowie die mikroconchen Untergattungen Parapeltoceras, Rursiccras und Parawedekindia.<br />
Untergattung Peltoceras s. str. [=VnipeltocerasJEANNET 1951); makroconche Vertreter der Gattung, deren Rippen am Außenbug gabeln, wo stets kräftige Knoten oder Dornen im<br />
Aber entwickelt werden. Zweite Knotenreihe am Nabelrand im allgemeinen schwächer oder ganz fehlend.<br />
P. (P) athleta (PHILLIPS<br />
1829), dn: Athlet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen;<br />
Orig. <strong>des</strong> NT, aufgestellt<br />
durch SPÄTH 1931, im<br />
BMNH.<br />
Art Sutur bei h :<br />
Gemäß JEANN'ET 1951 die<br />
breiteste aller Peltoceras-<br />
Arten. PRIESER unterschei<br />
det 1937 die Varietät spathi<br />
mit größerem Q. Sehr ähn<br />
lich ist storzi PRIESER.<br />
P. (P.) berckhemeri PRIESER<br />
1937, dn: F. BERCKHEMER,<br />
Abteilungsleiter im Stuttgar<br />
ter Naturkundemuseum,<br />
1890-1954.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT nicht auffind<br />
bar.<br />
Durch Skulpturentwicklung<br />
von athleta geschieden;<br />
flache Einschnürungen lassen<br />
die Berippung unregelmäßig<br />
erscheinen.<br />
P (P.) modelt PRIESER 1937,<br />
dn: R. MODEL, Geologe in<br />
Franken.<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch schmäleren Quer<br />
schnitt und schwächere Kno<br />
ten geschieden. Von ähnlich<br />
schmalem Querschnitt ist P.<br />
oppell PRIESER mit kräftige<br />
ren Außenknoten.<br />
144<br />
21 mm<br />
3,8 mm<br />
l;<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d -<br />
9 Im<br />
4,3 cm<br />
o Auf<br />
Bis d a<br />
Skulptur d<br />
2 feine, scharfe, unbe-<br />
knotete Radialrippen. Von da<br />
ab erscheinen Knötchen am<br />
Außenbug, die zu spitzen Dor<br />
nen anwachsen. Danach<br />
schwellen die Flankenrippen<br />
am Innenbug zu radial aus<br />
gezogenen Knoten an. Zwi<br />
schen den meist alternierenden<br />
Außenknoten spannen sich<br />
anfangs Bündel aus meist 2,<br />
seltener 3 Rippen, die im Alter<br />
in Wülste übergehen.<br />
Gegensatz zu athleta bifur<br />
kieren die meisten der radialen<br />
bis proradiaten Rippen sichtbar<br />
auf den Innenwindungen im<br />
äußeren Flankendrittel; Knöt<br />
chen am Außen- und Innenbug<br />
stellen sich erst später ein als<br />
bei athleta; die Innenknoten<br />
bilden meist die breiteste Win<br />
dungsstelle. Ab d 5 Rippen<br />
schwächung, so daß Dornen<br />
und Externwülste übrig blei<br />
ben.<br />
den Innenwindungen feine,<br />
regelmäßige Radialrippen, die<br />
kurz vor dem Außenbug bifur<br />
kieren. Ab d = 3 treten gleich<br />
zeitig am Innen- und Außen<br />
bug radiale bzw. spitze Knoten<br />
auf, letztere vereinigen meist<br />
mehrere externe Spalt- und<br />
Schaltrippen zu Bündeln.<br />
Gegenüber vorstehenden Arten<br />
bleiben die Knoten relativ zart;<br />
im Alter werden die knotigen<br />
Primärrippen sehr weitständig.<br />
in cm<br />
NT 7,3<br />
4,7<br />
7<br />
H T<br />
1<br />
14,8<br />
N<br />
in %<br />
47<br />
47<br />
45<br />
46<br />
48<br />
46<br />
47<br />
31<br />
32<br />
31<br />
33<br />
31<br />
32<br />
32<br />
(0,68)<br />
0,88<br />
Ö~69<br />
1,0<br />
1,1<br />
14 FR<br />
22 FR<br />
22 FR<br />
47 ER<br />
49 FR<br />
81 ER<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl 3a<br />
58; 1<br />
134<br />
193<br />
211<br />
cl 3a<br />
58; 2<br />
134<br />
193<br />
cl 3a<br />
58; 3<br />
193
An<br />
R (R) trifidum (QU. 1887),<br />
dn: lat. tri- = 3rei-, fi<strong>des</strong> —<br />
das Gespannte, Saite.<br />
PRIESER 1937 bestimmte<br />
Am. athleta QU. 1887, Taf.<br />
88, Fig. 1 zum LT; Orig. im<br />
SMNS.<br />
Externknoten dominieren<br />
gegenüber den Innenknoten<br />
stärker als bei vorstehenden<br />
ArtejT^ß bifidum QU. ent<br />
spricht einem Wachstumssta<br />
dium der An.<br />
P. (P.) dacquei (PRIESER<br />
1937)<br />
Orig. <strong>des</strong> HT scheint ver<br />
schollen.<br />
Von trifidum nur durch<br />
höhere Rippendichte und<br />
sehr wenig größeres N<br />
getrennt.<br />
P. (P.) unispinosum (QU.<br />
1847), dn: lat. unus = einzig,<br />
spinosus = bedornt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (kleines Bruch<br />
stück) im IGPT.<br />
Die Knotenreihe am Innen<br />
bug fehlt dieser Art völlig<br />
(TA der "Gattung" Unipelto-<br />
ceras JEANNET 1951).<br />
Sutur bei h =<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
25 mm 7 cm<br />
n Radiale<br />
Skulptur d<br />
Auf den Innenwindungen sind<br />
die Spaltpunkte der radialen<br />
bifurkierenden Rippen vor der<br />
Naht noch sichtbar. Das Adult<br />
stadium wird durch Vergröße<br />
rung von Rippenabstand und -<br />
Schärfe und manchmal eine<br />
Einschnürung eingeleitet. Dann<br />
entstehen Knoten und schließ<br />
lich Dornen an den Spaltpunk<br />
ten; danach schwellen die Rip<br />
pen am Innenbug an. Die<br />
Externdornen sind strecken<br />
weise durch 3 oder 2 Extern<br />
rippen verbunden (Schaltrip<br />
pen, Gabeläste).<br />
Rippenstiele mit gerade<br />
noch sichtbaren Spaltpunkten<br />
auf den Innenwindungen, Ein<br />
fachrippen selten. Gleichzeitig •<br />
mit Knoten am Außenbug tre<br />
ten Verdickungen am Innenbug<br />
auf. Außenknoten meist durch<br />
Bündel aus 3 Externrippen (1<br />
Schaltrippe) verbunden. Im<br />
Alter Schwächung der Rippen,<br />
Stärkung der Knoten, TZ<br />
etwas größer als bei trifidum.<br />
Auf den Innenwindungen gat<br />
tungstypisch dichte Rippen, die<br />
knotenlos am Außenbug spal<br />
ten. Ab d = 4 werden sie<br />
durch weitständiger werdende<br />
Einzelrippen abgelöst, die über<br />
dem Innenbug anschwellen,<br />
ohne dort knotig zu sein, und<br />
am Außenbug in Knoten<br />
enden. Zwischen den Knoten<br />
anfangs ventrale, gerade<br />
Externrippen, Altersventer<br />
in cm<br />
LT 6,2<br />
HT<br />
3,8<br />
4,3<br />
7,3<br />
9,1<br />
N<br />
in %<br />
40<br />
45<br />
48<br />
47<br />
4S<br />
50<br />
50<br />
H<br />
in %<br />
31<br />
27<br />
33<br />
32<br />
33<br />
30<br />
29<br />
30<br />
0,7<br />
0,61<br />
0,63<br />
0,83<br />
0,78<br />
0,83<br />
0,81 ,<br />
0,75 i<br />
21 FR<br />
(60) ER-<br />
Untergattung Peltoceratoi<strong>des</strong> SPÄTH 1924 {-W'edekmdia SCHINDEWOLF 1925); dn: - ei<strong>des</strong> = ähnlich, Peltoceras s. o.; TA Peltocerassemirugosum WAAGEN 1875. Makroconche<br />
Peltoceraten, deren Rippenspaltpunkte auf dem inneren Flankendrittel liegen. Im Alter ein oder zwei Reihen ausgeprägter Knoten bzw. Dornen.<br />
P P athletonles (LAHUSEN<br />
1SS3), dn: -ei<strong>des</strong> = ähnlich,<br />
athleta v o.<br />
LT gilt LAHUSFNs<br />
C<br />
:>,.} cm<br />
glatt.<br />
Leicht retroradiate Rippen<br />
bifurkieren teilweise am Innen<br />
bug der Innenwindungen, so<br />
daß die Skulptur dort unregel<br />
mäßig erscheint. Ab d 558<br />
4 Ein<br />
zelrippen, nur am Außenbug<br />
(ähnlich unispinosum) bekno<br />
tet. Knoten auf dem gerunde<br />
ten Venter durch leicht kon<br />
vexe Wülste verbunden, die<br />
median etwas geschwächt sind.<br />
LT 5,:<br />
8,8<br />
39 36 3,0<br />
0,96<br />
25 FR<br />
50 ER<br />
17 FR<br />
38 ER<br />
21 FR<br />
53 ER<br />
(32) FR<br />
145
Untergattung Parapeltoccras SCHINDE WOLF 1925; dn: gr. para= neben, Peltoceras s. o.;TA Nautilus annularis REINECKE 1818 (wegen ungenügender Abbildung wurden k-retu<br />
3 andere Typusarten gewählt). Mikroconche Peltoceraten (CALLOMON 1962; mit radialen bis proversen Rippen, die auf der äußeren Flankenhälfte gabeln und schwach beknntci<br />
sein können.<br />
P. (Par.) annulare (REI<br />
NECKE 1818), dn: lat. anu<br />
laris = beringt.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen;<br />
Gattungszugehörigkeit der<br />
Abb. oft bezweifelt. Charak<br />
teristisch scheint QU. 1887,<br />
Fig. 9 auf Taf. 88. P. stolleyi<br />
PRIESER ist äußerst ähnlich.<br />
P. (Par.f) oblongum (QU.<br />
1887), dn: lat. oblongus =<br />
länglich.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT (Am. annularis<br />
oblongus QU. 1887, Taf. 88,<br />
Fig. 12) im SMNS.<br />
Durch hochmündigen Quer<br />
schnitt ausgezeichnet.<br />
P. (Par.) pseudocaprinum<br />
PRIESER 1937, dn: gr. pseu-<br />
do- = falsch, caprinum s. u.<br />
Zum LT wird hier PRIESER<br />
1937, Taf. 3, Fig. 4<br />
bestimmt; Orig. nicht auf<br />
findbar.<br />
Von oblongum durch breite<br />
ren Querschnitt geschieden.<br />
Ähnlich, aber von etwas grö<br />
ßerer TZ ist bathyomphalum<br />
PRIESER.<br />
P. (Par.f) kaisert PRIESER<br />
1937.<br />
Ähnlich breitmündig wie<br />
pseudocaprinum, aber, ebenso<br />
wie erckenbergense PRIESER,<br />
mit radialen und nicht retro<br />
versen Sekundärrippen.<br />
P. (Par.) trapezoi<strong>des</strong> PRIESER<br />
1937, dn: trapezförmig.<br />
Zum LT wird hier das Orig.<br />
zu PRIESER 1937, Taf. 4,<br />
Fig. 4 bestimmt (in der<br />
BSPG).<br />
Von vorstehenden Arten<br />
durch anderen Querschnitt<br />
und größere TZ geschieden.<br />
146<br />
Sutur bei h •<br />
10 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
2,5 cm<br />
3,7 cm<br />
4 cm<br />
ca. 14 mm ca. 5 cm<br />
Skulptu d<br />
Vorwiegend radiale Rippen, die<br />
auf Flankenmitte bifurkieren<br />
und den Venter queren. Einzel<br />
rippen sporadisch, Knoten<br />
scheinen zu fehlen.<br />
P berzogenauense PRIESER<br />
1937 könnte eine dichter<br />
herippte Varietät sein.<br />
Auf den Innenwindungen<br />
dichte, radiale Rippen, von<br />
denen etwa jede zweite auf<br />
Flankenmitte bifurkiert. Extern<br />
rippen leicht konkav, im<br />
Wachstumsverlauf leicht kon<br />
vex werdend. Oft sind die im<br />
Alter nach außen rückenden<br />
Spaltpunkte leicht knotig ver<br />
dickt.<br />
Radiale Rippenstiele bifurkieren<br />
bei ca. 70% Flankenhöhe zu<br />
retroversen Sekundärrippen<br />
oder ziehen ungeteilt leicht<br />
konkav über den Venter, im<br />
Alter dort oft wulstig verdickt.<br />
Sporadisch können Spaltpunkte<br />
leicht beknotet sein, und 2<br />
Stiele darin zusammenlaufen.<br />
Auf den Innenwindungen<br />
erfolgt die Rippenspaltung in<br />
der Mitte der (im Gegensatz zu<br />
pseudocaprinum) sehr niedrigen<br />
Flanken, später im äußeren<br />
Drittel. Zahl der Einzelrippen<br />
mit dem Alter zunehmend,<br />
Rippenverlauf meist radial,<br />
manchmal leicht retroradiat,<br />
extern leicht konkav; Spalt<br />
punkte oft knotig verdickt.<br />
Relativ zu anderen Arten weit<br />
ständige, radiale Primärrippen,<br />
bei 2/3 Flankenhöhe bi- oder<br />
trifurkierend, dazwischen häu<br />
fig Einzelrippen. Altersrippen<br />
am Außen- und Innenbug kno<br />
tig verdickt, wobei die Spalt<br />
punkte zum Außenbug<br />
hochrücken können. Externrip<br />
pen nahezu gerade.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
HT 2,5 (50)<br />
HT<br />
3,3<br />
4,5<br />
LT 3,7<br />
12,5<br />
3,1<br />
3<br />
13,6<br />
4,3<br />
LT 4,f<br />
I 2,4<br />
I 3,4<br />
48<br />
42<br />
42<br />
49<br />
51<br />
51<br />
51<br />
50<br />
46<br />
45<br />
47<br />
44<br />
(28)<br />
30<br />
34<br />
34<br />
30<br />
25<br />
28<br />
27<br />
27<br />
30<br />
34<br />
28<br />
31<br />
(0,9)<br />
1,03<br />
0,94<br />
1,04<br />
0,84<br />
0,68,<br />
0,78<br />
0,78<br />
0,82 |<br />
0,80<br />
0,93 |<br />
0,73 .<br />
0,82
P. (Par.) bayki PRIESER<br />
Art Sutur bei h =<br />
1937, dn: E. BAYLE, franz.<br />
Geologe, 1819-1895.<br />
HT ist Am. athleta PHILLIPS<br />
in BAYLE 1878, Taf. 49, Fig.<br />
9.<br />
Obwohl nur leicht beknotet,<br />
dominieren die Nabelknoten<br />
(von JEANNET 1951 <strong>des</strong><br />
halb in Metapeltoceras<br />
SPÄTH einbezogen).<br />
P. (Par.) subannulosum PRIE<br />
SER 1937, dn: lat. sub- =<br />
untergeordnet, anulosus<br />
= Rursiceras-Art (s. u.).<br />
Zum LT wird hier das Orig.<br />
zu PRIESER 1937, Taf. 3,<br />
Fig. 7 bestimmt (in der<br />
BSPG).<br />
Übergangsform zu Rursiceras<br />
mit stark retroversen Sekun-<br />
därrippen. Sehr ähnlich ist<br />
pseudotorosum PRIESER bei<br />
etwas größerem Q und klei<br />
nerer TZ.<br />
13 mm<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
n<br />
6,4 cm<br />
o<br />
5,4 cm<br />
Skulptur d<br />
Feine, regelmäßige Radialrip<br />
pen spalten auf den Innenwin<br />
dungen streckenweise dicht vor<br />
der Nabelnaht, später am<br />
Außenbug in 2 oder 3 Gabel<br />
äste. Auf der Außenwindung<br />
(ab d = 4) Knoten in den<br />
Spaltpunkten und, radial<br />
gedehnt, am Innenbug.<br />
Scharfe, radiale Primärrippen,<br />
die bei ca. 70% Flankenhöhe<br />
zu retroversen Externrippen<br />
bifurkieren. Häufigkeit von<br />
Etnzelrippen nimmt mit dem<br />
Alter zu; extern gehen die Rip<br />
pen gerade, spater leicht kon<br />
kav und verdickt sowie median<br />
etwas niedergedrückt über den<br />
Venter.<br />
in cm<br />
HT 6,0<br />
13,7<br />
1.6,0<br />
f4,2<br />
15,4<br />
N<br />
in %<br />
46<br />
50<br />
49<br />
51<br />
50<br />
50<br />
51<br />
H<br />
in %<br />
30<br />
25<br />
25<br />
27<br />
30<br />
21<br />
21<br />
Q<br />
Z<br />
0,73 37 FR<br />
34 FR<br />
0,75 J 79 ER<br />
0,86<br />
24 FR<br />
46 FR<br />
31 FR<br />
1,01 |<br />
75 ER<br />
0,80 38 FR<br />
36 FR<br />
0,82 j 65 ER<br />
Untergattung Rursiceras BUCKM. 1919; dn: lat. rursus — rückwärts, gr. ceras = Horn; TA Am. r
Art<br />
P. K. relTJitum PRIESER<br />
193". dn: lat. retractus =<br />
versteckt Gabelpunkte).<br />
Orig. <strong>des</strong> HT in der BSPG.<br />
Durch gestreckte, retrora<br />
diate Rippen mit Spaltpunk<br />
ten am Außenbug aus<br />
gezeichnet.<br />
P. !RJ) fihtum (QU. 1887),<br />
dn: lat. filum = Faden.<br />
HT ist Am. jnmtlaris fiiitits<br />
QU. 188". Taf. 88, Fig. 20;<br />
Orig. im SMNS.<br />
Durch besondere, fadenarrige<br />
Skulptur gekennzeichnet.<br />
Sutur bei h =<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
o<br />
3,7 cm<br />
{ )<br />
4 cm<br />
Skulptur d<br />
8 3<br />
Ab d 1 sind die Gabelpunkte<br />
der retroradiaten, spater retro-<br />
konvexen Spaltrippen nicht<br />
mehr sichtbar. Zahlreiche Rip<br />
pen bleiben ungespalten, so<br />
daß TZ etwa 1,7 beträgt. Im<br />
Alter werden die Rippen weit<br />
ständiger, Knoten und Ohren<br />
sind nicht erwähnt.<br />
Auf den Innenwindungen feine,<br />
regelmäßige, leicht konkave<br />
Rippen, ab d == 2,5 auf der<br />
Flanke weitständig werdend,<br />
während extern zunehmende<br />
Schaltrippchen konstante<br />
Dichte verursachen. Auf der<br />
(Alters-?) Wohnkammer <strong>des</strong><br />
HT sehr weitständige, fadenar<br />
tige, retrokonvexe Primärrip<br />
pen, Externskulptur unregelmä-<br />
ßi g.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
HT 3,7 50 27 0,-8 |<br />
Q<br />
Z<br />
39 FR<br />
68 ER<br />
28 FR<br />
HT 4,3 46 30 0,91 j 62 ER<br />
Paraspidoceras SPÄTH 1925; dn: gr. para- = bei, Aspidoceras = Schildhorn; TA Am. meriani OPP. IS63. Sehr evolute, mit breitrechteckigem bis breittrapezoidem Querschnitt und<br />
schwach gerundeter Externfläche versehene Gehäuse. Skulptur aus radialen oder parabelförmigen Rippen, im Alter weitständig, wulstig und den kräftigen Dornen oder Knoten<br />
am Außenbug untergeordnet. Zweite Knotenreihe zum Teil am Innenbug in bestimmten Altersstadien. Nach ZEISS 1962 tritt von den drei Untergattungen Paraspidoceras s. str.,<br />
Struebinia ZEISS und Extranodites nur die letztere bereits im Ober-Callovium auf. Die von MILLER 1968 aufgestellte, hiervon abweichende Gliederung wird von GYGI, SADATI<br />
u. ZEISS 1979 abgelehnt.<br />
Untergattung Extranodites JEANNET 1951; dn: äußerlich beknotet; TA Extranodites knechti JEANNET 1951 (gemäß ZEISS 1962, S. 22). Paraspidoceraten mit Parabelrippen und<br />
in Wachstumsrichtung an der Basis verlängerten sowie ventral abgeplatteten Externdomen, die manchmal im Alter rundlich werden.<br />
P. (E.) inierninodatum ZEISS<br />
Auf<br />
1962, dn: mit inneren Kno<br />
t r<br />
ten versehen. < ><br />
HT ist Am. bakeriae distractus<br />
QU. 1887, Taf. 89, Fig.<br />
3; Orig. im IGPT.<br />
P. (E.) raricostatumZElSS<br />
1962, dn: lat. rarus = selten,<br />
i costatus = berippt.<br />
HT ist Am. bakeriae distractus<br />
QU. 1887, Taf. 89, Fig.<br />
7 ; Orig. im SMNS.<br />
Durch sehr weitständige Rip<br />
pen (Dornen) ausgezeichnet.<br />
148<br />
Auf der äußeren Windung <strong>des</strong><br />
HT rreten, an der Naht begin<br />
nend, konkave Parabelrippen<br />
auf, die zum vorderen Ende<br />
der langen, nabelwärts<br />
gekrümmten Externdornen<br />
vorschwingen und sich schnell<br />
durch Verstärkung ihres vor<br />
deren Teils in Radialrippen<br />
umwandeln, die sich am Innen<br />
bug zu Knoten verdicken.<br />
Während diese spitzer werden,<br />
schwächt sich die Rippe zwi<br />
schen Intern- und Externdorn<br />
ab.<br />
4,8 cm<br />
Auf den Innenwindungen<br />
nahezu radiale, schwache<br />
Wülste; Parabelrippen kaum<br />
wahrnehmbar, erstes Auftreten<br />
bei d Ä i Auf den Innenwindungen<br />
nahezu radiale, schwache<br />
Wülste; Parabelrippen kaum<br />
wahrnehmbar, erstes Auftreten<br />
bei d 1 in Sinusform. Im<br />
Ä<br />
Auf den Innenwindungen<br />
nahezu radiale, schwache<br />
Wülste; Parabelrippen kaum<br />
wahrnehmbar, erstes Auftreten<br />
bei d 1 in Sinusform. Im<br />
Ä<br />
1 in Sinusform. Im<br />
2,3 cm<br />
äußeren Teil der Parabel (kon<br />
vex) entsteht der Externkno<br />
ten, der seine Basis in Spiral<br />
richtung verbreiten. Extern<br />
konkave Rippchen; im Alter<br />
werden die Rippen auf der<br />
äußeren Flankenhälfte radial.<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl 3a<br />
59; 6<br />
195<br />
cl 3<br />
59; 1<br />
197<br />
HT 4,8 43 35 0,6 17 EKn cl 3b<br />
14,8<br />
16,5<br />
43<br />
(50)<br />
34<br />
(30)<br />
0,79<br />
(0,87)<br />
(20)<br />
(18)<br />
59; 8<br />
197<br />
279<br />
HT 2,3 41 38 10 cl 3<br />
1,5 39 •35 0,85 8 59; 9<br />
197<br />
279
P. (E.) distractum (QU.<br />
Art Sutur bei h =<br />
1857), dn: lat. distractus =<br />
auseinandergezogen (Quer<br />
schnitt).<br />
LT ist Am. bakeriae distractus<br />
QU. 1887, Taf. 89, Fig. 6 (=<br />
Am. bakeriae QU. 1849, Taf.<br />
16, Fig. 7); Orig. im IGPT.<br />
Von raricostatum durch dich<br />
tere Dornen, von interuino-<br />
datum durch fehlende Intern<br />
knoten geschieden.<br />
P (E.) aculifer ZEISS 1^62,<br />
Quer<br />
schnitt<br />
bei d =<br />
TT<br />
UJ<br />
3,7 cm<br />
dn: lat. aculeus = Stachel,<br />
fero — tragen. <br />
HT ist das Orig. Kr. 326 der<br />
Sig. OECHSLE, Kuchen/Fils.<br />
Ähnlich interninodatum, aber<br />
mit spitzeren und weniger<br />
dichten Internknoten.<br />
6,4 cm<br />
Skulptur d<br />
Kleine Extemknoten bereits<br />
auf den Innenwindungen, para<br />
belartige Rippen enden an<br />
ihren Vorderkanten und erlö<br />
schen früh, stellen sich aber auf<br />
der Innenhälfte der Außenwin-<br />
dung schwach wieder ein.<br />
Internknoten fehlen.<br />
Externknoten mit runder Basis<br />
und spitze Interndornen sind<br />
auf der Außenwändung <strong>des</strong> HT<br />
durch fibulare Rippen verbun<br />
den, die ein elliptisches Feld<br />
einschließen.<br />
in cm<br />
N<br />
in %<br />
H<br />
in %<br />
12 FR<br />
LT 3,7 43 31 0,9 1 14 Kn<br />
Q<br />
Z<br />
Zone<br />
Taf.<br />
Lit.<br />
cl 3b<br />
59; 10<br />
197<br />
279<br />
HT 6,4 44 35 0,85 12 Kn cl 3b<br />
5,2 43 3"" 0,88 14 Kn 59; 11<br />
Euaspidoceras SPÄTH 1931; dn: gr. Eu- = wohl-, echt-, Aspidoceras — Schildhorn; TA Am. perarmatus SOW. 1S22. Sehr evolute Gehäuse mit meist quadratischem Querschnitt,<br />
Gabel- und Parabelrippen auf den Innenwindungen, zwei Knotenreihen, verbunden durch kräftige Rippen, auf den Au/?enwindungen. Gattungsrang fragwürdig. Oberstes Callo<br />
vium.<br />
Eu. biarmatum (ZIETEN<br />
1831), dn: lat. bi- = zwei<br />
fach, armatus = bewaffnet.<br />
Orig. <strong>des</strong> HT verschollen.<br />
2,5 cm<br />
Die Abb. <strong>des</strong> HT zeigt prora-<br />
diat gedehnte Wülste dicht<br />
über dem Innenbug. Der flache<br />
Venter wird durch Dornen ver<br />
breitert, die sich, ebenfalls pro-<br />
radiat, etwas auf die Flanke<br />
ausdehnen.<br />
HT 2,5 (36) (40) 0,8<br />
279<br />
286<br />
149
TAFEL 1<br />
1 Partschicems esulcatum (QU. 1887), HT, Ober-Callovium, Öscliingen bei Mössingen/Württ.; Orig. zu QU. 1887, Taf. 86, Fig. 2S;<br />
SMNS, Nr. 28459; X 1,34<br />
2 Callipbylloceras bajociense (POMP. 1893), «Braunerjura alpha», Ottenbach bei Schwäbisch Gmünd; Orig. zu Am. heteropbylhis opaüni<br />
QU. 1886, Taf. 56, Fig. 10; IGPT; X 1,34<br />
3 Calliplrylloceras dispttiabile (ZITTEL 1868), LT, Mittlerer Jura, Swinice (Nordwest-Polen); = Am. tatricus PUSCH, aus KUDER-<br />
NATSCH 1852, Taf. 1, Fig. 1 u. 2<br />
4 Holcopbylloceras zignodianum (D'ORB. 1848), «Omatenton», Jungingen bei Hechingen; Orig. zu Am. tortisulcatus ornati QU. 1887,<br />
Taf. 86, Fig. 32; SMNS, Nr. 28461; X 1,18<br />
5 Soicerbyceras antecedens (POMP. 1893), oberes Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. heteropbyllus ornati QU. 1887,<br />
Taf. 86, Fig. 24; SMNS, Nr. 27789; X 1,34<br />
6 Sowerbyceras ovale (POMP. 1893), oberes Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Pbylloceras transiens POMP. 1893, Taf. 1, Fig.<br />
6; SMNS, Nr. 27792; X 1,34<br />
7 Soicerbyceras subtortisulcatiim (POMP. 1893), "Brauner Jura zeta», Ursulaberg bei Pfullingen; Orig. zu Am. tortisulcatus ornati QU.<br />
1887, Taf. 86, Fig. 34; SMNS, Nr. 28463/1; X 1,34<br />
8 Lytoceras penicillatum (QU. 1886), HT, «Brauner Jura alpha», Gammelshausen/Württ.; Orig. zu QU. 1886, Taf. 56, Fig. 7; IGPT;<br />
X0,22<br />
9 Lytoceras amplum (OPP. 1862), HT, oberes Aalenium (murcbisonae-Zone), Aalen; Orig. zu OPP. 1862, Taf. 45, Fig. 1; BSPG; X 0,49<br />
152
Tafel 2<br />
1 Lytoceras eu<strong>des</strong>ianum (D'ORB. 1845), «Kiesschicht <strong>des</strong> Braunjura delta», Pfullingen; Orig. zu Am. fimbriatiisgigas QU. 1886, Taf. 68,<br />
Fig. 1 u. 2; SMNS, Nr. 28575; X 0,24<br />
2 Pacbylytoceras torulosum (ZIETEN 1831), unteres Aalenium, Ottenbach bei Schwäbisch Gmünd; IGPT, Nr. 1626/1<br />
3 Pacbylytoceras dilucidum (OPP. 1856), HT, Braunjura alpha, Metzingen/Württ.; Orig. zu OPP. und POMP. 1896, Taf. 12, Fig. 8; BSPG<br />
4 Pachylytocers dilucidum (ZIETEN 1831), unterer Braunjura alpha, Krehbach bei Wilsgoldingen (Schwäbisch Gmünd); Orig. zu Am.<br />
tondosus QU. 1886, Taf. 55, Fig. 28; IGPT<br />
5 Pacbylytoceras taeniatum (POMP. 1896), LT, unterer Braunjura alpha, Goldbachle bei Schwäbisch Gmünd; Orig. zu POMP. 1896, Taf.<br />
12, Fig. 7; BSPG<br />
6 Hammatoceras sieboldi (OPP. 1862), HT, Zone <strong>des</strong> «Am, murchisonae-, Aalen; Orig. zu OPP. 1862, Taf. 46, Fig. 1; BSPG<br />
154
Tafel 3<br />
1 Hammatoceras diadematoi<strong>des</strong> (MAYER 1871), Ober-Aalenium (concavum-Zone), Metzingen/Württ.; Orig. zu RIEBER 1963, Taf. 8,<br />
Fig. 8; IGPT Cc 1211/72<br />
2 Hammatoceras insignoi<strong>des</strong> (QU. 1886), LT, «Braunjura Oberbeta oder Untergamma», Schörzingen bei Rottweil; Orig. zu Am. sowerbyi<br />
insignoi<strong>des</strong> QU. 1886, Taf. 61, Fig. 10; IGPT<br />
3 Plaiiammatoceras planiforme BUCKM. 1922, Ober-Aalenium {murcbisonae-Zone), Wochenberg bei Schömberg/Balingen; Orig. zu<br />
RIEBER 1963, Taf. 8, Fig. 10; IGPT Ce 1211/69; X 0,62<br />
4 Planammatoceras auerbachense (DORN 1935), JTT, Auerbaeh/Frankenalb, Ober-Aalenium (obere mitrchisonae-Zonc); Orig. zu<br />
DORN 1935, Taf. 1, Fig. 1; IGPEN<br />
5 Tmetoceras scissum (BENECKE 1865), Aalenium, Saint Quentin (Nordostfrankreich); aus ROMAN & BOYER 1923, Taf. 6, Fig. 6<br />
(=HT von Tmetoceras regleyi DUMORTIER)<br />
156
Tafel 4<br />
1 Erycites labrosus (QU. 1886), HT, «Torulosus-Schicht» <strong>des</strong> Unter-Aaleniums, Bodelshausen bei Tübingen; Orig. zu QU. 1886, Taf. 56,<br />
Fig. 11; IGPT; X 0,67<br />
2 Eudmetoceras amplecteits (BUCKM. 1889), Tonmergel zwischen Concava- und Discites-Bank (oberstes Aalenium), Eschacher Bergrutsch<br />
bei Blumberg/Baden; Orig. zu BAYER 1969a, Taf. 26, Fig. 2; Paläont. Inst, der Techn. Univ. Stuttgart S 1033<br />
3 Eudmetoceras euaptetum (BUCKM. 1922), Tonmergel zwischen Concava- und Discites-Bank (oberstes Aalenium), Eschacher Bergrutsch<br />
bei Blumberg/Baden; Orig. zu BAYER 1969a, Taf. 24, Fig. 1; Paläont. Inst, der Techn. Univ. Stuttg. S 1028<br />
4 Oppelia subradiata (SOW. 1823), HT, Inferior Oolite (vermutlich SBMZS-Zone), «Straße zwischen Bath und Bristol» (England); aus<br />
BUCKM. 1908, Taf. 6, Fig. 3<br />
5 Oxycerites aspidoi<strong>des</strong> (OPP. 1857), HT, obere parkinsoni-Zone (Ober-Bajocium), Ipf bei Bopfingen/Ostalb; Orig. zu OPP. 1862.<br />
Taf. 47, Fig. 4; BSPG; X 0,76<br />
158
Tafel 5<br />
1 Oxycerites yeovilensis ROLLIER 1911, HT, Unter-Bathonium, Yeovil (Südengland); Orig. zu Oppelia fusca WAAGEN 1869, Taf. 16,<br />
Fig. 6; BSPG<br />
2 Oxycerites seebacbi (WETZEI. 1950), Wuerttembergica-Schichten (Unter-Bathonium), Eimen/Hils (Niedersachsen); Orig. zu<br />
Oppelia (Oxycerites) fusca seebacbi WETZEL 1950, Taf. 9, Fig. 9; Geol. Inst. Göttingen Nr. 561-8<br />
3 Oxycerites oxus (BUCKM. 1926), subcontractus- oder morissi- Zone (Mittel-Bathonium), Bopfingen-Oberdorf/Ostalb; Orig. zu<br />
DIETL u. KAPITZKE 1983, Taf. 1, Fig. 4; SMNS Nr. 26686<br />
4 Oxycerites orbis (GIEBEL 1852), orbis-Zone (Ober-Bathonium), Bisingen-Thanheim/Zollernalb; Orig. zu DIETL 1982, Taf. 3, Fig. 1<br />
SMNS Nr. 26546; X 0,66<br />
5 Oxycerites subcostarius (OPP. 1862), HT, macroeepbalus- Zone (Unter-Callovium), Geisingen bei Donaueschingen; Orig. zu OPP.<br />
1862, Taf. 48, Fig. 2; BSPG<br />
6 Oecotraustes (Oecotraustes) nivernensis (DE GROSSOUVRE 1918), Fuscus-Bank (Unter-Bathonium), Lochenbach bei Balingen;<br />
Orig. zu HAHN 1968, Taf. 3, Fig. 8; Paläont. Inst, der Univ. Zürich, Sig. H. RIEBER<br />
7 Oecotraustes (Oecotraustes) bradleyi ARKELL 1951, Fuscus-Bank (Unter-Bathonium), Lochenbach bei Balingen; Orig. zu HAHN<br />
1968, Taf. 4, Fig. 5; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg Nr. Ba 22<br />
8 Oecotraustes (Oecotraustes) pygmaeus (ARKELL 1951), Fuscus-Bank (Unter-Bathonium), Lochenbach bei Balingen; Orig. zu HAHN<br />
1968, Taf. 4, Fig. 4; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg Nr. Ba 40<br />
9 Oecotraustes (Oecotraustes) deeipiens (DE GROSSOUVRE 1919), Fuscus-Bank (Unter-Bathonium), Lochenbach bei Balingen; Orig.<br />
zu HAHN 1968, Taf. 3, Fig. 4; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg Nr. Ba 35<br />
10 Oecotraustes (Paroecotraustes) fuscus (QU. 1846), Unter-Bathonium, Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. fuscus QU. 1887, Taf. 75,<br />
Fig. 6; SMNS, Nr. 28297; X 1,8<br />
11 Oecotraustes (Paroecotraustes) maubeugei STEPHANOV1966, HT, kondensiertes Mittel- und Ober-Bathonium, Prevala/Michailovgrad<br />
(Bulgarien); aus STEPHANOV 1966, Taf. 5, Fig. 1; Orig. im Geol. Inst. Sofia (Bulgarien)<br />
12 Prohecticoceras retrocostatum (DE GROSSOUVRE 1888), Ober-Bathonium, Blanaz, St. Rambert-en-Bugey (Ain, Südfrankreich); aus<br />
ELMI 1967, Taf. 5, Fig. 7; Orig. im Naturhist. Museum Lyon, Sig. DUMORTIER<br />
13 Eobecticoceras primaevwn (DE GROSSOUVRE 1919), Unter-Bathonium, Heusteige bei Eningen/Achalm; Orig. zu Am. pustulatus<br />
parkinsoni QU. 1887, Taf. 86, Fig. 7; SMNS, Nr. 28449/1; X 1,34<br />
160
Tafel 6<br />
1 Eohecticocerasbiflexuosum (D'ORB. 1846), HT, Ober-Bathonium, Niort/Deux-Sevres (Westfrankreich); aus D'ORB. 1846, Tif. 147,<br />
Fig. 1 u. 2<br />
2 Hecticoceras (Hecticoceras) bectkum (REINF.CKE 1818), obere Macrocephalen-Schichten (Unter-Callovium), Herznach (Schweiz);<br />
aus JEANNET 1951, Taf. 9, Fig. 2<br />
3 Hecticoceras (Hecticoceras) hecticum boginenseVETlTCLERC 1915, HT, Unter-Callovium, Bouin/Deux-Sevres (Westfrankreich); aus<br />
PET1TCLERC 1915, Taf. 1, Fig. 4<br />
4 Hecticoceras (Hecticoceras) hecticum posterius ZEISS 1959, HT, Mittel- und Ober-Callovium, Balingen-Streichen; Orig. zu Am. cf.<br />
bipartitus QU. 1887, Taf. 85, Fig. 14; SMNS, Nr. 28408<br />
5 Hecticoceras (Zieteniceras) zieteni DE TSYTOVITCH 1911, HT, Ober-Callovium, Cret de Chälame bei Chezery (Südostfrankreich);<br />
Orig. zu DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 1, Fig. 2; Museum der Naturgesch. Genf<br />
6 Hecticoceras (Zieteniceras) tubeiculatum ZEISS 1956, HT, coronatum-Zonc (Mittel-Callovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu<br />
ZEISS 1956, Taf. 1, Fig. 18; SMNS, Nr. 29972<br />
7 Hecticoceras (Zieteniceras) evoiutum LEE 1905, HT, Mittel-Callovium, La Faucille (Westschweiz); Orig. zu LEE 1905, Taf. 1, Fig. 6;<br />
Museum der Naturgesch. Genf<br />
8 Hecticoceras (Zieteniceras) sarasini DE TSYTOVITCH 1911, HT, Mittel-Callovium, La Riviere bei Chezery (Südostfrankreich); Orig.<br />
zu DE TSYTOVITCH 1911, Tif. 2, Fig. 2; Museum der Naturgesch. Genf<br />
9 Hecticoceras (Zieteniceras) karpinskyi DE TSYTOVITCH 1911, HT, Mittel-Callovium, La Riviere bei Chezery (Südostfrankreich);<br />
Orig. zu DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 2, Fig. 4; Museum der Naturgesch. Genf<br />
10 Hecticoceras (Zieteniceras) balinense BONARELLI 1894, HT, macrocepbahts-Zowt (Unter-Callovium), Baiin (Südwestpolen); aus<br />
NEUMAYR 1871, Taf. 9, Fig. 6<br />
11 Hecticoceras (Zieteniceras?) inflatum DE TSYTOVITCH 1911, HT, Mittel-Callovium, Les Hautes bei Chezery (Südostfrankreich);<br />
Orig. zu DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 8, Fig. 9; Museum der Naturgesch. Genf<br />
12 Hecticoceras (Chanasia) aureum ZEISS 1959, HT, Unter-Callovium, Ützing/Oberfranken; aus KRUMBECK 1936, S. 119, Fig. 5<br />
13 Hecticoceras (Chanasia) perlatum (QU. 1887), LT, Macroeephalen-Oolith, Geisingen-Gutmadingen/Baden; Orig. zu Am. hecticus<br />
perlatus QU. 1887, Taf. 82, Fig. 1; IGPT<br />
14 Hecticoceras (Chanasia) keilbergense KUHN 1939, HT, Unter-Callovium, Keilberg bei Regensburg; aus KUHN 1939, Taf. 4, Fig. 7<br />
15 Hecticoceras (Chanasia) parallelum (REINECKE 1818), calloviense-Zone (Unter-Callovium), Ützing/Oberfranken; aus KUHN 1939,<br />
Taf. 5, Fig. 8<br />
162
Tafel 7<br />
1 Hecticoceras (Chanasia) anoiiialuiii ELMI1967, Unter-Callovium (?), Linsengraben bei Metzingen-Glems; Orig. zu Am. becticus QU<br />
1887, Taf. 82, Fig. 2; IGPT<br />
2 Hecticoceras (Brightia) nodosum BONARELLI 1894, Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. becticus noilosusQU. 1887,<br />
Taf. 82, Fig. 10; SMNS, Nr. 28341<br />
3 Hecticoceras (Brightia) nodosum recuwum ZEISS 1956, HT, Callovium, Gammelsliausen/Württ.; Orig. zu Am. becticusnodosusQU.<br />
1887, Taf. 82, Fig. 11; SMNS, Nr. 28340<br />
4 Hecticoceras nodosum thalbeimense ZEISS 1959, HT, Callovium, Thalheim/Hohenzollern; aus QU. 1858, Taf. 71, Fig. 22 (Am.<br />
becticus nodosus)<br />
5 Hecticoceras (Brigthia) solinopborum BONARELLI 1894, HT, aus QU. 1858, Taf. 71, Fig. 23 (Am. becticus canaliculatus)<br />
6 Hecticoceras (Brigthia) solinopborum prorsosinuatum ZEISS 1959, HT, Callovium, Gammelshausen/Württ.; aus QU. 1887, Taf. 82,<br />
Fig. 19 (Am. becticus canaliculatus)<br />
7 Hecticoceras (Brigthia) tenuinodosum ZEISS 1956, HT, Jason- Zone (Mittel-Callovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu ZEISS 1956,<br />
Taf. 2, Fig. 12; BSPG<br />
8 Hecticoceras (Brigthia) difforme DE TSYTOVITCH 1911, LT, Mittel-Callovium, Les Hautes bei Chezery (Südostfrankreich); Orig. zu<br />
DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 7, Fig. 5; Museum der Naturgesch. Genf<br />
9 Hecticoceras (Brigthia) salvadorii (PARONA u. BONARELLI 1895), NT, Mittel-Callovium, Les Hautes bei Chezery (Südostfrankreich);<br />
Orig. zu DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 4, Fig. 4; Museum der Naturgesch. Genf<br />
10 Hecticoceras (Putealiceras) punctatum (STAHL 1824), HT, Callovium, Heiningen, Kreis Göppingen; Orig. zu Am. punctatus STAHL<br />
1824, Abb. 8a-c; SMNS, Nr. 29949<br />
11 Hecticoceras (Putealiceras) punctatum arcuatum ZEISS 1956, HT, jason-Zone (Mittel-Callovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu<br />
ZEISS 1956, Taf. 3, Fig. 10; BSPG<br />
12 Hecticoceras (Putealiceras) punctatum exile ZEISS 1956, HT, jason-Zone (Mittel-Callovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu ZEISS<br />
1956, Taf. 3, Fig. 11; BSPG<br />
13 Hecticoceras (Putealiceras) arkelli ZEISS 1956, HT, Jason- Zone (Mittel-Callovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu ZEISS 1956, Taf.<br />
3, Fig. 6; SMNS<br />
14 Hecticoceras (Putealiceras) douvillei (JEANNET 1951), -Oxford Dl •>, Herznach (Schweiz); Orig. zu Putealiceras punctatum var. JEAN<br />
NET 1951, Taf. 12, Fig. 8<br />
15 Hecticoceras (Putealiceras) suevum BONARELLI 1894, HT, Callovium, Gammelshausen/Württ., vermutlich irrtüml. von BONA<br />
RELLI als Orig. zu QU. 1846, Taf. 8, Fig. 1 (HT) angesehen; SMNS, Nr. 27721<br />
16 Hecticoceras (Putealiceras) krakoviense (NEUMAYR 1871), HT, «oberer Dogger», Czatkowice (Südpolen); Orig. zu Har/joceras<br />
krakoviense NEUMAYR 1871, Taf. 9, Fig. 5; BSPG<br />
17 Hecticoceras (Putealiceras) inaequifurcatum ZEISS 1959, HT, Callovium, Ratshausen/Württ.; Orig. zu Am. cf. becticus lunula QU.<br />
1887, Taf. 82, Fig. 40; SMNS, Nr. 28356<br />
18 Hecticoceras (Putealiceras) robustum DE TSYTOVTICH 1911, HT, Mittel-Callovi um, Les Hautes bei Chezery (Südostfrankreich):<br />
Orig. zu Hecticoceras balinense var. robusta DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 8, Fig. 10; Museum der Naturgesch. Genf<br />
164
Tafel 8<br />
1 Hecticoceras (Putealiceras) rossöme(TEISSEYRE 1883), HT, Callovium, Pronsk/Rjasan (UdSSR); Nachguis <strong>des</strong> Orig. zu TEISSEYRE<br />
18SJ, Taf. 1, Fig. 6; Paläont. Inst, der Univ. Wien<br />
2 Hecticoceras (Putealiceras) metomphalum BONARELLI 1S94, fason-Zoae (Mittel-Callovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu ZEISS<br />
1956, Taf. 2, Fig. 4; BSPG<br />
. 3 Hecticoceras (Putealiceras) metomphalum iiuilticostatuni DE TSYTOVITCH 1911, LT, Mittel-Callovium, La Riviere bei Chezery<br />
(Südostfrankreich); Orig. zu DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 5, Fig. 14; Museum der Naturgesch. Genf<br />
• 4 Hecticoceras (Putealiceras) subnodosum DE TSYTOVITCH 1911, LT, Mittel-Callovium, Les Hautes bei Chezery (Südostfrankreich);<br />
Orig. zu Hecticoceras brighti var. subnodosa DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 6, Fig. 8; Museum der Naturgesch. Genf<br />
5 Hecticoceras (Lunuloceras) fallax ZEISS 1959, Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. ZU Am. becticusgigas QU. 1887, Tal". 82,<br />
Fig. 36; SMNS, Nr. 28352<br />
6 Haticocenis (Lunuloceras) pseudopunetatnm (LAHUSEN 1883), LT, «Kirchdorf Podnowolok»/Rjasan (UdSSR); aus LAHUSEN<br />
1883, Taf. 11, Fig. II<br />
7 Hecticoceras (Lunuloceras) brigthii (PRATr 1841), Jason- Zone (Mittel-Callovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu ZEISS 1956,<br />
Taf. 1, Fig. 12; BSPG<br />
8 Hecticoceras (Lumdoceras) gigas (BORNE 1891), LT, Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. becticus gigas QU. 1887,<br />
Taf. 82, Fig. 35; SMNS, Nr. 28353<br />
9 Hecticoceras (Lunuloceras) lunuloidcs (KILIAN 1887), Callov iura, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. becticus compressus QU.<br />
1846, Taf. 8, Fig. 3; SMNS, Nr. 27710<br />
10 Hecticoceras (Lunuloceras) lunuloidcs sinuicostatum ZEISS 1959, HT, Callovium, Gammelshausen/Württ.'; Orig. zu Am. becticus<br />
compressus QU. 1887, Taf. 82, Fig. 32; SMNS, Nr. 28347<br />
11 Hecticoceras (Lunuloceras) lunula (REINECKE 1818), HT, Callovium, Thurnau/Frankenj aus ZEISS 1972, Fig. 35<br />
12 Hecticoceras (Lunuloceras) paulowi DE TSYTOVITCH 1911, LT, Mittel-Callovium, Chezery (Südostfrankreicli); Orig. zu DE TSY<br />
TOVITCH 1911, Taf. 7, Fig. 10; Museum der Naturgesch. Genf<br />
13 Hecticoceras (Lunuloceras) michailowense ZEISS 1956, HT, athleta-Zone (Ober-Gillovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu ZEISS<br />
1956, Taf. 1, Fig. 10; BSPG<br />
14 Hecticoceras (Lunuloceras) scbloenbachi DE TSYTOVITCH, HT, auceps-Zone (Mittel-Callovium), La Riviere bei Chezery (Südost<br />
frankreich); Orig. zu DE TSYTOVITCH 1911, Taf. 3, Fig. 12; Museum der Naturgesch. Genf<br />
15 Hecticoceras (Lunuloceras) suhnuitbeyi LEE 1905, Callovium, La Riviere bei Chezery (Südostfrankreich); Orig. zu DE TSYTO<br />
VITCH 1911, Taf. 5, Fig. 11; Museum der Naturgesch. Genf<br />
16 Hecticoceras (Lunuloceras) frederici ZEISS 1959, HT, Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. becticus lunula QU. 1887,<br />
Taf. 82, Fig. 22; SMNS, Nr. 28337/2<br />
17 Hecticoceras (Lunuloceras) orbigiryi DE TSYTOVITCH 1911, LT, Callovium, Chezery (Südostfrankreich); aus DE TSYTOVITCH<br />
1911, Taf. 4, Fig. 10 (Hecticoceras pseudopunetatum var. orbignyi)<br />
18 Hecticoceras (Lumdoceras) nodosulcatum (LAHUSEN 1883), LT, Ober-Callovium, Nikitina/Rjasan (UdSSR); aus LAHUSEN 1883,<br />
Taf. 11, Fig. 18<br />
19 Taramelliceras '•canaliculatum- (QU. 1846), HT(?), Ober-Callovium, Farrenberg bei Mössingen/Württ.; Orig. zu Am. flexuosus<br />
canaliculatus QU. 1887, Taf. 85, Fig. 41; SMNS, Nr. 27714<br />
20 Taramelliceras inerme (QU. 1887), LT, Ober-Callovium, Linsengraben bei Metzingen-Glems; Orig. zu Am. flexuosus inermis QU.<br />
1887, Taf. 85, Fig. 52; SMNS, Nr. 28433<br />
21 Taramelliceras episcopale (LORIOL 1898), Ober-Callovium, Balmberg (Schweiz); Orig. zu Am. flexuosus inflatus QU. 1887, Taf. 85,<br />
Fig. 57; SMNS, Nr. 28445<br />
22 Taramelliceras flexispinatum (OPP. 1857), Ober-Callovium, Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. flexuosus ^lobulus QU. 1887, Taf.<br />
85, Fig. 63; IGPT; X 1,34
Tafel 9<br />
J Taramelliceras punctulatum (QU. 1887), HT, Ober-Callovium, Linsengraben bei Metzingen-Glems; Orig. zu QU. 1887, Taf. 89,<br />
Fig. 26; SMNS, Nr. 28513; X 1,34<br />
2 Taramelliceras(t) vetox (OPP. 1862), Ober-Callovium, Mössingen-Osdbingen; Orig. zu QU. 1887, Taf. 85, Fig. 66; SMNS,<br />
Nr. 28443/1; X 1,34<br />
3 Creniceras crenatum (D'ORB. 1848), Unter-Oxfordium; Orig. zu Am. dentatus QU. 1887, Taf. 85, Fig. 32; SMNS, Nr. 28420; X 134<br />
4 Creniceras renggeri (OPP. 1862), -Omatenton»(?), Neuffen; Orig. zu Am. dentatus QU. 1887, Taf. 85, Fig. 36; SMNS, Nr. 28424;<br />
X 1,34<br />
5 Creniceras auritulus (OPP. 1862), atbleta-Zont (Ober-Callovium), Ursula-Berg bei Pfullingen/Württ.; Orig. zu OPP. 1862, Tal. 49.<br />
Fig. 1; BSPG; X 1,34<br />
6 Distichoceras (Disticboceras) bicostatum (STAHL 1824), Callovium, Schwäbische Alb; IGPT, Nr. 1626/3<br />
7 Disticboceras (Disticboceras) bicostatum nodulosum (QU. 1846), HT, Callovium, Balingen-Streichen; Orig. zu Am. bipartitus<br />
nodulosus QU. 1887, Taf. 85, Fig. 9; SMNS, Nr. 27693<br />
8 Disticboceras (Horioceras) bidentatus (QU. 1846), Callovium, Schwäbische Alb; Orig. zu QU. 1887, Taf. 85, Fig. 16; IGPt; X 1,34<br />
9 Phlycticeras pustulatum (REINECKE 1818), Mittel-Callovium, Franken; Orig. zu Am. pustulatus franconicus QU. 1887, Taf. 86,<br />
Fig. 15; SMNS, Nr. 28452; X 1,34<br />
10 Phlycticeras pustulatum nodosum (QU. 1887), Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. pustulatus QU. 1887, Taf. 86,<br />
Fig. 5; SMNS, Nr. 28448; X 1,34<br />
11 Phlycticeras polygonium (ZIETEN 1830), Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. pustulatus suevicus QU. 1887, Taf. 86,<br />
Fig. 10; SMNS, Nr. 27786<br />
12 Phlycticeras polygonium laevigalum (QU. 1887), Unter-Callovium, Gammelshausen/Württ.; aus SCHEURLEN 1928, Tif. 3, Fig. 25<br />
u. 26; x 1,34<br />
13 Phlycticeras giganteum (QU. 1887), HT, Unter-Callovium, Brunnental bei Laufen an der Eyach; Orig. zu Am. pustulatus giganteus QU.<br />
1887, Taf. 86, Fig. 6; IGPT<br />
14 Leioceras opalinum (REINECKE 1818), Unter-Aalenium, Teufelsloch bei Boll/Kr. Göppingen; Orig. zu QU. 1886, Taf. 55, Fig. 2;<br />
IGPT<br />
15 Leioceras opalinum lineatum BUCKM. 1899, Unter-Aalenium, Krehbach bei Wißgoldingen/Ostalbkreis; Orig. zu QU. 1886, Taf. 55,<br />
Fig. 12; IGPT<br />
16 Leioceras costoswn (BENECKE 1905), Unter-Aalenium, Goldbächle bei Waldstetten/Ostalbkreis; Orig. zu Am. opalinus costosus<br />
QU. 1886, Taf. 55, Fig. 21; SMNS, Nr. 28205<br />
168
Tafel 10<br />
1 Leioceras comptum (REINECKE 1818), comptum-Zone (Unter-Aalenium), Katzensteige bei Gosheim/Württ.; Orig. zu R1EBEK<br />
1963, Taf. 1, Fig. 4 u. 7; IGPT Nr. Ce 1211/1<br />
2 Leioceraspaucicostatum RIEBER 1963, HT, comptum-ZoM (Unter-Aalenium), Wochenberg bei Gosheim/Württ.; Orig. zu RIEBER<br />
1963, Taf. 2, Fig. 4 u. 5; IGPT Nr. Ce 1211/14<br />
3 Leioceras (?) crassicostatum RIEBER 1963, HT, comptum- Zone (Unter-Aalenium). Katzensteige bei Gosheim/Württ.; Orig. zu<br />
RIEBER 1963, Taf. 1, Fig. 10 u. 11; IGPT Nr. Ce 1211/13<br />
4 Staufenia sinon (BAYLE 1878), HT, vermutlich unteres Ober-Aalenium, Aalen-Wasseralfingen; Naehguß zu BAYLE 1878, Tat. 83,<br />
Fig. 1<br />
5 Staufenia opalinoi<strong>des</strong> (MAYER 1864), HT, Eisenerze <strong>des</strong> Ober-Aaleniums, Aalen; Orig. zu Am. murchisonaeacutusQU. 1886, Tif. 59.<br />
Fig. 5; IGPT<br />
6 Staufeniasehndensis (G. HOFFMANN 1913), LT, murchisonae-Zone (Ober-Aalenium), Sehnde bei Hannover; Orig. zu HOFFMANN<br />
1913, Taf. 4, Fig. 3; Geol. Inst, der Univ. Göttingen; X 0,73<br />
7 Staufenia discoidea (QU. 1886), LT, Ober-Aalenium, Schömberg-Schörzingen bei Balingen; Orig. zu QU. 1886, Taf. 58, Fig. 3; IGPT<br />
170<br />
*
Tafel 11<br />
1 Staufenia staufensis (OPP. 1858), Ober-Aalenium, Eichberg bei Blumberg/Südbaden; Sig. <strong>des</strong> Verfassers; X 0,47<br />
2 Ludwigia (Ludwigia) haugi DOUVILLE 1885, untere murchisonae-Zone (Ober-Aalenium), Scheffheu bei BIumberg-Achdorf/Südbaden;<br />
Orig. zu RIEBER 1963, Taf. 4, Fig. 3; IGPT Nr. Ce 1211/34<br />
3 Ludwigia (Ludwigia) bullifera (BUCKM. 1899), untere murchisonae-Zone, Scheffheu bei Blumberg-Achdorf/Südbaden; Orig. zu<br />
Ludwigia crassa RIEBER 1963, Taf. 4, Fig. 8; IGPT Nr. Ce 1211/33; X 0,65<br />
4 Ludwigia (Ludwigia) murchisonae (SOW. 1825), HT, murchisonae-Zone (Ober-Aalenium), Insel Skye (England); Nachguß <strong>des</strong> Orig.<br />
zu SOW. 1825, Taf. 550; X 0,60<br />
5 Ludwigia (Ludwigia) latecostata ALTHOFF 1940, Eisenerz <strong>des</strong> Ober-Aalenium, Aalen-Wasseralfingen; Orig. zu Am. murchisonae<br />
obtusus QU. 1886, Taf. 58, Fig. 9; IGPT<br />
172
Tafel 12<br />
1 Ludwigia (Ludwigia) bradfordensis (BUCKM. 1887), Eisenerz <strong>des</strong> Ober-Aalenium, Kuchen bei Geislingen a. d. Steige; Orig. zu Am.<br />
murchisonae planatus QU. 1886, Taf. 59, Fig. 16; X 0,67<br />
2 Ludwigia bradfordensis deleta (BUCKM. 1899), murchisonae- Zone (Ober-Aalenium), Scheffheu bei Blumberg-Achdorf/Südbaden;<br />
Orig. zu Ludwigia deleta? RIEBER 1963, Taf. 6, Fig. 1; IGPT Nr. Ce 1211/56<br />
3 Ludwigiagigantea (BUCKM. 1888), LT, Ober-Aalenium, Beaminster/Dorset (England); aus BUCKM. 1888, Taf. 11, Fig. 1 u.Taf. 12,<br />
Fig. 4; X 0,51<br />
4 Ludwigia (Pseudograpboceras) subtuberculata RIEBER 1963, HT, murchisottae-Zoat (Ober-Aalenium), Wochenberg bei Gosheim/<br />
Württ.; Orig. zu RIEBER 1963, Taf. 5, Fig. 12 u. 13; IGPT Nr. Ce 1211/40<br />
5 Ludwigia (Pseudograpboceras) umbilicafa BUCKM. 1899, murchisonae-Zone, Plettenberg bei Balingen-Schömberg; Orig. zu Ludwigia<br />
umbilicata? RIEBER 1963, Taf. 7, Fig. 6 u. 13; IGPT Nr. Ce 1211/41<br />
6 Ludwigia (Pseudograpboceras) helvetica (HORN 1909), HT, oberste Murchisonae-Schichten, Baseler Tafeljura; aus HORN 1909.<br />
Taf. 10, Fig. 2<br />
7 Graphoceras (Graphoceras) concavum (SOW. 1815), HT, concavum-Zone (Ober-Aalenium), zwischen Ilminster und Yeovil/Sommerset<br />
(England); Nachguß <strong>des</strong> Orig. zu SOW 1815, Taf. 94<br />
174
Tafel 13<br />
1 Graplioceras (Graphoceras) decorum BUCKM. 1904, Ober-Aalenium, Bradford Abbas/Dorset (England); aus BUCKM. 1888, Taf. 19,<br />
Fig. 3 u. 4 {"l.iocerjs concavum. Einer ribbed Spe<strong>des</strong> at an earlier age»)<br />
2 Graphoceras (Graphoceras) fallax (BUCKM. 1888), HT, Ober-Aalenium, Bradford Abbas/Dorset (England); aus BUCKM. 1888,<br />
Taf. 14, Fig. 10 u. 11; X 0,63<br />
3 Graphoceras (Ludwigella) cornu (BUCKM. 1887), LT, Ober-Aalenium, Halfway House, Sherborne/Dorset (England); aus BUCKM.<br />
1887, Taf. 4, Fig. 1 u. 2<br />
4 Graphoceras (Ludwigella) rudis (BUCKM. 1889), concavum- Zone (Ober-Aalenium), Georgenberg bei Reutlingen; Orig. zu Ludwigia<br />
cf. rudis RIEBER 1963, Taf. 7, Fig. 11; IGPT Nr. Ce 1211/66<br />
5 Graphoceras (Ludwigella) apertum (BUCKM. 1888), Ober-Aalenium, Bradford Abbas/Dorset (England); aus BUCKM. 1888, T«f. 10,<br />
Fig. 10 u. 11<br />
6 Hyperlioceras <strong>des</strong>ori (MOESCH 1867), «Braunjura beta», Katzensteige bei Gosheim/Württ. Orig. zu Am. discoideus QU. 1886,<br />
Taf. 58, Fig. 4; IGPT<br />
176
Tafel 14<br />
1 Hyperlioceras discites (WAAGEN 1867), «Bratinjura beta», Ratshausen/Württ.; Orig. zu Am. discoideus QU. 1886, Taf. 58, Fig. 1;<br />
IGPT<br />
2 Hyperlioceras subsectum (BUCKM. 1905), discites-Zone (Unter-Bajocium), Eichberg bei Blumberg/Südbaden; Orig. zu U. BAYER<br />
1969, Taf. 1, Fig. 4; Geol.-Paläont. Inst. Stuttgart; X 0,55<br />
3 Hyperlioceras rudidiscites BUCKM. 1904, discites-Zone (Unter-Bajocium), Eichberg bei Blumberg/Südbaden; Orig. zu U. BAYER<br />
1969, Taf. 3, Fig. 3; Geol.-Paläont. Inst. Stuttgart<br />
4 Sonninia propinquans (BAYLE 1878), LT, «Oolithe inferieure», Les Moutiers bei Caen/Normandie; aus BAYLE 1878, Taf. 84,<br />
Fig. 3 u. 4<br />
178
Tafel 15<br />
1 Hyperlioceras subdiscoidea BUCKM. 1889, discites-Zone (Unter-Bajocium), Eichberg bei Blumberg/Südbaden; Orig. zu U. BAYER<br />
1969, Tai'. 3, Fig. 2; Geol.-Paläont. Inst. Stuttgart; x 0,41<br />
2 Sonninia trigonata (QU. 1886), LT, «Braunjura Untergamma», Aalen-Wasseralfingen; Orig. zu Am. sowerbyi trigonatus QU. 1886,<br />
Taf. 61, Fig. 14; IGPT<br />
3 Sonninia berckhemeri DORN 1935, HT, laevinscula-Zone (Unter-Bajocium), Gingen an der Fils; Orig. zu DORN 1935, Taf. 21, Fig. 1;<br />
SMNS, Nr. 29739; X 0,8<br />
180
Tafel 16<br />
1 Sonninia pseudotubercidata DORN 1935, HT, sauzei-Zone (oberes Unter-Bajocium), Nenningen/Württ.; aus DORN 1935, Taf. 5,<br />
Fig. 1; X 0,63<br />
2 Sonninia jngifera (WAAGEN 1867), HT, Unter-Bajocium, Gingen an der Fils; Orig. zu WAAGEN 1867, Taf. 26, Fig. 1; BSPG; X 0,71<br />
3 Sonninia mesacantha (WAAGEN 1867), HT, Unter-Bajocium, Gingen an der Fils; Orig. zu WAAGEN 1867, Taf. 28, Fig. 1; BSPG;<br />
X0,67<br />
4 Sonninia arenata (QU. 1886), HT, Unter-Bajocium, Linsenbühl bei Metzingen-Neuhausen; Orig. zu QU. 1886, Taf. 60, Fig. 10; IGPT;<br />
X0,32<br />
182
Tafel 17<br />
1 Sonninia adicra (WAAGEN 1867), HT, Unter-Bajocium, Gingen an der Fils; Orig. zu WAAGEN 1867, Taf. 25, Fig. 1 j BSPG; X 0,76<br />
2 Sonninia polyacantba (WAAGEN 1867), HT, Unter-Bajocium, Gingen an der Fils; Orig. zu WAAGEN 1867, Taf. 29, Fig. 1; BSPG;<br />
X0.36<br />
3 Sonninia ovalis (QU. 1886), LT, Unter-Bajocium, Achdorf bei Blumberg/Südbaden; Orig. zu Am. sowerbyi ovalis QU. 1886, Taf. 62,<br />
Fig. 1; IGPT; X 0,45 (vergl. Tif. 18, Fig. 1)<br />
4 Somalia fissilobata (WAAGEN 1867), HT, Unter-Bajocium, Gingen an der Fils; Orig. zu WAAGEN 1867, Taf. 27, Fig. 1; BSPG;<br />
X0,45<br />
184
Tafel 18<br />
1 Septalansicht von Taf. 17, Fig. 3<br />
2 Sonninia patella (WAAGEN 1867), LT, Unter-Bajocium, Gingen an der Fils; Orig. zu WAAGEN 1867, Taf. 25, Fig. 2; BSPG; x 0,71<br />
3 Sonninia stepbani (BUCKM. 1882), «Sandmergel über der Sowerbyi-Bank», Nenningen/Württ.; Orig. zu OECHSLE 1958, Taf. 16,<br />
Fig. 4; IGPT Nr. 1054/19; X 0,52<br />
4 Sonninia tessoniana (D'ORB. 1845), «Sowerbyi-Bank», Nenningen/Württ.; Orig. zu OECHSLE 1958, Taf. 15, Fig. 4; IGPT<br />
Nr. 1054/20; X 0,57<br />
5 Sonninia pseudotrigpnata MAUBEUGE 1951, HT, Unter-Bajocium, Mont-Saint-Martin (Frankreich); aus MAUBEUGE 1951, Taf. 2,<br />
Fig. 2<br />
186
Tafel 19<br />
1 Sonninia furticarinata (QU. 1856), Unter-Bajocium, Gönninger Str., Pfullingen; Orig. zu QU. 1886, Taf. 68, Fig. 5; SMNS, Nr. 28217;<br />
x 0,62<br />
2 Somünia grandiplex OECHSLE 1958, HT, «Sowerbyi-Bank», Nenningen/Württ.; Orig. zu OECHSLE 1958, Taf. 20, Fig. 1; IGPT<br />
Nr. 1054/25; X 0,43<br />
3 Witchellia laeviuscula (SOW. 1824), IT, «Inferior Oolite», Dundry/Somerset (England); aus WEST. 1969, Fig. 35<br />
4 Witchellia sutneri (BRANCO 1879), HT, «Sowerbyi- oder Sauzei-Scbicbten» (Unter-Bajocium), St. Quentin bei Metz (Frankreich); aus<br />
BRANCO 1879, Taf. 5, Fig. 2<br />
5 Pelekodites zurcheri (DOUVILLE 1885), LT, Unter-Bajocium, Valaury bei Toulon (Frankreich); aus DOUVILLE 1885, Taf. 1, Fig. 6<br />
6 Pelekodites scblwnbergeri (HAUG 1893), HT, «Oolithe inferieur», I'orct de Haye bei Nancy (Frankreich); aus HUF 1968, Taf. 1, Fig. 4<br />
7 Pelekodites bucknmni (HAUG 1893), HT, «Zone mit Spbaeroceras sauzei-, Foret de Have bei Nancv (Frankreich); aus HUF 1968, Taf.<br />
3, Fig. 1<br />
8 Pelekodites punctatissiinus (HAUG 1893), Bajocium, Bethel bei Bielefeld; Orig. zu ALTHOFF 1919; Bun<strong>des</strong>anst. f. Geowiss. u. Rohst.<br />
Hannover, Nr. b 232<br />
9 Dorsetensia hannoverana (HILTERMANN 1939), LT, Unter-Bajocium, Eisenbahneinschnitt bei Hil<strong>des</strong>heim; aus HUF 1968, Taf. 6,<br />
Fig. 5<br />
10 Dorsetensia pinguis (ROEMER 1836), HT, Unter-Bajocium, Galgenberg bei Hil<strong>des</strong>heim; aus HUF 1968, Taf. 4, Fig. 7<br />
11 Dorsetensia dettafalcata (QU. 1858), LT, Mittel-Bajocium, Mössingen-Öschingen; Orig. zu QU. 1858, Taf. 53, Fig. 8; IGPT<br />
188
Tafel 20<br />
1 Dorseteitsui romani (OPP. 1857), HT, httmphriesimum-Zoue (Mittel-Bajocium), Mössingcn-Üscliingen; Orig. zu OPP. 1862, Ta£ 46,<br />
Fig. 2; BSPG<br />
2 Dorsetensia liostraca BUCKM. 1892, «UOterd«) Eisenoolithen <strong>des</strong> Braunjura delta-, Spaichingen; Orig. zu Am. tessoiiiamis QU. 1886,<br />
Taf. 63, Fig. 7; IGPT; X 0,62<br />
3 Dorsetensia subtecta BUCKM. 1892, HT, hitmplmesianum- Zone, Oborne/Dorset (England); aus HUF 1968, Taf. 41, Fig. 1 und<br />
Taf. 43, Fig. lb; X 0,62<br />
4 Oydoniceras (Oydoniceras) discus (SOW. 1813), HT, «Lower Cornbrash» (discus- Zone), Bedford (England); aus ARKELL 1951b,<br />
Taf. 2, Fig. 2<br />
5 Strigoceras truellei (D'ORB. 1845), «oberer Braunjura delta», Geisingen/Baden; Orig. zu Am. truellei trifurcatus QU. 1886, Taf. 69,<br />
Fig. 8; IGPT<br />
190
Tafel 21<br />
1 Strigoceras dorsocavatum (QU. 1857), HT, Ober-ßajocium, Ratshausen bei Balingen; aus QU. 1886, Taf. 69, Fig. 6<br />
2 Strigoceras septiairiiulum BUCKM. 1924, HT, «Inferior Oolite, Shell Bed», Bunun Bradstock/Dorsct (England); aus BUCKM<br />
1924, Taf. 470<br />
3 Lissoceraspsilodiscus (SCHLOENBACH 1865), «oberer Braunjura", Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. compLnnitoi<strong>des</strong>QU. 1886,<br />
Taf. 75, Fig. 27; SMNS, Nr. 28310<br />
4 Lissoceras oolithicum (D'ORB. 1845), «Braunjura delta» {niortense-Zoac), Eningen; Orig. zu QU. 1886, Taf. 69, Fig. 4; SMNS,<br />
Nr. 27758<br />
5 Lissoceras ferrifcx (ZITTEL 1868), «Braunjura delta-, Ipf bei Bopfmgen; Orig. zu Am. oolitbiais QU. 1886, Taf. 69, Fig. 5; IGPT<br />
6 Kumatostephamis turgiduhis (QU. 1886), LT, Unter-Bajocium, Laufen an der Eyach; Orig. zu QU. 1886, Taf. 66, Fig. 2; IGPT; X 0,55<br />
7 Kumatostephanus triplicatus (RENZ 1904), HT, oberes Unter-Bajocium, Laufen an der Eyach; Orig. zu Am. humphriesianus plamila<br />
QU. 1886, Taf. 66, Fig. 13; IGPT; X 0,8<br />
192
Tafel 22<br />
1 Stepbanoceras (Stephanocerds) bumphriesianum (SOW. 1825), LT, «Inferior Ool ite», Sherborne/Dorset (England); aus BUCKM. 1908,<br />
Taf. 7, Fig. 1; X 0,8<br />
2 Stepbanoceras (Stepbanoceras) bumphriesianum zieteni (QU. 1886), HT, Mittel-Bajocium, Schwäbische Alb; Orig. zu QU. 1886, Taf.<br />
66, Fig. 10; IGPT; X 0,45<br />
3 Stepbanoceras (Stepbanoceras) auerbachense SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1938, LT, «Humphriesianum-Schichten», Pinzig-Berg bei<br />
Auerbach/Franken; Orig. zu SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1938, Taf. 13, Fig. 5; IGPEN; X 0,77<br />
4 Stepbanoceras (Stepbanoceras) scalare LOEWE 1913, Mittel-Bajocium, Schwäbische Alb; Orig. zu Am. bumpbriesianus QU. 1886,<br />
Taf. 65, Fig. 15; IGPT; X 0,67<br />
194
Tafel 23<br />
1 Stepbanoceras (Stepbanoceras) subzieteni SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1938, HT, «Humphriesianum-Schichten», Staffelberg bei<br />
Lichtenfels/Franken; Orig. zu SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1938, Taf. 14, Fig. 1; IGPEN; X 0,51<br />
2 Stepbanoceras (Stepbanoceras) macrum (QU. 1886), LT, «feinkörniger Eisei loolith <strong>des</strong> Braunjura delta-, Schwäbische Alb; Orig. zu Am.<br />
bumpbriesianus macer Q\}. 1886, Taf. 65, Fig. 11; IGPT; X 0,31<br />
3 Stepbanoceras (Stepbanoceras) nodosum (QU. 1858), HT, «feinkörnige Oolithe <strong>des</strong> Braunjura delta», Ipf bei Bopfingen; Orig. zu QU-<br />
1886, Taf. 65, Fig. 17; IGPT<br />
4 Stepbanoceras (Stepbanoceras) latidorsum WEISERT 1932, HT, Mittel-Bajocium(?), Schwäbische Alb; Orig. zu Am. hiimpbriesunus<br />
QU. 1886, Taf. 65, Fig. 9; IGPT; x 0,60<br />
196
Tafel 24<br />
1 Stepbanocenis (Stephanoceras) pyritosum (QU. 1886), HT, Mittel-Bajocium, Mössingen-Öschingen; Orig. zu QU. 1886, Tat. 66,<br />
Fig. 4; SMNS, Nr. 28214; X 0,71<br />
2 Stephanoceras (Stepbanocenis) /;o//»7
Tafel 25<br />
1 Stcphanoceras (Stepbanoceras) mutabile (QU. 1886), HT, Mittel-Bajocium, Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. bumpbriesianus<br />
mutabilis QU. 1886, Taf. 66, Fig. 5; IGPT<br />
2 Stepbanoceras (Stepbanoceras) umbilicus (QU. 1886), HT, Mittel-Bajocium, Essingen bei Aalen; Orig. zu Am. bumpbriesianus umbili<br />
cus QU. 1886, Taf. 66, Fig. 6; IGPT<br />
3 Stepbanoceras (Normannites) orbignyi BUCKM. 1908, Mittel-Bajocium, Osterfeld bei Goslar/Harz; Orig. zu WEST. 1954, Taf. 5,<br />
Fig. 4; Geol. Inst. Braunschweig<br />
4 Stepbanoceras (Normannites) braikenridgii (SOW. 1818), «Otoites-Schichten» (Mittel-Bajocium), Gerzen bei Alfeld; Orig. zu WEST.<br />
1954, Taf. 9, Fig. 2; Geol. Inst, der Univ. Göttingen, Nr. Gzn 5<br />
5 Stepbanoceras (Normannites) braikenridgii ventriplanum (WEST. 1954), HT, Mittel-Bajocium, Gerzen bei Alfeld; Orig. zu WEST.<br />
1954, Taf. 9, Fig. 4; Amt für Bodenforschung, Hannover, Nr. b 13<br />
6 Stepbanoceras (Normannites) braikenridgii quenstedti ROCHE 1939, HT, «Braunjura delta», Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am.<br />
braikenridgii QU. 1886, Taf. 65, Fig. 6; IGPT<br />
7 Stepbanoceras (Normannites) vulgaricostatum (WEST. 1954), HT, «Tone <strong>des</strong> Braunjura delta», Mössingen-Öschingen; Orig. zu AM<br />
braikenridgii macer QU. 1886, Taf. 65, Fig. 4; IGPT<br />
8 Stepbanoceras (Normannites) turgidum (WEST. 1954), HT, Mittel-Bajocium, Goslar; Orig. zu WEST. 1954, Taf. 12, Fig. 1; Geol. Inst,<br />
der Univ. Göttingen, Nr. Gsr 11<br />
9 Stepbanoceras (Normannites) latumbilicatum (WEST 1954), HT, Mittel-Bajocium, Gerzen bei Alfeld; Orig. zu WEST. 1954, Taf. 13,<br />
Fig. 3; Geol. Inst, der Univ. Göttingen, Nr. Gzn 52<br />
200
Tafel 26<br />
1 Stephanoceras (Normannites) latumbilicatum bentzi (WEST. 1954), HT, Mittel-Bajocium, Osterfeld bei Goslar; Orig. zu WEST. 1954,<br />
Taf. 13, Fig. 5; Amt für Bodenforschung Hannover, Nr. b 15<br />
2 Stephanoceras (Normannites) platystoma (WEST. 1954), HT, Mittel-Bajocium, Osterfeld bei Goslar; Orig. zu WEST. 1954, Taf. 17,<br />
Fig. 6; Geol. Inst. Braunschweig<br />
3 Stephanoceras (Normannites) antiquum (WEST 1954), HT, Mittel-Bajocium, Gerzen bei Alfeld; Orig. zu WEST. 1954, Taf. 20, Fig. 4;<br />
Geol. Inst, der Univ. Göttingen, Nr. Gzn 73<br />
4 Stephanoceras (Normannites) mackenzii (MC LEARN 1929), Mittel-Bajocium, Osterfeld bei Goslar; Orig. zu WEST. 1954, Taf. 23,<br />
Fig. 2; Geol. Inst. Braunschweig<br />
5 Stephanoceras (Normannites) gracile (WEST. 1954), HT, Mittel-Bajocium, Osterfeld bei Goslar; Orig. zu WEST. 1954, Taf. 26, Fig. 3;<br />
Geol. Inst. Braunschweig<br />
6 Stephanoceras (Normannites) formositm (BUCKM. 1920), HT (Nachguß), Mittel-Bajocium (?), Frogden Quarry, Oborne (England);<br />
aus WEST. 1954, Taf. 23, Fig. 1<br />
7 Stephanoceras (Normannites) fonnosum variecostatum (WEST. 1954), HT, «Braunjura delta», Mössingen-Öschitigen; Orig. zu Am.<br />
braikenridgii QU. 1886, Taf. 65, Fig. 3; IGPT<br />
8 Stephanoceras (Normannites) latansatum (BUCKM. 1920), «Pinguis-Schichten» (Mittel-Bajocium), Gerzen bei Alfeld; Orig. zu<br />
WEST. 1954, Taf. 22, Fig. 2; Geol. Inst, der Univ. Göttingen, Nr. Gzn 30<br />
9 Stephanoceras (Nonnannites) mitis (WEST. 1954), HT, Mittel-Bajocium, Scheffheu bei Blumberg/Südbaden; aus WEST. 1954,<br />
Taf. 26, Fig. 1<br />
10 Stephanoceras (Normannites) aheeps (QU. 1886), HT, «Braunjura gamma», Laufen/Eyach; Orig. zu Am. contractus aneeps QU. 1886,<br />
Taf. 64, Fig. 20; IGPT<br />
202
Tafel 27<br />
1 leioceras blagdeni (SOW. 1818), HT, «lower Oolite», England; aus BUCKM. 1908, Taf. 2 u. Taf. 3, Fig. 1; x 0,50<br />
2 leioceras parvum WEISERT 1932, HT, «Braunjura delta», Laufen/Eyach; Orig. zu Am. coronatus QU. 1886, Taf. 67, Fig. 2; IGPT<br />
3 Telocerassubcoronatum (OPP. 1856), HT, «Braunjura delta», Himmelberg bei Talheim, Kr. Tuttlingen; Orig. zu Am. coronatus oolithi-<br />
cus QU. 1886, Taf. 67, Fig. 8; IGPT<br />
4 leioceras latiumbilicatwn SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1938, HT, obere Humphriesianum-Schichten, Teufelsgraben bei Auerbach/<br />
Franken; Orig. zu SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1938, Taf. 10, Fig. 6; IGPEN<br />
5 leioceras subblagdeni SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1938, LT, untere Blagdeni-Schichten, Teufelsgraben bei Auerbach/Franken;<br />
Orig. zu SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1938, Taf. 10, Fig. 1; IGPEN<br />
6 leioceras frecbi (RENZ 1904), HT, «Braunjura delta», Eningen/Achalm; Orig. zu Am. bumpbriesianus coronatus QU. 1886, Taf. 66,<br />
Fig. 11; IGPT<br />
7 leioceras triplex WEISERT 1932, LT, humphriesianum-Zone, Schwäbische Alb; Orig. zu WEISERT 1932, Taf. 16, Fig. 1; IGPT;<br />
x0,71<br />
204
Tafel 28<br />
1 leioceras banksii (SOW. 1818), HT, «Inferior Oolite», West-England; aus BUCKM. 1908, Tif. 1 u. Taf. 3, Fig. 2; X 0,37<br />
2 Emileia (Emileia) polysehi<strong>des</strong> (WAAGEN 1867), LT, sauzei-Zone (Unter-Bajocium), Neuffen; Orig. zu WEST 1964, Taf. 7, Fig. 2;<br />
BSPG, Sig. OPP.<br />
3 Emileia (Emileia) brocchii (SOW. 1818), HT, Unter-Bajocium (?), West-England; aus BUCKM. 1908, Taf. 4; X 0,73<br />
4 Emileia (Otoites) sauzei (D'ORB. 1846), NT, Unter-Bajocium, Fautenay, Vendee (Frankreich); aus WEST. 1954, Taf. 1, Fig. 1<br />
5 Emileia (Otoites) contractus (SOW. 1825), NT, Otoites-Schichten, Sherbome/Dorset (England); aus WEST. 1954, Taf. 1, Fig. 4<br />
206
Tafel 29<br />
1 Emileia (Emileia) quenstedti WEST. 1964, HT, «Braunjura gamma», Hohenzollem bei Hcchingen; Orig. zu Am. gervillii macrocephalus<br />
QU. 1886, Taf. 64, Fig. 13; IGPT; x 0,71<br />
1 Emileu (Otoites) pauper WEST. 1954, HT, Blaukalk, Eningen/Achalm; aus WEST. 1954, Taf. 3, Fig. 5<br />
3 Cbondroceras gervillii (SOW. 1818), HT, Mittel-Bajocium, Bayeux (Frankreich); aus WEST. 1956, Taf. 1, Fig. 1 (Nachguß)<br />
4 Cbondroceras evoluescens (WAAGEN 1867), -mittlerer Braunjura», Stuifen bei Schwäbisch Gmünd; Orig. zu Am. gervillii QU. 1886,<br />
Taf. 64, Fig. 3; IGPT<br />
5 Cbondroceras densicostatum WEST. 1956, HT, humplniesianum-Zone, Sulzstcingrube, Schweizer Jura; aus WEST. 1956, Taf. 3;<br />
Fig. 5<br />
6 Cbondroceras sebmidti WEST. 1956, HT, bumpbriesianum-Zone, Gerzen bei Alfeld; Orig. zu WEST 1956, Taf. 3, Fig. 7; Geol. Inst,<br />
der Univ. Göttingen, Nr. Gzn 108<br />
7 Cbondroceras orbignyanum (WRIGHT 1859), NT, Bajocium, Sully/Calvados (Frankreich); aus WEST. 1956, Taf. 5, Fig. 6 (Nachguß)<br />
8 CbondrocerastenueWEST. 1956,HTj7umpbriesianum-Zone,GmenbeiA\k\d;0ng.zu\VEST. 1956,Taf. 10,Fig. 1;Geol.Inst.der<br />
Univ. Göttingen, Nr. Gzn 128; X 1,34<br />
9 Cadomites (Cadomites) <strong>des</strong>iongebampsi (D'ORB. 1846), parkinsoni/zigzag-Zont, Müllheim/Baden; aus HAHN 1971,Taf.9,Fig. 16<br />
10 Cadomites (Cadomites) extinetus (QU. 1886), LT, «Braunjura epsilon», Eningen/Achalm; Orig. zu Am. aneeps extinetus QU. 1886,<br />
Taf. 74, Fig. 30; IGPT<br />
11 Cadomites (Cadomites) rectelobatus (HAUER 1857), kondensiertes Bathonium, Bopfingen-Oberdorf/Ostalb; aus HAHN 1971,<br />
Taf. 9, Fig. 9<br />
12 Cadomites (Polyplectites) linguiferus (D'ORB. 1846), NT, «Calcaires de Lucon» (Mittel-Bathonium). Frankreich; aus DE GROS<br />
SOUVRE 1930, Taf. 40, Fig. 10<br />
13 Cadomites (Polyplectites) globosus WEST. 1954, HT, Unter-Bathonium, Thalmässing/Mittelfranken; Ong. zu WEST. 1954, Taf. 32,<br />
Fig. 6; Geol. Inst. Braunschweig<br />
208
Tafel 30<br />
1 Cadonütes (Polyplectites) dornt (ROCHE 1939), LT, unterstes ßathonium (?), Thalmässing/Mittelfranken; Orig. zu Normannites<br />
(Polyplectites) linguiferus Form I DORN 1927, Taf. 5, Fig. 6; Geol. Inst, ßraiinschwcig, Slg. DORN<br />
2 Caumontisphinetes (Caumontisphinetes) diniensis PAVIA 1973, HT (Nachguß), Basis der banksii-Suhrxme (unterstes Ober-Bajocium),<br />
Chaudon (Südost-Frankreich); SMNS<br />
3 Caumontisphinetes (Caumontisphinetes) nodatus BUCKM. 1921, HT (Nachguß), unteres Ober-Bajocium, Clatcombe/Sherborne<br />
(Süd-England); SMNS<br />
4 Caumontisphinetes (Caumontisphinetes) nodatus bisingensis DILTI. 1980, HT, untere banksü-SvAaonc (Ober-Bajocium), Bisingen/<br />
Zollernalb; Orig. zu DIETI. 1980, Taf. 2, Fig. 4; SMNS Nr. 25864<br />
5 Quimontisphinctes (Caumontisphinetes) hennigi (BENTZ 1924), LT, niortense- Zone, Hansa-Stollen bei Harlingerode (Nordwest-<br />
Deutschland); aus BENTZ 1924, Taf. 9, Fig. 1<br />
6 Caumontisphinetes (Caumontisphinetes) rota (BENTZ 1924), potygyrdlis-Subzoae (Ober-Bajocium), Mössingen-Oschingen; Orig.<br />
ZU DIETL 1980, Tif. 5, Fig. 1; SMNS Nr. 23693<br />
7 Caumontisphinetes (Caumontisphinetes) htfurais BUCKM. 1920, HT (Nachguß), /w/ygynj/»s-Subzone (Ober-Bajocium), Ohorn/<br />
Dorset (Süd-England); SMNS<br />
8 Caumontisphinetes (Caumontisphinetes) polygyralis BUCKM. 1920, HT (Nachguß), /»o/ygwfo-Subzone (Ober-Bajocium), Lower<br />
Clatcombe, Sherbornc/Dorset (England); SMNS<br />
9 Caumontisphinetes (Caumontisphinetes?) prosieostatus STURANI 1971, HT, niortense-'Z.om, Monte Longara, Venetische Alpen (Italien);<br />
aus STURANI 1971, Fig. 46, 1; x 2,7<br />
10 Caumontisphinetes (hifraparkinsonia) inferior (BENTZ 1924), polygyralis- Subzone (Ober-Bajocium), Bisingen/Zollernalb; Orig. zu<br />
DIETL 1980, Taf. 5, Fig. 5; SMNS Nr. 25886<br />
11 Caumontisphinetes (hifraparkinsonia) phaulus BUCKM. 1922, HT (Nachguß), unteres Ober-Bajocium, Clatcombe/Sherborne (Süd-<br />
England); SMNS<br />
12 Caumontisphinetes (hifraparkinsonia) dehilis (WETZEL 1937), HT (Nachguß), «Subfurcaten-Schichten», Bielefeld; SMNS<br />
13 Caumontisphinetes (hifraparkinsonia) gruibingensis DIETL 1980, HT, niortense- Zone, Deutsches Haus bei Gruibingen/Wünt.;<br />
Orig. zu DIETL 1980, Taf. 5, Fig. 6; SMNS Nr. 25888<br />
14 Strenoceras bentzi DIETL 1983, HT, polygyralis-Subione (Ober-Bajocium), Teufelsloch bei Bad BollAViirtt.; Orig. zu DIETL 1983,<br />
Taf. 1, Fig. 2; SMNS Nr. 26599<br />
15 Strenoceras latidorsatuin BENTZ 1924, LT, Ober-Bajocium, Osterfeld bei Goslar; aus BENTZ 1924, Taf. 4, Fig. 11<br />
16 Strenoceras quenstedti DIETL 1983, LT, «oberer Braunjura delta», Herzogenau bei Gruibingen/Wünt.; Orig. zu Am. bifurcatus oolithicus<br />
QU. 1886, Taf. 70, Fig. 1; IGPT<br />
17 Strenoceras niortense (D'ORB. 1846), baculata-Subzone (Ober-Bajocium), Burladingen-Killer/Zollernalb; Orig. zu DIETL 1981,<br />
Taf. 1, Fig. 7; SMNS Nr. 26378<br />
210
Tafel 31<br />
1 Strenoceras bajocense (DE BLAJNVILLE 1840), HT, Ober-Bajocium, Caen/Normandie (Frankreich); aus DOUVILLE 1909, Taf. 133<br />
2 Strenoceras bigoti (BRASIL 1894), niortense-Zone, Teufelsloch bei Bad Boll/Württ.; Orig. zu DIETL 1983, Taf. 3, Fig. 5; SMNS<br />
Nr. 26612<br />
3 Strenoceras serpens (ZATWORNITZKY 1914), baadata-Subzoac (Ober-Bajocium), Burladingen-Killer/Württ.; Orig. zu DIETL<br />
1983, Taf. 3, Fig. 9; SMNS Nr. 26474<br />
4 Strenoceras suevicum DIETL 1983, HT, untere Hamiten-Tone (Ober-Bajocium), Eningen/Achalm; Orig. zu Am. bifurcatus latisulcatus<br />
QU. 1886, Taf. 70, Fig. 2; SMNS, Nr. 28222<br />
5 Strenoceras rotundum BENTZ 1928, HT (Nachguß), obere Subfurcaten-Schichten, Bielefeld; Lan<strong>des</strong>amt f. Bodenforschung Hannover<br />
6 Orthogarantiana Schweden (BENTZ 1924), «Braunjura delta», Farrenberg bei Messingen; Orig. zu Am. garantianus QU. 1886,<br />
Taf. 71, Fig. 3; IGPT<br />
7 Orthogarantiana conjugata (QU. 1886), HT, «Braunjura delta», Farrenberg bei Mössingen; Orig. zu Am. garantianus conjugatus QU.<br />
1886, Tif. 71, Fig. 10; IGPT<br />
8 Orthogarantiana densicostata (QU. 1886), HT, «Braunjura delta», Laufen/Eyach; Orig. zu Am. garantianus densicostatus QU. 1886,<br />
Taf. 71, Fig. 9; IGPT<br />
9 Orthogarantiana bifurcata (ZIETEN 1830), HT, Ober-Bajocium, Aalen-Wasseralfingen; aus ZIETEN 1831, Taf. 3, Fig. 3<br />
10 Orthogarantiana crassa (BENTZ 1924), «Braunjura delta», Laufen/Eyach; Orig. zu Am. garantianus QU. 1886, Taf. 71, Fig. 8; IGPT<br />
11 Orthogarantiana inflata (BENTZ 1924), «obere Subfurcaten-Schichten», Lindenbruch bei Harzburg; aus BENTZ 1924, Taf. 7, Fig. 3<br />
212
Tafel 32<br />
1 Garantiana (Garantiana) garantiam (D'ORB. 1846), LT, Ober-Bajocium, St. Vigor, Calvados; aus ARKELL 1956, Taf. 35, Fig. 2<br />
2 Garantiana (Garantiana) baatlata (QU. 1857), NT, «Braunjura delta-, Feuersee bei Eningen/Achalm; Orig. zu QU. 1886, Taf. 70,<br />
Fig. 7; SMNS, Nr. 28224<br />
3 Garantiana (Garantiana) longidens (QU. 1846), «Bifurcaten-Oobthe», Jungingen bei Hechingen; Orig. zu Am. parkmsoni longidens<br />
QU. 1886, Taf. 71, Fig. 6; IGPT<br />
4 Garantiana (Garantiana) dubia (QU. 1846), «Braunjura epsilon», Schwäbische Alb; Orig. zu QU. 1886, Taf. 71, Fig. 30; SMNS,<br />
Nr. 28253<br />
5 Garantiana (Garantiana) wetzeliTRAUTH 1923, HT, «Braunjura epsilon», Ipfbei Bopfingen/Ostalb; Orig. zu Am. parkmsoni densi-<br />
costa QU. 1886, Taf. 72, Fig. 1; IGPT<br />
6 Garantiana (Garantiana) coronata WETZEI. 1911, HT, untere Parkinsonien-Schichten, Teutoburger Wald; Orig. zu WETZEL 1911,<br />
Taf. 12, Fig. 13 u. 14; Geol. Inst, der Univ. Göttingen<br />
7 Garantiana (Pseudogarantiana) diebotoma BENTZ 1928, HT, «Pseudogarantien-Sehichten-, Bethel bei Bielefeld; aus BENTZ 1928,<br />
Taf. 19, Fig. 2<br />
8 Garantiana (Pseudogarantiana) minima WETZEL 1911, «untere Parkinsonien-Schichten, Teutoburger Wald; Orig. zu WETZEL<br />
1911, Taf. 11, Fig. 13; Geol. Inst, der Univ. Göttingen<br />
9 Garantiana (Pseudogarantiana) subfurcata (ZIETEN1830), HT, Ober-Bajocium, Schwabische Alb (ZIETENs Angabe «Lias-Schiefer<br />
von Jebenhausen» muß ein Irrtum sein); aus ZIETEN 1830, Taf. 7, Fig. 6<br />
10 Garantiana (Hlawiceras) alticosta WETZEL 1911, untere Parkinsonien-Schichten, Teutoburger Wald; Orig. zu WETZEL 1911,<br />
Taf. 12, Fig. 6; Geol. Inst, der Univ. Göttingen<br />
11 Garantiana (Hlawiceras) suevica WETZEL 1911, LT, «Bifurcaten-Oolith», Ipf bei Bopfingen/Ostalb; Ong. zu Am. garantianus QU.<br />
1886, Taf. 71, Fig. 15; IGPT<br />
12 Garantiana (Hlawiceras) quenstedti WETZEL 1911, HT, «Braunjura epsilon», Ipfbei Bopfingen/Ostalb; Orig. zu Am. parkinsoni<br />
longidens QU. 1886, Taf. 72, Fig. 3; IGPT<br />
214
"*afel 33<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
1<br />
Garantiana (Hlawiceras) lelragoira WETZEL 191 I, LT, untere Parkinsonien-Schichten, Teutoburger Wald; aus WETZEL 1911,<br />
Taf. 11, Fig. 8 u. 9<br />
^ Parkinsonia (Parkinsonia) arietis WETZEL 1911, «Eisenoolith <strong>des</strong> Braunjura epsilon», Ipf bei Bopfingen/Ostalb; Orig. zu Am. parkin<br />
3<br />
soni plamtlatus QU. 1886, Taf. 71, Fig. 20; IGPT<br />
Parkinsonia (Parkinsonia) rarecostata (BUCKM. 1881), Ober-Bajocium, Oberalfingen bei Aalen; Sig. <strong>des</strong> Verfassers<br />
Parkinsonia (Parkinsonia) radiata RENZ 1904, HT, «Eisenoolith <strong>des</strong> Braunjura epsilon», Ipf bei Bopfingen/Ostalb; Orig. zu Am. par<br />
kinsoni plamtlatus QU. 1886, Taf. 71, Fig. 19; IGPT<br />
Parkinsonia (Parkinsonia) radiata RENZ 1904, Parkinsonien-Schichten, Teutoburger Wald; aus WETZEL 1911, Taf. 15, Fig. 9 u. 10<br />
Parkinsonia (Parkinsonia) acris WETZEL 1911, HT, Parkinsonien-Schichten, Teutoburger Wald; aus WETZEL 1911, Taf. 15, Fig. 3<br />
Parkinsonia (Parkinsonia) parkinsoni (SOW. 1821), HT, Ober-Bajocium, Yeovil (England); aus BUCKM. 1908, Taf. 5, Fig. 2; x 0,8<br />
Parkinsonia (Parkinsonia) scbloenbachi SCHLIPPE 1888, LT, «Ferrugineus-Schichten», Bastberg bei Buchsweiler/Elsaß; aus SCHLIPPE<br />
1888, Taf. 4, Fig. 4<br />
216
Tafel 34<br />
1 Parkinsonia (Parkinsonia) densicosta NICOLESCO 1928, LT, «Braunjura epsilon», Ipf bei Bopfingen/Ostalb; Orig. zu Am. parkinsoni<br />
densicosta QU. 1886, Taf. 72, Fig. 2; IGPT<br />
2 Parkinsonia (Parkinsonia) siibplanulata WETZEL 1911, mittlere Parkinsonien-Schichten, Höhenberg in Franken; Orig. zu Parkinsonia<br />
planulata SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1931, Taf. 88, Fig. 2; IGPEN; x 0,8<br />
3 Parkinsonia (Parkinsonia) bomfordi ARKELL1956, HT, «3 Fuß unter dem Zigzag-Lager», Burton Bradstock/Dorset (Südengland);aus<br />
ARKELL 1956, Fig. 55/3; X 0,85<br />
4 Parkinsonia (Durotrigensia) neuffensis (OPP. 1857), HT, «Braunjura epsilon», Neuffen/Württ.; Orig. zu Am. parkinsonigigas QU. 1886,<br />
Taf. 72, Fig. 9; IGPT; X 0,59<br />
218
Tafel 35<br />
1 Parkinsonia (Gonolkites) convergens (BUCKM. 1925), kondensiertes Unter-Bathonium, ßerchenwald bei Dangstetten; Orig. zu<br />
HAHN 1970, Taf. 1, Fig. 4; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 300<br />
2 Parkinsonia (Oraniceras) gyrumbilicus (QU. 1886), HT, «Braunjura epsilon», Bopfingen/Ostalb; Orig. zu Am. parkinsoni compressus<br />
QU. 1886, Taf. 72, Fig. 15; IGPT; X 0,38<br />
3 Parkinsonia (Oraniceras) wuerttembergica (OPP. 1857), HT, «Braunjura epsilon», Schambach/Franken; Orig. zu Am. parkinsoni compressus<br />
QU. 1847, Taf. 11, Fig. 4; IGPT<br />
4 Parkinsonia (Oraniceras) fretensis WETZEL 1950, «Braunjura epsilon», Aalen-Wasseralfingen; Orig. zu Am. parkinsoni laevis QU.<br />
1886, Taf. 73, Fig. 3; IGPT; X 0,62<br />
5 Parkinsonia (Oraniceras) pseudomacroeepbalus WETZEL 1950, Unter-Bathonium, Aalen; Orig. zu HAHN 1970, Taf. 3, Fig. 12;<br />
SMNS, Nr. 21035<br />
6 Spiroceras orbignyi (BAUGIER u. SAUZE 1843), «oberer Braunjura delta», Eningen/Achalm; Orig. zu Hamites bifurcati QU. 1857,<br />
Taf. 55, Fig. 3; IGPT<br />
7 Spiroceras obliquecostatum (QU. 1886), HT, «oberer Braunjura delta», Eningen/Achalm; Orig. zu QU. 1886, Taf. 70, Fig. 28; SMNS,<br />
Nr. 27739<br />
220
Tafel 36<br />
1 Spiroceras sauzeanum (D'ORB. 1850), Ober-Bajocium, Eningen/Achalm; Orig. zu POTONlE 1929, Taf. 17, Fig. 1; X 0,36; oben<br />
Lateral-, unten Ventralansicht<br />
2 Spiroceras annulatiiiii (DESHAYES 1831), "Braunjura delta-, Eningen/Achalm; Orig. zu Hamites bifurcati QU. 1886, Taf. 70, Fig. 31;<br />
SMNS, Nr. 28236<br />
3 Spiroceras laevigatum (D'ORB. 1850), Ober-Bajocium, Eningen/Achalm; Orig. zu Hamites cf. baculatus (Ancyloceras taevigatus) QU.<br />
1886, Taf. 70, Fig. 17; SMNS, Nr. 27755/2<br />
4 Parapatoceras distans (BAUGIER u. SAUZE 1843), «Braunjura epsilon», Gutmadingen bei Geisingcn/Baden; Orig. zu Hamites<br />
macrocepbali QU. 1886, Taf. 70, Fig. 20 u. 21; oben Dorsal-, Mitte Lateral-, unten Ventralansicht; SMNS, Nr. 27782 u. 27774<br />
5 Parapatoceras tuberculatum (BAUGIER u. SAUZE 1843). Mittel-Callovium, Gammelshausen bei Göppingen; aus DIETL 1978a,<br />
Taf. 8, Fig. 5<br />
6 Paracuariceras incisum SCHINDEWOLF 1963, HT, jason-Zoiw (Mittel-Callovium), Gammelshauscn bei Göppingen; aus DIETL<br />
1978a, Taf. 9, Fig. 6; X 2,7<br />
7 Paracuariceras giganteum DIETL 1981, HT, macrocepbalus-ZoiK (Unter-Callovium), Bergrutsch Klingenbachtal oberhalb Bisingcn-<br />
Thanheim/Zollcmalb; Orig. zu DIETL 1981b, Taf. 1, Fig. 3; SMNS Nr. 26309<br />
8 Paracuariceras aeuforme DIETL 1981, HT, macrocephalus-Zxme (Unter-Callovium), Bergrutsch Klingenbachtal oberhalb Bisingen-<br />
Thanheim/Zollernalb; Orig. zu DIETL 1981b, Taf. 1, Fig. 11; SMNS Nr. 26321<br />
9 Acuariceras acuarius (QU. 1848), jason-Zone (Mittel-Callovium), Gammelshausen bei Göppingen; aus DIETL 1981b, Taf. 9,<br />
Fig. 9; X 2,7<br />
10 Morplioceras (Morpboceras) multiforme ARKELL 1951, «Braunjura epsilon», Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. parkinsoni inflatus<br />
QU. 1886, Taf. 73, Fig. 19; SMNS, Nr. 27689<br />
11 Morpboceras (Morphoceras) macrescens (BUCKM. 1923), «Braunjura epsilon», Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. parkinsoni inflatus<br />
QU. 1886, Taf. 73, Fig. 18; SMNS, Nr. 27761<br />
12 Morphoceras (Morphoceras) patescens (BUCKM. 1922), HT, Unter-Bathonium, Broad Windsor (England); aus ARKELL 1955,<br />
Taf. 17, Fig. 5<br />
13 Morpboceras (Morphoceras) egrediens (WETZEL 1937), HT, «Braunjura epsilon», Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. parkinsonia<br />
inflatus QU. 1886, Taf. 74, Fig. 1; SMNS, Nr. 28267<br />
14 Morphoceras (Morphoceras) jactatum (BUCKM. 1928), «Braunjura epsilon», Beuren bei Nürtingen; Orig. zu Am. parkinsoni inflatus<br />
QU. 1886, Taf. 73, Fig. 22; SMNS, Nr. 28261<br />
15 Morplxxeras (Ebrayiceras) sulcatum (ZIETEN 1830), ITT, Unter-Bathonium, Gammelshausen bei Göppingen; Orig. zu ZIETEN<br />
1830, Taf. 5, Fig. 3; BSPG, Nr. As XX 26; X 1,34<br />
16 Morphoceras (Ebrayiceras) rursum BUCKM. 1927, macrescens-Suimme (Unter-Bathonium), Erkenberg bei Neidlingcn, Kreis Nürtingen;<br />
Orig. zu HAHN 1970, Taf. 6, Fig. 10; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 354; x 1,34<br />
17 Asphinctites (Asphinctites) tenuiplicatus (BRAUNS 1865), kondensiertes Unter-Bathonium, Greding in Franken; Orig. zu HAHN<br />
1970, Taf. 8, Fig. 14; IGPEN, Nr. 1967<br />
222
Tafel 37<br />
1 Aspbmctites (Asphmctites) patrulü HAHN 1970, HT, Fuscus-Bank, Zillhausen bei Balingen; Orig. zu HAHN 1970, Taf. 8, Fig. 1;<br />
SMNS, Nr. 21052<br />
2 Asphmctites (Polyspbinctites) polysphinctus (BUCKM. 1922), Fuscus-Bank (Unter-Bathonium), Lochenbach bei Balingen; Orig. zu<br />
HAHN 1970, Taf. 8, Fig. 9; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 343; X 1,34<br />
3 Aspbmctites (Polyspbinctites) secundus (WETZEL 1950), tenuiplicatus-Subzonc (Unter-Bathonium), Eichberg bei Blumberg/Südba^<br />
den; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 344<br />
4 Macrocepbalites (Macrocephalites) macrocepbalns (SCHL. 1813), NT, Untcr-Callovium, Gebiet von Otlingen bei Nördlingen; aus<br />
CALLOMON 1971, Taf. 15 u. 16; x 0,62<br />
5 Macrocepbalites (Macrocepbalites) transitorius (SPÄTH 1928), «Braunjura epsilon», Dettingen an der Erms; Orig. zu Am. macrocepba<br />
lns tumidus QU. 1886, Taf. 76, Fig. 10; SMNS, Nr. 28315<br />
6 Macrocephalites (Macrocephalites) madagascariensis LEMOINE 1910, Unter-Callovium, Eningen/Achalm; Orig. zu M. macrocephalus<br />
ZETTEL 1884, Abb. 655; BSPG; X 0,74<br />
224
Tafel 38<br />
1 Macrocephalites (Macrocephalites) compressiis (QU. 1846), HT, «Braunjura epsilon», Lochen bei Balingen; Orig. zu Am. macrocephahis<br />
compressus QU. 1886, Tif. 76, Fig. 14; SMNS, Nr. 27687<br />
2 Macrocepbalites (Macrocepbalites) diadematus (WAAGEN 1875), «Golden Oolite», Keera Hill (Indien); aus WAAGEN 1875, Taf. 30,<br />
Fig. 4<br />
3 Macrocephalites (Macrocephalites?) rotimdus (QU. 1847), HT, «Braunjura epsilon», Achdorf bei Blumberg/Südbaden; Orig. zu Am.<br />
macrocephahis rotwulus Q.U. 1886, Taf. 76, Fig. 11; IGPT<br />
4 Macrocephalites (Dolikephalitesi) subtrapeziims WAAGEN 1875, «Golden Oolite», Keera Hill (Indien); aus WAAGEN 1875, Taf. 33,<br />
Fig. 4<br />
226
Tafel 39<br />
1 Macrocephalites (Dolikephalites?) lamellosus (SOW. 1840), HT, «Upper Golden Oolite», Chari, Kutch (Indien); Orig. zu SOW. 1840,<br />
Taf. 23, Fig. 8, aus THIERRY 1978, Taf. 34, Fig. 3<br />
2 Macrocephalites (Dolikephalites) tumidus (REINECKE 1818), HT, «Goldschnecken-Tonc» (Unter-Callovium), Langheim bei Coburg;<br />
aus ZEISS 1972, Abb. 47<br />
3 Macrocephalites (Dolikephalites) perseverans KUHN 1939, HT, «Callovien-Tone», Uetzing/Oberfranken; ausJEANNET 1954,Taf. 25,<br />
Hg. 4<br />
4 Macrocephalites (Dolikephalites?) grantanns (OPP. 1857), HT, «Great Oolite», England; aus D'ORB. 1846, Taf. 150 (Am. herveyi)<br />
5 Macrocephalites (Dolikephalites?) pila NIKITIN 1885, HT, Unter-Callovium, Elatma (UdSSR); aus NIKITIN 1885, Taf. 10, Fig. 45<br />
6 Kepplerites (Kepplerites) keppleri (OPP. 1862), LT, Callovium, Eningen/Achalm; Orig. zu OPP. 1862, S. 151 und BUCKM. 1922, Taf.<br />
289; BSPG<br />
22S
Tafel 40<br />
1 Kepplerttes (Kepplerites) gowerianus (SÜW. 1827), HT, Unter-Callovium [callouiense-ZAme), Brora (Ost-Sclioitland); aus TIN<br />
1963, Taf. 7, Fig. la-d<br />
2 Kepplcrites (Keppleritesf) toricellii (OPP. 1862), LT, macrocepbalus-Zone (Unter-Callovium), Eningen/Achalm; aus BUCKM.<br />
Taf. 292 (Toricelliceras toricellii)<br />
3 Kef)plerites (Toricellites) labuseni PARONA u. BONARELLI 1895, Unter-Callovium («Oolithe ferrugineuse»), Mont-du-Chat,<br />
(Südost-Frankreich); ausTINTANT 1963, Taf. 18, Fig. 1 (nicht abgebildeter «Typus» von PARONA u. BONARELLI 1895,5<br />
4 Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense (SOW. 1815), LT, «Kellaways Rock», Kellaways (Südengland); aus ARKELL 1956, Taf. 37,<br />
5 Sigaloceras (Sigaloceras) enodatum (NIKITIN 1881), HT, Mittcl-Callovium, Elatma (UdSSR); aus TINTANT 1963, Taf. 24,<br />
6 Kosmoceras (Kosmoceras) duncani (SOW. 1816), NT, «Oxford Clav», St. Neots, Huiuingdonshire (England); aus ARKELL<br />
Taf. 11, Fig. 6<br />
7 Kosmoceras (Kosmoceras) rowlslouense (YOUNG u. BIRD 1822), «Braunjura zeta», Linsengraben bei Metzingen-Glems; O:<br />
Am. Jason QU. 1887, Taf. 83, Fig. 22; SMNS, Nr. 28378<br />
8 Kosmoceras (Kosmoceras) spinosum (SOW. 1826), «Topotyp», lamberti-Zonc (Ober-Callovium), Tidmoor Point bei Weyi<br />
(Südengland); aus ARKELL 1940, Taf. 11, Fig. 1<br />
9 Kosmoceras (Kosmoceras) anmilatnm (QU. 1887), LT, «Ornatenton», Schwäbische Alb; Orig. zu Am. ornatus annulatns QU.<br />
Taf. 84, Fig. 17; SMNS, Nr. 28394<br />
10 Kosmoceras (Kosmoceras) tidmoorense ARKELL 1940; «Ornatenton», Schwäbische Alb; Orig. zu Am. ornatus QU. 1887, Ts<br />
Fig. 25; SMNS, Nr. 28397/1<br />
11 Kosmoceras (Kosmoceras) gemmatum (PHILLIPS 1829), NT, Ober-Callovium (?), Hackness Rock, Scarburough Castle/Yor<br />
(Nordengland); aus ARKELL 1940, Fig. 4<br />
12 Kosmoceras (Kosmoceras) «comprcssum- (QU. 1849), HT, «Braunjura zeta», Linsengraben bei Metzingen; aus QU. 1849,1<br />
Fig. 18<br />
13 Kosmoceras (Kosmoceras?) spoliatum (QU. 1858), HT, «Braunjura zeta», Albstadt-Margrethausen; Orig. zu Am. ornatus spc<br />
QU. 1887, Taf. 84, Fig. 3; SMNS, Nr. 28382<br />
230
Tafel 41<br />
1 Kosmoceras (Kosmoceras?) duplicosta (QU. 188/), «Schwarze- Knollen <strong>des</strong> Braunjura zeta", Erkenbrechtsweiler; aus QU. 1S87<br />
Taf. 89, Fig. 17<br />
2 Kosmoceras (Zugokosmoceras) Jason (REIN'ECKE 1818), Mittel-Callovium, Gruibingen; Sig. <strong>des</strong> Verf.; X 1,34<br />
3 Kosmoceras (Zugokosmoceras) pottucinum TEISSEYRE 1884, LT, Mittel-Callovium, Rjasan (zentrale UdSSR); Nachguß <strong>des</strong> Orig. zu •<br />
TEISSEYRE 1884, Taf. 30, Fig. 5; Paläont. Inst, der Univ. Wien<br />
4 Kosmoceras (Gulielmiceras) gulielmii (SOW. 1821); HT, Mittel-Callovium, Umgebung von Chippenham/Wiltshire (England); aus<br />
TINTANT 1963, Taf. 51, Fig. 1<br />
5 Kosmoceras (Gulielmiceras) complanalum TINTANT 1963, HT, Mittel-Callovium, Le Grand Four, Mäcon (S. et 1.., Frankreich); aus<br />
TINTANT 1963, Taf. 53, Fig. 1<br />
6 Kosmoceras (Spinikosmoceras) castor (REINECKE 1818), «Braunjura zeta-, Boller Wald bei Göppingen; Orig. zu «dicker Jason-, QU.<br />
1887, Taf. 83, Fig. 13; SMNS, Nr. 28370<br />
7 Kosmoceras (Spinikosmoceras) pollux (REINECKE 1818), «Ornatenton», Ebermannstadt in Franken; Orig. zu Am. omatus QU. 1887,<br />
Taf. 84, Fig. 19; SMNS, Nr. 28396/1<br />
8 Kosmoceras (Spinikosmoceras) omatum (SCHL. 1820), LT, Ober-Callovium, Langheim in Franken; aus BRINKMANN 1929b,Taf. 1,<br />
Fig. 5; X 1,8<br />
9 Kosmoceras (Spinikosmoceras) aculeatum (EICHWALD 1830), «Ornatenton», Schwäbische Alb; Orig. zu Am. omatus QU. 1887,<br />
Taf. 84, Fig. 26; SMNS, Nr. 28397/2<br />
10 Kosmoceras (Spinikosmoceras) transitionis NIKITIN 1881, HT, Ober-Callovium, Selichowo bei Rybinsk (UdSSR); aus NIKITIN<br />
1881, Taf. 4, Fig. 35<br />
11 Cadoceras sublaeve (SOW. 1814), «Chorotyp», Unter-Callovium, Kellaways/Wiltshire (England); aus BUCKM. 1922, Taf. 275<br />
12 Cadoceras cf. elatmae NIKITIN 1878, Macrocephalus-Oolith (Unter-Callovium), Achdorf bei Blumberg/Südbaden; Orig. zu Am.<br />
sublaevis QU. 1886, Tif. 79, Fig. 3; IGPT<br />
13 Cbamoussetia chamusseti (D'ORB. 1846), «oberer Braunjura», Ipf bei Bopfingen/Ostalb; Orig. zu QU. 1887, Taf. 90, Fig. 18; IGPT<br />
14 Quenstedtoceras intermissum BUCKM. 1922, HT, Oxford Clay, Weymouth (Südengland); aus BUCKM. 1922, Taf. 339 (Bourkelamherticeras<br />
intermissum)<br />
15 Quenstedtoceras intermissum BUCKM. 1922, breitmündige Varietät, «dicht unter den Mergelkuollen <strong>des</strong> Braunjura zeta», Linsengraben<br />
bei Metzingen; Orig. zu Am. lamberti macer QU. 1887, Taf. 90, Fig. 21; SMNS, Nr. 28520<br />
232
Tafel 42<br />
1 Cbamoussetia crobyloi<strong>des</strong> (QU. 1887), HT, Braunjura zeta, Linsengraben bei Metzingen; Orig. zu Am. lamberticrobyloi<strong>des</strong> QU. 1887,<br />
Taf. 90, Fig. 19; SMNS, Nr. 28524<br />
2 Quenstedtoceras lamberti (SOW. 1819), Ober-Callovium, Geislingen/Steige; IGPT, Nr. 1626/4<br />
3 Quenstedtoceras henrici DOUV1LLE 1912, Ober-Callovium, Villers-sur-Mer (Frankreich); aus DOUVILLE 1912, Taf. 4, Fig. 32<br />
4 Quenstedtoceras leachi (SOW. 1819), NT, lamberti-Zone, Tidmoor Point bei Weymouth (Südengland); aus ARKELL 1940, Taf. 10,<br />
Fig. 5<br />
5 Goliathiceras cf. goliatbns (D ORB. 1848), «S chwarze Knollen» <strong>des</strong> Braunjura zeta, Ursulaberg bei Eningen/Achalm; Orig. zu Am. lamberti<br />
inßatus QU. 1887, Taf. 90, Fig. 17; IGPT (durch Abrieb verschmälert)<br />
6 Goliathiceras (?) «plague- (QU. 1887), «Schwarze Knollen» <strong>des</strong> Braunjura zeta, Linsengraben bei Metzingen-Glems; Orig. zu QU.<br />
1887, Taf. 90, Fig. 15; IGPT<br />
7 Leptospbinctes (Leptospbinctes) leptus BUCKM. 1920, HT (Nachguß), obere niortense-Zone (Ober-Bajocium), Dorset (Südengland);<br />
Orig. zu DIETL 1980b, Abb. 3; SMNS<br />
8 Leptospbinctes (Leptospbinctes) davidsoni BUCKM. 1881 (Nachguß), Cadomcnsis-Lager (Ober-Bajocium), Sherborne (England);<br />
Orig. zu DIETL 1980b, Abb. 7, SMNS<br />
234
Tafel 43<br />
1 leptosphinctes (Leptosphinctes) festonensis PAVIA 1973, HT (Nachguß), blagdeni-Subzone (oberes Mittel-Bajocium), Ravin de Feston<br />
bei Digne (Südost-Frankreich)<br />
2 Leptosphinctes (Leptosphinctes) schmieren (BENTZ 1924), baculata-Svbzone (unteres Ober-Bajocium), Südhang <strong>des</strong> Eyach-Tales<br />
oberhalb Frommem; Orig. zu DIETL 1980b, Taf. 1, Fig. 1; SMNS, Nr. 25987; X 0,61<br />
3 leptosphinctes ( leptosphinctes) stephanoceratoi<strong>des</strong> (KACHADZE u. ZESASVILI 195 6, baculata-Subzxxae (unteres Ober-Bajocium),<br />
Bisingen/Zollemalb; Orig. zu DIETL 1980b, Taf. 4, Fig. 2; SMNS, Nr. 25999<br />
4 Leptosphinctes (Cleistosphinctes) deistus BUCKM. 1920, HT, niortense-Zoiw, Frogden Quarry, Obome/Dorset (Südengland); aus<br />
BUCKM. 1920, Taf. 161<br />
5 Leptosphinctes (Cleistosphinctes?) perspieuus (PARONA 1896), baculata- Subzone (unteres Ober-Bajocium), Bisingen/Zollemalb;<br />
Orig. zu DIETL 1980b, Taf. 10, Fig. 7; SMNS, Nr. 25998<br />
6 Leptosphinctes (Cleistosphinctes) paucicosta KACHADZE u. ZESASVILI 1956, /w/ygvnifo-Subzone (unteres Ober-Bajocium), Bisin<br />
gen/Zollemalb; Orig. zu DIETL 1980b, Taf. 10, Fig. 10; SMNS, Nr. 26015<br />
7 Leptosphinctes (Cleistosphinctes) minorDlETL 1980, HT, niortense-Zone (unteres Ober-Bajocium, Schlatt im Killertal (Württ.); Orig.<br />
zu DIETL 1980b, Taf. 10, Fig. 4; SMNS, Nr. 26132<br />
8 Vermisphinctes martiusi (SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1931), obere Parkinsonien-Schichten, Kirclileuser Knock bei Kulmbach;<br />
Orig. zu SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1931, Taf. 86, Fig. 5; IGPEN<br />
9 Bigotites lenki SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1931, HT, obere Parkinsonien-Schichten?, Heimburg bei Neumarkt/Oberpfalz; aus<br />
SCHMIDTILL u. KRUMBECK 1931, Taf. 90, Fig. 2<br />
236
Tafel 44<br />
1 Bigotites tuberculatus (NICOLESCO 1916), HT, Ober-Bajocium, Bayeux (Nordwest-Frankreich);ausNICOLESC01916),Taf.4,<br />
Fig. 2<br />
2 Planisphinctes tenuissimus (S1EMIRADZKI 1S9S), HT, Grenze Bajocium/Bathonium, Chaudon (Frankreich); aus SIEMIRADZKI<br />
1898, Taf. 21, Fig. 19<br />
3 Planisphinctesgredingensis (DORN 1927), HT, Unter-Bathonium, Thalmässing/Mittelfranken; Orig. zu DORN 1927, Taf. 6, Fig. 7;<br />
IGPEN<br />
4 Planisphinctes?incognitas (STEPHANOV 1972), HT, obere Parkinsonien-Schichten, Thalmässing/Mittelfranken; Orig. zu Perisphinc-<br />
tes perspieuus DORN 1927, Taf. 7, Fig. 2; IGPEN<br />
5 Zigzagiceras (Zigzagicers) euryodos (SCHMIDT 1846), Unter-Bathonium, Beuren bei Hechingen; Orig. zu HAHN 1969, Taf. 2, Fig. 4;<br />
SMNS, Nr. 21023<br />
6 Zigzagiceras (Zigzagiceras) plenum ARKELL 1958, Unter-Bathonium, Balingen-Zillhausen; Orig. zu HAHN 1969, Taf. 2, Fig. 3;<br />
SMNS, Nr. 20733<br />
7 Zigzagiceras (Procerozigzag) pseudoprocenim BUCKM. 1892, kondensiertes Unter-Bathonium, Buchenwald bei Dangstetten nahe<br />
Waldshut; Orig. zu HAHN 1972, Taf. 1, Fig. 1; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Slg. ROSSWOG; X 0,48<br />
8 Procerites (Procerites) laeviplex (QU. 1887), LT, yeovilensis-Subzone (Unter-Bathonium), Eningen/Achalm; Orig. zu QU. 1887,Taf. 80,<br />
Fig. 10; SMNS, Nr. 28576; X 0,23<br />
9 Procerites (Procerites) stepbanovi HAHN 1969, HT, yeovilensis/tenuiplicatits-Sxxbzone (oberes Unter-Bathonium), Lochenbach bei<br />
Balingen; Orig. zu HAHN 1969, Taf. 5, Fig. 1; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 121; X 0,30<br />
238
Tafel 45<br />
1 Procerites (Procerites) qitercimis (TERQUEM u. JOURDY 1869), retrocostatum- Zone (Ober-Bathonium), Berchenvvald bei Dangstet<br />
ten nahe Waldshut; Orig. zu HAHN 1969, Taf. 8, Fig. 2; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 126; X 0,41<br />
2 Procerites (Procerites) imitator (BUCKM. 1922), progracilis-Zone (Mittel-Bathonium), Eichberg bei Blumberg/Südbaden; Orig. zu<br />
HAHN 1969, Text-Abb. 4; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 129; X 0,52<br />
3 Procerites (Procerites) mirahilis ARKELL 1958, HT, Ober-Bathonium, Cotswold Slates bei Eyford/Glos. (England); aus ARKELL<br />
1958, Text-Fig. 75; X 0,24<br />
4 Procerites (Procerites) hodsoni ARKELL 1958, retrocostatum- Zone (Ober-Bathonium), Eichberg bei Blumberg/Südbaden; Orig. zu<br />
HAHN 1969, Text-Abb. 7; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 138; X 0,34<br />
240
Tafel 46<br />
1 Procerites (Procerites) eiebbergensis HAHN 1969, HT, retrocostatum-Zom (Ober-Bathonium), Eichberg bei Blumberg/Südbaden;<br />
Orig. zu HAHN 1969, Taf. 2, Fig. 1; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 141; x 0,30<br />
2 Procerites (Procerites) subprocerus (BUCKM. 1892), kondensiertes Unter-Bathonium, Berchenwald bei Dangstetten nahe Waldshut;<br />
Orig. zu HAHN 1972, Taf. 1, Fig. 2; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 152; X 0,42<br />
3 Procerites (Siemiradzkia) aurigera (OPP. 1857), NT, Unter-Bathonium, Samt-Benin d'Azy (Nievre, Frankreich); aus GROSSOUVRE<br />
1918, Taf. 15, Fig. 6<br />
4 Procerites (Siemiradzkia) matisconensis (LISSAJOUS 1923), subcoutractus-Zone (Mittel-Bathonium), Talheim am Lupfen; Orig. zu<br />
DIETL, EBEL u. HUGGER 1979, Abb. 4a; SMNS, Nr. 24478<br />
5 Procerites (Siemiradzkia) procera (v. SEEBACH 1864), HT, Unter-Bathonium, Mainzholzen/Hils, Niedersachsen; Orig. zu WEST.<br />
1958, Taf. 34, Fig. 1; Geol. Inst, der Univ. Göttingen<br />
6 Procerites (Siemiradzkia) locbenensis HAHN 1969, HT, yeovilensis/tenuiplicatus-Subzone (oberes Unter-Bathonium), Lochenbach bei<br />
Balingen; Orig. zu HAHN 1969, Taf. 6, Fig. 1; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 114<br />
7 Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) acuticosta (ROEMER 1911), Varians-Schichten, Riedböhringen bei Donaueschingen; Orig. zu<br />
HAHN 1969, Taf. 7, Fig. 3; SMNS, Nr. 21032<br />
242
Tafel 47<br />
1 Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) Ixnnoetnnorpbus BUCKM. 1922, HT, Cornbrash, Stalbridge Weston/Dorset (Eimland)-<br />
ARKELL 1958, Taf. 30, Fig. 4<br />
2 Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) psetidoaimularis LISSAJOUS 1923, HT, Mittel-Bathonium, Fuis.se (Frankteich); aus LI<br />
JOUS 1923, Taf. 4, Fig. 6<br />
3 Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) pseudoannularis LISSAJOUS 1923, Varians-Schichtcn [subcontracttis-ZoiK, Mittelnium),<br />
Taiheim am Lupfen; Orig. zu DIETL, EBEL u. HUCGER 1979, Abb. 4b; SMNS, Nr. 24482<br />
4 Homoeoplanulites (Homoeoplanulites?) buebbergensis (HAHN 1972), HT, SubcontractUS-Zoac (Mittel-Batlionium), Buchberg<br />
Blumberg'Südbaden; Orig. zu HAHN 1972, Taf. 2, Fig. 4; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg, Nr. Ba 151<br />
5 Homoeoplanulites (Paraehoffatia) subbakeriae (D'ORB. 1846), Aspidoi<strong>des</strong>-Oolith (Ober-Bathonium), Lautlingen bei Balingen;<br />
HAHN 1969, Taf. 3, Fig. 2; X 0,45<br />
6 Homoeoplanulites (Paraehoffatia) fimutus (OPP. 1857), HT, -Braunjura epsilon-, Achdorf an der Wutach; Orig. zu Am. triplicatus<br />
1847, Taf. 13, Fig. 7; IGPT<br />
244
Tafel 48<br />
1 lndosphinctes (Elatmites) revili MANGOLD 19/0, HT, Unter-Callovium, Fontaine du Landard, Chanaz (Savoyen, Frankreich); au;<br />
MANGOLD 1970, Taf. 7, Fig. 2<br />
2 Indosplrinctes(i) (Elatmites?) curvicosta (OPP. 1857), «Braunjura zeta-, Gammelshausen bei Göppingen; Orig. zu Am. convolutus para-<br />
bolis QU. 1847, Taf. 13, Fig. 2; SMNS, Nr. 27685<br />
3 lndosphinctes (Elatmites) graciosus (SIEMIRADZKI 1894), Unter-Callovium, Fontaine du Landard, Chanaz (Savoyen, Frankreich); au;<br />
MANGOLD 1970, Taf. 9, Fig. 2 u. 3<br />
4 lndosphinctes (Elatmites) comptoni (PRATT 1841), «Braunjura zeta», Linsengraben bei Metzingen-Glems; Orig. zu Am. convolutte<br />
auritulus QU. 1887, Taf. 81, Fig. 31; SMNS, Nr. 28332<br />
5 lndosphinctes (Elatmites) pseudoscopinensis (KUHN 1939), HT, Unter-Callovium, Ebermannstadt/Franken; aus KUHN 1939, Taf. 10.<br />
Fig. 12<br />
6 lndosphinctes (Elatmites) leptoi<strong>des</strong> (TILL 1911), HT, Callovium, Villäny (Ungarn); aus TILL 1911, Taf. 5, Fig. 1 und 2<br />
7 Wagnericeras suspensum (BUCKM. 1922), kondensiertes Unter- und Mittel-Bathonium, Bopfingen-Oberdorf/Ostalb; Orig. zu<br />
HAHN 1969, Taf. 1, Fig. 2; SMNS, Nr. 21030<br />
8 Wagnericeras fortecostatum (DE GROSSOUVRE 1930), HT, Mittel-Bathonium, Nievre (Frankreich); aus DE GROSSOUVRE 1930,<br />
Taf. 40, Fig. 11<br />
246
Tafel 49<br />
1 Choffatia (Choffatia) cerealis ARKELL 1959, HT, Combrash (Ober-Bathonium/Unter-Callovium), Umgebung von Yeovil (?) (Dorset.<br />
Südengland); aus ARKELL 1959, Taf. 31, Fig. 4; X 0,42<br />
2 Choffatia (Choffatia) orion (OPP. 1857), HT, «Braunjura zeta», Jungingen bei Hechingen; Orig. zu Am. convolutus gigas QU. 1847,<br />
Taf. 13, Fig. 6; SMNS, Nr. 27686<br />
3 Choffatia (Choffatia) recupcroi (GEMMELLARO 1872), HT, macrocephahis- Zone, Calatafimi, Provinz Trapani, Sizilien; aus GEM-<br />
MELLARO 1872, Taf. 5, Fig. 9<br />
4 Choffatia (Choffatia) evoluta (NEUMAYR 1871), Unter-Callovium, Baiin bei Krakau (Polen); aus NEUMAYR 1871, Taf. 14, Fig. 2<br />
5 Choffatia (Grossouvria) sulcifera (OPP. 1857), HT, «Braunjura zeta», Gammelshausen bei Göppingen; Orig. zu Am. convolutus omati<br />
QU. 1847, Taf. 13, Fig. 1; SMNS, Nr. 27722<br />
6 Choffatia (Grossouvria) evexa (QU. 1887), «Ornatenton», Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. convolutus evexus QU. 1887, Taf. 81,<br />
Fig. 16; SMNS, Nr. 28323<br />
7 Choffatia (Grossouvria) dilatata (QU. 1887), LT, «Ornatenton», Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. convolutusdilatatus QU. 1887,<br />
Taf. 81, Fig. 1; SMNS, Nr. 28318/1<br />
8 Choffatia (Grossouvria) crassa (SIEMIRADZKI 1894), macrocephalus-Zone, Geisingen/Donau; Orig. zu Am. triplicatus paraholis<br />
QU. 1886, Taf. 79, Fig. 39; IGPT<br />
9 Choffatia (Grossouvria) polonica (SIEMIRADZKI 1894), HT, Callovium, Rudniki (Südpolen); aus SIEMIRADZKI 1894, Taf. 41,<br />
Fig. 3<br />
10 Choffatia (Grossouvria) kontkiewiczi (SIEMIRADZKI 1894), HT, Callovium, Rudniki (Südpolen); aus SIEMIRADZKI 1894, Taf. 38,<br />
Fig. 3<br />
11 Choffatia (Grossouvria) evolutescens (KUHN 1939), HT, calbviense-Zone (Unter-Callovium), Ützing in Franken; aus KUHN 1939,<br />
Taf. 8, Fig. 6<br />
248
Tafel 50<br />
1 u. 2 Biuatispbinctes (Biuatispbinctes) rossicus (SIEMIRADZKI 1899), Mittel-Callovium (?), Tschulkowo, «Gouvernement" Rjasan<br />
(zentrale UdSSR); aus LAHUSEN 1883, Taf. 9, Fig. 6 (hier Fig. 1) und Fig. 4 (Perispbinctes mosqueiisis, hier Fig. 2))<br />
3 Bmatisphmctes (Okaites?) subaurigerus (TEISSEYRE 1883), «Ornatenton», Pronsk, «Gouvernement- Rjasan (zentrale UdSSR); aus<br />
TEISSEYRE 1883, Taf. 5, Fig. 39<br />
4 Proplamäites koenigi (SOW. 1820), «Kellaways Clay», nahe Chippenham/Wiltshire (England); aus ARKELL 1933<br />
5 Proplanulites teisseyrei TORNQUIST 1894, LT, Callovium, Chateau <strong>des</strong> Pourcan<strong>des</strong> bei Mezieres (Frankreich); aus TORNQUIST<br />
1894, Taf. 45, Fig. 1<br />
6 Proplamäites teisseyrei TORNQUIST 1894, Callovium, Ebermannstadt/Franken; Orig. aus der Slg. KUHN <strong>des</strong> IGPEN (urtümlich<br />
etikettiert mit KUHN 1939, Taf. 7, Fig. 14)<br />
7 Tulites (Tulites) modiolaris (SMITH 1817), NT, Fuller's Earth Rock (Mittel-Bathonium), Twiverton bei Bath (England); aus ARKELL<br />
1952, Taf. 11, Fig. 4<br />
8 Tulites (Tulites) subcontraetus (MORRIS u. LYCETT 1851), LT, Great Oolite (Mittel- und Ober-Bathonium), Minchinhampton/Glos.<br />
(England); aus BUCKM. 1921, Taf. 270<br />
250
Tafel 51<br />
1 Tulites (Tulites) cadus BUCKM. 1921, HT, Great Oolite (Mittel- und Ober-Bathonium), Minchinhampton/Glos. (England); aus<br />
ARKELL 1952, Text-Fig. 28; x 0,71<br />
2 Tulites (Tulites) rugifer (BUCKM. 1922), HT, Fuller's Earth Rock (Mittel-Bathonium), Thomford/Dorset (England); aus ARKELL<br />
1953, Taf/13, Fig. 1<br />
3 Tulites (Tulites) pofypleurus (BUCKM. 1923), HT, Fuller's Earth Rock (Mittel-Bathonium), Thomford/Dorset; aus ARKELL 1953,<br />
Taf. 13, Fig. 2<br />
4 Tulites (Tulites) pumilus ARKELL 1954, subcontractus-Zom (Mittel-Bathonium), Talheim am Lupfen; Orig. zu DIETL, EBEL u.<br />
HUGGER, Text-Abb. 3a; SMNS, Nr. 24461<br />
252
Tafel 52<br />
1<br />
1 Tulites CTrolliceras) reuteri (ARKELL 1951), HT, «Aspidoi<strong>des</strong>-Schichten•-, Holzberg bei Schwandorf/Oberpfalz; aus ARKELL 195 la,<br />
Taf. 2, Fig. 7<br />
2 Bullatimoipbites (Buüathnorphites) latecentratus (QU. 1886), HT, «Braunjura epsilon», Laufen an der Eyach; Orig. zu Am. bullatus latc-<br />
centratus QU. 1886, Tif. 77, Fig. 6; IGPT; x 0,8<br />
3 Bullatimorphites (BulLitimorphiles) weigelti (KUHN 1939), HT, Unter-Callovium, Ebermannstadt/Franken; Orig. zu «Spbaeroceras»<br />
weigelti KUHN 1939, Taf. 7, Fig. 3; IGPEN<br />
4 Bullatimorphites (Kheraiceras) bullatus (D'ORB. 1846), «Aspidoi<strong>des</strong>-Oolitlv (Ober-Bathonium), Eichberg bei Blumberg/Südbaden;<br />
Orig. zu HAHN 1971b, Taf. 7, Fig. 2; Geol. Lan<strong>des</strong>amt Freiburg; Nr. Ba 420<br />
5 Bullatimorphites (Kheraiceras) dorm (KUHN 1939), HT, Unter-Callovium, Ebermannstadt/Franken; Orig. zu ••Sphaeroceras« dornt<br />
KUHN 1939, Taf. 7, Fig. 2; IGPEN<br />
6 Bullatimorphites (Sphaeroptychius) margiiiatus (ARKELL 1951), HT, ••Aspidoi<strong>des</strong>-Schichten» (Ober-Bathonium), Holzberg bei<br />
Schwandorf/Oberpfalz; aus ARKELL 1951a, Taf. 1, Fig. 10<br />
7 Bullatimorphites (Bonihurites) suevicus (ROEMER 1911), LT, "Aspidoi<strong>des</strong>-Schichten», (Ober-Bathonium), Lechstedt bei Hil<strong>des</strong>heini;<br />
Orig. zu ROEMER 1911, Taf. 7, Fig. 20 und Taf. 4, Fig. 37; Geol. Inst, der Univ. Güttingen<br />
8 Bullatimorphites (Bonihurites) microstoma (D'ORB. 1846), "Braunjura epsilon», Lochen bei Balingen; Orig. zu QU. 1886, Taf. 78,<br />
Fig. 4; IGPT<br />
254
Tafel 53<br />
1 Morrisiceras (Morrisiceras) spham BUCKM. 1920, HT, Fuller's Earth Rock {sitbcontractus-Zone, Mittel-Bathonium), Umgebung von<br />
Sherborne/Dorset (England); aus ARKELL 1954, Text-Fig. 39<br />
2 Morrisiceras (Morrisiceras) morrisi (OPP. 1857), HT, Great Oolite (Mittel- und Ober-Bathonium), Minchinhampton/Glos. (England);<br />
aus ARKELL 1954, Taf. 14, Fig. 3<br />
3 Morrisiceras (Morrisiceras) comnia BUCKM. 1921, HT, Fuller's Earth Rock (sulxottiraetus-Zoae, Mittel-Bathonium), Shepton Monta-<br />
gue/Somerset (England); aus ARKELL 1954, Text-Fig. 44<br />
4 Morrisiceras (Morrisiceras) bulbosum (ARKELL 1954), morrisi-Zone (Mittel-Bathonium), Eichberg bei Blumberg/Südbaden; aus<br />
HAHN 1971b, Taf. 5, Fig. 1; x 0,85<br />
256
s<br />
Tafel 54<br />
1 Morrisiceras (Morrisiceras) krumbecki ARKELL 1951, HT, «Aspidoi<strong>des</strong>-Schichten» (Ober-Bathonium), Holzberg bei Sdivvandorf/<br />
Oberpfalz; aus ARKELL 1951a, Taf. 1, Fig. 7<br />
2 Morrisiceras (Holzbergia) schwandorfense (ARKELL 1951), HT, «Aspidoi<strong>des</strong>-Schichten» (Ober-Bathonium), Holzberg be. Schwan<br />
dorf/Oberpfalz; aus ARKELL 1951a, Taf. 1, Fig. 8<br />
3 Morrisiceras (Holzbergia) scbwandorfense (ARKELL 1951), feinnppige Varietät, kondensiertes Bathonium, Bopfingen-Oberdorf; aus<br />
HAHN 1971b, Taf. 4, Fig. 3<br />
4 Oecoptychius refractus (REINECKE 1818), «Braunjura zeta», Oberlenningen/Württ.; Orig. zu QU- 1887, Taf. 86, Fig. 37; SMNS,<br />
Nr. 27775; X 1,8<br />
5 Erymnoceras coronatum (D'ORB. 1847), LT?, «Oxford inferieur», Frankreich; aus D'ORB. 18 47<br />
> T a f<br />
- l 6 9<br />
6 Erymnoceras coronoi<strong>des</strong> (QU. 1887), LT, Ornatenton, Linsengraben bei Metzingen/Glems; Orig. zu Q U<br />
- 1 8 8 7<br />
SMNS, Nr. 28489<br />
' F<br />
' 8<br />
'<br />
'<br />
l j X<br />
°'<br />
2 6<br />
T a f 8 7<br />
' ' F<br />
' 8<br />
'<br />
7 Erymnoceras doliforme ROMAN, LT, «Minerai de fer», La Voulte-sur-Rhone (Frankreich); aus SAYN u. ROMAN, Taf. 13, Fig. _<br />
8 Pachyceras lalandeanum (D'ORB 1847), HT, Ober-Callovium, Frankreich; aus CHARPY 1976, Taf. 5, Fig. 4 («makroconche Form»);<br />
X0,62<br />
9 Pachyceras jarryi DOLMLLE 1912, NT, Ober-Callovium, VUlers-sur-Mer (Frankreich); aus CHARPY 1976, Taf. 2, Fig. 3 («mikro-<br />
conche Form»)<br />
258<br />
3 5 ,
Tafel 55<br />
1 Rehmannia rehmanni (OPP. 1857), «markoconcher Form-Typus», obere macrocephalus-Zone (Unter-Callovium), Limalonges, Deux<br />
Sevres (Frankreich); aus CARIOU 1980, Taf. 3, Fig. 2; X 0,65<br />
2 Rehmannia revili (PARONA u. BONARELLI 1897), Unter-Callovium, Doux, Deux-Sevres (Frankreich); aus CARIOU 1980, Taf. 4<br />
Fig. 5 (Rehmannia (Rehmannia) gr. rehmanni (OPP), f. revili, Mikroconch)<br />
3 Rehmannia flexuosa CARIOU 1980, HT, Makroconch, untere jason-Zonn (Mittel-Callovium) Grimaudiere, Vienne (Frankreich); aus<br />
CARIOU 1980, Taf. 15, Fig. 1; X 0,63<br />
4 Rehmannia britannica (ZEISS 1956), Makroconch, untere jason-Zom (Mittel-Callovium), La Grimaudiere, Vienne (Frankreich); aus<br />
CARIOU 1980, Taf. 18, Fig. 1<br />
5 Rehmannia inacuticostata (LOCZY 1915), HT, Callovium, Villänyer Gebirge (Ungarn); aus LOCZY 1915, Taf. 8, Fig. 3 (Reineckeia<br />
hungarica TILL var. inacuticostata); X 0,77<br />
260
Tafel 56<br />
1 Rebmannia jeanneti (ZE1SS 1956), HT, Callovium, Ueken (Schweiz); aus JEANNET 1951, Taf. 57, Fig. 2 (Rcineckeites Imngaricus<br />
TILL)<br />
2 Remeckeia (Reineckeia) francouica (QU. 1886), LT, «Epsilon-Oolith» (Unter-Callovium), Ipfbei Bopfingen/Ostalb; Orig. zu Am. anceps<br />
franconicus QU. 1886, Taf. 74, Fig. 39; IGPT; x 0,50<br />
3 Remeckeia (Reineckcia) anceps (REINECKE 1818), untere jason-Zone (Mittel-Callovium) La Grimaudiere, Vienne (Frankreich); aus<br />
CARIOU 1980, Taf. 35, Fig. 1; X 0,78<br />
4 Reineckeia (Reineckeia) anceps (REINECKE 1818), HT, «Goldschneckentonc», Ützing in Franken; aus ZEISS 1972, Taf. 3, Fig. 61<br />
(Reproduktion der RTINECKEschen Originalabbildung)<br />
5 Reineckeia (Reineckeia) kiliani PARONA u. BONARELLI 1897, Mittel-Gtllovium, Les Maison Blanches (Frankreich); aus CARIOU<br />
1980, Taf. 40, Fig. 4; X 0,42<br />
262
Tafel 57<br />
1 Reineckeia (Reineckeia?) pofycosta KUHN 1939, HT, Mittel-Callovium, Bernrieht in Franken; aus KUHN 1939, Taf. 2, Fig. 24<br />
2 Reineckeia (Reineckeia?) cf. polycosta KUHN 1939, Mittel-Callovium, Montreuil-Bellay, Maine et Loire (Frankreich); aus CARIOU<br />
1980, Taf. 42, Fig. 4; X 0,35<br />
3 Reineckeia (Reineckeites) eusculpta TILL 1911, Unter-Callovium, Doux, Deux-Sevres (Frankreich); aus CARIOU 1980, Taf. 27, Fig. 3<br />
(Reineckeia (Tyrannites) pictava (BOURQU1N) f. savarensis, Mikroconch); X 0,64<br />
4 Reineckeia (Reineckeites) corroyi ZEISS 1956, HT, Ober-Callovium, Vesaignes, Haute-Marne (Frankreich); aus CORROY 1932,<br />
Taf. 14, Fig. 1 u. 2 (Reineckeia stuebeli STEINMANN)<br />
5 Reineckeia (Reineckeites) stuebeli STEINMANN, LT, Mittel-Callovium, Mamers, Sarthe (Frankreich); aus CARIOU 1980, Taf. 41,<br />
% 4<br />
6 Reineckeia (Reineckeites) stuebeli STEINMANN, «Ornatenton», Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. parkinsoni coronatus QU.<br />
1886, Taf. 74, Fig. 17; SMNS, Nr. 28280<br />
7 Collotia (Collotia) falcata (TILL 1907), Mittel-Callovium, Besancon (Frankreich); aus BOURQUIN 1968, Taf. 17, Fig. 1<br />
8 Collotia (Collotia) fraasi (OPP. 1857), LT, atbleta-Zone (Ober-Callovium), Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. fraasi OPP. 1857,<br />
Taf. 48, Fig. 4; BSPG<br />
9 Collotia? (Collotia?) alemannica (ZEISS 1956), HT, athleta- Zone (Ober-Callovium), Blumberg/Südbaden; Orig. zu ZEISS 1956,<br />
Taf. 3, Fig. 12; BSPG<br />
10 Co//ofM (Kellawaysia) hereticus (MAYER 1865), Ober-Callovium, Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. fraasi OPP. 1857, Taf. 48,<br />
Fig. 6; BSPG<br />
264
Tafel 58<br />
1 Mtocems (Fehoceras) atbleta (PHILLIPS 1829), NT, Ober-CaUovium, Scarborougfa (England); aus SPÄTH 1931, Taf. 106, Fig. 3 u.<br />
Taf. 107, Fig. 5<br />
2 Fehoceras (Bsltoceras) berckhemeri PRIESER 1937, HT, untere athleta-Zoae (Ober-Callovium), Boll bei Göppingen; aus PRIESER<br />
1937, Ta£ 1, Fig. 1<br />
3 Peltoceras (Peltoceras) modeli PRIESER 1937, HT, untere atbleta-Zonc, Neidlingen; aus PRIESER 1937, Taf. 1, Fig. 10<br />
4 Peltoceras (Peltoceras) trifidum (QU. 1887), LT, «Braunjura zeta-, Ursulaberg bei Eningen/Achalm, aus QU. 1887, Taf. 88, Fig. 1<br />
(Am. athleta)<br />
5 Peltoceras (Peltoceras) dacquei (PRIESER 1937), HT, «Callovium von Dives» (Frankreich) aus PRIESER 1937, Taf. 3, Fig. 2; x 0,74<br />
6 Peltoceras (Peltoceras) unispmosum (QU. 1847), Ober-Callovium, Schwäbische Alb; IGPT, Nr. 1626/2<br />
7 Peltoceras (PeltoceratoiJes) athletoi<strong>des</strong> (IAHUSEN 1883), LT, Ober-Callovium, Fluß Poschwa, «Gouvernement» Rjasan (zentrale<br />
UdSSR); aus LAHUSEN 1883, Taf. 10, Fig. 7<br />
8 Peltoceras (Peltoceratoi<strong>des</strong>) athletoi<strong>des</strong> (LAHUSEN 1883), Ober-Callovium, Fluß Poschwa, «Gouvernement» Rjasan (zentrale UdSSR):<br />
aus LAHUSEN 1883, Taf. 10, Fig. 6<br />
9 Peltoceras (Parapeltoceras) aimulare (REINECKE 1818), «Braunjura zeta», Gammelsliausen/Württ.; Orig. zu Am. amiularis QU.<br />
1887, Taf. 88, Fig. 11; SMNS, Nr. 28498<br />
10 Peltoceras (Parapeltoceras?) oblongum (QU. 1887), HT, «Braunjura zeta», Ursulaberg bei Eningen/Achalm; Orig. zu Am. amiularis<br />
oblongus QU. 1887, Taf. 88, Fig. 12; SMNS, Nr. 28500<br />
11 Peltoceras (Parapeltoceras) pseudocaprimim PRIESER 1937, LT, «Braunjura zeta», Eningen/Achalm; aus PRIESER 1937, Taf. 3, Fig. 4<br />
12 Peltoceras (Parapeltoceras) kaiseri PRIESER 1937, untere atbleta-Zone, Boll bei Göppingen; Orig. zu PRIESER 1937, Taf. 1, Fig. 11;<br />
BSPG, Nr. 619<br />
266
Tafel 59<br />
1 Peltoceras (Parapeltoceras) trapezoi<strong>des</strong> PRIESER 1937, LT, athleta-Zone, Boll bei Göppingen; Orig. zu PRIESER 1937, Taf. 4; BSPG<br />
Nr. 411<br />
2 Peltoceras (Parapeltoceras) baylei PRIESER 1937, HT, Ober-Callovium, Argile de Dives, Calvados (Frankreicli); aus BAYLE 1878,<br />
Taf. 49, Fig. 9<br />
3 Peltoceras (Parapeltoceras) subamiulosurn PRIESER 1937, LT, athleta-Zonc, Boll bei Göppingen; Orig. zu PRIESER 1937, Taf. 3,<br />
Fig. 7; BSPG, Nr. 401<br />
4 Peltoceras (Rursiceras) annulosum (QU. 1887), LT, Ober-Callovium, Ursulaberg bei Eningen/Achalm; Orig. zu QU. 1887, Taf. 8S.<br />
Fig. 22; SMNS, Nr. 28505<br />
5 Peltoceras (Rursiceras) caprinum (QU. 1847), HT, «Braunjura zeta», Lochen bei Balingen; Orig. zu QU. 1847, Taf. 16, Fig. 5 und QU.<br />
1887, Taf. 88, Fig. 25; IGPT<br />
6 Peltoceras (Rursiceras) retractum PRIESER 1937, HT, athleta- Zone, Boll bei Göppingen; Orig. zu PRIESER 1937, Taf. 3, Fig. 8; BSPG,<br />
Nr. 415<br />
7 Peltoceras (Rursiceras?) filatum (QU. 1887), HT, «Braunjura zeta», Ursulaberg bei Eningen/Achalm; Orig. zu Am. annularisfilatusQU.<br />
1887, Taf. 88, Fig. 20; SMNS, Nr. 28503<br />
8 Paraspidoceras (Extranodites) interninodatwn ZEISS 1962, HT, Ober-Callovium, Gammelshausen/Württ.; Orig. zu Am. bakeriae<br />
distractus QU. 1887, Taf. 89, Fig. 3; IGPT<br />
9 Paraspidoceras (Extranodites) raricostatum ZEISS 1962, HT, Ober-Callovium, Mössingen-Öschingen; Orig. zu Am. bakeriae distractus<br />
QU. 1887, Taf. 89, Fig. 7; SMNS, Nr. 28509<br />
10 Paraspidoceras (Extranodites) distractum (QU. 1857), LT, Ober-Callovium, Stuifen bei Schwäbisch Gmünd; Orig. zu Am. bakeriae<br />
distractus QU. 1887, Taf. 89, Fig. 6; IGPT, HT, Lamberti-Knollen, Mühlhausen i.T/Württ.; aus ZEISS 1962, Taf. 2, Fig. 4<br />
11 Paraspidoceras (Extranodites) aculifer ZEISS 1962, HT, Lamberti-Knollen, Mühlhausen i. T./Württ.; aus ZEISS 1962, Taf. 2, Fig. 4<br />
12 Euaspidoceras biartnatum (ZIETEN 1831), HT, vermutlich Ober-Callovium, nahe Göppingen; aus ZIETEN 1831, Taf. 1, Fig. 6<br />
13 Peltoceras (Parapeltoceras) pseudocaprinum PRIESER 1937, LT, Externansicht zu Taf. 58, Fig. 11<br />
14 Peltoceras (Peltoceras) dacquei (PRIESER 1937), HT, Externansicht zu Taf. 58, Fig. 5<br />
268
8 Literatur<br />
1 Ai.rnon, \V. 1940, Die <strong>Ammoniten</strong>zonen der oberen Ludwigien-<br />
Schichten von Bielefeld; Palaeontographiea, Abt. A, 92, S. 1-44,<br />
T. 1-6.<br />
2 Arkell, W. J. 1933, The Jurassic System in Great Britain; Oxford<br />
University Press, 693 S., 41 T.<br />
3 - 1935-1948, Ammonites of the English Corallian Bcds; Palacontogr.<br />
Soc. Monograph, London, 504 S., 78 T.<br />
4 - 1940, The ammonite suecession at the Woodhain Briek Co's pit,<br />
Akeman St. Station, Bucks.,and its bearing on the Classification of<br />
the Oxford Clav; Quart. J. geol. Soc. (London), 95, S. 135-220,<br />
T.8-11.<br />
5 - 1951a, A Middle Bathonian ammonite fauna from Schwandorf,<br />
northeni Bavaria; Schweizer, paläont. Abli., 69, S. 1-18, T. 1-3.<br />
6 - 1951b, 1952-1955, 1956a, 1958, English Bathonian ammonites;<br />
Palaeontogr. Soc. Monograph, London, Nr. 452,456, 460, 465,<br />
468, 477, 481 u. 485, 264 S., 33 T.<br />
7 - 1956b, Jurassic geology of the world; Oliver &C Boyd (Edinburgh<br />
u. London), 819 S., 46 T.<br />
8 - 1957, Mesozoic Ammonoidea, in: MOORE, Treatise on Invertebrate<br />
Palcontology; Part L, Mollusca 4, S. 80-465, Univ. Kansas<br />
Press.<br />
9 BAUGIER, A. und M. Sauze 1843, Notice sur quelques coquilles de<br />
ki famille <strong>des</strong> Ammonidees; Memoire lu ä la Societe de Statistique,<br />
16S., 4T.<br />
10 Bayer, U. 1969a, Euaptetoceras und Eudmetoceras (Ammonoidea,<br />
Hammatoceratidae) aus der COnawa-ZoM (Ober-Aalenium) Süddeutschlands;<br />
N. Jb. Geol. Paläont., Abb., 133, S. 211 -222.T. 24-<br />
28.<br />
I I - 1969b, Die Gattung HyperliocerasßvcKMAN (Ammonoidea, Graphoecratidae)<br />
aus dem Unter-Bajocium ((/««'/«-Schichten), insbesondere<br />
vom Wutachtal (Südbaden); Jb. Min. oberrhein. geol.<br />
Ver., neue Folge, 51, S. 31-70, T. 1-4.<br />
12 - 1972, Zur Ontogenie und Variabilität <strong>des</strong> jurassischen Amnioniten<br />
Leioceras opalimim; N. Jb. Geol. Paläont., Abh., 140, S. 306-<br />
327, Abb. 1-10.<br />
13 Bayle, E. 1878, Fossiles prineipaux de terrains; Explic. de la carte<br />
geol. France, 4, Atlas Teil 1.<br />
14 BENECKE, E. W. 1905, Die Versteinerungen der Eisenerzformation<br />
von Deutsch-Lothringen und Luxemburg; Abh. geol. Spezialkarte<br />
Elsaß-Lothr., neue Folge, Heft 6, S. 1-575.<br />
15 Bemiz, A. 1924a, Die Garantianen-Schichtcn von Norddeutschland<br />
mit besonderer Berücksichtigung <strong>des</strong> Brauncisenoolith-Horizontes<br />
von Harzburg; Jb. preuß. geol. Lan<strong>des</strong>anst., 45, S. 119-193,<br />
T. 4-9.<br />
16 - 1924b, Uber Dogger und Tektonik der Bopfmger Gegend; Jb.<br />
Mitt. oberrhein. geol. Ver., neue Folge, 13, S. 1-45.<br />
17 - 1928, Über Strenoceraten und Garantianen, insbesondere aus<br />
dem mittleren Dogger von Bielefeld; Jb. preuß. geol. Lan<strong>des</strong>anst.,<br />
49, S. 138-206, T. 14-19.<br />
18 Besnosov, N. V. 1982, On the systematics of the Perispinctids<br />
(Ammonoidea); Paleontological J., 16, No. 1, S. 52-64, T. 6 u. 7.<br />
19 - und V. V. Kutuzova 1982, The systematics of the Parkinsoniids<br />
(Ammonitida); Paleontological J., 16, No. 3, S. 38-50, T. 3 u. 4,<br />
20 - und I. A. Mikhaylova 1981; Systematics of middle jurassic Leptosphinetinae<br />
and Zigzagiceratinac; Paleontological J., 15, No. 3,<br />
S. 42-56, T. 5 u. 6.<br />
21 Blind, W. und R.Jordan 1979, »Septengabelung» an einer Dorsetensia<br />
romani (Oppei.) aus dem nordwestdeutschen Dogger;<br />
Paläont. Z., 53, S. 137-141.<br />
11 Bourquin.J. 1967, Les Reineckei<strong>des</strong>; Ann. Sei. Univ. Bcsan^on (3),<br />
Geol., 4, S. 1-169, T. 1-51.<br />
23 BOZENHARDT, T, 1936, Zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte<br />
<strong>des</strong> Braunjura beta in Nordost-Württemberg; Mitt. miner.-geol.<br />
Inst. TH Stuttg., 28, 117 S.<br />
24 BrANCO, W. 1879, Der untere Dogger Deutsch-Lothnngcns; Abh.<br />
geol. Spezialkarte Elsaß-Lothr. II, 1.<br />
25 Brasil, L. 1896, Les genres Peltoceras et Cosmoceras dans les couches<br />
de Dives et de Villers-sur-Mer; Bull. Soc. geol. de Normandie,<br />
17, S. 36-49, T. 3 u. 4<br />
26 Brinkmann, R. 1929a, Statistisch-biostratigraphische Untersuchungen<br />
an mitteljurassischen <strong>Ammoniten</strong> über Artbegriff und<br />
Stammesentwicklung; Abh. Ges. Wiss. Göttingen, math.-physik.<br />
KL, neue Folge, 13, 3, 249 S-, 5 T.<br />
27 - 1929b, Monographie der Gattung Kosmoceras; Abh. Ges. Wiss.<br />
Güttingen, math.-physik. KL, neue Folge, 13, 4, 124 S., 1 T.<br />
2S Bück, E., W. Hahn und K. Schädel 1966, Zur Stratigraphie <strong>des</strong><br />
Bajodums und Bathoniums (Dogger ö-c) der Schwäbischen Alb;<br />
Jh. geol. Lan<strong>des</strong>amt Baden-Württ., 8, S. 23-46, T. 4-9.<br />
29 BuCKMAN, S. S. 1881, A <strong>des</strong>criptive catalogue of some of the species<br />
of ammonites from the Inferior Oolite of Dorsel; Quart. J. geol.<br />
Soc, 37, S. 588-608.<br />
30 - 1882, Some new species of ammonites from the Inferior Oolite;<br />
Proc. Dorset natur. Flist. Antiquariat] Field Club (Sherborne), 4, S.<br />
137-146.<br />
31 - 1889, The <strong>des</strong>cent of Sowtiiiia and Haminatoceras; Quart.J. geol.<br />
Soc., 45, S. 651-663, T. 22.<br />
32 - 1887-1894, 1898, 1899, 1904, 1905 und 1907, The Inferior<br />
Oolite Ammonites; Palaeontographical Soc. Monographs,<br />
Nr. 192,197,201,206,210,214,220,224,228,245,251,281,<br />
292, London.<br />
33 - 1892, The morphology of «Stephanoceras- zigzag; Quart J. geol.<br />
Soc. London, 48, S. 447-452, T. 13-14.<br />
34 - 1908, lllustrationsoftypespecimensof Inferior Oolite ammonites<br />
in the Sowerby collection; Palaeontographical Soc. Monograph<br />
Nr. 301.<br />
35 - 1909-1919, Yorkshire Type Ammonites; W. Wesley, London,<br />
Bd. 1 u. 2.<br />
36 - 1920-1930, Type Ammonites; W. Wesley, London, Bd. 3-7.<br />
37 Callomon, J. H. 1955, The Ammonite Suecession in the Löwer<br />
Oxford Clav and Kellaways Beds at Kidlington, Oxfordshire, and<br />
the Zones of the Callovian Stage; Phil. Trans. Roy. Soc. London<br />
(B), 239, S. 215-264, T. 2 u. 3.<br />
38 - 1963, Sexual dimorphism in Jurassic ammonites; Lcicesier Lit.<br />
Phil. Soc. Trans-, 57, S. 21-56.<br />
39 - 1969, Dimorphism in Jurassic ammonites; some reflections; in:<br />
Westermann 1969, Sexual dimorphism in fossil Metazoa and<br />
taxonomic implications; Int. Un. geol. Sei., Ser. A, No. 1, Schweizerbart<br />
Stuttgart, S. 11-125.<br />
40 - 1971, On the type species of MacrocephalitesZmu. 1884 and the<br />
type speeimens of Ammonites macrocephahis SCHLOTHEIM<br />
1813; Paleontology, 14, S. 114-130, T. 15-18.<br />
41 - 1980, Macrocephalites Zi'itel and Ammonites macrocephahis<br />
Schlorhcim; Bull. zool. Nomencl., 37, S. 109-113.<br />
42 - 1981, Dimorphism in ammonoids; in: House, M. R. und J. R.<br />
Senior, The Ammonoidea; Academic Press London, S. 257-275.<br />
43 Cariou, E. 1980, L'etage Callovien dans le centre-oeust de la<br />
France, II; Les Reineckeiidae (Ammonitina), systematique, dimorphisme<br />
et evolution; Diss. an der Univ. von Poitiers (Frankreich),<br />
U.E.R. Sei. fondamentales et appliquees Nr. 325, 792 S.<br />
44 CHARPY, N. 1976, Le genre Pachyceras (Callovien superieur ä<br />
Oxfordien moyen); Diss. an der Univ. von Dijon (Frankreich),<br />
153 S.<br />
45 Contini, D. 1969, Les Graphoceratidae du Jura franc-comtois;<br />
Ann. sei. Univ. Besancon, 3e Serie, Geol., 7, 92 S., 24 T.<br />
46 Denckmann, A. 1887, Uber die geognostischen Verhältnisse der<br />
Umgebung von Dörnten nördlich Goslar, mit besonderer Berücksichtigung<br />
der Fauna <strong>des</strong> oberen Lias; Abh. geol. Spezialkarte<br />
Preußen, 8, 2, 105 S., 10T.<br />
47 Dietl, G. 1973, Middle Jurassic (Dogger) Heteromorph Ammonites;<br />
in: Hallam, A., Atlas of Paleobiogeography; Elsevier Scientific<br />
Publishing Co., Amsterdam, S. 283-285.<br />
48 - 1974, Zur Stratigraphie und <strong>Ammoniten</strong>fauna <strong>des</strong> Dogger, insbesondere<br />
<strong>des</strong> Oberbajocium der westlichen Keltiberischcn Ketten<br />
(Spanien); Stuttg. Beitr. Naturk., Serie B, Nr. 14, 15 S., 2 T.<br />
49 - 1975, Die entrollten <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> Schwäbischen Juras; Stuttg.<br />
Beitr. Naturk., Serie C, 4, S. 36-43, 1 T.<br />
50 - 1977, The Braunjura (Brown Jurassic) in Southwest Germany;<br />
Stuttg. Beitr. Naturk., Serie B, 25, 41 S., 7 T.<br />
51 - 1978a, Die hetcromorphen <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> Dogger; Stuttg. Beitr.<br />
Naturk., Serie B, 33, 76 S., 11 T.<br />
52 - 1978b, Zur Braunjura y/6-Gren/.e (Unter-Bajocium) im Westteil<br />
der Schwäbischen Alb; Stuttg. Beitr. Naturk., Serie B, 36, 15 S.,<br />
IT.<br />
271
53 - 1980a, Die Animonitengattung Caumontisphinctes aus dem südwestdeutschen<br />
Subfurcaten-Oolith (Bajocium); Stuttg. Beitr.<br />
Naturk., Serie B, 51, 43 S.,5 1<br />
54 - 1980b, Die Ammonitcngattung Leptosphinctes aus dem Süd westdeutschen<br />
Subfurcaten-Oolith (Bajocium); Stuttg. Bcitr. Naturk.,<br />
Serie B, 66, 49 S., 10 T.<br />
55 - 198 la, Über Macrocephalites (Ammonoidea) aus dem Aspidoi<strong>des</strong>-<br />
Oolith und die Bathonium/Callovium-Grenzschichten der Zollernalb<br />
(SW-Deutschland); Stuttg. Bcitr. Naturk., Serie B, 68,15 S.,<br />
1 T.<br />
56 - 198 lb, Über Paracuariceras und andere heteromorphe <strong>Ammoniten</strong><br />
aus dem Macroeephalen-Oolith (Unter-Callovium) <strong>des</strong><br />
Schwäbischen Juras; Stuttg. Bcitr. Naturk., Serie B, 76,16 S., 2 T.<br />
57 - 1981c, Zur systematischen Stellung von Ammonites subfurcatus<br />
ZIETEN und deren Bedeutung für die subfurcatum-Zonc (Bajocium);<br />
Stuttg. Beitr. Naturk., Serie B, 81, 11 S., 1 T.<br />
58 - 1982, Das wirkliche Fundniveau von Ammonites aspidoi<strong>des</strong><br />
OPPEL (Ammonoidea, Mittl. Jura) am locus typicus; Stuttg. Beitr.<br />
Naturk., Serie B, 87, 21 S., 3 T.<br />
59 - 1983, Die <strong>Ammoniten</strong>-Gattung Strenoceras aus dem südwestdeutschen<br />
Subfurcaten-Oolith (Bajocium); Stuttg. Beitr. Naturk.,<br />
Serie B, 90, 37 S., 4 T.<br />
60 -, F. BEMMERER und G. NETH 1979, Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Subfurcaten-Ooliths<br />
(Ober-Bajocium) entlang der mittleren Schwäbischen<br />
Alb; Jh. Ges. Naturk. Württ., 134, S. 85-95.<br />
61 -, K. EBEL und R. HUGCER 1979, Zur Stratigraphie und <strong>Ammoniten</strong>fauna<br />
der Varians-Schichten (Bathonium) von Talheim am<br />
Lupfen (südwestl. Schwäbische Alb); Paläont. Z., 53, S. 182-197.<br />
62 - und A. ETZOLD 1977, The Aalenium at the Type Locality; Stuttg.<br />
Beitr. Naturk., Serie B, 30, 9 S., 2 T.<br />
63 -, R. FLAIG und E. GLÜCK 1978, Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Ober-Bajocium<br />
(Braunjura (5/e-Grcnzschichtcn) am Plettenberg bei Balingen,<br />
Württ.; Stuttg. Beitr. Naturk., Serie B, 40, 16 S., 5 Abb.<br />
64 -, M. FRANZ und H. v. REIS 1984, Das Mittel- und Ober-Bajocium<br />
im Gebiet der Wutach unter besonderer Berücksichtigung der<br />
pmgwis-Subzone; Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., neue Folge, 66,<br />
S. 307-320.<br />
65 - und W. HAAG 1980, Uber die «sowerl>yi-7.one» (Bajocium) in<br />
einem Profil bei Nenningen (ösd. Schwab. Alb); Stuttg. Bcitr.<br />
Naturk., Serie B, 60, 11 S-, 1 T.<br />
66 -, H. HAGER und F. SAUTER 1984, Ein Cycloi<strong>des</strong>-Horizont (km-<br />
phriesianum-Zone, Mittlerer Jura) im Gebiet von Aalen/Ostalb;<br />
Jh. Ges. Naturk. Württ., 139.<br />
67 - und R. HUGGER 1979, Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Ober-Bajocium<br />
(Braunjura öYe-Grenzschichten) der Zollernalb (Baden-Württ.);<br />
Stuttg. Beitr. Naturk., Serie B, 43, 14 S.<br />
68 -, R. HUGGER und D. SCHAAI 1983, Die Lage derBajocium/Bathonium-Grenze<br />
(Mittlerer Jura) in der südwestl. Schwäbischen Alb;<br />
Jh. Ges. Naturk. Württ., 138, S. 75-84.<br />
69 -,H.lMMEi.undJ. WIEDMANN 1978,Comparativestudieson heteromorph<br />
ammonites; N. Jb. Geol. Paläont., Abh., 157, S. 218-<br />
225.<br />
70 - und KAIMTZKE 1983, Das Bathonium (Mittlerer Jura) zwischen<br />
Aalen und Bopfingen, 1., Mittel-Bathonium; Stuttg. Beitr.<br />
Naturk., Serie B, 93, 27 S., 5 T.<br />
71 - und M. RlETER 1981, Zum Nachweis der sauzei-Zone (Mittlerer<br />
Jura) im Gebiet der Wutach, SW-Deutschland; Jh. Ges. Naturk.<br />
Württ., 136, S. 106-112.<br />
72 DONOVAN, D. T.,J. H. CALLOMON und M. K. HOWARTH 1981,<br />
Classification of the Jurassie Ammonitina; in: HOUSE.M. R. und J.<br />
R. SENIOR, The Ammonoidea; Systematics Association special<br />
Vol. 18, Academic Press London, S. 101-155<br />
73 - und H. HOLDER 1958, On the existence of heteromorph ammonoids<br />
in the Lias; N. Jb. Geol. Paläont., Mh., S. 217-220.<br />
74 D'ORBIGNY, A. 1842-1850, Paläontologie Francaise, Terrains<br />
Jurassiques, I, Cephalopo<strong>des</strong>; Paris, 642 S., 234 T.<br />
75 DORN, P. 1923, Beiträge zur Entwicklung <strong>des</strong> Opalinustones im<br />
nördlichen Frankenjura; Jb. Mitt. oberrhein. geol. Ver, neue<br />
Folge, 12, S. 13-14.<br />
76 - 1927, Die <strong>Ammoniten</strong>fauna der Parkinsonien-Schichten bei Thalmässing<br />
(Frankenalb); Jb. preuß. geol. Lan<strong>des</strong>anst., 48, S. 225-<br />
251, T. 4-7.<br />
77 - 1935, Die Hammatoceraten, Sonninien, Ludwigien, Dorsctensien<br />
272<br />
und Witchellien <strong>des</strong> süddeutschen, insbesondere fränkischen<br />
Doggers; Palaeontographica, A, 82, S. 1-124, T. 1-29.<br />
78 - 1939,Stratigraphisch-paIäontologische Untersuchungen im mittleren<br />
und oberen Dogger der Frankenalb; N. Jb. Min., Geol.<br />
Paläont., ß, Beil.-Bd. 82, S. 161-314.<br />
79 DOUVILLE, F. 1943, Revision <strong>des</strong> Genres Clydoniceras et fAacrocephalites;<br />
Mem. Soc. geol. France, 22, 48 S., 7 T.<br />
80 DOUVILLE, H. 1885, Sur quelques fossiles de la zone ä Ammonites<br />
sowerbyi <strong>des</strong> environ de Toulon; Bull. Soc. geol. France, Ser. 3,13,<br />
S. 12-44, T. 1-3.<br />
81 DOUVILLE, R. 1909, Palaeontologia universalis, Ser. 2/4, S. 101-<br />
200, Leval, Berlin und Paris.<br />
82 - 1912, Em<strong>des</strong> sur les Cardiocerati<strong>des</strong> de Dives, Villers-sur-Mer et<br />
quelques autres gisements; Mem. Soc. geol. France, Paleont., 19,<br />
Nr. 45, S. 1-77, 5 T.<br />
83 - 1913, Esquisse d'une Classification phylogenique <strong>des</strong> Oppelii<strong>des</strong>;<br />
Bull. Soc. geol. France, Ser. 4,13, S. 56-75.<br />
84 -1914,Etu<strong>des</strong> sur les Oppelii<strong>des</strong> de Dives et Villers-sur-Mer; Mem.<br />
Soc. geol. France, Paleont., 21, Nr. 48, 26 S., T. 4-5.<br />
85 - 1915, Etu<strong>des</strong> sur les Cosmocerati<strong>des</strong> <strong>des</strong> collections de l'Ecole<br />
Nationale Superieure <strong>des</strong> Mines et <strong>des</strong> quelques autres collections<br />
publiques ou privees; Mem. Carte geol. France, Paris, 75 S., 24 T.<br />
86 ELMI, E. 1963, Les Hammatoccratinae (Ammonitina) dans le Dogger<br />
Inferieur du Bassin Rhodanien; Trav. Lab. geol. Lyon, 10,<br />
S. 1-144, T. 1-11.<br />
87 - 1967, Le Lias superieur et lejurassique moyen de l'Ardeche; Doc.<br />
Lab. geol. Fac. Sei. Lyon, Nr. 19, fasc. 1-3, S. 1-845, T. 1-17.<br />
88 - und C. MANGOLD 1966, Etüde de quelques Oxycerites du Bathonien<br />
mferieur; Trav. Lab. geol. Fac. Sei. Lyon, n. ser., 13, S. 143-<br />
181, T. 8 u. 9.<br />
89 ENAY, R. 1959, Notes sur quelques Tuliti<strong>des</strong> (Ammonitina) du<br />
Bathonien; Bull. Soc. geol. France, Ser. 7, 1, S. 252-259, T. 7b.<br />
90 FAVRE, F. 1912, Contribution ä l'etude <strong>des</strong> Oppelia du Jurassique<br />
moyen; Schweiz, paläont. Abh., 38, S. 1-33, T. 1.<br />
91 FISCHER, H. 1924, Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Doggers bei Gosheim;Jb.<br />
Mitt. oberrhein. geol. Ver, neue Folge, 13, S. 97-109.<br />
92 FRANK, M. 1945, Die Schichten folge <strong>des</strong> mittleren Braunen Jura (y/<br />
(5, Bajocium) in Württ.; Jb. Mitt. oberrhein. geol. Ver., neue Folge,<br />
31, S. 1-32, 3 T.<br />
93 FREYBERG, B. v. 1951, Zur Stratigraphie und Fazieskunde <strong>des</strong> Doggersandsteins<br />
und seiner Flöze; Geologica Bavarica, Nr. 9,108 S.,<br />
16 T.<br />
94 - 1960, Parallelisierung der Eisenerzflöze im Dogger/? Bayerns und<br />
Württembergs; Abh. deutsch. Akad. Wiss. Berlin, Kl. III,Heft 1,S.<br />
247-262.<br />
95 GALÄCZ, A. 1980, Bajocian and Bathonian ammonites of Gyenespuszta<br />
Bakony Mts., Hungary; Geologica Hungarica, Ser.<br />
Palaeont., 39, 5-156, T. 1-36.<br />
96 GECZY, B. 1966, Ammonoi<strong>des</strong> jurassiques de Cscrnye, Montagne<br />
Bakony, Hongrie; Part 1: Hammatoceratidae, Part II: excl. Hammatoceratidac;<br />
Geologica Hungarica, Ser. Palaeont., 34, 185 S.,<br />
44 T. und 35, 282 S., 65 T.<br />
97 GEMMELLARO, G. G. 1872-1882, Sopra alcune fauna giuresi e liasiche<br />
della Sicilia; Palermo.<br />
98 GERARD, CH. und J. BICHEI.ONNE 1940, Les Ammonites aalenicnnes<br />
du minerai de fer de Lorraine; Mem. Soc. geol. France, neue<br />
Serie, 19, Nr. 42, S. 1-60, T. 1-33.<br />
99 - und H. CONTAUT 1936, Les Ammonites de la Zone ä Peltoceras<br />
athleta du centre-ouest de la France; Mem. Soc. geol. France, neue<br />
Serie, 13, Nr. 29, 79 S., 19 T.<br />
100 GEYER, O. F. und M. P. GWINNER 1962, Der Schwäbische Jura; Sig.<br />
geologischer Führer, 40, Gebr. Bornträger Berlin.<br />
101 - und M. P. GWINNER 1968, Einführung in die Geologie von Baden-<br />
Württemberg; Schweizerbart Stuttgart.<br />
102 GILLET, S. 1937, Les Ammonites du Bajocien d'Alsac et de Lorraine;<br />
Mem. Serv. Carte geol. Alsac-Lorr., 5, 130 S., 5 T.<br />
103 GIZEJEWSKA, M. 1981, Stratigraphy of the Callovian in the Wielun<br />
Upland; Acta geol. Polon., 31, S. 15-33, 2 T.<br />
104 GROSSOUVRE, A. DE 1918, Bajocien-Bathonien dans la Nievre; Bull.<br />
Soc. geol. France, 4, Nr. 18, S. 337-459, T. 13-16.<br />
105 - 1930, Notes sur le Bathonien moyen; Livre Jub. Cent. Soc. geol.<br />
France, 2, S. 361-387, T. 39 u. 40.<br />
106 GYGI, R. A. 1977, Revision der Ammonitcngattung Gregoryceras
(Aspidoceratidae) aus dein Oxfordian (Ober-Jura) der Nordschweiz<br />
und von Süddeucschland; Eclogac geol. Helvetiae, 70,<br />
S. 435-542, 11 T.<br />
107 - und D. Marchand 1976, La zone ä Lamberti d'Herznach; C. R.<br />
Acad. Sei. Paris, Ser. D, 282, S. 969-972.<br />
108 - und D. Marchand 1982, Les faunes de Cardioeeratinac (Ammonoidea)<br />
du Callovicn terminal et de l'Oxfordien inferieur et<br />
moyen de la Suisse septentrionale; Gcobios, 4, Nr. 15, S. 517-<br />
571, 13 T.<br />
109 -, S.-M. Sadati und A. Zeiss 1979, Neue Funde von Paraspidoceras<br />
(Ammonoidea) aus dem Oberen Jura von Mitteleuropa; Eclogae<br />
geol. Helvetiae, 72, Nr. 3, 897-952.<br />
110 Hahn, W. 1968, Die Oppeliidae Bünakelli und Haploceratidae<br />
Zittel (Ammonoidea) <strong>des</strong> Bathoniums im südwestdeutschen<br />
Jura; Jh. geol. Lan<strong>des</strong>amt Baden-Württ., 10, S. 7-72, T. 1-5.<br />
111 - 1969, Die Perisphinctidae Steinmann (Ammonoidea) <strong>des</strong> Bathoniums<br />
im südwestdeutschen Jura; Jh. geol. Lan<strong>des</strong>amt Baden-<br />
Württ., 11, S. 29-86, T. 1-9.<br />
112 - 1970, Die Parkinsoniidae Buckm. und Morphoceratidae Hyatt<br />
(Ammonoidea) <strong>des</strong> Bathoniums im südwestdeutschen Jura; Jh.<br />
geol. Lan<strong>des</strong>amt Baden-Württ., 12, S. 7-62, T. 1-8.<br />
113 - 1971a, Die Wutach, naturkundliche Monographie einer Flußlandschaft,<br />
Der Jura; Verlag bad. Lan<strong>des</strong>ver. Naturk. Naturschutz Freiburg/Br.<br />
114- 1971b, Die Tulitidae Buckm., Sphaeroceratidae Buckm. und Clydoniceratidae<br />
Buckm. (Ammonoidea) <strong>des</strong> Bathoniums im südwestdeutschen<br />
Jurajjh. geol. Lan<strong>des</strong>amt Baden-Württ., 13.S.55-<br />
122, T. 1-9.<br />
115 - 1972, Neue <strong>Ammoniten</strong>funde aus dem Bathonium der Schwäbischen<br />
Alb; Jh. geol. Lan<strong>des</strong>amt Baden-Württ., 14, S. 7-16, T. 1<br />
u. 2.<br />
116 - und U. Koerner 1971, Die Aufschlüsse im oberen Dogger<br />
(Bathonium-Callovium) im Albstollen der Bodenseewasserversorgung<br />
unter der Zollernalb (SW-Deutschland) ;Jh. geol. Lan<strong>des</strong>amt<br />
Baden-Württ., 13, S. 123-144, T. 10-12.<br />
117 - und K. Schädel 1967, Die stratigraphische Stellung der fuscus-<br />
Bank im oberen Dogger c (Bathonium) der Schwäbischen Alb; Jh.<br />
geol. Lan<strong>des</strong>amt Baden-Württ., 9, S. 59-67.<br />
118 - und A. Schreineu 1971, Neue Zeichen und Benennungen der<br />
Jura-Schichten auf den geologischen Karten Baden-Württembergs;<br />
Jb. Mitt. oberrhein. geol. Ver., neue Folge, 53, S. 275-279.<br />
119 Haug, E. 1885, Beiträge zu einer Monographie der Ammonitcngattung<br />
Harpoceras; N. Jb. Miner., Geol. Paläont., Bcil.-Bd. 3, S. 585-<br />
722, T. 11 u. 12.<br />
120 - 1893, Em<strong>des</strong> sur les Ammonites <strong>des</strong> etages moyens du Systeme<br />
jurassique; Bull. Soc. geol. France, ser. 3,20, S. 277-333, T. 8-10.<br />
121 Hiltermann, H. 1939, Stratigraphie und Paläontologie derSonninien-Schichten<br />
von Osnabrück und Bielefeld, I; Palaeontographica,<br />
A, 90, S. 109-209, T. 9-13.<br />
2 Holder,H. 1955, Die<strong>Ammoniten</strong>-Gattung Taramellicerasim südwestdeutschen<br />
Unter-und Mittel-Malm; Palacontographica, A,<br />
106, 153 S., 4 T.<br />
123 - 1956, Über Anomalien an jurassischen <strong>Ammoniten</strong>; Paläont. Z-,<br />
30, S. 95-107.<br />
124 - 1964, Handbuch der stratigraphischen Geologie, Bd. IV: Jura; F.<br />
Enke Stuttgart, 603 S., 158 Abb.<br />
125 - 1978, <strong>Ammoniten</strong> der Gattung Parapatoceras aus dem Mittel-Jura<br />
<strong>des</strong> Süntels (Niedersachsen); Paläont. Z., 52, S. 280-304.<br />
126 Hofemann, G. 1913, Stratigraphie und <strong>Ammoniten</strong>fauna <strong>des</strong><br />
unteren Doggers in Sehnde bei Hannover; Schweizerbart Stuttgart,<br />
202 S., 18 T.<br />
127 Hoffmann, K. 1966, Eudmetoceras amplectens Buckm. (Ammonoidea)<br />
aus dem Ober-Aalenium von Lörrach-Stetten; Jh. geol.<br />
Lan<strong>des</strong>amt Baden-Württ., 8, S. 13-22, S. 1-3.<br />
128 Horn, E. 1909, Die Harpoceraten der Murchisonae-Schichten <strong>des</strong><br />
Donau-Rheinzuges; Mitt. bad. geol. Lan<strong>des</strong>anst. Heidelberg, 4,<br />
S. 251-323, 7 T.<br />
129 Howarth, M. K. 1962, The Yorkshire type ammonites and nautiloids<br />
of Young and Bikd, Phillips and M. Simpson; Palaeontology,<br />
5, S. 93-136.<br />
130 Hoyermann, Th. 1917, Uber Dorsetensia Buckm. und Ammonites<br />
romani Opp. (unter besonderer Berücksichtigung <strong>des</strong> Vorkommens<br />
bei Gerzen); Diss. Tübingen, 64 S.<br />
131 H u i, W. 1968, Uber Sonninien und Dorsetensien aus dem Bajocium<br />
von Nordwestdeutschland; Beih. geol. Jb., Nr. 64, 126 S., 51 T.<br />
132 Hug, O. 1899, Beiträge zur Kenntnis der Lias- und Dogger-<strong>Ammoniten</strong><br />
aus der Zone der Freiburger Alpen; Abh. schweizer, paläont.<br />
Ges., 26.<br />
133 Illies, H. 1956, Der mittlere Dogger im badischen Oberrheingebiet;<br />
Bcr. naturf. Ges. Freiburg/Br., 48 S., 1 T.<br />
134 J eannet, A. 1951, Stratigraphie und Paläontologie <strong>des</strong> oolithischen<br />
Eisenerzlagers von Herznach und seiner Umgebung; Beitr. Geol.<br />
Schweiz, geotechn. Ser., Lief. 13, 5, 240 S., 107 T.<br />
135 - 1955, Die Macrocephaliten <strong>des</strong> Callovien von Herznach (Aargau);<br />
Eclogae geol. Helvetiae, 47, Nr. 2, S. 223-267, T. 13-27.<br />
136 Joly, B. 1976, Les Phylloceratidae malgaches au Jurassique; Doc.<br />
Lab. geol. Fac. Sei. Lyon, Nr. 67, S. 1-471, T. 1-9.<br />
137 Kachadze, I. R. und V. I. ZesaSvili 1956, Fauna <strong>des</strong> Bajociums aus<br />
den Tälern <strong>des</strong> Kuban und einiger seiner Nebenflüsse; Trudy geol.<br />
Inst. A. N. Georg. SSR, Ser. Geol., 9/14/2, S. 5-55, T. 1-8 (in rassisch).<br />
138 KlÖCKEK, P. 1966, Faunistische und feinstratigraphische Untersuchungen<br />
an der Lias-Doggergrenze am Schönberg bei Freiburg/<br />
Br.; Ber. naturf. Ges. Freiburg/Br., 56, S. 209-248 und 57, S. 69-<br />
118.<br />
139 Kopik.J. 1974, Genus Cadomites Munier-Chalmas (Ammonitina)<br />
in the upper Bajocian and Bathonian of the Cracow-Wielun<br />
Jurassic ränge and the Göry Swietokrzyskic mountains; Inst.<br />
Geol. Biul. 276, S. 7-53, T. 1-11.<br />
140 KovÄes, L. 1939, Bemerkungen zur systematischen Einteilung der<br />
jurassischen Phylloceraten; Tisia, 3, S. 278-320 (ungarisch und<br />
deutsch).<br />
141 Krenkel, E. 1915, Die Kelloway-Fauna von Popilani in Westrußland;<br />
Palaeontographica, 61, S. 191-362, T. 19-28.<br />
142 Krumbeck, L. 1936, Goldschnecken und andere Anunonshörner<br />
aus dem Jura der (bayerischen) Ostmark; Das Bayerland, 47,<br />
Heft 4.<br />
143 Krystin,!.. 1972, Die Ober-Bajocium undBathonium-<strong>Ammoniten</strong><br />
der Klaus-Schichten <strong>des</strong> Steinbruchs Neumühle bei Wien; Ann.<br />
naturhist. Mus. Wien, 76, S. 195-310, 24 T<br />
144 Kudernatsch, J. 1852, Die <strong>Ammoniten</strong> von Swinitza; Abh. kais.<br />
königl. geol. Rcichsanst., 1, 4 T.<br />
145 Kuhn, 0.1939, Die <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> fränkischen Calloviums; Nova<br />
Acta Leopoldina, neue Folge, 6, Nr. 43, S. 451-532, T. 1-10.<br />
146 - 1947, Gliederung und Fossilführung <strong>des</strong> Lias und Doggers in<br />
Franken; Ber. naturf. Ges. Bamberg, Nr. 30, S. 33-89.<br />
147 LAHUSEN, 1.1883, Die Fauna der jurassischen Bildungen <strong>des</strong> Rjasanschen<br />
Gouvernements. Mem. Com. geol. Petersburg, 1, Nr. 1,<br />
S. 1-94, T. 1-11 (russisch).<br />
148 I.emoine, E. 1932, Essai sur Revolution du genre Hecticoceras dans<br />
le Callovien de la chaine du Mont-du-Chat; Trav. Lab. Geol. Fac.<br />
Sei. Lyon, 19, Mem. 16, 527 S-, 24 T.<br />
149 Lewy, Z. 1983, Upper Callovian ammonites and middle Jurassic<br />
geological history of the Middle East; Geol. Survey Israel, Bull. 76,<br />
56 S., 7 T.<br />
150 Lissajous, M. 1923, Emde sur la faune du Bathonien <strong>des</strong> environs<br />
de Mäcon; Trav. Lab. Geol. Univ. Lyon, 3, Mem. 3, 286 S., 33 T.<br />
151 LÖCZY, L. v. 1915, Monographie der Villänyer Callovien-<strong>Ammoniten</strong>;<br />
Geol. Hung., 1, 3-4, 253 S., 14 T.<br />
152 Lörcher, E. 1939, Stratigraphie und Paläogeographie von Braunjura<br />
ß und Ober-a im südwestlichen Württemberg; N. Jb. Miner.<br />
Geol. Paläont., Beil.-Bd. 72, S. 120-162.<br />
153 Lominadze, T. A. 1977, Ontogeneticdevelopmentofthesuturein<br />
the Cadoceratinae; News Acad. Sei. Georgian SSR, 3, S. 326-331.<br />
154 Loriol, P. de 1898-1899, Emde sur les mollusques et brachiopo<strong>des</strong><br />
de l'Oxfordien Inferieur ouzoneä Ammonitesrewggeridujura<br />
Bernois; Mem. Soc. paleont. Suisse, 25 und 26.<br />
155 Mangold, C. 1970, Les Perisphinctidae du Jura meridional au<br />
Bathonien et au Callovien; Doc. Lab. Geol. Fac. Sei. Lyon, 41, 2,<br />
246 S., 16 T<br />
156 Maschke, E. 1907, Die Stephanoceras-Verwandten in den Coronaten-Schichten<br />
von Norddeutschland; Diss. Göttingen, 38 S.<br />
157 Maubeuce, P. L. 1951, Les Ammonites du Bajocien de la Region<br />
Frontiere Franco-Bclgique; Mem. Inst. roy. Sei. natur. Belgique, 2,<br />
42, 104 S., 16 T.<br />
158 Meledina, S. V. 1981, Some problems of the cardioceratid systematics;<br />
Paleontological J., 15, Nr. 2, S. 48-55.<br />
273
159 MERIA, G. 193-1, Ammouiti Giuresi dell'Appenino Centrale. II.<br />
Hammatoccratinae BUCKM.; Palacontographia Italien (Siena),34,<br />
S. 1-29,7. 1-4.<br />
160 MILLER, A. 1968, Die Subtaniilie Euaspidoeeratinae SPÄTH<br />
(Ammonoidea); Diss. Tübingen, 170 S.<br />
161 MODEL, R-1935, Zur Stratigraphie und Faunistik <strong>des</strong> schwäbischen<br />
Calloviums mit besonderer Berücksichtigung von Franken; Zbl.<br />
Miner. usw., Abt. B, Nr. 9, S. 337-345.<br />
162 - und E. MODEL 1938, Die Lamberti-Schichten von Trockau nebst<br />
einem Anhang: Castor-Pollux-Zone und Obductus-Lager; Jb.<br />
preuß. geol. Lan<strong>des</strong>anst., 58, S. 631-665, T. 51-53.<br />
163 MORRIS.J.undj.LYCETT 1850-1854,MolluscaoftheGreatOolite<br />
(chiefly from Miiichinhampton and the coast of Yorkshire), 1-111;<br />
Palaeontographical Soc. London, 278 S., 30 T.<br />
164 MORTON, N. 1971, Some Bajocian ammonites from western Scotland;<br />
Palaeontology, 14, S. 266-293, T. 40-51.<br />
165 - 1972, The Bajocian ammonite Dorsetensia in Skye, Scotland;<br />
Palaeontology, 15, S. 504-518.<br />
166 - 1975, Bajocian Sonniniklae and other ammonites from western<br />
Scotland; Palaeontology, 18, S. 41-91, 12 T.<br />
167 - 1976, Bajocian (Jurassic) Stratigraphy in Skye, western Scotland;<br />
Scott. J. Geol. 12 (I), S. 23-33.<br />
168 MÜNK, CH. 1979, Heteromorphe <strong>Ammoniten</strong> aus dem Unter-Callovium<br />
vom Westrand der nördlichen Frankenau); Paläont. Z.,53,<br />
S. 220-229.<br />
169 NEUMAYR, M. 1871a,Jurastudien III, die Phylloceraten <strong>des</strong> Dogger<br />
und Malm; Jb. kais. königl. geol. Reichsanst. Wien, 21, S. 297-<br />
354, T. 12-17.<br />
170 - 1971b, Die Cephalopoden der Oolithe von Baun; Abh. kais.<br />
königl. geol. Reichsanst., 5, S. 19-54, T. 9-15.<br />
171 NICOLESCO, C. P. 1928, Etüde monographique de genre Parkinsonia;<br />
Mem. Soc. geol. France, n. Ser., Mein. 9, 84 S., 16 T.<br />
172 - 1932, Etüde monographique du genre Bigotites; Mem. Soc. geol.<br />
France, n. Ser., Mem. 17, 52 S., 8 T.<br />
173 NIEDERHÖFER, H.J. und G. DIETI. (in Vorbereitung),QUENSTEDT-<br />
Onginale am Staatl. Mus. f. Naturkunde in Stuttgart. Ammonoidea;<br />
Stuttg. Beitr. Naturk., Serie B.<br />
174 NIKITIN, S. 1881, Diejuraablagerungen zwischen Rybinsk, Mologa<br />
und Myschkin an der oberen Wolga; Mem. Acad. Imp. Sei. St.<br />
Petersbourg, Ser. 7, 28 (5), 98 S., 7 T.<br />
175 - 1882-1898, Der Jura der Umgegend von Elatma; Nouv. Mem.<br />
Moscou, livr. 14 (1), S. 85-133, T. 1-6 und livr. 15 (2), S. 41-67,<br />
T.7-11.<br />
176 OECHSI.E, E. 1958, Stratigraphie und <strong>Ammoniten</strong>fauna derSonninien-Schicluen<br />
<strong>des</strong> Filsgebietes, unter besonderer Berücksichtigung<br />
der sowerbyi-Zone; Palaeontographiea, A, 111, S. 47-129,<br />
T. 10-20.<br />
177 OPPEL, A. 1856-1858, Die Juraformation Englands, Frankreichs<br />
und <strong>des</strong> südwestlichen Deutschlands; Ebner &: Seubert, Stuttgart,<br />
und württ. naturwiss. Jh. 12-14, 857 S.<br />
178 - 1862 u. 1863, Uber jurassische Cephalopoden; Paläont. Mitt.<br />
Mus. königl. bayer. Staat, 3, S. 127-266, T. 40-74.<br />
179 PALFRAMAN, D. F. B. 1969, Taxonomy of sexual dimorphism in<br />
ammonites: Morphogenetic evideuce üi Hecticoceras brigbtii; in<br />
WESTERMANN, G., Sexual dimorphism in fossil Metazoa; Intern.<br />
Union geol. Sei., A, 1, S. 126-154, T. 6-8.<br />
180 PARONA, C. F. und G. BONARELLI 1895, Sur la faune du Callovien<br />
inferieur de Savoie; Mem. Acad. Savoie, 6 (4), 179 S., 11 T.<br />
181 PARSONS, C. F. 1974, The SJi/ce; and -so called- sowerbyi Zones of<br />
the Lower Bajocian; Newsl. Stratigr. Leiden, 3 (3), S. 153-180,<br />
T. 1 u. 2.<br />
182 - 1976, Ammonite evidence fordating some Inferior Oolite sections<br />
in the north Cotsvvolds; Proc. Geol. Assoc, 87, S. 45-63, 2 T.<br />
183 - 1979, A stratigraphie revision of the Inferior Oolite of Dundry Hill,<br />
Bristol; Proc. Geol. Assoc., 90, S. 133-151, 2 T.<br />
184 PAVIA.G. 1971,Ammonitidel Baiociano superiorc di Digne (Francia<br />
SE, Dip. Basses-Alpes); Boll. Soc. paleont. Italiana, 10, S. 75-172,<br />
T. 13-29.<br />
185 - 1983a, New data on Orthogaraiitiana (Torrensia) STURANI 1971<br />
(Ammonitina) in the European upper Bajocian; Boll. Mus. reg. Sei.<br />
nat. Torino, 1, S. 201-214, T. 1.<br />
186 - 1983b, II Ammoniti e biostrat, del Bajociano inferiore di Digne<br />
(Francia S. E., Dip. Alpes-Haute-Provence);Monografia Mus. reg.<br />
Sei. nat. Torino, 254 S., 32 T.<br />
274<br />
187 PETIT CLERC, P. 1915, Essai sur la faune du Callovien dans le Departement<br />
<strong>des</strong> Deux-Sevres; Contr. Emde Terr. jurass. Oest France,<br />
Vesoul (Louis Bon), 144 S., 14 T.<br />
1S8 PIETZCKER. F. 1911, Über die Convoluten aus dem Ornatenton<br />
Schwabens; Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ., 67, S. 148-217.<br />
189 POMPECKJ.J. F. 1893 U. 1896, Beiträge zu einer Revision der <strong>Ammoniten</strong><br />
<strong>des</strong> Schwäbischen Jura; Schweizerbart Stuttgart, Lief. I, 94<br />
S., 7 T; Lief. II, S. 95-178, T. 8-12.<br />
190 - 1894, Über <strong>Ammoniten</strong> mit anormaler Wohnkammer; Jh. Ver.<br />
vaterl. Naturk. Württ., 49, S. 220-290, 1 T.<br />
191 - 1901, Die Jura-Ablagerungen zwischen Regensburg und Regenstauf;<br />
Geogn. Jh., 14, S. 139-220.<br />
192 POTONIE, R. 1929, Die ammonitischen Nebenformen <strong>des</strong> Dogger<br />
(Apsorroceras, Spiroceras, l'arapatoceras);}b. preuß. geol. Lan<strong>des</strong>anst.,<br />
50,1, S. 216-261, T. 17-19.<br />
193 PRIESER.TH. 1937, Beitrag zur Systematik und Stammesgeschichtc<br />
der europäischen Peltoceraten; Palaeontographiea, A, 86, S. 1-<br />
144, 9 T.<br />
194 PuclN, L. 1964, Ammonites prealpines. Etüde critique <strong>des</strong> Lytoceratina<br />
du Dogger; Schweiz, paläont. Abh., 80, 67 S., 4 T.<br />
195 QUENSTEDT, F. A. 1845-1849, Petrefaktenkunde Deutschlands,<br />
Die Cephalopoden; Fues, Tübingen, Heft 1-6, 580 S., 36 T.<br />
196 - 1856 u. 1857, Derjura; Laupp, Tübingen, Lief. 1 -4,842 S., 100 T.<br />
197 - 1886 u. 1887, Die <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> Sehwabischen Jura, II, Der<br />
Braune Jura; Schweizerban Stuttgart, Lief. 10-15,S. 441-816, T.<br />
55-90.<br />
198 RENZ, C. 1904, Der Jura von Daghestan; N. Jb. Müier. Geol.<br />
Paläont., 27.<br />
199 - 1925, Beiträge zur Cephalopodenfauna <strong>des</strong> älteren Doggers am<br />
Monte San Giuliano bei Trapani in Westsizilien; Abh. Schweiz,<br />
paläont. Ges., 45, S. 1-33, 2 T.<br />
200 REUTER, L. 190S, Die Ausbildung <strong>des</strong> oberen BraunenJuca im nördlichen<br />
Teil der Fränkischen Alb; Diss. Erlangen, Verlag Piloty u.<br />
Loehle, München, 118 S., 2 T.<br />
201 RiEBER, H.1961, Clydoniceras discus aus der Fuscus-Bank der Südwest-Alb;<br />
N. Jb. Geol. Paläont., Monatsh., Heft 2, S. 94-97.<br />
202 - 1963, <strong>Ammoniten</strong> und Stratigraphie <strong>des</strong> Braunjura/? der Schwäbischen<br />
Alb; Palaeontographiea, A, 122, S. 1-89, 8 T.<br />
203 - 1977, Remarks to the Aalenium of the Swabian Alb; Stuttg. Beitr.<br />
Naturk., Ser. B, Nr. 29, 5 S.<br />
204 ROLLIER.L. 1909,Phylogenie<strong>des</strong>principauxgenresd'ammonoi<strong>des</strong><br />
de rOoIithique (Dogger) et de l'Oxfordicn; Arch. Sei. phys. nat.<br />
Gencve, 28 (4), S. 611-632.<br />
205 ROMAN, F. 1913, Etüde sur la faune de Cephalopo<strong>des</strong> de I'Aalenien<br />
superieur de valle du Rhone (zone ä Ludwigia coneava); Ann. Soc.<br />
Linn. Lyon, n. Ser., 60, S. 45-69, 4 T.<br />
206 - und P. BOYER 1923, Sur quelques ammonites de la zoneä Ludwigia<br />
initrcbisonae du Lyonnais; Trav. Lab. geol. Lyon, 4, Mem. 4,<br />
S. 1-47, T. 1-9.<br />
207 SAYN, G. und F. ROMAN 1930, Monographie stratigraphique et<br />
palcontologique du Jurassique moyen de la Voulte-sur-Rliöne;<br />
Trav. Lab. geol. Fac. Sei. Lyon, 14, Mem. 2, S. 167-256, T. 13-21.<br />
208 SCHALCH, F. 1897, Der Braune Jura <strong>des</strong> Donau-Rheinzuges nach seiner<br />
Gliederung und Fossilführung; Mitt. grolsherzogl. bad. geol.<br />
Lan<strong>des</strong>anst., 3, Heft 3, S. 529-618.<br />
209 SCHEURLEN, H. 1928, Strigoceras und Pblycticeras; Palaeontographiea,<br />
70, S. 1-40, 4 T.<br />
210 SCHINDEWOLF, O. H. 1953, Über Strenoceras und andere Dogger-<br />
<strong>Ammoniten</strong>; N.Jb. Geol. Paläont., Monatsh., S. 119-130.<br />
211 - 1960-1968, Studien zur Stammesgeschichte der <strong>Ammoniten</strong>;<br />
Abh. Wiss. Liter. Mainz, math.-naturw. KL, Lief. I-VII, 901 S.<br />
212 - 1963, Acuariceras und andere heteromorphe <strong>Ammoniten</strong> aus dem<br />
oberen Dogger; N.Jb. Geol. Paläont., Abb., 116, S. 119-148,<br />
T. 6-8.<br />
213 SCHLEGELMILCH, R. 1972, Zur Bestimmung von <strong>Ammoniten</strong>-<br />
Bruchstücken; Aufschluß, 23 (3), S. 91-96.<br />
214 - 1976, Die <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> süddeutschen Lias; G. Fischer, Stuttgart,<br />
New York, 106 S., 52 T.<br />
215 SCHLEH, F. 1927, Eine Studie über den Braunjura ß'an nordöstlichen<br />
Schwaben und seine Eisenoolithflöze; Abh. prakt. Geol. Bergwirtschaftslehre,<br />
2, 43 S. (Diss. Tübingen).<br />
216 SCHLIPPE, A. O. 1888, Die Fauna <strong>des</strong> Bathonium im oberrheinischen<br />
Tiefland; Abh. geol. Spez.-Karte Elsaß-Lothr., 4, Heft 4,<br />
S. 1-266.
217 SCHI.OENBACH, U. 1865, Uber neue und weniger bekannte jurassische<br />
<strong>Ammoniten</strong>; Bcitr. Paläont. Jura- u. Kreide-Form. NW-<br />
Deuischl., I, Th. Fischer, Kassel.<br />
218 SCHMIDT,M. <strong>Ammoniten</strong>studien; Fortschr. Geol. Paläont.,Heft 1 ü.<br />
S. 271-36.5.<br />
219 SCHMIDTII.L, K. 1925 u. 1926, Zur Stratigraphie und Faunenkunde<br />
<strong>des</strong> Dogger-Sandsteins im nördlichen Frankenjura, I u. 11;<br />
Palaeontographica, 67, S. 1 -82, T. 1 -6 und 68, S. 1 -110, T. 1 -6.<br />
220 - und L KRUMBECK 1931, Uber die Parkinsonien.schichten Nordbayerns<br />
mit besonderer Berücksichtigung der Parkinsonien-<br />
Schichten NW-Deutschlands; Jb. preuls. geol. I.an<strong>des</strong>anst., 51,<br />
S. 819-894, 10 T.<br />
221 - und L KRUMBECK 1938, Die Coronatenschichien von Auerbach<br />
(Nordbayem); Z. deutsch, geol. Ges., 90, S. 297-360, T. 10-14.<br />
222 SCHMIDT-KAHLER, H. und A. ZEISS 1973, Die Juragliederung in<br />
Süddeutschland; Geologica Bavarica, 67, S. 155-161.<br />
223 SEEBACH, K. V. 1S64, Der Hannoversche Jura; Berlin, 138 S., 10 T.<br />
224 SENIOR, J. R. 1972, The ontogeny and phylogeny of some lower<br />
Bajocian Graphoccratid ammonites; Diss. Hüll (England).<br />
225 - 1977, The jurassic ammonite ßredyi.i BUCKM.; Palaeontology, 20,<br />
S. 675-693, T. 81-84.<br />
226 SEQUEIROS, L 1980, Modelos cuautitativos en bioestratigrafia:<br />
Aplication al Dogger de Belchite (Zaragoza); Estudios geol., 36,<br />
S. 275-279.<br />
227 SIEMIRAD'/.KI.J. 1894, Neue Beiträge zur Kenntnis der <strong>Ammoniten</strong>fauna<br />
der polnischen Eisenoolithe; Z. deutsch, geol. Ges., 46,<br />
S. 501-536, T.3S-42.<br />
228 - 1898 u. 1899, Monographische Beschreibung der <strong>Ammoniten</strong>gattung<br />
Perispbincles; Palaeontographica, 45, S. 69-352, T. 20-<br />
27.<br />
229 Solu H. 1953, Dogger-Profile aus dem Teufelsloch bei Bad Boll<br />
(Württ.); Jb. Mitt. oberrhein. geol. Ver., n. F., 35, S. 43-53.<br />
230 SOWERBY,J. 1812-1846, The mineral conchology of Great Britain;<br />
Mercdith, London, 7 Bande, 648 T.<br />
231 SPÄTH, L. F. 1927-1933, Revision of the Jurassic cephalopod fauna<br />
of Kachh (Cutch); Mem. geol. Surv. India, Pal.ieontologia Indica.<br />
n. ser., 9, Nr. 2, pari I-Vl, 952 S., 130 T.<br />
232 SPIEGLER, W. 1966, Graphoceratidae <strong>des</strong> Ober-Aalenium (Jura,<br />
NW-Deutschland); Mitt. geol. Staatsinst. Hamburg, 35, S. 5-113,<br />
T. 1-9.<br />
233 STAHI.ECKER, R. 1926, Brauner Jura und Tektonik im Kirchheiin-<br />
Urachcr Vulkangebiet; N. Jb. Miner. Geol. Paläont., Beil.-Bd. 54,<br />
S. 157-258.<br />
234 - 1934, Stratigraphie und Tektonik <strong>des</strong> Braunen Jura im Gebiet <strong>des</strong><br />
Stuifen und Rechberg; Jh. Ver. vaterländ. Naturk. Württ., 90,<br />
S. 59-121, 2 T.<br />
235 STEHN, E. 1923, Beiträge zur Kenntnis <strong>des</strong> Bathonium und Call"<br />
vium in Südamerika; in: STEINMANN, G., Beitr. Geol. Paläont.<br />
Südamerika; N.Jb. Miner. Geol. Paläont. Beil.-Bd. 49, S. 52-158,<br />
T. 1-8.<br />
236 STEINMANN, G. 1881, Zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation<br />
von Caracoles (Bolivien); N.Jb. Miner. Geol. Paläont., Beil.-Bd. 1,<br />
S. 239-301, T. 9-14.<br />
237 STEPHANOVJ. 1961, The Bathonian in the section of the Belogradcik-Gara<br />
Oreshets Road (NW-Bulgaria); Izv. geol. Inst. bulg.<br />
Akad. Nauk., 9, S. 337-369, T. 1-7.<br />
238 - 1966, The middle Jurassic ammonite genus Oecotraustes WAA<br />
GEN; Trav. Geol. Acad. Sc. Bulgarie - Ser. Paleont., 8, S. 26-69,<br />
T. 1-7.<br />
239 - 1972, Monograph on the Bathonian ammonite genus Siemiradzkia<br />
HYATT; Bull. geol. Inst. Sofia, Ser. Paleont., 21, S. 5-82,<br />
T 1-16.<br />
240 STURANI.C. 1966, Ammonites and stratigraphyof the Bathonian in<br />
the Digne-Barreme area; Boll. Soc. Paleont. Ital., 5,Nr. 1, S. 3-57,<br />
T. 1-24.<br />
241 - 1971, ammonites and stratigraphy of the "Posidonia alpina- beds<br />
of the Vcnelian Alps (mainly Bajocian); Mem. Ist. Geol. Min. Univ.<br />
Padova, 27, S. 1-190, 16 T.<br />
242 TEISSEYRE, L. 1883, Ein Beitrag zur Kenntnis der Cephalopodcnfauna<br />
der Ornatcntone im Gouvernement Rjasan; Sitz.-Ber. k.<br />
Akad. Wiss. Wien, Abi. I, 88.<br />
243 THIERRY.J. 1978, Le genre Macrocephalitesau Callovien inferieur;<br />
Mem. geol. PUniv. Dijon, 4, 491 S., 36 T.<br />
244 - 1980, Sta<strong>des</strong> de croissance chez le Macroccphalitidcs; Bull. Soc.<br />
zool. France, 105 (2), S. 313-323.<br />
245 TILL, A. 1910-1911. Die <strong>Ammoniten</strong>fauna <strong>des</strong> Kelloway von<br />
Vilany (Ungarn); Beitr. Paläont. Geol. Ösier.-Ung. u. <strong>des</strong> Orients,<br />
Bd. 23, S. 251-272, T. 16-19 u. Bd. 24, S. 1-45, T. 1-8.<br />
246 TINTANT, H. 1963, Les Kosmocerati<strong>des</strong> du Callovien inferieur ei<br />
moyen d'Europe occidentale: Publ. Univ. Dijon, 29,500 S., 5S T.<br />
247 TORNQUIST, A. 1894, Proplanuliten aus dem westeuropäischen<br />
Jura; Z. deutsch, geol. Ges., 46 (3), S. 547-579, T. 44-46.<br />
248 TORRENS, H. S. 1970, New names for two microconch ammonite<br />
genera from the Middle Bathonian of Europe and their macroconch<br />
counterpans; Boll. Soc. Paleont. Ital., 9 (2), S. 136-148,<br />
T.36.<br />
249 TSYTOVITCH, X. DE 1911, Hecticoceras du Callovien de Chezery;<br />
Mem. Soc. Paleont. Suisse, 37, 84 S., 8 T.<br />
250 WAAGEN, W. 1867, Über die Zone <strong>des</strong> Ammonites Sowerbyi; Geognost.-paläont.<br />
Bcitr., 1, S. 509-667, T. 24-34.<br />
251 - 1875, Jurassic launa ofKutch, 1, The Cephalopoda; Mem. geol.<br />
Surv. India, Palaeontologia Indica, Ser. 9, 1.<br />
252 WEBER, H. S. 1964. Zur Stratigraphie und <strong>Ammoniten</strong>fauna <strong>des</strong><br />
Braunjura ß der östlichen Schwäbischen Alb; Diss. Stuttgart,<br />
174 S., 3 T.<br />
253 WEISERT, K. 1932, Stepbanoceras im schwäbischen Braunen Jura<br />
delta; Palaeontographica, 76, S. 121-192, T. 15-19.<br />
254 WEISSERMEL, W. 1895, Ein Beilrag zur Gattung Quensledticeras;<br />
Z. deutsch, geol. Ges., 47, S. 307-330, T. 10-12.<br />
255 WENDT, J. 1963, Stratigraphisch-paläontologische Untersuchungen<br />
im Dogger Westsiziliens; Boll. Soc. Paleont. Ital., 2 (1), S. 57-<br />
145, T. 6-24.<br />
256 WERNER, F. 1959, Zur Kenntnis der Eisenerzfazies <strong>des</strong> Braunjura ß<br />
von Ostwürttemberg. Arb. geol.-paläont. Inst. TH Stuttg., n. F.,<br />
42, 169 S..7T.<br />
257 WESTERMANN,G. F.. G. 1954, Monographie derOtoitidae (Ammonoidea);<br />
Beih. geol. Jb., 15, 364 S., 33 T.<br />
258 - 1956a, Monographie der Bajocien-Gattungen Spbaeroceras und<br />
Cbondroceras (Ammonoidea); Beih. geol. Jb., 24, 125 S., 14 T.<br />
259 - 1956b, Phylogenie der Stephanocerataceae und Perisphinctaceae<br />
<strong>des</strong> Dogger; N.Jb. Geol. Paläont., Abh., 103, S. 223-279.<br />
260 - 1958, <strong>Ammoniten</strong>fauna und Stratigraphie <strong>des</strong> Bathonien NW-<br />
Deutschlands; Beih. geol. Jb., 32, 103 S., 49 T.<br />
261 - 1964a, Sexual-Dimorphismus bei Ammonoideen und seine<br />
Bedeutung für die Taxonomie der Otoitidae; Palaeontographica,<br />
A, 124, S. 33-73.<br />
262 - 1966, Covariation and laxonomy of the Jurassic ammonite Sonninia<br />
adicra; N.Jb. Geol. Paläont., Abh., 124, S. 289-312.<br />
263 - 1967, The umbilical lobes of Stephanoceratacean ammonites; J.<br />
Paleont., 41, S. 259-261.<br />
264 - 1964b u. 1969. The ammonite fauna olthcKialagvik Formation al<br />
Wide Bay (Alaska), I: Lower Bajocian, II: Sonninia sowerbyi zone;<br />
Bull, americ. Paleont., 47, S. 325-496, 32 T. und 57, S. 1-220,<br />
47 T.<br />
265 - 1975, Alfeldites nom. nov. for Germanites WESTERMANN 1954,<br />
non SCHINDI WOLF; J. Paleont., 49, S. 229.<br />
266 - und A. C. RICCARDI 1972 u. 1979, Middle Jurassic Ammonoid<br />
fauna and biochronology of the Argentine-Chilean An<strong>des</strong>, I u. II:<br />
Palaeontographica, A, 140, S. 1-116, T. 1-31 u. 164, S. 85-188,<br />
28 T.<br />
267 WETZEL, W. 1911, Faunistische und stratigraphische Untersuchungen<br />
der Parkinsonienschichten <strong>des</strong> Teutoburger Wal<strong>des</strong>; Palaeontographica,<br />
58, S. 139-277, T. 11-20.<br />
268 - 1936, Über einige stammesgcschiclulicli interessante Animonitenarten<br />
<strong>des</strong> obersten Bajocien; N.Jb. Miner. Geol. Paläont., Beil.-<br />
Bd. (B)75, S. 527-542, T. 21.<br />
269 - 1937, Studien zur Paläontologie <strong>des</strong> nordwesteuropäischen<br />
Bathonien; Palaeontographica, A, 87, S. 77-157, T. 10-15.<br />
270 - 1950, Fauna und Stratigraphie der wiierttenibergica-Schkhtcn,<br />
insbesondere Norddeutschlands; Palaeontographica, A, 99,<br />
S. 63-120, T. 7-9.<br />
271 - 1954, Die Bielefelder Garantianen, Geschichte einer <strong>Ammoniten</strong>gattung;<br />
Geol. Jb, 68, S. 547-585, T. 11 -14.<br />
272 WIEDMANN, J. 1970, Über den Ursprung der Neoammonoideen -<br />
Das Problem einer Typogenese; Eclogae geol. Helvetiae, 63 (3),<br />
S. 923-1020.
9 Abkürzungen<br />
Am. Ammonites<br />
BMNH British Museum of Natural History, London<br />
BSPG Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und<br />
historische Geologie, München<br />
BUCKM. S. S. BlICKMAN<br />
CEPP Centre d'Etude Docum. Palcont., Paris<br />
cf. vergleiche!<br />
dn derivatio nominis = Ableitung (Ursprung) <strong>des</strong> Namens<br />
D'ORB. A. D'Orbigny<br />
EKn Externknoten<br />
ER Externrippen<br />
FR Flankenrippen<br />
gr- griechisch<br />
HT Holotyp<br />
IGPEN<br />
Institut für Geologie und Paläontologie der Universität<br />
Erlangen-Niiniberg<br />
IGPT Institut für Geologie und Paläontologie der Universität<br />
Tübingen<br />
Kn Knoten<br />
lat. lateinisch<br />
LT Lectotyp<br />
MHNP Museum d'Histoire Naturelle, Paris<br />
NLABH Niedersächsisches L.an<strong>des</strong>amt für Bodenforschung,<br />
Hannover<br />
n. sp. nova spezies = neu aufgestellte Art<br />
NT Neotyp<br />
OPP. A. Oppei.<br />
pars<br />
POMP.<br />
teilweise<br />
J. E. POMPECKJ<br />
PR Primärrippe<br />
QU.<br />
SCHL.<br />
F. A. QUENSTEDT<br />
E. F. von Schlotheim<br />
sensu im Sinne von<br />
Slg.<br />
SMNS<br />
Sammlung<br />
s. o. siehe oben<br />
Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart<br />
SOW. J. de Sowerby<br />
SR<br />
Sekundärrippe<br />
s. str. sensu stricto = im engeren Sinne<br />
stad. im Stadium von<br />
s. u. siehe unten<br />
TZ Teilungsziffer<br />
UA Unterart<br />
var. varietas = Varietät<br />
WEST. G. E. G. Westermann
273 - undJ. KL'I.L.MANN 1981, Ammonoid suturcs in ontugcny and phylogeny;<br />
in: HOUSK, M. R. und J. R. SKNIOR, The Ammonoidea;<br />
Academic Press London, S. 215-255.<br />
274 WITTMANN, O. 1949, Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Doggers längs der<br />
Rheintaltlexur bei Lörrach und am Röttier Schloß; Ber. naturf.<br />
Ges. Freiburg/Br., 39, S. 149-195.<br />
275 ZEISS, A. 1955, Zur Stratigraphie <strong>des</strong> Callovien und Unter-Oxfordien<br />
bei Blumberg (Siidbadenhjh. geol. Lan<strong>des</strong>amt Baden-Württ.,<br />
l.S. 239-266, T. 9-10.<br />
276 - 1956, Hecticoceras und Reincckcu im Mittel- und Ober-Callovien<br />
von Blumberg (Südbaden), Abh. bayer. Akad. Wiss., math.-naturwiss.<br />
KL, n. Folge, Heft 80, 101 S., 4 T.<br />
277 - 1959, Hecticoceratinae (Ammonoidea jurassica); in: Fossilium<br />
Catalogus, I: Animalia, Pars 96, S. 1-155.<br />
278 - i960, Revision von <strong>Ammoniten</strong>bestimmungen aus dem fränkischen<br />
Dogger/?; Abh. deutsch. Akad. Wiss. Berlin, Kl. III, Heft 1,<br />
S. 263-266.<br />
279 - 1962, Die <strong>Ammoniten</strong>gattung ParaSpidoceras SPÄTH; Erlanger<br />
geol. Abh., Heft 41, S. 3-40, 4 T.<br />
280 - 1972, J. M. C. REINECKE und sein Werk: Des Urmeeres Nautili<br />
und Argonautae aus dem Gebiet von Coburg und Umgebung; G,<br />
Diskussion der Beschreibungen Reinecke's; Erlanger geol. Abh.,<br />
Heft 90, S. 31-42.T. 1-4.<br />
281 - 1974, Die Callovium-Amnioniten Äthiopiens und ihre zoogeogr<br />
phische Stellung; Paläont. Z., 48, S. 269-282, T. 37.<br />
282 - 1977, Jurassic stratigraphy of Franconia; Stuttg. Beitr. Naturl<br />
Ser.B, Nr. 31, S. 1-32.<br />
283 ZIEGLER, B. 1956, Creniceras dentatum im Mittel-Malm SV<br />
Deutschlands; N. Jb. Geol. Paläont., Monatsh., S. 553-57<br />
13 Abb.<br />
284 - Über <strong>Ammoniten</strong> <strong>des</strong> Schwäbischen Juras; Stuttg. Beitr. Naturl<br />
Ser. C, Heft 4, S. 3-22, T. 1-5.<br />
285 - 1981, Ammonoid biostratigraphy and provincialism: Jurassic<br />
Old World; in: HOUSE, M. R. undj. R. SENIOR, The Ammonc<br />
dea; Academic Press London, S. 433-457.<br />
286 ZIETEN, C. H. V. 1830-1834, Versteinerungen Württemberg<br />
Schweizerbart Stuttgart.<br />
287 ZITTEL, K. 1868, Paläontologische Notizen über Lias-, Jura- ut<br />
Krei<strong>des</strong>chichten in den Bayerischen und Osterreichischen Alpe<br />
Jb. kais. königl. geol. Reichsanst., 15.<br />
288 - 1884, Handbuch der Paläontologie, I, Abt. Paläozoologie, Bd.<br />
Mollusca und Arthropod;!; München und Leipzig.
10 Register<br />
Acantbaecites 46 Baculites 100 Intllatimoipbus 134<br />
Aconcceratinae 68 bajocense 88, 212 hullatus 134, 254<br />
acris 94,216 bajociense 23, 152 bullatus latecentratus 134, 254<br />
acris wetzeli 94 bajoeiformis 103 bullifera54, 172<br />
Acuariceras 10, 99, 101, 222 bakeriae 123<br />
acuarius 100, 101, 222 bakeriae distractus 148, 149, 268 Cadoceras 114, 132, 232<br />
acuforme 100, 222 balinense 36, 162 Cadomites 82, 83, 208, 210<br />
aadeatum 114, 232 balinense var. robusta 164 cadus 132, 252<br />
aculifer 149, 268 banksii 78, 206 Calliplrylloceras 23, 24, 152<br />
acuticosta 124,242 batbonicus 103 calloviense 17,100, 109, 230<br />
acuticostatum 77 batbyomphalum 146 calvus 126<br />
acutistriatum 113 baylei 54, 147, 268 canaliculatum 45, 166<br />
Adabofohceras 23 ßelemnitenbreccie 13 canaliculatus fuscus 33<br />
adicra 60, 184 bentzi 87,210 caprinum 147, 268<br />
Alcidia 31 Berbericeras 137 caprinum fraasi 147<br />
alemannka 143, 264 bercklxmeri 59, 144, 180, 266 castor 113, 232<br />
althoffi 90 biarmatum 149, 268 castor fasciculatum 113<br />
alticosta 92,214 bicostatum 47, 168 Catasigaloceras 112<br />
ammonoi<strong>des</strong> 116 bicostatum nodulosum 48, 168 Catulloceras 4<br />
amplectens 2S, 158 bidentatus 48, 16S Caumontisphinetes 6, 84-86, 210<br />
amplum 25, 152 bifidum 145 cavata 56<br />
Anakosmoceras 112 biflexitosum 34, 162 cerealis 128, 248<br />
Analytoceratidae 25 bifurcata 89, 212 chamousseti 115<br />
Anaplamdites 124 bifurcati 98, 99, 220, 222 Cbamoussetia 115, 232, 234<br />
anceps 76, 139-142, 202, 262 bifurcatus latisulcatus 88, 212 chamusseti 115, 232<br />
anceps ext inet us 82, 208 bifurcatus obliquecostatus 98 Cbanasia 36, 37, 162, 164<br />
anceps franconicus 140, 262 bifurcatus oolitbicus 87, 88, 210 cbanasiense 36<br />
Anceps-Oolith 17 bifurcus 85,210 Choffatia 124, 125, 128, 248<br />
Ancyloceras 99, 100, 222 Bigotella 119 Chondroceras 80, 132, 208<br />
ancylocon 9 bigoti 88, 212 Cleistospbinctes 118, 119, 236<br />
anguliferum 55 Bigotites 6,117,119, 236, 238 cleistus 118,236<br />
annulare 146, 266 Bikosmokeras 109 Clydoniceras 4, 30, 66, 190<br />
amiularis filatus 148, 26S Binatispbinctes 125, 130, 250 Clydoniceratinac 59<br />
amiularis oblongus 146, 266 binatus 130 cobra 128<br />
annulatum 99, 110, 222, 230 hipartitus 35, 47, 162 Collotia 7, 142, 264<br />
annulosum 147, 268 bipartitus nodulosus 168 comma 136, 256<br />
anomalum 37, 164 blagdeni 76, 204 complanata 65<br />
antecedens 24, 152 Blagdeni-Schichten 16 complanatoi<strong>des</strong> 68, 192<br />
antiquum 75, 202 Blaukalke 15 complanatum 112, 232<br />
apertum 57, 176 bodeni 147 compressum III, 230<br />
aplous diniensis 84 Bomburites 135, 254 compressus 105, 226<br />
approximatus 108 bomfordi 32, 95, 218 comptoni 126, 246<br />
Apsorroceras 98 Bourkelamberticeras 232 comptum 51, 170<br />
arbustigerus 127 boivery 63 Comptum-Banke 13<br />
arcitenens 56 bradfordensis 54, 174 coneavum 56, 174<br />
arenata 60, 180 bradfordensis baylei 54 Concavum-Bank 13, 15<br />
arietis 93,216 bradfordensis deleta 55, 174 convacum var. v-scriptum 56<br />
arkelli 40, 164 Bradfordia 4 conjugata 89, 212<br />
arkelli gerzense 81 bradleyi32, 160 contractus 79, 206<br />
Aspbinctites 103, 222, 224 braikenridgii 73, 75, 200, 202 contractus anceps 76, 202<br />
aspidoi<strong>des</strong> 16, 30, 31,158 braikenridgii macer 74, 200 convergens 96, 220<br />
Aspidoi<strong>des</strong>-Oolith 16 braikenridgii quenstedti 73, 200 convolutus auritulus 126, 246<br />
Aspidoi<strong>des</strong>-Schichten 17 braikenridgii uentriplanum 73, 200 convolutus dilatatus 248<br />
atbleta 17, 144, 145, 147, 266 Brasilia 53 convolutus evexus 129, 248<br />
athletoi<strong>des</strong> 145, 266 Brigbtia 33, 38, 39, 164 convolutus gigas 128, 248<br />
auerbachense 28, 70, 156, 194 brigbtii 43, 166 convolutus ornati 129, 248<br />
aureum 36, 162 brighti var. subnodosa 166 convolutus parabolis 126, 246<br />
aurigera 123, 242 britannica 140, 260 cornu 56, 176<br />
auritulus 47, 168 brocchii 78, 206 coronata 91, 214<br />
brongniarti 81 coronatus 77, 137, 138, 204, 258<br />
baculata 90, 214 buchbergensis 125, 244 coronatus oolitbicus 77, 204<br />
baculatus 98, 99, 222 huckmani 64, 135, 188 coronoi<strong>des</strong> 138, 258<br />
baculatus densicosta 100 bulbosum 136, 256 coronoi<strong>des</strong> gigas 137<br />
baculicon 9 Bullatimorphites 134, 254 corroyi 142, 264
cosmopolita 134<br />
costata 34<br />
Costileioccras 52<br />
costoswn 13, SO, 168<br />
costulatus 63<br />
cracovietise var. tuberculata 35<br />
crassa 54, 89, 119, 172, 212, 248<br />
crttssicostatum 51, 170<br />
crassizigzag 121<br />
crenatum 47, 168<br />
Creniceras 47, 168<br />
criocon 9<br />
cristagalli 49<br />
cristatns 47<br />
crobyloi<strong>des</strong> 115, 234<br />
curvicosta 126, 246<br />
Cypholioceras 50<br />
cyrtocon 9<br />
dacquei 145, 266, 268<br />
davidsoni 117, 234<br />
debilis 86, 210<br />
decipiens 32, 160<br />
decorat ns 110<br />
decorum 56, 176<br />
deflexum 57<br />
Delecticeras 66<br />
delpbinus 80<br />
delta falcata 65, 1S8<br />
deltafalcatus acutus 65<br />
densicosta 94,218<br />
densicostata 89, 212<br />
densicostatum 80, 208<br />
Dentalien-Tone 16<br />
dentatum 47, 168<br />
dentatus inermis 47<br />
Derolytoceratidae 25<br />
<strong>des</strong>iongebampsi 82, 208<br />
<strong>des</strong>ori 57<br />
devauxi 135<br />
diadematoi<strong>des</strong> 27, 156<br />
diailematus 105, 226<br />
dicbotoma 91,214<br />
dicbotoma nodosa 92<br />
difforme 39, 164<br />
dilatata 129, 248<br />
dilucidum 26, 154<br />
Dimorpbinites 6, 101<br />
diniensis 84, 210<br />
discites 57, 178<br />
diseoidea 53, 170<br />
diseoideus 52, 57, 58, 176, 178<br />
Discophyllitidae 23<br />
discus 30, 53, 66, 190<br />
discus clai'ilobus 53<br />
discus complanatus 31<br />
discus densiseptus 53<br />
discus latumbilicatus 52<br />
disputabile 23, 152<br />
distans 99, 222<br />
Disticboceras 47, 168<br />
distractum 149, 268<br />
doliforme 138, 258<br />
Dolikephalites 104, 106, 228<br />
dolius 106<br />
Donzdorfer Sandstein 13, 15<br />
d'Orbignyana 93<br />
dorni 83, 134, 210, 254<br />
280<br />
Dorsetensia 4, 15, 64-66, 188,<br />
dorsetensis 95<br />
dorsoeavatum 67, 192<br />
douvillei 40, 164<br />
dubia 91, 214<br />
Dumortieria 4, 13<br />
Dumortieriinae 2 7<br />
duncani 109, 230<br />
duplex 141<br />
duplicosta 111, 232<br />
Durotrigensia 95, 218<br />
Ebrayiceras 103, 222<br />
edouardianus 64<br />
egrediens 102, 222<br />
eichbergensis 123, 242<br />
elattnae 114, 232<br />
Elatmites 126, 131, 246<br />
Emileia 78, 79, 206, 208<br />
enodatum 109, 230<br />
enodus 98<br />
Eohecticoceras 34, 160, 162<br />
Epalxites 74, 76<br />
episcopale 46, 166<br />
Epistrenoceras 6,99<br />
erato 68<br />
erckenbergense 146<br />
Erycites 3, 6, 28, 158<br />
Erymnoceras 137, 258<br />
esulcatum 23, 152<br />
Eaiaptetoceras 28<br />
euaptetum 29, 158<br />
Eiuispidoceras 149, 268<br />
eu<strong>des</strong>ianum 25, 154<br />
Eudmetoceras 28, 158<br />
eudmetum 28<br />
Eulumdites 42<br />
euryodos 120, 238<br />
eusculpta 141,264<br />
evexa 129, 248<br />
evoluta 128, 248<br />
evolutescens 130, 248<br />
evolutum 35, 81, 162<br />
evolvescens 80, 208<br />
extinetus 82, 208<br />
Extranodites 148, 149, 268<br />
falcata 63, 142, 264<br />
fallax 28, 42, 56, 166, 176<br />
fallifax 28<br />
ferrifex 68, 192<br />
ferruginea 96<br />
Ferruginea-Schichten 17<br />
festonensis 117, 236<br />
filatum 148, 268<br />
ftmbriatus 25<br />
fimbriatus gigas 25, 154<br />
fimhriatus opalinus 26<br />
fiseberianus 126<br />
fissilobata 61, 184<br />
flaccidum 56<br />
flexicostatus 115<br />
flexispinatum 46, 166<br />
flexuosa 139, 260<br />
flexuosus canaliculatus 45, 166<br />
flexuosus globulus 46, 166<br />
flexuosus inermis 166<br />
flexuosus inflatus 46, 166<br />
folliformis 106<br />
formosum 75, 202<br />
formosum variecostatum 75, 202<br />
fomiosus 33, 105<br />
fortecostatum 127, 246<br />
fraasi 142, 143, 264<br />
franconica 140, 141, 262<br />
frechi 77, 204<br />
frederici 45, 166<br />
fretensis 97, 220<br />
Friderici Augusti 24, 94<br />
funatus 125, 244<br />
furticarinata 62, 188<br />
furticarinatus 65<br />
fusca 160<br />
fusca seebacbi 31, 160<br />
fuseoi<strong>des</strong> 31<br />
fuscus 30, 33, 44, 160<br />
Fuscus-Bank 16<br />
galilaeii 109<br />
Garantia 89<br />
Garantiana 6, 90, 214<br />
garantiana 90, 214<br />
garantianus 89, 90, 92, 212, 214<br />
garantianus conjugatus 89, 212<br />
garantianus densicostatus 89, 212<br />
garnieri 84<br />
gemmatum 111, 230<br />
genicularis 32<br />
gervillii 80, 208<br />
gervillii grandis 78<br />
gervillii macroeepbalus 79, 208<br />
gigantea 55, 174<br />
giganteum 49, 100, 168,222<br />
Giganteus-Tone 15<br />
gigas 43, 166<br />
gingensis 61<br />
globosus 83, 208<br />
goetzendorfensis 51<br />
Goliathiceras 116, 234<br />
Goliathites 116<br />
goliathus 116,234<br />
Gonolkitcs 96, 220<br />
gowerianus 108, 230<br />
Gowericeras 107<br />
gracile 75, 202<br />
Gracilisphinctes 121<br />
graciosus 126, 246<br />
grandiforme 80<br />
grandiplex 62, 188<br />
grantanus 107, 228<br />
Graphoceras 56, 57, 174, 176<br />
Graublaues Erzlager 17<br />
grave 50<br />
gredingensis 120, 238<br />
Grossouvria 129, 248<br />
gruibingensis 86, 210<br />
Gtdielmiceras 112, 232<br />
gulielmii 112, 232<br />
Gulielmina 109<br />
Gulielmites 112<br />
Gyrochorda comosa 13<br />
gyrumbilicus 96, 220<br />
Hamiten-Tone 26<br />
Hamites 98-100, 220, 222<br />
Hammatoceras 27, 154, 156
hamyanense 96 insignoi<strong>des</strong> 27, 156 lenki 119, 236<br />
hannoverana 64, 188 intermissum 115, 231 leoniae 72<br />
Harpoceras 41 interninodalum 148, 168 leptoi<strong>des</strong> 127,146<br />
Haselbiirgites 95 interruptus striatus 16 Leptosphinctes 6, 84, 117-119, 134,<br />
haugi 53, 172 intralaevis 55 136<br />
bebridica 15 leptus 117,134<br />
Hecticoceras 3, 33-45, 162-166 jodatum 101, III limosus 30, 31<br />
hecticum 34, 36, 162 jarryi 138, 158 lineatum 50<br />
hecticum boginense 34, 162 Jason 17, 110, III, 113,130,131 lineatus ferratus 15<br />
hecticum posterius 35, 162 Jeanetia 36 lineatus fuscus 15<br />
becticus 34, 37, 40, 164 jeanneti 140,161 lineatus penicillatus 15<br />
becticus canaliculatus 38, 164 Jeanneticeras 36 linguiferus 83, 208, 210<br />
becticus compressus 43, 166 jugifera 17, 60, 181 Lioceras SO, 56<br />
becticus gigas 42, 43, 45, 166 jugosus 65 Liodiscites 58<br />
becticus lunula 41, 42, 45, 164, 166 Jurensis-Mergel 13<br />
liostraca 65, 190<br />
becticus nodosus 38, 164<br />
Lissoceras 68, 192<br />
becticus parallelus 44 kaiseri 146,166 Lissoceratoi<strong>des</strong> 68<br />
becticus perlatus 37, 162 Kamptokepbalites 104 literatum 55<br />
belvetica 55, 174 karpinskyi 36, 161 Lithacoceras 62<br />
hennigi 85,210 keilbergense 37, 161 Lobokosmokeras 109<br />
henrici 116, 234 Kellaway Rock 17 Lobolytoceras 25<br />
hereticus 143, 264 Kellawaysia 141,164 Loboplanulites 128<br />
berveyi 107, 228 Kellawaysites 140 lochenensis 124, 242<br />
berzogenauense 146 keppleri 107, 228 Loczy ceras 139<br />
heteroplryllus esulcatus 23 Kepplerites 107, 228, 230 longidens 90, 214<br />
heteropbyllus lautlingensis 23 Kheraiceras 134, 254 Lucya 56<br />
beterophyllus opalini 23, 152 kiliani 141,262 lucyi 56<br />
heteroplryllus ornati 24, 152 killertalensis 119 Ludwigella 56, 57, 176<br />
hexagonus 108 knecbti 148 Ludwigia 51, S3-55, 172, 174<br />
Hlawiceras 92, 214, 216 Knorri-Tonc 16 Ludwigina 53<br />
hochstetteri 66 koenigi 131, 250 lunula 42, 44, 166<br />
bodsoni 122, 240 Konservativstamme 3 lunula var. difformis 39<br />
boffmanni 71, 198 kontkiewiczi 126, 130, 248 Lunuloceras 42-45, 166<br />
Holcoplrylloceras 24, 152 Kosmoceras 17, 109-114, 230, 232 lunuloi<strong>des</strong> 43, 166<br />
Holzbergia 137, 258 krakoviense 40, 164 lunuloi<strong>des</strong> sinuicostatum 43, 166<br />
homoeomorphus 124, 244 krakoviense ogivale 40 Lycetticeras 135<br />
Homoeoplanulites 123-125, 242, 244 krakoviense transiens 40 Lytoceras 25, 152, 154<br />
Horioceras 48, 168 krumbecki 136, 258<br />
bumphriesianum 69, 70, 194 Krumbeckia 133 mackenzü 75, 202<br />
Humphriesianum-Oolith 15 Kuhanoceras 117 macrescens 102, 222<br />
bumphriesianum zieteni 70, 194 kumaterus 69 Macrocephalen-Horizont 17<br />
bumpbriesianus coronatus 77, 204 Kumatostef)banus 69, 192 Macroeephalen-Oolith 16, 17<br />
bumpbriesianus crassicosta 69 macrocephali 99, 222<br />
bumpbriesianus macer 71, 196 labrosus 28, 158 Macrocephalites 16, 104-107, 224-228<br />
bumpbriesianus mutabilis 72, 200 laevigatum 99, 222 macroeepbalus 104, 105, 136, 224<br />
humphriesianus nodosus 71 laeviplex 121, 238 macroeepbalus compressus 105, 226<br />
bumpbriesianus planula 69, 192 laeviuscula 63, 188 macroeepbalus evolutus 107, 108<br />
humphriesianus umbilicus 72, 200 Lagenalisbank 16 macroeepbalus rotundus 106, 226<br />
hungarica inacuticostata 140, 260 tabuseni 108, 230 macroeepbalus tumidus 105, 224<br />
bungaricus 140, 262 lalandeanum 138, 258 macrum 71, 196<br />
Hyperlioceras 4, 15, 57, 58, 176-180 lamberti 17, 115, 234 madagascariensis 105, 224<br />
Lamberticeras 115 marginatus 135, 254<br />
imitator 122, 240 lamberti crolryloi<strong>des</strong> 234 martinsi 1,119<br />
impolita 57 lamberti inflatus 116, 234 martiusi 119,236<br />
inacuticostata 140, 260 Lamberti-Knollen 17 masckei 72, 73, 198<br />
inaequifurcatum 41, 164 lamberti macer 115, 116, 232 mathavense 41<br />
incisum 100, 222 lamellosus 106, 228 maticonensis 123, 242<br />
inclusum 56 latansatum 76, 202 maubeugei 33, 160<br />
incognitus 120, 238 latecentratus 134, 254 mayeri 61<br />
lndosphinctes 126, 127, 246 latecostata 54, 172 Mazapilitinae 68<br />
inerme 46, 166 latidorsatum 87,210 mediterraneum 24<br />
inferior 86, 210 latidorsum 71, 196 Megateuthis 15<br />
inflata 90, 212 latiumbilicatum 77, 204 meriani 148<br />
inflatum 36, 68, 162 Litumbilicatum 72, 200 mesacantha 15, 60, 182<br />
Infragarantiana 84 latumbilicatum bentzi 72, 202 Metapatoceras 99, 100<br />
Infraparkinsonia 86, 210 leachi 115, 116, 234 Metapeltoceras 147<br />
Infrapatoceras 99 Leioceras SO, 51, 168, 170 metomphalum 41, 166<br />
insignis 27 Leioceratinae 50 metomphalum acuticosta 42<br />
281
metomphalum multicostatum 42, 166<br />
metomphahm sovoiense 42<br />
mtchatiowense 44, 166<br />
microstoma 135, 254<br />
minima 91,214<br />
minor 119, 236<br />
mirabilis 122, 240<br />
mitis 76, 202<br />
modeli 37, 144, 266<br />
modcsta 62<br />
modiolaris 132, 250<br />
moisyi 63<br />
monestieri 23<br />
Monophyllitinae 23<br />
Morpboceras 6, 101, 222<br />
morrisi 136, 258<br />
Morrisiceras 6, 134-136, 256, 258<br />
inosqtiensis 130, 131, ISO<br />
multicostatus 140<br />
multiforme 101, 222<br />
multinodum 76<br />
murcbisonae 15, 53, 54, 172<br />
murcbisonae acutus 52, 170<br />
murcbisonae falcifera 54<br />
murcbisonae obtusus 53, 54, 172<br />
murcbisonae planatus 54, 174<br />
mutabile 72, 200<br />
Nadeleisenerz 13<br />
Nannina 64<br />
Nequeniceratinae 139<br />
neuffensis 95,218<br />
Neumarkt-Schichten 13<br />
nilssoni 23<br />
niortense 87,210<br />
nivernensis 32, 160<br />
nodatus 84, 210<br />
nodatus bisingensis 84, 210<br />
nodosulcatum 44, 45, 166<br />
nodosum 38, 71, 164, 196<br />
nodosum recurvum 38, 164<br />
nodosum tbalbeimensc 38, 164<br />
Normannites 73-76, 200, 202<br />
nudum 44<br />
obductum 112<br />
obliquecostatum 98, 220<br />
oblongum 146, 266<br />
obtusa latccostata 54<br />
obtusiformis 53<br />
ocellatum 103<br />
Ochetoceras 45<br />
Oecoptycbius 4, 137, 258<br />
Oecotraustes 32, 160<br />
Okaites 131, 250<br />
oolithicum 68, 192<br />
opaliniforme 50<br />
opalinoi<strong>des</strong> 13, 52, 170<br />
opalinum 50, 168<br />
opalinum lineatum 50, 168<br />
opalinus costosus 168<br />
Opalinus-Tone 13<br />
oppeli 144<br />
Oppelia 4, 30, 158, 160<br />
Oraniceras 96, 220<br />
orbignyanum 81,208<br />
orbignyi 45, 73, 83, 98, 166, 200<br />
orbis 16,31,160<br />
282<br />
Orion 128, 248 perspieuus 118, 120, 236, 238<br />
Ornaten-Tone 17 petri 119<br />
ornatum 113, 232 Phaulozigzag 123<br />
ornatus 110, 113, 114, 230, 232 phaulus 86, 210<br />
ornatus annulatus 230 Phlycticeras 4, 48, 49, 168<br />
ornatus compressus HO Plrylloceras 23<br />
ornatus rotundus 110 pictava f. savarensis 264<br />
ornatus spoliatus 111, 230 pila 107, 228<br />
Ortbogarantiana 89, 90, 212 pingue 103, 116, 234<br />
Ostreenkalkc 16 pingtds 64, 65, 131, 188<br />
Otoites 79, 206, 208 pinguissimus 79<br />
ovale 24, 152 Pionoceras 136<br />
ovalis 61, 184 plana 129<br />
ovalis gracililobata 61 Planammatoceras 28, 156<br />
ovalis rudis 61 planiforme- 28, 156<br />
oviformis 62 planilobus 120<br />
Oxford Clay 17 Planisphinctes 120, 238<br />
oxus 31, 160 planula 127<br />
Oxycerites 16, 30, 31, 158, 160 planulata 95, 218<br />
platyrrymum 92<br />
Pacbammatoceras 27 platyStoma 74, 202<br />
Pachyceras 138, 258 platystomus 134<br />
Pachyerymnoceras 138 platystomus globulatus 134<br />
Paclrylytoceras 26, 154 Plenum 121, 238<br />
paraholicus 131 Pleuroacanthitidae 25<br />
Paraehoffatia 124, 125, 244 Pleydellia 3<br />
Paracuariceras 99, 100, 222 Poecilomorpbus 63<br />
parallelum 37, 162 pollucinum 112, 232<br />
Parapatoceras 10, 99, 222 pollux 113, 232<br />
Parapeltoceras 146, 266, 268 polonica 130, 248<br />
Paraspidoceras 148, 268 {mlyacantha 61, 184<br />
Parawedckindia 144 polycosta 141, 264<br />
parkinsoni 92-94, 96, 216 polygonium 49, 168<br />
Parkinsonia 6, 93, 216-220 polygonium laevigatnin 49, 168<br />
parkinsoni anceps 143 polygyralis 84, 85, 210<br />
parkinsoni compressus 96, 220 polymorpbus 101<br />
parkinsoni compressus gyrumbilicus 96 Polyplectites 82, 83, 208, 210<br />
parkinsoni coronatus 141, 142, 264 polypleurus 133, 252<br />
parkinsoni densicosta 91, 94, 214, 218 fxylyscbi<strong>des</strong> 78<br />
parkinsoni depressus 93 Polyspbinctites 104, 224<br />
parkinsoni eimensis 96 polyspbinctus 104, 224<br />
parkinsoni gigas 95, 218 pompeckyi var. inflata 36<br />
parkinsoni inflatus 101, 102, 138, 222 postcreppini 139<br />
parkinsoni laevis 97, 220 postflexicostatum 115<br />
parkinsoni longidens 90, 92, 214 Praebigotites 84<br />
Parkinsoni-Oolich 16 praecursor 90<br />
parkinsoni planulatus 93-95- 216 Praesutneria 137<br />
Paroecotraustes 33, 160 primaevum 34, 160<br />
partsebi 23 procera 124, 242<br />
Partschiceras 23, 152 Procerites 121, 238-242<br />
parvum 77, 204 Procerozigzag 121, 238<br />
patefactor 63 Prohecticoceras 33, 35, 160<br />
patella 61,186 propinquans 59, 178<br />
patescens 102, 222 Proplamäites 131, 250<br />
patrulii 103, 224 prorsicostatus 85, 210<br />
paucicosta 118, 236 Prorsispbinctes 119<br />
paucicostatum 51, 170 Protancyloceras 9<br />
paulowi 44, 166 Protetragonitidae 25<br />
pauper 37, 79, 208 Pscudammatoceras 27<br />
Pelekodites 4, 63, 64, 188 pseudaurigerus 126<br />
pelekus 63 pseudo-aneeps 103<br />
Peltoceras 17, 144, 266, 268 pseudoannularis 125, 244<br />
Peltoceratoi<strong>des</strong> 145, 266 pseudocaprinum 146, 266, 268<br />
penicillatum 25, 152 Pseudogarantiam 87, 91, 214<br />
perarmatus 149 Pseudographoceras 55, 174<br />
perjueundus 69 Pseudolioceras 3<br />
perlatum 37, 162 pseudomacroeephalus 97, 220<br />
perseverans 107, 228 pseudoparkinsoni 94
Pseudoperisphinctes 124, 128 rowlstonense 110, 230 spoliatum III, 230<br />
Pseudoperisphinctinae 120, 127 rudidiscites 58, 178 staeschei 58<br />
pseudoprocerum 121, 238 rudis 57, 176 Staufenia 13, 52, 170, 172<br />
pseudopunctatum 41, 166 rugifer 133, 252<br />
Staufensis 52, 53, 172<br />
pseudopunctatum sucvum 41<br />
Rugiferites 132<br />
Staufensis-Bank 13<br />
pseudopunctatum var. orbignyi 45, 166 ruppeusis 140 Stenunatoceras 3, 69, 76<br />
pseudoscopinensis 117,146 Rursiceras 147, 268 stephani 62, 186<br />
pseudotorosum 147 nirsum 103, 222 Stepbanoceras 69-76, 194-202<br />
pseudotrigonata 61, 186 stepbanoceratoi<strong>des</strong> IIS, 236<br />
pseudotuberculata 59, 181 salvadorii 39, 164 stephanovi 121, 238<br />
psilodiscus 68, 191 sarasini 36, 162 stolleyi 146<br />
pidcbni 65 sauzeanum 98, 222 stompbus 117<br />
pnmilus 133,151 sauzei 79, 206 storzi 144<br />
punctatissinuis 64, 1S8 Stivarensis 141 Strenoceras 3, 87, 88, 210<br />
punctatum 39-41, 164 sayni 64 striatum 51<br />
punctatum arcuatum 39, 164 scalare 70, 194 Strigoceras 4, 66, 67, 190, 192<br />
punctatum exile 40, 164 scaphicon 9 Struebinia 148<br />
punctulatum 46, 168 schalcin 40 stuebeli 141, 142, 264<br />
pustulatum 48, 168 schindewolfi 81 subacuta 52<br />
pustulatum franconicus 48, 168 scbloenbachi 44, 95, 121, 166,216 subanceps 142<br />
pustulatum giganteus 49, 168 scblumbergeri 64, 188 subannulosum 147, 268<br />
pustulatum nodosum 48, 168 schmidti 81, 208 subarietis 93<br />
pustulatus parkinsoni 34, 160 Schmidtoceras 80 subaurigerus 131, 250<br />
pustulatus suevicus 49, 168 schmieren 117, 236 subbakeriae 125, 244<br />
Putealiceras 39-41, 164-166 scbroederi 89, 212 subblagdeni 77, 204<br />
putealis 39 schwandorfense 137, 258 subcontractus 132, 250<br />
pygmaeus 31, 160 Scbwandorfia 135 subcownatum 77, 204<br />
pyritosum 71, 198 scissum 29, 156 subcoronatus 117<br />
secundus 104, 224 subcostarius 31, 160<br />
quenstedti 79, 87, 91, 108,110, 114 seebacbi 31, 160 subdiscoidea 58, 180<br />
quenstedti spinosum 87 scbndensis 13, 52, 170 subfurcata 92,214<br />
Quenstedtoceras 17, 115, 116,131 semirugosum 145 Subfurcaten-Oolith 16<br />
quercinus 111, 140 semiserratum 100 subfurcalus 16, 87<br />
septicamiatum 67, 192 subfuscus 33<br />
radiata 94,116 serpens 88, 212 Suhgarantiana 92<br />
rarecostata 93, 216 serpenticon 19 Subgrossouvria 128<br />
Rarecostites 93 serrigerus 33 sublaeve 114, 232<br />
raricostatum 148, 268 sieboldi 27, 154 sublaevis 114, 132, 232<br />
recinctus 103 Siemiradzkia 103, 123, 242 Sublunuloceras 42<br />
rectecostatum 72 Sigaloceras 17, 109, 230 submatheyi 44, 166<br />
rectelobatus 82, 208 sinon 52, 170 submutatus 126<br />
recitperoi 128, 248 Sinon-Bänke 13 subnodosum 42, 166<br />
refractus 137, 258 Skirroceras 69, 71 subplanulata 95, 218<br />
refractus macrocephali 137 solinopborum 38, 164 subprocerus 123, 242<br />
regleyi 29, 156 solinopborum prorsosinuatum 38, 164 subpunctatum 33<br />
rehmanni 139, 140, 260 solinopborum reversum 38 subradiatus 4, 30, 32, 158<br />
Rehmannia 7, 139, 140,160, 161 Sonninia 3, 15, 27, 59-62, 178-188 subrotundum 107<br />
Reifcnberg-Scliichten 13 , Sowerbyceras 24, 152 subsectum 58, 178<br />
Reineckeia 3, 7, 140, 262, 264 sowerlyyi 15, 60 subtabulata 54<br />
Reineckeites 140, 141, 264 Sowerbyi-Bank 15 subtecta 66, 190<br />
renggeri 47, 168 sowerlryi carinodiscus 61 subtilis 129<br />
renggeri var. woodhamense 47 sowerbyi costosus 60 subtortisulcatum 24, 152<br />
retractum 148, 268 sowerbyi insignoi<strong>des</strong> 27, 60, 156 subtrapezinus 106, 226<br />
retrocostatum 33, 160 sowerbyi oualis 184 subtuherculata 55, 174<br />
reuten 36, 131, 133, 254 sowerbyi trigoiuitus 59, 180 subzieteni 70, 196<br />
reversus 147 sparsinodum 77 subzogenreuthense 72, 198<br />
revili 126, 139, 246, 260 spathi 143, 144 suevica 92,214<br />
robustum 41, 88, 164 Spatulatus-Bank 15 suevicum 88, 212<br />
Rollierites 137 sphaera 135, 256 suevicus 46, 135, 254<br />
romani 1, 65, 190 sphaericus 107 sulcatum 103, 222<br />
romanoi<strong>des</strong> 65 Spbaeroceras 80 sulcifera 129,248<br />
rossicus 130, 250 Sphaeroptycbius 135, 254 Suspensites 127<br />
rossiense 41, 166 Spinikosmoceras 113, 114, 232 suspensum 127, 246<br />
Rossiensiceras 39 spinosum 109, 110, 230 sutneri 63, 188<br />
rota 85, 210 Spiroceras 10, 98, 220, 222 svevum 40, 164<br />
Rotes Erzlager 17 Spirocerataceae 3<br />
rotundum 88, 212 Spiroceratinae 3 taeniatum 26, 154<br />
rotundus 106, 226 splendens 33 Taramelliceras 45, 166, 168
tatricus 23, 152<br />
teisseyrei 129, 131, 250<br />
Teloceras 16, 76-7S, 204, 206<br />
tenella 129<br />
tenera 58<br />
temic 81, 208<br />
tenuinodosum 39, 164<br />
temtiplicatus 103, 104, 222<br />
tenuissimus 120, 238<br />
tessoniana 62, 66, 186<br />
tessoiiianus 65, 190<br />
tessonianus falcatus 61<br />
tetmgomi 93, 216<br />
tidmoorense 110, 230<br />
Tmetoceras 3, 4, 29, 156<br />
Tmetoites 29<br />
toluUiria 13<br />
toricellii 108, 230<br />
Toricelliceras 108, 230<br />
Toricellites 108, 230<br />
Torrensia 89<br />
tortisulcatus 24<br />
tortisulcatus ornati 24, 152<br />
torulosum 26, 154<br />
Toxoceras 98<br />
toxocon 9<br />
trachinotus 45<br />
Trachyphyllitidae 25<br />
transiens 24, 152<br />
transitionis 114, 232<br />
transitörius 105, 224<br />
trapeza 26<br />
trapezoi<strong>des</strong> 146, 268<br />
Treptocenis 135<br />
trifidum 145, 266<br />
trigomta 59, 180<br />
trilineatwn 41<br />
triplex 78, 204<br />
triplicatus 69, 125, 192, 244<br />
triplicatus fuscus 104<br />
triplicatus parabolis 129, 248<br />
trochoceroid 9<br />
trochocon 9<br />
Trolliceras 133, 254<br />
truellei 66, 67, 190<br />
truellei gracilis 66<br />
truellei trifurcatus 66, 190<br />
tsytouitcbae 41<br />
tuberculatum 35, 100, 162, 222<br />
tuberculatus 119, 238<br />
tula 132<br />
Tulites 132, 134, 250-254<br />
tumidus 106, 228<br />
turgidulus 69, 192<br />
turgidum 74, 200<br />
turgidum densum 74<br />
Tyrannites 140, 264<br />
uetziiiguensis 106<br />
uhligi 108<br />
ultimum 118<br />
umbilicata 55, 174<br />
umbilkus 72, 200<br />
Unipeltoceras 144, 145<br />
unispinosum 145, 266<br />
Ussuritidae 23<br />
Varians-Oolith 16<br />
Varians-Schichten 16<br />
uelox 46, 168<br />
vermiformis 119<br />
Vermispbinctes 6, 119, 236<br />
verus 105<br />
i'iator 23<br />
Violettes Erzlager 17<br />
vulgaricostatum 74, 200<br />
vulgaricostatus pfafß 74<br />
waageni 33<br />
Waagenia 59<br />
wagneri 127<br />
Waguericeras 127, 246<br />
Wasserfallbänke 13<br />
Wedekindia 145<br />
Wedelsandsteine 15<br />
weigelti 134, 254<br />
weiserti 72<br />
wetzeli 91, 214<br />
Witcbellia 4, 63-65, 188<br />
wrigbti 80<br />
wuerttembergica 96, 220<br />
Wuerttembergica-Schichten 1<br />
yeovilensis 30, 160<br />
Zeissoceras 34<br />
zieteni 35, 162<br />
Zieteniceras 35, 36, 162<br />
zignodianum 40, 152<br />
zigzag 120<br />
Zigzagiceras 120, 238<br />
zogenreutbeiise 71<br />
Zopfplatten 13<br />
zugium 112<br />
Zugokosmoceras 112, 232<br />
zurcberi 63, 188