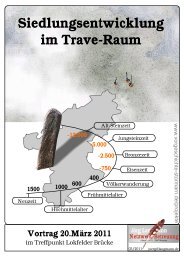Frühgeschichtliche Fernwege im Kreis Stormarn und im Raum Lübeck
Frühgeschichtliche Fernwege im Kreis Stormarn und im Raum Lübeck
Frühgeschichtliche Fernwege im Kreis Stormarn und im Raum Lübeck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Reinhold Beranek<br />
<strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong> <strong>und</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong><br />
Sonderdruck aus dem Jahrbuch 2007 <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong>
<strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong> <strong>und</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong><br />
Reinhold Beranek<br />
Das hier behandelte Gebiet zwischen der unteren Elbe <strong>und</strong> der Travemündung<br />
an der Ostsee nahm, dank seiner Lage <strong>und</strong> seiner Brücken-Funktion<br />
zum Ostseeraum <strong>und</strong> nach Skandinavien, bereits früh eine Sonderstellung<br />
auf den Feldern der Kommunikation, des Handels <strong>und</strong> des Verkehrs ein. Es<br />
umfasst den <strong>Raum</strong> der heutigen <strong>Kreis</strong>e <strong>Stormarn</strong>, Herzogtum Lauenburg<br />
sowie Teile der Hansestädte <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> Hamburg.<br />
Bereits in der Bronzezeit gibt es Hinweise auf einen Landtransport nördlich<br />
der Elbe. Für das hochentwickelte lokale Bronzehandwerk <strong>im</strong> Norden<br />
mussten die gr<strong>und</strong>legenden Rohstoffe Kupfer <strong>und</strong> Zinn aus den südlich<br />
1)<br />
gelegenen Teilen Europas eingeführt werden. Damit ergibt sich ein Zusam-<br />
menhang mit dem Verlauf der sogenannten Grabhügelwege, die auch <strong>im</strong> hier<br />
2)<br />
behandelten Untersuchungsgebiet mehrfach nachgewiesen werden können.<br />
Am Ende der Völkerwanderungszeit war das Land zwischen Eider <strong>und</strong> der<br />
unteren Elbe nur schwach von den nordelbingischen Sachsen besiedelt,<br />
so dass etwa um 700 n. Chr. slawische Bevölkerungsgruppen in den Norden<br />
<strong>und</strong> Osten des Landes einwandern konnten. Eine wesentliche machtpolitische<br />
Wende trat ein, als Karl der Große <strong>im</strong> Zuge der Sachsenkriege auch<br />
Nordelbingien eroberte. Eine fränkische Truppenabteilung unter ihrem<br />
Befehlshaber (Legaten) Eburisus besiegte in Waffenbrüderschaft mit einem<br />
slawischen Heer <strong>im</strong> Jahre 798 in der Schlacht von Bornhöved die sich lange<br />
wehrenden Sachsen. Das gesamte Gebiet nördlich der Elbe wurde 804<br />
3)<br />
zunächst den Slawen zur Besiedlung überlassen. Nach weiteren Auseinandersetzungen<br />
um die Machtverhältnisse, an denen auch die Dänen stark<br />
beteiligt waren, kam es um 810/817 auf friedlichem Wege zu einer erneuten<br />
Gebietsabgrenzung zwischen den fränkischen Sachsengauen <strong>und</strong> den<br />
slawischen Obodriten. Die Grenze, auch als „L<strong>im</strong>es saxoniae“ bekannt,<br />
erstreckte sich als eine Ödlandzone von der Mündung der Delvenau in die<br />
Elbe bis zur Kieler Förde. Genauere Angaben über den geographischen<br />
4)<br />
Verlauf werden jedoch erst um 1070 dokumentiert. Bis in die Zeit der<br />
Deutschen Ostsiedlung (Mitte des 12. Jahrh<strong>und</strong>erts) wurde die Völkergrenze<br />
<strong>im</strong> wesentlichen respektiert, obgleich es <strong>im</strong>mer wieder zu kriegerischen<br />
Auseinandersetzungen <strong>und</strong> Grenzüberschreitungen kam.<br />
Während der hier behandelten Zeitspanne des Früh- <strong>und</strong> Hochmittelalters<br />
verlief eine bedeutende überregionale Landverbindung, aus Westeuropa <strong>und</strong><br />
dem Rheinland kommend, über Bardowick/Hamburg zum alten Kernland<br />
34
des Obodritenstammes bzw. zu dessen Hauptorten Alt <strong>Lübeck</strong>, Oldenburg<br />
5)<br />
<strong>und</strong> Mecklenburg. Die Abb. 1 zeigt das frühe <strong>Fernwege</strong>netz zwischen der<br />
Unterelbe <strong>und</strong> der Ostsee während der Wikinger- <strong>und</strong> Slawenzeit, also etwa<br />
ab dem Jahre 800 bis zur Mitte des 12. Jahrh<strong>und</strong>erts. Abgebildet sind die<br />
wichtigsten <strong>Fernwege</strong> als Leitlinien, d. h. in allgemeinen Zügen bzw. grober<br />
Linienführung. Die dargestellten Wege verbanden die frühstädtischen<br />
6)<br />
Zentralorte, wichtige Burgplätze sowie bereits bestehende Handelsorte.<br />
Hervorzuheben sind drei schriftliche Erwähnungen mit einem direkten Bezug<br />
auf wichtige Fernwegtrassen:<br />
- Im Jahre 805 richtete Karl der Große in Bardowick – nahe der heutigen Stadt<br />
Lüneburg – eine Kontrollstation ein, um Waffenexporte in die slawischen<br />
Länder zu unterbinden. Der bereits erwähnte Handelsweg führte bei<br />
Artlenburg über die Elbe <strong>und</strong> weiter zu den altslawischen Zentralorten Alt<br />
7)<br />
<strong>Lübeck</strong>, Oldenburg <strong>und</strong> Mecklenburg.<br />
- Adam von Bremen beschreibt um 1070 einen wohl stark frequentierten<br />
Fernweg von Hammaburg nach Jumne, dem späteren Wolin an der<br />
8)<br />
heutigen polnischen Ostseeküste. Der Weg kreuzte den oben beschriebenen<br />
Fernweg an der Stecknitzfurt Hammer nördlich von Mölln. Somit<br />
waren auch die Handels- <strong>und</strong> Zentralorte Alt <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> Oldenburg gut<br />
erreichbar.<br />
- Gleichfalls <strong>im</strong> Adambericht (um 1070) wird ein Fernweg von Hamburg nach<br />
9)<br />
Oldenburg erwähnt. Diese offensichtlich kürzeste Wegverbindung zum<br />
wagrischen Zentralort Oldenburg führte zunächst zum Travefluss <strong>und</strong> an<br />
diesem entlang nach Alt <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> weiter nach Norden.<br />
Die schriftlichen Informationen über die Verkehrsverbindungen <strong>im</strong> frühen<br />
<strong>und</strong> hohen Mittelalter weisen auf bereits bestehende Handelsbeziehungen<br />
hin. Westliche Kaufleute betrieben ab dem 9. <strong>und</strong> insbesondere <strong>im</strong> 11./12.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert einen ansehnlichen Warenaustausch mit den Bewohnern der<br />
10)<br />
slawischen Hauptorte an der Ostseeküste. So gehört seit dem Beginn der<br />
kontinuierlichen Siedlungstätigkeit <strong>im</strong> 8./9. Jahrh<strong>und</strong>ert die Region zu den<br />
11)<br />
verkehrsräumlichen Vorzugsgebieten in Norddeutschland.<br />
Gr<strong>und</strong>lage der Rekonstruktion von Altwegen ist eine f<strong>und</strong>ierte historische,<br />
archäologische <strong>und</strong> geographische Forschung. Der frühe Landverkehr <strong>im</strong><br />
norddeutschen Flachland bewegte sich auf Trassen, die als sogenannte<br />
Naturwege entstanden sind. Dabei bildete sich die Fahrbahn ganz allmählich,<br />
indem der Verkehr <strong>im</strong>mer wieder der gewählten Linienführung folgte. Die<br />
Wege wurden infolge der häufigen Benutzung festgetreten <strong>und</strong> festgefahren;<br />
doch es fehlte dabei der feste Untergr<strong>und</strong>. Daher musste der Verkehr umso<br />
mehr auf die geologischen <strong>und</strong> hydrologischen Verhältnisse achten. So<br />
wurden auch manche Umwege in Kauf genommen. Bei den Naturwegen<br />
wurden nur die schl<strong>im</strong>msten Hindernisse geräumt. Sowohl systematische<br />
Wegebesserungen als auch ein Wegebau fanden, zunächst in bescheidenem<br />
35
12)<br />
Maße, ab dem (späten) Mittelalter statt. Als das Transportmittel der<br />
Frühzeit ist bereits ab dem Neolithikum der 2- <strong>und</strong> 4-rädrige Ochsenwagen<br />
bekannt. Im Früh- <strong>und</strong> Hochmittelalter diente das Pferd außer als Reittier<br />
auch zur Personenbeförderung, z. B. bei schnellen Botendiensten, vor allem<br />
als Last- <strong>und</strong> Saumtier; auch Esel <strong>und</strong> Maultiere wurden zum Tragen von<br />
Lasten eingesetzt. Typisch in der Zeit des zunehmenden Fernverkehrs,<br />
insbesondere ab dem 10. Jahrh<strong>und</strong>ert, war jedoch der von einem <strong>und</strong> auch<br />
mehreren Pferden gezogene 2-rädrige Karren. Be<strong>im</strong> Karren liegt die Last<br />
nicht allein auf den Wagenrädern, sondern über das Zuggestell trägt auch<br />
das Tier einen Teil der Last mit. Besonders auf steilen Strecken blieb der<br />
13)<br />
Karren das geeignetste Fahrzeug. Beginnend <strong>im</strong> 11. Jahrh<strong>und</strong>ert setzte<br />
sich dann <strong>im</strong> späten Mittelalter, bei zunehmender Wegebesserung bzw.<br />
einsetzendem Wegebau, der 4-rädrige Frachtwagen mit größerer Spurbreite<br />
zur Beförderung von größeren Lasten durch.<br />
Eine wichtige methodische Vorgehensweise bei der Rekonstruktion von<br />
Altwegen ist die Geländeaufnahme, wobei - wie bereits angeführt - das<br />
Bodenrelief eine wesentliche Rolle spielt. Wenn möglich vermied man<br />
feuchte Niederungen <strong>und</strong> große Anhöhen. Oft verliefen die Wege direkt auf<br />
den Wasserscheiden bzw. entlang der topographischen Höhenlinien.<br />
Insbesondere <strong>im</strong> frühen Mittelalter findet man die Trassenführung häufig in<br />
höher gelegenen schwächer bewaldeten Uferzonen der Flüsse. An<br />
geographisch gut geeigneten Stellen querte man die Flüsse meistens mittels<br />
Furten; doch gab es auch Brücken <strong>und</strong> Fähren. Sümpfe <strong>und</strong> Moore wurden<br />
schon früh mit Hilfe von Dämmen <strong>und</strong> Bohlenwegen überbrückt. Noch<br />
heute kann man einzelne Altwegereste, wie (auch mehrspurige) Wegerinnen<br />
<strong>und</strong> Hohlwege, vorwiegend an Steigungen in landwirtschaftlich<br />
ungenutzten Gebieten, auffinden. Dabei sind kurze steile Anstiege typisch<br />
14)<br />
für früh- <strong>und</strong> hochmittelalterliche Trassen. Punktuelle Hinweise <strong>im</strong><br />
Gelände liefert die archäologische Landesaufnahme mit Bef<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
F<strong>und</strong>en. So gibt es des Öfteren an markanten Wegestellen Befestigungsanlagen<br />
oder deren Relikte, die eine Funktion als Wegesicherung oder<br />
–sperre hatten. Ungünstig ist es um die schriftliche Überlieferung bestellt.<br />
Mit den spärlichen historischen Nachrichten aus frühgeschichtlicher Zeit<br />
lassen sich die Wegeführungen meist nur in allgemeinen Zügen bzw. grober<br />
Linienführung rekonstruieren. Bei Problemen der Altersbest<strong>im</strong>mung von<br />
Wegetrassen hat sich die retrospektive Methode oft bewährt. Es wird dabei,<br />
von jüngeren Belegen ausgehend, hier vom relativ gut erforschten spät-<br />
15)<br />
mittelalterlichen Wegenetz auf ältere Zustände geschlossen.<br />
Zu diesem methodischen Ansatz, bzw. zur Frage der Kontinuität von<br />
historischen Straßen in Schleswig-Holstein, schreibt K. Kersten: „Die größte<br />
Schwierigkeit für die Erforschung der alten Wege besteht in der Best<strong>im</strong>mung ihres<br />
Alters. Da ihr Verlauf durch die morphologischen Voraussetzungen<br />
36
des Geländes best<strong>im</strong>mt war, wird man ... durchweg annehmen können, daß die meisten<br />
der aus dem Mittelalter urk<strong>und</strong>lich überlieferten Hauptverbindungsstraßen bis<br />
16)<br />
weit in die Vorzeit zurückreichen“.<br />
Mit den Methoden zur Rekonstruktion von Altwegen <strong>und</strong> unter Berücksichtigung<br />
auch neuerer Veröffentlichungen der Archäologie <strong>und</strong> Verkehrs-<br />
17)<br />
geschichte, hat der Autor den genaueren Verlauf der frühgeschichtlichen<br />
Abb.1: <strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong> zwischen Unterelbe <strong>und</strong> Ostsee<br />
(Wegeleitlinien nach Herrmannen 1985 <strong>und</strong> Gabriel 1988, geändert)<br />
37
Fernwegtrassen <strong>im</strong> Arbeitsgebiet untersucht. In Teilen wurden Abweichungen<br />
von bisherigen Forschungsergebnissen festgestellt. Bei vier Wegen<br />
<strong>im</strong> Land Lauenburg (Abb. 2) konnten neue Trassenführungen ermittelt <strong>und</strong><br />
Abb.2: <strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong> zwischen Unterelbe <strong>und</strong><br />
Ostsee-Travemündung<br />
38
18)<br />
publiziert werden. Weiteres Sichten <strong>und</strong> Interpretieren der schriftlichen<br />
Quellen sowie umfangreiche Geländebegehungen ergaben gut verwendbare<br />
Hinweise <strong>und</strong> Anhaltspunkte für eine Erweiterung des Bearbeitungsgebietes.<br />
Im hier vorgestellten Beitrag werden insbesondere die Räume<br />
<strong>Stormarn</strong>, Hamburg <strong>und</strong> <strong>Lübeck</strong> betreffend die genaueren Trassenverläufe<br />
der folgenden frühgeschichtlichen <strong>Fernwege</strong> untersucht <strong>und</strong> beschrieben<br />
(Rekonstruktionsversuch):<br />
Der Fernweg von Hamburg nach Mecklenburg (Abb. 2, Fernweg 2)<br />
Hamburg – Nordufer Billefluss – Wegekreuzungspunkt Hammer (bei<br />
Mölln) – nach Mecklenburg <strong>und</strong> Reric (Wismarbucht) - bzw. mit<br />
Abzweigung bei Mölln in den <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong>.<br />
Die <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong> (Abb. 3)<br />
Sternförmige Wegekonzentration <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong>.<br />
Der Fernweg von der Ostsee nach Hamburg (Abb. 2, Fernweg 3)<br />
<strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong> – Nordufer Travefluss – <strong>Raum</strong> Oldesloe - Travefurt Nütschau<br />
- Bargteheide - nach Hamburg.<br />
Der Fernweg von Hamburg nach Mecklenburg<br />
Die Ke<strong>im</strong>zelle der Stadt Hamburg liegt auf einem Geländesporn zwischen<br />
Alster <strong>und</strong> Bille. Spätestens <strong>im</strong> 8. Jahrh<strong>und</strong>ert fand hier eine spätsächsische<br />
Besiedlung bzw. der Bau einer zeitgleichen Befestigung in Form einer<br />
Doppelkreisgrabenanlage statt, die archäologisch nachgewiesen wurden.<br />
Ab Anfang des 9. Jahrh<strong>und</strong>erts entwickelte sich an dieser Stelle unter<br />
fränkischem Einfluss ein Ort mit Fischern, Handwerkern <strong>und</strong> Händlern. Die<br />
ursprüngliche sächsische, wie auch die fränkische Ansiedlung befand sich<br />
südlich der heutigen St. Petri-Kirche, wo später der Hamburger Dom errichtet<br />
wurde. Gestützt auf Untersuchungen ab 1947 vermutet man an<br />
19)<br />
diesem Ort auch die mehrfach urk<strong>und</strong>lich erwähnte Burg Hammaburg.<br />
Eine westlich vorgelagerte Marktsiedlung <strong>und</strong> ein Anlegeplatz für Schiffe<br />
konnten nachgewiesen werden. Hier war auch bei Hochflut ein sicherer<br />
Warenumschlag vom Land zum Wasser möglich.<br />
Die Gründung der Stadt Hamburg <strong>und</strong> auch einer Kirche vor 814 durch die<br />
20)<br />
fränkischen Machthaber ist mehrfach schriftlich überliefert. Bereits 831<br />
wurde unter Bischof Ansgar der erste Bischofssitz nördlich der Elbe eingerichtet.<br />
Im Jahre 845 landeten die dänischen Wikinger unerwartet mit einer<br />
starken Flotte, zerstörten die Hammaburg <strong>und</strong> brannten auch die sonstigen<br />
Bauten nieder. Wenige Jahre danach, in der zweiten Hälfte des 9. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
errichtete man drei Erdwälle, die in Teilen erfasst <strong>und</strong> datiert wurden.<br />
21)<br />
Sie könnten von einer ehemaligen bischöflichen Domburg stammen. Seit<br />
der Bistumsgründung 831 muss es auf dem oben beschriebenen Domplatzgelände<br />
nacheinander mehrere aus Holz gebaute Kirchen gegeben haben.<br />
In Stein errichtete Kirchenbauten sind ab dem 11. Jahrh<strong>und</strong>ert nach-<br />
39
22)<br />
gewiesen. Sowohl der Wikingerüberfall <strong>im</strong> Jahre 845 als auch die<br />
Zerstörungen durch die Slaweneinfälle in den Jahren 983, 1066 <strong>und</strong> 1072,<br />
konnten die kontinuierliche Entwicklung der Stadt nicht aufhalten. Im 10. <strong>und</strong><br />
11. Jahrh<strong>und</strong>ert wurden sowohl von bischöflicher wie auch weltlicher Seite<br />
mehrere neue Befestigungsanlagen errichtet <strong>und</strong> auch die Marktsiedlung<br />
23)<br />
wurde erweitert. Den Hafen verlegte man an eine günstigere Stelle. Obgleich<br />
der Sitz des Erzbistums Hamburg/Bremen nach Bremen verlegt wurde, blieb<br />
Hamburg Ausgangspunkt der Missionierung des Nordens <strong>und</strong> die Stadt<br />
entwickelte sich langfristig zum politischen, wirtschaftlichen <strong>und</strong> kulturellen<br />
Zentrum der Region einschließlich <strong>Stormarn</strong>s.<br />
Auf einen bereits frühen überregionalen Handel weisen die keramischen<br />
F<strong>und</strong>e mit der Zeitstellung ab dem 9. Jahrh<strong>und</strong>ert hin. Sie kamen bei diversen<br />
archäologischen Grabungen auf dem Domplatzgelände zu Tage. Neben der<br />
vorherrschenden spätsächsischen Tonware wurde Muschelgrusware aus den<br />
friesischen Regionen <strong>und</strong>, etwa in gleichen Mengen, auch slawische bzw.<br />
slawisch beeinflusste Keramik aufgef<strong>und</strong>en. Dies führt zu der noch nicht<br />
beantworteten Frage: War Hamburg damals ein „multiethnischer Handelsplatz“,<br />
wo neben den Sachsen auch Friesen <strong>und</strong> Slawen siedelten? Oder sind deren Tongefäße<br />
nur auf dem Handelswege bzw. als Behälter für Naturalabgaben nach Hamburg<br />
24)<br />
gelangt? Bei Grabungen in der Gr. Reichenstrasse fand man außer <strong>im</strong>portierter<br />
Keramik des 9. bis 13. Jahrh<strong>und</strong>erts auch Teile einer bronzenen Klappwaage<br />
mit eisernem Zünglein. Derartige zusammenklappbare Taschen-<br />
waagen wurden von Kaufleuten der frühgeschichtlichen Zeit auf ihren Han-<br />
25)<br />
delsfahrten gewöhnlich mitgeführt.<br />
Auch Münzf<strong>und</strong>e sind Hinweise auf Handel <strong>und</strong> Verkehr: Münzen tauchen<br />
<strong>im</strong>mer dort auf, wo eine über den reinen Tauschhandel hinauswachsende,<br />
weiträumiger <strong>und</strong> differenzierter werdende Wirtschaft einen allgemein<br />
26)<br />
anerkannten, gr<strong>und</strong>legenden Wertmesser benötigte. Aus einer kaiserlichen<br />
Bestätigungsurk<strong>und</strong>e aus dem Jahr 888 kann geschlossen werden, dass<br />
Hamburg auch das Prägerecht für Münzen hatte (Monumenta MGH. DD.<br />
Germ. Karol. 3). Leider können die frühen hamburgischen Münzprägungen<br />
(vom späten 9. bis 11. Jahrh<strong>und</strong>ert) nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.<br />
Es gibt zwar einzelne Prägungen, die sowohl den Erzbischöfen von Hamburg/Bremen<br />
als auch den Herzögen von Sachsen zugeschrieben werden,<br />
doch diese Zuweisungen entbehren der notwendigen sicheren Gr<strong>und</strong>lage.<br />
Zweifelsfrei sind hingegen zwei Münzf<strong>und</strong>e aus den Domplatzgrabungen<br />
27)<br />
1980 bis 1987. Es handelt sich dabei um je eine Münze aus Alt <strong>Lübeck</strong> (1093-<br />
1127) <strong>und</strong> aus Bardowick (1100-1120). R. Schindler berichtet über die Auffindung<br />
von zwei weiteren Silbermünzen mit vermutlich zutreffender Zeit-<br />
stellung, die bereits früher auf hamburgischem Stadtgebiet zum Vorschein<br />
28)<br />
gekommen sind. So gibt es auch in der Hamburger Münzgeschichte Hinweise<br />
auf einen Fernhandel in frühgeschichtlicher Zeit.<br />
40
Hamburg war Ausgangs- <strong>und</strong> Endpunkt mehrerer frühgeschichtlicher<br />
29)<br />
Landwege. Westlich des beschriebenen frühgeschichtlichen Siedlungsareals<br />
befand sich an der in die Elbe mündenden Alster eine Furt, deren Lage sich<br />
aus dem Geländerelief ergibt. Hier erreichte ein bekannter von Norden<br />
kommender Fernweg (Abb. 2, 8) das Hamburger Gebiet. Dieser alte Heerweg,<br />
später auch als „Ochsenweg“ bekannt, führte über die gesamte C<strong>im</strong>brische<br />
Halbinsel <strong>und</strong> wurde bereits um 1070 von Adam von Bremen beschrieben.<br />
Von der Alsterfurt aus lässt sich die Wegetrasse auf höher gelegenem Gelände<br />
30)<br />
in Richtung Osten weiter verfolgen. Sie führte zunächst zum nördlichen<br />
Bereich der beschriebenen Marktsiedlung. Eine Überwachung des <strong>Fernwege</strong>s<br />
von der Hammaburg aus war jedenfalls gut möglich. Der in einem späteren<br />
Abschnitt noch behandelte Fernweg, von der Ostsee bzw. Travemündung<br />
ausgehend <strong>und</strong> zur Elbe führend (Abb. 2, 3), erreichte hier die Marktsiedlung.<br />
In Hamburg gab es sicherlich einen Elbübergang, doch wird dieser auf Gr<strong>und</strong><br />
der schwierigen hydromorphologischen Situation zumeist für den<br />
31)<br />
Fernverkehr als unbedeutend eingestuft. Offenk<strong>und</strong>ig ist, dass die wichtige<br />
zentrale Wegetrasse der frühen Stadt Hamburg als sogenannte Elbuferstraße<br />
(Abb. 2, 4) stromaufwärts <strong>und</strong> dann über den von der Natur begünstigten<br />
32)<br />
Elbübergang bei Artlenburg nach Lüneburg führte. Zunächst erreichte der<br />
Weg jedoch <strong>im</strong> heutigen Stadtteil Billstedt die Schiffbeker Burg. Sie lag am<br />
Steilufer der Bille, die weiter abwärts in die Elbe mündet. Historisch ist die<br />
Burg ab 1201 nachgewiesen; doch sie könnte auch älter sein. Die 1880 bei<br />
Ausgrabungen aufgef<strong>und</strong>enen Gefäßscherben hat man damals zeitlich in die<br />
33)<br />
Übergangszeit vom Früh- zum Hochmittelalter eingeordnet. Leider ist die<br />
Keramik heute nicht mehr auffindbar. Die Befestigung wird in der älteren<br />
Literatur als Bollwerk gegen die aus der Billeniederung vordringenden<br />
34)<br />
Slawen bzw. als Zufluchtsort angesprochen. Zweifellos diente die Wehranlage<br />
Schiffbek auch der Wegesicherung, denn hier verzweigte sich der<br />
Fernweg.<br />
Wie schon erwähnt, führte die wichtige <strong>Fernwege</strong>trasse (Abb. 2, 4) am nördlichen<br />
Elbufer entlang zum Elbübergang bei Artlenburg, der von der Erthene-<br />
35)<br />
burg gesichert war. Bekannt ist dieser Fernweg als Elbuferstraße. Die<br />
Elbquerung steht in einem direkten Zusammenhang mit dem nahen Ort<br />
Bardowick, der bereits 805 in den fränkischen Analen als Kontrollstation<br />
7)<br />
erwähnt wird. Karl der Große wollte hier, wie auch an einigen anderen<br />
Plätzen, die Waffenausfuhren aus dem Frankenreich in die slawischen Länder<br />
unterbinden. Die beschriebene Elbuferstraße wurde bis ins späte Mittelalter<br />
genutzt <strong>und</strong> noch <strong>im</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert war sie die wichtigste Verkehrsverbindung<br />
von Hamburg nach Lüneburg.<br />
Der hier behandelte durch Südstormarn führende Fernweg von Hamburg<br />
nach Mecklenburg (Abb. 2, 2) schwenkte von der Elbuferstraße bei der<br />
Schiffbeker Burg in nordöstlicher Richtung ab <strong>und</strong> verlief fast geradlinig<br />
41
zum Gebiet südlich des Ratzeburger Sees. Mit einigen Abweichungen folgt die<br />
hier beschriebene Trassenführung den Ausführungen von K. Kersten: Der<br />
36)<br />
Heerweg von Hamburg nach Ratzeburg. Wie bereits einleitend erwähnt,<br />
beschreibt der Chronist Adam von Bremen um 1070 einen offenbar stark<br />
genutzten Weg von „Hammaburg nach Jumne“, dem wahrscheinlichen<br />
späteren Wolin an der heutigen polnischen Ostseeküste. Die angegebene<br />
kurze Reisezeit von sieben Tagen berechtigt zu der Annahme, dass dabei das<br />
stormarnsche/lauenburgische Gebiet ohne Umwege durchquert wurde. Die<br />
heute noch als alter Heerweg bezeichnete Fernwegtrasse erreichte zunächst<br />
37)<br />
die Gegend der heutigen Stadt Glinde.<br />
Unweit östlich von Glinde befand sich in frühgeschichtlicher Zeit der<br />
Westrand eines großen Waldgebietes, das wahrscheinlich um die Mitte des 1.<br />
Jahrtausends weitgehend geschlossen war <strong>und</strong> von der Elbe bis zur Ostsee<br />
reichte. Die Bedeckung bestand aus Wald, Bruchwald, Moor <strong>und</strong> Heide.<br />
Dieses „Urwaldgebiet“ war kaum besiedelt <strong>und</strong> erstreckte sich hier nach<br />
38)<br />
Osten bis in die Gegend des heutigen Dorfes Nusse.<br />
Im Zuge des hier behandelten Wegeverlaufs treffen wir vor Glinde erstmals<br />
auf die Thematik der sogenannten Grabhügelwege. In der „Vorgeschichte<br />
des <strong>Kreis</strong>es <strong>Stormarn</strong>“ behandelt <strong>und</strong> kartiert H. Hingst die Grabhügel der<br />
Bronzezeit <strong>und</strong> auch unbest<strong>im</strong>mter Zeit des <strong>Kreis</strong>es <strong>und</strong> ebensolche <strong>im</strong><br />
Westteil des <strong>Kreis</strong>es Herzogtum Lauenburg. Deutlich erkennbar sind mehrere<br />
auffällige Anordnungen von Grabhügeln bzw. Grabhügelgruppen, die fast<br />
39)<br />
wie eine Kette nebeneinander liegen. Diese Hügelreihen aus vorgeschichtlicher<br />
Zeit werden oft mit zeitgleichen Wegeführungen in Verbindung<br />
gebracht. Eine weitere Nutzung bis ins Mittelalter hinein <strong>und</strong> auch in späterer<br />
Zeit ist durchaus möglich (Wegekontinuität). So können die Hügelreihen bei<br />
der Rekonstruktion von Altwegen als Wegeleitlinien sehr hilfreich sein.<br />
Nach dem heutigen Stand der Forschung existierte in unserer Region ab dem<br />
zweiten vorchristlichen Jahrtausend zwar ein entwickeltes, hochwertiges<br />
Bronzehandwerk, jedoch waren keinerlei einhe<strong>im</strong>ische natürliche Ressourcen<br />
vorhanden. Die Beschaffung der nötigen Rohstoffe Kupfer <strong>und</strong> Zinn bedingte<br />
gute Verbindungen mit den entsprechenden Lagerstätten. Diese gab es in<br />
Mittel- <strong>und</strong> Süddeutschland sowie vornehmlich <strong>im</strong> ostalpinen <strong>und</strong><br />
karpatenländischen <strong>Raum</strong>. Angesichts des Wertes <strong>und</strong> des Umfangs der<br />
umgeschlagenen „Waren“ muss bereits ein tragfähiges Wegenetz bestanden<br />
haben. Dabei erweist sich zumindest für das Gebiet nördlich der Elbe der<br />
40)<br />
Landtransport als günstigste Anbindungsmöglichkeit des Fernhandels.<br />
Vielfach wurde beobachtet, dass in Nordeuropa bereits <strong>im</strong> Neolithikum <strong>und</strong><br />
insbesondere in der Bronzezeit alte Wegetrassen häufig entlang von Reihen<br />
41)<br />
nachgewiesener Grabmonumente führen. Vor etwa 100 Jahren erkannte <strong>und</strong><br />
beschrieb der damalige dänische Reichsantiquar Sophus Müller erstmals<br />
42
diesen Zusammenhang. Ein Großteil seiner Beobachtungen haben sich<br />
bestätigt, doch seine Vermutung, dass „die Besiedlung vom Weg geschaffen“<br />
werde, erwies sich als Spekulation. Eher begründen naturräumliche -<br />
insbesondere geomorphologische <strong>und</strong> topographische - Voraussetzungen<br />
einen in Sequenzen abgelaufenen Siedlungsprozess, der sich in der linearen<br />
42)<br />
Anordnung der Grabhügel widerspiegelt. Die Grabhügel <strong>und</strong> Grabhügelgruppen<br />
liegen zumeist etwas weiter von den Niederungen entfernt <strong>und</strong> sind<br />
mit Vorzug auf Erhebungen <strong>und</strong> Geländewellen angelegt. Ähnliche naturräumliche<br />
Voraussetzungen treffen auch für den Verlauf der alten Wegetrassen<br />
zu, <strong>und</strong> so kommt es vermutlich zu dem beobachteten Phänomen der<br />
Grabhügelwege. Plausibel ist, dass die weithin sichtbaren oft recht hohen<br />
Hügel den Handelsleuten auch zur Orientierung gedient haben. So können<br />
Grabhügelketten durchaus Indizien für alte Wegeführungen sein, zwingend<br />
43)<br />
lässt sich aber nicht auf solche schließen.<br />
Wie bereits angedeutet, lag der hier behandelte Fernweg bereits vor Glinde<br />
<strong>im</strong> Bereich einer ausgeprägten Grabhügelkette, die sich mit über 160<br />
44)<br />
registrierten Hügeln in östlicher Richtung erstreckte. Ab Glinde führte die<br />
Wegetrasse, <strong>im</strong> funktionellen Zusammenhang mit der Hügelkette, südlich<br />
von der heutigen Landstraße weiter nach Ohe. Dies kann man auch einer<br />
Anmerkung in der Archäologischen Landesaufnahme entnehmen: Der<br />
beiderseits von Grabhügeln begleitete Westteil des Weges von Glinde nach Ohe wurde<br />
45)<br />
früher als Totenweg bezeichnet. Die Hügelreihen können weiter bis in die<br />
Gegend von Witzhave verfolgt werden. Bereits vorher erreichen sie den<br />
Uferbereich der Bille. Von dem diese Hügel begleitenden Fernweg dürfte in<br />
der Nähe der heutigen „Doktorbrücke“ eine Abzweigung in den Sachsenwald<br />
(Abb. 2) bestanden haben. In diesem größten geschlossenen Waldgebiet<br />
Die alte Billefurt bei Witzhave<br />
43
Schleswig-Holsteins befinden sich außer zahlreichen aus der Steinzeit<br />
46)<br />
stammenden Grabmonumenten über 650 Grabhügel. Mit Sicherheit war<br />
dieser große Siedlungskomplex an den Fernweg angeb<strong>und</strong>en. Die Querung<br />
des Billeflusses erfolgte wahrscheinlich über eine noch heute erkennbare Furt<br />
47)<br />
in der Nähe der genannten Doktorbrücke.<br />
Die Trasse führte nun eine längere Strecke weiter flussaufwärts, am<br />
westlichen Billehochufer entlang. Während sich der Wasserlauf bisher tief ins<br />
Gelände eingeschnitten hatte, ändert sich ab Grande die geographische<br />
Situation: In ihrem Oberlauf, vom Quellgebiet bis nach Grande, fließt die Bille<br />
durch breite <strong>und</strong> meist feuchte Niederungsgebiete. Deutlich erkennbar<br />
schwenkte die Wegetrasse vor Grande in nördlicher Richtung zu der höher<br />
gelegenen sandigen Ebene „Grander Heide“ ab. In einem langgestreckten<br />
Bogen querte der Weg die Ebene <strong>und</strong> näherte sich bei der heutigen Gemeinde<br />
48)<br />
Trittau wieder dem Billefluss. Im Uferbereich der Bille führte der Fernweg<br />
nun weiter stromaufwärts. Für die Trasse waren die erhöhten flachen Uferbereiche<br />
sehr gut geeignet <strong>und</strong> nach der Topographischen Karte von 1881 gab<br />
es hier einen durchgehenden Fahrweg. Noch heute wird er zum Teil als<br />
landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg genutzt. Vermutlich konnte die große<br />
waldbestandene Moränenlandschaft der nördlich gelegenen Hahnheide in<br />
frühgeschichtlicher Zeit nicht von einem Weg durchquert werden. Mit der<br />
hier angenommenen Wegeführung entlang des Oberlaufs der Bille wurde<br />
somit dieses Waldgebiet umgangen. Die Hahnheide war noch <strong>im</strong> späten<br />
Mittelalter räumlich mit dem Sachsenwald verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> gehörte zu dem<br />
bereits beschriebenen „Urwaldgebiet“.<br />
Das Quellgebiet der Bille wird allgemein <strong>im</strong> Linauer Moor lokalisiert. An seinem<br />
südlichen Rand befindet sich der heutige Ortsteil Billbaum. Diese Stelle<br />
wird als „Bilenispring“ in der L<strong>im</strong>esbeschreibung Adams von Bremen um<br />
1070 angeführt. Sie war also schon in frühgeschichtlicher Zeit ein markanter<br />
Geländepunkt. Hier überschreitet der Fernweg den bereits erwähnten „L<strong>im</strong>es<br />
saxoniae“, die bekannte Gebietsabgrenzung zwischen den fränkischen<br />
49)<br />
Sachsengauen <strong>und</strong> den slawischen Obodriten. Zur Querung des Billetales<br />
bestand hier, zwischen Moor <strong>und</strong> dem erst schwach ausgeprägten Billefluss,<br />
eine geographisch günstige Vorraussetzung. An dieser Stelle verlässt der<br />
Fernweg <strong>Stormarn</strong> <strong>und</strong> führt durch das Gebiet des <strong>Kreis</strong>es Herzogtum<br />
Lauenburg weiter zur Mecklenburger Landesgrenze.<br />
Zunächst verlief der Fernweg vermutlich weiter über das erhöhte Gelände<br />
50)<br />
nördlich vom heutigen Dorf Koberg, am unübersehbaren „Hohen Koberg“<br />
vorbei zum östlichen Ortsrand von Nusse (Furt) <strong>und</strong> dann weiter nach<br />
Panten. Panten war sicherlich ein Ort an der Fernstraße, denn der Ortsname<br />
wird von der urslawischen Bezeichnung „pot´b“ für „Weg, Bahn, Reise,<br />
51)<br />
Fahrt“ abgeleitet. Eine Weiterführung des Weges durch die Stecknitzniederung<br />
direkt östlich von Panten, also bei der heutigen Donnerschleuse in<br />
44
52)<br />
Richtung Ratzeburg, kann man ausschließen. Hier war die breite feuchte<br />
Stecknitzniederung nur schwer passierbar <strong>und</strong> eine Straßenführung nach<br />
Osten wird erst 1621 nachgewiesen. Die frühgeschichtliche Straße musste<br />
daher bei Panten nach Süden schwenken <strong>und</strong> erreichte über einen<br />
langgestreckten Sandrücken den slawischen Siedlungskomplex Hammer.<br />
Es vereinigte sich hier der Weg mit der von Süden bzw. vom<br />
sächsisch/fränkischen Handelsort Bardowick kommenden Fernstraße<br />
53)<br />
(Abb. 2, 1). Die gemeinsame Trasse überquerte den Stecknitzfluss (Furt),<br />
führte weiter nach Osten, <strong>und</strong> in der Gegend nördlich von Mölln trennten<br />
sich die beiden Wege wieder. Der Fernweg nach Mecklenburg erreichte<br />
zunächst den <strong>Raum</strong> Schmilau. Zwischen dem Ratzeburger See <strong>und</strong> dem<br />
Holtkoppel- bzw. Königsmoor südlich von Schmilau befindet sich eine<br />
schmale Landbrücke, die sich für eine Wegeführung in dem sonst nassen<br />
54)<br />
Gelände gut eignet. An dieser verkehrstechnisch günstigen Stelle wurden<br />
<strong>im</strong> Jahre 1093 während eines Aufstandes kampfstarke Heeresverbände<br />
mehrerer östlicher Slawenstämme zusammengezogen, <strong>und</strong> es kam hier zur<br />
55)<br />
bekannten Schlacht bei Schmilau.<br />
Im weiteren Verlauf nach Osten wird 1447 <strong>im</strong> Eckhorster Forst bei Kittlitz die<br />
Trasse als Heerweg erwähnt, <strong>und</strong> die bei Dutzow am Nordufer des<br />
Schaalsees vorhandenen stark ausgeprägten Straßendämme werden bereits<br />
56)<br />
1352 bezeugt. Der Fernweg (Abb. 2, 2) führte dann weiter zur obodritischen<br />
Hauptburg Mecklenburg. In deren Nähe an der Wismarbucht befand sich<br />
der bedeutende Handelsplatz Reric, der bereits <strong>im</strong> Jahre 808 schriftlich<br />
57)<br />
erwähnt wird. Er konnte über den hier beschriebenen Fernweg gut erreicht<br />
werden.<br />
An dieser Stelle soll auch die wichtige Verkehrsanbindung zur <strong>Lübeck</strong>er<br />
Bucht bzw. zur Travemündung besonders erwähnt werden. Wie oben<br />
angeführt, trennten sich die beiden <strong>Fernwege</strong> (Abb. 2, 1 <strong>und</strong> 2, 2) nördlich<br />
von Mölln. Hier befand sich ein größerer Wegeknoten, denn auch ein<br />
weiterer von Süden kommender Fernweg (Abb. 2, 5), der „Boizenburger<br />
58)<br />
Frachtweg“, stieß hinzu. An der „Fredeburg“ genannten Stelle wurde <strong>im</strong><br />
späten Mittelalter ein Wehrturm <strong>und</strong> eine Zollstelle errichtet. Von Fredeburg<br />
aus führte der Süd-Nord-Weg zum Steilufer des Ratzeburger Sees. Hier bei<br />
Einhaus wurde 1066 Ansverus, der Abt des Benediktinerklosters St. Georg,<br />
59)<br />
während eines Slawenaufstandes gesteinigt. Zum Gedenken an diesen<br />
Martertod errichtete man an dieser Stelle <strong>im</strong> späten Mittelalter ein Marterkreuz.<br />
Unweit davon führen mehrere alte Hohlwegspuren zum Seeufer<br />
hinab. Sie markieren die weitere Trassenführung des Weges, der dann be<strong>im</strong><br />
heutigen Ort Pogeez wiederum Geländespuren hinterlassen hat. Noch vor<br />
50 Jahren befanden sich hier die Reste eines Bohlendammes <strong>und</strong> am<br />
nördlichen Ortsrand ausgeprägte Wegerinnen, die nach K. Kersten wohl von<br />
60)<br />
dem frühgeschichtlichen Weg stammten. Darauf weist auch der slawische<br />
45
Abb.3: <strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong> <strong>und</strong> Topographie in der Umgebung von<br />
Alt- <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> der Stadthalbinsel <strong>Lübeck</strong><br />
(Nach Neugebauer 1975, geändert)<br />
46
Dorfname Pogeez hin: Er wird gedeutet als der Platz „am Faschinenweg,<br />
61)<br />
be<strong>im</strong> Damm“. Weiter nördlich, be<strong>im</strong> heutigen Ort Groß Grönau, dürfte<br />
eine Stichstraße zur 5 km (Luftlinie) entfernten frühslawischen Burg<br />
Klempau geführt haben: Über einen hügeligen Höhenzug in westlicher<br />
Richtung gelangt man zum Nordrand des Klempauer Moores, wo <strong>im</strong><br />
Sommer 2001 ein sehr gut erhaltener Bohlenweg freigelegt wurde. Die<br />
untersuchten Bauhölzer stammen aus den Jahren 760 bis um 877 (Dendro-<br />
daten) <strong>und</strong> die Richtung des Bohlenweges weist genau zum 400 m entfernten<br />
62)<br />
Platz der abgetragenen Ringwallburg Klempau. Bekanntlich befanden sich<br />
die altslawischen Burgen meist in Schutzlagen in einiger Entfernung von den<br />
63)<br />
<strong>Fernwege</strong>n <strong>und</strong> waren über kleinere (Stich-) Wege zu erreichen. Der<br />
Fernweg (Abb. 2, 1) erreichte be<strong>im</strong> Ort Groß Grönau das Gebiet der heutigen<br />
Hansestadt <strong>Lübeck</strong>.<br />
Die frühgeschichtlichen <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong><br />
Bereits in frühgeschichtlicher Zeit entwickelte sich der <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong> zu<br />
einem Mittelpunkt des überregionalen Verkehrs. Es vereinigten sich hier<br />
sternförmig mehrere bedeutende <strong>Fernwege</strong>.<br />
Der wichtige <strong>und</strong> bereits <strong>im</strong> Jahr 805 belegte Handelsweg aus dem<br />
Frankenreich (Abb. 2, 1) erreichte vom Süden kommend den <strong>Lübeck</strong>er<br />
64)<br />
Stadthügel, also die heutige Innenstadt. Die von Trave <strong>und</strong> Wakenitz<br />
umflossene Halbinsel (Abb. 3) war in slawischer Zeit zum größten Teil von<br />
65)<br />
sumpfigen, überfluteten Niederungen umgeben. Lediglich <strong>im</strong> Süden bzw.<br />
<strong>im</strong> Bereich des späteren Mühlentores (Abb. 3, 1) war festeres <strong>und</strong><br />
hochwasserfreies Gelände beiderseits der Wakenitz vorhanden. Hier querte<br />
die Wegetrasse den Fluss mittels einer Furt, die bereits 1159 durch eine<br />
66)<br />
Brücke abgelöst wurde. Schwach ansteigend führte der Weg empor zum<br />
Kamm des Hügels <strong>und</strong> verlief auf diesem in nördlicher Richtung weiter.<br />
In slawischer Zeit gab es möglicherweise <strong>im</strong> zentralen Bereich des Stadthügels<br />
eine westlich gerichtete Stichstraße hinab zum Traveufer. Hier könnte<br />
eine frühe Schiffsanlegestelle gelegen haben. Nach einer Textstelle in der<br />
Helmoldchronik hat Graf Adolf II bei der ersten Stadtgründung 1143 einen<br />
67)<br />
„trefflichen Hafen“ vorgef<strong>und</strong>en. Als Platz für diese potenzielle Vorgängeranlage<br />
des <strong>Lübeck</strong>er Hafens käme der Hügelsporn zwischen der heutigen<br />
Alf- <strong>und</strong> Fischstraße in Frage (Abb. 3, 2). Archäologisch gesichert ist sie<br />
jedoch nicht, denn der Hafen der Gründungssiedlung wurde noch nicht<br />
ergraben. Auch eine besondere Häufung von spätslawischer Keramik ist in<br />
diesem Bereich nicht zu erkennen. Die breite, sumpfige <strong>und</strong> bei Hochwasser<br />
überflutete Niederungszone am Traveufer erlaubte wohl kaum eine Querung<br />
des Flusses mittels einer Furt. Allerdings dürfte es in slawischer Zeit<br />
doch eine Verbindung von der Halbinsel zum westlichen Siedlungsraum der<br />
Wagrier gegeben haben. Man vermutet eine Fähre (Abb. 3, 3) in der Nähe des<br />
47
esiedelten Gebietes <strong>im</strong> Norden der Halbinsel. Hier am Traveufer sind als<br />
Straßennamen eine „Große“ <strong>und</strong> „Kleine Altefähre“ überliefert. Eine datierende<br />
Erwähnung liegt erst für 1283 vor <strong>und</strong> der Zusatz „Alt“ kann<br />
bedeuten, dass die Fähre <strong>im</strong> späten 13. Jahrh<strong>und</strong>ert bereits nicht mehr be-<br />
68)<br />
stand. Die Anlegestelle der Fährschiffe dürfte am schräg gegenüber liegenden<br />
Mündungstrichter des ehemaligen Struckbaches gelegen haben.<br />
Wie bereits erwähnt, führte die frühgeschichtliche Trasse auf dem Scheitel<br />
des Geländekamms nach Norden <strong>und</strong> erreichte den slawischen Burg- <strong>und</strong><br />
Siedlungsbereich Buku (Abb. 3, 4). Hier gibt es mehrere Hinweise auf eine<br />
frühgeschichtliche Wegeführung. Der enge Landzugang zwischen Trave <strong>und</strong><br />
Wakenitz wurde bereits in der römischen Kaiserzeit, also während der ersten<br />
69)<br />
Jahrh<strong>und</strong>erte nach Christi Geburt, durch eine Befestigungsanlage geschützt.<br />
Auch die eingewanderten Slawen erkannten diese strategisch wichtige Stelle<br />
70)<br />
<strong>und</strong> errichteten hier gleichfalls eine Burg. Der Keramikauswertung nach bestand<br />
diese während der früh- <strong>und</strong> mittelslawischen Zeit (8. bis 10. Jahrh<strong>und</strong>ert).<br />
Die Anlage kontrollierte sicherlich die oben erwähnte Fähre, wie auch<br />
den Fernweg, der unmittelbar am Rand des Burgwalles vorbeiführte.<br />
Den Archäologen ist vor kurzem die Aufdeckung eines ungewöhnlichen<br />
Bef<strong>und</strong>es gelungen. Bei Grabungsarbeiten <strong>im</strong> Bereich der östlich der Burg<br />
befindlichen slawischen Siedlung konnte ein Teilstück der hochmittelalterlichen<br />
Wegetrasse nachgewiesen werden. Die Wegespur mit gut erkennbaren<br />
Fahrrinnen wird in die 2. Hälfte des 12. Jahrh<strong>und</strong>erts datiert, also in die<br />
Zeit unmittelbar nach der slawischen Siedlungsperiode. Derartige Bef<strong>und</strong>e<br />
dieser frühen Zeitstellung sind <strong>im</strong> ganzen norddeutschen <strong>Raum</strong> nicht<br />
71)<br />
belegt. Um das Jahr 1875 wurde bei Umlagerungen von Erdmaterial <strong>im</strong><br />
Umfeld der Burg ein bedeutender (Silber-) Hort gef<strong>und</strong>en. Die genaue Lage<br />
sowie der „Behälter“ des F<strong>und</strong>es, die vielleicht einiges über die Herkunft<br />
hätten aussagen können, sind nicht bekannt. Doch eine sichere Zeitstellung ist<br />
möglich: Der F<strong>und</strong> enthielt neben wenigen Edelmetallobjekten mehr als 2770<br />
72)<br />
Münzen, mit Schlussmünze 1046-1056. Die hortenden Personen könnten<br />
Fernhändler oder auch am Handel beteiligte einhe<strong>im</strong>ische slawische Kaufleute<br />
gewesen sein.<br />
Über die früher nur 200 m schmale Landbrücke zwischen Trave <strong>und</strong> Wakenitz<br />
führte der Fernweg weiter nach Norden. Noch in der Nähe der Landbrücke<br />
vereinigte sich die Trasse mit einem Fernweg, der aus Richtung Osten <strong>und</strong><br />
den dort befindlichen slawischen Burg- <strong>und</strong> Siedlungszentren Mecklenburg<br />
<strong>und</strong> Schwerin kam (Abb. 2, 6). Die weiterführende Wegetrasse, auch hier auf<br />
dem Scheitel eines schwachen Höhenrückens liegend, erreichte wiederum<br />
den Travefluss. Hier befand sich an einer alten Flussschleife der<br />
Siedlungsraum der Burg Alt <strong>Lübeck</strong>. Umfangreiche neuzeitliche Flussbegradigungen<br />
(1. Durchstich 1882) haben hier das Vorburggelände stark<br />
48
verändert. Im ausgebaggerten Travebett lag seit dem frühen 12. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
eine Vorburgsiedlung mit einem ausgebauten Hafen für seegängige Schiffe<br />
(Abb. 3, 5). Sie war von Fernhandelskaufleuten bewohnt, die auch eine eigene<br />
Kirche errichteten. Be<strong>im</strong> Travedurchstich <strong>im</strong> Jahre 1882 kamen ausgedehnte<br />
Pfahlreihen, Hausreste sowie ein Körpergrab zum Vorschein. Auch wurden<br />
die Bruchstücke einer bronzenen Waagschale <strong>und</strong> zahlreiche spätslawische<br />
Keramikscherben aufgef<strong>und</strong>en. Die Travequerung erfolgte mittels einer Fähre<br />
73)<br />
oder Brücke.<br />
Jenseits des Traveflusses, auf einem Geländesporn zwischen Trave <strong>und</strong><br />
Schwartau, befand sich die slawische Burganlage Alt <strong>Lübeck</strong> mit einer<br />
mächtigen, in Teilen heute noch erhaltenen, Wallumr<strong>und</strong>ung (Abb. 3, 6).<br />
Durch umfangreiche Grabungen – zuletzt <strong>im</strong> Jahre 1999 – wurden auf dem<br />
Geländesporn zwei weitere Vorburgsiedlungen <strong>und</strong> innerhalb des Walles eine<br />
in Holz <strong>und</strong> später in Stein errichtete Kirche aufgedeckt. Alt <strong>Lübeck</strong> spielte<br />
insbesondere bei der Christianisierung der Slawen <strong>im</strong> 11. <strong>und</strong> 12. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
<strong>und</strong> als zeitweiliger Hauptort der Obodriten eine besondere Rolle. Aufgr<strong>und</strong><br />
der Schriftquellen <strong>und</strong> der vielen ergrabenen F<strong>und</strong>e lassen sich in Alt <strong>Lübeck</strong><br />
drei Nutzungsphasen unterscheiden:<br />
- Die erste Wallanlage wurde den Dendrodaten zufolge 817-819 errichtet. Dass<br />
in dieser frühen Phase in Alt <strong>Lübeck</strong> bereits ein Fernhandel stattfand, zeigen<br />
einige Importstücke: Eine Kleeblattfibel aus dem wikingischen Norden <strong>und</strong><br />
– aus dem Westen stammende – Scherben einer Tatinger Kanne <strong>und</strong> eines<br />
muschelgrusgemagerten Kugeltopfes. Die erste Alt <strong>Lübeck</strong>er Burg fand ihr<br />
Ende <strong>im</strong> fortgeschrittenen 9. Jahrh<strong>und</strong>ert; die Hintergründe dazu sind nicht<br />
geklärt.<br />
- Die nächste Ausbaustufe erlebte Alt <strong>Lübeck</strong> unter der Herrschaft des bereits<br />
christlichen Fürsten Gottschalk (1043–1066). Es setzte eine kontinuierliche<br />
bauliche Erweiterung ein, die zur Entwicklung eines großen Siedlungskomplexes<br />
führte. Unter Gottschalk wurde ab 1055 der alte Erdwall<br />
durch eine gewaltige vorgelagerte Holzkonstruktion auf die doppelte Größe<br />
verstärkt. Ein für diese Zeit schriftlich überliefertes Kloster konnte<br />
archäologisch noch nicht erfasst werden. Jedoch ergaben die Ausgrabungen,<br />
dass mit dem Bau eines tunnelartigen Tores <strong>im</strong> südlichen Teil<br />
des Walles <strong>und</strong> eines bohlenbelegten Torweges eben dahin eine Umorientierung<br />
der gesamten Burganlage zur Trave hin erfolgte. Damit deutete<br />
sich bereits eine verstärkte bauliche Berücksichtigung zugunsten von Handel<br />
<strong>und</strong> Verkehr an. Die zwischen 1066 <strong>und</strong> 1093 liegende heidnisch geprägte<br />
Herrschaftsphase unter Cruto hatte keine größeren Einflüsse auf das<br />
Siedlungsgeschehen <strong>und</strong> kann hier übergangen werden.<br />
- Während der nachfolgenden dritten Ausbaustufe ab 1093 regierte der<br />
Slawenkönig Heinrich (1093-1127), ein Sohn des bereits erwähnten Fürsten<br />
Gottschalk. Er unterhielt friedliche Beziehungen zu den benachbarten<br />
49
deutschen Fürsten sowie zu Dänemark. Unter ihm entwickelte sich Alt<br />
<strong>Lübeck</strong> zum bedeutendsten Hafenort des Obodritenreiches. Baulich kann<br />
man bereits von einem frühstädtischen Komplex sprechen, der aus zwei<br />
Vorburgsiedlungen, einem Hafen <strong>und</strong> der schon behandelten südlich<br />
angrenzenden Kaufleutesiedlung bestand. In der Burg haben Grabungen<br />
zwei aufeinanderfolgende Kirchbauten aufgedeckt; die erste aus Holz <strong>und</strong><br />
die spätere in Steinbauweise. Im südlichen Suburbium, beiderseits des<br />
Burgtores, haben ab den 90er Jahren des 11. Jahrh<strong>und</strong>erts Handwerker<br />
gelebt <strong>und</strong> in unterschiedlichen Gewerben gearbeitet. Die hier <strong>und</strong> in der<br />
Burg geborgenen F<strong>und</strong>e weisen auf einen vielfältigen Fernhandel hin:<br />
Perlen aus Glas, Bergkristall <strong>und</strong> Karneol belegen die Kontakte zu<br />
asiatischen Ländern. Aus Skandinavien stammen Runenknochen <strong>und</strong> ein<br />
Speckstein mit Runenzeichen sowie Schiefer für Wetzsteine. Auf die<br />
Verbindungen zu den Westgebieten verweisen Münzen, Goldf<strong>und</strong>e <strong>und</strong><br />
74)<br />
Keramikgegenstände, nur um die wichtigsten zu nennen.<br />
Deutlich sichtbar wird in Alt <strong>Lübeck</strong> das Zusammentreffen günstiger <strong>und</strong><br />
wichtiger Faktoren:<br />
- Ein stattlicher Burgwall, auch als Sperre gegen Angriffe von See her.<br />
- Herrschersitz, auf den sich der Aufbau erster kirchlicher Institutionen<br />
stützte.<br />
- Zentrale Lage innerhalb des beherrschten Landes <strong>im</strong> Netz der Fernhandelswege.<br />
- Ostseehandelsplatz, an dem möglicherweise bereits Salzhandel betrieben<br />
75)<br />
wurde, mit institutionalisierter Anwesenheit fremder Kaufleute.<br />
Ein weiterer Verkehrsanschluss ist mit dem Fernweg in Richtung Norden<br />
gegeben. Vom Geländesporn der Alt <strong>Lübeck</strong>er Burg führte der Weg zunächst<br />
eine kurze Strecke in nordwestlicher Richtung. Im Bereich der heutigen Stadt<br />
Bad Schwartau schwenkte er dann nach Norden ab. Das Ziel des <strong>Fernwege</strong>s<br />
waren die slawische Burg Oldenburg (Starigard) <strong>und</strong> die Insel Fehmarn,<br />
jeweils mit Anschluss an den seegängigen Schiffsverkehr. Die mehrfach<br />
schriftlich erwähnte Burg Oldenburg (Abb. 1) entwickelte sich seit ihrer<br />
Gründung um 700 kontinuierlich zur bedeutenden Hauptburg der Wagrier,<br />
einem Teilstamm der Obodriten. Nachdem ihre Fürsten den christlichen<br />
Glauben angenommen hatten, wurde Oldenburg 972 zum Bischofssitz<br />
erhoben. Zahlreiches als Grabungsf<strong>und</strong>e gesichertes <strong>im</strong>portiertes Fremdgut,<br />
insbesondere Gegenstände der herrschaftlichen Hofkultur, belegen den<br />
76)<br />
Anschluss Oldenburgs an das früh- <strong>und</strong> hochmittelalterliche Verkehrsnetz.<br />
Von Alt <strong>Lübeck</strong> bzw. ab dem erwähnten Wegepunkt in Bad Schwartau<br />
führte eine wichtige Wegetrasse nach Süden (Abb. 2, 3). Schwierig dürfte die<br />
Passage zwischen dem Tremser Teich <strong>und</strong> den feuchten Travewiesen<br />
50
gewesen sein. Vermutlich gab es hier schon früh einen Wegedamm. Der Weg<br />
folgte zunächst der Richtung der heutigen Schwartauer Landstraße. Der<br />
ehemalige Struckbach wurde kurz vor seinem breiten Mündungstrichter<br />
(Abb. 3, 7) in die Trave überschritten.<br />
Hier schwenkte ein weiterer Fernweg zum Siedlungsbereich Segeberg <strong>und</strong> zu<br />
77)<br />
den nördlich gelegenen gleichfalls wagrischen Gebieten ab. Für das späte<br />
Mittelalter wird der Trassenverlauf über das Dorf Schönböken <strong>und</strong> dem<br />
78)<br />
Landwehrdurchlass be<strong>im</strong> Steinrader Baum angenommen. In Weiterführung<br />
über die Orte Eckhorst, Mönkhagen, Struckdorf nach Segeberg ist<br />
der Weg durch Nennungen ab dem 14. Jahrh<strong>und</strong>ert gut belegt. Im bekannten<br />
Danckwerth`schen Kartenwerk von 1652 verweisen allerdings mehrere Karten<br />
auf einen weiteren etwas südlicher verlaufenden Wegezug <strong>und</strong> damit auf<br />
eine Trassenführung durch den heutigen <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong>. Ebenfalls durch<br />
Karten des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts angeregt, befasste sich der Reinfelder He<strong>im</strong>atforscher<br />
M. Clasen mit dieser südlichen „Lübschen Trade“, einer alternativen<br />
möglicherweise älteren Verbindung der beiden frühen Städte <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong><br />
Segeberg. Er stützte sich bei seinen Untersuchungen auch auf slawische Orts-<br />
namen wie Heilshoop, Zarpen <strong>und</strong> Pöhls <strong>und</strong> gab zwei in Frage kommende<br />
79)<br />
Trassenführungen an. Bei den erwähnten Dankwerthschen Karten des hier<br />
behandelten Gebiets bemängelt G. Schrecker, dass die angegebenen südlichen<br />
Routen der einzelnen Karten nicht übereinst<strong>im</strong>men. Doch lehnt auch<br />
sie eine südliche Wegeführung nicht vollständig ab: Es wird ... nicht ausgeschlossen,<br />
dass es weiter südlich auch damals schon einen oder mehrere Wege gab,<br />
auf denen man von Segeberg nach <strong>Lübeck</strong> gelangte, zumal diese Richtung die<br />
geradeste Verbindungslinie ... darstellt. Und weiter führt sie an, dass das Ge-<br />
lände, unruhig <strong>im</strong> kleinen, aber ohne Moore, Seen oder versumpfte Auwiesen von<br />
80)<br />
großer Ausdehnung, gut für eine Wegeführung geeignet ist. Diese topographische<br />
Beschreibung – <strong>und</strong> das haben auch Überprüfungen vor Ort<br />
ergeben – trifft sehr gut auf folgende das Heilsaugebiet querende Trassenführung<br />
(Abb. 2, 7) zu: Steinrader Baum, Heckkaten, über eine erhaltene alte<br />
Wegestrecke nach Hauberg <strong>und</strong> Heilshoop, nördlich des unruhigen Geländes<br />
am Zarpener Wallberg weiter nach Pöhls, Herrenbranden <strong>und</strong> über Söhren<br />
zur nördlichen Wegeführung nach Bad Segeberg. Zwischen Heckkaten <strong>und</strong><br />
Herrenbranden wird das <strong>Stormarn</strong>`sche <strong>Kreis</strong>gebiet durchquert. Die hier beschriebene<br />
Trassenführung deckt sich in Teilen mit den Angaben von M.<br />
Clasen. So könnte es in <strong>Stormarn</strong> durchaus eine südlich gelegene „Lübsche<br />
Trade“ gegeben haben, die als ältere Wegeführung möglicherweise bereits in<br />
81)<br />
frühgeschichtlicher Zeit genutzt wurde.<br />
Oben beschrieben wurden die Verkehrsverbindungen nach Segeberg<br />
ausgehend vom Wegepunkt (Abb. 3, 7) am ehemaligen Struckbach. Hier ist<br />
auch der Ausgangspunkt des <strong>im</strong> nächsten Abschnitt beschriebenen Fernwegs<br />
von der Ostsee nach Hamburg, dessen Trasse zunächst nach Süden zielt<br />
51
(jetzige Schwartauer Allee). Den nötigen Abstand einhaltend führte sie am<br />
unpassierbaren Bereich der Traveniederung entlang <strong>und</strong> schwenkte in Höhe<br />
der späteren Holstenbrücke bzw. des Holstentores nach Südwesten ab (Abb.<br />
3, 8). Da die Brücke relativ spät - 1188 indirekt <strong>und</strong> 1216 durch erste Nennung<br />
- belegt ist, dürfte hier in frühgeschichtlicher Zeit noch keine Wegever-<br />
82)<br />
bindung zur Stadthalbinsel bestanden haben. Untermauert wird dies durch<br />
die Beobachtung, dass die vom Westen <strong>und</strong> Süden ankommenden alten We-<br />
ge, also auch der Oldesloer Weg, deutlich am Holstentor vorbeiführten <strong>und</strong><br />
83)<br />
ursprünglich nach Alt <strong>Lübeck</strong> an der Schwartaumündung zielten. Bei Bruns<br />
u. Weczerka wird die nun folgende Wegestrecke als die „ursprüngliche<br />
Straße“ nach Oldesloe beschrieben: Über die jetzige Hansestraße <strong>und</strong> in de-<br />
ren Verlängerung führte der Weg zunächst auf das Gut Buntekuh <strong>und</strong><br />
84)<br />
Hohenstiege zu. Die Verlängerung der Hansestraße wird dabei nur noch als<br />
„Fußsteig“ bezeichnet. Auch in der Karte von 1879 der Königlich Preußischen<br />
Landesaufnahme ist hier lediglich ein Fußweg eingezeichnet. Der Weg hat<br />
also in späterer Zeit an Bedeutung verloren. Erfreulicherweise kann man<br />
auch heute der alten Verkehrsader folgen <strong>und</strong> zwar auf einem Fuß- <strong>und</strong> Radweg,<br />
der in einer leichten Zickzacklinie durch ein intensiv bebautes Wohngebiet<br />
führt. So ist hier noch die Spur eines „ursprünglichen“ Weges erhalten,<br />
die möglicherweise von der frühgeschichtlichen Fernwegtrasse stammt.<br />
Vom Gut Buntekuh aus führte <strong>im</strong> späten Mittelalter die überaus bedeutende<br />
Handelsstraße südlich am Gut Padelügge (Hohenstiege) vorbei, kreuzte die<br />
Landwehr am Pluggenbome <strong>und</strong> verließ damit den <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong>. Sehr<br />
wahrscheinlich nahm auch die frühgeschichtliche Trasse diesen Weg.<br />
Der Fernweg von der Ostsee nach Hamburg<br />
Der von <strong>Lübeck</strong> nach Hamburg führende <strong>und</strong> in der späteren Geschichte<br />
äußerst wichtige Fernweg (Abb. 2, 3) kann für die frühmittelalterliche Zeit<br />
nicht direkt belegt werden. Doch aufgr<strong>und</strong> der karolingischen Geschichte<br />
Hamburgs, wie auch durch frühe Hinweise auf die Oldesloer Salzquellen ist<br />
eine Wegenutzung in frühgeschichtlicher Zeit durchaus anzunehmen. Dies<br />
trifft auch zu auf einen über Hamburg führenden Fernweg nach Bremen, der<br />
allerdings erst <strong>im</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert intensiver genutzt wurde, doch vereinzelt<br />
85)<br />
schon früher belegt ist. Die hier behandelte Fernwegtrasse war ab der Jahrtausendwende<br />
sicherlich ein wichtiger Kommunikationsstrang zwischen<br />
dem Missionszentrum Hamburg <strong>und</strong> dem slawischen Zentralort Alt <strong>Lübeck</strong>,<br />
insbesondere unter den deutschfre<strong>und</strong>lichen Herrschern Gottschalk (1043-<br />
1066) <strong>und</strong> Heinrich (1093-1127). Bekanntlich wurde unter letzterem eine<br />
bedeutende Kaufmannssiedlung mit einem für die Ostseeschifffahrt<br />
geeigneten Hafen eingerichtet. Im einleitenden Abschnitt dieses Beitrags<br />
wurde bereits erwähnt, dass Adam von Bremen um 1070 einen Fernweg von<br />
52
Hamburg nach Oldenburg, der „großen Stadt der Wagrier“, beschreibt. Als<br />
Reisezeit ist darin nur ein Tag angegeben. Diese kürzeste Verbindung der<br />
beiden Städte verlief sicherlich über <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> damit wird die frühe<br />
Nutzung der hier behandelten Wegeführung bestätigt.<br />
Von der Stadtgrenze <strong>Lübeck</strong>s bis zum <strong>Raum</strong> westlich von Oldesloe treffen wir<br />
erneut auf das weitgehend geschlossene Waldgebiet, das in frühgeschicht-<br />
86)<br />
licher Zeit von der Elbe bis zur Ostsee reichte. Auch in der Beschreibung der<br />
Völkergrenze „L<strong>im</strong>es saxoniae“ des Chronisten Adam von Bremen wird der<br />
87)<br />
Travewald erwähnt. Wie in Südstormarn <strong>im</strong> Billetal querte auch hier der<br />
frühgeschichtliche Fernweg die Waldzone <strong>im</strong> geographisch günstigen Bereich<br />
der Trave.<br />
Für die Wegeführung ab <strong>Lübeck</strong> wird hier als Abb. 4 die Nachzeichnung einer<br />
Karte aus dem Jahre 1689 vorgelegt, bei der die wegegünstige Trassenführung<br />
<strong>im</strong> Uferbereich der Trave deutlich zu erkennen ist. Nach dem<br />
Verlassen des <strong>Lübeck</strong>`schen Gebietes kam der Fernweg bei Hansfelde <strong>und</strong><br />
Hamberge [in Abb. 4: Amberge] sehr nahe an den Travelauf heran. Be<strong>im</strong> heu-<br />
tigen Ort Eckernschmiede [Ziegelhof] schwenkte er mit dem Flusslauf in<br />
88)<br />
südwestlicher Richtung ab. Er wich damit dem weiter westlich gelegenen<br />
unruhigen Gelände aus. Der weitere Wegeverlauf ist gut in der Königlich<br />
Preußischen Landesaufnahme von 1879 zu verfolgen. In Teilen wird der Weg<br />
noch heute von der Landwirtschaft genutzt. Die Wegeführung nutzte die<br />
guten natürlichen bzw. geographischen Voraussetzungen <strong>im</strong> Uferbereich der<br />
Trave <strong>und</strong> sie dürfte somit sehr alt sein. Von Eckernschmiede [Ziegelhof]<br />
führte der Fernweg nach Groß Wesenberg <strong>und</strong> auf einer höher gelegenen<br />
Moränenzunge weiter nach Lokfeld [Lockstede]. Anschließend musste<br />
Abb.4: Alte Wegeführung zwischen <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> Oldesloe<br />
(Nachzeichnung der Karte: Eigentdliche Abbildung eines Deihl<br />
Holsteins benebens dem Herzogtum Stormaren..., Kopenhagen 1689)<br />
53
er den hier unpassierbaren Uferbereich der Trave verlassen <strong>und</strong> nach Nord-<br />
89)<br />
westen schwenken. Im weiteren Verlauf näherte sich die Fernwegtrasse bei<br />
der Steinfelder Hude [Hude] wieder dem Traveufer. Noch vor dem bergigen<br />
Waldgebiet „Der Kneeden“ schwenkte sie erneut nach Nordwesten ab (Abb.<br />
90)<br />
6, a). Der Weg verlief nun mäßig ansteigend in einem idyllischen Wiesental<br />
weiter, in dem ein schwacher Wasserlauf, der Kneedenbach, ins Travetal<br />
fließt.<br />
Im Zusammenhang mit dem Kneedenbach konnte ein wichtiger Hinweis aus<br />
dem Bereich der Sprachforschung ermittelt werden: In der Stiftungsurk<strong>und</strong>e<br />
von 1189 des Reinfelder Klosters wird bei der Grenzfestlegung ein Bach<br />
genannt: „rivulum qui dicitur Knegena“ (Bächlein genannt Knegena). Es<br />
ist der heutige Kneedenbach, von der Sprachforschung als „Fluss der Fürstin“<br />
interpretiert (Knegyna ist die weibliche Form zu Kneze, der Fürst). Dieser<br />
Flussname ist <strong>im</strong> Slawischen noch weiter verbreitet. Im Historischen<br />
Ortsnamenlexikon Schleswig-Holstein wird unter dem Stichwort Knee-<br />
91)<br />
dener Au (bei Kneeden, Stadt Bad Oldesloe) kritisch angeführt: Es fragt sich<br />
aber, wie bei einem kleinen Flusslauf die Bedeutung „Fürstin“ zu verstehen ist.<br />
Die positive Antwort ergibt sich aus den in diesem Beitrag später noch<br />
Abb.5: Hohlwegfächer Kneeden<br />
(Fahrwegrinnen als Skizze eingezeichnet in: Deutsche Gr<strong>und</strong>karte,<br />
Poggensee-Ost, 2002)<br />
54
genauer geschilderten Zusammenhängen: Der hier behandelte Fernweg<br />
führte <strong>im</strong> weiteren Verlauf in den Bereich des Fresenburger Wallbergs (Abb.<br />
6, c). Diese Burg war der Mittelpunkt einer größeren slawischen Siedlungskammer<br />
<strong>und</strong> dementsprechend auch Sitz eines mächtigen Burgherren, eines<br />
Knesen (Fürsten).<br />
Abb.6: <strong>Frühgeschichtliche</strong> <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> Nordwesten des <strong>Kreis</strong>es <strong>Stormarn</strong><br />
(Grabhügelgruppen nach Hingst 1959, Abb. 7, geändert)<br />
55
Die Trasse des Fernwegs verlief <strong>im</strong> erwähnten Wiesental anfangs schwach<br />
ansteigend entlang des Kneedenbaches. Auf dieser Strecke konnten an zwei<br />
Feuchtstellen knapp unter der heutigen Bodenfläche Steinpflasterungen<br />
festgestellt werden. Im oberen Bereich der Bachsenke querte der Weg an einer<br />
topographisch günstigen Stelle den Kneedenbach. Von der ehemals hier<br />
befindlichen (neuzeitlichen) Brücke sind noch heute große F<strong>und</strong>amentsteine<br />
<strong>und</strong> gleichfalls die Reste eines Feldsteinpflasters erhalten. Westlich der Brücke<br />
musste der weiterführende Weg eine steile Anhöhe mit einem Höhenunterschied<br />
von 16 m überwinden. Deutlich ist hier <strong>im</strong> ansteigenden Gelände<br />
ein <strong>im</strong>posanter Hohlwegfächer (Abb. 5 u. Abb. 6, b) mit mindestens 19 gut ausgeprägten<br />
Fahrrinnen zu erkennen. Lediglich in einem kleinen Bereich nächst<br />
der Brücke sind die Wegespuren zerstört. Aus dem Umfang <strong>und</strong> der Mannigfaltigkeit<br />
der Fahrrinnen bzw. der Fahrspur-Relikte ist zu entnehmen, dass der<br />
Verkehrsweg während einer sehr langen Zeitspanne genutzt wurde. Mithilfe<br />
der gr<strong>und</strong>legenden Arbeiten bzw. methodischen Untersuchungen zur histo-<br />
92)<br />
risch-geographischen Wegeforschung ist es gelungen, be<strong>im</strong> Hohlwegfächer<br />
Kneeden drei Nutzungsphasen zu unterscheiden.<br />
Südlicher Abschnitt (Abb. 5):<br />
93)<br />
Breite ausgebaute Hauptspur, Spurenbreite bis 5,5 m, Spurentiefe 1,5 bis 1,8<br />
m. Südlich der Hauptspur befinden sich mehrere Hohlwege (Ausweich- bzw.<br />
Vorgängerspuren). Dieser Bereich ist in der bekannten Varendorfkarte von<br />
94)<br />
1789 als eine hornförmige Trassenverbreiterung dargestellt.<br />
Belegte Datierung: Neuzeit.<br />
Nördlicher Abschnitt (Abb. 5):<br />
Schräg aufwärts <strong>im</strong> Hang verlaufende tiefe <strong>und</strong> lange Hohlwegspuren.<br />
Spurenbreite bis 5 m, Spurentiefe bis 1,8 m. Typische Merkmale eines künst-<br />
95)<br />
lichen „reliefbedingten Wegebaus“ mit beträchtlichen Bodenbewegungen.<br />
Fahrspur-Relikte von großen 4-rädrigen Wagen.<br />
Nutzungszeit: Spätes Mittelalter <strong>und</strong> Neuzeit.<br />
Mittlerer Abschnitt (Abb. 5):<br />
Schwächer ausgeprägte Fahrrinnen, die steil am Hang ansteigen.<br />
Spurenbreite 2,5 bis 3 m, Spurentiefe etwa 1,5 m. Fahrspur-Relikte von leichten<br />
(2-rädrigen) Wagen bzw. Karrenwagen. Diese Wegespuren sind typisch für<br />
96)<br />
einen sogenannten Naturweg; es hat also noch kein künstlicher Wegebau<br />
stattgef<strong>und</strong>en.<br />
Wahrscheinliche Nutzungszeit: Frühes <strong>und</strong> Hohes Mittelalter.<br />
Die unterschiedliche morphologische Beschaffenheit der beschriebenen<br />
Abschnitte des Hohlwegfächers Kneeden (F<strong>und</strong>meldung FM-NMS 2002/005,<br />
R. Beranek) ermöglichte somit eine Periodisierung dieses eindrucksvollen<br />
56
Wegereliktes. Im Zuge des hier behandelten <strong>Fernwege</strong>s ist das schwächer<br />
ausgeprägte Wegebündel <strong>im</strong> mittleren Abschnitt des Hohlwegfächers besonders<br />
wichtig. Hier ist eine Nutzung bereits in frühgeschichtlicher Zeit sehr<br />
wahrscheinlich.<br />
Die gut erhaltenen Hohlwegspuren enden an der Forstgrenze des<br />
Waldgebietes Kneeden. Wie die Ausläufer der Fahrrinnen in ihrer generellen<br />
Orientierung aufzeigen, vereinigten sich die Hohlwege auf dem anschließenden<br />
ebenen Gelände. Es wird heute landwirtschaftlich genutzt. Der<br />
Fernweg führte, wie auch der heute als Redder vorhandene Feldweg, auf<br />
97)<br />
einem schwachen Höhenrücken weiter in westlicher Richtung.<br />
Der frühgeschichtliche Weg verblieb auf der Anhöhe <strong>und</strong> berührte den <strong>Raum</strong><br />
der späteren Stadt Oldesloe nicht. Oldesloe wurde zu Beginn der deutschen<br />
Ostsiedlung (1143) an einem verkehrsgeographisch günstigen Platz gegründet.<br />
Der Ort liegt auf halber Strecke zwischen den Zentralorten <strong>Lübeck</strong><br />
<strong>und</strong> Hamburg <strong>und</strong> konnte jeweils in einer Tagesreise erreicht werden. Es<br />
vereinigen sich hier die beiden Flüsse Trave <strong>und</strong> Beste. Ein größerer Bogen der<br />
Trave bot ausreichenden Schutz für den gut gewählten Handelsplatz, wobei<br />
zu diesem Zeitpunkt auch die Schifffahrt an Bedeutung gewann. Wichtige<br />
frühe urk<strong>und</strong>liche Erwähnungen sind: 1151/52 Betrieb <strong>und</strong> Verschüttung der<br />
Saline, 1163 Nachweis der Kirche, 1175 Einrichtung eines landesherrlichen<br />
98)<br />
Zolls, 1188 Erwähnung einer Brücke über die Trave. Der nun zunehmende<br />
Transitverkehr erforderte eine neue kürzere Wegverbindung nach Hamburg.<br />
Sie führte nicht mehr über die Furt bei Nütschau, sondern man querte<br />
nunmehr den Travefluss <strong>im</strong> Ortsbereich von Oldesloe, zunächst wohl mittels<br />
einer Furt, später über die erwähnte Brücke. In zwei nachgewiesenen Va-<br />
rianten, über Rümpel (1342) <strong>und</strong> Blumendorf (1460), verliefen beide Trassen<br />
99)<br />
zum südwestlich gelegenen Ort Bargteheide.<br />
Wie bereits erwähnt, führte der frühgeschichtliche Fernweg, verbleibend auf<br />
dem Scheitel des Höhenrückens (Butterberg), weiter nach Westen. (In der<br />
Varendorfkarte von 1789 ist hier noch ein kurzes Wegestück in dieser Richtung<br />
verzeichnet). Im weiteren Verlauf wurde das heute bebaute nördliche Stadtgebiet<br />
von Oldesloe von der Trasse nur tangiert. Sie schwenkte hier, etwa der<br />
heutigen Straße nach Segeberg folgend, in nordwestlicher Richtung zum Gutsbereich<br />
Altfresenburg ab.<br />
Im Jahre 1980 wurde auf einer schwachen Geländekuppel nordwestlich der<br />
Gutshäuser ein größeres Areal zum Zwecke der Kiesgewinnung aufgedeckt.<br />
Bei den Erdarbeiten kamen F<strong>und</strong>e einer spätslawischen Siedlung (Abb. 6, d)<br />
100)<br />
zu Tage, die archäologisch untersucht <strong>und</strong> beschrieben wurde. Auf einer<br />
Fläche von 3000 qm sicherte man 14 Siedlungsgruben mit umfangreichem<br />
Keramikmaterial. Die überwiegende Anzahl der aufgef<strong>und</strong>enen Scherben<br />
(52 von 62) stammt aus spätslawischer Zeit (11. <strong>und</strong> 12. Jahrh<strong>und</strong>ert).<br />
57
Beachtenswert ist dabei das <strong>im</strong> östlichen Holstein erstmalige Auftreten der<br />
Verzierung „Ringaugen mit Kreuzeindruck“. Diese Gefäße mit der unge-<br />
wöhnlichen Verzierung stammten nicht aus der he<strong>im</strong>ischen Produktion,<br />
101)<br />
sondern wurden aus anderen Regionen eingeführt. Auffällig ist auch der<br />
Standort der Siedlung: Sie befindet sich nicht, wie bei den Slawen üblich, in<br />
natürlicher Schutzlage, sondern <strong>im</strong> offenen Gelände <strong>und</strong> unmittelbar am<br />
Fernweg. So könnte die Siedlung bereits ein früher Etappenort an der Fernhandelsroute<br />
von Alt <strong>Lübeck</strong> nach Hamburg gewesen sein. Wie berichtet,<br />
wurde die Kaufmannssiedlung in Alt <strong>Lübeck</strong> <strong>im</strong> frühen 12. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
nachgewiesen. Aus dem 1,7 km von Altfresenburg entferntem heutigen Stadtgebiet<br />
Oldesloe sind bislang lediglich früh- <strong>und</strong> mittelslawische Siedlungsspuren<br />
(Keramik) bekannt. So ist zu vermuten, dass die oben beschriebene<br />
spätslawische Ansiedlung der Vorgänger der deutschen Gründung Oldesloe<br />
102)<br />
war <strong>und</strong> somit eine Siedlungskontinuität in diesem <strong>Raum</strong> bestanden hat.<br />
Von der archäologischen F<strong>und</strong>stelle nur 500 m entfernt befinden sich in den<br />
Travewiesen solehaltige Quellen, auf die K. W. Struve <strong>und</strong> K. Chr.<br />
Baumgarten hingewiesen haben. Das bereits in frühgeschichtlicher Zeit,<br />
insbesondere als Konservierungsmittel für Fische, hochgeschätzte Salz wurde<br />
<strong>Frühgeschichtliche</strong> Importf<strong>und</strong>e<br />
links: 8-eckige <strong>und</strong> r<strong>und</strong>e Bergkristallperle,<br />
F<strong>und</strong>ort Hammer, Kr. Hzgt. Lauenburg, ca. 1:1<br />
rechts: spätslawische Gefäßscherbe, stempelverziert<br />
mit Ringaugen <strong>und</strong> Kreuzeindruck,<br />
F<strong>und</strong>ort Altfresenburg, Kr. <strong>Stormarn</strong>, ca. 1:2<br />
58
auch <strong>im</strong> slawisch besiedelten mittel- <strong>und</strong> norddeutschen <strong>Raum</strong> aus<br />
103)<br />
Solequellen gewonnen <strong>und</strong> gehandelt. So kann man durchaus annehmen,<br />
dass auch die Bewohner der spätslawischen Siedlung Altfresenburg die<br />
unmittelbar benachbarten Salzquellen gekannt <strong>und</strong> verwertet haben. Die<br />
nach 1143 eingewanderten deutschen Siedler haben das Wissen über die<br />
Salzvorkommen <strong>im</strong> Oldesloer <strong>Raum</strong> mit großer Wahrscheinlichkeit von den<br />
slawischen Bewohnern übernommen. Unter dem Holsteinischen Grafen<br />
Adolf II. wurden nach einem Bericht des Chronisten Helmold die <strong>im</strong> heutigen<br />
Oldesloer Stadtgebiet befindlichen Salzquellen in größerem Umfang ausge-<br />
104)<br />
beutet. Dem gleichen Helmoldbericht nach ließ Herzog Heinrich der Löwe<br />
kurze Zeit später (1151), aus Gründen der Konkurrenz zu seiner Salzproduktion<br />
in Lüneburg, die Salzquelle in Oldesloe „verstopfen“.<br />
Im weiteren Verlauf erreichte der Fernweg ein Gebiet mit zwei bedeutenden<br />
frühslawischen Befestigungsanlagen. Es handelt sich dabei um den „Fresenburger<br />
Wallberg“ direkt unterhalb des Gutes Altfresenburg <strong>und</strong> die in einer<br />
Entfernung von 1,9 km nordwestlich befindliche „Nütschauer Schanze“ (Abb.<br />
6, c u. e). Die beiden gut erhaltenen Ringwälle, beide am Travefluss gelegen,<br />
wurden <strong>im</strong> frühen Mittelalter errichtet <strong>und</strong> stehen damit <strong>im</strong> engen Zusammenhang<br />
mit der slawischen Einwanderung.<br />
Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand verließ <strong>im</strong> Zuge der Völkerwanderung<br />
der Großteil der germanischen Bevölkerung Ostholsteins <strong>und</strong> Lauenburgs<br />
spätestens <strong>im</strong> 5. Jahrh<strong>und</strong>ert seine Siedlungsgebiete. Gegen Ende des 7.<br />
<strong>und</strong> während des 8. Jahrh<strong>und</strong>erts erreichten slawische Einwanderer von<br />
Osten kommend den hier behandelten <strong>Raum</strong>. Den schriftlichen Quellen nach<br />
wurde das Gebiet nördlich der Trave von den Wagriern, einem Teilstamm der<br />
Obodriten, besiedelt. Man errichtete isoliert liegende offene <strong>und</strong> auch<br />
befestigte Siedlungen. Zu ihrem Schutze baute man auch Burgen, von denen<br />
sich einige zu Mittelpunkten sogenannter Siedlungskammern entwickelten.<br />
In einer weiteren Phase kam es zur Erschließung des ganzen Gebietes, zum<br />
Aufbau eines flächendeckenden Burgensystems mit einigen wirtschaftlichen<br />
105)<br />
<strong>und</strong> politischen Zentren.<br />
Von großer Wichtigkeit war den slawischen Einwanderern die Lage ihrer<br />
Ansiedlung; dies trifft zu sowohl bei den (offenen <strong>und</strong> befestigten) Siedlungen<br />
als auch <strong>im</strong> besonderen Maße bei den Burgplätzen. Man schützte sich vor<br />
Eindringlingen <strong>und</strong> bevorzugte windgeschützte Lagen. Auch genügend Land<br />
zur landwirtschaftlichen Nutzung musste vorhanden sein. Im hiesigen<br />
norddeutschen Flachland bevorzugte man Plätze <strong>im</strong> feuchten Niederungsgelände,<br />
die von drei Seiten schwer begehbar, oft unüberwindbar waren. Man<br />
nutzte schwache Erhöhungen <strong>und</strong> Kuppen am Rande von Mooren <strong>und</strong> in<br />
Flussauen. Oft lag die Ansiedlung auch auf Halbinseln an Seen <strong>und</strong> Spornen<br />
zwischen zusammenfließenden Gewässern, bzw. an Bach- <strong>und</strong> Flussschleifen.<br />
Ebenso wichtig wie die Sicherheitsaspekte waren die Voraus-<br />
59
setzungen für eine ausreichende Ernährung bzw. relativ autarke Versorgung<br />
mit Lebensmitteln. Im Umfeld der Siedlungen <strong>und</strong> der Burgplätze -<br />
letztere meistens mit angeschlossener Vorburgsiedlung - musste daher auch<br />
genügend nutzbare Bodenfläche vorhanden sein. Die besondere Wirtschaftsweise<br />
der Slawen war die Feld-Gras-Wirtschaft mit einem vergleichsweise<br />
hohen Anteil an Viehhaltung. Daher wählten die Slawen „für ihre<br />
Siedlungen Plätze <strong>im</strong> Grenzraum zwischen einer feuchten Niederung, die als<br />
Dauerweide genutzt werden konnte, <strong>und</strong> einem höhergelegenen trockenen Gebiet,<br />
106)<br />
auf dem das Wechselsystem von Gras- <strong>und</strong> Ackerfläche angelegt wurde“.<br />
Direkt unterhalb der heutigen Gebäude von Altfresenburg liegt <strong>im</strong><br />
Niederungsbereich der Trave auf einer weithin sichtbaren Moränenkuppe<br />
der Fresenburger Wallberg (Abb. 6, c). An beiden Seiten der Kuppe ist das<br />
Gelände am Traveufer noch heute stark vermoort. Zum Norden hin, auf<br />
mäßig ansteigendem Gelände, sind sehr günstige Voraussetzungen für eine<br />
landwirtschaftliche Nutzung gegeben. Hier könnte auch eine offene Vorburgsiedlung<br />
gelegen haben, die bislang noch nicht archäologisch nachge-<br />
107)<br />
wiesen werden konnte.<br />
Die Ringwallanlage Fresenburger Wallberg hat bei einer Böschungshöhe<br />
von 4 m einen Durchmesser von r<strong>und</strong> 80 x 90 m. Die Wallkuppen sind nach<br />
innen hin stark verschleift, so dass hier die Wallböschung nur schwach<br />
ausgebildet ist <strong>und</strong> der heutige Innenraum in einem noch nicht festgestellten<br />
Ausmaß erhöht sein dürfte. Eine gründliche archäologische Untersuchung<br />
der Anlage hat noch nicht stattgef<strong>und</strong>en. Zwei <strong>im</strong> Jahre 1950 gezogene<br />
Suchgräben erbrachten zahlreiches Keramikmaterial, einige Spinnwirtel,<br />
108)<br />
Wandbewurfsstücke, Tierknochen <strong>und</strong> verkohlte Hölzer. Als weitere<br />
F<strong>und</strong>gegenstände sind zwei Ringe, ein Knochenkamm, ein nadelartiges<br />
Knochenstäbchen, ein Messerfragment sowie Schleifsteine anzuführen. Am<br />
inneren Wallrand wurden vier Sargbestattungen aufgef<strong>und</strong>en, davon eine<br />
eines Kindes. Die aufgef<strong>und</strong>enen Gefäßscherben gehören fast ausnahmslos<br />
zu den frühslawischen Keramikgruppen Sukow <strong>und</strong> Feldberg. Nur einige<br />
wenige Scherben können zur mittelslawischen Gruppe Menkendorf<br />
gerechnet werden. Die beiden Keramikarten – älteres, noch unverziertes<br />
Sukow <strong>und</strong> jüngeres, meistens verziertes Feldberg – sind etwa gleich stark<br />
vertreten. Aufgr<strong>und</strong> des keramischen F<strong>und</strong>materials kann be<strong>im</strong> Fresenburger<br />
Wallberg, wie bei den meisten frühslawischen Anlagen Ostholsteins,<br />
eine Nutzung lediglich pauschal innerhalb des Zeitraums 8. <strong>und</strong> 9. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
angegeben werden. Nur bei wenigen Burganlagen in Ostholstein<br />
war bislang durch die Jahrringdatierung (Dendrochronologie) eine ge-<br />
109)<br />
nauere Zeitstellung möglich.<br />
Mit einer noch wenig verbreiteten Methode kann man bei der frühslawischen<br />
Keramik einen zusätzlichen Hinweis zur Datierung erhalten. Es<br />
60
handelt sich dabei um eine Überprüfung der Bearbeitungsspuren an den<br />
Gefäßrändern. Damit kann eine Unterscheidung von rein handgemachter<br />
(älterer) Keramik einerseits <strong>und</strong> oben abgedrehten (neueren) Gefäßen an-<br />
110)<br />
dererseits getroffen werden. In diesem Zusammenhang hat der Verfasser<br />
die verfügbaren Randscherben vom F<strong>und</strong>platz Fresenburger Wallberg mittels<br />
111)<br />
dieser Methode untersucht. Die Mehrzahl der überprüften Scherben (etwa<br />
90 Exemplare) wiesen noch keine Drehspuren auf. Damit überwiegt die ältere<br />
handgemachte Ware, was auf einen sehr frühen Siedlungsbeginn schließen<br />
lässt. Mit diesem Hinweis auf die frühe Errichtung des Fresenburger<br />
Wallbergs <strong>und</strong> mit der bereits erwähnten Auffindung einiger mittelslawischer<br />
Scherben vom Typ Menkendorf, kann auf eine durchgehende<br />
Besiedlung bis etwa 900 n. Chr. geschlossen werden.<br />
Der opt<strong>im</strong>ale Standort, die große Anzahl <strong>und</strong> Vielfalt der F<strong>und</strong>e mit<br />
Hinweisen auf eine autarke Versorgung sowie die kontinuierliche Nutzung<br />
der Burganlage Fresenburger Wallberg sind Indizien für die Funktion als<br />
112)<br />
bedeutende Siedlungsburg <strong>und</strong> Mittelpunkt einer Siedlungskammer. Ein<br />
wichtiges neues Argument kommt aus dem Bereich der Sprachforschung: Wie<br />
bereits beschrieben, taucht urk<strong>und</strong>lich <strong>im</strong> 4,5 km entfernten Forstgebiet<br />
Kneeden die slawische Bezeichnung „Knegena“ auf. Es ist die weibliche Form<br />
113)<br />
zu „Kneze“, in der Übersetzung der „Fürst“. So gibt es <strong>im</strong> Umfeld des Burg-<br />
<strong>und</strong> Siedlungskomplexes Fresenburg einen deutlichen Hinweis auf eine<br />
herausgehobene Persönlichkeit. Den Titel „Fürst“ hat wohl nur der burg-<br />
ansässige Adelige getragen, der als Herrscher an der Spitze eines slawischen<br />
114)<br />
Gaues, einer weiträumigen Siedlungskammer stand.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich befanden sich die slawischen Burgen in ausgesprochenen<br />
Schutzlagen; nur in seltenen Fällen führten die <strong>Fernwege</strong> in unmittelbarer<br />
Nähe vorbei. Man erreichte die Burgplätze in der Regel über kleine gut zu<br />
überschauende Stichwege. So gab es sicherlich von der Fernwegtrasse bei den<br />
heutigen Altfresenburger Gutsgebäuden einen Weg zum 800 m entfernt am<br />
Traveufer liegenden Fresenburger Wallberg.<br />
Der behandelte Fernweg führte jedoch in nordwestlicher Richtung weiter <strong>und</strong><br />
nach 1,5 km, kurz vor Schlamersdorf, hinab ins Travetal. Die Trave ist fast<br />
<strong>im</strong> gesamten Verlauf unterhalb von Segeberg von breiten feuchten<br />
Niederungen umgeben. Nur an wenigen Stellen ist eine Querung möglich,<br />
nämlich dort, wo sich trockene Landzungen ins sumpfige Wiesengelände<br />
vorschieben. Eine solche naturbedingte Lage befindet sich nordöstlich von<br />
Nütschau; hier verengt sich das nasse Umfeld des Flusses auf nur etwa 50 m.<br />
Der Fernweg konnte hier die Trave relativ leicht mittels einer Furt überqueren<br />
(Abb. 6, e). Alten Berichten nach kann auf ein sehr hohes Alter der Travefurt<br />
geschlossen werden. So ist man unterhalb der an diesem Platz befindlichen<br />
Brücke bei Reparaturarbeiten auf eine „Furt stammend aus der Steinzeit“<br />
gestoßen. Die zeitliche Angabe wird mit den hier aufgef<strong>und</strong>enen<br />
61
Steinartefakten begründet. Auf eine mögliche Nutzung während der<br />
Bronzezeit kann durch die später noch behandelte Grabhügelreihung bzw.<br />
den vermuteten Grabhügelweg geschlossen werden, die bei Nütschau das<br />
Travetal queren. Weg <strong>und</strong> Furt könnten auch mit den in der Nähe befind-<br />
lichen Salzquellen zusammenhängen, wo zwei bedeutende bronzezeitliche<br />
115)<br />
Depotf<strong>und</strong>e be<strong>im</strong> Torfstechen geborgen wurden. Ob das bei der Furt bei<br />
Baggerarbeiten um 1935 aufgef<strong>und</strong>ene stark verwitterte Eisenschwert aus der<br />
Eisenzeit oder aus der späteren fränkisch/slawischen Zeit stammte, kann<br />
116)<br />
nicht mehr festgestellt werden; es ist verschollen.<br />
Die Nütschauer Schanze war einst eine Wegesperre am Westufer der Trave.<br />
Direkt an der Travefurt <strong>und</strong> der Fernstraße liegt auf einem hochgelegenen<br />
Plateau die slawische Burganlage Nütschauer Schanze (Abb. 6, e). Ihr unmittelbares<br />
Umfeld besteht aus feuchten Senken <strong>und</strong> mehreren ausgeprägten<br />
Erosionsrinnen. Die Befestigung liegt auf einer größeren Kuppe an deren<br />
Hängen ein unregelmäßiger bogenförmiger Wall aufgeschüttet wurde. Die<br />
Anlage hat einen Durchmesser von etwa 80 m <strong>und</strong> die Wallhöhe liegt noch<br />
heute bis zu 2,5 m über dem nach Westen hin schwach geneigten Innenraum.<br />
Der Wall wird an der Traveseite durch den natürlichen Steilabfall ersetzt. Vor<br />
dem bogenförmigen Wallzug befindet sich auf seiner gesamten Länge<br />
ein ausgehobener Graben mit einer Tiefe bis zu 5 m vom Wall-<br />
62
117)<br />
gipfel aus gemessen. Bei Ausgrabungen in den Jahren 1949 <strong>und</strong> 1950 wurde<br />
weder eine Stratigraphie noch eine Kulturschicht angetroffen. Im Bereich ei-<br />
118)<br />
nes Tores bzw. einer Torgasse wurden dicke Holzkohleschichten ergraben.<br />
Es fanden sich nur wenige nach neueren Erkenntnissen ausnahmslos slawische<br />
Gefäßscherben, die bis in die Einzelheiten mit den Keramikf<strong>und</strong>en <strong>im</strong><br />
Fresenburger Wallberg übereinst<strong>im</strong>men. So ist die frühere Interpretation der<br />
119)<br />
Anlage Nütschau als sächsisch-fränkische Grenzburg überholt. Man kann<br />
von einer gewissen zeitgleichen Nutzung der beiden slawischen Anlagen<br />
innerhalb des 8. <strong>und</strong> 9. Jahrh<strong>und</strong>erts ausgehen.<br />
Die Anlage ist an allen Seiten von einem überaus unruhigen Gelände umgeben<br />
<strong>und</strong> es gibt kaum nutzbare Flächen für einen Getreideanbau bzw. eine<br />
120)<br />
Viehhaltung in ausreichender Größenordnung. Dieser Standort ist untypisch<br />
für eine reguläre frühslawische Siedlungsburg. Unwahrscheinlich ist<br />
auch der Neubau einer Siedlungsburg unmittelbar an einem bereits bestehenden<br />
Fernweg. Feindliche Truppen könnten so die Burganlage relativ leicht<br />
erreichen. Dies steht <strong>im</strong> Widerspruch zur gr<strong>und</strong>sätzlich auf Sicherheit bedachten<br />
slawischen Siedlungsweise, insbesondere bei der Standortwahl einer<br />
Burg. Aus dem spärlichen F<strong>und</strong>material kann geschlossen werden, dass die<br />
Burg nur selten oder nur schwach bewohnt war. Diese Argumente machen es<br />
wahrscheinlich, dass die Nütschauer Schanze in erster Linie zum Schutz <strong>und</strong><br />
der Kontrolle des Traveübergangs <strong>und</strong> des Fernwegs diente. In dieser Funktion<br />
war sie eine wichtige Verteidigungs- bzw. Sperranlage, gehörend zur<br />
121)<br />
Mittelpunktsburg Fresenburger Wall.<br />
Den Travefluss aufwärts, nördlich von Oldesloe, befindet sich das schriftlich<br />
überlieferte Waldgebiet „Travena Silva“. Es ist eine Station <strong>im</strong> Verlauf des<br />
bekannten „L<strong>im</strong>es saxoniae“, der von Adam von Bremen um 1070<br />
beschriebenen Völkergrenze zwischen dem fränkischen Reich <strong>und</strong> dem sla-<br />
122)<br />
wischen Machtbereich. Nach einem gemeinsam errungenen Sieg fränkisch/slawischer<br />
Verbände (798) über die Dänen überließ Karl d. Gr. <strong>im</strong> Jahre<br />
804 die sächsischen Gebiete nördlich der Elbe (Nordalbingien) den slawischen<br />
Obodriten. Sie sollten das fränkische Reich gegen die Expansionsbestrebungen<br />
der Dänen absichern. Bereits um 810 stellte sich heraus, dass die<br />
Slawen die ihnen übertragene Aufgabe nicht erfüllten bzw. erfüllen konnten.<br />
Sie verbündeten sich sogar mit den Dänen <strong>und</strong> griffen gemeinsam <strong>im</strong> Jahre 817<br />
die fränkische Burg Esesfeldt an, die jedoch gehalten werden konnte. Daraufhin<br />
ging 819 ein Heer aus Sachsen <strong>und</strong> Ostfranken über die Elbe <strong>und</strong> besiegte<br />
die abtrünnigen Slawen. In diesem Zusammenhang werden erstmalig Legaten<br />
<strong>und</strong> Präfekten in der sächsischen Grenzmark „l<strong>im</strong>ites Saxonici“ genannt, die<br />
123)<br />
auch die Befehlshaber der Truppen waren. Nachdem nun die Franken die Situation<br />
zu ihren Gunsten geklärt hatten, mussten sich die Slawen in die<br />
ostholsteinischen Gebiete zurückziehen <strong>und</strong> Nordalbingien wurde<br />
63
ins fränkische Reich eingegliedert. Nach K. W. Struve hat man sich die daraus<br />
resultierende Grenze „als eine Ödlandzone vorzustellen, die unbesiedelt war. Sie<br />
blieb <strong>im</strong> wesentlichen bis zum Ende der Slawenzeit die Völkerscheide zwischen Sachsen<br />
bzw. Deutschen <strong>und</strong> Slawen, auch wenn es von beiden Seiten her <strong>im</strong>mer wieder zu<br />
Grenzüberschreitungen <strong>und</strong> erbitterten Kämpfen kam. Die Westgrenze slawischer<br />
124)<br />
Ortsnamen ist dem L<strong>im</strong>esverlauf annähernd kongruent“. Mehrheitlich wird<br />
angenommen, dass die Ödlandzone der überlieferten linearen Grenze <strong>im</strong><br />
L<strong>im</strong>esbericht Adams von Bremen (um 1070) nach Westen vorgelagert war.<br />
Zum größten Teil können die <strong>im</strong> L<strong>im</strong>esbericht genannten Örtlichkeiten <strong>und</strong><br />
125)<br />
Geländeabschnitte gut lokalisiert werden. Die mehr oder weniger nasse<br />
Grenze (Fluss- <strong>und</strong> Bachläufe, Moore, Quellgebiete, Wasserscheiden) verläuft<br />
von der Elbe bei Lauenburg ausgehend etwa in nördlicher Richtung bis zur<br />
Kieler Bucht. Nördlich von Oldesloe befindet sich der bereits erwähnte<br />
Travewald, eine <strong>im</strong> L<strong>im</strong>esbericht erwähnte Station.<br />
Wie bereits beschrieben querte der behandelte Fernweg bei Nütschau den<br />
Travefluss (Abb. 6 e). Die tiefe Fahrrinne am nordöstlichen Ufer ist vermutlich<br />
durch die Wegenutzung entstanden. Auf der anderen Uferseite steigt die<br />
Trasse in einer natürlich entstandenen Erosionsrinne steil an. Unmittelbar am<br />
Traveübergang befindet sich, wie bereits erwähnt, der sehr steile Hang der<br />
Nütschauer Schanze. In die Erosionsrinne hat sich die Fahrspur als Hohlweg<br />
tief eingeschnitten. Nach ca. 300 m ist quer zum Weg ein nach Norden<br />
verlaufender Graben zu erkennen. Er hat bis vor kurzem noch keine besondere<br />
Beachtung gef<strong>und</strong>en. Der Graben wurde eindeutig künstlich angelegt mit<br />
126)<br />
steilen Hängen <strong>und</strong> einem auffallenden trapezförmigen Querschnitt. Oben<br />
hat er eine Breite von etwa 17 m <strong>und</strong> ist bis zu 5 m tief. In einer Länge von 200 m<br />
kann er gut verfolgt werden; er läuft allmählich <strong>im</strong> nassen Wiesengelände aus.<br />
Es ist unklar, ob der Graben eine militärische Funktion hatte oder ob er <strong>im</strong><br />
127)<br />
wesentlichen zur Kontrolle des friedlichen Verkehrs errichtet wurde.<br />
Die Rekonstruktion des frühgeschichtlichen <strong>Fernwege</strong>s der nachfolgend<br />
beschriebenen Strecke, führend von der Travefurt bei Nütschau über<br />
Bargteheide nach Hamburg, erweist sich wegen der nur spärlichen Hinweise<br />
als relativ schwierig. Lediglich eine frühe schriftliche Erwähnung aus dem<br />
Jahre 1110 könnte mit dem Fernweg zusammenhängen: Der in Hamburg<br />
eingesetzte billungische Lehnsgraf Gottfried geriet bei der Verfolgung sla-<br />
128)<br />
wischer Räuber in <strong>Stormarn</strong> in einen Hinterhalt <strong>und</strong> wurde getötet.<br />
Bei dem folgenden Rekonstruktionsversuch musste für die gesamte<br />
Wegestrecke bis Hamburg vorwiegend auf Hinweise aus vorgeschichtlicher<br />
Zeit zurückgegriffen werden. Die Thematik der bronzezeitlichen Grabhügelreihen<br />
<strong>und</strong> die sogenannten Grabhügelwege wurde in einem vorhergehenden<br />
Abschnitt ausführlich behandelt. Bekanntlich eignen sich die <strong>im</strong><br />
64
Gelände erkannten Reihungen von vorwiegend bronzezeitlichen Grabhügeln<br />
bzw. Grabhügelgruppen oft als Leitlinien für Wegeführungen, auch in späteren<br />
Zeitepochen (Wegekontinuität). Eine <strong>im</strong> nordwestlichen <strong>Stormarn</strong> ge-<br />
legene Hügelreihe hat H. Hingst erkannt <strong>und</strong> als eine mögliche vorge-<br />
129)<br />
schichtliche Wegeführung beschrieben. Danach verlief der hier rekonstruierte<br />
Weg der Hügelkette folgend, die ab dem Bereich nordöstlich von Oldesloe<br />
archäologisch gut erfasst ist. Der Weg führte über die Nütschauer Furt <strong>und</strong><br />
<strong>im</strong> weiteren Gelände mäßig ansteigend zunächst in westlicher Richtung (Abb.<br />
6; b, d, e). Zwischen den heutigen Orten Tralau <strong>und</strong> Vinzier (Abb. 6, f) traf der<br />
Weg auf eine weitere Grabhügelreihe bzw. Wegetrasse, die vom Norden her<br />
130)<br />
in das hier behandelte (Arbeits-) Gebiet gelangte. Diese <strong>im</strong> benachbarten<br />
Segeberger Gebiet erfasste Hügelkette wird flankiert von 12 Steinzeitgräbern,<br />
gleichfalls in linearer Anordnung. Oberflächlich wurden sie zerstört, doch<br />
131)<br />
konnten sie archäologisch gut nachgewiesen werden. Diese auch als Megalithgräber<br />
bekannten Grabanlagen mit steinernen Einbauten, den Grabkammern,<br />
waren fast <strong>im</strong>mer von Erd- oder Steinhügeln überdeckt. Das kom-<br />
binierte Auftreten von Grabhügelreihen aus der Bronzezeit <strong>und</strong> älteren Stein-<br />
132)<br />
zeitgräbern kann man zuweilen auch an anderen F<strong>und</strong>plätzen beobachten.<br />
Auffällig ist, dass gerade am Platz des Zusammentreffens der beiden<br />
Hügelreihen bzw. der Fernwegtrassen ein umfangreiches Brandgrubenfeld<br />
(Abb. 6, f) aufgef<strong>und</strong>en wurde. Derartige Bef<strong>und</strong>e, auch Feuerstellenplätze<br />
genannt, wurden erst in jüngster Zeit gründlich erforscht <strong>und</strong> publiziert. Sie<br />
bestehen aus kleineren fast <strong>im</strong>mer f<strong>und</strong>losen Steinsetzungen, oft in linearer<br />
Anordnung <strong>und</strong> in beträchtlicher räumlicher Ausweitung. Häufig konnte<br />
auch ein Zusammenhang mit bronzezeitlichen Grabhügeln erkannt werden.<br />
Als ein Schwerpunkt bei der Nutzung der Brandgrubenfelder wurde die<br />
14<br />
jüngere Bronzezeit <strong>und</strong> frühe Eisenzeit ermittelt ( C-Datierungen überwiegend<br />
von etwa 950-600 v. Chr.). Seit dem überregionalen Bekanntwerden<br />
von Feuerstellenplätzen in den späten sechziger <strong>und</strong> siebziger Jahren des<br />
letzten Jahrh<strong>und</strong>erts setzte sich zunehmend eine kultisch-religiöse Deutung<br />
durch. Wahrscheinlich ist, dass „die Feuerstellenplätze <strong>im</strong> Rahmen von beson-<br />
deren, religiös motivierten Zusammenkünften größerer Menschenmengen genutzt<br />
133)<br />
wurden“. So dürfte eine kultische Funktion des Platzes Tralau, am Zu-<br />
134)<br />
sammentreffen zweier bedeutender <strong>Fernwege</strong>, sehr wahrscheinlich sein.<br />
An dem beschriebenen Wegeteilstück haben sich noch bis in die Mitte des<br />
letzten Jahrh<strong>und</strong>erts drei alte Wegespuren erhalten (Abb. 6; g, f, h), die in der<br />
135)<br />
Archäologischen Landesaufnahme registriert <strong>und</strong> beschrieben wurden. Im<br />
Gelände sind diese Wegerelikte heute nicht mehr zu erkennen. Sie stammten<br />
wohl auch nicht direkt aus vor- bzw. frühgeschichtlicher Zeit; vielmehr<br />
dürften es Spuren von der mittelalterlichen oder der noch späteren<br />
65
neuzeitlichen Wegenutzung gewesen sein. Wichtig ist jedoch die berechtigte<br />
Vermutung, dass sich hier eine alte Trassenführung über weite Zeiträume als<br />
Wegeleitlinie erhalten hat.<br />
Bekanntlich ist in den archäologisch erfassten F<strong>und</strong>stellen <strong>im</strong> Nahbereich von<br />
Fernwegtrassen meist eine Häufung von <strong>im</strong>portiertem Fremdgut<br />
festzustellen. Dies ist auch <strong>im</strong> hier behandelten Trassenverlauf von Bad<br />
Oldesloe bis Bargteheide der Fall. Aus der Bronzezeit stammen zahlreiche<br />
136)<br />
Importf<strong>und</strong>e; die F<strong>und</strong>plätze sind der Abb. 6, 1-4 vermerkt. In Travenähe bei<br />
Bad Oldesloe liegen die erwähnten „Oldesloer Salzquellen“ <strong>und</strong> be<strong>im</strong><br />
Torfstechen <strong>im</strong> Brennermoor kamen bedeutende bronzezeitliche Depotf<strong>und</strong>e<br />
zu Tage. Es waren wohl sogenannte „Weihef<strong>und</strong>e“, denn den Vorzeitmen-<br />
schen waren solche ungewöhnlichen Stellen heilig <strong>und</strong> hier legten sie oft ihre<br />
137)<br />
Opfergaben nieder. Dass der Weg auch in der anschließenden Eisenzeit ge-<br />
nutzt wurde, geht aus den entsprechenden F<strong>und</strong>plätzen (Abb. 6, 5-7) mit<br />
138)<br />
<strong>im</strong>portiertem F<strong>und</strong>gut hervor. Auch Perlen sind meistens <strong>im</strong>portiertes<br />
Fremdgut. Nahe am beschriebenen Fernweg wurden an vier Plätzen aufge-<br />
139)<br />
f<strong>und</strong>en: 8 Glasperlen, 2 Bernsteinperlen <strong>und</strong> eine Steinperle.<br />
Wie auch bei H. Hingst angegeben, schwenkte die Grabhügelreihe bzw. die<br />
Fernwegtrasse be<strong>im</strong> Brandgrubenfeld Tralau (Abb. 6, f) nach Süden ab. In gemeinsamer<br />
Streckenführung mit dem von Norden aus dem <strong>Raum</strong> Segeberg<br />
kommenden Weg verlief der Fernweg somit weiter durch die heutigen Orts-<br />
140)<br />
bereiche von Grabau, Neritz, Elmenhorst <strong>und</strong> Bargteheide (Abb. 6). Auch auf<br />
dieser Strecke erkennt man eine klare Reihung der Grabhügel bzw. der Grabhügelgruppen.<br />
In Bargteheide knickte der Fernweg nach Südwesten ab <strong>und</strong><br />
erreichte über Bünningstedt <strong>und</strong> Hoisbüttel den bereits auf hamburgischem<br />
141)<br />
Gebiet befindlichen Ortsteil Bergstedt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bestand<br />
in Bergstedt bereits <strong>im</strong> Jahre 1072 eine Kirche. Neue Forschungen über<br />
Kirchengründungen haben ergeben, dass die frühesten Kirchenbauten <strong>im</strong><br />
Hamburger Umland gr<strong>und</strong>sätzlich an den wichtigsten Ausfahrtsstraßen<br />
142)<br />
lagen.<br />
Die oben beschriebene <strong>und</strong> als Wegeleitlinie präsentierte Grabhügelkette<br />
setzte sich auch weiter in südlicher Richtung fort. In diesem letzten Teilstück<br />
vor <strong>und</strong> in Hamburg befinden sich wie bei der vorhergehenden Wegestrecke<br />
gleichfalls größere Grabhügelgruppen: 8 Hügel an der Ortsgrenze Hoisbüttel/Volksdorf;<br />
9 Hügel in Bergstedt „Wöhlberge“; 6 Hügel in Wellings-<br />
143)<br />
büttel/Kl. Borstel; 18 Hügel <strong>im</strong> <strong>und</strong> be<strong>im</strong> Ohlsdorfer Friedhof.<br />
Im späten Mittelalter war für <strong>Lübeck</strong> die Straße nach Hamburg der wichtigste<br />
144)<br />
hansezeitliche Handelsweg. Er querte die Trave, wie bereits beschrieben,<br />
über eine Brücke in Oldesloe <strong>und</strong> führte (in zwei Varianten) in südwestlicher<br />
Richtung weiter nach Bargteheide. Wahrscheinlich ist ab Bargteheide die<br />
spätmittelalterliche Trasse <strong>im</strong> groben Verlauf mit dem frühgeschichtlichen<br />
Fernweg nach Hamburg identisch. Die hier befindliche älteste Zufahrt zum<br />
66
Hamburger Ortskern lag be<strong>im</strong> Spitaler Tor, wo 1220 eine communis strata<br />
145)<br />
erwähnt wird.<br />
Hamburg, Bischofssitz seit 831, war bereits in spätkarolingischer Zeit<br />
Ausgangs- <strong>und</strong> Endpunkt mehrerer Landwege. Hier an der Trichtermündung<br />
der Elbe befand sich ein mehrfach ausgebauter Hafen. Auch die neuen<br />
Hamburger Domplatzgrabungen ergaben Hinweise auf bereits seit dem 9.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert bestehende Handelsbeziehungen mit den westeuropäischen<br />
146)<br />
Provinzen.<br />
Die hier behandelten drei Abschnitte frühgeschichtlicher Wegeführungen,<br />
Der Fernweg von Hamburg nach Mecklenburg,<br />
Die <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> <strong>Lübeck</strong>,<br />
Der Fernweg von der Ostsee nach Hamburg,<br />
waren wichtige Verkehrsadern zwischen dem slawisch besiedelten<br />
Ostseeraum (Wagrien) <strong>und</strong> dem sächsisch/fränkischen Hauptort Hamburg<br />
an der Elbe. Sie zählten zu den bedeutenden Landverbindungen dieser<br />
bewegten Zeitperiode. Während der Wikinger- <strong>und</strong> Slawenzeit vom 8.–12.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert war Schleswig-Holstein, auch mit seinem südlichen Teilgebiet,<br />
147)<br />
eine Drehscheibe zwischen den Völkern.<br />
Quellen <strong>und</strong> Literatur<br />
ADAM: Adam von Bremen um 1070, Buch I-IV, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum<br />
(Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche).<br />
ASMUS 2002: W. Asmus, Der <strong>Kreis</strong> Herzogtum Lauenburg <strong>im</strong> norddeutschen Verkehrsnetz –<br />
Rückblick <strong>und</strong> Bilanz. Beiträge für Wissenschaft <strong>und</strong> Kultur, Band 5, 9-20 (Wentorf bei<br />
Hamburg).<br />
BAKKER u. KNOCHE 2003: J. A. Bakker u. B. Knoche, Erdwerke, Grabmonumente, Wegeplanung.<br />
Archäologie in Deutschland, 4/2003, 22-25 (Stuttgart).<br />
BANGERT 1925: F. Bangert, Geschichte der Stadt <strong>und</strong> des Kirchspiels Oldesloe (Bad Oldesloe).<br />
BAUMGARTEN 1983: K. Chr. Baumgarten, Spätslawische Siedlungsspuren bei Altfresenburg –<br />
Bad Oldesloe. <strong>Stormarn</strong>er Hefte 9, 215-219 (Neumünster).<br />
BERANEK 1997: R. Beranek, Zwei wichtige historische <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> Land Lauenburg.<br />
Mitteilungen der Archäologischen Gesellschaft Schleswig-Holstein e. V., Heft 8, 126-138<br />
(Schleswig).<br />
BERANEK 2002: R. Beranek, Die frühgeschichtlichen <strong>Fernwege</strong> <strong>im</strong> Land Lauenburg. Beiträge für<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Kultur. Band 5, 21-38 (Wentorf bei Hamburg).<br />
BOCK 1996: G. Bock, Studien zur Geschichte <strong>Stormarn</strong>s <strong>im</strong> Mittelalter. <strong>Stormarn</strong>er Hefte 19, 1996<br />
(Neumünster).<br />
BOCK 1999: G. Bock, Siedlungsausbau <strong>und</strong> Kirchengründungen am Beispiel Rahlstedt.<br />
Rahlstedter Jahrbuch für Geschichte <strong>und</strong> Kultur 1999, 38-46 (Rahlstedt).<br />
67
BOCK 2002: G. Bock, Die <strong>Stormarn</strong>er Overboden <strong>und</strong> der Beginn der mittelalterlichen Ostsiedlung.<br />
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 127, 35-74<br />
(Neumünster).<br />
BOIGS 1966: L. Boigs, Mittelalterliche Fernstraßen um Neumünster. Zeitschrift der Gesellschaft für<br />
Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 91, 43-92 (Neumünster).<br />
BRUNS u. WECZERKA 1967: F. Bruns u. H. Weczerka, Hansische Handelsstraßen (We<strong>im</strong>ar).<br />
BUDESHEIM 1984: W. Budeshe<strong>im</strong>, Die Entwicklung der mittelalterlichen Kulturlandschaft des<br />
heutigen <strong>Kreis</strong>es Lauenburg unter besonderer Berücksichtigung der slawischen Besiedlung<br />
(Wiesbaden).<br />
BUDESHEIM 1989: W. Budeshe<strong>im</strong>, Der „l<strong>im</strong>es saxoniae“ in <strong>Stormarn</strong>. <strong>Stormarn</strong>er Hefte 14, 222-242<br />
(Neumünster).<br />
BUDESHEIM 1990: W. Budeshe<strong>im</strong>, Die slawischen Burgen als Siedlungen der Landnahme <strong>im</strong><br />
westabodritischen Siedlungsraum bis zum beginnenden 9. Jahrh<strong>und</strong>ert. Mitteilungen der<br />
Geographischen Gesellschaft in Hamburg, Band 80, 413-440 (Stuttgart).<br />
BUSCH 1999: R. Busch Hg., Die Burgen. Die Kunst des Mittelalters in Hamburg (Hamburg).<br />
BUSCH 2002: R. Busch, Ein neues Bild der alten Stadt, Domplatzgrabung in Hamburg, Teil II, 7-8<br />
(Neumünster).<br />
CLASEN 1934: M. Clasen, Das Heilsaugebiet in seinen alten Wegen <strong>und</strong> Landstraßen.<br />
Nordelbingen Bd. 10, Tl. 3 u. 4, 1934; 509-536 (Heide i. H.).<br />
CLASEN 1952: M. Clasen, Zwischen <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> L<strong>im</strong>es (Rendsburg).<br />
DENECKE 1969: D. Denecke, Methodische Untersuchungen zur historisch-geographischen<br />
Wegeforschung <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> zwischen Solling <strong>und</strong> Harz (Göttingen).<br />
DENECKE 1979: D. Denecke, Methoden <strong>und</strong> Ergebnisse der historisch-geographischen <strong>und</strong><br />
archäologischen Untersuchung <strong>und</strong> Rekonstruktion mittelalterlicher Verkehrswege.<br />
Geschichtswissenschaft <strong>und</strong> Archäologie 433-483 (Sigmaringen).<br />
DREYER-EIMBCKE 2004: O. Dreyer-E<strong>im</strong>bcke, Geschichte der Kartographie am Beispiel Hamburg<br />
<strong>und</strong> Schleswig-Holstein (Oldenburg).<br />
DULINICZ 1991: M. Dulinicz, Die frühe slawische Besiedlung in Ostholstein. Offa 48, 1991, 299-328<br />
(Neumünster).<br />
DULINICZ u. KEMPKE 1993: M. Dulinicz u. T. Kempke, Die frühslawische Siedlung Kücknitz,<br />
Hansestadt <strong>Lübeck</strong>. <strong>Lübeck</strong>er Schriften zur Archäologie <strong>und</strong> Kulturgeschichte, Bd. 23, 1993, 47-<br />
58 (Bonn).<br />
ECKOLDT 1980: M. Eckoldt, Schiffahrt auf kleinen Flüssen Mitteleuropas in Römerzeit <strong>und</strong><br />
Mittelalter. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 14 (Oldenburg – Hamburg –<br />
München).<br />
ECKOLDT 1998: M. Eckoldt, Einleitung Mittelalter. Flüsse <strong>und</strong> Kanäle, 10-38 (Hamburg).<br />
EGGERS u. NAGEL 1989: U. Eggers u. F. N. Nagel, Die alte Salzstraße <strong>und</strong> das Industriedenkmal<br />
Saline Lüneburg, Lauenburgische Akademie für Wissenschaft <strong>und</strong> Kultur, Jahrbuch 1989, 49-72<br />
(Neumünster).<br />
ERDMANN 1980: W. Erdmann, Fronerei <strong>und</strong> Fleischmarkt. <strong>Lübeck</strong>er Schriften zur Archäologie<br />
<strong>und</strong> Kulturgeschichte, Bd. 3, 107-159 (Bonn).<br />
ERDRICH u. VOSS 1997: M. Erdrich u. H.-U. Voß, Die Perlen der Germanen des 1.- 5 Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
68
in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein <strong>und</strong> Niedersachsen. Perlen, Archäologie,<br />
Techniken, Analysen (Bonn).<br />
FEHRING 1994: G. P. Fehring, Der <strong>Lübeck</strong>er Stadthügel Bucu in slawischer Zeit. Zur slawischen<br />
Besiedlung zwischen Elbe <strong>und</strong> Oder. Beiträge für Wissenschaft <strong>und</strong> Kultur, Band 1, 44-53<br />
(Neumünster).<br />
FISCHER 2003: N. Fischer, Verkehrswesen. <strong>Stormarn</strong> Lexikon, 373 f (Neumünster).<br />
FLOHN 1967: H. Flohn, Kl<strong>im</strong>aschwankungen in historischer Zeit. Die Schwankungen <strong>und</strong><br />
Pendelungen des Kl<strong>im</strong>as in Europa, 81-90 (Braunschweig).<br />
GABRIEL 1988: I. Gabriel, Oldenburg – Wolin – Staraja Ladoga – Novgorod – Kiev. Bericht der<br />
Römisch-Germanischen Kommission 69, 103-278 (Mainz).<br />
GLÄSER 1983: M. Gläser, Die Slawen in Ostholstein (Dissertation Universität Hamburg 1983).<br />
GOLTZ 1990: B. Goltz, Die slawische Burg von Klein Gladebrügge, <strong>Kreis</strong> Segeberg. Offa 47, 159-210<br />
(Neumünster).<br />
GRABOWSKI 2002: M. Grabowski, 150 Jahre Ausgrabungen in Alt <strong>Lübeck</strong>. Heiden <strong>und</strong> Christen<br />
Slawenmission <strong>im</strong> Mittelalter, 43-54 (<strong>Lübeck</strong>).<br />
GÜNTHER 2003: B. Günther, Wegewesen. <strong>Stormarn</strong> Lexikon, 393 f (Neumünster).<br />
HARCK 2002: O. Harck, Anmerkungen zur Frühgeschichte Hamburgs. Domplatzgrabung in<br />
Hamburg, Teil II, 9-94 (Neumünster).<br />
HARCK u. KEMPKE 2002: O. Harck u. T. Kempke, Archäologische F<strong>und</strong>stellen des Mittelalters in<br />
der Hamburger Altstadt, Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Hamburg<br />
Altstadt, 32-39 (Stuttgart).<br />
HATZ 1975: G. Hatz, Streifzug durch die hamburgische Münzgeschichte. 650 Jahre hamburgisches<br />
Münzwesen (Hamburg).<br />
HATZ 2002: G. Hatz, Münzf<strong>und</strong>e der Domplatzgrabungen in Hamburg (1980-1987).<br />
Domplatzgrabung in Hamburg, Teil II, 205-212 (Neumünster).<br />
HELMOLD: Helmold v. Bosau um 1170, Buch I u. II, Chronica Slavorum (Slawenchronik)<br />
v.HENNIGS 2003 a: B. v. Hennigs, Fresenburger Wallberg. <strong>Stormarn</strong> Lexikon, 112 (Neumünster).<br />
v. HENNIGS 2003 b: B. v. Hennigs, Nütschauer Schanze, <strong>Stormarn</strong> Lexikon, 276 (Neumünster).<br />
HERRMANN 1968: J. Herrmann; Siedlung, Wirtschaft <strong>und</strong> gesellschaftliche Verhältnisse der<br />
slawischen Stämme zwischen Oder/Neisse <strong>und</strong> Elbe (Berlin).<br />
HERRMANN 1985: J. Herrmann, Die Slawen in Deutschland (Berlin).<br />
HERRMANN 2003: J. Herrmann, Typen von Kommunikationswegen <strong>im</strong> frühen Mittelalter <strong>im</strong><br />
nordwestslawischen Gebiet. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des<br />
Mittelalters <strong>und</strong> Neuzeit 14, 55-70 (Heidelberg).<br />
HINGST 1959: H. Hingst, Vorgeschichte des <strong>Kreis</strong>es <strong>Stormarn</strong> (Neumünster).<br />
HÜBENER 1993: W. Hübener, Frühmittelalterliche Zentralorte <strong>im</strong> Niederelbegebiet. Hammaburg,<br />
N.F. 10, 167-193 (Neumünster).<br />
JANKUHN 1955: H. Jankuhn, Die Nütschauer Schanze. Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-<br />
Holsteinische Geschichte, Band 79, 257-266 (Neumünster).<br />
69
KATZCHKE 1973: E. Katzschke, Verkehrswege zwischen <strong>Lübeck</strong> <strong>und</strong> Hamburg.<br />
Postgeschichtliche Blätter 16, 1973 (Hamburg).<br />
KEMPKE 1989: T. Kempke, Bemerkungen zur Delvenau-Stecknitz-Route <strong>im</strong> frühen Mittelalter.<br />
Hammaburg, N.F. 9, 175-184 (Neumünster).<br />
KEMPKE 2002 a: T. Kempke, Slawische Keramik vom Hamburger Domplatz. Domplatzgrabung in<br />
Hamburg, Teil II, 95-152 (Neumünster).<br />
KEMPKE 2002 b: T. Kempke, Hauptorte <strong>und</strong> Bistümer des Slawenlandes. Heiden <strong>und</strong> Christen<br />
Slawenmission <strong>im</strong> Mittelalter, 79-89 (<strong>Lübeck</strong>).<br />
KERSTEN 1939: K. Kersten, Vorgeschichte des <strong>Kreis</strong>es Steinburg (Neumünster).<br />
KERSTEN 1940: K. Kersten, <strong>Frühgeschichtliche</strong> Heerwege um Stade. Stader Archiv 30, 55-72<br />
(Stade).<br />
KERSTEN 1951 a: K. Kersten, Vorgeschichte des <strong>Kreis</strong>es Herzogtum Lauenburg (Neumünster).<br />
KERSTEN 1951 b: K. Kersten, Zum Problem der ur- <strong>und</strong> frühgeschichtlichen Wege in<br />
Norddeutschland. In: Festschrift für G. Schwantes, 136-141 (Neumünster).<br />
KLIPPEL 1983: G. Klippel, Sachsenwald. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland,<br />
<strong>Kreis</strong> Hzgt. Lauenburg II, 14-19 (Stuttgart).<br />
KRÜGER 1932: H. Krüger, Die vorgeschichtlichen Straßen in den Sachsenkriegen Karls des<br />
Großen. Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- u.<br />
Altertumsvereine, Jg. 80, 223-380 (Berlin).<br />
LAUR 1992: W. Laur, Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein (Neumünster).<br />
LAUX 1997: F. Laux, Historische Daten <strong>und</strong> Zusammenhänge. Studien zur frühgeschichtlichen<br />
Keramik aus dem slawischen Burgwall bei Hollenstedt, Ldkr. Harburg; Hammaburg N.F. 11,<br />
87-107 (Neumünster).<br />
LECIEJEWICZ 1987: l. Leciejewicz, Sachsen in den slawischen Ostseestädten <strong>im</strong> 10.-12.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Zeitschrift für Archäologie 21, 75-81 (Berlin).<br />
MEIER 2003: D. Meier, Bauer/Bürger/Edelmann. Stadt <strong>und</strong> Land <strong>im</strong> Mittelalter (Ostfildern).<br />
MÜHRENBERG 2003: D. Mührenberg, <strong>Lübeck</strong>s Entwicklung bis 1201. Dänen in <strong>Lübeck</strong> 1203 -<br />
2003, 19-25 (<strong>Lübeck</strong>).<br />
MÜLLER-WILLE 2000: M. Müller-Wille, Fernhandel <strong>und</strong> Handelsplätze, Europas Mitte um 1000,<br />
128-135 (Stuttgart).<br />
MÜLLER-WILLE 2002: M. Müller-Wille, Schleswig-Holstein Drehscheibe zwischen den Völkern,<br />
Spuren der Jahrtausende, 368-387 (Stuttgart).<br />
NEUGEBAUER 1975: W. Neugebauer, Burgwallsiedlung Alt-<strong>Lübeck</strong> – Hansestadt <strong>Lübeck</strong>,<br />
Gr<strong>und</strong>linien der Frühgeschichte des Travemündungsgebietes, 123-142 (<strong>Lübeck</strong>).<br />
NEUMANN 1977: H. Neumann, Die Befestigungsanlage Olgerdige <strong>und</strong> der jütische Heerweg.<br />
Studien zur Sachsenforschung, 295-305 (Hildeshe<strong>im</strong>).<br />
POKAHR 1950: G. Pokahr, Über Grabungen an der Schwedenschanze bei Nütschau. Die He<strong>im</strong>at<br />
57, Heft 1, 2-3 (Neumünster).<br />
PRANGE 1960: W. Prange, Siedlungsgeschichte des Landes Lauenburg <strong>im</strong> Mittelalter<br />
(Neumünster).<br />
70
RADIS 1998: U. Radis, Neue archäologische Erkenntnisse zur slawischen <strong>und</strong> frühen deutschen<br />
Besiedlung <strong>Lübeck</strong>s. <strong>Lübeck</strong>ische Blätter 5, 69-72 (<strong>Lübeck</strong>).<br />
RAUTENBERG 1883: E. Rautenberg, Der Spökelberg bei Schiffbek. Zeitschrift des Vereins für<br />
Hamburger Geschichte, Bd. 7, 621-645 (Hamburg).<br />
SCHINDLER 1957: R. Schindler, Ausgrabungen in Alt Hamburg (Hamburg).<br />
SCHINDLER 1960: R. Schindler, Die Bodenaltertümer der Freien <strong>und</strong> Hansestadt Hamburg<br />
(Hamburg).<br />
SCHMIDT u. FORLER 2003: J. P. Schmidt u. D. Forler, Ergebnisse der archäologischen<br />
Untersuchungen in Jarmen, Lkr. Demmin, Die Problematik der Feuerstellenplätze in<br />
Norddeutschland <strong>und</strong> <strong>im</strong> südlichen Skandinavien. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-<br />
Vorpommern, Jb. 2003, 7-79 (Lübstorf 2004).<br />
SCHMITZ 1990: A. Schmitz, Die Ortsnamen des <strong>Kreis</strong>es Herzogtum Lauenburg <strong>und</strong> der Stadt<br />
<strong>Lübeck</strong> (Neumünster).<br />
SCHRECKER 1933: G. Schrecker, Das spätmittelalterliche Straßennetz in Holstein <strong>und</strong> Lauenburg,<br />
Teil 1. Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Band 61, 16-109<br />
(Neumünster).<br />
STARK 2003: J. Stark, Der frühslawische Bohlenweg <strong>im</strong> Klempauer Moor, Hansestadt <strong>Lübeck</strong>, <strong>und</strong><br />
der Burgwall von Klempau, Kr. Hzgt. Lauenburg. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für<br />
Archäologie des Mittelalters <strong>und</strong> Neuzeit 14, 85-91 (Heidelberg).<br />
STRUVE 1979: K. W. Struve, Die Bronzezeit, Geschichte Schleswig-Holsteins, 2. Band, 3-141<br />
(Neumünster).<br />
STRUVE 1961: K. W. Struve, Die slawischen Burgen in Wagrien. Offa 17/18, 1961, 57-108<br />
(Neumünster).<br />
STRUVE 1981: K. W. Struve, Die Burgen in Schleswig-Holstein, Band 1, Die slawischen Burgen<br />
(Neumünster).<br />
STRUVE 1991: K. W. Struve, Zur Geschichte von Starigard/Oldenburg. Starigard/Oldenburg, 85-<br />
102 (Neumünster).<br />
TROMNAU 1976: G. Tromnau, Die vor- <strong>und</strong> frühgeschichtliche Besiedlung <strong>im</strong> Bereich des<br />
Brennermoors bei Bad Oldesloe. <strong>Stormarn</strong>er Hefte 3, 1976, 71-74 (Neumünster).<br />
TROMNAU 1996: G. Tromnau, Tralau – ein Bestattungsplatz der Bronzezeit <strong>und</strong> vorrömischen<br />
Eisenzeit <strong>im</strong> <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong>, Holstein. Hammaburg, Neue Folge 10, 121-166 (Neumünster).<br />
VARENDORFKARTE 1789: Topographisch Militärische Charte des Herzogtums Holstein (1789-<br />
1796). Herausgegeben vom Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein 1987.<br />
VOGEL 1972: V. Vogel, Slawische F<strong>und</strong>e in Wagrien (Neumünster).<br />
WIECHMANN 1996: R. Wiechmannn, Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein.<br />
Offa-Bücher, Band 77 (Neumünster).<br />
WIETRZICHOWSKI 1993: F. Wietrzichowski, Untersuchungen zu den Anfängen des<br />
frühmittelalterlichen Seehandels <strong>im</strong> südlichen Ostseeraum unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Grabungsergebnisse von Groß Strömkendorf. Wismarer Studien zur Archäologie <strong>und</strong><br />
Geschichte, Bd. 3 (Wismar).<br />
71
WILLERT 1990: H. Willert, Anfänge <strong>und</strong> frühe Entwicklung der Städte Kiel, Oldesloe <strong>und</strong> Plön<br />
(Neumünster).<br />
WILLROTH 1986: K.-H. Willroth, Landwege auf der c<strong>im</strong>brischen Halbinsel aus der Sicht der<br />
Archäologie. Siedlungsforschung, Archäologie – Geschichte – Geographie, Band 4, 9-44 (Bonn).<br />
WILLROTH 1992: K.-H. Willroth, Untersuchungen zur Besiedlungsgeschichte der Landschaften<br />
Angeln <strong>und</strong> Schwansen von der älteren Bronzezeit bis zum frühen Mittelalter. Offa-Bücher, Bd.<br />
72 (Neumünster).<br />
WILLROTH 1993: K.-H. Willroth, Frühstädtische Siedlungen <strong>und</strong> Handelsplätze des südlichen<br />
Ostseegebietes <strong>und</strong> ihr Umland. Archäologie des Mittelalters <strong>und</strong> Bauforschung <strong>im</strong> Hanseraum,<br />
277-288 (Rostock).<br />
WILLROTH 1999: K.-H. Willroth, Krieger, Häuptlinge oder “nur” freie Bauern. Zum Wandel in der<br />
Bronzezeitforschung. Beiträge für Wissenschaft <strong>und</strong> Kultur, Band 3, 39-66 (Neumünster).<br />
ZICH 2002 a: B. Zich, Ochsenweg/Haervejen – Nordeuropas kulturhistorische Wirbelsäule. Wege<br />
als Ziel. Kolloquium zur Wegeforschung in Münster, 67-83 (Münster).<br />
ZICH 2002 b: B. Zich, Wie alt ist der Ochsenweg? Von Wegen. Flensburger Regionale Studien. Band<br />
12, 16-19 (Flensburg).<br />
Anmerkungen<br />
1) ZICH 2002 b, 19 (Landtransport Bronzezeit). Auch Fertigwaren aus Bronze gelangten von Süden,<br />
möglicherweise durch den Handel auf dem Elbstrom, nach Schleswig-Holstein. Als Beispiel<br />
seien hier die Bronzedolche aus dem Aunjetitzer Kulturkreis (Böhmen, Mitteldeutschland,<br />
Polen) angeführt. Sie regten die he<strong>im</strong>ische Flintindustrie zur Gestaltung der prächtigen<br />
Fischschwanzdolche an (STRUVE 1979, 11).<br />
2) Auf die Thematik der Grabhügelwege wird <strong>im</strong> Beitrag noch später eingegangen werden.<br />
3) Annales Regni Francorum (Reichsannalen) 798 <strong>und</strong> desgl. 804.<br />
4) ADAM II 15 b. Über den „L<strong>im</strong>es saxoniae“ wird weiter unten noch ausführlich berichtet.<br />
5) KRÜGER 1932, Karten 4 <strong>und</strong> 5; HERRMANN 1968, 124; HERRMANN 2003, 56.<br />
6) Leitlinien <strong>Fernwege</strong>netz: HERRMANN 1985, 136. Abb. 53; GABRIEL 1988, 105. Abb. 1. Über die<br />
frühmittelalterlichen Zentralorte: HÜBENER 1993, 177 f; WILLERT 1990, 277; WILLROTH 1993,<br />
284 f; MÜLLER-WILLE 2002, 368 f. Die Burgwälle von Oldenburg, Alt <strong>Lübeck</strong>, Plön <strong>und</strong><br />
Mecklenburg nahmen als Zentralorte während der slawischen Zeit wichtige überregionale<br />
Funktionen wahr. Am Kreuzungspunkt der <strong>Fernwege</strong> 1 <strong>und</strong> 2 <strong>und</strong> dem bereits früh schiffbaren<br />
Stecknitzfluss (Abb. 2) befand sich der Siedlungskomplex <strong>und</strong> vermutliche Handelsplatz<br />
Hammer (KEMPKE 1989, 178 f). Der Fernhandelsort Reric (Reichsannalen, Annales Regni<br />
Francorum 808/809) konnte durch neue Grabungen in Groß Strömkendorf an der Ostsee<br />
lokalisiert werden (WIETRZICHOWSKI 1993, 46; MÜLLER-WILLE 2002, 376 f). Hamburg ab<br />
831, Neumünster <strong>und</strong> Segeberg nach 1127 waren wichtige Stützpunkte der Ostmission.<br />
7) Capitular von Diedenhofen (Thionville) 805. Im weiteren Verlauf nach Norden erreichte der<br />
Fernweg, über das spätere Missionszentrum Hamburg führend, auch das frühmittelalterliche<br />
72
Wegenetz auf der C<strong>im</strong>brischen Halbinsel (u. a. WILLROTH 1986, 16 f).<br />
8) ADAM II 19. Reisezeit 7 Tage.<br />
9) ADAM II 18, Schol. 16. Reisezeit 1 Tag.<br />
10)LECIEJEWICZ 1987, 75-81.<br />
11)ASMUS 2002, 9.<br />
12)DENECKE 1969, 77.<br />
13)BRUNS u. WECZERKA 1967, 46 f.<br />
14) DENECKE 1979, 455.<br />
15)BRUNS u. WECZERKA 1967, 99; DENECKE 1979, 433. Gut f<strong>und</strong>ierte Beschreibungen des<br />
spätmittelalterlichen Wegenetzes <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> Schleswig-Holstein: SCHRECKER 1933; BOIGS<br />
1966; BRUNS u. WECZERKA 1967.<br />
16)KERSTEN 1951 b, 136.<br />
17)Literatur zum frühgeschichtlichen Wegenetz bzw. Verkehrswesen <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> zwischen Elbe <strong>und</strong><br />
Ostsee: KERSTEN 1951 a, 126-130; ERDMANN 1980, 112-116; GLÄSER 1983, 263-275;<br />
WILLROTH 1986, 9-44; GABRIEL 1988, 103-109; KEMPKE 1989, 175-184; MÜLLER-WILLE 2002,<br />
368-379; FISCHER 2003, 373 f; GÜNTHER 2003, 393 f.<br />
18)BERANEK 1997; BERANEK 2002. Das vom Autor beschriebene neue Wegenetz (BERANEK<br />
1997) wurde übernommen in der Monographie „Bauer/Bürger/Edelmann. Stadt <strong>und</strong> Land <strong>im</strong><br />
Mittelalter“ (MEIER 2003, 124 f). Ferner bewertet J. Herrmann die neuen Trassenführungen nach<br />
BERANEK 2002 als „bedeutende neue Detailkenntnisse“ <strong>im</strong> frühgeschichtlichen <strong>Fernwege</strong>netz <strong>im</strong><br />
nordwestslawischen Gebiet (HERRMANN 2003, 55).<br />
19)SCHINDLER 1960, 48 f. Die sehr gut dokumentierten Grabungen von 1980 bis 1987 erbrachten<br />
jedoch keine Hinweise auf eine Befestigung aus der 1. Hälfte des 9. Jahrh<strong>und</strong>erts. So ist die<br />
Lokalisierung der urk<strong>und</strong>lich überlieferten karolingerzeitlichen Hammaburg erneut in Frage<br />
gestellt. Aus topographischer Sicht könnte dieser frühe Wall möglicherweise unter der Neuen<br />
Burg auf dem Westufer der Alster gelegen haben (HARCK u. KEMPKE 2002, 37).<br />
20)Die entsprechenden Texte werden (in deutscher Sprache) wiedergegeben bei: BUSCH 2002, 7.<br />
21)HARCK u. KEMPKE 2002, 35 f.<br />
22)HARCK 2002, 80.<br />
23)1066 entstand jenseits der Alster, ca. 500 m südwestlich vom Domplatzgelände, die Neue Burg<br />
als Sitz der Herzöge. An dieser Stelle könnte, wie bereits erwähnt, möglicherweise die alte<br />
Hammaburg gelegen haben. Welche Bedeutung der Wasserweg bzw. die Häfen bereits in<br />
frühgeschichtlicher Zeit hatten, ist noch nicht ausreichend erforscht.<br />
24)KEMPKE 2002 a, 129.<br />
25)SCHINDLER 1957, 55.<br />
26)HATZ 1975, 10.<br />
73
27) HATZ 2002, 205.<br />
74<br />
28) SCHINDLER 1957, 52 u. 1960, 100.<br />
29) MÜLLER-WILLE 2002, 368.<br />
30) HARCK 2002, 12, Abb. 3.<br />
31)Über die naturbedingten Schwierigkeiten der Elbquerung bei Hamburg werden<br />
unterschiedliche Ansichten vertreten. Zweifelsohne war das Stromspaltungsgebiet der Elbe<br />
verkehrsbehindernd, doch gibt es für die hier behandelte Zeitspanne Hinweise auf eine<br />
verminderte Wasserführung der Elbe (<strong>und</strong> anderer norddeutscher Flüsse), verursacht durch<br />
eine Kl<strong>im</strong>awarmphase von ca. 900 bis 1200 n. Chr. (ECKHOLDT 1998, 12; FLOHN 1967, 85f).<br />
Demnach dürfte die Querung des Elbflusses in dieser frühen Zeit, insbesondere während der<br />
Niedrigwasser-Phase (Ebbe), weniger problematisch gewesen sein als es oft vermutet wird.<br />
Auch hat sich seit dem Mittelalter die topographische Situation zwischen Norder- <strong>und</strong><br />
Süderelbe wesentlich verändert. Noch <strong>im</strong> 12. Jahrh<strong>und</strong>ert lag in diesem Bereich die bewohnte<br />
<strong>und</strong> überwiegend als Weideland genutzte Insel Gorrieswerder. Erst spätere Sturmfluten haben<br />
diese große Flussinsel in zahlreiche kleine Inseln unterteilt (DREYER-EIMBCKE 2004, 248). Es<br />
liegen auch frühe schriftliche Berichte über regionale Kontakte zwischen Hamburg <strong>und</strong> den<br />
Gebieten südlich der Elbe vor. So erwähnt Adam von Bremen um 1070 Verbindungen der<br />
bischöflichen Hammaburg mit seinen „3 Meilen entfernten“ südlich der Elbe gelegenem Hof <strong>und</strong><br />
Kloster Ramelsloh (ADAM I 25, 32, 53; II 43; III 32). Nach KERSTEN 1940, 64 war der „militärisch<br />
wie auch handelspolitisch gleich günstig gelegene Elbübergang bei Harburg“ von besonderer<br />
Bedeutung.<br />
32) Dass in Artlenburg die Elbe günstig gequert werden konnte, ist <strong>im</strong> natürlichen Geschehen von<br />
Ebbe <strong>und</strong> Flut begründet. Die Strömung der Elbe <strong>und</strong> der Wasseranstieg durch die Flut in der<br />
Unterelbe trafen auf der Höhe Artlenburg aufeinander. Dies führte zu einer Verminderung der<br />
Fließgeschwindigkeit, was wiederum stärkere Sand- <strong>und</strong> Schlickablagerungen zur Folge hatte.<br />
Die Sandbänke ermöglichten so die Überschreitung des breiten Stromtales. Eine Querung<br />
konnte mit Pferden <strong>und</strong> Fuhrwerken erfolgen; doch in ungünstigen Fällen musste wohl mittels<br />
Booten übergesetzt werden.<br />
33)BUSCH 1999, 34.<br />
34)RAUTENBERG 1883, 632.<br />
35)KERSTEN 1951 a, 128 f; BERANEK 2002, 32 f.<br />
36)KERSTEN 1951 a, 129 f <strong>und</strong> Abb. 80 A. Die Abweichungen <strong>im</strong> <strong>Kreis</strong> <strong>Stormarn</strong> sind: Eine etwas<br />
weiter südlich gelegene Wegeführung zwischen Glinde <strong>und</strong> Witzhave (Grabhügelweg) <strong>und</strong> der<br />
Trassenverlauf entlang der Bille süd- <strong>und</strong> östlich der Hahnheide. Im Lauenburger <strong>Raum</strong> ist<br />
zunächst eine kleinere Abweichung be<strong>im</strong> Dorf Koberg vorhanden; <strong>im</strong> weiteren Verlauf sind die<br />
Abweichungen größer: So wird hier der Fernweg nicht wie bei K. Kersten zur Inselstadt<br />
Ratzeburg geführt, sondern verläuft etwas südlicher über Schmilau (1093 Schlacht bei Schmilau)<br />
weiter ins Mecklenburger Land (BERANEK 2002, 28 f).<br />
37)KERSTEN 1951 a, 129.<br />
38)Für den hier behandelten <strong>Raum</strong> hat G. Bock erstmals die Ausdehnung dieser Waldzone genauer<br />
untersucht. Er analysierte in seiner Arbeit die früheste Besiedlung der einzelnen Gemarkungen.<br />
Bock konnte nachweisen, dass <strong>im</strong> 11. <strong>und</strong> 12. Jahrh<strong>und</strong>ert einige
slawische Dörfer, wie z. B. Trittau, Linau <strong>und</strong> auch Lütjensee, sich inselartig etwa in der Mitte des<br />
Waldgebietes befanden (BOCK 2002, 38 f; Abb. 1). Zur Methode der Rekonstruktion der<br />
Altlandschaft PRANGE 1960, 34-41.<br />
39)HINGST 1959, 91 u. Abb. 7.<br />
40)ZICH 2002 a, 81; ZICH 2002 b, 19.<br />
41) BAKKER u. KNOCHE 2003, 22-25.<br />
42( WILLROTH 1999, 56 f.<br />
43) WILLROTH 1992, 63.<br />
44) Die Hügelkette besteht aus folgenden in der archäologischen Landesaufnahme (HINGST 1959,<br />
123-510, F<strong>und</strong>stellen-Verzeichnis) registrierten Grabhügeln: Oststeinbek LA 5-15, Glinde LA 7-<br />
29, Schöningstedt LA 1-100; 134-136, Witzhave 1-32.<br />
45) HINGST 1959, 429.<br />
46) KLIPPEL 1983, 15.<br />
47) Etwa 200 m flussaufwärts von der „Doktorbrücke“ – so die Bezeichnung in den heutigen<br />
Topographischen Karten 1 : 25.000 – kann man die Überreste einer alten Furt erkennen, die schon<br />
lange außer Betrieb <strong>und</strong> in neueren Karten nicht mehr verzeichnet ist (F<strong>und</strong>meldung 4.7.06, R.<br />
Beranek). Nach einer Schleife verbreitert sich der Fluss zu einer Seichtstelle, wobei die Strömung<br />
sichtbar abn<strong>im</strong>mt. Hier mündet ein kleiner Bach <strong>und</strong> bei normalem Wasserstand ist der feste<br />
Untergr<strong>und</strong> gut sichtbar. Er besteht aus mäßig großen Steinen, die zum Teil bis zur<br />
Wasseroberfläche anstehen. An beiden nicht sehr steilen Ufern erkennt man schwache<br />
Wegespuren. Eine Überprüfung des Kartenmaterials hat ergeben, dass in der ersten<br />
Vermessungskarte des Sachsenwaldes aus dem Jahre 1670 ein Weg eingezeichnet ist, der etwa<br />
von Aumühle aus geradlinig nach Norden bis zu der Furtstelle führt. Auf der Topographischen<br />
Karte von 1880 ist hier ein Fußweg zu erkennen, der über den Fluss hinweg nach Witzhave<br />
weiterführt. Auch quert hier noch heute die Grenze der <strong>Kreis</strong>e <strong>Stormarn</strong> <strong>und</strong> Herzogtum<br />
Lauenburg den Billefluss. Die Furt dürfte somit vor sehr langer Zeit intensiv genutzt worden<br />
sein.<br />
48)Am Hang des hier ansteigenden Geländes zum Waldgebiet Hahnheide ist in der<br />
Archäologischen Landesaufnahme die nur wenig erforschte Wallanlage „Trittau Vorburg“<br />
registriert (Trittau LA 211/212). Anhand von Keramikf<strong>und</strong>en wird sie grob in die<br />
mittelalterliche/frühneuzeitliche Zeitspanne datiert, doch könnte ein Teil der Befestigung<br />
möglicherweise aus frühgeschichtlicher Zeit stammen. Es handelt sich dabei um eine größere<br />
kegelförmige Erhebung. Von ihr aus konnte die unmittelbar vorbeiführende Wegetrasse in<br />
beiden Richtungen weit eingesehen bzw. kontrolliert werden.<br />
49) Über den „L<strong>im</strong>es saxoniae“ wird weiter unten noch ausführlich berichtet, wie Anm.4).<br />
50)Bei Koberg gibt es eine kleine Abweichung von der Trassenführung nach K. Kersten, Anm. 36).<br />
Im Nordosten der heutigen Ortschaft Koberg lag nächst der Fernwegtrasse das vor 1230<br />
gegründete deutsche Dorf Coberch. Der Platz dieser ursprünglichen <strong>und</strong> später verlagerten<br />
Siedlungsstelle konnte durch die Bezeichnung „Ohlendörp“ in der Flurkarte von 1772 (PRANGE<br />
1960, 179) sowie durch gut datierbare Keramikf<strong>und</strong>e lokalisiert werden.<br />
75
51) LAUR 1992, 513.<br />
76<br />
52) Hier besteht eine größere Abweichung von der Trassenführung nach K. Kersten, wie Anm. 36).<br />
53)Be<strong>im</strong> frühslawischen Burgwall Hammer (KERSTEN 1951 a, 123; KEMPKE 1989, 178 f;<br />
BERANEK 2002, 24 f) vereinigten sich zwei wichtige <strong>Fernwege</strong> (Abb. 2, 1 u. 2, 2). Sie querten<br />
mittels einer nachgewiesenen Furt den Stecknitzfluss. Es ist wahrscheinlich, dass auf der<br />
Stecknitz bereits in frühgeschichtlicher Zeit eine (beschränkte) Schifffahrt möglich war, die<br />
jedoch von etwa 900 bis 1200 während eines Kl<strong>im</strong>aopt<strong>im</strong>ums aussetzte (ECKOLDT 1980, 67;<br />
ECKOLDT 1998, 12; FLOHN 1967, 85 f). Dies dürfte auch ein Gr<strong>und</strong> dafür gewesen sein, dass der<br />
umfangreiche Burg- <strong>und</strong> Siedlungskomplex Hammer <strong>im</strong> 10. Jahrh<strong>und</strong>ert aufgegeben wurde. In<br />
Hammer gibt es starke Hinweise auf einen frühen Fernhandel. So konnten, zusätzlich zum<br />
slawischen F<strong>und</strong>gut, westliche Importe aus dem fränkisch/sächsischen Einflussgebiet<br />
nachgewiesen werden (KEMPKE 1989, 178). Auch zwei Bergkristall-Perlen, die nachweislich<br />
aus der Gegend des nördlichen Kaukasus stammen, wurden aufgef<strong>und</strong>en (Finder: E.-G.<br />
Burmester, Ratzeburg).<br />
54) PRANGE 1960, 50.<br />
55)HELMOLD I 34. Die vereinigten slawischen Truppen bedrohten den „abtrünnigen“<br />
Slawenkönig Heinrich in Alt <strong>Lübeck</strong>, der sich zum Christentum bekannt hatte <strong>und</strong> mit dem<br />
Sachsenherzog Magnus eng verb<strong>und</strong>en war. Magnus wurde um Waffenhilfe gebeten <strong>und</strong> zog<br />
mit holsteinischen Streitkräften in Eilmärschen herbei. Überraschend griffen die Hilfstruppen<br />
noch am späten Nachmittag an <strong>und</strong> schlugen die zahlenmäßig überlegenen slawischen<br />
Verbände. Es wird berichtet, dass die slawischen Kämpfer von der untergehenden Sonne stark<br />
geblendet wurden <strong>und</strong> man dies als göttliche Fügung auslegte. Sehr wahrscheinlich benutzten<br />
die sächsischen Hilfstruppen aus Hamburg kommend den hier beschriebenen Fernweg. Der<br />
Sammelplatz der slawischen Streitkräfte lag vermutlich be<strong>im</strong> ehemaligen slawischen Dorf<br />
smilowe, das 2 km südlich vom heutigen Ort Schmilau lokalisiert werden konnte (F<strong>und</strong>meldung<br />
1992/72, R. Beranek; Finder H. Göbe).<br />
56)PRANGE 1960, 50.<br />
57)Annales Regni Frankorum (Reichsannalen) 808/809. Die Lage des Handelsortes Reric war lange<br />
Zeit umstritten. Durch neuere archäologische Ausgrabungen konnte Reric nunmehr an der<br />
Küste bei der Insel Poel lokalisiert werden. Wie Anm. 6).<br />
58)Am Wegeknoten nördlich von Mölln befindet sich <strong>im</strong> Tangenberger Forst an der Abzweigung<br />
nach <strong>Lübeck</strong> ein gut ausgeprägtes Hohlwegrelikt. Hier ergab eine durch Grabung erfolgte<br />
Untersuchung, dass das vorgef<strong>und</strong>ene Bodenprofil von der neuzeitlichen Benutzung dieses<br />
Wegeabschnitts stammt (EGGERS u. NAGEL 1989, 57-59). Ausgangspunkt des Boizenburger<br />
Frachtweges ist Lüneburg mit der ab Mitte des 10. Jahrh<strong>und</strong>erts nachgewiesenen Produktion des<br />
begehrten Wirtschaftsgutes Salz. Der dabei wohl wichtigste Handelsstrom dürfte bereits früh<br />
zur Ostsee (<strong>Lübeck</strong>) geführt haben. Der Boizenburger Frachtweg wird allgemein als die älteste<br />
Salzstraße in Richtung Norden angenommen (PRANGE 1960, 47). Über den durch eine Burg<br />
gesicherten Elbübergang bei Boizenburg (Fähre) führte die Trasse, die heute in überbauter Form<br />
noch gut erhalten ist, in nahezu gerader Linie nach Fredeburg. Hier ist die Verkehrsanbindung<br />
zur Ostsee gegeben (Abb. 2, 1). Der Warenverkehr dürfte bereits <strong>im</strong> 11. Jahrh<strong>und</strong>ert eingesetzt,<br />
die Hauptnutzungszeit <strong>im</strong> 12. <strong>und</strong> 13. Jahrh<strong>und</strong>ert gelegen haben. Weitere verkehrsrelevante<br />
Zusammenhänge bei BERANEK 2002, 30 f.
59)HELMOLD I, 22.<br />
60)KERSTEN 1951 a, 128.<br />
61)SCHMITZ 1990, 252.<br />
62)STARK 2003, 87. Man kann annehmen, dass eine derart aufwendige <strong>und</strong> mehrphasige<br />
Bohlenwegkonstruktion der guten Wegverbindung der Burg Klempau zum Zentralort Alt<br />
<strong>Lübeck</strong> diente. Damit ergibt sich ein plausibler Zusammenhang mit dem hier beschriebenen<br />
Fernweg.<br />
63)GLÄSER 1983, 270; Anm. 328.<br />
64)Beschreibung des S-N-<strong>Fernwege</strong>s von Bardowick zur Ostsee: KERSTEN 1951 a, 126-128;<br />
ERDMANN 1980, 112-114; KEMPKE 1989, 175-184; BERANEK 2002, 21-38.<br />
65)Neue Beschreibung des <strong>Lübeck</strong>er Stadthügels in slawischer Zeit in MÜHRENBERG 2003, 22;<br />
Abb. 3 (Kartenentwurf M. Gläser). Die Höhenlagen <strong>und</strong> der geologische Aufbau des Stadthügels<br />
bzw. die umliegenden Gewässer werden mit einer umfangreichen Literaturliste auch<br />
beschrieben bei ERDMANN 1980, 148; Anm. 58.<br />
66)HELMOLD I 87.<br />
67)HELMOLD I 57. Aus dem Helmoldtext geht nicht sicher hervor, ob es sich dabei um eine<br />
günstige natürliche Anlegestelle oder aber schon um einen in slawischer Zeit ausgebauten Hafen<br />
handelt (MÜHRENBERG 2003, 21).<br />
68)ERDMANN 1980, 114.<br />
69)FEHRING 1994, 46.<br />
70) HELMOLD I 57: „Wall der verlassenen Burg Buku, die einst Cruto erbaut hatte“. (Crutos<br />
Herrschaftszeit 1066–1093).<br />
71)RADIS 1998, 72. Bei neueren Grabungen <strong>im</strong> Verlauf der heutigen Großen Burgstraße stieß man<br />
in 2 m Tiefe auf eine aus grauem Sand, sehr viel Flint- <strong>und</strong> Feldsteinen sowie aus<br />
Knochenabfällen bestehende kompakte Schicht. Die 2 – 6 cm starke Packung dürfte durch<br />
intensives Befahren <strong>und</strong> Belaufen entstanden sein. In einem Abstand von 1,2 m zeichneten sich<br />
zwei Fahrrinnen als 5 – 20 cm breite <strong>und</strong> 10 – 15 cm tiefe Gräbchen ab. Die auf etwa 20 m erfassten<br />
Wegespuren führten nicht direkt zum heutigen Burgtor, sondern zu einer weiter östlich<br />
liegenden Stelle an der Stadtmauer. Dort befindet sich ein zugemauertes, aber an der nördlichen<br />
Seite der Mauer noch gut sichtbares Portal, das in die Zeit um 1200 datiert wird. Als ein weiteres<br />
Ergebnis erbrachten die Grabungen, dass das Vorburgareal während der gesamten slawischen<br />
Zeit vom 8. bis zum 12. Jahrh<strong>und</strong>ert besiedelt war (RADIS 1998, 70).<br />
72) WIECHMANN 1996, 158-163, 309; MÜLLER-WILLE 2000, 132.<br />
73)NEUGEBAUER 1975, 133; KEMPKE 2002 b, 87.<br />
74)GRABOWSKI 2002, 52. Vermutlich gab es in Alt <strong>Lübeck</strong> auch eine Münzstätte. Die hier wohl<br />
unter dem slawischen Fürsten Heinrich erstellten Nachprägungen deutscher <strong>und</strong> dänischer<br />
Münzen sind <strong>im</strong> Wesentlichen von F<strong>und</strong>orten in Ostholstein, aber auch aus Westmecklenburg,<br />
Hamburg <strong>und</strong> dem nördlichen Niedersachsen überliefert. Da ebensolche Prägungen gleichfalls<br />
in den skandinavischen Ländern gesichert wurden, kann sowohl auf einen Nah- als auch auf<br />
einen Fernhandel geschlossen werden (MÜLLER-WILLE 2000, 135).<br />
75)KEMPKE 2002 b, 88.<br />
77
76)GABRIEL 1988, 103 f; MÜLLER–WILLE 2002, 381.<br />
78<br />
77)Im <strong>Raum</strong> Bad Segeberg befinden sich mehrere slawische Burgen. Besonders zu erwähnen ist die<br />
um das Jahr 900 datierte Anlage Klein Gladebrügge. Sie liegt nahe am von <strong>Lübeck</strong> kommenden<br />
Fernweg. Bei umfangreichen Grabungen wurden auch Teile einer wikingerzeitlichen<br />
Schnellwaage aufgef<strong>und</strong>en. Dieser Waagentyp ist vorwiegend zum Wiegen von gröberem<br />
Handelsgut wie Fisch, Wolle, Bronze <strong>und</strong> Eisen – aber nicht zum Abwiegen von Münzen oder<br />
Edelmetall - geeignet (GOLTZ 1990, 191 f). Vom <strong>Raum</strong> Segeberg aus ist der Anschluss an das<br />
nördliche schleswig-holsteinische Wegenetz mit dem Handelszentrum Haithabu <strong>und</strong> die<br />
Landverbindung nach Dänemark gegeben (BOIGS 1966, 60 f; ZICH 2002 a, 79 f).<br />
78)SCHRECKER 1933, 54 f; BRUNS-WECZERKA 1967, 148.<br />
79) CLASEN 1952, 25; CLASEN 1934, 532.<br />
80)SCHRECKER 1933, 55 f.<br />
81) Die Bezeichnungen „Lübsche Trade“ sowie „Lübsche Traal“ sind auch in Verbindung mit dem<br />
alten Fernweg von Dithmarschen nach <strong>Lübeck</strong> überliefert (SCHRECKER 1933, 73). Die<br />
Anfangsstrecke des Weges wird mit der 1127 durchgeführten Reise des Missionspriesters<br />
Vicelin von Meldorf nach Faldera, dem späteren Neumünster, in Zusammenhang gebracht<br />
(HELMOLD I 47, BOIGS 1966, 80). Der Ort wurde Stützpunkt für seine Missionsarbeit. Nach K.<br />
Kersten führte <strong>im</strong> Mittelalter die „Lübsche Trade“ durch den nördlichen Teil des <strong>Kreis</strong>es<br />
Steinburg <strong>und</strong> weiter über Neumünster <strong>und</strong> Segeberg nach <strong>Lübeck</strong>. Doch ließ sich bislang das<br />
Vorhandensein des Weges in spätsächsischer Zeit nicht nachweisen. Andererseits hält K.<br />
Kersten es für wahrscheinlich, dass die Trasse als Verbindungsweg vom Westen nach dem Osten<br />
bereits in vorgeschichtlicher Zeit bestanden hat (KERSTEN 1939, 155). Einige gut ausgeprägte<br />
mittelalterliche bzw. frühneuzeitliche Hohlwegspuren sind noch <strong>im</strong> Waldgebiet Aukrug<br />
nordöstlich von Meezen erhalten.<br />
82) ERDMANN 1980, 114.<br />
83) BOIGS 1966, 59; WILLERT 1990, 182<br />
84) BRUNS u. WECZERKA 1997, 137 f.<br />
85) ERDMANN 1980, 115.<br />
86) Auch hier hat G. Bock die Ausdehnung der Waldzone untersucht (BOCK 2002, 40; Abb. 1).<br />
Gleichfalls konnte er, als Aussparung in der Waldzone, einige inselartig gelegene frühe<br />
Ansiedlungen nachweisen.<br />
87) ADAM II 15 b. „Travena silvam“ wird überwiegend als Travewald nördlich von Oldesloe<br />
lokalisiert.<br />
88)Südwestlich von Eckernschmiede kann man noch heute in der Nähe eines Flussknies eine<br />
schwach ausgeprägte Böschung von etwa 300 m Länge <strong>im</strong> Wiesengelände erkennen. Auch in<br />
den neueren topographischen Karten ist sie als Hanglinie eingezeichnet. Es dürfte sich hier ein<br />
Relikt einer alten Wegetrasse erhalten haben.<br />
89)Der Gr<strong>und</strong> hierfür ist ein größeres Feuchtgebiet mit einem Abfluss zur Trave. Die<br />
Richtungsänderung des Weges ist in der (großmaßstäblichen) Karte Abb. 4 nicht ersichtlich.<br />
90) Der Gr<strong>und</strong> hierfür ist topographisch bedingt: Die Hänge des Kneedenberges reichen hier nahe<br />
an den Flusslauf der Trave heran. Bis in die neuere Zeit kam es in diesem Uferbereich <strong>im</strong>mer
wieder zu Überschwemmungen <strong>und</strong> auch ein gefährlicher Erdrutsch ist überliefert (BANGERT<br />
1925, 390 <strong>und</strong> 460). Auch eine spätere <strong>im</strong> 13. Jahrh<strong>und</strong>ert gebaute Straße wich dieser kritischen<br />
Stelle aus <strong>und</strong> schwenkte gleichfalls nach Nordwesten ab. Diese kürzere Verbindung, von<br />
<strong>Lübeck</strong> über Reinfeld nach Oldesloe führend, haben die Mönche vom Kloster Reinfeld<br />
insbesondere gebaut, um ihre wirtschaftlichen <strong>und</strong> kirchlichen Kontakte zur Stadt <strong>Lübeck</strong> zu<br />
verbessern. Diese Straßenführung verlief wie die heutige B<strong>und</strong>esstraße über Eckernschmiede<br />
[in Abb. 4: Ziegelhof], Reinfeld [Reinfelde] <strong>und</strong> Steinfelder Hude [Hude] zum beschriebenen<br />
kritischen Uferbereich be<strong>im</strong> Forst Kneeden. Eine direkt nach Oldesloe führende Straße, <strong>im</strong><br />
schwierigen Uferbereich der Trave, konnte erst ab 1800 ausreichend sicher befahren werden<br />
(KATSCHKE 1973, 36). Die nördlich gelegene Straßentrasse über Reinfeld ist in der Karte von<br />
1689 (Abb. 4) nicht verzeichnet. Dies ist ein Hinweis, dass der südliche (frühgeschichtliche) Weg<br />
noch über längere Zeit genutzt wurde.<br />
91) LAUR 1992, 397.<br />
92) DENECKE 1969, DENECKE 1979.<br />
93) Die ausgebaute Hauptspur wird in der Abb. 5 zeichnerisch hervorgehoben. Sie führt auf der<br />
Anhöhe als Redder in westlicher Richtung weiter.<br />
94)In der VARENDORFKARTE 1789 ist die Einzeichnung von nebeneinander liegenden<br />
Fahrrinnen als Trassenverbreiterung durchaus üblich.<br />
95) In diesem Geländeabschnitt haben sich eindeutig die Relikte eines ausgebauten Hangweges<br />
erhalten. Dieser Hohlwegtyp wird in der Fachliteratur unter der Kategorie „Reliefbedingter<br />
Wegebau“ behandelt: „... Um für einen <strong>im</strong> Hang verlaufenden Weg eine in sich ebene Trasse zu<br />
schaffen, musste von der Hangseite etwas abgegraben <strong>und</strong> zur Talseite hin etwas aufgeschüttet werden“.<br />
Zu erkennen ist „...der künstliche Ausbau bei Relikten alter Wege an einer besonders versteilten,<br />
hangseitigen Böschung <strong>und</strong> einem künstlichen, dammartigen Aufwurf an der Talseite, der aus dem<br />
abgegrabenen Material aufgeschüttet worden ist“ (DENECKE 1969, 76). Der so in den Hang gebaute<br />
Weg hat sich bei der späteren Nutzung zumeist stark eingetieft. D. Denecke konnte auch<br />
nachweisen, dass der Bau von Hangwegen mit aufwendigen Erdarbeiten nicht erst in der<br />
Neuzeit, sondern bereits <strong>im</strong> (späten) Mittelalter einsetzte (DENECKE 1969, 76-77). Hier<br />
werden einige Beispiele für besonders ausgeprägte Hangweg-Relikte, die durch künstlichen<br />
Wegebau entstanden sind, angeführt: Bei Dorsten <strong>im</strong> Harz (DENECKE 1969, Abb. 33); bei<br />
Wittenborn am Nordufer des Mözener Sees in Schleswig-Holstein (KERSTEN 1939, 153). Ferner<br />
sind derartige Wegerelikte auch westlich von Hammenstedt (Harz) <strong>und</strong> bei Attendorn<br />
(Westfalen) anzutreffen.<br />
96)Relikte von Naturwegen in Form von Spurenbündeln sind vornehmlich an kurzen steilen<br />
Anstiegen anzutreffen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Reiter, leichte Karren <strong>und</strong> andere<br />
frühe Verkehrsmittel oft den kürzesten steilen Weg wählten. Derartige unzerstörte<br />
Spurenbündel, mit Teilungen <strong>und</strong> Zusammenführungen, finden sich bei ihrer spezifischen<br />
Bindung meist an Hängen in Waldgebieten (DENECKE 1969, S. 62-65). In Gegenden mit<br />
vergleichsweise geringer Bergigkeit zeichnen sich die früh- <strong>und</strong> hochmittelalterlichen Trassen<br />
oft durch relativ max<strong>im</strong>ale Steigungen aus (DENECKE 1979, 455).<br />
97) Kurz hinter der heutigen Häusergruppe „Butterberg“ schwenkte <strong>im</strong> späten Mittelalter <strong>und</strong> in<br />
der Neuzeit (bis um das Jahr 1800) die nach Oldesloe führende Straße in südwestlicher<br />
79
80<br />
Richtung ab. Wie bereits erwähnt, war dies die Alternativstrecke zur oft unpassierbaren Straße<br />
<strong>im</strong> Flussbereich der Trave östlich von Oldesloe. Wie Anm. 90. In der VARENDORFKARTE 1789<br />
sind beide Trassen gleichrangig eingezeichnet.<br />
98) Nachweise: 1151/52 HELMOLD I 76; 1163 Urk<strong>und</strong>enbuch des Bistums <strong>Lübeck</strong> UBL, Nr. 4; 1175<br />
Urk<strong>und</strong>enbuch des Bistums <strong>Lübeck</strong> UBL, Nr. 11; 1188 Urk<strong>und</strong>enbuch der Stadt <strong>Lübeck</strong> UBStL I,<br />
7 (Barbarossa-Privileg), erwähnt bei BRUNS u. WECZERKA 1967, 138.<br />
99)SCHRECKER 1933, 85-86.<br />
100)BAUMGARTEN 1983, 215-219. Die F<strong>und</strong>sicherung erfolgte <strong>im</strong> Auftrag des zuständigen<br />
Landesamtes von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft für Vor- <strong>und</strong> Frühgeschichte (K. Chr.<br />
Baumgarten, G. Altmann <strong>und</strong> J. Harting, alle Bad Oldesloe).<br />
101)Diese Verzierung ist stärker vertreten <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> Mecklenburg. Die Keramikuntersuchung <strong>und</strong><br />
ihre Interpretation erfolgte durch T. Kempke (damals <strong>Lübeck</strong>).<br />
102)Möglicherweise hat es in Oldesloe bereits vor 1143 eine sogenannte Kaufmannskirche gegeben,<br />
die später zur Pfarrkirche umfunktioniert wurde. Dies wäre ein Anzeichen für eine sehr frühe<br />
Anwesenheit deutscher Fernkaufleute an diesem Ort (WILLERT 1990, 194 f).<br />
103)STRUVE 1961, 98; BAUMGARTEN 1983, 216. Ein wichtiger Ort mit Salzquellen <strong>und</strong> einer<br />
größeren Salzproduktion ist <strong>im</strong> slawischen Siedlungsraum Mittel- <strong>und</strong> Norddeutschlands vor<br />
allem Halle. Weniger bedeutend sind nach HERRMANN 1985, 124 Salzvorkommen in<br />
Brandenburg, Mecklenburg <strong>und</strong> Wagrien (!).<br />
104)HELMOLD I, 76; GLÄSER 1983, 202.<br />
105)DULINICZ 1991, 323.<br />
106)BUDESHEIM 1989, 237; auch HERRMANN 1985, 154 f, 188.<br />
107)STRUVE 1981, 88.<br />
108)HINGST 1959, 159 f; STRUVE 1981, 89. Die Angabe über in 2 m Tiefe vorgef<strong>und</strong>ene<br />
„Kulturschichten“ könnte mit der umfangreichen Bodenbewegung be<strong>im</strong> Abtragen des Walles<br />
zusammenhängen.<br />
109)Dendrodaten frühslawischer F<strong>und</strong>komplexe Ostholsteins: Bosau-Bischofswerder 822-870,<br />
Scharstorf 770-900, Alt <strong>Lübeck</strong> 819, Oldenburg um 866, Kl. Gladebrügge 894-897 (DULINICZ<br />
1991, 299-328, hier 315).<br />
110)DULINICZ 1991, 314 f ; DULINICZ u. KEMPKE 1993, 51 f. Bei den Untersuchungen der<br />
Gefäßränder nach Drehspuren konnten am frühslawischen Siedlungsplatz Kücknitz<br />
(Hansestadt <strong>Lübeck</strong>) einzelne F<strong>und</strong>komplexe gut unterschieden werden.<br />
111)Der Verfasser dankt Frau I. Ulbricht (Landesmuseum Schleswig) für die fre<strong>und</strong>liche<br />
Bereitstellung der Keramikf<strong>und</strong>e vom Fresenburger Wallberg.<br />
112)VOGEL 1972, 52; v. HENNIGS 2003 a, 112.<br />
113)„kneze“ ist ein Lehnwort aus dem Germanischen, „kunigaz“, d. h. unser König (LAUR 1992,<br />
397).<br />
114)Um Oldesloe zeigt die von G. Bock erstellte, für die frühgeschichtliche Zeit zutreffende,<br />
Waldkarte (BOCK 2002, 40; Abb. 1) größere besiedelte Areale.
115)POKAHR 1950, 2; HINGST 1959, 91; TROMNAU 1976, 71-74.<br />
116)HINGST 1959, 465.<br />
117)Deutlich ist zu erkennen, dass der bogenförmige Wallzug von der topographischen Lage<br />
best<strong>im</strong>mt wurde <strong>und</strong> sich daraus auch die räumliche Ausdehnung der Befestigung, d. h. ihre<br />
beträchtliche Größe, ergeben hat. Offensichtlich wurde das Erdreich für den Wall vorwiegend<br />
von der Hangseite abgetragen, so dass ein sehr tiefer Graben als erwünschtes<br />
Annäherungshindernis entstand.<br />
118)JANKUHN 1955, 263.<br />
119)Alte Interpretation: JANKUHN 1955, 257-266; HINGST 1959, 71. Neue Interpretation: VOGEL<br />
1972, 75; v. HENNIGS 2003 b, 276.<br />
120)Die Burg befindet sich in markanter Hochlage. An der Nordseite wird das Burgplateau durch<br />
den Travefluss begrenzt, der an dieser Stelle einen kräftigen Prallhang geschaffen hat. Ein steiler<br />
Abhang befindet sich auch an der Nordwestseite, wo der Fernweg als Hohlweg in einer tiefen<br />
Erosionsrinne die Burg flankiert. Auch zur Landseite hin, in südwestlicher Richtung, fällt das<br />
Burgplateau zu einer nassen Senke ab. Sie n<strong>im</strong>mt das Wasser einer hier befindlichen Quelle auf.<br />
Auch <strong>im</strong> Osten der Anlage ist das Gelände durch natürliche Rinnen bzw. Feuchtstellen, mit<br />
dazwischen liegenden Erhebungen, stark gegliedert (JANKUHN 1955, 258-260; HINGST 1959,<br />
71).<br />
121)Die Nütschauer Schanze dürfte, wie W. Budeshe<strong>im</strong> dargestellt hat, <strong>im</strong> Zuge der<br />
Grenzfestlegung zwischen dem fränkischen Reich <strong>und</strong> dem Slawenland („L<strong>im</strong>es saxiniae“) in<br />
den Jahren nach 810 von den Slawen aufgegeben worden sein (BUDESHEIM 1990, 431).<br />
122)ADAM II, 15 b.<br />
123)LAUX 1997, 103.<br />
124)STRUVE 1991, 88.<br />
125)Ausführlich behandelt zuletzt bei BUDESHEIM 1984, 53-67; speziell den <strong>Raum</strong> Oldesloe<br />
betreffend bei BUDESHEIM 1989, 223-242; etwas modifiziert bei BOCK 1996, 25-70.<br />
126)Die Auffindung <strong>und</strong> der Nachweis der künstlichen Schaffung des Grabens ist Herrn K. W. Grell<br />
(Bad Oldesloe) gelungen. Der Verfasser bedankt sich für diesbezügliche Informationen.<br />
127)Eine ähnliche Sperranlage, die der Überwachung des Verkehrs diente, befindet sich in<br />
Dänemark nahe der deutschen Grenze (Olderdige am jütischen Heerweg). Der Graben ist hier<br />
relativ klein; er wird jedoch von einer aufwendigen Palisadenreihe begleitet. Als Zeitstellung<br />
14<br />
wurde mit der C-Methode das Ende der älteren Kaiserzeit ermittelt (NEUMANN 1977, 295-<br />
305).<br />
128)HELMOLD I 35.<br />
129)HINGST 1959, 91 <strong>und</strong> Abb. 7. Im Originaltext wird die Grabhügelreihung in umgekehrter<br />
Richtung beschrieben. Zur besseren Übersicht werden hier in Abb. 6 nicht die einzelnen<br />
Grabhügel, sondern Grabhügelgruppen (ab fünf Hügeln) gezeigt. Die beschriebene<br />
Grabhügelkette besteht aus über 170 einzelnen Hügeln!<br />
130)Dieser Fernweg kommt aus dem nördlich gelegenen Siedlungsraum Segeberg bzw. vom<br />
frühmittelalterlichen Handelszentrum Haithabu mit der Verkehrsverbindung nach Dänemark,<br />
wie Anm. 77).<br />
81
131)Steinzeitliche Großsteingräber laut Archäologischer Landesaufnahme des <strong>Kreis</strong>es Bad<br />
Segeberg: Gemeinde Högersdorf LA 38, 37, 36; Gemeinde Schwissel LA 9, 41, 25, 17; Gemeinde<br />
Bebensee LA 36, 63, 62, 60. Von den zerstörten Grabmonumenten gibt es eine reichhaltige<br />
Dokumentation <strong>und</strong> auch einige Spuren <strong>im</strong> Gelände sind noch vorhanden. Der Verfasser dankt<br />
Herrn I. Clausen <strong>und</strong> Herrn J. Kühl (beide Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein) für<br />
wichtige Hinweise den <strong>Raum</strong> Segeberg betreffend.<br />
82<br />
132)Über einen diesbezüglichen repräsentativen Bef<strong>und</strong>, auch mit einem nachgewiesenen<br />
Grabhügelweg, wurde vor kurzem aus Holland berichtet (BAKKER u. KNOCHE 2003, 22).<br />
133)SCHMIDT u. FORLER 2003, 38. Bei der Funktion der „Kultfeuerplätze“ wird insbesondere die<br />
Verehrung des Feuers „<strong>im</strong> Rahmen eines diesseitsbezogenen Fruchtbarkeitskults“ angenommen.<br />
Während der Versammlungen, verb<strong>und</strong>en mit religiösen Zeremonien <strong>und</strong> Prozessionen,<br />
wurden vermutlich auch Speisen <strong>im</strong> Feuer zubereitet. Desgleichen kann man den „Feuerrauch<br />
gen H<strong>im</strong>mel zu den Göttern des Lichts“ als Beleg eines ausgeprägten Feuerkults werten. Als<br />
konkreter Anlass für besondere religiös motivierte Versammlungen kommen Feiern sowohl bei<br />
Aussaat <strong>und</strong> Ernte als auch zur Sonnenwende sowie zum Gedenken an die Stammesväter oder<br />
Ahnen in Betracht.<br />
134)Das Brandgrubenfeld Tralau wurde in den Jahren 1987 bis 1997 durch F<strong>und</strong>stellenbeobachtung<br />
vor der Zerstörung durch Kiesabbau archäologisch erfasst (Archäologische Landesaufnahme<br />
Tralau LA 97/98, 1990/1993 f). Es hatte eine Ausdehnung von ca. 100 x 200 m <strong>und</strong> bestand aus<br />
mindestens 170 flach eingetieften, meist r<strong>und</strong>en Steinsetzungen (Durchmesser bis ca. 1 m).<br />
Zwischen den walnuss- bis kindskopfgroßen, meist geglühten Granitsteinen fanden sich nur<br />
Holzkohlenreste <strong>und</strong> tiefschwarze Erde. Datierbare F<strong>und</strong>e kamen nicht zu Tage. Auffällig sind<br />
mehrfache lineare Anordnungen der Feuerstellen, die deutlich nach Nordwest ausgerichtet<br />
sind. Da sich hier das Zusammentreffen zweier bedeutender <strong>Fernwege</strong> abzeichnet, dürfte es<br />
sich um einen Versammlungsort von überregionaler Bedeutung gehandelt haben. Der Platz<br />
Tralau wird auch in dem kürzlich erschienenen zusammenfassenden Bericht über die<br />
Feuerstellenplätze Norddeutschlands <strong>und</strong> Südskandinaviens (SCHMIDT u. FORLER 2003, 62)<br />
erwähnt. Die Bef<strong>und</strong>e am Platz Tralau wurden erkannt <strong>und</strong> archäologisch gesichert von Herrn<br />
K.-Chr. Baumgarten, Frau H. Grell <strong>und</strong> Herrn K.-W. Grell aus Bad Oldesloe. Ihnen gebührt auch<br />
Dank für diverse Informationen über die archäologische Situation <strong>im</strong> <strong>Raum</strong> Oldesloe.<br />
135)Unmittelbar südlich der <strong>Kreis</strong>grenze zu Segeberg befanden sich neben dem Feldweg von<br />
Tralau nach Neversdorf zwei etwa 4 m breite, kräftig eingetiefte Wegerinnen in einer Länge von<br />
etwa 40 m (Abb. 6, g). Südlich davon in gut 2 km Entfernung entdeckte man <strong>im</strong> Bereich eines<br />
größeren Grabhügelfeldes bzw. be<strong>im</strong> beschriebenen Brandgrubenfeld die Spuren eines alten<br />
Weges (Abb. 6, f). Wiederum weiter südlich <strong>im</strong> Ortsbereich von Neritz befanden sich die Spuren<br />
einer Wegegabelung (Abb. 6, h). Der hier zutreffende Wegeast führte in nordsüdlicher Richtung<br />
in einer Länge von 1000 m bis in die Gemarkung des Ortes Elmenhorst (HINGST 1959, 465 u.<br />
311).<br />
136)Plätze mit bronzezeitlichem Fremdgut (Importe), Abb. 6, 1-4: 1 Oldesloe-Poggensee (Bronzeaxt<br />
aus Ungarn), 2 Oldesloe (nordische Hängedose), 3 Oldesloe-Brennermoor „Großer <strong>und</strong> Kleiner
Oldesloer Depotf<strong>und</strong>“ (Bronzetüllenbeile, Lanzenspitzen, Bronzehängebecken, Halskragen,<br />
Armringe u. a. „Ilmenaukreis – Südelbe“), 4 Bargteheide (nordisches Griffzungenschwert mit<br />
verzierter Knaufplatte). Genauere F<strong>und</strong>beschreibungen bei HINGST 1959, 39-44, 151-155, 170.<br />
137)Dazu in TROMNAU 1976, 74: „Es bestehen m. E. kaum Zweifel daran, daß dem mit der Natur eng<br />
verb<strong>und</strong>enen Menschen der Bronzezeit solche Stellen nicht aufgefallen wären. Hier wachsen Pflanzen,<br />
die sonst in der weiteren Umgebung nicht zu finden sind. Das Wasser schmeckt salzig <strong>und</strong> friert <strong>im</strong><br />
Winter nur bei stärkerem Frost zu. Im Frühjahr schmilzt hier zuerst der Schnee! Es ist daher denkbar,<br />
dass diese <strong>im</strong>mer wiederkehrenden Beobachtungen als göttliches Zeichen oder sogar als die Gegenwart<br />
einer Gottheit selbst aufgefasst worden sind“.<br />
138)Plätze mit eisenzeitlichem Fremdgut (Importe), Abb. 6, 5-7: 5 Oldesloe (römischer Schmuck<br />
<strong>und</strong> Münzen), 6 Bargteheide (römisches Trinkservice), 7 Tralau (Messer mit 3-eckiger<br />
Heftplatte stammend aus Ostfrankreich od. Skandinavien, aufgef<strong>und</strong>en von Frau Chr. Pingel,<br />
Bad Oldesloe). F<strong>und</strong>beschreibungen bei HINGST 1959, 57-59 u. TROMNAU 1996, 165.<br />
139)Fünf Glasperlen, zwei davon mit besonderen Mustern, wurden <strong>im</strong> Urnenfriedhof Tralau LA 58<br />
gef<strong>und</strong>en. Sie werden als „Perlen der Germanen des 1.-5. Jahrh<strong>und</strong>erts“ bezeichnet (ERDRICH u.<br />
VOSS 1997, 77). Vom eisenzeitlichen Friedhof Bünningstedt LA 9 stammen drei Glasperlen <strong>und</strong><br />
zwei weitere aus Bernstein vom bronzezeitlichen Grabhügel Bargteheide LA 11 (HINGST 1959,<br />
461, 189 u. 171). Eine sehr kleine Perle aus vermutlich feinkristallinem Gestein, die bislang noch<br />
nicht genauer best<strong>im</strong>mt werden konnte, fand Herr W. Siebenhaar (Bargteheide) in der Nähe des<br />
oben beschriebenen Brandgrubenfeldes Tralau.<br />
140)Der Grabauer See südwestlich des Ortes Grabau wurde erst 1486 durch Aufstauen der<br />
Norderbeste künstlich angelegt.<br />
141)In der Gemarkung Hoisbüttel befindet sich die bronzezeitliche Grabhügelgruppe LA 10-17. Sie<br />
setzt sich <strong>im</strong> angrenzenden Hamburger Gebiet fort (SCHINDLER 1960, 270/1). Laut Ortsakte<br />
Hoisbüttel (Archäologisches Landesamt Schleswig) war bei der archäologischen<br />
Landesaufnahme vor 1959 am Nordrand der Hügel LA 16 u. 17 noch eine alte Wegerinne zu<br />
erkennen. Auch bei HINGST 1959, 288 sind Wegespuren angeführt.<br />
142)BOCK 1999, 44 f.<br />
143)SCHINDLER 1960, 270/1, 69, 159, 278-280, 197-200.<br />
144)SCHRECKER 1933, 81-92; BRUNS u. WECZERKA 1967, 141-142.<br />
145)SCHRECKER 1933, 88.<br />
146)KEMPKE 2002 a, 129.<br />
147)MÜLLER-WILLE 2002, 368.<br />
83