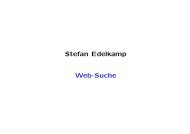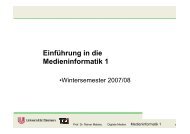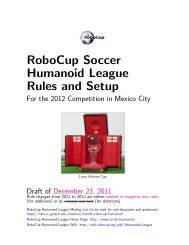Diplomarbeit Das L2L-Network: Ein Geschäftsmodell und ... - TZI
Diplomarbeit Das L2L-Network: Ein Geschäftsmodell und ... - TZI
Diplomarbeit Das L2L-Network: Ein Geschäftsmodell und ... - TZI
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Diplomarbeit</strong><br />
<strong>Das</strong> <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>:<br />
<strong>Ein</strong> <strong>Geschäftsmodell</strong> <strong>und</strong> Architekturkonzept<br />
für ein Netzwerk ortsbezogener Dienste<br />
Hendrik Witt<br />
Bremen, den 22. April 2004<br />
Fachbereich Mathematik <strong>und</strong> Informatik<br />
Gutachter:<br />
1. Prof. Dr. Otthein Herzog<br />
2. Dr. Andreas Breiter
Vorwort<br />
<strong>Das</strong> <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Projekt, aus dem die in dieser Arbeit thematisierte Idee eines Netz-<br />
werkes ortsbezogener Dienste entstammt, hat seinen Ursprung in der Arbeitsgruppe für<br />
Mobiles- <strong>und</strong> Wearable-Computing ([wearLab])[Wea04] des Technologie Zentrum Infor-<br />
matik (<strong>TZI</strong>) an der Universität Bremen.<br />
Bis zum heutigen Zeitpunkt wird das <strong>L2L</strong>-Projekt noch mit dem Status intern innerhalb<br />
des <strong>TZI</strong> geführt <strong>und</strong> ist bis dato nach außen hin noch nicht mit Veröffentlichungen o.ä.<br />
in Erscheinung getreten. <strong>Das</strong> Projekt besteht seit der Gründung aus zwei Personen, dem<br />
damaligen Leiter des [wearLab], Dr. Michael Boronowsky, <strong>und</strong> dem Autor dieser Arbeit.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die hier vorliegende Arbeit im wesentlichen eine Dokumentation der<br />
aktuellen Forschungsergebnisse des <strong>L2L</strong>-Projektes <strong>und</strong> soll als Gr<strong>und</strong>lage für weitergehen-<br />
de Forschungen dienen.<br />
i
” Die Visionäre der Gegenwart sind die Realisten der Zukunft.“<br />
[ Helmut Kohl ]<br />
I
Inhaltsverzeichnis<br />
1 <strong>Ein</strong>leitung 1<br />
1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br />
1.1.1 Aktuelle Trends auf dem Mobilfunksektor . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />
1.1.2 <strong>Das</strong> <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
1.2 Ziele <strong>und</strong> Abgrenzungen der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
1.3 Struktur der vorliegenden Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
2 Gr<strong>und</strong>lagen 7<br />
2.1 Ortsbezogene Dienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
2.1.1 Inhaltliche Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
2.1.2 Gr<strong>und</strong>legende Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
2.1.3 Positionierungstechniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
2.1.4 Bestehende Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
2.2 Peer-to-Peer Netzwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
2.2.1 Inhaltliche Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
2.2.2 Arten von Peer-to-Peer Netzwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
2.2.3 Peer-to-Peer als mögliche Basis für ortsbezogene Dienste . . . . . . . 22<br />
3 <strong>Ein</strong> <strong>Geschäftsmodell</strong> für ortsbezogene Dienste 27<br />
3.1 Gr<strong>und</strong>lagen zu <strong>Geschäftsmodell</strong>en für mobile Anwendungen . . . . . . . . . 27<br />
3.2 Marktanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
3.2.1 Mobile Märkte zwischen Hype <strong>und</strong> Realismus . . . . . . . . . . . . . 31<br />
3.2.2 Der Markt für ortsbezogene Dienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
3.2.3 Die Rolle der Nutzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />
3.2.4 Zusammenfassung der Marktanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />
3.3 Die Geschäftsidee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
3.3.1 Nutzungsszenario des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />
3.3.2 Aufgaben der Netzwerk-Teilnehmer innerhalb des Szenarios . . . . . 41<br />
3.4 Die Wertschöpfungskette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
3.4.1 Die Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
3.5 Perspektiven eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . 47<br />
3.5.1 Unterschiedliche Wege der Realisierung . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
3.5.2 Die Erlösquellen des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />
II
INHALTSVERZEICHNIS III<br />
3.5.3 Die Preis- <strong>und</strong> Produktstrategie des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . 53<br />
3.5.4 <strong>Das</strong> K<strong>und</strong>ensegment des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . 57<br />
3.5.5 Der Wertbeitrag des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />
3.6 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
4 Architekturkonzepte für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> 63<br />
4.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
4.1.1 Identifikation von Komponenten des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . 63<br />
4.1.2 Struktureller Aufbau des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />
4.2 Der <strong>L2L</strong>-Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
4.3 Die <strong>L2L</strong>-Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />
4.3.1 Query Performing Modul (QPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />
4.3.2 Resultset Rendering Modul (RRM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />
4.3.3 Content Exchange Module (CEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />
4.4 <strong>Das</strong> Konzept der Service Scopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />
4.5 <strong>Das</strong> Konzept des Location Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />
4.6 <strong>Ein</strong> Location Model für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />
4.6.1 Relation zwischen Location Contexten . . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />
4.6.2 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />
5 Räumliches Schließen 80<br />
5.1 Region Connection Calculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />
5.1.1 RCC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
5.1.2 RCC8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
5.2 Schließen über räumliche Relevanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />
5.2.1 Beschreibung räumlicher Anordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />
5.2.2 Räumliche Relevanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
5.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />
6 Datenaustausch auf Basis räumlicher Relevanz 93<br />
6.1 Idee des Content Exchange Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />
6.1.1 Der Austausch-Mechanismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
6.2 Formalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />
6.2.1 Erweiterte räumliche Relevanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />
6.2.2 Bestimmung der auszutauschenden Daten . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />
6.2.3 Veränderung von Meta-Daten durch den Datenaustausch . . . . . . 101<br />
6.2.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />
7 Fazit <strong>und</strong> Ausblick 103<br />
7.1 Zusammenfassung <strong>und</strong> kritische Reflexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Abbildungsverzeichnis<br />
1.1 Markt für standortbezogene Dienste (Prognose) Quelle: [Kur02] . . . . . . 2<br />
1.2 <strong>L2L</strong>-Projekt: Forschungsschwerpunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
2.1 Arten von Peer-to-Peer Netzwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
3.1 Die Komponenten eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s nach Zobel [Zob01] . . . . . . . . 29<br />
3.2 Durchschnittliche Ertragsquellen pro Nutzer in Europa [Dur01b] . . . . . . 32<br />
3.3 mCommerce Hype-Kurve [Dur01a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
3.4 Markt für standortbezogene Dienste (Prognose) Quelle: [Kur02] . . . . . . 34<br />
3.5 Der zeitlich unterschiedliche Verlauf der Hype-Kurven von mCommerce <strong>und</strong><br />
ortsbezogenen Diensten (eigene Darstellung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
3.6 Nutzerinteresse an Anwendungen im Bereich mCommerce nach [The00] . . 36<br />
3.7 Motive für die Nutzung von mCommerce Angeboten [The00] . . . . . . . . 37<br />
3.8 K<strong>und</strong>enanforderungen an mCommerce Angebote [Zob01] . . . . . . . . . . . 37<br />
3.9 Beispiel-Szenario für eine mögliche Nutzung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . 41<br />
3.10 Die Wertschöpfung innerhalb eines Produktionsprozesses angelehnt an [Sto69] 43<br />
3.11 Die Wertschöpfungskette des mBusiness nach Zobel [Zob01] . . . . . . . . . 44<br />
3.12 Die Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
3.13 Die strategische Ausrichtung zwischen Unabhängigkeit <strong>und</strong> Marktchancen . 49<br />
3.14 Art <strong>und</strong> Systematik der Erlösformen nach [PRW01] . . . . . . . . . . . . . . 50<br />
3.15 Mögliche Erlösquellen innerhalb der Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s 52<br />
3.16 Generelle Preisstrategien nach Clement [Cle02] . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
4.1 <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Komponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />
4.2 <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Umgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
4.3 Modul-Interaktion während des Integrationsprozesses . . . . . . . . . . . . . 69<br />
4.4 Basis-Architektur der <strong>L2L</strong>-Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />
4.5 Scope-based Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />
4.6 Erweitertes Scope-based Model mit Skalierung . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
4.7 Location-Model des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />
4.8 Inklusionsbeziehungen innerhalb des Location Models . . . . . . . . . . . . 78<br />
5.1 Definition der RCC5-Relationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
5.2 Definition der RCC8-Relationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
IV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS V<br />
5.3 Dekompositions-Hierarchie einer Polygon-Tessilierung . . . . . . . . . . . . 83<br />
5.4 Homogene Polygon-Tessilierung in Form eines Rasters . . . . . . . . . . . . 84<br />
5.5 Dekompositions-Baum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />
5.6 Abstraktion einer Region mittels einer pSRT . . . . . . . . . . . . . . . . . 85<br />
5.7 Unterschiede der Abstraktion mittels unterer <strong>und</strong> oberer Schranke . . . . . 86<br />
5.8 Erzeugung eines Nachbarschaftsgraphs GP auf Basis einer pSRT P . . . . . 88<br />
5.9 Berechnung der räumlichen Relevanz in Abhängigkeit von α . . . . . . . . 91<br />
6.1 Schematischer Fluß von Informationseinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 94<br />
6.2 Datenaustausch zwischen <strong>L2L</strong>-Units mittels des CEM . . . . . . . . . . . . 95
Tabellenverzeichnis<br />
2.1 Definitionsansätze für ortsbezogene Dienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
2.2 Positionierungstechniken im Überblick [Dur01b] . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
3.1 Abschöpfungs- <strong>und</strong> Penetrationsstrategie im Vergleich nach Wöhe [Wöh02] 56<br />
5.1 Basisrelationen des RCC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
5.2 Werte-Tabelle der RCC5-Relationen. T=True, F=False . . . . . . . . . . . 81<br />
6.1 Exemplarische Wertetabelle der deklarierten Relevanz . . . . . . . . . . . . 100<br />
VI
Kapitel 1<br />
<strong>Ein</strong>leitung<br />
1.1 Motivation<br />
Mobile Computer <strong>und</strong> Kommunikationsgeräte, wie Handy’s oder PDA’s (Personal Digital<br />
Assistants), haben in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Neue Möglichkei-<br />
ten haben sich für Unternehmen ergeben, mit ihren potentiellen K<strong>und</strong>en in Verbindung zu<br />
treten - jeder Zeit an jedem Ort. In diesem Zusammenhang ist nicht nur die Entwicklung<br />
modernerer <strong>und</strong> leistungsfähigerer Endgeräte von Bedeutung, sondern auch jene Entwick-<br />
lung mobiler Applikationen, die durch mobile Endgeräte, wie Handys oder zukünftige<br />
Smartphones, genutzt werden können.<br />
Die Entwicklung von mobilen Endgeräten scheint zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr<br />
das zentrale Problem für den Erfolg oder Mißerfolg am Mobilfunkmarkt zu sein. Viele<br />
am Markt verfügbare Geräte haben bereits heute einen höheren Leistungsumfang als der<br />
durchschnittliche Nutzer alltäglich benötigt. So ist es nicht verw<strong>und</strong>erlich, daß der Markt<br />
für Mobiltelefone nach aktuellen Analysen in weiten Teilen als gesättigt gilt. Dieses geht<br />
damit einher, daß aktuelle Prognosen über die Verbreitung von Computern nicht mehr<br />
länger daran gemessen werden, wieviele Personen einen Computer besitzen, sondern viel-<br />
mehr daran, wieviele Computer eine Person besitzt [DR99].<br />
Aufgr<strong>und</strong> dieser aktuellen Situation scheint es sinnvoll, sich in Zukunft stärker mit er-<br />
folgversprechenden mobilen Diensten bzw. Anwendungen auseinanderzusetzen als mit der<br />
Entwicklung neuer Mobiltelefone. Dieses gilt nach Analysten insbesondere für den Erfolg<br />
des Mobilfunks der dritten Generation (3G) <strong>und</strong> damit UMTS (Universal Mobile Tele-<br />
communication System) - dessen <strong>Ein</strong>führung kurz bevorsteht. <strong>Ein</strong>e Studie des Marktfor-<br />
schungsunternehmens TNS Emnid, die in zehn europäischen Ländern durchgeführt wurde,<br />
unterstreicht diese Analyse. Ihr nach sind 42 Prozent der Befragten an Angeboten <strong>und</strong><br />
Diensten der neuen Moblilfunkgeneration interessiert.<br />
Besonders interessant scheinen in diesem Zusammenhang ortsbezogene Mobilfunkdienste<br />
zu sein; jene Dienste, die auf Basis des aktuellen Aufenthaltsorts einer Person passende<br />
Informationen zur Verfügung stellen. Nach einer Studie von The Strategis Group steigt die<br />
Zahl der Nutzer für ortsbezogene Dienste - Location Based Services (LBS) - weltweit von<br />
derzeit 70 Millionen auf 220 Millionen im Jahr 2005, was ein Anstieg um ca. 300 Prozent<br />
1
KAPITEL 1. EINLEITUNG 2<br />
Mio. US $<br />
10000<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1,6<br />
13,2<br />
75<br />
195<br />
Markt für standortbezogene Dienste<br />
742<br />
1125<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
2451<br />
Nordamerika Europa<br />
Abbildung 1.1: Markt für standortbezogene Dienste (Prognose) Quelle: [Kur02]<br />
bedeutet. Abbildung 1.1 veranschaulicht diesen Sachverhalt aus der Wachstumsperspek-<br />
tive des Marktes im direkten Vergleich Europas mit Nordamerika. <strong>Ein</strong>e Emnid-Umfrage<br />
bestätigt dieses Interesse der Anwender ebenfalls: 80 Prozent finden ortsbezogene Dien-<br />
ste nützlich. Allerdings wird die Akzeptanz von LBS beim Verbraucher maßgeblich vom<br />
Mehrwert der mobil zur Verfügung gestellten Informationen <strong>und</strong> Anwendungen abhängen.<br />
1.1.1 Aktuelle Trends auf dem Mobilfunksektor<br />
<strong>Das</strong> momentan wohl bedeutendste Thema im Bereich Mobilfunk ist neben der Verbreitung<br />
von WLAN Hotspots in Großstädten, wie Hamburg oder München, immer noch UMTS.<br />
In der Vergangenheit hat die Versteigerung der UMTS-Lizenzen durch die Regulierungs-<br />
behörde für Telekommunikation <strong>und</strong> Post (RegTP) für Schlagzeilen in der Medienland-<br />
schaft gesorgt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde nach Auffassung vieler der Besitz von<br />
UMTS-Lizenzen als besonders wichtig für die zukünftige strategische Planung der großen<br />
Telekommunikationskonzerne, wie Deutsche Telekom, D2 Vodafone oder aber Mobilcom,<br />
eingestuft. Dieses führte dazu, daß für den Erwerb einer UMTS-Lizenz horrende Beträge in<br />
Milliarden Höhe gezahlt wurden <strong>und</strong> so eine erhebliche finanzielle Belastung für die Kon-<br />
zerne entstand. In der Zeit nach der Vergabe der Lizenzen wurden die einst euphorischen<br />
Stimmen für UMTS leiser <strong>und</strong> die Prognosen zunehmend realistischer, was unweigerlich<br />
zur Folge hatte, daß der Druck auf die Lizenzbesitzer aufgr<strong>und</strong> ihrer hohen finanziellen<br />
Investitionen zunahm.<br />
Nach einer in der Computer Zeitung vom 7. Februar 2003 zitierten Studie aus dem Hause<br />
Arthur D. Little wird sich UMTS nach Meinung der Analysten langsamer verbreiten als<br />
bisher angenommen. Dieses wurde dadurch begründet, daß es mit Hilfe moderner Tech-<br />
nologien möglich sein wird, durch den Mobilfunkstandard General Packet Radio Service<br />
3240<br />
4556<br />
6039<br />
6518<br />
9167
KAPITEL 1. EINLEITUNG 3<br />
(GPRS) 90 Prozent der neuen Multimediadienste auch ohne UMTS abzubilden. Aus die-<br />
sem Gr<strong>und</strong> sind die Provider der kommenden UMTS-Netze derzeit extrem daran inter-<br />
essiert, neue Dienste zu entwickeln, die die vorhandenen technischen Möglichkeiten von<br />
UMTS ausschöpfen, um so ihre K<strong>und</strong>en zu einem Umstieg auf die neuere Technik nach-<br />
haltig zu motivieren.<br />
Genau in diesem Bereich von mobilen Anwendungen <strong>und</strong> der Suche nach der ” Killerappli-<br />
kation“ können nach Meinung von Experten ortsbezogene Dienste angesiedelt werden, da<br />
z.B. für mehrwertorientierte ortsbezogene Dienste eine permanente Verbindung zum In-<br />
ternet, wie bei UMTS möglich, mehr als günstig wäre. Aber auch die Weiterentwicklungen<br />
auf dem Mobiltelefonmarkt <strong>und</strong> die Bestrebung der Hersteller, Positionierungstechnologie<br />
bereits ab Werk in ihre Geräte zu integrieren, eröffnet ein günstiges Umfeld für die Ent-<br />
wicklung ortsbezogener Dienste. Beispielsweise kündigte Motorola noch für 2003 UMTS-<br />
Handys mit standardmäßig integrierten GPS-Modul (Global Positioning System) an. Intel<br />
stellte bereits auf der CeBit 2003 in Hannover seinen neu entwickelten Manitoba Handy-<br />
chip vor. Dieser Chip soll nach Aussagen von Intel PR-Manager Peter Hayard gegenüber<br />
DIE WELT (Ausgabe vom 25. Februar 2003) ” ein Chip für die nächste Handygeneration“<br />
sein <strong>und</strong> die Rechenleistung von Handys stark in Richtung PC weiterentwickeln.<br />
Betrachtet man zusammenfassend den aktuellen Mobilfunkmarkt, so läßt sich erkennen,<br />
daß der Druck auf die Telekommunikationskonzerne immer stärker zunimmt, ihre K<strong>und</strong>en<br />
für die neue Generation von Mobilfunknetzen zu begeistern <strong>und</strong> sie zu einem Wechsel zu<br />
bewegen. <strong>Ein</strong> Wechsel der K<strong>und</strong>en zu UMTS wird aber nur dann in breiter Masse zu<br />
verzeichnen sein, wenn es den Konzernen gelingt, neue, für den K<strong>und</strong>en nützliche Anwen-<br />
dungen zu entwickeln, die die technischen Möglichkeiten von UMTS ausschöpfen. <strong>Ein</strong>e<br />
dieser gesuchten Anwendungen könnten hierbei die ortsbezogenen Dienste sein.<br />
1.1.2 <strong>Das</strong> <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Projekt<br />
<strong>Das</strong> Location-to-Location <strong>Network</strong> (<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>) Projekt erforscht Konzepte <strong>und</strong> Me-<br />
thoden für ortsbezogene Dienste. Hierbei liegt das zentrale Augenmerk innerhalb des Pro-<br />
jektes bei der Konzeption einer geeigneten Netzwerk-Infrastrukturbasis für ortsbezogene<br />
Dienste. Zum aktuellen Zeitpunkt wird die Forschung in diesem Bereich in Richtung ei-<br />
nes Peer-to-Peer Netzwerkes vorangetrieben. <strong>Ein</strong> Peer-to-Peer Netzwerk ist in diesem Fall<br />
primär dadurch charakterisiert, daß einzelne <strong>Ein</strong>heiten innerhalb eines Netzwerkes (hier<br />
Peers genannt) sowohl Client als auch Server sein können.<br />
Über die eigentliche Entwicklung eines Architekturmodells für ortsbezogene Dienste hin-<br />
aus erhebt das Projekt den Anspruch, die entwickelte Architektur bzw. deren Konzepte<br />
für Unternehmen interessant zu machen <strong>und</strong> versucht damit, die häufig auftretende Lücke<br />
zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen <strong>und</strong> praktischer Verwertbarkeit zu schließen.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die Entwicklung eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s für das zu entwickelnde<br />
Konzept eines ortsbezogenen Dienstes ebenfalls eine wichtige Säule innerhalb des Projek-
KAPITEL 1. EINLEITUNG 4<br />
Business Model<br />
Prototype Development<br />
The <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Project<br />
- Research Topics -<br />
Data Annotation Framework<br />
Concept’s &<br />
Architecture<br />
Abbildung 1.2: <strong>L2L</strong>-Projekt: Forschungsschwerpunkte<br />
tes. Abbildung 1.2 beinhaltet eine Übersicht aller Forschungsgebiete, die im <strong>L2L</strong>-Projekt<br />
primär verfolgt werden sollen.<br />
1.2 Ziele <strong>und</strong> Abgrenzungen der Arbeit<br />
Aufgr<strong>und</strong> der eingangs beschriebenen Möglichkeiten, die ortsbezogenen Diensten zuge-<br />
sprochen werden, scheint eine Auseinandersetzung mit dem Thema ortsbezogener Dienste<br />
nicht nur aktuell sondern auch zukunftsträchtig zu sein.<br />
Die vorliegende Arbeit soll versuchen, eine mögliche neue Sichtweise auf ortsbezogene<br />
Dienste zu präsentieren <strong>und</strong> dabei nicht nur ein isoliertes Architekturkonzept als Lösung<br />
für noch offene Probleme im Bereich der ortsbezogenen Dienste vorzustellen, sondern sich<br />
zusätzlich mit einer realen Verwertbarkeit der hier präsentierten Ideen <strong>und</strong> Ansätze im<br />
ökonomischen Umfeld auseinandersetzen. Es geht demnach in dieser Arbeit nicht darum,<br />
ein fertiges System zu entwickeln, das einen ortsbezogenen Dienst realisiert. Vielmehr soll<br />
das Marktsegment der mobilen Märkte ökonomisch analysiert werden, um Erkenntnisse zu<br />
gewinnen, welche Bedürfnisse der Markt bei ortsbezogenen Diensten hat, sowie ein Weg<br />
gef<strong>und</strong>en werden, wie ein hierzu passendes System aussehen könnte. Darüber hinaus hat<br />
diese Arbeit das Ziel, einen zentralen Aspekt bei ortsbezogenen Diensten, die Relevanz<br />
von Informationen an unterschiedlichen geographischen Orten, näher zu untersuchen <strong>und</strong><br />
einen Ansatz zu finden, mit dessen Hilfe eine Bewertung der Relevanz von Informationen<br />
<strong>und</strong> deren Verfügbarkeit in einem Netzwerk ortsbezogener Dienste möglich sein könnte.<br />
Die hier vorliegende Arbeit hat nicht das Ziel, detailliert auf Technologieentwicklungen<br />
aus dem Hardware-Bereich, wie z.B. die Positionsbestimmung von Objekten mittels GPS<br />
oder deren Funktionsweise, einzugehen. Auch eine ausführliche Darlegung der in dieser<br />
Arbeit vorgestellten Architekturkonzepte auf Implementationsebene soll ebenfalls nicht<br />
angestrebt werden, da sie nicht in dem hier zur Verfügung stehenden Rahmen auf einem<br />
adäquaten Niveau dargestellt werden könnte.<br />
Indoor Positioning Technics<br />
Content Management
KAPITEL 1. EINLEITUNG 5<br />
1.3 Struktur der vorliegenden Arbeit<br />
Die nachfolgenden Ausführungen innerhalb dieser Arbeit sind wie folgt strukturiert:<br />
Kapitel 2 legt die erforderlichen Gr<strong>und</strong>lagen für diese Arbeit <strong>und</strong> soll Anknüpfpunkte<br />
für nachfolgende Kapitel bilden. Innerhalb dieses Kapitels werden zentrale Begriffe der<br />
Arbeit in Bezug auf ortsbezogene Dienste <strong>und</strong> Peer-to-Peer Netzwerke definiert, um ein<br />
einheitliches Verständnis der inhaltlichen Bedeutungen zu schaffen. Darüber hinaus wer-<br />
den Projekte, die sich direkt oder indirekt mit der Entwicklung ortsbezogener Dienste<br />
auseinandersetzen, kurz vorgestellt, um dem Leser eine erste Orientierung im Themen-<br />
komplex dieser Arbeit zu ermöglichen.<br />
Kapitel 3 befaßt sich mit der ökonomischen Perspektive von ortsbezogenen Diensten in<br />
Form eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s. Hierzu werden vorab theoretische Gr<strong>und</strong>lagen gelegt <strong>und</strong><br />
eine Marktanalyse für den Bereich der mobilen Kommunikationsmärkte durchgeführt, die<br />
als Bezugspunkt für darauf folgende Ausführungen innerhalb des <strong>Geschäftsmodell</strong>s dient.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Geschäftsmodell</strong> selbst basiert auf der Idee eines ortsbezogenen Dienstes nach den<br />
Peer-to-Peer basierten Vorstellungen des <strong>L2L</strong>-Projektes <strong>und</strong> zeigt mögliche ökonomische<br />
Realisierungsaspekte auf. Von diesen Realisierungsaspketen werden am Ende des Kapi-<br />
tels Anforderungen <strong>und</strong> Rahmenbedingungen für den hier thematisierten ortsbezogenen<br />
Dienst abgeleitet, so daß diese in den nachfolgenden Kapiteln als Kriterien herangezogen<br />
werden können.<br />
Kapitel 4 geht nach den vorangegangenen ökonomischen Aspekten <strong>und</strong> den daraus ab-<br />
geleiteten Anforderungen über zu einer technischen Sichtweise des in dieser Arbeit the-<br />
matisierten ortsbezogenen Dienstes <strong>und</strong> stellt mögliche Architekturkonzepte vor, deren<br />
Beachtung eine Ausgangsbasis für ein zu entwickelndes Architekturmodell bietet. Abgese-<br />
hen von thematisierten Konzepten, die für ortsbezogene Dienste allgemein relevant sind,<br />
gehen die vorgestellten Konzepte im speziellen auf die Anforderungen des ortsbezogenen<br />
Dienstes dieser Arbeit ein <strong>und</strong> stellen Lösungsvorschläge zur Diskussion.<br />
Kapitel 5 befaßt sich aufbauend auf den vorgestellten Konzepten für ein Architekturmodell<br />
vertiefend mit dem Aspekt der Repräsentation von Objekten im physikalischen Raum <strong>und</strong><br />
den Möglichkeiten des räumlichen Schließens. Es zeigt einen Weg über einen qualitativen<br />
Ansatz zur Abstraktion von Regionen auf, mit dessen Hilfe der in dieser Arbeit thema-<br />
tisierte ortsbezogene Dienst seine Leistungen innerhalb einer realen Welt zur Verfügung<br />
stellen könnte. Darüber hinaus wird die Relevanz von Objekten im geographischen Raum<br />
thematisiert <strong>und</strong> ein theoretisches Konzept eingeführt, mit dessen Hilfe sich diese Relevanz<br />
berechnen läßt.<br />
Kapitel 6 vertieft die Möglichkeiten eines Datenaustausches innerhalb von Peer-to-Peer<br />
Netzwerken mittels der im vorherigen Kapitel eingeführten Berechnungsmethoden <strong>und</strong><br />
erweitert diese auf die räumliche Relevanz von Informationen <strong>und</strong> versucht, einen Aus-<br />
tauschmechanismus auf Basis der Konzepte <strong>und</strong> Methoden aus Kapitel 4 <strong>und</strong> 5 zu ent-<br />
wickeln <strong>und</strong> diesen formal zu beschreiben.
KAPITEL 1. EINLEITUNG 6<br />
Kapitel 7 schließt diese Arbeit ab <strong>und</strong> faßt hierbei nochmals zentrale Ergebnisse zusammen<br />
bzw. reflektiert die vorliegende Arbeit kritisch.
Kapitel 2<br />
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Nachdem im vorherigen Kapitel das Thema ortsbezogene Dienste allgemein aus der Sicht-<br />
weise der aktuellen Entwicklungen auf dem Mobilfunksektor betrachtet <strong>und</strong> das Umfeld<br />
von ortsbezogenen Diensten beleuchtet wurde, soll dieses Kapitel dazu dienen, ein gr<strong>und</strong>-<br />
legendes Verständnis zentraler Begriffe dieser Arbeit zu schaffen. Darüber hinaus werden<br />
einige Basiskonzepte für ortsbezogene Dienste eingeführt <strong>und</strong> diskutiert, inwieweit aus<br />
diesen ein Nutzen für ein neu zu entwickelndes Konzept eines ortsbezogenen Dienstes<br />
generiert werden kann. Abschließen wird dieses Kapitel mit einer kurzen Bestandsaufnah-<br />
me bereits bestehender Projekte im Bereich ortsbezogener Dienste, um dem Leser einen<br />
<strong>Ein</strong>druck vom aktuellen Stand auf diesem Gebiet zu vermitteln.<br />
2.1 Ortsbezogene Dienste<br />
Der Begriff ortsbezogene Dienste oder aber seine Synonyme finden derzeit immer häufiger<br />
Verwendung. Allerdings sind die verwendeten Begriffe, wie ortsbezogene Dienste, standort-<br />
bezogene Dienste, mobile location services oder aber location based services, <strong>und</strong> die sich<br />
dahinter verbergenden Inhalte weitgehend diffus.<br />
Es geht bei der Verwendung dieser Begriffe in irgendeiner Form um ” ortsbezogene Dienste“<br />
- soviel läßt sich zumeist entnehmen. Doch der Rest bleibt oftmals weitgehend unbeant-<br />
wortet. Nicht nur, daß die genaue inhaltliche Bedeutung bei vielen Verwendungen der<br />
Begriffe um ortsbezogene Dienste unbeantwortet bleibt, auch die Versuche, den Begriffen<br />
eine inhaltliche Bedeutung zukommen zu lassen, differieren oft enorm. Um ein einheitli-<br />
ches Verständnis für die Begrifflichkeit <strong>und</strong> deren Inhalt zu erlangen, sollen nachfolgend<br />
bestehende Ansätze bzgl. ihrer inhaltlichen Bedeutung analysiert <strong>und</strong> bewertet werden.<br />
2.1.1 Inhaltliche Bedeutung<br />
<strong>Ein</strong>e zunehmende Verwendung von Begriffen, die ortsbezogene Dienste beschreiben, geht<br />
nicht zwangsläufig einher mit einer steigenden Zahl an Definitionen. Zumeist wird die<br />
Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Bedeutung der verwendeten Begriffe häufig ver-<br />
nachlässigt oder gar ignoriert <strong>und</strong> statt dessen darauf vertraut, daß der Leser ein Verständ-<br />
nis von den Begriffen bereits besitzt. Dennoch lassen sich aber in der Literatur einige<br />
7
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 8<br />
UMTS Forum ” A business and consumer<br />
3G service, that enables users<br />
or machines to find other people, vehicles,<br />
resources, services or machines.<br />
It also enables others to find<br />
users, as well as enabling users to<br />
identify their own location via terminal<br />
or vehicle identification.“<br />
José ” A location-based service is a<br />
process or system providing a facility<br />
to the network whose usage is semantically<br />
associated with physical<br />
space.“<br />
Definitionsansätze<br />
Green/Betti/Davidson ortsbezogene<br />
Dienste sind ” Netzwerk-basierte<br />
Dienste, die eine automatische ermittelte<br />
ungefähre Position des Mobilfunkteilnehmers<br />
mit weiteren Informationen<br />
so verknüpft, daß ein<br />
Mehrwert für den Benutzer entsteht.“<br />
Tabelle 2.1: Definitionsansätze für ortsbezogene Dienste<br />
CSISS a location-based service is<br />
” an information service that exploits<br />
the ability of technology to know<br />
where it is, and to modify the information<br />
it presents accordingly“<br />
Zipf ” Location Based Services are<br />
Services for mobile users that take<br />
the current position of the user<br />
into account when performing their<br />
task.“<br />
Ansätze finden, die eine nachfolgende kurze Analyse der gewählten Definition zulassen<br />
(vgl. Tab. 2.1)<br />
UMTS Forum Ansatz (2000)<br />
” A business and consumer 3G service, that enables users or machines to find other people,<br />
vehicles, resources, services or machines. It also enables others to find users, as well as<br />
enabling users to identify their own location via terminal or vehicle identification.“ [UF01]<br />
In diesem Ansatz des UMTS-Forums werden Dienste erfaßt, die sich an zwei Marktseg-<br />
mente richten - den Konsumentenmarkt <strong>und</strong> den Geschäftsk<strong>und</strong>enmarkt. Die gegebene<br />
Definition beschränkt sich nur auf 3G-Dienste <strong>und</strong> damit ausschließlich auf UMTS-Netze.<br />
Es ist auffällig, daß bei der Frage, wer die ortsbezogenen Dienste verwenden soll, sowohl<br />
Menschen als auch Maschinen adressiert werden. Dieses führt dazu, daß ein ortsbezogener<br />
Dienst nach Auffassung des UMTS-Forums nicht zwangsläufig nur von Menschen genutzt<br />
werden kann. Die Verwendung von solchen ortsbezogenen Diensten kann für unterschiedli-<br />
che Zwecke geschehen, aber die Bereiche, wofür diese Dienste Verwendung finden, werden<br />
ausschließlich auf das Finden von Objekten <strong>und</strong> damit indirekt auf das Suchen beschränkt.<br />
<strong>Das</strong> UMTS-Forum greift weiterhin den Bereich der Positionsbestimmung indirekt auf <strong>und</strong><br />
charakterisiert die beschriebenen Dienste dadurch, daß eine Positionsbestimmung von Nut-<br />
zern sowohl durch dritte, wie z.B. Service-Provider, als auch durch einen Nutzer selbst<br />
durchgeführt werden kann.<br />
Auffällig ist, daß der Ansatz des UMTS-Forums keine Angaben darüber macht, welche
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 9<br />
Zusammenhänge zwischen der Position eines Nutzers <strong>und</strong> den ihm präsentierten Informa-<br />
tionen bestehen. Auch wird eine etwaige Dynamik, die durch die Positionsveränderung<br />
von Nutzern entstehen könnte, nicht betrachtet, so daß davon auszugehen ist, daß in den<br />
Augen des UMTS-Forums solche Überlegungen keine Rolle spielen.<br />
CSISS Ansatz (2001)<br />
” ...an information service that exploits the ability of technology to know where it is, and<br />
to modify the information it presents accordingly“[Fab03]<br />
Die Definition des CSISS (Center for Spatially Integrated Social Science) beschreibt einen<br />
ortsbezogenen Dienst explizit als einen Informationsdienst. Demnach kann jedes Informa-<br />
tionssystem einen ortsbezogenen Dienst darstellen, das die Möglichkeiten der Positionsbe-<br />
stimmung mit integriert <strong>und</strong> abhängig von diesen Informationen zur Verfügung stellt.<br />
Offen gelassen wird in diesem Ansatz, wer genau Nutzer eines solchen Systems ist bzw. sein<br />
könnte. Auch die Frage, welche Netzwerk-Infrastruktur diesen definierten Diensten zugrun-<br />
de liegt, ist im Gegensatz zum Ansatz des UMTS-Forums offen gelassen worden. Deshalb<br />
läßt sich auch der Zugang zu solchen Diensten nicht eindeutig nur auf mobile Umgebungen<br />
begrenzen. Im direkten Vergleich mit der vorangegangenen Definition des UMTS-Forums<br />
läßt sich aber feststellen, daß eine Beziehung zwischen darzustellenden Informationen <strong>und</strong><br />
einer aktuellen Position eines Nutzers für diese Definition eines ortsbezogenen Dienstes<br />
vorhanden sein muß.<br />
Green/Betti/Davidson Ansatz (2000)<br />
” ...Netzwerk-basierte Dienste, die eine automatische ermittelte ungefähre Position des Mobilfunkteilnehmers<br />
mit weiteren Informationen so verknüpft, daß ein Mehrwert für den<br />
Benutzer entsteht.“[GBD00] in [Mül02]<br />
In diesem Ansatz von Green et al. liegt der Fokus innerhalb der Definition auf der In-<br />
frastrukturbasis für die beschriebenen ortsbezogenen Dienste. Es handelt sich demnach<br />
bei einem ortsbezogenen Dienst um einen netzwerk-basierten Dienst, also einem Dienst,<br />
der über ein irgendwie geartetes Netzwerk verfügbar ist, wie beispielsweise einem Mobil-<br />
funknetz. Ebenfalls wird durch Green et al. auf die Existenz einer Positionsbestimmung<br />
eingegangen. Neu hinzu kommt an dieser Stelle allerdings erstmals die Beachtung der Ge-<br />
nauigkeit der Positionsbestimmung. Hierbei wird in der Definition nicht eine exakte Posi-<br />
tionsbestimmung für Service-Leistungen vorausgesetzt, sondern lediglich eine ungefähre.<br />
Die Ermittlung dieser Position ist im Gegensatz zu anderen Definitionen explizit als au-<br />
tomatisch ausgewiesen.<br />
Ging die vorherige Definition bereits von einer Beziehung zwischen Position <strong>und</strong> verfügba-<br />
rer Information aus <strong>und</strong> wies damit indirekt auf einen Nutzen durch kontextsensitive<br />
Informationen hin, so beschreiben Green et al. dieses explizit, wenn auch abstrakter da-<br />
durch, daß die beschriebenen ortsbezogenen Dienste einen Mehrwert für Nutzer bieten
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 10<br />
müssen.<br />
Im Vergleich zum vorherigen Ansatz wird sehr wage beschrieben, wie genau die Bezie-<br />
hung zwischen Position <strong>und</strong> Information bei einem ortsbezogenen Dienst aussehen soll.<br />
Durch die geforderte automatische Ermittlung der Position eines Nutzers scheint der be-<br />
schriebene Dienst allerdings proaktiv zu reagieren, d.h. die Informationen werden Nutzern<br />
automatisch, abhängig von der Position, zur Verfügung gestellt. <strong>Ein</strong>e manuelle Positions-<br />
bestimmung durch den Nutzer, wie durch das UMTS-Forum beschrieben, wird in diesem<br />
Ansatz nicht thematisiert.<br />
Zipf’s Ansatz (2002)<br />
” Location Based Services are Services for mobile users that take the current position of<br />
the user into account when performing their task.“[ZM02]<br />
Der Ansatz von Zipf beschreibt einen ortsbezogenen Dienst primär aus der Perspektive sei-<br />
ner Zielgruppe, den mobilen Nutzern. Über eine anderweitige Nutzung des Dienstes, z.B.<br />
durch stationäre Nutzung, sagt dieser Ansatz nichts aus, schließt es damit aber auch nicht<br />
explizit aus. Wichtig an dieser Stelle in Zipf’s Ansatz scheint vielmehr zu sein, daß der<br />
beschriebene Dienst die aktuelle Position eines Nutzers während seiner Arbeit berücksich-<br />
tigt. Diese Definition ist damit ähnlich zu den bereits diskutieren Ansätzen, die ebenfalls<br />
die Abhängigkeit eines ortsbezogenen Dienstes einzig <strong>und</strong> allein von der aktuellen Position<br />
eines Nutzer abhängig machen.<br />
Zipf beschreibt in seiner Definition, daß ortsbezogene Dienste auf Basis einer Position Auf-<br />
gaben durchführen, gibt aber keine Auskunft darüber, was diese Aufgaben sein könnten<br />
<strong>und</strong> welche Beziehungen zwischen der angesprochenen Position <strong>und</strong> den Aufgaben beste-<br />
hen.<br />
Im Vergleich zu anderen Ansätzen, wie denen vom UMTS-Forum, ist diese gewählte Defi-<br />
nition sehr allgemein gehalten <strong>und</strong> fokussiert kein direktes Anwendungsfeld. Dieses hat den<br />
Vorteil aber zugleich auch den Nachteil, daß keine genauen Aussagen über Positionierung,<br />
Zielgruppe etc. gemacht werden können.<br />
José’s Ansatz (2001)<br />
” A location-based service is a process or system providing a facility to the network whose<br />
usage is semantically associated with physical space.“[Jos01]<br />
José’s Definition beschreibt einen ortsbezogenen Dienst als ein System oder Prozeß, der<br />
seinen Dienst innerhalb eines Netzwerks zur Verfügung stellt. Ähnlich wie der vorherige<br />
Ansatz wird hier ebenfalls die dem System zugr<strong>und</strong>eliegende Infrastruktur erfaßt. Auffällig<br />
an dieser Definition ist hingegen, daß eine direkte Abhängigkeit des Dienstes von der Po-<br />
sition eines Nutzers (wie in Zipf’s Ansatz) fehlt. José greift in seinem Ansatz statt dessen<br />
eine räumliche Abhängigkeit des Systems durch eine semantische Verbindung des Dienstes<br />
mit einem physikalischem Raum auf <strong>und</strong> erhält so einen mächtigeren Ansatz, der neben
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 11<br />
einer bloßen Position eines Nutzers weitere Anhaltspunkte über einen Aufenthaltsort eines<br />
Nutzers abdecken kann.<br />
Generell läßt sich feststellen, daß sich dieser Ansatz von José stark von allen zuvor disku-<br />
tierten Ansätzen unterscheidet <strong>und</strong> eine offensichtlich abstraktere Perspektive auf einen<br />
ortsbezogenen Dienst beschreibt als es zuvor der Fall gewesen ist. José’s Verständnis von<br />
einem ortsbezogenen Dienst geht mehr in Richtung eines Ansatzes zur Beschreibung eines<br />
offenen Netzwerkes von ortsbezogenen Diensten als auf die Beschreibung eines einzelnen<br />
isolierten Dienstes. Dieses wird besonders deutlich durch seine Arbeit ” An Open Architec-<br />
ture for Location-Based Services in Heterogenous Mobile-Environments“ [Jos01], aus der<br />
diese Definition entnommen wurde.<br />
Zusammenfassung<br />
Betrachtet man zusammenfassend die vorgestellten Definitionen für ortsbezogene Dienste<br />
so läßt sich feststellen, daß ein einheitliches Verständnis nicht oder nur gering besteht.<br />
Sicherlich ist die <strong>Ein</strong>beziehung der aktuellen Position eines Nutzers in jeder Definition<br />
mehr oder weniger stark ausgeprägt zu finden. Doch bestehen sowohl bei der Ermittlung<br />
dieser Position als auch bei der Art, wie diese Verwendung findet, erhebliche Unterschie-<br />
de. Insbesondere wird bei den vorgestellten Ansätzen deutlich, daß die Schwerpunkte je<br />
nach Ausgangspunkt bzw. Sichtweise der definierenden Person oder Gruppe geprägt sind.<br />
So fokussiert das UMTS-Forum in seiner Definition beispielsweise sehr konkret auf die<br />
kommende Generation des Mobilfunks (3G). Wichtig aus ihrer Sicht ist es ebenfalls, die<br />
Zielgruppe für ortsbezogene Dienste klar zu nennen. Dieses könnte aber dadurch begründet<br />
werden, daß die Aufgaben des UMTS-Forums, nach eigenen Angaben, im Bereich Förde-<br />
rung <strong>und</strong> Vermittlung zwischen Anwendern <strong>und</strong> Anbietern kommender 3G Applikationen<br />
liegen [HK01]. Nimmt man hingegen José’s Ansatz, so ist dieser sehr viel allgemeiner <strong>und</strong><br />
abstrakter formuliert. Aber auch seine Definition ist wiederum passend für seine eigene<br />
Betrachtungsweise innerhalb seiner Arbeit, in der die Entwicklung einer offenen Architek-<br />
tur für ortsbezogene Dienste in heterogenen mobilen Umgebungen angestrebt wird (vgl.<br />
[Jos01]).<br />
Aufgr<strong>und</strong> der beschriebenen Problematik, daß die inhaltliche Bedeutung von ortsbezoge-<br />
nen Diensten mehr als heterogen ist, soll nachfolgend eine eigene Definition für ortsbezo-<br />
gene Dienste gegeben werden, die die inhaltliche Bedeutung des Begriffes für die weiteren<br />
Ausführungen der vorliegenden Arbeit versucht festzulegen. Hierbei wurde die Definiti-<br />
on auf der Basis der hier diskutierten Ansätze entwickelt <strong>und</strong> versucht, diese geeignet zu<br />
kombinieren.<br />
Definition 1 (Ortsbezogener Dienst [Location Based Service) ] <strong>Ein</strong> ortsbezogener<br />
Dienst ist jeder Prozeß oder jedes System, das einem Benutzer mindestens auf Basis des<br />
aktuellen Aufenthaltsorts kontextsensitive Informationen, d.h. Informationen, die einen<br />
räumlichen Bezug zum Aufenthaltsort haben, anbietet.
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 12<br />
2.1.2 Gr<strong>und</strong>legende Konzepte<br />
Nachdem die vorherigen Ausführungen versucht haben, die inhaltliche Bedeutung von<br />
ortsbezogenen Diensten zu klären, dient dieser Abschnitt dazu, gr<strong>und</strong>legende Kommunika-<br />
tionskonzepte für Informationssysteme zu erläutern, die auch bei ortsbezogenen Diensten<br />
oft zum <strong>Ein</strong>satz kommen. Im Bereich der ortsbezogenen Dienste findet man im wesentli-<br />
chen zwei unterschiedliche Konzepte, die sich mit der Art <strong>und</strong> insbesondere dem Ablauf<br />
der Kommunikation mit Clients befassen:<br />
Pull-orientierte Konzepte<br />
Von sogenannten ” Pull“-orientierten Konzepten spricht man im allgemeinen immer dann,<br />
wenn eine Reaktion durch ein System initial durch den Benutzer hervorgerufen werden<br />
muß. Der Benutzer muß bei diesem Konzept somit die gewünschten Informationen manu-<br />
ell holen ( ” pullen“).<br />
Betrachtet man z.B. den Such-Dienst, den eine Internet-Suchmaschine wie Google zur<br />
Verfügung stellt, so läßt sich dieser Dienst eindeutig als ” Pull“-Dienst einstufen: <strong>Ein</strong> Be-<br />
nutzer muß manuell seine Suchanfrage an die Maschine stellen <strong>und</strong> erhält erst danach ein<br />
Ergebnis passend zu seiner Anfrage.<br />
Näher am Kontext der ortsbezogenen Dienste sind beispielsweise Navigationssysteme als<br />
eine Art Pull-System zu nennen, da diese ebenfalls wie Such-Dienste erst nach Anga-<br />
be eines gewünschten Start-/Zielpaares eine Routenberechnung durchführen können. Wie<br />
dieses Beispiel andeutet, lassen sich ortsbezogene Dienste, die als Pull-System konzipiert<br />
sind, leicht unabhängig von Positionierungstechnologien aufbauen, da eine Positionsbe-<br />
stimmung durch einen Benutzer des Systems erfolgen kann bevor das System in Aktion<br />
tritt. Der ortsbezogene Dienst Vindigo [Vin03] ist hierfür ein gutes Beispiel. Er stellt für<br />
die Stadt New York ein kontextsensitives Informationssystem zur Verfügung <strong>und</strong> benötigt<br />
z.B. initial die Angabe der aktuellen Position eines Benutzers in Form von Straßenschnitt-<br />
punkten bevor es zur angegebenen Position passende Informationen anbietet.<br />
Pull-Systeme haben damit den Vorteil, daß sie für jeden Benutzer eine vergleichsweise ein-<br />
fache Nutzung ohne zusätzliche Positionierungstechnologie ermöglichen <strong>und</strong> somit auch<br />
für Benutzer mit Endgeräten, die nicht über die neueste Technologie verfügen, interessant<br />
sind. Die Möglichkeit, einem Benutzer Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne daß<br />
dieser manuell seine Position zur Verfügung stellt, ist hingegen einer der Nachteile dieses<br />
Konzeptes in Bezug auf ortsbezogene Dienste.<br />
Push-orientierte Konzepte<br />
<strong>Das</strong> ” Push“-orientierte Konzept stellt das Gegenstück zum zuvor erläuterten ” Pull“-<br />
orientierten Ansatz dar. Anstatt Informationen nur bei Bedarf eines Nutzers bzw. aufgr<strong>und</strong><br />
dessen Anfrage zur Verfügung zu stellen, werden die Informationen bei einem Push-System<br />
durch den Dienst automatisch an das jeweilige Endgerät des Benutzers gesendet. <strong>Ein</strong>e in-<br />
itiale Interaktion seitens des Benutzers ist nicht notwendig.
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 13<br />
Für den Bereich ortsbezogener Dienste bedeutet dieses insbesondere, daß die Positionie-<br />
rung des Benutzers automatisch erfolgen kann bzw. dieses technisch möglich ist. Informa-<br />
tionen können so je nach aktuellem Benutzerkontext im Hintergr<strong>und</strong> zusammengestellt<br />
<strong>und</strong> automatisch zum Endgerät eines Benutzers hin übermittelt werden. Aufgr<strong>und</strong> dieses<br />
Verhaltens müssen im Vergleich zu ” Pull“-orientierten Diensten höhere Anforderungen<br />
an die verwendeten Endgeräte <strong>und</strong> die genutzte Infrastruktur gestellt werden, um die-<br />
ses Konzept mit seinen Möglichkeiten auszuschöpfen. Beispielsweise ist für einen optima-<br />
len Betrieb eines ” Push“-basierten ortsbezogenen Dienstes im Idealfall eine permanente<br />
Online-Verbindung wünschenswert, damit Informationen zu jeder Zeit gesendet <strong>und</strong> emp-<br />
fangen werden können. Generell bietet dieses Konzept aber den Vorteil des hohen Au-<br />
tomatisationspotentials, das gerade bei mobilen Endgeräten mit oftmals eingeschränkten<br />
Bedienungsmöglichkeiten nicht unterschätzt werden sollte.<br />
An dieser Stelle sei kurz auf die Möglichkeit der Kombination von Push- <strong>und</strong> Pull-Ansätzen<br />
hingewiesen, mit deren Hilfe es möglich ist, die Vorteile beider Konzepte zu vereinen. Durch<br />
Kombination von ” Push“- <strong>und</strong> ” Pull“-Ansatz ist ein simulierter ” Push“-Ansatz denkbar,<br />
der durch aufeinanderfolgende ” Pull“-Intervalle ermöglicht werden kann <strong>und</strong> so Benutzern<br />
eine erhöhte Kontrolle über das Gesamtsystem verschafft.<br />
2.1.3 Positionierungstechniken<br />
Zentral für die Entwicklung von ortsbezogenen Diensten ist die Möglichkeit, die aktuelle<br />
Position eines Benutzers zu bestimmen (vgl. u.a. Abschnitt 2.1.1). Aus diesem Gr<strong>und</strong> soll<br />
dieser Abschnitt einen Überblick über verfügbare Positionstechnologien geben, sie aber<br />
nicht auf technischer Ebene diskutieren, da dieses für den Fokus dieser Arbeit nicht erfor-<br />
derlich ist.<br />
Die unterschiedlichen Techniken zur Positionsbestimmung unterscheiden sich im wesent-<br />
lichen durch die erzielte Genauigkeit bei der Bestimmung einer Position sowie der tech-<br />
nischen Voraussetzungen, die notwendig sind, um eine bestimmte Technik einsetzen zu<br />
können. Tabelle 2.2 gibt eine Übersicht über gängige Positionierungstechniken <strong>und</strong> ihre<br />
jeweiligen Eigenschaften. <strong>Ein</strong>e detailliertere Erläuterung einzelner Techniken zur Positi-<br />
onsbestimmung läßt sich u.a. in [Jag03] finden.<br />
Weniger wichtig für den Inhalt dieser Arbeit ist an dieser Stelle die genaue Funktionsweise<br />
von unterschiedlichen Verfahren zur Positionsbestimmung, sondern vielmehr die Erkennt-<br />
nis, daß es Positionierungstechniken gibt, die eine Lokalisierung eines Benutzers in mobilen<br />
Umgebungen ermöglichen. Darüber hinaus ist es zudem möglich, mit einigen Techniken,<br />
wie GPS (vgl. Tab. 2.2), eine sehr genaue Lokalisierung durchzuführen. Lediglich die Po-<br />
sitionsbestimmung innerhalb von Gebäuden scheint zum heutigen Zeitpunkt noch nicht<br />
weit fortgeschritten zu sein (GPS benötigt z.B. eine ” Sichtverbindung“ zu mind. drei GPS-<br />
Satelliten). Jedoch ist davon auszugehen, daß in Zukunft auch dieses keine echte Hürde für<br />
die Nutzung von ortsbezogenen Diensten auch innerhalb von Gebäuden sein wird. Bereits<br />
heute gibt es technische Geräte, die für eine Positionierung innerhalb von Gebäuden geeig-
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 14<br />
Location determining<br />
Positioning<br />
Calculation<br />
Cell ID Terrestrial<br />
<strong>Network</strong><br />
Enhance Call<br />
ID<br />
Angle of Arrival<br />
Time of Arrival<br />
Time Difference<br />
of<br />
Arrival<br />
Observed Time<br />
Difference<br />
Enhanced<br />
Observed Time<br />
Difference<br />
Terrestrial<br />
<strong>Network</strong><br />
Terrestrial<br />
<strong>Network</strong> or<br />
Device<br />
Terrestrial<br />
<strong>Network</strong> or<br />
Device<br />
Terrestrial<br />
<strong>Network</strong> or<br />
Device<br />
Terrestrial<br />
<strong>Network</strong> or<br />
Device<br />
Terrestrial<br />
<strong>Network</strong> +<br />
Satellite<br />
GPS Device from<br />
Satellite data<br />
AGPS Satellite +<br />
Terrestrial<br />
Technology Accuracy<br />
meters<br />
Cell proximity 100-<br />
2000<br />
Cell proximity up to<br />
50 in<br />
the city<br />
Triangulation up to<br />
200<br />
Triangulation up to<br />
100<br />
Upgrades<br />
needed<br />
Magnitude<br />
of upgrade<br />
(dimension)<br />
Cost of upgrade<br />
to user<br />
Time<br />
of<br />
Introduction<br />
Device Small Low (SIM) 2001<br />
Device Small Low (SIM) 2001<br />
Device<br />
and<br />
<strong>Network</strong><br />
Device<br />
and<br />
<strong>Network</strong><br />
Triangulation up to 15 Device<br />
and<br />
<strong>Network</strong><br />
Triangulation up to 50 Device<br />
and<br />
<strong>Network</strong><br />
Triangulation up to 20 Device<br />
and<br />
<strong>Network</strong><br />
Triangulation 10 Device<br />
and<br />
<strong>Network</strong><br />
Triangulation 5-50 Device<br />
and<br />
<strong>Network</strong><br />
Significant Moderate<br />
(chip)<br />
Significant Moderate<br />
(chip)<br />
Significant Moderate<br />
(chip)<br />
Significant Moderate<br />
(chip)<br />
Significant Moderate<br />
(new device)<br />
in headset<br />
Very Significant<br />
Very Significant<br />
Tabelle 2.2: Positionierungstechniken im Überblick [Dur01b]<br />
High (chip integration)<br />
High (chip integration)<br />
net wären, wie einem Spezial-Sensor von Leica. Dieser besteht aus einem Beschleunigungs-<br />
<strong>und</strong> Neigungssensor sowie einem Kompaß, mit dessen Hilfe eine relativ genaue Positions-<br />
bestimmung innerhalb von Gebäuden auch heute schon möglich wäre.<br />
Festzuhalten für den weiteren Verlauf bleibt also, daß die eigentliche Positionsbestimmung<br />
heute keine Problem mehr für ortsbezogene Dienste darstellt <strong>und</strong> aus diesem Gr<strong>und</strong>e hier<br />
nicht verstärkt betrachtet werden soll.<br />
2.1.4 Bestehende Ansätze<br />
Dieser Abschnitt beschreibt einige bestehende Informationssysteme, bei denen die durch<br />
das System zur Verfügung gestellten Informationen von einer aktuellen Position eines Be-<br />
nutzers abhängig sind. Ihre Beschreibung soll dazu dienen, ein Gefühl für den momentanen<br />
Entwicklungsstand im Bereich der ortsbezogenen Dienste zu erhalten. Wichtig in diesem<br />
Zusammenhang ist, daß die vorgestellten Ansätze ausschließlich dem wissenschaftlichen<br />
Bereich entstammen <strong>und</strong> sich somit meistens noch in der Entwicklung befinden <strong>und</strong> auch<br />
noch nicht für eine breite Nutzung in einer Gesellschaft zur Verfügung stehen.<br />
2001<br />
2002<br />
2000<br />
2001
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 15<br />
<strong>Das</strong> GUIDE Projekt<br />
<strong>Das</strong> GUIDE Projekt [DCMF99] hat ein System entwickelt, das Besuchern der Stadt Lan-<br />
caster einen kontextsensitiven Stadtführer zur Verfügung stellt. <strong>Das</strong> Verhalten des Systems<br />
ist hierbei primär von einem Benutzerprofil sowie der aktuellen Umgebung, in der sich der<br />
Benutzer bewegt, abhängig. <strong>Ein</strong>e Reihe weiterer Faktoren, die das System eigenständig<br />
bestimmt, wie z.B. die aktuelle Tageszeit oder aber die aktuelle Wetterlage, können das<br />
Verhalten zusätzlich ändern.<br />
Die Nutzung des GUIDE-Systems erfolgt über eine drahtlose Verbindung nach dem Wi-<br />
reless LAN Standard IEEE 802.11 mittels eines speziellen mobilen Gerätes, dem Fujitsu<br />
TeamPad 7600 [CDM + 00]. Die drahtlose Infrastruktur für GUIDE wird über strategisch<br />
positionierte Basisstationen (Access Points) aufgebaut. Jede durch eine Basisstation auf-<br />
gebaute Funkzelle ist mit einem Server assoziiert, der sowohl ortsbezogene Informationen<br />
zur Verfügung stellt als auch die Übertragung von Daten zum Endgerät hin vornimmt.<br />
Hauptbaustein in dem Informationsmodell des GUIDE-Systems sind die sogenannten Lo-<br />
cation Objects. Sie repräsentieren ein physikalisches Objekt <strong>und</strong> fungieren als Landmarke<br />
für eine bestimmte Region innerhalb der Stadt. Die Lancaster Burg wird hierbei z.B. durch<br />
ein Location Object repräsentiert <strong>und</strong> stellt Informationen, wie geographische Lage, Öff-<br />
nungszeiten oder aber <strong>Ein</strong>trittspreise, zur Verfügung.<br />
<strong>Ein</strong> Benutzer des Systems erhält immer jene ortsbezogenen Informationen auf sein mobiles<br />
Endgerät übertragen, die zum aktuellen Location Object bzw. der zugehörigen Funkzel-<br />
le assoziiert sind. Die Informationsrepräsentation auf dem Endgerät erfolgt hierbei über<br />
Standard-Hypertext.<br />
Die Repräsentation von geographischen Informationen wird im GUIDE Modell durch ei-<br />
ne weitere Klasse von Objekten, den Navigation Points, erreicht. Navigation Points re-<br />
präsentieren hierbei Wegpunkte zwischen Location Objects. In Kombination mit gewich-<br />
teten Relationen zwischen Location Objects ist es dem GUIDE-System möglich, komplette<br />
Stadttouren oder aber Routenplanung für Benutzer zur Verfügung zu stellen.<br />
<strong>Das</strong> AROUND Projekt<br />
<strong>Das</strong> AROUND Projekt [JMMC01] hat die Modellierung <strong>und</strong> Entwicklung einer Architek-<br />
tur zur Unterstützung von Location-based Services über das Internet zum Gegenstand. Es<br />
baut hierbei auf bereits existierende Arbeiten auf, versucht aber, im Vergleich zu ande-<br />
ren Projekten, keine einschränkende Annahmen über eine dem System zugr<strong>und</strong>eliegende<br />
Netzwerkinfrastruktur zu machen.<br />
Innerhalb des Projektes werden zwei Hauptziele verfolgt. Zum einen das Ziel, die Modellie-<br />
rung einer Architektur, die eine Auffindung von relevanten oder nahen Diensten bezüglich<br />
einer bestimmten Position eines Benutzers ermöglicht, zu realisieren <strong>und</strong> zum anderen,<br />
die Entwicklung eines Modells, das es erlaubt, flexibel Orte <strong>und</strong> deren räumliche Nähe<br />
zueinander zu modellieren.<br />
Der derzeit entwickelte Prototyp des AROUND Systems läßt sich über ein mobiles End-<br />
gerät mittels GSM oder IEEE 802.11 (WLAN) benutzen. Die bis dato entwickelte Lösung
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 16<br />
fokussiert einen generischen ” Urlauberassistenten“. Die Positionsbestimmung erfolgt mit-<br />
tels GPS <strong>und</strong> anderer Positionierungstechniken, die für die Netzwerkinfrastruktur realisiert<br />
werden können. Der existierende Prototyp ist hierbei so entworfen, daß einzelne Applika-<br />
tionen unabhängig voneinander ihre Dienste ortsabhängig zur Verfügung stellen können.<br />
Kern der AROUND Architektur ist das Scope Model, welches die Art <strong>und</strong> Weise definiert,<br />
wie ortsbezogene Dienste räumlich beschrieben werden können. Ziel ist es, eine Beziehung<br />
zwischen physikalischen Räumen <strong>und</strong> Diensten innerhalb eines Netzwerkes herzustellen.<br />
<strong>Das</strong> Scope Model basiert auf einer Menge von global verfügbaren symbolischen Orten, wie<br />
z.B. ” Gebäude A“ oder ” <strong>Ein</strong>kauf-Center“, die als Location Context bezeichnet werden.<br />
Ortsbezogene Dienste werden innerhalb der AROUND Architektur über die Registrierung<br />
innerhalb eines bestimmten Location Contextes verfügbar gemacht <strong>und</strong> sind so innerhalb<br />
bestimmter Scopes des Scope Models verfügbar.<br />
Die funktionale Struktur der AROUND Architektur besteht aus den AROUND Services,<br />
dem Contextualization Prozeß sowie einem Name Service. Der AROUND Service ist eine<br />
verteilte räumliche Infrastruktur, die durch einen AROUND Server zur Verfügung gestellt<br />
wird. Dieser übernimmt jeweils die Pflege <strong>und</strong> Wartung für eine Menge an Informatio-<br />
nen der jeweiligen Dienste. Jeder Location Context wird hierbei von einem bestimmten<br />
AROUND Server verwaltet. Der Prozeß der Contextualization innerhalb der AROUND<br />
Architektur ist jener Prozeß, der bestimmt, welcher Location Context am besten zur ak-<br />
tuellen Position eines Benutzers paßt. Dieser Prozeß bildet demnach die aktuelle Position<br />
eines Benutzers im physikalischen Raum auf eine Position im virtuellen Raum der Location<br />
Contexte ab. Der Name Service innerhalb der AROUND Architektur wird dazu benötigt,<br />
um global verfügbare Location Contexte in Referenzen zu bestimmten AROUND Servern<br />
aufzulösen, über welche dann nachfolgend auf den jeweilig registrierten ortsbezogenen<br />
Dienst zugegriffen werden kann.<br />
<strong>Das</strong> CRUMPET Projekt<br />
<strong>Das</strong> CRUMPET Projekt [PLM + 01] (Creation of User-friendly Mobile Services Personali-<br />
sed for Tourism) wird vom europäischem Programm ” Information Societies Technology“<br />
(IST) gefördert <strong>und</strong> ist dort unter der Projektnummer IST-1999-20147 registriert.<br />
CRUMPET hat das Ziel, eine neue Informationsverteilungs- <strong>und</strong> Integrationsplattform<br />
für Dienste, die an jedem Ort zugreifbar sein sollen, zu entwickeln. Benutzer sollen hier-<br />
bei, unabhängig von Endgeräten <strong>und</strong> Art der Netzwerkverbindung, diese Dienste nutzen<br />
können. Beispielsweise sollen sich mit CRUMPET Reisen vorbereiten oder aber Akti-<br />
vitäten während einer Reise oder direkt im Zielgebiet organisieren lassen.<br />
Die Dienste, die durch CRUMPET angeboten werden, sollen in der Lage sein, die Vor-<br />
teile, die sich aus der Integration <strong>und</strong> Anwendung von vier Schlüsseltechnologien auf den<br />
Bereich Tourismus gewinnen lassen, zu nutzen: ” personalized services, smart component-<br />
based middleware or ’smartware’, that uses multi-agent technology, location-aware services<br />
and mobile data communication“ [PLM + 01].<br />
Für die Realisierung der CRUMPET Architektur wurde auf einen agenten-orientierten An-
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 17<br />
satz auf Basis von FIPA-OS [The04] zurückgegriffen. Aufgr<strong>und</strong> der Größe <strong>und</strong> Komplexität<br />
der gesamten CRUMPET Architektur soll an dieser Stelle eine detaillierte Beschreibung<br />
der Architektur ausgelassen <strong>und</strong> stattdessen auf vertiefende Quellen, die sich näher mit<br />
der CRUMPET Architektur befassen, verwiesen werden (siehe hierzu z.B. [PLM + 01]).<br />
<strong>Das</strong> Nexus Projekt<br />
<strong>Das</strong> Nexus Projekt [VS00] entwickelt eine offene Plattform für ortsbezogene Dienste in<br />
mobilen Umgebungen. Zentraler Bestandteil dieser Plattform ist das sogenannte Augmen-<br />
ted World Model, welches ein Modell der realen Welt mit realen <strong>und</strong> virtuellen Objekten<br />
verwaltet. Für die Modellierung dieser Welt wird eine eigens hierfür entwickelte Modellie-<br />
rungssprache AWML eingesetzt. Durch eine offene Schnittstelle, über die das Nexus System<br />
verfügt, soll eine Integration von Informationen in das Gesamtsystem Nexus durch jede<br />
Datenquelle, ähnlich wie beim World Wide Web, ermöglicht werden. Aufgr<strong>und</strong> der Offen-<br />
heit des Systems ergibt sich eine hohe Heterogenität in der Datenbasis des Systems, für<br />
dessen Kontrolle Ansätze wie der Föderationsansatz entwickelt wurden. Der Föderations-<br />
ansatz stellt Anwendungen innerhalb von Nexus eine einheitliche Sicht auf die Datenbasis<br />
der integrierten Nexus-Dienste zur Verfügung <strong>und</strong> ermöglicht den Zugriff auf diese Daten<br />
über sogenannte Nexus-Knoten.<br />
Der generelle Aufbau der Nexus Architektur besteht aus den Komponenten Nexus-Anwen-<br />
dungen, Nexus-Knoten sowie Nexus-Diensten. Nexus-Knoten bieten den Nexus-Anwen-<br />
dungen eine einheitliche Sicht auf das modellierte Augmented World Model an. Nexus-<br />
Anwendungen können Anfragen an Nexus-Knoten mittels einer speziellen Anfragesprache<br />
AWQL stellen. Diese mittels AWQL formulierten Anfragen werden in einem folgenden<br />
Schritt an Nexus-Dienste delegiert. Mit Hilfe eines Spatial Model Servers lassen sich in<br />
Nexus Beziehungen zwischen der Position eines Benutzers <strong>und</strong> der jeweiligen Anfrage ge-<br />
nerieren <strong>und</strong> beeinflussen so das Ergebnis einer Anfrage ortsbezogen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Komplexität der Nexus Architektur <strong>und</strong> der vielen <strong>Ein</strong>zelmodule soll an die-<br />
ser Stelle, wie bereits bei der Erläuterung des CRUMPET Projektes, auf eine detaillierte<br />
Darstellung verzichtet werden. <strong>Ein</strong> guter <strong>Ein</strong>stieg in die NEXUS Architektur <strong>und</strong> deren<br />
zugr<strong>und</strong>eliegendem Konzept läßt sich in [Grz02] finden.<br />
<strong>Das</strong> FETISH Projekt<br />
<strong>Das</strong> FETISH Projekt (Federated European Tourism Information Systems Harmonisation)<br />
[VSA02] ist, wie auch CRUMPET, ein von der EU gefördertes IST Projekt mit dem Ziel,<br />
eine offene, verteilte Plattform für Dienste <strong>und</strong> Anwendungen aus dem Bereich Tourismus<br />
zu entwickeln. Hierbei steht die Etablierung einer Infrastruktur für touristisch orientierte<br />
Dienste im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Bestandteil der Infrastruktur können unterschiedlichste Instanzen sein, wie z.B. Dienste,<br />
Geräte oder aber einzelne Informationseinheiten. Aufgr<strong>und</strong> der so entstehenden hohen He-<br />
terogenität der integrierbaren Informationsquellen fokussiert FETISH nicht ausschließlich<br />
auf die Entwicklung eines ortsbezogenen Dienstes, sondern versteht diese Eigenschaft le-
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 18<br />
diglich als einen möglichen Bestandteil der entwickelten Infrastruktur, die durch mehrere<br />
Teildienste innerhalb der Architektur von FETISH ermöglicht werden kann.<br />
Für den Aufbau der technischen Komponenten wurde im Rahmen von FETISH die Jini<br />
Netzwerk Technologie [Sun03] auf WAN Umgebungen erweitert, um ein verteiltes Netzwerk<br />
an Servern, die bereits vorhandene Applikationen aus dem Bereich Tourismus organisieren<br />
<strong>und</strong> deren Dienste verteilt verfügbar machen, zu ermöglichen.<br />
Die FETISH Architektur besteht im wesentlichen aus der FETISH Advanced Directory<br />
Architecture (FADA) Infrastructure [VSA02]. Der FADA Kern stellt hierbei ein verteiltes<br />
Verzeichnis für Dienste dar <strong>und</strong> bietet FETISH-Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Dien-<br />
ste global zur Verfügung zu stellen. Service Provider haben die Möglichkeit, ihre Dienste<br />
bei FADA registrieren zu lassen. FADA selbst stellt darüber hinaus Service Proxys zur<br />
Verfügung, die es ermöglichen, Dienste auffindbar <strong>und</strong> zugänglich zu machen.<br />
Die Nutzung von Diensten durch Benutzer erfolgt über lokale Service Proxies, die über das<br />
Internet heruntergeladen <strong>und</strong> lokal ausgeführt werden. Diese lokalen Proxies kommunizie-<br />
ren sodann direkt mit den realen Service Proxies <strong>und</strong> machen deren Dienste direkt zugäng-<br />
lich. Die Verwaltung der realen Service Proxies wird durch den FADA-Kern gewährleistet,<br />
wobei jeder Service einen FADA-Knoten repräsentiert. Die Knoten selbst sind wiederum<br />
in einem Peer-to-Peer Netzwerk (siehe Abschnitt 2.2) basierend auf Jini Technologie orga-<br />
nisiert. Durch diese Organisationsstruktur ergibt sich eine Topologie aus FADA-Knoten,<br />
bei der die Kommunikation <strong>und</strong> Erkennung einzelner Knoten über ein Protokoll auf Ba-<br />
sis von Unicast stattfindet. D.h. FADA-Knoten kennen jeweils die Adresse von anderen<br />
existierenden Knoten in der Nähe (Nachbarknoten genannt), so daß sich über diesen Weg<br />
mit Hilfe des ” Wissens“ der Nachbarknoten jeder Knoten identifizieren läßt.<br />
Dadurch bedingt, daß die existierende Topologie von Knoten weder fest noch im voraus<br />
bekannt ist, ist eine dynamische Registrierung von neuen Knoten in FETISH genauso<br />
möglich wie das Verlassen des Netzwerkes. Diese Eigenschaft ermöglicht eine sehr robuste<br />
<strong>und</strong> ausfallsichere FETISH-Infrastruktur.<br />
Auf eine noch detailliertere Betrachtung der Eigenschaften <strong>und</strong> insbesondere der speziellen<br />
FADA-Kern Architektur soll an dieser Stelle verzichtet <strong>und</strong> statt dessen auf weiterführende<br />
Quellen, wie [VSA02], verwiesen werden.<br />
Zusammenfassung<br />
Zusammenfassend läßt sich für diesen Abschnitt festhalten, daß die hier exemplarisch<br />
dargestellten Ansätze bzw. Projekte zum Teil sehr unterschiedliche Wege beschreiten,<br />
um ihre definierten Projektziele zu erreichen. Wärend GUIDE, AROUND <strong>und</strong> NEXUS<br />
primär auf die Entwicklung ortsbezogener Dienste fokussieren, betrachten andere Projek-<br />
te ortsbezogene Dienste oft als eine mögliche Erweiterung ihrer Infrastruktur. Auffällig<br />
bei den Projekten GUIDE, AROUND <strong>und</strong> NEXUS ist die Entwicklung eines Ansatzes<br />
zur Modellierung von räumlichen Objekten, um Beziehungen zwischen einer Position im<br />
physikalischen Raum <strong>und</strong> ortsbezogenen Informationen herstellen zu können. Hierbei sind<br />
die entwickelten Ansätze sehr unterschiedlich. NEXUS entwickelte z.B. sogar eine eigene
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 19<br />
Modellierungssprache mit zugehöriger Anfragesprache, um eine realistische Modellierung<br />
räumlicher Konstellationen zu erreichen.<br />
Sieht man einmal von den Entwicklungen innerhalb des GUIDE Projektes ab, so läßt<br />
sich außerdem feststellen, daß alle vorgestellten Projekte versuchen, eine möglichst flexi-<br />
ble Infrastruktur zu schaffen, die in der Lage ist, unterschiedlichste Informationsquellen<br />
einheitlich in einem System zu integrieren. Dieses überträgt sich oftmals, wie z.B. bei<br />
AROUND <strong>und</strong> FETISH auf die Wahl der technischen Infrastruktur in Form von Netzwer-<br />
ken mit Eigenschaften angelehnt an Peer-to-Peer Netzwerke, die von ihrer Natur aus für<br />
Dynamik <strong>und</strong> Dezentralisierung stehen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> soll nachfolgender Abschnitt<br />
näher auf die Eigenschaften <strong>und</strong> Möglichkeiten von Peer-to-Peer Netzwerken eingehen <strong>und</strong><br />
versuchen, nützliche Eigenschaften für den Kontext der ortsbezogenen Dienste zu identi-<br />
fizieren.<br />
2.2 Peer-to-Peer Netzwerke<br />
Der vorherige Abschnitt hat den Themenkomplex ortsbezogener Dienste näher beleuchtet<br />
<strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen gelegt, die für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wichtig sind. Dieser<br />
Abschnitt soll selbiges für den Bereich der Peer-to-Peer Netzwerke gewährleisten. Insbe-<br />
sondere die inhaltliche Bedeutung des Begriffes Peer-to-Peer sowie die Eigenschaften dieser<br />
Art von Netzwerken stehen nachfolgend im Mittelpunkt.<br />
2.2.1 Inhaltliche Bedeutung<br />
Peer-to-Peer (P2P) Netzwerke werden vielfach mit der Marke Napster in Verbindung ge-<br />
bracht. Innerhalb der ursprünglichen Napster Musiktauschbörse wurde ein Peer-to-Peer-<br />
Netzwerk-Konzept zum Austausch von Dateien, wie z.B. komprimierte Audiodateien im<br />
MPEG Layer 3 (MP3) Format, benutzt. Doch Peer-to-Peer geht in seiner Idee weit über<br />
die Ansätze des bloßen Datenaustausches hinaus.<br />
<strong>Ein</strong>es der Hauptprobleme im Bereich Peer-to-Peer ist die zumeist vielfältige <strong>und</strong> verwir-<br />
rende Verwendung von unterschiedlichen Begriffen zu diesem Thema innerhalb von Pu-<br />
blikationen oder Diskussionen [Sch01]. <strong>Ein</strong>ige Ansätze, wie [Sin01] oder [TSR98], gehen<br />
z.B. lediglich davon aus, daß Peer-to-Peer als Gegenteil von Client/Server-Architekturen<br />
verstanden werden kann. Diesem Zusammenhang widerspricht hingegen Schollmeier in<br />
[Sch01] <strong>und</strong> stellt den Unterschied zwischen Client/Server <strong>und</strong> Peer-to-Peer mittels eines<br />
Konzeptes dar, bei dem in Peer-to-Peer Netzwerken jeder Teilnehmer (Peer) als ” Servent“<br />
agiert. <strong>Das</strong> Wort ” Servent“ ist ein durch Schollmeier künstlich erzeugtes Wort <strong>und</strong> setzt<br />
sich aus je einer Silbe der Worte Server <strong>und</strong> Client zusammen. Diese Wort-Konstruktion<br />
soll die Eigenschaft eines Peers innerhalb eines Netzwerkes dahingehend beschreiben, daß<br />
ein Peer zeitgleich sowohl als Server <strong>und</strong> Client agiert [Sch01].<br />
Aufgr<strong>und</strong> der hier kurz vorgestellten Iritationen bzw. unterschiedlichen Auffassungen bzgl.<br />
einem einheitlich inhaltlichen Verständnis von Peer-to-Peer Netzwerken sollen nachfolgend<br />
zwei Definitionen aus der Literatur angeführt werden, die diese unterschiedlichen Auffas-
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 20<br />
sungen nochmals unterstreichen:<br />
Definition 2 (Peer-to-Peer nach R. Schollmeier [Sch01]) A distributed network ar-<br />
chitecture may be called a Peer-to-Peer (P-to-P, P2P, ...) network, if the participants share<br />
a part of their own hardware resources (processing power, storage capacity, network link<br />
capa-city, printers, ...). These shared resources are necessary to provide the Service and<br />
content offered by the network (e.g. file sharing or shared workspaces for collaboration).<br />
They are accessible by other peers participants of such a network are thus resource (Ser-<br />
vice and content) providers as well as resource (Service and content) requestors (Servent-<br />
concept).<br />
Definition 3 (Peer-to-Peer nach C. Shirky [Shi01]) P2P is a class of applications<br />
that takes advantage of resources - storage, cycles, content, human presence - available at<br />
the edges of the Internet. Because accessing these decentralized resources means operating<br />
in an environment of unstable connectivity and unpredictable IP addresses, P2P nodes<br />
must operate the DNS system and have significant or total autonomy from central servers.<br />
Im Vergleich der beiden Ansätze wird deutlich, daß Shirky seinen Fokus mehr auf eine<br />
technische Ebene lenkt, Schollmeier hingegen legt mehr Wert auf auf die bereits eingangs<br />
diskutierte Rolle der einzelnen Peers innerhalb eines Peer-to-Peer Netzwerkes.<br />
Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit soll die inhaltliche Bedeutung des Begriffes Peer-to-<br />
Peer an die Definition von Schollmeier geknüpft werden, da diese besser die im nachfolgen-<br />
den benötigten Eigenschaften von Peer-to-Peer adressiert <strong>und</strong> zudem weitere Definitionen<br />
auf Schollmeiers Ansatz basieren.<br />
2.2.2 Arten von Peer-to-Peer Netzwerken<br />
Im Bereich der Peer-to-Peer Netze unterscheidet man im wesentlichen zwei unterschiedliche<br />
Arten von Netzen. Zum einen sind dieses Netze, die eine zentrale <strong>Ein</strong>heit innerhalb des<br />
Netzwerkes für ihr Funktionieren benötigen, <strong>und</strong> zum anderen solche, bei denen dieses<br />
nicht zutrifft - die also nur aus einzelnen Peers bestehen (vgl. Abb. 2.1). Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> wird oft eine Unterteilung von Peer-to-Peer Netzen in ” pure“ <strong>und</strong> ” hybride“ Peer-<br />
to-Peer Netzwerke vorgenommen.<br />
Beide Konzepte werden durch Schollmeier aufbauend auf seiner Peer-to-Peer Definition<br />
(Definition 2) wie folgt eingeführt:<br />
Definition 4 ( ” Pure“ Peer-to-Peer [Sch01]) A distributed network architecture has<br />
to be classified as a Pure Peer-to-Peer network, if it is firstly a Peer-to-Peer network<br />
according to Definition 2 and secondly if any single, arbitrary chosen Terminal Entity can<br />
be removed from the network without having the network suffering any loss of network<br />
service.<br />
Definition 5 ( ” Hybrid“ Peer-to-Peer [Sch01]) A distributed network architecture has<br />
to be classified as a Hybrid Peer-to-Peer network, if it is firstly a Peer-to-Peer network
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 21<br />
“Pure” Peer-to-Peer<br />
“Hybrid” Peer-to-Peer<br />
Abbildung 2.1: Arten von Peer-to-Peer Netzwerken<br />
according to Definition 2 and secondly a central entity is necessary to provide parts of the<br />
offered network services.<br />
Hybride Peer-to-Peer Netzwerke lassen sich nach den gegebenen Definitionen als Zwi-<br />
schenstück zwischen Diensten mit einer zentralisierten Ausrichtung, wie etwa bei FTP-<br />
Diensten zu finden, <strong>und</strong> einem puren Peer-to-Peer Dienst verstehen. <strong>Das</strong> bis dato wohl<br />
populärste Beispiel für ein hybrides Peer-to-Peer System ist die Musiktauschbörse Napster.<br />
Bei der Napster Architektur wurden durch das vorhandene Serversystem im wesentlichen<br />
alle Suchfunktionen im Netzwerk zur Verfügung gestellt. Genau in diesem Punkt liegt<br />
einer der Vorteile von hybriden Peer-to-Peer Netzen, da Such- <strong>und</strong> Indizierungsfunktio-<br />
nen zentral über eine leistungsfähige Datenbank realisiert werden können <strong>und</strong> nicht, wie<br />
bei purem Peer-to-Peer, durch das Gesamtsystem zur Verfügung gestellt werden müssen<br />
[BWDD02]. Im Vergleich zu puren Peer-to-Peer Netzen haben hybride Netze allerdings<br />
das Problem, daß nicht jeder Ausfall eines Peers innerhalb des Netzwerkes ohne Folgen<br />
bleiben muß, da beispielsweise bei Ausfall eines Servers die Gesamtfunktionalität gefähr-<br />
det wäre [Sch01].<br />
Betrachtet man die beiden unterschiedlichen Netztypen aus der ökonomischen Perspekti-<br />
ve, so läßt sich feststellen, daß bei puren Peer-to-Peer Netzen aufgr<strong>und</strong> eines fehlenden<br />
Servers keine zentrale Verwaltung <strong>und</strong> Wartung des Systems erfolgen muß. Die Idee der<br />
automatischen Selbstverwaltung steht hier somit im Vordergr<strong>und</strong>. <strong>Ein</strong>e technische Umset-<br />
zung dieses Netztyps dürfte allerdings aller Voraussicht nach schwieriger zu erreichen sein<br />
als dies bei hybriden Netzen der Fall wäre, da flexible Mechanismen erforderlich sind, die<br />
z.B. eine automatische Reaktion auf ungewöhnliche Systemzustände ermöglichen. Die Ent-<br />
wicklung solcher Mechanismen würde somit wahrscheinlich auf Gr<strong>und</strong> ihrer Komplexität<br />
eine hohe finanzielle Belastung innerhalb einer Entwicklung bedeuten. <strong>Das</strong> Fehlen einer<br />
Kontrollinstanz in puren Peer-to-Peer Netzen hat darüber hinaus zur Folge, daß ein sol-
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 22<br />
ches System schwer juristisch handhabbar ist, da ein Verantwortlicher fehlt. Ebenso ist es<br />
fraglich, ob durch das Fehlen einer Kontrollinstanz die Möglichkeit bei puren Peer-to-Peer<br />
Netzwerken besteht, ein funktionierendes <strong>Geschäftsmodell</strong> zu konzipieren, so daß man zu<br />
dem Schluß kommen kann, daß ein hybrides Peer-to-Peer eher eine positive ökonomische<br />
Perspektive bietet als ein System auf Basis eines puren Peer-to-Peer Netzwerkes.<br />
2.2.3 Peer-to-Peer als mögliche Basis für ortsbezogene Dienste<br />
<strong>Das</strong> Konzept der Peer-to-Peer Netzwerke ist in der Sache nicht revolutionär. Es wurde<br />
das erste Mal bereits vor ca. 30 Jahren eingeführt. <strong>Ein</strong>e Wiederbelebung erlebte es durch<br />
die jüngsten Erfolge von File sharing Anwendungen, wie Napster oder aber dem Gnutella<br />
Netzwerk. Doch nicht nur in diesem Bereich lassen sich Peer-to-Peer Netzwerke <strong>und</strong> ihre<br />
Eigenschaften sinnvoll einsetzen. Maedche beispielsweise schlägt eine <strong>Ein</strong>teilung von Peer-<br />
to-Peer Anwendungbereichen in drei Gruppen vor [Mae01]:<br />
• File sharing<br />
• Communication and Collaboration<br />
• Distributed Computing<br />
Denkt man an ein Archtekturkonzept für ortsbezogene Dienste, das sich an die Idee von<br />
Peer-to-Peer Netzwerken in seiner Gr<strong>und</strong>struktur anlehnt, wie in Abschnitt 2.1.4 be-<br />
reits angesprochen, dann läßt sich feststellen, daß sich einige Aspekte von ortsbezogenen<br />
Diensten in direkter oder abgewandelter Form in den drei Kategorien wiederfinden lassen.<br />
File sharing Aspekte könnten für den Transport <strong>und</strong> Abruf von ortsbezogenen Informa-<br />
tionen eingesetzt werden, wobei hingegen Ansätze des Distributed Computings nützlich<br />
für die komplexe Berechnung von räumlichen Benutzerprofilen sein könnten.<br />
Nachfolgende Betrachtung von Eigenschaften bzw. Vorteilen von Peer-to-Peer Netzwerken<br />
(vgl. hierzu auch [Fre02]) in Bezug auf ein Modell für ortsbezogene Dienste, das sich an<br />
Peer-to-Peer Strukturen anlehnt, soll mögliche Verknüpfungspunkte zwischen Peer-to-Peer<br />
<strong>und</strong> ortsbezogenen Diensten aufzeigen.<br />
Aktualität von Inhalten<br />
Die Suche in puren Peer-to-Peer Netzwerken findet immer in einem ad-hoc ähnlichen<br />
Modul statt. D.h. kein zentraler Index muß für die Suche benutzt werden, so daß Sucher-<br />
gebnisse konstant aktuell sein können.<br />
<strong>Ein</strong>es der existierenden Probleme bei ortsbezogenen Diensten ist die häufige Auslegung<br />
der Dienste für ein ganz spezifisches Problem bzw. dessen Lösung [Jos01]. Aufgr<strong>und</strong> der<br />
sehr individuellen Charakteristik vieler Problemstellungen ist die zugr<strong>und</strong>eliegende Tech-<br />
nik oftmals zentralisiert. <strong>Ein</strong> Zugang zu Diensten wird dann über einen zentralen Server<br />
eines bestimmten Service Providers gewährleistet. Durch die Verwendung einer zentralen<br />
Servereinheit können sich aber Probleme im Zusammenhang mit der Aktualität von Daten<br />
ergeben:
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 23<br />
Stellt man sich z.B. einen ortsbezogenen Dienst vor, der einen ” Restaurant-Finder“-Dienst<br />
anbietet, bei dem Informationen über Restaurants, wie z.B. deren Öffnungszeiten, verwen-<br />
det werden, dann könnte ein möglicher Weg für die Bereitstellung von Informationen durch<br />
einen Service Provider wie folgt aussehen: Der Service Provider sammelt im einfachsten<br />
Fall Informationen über die indizierten Restaurants <strong>und</strong> verbindet diese mit geographi-<br />
schen Daten. Anschließend stellt er diese über einen Server zur Verfügung.<br />
Wenn ein Restaurant sich nun entscheidet, z.B. seine Öffnungszeiten, die zuvor als Daten-<br />
satz aufgenommen wurden, zu ändern, dann wird dieses unbemerkt durch den ortsbezo-<br />
genen Dienst bleiben, da keine automatische Verbindung zwischen dem Anbieter (Service<br />
Provider) <strong>und</strong> dem ” Informationslieferanten“ besteht. Bereits ab diesem Zeitpunkt sind die<br />
Daten des Systems nicht mehr aktuell, da hierzu eine manuelle Änderung im System nötig<br />
wäre. Hat der Service Provider aber dennoch das Bestreben, sein angebotenes System ak-<br />
tuell <strong>und</strong> damit interessant für Benutzer zu halten, so bedeutet dieses einen beachtlichen<br />
Pflegeaufwand aufgr<strong>und</strong> fehlender automatisierter Aktualisierungsmechanismen.<br />
In einem Peer-to-Peer basierten Ansatz für einen ortsbezogenen Dienst wäre es hingegen<br />
denkbar, daß jedes Restaurant durch einen eigenständigen Peer innerhalb eines Netzwer-<br />
kes modelliert wird. Die Verwaltung dieses Peers könnte zudem in der Gewalt bzw. dem<br />
direkten <strong>Ein</strong>flußbereich des jeweiligen Restaurants liegen. Durch diese Struktur könnten<br />
Restaurants beliebige Datensätze zur Verfügung stellen <strong>und</strong> diese auch ändern. Würden<br />
die Daten eines Peers verändert, so wird die neue Information unmittelbar nach Änderung<br />
im gesamten Netzwerk zur Verfügung stehen - insbesondere auch für einen höheren Dienst,<br />
wie einem ” Restaurant-Finder“, der Informationen nur noch abstrakt agregieren müßte.<br />
Verteilung von Inhalten<br />
Peer-to-Peer Netzwerke unterstützen den Austausch <strong>und</strong> die Weiterleitung von Informa-<br />
tionen an Dritte an Stelle einer zentralen Bündelung von Informationen an einem einzigen<br />
Ort.<br />
Dynamische Informationen, die sich zur Laufzeit oder aber in bestimmten Abständen<br />
ändern, können, wie bereits zuvor angedeutet, problematisch in der Handhabung für orts-<br />
bezogene Dienste sein. Selbst wenn es einem Service Provider gelingt, einen Aktualisie-<br />
rungsmechanismus bei Änderung von Informationen mit Hilfe seiner ” Informationslieferan-<br />
ten“ zu etablieren, müßten dennoch manuelle Ergänzungen hinsichtlich einer Aufbereitung<br />
der Informationen mit räumlichen Informationen vorgenommen werden - insbesondere gilt<br />
dieses bei neu hinzugekommenen Informationen.<br />
Durch die Zentralisierung von ortsbezogenen Diensten <strong>und</strong> deren Informationen besteht so-<br />
mit kaum die Möglichkeit einer automatisierten Annotation von Informationen mit räum-<br />
lichen Daten, die für den Betrieb des Systems notwendig sind. Räumliche Beziehungen,<br />
die zwischen Informationen des Systems <strong>und</strong> dem physikalischen Raum bestehen, müssen<br />
aus diesem Gr<strong>und</strong>e im Vorfeld ” hard-kodiert“ werden. Jeder Informationszuwachs oder<br />
jede Veränderung bedarf eines manuellen Vorgangs seitens des Service Providers, um die<br />
Informationen für eine Nutzung aufzubereiten.
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 24<br />
Durch die Benutzung eines Peer-to-Peer basierten Ansatzes für einen ortsbezogenen Dienst<br />
könnte der Anmelde-Mechanismus des Netzwerkes dazu benutzt werden, um die Informa-<br />
tionseinheiten, die jeder Peer im Netzwerk zur Verfügung stellt, automatisch zu verteilen.<br />
Aber nicht nur die bloße Verteilung einzelner Informationseinheiten, sondern auch deren<br />
automatische Annotation mit räumlichen Zusatzdaten auf Basis eines physikalischen Her-<br />
kunftsortes im Netzwerk könnte hierdurch ermöglicht werden, sofern Peers selbst über ent-<br />
sprechende räumliche Informationen verfügen. Es wäre beispielsweise denkbar, abhängig<br />
von Beziehungen zwischen Peers, räumliche Daten für Informationseinheiten zu generieren,<br />
wie z.B. partonomische Relationen.<br />
Flexible Kommunikation<br />
In Peer-to-Peer Netzwerken ist jeder Peer in der Lage, Kommunikationsverbindungen zu<br />
anderen Peers innerhalb des Netzwerkes eigenständig aufzubauen.<br />
Der Standardisierungsprozeß im Bereich ortsbezogener Dienste ist bis zum aktuellem Zeit-<br />
punkt noch nicht sehr weit fortgeschritten, wenngleich die Bemühungen stetig wachsen.<br />
Dieses mag einer der Gründe sein, warum einige ortsbezogene Dienste noch nicht aufbau-<br />
end auf Standards entwickelt werden. Gegenwärtige Entwicklungen scheinen zumeist auf<br />
eigene proprietäre Lösungen zu setzen (vgl. 2.1.4). Hieraus resultiert zwangsläufig eine<br />
Schwachstelle im Zusammenhang mit der Kompatibilität unterschiedlicher Systeme. Viele<br />
Lösungen können deshalb nur in einer Art ” Stand-Alone“ Modus operieren <strong>und</strong> sind nicht<br />
in der Lage, von bereits bestehenden Systemen auf dem Markt zu profitieren oder aber<br />
auf deren Leistung aufzubauen. Hinzu kommt außerdem, daß bei zentralisierten Systemen<br />
ein Ausfall einzelner Server den Ausfall des Gesamtsystems zur Folge haben kann.<br />
Durch die Nutzung eines Peer-to-Peer basierten Ansatzes für ortsbezogene Dienste wäre<br />
eine flexible Kommunikation zwischen einzelnen Peers möglich, die eine gewisse Ausfall-<br />
sicherheit <strong>und</strong> standardisierte Kommunikation zugleich ermöglichen würde. Auf diesem<br />
Sektor existieren bereits diverse Schnittstellen <strong>und</strong> optimierte Konzepte, die eine solche<br />
Kommunikation unterstützen. <strong>Ein</strong>es der neueren Konzepte, die in diesem Bereich nutzbar<br />
wären, ist sicherlich das Konzept der Webservices.<br />
Unter der Annahme, daß jeder ortsbezogene Dienst aus mindestens einem Peer besteht,<br />
wäre es mit Hilfe des verwendeten Peer-to-Peer Kommunikationsprotokolls ebenfalls mög-<br />
lich, Verbindungen zu anderen Peers aufzubauen, wenn spezielle Informationen benötigt<br />
werden. Dieses könnte z.B. der Fall sein, wenn ein Benutzer detailliertere Informationen<br />
zu einem bestimmten Bereich abfragt <strong>und</strong> diese physikalisch nicht von dem aktuellen Peer,<br />
der mit einem Benutzer kommuniziert, verwaltet werden.<br />
Entsprechend dieses Ansatzes müßte darüber hinaus die Informationsbasis eines Peers<br />
nicht aus allen Informationen des ortsbezogenen Dienstes bestehen, auf die ein Benutzer<br />
durch einen Peer zugreifen kann. Jeder Peer könnte zusätzlich zu einer physikalisch vor-<br />
handenen Informationsbasis eine Referenzbasis auf weitere Informationen anderer Peers<br />
vorhalten, welche bei Bedarf aufgelöst werden könnten.
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 25<br />
Offerieren <strong>und</strong> Konsumieren von Inhalten<br />
Peers sind nicht nur in der Lage, Informationen oder Ressourcen von anderen Peers inner-<br />
halb eines Netzwerkes zu konsumieren, sondern sind vielmehr in der Lage, eigene Inhalte<br />
anzubieten.<br />
Bestehende Ansätze ortsbezogener Dienste stellen in der Regel nicht die Möglichkeit zur<br />
Verfügung, daß Benutzer eigene Informationen bereitstellen können. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
ist die Entwicklung einiger spezieller Dienste, die nicht nur mit der bloßen Position von<br />
Benutzern als einzigen dynamischen Inhalt operieren, schwierig. AT&T’s ” Find-a-Friend“<br />
Dienst [Wir03] ermöglicht es beispielsweise, daß Fre<strong>und</strong>e die jeweilige Position von ande-<br />
ren Fre<strong>und</strong>en mitgeteilt bekommen. Weitere Informationen können nicht zur Verfügung<br />
gestellt werden, da das System nicht mit dynamischen Daten umgehen kann - die aktuelle<br />
Position einer Person ist hierbei lediglich eine durch die permanente Ortung von Handys<br />
durch den Provider herbeigeführte Dynamik. Würde ein solches System mit dynamischen<br />
Informationen umgehen können, wären erweiterter ” Find-a-Friend“ Dienste möglich, die<br />
zusätzlich zur Position von Fre<strong>und</strong>en weitere ihnen zugeordnete Informationen anbieten.<br />
Hätte ein Benutzer z.B. die Möglichkeit, eine eigene private ” Location Homepage“ zur<br />
Verfügung zu stellen, die beliebige Informationen enthalten könnte, ließe sich ein solcher<br />
Dienst nicht nur ermöglichen, sondern würde zudem einem Benutzer die Kontrolle darüber<br />
bieten, welche Informationen er über sich preisgeben möchte.<br />
Möglich wäre für ein solches Verhalten ein Peer-to-Peer basierter Ansatz für ortsbezogene<br />
Dienste, bei dem ein Benutzer des Dienstes als Peer, der seine Position permanent ändern<br />
kann, modelliert würde. Dieses hätte dann den Vorteil, daß Benutzer wirklich eigenständig<br />
entscheiden, welche Informationen sie in einem System zur Verfügung stellen wollen, an-<br />
stelle diese Entscheidung an einen Service Provider abtreten zu müssen. <strong>Ein</strong> solches Kon-<br />
zept könnte auch ein Gr<strong>und</strong>ansatz für die Lösung von Problemen bzgl. der Privatsphäre<br />
bei Nutzung von ortsbezogenen Diensten sein, wie sie auch u.a. von Leonhard in [Leo98]<br />
diskutiert werden.<br />
Zusammenfassung<br />
Betrachtet man zusammenfassend die vorangegangenen Ausführungen, die sich mit ei-<br />
ner Verwendung von Peer-to-Peer basierten Ansätzen für eine Infrastruktur ortsbezogener<br />
Dienste beschäftigten, so sollte deutlich geworden sein, daß durch Peer-to-Peer eine fun-<br />
dierte Basis für ortsbezogene Dienste gebildet werden könnte. <strong>Ein</strong>ige aktuell diskutierte<br />
Probleme, wie die Integration dynamischer Informationen in die Entwicklung ortsbezoge-<br />
ner Dienste, könnten mit der Hilfe von Peer-to-Peer Konzepten gelöst oder aber zumindest<br />
vereinfacht werden. Insbesondere scheint hierbei die Dynamik, die ein Peer-to-Peer Netz-<br />
werk mit sich bringt, besonders interessant <strong>und</strong> geeignet für mobile Anwendungen, wie<br />
ortsbezogene Dienste, zu sein, da diese in vielen Fällen ähnliche Charakteristika aufwei-<br />
sen. Diese <strong>Ein</strong>schätzung läßt sich zusätzlich durch aktuelle Arbeiten in unterschiedlichen<br />
Projekten, wie z.B. dem bereits in Abschnitt 2.1.4 vorgestellten FETISH Projekt, unter-<br />
mauern.
KAPITEL 2. GRUNDLAGEN 26<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Erkenntnisse in Bezug auf Peer-to-Peer <strong>und</strong> ortsbezogene Dienste werden<br />
die nachfolgenden Kapitel dieser Arbeit ebenfalls auf ortsbezogene Dienste mit einem<br />
Peer-to-Peer basierten Ansatz eingehen <strong>und</strong> detaillierter aufzeigen, wie sich dieser Ansatz<br />
in einem Systemkonzept, angelehnt an die Idee von Peer-to-Peer Netzwerken, integrieren<br />
lassen könnte <strong>und</strong> wie dieser Ansatz sowohl eine ökonomische Perspektive bietet als auch<br />
technisch realisierbar ist.
Kapitel 3<br />
<strong>Ein</strong> <strong>Geschäftsmodell</strong> für<br />
ortsbezogene Dienste<br />
Nachdem das vorherige Kapitel in die allgemeinen Verständnisgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> zentralen<br />
Begrifflichkeiten dieser Arbeit einführte <strong>und</strong> darüber hinaus einen ersten <strong>Ein</strong>blick in die<br />
Idee eines Peer-to-Peer basierten Ansatzes für ortsbezogene Dienste gab, dient dieses Ka-<br />
pitel dazu, ein mögliches <strong>Geschäftsmodell</strong> für diesen Ansatz zu erläutern.<br />
<strong>Das</strong> im nachfolgenden präsentierte <strong>Geschäftsmodell</strong> stellt hierbei nur eine Möglichkeit un-<br />
ter vielen weiteren vorhandenen Ansätzen dar. Es soll von der gr<strong>und</strong>legenden Vision ausge-<br />
hend aufzeigen, welche Schritte notwendig sind, um den in dieser Arbeit vorgestellten orts-<br />
bezogenen Dienst in einem kommerziellen Umfeld zu etablieren. Abschließend dient dieses<br />
Kapitel dazu, basierend auf dem zugr<strong>und</strong>eliegenden <strong>Geschäftsmodell</strong> sowie existierender<br />
Nutzerinteressen im mobile Business Umfeld, Anforderungen <strong>und</strong> Rahmenbedingungen<br />
für die Entwicklung ortsbezogener Dienste im allgemeinen <strong>und</strong> dem hier thematisierten<br />
System im speziellen zu formulieren.<br />
Aufgr<strong>und</strong> dessen, daß in den folgenden Abschnitten immer wieder die Worte mobile Busi-<br />
ness (mBusiness) bzw. mobile Commerce (mCommerce) Verwendung finden, sollen sie an<br />
dieser Stelle kurz erläutert werden: Mobile Business steht stellvertretend für mobile An-<br />
wendungen, die keine finanziellen Transaktionen beinhalten. Mobile Commerce hingegen<br />
findet dann Verwendung, wenn eine Transaktion mit einem gewissen finanziellem Wert<br />
vorliegt, wie z.B. das Versenden von SMS durch einen Service Provider [Dur01a]. Es läßt<br />
sich allerdings feststellen, daß eine Unterscheidung dieser beiden Begriffe in der Literatur<br />
zumeist sehr unscharf bzw. gar nicht vorgenommen wird. Aus diesem Gr<strong>und</strong> werden im<br />
Nachfolgenden die Begriffe ebenfalls weitgehend synonym behandelt.<br />
3.1 Gr<strong>und</strong>lagen zu <strong>Geschäftsmodell</strong>en für mobile Anwen-<br />
dungen<br />
Vom aktuellem Zeitpunkt aus betrachtet, läßt sich ein gesellschaftlicher Wandel von der<br />
gerade erreichten modernen Kommunikationsgesellschaft hin zu einer mobilen Kommuni-<br />
27
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 28<br />
kationsgesellschaft, bei der eine größtmögliche Flexibilität <strong>und</strong> Mobilität von besonderer<br />
Bedeutung ist, verzeichnen. Der endgültige Startschuß in das mobile Zeitalter wurde wohl<br />
durch die Vergabe der knapp 50 Milliarden Euro teuren UMTS-Lizenzen in Deutschland im<br />
August 2000 an die Mobilfunknetz-Betreiber <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen neuen Möglich-<br />
keiten in der Nutzung mobiler Systeme gegeben [Cle02]. Nicht erst seit dieser Zeit findet<br />
der Begriff ” <strong>Geschäftsmodell</strong>“ immer mehr Verwendung, wenn es um die Generierung<br />
neuer Geschäftsideen geht. Dieses liegt seitens der Mobilfunknetz-Betreiber wohl darin<br />
begründet, daß der Druck nach dem Erwerb der UMTS-Lizenzen <strong>und</strong> dem daraus resul-<br />
tierenden immensen Investitionsvolumen größer den je geworden ist, <strong>Geschäftsmodell</strong>e zu<br />
entwickeln, die eine möglichst große Zahl an K<strong>und</strong>en gewinnen können <strong>und</strong> mit deren Hilfe<br />
profitable Geschäfte entstehen, um die Investitionen zu rechtfertigen.<br />
Timmers [Tim98], stellt jedoch bereits 1998 fest, daß sich in der Literatur, die sich mit<br />
dem Thema eCommerce beschäftigt, keine konsistente Benutzung des Begriffs ” Geschäfts-<br />
modell“ finden läßt. Darüber hinaus stellte Timmers fest, daß Autoren häufig gar keine<br />
Definition dieses Begriffes anstreben. Um dieser Diskrepanz über ein einheitliches inhaltli-<br />
ches Verständnis von <strong>Geschäftsmodell</strong>en Abhilfe zu schaffen, schlägt Timmers aufbauend<br />
auf einer initialen Geschäftsidee nachfolgende Strukturierung mit den relevanten Bestand-<br />
teilen eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s vor [GG01]:<br />
• <strong>Das</strong> Produkt (oder die Dienstleistung), seine Funktion <strong>und</strong> Spezifikationen<br />
• Die an der Erstellung des Produktes beteiligten Personen, Gruppen <strong>und</strong> Institutio-<br />
nen <strong>und</strong> Funktionen im Rahmen der Leistungserstellung<br />
• Der Nutzen, den die einzelnen Beteiligten <strong>und</strong> Akteure, Dienstleister <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en<br />
generieren.<br />
• Die Leistungen, die sie in diesem Rahmen zu erbringen haben<br />
Zusätzlich zu den dargestellten Bestandteilen müssen natürlich noch Ertragsquellen sowie<br />
eine geeignete Strategieplanung für ein komplettes <strong>Geschäftsmodell</strong> integriert werden, um<br />
sicher zu stellen, daß ein am Markt agierendes Unternehmen hiermit auch langfristig Er-<br />
folg erzielen könnte.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> wählt Zobel [Zob01] eine etwas andere Darstellung, um die inhaltliche<br />
Bedeutung eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s zu definieren. Nach Zobel besteht ein Geschäftsmo-<br />
dell im wesentlichen aus 3 Faktoren: dem Wertbeitrag für die K<strong>und</strong>en, der K<strong>und</strong>enseg-<br />
mentierung <strong>und</strong> den Erlösquellen, wobei alle drei Variablen voneinander abhängig sind.<br />
Rahmenbildend für das gesamte <strong>Geschäftsmodell</strong> steht eine geeignete Strategie.<br />
Als Gr<strong>und</strong>lage für ein zu erstellendes <strong>Geschäftsmodell</strong> dient in der Regel eine Markt-<br />
analyse, die Aufschluß über die aktuelle Situation am Markt in der jeweiligen Branche,<br />
Konkurrenten, Chancen <strong>und</strong> Risiken sowie Nutzerbedürfnisse etc. liefert.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Geschäftsmodell</strong> selbst baut gr<strong>und</strong>sätzlich auf einer zunächst meist vagen Geschäfts-<br />
idee auf <strong>und</strong> versucht dann, in einzelnen Schritten diese Idee detailliert zu spezifizieren. Im<br />
Nachfolgenden soll näher auf die einzelnen Komponenten des in Abbildung 3.1 dargestell-<br />
ten <strong>Geschäftsmodell</strong>s nach Zobel eingegangen werden, um deren inhaltliche Bestandteile
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 29<br />
Wertbeitrag<br />
(USP)<br />
Strategie<br />
<strong>Geschäftsmodell</strong><br />
Erlösquellen<br />
K<strong>und</strong>ensegment<br />
Abbildung 3.1: Die Komponenten eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s nach Zobel [Zob01]<br />
zu verdeutlichen, die notwendig sind, um ein <strong>Geschäftsmodell</strong> aus einer Idee heraus zu<br />
generieren.<br />
Wertbeitrag Der Wertbeitrag ist der Wert oder Nutzen, den ein K<strong>und</strong>e aus der Nut-<br />
zung eines Angebotes für sich gewinnt. Im englischen Sprachgebrauch wird dieses<br />
als Unique Selling Proposition (USP) bezeichnet. Hierbei wird durch die Verwen-<br />
dung von unique deutlich gemacht, daß es darum geht, einen möglichst einzigartigen<br />
Wertbeitrag für einen K<strong>und</strong>en zu generieren, d.h. einen Wertbeitrag zu schaffen,<br />
der möglichst nicht durch andere Anbieter oder vergleichbare Angebote substituiert<br />
werden kann.<br />
Darüber hinaus muß betrachtet werden, welchen Wert ein potentieller K<strong>und</strong>e aus un-<br />
terschiedlichen Bereichen (Geschäftsk<strong>und</strong>en, Privatk<strong>und</strong>en etc.) erhält. In der Regel<br />
läßt sich feststellen, daß für unterschiedliche K<strong>und</strong>engruppen jedesmal andere Werte<br />
geschaffen werden können. Hierbei ist es für ein <strong>Geschäftsmodell</strong> von Bedeutung, für<br />
welche Gruppen sich maximale Werte schaffen lassen.<br />
K<strong>und</strong>ensegment <strong>Das</strong> K<strong>und</strong>ensegment ist nahezu nahtlos mit dem Wertbeitrag gekop-<br />
pelt. <strong>Ein</strong> Angebot, das aus einer Geschäftsidee heraus resultiert, ist nicht zwangsläufig<br />
nur auf eine spezielle K<strong>und</strong>engruppe festgelegt, sondern kann auf verschiedene Grup-<br />
pen bzw. Segmente übertragen werden. Zentral im Bereich K<strong>und</strong>ensegment ist dem-<br />
nach die Frage, welches K<strong>und</strong>ensegment ein Anbieter bedienen kann <strong>und</strong> will <strong>und</strong><br />
wie das jeweilige Angebot an die unterschiedlichen Bedingungen angepaßt werden<br />
muß. <strong>Ein</strong> Anbieter muß abhängig von einer Markteinschätzung abwägen, ob er sich<br />
nur auf einzelne spezielle K<strong>und</strong>ensegmente konzentrieren will oder aber einen breiten<br />
Fokus für sein Angebot wählt.<br />
Der Bereich des K<strong>und</strong>ensegmentes <strong>und</strong> die Festlegung der Zielgruppen befindet sich<br />
in permanenter Abhängigkeit zu den gewählten Erlösquellen <strong>und</strong> insbesondere zu<br />
der gewählten Strategie für ein <strong>Geschäftsmodell</strong>. So kann es beispielsweise Bestand-<br />
teil einer Strategie sein, das K<strong>und</strong>ensegment im Laufe der Zeit zu wechseln <strong>und</strong> so
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 30<br />
zum Start mehr auf den Bereich Pionierk<strong>und</strong>en zu fokussieren, also jene K<strong>und</strong>en,<br />
die die Bedürfnisse des Marktes antizipieren <strong>und</strong> zugleich technisch interessiert sind<br />
<strong>und</strong> kleine Mängel des Angebotes eher akzeptieren als ein Durchschnittsk<strong>und</strong>e.<br />
Erlösquellen <strong>Ein</strong>e weitere wichtige Komponente innerhalb des <strong>Geschäftsmodell</strong>s nehmen<br />
die Erlösquellen ein. Ohne die Entwicklung geeigneter Erlösquellen für ein Angebot<br />
kann kein Anbieter lange am Markt agieren. Gerade im Bereich mCommerce, wo der<br />
Markt noch nicht so stark erforscht ist wie in anderen Bereichen, ist es besonders<br />
wichtig, zeitgleich mehrere Erlösmodelle zu entwickeln, um bei einer Nichtakzeptanz<br />
eines Modells am Markt Ausweichmöglichkeiten zu haben. Ausgangspunkt für eine<br />
solche Art der Überlegung ist die Frage danach, wer für ein Angebot was zahlen<br />
würde. Für die Beantwortung muß sowohl im engeren Sinne das fokussierte Kun-<br />
densegment betrachtet werden als auch die diversen Möglichkeiten von direkten <strong>und</strong><br />
indirekten Erlösformen, um ein optimales Ergebnis für das Angebot zu erzielen.<br />
Strategie Die letzte Komponente des <strong>Geschäftsmodell</strong>s befaßt sich mit der Auswahl einer<br />
geeigneten Strategie für den Markteintritt des Angebotes sowie der generellen Stra-<br />
tegie über die Laufzeit des Angebotes. Sie bildet, wie eingangs beschrieben, den alles<br />
umschließenden Rahmen für das zu definierende <strong>Geschäftsmodell</strong>. Darüber hinaus<br />
befaßt sich der Bereich der Strategiebildung zudem mit Aspekten, wie eine gr<strong>und</strong>le-<br />
gende Produkt- <strong>und</strong> Preispolitik oder aber die langfristig angestrebte Marktposition.<br />
Als theoretische Basis für eine geeignete Strategie bietet die traditionelle Betriebs-<br />
wirtschaftslehre unterschiedlichste Ansätze an, wie z.B. die Theorie des ” Marked-<br />
based View“ oder aber die des ” Ressource-based View“. Der Ansatz des ” Marked-<br />
based View“ geht dabei auf den maßgeblichen Mitbegründer der modernen Management-<br />
Strategien Michael E. Porter <strong>und</strong> seine 1992 publizierte Arbeit [Por02] zurück. Bei<br />
diesem marktorientierten Ansatz geht es darum, eine Strategie auf Basis der Wett-<br />
bewerbsbedingungen in der ” Produkt/Markt Arena“ mit dem Ziel zu entwickeln ein<br />
Unternehmen in eine optimale Position zu Wettbewerbskräften <strong>und</strong> direkten Kon-<br />
kurrenten zu bringen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen [Hil02]. Die Theorie des<br />
” Ressource-based View“ versucht analog zum Marked-based View“ ebenfalls eine<br />
”<br />
Strategie zu entwickeln, die einem Unternehmen Wettbewerbsvorteile sichert. Je-<br />
doch liegt das Hauptaugenmerk nicht auf der Positionierung des Unternehmens im<br />
ökonomischem Umfeld, sondern auf einer Stärken- <strong>und</strong> Schwächenanalyse des Un-<br />
ternehmens. Der Ressource-based View geht im Gegensatz zum marktorientieren<br />
Ansatz davon aus, daß Wettbewerbsvorteile auf Gr<strong>und</strong>lage von bestimmten Fähig-<br />
keiten eines Unternehmens erzielt werden <strong>und</strong> nicht auf einer Ebene der strategischen<br />
Geschäftseinheiten [Hil02].<br />
<strong>Ein</strong>e detaillierte Betrachtung der einzelnen Formen bzw. Komponenten innerhalb der<br />
Strategiebildung für <strong>Geschäftsmodell</strong>e kann der Standard-Literatur der Betriebswirt-<br />
schaftslehre entnommen werden. Spezielle Ansätze für den Bereich mBusiness lassen<br />
sich in [Cle02] finden.
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 31<br />
Ausgangspunkt für das in den nachfolgenden Abschnitten dargestellte <strong>Geschäftsmodell</strong><br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s bildet eine Marktanalyse über mobile <strong>und</strong> ortsbezogene Dienste. Auf<br />
dieser Analyse <strong>und</strong> den daraus gewonnenen Erkenntnissen aufbauend, wird die noch vage<br />
Geschäftsidee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s formuliert. Sie wiederum gibt Aufschluß über Art <strong>und</strong><br />
Aufbau einer dem <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> zugr<strong>und</strong>eliegenden Wertschöpfungskette, die alle beteilig-<br />
ten Akteure integriert. Nach dieser Darstellung wird auf die einzelnen o.g. Komponenten<br />
des <strong>Geschäftsmodell</strong>s detailliert eingegangen. Den Abschluß bildet eine Zusammenfassung<br />
wesentlicher Erkenntnisse, Anforderungen <strong>und</strong> Rahmenbedingungen an ein auf Basis des<br />
<strong>Geschäftsmodell</strong>s zu entwickelndes System.<br />
3.2 Marktanalyse<br />
Die im nachfolgenden präsentierte Marktanalyse soll die wesentlichen Rahmenbedingungen<br />
für mobile Märkte <strong>und</strong> insbesondere für den Markt der ortsbezogenen Dienste erläutern.<br />
Diese Erläuterungen sollen dazu dienen, ein besseres Verständnis des Marktes zu erlan-<br />
gen, um das Potential des in diesem Kapitel vorgestellten <strong>Geschäftsmodell</strong>s realistisch<br />
einzuschätzen zu können. Hauptaugenmerk soll hierbei auf die allgemeine Betrachtung<br />
der relevanten Märkte sowie eine Betrachtung von Nutzerinteressen <strong>und</strong> Nutzungsproble-<br />
men mobiler bzw. ortsbezogener Dienste gelegt werden.<br />
3.2.1 Mobile Märkte zwischen Hype <strong>und</strong> Realismus<br />
Innerhalb der vergangenen 10 Jahre wurde in der Wirtschaft, sowohl national wie auch<br />
international, ein extremes Wachstum in den Bereichen Internet <strong>und</strong> mobile Telekommu-<br />
nikation erreicht. Die Euphorie in diesen beiden Märkten führte 1999 bis Anfang 2000 zu<br />
einem Wachstumshöhepunkt. Viele Aktien von Unternehmen, die ihre Wirkungskreise in<br />
diesen beiden Märkten hatten, waren aus heutiger Sicht völlig überzogen bewertet <strong>und</strong><br />
es hatte den Anschein als glaubten Investoren an ein scheinbar unbegrenztes Wachstum<br />
[Lad02]. Rückblickend wird dieses Phänomen in der Börsenlandschaft als das ” Platzen der<br />
Dotcom-Blase“ angesehen, was die extremen Kursverluste <strong>und</strong> diversen Insolvenzen von<br />
” Dotcom“-Unternehmen symbolisieren soll.<br />
Ähnliches läßt sich auch im Zusammenhang mit den Ankündigungen <strong>und</strong> der darauf fol-<br />
genden Euphorie um die <strong>Ein</strong>führung von UMTS feststellen. Dieses läßt sich wahrschein-<br />
lich darauf zurückführen, daß der Ankündigungszeitpunkt genau am Ende der überhitzten<br />
Phase des ” Dotcom Hypes“ platziert wurde <strong>und</strong> man hieraus versuchte, neue Hoffnung zu<br />
schöpfen. Doch auch hier mußte die Euphorie schnell der Realität weichen <strong>und</strong> man stell-<br />
te fest, daß die Investitionen der Mobilfunkanbieter in UMTS-Lizenzpakete sich nicht auf<br />
kurze Sicht leicht amortisieren lassen würden, wie noch kurz vor dem Erwerb erwartet wur-<br />
de. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird derzeit die Chance in multimedialen mobilen Datendiensten,<br />
also im mCommerce bzw. mBusiness gesehen, da diese Anwendungen Netzlasten erzeu-
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 32<br />
gen könnten, die die modernen UMTS-Netze <strong>und</strong> ihre hohen Bandbreiten rechtfertigen<br />
könnten [Lad02].<br />
Euro per month<br />
ARPU Development in Europe Split by Revenue Source<br />
50,00<br />
45,00<br />
40,00<br />
35,00<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Access/Subscription ARPU 7,50 5,10 4,20 3,80 3,60 3,50 3,40<br />
Voice Traffic ARPU 36,80 31,20 29,10 26,70 24,50 22,30 19,20<br />
Data Traffic ARPU 0,20 0,30 0,50 1,70 3,50 5,10 7,40<br />
Content & Service ARPU 1,80 2,40 3,20 3,30 3,70 5,30 8,70<br />
Indirect ARPU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00<br />
Abbildung 3.2: Durchschnittliche Ertragsquellen pro Nutzer in Europa [Dur01b]<br />
Dieser Trend wird ebenfalls durch eine von Durlacher Research Ltd. bereits im Jahr 2001<br />
durchgeführte Marktanalyse untermauert. Ihr nach sind in der Zeit von 2003 bis 2005<br />
die größten Zuwachsraten gemessen als ” durchschnittlicher Ertrag pro Nutzer“ (englisch:<br />
Average Revenue Per User (ARPU)) in Europa in den Bereichen Data Traffic sowie Con-<br />
tent & Service ARPU zu verzeichnen (vgl. Abb. 3.2). Die größte <strong>Ein</strong>namequelle stellt<br />
allerdings immer noch der Bereich Voice Traffic ARPU dar, wobei hier die prozentualen<br />
Zuwachsraten rückläufig sind, was einen Trend zu einer mehr datengetriebenen Nutzung<br />
von mobilen Kommunikationsgeräten bedeuten würde.<br />
Die Markt-Schwankungen, die durch erste Euphorie <strong>und</strong> darauf folgende Ernüchterung bei<br />
der <strong>Ein</strong>führung neuer Technologien entstehen, werden inzwischen als sehr typisch betrach-<br />
tet. Rogers [Rog83] beschrieb dieses bereits 1983 in seiner Arbeit ” Diffusion of Innovations“<br />
unter dem Begriff ” Diffusionskurve für Innovationen“. In diesem Zusammenhang hat sich<br />
das Wort ” Hype“ als Beschreibung für das Phänomen der extremen Übertreibung eta-<br />
bliert. Die Darstellung der Schwankungen am Markt läßt sich graphisch, wie in Abbildung<br />
3.3 dargestellt, veranschaulichen. Man spricht dann oft von der sogenannten Hype-Kurve.<br />
Hierbei zeigt diese auf, daß am Anfang einer neuen Technologieeinführung eine Phase der<br />
positiven Übertreibung steht. Ihr folgt eine Phase der Enttäuschung, Ernüchterung <strong>und</strong>
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 33<br />
Hype<br />
Disapointment<br />
mCommerce Hype<br />
Realism<br />
Growth<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Mobile Commerce<br />
Reality<br />
Abbildung 3.3: mCommerce Hype-Kurve [Dur01a]<br />
negativen Übertreibung bis hin zu einer realistischen <strong>Ein</strong>schätzung. Erst nach Ende dieser<br />
Phase kann ein normales, den Bedingungen gerecht werdendes Wachstum erzielt werden.<br />
Abbildung 3.3 zeigt jedoch in diesem speziellen Fall nicht nur den generellen Verlauf der<br />
Hype-Kurve, sondern beschreibt ebenfalls die zeitliche Abfolge der Phasen des mCom-<br />
merce, so daß zum aktuellen Zeitpunkt (2003) nach der dargestellten <strong>Ein</strong>schätzung von<br />
Durlacher Research Ldt. die letzte Phase, die sich durch realistische Wachstums-Chancen<br />
auszeichnet, begonnen hat.<br />
Im nachfolgenden Abschnitt soll genau hier angesetzt werden, um zu untersuchen, inwie-<br />
weit sich der Markt für ortsbezogene Dienste, der ein Teilmarkt im mBusiness darstellt,<br />
diesen Prognosen gerecht wird.<br />
3.2.2 Der Markt für ortsbezogene Dienste<br />
Ortsbezogene Dienste sind nach ihrer Definition her datengetriebene Dienste, da sie einem<br />
Nutzer ein Informationssystem zur Verfügung stellen, dessen präsentierte Informationen<br />
einen zum aktuellen Ortskontext passenden Fokus besitzen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> sind orts-<br />
bezogene Dienste von besonderen Interesse im mBusiness, da sie das Potential haben,<br />
dem bereits festgestellten Trend hin zu einer mehr datengetriebenen Nutzung von mobiler<br />
Kommunikation gerecht zu werden.<br />
Bei dem Vergleich von Analysen, die sich mit dem zukünftigen Markt für ortsbezogene<br />
Dienste befaßt haben, läßt sich feststellen, daß - wie bereits zuvor im Gesamtbereich<br />
mCommerce - sich ebenfalls ein Hype um das Thema ortsbezogene Dienste entwickelt<br />
hat. Entsprechend prognostizierten Analysten dem Markt für ortsbezogene Dienste ein<br />
Volumen von etwa 18 Milliarden US $ bis zum Jahreswechsel 2005/2006 [Lad02]:<br />
• Strategy Analytics, Dez. 2000: 16 Milliarden in 2005
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 34<br />
• Ovum, Jan. 2001: 20 Milliarden 2006<br />
• Analysys, Feb. 2001: 2 Milliarden Ende 2002, 18,5 Milliarden in 2006<br />
Auch im direkten Vergleich von Nordamerika <strong>und</strong> Europa wurde durch die Regulierungs-<br />
behörde für Telekommunikation (RegTP) eine Prognose veröffentlicht, die nicht nur den<br />
Markt als sehr optimistisch einschätzte, sondern auch den europäischen Markt weit im<br />
Vorteil gegenüber Nordamerika sah <strong>und</strong> vom heutigen Zeitpunkt aus betrachtet einen<br />
Marktzuwachs von derzeit 70 Millionen US $ auf 220 Millionen US $ im Jahr 2005 pro-<br />
gnostizierte, was ein Anstieg um 300 Prozent bedeuten würde (vgl. Abbildung 3.4).<br />
Mio. US $<br />
10000<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1,6<br />
13,2<br />
75<br />
195<br />
Markt für standortbezogene Dienste<br />
1125<br />
742<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
2451<br />
Nordamerika Europa<br />
Abbildung 3.4: Markt für standortbezogene Dienste (Prognose) Quelle: [Kur02]<br />
Diese Betrachtung der allgemeinen Prognosen zum Markt für ortsbezogene Dienste macht<br />
deutlich, daß die Entwicklung des Bereiches ortsbezogene Dienste aller Wahrscheinlichkeit<br />
nach ebenfalls den Gesetzen der Hype-Kurve unterliegt wie bereits zuvor der mCommerce<br />
Markt. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist es nicht verw<strong>und</strong>erlich, daß entgegen den überhitzten Pro-<br />
gnosen in der Hype-Phase zum aktuellen Zeitpunkt nur eine geringe Zahl an Applikationen<br />
am Markt existiert, die einen Ortskontext integrieren. Dennoch läßt sich eine allmähliche<br />
Zunahme an Applikationen am Markt verzeichnen, die versuchen, im Bereich ortsbezo-<br />
gene Dienste Fuß zu fassen. So hat beispielsweise Vodafone für Mitte bis Ende 2003 die<br />
Verfügbarkeit seines ” Friendzone“-Dienstes angekündigt, der es Benutzern ermöglichen<br />
soll, auf Basis von SMS Fre<strong>und</strong>e in der Nähe aufzufinden, um sich so spontan für ein<br />
Treffen verabreden zu können. <strong>Ein</strong> anderes Beispiel für bereits etablierte ortsbezogene<br />
Dienste ist das Vindigo System [Vin03]. Es stellt Nutzern eine Applikation für PDA’s zur<br />
Verfügung <strong>und</strong> ermöglicht einen spezifischen Zugriff auf Informationen, wie Wegstrecken,<br />
Restaurants etc. <strong>Das</strong> System bietet aber keine automatische Ortsidentifikation, sondern<br />
ist auf die manuellen Angaben des Benutzers angewiesen.<br />
Setzt man die eingangs beschriebenen überzogenen Prognosen für ortsbezogene Dienste in<br />
Beziehung mit der aktuellen Marktsituation, gemessen an verfügbaren <strong>und</strong> bekannten orts-<br />
3240<br />
4556<br />
6039<br />
6518<br />
9167
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 35<br />
bezogenen Anwendungen, dann läßt sich annehmen, daß die anfängliche Hype-Phase bei<br />
ortsbezogenen Diensten überw<strong>und</strong>en scheint <strong>und</strong> wir uns derzeit an der Schwelle zwischen<br />
Realismus <strong>und</strong> leichtem Marktwachstum bewegen müßten. Demnach ist die Hype-Kurve<br />
für die Technologie ortsbezogener Dienste im Vergleich zur Kurve des mCommerce (siehe<br />
Abb. 3.3) zeitlich um mindestens 2 Jahre nach hinten verschoben. <strong>Ein</strong>e Darstellung dieser<br />
möglichen Verschiebung zeigt Abbildung 3.5.<br />
mCommerce <strong>und</strong> Loction Based Service Hype<br />
im Vergleich<br />
Hype<br />
Disapointment<br />
~ 2 years<br />
Realism<br />
Mobile Commerce<br />
Reality<br />
Growth<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Location Based Services<br />
Reality<br />
Abbildung 3.5: Der zeitlich unterschiedliche Verlauf der Hype-Kurven von mCommerce<br />
<strong>und</strong> ortsbezogenen Diensten (eigene Darstellung)<br />
Geht man von der dargestellten Hype-Kurve für ortsbezogene Dienste aus, dann läßt sich<br />
der Markt in der nahen Zukunft als sehr günstig für die <strong>Ein</strong>führung neuer Anwendungen<br />
mit Ortskontexten einstufen. Dieses läßt sich ebenfalls dadurch belegen, daß bei Umfra-<br />
gen in der Vergangenheit bereits ein erhöhtes Bedürfnis nach ortsbezogenen Diensten zu<br />
verzeichnen war. In einer Analyse der Boston Consulting Group (BCG) vom November<br />
2000 wurde bereits ein erhöhtes Interesse an ortsbezogenen Diensten bei den Befragten<br />
festgestellt: Mehr als ein Drittel aller mCommerce Nutzer äußerte demnach ein Interesse<br />
an dieser Art von Diensten. Zusammen mit einem ermittelten Interesse nach regionalen<br />
Informationen (Zug Informationen, Restaurant Orte etc.) ist das Interesse potentieller<br />
Nutzer auf über 60 Prozent zu beziffern, was den Großbereich ortsbezogener Dienste da-<br />
mit zu dem populärsten Applikationen aller nicht Kommunikationsapplikationen macht<br />
[The00](vgl. Abbildung 3.6).<br />
Selbst wenn die Erhebung dieser Daten im nachhinein betrachtet zeitlich in der Hype-<br />
Phase zu platziert ist, so ist es doch wahrscheinlich, daß sich die generellen Bedürfnisse<br />
in der Bevölkerung mit fortschreitender Zeit nicht gr<strong>und</strong>sätzlich geändert haben dürften.<br />
Insbesondere auch dann nicht, wenn sich die technischen Rahmenbedingungen, wie Positi-<br />
onsbestimmung oder breitbandige Datenverbindungen, im Gegensatz zum Erhebungszeit-<br />
punkt verbessert haben bzw. jetzt erst real vorhanden sind. Darüber hinaus ist die damals<br />
noch weitgehend unbekannte <strong>und</strong> neu gewesene Idee ” ortsbezogene Dienste“ zum heutigen
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 36<br />
Banking<br />
Ring tone and<br />
Screen saver<br />
dow nloads<br />
Location-based<br />
Services<br />
Regional Information<br />
14%<br />
Usage / Interest in mCommerce Applications<br />
20%<br />
19%<br />
30%<br />
36%<br />
28%<br />
50%<br />
49%<br />
56%<br />
55%<br />
62%<br />
67%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%<br />
of respondents<br />
Current mCommerce users who<br />
use the application<br />
Current mCommerce users who are<br />
interested in the application<br />
Potential mCommerce users who<br />
are interested in the application<br />
Abbildung 3.6: Nutzerinteresse an Anwendungen im Bereich mCommerce nach [The00]<br />
Zeitpunkt durch erhöhtes Medieninteresse (vgl. z.B. Artikel in Computer Zeitung 39/2002,<br />
Computer Zeitung 8/2003, DIE WELT vom 25. Feb. 2003) einer breiteren Masse bekannt<br />
als noch zum Zeitpunkt der Hype-Phase.<br />
3.2.3 Die Rolle der Nutzer<br />
Bei aller Betrachtung der generellen Marktbedingungen für oder gegen ein positives Um-<br />
feld für die <strong>Ein</strong>führung von ortsbezogenen Diensten dürfen die Interessen der potentiellen<br />
Nutzer solcher Dienste nicht außer acht gelassen werden, da kein System ohne Nutzer<br />
funktionieren kann. Leider sind K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Anbieter zum aktuellen Zeitpunkt bzw. in<br />
der Zeit vergangener Analysen nicht in der Lage gewesen, die Möglichkeiten des mCom-<br />
merce mit neuen Technologien <strong>und</strong> Organisationsformen <strong>und</strong> deren Weiterentwicklung zu<br />
überblicken [BF02]. Wenn aber den K<strong>und</strong>en bereits schon ein Überblick fehlt, dann wird es<br />
ebenfalls schwierig sein, die Bedürfnisse <strong>und</strong> Wünsche richtig zu artikulieren. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> sind nachfolgende Ausführungen mit Bezug auf empirische Ergebnisse mit einer<br />
gewissen Vorsicht zu betrachten.<br />
Für den Bereich der ortsbezogenen Dienste existieren derzeit nur wenige Erhebungen <strong>und</strong><br />
Analysen mit einer breiten Basis an Befragten. Kölmel stellt beispielsweise in [KH02] Er-<br />
gebnisse einer empirischen Analyse für ortsbezogene Dienste vor, kann aber leider nur<br />
auf eine Basis von 479 Befragten zurückgreifen. Auch in größeren Analysen, wie der von<br />
der Boston Consulting Group [The00], lassen sich nur wenige Aussagen speziell zu orts-<br />
bezogenen Diensten finden. Aus diesem Gr<strong>und</strong> soll an dieser Stelle mehr auf allgemeine<br />
Nutzeranfoderungen für den Bereich mCommerce eingegangen werden. <strong>Ein</strong>e Übertragung<br />
dieser Erkenntnisse auf den Bereich ortsbezogener Dienste scheint dann möglich.
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 37<br />
Anforderungen der K<strong>und</strong>en<br />
Nach einer Studie der Boston Consulting Group, die 2000 die ersten Pionier-Nutzer im<br />
mCommerce befragte, sind die Nutzungsmotive eher ökonomisch orientiert. Primär sei es<br />
demnach wichtig, durch die Nutzung mobiler Anwendungen Zeit einzusparen. Ebenfalls<br />
wichtig sei es, aktuelle Informationen zu erhalten oder aber einfache <strong>und</strong> effektive zu<br />
kommunizieren (vgl. Abbildung 3.7).<br />
Neue Fre<strong>und</strong>e finden<br />
Zeitvertreib<br />
Etw as Neues ausprobieren<br />
Zugang zu konkreten Anw endungen<br />
Computernutzung umgehen<br />
Spaß haben<br />
Niedrige Preise, Soderangebote<br />
Hilfe in Notfallsituationen<br />
Kontakt zu Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Familie<br />
Kommunizieren ist einfacher <strong>und</strong> effektiver<br />
Aktuelle Informationen in Echtzeit<br />
Zeit sparen<br />
Motive für die Nutzung von mCommerce Angeboten<br />
25%<br />
37%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%<br />
47%<br />
49%<br />
Anteil der Befragten<br />
Abbildung 3.7: Motive für die Nutzung von mCommerce Angeboten [The00]<br />
Generell wird die Nutzung von Angeboten davon abhängen, wie hoch der Wertgewinn<br />
durch eine Nutzung eingestuft wird [BF02]. Neben dieser eher ökonomischen Sichtwei-<br />
se spielen aber auch soziale <strong>und</strong> psychologische Aspekte eine Rolle, da durch das allge-<br />
genwärtige Mobiltelefon praktisch immer <strong>und</strong> überall soziale Beziehungen gepflegt werden<br />
können. Zobel [Zob01] weist sogar auf einen Gruppenzwang hin bei dem japanische Tee-<br />
nager zur Nutzung von Mobiltelefonen mit i-Mode-Service ” genötigt“ werden, wenn sie<br />
nicht von ihrer Clique ausgeschlossen werden wollen.<br />
K<strong>und</strong>enanforderungen<br />
Soll-Kriterien<br />
Soziale Beziehungen <strong>und</strong> Anerkennung<br />
Macht<br />
einfacher, schneller, mehr<br />
Unterhaltung<br />
Sicherheit<br />
Muss-Kriterien 3-Minuten-Wert <strong>Ein</strong>fachheit Zusatznutzen<br />
Abbildung 3.8: K<strong>und</strong>enanforderungen an mCommerce Angebote [Zob01]<br />
53%<br />
53%<br />
54%<br />
71%<br />
74%<br />
81%<br />
83%<br />
84%
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 38<br />
Aufgr<strong>und</strong> der wahrscheinlich großen Menge an Anforderungen der K<strong>und</strong>en, die über die<br />
hier vorgestellte kleine Auswahl hinausgehen, scheint eine generelle Gruppierung oder<br />
Vereinfachung wesentlich sinnvoller. Zobel [Zob01] entwickelt hierfür ein in Abbildung 3.8<br />
dargestelltes Modell indem er generell zwischen Soll- <strong>und</strong> Muss-Kriterien unterscheidet:<br />
Muss-Kriterien für eine erfolgreiche mCommerce Anwendung sind zwingend zu erfüllen<br />
<strong>und</strong> werden deshalb auf unterster Ebene als F<strong>und</strong>ament der K<strong>und</strong>enanforderungen darge-<br />
stellt. <strong>Das</strong> Angebot muß bei kurzem Zeitaufwand bereits einen Wert generieren, wie ein<br />
Kaufabschluß oder eine erfolgreiche Informationsrecherche. Außerdem muß das Angebot<br />
einfach in der Handhabung <strong>und</strong> in der Navigation sein. <strong>Ein</strong>e einfache 1:1 Übertragung von<br />
stationären Anwendungen auf mobile Umgebungen reicht nach Zobel demnach nicht aus.<br />
Zu guter letzt muß das Angebot einen Zusatznutzen für den K<strong>und</strong>en generieren können,<br />
optimalerweise die <strong>Ein</strong>zigartigkeit des Angebots.<br />
Die Soll-Kriterien bauen auf den Muss-Kriterien auf <strong>und</strong> greifen u.a. auf die bereits zuvor<br />
kurz erwähnten sozialen Beziehungen zurück. Die weiteren Kriterien gehen zum Teil in sehr<br />
unterschiedliche Richtungen <strong>und</strong> die dargestellte Liste sollte in keinem Fall als abgeschlos-<br />
sen angesehen werden. Vielmehr geht es bei den Soll-Kriterien darum, zu erkennen, daß<br />
je nach Anwendung unterschiedliche Aspekt zu den Muss-Kriterien hinzu kommen, deren<br />
Betrachtung mehr als ratsam ist. Unter dem in diesem Zusammenhang etwas ungewöhn-<br />
lich klingenden Begriff ” Macht“ versteht Zobel, daß z.B. eine permanente Erreichbarkeit<br />
durch die Nutzung von Mobiltelefonen durch Dritte zu einer Art Macht ausgeweitet wer-<br />
den kann, in dem Sinne, daß diese zu jedem Zeitpunkt in das Leben z.B. durch einen Anruf<br />
eingreifen können, ohne daß der Besitzer eines Mobiltelefones sich dagegen wehren kann.<br />
3.2.4 Zusammenfassung der Marktanalyse<br />
Betrachtet man die dargestellten Ergebnisse zusammenfassend, dann läßt sich festhalten,<br />
daß bei der <strong>Ein</strong>führung von ortsbezogenen Diensten aller Wahrscheinlichkeit nach die glei-<br />
chen Gesetze gelten werden wie bei der <strong>Ein</strong>führung des mCommerce. Allerdings befinden<br />
wir uns sowohl im mCommerce wie auch bei ortsbezogenen Diensten nicht mehr in einer<br />
Hype-Phase sondern am Anfang einer Phase, die durch realistische Markteinschätzungen<br />
geprägt ist. Aus diesem Gr<strong>und</strong> kann man zum heutigen Zeitpunkt davon ausgehen, daß der<br />
Markt <strong>und</strong> die Nutzer generell bereit sind, neue Applikationen auf Basis von ortsbezogenen<br />
Diensten zu nutzen. Demnach müßte die Anzahl an kommerziell nutzbaren Diensten in der<br />
Folgezeit kontinuierlich zunehmen, so daß momentane Vormärsche von großen Anbietern,<br />
wie z.B. Vodafone mit dem ” FriendZone“ Dienst, erst der Anfang einer neuen Ära sind.<br />
<strong>Ein</strong> weiterer Aspekt, der die positive Marktsituation für ortsbezogene Dienste weiter<br />
verstärkt, nämlich die Mobilfunk-Hardware als Zugangsmedium zu mobilen Anwendun-<br />
gen, wurde hier nicht näher thematisiert. Es ist allerdings davon auszugehen, daß die Zahl<br />
der IP-fähigen Endgeräte in den nächsten Jahren, u.a. bedingt durch neue Markterschlies-<br />
sungen internetfähiger Übertragungstechnologien, weiter ansteigen wird [BF02]. Ebenfalls<br />
sind andere technische Rahmenbedingungen, wie Positionsbestimmung etc., zum aktuellen<br />
Zeitpunkt kein echtes Problem mehr, so daß ein <strong>Ein</strong>satz ortsbezogener Dienste hierdurch
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 39<br />
nicht gefährdet würde (vgl. Kapitel 2.1).<br />
Abschließend bleibt noch eine letzte Anmerkung festzuhalten, die sich auf die gesamte<br />
dargestellte Analyse bezieht. Bei der Analyse <strong>und</strong> Bewertung des Marktes konnte auf<br />
keine eigenen Erhebungen zurückgegriffen werden, da für ein repräsentatives Ergebnis<br />
sehr hohe Beteiligungszahlen notwendig gewesen wären, die den Umfang dieser Arbeit ge-<br />
sprengt hätten. Stellvertretend für eine eigene Erhebung wurde deshalb im wesentlichen<br />
auf Ergebnisse <strong>und</strong> Zahlen zurückgegriffen, die verfügbaren Marktanalysen <strong>und</strong> Berichten<br />
entnommen werden konnten. Somit sind die präsentierten Zahlen <strong>und</strong> Bewertungen von<br />
Situationen stets kritisch zu betrachten, da nicht ausgeschlossen werden kann, daß die<br />
jeweilige Institution mit ihrer Darstellung eigene Interessen verfolgt, die nicht absolut der<br />
Realität am Markt entsprechen. Dennoch sollte es mit Hilfe dieses Materials allerdings<br />
möglich sein, eine gewisse Marktvorstellung zu erhalten.<br />
Nachdem dieser Abschnitt einen tieferen <strong>Ein</strong>blick in den Markt für mobile <strong>und</strong> ortsbezoge-<br />
ne Dienste gegeben hat, kann eine erste Geschäftsidee vor diesem Hintergr<strong>und</strong> formuliert<br />
werden, aus der dann wiederum weitere Implikationen ableitbar sind.<br />
3.3 Die Geschäftsidee<br />
In diesem Abschnitt soll die generelle Geschäftsidee präsentiert werden, die dem im die-<br />
sem Kapitel dargestellten <strong>Geschäftsmodell</strong> zugr<strong>und</strong>e liegt. Die Geschäftsidee stellt eine in<br />
weiten Teilen noch meist vage formulierte Idee oder Vision als Basis für weitere Konkreti-<br />
sierungen innerhalb eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s dar <strong>und</strong> bietet daher nicht auf alle Fragen im<br />
Detail Antwort. <strong>Ein</strong>e detailliertere Ausarbeitung dieser Fragen läßt sich aber in nachfol-<br />
genden Schritten innerhalb dieser Arbeit finden.<br />
” Anbieten einer flexiblen dezentralen Informationssystem-Infrastruktur für<br />
ortsbezogene Informationen an beliebige Institutionen zur Nutzung als<br />
ortsbezogenes Informationssystem mit Zugang über Mobilfunknetze.“<br />
Die Idee des sogenannten Location-to-Location <strong>Network</strong>s (<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>) ist die Erzeu-<br />
gung eines ortsbezogenen Informationssystems, mit dessen Hilfe Nutzern Informationen<br />
zur Verfügung gestellt werden, die eine gewisse örtliche bzw. räumliche Relevanz bzgl.<br />
des aktuellen Aufenthaltsorts haben. Hierbei soll die zentrale Idee verfolgt werden, die<br />
Informationseinheiten, die das System zur Verfügung stellt, weder an einem zentralen Ort<br />
zu konzentrieren <strong>und</strong> damit zu verwalten, noch die Erstellung der Informationseinheiten<br />
durch zentrale Instanzen durchzuführen. <strong>Ein</strong>e Erstellung von Informationseinheiten soll<br />
vielmehr durch beliebige Teilnehmer innerhalb des Netzwerkes möglich sein. Dadurch, daß<br />
das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> nicht über eine zentrale Datenhaltung verfügen soll, können die durch In-<br />
stitutionen bereitgestellten Informationen an einem beliebigen Ort, vorzugsweise am Ort<br />
der Erstellung, vorgehalten werden, <strong>und</strong> sind so leicht für einen schnellen <strong>und</strong> direkten
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 40<br />
Zugriff zugänglich. Bei der Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s ist es entscheidend, daß die Informa-<br />
tionseinheiten, die eine Institution zur Verfügung stellt, zum einen Informationen über<br />
die Institution sein sollten <strong>und</strong> zum anderen eine räumliche Abhängigkeit besitzen. Bei-<br />
spielsweise sollte ein Warenhaus in einer Innenstadt Informationen über das Unternehmen<br />
<strong>und</strong> räumlich relevante Informationen für Nutzer zur Verfügung stellen, wie z.B. aktuel-<br />
le Angebote, Öffnungszeiten oder aber Informationen über die Länge der Schlangen an<br />
den Kassen. Nicht zur Verfügung sollen hingegen Informationen gestellt werden, die einen<br />
sehr weiten Gültigkeitsbereich haben, wie z.B. Daten des Unternehmenserfolges im ver-<br />
gangenen Jahr o.ä. Hierzu werden andere Möglichkeiten durch das System zur Verfügung<br />
gestellt, die einen theoretischen Zugang dennoch ermöglichen würden, aber sicherstellen,<br />
daß die Informationseinheiten nicht denen einer Internet-Präsenz gleichen.<br />
Im Nachfolgenden soll anhand eines kleinen Szenarios genauer erläutert werden, wie das<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> arbeitet <strong>und</strong> welche Rolle dabei die verschiedenen Beteiligten spielen. <strong>Ein</strong>e<br />
Betrachtung der technischen Machbarkeit <strong>und</strong> Realisierung von Funktionalitäten ist hier<br />
nicht Bestandteil <strong>und</strong> wird erst in Kapitel 4 genauer betrachtet. Auch etwaige implizite<br />
organisatorische <strong>und</strong> logistische Annahmen, die innerhalb des Szenarios getroffen werden<br />
<strong>und</strong> für den Erfolg der Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s relevant sind, sollen an dieser Stelle nicht<br />
detailliert betrachtet werden.<br />
3.3.1 Nutzungsszenario des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Für eine beispielhafte Beschreibung eines Nutzungsszenarios soll die in Abbildung 3.9<br />
dargestellte geographische Konfiguration des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s als Ausgangsbasis dienen. In-<br />
nerhalb dieses kleinen Auschnittes des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s könnte eine Nutzung dann wie nach-<br />
folgend beschrieben aussehen:<br />
<strong>Ein</strong>e Person P hat den ortsbezogenen Dienst des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s abonniert <strong>und</strong> somit durch<br />
seine mobilen Endgeräte (z.B. PDA oder Auto-Navigationssystem) Zugang zum System. P<br />
fährt mit dem Auto in die Stadt <strong>und</strong> möchte gerne einige Besorgungen machen. Als erstes<br />
sollen in einem Lebensmittelgeschäft (Gebäude C) Gr<strong>und</strong>nahrungsmittel gekauft werden.<br />
Kurz bevor P das Lebensmittelgeschäft erreicht zeigt sein Auto-Navigationssystem an,<br />
daß das Lebensmittelgeschäft meldet, daß momentan die Wartezeiten an den Kassen 10<br />
Minuten betragen. Diese Zeit ist P für die zu kaufenden Artikel zu lange <strong>und</strong> er entschließt<br />
sich weiterzufahren, um weitere Besorgungen in der Innenstadt zu tätigen. Zuvor nutzt er<br />
allerdings den angebotenen Service des Lebensmittelgeschäftes <strong>und</strong> gibt seine <strong>Ein</strong>kaufsliste<br />
online ab <strong>und</strong> kann dann nach zwei St<strong>und</strong>en die Waren an einer speziellen Warenausgabe<br />
im Lebensmittelgeschäft abholen, ohne an einer Kasse zu warten.<br />
Auf der Weiterfahrt in die Innenstadt steht P vor dem Problem der bekannten Parkplatz-<br />
Suche. Er fährt an einem Parkhaus vorbei <strong>und</strong> schaut auf sein Navigationssystem, das ihm<br />
meldet, daß in diesem Parkhaus noch mehr als zehn Plätze frei sind. P entschließt sich,<br />
dieses Parkhaus anzusteuern <strong>und</strong> nutzt den durch den Parkhausbetreiber angebotenen
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 41<br />
Innenstadt<br />
Gebäude<br />
C Café Gebäude<br />
A<br />
Parkhaus<br />
Gebäude<br />
B<br />
Abbildung 3.9: Beispiel-Szenario für eine mögliche Nutzung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
“Parkplatz-Leitsystem-Service“, der ihn genau zu einem freien Parkplatz innerhalb des<br />
Parkhauses ohne langes Suchen lotst. P macht sich nun vom Parkhaus aus auf den Weg<br />
zum <strong>Ein</strong>zelhandel-Unternehmen in Gebäude A. Auf dem Weg dahin kommt er an Gebäude<br />
B vorbei <strong>und</strong> sein PDA meldet ihm ein interessantes Angebot <strong>und</strong> zusätzlich einen Rabatt-<br />
Coupon für diesen Artikel, wenn er diesen sofort kaufen würde. P entschließt sich, dieses zu<br />
tun <strong>und</strong> geht kurzerhand in Gebäude B, kauft den angebotenen Artikel <strong>und</strong> erhält zusätz-<br />
lich einen Rabatt durch Angabe der Rabattnummer, die sein PDA anzeigt. Anschließend<br />
verläßt P das Gebäude <strong>und</strong> macht sich auf den weiteren Weg. Er entschließt sich zuvor<br />
noch einen Kaffee zu trinken <strong>und</strong> setzt sich in ein Café gegenüber des <strong>Ein</strong>zelhändlers in<br />
Gebäude A. Da er nicht genau weiß, wie lange der kleine <strong>Ein</strong>zelhändler in Gebäude A<br />
geöffnet hat, nimmt er wiederum kurzerhand den PDA <strong>und</strong> schaut sich Informationen<br />
über das Gebäude A an, die ihm angeboten werden, <strong>und</strong> sieht kurze Zeit später, daß er<br />
noch 1 St<strong>und</strong>e bis Ladenschluß Zeit hat <strong>und</strong> sich somit nicht zu beeilen braucht. Nach-<br />
dem er den Kaffee getrunken <strong>und</strong> die letzten Besorgungen gemacht hat, geht er zurück zu<br />
seinem Auto <strong>und</strong> will die bestellten Lebensmittel im Lebensmittelgeschäft (Gebäude C)<br />
abholen. Er setzt sich ins Auto <strong>und</strong> prüft zuvor noch die aktuellen Stauinformationen der<br />
Innenstadt, die durch die Innenstadt selbst angeboten werden. Er stellt fest, daß auf dem<br />
Weg den er gekommen ist, ein Stau aufgr<strong>und</strong> eines Unfalls gemeldet ist <strong>und</strong> entschließt<br />
sich, eine alternative Route zum Lebensmittelgeschäft zu wählen, um Zeit zu sparen. Am<br />
Lebensmittelgeschäft angekommen nimmt er die bestellten Lebensmittel entgegen <strong>und</strong><br />
fährt weiter nach Hause.<br />
3.3.2 Aufgaben der Netzwerk-Teilnehmer innerhalb des Szenarios<br />
Um das gegebene Szenario mittels des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s realisieren zu können, soll nachfol-<br />
gende Betrachtung dazu dienen aufzuzeigen, welche Maßnahmen die einzelnen Beteiligten
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 42<br />
innerhalb des Szenarios treffen müssen.<br />
Um das gegebene Szenario zu realisieren, muß zuerst durch jeden Netzwerk-Teilnehmer,<br />
der Informationen zur Verfügung stellen möchte, ein Zugang zum Netzwerk beim Betrei-<br />
ber beantragt werden. Wird dieser genehmigt, können die Informationseinheiten durch die<br />
Teilnehmer modelliert <strong>und</strong> anschließend im Netzwerk angeboten werden. Die an dem Sze-<br />
nario beteiligten Institutionen sind ein Betreiber für Informationen über die Stadt sowie<br />
die jeweiligen Institutionen zu den Gebäuden A bis C <strong>und</strong> das Parkhaus.<br />
Innenstadt <strong>Ein</strong> Betreiber, der Informationen über eine Innenstadt anbietet, wird in der<br />
Regel eine übergeordnete Institution sein. Denkbar an dieser Stelle sind Institutio-<br />
nen, die bereits zum heutigen Zeitpunkt die Internet-Präsenzen von Städten organi-<br />
sieren <strong>und</strong> betreiben.<br />
Für die Bereitstellung von Informationen innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s bedeutet die-<br />
ses, daß im wesentlichen auf bereits vorhandenes Material zurückgegriffen werden<br />
kann. In dem hier vorgestellten Szenario wären dieses lediglich aktuelle Stau-Mel-<br />
dungen.<br />
Parkhaus Der Betreiber eines Parkhauses muß für die Erfüllung seines Angebotes in-<br />
nerhalb des Szenarios lediglich die Informationen über noch verfügbare Parkplätze<br />
bereit stellen. Die Fähigkeit genau zu wissen, an welcher Stelle welche Parkplätze<br />
noch frei sind, bedarf einer separaten Lösung. Existiert diese Lösung, dann muß<br />
dafür gesorgt werden, daß das System, das das ” Parkplatz-Leitsystem“ ermöglicht,<br />
im <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> zugänglich ist.<br />
Gebäude A Der Betreiber innerhalb des Gebäudes A kann z.B. eine Gemeinschaft aller<br />
im Gebäude ansässigen Unternehmen sein. Hier müssen dann die jeweiligen Unter-<br />
nehmen selbst entscheiden, welche Informationen sie ihren potentiellen K<strong>und</strong>en an-<br />
bieten wollen. Dieses wird im wesentlichen eine spezielle Auswahl aus Informationen<br />
sein, die bereits auf einer Internet-Präsenz des Unternehmens zur Verfügung gestellt<br />
werden. Im konkreten Szenario wären dieses neben dem Namen des Unternehmens<br />
die Öffungszeiten.<br />
Gebäude B Der Betreiber innerhalb des Gebäudes B ist ein entsprechend großes Unter-<br />
nehmen <strong>und</strong> kann deshalb selbst seine Informationen im Netzwerk zur Verfügung<br />
stellen <strong>und</strong> ist nicht auf einen Zusammenschluß mehrerer angewiesen. Für das Sze-<br />
nario reicht es hier aus, eine Menge von Angeboten zu definieren, die potentiellen<br />
K<strong>und</strong>en in der Nähe angeboten werden sollen. Die Möglichkeit, spezielle Rabatte für<br />
Nutzer des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s einzuräumen, könnte im einfachsten Fall durch eine sepa-<br />
rate Informationseinheit modelliert werden, die eine einmalig gültige Rabattnummer<br />
generiert.<br />
Gebäude C Der Betreiber innerhalb des Gebäudes C kann für die Ermöglichung sei-<br />
nes Bestelldienstes innerhalb des Szenarios direkt auf eine evtl. bereits vorhandene<br />
Lösung aus seiner Internet-Präsenz zurückgreifen. Im einfachsten Fall läßt sich diese
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 43<br />
Funktionalität auch über eine normale E-Mail an eine spezielle E-Mail-Adresse er-<br />
reichen. Für die Zurverfügungstellung der Informationen über die durchschnittlichen<br />
Wartezeiten an den Kassen muß der Betreiber ein System entwickeln, das diese War-<br />
tezeiten mißt. Kann dieses geschehen, dann stellt die durchschnittliche Wartezeit nur<br />
eine weitere kleine Informationseinheit für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> dar.<br />
Die dargestellten Aufgaben, die die jeweiligen Betreiber zu erfüllen haben, um das gegebene<br />
Szenario zu realisieren, sind an dieser Stelle idealisiert zu betrachten <strong>und</strong> müssen im realen<br />
Fall mit weiteren Informationen aufbereitet werden, damit sie für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> nutzbar<br />
sind. Dieses Problem wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgegriffen.<br />
Wichtig an dieser Stelle bleibt abschließend festzuhalten, daß die Betreiber sich keine<br />
Gedanken über die Zugänglichkeit ihrer Informationen innerhalb des Netzwerkes, abhängig<br />
von einem aktuellen Aufenthaltsort von Benutzern, machen müssen. Dieses ist zentraler<br />
Bestandteil der Basis des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s.<br />
Nachdem dieser Abschnitt eine bessere Vorstellung des Systems vermitteln sollte, wird<br />
nachfolgender Abschnitt nochmals detaillierter auf die beteiligten Akteure eingehen <strong>und</strong><br />
diese in einer Wertschöpfungskette arrangieren.<br />
3.4 Die Wertschöpfungskette<br />
Für den Bereich mBusiness lassen sich unterschiedliche Ausprägungen einer Wertschöp-<br />
fungskette finden. Der Begriff Wertschöpfung meint hierbei grob jenen Wertzuwachs, den<br />
ein Produkt nach einem bestimmten betrieblichen ” Veredelungsprozess“ erhält. Abbildung<br />
3.10 stellt diesen Sachverhalt graphisch im Rahmen eines Produktionskontos dar.<br />
Netto -<br />
produktionswert<br />
Kauf von<br />
Vorleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Wertschöpfung<br />
Verkauf an andere<br />
Wirtschaftssubjekte<br />
Brutto -<br />
produktionswert<br />
Abbildung 3.10: Die Wertschöpfung innerhalb eines Produktionsprozesses angelehnt an<br />
[Sto69]<br />
<strong>Ein</strong>e Wertschöpfungskette ist dann die Verkettung mehrerer solcher ” Veredelungspro-<br />
zesse“ durch unterschiedliche Akteure. Die einzelnen Glieder einer Wertschöpfungskette<br />
(Wertschöpfungsbereiche genannt) sind stark miteinander verknüpft <strong>und</strong> stehen somit in<br />
einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis zueinander, weshalb sie auch als Kette dar-<br />
gestellt werden [S + 02]. Die Besetzung der Wertschöpfungsbereiche geschieht durch un-<br />
terschiedliche Player, wobei deren unternehmerische Zielsetzungen <strong>und</strong> Strategien zu den
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 44<br />
jeweiligen Bereichen passen.<br />
Zobel [Zob01] schlägt für den Bereich mBusiness die Wertschöpfungsbereiche Infrastruk-<br />
tur, Betreiber, Content, Anwendungen <strong>und</strong> Portale vor <strong>und</strong> arrangiert diese in einer eige-<br />
nen Wertschöpfungskette, wie in Abbildung 3.11 dargestellt.<br />
Infrastruktur Betreiber Content Anwendung Portal<br />
Hersteller-Endgeräte<br />
Netzwerk-Dienstleister<br />
Software-Entwickler<br />
Plattform-Entwickler<br />
System-Integrator<br />
WASP<br />
Mobilfunkbetreiber<br />
Virtueller<br />
Netzwerkbetreiber<br />
Weiterverkäufer<br />
Informationsanbieter<br />
Aggregator<br />
Distributor<br />
Werbung<br />
Unterhaltung<br />
Finanzdienste<br />
Navigation/Information<br />
Unified Messaging<br />
Kalender<br />
Zahlung/Transaktion<br />
Sicherheit<br />
Shopping<br />
Horizontal<br />
Abbildung 3.11: Die Wertschöpfungskette des mBusiness nach Zobel [Zob01]<br />
Demnach haben Unternehmen die Wahlmöglichkeit, in welchem der fünf unterschiedlichen<br />
Wetschöpfungsbereiche sie präsent sein wollen. In der Vergangenheit waren die einzel-<br />
nen Bereiche <strong>und</strong> Player zumeist klar voneinander abgegrenzt: Infrastruktur wurde von<br />
Mobilfunk-Hardware-Herstellern, wie Nokia, Ericsson oder Siemens, besetzt. Der Verkauf<br />
von Verträgen wurde durch Netzwerkbetreiber, wie Vodafone oder Telekom, gewährlei-<br />
stet. Inhalte wurden durch Dritte geliefert. Mit zunehmender Reife des mBusiness ändert<br />
sich dieses jedoch <strong>und</strong> Infrastrukturfirmen oder Mobilfunkbetreiber versuchen, ebenfalls in<br />
anderen Bereichen der Wertschöpfungskette Fuß zu fassen <strong>und</strong> generieren so mittlerweile<br />
z.B. eigene Inhalte für ihre eigenen Anwendungen [Zob01].<br />
3.4.1 Die Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Die Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s ist in der wesentlichen Struktur identisch mit<br />
der Wertschöpfungskette des mBusiness aus dem vorherigen Abschnitt. Jedoch ist der<br />
primäre Fokus an dieser Stelle mehr auf die einzelnen Beteiligten <strong>und</strong> ihre Besetzung von<br />
mitunter mehreren Bereichen der Wertschöpfungskette gerichtet, die notwendig sind, um<br />
die Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zu verwirklichen. Für diese Verwirklichung bedarf es ebenfalls,<br />
wie im mBusiness, der fünf unterschiedlichen Bereiche: Infrastruktur, Betreiber, Content,<br />
Anwendung <strong>und</strong> Portal.<br />
WASP<br />
Vertikal<br />
Infrastruktur Betreiber Content Anwendung Portal<br />
Hardware Mobilfunkbetreiber<br />
Software<br />
Virtueller<br />
Netzwerkbetreiber<br />
Informationsanbieter<br />
Aggregatoren<br />
Navigation/Kartographie<br />
Zahlung/Transaktion<br />
Systemzugang<br />
Abbildung 3.12: Die Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Abbildung 3.12 veranschaulicht hierbei nicht nur die einzelnen Beteiligten an der Wert-<br />
schöpfungskette, sondern zeigt darüber hinaus für jedes Glied der Wertschöpfungskette
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 45<br />
entweder Aufgaben auf, die im jeweiligen Bereich eine zentrale Rolle spielen, oder aber<br />
Institutionen, die die jeweiligen Bereiche real bekleiden könnten.<br />
Im Nachfolgenden soll genauer erläutert werden, welche Aufgaben <strong>und</strong> Eigenschaften auf<br />
die einzelnen Akteure innerhalb der Wertschöpfungskette zukommen <strong>und</strong> wie diese die<br />
Funktion des Gesamtsystems gewährleisten können:<br />
1. Infrastruktur / Betreiber<br />
Betrachtet man den Bereich Infrastruktur für sich, dann läßt sich feststellen, daß sich<br />
dieser Bereich normalerweise quer oder aber parallel zu allen anderen Bereichen der<br />
Wertschöpfungskette erstrecken müßte, da es für jeden Bereich entsprechende Zu-<br />
lieferer für eine gr<strong>und</strong>legende Infrastruktur gibt: Für den Betrieb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
bedarf es z.B. einer Mobilfunknetz-Infrastruktur mit unterschiedlichster Hardware<br />
<strong>und</strong> Software. Anwendungen müssen auf entsprechenden Plattformen laufen usw.<br />
Generell läßt sich ein Trend zu wachsender Integration erkennen. So wird z.B. durch<br />
Unternehmenszusammenschlüsse oder -verkäufe versucht, wesentliche Teile des Infra-<br />
strukturbereiches zu kontrollieren [Zob01]. Mobilfunkanbieter treten immer häufiger<br />
als Wireless Application Service Provider (WASP) auf <strong>und</strong> betreiben eigene Anwen-<br />
dungen oder Anwendungen im Auftrag von Dritten. Generell haben Mobilfunkbetrei-<br />
ber die stärkste Ausgangssituation innerhalb von mBusiness-Anwendungen. Dieses<br />
liegt unter anderem daran, daß sie K<strong>und</strong>enverbindungen mit laufenden Zahlungsbe-<br />
ziehungen haben. Darüber hinaus sind sie natürlich auch im Besitz von Schlüsselda-<br />
ten über ihre K<strong>und</strong>en, wie z.B. das Wissen über den aktuellen Aufenthaltsort eines<br />
bestimmten K<strong>und</strong>en. Aber auch die Tatsache, daß Mobilfunkanbieter bei jedem an<br />
einen K<strong>und</strong>en übermittelten Datenpaket oder an jeder Minute Netzzugang verdie-<br />
nen, macht ihre Position innerhalb der Wertschöpfungskette zur stärksten Partei<br />
[Zob01].<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurde der Bereich Infrastruktur eng mit dem Bereich Betrei-<br />
ber gekoppelt (vgl. Abb. 3.12) <strong>und</strong> soll verdeutlichen, daß für die Verwirklichung<br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s die notwendigen Infrastruktur-Maßnahmen, wie Zugangssoftware<br />
oder Aufbau des Mobilfunknetzes, direkt durch den Betreiber des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s er-<br />
bracht werden können.<br />
<strong>Ein</strong> Betreiber des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s sollte demnach idealerweise ein Mobilfunkanbieter<br />
sein. Dieser verfügt bereits über ein vorzugsweise eigenes Mobilfunknetz <strong>und</strong> speziel-<br />
les Wissen wie eingangs beschrieben. Darüber hinaus besteht das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> aus<br />
einem Peer-to-Peer Netzwerk, das durch eine spezielle Zugangssoftware aufgebaut<br />
wird, ähnlich wie bei bekannten Peer-to-Peer Netzwerken, wie z.B. Gnutella oder<br />
Napster. Da diese Software elementarer Bestandteil des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s ist, sollte<br />
somit auch die Kontrolle über das Gesamtsystem, die durch diese Zugangssoftwa-<br />
re erreicht wird, bei dem Mobilfunkanbieter liegen. Ist kein eigenes Mobilfunknetz<br />
verfügbar, dann kann der Aufgabenbereich Betrieb auch durch einen virtuellen Netz-<br />
werkbetreiber, der Netzwerkkapazitäten bei Mobilfunkbetreibern anmietet, ausgeübt
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 46<br />
werden. <strong>Ein</strong>e Verschmelzung der Bereiche Infrastruktur <strong>und</strong> Betreiber scheint hier-<br />
durch mehr als sinnvoll.<br />
2. Content<br />
In der Vergangenheit dienten Content-Anbieter für viele Mobilfunkanbieter, die ei-<br />
gene Portale etablieren wollten, als reine Content-Lieferanten, die somit mehr oder<br />
weniger als Mittel zum Zweck mißbraucht wurden, da die Portalbetreiber nicht al-<br />
leine in der Lage waren, Content in ausreichender Aktualität <strong>und</strong> Bandbreite zu ge-<br />
nerieren. Trotz dieser Abhängigkeit der Portalbetreiber von den Content-Anbietern<br />
war die Ausgangssituation der Anbieter tendenziell ungünstig, da sie keine direkte<br />
K<strong>und</strong>enschnittstelle besaßen <strong>und</strong> als reiner Zulieferer schnell durch einen anderen<br />
ersetzbar waren [Zob01].<br />
Interessanter wird die Ausgangssituation für Content-Anbieter, wenn man an neue<br />
Formen von Inhalten denkt, die z.B. kontext- <strong>und</strong> insbesondere orts- oder zeitabhängig<br />
sind. Hierdurch werden Angebote möglich, die sich auf einen aktuellen Ort zuschnei-<br />
den lassen <strong>und</strong> so z.B. Sonderangebote lokaler <strong>Ein</strong>zelhändler präsentieren oder aber<br />
den Weg zum nächsten Restaurant weisen können. Genau diese Art von Informa-<br />
tionen sind aber zentraler Bestandteil von ortsbezogenen Diensten wie dem <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>. Content-Anbieter für ortsbezogene Dienste haben damit die Möglichkeit,<br />
unterschiedlichste Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, von der einfachen Ge-<br />
nerierung von Inhalten in speziellen Formaten für kontext-sensitive Anwendungen bis<br />
hin zur Aggregation von existierenden Informationen zu höherwertigen oder kontext-<br />
speziellen Informationen.<br />
Durch die Architektur des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s wird es ggf. sogar möglich sein, den Bereich<br />
Content zu dezentralisieren, so daß jeder Nutzer des Netzwerkes eigene Informatio-<br />
nen zur Verfügung stellen könnte, wenn dieses durch den Betreiber gewünscht ist.<br />
Wichtig ist im Rahmen des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s festzuhalten, daß der Bereich Content<br />
elementar für den Gesamterfolg des Systems ist, da ein System ohne ausreichen-<br />
de Inhalte keine Zukunft haben dürfte, was den Bereich Content innerhalb der<br />
Wertschöpfungskette nachhaltig stärken sollte.<br />
3. Anwendung<br />
Der Bereich der Anwendungen bietet aufgr<strong>und</strong> der großen Artenvielfalt von An-<br />
wendungen für Akteure den wohl größten Spielraum innerhalb der Wertschöpfungs-<br />
kette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s. Hierbei kann die Art der Anwendung unterschiedlichste<br />
Ausprägungen besitzen. Sowohl das Anbieten von <strong>Ein</strong>zelanwendungen, wie z.B. ein<br />
Stadtplanausschnitt zu einer gegebenen Koordinate, als auch die Anwendungsko-<br />
ordination unterschiedlicher Teilanwendungen ist hier denkbar. Insbesondere sind<br />
hier z.B. Koordinatoren denkbar, die es schaffen, die unterschiedlichsten Zahlungs-<br />
systeme zur Verfügung stellen, um Leistungen, die innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s in<br />
Anspruch genommen werden können, abzurechnen.<br />
Die Position von Akteuren innerhalb des Bereiches Anwendung wird aller Voraus-<br />
sicht nach von der Wertigkeit der zur Verfügung gestellten Anwendung abhängen
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 47<br />
<strong>und</strong> kann somit von Anbieter zu Anbieter stark differieren. Betrachtet man bei-<br />
spielsweise einen Betreiber, der es schafft, sämtliche gängigen Zahlungssysteme über<br />
eine einheitliche Anwendung zur Verfügung zu stellen, so wird seine Position nach-<br />
haltig gestärkt sein, da andere Akteure innerhalb der Wertschöpfungskette auf solche<br />
Dienste angewiesen sind, um sich ihre eigenen Leistungen vergüten lassen zu können.<br />
Hierbei ist es allerdings nicht ausgeschlossen, daß sich die Position eines Anbieters<br />
im Laufe der Zeit mit dem Aufkommen von Konkurrenzanwendungen verschlechtern<br />
kann, wenn es nicht gelingt, einen einmaligen Wertbeitrag für den K<strong>und</strong>en sicherzu-<br />
stellen.<br />
4. Portal<br />
Unter einem Portal versteht man im allgemeinen einen Dienst, der eine Startseite für<br />
die Nutzung mit mobilen Endgeräten zur Verfügung stellt [Zob01]. Somit bündelt ein<br />
Portal idealerweise alle wichtigen Nutzungsbereiche <strong>und</strong> stellt dem Nutzer zugleich<br />
eine einheitliche Navigation zur Verfügung. Im Vergleich mit dem stationären Inter-<br />
net ist die Position von Portalen in mobilen Umgebungen stärker [GG01]. Dieses liegt<br />
unter anderem darin begründet, daß Nutzer von mBusiness Angeboten aufgr<strong>und</strong> ho-<br />
her Zugangskosten weniger bereit sind, im mobilen Internet zu surfen, um Angebote<br />
zu finden, als vergleichsweise beim stationären Internet mit niedrigen Zugangskosten<br />
[S + 02].<br />
Auch im Bereich der Portale haben Mobilfunkanbieter die stärkste Ausgangssituati-<br />
on, da sie das Vertrauen der K<strong>und</strong>en besitzen. Aber nicht nur das Vertrauen, sondern<br />
auch die technischen Möglichkeiten, die ein Mobilfunkanbieter durch den Verkauf von<br />
Handys mit eigener SIM-Karte besitzt, sind hier nicht außer acht zu lassen. Es ist so<br />
z.B. möglich, einen Nutzer vor jeder Nutzung von mobilen Diensten automatisch auf<br />
die Startseite des Mobilfunkanbieters zu leiten [Zob01]. Diese Startseite kann dann<br />
idealerweise ein Portal des Anbieters sein <strong>und</strong> läßt sich so leicht verbreiten, da der<br />
Nutzer keine Wahl hat, diese Seite nicht zu benutzen.<br />
Für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> im speziellen bedeutet dieses, daß der Bereich Portal, wie be-<br />
reits die Bereiche Infrastruktur <strong>und</strong> Betreiber, primär in der Hand des Mobilfunkbe-<br />
treibers liegen sollte. Dieser Sachverhalt wird ebenfalls in Abbildung 3.12, neben der<br />
eigentlichen Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s, durch die vorhandenen grauen<br />
Hinterlegungen verdeutlicht.<br />
3.5 Perspektiven eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Dieser Abschnitt soll aufzeigen, daß es für die Realisierung eines möglichen Geschäftsmo-<br />
dells des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s die unterschiedlichsten Wege gibt. Da jede Geschäftsidee generell<br />
mehrere <strong>Geschäftsmodell</strong>e haben kann, sollen an dieser Stelle zunächst verschiedene Wege<br />
für ein <strong>Geschäftsmodell</strong> skizziert werden. Hierbei ist der Fokus beschränkt auf die Sicht<br />
eines Anbieters des <strong>L2L</strong>-Systems, der das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> betreibt, aber nicht zugleich Be-<br />
treiber des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s <strong>und</strong> Betreiber eines Mobilfunknetzes ist, wie dieses in Abschnitt
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 48<br />
3.4.1 aufgr<strong>und</strong> der idealen Wirkungskette angenommen wurde.<br />
Der Gr<strong>und</strong> für diese abweichende Annahme besteht primär darin, daß ein Geschäftsmo-<br />
dell, das einzig <strong>und</strong> allein von einem großen Mobilfunkanbieter betrieben wird, relativ<br />
uninteressant für viele Leser dieser Arbeit aus dem Bereich klein- <strong>und</strong> mittelständischer<br />
Unternehmen sein dürfte. Es ist ersichtlich, daß Mobilfunkunternehmen aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
Marktmacht andere Rahmenbedingungen in ihre Überlegungen für oder gegen ein neu zu<br />
etablierendes System, wie dem hier vorgestellten <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>, einbeziehen können als<br />
kleinere Unternehmen, die im Bereich Entwicklung <strong>und</strong> Betrieb von Software-Systemen<br />
angesiedelt sind. Aus diesem Gr<strong>und</strong> heraus sollen die nachfolgenden Abschnitte versuchen,<br />
einen Weg aufzuzeigen, wie auch kleine Unternehmen dennoch erfolgreich ein System wie<br />
das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> betreiben könnten, ohne eine Marktmacht wie Mobilfunkbetreiber zu<br />
besitzen.<br />
3.5.1 Unterschiedliche Wege der Realisierung<br />
Für die Umsetzung der Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s lassen sich im wesentlichen zwei charakte-<br />
ristisch unterschiedliche Wege aufzeigen, die für eine Realisierung zur Verfügung stehen:<br />
1. Kooperation<br />
Unter Kooperation soll in diesem Zusammenhang das enge Zusammenwirken von<br />
einem Anbieter des eigentlichen <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s <strong>und</strong> einem Mobilfunkbetreiber, über<br />
dessen Netz das System zugänglich ist, verstanden werden.<br />
Aus der strategischen Perspektive betrachtet birgt diese Kooperation für den An-<br />
bieter den Vorteil, daß die Marktmacht <strong>und</strong> -position des Mobilfunkbetreibers posi-<br />
tiv mittels Werbung, K<strong>und</strong>enkontakten, Medienpräsenz etc. für die Etablierung des<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s genutzt werden könnte. Auch die einfacheren Abrechnungsgmöglich-<br />
keiten über die Mobilfunkrechnung sind ebenso von Vorteil wie die Nutzung der<br />
Ortsinformationen der Mobilfunkk<strong>und</strong>en, die einzig <strong>und</strong> allein in der Gewalt des<br />
Mobilfunkbetreibers liegen. Auf der anderen Seite muß aber berücksichtigt werden,<br />
daß dieses alles nur dann nutzbar ist, wenn es dem Anbieter des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s ge-<br />
lingt, einen Mobilfunkanbieter von seinem Vorhaben zu überzeugen. Nachteilig ist<br />
hierbei zusätzlich, daß die Anzahl an potentiellen Mobilfunkanbietern eher gering<br />
ist. <strong>Ein</strong>e Kooperation bedeutet zudem auch immer eine gewisse Abhängigkeit bzw.<br />
Unflexibilität in eigenen Entscheidungen, da ein Kooperationspartner in der Regel<br />
immer ein gewisses Mitspracherecht für sich beanspruchen wird - insbesondere dann,<br />
wenn seine Marktmacht groß ist.<br />
2. Konkurrenz<br />
Unter Konkurrenz soll hier das Gegenteil von Kooperation verstanden werden. Es<br />
existiert somit keine direkte Partnerschaft zwischen einem Anbieter des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
<strong>und</strong> einem Mobilfunkanbieter.<br />
Dieses Vorgehen bietet strategisch die Möglichkeit, einen vollständig unabhängigen<br />
Service zu etablieren, der im Internet zur Verfügung gestellt wird <strong>und</strong> für dessen<br />
Zugang lediglich ein Internet-Gateway eines beliebigen Mobilfunkanbieters genutzt
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 49<br />
hoch<br />
Unahängigkeit<br />
niedrig<br />
Konkurrenz<br />
niedrig<br />
Marktchancen<br />
Kooperation<br />
hoch<br />
Abbildung 3.13: Die strategische Ausrichtung zwischen Unabhängigkeit <strong>und</strong> Marktchancen<br />
werden muß, wie vergleichsweise bei WAP-Internetseiten. Im Vergleich zur Koope-<br />
ration besteht hierbei die Möglichkeit, den Dienst vollständig von der Anzahl der<br />
Mobilfunkbetreiber unabhängig zu machen. Nutzer könnten somit den Dienst un-<br />
abhängig von ihrem Vertrag mit einem bestimmten Mobilfunkanbieter aus ihrem<br />
jeweiligen Mobilfunknetz heraus nutzen. Dieses hätte zusätzlich den Vorteil, daß<br />
wirtschaftliche Schwierigkeiten, denen Mobilfunkanbietern in der Zukunft aufgr<strong>und</strong><br />
evtl. höherer Konkurrenz ausgesetzt sein könnten, einen Anbieter des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
vollständig unberührt lassen würden. Die Möglichkeit der vollständigen Unabhängig-<br />
keit hat allerdings den Nachteil, daß die Informationen, die für den Betrieb des<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s essentiell sind, nämlich die aktuellen Ortsinformationen von Nutzern,<br />
von den Mobilfunkbetreibern gekauft werden müssen, wenn das System auch von<br />
Mobilfunknutzern ohne eigenes GPS-Modul nutzbar sein soll. Auch die Abrechnung<br />
der angebotenen Leistungen bedarf in diesem Fall einer detaillierteren Überlegung,<br />
da die einfachste Form der Abrechnung über die Rechnung des Mobilfunkbetreibers<br />
nicht direkt genutzt werden kann <strong>und</strong> so Modelle entwickelt werden müssen, die eine<br />
Vergütung der Leistungen dennoch ermöglicht.<br />
Betrachtet man diese beiden möglichen Wege zwischen den Dimensionen Unabhängigkeit<br />
<strong>und</strong> Marktchancen in der Darstellungsform eines Strategic Grid [AAM02], wie in Abbil-<br />
dung 3.13, dann läßt sich hieraus ableiten, daß der strategisch beste Weg ein Mittelweg<br />
zwischen Kooperation <strong>und</strong> Konkurrenz sein müßte.<br />
Für einen Anbieter des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s bedeutet dieses, daß er eine bestmögliche Koopera-<br />
tion mit dem Mobilfunkbetreiber aushandeln sollte, in der festgelegt ist, daß die Daten, die<br />
der Anbieter zwingend für den Betrieb seines Dienstes benötigt, wie Ortsinformationen<br />
von Nutzern <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enabrechnungsdaten, in geeigneter Weise zur Verfügung gestellt<br />
werden. Im Gegenzug muß sich der Anbieter genau Gedanken darüber machen, in welcher<br />
Art der Mobilfunkbetreiber an dem Erfolg des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s beteiligt werden soll. Hier-<br />
bei ist eine zuvor genauestens durchgeführte Analyse von Erlösmodellen sowie eine zuvor<br />
festgelegte Preis- <strong>und</strong> Produktstrategie wichtigster Bestandteil der Verhandlungen.<br />
In den nachfolgenden Ausführungen werden u.a. genau diese Bestandteile diskutiert <strong>und</strong>
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 50<br />
aufgezeigt, welche Möglichkeiten einem Anbieter eines <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s gr<strong>und</strong>sätzlich für die-<br />
se Bestandteile zur Verfügung stehen <strong>und</strong> darüber hinaus auch geeignet sind. Des weiteren<br />
werden die einzelnen Komponenten, die das <strong>Geschäftsmodell</strong> zusätzlich neben geeigneten<br />
Erlösquellen <strong>und</strong> einer generellen Strategie beinhaltet, wie K<strong>und</strong>ensegment <strong>und</strong> Wertbei-<br />
trag, ebenfalls beleuchtet.<br />
3.5.2 Die Erlösquellen des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Die Wahl von geeigneten Erlösformen für ein <strong>Geschäftsmodell</strong> stellt die Basis für eine<br />
nachfolgende Betrachtung der Preis- <strong>und</strong> Produktstrategie innerhalb einer allgemeinen<br />
Strategiebildung für ein <strong>Geschäftsmodell</strong> dar. Durch die Wahl der Erlösformen legt der<br />
Anbieter fest, wie er seine angebotenen Leistungen finanzieren will, <strong>und</strong> stellt sich so z.B.<br />
die Frage, ob die Leistungen über eine Nutzungsgebühr oder aber über Werbeeinnahmen<br />
finanziert werden sollen [PRW01]. Auf Basis dieser Entscheidungen kann dann innerhalb<br />
einer allgemeinen Strategie für das <strong>Geschäftsmodell</strong> die konkrete Preis- <strong>und</strong> Produktstra-<br />
tegie entwickelt werden, die dann wiederum Auskunft darüber gibt, wie genau z.B. die<br />
Höhe von Gebühren angesetzt werden muß. Abbildung 3.14 gibt hierzu einen Überblick<br />
über Art <strong>und</strong> Systematik von Erlösformen.<br />
- Anschlußgebühren<br />
- Lizenzgebühren<br />
- Spezielle<br />
Empfangsgeräte<br />
Erlösformen<br />
direkt indirekt<br />
nutzungsabhängig nutzungsunabhängig<br />
<strong>Ein</strong>zeltransaktionen einmalig periodisch via Unternehmen via Staat<br />
- nach Leistungsmenge<br />
- nach Leistungsdauer<br />
- Abonnement<br />
- R<strong>und</strong>funkgebühren<br />
- Werbung<br />
- Datamining<br />
- Kommission<br />
- Subventionierung<br />
Abbildung 3.14: Art <strong>und</strong> Systematik der Erlösformen nach [PRW01]<br />
Generell unterscheidet man bei den Erlösformen primär zwischen direkten <strong>und</strong> indirek-<br />
ten Erlösformen. Bei direkten Erlösformen stammen die <strong>Ein</strong>nahmen unmittelbar von den<br />
Nachfragern eines Angebotes. Bei indirekten Erlösformen wird das Angebot hingegen ko-<br />
stenlos zur Verfügung gestellt <strong>und</strong> die <strong>Ein</strong>nahmen für Leistungen werden durch andere<br />
Unternehmen oder dem Staat vergütet [PRW01].<br />
Direkte Erlösformen spielen im mCommerce eine wichtige Rolle. Es kommt allerdings dar-<br />
auf an, welche Art von Produkten oder Leistungen angeboten werden soll [Cle02]. Nach<br />
<strong>Ein</strong>schätzungen von Fachleuten werden in der frühen Phase des mCommerce solche Ange-<br />
bote erfolgreich sein, die eindeutig zu definieren <strong>und</strong> leicht zu kommunizieren sind [Zob01].<br />
Nach <strong>Ein</strong>schätzung von Clement [Cle02] werden nur Angebote, die ausschließlich auf di-<br />
rekte Erlösformen setzen, erfolgreich bestehen können, wenn sie entweder teure Güter
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 51<br />
anbieten oder aber innovativ sind.<br />
Indirekte Erlösformen haben ebenfalls im mCommerce ihre <strong>Das</strong>einsberechtigung. Es müssen<br />
allerdings die Besonderheiten im Nutzerverhalten gegenüber dem elektronischen Geschäfts-<br />
verkehr beachtet werden. Z.B. wird die Überschüttung von Mobilfunk-Nutzern mit Massen<br />
an Werbung schnell dazu führen, die K<strong>und</strong>en zu verprellen [Cle02]. Generell gibt es aber<br />
neben der Werbung weitere indirekte Erlösquellen, wie Kommission oder aber Datami-<br />
ning. Insbesondere beim Datamining stellt sich die Frage, ob dieser im Internet bereits<br />
erfolgreich praktizierte Ansatz auch in mobilen Umgebungen bestehen kann <strong>und</strong> ob auch<br />
hier aus mobilen Daten gewonnene K<strong>und</strong>eninformationen an Dritte weiter verkauft wer-<br />
den können. Denkt man beispielsweise an die Möglichkeiten bei ortsbezogenen Diensten,<br />
Verhaltensmuster von Nutzergruppen aufgr<strong>und</strong> ihres räumlichen Verhaltens generieren zu<br />
können, dann scheint der Bereich Datamining auch im mCommerce ein enormes Potential<br />
zu besitzen, wenngleich rechtliche Aspekte dieses relativieren könnten.<br />
Folgerungen für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong><br />
Für einen Anbieter des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s sind generell unterschiedliche Erlösquellen denkbar,<br />
die im Detail von der gewählten Strategie abhängig sind. Abbildung 3.15 veranschaulicht<br />
in diesem Zusammenhang eine mögliche Variante von Erlösquellen aus der Perspektive<br />
eines <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>-Betreibers, der in Kooperation mit einem Mobilfunkanbieter operiert.<br />
Hierbei wird in der Abbildung dargestellt, auf welche Art Erlöse in den einzelnen Berei-<br />
chen der Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s erzielt werden könnten. Darüber hinaus<br />
zeigt Abbildung 3.15 zusätzlich, welche Waren <strong>und</strong> Dienstleistungen hierfür von einzelnen<br />
Akteuren innerhalb der Wertschöpfungskette bezogen bzw. angeboten werden.<br />
Für den Bereich Content innerhalb der Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s, wäre es<br />
z.B. denkbar, daß jeder Informationsanbieter gewisse Flächen im Umkreis eines Objektes<br />
erwerben kann, für welche er Informationen zur Verfügung stellen möchte. Diese Fläche<br />
würde er idealerweise nicht erwerben können, sondern lediglich mieten, was regelmäßige<br />
<strong>Ein</strong>nahmen sichern würde. In diesem Fall wäre die Wahl auf direkte nutzungsunabhängige<br />
Erlösformen gefallen, die einen periodisch wiederkehrenden Charakter aufweisen.<br />
Der Bereich Portal stellt in dem hier vorgeschlagenen Modell die Schnittstelle zu den<br />
Benutzern des Systems dar. Benutzer können über das Portal auf die Leistungen des<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zugreifen. Hier gilt somit besondere Vorsicht bei der Wahl der geeigneten<br />
Erlösformen. Es wird nicht möglich sein, Benutzern ein zu ” modernes“ Erlöskonzept zu<br />
offerieren, da ein solches Konzept anfangs unverständlich oder ungewohnt sein könnte.<br />
Dieses hätte dann zur Folge, daß Benutzer mit Zurückhaltung bei der Nutzung reagieren<br />
würden <strong>und</strong> so eine kritische Masse an Benutzern des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s nur schwer erreichbar<br />
wäre. Mit der Wahl einer direkten nutzungsabhängigen Erlösform im Form von Transaktio-<br />
nen, wie bereits aus anderen Bereichen des Mobilfunks für Benutzer hinlänglich bekannt,<br />
könnte dieses Problem umgangen werden. <strong>Ein</strong>e Ergänzung bzw. Kombination mit wei-<br />
teren direkten nutzungsunabhängigen Erlösquellen, wie z.B. mittels am Markt gängiger
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 52<br />
Anwendung<br />
Navigation/Kartographie<br />
Zahlung/Transaktion<br />
Vermietung virtueller<br />
geographischer Flächen<br />
<strong>L2L</strong>-spezifische<br />
Anwendungen <strong>und</strong> Dienste<br />
direkte Vergütung von<br />
Leistungen<br />
Provision für erzeugten<br />
Netzwerkverkehr<br />
WASP<br />
Content<br />
Informationsanbieter<br />
Aggregatoren<br />
Infrastruktur Betreiber<br />
Hardware Mobilfunkbetreiber<br />
Software<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong><br />
Betreiber<br />
Zugriff auf Technik &<br />
Netzinformationen<br />
Miete für geographische<br />
Flächen<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Plattform<br />
Portal<br />
Systemzugang<br />
Nutzungsentgelt<br />
(transaktionsbasiert)<br />
direkte Vergütung von<br />
Leistungen<br />
Legende:<br />
System-Benutzer<br />
monetäre Leistungen<br />
Waren- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abbildung 3.15: Mögliche Erlösquellen innerhalb der Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>s<br />
Gr<strong>und</strong>gebühren, scheint gerade in der Startphase des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s ungeeignet zu sein.<br />
Hierdurch würde beim potentiellen Benutzer ein unnötiger Bindungsgedanke aufgebaut<br />
werden, der sich insbesondere bei neuen Produkten im Hinblick auf die K<strong>und</strong>engewinnung<br />
negativ auswirken würde, da eine breite Masse der potentiellen Benutzer noch keine de-<br />
taillierte <strong>Ein</strong>schätzung über den persönlichen Nutzen einer Anwendung erwerben konnte.<br />
Fur den Bereich der Anwendungen sind sehr vielfältige Erlösmodelle denkbar, weil die in<br />
diesem Bereich erbrachten Leistungen stark differieren können. Da es sich aber hierbei<br />
in der Regel um Software-Komponenten in Form von Diensten handeln wird, ist davon<br />
auszugehen, daß an dieser Stelle direkte Erlösformen zum <strong>Ein</strong>satz kommen sollten.<br />
Innerhalb der Bereiche Infrastruktur <strong>und</strong> Betreiber der Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>s stehen für den <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>-Betreiber aller Wahrscheinlichkeit nach nur wenige<br />
Erlösquellen zur Verfügung. Aufgr<strong>und</strong> der eingangs beschriebenen Kooperation von <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>-Betreiber <strong>und</strong> Mobilfunkbetreiber ist der Betreiber des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s primär<br />
Leistungsempfänger des Mobilfunkbetreibers <strong>und</strong> wird diesen hierfür geeignet vergüten<br />
müssen. Denkbar in Abhängigkeit zu der jeweiligen Kooperation wären allenfalls direkte<br />
nutzungsabhängige Erlöse, die in Form von Provisionen auf den durch das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong><br />
generierten Datenverkehr im Mobilfunknetz des Kooperationspartners erzielt werden könn-<br />
ten.
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 53<br />
Wie diese Ausführungen zeigen, gibt es eine große Anzahl an möglichen Varianten, um<br />
geeignete Erlösmodelle für unterschiedliche Gruppen zu finden. Im allgemeinen sollte an<br />
dieser Stelle allerdings immer beachtet werden, daß die gewählten Modelle auch eine ge-<br />
wisse Marktakzeptanz haben müssen, insbesondere dann, wenn sie neu oder ungewöhnlich<br />
sind.<br />
3.5.3 Die Preis- <strong>und</strong> Produktstrategie des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Bei der Findung der geeigneten Preis- <strong>und</strong> Produktstrategie geht es darum, eine geeignete<br />
Strategie zu finden, die ein langfristiges <strong>und</strong> erfolgreiches Bestehen am Markt sichern kann.<br />
Die Betriebswirtschaftslehre liefert für diesen Findungsprozeß diverse Hilfsmittel, die unter<br />
dem Begriff absatzpolitische Instrumente oder aber Marketing-Instrumente subsummiert<br />
werden [Wöh02]. Diese absatzpolitischen Instrumente sind hierbei wiederum in Produkt-,<br />
Preis-, Kommunikations- <strong>und</strong> Distributionspolitik unterteilt, wobei an dieser Stelle nur die<br />
ersten beiden näher beleuchtet werden sollen. <strong>Ein</strong>e detaillierte <strong>Ein</strong>führung in alle Bereiche<br />
der absatzpolitischen Instrumente kann in [Wöh02] gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Produktpolitik<br />
Die Produktpolitik steht in der Reihe der absatzpolitischen Instrumente an vorderster<br />
Stelle <strong>und</strong> wird teilweise auch als das ” Herz des Marketings“ bezeichnet. Die Aufgabe der<br />
Produktpolitik ist es, ein Angebot zu entwickeln, das an den Bedürfnissen der Nachfrager<br />
orientiert ist [Wöh02]. Ziel ist es hierbei, das eigene Produkt so zu konzipieren, daß es sich<br />
positiv von Konkurrenzprodukten abhebt. Darüber hinaus ist es wichtig, das Produkt zu<br />
einem ” Gut eigener Art“ zu machen, um so eine gewisse Produktheterogenität am Markt<br />
zu erzielen, was dazu führt, daß der Anbieter des Produktes nicht so schnell von einem<br />
intensiven Preiswettbewerb erfaßt wird [Wöh02].<br />
Aufgr<strong>und</strong> des technischen Fortschritts <strong>und</strong> des sich über die Zeit verschiebenden Bedarfs<br />
auf der Seite der Nachfrager wird dem Markt eine mehr oder weniger starke Dynamik ver-<br />
liehen, die gerade im noch relativ jungen Bereich mCommerce, aller Voraussicht nach, eher<br />
auf einem höheren Niveau sein wird. Aus diesem Gr<strong>und</strong> kann ein Anbieter, der bereits eine<br />
gewisse Vormachtstellung mit einem Produkt erreicht hat, diese auch nur dann behaupten,<br />
wenn er seine Produkte ständig an die sich wandelnden Bedingungen des Marktes anpaßt.<br />
Innerhalb der Produktpolitik ist es deshalb wichtig, das Angebot permanent zu überprüfen<br />
<strong>und</strong> auf neue Bedürfnisse am Markt zu reagieren, um nicht ins Abseits gegenüber ande-<br />
ren Anbietern zu gelangen. Für diesen dynamischen Prozeß der Produktanpassung stehen<br />
innerhalb der Produktpolitik wiederum unterschiedliche Mittel zur Verfügung [Wöh02]:<br />
Produktinnovation, Produktvariation bzw. Produkteliminierung. Hierbei spricht man von<br />
Produkteliminierung, wenn alte Produkte aus dem Markt genommen werden. Die Möglich-<br />
keiten der Produktvariation bzw. Produktdifferenzierung bestehen darin, für mehr oder<br />
weniger fast identische Güter eines Anbieters unterschiedliche Preise für unterschiedliche<br />
Nachfrager festzusetzen [PRW01]. Dieses kann seine Ausprägung in unterschiedlichster<br />
Art <strong>und</strong> Weise haben <strong>und</strong> wird besonders häufig bei reinen Informationsgütern, wie z.B.
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 54<br />
Software, angewendet. Hier ist eine gängige Form der Differenzierung, unterschiedliche<br />
Versionen zu unterschiedlichen Preisen für Unternehmen, Privatpersonen, Studenten etc.<br />
anzubieten, ohne daß der Leistungsumfang der Software extrem unterschiedlich ist. <strong>Ein</strong>e<br />
detailliertere <strong>Ein</strong>führung in die Möglichkeiten der Produktdifferenzierung kann in [PRW01]<br />
gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Für einen Anbieter des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s bleibt an dieser Stelle lediglich festzuhalten, daß<br />
eine genaue Betrachtung der unterschiedlichen Möglichkeiten, Produkte aus der Idee des<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zu generieren, nicht nur eine einmalige Aufgabe beschreibt, sondern viel-<br />
mehr ein kontinuierlicher iterativer Prozeß ist, der ständig die aktuellen <strong>und</strong> zukünftigen<br />
Marktausprägungen beachten sollte.<br />
Preispolitik<br />
Die Preispolitik beinhaltet die einmalige Festlegung <strong>und</strong> laufende Anpassung des Preises<br />
als Gegenleistung für durch K<strong>und</strong>en in Anspruch genommene Leistungen [Ger02]. Für die<br />
Festlegung des Preises stellt die Betriebswirtschaftslehre diverse komplexe <strong>und</strong> weniger<br />
komplexe Verfahren zur Verfügung, um den Preis für ein jeweiliges Gut zu bestimmen,<br />
wie z.B. kostenorientierte Preisbildung oder nachfrageorientierte Preisbildung. <strong>Ein</strong>e sehr<br />
einfache Darstellung der Preisbildung kann der kostenorientierten Preisbildung entnom-<br />
men werden, wonach sich der Angebotspreis p aus den Kosten k zuzüglich eines mehr oder<br />
weniger einheitlichen Gewinnzuschlags g ergibt [Wöh02]:<br />
p = k(1 + g<br />
100 )<br />
Hierbei wird aber eine Problematik innerhalb der kostenorientierten Preisbildung deut-<br />
lich, wenn man eine Kalkulation auf Vollkostenbasis ansetzt, bei der die Selbstkosten k<br />
anteilige Gemeinkosten bzw. anteilige Fixkosten enthalten. In beiden Fällen ist der Anteil<br />
der in k enthaltenen Gemeinkosten bzw. Fixkosten um so höher je kleiner die abgesetzte<br />
Menge m des Produktes ist [Wöh02]. Der Angebotspreis p ist somit ebenfalls abhängig<br />
von der Absatzmenge. Bei der Absatzmenge besteht jedoch die Problematik der möglichst<br />
genauen Voraussage der absetzbaren Mengen, die im allgemeinen nicht möglich ist. Aus<br />
dieser Problematik heraus soll an dieser Stelle auf eine formale Preisbildung für die Pro-<br />
dukte des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s aufgr<strong>und</strong> fehlender Zahlen verzichtet <strong>und</strong> statt dessen generelle<br />
Preisstrategien diskutiert werden.<br />
Generelle Preisstrategien<br />
Unabhängig von einer kurzfristigen preispolitischen Entscheidung müssen Anbieter preis-<br />
politische Gr<strong>und</strong>satzentscheidungen treffen, die eine langfristige Wirkung haben [Wöh02].<br />
Aufgr<strong>und</strong> ihrer langfristigen Wirkung sind sie ein wichtiger Bestandteil eines Geschäftsmo-<br />
dells <strong>und</strong> können dieses in seiner Erscheinung nachhaltig verändern. Da neue Anwendungen<br />
im mCommerce sich normalerweise durch einen relativ kurzen Produktlebenszyklus aus-<br />
zeichnen, besteht am Anfang der Produkteinführung die Möglichkeit von unterschiedlichen
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 55<br />
Preis<br />
p*<br />
Pulsationsstrategie<br />
Skimmingstrategie<br />
Schnibbelstrategie<br />
Penetrationsstrategie<br />
Zeit<br />
Abbildung 3.16: Generelle Preisstrategien nach Clement [Cle02]<br />
Preisstrategien (vgl. Abbildung 3.16) für ein Produkt in Abhängigkeit der jeweiligen Ziele<br />
des Anbieters. Dieses gilt in gleicher Form für den Anbieter des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s. Er muß<br />
sich Gedanken darüber machen, wie er in Kombination mit geeigneten Erlösquellen (vgl.<br />
Abschnitt 3.5.2) eine bestmögliche Preisstrategie erarbeitet, die die langfristige Strategie<br />
<strong>und</strong> den Erfolg des Unternehmens sichern.<br />
Die Skimming- oder Abschöpfungsstrategie verfolgt hierbei das Ziel, die Zahlungsbereit-<br />
schaft von Pionierk<strong>und</strong>en zu Beginn der <strong>Ein</strong>führungsphase eines Produktes optimal ab-<br />
zuschöpfen [Cle02]. Hierzu wird für eine kurze Zeit ein Preis für das Produkt gewählt,<br />
der oberhalb eines optimalen Preises p ∗ für das Produkt liegt. In der Folgezeit wird dieser<br />
Preis dann sukzessive gesenkt, was dazu führt, daß einerseits neue Erlösquellen gef<strong>und</strong>en<br />
werden müssen, um Erlöse zu sichern, andererseits aber durch die Senkung neue Nach-<br />
fragerkreise erschlossen werden. <strong>Ein</strong> Nachteil bei der Wahl dieser Strategie liegt darin,<br />
daß es dem Anbieter nicht möglich ist, eine gesicherte Marktposition gegenüber anderen<br />
Wettbewerbern auszubauen, da die Anzahl der K<strong>und</strong>en, die bereit sind, den festgesetzten<br />
Preis zu zahlen, vergleichsweise geringer ist als bei einer Strategie, die über niedrige Preise<br />
operiert.<br />
<strong>Ein</strong>e Strategie, die über extrem niedrige Preise unterhalb eines optimalen Preises p ∗ ope-<br />
riert, ist die Penetrations- oder Marktdurchdringungsstrategie. Bei ihr wird das Ziel ver-<br />
folgt, eine Marktdurchdringung zu erreichen <strong>und</strong> so lange wie möglich eine Monopol-<br />
stellung zu erzielen, oder wenn dieses nicht möglich ist, einen sehr großen Marktanteil<br />
zu erreichen [Wöh02]. Dieser Strategie zugr<strong>und</strong>e liegt allerdings die Annahme, daß be-<br />
reits eine latente Nachfrage existiert, die durch geeignete Marketingmaßnahmen, wie z.B.<br />
Werbung, aktiviert werden kann [Cle02]. Der Nachteil dieser Strategie besteht darin, daß<br />
bei Erreichen einer zu geringen K<strong>und</strong>enanzahl die ohnehin finanziell schwierige Situation<br />
zusätzlich verstärkt wird. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist es mit Hilfe dieser Strategie für kleine<br />
Unternehmen, die sich z.B. nur auf den Bereich mCommerce konzentrieren <strong>und</strong> zugleich<br />
über eingeschränkte finanzielle Mittel verfügen, schwieriger Erfolge zu erzielen als für große
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 56<br />
Merkmal des<br />
Anbieters<br />
Sonderstellung<br />
durch<br />
Abschöpfungsstrategie Penetrationsstrategie<br />
großes Innovationspotential große Kapitalkraft<br />
technischer Vorsprung: rechtli-<br />
chen Schutz<br />
Chance schnelle Amortisation der F +<br />
E-Kosten über Massenabsatz<br />
konkurrenzlos niedrigen Preis<br />
langsame Amortisation der F +<br />
E-Kosten über Massenabsatz<br />
Risiko Innovation mißlingt Aufnahmefähigkeit des Marktes<br />
wird überschätzt<br />
Tabelle 3.1: Abschöpfungs- <strong>und</strong> Penetrationsstrategie im Vergleich nach Wöhe [Wöh02]<br />
Unternehmen [Cle02].<br />
Da Abschöpfungs- <strong>und</strong> Penetrationsstrategie die beiden gegensätzlichsten Strategien der<br />
hier vorgestellten darstellen, zeigt Tabelle 3.1 zusätzlich einen direkten Vergleich der<br />
Stärken <strong>und</strong> Schwächen dieser beiden Strategien für ausgewählte Kriterien.<br />
Neben den bereits vorgestellten Strategien sind aber auch noch weitere denkbar. Aber auch<br />
sie bieten kein ” Patentrezept“, sondern sind ebenfalls mit Risiken behaftet. Die Pulsati-<br />
onsstrategie versucht von einem initial relativ hohen Preisniveau oberhalb des optimalen<br />
Preises p ∗ , auszugehen, um dann im folgenden in eine Abwechslung von starken Preis-<br />
nachlässen <strong>und</strong> -anhebungen überzugehen [Cle02]. Die Preisnachlässe sollen am Markt da-<br />
zu dienen, einen gesteigerten Kaufanreiz bei den Nachfragern zu erzeugen. Allerdings hat<br />
diese Strategie den Nachteil, daß bedingt durch ein ständiges Auf <strong>und</strong> Ab des Preises kaum<br />
ein Massenmarkt geschaffen werden kann. Gleiches gilt auch für die Schnibbelstrategie, bei<br />
der ein gewisses Preisniveau, das durch die Konkurrenz vorgegeben wird, immer wieder<br />
zu unterbieten ist. Diese Art der Preissenkung soll dann dazu dienen, daß ein branchen-<br />
weiter Kostendruck entsteht, dem nur durch eine allgemeine <strong>und</strong> spürbare Preisanhebung<br />
ausgewichen werden kann.<br />
Folgerungen für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong><br />
Die Frage nach der geeigneten Preis- <strong>und</strong> Produktstrategie für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> kann an<br />
dieser Stelle nicht vollständig beantwortet werden. Sie wird unter anderem davon abhängig<br />
sein, wie genau die aktuelle Situation am Mobilfunkmarkt zum Zeitpunkt der <strong>Ein</strong>führung<br />
aussehen wird. Ist die jetzige Tendenz der Mobilfunknutzer hin zu einer kostenlosen Nut-<br />
zung von mCommerce-Angeboten, wie aus dem Bereich stationäres Internet mittlerweile<br />
gewohnt, zum <strong>Ein</strong>führungszeitpunkt des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s immer noch vorhanden, dann hätte<br />
eine Strategie, die an einer Marktabschöpfung durch hohe Preise orientiert ist, wohl weni-<br />
ger durchschlagenden Erfolg als eine Strategie niedriger Preise, wie die der Penetrations-<br />
strategie. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch die wohl extremste Form der Pene-<br />
trationsstrategie, die auf eine kostenlose Zuverfügungstellung des Dienstes für Endnutzer
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 57<br />
basiert. In diesem Fall müßten die entstehenden Kosten über andere Kanäle querfinanziert<br />
werden. Hierbei würde sich anbieten, die entstehenden Kosten z.B. über Mieteinnahmen<br />
der Informationsanbieter oder/<strong>und</strong> Provisionsbeteiligungen für entstehenden Netzwerk-<br />
verkehr auf Seiten der Mobilfunkbetreiber zu kompensieren. Aber auch eine Vergütung<br />
für ” Premium“-Dienste, die auf Standard-Versionen aufbauen, ist ebenso denkbar.<br />
Diese unter dem Namen ” Follow the Free“ bekannte Strategie vereint durch eine kosten-<br />
lose Abgabe die besonderen Kostenstrukturen digitaler Informationsprodukte mit dem<br />
Phänomen der Netzwerkeffekte [Z + 99]. Hierbei ist ” Follow the Free“ keine vollkommen<br />
neue Preisstrategie sondern basiert auf bereits existierende Strategieansätze. Zu beachten<br />
gilt, daß ein anfänglicher Verzicht auf Umsätze zu einer nicht zu unterschätzenden ” Inve-<br />
stition in die Zukunft“ führt <strong>und</strong> ein hohes unternehmerisches Risiko birgt [Z + 99]. Erfolge<br />
von Unternehmen, wie die von Netscape oder Microsoft bei der <strong>Ein</strong>führung ihrer Internet-<br />
Browser, zeigen jedoch, daß diese Strategiewahl dennoch sehr erfolgreich sein kann. Dieses<br />
liegt primär darin begründet, daß der entstehende ” Lock-in“-Effekt eine langfristige Kun-<br />
denbindung erzielt, die stark genug ist, um K<strong>und</strong>en auch an andere Unternehmensleistun-<br />
gen zu binden [Z + 99].<br />
3.5.4 <strong>Das</strong> K<strong>und</strong>ensegment des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Nach einer Studie der Boston Consulting Group [The00] zeichnete sich die erste Welle der<br />
mCommerce-Nutzer im Vergleich zum stationären Internet dadurch aus, daß die Nutzer<br />
jünger <strong>und</strong> am Bevölkerungsdurchschnitt gemessen besser gebildet waren <strong>und</strong> dadurch<br />
bedingt über ein höheres <strong>Ein</strong>kommen verfügten.<br />
Nach Geer [GG01] ist davon auszugehen, daß sich die Nutzer des mCommerce in drei<br />
Gruppen unterteilen:<br />
1. Jugendliche unter 18 Jahren<br />
2. Studenten zwischen 18 <strong>und</strong> 25 Jahren<br />
3. junge Geschäftsleute, die Mitte der achziger Jahre als Young Urban Professionals<br />
(Yuppies) bezeichnet wurden<br />
Für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> ist davon auszugehen, daß auf Seiten der Endnutzer des Dienstes die-<br />
se angegebenen Eigenschaften ebenfalls das adressierte K<strong>und</strong>ensegment charakterisieren.<br />
Allerdings sollte die Gruppe ’‘junge Geschäftsleute“ besser auf ’‘mobile Geschäftsleute“<br />
erweitert werden, da dieses dem momentanen Trend der zunehmenden Mobilitätsanforde-<br />
rungen in Berufsprofilen eher entspricht. Begründen läßt sich dieses zusätzlich dadurch, daß<br />
der ortsbezogene Dienst, den das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> seinen K<strong>und</strong>en zur Verfügung stellt, eine<br />
von der Nutzungsbereitschaft aus gesehene ” normale“ mCommerce Anwendung darstellt<br />
<strong>und</strong> deshalb auch von genau derselben K<strong>und</strong>engruppe in Anspruch genommen werden<br />
sollte.<br />
Auf der anderen Seite adressiert das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>, wie bereits in der zugehörigen Wert-<br />
schöpfungskette angedeutet, zusätzlich zum Privatk<strong>und</strong>ensegment das Segment der Ge-
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 58<br />
schäftsk<strong>und</strong>en. Auf Geschäftsk<strong>und</strong>en wird hierbei in den Bereichen Content <strong>und</strong> Anwen-<br />
dungen abgezielt, da hier davon auszugehen ist, daß Informationslieferanten, die Informa-<br />
tionen im <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> zur Verfügung stellen, ein gewisses eigenes (werbendes) Interes-<br />
se verfolgen werden, welches charakteristisch für am Markt agierende Unternehmen ist.<br />
Der Bereich der Unternehmen, die Anwendungen innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zur Nut-<br />
zung durch Informationsanbieter zur Verfügung stellen, wird in der Regel der sein, deren<br />
Geschäftsfelder im Bereich Entwicklung <strong>und</strong> Betrieb von Anwendungen liegen.<br />
Aus dieser mehrdimensionalen Adressierung der K<strong>und</strong>ensegmente Privat- <strong>und</strong> Geschäfts-<br />
k<strong>und</strong>en muß bei der Umsetzung der Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s genauestens darauf geachtet<br />
werden, daß die einzelnen gewählten Strategien, Erlösmodelle etc. bestmöglich aufeinander<br />
abgestimmt werden, um alle K<strong>und</strong>ensegmente gleichermaßen zu befriedigen.<br />
3.5.5 Der Wertbeitrag des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Der Wertbeitrag beschreibt den Wert oder Nutzen, den ein K<strong>und</strong>e durch die Benutzung<br />
des jeweiligen Angebotes erhält. Ohne einen solchen Nutzen, der idealerweise einfach zu<br />
kommunizieren sein sollte, wird ein Anbieter langfristig keine K<strong>und</strong>enbindung für sein An-<br />
gebot erzielen können.<br />
Für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> besteht nicht nur ein einziger Wertbeitrag für alle Nutzer bzw.<br />
Beteiligten am System. Der Wertbeitrag läßt sich vielmehr für die K<strong>und</strong>ensegmente Pri-<br />
vatk<strong>und</strong>en (Endanwender) <strong>und</strong> Geschäftsk<strong>und</strong>en differenziert beschreiben:<br />
Privatk<strong>und</strong>en Der Nutzen für den Privat- oder Endk<strong>und</strong>enbereich ist relativ leicht zu<br />
beschreiben: <strong>Ein</strong> Endnutzer des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s hat mit Hilfe des Systems die Möglich-<br />
keit, auf kontextsensitive Informationen zuzugreifen. Er erhält hierdurch nur Zugriff<br />
auf Informationen, die zum aktuellen Zeitpunkt aufgr<strong>und</strong> seines räumliches Verhal-<br />
tens relevant für ihn sein könnten - überflüssige Informationen werden vermieden.<br />
Der persönliche Mehrwert für einen jeweiligen Nutzer kann hierbei stark differieren.<br />
<strong>Ein</strong>erseits könnte das System einen Informationsbedarf eines Nutzers befriedigen,<br />
diesen aber zugleich vor einer, in der heutigen Zeit häufig vorkommenden Informati-<br />
onsflut <strong>und</strong> damit vor langwierigen Selektionsprozessen schützen. Andererseits kann<br />
die Versorgung mit regionalen Informationen für andere Nutzer, z.B. Touristen, da-<br />
zu dienen, Detailinformationen über Objekte oder Gebäude zu erhalten ohne diese<br />
direkt besuchen zu müssen.<br />
Geschäftsk<strong>und</strong>en Der Nutzen des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s für Geschäftsk<strong>und</strong>en muß wiederum<br />
differenziert werden für solche Unternehmen, die sich innerhalb des Wertschöpfungs-<br />
bereiches Content bewegen, <strong>und</strong> jenen im Bereich Anwendungen.<br />
Anbieter von Inhalten innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s haben den Nutzen, daß sie ihr<br />
Unternehmen, ähnlich eines Internetauftritts, präsentieren können. Hinzu kommt in<br />
dieser speziellen Form, daß die präsentierten Informationen immer dem Kontext des<br />
Nutzers entsprechen. Somit werden nur wirklich wichtige Informationen, für die ein<br />
momentanes potentielles Interesse beim Nutzer besteht, zur Verfügung gestellt. In
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 59<br />
diesem Zusammenhang könnten neue kontextsensitive Werbeformen, wie z.B. Loca-<br />
tion Based Advertisement, mit extrem hoher Erfolgsquote etabliert werden. Detail-<br />
liertere Informationen <strong>und</strong> Möglichkeiten von Location Based Advertisement lassen<br />
sich z.B. in [Woh02] finden.<br />
Für Anbieter von Anwendungen innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s ergibt sich hingegen<br />
ein anderer Nutzen, der darin liegt, über das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> neue Märkte für bereits<br />
bestehende eigene Anwendungen zu finden. Anbieter könnten so mit evtl. geringer<br />
Anpassung eine nahtlose Integration ihrer Anwendungen erreichen. Aber auch eine<br />
Entwicklung von neuen Anwendungen, die speziell auf die Anforderungen der In-<br />
formationsanbieter ausgerichtet sind, wie z.B. Stadtplan-Dienste etc., können dazu<br />
beitragen, neue Absatzmärkte zu erschließen.<br />
3.6 Zusammenfassung<br />
Dieser Abschnitt umfaßt den letzten Bereich innerhalb der Ausführungen des hier vor-<br />
geschlagenen <strong>Geschäftsmodell</strong>s für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>. Er soll abschließend dazu dienen,<br />
wesentliche bisher gewonnene Erkenntnisse zusammenzufassen sowie generelle Anforde-<br />
rungen <strong>und</strong> Rahmenbedingungen an eine dem <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> zugr<strong>und</strong>e liegende technische<br />
Architektur abzuleiten, welche Bestandteil der nachfolgenden Kapitel sein wird.<br />
Die zentrale Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s, die in Abschitt 3.3 beschrieben wurde, ist, Informa-<br />
tionseinheiten des Systems nicht an einem zentralen Ort zu bündeln. Vielmehr soll die<br />
Möglichkeit der Dezentralisierung geboten werden, die durch ein Peer-2-Peer Netzwerk<br />
realisiert werden soll. Aufgr<strong>und</strong> ökonomischer Perspektiven ist es sinnvoll, hierfür ein hy-<br />
brides Peer-2-Peer Netzwerk zu wählen, um eine zentrale Kontrollinstanz innerhalb des<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s, wie bereits in Abschnitt 2.2 thematisiert, zu ermöglichen. Hieraus ergibt<br />
sich eine erste Anforderung:<br />
Anforderung A-I Aufbau des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s auf Basis eines hybriden Peer-2-Peer Netz-<br />
werkes.<br />
Mit der Wahl eines hybriden Peer-2-Peer Netzwerkes als Basis für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> er-<br />
gibt sich zwangsläufig der Bedarf eines Mechanismus, der für einen Benutzer des Systems<br />
mit spezifischem Ortskontext den jeweilig aktuellen Zugangsknoten (Peer) zum Netzwerk<br />
ermittelt. Dieser Zugangsknoten übernimmt dann im folgenden so lange die Kommunika-<br />
tion mit dem Benutzer wie dessen Ortskontext passend ist. Andernfalls wird der Benutzer<br />
einem anderem Zugangsknoten im Netzwerk ” übergeben“.<br />
Anforderung A-II Anbieten eines Mechanismus, der die Ermittlung eines passenden<br />
Zugangsknotens zum System ermöglicht.<br />
Diese Überlegung setzt allerdings voraus, daß eine gewisse Modellierung von einzelnen ” Or-<br />
ten“ repräsentiert durch Zugangsknoten vorhanden ist. <strong>Ein</strong>e solche Modellierung sollte es
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 60<br />
z.B. ermöglichen, das in Abschnitt 3.9 dargestellte Szenario mit mehreren Gebäuden abzu-<br />
bilden. Hierbei ist auch zu beachten, daß Nachbarschafts- <strong>und</strong> hierarchische Beziehungen<br />
ebenfalls abbildbar sein sollten, um auch reale Konstellationen, wie mehrere Unterneh-<br />
men innerhalb eines großen Gebäudes, zu realisieren. Des weiteren läßt sich eine solche<br />
Modellierung zusätzlich dazu benutzen, die in Abschnitt 3.5.2 angedachte Vermietung von<br />
virtuellen Flächen an Informationsanbieter abzuwickeln.<br />
Anforderung A-III Unterstützung eines Modells, das eine Abbildung räumlicher Rea-<br />
litäten auf Zugangsknoten ermöglicht.<br />
Nachdem diese bereits genannten Anforderungen notwendig sind, um Funktionalitäten,<br />
die besondere Bedingungen von Peer-2-Peer Netzen nutzen, zu ermöglichen, gehen nach-<br />
folgende Betrachtungen eher auf die Inhalte ein, die innerhalb des Systems ausgetauscht<br />
bzw. dem Benutzer kontextspezifisch zur Verfügung gestellt werden sollen.<br />
Damit Inhalte durch das System überhaupt kontextspezifisch zur Verfügung gestellt wer-<br />
den können, muß den Content-Anbietern innerhalb der Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<br />
Netzwerks (vgl. Abschnitt 3.4.1) eine Möglichkeit gegeben werden, die kontextspezifischen<br />
Informationseinheiten im System abzubilden. Es muß also eine Beschreibungsart (Sprache)<br />
vorhanden sein, die auf der einen Seite einfach genug ist, um auch kleineren Unterneh-<br />
men die Möglichkeit der Nutzung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s als Anbieter von Informationen durch<br />
eigene Informationserstellung zu ermöglichen; auf der anderen Seite aber mächtig genug<br />
ist, um komplexe räumliche Verhältnisse modellierbar zu machen, um Unternehmen die<br />
sich auf die Erstellung von Inhalten für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> spezialisiert haben, vielfältige<br />
Service-Leistungen zu ermöglichen. Diese Maßnahme sollte gewährleisten, daß die essen-<br />
tiellen Inhalte (vgl. Abschnitt 3.4.1) für den Erfolg des Systems in ausreichender Anzahl<br />
verfügbar sind.<br />
Anforderung A-IV Unterstützung einer räumlichen Beschreibungmöglichkeit für kon-<br />
textspezifische Informationen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> des hohen Bedarfs an Informationseinheiten ergibt sich zwangsläufig ebenfalls<br />
ein Bedarf nach einem geeigneten Strukturierungs- <strong>und</strong> Aggregierungsmechanismus, der<br />
Nutzern des Systems die Informationen in einer effizienten Art <strong>und</strong> Weise zur Verfügung<br />
stellt, um lange ” Online-Zeiten“ <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ene hohe Kosten durch Suchen zu<br />
vermeiden. Dieses wurde bereits in Abschnitt 3.4.1 innerhalb des Wertschöpfungsberei-<br />
ches Portal diskutiert. Im Idealfall wäre es wünschenswert, ein Portal zu besitzen, das<br />
sich immer dem aktuellem Kontext seines Nutzers anpaßt, so daß dieser eine auf seinen<br />
aktuellen Aufenthaltsort zugeschnittene Homepage ( ” Location Page“) erhält. <strong>Ein</strong>e solche<br />
” Location Page“ würde darüber hinaus vielfältige Preis- <strong>und</strong> Produktstrategien auf Basis<br />
von Premium-Diensten, wie in Abschnitt 3.16 besprochen, ermöglichen.<br />
Anforderung A-V Unterstützung einer zentralen kontextsensitiven Benutzungsschnitt-
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 61<br />
stelle (Portal) für Endbenutzer.<br />
Betrachtet man die vielen kontextspezifisch annotierten Informationseinheiten innerhalb<br />
des Systems unter dem Hintergr<strong>und</strong> des Peer-2-Peer Netzes <strong>und</strong> der Modellierung von<br />
einzelnen Peers als räumlich arrangierte Objekte, dann ist ein weiterer Mechanismus er-<br />
forderlich, der einzelne Informationseinheiten zwischen Peers eigenständig austauscht. <strong>Ein</strong><br />
Austausch soll hierbei auf Basis der räumlichen Beziehungen einzelner Peers <strong>und</strong> den<br />
ausgetauschten Informationseinheiten geschehen. Dieses ist erforderlich, um zum einen<br />
Nutzern eine hohe Qualität der dargebotenen Informationen (Wertbeitrag) garantieren zu<br />
können, <strong>und</strong> zum anderen, um die Effizienz des Systems zu steigern <strong>und</strong> ” Online-Kosten“<br />
zu senken.<br />
Anforderung A-VI Unterstützung eines Austauschmechanismus für Informationseinhei-<br />
ten auf Basis räumlicher Beziehungen.<br />
Diese eher technischen Anforderungen ergeben sich größtenteils aus der Basis-Architektur<br />
eines Peer-2-Peer Netzwerkes. Andere Anforderungen ergeben sich bedingt durch die vor-<br />
gestellte Wertschöpfungskette des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s <strong>und</strong> deren Konsequenzen.<br />
Es gibt allerdings neben der wohl wichtigsten Anforderung an einen ortsbezogenen Dienst,<br />
der Ermittlung von Informationen, die einem aktuellen räumlichen Kontext entsprechen,<br />
weitere Rahmenbedingungen, die ebenfalls nicht außer acht bei einer erfolgreichen <strong>Ein</strong>-<br />
führung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s gelassen werden dürfen:<br />
Rahmenbedingung R-1 Sicherstellung von Datenschutzmaßnahmen der personenbezo-<br />
genen <strong>und</strong> -beziehbaren Daten innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s.<br />
Gerade für den Bereich der ortsbezogenen Dienste ist die unrechtmäßige Nutzung<br />
personenbezogener Daten wohl eine der größten Unsicherheitsfaktoren aus Sicht der<br />
Benutzer. Aus diesem Gr<strong>und</strong> müssen Maßnahmen getroffen werden, die den Benutzer<br />
bzw. K<strong>und</strong>en vor unrechtmäßiger Verwendung seiner ” Datenspuren“, die er wärend<br />
der Nutzung des Systems hinterläßt, dauerhaft schützen.<br />
Rahmenbedingung R-2 Sicherstellung einer von der Positionierungstechnologie unab-<br />
hängigen Nutzung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s.<br />
Die Entwicklung einer Architektur, die unabhängig von bestimmten Positionierungs-<br />
technologien ist, soll einen Ausschluß von Benutzern gewährleisten, die aus unter-<br />
schiedlichsten Gründen evtl. nicht die Positionierung über den Mobilfunkanbieter<br />
freigeben möchten. Die Architektur sollte es demnach vielmehr ermöglichen, die<br />
notwendigen Positionsdaten soweit zu abstrahieren, daß ggf. auch eine manuelle Po-<br />
sitionsbestimmung durch den Benutzer möglich wäre.<br />
Rahmenbedingung R-3 Sicherstellung einer angemessenen Nutzungsgeschwindigkeit<br />
<strong>und</strong> Ausfallsicherheit des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s
KAPITEL 3. EIN GESCHÄFTSMODELL FÜR ORTSBEZOGENE DIENSTE 62<br />
<strong>Ein</strong>e angemessene Nutzungsgeschwindigkeit einer Anwendung ist bei jedem Softwa-<br />
resystem generell anzustreben. Da es sich bei dem hier thematisierten System um<br />
eine mCommerce-Anwendung handelt, bei der die Online-Zeiten generell teuer für<br />
Benutzer sind, sollte diesem Aspekt besondere Beachtung zukommen.<br />
Abschließend läßt sich festhalten, daß die in diesem Kapitel dargestellten Ausführungen<br />
über eine mögliche kommerzielle Vermarktung eines ortsbezogenen Dienstes auf Peer-2-<br />
Peer Basis eine erste Basis für weitere Überlegungen bieten kann. Neben der generellen<br />
Entwicklung von <strong>Geschäftsmodell</strong>en wurde ausgehend von einer Marktanalyse <strong>und</strong> einer<br />
Geschäftsidee aufgezeigt, welche Möglichkeiten im mobilen Marktsegment für ortsbezoge-<br />
ne Dienste bestehen. Dabei wurde ausführlich auf mögliche Erlösquellen <strong>und</strong> eine dazu<br />
passende Preis- <strong>und</strong> Produktstrategie eingegangen, ohne die Rolle der Nutzer solcher Sy-<br />
steme außer acht zu lassen. Auch die Ausführungen bzgl. der Wertschöpfungskette haben<br />
aufgezeigt, daß es viele Möglichkeiten gibt, ortsbezogene Dienste kommerziell zu betrei-<br />
ben, auch dann, wenn der Betreiber nicht ein Mobilfunknetz-Betreiber ist.<br />
Festzustellen bleibt, daß eine gute Strategie eines der schwierigsten aber zugleich wichtig-<br />
sten Elemente für ein gutes <strong>Geschäftsmodell</strong> ist. <strong>Ein</strong>e Strategie greift in alle Teilbereiche<br />
eines <strong>Geschäftsmodell</strong>s ein <strong>und</strong> wird gleichzeitig von allen Teilbereichen beeinflußt. <strong>Ein</strong>e<br />
kleine Änderung der Erlösquellen kann z.B. schon dazu führen, daß eine gesamte Strategie<br />
neu überdacht werden muß.<br />
Die nachfolgenden Kapitel werden sich näher mit einer technischen Umsetzung des <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>s auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Kapitel beschäftigen <strong>und</strong><br />
Anhaltspunkte geben, wie ein solches System zu realisieren wäre. Die in diesem Abschnitt<br />
abgeleiteten Anforderungen <strong>und</strong> Rahmenbedingungen stellen nur einen kleinen Teil aller<br />
Anforderungen dar <strong>und</strong> sind deshalb keinesfalls als abschließend zu betrachten. Sie sind<br />
somit auch kein komplettes Ergebniss einer Anforderungsanalyse <strong>und</strong> sollen nicht als ein<br />
Pflichtenheft für nachfolgende Ausführungen verstanden werden, wohl aber als richtungs-<br />
weisende Anforderungen bzw. Kriterien.
Kapitel 4<br />
Architekturkonzepte für das<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong><br />
Nachdem die vorangegangenen Kapitel eher allgemeine Rahmenbedingungen für ortsbe-<br />
zogene Dienste <strong>und</strong> wirtschaftliche Aspekte für den Betrieb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s erörtert<br />
haben, bildet dieses Kapitel den Übergang zu einer mehr technisch orientierten Sichtweise<br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s <strong>und</strong> beschreibt mögliche Architekturkonzepte.<br />
4.1 Überblick<br />
Die hier vorgestellten Architekturkonzepte für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> basieren auf der zugehöri-<br />
gen Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s <strong>und</strong> bauen auf Erkenntnissen, Anforderungen <strong>und</strong> Rahmenbe-<br />
dingungen der vorangegangenen Kapitel auf.<br />
Dieser erste Abschnitt bietet eine sehr abstrakte Sicht auf die Architektur eines <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>s <strong>und</strong> soll die wesentlichen Komponenten <strong>und</strong> ihr Zusammenspiel auf höherer<br />
Ebene beschreiben.<br />
Ziel ist es, den Leser in die generelle Funktionsweise des Netzwerkes bzw. dessen Aufbau<br />
einzuführen, um eine detaillierte Betrachtung einzelner Komponenten in nachfolgenden<br />
Abschnitten zu ermöglichen.<br />
4.1.1 Identifikation von Komponenten des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
In Abschnitt 3.3 wurde ausführlich auf die dem <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> zugr<strong>und</strong>e liegende Geschäfts-<br />
idee eingegangen. In dieser Darstellung wurde die Idee auf einer informellen Ebene erläutert.<br />
Dieser Abschnitt dient dazu, die bekannte Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s aufzugreifen <strong>und</strong> sie auf<br />
eine technische Ebene zu abstrahieren. Mittels der Abstraktion werden dann im folgen-<br />
den wesentliche Komponenten des Systems, die für den weiteren Verlauf dieses Kapitels<br />
relevant sind, identifiziert. Hierbei geht es jedoch nicht darum, alle Detail-Fragen zu be-<br />
antworten.<br />
63
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 64<br />
Client<br />
<strong>L2L</strong><br />
Unit<br />
<strong>L2L</strong><br />
Unit<br />
<strong>L2L</strong><br />
Unit<br />
<strong>L2L</strong><br />
Server<br />
<strong>L2L</strong><br />
Unit<br />
<strong>L2L</strong><br />
Unit<br />
Abbildung 4.1: <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Komponenten<br />
<strong>Ein</strong>e der zentralen Anforderungen aus Abschnitt 3.6 war die Erkenntnis, daß die Netzwerk-<br />
Basisstruktur für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> ein hybrides Peer-2-Peer Netzwerk sein sollte, damit<br />
ein zentraler Zugangspunkt zum Netzwerk existiert. Da ein Peer-2-Peer Netzwerk per De-<br />
finition nur aus einzelnen Peers besteht, fällt die Unterteilung der Basis-Komponenten des<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s auf höchster Abstraktionsebene vergleichsweise leicht, da diese vorgegeben<br />
ist. Es existieren zwei verschiedene Komponenten im System:<br />
1. <strong>L2L</strong>-Server<br />
2. <strong>L2L</strong>-Unit<br />
Hierbei übernimmt der <strong>L2L</strong>-Server die per Definition von hybriden Netzwerken geforder-<br />
te Funktion einer Zentralinstanz, die Teile der Dienstleistungen innerhalb des Netzwerkes<br />
übernimmt (vgl. Abschnitt 2.2). Der <strong>L2L</strong>-Server ist hierbei primärer Zugangspunkt zum<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> <strong>und</strong> realisiert neben dem initialen Netzwerkzugang eine Vielzahl von zentra-<br />
len Anforderungen für die Funktionsweise des ortsbezogenen Dienstes, wie z.B. die Pflege<br />
eines sogenannten Location Models, also einer Repräsentation der räumlichen Strukturen<br />
der <strong>L2L</strong>-Units oder aber die Ermittlung einer auf den aktuellen Benutzer-Kontext passen-<br />
den <strong>L2L</strong>-Unit für die weitere Abwicklung der Dienste des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s.<br />
Die <strong>L2L</strong>-Unit repräsentiert hingegen jedes Objekt, das innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s als In-<br />
formationsanbieter zur Verfügung steht <strong>und</strong> beinhaltet unterschiedlichste Komponenten,<br />
die für die Abwicklung sämtlicher Funktionalitäten erforderlich sind, wie z.B. die Bearbei-<br />
tung von Benutzeranfragen.<br />
Da ein Peer-2-Peer Netzwerk nur aus einzelnen Peers besteht, wird auch der Client ei-<br />
nes Benutzers als ein solcher modelliert (vgl. Abb. 4.1). Dieses hat zur Folge, daß eine<br />
Unterscheidung von Informationsanbietern <strong>und</strong> Benutzern des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s auf dieser<br />
Abstraktionsebene nicht möglich ist, so daß sie beide jeweils als <strong>L2L</strong>-Unit modelliert wer-<br />
den.<br />
Diese Sichtweise ermöglicht es, daß Benutzer ebenfalls Informationen im Netzwerk anbieten<br />
können. Im Realfall wird sich allerdings eine kommerzielle Zugangssoftware für Benutzer
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 65<br />
von jener der Informationsanbieter unterscheiden, da viele Funktionalitäten auf Seiten<br />
des Clients nicht benötigt werden <strong>und</strong> darüber hinaus die Handhabbarkeit der Software<br />
auf mobilen Endgeräten aufgr<strong>und</strong> limitierter Ressourcen (Speicher, CPU) nicht oder nur<br />
schwer möglich wäre. Dieser Aspekt soll nachfolgend nicht näher thematisiert werden, um<br />
eine zu komplexe Darstellung der Zusammenhänge zu vermeiden. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird<br />
der Begriff Client immer dann verwendet, wenn es sich um eine <strong>L2L</strong>-Unit handelt, die von<br />
einem Benutzer des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s benutzt wird <strong>und</strong> nicht primär als Informationsanbieter<br />
fungiert.<br />
4.1.2 Struktureller Aufbau des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Die in Abbildung 4.2 beispielhaft dargestellte technisch orientierte Sichtweise eines Aus-<br />
schnittes des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s besteht aus einer Anzahl verschiedener Gebäude bzw. Objekte,<br />
die am <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> teilnehmen <strong>und</strong> somit aus Systemsicht <strong>L2L</strong>-Units darstellen, die Be-<br />
standteil des hybriden Peer-2-Peer Netzwerkes sind, das durch einen zentralen Server als<br />
Kontrollinstanz verwaltet wird (in Abb. 4.2 nicht dargestellt).<br />
Jede <strong>L2L</strong>-Unit besitzt hierbei einen gewissen Zuständigkeitsbereich (Service Scope) oder<br />
kurz Scope, der in Abbildung 4.2 als gestrichelter Kreis dargestellt ist <strong>und</strong> wie folgt cha-<br />
rakterisiert werden kann:<br />
Definition 6 (Service Scope) <strong>Ein</strong> Service Scope ist eine Region innerhalb eines geo-<br />
graphischen Raumes, für die eine <strong>L2L</strong>-Unit zuständig ist <strong>und</strong> innerhalb derer sie Dienst-<br />
leistungen erbringt.<br />
<strong>Ein</strong>e Region, die durch einen Service Scope einer <strong>L2L</strong>-Unit repräsentiert wird, kann durch<br />
Definition 6 nahezu beliebig gewählt werden. Es kann ein Raum innerhalb eines Gebäudes,<br />
ein Gebäude oder sogar ein ganzer Stadtteil sein. Voraussetzung ist nur, daß diese Region<br />
mittels geeigneter Strukturen beschrieben werden kann, wie z.B. mittels eines Polygons<br />
als Beschreibung für Flächen.<br />
<strong>Ein</strong> Benutzer, der Zugang zum System erhalten will, muß sich primär bei der zentralen<br />
Verwaltungseinheit des <strong>L2L</strong>-Netzwerkes (<strong>L2L</strong>-Server) authentifizieren. Nach der Authen-<br />
tifikation wird unter Berücksichtigung des aktuellen Aufenthaltsorts dem Benutzer eine<br />
passende <strong>L2L</strong>-Unit zugewiesen. Nach diesem Vorgang findet jegliche weitere Kommuni-<br />
kation zwischen den einzelnen <strong>L2L</strong>-Units <strong>und</strong> dem Benutzer direkt statt - beginnend mit<br />
der initial zugewiesenen <strong>L2L</strong>-Unit. Verläßt ein Benutzer den Scope einer <strong>L2L</strong>-Unit <strong>und</strong><br />
entfernt sich damit aus deren Zuständigkeitsbereich, so wird dieser automatisch an eine<br />
andere <strong>L2L</strong>-Unit ” übergeben“. Dieser Vorgang ist ähnlich einem ” Handover“ in Mobil-<br />
funknetzen <strong>und</strong> sollte eine permanente Netzverbindung ohne Unterbrechungen sichern. In<br />
Abbildung 4.2 ist dieses durch einen Bewegungspfeil zwischen zwei Benutzern bzw. zwi-<br />
schen <strong>L2L</strong>-Units symbolisiert.<br />
Der Zugriff eines Benutzers auf ortsbezogene Informationen innerhalb des Netzwerkes wird<br />
mittels einer Art ” Homepage des aktuellen Ortes“, einer Location-Page, realisiert. Hierbei
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 66<br />
Location<br />
Page<br />
<strong>L2L</strong> Unit<br />
<strong>L2L</strong> Unit<br />
change unit<br />
<strong>L2L</strong> Unit<br />
proceeds to<br />
Location<br />
Page<br />
<strong>L2L</strong> Unit<br />
Abbildung 4.2: <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> Umgebung<br />
ist die Form <strong>und</strong> der Inhalt einer Location-Page abhängig von einem aktuellen Benutzer-<br />
Kontext inklusive eines Aufenthaltsorts. <strong>Ein</strong>e dynamische Anpassung der Location-Page<br />
an veränderte Bedingungen wird mittels des vorhandenen Handover-Mechanismus möglich,<br />
so daß neue Informationen push-basiert an einen Benutzer gesendet werden können.<br />
Nachdem bis zu dieser Stelle der strukturelle Aufbau beschrieben wurde, gehen die nachfol-<br />
genden Abschnitte näher auf einzelne Komponenten <strong>und</strong> Konzepte ein, die es ermöglichen<br />
können, den hier beschriebenen Ablauf zu realisieren.<br />
4.2 Der <strong>L2L</strong>-Server<br />
Der <strong>L2L</strong>-Server stellt innerhalb des <strong>L2L</strong>-Netzwerkes einige der wichtigsten Funktionen zur<br />
Verfügung. Seine zentrale <strong>und</strong> gewichtigste Aufgabe besteht darin, ein räumliches Modell<br />
(Location Model) der im Netzwerk verfügbaren <strong>L2L</strong>-Units zu verwalten <strong>und</strong> mit dessen<br />
Hilfe Benutzer-Kontexte innerhalb des Systems zu bestimmen. Gerade in der Anfangs-<br />
phase einer Nutzung des <strong>L2L</strong>-Netzwerkes durch einen Client ist der <strong>L2L</strong>-Server zusätzlich<br />
für eine korrekte Authentifizierung zuständig. Diese Aufgaben sollen nachfolgend näher<br />
beschrieben werden:<br />
Authentifikation Für jede Art kommerziell betriebener Anwendungen ist ein Authen-<br />
tifikationsmechanismus erforderlich, der eine Zugangskontrolle realisiert, die es nur<br />
registrierten Benutzern ermöglicht, Leistungen innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zu be-<br />
ziehen.<br />
Die technische Realisierung dieses Mechanismus ist für die hier dargestellten Zu-<br />
sammenhänge jedoch nicht von besonderem Interesse, da bereits erprobte Zugangs-<br />
systeme für mobile Netze existieren <strong>und</strong> erfolgreich von Mobilfunknetz-Betreibern<br />
eingesetzt werden. <strong>Das</strong> derzeit verwendetete Verfahren für eine Authentifikation ba-<br />
siert in den meisten Fällen auf der SIM-Karte (Subscriber Identity Module) eines
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 67<br />
Mobiltelefons. Die Authentifikation wird hierbei mittels einer eindeutigen Identifika-<br />
tionsnummer, die auf der SIM-Karte hinterlegt ist, ermöglicht. Weitere Ausführun-<br />
gen zu Authentifikationsmechanismen <strong>und</strong> Sicherheit in mobilen Netzen lassen sich<br />
u.a. in [Jag03] finden.<br />
Kontext Bestimmung Die Bestimmung des Kontextes eines Clients innerhalb des <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>s ist eine der wesentlichen Anforderungen an den zu realisierenden ortsbe-<br />
zogenen Dienst. <strong>Ein</strong> Kontext kann hierbei jegliches Muster bestehend aus beliebigen<br />
Teilkomponenten sein, das mindestens Auskunft über die aktuelle Position eines Cli-<br />
ents liefert.<br />
Schlieder [SW02] führt in diesem Zusammenhang für die Interpretation räumlichen<br />
Verhaltens den Begriff des Motion-Pattern ein. <strong>Ein</strong> Motion-Pattern ist hierbei formal<br />
durch ein 5-Tupel aus temporären räumlichen Parametern eines Objektes bestimmt:<br />
( Position, Blickrichtung, Bewegungsrichtung, Distanz, Dauer )<br />
Position <strong>und</strong> Blickrichtung beschreiben das Ergebnis einer Bewegung, z.B. die ak-<br />
tuelle Position eines Benutzers <strong>und</strong> dessen momentane Blickrichtung. Die anderen<br />
Parameter beschreiben hingegen die Bewegung in sich <strong>und</strong> werden in Abhängigkeit<br />
einer vorangegangenen Bewegung gemessen. So berechnet sich beispielsweise die Di-<br />
stanz als Entfernung zwischen der aktuellen Position <strong>und</strong> der zuletzt bekannten.<br />
<strong>Ein</strong> Konzept wie das des Motion Pattern kann Kontexte, wie sie für ortsbezogene<br />
Dienste relevant sind, sehr mächtig beschreiben, da neben der eigentlichen Positi-<br />
on eines Clients zusätzliche Informationen über dessen ” räumliches Verhalten“ zur<br />
Verfügung stehen. Beispielsweise könnte ein Parameter Blickrichtung dazu verwen-<br />
det werden, solche Informationen einem Benutzer detaillierter zu präsentieren, die<br />
aktuell in dessen Blickwinkel liegen.<br />
<strong>Ein</strong>e technische Realisierung der Kontext-Bestimmung durch den <strong>L2L</strong>-Server auf Basis<br />
des Motion-Pattern Konzeptes wäre abhängig von einer Reihe externer Funktionalitäten,<br />
wie z.B. der Positionsbestimmung auf Basis unterschiedlicher Technologien<br />
(vgl. Abschnitt 2.2) oder aber der Messung von Bewegungsgeschwindigkeiten mittels<br />
Beschleunigungssensoren. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e scheint eine maximale Abstraktion<br />
von Konzepten zur Kontext-Beschreibung erforderlich, da nicht vorausgesetzt werden<br />
kann, daß jeder Client sämtliche Hardware-Voraussetzungen (z.B. GPS-Sensor)<br />
für die Ermittlung oben beschriebener Daten erfüllt.<br />
i n t e r f a c e UserContext {<br />
}<br />
MotionPattern g e t M o t i o n P a t t e r n F o r U s e r ( u n i q u e U s e r I d ) ;<br />
Listing 4.1: Interface zur Ermittlung eines Kontextes auf Basis des Motion-Pattern
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 68<br />
Durch eine Kapselung aller kontext-relevanten Messdaten innerhalb eines abstrak-<br />
ten Datentyps MotionPattern, wie in Listing 4.1 dargestellt, wäre ein einheitlicher<br />
Zugriff möglich. Hierbei sollte bei einer Umsetzung dieses Ansatzes eine besondere<br />
Beachtung den flexiblen Benutzungsmöglichkeiten zukommen. D.h. es sollte möglich<br />
sein, nur gewisse Komponenten eines Motion-Pattern auszulesen, um nicht nur ei-<br />
ne Differenzierung zwischen Basis- <strong>und</strong> Premium-Diensten, wie im <strong>Geschäftsmodell</strong><br />
thematisiert, bei Bedarf vorzunehmen, sondern auch auf unterschiedliche Client-<br />
Hardware reagieren zu können.<br />
Bzgl. der Differenzierung von Basis- <strong>und</strong> Premium-Diensten wäre ein Basis-Dienst<br />
denkbar, der nur aus einer einzelnen Komponente des Motion-Pattern besteht, wie<br />
z.B. der Komponente Position. Premium-Dienste würden dementsprechend auf meh-<br />
rere Komponenten eines Motion-Pattern zugreifen <strong>und</strong> diese mit in eine Auswertung<br />
einbeziehen.<br />
Location-Model Zu Beginn jeglicher Nutzung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s, egal ob durch Infor-<br />
mationsanbieter oder Clients, steht die Initiierung von Kommunikationsbeziehungen<br />
zwischen Netzwerk-Peers. <strong>L2L</strong>-Units, die als Informationsanbieter fungieren, müssen<br />
genau wie Clients in das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> integriert werden <strong>und</strong> benötigen einen ” Über-<br />
blick“ über andere Teilnehmer im Netzwerk, um nachfolgende Kommunikationsbe-<br />
ziehungen aufbauen zu können.<br />
Zentraler Bestandteil in diesem Prozeß ist das Konzept des Location-Models, das ein<br />
räumliches Abbild aller im System integrierten <strong>L2L</strong>-Units beschreibt. Mittels eines<br />
solchen Location-Models ist es möglich, Aussagen <strong>und</strong> Schlüsse über räumliche Be-<br />
ziehungen zwischen Objekten (<strong>L2L</strong>-Units) zu treffen, wie z.B. die Bestimmung von<br />
räumlichen Nachbarn einer <strong>L2L</strong>-Unit. Diese Informationen könnten beispielsweise<br />
innerhalb einer <strong>L2L</strong>-Unit Verwendung finden, um den im Abschnitt 4.1.2 angespro-<br />
chenen ” Handover“ von Clients zu realisieren.<br />
Für eine solche Integration einer <strong>L2L</strong>-Unit in ein bestehendes Location-Model sind<br />
verschiedene räumliche Informationen über eine <strong>L2L</strong>-Unit erforderlich, wie z.B. de-<br />
ren räumliche Position in Form eines Service Scopes. Auch für die Integration von<br />
Clients sind räumliche Informationen, wie die aktuelle Position, notwendig, um zu<br />
ermitteln, innerhalb welches Service Scope sich ein Client befindet.<br />
Abbildung 4.3 zeigt mittels eines groben UML-Sequenzdiagamms exemplarisch die<br />
Idee des Integrationsprozesses von <strong>L2L</strong>-Units in das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> <strong>und</strong> die damit<br />
verb<strong>und</strong>ene Veränderung des Location-Models.<br />
<strong>Ein</strong>e genauere Betrachtung dieses Ablaufes, insbesondere des Location-Models, fin-<br />
det sich in Abschnitt 4.5. An dieser Stelle bleibt nur festzuhalten, daß die Realisie-<br />
rung eines solchen Moduls eng mit anderen Modulen des <strong>L2L</strong>-Servers kooperieren<br />
müßte, um die gegebenen Anforderungen zur erfüllen.<br />
<strong>Das</strong> an dieser Stelle nicht thematisierte ” Abmelden von <strong>L2L</strong>-Units vom Netzwerk“,<br />
stellt in wesentlichen Zügen eine Umkehrung des dargestellten Integrationsprozesses
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 69<br />
Abbildung 4.3: Modul-Interaktion während des Integrationsprozesses<br />
dar <strong>und</strong> würde sich somit indirekt bei dessen Entwicklung ergeben.<br />
Mit Hilfe der vorgestellten Konzepte <strong>und</strong> ihrer Verwendung innerhalb des <strong>L2L</strong>-Servers<br />
scheint die Entwicklung eines Basis-Architekturmodells mit detaillierten Spezifikationen<br />
möglich. Vergleicht man beispielsweise die hier vorgestellten Ansätze mit den festgehal-<br />
tenen Anforderungen <strong>und</strong> Rahmenbedingungen an das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> aus Abschnitt 3.6,<br />
so läßt sich feststellen, daß die präsentierten Konzepte diese erfüllen könnten. Die Anfor-<br />
derungen A-I, A-II <strong>und</strong> A-III haben hierbei <strong>Ein</strong>fluß auf die Architektur des <strong>L2L</strong>-Servers.<br />
Anforderung A-I beeinflußt hierbei nur am Rande die Architektur des <strong>L2L</strong>-Servers, da sie<br />
lediglich aufgr<strong>und</strong> des geforderten hybriden Peer-2-Peer Netzwerkes eine zentrale Server-<br />
Instanz innerhalb des Netzwerkes fordert. Die Anforderungen A-II <strong>und</strong> A-III stehen hinge-<br />
gen im direkten Zusammenhang mit dem Modul ” Initiierung von Kommunikationsbezie-<br />
hungen“ <strong>und</strong> fordern die Existenz eines Modells, das die räumlichen Strukturen einzelner<br />
Peers abbildet, was durch das Location-Model abgedeckt wird, sowie die generelle Existenz<br />
dieses Moduls.<br />
4.3 Die <strong>L2L</strong>-Unit<br />
Nachdem bereits im vorangegangenen Abschnitt auf Architekturkonzepte des <strong>L2L</strong>-Servers<br />
<strong>und</strong> dessen Basis-Module eingegangen wurde, dient folgender Abschnitt dazu, selbiges für
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 70<br />
die <strong>L2L</strong>-Unit zu gewährleisten.<br />
Die <strong>L2L</strong>-Unit bildet sowohl für Informationsanbieter als auch für Benutzer des <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>s die entscheidende Komponente <strong>und</strong> integriert sich als Peer in das Peer-2-Peer<br />
Konzept des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s. <strong>L2L</strong>-Units bearbeiten Anfragen von Benutzern, stellen Er-<br />
gebnisse zur Verfügung <strong>und</strong> regeln zusätzlich den Austausch von Informationseinheiten<br />
zwischen unterschiedlichen <strong>L2L</strong>-Units.<br />
Bezogen auf die Basis-Anforderungen an das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> aus Abschnitt 3.6 <strong>und</strong> das ge-<br />
nerell gewählte Architekturkonzept für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> mit nur zwei Elementen muß die<br />
<strong>L2L</strong>-Unit dementsprechend mindestens die Anforderungen A-IV bis A-VI unterstützen,<br />
die sich zum einen mit einem Beschreibungsmodell der Informationen im System befassen<br />
<strong>und</strong> zum anderen einen Austauschmechanismus für Informationen fordern.<br />
User Query<br />
QPM<br />
<strong>L2L</strong> Unit<br />
annotated database<br />
RRM<br />
Result<br />
CEM<br />
Unit Communication<br />
Abbildung 4.4: Basis-Architektur der <strong>L2L</strong>-Unit<br />
Zur Realisierung dieser Anforderungen besteht das Basis-Konzept der <strong>L2L</strong>-Unit, wie in Ab-<br />
bildung 4.4 dargestellt, primär aus drei zentralen Komponenten: <strong>Ein</strong>e Komponente für den<br />
netzwerk-internen Austausch von Informationseinheiten zwischen einzelnen Units (CEM);<br />
eine weitere Komponente für die Bearbeitung von Benutzer-Anfragen <strong>und</strong> das Ausliefern<br />
von Ergebnissen (QPM) sowie eine Komponente für das Erzeugen einer Location-Page,<br />
die ortsbezogene Informationen in einer hypertextbasierten Art <strong>und</strong> Weise für Clients zur<br />
Verfügung stellt (RRM).<br />
Zur Erfüllung dieser Leistungen ist der Zugriff auf eine Datenbasis, die ortsbezogene In-<br />
formationseinheiten verwaltet, unumgänglich. Wie in Abbildung 4.4 bereits angedeutet,<br />
sind die vorhandenen ortsbezogenen Informationen in einer bestimmten Art <strong>und</strong> Weise mit<br />
Zusatzinformationen annotiert, so daß sie eine spezifische Semantik erhalten <strong>und</strong> durch<br />
ein System interpretiert <strong>und</strong> kategorisiert werden können. <strong>Ein</strong>e solche Form der Daten-<br />
basis ist somit eine unmittelbare Konsequenz aus Anforderung A-IV, die eine geeignete<br />
Beschreibungssprache für orts- bzw. kontextbezogene Informationen fordert.<br />
Im folgenden wird näher auf die einzelnen Module <strong>und</strong> deren Aufgaben eingegangen.
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 71<br />
4.3.1 Query Performing Modul (QPM)<br />
<strong>Das</strong> QPM bearbeitet Anfragen, die primär aus einem Kontext eines Clients bestehen.<br />
Basis für diesen Kontext kann das bereits eingeführte Konzept des Motion-Pattern sein.<br />
Zusätzlich zu diesen eher dynamischen Informationen sollte aber auch die Möglichkeit<br />
zur Erfassung von statischen Benutzerinformationen gegeben sein, bei denen ein Benutzer<br />
weitere Informationen in der Form eines Benutzer-Profils angeben kann. Dieses hat zur<br />
Folge, daß eine Anfrage an das QPM aus einem Tupel folgenden Aufbaus bestehen würde:<br />
(Motion-Pattern, User-Profil)<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s bzw. des Konzeptes des Service Scopes werden durch<br />
das QPM einer <strong>L2L</strong>-Unit nur solche Anfragen beantwortet, für die eine <strong>L2L</strong>-Unit innerhalb<br />
ihres Scopes aktuell zuständig ist. Basierend auf diesem Scope-Ansatz läßt sich auch ohne<br />
vorhandene benutzerspezifische Kontext-Informationen ein gewisser Kontext ermitteln,<br />
mit dessen Hilfe es möglich wäre, auch Clients mit ortsbezogenen Informationen zu bedienen,<br />
die einer detaillierten Aufzeichnung von Verhaltensinformationen mittels Motion-<br />
Pattern oder aber zusätzlicher Informationen durch ein Benutzer-Profil nicht zustimmen.<br />
In diesem Fall würde zwar die Qualität der präsentierten Informationen geringer sein, aber<br />
ein Ausschluß von Benutzern vermieden.<br />
i n t e r f a c e R e q u e s t I n t e r f a c e {<br />
}<br />
R e s u l t performRequest ( MotionPattern , U s e r P r o f i l ) ;<br />
R e s u l t performRequest ( ) ;<br />
Listing 4.2: Interface für Anfragen an das QPM<br />
Für die Realisierung eines Anfrage-Mechanismus würde dieses bedeuten, daß eine Anfra-<br />
ge auch dann gültig ist, wenn das gegebene Anfrage-Tupel leer ist <strong>und</strong> nur die Scope-<br />
Informationen genutzt werden können. Hierbei könnte dann allerdings nur sehr grob er-<br />
mittelt werden, wo sich ein Benutzer aufhält. Mittels dieser Erkenntnisse läßt sich eine<br />
Schnittstellenbeschreibung, wie in Listing 4.2 angedeutet, ableiten, die durch ein QPM zu<br />
erfüllen wäre.<br />
Für eine genaue Spezifikation eines solchen Anfrage-Mechanismus mit konkreten Aus-<br />
wertungsstrategien der einzelnen Komponenten eines Anfrage-Tupels läßt sich auf belie-<br />
big komplexe Verfahren zurückgreifen. Im wesentlichen sind diese nur abhängig von den<br />
Möglichkeiten eines zu definierenden Beschreibungssystems für ortsbezogene Informatio-<br />
nen des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s. Denkbar wären an dieser Stelle Verfahren aus dem Bereich der<br />
künstlichen Intelligenz mit Hilfsmitteln wie Ontologien oder kognitiven Suchtechnologien.<br />
Ausführungen hierzu sind z.B. in [Fen01] oder [Bel00] zu finden.
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 72<br />
4.3.2 Resultset Rendering Modul (RRM)<br />
<strong>Das</strong> Resultset Rendering Modul ist für die Aufbereitung der Ergebnisse des QPM zuständig.<br />
<strong>Das</strong> QPM Modul wird im allgemeinen eine Menge an relevanten Informationseinheiten,<br />
die zu einem aktuellen Kontext existieren, zur Verfügung stellen. Hierbei muß davon aus-<br />
gegangen werden, daß diese Ergebnismengen eine nicht zu unterschätzende Mächtigkeit<br />
aufweisen können, die es gilt weiter zu aggregieren. <strong>Ein</strong>e Aggregation ist insbesondere<br />
auch deshalb notwendig, da das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> ein System für mobile Umgebungen ist, die<br />
sich durch mobile <strong>und</strong> damit relativ kleine Geräte mit beispielsweise geringen Display-<br />
Größen auszeichnen. Demzufolge muß es durch das RPM gelingen, die Ergebnismenge<br />
soweit zusammenzufassen, daß sie auf den jeweiligen Endgeräten adäquat darstellbar ist.<br />
Um dieses Problem zu lösen, wäre es z.B. mittels Ontologien <strong>und</strong> entsprechend verfügba-<br />
rer Meta-Daten der Informationseinheiten denkbar, zu versuchen, einen möglichst ” kleinen<br />
gemeinsamen Nenner“ für mehrere Informationseinheiten zu finden, um sie so unter einem<br />
Oberbegriff zusammenfassen zu können. <strong>Ein</strong> einfaches Beispiel hierfür wäre eine Zusam-<br />
menfassung italienischer, spanischer <strong>und</strong> französischer Restaurants unter einem Oberbe-<br />
griff wie mediterrane Gastronomie.<br />
Da sich dieses Modul augenscheinlich im Kern mit der Problematik der geeigneten Präsen-<br />
tation von Informationen auf mobilen Endgeräten befaßt <strong>und</strong> dieser Bereich bereits um-<br />
fangreich in der Literatur diskutiert wird, soll eine Vertiefung des RPM an dieser Stelle<br />
nicht näher verfolgt werden.<br />
4.3.3 Content Exchange Module (CEM)<br />
<strong>Das</strong> Content Exchange Modul ist für den eigenständigen Austausch von Informationsein-<br />
heiten zwischen einzelnen <strong>L2L</strong>-Units verantwortlich. <strong>Ein</strong> Austausch von Informationsein-<br />
heiten mit anderen <strong>L2L</strong>-Units findet hierbei auf Basis räumlicher Beziehungen statt. Mit<br />
Hilfe des CEM soll gewährleistet werden, daß sämtliche Module innerhalb eines Architek-<br />
turmodells einer <strong>L2L</strong>-Unit, die auf der eigenen Datenbasis agieren, stets auf relevanten<br />
<strong>und</strong> aktuellen Daten agieren. Die zentrale Idee ist es, hierbei Verbindungen zu anderen<br />
<strong>L2L</strong>-Units innerhalb des Netzwerkes zum Zweck der Anfrage-Auswertung vollständig zu<br />
vermeiden <strong>und</strong> damit die Antwortzeiten innerhalb des Netzwerkes zu optimieren. Darüber<br />
hinaus kann dieses Modul mit seinem Mechanismus helfen, die bereits in Abschnitt 4.3.2<br />
kurz angesprochenen Probleme des RRM bzgl. einer Präsentation von Informationen zu<br />
lösen, wenn man davon ausgeht, daß ein CEM eine Vorselektion relevanter Informationen<br />
für eine Darstellung auf mobilen Endgeräten ermöglichen könnte.<br />
Auf dieses Modul wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel 6 dieser Arbeit detailliert<br />
eingegangen.<br />
4.4 <strong>Das</strong> Konzept der Service Scopes<br />
Dieser Abschnitt soll den bereits in Definition 6 eingeführten Begriff des Service Scopes<br />
<strong>und</strong> dessen Zusammenhang mit der Beantwortung von Anfragen durch einen Client näher
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 73<br />
verdeutlichen.<br />
<strong>Das</strong> für die <strong>L2L</strong>-Unit verwendbare Konzept der Service Scopes basiert auf dem Ansatz,<br />
Dienstleistungen von <strong>L2L</strong>-Units bzw. deren Verfügbarkeit mit einem physikalischen Raum<br />
zu assoziieren. D.h. jeder <strong>L2L</strong>-Unit wird eine geographische Region zugeordnet, für die sie<br />
zuständig ist <strong>und</strong> innerhalb derer sie für Clients Dienstleistungen anbietet.<br />
<strong>Ein</strong> so gewählter Ansatz würde es u.a. ermöglichen, daß eine exakte Positionsbestim-<br />
mung von Clients, unter der Bedingung ausreichend großer Service Scopes, nicht zwin-<br />
gend notwendig ist, da ein Aufenthalt innerhalb einer Region als ausschlaggebend für die<br />
Zuständigkeit einer <strong>L2L</strong>-Unit gewählt werden könnte.<br />
6<br />
1<br />
C<br />
3<br />
Abbildung 4.5: Scope-based Model<br />
Für die Auswahl der zuständigen <strong>L2L</strong>-Unit könnte an dieser Stelle das Scope-based Model<br />
verwendet werden. Hierbei werden die <strong>L2L</strong>-Units als zuständig für einen Client ausgewählt,<br />
innerhalb deren Scope sich dieser aufhält. Der Prozeß der Ermittlung der zuständigen <strong>L2L</strong>-<br />
Unit wäre in diesem Fall nur abhängig von der Position des Clients <strong>und</strong> des assoziierten<br />
Service Scopes der <strong>L2L</strong>-Units. <strong>Ein</strong>e Position der <strong>L2L</strong>-Unit selbst ist damit, anders als bei<br />
Verwendung eines entfernungsbasierten Modells, nicht relevant.<br />
<strong>Ein</strong> entfernungsbasiertes Modell würde hingegen die <strong>L2L</strong>-Unit mit kleinster Entfernung<br />
zwischen der Position des Clients <strong>und</strong> dem Standort einer <strong>L2L</strong>-Unit suchen. Detailliertere<br />
Ausführungen hierzu lassen sich in [Leo98] finden.<br />
Durch eine Verwendung des Scope-based Models anstelle eines Distance-based Models kann<br />
demnach eine größere Flexibilität <strong>und</strong> Erweiterbarkeit gewährleistet werden bei der <strong>L2L</strong>-<br />
Units nicht zwingend am Ort ihrer physikalischen Zuständigkeit vorhanden sein müssen.<br />
Abbildung 4.5 veranschaulicht den beschriebenen Bestimungsprozeß mittels des Scope-<br />
based Models. Für einen Client C am gegebenen Ort würden die <strong>L2L</strong>-Units gef<strong>und</strong>en<br />
werden, deren Service-Scopes durch die verstärkt dargestellten Linien markiert sind (1,2,3<br />
<strong>und</strong> 4). Nur diese enthalten die Position des Clients vollständig.<br />
Um einem Client die Möglichkeit geben zu können, direkt die Ergebnisse einer Location-<br />
Page auf Basis seiner eigenen Wünsche (vgl. User-Profil in Abs. 4.3.1) zu beeinflussen,<br />
4<br />
2<br />
5<br />
7
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 74<br />
wäre eine kleine Variation des vorgestellten Scope-based Models notwendig. Hier müßte,<br />
anstelle die aktuelle Position, im Idealfall gegeben durch eine einzelne Koordinate, für die<br />
Auswertung zu nutzen, ein Client in die Lage versetzt werden können, einen gewissen Be-<br />
reich um seine eigentliche Position zu definieren. Diese Art der Skalierung einer Position<br />
auf eine Fläche um die eigentliche Position würde dann das Ergebnis des Bestimmungspro-<br />
zesses der zuständigen <strong>L2L</strong>-Units dahingehend verändern, daß nur noch solche <strong>L2L</strong>-Units<br />
ausgewählt werden, innerhalb deren Service Scope sowohl die aktuelle Position als auch<br />
die durch den Client skalierte Fläche liegen [Jos01]. Abbildung 4.6 veranschaulicht diese<br />
Erweiterung des Scope-based Models <strong>und</strong> liefert als Ergebnis nur noch die <strong>L2L</strong>-Units mit<br />
dem Service-Scope 1 <strong>und</strong> 2.<br />
6<br />
1<br />
C<br />
3<br />
Abbildung 4.6: Erweitertes Scope-based Model mit Skalierung<br />
Mittels dieser Erweiterung wäre es nun möglich, die mittels der Location-Page dargestell-<br />
ten Informationen für einen Client nach seinen individuellen Bedürfnissen zu gestalten.<br />
Versucht man, die durch einen Client vorzunehmende Skalierung semantisch zu deuten, so<br />
könnte man z.B. annehmen, daß je größer der Skalierungsfaktor ist desto größer ist auch<br />
der mögliche Aktionsradius bzw. die Mobilität des Benutzers. <strong>Ein</strong> einfaches Beispiel hierfür<br />
wären z.B. zwei Personen, die sich innerhalb des in Abschnitt 3.9 dargestellten Szenarios<br />
auf derselben Straße befinden, sich aber dadurch unterscheiden, daß eine Person mit ei-<br />
nem Auto unterwegs ist <strong>und</strong> die andere zu Fuß. Beide Personen nutzen das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>,<br />
sind aber an unterschiedlichen Reichweiten der dargebotenen Informationen interessiert.<br />
Während der Fußgänger eher detailliertere Informationen bevorzugen wird, die in seiner<br />
unmittelbaren, zu Fuß erreichbaren Nähe liegen, ist der Autofahrer an Informationen in-<br />
teressiert, die eine größere Fläche abdecken, aber weniger detailliert auf Gr<strong>und</strong> seiner<br />
Fortbewegungsgeschwindigkeit sind. Dementsprechend würde der Skalierungsfaktor des<br />
Autofahrers viel größer gewählt werden müssen als der des Fußgängers, um die gewünsch-<br />
ten Informationen zu erhalten.<br />
Wie das beschriebene Szenario bereits andeutet, stellt die richtige Wahl eines geeigne-<br />
ten Skalierungsfaktors für eine Realisierung eines der Hauptprobleme dar. Wünschenswert<br />
4<br />
2<br />
5<br />
7
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 75<br />
wäre im Idealfall eine automatisierte Bestimmung des Skalierungsfaktors auf Basis eines<br />
aktuellen Benutzerverhaltens. Bei einer Orientierung an der Bewegungsgeschwindigkeit<br />
eines Benutzers zur Bestimmung des Faktors, wie im Szenario dargestellt, wären bei-<br />
spielsweise technische Komponenten, wie ein Beschleunigungssensor, für eine Realisierung<br />
notwendig.<br />
4.5 <strong>Das</strong> Konzept des Location Models<br />
Service Scopes, wie bereits zuvor diskutiert, bilden einen Basis-Mechanismus innerhalb<br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s <strong>und</strong> ermöglichen die Assoziation von Dienstleistungen einer <strong>L2L</strong>-Unit<br />
mit einem physikalischen Raum.<br />
Dieser Abschnitt beschreibt einen auf den Service Scopes aufbauenden Ansatz zur Be-<br />
schreibung räumlich arrangierter Objekte. Solche Ansätze werden in der Literatur oft<br />
unter dem Begriff des Location Models beschrieben. Gerade im Bereich der ortsbezogenen<br />
Dienste stellen Location Models ein zentrales Konzept bei der Realisierung dar. Aufgr<strong>und</strong><br />
der Vielzahl unterschiedlicher Modelle, die sich zum Teil stark in ihrer Art <strong>und</strong> Weise<br />
wie Informationen repräsentiert werden unterscheiden, schlägt Leonhardt in [Leo98] eine<br />
generelle Klassifikation aller Modelle in zwei Gruppen vor:<br />
• Symbolische Modelle<br />
• Geometrische Modelle<br />
Symbolische Modelle basieren hierbei auf einer Beschreibung von Regionen <strong>und</strong> Ob-<br />
jekten durch abstrakte Symbole, z.B. Namen wie ” Raum 5210“ oder ” Hauptbahnhof<br />
Bremen“. Aufgr<strong>und</strong> der Repräsentation von Regionen <strong>und</strong> Objekten durch Namen<br />
werden Regionen normalerweise als Mengen <strong>und</strong> Objekte als Elemente von Mengen<br />
modelliert [Leo98]. Als unmittelbare Konsequenz aus diesem Ansatz ergibt sich, daß<br />
ein Objekt Element einer Region ist wann immer es physikalisch innerhalb der Re-<br />
gion liegt.<br />
Die primären Vorteile dieses Ansatzes liegen in dem einfach zu erreichenden Zugriff<br />
auf ortsbezogene Informationen, sofern auf den relevanten Ort über einen Namen zu-<br />
gegriffen werden kann. Nachteilig hingegen ist, daß die Menge der zu verwaltenden<br />
Symbole innerhalb des Modells je nach Anwendungsdomäne sehr groß sein kann. Im<br />
allgemeinen werden zusätzlich die Regionen <strong>und</strong> deren Symbole manuell konstruiert<br />
<strong>und</strong> verwaltet.<br />
Geometrische Modelle verfolgen hingegen ein anderes Konzept <strong>und</strong> bauen auf ein oder<br />
mehrere Referenz-Koordinatensysteme auf. Regionen werden typischerweise durch<br />
Mengen von Koordinaten beschrieben. Im Gegensatz zu den symbolischen Modellen<br />
gibt es keine ableitbaren Zusammenhänge zwischen Regionen <strong>und</strong> Objekten, da alles<br />
nur mittels Koordinaten beschrieben wird [Leo98]. Aus diesem Gr<strong>und</strong> sind geometri-<br />
sche Modelle schwieriger anzuwenden als symbolische Modelle, bieten aber potentiell<br />
mehr Leistungsfähigkeit.
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 76<br />
Vorteile dieser Modelle sind u.a. die Flexibilität <strong>und</strong> Genauigkeit bei der Auswertung<br />
koordinatenbasierter räumlicher Anfragen. Nachteilig ist hingegen z.B. die Notwen-<br />
digkeit der Übersetzung jeglicher akquirierter Informationen, wie sie beispielsweise<br />
von Sensoren geliefert werden, in das Referenz-Koordinatensystem.<br />
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß beide Ansätze ihre Vor- <strong>und</strong> Nachteile besitzen<br />
<strong>und</strong> eine Entscheidung für oder gegen ein Modell im wesentlichen von der Beschaffenheit<br />
des zu konzipierenden Systems abhängt. In einigen Fällen, insbesondere dann, wenn es sich<br />
um ein geschlossenes System mit festen Anforderungen handelt, kann die Entscheidung für<br />
ein einzelnes Modell sinnvoll sein. Im allgemeinen liegt die beste Lösung für ein Problem<br />
allerdings meistens in der Mitte eines Spektrums, so daß eine Kombination beider Ansätze<br />
notwendig ist. Nach Leonhards Auffassung in [Leo98] brauchen insbesondere ortsbezogene<br />
Dienste mit einem globaleren Fokus beide Formen der Modelle.<br />
4.6 <strong>Ein</strong> Location Model für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong><br />
Die vorangegangenen Ausführungen haben bis hierhin das Spektrum an möglichen Model-<br />
len für die Entwicklung eines eigenen Location Models für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> aufgezeigt.<br />
<strong>Ein</strong> spezielles Modell für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> sollte demnach aus einer Kombination von<br />
symbolischen- <strong>und</strong> geometrischen Modellen bestehen. Diese Empfehlung von Leonhardt<br />
scheint unter Betrachtung der Anforderungen an das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> mehr als sinnvoll.<br />
<strong>Ein</strong>e symbolische Variante ermöglicht es z.B. Benutzern des Systems, auf eine bekannte<br />
<strong>und</strong> ihnen vertraute Weise mittels Namen Objekte oder Regionen zu referenzieren oder zu<br />
beschreiben. Hingegen bietet eine geometrische Variante dem System selbst eine mächtige<br />
<strong>und</strong> präzise Möglichkeit, auf einer für einen Menschen wenig verständlichen Ebene Be-<br />
rechnungen <strong>und</strong> Schlußfolgerungen aus Objektkonstellationen oder Sensordaten zu ziehen<br />
<strong>und</strong> diese auszuwerten.<br />
B<br />
>Street<<br />
A<br />
>Outskirt<<br />
D<br />
>Building<<br />
A*<br />
C<br />
>Street<<br />
E<br />
>Museum<<br />
D* E*<br />
B* C*<br />
Abbildung 4.7: Location-Model des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
Symbolic<br />
Geometric
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 77<br />
<strong>Ein</strong> kombiniertes Modell könnte für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> mittels einer symbolischen Abstrak-<br />
tion der vorhandenen geometrisch orientierten Service Scopes konstruiert werden. Hierbei<br />
ist es notwendig, daß jedem Symbol mindestens einen vorhandenen Service Scope im Sy-<br />
stem <strong>und</strong> indirekt seine damit verb<strong>und</strong>ene <strong>L2L</strong>-Unit referenziert. Abbildung 4.7 zeigt eine<br />
so geartete Struktur exemplarisch. Die neu erzeugten Symbole stellen für einen Service Sco-<br />
pe eine Art Ortskontext dar, in dem sich ein Benutzer oder Objekt immer dann befindet,<br />
wenn er sich physikalisch innerhalb eines Service Scopes aufhält. Mittels der geometrischen<br />
<strong>und</strong> damit koordinatenbasierten Service Scopes lassen sich darüber hinaus räumliche Be-<br />
ziehungen zwischen Symbolen berechnen. Nähere Ausführungen hierzu sind Bestandteil<br />
des nachfolgenden Kapitels 5. Die berechneten Beziehungen können wiederum ebenfalls<br />
auf eine symbolische Ebene, wie z.B. durch benachbart-mit etc. abstrahiert werden, so daß<br />
es möglich ist, eine komplette symbolische Darstellung des geometrischen Modells basie-<br />
rend auf Service Scopes zu generieren.<br />
In den folgenden Ausführungen wird anstelle des Begriffs Ortskontext der Name Location<br />
Context verwendet, da dieser häufig in der Literatur zu finden ist. Unter einem Location<br />
Context soll ein Objekt verstanden werden, das mehrere Teilkomponenten kapseln kann:<br />
Definition 7 (Location Context) <strong>Ein</strong> Location Context ist ein Objekt, das durch ein<br />
eindeutiges Symbol beschrieben ist <strong>und</strong> einen geometrischen Service Scope einer <strong>L2L</strong>-Unit<br />
referenziert.<br />
4.6.1 Relation zwischen Location Contexten<br />
Relationen <strong>und</strong> insbesondere räumliche Relationen spielen innerhalb des hier präsentierten<br />
Ansatzes eines Location Models für <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> eine zentrale Rolle, da sie entscheidend<br />
dazu beitragen, die für einen ortsbezogenen Dienst notwendigen realen räumlichen Kon-<br />
stellationen zu modellieren.<br />
Wie bereits in Abbildung 4.7 angedeutet, werden räumliche Relationen zwischen unter-<br />
schiedlichen Location Contexts durch binäre Verbindungen dargestellt. Mit Hilfe dieser<br />
Relationen könnte u.a. ein Prozeß zur Findung der optimalen zuständigen <strong>L2L</strong>-Unit für<br />
eine Client-Anfrage ermöglicht werden. Optimal in diesem Sinne wäre eine Ermittlung der<br />
<strong>L2L</strong>-Unit, deren Service Scope am kleinsten ist <strong>und</strong> die Position eines Clients dennoch<br />
enthält.<br />
Die Ausführungen über die Service Scopes in Abschnitt 4.4 haben es bislang nur ermöglicht,<br />
relativ grob zuständige <strong>L2L</strong>-Units zu finden. <strong>Ein</strong>e Optimierung dieses Ansatzes mit Hilfe<br />
von Relationen zwischen Location Contexts, die indirekt auch die Relationen zwischen Ser-<br />
vice Scopes beschreiben, ist denkbar, bei der die kleinste <strong>L2L</strong>-Unit durch Auswertung einer<br />
Inklusionsrelation der Art part-of vorgenommen wird. Abbildung 4.8 zeigt ein Location<br />
Model mit existierenden Inklusionsbeziehungen zwischen einzelnen Location Contexts.<br />
In der durch Abbildung 4.8 gegebenen Konstellation von <strong>L2L</strong>-Units ließe sich nun bei-<br />
spielsweise <strong>L2L</strong>-Unit D für einen Client in Scope D ∗ ermitteln: <strong>Das</strong> Scope-based Model<br />
würde die Scopes A ∗ , B ∗ , C ∗ <strong>und</strong> D ∗ liefern, da diese alle vollständig einen Client in D ∗<br />
enthalten würden. Mit Hilfe der Inklusion läßt sich nun aber zusätzlich feststellen, daß D ∗
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 78<br />
A<br />
B C<br />
part-of<br />
part-of<br />
part-of<br />
D<br />
D*<br />
B* C*<br />
A*<br />
part-of<br />
part-of<br />
Location Context<br />
Service Scope<br />
Abbildung 4.8: Inklusionsbeziehungen innerhalb des Location Models<br />
die optimale <strong>L2L</strong>-Unit ist, da D ∗ Teil von allen anderen Scopes ist.<br />
An dieser Stelle gilt es aber zu bemerken, daß dieser Mechanismus noch nicht alle mögli-<br />
chen räumlichen Konstellationen <strong>und</strong> eine damit verb<strong>und</strong>ene eindeutige Bestimmung einer<br />
optimalen <strong>L2L</strong>-Unit zuläßt. Probleme entstehen z.B. bei identisch großen Service Scopes,<br />
wie es bei B ∗ <strong>und</strong> C ∗ der Fall ist. Sollte z.B. D ∗ einmal nicht existieren, so besteht die<br />
Wahl zwischen B ∗ <strong>und</strong> C ∗ als optimale <strong>L2L</strong>-Unit für eine Client-Anfrage. An dieser Stelle<br />
müßten weitere Überlegungen ansetzen, um dieses Konzept auf beliebige räumliche Kon-<br />
stellationen zu erweitern.<br />
Neben der Optimierung des Prozesses zur Wahl der optimalen <strong>L2L</strong>-Unit für eine Client-<br />
Anfrage lassen sich räumliche Relationen ebenfalls dazu verwenden, einen Informationsaus-<br />
tausch zwischen <strong>L2L</strong>-Units zum Zwecke der Abwicklung von Client-Anfragen zu ermögli-<br />
chen. <strong>Ein</strong>e genauere Untersuchung dieser Möglichkeiten des Informationsaustausches auf<br />
Basis räumlicher Beziehungen wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel 6 durchgeführt.<br />
4.6.2 Zusammenfassung<br />
<strong>Das</strong> Konzept des Location Models für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> wurde, basierend auf einer gr<strong>und</strong>-<br />
legenden Idee <strong>und</strong> generellen Klassifizierung zur Bestimmung zentraler Eigenschaften von<br />
Location Models, als eine Kombination aus symbolischen- <strong>und</strong> geometrischen Modellen<br />
eingeführt. Es abstrahierte bzw. referenzierte geometrische Service Scopes mittels symbo-<br />
lischer Elemente - den Location Contexts. Diese Kombination ermöglicht einerseits präzi-<br />
ses Rechnen mittels Koordinaten auf der geometrischen Ebene, wie es durch Maschinen<br />
möglich ist, <strong>und</strong> andererseits den intuitiven Umgang mit Symbolen in Form von Namen<br />
mit eindeutigem Inhalt für Menschen.<br />
Wichtiger Bestandteil des Modells waren Relationen zwischen Location-Contexts. Sie<br />
dienten u.a. als Hilfsmittel zur Optimierung des Findungsprozesses einer zuständigen <strong>L2L</strong>-<br />
Unit für eine Client-Anfrage auf Basis des Scope-based Models <strong>und</strong> sind zusätzlich notwen-
KAPITEL 4. ARCHITEKTURKONZEPTE FÜR DAS <strong>L2L</strong>-NETWORK 79<br />
dig, um Client-Anfragen in Kooperation mit anderen <strong>L2L</strong>-Units bearbeiten <strong>und</strong> auswerten<br />
zu können.<br />
Nachdem in diesem Kapitel mögliche Architekturkonzepte für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> vorgestellt<br />
<strong>und</strong> in die Struktur eines Location Models <strong>und</strong> dessen Verwendung eingeführt wurde, soll<br />
im nachfolgenden Kapitel genauer auf die Möglichkeiten des präzisen Rechnens, die durch<br />
eine geometrische Ebene innerhalb des vorgestellten Location Models zur Verfügung ge-<br />
stellt werden, eingegangen werden. Zu diesem Zweck wird nachfolgend in das Gebiet des<br />
räumlichen Schließens eingeführt, um aufzuzeigen, wie es mit Hilfe eines formalen Kalküls<br />
möglich ist, Schlußfolgerungen aus den Informationen, die in einem Location Model ko-<br />
diert sind, abzuleiten. Zentrales Verbindungsglied zwischen dem <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> <strong>und</strong> dem<br />
im nachfolgenden Kapitel vorgestellten Kalkül sind die Service Scopes aus der geometri-<br />
schen Ebene des bereits vorgestellten Location Models. Diese werden allerdings in den<br />
nachfolgenden Ausführungen in Kapitel 5 auf eine universelle Ebene durch den Begriff<br />
der Regionen in Form von Polygonen abstrahiert <strong>und</strong> sind infolgedessen nicht explizit als<br />
Service Scopes im Sinne des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s gekennzeichnet.
Kapitel 5<br />
Räumliches Schließen<br />
Geo-referenzierte Informationen werden immer häufiger in Anwendungen benutzt, die sich<br />
an gewisse räumliche Verhältnisse anpassen, wie z.B. im Bereich der ortsbezogenen Dien-<br />
ste. <strong>Ein</strong>e Abstraktion bzw. Abbildung von realen räumlichen Strukturen in maschinenin-<br />
terpretierbare Formen ist somit eine unmittelbare Notwendigkeit, wenn diese in Informa-<br />
tionssysteme integriert werden sollen.<br />
Die präsentierten Ansätze in diesem Kapitel beschäftigen sich nicht nur allein mit geeig-<br />
neten Modellierungen von räumlichen Strukturen, sondern stellen zusätzlich eine Reihe<br />
von Mechanismen zur Verfügung, die es ermöglichen, Schlußfolgerungen aus gegebenen<br />
räumlichen Informationen zu ziehen.<br />
Dieses Kapitel dient dazu, einen Ansatz zur Modellierung von räumlichen Konfiguratio-<br />
nen vorzustellen, der Verwendung bei einem System wie dem <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> mit einem<br />
Konzept der Service Scopes auf einer geometrischen Ebene innerhalb des dazugehörigen<br />
Location Models finden könnte. Hierzu wird ein graphbasierter qualitativer Ansatz zur<br />
diskreten Approximation von Regionen (Service Scopes) detailliert diskutiert, da er Basis<br />
für noch folgende Ausführungen in Kapitel 6 ist. Innerhalb dieses Modells wird der Begriff<br />
der räumlichen Relevanz ebenso eingeführt wie eine Formalisierung des Modells auf Basis<br />
eines metrischen Systems. Da das Modell selbst zum Teil auf ein Kalkül zur Beschreibung<br />
von Objektüberlagerungen zurückgreift, wird dieser Kalkül am Anfang des Kapitels kurz<br />
vorgestellt.<br />
5.1 Region Connection Calculus<br />
Der Region Connection Calculus (RCC) ist ein topologischer Ansatz mit dessen Hilfe<br />
Relationen zwischen zwei Regionen in Bezug auf ihre Überlappung definiert <strong>und</strong> Schluß-<br />
folgerungen aus diesen gezogen werden können. Der RCC Kalkül wurde 1992 von Randell<br />
at al. [RCC92] eingeführt <strong>und</strong> beachtet die absolut existierende Distanz zwischen Regionen<br />
genau so wenig wie die Orientierung von Regionen zueinander. Er dient also im Kern dazu<br />
zu beschreiben, in welcher Art <strong>und</strong> Weise sich Regionen überlappen oder nicht.<br />
In der Praxis lassen sich zwei unterschiedliche Varianten des RCC finden, die sich in der<br />
Anzahl der zur Beschreibung von Überlappungen verfügbaren Relationen unterscheiden.<br />
80
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 81<br />
Diese sollen nachfolgend kurz vorgestellt werden.<br />
5.1.1 RCC5<br />
Die erste Variante wird als RCC5 bezeichnet <strong>und</strong> stellt 5 Basisrelationen für die Beschrei-<br />
bung der Beziehungen zwischen zwei Regionen zur Verfügung: disjoined, partial-overlapped,<br />
proper-part, inverse-proper-part <strong>und</strong> equal.<br />
Relation Symbol Inverse<br />
X disjoint Y DC DC<br />
X partial-overlapped Y PO PO<br />
X proper-part Y PP PP i<br />
X equal Y EQ EQ<br />
Tabelle 5.1: Basisrelationen des RCC5<br />
Mit Hilfe dieser fünf Relationen lassen sich nun die Beziehungen zwischen zwei Regionen<br />
X <strong>und</strong> Y , wie in Abbildung 5.1 dargestellt, beschreiben. Jede Relation des RCC5 läßt sich<br />
hierbei eindeutig durch die Angabe eines boolschen Tripels ermitteln [Bit01]:<br />
(X ∧ Y =⊥, X ∧ Y = X, X ∧ Y = Y ), ⊥ sei die leere Menge (5.1)<br />
Die für die Bestimmung der vorliegenden Relation notwendigen boolschen Werte sind in<br />
nachfolgender Tabelle aufgeführt.<br />
X ∧ Y =⊥ X ∧ Y = X X ∧ Y = Y RCC5<br />
F F F DC<br />
T F F PO<br />
T T F PP<br />
T F T PP i<br />
T T T EQ<br />
Tabelle 5.2: Werte-Tabelle der RCC5-Relationen. T=True, F=False<br />
Mit den bis hierher dargestellten Relationen lassen sich die Beziehungen zwischen zwei<br />
Regionen formal beschreiben. Für das Schließen von neuen Informationen auf Basis einer<br />
vorliegenden Anordnung von Regionen wird auf das Hilfsmittel der Komposition zurück-<br />
gegriffen. <strong>Ein</strong>e Darstellung der Ergebnisse kann in [Bit01] gef<strong>und</strong>en werden <strong>und</strong> soll an<br />
dieser Stelle nicht näher erläutert werden.<br />
Die Darstellung der fünf möglichen Konstellationen von zwei Regionen zueinander ist in<br />
Abbildung 5.1 dargestellt. Darüber hinaus gibt die Abbildung an, welche Relationen ” be-<br />
nachbart“ zueinander sind, d.h. über welche Schritte es möglich ist, von einer Konstellation<br />
über die Zeit gesehen zu einer anderen zu gelangen.<br />
5.1.2 RCC8<br />
Der RCC8 Kalkül stellt eine Erweiterung des RCC5 um weitere drei Relationen dar <strong>und</strong><br />
erweitert diesen in Bezug auf die Begenzungsunabhängigkeit. D.h. es werden auch topo-
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 82<br />
Y<br />
X<br />
X{PP}Y<br />
i<br />
X{DC}Y X{PO}Y X{PP}Y<br />
Abbildung 5.1: Definition der RCC5-Relationen<br />
X{EQ}Y<br />
logische Beziehungen innerhalb <strong>und</strong> an den Grenzen von Regionen gesondert betrachtet.<br />
Beim RCC5 wurde beispielsweise nicht unterschieden, ob zwei Regionen wirklich überlap-<br />
pen oder sich nur an ihren Grenzen berühren.<br />
Y<br />
X<br />
X{TPP}Y<br />
X{NTPP}Y<br />
i<br />
i<br />
X{DC}Y X{EC}Y X{PO}Y X{TPP}Y X{NTPP}Y<br />
Abbildung 5.2: Definition der RCC8-Relationen<br />
X{EQ}Y<br />
Für diese Situation bietet der RCC8 hingegen eine Beschreibung mittels der neuen Rela-<br />
tion externally-connected (EC) an, die Verwendung findet, wenn sich zwei Regionen nur<br />
in ihren Grenzen berühren, sich aber nicht überschneiden. Des weiteren wurde die Re-<br />
lation proper-part in zwei neue Relationen aufgeteilt, tangency-proper-part (TPP) <strong>und</strong><br />
non-tangency-proper-part(NTPP). Für das Inverse von proper-part gilt dieses in gleicher<br />
Form. Diese vier Relationen dienen dazu, das Innere von Regionen näher zu beschreiben.<br />
Abbildung 5.2 veranschaulicht die Definition der acht Relationen des RCC8 graphisch.<br />
Für das Schließen neuer Informationen wird auch hier die Komposition eingesetzt. <strong>Ein</strong>e<br />
detaillierte Betrachtung der Ergebnisse dieser Komposition kann z.B. in [Bit01] gef<strong>und</strong>en<br />
werden. <strong>Ein</strong>e detaillierte <strong>Ein</strong>führung in den RCC ist in [CBJG97] zu finden.<br />
Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich näher mit einem anderen Ansatz zur Re-<br />
präsentation von Regionen <strong>und</strong> dem Schließen neuer Informationen auf Basis eines quali-<br />
tativen Ansatzes, baut aber auf den Erkenntnissen <strong>und</strong> Relationen des RCC Kalküls auf,<br />
so daß dieser Abschnitt über den RCC als Gr<strong>und</strong>lage für weitere Ausführungen zu sehen<br />
ist <strong>und</strong> nicht den Anspruch der vollständigen oder detaillierten Beschreibung hat.
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 83<br />
5.2 Schließen über räumliche Relevanz<br />
<strong>Ein</strong> wichtiger Ansatz beim räumlichen Schließen ist das Schließen über räumliche Rele-<br />
vanzen. Vögele beschreibt hierfür in [VS01] einen qualitativen Ansatz auf Basis diskreter<br />
Aporoximantionen von Regionen. Die Kern-Komponenten seines Referenz-Modells sind<br />
hierbei eine qualitative graph-basierte Abstraktion von Regionen mit Hilfe von Polygon-<br />
Standard-Referenz-Tessilierungen (pSRT) <strong>und</strong> deren hierarchischer Dekomposition. <strong>Das</strong><br />
eigentliche Schließen über räumliche Relevanzen basiert hierbei auf einem metrischen Ver-<br />
fahren, das vertikale <strong>und</strong> horizontale Entfernungen zwischen Objekten im Raum bestimmt,<br />
um so ein Maß für die räumliche Relevanz zu ermitteln.<br />
5.2.1 Beschreibung räumlicher Anordnungen<br />
Im allgemeinen werden in Geographischen-Informations-Systemen (GIS) Polygone häufig<br />
dazu verwendet, um geographische Objekte oder Regionen im 2-dimensionalen Raum (2D)<br />
zu beschreiben. In der Regel wird hierbei ein Polygon durch eine endliche Menge von<br />
Kanten beschrieben.<br />
Abbildung 5.3: Dekompositions-Hierarchie einer Polygon-Tessilierung<br />
Im 2D-Raum lassen sich Polygone auf unterschiedlichste Weise anordnen. Nimmt man<br />
eine Menge von Polygonen P1, ..., Pn die alle von einem Polygon P umschlossen werden,<br />
so lassen sich zwei unterschiedliche Arten von Anordnungen innerhalb des umschließenden<br />
Polygons P identifizieren [SVV01]:<br />
1. Polygonal Covering, P = P1 ∪ ... ∪ Pn<br />
Alle Polygone überdecken das Polygon P bzw. dessen Fläche. Im allgemeinen werden<br />
sich die Polygone sogar überlagern.<br />
2. Polygonal Patchwork Interior, ∀ i = j; i, j ∈ {1, .., n} : Pi ∩ Pj = ∅<br />
Alle Polygone sind entweder disjunkt voneinander oder aber schneiden sich nur in<br />
ihren Kanten <strong>und</strong>/oder Eckpunkten, so daß an keiner Stelle Überlappungen existie-<br />
ren.<br />
Auf Basis dieser beiden genannten Typen läßt sich nun eine weitere spezielle aber dennoch<br />
typische Anordnung von Polygonen definieren, die Polygon-Tessilierung (engl. polygonal
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 84<br />
tessilation). Sie kann als Mischform aus einem Polygon Covering, das zugleich ein Polygonal<br />
Patchwork ist, beschrieben werden [VS01]. D.h. die Polygone P1, ..., Pn überschneiden sich<br />
nie <strong>und</strong> ihre Vereinigung bildet das all-umschließende Polygon P . <strong>Ein</strong> Beispiel für eine<br />
homogene Polygon-Tessilierung wäre eine Zerlegung des Polygons P in ein Raster aus<br />
gleichen Rasterelementen, wie in Abbildung 5.4 dargestellt.<br />
Abbildung 5.4: Homogene Polygon-Tessilierung in Form eines Rasters<br />
Existiert einer dieser drei beschriebenen Typen von Polygon-Anordnungen im 2D-Raum,<br />
so läßt sich hieraus durch Dekomposition eine hierarchische Datenstruktur ableiten, welche<br />
die räumlichen, partonomischen Beziehungen zwischen Polygonen in Form einer Part-of<br />
bzw. Teil-von Relation beschreibt [SVV01]. Abbildung 5.5 veranschaulicht hierbei die hier-<br />
archische Datenstruktur in Form eines Dekompositionsbaumes, der aus einer Tessilierung<br />
von Polygonen, wie in Abbildung 5.3 dargestellt, generiert werden kann. Hierbei können<br />
die einzelnen Ebenen des Baums als eine Art level-of-detail interpretiert werden [VS01].<br />
Abbildung 5.5: Dekompositions-Baum<br />
Mit Hilfe eines solchen Dekompositions-Baumes lassen sich nun Informationen über räum-<br />
liche Beziehungen von Objekten bzw. deren Lage zueinander extrahieren. Beispielsweise<br />
ist es möglich festzustellen, daß die Region AC von der Region A umschlossen ist <strong>und</strong><br />
neben ihr noch zwei weitere Regionen existieren.<br />
Diese sogenannten vertikalen räumlichen Informationen über Objekte fließen zu einem<br />
späteren Zeitpunkt in die Ermittlung der räumlichen Relevanz von Objekten, die in Ab-<br />
schnitt 5.2.2 thematisiert wird, ein.
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 85<br />
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich näher mit der Art <strong>und</strong> Weise, wie Polygone quali-<br />
tativ abstrahiert werden können <strong>und</strong> welche Hürden dabei zu überwinden sind.<br />
Qualitative Abstraktion von Regionen<br />
Vögeles Ansatz bei der qualitativen Abstraktion von Regionen ist es, eine gewisse, real<br />
existente Region, die im allgemeinen durch ein GIS Koordinaten-Polygon beschrieben wird,<br />
mittels einer Polygon-Standard-Referenz-Tessilierung (pSRT) virtuell zu überlagern, um<br />
so das GIS Koordinaten-Polygon qualitativ zu abstrahieren. Dieses erreicht Vögele durch<br />
eine Abbildung µ, die eine reale Region P in der Form auf eine Menge von Rasterelementen<br />
ri einer pSRT der Form R = r1∪r2∪...∪rn abbildet, so daß alle Rasterelemente ri der pSRT<br />
zur qualitativen Beschreibungsmenge der realen Region gehören, die sich mit dem realen<br />
GIS Koordinaten-Polygon der Region schneiden oder vollständig von dieser überlagert<br />
werden.<br />
Definition 8 (Qualitative Abbildung) Sei p ∈ P eine qualitativ zu abstrahierende<br />
Region, die durch ein GIS Koordinaten-Polygon beschrieben ist <strong>und</strong> R eine pSRT mit<br />
R = {r1, ..., rn}, dann wird p durch µ : P → 2 R wie folgt approximiert:<br />
µ(p) = {r ∈ R | EQ(p, r) ∨ P P (p, r) ∨ P O(p, r) }<br />
<strong>Ein</strong> Beispiel für eine so geartete Abstraktion ist in Abbildung 5.6 durch die schraffierten<br />
Rastereinheiten, die eine zu approximierende Region vollständig überlagert oder diese<br />
schneidet, dargestellt.<br />
Abbildung 5.6: Abstraktion einer Region mittels einer pSRT<br />
Die Genauigkeit dieser qualitativen Abschätzung der realen Region ist hierbei abhängig<br />
von der Auflösung der pSRT bzw. der Größe der einzelnen Rasterelemente. Im allgemei-<br />
nen wird dieser Ansatz allerdings zu einer Überschätzung der realen Region führen, da<br />
keine Unterscheidung dahingehend stattfindet, ob eine Überschneidung von Real-Polygon<br />
<strong>und</strong> Rasterelementen nur marginal oder real vorhanden ist. D.h. selbst bei einer zu ver-<br />
nachlässigenden kleinen Überlagerung von Rasterelementen durch ein Real-Polygon von<br />
nur einem Prozent wird dieses Element bereits zur approximierenden Menge hinzugezählt.<br />
Um diesem Problem zu begegnen, greift Vögele auf einen Ansatz von Worboys [Wor95]
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 86<br />
zurück <strong>und</strong> versucht, für eine exaktere Abstraktion eine untere <strong>und</strong> obere Approximati-<br />
onsschranke für die zu abstrahierende Region anzugeben.<br />
Für die formale Beschreibung dieser Schranken kommt, wie bereits in Definition 8 verwen-<br />
det, der Region Connection Calculus in der Variante mit fünf Relationen (RCC-5) zum<br />
<strong>Ein</strong>satz. Dieser eignet sich, wie bereits eingangs in Abschnitt 5.1 erläutert, sehr gut zur<br />
Beschreibung von Verhältnissen zwischen zwei Objekten im 2D-Raum.<br />
Die obere Schranke ¯ Sp läßt sich somit mittels RCC-5 bzgl. einer Region p <strong>und</strong> Rasterein-<br />
heiten r ∈ R einer pSRT wie folgt beschreiben:<br />
¯Sp = { r| EQ(r, p) ∨ P P (r, p) ∨ P O(r, p) } (5.2)<br />
<strong>Ein</strong>e untere Schranke läßt sich dementsprechend dadurch beschreiben, daß nur Elemente<br />
aufgenommen werden, die gleich oder vollständig in p enthalten sind. Überschneidende<br />
Elemente werden nicht beachtet, so daß diese Menge von Rastereinheiten das reale Polygon<br />
im allgemeinen immer unterschätzt.<br />
S p = { r| EQ(r, p) ∨ P P (r, p) } (5.3)<br />
Auf Basis dieser beiden Schranken lassen sich nun weitere detaillierte Überlegungen an-<br />
knüpfen, die eine Optimierung der qualitativen Abstraktion ermöglichen. Da diese für die<br />
hier vorliegende Arbeit nicht erforderlich sind, soll an dieser Stelle lediglich auf weitere<br />
Ausführungen in [VSV03] verwiesen werden. <strong>Ein</strong>en <strong>Ein</strong>druck der Genauigkeit der unter-<br />
schiedlichen Approximationen, die sich durch ¯ Sp <strong>und</strong> S p ergeben, ist in Abbildung 5.7<br />
exemplarisch dargestellt.<br />
£¡£ ¤¡¤<br />
¤¡¤ £¡£<br />
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡<br />
¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢<br />
¡<br />
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡<br />
¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢<br />
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡<br />
¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢<br />
¡ ¡<br />
¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡<br />
Abbildung 5.7: Unterschiede der Abstraktion mittels unterer <strong>und</strong> oberer Schranke<br />
5.2.2 Räumliche Relevanz<br />
Betrachtet man den Unterschied zwischen Daten <strong>und</strong> Informationen näher, wie häufig im<br />
Bereich des Wissensmanagements zu finden, dann gibt es neben vielen anderen Interpe-<br />
trationen die Ansicht, daß Daten nichts mehr als eine Aneinanderreihung von Symbolen<br />
sind. Aus Daten werden erst Informationen, wenn sie einem bestimmtem Zweck zugeord-<br />
net werden [Ste93].
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 87<br />
Informationen sind demnach immer subjektrelevant <strong>und</strong> kontextrelativ, also benutzer- <strong>und</strong><br />
zweckbezogen. <strong>Ein</strong>e japanische Zeitung würde z.B. für einen Europäer ohne Japanisch-<br />
Kenntnisse keine einzige Information enthalten, sondern lediglich Daten darstellen. <strong>Ein</strong><br />
Japaner könnte aber sehr wohl auf die Informationen der Zeitung zugreifen.<br />
Erweitert man diese Sichtweise auf Informationen um eine räumliche Komponente, so<br />
erhält man eine räumliche Relevanz von Informationen. Räumliche Relevanz bedeutet in<br />
diesem Zusammenhang, daß Informationen, die einen räumlichen Bezug haben, im engeren<br />
Sinne erst dann Informationen darstellen, wenn ein Empfänger dieser Informationen sich<br />
in einem gewissen räumlichen Kontext in Bezug auf diese Informationen befindet.<br />
Vögele et al. [VS01] gehen, mit einem Fokus auf GIS, bei ihrem Ansatz von der Annah-<br />
me aus, daß die räumliche Relevanz von Objekten größer ist je näher sie sich zu einem<br />
befinden. Hierbei stützen sie sich auf eine Aussage von Tobler [Tob70] über Objekte im<br />
geographischen Raum: ” everything is related to everything else, but near things are more<br />
related than distant things“.<br />
Somit ist die räumliche Relevanz σ(rq, ri) eines durch ri qualitativ mittels µ abstrahierten<br />
Ortes bzw. Objektes pi in Abhängigkeit zu einem durch rq abstrahierten Anfrageort pq<br />
um so höher je geringer die Entfernung D zwischen ri <strong>und</strong> rq ist [SVV01]. Im einfachsten<br />
1<br />
Fall läßt sich die räumliche Relevanz dann definieren als σ(rq, ri) = D(rq,ri) .<br />
Für den Vergleich von zwei unterschiedlichen Orten ri <strong>und</strong> rj läßt sich somit ausdrücken,<br />
daß der Ort ri räumlich relevanter ist als rj falls in Bezug zu einem Anfrageort σ(rq, ri) ><br />
σ(rq, rj) gilt.<br />
Innerhalb des von Vögele [VS01] vorgeschlagenen graph-basierten räumlichen Referenz-<br />
modells läßt sich die räumliche Relevanz bzw. dessen Kern-Bestandteil, die Entfernung<br />
zwischen zwei Objekten, leicht über die graphen-theoretische Distanz zwischen Knoten<br />
innerhalb eines Graphen berechnen.<br />
Da das von Vögele beschriebene Modell nicht nur aus dem bereits eingangs in Abschnitt<br />
5.2.1 eingeführten Dekompositions-Baum, der die hierarchischen Beziehungen von Ob-<br />
jekten in Form von Part-Of Relationen kodierte, besteht, sondern zusätzlich aus einem<br />
Nachbarschafts-Graph bzw. Connection-Graph [SVV01], wird die räumliche Relevanz aus<br />
zwei Komponenten berechnet.<br />
Die zweite Datenstruktur innerhalb des Modells von Vögele sind die Nachbarschafts-<br />
Graphen, welche im wesentlichen topologische Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Po-<br />
lygonen <strong>und</strong> deren Ordnung kodierten [VS01]. Für die genaue Berechnung der räumlichen<br />
Relevanz aus zwei Komponenten stehen Vögele somit zwei unterschiedliche Entfernungen<br />
zur Verfügung, die er als vertikale <strong>und</strong> horizontale Entfernung bezeichnet.<br />
σ(rq, ri) = Dvertikal(rq, ri) + Dhorizontal(rq, ri) (5.4)<br />
Hierbei wird die vertikale Entfernung mittels des Dekompositions-Baums <strong>und</strong> die horizon-<br />
tale Entfernung über den Nachbarschafts-Graphen berechnet.
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 88<br />
Horizontale Distanz<br />
Die horizontale Distanz h(rq, ri) zwischen zwei Knoten rq <strong>und</strong> ri innerhalb eines Nachbar-<br />
schaftsgraphen läßt sich, wie bereits eingangs beschrieben, über die Distanz zwischen den<br />
Knoten im Graph berechnen. Somit ist die horizontale Distanz zwischen zwei Objekten<br />
um so größer je größer die reale Distanz zwischen ihren Knoten ist.<br />
Vögele gibt bei der Beschreibung seines Modells als Beispiel einer einfachen Berechnungs-<br />
methode für die horizontale Distanz einen Weg über die euklidische Entfernung zwischen<br />
Objekten an. Hierbei geht er von einer Abstraktion der Objektkonturen eines Objektes p<br />
auf Rastereinheiten ri ∈ µ(p), wie in Definition 8 beschrieben, aus <strong>und</strong> mißt die Entfer-<br />
nung zwischen dem Mittelpunkt des Anfrageortes <strong>und</strong> dem Mittelpunkt des abstrahierten<br />
Objektes.<br />
Abbildung 5.8: Erzeugung eines Nachbarschaftsgraphs GP auf Basis einer pSRT P<br />
<strong>Ein</strong> Problem bei diesem Vorschlag stellt die Bestimmung des Mittelpunktes des abstra-<br />
hierten Objektes durch Rastereinheiten dar. Geht man von einer pSRT aus, die aus einem<br />
homogenen Raster mit gleich großen Rastereinheiten besteht, wie bspw. in Abbildung 5.4<br />
dargestellt, so ist die durch das Abstraktionsverfahren gewonnene qualitative Beschreibung<br />
einer Region immer ein Vieleck mit ausschließlich rechten Winkeln. In einem solchen Viel-<br />
eck wäre die Bestimmung des Mittelpunktes als Ausgangspunkt für eine Distanz-Messung<br />
im allgemeinen direkt nicht möglich.<br />
<strong>Ein</strong> möglicher Ansatz zur Umgehung dieses Problems wäre, die Entfernung zwischen einem<br />
druch rq abstrahierten Anfrageort pq <strong>und</strong> einem qualitativ abstrahierten Objekt pi, das<br />
durch eine Menge von Rastereinheiten pi = µ(pi) = {r1, ..., rk} repräsentiert wird, über<br />
den Mittelwert aller Entfernungen D zwischen den Mittelpunkten der Rastereinheiten<br />
ri ∈ µ(pi) <strong>und</strong> dem Mittelpunkt der Rastereinheit des Anfrageortes rq zu ermitteln.<br />
<br />
ri∈µ(pi)<br />
D(rq, µ(pi)) =<br />
D(rq, ri)<br />
(5.5)<br />
|µ(pi)|<br />
Wird die in Gleichung 5.5 dargestellte Entfernung D(rq, ri) zwischen zwei Rastereinheiten<br />
rq <strong>und</strong> ri weiterhin über die euklidische Entfernung, wie von Vögele beispielhaft vorge-<br />
schlagen, definiert, so ist die Voraussetzung für eine korrekte Berechnung eine eindeutige<br />
Bestimmbarkeit des Mittelpunktes einer Rastereinheit, wie es z.B. bei rechteckigen Ra-<br />
stereinheiten der Fall wäre. Würde man die Entfernung D hingegen über die kürzeste
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 89<br />
Entfernung zwischen zwei Knoten innerhalb eines Nachbarschaftsgraphen, wie in Abbil-<br />
dung 5.8 dargestellt, definieren, so würde die <strong>Ein</strong>schränkung der Bestimmbarkeit eines<br />
Mittelpunktes einer Rastereinheit wegfallen können.<br />
Vertikale Distanz<br />
Die vertikale Distanz v(rq, ri) zwischen zwei Objekten kann innerhalb des vorhandenen<br />
hierarchischen Dekompositions-Baumes ermittelt werden, der die partonomische Struktur<br />
zwischen Objekten abbildet (siehe Abschnitt 5.2.1).<br />
Für die Ermittlung dieser Distanz kann wiederum auf die graph-theoretische Berechnung<br />
der Entfernung Dtree zwischen zwei Knoten innerhalb des Baumes zurückgegriffen werden<br />
<strong>und</strong> stellt somit kein Problem dar.<br />
D(pq, pi) = Dtree(vpq, vpi ) mit v ∈ V, GP = (E, V ) (5.6)<br />
Die Beachtung der einzelnen Rastereinheiten ri eines abstrahierten Objektes pi, wie bei<br />
der Berechnung der horizontalen Distanz diskutiert, stellen bei der Berechnung der ver-<br />
tikalen Distanz keine Hürde dar. Dieses ist im wesentlichen dadurch begründet, daß der<br />
Dekompositions-Baum als Knoten nur die Objekte pi als Referenzen führt <strong>und</strong> keine In-<br />
formationen über deren qualitative Abstraktion beinhaltet.<br />
Semantik von horizontaler <strong>und</strong> vertikaler Distanz<br />
Versucht man näher die Bedeutung der beiden Distanzmessungen <strong>und</strong> deren Ausprägung<br />
zu verstehen, so ist auffällig, daß ein Verständnis der vertikalen Distanz v um ein vielfaches<br />
schwieriger scheint als das der horizontalen Distanz h.<br />
Die Bedeutung der horizontalen Distanz läßt sich als die wahre räumliche Distanz zwischen<br />
zwei Objekten, die durch eine qualitative Approximation gemessen wird, beschreiben. D.h.<br />
je größer h ist desto größer ist die Entfernung zwischen zwei Objekten. Beschreibt man<br />
die horizontale Distanz beispielsweise durch eine Relation Nachbarschaft, so ließe sich h<br />
als ein Nachbarschaftsgrad interpretieren, der sinkt sobald h steigt.<br />
Die Semantik der vertikalen Distanz v hängt im Gegensatz zur horizontalen Distanz stark<br />
von der Semantik der verwendeten pSRT <strong>und</strong> der sich daraus ergebenden Dekomposi-<br />
tonshierarchie ab [VS01]. Ist beispielsweise eine pSRT durch verschiedene administrative<br />
Gebiete bestimmt, so bedeutet ein niedriger Wert für v(rq, ri), daß rq <strong>und</strong> ri zum sel-<br />
ben administrativen Super-Gebiet gehören, also im Dekompositionsbaum, der partono-<br />
mische Strukturen kodiert, einen gemeinsamen Vaterknoten besitzen <strong>und</strong> sich zusätzlich<br />
im selben Zweig des Baumes befinden. <strong>Ein</strong> hoher Wert für v(rq, ri) bedeutet hingegen,<br />
daß rq <strong>und</strong> ri ” administrativ gesehen“ weit voneinander getrennt sind. Ist z.B. die maxi-<br />
male Tiefe eines Dekompsitionsbaumes TdepthMax kleiner als der Wert von v(rq, ri), also<br />
TdepthMax < v(rq, ri), so bedeutet dieses, daß sich rq <strong>und</strong> ri in verschiedenen Zweigen eines<br />
Dekompositionsbaumes befinden müssen.<br />
Stellt man sich anstelle der administrativen Gebiete z.B. die Service-Scopes der <strong>L2L</strong>-Units<br />
innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s vor, so ist z.B. eine Interpretation der Werte von v in Bezug
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 90<br />
auf ihren Informationscharakter möglich: Niedrige Werte würden speziellere Informationen<br />
bedeuten <strong>und</strong> höhere Werte allgemeine Informationen.<br />
Formale Definition der räumlichen Relevanz<br />
Nachdem bis hierhin alle wesentlichen Komponenten, die für die formale Beschreibung der<br />
räumlichen Relevanz nach Vögele notwendig sind, eingeführt wurden, kann die räumliche<br />
Relevanz nun als Linearkombination von horizontaler <strong>und</strong> vertikaler Distanz wie folgt<br />
beschrieben werden:<br />
Definition 9 (Räumliche Relevanz) Die räumliche Relevanz einer durch ri mittels µ<br />
qualitativ abstrahierten Region pi in Bezug zu einem aktuellen Anfrageort rq ist definiert<br />
als<br />
σ(rq, ri) =<br />
1<br />
D(rq,ri)<br />
mit D(rq, ri) = α · h(rq, ri) + (1 − α) · v(rq, ri), α ∈ [0, 1]<br />
Die Formalisierung der räumlichen Relevanz in Form einer Linearkombination bietet bei<br />
der Anfrageformulierung eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Wichtung der einzelnen<br />
Teilkomponenten.<br />
Der Term α innerhalb der Definiton der räumlichen Relevanz stellt einen Wichtungs-Faktor<br />
zur Verfügung, der reelle Werte innerhalb des Intervalls [0, 1] annehmen kann. Durch die<br />
Veränderung von α ist eine Feinabstimmung einer räumlichen Anfrage möglich. Sollte in-<br />
nerhalb einer Anfrage das Interesse verstärkt auf Informationen liegen, die im wesentlichen<br />
möglichst nah sind, so ist α maximal mit einem Wert α = 1 zu belegen. Ist es hingegen<br />
mehr von Interesse, Informationen zu erhalten, die aus demselben Teil einer hierarchischen<br />
Partonomie stammen, so ist α maximal mit α = 0 belegbar [VS01].<br />
Damit die beschriebene Wichtung von horizontaler <strong>und</strong> vertikaler Relevanz durch unter-<br />
schiedliche Werte für α invariant zu einer räumlichen Konstellation von Objekten ist,<br />
müßte eine metrische Vergleichbarkeit von h <strong>und</strong> v existieren. D.h. unabhängig von realen<br />
räumlichen Objektkonstellationen, die durch Vögeles Ansatz in bekannter Art abstrahiert<br />
werden, sollten die berechneten Werte der horizontalen <strong>und</strong> vertikalen Relevanz absolut<br />
vergleichbar miteinander sein, um kein ” Ungleichgewicht“ innerhalb der Berechnung der<br />
Entfernung zwischen zwei Objekten, wie in Definition 9 beschrieben, entstehen zu las-<br />
sen, das indirekt über α ausgeglichen werden <strong>und</strong> sich somit die Semantik von α von<br />
Fall zu Fall verändern würde. Generell liefern h <strong>und</strong> v in der hier definierten Art positi-<br />
ve Werte, wobei im Mittel die Werte von v, welche die Objektentfernungen beschreiben,<br />
die Werte h übersteigen werden, da im allgemeinen davon ausgegangen werden muß, daß<br />
z.B. eine hierarchische Struktur von Objekten innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s eine geringe-<br />
re Verschachtelungstiefe erreicht als die durchschnittliche räumliche Entfernung zwischen<br />
Objekten im <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> ist.<br />
<strong>Ein</strong>e erste intuitive Idee, diesem Problem innerhalb Vögeles Ansatz zu begegnen wäre z.B.<br />
eine Normierung von h <strong>und</strong> v auf denselben Wertebereich mittels maximaler Entfernungen.
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 91<br />
Hierzu könnten h <strong>und</strong> v beispielsweise durch den Suchradius im Dekompositionsbaum bzw.<br />
durch die maximale Entfernung zwischen zwei Knoten im Nachbarschaftsgraphen dividiert<br />
werden.<br />
Auswirkung der Belegung von α auf die Werte der räumlichen Relevanz<br />
<strong>Ein</strong> einfaches Beispiel soll nachfolgend die <strong>Ein</strong>flüsse von α auf die Ausprägung der Werte<br />
der räumlichen Relevanz σ versuchen zu verdeutlichen.<br />
= 1 = 0 = 0,5<br />
p q<br />
p q<br />
Räumliche Relevanz<br />
abnehmend<br />
Abbildung 5.9: Berechnung der räumlichen Relevanz in Abhängigkeit von α<br />
Ausgangspunkt für eine Berechnung von σ ist eine homogene pSRT, die stark vereinfacht<br />
<strong>und</strong> idealisiert ein Land wie Deutschland mit dessen Landes- <strong>und</strong> Ortsgrenzen repräsen-<br />
tieren soll. Abbildung 5.9 zeigt sowohl die pSRT wie auch die Ergebnisse der Berechnung<br />
von σ mit unterschiedlichen Belegungen für α durch Farbabstufungen. <strong>Ein</strong>e einzelne Ra-<br />
stereinheit ri soll hierbei einen Ort mit dessen Ortsgrenzen symbolisieren. <strong>Ein</strong> B<strong>und</strong>esland<br />
besteht aus mehreren Orten. Alle B<strong>und</strong>esländer liegen wiederum in den Landesgrenzen des<br />
Landes.<br />
Als Anfrageort pq wird eine Position in der Mitte eines Ortes rq gewählt. Offensichtlich hat<br />
dieser Ort bezogen auf sich selbst die maximal mögliche räumliche Relevanz (σ(rq, rq)=1),<br />
da der Anfrageort pq minimal durch den Ort rq selbst approximiert werden kann. Bei ei-<br />
nem Wert von α = 1 entstehen bei der Berechnung von σ kreisförmige Relevanzzonen mit<br />
vom Zentrum aus abnehmender räumlicher Relevanz (Abb. 5.9 links). Diese entstehen-<br />
den Zonen sind ausschließlich abhängig von ihrer geographischen Nachbarschaft zu pq <strong>und</strong><br />
berücksichtigen an keiner Stelle existierende Landesgrenzen. <strong>Ein</strong>e Berücksichtigung dieser<br />
Grenzen ist nur über die vertikale Distanz möglich, diese spielt aber keine Rolle bei einer<br />
Belegung von α = 1. Somit nimmt die räumliche Relevanz stetig ab je weiter entfernt ein<br />
Ort vom Anfrageort pq ist.<br />
Für den Fall, daß α = 0 ist, erhalten alle Orte, die zusammen mit dem Anfrageort pq zu<br />
ein- <strong>und</strong> demselben B<strong>und</strong>esland gehören dieselbe räumliche Relevanz. Alle Orte erhalten<br />
dieselbe Relevanz, da sie denselben Vaterknoten im Dekompositionsbaum besitzen <strong>und</strong><br />
ppq q
KAPITEL 5. RÄUMLICHES SCHLIESSEN 92<br />
damit die zu messende Entfernung in der Dekompositionshierarchie bei allen identisch ist<br />
(Abb. 5.9 Mitte). Alle benachbarten Regionen wurden dementsprechend einer niedrigeren<br />
Relevanz zugeordnet. Diese Zuordnung ergibt sich ebenfalls durch die Position auf einer<br />
anderen Ebene inerhalb der Dekompositionshierarchie im Vergleich zum Anfrageort.<br />
Für eine Belegung von α = 0, 5 sieht das entstehende Muster der Zonen mit gleicher<br />
räumlicher Relevanz etwas komplexer aus als bei den beiden zuvor beschriebenen Bele-<br />
gungen, ergibt sich aber direkt aus deren Kombination. Die Relevanzabstufung wird durch<br />
kreisförmige Zonen um den Anfrageort pq bestimmt. Jedoch beeinflußt die vertikale Di-<br />
stanz punktuell die Übergänge der kreisförmigen Zonen immer dort, wo eine Landesgrenze<br />
innerhalb einer solchen Zone liegt. An diesen Stellen ist die Relevanz zwar niedriger als<br />
in der vorherigen Zone vom Anfrageort aus gesehen, aber immer noch höher als der Wert<br />
der Relevanz außerhalb einer Landesgrenze.<br />
5.3 Zusammenfassung<br />
Die hier beschriebenen Ansätze zur Modellierung von räumlichen Konfigurationen stellen<br />
nur eine Möglichkeit von vielen aus dem Gebiet des räumlichen Schließens dar. Insbe-<br />
sondere der Region Connection Calculus dient oft als Gr<strong>und</strong>lage für darauf aufbauende<br />
Modelle <strong>und</strong> wurde aus diesem Gr<strong>und</strong> auch hier kurz vorgestellt.<br />
<strong>Das</strong> in diesem Kapitel detaillierter beschriebene graph-basierte Referenzmodell von Vögele<br />
at al. zur Abstraktion von Regionen hat gezeigt, wie es mittels einer Standard-Referenz-<br />
Tessilierung möglich ist, qualitative räumliche Informationen über Objekte zu erhalten,<br />
ohne ein schwergewichtiges System einsetzen zu müssen. Diese dargestellten Möglichkeiten<br />
zur Abstraktion von Regionen können innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s dazu genutzt werden,<br />
die geometrisch definierten Regionen in Form von Service Scopes ebenfalls zu abstrahie-<br />
ren, um so das Konzept der räumlichen Relevanz von Objekten auch in das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong><br />
integrieren zu können.<br />
Durch die Möglichkeit der Wichtung von horizontaler <strong>und</strong> vertikaler Relevanz durch einen<br />
Faktor α bietet die räumliche Relevanz einen Mechanismus, der semantische räumliche<br />
Konstellationen, wie z.B. das Enthaltensein von Regionen in anderen, berücksichtigt <strong>und</strong><br />
damit Relevanzen auf- oder abwerten kann. Gerade dieses ist für die Idee des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
mit seiner Struktur von ineinander verschachtelter Service-Scopes besonders interessant<br />
<strong>und</strong> könnte dazu verwendet werden, Informationen des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s mittels räumlicher<br />
Relationen zu strukturieren <strong>und</strong> zu bewerten. Gelingt dieses, so wäre es möglich, Benut-<br />
zern nur noch solche Informationen zu präsentieren, die eine gewisse ” Relevanzschwelle“<br />
überschreiten. Darüber hinaus könnte ein Mechanismus entwickelt werden, der es einer<br />
<strong>L2L</strong>-Unit erlaubt, generell relevante Informationen für ihren eigenen <strong>Ein</strong>flußbereich im<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> automatisch zu sammeln bevor eine Client-Anfrage vorliegt. <strong>Ein</strong>e Entwick-<br />
lung eines solchen Mechanismus soll Bestandteil des nachfolgenden Kapitels sein.
Kapitel 6<br />
Datenaustausch auf Basis<br />
räumlicher Relevanz<br />
Nachdem die vorangegangenen Kapitel 4 <strong>und</strong> 5 sowohl die gr<strong>und</strong>legende Architektur des<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s als auch einen Mechanismus erläutert haben, der die Relevanz von räum-<br />
lichen Daten bewertet, dient dieses Kapitel dazu, daß bereits in Abschnitt 4.3.3 kurz<br />
angesprochene Content-Exchange-Module (CEM) detaillierter zu untersuchen.<br />
Innerhalb der nachfolgenden Ausführungen wird eine mögliche Variante eines Mechanis-<br />
mus beschrieben, mit dessen Hilfe es möglich sein könnte, Informationseinheiten innerhalb<br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zwischen <strong>L2L</strong>-Units auf Basis räumlicher Beziehungen automatisiert<br />
auszutauschen. Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die generelle Idee des CEM bzw.<br />
eine Motivation für den vorgestellten Austausch-Mechanismus. Die anschließenden for-<br />
maleren Überlegungen basieren hierbei auf den Erkenntnissen des Kapitels 5 <strong>und</strong> versu-<br />
chen, eine Erweiterung zu konstruieren, die spezifische Charakteristika des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s<br />
berücksichtigt.<br />
6.1 Idee des Content Exchange Modules<br />
Die Aufgabe, die das Content Exchange Modul erfüllen sollte, war der Austausch von<br />
räumlich annotierten Informationseinheiten zwischen verschiedenen <strong>L2L</strong>-Units innerhalb<br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zwecks Beantwortung von Client-Anfragen. Hierbei ist die Idee, einen<br />
Algorithmus zu entwickeln, der es ermöglicht, Informationseinheiten auf Basis ihrer räum-<br />
lichen Relevanz zwischen <strong>L2L</strong>-Units automatisch so auszutauschen, daß die Datenbasis<br />
jeder <strong>L2L</strong>-Unit nur solche Informationseinheiten verwaltet, die oberhalb einer gewissen<br />
Relevanz-Schwelle in Bezug auf den Service-Scope einer Unit liegen <strong>und</strong> diese damit po-<br />
tentiell zur Ergebnismenge von Client-Anfragen gehören.<br />
Abbildung 6.1 zeigt stark vereinfacht einen Austausch von Informationseinheiten einzel-<br />
ner <strong>L2L</strong>-Units innerhalb eines <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s (<strong>L2L</strong>-Units werden in Abbildung 6.1 durch<br />
Netzknoten/ Peers dargestellt). Mit Hilfe der dargestellten Zusammenhänge soll versucht<br />
werden zu verdeutlichen, daß unterschiedliche Informationseinheiten, abhängig von beste-<br />
93
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 94<br />
C<br />
E<br />
Datenbasis<br />
§ § § § § ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨<br />
§<br />
D<br />
<br />
<br />
<br />
© ©<br />
© ©<br />
© ©<br />
B<br />
A<br />
Datenbasis<br />
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¥<br />
Datenbasis<br />
Abbildung 6.1: Schematischer Fluß von Informationseinheiten<br />
henden Relationen zwischen <strong>L2L</strong>-Units, im Netzwerk ausgetauscht <strong>und</strong> damit verbreitet<br />
werden könnten.<br />
Betrachtet man den Austausch von A nach B, so wird deutlich, daß nur bestimmte In-<br />
formationseinheiten für einen Austausch relevant sind <strong>und</strong> andere hingegen nicht ausge-<br />
tauscht werden. Nach einem Austausch beinhaltet die Datenbasis von B neben den eigenen<br />
Informationseinheiten zusätzlich zwei neue <strong>Ein</strong>heiten, die sie durch den Austausch mit A<br />
hinzugewonnen hat. Tauscht nun <strong>L2L</strong>-Unit B ihrerseits Informationseinheiten mit einer<br />
<strong>L2L</strong>-Unit C aus, so wird die Bewertung der relevanten Informationseinheiten für einen<br />
Austausch auf Basis bestehender Beziehungen zwischen B <strong>und</strong> C <strong>und</strong> der aktuellen Da-<br />
tenbasis von B, bestehend aus vier Informationseinheiten, durchgeführt. Diese Art der Be-<br />
wertung führt dazu, daß auch initial nicht in B vorhanden gewesene Informationseinheiten<br />
weitergegeben <strong>und</strong> abhängig von ihrer Relevanz für eine <strong>L2L</strong>-Unit verbreitet werden könn-<br />
ten. <strong>Ein</strong>e Verbreitung von Informationseinheiten im Netzwerk hinge damit nicht von einer<br />
direkten Verbindung zwischen <strong>L2L</strong>-Units ab. Dieser beschriebene Ablauf ist in Abbildung<br />
6.1 durch den Fluß von Informationseinheiten zwischen A,B <strong>und</strong> C mittels unterschiedlich<br />
schraffierter Kästchen dargestellt.<br />
<strong>Ein</strong>e Antwort auf die Frage, welche Informationseinheiten genau zu einem Zeitpunkt aus-<br />
getauscht werden, basiert hierbei prinzipiell immer auf einer aktuellen Datenbasis einer<br />
<strong>L2L</strong>-Unit. <strong>Ein</strong>e genauere Betrachtung der Zusammenhänge soll allerdings erst im weiteren<br />
Verlauf dieses Kapitels durchgeführt werden.<br />
<strong>Ein</strong> derartiger Mechanismus könnte es im Idealfall ermöglichen, den Push-basierten Ansatz<br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s mittels der Location-Page dahingehend zu optimieren bzw. zu verein-<br />
fachen, daß die Generierung der Location-Page durch eine spezielle ” Sicht“ auf die lokal<br />
vorhandene Datenbasis einer <strong>L2L</strong>-Unit erzeugt werden könnte. <strong>Ein</strong>e zusätzliche bedarfsori-<br />
entierte Akquirierung von relevanten Daten durch eine <strong>L2L</strong>-Unit während der Abarbeitung<br />
einer Anfrage würde entfallen können, was sich wiederum positiv auf die Antwortzeiten des<br />
Systems auswirkt. Angemessene Antwortzeiten waren eine der in Abschnitt 3.6 dargestell-
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 95<br />
ten Rahmenbedingungen, die auf diesem Weg erfüllt werden könnten. Diesem zugr<strong>und</strong>e<br />
liegt die Annahme, daß ein ” Prefetching“ von Informationseinheiten durch <strong>L2L</strong>-Units im<br />
Vergleich zu einer ” on demand“ Akquirierung innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s Geschwindig-<br />
keitsvorteile bietet <strong>und</strong> sich zusätzlich eine Optimierung des Netzwerkverkehrs erreichen<br />
ließe.<br />
6.1.1 Der Austausch-Mechanismus<br />
Dieser Abschnitt dient dazu, wesentliche Komponenten des Austausch-Mechanismus zu<br />
identifizieren sowie deren Funktionsweise auf einer informellen Ebene zu erläutern.<br />
<strong>L2L</strong>-Unit A <strong>L2L</strong>-Unit B<br />
CEM<br />
Filter<br />
Database<br />
Information<br />
Items<br />
Location<br />
Model<br />
CEM<br />
Modify<br />
Database<br />
Abbildung 6.2: Datenaustausch zwischen <strong>L2L</strong>-Units mittels des CEM<br />
Abbildung 6.2 stellt stark vereinfacht den Datenaustausch zwischen zwei <strong>L2L</strong>-Units A <strong>und</strong><br />
B dar. Für einen Datenaustausch sind innerhalb des CEM zwei wesentliche Komponenten<br />
von besonderer Bedeutung:<br />
1. Die Filter-Komponente<br />
2. Die Modify-Komponente<br />
Zu Beginn eines Datenaustausches ist die Komponente Filter von <strong>L2L</strong>-Unit A innerhalb<br />
des CEM dafür verantwortlich, die für den Austausch mit <strong>L2L</strong>-Unit B relevanten Infor-<br />
mationseinheiten aus der eigenen Datenbasis zu extrahieren. Hierbei wird auf Basis der<br />
existierenden räumlichen Beziehungen zwischen A <strong>und</strong> B für jedes Datum der Datenbasis<br />
bestimmt, ob es für den Transfer zu <strong>L2L</strong>-Unit B in Frage kommt oder nicht. Um diese<br />
Aufgabe zu lösen, ist es erforderlich, daß die <strong>L2L</strong>-Unit Zugriff auf das Location-Modell<br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s hat. Mit Hilfe der Informationen aus dem Location-Modell ist es dann<br />
möglich, eine geeignete Bewertung auf Basis der räumlichen Beziehungen von A <strong>und</strong> B<br />
durchzuführen.<br />
Die durch die Filter-Komponente von <strong>L2L</strong>-Unit A ausgewählten Informationseinheiten<br />
können dann über die <strong>L2L</strong>-Netzwerkinfrastruktur an <strong>L2L</strong>-Unit B übermittelt werden.
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 96<br />
Die Komponente Modify innerhalb der <strong>L2L</strong>-Unit B bearbeitet die neu empfangenen Infor-<br />
mationseinheiten bevor sie endgültig in die eigene Datenbasis von B übernommen werden<br />
können.<br />
Die Bearbeitung von Informationseinheiten beschränkt sich im wesentlichen auf die An-<br />
passung von Meta-Informationen der neuen Informationseinheiten. Ziel dieser Bearbeitung<br />
ist es, die ” Geschichte“ einer Informationseinheit in Bezug auf ihren zurückgelegten Weg<br />
von der Ursprungs-<strong>L2L</strong>-Unit zu dokumentieren. Die Dokumentation dieses Weges setzt<br />
ein gewisses räumliches Wissen über die <strong>L2L</strong>-Units voraus, welches über das Location-<br />
Modell des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zugänglich ist. <strong>Ein</strong>e solche Information über den zurückgelegten<br />
Weg einer Informationseinheit innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s bietet ein zusätzliches varia-<br />
bles Identifikationsmerkmal, das in die Bewertung der Filter-Komponente einfließt <strong>und</strong> die<br />
eher statischen räumlichen Beziehungen zwischen <strong>L2L</strong>-Units ergänzt.<br />
Um ein besseres Verständnis für die zuletzt diskutierte Existenz von Meta-Informationen<br />
einer Informationseinheit zu erhalten, gibt nachfolgender Abschnitt ein Beispiel dafür, wie<br />
die Struktur einer Informationseinheit innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s aussehen könnte <strong>und</strong><br />
welche Repräsentationsart hierfür in Frage käme.<br />
Meta-Informationen<br />
Die vorangegangenen Ausführungen haben verdeutlicht, welche Komponenten bei dem<br />
hier verfolgten Ansatz notwendig sind. Für eine praktische Umsetzung dieses Ansatzes ist<br />
es notwendig bzw. sinnvoll, Informationseinheiten innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s um eine<br />
gewisse Menge an Meta-Informationen zu ergänzen, die es Systemen oder Algorithmen<br />
ermöglichen, nähere Informationen über Informationseinheiten zu erhalten.<br />
Bei der Erstellung oder Generierung von Informationseinheiten für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> müßte<br />
demnach ein Annotationskonzept existieren bzw. entwickelt werden, das es ermöglicht,<br />
maschineninterpretierbare <strong>und</strong> menscheninterpretierbare Informationen gleichzeitig abzulegen.<br />
Als Beschreibungsmittel für solche Anforderungen hat sich in der vergangenen Zeit<br />
die Extensible Markup Language (XML) durchgesetzt, so daß eine Verwendung dieser<br />
auch im Bereich der Kodierung von Informationseinheiten für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> möglich<br />
<strong>und</strong> sinnvoll scheint.<br />
XML bietet die Möglichkeit einer flexiblen Spezifikation von Daten <strong>und</strong> ihrer Struktur.<br />
<strong>Ein</strong>er der Vorteile ist hierbei, daß Daten, die in XML notiert werden, bis zu einem gewissen<br />
Grad menschenlesbar sind.<br />
<strong>Ein</strong>e detaillierte Betrachtung der umfangreichen Modellierungsmöglichkeit mittels XML<br />
soll an dieser Stelle vermieden werden. Vielmehr soll Listing 6.1 versuchen, einen <strong>Ein</strong>druck<br />
davon zu vermitteln, wie eine Informationseinheit modelliert werden könnte.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
0125 hau24581<br />
7834 uia23823
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 97<br />
B u i l d i n g<br />
<br />
<br />
< s p a t i a l r e l e v a n c e> LOCAL <br />
< s p a t i a l r e l e v a n c e> NEIGHBORHOOD <br />
<br />
< s p a t i a l h i s t o r y v a l u e><br />
0.2568<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
. . .<br />
<br />
Listing 6.1: Meta-Informationen in XML<br />
<strong>Ein</strong>e in XML notierte Informationseinheit sollte im wesentlichen aus zwei Teilen beste-<br />
hen, den Meta- <strong>und</strong> Realdaten. Neben allgemeinen Metadaten, wie eindeutige Identifika-<br />
tionsnummer (id), Zugehörigkeit zu einer <strong>L2L</strong>-Unit (home id) etc., sind weitere <strong>Ein</strong>träge<br />
notwendig, die sich speziell auf die Realisierung eines Austauschmechanismus beziehen.<br />
Hierbei müssen Möglichkeiten vorhanden sein, die eine Bewertung einer Information in<br />
Bezug auf ihre Relevanz für andere <strong>L2L</strong>-Units im System ermöglicht. In Listing 6.1 ist<br />
dieses mit dem Bereich public angedeutet worden. Er beinhaltet Parameter, die auf Ba-<br />
sis räumlicher Relationen (wie z.B. LOCAL oder NEIGHBORHOOD) eine Relevanzzuordnung<br />
ermöglichen sollten. Ebenfalls in diesem Bereich integriert sollte ein Wert sein, der die<br />
Vergangenheit einer Informationseinheit in Bezug auf dessen Austausch mit anderen <strong>L2L</strong>-<br />
Units dokumentiert, wie mit spatial history value angedeutet.<br />
Als wesentliche Erkenntnis bleibt an dieser Stelle jedoch festzuhalten, daß Informationsein-<br />
heiten über die Möglichkeit der Meta-Annotation verfügen sollten. Der nächste Abschnitt<br />
geht näher auf die hier noch sehr vage beschriebenen Elemente <strong>und</strong> Mechanismen des<br />
Austausch-Mechanismus ein <strong>und</strong> gibt für die hier identifizierten Komponenten konkrete<br />
Beispiele einer möglichen Realisierung auf Basis räumlicher Relevanzen wie sie in Kapitel<br />
5 diskutiert wurden.<br />
6.2 Formalisierung<br />
Dieser Abschnitt dient, wie bereits erwähnt, dazu, eine formale Beschreibung für den hier<br />
vorgeschlagenen Datenaustausch zwischen <strong>L2L</strong>-Units auf Basis von bereits in Kapitel 5<br />
eingeführten Konzepten vorzunehmen.<br />
In Abschnitt 6.1 wurde informell die gr<strong>und</strong>sätzliche Idee des CEM <strong>und</strong> der mögliche Ablauf<br />
eines Datenaustausches geschildert. Für die nachfolgenden Betrachtungen des automati-
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 98<br />
schen Austausches zwischen <strong>L2L</strong>-Units gilt es demnach zwei wesentliche Schritte formal<br />
zu betrachten:<br />
1. Bestimmung der auszutauschenden Informationseinheiten<br />
2. Veränderung von Meta-Daten auf Basis des Austausches<br />
Um dieses zu beschreiben, ist es vorab notwendig, einige Voraussetzungen zu schaffen, mit<br />
deren Hilfe dann die beiden beschriebenen Punkte definiert werden können.<br />
6.2.1 Erweiterte räumliche Relevanz<br />
Die räumliche Relevanz σ war als ein Maß beschrieben, das ausdrückt, wie räumlich re-<br />
levant Objekte in Bezug auf einen aktuellen Ort sind. Um den automatischen Datenaus-<br />
tausch zwischen zwei Units im Sinne des CEM zu ermöglichen, setzt der hier vorgestellte<br />
Ansatz auf der bekannten Definition der räumlichen Relevanz auf, erweitert diese aber<br />
hinsichtlich der neuen Anforderungen, die sich aus der angestrebten Funktionsweise des<br />
CEM ergeben. Im wesentlichen bezieht sich diese Erweiterung auf die Integration eines<br />
einzelnen Datums des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s in die Berechnung der räumlichen Relevanz σ.<br />
Die zentrale Komponente, die für den Datenaustausch auf Basis räumlicher Relevanzen<br />
notwendig ist, ist die Zuordnung von räumlichen Relevanzen zu Informationseinheiten<br />
innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s. Erst mit ihrer Hilfe ist es möglich festzustellen, welche In-<br />
formationseinheiten für einen Austausch in Frage kommen <strong>und</strong> welche hingegen nicht.<br />
Die bisher bekannte Definition der räumlichen Relevanz ist lediglich von zwei Objekten,<br />
denen eine geographische Position zugr<strong>und</strong>e liegt, abhängig, nämlich einem Anfrageort<br />
<strong>und</strong> einem Ort für den die räumliche Relevanz berechnet werden soll. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
gilt es ein Konstrukt zu entwickeln, welches zum einen an eine Informationseinheit gebun-<br />
den ist <strong>und</strong> zum anderen die Berechnung der räumlichen Relevanz beeinflussen kann. <strong>Ein</strong>e<br />
Möglichkeit dieses zu erreichen ist die <strong>Ein</strong>führung der deklarierten Relevanz.<br />
Deklarierte Relevanz<br />
Die deklarierte Relevanz ist ein ähnliches Maß wie die räumliche Relevanz, die aber initial<br />
bei der Erstellung einer Informationseinheit festgelegt werden kann <strong>und</strong> als Meta-Datum<br />
einer Informationseinheit über eine Abbildung δ verfügbar ist (vgl. Abs. 6.1). Diese ordnet<br />
jedem Datum di ∈ Dk einer Datenbasis Dk einer zugehörigen <strong>L2L</strong>-Unit k einen reellen<br />
Wert innerhalb des Intervalls [0, 1] zu:<br />
δ : D → [0, 1] (6.1)<br />
Bei der deklarierten Relevanz existiert, wie bereits bei der räumlichen Relevanz σ, eine<br />
gewisse Vergleichbarkeit von Informationseinheiten auf Basis ihrer deklarierten Relevanz.<br />
Gilt für zwei Informationseinheiten di <strong>und</strong> dj aus derselben Datenbasis (di, dj ∈ D) die<br />
Gleichung δ(di) > δ(dj), so ist di lokal relevanter als dj, so daß alle Daten einer <strong>L2L</strong>-Unit
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 99<br />
einer Ordnungsrelation unterliegen, mit deren Hilfe sich z.B. Suchprozesse optimieren las-<br />
sen.<br />
<strong>Ein</strong>e Erweiterung der räumlichen Relevanz hinsichtlich der bereits eingangs angesproche-<br />
nen Bindung an Informationseinheiten läßt sich nun mittels der deklarierten Relevanz δ<br />
realisieren. Die erweiterte räumliche Relevanz σ ∗ ist somit eine Erweiterung der räumli-<br />
chen Relevanz σ um einen weiteren Parameter, so daß σ ∗ auf Basis eines Anfrageortes<br />
pq ∈ P , eines Bezugsortes pi ∈ P sowie zusätzlich eines Datums einer <strong>L2L</strong>-Unit di ∈ D<br />
definiert werden kann.<br />
σ ∗ : P × P × D → [0, 1] (6.2)<br />
Auf diese beschriebene Art ist σ ∗ nun zwar an ein Datum einer <strong>L2L</strong>-Unit geb<strong>und</strong>en, je-<br />
doch besteht noch keine direkte Verbindung zu den zwei für den Austausch von Daten<br />
im Sinne des CEM notwendigen <strong>L2L</strong>-Units. Derzeit besteht lediglich die Möglichkeit der<br />
Angabe von zwei unterschiedlichen Objekten, die sich durch Rastereinheiten einer pSRT<br />
mittels der Abbildung µ qualitativ abstrahieren lassen (vgl. Abschnitt 5.2.1). Dieses ist<br />
allerdings keine wirkliche <strong>Ein</strong>schränkung, da auch <strong>L2L</strong>-Units eine gewisse Region bzw. ein<br />
Objekt im Sinne der räumlichen Relevanz σ darstellen, die durch ihren geographischen<br />
Service-Scope beschrieben ist. Deshalb soll aus Gründen der einfacheren Darstellung im<br />
folgenden anstelle der für die Berechnung von σ notwendigen Rastereinheiten einer pSRT,<br />
die in Abhängigkeit von einem Objekt/Polygon p ∈ P durch die Abbildung µ ermittelt<br />
werden können, synonym eine <strong>L2L</strong>-Unit benutzt werden.<br />
<strong>Ein</strong>e formale Verbindung zwischen <strong>L2L</strong>-Unit <strong>und</strong> qualitativ zu abstrahierenden Polygo-<br />
nen p ∈ P wäre leicht über den Umweg des Service-Scopes einer <strong>L2L</strong>-Unit möglich, der<br />
ebenfalls durch ein Polygon repräsentiert wird.<br />
Definition 10 (Erweiterte räumliche Relevanz) Die erweiterte räumliche Relevanz<br />
σ ∗ für <strong>L2L</strong>-Units A <strong>und</strong> B bzgl. einen Datums d ist definiert als<br />
σ ∗ (A, B, d) = β · σ(A, B) + (1 − β) · δ(d)<br />
mit d ∈ DA, β ∈ [0, 1]<br />
Die Definition von σ ∗ ist analog zum Aufbau der Definition von σ <strong>und</strong> greift ebenfalls<br />
auf eine Darstellung in Form einer Linearkombination mittels eines Faktors β zurück. Der<br />
Wertebereich für β ist identisch mit dem für den Faktor α innerhalb der Definition von<br />
σ. Er bietet ebenfalls die Möglichkeit, die eine oder andere Teilkomponente stärker oder<br />
schwächer zu gewichten.<br />
Nachdem bis zu diesem Punkt die Voraussetzung für die Festlegung der zentralen Be-<br />
standteile des CEM Austausch-Mechanismus geschaffen wurde, gehen die nachfolgenden<br />
Abschnitte neben einer exemplarischen Ausprägung der deklarierten Relevanz näher auf<br />
die einzelnen Bestandteile des Austauschmechanismus ein <strong>und</strong> versuchen, sie formal fest-<br />
zulegen.
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 100<br />
Exemplarische Ausprägung von δ<br />
<strong>Ein</strong> einfache Möglichkeit, die bis dato nur abstrakt eingeführte deklarierte Relevanz δ<br />
zu beschreiben, ist über eine abschnittsweise definierte Funktion möglich, die einer Menge<br />
räumlicher Relationen einen gewissen Wert für δ zuordnet: Für eine Menge von Relationen<br />
bestehend aus drei Basisrelationen Lokal, Nachbarschaft <strong>und</strong> Überall gibt Tabelle 6.1 eine<br />
beispielhafte Belegung an.<br />
Relation δ<br />
Lokal 0<br />
Nachbarschaft 0,5<br />
Überall 1<br />
Tabelle 6.1: Exemplarische Wertetabelle der deklarierten Relevanz<br />
Diese in der Tabelle 6.1 dargestellte Ausprägung von δ basiert auf einer Sichtweise des<br />
möglichen ” Verbreitungsgrades“ einer Informationseinheit im <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>. Hierbei sei<br />
die Annahme getroffen, daß eine Information generell weniger relevant an Orten ist, die<br />
weiter vom Ursprung einer Informationseinheit entfernt sind. Um dieses Verhalten inner-<br />
halb des Austausch-Mechanismus zu erreichen, müßte δ infolgedessen um so kleinere Werte<br />
annehmen je geringer der Verbreitungsgrad einer Informationseinheit sein soll, da die Ent-<br />
scheidung über eine Verbreitung von σ ∗ abhängig ist, diese aber wiederum um so größer<br />
ist je größer der Summand (1 − β) · δ(d) ist.<br />
Damit eine Informationseinheit nur lokal verfügbar innerhalb des Service Scopes einer zu-<br />
gehörigen <strong>L2L</strong>-Unit ist, müßte δ mit einem Wert von Null belegt werden. <strong>Ein</strong>e Belegung<br />
von <strong>Ein</strong>s würde hingegen eine maximale Verbreitung einer Informationseinheit vom Ort<br />
ihrer zugehörigen <strong>L2L</strong>-Unit aus ermöglichen.<br />
Für eine Definition von δ soll an dieser Stelle ausdrücklich festgehalten werden, daß beliebig<br />
komplexe Berechnungsverfahren verwendet werden können, um δ zu beschreiben. Hierbei<br />
wird die Qualität des hier thematisierten Austauschmechanismus aller Voraussicht nach<br />
jedoch stark an die Qualität <strong>und</strong> Ausdrucksmächtigkeit von δ geknüpft sein, so daß eine<br />
adäquate Definition dennoch nicht gerade leicht zu finden sein wird.<br />
6.2.2 Bestimmung der auszutauschenden Daten<br />
Die Ermittlung der Menge an auszutauschenden Daten zwischen zwei <strong>L2L</strong>-Units im Sinne<br />
des CEM baut im wesentlichen auf der Definition der erweiterten räumlichen Relevanz σ ∗<br />
auf <strong>und</strong> realisiert die Komponente Filter, wie in Abbildung 6.2 bereits dargestellt. Hierzu<br />
wird der Ansatz verfolgt, genau solche Daten aus der Datenbasis einer <strong>L2L</strong>-Unit für den<br />
Austausch mit einer weiteren <strong>L2L</strong>-Unit herauszufiltern, deren Werte für σ ∗ oberhalb eines<br />
gewissen Schwelle liegen.<br />
x ≤ σ ∗ mit x ∈ [0, 1] (6.3)<br />
Bei der genauen Bestimmung dieser Menge sei allerdings vorab auf ein wichtiges Detail
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 101<br />
hingewiesen, das sich auf die ” Richtung“ eines Datenaustausches zwischen zwei <strong>L2L</strong>-Units<br />
innerhalb des <strong>L2L</strong>-Netzwerkes bezieht.<br />
Der hier diskutierte ” automatische Austausch von Daten“ ist streng genommen mehr ein<br />
Senden <strong>und</strong> Empfangen von Daten, wobei die Rolle des Senders <strong>und</strong> des Empfängers bei<br />
jedem Austausch fest ist <strong>und</strong> nicht gewechselt werden kann. Von einem echtem Austausch<br />
von Daten zwischen zwei Units A <strong>und</strong> B kann nur dann gesprochen werden, wenn in zwei<br />
voneinander unabhängigen Datentransfers sowohl Unit A als auch Unit B jeweils die Rolle<br />
des Senders <strong>und</strong> Empfängers übernommen hat.<br />
Dieses führt dazu, daß für einen Datentransfer von A nach B, notiert als A → B, nur<br />
dann ein Austausch A ←→ B vorliegt, falls auch der Transfer B → A stattgef<strong>und</strong>en hat.<br />
Definition 11 (Datenaustausch) <strong>Ein</strong> Datenaustausch zwischen zwei <strong>L2L</strong>-Units A <strong>und</strong><br />
B ist definiert in zwei voneinander unabhängigen Schritten.<br />
A ←→ B ⇔ A → B ∧ B → A<br />
Die nachfolgend angegebenen Beschreibungen von Mengen werden jeweils nur für eine<br />
Teilkomponente des Datenaustausches angegeben, da sie sich jeweils auf eine Datenbasis<br />
einer <strong>L2L</strong>-Unit beziehen bzw. von dieser beeinflußt werden.<br />
Die Menge der auszutauschenden Daten ∆ zwischen <strong>L2L</strong>-Unit A <strong>und</strong> B läßt sich auf Basis<br />
der erweiterten räumlichen Relevanz <strong>und</strong> aller bis hierhin thematisierten Konzepte wie<br />
folgt beschreiben.<br />
∆A→B = { d ∈ DA | x ≤ σ ∗ (A, B, d) }, x ∈ [0, 1] (6.4)<br />
6.2.3 Veränderung von Meta-Daten durch den Datenaustausch<br />
Nachdem die für den Austausch zwischen zwei <strong>L2L</strong>-Units relevanten Daten über die Men-<br />
ge ∆A→B bestimmbar sind, gilt es nun die notwendige Veränderung der Meta-Daten von<br />
Informationseinheiten mittels der deklarierten Relevanz δ geeignet vorzunehmen. Hierzu<br />
wäre es wünschenswert, wenn sich δ immer in Abhängigkeit eines aktuellen Datenaus-<br />
tausches zwischen zwei <strong>L2L</strong>-Units verändert, aber gleichzeitig seine Vergangenheit bzw.<br />
seinen ursprünglichen Herkunftscharakter nicht vollständig verliert.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> scheint eine Kombination von δ mit einer aktuellen Austauschsituati-<br />
on, die wiederum durch die räumliche Relevanz σ beschrieben ist, denkbar. Gleichung 6.5<br />
beschreibt eine Möglichkeit, wie sich δ innerhalb eines Austausches zwischen <strong>L2L</strong>-Unit A<br />
<strong>und</strong> B verändern ließe, wenn der neue Wert für δ als δ ′ notiert würde.<br />
∀ d ∈ ∆A→B : δ ′ (d) := δ(d) − γ · (1 − σ(A, B)), γ ∈ [0, 1] (6.5)<br />
Diese Beschreibung der Veränderung setzt auf der tatsächlich auszutauschende Menge an<br />
Informationseinheiten ∆A→B auf <strong>und</strong> gibt für alle Elemente dieser Menge eine Verände-<br />
rung an, bei der die bisherige deklarierte Relevanz δ sowie ein mittels γ gewichteter Anteil<br />
der räumlichen Relevanz σ einfließen.
KAPITEL 6. DATENAUSTAUSCH AUF BASIS RÄUMLICHER RELEVANZ 102<br />
Durch die Subtraktion von γ · (1 − σ(A, B)) hat die beschriebene Veränderung von δ die<br />
Eigenschaft, daß die deklarierte Relevanz mit zunehmender Teilnahme an Datentransfers<br />
sinkt, da σ(A, B) im allgemeinen um so kleiner ist je weiter A <strong>und</strong> B voneinander entfernt<br />
sind <strong>und</strong> damit (1−σ(A, B) größer wird. Dieses Verhalten von δ unterstützt wiederum die<br />
These von Tobler [Tob70], die schon Ausgangspunkt für die Betrachtungen zur räumlichen<br />
Relevanz war. Sie besagte, das Objekte relevanter sind, je näher sie zu einem selbst sind.<br />
Ihr Umkehrschluß wäre dementsprechend, daß Objekte irrelevanter sind, je weiter sie sich<br />
von einem entfernen. Geht man bei den Datentransfers davon aus, daß sich im Mittel bei<br />
jedem Transfer die Informationseinheiten von ihrem Ursprung weiter entfernen, so ließe<br />
sich diese These auch hierhin übertragen.<br />
6.2.4 Zusammenfassung<br />
Die Ausführungen haben einen Weg gezeigt, wie es möglich sein könnte, die informell<br />
dargestellten Überlegungen in eine formalere Form zu transformieren. <strong>Ein</strong> wesentlicher<br />
Bestandteil des hier vorgestellten Lösungsansatzes basierte auf der Existenz eines Meta-<br />
Datums, über das jede Informationseinheit innerhalb des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s verfügt <strong>und</strong> das<br />
als eine Art ” Vergangenheitsprotokoll“ verstanden werden kann. Mit Hilfe dieses Meta-<br />
Datums konnte eine Erweiterung des Modells zur räumlichen Relevanz, wie es von Vögele<br />
in [VS01] eingeführt wurde, erfolgen, welches wiederum Ausgangspunkt für die Beschrei-<br />
bung der auszutauschenden Daten <strong>und</strong> der Meta-Daten-Veränderung war.<br />
Die größte Schwierigkeit bei dem hier vorgestellten Ansatz ist die genaue Ausprägung<br />
der deklarierten Relevanz, deren Qualität aller Voraussicht nach zentral für die Qualität<br />
der Ergebnisse des Austauschmechanismus sein wird. <strong>Ein</strong> exemplarisches Beispiel hat eine<br />
einfache Ausprägung der deklarierten Relevanz aufgezeigt, um einen ersten <strong>Ein</strong>druck über<br />
die Möglichkeiten der Definition zu geben. Für eine praktische Verwertbarkeit auf hohem<br />
Niveau müßten aber an dieser Stelle aller Wahrscheinlichkeit nach weitere Optimierungen<br />
vorgenommen werden, um das gewünschte Verhalten des Mechanismus im Detail zu er-<br />
halten.<br />
Neben diesem hier vorgestellten Ansatz zur Realisierung des Austauschmechanismus sind<br />
mit Sicherheit noch weitere Ansätze denkbar, die das hier thematisierte Problem vielleicht<br />
sogar effizienter oder besser lösen könnten. Der Anspruch der Ausführungen in diesem<br />
Abschnitt lag jedoch nicht auf Vollständigkeit oder Effizienz, sondern sollte dem Leser<br />
vielmehr dazu dienen, einen tieferen <strong>Ein</strong>blick in die Thematik <strong>und</strong> die Möglichkeiten des<br />
automatisierten Datenaustausches auf Basis räumlicher Beziehungen innerhalb des <strong>L2L</strong>-<br />
<strong>Network</strong>s zu erhalten <strong>und</strong> zu realisieren, daß hierdurch Möglichkeiten gegeben sein könn-<br />
ten, die weit über die bis dato verwendeten Ansätze für die Auswertung von ortsbezogenen<br />
Anfragen im Bereich der ortsbezogenen Dienste hinausgehen.
Kapitel 7<br />
Fazit <strong>und</strong> Ausblick<br />
Dieses Kapitel bildet den Abschluß der vorliegenden Arbeit <strong>und</strong> soll unter Berücksichti-<br />
gung einer kritischen Reflexion der dargestellten Zusammenhänge gewonnene Erkenntnisse<br />
dieser Arbeit zusammenfassen. <strong>Ein</strong> anschließender Ausblick r<strong>und</strong>et diese Arbeit in Bezug<br />
auf offene Probleme <strong>und</strong> mögliche zukünftige Arbeiten ab.<br />
7.1 Zusammenfassung <strong>und</strong> kritische Reflexion<br />
Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, wie schwierig es ist aus einer Geschäftsidee heraus<br />
ein funktionsfähiges <strong>Geschäftsmodell</strong> zu entwickeln, das sowohl wirtschaftlich sinnvoll als<br />
auch technisch realisierbar ist. Angesichts der noch immer kurzen Innovationszyklen bei<br />
Mobilfunkgeräten <strong>und</strong> -netzen <strong>und</strong> einer nicht zu unterschätzenden Marktmacht von Mo-<br />
bilfunkanbietern ist die Etablierung neuer Unternehmenskonzepte im Mobilfunk-Sektor<br />
ein hohes Risiko, wenngleich der Markt viele Chancen aufgr<strong>und</strong> einer Vielzahl potentieller<br />
K<strong>und</strong>en birgt. Wenn es gelingt, mit dem vorgestellten Konzept eine genügend große An-<br />
zahl an K<strong>und</strong>en zu gewinnen, um eine kritische Masse zu erreichen, kann eine gesicherte<br />
Marktposition, die langfristig Gewinne sichern könnte, im gerade erst entstehenden Markt<br />
für ortsbezogene Dienste etabliert werden.<br />
Als einer der gewichtigen Vorteile bei dem hier vorgestellten Modell des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s ist<br />
der Zeitpunkt für einen Markteintritt bzw. dessen technische Realisierbarkeit zu nennen.<br />
<strong>Ein</strong>e Vielzahl von Ideen im Bereich ortsbezogener Dienste wurde bereits in der Vergan-<br />
genheit entwickelt <strong>und</strong> am Markt angeboten bevor technologische Rahmenbedingungen<br />
gegeben waren, um diese Ideen zu realisieren. Geht man hingegen von den in dieser Arbeit<br />
leider nur auf Basis existierender Kennzahlen aus der Literatur <strong>und</strong> ohne eigene Evalua-<br />
tion analysierten zeitlichen Entwicklungsphasen des Marktes aus, so ist eine <strong>Ein</strong>führung<br />
des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s zum jetzigen Zeitpunkt als positiv zu bewerten, da einerseits der Markt<br />
für ortsbezogene Dienste am Anfang der Wachstumsphase steht <strong>und</strong> andererseits die tech-<br />
nologischen Rahmenbedingungen, die für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> notwendig sind, bereits heute<br />
existieren. Zu beachten gilt es aber bei allen positiven Indikatoren, daß auch bei günstiger<br />
oder möglicherweise idealer Marktsituation, Erfolgsfaktoren, wie Erlösquellen <strong>und</strong> Stra-<br />
tegiebildung, von entscheidender Bedeutung bleiben, ohne die ein langfristiger Unterneh-<br />
103
KAPITEL 7. FAZIT UND AUSBLICK 104<br />
menserfolg ausgeschlossen ist. Gerade aus diesem Gr<strong>und</strong> hat die Diskussion der Erfolgsfak-<br />
toren des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s in dieser Arbeit versucht, eine breite Basis an möglichen Wegen<br />
aufzuzeigen mit deren Hilfe eine solide inhaltliche Auseinandersetzung mit den so wichti-<br />
gen Erfolgsfaktoren möglich ist.<br />
<strong>Ein</strong> <strong>Geschäftsmodell</strong> allein kann aber keinen Erfolg erzielen, wenn nicht auch das F<strong>und</strong>a-<br />
ment des Modells, nämlich das eigentliche Produkt oder die anzubietende Dienstleistung,<br />
existiert. Die vorliegende Arbeit konnte zwar aufgr<strong>und</strong> ihres thematischen Schwerpunkts in<br />
der Schnittmenge von angewandter <strong>und</strong> praktischer Informatik nicht final die Existenz des<br />
<strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s mit Hilfe einer Referenzimplementation belegen, wohl aber durch Architek-<br />
turkonzepte einen detaillierten Weg aufzeigen, wie die Konstruktion eines solchen Systems<br />
ermöglicht wird. Zentraler Bestandteil waren hierbei die Überlegungen, in welcher Form<br />
eine Umsetzung mittels Peer-to-Peer basierter Konzepte möglich ist <strong>und</strong> welche Konzepte<br />
im Speziellen hierfür in Frage kommen. Um dieses zu erreichen, wurden die einzelnen Kom-<br />
ponenten des Systems analysiert <strong>und</strong> konkrete Lösungsvorschläge formuliert, die bei einer<br />
Realisierung zum <strong>Ein</strong>satz kommen könnten. Wichtigster Bestandteil der vorgestellten Ar-<br />
chitekturkonzepte war das Location Modell des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s <strong>und</strong> das damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Konzept der Service Scopes. Mit ihrer Hilfe konnte ein leistungsfähiges Konzept zur Mo-<br />
dellierung von räumlichen Konstellationen entwickelt werden, auf dessen Gr<strong>und</strong>lage der<br />
ebenfalls vorgestellte Ansatz der räumlichen Relevanz von Objekten diskutiert wurde. <strong>Das</strong><br />
präsentierte Konzept der räumlichen Relevanz stellte einen Mechanismus zur Verfügung,<br />
mit dem Objekte im geographischen Raum bewertet werden konnten, um festzustellen,<br />
wie relevant Objekte für einen aktuellen Aufenthaltsort einer Person sind. Dieser anfangs<br />
eingeführte Mechanismus erlaubte es, nur Objekte mit einer Relevanz zu bewerten, nicht<br />
aber die Bewertung der für einen ortsbezogenen Dienst wichtigen Informationen über Ob-<br />
jekte. Zu diesem Zweck wurde der Ansatz der räumlichen Relevanz auf die gegebenen<br />
Anforderungen des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s erweitert <strong>und</strong> ein Mechanismus beschrieben, der einen<br />
automatischen Datenaustausch von Informationen zwischen <strong>L2L</strong>-Units auf Basis räumli-<br />
cher Relevanz realisieren sollte. Dem dargestellten Mechanismus lag die Idee zugr<strong>und</strong>e,<br />
Antwortzeiten innerhalb des Netzwerkes möglicherweise dadurch reduzieren zu können,<br />
daß jede Datenbasis einer <strong>L2L</strong>-Unit nur solche Informationen beinhaltet, die relevant für<br />
ihren jeweiligen Service Scope sind <strong>und</strong> damit eine Akquirierung von Informationen aus<br />
dem Netzwerk zum Zeitpunkt einer Client-Anfrage entfallen könnte. <strong>Ein</strong> positiver Ne-<br />
beneffekt bei diesem Ansatz war die Tatsache, daß das Problem der Präsentation von<br />
Informationen auf mobilen Endgeräten durch die Existenz eines Bewertungsmechanismus<br />
für Informationen erleichtert werden konnte. Hierbei war die nur kurz angeschnittene Idee,<br />
generell nur solche Informationen einem Benutzer des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s anzuzeigen, die ober-<br />
halb einer gewissen Relevanzschwelle liegen <strong>und</strong> die bei Bedarf ggf. mittels geeigneter<br />
Oberbegriffe weiter zu aggregieren sind.<br />
Abschließend soll erwähnt werden, daß eine exemplarische Realisierung des vorgestellten<br />
Austausch-Mechanismus in Form eines Programmes zum Zweck der Evaluation wünschens-<br />
wert gewesen wäre; der Implementationsumfang eines solchen Programms bzw. die Lösung<br />
des Darstellungsproblems räumlicher Informationen in einer für den Leser verständlichen
KAPITEL 7. FAZIT UND AUSBLICK 105<br />
Art <strong>und</strong> Weise hätte aber den gegebenen Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Im Nachhinein<br />
betrachtet bleibt festzustellen, daß eine Auseinandersetzung mit der Frage der Realisie-<br />
rung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s auf Basis bereits am Markt erhältlicher Software-Komponenten<br />
gerade im Hinblick auf die wirtschaftliche Betrachtung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s innerhalb dieser<br />
Arbeit sinnvoll gewesen wäre, um eine kosten- <strong>und</strong> zeitintensive Neuentwicklung zu um-<br />
gehen. <strong>Ein</strong>e solche Auseinandersetzung sollte in nächster Zukunft angestrebt werden.<br />
Die vorliegende Arbeit konnte noch nicht alle Fragen um das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> beantworten.<br />
In der Zukunft werden weitere Arbeiten folgen müssen, die Teilkomponenten weiter analy-<br />
sieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Insbesondere bleibt in dieser Arbeit die Frage<br />
nach einer Realisierung des Resultset Rendering Moduls, das für die Präsentation von In-<br />
formationen auf mobilen Endgeräten zuständig ist, offen. Gerade aber dieses Modul muß<br />
vor einer Markteinführung des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s konstruiert werden, da andernfalls eine Be-<br />
nutzungsschnittstelle zum System fehlen würde.<br />
Neben den eigentlichen Komponenten des <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s sind noch eine Reihe weiterer<br />
Überlegungen wünschenswert, die sich beispielsweise mit einem Content-Management-<br />
System (CSM) zur einfachen Erstellung <strong>und</strong> Pflege von Inhalten für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong><br />
beschäftigen. Aber auch die Entwicklung eines Konzeptes, das eine lückenlose Naviga-<br />
tion bzw. Positionsbestimmung sowohl im Indoor- als auch Outdoor-Bereich über eine<br />
einheitliche Schnittstelle für das <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong> ermöglicht, könnte die Leistungsfähigkeit<br />
des Gesamtsystems entscheidend vorantreiben. Zu guter Letzt ist die Entwicklung eines<br />
Prototyps erstrebenswert, mit dessen Hilfe sich eine Testumgebung für Komponenten ei-<br />
nes <strong>L2L</strong>-<strong>Network</strong>s schaffen läßt, um Fehler, Performance, Usability o.ä. zu testen <strong>und</strong> zu<br />
optimieren.
Literaturverzeichnis<br />
[AAM02] Applegate, L.M. ; Austin, R.D. ; McFarlan, F.W.: Corporate Information<br />
Strategy and Management: The Challenges of Managing in a <strong>Network</strong> Economy.<br />
6. McGraw-Hill, 2002<br />
[Ant95] Antweiler, J.: Wirtschaftlichkeitsanalyse von Informations- <strong>und</strong> Kommuni-<br />
kationssystemen (IKS). Köln : DATAKONTEXT-Fachverlag, 1995<br />
[Apa03] Apache: The Apache XML Project Homepage. 2003. – http://xml.apache.org/<br />
[B + 01] Burkardt, J. [u. a.]: Pervasive Computing. Addison-Wesley, 2001<br />
[BC01] Barfield, W. ; Candell, T.: F<strong>und</strong>amentals of Wearable Computers and Argu-<br />
mented Reality. Mahwah, New Jersy : Lawrence Erlbaum Associated Pictures,<br />
2001<br />
[Bel00] Belew, R.: Finding Out About - A Cognitive Perspective on Search Engine<br />
Technology and the WWW. Cambridge, United Kingdom : Cambridge University<br />
Press, 2000<br />
[BF02] Bliemel, Friedhelm ; Fassott, Georg: K<strong>und</strong>enfokus im Mobilen Commerce:<br />
Anforderungen der K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Anforderungen an die K<strong>und</strong>en. In: Mobile Com-<br />
merce - Gr<strong>und</strong>lagen, <strong>Geschäftsmodell</strong>e, Erfolgsfaktoren. Günter Silberer et al.,<br />
2002, S. 3–23<br />
[Bit01] Bittner, Thomas: Approximate Qualitative Temporal Reasoning. 2001. –<br />
hppt://citeseer.nj.nec.com/bittner01approximate.html<br />
[BWDD02] Backx, P. ; Wauters, T. ; Dhoedt, B. ; Demeester, P.: A comparison<br />
of peer-to-peer architectures. In: Eurescom Summit 2002 (2002). – Heidelberg,<br />
Germany<br />
[CBJG97] Cohn, A. G. ; Bennett, B. ; J.Gooday ; Gotts, N. M.: Qualitative Spa-<br />
tial Representation an Reasoning with the Region Connection Calculus. In:<br />
Geoinformatica Bd. 1. Boston, 1997, S. 1–44<br />
[CDM + 00] Cheverst, K. ; Davies, N. ; Mitchell, K. ; Friday, A. ; Efstratiou,<br />
C.: Developing a Context-aware Electronic Tourist Guide: Some Issues and<br />
Experiences. (2000). – Department of Computing, Lancaster Universtity<br />
106
LITERATURVERZEICHNIS 107<br />
[Cle02] Clement, Reiner: <strong>Geschäftsmodell</strong>e im Mobile Commerce. In: Mobile Com-<br />
merce - Gr<strong>und</strong>lagen, <strong>Geschäftsmodell</strong>e, Erfolgsfaktoren. Günter Silbert at al.,<br />
2002, S. 26–43<br />
[DCMF99] Davies, N. ; Cheverst, K. ; Mitchell, K. ; Friday, A.: Caches in the Air:<br />
Disseminating Tourist Information in the Guide System. New Orleans, Lousiana,<br />
1999 (Second IEEE Workshop on Mobile Computing Systems and Applications)<br />
[DR99] Dutta-Roy, A.: Technology 1999 Analysis and Forcast: Computers. In: IEEE<br />
Spectrum 36 (1999), Nr. 1, S. 46–51<br />
[Dur01a] Durlacher Research: Mobile Commerce Report / Durlacher Research Ltd.<br />
(UK). London, 2001. – Forschungsbericht<br />
[Dur01b] Durlacher Research: UMTS - An Investment Perspective / Durlacher<br />
Research Ltd. (UK). London, March 2001. – Forschungsbericht<br />
[Fab03] Fabrikant, Sara I. The use of location-based services in distributed collaborative<br />
visualization environments. CSISS Secialist Meeting on Location-based Services.<br />
2003<br />
[Fen01] Fensel, D.: Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Elec-<br />
tronic Commerce. Heidelberg : Springer-Verlag, 2001<br />
[Fre02] Freismuth, Dieter. Peer-to-Peer: <strong>Ein</strong>tagsfliege oder Zukunftsmodell? Graz<br />
University of Technologie, Austria. Januar 2002<br />
[GBD00] Green, J. ; Betti, D. ; Davison, J.: Mobile Location Services: Market Strate-<br />
gies. 2000. – http://www.ovum.com<br />
[Ger02] Gerpott, Torsten J.: Wettbewerbsstrategische Positionierung von Mobilfun-<br />
knetzbetreibern im Mobile Business. In: Mobile Commerce - Gr<strong>und</strong>lagen,<br />
<strong>Geschäftsmodell</strong>e, Erfolgsfaktoren. Günter Silbert et al., 2002, S. 45–65<br />
[GG01] Geer, Ralf ; Gross, Roland: M-Commerce: <strong>Geschäftsmodell</strong>e für das mobile<br />
Internet. Landsberg/Lech : Verlag Moderne Industrie, 2001<br />
[Gru93] Gruber, T.: Towards Principles for the Design of Ontologies Used for Know-<br />
ledge Sharing. (1993)<br />
[Grz02] Grzan, Stjepan: Enabeling technology for indoor location aware infromation<br />
system, Universität Stuttgart, <strong>Diplomarbeit</strong>, Januar 2002<br />
[Hil02] Hille, Maren: Strategieoptionen für Energieversorgungsunternehmen als Reak-<br />
tion auf einen rückläufigen Absatz im Wärmemarkt, Carl von Ossietzky Univer-<br />
sität Oldenburg, Diss., 2002<br />
[HK01] Huber, J. ; Kohil, J.: A Reference Handbook for Portal Operators, Developers<br />
and the Mobile Industry. (2001)
LITERATURVERZEICHNIS 108<br />
[Jag03] Jagoe, Andrew: Mobile Location Services: The Definitive Guide. New Jersey,<br />
USA : Prentice Hall, 2003<br />
[JMMC01] José, R. ; Moreira, A. ; Meneses, F. ; Coulson, G.: An Open Architec-<br />
ture for Developing Mobile Location-Based Applications over the Internet. In:<br />
Proceedings of the 6th IEEE Symposium on Computers and Communications.<br />
Hammamet, Tunisia : IEEE Computer Society, July 2001. – ISBN 0-7695-1177-5,<br />
S. 500–503<br />
[Jos01] José, Rui Joao P.: An Open Architecture for Location-Based Services in He-<br />
terogeneous Mobile Environments, Lancaster University, England, Diss., April<br />
2001<br />
[KH02] Kölmel, Bernhard ; Hubschneider, Martin: Nutzererwartungen an Location<br />
Based Services - Ergebnis einer empirischen Analyse. (2002)<br />
[KS00] Kashyap, V. ; Sheth, A.: Information Brokering Across Heterogeneous Digital<br />
Data - A Metadata-based Approach. Massachusetts : Kluwer Academic Pubis-<br />
hers, 2000<br />
[Kur02] Kurth, Matthias. The Vision of a mobile Europe. Regulierungsbehörde für<br />
Telekommunikation <strong>und</strong> Post (RegTP). Oktober 2002<br />
[Lad02] Ladstätter, Peter. Location Based Services: bloßer Hype oder reale<br />
Wertschöpfung. Symposium für TeleKartographie <strong>und</strong> Location Based Services<br />
in Wien, Österreich. Januar 2002<br />
[Leo98] Leonhardt, Ulf: Supporting Location-Awareness in Open Distributed Systems,<br />
University of London, Diss., May 1998<br />
[Mae01] Maedche, Alexander. Interoperable Anwendungssysteme. Vorlesung an der<br />
Universität Kalsruhe. 2001<br />
[Mül02] Müller, Jens: Entwicklung eines Konzeptes für mobiles standortbasiertes En-<br />
tertainment, Technische Universität Darmstadt, <strong>Diplomarbeit</strong>, März 2002<br />
[MS00] Maedche, A. ; Staab, S.: Applying Semantic Web Technologies for Tourism<br />
Information Sytems. (2000)<br />
[Ora01] Oram, Andy: Peer to Peer: Harnessing the Power of Distruptive Technologies.<br />
O’Reilly, 2001<br />
[PLM + 01] Poslad, S. ; Laamanen, H. ; Malaka, R. ; Nick, A. ; Zipf, A.: Crumpet:<br />
Creation Of User-Friendly Mobile Services Personalised For Tourism. (2001)<br />
[Por02] Porter, Michael E.: Wettbewerbsvorteile (Competitive advantage): Spitzenlei-<br />
stungen erreichen <strong>und</strong> behaupten. Frankfurt/Main, 2002
LITERATURVERZEICHNIS 109<br />
[PRW01] Picote, Arnold ; Reichwald, Ralf ; Wigand, Rolf T.: Die grenzenlose Un-<br />
ternehmung. 4. Auflage. Gabler Verlag, 2001<br />
[RCC92] ; Randell, David A. (Hrsg.) ; Cui, Zhan (Hrsg.) ; Cohn, Anthony G. (Hrsg.):<br />
A Spatial Logic based on Regions and Connection. 3dr Int. Conf. on Knowlegde<br />
Representation and Reasoning, 1992<br />
[Rie94] Rieken: Intelligent Agents. In: Communication of the ACM 37 (1994), July<br />
[Rog83] Rogers, Everett M.: Diffusion of Innovations. 3. New York, 1983<br />
[S + 02] Scheer, August-Wilhelm [u. a.]: <strong>Das</strong> mobile Unternehmen. In: Mobile Com-<br />
merce - Gr<strong>und</strong>lagen, <strong>Geschäftsmodell</strong>e, Erfolgsfaktoren. Günter Silberer et al.,<br />
2002, S. 91–110<br />
[Sch00] Schirmer, J.: Towards Authoring of Mobile Agents - An End-user Interactive<br />
and Programming Approach. (2000)<br />
[Sch01] Schollmeier, R.: A Definition of Peer-to-Peer <strong>Network</strong>ing for the Classification<br />
of Peer-to-Peer Architectures and Applications. In: IEEE 2001 International<br />
Conference on Peer-to-Peer Computiong. Linköping, Sweden, August 27-29 2001<br />
[Shi01] Shirky, C.: Listening to Napster. In: A. Oram: Peer-to-Peer: Harnessing the<br />
Power of Disruptive Technologies. Sebastopol, CA, USA : O’Reilly, 2001<br />
[Sin01] Singh, M.P.: Peering at Peer-to-Peer Computing. In: IEEE Internet Computing<br />
Vol. 5 (2001), January/February, Nr. No. 1<br />
[Ste93] Steinmüller, W.: Informationstechnologie <strong>und</strong> Gesellschaft: <strong>Ein</strong>führung in die<br />
Angewandte Informatik. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1993<br />
[Sto69] Stobbe, Alfred: Volkswirtschaftliches Rechnungswesen. 2. Auflage. Berlin,<br />
Deutschland : Springer Verlag, 1969<br />
[Sun03] Sun Microsystems: The Jini <strong>Network</strong> Technology. 2003. –<br />
http://wwws.sun.com/software/jini/<br />
[SVV01] Schlieder, C. ; Vögele, T. ; Visser, U.: Qualitative Spatial Reasoning for<br />
Information Retreival by Gazetteers. In: Conference on Spatial Information<br />
Theory (COSIT) (2001)<br />
[SW02] Schlieder, C. ; Werner, A.: Interpretation of Intentional Behavior in Spatial<br />
Partonomies. (2002)<br />
[The00] The Boston Consultion Group: Mobile Commerce: Winning the On-Air<br />
Consumer / The Boston Consultion Group, Inc. Boston, November 2000. –<br />
Forschungsbericht
LITERATURVERZEICHNIS 110<br />
[The04] The Fo<strong>und</strong>ation for Intelligent Physical Agents (FIPA): Project-<br />
Homepage. 2004. – http://www.fipa.org<br />
[Tim98] Timmers, Paul: Business Models für Electronic Markets. (1998), April<br />
[Tob70] Tobler, W.: A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit<br />
Region. In: Economic Geography 46 (1970), S. 360–371<br />
[TSR98] Thomas, L. ; Suchter, S. ; Rifkin, A.: Developing Peer-to-Peer Applications<br />
on the Internet: the Distributed Editor, SimulEdit. In: Dr. Dobb’s Journal<br />
(1998), January, Nr. 281, S. 76–81<br />
[UF01] UMTS-Forum: 3G Protal Study - A Reference Handbook for Operators, De-<br />
velopers and the Mobile Industry. 2001 ( 16). – Forschungsbericht. http://umts-<br />
forum.org/reports.html<br />
[UF02] UMTS-Forum: Key Components for 3G Devices. (2002)<br />
[UG96] Uschold, M. ; Grüninger, M.: Ontologies: Principles, Methods and Applica-<br />
tions. In: Knowledge engeneering Review 11(2) (1996)<br />
[Vin03] Vindigo Inc.: The Vindigo Homepage. (2003). – http://www.vindigo.com<br />
[VS00] Volz, Steffen ; Sester, Monika: NEXUS - Distributed Data Management Con-<br />
cepts for Location Aware Applications / University of Stuttgart. Stuttgart,<br />
Germany, 2000. – Forschungsbericht<br />
[VS01] Vögele, T. ; Schlieder, C.: Spatially-Aware Information Retrieval with<br />
Graph-Based Qualitative Reference Models. (2001)<br />
[VSA02] Vidal, M. ; Sánchez, J. ; Aparicio, J.: Core FADA. FETISH Project, 2002.<br />
– http://fetish.t-6.it<br />
[VSV03] Vögele, T. ; Schlieder, C. ; Visser, U.: Intuitive Modelling of Place Name<br />
Regions for Spatial Information Retrieval. (2003)<br />
[W + 00] Wu, J. K. [u. a.]: Perspectives on Content-Based Multimedia Systems.<br />
Dordrecht, Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2000<br />
[W3C03] W3C: The Semantic Web Homepage. 2003. – http://www.w3c.org/2001/sw/<br />
[Wea04] Wearlab: Homepage der Arbeitsgruppe. 2004. – http://www.wearlab.de<br />
[Wöh02] Wöhe, Günter: <strong>Ein</strong>führung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 21.<br />
Verlag Vahlen, 2002<br />
[Wir03] Wireless, AT&T: The Find-A-Friend Homepage. 2003. –<br />
http://www.attws.com/mmode/features/findit/FindFriends/
LITERATURVERZEICHNIS 111<br />
[Woh02] Wohlfahrt, Jens: Wireless Advertising. In: Mobile Commerce - Gr<strong>und</strong>lagen,<br />
<strong>Geschäftsmodell</strong>e, Erfolgsfaktoren, 2002, S. 245–263<br />
[Wor95] Worboys, M. F.: GIS - A Computing Perspective. London, Philadelphia :<br />
Taylor & Francis, 1995<br />
[Z + 99] Zerdick, Axel [u. a.]: Die Internet-Ökonomie. Berlin : Springer Verlag, 1999<br />
[ZM02] Zipf, Alexander ; Malaka, Rainer: Developing Location Based Services for<br />
Tourism - The Service Provider View / European Media Laboratory EML.<br />
Heidelberg, Germany, 2002. – Forschungsbericht<br />
[Zob01] Zobel, Jörg: Mobile Business <strong>und</strong> M-Commerce. München : Hanser Verlag,<br />
2001
LITERATURVERZEICHNIS 112<br />
Erklärung<br />
Hiermit versichere ich, daß ich diese vorliegende Arbeit selbständig <strong>und</strong> nur unter Zuhil-<br />
fenahme von als solchen gekennzeichneten Mitteln verfasst habe.<br />
Bremen, den 22. April 2004<br />
Hendrik Witt