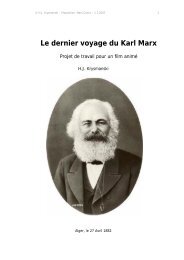Veränderungen im Quadrat: Computervermittelte Kommunikation ...
Veränderungen im Quadrat: Computervermittelte Kommunikation ...
Veränderungen im Quadrat: Computervermittelte Kommunikation ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TEORIE VĚDY XII(XXV)1 2003<br />
VERÄNDERUNGEN IM QUADRAT: COMPUTERVERMITTELTE<br />
KOMMUNIKATION UND MODERNE GESELLSCHAFT<br />
Überlegungen zum Design des europäischen Forschungs-Netzwerks<br />
„Kulturelle Diversität und neue Medien“<br />
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
Abstrakt<br />
Der Aufsatz präsentiert zunächst die Hintergründe der Genese des europäischen<br />
Forschungs-Netzwerks „Kulturelle Diversität und neue Medien“ (CULTMEDIA).<br />
Anschließend legt er dar, wie seine Forschungstätigkeiten auf drei Ebenen<br />
entfaltet werden können, der „begrifflich-konzeptionellen“, der „diskursivvergleichenden“<br />
und der „synthetisch-konziliären Forschungs-ebene“. Daraufhin<br />
befasst er sich mit der Ausweisung von vier zentralen Forschungsfeldern:<br />
„Privatheit und Öffentlichkeit“, „Identität und Gemeinschaft“, „Wissen und<br />
Wirtschaft“ sowie „(Un-)Sicherheit und Vertrauen“. Zum Schluss führt er dann<br />
Überlegungen zur konzeptionellen Fundierung von CULTMEDIA <strong>im</strong><br />
„Vierecksverhältnis“ von Kultur, Gesellschaft, Technik und Medien aus.<br />
1. Vorbemerkung<br />
„European Research Network on Cultural Diversity and New Media“<br />
(CULTMEDIA) – so lautet der Name eines sich derzeit konsolidierenden<br />
interdisziplinären und multinationalen Kooperationsverbunds. Der folgende<br />
Beitrag enthält Überlegungen zu Ansatz und Zielsetzung. Er greift auch auf<br />
Ausarbeitungen einzelner „Netzknoten“ sowie die Ergebnisse intensiver<br />
Diskussionen zwischen Mitgliedern von CULTMEDIA zurück, die hier nicht en<br />
détail ausgewiesen werden können. Deshalb sei an dieser Stelle allen gedankt,<br />
die dazu beigetragen haben, CULTMEDIA „auf den Weg zu bringen“.<br />
Hintergrund für den Aufbau von CULTMEDIA sind die Ergebnisse einer<br />
Studie, die das Büro für Technikfolgenabschätzung be<strong>im</strong> Deutschen<br />
Bundestag (TAB) in den Jahren 2000 und 2001 durchführte (vgl. Paschen et<br />
7
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
al. 2002). Diese Studie war durch den Ausschuss für Kultur und Medien des<br />
Deutschen Bundestages angeregt worden und hatte „Bisherige und zukünftige<br />
Auswirkungen der Entwicklung Neuer Medien auf den Kulturbegriff, die<br />
Kulturpolitik, die Kulturwirtschaft und den Kulturbetrieb“ zum Gegenstand.<br />
Sie konzentrierte sich – neben Überlegungen zum Wandel von<br />
Kulturverständnissen und Kulturkonzepten – auf die Themen „Neue Medien<br />
und Medienmärkte“ sowie „Neue Produktions-, Vermittlungs- und<br />
Rezeptionsformen in ausgewählten Kulturbereichen (Literatur, Musik, Film)“.<br />
Auf diese Weise wurden einerseits aktuelle <strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> Bereich der<br />
Medien und der Medienmärkte, andererseits exemplarisch deren<br />
Auswirkungen auf „traditionelle“ Kulturbereiche deutlich. Hinsichtlich dieser<br />
<strong>Veränderungen</strong> wurde zwischen dem kulturellen Produkt und seinen<br />
Produktionsformen auf der einen Seite (inhaltlich-gestalterische Ebene) und<br />
der Verbreitung sowie Rezeption von Kulturprodukten auf der anderen Seite<br />
(Marketing- und <strong>Kommunikation</strong>sebene) unterschieden. 1<br />
Im Anschluss daran beabsichtigt CULTMEDIA nun, kulturelle<br />
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> Gefolge der sogenannten „Neuen Medien“ vorrangig in<br />
folgenden zwei prioritären Hinsichten zu seinem Forschungsgegenstand zu<br />
machen: erstens bezieht es sich auf das Internet als dem Repräsentanten der<br />
neuen Medien; zweitens bezieht es sich auf solche kulturellen Praxen, die sich<br />
in den lebensweltlichen und systemischen Zusammenhängen der alltäglichen<br />
Nutzung dieses sozio-technischen Mediums verändern. Neben generellen<br />
interdisziplinären Analysen geht es dabei in erster Linie um multinationale<br />
Vergleiche.<br />
1 Im Juni 2003 hat der Deutsche Bundestag in Fortführung der genannten TAB-Studie das<br />
Projekt „Analyse netzbasierter <strong>Kommunikation</strong> unter kulturellen Aspekten“ mit einer<br />
Laufzeit von 18 Monaten beschlossen.<br />
8
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
Die konzeptionellen und programmatischen Grundlagen dieser Arbeiten<br />
von CULTMEDIA werden <strong>im</strong> Folgenden skizziert. 2<br />
2. Die Erschliessung seiner drei Forschungsebenen<br />
Zwischen der kulturellen Entwicklung der Völker und der Nutzung von<br />
<strong>Kommunikation</strong>smedien bestehen seit jeher enge Verbindungen. Auch was die<br />
Entwicklung und Nutzung von digitalen Medien <strong>im</strong> Verbund mit<br />
computervermittelter <strong>Kommunikation</strong> und die Transformation moderner<br />
Gesellschaften betrifft, setzen sich diese engen Zusammenhänge fort.<br />
Die jeweiligen Möglichkeiten der Gesellschaft zur Erarbeitung,<br />
Verteilung, Speicherung, Nutzung und Überprüfung von Informationen und<br />
Wissen bilden einen wichtigen dynamischen Faktor des soziokulturellen<br />
Wandels. Die Anfänge der Schriftkultur, die Erfindung des Buchdrucks oder<br />
auch die „moderneren“ Medien wie Presse, Rundfunk und vor allem<br />
Fernsehen haben entscheidend zu folgenreichen kulturellen und sozialen<br />
Umwälzungen beigetragen. Die informations- und kommunikations-<br />
technologische Entwicklungsdynamik 3 lässt es daher sinnvoll erscheinen,<br />
ebenfalls nach den kulturellen Bedingungen und Implikationen der – auch<br />
2 Auf die systematische Angabe weiterführender, auch eigener Literatur wird wegen deren<br />
Umfang und Vielfalt in diesem Aufsatz bewusst verzichtet. In der gegenwärtigen<br />
Projektphase angelaufen ist die Erarbeitung verschiedener themenzentrierter „state-ofthe-art“-Reports<br />
sowie einer strukturierten Bibliografie, die die relevanten Publikationen<br />
auswerten.<br />
3 Als Stichworte dafür seien Digitalisierung, Allgegenwärtigkeit der Computersysteme,<br />
Vernetzung von Hardware-Komponenten in offener Weise und globaler D<strong>im</strong>ension<br />
sowie Konvergenz der Übertragungswege und der Endgeräte genannt. Hinzu treten<br />
Datenkompression zur Beschleunigung der Informationsübermittlung und Erhöhung der<br />
Speicherdichte, Miniaturisierung von Bauteilen, Baugruppen und Geräten, die<br />
Desintegration von technischen Funktionseinheiten sowie ihre prinzipielle Interaktivität.<br />
9
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
mangels eines besseren Begriffs – zusammenfassend als „neue Medien“<br />
bezeichneten Informations- und <strong>Kommunikation</strong>smöglichkeiten zu fragen, für<br />
die das Internet synonym steht.<br />
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der zu untersuchende Formwandel<br />
kultureller Praxen nicht einfach technikinduziert verläuft, sondern in einem<br />
wechselbezüglichen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungs-<br />
prozessen steht, für die hier als Stichworte Globalisierung, Individualisierung,<br />
reflexive Modernisierung, Komplexitäts- und Kontingenzsteigerung sowie<br />
Wertewandel genannt seien.<br />
Vor diesem Hintergrund untersucht CULTMEDIA jene <strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong><br />
Verhältnis von Sozialität (Bildung individueller und kollektiver Identitäten,<br />
Formen der Vergemeinschaftung) und Kulturalität (kulturelle Praktiken und<br />
Güter als Bedeutungsmuster des gesellschaftlichen Lebens), die sich in<br />
Verbindung mit der Entwicklung und Nutzung des Internet (als technischem<br />
Informations- und <strong>Kommunikation</strong>smedium) ergeben. Damit untersucht<br />
CULTMEDIA Prozesse, die die europäische Gegenwartsgesellschaft(en)<br />
transformieren und einen wesentlichen Teil ihres Übergangs zur sogenannten<br />
„knowledge-based society“ ausmachen.<br />
Diese Wandlungen finden in der Europäischen Union in einem Milieu<br />
hochgradiger kultureller Diversität statt und werden dadurch in ihrer Form und<br />
ihrem Verlauf (Tempo, Richtung, Muster) beeinflusst. Umgekehrt wirken sie<br />
aber auch gleichzeitig auf eben dieses Milieu ein und verändern die Dynamik,<br />
mit der sich in der EU diversifizierte nationale Kulturen in wechselseitiger<br />
Verbundenheit weiterentwickeln.<br />
Die Forschungsleistungen von CULTMEDIA sollen auf drei Ebenen erbracht<br />
werden, die aufeinander aufbauen, allerdings nicht unbedingt nacheinander<br />
abzuarbeiten sind, insofern ihre Wechselbezüglichkeit zu berücksichtigen ist.<br />
Sie werden an dieser Stelle kurz skizziert.<br />
Abbildung 1: Übersicht zum wissenschaftlichen Design von CULTMEDIA:<br />
Forschungsebenen, Forschungsfelder und Reflexionsbezüge<br />
10
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
11
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
2.1. Begrifflich-konzeptionelle Forschungsebene: Verhältnis von Kultur<br />
und Medien<br />
Auf der „ersten“ Forschungsebene geht es darum, begrifflichkonzeptionelle<br />
Arbeiten fortzuführen, begleitend zu vertiefen und<br />
reflektierend zu überprüfen. 4 Dies geschieht ausgehend vom gegenwärtigen<br />
Stand der Forschung, die Wechselwirkungen von Kultur und Medien<br />
betreffend, der <strong>im</strong> weiteren zusammen mit seinen offenen Fragen und<br />
Problematisierungsdesideraten darzulegen sein wird. Behandelt werden sollen<br />
in diesem Zusammenhang vor allem die grundlegenden Begrifflichkeiten.<br />
Im direkten Zusammenhang der begrifflich-konzeptionellen „ersten“<br />
Ebene stehen fünf Aufgaben. Es handelt sich dabei erstens um die<br />
grundlegende Auseinandersetzung mit den vielfältigen Best<strong>im</strong>mungen des<br />
Kulturbegriffs. Zweitens soll <strong>im</strong> Zusammenhang wechselbezüglicher<br />
gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse ein Konzept der „kulturellen<br />
Transformation“ diskutiert und elaboriert werden, welches die Grundlage<br />
dafür darstellt, einen für die Untersuchung der europäischen<br />
Gegenwartsgesellschaften angemessenen Kulturbegriff zu entwerfen. Drittens<br />
geht es um einen Technikbegriff, der auch den Verbindungen von Kultur und<br />
Technik gerecht wird. Viertens ist ein grundlegender Medienbegriffs<br />
auszuarbeiten, der sowohl in der Lage ist, die Kontinuitäten von „alten“ und<br />
„neuen“ Medien als auch deren unterscheidende Charakteristika angemessen<br />
abzubilden. Im weiteren wird schließlich fünftens die Aufarbeitung der<br />
„Konvergenz“ digitaler Medien und ihrer Bedeutung vor allem <strong>im</strong><br />
Zusammenhang mit dem Internet zu behandeln sein. 5<br />
Weitere mittelbare begrifflich-konzeptionelle Ausarbeitungen stehen <strong>im</strong><br />
direkten Zusammenhang mit der empirisch-vergleichenden „zweiten“ sowie<br />
4 Parallel zu den eingangs erwähnten „state-of-the-art“-Reports sowie der Bibliografie<br />
wurde in der laufenden Projektphase auch damit begonnen, ein vergleichendes Glossar<br />
der für das Forschungsgebiet von CULTMEDIA wichtigsten Begriffe und Komposita zu<br />
erarbeiten.<br />
5 Die in dieser Aufgabenbest<strong>im</strong>mung für die zukünftige Arbeit von CULTMEDIA<br />
aufgeführten fünf Punkte werden ansatzweise <strong>im</strong> Abschnitt 4. dieses Aufsatzes<br />
behandelt.<br />
12
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
der synthetisch-konziliären „dritten“ Forschungsebene. Sie betreffen einerseits<br />
die Zusammenhänge von „Gemeinschaft“ und „Identität“, „Öffentlichkeit“<br />
und „Privatheit“, „Wissen“ und „Wirtschaften“ sowie „(Un-)Sicherheit“ und<br />
„Vertrauen“. Andererseits geht es um vertiefte Einsichten hinsichtlich<br />
„kultureller Identität“, „europäischer Identität“, „interkultureller<br />
<strong>Kommunikation</strong>“ und „europäischer Integration“.<br />
2.2. Diskursiv-vergleichende Forschungsebene: Wechselwirkungen<br />
zwischen kultureller Diversität und neuen Medien<br />
Hinsichtlich der Wechselwirkungen von kultureller Diversität und neuen<br />
Medien, genauer: ihrer Folgen für die „kulturelle Diversität“, 6 ist davon<br />
auszugehen, dass weder die These einer durchgängigen kulturellen<br />
Homogenisierung noch die These einer durchgängigen kulturellen<br />
Diversifizierung belegt werden kann. Vielmehr haben wir es mit einem<br />
Spannungsfeld zu tun, zwischen dessen beiden Polen – Homogenisierung auf<br />
der einen, Diversifizierung auf der anderen Seite – ein Terrain komplexer<br />
Überlagerungen und vielfältiger Gestaltungsoptionen erzeugt wird. Welche<br />
Formen diese Überlagerungen annehmen, hängt davon ab, wie sie<br />
gesellschaftlich gestaltet werden, welche Kontextbedingungen (sprachliche<br />
und kulturelle Verschiedenheiten der europäischen Nationen) und Kräfte auf<br />
sie einwirken. Formbest<strong>im</strong>mend für die Wechselwirkungen von kultureller<br />
Diversität und neuen Medien sind also nicht einfach nur die Charakteristika<br />
der neuen Medien, sondern, wie optionale Zusammenhänge konkret werden,<br />
unter Einwirkung von Akteurskoalitionen (Netzbetreiber, Inhalte-Anbieter,<br />
User-Gruppen, Medien- und Kulturpolitiker) und makrogesellschaftlicher<br />
Prozesse wie etwa der (wirtschaftlichen) Globalisierung, der<br />
Individualisierung oder der reflexiven Modernisierung.<br />
6 Die umgekehrte Thematisierungsrichtung, die die Wechselwirkungen von kultureller<br />
Diversität und neuen Medien hinsichtlich ihrer Folgen für diese Medien“ betrifft<br />
(„Werden sie anders <strong>im</strong>plementiert, genutzt, weiterentwickelt?“), wird hier nur in<br />
zweiter Linie behandelt.<br />
13
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
In den Zusammenhängen der Wechselwirkungen von kultureller Diversität<br />
und neuen Medien und ihrer Rolle <strong>im</strong> Prozess der europäischen Integration ist<br />
von besonderem Interesse, ob und in welchem Maße es Ähnlichkeiten und<br />
Muster <strong>im</strong> Verhältnis von Ost- und Westeuropa oder auch von Nord- und Süd-<br />
Europa gibt, ob sich Ähnlichkeiten und Unterschiedlichkeiten zu einem<br />
Muster fügen oder ob sie sich <strong>im</strong> Sinne einer Anordnung verteilen.<br />
Die zweite Ebene umfasst daher diskursiv-vergleichende Forschungen, die<br />
sich den gegenwärtigen Wechselwirkungen von kultureller Diversität und<br />
neuen Medien widmen. Zwei Aufgaben stehen hierbei für CULTMEDIA <strong>im</strong><br />
Vordergrund: Erstens soll <strong>im</strong> Zusammenhang einer Erörterung der generellen<br />
Wechselwirkungen von Medienentwicklung und Kulturwandel das<br />
Spannungsfeld von Homogenisierung und Diversifizierung näher ausgelotet<br />
werden. Zweitens sollen diese Wechselwirkungen dann <strong>im</strong> Zusammenhang<br />
mit den vier Forschungsfeldern, die <strong>im</strong> Abschnitt 3. vorgestellt werden,<br />
untersucht werden, und zwar verbunden mit dem Ziel einer vergleichenden<br />
Herausarbeitung ihrer Muster.<br />
2.3 Synthetisch-konziliäre Forschungsebene: Momente europäischer<br />
Integration<br />
Mit den Mitteln der vergleichenden Beforschung der Wechselwirkungen<br />
von kultureller Diversität und neuen Medien auf ausgewählten<br />
Forschungsfeldern sollen nicht nur Muster der jeweiligen Wechselwirkungen<br />
identifiziert, sondern es soll auch untersucht werden, in welchem Maße dieses<br />
Muster <strong>im</strong> Vergleich europäischer Nationen variiert. Statt „nur“ eine<br />
allgemeine Diskussion um kulturelle Diversität als Moment europäischer<br />
Integration zu führen, etwa darüber, ob sie als Stärke oder als Schwäche zu<br />
begreifen sei, wird die Frage nach dem Zusammenhang von kultureller<br />
Diversität und neuen Medien auf diese Weise <strong>im</strong> Kontext von vier konkreten<br />
Komplexen untersucht, die für die Entwicklung der europäischen<br />
Gegenwartsgesellschaft(en) und den Verlauf der EU-Integrationsprozesse von<br />
besonderer Bedeutung sind.<br />
14
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
Das zentrale Anliegen der „dritten“ Forschungsebene von CULTMEDIA ist<br />
dementsprechend, die Rolle dieser Wechselwirkungen als „Moment<br />
europäischer Integration“ zu untersuchen. Klärungsbedürftig sind in diesem<br />
Zusammenhang erstens die Bedeutung von „kultureller Identität“ (nationale<br />
Identitäten – europäische Identität) für den Prozess der europäischen<br />
Integration, und zwar <strong>im</strong> Zusammenhang mit ihren (jeweiligen) politischen<br />
und ökonomischen Kontextbedingungen. Zweitens geht es darum,<br />
Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der o.a. Wechselwirkungsmuster<br />
zwischen kultureller Diversität und neuen Medien auf den ausgewählten<br />
Forschungsfeldern zu ziehen. Drittens schließlich sind vor diesem Hintergrund<br />
Empfehlungen zur weiteren Ausgestaltung der Medien- und Kulturpolitiken<br />
der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zu entwickeln. Dabei geht es nicht nur um<br />
die St<strong>im</strong>migkeit ihrer Richtlinien, sondern auch um ihre Ansatzpunkte und<br />
Instrumente sowie um die Frage, ob es <strong>im</strong> Rahmen der jüngsten europäischen<br />
Erweiterung hier einen besonderen Handlungsbedarf gibt und mit welchen<br />
Maßnahmen diesem entsprochen werden kann.<br />
3. Die Ausweisung seiner vier Forschungsfelder<br />
Um die Wechselwirkungen zwischen kultureller Diversität und neuen<br />
Medien in ihrer Funktion als ein Moment der europäischer Integration<br />
aufzuarbeiten, werden sie <strong>im</strong> Vergleich europäischer Nationen untersucht.<br />
Um dabei der oben angedeuteten Breite und Vielschichtigkeit möglicher<br />
Wechselwirkungen einigermaßen gerecht zu werden, sollen die Implikationen<br />
der kulturellen Transformationen sowohl <strong>im</strong> Bereich der sozialen als auch der<br />
politischen und der ökonomischen D<strong>im</strong>ension untersucht werden. Die drei<br />
unsererseits abgegrenzten Forschungsfelder tragen aber nicht nur dem<br />
Gedanken der Erschließung dieser drei D<strong>im</strong>ensionen Rechnung, sondern sind<br />
auf drei Forschungsprobleme hin angelegt, deren Bedeutung darin liegt,<br />
gegenwärtige Veränderungsprozesse von kardinaler Bedeutung für die weitere<br />
Entwicklung Europas möglichst trennscharf erfassen zu können.<br />
15
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
- Das Forschungsfeld 1 „Privatheit und Öffentlichkeit“ erschließt die soziopolitische<br />
D<strong>im</strong>ension mit Hilfe der Leitfrage: Was verändert sich unter<br />
dem Einfluss der neuen Medien <strong>im</strong> Verhältnis von Privatheit und<br />
Öffentlichkeit?<br />
- Das Forschungsfeld 2 „Identität und Gemeinschaft“ erschließt die sozialkulturelle<br />
D<strong>im</strong>ension mit Hilfe der Leitfrage: Was verändert sich unter<br />
dem Einfluss der neuen Medien <strong>im</strong> Verhältnis von Identität und<br />
Gemeinschaft?<br />
- Das Forschungsfeld 3 „Wissen und Wirtschaft“ erschließt die sozioökonomische<br />
D<strong>im</strong>ension mit Hilfe der Leitfrage: Was verändert sich unter<br />
dem Einfluss der neuen Medien <strong>im</strong> Verhältnis von Wissen und Wirtschaft?<br />
Hinzu tritt als Querschnittsthema (und Forschungsfeld 4) der Bereich<br />
„(Un-)Sicherheit und Vertrauen“, dessen Forschungsproblem – die veränderte<br />
Balance dieser beiden für die Verfasstheit moderner Gesellschaften<br />
fundamentalen Parameter – sich <strong>im</strong> Schnittfeld der drei genannten<br />
Forschungsfelder entfaltet. Seine Untersuchung wird durch die folgende<br />
Leitfrage erschlossen: Welche <strong>Veränderungen</strong>, Problemlagen und<br />
Lösungsansätze ergeben sich hinsichtlich des Verhältnisses von<br />
(Un-)Sicherheit und Vertrauen auf den drei Forschungsfeldern „Privatheit und<br />
Öffentlichkeit“ (z.B. elektronische Signaturen), „Identität und Gemeinschaft“<br />
(z.B. Diebstahl von Identitäten) sowie „Wissen und Wirtschaft“ (z.B.<br />
unautorisierte <strong>Veränderungen</strong>)?<br />
Im Folgenden werden diese vier Forschungsfelder in Form einer knappen<br />
Skizze vorgestellt. 7<br />
7 Im Rahmen der laufenden Arbeiten von CULTMEDIA werden die vier Forschungsfelder<br />
derzeit näher ausgearbeitet. Dies geschieht zunächst durch die Formulierung von<br />
Forschungsfragen zur näheren Charakterisierung der jeweiligen zwei miteinander<br />
verschränkten Phänomene sowie ihrer Ursachen und Folgen.<br />
16
3.1 Privatheit und Öffentlichkeit<br />
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
Das erste Forschungsfeld von CULTMEDIA firmiert unter dem Titel<br />
„Privatheit und Öffentlichkeit“ („Privacy and the Public Sphere“). Im<br />
Zusammenhang von kultureller Diversität und neuen Medien geht es hierbei<br />
um die Bedingungen des Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit,<br />
insoweit sich diese durch computervermittelte <strong>Kommunikation</strong> verändern.<br />
„Privatheit“ umfasst das Recht eines jeden Individuums auf den Schutz seiner<br />
Privatsphäre. Dieses Grundrecht ist ein Bestandteil der Verfassungen<br />
moderner Gesellschaften und wird in verschiedenen internationalen<br />
Abkommen ausdrücklich anerkannt. Seit Beginn der Neuzeit fungiert es <strong>im</strong><br />
Sinne einer regulativen Idee als Basis des gesellschaftlichen Lebens, der<br />
interpersonalen <strong>Kommunikation</strong> und der sozialen Interaktion. Dieses Recht<br />
geht aus dem Interesse des Individuums an der Aufrechterhaltung eines<br />
Raums hervor, der frei von der unautorisierten Einsichtnahme und<br />
Beeinflussung durch andere Menschen, Unternehmen, Institutionen oder<br />
staatliche Organe bleiben soll. Eine D<strong>im</strong>ensionen von „Privatheit“ bezieht sich<br />
auf persönliche Verhaltensweisen und Handlungspräferenzen <strong>im</strong> Sinne<br />
sexueller, religiöser oder kultureller Praktiken. Hinzu tritt die D<strong>im</strong>ension des<br />
persönlichen <strong>Kommunikation</strong>sverhaltens bei der Inanspruchnahme<br />
entsprechender Medien und Dienste (Telefon, Email, Chat usw.). Schließlich<br />
geht es um die D<strong>im</strong>ension des Zugriffs auf persönliche Daten (Datenschutz),<br />
etwa solche medizinischer und finanzieller Art, die digital gespeichert,<br />
übermittelt und verarbeitet werden. Mit „Öffentlichkeit“ wird jener<br />
gesellschaftliche Bereich bezeichnet, der <strong>im</strong> Unterschied zum privaten Bereich<br />
(der Individuen, der Familie, auch der auf Privateigentum beruhenden<br />
wirtschaftlichen Entscheidungen) prinzipiell allen an einer Gesellschaft<br />
beteiligten Personen offen stehen soll bzw. als unabdingbare Voraussetzung<br />
der Demokratie allen Gesellschaftsmitgliedern offen stehen muss. Die<br />
Grenzziehung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen ist variabel. Sie<br />
ist historischen <strong>Veränderungen</strong> unterworfen, wird in unterschiedlichen<br />
Kulturen (etwa über Alltagspraxis oder öffentliche Meinung) verschieden<br />
17
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
best<strong>im</strong>mt und ist durch politisch-rechtliche Setzungen in der einen oder<br />
anderen Weise fixiert. Sie ist zudem abhängig von den zur Verfügung<br />
stehenden und genutzten Technologien bzw. Medien.<br />
Skizzieren lässt sich das Forschungsfeld durch die folgenden Punkte:<br />
- Veränderung in der Auffassung von Privatheit und Öffentlichkeit;<br />
- Einfluss der neuen Medien (vor allem des Internet) auf die Verschiebung<br />
des Verstehens von Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit;<br />
- Einfluss der neuen Medien auf <strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> Wertsystem des<br />
Einzelnen hinsichtlich des Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit –<br />
Universalismus und Partikularismus;<br />
- Möglichkeiten und Herausforderungen digitaler Medien hinsichtlich der<br />
Authentizität und Vertrauenswürdigkeit von Bildern und Dokumenten bzw.<br />
ihren Quellen <strong>im</strong> Zusammenhang ihrer Kulturbedeutung und ihres<br />
Einflusses auf die (politische) Urteils- und Willensbildung.<br />
3.2 Identität und Gemeinschaft<br />
Das zweite Forschungsfeld von CULTMEDIA firmiert unter dem Titel<br />
„Identität und Gemeinschaft“ („Identity and the Community“). Im<br />
Zusammenhang von kultureller Diversität und neuen Medien geht es hierbei<br />
um sich verändernde Muster individueller Identitätsbildung (<strong>im</strong> Verhältnis<br />
von personaler und sozialer Identität) sowie der Bildung von Gemeinschaften<br />
(als Assoziation zusammen lebender, interagierender oder miteinander<br />
kommunizierender Personen). Weitere Erkenntnisinteressen sind hierbei auf<br />
die Entbindung von raum-zeitlicher Nachbarschaft, auf dadurch veränderte<br />
Verhaltensnormen sowie auf veränderte Formen der In- und Exklusion<br />
gerichtet, vor allem insoweit diese Folgen für die soziale Differenzierung und<br />
die kulturelle Diversität überhaupt auslösen.<br />
Skizzieren lässt sich das Forschungsfeld durch die folgenden Punkte:<br />
- Wirkungen der Entwicklung und Einführung von Technologien der<br />
computervermittelten <strong>Kommunikation</strong> (CMC) (Internet, WWW), digitaler<br />
Medien (DM) (digital photo- and videography) und solcher zur Erzeugung<br />
virtueller Realitäten (VR) auf <strong>Kommunikation</strong>s-, Interaktions- und<br />
18
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
Wahrnehmungsprozesse, kulturelle Praktiken und unser Selbst- und<br />
Wirklichkeitsverständnis;<br />
- Frage danach, wie die Nutzung dieser Medien und Technologien das<br />
gegenwärtig praktizierte (erfahrene, erlebte, erzeugte) Verhältnis von<br />
Virtualität und Realität (Wahrnehmung, Repräsentation, Konstruktion,<br />
S<strong>im</strong>ulation, Täuschung, Raum/Zeit-Bezug) und unser (alltägliches,<br />
lebensweltliches / professionelles, wissenschaftlich-technisches / und<br />
philosophisches, reflexives) Verständnis dieses Verhältnisses verändert;<br />
- Problem der Best<strong>im</strong>mung der wesentlichen – unterscheidenden –<br />
Charakteristika von „computer mediated communication“ (CMC), digital<br />
media (DM) und „virtual-reality“-Technologien (VR) <strong>im</strong> Rahmen ihrer<br />
Anwendung und Nutzung, und zwar <strong>im</strong> Vergleich zur Verwendung<br />
analoger Technologien (Fax, Telefon, Telegrafie) sowie der<br />
massenmedialen <strong>Kommunikation</strong> (Radio, Kino, TV), der schriftlichen<br />
<strong>Kommunikation</strong> (Briefe, Bücher, Zeitungen) und der lebensweltlichen<br />
„face-to-face“-Verständigung (gesprochene, geschriebene, visuelle und<br />
hypermediale <strong>Kommunikation</strong> / uni-, bi- und multidirektionale<br />
<strong>Kommunikation</strong>);<br />
- sich verändernde Muster individueller Identitätsbildung (Ano- und<br />
Pseudonymisierung; Präsentation veränderter körperlicher,<br />
geschlechtlicher, persönlicher, ethnischer und sozialer Merkmale) durch<br />
Internet- und Mediennutzung (cyberidentity) und ihrer Folgen für<br />
interpersonale und soziale Beziehungen (Begrenzung oder Fortsetzung <strong>im</strong><br />
‚real life’; Öffnung von <strong>Kommunikation</strong> oder narzistische und autistische<br />
Tendenzen; etc.);<br />
- sich verändernde Mustern kollektiver Identitätsbildung (digital citizenship)<br />
und neuer Vergemeinschaftungen (virtual communities) durch Internet-<br />
und Mediennutzung (Interessenszentrierung; affektuelle Komponenten;<br />
Entbindung von raum-zeitlicher Nachbarschaft; Verhaltensnormen; In-<br />
und Exklusion) sowie ihrer Folgen für die soziale Differenzierung und die<br />
kulturelle Diversität überhaupt (sub-kulturelle, ethnische, regionale und<br />
nationale Identitäten; sprachliche Vielfalt).<br />
19
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
3.3 Wissen und Wirtschaft<br />
Das dritte Forschungsfeld von CULTMEDIA firmiert unter dem Titel<br />
„Wissen und Wirtschaft“ („Knowledge and the Economy“). Im<br />
Zusammenhang von kultureller Diversität und neuen Medien geht es hierbei<br />
um das sich verändernde Zusammenspiel Wissen schaffenden<br />
(wissenschaftlichen) und Wissen verwertenden (wirtschaftlichen) Tuns. In<br />
dem Maße, wie spezifische Unterschiede in der kulturell definierten<br />
Eigensinnigkeit von Aktivitäten dieser beiden Handlungsfelder bestehen, ist<br />
zu erwarten, dass sich diese <strong>im</strong> Gefolge von computervermittelter<br />
<strong>Kommunikation</strong> und Globalisierung auf unterschiedliche Art und Weise<br />
verändern. Von Bedeutung ist hierbei auch die Zunahme kultureller<br />
Reflexivität und die Relativierung kultureller Prägungen durch gesteigerte<br />
Vergleichsmöglichkeiten. Globalisierungsprozesse steigern zudem den Grad<br />
der Vernetzung der von Globalisierungsprozessen erfassten Aktivitäten, deren<br />
kulturell definierter Eigensinn sich dadurch mehr oder weniger verändert.<br />
Skizzieren lässt sich das Forschungsfeld durch die folgenden Punkte:<br />
- Folgen der Konvergenz von Technologien der elektronischen<br />
Datenverarbeitung (Computer) und der computervermittelten<br />
<strong>Kommunikation</strong> (Internet) für die gesellschaftlichen (sozio-ökonomischen,<br />
kulturellen) Zusammenhänge, Formen und Verfahren des Umgangs mit<br />
Informationen und Wissen;<br />
- Zusammenhang der Prozesse der Informationsverarbeitung, -speicherung<br />
und -übermittlung mit denen der Wissenserzeugung und -bereitstellung,<br />
besonders hinsichtlich des Transfers von Wissen <strong>im</strong> Verhältnis von<br />
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sowie seiner Nutzung und<br />
Verwertung (privat – kommerziell);<br />
- Best<strong>im</strong>mungen von Wissen in diesem Kontext (Definitionen bzw.<br />
Konzeptionen von Wesen und Funktionen; Verhältnis von Information<br />
und Wissen; Wissen als Handlungspotential; Differenzierung von Formen:<br />
kulturelles W. – wissenschaftliches W. – professionelles W. – Anwenderwissen;<br />
Orientierungswissen versus Verfügungswissen; etc.);<br />
Charakteristika veränderter Wissensformen bzw. eines allgemeinen<br />
20
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
Formwandels (Beschleunigung des Wissenszuwachses und seiner<br />
Entwertung; Kontextualisierung);<br />
- Verschiebungen <strong>im</strong> Verhältnis der Produktionsfaktoren Wissen, Arbeit,<br />
Kapital und Natur – was macht Wissen zum <strong>im</strong>materiellen Schlüsselfaktor<br />
für die Entwicklung einer Europäischen Wissensgesellschaft (European<br />
knowledge-based society);<br />
- Wissen als Ware vs. Wissen als Gemeingut (Eigentums- und<br />
Nutzungsrechte; copyright, patente);<br />
- Beziehungen zwischen kulturellem Wissen und kultureller Diversität;<br />
Folgen, Probleme und Perspektiven der Digitalisierung <strong>im</strong> Zusammenhang<br />
von Bewahrung, Weitergabe und Zugriff (access) auf das kulturelle Erbe<br />
(cultural memory, cultural heritage) (Bildung, Bibliotheken, Museen,<br />
Denkmalpflege).<br />
3.4 (Un-)Sicherheit und Vertrauen<br />
Das Forschungsproblem des Querschnittsthemas „(Un-)Sicherheit und<br />
Vertrauen“ („(In-)Security and Trust“), das zugleich das vierte Forschungsfeld<br />
von CULTMEDIA ausmacht, betrifft die veränderte Balance dieser beiden für<br />
die Verfasstheit moderner Gesellschaften fundamentalen Parameter, vor allem<br />
insofern sich dieses Problem <strong>im</strong> Schnittfeld der drei genannten<br />
Forschungsfelder in besonderer Weise entfaltet.<br />
Jegliche Nutzung von Technik setzt Vertrauen voraus, etwa hinsichtlich<br />
Funktionserfüllung, Zweckrealisierung und Verfügbarkeit. Vertrauen kann<br />
sich dabei auf einzelne Personen oder umfassendere soziale Institutionen und<br />
Systeme beziehen. Indem Vertrauen die mit jedem Schritt verbundenen<br />
Unsicherheiten kompensiert, werden Handlungsmöglichkeiten erschlossen, die<br />
ohne dieses Vertrauen nicht zustande gekommen wären. Sicherheit wird <strong>im</strong><br />
Deutschen in mindestens drei Bedeutungen verwendet: Sicherheit als<br />
Geborgenheit, als Selbstsicherheit und als Systemsicherheit (herstellbarer,<br />
berechenbarer Mittel für beliebige Zwecke). Alle drei Verwendungen sind für<br />
CULTMEDIA relevant, da sie auch jene menschlichen Hervorbringungen<br />
betreffen, die als neue Medien bezeichnet werden. Zu thematisieren ist damit<br />
21
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
das kulturelle Selbstverständnis einer Gesellschaft einschließlich ihres<br />
„Sicherheitsverständnisses“ (Sicherheitsbedürfnis, Unsicherheitserfahrung,<br />
Gefahrenvorsorge, <strong>Kommunikation</strong> über mögliche Vor- und Nachteile bzw.<br />
„Gewinne“ und „Verluste“). Damit wird zugleich die Grenze des je zeit- und<br />
kontextabhängigen akzeptablen bzw. akzeptierten Technik nutzenden<br />
Handelns (z.B. hinsichtlich des Sicherungsaufwands, des Verhältnisses von<br />
Kosten und Nutzen oder der Einfachheit der Handhabung) festgelegt, deren<br />
Überschreitung zu individuellen wie institutionellen „Abwehrreaktionen“<br />
(Ablehnung, uneffektive Nutzung, Rückgriff auf konventionelle Lösungen<br />
u.ä.) führen kann. Über das individuelle Sicherheitsbedürfnis und -verlangen<br />
hinaus haben verschiedene soziale Gruppen einen je unterschiedlichen<br />
kollektiven Umgang mit Unbest<strong>im</strong>mtheiten, Gefahren und Risiken der<br />
Technik entwickelt. Eine Lösung der mit den individuellen und subjektiven<br />
Sicherheitsbedürfnissen verbundenen Probleme kann nur in der Entwicklung<br />
von angemessenen Sicherheitskulturen in dem unauflösbaren Spannungsfeld<br />
der Integrität von Individuum und Gesellschaft liegen.<br />
Skizzieren lässt sich dieses Forschungsfeld durch die folgenden Punkte:<br />
- Balance zwischen den technischen, rechtlichen u.a. Maßnahmen zum<br />
Schutz der Privatheit und denen zum Schutz der Öffentlichkeit;<br />
- das Problem des Datenschutzes und das Maßes an realem Risiko;<br />
möglicher Missbrauch von persönlichen Daten und mögliche<br />
Manipulation mit der Identität des Menschen;<br />
- Internetkultur und Anforderungen an Datenschutz und Privatheit;<br />
- Kultur und Unsicherheit – Vulnerabilität der Infrastrukturen der Moderne<br />
am Beispiel des Internet;<br />
- länder- bzw. kulturvergleichender Blick auf den Umgang mit e-Security-<br />
Fragen <strong>im</strong> Umkreis der neuen Medien – Sicherheits„kulturen“ <strong>im</strong> engeren<br />
Sinne;<br />
- Internetkultur und Anforderungen an Datenschutz und Privatheit; die klare<br />
Identifikation der Grenzen zwischen dem Recht des Individuums an<br />
Informationen und dem Recht an Privatheit; die Zensur <strong>im</strong> Internet kontra<br />
freier Zugang zur vollständigen Informationen;<br />
22
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
- Kultur und Unsicherheit – Vulnerabilität der Infrastrukturen der Moderne<br />
am Beispiel des Internet; länder- bzw. kulturvergleichender Blick auf den<br />
Umgang mit e-Security-Fragen <strong>im</strong> Umkreis der neuen Medien –<br />
Sicherheits„kulturen“ <strong>im</strong> engeren Sinne.<br />
4. Zu seiner inhaltlich-konzeptionellen Fundierung<br />
Die Wechselwirkungen zwischen kultureller Diversität und neuen Medien<br />
entfalten sich in einer komplexen Matrix, deren vier Eckpunkte durch die<br />
Begriffe „Kultur“, „Gesellschaft“, „Technik“ und „Medien“ gesetzt sind. Sie<br />
werden in diesem Kapitel in zwei, die Zusammenhänge von Kultur und<br />
Gesellschaft einerseits und von Technik und Medien andererseits miteinander<br />
verbindenden Abschnitten erörtert.<br />
Begriffe sind nicht wahr oder falsch, sondern sie sind dem Zweck, für den<br />
sie gebraucht und konstruiert werden, mehr oder weniger angemessen, und<br />
dieser Zweck liegt bei CULTMEDIA darin, die Wechselwirkungen von<br />
kultureller Diversität und neuen Medien zu erschließen sowie<br />
nachzuvollziehen, welche Rolle sie für die europäische Integration spielen.<br />
CULTMEDIA kann sich daher nicht damit begnügen, einen einzelnen,<br />
eindeutigen Kultur-, Technik- oder Medienbegriff auszuweisen bzw. sich<br />
darauf zu stützen. Folgerichtig geht es in diesem Zusammenhang nicht darum,<br />
einzelne Best<strong>im</strong>mungen als „richtig“ oder theoretisch am weitesten<br />
„fortgeschritten“ auszuweisen. Im Gegenteil: Zunächst ist die Vielfalt der<br />
Bedeutungen zu erschließen, in denen mit diesen Wörtern in Wissenschaft und<br />
Gesellschaft(en) operiert wird, ist die Vielschichtigkeit der Diskurse zu<br />
berücksichtigen. Erst vor diesem Hintergrund ist ein Zugang zum<br />
vielgestaltigen Wechselwirkungsverhältnis von kultureller Diversität und<br />
neuen Medien zu gewinnen, zu konsolidieren und weiter auszubauen, d.h. für<br />
die anstehenden Forschungsaufgaben tragfähig zu machen.<br />
CULTMEDIA folgt auch nicht einer einzelnen Herangehensweise (die<br />
zudem <strong>im</strong> Widerspruch zu seiner erklärten Interdisziplinarität stehen würde!),<br />
sondern ist in seiner Gegenstands- und Problemerschließung einer Vielfalt<br />
23
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
wissenschaftlicher Perspektiven verpflichtet. Allerdings bedeutet das nicht<br />
Beliebigkeit: Der Ausgangspunkt ist ein gemeinsames, wenn auch „an den<br />
Rändern unscharfes“ Konzept, einschließlich best<strong>im</strong>mter begrifflicher<br />
Vorverständnisse, deren Problemadäquatheit jedoch stets einer Revision offen<br />
steht. Im Folgenden geht es um diese konzeptionell-begrifflichen<br />
Ausgangspunkte, die <strong>im</strong> Sinne erkenntnis- und handlungsleitender<br />
Präsuppositionen zu verstehen sind.<br />
4.1 Kultur und Gesellschaft(en) – ein Verhältnis <strong>im</strong> Wandel<br />
Was die „Gesellschaft“ angeht, verändern sich <strong>im</strong> Zusammenhang mit der<br />
Transformation ihrer kulturellen Grundlagen durch die breite Nutzung der<br />
neuen Medien sowohl die Wirkungsbedingungen gesellschaftlicher<br />
Teilsysteme, die Arbeitsweise von Organisationen und die<br />
Interaktionsmöglichkeiten von Individuen. Entscheidend ist aber nicht die<br />
Summe der <strong>Veränderungen</strong> in allen Interaktionsfeldern und Lebensbereichen,<br />
sondern vor allem das sich wandelnde Verhältnis der Durchdringung und<br />
Abgrenzung „lebensweltlicher“ und „systemischer“ <strong>Kommunikation</strong>s- und<br />
Handlungszusammenhänge.<br />
Differenzierungen von „Kultur“ unterscheiden herkömmlicher Weise nach<br />
Raum und Verbreitungsbereich (regionale, nationale, internationale Kulturen),<br />
nach gesellschaftlicher Akzeptanz bzw. Repräsentativität (Hochkultur,<br />
Subkulturen), nach der Sozialsystemspezifik (Industriekultur, Sportkultur),<br />
nach den Trägern (höfische Kultur, Klosterkultur, Jugendkultur) und nach der<br />
Bindung an best<strong>im</strong>mte Typen von Manifestationen (Musikkultur), wobei eine<br />
Zeitkomponente stets <strong>im</strong>manent ist.<br />
Für die Gegenwart ist davon auszugehen, dass sich die Summe dieser<br />
Teilkulturen nicht widerspruchslos zu einem Kulturganzen zusammenfügt, das<br />
allgemeinverbindliche Orientierungen abzuleiten erlauben würde. Diesem<br />
Befund entspricht auch, dass sich diese kulturelle Vielfalt in einer Vielfalt<br />
von Kulturkonzepten und -verständnissen niederschlägt.<br />
Hinsichtlich seiner Bedeutung und Verwendung gehört „Kultur“ zu den<br />
wissenschaftlich heikelsten und zugleich am meisten strapazierten Begriffen.<br />
24
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
Der Kulturbegriff hat in den letzten Jahrzehnten eine Konjunktur erlebt, die<br />
weit über die akademischen Debatten hinaus reicht. Die neuere<br />
Medienentwicklung fand vor dem Hintergrund dieser Konjunktur statt, und<br />
was als mögliche Auswirkungen der Medienentwicklung auf das Verständnis<br />
von „Kultur“ gesehen wird, hängt davon ab, welches der historisch<br />
gewachsenen Kulturkonzepte zugrunde gelegt wird.<br />
In diesem Zusammenhang ist zunächst zwischen den wichtigsten Typen<br />
von Kulturbegriffen zu unterscheiden. Eine gängige Unterscheidung ist die<br />
zwischen ethnographischen bzw. ethnologischen und jenen stark normativen<br />
Kulturbegriffen, die in der Tradition des Humanismus stehen (vgl. King 1993,<br />
S. 2). Eine weitere mögliche Unterscheidung ist die zwischen „Kultur“ als<br />
Lebensweise schlechthin (ethnologisches Kulturkonzept), als Kunst, als<br />
human gestaltete Lebensweise (engagiert normatives Kulturkonzept der<br />
humanistischen Tradition) und als symbolisch verhandelte Sphäre der Werte<br />
und Normen in der Gesellschaft (vgl. Fuchs 1999, S. 220f.).<br />
Die gegenwärtige Konjunktur des Kulturbegriffes in Wissenschaften und<br />
Politik ist nach S. J. Schmidt nicht eine Modeerscheinung, sondern ein „Indiz<br />
für eine bedeutsame gesellschaftliche Entwicklung“, eine „Entwicklung von<br />
der Dominanz von Materialitäten hin zu einer Dominanz von Wissen“, die<br />
wiederum durch die Entwicklung von Informations- und <strong>Kommunikation</strong>stechnologien<br />
maßgeblich beeinflusst wird (vgl. Schmidt 2000, S. 32ff.).<br />
4.1.1 Kultur – Territorialität – Globalisierung<br />
Als ein hervorstechendes Merkmal neuer Medien gilt die Tatsache, dass<br />
deren Ausbreitung die kulturelle Bedeutung von räumlicher Nähe und Distanz<br />
verändert. Das vernetzte Individuum wächst – so die weit verbreitete<br />
Auffassung – gleichsam mit seinen Handlungen <strong>im</strong> <strong>Kommunikation</strong>snetz über<br />
die Grenzen national verfasster Gesellschaften hinaus, die Möglichkeiten<br />
transnationalen kulturellen Austauschs und der Individualisierung steigen.<br />
Befördert wird dies durch allgemeine Tendenzen der Globalisierung, denen<br />
zumeist eine herausragende Bedeutung für den aktuellen Wandel von<br />
Kulturkonzepten beigemessen wird.<br />
25
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
In den letzten Jahren entwickelten sich durch unterschiedliche Anregungen<br />
sowohl neue Ansätze zur Erforschung des Verhältnisses zwischen dem<br />
„Westen“ und anderen Weltregionen als auch ein verstärktes Interesse an<br />
individuellen und kollektiven Aneignungsprozessen massenmedial verbreiteter<br />
Kulturinhalte. Die Bedeutung dieser Aneignungsprozesse für den kulturellen<br />
Wandel in den verschiedenen Weltregionen kann dabei in den in ihnen<br />
verfügbar werdenden alternativen (vom traditionellen räumlichen<br />
Erfahrungszusammenhang abgelösten) Lebensentwürfen liegen, in den<br />
„möglichen Leben“, die durch die Medien vermittelt werden (vgl. Appadurai<br />
1996). Angesichts der Möglichkeiten computergestützter <strong>Kommunikation</strong><br />
zwischen weit voneinander Entfernten und der zunehmenden kulturellen<br />
Bedeutung von Migrationen dürfte es zu einem weiteren Bedeutungszuwachs<br />
ethnologischer Themen – wie dem der „virtuellen Ethnizität“ und der<br />
„kulturellen Hybridisierung“ – kommen.<br />
In der Auseinandersetzung mit den traditionellen Kulturbegriffen entstehen<br />
z.Z. neue Kulturkonzepte, die – obwohl sie oft noch wenig konturiert und nur<br />
in Ansätzen ausgearbeitet sind – einige gemeinsame Charakteristika<br />
aufweisen: Das Individuum rückt wieder in den Mittelpunkt des<br />
kulturtheoretischen Interesses, wobei u.a. posttraditionalen Formen der<br />
Vergemeinschaftung und transnationalen Vernetzungen besondere Relevanz<br />
beigemessen wird. Es existiert eine Tendenz der „Verflüssigung“ und<br />
„Entterritorialisierung“ des Kulturbegriffs, eine Betonung von Aspekten des<br />
Zusammenhangs von kulturellem Wandel und kultureller Globalisierung. Hält<br />
diese Tendenz an, dürfte es zu einem zentralen Thema kulturpolitischer<br />
Debatten werden, welche Rolle ein künftiger „Transnationalstaat“ (U. Beck)<br />
hinsichtlich des weltumspannenden „Kulturraums Internet“ spielen kann.<br />
Prozesse der Individualisierung ebenso wie der Globalisierung bringen<br />
eine Relativierung der kulturellen Relevanz der durch räumliche Nähe<br />
gekennzeichneten sozialen Beziehungen mit sich. Wir sind nicht mehr <strong>im</strong><br />
selben Maße wie früher auf lokale Verortung als Quelle von Information,<br />
Erfahrung, Unterhaltung, Sicherheitsgefühl und Selbstverständnis angewiesen.<br />
Die Tendenz der Relativierung der kulturellen Relevanz räumlicher Nähe steht<br />
26
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
nach weit verbreiteter Ansicht in einem engen Zusammenhang mit der<br />
neueren Medienentwicklung, aber auch mit Migration und Tourismus. 8<br />
Polarisierungen der Art „Globalisierung vs. Lokalisierung“,<br />
„Homogenisierung vs. Heterogenisierung“ oder „Universalismus vs.<br />
Partikularismus“ führen daher nicht weiter. Dass sie die Debatten über die<br />
Wechselwirkungen von Globalisierung und Medienentwicklung trotzdem<br />
<strong>im</strong>mer noch prägen, dürfte der Neuheit der in Frage stehenden Entwicklungen<br />
geschuldet sein.<br />
4.1.2 In Richtung auf einen gegenwarts- und projektadäquaten Kulturbegriff<br />
Die Beantwortung der Frage, was unter einem zeitgemäßen Kulturbegriff<br />
zu verstehen ist, wird so zu einem der zentralen Ausgangspunkte von<br />
CULTMEDIA. Um die Arbeiten von CULTMEDIA auf der diskursivvergleichenden<br />
(„zweiten“) Forschungsebene zu fundieren, wird ein<br />
Kulturbegriff gebraucht, der es erlaubt, kulturelle Diversität so zu fassen, dass<br />
Wechselwirkungen zwischen kultureller Diversität und neuen Medien nicht<br />
nur <strong>im</strong> allgemeinen thematisierbar sind, sondern auch <strong>im</strong> besonderen auf den<br />
ausgewählten vier Forschungsfeldern (vgl. dazu Abschnitt 3.).<br />
Naheliegend ist es, in diesem Zusammenhang einen relativ weiten<br />
Kulturbegriff wählen, etwa den der Abschlusserklärung der 1982 in Mexiko<br />
abgehaltenen Weltkonferenz über Kulturpolitik. 9 Ihr Kulturbegriff ist jedoch<br />
zu allgemein, zu unspezifisch und vor allem nicht operationalisierbar.<br />
Allerdings eröffnet nur ein hinreichend weiter Kulturbegriff die Möglichkeit<br />
zu beobachten, wie sich die medialen Wandlungen auf kulturelle Strukturen,<br />
8 Die Wahrnehmung dieser Tendenz sollte aber nicht dazu verleiten, lokale Aspekte zu<br />
vernachlässigen. Dem wird versucht, mit Konzepten wie z.B. dem der „Glokalisierung“<br />
(Robertson 1998) Rechnung zu tragen.<br />
9 Darin wird hervorgehoben, „daß die Kultur in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit<br />
der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte<br />
angesehen werden kann, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen.<br />
Das schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die<br />
Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen“.<br />
27
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
Organisationsformen und <strong>Kommunikation</strong>s- und Interaktionsweisen<br />
(„kommunikatives Handeln“, Wahrheit, Authentizität etc.) auswirken.<br />
Der Ausgangspunkt unserer weiteren Überlegungen ist dessen ungeachtet<br />
weniger extensional als vielmehr genetisch: Kultur entsteht innerhalb von<br />
Prozessen kognitiver, emotionaler und praktischer Auseinandersetzung von<br />
interagierenden Individuen mit den Bedingungen ihres Handelns, die ihrerseits<br />
nicht nur soziale, sondern auch technische und ökologische D<strong>im</strong>ensionen<br />
umfassen.<br />
Angemessen für das von CULTMEDIA verfolgte Anliegen könnte folgende<br />
begriffliche Best<strong>im</strong>mung sein, die <strong>im</strong> Sinne einer ersten Annäherung zu<br />
verstehen ist: Kultur ist danach das Ergebnis menschlicher Lebens- und<br />
Daseinsbewältigung in einer Handlungs- und <strong>Kommunikation</strong>sgemeinschaft,<br />
mit anderen Worten die „raum-zeitlich eingrenzbare Gesamtheit gemeinsamer<br />
materieller und ideeller Hervorbringungen, internalisierter Werte und<br />
Sinndeutungen sowie institutionalisierter Lebensformen von Menschen“<br />
(Klein 2000). Wird Kultur so als „die Gesamtheit der bewussten und<br />
unbewussten kollektiven Muster des Denkens, Empfindens und Handelns<br />
verstanden, die von Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft sozial<br />
erworben und tradiert werden und eine spezifische, abgrenzbare Eigenschaft<br />
dieser Gesellschaft bilden“ (Hermeking 2001, S. 18), dann schließt das sowohl<br />
an die resümierenden und „klassischen“ Überlegungen von Kroeber und<br />
Kluckholm an, die in die Kultur ausdrücklich auch die „in den geschaffenen<br />
materiellen Gütern zum Ausdruck kommenden Errungenschaften“<br />
einschließen (vgl. Kroeber, Kluckholm 1952, S. 181), als auch an den<br />
Denkansatz von Arnold Gehlen, für den Kultur der „Inbegriff der Sachmittel<br />
und Vorstellungsmittel, der Sach- und Denktechniken“ ist (Gehlen 1958,<br />
S. 86).<br />
Best<strong>im</strong>mungsstücke dieses Kulturverständnisses sind vor allem:<br />
- sowohl ideelle wie materielle (vergegenständlichte, „verdinglichte“)<br />
Bereiche;<br />
- tradierte, auf Dauer angelegte Hervorbringungen;<br />
28
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
- sowohl räumlich („Gemeinschaft“) wie zeitlich begrenzte bzw.<br />
eingegrenzte (auch: abgegrenzte) materielle und ideelle „Muster“;<br />
- die Aspekte, sowohl Produkt von Handlungen als auch konditionierendes<br />
Element weiterer Handlungen zu sein.<br />
4.1.3 Kulturen des Privaten & Öffentlichen, von Identität & Gemeinschaft, von<br />
Wissen & Wirtschaften, von (Un-)Sicherheit & Vertrauen<br />
Gerade in diesem Sinne ist Kultur mehr als die Summe der Produkte eines<br />
unscharf ausdifferenzierten gesellschaftlichen Handlungsbereichs, der sich<br />
darauf spezialisiert hat, kulturelle Güter zu produzieren, auf dem<br />
„Kulturschaffende“ tätig sind, in Kunst, Musik und Literatur sowie weiteren<br />
Zweigen dieses Metiers. Kultur stellt in diesem besonderen Sinne aber auch<br />
mehr dar als einfach Lebensstile oder auch eine Menge von Normen, Werten<br />
oder Überzeugungen. Vielmehr ist sie als eine Art von Matrix zu verstehen,<br />
die Bedeutungsfelder ausweist, die best<strong>im</strong>mte Assoziationsmöglichkeiten<br />
bietet (und andere ausschließt), die sinnstiftende Begründungen für distinkte<br />
Handlungsweisen und Interaktionsmuster bereithält, die miteinander<br />
verbunden deskriptiv und präskriptiv arbeitet, also kognitiv richtiges<br />
(„funktionales“) und normativ richtiges („gutes“) Handeln oder besser<br />
Opportunitäten des Handelns ausweist.<br />
Diese kulturelle Prägung zeigt sich auch in den vier Forschungsfeldern von<br />
CULTMEDIA:<br />
- Welches distinkte Kommunizieren und Handeln „privat“ – d.h. nicht in der<br />
Öffentlichkeit – ausgeübt wird, werden kann, werden darf und werden<br />
soll, ja sogar ein Recht dazu hat, abgeschirmt und geschützt zu werden,<br />
und wo die Grenzen dieser Abschirmung und dieses Schutzes liegen, wird<br />
kulturell codiert. Umgekehrt wird kulturell umrissen und mit<br />
Begründungen versorgt, welches Handeln und Kommunizieren<br />
„öffentlich“ ausgeführt werden soll, darf oder kann, welches „öffentliche“<br />
Tun Schutz und Unterstützung verdient (z.B. Versammlungsfreiheit) und<br />
welches nicht (z.B. Aufruhr und Landfriedensbruch).<br />
29
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
- Auch „Identität“, d.h. einerseits die Möglichkeiten zur individuellen<br />
Identitätsbildung von Handlungssubjekten und andererseits deren<br />
Beachtung oder Anerkennung seitens sozialer Gemeinschaften oder der<br />
Gesellschaft insgesamt folgt einem Muster kultureller Codierung. Als<br />
sozio-kulturelle Konstruktionen stellen Geschlechter, Berufe, Herkunft<br />
oder Nationalität eine Art von Matrize zur Entwicklung und Ausbildung<br />
distinkter Ideen und Handlungsweisen dar, die eine gewisse Stabilität<br />
aufweisen, aber auch selbst geformt, verändert, für Neues geöffnet oder<br />
Anderem gegenüber abgeschirmt werden können. Gleiches gilt für<br />
religiöse oder politische Überzeugungen (Republikaner, Monarchist) oder<br />
„kulturelle“ Ausdrucksformen (Punk, Skin) und Interessensgebiete<br />
(Hacker), Identifikation mit einer Sportart (Fußballfan), mit best<strong>im</strong>mten<br />
Mannschaften (Borussia) oder Athleten, mit best<strong>im</strong>mten Musikrichtungen<br />
(Reggae), Gruppen, Stars oder Lebensformen („Bewohner“ einer digitalen<br />
Stadt, „Leben“ <strong>im</strong> „Multi User Dungeon“). Kulturell hervorgebracht wird<br />
auf diese Weise, was man glaubt (Inhalte), wie man das praktiziert<br />
(Verhaltensweisen) und wie man das entäußert (Kleidung, Frisuren,<br />
Fahnen, Erkennungszeichen), aber auch, welchen Charakters (aggressiv,<br />
friedlich, solidarisch, konkurrenzbetont usw.) die „Gemeinschaft“ ist, der<br />
die Individuen mit ihren korrespondierenden subjektiven Identitäten<br />
zugehören.<br />
- Infolgedessen prägt Kultur auch das „Wissen“ einer Gesellschaft, also die<br />
Formen des Wissens sowie deren Anerkennung als legit<strong>im</strong>e Formen und<br />
Quellen des Wissens, die Inhalte des Wissens sowie deren Anerkennung<br />
als gültig, richtig, wahr, und schließlich seine Verwendungsweisen. Auch<br />
das „Wirtschaften“ ist kein nur zweckbedingtes, kulturfreies Tun, denn<br />
Kultur setzt seine Zwecke, best<strong>im</strong>mt was Wert und Nutzen hat, vermittelt<br />
seine Formen, seine Muster (kooperativ, konkurrentiell etc.) und was<br />
überhaupt handelbare Wirtschaftsgüter (Waren) sind und was nicht (Liebe,<br />
Menschenwürde, öffentliche Güter).<br />
- Dass, was als unsicherer oder sicherer Zustand gilt, ist kein Fixum,<br />
sondern abhängig von kulturellen Vorverständnissen. Auf diese Weise<br />
werden Situationen und Handlungskontexte in unterschiedlichem Maße<br />
30
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
mit Attributen der „Unsicherheit“ oder der „Sicherheit“ belegt, was dazu<br />
führt, dass man sich in diesen Situationen oder Handlungskontexten<br />
unterschiedlich (vorsichtig) verhält. In Verbindung damit stellt<br />
„Vertrauen“, aber auch „Mißtrauen“ eine notwendige Ressource für jedes<br />
(seinen Erfolg intendierende) Handeln dar. Beide sind wiederum kulturell<br />
geprägt.<br />
4.2 Technik, Medien und computervermittelte <strong>Kommunikation</strong><br />
Für das Verständnis und den Begriff der Technik ist es – analog zum<br />
Kulturbegriff – von entscheidender Bedeutung, breit und komplex genug<br />
angelegt zu sein, um die Einbettung der Technik in kulturelle Prozesse und die<br />
Verwobenheit von Technik und Kultur systematisch bearbeiten zu können,<br />
einerseits mit den Auswirkungen des technischen Wandels auf die Kultur und<br />
andererseits mit den Einflüssen der Kultur auf die Technik. Mit diesen<br />
Zusammenhängen unlösbar verflochten sind die Bedingungen, unter denen<br />
Medien sich entwickeln und ihrerseits wirksam werden.<br />
4.2.1 In ihren kulturellen Zusammenhängen: technische Artefakte & technisches<br />
Handeln<br />
Geläufige „Definitionen“ von Technik lauten etwa: „(...) als Technik<br />
bezeichnen wir künstliche Gegenstände und Verfahren, die praktischen<br />
Zwecken dienen“ (Sachsse 1992, S. 359). Derartige Formulierungen – sie<br />
seien „enges Technikverständnis“ genannt – rücken das Gegenständliche, das<br />
„Arte-Faktische“ von Technik in den Mittelpunkt. Das ist ziemlich einseitig,<br />
da etwa die Frage nach der Entstehung von Technik nicht berührt wird.<br />
Technik ist dem Menschen nicht „gegeben“ (wie etwa die Natur), sie ist nicht<br />
– <strong>im</strong> ursprünglichen Sinne des Wortes – „naturwüchsig“ und „fällt auch nicht<br />
vom H<strong>im</strong>mel“, sondern sie muss „gemacht“, „erzeugt“, „hervorgebracht"<br />
werden.<br />
Erst vor diesem Hintergrund wird einsichtig, dass Technik nicht<br />
„natürlich“, sondern „künstlich“ ist. Hinzu kommt, dass technische<br />
Sachsysteme Mittel für die Realisierung menschlicher Zwecke darstellen. Für<br />
31
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
ein angemessenes Technikverständnis ist beides zu berücksichtigen. In einem<br />
solcherart erweiterten Technikverständnis (Technikbegriff „mittlerer“<br />
Reichweite) umfasst Technik erstens die Menge der nutzenorientierten,<br />
künstlichen, gegenständlichen Gebilde (d.h. die Artefakte oder technischen<br />
Sachsysteme), zweitens die Menge menschlicher Handlungen und<br />
Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen, und drittens die Menge<br />
menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden (vgl.<br />
Ropohl 1993, S. 672). So gefasst bezeichnet „Technik“ nicht nur die von<br />
Menschen gemachten Gegenstände („Artefakte“) selbst, sondern schließt auch<br />
deren Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge („Kontexte“) ein (also<br />
das „Gemacht-Sein“ und das „Verwendet-“ bzw. „Genutzt-Werden"). Damit<br />
wird Technik nicht als etwas Statisches angesehen, sondern zu einem Bereich<br />
mit Genese, Dynamik und Wandel.<br />
Wenn nun berücksichtigt wird, dass in den genannten Kontexten<br />
unterschiedliche Bedingungen (vor allem individueller, wissenschaftlichtechnischer,<br />
ökonomischer, rechtlicher, politischer, ökologischer und ethischer<br />
Art) von einflussnehmender Bedeutung sind, dann ist erstens einsichtig, dass<br />
mittels dieses „weite(re)n Verständnisses“ Technik nicht als isolierter,<br />
autonomer Bereich lebensweltlicher Wirklichkeit, sondern in seinem Werden,<br />
Bestehen und Vergehen als auf das engste mit Individuum und Gesellschaft,<br />
mit Politik und Wirtschaft untrennbar verflochten („vernetzt“) aufgefasst, zu<br />
einem „sozialen Phänomen“ wird. Zweitens gilt es zu begreifen, dass Technik<br />
„ihren Einsatz und ihren alltäglichen Gebrauch (...) in einem sozio-kulturellen<br />
Kontext, <strong>im</strong> Kontext kollektiver Interpretationen und Deutungen“ (Hörning<br />
1985, S. 199) findet. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass technische Objekte<br />
keinesfalls notwendigerweise so und nicht anders, wie sie uns allgegenwärtig<br />
sind, d.h. aus autonomen technischen Bedingungen, in den Alltag gelangen.<br />
Technische Sachsysteme sind in ihrer Entstehung wie in ihrer Verwendung<br />
Ausdruck sowohl eigener wie fremder („eingebauter“) Absichten und Zwecke.<br />
Trotz aller genau eingebauter und eingeschriebener Handlungsanweisungen,<br />
deren Befolgung gerade für den Laien die opt<strong>im</strong>ale Funktionsnutzung<br />
verspricht, bietet auch und gerade die Alltagstechnik oft erhebliche<br />
Spielräume der Nutzung: Aufgegriffen vom einen, schlecht eingesetzt vom<br />
32
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
anderen, ignoriert vom dritten – stets jedoch vor dem Hintergrund best<strong>im</strong>mter<br />
Nutzungserwartungen, beeinflusst durch Wertung und Werbung sowie<br />
eingebettet in best<strong>im</strong>mte gesellschaftliche und technische „Infrastrukturen“.<br />
Die „Nützlichkeit von Technik ist <strong>im</strong>mer auch etwas kulturell Interpretiertes“<br />
(Hörning 1985, S. 200). Damit wird auch deutlich, dass Kultur über die sie<br />
„tragenden“ Menschen die Implementierung und Diffusion technischer<br />
Lösungen erheblich beeinflusst, indem diese z.B. für die Realisierung von<br />
Zwecken genutzt oder nicht genutzt (abgelehnt), Modifizierungen,<br />
Nachbesserungen und Anpassungen erzwungen sowie Verhaltens<br />
„vorschriften“ für Mensch-Technik-Interaktionen hervorgebracht werden. Zu<br />
fragen wäre in CULTMEDIA deshalb nach den kulturellen Freiheitsgraden in<br />
der Aufnahme von und <strong>im</strong> Umgang mit Technik <strong>im</strong> Alltag, danach, wie<br />
unterschiedliche Gruppen, Schichten, Generationen, Kulturen mit<br />
(identischen!?) Technikangeboten umgehen.<br />
4.2.2 Medien: ihre technische und ihre sozio-kulturelle Seite<br />
Ein sich durch die Mediendiskurse ziehender Orientierungsunterschied<br />
besteht darin, Medien eher als technische Systeme einerseits oder als soziokulturelle<br />
Praktiken andererseits zu verstehen. Für das Anliegen von<br />
CULTMEDIA kommt es jedoch darauf an, sowohl die technische wie die soziokulturelle<br />
Seite der Medien zu sehen. Denn in ihren Wechselwirkungen liegt<br />
eines der relevanten Bezugsprobleme von CULTMEDIA. Um in diesem Sinne<br />
ein für CULTMEDIA adäquates Medienverständnis zu entwickeln, gilt es die<br />
Vielfalt der fachwissenschaftlichen Medienkonzepte zu durchmustern und<br />
konzeptionelle Einseitigkeiten aufzuklären.<br />
Für die Leitfrage nach dem Verhältnis von neuen Medien und Kultur stellt<br />
sich – wie generell in Diskursen über Technik und Gesellschaft – die Frage, in<br />
welchem Maße gesellschaftliche bzw. kulturelle <strong>Veränderungen</strong> notwendig in<br />
der Technik selbst angelegt sind (von der Technik sozusagen als<br />
Anpassungsleistungen „gefordert“ werden) oder in welchem Maße umgekehrt<br />
<strong>Veränderungen</strong> von den sozialen und kulturellen Praktiken, in die Technik als<br />
Mittel integriert wird, abhängig sind. Dabei ist grundsätzlich die Gefahr der<br />
33
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
Übervereinfachung in zwei – zu einseitige – Konzeptualisierungen<br />
(„Engführungen“) gegeben. In Bezug auf die (neuen) Medien lässt sich<br />
zwischen einer (eher) medientheoretischen und einer (eher)<br />
kommunikationstheoretischen Engführung unterscheiden (vgl. Rammert<br />
2000). 10<br />
Für beide Konzeptualisierungen lassen sich in der Medienwirklichkeit<br />
Belege finden. Für das Vorhaben von CULTMEDIA ist eine Entscheidung für<br />
eine der Perspektiven weder sinnvoll noch nötig. Sie können als zwei<br />
unterschiedliche und von Fall zu Fall heuristisch sinnvolle Auffassungen der<br />
in der Beziehung von Medien und Kultur angelegten Dynamik soziokulturellen<br />
Wandels festgehalten werden. 11<br />
Medium bedeutet Mittelglied, vermittelndes Element. In der<br />
<strong>Kommunikation</strong>swissenschaft bezeichnet man – davon abgeleitet – damit eine<br />
Vermittlungsinstanz für Informationen. Medien sind somit Vermittlungs-<br />
10 Die medientheoretische Engführung beruht auf der Denkfigur, dass das Medium selbst<br />
unabhängig von seiner Verwendung das Verhältnis des Menschen zur Welt verändert.<br />
Die Übertreibung dieser Denkfigur lautet: Jedes Medium schafft eine andere Weltsicht.<br />
In dieser Übertreibung liegt ein stark vereinfachtes Verständnis über den<br />
Zusammenhang von Medium und <strong>Kommunikation</strong>, nämlich dass jede neue<br />
Medientechnologie eine andere <strong>Kommunikation</strong>sweise durchsetzt und die alten Formen<br />
der <strong>Kommunikation</strong> ablöst. Die kommunikationstheoretische Engführung resultiert aus<br />
der Übertreibung der Denkfigur, dass das Medium ein neutrales Mittel sei, das neue<br />
Möglichkeiten eröffne, und dass es allein auf die menschlichen Akteure und ihre<br />
Handlungen ankomme, wie sich durch Mediennutzung die <strong>Kommunikation</strong>s- und<br />
Interaktionsverhältnisse verändern. Diese Denkfigur skaliert die Wirklichkeit der<br />
Medien auf den Umgang mit Werkzeugen zurück.<br />
11 Einseitigkeiten lassen sich dann vermeiden, wenn man analytisch folgende von Rammert<br />
vorgeschlagenen Ebenen der Dialektik von Medienstrukturen und Medienpraktiken<br />
gleichberechtigt und in ihren Wechselwirkungen berücksichtigt (vgl. Rammert 2000,<br />
S. 125): a) die Medien „als materielle Träger mit spezifischen Bezügen zu den<br />
menschlichen Sinnen und zur physikalischen Umwelt, zu zeitlichen und räumlichen<br />
D<strong>im</strong>ensionen“; b) die technischen Formen, „wie sie in Technikprojekten konkret<br />
konstruiert, in ihren körperlichen, physikalischen und zeichenhaften Elementen<br />
konfiguriert und in ihrem Kontext installiert sind“; c) die institutionalisierten Formen,<br />
„wie sie <strong>im</strong> Hinblick auf ihr Funktionieren und den Umgang mit ihnen rechtlich<br />
normiert und technisch standardisiert sind“; d) die Programme, „die angebotenen<br />
Funktionen und Dienste“; e) die Praktiken, „die Art und Weise, wie Hersteller, Anbieter,<br />
Betreiber und vor allem Nutzer mit den Medien umgehen“.<br />
34
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
systeme für Informationen aller Art (Nachrichten, Meinungen, Unterhaltung).<br />
Ihre Funktion ist der Transport von Inhalten, wobei spezifische Restriktionen<br />
des Mediums formend auf den Inhalt wirken können. Technische<br />
<strong>Kommunikation</strong>smittel (etwa in Form der Informations- und<br />
<strong>Kommunikation</strong>stechnik) dienen der Übermittlung bzw. Weiterleitung,<br />
Speicherung und Verbreitung von Informationen. 12<br />
Eine <strong>im</strong> Zusammenhang von Medien und Technik wichtige Unterscheidung<br />
ist die zwischen Pr<strong>im</strong>ärmedien, für deren Funktion der Einsatz von<br />
Technik nicht notwendig ist (z.B. Theater), Sekundärmedien, für deren<br />
Funktion der Einsatz von Technik zwar produktionsseitig, aber nicht<br />
rezeptionsseitig erforderlich ist (z.B. Tageszeitung), Tertiärmedien, für deren<br />
Funktion Technikeinsatz auf beiden Seiten nötig ist, also sowohl bei der<br />
Produktion als auch bei der Rezeption (z.B. Schallplatte). Hinzu treten die<br />
Quartärmedien, für deren Funktion neben der technischen Unterstützung von<br />
Produktion und Rezeption auch die technische Vermittlung der Distribution<br />
unabdingbar ist (Onlinemedien, welche die konventionelle Sender/Empfänger-<br />
Beziehung aufzulösen geeignet sind) (vgl. Faulstich 2000, S. 21).<br />
Im Sinne einer Arbeitsdefinition werden <strong>im</strong> vorliegenden Zusammenhang<br />
unter Medien jene sozio-technischen Systeme und kulturellen Praktiken der<br />
Verbreitung und Speicherung von Information verstanden, welche der<br />
Gestaltung von <strong>Kommunikation</strong> und Interaktion dienen und dadurch die<br />
kollektive sowie individuelle Wahrnehmung und Erfahrungsbildung in der<br />
Lebenswelt mitbest<strong>im</strong>men. Ebenfalls <strong>im</strong> Sinne einer vorläufigen Best<strong>im</strong>mung<br />
sind mit neuen Medien solche Medien gemeint, deren technische Basis auf<br />
12 Sucht man in der medienwissenschaftlichen Literatur nach einem gemeinsamen Nenner,<br />
so liegt er darin, dass Medien der Speicherung und Wiedergabe von Information und der<br />
Vermittlung von <strong>Kommunikation</strong> dienen. Kommunizieren wird üblicherweise als ein<br />
Informationsaustausch zwischen Individuen verstanden, der auf Gegenseitigkeit und<br />
Wechselwirkung basiert, Informieren dagegen als ein Prozess, der nur in eine Richtung<br />
erfolgt. Weder das Informieren noch das Kommunizieren wird notwendigerweise als ein<br />
einfaches (lineares) „Senden und Empfangen“ modelliert. Botschaften („messages“)<br />
können nicht nur als physikalische Ereignisse betrachtet werden, sondern müssen auch<br />
als „Enkodierungen“ und „Dekodierungen“, d.h. als interpretative Akte in einem<br />
sozialen „Umfeld“ und vor einem kulturellen „Hintergrund“ begriffen werden.<br />
35
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
Digitalisierung, Miniaturisierung, Datenkompression, Vernetzung und<br />
Konvergenz beruht.<br />
4.2.3 Digitale Medien: ihre Konvergenz und die Genese eines ubiquitären<br />
<strong>Kommunikation</strong>ssystems<br />
Entlang des Verständnisses von Medien als „Kanälen“ lassen sich heute<br />
(mit Faulstich 2000, S. 22) ca. zwanzig Einzelmedien unterscheiden, nämlich<br />
– in alphabetischer Reihenfolge – Blatt, Brief, Buch, Computer, Fernsehen,<br />
Film, Foto, Heft/Heftchen, Hörfunk, Internet/Online-Medien, Mult<strong>im</strong>edia,<br />
Plakat, Telefon, Theater, Tonträger (Schallplatte, Kassette, CD), Video/DVD,<br />
Zeitschrift und Zeitung.<br />
Auch die „alten“ Medien waren einmal „neu“. Jenseits des Aspekts ihrer<br />
noch ausstehenden Veralltäglichung ist die Kategorie der neuen Medien<br />
deshalb substantiell zu charakterisieren, um mit ihr in wissenschaftlichen<br />
Zusammenhängen operieren zu können. Im weiteren ist diese substantielle<br />
Charakterisierung auf einen angemessenen Begriff zu bringen, der eindeutig<br />
macht, was mit neuen Medien <strong>im</strong> engeren Forschungszusammenhang von<br />
CULTMEDIA gemeint ist. 13 Ohne schon jetzt eine befriedigende Lösung für<br />
diese Aufgabe parat zu haben, kann doch auf die grundlegende Bedeutung der<br />
Konvergenz in dieser Sache hingewiesen werden.<br />
Vor dem Hintergrund dieser medialen Konvergenz wird CULTMEDIA seine<br />
Untersuchungen zum Verhältnis von kultureller Diversität und neuen Medien<br />
auf das Internet fokussieren. Dieses ist gegenwärtig nicht nur das<br />
dominierende und dynamischste Element <strong>im</strong> Bereich der neuen Medien,<br />
sondern auch das Element mit den quantitativ wie qualitativ am weitesten<br />
13 Was den Aspekt ihrer materiellen Träger oder ihren Objektbereich angeht, lassen sich<br />
die neuen Medien grob eingrenzen als Bereich mikroelektronisch basierter Hard- und<br />
Software-Technologien. „Kern dieser Technologien sind hoch leistungsfähige Computer<br />
verschiedenster Formen, deren Besonderheit unter anderem darin besteht, dass sie nicht<br />
darauf beschränkt sind, isoliert zu arbeiten, sondern sowohl lokal (...) als vor allem auch<br />
überörtlich und letztlich weltweit (...) nahezu unbegrenzt vernetzbar sind und dabei<br />
gleichberechtigt wechselseitigen Austausch („Interaktivität“) erlauben. Damit werden<br />
diese Anlagen zu einem Hilfsmittel (...) für individuelle und überindividuelle<br />
<strong>Kommunikation</strong> in allen Sphären der Gesellschaft“ (Boehnke et al. 1999, S. 9).<br />
36
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
reichenden Folgewirkungen sozio-politischer, sozial-kultureller und sozioökonomischer<br />
Art.<br />
Internet steht für „Interconnected Networks“. Es ist ein Verbund von<br />
Rechner-Teilnetzen, in dem paketvermittelt (TCP/IP) digitale Daten<br />
ausgetauscht werden. Das Internet verbindet mehr oder weniger autonome<br />
Computer zum Zwecke des Datenaustausches. Die Universalität der Computer<br />
prägt sich hierbei dem Netz auf und gewinnt mit der globalen Vernetzung eine<br />
neue raum-zeitliche D<strong>im</strong>ension. Das Internet ist die Synergie aus Computer<br />
und globalem Netzverbund: Ein Zwitter, teils Computer-Netzwerk teils<br />
Netzwerk-Computer, teils den Nutzer int<strong>im</strong> individualisierend teils global<br />
vergemeinschaftend.<br />
Das Internet gewinnt seine Leistungsfähigkeit und seine Entwicklungspotenzen<br />
u.a. aus<br />
- der Universalität der es konstituierenden Computer;<br />
- der Digitalisierbarkeit aller Informationen und ihrer Behandlung als Daten;<br />
- der Effizienz des paketvermittelten Datenaustausches;<br />
- der Festschreibung von Standards, die auf allen Computern arbeiten;<br />
- der einfachen Handhabbarkeit der WEB-Browser als universelles<br />
Computerinterface;<br />
- der Leistungsfähigkeit der Hypertext Technologie, die komplexe Datenstrukturen<br />
unauffällig einzubetten vermag;<br />
- der Interaktivität und der Mitgestaltungsfähigkeit des WWW;<br />
- der hohen Verbreitung.<br />
Bereits heute modifiziert, ergänzt bzw. ersetzt das Internet eine Vielzahl<br />
historisch gewachsener Kulturtechniken: Es ist ein<br />
- individuelles <strong>Kommunikation</strong>smedium (Telefon, Videofon, Email, Chat);<br />
- Unterhaltungsmedium (Film, Fernsehen, Radio, Online-Spiele u.v.a.m.);<br />
- Informationsmedium (Zeitungen, Bücher, Magazine, Büchereien, Daten-<br />
bänke);<br />
- Medium der Wissensverarbeitung, das – unterstützt durch Spracherkennung<br />
und -synthese, (Hand)-Schriftenerkennung und Klassifikation<br />
37
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
graphischer Daten – zur Potenzierung menschlicher Intelligenzleistungen<br />
führt;<br />
- Handelsmedium (Kauf, Verkauf, Versteigerung);<br />
- Medium der direkten Verteilung <strong>im</strong>materieller Güter (Printmedien, Musik,<br />
Filme, Finanztransaktionen, Bildung, Beratung);<br />
- Medium der Fernsteuerung, Fernwartung, Fernüberwachung, d.h. ein<br />
„Verbundrechner“;<br />
- Medium der Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung;<br />
- Medium, das durch seine globale Verbreitung und seinen schnellen Datenfluss<br />
die raumzeitlichen Koordinaten der Nutzer modifiziert.<br />
Als Netzverbund entstanden, vermag das Internet alle traditionellen Netze<br />
(<strong>im</strong> Rahmen ihrer Digitalisierung) und alle neu entstehenden Netze (UMTS<br />
u.ä.) zu integrieren. Damit qualifiziert sich das Internet zu einem<br />
herausragendenden Gegenstand bei der Analyse der kulturellen<br />
<strong>Veränderungen</strong>, die mit dem Aufkommen der neuen Medien verbunden sind.<br />
Ein weiterer Grund für CULTMEDIA, sich in der Beforschung des<br />
Verhältnisses von kultureller Diversität und neuen Medien auf das Internet zu<br />
konzentrieren, liegt in der Bedeutung, die dem Internet in öffentlichen<br />
Debatten beigemessen wird, als Motor gesellschaftlichen und als Triebfeder<br />
kulturellen Wandels.<br />
4.2.4 Reflexionsbezüge, Charakteristika und Bedeutung der neuen Medien<br />
Um besser erschließen zu können, von welcher Gestalt und Bedeutung die<br />
kulturellen Transformationen sind, die sich in Verbindung mit der<br />
Entwicklung der neuen Medien ergeben, dienen zwei Reflexionsbezüge,<br />
einerseits das Verhältnis von „Realität und Virtualität“ und andererseits das<br />
von „Raum und Zeit“. Beide Reflexionsbezüge sollen systematisch, d.h. auf<br />
allen drei Forschungsebenen von CULTMEDIA sowie seinen vier Forschungsfeldern<br />
berücksichtigt werden. Entscheidend ist dabei, dass die kulturellen<br />
Transformationen nicht einfach eine Folge erweiterter Möglichkeiten der<br />
<strong>Kommunikation</strong> und Symbolverarbeitung oder auch deren breiterer Nutzung<br />
38
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
sind, sondern dass sich die neuen Medien wesentlich dadurch auszeichnen,<br />
dass sie die Verhältnisse von Virtualität und Realität und von Raum und Zeit<br />
in einem bisher unbekannten Ausmaß verändern, verfügbar und gestaltbar<br />
machen, sie auf eine komplexe Weise „umstricken“. Statt der Vertretung<br />
eind<strong>im</strong>ensionaler Thesen, etwa eines „weicheren“ Realitätsbezugs durch<br />
Virtualität oder einer „Schrumpfung“ des Raumes durch elektronische<br />
<strong>Kommunikation</strong>, soll auf diese Weise thematisiert werden, welche<br />
Gestaltungspotentiale den neuen Medien innewohnen, um neue Verhältnisse<br />
zu erzeugen, z.B. durch den jederzeit und weltweit möglichen Zugang zu<br />
einem enormen Reservoir an Informationsquellen und Wissensbeständen.<br />
Das Neuartige, das von den digitalen Medien hervorgebracht wird, sind die<br />
verschiedenen Möglichkeiten, mit Hilfe dieses einen Mediums konvergenter<br />
neuer Medien unterschiedliche <strong>Kommunikation</strong>smuster gleichermaßen gut zu<br />
realisieren: 1:1 – eine Person kann zu einer einzelnen anderen eine<br />
<strong>Kommunikation</strong> herstellen; 1:n – einer kann sich an viele wenden; m:1 – viele<br />
wenden sich an einen einzelnen; m:n – viele wenden sich an viele. Auf dieser<br />
Grundlage sind neue Mischungsformen möglich, so wenn in einer E-Mail an<br />
einen einzelnen Adressaten <strong>im</strong> „CC“ eine Reihe von Personen zu „Mitlesern“<br />
gemacht werden, die insoweit an der Themengemeinschaft des Absenders<br />
teilhaben können. In diesem Kontext ist auch der Begriff der „virtuellen<br />
Gemeinschaften“ von Belang, wobei allerdings u.a. zwischen dem Kern und<br />
der Peripherie, also den „flüchtigen Besuchern“ solcher Gemeinschaften, zu<br />
unterscheiden ist.<br />
Durch die Digitalisierung werden Daten umfassend neu kombinierbar,<br />
denn sie bedeutet die Codierung von Information in diskreten Zeichenketten.<br />
Diese, und mit ihnen die digitalisierte Information, können dann verlustfrei<br />
gespeichert und kommuniziert, aber auch in Teile zerlegt sowie in veränderter<br />
Weise kombiniert und transformiert werden. Darüber hinaus werden<br />
Möglichkeiten ihrer weitgehend spurenlosen Manipulation, ihrer praktisch<br />
nicht kontrollierbaren Speicherung an unbekannten Orten und ihres<br />
unbemerkbaren Kopierens eröffnet. Digitale Informationstechnik löst die<br />
diskreten Zeichenketten weitestgehend von materiellen Trägern, indem<br />
39
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
Speicherung und Übertragung mittels einer binären Codierung vorgenommen<br />
werden. Ermöglicht wird eine nahezu vollkommene Flexibilität des Umgangs<br />
mit digitalisierter Information. Ihre Kehrseite ist die Entstehung neuer Formen<br />
der Technikabhängigkeit, z.B. von jeweils neuesten Programmversionen oder<br />
Technikgenerationen.<br />
Das Internet, Grundlage von Online-Information und -<strong>Kommunikation</strong>, ist<br />
– als ein globales, die Medienentwicklung umfassend veränderndes<br />
Übertragungssystem – für CULTMEDIA von besonderem Interesse. Innerhalb<br />
der Medien- und <strong>Kommunikation</strong>swissenschaften ist die Best<strong>im</strong>mung von<br />
Online-Medien noch umstritten. Eine am Verhältnis von Produktion und<br />
Rezeption ansetzende Unterscheidung von Massen-, Gruppen- und<br />
Individualkommunikation verbietet sich, weil Online-Medien die „Rollenasymmetrie<br />
von Sender und Empfänger“ auflösen. Für eine Untersuchung sind<br />
verschiedene <strong>Kommunikation</strong>sformen <strong>im</strong> Internet und Internet-Dienste zu<br />
unterscheiden.<br />
In diesem Zusammenhang sind <strong>Veränderungen</strong> von Identitäten, sozialen<br />
Beziehungen und sozialen Gruppen durch das Internet von besonderer<br />
Relevanz. Beispielhaft sei dies <strong>im</strong> Folgenden hinsichtlich der Feststellung<br />
dargelegt, dass via Internet ein von der persönlichen Begegnung deutlich<br />
abweichender interpersonaler Austausch stattfinden kann. Für diesen hat sich<br />
der Begriff der „Computer-Mediated Communication“ (CMC) eingebürgert,<br />
wobei bisher zumeist textvermittelte <strong>Kommunikation</strong> gemeint ist. Zur<br />
Unterscheidung zwischen den verschiedenen Aspekten der CMC weist Döring<br />
auf die natürliche Grundform menschlicher <strong>Kommunikation</strong> hin, die „Face-to-<br />
Face-Situation“: Bei dieser sind wir zur selben Zeit am selben Ort (körperliche<br />
Ko-Präsenz) und tauschen verbale und non-verbale Botschaften aus.<br />
<strong>Kommunikation</strong>smedien befreien die interpersonale <strong>Kommunikation</strong> von der<br />
Restriktion (oder auch vom Vergnügen) der Ko-Präsenz und ermöglichen es,<br />
mit räumlich entfernten Personen in Kontakt zu treten (vgl. Döring 1998,<br />
S. 34).<br />
Weit verbreitet ist die Unterscheidung von zwei Formen der<br />
<strong>Kommunikation</strong>: der zeitversetzten, asynchronen <strong>Kommunikation</strong> (z.B. Brief,<br />
40
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
Email, Telefax, Telegramm, Nachricht auf dem Anrufbeantworter) und der<br />
zeitgleichen, synchronen <strong>Kommunikation</strong> (z.B. Telefonieren, Chatten,<br />
Videokonferenzen). Bei der CMC sind – vor allem durch Email, Newsgroups<br />
und WWW-Sites – asynchrone und – vor allem durch „Internet Relay Chat“<br />
(IRC) – synchrone Verbindungen möglich. Von besonderer Bedeutung und<br />
viel diskutiert ist die Möglichkeit anonymer <strong>Kommunikation</strong> <strong>im</strong> Internet.<br />
Bei der synchronen CMC ändern sich <strong>Kommunikation</strong>svorgänge<br />
fundamental, weil eine virtuelle Handlungsebene zum Tragen kommt. Es wird<br />
nicht nur kommuniziert, sondern auch virtuell interagiert, z.B. in den<br />
Spielwelten der „Multi User Dungeons“ (MUDs).<br />
Über nationale und kulturelle Grenzen hinweg kommunizieren Menschen<br />
miteinander, die sich nicht mehr <strong>im</strong> klassischen Sinne kennen. Die durch das<br />
Internet ermöglichte anonymisierte Form der <strong>Kommunikation</strong> löst die in der<br />
<strong>Kommunikation</strong> unter Anwesenden stets gegebenen Formen der<br />
Verbindlichkeit auf. In Chatrooms oder Newsgroups des Internet, die die<br />
meisten Vorstellungen über elektronische oder virtuelle Gemeinschaften<br />
best<strong>im</strong>men, finden sich verschiedenartige Gruppen über das Thema<br />
zusammen, dort werden die Informationen zwischen vielen Sendern und<br />
Empfängern transportiert. Auf den durch die Anonymität der <strong>Kommunikation</strong><br />
gegebenen Mangel an Verbindlichkeit reagieren die Gruppen durch eigene<br />
gemeinsame Verhaltensregeln (z.B. Netiquette oder Online-Slang). Im Falle<br />
geschäftlicher Transaktionen über das Internet stellen Anonymität und<br />
(Un-)Verbindlichkeit ein Problem dar, auf das durch die Schaffung von<br />
technischen Substituten für herkömmliche Formen der geschäftlichen<br />
Verbindlichkeit reagiert wird (z.B. elektronische Signatur).<br />
Bedeutsam für CULTMEDIA ist auch die These, dass sich aus der<br />
Medienentwicklung neue Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe und<br />
politischen Organisierung ergeben. Allerdings richtet sich dabei das<br />
Hauptaugenmerk oft auf Menschen in den ärmeren Ländern der Welt und<br />
weniger auf die Unterschichten in den wohlhabenderen Staaten. Exemplarisch<br />
interessant ist hierbei eine Untersuchung des Internet von J. Slevin, die sich<br />
41
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
u.a. auf Theorien von Giddens stützt (vgl. Slevin 2000). 14 Sie interessiert sich<br />
vor allem für die Frage, wie das Internet die Beziehungen zwischen lokalen<br />
Aktivitäten und der „(inter)action across distance“ verändert, und wie es dazu<br />
genutzt werden kann, den Einfluss von Globalisierungsprozessen auf die<br />
Gesellschaft(en) besser zu kontrollieren. Die Globalisierung versteht Slevin<br />
als ein „inherent feature of the modern world“, dessen Ursprünge historisch<br />
sehr weit zurück reichen. Durch die Globalisierung komme es derzeit zu einer<br />
Neuordnung von Raum und Zeit, wobei das Handeln über Distanzen hinweg<br />
von zentraler Bedeutung sei. Das Internet besitze in diesem Zusammenhang<br />
eine ausgesprochen wichtige Rolle, da es eben dieses Handeln entscheidend<br />
erleichtern könne.<br />
Neue Medien verändern die kulturelle Bedeutung von räumlicher Nähe<br />
und Distanz. Das vernetzte Individuum wächst – so eine verbreitete<br />
Auffassung – mit seinen interaktiven und kommunikativen Handlungen über<br />
die Grenzen lokaler Gemeinschaft und nationaler Gesellschaften gleichsam<br />
hinaus und kann am transnationalen kulturellen Austausch partizipieren. Vor<br />
allem verändert die aktuelle Medienentwicklung die kulturell bedeutsamen<br />
Funktionen räumlicher (aber auch historisch-zeitlicher) Nähe und Ferne, wie<br />
z.B. <strong>im</strong> Fall der Entkopplung von räumlicher Nähe einerseits und der Bildung<br />
kultureller Zusammengehörigkeitsgefühle sowie der Behauptung kultureller<br />
Identität andererseits (Stichwort „Entterritorialisierung von Kultur“): Aus<br />
territorial lokalisierten, gleichsam kompakten kulturellen Traditionen können<br />
auf massenmedialer Grundlage insulär verteilte werden. Durch den aktuellen<br />
Globalisierungsschub <strong>im</strong> Medienbereich ändert sich so die wichtige Rolle,<br />
welche Massenmedien seit drei Jahrhunderten bei der sozialen Konstruktion<br />
„<strong>im</strong>aginierter Gemeinschaften“ (bislang vor allem: Völker, Nationen) gespielt<br />
haben. Zudem werden nun neue Medien der Identitätspolitik kleiner und<br />
14 A. Giddens sieht einen engen Zusammenhang zwischen den Prozessen der<br />
raumzeitlichen Abstandsvergrößerung, der Entbettung der sozialen Systeme (des<br />
„Heraushebens“ sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusammenhängen<br />
und ihre unbegrenzte Raum-Zeit-Spannen übergreifende Umstrukturierung) und<br />
der Globalisierung, die für die Moderne kennzeichnend seien. Die genannten drei<br />
Prozesse wurden und werden nach seiner Ansicht grundlegend von der Medienentwicklung<br />
beeinflusst (vgl. Giddens 1990).<br />
42
<strong>Veränderungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Quadrat</strong><br />
spezialisierter Arten von Gemeinschaften und anderen kulturell relevanten<br />
sozialen Zusammenhängen dienstbar (z.B. neuen sozialen Bewegungen,<br />
Nichtregierungsorganisationen, transnationalen Konzernen und ethnischen,<br />
sexuellen oder anderen Minderheiten).<br />
5. Ausblick<br />
Die Komplexität und Dynamik des „quadratischen“ Verhältnisses der in-<br />
und extensiven Wechselwirkungen von Kultur, Gesellschaft, Technik und<br />
Medien ist nicht nur von überragender Bedeutung für die Zukunft Europas.<br />
Sie hat auch ein Forschungsgebiet hervorgebracht, welches „jenseits“ des<br />
disziplinären Zuschnitts einzelner Wissenschaften liegt. Darüber hinaus<br />
verlangt seine Erschließung, unbedingt auch interkulturell miteinander zu<br />
kooperieren.<br />
Das europäische Forschungs-Netzwerks „Kulturelle Diversität und neue<br />
Medien“, dessen Design hier vorgestellt wurde, wird gegenwärtig von<br />
vierzehn Instituten aus acht Ländern getragen. Weitere „Netzknoten“ sind<br />
nicht nur erwünscht, sondern auch erforderlich, um sowohl die theoretische als<br />
auch die empirische Basis der Untersuchungen verbreitern zu können.<br />
Interessierte Forschungsgruppen sind deshalb zur Mitarbeit recht herzlich<br />
eingeladen.<br />
Literatur<br />
Appadurai, A. (1998): Modernity at Large. Cultural D<strong>im</strong>ensions of Globalization. 4. Aufl.<br />
Minneapolis u.a.<br />
Boehnke, K.; Dilger, W.; Habscheid, S.; Holly, W.; Keitel, E.; Krems, J.; Münch. T.<br />
(1999): Neue Medien <strong>im</strong> Alltag: Von individueller Nutzung zu soziokulturellem Wandel.<br />
Lengerich u.a.<br />
Döring, N. (1998): Sozialpsychologie des Internet. Göttingen u.a.<br />
Faulstich, W. (2000): Medium. In: Faulstich, W. (Hrsg.): Grundwissen Medien. 4. Aufl.<br />
München, S. 21-108.<br />
Fuchs, M. (1999): Mensch und Kultur. Zu den anthropologischen Grundlagen von<br />
Kulturarbeit und Kulturpolitik. Opladen u.a.<br />
Gehlen, A. (1958): Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. 6. Aufl. Bonn.<br />
43
Gerhard Banse, Andreas Metzner-Szigeth<br />
Giddens, A. (1990): The Consequences of Modernity. Stanford/Cal.<br />
Klein, H.-J. (2000): Kultur. In: Schäfers, B. (Hrsg.): Grundbegriffe der Soziologie. 6. Aufl.<br />
Opladen, S. 196-199.<br />
Hermeking, M. (2001): Kulturen und Technik. Techniktransfer als Arbeitsfeld der<br />
Interkulturellen <strong>Kommunikation</strong>. Beispiele aus der arabischen, russischen und<br />
lateinamerikanischen Region. Münster u.a.<br />
Hörning, K. H. (1985): Technik und Symbol. Ein Beitrag zur Soziologie alltäglichen<br />
Technikumgangs. In: Soziale Welt, S. 185-207.<br />
King, A. (1993): Introduction: Spaces of Cultures, Spaces of Knowledge. In: King. A.<br />
(Hrsg.): Culture, Globalization and the World-System. Contemporary Conditions for the<br />
Representation of Identity. Binghamton/N.Y., S. 1-18.<br />
Kroeber, A. L.; Kluckhohn, C. (1952): Culture. A Critical Review of Concepts and<br />
Definitions. Cambridge/Mass.<br />
Paschen, H.; Wingert, B.; Coenen, Ch.; Banse, G. (2002): Kultur – Medien – Märkte.<br />
Medienentwicklung und kultureller Wandel. Berlin.<br />
Rammert, W. (2000): Virtuelle Realitäten als medial erzeugte Sonderwirklichkeiten.<br />
<strong>Veränderungen</strong> der <strong>Kommunikation</strong> <strong>im</strong> Netz der Computer. In: Rammert, W.: Technik aus<br />
soziologischer Perspektive II. Opladen, S. 115-128.<br />
Robertson, C. Y. (1998): Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum und<br />
Zeit. In: Beck, U. (Hrsg.): Perspektiven der Weltgesellschaft. Frankfurt a.M., S. 192-220.<br />
Ropohl, G. (1993): Technik. In: Brockhaus-Enzyklopädie. Bd. 21. Mannhe<strong>im</strong>, S. 672-674.<br />
Sachsse, H. (1992): Technik. In: Seiffert, H.; Radnitzky, G. (Hrsg.): Handlexikon zur<br />
Wissenschaftstheorie. München, S. 358-361.<br />
Schmidt, S. J. (2000): Kalte Faszination. Medien Kultur Wissenschaft in der<br />
Mediengesellschaft. Weilerswist.<br />
Slevin, J. (2000): The Internet and Society. Cambridge.<br />
Banse, Gerhard; Professor Dr. sc. phil.<br />
Forschungszentrum Karlsruhe; Institut für Technikfolgenabschätzung und<br />
Systemanalyse; Deutschland<br />
Postfach 3640, D – 76021 Karlsruhe<br />
banse@itas.fzk.de<br />
Metzner, Andreas; PD Dr. habil.<br />
Institut für Management & Sustainability Issues<br />
Münster, Humperdinckstraße<br />
metzner@uni-muenster.de<br />
44