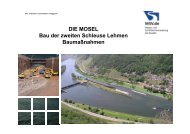Natura 2000-Erheblichkeitsabschätzung - Verbandsgemeinde ...
Natura 2000-Erheblichkeitsabschätzung - Verbandsgemeinde ...
Natura 2000-Erheblichkeitsabschätzung - Verbandsgemeinde ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
VERBANDSGEMEINDE UNTERMOSEL<br />
BAULEITPLANUNG<br />
15. ÄNDERUNG<br />
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN<br />
AUSWEISUNG EINES SONDERGEBIETES<br />
IN DER ORTSGEMEINDE BURGEN<br />
„TEMPORÄRE ABSTELLFLÄCHE FÜR<br />
CAMPINGFAHRZEUGE UND BOOTE“<br />
- NATURA <strong>2000</strong>-ERHEBLICHKEITS-ABSCHÄTZUNG
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
3<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Auftraggeber:<br />
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
Auftragnehmer:<br />
WeSt<br />
Stadtplaner<br />
WeSt-Stadtplaner<br />
Tannenweg 10<br />
56751 Polch<br />
Telefon: 02654/964573<br />
Fax: 02654/964574<br />
Mail: west-stadtplaner@t-online.de<br />
Bearbeitung:<br />
Dipl.-Ing. Dirk Strang<br />
Verfahren:<br />
Beteiligung der Öffentlichkeit<br />
nach § 3 (2) BauGB und der Behörden sowie<br />
sonstiger Träger öffentlicher Belange<br />
nach § 4 (2) BauGB<br />
Projekt:<br />
Ausweisung eines Sondergebietes<br />
in der Ortsgemeinde Burgen<br />
„Temporäre Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
Stand:<br />
September 2012<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
4<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
1 AUSGANGSSITUATION ................................................................................................................5<br />
2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS ............................................................................................6<br />
2.1 Räumliche Lage .................................................................................................................6<br />
2.2 Verkehr ...............................................................................................................................6<br />
2.3 Nutzung ..............................................................................................................................6<br />
2.4 Ver- und Entsorgung .........................................................................................................7<br />
2.5 Topographie .......................................................................................................................7<br />
2.6 Schutzgebiete ....................................................................................................................7<br />
2.7 Vorhaben ............................................................................................................................8<br />
3 AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS ...........................................................................................9<br />
3.1 Baubedingte Auswirkungen ..............................................................................................9<br />
3.2 Anlagenbedingte Auswirkungen ..................................................................................... 10<br />
3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen .................................................................................... 11<br />
4 ERHEBLICHKEITSABSCHÄTZUNG ZUM FFH-GEBIET „MOSELHÄNGE UND<br />
NEBEN-TÄLER“........................................................................................................................... 11<br />
4.1 <strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong> zum FFH-Gebiet Nr. 5809-301 „Moselhänge und Nebentäler<br />
der unteren Mosel“ ............................................................................................................. 11<br />
5 ERHEBLICHKEITSABSCHÄTZUNG ZUM VSG-GEBIET NR. VSG-5809-401 „MITTEL- UND<br />
UNTERMOSEL“ ........................................................................................................................... 22<br />
5.1 <strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong> zum VSG-Gebiet Nr. 5809-401 „Moselhänge und Nebentäler<br />
der unteren Mosel“ ............................................................................................................. 22<br />
6 Abschätzung von Beeinträchtigungen für die <strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-Gebiete......................................... 31<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
5<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
1 AUSGANGSSITUATION<br />
Die <strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel beabsichtigt die 15. Änderung des Flächennutzungsplans.<br />
Inhalt der Planänderung ist die Darstellung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung<br />
„Temporäre Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“.<br />
Durch die vorliegende 15. Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die<br />
Erweiterung einer bereits bestehenden Abstellfläche geschaffen werden. Mit der Erweiterung<br />
soll der bestehenden Nachfragesituation nach Abstellflächen für Campingfahrzeuge und<br />
Boote insbesondere in den Wintermonaten begegnet werden.<br />
Die bestehende Abstellfläche wurde durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am<br />
01.06.2001 genehmigt. In der Baugenehmigung wurde klar zum Ausdruck gebracht, dass die<br />
Fläche nur für das Abstellen von Campingfahrzeuge genutzt werden darf. Ein campingartiges<br />
Verhalten bzw. die Errichtung eines Campingplatzes waren nicht Bestandteil der Baugenehmigung<br />
und sind somit nicht zulässig.<br />
Zur Begründung des Planungserfordernisses werden insbesondere die in § 1 (6) Nr. 8<br />
BauGB verankerten Belange der Wirtschaft angeführt. Die <strong>Verbandsgemeinde</strong> begründet die<br />
Planung auf der Grundlage der Planungsleitlinie des § 1 (6) Nr. 8 a Baugesetzbuch. Demnach<br />
hat eine planende Gemeinde u.a. die Aufgabe, die Belange der Wirtschaft durch ein<br />
ausreichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechendes Flächenangebot zu berücksichtigen.<br />
Im vorliegenden Fall ist es für die <strong>Verbandsgemeinde</strong> in Abstimmung mit der Ortsgemeinde<br />
von Bedeutung, die Standortinteressen des ortsansässigen Unternehmens an der weiteren<br />
Ausnutzung des vorhandenen Bestandes sowie das Bedürfnis nach Betriebserweiterung zu<br />
gewährleisten. Die konkret geäußerte Erweiterungsabsicht hat die <strong>Verbandsgemeinde</strong> zur<br />
Ausweisung des Sondergebiets veranlasst.<br />
Damit will die Ortsgemeinde einen Beitrag für eine „aktive“ Wirtschaftsförderung mit dem Ziel<br />
der Erhaltung und Ausbau von Wirtschaftskraft vor Ort leisten.<br />
Ein weiteres Ziel ist die die Bereitstellung des beschriebenen Flächenangebotes für den<br />
Campingtourismus an der Mosel. Auf diese Weise kann eine „Bindung“ der Campingtouristen<br />
an die Erholungs- und Urlaubsregion „Mosel“ erfolgen, was sich wiederum positiv für den<br />
auf (Camping) Touristen ausgerichteten Wirtschaftszweig auswirken dürfte.<br />
Südöstlich grenzen an den Änderungsbereich<br />
• das FFH-Gebiet DE-5809-301 „Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel“ sowie<br />
• das Vogelschutzgebiet DE-5809-401 „Mittel- und Untermosel“.<br />
Es gilt zu klären, ob durch die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungsplans Auswirkungen<br />
für die genannten Schutzgebiete zu erwarten sind, die eine Umsetzung der Planung<br />
i.S. des § 1 (3) BauGB in Frage stellen oder in Gänze ausschließen.<br />
Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Ebene des Flächennutzungsplans keine verbindlichen<br />
Baurechte geschaffen werden.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
6<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS<br />
2.1 Räumliche Lage<br />
Die Siedlungspotenzialfläche liegt nordöstlich des Siedlungskörpers von Burgen. Unmittelbar<br />
angrenzenden befinden sich die gemeindlichen Sportstätten wie Sportplatz und Schützenhaus.<br />
Die Mosel verläuft nordwestlich in einer Entfernung von ca. 150 m. Die südöstliche Grenze<br />
des Änderungsbereichs bildet eine zusammenhängende Waldfläche.<br />
Der Änderungsbereich weist eine Größe von etwa 1.530 m² auf.<br />
Abb.: Lage der Baulandpotenzialflächen, Quelle TK 25.000 Landesamt für Vermessung und Geobasisinformationen<br />
2.2 Verkehr<br />
Die Siedlungspotenzialfläche ist über die gemeindliche Erschließungsstraße „Schulstraße“<br />
erschlossen. Nordwestlich verläuft in einer Entfernung von etwa 80 die Bundesstraße B 49.<br />
2.3 Nutzung<br />
Die Potenzialfläche selbst sowie die angrenzenden Flächen sind aus bauplanungsrechtlicher<br />
Sicht dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
7<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Die umliegenden Flächen werden größtenteils als extensive Wiesen mit Streuobstbestand<br />
genutzt. Einzelne Flächen werden für die Pferdehaltung genutzt.<br />
Südöstlich grenzt – wie bereits erwähnt – eine zusammenhängende Waldfläche an.<br />
Der Campingplatz in der Ortsgemeinde Burgen liegt in einer Entfernung von ca. 170 m<br />
nordwestlich der Abstellfläche.<br />
Eine Einzelbebauung sowie die gemeindlichen Sportstätten befinden sich nordöstlich des<br />
Änderungsbereichs.<br />
Die nächstgelegene, im Zusammenhang bebaute Wohnbebauung von Burgen ist südwestlich<br />
des Änderungsbereichs in einer Entfernung von ca. 120 m gelegen.<br />
2.4 Ver- und Entsorgung<br />
Die notwendigen Infrastruktureinrichtungen der Ver- und Entsorgung (Abwasser, Wasser,<br />
Löschwasser, Strom), die im Bedarfsfall für eine ordnungsgemäße Erschließung des Änderungsbereichs<br />
benötigt werden, sind vorhanden. Es ist jedoch anzumerken, dass es sich vorliegend<br />
um eine „reine“ Abstellfläche für Campingfahrzeuge handelt. Ein dauerhafter Aufenthalt<br />
von Personen ist nicht vorgesehen. Schmutzwasser wird somit nicht anfallen.<br />
Die RWE Net AG, Netzregion Südwest hatte im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens<br />
zur bereits errichteten Abstellfläche mit Schreiben vom 23.04.2001 auf eine, die Abstellfläche<br />
durchquerende 20 KV-Freileitung hingewiesen. Es wurde die Auflage nach Einhaltung eines<br />
15 m breiten Schutzstreifens (je 7,5 m beiderseits der Leitungsachse) erteilt. Dem Bauvorhaben<br />
wurde seinerzeit unter Auflagen.<br />
Die zur Überplanung anstehende Fläche wird ebenfalls von der 20 kV-Freileitung durchquert,<br />
so dass die seinerzeit gemachten Auflagen auch in der 15. Änderung des Flächennutzungsplans<br />
zu berücksichtigen sind.<br />
Die Rhein-Main-Transportgesellschaft mbH hat im Schreiben vom 27.09.2011 mitgeteilt,<br />
dass in unmittelbarer Nähe, nördlich vom Änderungsbereich eine Mineralöl- Produktenpipeline<br />
verläuft.<br />
2.5 Topographie<br />
Anhand der TK 25 wurde eine Auswertung der topographischen Verhältnisse im Plangebiet<br />
vorgenommen.<br />
Das Gelände zeigt ausgehend von der südöstlich gelegenen Waldfläche ein Gefälle von ca.<br />
11% in Richtung „Schulstraße“. Um eine funktionsgerechte Nutzung des Geländes zu ermöglichen,<br />
ist eine Geländemodellierung notwendig.<br />
2.6 Schutzgebiete<br />
Der Änderungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet von Schweich bis Koblenz“.<br />
Das Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung zeigt die zur Überplanung<br />
anstehende Fläche am östlichen Rand einer biotopkartierten Fläche. Es handelt sich hierbei<br />
um das Gebiet BT-5710-0204-2006 „Streuobstweide östlich Burgen“. Der Schutzstatus ist<br />
mit „Schutz wegen Belebung der Landschaft“ angegeben. Schutzziel ist die Beibehaltung der<br />
extensiven Nutzung.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
8<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Es handelt sich nicht um ein pauschalgeschütztes Biotop. Die Größe beträgt ca. 0,69 ha.<br />
Nördlich des Änderungsbereichs liegt das BT-5710-0202-2006 „Streuobstwiesen östlich Burgen“<br />
mit einer Größe von ca. 7 ha. Schutzstatus und –ziel sind identisch.<br />
Nachfolgend sind die biotopkartierten Flächen gemäß Angaben aus dem LANIs abgebildet.<br />
Der Landschaftsplan der <strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel stellt den Änderungsbereich als<br />
Streuobstwiese mit dem Zusatz „Pflegemaßnahmen“ dar.<br />
2.7 Vorhaben<br />
Wesentliches Merkmal der Einrichtung ist die temporäre Unterbringung von Campingfahrzeugen<br />
und Booten. Das Angebot richtet sich besonders an die Campingtouristen, die während<br />
der Wintermonate ihre freie Zeit nicht auf den Campingplätzen verbringen. Es soll vermieden<br />
werden, dass sie ihre Campingfahrzeuge zwischen dem oftmals weiter entfernt liegenden<br />
Wohnort und dem Campingplatz hin und her transportieren müssen. Ein weiterer<br />
Aspekt ist die hochwasserfreie Lage der Abstellfläche und die daraus resultierende „sichere“<br />
Abstellmöglichkeit für Campingfahrzeuge.<br />
Für den Bereich der 15. Änderung wird daher als Art der baulichen Nutzung ein Sondergebiet<br />
gemäß § 11 BauNVO dargestellt. Zwecks Konkretisierung wird das Sondergebiet mit der<br />
Zweckbestimmung „Temporäre Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“ dargestellt.<br />
Mit der Festlegung der Zweckbestimmung wird bereits auf der Ebene der vorbereitenden<br />
Bauleitplanung definiert, welche Anlagen und Einrichtungen künftig zulässig sind.<br />
Die Abstellfläche soll ausschließlich der Errichtung von Flächen für die temporäre Unterbringung<br />
von Abstellplätzen für Campingfahrzeuge und Booten dienen. Der Begriff „Camping-<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
9<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
fahrzeuge“ erfasst neben dem „klassischen“ Campingwagen auch selbst fahrende Wohnmobile.<br />
Ebenso ist das Abstellen von Booten zulässig.<br />
Die Unterbringung sonstiger mobiler Freizeitunterkünfte in Form von Zelten, Mobilheimen,<br />
Kleinwochenendhäusern u.ä. ist ebenso unzulässig wie die Ausübung campingartiger Handlungen<br />
(z.B. Grillen, das Aufstellen von Zelten, Übernachten u.ä.).<br />
Bauliche Anlagen und Einrichtungen, die dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen,<br />
sind ebenso unzulässig wie sonstige Zubehöranlagen (z.B. „Waschanlage“) sowie Carports<br />
und Garagen.<br />
Für die Herstellung der Abstellflächen wird – in Anlehnung an die bereits hergerichtete und<br />
genehmigte Abstellfläche - eine Geländemodellierung notwendig sein.<br />
In der in Kapitel 1 angeführten Baugenehmigung vom 01.06.2001 zur bestehenden Abstellfläche<br />
wurde dem Eigentümer auferlegt, dass Böschungen nicht höher als 2 m ausgebildet<br />
werden dürfen. Zudem wurde die Böschungsneigung mit 1:2 festgelegt (Höhe = 2 m, Breite =<br />
4 m). Zudem sollen die Böschungen einen Abstand von mindestens 0,5 m zur „Schulstraße“<br />
einhalten. Außerdem wurde die Auflage erteilt, wonach die Böschungen mit großkronigen<br />
Bäumen in einem Abstand von 10 m bepflanzt und ein mindestens 5 m breiter Pflanzstreifen<br />
zur „Schulstraße“ hin angelegt werden müssen.<br />
Eine dauerhafte Versiegelung der Abstell- und Wegeflächen ist nicht vorgesehen. Vielmehr<br />
kann nach Durchführung der Geländemodellierung die Abstellfläche mit einer Raseneinsaat<br />
versehen werden. Diese Befestigungsart reicht aus, da ein häufiger bzw. ständiger Stellplatzwechsel<br />
ausgeschlossen werden kann.<br />
Das Verkehrsaufkommen ist begrenzt auf die Abstell- und Abholvorgänge der Campingfahrzeuge<br />
zu Beginn und Ende der „Camping-Saison“ (i.d.R. April bis September).<br />
3 AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS<br />
3.1 Baubedingte Auswirkungen<br />
Die angestrebte Nutzung des Plangebietes ist zunächst mit der Durchführung von Tiefbauarbeiten<br />
zur Herrichtung des Geländes verbunden.<br />
Die anschließende Nutzung als Abstellfläche wird zu einer Verdichtung der Wege- und Stellplatzflächen<br />
führen.<br />
Temporär bzw. saisonal kann eine Bewegungsunruhe – und hieraus resultierend - Verkehrslärm<br />
hervorgerufen werden. Diese Auswirkungen beschränken sich jedoch auf wenige Tage<br />
und hier nur auf den Zeitraum, in dem die Campingfahrzeuge im Winterquartier abgestellt<br />
werden bzw. aus dem Quartier abgeholt werden. Im Folgenden sind die verschiedenen Vorhabenmerkmale<br />
und ihre möglichen Auswirkungen für die <strong>Natura</strong>-<strong>2000</strong>-Gebiete dargestellt.<br />
Baubedingte Auswirkungen<br />
Gefährdeter Bereich Schadfaktoren/ Schadwirkungen Bewertung<br />
Boden • Erosion im Rahmen der Geländemodellierung<br />
• Verdichtung durch Befahren mit<br />
Baustellenfahrzeugen<br />
• Schmier- und Schadstoffeintrag<br />
durch Baustellenfahrzeuge<br />
Wasser • Schmier- und Schadstoffeintrag<br />
in das Grundwasser<br />
0<br />
0<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
10<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Luft • Emission durch Kraftfahrzeugbetrieb<br />
(Baustellenfahrzeuge)<br />
Flora und Fauna • Beeinträchtigung durch Bodenbearbeitung<br />
und Befahren des<br />
Bodens<br />
• Änderung bzw. Beseitigung der<br />
Streuobstwiese<br />
• temporäre Lärmbeeinträchtigungen<br />
für die Tierwelt<br />
0 keine erheblichen Auswirkungen - weniger erhebliche Auswirkung -- erhebliche Auswirkungen<br />
3.2 Anlagenbedingte Auswirkungen<br />
Bei den anlagenbedingten Auswirkungen handelt es sich um solche Beeinträchtigungen, die<br />
durch bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen aller Art entstehen.<br />
Es sind zumeist Auswirkungen, die durch die Inanspruchnahme von Flächen auf Dauer hervorgerufen<br />
werden.<br />
In erster Linie sind folgende Hauptpunkte zu nennen:<br />
• Flächenversiegelung bzw. –verdichtung,<br />
• dauerhafte Veränderungen des Landschaftsbildes,<br />
Gefährdeter Bereich Schadfaktoren/ Schadwirkungen Bewertung<br />
Boden • Schmier- und Schadstoffeintrag<br />
durch Campingfahrzeuge<br />
(Wohnmobile)<br />
Wasser • Schmier- und Schadstoffeintrag<br />
in das Grundwasser<br />
• Verminderung der Grundwasserneubildung<br />
– zumindest<br />
temporär<br />
• Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses<br />
Flora und Fauna • Änderung bzw. Beseitigung der<br />
Streuobstwiese<br />
• (temporärer) Verlust von Nahrungshabitaten<br />
im Zeitraum Oktober<br />
bis März<br />
Landschaftsbild • Verlust von die Landschaft mitprägendenLandschaftselementen<br />
(Streuobst)<br />
• (Kleinräumige) Beeinträchtigung<br />
durch Geländemodellierung<br />
0 keine erheblichen Auswirkungen - weniger erhebliche Auswirkung -- erhebliche Auswirkungen<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
11<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen<br />
Unter die betriebsbedingten Auswirkungen fallen Veränderungen in der Umwelt, die durch<br />
den täglichen Betrieb entstehen.<br />
Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen<br />
• „Arbeitsprozesse“ (Lärm-, Schadstoffemissionen),<br />
• Verkehr (Lärm- und Schadstoffemissionen)<br />
Aufgrund des Fehlens betriebsspezifischer Daten (Energiebedarf, Abfälle, Abwässer, eingesetzte<br />
Betriebsmittel, genaue Größe etc.) sind Aussagen über die Auswirkungen nur im begrenzten<br />
Umfang möglich.<br />
Gefährdeter Bereich Schadfaktoren/ Schadwirkungen Bewertung<br />
Boden • Verdichtung durch Befahren der<br />
Wegeflächen<br />
• Verdichtung des Bodens auf<br />
den Abstellflächen durch die<br />
temporäre Bewegung der Campingfahrzeuge<br />
Wasser • Schmier- und Schadstoffeintrag<br />
in das Grundwasser auf den<br />
Abstellflächen (Wohnmobile)<br />
Flora und Fauna • Beeinträchtigung durch Befahren<br />
des Bodens<br />
• temporäre Lärmbeeinträchtigungen<br />
für die Tierwelt durch<br />
den Verkehr bei Abholen und<br />
Abstellen der Campingfahrzeuge<br />
0 keine erheblichen Auswirkungen - weniger erhebliche Auswirkung -- erhebliche Auswirkungen<br />
4 ERHEBLICHKEITSABSCHÄTZUNG ZUM FFH-GEBIET „MOSELHÄNGE UND NE-<br />
BENTÄLER“<br />
4.1 <strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong> zum FFH-Gebiet Nr. 5809-301 „Moselhänge und Nebentäler<br />
der unteren Mosel“<br />
Angaben zum NATURA <strong>2000</strong>-Gebiet Quelle: (offizielle Liste, Schattenliste) Standartdatenbogen<br />
FFH-Nr.: 5908-301<br />
Name: Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel<br />
Fläche: ca. 16.273 ha ha<br />
Schutzstatus: Landschaftsschutzgebiet Moselgebiet von Schweich bis Koblenz<br />
-<br />
0<br />
0<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
12<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
1.1 Kurzcharakteristik des Planungsraumes:<br />
Vogelschutzgebiet Mittel- und Untermosel<br />
Von flächigen Hängen gekennzeichnetes Tal der Mosel, tief<br />
eingeschnittene Nebentäler mit naturnahen Bächen, vielfältigen<br />
Xerothermbiotopen. Hang- und Schluchtwälder, Buchenwälder,<br />
Blockschutt- und Eichen-Hainbuchen-Trockenwaldbestandteile.<br />
Vorkommen vielfältiger Biotopkomplexe des Moseltals, Fels-<br />
und Gesteinshaldenbiotope der Hangbereiche mit Magerrasen,<br />
Naturnahe Bäche und umgebende naturnahe Laubwälder.<br />
Grosse Fledermausquartiere und Jagdhabitate mit Wiesenkomplexen,<br />
z.T. mit traditionellen Weinbergslandschaften und Niederwaldnutzungen.<br />
1.2 Lebensraum-typen/Arten<br />
Im Folgenden werden Lebensraum und die wesentlichen Gefährdungen zu den aufgeführten FFH-<br />
Arten aufgeführt. Es erfolgt eine Bewertung, ob für die jeweilige Art eine erhebliche Beeinträchtigung<br />
durch die geplante Darstellung des Sondergebietes zu erwarten ist.<br />
Dünnfarn<br />
I. Lebensraum<br />
Trichomanes speciosum Der Prächtige Dünnfarn wächst an silikatischen, weitgehend frostgeschützten<br />
und lichtarmen Standorten zwischen 100 und 400 Meter über NN. Dies<br />
sind vor allem Felsspalten, Höhlendecken oder Nischen in Felsen und<br />
Blockschutthalden mit ganzjährig hoher Luftfeuchte. Die Wuchsorte liegen<br />
meist in schattigen Wäldern. Besonders günstige Standorte sind wasserzügige<br />
Sandsteinformationen. Im Buntsandstein werden bevorzugt die Deckenbereiche<br />
im hinteren Teil der oft mehr als 50 cm tiefen Höhlungen besiedelt.<br />
Grünes Gabelzahnmoos<br />
Dicranum viride<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Zu den Gefährdungsfaktoren zählen natürliche Prozesse wie Erosion und<br />
Verwitterung, aber auch direkte Eingriffe an den Wuchsorten wie Gesteinsabbau,<br />
Veränderungen des Wasserhaushaltes sowie forstliche Nutzung, sofern<br />
dadurch das Mikroklima am Wuchsort verändert wird. Wegen unzureichender<br />
Kenntnisse kann die Gefährdung der Art in Deutsch-land noch<br />
nicht abschließend beurteilt werden.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Lebensraumart.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Das Grüne Besenmoos wächst als Epiphyt vorwiegend an der Stammbasis<br />
von Laubbäumen auf basen- und nährstoffreicher Borke, besonders an Buchen,<br />
aber unter anderem auch an Eichen, Birken, Hainbuchen, E-schen,<br />
Erlen und Weiden in überwiegend alten, lichtdurchlässigen Laub- und<br />
Mischwald-beständen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit ist Voraussetzung für das<br />
Vorkommen der Art.<br />
Bevorzugt besiedelt werden mittelalte Gehölze, bei der Hainbuche beispielsweise<br />
60-80 jährige Stämme. Selten ist Dicranum viride auch auf kalkfreien<br />
Felsen zu finden. Im Saar-Nahe-Bergland werden auch Felsstandorte<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
13<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Bechsteinfledermaus<br />
Myotis bechsteini<br />
besiedelt.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Epiphytische Waldmoose sind durch Zerstörung ihrer Standorte (Kahlschläge,<br />
Gesteinsabbau), durch Änderungen der forstlichen Nutzung und in besonderem<br />
Maße durch Luftverschmutzung gefährdet. Werden die Wuchsorte<br />
verändert, beispielsweise durch Umwandlung von Laub- zu Nadelwäldern,<br />
ändern sich auch Feuchtigkeit, Lichteinfall oder ph-Wert der Borke. Ein<br />
erhöhter Stickstoffeintrag über die Luft kann dazu führen, dass das Grüne<br />
Besenmoos von wuchskräftigeren Arten verdrängt wird.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Lebensraumart.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Im Sommer lebt die Bechsteinfledermaus vorzugsweise in feuchten, alten,<br />
strukturreichen Laub- und Mischwäldern. Sie kommt aber auch in<br />
Kiefernwäldern oder in (waldnah gelegenen) Obstwiesen, Parks und<br />
Gärten mit entsprechendem Baumbestand vor. Sie gilt als die in Europa<br />
am stärksten an Waldlebensräume gebundene Fledermausart.<br />
Kolonien der Bechsteinfledermaus (mit ca. 20 Individuen) benötigen zusammenhängende<br />
Waldkomplexe in einer Mindestgröße von 250 - 300<br />
ha als Jagdhabitat. Die günstigsten Jagdbiotope liegen in Bereichen mit<br />
hoher Nahrungsdichte, beispielsweise entlang von Waldbächen. Ungeeignete<br />
Jagdbiotope sind Fichtenaufforstungen oder Dickungen.<br />
Hohle Bäume, Bäume mit Stammrissen sowie Faul- oder Spechthöhlen<br />
dienen der Bechsteinfledermaus als Quartier, vereinzelt akzeptiert sie<br />
auch den Raum hinter der abgeplatzten Borke von Bäumen. Gerne besiedelt<br />
sie Vogel- oder spezielle Fledermauskästen.<br />
Den Winter verbringt sie in unterirdischen Anlagen wie Höhlen und Stollen<br />
in Steinbrüchen oder stillgelegten Bergwerken und in Kellern, möglicherweise<br />
auch in hohlen Bäumen. Die Winterschlafplätze können bis<br />
zu 40 km von den Sommerquartieren entfernt liegen.<br />
Wegen ihrer ausgeprägten Bindung an ihre Kolonie ist die Bechsteinfledermaus<br />
besonders empfindlich gegenüber Veränderungen ihres Lebensraums<br />
unter anderem durch waldbauliche Maßnahmen.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Wegen ihrer ausgeprägten Standorttreue ist die Bechsteinfledermaus<br />
besonders gefährdet durch Veränderungen ihres Lebensraums unter<br />
anderem durch waldbauliche Maßnahmen. Niedrige Flughöhen bei der<br />
Nahrungssuche machen sie besonders anfällig gegenüber Kollisionen<br />
mit Kraftfahrzeugen.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
14<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Großes Mausohr<br />
Myotis myotis<br />
Gelbbauchunke<br />
Bombina variegata<br />
I. Lebensraum<br />
Das Große Mausohr richtet seine Wochenstubenkolonien meist in großen<br />
trockenen Dachräumen ein wie sie oft in Kirchen zu finden sind.<br />
Aber auch in Scheunen oder Brückenbauwerken wurden schon Wochenstubenkolonien<br />
entdeckt. In kleineren Quartieren in Gebäudespalten,<br />
Höhlen, Stollen und Baumhöhlen sind überwiegend die separat lebenden<br />
Männchen anzutreffen.<br />
Bevorzugte Jagdbiotope sind galerieartig aufgebaute Wälder mit gering<br />
entwickelter bis fehlender Strauch- und Krautschicht. Auch Kulturland<br />
wird zur Jagd genutzt. Die Jagdgebiete liegen im Umkreis des Tagesschlafverstecks,<br />
können bei großen Kolonien aber mehr als 15 Kilometer<br />
entfernt sein. Jedes Individuum benötigt mehrere Hektar Fläche zur<br />
Jagd. Als Winterquartiere des Großen Mausohrs dienen Höhlen, Stollen<br />
und frostfreie Keller.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Die vorhandenen Quartiere sind durch Gebäuderenovierungen gefährdet.<br />
Die Anwendung toxischer Holzschutzmittel in den Sommerquartieren<br />
führt zu Vergiftungen. Schon kleinere bauliche Veränderungen an<br />
den Quartiergebäuden können zu Beeinträchtigungen führen, denn die<br />
Ein- und Ausfluggewohnheiten des Großen Mausohrs sind stark an Traditionen<br />
gebunden, die sich im Laufe der Jahre in einer Kolonie ausgebildet<br />
haben. So fliegt beispielsweise die ganze Kolonie in einer Kirche<br />
allabendlich durch den Kirchturm über mehrere Stockwerke hinunter bis<br />
zu einer ganz bestimmten Öffnung, durch welche dann ein Tier nach<br />
dem anderen das Gebäude verlässt.<br />
Ähnliche Bindungen bestehen zu den angestammten Jagdgebieten der<br />
Population. Daher reagiert das Mausohr auch hier empfindlich auf Veränderungen.<br />
Weitere Gefährdungsursachen sind Störungen des Winterschlafs und<br />
die Reduzierung des Nahrungsangebots durch den großflächigen Einsatz<br />
von Insektiziden.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Gelbbauchunken sind in erster Linie in vegetationsarmen, unbeschatteten<br />
Tümpeln und Kleinstgewässern zu finden. Neben den natürlich entstandenen<br />
Gewässern in Fluss- und Bachauen werden Gewässer in<br />
Abgrabungsflächen wie Steinbrüchen, Kies-, Sand-, Ton- und Lehmgruben<br />
oder auch Fahrspuren als Lebensraum angenommen.<br />
Laichgewässer sind flach, vegetationsarm und oft nur temporär wasserführend.<br />
Die jungen Tiere und die Weibchen halten sich dagegen in<br />
dauerhaft wasserführenden Gewässern auf, die stärker durch Vegetation<br />
strukturiert sind.<br />
Etwa 70% der Zeit verbringen die Gelbbauchunken bevorzugt in Wäldern,<br />
wo sie sich in Lücken zwischen Steinen, in Nagerbauten und in<br />
vergleichbaren schmalen Hohlräumen versteckt halten.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
15<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Apollo<br />
Parnassius apollo<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Für die Gelbbauchunke geeignete Lebensräume entstehen in Flussund<br />
Bachauen durch gewässerdynamische Prozesse immer wieder neu.<br />
In der Vergangenheit wurden diese Prozesse durch wasserbauliche<br />
Maßnahmen stark eingeschränkt, sodass sich die bedeutenden Populationen<br />
der Gelbbauchunken vorwiegend in Abgrabungsflächen entwickelt<br />
haben. Die in Folge der Abgrabungen durchgeführten Rekultivierungsmaßnahmen<br />
haben jedoch den Flachwasserbereichen nicht den<br />
nötigen Rahmen gegeben.<br />
Fahrspuren in Feld- oder Wirtschaftswegen werden zugeschüttelt oder<br />
durch Wegebau beseitigt, sodass auch diese Lebensräume für die<br />
Gelbbauchunke nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen.<br />
Sowohl in natürlichen als auch in von Menschen geschaffenen Lebensräumen<br />
ist für die Gelbbauchunke entscheidend, dass stets geeignete<br />
Gewässerstadien vorhanden sind, die optimale Bedingungen für die<br />
Entwicklung der Kaulquappen bieten, in denen aber auch die erwachsenen<br />
Tiere leben können. Weiterhin sind in unmittelbarer Nähe zu den<br />
Gewässern strukturreiche Laubwälder notwendig, in denen die erwachsenen<br />
Tiere die größte Zeit ihres Lebens verbringen.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Der Apollofalter kommt vorwiegend in den mittleren Höhenlagen vor.<br />
Fels- und Schuttfluren, Natursteinmauern in Habitatnähe sowie ehemals<br />
(heute kaum mehr) Weinberge sind bevorzugte Lebensräume. Zu den<br />
Lebensräumen des Roten Apollos zählen sonnige, trockene Standorte<br />
mit steinigem Untergrund, vor allem felsige Hänge, Geröllhalden und<br />
Felsabbruchkanten, auch Bahn- und Straßenböschungen sowie Abraumhalden<br />
von Steinbrüchen. Die Art ist insgesamt stark abhängig vom<br />
Vorkommen der Raupennahrungspflanzen, an welchen auch die Eiablage<br />
erfolgt.<br />
Der Apollofalter besucht nicht nur die weißen Blüten von Sedum album,<br />
sondern vorzugsweise die roten und violetten Blüten von Disteln, Flockenblumen<br />
und Oregano.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
In Mitteleuropa ist Parnassius apollo außerhalb des Alpengebiets durch<br />
Lebensraumverlust (Aufforstungen, Verbrachung, Verbuschung, Siedlungs-<br />
und Straßenbau, teilweise auch Gesteinsabbau an besiedelten<br />
Stellen) vom Aussterben bedroht. Im Einzelfall können Habitate aber<br />
auch durch Anlage von Steinbrüchen neu entstehen, allerdings kaum<br />
mehr durch heutige Abbauverfahren. Wenige Populationen existieren<br />
noch an der Mosel.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
16<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Russischer Bär<br />
Callimorpha quadripunctaria<br />
Bachneunauge<br />
Lampetra planeri<br />
Groppe<br />
Cottus gobio<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Callimorpha quadripunctaria ist charakteristisch für lichte, wechselfeuchte<br />
Wälder und besonders buschige, mit Magerrasen durchsetzte Felshänge,<br />
die an Laubwald grenzen (wärmeliebende Art).<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Gefährdet ist Callimorpha quadripunctaria durch den Rückgang an besiedelbarem<br />
Habitat (dichte Aufforstungen, Nivellierungen, Überbauungen).<br />
Sie ist aber noch relativ weit verbreitet.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Das Bachneunauge führt im Gegensatz zu seinen größeren Verwandten<br />
nur kurze Laichwanderungen stromaufwärts durch und verbringt sein<br />
ganzes Leben stationär in Bächen und kleinen Flüssen. Mitunter werden<br />
auch noch kleinste Bäche mit geringer Wasserführung besiedelt. Die<br />
Larven sind auf ruhig fließende<br />
Gewässerabschnitte mit sandigem Feinsubstrat, meist Flachwasserbereiche,<br />
angewiesen, die erwachsenen Exemplare benötigen rascher<br />
fließende Gewässerbereiche mit kiesigen und steinigen Strecken zum<br />
Ansaugen und zur Fortpflanzung.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Die jahrelange enge Bindung der Larven an saubere, durchströmte<br />
Sandbänke macht sie besonders empfindlich gegenüber Eingriffen in<br />
geeignete Larvenlebensräume durch Gewässerunterhaltungs- oder -<br />
ausbaumaßnahmen. Auch der Fraßdruck durch einen hohen Forellenbesatz<br />
und Gewässerverschmutzung gefährden das Bachneunauge.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Die Groppe ist ein typischer Bewohner sommerkühler und sauerstoffreicher<br />
Bäche und Flüsse der Forellen- und Äschenregion mit grobkiesigen<br />
bis steinigen Bodensubstraten. Aber auch stehende Gewässer werden<br />
besiedelt. Günstig sind Temperaturen von 14° - 16°C. Die Ansprüche an<br />
die Wasserqualität und den Lebensraum sind hoch. Wichtig sind auch<br />
ausreichende Versteckmöglichkeiten zwischen Steinen. In ausgebau-<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
17<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Hirschkäfer<br />
Lucanus cervus<br />
ten, strukturarmen Gewässern verschwindet die Art.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Auf eine Versauerung ihres Lebensraums Wasser, auch durch den Anbau<br />
von Fichten in Gewässernähe, sowie auf Gewässerverunreinigungen<br />
mit nachfolgender Verschlammung und Unterhaltungsmaßnahmen<br />
reagiert die Groppe sehr empfindlich. Der Eintrag von Sedimenten und<br />
vor allem Nährstoffanreicherung generell und durch Abtrag von angrenzenden<br />
landwirtschaftlichen Nutzflächen im Besonderen führt zu einer<br />
zunehmenden Verschlammung des Lückensystems der Gewässersohle<br />
durch Schwebstoffdrift. Sedimente dringen in das Lückensystem der<br />
Sohle ein, Schlamm mit hohen organischen Anteilen überdeckt das<br />
Substrat. Hierdurch werden zum einen unmittelbar die Versteck- und<br />
Ernährungsmöglichkeiten an der Gewässersohle beeinträchtigt, zum<br />
anderen verschlechtert sich die Sauerstoffversorgung stark. Bereiche<br />
mit hohen Konzentrationen an gelöstem organischem Kohlenstoff aus<br />
Materialien verschiedenen Ursprungs werden von der Groppe gemieden.<br />
Barrieren verhindern die das Gewässer aufwärts gerichteten Kompensationswanderungen<br />
vor allem der Jungfische und somit den genetischen<br />
Austausch zwischen den Teilpopulationen eines Fließgewässers. Schone<br />
kleine Schwellen stellen unüberwindbare Hindernisse für diesen kleinen<br />
Fisch dar. Bereits Barrieren ab 15 - 20 Zentimeter Höhe sind für die<br />
Groppe unpassierbar. Aufstiegshindernisse bewirken einen so genannten<br />
"Ventileffekt" zum Gewässerunterlauf, der eine Population auf Dauer<br />
hochgradig in Existenznot bringen kann.<br />
Eine weitere Gefährdung kann aus einem intensiven Besatz der Gewässer<br />
mit räuberisch lebenden Fischarten, zum Beispiel der Forelle resultieren.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Hirschkäfer gelten traditionell als Wald- beziehungsweise Waldrandart<br />
mit Schwerpunktvorkommen in alten, lichten Eichenwäldern. Lebensräume<br />
in Parks und Gärten sind bekannt, galten aber bisher eher als die<br />
Ausnahme.<br />
Grund für den Rückgang ist die Zerstörung des Lebensraums, beispielsweise<br />
durch zu intensive Forstwirtschaft. Wirtschaftswald ist meist<br />
zu dicht bestockt, als dass der Hirschkäfer hier einen geeigneten Lebensraum<br />
finden würde. Es gibt zu wenig alte, dicke, anbrüchige Bäume<br />
und Strünke. Lucanus cervus benötigt große, lichte Eichenwälder mit einer<br />
Mindestmenge an totem Holz. Das Anpflanzen nicht lebensraumtypischer<br />
Gehölze in großem Stil oder Kahlschläge stellen eine erhebliche<br />
Gefährdung dieses imposanten Käfers dar.<br />
Dem gegenüber steht die Erkenntnis, dass Hirschkäfer heute auch verstärkt<br />
Lebensräume im urban-landwirtschaftlich geprägten Raum haben.<br />
Die Art zeigt sowohl im Wald als auch in urban-landwirtschaftlichen<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
18<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Eisvogel<br />
Alcedo atthis<br />
Räumen Kulturfolgereigenschaften. Bei der Auswahl des Bruthabitats<br />
hat das Weibchen eine ausgeprägte Präferenz für sonnig-warme, möglichst<br />
offene Standorte.<br />
Als Bruthabitate kommen mehrjährig abgestorbene Baumstümpfe in<br />
Frage, liegendes Holz nur bei Erdkontakt. Für eine Eignung sind der<br />
Standort und der Zersetzungsgrad entscheidender als die Baumart.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Der Wandel in der Nutzung der Wälder wie beispielsweise die Aufgabe<br />
der bis etwa 1950 üblichen Niederwaldwirtschaft hat in der Vergangenheit<br />
vielerorts zu einer Verschlechterung der kleinstandörtlichen Verhältnisse<br />
im Umfeld potenzieller Bruthabitate und zu einem allgemeinen<br />
Rückgang des Hirschkäfers geführt.<br />
Die drastische Zunahme der Schwarzwildpopulationen in den letzten<br />
Jahren bedroht Bruthabitate im Wald.<br />
Da Hirschkäfer von den Menschen aufgrund des geänderten Arbeitsund<br />
Freizeitverhalten kaum wahrgenommen werden, wird auch auf den<br />
Erhalt ihrer Habitate keine gezielte Rücksicht genommen.<br />
Hirschkäfer haben neben dem Schwarzwild eine Reihe weiterer natürlicher<br />
Feinde, darunter zum Beispiel Dachs, Specht und Waldkauz, außerhalb<br />
des Waldes auch Katze und Elster. Unter den erwachsenen Käfern<br />
treten im besiedelten Raum teilweise starke Verluste durch Straßenverkehr<br />
auf.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Der Eisvogel lebt an mäßig schnell fließenden oder stehenden, klaren<br />
Gewässern mit Kleinfischbestand und Sitzwarten. Seine Nahrung setzt<br />
sich aus Fischen, Wasserinsekten (Imagines und Larven), Kleinkrebsen<br />
und Kaulquappen zusammen<br />
Diese sollten von einem ausreichenden Angebot an Sitzwarten und<br />
möglichst auch von Gehölzen gesäumt sein. Es werden Flüsse, Bäche,<br />
Seen und auch vom Menschen geschaffene Gewässer wie Altwässer,<br />
Tümpel, Gräben, Kanäle, Teichanlagen, Talsperren und Abgrabungen<br />
genutzt. Außerhalb der Brutzeit kann er sich sogar am Meer aufhalten.<br />
Als Brutplätze dienen Steilufer oder große Wurzelteller umgestürzter<br />
Bäume mit dicker Erdschicht. Auch vom Menschen geschaffene Hohlwege<br />
und Gruben werden genutzt.<br />
Der Bestand unterliegt in Abhängigkeit von der Strenge der Winter starken<br />
jährlichen Schwankungen<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Als natürliche Ursachen sind insbesondere Bestandseinbrüche durch<br />
Extremwinter zu nennen, daneben auch negative Auswirkungen von<br />
Hochwassern (Vernichtung der Bruten, Verlust der Brutwände, ferner<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
19<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Uhu<br />
(Bubo bubo)<br />
vermehrte Schwebstofffracht; Wassertrübung) und geringerer Bruterfolg<br />
in verregneten Sommern (verringerte Jagdmöglichkeit in aufgewühlten<br />
und trüberen Gewässern);<br />
• Ursache für den längerfristigen und gravierenden Rückgang des Eisvogelbestandes<br />
zwischen den 1950er und 1970er Jahren waren<br />
anthropogene Veränderungen der Lebensräume des Eisvogels;<br />
• Störungen an Brutplätzen durch Freizeitbetrieb;<br />
• Direkte Verfolgung, Abschuss oder Fang, Verfolgung auch in den<br />
Winterquartieren; Unfälle, z. B. durch Straßenverkehr, Glasscheiben,<br />
Festfrieren an metallischen Sitzwarten;<br />
• Verluste der Bruten durch höhlenaufgrabende Prädatoren<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Der Uhu bevorzugt offene, meist locker bewaldete und reich strukturierte<br />
Gebiete, oft in der Nähe von Flüssen und Seen. Die Nistplätze befinden<br />
sich überwiegend an schmalen Vorsprüngen exponierter Felswände,<br />
an felsigen Abbrüchen oder an schütter bewachsenen Steilwänden.<br />
Bei uns vor allem auch in Steinbrüchen und im Tiefland Mitteleuropas<br />
zudem in Greifvogelhorsten oder am Boden. Die Jagdgebiete sind weiträumige<br />
Niederungen, Siedlungsränder, halb offene Hanglagen, nahrungsreiche<br />
Wälder etc., auch Mülldeponien in einem Radius von in der<br />
Regel weniger als drei Kilometern (Reviergröße: ca. <strong>2000</strong> ha).<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Große Gefahren sind Verluste an Freileitungen, Straßen und Eisenbahn;<br />
• Geringer Bruterfolg durch Störungen am Brutplatz (z. B. Freizeitnutzung);<br />
• Verringerung des Nahrungsangebots durch Intensivierung und Mechanisierung<br />
der Landwirtschaft, Grünlandumbruch sowie Erschließung,<br />
ferner durch ungünstige Witterung zur Brutzeit und ausbleibende<br />
Mäusegradationen;<br />
• Erhöhte Sterblichkeit infolge langer, schneereicher Winter;<br />
• Jungvogelverluste durch Absturz aus den Horsten sowie (meist nur<br />
nach massiven Störungen) durch Prädation an Horsten;<br />
• Vergitterung von Felsen zur Steinschlagsicherung.<br />
•<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
20<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Haselhuhn<br />
(Tetrastes bonasia)<br />
Wespenbussard<br />
Pernis apivorus<br />
I. Lebensraum<br />
Das Haselhuhn benötigt unterholzreiche Wälder mit einer vielseitigen<br />
Artenzusammensetzung und mit einer reichen horizontalen und vertikalen<br />
Gliederung. Gute Haselhuhnbiotope weisen Laubbäume, eine nicht<br />
zu dichte Kraut-, Hochstauden- und Zwergstrauchschicht, die Beeren<br />
als Nahrung anbieten sowie Dickichte auf. Ungeeignete Habitate sind<br />
durchforstete oder dicht geschlossene Altersklassenbestände.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Ein wichtiger Faktor für den Rückgang der Haselhuhnpopulation, stellt<br />
neben der regionalen Bejagung vor der Jahrhundertwende, die gravierende<br />
Änderung der forstlichen Nutzung dar. Besonders der Rückgang<br />
der Niederwälder ist eine wichtige Ursache für die negative Bestandsänderung.<br />
Die Überführung der Laub- und Mischwälder zu reinen Altersklassenbeständen,<br />
den Anbau von Fichtenmonokulturen und die<br />
Umwandlung von Nieder- und Mittelwald in Hochwald führen zu Lichtmangel<br />
und so zur Verdrängung von Pflanzen- und Wirbellosenarten,<br />
die für das Haselhuhn lebensnotwendig sind. Auch die Klimaveränderung<br />
stellt einen Gefährdungsfaktor für das an kontinentale Klimaverhältnisse<br />
angepasste Tier dar. Nasskalte Sommer führen zu eine erhöhten<br />
Kükensterblichkeit und bei milden, niederschlagsreichen Wintern<br />
sind teilweise hohe Verluste der Alttiere festzustellen.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Der Wespenbussard ist Brutvogel größerer, abwechslungsreich strukturierter<br />
Buchen-, Eichen- und Laubmischwälder. Im Mittelgebirge werden<br />
Kuppen und obere Hangbereiche als Horststandorte bevorzugt. Nahrungshabitate<br />
sind sonnige Waldpartien wie Lichtungen, Kahlschläge,<br />
Windwürfe, Waldwiesen, Wegränder, Schneisen sowie halb offenes<br />
Grünland, Raine, Magerrasen, Heiden und ähnliche extensiv genutzte<br />
Flächen. Die zeitliche Nutzung der verschiedenen Habitatelemente im<br />
Brutrevier ist kaum erforscht. Ausgedehntes Agrarland (Ackerbau) bietet<br />
ihm keinen Lebensraum.<br />
In Rheinland-Pfalz ist der Wespenbussard landesweit überwiegend in<br />
geringer Dichte verbreitet und besiedelt mit Ausnahme der Höhenlagen<br />
alle Höhenstufen, vom Auwald am Oberrhein bis in die Mittelgebirge.<br />
Ausgedehnte, ruhigere Waldlandschaften, extensiv genutzte, kleinflächig<br />
gegliederte Grünländereien mit sonnenexponierten Hängen bieten<br />
dem Wespenbussard gute Lebensbedingungen. Bevorzugt in thermisch<br />
günstigen Gebieten entlang von Rhein, Mosel, Ahr, Nahe und Lahn.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Verringertes Nahrungsangebot durch Ausräumung der Landschaft,<br />
Zerstörung und Eutrophierung ursprünglich insektenrei-<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
21<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
cher Kulturlandschaft<br />
• Eingriffe in Altholzbestände, kurze Umtriebszeiten, Verringerung<br />
des Laubholzanteils<br />
• Störungen an den Brutplätzen während der Brutzeit<br />
• Intensive Verfolgung auf dem Zug<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
Steinkrebs<br />
I. Lebensraum<br />
Austropotamobius tor- Der Steinkrebs besiedelt vorwiegend strukturreiche, kühle, meist kleinerentiumre<br />
Wald- und Wiesenbäche sowie Weiher und Seen höher liegender<br />
Regionen. Selbst in extremen Gebirgsbächen ist er anzutreffen. Er bevorzugt<br />
Abschnitte mit schneller Strömung und steinig-kiesigem Substrat<br />
sowie Uferbereiche, eine gute Wasserqualität und ausreichende<br />
Versteckmöglichkeiten.<br />
Die optimalen sommerlichen Gewässertemperaturen liegen für diese Art<br />
zwischen 14 und 18° C, mindestens 5-8° C sind Voraussetzung für die<br />
Aktivität der Tiere, 20-23°C sollten dagegen nicht überschritten werden.Der<br />
Steinkrebs lebt in Höhlen, die er ins Ufer gräbt, unter Steinblöcken<br />
und Wurzeln.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Der Steinkrebs ist wegen seiner isolierten Vorkommen im gesamten<br />
Verbreitungsgebiet gefährdet. Nicht zuletzt seine Ortstreue behindert eine<br />
natürliche Wiederbesiedlung geeigneter Gewässer.<br />
Veränderungen seines Lebensraumes durch Begradigungen und Uferverbau,<br />
Uferabbrüche und Einträge von Schwemmstoffen, zum Beispiel<br />
durch unmittelbar ans Ufer angrenzende landwirtschaftliche Ackerflächen,<br />
können Populationen zum Erlöschen bringen. Der Steinkrebs reagiert<br />
empfindlich auf die Verfüllung seiner Wohnhöhlen mit Sedimenten<br />
und auf den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln ins Gewässer.<br />
Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Insektiziden in Gewässernähe<br />
geboten. Krebse sind Gliederfüßer und reagieren auf diese Mittel<br />
besonders empfindlich.<br />
Der Besatz mit Aalen in Steinkrebsgewässern kann Krebsbestände<br />
stark reduzieren. Auch andere räuberische Fischarten wie Barsche oder<br />
Hechte können einen hohen Fraßdruck auf Flusskrebse ausüben. Bei<br />
Elektrobefischungen werfen die Tiere oft ihre Scheren oder Beine ab.<br />
Daher geht auch hiervon eine Bedrohung aus.<br />
Eine ernste Gefahr sind alle fremdländischen, vor allem aber amerikanische<br />
Krebsarten als potenzielle Überträger der Krebspest. Diese Infektion<br />
mit dem Schlauchpilz Aphanomyces astaci, der im 19. Jahrhundert<br />
aus Nordamerika nach Europa eingeschleppt wurde, ist für europäische<br />
Krebsarten tödlich. Diese Krankheit ist der Grund für den weltweiten<br />
Rückgang des Edelkrebses.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
22<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
5 ERHEBLICHKEITSABSCHÄTZUNG ZUM VSG-GEBIET NR. VSG-5809-401 „MITTEL- UND<br />
UNTERMOSEL“<br />
5.1 <strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong> zum VSG-Gebiet Nr. 5809-401 „Mittel- und Untermosel“<br />
Angaben zum NATURA <strong>2000</strong>-Gebiet Quelle: (offizielle Liste, Schattenliste)<br />
Standartdatenbogen<br />
VSG-Nr.: 5908-401<br />
Name: Mittel- und Untermosel<br />
Fläche: ca. 15.891 ha<br />
Schutzstatus: Landschaftsschutzgebiet Moselgebiet von Schweich bis<br />
Koblenz<br />
Vogelschutzgebiet Mittel- und Untermosel<br />
1.1 Kurzcharakteristik des Planungsraumes:<br />
Das Kerbtal der Mosel gehört zu den landschaftlich schönsten<br />
Gebieten von Rheinland-Pfalz. Die Abgrenzung orientiert<br />
sich an den klimatisch begünstigten Steilhängen und<br />
umfasst eine Reihe tief eingeschnittener Seitentäler, deren<br />
Flanken in der Regel bewaldet sind.<br />
Brachen und unterschiedliche Waldtypen mit dominierenden<br />
Laubholzbeständen sind die wesentlichen Lebensräume.<br />
Die Vermehrung und flächenmäßige Ausdehnung artenreicher<br />
Lebensraumtypen macht das Gebiet für eine Vielzahl<br />
bedrohter, in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie benannter<br />
Vogelarten attraktiv und schützenswert. Mehrere Arten weisen<br />
hier mit ihre größten Brutvorkommen in Rheinland-Pfalz<br />
auf.<br />
1.2 Lebensraum-typen/Arten Zielarten der Vogelschutzrichtlinie:<br />
Haselhuhn (Tetrastes bonasia)<br />
Mittelspecht (Dendrocopos medius)<br />
Neuntöter (Lanius collurio)<br />
Rotmilan (Milvus milvus)<br />
Schwarzmilan (Milvus migrans)<br />
Schwarzspecht (Dryocopus martius)<br />
Schwarzstorch (Ciconia nigra)<br />
Uhu (Bubo bubo)<br />
Wanderfalke (Falco peregrinus)<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
23<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Erhaltungsziel<br />
Haselhuhn<br />
(Tetrastes bonasia)<br />
Mittelspecht<br />
Dendrocopos medius<br />
Wendehals (Jynx torquilla)<br />
Wespenbussard (Pernis apivorus)<br />
Zippammer (Emberiza cia)<br />
Erhaltung oder Wiederherstellung strukturreicher Laub- und<br />
Mischwälder sowie von Magerrasen mit Brachen und Felsbiotopen,<br />
Erhaltung oder Wiederherstellung der natürlichen<br />
Gewässer- und Uferzonendynamik, ihrer typischen Lebensräume<br />
und -gemeinschaften sowie der Gewässerqualität.<br />
I. Lebensraum<br />
Das Haselhuhn benötigt unterholzreiche Wälder mit einer vielseitigen Artenzusammensetzung<br />
und mit einer reichen horizontalen und vertikalen<br />
Gliederung. Gute Haselhuhnbiotope weisen Laubbäume, eine nicht zu<br />
dichte Kraut-, Hochstauden- und Zwergstrauchschicht, die Beeren als<br />
Nahrung anbieten sowie Dickichte auf. Ungeeignete Habitate sind durchforstete<br />
oder dicht geschlossene Altersklassenbestände.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Ein wichtiger Faktor für den Rückgang der Haselhuhnpopulation, stellt neben<br />
der regionalen Bejagung vor der Jahrhundertwende, die gravierende<br />
Änderung der forstlichen Nutzung dar. Besonders der Rückgang der Niederwälder<br />
ist eine wichtige Ursache für die negative Bestandsänderung.<br />
Die Überführung der Laub- und Mischwälder zu reinen Altersklassenbeständen,<br />
den Anbau von Fichtenmonokulturen und die Umwandlung von<br />
Nieder- und Mittelwald in Hochwald führen zu Lichtmangel und so zur<br />
Verdrängung von Pflanzen- und Wirbellosenarten, die für das Haselhuhn<br />
lebensnotwendig sind. Auch die Klimaveränderung stellt einen Gefährdungsfaktor<br />
für das an kontinentale Klimaverhältnisse angepasste Tier<br />
dar. Nasskalte Sommer führen zu eine erhöhten Kükensterblichkeit und<br />
bei milden, niederschlagsreichen Wintern sind teilweise hohe Verluste der<br />
Alttiere festzustellen.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
In Mitteleuropa ist der Mittelspecht bevorzugt in Hartholzauen und (auch<br />
staunassen) artenreichen (produktiven) und alten Laubmischwäldern zu<br />
finden. Gebietsweise hat die Art eine sehr starke Bindung an Eichen, aber<br />
auch an andere überwiegend rauborkige Altstämme. Im Anschluss an<br />
größere Altholzbestände ist der Mittelspecht zudem in reich strukturierten,<br />
anthropogen beeinflussten Sekundärbiotopen wie Streuobstbeständen<br />
und Parks zu finden. Die Bestandsdichte steigt mit Zunahme des Eichenanteils.<br />
Der Mittelspecht ist bei seiner Brutbaumwahl flexibel; er bevorzugt<br />
allerdings auch hier Eichen. Die Höhlen befinden sich in der Regel im Bereich<br />
von Schadstellen sowie in abgestorbenen bzw. morschen Bäumen<br />
oder Ästen, wobei die mittlere Höhe ca. 9 Meter beträgt (1,5 – 20 Meter).<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
24<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Neuntöter<br />
Lanius collurio<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Lebensraumverlust durch kurze Umtriebszeiten, Entnahme von Alteichen;<br />
• Zerstörung oder Trockenfallen von Hartholzauen;<br />
• Verdrängung der Eiche durch die Buche;<br />
• „Verinseln“ geeigneter Waldgebiete;<br />
• Beseitigung von Streuobstwiesen oder Verluste alter Obstbestände.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Der Neuntöter ist ein Brutvogel reich strukturierter, offener bis halb offener<br />
Landschaften in thermisch günstiger Lage. Dazu gehören z. B. Heckenlandschaften,<br />
Trocken- und Magerrasen, frühe Stadien von Sukzessionsflächen,<br />
Feldgehölze, Weinberge, Streuobstwiesen, Ödländer, Moore,<br />
verwilderte Gärten usw. Die Nester befinden sich meist in bis zum Boden<br />
Deckung bietenden Hecken oder Gebüschen.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Beeinträchtigung durch zunehmend atlantisch geprägtes Klima;<br />
• Lebensraumzerstörung oder -veränderung:<br />
o Ausräumung und Uniformierung der Agrarlandschaft, dabei insbesondere<br />
Beseitigung von Heckenmosaiken<br />
o Erstaufforstung<br />
o Umbruch von Grünland, Nutzungsaufgabe von Heide- und (trockengelegten)<br />
Moorflächen<br />
o Landschaftsverbrauch und Versiegelung<br />
• Abnahme der Nahrung oder ihrer Zugänglichkeit durch Eutrophierung,<br />
Intensivierungsmaßnahmen (u. a. Grünlandumbruch, Vergrößerung<br />
der Schläge, Bewirtschaftung bis unmittelbar an die Randstrukturen);<br />
• Häufige Mahden;<br />
• Rückgang der Weidewirtschaft;<br />
• Zerstörung der Strukturvielfalt;<br />
• Verlust von Magerrasen;<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art, da ausreichend Ausweichflächen<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
25<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Rotmilan<br />
Milvus milvus<br />
I. Lebensraum<br />
Der Lebensraum des Rotmilans besteht aus zwei Haupttypen: Wald als<br />
Brut- und Ruhehabitat und waldfreies Gelände als Nahrungshabitat. Insgesamt<br />
erfüllt eine abwechslungsreiche Landschaft aus Offenland (mit<br />
hohem Grünlandanteil) und Wald (mit einem hohen Anteil an altem Laubwald)<br />
die Ansprüche des Rotmilans am besten. Die intraspezifische Territorialität<br />
führt im Allgemeinen zu einer gleichmäßigen Verteilung der Reviere<br />
im Raum. Die Horste werden generell auf hohen Bäumen, meist in<br />
der Waldrandzone, angelegt. Als bevorzugtes Jagdgebiet des Rotmilans<br />
dienen Grünlandgebiete (Wiesen) mit unterschiedlichem Nutzungs(schnitt)muster.<br />
In der Reproduktionszeit liegen die Jagdanteile auf<br />
Grünland bei > 80%. Auch Mülldeponien können lokalen Rotmilanvorkommen<br />
als wichtiges Nahrungshabitat dienen.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Stark verringertes Nahrungsangebot infolge Intensivierung der Landwirtschaft<br />
und Verbauung der Landschaft (Flächenverbrauch) (z.B.<br />
Rückgang des Hamsters, Verringerung der Mäusegradation);<br />
• Sekundärvergiftungen durch Rodentizide bei der Nagerbekämpfung;<br />
• Störung des Brutgeschäftes durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in<br />
der Horstumgebung während der Brutzeit, kurze Umtriebszeiten und<br />
Abnahme des älteren Laubholzanteils;<br />
• Störungen und Vergrämung im Horstbereich durch Freizeitnutzung;<br />
• Verluste an Freileitungen und ungesicherten Masten;<br />
• offenbar häufigstes Kollisionsopfer unter den Greifvögeln an Windenergieanlagen.<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art, da ausreichend Ausweichflächen<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
26<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Schwarzmilan<br />
Milvus migrans)<br />
I. Lebensraum<br />
Generell werden für die Besiedelung gewässerreiche Landschaften der<br />
Tieflagen (Flussauen, Seen) gegenüber Tallagen der Mittelgebirge vorgezogen<br />
und dicht bewaldete Bereiche mit nur wenigen Gewässern und geringem<br />
Offenlandanteil gemieden. Der Schwarzmilan brütet auf Bäumen<br />
größerer Feldgehölze und hoher, lückiger Altholzbestände in ebenem und<br />
hügeligem Gelände, oft in Gewässernähe und daher häufig in Eichenmischwäldern<br />
beziehungsweise Hart- und Weichholzauen. Die Horstbäume<br />
befinden sich in geringer Entfernung zum Waldrand. Nicht selten brütet<br />
der Schwarzmilan in oder in der Nähe von Graureiher- und Kormorankolonien,<br />
da er als Schmarotzer von der Nahrung der Koloniebrüter profitiert.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Lebensraumverluste durch Zerstörung natürlicher Auenlandschaften<br />
und Auwälder, kurze Umtriebszeiten sowie Veränderungen in der<br />
Landnutzung;<br />
• Als Aas- und Abfallfresser gefährdet durch Kontamination der Beutetiere<br />
mit Pestiziden und anderen Giften<br />
• Eintragen von Plastikmüll kann zu Staunässe im Nest führen;<br />
dadurch Auskühlen und Absterben der Embryonen<br />
• Brutaufgabe durch Maßnahmen (Holzselbstwerber) im Horstumfeld<br />
während der Brutzeit (bspw. Fällen von Horstbäumen, Freizeitaktivitäten)<br />
• Verluste an Freileitungen und ungesicherten Masten (Stromschluss)<br />
• Verringerung des Nahrungsangebotes durch geänderte Deponietechnik<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
27<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Schwarzstorch<br />
Ciconia nigra<br />
Uhu<br />
(Bubo bubo)<br />
I. Lebensraum<br />
Der Schwarzstorch ist ein typischer Waldbewohner und Indikator für störungsarme,<br />
altholzreiche Waldökosysteme. Die Brutgebiete liegen überwiegend<br />
in großflächigen, strukturreichen und ungestörten Waldgebieten<br />
der Mittelgebirge mit eingestreuten aufgelichteten Altholzbeständen (insbesondere<br />
Buche und Eiche). Zur Nahrungssuche nutzt die Art abwechslungsreiche<br />
Feuchtgebiete, d.h. fischreiche Fließgewässer und Gräben,<br />
Bruchwälder, Teichgebiete sowie Nass- und Feuchtwiesen. Der Horst, der<br />
durch eine natürliche Anflugschneise (ungenutzte Wege, alte Schneisen)<br />
gedeckt angeflogen werden kann, befindet sich in der Regel in altem<br />
Baumbestand. Der Horstbaum weist häufig ein geschlossenes Kronendach<br />
und starke Seitenäste auf, wobei oft die unteren in Stammnähe zum<br />
Horstbau genutzt werden. Neben der Großflächigkeit des Waldgebietes,<br />
die allerdings nicht der ausschlaggebende Faktor zu sein scheint, sind offensichtlich<br />
vor allem relative Ruhe und Ungestörtheit sowie gut erreichbare<br />
Nahrungsgründe für die Brutgebietsauswahl relevant.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Eine der bedeutendsten Gefährdungsursachen in den Brutgebieten<br />
ist die Kollision mit Mittel- und Niederspannungsleitungen sowie der<br />
Stromschluss an nicht gesicherten Masttypen (Abspannmaste, Maste<br />
mit Stützisolatoren);<br />
• Störungen an den Horstplätzen während der Brutzeit mit z. T. direkter<br />
Auswirkung auf den Bruterfolg durch Personen (z. B. Wanderer,<br />
Hobbyfotografen, Jäger, Reiter) in weniger als 100 m Entfernung vom<br />
Horst oder forstliche Maßnahmen in weniger als 300 m Entfernung;<br />
• Errichtung von Windkraftanlagen im Umfeld von Schwarzstorchrevieren;<br />
• Verluste durch Anflug an Stacheldraht im Bereich von Fließgewässern,<br />
die als Viehtränke eingezäunt sind;<br />
• Kalkungsflüge im Horstbereich während der Brutzeit;<br />
• Heißluftballonfahrten und Flugbewegungen dicht über den Brutgebieten;<br />
• Übermäßige Walderschließung;<br />
• Waldumbau; übermäßiger Einschlag von Althölzern, kurze Umtriebszeiten,<br />
Aufforstung mit Nadelhölzern;<br />
• Zuwachsen von Waldwiesen infolge Nutzungsaufgabe;<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Der Uhu bevorzugt offene, meist locker bewaldete und reich strukturierte<br />
Gebiete, oft in der Nähe von Flüssen und Seen. Die Nistplätze befinden<br />
sich überwiegend an schmalen Vorsprüngen exponierter Felswände, an<br />
felsigen Abbrüchen oder an schütter bewachsenen Steilwänden. Bei uns<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
28<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Wendehals<br />
Jynx torquilla<br />
vor allem auch in Steinbrüchen und im Tiefland Mitteleuropas zudem in<br />
Greifvogelhorsten oder am Boden. Die Jagdgebiete sind weiträumige Niederungen,<br />
Siedlungsränder, halb offene Hanglagen, nahrungsreiche Wälder<br />
etc., auch Mülldeponien in einem Radius von in der Regel weniger als<br />
drei Kilometern (Reviergröße: ca. <strong>2000</strong> ha).<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
Große Gefahren sind Verluste an Freileitungen, Straßen und Eisenbahn;<br />
• Geringer Bruterfolg durch Störungen am Brutplatz (z. B. Freizeitnutzung);<br />
• Verringerung des Nahrungsangebots durch Intensivierung und Mechanisierung<br />
der Landwirtschaft, Grünlandumbruch sowie Erschließung,<br />
ferner durch ungünstige Witterung zur Brutzeit und ausbleibende Mäusegradationen;<br />
• Erhöhte Sterblichkeit infolge langer, schneereicher Winter;<br />
• Jungvogelverluste durch Absturz aus den Horsten sowie (meist nur<br />
nach massiven Störungen) durch Prädation an Horsten;<br />
• Vergitterung von Felsen zur Steinschlagsicherung.<br />
•<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Waldränder, Lichtungen und offenes Waldland (meist Laub-, aber auch<br />
Nadelwald), Streuobstwiesen, Parks, große Gärten. Außerhalb der Brutzeit<br />
auch in Gebüsch und Offenland.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Ungünstige klimatische Faktoren (Niederschläge und Temperatur)<br />
während der Brut- und Aufzuchtszeit;<br />
• Lebensraumentwertung, Lebensraumverlust und Lebensraumzerstörung:<br />
• Vernichtung von Brutbäumen;<br />
• Verlust von Nahrungshabitaten;<br />
• Eutrophierung und Verbrachung von kurzrasigem Grünland und Viehweiden;<br />
• Umwandlung vieler Feld- und Obstgärten in "gepflegte" Kleingärten;<br />
• Siedlungsbau; viele typische Streuobstbestände wurden und werden<br />
durch Ausdehnung von Wohn- und Industriesiedlungen sowie Freizeiteinrichtungen<br />
überbaut;<br />
• Straßenbau, Verlust von Obstbaumalleen, Asphaltierung eines Großteils<br />
der Feldwege.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
29<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Wanderfalke<br />
Falco peregrinus<br />
Wespenbussard<br />
Pernis apivorus<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art, da ausreichend Ausweichflächen<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung.<br />
I. Lebensraum<br />
Der Wanderfalke ist sehr vielseitig hinsichtlich seiner Lebensraumansprüche<br />
und meidet lediglich hochalpine Gebiete, großflächig ausgeräumte<br />
Kulturlandschaft sowie große geschlossene Waldkomplexe. Er brütet bevorzugt<br />
an steilen Felswänden in Flusstälern und Waldgebirgen, an Steilküsten<br />
und Steinbrüchen, war früher aber auch Baumbrüter in lichten Althölzern<br />
(dort ausgerottet), an Waldrändern usw. und Bodenbrüter in großen<br />
Moorgebieten der borealen Zone Nordeuropas (ausnahmsweise auch<br />
auf Inseln Mitteleuropas). Außerdem nehmen Bruten an hohen Bauwerken<br />
auch innerhalb von Großstädten zu. Die Jagd vollzieht sich vorwiegend<br />
in offener Landschaft, vor allem im Winter nicht selten auch am<br />
Wasser, inzwischen vermehrt auch innerhalb von Großstädten.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Gebietsweise direkte Verfolgung (illegaler Abschuss und Vergiftung, illegales<br />
Aushorsten und Fallenfang zu Aufzuchtzwecken)<br />
• Störungen an den Brutplätzen durch Freizeitaktivitäten (Wandern, Klettern<br />
etc.) und Forstarbeiten<br />
• Freileitungs- und Strommastenopfer<br />
• Natürliche Verluste durch ungünstige Witterung zur Brutzeit sowie<br />
durch Steinmarder, Uhu, Parasitenbefall etc.<br />
• Verlust des Lebensraumes durch Zersiedelung, Zerschneidung, Verdrahtung<br />
etc.<br />
• Rückgang der Beutetiere<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung<br />
I. Lebensraum<br />
Der Wespenbussard ist Brutvogel größerer, abwechslungsreich strukturierter<br />
Buchen-, Eichen- und Laubmischwälder. Im Mittelgebirge werden<br />
Kuppen und obere Hangbereiche als Horststandorte bevorzugt.<br />
Nahrungshabitate sind sonnige Waldpartien wie Lichtungen, Kahlschläge,<br />
Windwürfe, Waldwiesen, Wegränder, Schneisen sowie halb offenes Grünland,<br />
Raine, Magerrasen, Heiden und ähnliche extensiv genutzte Flächen.<br />
Die zeitliche Nutzung der verschiedenen Habitatelemente im Brutrevier ist<br />
kaum erforscht. Ausgedehntes Agrarland (Ackerbau) bietet ihm keinen<br />
Lebensraum.<br />
In Rheinland-Pfalz ist der Wespenbussard landesweit überwiegend in geringer<br />
Dichte verbreitet und besiedelt mit Ausnahme der Höhenlagen alle<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
30<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Zippammer<br />
Emberiza cia<br />
Höhenstufen, vom Auwald am Oberrhein bis in die Mittelgebirge. Ausgedehnte,<br />
ruhigere Waldlandschaften, extensiv genutzte, kleinflächig gegliederte<br />
Grünländereien mit sonnenexponierten Hängen bieten dem Wespenbussard<br />
gute Lebensbedingungen. Bevorzugt in thermisch günstigen<br />
Gebieten entlang von Rhein, Mosel, Ahr, Nahe und Lahn.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Verringertes Nahrungsangebot durch Ausräumung der Landschaft,<br />
Zerstörung und Eutrophierung ursprünglich insektenreicher Kulturlandschaft<br />
• Eingriffe in Altholzbestände, kurze Umtriebszeiten, Verringerung des<br />
Laubholzanteils<br />
• Störungen an den Brutplätzen während der Brutzeit<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art, da ausreichend Ausweichflächen<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung<br />
I. Lebensraum<br />
Offene, felsige Hügel und Berghänge, oft mit Büschen und vereinzelten<br />
Bäumen, besonders extensiv bewirtschaftete Weinberge; kleine Felder<br />
und Gärten im Gebirge, ferner Lichtungen und Ränder von hochgelegenen<br />
Wäldern, gelegentlich auf Windwurfflächen und Kahlschlägen, häufiger<br />
auch Steinbrüche.<br />
II. Gefährdungen/ Beeinträchtigungen<br />
• Lebensraumveränderungen durch Aufgabe traditioneller Nutzungsformen,<br />
z. B. der extensiven Beweidung steiler Hänge oder des Steillagenweinbaus,<br />
in der Folge Sukzession<br />
• Erstaufforstung;<br />
• Natürliche Ursachen wie Klimaveränderungen<br />
III. Bewertung<br />
Das Vorhaben bleibt ohne Wirkung auf die Art.<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
31<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
6 Abschätzung von Beeinträchtigungen für die <strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-Gebiete<br />
Beeinträchtigung<br />
mit Bezug zur Fläche:<br />
Erläuterung:<br />
Zerschneidung:<br />
nein<br />
Restflächen in %:<br />
keine<br />
Beeinträchtigung: nicht<br />
erheblich<br />
kleinster Abstand in m:<br />
ca. 10 m<br />
Gebietsverkleinerung<br />
in %: 0,00<br />
Vorübergehende Inanspruchnahme:<br />
nein<br />
Aus den o.g. Darstellungen wird deutlich, dass keine der zwei sich in der Nähe befindlichen <strong>Natura</strong><br />
<strong>2000</strong>-Gebiete durch das geplante Vorhaben zerschnitten, vorübergehend in Anspruch genommen<br />
werden oder eine Gebietsverkleinerung erfahren.<br />
Beeinträchtigung<br />
mit Bezug zur Funktion:<br />
Erläuterung:<br />
Lebensraumtypen nach Anhang<br />
I<br />
Arten nach Anhang II<br />
prioritäre Lebensraumtypen prioritäre Arten<br />
Puffer- oder Entwicklungsfunktionen besondere Lebensgemeinschaften<br />
sehr kleinflächige Inanspruchnahme Unmaßgebliche Gebietsbestandteile<br />
Durch das geplante Vorhaben außerhalb der <strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-Gebiete wird hinsichtlich der o.a. Arten und<br />
Lebensräume angeführt, dass bei einer Realisierung der Planung davon auszugehen ist, dass einzelne<br />
Individuen, die diesen Bereich als temporäre Nahrungshabitate nutzen, in angrenzende Bereiche<br />
ausweichen können. Insbesondere können Vogelarten des Vogelschutzgebietes „Mittel- und Untermosel“<br />
(z.B. Wendehals), die nördlich und westlich an den Planungsraum angrenzenden Bereiche mit<br />
vergleichbaren Biotopqualitäten als Nahrungshabitat nutzen.<br />
Durch die in räumlicher Nähe liegenden Einrichtungen der Freizeit- und Erholungsnutzung (Sportplatz<br />
und Schießstand), der bestehenden Abstellfläche für Campingfahrzeuge, der Pferdehaltung auf einzelnen<br />
Flächen und sonstigen anthropogenen Vorbelastungen (Verkehr der Schulstraße mit direkter<br />
Anbindung an die B 49, Frequentierung der Wege im Rahmen der Freizeitnutzung) kann angenommen<br />
werden, dass störungsempfindliche Arten der <strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-Gebiete den Planungsraum zum jetzigen<br />
Zeitpunkt nicht bzw. nur bedingt als Nahrungshabitat nutzen.<br />
Bei einer geänderten Nutzung des Plangebietes ist daher für die Arten von keiner erheblichen oder<br />
nachhaltigen Beeinträchtigung des Plangebietes auszugehen.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner
<strong>Verbandsgemeinde</strong> Untermosel<br />
15. Änderung Flächennutzungsplan<br />
Ortsgemeinde Burgen<br />
32<br />
Sondergebiet „Abstellfläche für Campingfahrzeuge und Boote“<br />
<strong>Natura</strong> <strong>2000</strong>-<strong>Erheblichkeitsabschätzung</strong><br />
Kumulative Wirkungen durch andere Projekte oder Pläne<br />
Erläuterung:<br />
Neben den o.a. Einrichtungen besteht seitens der Ortsgemeinde keine Planungsabsicht nach weiterer<br />
Inanspruchnahme der unbebauten Flächen für Siedlungszwecke bzw. für die Freizeit- und Erholungsnutzung.<br />
Die an den Änderungsbereich angrenzenden Flächen weisen ähnliche Eigenschaften auf, so<br />
dass es trotz der kleinflächigen Inanspruchnahme der biotopkartierten Fläche unter Berücksichtigung<br />
bestehender Nutzungen zu keinen erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen für die <strong>Natura</strong><br />
<strong>2000</strong>-Gebiete kommen wird.<br />
Einschätzung:<br />
Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Moselhänge und Nebentäler<br />
der unteren Mosel“ 5809-301 und des Vogelschutzgebietes Mittel- und Untermosel“ 5809-401 sind<br />
durch die geplante Bauflächendarstellung unter Berücksichtigung der temporären (saisonalen) Nutzung<br />
nicht zu erwarten.<br />
WeSt<br />
Stadtplaner