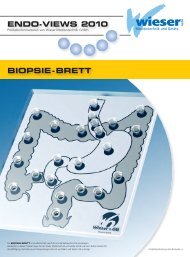ERBE Papillotomie - Wieser Medizintechnik
ERBE Papillotomie - Wieser Medizintechnik
ERBE Papillotomie - Wieser Medizintechnik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HF-chirurgische <strong>Papillotomie</strong> mit<br />
softwaregesteuerten Schnitten –<br />
ENDO CUT<br />
F. Kalthoff/M. Hagg<br />
HOCHFREQUENZ<br />
C H I R U R G I E
Wichtiger Hinweis<br />
Die Autoren und die <strong>ERBE</strong> Elektromedizin GmbH haben größtmögliche Sorgfalt auf die Erstellung dieser<br />
Broschüre verwandt. Dennoch können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Die in der Broschüre<br />
enthaltenen Informationen und Empfehlungen begründen keine Ansprüche gegen die Autoren oder die<br />
<strong>ERBE</strong> Elektromedizin GmbH. Sollte sich eine Haftung aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen ergeben,<br />
so beschränkt sich diese auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.<br />
Die Angaben über Einstellwerte, Applikationsstellen, Applikationsdauer und den Gebrauch der Instrumentarien<br />
beruhen auf klinischen Erfahrungen. Es handelt sich jedoch lediglich um Richtwerte, die von dem<br />
Operateur auf ihre Anwendbarkeit geprüft werden müssen. Abhängig von den individuellen Gegebenheiten<br />
kann es erforderlich sein, von den Angaben in dieser Broschüre abzuweichen.<br />
Infolge von Forschung und klinischen Erfahrungen ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen.<br />
Auch daraus kann sich ergeben, dass eine Abweichung von den hier enthaltenen Angaben sinnvoll sein<br />
kann.
Inhalt<br />
Teil 1<br />
Wirkungsweise von<br />
ENDO CUT bei der<br />
<strong>Papillotomie</strong> 2<br />
Teil 2<br />
Anwendungsempfehlungen<br />
für<br />
die <strong>Papillotomie</strong><br />
mit ENDO CUT 4<br />
Teil 3<br />
Glossar 7<br />
Der ENDO CUT<br />
Einleitung<br />
Seit Einführung der endoskopischen<br />
<strong>Papillotomie</strong>/Sphinkterotomie etablierten<br />
sich eine Vielzahl von Varianten<br />
bzgl. der Nutzung von hochfrequenten<br />
Strömen zur Schlitzung<br />
der Papilla.<br />
Im Wesentlichen sind dies:<br />
– die Nutzung von monopolarem<br />
Koagulationsstrom<br />
– die Nutzung von monopolarem<br />
Schneidestrom<br />
– der manuelle Wechsel zwischen<br />
Koagulationsstrom und Schneidestrom<br />
nach Ermessen des Operateurs<br />
– sowie diverse Varianten von Stromqualitäten<br />
verschiedenster Hersteller<br />
von HF-Geräten.<br />
Das Ziel all dieser Varianten war es,<br />
einen hochfrequenten Strom zur<br />
Gewebetrennung zu finden, der<br />
einerseits in der Lage ist, eine ausreichende<br />
primäre Hämostase zu gewährleisten.<br />
Andererseits soll die<br />
thermische Belastung durch Koagulation<br />
auf das umliegende Gewebe<br />
gering gehalten werden.<br />
Eine weitere Anforderung an einen<br />
hochfrequenten Schnitt bei der <strong>Papillotomie</strong><br />
ist der kontrollierbare, langsame<br />
und präzise Schnittverlauf.<br />
Gemeinsam haben die oben genannten<br />
Varianten, dass sie meist einen<br />
Kompromiss darstellen. So ist hochfrequenter<br />
Schneidestrom in der<br />
Lage, einen ausgezeichneten Schnitt<br />
durchzuführen, hat aber Mängel in<br />
der Hämostase. Ein Koagulationsstrom<br />
hingegen besitzt gute Hämostaseeigenschaften,<br />
jedoch keine<br />
oder schlechte Schneideeigenschaften<br />
und führt zudem zu einer thermischen<br />
Belastung der Schnittränder.<br />
Der häufig angewandte manuelle<br />
Wechsel zwischen Schneide- und<br />
Koagulationsstrom basiert mehr oder<br />
minder auf Erfahrungswerten des<br />
Operateurs. Der Operateur schätzt<br />
hierbei ein, wann auf Koagulationsoder<br />
Schneidestrom gewechselt<br />
werden muss.<br />
<strong>ERBE</strong> entwickelte aus dieser Problemstellung,<br />
auf Basis der richtungsweisenden<br />
HF-Gerätegeneration<br />
ERBOTOM ICC, einen softwaregesteuerten<br />
Schnitt für die <strong>Papillotomie</strong>/Sphinkterotomie<br />
sowie für die<br />
Polypektomie, den ENDO CUT.<br />
Seit Einführung von ENDO CUT im<br />
Jahre 1993 sind weltweit mehr als<br />
5000 ERBOTOM ICC Geräte mit<br />
ENDO CUT im Einsatz. Sie verbesserten<br />
maßgeblich die Anwendungssicherheit<br />
sowie die operativen<br />
Ergebnisse der Polypektomie und<br />
<strong>Papillotomie</strong>.<br />
ENDO CUT automatisiert viele Abläufe<br />
der <strong>Papillotomie</strong>. Trotzdem handelt<br />
es sich um eine HF-chirurgische<br />
Anwendung, die vom Anwender<br />
erlernt und umgesetzt werden muss.<br />
Diese Broschüre soll die Lernphase bei<br />
der <strong>Papillotomie</strong> mit ENDO CUT<br />
unterstützen.*<br />
* Die Broschüre »HF-chirurgische Polypektomie mit<br />
softwaregesteuerten Schnitten« ist ebenfalls<br />
erhältlich bei <strong>ERBE</strong> Elektromedizin.<br />
Auf die mit [a], [b] usw. gekennzeichneten<br />
Begriffe in den folgenden<br />
Kapiteln wird im Kapitel »Glossar«<br />
besonders eingegangen.<br />
1
Teil 1<br />
ENDO CUT hat die Aufgabe, den<br />
Operateur in seiner Arbeit zu unterstützen<br />
und wirkt auf der Grundlage<br />
der Messung physikalischer Parameter<br />
während der Anwendung.<br />
ENDO CUT eignet sich sowohl für<br />
den Einsatz des Papillotoms als auch<br />
für den Einsatz des Nadelmessers.<br />
Im Wesentlichen wird durch eine<br />
Fraktionierung des Schnittes die<br />
Schnittgeschwindigkeit reguliert.<br />
Abb. 1: Schnittverlauf/<strong>Papillotomie</strong> mittels ENDO CUT<br />
2<br />
Wirkungsweise von ENDO CUT<br />
bei der <strong>Papillotomie</strong><br />
Zum einen wird dadurch die Einwirkdauer<br />
des hochfrequenten Stromes [a]<br />
und damit die thermische Belastung<br />
auf das Schnittgebiet minimiert. Zum<br />
anderen wird der Schnitt gebremst<br />
und dadurch kontrollierbarer.<br />
ENDO CUT erhöht hierdurch die Sicherheit<br />
und Qualität der Operationsergebnisse<br />
während der <strong>Papillotomie</strong>.<br />
1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3<br />
ENDO CUT basiert auf drei Phasen:<br />
1. Anschnittphase<br />
2. Schnittphase<br />
3. Koagulationsphase<br />
Die Phasen 2 und 3 wiederholen sich<br />
bis die <strong>Papillotomie</strong> beendet ist bzw.<br />
bis der Schnitt durch den Operateur<br />
unterbrochen wird.<br />
1. Anschnittphase 2. Schnittphase 3. Koagulationsphase<br />
U<br />
Spannung<br />
Phase<br />
S<br />
Schnitttiefe<br />
t<br />
Zeit
Phase 1:<br />
Anschnittphase<br />
Nach der Positionierung des Papillotoms<br />
bzw. des Nadelmessers wird<br />
durch Betätigen des gelben Fußschalters<br />
die ENDO CUT-Funktion gestartet.<br />
Aufgrund des geringen elektrischen<br />
Widerstandes zwischen dem Schneidedraht<br />
bzw. dem Nadelmesser und<br />
dem Gewebe zu Beginn dieser Phase<br />
wirkt der Schneidestrom vergleichbar<br />
einer Softkoagulation [e] . Mit fortlaufender<br />
Softkoagulation steigt durch<br />
Austrocknung des Gewebes der elektrische<br />
Widerstand und somit, abzuleiten<br />
aus dem Ohmschen Gesetz [i] ,<br />
auch die elektrische Spannung [g] , bis<br />
eine Spannung von mehr als 200 Volt<br />
erreicht ist, also die Spannung, die<br />
zum HF-chirurgischen Schnitt [c]<br />
benötigt wird.<br />
Diese Vorgehensweise sichert eine<br />
ausreichende Koagulation [d] des<br />
Gewebes vor der Anschnittphase.<br />
Unmittelbar nach Erreichen der 200-<br />
Volt-Marke und Erkennung der ersten<br />
Lichtbogen durch die Meß-Sensorik<br />
startet Phase 2.<br />
U<br />
Phase 2:<br />
Schnittphase<br />
Den Lichtbogen/Funken zwischen<br />
Instrument und dem Gewebe kommt<br />
eine entscheidende Bedeu-tung zu.<br />
Dieser ist notwendig für den HF-<br />
Schnitt (siehe auch [c] ).<br />
Nachdem, wie zu Phase 1 beschrieben,<br />
erste Lichtbogen/Funken von<br />
der Sensorik erkannt worden sind,<br />
wird der erste Schneideimpuls generiert.<br />
Die Dauer dieses Impulses beträgt<br />
50 ms (<strong>ERBE</strong> Standardeinstellung, jedoch<br />
veränderbar), ist also sehr kurz.<br />
Begründet ist dies dadurch, dass der<br />
zurückgelegte Weg während des<br />
Schneideimpulses möglichst gering<br />
bleiben soll. Der Operateur bekommt<br />
hierdurch Zeit zur Beobachtung des<br />
Schnittes und kann, falls notwendig,<br />
korrigierend einwirken.<br />
Der Schneideimpuls ist ein Schnitt mit<br />
wenig Hämostase. Die Schnittränder<br />
werden also thermisch wenig belastet.<br />
t<br />
t<br />
Phase 1<br />
Phase 1 2<br />
Phase<br />
U<br />
Phase 3:<br />
Koagulationsphase<br />
Diese Phase hat bei der <strong>Papillotomie</strong><br />
die primäre Aufgabe, den Schnittverlauf<br />
zu unterbrechen und dadurch für<br />
den Operateur kontrollierbarer zu<br />
gestalten. Zwar wird in dieser Phase<br />
eine 750 ms dauernde (<strong>ERBE</strong> Standardeinstellung,<br />
jedoch veränderbar)<br />
Softkoagulation [e] initiiert, diese kann<br />
aber durch die geringe Auflagefläche<br />
des Papillotomdrahtes und dessen<br />
geringer Wärmekapazität kaum zur<br />
Entfaltung kommen.<br />
Die Phasen 2 und 3 wiederholen sich<br />
nun im Rhythmus 50 ms Schneiden<br />
und 750 ms Koagulieren, bis die Aktivierung<br />
beendet wird.<br />
Abb. 2: Anschnittphase Abb. 3: Schneideimpuls<br />
Abb. 4: Koagulationsphase<br />
S<br />
U<br />
1 2 3 2 3<br />
2<br />
Teil 1<br />
S<br />
t<br />
3
Teil 2<br />
ENDO CUT automatisiert viele Abläufe<br />
bei der <strong>Papillotomie</strong>. Trotzdem<br />
handelt es sich hierbei um HFchirurgische<br />
Anwendungen, mit allen<br />
Anforderungen und Risiken<br />
einer HF-chirurgischen Operation, wie<br />
sie allgemein bekannt und in den<br />
4<br />
Empfohlene Geräteeinstellung:<br />
Abb. 5: ICC 200 mit ENDO CUT<br />
HF-Chirurgiegeräte der Serie ERBO-<br />
TOM ICC mit ENDO CUT-Automatik<br />
werden mit einer Grundeinstellung<br />
von 120 Watt max. Schneideleistung<br />
im Effekt 3 und einer max.<br />
Koagulationsleistung von 60 Watt<br />
im Modus Forced Koagulation geliefert.<br />
Es handelt sich hierbei um<br />
eine Empfehlung, die aus Erfahrungswerten<br />
abgeleitet wurde. Da<br />
die Anforderungen an das HF-Chirurgiegerät<br />
ERBOTOM ICC mit<br />
ENDO CUT bei der <strong>Papillotomie</strong><br />
nicht stark variieren und das Gerät<br />
durch automatische Anpassungen<br />
einen reproduzierbaren Schnitt<br />
erzeugen kann, ist es nur selten<br />
erforderlich, die Einstellwerte zu<br />
ändern.<br />
Nichtsdestotrotz geben wir einige<br />
Tipps, wie das Schnitt- und Koagulationsverhalten<br />
bei Änderungen<br />
der Einstellwerte variiert.<br />
Anwendungsempfehlungen für die<br />
<strong>Papillotomie</strong> mit ENDO CUT<br />
ICC-Geräte-Gebrauchsanweisungen<br />
beschrieben sind.<br />
Mit diesen Anwendungsempfehlungen<br />
versuchen wir, die Lernphase zu<br />
unterstützen.<br />
Änderung der maximalen<br />
CUT-Leistung<br />
Die Einstellung der Leistung hat nur<br />
wenig direkten Einfluss auf das<br />
Schnitt- und Koagulationsverhalten<br />
bei der <strong>Papillotomie</strong>. Die Aufgabe<br />
der Leistungseinstellung ist es, die<br />
Obergrenze der Leistungsabgabe<br />
zu definieren. Es handelt sich um<br />
ein Sicherheitskriterium. Die max.<br />
Leistung sollte so gering wie möglich<br />
gewählt werden. Die Einstellung<br />
von 120 Watt, wie sie als<br />
Standardeinstellung empfohlen<br />
wird, hat hier gute Ergebnisse<br />
erzielt.<br />
Änderung des CUT-Effektes<br />
Der einstellbare Effekt im Schneidekanal<br />
definiert die Hämostase beim<br />
Schnitt. Die vier Stufen des Effektes<br />
stellen eine Steigerung der primären<br />
Alle folgenden Hinweise sind Empfehlungen,<br />
die vom Operateur auf<br />
ihre Umsetzbarkeit geprüft werden<br />
müssen. Alle Angaben beziehen sich<br />
auf die Gerätereihe ERBOTOM ICC<br />
mit ENDO CUT.<br />
Hämostase dar. Stufe 1 stellt eine<br />
leichte Hämostase dar, Stufe 4 hingegen<br />
ist ein stärker koagulierender<br />
Schnitt. Da eine starke Hämostase<br />
der Schnittränder für die Entstehung<br />
einer Pankreatitis mitverantwortlich<br />
gemacht wird, ist es sinnvoll,<br />
den Effekt möglichst niedrig<br />
einzustellen. Wird der Effekt jedoch<br />
zu tief gewählt, kann es zu Blutungen<br />
kommen. Die vorgegebene<br />
Einstellung Effekt 3 hat auch hier<br />
sehr gute Ergebnisse erzielt.<br />
Änderung des<br />
AUTO-COAG-Modes<br />
Der Koagulationsmode hat keinen<br />
Einfluss auf die ENDO CUT-Funktion<br />
und ist kein Parameter der<br />
Schnitt-Fraktionierung ENDO CUT.<br />
Die in Abb. 5 voreingestellte Forced<br />
Koagulation [f] wird über das blaue<br />
Fußpedal aktiviert, z. B. zur ergänzenden<br />
Blutstillung.<br />
Achtung: Vor Beginn der <strong>Papillotomie</strong><br />
muss immer geprüft werden,<br />
ob die ENDO CUT-Funktion<br />
eingeschaltet ist. Dies wird entweder<br />
durch eine Leuchtdiode<br />
auf dem ENDO CUT-Taster (ICC<br />
200) oder durch die Anzeige E<br />
im Programmfeld (ICC 350)<br />
signalisiert.
Phase 1: Anschnittphase<br />
Das Papillotom wird positioniert und<br />
leicht angespannt. Durch Betätigen<br />
des gelben Fußschalters wird die<br />
ENDO CUT-Funktion aktiviert. Der<br />
Fußschalter wird während der gewünschten<br />
Aktivierungszeit gedrückt<br />
gehalten. (Die ENDO CUT-Funktion<br />
kann jederzeit durch Beenden der Fußschalteraktivierung<br />
unterbrochen werden.)<br />
Das umliegende Gewebe wird<br />
nun kurzzeitig koaguliert (Abb. 6).<br />
ENDO CUT signalisiert dies durch ein<br />
dauerhaftes Tonsignal.<br />
Abb. 6: Anschnittphase<br />
Abb. 9: Schnittphase<br />
Phase 2: Schnittphase<br />
Nach kurzer Koagulation wechselt<br />
ENDO CUT in den fraktionierten<br />
Modus, dies wird durch einen pulsierenden<br />
Ton signalisiert (Abb. 7).<br />
Es kommt zur Schneidebewegung<br />
des <strong>Papillotomie</strong>drahtes. Nach 50 ms<br />
wird die erste Koagulationsphase<br />
(Abb. 8) erreicht.<br />
Diese Phase kann, ebenfalls jederzeit,<br />
durch Unterbrechen der Fußschalterbetätigung<br />
gestoppt werden.<br />
Abb. 7: Schnittphase<br />
Abb. 10: Koagulationsphase<br />
Abb. 8: Koagulationsphase<br />
Abb. 11: Schnittphase<br />
Teil 2<br />
Phase 3: Koagulationsphase<br />
Wie bereits erwähnt, dient die Koagulationsphase<br />
(Abb. 8) bei der <strong>Papillotomie</strong><br />
primär dazu, dem Operateur<br />
Zeit für die Beobachtung und die<br />
etwaige Korrektur des Schnittverlaufes<br />
zu verschaffen. Aufgrund der<br />
geringen Auflagefläche und der geringen<br />
Wärmekapazität des Papillotomdrahtes<br />
kommt es nur eingeschränkt<br />
zur Koagulation. Die Koagulationsphase<br />
dauert 750 ms mit einer<br />
Softkoagulation, die kaum Karbonisationsrisiken<br />
birgt.<br />
ENDO CUT definiert sich durch das<br />
Zusammenspiel von Phase 2 und Phase<br />
3 als gebremster Schnitt. Die Phasen<br />
2 und 3 wiederholen sich nun<br />
(Abb. 9, 10 und 11) bis die Aktivierung<br />
beendet wird.<br />
5
Teil 2<br />
6<br />
Fazit:<br />
ENDO CUT nimmt durch die Fraktionierung<br />
des Schnittes Einfluss<br />
auf die Schnittgeschwindigkeit.<br />
Durch den 50/750 ms Cut/Coag-<br />
Rhythmus wird der Schnitt gebremst<br />
und kontrollierbarer.<br />
– Das Risiko des unkontrollierten<br />
Einbrechens des Papillotomdrahtes<br />
(»Zipper-Effekt«) ist stark<br />
minimiert.<br />
– Das Risiko einer Blutung durch<br />
einen zu schnellen Schnitt ist<br />
minimiert.<br />
– Das Risiko einer zu starken Koagulation<br />
bzw. Karbonisation der<br />
Schnittränder durch einen zu<br />
langsamen Schnitt ist minimiert.<br />
ENDO CUT benutzt für die 50 ms<br />
dauernde Schnittphase einen<br />
Schnitt mit wenig Hämostase und<br />
für die 750 ms dauernde Koagulation<br />
eine Softkoagulation ohne<br />
Karbonisationseffekte.<br />
ENDO CUT ermöglicht somit einen<br />
ausgewogenen Schnitt bei der <strong>Papillotomie</strong>/Sphinkterotomie<br />
mit<br />
optimalen Schnitträndern, gekennzeichnet<br />
durch:<br />
– minimale thermische Belastung<br />
– keine Karbonisation<br />
– effektive Hämostase.
Glossar<br />
[a] HF Wechselstrom<br />
Wechselstrom im Frequenzbereich<br />
100 kHz bis in den GHz-Bereich<br />
(Abk. HF).<br />
HF-Wechselstrom wird in der Medizin<br />
zum Schneiden, Koagulieren und<br />
Devitalisieren von Gewebe eingesetzt.<br />
HF-Wechselstrom eignet sich<br />
für diese Einsatzgebiete, da er im<br />
Vergleich zu Gleichstrom (Bildung<br />
von Säuren und Laugen an den Elektroden)<br />
und niederfrequentem Wechselstrom<br />
(neuromuskuläre Reizung)<br />
kaum negativen Einfluss auf den<br />
Patienten hat.<br />
NR<br />
1 Hz 100 Hz 100 kHz 1000 kHz<br />
Abb. 12: Neuromuskuläre Reizung NR in<br />
Abhängigkeit von der Frequenz<br />
[b] Monopolare HF-Chirurgie<br />
Die monopolare Technik wird durch<br />
zwei getrennt am Körper anliegende<br />
Elektroden charakterisiert: Der aktiven<br />
Elektrode – im Fall der <strong>Papillotomie</strong><br />
ist dies der Papillotomdraht –<br />
und der großflächigen Neutralelektrode,<br />
die sinnvoller Weise meist am<br />
Oberschenkel bzw. am Oberarm des<br />
Patienten angelegt wird.<br />
aktive<br />
Elektrode<br />
I HF I HF IHF I HF<br />
I HF<br />
Neutralelektrode<br />
Abb. 13: Monopolare Technik<br />
350 kHz<br />
f<br />
[c] HF-Schnitt<br />
Ein durch hochfrequenten Wechselstrom<br />
initiierter Gewebeschnitt entsteht<br />
durch Anlegen einer Spannung<br />
von über 200 V zwischen aktiver<br />
Elektrode und Gewebe. Ab dieser<br />
Spannung entstehen zwischen aktiver<br />
Elektrode und Gewebe Lichtbogen,<br />
die in der Lage sind, Gewebezellen<br />
so schnell zu erhitzen, dass die<br />
intrazelluläre Flüssigkeit explosionsartig<br />
verdampft und die Zellwände<br />
zerreißt.<br />
H2O<br />
H2O<br />
IHF<br />
T>100 °C<br />
H2O<br />
H2O<br />
Abb. 14: Zellplatzen beim hochfrequenten<br />
Schnitt<br />
[d] HF- Koagulation<br />
Durch das Anlegen einer hochfrequenten<br />
Wechselspannung von<br />
unter 200 V an die aktive Elektrode<br />
wird kein Lichtbogen erzeugt. Die<br />
intrazelluläre Flüssigkeit wird ausreichend<br />
langsam erhitzt, dies führt zum<br />
Verdampfen der Flüssigkeit und die<br />
Zelle schrumpft. Dies hat unter anderem<br />
zur Folge, dass die Gewebeoberfläche<br />
reduziert wird und somit das<br />
Gefäßlumen einengt bzw. verschließt.<br />
Viele Koagulationsarten sind keine<br />
ausschließliche Koagulation, sondern<br />
beinhalten einen Funkenanteil, ausgelöst<br />
durch eine über 200 V liegende<br />
Spannung. Diese Koagulationen<br />
eignen sich auch bedingt zum<br />
Schneiden und werden (selten) auch<br />
zur <strong>Papillotomie</strong> genutzt (siehe auch<br />
Forced Koagulation [f] ).<br />
H2O<br />
IHF<br />
T
Teil 3<br />
[f] Monopolare Forced<br />
Koagulation<br />
Koagulation mit einer Spannung<br />
über 200 Volt. Eine Koagulation mit<br />
einem durch Funkenbildung hervorgerufenen<br />
Schneideanteil. Der Koagulationseffekt<br />
ist schneller als bei<br />
der Softkoagulation. Eignet sich gut<br />
zur Koagulation einer etwaigen Blutung<br />
bei der <strong>Papillotomie</strong>.<br />
Abb.18: Kugelelektrode, Forced Koagulation<br />
Abb. 19: <strong>Papillotomie</strong>, Forced Koagulation<br />
8<br />
[g] Elektrische Spannung<br />
Formelzeichen U, die Potentialdifferenz<br />
zwischen 2 Punkten eines elektrischen<br />
Feldes; Ursache des elektrischen<br />
Stroms. Die Einheit der elektrischen<br />
Spannung ist Volt.<br />
[h] Elektrischer Strom<br />
Formelzeichen I, Ausgleich von Spannungsunterschieden<br />
zwischen zwei<br />
Elektroden durch eine leitende Verbindung.<br />
Die Einheit des elektrischen<br />
Stroms ist Ampere.<br />
Im Fall der HF-Chirurgie wird der<br />
Spannungsunterschied an der aktiven<br />
Elektrode und der großflächigen<br />
Neutralelektrode angelegt. Die leitende<br />
Verbindung ist das Körpergewebe.<br />
[i] Elektrischer Widerstand<br />
Widerstand (Formelzeichen R), den<br />
ein Leiter dem Durchgang eines<br />
elektrischen Stroms entgegensetzt;<br />
rechnerisch das Verhältnis der angelegten<br />
elektrischen Spannung U zum<br />
Strom I:<br />
R = U/I (Ohmsches Gesetz)<br />
Die Einheit des elektrischen Widerstands<br />
ist Ohm.<br />
[k] Modulierte Stromformen<br />
Durch das Formen von Wechselströmen<br />
und/oder durch das Bilden von<br />
Impulspaketen, kann in der HF-Chirurgie<br />
Einfluss genommen werden auf<br />
Parameter wie Schnittgeschwindigkeit,<br />
Koagulationseffekt etc.<br />
U P<br />
Ueff Ueff Ueff<br />
k<br />
U P<br />
Abb. 20: Abhängigkeit der Koagulationstiefe<br />
von der Modulation in Verbindung mit Spannungsänderungen<br />
Stromdichte<br />
Die elektrische Stromdichte (Formelzeichen<br />
J) ist der Quotient aus Stromstärke<br />
I und stromdurchflossener<br />
Fläche: J = I/A.<br />
Die Einheit der elektrischen Stromdichte<br />
ist: A/m 2 .<br />
Wird biologisches Gewebe von Strom<br />
durchflossen, ist die Stromstärke von<br />
Ort zu Ort verschieden. In biologischem<br />
Gewebe, in dem hohe Stromdichten<br />
auftreten, kann dies zu dessen<br />
Erwärmung führen. Dieser Effekt<br />
kann gezielt z. B. zum HF-Schnitt<br />
genutzt werden, aber auch eine<br />
Gewebeerwärmung außerhalb des<br />
OP-Gebietes zur Folge haben.<br />
U P<br />
T1<br />
T2
Belgien, Diegem<br />
Telefon (00 32) 24 0313 60<br />
erbe@erbe.be<br />
China, Shanghai *<br />
Telefon (00 86) 21- 62 75 84 40<br />
erbe@erbechina.com<br />
Frankreich, Limonest<br />
Telefon (00 33) 4 78 64 92 55<br />
erbe@erbe-france.com<br />
Großbritannien, Leeds<br />
Telefon (00 44) 1132-53 03 33<br />
sales@erbeuk.com<br />
Niederlande, Werkendam<br />
Telefon (00 31) 183 509 755<br />
klantenservice@erbe.nl<br />
Österreich, Wien<br />
Telefon (00 43) 1-8 93 24 46<br />
erbe-aut@erbe-med.com<br />
Polen, Warszawa<br />
Telefon (00 48) 2 26 42-25 26<br />
sales@erbe.pl<br />
Russland, Moskau *<br />
Telefon 007-095-258 1905<br />
erbe-rus@erbe-med.com<br />
Schweiz, Winterthur<br />
Telefon (00 41) 52-2 33 37 27<br />
sales@deltamed.ch<br />
Ungarn, Budapest<br />
Telefon (00 36) 1-2 62 69 86<br />
info@erbe-med.hu<br />
USA, Marietta<br />
Telefon (001) 770-955-4400<br />
sales@erbe-usa.com<br />
* Repräsentanz<br />
<strong>ERBE</strong> Deutschland<br />
Vertriebsteam Mitte-West<br />
Telefon 0 70 71/7 55-405<br />
Telefax 0 70 71/7 55-5405<br />
team-mitte-west@erbe-med.de<br />
NRW<br />
Telefon 0 23 05/35 88-0<br />
GSNRW@erbe-med.de<br />
Frankfurt<br />
Vertriebsteam Süd<br />
Telefon 0 70 71/7 55-406<br />
Telefax 0 70 71/7 55-5406<br />
team-sued@erbe-med.de<br />
Baden-Württemberg<br />
München<br />
K UNDEN-HOTLINE<br />
Telefon 0 70 71/7 55-1 23<br />
Telefax 0 70 71/7 55-51 23<br />
Support@erbe-med.de<br />
T ECHNISCHER S ERVICE<br />
Telefon 0 70 71/7 55-4 37<br />
Telefax 0 70 71/7 55-1 89<br />
Techservice@erbe-med.de<br />
Vertriebsteam Nord-Ost<br />
Telefon 0 70 71/7 55-404<br />
Telefax 0 70 71/7 55-5404<br />
team-nord-ost@erbe-med.de<br />
Berlin<br />
Telefon 03 37 08/5 59-0<br />
GSBerlin@erbe-med.de<br />
Hannover<br />
Leipzig<br />
<strong>ERBE</strong> Elektromedizin GmbH<br />
Waldhörnlestraße 17<br />
D-72072 Tübingen<br />
Telefon 0 70 71/7 55-0<br />
Telefax 0 70 71/7 55-1 79<br />
sales@erbe-med.de<br />
www.erbe-med.de