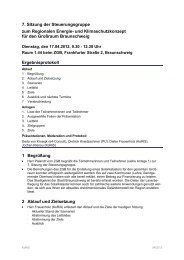Landwirtschaftlicher Fachbeitrag, Bewertung von Trassenvarianten ...
Landwirtschaftlicher Fachbeitrag, Bewertung von Trassenvarianten ...
Landwirtschaftlicher Fachbeitrag, Bewertung von Trassenvarianten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Landwirtschaftlicher</strong> <strong>Fachbeitrag</strong><br />
<strong>Bewertung</strong> <strong>von</strong> <strong>Trassenvarianten</strong><br />
der Ortsumgehung Brome
Inhaltsverzeichnis<br />
1 EINLEITUNG 4<br />
2 RAUMANALYSE – LANDWIRTSCHAFT IM UNTERSUCHUNGSRAUM 6<br />
2.1 Standortbezogene Wirtschaftsfaktoren 6<br />
2.2 Betriebs- und Produktionsstruktur 12<br />
2.3 Auswirkungen auf die Landwirtschaft 14<br />
3 VARIANTENVERGLEICH B 248 OU BROME 19<br />
3.1 Flächenentzug 20<br />
3.2 Schlagstruktur (An- und Durchschneidungen) 21<br />
3.3 Querung <strong>von</strong> Wirtschaftswegen und Beregnungsleitungen 23<br />
4 ENTSCHEIDUNGSMATRIX UND BEURTEILUNG DER TRASSEN-<br />
VARIANTEN AUS LANDWIRTSCHAFTLICHER SICHT 24<br />
5 ERGÄNZENDE BEWERTUNGSFAKTOREN 26<br />
6 PLANUNGSHINWEISE 27<br />
6.1 Weiterführung der Umgehung B 248 in Richtung Westen (OU Voitze) 27<br />
6.2 Alternativen und Korrekturen der vorgelegten <strong>Trassenvarianten</strong> 27<br />
6.3 Sonstiges 28<br />
7 ZUSAMMENFASSUNG 29<br />
8 LITERATURVERZEICHNIS 30<br />
9 KARTENANHANG 31<br />
2
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Vorsorgegebiete Landwirtschaft (Nds.) aufgrund des natürlichen<br />
Ertragspotenzials....................................................................................... 7<br />
Tabelle 2: Langjährige Klimaeckdaten für Brome....................................................... 8<br />
Tabelle 3: Kennzahlen der Gemarkungen auf Gebiet des Landes Niedersachsen .... 9<br />
Tabelle 4: Durchschnittlicher Zusatzwasserbedarf landwirtschaftlicher Kulturen...... 10<br />
Tabelle 5: Äußere Verkehrslage (Auswahl verschiedener Markthandelspartner)..... 11<br />
Tabelle 6: Deckungsbeiträge und Arbeitsaufwand ................................................... 16<br />
Tabelle 7: Streckenlänge und Flächeninanspruchnahme......................................... 20<br />
Tabelle 8: Anteil der Betroffenheit <strong>von</strong> Bodentypen (Schätzung) ............................. 20<br />
Tabelle 9: Ertragsindex und durchschnittlich betroffene Bodenzahlen .................... 21<br />
Tabelle 10: Vergleichswert An- und Durchschneidungsschäden.............................. 22<br />
Tabelle 11: Querung <strong>von</strong> Wirtschaftswegen............................................................. 23<br />
Tabelle 12: Überbaute Beregnungsleitungen ........................................................... 24<br />
Tabelle 13: Rangfolge der Varianten bei den einzelnen Beurteilungskriterien.......... 24<br />
Tabelle 14: Bildung eines Vergleichswertes ............................................................. 25<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Vorgehensweise .................................................................................... 5<br />
Abbildung 2: Gewichtungsfaktoren........................................................................... 19<br />
Kartenverzeichnis<br />
Karte 1: Bodentypen................................................................................................. 32<br />
Karte 2: Bodenzahlen …………………………………………………………………..... 33<br />
Karte 3: Meliorationsmaßnahmen…………………………………………………… ..... 34<br />
Karte 4: Hofstandorte………………………………………………………………………35<br />
Karte 5: Bewirtschafter .............. ………………………………………………………...36<br />
Karte 6: Trassenalternativen……………………………………………… ................….37<br />
3
1 Einleitung<br />
Als Folge der Wiedervereinigung und der damit verbundenen Verkehrsentwicklung<br />
wird die Erforderlichkeit einer Ortsumgehung Brome im Zuge der Neutrassierung der<br />
B 248 diskutiert. Unter Einbeziehung einer großen Lösung auch über das Gebiet des<br />
Bundeslandes Sachsen-Anhalt verbleiben aus Sicht der Straßenplaner zwei zu beurteilende<br />
<strong>Trassenvarianten</strong> nördlich <strong>von</strong> Brome sowie eine Trassenvariante südlich<br />
<strong>von</strong> Brome in der näheren Betrachtung.<br />
Ein Scopingtermin gemäß § 5 UVPG wurde am 23.04.2002 durchgeführt. Die Überprüfung<br />
der FFH-Verträglichkeit ist am 06.07.2004 vorgestellt worden. Das Verfahren<br />
befindet sich im Stadium der Tassenfindung/Raumordnung.<br />
Alle <strong>Trassenvarianten</strong> führen durch Gemarkungsbereiche, in denen eine intensive<br />
landwirtschaftliche Flächenbewirtschaftung erfolgt. Böden stellen eines der wichtigsten<br />
Produktionsmittel der Landwirte dar. Dieses Produktionsmittel ist durch seine Unvermehrbarkeit<br />
gekennzeichnet. Der Bau einer Umgehungsstraße führt zu einem<br />
Flächenverbrauch, zur An- und Durchschneidung landwirtschaftlich genutzter Flächen<br />
und zu Eingriffen in das landwirtschaftliche Wege- und Beregnungsnetz. Dies<br />
hat unmittelbar einkommenswirksame Belastungen der betroffenen Landwirte zur<br />
Folge.<br />
Die Entscheidungsträger haben diese besondere Betroffenheit der Landwirte erkannt<br />
und sich dazu entschlossen, mit der Auftragsvergabe eines landwirtschaftlichen<br />
<strong>Fachbeitrag</strong>es die Belange der Landwirtschaft rechtzeitig und detailliert zu ermitteln<br />
und frühzeitig in die Abwägung einfließen zu lassen.<br />
Mit Schreiben vom 10.05.2004 erteilte der Landkreis Gifhorn der Landwirtschaftskammer<br />
Hannover, Bezirksstelle Braunschweig, den Auftrag, einen landwirtschaftlichen<br />
<strong>Fachbeitrag</strong> zur Beurteilung der <strong>Trassenvarianten</strong> der Ortsumgehung Brome (B<br />
248) zu erstellen. Im Entwurf wurde dann mit Stand vom 04.10.2004 eine <strong>Bewertung</strong><br />
der aktuell diskutierten <strong>Trassenvarianten</strong> dem Landkreis Gifhorn vorgelegt.<br />
Unter anderem aufgrund naturschutzfachlicher Gesichtspunkte sind in der Zwischenzeit<br />
die <strong>Trassenvarianten</strong> verändert worden. Neben zwei ortsnahen Varianten ist nun<br />
eine weiträumige Nordumgehung, die das Bundesland Sachsen-Anhalt tangiert, aufgenommen<br />
worden. Eine Ergänzungsauftrag zur Beurteilung dieser Trassen wurde<br />
mit Schreiben vom 19.12.2005 durch den Landkreis Gifhorn an die Landwirtschaftskammer<br />
Niedersachsen erteilt.<br />
Eine Überarbeitung der Südtrasse (enge Südumgehung) wurde u.a. aufgrund der<br />
neu errichteten Biogasanlage im östlichen Trassenverlauf im Jahr 2006 erforderlich<br />
und aktuell in vorliegendem <strong>Fachbeitrag</strong> berücksichtigt.<br />
Eine Variante Süd 2, die über einen großen Streckenabschnitt durch den Bromer<br />
Busch verläuft (Stand: November 2006; Kartengrundlage Ingenieurgemeinschaft<br />
Schubert), ist darüber hinaus entwickelt worden. Aufgrund der forstlichen Betroffenheit<br />
und daraus resultierender Kompensationsmaßnahmenansprüche ist diese Trasse<br />
nicht in die Beurteilungsmatrix der Landwirtschaft eingeflossen. Eine Beurteilung<br />
erfolgt im Einvernehmen mit dem Landkreis Gifhorn als Auftraggeber des Fachbei-<br />
4
trages außerhalb dieser Abhandlung unter Einbeziehung der forstfachlichen Beratung.<br />
Der landwirtschaftliche <strong>Fachbeitrag</strong> basiert auf verschiedenen Auswertungen und<br />
Erhebungen, wie<br />
• Befragungen (auch einzelbetrieblich)<br />
• örtlichen Erhebungen und Kartierungen<br />
• Auswertungen <strong>von</strong> Kartenmaterial und anderen Fachplanungen<br />
• Literaturrecherche<br />
• Berücksichtigung <strong>von</strong> Daten des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung<br />
und des Katasteramtes.<br />
Der <strong>Fachbeitrag</strong> berücksichtigt die Belange der örtlichen Landwirtschaft, ohne in diesem<br />
Punkt die Tiefe einer Betroffenheitsanalyse zu erreichen. Neben den Produktionsbedingungen<br />
(u.a. Boden, Klima, Wasser) wird die Produktionsstruktur der Betriebe<br />
aufgezeigt (u.a. nach Befragung der Landwirte). Eine Bewirtschafterkartierung<br />
wurde vorgenommen und die Lage <strong>von</strong> Beregnungsbrunnen und –leitungen sowie<br />
Meliorationsmaßnahmen ermittelt.<br />
Wesentlicher Bestandteil des <strong>Fachbeitrag</strong>es ist das Aufzeigen <strong>von</strong> Beurteilungsansätzen<br />
zu den <strong>Trassenvarianten</strong> aus landwirtschaftlicher Sicht. Hierzu zählen beispielsweise<br />
An- und Durchschneideeffekte der Varianten sowie die Streckenlänge.<br />
Die Bildung eines Vergleichswertes (Index), der aus Streckenlänge und Standortproduktivität<br />
(Bodenzahl) entwickelt wurde, erlaubt eine weitere wertende Gegenüberstellung<br />
der Varianten.<br />
Danach wird durch Gewichtung der Einzelkriterien eine Gesamtbewertung der Varianten<br />
bezüglich ihrer zu erwartenden Auswirkungen auf die örtliche Landwirtschaft<br />
vorgenommen.<br />
Abbildung 1: Vorgehensweise<br />
Wirtschaftswege Ertragsindex<br />
(Länge u. Bodenzahl)<br />
Ergänzende<br />
<strong>Bewertung</strong>sfaktoren<br />
Beregnungs-<br />
leitungen<br />
Rangbildung und Gewichtung nach Betroffenheit<br />
Bildung eines<br />
Vergleichswertes<br />
Trassenbewertung<br />
5<br />
Schlagstruktur
2 Raumanalyse – Landwirtschaft im Untersuchungsraum<br />
2.1 Standortbezogene Wirtschaftsfaktoren<br />
Von wesentlicher Bedeutung für die örtliche Landwirtschaft sind die natürlichen<br />
Standortbedingungen. Diese manifestieren sich besonders in den Bodenverhältnissen.<br />
Weiterhin hat das vorherrschende Klima Einfluss auf Ertrag und Qualität der<br />
landwirtschaftlichen Produkte. Ableitbar sind mögliche notwendige menschliche Einflüsse<br />
(Melioration, Dränage, Beregnung).<br />
Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands ist der Untersuchungsraum der<br />
Ostheide zuzuordnen. Diese gliedert sich in die Bromer Geest zwischen Voitze und<br />
Brome sowie das Ohretal, eine <strong>von</strong> Talsanden angefüllte Schmelzwasserrinne. Nach<br />
der länderbezogenen räumlichen Gliederung wird der Untersuchungsraum dem Naturraum<br />
„Lüneburger Heide und Wendland-westlicher Teil“ zugeordnet.<br />
Boden<br />
Landwirtschaftliche Auswertungen zu Böden und deren Eigenschaften können auf<br />
vielfältige Weise vorgenommen werden. In der nachfolgenden Betrachtung wird auf<br />
die Betroffenheit der verschiedenen Bodentypen sowie die natürliche Ertragsfähigkeit<br />
der <strong>von</strong> der Planung betroffenen Bereiche eingegangen. Die Bodentypen sind in Karte<br />
1 des Anhanges dargestellt.<br />
Böden mit charakteristischer Abfolge und Ausprägung der Bodenhorizonte werden<br />
zu einem Bodentyp zusammengefasst (Grundlage der Bodensystematik). Übergänge<br />
zwischen zwei Bodentypen werden durch einen Bindestrich dargestellt. Hierbei überwiegen<br />
dann die Charakteristiken des Letztgenannten.<br />
Einige Stichworte vermitteln Unterschiede, die besonders für den Flächenbewirtschafter<br />
<strong>von</strong> Bedeutung sind:<br />
Parabraunerde: Tonverlagerung (Lessivierung) vom Oberboden in den Unterboden.<br />
Es handelt sich um fruchtbare Ackerböden mit hohen geogenen Nährstoffvorräten,<br />
günstigem Wasserhaushalt, guter Nährstoffversorgung und i.d.R. hohen Bodenzahlen.<br />
Braunerde: Aufgrund der silicatischen Verwitterung Überzüge (Verbraunung) an z.B.<br />
Tonmineralen. Es gibt viele Subtypen/Ausgangsgesteine, so dass die Nutzung hier<br />
nicht einheitlich beschrieben werden kann. Für die Braunerden im Untersuchungsraum<br />
kann <strong>von</strong> mittleren Nährstoffvorräten und geringem bis mittlerem Wasserhaushalt<br />
ausgegangen werden.<br />
Podsol: Lösungs- und Auswaschungsprozess im Oberboden, der dadurch aufgehellt<br />
(russ. Podzol=aschfahl) ist. Häufig bildet sich Ortstein (die ausgewaschenen Sesquioxide<br />
verdichten sich), der dann zu Problemen in der Bewirtschaftung führt. Es<br />
handelt sich um relativ ungünstige Standorte, die i.d.R eine niedrige Wasserspeicher-<br />
6
leistung, eine geringe N- und P- Verfügbarkeit sowie Armut an K, Ca, Mg und Mikronährstoffen<br />
aufweisen.<br />
Gley: Böden mit rostfarbener Oxidationszone im Kapillarsaum des Grundwassers.<br />
Darunter liegt der dauerhaft wasserbeeinflusste Horizont, der durch die Reduktionsvorgänge<br />
graublau/grauschwarz gefärbt ist. Auch hier existieren viele Subtypen. Die<br />
landwirtschaftliche Nutzung wird besonders durch die Höhe des Grundwasserstandes<br />
beeinflusst. Der überwiegende Teil der <strong>von</strong> den Trassen beeinflussten Bodentypen<br />
Gley wird als Grünland genutzt. Dies ist Indiz für einen aus Sicht der Ackernutzung<br />
ungünstigen Grundwasserstand.<br />
Pseudogley: Von Staunässe geprägter Bodentyp. Typisch für Standorte mit Wechselfeuchte<br />
, d.h. saisonaler Trockenheit bzw. Vernässung. Der Staukörper im Unterboden<br />
ist schlecht belüftet und bietet Pflanzenwurzeln häufig kein Durchkommen. Auch<br />
hier viele Subtypen; die Höhe des Staukörpers in Verbindung mit der Niederschlagsmenge<br />
beeinflussen die Nutzungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft.<br />
Der Landwirtschaftliche <strong>Fachbeitrag</strong> zum Regionalen Raumordnungsprogramm für<br />
den Großraum Braunschweig greift in Teil 2 die Leitbilder und Potenziale zur Entwicklung<br />
und Darstellung der Landwirtschaft auf (Landwirtschaftskammer Hannover,<br />
2000).<br />
In der zum Landwirtschaftlichen <strong>Fachbeitrag</strong> zum Regionalen Raumordnungsprogramm<br />
erstellten Themenkarte „Vorsorgegebiete für Landwirtschaft“ wird auch das<br />
natürliche, standortbezogene Ertragspotenzial dargestellt (Planzeichen 4.1). Grundlage<br />
hierfür sind Auswertungen des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung,<br />
das für jede Bodenregion das Ertragspotential der Böden in sieben Klassen<br />
unterteilt. Die Klassen 4 bis 7 (Ertragspotential mittel bis äußerst hoch) sind im <strong>Fachbeitrag</strong><br />
zum RROP als Vorsorgegebiete Landwirtschaft dargestellt worden.<br />
Tabelle 1: Vorsorgegebiete Landwirtschaft (Nds.) aufgrund des natürlichen Ertragspotenzials<br />
Landwirtschaftliche Flächen<br />
Vorsorgegebiet<br />
(Planzeichen 4.1)<br />
nördlich der alten B 248 95 % der LF<br />
südlich der alten B 248 40 % der LF<br />
Im Rahmen der Bodenschätzung hat der Boden mit der höchsten Ertragsfähigkeit in<br />
Deutschland die Zahl 100 (Vergleichsboden liegt in der Magdeburger Börde) erhalten.<br />
Die Schätzung erfolgt als Reinertragsschätzung. Jedes Grundstück erhält eine<br />
Wertzahl, die angibt, in welchem Verhältnis der Reinertrag des geschätzten Grundstückes<br />
zum Reinertrag des Bodens mit der Wertzahl 100 liegt. Die Bodenzahl ist der<br />
Maßstab für den Bodenwert unter Berücksichtigung seiner Bodenfruchtbarkeit und<br />
der natürlichen Ertragsfaktoren. Standortbesonderheiten können durch Zu- und Abschläge<br />
<strong>von</strong> der Bodenzahl einbezogen werden, die dann abschließend die Ackerzahl<br />
ergeben.<br />
7
Die Ertragsfähigkeit im Betrachtungsraum ist über die dargestellten Bodenzahlen der<br />
Karte 2 im Anhang zu entnehmen. Westlich (Beginn der Baustrecken) und östlich <strong>von</strong><br />
Brome (Ende der Baustrecke) liegen vergleichsweise geringere Bodenzahlen vor (30<br />
und darunter). Nördlich und südlich Brome sind Bodenzahlen <strong>von</strong> durchschnittlich 40<br />
Punkten anzutreffen. Die Bodenzahlen beruhen auf Angaben der Oberfinanzdirektion<br />
Hannover sowie des Landesamtes für Geologie und Bergwesen des Landes Sachsen-Anhalt.<br />
Relief<br />
Das Gelände ist leicht kupiert. Niederungsbereiche sind im Süd-Osten bzw. in der<br />
Ohre Niederung anzutreffen. Ansonsten kann das Gelände aus Sicht der Landbewirtschaftung<br />
als weitgehend barrierefrei und ohne Gefährdung durch Wassererosion<br />
angesehen werden. Winderosion spielt nach Erfahrungen der Landwirte eine untergeordnete<br />
Rolle.<br />
Klima<br />
Nach dem Entwurf der Umweltverträglichkeitsstudie (alw, 2004) ist das Klima im Untersuchungsraum<br />
schwach maritim geprägt. Es ist gekennzeichnet durch kühle Sommer<br />
und milde Winter.<br />
Hinsichtlich der Verteilung der Niederschlagsmengen zeigen sich nach der UVS lokale<br />
Unterschiede. Westlich <strong>von</strong> Brome fallen durchschnittlich 600 bis 650 mm Niederschlag<br />
im Jahr; östlich <strong>von</strong> Brome beträgt die Niederschlagsmenge nur 550 bis 600<br />
mm. Überwiegend herrschen westliche Winde vor.<br />
Tabelle 2: Langjährige Klimaeckdaten für Brome<br />
Zeitraum<br />
Temperatur<br />
° C<br />
Niederschlag<br />
mm<br />
Januar 0,4 49,5<br />
Februar 1,0 32,3<br />
März 4,3 43,6<br />
April 7,9 47,4<br />
Mai 12,7 54,5<br />
Juni 15,8 72,7<br />
Juli 17,1 60,6<br />
August 17,0 70,6<br />
September 13,9 43,4<br />
Oktober 9,8 42,0<br />
November 4,9 49,3<br />
Dezember 1,7 56,2<br />
im Mittel 8,88 622,1 mm<br />
Quelle: DWD; über Fachverband Feldberegnung<br />
8
Insbesondere in der Hauptvegetationsphase <strong>von</strong> Ende April bis September reichen<br />
die natürlichen Niederschläge in Verbindung mit der nutzbaren Feldkapazität der<br />
vorherrschenden Bodentypen nicht aus, den Bedarf der Kulturen an Wasser zu decken.<br />
Nutzungsstruktur<br />
Im Untersuchungsraum, der die vier Gemarkungen Altendorf, Brome, Voitze und<br />
Wendischbrome (Sachsen-Anhalt) tangiert, dominiert hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen<br />
Nutzung der Ackerbau. Das Grünland befindet sich im Bereich der<br />
Ohre sowie südlich der Ortslage Brome im Bereich einer z.Z. nicht mehr bewirtschafteten<br />
Hofstelle an der Braunschweiger Straße (überwiegend Pferdehaltung und Extensivrinder).<br />
Nutzwald (nicht unmittelbar betroffen) befindet sich nur im Bereich der<br />
Südvariante. Die Verteilung der Nutzungen in den Gemarkungen wird aus der folgenden<br />
Tabelle deutlich:<br />
Tabelle 3: Kennzahlen der Gemarkungen auf Gebiet des Landes Niedersachsen<br />
Kennzahl<br />
Gemarkung<br />
Brome<br />
Gemarkung<br />
Altendorf<br />
Gemarkung<br />
Voitze<br />
Ackerland (ha) 503 390 556<br />
Grünland (ha) 70 45 131<br />
LF Gesamt (ha) 573 435 687<br />
Forst (ha) 263 35 321<br />
Land und Forst (ha) 836 470 1008<br />
Gemarkungsfläche (ha) 983 502 1070<br />
Ø Ackerzahl 34 38 33<br />
Ø Grünlandzahl 39 36 37<br />
Quelle: Oberfinanzdirektion Hannover, 1997<br />
Die Ackerflächen zeigen überwiegend gute Schlagstrukturen und Zuschnitte mit einer<br />
geschätzten durchschnittlichen Bewirtschaftungsgröße <strong>von</strong> ca. 6-8 ha auf.<br />
Innerhalb des Untersuchungsraumes unterscheiden sich die Schlaggrößen. Im nördlichen<br />
und östlichen Bereich können 6-7 ha angenommen werden, südlich werden im<br />
Durchschnitt 4-5 ha große Flächen bewirtschaftet und westlich (u.a. aufgrund der<br />
Flurbereinigung Voitze) können 10 ha angenommen werden. In Wendischbrome sind<br />
überwiegend Flächengrößen über 10 ha zu verzeichnen.<br />
Die Schlaggröße als wichtiges Kriterium der Produktionsbedingungen ist im Untersuchungsraum<br />
als vergleichsweise gut zu bezeichnen.<br />
Dränage, Beregnung, Wirtschaftswege<br />
Die Beregnungsbedürftigkeit ergibt sich aus der im Untersuchungsraum vorherrschenden<br />
bodenbedingten geringen Wasserspeicherfähigkeit der Flächen verbunden<br />
mit einer negativen klimatischen Wasserbilanz in der Vegetationsperiode sowie dem<br />
Wasserbedarf der angebauten Kulturen.<br />
Die Beregnungswürdigkeit ist eine ökonomische Kenngröße und betrachtet den Vergleich<br />
zwischen Aufwand (Kosten des Betriebsmitteleinsatzes Feldberegnung) und<br />
dem (Geld-) Ertrag, der sich aus Qualität und Menge der Ernteerzeugnisse ableitet.<br />
9
Insbesondere Hackfrüchte (Zuckerrüben und Kartoffeln) sowie Gemüse und Sonderkulturen<br />
(Zwiebeln, Kohl, Erdbeeren, Spargel u.a.) sind beregnungsbedürftig und beregnungswürdig.<br />
Aber auch der Anbau <strong>von</strong> Getreide fällt hierunter. So sind bei dem<br />
Sommergerstenanbau Ertrag und Qualität (Eiweißgehalt) zum Erreichen der Einstufung<br />
als Braugerste häufig in erster Linie <strong>von</strong> dem Betriebsmitteleinsatz Beregnung<br />
abhängig.<br />
Im Untersuchungsraum werden nahezu alle landwirtschaftlichen Flächen beregnet.<br />
Die entsprechenden Einrichtungen (Brunnen, Beregnungsleitungen) sind in der Karte<br />
3 (Meliorationsmaßnahmen) des Anhanges dargestellt. Die Wasserförderung wird<br />
über Dieselaggregate oder über elektrische Pumpen vorgenommen. Einige Landwirte<br />
nutzen gemeinsam Brunnen und führen dann das Wasser über Erdleitungen zum<br />
Bestimmungsort (Standort der Beregnungsmaschine).<br />
Erhebungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Braunschweig,<br />
zeigen, dass im Raum Brome im Mittel der letzten 7 Jahre eine Zusatzregenhöhe<br />
<strong>von</strong> 84 mm/ha gegeben wurde. In den trockenen Jahren 1995, 1996, 1999<br />
und 2000 wurde im Mittel jedoch rd. 96 mm Zusatzwasser (ca. 3-4 Regengaben) eingesetzt.<br />
Die Kalkulation des Beregnungswasserbedarfes kann sich an der in Karte 2 dargestellten<br />
Bodengüte orientieren:<br />
Tabelle 4: Durchschnittlicher Zusatzwasserbedarf landwirtschaftlicher Kulturen<br />
Durchschnittlicher Zusatzwasserbedarf<br />
Kultur Bodenbonität gering Bodenbonität mittel<br />
mm/a<br />
mm/a<br />
Zuckerrüben 120 90<br />
Kartoffeln 120 100<br />
Braugerste (Sommergerste)<br />
Wintergetreide<br />
75 75<br />
(Weizen, Gerste, Roggen, Triticale) 60-90<br />
30-70<br />
Raps 40 20<br />
Silomais 60 30<br />
Gemüse 120 100<br />
Die Abführung überschüssiger Bodenwassermengen durch Dränagen wird nur auf<br />
einem geringen Flächenanteil vorgenommen. Bei der Befragung wurden uns drei<br />
dränierte Flächen im Bereich der Gemarkung Altendorf benannt. In der Karte 3 (Meliorationsmaßnahmen)<br />
sind diese Flächen ausgewiesen.<br />
Das Wirtschaftswegenetz ist überwiegend gut ausgebaut. Lediglich in sehr geringen<br />
Teilbereichen ist eine ausreichende Befestigung über Asphaltdecke o.ä. nicht vorhanden.<br />
Die Erreichbarkeit sämtlicher Nutzflächen ist über das bestehende Wegenetz<br />
gegeben, das derzeit ohne wesentliche zeitliche Einschränkungen (keine Umwege)<br />
durch die Betriebe verwendet werden kann. Die Wege stehen u.W. im Eigentum<br />
der politischen Gemeinde.<br />
10
Lage der Hofstellen, Verkehrsbeziehungen, Gemarkungen<br />
Die Hofstellen im Untersuchungsraum sind in der Karte 4 kartiert. Die landwirtschaftliche<br />
Hofstelle Kremeike (mit Biogasanlage) sowie die ehemalige Hofstelle Schaper,<br />
auf der noch Schweinemast betrieben wird (nordöstlicher Bereich des Untersuchungsraumes)<br />
befinden sich im Außenbereich, der <strong>von</strong> der Südvariante tangiert<br />
wird.<br />
Auf der ehemaligen Hofstelle Paasche südöstlich <strong>von</strong> Brome (östlich des Einkaufszentrums/der<br />
Feuerwehr) wird noch Pferdehaltung betrieben.<br />
Nordwestlich <strong>von</strong> Altendorf liegt im Außenbereich die landwirtschaftliche Hofstelle<br />
Böttcher (Gödchen Mühle). Östlich da<strong>von</strong> berührt die weiträumige Nordumgehung<br />
(Variante Nord 2) das nähere Umfeld dieser Hofstelle.<br />
Die weiteren Hofstellen liegen in den Ortslagen Voitze, Altendorf und Brome. Der<br />
Betrieb Dörrheide an der Dörrheidenstraße in Altendorf hat aufgrund der unmittelbaren<br />
Lage zu seinen Bewirtschaftungsflächen eine mit dem Außenbereich vergleichbare<br />
Feld-Hof-Beziehung.<br />
Von den Trassen betroffene Ackerflächen werden über Brome hinaus <strong>von</strong> Landwirten<br />
mit Hofstellen in Grasleben, Wendisch-Brome, Tülau-Fahrenhorst, Benitz, Voitze,<br />
Jübar und Parsau bewirtschaftet.<br />
Bei den Verkehrsbeziehungen sind die innere und die äußere Verkehrslage zu unterscheiden.<br />
Die innere Verkehrslage kennzeichnet die Beziehung Hofstelle-Nutzfläche. Diese ist<br />
überwiegend als gut bis sehr gut zu bezeichnen. Bis auf den Betrieb aus Grasleben<br />
werden die Nutzflächen im Bereich der <strong>Trassenvarianten</strong> durch Landwirte aus umliegenden<br />
Ortschaften genutzt. Von Tülau und Benitz sind ca. 5 km Entfernung zu den<br />
Bewirtschaftungsflächen zu verzeichnen. Parsau befindet sich ca. 10 km entfernt.<br />
Durch die Biogasanlagen entsteht eine besondere Feld-Anlagenbeziehung. Fahrten<br />
werden einerseits durch die großen Mengen an Inputmaterial erforderlich. Andererseits<br />
ist nahezu die gleiche Menge als Output im Rahmen der Düngung wieder auf<br />
den Betriebsflächen zu verteilen.<br />
Die äußere Verkehrslage ist gekennzeichnet durch überregionale Verkehrsbeziehungen.<br />
Die Markthandelspartner der örtlichen Betriebe sind in der nachfolgenden Tabelle<br />
aufgeführt.<br />
Tabelle 5: Äußere Verkehrslage (Auswahl verschiedener Markthandelspartner)<br />
Handelspartner Standort<br />
Zuckerfabrik Klein Wanzleben, Uelzen<br />
Kartoffeln (Stärke und Veredelung) Hagenow, Dallmin, Wittingen, Hankensbüttel<br />
Kartoffeln (Speise) Uelzen, Hankensbüttel<br />
Getreide Tiddische, Wettendorf, Wittingen u.a.<br />
Betriebsmittel (z.B. Düngemittel) Tiddische, Wittingen, Hankensbüttel<br />
Landmaschinenwerkstätten Tülau, Voitze, Beetzendorf<br />
Schlachthof Lüneburg, ortsansässige Schlachter<br />
Zwiebeln Dollbergen<br />
11
Teilweise werden überbetriebliche Transportgemeinschaften gebildet (Zuckerrübenabfuhr).<br />
Einige Landwirte verfügen für Transportarbeiten auch über LKWs. Größe<br />
und Gewichte landwirtschaftlicher Fahrzeuge haben in der Vergangenheit deutlich<br />
zugenommen. Dies ist auch für die Zukunft zu erwarten. Bei der Benutzung <strong>von</strong> Verkehrswegen<br />
sind hohe Anforderungen an die Funktionalität bzw. Wegeverhältnisse<br />
zu verzeichnen. Dies trifft auch auf Transportarbeiten zu. Bei LKW-Abfuhr <strong>von</strong> Erntegütern<br />
ist zu beachten, dass diese i.d.R. nicht den Acker befahren können und auf<br />
festem Untergrund beladen werden müssen. Darüber hinaus ist aufgrund der fehlenden<br />
Wendemöglichkeit die Einrichtung eines Rundparcours insbesondere bei der<br />
Zuckerrübenabfuhr erforderlich.<br />
2.2 Betriebs- und Produktionsstruktur<br />
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe, Betriebsform und Familieneinkommen<br />
Im Bereich der Trassen bewirtschaften 19 landwirtschaftliche Betriebe Nutzflächen.<br />
Unterteilt nach dem Anteil am Familieneinkommen können 17 dieser Betriebe der<br />
Gruppe der Haupterwerbsbetrieb zugeordnet werden.<br />
Ein Betrieb wird im Nebenerwerb bewirtschaftet. Darüber hinaus handelt es sich bei<br />
einem Betrieb in Sachsen-Anhalt um eine Agrargenossenschaft. Die Hobbypferdehaltung<br />
und -grünlandnutzung ist in der Bewirtschafterkartierung mit erfasst worden.<br />
Im Vergleich zu den Gesamtanteilen im Landkreis Gifhorn ist ein unterdurchschnittlicher<br />
Anteil Nebenerwerbslandwirte im Untersuchungsraum zu verzeichnen (vgl. auch<br />
Landwirtschaftskammer Hannover, Zahlen aus der Landwirtschaft 2003).<br />
Im Rahmen der landwirtschaftlichen Betriebssystematik werden verschiedene Betriebsformen<br />
anhand der Struktur des Gesamtstandarddeckungsbeitrags unterschieden.<br />
Die betroffenen Betriebe werden größtenteils als reine Marktfruchtbetriebe (Produktion<br />
und Vermarktung <strong>von</strong> Zuckerrüben, Kartoffeln, Getreide etc.) geführt. Lediglich<br />
ein Betrieb ist als Futterbaubetrieb (Milchkühe) einzustufen, ein Betrieb lässt sich<br />
den Gemischtbetrieben zuordnen.<br />
Aus dieser Zusammenstellung wird die besondere Bedeutung des Ackerbaus für die<br />
Einkommensentstehung im Gebiet deutlich.<br />
Betriebsgröße und Anteil an Eigentumsflächen<br />
Im Durchschnitt bewirtschaften die Betriebe rd. 155 ha Betriebsfläche. Hier<strong>von</strong> stehen<br />
durchschnittlich rd. 70 ha im Eigentum der Betriebe (rd. 45 % der Bewirtschaftungsfläche),<br />
die restliche Fläche ist zugepachtet.<br />
Die Agrargenossenschaft Jübar nimmt aufgrund ihrer Struktur und Größe eine Sonderstellung<br />
ein.<br />
Hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse weisen zwei Betriebe Besonderheiten auf: Ein<br />
Nebenerwerbslandwirt bewirtschaftet nur Eigentumsflächen, dagegen hat ein Haupterwerbsbetrieb<br />
ausschließlich Pachtflächen in Bewirtschaftung.<br />
12
Viehhaltung und ackerbauliches Fruchtartenverhältnis<br />
Die Viehhaltung spielt im Untersuchungsraum eine weitgehend untergeordnete Rolle.<br />
Von den 19 durch die <strong>Trassenvarianten</strong> berührten Betrieben halten fünf Betriebe<br />
Mastschweine, ein Betrieb Zuchtsauen, ein Betrieb Legehennen, zwei Betriebe<br />
Milchkühe sowie ein Betrieb Mutterkühe mit Nachzucht.<br />
Nach Erhebung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (in: Landwirtschaftskammer<br />
Hannover: Zahlen aus der Landwirtschaft 2003) wurden in Niedersachsen<br />
im Jahr 2002 auf den Ackerflächen durchschnittlich 58 % Getreide, 6 % Zuckerrüben,<br />
7 % Kartoffeln und 5 % Raps angebaut.<br />
Wie dargestellt, dominiert im Untersuchungsgebiet der Marktfruchtbaubetrieb. Hierbei<br />
ist ein überdurchschnittlicher Anteil an Hackfrüchten und Sonderkulturen zu verzeichnen.<br />
Im gesamten Untersuchungsraum werden ca. 50 % (ca. 30 % Kartoffeln und ca.<br />
20 % Zuckerrüben) Hackfrüchte angebaut. Einige Betriebe haben aufgrund <strong>von</strong> Sonderkulturen<br />
(Gemüse wie verschiedene Kohlarten, Möhren und Zwiebeln) einen<br />
Hackfruchtanteil <strong>von</strong> 60 bis 70 %. Durch die Biogasanlage ist der Anteil an Silomais<br />
erheblich gestiegen.<br />
An Getreide wird im Rahmen der Fruchtfolge dann überwiegend Sommergerste und<br />
Wintergetreide (Roggen, Gerste) angebaut. Diese Kulturen sind aufgrund der nachwachsenden<br />
Rohstoffe insgesamt rückläufig.<br />
Aufgrund der steigenden Nachfrage der kartoffelverarbeitenden Industrie hat der Kartoffelanbau<br />
stark zugenommen. Die Intensivierung des Hackfruchtanbaus im Plangebiet<br />
lässt sich u.a. darin begründen, dass spezialisierte Landwirte Kartoffelanbau auf<br />
Flächen <strong>von</strong> landwirtschaftlichen Betrieben ohne Kartoffelanbau durch jährliche<br />
Pachtverträge oder Flächentausch in Bewirtschaftung nehmen. Dies induziert auch<br />
eine hohe Beregnungsintensität im Untersuchungsraum.<br />
Nachwachsende Rohstoffe und Biogasanlagen<br />
Im Gemeindegebiet sind mehrere landwirtschaftliche Biogasanlagen entstanden.<br />
Im Nahbereich der Südtrasse liegt die Anlage des Landwirtes E. Kremeike. Mit hohem<br />
Investitionsvolumen ist dieser Betriebszweig auf Generationen ausgelegt. Aufgrund<br />
der Nähe zur Hofstelle im Außenbereich, aber auch zu den Bewirtschaftungsflächen<br />
(u.a. in Sachsen-Anhalt), ist dieses Kriterium – u.a. unter Berücksichtigung<br />
der Arbeitswirtschaft- in die Gesamtbeurteilung einzustellen.<br />
Weitere Anlagen außerhalb der engen Trassenlage sind zu dem in Wiswedel, Benitz,<br />
und Tülau entstanden. Planungen bestehen derzeit für Anlagen in Voitze und<br />
Altendorf.<br />
Erwerbskombinationen, Sonderkulturen<br />
Die Erzeugung ldw. Produkte in Kombination mit einer direkten Vermarktung an den<br />
Endverbraucher ist für fünf Betriebe ein besonderes wirtschaftliches Standbein.<br />
Die Umstellungsphase zum ökologischen Landbau hat ein landwirtschaftlicher Betrieb<br />
mit Flächen überwiegend in der Gemarkung Altendorf abgeschlossen. Dieser<br />
baut auf den Betriebsflächen neben Getreide, Kartoffeln und Leguminosen (z.B. Erbsen)<br />
auch Sonderkulturen (Spargel, Erdbeeren) an. Ggf. soll zukünftig auch die<br />
Viehhaltung wieder aufgenommen werden.<br />
13
Von den anderen Betrieben hebt sich die Flächennutzung der Landwirte Ulrich Dörrheide<br />
und Bromann-Behrens ab. Von diesen Betrieben werden Gemüse bzw. Sonderkulturen<br />
(u.a. Kohlarten, Wirsing, Kohlrabi, Salat, Kürbis, Zucchini, Sellerie sowie<br />
Schnittblumen) auf einer Fläche <strong>von</strong> ca. 25 - 30 ha pro Jahr angebaut. Die im Rahmen<br />
der Fruchtfolge wechselnden Anbauflächen, die über ein ausgebautes Beregnungsnetz<br />
verfügen, stehen überwiegend arrondiert im Bereich der Nordvarianten<br />
(Gemarkung Altendorf) zu Verfügung. Besonders für den Betrieb Dörrheide handelt<br />
es sich um hofnahe Flächen.<br />
Ein Merkmal dieser Sonderkulturen ist (neben dem hohen Beregnungsaufwand) die<br />
hohe Arbeitsintensität. So werden im Zeitraum März/April bis Juni/Juli eines Jahres<br />
ca. 10 Fahrten/Tag zu der Fläche (Bestellung, Pflegemaßnahmen, Ernte, Beregnung)<br />
erforderlich. Hier<strong>von</strong> sind mindestens 2 Fahrten/Tag mit dem Schlepper zu absolvieren.<br />
Zwiebeln werden im Rahmen der Fruchtfolge auch durch die Landwirte Volkmer<br />
(nördlicher und südlicher Untersuchungsraum), Bromann-Behrens (nördlicher Untersuchungsraum)<br />
und Kremeike/Behrend (überwiegend östlicher Untersuchungsraum)<br />
angebaut.<br />
2.3 Auswirkungen auf die Landwirtschaft<br />
Grundsätzliches und Nullvariante<br />
Durch den Umgehungsstraßenbau werden die Agrarstruktur und die Entwicklungsmöglichkeiten<br />
der Betriebe beeinträchtigt. Die Trasse verursacht neben dem erheblichen<br />
Flächenverbrauch (auch durch Ausgleichsmaßnahmen) Wirtschaftserschwernisse<br />
in Form <strong>von</strong> An- und Durchschneidungen landwirtschaftlicher Flächen. Darüber<br />
hinaus werden Wirtschaftswegenetze zerschnitten und bestehende Beregnungs- und<br />
Dränageeinrichtungen überbaut.<br />
Durch eine Ortsumgehung ergeben sich zum Teil gravierende Auswirkungen auf die<br />
Befriedigung der Landnachfrage wachstumsorientierter Betriebe. Unter den heutigen<br />
agrarpolitischen Rahmenbedingungen ist eine ausreichende Flächenausstattung eine<br />
unverzichtbare Voraussetzung für die erfolgreiche Existenz der im Raum besonders<br />
auf Marktfruchtbau spezialisierten Betriebe.<br />
Aus Allem folgt, das für die Betriebe der Status Quo bzw. die Null-Variante das Optimum<br />
darstellt. Die Landwirtschaft benötigt die Ortsumgehung nicht.<br />
Einzelbetriebliche Betroffenheit<br />
Von den Trassen sind alle im Bereich der jeweiligen Variante liegenden Betriebe<br />
mehr oder weniger stark betroffen. Die im Anhang beigefügte Karte 5 zeigt die Bewirtschaftungsflächen<br />
der Landwirte. Sie schließt auch Flächen der Hobbypferdehaltung<br />
mit ein und enthält somit nicht 19 (s.o.) sondern 21 Bewirtschafternummern.<br />
Es wird deutlich, das die Bewirtschafter infolge <strong>von</strong> Zupacht und freiwilliger Flächenzusammenlegung<br />
über große zusammenhängende Flächeneinheiten verfügen. Wird<br />
dieser räumliche Zusammenhang gestört, entstehen erhebliche Bewirtschaftungsbeeinträchtigungen.<br />
Eine generelle Aussage, wonach bestimmte Trassen eine beson-<br />
14
ders geringe Betroffenheit einzelner Landwirte verursachen, kann nicht gegeben werden.<br />
Sowohl bei den beiden Nordvarianten als auch bei der Südvariante werden<br />
einzelne Landwirte besonders stark beeinträchtigt. Eine Sonderstellung nimmt zudem<br />
noch der bereits angesprochene Gemüseanbau im Bereich der Gemarkung Altendorf<br />
(beide Nordvarianten) ein.<br />
Zu berücksichtigen ist die Biogasanlage Kremeike und die Verkehrsbeziehungen zu<br />
den landwirtschaftlichen Flächen des Betriebes (Transport <strong>von</strong> Input-/ Outputmaterialien).<br />
Die Südtrasse führt hier zu einer besonderen einzelbetrieblichen Betroffenheit.<br />
Der Betrieb bewirtschaftet umfangreich Flächen in Sachsen-Anhalt, die nun durch die<br />
Trasse der Südumgehung <strong>von</strong> der Hofstelle/Biogasanlage und dem frequentierten<br />
Wirtschaftswegenetz abgeschnitten werden. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf<br />
den Anlagenbetrieb und die Sicherheit und Leichtigkeit der durchzuführenden Wirtschaftsfahrten.<br />
Flächeninanspruchnahme<br />
Für die überwiegend ackerbaulich ausgerichteten Betriebe im Untersuchungsraum<br />
wird über die Flächeninanspruchnahme die wichtigste Produktionsgrundlage angegriffen.<br />
Landwirtschaftliche Nutzfläche ist nicht vermehrbar.<br />
Dieser Flächenentzug wirkt auf der einzelbetrieblichen Ebene unmittelbare gewinnmindernd.<br />
So verschlechtert sich die Auslastung der verbleibenden betrieblichen<br />
Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital) und die Möglichkeit zur Nutzung <strong>von</strong> Größenvorteilen<br />
(z.B. Abschreibungsschwelle der Maschinen nimmt ab, vgl. auch KÖHNE,<br />
1987, S. 80).<br />
Der Deckungsbeitrag einer Fläche (DB= Marktleistung/Verkaufserlös minus proportionale<br />
Spezialkosten) ist je nach Ausrichtung und Organisation des Betriebes, angebauter<br />
Kultur, gewählter Vermarktungsform und Produktionsintensität sehr unterschiedlich.<br />
Auszüge aus den Richtwert-Deckungsbeiträgen 2005/2006 der Landwirtschaftskammer<br />
Niedersachsen verdeutlichen die Spannbreite <strong>von</strong> Arbeitsaufwand, Erlös, variablen<br />
Kosten und Deckungsbeitrag zwischen einzelnen ausgewählten Kulturen (unter<br />
Beregnung). Ergänzend zu den Angaben in Tabelle 6 ist darauf hinzuweisen, dass<br />
die Vermarktungserlöse bei der (Speise-) Kartoffel erheblich schwanken können, so<br />
das auch deutlich niedrigere DB in den einzelnen Jahren zu erzielen sind.<br />
Der Deckungsbeitrag ist keinesfalls mit dem Betriebsgewinn gleichzusetzen, sondern<br />
hier<strong>von</strong> sind noch Festkosten (Maschinen, Pacht) und Entlohnung des Faktors Arbeit<br />
zu begleichen.<br />
15
Tabelle 6: Deckungsbeiträge und Arbeitsaufwand<br />
Kultur<br />
Sommerbraugerste**<br />
mit 60 dt/ha<br />
Speisekartoffeln**<br />
450 dt/ha<br />
Stärkekartoffeln**<br />
600 dt/ha<br />
Zuckerrüben**<br />
550 dt/ha<br />
Silomais Biogas**<br />
Ertrag 436 dt/ha<br />
Blumenkohl *<br />
27.000 Stück/ha<br />
Kohlrabi *<br />
110.000 Stück/ha<br />
Arbeitsaufwand<br />
Std/ha<br />
Erlös<br />
€/ha<br />
variable<br />
Kosten<br />
€/ha<br />
16<br />
Deckungsbeitrag<br />
€/ha<br />
8,8 738 567 171<br />
28,7 8.682 1.812 6.870<br />
42,2 3.171 2.037 1.134<br />
18,9 2.416 1.439 977<br />
9,4 1.273 886 388<br />
90<br />
(ohne Saison<br />
AK)<br />
90<br />
(ohne Saison<br />
AK)<br />
Quelle: Richtwert Deckungsbeiträge 2005*/2006**<br />
17.496 11.014 6.482<br />
23.566 17.887 5.679<br />
Ein Eingriff in Flächen, die (im Rahmen der Fruchtfolge) zum Anbau <strong>von</strong> Kartoffeln,<br />
Zuckerrüben und Sonderkulturen genutzt werden, ist zusammenfassend schwerwiegender<br />
zu betrachten, als bei (ausschließlichen) Flächen des Getreide und Futterbaus<br />
bzw. auf Grünland.<br />
Der Flächenentzug kann in sehr begrenztem Umfang durch die Bereitstellung bzw.<br />
den Kauf <strong>von</strong> Ersatzland abgemildert werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Betriebe<br />
ihr betriebliches Wachstum größtenteils durch die Zupacht <strong>von</strong> Flächen erreicht<br />
haben. Die Pachtquote liegt häufig bei über 50 % der Gesamtbetriebsfläche.<br />
Es besteht daher eine besondere Problematik beim Entzug <strong>von</strong> Pachtflächen, denn<br />
die Betriebe sind zwar auf diese Pachtflächen angewiesen, verfügen jedoch nicht<br />
über die Eigentumsrechte und können insofern allenfalls eine geringe Pachtwertentschädigung<br />
geltend machen.<br />
Ein großes Problem neben der Landinanspruchnahme durch die Trasse ist der Bedarf<br />
an landwirtschaftlichen Flächen, die im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung<br />
als Ausgleich und Ersatz benötigt werden. Die Bezifferung dieses Flächenbedarfes<br />
in ha dürfte erst nach Vorliegen der landschaftspflegerischen Begleitpläne<br />
möglich sein. In jedem Fall ist dieser Landentzug bereits im Vorfeld zu betrachten<br />
und sollte bei der Detailplanung bzw. beim Verlauf der Trasse berücksichtigt werden.<br />
So kann die Zerschneidung oder Überbauung einer aus Naturschutzsicht wertvollen<br />
Fläche, die die Landwirtschaft nicht unmittelbar betrifft (z.B. Brachflächen) zu<br />
einem so erheblichen Ausgleichsanspruch führen, dass ein Trassenverlauf über Ackerland<br />
in der Summe zu einem geringeren Landentzug führen würde.
Da der Landverbrauch für die Straße neben dem Straßenquerschnitt auch <strong>von</strong> den<br />
Böschungs- und Einschnittswinkeln, Lärmschutzmaßnahmen, parallelen Wirtschaftswegen<br />
usw. abhängig ist, ist eine abschließende Quantifizierung nur bedingt<br />
möglich. Die Streckenlänge kann jedoch als Beurteilungskriterium und Vergleichsmaßstab<br />
für den Landverbrauch herangezogen werden.<br />
Eine Besonderheit ergibt sich im Bereich der Trassenlage auf vorhandenen Wirtschaftswegen.<br />
Da aber die landwirtschaftlichen Nutzflächen auch zukünftig gesichert<br />
erschlossen werden müssen, ist je nach Bedarf <strong>von</strong> Ersatzwirtschaftswegen auszugehen.<br />
Zudem ist die Trasse der Ortsumgehung breiter als der vorhandene zu überbauende<br />
Wirtschaftsweg. Insgesamt ist auch hier das Kriterium Streckenlänge daher<br />
ein geeignetes Mittel der Beurteilung.<br />
Verknüpfung der Beurteilungskriterien Standortproduktivität (Bodenzahl) und<br />
Streckenlänge<br />
Nicht allein die Landinanspruchnahme ist für die Beurteilung des Verlustes Betriebsmittel<br />
Boden <strong>von</strong> Bedeutung. Die Bonitierung bzw. Qualität führt zu einer unterschiedlichen<br />
Betroffenheit je in Anspruch genommener Flächeneinheit.<br />
Eine große Streckenlänge ist aufgrund des Landverbrauches aus Sicht der Landwirtschaft<br />
negativ zu beurteilen. Die Beanspruchung <strong>von</strong> guten Böden ist verhältnismäßig<br />
mit größeren Nachteilen für die Landwirtschaft verbunden, als die <strong>von</strong> Böden mit<br />
geringer Bonitierung.<br />
Um diesen Umstand zu berücksichtigen, wird in der Auswertung eine Verknüpfung<br />
der Streckenlänge mit der Bodenzahl vorgenommen. Der so ermittelte Ertragsindex<br />
berücksichtigt und gewichtet die Überbauung <strong>von</strong> Böden mit hoher Standortproduktivität<br />
gegenüber der Überbauung <strong>von</strong> Böden, die <strong>von</strong> der Ertragsfähigkeit schlechter<br />
abschneiden.<br />
Schlagstruktur (Schlaggröße, Schlagzuschnitte)<br />
Für den Ackerbau mit heutigem modernen Maschinenpark sind möglichst rechteckige<br />
Zuschnitte akzeptabler Größe für eine rationelle und rentable Bewirtschaftung erforderlich.<br />
Zwangsläufig führt ein linienförmiger Eingriff zur Abtrennung <strong>von</strong> Teilflächen<br />
<strong>von</strong> einem Feldstück (Anschneidung) oder zu einer Teilung einer Bewirtschaftungsfläche<br />
in mehrere Einzelflächen (Durchschneidung).<br />
Ein Anschnitt kann u.a. die Entstehung <strong>von</strong> unförmigen Nutzflächen, Flächenverkleinerung<br />
oder den Verbleib <strong>von</strong> unwirtschaftlichen Restflächen zur Folge haben. Dabei<br />
sind Größe und Form der Flächen wichtige Kenngrößen für eine <strong>Bewertung</strong> der Betroffenheit.<br />
Die Durchschneidung <strong>von</strong> landwirtschaftlichen Nutzflächen ist noch problematischer.<br />
So entstehen wirtschaftliche Nachteile umso mehr, je höher die Zahl verbleibender<br />
Dreiecks- und Keilformen infolge einer Durchschneidung ist; zumal bei der (diagonalen)<br />
Durchschneidung einer Bewirtschaftungseinheit beidseitig der Straßentrasse<br />
Dreiecks- oder Keilformen entstehen. Ein Flurbereinigungsverfahren kann die Betroffenheit<br />
abmildern.<br />
17
In diesem Zusammenhang ist auf den großen Hackfrucht- und Gemüseanteil sowie<br />
die Feldberegnung hinzuweisen. Hier wirken sich die angesprochenen Effekte besonders<br />
negativ aus. Erschwert werden hierdurch u.a. die Bodenbearbeitung, Aussaat<br />
und Pflegemaßnahmen (Pflanzenschutz und Düngung) aber auch die Ernte.<br />
Hier ist die wirtschaftliche Betroffenheit – auch durch den erforderlichen höheren Arbeitsaufwand<br />
und die Mehrzahl an Durchfahrten/Arbeitsgängen im Bestand – wesentlich<br />
höher als bei Getreide.<br />
Störung der Infrastruktur (Beregnung, Wege, Gewässernetz)<br />
Wie dargestellt, ist die Zusatzwasserversorgung durch Beregnung <strong>von</strong> eminenter<br />
Bedeutung. Die Trasse kann Beregnungsbrunnen und Leitungen überbauen.<br />
Die Überbauung <strong>von</strong> Erdleitungen, die zahlreich im Gebiet vorhanden sind, kann zu<br />
erheblichen Einschränkungen in Funktion und Wartung führen. Zudem wird der Arbeitszeitaufwand<br />
(Erreichbarkeit des Brunnens sowie verkehrliche Beziehung zu der<br />
Beregnungsmaschine) stark erhöht.<br />
Im Nahbereich der Trasse wird die Beregnungsmöglichkeit eingeschränkt sein. Die<br />
Landwirte haben dafür Sorge zu tragen, das kein Beregnungswasser auf die Bundesstraße<br />
gelangt. Aufgrund <strong>von</strong> Windeinflüssen und des Zuschnitts der Flächen<br />
kann ein Streifen <strong>von</strong> jeweils 20 m entlang der Trasse zukünftig nicht mehr gesichert<br />
beregnet werden. Die fehlende Wassermenge auf diesen trassenbegleitenden Streifen<br />
führt zu erheblichen Ertrags- und Qualitätsausfällen. Eine Abwertung dieses<br />
Streifens ist daher erforderlich. Das Grünland wird i.d.R. weniger beregnet als das<br />
Ackerland.<br />
Die Durchschneidung eines landwirtschaftlichen Weges, aber auch einer öffentlichen<br />
Straße, führt zu einem Störfaktor für den landwirtschaftlichen Verkehr. Umwege mit<br />
entsprechendem Mehraufwand (Arbeitszeit, Maschinenkosten) sind die Folge.<br />
In der vorliegenden Untersuchung wurde die Überbauung <strong>von</strong> Vorflutern (ohne Ohre)<br />
nicht besonders ermittelt. Im Vergleich zu landwirtschaftlichen Regionen, in denen<br />
ein Überschuss an Bodenwasser zu erheblichen Einschränkungen führt bzw. Dränagen<br />
eine wesentliche Rolle spielen, ist die Bedeutung einer Überbauung u.E. hier<br />
eher vernachlässigbar.<br />
<strong>Bewertung</strong>smatrix - Beschreibung Methodik und Ansätze<br />
Die vorgestellten Beurteilungskriterien lassen sich über Zählungen numerisch darstellen<br />
und ermöglichen damit einen direkten Vergleich. Die einzelnen Betroffenheiten<br />
können trassenweise in ihrer Rangfolge dargestellt werden.<br />
Zweck dieser Auswertung ist es, die verschiedenen <strong>Trassenvarianten</strong> miteinander<br />
vergleichbar zu machen. Hierzu wird mit dem Ziel einer objektiven Gesamtbeurteilung<br />
festgestellt, welche Vorzüglichkeit sich für die einzelnen <strong>Trassenvarianten</strong> hinsichtlich<br />
des jeweils betrachteten <strong>Bewertung</strong>skriteriums ergibt.<br />
Die Bildung eines aggregierten Vergleichswertes schafft die Möglichkeit, zu einem<br />
aussagefähigen Gesamtergebnis zu gelangen. Dazu wird die Vorzüglichkeit der<br />
18
Trassen (d.h. der erzielte Rang) für jedes der einzelnen Beurteilungskriterien mit<br />
Gewichtungsfaktoren multipliziert. In den Gewichtungsfaktoren spiegelt sich die Bedeutung<br />
der <strong>Bewertung</strong>skriterien für die örtliche Landwirtschaft wider.<br />
Die folgende Abbildung zeigt die angesetzten Anteile der einzelnen Kriterien an der<br />
Gesamtbewertung der Varianten:<br />
Abbildung 2: Gewichtungsfaktoren<br />
Wirtschaftswege Ertragsindex<br />
(Länge u. Bodenzahl)<br />
20 % 30 % 5 %<br />
Betroffenheit<br />
Beregnungsleitungen<br />
3 Variantenvergleich B 248 OU Brome<br />
Schlagstruktur<br />
45 %<br />
Der Landwirtschaftskammer sind zur Beurteilung drei <strong>Trassenvarianten</strong> vorgelegt<br />
worden:<br />
1. Variante Süd (Südumgehung)<br />
Variante Süd wird <strong>von</strong> Westen kommend <strong>von</strong> der B 248 auf einen landwirtschaftlichen<br />
Wirtschaftsweg bis zur B 244 (hier Kreisel vorgesehen) geführt.<br />
Danach ist der Streckenverlauf über landwirtschaftliche Nutzflächen vorgesehen.<br />
Die Trasse verläuft nördlich des Bromer Busches über Grünland und wird<br />
mit einer Kreuzung an der Steimker Straße geplant. Der hieran anschließende<br />
östliche Verlauf ist über landwirtschaftliche Nutzflächen (weitestgehend Ackerland)<br />
vorgesehen. Die Trasse Süd (2007) verläuft im östlichen Bereich auf einem<br />
Wirtschaftsweg (auch Erschließung Hofstelle Schaper) und schließt im<br />
unmittelbaren Nahbereich der Biogasanlage wieder auf die alte B248.<br />
2. Variante Nord 1 (enge Nordumgehung)<br />
Die enge Nordumgehung hat westlich <strong>von</strong> der B 248 kommend ihren Ursprung<br />
und verläuft über landwirtschaftliche Nutzflächen. Sie tangiert hier auch die<br />
vorhandenen Wirtschaftswege und das stillgelegte Schienennetz (Güterverkehr).<br />
Nördlich der Dörrheidenstraße ist ein Kreisel an der B 244 eingeplant.<br />
Die Trasse kreuzt dann in östlicher Richtung die Ohre und orientiert sich im<br />
weiteren Verlauf teilweise am ehemaligen Grenzstreifen. Ihren Anschluss an<br />
die vorhandene B 248 findet diese Variante nördlich der landwirtschaftlichen<br />
Hofstelle Kremeike.<br />
19
3. Variante Nord 2 (weiträumige Nordumgehung)<br />
Auch hier verläuft die Trasse <strong>von</strong> der B 248 ausgehend in nordöstlicher Richtung<br />
über landwirtschaftliche Nutzflächen (zunächst gleicher Verlauf wie Nord<br />
1), setzt diese Richtung jedoch länger fort als die Variante Nord 1und kreuzt<br />
die B 244 östlich der landwirtschaftlichen Hofstelle Böttcher (Gödchen Mühle)<br />
Sie überquert die Ohre und knickt nördlich in das benachbarte Bundesland<br />
Sachsen-Anhalt. Hier wird Wendischbrome nördlich umgangen. Der Trassenverlauf<br />
geht auch hier über landwirtschaftliche Ackerflächen, tangiert den<br />
Grenzstreifen und führt über niedersächsisches Gebiet wieder an die B 248<br />
(auch hier nördlich der Hofstelle Kremeike).<br />
3.1 Flächenentzug<br />
Bei einem Straßenquerschnitt RQ 10,5 (angenommene Breite inkl. Nebenanlagen:<br />
16,25 m) ergibt sich die folgende Flächeninanspruchnahme:<br />
Tabelle 7: Streckenlänge und Flächeninanspruchnahme<br />
Variante Länge in km* Fläche in ha<br />
Süd 5,7 9,3<br />
Nord 1 6,5 10,5<br />
Nord 2 7,4 12,0<br />
*Länge der Trassen inkl. Einmündungsbereiche auf B 248<br />
Zu der o.g. Inanspruchnahme ist der Flächenverbrauch durch Kreisel und Zubringer<br />
sowie der Ausgleichsmaßnahmen hinzuzuzählen. Darüber hinaus werden Flächen<br />
für den Bau <strong>von</strong> Ersatzwirtschaftswegen der Landwirtschaft benötigt.<br />
Vorübergehend werden Flächen als Baustraßen, zur Ablagerung Bodenmaterial u.ä,<br />
benötigt.<br />
Bodentypen<br />
Einen Überblick der Betroffenheit einzelner Bodentypen durch die Trassen vermittelt<br />
die nachfolgende Übersicht:<br />
Tabelle 8: Anteil der Betroffenheit <strong>von</strong> Bodentypen (Schätzung)<br />
Bodentyp<br />
Variante Süd Variante Nord 1 Variante Nord 2<br />
(%)<br />
(%)<br />
(%)<br />
Parabraunerde 16 40 49<br />
Podsol-Braunerden 63 8 8<br />
Gley 3 - -<br />
Niedermoor 3 - -<br />
Braunerde 15 29 43<br />
Gley mit Niedermoorauflage - 18 -<br />
Pseudogley-Parabraunerde - 5 -<br />
Quelle: eigene Auswertung unter Berücksichtigung Daten des NLfB (2004)<br />
20
Auch wenn die prozentuale Betroffenheit der Bodentypen aufgrund der unterschiedlichen<br />
Trassenlängen nur eingeschränkt vergleichen lässt, gibt die Tabelle doch einen<br />
Überblick über die Verteilung der Böden im Raum und deren Inanspruchnahme (vgl.<br />
auch die im Anhang enthaltene Karte 1 der Bodentypen).<br />
So sind im Bereich der Südvariante überwiegend Podsol-Braunerden und Braunerden<br />
betroffen. Die Nordvarianten überbauen überwiegend Parabraunerden und<br />
Braunerden. Darüber hinaus finden sich in den Niederungsbereichen grundwasserbeeinflusste<br />
Bodentypen (Gley mit Niedermoorauflage).<br />
Nordwestlich der B248, außerhalb der vorgelegten Trassen in der Gemarkung Voitze<br />
ist dagegen überwiegend der Bodentyp Podsol anzutreffen.<br />
Die betroffenen Bodentypen werden an dieser Stelle nur ergänzend ausgewiesen<br />
und fließen nicht in die Gesamtbewertung ein, da sie keinen vergleichbaren Maßstab<br />
darstellen.<br />
Ertragsindex (Streckenlänge * Bodenzahl)<br />
Die Streckenlängen wurden zur Bildung des Ertragsindex mit der jeweiligen Betroffenheit<br />
der Bodenzahl multipliziert.<br />
Tabelle 9: Ertragsindex und durchschnittlich betroffene Bodenzahlen<br />
Variante Länge in km *<br />
Süd<br />
Nord 1<br />
Nord 2<br />
5,7<br />
6,5<br />
7,4<br />
durchschnittliche<br />
Bodenzahl<br />
Ertragsindex<br />
35,6 203<br />
34,7 226<br />
33,9 251<br />
Die betroffenen Bodenzahlen in den Trassen unterscheiden sich kaum. Insbesondere<br />
aufgrund der insgesamt kürzeren Streckenlänge schneidet die Südtrasse bei diesem<br />
<strong>Bewertung</strong>skriterium am besten ab.<br />
Eine nähere Erläuterung/Darstellung zu den Bodenzahlen wird auf Seite 8 und in der<br />
Karte 2 dieses <strong>Fachbeitrag</strong>es gegeben.<br />
3.2 Schlagstruktur (An- und Durchschneidungen)<br />
Die arbeitswirtschaftlich optimale Schlaggröße ist eine dynamische, stark technikabhängige<br />
Größe und muss stets der Entwicklung im landtechnischen Bereich angepasst<br />
werden. Eine günstige Schlaggröße kann erhebliche Kosteneinsparungen bedeuten.<br />
Nimmt man realistische Parzellengrößenunterschiede <strong>von</strong> 1 ha zu 10 ha als<br />
Beispiel, dann sind bei Halmfrüchten Arbeitserledigungskostenunterschiede <strong>von</strong> 146<br />
€ /ha bei vorhandener mittlerer Mechanisierung und 309 € /ha bei langfristig angepasster<br />
Mechanisierung zu erwarten (Janinhoff, 2001). Dies bedeutet, dass An- und<br />
Durchschneidungen sich unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit der Flächenbewirtschaftung<br />
auswirken.<br />
21
Die Berechnung <strong>von</strong> Einkommensverlusten aufgrund der Wirtschaftserschwernisse<br />
durch agrarstrukturelle Veränderungen erfolgt in der Regel im Zusammenhang mit<br />
Entschädigungsfällen. Es soll daher zunächst ein Blick auf die dabei gängigen Vorgehensweisen<br />
geworfen werden. In Entschädigungsfällen <strong>von</strong> der Rechtsprechung<br />
anerkannt ist sowohl die Richtwertmethode der Anlage 2 zu den Entschädigungsrichtlinien<br />
Landwirtschaft (LandR 78) als auch die so genannte Differenzwertmethode<br />
nach Beckmann & Huth.<br />
Erstgenannte Methode beruht auf Richtwerten über den Anschneidungsschaden je<br />
m 2 abgetrennte Fläche, aufgeschlüsselt in Arbeitskosten, Maschinenkosten und Ertragsverluste.<br />
Ihrer Berechnung liegen einige Vereinfachungen zugrunde, die mit den<br />
jeweiligen betriebsspezifischen Verhältnissen nicht genau übereinstimmen, und daher<br />
nur näherungsweise Ergebnisse liefern. So wird die Richtwertmethode i.d.R. bei<br />
Grundstücken angewandt werden, deren Ausgangsform nicht wesentlich <strong>von</strong> der eines<br />
Rechteckes abweicht. Hinsichtlich der Seitenverhältnisse, der Anschneidungsarten<br />
und -winkel sowie des Umfanges der Entzugsfläche werden verschiedene Alternativen<br />
zur Auswahl gestellt. Auch über die Grundstücksgröße, das Lohnniveau, die<br />
Maschinenkosten, das Ertragsniveau und den Hackfruchtanteil in der Fruchtfolge<br />
werden Annahmen getroffen, die bei Abweichungen <strong>von</strong> den tatsächlichen Bedingungen<br />
über Korrekturfaktoren angeglichen werden müssen.<br />
Die oben zitierte Differenzwertmethode erlaubt zwar eine stärkere Berücksichtigung<br />
der fallspezifischen Schlag- und Betriebsverhältnisse. Die einzelnen Komponenten<br />
des Einkommensverlustes durch An- und Durchschneidungsschäden müssen hierzu<br />
aber detaillierter aufgeschlüsselt werden. Auch bei dieser Methode finden noch immer<br />
viele Durchschnittswerte Verwendung, die nur begrenzt an die tatsächlichen Gegebenheiten<br />
des <strong>Bewertung</strong>sfalles angepasst werden können.<br />
Für den vorliegenden Variantenvergleich sind keine Entschädigungsbeträge zu ermitteln<br />
sondern lediglich tendenzielle Aussagen über die agrarstrukturelle Wirkung der<br />
verschiedenen Alternativen zu treffen. Es werden daher in Anlehnung an die LandR<br />
78 dimensionslose Vergleichswerte ermittelt, die lediglich das trassenabhängige Verhältnis<br />
der zu erwartenden An- und Durchschneidungsschäden darstellen.<br />
Hierzu ist jeder der <strong>von</strong> den <strong>Trassenvarianten</strong> berührten Schläge zunächst ermittelt<br />
und dann hinsichtlich Größe und Bewirtschaftungsrichtung in Bezug auf die Anschneidung<br />
beurteilt worden. Die addierten Einzelwerte ergeben die Ergebnisse in<br />
der nachfolgenden Tabelle wieder. Hier zeigt sich, dass die Variante Süd aufgrund<br />
der im Bereich <strong>von</strong> Wirtschaftswegen verlaufenden Streckenführung und der vergleichsweise<br />
kürzeren Trassenlänge am günstigsten abschneidet.<br />
Tabelle 10: Vergleichswert An- und Durchschneidungsschäden<br />
Variante<br />
dimensionsloser Vergleichswert<br />
An- und Durchschneidungsschaden<br />
Süd 245<br />
Nord 1 472<br />
Nord 2 719<br />
22
Bei der Variante Süd werden 29 Ackerschläge an- und durchschnitten, die über eine<br />
durchschnittliche Größe <strong>von</strong> 4,7 ha verfügen. Darüber hinaus werden 5 Grünlandflächen<br />
tangiert.<br />
Die Variante Nord 1 (enge Nordumgehung) zerschneidet 21 Ackerflächen (zzgl. zwei<br />
Grünlandflächen) mit einer durchschnittlichen Größe <strong>von</strong> rd. 7,9 ha und die Variante<br />
Nord 2 durchschneidet 26 Ackerschläge (zzgl. einer Grünlandfläche) mit einer durchschnittlichen<br />
Größe <strong>von</strong> rd. 10,1 ha.<br />
Da Zerschneidungsschäden durch eine Trassenführung entlang vorhandener Wege<br />
deutlich geringer ausfallen, ergeben sich hier gegenüber einer Neutrassierung auf<br />
landwirtschaftlicher Nutzfläche wesentliche Unterschiede.<br />
3.3 Querung <strong>von</strong> Wirtschaftswegen und Beregnungsleitungen<br />
Wirtschaftswege<br />
Die Querungen der L 287 und der B 244 werden bei der Zählung nicht als Barriere<br />
angesehen, da hier Kreisel geplant sind.<br />
Variante Süd quert 12 Wirtschaftswege. Hierbei wurde die vollständige Überbauung<br />
des Wirtschaftsweges im südwestlichen Bereich (westlich B 244) nicht berücksichtigt,<br />
da <strong>von</strong> der Neuanlage eines parallel verlaufenden Wirtschaftsweges auszugehen ist.<br />
Die Varianten Nord 1 und Nord 2 queren jeweils 9 Wirtschaftswege (inkl. Wendischbromer<br />
Straße).<br />
Tabelle 11: Querung <strong>von</strong> Wirtschaftswegen<br />
Variante Anzahl Wirtschaftswege<br />
Süd 12<br />
Nord 1 9<br />
Nord 2 9<br />
Die Südumgehung überbaut somit drei Wirtschaftswege mehr als die beiden Nordvarianten.<br />
Da im derzeitigen Planungsstand die verkehrlichen Anbindungen an die<br />
Ortsumgehung und mögliche Ersatzwirtschaftswege noch nicht bestimmt sind, ist<br />
keine vergleichende <strong>Bewertung</strong> der im Einzelnen betroffenen Wirtschaftswege vorgenommen<br />
worden. Im Rahmen der nachfolgenden ergänzenden <strong>Bewertung</strong>sfaktoren<br />
wird hierauf noch Bezug genommen.<br />
Beregnungsleitungen<br />
Das Plangebiet verfügt über ein gut ausgebautes ortsfestes Beregnungsnetz. Nahezu<br />
alle Flächen im Bereich der Trassen können hierüber mit Beregnungswasser versorgt<br />
werden.<br />
Bei den Erhebungen sind die unterirdisch verlegten Beregnungsleitungen aufgenommen<br />
worden. Fliegende Leitungen (oberirdische Schlauch- und Rohrleitungen)<br />
sind in der nachfolgenden Tabelle der überbauten Beregnungsleitungen nicht berücksichtigt<br />
worden.<br />
23
Tabelle 12: Überbaute Beregnungsleitungen<br />
Variante<br />
Anzahl<br />
Beregnungsleitungen<br />
Süd 16<br />
Nord 1 16<br />
Nord 2 14<br />
An der Anzahl der geschnittenen Beregnungsleitungen wird die besondere Bedeutung<br />
der Beregnung im Raum deutlich. Durch die Verlegung <strong>von</strong> festen Anlagen<br />
können deutliche arbeitswirtschaftliche Vorteile erzielt werden. Im Bereich der Nordtrasse<br />
verlaufen tlw. Leitungen verschiedener Landwirte nebeneinander. Hier ist besonders<br />
die Zusatzwasserversorgung für den Gemüsebau zu erwähnen. Die im Osten<br />
der Nordtrassen liegenden Erdleitungen sind besonders unter dem Aspekt der<br />
hier anzutreffenden großen Bewirtschaftungseinheiten zu erwähnen.<br />
Besondere Bedeutung hat das Ringsystem im Süden. Der mit einer elektrischen<br />
Pumpe ausgestattete Brunnen südlich der B 248 verfügt über eine ausgesprochen<br />
hohe Leistungsfähigkeit.<br />
Dränagen sind aufgrund der geringen Betroffenheit nicht besonders erfasst und daher<br />
nicht in die Beurteilungsmatrix eingeflossen (vgl. Punkt 5).<br />
4 Entscheidungsmatrix und Beurteilung der <strong>Trassenvarianten</strong><br />
aus landwirtschaftlicher Sicht<br />
Die nachfolgende Tabelle gibt eine trassenbezogene Reihenfolge bei der Beeinträchtigung<br />
der dargestellten <strong>Bewertung</strong>skriterien wieder. Rang 1 bedeutet eine aus landwirtschaftlicher<br />
Sicht vergleichsweise geringere Belastung, während Rang 3 die nach<br />
dem jeweiligen Kriterium ungünstigste Trasse ausweist.<br />
Beispielsweise hat die Variante Süd die geringste Streckenlänge (Flächenentzug)<br />
vorzuweisen und erhält damit den Rang 1 (geringste Betroffenheit). Die Variante<br />
Nord 2 verfügt über die längste Strecke und erhält daher Rang 3 (höchste Betroffenheit).<br />
Tabelle 13: Rangfolge der Varianten bei den einzelnen Beurteilungskriterien<br />
Variante<br />
Süd<br />
Nord 1<br />
Nord 2<br />
Ertrags-<br />
index<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Wirtschafts-<br />
wege<br />
3<br />
1<br />
1<br />
Beregnungs-<br />
leitungen An-/Durchschnitt<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
3<br />
24
In die Entscheidungsfindung gehen nicht alle <strong>Bewertung</strong>skriterien mit gleicher Gewichtung<br />
ein, es erfolgt vielmehr eine Differenzierung. So fließen die Überquerung<br />
<strong>von</strong> Wegen mit 20 %, der Ertragsindex (Länge * Bodenzahl) mit 30 %, die Überbauung<br />
<strong>von</strong> Erdleitungen mit 5 % sowie die Betroffenheit der Schlagstruktur mit 45 %<br />
ein. Diese Faktoren sind mit der örtlichen Landwirtschaft abgestimmt und werden in<br />
Anlehnung an die in der Vergangenheit vorgenommene <strong>Bewertung</strong> einer Neutrassierung<br />
der Bundesstraße 4 vorgenommen.<br />
Tabelle 14: Bildung eines Vergleichswertes<br />
(Multiplikation der Rangfolge mit der Gewichtung)<br />
Variante<br />
Ertrags-<br />
index<br />
Wirtschafts-<br />
wege<br />
Beregnungs-<br />
leitungen<br />
An-/<br />
Durchschnitt<br />
25<br />
Vergleichs-<br />
wert<br />
Süd 0,3 0,6 0,10 0,45 1,45<br />
Nord 1 0,6 0,2 0,10 0,9 1,80<br />
Nord 2 0,9 0,2 0,05 1,35 2,50<br />
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Variante Süd den geringsten Vergleichswert<br />
(1,45) aufweist und somit unter den drei beurteilten Trassen den vergleichsweise geringsten<br />
negativen Einfluss aufweist.<br />
Hiernach folgt die Variante Nord 1 mit einem Vergleichswert <strong>von</strong> 1,80. Diese Variante<br />
liegt bei der Gesamtbeurteilung zwischen der Südvariante und der Variante Nord 2,<br />
die aufgrund des Vergleichswertes <strong>von</strong> 2,50 einen vergleichbar hohen negativen<br />
Einfluss aufweist.
5 Ergänzende <strong>Bewertung</strong>sfaktoren<br />
Nachfolgend werden einige Besonderheiten dargestellt, die zwar keinen Eingang in<br />
die oben aufgeführte Beurteilungsmatrix genommen haben, aber dennoch bei der<br />
Trassenwahl zu berücksichtigen sind:<br />
• Nur im Norden in der Gemarkung Altendorf sind Dränagen betroffen.<br />
• Die Biogasanlage Kremeike ist ein bedeutender Betriebsschwerpunkt Die Südvariante<br />
stört die Feld-Anlagenbeziehung. Eine starke einzelbetriebliche Betroffenheit<br />
ist zu verzeichnen.<br />
• Variante Nord 1 sowie in Teilbereichen auch die Variante Nord 2 führen voraussichtlich<br />
zu besonders einschneidenden Einschränkungen eines spezialisierten<br />
Gemüsebaubetriebes mit arrondierten hofnahen Flächen. Auch aufgrund der Arbeitsintensität<br />
auf den Flächen wirkt sich die Ortsumgehung negativ auf die Feld-<br />
Hof-Beziehung aus.<br />
• Im Rahmen der Planung sollte sich der einzelbetrieblichen Betroffenheit angenommen<br />
werden. Durch verschiedenste Maßnahmen können die negativen Einflüsse<br />
auf die Betriebe abgemildert werden. Insbesondere auf die Schaffung <strong>von</strong><br />
Ersatzwirtschaftswegen sowie die Sicherstellung der Beregnung ist dabei zu achten.<br />
Naturschutzfachliche Ersatzmaßnahmen dürfen die <strong>von</strong> der Trassenplanung<br />
direkt betroffenen Betriebe darüber hinaus nicht übermäßig belasten.<br />
• Bei den <strong>von</strong> den Nordvarianten betroffenen Wirtschaftswegen, die tlw. Gemeindverbindungswege<br />
sind, wird weitgehend ein größerer Gemarkungsteil angeschlossen<br />
(besonders Gemarkung Altendorf) bzw. es bestehen gemarkungsübergreifende<br />
Beziehungen. Zudem sind durch den intensiven Gemüsebau hier viele<br />
Fahrten auf den Wirtschaftswegen zu verzeichnen.<br />
• Die Südtrasse führt über Wirtschaftswege, die in das benachbarte Bundesland<br />
führen. Für die hier grenzübergreifend wirtschaftenden Betriebe hat das Wegesystem<br />
daher eine besondere Bedeutung.<br />
• Eine Abwertung der nicht in vollem Umfang an der Bundesstraße gelegenen Beregnungsflächen<br />
(Annahme: nicht zu beregnender Streifen 20 m) ist fachlich<br />
sinnvoll. Das Grünland wird weniger beregnet als das Ackerland. Im Bereich der<br />
Südtrasse befindet sich Grünland überwiegend im Bereich der Ohre und in Ortsnähe<br />
Brome. Im Bereich der Nordtrassen ist Grünland nur im Bereich der Ohre<br />
anzutreffen. Die beiden im Bereich der Südtrasse liegenden Waldflächen erhalten<br />
kein Beregnungswasser. Die nördlichen Trassen sind <strong>von</strong> der o.g. Abwertung in<br />
höherem Maße betroffen (dies auch, weil durch den Gemüsebau eine höhere Beregnungsintensität<br />
erforderlich ist).<br />
• Wie bereits ausgeführt, kann die Quantifizierung der unterschiedlichen Ausgleichsansprüche<br />
zum derzeitigen Planungsstand nicht vorgenommen werden<br />
und in die Beurteilungsmatrix einfließen. Die südliche Variante streift Grünland<br />
und die Ohre. Die nördlichen Trassen führen über das FFH Gebiet der Ohre Nie-<br />
26
derung und daran angrenzendes Grünland. Auch hier wird voraussichtlich ein hoher<br />
Ausgleichsanspruch die Folge sein.<br />
• Auf die Besonderheiten der Feld-Anlagenbeziehung zur Biogasanlage Kremeike<br />
ist bereits eingegangen worden. Sollte die Südtrasse ausgewählt werden, ist dies<br />
besonders zu berücksichtigen (vgl. auch 6.2 Trassenalternativen).<br />
6 Planungshinweise<br />
Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche durch die Maßnahmen ist für die<br />
Landwirtschaft <strong>von</strong> hoher Bedeutung.<br />
In jedem Fall ist aber die örtliche Landwirtschaft bei der Suche nach geeigneten<br />
Ausgleichsflächen einzubinden. Geeignet sind beispielsweise unwirtschaftliche Restflächen<br />
(die z.B. aus dem Bau der Straße resultieren) bzw. Grenzertragsflächen und<br />
Grünland. Gegenüber der Straßenplanung besteht bei der Auswahl der Ausgleichsmaßnahmen<br />
eine höhere Flexibilität, so dass auch auf andere Gemarkungen ausgewichen<br />
werden kann.<br />
6.1 Weiterführung der Umgehung B 248 in Richtung Westen (OU<br />
Voitze)<br />
Die Bodenzahlen liegen südlich <strong>von</strong> Voitze (durchschnittlich 30) niedriger als nördlich<br />
(durchschnittlich 34) der Ortslage.<br />
Wir empfehlen, bei näheren Planungen einer Ortsumgehung Voitze den vorgelegten<br />
<strong>Fachbeitrag</strong> zu ergänzen und die Kartierung sowie die Berechnungen auch hier anzuwenden.<br />
Von der Tendenz wird <strong>von</strong> der örtlichen Landwirtschaft die nördliche Umgehung <strong>von</strong><br />
Voitze präferiert.<br />
6.2 Alternativen und Korrekturen der vorgelegten <strong>Trassenvarianten</strong><br />
Die Südvariante könnte – sofern straßenplanerische Aspekte nicht entgegenstehen –<br />
noch optimiert werden. Dadurch werden die umliegenden Ackerflächen auch weniger<br />
zerschnitten<br />
In der beigefügten Karte 6 „Alternativen“ ist eine enge Südumgehung als Alternative<br />
zur bestehenden Südvariante aufgenommen worden. Diese Lage entspricht der vorgelegten<br />
Trasse Süd 2, die aus dem Wald kommend enger an der Ortslage Brome<br />
im östlichen Teil verläuft.<br />
Der Landverbrauch würde sich durch die vergleichsweise kurze Streckenlänge <strong>von</strong><br />
rd. 4,5 km deutlich verringern. Zudem wäre der Eingriff in die Agrarstruktur hier minimiert.<br />
27
Die Biogasanlage Kremeike wird durch die Alternative nicht mehr im Nahbereich tangiert.<br />
Eine Erreichbarkeit der Flächen in Sachsen-Anhalt wäre gegeben.<br />
Auch die bisher am schlechtesten bewertete Variante Nord 2 kann noch deutlich verbessert<br />
werden. Zu diskutieren ist, inwieweit die Trasse <strong>von</strong> Westen kommend noch<br />
auf die B 248 östlich zurück schwenken muss. Fahrzeuge haben als Start oder Ziel<br />
die Ortslage Mellin. Wir schlagen vor, die Trasse an die Kreisstraße 1128 anzuschließen<br />
(vgl. Karte 6). Der derzeitige Zustand der K 1128 würde eine Modernisierung<br />
und Einbindung in die Umgehungsplanung sinnvoll erscheinen lassen. Aus<br />
landwirtschaftlicher Sicht könnten durch diese Variante der Landverbrauch und die<br />
Zerschneidungsschäden deutlich vermindert werden. Die Streckenlänge dieser verkürzten<br />
Trasse beläuft sich auf ca. 5,1 km.<br />
Ein Teil des LKW-Verkehrs wird durch das Spanplattenwerk Glunz hervorgerufen.<br />
Alternativen im östlichen Raum könnten ggf. auch südlich des Bromer Busches nach<br />
Steimke hin geprüft werden.<br />
Sollte aufgrund außerlandwirtschaftlicher Belange an den Varianten im Norden planerisch<br />
festgehalten werden, sollte eine Trassenlage auf bzw. neben dem ehemaligen<br />
Grenzstreifen und entlang <strong>von</strong> Flurstücksgrenzen eingehend geprüft werden.<br />
6.3 Sonstiges<br />
Es ist sicherzustellen, dass die neue Ortsumgehung durch den landwirtschaftlichen<br />
Verkehr genutzt werden kann. Die Trasse darf zudem keine Barriere für die Verlegung<br />
<strong>von</strong> Beregnungsleitungen darstellen. Bereits in der Planung sollten Überquerungsmöglichkeiten<br />
sowie ggf. Leerrohre festgelegt werden.<br />
Ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren wird im Grundsatz für erforderlich gehalten.<br />
Insbesondere können hier Fragestellungen bezüglich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,<br />
der Ersatzlandbereitstellung, der Verwendung unwirtschaftlicher<br />
Restflächen sowie der Beregnung und des Wegesystems abgehandelt werden.<br />
Von den Voitzer Landwirten werden Mehrbelastungen des Verkehrs in der Ortslage<br />
befürchtet. Die Hofstelle liegen überwiegend zur B 248. Ein hoher Verkehrsfluss, der<br />
kein gesichertes Einfädeln <strong>von</strong> den Hofstellen auf die Bundesstraße bzw. beim<br />
Linksabbiegen <strong>von</strong> der Bundesstraße gewährleistet, führt zu erheblichen zusätzlichen<br />
Arbeitszeitbelastungen. Die Verkehrsplanung sollte sich dieses Sachverhaltes<br />
noch annehmen.<br />
Die Null-Variante ist aus Sicht der landwirtschaftlichen Belange die verträglichste Lösung.<br />
Von den örtlichen Betrieben wird die Notwendigkeit einer Ortsumgehung überwiegend<br />
nicht gesehen. Alternativen werden z.B. durch Veränderungen in der Ortslage<br />
(Parkverbot sowie Entspannung des Nadelöhrs durch ggf. Abriss des Wohnhauses<br />
im Kurvenbereich) gesehen. Der PKW-Verkehr hat nach Einschätzung der<br />
Landwirte in dem Streckenabschnitt keine übermäßig starke Bedeutung. Ggf. könnte<br />
der Streckenabschnitt für den überörtlichen Schwerlastverkehr gesperrt werden.<br />
Hinzuweisen ist hier auch auf die bereits realisierte kleine Ortsumgehung<br />
Radenbeck, die für das Spanplattenwerk Verkehrsströme aufnimmt.<br />
28
7 Zusammenfassung<br />
Eine Neutrassierung der Bundesstraße 248 im Zuge der angedachten Ortsumgehung<br />
Brome stellt für die örtliche Landwirtschaft einen erheblichen Eingriff in die derzeitigen<br />
Bewirtschaftungsstrukturen dar. Mit dem vorliegenden landwirtschaftlichen<br />
<strong>Fachbeitrag</strong> werden die hierfür maßgeblichen Einflussfaktoren dargestellt und bewertet.<br />
Auf Grundlage der durchgeführten Berechnungen sowie ergänzender Beurteilungskriterien<br />
werden die zur Diskussion stehenden <strong>Trassenvarianten</strong> hinsichtlich<br />
ihrer agrarstrukturellen Auswirkungen und dementsprechend auch im Hinblick auf<br />
ihre relative Vorzüglichkeit aus landwirtschaftlicher Sicht in eine Rangfolge eingeordnet.<br />
Unter der Prämisse, dass die Nullvariante naturgemäß die geringsten Belastungen<br />
für die Landwirtschaft bedeutet, stellt sich unter den drei Trassenvorschlägen die sogenannte<br />
Südvariante als die am geringsten belastende Variante dar. Es folgt die<br />
Variante Nord 1, deren Verlauf weiträumiger um die Ortslage Brome führt und auch<br />
die Ortslage Altendorf umschließt. Die Variante Nord 2 schließlich umgeht auch noch<br />
die bereits in Sachsen-Anhalt befindliche Ortslage Wendischbrome und weist aus<br />
landwirtschaftlicher Sicht die schwerwiegendsten Eingriffe in die Agrarstruktur auf.<br />
In jedem Fall sollte die einzelbetriebliche Betroffenheit im weiteren Verfahren berücksichtigt<br />
werden. Sowohl <strong>von</strong> den Nordtrassen als auch <strong>von</strong> der Südumgehung sind<br />
einzelne Landwirte in besonders starkem Maß beeinträchtigt.<br />
Grundsätzlich sollte der Bedarf einer Ortsumgehung noch einmal tiefergehend geprüft<br />
werden, da jede der <strong>Trassenvarianten</strong> zu erheblichen Belastungen der örtlichen<br />
Landwirtschaft führen würde. Darüber hinaus sollten die bisher vorliegenden Varianten<br />
hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den landwirtschaftlichen Belangen noch optimiert<br />
werden. Die diesbezüglich in Text und Karte erläuterten Änderungsvorschläge<br />
führen aufgrund verringerter Streckenlängen und einer stärkeren Orientierung an<br />
vorhandenen Bewirtschaftungsstrukturen zwangsläufig auch zu geringeren Belastungen.<br />
Bei alledem ist zu berücksichtigen, dass naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen<br />
zu keiner erheblichen Betroffenheit des landwirtschaftlichen Bereiches<br />
(verbunden mit weiteren Flächenverlusten) führen darf.<br />
Sollte eine Ortsumgehung unumgänglich sein, wäre insofern eine optimierte Südvariante<br />
aus landwirtschaftlicher Sicht als Vorzugsvariante zu bewerten.<br />
29
8 Literaturverzeichnis<br />
Alw (Arbeitsgruppe Land & Wasser): Entwurf UVS Ortumgehung Brome 2004-07-29<br />
Fachverband Feldberegnung: Schriftliche Auskunft 29 KW 2004; Wetterdaten des<br />
Deutschen Wetterdienstes<br />
Diez/Weigelt (1991): Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung, 1991<br />
Hintermaier-Erhard, Zech Wörterbuch der Bodenkunde 1997<br />
Janinhoff, Alfons (2001): Größer ist günstiger in Agrarmarkt 2/2001<br />
Köhne, Manfred: Landwirtschaftliche Taxationslehre, Berlin 1987<br />
Landwirtschaftskammer Hannover: Teil 2 des Landwirtschaftlichen <strong>Fachbeitrag</strong>es<br />
zum RROP Leitbilder und Potenziale zur Entwicklung und Darstellung der Landwirtschaft;<br />
Karte Vorsorgegebiete für Landwirtschaft, 2000<br />
Landwirtschaftskammer Niedersachsen: Richtwert-Deckungsbeiträge 2005 und 2006<br />
Landwirtschaftskammer Hannover: Zahlen aus der Landwirtschaft 2003<br />
NLfB Bodentypen im Untersuchungsraum 2004 …. CD-ROM<br />
Oberfinanzdirektion Hannover (1997), Durchschnittliche Bodenwertzahlen und bodengeschätzt<br />
Flächen vom 20.03.1996<br />
Planungsgruppe Witt (1997): Dorferneuerungsplan Altendorf 1997<br />
30
9 Kartenanhang<br />
31