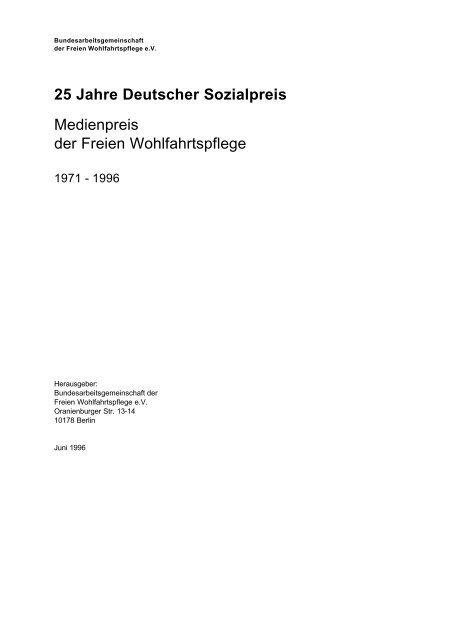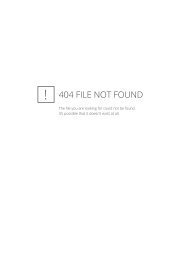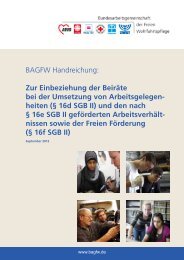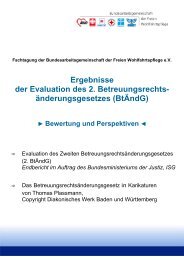Download als PDF - Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien ...
Download als PDF - Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien ...
Download als PDF - Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bundesarbeitsgemeinschaft</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Freien</strong> Wohlfahrtspflege e.V.<br />
25 Jahre Deutscher Sozialpreis<br />
Medienpreis<br />
<strong>der</strong> <strong>Freien</strong> Wohlfahrtspflege<br />
1971 - 1996<br />
Herausgeber:<br />
<strong>Bundesarbeitsgemeinschaft</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Freien</strong> Wohlfahrtspflege e.V.<br />
Oranienburger Str. 13-14<br />
10178 Berlin<br />
Juni 1996
INHALT<br />
Der Medienpreis<br />
Die Preisträger<br />
Hörfunk<br />
Fernsehen<br />
Print<br />
Sozialfotografie<br />
Personenregister
DER MEDIENPREIS<br />
Die <strong>Bundesarbeitsgemeinschaft</strong> <strong>der</strong> <strong>Freien</strong> Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW) verleiht seit 1971 jährlich einen<br />
Medienpreis für herausragende journalistische Arbeiten zu sozialen Themen. Dabei steht die Wirkung auf das<br />
gesellschaftliche Bewusstsein im Mittelpunkt. So heißt es in den Wettbewerbsstatuten: „Ausgezeichnet<br />
werden Beiträge, die sich mit <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Situation und mit Problemen notleiden<strong>der</strong> o<strong>der</strong> sozial<br />
benachteiligter Gruppen o<strong>der</strong> Personen in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland befassen und die den<br />
Leser/Hörer/Zuschauer/ Betrachter anregen, sich mit sozialen Themen auseinan<strong>der</strong> zusetzen.“ Folglich sind<br />
nur Beiträge zum Wettbewerb zugelassen, die über die Wie<strong>der</strong>gabe von Nachrichten und über die allgemeine<br />
Berichterstattung zu sozialpolitischen Meldungen hinausgehen.<br />
Die Wohlfahrtsverbände <strong>als</strong> Stifter des Medienpreises wollen mit <strong>der</strong> Auszeichnung vor allem auch<br />
Journalisten und Medien stärken, die sich bedrängten Menschen vorurteilsfrei zuwenden und <strong>der</strong>en<br />
Persönlichkeit und Schicksal ohne Mitleidshaltung darstellen. Die Preisverleihung versteht sich auch <strong>als</strong><br />
Anerkennung und Dank an Redaktionen, Herausgeber und Intendanten dafür, dass sie sozialen Themen in<br />
ihren Medien den notwendigen Raum geben und damit Partei ergreifen für Menschen in sozialen Notlagen.<br />
Teilnahmeberechtigt sind Beiträge, die im Vorjahr veröffentlicht wurden. Einreichungen in den Sparten Hörfunk<br />
und Fernsehen können nur über den Sen<strong>der</strong> erfolgen. In den Bereichen Print und Sozialfotografie kann je<strong>der</strong><br />
Autor/Fotograf mit maximal zwei Arbeiten am Wettbewerb teilnehmen.<br />
Die BAGFW beruft eine Jury, die aus vier mit sozialen und sozialpolitischen Themen vertrauen Journalisten<br />
und drei Vertretern <strong>der</strong> <strong>Freien</strong> Wohlfahrtspflege besteht.<br />
An Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Jury o<strong>der</strong> ihre nächsten Angehörigen wird <strong>der</strong> Preis nicht verliehen. Die Entscheidungen <strong>der</strong><br />
Jury sind endgültig und erfolgen unter Ausschluss des Rechtsweges.<br />
Der Medienpreis ist je Sparte mit insgesamt DM 10.000,-- dotiert. Eine Aufteilung zur Prämierung mehrerer<br />
Beiträge in einer Sparte ist möglich. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen einer öffentlichen<br />
Festveranstaltung.
DIE PREISTRÄGER<br />
Rundfunk<br />
1971 Ekkehard Sass<br />
Auf <strong>der</strong> Warteliste<br />
Das geistig behin<strong>der</strong>te Kind und die Gesellschaft<br />
Die genaue Zahl <strong>der</strong> geistig Behin<strong>der</strong>ten in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin ist<br />
nicht bekannt. Rund 100.000 sind durch die Gesundheitsämter erfasst. Die Behörden gehen aber<br />
davon aus, dass noch einmal die gleiche Anzahl bei ihnen unbekannt ist.<br />
Der Autor hat Heime besucht, in denen geistig behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong> leben. Er hat mit Eltern <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong> gesprochen, mit Ärzten und Fürsorgern. Er hat Spezi<strong>als</strong>chulen aufgesucht und<br />
Arbeitsplätze, die für die Heranwachsenden eingerichtet wurden. Vor allen Dingen aber hat er die<br />
Kin<strong>der</strong> selbst gesehen und mit ihnen gelebt.<br />
In seiner Sendung kommt er zu Schlussfolgerungen, die einige bisher übliche Behandlungs- und<br />
Erziehungsmethoden für geistig behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong> in Frage stellen.<br />
Sen<strong>der</strong> Freies Berlin<br />
23.12.1970<br />
1972 Ruprecht Kurzrock<br />
Rauschgift - Bewusstsein - Gesellschaft<br />
Zur Entwicklung <strong>der</strong> chemischen Manipulation<br />
1. Preis<br />
Die Sendung beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Entwicklung eines Problems, das in autoritären<br />
Gesellschaften durch Anwendung härtester Zwangsmaßnahmen radikal unterdrückt wird, besser<br />
gesagt: verdrängt wird. Dem wachsenden Drogenkonsum vieler Millionen Menschen sind nicht<br />
nur die Industriestaaten des Westens, son<strong>der</strong>n im gleichfalls steigenden Umfang viele Nationen<br />
<strong>der</strong> Dritten Welt ausgeliefert.<br />
Es ist bekannt, dass es sich beim Drogen-Konsum und Drogen-Mißbrauch gerade junger<br />
Menschen um ein vielschichtiges Phänomen handelt, das eben sosehr in <strong>der</strong> Person des<br />
einzelnen begründet ist wie in den gesellschaftlichen Zusammenhängen und in <strong>der</strong> „geistigen<br />
Situation <strong>der</strong> Zeit“.<br />
Der Beitrag will durch Gespräche mit Drogenabhängigen, Ärzten und Kriminalisten Hinweise<br />
geben, aufmerksam machen und wenn möglich: warnen.<br />
Rias<br />
26.05.1971<br />
Klaus Antes / Christiane Ehrhardt<br />
Männer hinter Gittern<br />
Gespräche mit Lebenslänglichen<br />
2. Preis<br />
Gefängnis-Schicksale: schon drei, sechs, neun, zwölf, fünfzehn o<strong>der</strong> achtzehn Jahre unter<br />
Verschluss. Als Mör<strong>der</strong> verurteilt - ein Leben lang. Alter: 30, 31, 33, 35, 46 und 68.<br />
Sie schauen uns an. Blick in den Spiegel. Sie möchten gefallen, aber was sie sehen, gefällt<br />
ihnen nicht: die fahle, fettige Haut, die schlechten Zähne. Diese Arme-Lu<strong>der</strong>-Kluft...! Die<br />
Drillichhose viel zu weit, das blau-weiß-gestreifte Hemd überall gestopft. Die Schuhe - Blei an<br />
den Füßen. Je<strong>der</strong> ist an<strong>der</strong>s, und doch sind sie alle gleich: verramschte Individualität.<br />
Kein Wärter stört, kein Wort wird überwacht, kein Gefühl gebremst. Sie sollten alles sagen<br />
können, sagen, was sie lähmt, was sie quält, und sie sollten es so sagen, wie sie es sagen,<br />
wenn sie unter sich sind.
Bayerischer Rundfunk<br />
17.12.1971<br />
Hansjörg Martin<br />
Die Leute aus dem Lager<br />
2. Preis<br />
Das Lager, eins von vielen, befindet sich zwischen einer Wohnsiedlung und einem Industriegelände.<br />
Die Menschen, die da leben - recht und schlecht leben - sind durch widrige Umstände o<strong>der</strong> durch<br />
eigenes Verschulden in diese Außenseiter-Schieflage geraten. Was heißt überhaupt „Verschulden“?<br />
Wer an dem Rand o<strong>der</strong> gar außerhalb <strong>der</strong> Gesellschaft zu leben gezwungen ist, hat nie allein schuld<br />
daran. Seine Umwelt, die Gesellschaft, seine Ausbildung, alles trägt zum Scheitern bei.<br />
Das „Leute aus dem Lager“ meist unter <strong>der</strong> Situation leiden, ist kein Geheimnis. Sie werden überall<br />
dort, wo sie ihre Adresse angeben müssen, in die „Outcast“-Kategorie eingestuft. Einer „aus dem<br />
Lager“ hat weniger Chancen - das geht schon in <strong>der</strong> Schule los, setzt sich bei <strong>der</strong> Lehrstellensuche,<br />
beim Kampf um einen Arbeitsplatz fort..., und es erzeugt einen Teufelskreis, aus dem nur wenige<br />
auszubrechen vermögen. Ein Bericht über die Lebensbedingungen von Obdachlosen.<br />
Norddeutscher Rundfunk<br />
01.03.1971<br />
1973 Walter Leo<br />
Wohin soll ich denn nur gehen?<br />
Gespräche mit Lebensmüden<br />
„Ich hoffe nur noch, dass ich morgen nicht mehr leben muss.“ Ein Satz aus dem Abschiedsbrief einer<br />
18jährigen an ihre Freundin. Kurz darauf nahm sie sich das Leben. Warum? Warum beenden<br />
Menschen selbst ihr Leben? In <strong>der</strong> Sendung berichtet <strong>der</strong> Autor von Menschen - jungen und alten,<br />
Männern und Frauen -, die sich das Leben nahmen. So unterschiedlich ihre Geschichten sind, vielen<br />
Selbstmör<strong>der</strong>n ist eines gemein: Im Grunde genommen wollen sie weiterleben und nicht sterben. Ihr<br />
Selbstmord ist ein Ruf nach Hilfe. Ein Ruf freilich, <strong>der</strong> zugleich ihre ganze Verschlossenheit und<br />
Sprachlosigkeit demonstriert, ihre Unfähigkeit, sich helfen zu lassen.<br />
Süddeutscher Rundfunk<br />
05.12.1972<br />
1974 Helmut Fritz / Maria Hohmann<br />
Ich bin ein Contergankind<br />
Ein Radio-Protokoll<br />
1. Preis<br />
Birgitt ist eines von 2.394 in <strong>der</strong> Bundesrepublik registrierten Contergankin<strong>der</strong>n. Contergan ist das<br />
Stichwort für die größte Arzneimittel-Katastrophe in <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Medizin.<br />
Die Zeit ist für die Contergan-Kin<strong>der</strong> nicht stehengeblieben. Sie wuchsen aus <strong>der</strong> Obhut des<br />
Elternhauses hinaus, gingen in die Schule und beginnen nun, dreizehn Jahre nach <strong>der</strong> Katastrophe,<br />
ihren Zustand und seine Konsequenzen zu begreifen und zu empfinden.<br />
Das Feature stellt die Unsentimentalität dieses Mädchens gegen das Mitleid, mit dem solche Kin<strong>der</strong><br />
häufig gesehen werden, ohne jene mitleidsvolle Beklommenheit, mit <strong>der</strong> so oft auf das Phänomen <strong>der</strong><br />
Verkrüppelung reagiert wird.<br />
Hessischer Rundfunk<br />
28.07.1973
Dieter Kühn / Martin Sperr<br />
Lemsomd<br />
2. Preis<br />
Die Existenzangst alter Menschen ist Thema des Monologs „Lemsomd“ („Lebensabend“). Eine<br />
alte Frau redet sich die Enttäuschung über das triste Leben im Altersheim vom Leib. Böse<br />
Erfahrungen mit einer Zimmergenossin und angelesene Vorurteile mischen sich in ihrem Kopf zu<br />
Gedankenfolgen, in denen immer wie<strong>der</strong> die nackte Angst vor <strong>der</strong> Zukunft durchbricht.<br />
Bayerischer Rundfunk<br />
19.03.1973<br />
1975 Lutz Lehmann<br />
Da haben die an<strong>der</strong>n aber Glück gehabt<br />
Contergan-Kin<strong>der</strong> heute<br />
Die Arzneimittel-Katastrophe Contergan ist nicht vergessen: 2.500 geschädigte Kin<strong>der</strong>;<br />
insgesamt 150 Millionen Mark Kapitalhilfe und Renten, die bereitgestellt wurden. Aber wie erlebt<br />
ein Kind ohne Beine seine Umwelt? Was erhofft sich ein Mädchen ohne Arme von <strong>der</strong> Zukunft?<br />
Welche Ausbildung kann es für einen gehörlosen Jungen geben?<br />
Die Probleme und Konflikte in den betroffenen Familien stellt <strong>der</strong> Bericht an sechs Beispielen<br />
dar: Barbara, 13, ohne Arme geboren; Dorothee 12, ohne Beine geboren; Felix 12, ohne Arme<br />
und mit schwerem Hörschaden geboren; Sabine, 13, mit zwei verkrüppelten Armen und einem<br />
verkürzten Bein geboren; Stephan, 12, ohne Arme und Beine geboren; Andreas und Peter, 13,<br />
gehörlos und mit Gesichtsmuskel-Lähmung geboren. Mit den Eltern und den Kin<strong>der</strong>n wurden<br />
ausführliche Gespräche geführt und aufgezeichnet.<br />
Sen<strong>der</strong> Freies Berlin<br />
05.12.1974<br />
1976 Christiane Ehrhardt<br />
Die Krücken<br />
Chronik einer Behin<strong>der</strong>ung<br />
Weiß man, wie das ist, im Bett zu liegen mit <strong>der</strong> Angst, nie wie<strong>der</strong> aufstehen zu können? Und<br />
wenn man wie<strong>der</strong> aufstehen kann, nie wie<strong>der</strong> so laufen zu können, wie man immer gelaufen ist,<br />
sein ganzes Leben lang bis jetzt? Behin<strong>der</strong>t zu sein für den Rest seines Lebens, vielleicht hilflos,<br />
bedauert, bemitleidet, mit Ratschlägen versehen und Mahnungen? Weiß man, dass es einen<br />
treffen kann, jeden von uns und jeden Tag? Kaum einer macht sich das klar, und wer es erlebt<br />
hat, vergisst es wie<strong>der</strong>, verdrängt es, will es nicht wahrhaben, will so sein, wie er immer war.<br />
Sen<strong>der</strong> Freies Berlin<br />
12.06.1975
1977 Charles Dürr / Wolfgang Schiffer<br />
Verurteilt<br />
Christa Palms Briefe in den Knast<br />
Das Dokumentarhörspiel entwickelt die Geschichte von Christa Palm anhand von Briefen, die sie „in<br />
den Knast“ schreibt. Adressat ist ihr Verlobter, <strong>der</strong> wegen Einbruchs festgenommen wird. Aus den<br />
Briefen wird deutlich, wie sich ihr Verhältnis durch die Festnahme und die Umstände <strong>der</strong> Haft<br />
verän<strong>der</strong>n, welche Last die junge Frau „draußen“ zu tragen hat.<br />
Christa, zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Verhaftung im zweiten Monat schwanger, erträgt diese Last, auch <strong>als</strong> sich<br />
finanzielle Schwierigkeiten einstellen mit all den damit verbundenen Demütigungen: Gang zum<br />
Sozialamt, Schulden beim Kaufmann an <strong>der</strong> Ecke. Was die Liebenden, die im „Knast“ schließlich<br />
heiraten, auseinan<strong>der</strong>bringt, ist die bei<strong>der</strong>seitige Isolation, das Getrenntsein voneinan<strong>der</strong>. Das<br />
Hörspiel macht auf die Unmöglichkeiten des Strafvollzugs aufmerksam; nicht mal am Hochzeitstag<br />
dürfen die Eheleute allein sein. In dieser Situation, die eine wachsende Isolation und Entfremdung <strong>der</strong><br />
Partner voneinan<strong>der</strong> begünstigt, liegt die Wurzel des Scheiterns <strong>der</strong> Ehe.<br />
Westdeutscher Rundfunk<br />
21.09.1976<br />
1978 Martina Birnbreier<br />
Todesursache Heroin<br />
Ausgangspunkt ist eine kurze Zeitungsnotiz über ein Mädchen, das an einer Überdosis Heroin<br />
gestorben war. Mit Hilfe des Frankfurter Rauschgiftdezernats konnte die Autorin Kontakt zur<br />
Drogenszene knüpfen und dort nach langwierigen Recherchen frühere Bekannte des Opfers finden.<br />
Auch die Mutter <strong>der</strong> Toten erklärte sich bereit, an <strong>der</strong> Aufarbeitung des Themas mitzuwirken. So<br />
entstand ein Protokoll über Leben und Sterben des Rauschgiftopfers Ulli Schrö<strong>der</strong>. Aus den<br />
unterschiedlichen Perspektiven fügen sich Teilwahrheiten zu einem Ganzen. In Aussagen <strong>der</strong><br />
ehemaligen Freundin des Opfers spiegeln sich <strong>der</strong>en eigene Aussichtslosigkeit, das Drogenproblem<br />
zu bewältigen.<br />
Südwestfunk<br />
14.09.1977<br />
1979 Gisela Reinken<br />
Wie kann man damit fertig werden?<br />
Einen fanden sie tot in einer Toilette; einen Sechzehnjährigen in einer Spielhalle. Ein<br />
Fünfundzwanzigjähriger lief im Rausch gegen einen Zug; ein fünfzehnjähriger Re<strong>als</strong>chüler sprang<br />
während eines LSD-Horrortrips von einem Fabrikdach. Ein Entsetzen ohne Ende. Und für die, die<br />
leben, ein Entsetzen, dessen Ende nicht abzusehen ist.<br />
Über Menschen, die von Drogen und vom Alkohol abhängig geworden sind, ist schon viel geschrieben<br />
und gesprochen worden. Aber wie geht es denen, die dem Verfallenen am nächsten stehen - <strong>der</strong><br />
Mutter, <strong>der</strong> Schwester, dem Vater, die ohnmächtig mit ansehen müssen, wie ihr Kind, wie ihr Bru<strong>der</strong>,<br />
wie ihre Schwester, sich aus <strong>der</strong> Gemeinschaft löst und in eine Sphäre untertaucht, in die man ihm<br />
und ihr nicht mehr folgen kann, die miterleben müssen, wie ihr Kind im Elend - und wohl auch im<br />
Verbrechen verkommt? Kann eine Familie überhaupt „normal“ weiterleben mit dieser Last? Wie wird<br />
sie fertig mit <strong>der</strong> Frage, wer nun das Elend verschuldet habe, das über alle gekommen ist?<br />
Radio Bremen<br />
22.05.1978<br />
1980 Gretel Rieber<br />
Die Frau des Zigeuners
Ulla Kierpacz ist seit mehr <strong>als</strong> zehn Jahren mit einem Zigeuner verheiratet. Ihr Mann wurde in Polen<br />
geboren, lebt aber seit 1958 in <strong>der</strong> Bundesrepublik. Dennoch hat er immer noch keinen deutschen<br />
Pass; er ist staatenlos. Seine Anträge auf Einbürgerung wurden bis heute abgelehnt, denn ihm fehlt<br />
eine wichtige Voraussetzung für die Einbürgerung: er kann nicht lesen und schreiben. Ein Grund<br />
auch, weshalb er zur Zeit keine geregelte Arbeit hat. Täglich mit Teppichen herumzufahren und zu<br />
hausieren, wie die Familie es früher getan hat, kommt nicht mehr in Frage. Die kleine Tochter wurde<br />
in diesem Jahr eingeschult. Ihr jedenfalls soll das Schicksal vieler Zigeunerkin<strong>der</strong> erspart bleiben:<br />
ungenügende o<strong>der</strong> keine Schulbildung, Straffälligkeit, Sozialfürsorge. Ulla Kierpacz hat viel erlebt in<br />
den zehn Jahren ihrer Ehe. Einen Bruchteil davon erzählt sie in dieser Sendung selbst.<br />
Westdeutscher Rundfunk<br />
09.09.1979<br />
1981 Helmut Fritz<br />
Heroinfamilie<br />
Das Heroinproblem aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Eltern, <strong>als</strong> Familienkatastrophe. Die Angehörigen eines<br />
Süchtigen dürften die einzigen sein, die alle Aspekte des Heroins unmittelbar erleben: Einstieg in<br />
die Sucht, ihr Verlauf, <strong>der</strong> Kampf mit dem Dealer, die Kriminalisierung, die Zerstörung des<br />
Menschen, <strong>der</strong> Mangel an ärztlicher Versorgung, die Entzugserscheinungen, die Zerstörung <strong>der</strong><br />
Familie und schließlich: die Sisyphusarbeit <strong>der</strong> Therapie. Niemand kann darüber authentischer<br />
reden <strong>als</strong> die Eltern <strong>der</strong> Süchtigen.<br />
Gleichzeitig stellt die Sendung zwischen den betroffenen Familien eine Art Öffentlichkeit her, gibt<br />
Anstoß zu einem solidarischen Empfinden und Handeln - die „Elternkreise heroingeschädigter<br />
Familien“ sind ein Schritt in diese Richtung.<br />
Südwestfunk<br />
07.12.1980<br />
1982 Ingrid Tourneau<br />
Heimlich und allein<br />
Frauenalkoholismus<br />
Die Zahl alkoholkranker Frauen steigt ständig. Zwar gibt es keine präzisen Erfahrungswerte, da<br />
die Dunkelziffer <strong>der</strong> unbekannten und nie bekannt werdenden Fälle sehr hoch ist. Dennoch gehen<br />
Wissenschaftler davon aus, dass zu Beginn dieses Jahrhun<strong>der</strong>ts 19 Alkoholiker auf eine<br />
alkoholabhängige Frau kamen, heute jedoch nur noch vier alkoholkranke Männer einer vom<br />
Alkohol Abhängigen gegenüberstehen.<br />
Männer trinken in <strong>der</strong> Öffentlichkeit mit an<strong>der</strong>en Männern. Frauen trinken meist heimlich und<br />
allein. Diese Verheimlichungstendenz ist eines <strong>der</strong> auffälligsten Merkmale des weiblichen<br />
Alkoholismus.<br />
Obwohl sich die Einstellung zum Alkoholismus gewandelt hat, ist die Ablehnung <strong>der</strong><br />
alkoholkranken Frau auch heute noch wesentlich stärker <strong>als</strong> die Ablehnung des<br />
alkoholabhängigen Mannes. So sehr man Trinkexzesse beim Mann <strong>als</strong> männlich toleriert, so<br />
wenig Verständnis zeigt man bei Frauen. Die Trunkenheit <strong>der</strong> Frau ist mit einer starken<br />
repressiven Einstellung <strong>der</strong> Gesellschaft belegt.<br />
Rias<br />
19.11.1981<br />
1983 Inge Kurtz<br />
Das dankbare Angriffsobjekt<br />
Berichte aus dem Frauenhaus<br />
Scheidungsanwälte, Psychiater, Ärzte, Polizisten, Pfarrer, Politiker o<strong>der</strong>: misshandelte Frauen -<br />
sie müssten es eigentlich besser wissen. Allen schlimmen Erfahrungen zum Trotz ist die Ehe in<br />
unserer Gesellschaft aber immer noch das beliebte Projektionsobjekt für Träume von Liebe,
Geborgenheit und Glück. Aus Scham, dem Anspruch des Ide<strong>als</strong> nicht gerecht zu werden,<br />
übertünchen alle Beteiligten das Bild <strong>der</strong> Hilflosigkeit und Gewalt. Sogar die Opfer.<br />
Bis vor einigen Jahren gab es deshalb keine Einrichtungen, um misshandelten Frauen zu helfen.<br />
Erst durch die Frauenbewegung, durch Berichte aus Frauenhäusern, beginnt <strong>der</strong> Lack zu<br />
blättern. In diesem Originalhörspiel erzählen Frauen und Kin<strong>der</strong> von körperlichen und<br />
psychischen Misshandlungen, vom Versuch <strong>der</strong> Ehemänner und Väter, ihren gesellschaftlich<br />
sanktionierten, vermeintlichen Herrschaftsanspruch innerhalb <strong>der</strong> eigenen vier Wände notfalls mit<br />
Gewalt durchzusetzen.<br />
Hessischer Rundfunk<br />
05.04.1982<br />
1984 Beate Schubert<br />
Dabei kann Dir keiner helfen<br />
Porträt <strong>der</strong> Fixerin Paula W.<br />
Als ich sie kennenlerne, mittags am U-Bahnhof Kurfürstendamm, ist sie gut drauf, hat sich<br />
gerade einen Schuss gesetzt. Stecknadelkopfgroß sind ihre Pupillen, die Augen glänzen. Drei<br />
Päckchen Dope muss sie noch verkaufen, aber ich solle auf sie warten in ihrer Wohnung, da<br />
können wir reden! Erst Stunden später kommt sie nach Hause, ist ihr Dope nicht losgeworden.<br />
Sie ist jetzt auf turkey, hat Entzugserscheinungen.<br />
Paula ist eine von unzähligen Kleindealern, die, selbst süchtig, den Handel mit Heroin dazu<br />
benutzen, ihren Eigenbedarf zu decken. Jahrelang ist sie auf den Strich gegangen, um sich das<br />
Geld für die tägliche Spritze zu beschaffen. Dann hat sie Rainer kennengelernt, einen Studenten,<br />
<strong>der</strong> nicht trinkt und nicht raucht. Er will Paula von <strong>der</strong> Droge losbekommen. Aber kurz nachdem<br />
sie mir ihre Geschichte erzählt hat, wird sie wie<strong>der</strong> wegen Eigenverbrauchs verhaftet und kommt<br />
ins Frauengefängnis.<br />
Drei Jahre lang höre ich nichts von ihr, weiß nur, sie hat Rainer geheiratet und lebt irgendwo in<br />
Westdeutschland. Eines Abends ein Anruf: „Hier Paula, ich wollt Dir nur sagen, ich hab’s<br />
geschafft, ich bin clean...“<br />
Sen<strong>der</strong> Freies Berlin<br />
05.06.1983<br />
1985 Bärbel Döhring<br />
Die gucken einen an mit großen Augen<br />
Über die Situation von Kin<strong>der</strong>n alkoholabhängiger Eltern<br />
Kin<strong>der</strong> alkoholkranker Eltern leiden unter einer Vielzahl von Störungen. Neben<br />
psychomotorischen, angstneurotischen und depressiven Symptomen tritt aggressives Verhalten<br />
in Form von Wutausbrüchen, Auflehnung, Trotz und Hyperaktivität auf. Mädchen richten ihre<br />
Aggressionen eher gegen sich selbst, während Jungen sie an Gegenständen o<strong>der</strong> Menschen<br />
auslassen. Alle diese Auffälligkeiten und Schwierigkeiten <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> und Jugendlichen werden<br />
verständlich, wenn man bedenkt, was sie - oftm<strong>als</strong> von klein auf - mitgemacht haben.<br />
In <strong>der</strong> Sendung kommen Kin<strong>der</strong> und Jugendliche einer Selbsthilfeorganisation zu Wort, <strong>der</strong>en<br />
Eltern Schwierigkeiten mit dem Alkohol haben. Sie sprechen über ihre Erfahrungen und<br />
gegenseitige Hilfe.<br />
Südwestfunk<br />
31.10.1984<br />
1986 Axel Wriedt<br />
Spiel <strong>als</strong> Sucht<br />
Spielsucht, auch und gerade an den Spielautomaten, ist eine Sucht, die zwar <strong>als</strong> solche<br />
langsam auch von Institutionen anerkannt wird (z.B. von den Krankenkassen), doch es besteht<br />
so gut wie keine Therapie. So wird versucht, in Selbsthilfegruppen von „anonymen Spielern“ in<br />
Gruppentherapie das Problem anzugehen. Und das ist bei einer geschätzten Zahl von ca.
300.000 bis 400.000 Spielern dringend notwendig. Spielsucht ist zwar kein körperliches<br />
Symptom, doch sind die Mechanismen ähnlich wie z.B. bei Alkoholismus, Tabletten- o<strong>der</strong><br />
Drogenabhängigkeit.<br />
Eine Schwerpunktsendung mit Therapeuten und Betroffenen unter Beteiligung <strong>der</strong> Hörer über<br />
Probleme <strong>der</strong> Sucht.<br />
Norddeutscher Rundfunk<br />
30.09.1985<br />
1987 Mechthild Müser<br />
Wenn Ihr mit mir weintet, wäre es nicht so hart...<br />
Begleitung Sterben<strong>der</strong> im neuen Licht<br />
Sterbende werden ausgeson<strong>der</strong>t, isoliert, ihr Anblick erscheint unzumutbar. Selbst in<br />
Krankenhäusern und Pflegestationen schiebt man sie in Sterbezimmer o<strong>der</strong> - auch das soll noch<br />
vorkommen - einfach in Abstellkammern. Extra-Zimmer, ja, aber keine Extra-Zuwendung.<br />
Der Ruf nach humanen Bedingungen, unter denen Menschen sich in Würde auf ihr Sterben<br />
vorbereiten können, trifft in erster Linie Ärzte und Pflegepersonal. Die haben jahrelang gelernt,<br />
dass es ihre Aufgabe ist zu heilen, Leben zu verlängern. Dem gegenüber steht jedoch das<br />
Modell <strong>der</strong> Sterbebegleitung von Hospizen, in denen sich die Arbeit darauf konzentriert,<br />
lebensverlängernde Maßnahmen zugunsten einer Therapie zu unterlassen, die den Patienten<br />
schmerzfrei hält, ohne ihn dabei bewusstlos zu machen. Hinzu kommt eine intensive<br />
menschliche Betreuung. Auf diese Weise wird es den Sterbenden ermöglicht, ihr Ende bewusst<br />
zu erleben, die Angst vor dem Tod zu verlieren und Abschied zu nehmen.<br />
Radio Bremen<br />
09.11.1986<br />
1988 Chris Pohl<br />
Manchmal bin ich traurig<br />
Kin<strong>der</strong> von Asylbewerbern<br />
Täglich hören und lesen wir etwas über Asylanten: woher sie kommen und warum sie hier sind.<br />
Doch kaum einer weiß, wie es den Kin<strong>der</strong>n geht, die mit ihren Eltern und Geschwistern ihre<br />
Heimat verlassen mussten. Wie leben sie? Wo sind sie untergebracht? Wie werden sie<br />
aufgenommen? Dürfen sie in die Schule? Die Autorin hat mit zwei Jugendlichen<br />
Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnheime besucht und dort mit Kin<strong>der</strong>n von Asylbewerbern<br />
über diese Fragen gesprochen.<br />
Süddeutscher Rundfunk<br />
14.06.1987<br />
1989 Hermann Theißen / Hans Woller<br />
Jenseits <strong>der</strong> Überschüsse<br />
Armut in <strong>der</strong> Europäischen Gemeinschaft<br />
Bis vor wenigen Jahren beschränkte sich das Betätigungsfeld <strong>der</strong> französischen Hilfeorganisation<br />
„Médecins sans frontières“ auf die sogenannte Dritte Welt. Heute fühlen sich die Ärzte<br />
verpflichtet, auch in Frankreich selbst ärztliche Hilfe zu leisten - denjenigen, die durch die<br />
Maschen des sozialen Netzes gefallen sind und keinen Anspruch mehr auf einen Krankenschein<br />
haben.<br />
Bayswater, ein Hotel-Viertel in London. Zu den vielen Touristen sind in den letzten Jahren über<br />
1.500 „bed and breakfast“-Familien gekommen. Familien, die obdachlos geworden sind und unter<br />
menschenunwürdigen Verhältnissen auf eine Sozialwohnung warten.<br />
Soziale Not auch in <strong>der</strong> Bundesrepublik: Ältere Menschen, Langzeitarbeitslose, arbeitslose<br />
Jugendliche und alleinstehende Elternteile sind hier wie überall in <strong>der</strong> EG die Betroffenen.
Armut ist schon lange nicht mehr nur ein Problem <strong>der</strong> europäischen Südstaaten. Jenseits <strong>der</strong><br />
Überschüsse hat sich in allen Staaten <strong>der</strong> EG ein ständig wachsen<strong>der</strong> Personenkreis gebildet,<br />
<strong>der</strong> in bitterster Not sein Leben fristet.<br />
Deutschlandfunk<br />
28.06.1988<br />
1990 Ulrike Baur<br />
Im Leiden nicht allein<br />
Das Christopherushaus in Frankfurt begleitet Sterbenskranke<br />
„Lebenshilfe für Krebsbetroffene“ nennt sich das Christophorushaus, ein Projekt, dass in dieser<br />
Form einzigartig ist in <strong>der</strong> Bundesrepublik. Seine Vorbil<strong>der</strong> liegen in England, in Einrichtungen,<br />
die sich dort „Hospiz“ nennen. Keine Sterbekliniken, wie hierzulande fälschlich behauptet wird,<br />
son<strong>der</strong>n Zentren, <strong>der</strong>en Hauptaugenmerk auf <strong>der</strong> ambulanten Betreuung Schwerstkranker liegt.<br />
Menschen, für die es wenig o<strong>der</strong> keine Hoffnung gibt und die in Frieden zuhause sterben<br />
möchten. Nur wer einsam ist o<strong>der</strong> zu hause nicht mehr versorgt werden kann, wird auch<br />
stationär aufgenommen, findet im Haus selbst die Ruhe und Zuwendung, die er braucht, um sich<br />
auf das Sterben vorzubereiten.<br />
Das Christophorushaus bündelt viele Hilfsangebote, die an<strong>der</strong>swo über die ganze Stadt und<br />
verschiedenste Institutionen verstreut und damit für viele Hilfesuchende, die mit Zeit und Energie<br />
haushalten müssen, nicht o<strong>der</strong> nur schwer erreichbar sind.<br />
Hessischer Rundfunk<br />
08.12.1989<br />
1991 Karl Siebig<br />
...und immer verkehrt 'rum gelebt<br />
Esther Kaempfe - 20 Jahre Leben mit Straftätern<br />
20 Jahre lang nahm die Flensburgerin Esther Kaempfe vornehmlich jugendliche Straftäter in ihre<br />
Wohnung auf. Ihre Motive, Erfolge und Misserfolge werden in Gesprächen mit ihr und mit den<br />
jungen Straftätern thematisiert. Die Geschichten <strong>der</strong> jungen Menschen ähneln einan<strong>der</strong>: von den<br />
Eltern ins Heim abgeschoben, irgendwann straffällig geworden, aus <strong>der</strong> Haftanstalt ins Nichts<br />
entlassen. Sie berichten selbst über ihre Versuche, in dieser Lage Tritt zu fassen, eine Wohnung<br />
und einen Job zu finden.<br />
Norddeutscher Rundfunk<br />
07.09.1990<br />
1992 Dietlind Klemm / Eva Kirschenhofer<br />
Liebe ist, <strong>als</strong> ob man plötzlich ein Gewitter erlebt<br />
Geistig Behin<strong>der</strong>te, Liebe und Sexualität<br />
Partnerschaft, Liebe und Sexualität waren für Menschen mit geistiger Behin<strong>der</strong>ung lange Zeit<br />
tabu - passten nicht zu ihrem versteckten Leben in <strong>der</strong> Familie o<strong>der</strong> in großen, streng nach<br />
Geschlechtern getrennten Heimen.<br />
Längst zeigt sich, dass Menschen mit geistiger Behin<strong>der</strong>ung einan<strong>der</strong> liebevolle zärtliche,<br />
unterstützende Partner sein können. Aber was ist, wenn ein Kind entsteht? Gibt es dann an<strong>der</strong>e<br />
Lösungen <strong>als</strong> Schwangerschaftsabbruch o<strong>der</strong> Adoption?<br />
Die Autorinnen haben mit Müttern über ihre Ängste und Hoffnungen gesprochen - mit<br />
Pädagogen, die sich dem Thema verantwortungsbewusst öffnen - und natürlich mit Betroffenen.<br />
Alltagsszenen aus einem Heim zeigen, wie junge Mütter lernen, Verantwortung zu übernehmen,<br />
und wie für die gesunde Entwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> gesorgt werden kann.<br />
Bayerischer Rundfunk<br />
29.07.1991
1993 Eva Schindele<br />
Der ewige Schlaf<br />
Der Tod <strong>als</strong> gesellschaftliches Tabu<br />
Dass es vielleicht auch so etwas gibt wie ein Bedürfnis nach einem guten Lebensende, die<br />
Lebensgestalt abgerundet wird am Ende, wenn wir so etwas hätten wie eine Kultur des<br />
Lebensendes. Dass Menschen sterben können, nicht nur gelassen werden, son<strong>der</strong>n auch von<br />
sich aus sterben können. Das würde bedeuten, dass man sich auch Gedanken machen könnte,<br />
wie man aus diesem Leben scheiden, wie man seine Angehörigen o<strong>der</strong> Liebsten verlassen<br />
möchte.<br />
Gestorben wird heute oft unter unwürdigen Umständen im Krankenhaus. Erst in den letzten<br />
Jahren entwickelte vor allem die Hospizbewegung Alternativen für die letzte Lebensphase. Über<br />
den Hospizgedanken und Hilfestellungen für Angehörige von Sterbenskranken wird in dieser<br />
Sendung berichtet. Ebenso vom Sterben im Krankenhaus, von passiver Sterbehilfe, den damit<br />
verbundenen ethischen Konflikten und <strong>der</strong> Relevanz eines Patiententestaments.<br />
Radio Bremen<br />
24.09.1992<br />
1994 Erwin Bienewald<br />
Mallorca hin und zurück<br />
Tagebuch einer verrückten Reise<br />
Sechs psychisch kranke Frauen und Männer haben zusammen mehr <strong>als</strong> 150 Jahre in einer<br />
psychiatrischen Langzeitklinik gelebt. Sie galten <strong>als</strong> unheilbar krank, wurden mit Tabletten und<br />
Spritzen ruhiggestellt, mussten für ein Taschengeld in <strong>der</strong> Küche o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Wäscherei arbeiten.<br />
Dann kam die Psychiatriereform. Die Klinik wurde aufgelöst. Die Bewohner kehrten zurück in die<br />
Stadt. Aus Insassen wurden Bürger, die heute zum Teil in Heimen, zum größeren Teil aber in<br />
Wohngemeinschaften leben. Sie müssen nach wie vor betreut werden, aber viele <strong>der</strong> früheren<br />
Patienten haben gelernt, selbständig zu wirtschaften und den Haushalt zu versorgen.<br />
Anfang 1993 hatten sie die Idee, zusammen ins Ausland zu reisen. Ihr Wunschziel: Mallorca. Im<br />
Mai 1993 war es so weit: Der Ort war ausgesucht, Hotel und Flug waren gebucht. Zusammen mit<br />
zwei Betreuern machten sie sich auf eine abenteuerliche Reise. Der Autor hat die<br />
ungewöhnlichen Urlauber auf ihrer Reise mit dem Mikrophon begleitet.<br />
Radio Bremen<br />
23.09.1993<br />
1995 Hildegard Hartmann<br />
Homosexuelle Jugendliche: Die große Angst vor dem Coming out<br />
Homosexuelle müssen heute zwar keine strafrechtliche Verfolgung mehr fürchten, aber sie<br />
werden - gerade in den Zeiten von AIDS - immer noch ausgegrenzt und diskriminiert. Können<br />
Jugendliche, die sich zu ihrem eigenen Geschlecht hingezogen fühlen, vor diesem Hintergrund<br />
ihre sexuelle Identität angstfrei entwickeln und sich offen zu ihrer Veranlagung bekennen?<br />
Welche Rolle spielt dabei die Einstellung <strong>der</strong> Eltern, die Reaktion <strong>der</strong> Umwelt? In <strong>der</strong> Sendung<br />
kommen homosexuelle Jungen und Mädchen, Fachleute und betroffene Eltern zu Wort.<br />
Bayerischer Rundfunk<br />
21.11.1994<br />
1996 Hannelore Dauer<br />
Sprich und Du bist frei<br />
Annäherung an Überlebende <strong>der</strong> Folter<br />
Wie viele Menschen jährlich weltweit an <strong>der</strong> Folter sterben, kann niemand sagen. Amnesty<br />
International registrierte 1993 500 Häftlinge, die an <strong>der</strong> Folter starben. Die Dunkelziffer dürfte weit
höher liegen. Das aktuelle Jahrbuch von Amnesty wird jedenfalls von Jahr zu Jahr umfangreicher.<br />
Die Organisation spricht von Menschenrechtsverletzungen „in einem Ausmaß, das sich je<strong>der</strong><br />
Vorstellung entzieht.“ Seit 1948 ist die Folter - „im Rahmen <strong>der</strong> Allgemeinen Erklärung <strong>der</strong><br />
Menschenrechte“ - auf <strong>der</strong> ganzen Welt geächtet, und doch wird sie heute mehr denn je<br />
praktiziert. Die Autorin hat in ihrem Feature mit Menschen gesprochen, die trotz unsäglicher<br />
Torturen die Folter überlebt haben.<br />
Südwestfunk<br />
08.03.1995
Fernsehen<br />
1976 Hans Mohl<br />
Für beson<strong>der</strong>e Verdienste <strong>als</strong> För<strong>der</strong>er und Freund behin<strong>der</strong>ter Menschen und ihrer<br />
Helfer<br />
Die journalistische Laufbahn von Hans Mohl ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Probleme<br />
beson<strong>der</strong>s benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt <strong>der</strong> Arbeit stellt, dass sie sich<br />
zu <strong>der</strong>en Anwalt macht und beispielhafte Möglichkeiten des Engagements aufzeigt. Gewürdigt<br />
wird <strong>der</strong> Einsatz <strong>als</strong> Leiter <strong>der</strong> Zweites Deutsches Fernsehen-Redaktion „Gesundheit und Natur“<br />
für körperlich und geistig behin<strong>der</strong>te Menschen ebenso wie für psychisch Kranke.<br />
Als Initiator und Mo<strong>der</strong>ator <strong>der</strong> „Aktion Sorgenkind“ hat Hans Mohl <strong>der</strong> Bevölkerung die Probleme<br />
behin<strong>der</strong>ter Menschen bewusst gemacht. Er hat damit nicht nur eine Welle <strong>der</strong> Hilfsbereitschaft<br />
ausgelöst, son<strong>der</strong>n wesentlich mit dazu beigetragen, dass sich die Gesellschaft verantwortlicher<br />
für ihre behin<strong>der</strong>ten Mitmenschen fühlt.<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
1977 - nicht ausgeschrieben -<br />
1978 Hannelore Gadatsch<br />
Der Fall Eigenmann<br />
Der Beitrag berichtet über eine Familie mit drei Kin<strong>der</strong>n, <strong>der</strong>en Leben durch einen ärztlichen<br />
Kunstfehler fast zerstört wurde.<br />
Im Alter von fünf Jahren wurde die Tochter an den Mandeln operiert. Während <strong>der</strong> Operation kam<br />
es zu einem Narkosezwischenfall. Die Folgen: Das Kind erlitt irreparable Hirnschäden und ist<br />
seit <strong>der</strong> Operation schwerstbehin<strong>der</strong>t. Über 10 Jahre dauerte es, ehe die Eltern - in einem vor<br />
Gericht geschlossenen Vergleich - wenigstens finanziell entschädigt wurden.<br />
Opfer von Kunstfehlern - noch immer ohne eine wirksame Lobby in <strong>der</strong> Bundesrepublik - Fazit<br />
des Schicks<strong>als</strong> dieser Familie.<br />
Südwestfunk<br />
28.03.1977<br />
1979 Frank Krink<br />
Rauschgift<br />
1. Preis<br />
Berlin (West) ist eines <strong>der</strong> Rauschgiftzentren Europas. Über 5.000 Heroinsüchtige und 84 Tote,<br />
das ist die Bilanz 1977. Pro Jahr wird in <strong>der</strong> Stadt Rauschgift für einige hun<strong>der</strong>t Millionen Mark<br />
umgesetzt. Zum Drogenmilieu gehören Raub, Erpressung, Mord und Prostitution.<br />
Der Film schil<strong>der</strong>t die Zustände auf <strong>der</strong> Drogenszene und beobachtet die Polizei bei ihrem fast<br />
aussichtslosen Kampf gegen den Drogenhandel. Opfer <strong>der</strong> skrupellosen Rauschgifthändler sind<br />
schon Kin<strong>der</strong>. Süchtige - unter ihnen ein 14jähriges Mädchen - berichten, in welchen Teufelskreis<br />
sie geraten sind.<br />
Kann einem Heroinsüchtigen überhaupt geholfen werden? Dieser Frage wird in einer<br />
Nervenheilanstalt und in verschiedenen Therapiegemeinschaften nachgegangen.<br />
Sen<strong>der</strong> Freies Berlin<br />
12.01.1978
Marion Odenthal-Brandt / Arno Schmuckler<br />
Die Kin<strong>der</strong> zahlen die Zeche<br />
Junge Auslän<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland<br />
1. Preis<br />
Schon heute ist in vielen Großstädten <strong>der</strong> Bundesrepublik jedes zweite neugeborene Kind ein<br />
Auslän<strong>der</strong>. Niemand weiß, wie viele von ihnen hier bleiben werden. Denn die Zeiten <strong>der</strong><br />
Hochkonjunktur, <strong>als</strong> jede Arbeitskraft umworben wurde, sind vorbei. Das Auslän<strong>der</strong>gesetz lässt<br />
Spielräume offen, die im Zweifelsfall zum Nachteil <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> benutzt werden können. Viele<br />
Jugendliche wollen hier bleiben, aber nur wenige haben Aussicht auf Arbeit o<strong>der</strong> eine Lehrstelle.<br />
Für die Erwachsenen bedeutet <strong>der</strong> Aufenthalt im fremden Land wirtschaftlichen und sozialen<br />
Aufstieg. Doch den Preis dafür zahlen die Kin<strong>der</strong>. Sie sind doppelt benachteiligt, denn sie<br />
müssen nicht nur die Sprachbarrieren, son<strong>der</strong>n auch die Wi<strong>der</strong>stände in ihrer sozialen Umwelt<br />
überwinden.<br />
Der Film schil<strong>der</strong>t nicht nur die Situation dieser jungen Auslän<strong>der</strong>, son<strong>der</strong>n versucht auch,<br />
Auswege zu zeigen. So gibt es eine Vielzahl von privaten, kirchlichen und staatlichen Initiativen,<br />
die darauf abzielen, Modelle zu finden, um eine Einglie<strong>der</strong>ung voranzutreiben. Als vordringlichste<br />
Aufgabe gilt jedoch die Anpassung des Auslän<strong>der</strong>rechts an die Realität. Wie kann verhin<strong>der</strong>t<br />
werden, dass aus dieser zweiten und dritten Auslän<strong>der</strong>generation das wird, was Fachleute heute<br />
eine „soziale Zeitzün<strong>der</strong>bombe“ nennen?<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
26.09.1978<br />
1980 Michael Stefanowski<br />
Kindesmißhandlung - Es hilft nichts außer Hilfe<br />
„Verlassene Kin<strong>der</strong> halbverhungert aufgefunden“, „Kind aus Angst getötet“, „Baby starb an<br />
Unterernährung“, „Immer gab es Prügel zum Essen“, so und ähnlich lauten die Meldungen, die<br />
durch die Presse gehen. Die Misshandlung von Kin<strong>der</strong>n gehört zu den Delikten mit <strong>der</strong> größten<br />
Dunkelziffer. Zur Anzeige kommt es meist erst dann, wenn es zu spät ist.<br />
Polizeilich werden in <strong>der</strong> Bundesrepublik und in West-Berlin jährlich über 4.000 Fälle von<br />
Kindesmisshandlungen und -vernachlässigungen erfasst. Diese Krimin<strong>als</strong>tatistik zeigt das<br />
tatsächliche Ausmaß jedoch nicht einmal annähernd an. Schätzungen, die von klinischen Daten<br />
ausgehen, sprechen von mindestens 30.000 Fällen pro Jahr in <strong>der</strong> Bundesrepublik.<br />
Hinter jedem „Fall“ steht ein grausames Kin<strong>der</strong>schicksal, aber häufig auch eine nicht min<strong>der</strong><br />
bedrückende soziale Situation <strong>der</strong> Erziehenden. Der Bericht untersucht unter an<strong>der</strong>em die<br />
Ursachen für diese gesellschaftliche Realität.<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
16.12.1979<br />
1981 Frank Krink<br />
Querschnittgelähmt<br />
In <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland gibt es rund 20.000 Querschnittgelähmte. Jedes Jahr<br />
kommen Tausende hinzu, durch Verkehrs-, Bade-, Arbeitsunfälle und durch Selbstmordversuche.<br />
Die Dokumentation setzt sich mit Möglichkeiten und Grenzen <strong>der</strong> Hilfe für Querschnittgelähmte<br />
auseinan<strong>der</strong>.<br />
Am Beispiel eines 31jährigen Familienvaters wird verdeutlicht, wie massiv die plötzliche<br />
Behin<strong>der</strong>ung in das Leben eingreift und medizinische wie auch materielle Hilfen allein nicht<br />
vermögen, den Willen zum Weiterleben zu stärken. An <strong>der</strong> täglichen Konfrontation mit <strong>der</strong><br />
Behin<strong>der</strong>ung und dem Verlust gewachsener Rollen in den Beziehungen zerbrechen Ehen, reißen<br />
familiäre und soziale Bande. Betroffene schil<strong>der</strong>n im Gespräch mit dem Autor aber auch, wie sie<br />
im Wechselspiel von Hoffnung und tiefer Verzweiflung lernen, nicht hilflos und einsam, vom<br />
Mitleid an<strong>der</strong>er und zur Untätigkeit verdammt zu sein, son<strong>der</strong>n ein Leben unter vollständig neuen<br />
Bedingungen zu führen.
Sen<strong>der</strong> Freies Berlin<br />
04.03.1980<br />
1982 Katja Aschke<br />
Haben Sie denn nie gearbeitet?<br />
Ein Bericht über Armut im Alter<br />
Wir leben in einem schönen und reichen Land. Noch nie ging es uns so gut wie heute, den<br />
jungen, wie den alten Leuten. Von den 11,3 Millionen Rentnern zum Beispiel kann man sagen,<br />
dass für die meisten von ihnen das Leben noch nie so sorglos war wie jetzt.<br />
Für die meisten, aber nicht für alle: 2,3 Millionen beziehen eine Rente, die unter dem<br />
Existenzminimum, das heißt unter 330 DM, liegt. 2,2 Millionen von ihnen sind Frauen. Es heißt<br />
zwar, wer gearbeitet hat, hat auch geklebt, und wer geklebt hat, kriegt seine wohlverdiente<br />
Rente. Aber da stellt sich doch die Frage: Was haben denn diese 2,2 Millionen Frauen ihr Leben<br />
lang gemacht? Vier von diesen Frauen erzählen in diesem Film über ihr Leben.<br />
Sen<strong>der</strong> Freies Berlin<br />
01.05.1981<br />
1983 Christiane Ehrhardt / Friedrich-Karl Grund<br />
Ich war in <strong>der</strong> Nervenklinik<br />
Wenn man ein Kind nicht begreift, kann man es auch nicht erziehen, nicht die Eltern, nicht die<br />
Heime - <strong>als</strong>o gibt man auf und möchte das Kind weitergeben - aber wohin? In die Familie - da<br />
würde es ja wie<strong>der</strong> verkommen - auf die Straße? Dort würde es verwahrlosen und davor muss<br />
man das Kind bewahren - <strong>als</strong>o wird es verwahrt - in <strong>der</strong> Psychiatrie. Nicht für ein o<strong>der</strong> zwei Jahre,<br />
nein, für 12 Jahre.<br />
Mit 16 wurde Gerhard V. eingewiesen - aber er wollte leben - draußen, irgendwo. Also brach er<br />
aus. Natürlich hat man ihn gefunden und zurückgebracht und spüren lassen, was er unter<br />
seinem Leben zu verstehen hat: Ja und nicht Nein sagen, an sich halten, aushalten - auch die<br />
Spritzen, die geschlossenen Türen, die vergitterten Fenster. „Da drinnen lebt man wie in einem<br />
Sarg“, sagt er und „Nach einem Jahr wusste ich, da gehörst du nicht hin, du bist nicht<br />
schizophren, du bist Epileptiker und das ist etwas an<strong>der</strong>es“. Trotzdem blieb er drin - trotzdem<br />
wurde er entmündigt. Kein Schulabschluss, keine Berufserfahrung, 12 Jahre Nervenklinik. Für<br />
Ämter und Behörden ist Gerhard V. eine Akte.<br />
Bayerischer Rundfunk<br />
01.09.1982<br />
1984 Gebhard Plangger<br />
Spastiker treiben Sport<br />
Es war ein kleines Stadtsportfest - wie jedes an<strong>der</strong>e. Und doch ganz an<strong>der</strong>s. Denn die Athleten<br />
waren nicht Sportler, son<strong>der</strong>n Spastiker; zum Teil sehr stark behin<strong>der</strong>te junge Menschen, die<br />
sich in Mössingen am Fuße <strong>der</strong> Schwäbischen Alb zu Leichtathletikwettkämpfen getroffen<br />
hatten.<br />
Eine Reportage über ein Sportfest <strong>als</strong>o. Was aber die Faszination dieses Film ausmacht, ist das<br />
subjektive Erlebnis des Aufnahmeteams. Es beginnt am Morgen, sich mit distanzierten Bil<strong>der</strong>n<br />
dem Thema und den Menschen zu nähern, Bil<strong>der</strong>, die man ansehen kann, die niemanden<br />
schocken. Von Minute zu Minute aber werden die Bil<strong>der</strong> dichter, die Kamera nähert sich immer<br />
mehr den jungen Menschen, ihre Gesichter gewinnen Konturen. Am Ende ist das Fernsehteam<br />
mittendrin, alle Berührungsängste sind geschwunden.<br />
Der Film wurde absichtlich in den Sportsendungen platziert, um gerade in diesem Programmteil,<br />
<strong>der</strong> sich sonst nur mit Höchstleistungen befasst, auf das Schicksal Benachteiligter und<br />
Behin<strong>der</strong>ter aufmerksam zu machen.<br />
Südwestfunk<br />
06.10.1983
1985 Birgit Kienzle<br />
...und hätten <strong>der</strong> Hilfe nicht<br />
Über die Arbeit <strong>der</strong> Schwestern in <strong>der</strong> Sozi<strong>als</strong>tation Offenburg<br />
1. Preis<br />
Die Gemeindeschwester ist täglich unterwegs, oft über das hinaus, was die Arbeitszeitordnung<br />
regelt. Fast immer ohne Aussicht auf das, was wir „Erfolg“ nennen. Denn am Ende ihrer Mühe<br />
um kranke und alte Menschen steht fast immer <strong>der</strong> Tod.<br />
Das Klischee von <strong>der</strong> Einzelkämpferin, die tagaus, tagein mit ihrem Fahrrad allein unterwegs ist,<br />
stimmt heute nicht mehr. Gemeindeschwestern sind Teil einer Sozi<strong>als</strong>tation, ein Team von 8-<br />
10 Fachkräften, das für einen Bereich von ca. 20.000 Menschen zuständig ist.<br />
Durch die geplanten Einsparungen in <strong>der</strong> Sozialpolitik wird wie<strong>der</strong> ein verstärkter Einsatz <strong>der</strong><br />
Betroffenen, ihrer Familie und vielleicht auch eine Form von Nachbarschaftshilfe verlangt.<br />
Dadurch gewinnt <strong>der</strong> Beruf <strong>der</strong> Gemeindeschwester eine beson<strong>der</strong>e Aktualität. Aber wer ist in<br />
einer Zeit, in <strong>der</strong> alles machbar scheint und in <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Ideale gelten, <strong>als</strong> <strong>der</strong> Einsatz für den<br />
Nächsten, noch bereit diesen Beruf auszuüben? Welche Anfor<strong>der</strong>ungen stellt dieser Beruf, wo<br />
sind und wo müssen Grenzen von Einsatzbereitschaft sein? Wie sieht <strong>der</strong> Alltag heute aus?<br />
Fragen, denen am Beispiel einer Gemeindeschwester nachgegangen wird.<br />
Südwestfunk<br />
15.11.1984<br />
Jürgen Roth<br />
Asylanten - Bericht aus einem Sammellager<br />
2. Preis<br />
Der Bericht schil<strong>der</strong>t das Leben von Asylanten in einer Gemeinschaftsunterkunft in Eschborn in<br />
Hessen. Dieses Lager ist, im Gegensatz zu vielen an<strong>der</strong>en, ein sehr mo<strong>der</strong>nes und daher<br />
durchaus nicht typisch. Trotzdem werden auch hier die vielen Probleme sichtbar, vor denen die<br />
Asylanten, aber auch diejenigen, die für sie verantwortlich sind, stehen. Auf engem Raum sind<br />
Menschen unterschiedlichster Religion, Mentalität und sozialer Herkunft zusammengedrängt.<br />
Gemeinsam haben sie eigentlich nur die Hoffnung, in Deutschland bleiben zu können. Diese<br />
Hoffnung wird aber in zunehmendem Maße enttäuscht. Immer weniger Menschen erhalten Asyl,<br />
seit die Bestimmungen erheblich verschärft wurden.<br />
Der Film zeigt auch die Konflikte <strong>der</strong> Leute, die mit dem Asylverfahren zu tun haben:<br />
Rechtsanwälte, Richter, Gutachter und Verwaltungsbeamte. Sie müssen über das Schicksal von<br />
Tausenden entscheiden, eine Aufgabe, die sicher manchen überfor<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> in moralische<br />
Konflikte stürzt.<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
07.05.1984<br />
1986 Dieter Sauter<br />
Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> Krise - Die Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> Arbeitslosen<br />
1. Preis<br />
Die Dokumentation geht <strong>der</strong> Frage nach, wie sich Arbeitslosigkeit <strong>der</strong> Eltern auf die Kin<strong>der</strong><br />
auswirkt. Für weit über eine Million Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Bundesrepublik gilt, dass entwe<strong>der</strong> die Mutter<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Vater arbeitslos ist. „Man gehört im Klassenverband nicht mehr dazu, nicht nur, weil<br />
man finanziell mit den an<strong>der</strong>en nicht mehr mithalten kann. Man ist ‘abgestempelt’“. So die<br />
Aussage einer betroffenen Schülerin. Die Sozialwissenschaftler sprechen von Stigmatisierung.<br />
Experten <strong>der</strong> Wohlfahrtsverbände beobachten immer häufiger eine Reihe körperlicher Reaktionen<br />
bei den betroffenen Kin<strong>der</strong>n, z. B. nervöse Schlafstörungen, Bronchitis, Stottern,<br />
Konzentrationsschwäche, Leistungsabfall in <strong>der</strong> Schule.<br />
Viele Jugendliche wollen angesichts <strong>der</strong> angespannten finanziellen Lage keine Ausbildung<br />
machen, son<strong>der</strong>n erst einmal Geld verdienen, auch um den Eltern zu helfen.<br />
Es gibt hier Hilfsangebote <strong>der</strong> Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden und Gewerkschaften. Aber<br />
sie lösen das Problem nicht.
Bayerischer Rundfunk<br />
13.1.1985<br />
Karin Storch<br />
Kindesmißhandlung<br />
1. Preis<br />
Jährlich werden in <strong>der</strong> Bundesrepublik fast 30.000 Kindesmisshandlungen polizeilich bekannt.<br />
Die Dunkelziffer ist hoch. Mit Mitleid, Wut, Haß, Trauer und Angst wird häufig auf brutale Gewalt<br />
gegen Kin<strong>der</strong> reagiert. Die misshandelnden Eltern werden ein Fall für den Staatsanwalt. Die<br />
betroffenen Kin<strong>der</strong> landen im Heim, und die Erfahrung zeigt, dass sie später häufig selber nicht<br />
mit ihren Erziehungsaufgaben fertig werden.<br />
Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Reportage steht die Alltagsarbeit des Kin<strong>der</strong>schutzbundes Kassel und des<br />
Berliner Kin<strong>der</strong>schutz-Zentrums. Das Prinzip <strong>der</strong> Kasseler Familien-Beratungsstelle heißt „Helfen<br />
durch materielle Absicherung, konkrete Entlastung und längerfristige Arbeit mit <strong>der</strong> Familie“.<br />
Dabei geht es zum Beispiel um Wohngeld, die Suche nach einem Kin<strong>der</strong>gartenplatz und das<br />
gemeinsame Herausfinden, wie sich Konflikte ohne Gewalt lösen lassen. Bei den Berlinern reicht<br />
die Hilfe von <strong>der</strong> Versorgung und Entlastung in Krisensituationen bis hin zu Beratung und<br />
Therapie.<br />
Beiden Einrichtungen gemeinsam ist die Initiative, Eltern und Kin<strong>der</strong> in Krisensituationen<br />
vorübergehend zu trennen, Kin<strong>der</strong>n Sicherheit zu bieten. In <strong>der</strong> Mehrzahl <strong>der</strong> Fälle können die<br />
Familien später wie<strong>der</strong> zusammengebracht werden.<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
13.05.1985<br />
1987 Bernd Wiegmann<br />
Treffen kann es jeden...<br />
Ein Bericht über häusliche Pflege<br />
1. Preis<br />
Maria S., 89 Jahre alt, bettlägerig, zeitlich und örtlich nicht mehr orientiert, wird von ihrer Tochter<br />
gepflegt. Rund um die Uhr - jahrein, jahraus. Karl L., 76 Jahre alt, gelähmt, Rollstuhlfahrer, wird<br />
seit vielen Jahren von seiner Lebensgefährtin betreut. Zwei von rund 1,8 Millionen Menschen, die<br />
<strong>der</strong> häuslichen Pflege bedürfen. Diese Pflege <strong>der</strong> Familie geht für viele Angehörige, meist Frauen,<br />
physisch und psychisch an die Grenze <strong>der</strong> Belastbarkeit. Und auch die finanziellen Probleme<br />
sind groß: Für das Risiko <strong>der</strong> Pflege gibt es bislang keine Solidarversicherung wie beispielsweise<br />
im Krankheitsfall. Jetzt ist, nach jahrelangen Diskussionen zwischen Verbänden und Politikern,<br />
eine Minimallösung in Sicht: <strong>der</strong> Einstieg in eine Pflegegeldversicherung.<br />
Ein Modellprojekt ist Ausgangspunkt <strong>der</strong> Dokumentation. 16 Pflegebedürftige werden vier<br />
Wochen lang in einer Wiesbadener Kirche versorgt, um den sonst pflegenden<br />
Familienangehörigen Zeit zum Urlaub, Zeit zum Durchatmen zu geben. Schwerpunkt <strong>der</strong><br />
Sendung sind anhand exemplarisch ausgewählter Fälle die häusliche Pflege, die Probleme und<br />
Belastungen <strong>der</strong> Pflegebedürftigen und <strong>der</strong> Pflegepersonen. Und: die möglichen Erleichterungen,<br />
die <strong>der</strong> neue Gesetzentwurf den Betroffenen bringen könnte.<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
03.09.1986<br />
Silvia Storz<br />
Zivildienstleisten<strong>der</strong><br />
2. Preis<br />
„Zivis sind Drückeberger, sie gehen den bequemen Weg <strong>der</strong> Wehrdienstverweigerung, entziehen<br />
sich ihrer vaterländischen Pflicht, lassen die an<strong>der</strong>en durch den Schlamm robben und machen<br />
sich einen Lenz“, so lauteten - etwas zugespitzt - auch noch in den achtziger Jahren die<br />
Stammtischparolen, wenn es um die jungen Männer ging, die in steigen<strong>der</strong> Zahl den zivilen<br />
Ersatzdienst dem Dienst an <strong>der</strong> Waffe vorzogen.
Der Beitrag versucht, diesem Vorurteil durch eine Reportage des „Zivi -Alltags“ auf <strong>der</strong><br />
Pflegestation eines Stuttgarter Altenheimes zu begegnen. Der Film verlässt sich auf die<br />
Beobachtungen <strong>der</strong> Kamera, die diskret den täglichen Pflegeaufwand an Schwerkranken, an<br />
Verwirrten und Sterbenden dokumentiert. Der „Zivi“ reflektiert in On- und Off-Tönen seine Arbeit,<br />
seine Anfangsschwierigkeiten, seine Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Krankheit und Tod, berichtet über<br />
den seelischen Kraftaufwand, den seine tägliche Arbeit erfor<strong>der</strong>t. Aus dem Zusammenspiel von<br />
Aussagen und Beobachtungen wird deutlich, wie unentbehrlich für das gesamte soziale Netz die<br />
Arbeit <strong>der</strong> „Zivis“ ist. Sie sind in einem durchorganisierten Pflegebetrieb diejenigen, die - weil sie<br />
es nur auf Zeit tun - die menschliche und pflegerische Zuwendung oft engagiert verbinden - auch<br />
und gerade da, wo Angehörige und Professionelle nicht mehr können o<strong>der</strong> wollen.<br />
Süddeutscher Rundfunk<br />
18.04.1986<br />
1988 Medienwerkstatt Franken<br />
Verfolgt und vergessen<br />
Die Vernichtung <strong>der</strong> Zigeuner in Auschwitz und ihre Verfolgung bis heute<br />
Oktober 1985. Mit einer Gruppe deutscher Sinti und Roma fährt das Filmteam nach Polen, um<br />
das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz zu besuchen. Mit dabei ehemalige Häftlinge. Für<br />
sie nach 40 Jahren ein Wie<strong>der</strong>sehen mit einem Ort, den sie nie lebend zu verlassen glaubten.<br />
Über 500.000 Zigeuner wurden während des Faschismus ermordet und damit ein ganzes Volk<br />
fast vollkommen ausgerottet: Nur wenige haben überlebt. Sie erinnern sich.<br />
Kein Film über nur Vergangenes. Die Angst <strong>der</strong> Sinti hat sich bis heute erhalten. In ihren<br />
Erzählungen über dam<strong>als</strong> vermischt sich ihre Erfahrung <strong>der</strong> Verfolgung bis heute. Trotz <strong>der</strong><br />
eindeutig rassischen Verfolgung wurde vielen Sinti nach dem Krieg eine Wie<strong>der</strong>gutmachung mit<br />
<strong>der</strong> Begründung verwehrt, sie seien <strong>als</strong> Asoziale und Kriminelle zu Recht in die<br />
Konzentrationslager eingewiesen worden.<br />
Auch ein Film über verschiedene Arten zu trauern. Die Melancholie <strong>der</strong> Filmemacher und <strong>der</strong><br />
Überlebenswille <strong>der</strong> Sinti, für die Lachen und Weinen auch an einem Ort wie Auschwitz<br />
zusammengehören.<br />
Radio Bremen<br />
17.02.1987<br />
1989 Gardi Deppe<br />
Schnüffeln macht kaputt<br />
1. Preis<br />
S. ist 26 Jahre alt und lebt in Berlin. Mit zehn Jahren begann er zu schnüffeln, <strong>als</strong>o chemische<br />
Lösungsmittel zu inhalieren. Wie bei fast allen Drogensüchtigen, begann es mit purer Neugierde.<br />
Und wie bei vielen, war auch bei S. die familiäre Situation so miserabel, dass niemand ihn<br />
zurückhielt. Die gesundheitlichen Folgen waren katastrophal, S. leidet unter Lähmungen.<br />
In Berlin sollen es ungefähr 2.000 Menschen sein, vor allem Kin<strong>der</strong> und Jugendliche, aber auch<br />
ältere Menschen, die sich regelmäßig an <strong>der</strong> Billigdroge aus dem Kaufhaus berauschen. In <strong>der</strong><br />
ganzen Bundesrepublik rechnet man mit einigen zehntausend. Das Problem bei dieser<br />
speziellen Art <strong>der</strong> Sucht ist, dass die verwendeten Stoffe problemlos erhältlich sind. Deswegen<br />
kann das Schnüffeln nicht mit Maßnahmen gegen Produzenten, Schmuggler und Dealer<br />
bekämpft werden, son<strong>der</strong>n nur durch Aufklärung.<br />
Der Film zeigt die verheerenden gesundheitlichen und sozialen Folgeschäden des Konsums<br />
dieser leicht zugänglichen Billigdroge und macht auf einen Mangel an präventiven, begleitenden<br />
und nachsorgenden therapeutischen Maßnahmen aufmerksam.<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
02.05.1988<br />
Jo Frühwirth / Kristina Roth<br />
Helfer ohne Hilfe
Aus dem Alltag des Pflegeperson<strong>als</strong> im Krankenhaus<br />
1. Preis<br />
Vor einigen Jahren noch gab es für die Ausbildung zur Krankenschwester meist doppelt so viele<br />
Bewerber wie Plätze. Heute bereits können manche Ausbildungsplätze nicht mehr besetzt<br />
werden. Für die ausgehenden 90er Jahre befürchten Fachleute nur noch 60 bis 70 Prozent<br />
Auslastung bei den Krankenpflegeschulen, wenn die Entwicklung so weiter geht. Und bereits<br />
jetzt wird an einigen Universitätskliniken des Landes vom Pflegenotstand gesprochen.<br />
Das Image des Krankenpflegeberufes hat sich kräftig gewandelt. Ursachen sind zum Beispiel die<br />
körperlichen Anstrengungen durch Überstunden, die psychischen Belastungen des Berufes und<br />
alles bei geringer Bezahlung.<br />
An Beispielen aus dem Alltag von Schwestern, Pflegern und Ärzten informieren die Autoren über<br />
die Situation in <strong>der</strong> Krankenpflege, konfrontieren mit den Auswirkungen des Pflegenotstandes,<br />
mit dem psychischen und physischen Druck, dem die Pflegekräfte täglich ausgesetzt sind, und<br />
zeigen, dass Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen in keinem angemessenen Verhältnis<br />
zu den Belastungen des Pflegeperson<strong>als</strong> stehen.<br />
Süddeutscher Rundfunk<br />
07.12.1988<br />
1990 Eike Besuden<br />
...dann bin ich weg - na und?<br />
Das kurze, trostlose Leben <strong>der</strong> Manuela H.<br />
Die 30. Leiche: Randnotiz in <strong>der</strong> Chronik <strong>der</strong> Bremer Drogenszene. Manuela H., 24 Jahre alt,<br />
ledig, ein Kind, wird beerdigt. Für die Junkies kein Grund zur Trauer: Die Beschaffung des<br />
nächsten Schusses ist wichtiger. Für die „heile Welt“ drum herum eher ein Grund zum wohligen<br />
Gruseln: Die Horrorszene im Bremer Ostertor ist um eine kaputte Figur ärmer, die nächste<br />
Leiche wird ein paar Tage später gefunden werden.<br />
In einer filmischen Rekonstruktion wird das Leben von Manuela H. erzählt, ein Leben nicht nur<br />
typisch für diese Stadt. Der Film ist keine analytische Abhandlung des Drogenproblems, es ist<br />
eine „Nahaufnahme“, im Wortsinn „Szenenbeschreibung“, mit Überlebenden und<br />
„Überlebenshelfern“: Familie, Junkies, Betreuern, Knastkolleginnen, Anwälten, Ärzten und<br />
Polizei. Alle jene, mit denen Manuela in ihrem kurzen und trostlosen Leben zusammentraf. Ein<br />
Portrait vor dem Hintergrund einer Drogenszene, die - wie kaum an<strong>der</strong>swo - überschaubar, offen<br />
und kontrollierbar scheint; ein unsentimentaler Nachruf auf eine Frau, die an den<br />
Gesetzmäßigkeiten dieser Szene zerbrechen musste.<br />
Radio Bremen<br />
27.07.1989<br />
1991 Susanne Bausch<br />
Je<strong>der</strong> Tag ist ein Geschenk<br />
Ein ehemaliger Patient <strong>als</strong> Helfer auf <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>krebsstation<br />
1. Preis<br />
Hauptfigur des reinen O-Ton-Films ohne Kommentar ist <strong>der</strong> 20jährige Joachim, <strong>der</strong> ein freiwilliges<br />
soziales Jahr auf <strong>der</strong> Krebsstation einer Kin<strong>der</strong>klinik macht, auf <strong>der</strong> er einst selbst Patient war.<br />
Der Dokumentarfilm beobachtet seinen Arbeitsalltag und damit auch den Stationsalltag: die<br />
Kin<strong>der</strong> und Jugendlichen, mit denen er helfend umgeht; Eltern, die ihr Kind auf <strong>der</strong> Station<br />
betreuen; Schwestern, Ärzte.<br />
Der Film vermittelt etwas vom Umgang mit Krankheit, von einer völlig verän<strong>der</strong>ten<br />
Lebenssituation, von Ängsten, Sorgen, Hoffnungen, von Wut und Kampf und Lebenskraft und<br />
auch von Freude und Dankbarkeit für jeden Tag, an dem es gut geht.<br />
Für Joachim hat die freiwillige Arbeit auf <strong>der</strong> Station einen beson<strong>der</strong>en Stellenwert: Die<br />
Erfahrungen seines eigenen Aufenthalts befähigen ihn zu einer beson<strong>der</strong>s einfühlsamen<br />
Betreuung <strong>der</strong> jungen Patienten dort, und sein täglicher Umgang mit ihnen hilft ihm selbst bei <strong>der</strong><br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung mit seinen Erinnerungen und seiner eigenen Krankheit.
Süddeutscher Rundfunk<br />
09.11.1990<br />
Gerlinde Böhm<br />
Mehr Zeit für den Patienten<br />
2. Preis<br />
Schwester Anne pflegt Patienten im Berliner St. Joseph-Krankenhaus. Dort hat man versucht,<br />
den „Pflegenotstand“ wenn nicht zu beseitigen, so doch zu lin<strong>der</strong>n. Eine Gruppe von sechs<br />
Schwestern pflegt 21 Patienten: Gruppenpflege statt Funktionspflege, die mehr <strong>der</strong><br />
Fließbandarbeit gleicht. Die Schwestern haben nur noch einen Wechsel zwischen Früh- und<br />
Spätschicht, <strong>als</strong>o nicht mehr zwischen Tag- und Nachtarbeit. Sie haben mehr Zeit für ihre<br />
Patienten, weil sie von Abhol- und Bringdiensten entlastet werden.<br />
Dazu hat das Krankenhaus großzügige Regelungen <strong>der</strong> Teilzeitarbeit und des<br />
Mutterschaftsurlaubs eingeführt, so dass die Fluktuation des Pflegeperson<strong>als</strong> niedrig ist. Und<br />
das Krankenhaus hat noch Ordensschwestern, meist ältere, die vor allem die Begleitung<br />
Sterben<strong>der</strong> übernommen haben. Aber die Probleme des Berufsstandes sind damit noch bei<br />
weitem nicht gelöst.<br />
Der Film macht anhand dieses Beispiels deutlich, was zur Behebung des sogenannten<br />
„Pflegenotstands“ getan werden kann. Sein Fazit: Humanität ist eine gesellschaftliche Aufgabe,<br />
die ihren Preis hat. Nur wenn die Gesellschaft bereit ist, den Beruf <strong>der</strong> Pflegenden mit Geld<br />
ebenso wie mit Ansehen zu entlohnen, kann dieser wie<strong>der</strong> zu einem attraktiven Beruf werden.<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
18.07.1990<br />
Raimund Koplin<br />
Nachruf auf Sonja S.<br />
2. Preis<br />
Im Oktober 1989 meldeten Zeitungen, dass eine junge Frau an einem Waldrand nahe <strong>der</strong><br />
Autobahn Frankfurt/Darmstadt erwürgt aufgefunden wurde. Der Leichnam schien achtlos<br />
weggeworfen. Der Name <strong>der</strong> Toten: Sonja S. Alter: 25. Beruf: Prostituierte.<br />
Was ging dem Mord an Sonja S. voraus? Wer hat wann und wie die Anfänge für jenen<br />
Lebensweg gesetzt, <strong>der</strong> scheinbar so folgerichtig seinen Verlauf nahm? Hätten Angehörige,<br />
Bekannte, Behörden sie noch retten können o<strong>der</strong> war Sonja S. tatsächlich „verloren“? Der Film<br />
ist we<strong>der</strong> eine Sensationsreportage noch ein Enthüllungsbericht. Er ist vielmehr das Portrait<br />
eines Menschen, <strong>der</strong> bis zu seinem Tod ein Gefühl nie erleben durfte: von einem an<strong>der</strong>en<br />
Menschen geliebt zu werden. Nacherzählt wird die Geschichte <strong>der</strong> Sonja S. von Zeitzeugen, die<br />
ihren Weg gekreuzt haben. Und von Sonja S. selbst, die ihre Erlebnisse, ihre Verzweiflung in<br />
Briefen festgehalten hat. Die Dramaturgie ergibt sich dabei nicht aus Handlungen, son<strong>der</strong>n aus<br />
Gesprächen.<br />
„Warum bin ich eigentlich auf die Welt gekommen“, hat Sonja S. kurz vor ihrem Tod in ihr<br />
Tagebuch geschrieben. Keiner hat das je sagen können. Sonja S. ist irgendwo auf einem<br />
Friedhof begraben worden. In aller Stille. Auf ihrem Grabstein steht nicht einmal <strong>der</strong> Name.<br />
Bayerischer Rundfunk<br />
26.06.1991<br />
1992 Ulli Rothaus / Peter Schmidt<br />
Wir zählen täglich unsere Stunden<br />
Über AIDS in Berlin<br />
15.000 bis 20.000 HIV-Positive leben in Berlin, mehr <strong>als</strong> 1.000 Erkrankte mit „Vollbild-AIDS“.<br />
Etwa 1.000 Menschen sind in Berlin bereits an <strong>der</strong> Immunschwäche gestorben, knapp 100 davon<br />
waren Kin<strong>der</strong>. Tödliche Normalität.<br />
Steigende Zahlen - aber gesunkenes Interesse, zehn Jahre nach <strong>der</strong> ersten Pressemeldung zum<br />
Thema AIDS. Vorbei ist auch die Zeit <strong>der</strong> großen Beunruhigung. AIDS ist zum marginalen
Min<strong>der</strong>heitenproblem von Schwulen, Fixern, und einigen Prominenten geworden. Und die Politik?<br />
Die 1987 beschlossenen AIDS-Sofortprogramme des Bundes laufen in diesem Jahr aus. Ihre<br />
Zukunft ist ungewiss. Die Selbsthilfegruppen sollen in den nächsten Jahren „abgewickelt“<br />
werden. Zeit für eine Bestandsaufnahme.<br />
Die Reportage gibt einen Einblick in die Wirklichkeit <strong>der</strong> HIV-Infizierten und AIDS-Kranken in<br />
beiden Teilen <strong>der</strong> Stadt. Seit dem Fall <strong>der</strong> Mauer steigt im Ostteil Berlins die Zahl <strong>der</strong> Infizierten<br />
rapide. Eine vor zwei Jahren kaum bekannte Krankheit trifft auf ein Gesundheitssystem im<br />
Umbruch. Es geht um Prävention und Betreuung, um ambulante und stationäre Pflege, um<br />
Sterbehilfe und um Trauerarbeit. Die aktuelle Situation <strong>der</strong> Selbsthilfegruppen in beiden Teilen <strong>der</strong><br />
Stadt steht im Mittelpunkt <strong>der</strong> Reportage.<br />
Zweites Deutsches Fernsehen<br />
03.09.1991<br />
1993 Gretl Brand / Ellen Rudnitzky<br />
Florian. Ein geistig behin<strong>der</strong>tes Kind in <strong>der</strong> Regelschule<br />
Bilanz nach acht Jahren<br />
Der fünfzehnjährige Florian besucht die 9. Klasse einer Gesamtschule in Köln. Er ist mongoloid,<br />
aber das ist bei seinen Klassenkameraden und innerhalb <strong>der</strong> ganzen Schule kaum noch ein<br />
Thema. In <strong>der</strong> Gesamtschule werden in einem Modellversuch inzwischen mehrere körperlich und<br />
geistig behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong> zusammen mit nichtbehin<strong>der</strong>ten Kin<strong>der</strong>n unterrichtet.<br />
Die Aufnahme geistig behin<strong>der</strong>ter Kin<strong>der</strong> in Regelschulklassen ist jedoch nach wie vor<br />
umstritten. Einer <strong>der</strong> wenigen Versuche in dieser Richtung wird in dieser Langzeitbeobachtung<br />
dokumentiert; seit seinem 1. Schuljahr wurde Florian begleitet.<br />
In diesem Jahr steht für die Schüler <strong>der</strong> 9. Klasse ein vierwöchiges Berufspraktikum an. Für<br />
Florian ist dies ein beson<strong>der</strong>s wichtiger Abschnitt, denn so gut die Integration in <strong>der</strong> Schule<br />
gelungen ist, wie er den Schritt in die Arbeitswelt tun wird, ist noch ungewiß. Seine Eltern<br />
kämpfen in Arbeitskreisen und Einzelaktionen dafür, dass die Integration nicht am Schultor<br />
aufhört, son<strong>der</strong>n <strong>als</strong> lebenslanges Konzept für Behin<strong>der</strong>te akzeptiert wird.<br />
Westdeutscher Rundfunk<br />
21.12.1992<br />
1994 Hannelore Gadatsch<br />
Was Menschen Menschen antun - Über die Behandlung von Folteropfern in Berlin und<br />
Kopenhagen<br />
1. Preis<br />
Folter - die Geißel des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts, wird in jedem zweiten Land <strong>der</strong> Erde mit entsetzlichem<br />
Ideenreichtum betrieben.<br />
Die Folgen: Während die Folterer straffrei ausgehen, leiden die Opfer ein Leben lang. Hoffnung<br />
bringen spezielle Rehabilitationszentren.<br />
Der Film berichtet von <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> dänischen Ärztin Dr. Inge Genefke in ihrer Kopenhagener<br />
Klinik RCT - für ihr Engagement mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet - und <strong>der</strong> Arbeit<br />
des Berliner Behandlungszentrums für Folteropfer.<br />
Südwestfunk<br />
22.06.1993<br />
Peter Wingert<br />
Leben bis zuletzt<br />
Eindrücke von <strong>der</strong> Hospizbewegung in Halle<br />
2. Preis<br />
Seit <strong>der</strong> Wende verbietet kein Parteisekretär <strong>der</strong> Hospizgruppe den Zugang zu Sterbenskranken.<br />
Statt dessen haben die Hospizhelfer an<strong>der</strong>e Sorgen: Wegen <strong>der</strong> Angst um den eigenen<br />
Arbeitsplatz möchte sich jetzt niemand mehr um die Betreuung sterben<strong>der</strong> Angehöriger
kümmern. Weil die alten Notgemeinschaften <strong>der</strong> ehemaligen DDR zerbrechen, kommt <strong>der</strong><br />
Hospizgruppe in Halle zunehmende Bedeutung zu.<br />
Der Film begleitet <strong>der</strong>en Helfer bei ihren Begegnungen mit Patienten. Er dokumentiert, wie<br />
Offenheit und Ehrlichkeit beim Patienten Vertrauen wecken, weil <strong>der</strong> Sterbebegleiter keine Rolle<br />
spielt. So wird <strong>der</strong> Weg frei für einen Dialog über die Hoffnung - trotz des nahen Todes.<br />
Sen<strong>der</strong> Freies Berlin<br />
09.04.1993<br />
1995 - nicht vergeben -<br />
1996 Klaus Antes<br />
Notaufnahme<br />
1. Preis<br />
Die kleine „Gastkirche“ im Zentrum von Recklinghausen hat eine jahrhun<strong>der</strong>tealte Tradition im<br />
Dienen und Helfen. Schon immer kümmerte man sich um die mühselig Beladenen, die<br />
Behin<strong>der</strong>ten, Benachteiligten, um Ausgegrenzte o<strong>der</strong> seelisch Eingebrochene. Seit geraumer<br />
Zeit ist die existentielle Not in unserer Gesellschaft größer geworden, hat immer mehr Menschen<br />
verarmen lassen. Die Brü<strong>der</strong> und Schwestern <strong>der</strong> Kommunität beschlossen deshalb, den<br />
Arbeits- und Obdachlosen, Junkies und psychisch Kranken täglich ein Frühstück und ein<br />
warmes Essen anzubieten. Kostenlos. Außerdem einen Ort, an dem sie sich waschen, für ein<br />
paar Mark ‘ne Hose o<strong>der</strong> Jacke kaufen und miteinan<strong>der</strong> reden können: über die Welt und Gott.<br />
Diese Art von Christentum, Engagement o<strong>der</strong> Erbarmen, unabhängig von <strong>der</strong> Konfession, wird<br />
zum Teil aus Spenden finanziert.<br />
Westdeutscher Rundfunk<br />
27.06.1995<br />
Michael Möller<br />
Fluchtburg: Feuerbergstraße<br />
Zwischenlager für verstoßene Kin<strong>der</strong><br />
1. Preis<br />
In <strong>der</strong> Hamburger Feuerbergstraße ist <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- und Jugendnotdienst untergebracht. Dieser<br />
Dienst ist überlastet. Er steht vor dem Kollaps. Im letzten Jahr erreichten die Sozialarbeiter in<br />
<strong>der</strong> Feuerbergstraße über 10.000 Notrufe, Tendenz: steigend. Vor fünf Jahren waren es noch<br />
2.000 weniger. Der Film dokumentiert die Arbeit des Kin<strong>der</strong>- und Jugendnotdienstes, das Leben<br />
in <strong>der</strong> Feuerbergstraße und die Biographien <strong>der</strong> „angelieferten“ Kin<strong>der</strong>. Fast alle haben brutale<br />
Lebensgeschichten hinter sich. Viele sind misshandelt, vernachlässigt o<strong>der</strong> sogar vergewaltigt<br />
worden. Viele flüchteten auf dem Höhepunkt extremer familiärer Krisen hierher in die<br />
Feuerbergstraße. Der Aufenthalt sollte nicht länger <strong>als</strong> ein paar Tage dauern. Doch oft vergehen<br />
Wochen und sogar Monate, bis sie weitergereicht werden können an Heime o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Pflegestellen.<br />
Südwestfunk<br />
11.01.1995
Print<br />
1973 Hans-Joachim Noack<br />
Wie man überleben lernt<br />
Ein Friedensdorf e.V.<br />
Vietnamesische Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Bundesrepublik, Napalmkin<strong>der</strong>, Querschnittgelähmte, Poliokranke:<br />
zusammengezogen in einer Siedlung an <strong>der</strong> Peripherie des Pütt. Die Schlote und För<strong>der</strong>türme<br />
<strong>der</strong> nahen Stadt Oberhausen stehen wie Schemen am Horizont. Das Dorf, die Ansammlung<br />
mehrerer neuer, sehr nüchtern dem Zweck entsprechen<strong>der</strong> Häuser, heißt Friedensdorf. Ein<br />
schönes Wort für die unauffällige Enklave einer bedrückenden Welt.<br />
Zwischenbilanz eines Friedenswerkes. Unter dem Strich stehen offene Fragen. Die Erfahrungen<br />
haben gezeigt, dass <strong>der</strong> hohe Stand medizinischer Kunst hierzulande allein nichts bewirkt. Das<br />
Schlüsselwort heißt gesellschaftliche Einglie<strong>der</strong>ung. Den Gebrandmarkten eine Bildung zu<br />
vermitteln, die sie im Zuge des Aufbaus ihres geschundenen Heimatlandes <strong>als</strong> unverzichtbare<br />
Kräfte ausweist, könnte manches kompensieren, was den Opfern heute noch undenkbar<br />
erscheint.<br />
Frankfurter Rundschau<br />
23.12.1972<br />
1974 Petra Michaely<br />
Warum sammelt Frau Schumann Tabletten?<br />
Von <strong>der</strong> Unsicherheit <strong>der</strong> Obdachlosen<br />
1. Preis<br />
Portrait einer Familie in einer Obdachlosensiedlung draußen vor <strong>der</strong> Stadt. Dreizehn Jahre<br />
Obdachlosigkeit haben entmutigt, in die Isolation getrieben. Vor allem die Mütter und ihre Kin<strong>der</strong><br />
leiden an den Lebensbedingungen.<br />
Wohnverhältnisse, die krank machen, die die Kin<strong>der</strong> aggressiv und die Son<strong>der</strong>schule zum<br />
normalen Schicksal werden lassen: Die Kin<strong>der</strong> sind frech, die Möbel an <strong>der</strong> Rückfront<br />
schimmelig, die Matratzen faul, die Wäsche hat Stockflecken. Wo immer man die Familie<br />
einweist - schon beim Einzug ist sie gezeichnet. Und <strong>der</strong> spärliche Rückhalt bei<br />
Schicks<strong>als</strong>genossen reißt ab. In dieser Stimmung sammelt Frau Schumann Tabletten.<br />
Frankfurter Allgemeine Zeitung<br />
22.09.1973<br />
Josef Dörr<br />
Zum Beispiel...<br />
Serie zur beruflichen Situation behin<strong>der</strong>ter Menschen<br />
2. Preis<br />
Es ist kein Honiglecken, <strong>als</strong> behin<strong>der</strong>ter Mensch in dieser Zeit zu leben, in dieser Gesellschaft,<br />
die ganz auf Leistung ausgerichtet ist. Es hat sich viel geän<strong>der</strong>t im Bewusstsein <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit, gewiss. Verständnis ist geweckt worden bei den Mitbürgern, und beim Staat die<br />
soziale Verantwortung. Es sind Schulen für behin<strong>der</strong>te Kin<strong>der</strong> eingerichtet worden und<br />
Ausbildungsstätten für Erwachsene. Neue Möglichkeiten <strong>der</strong> Rehabilitation wurden entwickelt,<br />
neue Heime konzipiert. Aber wenn es um die völlige Integration behin<strong>der</strong>ter Menschen geht, um<br />
die Integration in das Arbeitsleben, die ihnen die Selbständigkeit geben könnte, die für uns<br />
Nichtbehin<strong>der</strong>te selbstverständlich ist, baut sich Hin<strong>der</strong>nis um Hin<strong>der</strong>nis vor ihnen auf: Barrieren<br />
aus Vorurteilen. Es gehört eine fast unmenschliche Energie dazu, sie zu überwinden. Eine Serie<br />
über Menschen, die es dennoch geschafft haben.<br />
Rhein-Zeitung<br />
28.06.1973 ff. (Serie)
Raimund Hoghe<br />
Bethel zwischen gestern und morgen<br />
2. Preis<br />
Bethel - Ein Symbol für die Menschlichkeit unserer Gesellschaft? Teil von Bielefeld o<strong>der</strong> Getto für<br />
die Kranken, Behin<strong>der</strong>ten, Benachteiligten? Endstation für die, die an<strong>der</strong>s sind? Fragen, die<br />
einen Teil <strong>der</strong> auch innerhalb Bethels immer stärker diskutierten Problematik wi<strong>der</strong>spiegeln.<br />
Doch sie sind nur ein Aspekt des sich verän<strong>der</strong>nden „Hauses Gottes“ (Bethel). Zur<br />
gegenwärtigen Neuorientierung gehören auch mo<strong>der</strong>ne Formen <strong>der</strong> Therapie, Mangel an<br />
qualifizierten Mitarbeitern, die Prägung von Bethel.<br />
Westfalen-Blatt<br />
07.02.1973 ff. (Serie)<br />
1975 Benno Kroll<br />
Mehr für an<strong>der</strong>e tun<br />
Serie über Gruppen, die benachteiligten Menschen helfen<br />
1. Preis<br />
Hier gehören die Behin<strong>der</strong>ten dazu: Ein Bericht über die „Wohngruppe Wimmelstraße“ in Kassel,<br />
in <strong>der</strong> Gesunde und Behin<strong>der</strong>te zusammenleben.<br />
Sie sind Freunde <strong>der</strong> Gefangenen: In Stuttgart kümmert sich eine Initiativgruppe um<br />
Strafgefangene. Die Mitglie<strong>der</strong> besuchen Häftlinge, beraten sie, helfen ihnen nach <strong>der</strong><br />
Entlassung, besorgen ihnen Arbeit.<br />
Im Club finden sie Verständnis: Psychisch Kranke stoßen im Alltagsleben entwe<strong>der</strong> auf Furcht<br />
o<strong>der</strong> auf Mitleid. Aber mit beiden tut man ihnen unrecht. Wie diesen Patienten geholfen werden<br />
kann, zeigt das Beispiel einer Initiativgruppe von Freiburgern Studenten und Bürgern.<br />
Sie sollen hier keine Fremden bleiben: In München betreut eine Initiativgruppe Kin<strong>der</strong> von<br />
Gastarbeitern. Die Mitglie<strong>der</strong> laden die Jungen und Mädchen zu sich ein, bringen ihnen Deutsch<br />
bei, helfen bei Schulaufgaben und organisieren Spielnachmittage für sie.<br />
Brigitte<br />
Heft 7/74 ff. (Serie)<br />
Jürgen Thebrath<br />
Allein packt es keiner<br />
Wie sich „schwere Jungs“ auf die Freiheit vorbereiten<br />
2. Preis<br />
Um Strafgefangene, die man in einer Mischung von Respekt und Geringschätzung „schwere<br />
Jungs“ zu nennen pflegt, geht es in <strong>der</strong> sozialtherapeutischen Anstalt Düren. Dort, in einem<br />
Gefängnis ganz neuer Art, versuchen Psychologen, Sozialarbeiter und Justizbeamte, mehrfach<br />
vorbestraften Gefangenen zu helfen. Nach Düren gibt es für die Entlassenen, die alle schon den<br />
bitteren Kreislauf von Haft, Straftat und erneuter Verurteilung erfahren haben, nur noch zwei<br />
Wege: <strong>der</strong> eine führt zurück in die Gesellschaft, <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e nach erneuten Straftaten zur<br />
unbefristeten Sicherungsverwahrung.<br />
Westdeutsche Allgemeine Zeitung<br />
25.05.1974<br />
1976 Josef Dörr<br />
Mein Name ist Jürgen - Ich bin Alkoholiker<br />
Ein Bericht aus <strong>der</strong> Suchtstation<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Alkoholiker in <strong>der</strong> Bundesrepublik steigt von Jahr zu Jahr, nicht zuletzt dank <strong>der</strong><br />
Werbung für den "Sorgenbrecher" Alkohol. Nach <strong>der</strong> Reichsversicherungsordnung ist<br />
Alkoholismus eine Krankheit, <strong>der</strong>en Behandlung von den Krankenkassen finanziert werden<br />
muss, eine Behandlung, die nur sehr geringe Erfolgsquoten vorzeigen kann.
Was ist Alkoholismus nun wirklich? Wie macht er sich bemerkbar, welches sind die Gründe für<br />
die rapide Zunahme und was kann dagegen getan werden? Der Autor lebte drei Tage in <strong>der</strong><br />
Suchtabteilung <strong>der</strong> Landesnervenklinik An<strong>der</strong>nach mit Alkoholikern und Tablettenabhängigen<br />
zusammen, um aus eigener Anschauung über diese Sucht zu berichten.<br />
Rhein-Zeitung<br />
06./07.12.1975<br />
1977 Esther Knorr-An<strong>der</strong>s<br />
Ihr wolltet uns los sein - nun zahlt auch<br />
„Sie meinen wohl, alte Leute haben Söhne und Töchter und Enkel. Natürlich haben sie. Trotzdem<br />
werden wir in Altenheime gesteckt. Unsere Kin<strong>der</strong> wollen uns los sein. Besuchen tun sie uns<br />
selten. Und wenn, laufen sie schnell wie<strong>der</strong> weg. Dabei sind Besuche so wichtig. Am wichtigsten<br />
für uns. Schön muss <strong>der</strong> Besuch sein. Gut angezogen. Darüber können wir stundenlang reden.<br />
Es ist auch Neid dabei. Das tut wohl. (...) Sie stecken uns Geld unter die Nachttischdecke.<br />
Unsere Kin<strong>der</strong>. Doch zum Kaffeetrinken nehmen sie uns nicht mit. Sie wollen uns los sein. Dafür<br />
zahlen sie...“<br />
Gespräche mit Altenheimbewohnerinnen. Sie sind in ihrer neuen Umgebung nicht glücklich, aber<br />
zufrieden.<br />
DIE ZEIT<br />
05.11.1976<br />
1978 Maria Urbanczyk<br />
Kin<strong>der</strong>heime - ohne sie geht es nicht<br />
1. Preis<br />
Heimkin<strong>der</strong> - bedauernswert, solange sie klein, und lebensuntüchtig, wenn sie groß sind?<br />
Kin<strong>der</strong>heime, nicht mehr <strong>als</strong> ein noch notwendiges Übel? Die nicht selten bösartige Kritik <strong>der</strong><br />
letzten Jahre sowie soziale Initiativen und Modelle haben einen umfassenden Wandel in <strong>der</strong><br />
Heimerziehung ausgelöst. Eine Serie mit Beispielen aus dem Münsterland.<br />
Westfälische Nachrichten<br />
26.02.1977 ff. (Serie)<br />
Birgit Berg<br />
Blaue Witwe<br />
2. Preis<br />
„Der große Durst, <strong>der</strong> die Satten überfällt, ist in Wahrheit <strong>der</strong> Durst nach Anerkennung,<br />
sinnvollem Tun und Zuwendung. Oft gab man ihnen schon <strong>als</strong> Kind statt dessen nur die Flasche.<br />
Menschen ertragen es nicht, zahllos zu sein und ohne Gesicht und Gewicht. In einer Zeit, die<br />
den einzelnen einebnet, greift er zum Glas - dem Vergrößerungsglas für sein Ich. Nun kann er<br />
etwas, wagt er mehr, glaubt er alles. Und wird in den Augen <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en kleiner... Blutprobe <strong>der</strong><br />
Verzweiflung: Wie viel Promille Selbstvertrauen hatte ein Mensch nötig?“<br />
Eine Kolumne über Alkoholismus in Deutschland, über die „verniedlichte“ Droge, und mögliche<br />
Wege im Kampf gegen die Sucht.<br />
Rhein-Zeitung<br />
12.05.1977<br />
Hans-Peter Schreijäg<br />
Die Isolation ist das größte Problem<br />
Als Zivildienstleisten<strong>der</strong> bei Behin<strong>der</strong>ten / Aus Befangenheit wurde Freundschaft<br />
2. Preis
„Als ich zu Beginn meines Zivildienstes den ersten Kontakt mit Behin<strong>der</strong>ten hatte, waren meine<br />
Gefühle von einer hemmenden Umgangsunsicherheit und Befangenheit bestimmt. (...) Irgendwo<br />
in meinem Unterbewusstsein schwirrten dann auch noch die gängigen Vorurteile gegenüber<br />
Behin<strong>der</strong>ten herum. Würde ich es mit stumpfsinnigen, bösartigen, min<strong>der</strong>wertigen Menschen zu<br />
tun haben, <strong>der</strong>en Anblick bei ‘Normalen’ Ekel und Abscheu erzeugt?“<br />
Schwarzwäl<strong>der</strong> Bote<br />
24.12.1977<br />
1979 Josef Dörr<br />
Die Zeitung, die man hören kann<br />
1. Preis<br />
Reportage über eine Lokalzeitung für sehbehin<strong>der</strong>te und blinde Menschen und <strong>der</strong>en „Leser“. Seit<br />
ein paar Jahren kommt die Rhein-Zeitung auf Tonbandkassette gesprochen zu ihnen ins Haus.<br />
So erfahren sie nicht nur durch Rundfunk o<strong>der</strong> Blindenzeitschriften, was draußen in aller Welt<br />
geschieht, sie hören nun auch, was es Neues in <strong>der</strong> unmittelbaren Umgebung gibt. Tausend<br />
Dinge, Meldungen, Berichte, Reportagen, nicht wichtig genug für Rundfunk o<strong>der</strong> Fernsehen, aber<br />
eben das, was zum Leben in einer Gemeinschaft gehört.<br />
Rhein-Zeitung<br />
08./09.07.1978<br />
Beatrix Geisel<br />
Das zähe Leben <strong>der</strong> tristen Notunterkünfte<br />
1. Preis<br />
Reportage über die Probleme des Mannheimer Obdachlosengebiets, das bis vor wenigen Jahren<br />
<strong>als</strong> <strong>der</strong> größte zusammenhängende „soziale Brennpunkt“ <strong>der</strong> gesamten Bundesrepublik galt.<br />
Über die aktuelle Tagesberichterstattung hinaus wird exemplarisch dargestellt, warum<br />
Obdachlose selbst kaum in <strong>der</strong> Lage sind, ihre Situation zu verän<strong>der</strong>n und, warum die<br />
verantwortlichen Kommunalpolitiker an<strong>der</strong>e „Prioritäten setzen“.<br />
Welt <strong>der</strong> Arbeit<br />
09.03.1978<br />
Erika Ruckdäschel<br />
Armut in einem reichen Land<br />
1. Preis<br />
Menschen, die am Rand des Existenzminimums leben, vor allem Frauen, die unverschuldet in<br />
Not geraten sind. Am meisten sind alte Menschen betroffen. Trotzdem hält die öffentliche<br />
Meinung strikt daran fest, dass es in <strong>der</strong> Bundesrepublik keine nennenswerte Armut gäbe. Dabei<br />
sind es 11,1 Prozent <strong>der</strong> Bevölkerung, die zum Lebensunterhalt nicht mehr haben <strong>als</strong> inzwischen<br />
ca. 350 DM monatlich.<br />
Sonntagsblatt<br />
06/1978<br />
Andreas Krzok<br />
In <strong>der</strong> Einsamkeit ein Fünkchen Glück: „Es ist jemand für mich da“<br />
1. Preis<br />
Patienten in <strong>der</strong> Landesklinik Süchteln, tadellos versorgt, um die sich immer jemand kümmert<br />
und die dennoch mutterseelen allein sind auf <strong>der</strong> Welt. Menschen, die keine Angehörigen haben<br />
o<strong>der</strong> von diesen vergessen wurden, die oft Jahre, ja gar ein Leben lang eine Klinikstation <strong>als</strong> ihr
Zuhause ansehen müssen. Gespräche mit Frauen und Männern im Sozialdienst <strong>der</strong> Klinik über<br />
Wege, den Patienten ein Stück <strong>der</strong> Einsamkeit zu nehmen.<br />
Rheinische Post<br />
23.12.1978
Christel Hofmann<br />
Wir kennen hier nur die Nummern<br />
1. Preis<br />
Wer war Anton G.? Nachruf auf einen Unbekannten, für den die Umwelt zu einer<br />
Vernichtungsmaschinerie wurde. Die wenigen, die ihn kannten, werden ihn bald vergessen<br />
haben. Er wurde im Grab Nr. 215 beigesetzt. Pfarrer und Küster <strong>der</strong> nahen Pfarrei gaben ihm das<br />
letzte Geleit. In <strong>der</strong> Verwaltung wurde bald darauf seine Akte geschlossen, sein Name aus <strong>der</strong><br />
Kartei gestrichen.<br />
DIE ZEIT<br />
06.01.1978<br />
1980 Michael Wesener<br />
Leben auf <strong>der</strong> Endstation<br />
Ohne Hoffnung, aber nicht trostlos: Der Alltag in einem Altenpflegeheim<br />
1. Preis<br />
Altenpflegeheime gerieten während <strong>der</strong> letzten Wochen wie<strong>der</strong>holt in die Schlagzeilen: Klagen<br />
über angebliche o<strong>der</strong> tatsächliche Missstände waren nach draußen gedrungen. Wie aber sieht<br />
es „drinnen“ wirklich aus? Was ist Alltag in einem Altenpflegeheim, <strong>der</strong> - nach Altenwohnheim -<br />
meist letzten Stufe auf dem Weg ins Grab? Der Autor arbeitete sechs Tage <strong>als</strong> Hilfspfleger in<br />
einem städtischen und einem privaten Altenpflegeheim. Seine Eindrücke fasst er in drei<br />
Reportagen zusammen.<br />
Kölner Stadt-Anzeiger<br />
22.12.1979 ff. (Serie)<br />
Gerhard M. Kirk<br />
Es hat keinen Sinn, daran zu denken, wie es sein könnte<br />
Eltern behin<strong>der</strong>ter Kin<strong>der</strong> und ihre Erfahrungen mit <strong>der</strong> Umwelt.<br />
2. Preis<br />
Auf Schritt und Tritt begegnen ihnen aggressive Unsicherheit o<strong>der</strong> mitleidiges Unverständnis,<br />
selten nur eine Anteilnahme <strong>der</strong> Selbstverständlichkeit. Vater und Mutter eines behin<strong>der</strong>ten<br />
Kindes zu sein, bedeutet für sie zunächst einmal, selbst behin<strong>der</strong>t zu werden - alleingelassen<br />
mit dem fortdauernden Schock, „so einem“ Kind das Leben geschenkt zu haben, einem Kind,<br />
das nicht in die normierte Ordnung unserer Gesellschaft zu passen scheint. Wie werden Eltern<br />
damit fertig? Ist die Geburt eines behin<strong>der</strong>ten Kindes etwas, womit Eltern überhaupt jem<strong>als</strong> fertig<br />
werden können?<br />
Badische Zeitung<br />
22./23.09.1979<br />
1981 Hans J. Geppert<br />
Die Wohltätigkeit aus dem Warenkorb<br />
1. Preis<br />
Kritische Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Armut und „Armenfürsorge“ in <strong>der</strong> Bundesrepublik anlässlich<br />
des 100sten Geburtstages des Deutschen Vereins für öffentliche und private Vorsorge. Trotz aller<br />
Erfolge beim Ausbau des Sozialwesens und eines weltweit zu den besten zählenden Netzes<br />
sozialer Sicherung sind die Probleme von 2,2 Millionen Sozialhilfeempfängern in <strong>der</strong><br />
Bundesrepublik nicht gelöst. Auch nicht die <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>ten, <strong>der</strong> Rentner, <strong>der</strong> ausländischen<br />
Mitbürger, <strong>der</strong> kin<strong>der</strong>reichen Familien, <strong>der</strong> psychisch Kranken.<br />
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt<br />
04.05.1980
Petra Michaely<br />
Selbstgemachtes Glück in eigenen Wänden<br />
Eine heruntergekommene Siedlung än<strong>der</strong>t ihr Gesicht<br />
1. Preis<br />
Neunkirchen, eine städtische Siedlung aus den fünfziger Jahren: vierzig Häuser mit achtzig<br />
Wohnungen für Leute, die auf dem Wohnungsmarkt keine Chance hatten: Obdachlose,<br />
Nichtsesshafte, kin<strong>der</strong>reiche Familien, Mietschuldner. Die Siedlung galt <strong>als</strong> “Fass ohne Boden“,<br />
ihre Bewohner wurden gemieden.<br />
Dann erhielten die Mieter das Angebot, ihre Wohnungen weit unter Marktpreis zu erwerben. Das<br />
Bewusstsein, Eigenes zu besitzen, hat Erstaunliches bewirkt. Die Chance, alles in die eigenen<br />
Hände zu nehmen, wird <strong>als</strong> Glück empfunden, und <strong>der</strong> Zusammenhalt, den die Bewohner <strong>als</strong><br />
Diskriminierte gegenüber „den an<strong>der</strong>en“ jahrelang übten, äußert sich jetzt in gemeinsamer Kraft<br />
zum Ausbau <strong>der</strong> Siedlung.<br />
Frankfurter Allgemeine Zeitung<br />
13.12.1980<br />
Heinz Welz<br />
Die halten dich doch für bekloppt<br />
Wenn Erwachsene lesen und schreiben lernen<br />
2. Preis<br />
In <strong>der</strong> Bundesrepublik gibt es eine Million Menschen - erwachsene Menschen, die we<strong>der</strong> lesen<br />
noch schreiben können: Sie haben es nicht gelernt, <strong>als</strong> sie jung waren. Nun können sie nicht<br />
einmal Straßenschil<strong>der</strong> lesen. Wie finden sie sich in dieser Welt zurecht? Über Analphabeten in<br />
Deutschland.<br />
Kölner Stadt-Anzeiger<br />
22.11.1980<br />
1982 Christine Jäckel<br />
Die Station am Ende des Lebens<br />
1. Preis<br />
Vierzehn Tage arbeitete die Autorin in einem städtischen Altenpflegeheim. Sie wollte den Alltag<br />
alter Menschen erleben, <strong>der</strong>en letztes Zuhause dieses Heim geworden ist. Außer <strong>der</strong><br />
Heimleitung wusste niemand, wer die junge „Praktikantin“ war. Erst am Schluss erfuhren die<br />
Pflegerinnen und Pfleger die wahre Identität ihrer Kollegin auf Zeit. Ein Tagebuch über die<br />
Erlebnisse in einem Altenpflegeheim.<br />
Hannoversche Allgemeine Zeitung<br />
06.01.1981 ff. (Serie)<br />
Lokalredaktion<br />
Gesprächsrunde mit Experten zum Thema „Behin<strong>der</strong>te“<br />
1. Preis<br />
Nicht erst seit Beginn des Jahres <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>ten hat man erkannt, dass die Bedürfnisse <strong>der</strong><br />
Behin<strong>der</strong>ten im Bewusstsein <strong>der</strong> übrigen Bevölkerung zu kurz gekommen sind. Es hat Anfänge<br />
für ein besseres Miteinan<strong>der</strong> und Füreinan<strong>der</strong> gegeben, doch mangelt es noch an allen Ecken<br />
und Kanten.<br />
Eine Gesprächsrunde mit Experten über Möglichkeiten, behin<strong>der</strong>ten Menschen das Leben zu<br />
erleichtern.<br />
Wolfenbütteler Zeitung<br />
27.03.1981 ff. (Serie)
1983 Norbert Kandel<br />
Tod im Sozi<strong>als</strong>taat<br />
Opfer eines Apparats<br />
1. Preis<br />
Er hatte sein ganzes Leben schwer gearbeitet. Plötzlich wurde er krank. So krank, dass er eine<br />
Zeitrente erhielt. Doch die Ärzte stempelten ihn ab zu einem Fall für die Psychiatrie. Als dann<br />
<strong>der</strong> Ablehnungsbescheid <strong>der</strong> Rentenversicherung eintraf, nahm sich <strong>der</strong> 53jährige Arbeiter Senon<br />
Steinke aus Hannover das Leben. Sein Tod ist ein Vorwurf an die Halbgötter in Weiß und an die<br />
verbeamteten Sachbearbeiter in <strong>der</strong> Rentenversicherung. Gewiß, <strong>der</strong> Tote war ein Einzelgänger.<br />
Gerade deshalb jedoch sollte sein Tod Arbeitnehmern Mut machen, sich gegen Bürokratie und<br />
Willkür zur Wehr zu setzen. Hintergründe eines Falles, über den bisher nur Vermutungen<br />
umliefen.<br />
Metall<br />
01.12.1982<br />
Ursula Unland<br />
Hilfe zu Hause - Chance für viele<br />
2. Preis<br />
Seit <strong>der</strong> Gründung <strong>der</strong> ersten Sozi<strong>als</strong>tation in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland vor rund zehn<br />
Jahren sind inzwischen 1.493 Einrichtungen dieser Art aufgebaut worden. Ihre Mitarbeiter<br />
begegnen in vielen Fällen Menschen in Grenzsituationen ihres Lebens, begleiten sie in schwerer<br />
Krankheit, Angst, Schmerzen, Einsamkeit, oft bis zum Tod - das alles zu Hause, in <strong>der</strong> eigenen<br />
Wohnung, im altvertrauten Bett, in <strong>der</strong> Familie. Das ist das eigentliche Ziel <strong>der</strong> Sozi<strong>als</strong>tationen:<br />
Krankenhaus- und Heimaufenthalte zu vermeiden, wenn es nur möglich ist.<br />
Eine Reportage über neue Konzepte und Herausfor<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> ambulanten Betreuung und<br />
Pflege alter, kranker und behin<strong>der</strong>ter Menschen.<br />
Westfälische Nachrichten<br />
10.06.1982 ff. (Serie)<br />
1984 Stefan Geiger<br />
Im Alter auf Sozialhilfe angewiesen<br />
Armut in <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
1. Preis<br />
Maria Maier und Anna Kow<strong>als</strong>ki sind zwei von jenen 2,1 Millionen Menschen in <strong>der</strong><br />
Bundesrepublik, die im untersten jener „sozialen Netze“ liegen, die nach Ansicht mancher<br />
Zeitgenossen zu bequemen „Hängematten“ geworden sind und deshalb keinen Anreiz mehr zu<br />
Selbsthilfe und Eigeninitiative bilden. Die Wirklichkeit sieht an<strong>der</strong>s aus: Etwa drei Viertel <strong>der</strong><br />
insgesamt gut 16 Milliarden Mark, die im vergangen Jahr für Sozialhilfe ausgegeben wurden,<br />
flossen an alte o<strong>der</strong> behin<strong>der</strong>te Menschen. Zwei Einzelfälle, die weniger Schlagzeilen machen<br />
<strong>als</strong> Berichte über den Missbrauch von Sozialleistungen.<br />
Stuttgarter Zeitung<br />
15.09.1983<br />
Evelyn Holst<br />
Arthur Gottwalds zweites Leben<br />
2. Preis<br />
Passieren kann so etwas jedem an jedem Tag: Querschnittlähmung nach einem Unfall. Wie es<br />
ein Hamburger Sportlehrer schaffte, sich nicht aufzugeben, ist eine ganz alltägliche Geschichte<br />
von <strong>der</strong> Kraft eines Menschen.
Stern<br />
19.05.1983<br />
1985 Margot Dankwerth-Kiemle<br />
Mein Freund ist Türke<br />
1. Preis<br />
Eine Serie über das Zusammenleben von Deutschen und Türken: „Ayten: Sabine ist wie eine<br />
Tochter“ / „Die Bläck Fööss kämpfen für Sakir“ / „Die erste Liebe im Kin<strong>der</strong>garten“ / „Die sollen<br />
doch endlich abhauen“ / „Vural und Alfred - am Fließband lernten sie sich kennen“ / „Wenn<br />
Isabel tanzen geht, muss Hamiyet zuhause abwaschen“ / „Eine Schulklasse lernt sich zu<br />
vertragen“ / „Berufsverbot, weil er Türke ist“ / „Zwei Ehepaare - erst seit sie Rentner sind,<br />
verstehen sie sich“ / „Für Kurden auf Kaffeefahrt“ / „Vor dem Ehemann nach Köln geflohen“<br />
Express<br />
24.09.1984 ff. (Serie)<br />
Gerda Klier<br />
(K)Ein Leben im Getto<br />
Asylbewerber - Schmarotzer o<strong>der</strong> Schutzlose?<br />
1. Preis<br />
Für den einen ist Ibrahim Özdemir ein Schmarotzer, ein Türke, <strong>der</strong> es sich auf unsere Kosten gut<br />
gehen lässt in Deutschland. Für die an<strong>der</strong>en ist er ein Märtyrer, <strong>der</strong> seines Glaubens wegen ein<br />
erbärmliches Leben in einem fremden Land auf sich nimmt. Ibrahim Özdemir ist Asylbewerber,<br />
einer jener 200.000 Flüchtlinge in Deutschland, <strong>der</strong>en Zahl auf Weltebene zwischen etwa zehn<br />
und fünfzehn Millionen geschätzt wird. Der Bericht schil<strong>der</strong>t, wie er und seine Familie hier leben.<br />
Frau im Leben<br />
02 1984<br />
1986 Werner Knobbe<br />
Armut - Sozialhilfe - Selbsthilfe<br />
1. Preis<br />
Die Ausgrenzung ins wirtschaftliche Abseits: Die Sozi<strong>als</strong>tatistiker <strong>der</strong> Bundesrepublik verbuchen<br />
Rekordmarken: bei Arbeitslosen und Sozialhilfe-Empfängern auf <strong>der</strong> einen, bei den<br />
Unternehmensgewinnen auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite. Neben <strong>der</strong> „Neuen Armut“ steht ein an<strong>der</strong>es,<br />
weniger beachtetes Phänomen: <strong>der</strong> „Neue Reichtum“.<br />
Eigentlich ist man ein Mensch dritter Klasse: Am 1. Juli des Jahres tritt nach 15 Jahren ohne<br />
Verän<strong>der</strong>ung ein neuer „Warenkorb“ in Kraft. Sozialhilfe-Empfänger dürfen dann 17 Mark pro<br />
Monat mehr für Energie und Ernährung ausgeben. Weitere zehn Mark sollen die<br />
Preissteigerungsrate ausgleichen. Doch die jetzt beschlossene Anhebung än<strong>der</strong>t an <strong>der</strong><br />
Situation <strong>der</strong> Bezieher so gut wie nichts.<br />
„Wenn alle kämen, wären die Kommunen pleite“: Nur je<strong>der</strong> zweite Bedürftige geht zum<br />
Sozialamt und diejenigen, die vom Sozialamt leben, bekommen längst nicht alles, was ihnen<br />
zusteht.<br />
Kieler Rundschau<br />
13.06.1985 ff. (Serie)
Dietmar Wittmann<br />
Wenn Freizeit krank macht<br />
Vorgezogener Ruhestand ist nicht je<strong>der</strong>manns Geschmack<br />
2. Preis<br />
Eine neue Generation von Ruheständlern, die den Sozialforschern Rätsel aufgibt: Die<br />
„freigesetzten Männer im sechsten Lebensjahrzehnt“, beneidete Nutznießer in Mode<br />
gekommener Vorruhestandsregelungen, haben sich unbemerkt zu einer Problemgeneration<br />
entwickelt, die oft nichts mit sich anzufangen weiß. Aller Voraussicht nach sammelt sich hier<br />
sozialer Zündstoff an, <strong>der</strong> vielleicht erst in einigen Jahren sichtbar werden, dann aber zu einer<br />
„Kostenlawine“ führen könnte. Was ist los mit Deutschlands „jungen Ruheständlern“?<br />
Nürnberger Zeitung<br />
22.02.1985 ff. (Serie)<br />
1987 Axel Veiel<br />
Mutterinstinkt darf sich auf ein Kätzchen richten<br />
Die Sterilisation geistig Behin<strong>der</strong>ter im rechtlichen Abseits<br />
1. Preis<br />
Die starren Grenzen, die das Recht <strong>der</strong> Sterilisation geistig Behin<strong>der</strong>ter gezogen hat, sind zwar<br />
alles an<strong>der</strong>e <strong>als</strong> eine „Gesetzeslücke“, wie von den Angehörigen und Verbänden geistig<br />
Behin<strong>der</strong>ter gern vorgebracht wird. Sie scheinen jedoch den Interessen <strong>der</strong> Beteiligten, seien es<br />
nun Eltern, Betreuer, Ärzte o<strong>der</strong> Psychologen, nicht gerecht zu werden. Tatsache ist jedenfalls,<br />
dass Rechtsanspruch und Rechtswirksamkeit meilenweit auseinan<strong>der</strong> klaffen.<br />
Wie sind das Selbstbestimmungsrecht des Behin<strong>der</strong>ten, die Interessen <strong>der</strong> Angehörigen und des<br />
ungeborenen Lebens unter einen Hut zu bringen? Einig ist man sich darüber, dass ein geistig<br />
Behin<strong>der</strong>ter, <strong>der</strong> Tragweite und Bedeutung einer Sterilisation zu erfassen vermag, allein die<br />
Entscheidung über den irreversiblen Eingriff in seinen Körper zu treffen hat.<br />
Stuttgarter Zeitung<br />
22.12.1986<br />
Gabriele Grobelny-Stoffers<br />
Und dann haben wir den Tod ausgelacht...<br />
2. Preis<br />
Viele alte Menschen kennen sie, diese elende Einsamkeit. Keinen mehr haben für die<br />
Bepflanzung auf dem Grab. Die Familie, die Freunde, alle schon lange auf dem Friedhof.<br />
Manchmal ist es schwer, den Mut zu behalten, wenn das Lebensende langsam, aber sicher<br />
naht. Oft sind es die Kleinigkeiten, die Auftrieb geben. Persönliche Erfahrungen mit zwei<br />
hochbetagten Nachbarinnen.<br />
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt<br />
23.11.1986<br />
Sibylle Krause -Burger<br />
Wie aus Robby Rambo ein zärtlicher Zivi wurde<br />
Vom wechselhaften Streben eines jungen Mannes, <strong>der</strong> ungeahnte Talente in sich entdeckt<br />
2. Preis<br />
Eine Männerschönheit ist dieser Junge und nicht einmal eine vom Typ des faden Beau.<br />
Breitschultrig, brustbehaart unter dem halb geöffneten Hemd, fast kahlgeschoren, den Ring im<br />
Ohr, die Le<strong>der</strong>jacke auf den Schultern, Jeans um die Hüften, steht er da, lässt die Kippen<br />
aufglimmen, und wenn sich’s ergibt, auch die Puppen tanzen. Weh’ dem Goldkind, das diesem<br />
Macho mehr <strong>als</strong> eine Nacht, <strong>als</strong> nur die flüchtigste Zuneigung schenkt.
Wohl denen jedoch, die ihn tagsüber haben. Ihnen gehört er ganz. Wenn er morgens, kurz nach<br />
acht, in die Gruppe kommt, fällt ihm Jutta, das mongoloide Mädchen mit <strong>der</strong> tiefen Stimme um<br />
den H<strong>als</strong> und küsst ihn ab. „Robby, alte Hütte“, stammelt <strong>der</strong> fallsüchtige Dieter begeistert.<br />
Maren und Renate, die im Rollstuhl sitzen, surren ihm entgegen. Sogar Karl, <strong>der</strong> Autist, lässt<br />
sehen, dass sich weit weg in seinem Innern etwas bewegt.<br />
Stuttgarter Zeitung<br />
23.12.1986<br />
1988 Thomas Schmidt<br />
Die Alten kommen<br />
Wie leben alte Menschen im High-Tech-Zeitalter, was bewegt sie, wovon träumen sie? Je<strong>der</strong><br />
kennt sie, die unscheinbaren Alten. Unauffällig sind sie unter uns. Aber Toleranz tut not: Wir<br />
lachen höchstens mal über ihre Selbstgespräche, wun<strong>der</strong>n uns über ihre Hilflosigkeit zwischen<br />
Fahrplänen und Geldautomaten, schütteln aus Unverständnis verärgert den Kopf, wenn die<br />
Schlange an <strong>der</strong> Supermarkt-Kasse durch ihre Umständlichkeit länger und länger wird.<br />
Recherchen begannen, die ein Vierteljahr in Anspruch nahmen, bei allen, die ehrenamtlich o<strong>der</strong><br />
hauptberuflich in <strong>der</strong> Altenpflege tätig sind. Auch die alten Menschen selbst wurden gefragt: jene,<br />
die in Alten- o<strong>der</strong> Pflegeheimen leben ebenso wie jene, die noch in den eigenen vier Wänden<br />
o<strong>der</strong> in Altenappartements wohnen. Alle kommen sie zu Wort, die Armen und die Reichen, die<br />
Pflegebedürftigen und die Junggebliebenen, die alten und die neuen Alten. Langsam entstand<br />
das Bild einer Bevölkerungsgruppe, die immer noch im Abseits steht und erst langsam an<br />
Selbstvertrauen gewinnt.<br />
Fränkische Nachrichten<br />
15.08.1987 ff. (Serie)<br />
Hubert Heinz<br />
Körperbehin<strong>der</strong>te in Schramberg<br />
2. Preis<br />
Jede Treppe ist ein unüberwindbares Hin<strong>der</strong>nis. Türen sind zu schmal, kleine Absätze Kraftakte<br />
und manche Eingänge schlicht nicht zu erreichen. Aus dem Rollstuhl sieht die Welt ganz an<strong>der</strong>s<br />
aus. Städte werden zu einem Hin<strong>der</strong>nis-Parcours, gebaut von Gesunden für ihresgleichen. Der<br />
Autor testete, wie sich ein Rollstuhlfahrer in Schramberg fühlen muss, wo er aneckt o<strong>der</strong> nicht<br />
weiterkommt und welche Türen für ihn verschlossen bleiben. Auch ein Bericht über<br />
Selbsthilfegruppen körperbehin<strong>der</strong>ter Menschen vor Ort.<br />
Schwäbische Zeitung<br />
29.08.1987 ff. (Serie)<br />
1989 Eckhard Stengel<br />
Integration behin<strong>der</strong>ter Kin<strong>der</strong> in die Grundschule<br />
1. Preis<br />
In Bad Sooden-Allendorf geht es um das Schicksal <strong>der</strong> siebenjährigen Kin<strong>der</strong> Katharina und Tim.<br />
Beide leben schon länger mit Nichtbehin<strong>der</strong>ten zusammen: Katharina im Kin<strong>der</strong>garten, Tim in<br />
einer Vorklasse. Nach den Sommerferien sollen sie nun eingeschult werden. Üblicherweise<br />
würden sie auf eine Son<strong>der</strong>schule geschickt, doch die Eltern und alle beteiligten Pädagogen sind<br />
sich darin einig, dass die beiden auch weiterhin gemeinsam mit nichtbehin<strong>der</strong>ten Kin<strong>der</strong>n<br />
aufwachsen sollten und deshalb besser in einer integrierten Grundschulklasse aufgehoben<br />
wären. Doch die Schulbehörden weigern sich, die nötige Genehmigung zu geben.<br />
Das Protokoll einer Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> Kultusbehörde über die Integration behin<strong>der</strong>ter<br />
Kin<strong>der</strong> in die Regelschule.<br />
Frankfurter Rundschau<br />
06.07.1988 ff. (Serie)
Maria Urbanczyk<br />
alt + krank = unsichtbar<br />
2. Preis<br />
Die höhere Lebenserwartung, die keinesfalls gleichzusetzen ist mit Gesundheit bis ins hohe<br />
Alter, schlägt sich in wachsenden Pflegezeiten nie<strong>der</strong>. Nach <strong>der</strong> „Social-data-Erhebung“ des<br />
Bundesfamilienministeriums werden Angehörige in den Familien in jedem zweiten Fall länger <strong>als</strong><br />
zehn Jahre gepflegt. Und am Ende stehen nicht die wie<strong>der</strong>gewonnene Leistungsfähigkeit und<br />
Unabhängigkeit, son<strong>der</strong>n Krankenhaus, häufig geistiger Abbau, Tod.<br />
Altwerden mit Familienanschluss bei immer höherer Lebenserwartung - ein blin<strong>der</strong> Fleck im<br />
Allgemeinwissen über unser Gemeinwesen. Eine Serie über die Situation hochbetagter,<br />
pflegebedürftiger, vielfach <strong>der</strong> Isolation ausgesetzter Menschen und ihrer Angehörigen.<br />
Westfälische Nachrichten<br />
21.03.1988 ff. (Serie)<br />
1990 Uta König<br />
Was heißt schon normal?<br />
1. Preis<br />
Menschen, die seelisch krank sind, Menschen, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden,<br />
kommen in die Psychiatrie. Viel Leid bliebe den seelisch Kranken erspart, wenn sie dort, wo sie<br />
leben, stationär o<strong>der</strong> ambulant Hilfe fänden. Doch die Auflösung <strong>der</strong> Großkrankenhäuser<br />
zugunsten kleiner psychiatrischer Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern ist ins Stocken<br />
geraten. Die Sozialpsychiatrischen Dienste sind personell meist schlecht besetzt. Es fehlt an<br />
betreuten Wohn- und Arbeitsplätzen für psychisch Kranke. Die Folge: Die psychiatrischen<br />
Anstalten füllen weiterhin ihre Betten.<br />
Drei Wochen lang hat die Autorin den Alltag auf Stationen psychiatrischer Großkrankenhäuser<br />
erlebt. Einblicke in das Innenleben von Anstalten.<br />
Stern<br />
22.03.1989<br />
Keyvan Dahesch<br />
Viele Worte, aber nur wenige Taten<br />
Zur Situation <strong>der</strong> Schwerstbehin<strong>der</strong>ten in <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
2. Preis<br />
Der Arbeitsplatz, eine <strong>der</strong> wichtigen Hürden, die Schwerstbehin<strong>der</strong>te auf dem Weg zur<br />
gesellschaftlichen Einglie<strong>der</strong>ung überwinden müssen. Denn nur wenige Arbeitgeber erfüllen die<br />
Beschäftigungspflicht. Statt dessen bezahlen sie 150 Mark „Ausgleichsabgabe“ im Monat, die<br />
sie <strong>als</strong> Betriebsausgabe von den Steuern absetzen.<br />
Das Geld für eine Pflegekraft können die Schwerstbehin<strong>der</strong>ten kaum aufbringen. Für die<br />
Pflegekosten jener, die im Kin<strong>der</strong>garten, in <strong>der</strong> Schule, am Arbeitsplatz o<strong>der</strong> auf dem Weg<br />
dorthin durch Unfall zu ihrer Behin<strong>der</strong>ung gekommen sind, kommen die Berufsgenossenschaften<br />
auf. Die an<strong>der</strong>en Schwerstbehin<strong>der</strong>ten sind - mit wenigen Ausnahmen - auf das Pflegegeld nach<br />
dem Bundessozialhilfegesetz angewiesen.<br />
So erleben die Schwerstbehin<strong>der</strong>ten bei ihren Problemen und Anliegen die verantwortlichen<br />
Politiker - von wenigen, <strong>als</strong> wohltuend empfundenen Ausnahmen abgesehen - recht wortreich<br />
aber tatenarm.<br />
Frankfurter Rundschau<br />
18.03.1989<br />
1991 Walter Kronenberger<br />
AIDS: Die Einsamkeit ist schlimmer <strong>als</strong> <strong>der</strong> Tod
AIDS? Darüber wissen wir doch alles! Über Prävention und Präservative, über<br />
Ansteckungsmöglichkeiten und „Safer Sex“ sind wir bestens informiert - o<strong>der</strong> glauben es<br />
zumindest. Aber was wissen wir wirklich von AIDS? Vom Leid <strong>der</strong> Betroffenen, von <strong>der</strong> Last, die<br />
auf den Schultern von Familienangehörigen und medizinischen Helfern liegt, von <strong>der</strong> psychischen<br />
Belastung, die das Todesurteil „HIV positiv“ bedeutet?<br />
Nicht nur die medizinischen, auch die menschlichen Aspekte des Phänomens AIDS stehen im<br />
Mittelpunkt dieser Serie, die die Bereitschaft zur sexuellen Verantwortung und darüber hinaus,<br />
Mitmenschlichkeit und Toleranz wecken will.<br />
Saarbrücker Zeitung<br />
14./15.07.1990 ff. (Serie)<br />
1992 Jürgen Bischoff<br />
Auf einmal bist du <strong>der</strong> letzte Dreck<br />
1. Preis<br />
Schätzungsweise 50.000 Menschen sind allein in Hamburg ohne Wohnung. Mehr <strong>als</strong> 2.000 von<br />
ihnen übernachten auf Straßen, unter Brücken, auf Spielplätzen. Im gesamten deutschen<br />
Westen sind knapp eine Million in Billigpensionen, Containern und Lagern untergebracht: weitere<br />
200.000 Menschen - Tendenz steigend - leben ganz ohne Dach überm Kopf auf <strong>der</strong> Straße. Die<br />
Zahl <strong>der</strong> Wohnungslosen hat damit wie<strong>der</strong> den Stand <strong>der</strong> Nachkriegszeit erreicht. Doch es wird<br />
noch schlimmer kommen: Schon jetzt vegetieren zehn Prozent <strong>der</strong> Westdeutschen an o<strong>der</strong><br />
unterhalb <strong>der</strong> Armutsgrenze. 600.000 sind aktuell von Obdachlosigkeit bedroht.<br />
Eine Reportage über gestern noch angesehene Bürger, heute Randfiguren <strong>der</strong> Gesellschaft - das<br />
geht immer schneller in Zeiten von Wohnungsnot und Mietenexplosion.<br />
Brigitte<br />
Heft 4/91<br />
Michael Knopf<br />
Die kleine Hälfte <strong>der</strong> Welt<br />
Aus dem Leben des Behin<strong>der</strong>ten Frank Reisinger in Schwarzenstein<br />
2. Preis<br />
Die Welt <strong>der</strong>er wie du und ich hat ebenfalls zwei Hälften, eine große und eine kleine. Ein<br />
schmaler Grat markiert die Grenze; die einen haben wenig zu klagen, die an<strong>der</strong>en haben längst<br />
aufgehört, zu klagen, und sich im Abseits eingerichtet wie Frank Reisinger.<br />
Seine Welt hat zwei Hälften, eine große und eine kleine: Hier <strong>der</strong> Alltag, durch den er mit Mühe<br />
seine wi<strong>der</strong>spenstigen Glie<strong>der</strong> bewegt; dort die Stars, die ihm die Hand drücken und<br />
Autogramme schenken und dann <strong>als</strong> bunte Bil<strong>der</strong> an <strong>der</strong> Wand hängen, eine Art Himmel. Und<br />
manchmal fügen sich all diese Hälften zusammen und formen Momente, in denen sich’s leben<br />
lässt.<br />
Frankenpost<br />
30./31.03.1991<br />
1993 Susanne Hassenkamp<br />
Gell, Manni, du gibst mich nicht in ein Heim?<br />
1. Preis<br />
In <strong>der</strong> Bundesrepublik leben 1,65 Millionen pflegebedürftige Menschen. 1,2 Millionen von ihnen<br />
werden zu Hause betreut - wie Inge Wörner, die multiple Sklerose hat. Seit sieben Jahren wird<br />
sie von ihrem Lebensgefährten betreut. Ohne ihn müsste sie in einem Pflegeheim leben. Gute<br />
Taten werden vom Staat jedoch nicht nur ignoriert, son<strong>der</strong>n noch zusätzlich bestraft: Freiwillige<br />
Pflege ist keine Arbeit, und wer nicht arbeitet, bekommt keine Rente. Ihr Schicksal zeigt<br />
beispielhaft: Mit <strong>der</strong> geplanten Pflegeversicherung muss Bonn endlich zur Sache kommen.
Brigitte<br />
Heft 19/1992<br />
Stefan Willeke<br />
Der Sheriff vom Pott<br />
Ein Polizist <strong>als</strong> Sozialarbeiter am Rande Duisburgs<br />
2. Preis<br />
Der Mann, den sie den Sheriff nennen, bürgt für den lebenswichtigen Rest Menschlichkeit in<br />
einem vergessenen Notquartier <strong>der</strong> Wohlstandsgesellschaft: Sein Wort ist Gesetz, seine Hilfe<br />
lin<strong>der</strong>t Elend, und seine Ratschläge finden Gehör in Duisburgs Problemviertel Bruckhausen. An<br />
sich ist Hans Raulien nur Polizeibeamter mit Sitz in einer bescheidenen Zwei-Zimmer-Wache,<br />
Polizeihauptmeister am Rande von Duisburgs Schutzbereich II. In Wirklichkeit ist Hans Raulien<br />
die Seele des Viertels, ein uniformierter Sozialarbeiter, <strong>der</strong> sich seit neun Jahren um die Sorgen<br />
<strong>der</strong> 8.349 Bruckhausener kümmert. Sheriff zu sein in Bruckhausen ist kein Beruf, son<strong>der</strong>n eine<br />
Lebensaufgabe.<br />
Frankfurter Rundschau<br />
26.09.1992<br />
1994 Kathrin Kramer<br />
Gewissen in Not<br />
„Will ich ein Kind bekommen, von dem ich weiß, dass es behin<strong>der</strong>t ist?“<br />
1. Preis<br />
Frauen zwischen den Fronten: Auf <strong>der</strong> einen Seite wächst <strong>der</strong> moralische Druck, Kin<strong>der</strong> zu<br />
gebären, wie das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum § 218 bestätigt. Aus je<strong>der</strong><br />
Zeile des Urteils spricht tiefes Misstrauen gegenüber dem Verantwortungsgefühl schwangerer<br />
Frauen. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite bürdet die mo<strong>der</strong>ne Wissenschaft, weitgehend unangefochten von<br />
Rechtsprechung und Moral, den Frauen neue Verantwortung auf. Die scheinbar unbegrenzten<br />
Möglichkeiten pränataler Diagnostik, Vorhersagen über die Gesundheit des zu erwartenden<br />
Kindes zu machen, führen an die Grenzen menschlicher Entscheidungsfähigkeit.<br />
Zwei Frauen erzählen, wie sie sich dieser Situation gestellt haben. Beide erhielten nach <strong>der</strong><br />
Fruchtwasseruntersuchung den Befund: „Trisomie 21“, im Volksmund Mongolismus genannt. Die<br />
eine entschied sich für den Abbruch <strong>der</strong> Schwangerschaft. Die an<strong>der</strong>e lebt heute mit ihrem<br />
behin<strong>der</strong>ten Kind.<br />
Badische Zeitung<br />
14.08.1993<br />
Ildikó von Kürthy<br />
Hier stirbt niemand einsam<br />
2. Preis<br />
In <strong>der</strong> Bundesrepublik sterben jährlich 400.000 Menschen im Krankenhaus. Die meisten von<br />
ihnen unwürdig und allein zwischen Apparaten und Infusionen. Doch es gibt auch ein Dutzend<br />
Hospize, wo Sterbenden geholfen wird, dem Tod in Würde zu begegnen.<br />
Das Aachener Hospiz Haus Hörn war eines <strong>der</strong> ersten Hospize in Deutschland. Ein Haus mit 53<br />
Gästen, von denen manche nur wenige Wochen bleiben, an<strong>der</strong>e Jahre - für fast alle die letzte<br />
Station in ihrem Leben. Und die Entscheidung, sich <strong>der</strong> Pflege eines Hospizes anzuvertrauen, ist<br />
immer auch die Entscheidung, den Tod zuzulassen, wenn es an <strong>der</strong> Zeit ist. Keine<br />
lebensverlängernden Maßnahmen. Keine Monitore, auf denen Leben in Kurven messbar ist. Nicht<br />
leben um jeden Preis.<br />
Brigitte<br />
21/93
1995 Jochen Temsch<br />
Das wird schon wie<strong>der</strong> werden<br />
1. Preis<br />
Ich leiste Zivildienst. Meine Patienten sind gelähmt, verkalkt, verkrebst, hirnschwündig, offen und<br />
fast tot. Ich arbeite an den Körperöffnungen <strong>der</strong> Menschen, ganz am Ende. Dort, wo <strong>der</strong> einzelne<br />
aufhört zu existieren, wo er sich langsam auflöst und zu einem übelriechenden Haufen welken<br />
Fleisches wird.<br />
Die Medizin hat die Lebenserwartung verlängert. Doch es ist keine allzu große Erwartung, die<br />
man an so ein verlängertes Leben stellen kann. Denn man wird krank an diesem langen Leben,<br />
stinkig, offen und eitrig. In den Klinken ist <strong>der</strong> Tod ein Betriebsunfall. Und schon jetzt gibt es<br />
keine Pflegeplätze mehr. Die Armut, in <strong>der</strong> die meisten mit ihren unverschämt niedrigen Renten<br />
leben, schreit nach Gerechtigkeit! Sie bekommen Medikamente und vergehen erst, nachdem sie<br />
sich selber viel zu lange überlebt haben. Das macht mich krank. Aber unsere Generation besteht<br />
nur aus Plastik, Konsum und Karrieredenken. Die einzigen Werte sind gut aussehen und Spaß<br />
haben.<br />
DIE ZEIT<br />
25.11.1994<br />
Gertrud Rückert<br />
Gedanken einer alten Frau zur allerletzten Seite <strong>der</strong> ZEIT<br />
Eine Erwi<strong>der</strong>ung auf den Erfahrungsbericht von Jochen Temsch<br />
1. Preis<br />
Nicht, dass ich „gelähmt, verkalkt, verkrebst, hirnschwündig, offen und schon fast tot“ wäre, nein,<br />
das ist mir bisher erspart geblieben. Und seit einer Woche hoffe ich noch inständiger, dass ich<br />
diese Art von Hinfälligkeit nicht werde erleben müssen. Nicht nur des Leidens wegen, davor habe<br />
ich weniger Angst, eher schon <strong>der</strong> Zivis wegen und all <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en, die mich pflegen müssten.<br />
Ich habe ja zur Kenntnis nehmen müssen, wie man in <strong>der</strong>en Situation denken kann.<br />
Ich vermute, dass man uns Alte auf die Dauer gesellschaftlich loshaben will. Wir haben<br />
ausgedient. Man kann keinen Nutzen mehr in uns entdecken, wenn wir aufgehört haben,<br />
Arbeiter, Erzieher, Konsument zu sein, und nur noch hochbezahlte Rentner und teure Pflegefälle<br />
sind.<br />
Ich fürchte eine Kultur <strong>der</strong> Erbarmungslosigkeit, für die wir Alten zunächst nur ein erstes Ziel<br />
abgeben, die sich zu einer Kultur <strong>der</strong> Erbärmlichkeit entwickelt, weil sie das warme Herz nicht<br />
mehr duldet. Barmherzigkeit ist ein sterben<strong>der</strong> Wert in unserer Zeit.<br />
DIE ZEIT<br />
16.12.1994<br />
1996 Roland Bäurle<br />
Ist ja keimig, was du anhast<br />
Zur Lage <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
Rund 2,2 Millionen Kin<strong>der</strong> in Deutschland wachsen in Armut heran - 11,8 Prozent aller Kin<strong>der</strong> in<br />
den alten Bundeslän<strong>der</strong>n, mehr <strong>als</strong> jedes fünfte Kind in den neuen. Bereits je<strong>der</strong> dritte<br />
Sozialhilfeempfänger ist heute jünger <strong>als</strong> 15 Jahre. Tendenz steigend.<br />
Kin<strong>der</strong> gelten <strong>als</strong> Armutsrisiko - für die Eltern. Was aber bedeutet Armut für die Kin<strong>der</strong> selbst?<br />
Was empfinden Jungen und Mädchen, die mitten im Wohlstand zu zweit in einem Bett schlafen<br />
und den Haushalt führen müssen - und die schon mal von Freunden verdroschen werden, weil sie<br />
statt Markenhosen No-name-Jeans tragen?<br />
Süddeutsche Zeitung Magazin<br />
28.04.1995
1992 Bert Bostelmann<br />
Ambulante Altenpflege<br />
1. Preis<br />
Abbildung s. Seite<br />
Plakatausstellung München<br />
12/1991<br />
Michael Matejka<br />
Abseits<br />
2. Preis<br />
Abbildung s. Seite<br />
Nürnberger Nachrichten<br />
27.09.1991<br />
1993 Vincent Kohlbecher<br />
Neue Heimat im Behälter<br />
1. Preis<br />
Abbildung s. Seite<br />
ZEITmagazin<br />
11.12.1992<br />
Oliver Heissner<br />
Lagerkin<strong>der</strong> (Serie)<br />
2. Preis<br />
Abbildungen s. Seite<br />
amnesty-international-Taschenkalen<strong>der</strong><br />
1992<br />
1994 Holger Floß<br />
Die graue Revolution (Serie)<br />
1. Preis<br />
Abbildungen s. Seite<br />
DIE ZEIT<br />
26.03.1993<br />
Ines Krüger<br />
30 Jahre nach <strong>der</strong> Pharmakatastrophe - Wie Conterganopfer ihr Leben meistern<br />
2. Preis<br />
Abbildung s. Seite<br />
Stern<br />
02.12.1993
1995 Gerd Engelsmann<br />
Häusliche Pflege<br />
1. Preis<br />
Abbildung s. Seite<br />
Berliner Zeitung<br />
12.12.1994<br />
Andreas Bohnenstengel<br />
Kin<strong>der</strong> im Asyl (Serie)<br />
2. Preis<br />
Abbildungen s. Seite<br />
Süddeutsche Zeitung Magazin<br />
23.09.1994<br />
José Giribás<br />
Chemotherapie in <strong>der</strong> Berliner Charité<br />
2. Preis<br />
Abbildung s. Seite<br />
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt<br />
13.05.1994<br />
1996 Frank Schultze<br />
Glück im Unglück (Serie)<br />
1. Preis<br />
Abbildungen s. Seite<br />
ZEITmagazin<br />
09.06.1995<br />
1996 Marily Stroux<br />
Kein festen Boden unter den Füßen<br />
Flüchtlinge auf den Wohnschiffen<br />
Abbildung s. Seite<br />
Foto-Dokumentation<br />
06/1995
PERSONENREGISTER<br />
Antes, Klaus,<br />
Aschke, Katja,<br />
Baur, Ulrike,<br />
Bäurle, Roland,<br />
Bausch, Susanne,<br />
Berg, Birgit,<br />
Besuden, Eike,<br />
Bienewald, Erwin,<br />
Birnbreier, Martina,<br />
Bischoff, Jürgen,<br />
Böhm, Gerlinde,<br />
Bohnenstengel, Andreas,<br />
Bostelmann, Bert,<br />
Brand, Gretl,<br />
Dahesch, Keyvan,<br />
Dankwerth-Kiemle, Margot,<br />
Dauer, Hannelore,<br />
Deppe, Gardi,<br />
Döhring, Bärbel,<br />
Dörr, Josef,<br />
Dürr, Charles,<br />
Ehrhardt, Christiane,<br />
Engelsmann, Gerd,<br />
Floß, Holger,<br />
Fritz, Helmut,<br />
Frühwirth, Jo,<br />
Gadatsch, Hannelore,<br />
Geiger, Stefan,<br />
Geisel, Beatrix,<br />
Geppert, Hans J.,<br />
Giribás, José,<br />
Grobelny-Stoffers, Gabriele,<br />
Grund, Friedrich-Karl<br />
Hartmann, Hildegard,<br />
Hassenkamp, Susanne,<br />
Heinz, Hubert,<br />
Heissner, Oliver,<br />
Hofmann, Christel,<br />
Hoghe, Raimund,<br />
Hohmann, Maria<br />
Holst, Evelyn,<br />
Jäckel, Christine,<br />
Kandel, Norbert,<br />
Kienzle, Birgit,<br />
Kirk, Gerhard M.,<br />
Kirschenhofer, Eva,<br />
Klemm, Dietlind,<br />
Klier, Gerda,<br />
Knobbe, Werner,<br />
Knopf, Michael,<br />
Knorr-An<strong>der</strong>s, Esther,<br />
Kohlbecher, Vincent,<br />
König, Uta,<br />
Koplin, Raimund,<br />
Kramer, Kathrin,<br />
Krause-Burger, Sibylle,<br />
Krink, Frank,<br />
Kroll, Benno,<br />
Kronenberger, Walter,<br />
Krüger, Ines,<br />
Krzok, Andreas,<br />
Kühn, Dieter,<br />
Kurtz, Inge,<br />
Kurzrock, Ruprecht,<br />
Lehmann, Lutz,<br />
Leo, Walter,<br />
Martin, Hansjörg,<br />
Matejka, Michael,<br />
Medienwerkstatt Franken, ,<br />
Michaely, Petra,<br />
Mohl, Hans,<br />
Möller, Michael,<br />
Müser, Mechthild,<br />
Noack, Hans-Joachim,<br />
Odenthal-Brandt, Marion,<br />
Plangger, Gebhard,<br />
Pohl, Chris,<br />
Reinken, Gisela,<br />
Rieber, Gretel,<br />
Roth, Jürgen,<br />
Roth, Kristina<br />
Rothaus, Ulli,<br />
Ruckdäschel, Erika,<br />
Rückert, Gertrud,<br />
Rudnitzky, Ellen<br />
Sass, Ekkehard,<br />
Sauter, Dieter,<br />
Schiffer, Wolfgang<br />
Schindele, Eva,<br />
Schmidt, Peter,<br />
Schmidt, Thomas,<br />
Schmuckler, Arno<br />
Schreijäg, Hans-Peter,<br />
Schubert, Beate,<br />
Schultze, Frank,<br />
Siebig, Karl,<br />
Sperr, Martin,<br />
Stefanowski, Michael,<br />
Stengel, Eckhard,<br />
Storch, Karin,<br />
Storz, Silvia,<br />
Stroux, Marily,<br />
Temsch, Jochen,<br />
Thebrath, Jürgen,<br />
Theißen, Hermann,<br />
Tourneau, Ingrid,<br />
Unland, Ursula,<br />
Urbanczyk, Maria,<br />
Veiel, Axel,<br />
von Kürthy, Ildikó,<br />
Welz, Heinz,<br />
Wesener, Michael,<br />
Wiegmann, Bernd,<br />
Willeke, Stefan,<br />
Wingert, Peter,<br />
Wittmann, Dietmar,<br />
Woller, Hans
Wriedt, Axel,