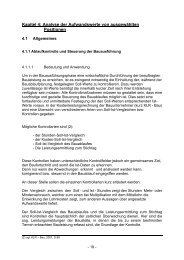Nachweispraxis Biegeknicken und Biegedrillknicken - Bauingenieur24
Nachweispraxis Biegeknicken und Biegedrillknicken - Bauingenieur24
Nachweispraxis Biegeknicken und Biegedrillknicken - Bauingenieur24
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 1<br />
Inhaltsverzeichnis <strong>und</strong> Vorwort<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Nachweispraxis</strong> <strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong><br />
ISBN 3-433-02494-4<br />
Verlag Ernst & Sohn - Berlin<br />
Vorwort ................................................................................................................................V<br />
Erläuterung zu Gliederung <strong>und</strong> Inhalt der Teile A, B <strong>und</strong> C: ............................................ VII<br />
Teil A: Einführung<br />
I <strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong> von Stäben<br />
mit doppeltsymmetrischem I-Querschnitt .......................................................... 3<br />
1 Allgemeines .......................................................................................................... 3<br />
2 <strong>Biegeknicken</strong> mit Ersatzstabverfahren ................................................................ 6<br />
2.1 Planmäßig mittiger Druck....................................................................................... 7<br />
2.1.1 Verzweigungslast (Knicklast) mittig gedrückter Stäbe .............................................. 7<br />
2.1.2 Traglast mittig gedrückter Stäbe ............................................................................. 8<br />
2.1.3 Ersatzstabnachweis für mutig gedrückte Stäbe ....................................................... 9<br />
2.2 Biegung mit Normalkraft .......................................................................................10<br />
2.2.1 Ersatzstabnachweis für Biegung mit Normalkraft...................................................10<br />
2.2.1.1 Einachsige Biegung mit Normalkraft......................................................................11<br />
2.2.1.2 Zweiachsige Biegung mit Normalkraft ....................................................................11<br />
3 <strong>Biegeknicken</strong> als Spannungsproblem <strong>und</strong> als Traglastproblem<br />
mit Schnittgrößen nach Theorie II. Ordnung ..................................................... 2<br />
3.1 Planmäßig mittiger Druck......................................................................................13<br />
3.1.1 Verfahren Elastisch-Elastisch................................................................................13<br />
3.1.2 Verfahren Elastisch-Plastisch ................................................................................14<br />
3.2 Biegung mit Normalkraft .......................................................................................14<br />
3.2.1 Verfahren Elastisch-Elastisch................................................................................15<br />
3.2.2 Verfahren Elastisch-Plastisch ................................................................................16<br />
4 <strong>Biegedrillknicken</strong> als vereinfachter Nachweis ....................................................18<br />
4.1 Planmäßig mutiger Druck......................................................................................19<br />
4.1.1 Verzweigungslast (Drillknicklast) mittig gedrückter Stäbe.......................................20<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 2<br />
4.1.2 Traglast mittig gedrückter Stäbe ............................................................................20<br />
4.1.3 Vereinfachter Nachweis für mutig gedrückte Stäbe.................................................21<br />
4.2 Biegung mit oder ohne Normalkraft .......................................................................22<br />
4.2.1 Ideale Biegedrillknickmomente ..............................................................................22<br />
4.2.2 Tragbiegemomente für <strong>Biegedrillknicken</strong>................................................................23<br />
4.2.3 Vereinfachter Tragsicherheitsnachweis ..................................................................25<br />
4.3 Biegung mit oder ohne Normalkraft mit planmäßiger Torsinn.................................26<br />
5 <strong>Biegedrillknicken</strong> als Spannungsproblem <strong>und</strong> als Traglastproblem<br />
mit Schnittgrößen nach Theorie II. Ordnung .....................................................26<br />
5.1 Planmäßig mittiger Druck......................................................................................27<br />
5.1.1 Verfahren Elastisch-Elastisch................................................................................27<br />
5.1.2 Verfahren Elastisch-Plastisch ................................................................................29<br />
5.2 Biegung mit oder ohne Normalkraft .......................................................................29<br />
5.2.1 Verfahren Elastisch-Elastisch................................................................................31<br />
5.2.2 Verfahren Elastisch-Plastisch ................................................................................32<br />
5.3 Biegung mit oder ohne Normalkraft mit planmäßiger Torsinn.................................33<br />
5.3.1 Verfahren Elastisch-Elastisch: Nachweise wie in Abschn. 5.2.1 ..............................33<br />
5.3.2 Verfahren Elastisch-Plastisch: Nachweise wie in Abschn. 5.2.2 ..............................33<br />
6 Interpretation der Nachweisergebnisse...............................................................33<br />
7 Mischung der Nachweise .....................................................................................33<br />
II <strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong> von Stäben mit<br />
doppeltsymmetrischem I-Querschnitt in Stabwerken ........................................34<br />
1 Versagensarten für einen Zweigelenkrahmen .....................................................34<br />
1.1 Planmäßig mittiger Druck......................................................................................34<br />
1.2 Einachsige Biegung My mit/ohne Normalkraft........................................................36<br />
1.3 Zweiachsige Biegung MY + MZ mit/ohne Normalkraft..............................................38<br />
1.4 Ein- oder zweiachsige Biegung My oder My + MZ<br />
mit/ohne Normalkraft mit planmäßiger Torsion .....................................................40<br />
2 Nachweisablauf ....................................................................................................40<br />
2.1 Einachsige Biegung My mit/ohne (bzw. vernachlässigbarer)<br />
Normalkraft ..........................................................................................................41<br />
2.2 Zweiachsige Biegung mit oder ohne Normalkraft ....................................................46<br />
2.3 Ein- oder zweiachsige Biegung mit/ohne Normalkraft<br />
mit planmäßiger Torsion .......................................................................................46<br />
3 Räumliche Stabwerke ..........................................................................................47<br />
4 Mischung der Nachweise .....................................................................................48<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 3<br />
III <strong>Biegedrillknicken</strong> unter Berücksichtigung angrenzender Bauteile ....................50<br />
1 Allgemeines .........................................................................................................50<br />
2 Gabellager ............................................................................................................52<br />
2.1 Gabellager bei Trägern, Stegverformbarkeit............................................................52<br />
2.2 Gabellager bei Rahmenecken .................................................................................53<br />
3 Lagerung durch angrenzende Bauteile ................................................................54<br />
3.1 Lagerung durch Verbände .....................................................................................54<br />
3.2 Lagerung durch Schubfelder..................................................................................54<br />
3.3 Drehbettung durch Trapezprofile ...........................................................................56<br />
3.4 Drehfederung durch Träger ...................................................................................57<br />
4 Idealisierung stahlbauüblicher Lagerungen ........................................................57<br />
4.1 Einseitige Lagerungen ...........................................................................................58<br />
4.2 Beidseitige Lagerungen..........................................................................................61<br />
5 Beispiele zu Teil III..............................................................................................64<br />
Teil B: Bemessungshilfen<br />
1 Zusammenstellung der Nachweise ......................................................................67<br />
1.1 <strong>Biegeknicken</strong> mit Ersatzstabverfahren, <strong>Biegedrillknicken</strong> als<br />
vereinfachter Nachweis..........................................................................................67<br />
1.1.1 Übersicht über die Nachweisformeln ......................................................................67<br />
1.1.2 Begriffe .................................................................................................................68<br />
1.1.3 Nachweise N1 bis N8 .............................................................................................69<br />
1.1.4 Auszug aus DIN 18 800-2: Elemente (204), (304), (311)<br />
<strong>und</strong> Tabelle 11 ......................................................................................................76<br />
1.1.5 Schnittgrößenregelung, Imperfektionsregelung.......................................................81<br />
1.2 <strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong> als Spannungsproblem (EE)<br />
<strong>und</strong> Traglastproblem (EP) .....................................................................................84<br />
1.2.1 Nachweis als Spannungsproblem, Verfahren EE, Nachweise N9, N10 .....................84<br />
1.2.2 Nachweis als Traglastproblem, Verfahren EP, Nachweise N11 bis N14 ....................86<br />
1.2.3 Schnittgrößenregelung, Imperfektionsregelung.......................................................89<br />
1.2.4 Zum Ansatz von Ersatzimperfektionen ...................................................................92<br />
1.3 Biegedrillknicksicherheit durch Nachweis ausreichender Drehbettung ...................94<br />
1.3.1 Auszug aus DIN 18 800-2: Elemente (307), (308), (309) <strong>und</strong> Tabelle 7 ....................94<br />
1.4 Erläuterungen zu den Nachweisverfahren EE, EP, PP <strong>und</strong><br />
zur Fließzonentheorie ............................................................................................98<br />
1.4.1 Verfahren Elastisch-Elastisch (EE), elastische Grenzlast ........................................99<br />
1.4.2 Verfahren Elastisch-Plastisch (EP) .........................................................................99<br />
1.4.3 Verfahren Plastisch-Plastisch (PP)........................................................................100<br />
1.4.3.1 Fließgelenktheorie ...............................................................................................101<br />
1.4.3.2 Fließzonentheorie ................................................................................................102<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 4<br />
2 Begriffe aus der Stabilitätstheorie ....................................................................105<br />
2.1 Knicken - Eulersche Knicklast .............................................................................105<br />
2.2 Ideales Biegedrillknickmoment ............................................................................107<br />
2.2.1 Differentialgleichungsmethode.............................................................................107<br />
2.2.2 Weitere Lösungsverfahren....................................................................................110<br />
2.2.3 Abschätzung idealer Biegedrillknickmomente.......................................................110<br />
3 Näherungsverfahren für Berechnungen nach Theorie II. Ordnung ...................115<br />
3.1 Stäbe ..................................................................................................................116<br />
3.2 Zweigelenkrahmen ..............................................................................................117<br />
4 Schnittgrößen <strong>und</strong> Spannungen bei Biegung <strong>und</strong> Torsion................................120<br />
4.1 Näherungsbetrachtung für die Torsionsschnittgrößen: Flanschquerkraft<br />
<strong>und</strong> Flanschbiegemoment....................................................................................120<br />
4.2 Differentialgleichung der gemischten Torsinn, Normalspannungen <strong>und</strong><br />
Schubspannungen infolge Torsion .......................................................................122<br />
4.3 Randbedingungen <strong>und</strong> Randschnittgrößen torsionsbeanspruchter<br />
Träger .................................................................................................................126<br />
4.3.1 Gabellager, Wölbeinspannung .............................................................................126<br />
4.3.2 Elastische Wölbstützungen..................................................................................126<br />
4.4 Zustandslinien ausgewählter Systeme .................................................................127<br />
4.5 Übersicht über die Schnittgrößen <strong>und</strong> Spannungen bei zweiachsiger<br />
Biegung mit Normalkraft mit Torsion ...................................................................127<br />
4.6 Schnittgrößen <strong>und</strong> Spannungen bei Biegung <strong>und</strong> Torsinn nach<br />
Theorie II. Ordnung .............................................................................................131<br />
5 Knicklasten <strong>und</strong> Verzweigungslastfaktoren für mutig gedrückte<br />
Stäbe mit doppeltsymmetrischem I-Querschnitt..............................................133<br />
5.1 Nki,y <strong>und</strong> Nki,Z für „einfache“ Stäbe ........................................................................133<br />
5.2 Nki,y <strong>und</strong> Nki,Z für Stäbe in Rahmen mit verschieblichen Knotenpunkten................134<br />
5.2.1 Knicklängenbeiwerte β für Rahmenstiele..............................................................134<br />
5.2.2 Verzweigungslastfaktor ηKi; für Rahmen...............................................................135<br />
5.3 Rahmen mit unverschieblichen Knotenpunkten ...................................................137<br />
6 Drillknicken, <strong>Biegedrillknicken</strong> (NKi,D) für mutig gedrückte Stäbe<br />
mit doppeltsymmetrischem I-Querschnitt .......................................................138<br />
6.1 Drillknicken des gabelgelagerten Stabes...............................................................139<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 5<br />
6.2 <strong>Biegedrillknicken</strong> (NKi,D) bei Stäben mit Abstützung in y-Richtung<br />
Geb<strong>und</strong>ene Drehachse/Schubfeldaussteifung......................................................139<br />
6.2.1 NKi,D bei geb<strong>und</strong>ener Drehachse (S ≥ erf S) ...........................................................140<br />
6.2.2 NKi,D bei Schubfeldaussteifung (S < erf S) .............................................................141<br />
6.2.3 NKi,D bei äquidistanter seitlicher Abstützung ........................................................142<br />
6.3 <strong>Biegedrillknicken</strong> NKi,D bei Stäben mit Drehbettung, Drehfederung .......................144<br />
6.3.1 NKi,D bei Drehbettung...........................................................................................144<br />
6.3.2 NKi,D bei Drehfederung .........................................................................................145<br />
6.4 <strong>Biegedrillknicken</strong> (NKi,D) bei Stäben mit Abstützung in y-Richtung <strong>und</strong><br />
Drehbettung/Drehfederung .................................................................................146<br />
6.4.1 NKi,D bei geb<strong>und</strong>ener Drehachse <strong>und</strong> Drehbettung................................................146<br />
6.4.2 NKi,D bei Schubfeldaussteifung (S ≥ erf S <strong>und</strong> S < erf S)<br />
<strong>und</strong> Drehbettung/Drehfederung ..........................................................................147<br />
6.4.3 NKi,D bei äquidistanter seitlicher Abstützung <strong>und</strong> Drehfederung ...........................148<br />
7 Ideale Biegedrillknickmomente für Träger<br />
mit doppeltsymmetrischem I-Querschnitt (N = 0) ............................................149<br />
7.1 Biegedrillknickmomente (MKi,y) gabelgelagerter Träger ..........................................149<br />
7.1.1 MKi,y für Einfeldträger ..........................................................................................149<br />
7.1.2 MKi,y für Einfeldträger mit Endmomenten .............................................................151<br />
7.1.3 MKi,y für Durchlaufträger mit gleichen <strong>und</strong> ungleichen Feldlängen ........................154<br />
7.1.4 MKi,y für Durchlaufträger als Kette von Einfeldträgern ..........................................155<br />
7.2 Biegedrillknickmomente (MKi,y) für Träger mit Abstützung<br />
in y-Richtung - geb<strong>und</strong>ene Drehachse oder Schubfeldaussteifung ........................155<br />
7.2.1 MKi,y bei geb<strong>und</strong>ener Drehachse...........................................................................155<br />
7.2.1.1 MKi,y für Einfeldträger ohne Endmomente.............................................................155<br />
7.2.1.2 MKi,y für Einfeldträger mit Endmomenten .............................................................156<br />
7.2.1.3 MKi,y für Durchlaufträger .....................................................................................157<br />
7.2.1.4 MKi,y für Durchlaufträger mit gleichen <strong>und</strong> ungleichen Feldlängen ........................159<br />
7.2.2 MKi,y bei Schubfeldaussteifung (S ≥ erf S <strong>und</strong> S < erf S).........................................160<br />
7.2.3 Träger mit äquidistanter seitlicher Stützung ........................................................162<br />
7.2.3.1 MKi,y für Einfeldträger ..........................................................................................162<br />
7.2.3.2 MKi,y für Durchlaufträger .....................................................................................163<br />
7.3 Biegedrillknickmomente (MKi,y) für Träger mit Drehbettung<br />
oder Drehfederung ..............................................................................................164<br />
7.3.1 MKi,y bei Drehbettung...........................................................................................165<br />
7.3.1.1 MKi,y für Einfeldträger ..........................................................................................165<br />
7.3.1.2 MKi,y für Durchlaufträger .....................................................................................167<br />
7.3.2 MKi,y bei Drehfederung .........................................................................................167<br />
7.4 Biegedrillknickmomente (MKi,y) für Träger mit Abstützung<br />
in y-Richtung <strong>und</strong> Drehbettung oder Drehfederung..............................................168<br />
7.4.1 MKi,y bei geb<strong>und</strong>ener Drehachse (S ≥ erf S)............................................................168<br />
7.4.1.1 MKi,y für Einfeldträger ohne Endmomente.............................................................168<br />
7.4.1.2 MKi,y für Einfeldträger mit Endmomenten .............................................................169<br />
7.4.1.3 MKi,y für Durchlaufträger .....................................................................................169<br />
7.4.2 MKi,y bei Schubfeldaussteifung (S < erf S) <strong>und</strong><br />
Drehbettung/Drehfederung .................................................................................169<br />
7.4.3 MKi,y für Träger mit äquidistanter seitlicher Abstützung<br />
mit Drehfederung ................................................................................................170<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 6<br />
7.5 Biegedrillknickmomente MKi,y für Träger mit Schubfeldaussteifung,<br />
Translationsbettung, Aussteifungsträger, Drehbettung.........................................170<br />
7.6 Biegedrillknickmomente MKi,y für Systeme mit Kragarm........................................171<br />
7.6.1 Biegedrillknickmomente MKi,y für Kragträger ........................................................171<br />
7.6.1.1 MKi,y bei freiem Kragende .....................................................................................172<br />
7.6.1.2 MKi,y bei Kragende mit vertikal verschieblichem Gabellager ...................................172<br />
7.6.2 Biegedrillknickmomente (MKi,y) für Einfeldträger mit Kragarm...............................173<br />
7.6.2.1 MKi,y bei freier Drehachse.....................................................................................173<br />
7.6.2.2 MKi,y bei geb<strong>und</strong>ener Drehachse...........................................................................174<br />
7.7 Verzweigungslastfaktor;Umrechnung von MKi,y<br />
auf andere Nachweisstellen .................................................................................175<br />
7.8 Interpolation von idealen Biegedrillknickmomenten..............................................176<br />
8 Abstützung durch angrenzende Bauteile ..........................................................178<br />
8.1 Schubsteifigkeit, Mindestschubsteifigkeit.............................................................178<br />
8.1.1 Trapezprofilschubfeld ..........................................................................................178<br />
8.1.2 Schubsteifigkeit von Verbänden...........................................................................180<br />
8.1.3 Trapezprofilschubfelder <strong>und</strong> Verbände.................................................................182<br />
8.2 Drehbettung, Drehfederung.................................................................................183<br />
8.2.1 Kontinuierliche Drehbettung durch Trapezprofile .................................................185<br />
8.2.2 Diskrete Drehfedern durch angrenzende Bauteile.................................................186<br />
8.2.2.1 Drehfederanteil aus Profilverformung nicht ausgesteifter Stege.............................187<br />
8.2.2.2 Drehfederanteil aus Profilverformung ausgesteifter Stege .....................................189<br />
8.3 Kopplung von Biegeträgern in Querrichtung ........................................................189<br />
8.4 Gegenseitige Beeinflussung gestützter <strong>und</strong> abstützender Bauteile ........................190<br />
8.4.1 Stabilisierende Einflüsse .....................................................................................190<br />
8.4.2 Zusatzbeanspruchungen .....................................................................................191<br />
9 Beanspruchung der Verbindungsmittel zwischen gestütztem <strong>und</strong><br />
abstützendem Bauteil........................................................................................192<br />
9.1 Bei Drehbettung durch Trapezprofile ...................................................................192<br />
9.2 Bei Stabilisierung durch Schubfelder...................................................................193<br />
9.3 Bei Drehbettung <strong>und</strong> Schubfeldwirkung ..............................................................198<br />
9.4 Bei Drehfederung durch Träger ...........................................................................201<br />
9.5 Bei Stabilisierung durch Verbände.......................................................................202<br />
10 Weitere Lagerungen...........................................................................................203<br />
10.1 Träger mit Ausklinkungen ...................................................................................203<br />
10.2 Riegel mit elastischer Torsionsstützung ...............................................................203<br />
10.3 Elastische Wölbstützungen..................................................................................204<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 7<br />
10.3.1 Kopfplatte ...........................................................................................................205<br />
10.3.2 Überstand...........................................................................................................206<br />
10.3.3 Stützenanschluß .................................................................................................206<br />
10.3.4 Drillkopplung der Flansche .................................................................................207<br />
10.4 Stegverformbarkeit an Auflagern..........................................................................207<br />
Teil C: Beispiele<br />
1 Zusammenstellung der Beispiele.......................................................................211<br />
2 Allgemeine Angaben, Berechnungsansätze .......................................................217<br />
3 Beispiele ............................................................................................................219<br />
4 Vergleiche mit Traglasten nach der Fließzonentheorie....................................410<br />
Literaturverzeichnis .........................................................................................................413<br />
Stichwortverzeichnis ........................................................................................................417<br />
Vorwort<br />
<strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong> sind in vielen Fällen die bemessungsmaßgebenden<br />
Versagensformen von Stäben, Stabzügen <strong>und</strong> Stabwerken aus dünnwandigen (offenen) Profilen.<br />
Der Nachweis der Biegeknicksicherheit kann mit dem Ersatzstabverfahren nach DIN 18 800-2<br />
oder als Spannungsproblem/Traglastproblem mit Schnittgrößen Theorie II. Ordnung erbracht<br />
werden.<br />
Viele der in der Praxis vorkommenden Biegedrillknickprobleme können, ausgehend von idealen<br />
Biegedrillknickmomenten (Verzweigungslast bei Biegebeanspruchung) <strong>und</strong> für Knicklasten (Verzweigungslast<br />
bei mittigem Druck), mit dem vereinfachten Verfahren nach DIN 18 800-2 gelöst<br />
werden. Verzweigungslasten sind in der einschlägigen Literatur - meist in Form von Diagrammen<br />
- enthalten.<br />
Lösungen für das Verzweigungsproblem <strong>und</strong> für das eigentlich zu lösende Spannungsproblem<br />
oder Traglastproblem können auch mit Programmen für Biegung <strong>und</strong> Torsinn (finite Stabelemente,<br />
finite Elemente) erarbeitet werden.<br />
Die Anwendung solcher Programme wird vermehrt Nachweise „von Hand“ ablösen, ähnlich wie<br />
dies mit der Schnittgrößenberechnung mit Stabwerkprogrammen bereits der Fall ist.<br />
Kenntnisse der gr<strong>und</strong>sätzlichen Zusammenhänge sind jedoch zur Beurteilung der Berechnungsergebnisse<br />
in beiden Fällen erforderlich.<br />
Ein Ziel vorliegender Beispielsammlung ist es, die Nachweismöglichkeiten <strong>und</strong> die Art der Nachweisführung<br />
anhand von Beispielen aus der Praxis Schritt für Schritt zu erläutern.<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 8<br />
Es werden jeweils folgende zwei Nachweismöglichkeiten behandelt:<br />
1. Nachweismöglichkeit<br />
<strong>Biegeknicken</strong> mit Ersatzstabverfahren<br />
<strong>Biegedrillknicken</strong> als vereinfachter Nachweis<br />
2. Nachweismöglichkeit<br />
<strong>Biegeknicken</strong> als Spannungsproblem <strong>und</strong> als Traglastproblem mit Schnittgrößen nach Theorie II.<br />
Ordnung<br />
<strong>Biegedrillknicken</strong> als Spannungsproblem <strong>und</strong> als Traglastproblem mit Schnittgrößen nach Theorie<br />
II. Ordnung unter Verwendung von Finite-(Stab)-Element-Programmen<br />
Beide Nachweismöglichkeiten werden parallel dargestellt <strong>und</strong> können unabhängig voneinander<br />
verfolgt werden.<br />
Gegliedert ist das Buch in 3 Teile:<br />
Teil A: Einführung<br />
Teil B: Bemessungshilfen<br />
Teil C: Beispiele<br />
Durch diese Gliederung läßt sich häufigeres Blättern zwischen den drei Teilen nicht vermeiden,<br />
sie führt jedoch zu einer jeweils in sich geschlossenen, kompakten Darstellung der drei Bereiche<br />
„Einführung - Bemessungshilfen – Beispiele“ <strong>und</strong> sie erlaubt folgende Verwendungsmöglichkeiten:<br />
Einführung in die <strong>Nachweispraxis</strong>: Teil A (Abschnitte I <strong>und</strong> II) mit Teil C (Beispiele 1 bis 7e)<br />
führt in die Begriffe <strong>und</strong> Nachweismöglichkeiten ein.<br />
Nachschlagewerk: Teil C mit Teil B eignet sich zum gezielten Auffinden von Nachweisabläufen in<br />
Abhängigkeit von statischem System <strong>und</strong> Beanspruchung. Eine beschreibende Zusammenstellung<br />
aller Beispiele findet sich in Teil C, Abschnitt 1.<br />
Angeregt zur Erarbeitung dieses Buches hat mich u. a. die Tatsache, daß in den Lehrveranstaltungen<br />
Stahlbau an Fachhochschulen meist zu wenig Zeit zur Behandlung der Stabilitätsprobleme<br />
stabförmiger Tragwerke zur Verfügung steht <strong>und</strong> daß die Einarbeitung in dieses Gebiet im<br />
Berufsalltag anhand der zahlreichen einschlägigen Veröffentlichungen einen großen Aufwand bedeutet,<br />
wenn keine zusammenfassende einführende Darstellung der Problematik zur Verfügung<br />
steht.<br />
Ich danke allen Fachkollegen, insbesondere den Verfassern der verwendeten Programme, die mit<br />
wertvollen Anregungen <strong>und</strong> Ratschlägen zur Verwirklichung dieses Buches beigetragen haben.<br />
Weiterhin danke ich den Studenten, die bei der EDV-Bearbeitung der Texte <strong>und</strong> Zeichnungen <strong>und</strong><br />
bei der Nachrechnung von Beispielen mitgearbeitet haben, für die nützlichen Anregungen aus<br />
Sicht der Studierenden.<br />
Die in diesem Buch enthaltenen Informationen, Formeln, Diagramme, Näherungsnachweise, Auszüge<br />
aus Normen <strong>und</strong> Literatur wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt; Nachweise in der<br />
Praxis sind jedoch nach dem jeweiligen Wortlaut der einschlägigen Normen, der mitgeltenden Bestimmungen<br />
<strong>und</strong> der Originalliteratur zu führen, die hier nur auszugsweise wiedergegeben sind.<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 9<br />
Systematische Vergleiche zwischen Verzweigungslasten aus FE-Programmen <strong>und</strong> Verzweigungslasten<br />
aus den Formeln <strong>und</strong> Diagrammen aus der Literatur wurden nicht durchgeführt; soweit in<br />
den Beispielen vergleichende Gegenüberstellungen von Verzweigungslasten enthalten sind, ergab<br />
sich jeweils eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse.<br />
Erläuterung zu Gliederung <strong>und</strong> Inhalt der Teile A, B <strong>und</strong> C<br />
Teil A ist in 3 Teile gegliedert:<br />
I. <strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong> von Stäben mit doppeltsymmetrischem I-Querschnitt<br />
II. <strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong> von Stäben mit doppeltsymmetrischem I-Querschnitt<br />
in Stabwerken<br />
III. <strong>Biegedrillknicken</strong> unter Berücksichtigung angrenzender Bauteile<br />
In Teil A-I werden die Versagensarten <strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong> von Stäben, sowie<br />
Begriffe aus der Stabilitätstheorie anschaulich erläutert. Hinweise im Text (--> „ ... vgl. Teil B,<br />
Abschn . ...") führen den Leser, der etwas über den theoretischen Hintergr<strong>und</strong> nachlesen möchte,<br />
in die entsprechenden Abschnitte in Teil B.<br />
Die Nachweisformeln sind in Teil A-I nur soweit angegeben, daß die Zuordnung „Schnittgrößen -<br />
Nachweisformel“sich einprägt. Ausführliche Angaben zu den Nachweisen sind in Teil B Abschn. 1<br />
zusammengestellt.<br />
Für Leser, die sich in das hier behandelte Stabilitätsproblem einarbeiten, empfiehlt es sich, den<br />
Hinweisen zu den Beispielen („1 Beispiel: Teil C, Bsp . ...“) direkt zu folgen.<br />
In Teil A-II wird die Anwendung der in Teil A-I behandelten Nachweise für Stäbe in Stabwerken<br />
erläutert <strong>und</strong> es werden die Besonderheiten herausgearbeitet, die bei der Nachweisführung zu<br />
beachten sind. Auch hier wird jeder neue Schritt durch ein Beispiel begleitet („1 Beispiel: Teil C,<br />
Bsp . ...")<br />
Dem Leser werden in Teil A-I <strong>und</strong> A-II die Lösungswege vorgestellt, die zum Bearbeiten einer bestimmten<br />
Problemstellung erforderlich sind. Der gesamtheitliche Überblick stellt sich dabei nach<br />
<strong>und</strong> nach mit wachsender Anzahl bearbeiteter Beispiele ein.<br />
In Teil A-III sind Lagerungen <strong>und</strong> abstützende Bauteile (Verbände, Trapezprofile u. a.) <strong>und</strong> ihre<br />
Übersetzung in Lagerungssymbole zusammengestellt. Teil A-III soll lediglich einen Überblick über<br />
die Idealisierung abstützender Bauteile zu Wegfedern, Drehfedern, Gabellagern u. ä. vermitteln.<br />
Die rechnerische Berücksichtigung der Lagerungen in den Verzweigungslasten (ideale Biegedrillknickmomente,<br />
Knicklasten) oder bei der Berechnung der Schnittgrößen für Nachweise als Spannungsproblem/Traglastproblem<br />
wird in den entsprechenden Beispielen herausgearbeitet, Rückverweise<br />
auf Teil B führen dabei zu den Abschnitten (-> „ ... vgl. Teil B, Abschn . ..."), in denen Einzelheiten<br />
der Berechnungen zusammengestellt sind.<br />
Teil B enthält eine vollständige Zusammenstellung der Nachweise, Auszüge aus DIN 18 800-2,<br />
Begriffe aus der Stabilitätstheorie <strong>und</strong> aus der Torsionstheorie sowie Bemessungshilfen.<br />
Die Nachweise <strong>und</strong> Nachweisabläufe für <strong>Biegeknicken</strong> <strong>und</strong> <strong>Biegedrillknicken</strong> sind für die 1. <strong>und</strong><br />
2. Nachweismöglichkeit übersichtlich zusammengestellt <strong>und</strong>, soweit erforderlich, mit Erläuterungen<br />
versehen.<br />
Begriffe aus der Stabilitätstheorie <strong>und</strong> aus der Torsionstheorie werden für einfache Fälle, z. T.<br />
anhand von Differentialgleichungen <strong>und</strong> deren Lösungen, soweit dargestellt, daß die Nachweisabläufe<br />
<strong>und</strong> Beispiele ohne Zuhilfenahme weiterer Literatur bearbeitet werden können.<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold
Seite 10<br />
Ausführlich zusammengestellt sind ideale Knicklasten, Biegedrillknicklasten <strong>und</strong> Biegedrillknickmomente<br />
nach der Elastizitätstheorie auch unter Berücksichtigung der stabilisierenden<br />
Wirkung angrenzender Bauteile.<br />
Die rechnerische Erfassung stabilisierender Bauteile wie: Trapezprofile, Verbände, Pfetten sowie<br />
deren Verbindung mit den zu stabilisierenden Bauteilen ist erläutert <strong>und</strong> die erforderlichen<br />
Nachweisformeln sind angegeben.<br />
Weitere Lagerungen <strong>und</strong> Stützungen <strong>und</strong> deren Berücksichtigungsmöglichkeiten bei den Nachweisen<br />
sind abschließend zusammengestellt.<br />
Teil C enthält 42 praxisbezogene Beispiele.<br />
In den einführenden Beispielen 1 bis 7e sind für alle vorkommenden Beanspruchungen mittiger<br />
Druck bis zweiachsige Biegung mit Normalkraft mit planmäßiger Torsinn - die Nachweise an gabelgelagerten<br />
Trägern, Stützen <strong>und</strong> Rahmenstielen mit vollständiger Angabe der Nachweisformeln<br />
durchgerechnet.<br />
Die nachfolgenden Beispiele 8a bis 16b sind so gewählt, daß der Einfluß der konstruktiven Gestaltung<br />
des Gesamttragwerks auf die Nachweise des herausgelösten Teiltragwerks deutlich wird.<br />
Dargestellt sind jeweils das Gesamttragwerk <strong>und</strong> herausgelöste Teiltragwerke, die den Nachweisen<br />
zugr<strong>und</strong>egelegt werden.<br />
Die Lagerungen <strong>und</strong> die abstützenden Bauteile (z. B. Verbände, Trapezprofile u. a.) sind z. T. detailliert<br />
dargestellt <strong>und</strong> erläutert. Die Beispiele sind vollständig durchgerechnet, bei allen Nachweisschritten<br />
sind Hinweise auf die „F<strong>und</strong>stellen“ in Teil B, mit Nachweisnummern oder Abschnittsnummern,<br />
in der die verwendeten Formeln oder Bemessungshilfen zu finden sind, angegeben.<br />
bauingenieur24 Informationsdienste oHG • Nordstrasse 19 • 63505 Langenselbold