Volker Michels "Spitzbübischer Spötter" und "treuherzige Nachtigall ...
Volker Michels "Spitzbübischer Spötter" und "treuherzige Nachtigall ...
Volker Michels "Spitzbübischer Spötter" und "treuherzige Nachtigall ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Volker</strong> <strong>Michels</strong><br />
"<strong>Spitzbübischer</strong> Spötter" <strong>und</strong> "<strong>treuherzige</strong> <strong>Nachtigall</strong>"?<br />
Thomas Mann <strong>und</strong> Hermann Hesse<br />
Der Schweizer Literaturkritiker Otto Basler (1902-1984) hat tos eiae<br />
charakteristische Anekdete überliefert. Er war mit den beiden Dichtern so gut<br />
befre<strong>und</strong>et, daß sie ihn sogar in seinem Herrn im Aargau besuchten. Als<br />
Thomas Mann am 6. Juli 1950 vor seiner Haustür stand, begrüßte ihn Otto<br />
Basler mit dem Schiller-Zitat: "Ein werter, treuer Gast, kein bessrer Mann ist<br />
über diese Schwelle noch gegangen." Daraufhabe Thomas Mann einen ,<br />
Augenblick gestutzt, seinen Fuß von der Stufe zurückgezogen <strong>und</strong> vÄwunHert<br />
geantwortet: "Aber sagen Sie, lieber Fre<strong>und</strong>, ist nicht kürzlich Hermann Hesse<br />
dagewesen?" "Ja, das schon", antwortete Otto Basler "aber er betrat das Haus<br />
von der anderen Seite." "Ach so," erwiderte Thomas Mann <strong>und</strong> trat daraufhin «<br />
»unter ein.<br />
Bis es zu dieser Wertschätzung kam, dauerte es wohl zwanzig Jahre.<br />
"<strong>Spitzbübischer</strong> Spötter" hat Hermann Hesse seinen Kollegen genannt, <strong>und</strong><br />
eine <strong>Nachtigall</strong> unter all den Kanarienvögeln in den Käfigen deutscher Haus-<br />
backenheit war Hesse für Thomas Mann. Was hat die beiden zuerst getrennt,<br />
um sie dann schließlich auf eine Weise zu verbinden, die, wie Thomas Mann<br />
einmal sagte, "aus Verschiedenheiten so gut ihre Nahrung zog wie aus<br />
Ähnlichkeiten"?<br />
Unsere Herkunft, werden wir nicht los, so sehr wir uns auch davon zu<br />
emanzipieren <strong>und</strong> abzuheben versuchen. Die Weichenstellungen der Kindheit<br />
bleiben erhalten, welches Fortbewegungsmittel man später auch immer<br />
benützt. In der deutschen Literatur unseres Jahrh<strong>und</strong>erts läßt sich das kaum<br />
besser studieren, als am Schicksal <strong>und</strong> Werk von Thomas Mann <strong>und</strong> Hermann<br />
Hesse, ihrer mittlerweile in aller Welt wohl wirkungsvollsten Vertreter. Bis<br />
hinein in ihren Lebensstil sind auch sie trotz aller Emanzipation zeitlebens<br />
geblieben, was ihre Väter waren: norddeutscher Großbürger <strong>und</strong> auf<br />
öffentliche Selbstdarstellung bedachter Senatorensohn der eine, süddeutscher<br />
Asket <strong>und</strong> Missionszögling der andere. Beide aus dem Nest gefallen <strong>und</strong><br />
deshalb von den zurückbleibenden Hütern der Herkunft als Nestbeschmutzer<br />
bezichtigt. Doch was haben sie aus ihrer Mitgift gemacht!<br />
Was seit Generationen nur auf die materielle Bereicherung eines Lübecker<br />
Kaufmannsgeschlechtes bedacht war, wurde durch Thomas Mann aus der<br />
Sphäre des sippengeb<strong>und</strong>enen Eigennutzes auf eine Weise ins Menschheitliche<br />
resozialisiert, daß Millionen von Menschen davon profitieren konnten. Und<br />
was bei den Vorfahren Hermann Hesses mit ihrer sogenannten Heidenmission
auf eine Bekehrung uijd religiöse Unterwerfung Asiens angelegt war, führte<br />
bei ihm zu einer Revision jeder eurozentrischen, konfessionellen <strong>und</strong> ' ; »<br />
kolonialen Anmaßung. Es bewirkte im Westen eine Popularisierung<br />
buddhistischen, hinduistischen <strong>und</strong> taoistischen Gedankengutes, dank einer<br />
.. fit"! V' •'•-V-ll. v- A Z :- l -t<br />
poetischen Überzeugungskraft' die den Alleingültigkeitswahn der christlichen<br />
Kirchen durch ^neinschaösfordernde Brückenschläge zu überwinden noch<br />
immer in vollem Gang ist. Daß die vita activa, also der aggressive Wettlauf um<br />
Profit <strong>und</strong> Karriere in zivilisatorischem Selbstmord münden muß ohne die vita<br />
contemplativa, die Gegensteuerung dessen, was Lebensqualität <strong>und</strong><br />
Menschlichkeit ausmachen, ist selten konfessionsübergreifend-glaubwürdiger<br />
vorgelebt <strong>und</strong> in so einprägsame dichterische Gleichnisse gebracht worden wie<br />
vom entlaufenen Theologensohn Hermann Hesse.<br />
Die Wirkungsgeschichte von Thomas Mann <strong>und</strong> des um zwei Jahre jüngeren<br />
Hermann Hesse hat also, was iteÄ-feeider weltweite Wertschätzung betrifft,<br />
manches gemeinsam, wenn sich auch ihr Leserpublikum in aufschlußreicher<br />
Weise unterscheidet. Sind es vor allem die Vierzehn- bis Fünf<strong>und</strong>dreißigj<br />
ährigen, ganz gleich, ob mit oder ohne Hochschulbildung, die Hermann Hesse<br />
lesen, <strong>und</strong> dann wieder ältere Menschen, sobald sie das Berufsleben <strong>und</strong> die<br />
damit verb<strong>und</strong>enen Anpassungszwänge hinter sich haben, so ist es bei Thomas<br />
Mann eher die akademische Jugend, sind es die Berufstätigen <strong>und</strong> Karriere-<br />
bewußten aller Altersstufen, die zu seinen Büchern greifen. Das-hal, wie wil<br />
,^AiüagenmdJhres-AnspruehesTiegen. Und doch waren, so unterschiedlich sieh<br />
4- ,' !_, ,f.jj kt^djtg.^,<br />
Ausgangskonstellatiönen^^efßlüffend ähn-<br />
lich.<br />
Ein Glückwunschbrief Thomas Manns zu Hermann Hesses 75. Geburtstag<br />
schließt mit den Worten: "Auf Wiedersehen lieber alter Weggenosse durchs<br />
Tal der Tränen, worin uns beiden der Trost der Träume gegeben war, des<br />
Spieles <strong>und</strong> der Form."<br />
Der Trost der Träume? Wie Thomas Mann war auch Hermann Hesse von<br />
Kindesbeinen an darauf angewiesen, sich herauszuträumen aus einem Alltag,<br />
mit dem er sich nur schwer abfinden konnte. Schon die Erwartungen der Eltern<br />
<strong>und</strong> der Schule machten beiden zu schaffen. Sie nicht erfüllen zu können, war<br />
das lebensbestimmende Trauma, das Thomas Mann <strong>und</strong> Hesse verband. Was<br />
sie bereits am Gymnasium scheitern ließ, war das Gegenteil dessen, was man<br />
ihnen dort ins Zeugnis schrieb. Es war nicht ein Mangel an Begabung <strong>und</strong><br />
Gutwilligkeit, sondern deren Übermaß, was sie daran hinderte, den<br />
Zukunftsplänen der Familie <strong>und</strong> den Bildungsvorstellungen der Schule zu ent-
sprechen <strong>und</strong> sich mitflormativer Schnellfertigkeit fcÄdafctik gymnasialen<br />
Wissensvermittlung zu fugen. Wer den Drill nicht ertrug, in einem Minimum<br />
WVb iTiii rjfii'^'<br />
an Zeit, ein Maximum unterschiedlichsten Wissensstoffes unreilelfeert zu<br />
' i /<br />
speichern <strong>und</strong> automatenhaft abruf bar zu haben, galt als faul oder als renitenter<br />
Träumer. Wen aber das Gelernte beschäftigte <strong>und</strong> aufwühlte, wie die Odyssee<br />
des Homer den jungen Hans Giebenrath in Hesses Unterm Rad oder Schillers<br />
Don Carlos den Tonio Kroger in Thomas Manns gleichnamiger Erzählung, der<br />
blieb zurück <strong>und</strong> verpaßte den Anschluß. Denn die Überflutung mit immer<br />
neuen; Informationen behindert das Bedürfnis,-sie zu durchdringen. Und nicht<br />
zuletzt die Abneigung gegen solche Schnellfertigkeit nötigte Thomas Mann<br />
wie Hermann Hesse, das Gymnasium schon mit Sek<strong>und</strong>areife zu verlassen;<br />
Hesse mit sechzehn, Thomas Mann mit achtzehn Jahren, weil er zwei Klassen<br />
wiederholen mußte. Ein folgenreiches Stigma für beide, denn die Demütigung<br />
des Selbstwertgefühls, die daraus entsprang, brachte sie dazu, alsbald den<br />
Gegenbeweis anzutreten, also den Vorwurf der Träumerei <strong>und</strong> Trägheit zu<br />
widerlegen <strong>und</strong> durch ein Lebenswerk zu rechtfertigen, das als Erkenntnis-,<br />
Fleiß- <strong>und</strong> Bildungsleistung alles übertrifft, was durch gymnasiale <strong>und</strong><br />
akademische Wissensvermittlung erreicht werden kann. Wie unauslöschlich<br />
dieses frühe Trauma gewesen sein muß, zeigt sich unter anderem darin, daß<br />
noch der 76jährige Thomas Mann in seinem letzten Werk, Felix Krull, das<br />
bereits 1909 konzipierte Hochstaplermotiv wieder aufgreift <strong>und</strong> Hesse<br />
gleichfalls im Alter von mehr als siebzig Jahren immer noch träumt, die drei<br />
letzten Schulklassen bis zum Abitur nachholen zu müssen, um - wie er sagt<br />
"vielleicht doch noch etwas Rechtes zu werden".<br />
Die Triebfeder für Thomas Manns erzählerisches Werk war eine Form, wie er<br />
es nannte, "sublimer Rache an der Wirklichkeit". Sie spornte ihn an, sich auf<br />
eigene Faust Kenntnisse aus fast allen akademischen Disziplinen <strong>und</strong> Wissensgebieten<br />
anzueignen, um es in seinen Büchern denen zeigen zu können, die<br />
sich angemaßt hatten, ihn in der Schule zweimal sitzen zu lassen. So lesen sich<br />
Romane wie Königliche Hoheit aufweite Strecken wie ein Exkurs in<br />
Volkswirtschaft, Der Zauberberg wie eine Enzyklopädie der Medizin <strong>und</strong><br />
geistigen Strömungen der zwanziger Jahre, die Josephs-Romane wie eine<br />
archäologisch-völkerk<strong>und</strong>liche Kulturgeschichte, wofür denn auch die<br />
Fachwissenschaftler Thomas Mann einen oft geradezu neidischen Respekt<br />
gezollt <strong>und</strong> ihn mit Ehrendoktorhüten der verschiedensten Disziplinen<br />
eingedeckt haben, natürlich zu dessen größtem Vergnügen <strong>und</strong> verschmitzter<br />
Genugtuung.<br />
Hesse dagegen hat ein kulturkritisches Werk von etwa dreitausend<br />
Buchbesprechungen hinterlassen, worin er von der Jahrh<strong>und</strong>ertwende bis in die
50er Jahre hinein die deutsche Publizistik auf eine Weise kommentiert,<br />
begleitet <strong>und</strong> befruchtet hat, daß sogar der unbestechliche Kurt Tucholsky<br />
nicht umhin kam, in der Zeitschrift "Die Weltbühne" festzustellen: "Hesses<br />
Buchkritiken haben in Deutschland kein Gegenstück. Aus jeder kann man<br />
etwas lernen, sehr viel sogar." Hesse selbst hat dieses riesige bildungspolitische<br />
Panorama, das - wenn es einmal komplett veröffentlicht sein wird -, wohl fünf<br />
Bände mit insgesamt viertausend Seiten füllt, nie in Buchform zusammen-<br />
gefaßt. Diese Schriften erschienen zu seine Lebzeiten verstreut in etwa sechzig<br />
verschiedenen deutschen <strong>und</strong> ausländischen Blättern <strong>und</strong> gehören zu den<br />
imponierendsten Überraschungen seines Nachlasses. Auf ganz andere Weise<br />
als Thomas Mann, doch in Wirkung <strong>und</strong> pädagogischem Eros durchaus<br />
vergleichbar, hat Hesse damit sein Defizit an fahrplanmäßiger Ausbildung<br />
durch eine Leistung wettgemacht, die jeden Akademiker beschämen müßte.<br />
Eine sehnsüchtige Eifersucht auf die Unbeschwertheit <strong>und</strong> Grazie der<br />
Leichtlebigen <strong>und</strong> ein Insuffizienzgefühl gegenüber den Normalen <strong>und</strong> An-<br />
passungsfähigen, denen ihr dickes Fell <strong>und</strong> ihre Sendungslosigkeit das Leben<br />
so sehr erleichtert, ist eines der in den verschiedendsten Verkleidungen wiederkehrenden<br />
Hauptmotive der Bücher Thomas Manns. Es ist das Los des kleinen<br />
Hanno Buddenbrook, der in der Musik einen Schutz sucht vor den Gewaltsamkeiten<br />
der Schule <strong>und</strong> dem karrierebestimmten Erwartungsdruck seines Vaters,<br />
unter dem er zerbricht. Es ist auch das Los des lebenslinkischen Tonio Kroger,<br />
der nie von den um ihrer Unbeschwertheit so sehnsüchtig geliebten Hans<br />
Hansen <strong>und</strong> Inge Holm als ihresgleichen akzeptiert <strong>und</strong> wiedergeliebt werden<br />
kann, weil seine schwerblütige Nachdenklichkeit ihrem rechenschaftslosen<br />
Charme nicht gewachsen ist. "Ich bin so dumm, immer die zu lieben, die<br />
clever sind, obwohl ich doch auf Dauer nicht mitkann", bekennt Thomas Mann<br />
1901 seinem Bruder Heinrich. Dasselbe Motiv kehrt dann wieder in Königliche<br />
Hoheit, dem Roman des Dreißigjährigen, der nach dem Erfolg der Budden-<br />
brooks so sehr an Selbstbewußtsein gewonnen hat, daß er von nun an seine<br />
Insuffizienzgefühle nicht mehr als Makel, sondern als repräsentative Auszeichnung<br />
zu erkennen <strong>und</strong> zu stilisieren beginnt. So ist sein Prinz Klaus Heinrich
Degeneration als auch die hoffnungslose Finanzlage des Fürstenhauses<br />
aufzufangen. Die lebensgeschichtlichen Parallelen zwischen dem Helden <strong>und</strong><br />
seinem Erfinder sind offensichtlich. Damals hatte Thomas Mann die aus<br />
vermögender Professorenfamilie stammende Abiturientin Katja Pringsheim<br />
geheiratet, deren ungebrochene Lebenstüchtigkeit seinen eigenen Mangel<br />
Cl ' " ( !<br />
daran stabilisierte <strong>und</strong> deren bildungsbürgerliche Herkunft den gescheiterten<br />
Gymnasiasten nun auch ins akademische Großbürgertum aufsteigen ließ. Wie<br />
sein Prinz Klaus Heinrich hat der Leistungsethiker Thomas Mann dies nach<br />
<strong>und</strong> nach auf eine Weise gerechtfertigt, daß selbst sein künftiges Liebäugeln<br />
mit der Rolle als Nach- <strong>und</strong> Thronfolger Richard Wagners, Schillers <strong>und</strong><br />
Goethes, ja, schließlich gar sein Selbstbewußtsein als Präzeptor Germaniae<br />
wohl heute nur noch von Analphabeten als anmaßend empf<strong>und</strong>en werden<br />
(^V.-fvlt-fv-"-.» «'•, ' «!.'f<br />
kann. (Wir kennen ja seinen kühnen, doch keineswegs ungerechtfertigten<br />
Ausspruch: "Wo ich bin, ist die deutsche Kultur" aus seiner Exilzeit in den<br />
USA.) /<br />
Das Muster vom weltfremden Simplicissimus, der dank seines Min-<br />
derwertigkeitsgefühls gezwungen ist, sich die Welt genauer anzuschauen^ als<br />
jede der gängigen Weltanschauungen es vermag, setzt sich dann fort in dem<br />
von jeder Schulbildung unbeleckten, doch um so wissensbegierigeren Hochstapler<br />
Felix Krull, beim ahnungslosen Hans Castorp auf dem Zauberberg,<br />
beim verträumten, <strong>und</strong> deshalb allen Träumen gewachsenen Joseph der gleichnamigen<br />
Romane, beim Doktor Faustus, den sein Teufelspakt mit eter t HZ f<br />
Geschlechtskrankheit zum Genie werden läßt, <strong>und</strong> schließlich bei dem in<br />
Sünde gezeugten <strong>und</strong> den Inzest fortsetzenden Gregorius, einem<br />
Unglückswurm, den Makel <strong>und</strong> Sünde zum Erwählten <strong>und</strong> schließlich zum<br />
Papst aufsteigen lassen.<br />
Welthaltiger <strong>und</strong> ambitionierter hat niemand eine Schwäche in Stärke,<br />
Minderwertigkeitsgefühle in Mehrwert uifä?i8&»e«©jzu läutern verstanden.<br />
Und dies auf einem Niveau, das nicht nur stimmig, sondern auch tröstlich <strong>und</strong><br />
anspornend ist. - Soweit Thomas Mann.<br />
Der aus vergleichsweise ärmlichen, kleinstädtisch-schwäbischen Verhältnissen<br />
stammende Hermann Hesse dagegen kam aus ohne Königliche Hoheiten,<br />
Hochstapler, Pharaonen <strong>und</strong> Päpste. Er hat dasselbe Problem ohne Anspruch<br />
auf Glanz <strong>und</strong> Repräsentanz gemeistert <strong>und</strong> sein unfreiwilliges Außenseitertum<br />
durchaus nicht als stolze Auszeichnung bewirtschaftet, sondern als leidvolle,<br />
doch funkensprühende Reibung an den Spielregeln einer von Profitstreben,<br />
Bigotterie, kolonialem, industriellem <strong>und</strong> nationalem Größenwahn korrum-
pierten Gesellschaft, die jedem das Leben zur Hölle macht, der es wagt, ein<br />
Original zu bleiben <strong>und</strong> sich nicht verbiegen zu lassen von einer Anpassung<br />
ans Übliche.<br />
Die Figuren semer Erzählungen <strong>und</strong> Romane vom zivilisationsüberdrüssigen<br />
Peter Camenzind, zum Landstreicher Knulp bis hin zum Steppenwolf sind<br />
keine Helden, die sich siegreich hervortun aus der Sphäre ihrer Herkunft,<br />
sondern sie bleiben Gebeutelte, Einzelgänger <strong>und</strong> Sonderlinge, die sich jeder<br />
auf seine Weise zur Wehr setzen, sobald Konvention <strong>und</strong> Fremdbestimmung<br />
sie daran hindern, ihre Anlage <strong>und</strong> Eigenständigkeit zu behaupten. Es sind<br />
Outsider, Abenteurer, Vaganten <strong>und</strong> Heimatlose, mitunter auch aus irgendeiner<br />
Not heraus straffällig Gewordene <strong>und</strong> nicht zuletzt solche, die mit alternativen<br />
Existenzformen experimentieren, wie Hesse selbst, der sich dreißigjährig in die<br />
Lebensreformerkolonie auf dem Monte Verita begab, um auszuprobieren, ob<br />
deren übrigens schon damals ökologisch <strong>und</strong> ganzheitlich orientierte Methoden<br />
eines "Zurück zur Natur" noch trag- <strong>und</strong> zukunftsfähig seien. Undenkbar, sich<br />
den Verfasser der Königlichen Hoheit vorzustellen in dieser Freikörper-<br />
Komune von Aussteigern, vegetarischen Kohlrabi-Aposteln, Magnetopathen<br />
<strong>und</strong> Sektierern. Nach knapp einem Monat war Hesse kuriert vom<br />
Anachronismus solcher Experimente, um sich daraufhin erstmals mit<br />
asiatischen Gegenmodellen zum militanten Imponiergehabe des -,-./<br />
WHfeelminisehenJ^lüsGh'--<strong>und</strong> Pomp-Zeitakers zu befassen <strong>und</strong> wenige Jahre<br />
später den indischen Subkontinent zu bereisen, auf der Suche nach humaneren<br />
Spielarten des Zusammenlebens. Daß er sie auch im dortigen Alltag nur noch<br />
in Spurenelementen fand, hat nichts zu besagen, lieferten sie ihm doch<br />
Anstöße, die er in Büchern wie Demian, Siddhartha, Die Morgenlandfahrt <strong>und</strong><br />
dem Glasperlenspiel mit den humanistischen Traditionen des Abendlandes in<br />
Einklang zu bringen <strong>und</strong> zu einem Kontrastprogramm auszubauen verstand,<br />
dessen Aktualität die fulminante Wirkungsgeschichte seiner Bücher beweist.<br />
Vt x* = l ^ •"" ' * '<br />
Mittlerweile sind sie r<strong>und</strong> um den Globus in -annähernd h<strong>und</strong>ert Millionen<br />
Exemplaren verbreitet, ein Phänomen, das einzigartig ist in der Geschichte der<br />
deutschen Literatur.<br />
Bei Hesse also kein genüßliches Abbilden <strong>und</strong> spöttisches Kratzen am<br />
Lack der bestehenden Verhältnisse, sondern ein ruheloses, auf deren Humani-<br />
sierung bedachtes Ungenügen. Getreu seiner Devise: "Damit das Mögliche entsteht,<br />
muß immer wieder das Unmögliche versucht werden." Bein!<br />
kleinstädtichen Pfarrerssohn also: Sympathie mit dem Schicksal der kleinen<br />
Leute, ganz in der auf Weltverbesserung zielenden Tradition seiner<br />
missionierenden Vorfahren.
Beim hanseatischen Patritziersohn Thomas Mann dieselbe Verkettung mit der<br />
Herkunft: also wahlverwandtschaftliches Identifizieren mit Repräsentanten,<br />
parodistischer Abstand vom Durchschnittsmenschen. Dichtung als Selbststili-<br />
sierung, aber mit gedeckten Schecks, ohne falsche Anmaßung.<br />
Bei Hesse dagegen Dichtung als Bekenntnis <strong>und</strong> Selbsttherapie in Seelen-<br />
biographien, welche die individuelle Misere nicht überhöhen, sondern<br />
schonungslos bloßlegen. Bei Hesse Introversion, Extrovertiertheit bei Thomas<br />
Mann, der seine Gestalten mit seitenlangen Beschreibungen ihres Äußeren zu<br />
charakterisieren versteht. Bei Hesse stattdessen ein an Identifikation grenzen-<br />
8". i, ' , *
hatte, an einem der ersten Apriltage des Jahres 1904. "Beide waren wir noch<br />
Junggesellen", erinnert sich Hesse. "Im übrigen freilich waren wir einander<br />
nicht sehr ähnlich, man konnte es uns schon an Kleidung <strong>und</strong> Schuhzeug<br />
ansehen."<br />
Was wteii^erterJBffl^^^^Ttes-Äsop die elegante Stadtmaus Thomas<br />
Mann von der unscheinbaren Feldmaus Hermann Hesse damals gehalten haben<br />
muß, klingt nach in einem Antwortschreiben, welches er im Februar 1907 an<br />
den Herausgeber von S. Fischers Zeitschrift "Die Neue R<strong>und</strong>schau" gerichtet<br />
hat auf dessen Besorgnis hin, sein Mitarbeiter Thomas Mann werde abwandern<br />
in Hesses soeben gegründete Münchner Kulturzeitschrift "März": "Seien Sie<br />
unbesorgt", heißt es in dieser ersten bisher auffindbaren Äußerung Thomas<br />
*.. '. -,.t - 'c'-f-f.' »<br />
Manns über Hesse, "ich finde den >März< philiströs <strong>und</strong> ruppig. Politisch:<br />
süddeutsch-demokratisch <strong>und</strong> litterarisch: Hermann Hesse - nun, ich bin kein<br />
Ästhet, aber das ist mir zu treuherzig." Damals schrieb Thomas Mann gerade<br />
seine Königliche Hoheit, dieses virtuose, dieh-noch ganz demokratieferne<br />
Selbstportrait, Welten entfernt von Hesses meinetwegen <strong>treuherzige</strong>m Peter<br />
Camenzind oder von Unterm Rad mit seinen Ausfällen gegen den Kaiser <strong>und</strong><br />
die Präpotenz der preußischen Hohenzollern mit ihren blanken Kanonen, doch<br />
nicht mehr so weit entfernt von der Künstlerproblematik des Musikerromans<br />
Gertrud, an dem Hesse damals etwa gleichzeitig schrieb. Hesse äußerte sich<br />
über die erste Begegnung mit Thomas Mann schon in einem Brief vom<br />
November 1904 an Alexander von Bernus: "In München war ich einmal einen<br />
Abend mit ihm zusammen <strong>und</strong> fand ihn fein <strong>und</strong> sympathisch."<br />
1910 erschien in der Zeitschrift "März" Hesses zweite öffentliche Äußerung<br />
über den Kollegen, eine dreiseitige, nicht ganz unkritische Empfehlung von<br />
Königliche Hoheit unter dem Titel "Gute neue Bücher".<br />
Diese wollen wir etwas genauer ansehen, nicht ihrer kritischen Vorbehalte<br />
wegen, sondern weil sie die Unterschiede zwischen Hesses vermeintlicher<br />
Treuherzigkeit <strong>und</strong> der durchtriebeneren Erzählweise Thomas Manns sehr<br />
schön aufzeigt. Wieder beginnt Hesse seine Besprechung mit einer Referenz an<br />
die Buddenbrooks, die er als ein Werk bezeichnet, das man im Lauf der Jahre<br />
mit eigenem Erleben verwechseln könne. "Die Buddenbrooks waren so<br />
absichtslos, unerf<strong>und</strong>en, natürlich <strong>und</strong> überzeugend wie ein Stück Natur, man<br />
verlor ihnen gegenüber den ästhetischen Standpunkt <strong>und</strong> gab sich hui wie dem<br />
Anblick eines natürlichen Geschehens." Königliche Hoheit dagegen sei "nur<br />
ein Roman, etwas Gewelltes, dem wir mit Interesse, Liebe, Bew<strong>und</strong>erung, aber<br />
nicht mit solch selbstvergessener Hingenommenheit folgen". Thomas Mann<br />
habe zwar eine Sicherheit des Geschmacks, die auf höchster Bildung beruht,<br />
nicht aber die traumwandlerische Sicherheit des naiven Genies. Dieses denke
überhaupt nicht an die Leser. Thomas Mann jedoch, der mißtrauische<br />
Intellektuelle, suche sein Publikum auf Distanz zu halten, indem er es<br />
einerseits ironisiere, ihm andererseits aber wieder Erleichterungen <strong>und</strong><br />
Eselsbrücken baue. Dazu gehöre die boshafte Manier, jede Figur bei ihrem<br />
Wiederauftreten ihre stereotypen Attribute vorzeigen zu lassen <strong>und</strong> ein etwas<br />
geschmackloses Spiel mit Namen <strong>und</strong> Masken zu treiben. "Er bringt einen<br />
Doktor Überbein mit grüner Gesichtshaut <strong>und</strong> rotem Bart, ein Fräulein<br />
Unschlitt, die Tochter eines Seifensieders, auch einen Herrn Schustermann mit<br />
seinen Zeitungsausschnitten", Figuren, die nichts als Masken seien. Wenn man<br />
dagegen eine von Thomas Manns unglaublich liebevollen Naturbetrachtungen<br />
oder einen seiner leuchtenden Sätze über Kunst gelesen habe, begreife man<br />
nicht, wie derselbe Mensch seine Kunst so mißbrauchen könne. Denn mit<br />
seinen gewiß witzigen, amüsanten <strong>und</strong> heimlich befriedigenden Antreibereien<br />
des Publikums räume er dem gemeinen Leser eine Art Überlegenheit ein, um<br />
ihm alles Feine, Ernsthafte, Sagenswerte dafür zu unterschlagen, denn das sage<br />
t*VMl«-wer<br />
zwar auch, aber so zart <strong>und</strong> nebenbei, daß j«»sr es nicht mehr merke. "Wir<br />
möchten einmal", so schließt Hesses Besprechung, "ein Buch von Thomas<br />
Mann lesen, in dem er an den Leser gar nicht denkt, in dem er niemand zu<br />
verlocken <strong>und</strong> niemand zu ironisieren trachtet. Wir werden dieses Buch nie<br />
bekommen. Denn jenes Spiel mit der Maus gehört bei Thomas Mann zum<br />
Wesen." Gleichwohl sei Königliche Hoheit ein Anlaß zur Freude. Denn selbst<br />
das Unscheinbarste, was von diesem feinen Schriftsteller komme, stehe immer<br />
noch hoch über dem Üblichen.<br />
Das "März"-Heft mit dieser Kritik hat Hesse dem ihm inzwischen ja persönlich<br />
bekannten Thomas Mann zugeschickt, verb<strong>und</strong>en mit einer erneuten Einladung<br />
zur Mitarbeit jener von ihm <strong>und</strong> Ludwig Thoma herausgegebenen Zeitschrift,<br />
die Thomas Mann nun befolgte.<br />
In seiner Antwort bestreitet Thomas Mann ein bewußtes Liebäugeln mit dem<br />
Publikum <strong>und</strong> rechtfertigt sowohl seine karikierenden Namen als auch das<br />
stereotype Wiederholen immer derselben äußeren Attribute bei Nebenfiguren<br />
mit seiner Vorliebe für die "demagogische Kunst" Richard Wagners, die ihn,<br />
wie er schreibt, "vielleicht für immer beeinflußt, um nicht zu sagen korrum-<br />
piert ha^er"<br />
Es ist Richard Wagners auf Rausch, Monumentalität <strong>und</strong> suggestive<br />
Überwältigung bedachter Trend zum Gesamtkunstwerk <strong>und</strong> die<br />
Kompositionstechnik des Leitmotives •ajte'Selbstzitqt, auf die Thomas Mann<br />
hier verweist <strong>und</strong> von der er tatsächlich niemals lassen konnte bis in seine<br />
letzten Romane hinein. Denn die Prägung durch diesen Tonkünstler, dem er in<br />
solcher Haßliebe verfallen war, daß er ihn als "pathetischen Theatraliker"
10<br />
bezeichnen konnte, war Thomas Manns frühestes Bildungserlebnis, das ihm im<br />
Guten wie im Problematischen künftig noch viel zu schaffen machen sollte.<br />
Wagnersches Nibelungen-Muskelspiel rumort auch im romantisierenden<br />
Patriotismus seiner Stellungnahmen zum Ersten Weltkrieg, die auf eine<br />
Verhöhnung der Gegner Deutschlands, insbesondere, der von seinem Bruder<br />
Heinrich so hochgeschätzten französichen Nachbarn hinausliefen.<br />
Hesses musikalische Vorlieben dagegen galten dem 15. bis 18. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
den kristallinen Ordnungen der Harmonielehre Bachs, der Barock-<br />
musik, Mozart bis Chopin <strong>und</strong> dem auch von Thomas Mann geliebten Franz<br />
Schubert. Über Thomas Manns Verhältnis zur Musik schrieb Hesse 1949 in<br />
einem Brief an Karl Dettinger: "Es ist ein romantisch-sentimentales, <strong>und</strong> er hat<br />
mit ungeheurem Fleiß ein intellektuelles daraus gemacht." Über Wagner<br />
sollten die beiden bei ihren späteren Zusammenkünften noch viel debattieren.<br />
Und als die Nationalsozialisten im März 1934 in Leipzig Wagner-Festspiele<br />
inszenierten, wobei nun auch Hitler sich intim mit dem Komponisten verglich,<br />
schrieb Hesse dem Kollegen beinah schadenfroh: "Sie wissen ja, daß ich in<br />
dem, was Sie Abschätziges <strong>und</strong> Kritisches über Wagners Theatralik <strong>und</strong><br />
Großmannssucht sagen, sehr mit Ihnen übereinstimme, während Ihre Dennoch-<br />
Liebe zu Wagner mir zwar ehrwürdig <strong>und</strong> auch rührend, aber doch nur halb<br />
verständlich ist... Ich kann ihn, offen gesagt, nicht ausstehen. Und vermutlich<br />
empfand ich bei dem Blick auf jene Zeitung mit Hitlers Superlativen über<br />
Wagner Ihnen gegenüber etwas wie: >Da haben Sie Ihren Wagner
würdigen... Dagegen sah ich in einem Nebenraum einige Stücke von<br />
11<br />
Nietzsche, wegen dem ich als Jüngling öfter von Basel für einen Sonntag nach<br />
Luzern fuhr, die mir den Besuch reichlich lohnten."<br />
Mit Nietzsche war man wieder auf dem Boden der Gemeinsamkeiten. Denn für<br />
den Verfasser des Doktor Faustus wie für den Autor von Zarathustras<br />
Wiederkehr ist Nietzsche ein lebensbestimmender Kompaß gewesen. Thomas<br />
Mann verehrte in Nietzsche den erfahrensten Psychologen der Dekadenz,<br />
Hesse den Anti-Patrioten <strong>und</strong> Kritiker jedes Kollektivismus, für den nur das<br />
Gewissen die höchste Instanz war. Diese bei aller Liebe doch wieder recht<br />
verschiedene Form ihrer Nietzsche-Aneignung war es denn auch, was die<br />
lange Sendepause ihres eben erst begonnenen Zwiegespräches bis in den<br />
Ersten Weltkrieg hinein erklärt.<br />
Hesse hatte Deutschland 1912 verlassen <strong>und</strong> war mit seiner Familie<br />
zurück in die Schweiz, ffl3as^erloffiftsland"semef-Frau, nach Bern übersiedelt,<br />
nicht zuletzt aus einem Unbehagen an den realen königlichen Hoheiten<br />
in Berlin, gegen deren prahlerisches Regiment seine Mitarbeit an den Zeitschriften<br />
"Simplicissimus" <strong>und</strong> "März" gerichtet war. Den Ausbruch des Ersten<br />
Weltkriegs erlebte Hesse also bereits im Exil, während Thomas Mann ihn von<br />
München aus verfolgte. Das mag zu der ganz unterschiedlichen Weise beige-<br />
tragen haben, womit sie damals auf diese rauschhafte Heimsuchung reagierten.<br />
Zwar war auch Hesse bis 1915 keineswegs frei von solidarischen Sympathien<br />
zu seinen Landsleuten, wie wir inzwischen aus seinen Briefen <strong>und</strong> Tagebuch-<br />
notizen wissen, aber die nationalistische Selbstzerfleischung Europas empfand<br />
er als barbarisch <strong>und</strong> rückständig. Einzig die Hoffnung, daß der Krieg endlich<br />
der Monarchie den Garaus machen <strong>und</strong> Deutschland eine sozialere Gesell-<br />
schaftsordnung bescheren werde, ließ ihn noch eine Zeitlang über die Zweckmäßigkeit<br />
des Gemetzels schwanken. Seine öffentlichen Stellungnahmen<br />
jedoch, vom Aufruf "O Fre<strong>und</strong>e nicht diese Töne" im Oktober 1914 bis bin zu<br />
Zarathustras Wiederkehr im Januar 1919, waren alle gegen die deutsche<br />
Kriegsführung gerichtet.<br />
| DeFI^SScH verstorbene Schweizer Thomas Mann-Forscher Hans Wysling hat<br />
in seinem Hauptwerk, der in jeder Hinsicht gewichtigen Thomas Mann-<br />
Bildbiographie Hesse zu den Propragandisten des Krieges gezählt, in einem<br />
Zug mit Thomas Mann, Hofmannsthal, Hauptmann, Musil, Döblin, Kerr <strong>und</strong><br />
vielen anderen. Um dies zu belegen, faksimilierte er neben Thomas Manns<br />
Gedanken im Kriege eine ganzefDoppelseite mit zwölf ähnliehen<br />
publizistischen Hymnen anderer "Autoren auf die große Zeit, doch für Hesse<br />
blieb er den Beleg schuldig. Denn es gibt keinen. Sein Hinweis darauf, daß
neben Thomas Mann auch andere Intellektuelle damals dem patrlojlschen<br />
Fieber erlegen sind, mag diesen entlasten. Aber pian ver4eckf eine der<br />
12<br />
entscheidenden Gr<strong>und</strong>lagen seiner künftigerjtBezlehung zu Hesse, wenn man<br />
die Unterschiede in ihrem Verhältnis^ Deutschland verwischt. Solidarität mit<br />
dem "Zauberer" in Ehren^jdotSi unter den Zauberlehrlingen von Peter de<br />
Mendelssohn über-Inge <strong>und</strong> Walter Jens, Hermann ldrjö|kejbis Marcel Reich-<br />
Ranicki gibt es eine fatale Tendenz, die politischen Differenzen zu frisieren,<br />
•-- • . ... , - ."•••-•-••-• - -,B^CT-«r_Tj.^fti"W "M. mj^^<br />
w^mit atieh ^^"fbürrrasrMsBftH-^Pöf SShungl^Sri.gedient sein*kaS^Es nimmt<br />
Thomas Mann nichts von seiner Größe, wenn man die Quelle der in seinem<br />
Leben verfänglichen, im Werk jedoch ungemein produktiv gewordenen<br />
Konflikte in seinem Bedürfnis nach Repräsentanz erkennt, ob er sie sich nun<br />
erfindet als Personalunion mit der Königlichen Hoheit des monarchistischen<br />
Deutschland, im Ersten Weltkrieg mit dem Soldatenkönig Friedrich dem<br />
Großen, oder ob er sie selber praktiziert, in der Weimarer Republik als<br />
Aushängeschild der Preußischen Akademie, als Sprecher der Emigranten im<br />
Exil oder im Kalten Krieg der Ost-West-Spannung als Überbrücker des<br />
Eisernen Vorhangs mit seinen Vortragsreisen sowohl ins kapitalistische wie ins<br />
kommunistische Deutschland 1947 <strong>und</strong> 1955 zu den Goethe- <strong>und</strong> Schiller-<br />
Feiern.<br />
Jeder dieser Rollen war Thomas Mann auf glanzvolle Weise gewachsen, hat er<br />
doch zu ihrer weltanschaulichen Rechtfertigung auf subtilere <strong>und</strong> gescheitere<br />
Weise argumentiert als alle Politiker. Nicht aus Opportunismus, wie seine<br />
Gegner ihm vorwerfen, sondern durch eine leidvolle politische Entwicklung<br />
aus patriarchalischer Traditionsverb<strong>und</strong>enheit <strong>und</strong> aristokratischem Künstlerbewußtsein<br />
("Demokratie sei die Bestimmung des Niveaus von unten her",<br />
sagte er im Ersten Weltkrieg) bis schließlich zur virtuosen Parteinahme für die<br />
Demokratie <strong>und</strong> Überwindung der ideologischen Schranken.<br />
Daß diese Entwicklung bei Hermann Hesse ungleich früher einsetzte,<br />
ist nicht verw<strong>und</strong>erlich. Uneitel, fern von allen schaustellerischen Ambitionen,<br />
weit weg von den Metropolen, von Wettbewerbs- <strong>und</strong> Profilierungsbedürf-<br />
nissen, öffentlichkeitsscheu <strong>und</strong> unbestechlich wie er war, sind ihm viele der<br />
Verstrickungen <strong>und</strong> Umwege Thomas Manns erspart geblieben. Aber auch das<br />
hatte seinen Preis in der geringeren Welthaltigkeit, Durchtriebenheit,<br />
Intellektualität <strong>und</strong> Komplexität seines Werkes, das wie ein Volkslied anmutet,<br />
verglichen mit der raffiniert symphonischen Umsetzung der übrigens oft<br />
verblüffend ähnlichen Motive <strong>und</strong> Themen bei Thomas Mann.<br />
Doch zurück in den Ersten Weltkrieg. Als Missionarssohn begründete<br />
Hesse 1915 die Mission seiner Kriegsgefangenenfürsorge, zu einem Zeitpunkt,<br />
als der Kaufmannssohn Thomas Mann noch dafür plädierte, daß Deutschland
zu seiner Radikalität im Geistigen nun endlich auch die realpolitische hin-<br />
13<br />
zugewinnen müsse. Das hielt ihn freilich nicht davon ab, den Kollegen Hesse<br />
bei seiner Sozialarbeit zu unterstützen.<br />
Der Krieg nahm seinen Lauf<strong>und</strong> bescherte Hesse damals schon das,<br />
was Thomas Mann erst 2wanzig Jahre später erleben sollte: die politische<br />
Ächtung der deutschen Presse als Vaterlandsverräter. Hesses politische Mahnrufe<br />
zwangen diesen ab 1917 sogar dazu, sich für seine zeitkritischen Ver-<br />
öffentlichungen einen Decknamen zuzulegen, ein Purgatorium, das er schließlich<br />
nur noch mit Hilfe der Psychoanalyse bewältigen konnte. Das Fegefeuer<br />
für Thomas Mann waren die Betrachtungen eines Unpolitischen, eine<br />
o- •-..<br />
virtuoses, mit allen Wassern der Dialektik gewaschenes Rechtfertigungs- <strong>und</strong><br />
Rückzugsgefecht vom Aristokraten zum Demokraten, das erst 1924 im<br />
Zauberberg seinen Abschluß fand.<br />
Die Selbsttherapie für Hesse war der Demian, 1917 geschrieben <strong>und</strong> zwei<br />
Jahre später pseudonym erschienen, bezeichnenderweise unter demselben<br />
Decknamen, den er auch für seine politischen Mahnrufe im Ersten Weltkrieg<br />
verwendet hatte: Emil Sinclair.<br />
Thomas Mann war einer der ersten Leser des Buches <strong>und</strong> notierte am<br />
29.5.1919 in sein Tagebuch: "Las die Erzählung von Sinclair weiter, mit<br />
größter Achtung <strong>und</strong> auch Unruhe, weil mir das psychoanalytische Element<br />
darin entschieden geistiger <strong>und</strong> bedeutender verwendet scheint als im Zauber-<br />
berg, aber stellenweise auf merkwürdig ähnliche Art." Weil er den Verfasser<br />
nicht erriet, schrieb er einige Tage später dem gemeinsamen Verleger S.<br />
Fischer: "Sagen Sie mir bitte: wer ist Emil Sinclair? Wie alt ist er, wo lebt er?<br />
Sein Demian hat mir mehr Eindruck gemacht, als irgendetwas Neues seit<br />
langem. Das ist eine schöne, kluge, ernste, bedeutende Arbeit. Ich las sie mit<br />
größter Bewegung <strong>und</strong> Freude... Auf so bedeutende Art hat noch keiner eine<br />
Erzählung in den Krieg münden lassen."<br />
In den Krieg münden sollte fünf Jahre später auch Thomas Manns Zauberberg,<br />
dessen begonnenes <strong>und</strong> wegen der Betrachtungen eines Unpolitischen beiseite<br />
gelegtes Manuskript er damals gerade wieder hervorgeholt hatte.<br />
Als Otto Flake dann ein Jahr später, auf einen Wink seiner Frau hin (denn die<br />
i (U W-ft^.v-7<br />
Frauen sind^meist die besseren Leser), das Sinclair-Pseudonym lüftete,<br />
vermerkt Thomas Mann in einem Brief an Philipp Witkop: "Sollte Demian,<br />
den ich sehr liebe wirklich von Hesse sein? Daß er dem Freudianismus so<br />
zugänglich war, sollte mich w<strong>und</strong>ern. Und warum dieses Versteckspiel - in<br />
einem Augenblick wo er sein Äußerstes <strong>und</strong> Bestes gab?" Noch Jahrzehnte<br />
später in seinem Vorwort zur amerikanischen Ausgabe des Demian vergleicht
14<br />
Thomas Mann die Erzählung mit Goethes Leiden des jungen Werther, weil sie<br />
"mit geheimnisvoller Genauigkeit den Nerv der Zeit traf <strong>und</strong> eine ganze<br />
Jugend, die wähnte, aus ihrer Mitte sei ihr ein Künder ihres tiefsten Lebens<br />
entstanden, zu dankbarem Entzücken hinriß."<br />
Im Januar 1924, zehn Monate vor dem Zauberberg, erschien unter dem<br />
Titel Psychologia Balnearia Hesses Kurgast, der in seiner ironischen Selbst-<br />
persiflage zu Thomas Manns Lieblingsbüchern zählte, weil er ihm vorkam, wie<br />
er sagte, "als wärs ein Stück von mir", obwohl Hesses Humor ja eher auf seine<br />
eigenen Kosten geht als auf Kosten anderer wiec4>ei=¥fe0iHas^äBI. Anfang<br />
Oktober 1926 fuhr Thomas Mann dann selber nach Baden an den Schauplatz<br />
der Geschichte <strong>und</strong> schrieb dem Kollegen auf einer Postkarte: "Unmöglich,<br />
lieber Herr Hesse, hier nicht Ihrer <strong>und</strong> Ihres entzückendsten Buches zu<br />
gedenken! Nehmen Sie die erinnerungsvollen dankbaren Grüße dreier in Ihren<br />
Spuren wandelnder Touristen: Thomas Mann, Katja Mann <strong>und</strong> Ernst Bertram."<br />
In einem verlorengegangenen Brief muß er, wohl auf den Kurgast hin, Hesse<br />
zu sich nach München eingeladen haben, ein Angebot, auf das dieser erstaunlicherweise<br />
1925 im Verlauf seiner Nürnberger Reise einging. Denn höchst<br />
selten besuchte Hesse von sich aus irgendwelche Schriftstellerkollegen, die ihn<br />
ihrerseits dafür um so hartnäckiger auch in seinen entlegensten Domizilen auf-<br />
X, . I _ ^ '•* ; -s. ? ;<br />
zufinden verstanden. AW2S44.1925 berichtet Hesse über die Visite an Emmy<br />
Ball-Hennings: "Gestern abend war ich zum Abendessen <strong>und</strong> zwar bis spät in<br />
die Nacht hinein bei Thomas Mann, den ich wohl seit sechzehn oder siebzehn<br />
Jahren nicht mehr gesehen hatte, der sich aber nicht im mindesten verändert<br />
hat <strong>und</strong> mir in seiner gepflegten, wohlgelaunten Art wieder außerordentlich<br />
sympathisch war." Kurz zuvor hatte Hesse das jüngste Buch von Thomas<br />
Mann verteidigt in einer seiner zahlreichen Antworten auf Zuschriften von<br />
Lesern, die ihm auf Kosten von Thomas Mann um den Bart zu gehen suchten:<br />
"Über den Zauberberg kann ich mich nicht so ablehnend äußern wie Sie.<br />
Zuweilen erinnert ja gewiß die Begabtheit <strong>und</strong> Beredtheit dieses Buches ein<br />
wenig an das Gleichnis vom tönenden Erz. Aber in unserer so furchtbar<br />
dünnen, armen Literatur von heute müssen wir froh sein, diese Qualität zu<br />
besitzen, denn wenn es Thomas Mann vielleicht manchmal an der wahren<br />
Frömmigkeit <strong>und</strong> Liebe zu mangeln scheint, so hat er doch in hohem Grad die<br />
Liebe, Ehrfurcht <strong>und</strong> Opferwilligkeit für das eigene Werk <strong>und</strong> Handwerk. Das<br />
ist heute schon außerordentlich viel."<br />
Nicht verw<strong>und</strong>erlich in diesem Schreiben des Theologensprößlings ist<br />
der Hinweis auf das biblische Gleichnis vom tönenden Erz, der auf das<br />
Gepränge mit meist angelesenen <strong>und</strong> dann poetisch verschmolzenen Bil-
15<br />
dungswissen zielt, womit Thomas Mann, ganz im Gegensatz zu Hesse geffist,<br />
seine Erzählungen mitunter überfrachtet. Verglichen mit Thomas Mann scheint<br />
jmr_ persönlich Hesse der spontanere Erzähler zu sein, der durch die Wucht<br />
seiner Anliegen auch ohne wissenschaftlich-kulturphilosophischen Überbau<br />
auskommt, um zu überzeugen. Das zeigt auch die ganz unterschiedliche<br />
Arbeitsweise der beiden. Hesse war kein Leistungsethiker, der sich mit<br />
v - . •- . -! • '<br />
uhrenhafter Zuverlässigkeit von morgens neun bis mittags eins an den<br />
Schreibtisch setzte, um den Pegasus herbeizuzwingen, sondern vergleichsweise<br />
<strong>und</strong>iszipliniert. Er schrieb nur dann, wenn es ihn dazu drängte, oder - wie er<br />
sagte - wenn der Zaubervogel ihm sang. Da dies jederzeit, auch mitten in der<br />
Nacht, sein konnte, muß er für seine Angehörigen eine Zumutung gewesen<br />
sein. Denn dann schrieb er eruptiv <strong>und</strong> reagierte ungehalten auf jede Störung.<br />
Ahnlich ärgerlich war ihm das ständige Ausgespieltwerden auf Kosten von<br />
Thomas Mann. "Ich bin betrübt darüber", schrieb er einem dieser Schmeichler,<br />
"daß auch Sie, ein scheinbar so guter Leser, Hesse nicht schätzen können, ohne<br />
Thomas Mann dafür herabzusetzen. Ich habe dafür gar keinen Sinn, <strong>und</strong> jede<br />
solche Bemerkung eines Lesers, der mich besonders loben möchte, entwertet<br />
mir alles, was er sagt. Wenn Sie die Gabe haben, Hesse zu verstehen, Thomas<br />
Mann aber nicht, so ist das Ihre Sache. Wenn Ihnen das Organ fehlt, diese<br />
entzückende <strong>und</strong> höchst einmalige Erscheinung im Raum der deutschen<br />
Sprache erfassen <strong>und</strong> ihr gerecht werden zu können, so ist das einzig Ihr<br />
eigener Schaden <strong>und</strong> geht mich nichts an. Aber daß ich, der ich ... ein treuer<br />
Bew<strong>und</strong>erer von Thomas Mann bin, ständig dazu herhalten soll, gegen ihn<br />
ausgespielt zu werden, ist mir höchst widerlich." Das war 1947. In den<br />
zwanziger Jahren jedoch gab es zwischen den beiden noch erhebliche<br />
politische Unterschiede. Auf jene Zeit zurückblickend schrieb Hesse 1933 an<br />
R. J. Humm: " Thomas Mann ist mir befre<strong>und</strong>et, doch die wenigen Male, wo er<br />
mit mir auf Soziales zu sprechen kam, stand er, bei aller intellektuellen Billi-<br />
gung des Sozialismus, mit seinem Herzen so viel weiter rechts als ich, war in<br />
seinem gepflegten, feinen Wesen so unangegriffen vom klaffenden Riß der<br />
Welt, daß es mich schauderte."<br />
Dies zeigte sich auch schon in der Weimarer Republik, als Hesse Thomas<br />
Mann zuliebe 1926 schweren Herzens die Wahl in die Preußische Akademie<br />
für Sprache <strong>und</strong> Dichtung akzeptierte, der einzigen offiziellen Zugehörigkeit,<br />
auf die er sich je einließ <strong>und</strong> die er vier Jahre später wieder aufkündigte, weil<br />
er nach <strong>und</strong> nach den Eindruck gewonnen habe (wie es in seinem<br />
Begründungsschreiben hieß): "Beim nächsten Krieg wird diese Akademie<br />
wieder viel zu der Schar jener neunzig oder h<strong>und</strong>ert Prominenten beitragen,
welche das Volk erneut wie 1914 im Staatsauftrag über alle lebenswichtigen<br />
Fragen belügen werden."<br />
Thomas Mann sah den politischen Kurs damals weniger skeptisch <strong>und</strong><br />
16<br />
versuchte Hesse 1931 zu bewegen, seinen Austritt rückgängig zu machen. "Ich<br />
bin nicht mißtrauisch gegen den jetzigen Staat", antwortete ihm Hesse, "weil er<br />
neu <strong>und</strong> republikanisch ist, sondern weil er mir beides zu wenig ist"; <strong>und</strong> er<br />
sehe in dem Versuch, die freien Geister in einer Akademie zu vereinigen, die<br />
Absicht der Regierung, diese oft unbequemen Kritiker leichter im Zaum zu<br />
halten. Hierauf Thomas Mann, ohne auf das Politische einzugehen, stattdessen<br />
das Persönliche betonend: "Ich weiß sehr gut, daß Ihnen das Gesellschaftlich-<br />
Offizielle, das4ffi-fctterarisch=Korf)orativeii immer-liegt, von Gr<strong>und</strong> aus<br />
widersteht. Aber", fügt er hinzu, "wem ginge es anders?" Über diese Frage<br />
mag Hesse geschmunzelt haben, wie wir es tun, die wir von Thomas Manns<br />
diplomatischer Elastizität <strong>und</strong> Lust an repräsentativer Selbstdarstellung wissen. '<br />
Kein W<strong>und</strong>er, daß Hesse hinwiederum auf diesen Punkt Jiicht einging, sondern ,<br />
erneut zur Sache kam: "Also, der letzte Gr<strong>und</strong> meines Unvermögens zur "fr<br />
Einordnung in eine offizielle deutsche Korporation ist mein tiefes Mißtrauen<br />
gegen die deutsche Republik. Dieser halt- <strong>und</strong> geistlose Staat ist entstanden aus<br />
dem Vakuum, aus der Erschöpfung nach dem Krieg. Die paar guten Geister<br />
der Revolution, welche keine war, sind totgeschlagen unter Billigung von<br />
99 % des Volkes. Die Gerichte sind ungerecht, die Beamten gleichgültig, das<br />
Volk vollkommen infantiL^Die kleine Minderheit gutgewillter Republikaner<br />
* i—- !j~ .-*<br />
halte-er- für machtlos. Es werde eine blutige Welle faschistischen Terrors<br />
kommen.<br />
Und als dies genau ein Jahr später eintraf, gab Thomas Mann noch vier<br />
Wochen vor Hitlers Machtergreifung in einem Brief an Hesse folgende<br />
Entwarnung: "Wir sind aber, glaube ich, über den Berg. Der Gipfel des<br />
Wahnsinns scheint überschritten, <strong>und</strong> wenn wir alt werden, können wir noch<br />
ganz heitere Tage sehen." Acht Wochen später brannte der Reichstag, <strong>und</strong><br />
Thomas Mann - dank eines glücklichen Zufalls damals gerade auf<br />
Vortragsreise in Amsterdam, Brüssel <strong>und</strong> Paris - sollte von nun an vierzehn<br />
Jahre lang keinen deutschen Boden mehr betreten. Im März 1933 depechierte<br />
nun auch er seinen Austritt aus der Preußischen Akademie <strong>und</strong> notiert am Tag<br />
darauf ins Tagebuch: "Zunehmender Erregungs- <strong>und</strong> Verzagtheitszustand...<br />
Ratlosigkeit, Muskelzittern, fast Schüttelfrost <strong>und</strong> Furcht, die vernünftige<br />
Besinnung zu verlieren." Drei Tage später telefoniert seine Frau Katja mit<br />
Hesse, ihr Mann sein noch ganz gebrochen <strong>und</strong> liege im Bett. Er stehe an erster<br />
Stelle auf der schwarzen Liste derer, die von der neuen Terrorregierung als<br />
Volksfeind angeprangert <strong>und</strong> als vogelfrei erklärt sind. Am liebsten käme er
jetzt nach Lugano zu einer Lagebesprechung mit Hesse. Am 26. März traf er<br />
ein <strong>und</strong> blieb einen Monat. "Es war gut", heißt es im Tagebuch, "daß wir<br />
17<br />
gleich den ersten Abend mit Hesses verbrachten, in dem schönen eleganten<br />
Hause, das ihnen sein Züricher Fre<strong>und</strong> Bodmer geschenkt hat." Um dieses<br />
Haus hat er den Kollegen sehr beneidet. Noch 1941, in Amerika, schrieb er an<br />
Agnes E. Meyer von der "Washington Post": "Meinem Fre<strong>und</strong>e Hermann<br />
Hesse hat ein reicher Schweizer Mäzen in Montagnola ein schönes Haus<br />
gebaut, worin ich ihn oft besucht habe. Der Gute wollte es nicht einmal zum<br />
Besitz haben... Das Haus bleibt dem Erbauer, <strong>und</strong> Hesse wohnt nur eben mit<br />
seiner Frau auf Lebzeiten darin. Warum ist in diesem Lande nie eine Stadt,<br />
eine Universität auf den Gedanken gekommen, mir etwas ähnliches<br />
anzutragen, um sagen zu können >we have him, he is ours
18<br />
häufig wiedergesehen, sei es im Tessin, in Baden oder seinem eigenen Heim in<br />
Küsnacht. Schon 1930, kurz nachdem er selbst den Nobelpreis erhalten <strong>und</strong><br />
somit für diese Auszeichnung vorschlagsberechtigt wurde, hat er Hesse, der<br />
ihm, wie er sagte, bald "zum Nächsten <strong>und</strong> Liebsten" unter den zeitgenössischen<br />
Schriftstellerkollegen werden sollte, auf dessen Roman Narziß <strong>und</strong><br />
Goldm<strong>und</strong>hin gleichfalls für diese Ehrung vorgeschlagen. Er wiederholte die<br />
Empfehlung 1933 in einem Brief an Fredrik Bööks: "Ich habe schon Jahr <strong>und</strong><br />
Tag meine Stimme für Hermann Hesse, den Dichter des Steppenwolfes<br />
abgegeben, indem Sie in wählten, würden Sie die Schweiz, zusammen mit dem<br />
älteren, wahren, reinen, geistigen, ewigen Deutschland ehren. Die Welt würde<br />
das wohl verstehen <strong>und</strong> auch das Deutschland, das heute schweigt <strong>und</strong> leidet,<br />
würde Ihnen von Herzen danken." Freilich mußte er den Vorschlag noch oft<br />
erneuern, bis 1946 endlich auch in Stockholm der Groschen fiel.<br />
Daß der öffentlichkeits- <strong>und</strong> medienscheue Hesse Thomas Mann nicht,<br />
wie zum Beispiel die imposante Allgegenwart Gerhart Hauptmanns, störte bei<br />
seinen internationalen Auftritten als Nachfolger Goethes <strong>und</strong> Repräsentant des<br />
geistigen Deutschland, mag zu diesem Wohlwollen beigetragen haben. Aber es<br />
gab noch tiefere Gründe für diese Sympathie. Weder Hesse noch Thomas<br />
Mann waren Neutöner. Mit dem "dernier cri" hatten sie beide nichts im Sinn<br />
<strong>und</strong> waren alles andere als darauf versessen, durch einen neuen so<strong>und</strong> die<br />
Tradition aus den Angeln heben <strong>und</strong> mit sich selbst ein neues Zeitalter einläuten<br />
zu wollen. Beide, tief verwurzelt in der Tradition, waren sie der fdentf- '•-*< J,v»< ? ! f<br />
täf zwischen Moral <strong>und</strong> Geist, Ethik <strong>und</strong> Ästhetik verpflichtet - durch rückwärtige<br />
Bindungen, bei Hesse in die deutsche Romantik, bei Thomas Mann zu<br />
den Erzählern des Naturalismus. Sie machten das Überlieferte äfctaeil, pf äzis<br />
<strong>und</strong> kompatibel, besonders Thomas Mann, dem es auf eine exzessive ; - , ' '<br />
Vertiefung <strong>und</strong> Nutzanwendung historischer Stoffe ankam. Eine<br />
Rekordleistung darin ist sein Josephs-Roman, dessen Stoff im Alten Testament<br />
knapp 30 Seiten einnimmt <strong>und</strong> von Thomas Mann auf 1350 Seiten<br />
ausgeleuchtet wird. Dabei habe er, äußerte Hesse, "nicht das Geringste dazu<br />
erf<strong>und</strong>en. Manchmal sieht man, daß wir Dichter doch nicht ganz überflüssig<br />
sind". Thomas Mann wiederum betonte anläßlich des Demian: "Die besten<br />
Diener des Neuen sind doch stets diejenigen, die das Alte kennen <strong>und</strong> lieben<br />
<strong>und</strong> es ins Zukünftige hineintragen."<br />
"Maß <strong>und</strong> Wert" nannte Thomas Mann denn auch eine 1937 von ihm<br />
herausgegebene Zeitschrift, denn Maß war für ihn gleichbedeutend mit Ord-<br />
nung <strong>und</strong> Licht.
19<br />
"Ich bin ein Mann des Gleichgewichtes", schrieb er im Februar 1935 an Karl<br />
Kerenyi, "<strong>und</strong> lehne mich instinktiv nach links, wenn der Kahn rechts zu<br />
kentern droht, <strong>und</strong> umgekehrt."<br />
JJajiüVJvie^Gh'diesesiied<br />
^*M^^«— *^<br />
äußerte, hier nur zwei Beispiele: 1930, anläßlich der Kritiken zu semer soeben<br />
erschienenen Erzählung Narziß <strong>und</strong> Goldm<strong>und</strong>, bemerkte dieser: "Jetzt<br />
kommen die gleichen Leute, die dem Steppenwolf eine des Dichters unwürdige<br />
Aktualität vorgeworfen haben <strong>und</strong> sprechen beim Gpldrn<strong>und</strong> von einer >Flucht<br />
./*'<br />
in die Vergangenheit^ Ich aber habe ich diesemJBuch der Idee von<br />
Deutschland <strong>und</strong> deutschem Wesen, die ich seit Kindheit in mir trage, einmal<br />
Ausdruck gegeben <strong>und</strong> ihr meine Liebe ge'standen - gerade weil ich alles, was<br />
heute spezifisch deutsch ist, so sehr hasse."<br />
Auch in Deinem ein Jahr später begonnenen Alterswerk Das Glasperlenspiel,<br />
an dessen Entstehung er den Kollegen passagenweise teilhaben ließ, setzte<br />
Hesse dieses Kontrastprogrämm fo|t. Seine gegen den deutschnationalen<br />
Mythos ^on Blut <strong>und</strong> Boden gerichtete Tendenz hat Thomas Mann denn auch<br />
sofort bemerkt. Das zeigt sein Tagebucheintrag über das Regenmacher-Kapitel<br />
vom 6.5U934: "Die Novelle ist schön gearbeitet <strong>und</strong> betreut das Primitive auf<br />
eine humane Art, ohne es zu verherrlichen." Etwas ganz Ahnliches unternahm<br />
damals auch Thomas Mann mit dem Vergangenheitstrip seiner Josephs-<br />
Romane/deren übernationale Tendenz er 1941 in einem Brief an Karl Kerenyi<br />
so charakterisierte: "Man muß dem intellektuellen Faschismus den Mythos<br />
wegnehmen <strong>und</strong> ihn ins Humane umfunktionieren. Ich tue längst nichts<br />
•anderes mehf." Wie aber reagierten die neuen Machthaber darauf?<br />
Die ersten beiden J„Qsephsr,Romane 'wären trotz Thomas Manns unfreiwilliger "<br />
Exöterang noch im Berliner S. Fischer Verlag erschienen, der ja auch<br />
Hermann Hesses publizistische Heimat war. Noch kurz vor seinenvTod im<br />
Oktober 1934 hatte Samuel Fischer seinen,Schwiegersohn Gottfried Bermann<br />
l/i/C'HsXit.' r*-- -f<br />
Fischer <strong>und</strong> Peter Suhrkamp als leineJ^aehfolger bestimmt. Obwohl als Jude<br />
unerwünscht, versuchte Bermann Fischer solange wiejtnöglich die Stellung in<br />
Berlin zu halten, bis schließlich auch er dem Druck'der politischen<br />
Verhältnisse weichen <strong>und</strong> mit seiner FamiliejMs nazistisch gewordene<br />
Deutschland verlassen mußte. Es grenzt aaein W<strong>und</strong>er, daß er noch 1936<br />
emigrieren konnte <strong>und</strong> neben einer finanziellen Entschädigung (200 Tsd. RM)<br />
sogar die kompletten Buchbestände'(780 Tsd. Bände) der politisch mißliebigen<br />
Verlagsautoren (zu denen inzwischen auch Thomas Mann zählte) mit nach<br />
Österreich in seinen ersten Exilverlag nehmen konnte. Das hatte er den<br />
geschickten Verhandlungen Peter Suhrkamps mit der
Reichsschriftturnskammer zu verdanken, die jenen Verlagsteil freilich nur<br />
20<br />
unter der Bedingung freigab, daß das Werk des gleichfalls in den Exilverlag<br />
drängenden "arischen" Dichters Hermann Hesse im Berliner Stammhaus blieb.<br />
"Was Sie gelten", schrieb Thomas Mann am 7.3.1936 nicht ohne einen Anfiug<br />
von Neid an Hermann Hesse, "zeigt sich ja darin, daß man Ihr bisheriges Werk<br />
durchaus nicht mit hinauslassen will. Es muß im Lande bleiben ... Meins darf<br />
hinaus, <strong>und</strong> es wird sich dann eben nur fragen, ob es [vom Exil aus] wird<br />
eingeführt werden dürfen." K *, '-•• .-* ' '•*'"<br />
Weltkrieg <strong>und</strong> den Inflationsjahren, auf die rhäzenatische Hilfe seiner<br />
'! '; f Vu i,
es etwas wie ein heilsamer Schock, als gestern aus der Schweiz das große<br />
Spätwerk des alten Hermann Hesse eintraf, an dem er länger als ein<br />
Jahrzehnt... gearbeitet hat. Das Glasperlenspiel, etwas völlig Versponnenes,<br />
Einsames, Tiefsinniges, Keusches <strong>und</strong> Dollar-Fernes, unübersetzbar, enorm<br />
deutsch. Dabei hat es, schon als fingierte Biographie, aber auch durch die<br />
21<br />
Rolle, die die Musik darin spielt etc., eine unheimliche, geisterhaft-brüderliche<br />
Verwandtschaft mit meiner gegenwärtigen Schreiberei. Es ist immer eine<br />
eigentümlich verletzende Entdeckung, daß man nicht allein auf der Welt ist.<br />
Goethe fragt einmal unverfroren: >Lebt man denn, wenn andere leben?
22<br />
Htddigungen empfangen haben, die sich durch ehrenvolle Vergleiche mit dem<br />
blauäugigen schwäbischen Idylliker mehr Würze zu geben strebten." -*<br />
Endlich im Oktober 1947, vier Jahre nach Hesses Glasperlenspiel, war<br />
auch der Doktor Faustus erschienen, <strong>und</strong> in das Exemplar, das der Verfasser<br />
seinem Kollegen schickte, notierte er die Widmung: "Hermann Hesse - dies<br />
Glasperlenspiel mit schwarzen Perlen von seinem Fre<strong>und</strong>e Thomas Mann".<br />
Schwarze Magie also im Pakt des modernen Faustus mit dem Teufel, weiße<br />
Magie im Glasperlenspiel, einer Versuchsanordnung zur künftigen Vermeidung<br />
solcher Teufeleien. -<br />
Gespannt lauerte Thomas Mann nun auf alles, was seine Kollegen über<br />
diesen seinen neuesten Hochseilakt äußerten. Hesse tat es direkt <strong>und</strong> mit wohl-<br />
begründetem Beifall in einem ausführlichen Schreiben vom Dezember 1947 an<br />
den Verfasser. Aber Thomas Mann traute diesem ihm gar zu gut duftenden<br />
Braten nicht recht <strong>und</strong> schrieb an den gemeinsamen Fre<strong>und</strong> Otto Basler:<br />
"Unter uns, es ist mir ziemlich deutlich, daß Hesse nicht sehr angetan ist vom<br />
Faustus. Wenn er direkt davon spricht, läßt er sich nichts merken. Aber vorher,<br />
als von der Fortsetzung des Krull die Rede ist, freut er sich bedeutsam auf den<br />
>Spaziergang in artistischer Höhenluft< <strong>und</strong> auf das >Spiel mit einer von<br />
aktuellen <strong>und</strong> makaberen Problemen freien Materiekaum jemals die gute Laune, den Spaß am Theater<br />
verloren< habe. >Kaum jemals< ist sehr zart gesagt."<br />
So ganz unrecht hatte Thomas Mann mit seinem Argwohn nicht. Der<br />
Frau des Verlegers Bermann Fischer schrieb Hesse damals zwar, daß er abends<br />
mit hohem Genuß den Leverkühn lese, <strong>und</strong> an Albrecht Goes, daß der umfangreiche<br />
neue Roman ihn ergötze, er sei "scheinbar weitschweifig-versponnen im<br />
Einzelnen aber in jedem Satz präzis <strong>und</strong> klar geschliffen, so daß man<br />
aufpassen muß wie bei polyphoner Musik, um möglichst wenig zu überhören."<br />
Aber nach Beendigung der Lektüre gab es doch auch Vorbehalte. So lesen wir<br />
in Hesses Brief vom 20.1.48 an Otto Basler: "Vermutlich hat Thomas Mann<br />
das >faustisch< Deutsche, wie er es kannte, <strong>und</strong> wie er es in sich selber trägt,<br />
einmal von seiner diabolischen Seite betrachten wollen <strong>und</strong> zwar im Bild der<br />
deutschen Musikalität, die ja einerseits eine hohe Begabung, andererseits auch<br />
ein Laster ist, so wie Thomas Mann selber vermutlich seine tiefe Liebe zu<br />
Wagner als problematisch <strong>und</strong> gefährlich empfindet. Das wäre das Primäre.<br />
Hinzugetan hat er dann noch das andere, das Stück Zeitgeschichte <strong>und</strong><br />
Schlüsselroman, den schlechteren aber auch amüsanteren Teil des Werkes, <strong>und</strong><br />
hat insofern ins Schwarze getroffen, als München in der Geschichte der reak-<br />
tionären Tendenzen wirklich eine führende Rolle gespielt hat <strong>und</strong> vermutlich
auch heute noch spielt." Doch als Süddeutscher <strong>und</strong> Alemanne relativiert er<br />
auch^wieder was er an Thomas Manns norddeutscher Herablassung als<br />
ungerecht empfindet <strong>und</strong> bemerkt: "Thomas Mann hat das Süddeutsche stets<br />
beinahe nur parodistisch gesehen, wenn auch oft sehr gut beobachtet, aber<br />
23<br />
ohne Herzensbeziehung, <strong>und</strong> als großer Arbeiter <strong>und</strong> von seinem Werk<br />
Besessener hat er Vieles vereinfachen müssen, was wir komplizierter nehmen".<br />
Und über ihrer beider Verhältnis in diesem Zusammenhang: "Wenn ich für ihn<br />
ein scheinbar etwas ländlicher <strong>und</strong> harmloser kleiner Bruder bin, so spürt <strong>und</strong><br />
kennt er doch das fremde Zentrum, um das ich schwinge, ganz gut." (am<br />
20,7.1950 an Ludwig Renner)<br />
Thomas Mann zögerte lange bis er aus seinem kalifornischen Exil nach Europa<br />
zurückkehrte. Das Gift, das man in den zwölf Jahren des großspurigen<br />
Tausendjährigen Reiches gegen ihn verspritzt hatte, wirkte noch lange nach,<br />
selbst bei den in Deutschland verbliebenen Autorenkollegen, der sogenannten<br />
Inneren Emigration, von denen nur ganz wenige, obenan Ernst Penzoldt,<br />
Albrecht Goes <strong>und</strong> Alfred Andersen, sich öffentlich zu ihm zu bekennen<br />
wagten.<br />
Um das Terrain zu sondieren, ließ er sich 1947, 1949 <strong>und</strong> 1950 auf kurze<br />
Vortragsreisen in seine alte Heimat ein, um sich dann 1952 aus guten Gründen<br />
nicht in München niederzulassen, wo er bis zur Bedrohung durch Hitler drei<br />
Jahrzehnte gelebt hatte, sondern dort, wo auch Hesse war, in der Schweiz.<br />
Hier trafen sie sich nun alljährlich wieder, in Montagnola zumeist <strong>und</strong><br />
1954 auch für einige Wochen im Engadin, in Nietzsches Sils Maria. Dort<br />
bewohnten sie im selben Hotel den gleichen Flügel, Katja <strong>und</strong> Thomas Mann<br />
ein Stockwerk höher, Ninon <strong>und</strong> Hermann Hesse die Zimmer darunter. Man<br />
las sich vor, spaßte <strong>und</strong> w<strong>und</strong>erte sich über die Kapriolen deutscher Ver-<br />
gangenheitsbewältigung, sei es nun durch die Besatzungsmächte mit dem Ver-<br />
such des amerikanischen Pressesprechers Hans Habe, Hesse im Nachkriegsdeutschland<br />
m<strong>und</strong>tot zu machen, oder über den Amoklauf des damaligen<br />
Rektors der Basler Universität Walter Muschg, der Thomas Mann vorwarf, er<br />
habe durch seine nihilistische Schreiberei Deutschland dem Nationalsozialis-<br />
mus in die Arme getrieben.<br />
Als Thomas Mann durch Dritte erfuhr, aufweiche Weise sich Hesse schon<br />
Jahre zuvor, gleich nach der Veröffentlichung dieser Äußerungen in Muschgs<br />
Tragischer Literaturgeschichte (1948) gewehrt hatte, schrieb er an Otto Basler,<br />
dieser Hesse sei doch ein kurioser Mann: "Immer stellt er sich als uralt,<br />
abgenutzt, weit- <strong>und</strong> meinungsmüde dar, <strong>und</strong> dann plötzlich schlägt er drein<br />
wie ein junger Kämpe, daß die Funken sprühen. Es ist ein Vergnügen."
24<br />
Angriffe auf Thomas Mann schmerzten Hesse nicht weniger als die deutsche<br />
Restauration <strong>und</strong> Wiederbewaffnung. Sie erregten ihn zuweilen mehr als gegen<br />
ihn selbst gerichtete Attacken. Das lag für ihn alles auf einer Ebene. Wie auch<br />
die Schmähungen Alfred Döblins, der den Erzählstil Thomas Manns als großbürgerliche<br />
"Degeneration" <strong>und</strong> "Bügelfaltenprosa" abgetan <strong>und</strong> Hesse<br />
schlichtweg als "langweilige Limonade" bezeichnet hatte. Als<br />
Eifersuchtsreaktion auf den Nobelpreis war das vielleicht noch einzuordnen,<br />
nicht aber die Angriffe Manfred Hausmanns <strong>und</strong> die überheblichen<br />
Absetzmanöver der Kriegsheimkehrergeneration mit ihrer<br />
"Kahlschlagliteratur" <strong>und</strong> die der "Gruppe 47".<br />
"Das Versagen der deutschen Leser Thomas Mann gegenüber", schrieb<br />
Hesse noch 1951 i-a=@iaem^BrJbfeatt^^te4i^^ffl^Hfl, "ist auffallend. Die<br />
deutsche Jugend kennt als Gegenmittel zu der ihr eingeborenen Sentimentalität<br />
nur noch den Heroismus <strong>und</strong> Zynismus, nicht aber die Ironie." Thomas Manns<br />
höhere Heiterkeit, seine Methode des ironischen Distanzierens, hielt Hesse für<br />
eine Art Abwehr des Ergriffenwerdens, der Faszination. Dies, meinte er, zeige<br />
sich auch in der Art seines Vorlesens. Thomas Mann sei, berichtet er, nachdem<br />
er ihm im Mai 1950 zwei Kapitel aus dem Erwählten zum besten gegeben<br />
hatte, "unglaublich frisch <strong>und</strong> unverändert in seiner adretten <strong>und</strong> leicht<br />
mokanten Art. Ihn sprechen zu hören, ist schon rein sprachlich ein Genuß."<br />
"So wie er liest, spricht er auch, stets genauestens akzentuierend, mit etwas<br />
Mimik, viel Distanz <strong>und</strong> Ironie <strong>und</strong> stets mit einer Spaßigkeit <strong>und</strong><br />
Spitzbüberei, für die man ihn gern hätte, wenn man es nicht schon aus anderen<br />
Gründen täte."<br />
"Sterben Sie ja nicht vor mir!" schrieb Thomas Mann zu Hesses 75.<br />
Geburtstag, "Erstens wäre es naseweis, denn ich bin der nächste dazu. Und<br />
dann: Sie würden mir furchtbar fehlen in dem Wirrsal, denn Sie sind mir darin<br />
ein guter Gesell, Beistand, Beispiel, Bekräftigung, <strong>und</strong> sehr allein würd ich<br />
mich ohne Sie fühlen." Und daraufhin Hesse: "Sollten Sie etwa vor mir das<br />
Zeitliche segnen - ein schönes Wort, das genau genommen ja nichts andreres<br />
meint als ein Preisen der Vergänglichkeit - so würde ich mich allerdings kaum<br />
zu einem Preisen oder Segnen aufzuraffen imstande sein, sondern einfach sehr<br />
betrübt werden." Und als Thomas Mann dann tatsächlich vor ihm starb, sprach<br />
Hesse von einem Gefühl der Leere <strong>und</strong> des Alleingebliebenseins wie zwei<br />
Jahre zuvor beim Verlust seiner letzten Schwester. In tiefer Trauer nehme er<br />
Abschied, schrieb Hesse 1955 in der "Neuen Zürcher Zeitung": "Von diesem<br />
Meister der deutschen Prosa, dem trotz allen Ehrungen <strong>und</strong> Erfolgen viel Verkannten.<br />
Was hinter seiner Ironie <strong>und</strong> Virtuosität an Herz, an Treue, Verantwortlichkeit<br />
<strong>und</strong> Liebesfähigkeit stand, jahrzehntelang unbegriffen vom großen
25<br />
deutschen Publikum, das wird sein Werk <strong>und</strong> Andenken weit über unsere ver-<br />
worrenen Zeiten hinaus lebendig erhalten."<br />
So ist es denn auch gekommen, wie andererseits auch Thomas Manns<br />
Vorhersage eingetroffen ist, daß Hermann Hesse, freilich erst nach seinem<br />
Tod, auf wahrhaft grenzüberschreitende Weise die "Sympathie der<br />
Menschheit" gewonnen hat, mit einem Werk, das, wie Thomas Mann betonte,<br />
"seinesgleichen sucht an Vielschichtigkeit <strong>und</strong> Beladenheit mit den Problemen<br />
von Ich <strong>und</strong> Welt".


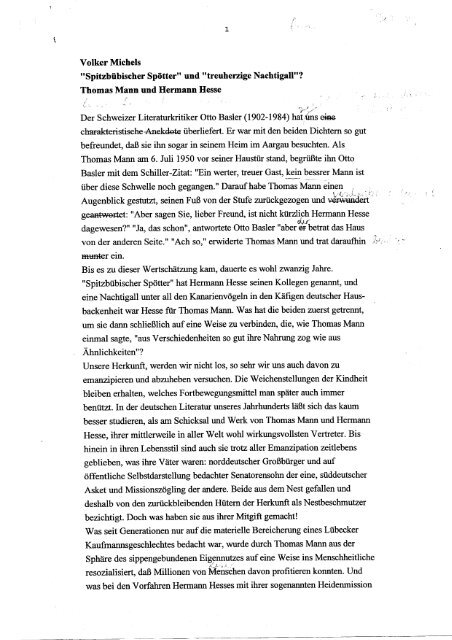
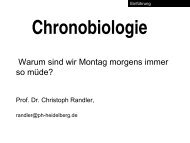
![Mozart Stadtführer herunterladen [PDF] - Frankfurter Bürgerstiftung ...](https://img.yumpu.com/13410016/1/184x260/mozart-stadtfuhrer-herunterladen-pdf-frankfurter-burgerstiftung-.jpg?quality=85)



