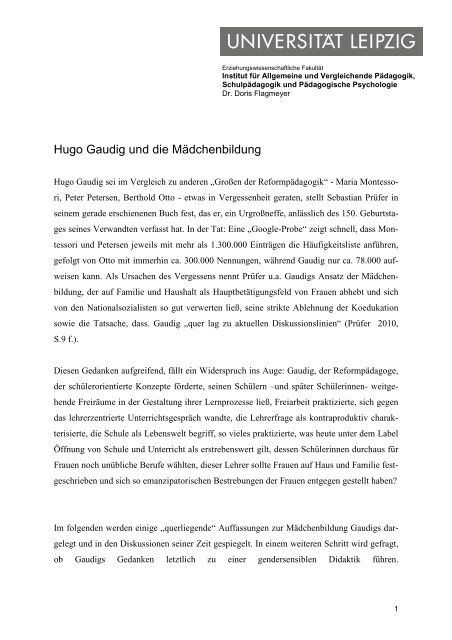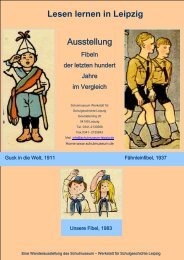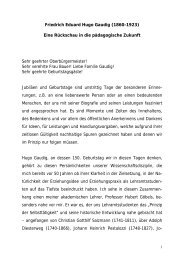Hugo Gaudig und die Mädchenbildung - Schulmuseum Leipzig
Hugo Gaudig und die Mädchenbildung - Schulmuseum Leipzig
Hugo Gaudig und die Mädchenbildung - Schulmuseum Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Hugo</strong> <strong>Gaudig</strong> <strong>und</strong> <strong>die</strong> <strong>Mädchenbildung</strong><br />
Erziehungswissenschaftliche Fakultät<br />
Institut für Allgemeine <strong>und</strong> Vergleichende Pädagogik,<br />
Schulpädagogik <strong>und</strong> Pädagogische Psychologie<br />
Dr. Doris Flagmeyer<br />
<strong>Hugo</strong> <strong>Gaudig</strong> sei im Vergleich zu anderen „Großen der Reformpädagogik“ - Maria Montesso-<br />
ri, Peter Petersen, Berthold Otto - etwas in Vergessenheit geraten, stellt Sebastian Prüfer in<br />
seinem gerade erschienenen Buch fest, das er, ein Urgroßneffe, anlässlich des 150. Geburtsta-<br />
ges seines Verwandten verfasst hat. In der Tat: Eine „Google-Probe“ zeigt schnell, dass Mon-<br />
tessori <strong>und</strong> Petersen jeweils mit mehr als 1.300.000 Einträgen <strong>die</strong> Häufigkeitsliste anführen,<br />
gefolgt von Otto mit immerhin ca. 300.000 Nennungen, während <strong>Gaudig</strong> nur ca. 78.000 auf-<br />
weisen kann. Als Ursachen des Vergessens nennt Prüfer u.a. <strong>Gaudig</strong>s Ansatz der Mädchen-<br />
bildung, der auf Familie <strong>und</strong> Haushalt als Hauptbetätigungsfeld von Frauen abhebt <strong>und</strong> sich<br />
von den Nationalsozialisten so gut verwerten ließ, seine strikte Ablehnung der Koedukation<br />
sowie <strong>die</strong> Tatsache, dass. <strong>Gaudig</strong> „quer lag zu aktuellen Diskussionslinien“ (Prüfer 2010,<br />
S.9 f.).<br />
Diesen Gedanken aufgreifend, fällt ein Widerspruch ins Auge: <strong>Gaudig</strong>, der Reformpädagoge,<br />
der schülerorientierte Konzepte förderte, seinen Schülern –<strong>und</strong> später Schülerinnen- weitge-<br />
hende Freiräume in der Gestaltung ihrer Lernprozesse ließ, Freiarbeit praktizierte, sich gegen<br />
das lehrerzentrierte Unterrichtsgespräch wandte, <strong>die</strong> Lehrerfrage als kontraproduktiv charak-<br />
terisierte, <strong>die</strong> Schule als Lebenswelt begriff, so vieles praktizierte, was heute unter dem Label<br />
Öffnung von Schule <strong>und</strong> Unterricht als erstrebenswert gilt, dessen Schülerinnen durchaus für<br />
Frauen noch unübliche Berufe wählten, <strong>die</strong>ser Lehrer sollte Frauen auf Haus <strong>und</strong> Familie fest-<br />
geschrieben <strong>und</strong> sich so emanzipatorischen Bestrebungen der Frauen entgegen gestellt haben?<br />
Im folgenden werden einige „querliegende“ Auffassungen zur <strong>Mädchenbildung</strong> <strong>Gaudig</strong>s dar-<br />
gelegt <strong>und</strong> in den Diskussionen seiner Zeit gespiegelt. In einem weiteren Schritt wird gefragt,<br />
ob <strong>Gaudig</strong>s Gedanken letztlich zu einer gendersensiblen Didaktik führen.<br />
1
Vorab: Was veranlasste <strong>Gaudig</strong>, sich mit <strong>Mädchenbildung</strong> zu befassen? Aus seiner Biografie<br />
geht hervor, dass <strong>Gaudig</strong> an der Universität Halle-Wittenberg stu<strong>die</strong>rte <strong>und</strong> an den Francke<br />
schen Stiftungen ein Probejahr unter dem Herbartianer Otto Frick absolvierte. Nach mehrjäh-<br />
riger Tätigkeit am Realgymnasium in Gera kehrte <strong>Gaudig</strong> –wohl aus pekuniären Gründen- an<br />
den Ort seiner Probezeit zurück, um dort Direktor der Höheren Mädchenschule zu werden.<br />
Dies war ein Schritt, der von den Geraer Kollegen halb spöttisch, halb mitleidig als Abstieg<br />
betrachtet wurde. <strong>Gaudig</strong> indessen widmete sich mit der gleichen Gründlichkeit, mit der er<br />
seinen Unterricht an der Knabenschule vorbereitete, der neuen Aufgabe. Vielleicht regten<br />
auch <strong>die</strong> drei kleinen Töchter zu Hause sein Nachdenken über <strong>Mädchenbildung</strong> an. Seine<br />
Frau beschreibt jedenfalls in ihrem Erinnerungsbüchlein den Stolz des Vaters, seine Freude an<br />
der ges<strong>und</strong>en Entwicklung der Töchter, das Belauschen <strong>und</strong> Beobachten ihrer Eigenart <strong>und</strong><br />
ihres geistigen Lebens (vgl. Prüfer 2010).<br />
<strong>Gaudig</strong> forderte für Mädchen eine gleichwertige, nicht gleichartige Bildung. In den „Didakti-<br />
schen Ketzereien“ schrieb er, <strong>die</strong> Mädchenschullehrer sollten sich abgewöhnen, <strong>die</strong> höhere<br />
Knabenschule aus einer Froschperspektive zu betrachten, als sei allein <strong>die</strong> Knabenschule da-<br />
seinsberechtigt <strong>und</strong> von den Mädchenschullehrern nachzuahmen. Die höhere Mädchenschule<br />
müsse ein wenig „Ellbogengenie“ entdecken, d.h. sich durch eigene Energie den ihr gebüh-<br />
renden Platz sichern (<strong>Gaudig</strong> 1920, S. 132).<br />
Mit seinen Schriften reihte sich <strong>Gaudig</strong> in <strong>die</strong> Diskussionen seiner Zeit ein. Stritt man zuvor,<br />
ob für Mädchen <strong>die</strong> Familie als Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungsinstanz ausreiche oder es der Schule<br />
bedürfe, ging es nunmehr um <strong>die</strong> Frage, welche Schulform für Mädchen <strong>die</strong> geeignete sei <strong>und</strong><br />
welche Stellung ihr im Schulsystem zukomme. Diese Auseinandersetzung wurde mit großer<br />
Schärfe zwischen den Interessenverbänden der männlichen Oberlehrer <strong>und</strong> den im Allgemei-<br />
nen Deutschen Lehrerinnenverein organisierten Lehrerinnen geführt. Zwar wurden unter-<br />
schiedliche Bildungsvorstellungen formuliert, letztlich beanspruchten aber beide Seiten <strong>die</strong><br />
höhere Mädchenschule für sich als Arbeitsfeld. Dabei wurden sowohl Gleichheit als auch<br />
Differenz der Geschlechter als Argumentationsstränge genutzt (vgl. Kleinau 1996, S. 113).<br />
Helene Lange, langjährige Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins, er-<br />
hob in ihrer Schrift „Die höhere Mädchenschule <strong>und</strong> ihre Bestimmung“ zwei Forderungen<br />
2
„mehr Beteiligung des weiblichen Elements“, vor allem in Deutsch <strong>und</strong> Religion, <strong>und</strong> <strong>die</strong><br />
„Ausbildung wissenschaftlicher Lehrerinnen“. Sie begründete <strong>die</strong>se mit den unterschiedlichen<br />
kulturellen Aufgaben von Männern <strong>und</strong> Frauen. Jene seien zur Mutterschaft bestimmt. Diese<br />
potentielle Möglichkeit bestimme weibliche Eigenarten wie den Zug zum Persönlichen, Kon-<br />
kreten, schnellere <strong>und</strong> tiefere Fühlung, Altruismus <strong>und</strong> Mitleid im Gegensatz zu der abstrakte-<br />
ren, spekulativen, auf das Systematische, Unpersönliche gerichtete Veranlagung des Mannes.<br />
Die Differenzierung der Geschlechter steige mit „erhöhter Kultur“. Lange forderte schließ-<br />
lich, <strong>die</strong> weibliche Eigenart solle zum Segen der Gesellschaft im häuslichen <strong>und</strong> außerhäusli-<br />
chen Bereich (sprich Schule) wirken. In den Mädchenschulen solle das „Princip der Kraftbil-<br />
dung“ (im Gegensatz zum Princip des Abschließens <strong>und</strong> Fertigmachens) gelten. Dieses erfor-<br />
dere notwendig Lehrerinnen, denn nur <strong>die</strong>se seien in der Lage, <strong>die</strong> weibliche Psyche „bis in<br />
<strong>die</strong> tiefsten Falten hinein“ zu verstehen. Allerdings stieß das Differenzprinzip an bildungspoli-<br />
tische Grenzen, so dass angesichts ungleicher Mittelverteilungen <strong>und</strong> fortwährender Un-<br />
gleichbehandlung der Geschlechter eine Abkehr von der Idee eines eigenständigen Mädchen-<br />
schulwesens erfolgte <strong>und</strong> Koedukation gefordert wurde (vgl. Kleinau 1996, S.115-118).<br />
Im Gegensatz zum Differenzprinzip stehen Auffassungen der Gleichheit, <strong>die</strong> zu Forderungen<br />
nach gleicher Bildung für Mädchen <strong>und</strong> Jungen <strong>und</strong> dem gleichberechtigten Zugang zum Be-<br />
rufsleben führen. Gleiche Bildung bedeutet letztlich Koedukation, Öffnung der Knabengym-<br />
nasien für Mädchen. Eine Vertreterin <strong>die</strong>ser Richtung, Hedwig Kettler, kritisierte <strong>die</strong> verbrei-<br />
tete Annahme einer angeborenen geistigen Unterlegenheit der Frau. Wie Ursula Scheu Jahr-<br />
zehnte später („Wir werden nicht als Mädchen geboren, sondern dazu gemacht“) meinte auch<br />
sie, Geschlecht sei ausschließlich eine soziale Konstruktion <strong>und</strong> schlug deshalb einen Tausch<br />
der Bildungsangebote - Töchterschulen für Jungen, Gymnasien für Mädchen - vor, um <strong>die</strong>se<br />
Hypothese zu überprüfen (vgl. Kleinau 1996, S.125-127). Das wurde natürlich nicht getan,<br />
<strong>und</strong> auch <strong>die</strong> Forderung nach Koedukation blieb zunächst wirkungslos.<br />
Beiden Ansätzen war gemeinsam, dass am Anfang eine Idee stand, für deren Umsetzung ent-<br />
sprechende schulische Bedingungen geschaffen werden sollten, aber real in jener Zeit nicht<br />
gestaltet werden konnten.<br />
Im Unterschied dazu hat <strong>Gaudig</strong> seine Ideen aus seiner langjährigen pädagogischen Praxis als<br />
Mädchenschullehrer <strong>und</strong> –leiter heraus entwickelt. Wie viele seiner Zeitgenossen <strong>und</strong> wohl<br />
auch Zeitgenossinnen sah er den „natürlichen Beruf der Frau“ als einen dreifachen- Gattin,<br />
Mutter <strong>und</strong> Hausverwalterin. Er betonte dessen Vorzüge- der Frau bleibe das moderne Spezia-<br />
3
listentum erspart <strong>und</strong> sie könne sich in schöner Vielseitigkeit entfalten. Er gestand den Frauen<br />
allerdings ausdrücklich das Recht auf eine individuelle Entscheidung gegen <strong>die</strong> Ehe zu, wies<br />
aber auch auf <strong>die</strong> Folgen einer solchen, nämlich <strong>die</strong> Gefährdung der Familie als unersetzliche<br />
Pflegestätte für <strong>die</strong> kindliche Persönlichkeit <strong>und</strong> als Gr<strong>und</strong>lage der bürgerlichen Kultur hin<br />
(vgl. <strong>Gaudig</strong> 1923, S.69). Mit <strong>die</strong>ser Sicht auf den „natürlichen Beruf der Frau“ kann <strong>Gaudig</strong><br />
der Vorwurf der Befangenheit im Zeitgeist <strong>und</strong> eines verengten Blicks– denn er hat wohl nur<br />
<strong>die</strong> bürgerliche Familie im Blick - nicht erspart werden. Spannend aus heutiger Perspektive ist<br />
seine Argumentation, dass der Versuch, Leben in der Familie <strong>und</strong> im Beruf zu vereinbaren, zu<br />
einem permanenten Konflikt führen, <strong>die</strong> „Seele der Frau vor das furchtbare Entweder –Oder<br />
eines unausgesetzten Gewissenskampfes“ stellen würde. Dass <strong>die</strong>ser „Gewissenskampf“<br />
Frauen noch Jahrzehnte später beschäftigen wird, hat er wohl nicht vorausgeahnt – dass er<br />
auch Männer berührt, würde ihn vermutlich sehr überraschen.<br />
Immer wieder argumentierte <strong>Gaudig</strong> schlüssig, dass, da sich Frauen in der Schule auf ihren<br />
„natürlichen Beruf“ vorbereiten müssen, der Staat, der der Familie als Gr<strong>und</strong>lage der bürger-<br />
lichen Kultur bedarf, in der Pflicht der Förderung höherer Mädchenschulen ist. Er lehnte Ko-<br />
edukation strikt ab. Seiner Meinung nach bringe eine Gemeinschaftserziehung für Mädchen<br />
nur Nachteile, da sich Unterrichtsinhalte <strong>und</strong>- methoden an den Knaben ausrichten – Jahr-<br />
zehnte später beschäftigt genau <strong>die</strong>se Voraussicht immer noch. Er forderte, <strong>die</strong> höhere Mäd-<br />
chenschule müsse sich in Lehrinhalten <strong>und</strong> methodischer Gestaltung an der weiblichen Eigen-<br />
art orientieren (Vgl. <strong>Gaudig</strong> 1912, S. 231 ff.). Diese beschrieb er in vielen Schriften, oft mit<br />
Bezug auf Meumann, einen Vertreter der experimentellen Psychologie, obwohl er den For-<br />
schungsstand als noch wenig gesichert einschätzte. Da er eine „doppelte Richtung der Bil-<br />
dungsarbeit“ (<strong>Gaudig</strong> 1920, S.76) vorschlug, konnte seiner Aufassung nach der wenig gesi-<br />
cherte Forschungsstand außer acht bleiben. Doppelte Richtung bedeutete für <strong>Gaudig</strong>, Stärken<br />
weiblicher Begabung besonders sorgfältig zu entwickeln, zugleich durch eine zulängliche<br />
Ausbildung weniger gut liegender Funktionen Einseitigkeit vermeiden. Einige Beispiele mö-<br />
gen das untersetzen: So hebt <strong>Gaudig</strong> <strong>die</strong> besondere Sprechlust <strong>und</strong> –gewandheit der Mädchen<br />
hervor. „Man lasse <strong>die</strong> Mädchen sich aussprechen <strong>und</strong> sorge dafür, dass sie es bald mit gutem<br />
Geschmack tun, der Sprachform Wert beilegen <strong>und</strong> das Sprechen unter ernsthafte Kontrolle<br />
nehmen“ (s.o., S. 42). Weiter heißt es in den „Didaktischen Ketzereien“, dass Mädchen“ visu-<br />
eller denken“ (s.o., S.77), ihre Wahrnehmungen umfassender <strong>und</strong> auch fehlerfreier sind. Diese<br />
Begabung ist kunstmäßig zu entwickeln, zugleich soll aber auch Geistespflege erfolgen, in-<br />
dem z. B. bei zusammengesetzten Gegenständen <strong>die</strong> geistige Tätigkeit nach der Anschauung<br />
auf <strong>die</strong> Anordnung der Teile <strong>und</strong> ihre Beziehungen gelenkt wird. Eine andere Begabung der<br />
4
Mädchen ist <strong>die</strong> Lebhaftigkeit der Phantasie, <strong>die</strong> gewöhnt werden muss- <strong>Gaudig</strong> selbst nennt<br />
es <strong>die</strong> Paradoxie wagen (1920, S.79)- exakt zu gestalten. Dem weiblichen Geist sagen <strong>die</strong><br />
synthetischen, konkreten Funktionen mehr zu als <strong>die</strong> anlytischen. Erstere seien zu pflegen, um<br />
so Munterkeit, Lebhaftigkeit, Beweglichkeit <strong>und</strong> Frische des weiblichen Geists zu erhalten.<br />
Zugleich soll analytische Prüfung den Wert synthetischer Vorstellungsgebilde erkennen las-<br />
sen. <strong>Gaudig</strong> merkt weiterhin an, dass Mädchen schneller im Denken <strong>und</strong> Sprechen sind, sich<br />
eher einem Vielerlei von Dingen zuwenden, zu Unexakheit im Sprechen <strong>und</strong> Denken neigen,<br />
merkt auch Mängel im räumlichen Erfassen an-Qualitäten, <strong>die</strong> auch in der Gegenwart noch<br />
als „typisch weiblich“ charakterisiert werden. Bemerkenswert ist jedoch immer wieder seine<br />
„Doppelstrategie“, Vorzüge des Gegebenen zu nutzen <strong>und</strong> Einseitigkeiten zu vermeiden, eher<br />
auf <strong>die</strong> Stärken als <strong>die</strong> Schwächen oder Defizite zu blicken. Diese Doppelstrategie, <strong>die</strong> auf<br />
freies Tätigsein abhebt, scheint natürlich nicht nur für Mädchenschulen sinnvoll, auch Jungen<br />
können von einem solchen Vorgehen profitieren.<br />
In seinen Schriften thematisiert <strong>Gaudig</strong> vielfach <strong>die</strong> Stofffülle, <strong>die</strong> eine freie Betätigung der<br />
Geisteskraft behindert. „Wage es, unwissend zu sein“ möchte er den höheren Mädchenschu-<br />
len zurufen. Sie sollen kühlen Mut gewinnen, wenn gelärmt wird, dass irgendwelche höheren<br />
Töchter <strong>die</strong>s <strong>und</strong> jenes nicht wissen, was höhere Knaben wissen (vgl.<strong>Gaudig</strong> 1920, S.28). Es<br />
komme nur so viel Stoff in den Lehrplan, dass sich an ihm <strong>und</strong> in ihm energisches freies Den-<br />
ken <strong>und</strong> Arbeiten entwickeln kann. Dieser Stoff ist ohne Befangenheit <strong>und</strong> Rücksicht auf his-<br />
torische Überlieferung so auszuwählen, dass sich das Wesentliche der Gottes-, Menschen-<br />
<strong>und</strong> Naturerkenntnis erschließt. Eine Forderung, <strong>die</strong> wohl für Mädchen – <strong>und</strong> Knabenschulen<br />
zutrifft. Für <strong>die</strong> Mädchenschulen schlägt <strong>Gaudig</strong> vor, dass Lehrplaninhalte nicht nur nach<br />
ihrem Gewicht für eine Welterkenntnis bestimmt werden, sondern dass „der natürliche Zug<br />
des Interesses im Frauengeist“ zu beachten ist. Dieser gelte besonders dem persönlichen Le-<br />
ben <strong>und</strong> man könne ihm Rechnung tragen, indem man in Religion, Deutsch, Geschichte <strong>und</strong><br />
Fremdsprachen in <strong>die</strong> Höhen <strong>und</strong> Tiefen des Personenlebens einführt. Zugleich sei auch ein<br />
Gegengewicht zu schaffen zu schaffen durch <strong>die</strong> Beschäftigung mit Mathematik, Gesetzmä-<br />
ßigkeit in den Naturwissenschaften, Technik <strong>und</strong> der sozialen Frage des XX. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Bleibt wiederum festzustellen, dass auch <strong>die</strong> Forderungen inhaltlicher Akzentuierung auf <strong>die</strong><br />
Jungenschulen ohne weiteres übertragen werden können – das Wesentliche für Welterkennt-<br />
nis bestimmen <strong>und</strong> am Jungeninteresse anknüpfen.<br />
5
<strong>Gaudig</strong> sah es - eigene leidvolle Schülererfahrungen aufgreifend (vgl. <strong>Gaudig</strong> 1969) - als Vor-<br />
teil, dass <strong>die</strong> höheren Mädchenschulen nicht an das Berechtigungswesen angeschlossen wa-<br />
ren, weil so <strong>die</strong> Freude an den Inhalten <strong>und</strong> dem Tätigsein selbst als Motive wirkten <strong>und</strong> nicht<br />
nur das Schielen nach den Abschlüssen den Unterrichtsalltag bestimmten. Aus <strong>die</strong>sen Überle-<br />
gungen heraus stellte er auch eine Verknüpfung mit berufsbildenden Funktionen in Frage<br />
(vgl. <strong>Gaudig</strong> 1912, S. 215ff).<br />
<strong>Gaudig</strong> plä<strong>die</strong>rte für ein Lehrerkollegium, das sich aus Männern <strong>und</strong> Frauen zusammensetzt<br />
<strong>und</strong> folgte <strong>die</strong>ser Idee als Leiter einer höheren Mädchenschule. Er kritisierte Bestrebungen der<br />
Frauenbewegung, an <strong>die</strong>sen Schulen nur Lehrerinnen einzusetzen, weil nur <strong>die</strong>se <strong>die</strong> Mäd-<br />
chenseele verstehen könnten. Man solle aus der Mädchenseele kein Mysterium machen, son-<br />
dern not tue ein eindringliches psychologisches Studium <strong>und</strong> tüchtige Übung im Beobachten.<br />
Wiederum eine Forderung, <strong>die</strong> auch Jungenschulen gut tun würde.<br />
Fazit:<br />
So „quer“ zu den damaligen Diskussionen lag <strong>Gaudig</strong> wohl nicht. Nicht nur er bezog sich auf<br />
<strong>die</strong> Theorie der Geschlechterdifferenz, um sein Leitbild einer Mädchenschule zu entwickeln.<br />
Ausgehend vom Differenzprinzip, das er mit dem damaligen Kenntnisstand der Psychologie<br />
zu begründen suchte, <strong>und</strong> seinen pädagogischen Erfahrungen leitete er Gr<strong>und</strong>sätze für <strong>die</strong><br />
höhere Mädchenschule ab.<br />
Widerspruch rief damals seine Vorstellung vom „natürlichen Beruf“ der Frau <strong>und</strong> denkbaren<br />
Erwerbsberufen (Lehrerinnen, Erzieherinnen, Pflegerinnen) hervor. Aus heutiger Sicht emp-<br />
findet man angesichts <strong>die</strong>ser Vorstellung Befremden, sollte aber bedenken, dass damals auch<br />
Frauenrechtlerinnen <strong>die</strong>se Berufe in Erwägung zogen. Ein schlüssiges Konzept der Verein-<br />
barkeit von Familie <strong>und</strong> Beruf konnten auch sie nicht vorlegen. Heute, fast 100 Jahre später,<br />
verzeichnen wir immer noch typische Frauenberufe <strong>und</strong> beklagen zu wenig Ingenieurinnen,<br />
Naturwissenschaftlerinnen, Professorinnen, Managerinnen u.a.<br />
Betrachtet man <strong>Gaudig</strong>s Gedanken zur weiblichen Eigenart, so bestätigen heutige Erkenntnis-<br />
se der Psychologie, Neurobiologie <strong>und</strong> Kognitionswissenschaft viele seiner Annahmen. Es<br />
gibt geschlechtsspezifische Unterschiede bei menschlichen Lern- <strong>und</strong> Entwicklungsprozessen<br />
(vgl. Pinker 2008). Seine Schlussfolgerung einer „doppelten Richtung der Bildungsarbeit“,<br />
Stärken weiblicher Begabung besonders sorgfältig zu entwickeln <strong>und</strong> zugleich durch eine<br />
6
Förderung weniger gut ausgebildeter Fähigkeiten Einseitigkeit vermeiden, lässt sich auf <strong>die</strong><br />
Jungenbildung übertragen <strong>und</strong> kann einen gendersensiblen Umgang mir Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern begründen.<br />
Das Bestehen auf Monoedukation, das ihm vorgeworfen wurde, könnte neben der Überzeu-<br />
gung, nur so könne man den Mädchen gerecht werden, auch Bedingungen damaliger Schul-<br />
entwicklung geschuldet sein. Das Gymnasium für Knaben war seit fast 100 Jahren in festen<br />
Strukturen verhaftet – Jahrgangsklassen, Lehrplan, Unterrichtsfächer, Fachlehrer, St<strong>und</strong>en-<br />
plan, Zensuren, Abschlusszeugnisse mit Berechtigungen. Dagegen bot <strong>die</strong> höhere Mädchen-<br />
schule, neu entstanden <strong>und</strong> noch nicht in das Berechtigungssystem eingeb<strong>und</strong>en, dem Re-<br />
formpädagogen ungleich mehr Gestaltungsmöglichkeiten.<br />
Betrachtet man <strong>die</strong> Debatten um Koedukation heute, so ist zu konstatieren, dass das gemein-<br />
same Lernen von Jungen <strong>und</strong> Mädchen nicht den erhofften Gewinn gebracht hat. Insofern ist<br />
man geneigt, <strong>Gaudig</strong> zuzustimmen, zwar nicht zur Monoedukation zurückzukehren, aber seine<br />
Ideen für eine gendersensible Didaktik aufzunehmen.<br />
Literatur:<br />
<strong>Gaudig</strong>, H.: Die Idee der Persönlichkeit <strong>und</strong> ihre Bedeutung für <strong>die</strong> Pädagogik. Sonderausga-<br />
be. Unveränd. reprograf. Nachdruck d. Ausgabe <strong>Leipzig</strong> 1923. Wiss. Buchgesellschaft, 1965.<br />
<strong>Gaudig</strong>, <strong>Hugo</strong>: Didaktische Ketzereien. Teubner 1920<br />
<strong>Gaudig</strong>, <strong>Hugo</strong>: Die Schule der Selbsttätigkeit. Klinkhardt 1969<br />
<strong>Gaudig</strong>, <strong>Hugo</strong>: Höheres Mädchenschulwesen. In: Hinneberg, Paul. (Hrsg).: Die Kultur der<br />
Gegenwart. Ihre Entwicklung <strong>und</strong> ihre Ziele. Teubner 1912.<br />
Kleinau, Elke/ Opitz, Claudia: Geschichte der Mädchen- <strong>und</strong> Frauenbildung. Bd.2. Campus<br />
1996<br />
Kratochwil, Leopold: Pädagogisches Handeln bei <strong>Hugo</strong> <strong>Gaudig</strong>, Maria Montessori <strong>und</strong> Peter<br />
Petersen. Auer 1992<br />
Pinker, Susan: Das Geschlechterparadox. Über begabte Mädchen, schwierige Jungs <strong>und</strong> den<br />
wahren Unterschied zwischen Männern <strong>und</strong> Frauen. Deutsche Verlagsanstalt 2008<br />
Prüfer, Sebastian: <strong>Hugo</strong> <strong>Gaudig</strong>. Beiträge zum 150. Geburtstag. Projekte-Verlag 2010<br />
7