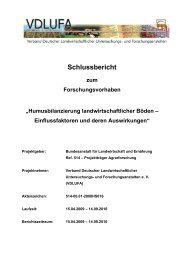Wirkung von Gärprodukten aus Biogasanlagen ... - Humusnetzwerk
Wirkung von Gärprodukten aus Biogasanlagen ... - Humusnetzwerk
Wirkung von Gärprodukten aus Biogasanlagen ... - Humusnetzwerk
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Wirkung</strong> <strong>von</strong> <strong>Gärprodukten</strong> <strong>aus</strong> <strong>Biogasanlagen</strong> auf<br />
Humusreproduktion und Bodenökologie<br />
Kerstin Nielsen ∗ , Gabriela Bermejo ∗∗ , Karen Sensel * , Verena Wragge * , Stefanie Krück ** ,<br />
Frank Ellmer ∗∗<br />
In der Regel werden Gärprodukte <strong>aus</strong> <strong>Biogasanlagen</strong> als Dünger auf landwirtschaftliche<br />
Nutzflächen <strong>aus</strong>gebracht. Mit dem intensiven Anbau <strong>von</strong> Silomais, einer stark<br />
humuszehrenden Fruchtart, wächst die Sorge einer negativen Humusbilanz. Durch die<br />
Rückführung organischer Substanz über die Gärprodukte in den Boden kann unmittelbar zur<br />
Humusreproduktion beigetragen werden. Ob die Humusreproduktionsleistung <strong>von</strong><br />
<strong>Gärprodukten</strong> <strong>aus</strong> <strong>Biogasanlagen</strong> für eine <strong>aus</strong>geglichene Humusbilanz <strong>aus</strong>reicht, ist allerdings<br />
bisher noch ungeklärt. Auch die <strong>Wirkung</strong> <strong>von</strong> <strong>Gärprodukten</strong> auf die Bodenökologie ist derzeit<br />
noch nicht hinreichend erforscht. Untersuchungen u. a. zu diesen Fragestellungen werden am<br />
Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin<br />
(IASP) zusammen mit dem Fachgebiet für Acker- und Pflanzenbau der Humboldt-Universität<br />
zu Berlin durchgeführt.<br />
Bis jetzt gibt es sehr wenige Erkenntnisse hinsichtlich der C-Mineralisierung und der<br />
Abb<strong>aus</strong>tabilität <strong>von</strong> <strong>Gärprodukten</strong> im Boden und damit ihres Potenzials für die<br />
Humusreproduktion.<br />
Untersucht wurden ein flüssiges Gärprodukt <strong>aus</strong> einer Anlage mit Nassfermentation, welche<br />
Rindergülle und Maissilage einsetzt, sowie ein festes Gärprodukt <strong>aus</strong> einer<br />
Trockenfermentationsanlage, die <strong>aus</strong>schließlich Maissilage als Substrat einsetzt (Tab. 1).<br />
Mit Hilfe eines aeroben Inkubationsversuches über 100 Tage wurde über die Messung der<br />
CO2-Freisetzung <strong>von</strong> Sandboden-Dünger-Gemischen der Abbau der organischen Substanz<br />
<strong>aus</strong> <strong>Gärprodukten</strong> im Vergleich zu Rindergülle und Stallmist im Boden bestimmt (Abb. 1).<br />
Dabei wurden jeweils 50 g Sandboden mit einer Düngermenge, die 0,11 mg N g -1 Boden<br />
entspricht, gemischt. Die Bodenatmung der Proben wurde mittels Respirometer (Respicond,<br />
Nordgren Innovations, Schweden) ermittelt.<br />
Mineralisierter Anteil des Dünger‐<br />
Kohlenstoffs [%]<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Rindermist (verrottet) Rindergülle<br />
Gärprodukt fest Gärprodukt flüssig<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Zeit [d]<br />
Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der C-Mineralisierung<br />
<strong>von</strong> Bodenproben mit <strong>Gärprodukten</strong> im Vergleich zu<br />
Rindergülle und Rindermist<br />
Mineralisierter Anteil des Dünger‐<br />
Kohlenstoffs [%]<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Rindermist<br />
(verrottet)<br />
Gärprodukt<br />
fest<br />
Rindergülle Gärprodukt<br />
flüssig<br />
Abbildung 2: Mineralisierter Anteil des Dünger-<br />
Kohlenstoffs in Sandboden nach 100 Tage Inkubation<br />
bei 22 °C (Mittelwerte und Standardfehler)<br />
In der Versuchsvariante mit Rindergülle wurde nach 100 Tagen Inkubation ein mineralisierter<br />
Anteil des Düngerkohlenstoffs <strong>von</strong> 48 % festgestellt (Abb. 2). Dieser lag damit mehr als<br />
doppelt so hoch wie im flüssigen Gärprodukt (22 %). Im festen Gärprodukt lag der<br />
∗ Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin (IASP)<br />
∗ ∗ Humboldt‐Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich‐Gärtnerische Fakultät, FG Acker‐ und Pflanzenbau
mineralisierte Anteil des Düngerkohlenstoffs mit 55 % mehr als viermal so hoch wie im<br />
verrotteten Rindermist (13 %). Nach 100tägiger Inkubation war jedoch im festen Gärprodukt<br />
und im verrotteten Rindermist noch kein stabiler Zustand der organischen Substanz im Boden<br />
erreicht. Diese Ergebnisse zeigen, dass die organische Substanz im flüssigen Gärprodukt<br />
stabiler ist als die der Gülle und die organische Substanz im festen Gärprodukt weniger<br />
stabilisiert ist als die <strong>von</strong> Stallmist. Nach den Richtwerten der VDLUFA-<br />
Humusbilanzierungsmethode wurden mangels verfügbarer Daten gleiche Humus-C-Werte 1<br />
der organischen Substanz für flüssige Gärprodukte und Gülle sowie ähnliche Humus-C-Werte<br />
für feste Gärprodukte und Stallmist angenommen. Dies kann durch die vorliegenden<br />
Versuchsergebnisse nicht bestätigt werden. Die Abb<strong>aus</strong>tabilität der organischen Substanz<br />
wird u. a. durch deren Zusammensetzung beeinflusst. Es konnte eine Korrelation zwischen<br />
den jeweiligen mineralisierten organischen Kohlenstoffanteilen und dem Gehalt an Cellulose<br />
und Hemicellulose in den organischen Düngern beobachtet werden (Abb. 3).<br />
Mineralisierte Anteil des Dünger‐<br />
Kohlenstoffs [%]<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
R² = 0,9497<br />
0 10 20 30 40<br />
Cellulose‐ und Hemicelluloseanteil der Dünger [% TS]<br />
Abbildung 3: Beziehung zwischen dem<br />
Cellulose- und Hemicelluloseanteil und dem<br />
mineralisierten Dünger-Kohlenstoff<br />
Parameter<br />
Gärprodukt<br />
fest<br />
Rindermist<br />
(verrottet)<br />
Gärprodukt<br />
flüssig<br />
Rindergülle<br />
TS [%] 13,8 22,7 8,0 9,0<br />
oTS [% TS] 79,1 68,4 71,5 78,8<br />
pH 8,4 7,6 7,8 7,5<br />
Corg [% TS] 39,4 29,8 37,1 42,7<br />
Nges [% TS] 4,3 2,9 5,8 3,9<br />
NH4 + -N [% TS] 1,5 0,1 2,9 2,1<br />
C/N 9 10 6 11<br />
Lignin [% TS] 9,3 23,1 11,8 6,5<br />
Hemicellulose [% TS] 18,0 0,8 13,7 14,7<br />
Cellulose [% TS] 17,7 11,9 8,9 17,3<br />
Tabelle 1: Stoffliche Parameter der eingesetzten organischen<br />
Dünger<br />
Bodenlebewesen sind stark <strong>von</strong> ihrem unmittelbaren Lebensraum abhängig und <strong>aus</strong> diesem<br />
Grund gut als Bioindikatoren für ökologische Zustandsgrößen <strong>von</strong> Böden geeignet. Am<br />
Standort Berlin-Dahlem wurde im Herbst 2009 die <strong>Wirkung</strong> fester und flüssiger Gärprodukte<br />
im Vergleich zu Wirtschaftsdüngern auf Regenwürmer in einer Braunerde-Fahlerde<br />
untersucht. Dazu wurden 120 kg ha -1 Nges <strong>aus</strong> festen und flüssigen <strong>Gärprodukten</strong> sowie<br />
Wirtschaftsdüngern in einer einfaktoriellen Blockanlage mit vierfacher Wiederholung zu<br />
Sorghum <strong>aus</strong>gebracht. Als Kontrolle diente eine ungedüngte Variante. Einen Monat nach der<br />
Düngung wurde die Abundanz <strong>von</strong> Regenwürmern bestimmt. Dafür wurde ein definiertes<br />
Bodenvolumen <strong>von</strong> 2mal 1/8 m 2 und 20 cm Tiefe pro Parzelle beprobt. Mittels Formalin-<br />
Extraktion wurden anektische, also tiefgrabende Arten erfasst (Abb. 4).<br />
Abbildung 4: Feldversuch mit <strong>aus</strong>gebrachten organischen Düngern, Hand-Sortierung <strong>von</strong> Regenwürmern und<br />
Lebensräume verschiedener Regenwurm-Gruppen<br />
1 Humus‐C ist der für die Humusreproduktion im Boden anrechenbare Kohlenstoff
Die Ergebnisse zeigen, dass die organischen Dünger die Regenwurmabundanz gegenüber der<br />
Kontrolle erhöht haben. Die höchste Individuendichte wurde in der mit verrottetem<br />
Rindermist gedüngten Variante festgestellt (Abb. 5). Dieser organische Dünger hatte<br />
verglichen mit den anderen geprüften Stoffen den höchsten Trockensubstanzgehalt und das<br />
weiteste C/N-Verhältnis (Tab. 1). Diese Eigenschaften scheinen eine positive <strong>Wirkung</strong> auf die<br />
Populationsentwicklung der Lumbriciden zu haben. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass<br />
dies nur für die untersuchten spezifischen Boden- und Klimabedingungen gilt.<br />
Abbildung 5: Gesamtabundanz <strong>von</strong> Regenwürmern, unterteilt nach Arten, 1 Monat nach Ausbringung<br />
verschiedener organischer Dünger im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle (Mittelwerte und Standardfehler);<br />
A. = Gattung Aporrectodea, spec = species<br />
Nach dem Einsatz <strong>von</strong> <strong>Gärprodukten</strong> war die Abundanz <strong>von</strong> Regenwürmern um rund 30 %<br />
höher als in der ungedüngten Kontrolle. Dies resultierte hauptsächlich <strong>aus</strong> einem verstärkten<br />
Auftreten der Arten Aporrectodea caliginosa und Aporrectodea icterica. Verglichen mit<br />
Gülle- und Stallmistdüngung blieben die Effekte allerdings um 25 bzw. 27 % geringer. Das ist<br />
möglicherweise auf die höheren NH4 + -N-Konzentrationen und pH-Werte der Gärprodukte<br />
zurückzuführen. Zudem wurde weniger organische Substanz als durch Gülle und Stallmist<br />
eingebracht, so dass die Ernährungsbedingungen für die Makrofauna des Bodens bei<br />
Gärproduktdüngung weniger günstig <strong>aus</strong>fällt als bei der Düngung mit Gülle oder Stallmist.<br />
Nach den vorliegenden Untersuchungen haben Gärprodukte eine fördernde <strong>Wirkung</strong> auf die<br />
Abundanz <strong>von</strong> Regenwürmern in Ackerböden, der positive Effekt herkömmlicher<br />
Wirtschaftsdünger wird jedoch nicht erreicht.<br />
Durch den Abbau der organischen Substanz im Fermenter und dem dadurch eingeengten C/N-<br />
Verhältnis gelangt bei der N-bezogenen Düngung mit flüssigem Gärprodukt insgesamt<br />
weniger Kohlenstoff in den Boden als bei Gülle. Allerdings ist die organische Substanz im<br />
flüssigen Gärprodukt stabiler als die <strong>von</strong> Gülle und trägt daher in höherem Maße zur<br />
Humusreproduktion bei. Die organische Substanz in festen <strong>Gärprodukten</strong> ist dagegen deutlich<br />
weniger stabilisiert als die <strong>von</strong> Stallmist. Der Anteil und die Abb<strong>aus</strong>tabilität der organischen<br />
Substanz in den <strong>Gärprodukten</strong> sind u. a. <strong>von</strong> den eingesetzten Substraten und<br />
anlagenspezifischen Parametern wie der Verfahrensart und der Verweilzeit abhängig. Die<br />
VDLUFA-Richtwerte für die Humusreproduktionsleistung <strong>von</strong> <strong>Gärprodukten</strong> bedürfen einer<br />
Prüfung und einer stärkeren Differenzierung notwendigerweise unter Einbeziehung <strong>von</strong><br />
mehrjährigen Feldversuchen. Weitere Forschungen zu dieser Thematik sind am Institut für<br />
Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin (IASP) geplant.