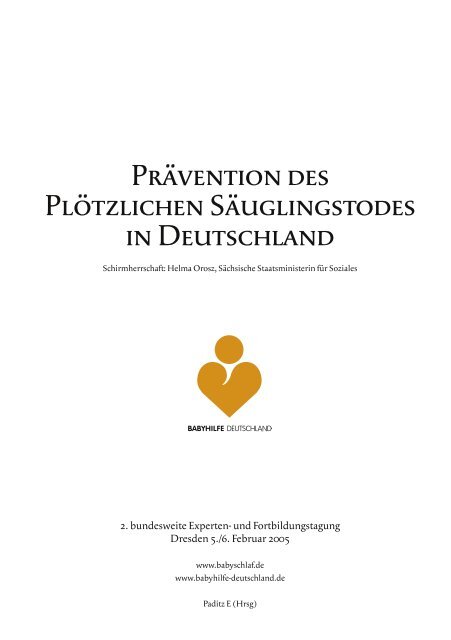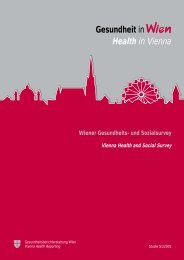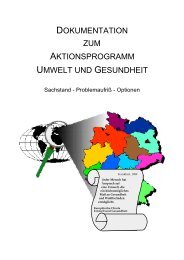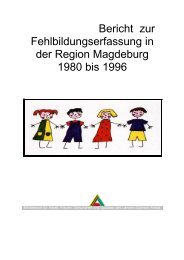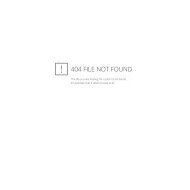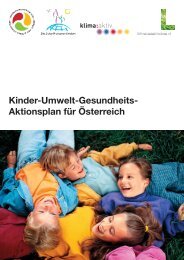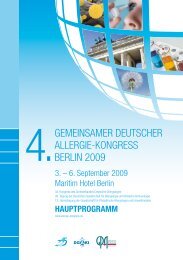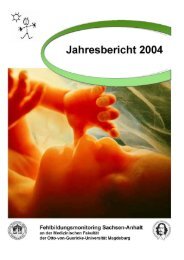AT2005-8021 Tagungsband II.indd - Kinder-Umwelt-Gesundheit
AT2005-8021 Tagungsband II.indd - Kinder-Umwelt-Gesundheit
AT2005-8021 Tagungsband II.indd - Kinder-Umwelt-Gesundheit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prävention des<br />
Plötzlichen Säuglingstodes<br />
in Deutschland<br />
Schirmherrschaft: Helma Orosz, Sächsische Staatsministerin für Soziales<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Dresden 5./6. Februar 2005<br />
www.babyschlaf.de<br />
www.babyhilfe-deutschland.de<br />
Paditz E (Hrsg)
Inhalt<br />
Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Grußwort der Staatsministerin Helma Orosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
SID-Prävention in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
Die Vereinigung leitender <strong>Kinder</strong>- und Jugendärzte und <strong>Kinder</strong>chirurgen<br />
Deutschlands (VLKKD) als Förderer des Programmes zur Prävention des<br />
plötzlichen Kindstodes in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />
SID-Prävention in Hessen 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
SID-Prävention in Rheinland-Pfalz 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen . . . . . . . . . . . . . 39<br />
Faktoren für eine bessere Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
Beinahe-SID unter stationärer Überwachung mit schwersten neurologischen<br />
Folgeschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
Impfungen und der plötzliche Säuglingstod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
SID-Häufung bei bestimmten Wetterlagen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />
Autonomes Nervensystem und plötzlicher Säuglingstod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />
Gibt es einen genetischen Hintergrund für den plötzlichen Kindstod? . . . . . . . . . . . . . 91<br />
Verzögerte funktionelle Hirnreifung bei <strong>Kinder</strong>n Methadon-substituierter<br />
Mütter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />
Indikatoren für eine Arousal-Aktivierung bei Säuglingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />
Koordination der Handlungsträger bei plötzlichem Säuglingstod vor Ort . . . . . . . . . 101<br />
Computertomographie und Magnetresonanztomographie in der<br />
postmortalen Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105<br />
Trauer nach plötzlichem Säuglingstod: Folgen und Hilfsmöglichkeiten. . . . . . . . . . . . 111<br />
Vergleich von Trauerreaktionen bei Eltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117<br />
Proaktive telefonische Raucherberatung von Schwangeren und Müttern<br />
von Säuglingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127<br />
Gründungsaufruf der Babyhilfe Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131<br />
Satzung der Babyhilfe Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />
Antrag auf Mitgliedschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145<br />
3
4<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Impressum<br />
Herausgeber: Prof. Dr. med. habil. Ekkehart Paditz<br />
Vorsitzender Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
Klinik und Poliklinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin<br />
der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der<br />
Technischen Universität Dresden<br />
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden<br />
Telefon (03 51) 4 58 31 60<br />
Telefax (03 51) 4 58 57 72<br />
E-Mail: Ekkehart.Paditz@uniklinikum-dresden.de<br />
Geschäftsstelle der Babyhilfe Deutschland:<br />
Lingnerschloss Dresden (Torhaus)<br />
Bautzner Straße 132, 01099 Dresden<br />
Im Auftrag des Vorstandes, des Kuratoriums und der Beiräte der<br />
Babyhilfe Deutschland:<br />
Staatsminister a. D. Georg Brüggen, Vorsitzender des Kuratoriums<br />
Dr. med. Katharina Stahn, Stellvertr. Vorsitzende des Vorstandes<br />
Dipl.-Med. Stefan Scharfe, Medizinalvorstand<br />
Gerd Pfetzer, Finanzvorstand<br />
Constanze Geiert, Justiziar<br />
Staatssekretär a. D. Albin Nees, Dr. med. Eleonore Lossen-Geisler,<br />
PD Dr. med. Thomas Erler, Birgit Pätzmann-Sietas im Namen des<br />
Länderbeirates<br />
Prof. Dr. med. Gerhard Jorch, Prof. Dr. med. Christian F. Poets, Prof.<br />
Dr. med. Karl Bentele, Prof. Dr. med. Harald Schachinger, Prof. Dr.<br />
med. Volker Hesse, PD Dr. med. Bernhard Schlüter, Dr. med. Gotthard<br />
von Czettritz, PD Dr. rer. nat. Sabine Scholle, Dr. med. Bernhard<br />
Hoch, Dipl.-Päd. Hermann-Josef Schwab, Dipl.-Psych. Peter<br />
Lindinger im Namen des Wissenschaftlichen Beirates<br />
Haike Korbl, Hermann-Josef Schwab im Namen des Beirates Selbsthilfegruppen<br />
Titelblatt: Bernd Hanke (BDG), Dresden. Foto (Dresden): E.Paditz,<br />
Foto (Babyschale der Urbevölkerung der Anadamanen/ Inselgruppe<br />
im Indischen Ozean): Katalog Nr. 18 111, Staatliche Ethnografische<br />
Sammlungen Sachsen, Museum für Völkerkunde Dresden; Entwicklung<br />
des Slogans zur Andamanen-Wiege: Thomas Pabst von der<br />
Thomas Pabst Kommunikationsberatung Heidelberg.<br />
Wir danken Frau Dr. Lydia Icke-Schwalbe/Museum für Völkerkunde<br />
Dresden, Herrn Dr. Klaus-Peter Kästner/Ethnografische Sammlung<br />
Sachsens, Herrn Dr. Jenzen/Museum für Völkerkunde der Staatlichen<br />
Kunstsammlungen Dresden, den Herren René Wagner und<br />
André Köhler/Karl-May-Museum Radebeul bei Dresden für die<br />
Bereitstellung von Originalobjekten und Bildvorlagen zum Beitrag<br />
Babywiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen. Hannelore<br />
Hausding-Herzfeld und Birgit Oppelt unterstützten freundlicherweise<br />
die Arbeiten am Manuskript. Katja Dähne vom Knüpfer-<br />
Verlag Dresden lieferte die reprofähigen Scans und Bildvorlagen.<br />
Das Manuskript von Frau Prof. Dr. med. Gisela Molz aus Zürich<br />
konnte dank der freundlichen organisatorischen Unterstützung von<br />
Jean-Claude Meier aus Zollikerberg/Schweiz in den <strong>Tagungsband</strong><br />
aufgenommen werden.<br />
Wir danken allen Inserenten dieses Bandes für Ihre Unterstützung.<br />
Satz, Druck und Gesamtherstellung:<br />
Druckerei & Verlag Christoph Hille, Dresden 2005<br />
ISBN 3-932858-86-7
Grußwort<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
vor einem Jahr fand bei uns in Dresden<br />
die erste bundesweite Experten- und<br />
Fortbildungstagung „Prävention des<br />
plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland“<br />
statt. Auf Grund der positiven<br />
Resonanz auf diese Tagung darf ich Sie<br />
nun zum zweiten Mal hier in der sächsischen<br />
Landeshauptstadt begrüßen. Es ist<br />
mir eine besondere Freude, wieder die<br />
Schirmherrschaft über diese Veranstaltung<br />
zu übernehmen.<br />
Der Plötzliche Säuglingstod ist in den<br />
Industrieländern leider immer noch die<br />
häufigste Todesursache bei <strong>Kinder</strong>n im<br />
ersten Lebensjahr. Im Jahre 1991 waren<br />
in Sachsen 21 Todesfälle zu beklagen, im<br />
Jahr 2003 noch zehn. Hinter diesen Zahlen<br />
stehen große Anstrengungen. Diese<br />
sind darauf gerichtet, jene Risiken zu<br />
vermindern, die zum Plötzlichem Säuglingstod<br />
führen können. Im Rahmen des<br />
Vereins „Schlafmedizin Sachsen e. V.“<br />
und der Arbeitsgruppe des Sächsischen<br />
Staatsministeriums für Soziales „Prävention<br />
des Plötzlichen Säuglingstodes“<br />
wurde in den vergangenen zehn Jahren<br />
eine erfolgreiche Arbeit geleistet. Um<br />
den Erfolg nachhaltig zu sichern, muss<br />
die dauerhafte Aufklärung weiterhin im<br />
Zentrum unserer Bemühungen stehen.<br />
Der Verlust eines Kindes durch Plötzlichen<br />
Säuglingstod ist ein schwerer Schicksalsschlag<br />
und führt möglicherweise bei<br />
vielen Betroffenen in stärkerem Maße zu<br />
psychischen und physischen Erkrankungen<br />
als bei anderen Todesursachen.<br />
Im Rahmen eines Fachgutachtens „Hilfe<br />
für betroffene Familien“ sollte das<br />
Augenmerk auf diese Thematik gelenkt<br />
werden. Ein Ziel war es, jenen, die als<br />
Helferinnen oder Helfer – sei es als Arzt,<br />
Rettungshelfer oder Hebamme – Kontakt<br />
mit Betroffenen haben, Hilfe anzubieten.<br />
Die Ergebnisse dieser Studie<br />
werden Ihnen während der Tagung präsentiert.<br />
Ich hoffe, diese Veranstaltung mit den<br />
zahlreichen interessanten Vorträgen und<br />
Workshops dient dazu, dass das Interesse<br />
an der Prävention des plötzlichen<br />
Säuglingstodes wachgehalten wird und<br />
damit zu einer bundesweit dauerhaften<br />
Aufklärungsarbeit führt.<br />
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer<br />
weiteren verantwortungsvollen Tätigkeit<br />
und für die Tagung ein gutes Gelingen.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Orosz<br />
Grußwort<br />
Helma Orosz<br />
Sächs. Staatsministerin für Soziales<br />
5
SID-Prävention in der Schweiz<br />
M. Sutter<br />
Die SID-Prävention in der Schweiz<br />
nahm 1985 ihren Anfang. Der Autor<br />
erlebte einige Fälle von SID, vergeblicher<br />
Reanimationsversuche und hilflose<br />
Eltern und Ärzte. Dies motivierte ihn,<br />
1985 zu André Kahn nach Brüssel zu<br />
fahren und Ideen in die Schweiz zurückzubringen.<br />
1986 setzten sich ein Dutzend Pädiater<br />
(Vertreter der Universitätskinderkliniken<br />
und größeren <strong>Kinder</strong>kliniken<br />
zusammen, um das Thema SID zu diskutieren.<br />
Von SID sprach zu dieser Zeit in<br />
der Schweiz kaum jemand, geschweige<br />
denn von Prävention. In dieser ersten<br />
Sitzung wurden folgende Themen diskutiert:<br />
Untersuchung nach erfolgtem<br />
SID, Procedere bei Risikokindern, Elternselbsthilfeorganisation,SID-Merkblatt<br />
für die Schweizerische Gesellschaft<br />
für Pädiatrie.<br />
Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik<br />
wurden zusammengetragen und man<br />
realisierte bald einmal, dass diese Zahlen<br />
mit Vorsicht interpretiert werden mussten,<br />
da auch die Definition von SID nicht<br />
einheitlich war und zudem ein guter Teil<br />
dieser SID-Diagnosen ohne Autopsie gestellt<br />
wurden, obschon ein SID als außergewöhnlicher<br />
Todesfall in der Schweiz<br />
von Gesetzes wegen von Untersuchungsrichter<br />
und Polizei und mittels Autopsie<br />
abgeklärt werden müsste.<br />
1988 fand eine Tagung statt, an der<br />
Pädiater, Pathologen und Eltern parallele<br />
und gemeinsame Sitzungen durchführten<br />
und einheitliches Vorgehen<br />
Sutter<br />
SID-Prävention in der Schweiz<br />
diskutierten. Im gleichen Jahr wurde<br />
die Elternselbsthilfeorganisation SIDS<br />
Schweiz gegründet. 1989 trat man auch<br />
an die Öffentlichkeit über Presse und Radiosendungen.<br />
Es wurde auch ein vielbeachteter<br />
Dokumentarfilm gedreht.<br />
Am 20. Mai 1992 erfolgte der erste<br />
große Schritt bezüglich Prävention mit<br />
einem Artikel in der Schweiz. Ärztezeitung,<br />
in welchem vor der Bauchlage gewarnt<br />
wurde (Lit. 1). Dieses Statement<br />
erfolgte auf Grund einer Consensus-Sitzung<br />
der SID Kommission der SGP.<br />
1992 und 1993 führte das Institut für<br />
Sozial- und Präventivmedizin der Universität<br />
Genf eine Umfrage betreffend<br />
Risikofaktoren durch und prognostizierte<br />
einen Rückgang der SID-Frequenz in<br />
der Schweiz um 50 bis 70 %, wenn die<br />
Präventivpunkte Schlafposition, Tabak<br />
und Stillen propagiert würden. Damals<br />
schliefen noch 40 % der <strong>Kinder</strong> in der<br />
Bauchlage.<br />
1993 publizierte der Autor einen Übersichtsartikel<br />
zum Thema SID in der Paediatica,<br />
der Fachzeitschrift der Schweiz.<br />
Gesellschaft für Pädiatrie: Schwerpunkte<br />
waren Risikofaktoren und Prävention<br />
von SID (Lit. 2). Es entstanden lebhafte<br />
Diskussionen zwischen den Mitgliedern<br />
der SID-Kommission und Gegnern der<br />
Rückenlage, die aus verschiedenen Lagern<br />
kamen (Krankenschwestern, Hebammen,<br />
Mütter- und Väterberatungsschwestern,<br />
aber auch Kolleginnen und<br />
Kollegen).<br />
7
8<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
1993 bis 1995 wurde im Rahmen einer<br />
Dissertation eine Fall-Kontroll-Studie<br />
durchgeführt, die im wesentlichen<br />
die Resultate anderer Länder bestätigte<br />
(Lit. 3).<br />
1996 Gründung des sogenannten Elternpiketts<br />
im Raume Zürich/Winterthur<br />
und Bern. Betroffene Eltern wurden<br />
intensiv vorbereitet, um in der akuten<br />
Situation eines SID den neu betroffenen<br />
Eltern beizustehen und sie ein Stück ihres<br />
Weges zu begleiten. Der Elternpikett<br />
ist leider im Raume Bern nie realisiert<br />
worden, funktionierte jedoch im Raume<br />
Zürich/Winterthur eine Zeitlang, bis<br />
mangels genügender Teilnahme betroffener<br />
Eltern das Projekt eingestellt werden<br />
musste.<br />
1997 erfolgte eine große Plakataktion,<br />
die sich an Pädiater, Geburtshelfer,<br />
Geburtskliniken, Allgemein-Mediziner,<br />
Mütter- und Väterberatungsstellen etc.<br />
richtete. Es wurden Tausende von Plakaten<br />
mit den bekannten Präventionsmaßnahmen<br />
an diese Praxen und Spitäler<br />
versandt.<br />
Die Aktion wurde finanziell vom Bundesamt<br />
für <strong>Gesundheit</strong> und von der<br />
Schweiz. Stiftung für <strong>Gesundheit</strong>sförderung<br />
unterstützt. 1998 entwarfen der Autor<br />
und die Elternselbsthilfeorganisation<br />
SIDS-Schweiz eine Broschüre, die allen<br />
Wöchnerinnen abgegeben wurde, die<br />
großen Anklang fand und sehr beachtet<br />
wurde. Diese Aktion wurde auch über<br />
die Schweiz. Ärztezeitung allen Kolleginnen<br />
und Kollegen in Erinnerung gerufen<br />
(Lit. 4). Diese Broschüren wurden über<br />
mehrere Jahre an jede Wöchnerin abgegeben<br />
und schließlich in gekürzter Form<br />
ins <strong>Gesundheit</strong>sheft, das jedes Kind ab<br />
Geburt begleitet, integriert.<br />
Die Broschüren werden zur Zeit nur<br />
noch auf Wunsch von Spitälern oder an<br />
Einzelpersonen abgegeben. Dies unter<br />
anderem auch aus finanziellen Gründen,<br />
da Druck und Verteilung der Broschüren<br />
die finanziellen Möglichkeiten der bestehenden<br />
Organisationen überfordern.<br />
• 1999 erarbeitete eine Arbeitsgruppe<br />
der <strong>Kinder</strong>klinik Bern ein Consensuspapier<br />
betreffend Vorgehen bei SID<br />
und ALTE.<br />
• 2000/2001: mehrere Fernsehauftritte<br />
des Autors und betroffener Eltern in<br />
Sendungen mit hohen Einschaltquoten<br />
(<strong>Gesundheit</strong>ssprechstunde, Quer).<br />
• 2004: Ausarbeitung eines Consensuspapiers<br />
betreffend SID und ALTE, das<br />
gesamt-schweizerisch gestreut werden<br />
soll (vorgesehen für 2005).<br />
Insgesamt kann gesagt werden, dass die<br />
Bemühungen der letzten 18 Jahre Früchte<br />
getragen haben: Die SID-Frequenz ist<br />
auf unter 0,3 % gefallen (siehe Tabelle);<br />
frisch betroffene Eltern finden rasch Zugang<br />
zu Selbsthilfegruppen; jede Pädiatrische<br />
Klinik hat klare Richtlinien zum<br />
Vorgehen zum SID und ALTE.
SID-Häufigkeit Schweiz<br />
Datum Knabe Mädchen Total Geburten SID-Inzidenz (‰)<br />
Literatur<br />
1989 55 45 100 81 180 1.23<br />
1990 58 41 99 83 939 1.18<br />
1991 48 40 88 86 200 1.02<br />
1992 49 35 84 86 910 0.97<br />
1993 51 31 82 83 762 0.98<br />
1994 42 18 60 82 980 0.72<br />
1995 35 19 54 82 201 0.66<br />
1996 27 10 37 83 007 0.45<br />
1997 27 13 40 80 584 0.5<br />
1998 19 11 30 78 949 0.38<br />
1999 23 14 37 78 408 0.47<br />
2000 11 13 25 78 458 0.32<br />
2001 13 8 21 73 509 0.29<br />
1 Schweiz. Ärztezeitung, Heft 2/1992;<br />
20. Mai 1992<br />
2 Paediatrica, Vol 4, No. 3, 1993, p18<br />
3 M. Mosimann, Inauguraldissertation der medizinischen<br />
Fakultät der Universität Bern<br />
4 Schweiz. Ärztezeitung, Heft 24/1997;<br />
11. Juni 97<br />
Autor<br />
Dr. med. Martin Sutter<br />
Kreuzgasse 17, 3076 Worb, Schweiz<br />
Sutter<br />
SID-Prävention in der Schweiz<br />
9
Zusammenfassung<br />
In Deutschland sind zwischen 1980<br />
bis 2002 18 652 Babies am plötzlichen<br />
Säuglingstod gestorben. Im Jahre 2002<br />
waren es 367 Fälle, im Vergleich dazu<br />
verstarben 287 <strong>Kinder</strong> bis zum 15. Lebensjahr<br />
an Krebserkrankungen (19<br />
im ersten Lebensjahr) sowie 111 infolge<br />
von tödlichen Schul- und Wegeunfällen.<br />
Der plötzliche Säuglingstod<br />
ist damit weiterhin die häufigste<br />
Todesursache im Kindesalter jenseits<br />
der Neugeborenenperiode. Die Häufigkeit<br />
des plötzlichen Säuglingstodes<br />
ist in Deutschland seit 1991 um 67 %<br />
von 1,55/1 000 Lebendgeburten auf<br />
0,51/1 000 zurückgegangen. Etwa 6 300<br />
<strong>Kinder</strong> verdanken ihr Leben den seit<br />
1991 in Deutschland anlaufenden Präventionskampagnen<br />
(483 Babies pro<br />
Jahr bzw. neun Babies pro Woche bzw.<br />
37 Babies pro Monat). Ausgehend von<br />
der niederländischen Häufigkeitsziffer<br />
für das Jahr 2002 von 0,11/1 000 und<br />
den im Regierungsbezirk Dresden in<br />
mehreren Jahrgängen erreichten Ziffern<br />
um 0,08/1 000 erscheint es als realistisch,<br />
dass die Häufigkeit des plötzlichen<br />
Säuglingstodes in Deutschland<br />
um weitere 288 bis 309 Todesfälle<br />
vermindert werden kann. Das aktuelle<br />
Ziel sollte deshalb sein, ca. 300 Babies<br />
pro Jahr bzw. 23 Babies pro Woche<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in<br />
Deutschland<br />
Paditz E<br />
Klinik und Poliklinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der<br />
Technischen Universität Dresden<br />
vor dem plötzlichen Säuglingstod zu<br />
bewahren.<br />
Bereits bei der SID-Definition wird<br />
deutlich, dass weitere systematische<br />
Anstrengungen erforderlich sind, um<br />
Notärzte, betroffene Eltern, Polizisten,<br />
Staatsanwälte und Politiker in aktuelle<br />
Diskussionen, Schulungen, Leitlinien<br />
und Dienstanweisungen einzubeziehen,<br />
um die Obduktionsrate wesentlich<br />
zu erhöhen. Die Vermittlung des<br />
vorhandenen Kenntnisstandes an heterogene<br />
und sich ständig neu regenerierende<br />
Zielgruppen bleibt eine<br />
weitere kurz-, mittel- und langfristige<br />
Aufgabe. Die zielgruppenspezifische<br />
Ansprache und Motivation ist wesentlich<br />
zu verbessern, um wirklich möglichst<br />
viele Menschen zu erreichen.<br />
Definition SID<br />
Der plötzliche Säuglingstod (SID, sudden<br />
infant death) tritt plötzlich und unerwartet<br />
aus scheinbarer <strong>Gesundheit</strong> heraus<br />
meistens während der Schlafenszeit<br />
in der Nacht oder am Tage auf. Individual-<br />
und familienanamnestisch, hinsichtlich<br />
körperlicher Symptome, der Analyse<br />
der Schlafumgebung und der aktuellen<br />
Auffindesituation sowie postmortal erhobener<br />
Befunde (postmortales MRT, CT<br />
und Röntgen, Autopsie, toxikologische,<br />
infektiologische, metabolische, histolo-<br />
11
12<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
gische, elektronenmikroskopische und<br />
ggf. auch molekularbiologische Untersuchungen,<br />
erweiterte nochmalige Analyse<br />
der Guthriekärtchen des Neugeborenenscreenings)<br />
lassen sich nach dem derzeitigen<br />
Kenntnisstand keine zum Tode<br />
führenden Krankheitsursachen oder äußeren<br />
Umstände finden. Insofern ist der<br />
plötzliche Säuglingstod eine Ausschlussdiagnose<br />
und eine Todesart. Da die Todesursache<br />
nicht bekannt ist, ist auf dem<br />
Totenschein „ungeklärte Todesursache“<br />
anzugeben. Das Phänomen ist nicht auf<br />
das erste Lebensjahr begrenzt, auch innerhalb<br />
der Neugeborenenperiode sind<br />
einzelne plötzliche Säuglingstodesfälle<br />
beobachtet worden und etwa zwei bis<br />
sechs Prozent der plötzlichen Kindstodesfälle<br />
ereignen sich im zweiten Lebensjahr<br />
(Bajanowski und Poets 2004). Die<br />
Verschlüsslung erfolgt unter der Diagnose<br />
Nr. „R95“ (plötzlicher Säuglingstod),<br />
in der Bundesstatistik sind die erforderlichen<br />
Häufigkeitsangaben zum Teil<br />
aber nur unter dem Begriff „plötzlicher<br />
Kindstod“ zu finden (www.gbe-bund.<br />
de). Die Autopsie gehört zur Definition<br />
des SID, d. h. anamnestisch und klinisch<br />
kann immer nur der Verdacht auf einen<br />
plötzlichen Säuglingstod oder jenseits<br />
des ersten Lebensjahres auf einen plötzlichen<br />
Kindstod als Ausschlussdiagnose<br />
geäußert werden, da ohne Autopsie<br />
(oder postmortales MRT bzw. CT und<br />
Skelettröntgen) z. B. mehrzeitige Frakturen,<br />
eine Hirnblutung, eine perakut<br />
verlaufende Infektion oder ein Invaginationsileus<br />
nicht ausgeschlossen werden<br />
können (Tab.1).<br />
Tab. 1 Differenzialdiagnosen des plötzlichen Säuglingstodes (vgl. Bajanowski und<br />
Poets 2004)<br />
Natürlicher Tod Nichtnatürlicher Tod<br />
1. Infektionen (Pneumonien, Meningoenzephalitis,<br />
Gastroenteritis, Myokarditis, Sepsis)<br />
2. Stoffwechselstörungen (Fettsäureoxidationsdefekte,<br />
Pyruvatdehydrogenasemangel, Biotinidase-Mangel,<br />
Hyperinsulinismus, Thiaminstoffwechselstörungen)<br />
3. Fehlbildungen (Gefäßmalformationen, Herzfehler,<br />
Kardiomyopathien, Endokardfibroelastose)<br />
Ersticken (unter weicher Bettdecke, durch Verschluss<br />
der Atemöffnungen, durch Thoraxkompression,<br />
durch Aspiration von Mageninhalt)<br />
Schütteltrauma<br />
Intoxikation<br />
4. Pierre-Robin-Sequenz Verdeckte Formen der stumpfen Gewalteinwirkung<br />
(z. B. stumpfes Bauchtrauma)<br />
5. Rye-Syndrom „Münchhausensyndrom by proxy“ mit tödlichem<br />
Ausgang (by proxy = Stellvertreter; d. h.<br />
eine Bezugsperson fügt einem Kind Schäden zu,<br />
um eine Krankheit des Kindes vorzutäuschen)<br />
6. Hyperthermie aus innerer Ursache Vernachlässigung<br />
7. Bronchopulmonale Dysplasie Hyperthermie aus äußerer Ursache
Da die SID-Autopsierate in Deutschland<br />
zur Zeit nur bei etwa 50 % liegt<br />
(Bajanowski und Poets 2004) und z. B.<br />
auch in Sachsen nur maximal 9/10 SID-<br />
Fällen obduziert wurden (siehe Abb. 2<br />
in Lange 2002) können die offiziellen<br />
Statistiken nur bei gleichzeitiger Betrachtung<br />
des Verlaufs der Säuglingssterblichkeit<br />
im ersten Lebensjahr sowie – falls<br />
verfügbar – der Säuglingssterblichkeit<br />
zwischen dem zweiten bis sechsten bzw.<br />
zwölften Lebensmonat – hinreichend zur<br />
Einschätzung des Verlaufes der SID-Häufigkeit<br />
herangezogen werden. Aus der<br />
Zusammenschau aller anamnestischen,<br />
klinischen und autoptischen Befunde<br />
lässt sich in 60 bis 70 % der Fälle die Diagnose<br />
„plötzlicher Säuglingstod“ (SID,<br />
R 95) ableiten. In zehn bis 20 % der Fälle<br />
finden sich hinreichend erklärbare Ursachen<br />
(siehe Tabelle 1). Weitere 20 bis<br />
30 % der Fälle lassen sich nur teilweise<br />
erklären und werden aus pädiatrischer<br />
Sicht nach dem derzeitigen Kenntnisstand<br />
ebenfalls als SID klassifiziert (Bentele<br />
2004).<br />
Bei der Beratung betroffener Eltern<br />
sollte immer wieder darauf hingewiesen<br />
werden, dass Hinterbliebene, denen<br />
eine Autopsie nicht angeboten wurde<br />
oder die eine Autopsie verweigerten,<br />
später bedauern, dass die Autopsie nicht<br />
durchgeführt wurde. Das Argument der<br />
Unversehrtheit des Körpers des verstorbenen<br />
Kindes erscheint zunächst nachvollziehbar.<br />
Andererseits sollte den Eltern<br />
aber auch zu bedenken gegeben<br />
werden, dass das Kausalitätsbedürfnis<br />
und Schuldgefühle als langfristig wirkende<br />
destruktive Kräfte und nur durch die<br />
Obduktion außer Kraft gesetzt werden<br />
können. Das potenzielle Chaos von ei-<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
genen Vermutungen und Befürchtungen<br />
sowie von fremden Gerüchten oder<br />
Schuldzuweisungen kann nur durch die<br />
kompetente ärztliche Übermittlung des<br />
Autopsieergebnisses und weiterer postmortal<br />
erhobener Befunde geordnet und<br />
bereinigt werden.<br />
Ein Vater, dessen Kind plötzlich gestorben<br />
war, machte folgende wesentliche<br />
Ergänzungen:<br />
• Auch verstorbene <strong>Kinder</strong> haben<br />
das Recht, dass man sich um die Ursache<br />
ihres Todes kümmert, um anderen<br />
<strong>Kinder</strong>n und Familien dieses<br />
Schicksal möglicherweise zu ersparen,<br />
denn es passiert nichts ohne<br />
Ursache.<br />
• Die Autopie kann helfen, einem eigenen<br />
Kind (d. h. bereits lebenden<br />
Geschwistern oder nachfolgenden<br />
Geschwistern) oder anderen <strong>Kinder</strong>n.<br />
• Es sollte darauf aufmerksam gemacht<br />
werden, dass die Aufbahrung<br />
des verstorbenen Kindes auch<br />
nach der Obduktion nochmals zu<br />
Hause möglich ist. Dies kann mit<br />
den regional zuständigen Handlungsträgern<br />
besprochen werden<br />
und den Hinterbliebenen das Abschiednehmen<br />
wesentlich erleichtern.<br />
• Die Zustimmung zur Obduktion<br />
ist psychologisch die Zustimmung<br />
zum Tode des Kindes, den man<br />
noch nicht begreifen kann.<br />
• Seine Frau und er selbst würden<br />
heute einer Autopsie ihres Kindes<br />
zustimmen und bedauern, dass die<br />
Autopsie damals nicht erfolgt ist.<br />
13
14<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Notärzte, Polizisten und Staatsanwälte<br />
sollten ebenfalls eindringlich darauf aufmerksam<br />
gemacht werden, dass es einen<br />
Kunstfehler darstellt, zu behaupten, dies<br />
sei „ein typischer Fall von plötzlichem<br />
Säuglingstod“, ohne dass eine Autopsie<br />
erfolgt ist, da die in Tab. 1 aufgeführten<br />
Diagnosen ohne Autopsie nicht ausgeschlossen<br />
werden können. Die Autopsie<br />
gehört obligat und notwendigerweise zur<br />
Definition des SID und sollte deshalb in<br />
jedem Falle angeordnet werden. Ein Ermessensspielraum<br />
besteht per definitionem<br />
nicht. Ein routinierter Algorithmus<br />
schützt betroffene Eltern damit auch vor<br />
einer Stigmatisierung, wann eine Autopsie<br />
angeordnet wird oder nicht.<br />
Die Entwicklung des postmortalen<br />
MRT und CT in Verbindung mit postmortalen<br />
Skelettröntgenaufnahmen auf<br />
dem Wege zu gezielten postmortalen<br />
Biopsien könnte in Zukunft möglicherweise<br />
eine gangbare Alternative zum<br />
bisherigen Goldstandard der Autopsie<br />
darstellen. Die Beurteilung der Auffindesituation<br />
und der Schlafumgebung sollte<br />
systematischer als bisher in die Arbeit<br />
der Notärzte und der Polizei einbezogen<br />
werden. Hierzu werden zur Zeit entsprechende<br />
Protokollvorschläge erarbeitet.<br />
Häufigkeit<br />
In Deutschland sind zwischen 1990<br />
bis 2002 10,3 Millionen <strong>Kinder</strong> lebend<br />
geboren worden (genau: 10 262 767 Lebendgeburten),<br />
davon sind 9 610 Babies<br />
plötzlich und unerwartet gestorben.<br />
1980 bis 2002 wurden 18 652 plötzliche<br />
Kindstodesfälle im ersten Lebensjahr<br />
registriert. Das Häufigkeitsmaximum<br />
lag im Jahr 1991 auf dem Höhepunkt<br />
der „Bauchlage-Epidemie“ (!) mit 1 285<br />
plötzlichen Säuglingstodesfällen. Dies<br />
entsprach für 1991 mit 830 019 Lebendgeburten<br />
1,55 plötzlichen Säuglingstodesfällen<br />
pro 1 000 Lebendgeburten. Im<br />
Jahre 2002 sind 367 Babies am plötzlichen<br />
Säuglingstod gestorben, bei 719 250<br />
Lebendgeburten einer Häufigkeit von<br />
0,51 Fällen pro 1 000 Lebendgeburten<br />
entsprechend (Abb. 1).<br />
Der plötzliche Säuglingstod stellt in<br />
Deutschland auch im Jahre 2002 weiterhin<br />
die häufigste Todesart jenseits<br />
der Neugeborenenperiode dar (Tab. 2).<br />
plötzlicher Säuglingstod 367<br />
Krebs (<strong>Kinder</strong> unter 15 Jahre) 287*<br />
tödliche Schul- und Wegeunfälle 111**<br />
* davon 19 Todesfälle im ersten Lebensjahr infolge<br />
von Krebserkrankungen<br />
** <strong>Kinder</strong>, Schüler und Studenten; davon 14 tödliche<br />
Schulunfälle und 97 tödliche Wegeunfälle<br />
Tab. 2 Anzahl von Todesfällen im Kindesalter in<br />
Deutschland im Jahre 2002 (Quelle: www.gbebund.de,<br />
Stand vom 2. Januar 2005)<br />
Die weltweit niedrigste SID-Häufigkeit<br />
wurde 2002 wiederum in den Niederlanden<br />
mit 0,11/1 000 Lebendgeburten<br />
registriert (www.wiegendood.nl).<br />
Abnahme der SID-Häufigkeit in<br />
Deutschland zwischen 1991 bis<br />
2002 um 67 %<br />
Die Verminderung der SID-Häufigkeit<br />
zwischen 1991 (dem Häufigkeitsmaximum<br />
in Deutschland, s. Abb. 1) und 2002<br />
von 1.285 auf 367 Fälle pro Jahr bzw. von
Anzahl von plötzlichen Kindstodesfällen in Deutschland zwischen<br />
1 400<br />
1 285<br />
1 283<br />
1 200<br />
1 140<br />
1 094<br />
1 054<br />
1 021<br />
1 000<br />
924<br />
929<br />
870<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
810<br />
807<br />
751<br />
800<br />
692<br />
747<br />
751<br />
774<br />
671<br />
662<br />
602<br />
600<br />
507<br />
482<br />
429<br />
400<br />
367<br />
200<br />
0<br />
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002<br />
Abb. 1 Anzahl von plötzlichen Säuglingstodesfällen in Deutschland zwischen 1980 bis 2002 (Quelle: www.gbe-bund.de, Stand vom 2. Januar 2005)<br />
15
16<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
1,55 auf 0,51 pro 1 000 Lebendgeburten<br />
entspricht einer Häufigkeitsabnahme<br />
von 67 % innerhalb von 12 Jahren. Hätte<br />
diese Häufigkeitsabnahme nicht stattgefunden,<br />
wären zwischen 1990-2002<br />
nicht weniger als 15 888 Babies plötzlich<br />
gestorben, real sind aber 9 610 Säuglinge<br />
plötzlich tot aufgefunden worden.<br />
Demnach verdanken 6 278 Babies (483<br />
Babies pro Jahr bzw. neun Babies pro<br />
Woche bzw. 37 Babies pro Monat) ihr<br />
Leben den seit 1991 in Deutschland anlaufenden<br />
Präventionskampagnen.<br />
Diese Häufigkeitsabnahme kann direkt<br />
mit Präventionsmaßnahmen (Informationskampagnen<br />
insbesondere zur<br />
Vermeidung der Bauchlage als Schlafposition<br />
für Säuglinge) in Verbindung gebracht<br />
werden, da auch aus Deutschland<br />
drei Studien vorliegen, die diese Interventionseffekte<br />
belegen:<br />
1. In der DDR führte das staatliche Verbot<br />
der Bauchlage als Schlafposition<br />
für Säuglinge im Jahre 1972 zu einer<br />
Abnahme plötzlicher Todesfälle im<br />
Säuglingsalter um 56 % innerhalb von<br />
fünf Jahren durch eine konsequent<br />
durchgesetzte ministerielle Anordnung<br />
(1972–1976)(Schwab 2004). Bei<br />
der Durchsetzung dieser Anordnung<br />
spielten offenbar drei Faktoren eine<br />
wesentliche Rolle:<br />
• die ministerielle Richtlinie wurde auf<br />
dem Dienstweg „von oben nach unten“,<br />
d. h. vom Ministerium über die<br />
untergeordneten Verwaltungsstrukturen<br />
(Bezirk, Kreis, Stadt) bis hin zu<br />
jeder einzelnen <strong>Kinder</strong>einrichtung<br />
(<strong>Kinder</strong>krippe) innerhalb weniger<br />
Tage bzw. Wochen im Sinne einer<br />
verbindlichen Leitlinie vermittelt,<br />
bei der jede einzelne Krippenerzieherin<br />
im Rahmen einer Teambesprechung<br />
(Fortbildung, meist parallel<br />
zu einer Arbeitsschutzbesprechung)<br />
persönlich unterschreiben musste,<br />
dass sie von dieser Richtlinie Kenntnis<br />
genommen hatte. Verstöße gegen<br />
diese Pflegerichtlinie wurden<br />
mit arbeitsrechtlichen bzw. disziplinarischen<br />
Maßnahmen geahndet<br />
(Schwab 2004), d. h. es erfolgte eine<br />
konsequente Qualitätskontrolle der<br />
Pflege;<br />
• das Thema wurde auch in der öffentlichen<br />
Diskussion thematisiert, indem<br />
weit verbreitete gesundheitserzieherische<br />
populärwissenschaftliche Zeitschriften<br />
über die Schlafposition von<br />
Säuglingen informierten („Humanitas“,<br />
„Deine <strong>Gesundheit</strong>“);<br />
• auf regionaler Ebene (Kreis bzw.<br />
Stadtkreis bei größeren Städten)<br />
arbeiteten Säuglingssterblichkeits-<br />
Kommissionen, in denen jeder Säuglingssterbefall<br />
von einer interdisziplinär<br />
besetzten Gruppe ausgewertet<br />
wurde. Der Kreisarzt sammelte und<br />
sichtete alle zugehörigen Unterlagen<br />
und lud die beteiligten Handlungsträger<br />
(Notärzte, Klinikärzte bzw.<br />
Klinikdirektoren) bei Bedarf monatlich<br />
zu einer Fallkonferenz ein. Mit<br />
dieser systematischen, kontinuierlichen<br />
und regionalisierten Schwachstellenanalyse<br />
konnten zeitnahe Rückinformationen<br />
gegeben werden.<br />
2. Die Westfälische Kindstodsstudie<br />
(Jorch 1991) in Nordrhein-Westfalen
führte auf Grund der öffentlichen Risikowarnung<br />
vor der Bauchlage als<br />
Schlafposition zwischen 1991 und 1992<br />
zu einem sofortigen überdurchschnittlichen<br />
Rückgang der SID-Häufigkeit<br />
in Deutschland von 1,55 auf 1,14 pro<br />
1 000 Lebendgeburten bzw. von 1 285<br />
auf 924 SID-Fällen (= Rückgang um<br />
26,4 % innerhalb von einem Jahr in<br />
Deutschland parallel zu öffentlichen<br />
Hinweisen über die Medien über das<br />
Risiko der Bauchlage als Schlafposition).<br />
Innerhalb von Nordrhein-Westfalen<br />
führte diese Studie von 1990 bis<br />
1992 zu einem Häufigkeitsrückgang<br />
um 40,5 %:<br />
NRW: 1990 489 Fälle = 2,45 pro 1 000<br />
Lebendgeburten<br />
1991 436 Fälle = 2,197/1 000<br />
(Nachweis der Bauchlage als<br />
Schlafposition als SID-Risikofaktor<br />
und sofortiger öffentlicher<br />
Risikohinweis)<br />
1992 287 Fälle = 1,458/1 000.<br />
(Quelle: www.gbe-bund.de, Stand vom 2. Januar<br />
2005)<br />
3. In Sachsen wurde die SID-Häufigkeit<br />
innerhalb von zehn Jahren zwischen<br />
1992–2002 um 70,0 % reduziert (Maximum<br />
1992 mit 0,83 Fällen pro 1 000<br />
Lebendgeburten, im Jahre 2002 noch<br />
0,25 pro 1 000 Lebendgeburten). Hier<br />
überlagert sich der Effekt der Westfälischen<br />
Kindstodsstudie mit dem ab<br />
1994 im Regierungsbezirk Dresden<br />
einsetzenden sächsischen Präventionsprogramm.<br />
Innerhalb einer Interventionsstudie<br />
mit zwei Kontrollgruppen<br />
konnte gezeigt werden, dass die<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Übergabe eines Informationsblattes<br />
in den Entbindungseinrichtungen im<br />
Regierungsbezirk Dresden zwischen<br />
1994–2001 zu einer Senkung der Häufigkeit<br />
des plötzlichen Kindstodes<br />
führte, während in den benachbarten<br />
Regierungsbezirken Leipzig und<br />
Chemnitz ohne derartige Intervention<br />
keine Häufigkeitsveränderungen erfolgten.<br />
Die Ausdehnung des Programmes<br />
auf alle drei Regierungsbezirke ab<br />
2002 ergab sofort eine Verminderung<br />
der SID-Häufigkeit in allen drei Regierungsbezirken<br />
Sachsens (Paditz 2003).<br />
Im Regierungsbezirk Dresden wurde<br />
das niederländische Häufigkeitsniveau<br />
von 0,11 in den Jahren 1997,<br />
1999, 2001 und 2002 mit Häufigkeitsziffern<br />
von 0,09/ 0,08/ 0,16 bzw. 0,16<br />
erreicht bzw. unterschritten.<br />
Demzufolge konnte die Häufigkeit<br />
des gefürchteten plötzlichen Kindstodes<br />
als häufigste Todesursache im Kindesalter<br />
jenseits der Neugeborenenperiode<br />
nur durch Informationsübergabe und<br />
damit durch gezielte Beeinflussung des<br />
Pflegeverhaltens von Eltern, Großeltern,<br />
Babysittern, <strong>Kinder</strong>krankenschwestern,<br />
Hebammen und von allen weiteren Personen,<br />
die Babies zum Schlafen legen, in<br />
Deutschland seit 1991 bis 2002 um 67 %<br />
vermindert werden (weitergehende<br />
Argumentation siehe: Bajanowski und<br />
Poets 2004).<br />
Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll,<br />
dass die Häufigkeit dieser gefürchteten<br />
Todesart durch alleinige Informationsübermittlung<br />
erheblich vermindert werden<br />
kann – ohne Einsatz apparativer<br />
Medizin, ohne Operation, ohne Bestrah-<br />
17
18<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
lung und ohne Medikamente. Damit ist<br />
der Beweis angetreten worden, dass es<br />
sich lohnt, sich für gezielte Prävention zu<br />
engagieren.<br />
Entwicklung der SID-Häufigkeit in den Bundesländern zwischen 1990/1992 bis zu 2002<br />
(Differenz) 1990/1992 vs. 2002)<br />
1,04<br />
1,55<br />
0,51<br />
Deutschland<br />
0,31<br />
0,34<br />
–0,03<br />
Sachsen-Anhalt<br />
0,34<br />
0,69<br />
0,35<br />
Thüringen<br />
0,42<br />
0,67<br />
0,25<br />
Sachsen<br />
0,74<br />
1,3<br />
0,77<br />
1,33<br />
0,56 0,56<br />
Hessen<br />
Brandenburg<br />
0,91<br />
1,54<br />
0,63<br />
Saarland<br />
0,93<br />
1,37<br />
0,44<br />
0,93<br />
1,17<br />
0,24<br />
Bayern<br />
Mecklemburg-Vorpommern<br />
1,09<br />
1,34<br />
0,25<br />
Baden-Würtemberg<br />
In den einzelnen Bundesländern nahm<br />
die Häufigkeit des plötzlichen Säuglingstodes<br />
ausgehend von unterschiedlichen<br />
Ausgangshäufigkeiten in unterschiedli-<br />
chem Maße ab (Abb. 2).<br />
1,13<br />
1,61<br />
0,48<br />
Niedersachsen<br />
1,18<br />
1,06<br />
0,42<br />
Berlin<br />
1,41<br />
1,92<br />
0,51<br />
Hamburg<br />
1,63<br />
2,11<br />
0,48<br />
Schleswig-Holstein<br />
1,65<br />
2,45<br />
0,8<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
1,67<br />
2,36<br />
0,69<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Abb. 2 Häufigkeit des plötzlichen Säuglingstodes in den einzelnen Bundesländern Deutschlands in den<br />
Differenz der SID-Häufigkeit<br />
max. SID-Häufigkeit<br />
SID-Häufigkeit 2002<br />
Jahrgängen 1990/1992 (max.) 1990–1992 vs. 2002 (Mitte) im 1990, Vergleich 1991 bzw. 1992 zu den Jahrgängen 2000–2002 (unten). (Für diesen Vergleich<br />
wurden jeweils drei Jahrgänge pro Bundesland summarisch miteinander verglichen, um im Falle kleiner<br />
Bundesländer eine annähernd ausreichend hohe Anzahl von Lebendgeburten für den Vergleich der SID-<br />
Raten pro 1 000 Lebendgeburten zu erhalten.) Oben: Veränderung der SID-Häufigkeit pro Bundesland<br />
(= Differenz 1990/1992 vs. 2000/2002). SID-Häufigkeit in Fällen pro 1 000 Lebendgeburten.<br />
Tragischer Traditionsbruch<br />
Die „Bauchlagekatastrophe“ mit ihrem<br />
Häufigkeitsmaximum im Jahre 1991<br />
wird als „ärztlich verursachte Tragödie“<br />
betrachtet („Suffocated Prone: The Iatrogenic<br />
Tragedy of SIDS“ 2000), da mit der<br />
Empfehlung der Bauchlage als Schlafposition<br />
für Säuglinge beginnend ab 1965–<br />
1969 auch in Deutschland ein tragischer<br />
1,82<br />
2,18<br />
0,36<br />
Bremen<br />
Traditionsbruch (Paditz 2003) vollzogen<br />
wurde. Kulturhistorische Untersuchungen<br />
zum Pflegeverhalten in vergangenen<br />
Jahrhunderten zeigen inzwischen, dass<br />
es in den vergangenen Jahrhunderten<br />
üblich war, Babies in Rückenlage und in<br />
einer eigenen Schlafstatt (z. B. einer Wiege)<br />
zum Schlafen zu legen (Abb. 3).
„Es ist nämlich die Art und Weise, wie<br />
ein gesunder Säugling schläft. Der gesunde<br />
Säugling liegt während des Schlafes immer<br />
und immer auf dem Rücken.“<br />
Hochsinger: <strong>Gesundheit</strong>spflege des Kindes im<br />
Elternhaus. Deutike-Verlag, Leipzig 1917, p. 14<br />
„Typisch für den jungen Säugling ist<br />
seine Schlafhaltung, bei welcher er auf dem<br />
Rücken liegt und die Arme in den Ellenbogen<br />
gebeugt, seitlich vom Oberkörper<br />
gehalten werden.“<br />
Optiz H, Schmidt F (Hrsg): Handbuch der<br />
<strong>Kinder</strong>heilkunde. Springer-Verlag, Heidelberg<br />
1966, p. 347<br />
Abb. 3 Typische Zitate aus Lehrbüchern zur Schlafposition<br />
von Säuglingen aus den Jahren 1917 und<br />
1966 vor Beginn der „Bauchlage-Katastrophe“<br />
Auf diese Weise konnten die beiden<br />
Risikofaktoren Bauchlage und Seitenlage<br />
sowie Cosleeping/Bed-Sharing/Familienbett<br />
vermieden werden. In Deutschland<br />
und in den Niederlanden ist die Bauchlage<br />
als einer der wesentlichen SID-Risikofaktoren<br />
lange bekannt:<br />
• Die Arbeitsgruppe Morbidität und<br />
Mortalität im Kindesalter der Gesellschaft<br />
für Pädiatrie der DDR sprach<br />
sich bereits am 27. Januar 1972 in ihrer<br />
Arbeitstagung in Dresden gemeinsam<br />
mit dem Ministerium für <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />
der DDR gegen die Empfehlung<br />
der Bauchlage als Schlafposition aus,<br />
da für die zum damaligen Zeitpunkt<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
gängige Umorientierung im Pflegeverhalten<br />
keine wissenschaftlichen Belege<br />
vorlagen. Sieben plötzliche Kindstodesfälle<br />
in Bauchlage unterstützen<br />
diese Position. Daraufhin wurde am<br />
8. Juni 1972 eine entsprechende ministerielle<br />
Richtlinie veröffentlicht, die<br />
bereits vorab am 11. März 1972 und<br />
im April 1972 in den Zeitschriften<br />
„Humanitas“ bzw. „Deine <strong>Gesundheit</strong>“<br />
abgedruckt wurde (Schwab 2004,<br />
Mecklinger 1972).<br />
• In den Niederlanden machte Prof. de<br />
Jonge 1987 auf das Risiko der Bauchlage<br />
aufmerksam.<br />
• 1991 ist die Bauchlage auch in Deutschland<br />
durch die Westfälische Kindstodsstudie<br />
als SID-Risikofaktor wissenschaftlich<br />
gesichert worden (G. Jorch<br />
1991). Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits<br />
zahlreiche weitere Studien vor,<br />
die die Bauchlage als SID-Risiko herausstellten;<br />
Beal und Finch aus Australien<br />
publizierten schon 1991 eine<br />
Metaanalyse über 19 Fall-Kontroll-Studien<br />
zu diesem Thema (OR 2,72; 95 %-<br />
Konfidenzintervall 2,27–3,26)(Beal<br />
&Finch 1991).<br />
• Den aktuellen Kriterien der Evidence<br />
Based Medicine wurde mit der deutschen<br />
BMBF-Studie genügt, in der 333<br />
SID-Fälle mit 998 Kontrollen verglichen<br />
wurden. In dieser Studie wurde<br />
die Bauchlage als gravierender SID-<br />
Risikofaktor bestätigt. Demnach wird<br />
das Risiko, am plötzlichen Säuglingstod<br />
zu versterben, durch die Bauchlage<br />
um das 8–16fache erhöht. Schlafen im<br />
Bett mit einem Erwachsenen erhöhte<br />
das Risiko, am plötzlichen Säuglingstod<br />
zu versterben, um das 2,4fache<br />
(Bajanowski und Poets 2004).<br />
19
20<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Unser Ziel: 300 Babies pro Jahr<br />
(= 23 Babies pro Woche)<br />
mehr als bisher sollen am Leben<br />
bleiben!<br />
Das derzeitige SID-Häufigkeitsniveau<br />
in Deutschland von 0,51/1 000 hält dem<br />
derzeitigen internationalen Vergleich<br />
noch nicht Stand. Das erklärte Ziel ist es,<br />
das niederländische Häufigkeitsniveau<br />
von 0,11/1 000 auch für Deutschland zu<br />
erreichen oder zu unterschreiten, z. B. auf<br />
den im Regierungsbezirk Dresden zeitweilig<br />
erreichten Wert von 0,08/1 000.<br />
Dieses Ziel ist realistisch, da in Sachsen<br />
mit der Einrichtung des bundesweit<br />
ersten proaktiven Raucherberatungstelefones<br />
(in diesem Falle für rauchende<br />
Schwangere und Mütter) nachgewiesen<br />
werden konnte, dass auch der SID-Risikofaktor<br />
Tabakrauchexposition in ca.<br />
60 % der Fälle innerhalb von 14 Tagen<br />
wesentlich beeinflusst werden kann (ca.<br />
40 % Rauchstopp, ca. 20 % deutliche Reduktion<br />
des Zigarettenkonsums). Diese<br />
Option geht über die niederländische<br />
Kampagne hinaus, so dass es realistisch<br />
ist, dass die niederländischen Zahlen<br />
auch in Deutschland nicht nur erreicht,<br />
sondern möglicherweise auch unterschritten<br />
werden können.<br />
367 Fälle im Jahre 2002 entsprechen<br />
0,5102/1 000 Lebendgeburten. 0,11/1 000<br />
würden 79 Fällen entsprechen, d. h. 288<br />
Babies weniger als bisher würden am<br />
plötzlichen Säuglingstod sterben, wenn<br />
wir 2002 schon die niederländischen<br />
Zahlen erreicht hätten. Die Minimalwerte<br />
aus dem Regierungsbezirk Dresden<br />
von 0,08/1 000 Lebendgeburten würden<br />
58 Fälle bedeuten, d. h. 309 Fälle weniger.<br />
Demnach ist es realistisch, davon auszugehen,<br />
das von 367 SID-Fällen im Jahre<br />
2002 durchaus 300 Babies pro Jahr (= 23<br />
Babies pro Woche!) vor dem plötzlichen<br />
Kindstod bewahrt werden können, wenn<br />
wir es schaffen, die Informationskampagne<br />
professionell in ganz Deutschland zu<br />
verbreiten.<br />
Prävention des<br />
plötzlichen Säuglingstodes<br />
als zielgruppenorientierte<br />
Informationskampagne<br />
Aus dem derzeitigen Kenntnisstand<br />
ergibt sich, dass sich die Häufigkeit des<br />
plötzlichen Säuglingstodes allein durch<br />
Beeinflussung des Pflegeverhaltens um<br />
80 bis 90 % vermindern lässt. Die zu<br />
übermittelnden Informationen ergeben<br />
sich aus den umfangreich vorliegenden<br />
Fall-Kontroll- und Interventionsstudien<br />
zum plötzlichen Säuglingstod, in denen<br />
herausgearbeitet werden konnte, wie ein<br />
Baby sicher schläft:<br />
Ihr Baby schläft am sichersten<br />
• in Rückenlage<br />
• im Schlafsack ohne zusätzliche Bett-<br />
decke<br />
• auf einer festen und relativ wenig<br />
eindrückbaren Matratze<br />
• ohne Fellunterlage, ohne Kopfkissen<br />
und ohne Nestchen<br />
• ohne Kuscheltier, das die Atemwege<br />
verschließen könnte oder kleine<br />
Teile hat, die Ihr Baby verschlucken<br />
oder in die Atemwege bekommen<br />
könnte
• im Schlafzimmer der Eltern<br />
• im eigenen Bettchen<br />
• bei einer Zimmertemperatur um<br />
18 Grad<br />
• ohne Kopfbedeckung<br />
• in einer rauchfreien Umgebung<br />
vor und nach der Geburt<br />
• Stillen und Impfungen vermindern<br />
die Risiken für Ihr Baby. (vgl. Bajanowski<br />
und Poets 2004 sowie <strong>Tagungsband</strong><br />
2004: www.babyschlaf.<br />
de; „Weiterbildung“)<br />
Die aktuelle Herausforderung besteht<br />
mit unveränderter Intensität in der Aufgabe,<br />
diese Informationen an nahezu alle<br />
Personen relevanter Zielgruppen heranzubringen<br />
und diese Personen nachhaltig<br />
zu motivieren, diese Informationen<br />
weiterzugeben bzw. aktiv in ihr eigenes<br />
Verhalten einzubeziehen. Die Beschäftigung<br />
mit dem Thema SID-Prävention<br />
lässt immer deutlicher werden, dass das<br />
Präventionsprojekt nur dann durchgreifend<br />
erfolgreich sein wird, wenn es gelingt,<br />
sehr differenzierte zielgruppenspezifische<br />
Kommunikationsstrategien zu<br />
entwickeln. Folgende Zielgruppen sind<br />
von besonderer Bedeutung (Tab. 2):<br />
Tab. 2 SID-Prävention als ziel-<br />
gruppenspezifische Informationskampagne.<br />
Zielgruppen<br />
1. Schwangere, deren Partner, Eltern<br />
von Säuglingen<br />
2. Babysitter, Tagesmütter, Großeltern,<br />
Geschwister, Erzieherinnen<br />
3. Hebammen, <strong>Kinder</strong>krankenschwestern,<strong>Kinder</strong>krankenpfleger,<br />
Schwestern, Pfleger, Stillberaterinnen/Laktationsberaterinnen,<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten<br />
4. <strong>Kinder</strong>ärzte, Frauenärzte, Allgemeinmediziner/Hausärzte<br />
5. Journalisten und weitere Medienvertreter<br />
6. Politiker, Mitarbeiter von Krankenkassen,<br />
statistischen Landesämtern<br />
und ähnlichen Behörden<br />
7. Hersteller und Händler von Babybetten,<br />
Matratzen, Babyschlafsäcken<br />
etc.<br />
8. Notärzte, Kriseninterventionsdienste,<br />
Psychologen, Polizisten,<br />
Staatsanwälte, Rechtsmediziner,<br />
<strong>Kinder</strong>pathologen, Pathologen,<br />
<strong>Kinder</strong>radiologen, Radiologen,<br />
Molekulargenetiker, Epidemiologen<br />
9. Sponsoren (z. B. Lions-Clubs, Banken,<br />
Stiftungen, Privatpersonen,<br />
Vereine etc.)<br />
Weiterhin ist es erforderlich, dass die<br />
bekannten Inhalte in geeigneter Form<br />
regional immer wieder kommuniziert<br />
werden, da sich die Zielgruppen ständig<br />
erneuern; etwa 50 % aller Schwangeren<br />
sind Erstgebärende. Die gruppenspezifischen<br />
Interessen und Traditionen<br />
müssen bei der Kontaktaufnahme berücksichtigt<br />
werden, um die Chance zu<br />
erhöhen, die o. g. Inhalte zu vermitteln.<br />
21
22<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Fallbeispiel<br />
Ein sieben Monate alter Säugling wird<br />
morgens in Rückenlage im Schlafsack<br />
tot aufgefunden. Sein Gesicht ist bis in<br />
die Stirn-Augenpartie von einer dünnen<br />
Daunendecke überdeckt. Der Kopf<br />
stößt an ein zusammengerolltes Handtuch<br />
zwischen Kopf und oberen Bettrand<br />
an. Die Rettungsmediziner stellen<br />
bei dem annehmbar schon vor einigen<br />
Stunden verstorbenen Kind noch immer<br />
ein Körpertemperatur von 38,8 Grad<br />
fest. Die Mutter berichtet, dass ihr nach<br />
dem Auffinden des Kindes Hitze aus<br />
dem Schlafsack entgegenströmte, als sie<br />
diesen öffnete. Meteorologisch fiel auf,<br />
dass es zum Todeszeitpunkt zu einem<br />
sehr raschen Temperaturanstieg mitten<br />
im Winter kam. Die regionale Informationskampagne<br />
mit der Übergabe<br />
von Informationsblättern an die Eltern<br />
während der Schwangerschaft durch<br />
Frauenarzt und Hebamme, in der Entbindungseinrichtung<br />
sowie während<br />
der Vorsorgeuntersuchungen durch den<br />
niedergelassenen <strong>Kinder</strong>arzt hatte diese<br />
Familie nicht erreicht. Weder über<br />
die öffentlichen Medien noch über die<br />
medizinischen Kompetenzträger. Der<br />
heute als Hauptrisikofaktor bekannte<br />
Faktor „Überdecken“ war den gebildeten<br />
Eltern nicht bekannt. Es muss offenbleiben,<br />
ob dieser konkrete plötzliche<br />
Säuglingstodesfall mit Hyperthermie<br />
vermeidbar gewesen wäre, wenn das<br />
Überdecken und die fehlende Hitzeentlastung<br />
über die Kopf- und Gesichtshaut<br />
bei gleichzeitigem generellen Weglassen<br />
der Handtuchrolle zwischen Kopf und<br />
oberer Bettkante nicht vorgelegen hätte.<br />
Aus statistischer Sicht wäre das Risiko<br />
allerdings wesentlich vermindert worden<br />
und die Auffindesituation entspricht<br />
leider „typischen“ SID-Fällen. Da eine<br />
Autopsie entsprechend des Wunsches<br />
der Eltern nicht veranlasst wurde, können<br />
eine Infektion, eine Kardiomyopathie<br />
und andere mögliche Todesursachen<br />
nicht ausgeschlossen werden (s. Tab. 1).<br />
Das Team der Notärzte und eine Psychologin<br />
widmeten den betroffenen Eltern<br />
viel Zeit. Sie konnten ihnen aber<br />
nicht vermitteln, welche Bedeutung die<br />
Obduktion des Kindes für die weitere<br />
individuelle Aufklärung, Beratung und<br />
Trauerbewältigung hat. Auch seitens des<br />
Staatsanwaltes wurde keine Obduktion<br />
angeordnet, der Wille der Eltern wurde<br />
berücksichtigt, die Würde des gestorbenen<br />
Kindes unangetastet zu lassen.<br />
Das Beispiel zeigt, dass es leider noch<br />
längst nicht gelungen ist, alle Bevölkerungsgruppen<br />
und alle Gruppen medizinischer<br />
Kompetenzträger zu erreichen<br />
und zu motivieren, sich aktiv an<br />
der Präventionskampagne zu beteiligen.<br />
Die Vorstellungen von Frauenärzten und<br />
Hebammen, die Geburtshäuser betreiben<br />
(wie in diesem Falle vorliegend),<br />
sollten deshalb noch stärker als bisher<br />
in die zielgruppenspezifische Ansprache<br />
einbezogen werden. Der völkerkundlich<br />
orientierte Beitrag von G.K. Hinkel<br />
über Wiegen anderer Völker und Kulturen<br />
innerhalb dieser Tagung ist ein<br />
Schritt in diese Richtung. Weiterhin ist<br />
es erforderlich, dass die Übergabe des Informationsblattes<br />
„Sicherer Babyschlaf“<br />
im Krankenblatt sowie im Vorsorgeheft<br />
schriftlich dokumentiert wird, damit<br />
diese letztlich potenziell lebensrettende<br />
Informationsübergabe zu einer bindenden<br />
Routine wird und nicht dem Zufall
überlassen bleibt. Schließlich wird auch<br />
der Schulungsbedarf für das Nothilfepersonal,<br />
für Polizei und für die Staatsanwälte<br />
deutlich, damit den betroffenen<br />
Eltern in geeigneter Weise der insbesondere<br />
auch subjektiv bedeutsame Stellenwert<br />
der Autopsie sowie möglicher Alternativen<br />
(postmortales MRT, CT inkl.<br />
gezielter Organbiopsien) verdeutlicht<br />
werden kann. Seitens der beteiligten niedergelassenen<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte, Hebammen<br />
und Frauenärzte wurde ein nochmaliger<br />
deutlicher aktueller Fortbildungsbedarf<br />
signalisiert, der in entsprechenden<br />
Fortbildungen angeboten werden wird.<br />
Außerdem wird eine Fallkonferenz angestrebt,<br />
in der alle Handlungsträger an<br />
einen Tisch gebracht werden sollen.<br />
Aktionen und Projekte 2004<br />
Seit der ersten bundesweiten Experten-<br />
und Fortbildungstagung „Prävention<br />
Plötzlicher Säuglingstod in Deutschland“<br />
vom 23. bis 24. Januar 2004 in<br />
Dresden sind eine Reihe von Initiativen<br />
in Gang gekommen, die zur Forcierung<br />
der SID-Prävention in Deutschland auf<br />
regionaler und bundesweiter Ebene beitragen:<br />
• am 22. April 2004 wurde in Dresden<br />
im Ergebnis der Tagung der Verein<br />
Babyhilfe Deutschland e. V. als bundesweit<br />
aktive kooperative Plattform<br />
für die Prävention des plötzlichen<br />
Säuglingstodes und anderer lebensbedrohlicher<br />
Erkrankungen im Säuglings-<br />
und Kleinkindesalter gegründet<br />
(www.babyhilfe-deutschland.de,<br />
www.babyschlaf.de ),<br />
• anlässlich des internationalen Tages<br />
des Kindes am 1. Juni 2004 wurde<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
allen <strong>Kinder</strong>tags-Babies in einer bundesweiten<br />
Geschenk- und Presseaktion<br />
der Babyhilfe Deutschland mit<br />
Unterstützung der Hilfsorganisation<br />
der BILD-Zeitung „Ein Herz für <strong>Kinder</strong>“<br />
aus Hamburg ein Babyschlafsack<br />
geschenkt, für diese Aktion wurden<br />
seitens der Babyhilfe Deutschland<br />
2 000 Babyschlafsäcke zur Verfügung<br />
gestellt;<br />
• in einer erweiterten Vorstandsitzung<br />
der Babyhilfe Deutschland wurde eine<br />
Leitlinie „Sicherer Babyschlaf“ für <strong>Kinder</strong>kliniken<br />
und weitere öffentliche<br />
Einrichtungen entworfen,<br />
• seitens der Arbeitsgruppe Pädiatrie der<br />
DGSM wurde eine Passage zur Prävention<br />
des plötzlichen Säuglingstodes in<br />
die Neufassung der Gelben Vorsorgehefte<br />
eingebracht, diese Option wurde<br />
durch die BZgA in Köln akzeptiert und<br />
übernommen,<br />
• gemeinsam mit der Arbeitsgruppe<br />
Pädiatrie der Deutschen Gesellschaft<br />
für Schlafforschung und Schlafmedizin<br />
(DGSM) konnte unter der Federführung<br />
von Prof. Dr. C.F. Poets aus<br />
Tübingen eine AWMF-Leitlinie zur<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes<br />
publiziert werden (s. Leitlinien<br />
der Deutschen Gesellschaft für <strong>Kinder</strong>heilkunde<br />
und Jugendmedizin und<br />
www.babyschlaf.de),<br />
• im März 2004 wurde im Saarland eine<br />
umfassende Informationskampagne<br />
zur Prävention des plötzlichen Säuglingstodes<br />
gestartet, die sich an der<br />
Struktur der sächsischen Kampagne<br />
orientiert (interdisziplinäre ministerielle<br />
Steuerungsgruppe, Innenraumplakat<br />
für Arzt- und Hebammenpraxen,<br />
<strong>Kinder</strong>kliniken und Entbindungsein-<br />
23
24<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
richtungen, Übergabe eines Informationsblattes<br />
für Schwangere und Eltern<br />
zu drei Zeitpunkten in Verbindung<br />
mit einem kompetenten Informationsgespräch,<br />
Schulung und Motivation<br />
der medizinischen Kompetenzträger<br />
in einer öffentlichen Startveranstaltung),<br />
alle Entbindungseinrichtungen<br />
im Saarland wurden mit Babyschlafsäcken<br />
ausgestattet; der Druck des Faltblattes<br />
wurde durch den Lions-Club<br />
Homburg/Saar unterstützt;<br />
• in mehreren Entbindungseinrichtungen<br />
und <strong>Kinder</strong>kliniken wurden Babyschlafsäcke<br />
eingeführt, diese Aktionen<br />
wurden z. B. von der GEPS Hessen,<br />
von Lions-Clubs im Rhein-Main-Gebiet<br />
oder vom Steigenberger-Parkhotel<br />
in Radebeul/Dresden unterstützt; die<br />
GEPS Hessen e. V. konnte drei Entbindungseinrichtungen<br />
mit Babyschlafsäcken<br />
ausstatten und die hessische<br />
Sozialministerin Silke Lautenschläger<br />
als Schirmherrin der Kampagne gewinnen;<br />
die GEPS RLP/Saarland e. V.<br />
stattet übergibt an zehn Kliniken Babyschlafsäcke,<br />
die in den Entbindungseinrichtungen<br />
verschenkt werden können<br />
– mit der Auflage, dass mit den<br />
Eltern ein Gespräch über den sicheren<br />
Babyschlaf geführt wird;<br />
• in den Helios-Kliniken Deutschlands<br />
wurde die Einführung von Babyschlafsäcken<br />
auf den Säuglingsstationen mit<br />
der Propagierung einer internen Pflege-Leitlinie<br />
verbunden,<br />
• in Rheinland-Pfalz wurde die zweite<br />
Auflage der Informationsbroschüre für<br />
Eltern herausgegeben; diese Broschüre<br />
des Sozialministeriums RLP, der GEPS<br />
RLP/Saarland e. V. sowie der Berufsverbände<br />
der <strong>Kinder</strong>ärzte, der Frauen-<br />
ärzte und der Hebammen mit einem<br />
Grußwort der Sozialministerin Malu<br />
Dreyer wird mit dem Erziehungsgeldantrag<br />
an alle Familien geschickt,<br />
• die von der GEPS-RLP/Saarland gemeinsam<br />
mit der Fachhochschule für<br />
Mediendesign produzierten TV-Spots<br />
zur Prävention des plötzlichen Säuglingstodes<br />
(drei Spots á 30 Sekunden)<br />
konnten über die Babyhilfe Deutschland<br />
dank der Unterstützung der Thomas<br />
Pabst Kommunikationsberatung<br />
Heidelberg in das Programm mehrerer<br />
privater Fernsehsender integriert<br />
und bereits mehrfach gesendet werden<br />
(z. B. RTL, ntv); die Spots können<br />
unter www.babyhilfe-deutschland.de<br />
„Aktuelles“ eingesehen werden,<br />
• die Babyhilfe Deutschland hat gemeinsam<br />
mit Dr. J. Sperhake vom Hamburger<br />
Bündnis gegen den plötzlichen<br />
Säuglingstod begonnen, ein Protokoll<br />
zur strukturierten Beschreibung der<br />
Auffindesituation durch Polizisten<br />
und/oder Notärzte zu entwickeln,<br />
• Studenten der Fachschule für Grafik<br />
und Mediendesign der Akademie für<br />
Bauwesen und Technik in Leipzig haben<br />
unter der Leitung des Grafikers<br />
Stephan Wagner mit der Entwicklung<br />
von jugendorientierten Plakaten für<br />
eine bundesweite Außenplakataktion<br />
begonnen,<br />
• seitens der GEPS NRW e.V. wurde mit<br />
Unterstützung der Fa. Nestlé ein weiteres<br />
Innenraum-Plakat zur gesunden<br />
Schlafumgebung in Umlauf gebracht,<br />
• in Köln wurde von Dr. med A. Wiater<br />
ein Faltblatt zum sicheren Babyschlaf<br />
herausgegeben,<br />
• in mehreren Gymnasien und Fachschulen<br />
sind Schüler- und Studenten-
projekte zu Fragen der Prävention des<br />
plötzlichen Säuglingstodes in Gang<br />
gekommen (Dresden, Eisenberg/Thüringen,<br />
Potsdam, Köln),<br />
• in Frankfurt/M. wurde mit „1plus<br />
e. V.“ ein weiterer Verein engagierter<br />
Bürger gegründet, der sich mit der Prävention<br />
des plötzlichen Säuglingstodes<br />
beschäftigt und in enger Kooperation<br />
und inhaltlicher Abstimmung mit der<br />
Babyhilfe Deutschland öffentlichkeitswirksame<br />
Informationskampagnen<br />
(insbesondere weitere TV-Spots) entwickeln<br />
und verbreiten wird,<br />
• im <strong>Kinder</strong>schlaflabor der Klinik und<br />
Poliklinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin<br />
der TU Dresden wurde eine<br />
materialkundliche Untersuchung von<br />
Babyschlafsäcken gestartet,<br />
• die Arbeitsgruppe Schlafmedizin der<br />
Gesellschaft für Pneumologie (GPP)<br />
regte eine umfassende Marktanalyse<br />
über Heimmonitore in Deutschland<br />
an (siehe Beitrag von Dr.-Ing. M. Rabenau<br />
in diesem Band), außerdem soll<br />
ein klinisches Prüfprotokoll für Heimmonitore<br />
erarbeitet werden,<br />
• in der Universitäts-<strong>Kinder</strong>klinik Magdeburg<br />
wurde eine Umfrage über die<br />
Verwendung von Heimmonitoren<br />
gestartet, die den derzeitigen Kenntnisstand<br />
und das Verordnungsverhalten<br />
reflektieren wird (Frau Dr. U.<br />
Beyer),<br />
• die Arbeitsgruppe Prävention des<br />
plötzlichen Säuglingstodes des sächsischen<br />
Staatsministeriums für Soziales<br />
legte ein Fachgutachten „Hilfe für betroffene<br />
Familien“ vor (siehe gesonderter<br />
Textband von Dipl.-Psych. Dr.<br />
rer. nat. A. Mosshammer und Prof. Dr.<br />
med. E. Paditz), in dem über 25 000<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Hinterbliebene und 674 Studien berichtet<br />
wird,<br />
• die AOK Sachsen wir das proaktive Beratungstelefon<br />
für rauchende Schwangere<br />
und Mütter im Rahmen der Prävention<br />
des plötzlichen Säuglingstodes<br />
weiterhin finanziell und inhaltlich unterstützen,<br />
• in München fand unter der Schirmherrschaft<br />
der Gattin des Bundespräsidenten<br />
Eva Köhler ein Symposium<br />
„Prävention im Kindes- und Jugendalter“<br />
(wissenschatliche Leitung: Prof.<br />
Dr. med. B. Koletzko, München) der<br />
Stiftung <strong>Kinder</strong>gesundheit (Schirmherrschaft:<br />
Dr. med. Irene Epple-Waigel)<br />
statt, auf dem Prof. Dr. med. G.<br />
Jorch aus Magdeburg auf Grund seiner<br />
hervorragenden Verdienste innerhalb<br />
der SID-Forschung und –Prävention<br />
mit dem Meinhardt von Pfaundler-<br />
Preis ausgezeichnet wurde,<br />
• das Hamburger Bündnis gegen den<br />
plötzlichen Säuglingstod veranstaltete<br />
eine Tagesveranstaltung über aktuelle<br />
Fragen der Prävention des plötzlichen<br />
Säuglingstodes mit niederländischen<br />
Gästen,<br />
• der wissenschaftliche Beirat der GEPS<br />
Deutschland e. V. tagte in Aschaffenburg<br />
und befasste sich insbesondere<br />
mit Fragen der Thermoregulation bei<br />
Säuglingen (PD Dr. med. T. Schäfer,<br />
Bochum) und Ergebnissen der deutschen<br />
BMBF-Fall-Kontroll-Studie (PD<br />
Dr. med. Th. Bajanowski, Essen),<br />
• innerhalb der Medica Düsseldorf,<br />
der Jahrestagung des Deutschen Hebammenverbandes<br />
in Karlsruhe, der<br />
Jahrestagung der Nationalen Stillkommission<br />
beim Bundesinstitut für<br />
Risikobewertung Berlin sowie inner-<br />
25
26<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
halb der 100. Jahrestagung für <strong>Kinder</strong>heilkunde<br />
und Jugendmedizin in Berlin<br />
wurde das Thema SID-Prävention<br />
in eigenen Symposien bzw. Vorträgen<br />
vorgestellt,<br />
• seitens der Babyhilfe Deutschland<br />
wurde mit einer rege frequentierten<br />
ausführlichen Argumentationslinie im<br />
Internet sowie mit einer Pressemitteilung<br />
auf einen Focus-Beitrag und nachfolgende<br />
regionale Presse- und TV-Beiträge<br />
reagiert, in dem fälschlicherweise<br />
mitgeteilt wurde, dass die 6fach-Impfung<br />
mit einem erhöhten SID-Risiko<br />
verbunden sei (siehe www.babyschlaf.<br />
de).<br />
Strukturen<br />
Präventionspolitik hat erst dann die<br />
Chance auf nachhaltige Effekte, wenn<br />
die erwähnten Aktionen und Projekte in<br />
entsprechende Strukturen und Routineabläufe<br />
eingebunden werden können.<br />
Diesbzgl. sei an folgende Grundsatzpapiere<br />
erinnert:<br />
• Konsenspapier SID-Prävention in<br />
Deutschland (Paditz et al. 2003),<br />
• AWMF-Leitlinie Plötzlicher Säuglingstod<br />
(Poets et al. 2004 und www.<br />
babyschlaf.de; „Weiterbildung“, <strong>Tagungsband</strong><br />
2004),<br />
• Beschluss 7.2 der 76. <strong>Gesundheit</strong>sministerkonferenz<br />
(GMK) vom 2. und<br />
3. Juli 2003 in Chemnitz mit Hinweis<br />
auf den Beschluss der 74. GMK und auf<br />
das Konsenspapier SID-Prävention in<br />
Deutschland 2003.<br />
In mehreren Bundesländern sind unter<br />
der Federführung der Sozialministerien<br />
oder Senate bzw. offiziell beauftragter<br />
Vereine interdisziplinäre Arbeitsgruppen<br />
zur Prävention des plötzlichen<br />
Säuglingstodes entstanden, die sich<br />
um die regionale Organisation der Informationskampagne<br />
bemühen (z. B.<br />
in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Brandenburg, Hessen, Bayern,<br />
Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen,<br />
Thüringen, Rheinland-Pfalz, Baden-<br />
Württemberg, Saarland).<br />
In Hamburg und in Sachsen wurde die<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes<br />
als politisches <strong>Gesundheit</strong>sziel definiert.<br />
In Rheinland-Pfalz übernahm der Ministerpräsident<br />
Kurt Beck die Schirmherrschaft<br />
über die GEPS RLP/Saarland<br />
e. V. In Sachsen konnten mit Dr. Hans<br />
Geißler, Christine Weber und Helma<br />
Orosz drei SozialministerInnen in Folge<br />
für die SID-Präventionskampagne gewonnen<br />
werden. Staatsministerin Helma<br />
Orosz übernahm die Schirmherrschaft<br />
über die erste und über die zweite<br />
bundesweite Fortbildungs- und Expertentagung<br />
„Prävention des plötzlichen<br />
Säuglingstodes in Deutschland“. Die<br />
hessische Sozialministerin Silke Lautenschläger<br />
ist seit 2004 Schirmherrin der<br />
von der GEPS Hessen eV. initiierten SID-<br />
Präventionskampagne.<br />
In Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg,<br />
in Bayern und in Rheinland-Pfalz/<br />
Saarland (sowie möglicherweise auch<br />
in anderen Bundesländern) bestehen<br />
seitens der GEPS bzw. seitens staatlicher<br />
und klinischer Strukturen (siehe Beitrag<br />
in diesem Band von PD Dr. med. Th.<br />
Erler, Cottbus) Kontakte zu Organen<br />
der Polizei und der Staatsanwaltschaft,<br />
für die entsprechende Fortbildungen für
Notfalleinsätze erfolgen. Seitens der Babyhilfe<br />
Deutschland wird zur Zeit eine<br />
Dienstanweisung vorbereitet, die allen<br />
Polizeistrukturen als Handlungsanleitung<br />
zur Verfügung gestellt werden soll.<br />
Durch die Einbeziehung der Innenministerkonferenz<br />
soll die Verbindlichkeit<br />
der Einhaltung dieser Dienstanweisung<br />
erhöht werden.<br />
Wünschenswert ist die Einrichtung<br />
regional und kontinuierlich tätiger Säuglingssterblichkeitskommissionen,<br />
denn<br />
nur durch derartige zeitnahe, interdisziplinäre<br />
Fallkonferenzen im Sinne systematischer<br />
Schwachstellenanalysen<br />
wird es gelingen, Todesfälle eindeutig zu<br />
klassifizieren und Präventionslücken zu<br />
schließen. Das exemplarisch angeführte<br />
aktuelle Fallbeispiel sowie die Standpunkte<br />
des Vaters eines Kindes, das am<br />
plötzlichen Säuglingstod gestorben ist,<br />
illustrieren, dass derartige zeitnahe Analysen<br />
konstruktive Lösungsansätze vermitteln<br />
können.<br />
Literatur<br />
1 Bajanowski Th, Poets CF: Der plötzliche Säuglingstod.<br />
Epidemiologie, Ätiologie, Pathophysiologie<br />
und Differenzialdianostik. Deutsches Ärzteblatt<br />
101 (2004) vom 19. November, Heft 47,<br />
B 2695–B 2699<br />
2 Bentele KHP: Plötzlicher Säuglingstod (Sudden<br />
Infanth Death – SID) und akute, anscheinend<br />
lebensbedrohliche Ereignisse (ALE). In: Speer CP,<br />
Gahr M: Pädiatrie, 2. Aufl., Springer Medizin Verlag<br />
Heidelberg, 2005, pp. 1215–1222<br />
3 Beal SM, Finch CF: An overview of retrospective<br />
case-control studies investigating the relationship<br />
between prone sleeping position and SIDS. J<br />
Paediatr Health 27/6 (1991) 334–339<br />
Paditz<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
4 Jorch G, Findeisen M, Brinckmann B, Trowitzsch<br />
E, Weihrauch B: Bauchlage und plötzlicher<br />
Säuglingstod. Deutsches Ärzteblatt 88 (1991) C<br />
2343–2347<br />
5 Mecklinger L: Richtlinie für die Anwendung<br />
der Bauchlage bei Säuglingen als propylaktische<br />
Maßnahme bei Säuglingen vom 15. Mai 1972. Verfügungen<br />
und Mitteilungen des Ministeriums für<br />
<strong>Gesundheit</strong>swesen, Berlin, 8. Juni 1972, p. 47<br />
6 Lange B: SIDS-Häufigkeit: ist Deutschland ein<br />
Entwicklungsland? Epidemiologie SIDS in Sachsen<br />
im nationalen und internationalen Vergleich. In:<br />
Paditz E (Hrsg.): Gesunder Babyschlaf. Prävention<br />
des plötzlichen Säuglingstodes in Sachsen. Druckerei<br />
und Verlag Christoph Hille Dresden, 2002, pp.<br />
35–41<br />
7 Paditz E: Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes<br />
in Deutschland. Wien Klin Wochenschr<br />
115/24 (2003) 874–880<br />
8 Schwab H-J: Das Verbot der Bauchlage für<br />
schlafende Säuglinge in der DDR. Hintergründe<br />
der Verordnung des Ministeriums für <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />
aus dem Jahre 1972. In: Paditz E (Hrsg.):<br />
Prävention Plötzlicher Säuglingstod in Deutschland.<br />
1. Bundesweite Expertentagung. Dresden<br />
23.-24. Januar 2004. Druckerei & Verlag Christoph<br />
Hille, Dresden 2004, pp. 148-161<br />
9 Suffocated Prone: The Iatrogenic Tragedy of<br />
SIDS 2000. Am J Public Health 90 (2000) 527–531<br />
Autor<br />
Prof. Dr. med. Ekkehart Paditz<br />
Vorsitzender Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
Klinik und Poliklinik<br />
für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin<br />
der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus<br />
der Technischen Universität Dresden<br />
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden<br />
Telefon (03 51) 4 58 31 60<br />
Telefax (03 51) 4 58 57 72<br />
Ekkehart.Paditz@uniklinikum-dresden.de<br />
www.babyschlaf.de<br />
www.babyhilfe-deutschland.de<br />
27
Die Vereinigung leitender <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendärzte und <strong>Kinder</strong>chirurgen Deutschlands<br />
(VLKKD) als Förderer der Aktion zur Prävention<br />
des plötzlichen Kindstodes in Deutschland<br />
Prof. Dr. med. V. Hesse Vorsitzender der VLKKD<br />
Die VLKKD ist ein Arbeitsgremium<br />
der leitenden <strong>Kinder</strong>- und Jugendärzte<br />
und <strong>Kinder</strong>chirurgen, das sich um eine<br />
Optimierung der Arbeit von <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendkliniken und kinderchirurgischen<br />
Kliniken und Abteilungen bemüht und<br />
neben der fachlichen Arbeit besonders<br />
auch berufspolitisch im Rahmen der Vertretung<br />
der stationären Pädiatrie aktiv<br />
ist. In der Obleutetagung der VLKKD<br />
kommen die gewählten Vertreter der<br />
einzelnen Bundesländer zusammen und<br />
besprechen die jeweiligen aktiven Aufgabenstellungen.<br />
Im zweijährigen Rhythmus werden<br />
Plenartagungen mit alle leitenden Ärzten<br />
durchgeführt (siehe auch www.<br />
vlkkd.de).<br />
Die Verhinderung des plötzlichen<br />
Kindstodes ist ein elementares Anliegen<br />
auch der Arbeit der leitenden Ärzte, insbesondere<br />
geht es auch um die Umsetzung<br />
der Richtlinien der Akademie für<br />
<strong>Kinder</strong>heilkunde und der Vorschläge der<br />
Babyhilfe Deutschland — speziell der<br />
Leitlinie „Rückenlage und Schlafsäcke<br />
für reife Neugeborene in Kliniken und<br />
öffentlichen Einrichtungen“ — in den<br />
stationären Einrichtungen der <strong>Kinder</strong>medizin<br />
in Deutschland Hierbei ist die<br />
VLKKD ein wichtiger und konstruktiver<br />
Partner.<br />
Autor<br />
Hesse<br />
VLKKD<br />
Prof. Dr. med. V. Hesse Vorsitzender der VLKKD<br />
29
SID- Prävention in Hessen 2004<br />
Evert W 1 , Peter W A 2<br />
1 Klinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin Offenbach, Chefarzt i. R.<br />
2 Gemeinsame Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod, GEPS Hessen e. V.<br />
Die erste bundesweite Expertentagung<br />
„Prävention Plötzlicher Säuglingstod“<br />
vom 23. bis 24. Januar 2004 hat eindrucksvoll<br />
unter Beweis gestellt, wie mit<br />
einfachen Maßnahmen der Risikoauf-<br />
klärung und Schulung von Eltern und<br />
medizinischem Personal das Risiko des<br />
Plötzlichen Säuglingstodes drastisch vermindert<br />
werden kann.<br />
Tabelle 1. SID-Häufigkeit in Deutschland, Vergleich zwischen den<br />
Bundesländern. Häufigkeitsangaben in Anzahl SID-Fälle pro 1 000 Lebendgeburten<br />
(modifiziert nach Lange 2001, Paditz 2003)<br />
Jahr(e)<br />
Häufigkeit<br />
1999<br />
SID/1 000<br />
Evert und Peter<br />
SIDS Prävention in Hessen 2004<br />
1990–1999***<br />
SID/1 000<br />
Sachsen 0,25 0,44 139<br />
RB Dresden 0,08 0,34*** (39)<br />
Bremen 0,33 1,19 78<br />
Sachsen-Anhalt 0,33 0,44 80<br />
Mecklenburg-Vorpommern keine Angaben* 0,57 71<br />
Brandenburg 0,39 0,60 99<br />
Thüringen 0,41 0,49 81<br />
Baden-Würtemberg 0,44 0,79 912<br />
Bayern 0,53 0,85 1 112<br />
Hessen 0,54 0,91 554<br />
Niedersachsen 0,63 0,97 804<br />
Saarland 0,67 0,99 101<br />
Berlin 0,74 0,89 270<br />
Schleswig-Holstein 0,77 1,09 310<br />
Hamburg 0,81 1,21 198<br />
Rheinland-Pfalz 0,97 1,40 575<br />
Nordrhein-Westfalen 1,02 1,56 2 948<br />
Summe 8 332<br />
1990–1999<br />
SID-Fälle absolut<br />
Für Mecklenburg-Vorpommern lagen innerhalb der offiziellen Statistik keine vollständigen Angaben vor<br />
(D. Olbertz, Rostock, persönliche Mitteilung). **Zusammenfassung dieser Jahrgänge, um einen Vergleich<br />
zwischen den Bundesländern auf der Grundlage von Geburtsziffern von mindestens 100 000 Lebendgeburten<br />
zu ermöglichen; lediglich in Bremen wurde diese Zahl mit 65 537 Lebendgeburten in diesem Zeitintervall<br />
nicht erreicht. ***Regierungsbezirk Dresden/Sachsen, ca. 12 000 Lebendgeburten pro Jahr. Start der<br />
Informationskampagne über die Entbindungseinrichtungen 1994. In die Gruppe 1990–1999 gingen 115 683<br />
Lebendgeburten ein. 1994–1996 wurden noch 0,45 SID-Fälle/1 000 Lebendgeburten registriert (13/29,049),<br />
1997–1999 lag diese Ziffer bei 0,11 (1 Fall pro Jahr, d. h. 3 SID-Fälle pro 36 166 Lebendgeburten).<br />
31
32<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Die vorgetragenen Ergebnisse und<br />
Ländervergleiche gaben für das Bundesland<br />
Hessen Anlass für zwei SID-Präventionsinitiativen.<br />
Der Anfang der 80er Jahre gegründete<br />
Landesverband GEPS Hessen e. V. hat<br />
mit seinen Mitgliedern die Ziele der<br />
GEPS Deutschland verfolgt und dabei<br />
betroffene Familien in der Trauerarbeit<br />
begleitet und betreut, sowie über Broschüren,<br />
Informationsveranstaltungen,<br />
Vorträge und Rundbriefe die Präventionsempfehlungen<br />
unterstützt.<br />
Im Anschluss an die Dresdner Tagung<br />
mit dem Erfolg des BL-Sachsen vor Augen,<br />
hat GEPS Hessen e. V. eine landesweite<br />
SID-Präventions-Kampagne<br />
gestartet. Unter der Schirmherrschaft<br />
der Hessischen Sozialministerin Frau<br />
Silke Lautenschläger wurden drei Geburtshilfliche<br />
Kliniken unter Beteiligung<br />
der Öffentlichkeit jeweils mit 60 aus<br />
eigenen Spenden und Mitgliedsbeiträgen<br />
finanzierte Schlafsäcke im Wert von<br />
4 000 Euro ausgestattet.<br />
Am 6. Oktober 2004 erfolgte die Auftaktsveranstaltung<br />
und Start der Schlafsackaktion<br />
im St. Marien-Krankenhaus<br />
Frankfurt in Verbindung mit einer Fortbildungsveranstaltung<br />
und gemeinsamen<br />
Pressekonferenz der GEPS Hessen<br />
e. V. und Babyhilfe Deutschland mit dem<br />
Vorsitzenden Herrn Prof. Paditz. Die<br />
Veranstaltung wurde von der Nestlé Nutrition<br />
GmbH unterstützt.<br />
Am 12. Oktober 2004 erfolgte in Anwesenheit<br />
von Frau Sozialministerin<br />
Lautenschläger neben der Schlafsackübergabe<br />
eine Pressekonferenz und die<br />
Übergabe einer Note durch Herrn W. R.<br />
Die GEPS Hessen e. V. stattete mehrere Entbindungseinrichtungen<br />
in Frankfurt/M. (Fr. R. Aniolek,<br />
Foto oben, links im Bild) und in Darmstadt<br />
(Foto unten: Fr. F. Braxenthaler, zweite von rechts,<br />
sowie Hr. W. A. Peter, zweiter voon links) mit Babyschlafsäcken<br />
aus. Chefarzt Dr. med. Klaus Engel<br />
vom St. Marienkrankenhaus Frankfurt/M. (Foto<br />
oben) sorgt für die erforderliche Information des<br />
Personals in seiner Klinik und in seiner Region.<br />
Peter mit den Inhalten der 76. GMK, dem<br />
auf der Dresdner Tagung gemeinsam beschlossenen<br />
Konsensuspapier und der<br />
Forderung zur Einrichtung einer „AG<br />
SID-Prävention auf Landesebene“ unter<br />
Einbeziehung von GEPS, Gynäkologen,<br />
<strong>Kinder</strong>ärzten, Hebammen und weiteren<br />
Berufsgruppen.<br />
Am 3. November 2004 erfolgte durch<br />
Fr. S. Bartholomae, GEPS Hess. die
Fälle pro 100 000<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Schlafsackübergabe und entsprechende<br />
Informationen, in Anwesenheit von regionalen<br />
Pressevertretern, in der Asklepios-<br />
Klinik Lich.<br />
Bereits im Juli 2004 konnte Herr W.<br />
Evert an seiner <strong>Kinder</strong>klinik und der<br />
Frauenklinik des Klinikum Offenbach<br />
die Präventionskampagne gegen den<br />
Plötzlichen Säuglingstod starten. Die<br />
Dresdner Erfolge und das schlechte Abschneiden<br />
anderer Bundesländer waren<br />
vor dem Hintergrund der einfachen Präventionsmaßnahmen<br />
und Vorbeugung<br />
erschütternder Einzelschicksale Anlass,<br />
diese Aktion zunächst lokal anzufangen<br />
und dann auszuweiten.<br />
Geburtenrate, Säuglingssterblichkeit und SID in Hessen<br />
Jahr<br />
Sterblichkeit am plötzlichen Kindstod im ersten Lebensjahr<br />
pro 100 000 Lebendgeborene in Deutschland, 3-Jahresmittelwert 2000-2002<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Bremen<br />
Lebendgeborene<br />
Saarland<br />
Schleswig-Holstein<br />
Niedersachsen<br />
Quelle: Statistisches Landesamt Hessen<br />
Gestorbene<br />
Säuglinge<br />
insgesamt<br />
Gestorbene<br />
Säuglinge/1 000<br />
Lebendgeburten<br />
SIDS<br />
1995 59 858 276 4,6 0,75<br />
SIDS/1 000<br />
Lebendgeburten<br />
1996 62 391 297 4,8 41 0,66<br />
1997 63 124 283 4,5 33 0,52<br />
1998 60 567 293 4,8 42 0,69<br />
1999 58 996 269 4,6 32 0,54<br />
2000 58 817 253 4,3 19 0,32<br />
2001 56 228 232 4,1 33 0,59<br />
2002 55 324 239 4,3 31 0,56<br />
2003 54 400 215 3,9 26 0,48<br />
Quelle: Statistisches Landesamt Hessen<br />
Brandenburg<br />
Deutschland<br />
Hessen<br />
Bayern<br />
Evert und Peter<br />
SIDS Prävention in Hessen 2004<br />
Berlin<br />
Baden-Würtemberg<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Sachsen<br />
Mecklemburg-Vorpommern<br />
Hamburg<br />
Thüringen<br />
33
34<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Beim Benefiz-Golfturnier des Lions-Club Mühlheim in Bad Orb waren die 5 000 Euro zusammengekommen,<br />
die nun Matthias Belz, Dr. Richard L. Gunkel und Lothar Leger (von links) an Dr. Evert (zweiter von<br />
links) übergaben.<br />
5 000 Euro Startkapital als Erlös aus einem<br />
Benefiz-Golfturnier des Lions Club<br />
Mühlheim sowie die Spenden des Lions<br />
Club Offenbach-Lederstadt in Höhe<br />
von 2 000 Euro und weitere 1 000 Euro<br />
anlässlich der Neugründung des Lions<br />
Club Rhein-Main Offenbach waren die<br />
Grundlage für eine Aktion, in der die gesunden<br />
und kranken Neugeborenen mit<br />
Verlassen des Klinikum Offenbach ein<br />
Schlafsack geschenkt werden konnte.<br />
Zusätzlich wurden intensive Schulungsmaßnahmen<br />
bei Ärzten, Pflegepersonal,<br />
Hebammen und anlässlich einer<br />
Abschiedsveranstaltung im Rahmen ei-<br />
ner Ärztefortbildung durchgeführt. Als<br />
sehr hilfreich erwiesen sich die Plakate<br />
der Babyhilfe und insbesondere das<br />
Sächsische Faltblatt mit Hinweisen zur<br />
Prophylaxe des Plötzlichen Säuglingstodes<br />
von der Babyhilfe Deutschland, das<br />
W. Evert dankenswerterweise übernehmen<br />
durfte und mit Hinweisen auf die<br />
GEPS Hessen e. V. sowie örtlichen Sponsoren<br />
versehen konnte.<br />
Die Offenbacher Initiative ist mittlerweile<br />
unter das Dach der <strong>Kinder</strong>hilfestiftung<br />
e. V., einer Initiative der Bürger und<br />
der Wirtschaft des Rhein-Main Gebietes,<br />
angesiedelt worden. Das Präventions-
projekt wurde auch hier anlässlich einer<br />
Kuratoriumssitzung einer großen Zahl<br />
einflussreicher Persönlichkeiten des<br />
Rhein-Main Gebietes und den Leitern<br />
der <strong>Kinder</strong>kliniken vorgestellt. Über die<br />
<strong>Kinder</strong>hilfestiftung e. V. sind inzwischen<br />
weitere Aufklärungen und Spenden erfolgt.<br />
So konnten u. a. anlässlich einer<br />
Weindegustation der Firma Giovo 2 000<br />
Euro und dem 100-jährigem Bestehen<br />
der Bäckerei Schilling in Mühlheim 1 000<br />
Euro für die Kampagne gegen den Plötz-<br />
Evert und Peter<br />
SIDS Prävention in Hessen 2004<br />
lichen Säuglingstod<br />
entgegengenommen<br />
werden.<br />
Sehr erfreulich<br />
war die Finanzierung<br />
von klinikeigenen<br />
Schlafsäcken im<br />
Klinikum Offenbach<br />
durch den Erlös der<br />
Betriebsfeier des Klinikum.<br />
Die Bedeutung<br />
der Schulungsmaßnahmen<br />
in den GeburtshilflichenAbteilungen<br />
und den<br />
<strong>Kinder</strong>kliniken darf<br />
nicht unterschätzt<br />
werden. Hier wird<br />
durch die Beispielgebung,<br />
das Praktizierte,<br />
eine Grundlage<br />
für den Erfolg<br />
der Aktion gelegt.<br />
Die regelmäßige Beratung<br />
der Schwangeren,<br />
die Betreuung<br />
in den Geburtshilflichen–<br />
und <strong>Kinder</strong>kliniken<br />
sowie die<br />
Nachverfolgung in den kinderärztlichen<br />
Praxen sind ein wesentlicher Faktor dafür,<br />
dass die Präventionsmaßnahmen in<br />
den Familien fortgesetzt werden.<br />
Von Vorteil ist der Eintrag der SID-<br />
Präventionsmaßnahmen (Hinweis) in<br />
das <strong>Kinder</strong>vorsorgeheft, dadurch ist eine<br />
95 bis 97 % Erreichbarkeit der Eltern<br />
gegeben.<br />
Auffällig war, dass insbesondere im<br />
Pflegebereich intensive Überzeugungsarbeit<br />
zur Vermeidung der Überdeckung<br />
35
36<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
erforderlich war und im Ärztebereich die<br />
Rückenlage und die Vermeidung der Seitenlage<br />
auf Widerstand stieß.<br />
Gemeinsam mit der GEPS Hessen e. V.<br />
wird auch in Hessen die Präventionsarbeit<br />
zur Prophylaxe des Plötzlichen Säuglingstodes<br />
weiter ausgedehnt.<br />
Hinweis:<br />
Im Januar 2005 sollen erste Ergebnisse<br />
der „German Study of Sudden Infant<br />
Death“ in Acta Pediatrica veröffentlicht<br />
werden. Es handelt sich um eine durch<br />
das Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung geförderte multizentrische<br />
epidemiologische und anatomisch-pathologische<br />
Studie, an der auch hessische<br />
Einrichtungen beteiligt waren. Genauere<br />
Informationen und eine Publikation<br />
zur Methodik sind abrufbar unter www.<br />
kindstod.org<br />
Gemeinsam mit der GEPS Hessen e. V.<br />
wird auch in Hessen die Präventionsarbeit<br />
zur Prophylaxe des Plötzlichen Säuglingstodes<br />
weiter ausgedehnt.<br />
Autoren<br />
Wolfgang A. Peter<br />
GEPS Hessen e. V.<br />
Moischter Straße 9, 53043 Marburg/Cappel<br />
Telefon (0 64 21) 5 15 41<br />
Mobil 01 73/6 52 43 47<br />
Dr. med. Wolfgang Evert<br />
Lilienweg 22, 63165 Mühlheim/M.<br />
cwevert@yahoo.de<br />
<strong>Kinder</strong>hilfestiftung e. V.<br />
Steinlestraße 31, 60596 Frankfurt/M.<br />
www.kinderhilfestiftung.org<br />
Literatur<br />
Paditz E: Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes<br />
in Deutschland. Wien Klin. Wochenschr. 115/24<br />
(2003) 874–880
Weiterentwicklung der Initiativen zur SID-Prävention<br />
in Rheinland-Pfalz<br />
Lossen-Geißler E<br />
Mainz<br />
Lossen-Geißler<br />
Weiterentwicklung der Initiativen zur SID-Prävention in Rheinland-Pfalz<br />
Anknüpfend an die bereits seit 1995<br />
ergriffenen Maßnahmen zur Prävention<br />
des Plötzlichen Säuglingstods, die<br />
im <strong>Tagungsband</strong> der letztjährigen Veranstaltung<br />
ausführlich dargestellt sind,<br />
hat das Ministerium für Arbeit, Soziales,<br />
Familie und <strong>Gesundheit</strong> Rheinland-<br />
Pfalz im Jahr 2004 eine überarbeitete<br />
Neuauflage der Informationsbroschüre<br />
„So schläft Ihr Baby am sichersten“<br />
herausgegeben. Diese Broschüre, vom<br />
Ministerium gemeinsam mit Fachleuten<br />
und der Gemeinsamen Elterninitiative<br />
Plötzlicher Säuglingstod, Landesverband<br />
Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. (GEPS)<br />
erarbeitet, wird als Teil der umfassenden<br />
Aufklärungskampagne des Landes flächendeckend<br />
verteilt.<br />
Neben der Information von Ärzteschaft,<br />
Hebammen, Angehörigen aller<br />
Krankenpflegeberufe, von Krankenhäusern,<br />
Krankenkassen und anderen Multiplikatoren<br />
wird die Broschüre auch<br />
den Elternbriefen von Frau Ministerin<br />
Malu Dreyer an die Eltern aller neugeborenen<br />
<strong>Kinder</strong> beigefügt, so dass eine<br />
annähernd flächendeckende Verbreitung<br />
gewährleistet ist. Ferner ist sie als<br />
pdf-Datei über die Internetseite des Ministeriums<br />
(www.masfg.rlp.de), die der<br />
GEPS (www.geps-rp-saar.de)und die der<br />
Babyhilfe Deutschland (www.babyhilfedeutschland.de)<br />
abrufbar.<br />
Erfreulicherweise ist es mit der dankenswerten<br />
Unterstützung von Herrn<br />
Professor Dr. Paditz gelungen, die von<br />
der Fachhochschule für Mediengestaltung<br />
in Mainz gemeinsam mit GEPS und<br />
Ministerium entwickelten und produzierten<br />
Fernsehspots zum Thema bei RTL<br />
zur Ausstrahlung unterzubringen; sie<br />
sind ferner einsehbar im Internet unter<br />
www.babyhilfe-deutschland.de.<br />
Als weiterer Schritt ist geplant, im<br />
Frühjahr 2005 mit den Geburts- und <strong>Kinder</strong>kliniken<br />
der rheinland-pfälzischen<br />
Krankenhäuser eine vertragliche Vereinbarung<br />
darüber zu schließen, dass die<br />
Eltern neugeborener <strong>Kinder</strong> bereits im<br />
Krankenhaus über die Grundvoraussetzungen<br />
für eine gesunde Schlafumgebung<br />
informiert werden und zusätzlich<br />
die Broschüre erhalten. Dieses Vorhaben<br />
wird derzeit durch ein Projekt vorbereitet,<br />
bei dem neun ausgewählte Kliniken<br />
zunächst jeweils 100 Schlafsäcke an die<br />
Eltern oder Sorgeberechtigten Neugeborener<br />
übergeben und sich in diesem Zusammenhang<br />
zu Aufklärungsgesprächen<br />
und entsprechender Öffentlichkeitsarbeit<br />
verpflichten. Dieses Projekt wurde<br />
von der GEPS Rheinland-Pfalz/Saarland<br />
initiiert und wird von der „Aktion Herzenssache“<br />
des Südwestrundfunks SWR<br />
und des Saarländischen Rundfunks SR,<br />
der Techniker Krankenkasse Rheinland-<br />
Pfalz und dem Ministerium für Arbeit,<br />
Soziales, Familie und <strong>Gesundheit</strong> Rheinland-Pfalz<br />
und der GEPS selbst finanziert.<br />
37
38<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Von 2000 auf 2003 konnte die Zahl der<br />
am Plötzlichen Säuglingstod verstorbenen<br />
<strong>Kinder</strong> von 41 auf 20 reduziert werden;<br />
2004 wurden von Januar bis August<br />
zehn Todesfälle gemeldet. Durch die<br />
in Rheinland-Pfalz konsequent und gemeinsam<br />
fortzuführenden Aufklärungsbemühungen<br />
sollte es gelingen, die Zahl<br />
der Todesfälle auf weniger als fünf im<br />
Jahr zu senken.<br />
Autorin<br />
Dr. Eleonore Lossen-Geißler
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten<br />
und Kulturen<br />
Hinkel GK<br />
Dresden<br />
Zusammenfassung<br />
Hinkel<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen<br />
Der römische Arzt Galen (129–199)<br />
empfiehlt drei wirksame Mittel zur Beruhigung<br />
eines Säuglings: Das Stillen,<br />
das Wiegen und das Vorsingen von Wiegenliedern.<br />
Die erste Wiege lässt sich<br />
79 nach Christus in einem einfachen<br />
pompejanischen Wohnhaus nachweisen,<br />
1230 findet sich im Sachsenspiegel<br />
die erste bildliche Darstellung einer<br />
Wiege. Walter Pflug bezeichnete den<br />
Uterus der Frau (Braunschweig 1923)<br />
als Urform der Wiege. In gleicher Weise<br />
hatte sich bereits der englische Arzt<br />
Michael Underwood 1784 unter Hinweis<br />
auf den schaukelnden Fetus im<br />
Mutterleib geäußert, da „in der gleichmäßigen<br />
Bewegung der Wiege etwas so<br />
natürliches und angenehmes zu liegen<br />
scheint, dass man sich nur zu Gunsten<br />
der Wiege aussprechen kann“.<br />
Weltweit lassen sich bei zahlreichen<br />
Völkern Babywiegen nachweisen. Beginnend<br />
von einer muldenförmigen<br />
Babyschale der Urbevölkerung der<br />
Andamanen im Indischen Ozean wird<br />
im vorliegenden Beitrag eine Typologie<br />
der Wiegenformen der Völker<br />
vorgestellt. Auf Pracht- und Prunkwiegen<br />
wird dabei nicht eingegangen. Die<br />
zahlreichen Objekte sprechen dafür,<br />
dass weltweit bei zahlreichen Völkern<br />
Wiegen verwendet wurden und werden.<br />
Die Hintergründe dieses uralten<br />
tradierten Pflegeverhaltens werden<br />
aus entwicklungs- und sinnesphysiologischer<br />
Sicht diskutiert und sind auch<br />
vor dem Hintergrund leidvoller Erfahrungen<br />
mit dem plötzlichen Kindstod<br />
nachvollziehbar.<br />
1. Die Wiege im Streit ärztlicher<br />
Meinungen:<br />
Seit jeher haben Mütter Probleme mit<br />
der Beruhigung und dem Einschlafen ihrer<br />
<strong>Kinder</strong>, seit jeher gibt es die Wiege als<br />
Mittel zur Schlafförderung.<br />
Die rhythmisch wiegende Bewegung<br />
empfahl bereits der griechische Philosoph<br />
Platon (427–347 v. Chr.): „Wenn<br />
das Einschlafen schwer einschlafender<br />
<strong>Kinder</strong> gefördert werden soll, so werden<br />
sie nicht ruhig gehalten, sondern bewegt,<br />
indem man sie unaufhörlich auf den<br />
Armen schaukelt.“ 1 Der römische Arzt Galen<br />
(129–199) führt zur Beruhigung des<br />
unzufriedenen Säuglings drei wirksame<br />
Mittel an: Stillen, Wiegen und das Vorsingen<br />
von Wiegenliedern. Mit bestem<br />
Gewissen dürfen wir behaupten, diese<br />
Lehre gilt noch heute. Ausführliche „Anweisungen“<br />
über den Gebrauch der Wiege<br />
finden sich bei dem alexandrinischen<br />
Arzt Soranus von Ephesos (98–138): „Die<br />
Bewegung des Schaukelns ist der Konstitution<br />
des Kindes anzupassen.“<br />
1 Die historischen Zitate sind entnommen von Albrecht<br />
Peiper (8) und Friedrich v. Zglinicki (11).<br />
39
40<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Der persische Philosoph und Arzt Ibn Sina<br />
oder Avicenna (980–1037) meint: „Wenn<br />
das Kind nach dem Stillen schläft, soll<br />
man nicht unsanft mit ihm umgehen,<br />
indem man die Wiege in so eine heftige<br />
Bewegung versetzt, dass davon die Milch<br />
in dem Magen umgerührt wird, vielmehr<br />
schaukle man die Wiege gelinde.“<br />
Gegen die Heftigkeit des Wiegens<br />
wandten sich seit dem 18. Jahrhundert<br />
zahlreiche Ärzte: 1722 warnte der Baseler<br />
Arzt Theodor Zwinger: (1658–1724) „Es<br />
geht nicht an, dass ein Kind in seiner<br />
Wiege heftig herumgeschaukelt wird,<br />
weil die Eingeweide des Kleinen auch<br />
heftig bewegt werden und so häufig dem<br />
Gehirn ein Schaden zugeführt wird.“<br />
Immerhin hat Zwinger nichts gegen die<br />
Wiege als solches. Anders der Reformpädagoge<br />
Jean Jacques Rousseau (1712–<br />
1778). 1762 gibt er seine „Erziehungsgrundsätze“<br />
in seinem Roman „Emile“<br />
bekannt. Darin heißt es: „… dass es nie<br />
notwendig ist, <strong>Kinder</strong> zu wiegen, und das<br />
dieser Brauch ihnen oft verderblich ist.“<br />
Wir bezweifeln stark, dass dies Rousseau<br />
richtig zu beurteilen vermag, zumal er<br />
auch nichts dabei empfand, seine fünf<br />
unehelichen <strong>Kinder</strong> sofort nach der Geburt<br />
in ein Findelhaus einzuliefern. Zunächst<br />
widersprach man Rousseau und<br />
versuchte seine Lehre medizinisch zu<br />
widerlegen: 1764 widersprach der französische<br />
Leibarzt Brouzet: „… dass man<br />
die <strong>Kinder</strong> durch nichts mehr beruhigen<br />
könnte als durch Bewegung.“<br />
1769 beantwortete der kursächsische<br />
Arzt Johann August Unzer (1727–1791)<br />
eine Anfrage in einer populärwissenschaftlichen<br />
Zeitschrift: „So wiegen Sie<br />
das Kind immerhin ohne Gewissensangst;<br />
lassen Sie der Wiege aber keinen<br />
Schwung geben, sondern sie mit der<br />
Hand sanft leiten.“ Noch einsichtiger<br />
war der englische Arzt Michael Underwood<br />
(1737–1820) 1784: Er meint unter Hinweis<br />
auf den schaukelnden Fetus im<br />
Mutterleib, dass „in der gleichmäßigen<br />
Bewegung der Wiege etwas so natürliches<br />
und angenehmes zu liegen scheint,<br />
dass man sich nur zu Gunsten der Wiege<br />
aussprechen kann.“<br />
Der Streit um den Nutzen der Wiege<br />
ging hin und her, im Grunde blieb die<br />
Diskussion ein „akademischer Streit“,<br />
ohne dass das schaukelnde Bett an Volkstümlichkeit<br />
verlor. Einen interessanten<br />
Diskussionsbeitrag im Streit lieferte der<br />
Meininger Arzt Friedrich Jahn (1766–1813).<br />
Der Autor bezieht sich auf die vieldiskutierte<br />
Meinung, dass die <strong>Kinder</strong> beim<br />
Schaukeln „seekrank“ würden. Jahn vertrat<br />
bereits damals den richtigen Standpunkt,<br />
dass „die <strong>Kinder</strong> vom Wiegen<br />
nicht dieselben Vorstellungen haben,<br />
wie wir Erwachsenen vom Schaukeln auf<br />
dem Wagen, im Schiffe usw. Die <strong>Kinder</strong><br />
haben keine unangenehmen, sondern<br />
angenehme Empfindung dabei“.<br />
Auch Christoph Wilhelm Hufeland<br />
(1762–1836) tritt 1803 für die Benutzung<br />
der Wiege ein. Christian August Struve<br />
warnt 1797 vor Anwendung schlafmachender<br />
Mittel wie Opiate, Mohnsuppen,<br />
Mohnmilch usw. und vor zu heftigem<br />
Wiegen. Immerhin räumt er ein:<br />
„Das sanfte Wiegen, die Nachahmung<br />
der schwankenden Bewegungen im Mutterleib,<br />
ist für kleine <strong>Kinder</strong> heilsam<br />
und nicht leicht durch andere Bewegungen<br />
zu ersetzen. Aber leider muss man<br />
manchmal die <strong>Kinder</strong> unverständigen<br />
Menschen überlassen, die mit der Wiege<br />
nicht umzugehen wissen“.
Hinkel<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen<br />
Ausgesprochene Wiegengegner sind:<br />
• der hessische Pfarrer Friedrich Heinrich<br />
Schwarz 1804: „Wiege ist ein Angriff<br />
auf das Gehirn und die ganze Natur“,<br />
• der französische Geburtshelfer und <strong>Kinder</strong>arzt<br />
Leroy 1805: „Durch das Schütteln<br />
kann vorzüglich die unsichtbare Organisation<br />
des Gehirns und der Gefühle<br />
nachteilig verändert werden … woraus<br />
große Unordnung in den Eingeweiden<br />
mancher <strong>Kinder</strong> entsteht.“<br />
In der Folge entkräfteten viele Mediziner<br />
die Argumente der Wiegengegner.<br />
1810 schreibt Adolf Christian Henke<br />
(1775–1843) in seinem Taschenbuch für<br />
Mütter: „Ausgezeichnete Ärzte haben<br />
die Verteidigung des uralten Brauches<br />
der Wiegen, die schon die Römer kannten,<br />
übernommen. Die unangenehme<br />
Empfindung, die Erwachsene von einer<br />
schaukelnden Bewegung in Horizontallage<br />
bekommen, findet beim Kind nicht<br />
statt … im Gegenteil scheint sie dem Kinde,<br />
das vor seiner Geburt einer ähnlich<br />
schaukelnden Bewegung ausgesetzt war,<br />
ganz behaglich zu sein .“<br />
Der Leipziger Arzt Hermann Klenke<br />
schreibt 1895, dass die Anschuldigungen<br />
gegen die Wiege übertrieben seien, weil<br />
„viele geistreiche Leute selbst in der<br />
Wiege gelegen haben“. Einer der letzten<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte, die in die Debatte um die<br />
Wiege eingriffen, war der Leipziger <strong>Kinder</strong>arzt<br />
Albrecht Peiper (1889–1968).<br />
Der Autor betont, dass es überhaupt<br />
kein besseres Beruhigungsmittel gäbe.<br />
„Ein zum Schreien aufgelegter Säugling<br />
beruhigt sich in der Wiege sofort … Die<br />
Wiege ist nichts anderes als ein Ersatz für<br />
das natürliche Tragbett des Kindes auf<br />
dem Schoß, im Arm oder auf dem Rü-<br />
cken der Mutter. So dient die Wiege letztendlich<br />
als Attrappe, indem sie dem Kind<br />
die Gegenwart der Mutter vortäuscht.<br />
Sein Lage- und Bewegungssinn sind bereits<br />
gut ausgebildet. Für den Erfolg des<br />
Wiegens ist es gleich, ob unter natürlichen<br />
Bedingungen auf dem Leib seiner<br />
Mutter, in seiner Wiege oder sonst wie<br />
gewiegt wird. Der junge Säugling empfindet<br />
den Unterschied nicht, sondern<br />
wird durch das Wiegen beruhigt, als ob es<br />
seine Mutter wäre“. Ganz abgesehen von<br />
Peiper stehen heute viele <strong>Kinder</strong>ärzte auf<br />
dem Standpunkt, dass die <strong>Kinder</strong>wiege<br />
zu Unrecht aus dem <strong>Kinder</strong>zimmer verbannt<br />
wurde.<br />
Zur Lagerung des Säuglings<br />
In allen bekannten Wiegen-Illustrationen<br />
ist der Säugling – falls er überhaupt<br />
dargestellt wird – in Rückenlage<br />
zu sehen. In Bauchlage bzw. Unterarmstütz<br />
wird das Kind immer nur im<br />
direkten Kontakt zur Mutter und der<br />
Amme gezeigt. Eine Umlagerung des<br />
schlafenden Säuglings aus der Wiege<br />
ins mütterliche Bett ist in bildlichen<br />
Darstellungen nicht bekannt.<br />
Im 18. und 19. Jahrhundert bestand<br />
eine Unsitte die <strong>Kinder</strong> zum Schlafen<br />
mit ins mütterliche Bett zu nehmen. In<br />
der kinderärztlichen Literatur wurde<br />
bereits damals auf die erhöhte <strong>Kinder</strong>sterblichkeit<br />
durch Überdecken und<br />
Überrollen hingewiesen. Zur Verhütung<br />
eines derartigen Ereignisses hat<br />
sich in Italien eine Art Schutzgehäuse,<br />
eine sogenannte Arcuccio verbreitet,<br />
unter die Säuglinge im Bett der Mutter<br />
gelegt werden sollten. Der bekannte<br />
Arzt und <strong>Gesundheit</strong>serzieher B. Ch.<br />
41
42<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Faust (1755–1842) erwähnt in seinem<br />
<strong>Gesundheit</strong>skatechismus ein derartiges<br />
Schutzgehäuse und verweist dringlich<br />
auf die alleinige Lagerung des Kindes<br />
ins Bett.<br />
2. Kinetik und Akustik – Sinnesphysiologie<br />
des Säuglings<br />
Isabella Bielicki schreibt 1971: „ denn<br />
die <strong>Kinder</strong> lieben die rhythmisch schaukelnde<br />
Bewegung des Wiegens. Diese<br />
Bewegung begleiten wir gewöhnlich mit<br />
dem Rhythmus eines einschläfernden<br />
Reimes, eines Wiegenliedes. Das unruhige<br />
Kind wird stiller, schläft ein. Der<br />
Wunsch, gewiegt zu werden, der in der<br />
Säuglingszeit am ausgeprägtesten ist,<br />
besteht in der Kindheit weiter. Schaukelpferd,<br />
Luftschaukel und Karussell<br />
sind während der ganzen Kindheit eine<br />
unerschöpfliche Quelle der Freude. Besonders<br />
gesunde und glückliche <strong>Kinder</strong><br />
verlangen danach gewiegt zu werden.<br />
Einsame <strong>Kinder</strong> flüchten sich in das Wiegen<br />
als der einzigen, ihnen gebliebenen<br />
Form, sich wohl zu fühlen. Sie schaukeln<br />
oder wackeln stundenlang monoton hin<br />
und her und geben der Welt damit zu<br />
verstehen, nichts ist mir geblieben im<br />
Leben, nur das Schaukeln!<br />
Es kommt aber auch vor, dass ein Säugling<br />
– völlig gesund und normal – sich<br />
wiegt, indem er sich rhythmisch von einer<br />
Seite auf die andere wälzt. Er schläft<br />
sich damit einige Minuten lang ein, bevor<br />
er in einen tiefen Schlaf fällt.“<br />
Der Hunger nach Bewegungsreizen<br />
muss in Zusammenhang mit dem Mechanismus<br />
der Tätigkeit des ZNS gesehen<br />
werden. Forschungen über die<br />
anatomische Reife des Gehirns beim<br />
Neugeborenen haben gezeigt, dass das<br />
Gleichgewichtszentrum eines der am<br />
frühesten heranreifenden Gehirnteile<br />
ist. Die Gleichgewichtsrezeptoren im<br />
Vestibularapparat des inneren Ohres<br />
sind einer der Sinne, die bereits am Ende<br />
des dritten Fetalmonats ihre Tätigkeit<br />
aufnehmen.<br />
Aus dieser Erkenntnis zieht Bielicki<br />
für das Verständnis des Wiegens folgende<br />
Schlussfolgerungen: „Die Frucht im<br />
Mutterleib ist ständig der wiegenden,<br />
rhythmischen Bewegung des Körpers der<br />
Mutter ausgesetzt. Die Frucht wird gewiegt<br />
von dem rhythmischen Pulsschlag<br />
des mütterlichen Herzens, von ihrem<br />
Atem, von jeder Bewegung“. Dann wird<br />
die Welt plötzlich mit der Durchtrennung<br />
der Nabelschnur nach der Geburt<br />
unbeweglich! Das Wiegen, auf das der<br />
fetale Organismus eingestellt war, hört<br />
auf. In den letzten Jahren hat sich in der<br />
Medizin ein eigener Zweig entwickelt:<br />
die Wissenschaft von der Deprivation,<br />
d. h. dem Mangel an äußeren Reizen.<br />
Unter dem Begriff des „Deprivationssyndroms“<br />
oder „Maternal-Deprivation“<br />
versteht man alle Beschwerden und<br />
Krisen, die dann auftraten, wenn dem<br />
Säugling und dem Kleinkind ungenügende<br />
Pflegezuwendungen und ungenügend<br />
Liebe verabfolgt werden und das<br />
Kind langsam verkümmert. Naturvölker<br />
kennen keine solche seelische Verkümmerung<br />
ihrer <strong>Kinder</strong>. Sie kennen keine<br />
abrupte Trennung, denn vom Tage der<br />
Geburt an wird das Kind herumgetragen<br />
und lebt dort weiter im rhythmischen<br />
Wiegen der mütterlichen Schritte, ihrer<br />
Bewegungen, ihrer Arbeit, ihres Tanzens.<br />
Mediziner und Pädagogen fordern<br />
daher immer stärker, den Mutter-Kind-
Kontakt zu pflegen und zu fördern. Das<br />
Wiegen des Kindes trägt dazu bei. Die<br />
Wiege kann dann eine „Ersatzmutter“<br />
werden. Walter Pflug geht sogar soweit,<br />
den Uterus der Frau als die Urform der Wiege<br />
zu bezeichnen. Die ersten Wiegen der<br />
Menschheit waren Mulden, Tröge und<br />
ausgehöhlte Baumstämme. Diese Wiegenformen<br />
sind als Ersatz für den Mutterschoß<br />
zu sehen. Der Reizhunger des<br />
Säuglings nach rhythmischer Bewegung<br />
kann zu Hause nur durch Einfühlungsvermögen<br />
der Mutter in die Tat umgesetzt<br />
werden, also mit Beweisen mütterlicher<br />
Liebe. Wolfgang Metzger drückt<br />
das so aus: „Das kleine Kind gedeiht,<br />
wenn man es so behandelt, als ob es eine<br />
Seele hätte.“ Das lateinische Sprichwort:<br />
„Mens sana in corpore sano“ hat der<br />
<strong>Kinder</strong>arzt Ernst Moro (1874–1951) mit<br />
Recht umgedreht: „Ist die Seele krank,<br />
dann leidet der Körper!“<br />
3. Das Wiegenlied<br />
Hinkel<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen<br />
Seit jeher hat man sich zur Schlafförderung<br />
des Säuglings nicht nur der Kinetik,<br />
sondern auch der Akustik bedient. Die<br />
Ansicht von Platon über das Wiegen haben<br />
wir vorangestellt. Eindringlich weist<br />
er auf die Akustik hin, nämlich auf den<br />
Gesang der Mütter. Platon sagt: „Wenn<br />
das Einschlafen schwer einschlafender<br />
<strong>Kinder</strong> von ihren Müttern gefördert werden<br />
soll, so werden sie nicht ruhig gehalten,<br />
sondern im Gegenteil bewegt,<br />
in dem man sie unaufhörlich auf den<br />
Armen schaukelt. Dabei schweigen die<br />
Mütter nicht etwa, sondern singen ihnen<br />
irgend eine Weise vor und bringen sie<br />
auf diese Weise wie mit rauschender Musik<br />
zum Schlafen.“ Die Schlummerlieder<br />
lauteten damals nicht anders als heute; so<br />
heißt es in den „Idyllen“ des griechischen<br />
Dichters Theokritos (3. Jhd. v. Chr.) – zitiert<br />
bei Peiper: Alkmene wäscht ihre<br />
Zwillinge Herakles und Iphikles, gibt<br />
ihnen Milch zu trinken und wiegt sie auf<br />
dem ehernen Schild ihres Vaters in den<br />
Schlaf. Dazu singt sie:<br />
„Schlafet ihr lieblichen <strong>Kinder</strong><br />
Den köstlich erquickenden Schlummer.<br />
Schlafet ihr brüderlich Paar,<br />
Ihr herzigen, blühenden Knaben.<br />
Glücklich genießt die Ruh´<br />
Und erlebt mir glücklich den Morgen“.<br />
Sprach es und wiegte den Schild und<br />
gewaltiger Schlummer umfing sie. Nach<br />
Galen (<strong>Gesundheit</strong>slehre I, 7) – zitiert<br />
bei v. Zglinicki – haben die Ammen drei<br />
Mittel gegen den Kummer des Neugeborenen<br />
erfunden:<br />
das Stillen,<br />
das Wiegen auf den Armen und<br />
das Singen von Wiegenliedern.<br />
1554 unterweist Jacob Rueff die Mütter<br />
und Hebammen:<br />
„Sing auch dazu eine süße Weis’,<br />
mit halber Stimme ohn’ groß Geschrei,<br />
das bringt ihm Frommen mancherlei.<br />
Sein Geist wird ihm dadurch erfreut,<br />
ein süßer Schlaf ist ihm bereit!“<br />
1577 schreibt der deutsche Dichter und<br />
Satiriker Johann Fischart:<br />
„Wo Honig ist, da sammeln sich die<br />
Fliegen;<br />
wo <strong>Kinder</strong> sind, da singt man um die<br />
Wiegen.“<br />
Im 19. Jahrhundert berichtet Friedrich<br />
Rückert über seine eigene Kindheit:<br />
43
44<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
„Ich war ein böses Kind und schlief nie<br />
ungesungen;<br />
doch schlief ich ein geschwind, sobald ein<br />
Lied erklungen,<br />
das meine Mutter sang, gelind.<br />
Und also bin ich noch, ein Schlaflied muss<br />
mir klingen;<br />
nur dieses lernt ich noch, es selber mir zu<br />
singen,<br />
seit ich der Mutter wuchs zu hoch.<br />
Und was mir tief und hoch nun mancherlei<br />
erklungen,<br />
ist nur ein Nachhall doch von dem, was sie<br />
gesungen;<br />
die Mutter singt im Schlaf mich noch.“<br />
Die Wiegenlieder-Literatur ist sehr<br />
umfangreich. Alle Völker der Welt besitzen<br />
eine aus sich selbst entwickelte und<br />
über Generationen vererbte „Volkspoesie“.<br />
Die allgemeine Kultur eines Volkes<br />
beeinflusst kaum das Wiegenlied.<br />
• Unentwickelt ist der Verstand des Wiegenliedes<br />
aller Völker.<br />
• Unentwickelt wird es auch gesungen.<br />
• Die Liebe zu dem Kleinen ist der Lehrmeister<br />
und Überlieferer zugleich.<br />
Was die Urgroßmutter erfunden, singt<br />
noch die Urenkelin ihrer Tochter.<br />
• Herzlich und innig soll es klingen.<br />
• Leicht erfundene Reime und ruhig dahinschreitender<br />
Rhythmus sollen dem<br />
Wiegenlied etwas Trauliches verleihen.<br />
• Manches Wiegenlied ist aber auch eine<br />
Offenbarung des Gemütslebens der<br />
Mutter<br />
Das Wiegenlied ist ein Element der<br />
Einzelfamilie. Es gehört damit in den<br />
engen Familienbereich und nicht auf<br />
das Konzertpodium. Wenn Peter Schreier<br />
Abend- und Schlaflieder von Robert<br />
Schumann und Johannes Brahms singt<br />
oder Adele Stolte das wunderschöne Lied<br />
„Schlaf mein Herzsöhnchen …“, dann<br />
sind das keine eigentlichen Wiegenlieder,<br />
sondern Kunstlieder.<br />
Von Seiten der Verhaltensforschung<br />
haben sich seit 1960 Dr. Johann Kneutgen<br />
und von Seiten der Musiktherapie<br />
Dr. Günter Last mit dem Wiegen- und<br />
Schlaflied befasst.<br />
Das Vorspielen von Wiegenliedern<br />
erzeugt nicht nur bei <strong>Kinder</strong>n sondern<br />
auch bei Erwachsenen Beruhigung, Entspannung<br />
und Schlaf. Der Tonumfang<br />
dieser Lieder ist gering, es finden sich<br />
keine großen Intervalle. Sie sind meist<br />
im 4/4 oder 2/4 Takt geschrieben. Das bewirkt<br />
den Eindruck des ruhigen Gleitens.<br />
Die Atmung passt sich dem melodischen<br />
Ablauf an, sie wird flach und regelmäßig,<br />
fließend wie beim Schlafenden. Die<br />
Herzfrequenz verlangsamt sich und das<br />
Psychogalvanogramm 2 zeigt keine Zeichen<br />
von Erregungen. Unter Einwirkung<br />
eines Wiegenliedes entsteht das Gefühl<br />
von Wohlbehagen und Entspannung.<br />
Schließlich tritt der Schlaf ein.<br />
Bietet man im Gegenexperiment Jazz-<br />
oder Beatmusik, so erzeugt man genau<br />
entgegengesetzte Wirkung. Bei Beatmusik<br />
entstehen beispielsweise fast Alarmreaktionen<br />
mit Anstieg von Blutdruck,<br />
Herz- und Atemfrequenz. Auf Hühner<br />
wirkt Beat sogar katastrophal. Sie flüchten<br />
panikartig und stürzen und trampeln<br />
sich dabei zu Tode (zitiert bei G. Last).<br />
2 Erfasst galvanische Hautreflexe, die schon bei<br />
leichten vegetativen Erregungen Anstieg zeigen
Hinkel<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen<br />
Die Wirkung des Wiegenliedes resultiert<br />
1. aus der Harmonie, aus der gleichförmigen<br />
Melodie und der Ruhe.<br />
2. Aus der Stimmung; sie liegt im Lied und<br />
der Interpretation und überträgt sich –<br />
ohne Kontrolle des Verstandes – in die<br />
für die Steuerung von Emotionen und<br />
vegetativen Vorgängen verantwortlichen<br />
Hirnstrukturen. Die psychovegetativen<br />
Stimulationen werden dabei<br />
durch das Wiegen noch besonders gefördert.<br />
Zur Synchronisation gibt Oehler folgende<br />
Erklärung unter Bezug auf den<br />
in der Physik bekannten Magneteffekt:<br />
Zwei verschiedene Rhythmen gleichen<br />
sich zum Zweck der Synchronisation an,<br />
ein Rhythmus nimmt den anderen mit.<br />
Solch eine Beeinflussung kann auch von<br />
außen eintreten. Ein innerer Rhythmus<br />
läuft im Sinne eines externen Reizgeschehens<br />
ab, z. B. auch beim militärischen Zeremoniell,<br />
bei verschiedenen Rieten und<br />
Kulthandlungen, beim Tanz u. a.<br />
Damit die Synchronisation wirken<br />
kann, müssen die äußeren Reize den entsprechenden<br />
Rhythmus haben, darüber<br />
hinaus spielen Intensität, Prägnanz und<br />
Qualität eine Rolle. Diese Merkmale<br />
sind unabhängig von jeglicher Kultur.<br />
Chinesische Wiegenlieder wirken<br />
genauso einschläfernd wie deutsche<br />
oder polnische. Wiegenlieder<br />
sind also auch heute noch geeignet,<br />
eine Schlafinduktion zu erzielen. Sie<br />
fördern die Einschlafbereitschaft und erzeugen<br />
einen physiologischen Schlaf, ganz<br />
im Gegensatz zum medikamentös induzierten<br />
Schlaf. In speziellen Krankenhäusern,<br />
Anstalten und Heimen wird sogar<br />
mit dem Wiegen- und Schlaflied eine<br />
Musiktherapie betrieben.<br />
4. Die Wiegenformen und ihre<br />
Verbreitung<br />
1. Die Trogwiege<br />
Sie ist die „Urform der Wiegen“. Die<br />
Tochterformen sind offenbar in allen<br />
Ländern zu allen Zeiten entstanden. Dafür<br />
spricht, dass verschiedene Wiegenformen<br />
immer nebeneinander nachweisbar<br />
sind.<br />
Ovid (43 v. Chr.–17 n. Chr.) erzählt<br />
eine Sage von der kreißenden Myrrha,<br />
die in einen Baum verwandelt wird. Als<br />
die Göttin der Geburten erscheint und<br />
ihre Hand an den Baum legt, öffnet sich<br />
dieser wie bei einem Kaiserschnitt und<br />
aus der berstenden Rinde erscheint Adonis,<br />
der Jüngling von sprichwörtlicher<br />
Schönheit. In Ovid’s Sage verbirgt sich<br />
eine Assoziation zur ersten Wiege der<br />
Welt: dem ausgehöhlten Baumstamm<br />
oder dem <strong>Kinder</strong>trog. Bei Naturvölkern<br />
wird die Einbaumwiege auch heute noch<br />
verwendet. Saglio (zitiert bei Pflug)<br />
spricht von römischen Trogwiegen, die<br />
etwa die Form eines Nachens haben, dessen<br />
untere Wölbung eine Schaukelbewegung<br />
ermöglicht. (Abb. 1)<br />
Abb. 1:<br />
Muldenförmige<br />
Babyschale von 74,5 cm Länge und 21 cm Breite.<br />
Herkunft: von der Urbevölkerung der Andamanen,<br />
einer Inselgruppe im Indischen Ozean. Die<br />
Innenfläche zeigt eine Ornamentik, als ob der<br />
Schnitzer aus Freude etwas Schönes und Unnützes<br />
hineingravieren wollte. (Katalog Nr.18 111, Staatliche<br />
Ethnografische Sammlungen Sachsen, Museum<br />
für Völkerkunde Dresden)<br />
45
46<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Varianten der Trogwiege:<br />
Sie stehen mit der Lebensweise der<br />
Völker in Beziehung. So verwundert es<br />
nicht, dass in den griechischen Legenden<br />
ein Schild oder ein Getreidesieb bzw.<br />
Getreidekorb benutzt wurde. Trogwiegen<br />
wurden von Naturvölkern in Hori-<br />
Abb. 2<br />
zontlage herumgetragen oder auf dem<br />
Kopf balanciert, wie alte Reliefplatten zu<br />
erkennen geben.<br />
Aus den Trogwiegen entwickeln sich<br />
die Troghänge-, Kastenhänge- und Lattenwiegen,<br />
wie an einzelnen Beispielen<br />
gezeigt werden kann. (Abb. 2–6).<br />
Abb. 3<br />
Abb. 2: Holzwiege von den Oroken auf Sachalin von 50 x 27 cm Größe mit haubenförmigem bewegliche<br />
Kopfteil in zusätzlichem Kopfschutzbügel. Am Kopf- und Fußteil Lederschnüre zum Aufhängen der Wiege.<br />
Die Wiege hat am Kopfteil außen sechs verzierte Hölzchen (Amulette? Klangelemente?).<br />
(Katalog Nr. 38 954, Staatliche Ethnografische Sammlungen Sachsen, Museum für Völkerkunde Dresden)<br />
Abb. 3: <strong>Kinder</strong>hängewiege aus dem Solonenzeltlager (Innerasienexpedition, 1927/1928), gefertigt aus<br />
Birkenrinde und Weidenzweigen. An der Wiege hängen zwei Männel und zwei Vögel als Schutzfiguren zur<br />
Abwehr von Krankheiten. In der Wiege befindet sich eine Wiegeneinlage aus Baumrinde, die mit Holzmehl<br />
oder verrotteten Weidenholz gefüllt ist. Hierauf wird der nackte Säugling gelegt, dessen Urin und<br />
Kot von dem Holzmehl aufgenommen wird. (Katalog Nr. 46 501, Staatliche Ethnografische Sammlungen<br />
Sachsen, Museum für Völkerkunde Dresden)
Abb. 4<br />
Hinkel<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen<br />
Abb. 5<br />
Abb. 6<br />
Abb. 4 und 5: <strong>Kinder</strong>wiege aus Birkenrinde der Mansen (Wogulen) von 46 x 26 x 50 cm. Die relativ kleine<br />
Wiegefläche und das Kopfteil bestehen aus mehrfach vernähter Birkenrinde.<br />
Randbefestigung aus umwickelten Weidenholz und Lederschlaufen zum Verschnüren des Kindes, zusätzlich<br />
sind Metallringe zum Aufhängen der Wiege angebracht. Füllung der Wiege zum Auffangen des Urins mit<br />
Bast- oder Holzwolle.<br />
(Katalog Nr. 40 487, Staatliche Ethnografische Sammlungen Sachsen, Museum für Völkerkunde Dresden)<br />
Abb. 6: Kastenwiege aus Palaghat/Südindien von 100 x 50 cm Größe, mit gedrechselten Füßen und Seitenstäben.<br />
Mit kräftigen Eisenhaken kann die Wiege aufgehängt werden.<br />
(Katalog Nr. 42 436, Staatliche Ethnografische Sammlungen Sachsen, Museum für Völkerkunde Dresden)<br />
47
48<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
2. Die Rückentragewiegen und<br />
<strong>Kinder</strong>tragen, Rucksackwiegen<br />
und Wegetragetücher<br />
Viele Naturvölker kennen<br />
keine Wiege, sondern tragen<br />
ihre <strong>Kinder</strong> im Huckepack<br />
ständig mit sich herum.<br />
Entsprechend den Volksbräuchen<br />
klammern sich<br />
die <strong>Kinder</strong> an den Rücken,<br />
sitzen auf dem Gesäß oder<br />
der Hüfte und werden gehalten<br />
von Tragegurten,<br />
Tragetüchern, einem Beutel<br />
oder einer festen Kiepe.<br />
Keinesfalls ist die Rückentragewiege<br />
nur bei Naturvölkern<br />
zu finden. Sie findet<br />
sich auch heute noch in Kulturländern.<br />
Abb. 7<br />
Vorteile der Rückentragewiegen<br />
sind:<br />
1. Sie ermöglichen einen frühen <strong>Umwelt</strong>kontakt<br />
und<br />
2. sie fördern einen intensiven Mutter-<br />
Kind-Kontakt.<br />
Die „Huckepackwiege“ wird vorzugsweise<br />
aus soziologischen Gründen genutzt:<br />
Naturvölker sind meist Nomaden. Nomadisierende<br />
müssen auf unwegsamen<br />
Pfaden beide Hände frei haben, also die<br />
<strong>Kinder</strong> auf dem Rücken tragen. Mit dem<br />
Huckepack arbeiten die Frauen auf dem<br />
Felde, verrichten Hausarbeit und führen<br />
kultische Tänze auf, ohne dass das Kind<br />
dabei erwacht.<br />
In allen Kulturen herrschen einfache<br />
Tragetuch- oder Tragefellwiegen vor, gegenüber<br />
festen Kiepen. Ein Stirnband gilt<br />
als Symbol der Mutterschaft.<br />
Im hohen Norden gibt es<br />
heute noch den sogenannten<br />
Amaut, einen Frauenpelz<br />
mit besonders weitem<br />
Rücken, der mit Knöpfen<br />
und Riemen einen<br />
Beutel bildet und worin<br />
das Kind hineingesetzt<br />
wird (Abb. 7).<br />
Rückentragewiegen<br />
mit festen „Nackenstützen“<br />
und schirmartigen<br />
Vorrichtungen, sind be-<br />
Abb. 8
Abb. 9<br />
Hinkel<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen<br />
sonders bei den nordamerikanischen<br />
Indianern zu finden. Rückentragewiegen<br />
werden auch zum Transport über den<br />
Sattel der Pferde und anderer Zugtiere<br />
gepackt (Abb. 8).<br />
Die Indianerwiegen Nordamerikas<br />
sind meist Brettwiegen. Das Wiegenbrett<br />
wird ringsum mit Leisten versehen, das<br />
Innere enthält geflochtene Bastmatten,<br />
Felle, Laub, Moos oder Federn. Außen<br />
sind lange, geschmückte Schulterrieme<br />
angebracht. Diese Wiegen enthalten<br />
Fußrasten, mitunter aufgesetzte Ledertaschen,<br />
Lederplanen zum Zuschnüren,<br />
an dem Kopfbügel hängen Spielzeug,<br />
Schmuck oder Fetische (Abb. 9).<br />
Varianten der Indianerwiegen sind:<br />
• für kleine <strong>Kinder</strong> die Hürdenwiegen<br />
und<br />
• für größere <strong>Kinder</strong> die Holzleiterwiegen.<br />
Mancher dieser Wiegen können mit<br />
einem spitzen Pfahl in die Erde gerammt<br />
oder an einen Baum angelehnt werden.<br />
Abb. 7: Fellsackwiege der Eskimos/Alaska. Babytragesack aus Robbenfell, verziert mit Leder, Fell und Perlen<br />
(Katalog Nr. 46 628, Staatliche Ethnografische Sammlungen Sachsen, Museum für Völkerkunde Dresden)<br />
Abb. 8: Sioux-Trage: Hirschleder auf gebogenem Rundholz. Verzierung mit Stachelschweinborsten<br />
(Katalog Nr. 372 Karl May-Museum Radebeul)<br />
Abb. 9: Leitergestelltrage der Prärieindianer (Dakota) aus Hirschleder , bemalt<br />
Rückentragekiepen werden zum Transport auch an den Sattel gehängt oder mit langen Schulterriemen<br />
getragen. Die Wiegen enthalten zum Teil aufgesetzte Ledertaschen und Lederplanen zum Zuschnüren und<br />
gelegentlich einen Kopfbügel. (Katalog Nr. 1209 Karl May-Museum Radebeul)<br />
49
50<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
3. Hängewiegen<br />
Sie haben eine überregionale Verbreitung<br />
in allen Teilen der Welt gefunden,<br />
besonders aber wo Raumknappheit<br />
herscht oder in Gegenden mit bevorzugtem<br />
Brauchtum wie bei den Ostslawen.<br />
Der Formenreichtum ist beträchtlich:<br />
• Trog-, Korb-, Schachtel- oder Kistenform<br />
• Leinwandbeutel, so genannte „Sackschaukeln“<br />
• in Skandinavien Fellsackwiegen<br />
• Lakenwiegen: an vier Enden wird ein<br />
Laken verknüpft und an einen Baum<br />
oder drei pyramidal zusammengestellten<br />
Stangen gehängt.<br />
Varianten sind die „Feldwiegen“<br />
oder die „Wippenstangenwiegen“.<br />
Sie<br />
ermöglichen vertikale und<br />
horizontale Schaukelbewegungen<br />
oder die „Tretwiege“<br />
bei der über eine<br />
Fußschlaufe die Wiege bei<br />
der Handarbeit bewegt werden<br />
kann. Ein bäuerliches<br />
Sprichwort wird jetzt auch<br />
verständlich, wenn es heißt:<br />
„Ich kannte ihn schon, als<br />
er noch am Baum hing.“ Etwas<br />
luxuriöse Ausführungen<br />
sind Gestellhängewiegen. Diese gibt es<br />
ausschließlich als querschwingende Wiegenkörbe<br />
oder Wiegenkästen.<br />
4. Kufenartige Wiegen und Kufenwiegen:<br />
Ab dem 13. Jahrhundert sind diese<br />
Wiegen die verbreitetesten in West-<br />
europa. Absolut vorherrschend ist die<br />
querschwingende Wiege. Seltener sind<br />
„Längsschwinger„. Sie schwingen langsamer<br />
und können nicht so schnell umkippen.<br />
Die Anspielung „ei is övern Kopp geweigert“<br />
(er ist über den Kopf gewiegt)<br />
meint wohl eine längsschwingende Wiege.<br />
Auf zwei Votivtafeln aus der italienischen<br />
Renaissance des 16. Jahrhundert<br />
sind längsschwingende Kufenwiegen<br />
dargestellt.<br />
Beide Frauen, welche die Wiege an<br />
einem Griff schaukeln, bitten die heilige<br />
Maria um Genesung des Kindes. (Abb.<br />
10)<br />
Abb. 10<br />
Abb. 10: Längsschwingende Trogwiege auf einer<br />
Votivtafel aus dem Jahre 1470. Eine betende Mutter<br />
an der Wiege ihres Kindes. Die Mutter wendet<br />
sich an eine Heilige und bittet um Genesung ihres<br />
Kindes. Standort: Kirche St. Maria del Monte im<br />
italienischen Compartimento Emilio – zitiert bei<br />
F. v. Zglinicki
Hinkel<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen<br />
Von den querschwingenden Wiegen<br />
gibt es auch verschiedene Formen:<br />
• Wiegenstühle, das sind hochgestelzte<br />
Gestelle auf Kufen.<br />
• Dann gibt es kufenartige Wiegen mit<br />
heruntergezogenen Schmalseiten, so<br />
dass die Wiegen auf der abgerundeten<br />
Schmalseite geschaukelt werden. Bei<br />
kleinem Kufenradius könnte sie leicht<br />
umkippen.<br />
• Die echte Kufenwiege ist die bodenständige<br />
Wiege und wegen des großen<br />
Kufenradius ist sie auch nicht umsturzgefährdet.<br />
Pflug nimmt an, dass die Kufenwiege<br />
bei den Turkvölkern ihren Ausgang<br />
nahm. Andererseits wurde bei Ausgrabungen<br />
im Herkulanum am Vesuv – also<br />
bereits 79 nach Chr. nachweisbar – eine<br />
hölzerne hochgestelzte Kufenwiege gefunden.<br />
Auf Fresken und Altarbildern<br />
des frühen Mittelalters sind bei Darstellungen<br />
der Geburt des Jesuskindes hochgestelzte<br />
Kufenwiegen zu sehen. Die<br />
älteste Wiegendarstellung im deutschen<br />
Raum findet sich im Sachsenspiegel des<br />
Eike von Repgow von 1239 mit Darstellung<br />
der vier Geburtszeugen und einer<br />
hochgestelzten Kufenwiege. In der illustrierten<br />
Handschrift des Heinrich von<br />
Laufenberg (1391–1460), ein Dichter<br />
und Priester, der dafür eintrat, dass die<br />
Mütter selbst ihre <strong>Kinder</strong> stillen sollten,<br />
findet sich eine Stillszene mit einer bodennahen<br />
Kufenwiege (Abb. 11)<br />
In einer Handschriften-Miniatur von<br />
1448 findet sich eine Illustration von der<br />
Legende der Heiligen Helena. Eine Wiegenfrau<br />
schaukelt einen Wiegenkorb mit<br />
einem Wiegenband so wie es im ober-<br />
schlesischen Weihnachtslied gesungen<br />
wird:<br />
„Auf dem Berge da wehet der Wind, da<br />
wiegt Maria ihr Kind.<br />
Sie wiegt es mit ihrer schneeweißen Hand,<br />
sie braucht dazu kein Wiegenband.“<br />
Das Wiegen ohne ein Wiegenband<br />
soll die besondere Nähe zum Kind aufzeigen.<br />
Querschwingende Kufenwiegen<br />
sind von verschiedenen Künstlern dargestellt<br />
werden u. a.<br />
• Albrecht Dürer „Marienleben“<br />
• Johann Gottlieb Hantzsch „Häusliche<br />
Szene“<br />
• Ludwig Richter „Familienglück“<br />
• Jan Brueghel „Vornehmer Besuch in<br />
einer Bauernstube“.<br />
Eine Variante der Kufenwiege ist die<br />
Stangenwiege, die es heute noch in den<br />
Ländern des mittlern Osten gibt. Die<br />
Stange zwischen Kopf- und Fußteil gibt<br />
der Wiege eine bessere Stabilität. Sie<br />
kann getragen werden. Eine schöne Stangenwiege<br />
findet sich im Topkapi-Muse-<br />
Abb. 11<br />
Abb. 11: Bodennahe Kufenwiege mit kleinem Kufenradius<br />
(dadurch umsturzgefährdet).<br />
Illustrierte Handschrift des Heinrich von Laufenberg<br />
(1391–1460). Standort: Zentralbibliothek<br />
Zürich – zitiert bei F. v. Zglinicki<br />
51
52<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
um in Istanbul. Mit dieser Wiege wird<br />
eine öffentliche Prozession nach Geburt<br />
des Sultankindes im Sultanspalast durchgeführt.<br />
5. Die Wiege in der Volkskunst<br />
Die Schmuckmöglichkeiten der Wiege<br />
sind bei den Kulturvölkern nahezu<br />
unbegrenzt. Die Wiege ist mehr als ein<br />
Gebrauchsmöbel. Je nach persönlichem<br />
Ausdrucksvermögens des Wiegenherstellers<br />
unterscheiden sich bäuerliche<br />
und ländliche Wiegen in ihrer künstlerischen<br />
Qualität. Das Dekor wird durch<br />
Malerei und Schnitzkunst bestimmt:<br />
Profane und religiöse Motive können<br />
unterschieden werden. Profane Motive<br />
sind Pflanzen, Ranken, Akanthusblätter,<br />
Muschelwerk, geometrische Figuren,<br />
Sprüche, Symbolzeichen u. a.<br />
Religiöse Motive sind Monogramm<br />
Christi und Maria, JHS, biblische Darstellungen,<br />
besonders Herzmotive und<br />
Fische.<br />
Abb. 12<br />
Beispiele aus dem Dresdner Volkskunstmuseum<br />
sollen dies belegen:<br />
Die Lausitzer Wiege von 1734 (Abb.<br />
12 und 13) mit der sogenannten Herrnhuter<br />
Malerei zeigt Beschriftungen am<br />
Kopf- und Fußende „AO“ bzw. „1734„<br />
und an den Längsseiten:<br />
„Schlaf mein liebes Kindelein,<br />
und tu deine Äuglein zu,<br />
der liebe Gott will dein Vater sein“ und<br />
„Der Engel des Herrn lagert um sich die<br />
her<br />
so denen, die ihn fürchten und hilft ihnen<br />
aus.“<br />
Abb. 13<br />
Abb. 12 und 13: Lausitzer Wiege von 1734 mit religiösen<br />
Motiven, sog. Herrnhuter Malerei.<br />
(Museum für Volkskunst der Staatlichen Kunstsammlungen<br />
Dresden)
Die Dresdner Wiege von 1824 (Abb.<br />
14 und 15) weist Blumenornamentik<br />
auf. Auf dem Bodenbrett ist ein Loch eingebohrt<br />
für die Urinableitung mit einem<br />
röhrenartigen System, wie es <strong>Kinder</strong>krankenschwestern<br />
für die Urinsammlung<br />
benutzen.<br />
Abb. 14<br />
Abb. 15<br />
Hinkel<br />
Geschichte der Wiegen in verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen<br />
Familienwiegen werden oft über viele<br />
Generationen weitergegeben. Die Wiegeninsassen<br />
sind häufig am Fußende<br />
oder auf einem innen liegendem Wiegenbrett<br />
verzeichnet. Die Bemalungen<br />
weisen – außer religiösen und profanen<br />
Abb. 14und 15: Dresdner Wiege von 1824 mit<br />
profaner Bemalung. (Museum für Volkskunst der<br />
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden)<br />
Motiven auf die Familientraditionen u. a.<br />
auch auf die Familienwappen hin (Abb.<br />
16).<br />
Abb. 16<br />
Diese Wiegen werden auch auf dem<br />
„Plunderwagen“ ganz oben auf als die<br />
Mitgift der Brautleute gepackt dargestellt.<br />
Abb. 16: Bäuerliche Familienwiege Heimatmuseum<br />
St. Moritz/Engadin<br />
53
54<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Danksagung<br />
Ich danke Herrn Professor Dr. Ekkehart<br />
Paditz für viele kritische Hinweise<br />
und Korrekturen der Testvorlage.<br />
Wir danken Frau Dr. Lydia Icke-Schwalbe<br />
vom Museum für Völkerkunde Dresden,<br />
Herrn Dr. Klaus-Peter Kästner für<br />
die Auswahl der Wiegen aus der Ethnografischen<br />
Sammlung Sachsens, Herrn<br />
Dr. Jenzen vom Museum für Völkerkunde<br />
der Staatlichen Kunstsammlungen<br />
Dresden sowie Herrn René Wagner und<br />
Herrn André Köhler vom Karl-May-Museum<br />
Radebeul für die Unterstützung<br />
bei der Bereitstellung zahlreicher Originale<br />
und Abbildungen.<br />
Literatur<br />
1. Isabella Bielicki: Dein Kind braucht Liebe.<br />
München, 1971<br />
2. Bernhard Christoph Faust: <strong>Gesundheit</strong>skatechismus.<br />
J.F. Althaus / Hofbuchdruckerei, Bückeburg 1794<br />
3. Günter Last: Behandlung von Schlafstörungen<br />
durch Wiegenlieder.<br />
Therapie der Gegenwart 112 (1973) 3–15<br />
4. Helga Lindner: Mit dem Liede kommt der<br />
Schlaf.<br />
Die Union 13/14. Dezember 1980<br />
5. Ernst Meier: Stil- und Klangstudien zum Wiegenlied.<br />
Dissertation der Philosoph. Fakultät der<br />
Univ. Greifswald 1932<br />
6. Curt Müller: Wiegenlieder aus Sachsen.<br />
Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung<br />
Nr. 89 vom 29. September 1906<br />
7. W. Oehler: Die Union vom 13./14. Dezember<br />
1980<br />
8. Albrecht Peiper: Chronik der <strong>Kinder</strong>heilkunde.<br />
3. Auflage.<br />
VEB Georg Thieme-Verlag 1958<br />
9. Walter Pflug: Die <strong>Kinder</strong>wiege, ihre Form und<br />
ihre Verbreitung.<br />
In: Archiv für Anthropologie (Braunschweig) NF<br />
19 (1923) 185–223<br />
10. H. Ploß: Das kleine Kind vom Tragbett bis zum<br />
ersten Schritt.<br />
Verlag A. B. Auerbach, Berlin 1881<br />
11. Friedrich v. Zglinicki: Die Wiege. Pustet Verlag,<br />
Regensburg 1979<br />
Anschrift des Verfassers<br />
Prof. em. Dr. med. Georg Klaus Hinkel<br />
Schlüterstraße 11, 01277 Dresden
Eine Bemerkung vorweg: Es geht in<br />
diesem Beitrag in erster Linie darum, das<br />
Handwerkszeug für erfolgreiche Kommunikation<br />
mit den SID-Risikogruppen<br />
zu vermitteln – die neuesten Kommunikationsmodelle<br />
dürfen Sie gern an anderer<br />
Stelle nachlesen. Mit der bewussten<br />
Wahl des Begriffs „Handwerkszeug“ soll<br />
Ihnen zum einen die Angst vor dem Gefühl<br />
genommen werden, trotz jahrelangem<br />
Fachstudiums möglicherweise das<br />
grundlegendste unserer Zivilisation verlernt<br />
zu haben: das miteinander reden.<br />
Zum anderen sollen Sie erkennen, dass<br />
Kommunikation durch bloße Übung<br />
perfektioniert werden kann – einfach<br />
nur dadurch, dass man sie als Mittel zum<br />
Zweck betrachtet. Es geht in diesem Beitrag<br />
also weniger um die Kommunikations-Theorie<br />
als Selbstzweck sondern um<br />
die alltägliche, zumeist schnöde Praxis:<br />
darum Gedanken und Gefühle ausdrücken,<br />
sie zu übermitteln, zu verbreiten –<br />
und es geht darum verstanden zu werden<br />
und einen Platz im Gedächtnis des Gesprächspartners<br />
zu finden. Letztendlich<br />
unternehmen wir aber die Anstrengung<br />
– und das sollten wir uns immer wieder<br />
klar vor Augen führen -, um eine Reaktion<br />
des Gegenübers zu provozieren, um<br />
einen Handlungsprozess in Gang zu setzen.<br />
Doch genug der Vorrede.<br />
Pabst<br />
Faktoren für eine bessere Kommunikation<br />
Damit die Botschaft ankommt:<br />
Faktoren für eine bessere Kommunikation<br />
Pabst T<br />
Thomas Pabst Kommunikationsberatung Heidelberg<br />
Wo es hakt: zu viel, zu klein, zu<br />
abstrakt<br />
Im Fall der SID-Prävention in Deutschland<br />
sehe ich – zumindest was die Kommunikation<br />
angeht – derzeit drei Herausforderungen,<br />
die es zu meistern gilt:<br />
1.) Zu viele, zu kleine Interessensgruppen<br />
verbreiten – jeder auf seine Weise<br />
und aus seiner Sicht – zu viele (teils abstrakte)<br />
Präventions-Botschaften. Diese<br />
vielen Botschaften heben sich gegenseitig<br />
auf oder kommen – wenn überhaupt – zu<br />
leise beim Empfänger an, um dort eine<br />
Wirkung zu entfachen. Der Empfänger<br />
nimmt die Botschaften als diffuses Stimmengewirr<br />
war. Bildlich könnte man sich<br />
die Situation mit einem Wellenspiel in<br />
einem kleinen See vorstellen: Wirft man<br />
einen großen Stein hinein, hebt sich der<br />
Wasserpegel am Ufer erkennbar. Wirft<br />
man stattdessen viele kleine Steine an<br />
unterschiedlichen Stellen in den See,<br />
bleibt das Ufer dennoch ruhig.<br />
2.) Da die direkte Kommunikation<br />
mit den Empfängern (unserer Zielgruppe)<br />
zu aufwändig und zu teuer wäre,<br />
sind alle Absender von Präventionsbotschaften<br />
(Kompetenzträger, Vereine,<br />
Selbsthilfegruppen) auf Multiplikatoren<br />
angewiesen. Hier bricht häufig schon<br />
der Kommunikationsfluss ab, der eigentlich<br />
vom Sender über den Mittler bis<br />
hin zum Empfänger ungestört ablaufen<br />
sollte. Damit dieser Kommunikations-<br />
55
56<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
fluss nicht abbricht, empfiehlt es sich die<br />
Multiplikatoren immer als sehr sensible<br />
(und zumeist auch politische) Menschen<br />
zu betrachten, das heißt sie müssen die<br />
Botschaft nicht nur erhalten, sie müssen<br />
sie bewusst aufnehmen, sie müssen sie<br />
verstehen und sie müssen motiviert werden,<br />
Ihre Botschaft weiterzuverbreiten.<br />
Insbesondere die Presse- und Lobbyarbeit<br />
muss an dieser Stelle professionalisiert<br />
werden.<br />
3.) Wenn die Botschaft bei der Zielgruppe<br />
ankommt, passiert es immer wieder,<br />
dass die Botschaft im Kern nicht<br />
erkannt, ihre Auswirkungen auf das eigene<br />
Leben nicht nachvollzogen und<br />
deshalb auch nicht ernst genommen<br />
wird. Hier gibt es meiner Meinung nach<br />
die größten Probleme. So erreichte die<br />
Babyhilfe nach der großen Schlafsack-<br />
Verlosungsaktion ein Dankesschreiben<br />
eines Gewinners mit einem Foto eines<br />
Säuglings, das in bäuchlings auf einem<br />
Schafsfell schlief. Aber auch Hebammen<br />
und Krankenhauspersonal scheinen mit<br />
der Glaubwürdigkeit von SID-Risikofaktoren<br />
mitunter ein Problem zu haben.<br />
Anders lässt es sich wohl kaum erklären,<br />
dass jedes Jahr … SID-Fälle in Krankenhäusern<br />
zu beklagen sind, obwohl<br />
sich das medizinische Personal eigentlich<br />
über die SID-Risiken im Klaren<br />
sein müsste. Möglicherweise liegt dieser<br />
beklagenswerte Umstand an der Tatsache,<br />
dass die Kommunikation nur selten<br />
bei den Bedürfnissen der Zielgruppe<br />
ansetzt – sich also weder deren Umfeld<br />
und Zeitrahmen schert, noch sich bewusst<br />
deren Sprache bedient. Im Fall<br />
des Schlafsackgewinners hätte es möglicherweise<br />
geholfen, anstatt abstrakt von<br />
den Risikofaktoren Überwärmung und<br />
Überdeckung zu reden, mehr die Folgen<br />
der Risikofaktoren in den Mittelpunkt<br />
der Kommunikation zu stellen. Es muss<br />
ihm klar werden, dass sein Baby deutlich<br />
schlechter auf Sauerstoffmangel im<br />
Blut reagiert, wenn es zu warm schläft<br />
oder gar Kohlenmonoxid aus der eigenen<br />
Atemluft inhalieren muss. Erst wenn<br />
er verstanden hat, dass seine Verhaltensweisen<br />
eine lebensbedrohliche Gefahr<br />
für sein Baby darstellt dürfen, ist er auch<br />
empfänglich für weiteres Zahlenmaterial,<br />
mit dem Sie Ihre Präventionsbotschaft<br />
untermauern können.<br />
Und keine Angst vor deutlichen Worten:<br />
Im Gegensatz zu manch einem Politiker<br />
oder Vorgesetzen, müssen Sie<br />
unangenehme Wahrheiten nicht durch<br />
wohlwollende Worte verschleiern. Beweisen<br />
Sie Größe und widerstehen Sie<br />
auch der Versuchung, Ihr Gegenüber<br />
beeindrucken zu müssen! Für den Erfolg<br />
einer Präventionskampagne gegen den<br />
plötzlichen Säuglingstod, gibt es nur ein<br />
einzige wichtige Motivation: Sie wollen<br />
und müssen von Ihrer Zielgruppe verstanden<br />
werden.<br />
Mit wem wir es zu tun haben:<br />
Multiplikatoren und Zielgruppe<br />
sind auch nur Menschen<br />
Was ist zu tun? Wir müssen zurück zu<br />
den Wurzeln und wir müssen von denen<br />
lernen, die tagtäglich mit vielen Millionen<br />
Menschen erfolgreich kommunizieren:<br />
von den Journalisten zum Beispiel.<br />
Denn schließlich müssen wir genau diese<br />
Berufsgruppe als Multiplikator überzeugen,<br />
damit sie unsere Botschaften möglichst<br />
perfekt bei unserer Zielgruppe
platziert. Aber auch wenn wir die Journalisten<br />
auf dem Weg an unsere Zielgruppe<br />
umgehen können – wichtig ist, dass wir<br />
uns immer wieder vor Augen halten, dass<br />
unser Gegenüber ein Mensch mit Interessen<br />
und Neigungen (aber auch mit<br />
Antipathien und Fehleinschätzungen) ist<br />
– und auch als solcher behandelt werden<br />
will und muss. Entscheidend darüber, ob<br />
eine Botschaft bei Ihrer Zielgruppe ankommt<br />
ist aber, dass wir vor jeder wichtigen<br />
Äußerung kurz in uns gehen und uns<br />
fragen, welches Ziel wir mit dieser Äußerung<br />
verfolgen: Was sollen unsere Worte<br />
bei unserem Gegenüber emotional und<br />
intellektuell auslösen? Sowohl Bauch als<br />
auch Kopf müssen wir bedienen, wenn<br />
sich unser Gegenüber dauerhaft an unser<br />
Gespräch erinnern soll.<br />
Wie eine Botschaft zur<br />
Nachricht wird: menschliche<br />
Schwächen für sich nutzen<br />
Aus dieser Erkenntnis der Gehirnforschung<br />
entwickelten die Kommunikationswissenschaftler<br />
Galtung und Ruge<br />
1965 1 die so genannten Nachrichtenfaktoren,<br />
die als grober Anhaltspunkt für<br />
den Aufmerksamkeitswert/Wirkungsgrad<br />
einer Botschaft gelten. Wichtig! Jeder<br />
Nachrichtenfaktor steht immer in<br />
direkter Relation zu dem Mitglied der<br />
Zielgruppe, das mit der Botschaft konfrontiert<br />
wird. Eine Mutter wird für<br />
Baby-Themen immer empfänglicher sein<br />
als eine Studentin, die in der gleichen<br />
Stadt wohnt, genau so alt wie die Mutter<br />
ist, einen ähnlichen Intellekt hat, die aber<br />
im Gegensatz zu der Mutter ihr Familienleben<br />
noch vor sich sieht.<br />
Pabst<br />
Faktoren für eine bessere Kommunikation<br />
Galtung/Ruge beschreiben insbesondere<br />
die folgenden zwölf Nachrichtenfaktoren;<br />
die Lehren für die Praxis finden<br />
Sie hinter den Pfeilen:<br />
1.) zeitliche Nähe –> jede Botschaft sollte<br />
sich auf ein Ereignis beziehen, das<br />
gerade geschehen ist. Liegt das Ereignis<br />
schon eine Weile zurück, sollte es<br />
durch möglichst viele aktuelle Aspekte<br />
aufgepeppt werden.<br />
2.) Schwellengröße –> jede Botschaft<br />
konkurriert mit anderen Botschaften,<br />
die zeitgleich an unseren Empfänger<br />
gesendet werden. Soll unsere<br />
Botschaft vom Empfänger als lauteste<br />
und wichtigste wahrgenommen werden,<br />
muss sie sich auf ein möglichst<br />
großes Ereignis beziehen.<br />
3.) Eindeutigkeit –> Botschaften mit<br />
mehreren Aspekten müssen zur besseren<br />
Verständlichkeit immer in einzelne<br />
Aspekte aufgelöst werden. Um<br />
den Kern einer Geschichte zu erfassen,<br />
formulieren Journalisten zum<br />
Beispiel bei jeder Geschichte zuerst<br />
den „Fensterbrüller“: eine Schlagzeile,<br />
bei der sich die Leute umdrehen,<br />
wenn man sie aus dem Fenster auf<br />
die Straße brüllen würde. „Lege Dein<br />
Baby zum Schlafen auf den Rücken!“<br />
wäre so ein Fensterbrüller. „Babys<br />
lieben es rauchfrei“ ist dagegen noch<br />
zu abstrakt, um als Fensterbrüller<br />
seine volle Wirkung zu verbreiten.<br />
In diesem Fall müssen die Fäden Botschaft<br />
noch weiter entwirrt werden.<br />
Zum Beispiel könnte der Fensterbrüller<br />
heißen: „Mach die Zigarette<br />
aus, wenn dein Baby schläft!“ oder<br />
ganz einfach „Babys mögen keinen<br />
Rauch!“<br />
57
58<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
4.) psychische und lokale Nähe –> Botschaften<br />
müssen für den einzelnen<br />
Empfänger immer nachempfindbar<br />
formuliert werden. Je mehr die Botschaft<br />
mit dem Erlebten des Empfängers<br />
zu tun hat und je näher sie an seinem<br />
Lebensumfeld ist, desto stärker<br />
wird die Botschaft erlebt – und desto<br />
größer wird die Chance gehört zu<br />
werden.<br />
5.) Erfüllung unserer sehnlichsten Wünsche<br />
–> siehe psychische Nähe<br />
6.) Überraschungsfaktor -> Wenn partout<br />
nichts Überraschendes an einer<br />
Botschaft gefunden werden kann, so<br />
sollte zumindest versucht werden,<br />
die Botschaft auf eine ungewöhnliche<br />
Art und Weise zu präsentieren.<br />
7.) Kontinuität –> Beim Formulieren einer<br />
Geschichte, mit der eine Botschaft<br />
transportiert werden soll, sollte<br />
immer auch schon daran gedacht<br />
werden, wie die Geschichte fortgesetzt<br />
werden kann. Denn ist ein Thema<br />
einmal in den Nachrichten, fällt<br />
es so schnell nicht wieder heraus – es<br />
sei denn, es tritt auf der Stelle. Dann<br />
wird es langweilig. Bevor es dazu<br />
kommt, also schnell einen neuen Aspekt<br />
in die Diskussion einbringen!<br />
8.) Kuriosität, Unterhaltungsfaktor –><br />
Geschichten, die mit einem Schmunzeln<br />
erzählt werden können, werden<br />
immer dankbar weiter getragen. Sie<br />
dienen als willkommener Kontrast<br />
für die (zumeist tristen) Begebenheiten,<br />
die einen Großteil unseres<br />
Lebens bestimmen.<br />
9.) Mächtige Länder –> Botschaften sollten<br />
sich entweder auf wichtige große<br />
oder schnelle wendige Länder beziehen.<br />
10.) Mächtige Personen –> Botschaften<br />
sollten grundsätzlich handelnde Akteure<br />
haben – je einflussreicher, desto<br />
besser. Zahlen allein können nicht<br />
handeln, deshalb wirken sie langweilig,<br />
solange nicht zusätzlich ein anderer<br />
Nachrichtenfaktor erfüllt ist!<br />
11.) Personalisierung –> Weg mit anonymen<br />
Risikofaktoren, her mit (lebendigen<br />
oder toten) <strong>Kinder</strong>n, (freudestrahlenden<br />
oder trauernden)<br />
Eltern, (engagierten oder besorgten)<br />
Babysittern! Ansonsten gilt Punkt<br />
10.<br />
12.) Negativismus –> Über dieses Gesetz<br />
beschweren sich nicht nur Wirtschaftsbosse<br />
und Politiker: Eine<br />
schlechte Botschaft verkauft sich<br />
besser als eine gute. Der Grund ist<br />
einleuchtend: Angst und Furcht gehören<br />
zu den stärksten und kontinuierlichsten<br />
Gefühlen, die ein Mensch<br />
erleben kann. Im Fall der SID-Prävention<br />
muss insbesondere dieser<br />
Punkt jedoch mit äußerster Vorsicht<br />
behandelt werden, da Angst und<br />
Furcht in den meisten Fällen auch<br />
eine lähmende Komponente mit<br />
sich bringt.<br />
Da 1965 der Einfluss des Fernsehens<br />
bei der Vermittlung einer Botschaft an<br />
eine möglichst große Zielgruppe bei weitem<br />
noch nicht so eine entscheidende<br />
Rolle gespielt hat wie heute, müsste noch<br />
ein dreizehnter Nachrichtenfaktor zu<br />
der Liste hinzugefügt werden.<br />
13.) Bildhaftigkeit –> bevor Sie eine Botschaft<br />
formulieren, denken Sie bitte<br />
daran, dass diese Botschaft in möglichst<br />
beeindruckenden (Sprach-)<br />
Bildern kommuniziert werden kann.
Wenn Sie das Fernsehen als Kommunikationskanal<br />
wählen, ist dieser<br />
Faktor unabdingbare Voraussetzung.<br />
Und mag das Thema noch so wichtig<br />
sein: keine Bilder, kein Fernsehen.<br />
Wie unser Anspruch aussieht:<br />
erst nachdenken, dann reden.<br />
Ideal wäre also, wenn es uns gelänge,<br />
die Botschaften der SID-Prävention<br />
bildhaft, aktuell, laut, eindeutig, eindringlich,<br />
hoffend, überraschend, unterhaltend,<br />
personalisiert und in der Konsequenz<br />
ein wenig negativ zu formulieren.<br />
Dabei sollte sie pointiert sein und den<br />
Unterschied zum gewohnten Mittelmaß<br />
deutlich herausarbeiten.<br />
Das sollte unser Anspruch sein. Hierfür<br />
wünsche ich Ihnen viel Erfolg! Und<br />
ich würde mich freuen, wenn Sie diese<br />
Ansprüche in der zweiten SID-Präventionstagung<br />
– zumindest ansatzweise<br />
– erfüllt sehen, so dass die wichtigsten<br />
Botschaften des Kongresses in Ihrem Gedächtnis<br />
mit positiven Bildern verbunden<br />
sind und sie diese in Ihrem Umfeld<br />
so oft wie möglich weiter verbreiten.<br />
Autor<br />
Thomas Pabst, Kommunikationsberatung<br />
Langgarten 21, 69124 Heidelberg<br />
Telefon (0 62 21) 8 94 67 83<br />
Telefax (0 62 21) 8 94 67<br />
tpkomm@gmx.de http://pabst.pr-server.de<br />
Literatur<br />
1 Elisabeth Noelle-Neumann u. a. (Hrsg.):<br />
Fischer Lexikon Publizistik. Massenkommunikation.<br />
Fischer: Frankfurt/M. 2000, S. 331<br />
Pabst<br />
Faktoren für eine bessere Kommunikation<br />
59
Brückmann<br />
Beinahe-SID unter stationärer Überwachung mit schwersten neurologischen Folgeschäden<br />
Beinahe-SID unter stationärer Überwachung mit<br />
schwersten neurologischen Folgeschäden<br />
Brückmann D<br />
<strong>Kinder</strong>krankenhaus St. Nikolaus Oberschwabenklinik gGmbH, Abteilung für Neuropädiatrie Ravensburg<br />
Einleitung<br />
Der plötzliche unerwartete Säuglingstod<br />
wurde definiert als plötzlicher Tod<br />
eines Säuglings oder Kleinkindes, der<br />
unerwartet eintritt und bei dem sorgfältige<br />
Untersuchungen keine adäquate<br />
Ursache nachweisen lassen (Beckwith<br />
1970). Die Definition wurde später erweitert<br />
bezüglich der Vorgeschichte,<br />
der Todesumstände und der Obduktion<br />
(Willinger 1991, Beckwith 1992, 1993).<br />
Ein SID ist für die Betroffenen immer ein<br />
katastrophales Ereignis. Wenn sich dieses<br />
aber in der als sicher angenommenen<br />
Umgebung einer Klinik ereignet, zeigen<br />
sich alle Beteiligten fassungslos, von den<br />
Eltern werden schuldhaftes Versagen<br />
und Versäumnisse angenommen.<br />
Vor Jahren – noch in Zeiten sehr selektiver<br />
Monitorüberwachung – war in<br />
unserer Klinik ein Säugling am SID in<br />
Bauchlage verstorben, nachdem sein Monitor<br />
von einem anderen Kind mit Bluttransfusion<br />
benötigt worden war. Dass<br />
jedoch eine Monitorüberwachung nicht<br />
immer zuverlässigen Schutz bietet, soll<br />
am folgenden Fall dargestellt werden.<br />
Kasuistik<br />
Roberto L-S, war in der 35. SSW geboren<br />
worden, die postnatale Entwicklung<br />
war unauffällig. Zwei Tage vor der stati-<br />
onären Aufnahme – im chronologischen<br />
Alter von vier Monaten – bestand eine<br />
Obstipation. Nach abführenden Maßnahmen<br />
wurde blutig-schleimiger Stuhl<br />
abgesetzt. Daraufhin erfolgte die Einweisung<br />
untter dem Verdacht auf Invagination.<br />
Diese bestätigte sich zunächst nicht,<br />
das Kind wurde aber zur Beobachtung<br />
aufgenommen. Wegen angenommener<br />
Bauchschmerzen wurde R. auf den Bauch<br />
gelegt und mit einem Herz-Atem Monitor<br />
überwacht. In der folgenden Nacht<br />
wurde er zwei Stunden nach Nahrungsaufnahme<br />
nach Monitoralarm bei 49/<br />
min HF blass-zyanotisch im Erbrochenen<br />
aufgefunden. Nach rascher Reanimation<br />
und Absaugung war eine maschinelle<br />
Beatmung über elf Tage erforderlich. Ab<br />
dem fünften Behandlungstag stellten sich<br />
fokale Krampfanfälle sowie eine myoklonische<br />
Enzephalopathie mit massiven<br />
Myoklonien auf minimalste Reize ein.<br />
Es wurde eine antikonvulsive Therapie<br />
mit Carbamazepin und Clonazepam mit<br />
mäßigem Erfolg eingeleitet. Im MRI des<br />
Schädels zeigten sich später ausgedehnte<br />
Nekrosen im Marklager und cortikal, generalisierte<br />
Hirnatrophie und lakunäre<br />
Defekte im Bereich der Pons, der Stammganglien<br />
und des Thalamus beidseits.<br />
Klinik und VEP ergaben Hinweise auf<br />
eine cortikale Amaurose (VEP = visuell<br />
evozierte Potenziale; cortikale Amaurose<br />
= zentral bedingte Blindheit).<br />
61
62<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Diskussion<br />
und Schlussfolgerung<br />
Es liegen keine verlässlichen Daten von<br />
SID mit und ohne erfolgreiche Reanimation<br />
in der Klinik vor. Der Erfolg der<br />
jetzt generellen Monitorüberwachung<br />
ist ebenfalls nicht beurteilbar. Unter<br />
Überwachung mit Atemmonitor sind in<br />
einer englischen Studie in der Klinik 16<br />
Todesfälle aufgetreten (Samuels 1993).<br />
Zudem ist nach der derzeitigen Einschätzung<br />
die Monitiorüberwachung vorwiegend<br />
als diagnostische Maßnahme anzusehen<br />
(Poets 2000). Eine Überwachung<br />
mit Herz-Atemmonitor erscheint problematisch,<br />
da eine Bradykardie nicht<br />
selten erst nach längerer Hypoxie auftritt<br />
(Poets 1993). Ob unser Patient das akute<br />
Ereignis mit Pulsoxymetrie unbeschadet<br />
überstanden hätte, ist zwar nicht nachweisbar,<br />
aber dennoch nicht auszuschließen.<br />
Für unsere Klinik wurde die Folgerung<br />
gezogen, dass Säuglinge nur nach strenger<br />
Indikation und schriftlicher ärztlicher<br />
Anweisung in Bauchlage gebracht<br />
werden dürfen und dann pulsoxymetrisch<br />
im beat zu beat Modus überwacht<br />
werden müssen.<br />
Literatur<br />
Beckwith JB (1970) Discussion of terminology<br />
and definition of sudden infant death syndrom.<br />
In Bergmann AB, Beckwith JB, Ray CG Sudden<br />
infant death syndrom. Proceedings of the Second<br />
International Conference on the Causes of Sudden<br />
Death in Infants.University of Washington Press,<br />
Seattle, pp 14–22<br />
Beckwith JB (1993) A proposed new definition of<br />
sudden infant death syndrom. In Walker AM, Mc<br />
Millen C Second SIDS International Conference<br />
1992. Perinatology Press. Ithaka New York pp<br />
421–424<br />
Poets CF, Samuels MP, Noyes J, Hewertson J, Hartmann<br />
H, Holder A, Southhall DB (1993) Home<br />
event recordings of oxygenation, breathing movements,<br />
and electrocardiogram in infants and young<br />
children with apparent life-threatening events. J<br />
Pediatrics 123: 693–701<br />
Poets CF (2000) Heimmonitoring in Kurz R, Kenner<br />
TH, Poets CF (Herausgeber) Der plötzliche<br />
Säuglindgstod Springer Verlag Wien: 227–234<br />
Samuels MP, Stebbens VA, Poets CF, Southall DP<br />
(1993) Death on infant apnoe monitors. J Maternal<br />
Child Health 18: 262–266<br />
Willinger M, James LS, Catz C Defining the sudden<br />
infant death syndrom: deliberations of an expert<br />
panel convened by the National Institute of Child<br />
Health and Human Development. Pediatr Pathol<br />
11: 677–684<br />
Autor<br />
Dr. med. Detlef, A. Th. Brückmann<br />
Abteilung für Neuropädiatrie<br />
im <strong>Kinder</strong>krankenhaus St. Nikolaus<br />
Oberschwabenklinik gGmbH<br />
Nikolausstraße 10, 88212 Ravensburg<br />
Telefon (07 51) 87 32 78<br />
Telefax (07 51) 87 32 30<br />
detlef.brueckmann@oberschwaben-klinik.de
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
Zusammenfassung<br />
Sowohl medizinische Indikationen für<br />
den Heimmonitoreinsatz als auch ein<br />
steigendes Risikobewusstsein der Eltern<br />
lassen einen schnell wachsenden Markt<br />
für Heimüberwachung von Säuglingen<br />
entstehen. Die Definition des SID –<br />
als unerwartetes und nicht erklärbares<br />
Ereignis – sowie die noch unvollständige<br />
wissenschaftliche Durchdringung<br />
des Phänomens machen SID zu einem<br />
aktuellen medizinischen, medizintechnischen<br />
und wirtschaftlichen Problem.<br />
Verschiedene Veröffentlichungen zeigen,<br />
dass Heimmonitore die Erwartungen<br />
von Ärzten und Eltern nur teilweise<br />
erfüllen, was insbesondere die korrekte<br />
Ermittlung und Vorwarnung von lebensbedrohlichen<br />
Zuständen des Säuglings<br />
betrifft. Die häufigen Fehlalarme beim<br />
Einsatz von Heimmonitoren stellen ihre<br />
Applikation in Frage. Zur Erreichung einer<br />
notwendigen Mindestqualität ist unbedingt<br />
eine einheitliche Verifizierung<br />
z. B. durch Signalverläufe von Fällen<br />
mit lebensbedrohlichem Charakter und<br />
durch klinisch professionelle Testung im<br />
Rahmen der Polysomnografie erforderlich.<br />
Im vorliegenden Beitrag wird ein<br />
Überblick zu den am deutschen Markt<br />
verfügbaren Monitoren für pädiatrische<br />
Heimüberwachung gegeben. Der Heimmonitor<br />
als biomedizinisches Gerät, als<br />
Hilfsmittel im Sinne der Patientenbetreuung,<br />
wurde dabei aus technischer<br />
und wirtschaftlicher Sicht analysiert.<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
Rabenau M, Andres M, Naumann K, Poll P<br />
Institut für Biomedizinische Technik, Fakultät Elektrotechnik & Informationstechnik der TU Dresden<br />
Fakten zur Bewertung des Heimmonitormarktes:<br />
• Bisher gibt es nur drei Heimmonitore,<br />
die in klinischen Studien parallel<br />
zur kontinuierlichen Polysomnografie<br />
geprüft wurden. Dabei<br />
hat sich gezeigt, dass die Fehlalarmquote<br />
hoch und das Eventrecording<br />
unzuverlässig ist. Standardisierte<br />
Prüfprotokolle fehlen bisher als<br />
Zugangskriterium zum Markt.<br />
• In Deutschland bieten etwa 16 Firmen<br />
rund 50 verschiedene Heimmonitore<br />
und Pulsoximeter an.<br />
Im Heil- und Hilfsmittelkatalog<br />
der gesetzlichen Krankenkassen<br />
sind gegenwärtig 25 SID-Monitore<br />
gelistet. Die Preise (inkl. 16 %<br />
Mwst., ohne Sensoren und Elektroden)<br />
liegen bei ca. 1 000 Euro<br />
für Atemfrequenz-Monitore, bei<br />
ca. 2 500 Euro (± 1200 Euro) für<br />
Atem-und-Herzfrequenz-Monitore<br />
mit integriertem Speicher sowie<br />
bei ca. 4 500 Euro (±1 200 Euro) für<br />
Atem-und-Herzfrequenz-Monitore<br />
mit zusätzlich integriertem Pulsoximeter.<br />
• Im Jahr 2003 wurden in Deutschland<br />
ca. 4 500 ± 300 Heimmonitore<br />
für Säuglinge nach dem Hilfsmittelverzeichnis<br />
Nr. 21.24.02 von den<br />
gesetzlichen Krankenkassen finanziert.<br />
• Dies entspricht bei Annahme eines<br />
mittleren Preises von 2 000 Euro<br />
einem Umsatzvolumen von min-<br />
63
64<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
destens zehn Millionen Euro. Pulsoximeter<br />
als alleinige Verordnung,<br />
Sensoren, Elektroden etc. sind darin<br />
noch nicht enthalten.<br />
Einleitung<br />
Medizinische Indikationen 1 für einen<br />
Heimmonitoreinsatz und ein steigendes<br />
Risikobewusstsein von Eltern, insbesondere<br />
die Angst ihr Kind durch den<br />
plötzlichen Säuglingstod zu verlieren,<br />
haben einen schnell wachsenden Markt<br />
für Heimüberwachung von Säuglingen<br />
hervorgebracht. Die Definition zum<br />
SID 2 , der gegenwärtige wissenschaftliche<br />
Erkenntnisstand zur Diagnose SID<br />
[7, 14], die Dynamik der technischen<br />
Entwicklung bei den Heimmonitoren<br />
und der damit verbundene Erkenntnisprozess<br />
zeigen in verschiedenen Veröffentlichungen<br />
[1, 3, 10, 13], dass Heimmonitore<br />
teilweise nicht die von ihnen<br />
hervorgerufenen Erwartungen bei Ärzten<br />
und Eltern erfüllen. Insbesondere die<br />
Ermittlung und die Vorwarnung von lebensbedrohlichen<br />
Zuständen des Säuglings<br />
werden unterschiedlich realisiert<br />
[2].<br />
Der vorliegende Beitrag soll aus technischer<br />
Sicht einen Überblick über die<br />
am deutschen Markt verfügbaren Heimmonitore<br />
geben und so zur objektiven<br />
Bewertung des Marktes der Heimmonitore<br />
beitragen. Für die Krankenkassen<br />
sind Heimmonitore im Sinne der Patientenbetreuung<br />
spezielle Biomedizinische<br />
Geräte, die der Kategorie Hilfsmittel<br />
zuzuordnen sind.<br />
Da die Gerätebezeichnungen variieren,<br />
wurde zur Begriffsbestimmung folgende<br />
Vorgabe vereinbart: Als Heimmo-<br />
nitore werden im Weiteren Geräte oder<br />
Einrichtungen verstanden, welche sowohl<br />
messen und überwachen als auch den aktuellen<br />
Status der Messung anzeigen können und<br />
im vorgegebenen Notfall alarmieren. Nicht<br />
betrachtet dagegen werden Geräte, die<br />
diesen Kriterien nicht entsprechen. Dies<br />
betrifft insbesondere sog. Babyphone 3<br />
bzw. Baby-Videophone. Sie beschränken<br />
sich auf das reine Übertragen von Informationen.<br />
Sie nehmen also keine Bewertung<br />
entsprechender Biosignale für kritische<br />
Zustände und damit verbundene<br />
mögliche Alarmierungen vor.<br />
Die Zusammenstellung der Heimmonitore<br />
entstand auf der Basis:<br />
1 z.B. nach einem Vorfall von ALTE (apparent<br />
life threatening event) oder ALE (anscheinend<br />
lebensbedrohliches Ereignis) – d. h. überlebtes<br />
offensichtlich lebensbedrohliches Ereignis, bei<br />
maschinell beatmeten <strong>Kinder</strong> oder bei Frühgeborenen,<br />
die zum Zeitpunkt der Entlassung<br />
noch signifikante Apnoen bzw. Hypooxämien<br />
aufweisen [4, 5, 8]<br />
2 SID/SIDS steht als Abkürzung für „Sudden<br />
Infant Death Syndrom“, die englische Bezeichnung<br />
für die Diagnose „Plötzlicher Kindstod“ -<br />
der häufigsten Todesursache im ersten Lebensjahr.<br />
Die seit 30 Jahren gültige Definition sieht<br />
in der Diagnose „Plötzlicher Kindstod“ den<br />
„plötzlichen Tod eines Säuglings oder Kleinkinds,<br />
der aufgrund der Anamnese unerwartet<br />
ist und bei dem eine gründliche postmortale<br />
Untersuchung keine adäquate Todesursache<br />
zu zeigen vermag“ [12].<br />
3 Beispiele findet man beim Spezialversand für<br />
<strong>Kinder</strong>sicherheitsprodukte - Silke Grützner /<br />
Dortmund (www.kinder-sicherheit.de/babyphone)<br />
oder beim Babyphonversand Fortkamp<br />
Internetmarketing / Billerbeck (www.<br />
babyphonversand.de)
• umfangreicher Recherchen im Internet<br />
mit verschiedenen Synonyma 4 (z. B.<br />
Heimmonitoring/-monitore, Überwa-<br />
chungsmonitoring/-monitore [für<br />
Herz, Atmung, Sauerstoffsättigung],<br />
Apnoe-Monitore, Herz-/Atemfrequenzmonitore,<br />
SIDS-Monitore/-Über-<br />
wachungsmonitore, Baby-Monitore),<br />
• verschiedener Homepage-Informationen<br />
von Herstellern und Vertriebsfirmen<br />
zutreffender Gerätetechnik,<br />
• telefonischer Kontaktaufnahme oder<br />
E-Mail-Austausche mit Herstellern<br />
bzw. Vertreibern,<br />
• des Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelverzeichnisses<br />
der Krankenkassen und<br />
• schriftlicher Anfragen bei ausgewählten<br />
Krankenkassen.<br />
Gerätetypenübersicht, Anbieter 5<br />
Die aus den Angaben der Hersteller<br />
und verschiedener Vertreiber zusammengestellte<br />
Übersicht in Tabelle 1 soll<br />
dem Pädiater eine Vorstellung über die<br />
auf dem deutschen Markt verfügbare,<br />
umfangreiche Gerätetechnik zum Heimmonitoring<br />
geben. Bedingt durch die<br />
zügige technische Entwicklung auf dem<br />
Gebiet der Heimmonitore ist das Angebot<br />
einer ständigen Änderung und<br />
Erweiterung unterworfen. Diese Gerätetechnik<br />
kann aus der applikativen Sicht<br />
Heimmonitoring beispielsweise nach den<br />
bewerteten Biosignalen folgendermaßen<br />
eingeteilt werden:<br />
• Atemfrequenz-Monitore (Apnoe-Monitor),<br />
• Atem-und-Herzfrequenz (EKG)-Monitore,<br />
• Multiparameter-Monitore (neben<br />
Atem- und Herzfrequenz werden wei-<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
tere Biosignale wie O2-Sättigung oder<br />
CO2-Gehalt teilweise auch Temperatur,<br />
Blutdruck bewertet),<br />
• Pulsoximeter (O2-Sättigung) und<br />
• Capnographen (CO2-Gehalt).<br />
In diesem Gerätesortiment insbesondere<br />
unter den Überschriften: SIDS-<br />
Monitor, Babymonitoring, Neugeborenen-<br />
Überwachungssystem, Monitoring von<br />
Neugeborenen, Überwachung der Atem- und<br />
Herzfunktion von Säuglingen, Überwachungsgeräte<br />
gegen den Plötzlichen Kindstod,<br />
Säuglingsmonitore für SIDS-Prävention sowie<br />
Home Care finden sich ca. 16 Hersteller<br />
oder Anbieter in Deutschland:<br />
• Air Products Medical GmbH/Hattingen<br />
(www.airproducts.de)<br />
• Bitmos GmbH/Düsseldorf<br />
(www.bitmos.de)<br />
• Datex-Ohmeda GmbH/Duisburg<br />
(www.datex-ohmeda.de)<br />
• Getemed Medizin- und Informationstechnik<br />
AG/Teltow<br />
(www.getemed.de)<br />
• Hoffrichter GmbH/Schwerin<br />
(www.hoffrichter.de)<br />
• Heinen + Löwenstein (H&L) GmbH/<br />
Bad Ems (www.hul.de)<br />
• Masimo Corporation/USA<br />
(www.masimo.com)<br />
4 siehe auch im UMDNS (Universal Medical Device<br />
Nomenclature System) bei DIMDI (Deutsches<br />
Institut für Medizinische Dokumentation<br />
und Information) unter www.dimdi.<br />
de oder www.kliniken.de im Menü Lieferanten<br />
und UMDNS-Nomenklatur<br />
5 Es wurde die Bezeichnung Anbieter gewählt, da<br />
sowohl Hersteller als auch Vertreiber ausländischer<br />
Technik das Geräteangebot in Deutschland<br />
bestimmen.<br />
65
66<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
• Medlab medizinische Diagnosegeräte<br />
GmbH/Karlsruhe<br />
(www.medlab-gmbh.de)<br />
• MLM GmbH/Teltow<br />
(www.ursula-weisensee.de)<br />
• Nellcor Puritan Bennett/Pleasanton,<br />
USA (www.nellcor.com)<br />
• Radiometer GmbH/Willich<br />
(www.radiometer.de)<br />
• Saegeling Medizintechnik GmbH/Heidenau<br />
(www.saegeling-mt.de)<br />
• Schulte-Elektronik GmbH/Olsberg<br />
(www.schulte-elektronik.de)<br />
• Smiths Medical Deutschland GmbH/<br />
Kirchseeon (www.smiths-web.de) verbunden<br />
mit Graseby Medical Limited/<br />
Hertfordshire UK<br />
(www.graseby.co.uk/index2.php)<br />
• F. Stephan GmbH/Gackenbach<br />
(www.stephan-gmbh.com)<br />
• VitalAire GmbH / Norderstedt (www.<br />
vitalaire.de)<br />
• Weinmann Geräte für Medizin<br />
GmbH + Co.KG/Hamburg<br />
(www.weinmann.de)<br />
• Werner & Müller – Gesellschaft für<br />
Medizintechnik – Produkte Vertriebs<br />
mbH/Wiesenbach<br />
(www.wernerundmueller.de)<br />
• Funny Handel GmbH & Co. KG/Düsseldorf<br />
(www.funny-handel.de) deutscher<br />
Anbieter für Angelcare/Kanada<br />
(www.angelcare-monitor.com)<br />
• Nonin Medical, Inc./USA<br />
(www.nonin.com)<br />
Für eine Überschaubarkeit der Tabelle<br />
1 wurden bei der Geräteauflistung entsprechende<br />
Gerätefamilien und ähnliche<br />
Gerätearten eines Herstellers immer<br />
zusammengefasst. Auch können einige<br />
Geräte von verschiedenen Anbietern bezogen<br />
werden, was durch die Angabe<br />
weiterer Firmen verdeutlicht wird.<br />
Tabelle 1: Zusammenstellung Überwachungsgeräte für Säuglinge u. Kleinkinder<br />
Typ Nr. Geräte Anbieter Biogrößen<br />
AF HF SaO2 etCO2<br />
1* Angelcare® Typ AC100, AC201-R Funny Handel x – – –<br />
2* SpiroGuard Hoffrichter x – – –<br />
3* SISS Babycontrol® Schulte-Elektronik x – – –<br />
4* MR 10 VitalAire, Graseby x – – –<br />
5* Neoguard% Bitmos x x – –<br />
6* VitaGuard® VG 2000 #§, VG 2100 Getemed, H&L x x – –<br />
7* SD 1 # Air Products Medical x x – –<br />
8* RW 2000 # Werner & Müller x x – –<br />
9* SpiroGuard C Hoffrichter x x – –<br />
10* Sterntaler Typ I, <strong>II</strong> Hoffrichter x x – –<br />
11* Samson% H&L, Saegeling x x – –<br />
12* SIDS 900 S, 970 S Saegeling x x – –<br />
13* Babycontrol® plus bzw. plus EKG Schulte-Elektronik x x – –<br />
14* NeoSid Nova F. Stephan x x – –<br />
15* MR 20 VitalAire, Graseby x x – –<br />
Atemfrequenz-M.<br />
Atem-und-Herzfrequenz-Monitore
Multiparameter-Monitore<br />
Pulsoximeter<br />
Capno.<br />
16* VitaGuard® VG 3000 #§, VG 3100 Getemed, H&L x x x –<br />
17* SD 2 # Air Products Medical x x x –<br />
18* RW 3000 # Werner & Müller x x x –<br />
19* BabyMonitor Fredy% MLM x x x –<br />
20* NeoSid Nova plus F. Stephan x x x –<br />
21* Babycontrol® SpO2 Schulte-Elektronik x x x –<br />
22* MR 30 VitalAire, Graseby x x x –<br />
23* M6 VitalAire, Saegeling x x x –<br />
24* M8 VitalAire, Saegeling x x x x<br />
25* CO2 SMO plus H&L x – x x<br />
26* Capnox Medlab x – x x<br />
27* NPB-75 Nellcor, VitalAire – x x x<br />
28* sat 703, 801, 816 Bitmos – – x –<br />
29* 3800, 3900/3900P Pulsoximeter Datex-Ohmeda – – x –<br />
30* TuffSat Handoximeter Datex-Ohmeda – – x –<br />
31* VitaGuard® VG 300 #§ , VG 310 Getemed – – x –<br />
32* PX 1 # Air Products Medical – – x –<br />
33* RW 300 # Werner & Müller – – x –<br />
34* Masimo Radical; RAD-5/5v/-9 Masimo, Getemed u. a. – – x –<br />
35* Nanox Medlab – – x –<br />
36* POX10L Medlab – x x –<br />
37* NPB-40 Nellcor, VitalAire – - x –<br />
38* PalmSAT® 2500, Onyx® Nonin Medical – x x –<br />
39* TCM4+ Radiometer – – x –<br />
40* Oxycount® mini Weinmann, VitalAire – x x –<br />
41* Capnogard H&L x – – x<br />
42* Capnocount® mini Weinmann x – – x<br />
43* Cap 10, Capnos Medlab x – – x<br />
Erläuterungen<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
Typ Nr. Geräte Anbieter Biogrößen<br />
AF HF SaO2 etCO2<br />
AF – Atemfrequenz HF – Herzfrequenz<br />
SaO2 – Sauerstoffsättigung etCO2 – endexspiratorischer Kohlendioxidgehalt<br />
* eingetragenes Hilfsmittel siehe Tabelle 2<br />
# Nach www.getemed.net/deutsch/start_deutsch.htm unter Produkte, Monitoring und OEM-Versionen<br />
(vom 29. November 2004) sind die Getemed-Monitore auch als baugleiche OEM-Versionen der Firmen<br />
Air Products Medical und Werner & Müller erhältlich.<br />
§ Nach Auskunft des Anbieters: Auslaufmodell wird durch eine Weiterentwicklung ersetzt.<br />
% Gerät ist nach Auskunft des Anbieters nicht mehr erhältlich.<br />
+ Gerät misst auch den transkutanen CO2.<br />
67
68<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Die technische Realisierung der Geräte<br />
ist sehr unterschiedlich. Ihre Beschreibung<br />
muss im konkreten Fall aus der Gerätedokumentation<br />
des Herstellers entnommen<br />
werden. In Tabelle 1 wurden zu<br />
den jeweiligen Geräten die gemessenen<br />
Biogrößen aufgeführt, woraus sich die<br />
Gerätezuordnung zu den Monitortypen<br />
ergibt. Daneben sind für die Bewertung<br />
des konkreten Monitors noch weitere<br />
wesentliche Kriterien zu nennen, wie:<br />
• Netz- oder Batteriegerät (Größe bzw.<br />
Gewicht; Eignung für den mobilen<br />
Einsatz),<br />
• Sensortypen und -eigenschaften,<br />
• Gestaltung und Größe (Lesbarkeit)<br />
der Anzeige,<br />
• Möglichkeit der Messwertspeicherung<br />
(Eventrecording oder kontinuierliche<br />
Speicherung),<br />
• Möglichkeit der Messwertsausgabe per<br />
Drucker und/oder an PC,<br />
• Arten der Alarmierung (optische, akustisch),<br />
Einstellbarkeit von Ansprechempfindlichkeit<br />
und Alarmgrenzen.<br />
Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen<br />
Heimmonitore sind aufgrund ihrer<br />
Nutzung im Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelverzeichnis<br />
aufgeführt (Tabelle 2),<br />
da sie im Heimbereich der Patienten<br />
eingesetzt und als Hilfsmittel geeignet<br />
sind, „eine konkrete Krankheit oder Behinderung<br />
zu verhindern“ [<strong>II</strong>]. Hilfsmittel<br />
dienen vorzugsweise dazu, Körperfunktionen<br />
Betroffener zu ersetzen,<br />
zu ergänzen oder zu verbessern, um die<br />
Alltagsverrichtungen möglichst selbstständig<br />
durchzuführen aber auch einer<br />
drohenden Behinderung, einer Krank-<br />
heit bzw. deren Verschlimmerung oder<br />
dem Eintritt von Pflegebedürftigkeit vorzubeugen.<br />
Nach § 128 SGB V 6 haben die<br />
Spitzenverbände 7 der Krankenkassen<br />
das Hilfsmittelverzeichnis zu erstellen,<br />
in dem die von der Leistungspflicht der<br />
gesetzlichen Krankenversicherung umfassten<br />
Produkte aufgeführt werden. Das<br />
Hilfsmittelverzeichnis ist regelmäßig<br />
fortzuschreiben.<br />
Nach dem Verständnis im Antragsverfahren<br />
[<strong>II</strong>] sind Hilfsmittel sächliche<br />
Mittel oder technische Produkte:<br />
• Sie sichern den Erfolg einer Krankenbehandlung,<br />
gleichen eine Behinderung<br />
aus oder beugen einer drohenden<br />
Behinderung vor.<br />
• Sie werden im allgemeinen Lebensbereich<br />
bzw. im häuslichen Umfeld<br />
des Betroffenen eingesetzt, so dass sie<br />
dort in der Regel durch nicht medizinisch<br />
ausgebildete Personen genutzt<br />
werden. Sie müssen deshalb einfach zu<br />
handhaben sein.<br />
• Sie dienen der Befriedigung der elementaren<br />
Grundbedürfnisse des täglichen<br />
Lebens.<br />
• Sie sind von der Funktion her transportabel.<br />
• Sie werden über den Fachhandel durch<br />
zugelassene Leistungserbringer abgegeben.<br />
(Produkte, die ausschließlich<br />
vom Arzt angelegt oder vom Arzt in<br />
den Körper eingeführt werden, sind<br />
keine Hilfsmittel.)<br />
6 SGB V - Sozialgesetzbuch Fünftes Buch: Gesetzliche<br />
Krankenversicherung<br />
7 VdAK – Verband der Angestellten-Krankenkassen<br />
e. V. und<br />
AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V.
Gewünschte Objekte werden auf Antrag<br />
der Hersteller in das Hilfsmittel-<br />
oder Pflegehilfsmittelverzeichnis aufgenommen,<br />
damit diese grundsätzlich<br />
durch die gesetzliche Krankenversicherung<br />
oder die soziale Pflegeversicherung<br />
finanziert werden können. Das Hilfsmittelverzeichnis<br />
gliedert sich in 33 Produktgruppen,<br />
um die Vielfalt der Produkte<br />
entsprechend ihrer Einsatzgebiete zu systematisieren.<br />
Jedes Produkt, für das der<br />
therapeutische oder pflegerische Nutzen<br />
bzw. die Funktionstauglichkeit und die<br />
Qualität nachgewiesen werden konnten<br />
(s. Pkt. 5), wird nach entsprechender<br />
Entscheidung der Spitzenverbände in<br />
den Produktübersichten des Hilfsmittel-<br />
oder Pflegehilfsmittelverzeichnisses<br />
aufgelistet. [<strong>II</strong>]<br />
Ein anerkanntes Hilfsmittel erhält eine<br />
zehnstellige Positionsnummer (Bedeutung<br />
der Zuordnung links beginnend,<br />
mit Angabe von Kennung und Bezeichnung<br />
für Heimmonitore):<br />
• 2-stellig Produktgruppe (21 – Messgeräte<br />
für Körperzustände/-funktionen)<br />
• 2-stellig Anwendungsort (24 – Atmungsorgane)<br />
• 2-stellig Untergruppe (02 – Überwachungsgeräte<br />
für Säuglinge/SIDS-Monitore)<br />
• 1-stellig Produktart<br />
(0 – Atemfrequenz-Monitore<br />
1 – Herzfrequenz-Monitore [keine Bedeutung]<br />
2 – kombinierte Atem-und-Herzfrequenz-<br />
Monitore ohne integrierten Speicher<br />
3 – Speichereinheit für kombinierte<br />
Atem-und-Herzfrequenz-Monitore<br />
[keine Bedeutung]<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
4 – kombinierte Atem-und-Herzfrequenz-<br />
Monitore mit integriertem Speicher<br />
5 – z. Z. nn [eventuell 8 : kombinierte<br />
Atem-und-Herzfrequenz-Monitore<br />
mit integriertem Speicher und Pulsoxymetrie])<br />
• 3-stellige individuelle Endziffer eines<br />
Produktes (z. B. BabyMonitor<br />
Fredy Art.-Nr.5250: 21.24.02.4.010;<br />
BabyMonitor Fredy Art.-Nr.5252:<br />
21.24.02.5.003 [vgl. Tabelle 2]).<br />
8 Vermutung der Verfasser aufgrund der eingeordneten<br />
Geräte<br />
69
70<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Tabelle 2: Auszug aus dem Hilfsmittelverzeichnis nach § 128 SGB V [I]<br />
Untergruppe 21-24-02 Überwachungsgeräte für Säuglinge/SIDS-Monitore<br />
Positions-Nr. Bezeichnung Hersteller<br />
Art 0 – Atemfrequenz-Monitore<br />
21-24-02-0-001 Spiroguard 5 SG Art.-Nr. 00003102/5 SG 102 Hoffrichter<br />
21-24-02-0-002 SISS Babycontrol Mobil (BCm) Schulte-Elektronik<br />
21-24-02-0-003 MR 10 Art.-Nr. 0902-0002 VitalAire<br />
21-24-02-0-004 SISS Babycontrol temp (BCt) Art.-Nr. B00040 Schulte-Elektronik<br />
21-24-02-0-005 SISS Babycontrol Art.-Nr. B00001 Schulte-Elektronik<br />
Art 1 – Herzfrequenz-Monitore: nicht besetzt<br />
Art 2 – kombinierte Atem-und-Herzfrequenz-Monitore ohne integrierten Speicher<br />
21-24-02-2-001 SISS Babycontrol Mobil Plus (BCmp), Art.-Nr. B0015 Schulte-Elektronik<br />
Art 3 – Speichereinheit für kombinierte Atem-und-Herzfrequenz-Monitore: nicht besetzt<br />
Art 4 – kombinierte Atem-und-Herzfrequenz-Monitore mit integriertem Speicher<br />
21-24-02-4-001 VitaGuard VG 2000 Art.-Nr. 72020 Getemed<br />
21-24-02-4-002 Sterntaler Typ 1, Art-Nr. 00006401 – 4 Hoffrichter<br />
21-24-02-4-003 Sterntaler Typ 2, Art-Nr. 00006421 – 24 Hoffrichter<br />
21-24-02-4-004 Air Products Medical SD1 Art.-Nr. 02019 Air Products Medical<br />
21-24-02-4-005 Baby Screener Art.-Nr. 5054 MLM<br />
21-24-02-4-006 MR 10 S Art.-Nr. 0902-0016 VitalAire<br />
21-24-02-4-007 Spiroguard C Art.-Nr. 00006/6SG Hoffrichter<br />
21-24-02-4-008 SISS Babycontrol Mobil Plus S (HCMS), Art.-Nr. B0017 Schulte-Elektronik<br />
21-24-02-4-009 Samson Art.-Nr. 300-000 Heinen + Löwenstein<br />
21-24-02-4-010 BabyMonitor Fredy Art-Nr. 5250 MLM<br />
21-24-02-4-011 SISS Babycontrol Plus Art.-Nr. B00005 Schulte-Elektronik<br />
21-24-02-4-012 NeoSid Nova Art-Nr. 138861000 Stephan<br />
21-24-02-4-013 Neoguard Art.-Nr. 37-1000 Bitmos<br />
21-24-02-4-014<br />
Art 5 – nn<br />
VitaGuard VG 2100, Art.-Nr. REF 73111012 Getemed<br />
21-24-02-5-001 Air Products Medical SD 2, Art.-Nr. 02020 Air Products Medical<br />
21-24-02-5-002 VitaGuard 3000 Art.-Nr. 72018 Getemed<br />
21-24-02-5-003 BabyMonitor Fredy Art-Nr. 5252 MLM<br />
21-24-02-5-004 NeoSid Nova Plus Art-Nr. 138961000 Stephan<br />
21-24-02-5-005 VitaGuard 3100 Art.-Nr. REF 73112012 Getemed
Die Zuordnung der Säuglingsmonitore<br />
zu der Gruppe „Anwendungsort – Atmungsorgane“<br />
lässt darauf schließen,<br />
dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieser<br />
Hilfsmittelart (Heimmonitore) die<br />
Diagnose Plötzlicher Kindstod mit dem<br />
Versagen der Atmung assoziiert wurde.<br />
Pulsoxymeter und Capnographen für<br />
die Heimanwendung besitzen derzeit<br />
noch keine Einordnung in das Hilfsmittelverzeichnis.<br />
Ein Mitarbeiter des IKK 9<br />
Bundesverbandes erklärte dazu: „Die<br />
Hersteller scheuen die Prüfung zur Erstellung<br />
einer neuen Kategorie, denn diese<br />
ist umfangreicher als die Einstellung<br />
(Einordnung und Zulassung) des Gerätes<br />
in eine bestehende Produktart.“<br />
Im Hilfsmittelverzeichnis gelistete<br />
Heimmonitore (Tabelle 2) werden von<br />
Krankenkassen bei vorliegender Indikation<br />
finanziert. Nach Auskunft einzelner<br />
Krankenkassen können Sachbearbeiter<br />
der Krankenkassen auch Geräte<br />
genehmigen, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis<br />
aufgeführt sind. Da Säuglingsüberwachungsmonitore<br />
nur einen sehr<br />
geringen Teil der zu genehmigenden<br />
Hilfsmittel darstellen, wird in der Regel<br />
auf eine sonst notwendige tiefer gehende<br />
Prüfung nach Anbietern und Preisen<br />
verzichtet. Somit bleibt es gänzlich dem<br />
Pädiater überlassen, für welches Gerät er<br />
sich entscheidet.<br />
Für eine Hochrechnung aller von<br />
Krankenkassen finanzierten Heimmonitore<br />
bezogen auf Gesamtdeutschland im<br />
Jahr 2003 wurden acht repräsentative gesetzliche<br />
Krankenkassen angeschrieben<br />
(fünf große, d.h. mindestens 0,7 Mio.<br />
Mitglieder bzw. mindestens 1 Mio. Ver-<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
sicherte, auf Bundeslandebene arbeitende<br />
Krankenkassen und drei große, d. h.<br />
mindestens 3,5 Mio. Mitglieder bzw.<br />
mindestens 5 Mio. Versicherte, Deutschland<br />
weit arbeitende Krankenkassen).<br />
Zwei Krankenkassen konnten nach eigenen<br />
Angaben kein Zahlenmaterial dazu<br />
ermitteln. Drei Krankenkassen wollten<br />
keine Zahlen weiter geben. Die folgende<br />
Kalkulation basiert im Wesentlichen<br />
auf zwei verschiedenen Angaben (einer<br />
Krankenkasse auf Bundeslandebene<br />
und einer Deutschland weit arbeitenden<br />
Krankenkasse).<br />
Die Basis einer überschlägigen Proportionalitätsberechnung<br />
für das Jahr 2003<br />
bilden dabei<br />
• die in einer Krankenkasse versicherten<br />
Neugeborenen,<br />
• die Neugeborenen der BRD und aufgeteilt<br />
nach Bundesländern,<br />
• die in einer Krankenkasse Versicherten<br />
und<br />
• die gesamte BRD-Bevölkerung sowie<br />
die der Bundesländer.<br />
Dabei kommt man sowohl über die<br />
Deutschland weit arbeitende Krankenkasse<br />
(2003: 670 Heimmonitore) als<br />
auch über die auf Bundeslandebene<br />
arbeitende Krankenkasse (2003: 110<br />
Heimmonitore) auf eine Anzahl von ca.<br />
4 500 Heimmonitoren (± 300 Stück), die<br />
2003 nach dem Hilfsmittelverzeichnis<br />
Nr. 21.24.02 von allen Krankenkassen<br />
finanziert wurden. In dieser Zahl sind<br />
keine Pulsoxymeter enthalten, da sie einzeln<br />
von der Statistik noch nicht erfasst<br />
werden.<br />
9 IKK – Innungskrankenkasse<br />
71
72<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Kostenanalyse<br />
Medizinprodukte sind in ihrer wirtschaftlichen<br />
Bewertung nicht den Wirkungsmechanismen<br />
des freien Marktes<br />
unterworfen. Sie sind teilweise erheblich<br />
in ihrer Durchsetzung eingeschränkt.<br />
„Die Marktfähigkeit medizintechnischer<br />
Produkte wird daher oft von anderen Gesichtspunkten<br />
mitbestimmt, als dies bei den<br />
übrigen industriellen Produkten der Fall ist.<br />
Insbesondere ist eine vorausplanende Marktanalyse<br />
viel schwieriger als auf anderen Sektoren,<br />
da bei wirklich neuartigen Produkten<br />
zunächst nicht vorausgesehen werden kann,<br />
ob und wann sie durch die Aufnahme in den<br />
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen<br />
abrechnungsfähig und daher oft erst<br />
im eigentlichen Sinn ‚marktfähig‘ gemacht<br />
werden.“ [6]<br />
Um nun eine Kostenanalyse der Heimmonitore<br />
vorzunehmen, erfolgt diese<br />
auf der Grundlage des VDAK-Hilfsmittelverzeichnis-Auszuges<br />
mit Stand zum<br />
Juni 2004. Darin waren 23 SIDS-Monitore<br />
unterschiedlicher Klassifikation<br />
und Hersteller aufgelistet, deren Kosten<br />
auf Rezept des behandelnden Arztes<br />
von den gesetzlichen Krankenkassen<br />
übernommen werden. Die einzelnen<br />
Geräte schlüsselten sich dabei wie folgt<br />
auf: fünf Atemfrequenz-Monitore, ein<br />
kombinierter Atem-und-Herzfrequenz-<br />
Monitor ohne integrierten Speicher, 13<br />
kombinierte Atem-und-Herzfrequenz-<br />
Monitore mit integriertem Speicher und<br />
vier kombinierte Atem-und-Herzfrequenz-Monitore<br />
mit integriertem Speicher<br />
und Pulsoxymetrie.<br />
Die Preisangaben enthalten bereits<br />
die gesetzlich erhobene Mehrwertsteuer<br />
in Höhe von 16 % und sind in der Regel<br />
exklusive Zubehör, wie Elektroden<br />
oder Sensoren. Bei einem Vergleich der<br />
abgebildeten Kosten für die einzelnen<br />
Monitore wird ersichtlich, dass mit zunehmendem<br />
technologischen Integrationsgrad<br />
ein sprunghafter Anstieg der<br />
Preise erfolgt.<br />
In der Kategorie der Atemfrequenz-<br />
Monitore basiert die Preisangabe von<br />
ca. 1 000 Euro auf einem Gerät und<br />
ist dazu nur bedingt aussagekräftig, da<br />
nach Anbieteraussagen praktisch keine<br />
Nachfrage mehr bei dieser Geräteart<br />
besteht. Für die Kategorie kombinierte<br />
Atem-und-Herzfrequenz-Monitore mit<br />
integriertem Speicher müssen durchschnittlich<br />
2 500 Euro bei einer Preisspanne<br />
von etwa 1 200 Euro veranschlagt<br />
werden. Die durchschnittlichen Kosten<br />
bei der leistungsfähigsten Kategorie, der<br />
kombinierten Atem-und-Herzfrequenz-<br />
Monitore mit integriertem Speicher und<br />
Pulsoxymetrie, betragen für einen Monitor<br />
etwa 4 500 Euro bei einer Preisspannweite<br />
von etwa 1 200 Euro. Die<br />
Durchschnittspreise steigen von der Leistungsstufe<br />
der Atemfrequenz-Monitore<br />
zu den kombinierten Atem-und-Herzfrequenz-Monitoren<br />
mit integriertem Speicher<br />
um ca. 1 500 Euro. Die Erweiterung<br />
der kombinierten Atem-und-Herzfrequenz-Monitore<br />
mit integriertem Speicher<br />
um das Element der Pulsoxymetrie<br />
zieht einen durchschnittlichen Preisanstieg<br />
von ca. 2000 Euro nach sich. Die<br />
Spannweite der Preise innerhalb einer<br />
Kategorie bleibt jedoch annähernd konstant.
Qualitätsbewertung<br />
Um den notwendigen Anforderungen<br />
an Zuverlässigkeit, Qualität und<br />
Sicherheit zu entsprechen, muss der Gerätehersteller<br />
eines Produktes die verschiedensten<br />
Standards, Normen und<br />
Gesetze beachten. Zu den Grundrichtlinien,<br />
die ein Gerät zu erfüllen hat, gehören<br />
die technischen Normen und die<br />
Konformitätskennzeichnung durch das<br />
CE-Zeichen 10 .<br />
Im vorliegenden Fall müssen die Produkte<br />
zusätzlich nach dem Medizinproduktegesetz<br />
(MPG – 93/42/EWG) geprüft<br />
werden. Das MPG definiert sich<br />
nach § 1: „den Verkehr mit Medizinprodukten<br />
zu regeln und dadurch für die Sicherheit,<br />
Eignung und Leistung der Medizinprodukte<br />
sowie die <strong>Gesundheit</strong> und den erforderlichen<br />
Schutz der Patienten, Anwender und Dritter<br />
zu sorgen“ [9]. Medizinprodukte sind<br />
nach §3 Abs.1 MPG definiert als „alle …<br />
Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe<br />
… oder andere Gegenstände einschließlich<br />
der für ein einwandfreies Funktionieren des<br />
Medizinproduktes eingesetzten Software, die<br />
vom Hersteller zur Anwendung für Menschen<br />
mittels ihrer Funktionen zum Zwecke<br />
a) der Erkennung, Verhütung, Überwachung,<br />
Behandlung oder Linderung von<br />
Krankheiten,<br />
b) der Erkennung, Überwachung, Behandlung,<br />
Linderung oder Kompensierung von<br />
Verletzungen oder Krankheiten, … zu dienen<br />
bestimmt sind …“ [9]<br />
Je nach Invasivität, Kontaktdauer, Energieeintrag<br />
werden Medizinprodukte<br />
vier Risikoklassen zugeordnet: I, <strong>II</strong>a, <strong>II</strong>b,<br />
<strong>II</strong>I. Die Klassifizierung ist für den Geräteentwickler<br />
wichtig, um die geeigneten<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
Konformitätsanforderungen zu erfüllen.<br />
„Die Konformitätsbewertungsverfahren für<br />
Produkte der Klasse I können generell unter<br />
der alleinigen Verantwortung des Herstellers<br />
erfolgen, da der Grad der Verletzbarkeit durch<br />
diese Produkte gering ist. Für die Produkte der<br />
Klasse <strong>II</strong>a ist die Beteiligung einer benannten<br />
Stelle 11 für das Herstellungsstadium verbindlich.<br />
Für die Produkte der Klassen <strong>II</strong>b und <strong>II</strong>I,<br />
die ein hohes Gefahrenpotential darstellen, ist<br />
eine Kontrolle durch eine benannte Stelle in<br />
bezug auf die Auslegung der Produkte sowie<br />
ihre Herstellung erforderlich.“ [9] In diesen<br />
Fällen ist nach § 17 Abs. 2 MPG außer der<br />
CE-Kennzeichnung auch die Kennnummer<br />
der benannten Stelle aufzuführen,<br />
die für die Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrensverantwortlich<br />
ist. Für die höchste Klasse, die Klasse<br />
<strong>II</strong>I, sind klinische Studien nachzuweisen.<br />
Es handelt sich hier um lebenserhaltende<br />
Geräte oder solche mit einer langen<br />
Kontaktdauer und hoher Invasivität. Im<br />
MPG Anhang X Absatz 1.1 [9] heißt es<br />
dazu: „Das Erbringen des Nachweises, dass<br />
… die genannten merkmal- und leistungsrelevanten<br />
Anforderungen von dem Produkt bei<br />
normalen Einsatzbedingungen erfüllt werden,<br />
10 Die CE-Kennzeichnung ist Voraussetzung dafür,<br />
dass ein Produkt innerhalb der EU verkauft<br />
werden darf. Es ist durch den Hersteller<br />
(EU-Importeur) anzubringen, nach dem dieser<br />
durch ein Konformitätsbewertungsverfahren<br />
die Übereinstimmung des Produktes mit<br />
den grundlegenden EU-Richtlinien und deren<br />
Einhaltung nachgewiesen hat. [9]<br />
11 Benannte Stelle ist die für die Durchführung<br />
von Prüfungen und Erteilung von Bescheinigungen<br />
im Zusammenhang mit Konformitätsbewertungsverfahren<br />
vorgesehene Stelle, die<br />
der EU-Kommission und den Vertragsstaaten<br />
von einem Vertragsstaat benannt worden ist.<br />
73
74<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
… müssen insbesondere bei implantierbaren<br />
Produkten und bei Produkten der Klasse <strong>II</strong>I<br />
durch klinische Daten belegt werden.“<br />
Monitore werden allgemein in die<br />
Klasse <strong>II</strong>a oder <strong>II</strong>b eingeordnet, da sie<br />
Elektroden zur Abnahme von Signalen<br />
verwenden. Meist sind Heimmonitore<br />
der Klasse <strong>II</strong>b zugeordnet, da sie Parameter<br />
überwachen, welche lebensnotwendig<br />
sind. Wegen dieser Zuordnung<br />
ist es nach dem MPG nicht notwendig,<br />
dass ein Monitor (nach MPG, Anhang<br />
IX Absatz 3.2 – Kasse <strong>II</strong>a oder <strong>II</strong>b [9]) im<br />
Zulassungsverfahren einen Nachweis für<br />
die Sicherheit der Biosignalverarbeitung<br />
im Vergleich zu standardisierten Untersuchungsprotokollen<br />
erfüllen muss.<br />
Wie bereits in Punkt 3 beschrieben,<br />
sind Heimmonitore im Sinne der Applikation<br />
Hilfsmittel. Beim Verfahren zum<br />
Eintrag eines neuen Produktes in das<br />
Hilfsmittelverzeichnis gilt § 139 Qualitätssicherung<br />
bei Hilfsmitteln SGB V:<br />
„(1) Die Spitzenverbände der Krankenkassen<br />
gemeinsam und einheitlich sollen zur<br />
Sicherung einer ausreichenden, zweckmäßigen,<br />
funktionsgerechten und wirtschaftlichen<br />
Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln<br />
für bestimmte Hilfsmittel Qualitätsstandards<br />
entwickeln. Die Qualitätsstandards sind im<br />
Hilfsmittelverzeichnis nach § 128 zu veröffentlichen.<br />
(2) Voraussetzung der Aufnahme neuer<br />
Hilfsmittel in das Hilfsmittelverzeichnis ist,<br />
dass der Hersteller die Funktionstauglichkeit<br />
und den therapeutischen Nutzen des<br />
Hilfsmittels sowie seine Qualität nachweist.<br />
Über die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis<br />
entscheiden die Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen gemeinsam und einheit-<br />
lich, nachdem der Medizinische Dienst die<br />
Voraussetzungen geprüft hat. Das Verfahren<br />
zur Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis<br />
regeln die Spitzenverbände der Krankenkassen.<br />
Dabei ist darauf hinzuwirken, dass die<br />
Unterlagen innerhalb von sechs Monaten<br />
nach Antragstellung vollständig vorliegen,<br />
und sicherzustellen, dass die Entscheidung<br />
spätestens sechs Monate nach Vorlage der<br />
vollständigen Unterlagen getroffen wird.<br />
Über die Entscheidung ist ein Bescheid zu<br />
erteilen.<br />
(3) Die Spitzenverbände der Krankenkassen<br />
gemeinsam und einheitlich geben<br />
produktgruppenbezogene Empfehlungen zur<br />
Fortbildung der Leistungserbringer von Hilfsmitteln<br />
und zur Qualitätssicherung der Leistungserbringung<br />
ab.“<br />
Damit ein neues Produkt im Hilfsmittelverzeichnis<br />
gelistet wird, sind somit<br />
entsprechend §139 SGB V folgende Prüfungsschritte<br />
notwendig 12 :<br />
1. Einreichung des Antrages [<strong>II</strong>I] vom<br />
Hersteller beim IKK-Bundesverband<br />
(Zuständigkeit).<br />
2. Die Arbeitsgruppe Hilfsmittel des Medizinischen<br />
Dienstes der Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen (MDS, www.mdsev.org)<br />
wird tätig und prüft den Antrag.<br />
3. Es werden Fachmeinungen eingeholt<br />
und die Bewertung vorgenommen.<br />
4. Die „vorläufige“ Entscheidung ergeht<br />
an den Hersteller.<br />
5. Die Entscheidung auf Anerkennung<br />
als Hilfsmittel.<br />
12 Auskunft Fachberater Hilfsmittel, Geschäftsbereich<br />
Markt, Abteilung Leistungen der AOK<br />
Sachsen
6. Es kommt zur Fortschreibung des<br />
Hilfsmittelverzeichnisses durch die<br />
Spitzenverbände der Krankenkassen.<br />
7. Die Anerkennung des neuen Hilfsmittels<br />
wird bekannt gemacht. Es erfolgt<br />
die Veröffentlichung im Bundesanzeiger<br />
13 sowie im Internet unter<br />
www.g-k-v.com 14 .<br />
Da die Aufnahme von Produkten in<br />
das Hilfsmittelverzeichnis Verwaltungsaktcharakter<br />
hat, sind die Antragsverfahren<br />
nach verwaltungsrechtlichen Vorschriften<br />
durchzuführen. Dabei gilt der<br />
Grundsatz, dass die Kriterien zur Bewertung<br />
von neuen Untersuchungs- und<br />
Behandlungsmethoden in der vertragsärztlichen<br />
Versorgung (nach den Richtlinien<br />
des Bundesausschusses der Ärzte<br />
und Krankenkassen gemäß § 135 Abs. 1<br />
i. V. m. § 92 Abs.1 Satz 2 Nr. 5 SGB V)<br />
auch für die Wirksamkeitsnachweise bei<br />
Hilfsmitteln maßgebend sind. [<strong>II</strong>]<br />
Voraussetzung für die Aufnahme von<br />
Produkten in das Hilfsmittelverzeichnis<br />
ist, dass der Hersteller die Funktionstauglichkeit<br />
und den therapeutischen Nutzen<br />
des Hilfsmittels sowie seine Qualität<br />
nachweist (§ 139 Abs. 2 SGB V).<br />
Die Spitzenverbände haben dem entsprechend<br />
Standards nach folgendem<br />
Schema formuliert:<br />
I. Therapeutischer/Pflegerischer Nutzen<br />
<strong>II</strong>. Funktionstauglichkeit<br />
<strong>II</strong>I. Qualität (Standards nach § 139 Abs.<br />
1 SGB V)<br />
<strong>II</strong>I.1 Allgemeine Anforderungen<br />
<strong>II</strong>I.2 Technische Anforderungen<br />
<strong>II</strong>I.3 Anforderungen an die Sicherheit<br />
<strong>II</strong>I.4 Anforderungen an die Biokompatibilität<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
<strong>II</strong>I.5 Anforderungen an den Lieferumfang<br />
Diese Standards werden jeweils für<br />
eine Produktuntergruppe festgelegt. Sie<br />
beschreiben die medizinischen und technischen<br />
Merkmale der Produkte, die<br />
eingehalten und nachgewiesen werden<br />
müssen, damit diese in das Hilfsmittel-<br />
oder Pflegehilfsmittelverzeichnis aufgenommen<br />
werden. [<strong>II</strong>]<br />
Der Antrag zur Aufnahme eines neuen<br />
Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis<br />
der Produktgruppe 21 (Messgeräte<br />
für Körperzustände) [<strong>II</strong>I] umfasst etwa<br />
50 Punkte/Fragen zum Gerät. Verschiedene<br />
Fragen betreffen konstruktive und<br />
funktionelle Merkmale. Tabelle 3 enthält<br />
die qualitätskennzeichnenden Angaben,<br />
die der Hersteller für jedes Produkt nachweisen<br />
muss. Nach Punkt 6 Qualitätsstandards<br />
des Antrags sind im Hilfsmittelverzeichnis<br />
die medizinischen und<br />
technischen Anforderungen zu jeder Untergruppe<br />
einzeln aufzuführen. Für die<br />
Untergruppe 21-24-02 Überwachungsgeräte<br />
für Säuglinge/SIDS-Monitor gelten die<br />
in Tabelle 4 genannten Anforderungen.<br />
Die Hersteller sind also gezwungen<br />
eine Vielzahl von Prüfungen an ihren<br />
Geräten durchzuführen und sie zur Anerkennung<br />
als Hilfsmittel nachzuweisen.<br />
Die reine Zulassung als Medizinprodukt<br />
reicht den Spitzenverbänden der Krankenkassen<br />
nicht aus. Es ist ein Nachweis<br />
13 Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH,<br />
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, www.<br />
bundesanzeiger.de<br />
14 GKV-Homepage: Gemeinschaftsprojekt aller<br />
Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen<br />
75
76<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
über Funktionstauglichkeit und den therapeutischen<br />
Nutzen, sowie die Qualität<br />
des Gerätes zu führen. (Der Nachweis<br />
des therapeutischen Nutzens ist für Dia-<br />
Tabelle 3: Qualitätsbeschreibende Punkte bzw. Forderungen im Antrag zur Aufnahme<br />
eines neuen Hilfsmittel in das Hilfsmittelverzeichnis [<strong>II</strong>I]<br />
6. Qualitätsstandards: Im Hilfsmittelverzeichnis sind die medizinischen und technischen Anforderun-<br />
gen der veröffentlichten Produktgruppe zu jeder Untergruppe einzeln aufgeführt.<br />
6.1 Nehmen Sie in der Reihenfolge der Auflistung zu den medizinischen und technischen Anforderun-<br />
gen der jeweiligen Produktuntergruppe einzeln Stellung, inwieweit Ihr Produkt diese Anforderun-<br />
gen erfüllt, einschließlich der entsprechenden Nachweise.<br />
6.2 Wenn Mindestwerte oder Maßangaben gefordert werden, bitten wir um Angabe der tatsächlichen<br />
Werte mit Angabe der Prüf-/Messmethoden.<br />
6.3 Weicht Ihr Produkt von den Qualitätsstandards ab? (Bitte genaue Definition wo und wie und war-<br />
um?)<br />
gnosegeräte, wie im Fall der Hilfsmittel-<br />
Untergruppe 21-24-02 Überwachungsgeräte<br />
für Säuglinge/SIDS-Monitor, nicht<br />
zu erbringen.)<br />
7. Spezielle Angaben zum Produkt<br />
7.1 Allgemein: Genaue Beschreibung des Messverfahrens, -prinzips, der Sensorik etc. beifügen Nachweise<br />
über die Messgenauigkeit mit Angabe der Prüfmethode etc. beifügen Angaben über Umgebungs-,<br />
und Betriebsbedingungen beifügen<br />
Genaue Beschreibung der Handhabung, Reinigung und Pflege des Gerätes<br />
Angaben zu sicherheitstechnischen bzw. messtechnischen Kontrollen<br />
Angaben zu Selbsttest, Fehlermeldungen, Alarme etc.<br />
7. 2 Angabe der mit der Schleimhaut oder Haut oder dem Körper in Kontakt kommenden Materialien<br />
und Zuordnung der Biokompatibilitätsnachweise<br />
8. Gutachten, Untersuchungs- und Testergebnisse zur technischen Qualität und Funktionstauglichkeit<br />
gemäß § 139 SGB V<br />
8.1 Nachweis über die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und Zulassungsvorschriften (z. B. in<br />
Form von Bauart- oder Musterprüfungen, sicherheitstechnische Prüfungen, wie GS-Zeichen und<br />
sonstige Prüfungen unabhängiger/zertifizierter Stellen)<br />
8.2 Welche Gesetze und Verordnungen wurden eingehalten (z. B. MPG, EMVG, GSG etc.)? (Nachweis<br />
durch Zertifikate) Welche Normen wurden hinzugezogen, oder warum wurden die vorhandenen<br />
Normen nicht hinzugezogen bzw. eingehalten?<br />
8.3 Falls eine Konformitätserklärung (CE-Kennzeichnung) durchgeführt wurde, Nachweis durch vollständige<br />
Unterlagen, wie Prüfbescheinigungen, Zertifikate und Prüfberichte mit Auflistung der<br />
geprüften Komponenten.<br />
9. Beschreibung der medizinischen/pflegerischen Anwendungsgebiete/Indikationen und Kontraindikationen
10. Nachweis der Wirkungsweise und des therapeutischen Nutzens gemäß § 139 SGB V<br />
Es sind in Form von Studien (in deutscher Sprache) nach folgenden Kategorien vorzulegen:<br />
10.1 Fallkontrollstudie(n) oder prospektive Studie(n)<br />
10.2 Zeitvergleichstudie(n)<br />
10.3 Nicht kontrollierte Studie(n)<br />
10.4 aktuelle, wissenschaftlich begründete Aussagen anerkannter und zuständiger Experten-/Fachgesellschaften<br />
zur Gebrauchstauglichkeit/therapeutischer Nutzen<br />
Einem Antrag sollten mindestens eine Studie nach 10.1–10.3 oder mindestens zwei Studien nach 10.4<br />
bzw. beigefügt werden.<br />
11. Beschreibung möglicher Risiken bei der Anwendung durch Risikoanalyse mit Nutzen-/Risikoabwägung.<br />
Vollständige Unterlagen für alle Unfall-, Sicherheitsrisiken und Nebenwirkungen beilegen!<br />
Tabelle 4: Anforderungen an das Produkt der Untergruppe 21-24-02 [IV]<br />
Medizinische Anforderungen Technische Anforderungen<br />
Die Geräte müssen zur häuslichen Überwachung<br />
geeignet sein.<br />
Eine für die Selbstmessung geeignete Bedienungsanleitung<br />
in deutscher Sprache mit verständlicher<br />
Erläuterung aller für die richtige Anwendung wesentlichen<br />
Vorbereitungs- und Bedienungsschritte<br />
sowie der Art der Alarmmeldungen muss mitgeliefert<br />
werden.<br />
Erkennung der Veränderungen des überwachten<br />
Organsystems (Atmung, Herzaktion), die zu einer<br />
Gefährdung des überwachten Säuglings führen<br />
können.<br />
Geeignete Empfindlichkeit (einstellbar);<br />
Geeignete Alarmgrenzen/Alarme (einstellbar);<br />
Umgebungs- und Betriebsbedingungen sowie Art<br />
und Häufigkeit der erforderlichen Nachprüfungen/Kalibrierungen<br />
müssen zur Gewährleistung<br />
der Messsicherheit vom Hersteller gegeben sein.<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
Einhaltung der geltenden Normen, Gesetze und<br />
Verordnungen;<br />
Nachweis der Einhaltung aller relevanten Sicherheitsbestimmungen<br />
und Vorschriften, z. B.<br />
GS-Zeichen (bei Netzgeräten) oder mindestens<br />
gleichwertiger anderer Nachweis durch unabhängiges<br />
Prüfinstitut;<br />
Akustischer Alarm in ausreichender Lautstärke;<br />
Wiederverwendbare Sensoren/Elektroden;<br />
Alarmfunktion für Gerätestörungen;<br />
Zusatzanforderungen an Geräte mit integrierter<br />
Speichereinheit und an zusätzliche Speichereinheiten:<br />
• Speicherung von Daten bleibt auch nach<br />
Stromausfall erhalten,<br />
• Speicherung von Daten von klinisch relevanten<br />
Parametern,<br />
• ohne Drucker/Schreiber oder sonstige Ausgabegeräte.<br />
77
78<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Für den Hersteller bedeutet jede Produktänderung<br />
gegenüber der ursprünglich<br />
angemeldeten und in das Hilfsmittelverzeichnis<br />
aufgenommenen Version<br />
eines Produktes, auch einen neuen Antrag<br />
beim IKK-Bundesverband zu stellen.<br />
Im Einzelfall wird dann entschieden,<br />
ob es zu einer Neulistung des Produktes<br />
kommt oder ob die vorhandenen<br />
Einträge angepasst werden müssen.<br />
Bei elektrotechnischen Produkten können<br />
technische Änderungen eine neue<br />
EMV 15 -Prüfung sowie die Aktualisierung<br />
der Aussagen bezüglich der elektrischen<br />
Sicherheit erforderlich machen. Designänderungen<br />
vom Produkt können<br />
auch dazu führen, dass eine zuvor zufriedenstellende<br />
Handhabbarkeit verloren<br />
geht. Weiterentwicklungen bereits gelisteter<br />
Produkte können aber auch zu<br />
einer Ausweitung des Indikationsspektrums<br />
führen, so dass hier ebenfalls eine<br />
Prüfung erforderlich ist mit dem Ziel, für<br />
ein spezielles Produkt einen erweiterten<br />
Indikationsrahmen zu definieren. [V]<br />
Ein Vergleichstest von Heimmonitoren<br />
mit der Polysomnografie im Schlaflabor<br />
ist gegenwärtig kein vorgeschriebenes<br />
Prüfverfahren der Hersteller und Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen für die<br />
Produktaufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis<br />
bzw. eine Zulassungsvoraussetzung<br />
für Monitore. In der wissenschaftlichen<br />
Fachliteratur wurden bisher erst<br />
drei Untersuchungen bekannt, in denen<br />
ein Heimmonitor simultan zu einer kontinuierlichen<br />
Polysomnografie überprüft<br />
wurde [1]. Die Ergebnisse haben gezeigt,<br />
dass die Erkennungsqualität, d. h. die Bewertung<br />
von Sensitivität und Spezifität,<br />
ungenügend war, weswegen der Einsatz<br />
dieser Monitore nicht zu einem falschen<br />
Sicherheitsgefühl verleiten darf.<br />
Grundsätzlich kann ein Monitor nur<br />
alarmieren, nicht verhindern. Damit<br />
ist die kompetente Schulung der Eltern<br />
im Umgang mit dem Gerät sowie für<br />
Erste-Hilfe-Maßnahmen im Notfall die<br />
wesentliche und wichtige Grundlage<br />
beim Heimmontoreinsatz. Daraus ist<br />
aber auch die generelle technische Anforderung<br />
an einen SID-Monitor abzuleiten:<br />
er muss den lebensbedrohlichen<br />
Zustand sicher in der Entstehungsphase<br />
erkennen, um für die Alarmierung und<br />
erfolgreiche Reanimierung ausreichend<br />
Zeit zur Verfügung zu haben. Diese Erkennungsfähigkeit<br />
der SID-Monitore<br />
muss damit aber auch mit einheitlichen,<br />
reproduzierbaren Prüfverfahren nachgewiesen<br />
werden.<br />
Nach neusten Veröffentlichungen [4,<br />
7, 13, 14] müssen der Wert und die Zuverlässigkeit<br />
häuslicher Überwachung<br />
mittels speziell entwickelter Heimmonitore<br />
medizinisch und technisch abgeklärt<br />
werden. Neben dem Stellenwert<br />
des Monitorings bei der SID-Prävention<br />
[8, 10, 11] zeigen Veröffentlichungen [7]<br />
aber auch, dass aus dem Wissensmangel<br />
bezüglich SID die korrekte Ermittlung<br />
von lebensbedrohlichen Zuständen des<br />
Säuglings so weit wie möglich spezifiziert<br />
werden muss. Dazu sollte der<br />
vorhandene Einsatz von kombinierten<br />
Atem-und-Herzfrequenz-Monitoren mit<br />
integriertem Speicher und Pulsoxymetrie<br />
speziell mit kontinuierlicher Aufzeichnung<br />
15 EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit
(kein Eventrecording 16 ) für eine zentrale<br />
Datensammlung bei zufällig erfassten<br />
und dokumentierten SID-Fällen für Forschungszwecke<br />
aufgebaut werden. Die<br />
über Jahre gesammelten Signalverläufe<br />
können dann, neben der medizinischen<br />
Bewertung auch für eine grundlegende<br />
Qualitätssicherung der Heimmonitore<br />
bei der weiteren Geräteentwicklung und<br />
-testung genutzt werden.<br />
Des Weiteren sind zum Qualitätsnachweis<br />
sowie zur Unterscheidung von<br />
„richtigen“ Alarmen und Fehlalarmen<br />
einheitliche Verifizierungen z. B. Gerätetestung<br />
mit Signalverläufen von lebensbedrohlichem<br />
Charakter und durch klinisch<br />
professionelle Testung im Rahmen<br />
der Polysomnografie unbedingt notwendig.<br />
16 Hier erfolgt eine Vorverarbeitung bzw. Ereignisauswahl,<br />
wodurch eventuell entscheidende<br />
Signalverläufe verloren gehen können!<br />
Rabenau, Andres, Naumann und Poll<br />
Heimmonitoring in der Pädiatrie<br />
Literatur<br />
Print-Quellen<br />
1 de Nardi S, Paditz E, Erler T, Grundtzke A: Zuverlässigkeit<br />
eines Heimmonitors mit Event-Recording<br />
im Vergleich zur kontinuierlichen Polysomnografie<br />
im Säuglingsalter. Wien Klin Wochenschr<br />
(2003) 115/12: 421–428.<br />
2 de Nardi S, Paditz E: Zuverlässigkeit eines<br />
Heimmonitors im Säuglingsalter. In: Paditz E<br />
(Hrsg.): Prävention des Plötzlicher Säuglingstod<br />
in Deutschland, 1. Bundesweite Expertentagung<br />
23.–24. Januar 2004, Hille, Dresden 2004, 81–84;<br />
www.babyschlaf.de, „Weiterbildung“, Textband<br />
Tagung 2004.<br />
3 Erler Th: Longitudinalstudie zur Erstellung<br />
polysomnografischer Referenzwerte für <strong>Kinder</strong> im<br />
ersten Lebensjahr unter besonderer Berücksichtigung<br />
von Grundlagen, Methodik und Anwendungsmöglichkeiten<br />
der Polysomnografie (PSG)<br />
im Säuglingsalter. Habilitationsschrift. Berlin<br />
2001.<br />
4 Erler T, Grunske A: Scheinbar lebensbedrohliche<br />
Ereignisse im Säuglingsalter – ALTE: apparent<br />
life-threatening events. <strong>Kinder</strong>heilkd (2003) 151/5:<br />
520–526.<br />
5 Hörnchen H et al.: Vorschläge zum Einsatz<br />
des Heimmonitors. Der <strong>Kinder</strong>arzt (1997) 28/3:<br />
292–293.<br />
6 Hutten H: Biomedizinische Technik 1991 – Betrachtungen<br />
zur Situation eines multidisziplinären<br />
Fachgebietes. Springer, Berlin – Heidelberg 1991.<br />
7 Jorch G, Fischer D, Beyer U: Prävention des<br />
plötzlichen Säuglingstodes. <strong>Kinder</strong>heilkd (2003)<br />
151/5: 514–519.<br />
8 Kiechl-Kohlendorfer U: Der Plötzliche Säuglingstod<br />
– Präventionsprogramme in Österreich.<br />
Wien Klin Wochenschr (2003) 115/24: 881–886.<br />
79
80<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
9 Kindler M, Menke W: Medizinproduktegesetz<br />
– MPG, Kommentierte Ausgabe mit Arbeitshilfen<br />
und Materialien. ecomed, Landsberg, 4., akt. u. erg.<br />
Aufl. 1998.<br />
10 4. Österreichisches SIDS-Konsensus-Gespräch<br />
anlässlich der Wiener SIDS-Präventionskampagne<br />
‚Sicheres Schlafen‘. Wien Klin Wochenschr (2000)<br />
112/5: 187–192.<br />
11 Paditz E: Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes<br />
in Deutschland. Wien Klin Wochenschr<br />
(2003) 115/24: 874–880.<br />
12 Poets C F: Der plötzliche Kindstod. In: Lentze,<br />
M.J.; Schub, J.; Spranger, J. (Hrsg.): Pädiatrie<br />
– Grundlagen und Praxis. Springer, Heidelberg<br />
2000, S. 153–159.<br />
13 Poets C F: Heimmonitoring bei Säuglingen mit<br />
erhöhtem Kindstodrisiko: Anregungen zu einem<br />
Überdenken der gegenwärtigen Praxis. Wien Klin<br />
Wochenschr (2000) 112/5: 198–203.<br />
14 Poets C F, Urschitz M S, von Bodman A: Pathophysiologische<br />
Erklärungsmodelle zum plötzlichen<br />
Säuglingstod. <strong>Kinder</strong>heilkd (2003) 151/5:<br />
504–509.<br />
Internet-Quellen<br />
I Homepage des Verbandes der Angestellten-Krankenkassen<br />
e. V. (VdAK) und des Arbeiter-Ersatzkassen-Verbandes<br />
e. V. (AEV): www.<br />
vdak-aev.de/; Hilfsmittelverzeichnis, Stand 30. September<br />
2004; download (23. November 2004):<br />
www.vdak-aev.de/hilfsmittelverzeichnis.htm.<br />
<strong>II</strong> Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelverzeichnis<br />
– Grundlagen zum Antragsverfahren. IKK-Information,<br />
IKK-Bundesverband, Referat Hilfsmittel/Medizinprodukte,<br />
Bergisch Gladbach, August<br />
2003; download (2. Dezember 2004): www.ikk.<br />
de/ikk/generator/ikk/service-und-beratung/download/35018.pdf.<br />
<strong>II</strong>I Medizinischer Dienst der Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen e. V. Essen: www.mds-ev.org;<br />
Fragebogen als Antrag zur Aufnahme eines neue<br />
Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis nach §<br />
128 SGB V; download (2. Dezember 2004): www.<br />
mds-ev.org/kv/himi/uebersicht.html – Fragebogen<br />
unter Punkt Produktgruppe 21 „Messgeräte für<br />
Körperzustände/-funktionen“.<br />
IV Medizinischer Dienst der Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen e. V. Essen: www.mds-ev.org;<br />
Qualitätsstandard für den Antrag zur Aufnahme eines<br />
neue Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis<br />
nach § 128 SGB V; download (2. Dezember 2004):<br />
www.mds-ev.org/kv/himi/uebersicht.html – Qualitätsstandard<br />
unter Punkt Produktgruppe 21 „Messgeräte<br />
für Körperzustände/-funktionen“.<br />
V Medizinischer Dienst der Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen e. V. Essen: Hinweise zum Antragsverfahren<br />
für Hersteller (2. Dezember 2004):<br />
www.mds-ev.org/kv/himi/link9.html.<br />
Autoren<br />
Dr.-Ing. Matthias Rabenau<br />
Cand.-Ing. Matthias Andres<br />
Cand. Wirtsch.-Ing. Katja Naumann<br />
Prof.Dr.med.habil.Dipl.-Ing. Rüdiger Poll<br />
Institut für Biomedizinische Technik<br />
Fakultät Elektrotechnik/Informationstechnik<br />
Technische Universität Dresden<br />
01062 Dresden<br />
Telefon (03 51) 46 33 48 05<br />
Telefax (03 51) 46 33 60 26<br />
rabenau@rcs.urz.tu-dresden.de
Impfungen und der Plötzliche Säuglingstod<br />
Vennemann Mechtild<br />
Universität Münster, Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin<br />
Fragestellung: Führen Impfungen zu einem<br />
erhöhten Risiko für den Plötzlichen<br />
Säuglingstod?<br />
Design: In der Hälfte des Bundesgebietes<br />
wurde über drei Jahre eine Fall-<br />
Kontroll Studie zum Plötzlichen Kindstod<br />
durchgeführt. Insgesamt wurden 333<br />
SIDS Fälle und 998 Kontrollen in die<br />
Studie eingeschlossen. Der Impfstatus<br />
wurde einmal bei den Eltern erfragt und<br />
zusätzlich bei dem behandelten Pädiater.<br />
Bei 97 % der Kontrollkinder und bei<br />
92 % der Fallkinder konnte der Impfstatus<br />
erhoben werden.<br />
Ergebnisse: Impfungen führten zu einer<br />
Verminderung des Risikos für den Plötzlichen<br />
Kindstod (Odds ratio: 0,41, 95 %<br />
Konfidenz Intervall 0,28–0,59). Nach<br />
Adjustierung für potentielle Confounder<br />
und verschiedene Faktoren v.a. der<br />
Schlafumgebung war das Risiko für den<br />
Plötzlichen Kindstod für geimpfte <strong>Kinder</strong><br />
immer noch niedriger als für nicht<br />
geimpfte <strong>Kinder</strong> (OR: 0,54, 95 % KI:<br />
0,30–0.99). 41 <strong>Kinder</strong> starben innerhalb<br />
von 14 Tagen nach Impfung, verglichen<br />
mit 183 Kontrollen, die 14 Tage vor Interview<br />
geimpft wurden (adj.: OR: 0,71,<br />
95 % KI: 0,4–1,3).<br />
Schlussfolgerung: Impfungen erhöhen<br />
nicht das Risiko für den plötzlichen Säuglingstod<br />
in Deutschland, sondern wirken<br />
protektiv. Auch in internationalen Studien,<br />
die in so unterschiedlichen Ländern<br />
Vennemann<br />
Impfungen und der Plötzliche Säuglingstod<br />
durchgeführt wurden wie Neuseeland,<br />
England, Norwegen, Schweden und Dänemark<br />
konnte Impfen nicht als Risikofaktor<br />
nachgewiesen wurden, sondern<br />
immer nur als risikomindernder Faktor.<br />
Autorin<br />
Dr. med. Mechtild Vennemann, MPH<br />
Institute für Epidemiologie und Sozialmedizin<br />
Universität Münster<br />
Domagkstraße 3, 48129 Münster<br />
Telefon (02 51) 83-5 56 48<br />
Telefax (02 51) 83-5 53 00<br />
vennemam@uni-muenster.de<br />
81
Molz<br />
SID-Häufung bei bestimmten Wetterlagen?<br />
SID-Häufung bei bestimmten Wetterlagen?<br />
Molz G 1 , Defila C 2 , Amberg R 3 , Friedrich-Koch A 1<br />
1 Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich<br />
2 Schweizerische Meteorologische Anstalt Zürich<br />
3 Institut für Rechtsmedizin Freiburg/Br.<br />
Einleitung<br />
Tödliche Ereignisse, die sich im klinischen<br />
Erscheinungsbild gleichen und<br />
zeitlich häufen, werden im englischen<br />
Sprachgebrauch „Clustering in time<br />
and space“ genannt. Clustering erfasst<br />
Doppel- und Mehrfachereignisse mit<br />
gleichem Sterbedatum. Ereignisse mit<br />
einem zeitlichen Abstand „space“ von einem<br />
oder zwei Tagen gelten als in „clusters<br />
involved“. Diesen Begriff haben wir<br />
unter der Bezeichnung „vernetzt“ übernommen.<br />
Beim UST (unerwarteter Säuglingstod)<br />
ist dieses Phänomen vor mehr als<br />
30 Jahren erstmals beschrieben worden.<br />
Kanadische, amerikanische und englische<br />
Epidemiologen waren beeindruckt<br />
von der Tatsache, dass sich an einigen<br />
Tagen gleichzeitig zwei oder drei Todesfälle<br />
ereignet haben oder dass diese mit<br />
einem Intervall von ein bis zwei Tagen<br />
aufeinander gefolgt sind. Kraus hat 1967<br />
in Toronto unter 86 Todesfällen vier Tage<br />
mit je einem Doppelereignis und zweimal<br />
Vernetzung durch einen zweiten<br />
Todesfall am folgenden Tag beobachtet.<br />
Bergmann berichtete 1967 aus Seattle<br />
über eine „marked epidemicity“ unter<br />
28 Todesfällen: zwischen März und Oktober<br />
gab es ein Doppelereignis (31.<br />
März), ein Dreifachereignis (23. Septem-<br />
ber), am 16., 17. und 18. Oktober je ein<br />
Einzelereignis und am 20. Oktober das<br />
vierte Ereignis. 1971 hat Kraus in Süd-<br />
ostontario unter 106 Todesfällen zwei<br />
Tage mit Dreifachereignissen, sieben<br />
Tage mit Doppelereignissen und insgesamt<br />
27 „vernetzte“ <strong>Kinder</strong> registriert.<br />
Die Frage, ob Cluster oder Vernetzung<br />
zufällig oder unter dem Einfluss klimatischer<br />
Verhältnisse entstehen, wird seit<br />
langem diskutiert. Die Human-Biometeorologie<br />
versucht, Einblicke in das atmosphärische<br />
Geschehen zu gewinnen,<br />
indem sie einige meteorologische Elemente<br />
wie Luftdruck, Lufttemperatur,<br />
relative Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit<br />
prüft. Seit einiger Zeit<br />
arbeitet die Biometeorologie mit der Methode<br />
der Wetterlagen nach Brezowski.<br />
Hierbei werden nicht mehr einzelne Parameter<br />
des Wetters geprüft, sondern der<br />
Wettercharakter beurteilt. Der klassische<br />
Ablauf von einem Hochdruckgebiet über<br />
Warmluftfront, Warmluftsektor bis zum<br />
Tiefdruckgebiet wird in verschiedene<br />
Klassen unterteilt. Die Wetterklassifikation<br />
nach Brezowski wurde 1977 nach<br />
Altherr für die Schweizer Verhältnisse<br />
modifiziert und auf zehn Wetterklassen<br />
festgelegt. Einige Wetterklassen gelten<br />
als biologisch ungünstig, da sie auf Lebensvorgänge<br />
negativ einwirken. Hierzu<br />
gehören die Klasse 3 (Zufuhr von warmer<br />
83
84<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
subtropischer Luft in der Höhe) und die<br />
Klasse 4 (Warmsektor mit hochreichender<br />
subtropischer Warmluft vom Boden<br />
bis zur Tropopause). Kennzeichen der<br />
Klasse fünf ist der Kaltluftdurchgang<br />
(Bodenfront).<br />
Anlass, der Frage einer SID-Häufung<br />
bei bestimmten Wetterlagen nachzugehen,<br />
war ein Dreifachereignis, das am<br />
11. Januar 1991 im Raum Zürich zu beobachten<br />
war: in einem westlichen Vorort<br />
von Zürich wurde ein fünf Monate altes<br />
Mädchen um 5:00 Uhr in seinem Bett<br />
tot aufgefunden. In der Stadt Zürich<br />
wurde kurz nach acht Uhr ein 33 Tage<br />
altes Mädchen leblos tot gefunden. Kurz<br />
zuvor hatte der Vater – ein <strong>Kinder</strong>arzt<br />
– Nachschau gehalten und nichts Auffälliges<br />
bemerkt. Das dritte Kind, ein fünf<br />
Wochen alter Knabe, wurde um 22:30<br />
Uhr in einem östlich von Zürich – etwa<br />
sechs Kilometer entfernten – kleinen Ort<br />
leblos aufgefunden. Beim Niederlegen<br />
um 22:00 Uhr war der Kleine unauffällig<br />
gewesen. Die vom Vater – einem Kieferchirurgen<br />
– sofort versuchte Reanimation<br />
blieb erfolglos.<br />
Das Dreifachereignis hielten wir zunächst<br />
für einen tragischen Zufall. Wir<br />
überprüften jedoch das Kollektiv der<br />
vorangegangenen UST-<strong>Kinder</strong> bis<br />
zum Jahr 1984. Dabei entdeckten wir<br />
vier Doppelereignisse: 13. März 1988,<br />
4. Juli 1987, 7. Dezember 1986 und<br />
16. Januar 1985. Wir haben eine retrospektive<br />
Untersuchung durchgeführt<br />
über die 1984 als UST gemeldeten plötzlich<br />
verstorbenen Säuglinge.<br />
Die <strong>Kinder</strong>, aus dem Raum Zürich,<br />
Winterthur, Thurgau, St. Gallen, Aarau<br />
und Bern stammend, waren in den Instituten<br />
für Rechtsmedizin Zürich, St.<br />
Gallen und Bern untersucht worden und<br />
in den zuständigen Pathologischen Instituten<br />
– in Winterthur, Münsterlingen<br />
bzw. Aarau untersucht worden. Das Institut<br />
für Rechtsmedizin der Universität<br />
Freiburg stellte uns 167 Untersuchungen<br />
zur Verfügung. Unter ihnen überraschte<br />
ein viereinhalb Monate alter Knabe<br />
mit seinem Sterbetag – 11. Januar 1991.<br />
Damit wurde das Dreifachereignis zum<br />
Vierfachereignis.<br />
Methodik<br />
Unser Beobachtungsgut umfasst 728<br />
UST-<strong>Kinder</strong> aus den Jahren 1984 bis 1995<br />
aus den Regionen Aarau, Winterthur, St.<br />
Gallen, Bern und Zürich. An klinischen<br />
Daten registrierten wir: Geschlecht, erreichtes<br />
Lebensalter, Sterbetag im Wochengang,<br />
Sterbemonat im Jahresgang<br />
(Saison) und eine möglichst genaue Sterbezeit.<br />
Bei „vernetzten“ <strong>Kinder</strong>n unterschieden<br />
wir nach den Intervallen bis<br />
zu –24, –48 und –72 Stunden vor dem<br />
Todesereignis.<br />
Wetterlagen: Die zur Untersuchung<br />
notwendigen Daten stellte uns die aerologische<br />
Station MeteoSchweiz zur Verfügung.<br />
Dort werden zweimal täglich (um<br />
0:00 Uhr und 12:00 Uhr Weltzeit) die<br />
Wetterlagen nach Brezowski bestimmt.<br />
C. Defila ordnete den Ereignissen die<br />
Wetterlagen zum Zeitpunkt des Todes<br />
(+/– 0 h) sowie –12, –24 und –36 Stunden<br />
vorher zu.<br />
Ergebnisse<br />
Von den 728 <strong>Kinder</strong>n sind 132 (18 %)<br />
durch Cluster verbunden. Clusterbildung<br />
hat es an 61 Tagen gegeben:
• an 52 Tagen starben zwei <strong>Kinder</strong><br />
• an acht Tagen starben drei <strong>Kinder</strong><br />
• an einem Tag verstarben vier <strong>Kinder</strong>.<br />
Von den Doppelereignissen ereigneten<br />
sich zehn am gleichen Ort, von den<br />
Dreifachereignissen zwei am gleichen<br />
Ort. Eine gleiche Sterbezeit gab es bei<br />
zwei <strong>Kinder</strong>n (jeweils 0:05 Uhr). Der<br />
kürzeste Zeitunterschied lag ansonsten<br />
bei 30 Minuten, der längste bei 18 Stunden<br />
innerhalb verbundener Ereignisse.<br />
Das Lebensalter der Clusterpartner differierte<br />
um einen Tag (78 und 79 Tage<br />
junge Knaben) bis zu 273 Tagen (ein 88<br />
Tage junger Bub vs. ein 311 Tage altes<br />
Mädchen).<br />
Biotope (d. h. ungünstige) Wetterlagen<br />
zeigten folgende Verteilungen im<br />
Hinblick auf die plötzlichen Säuglingstodesfälle<br />
am Ereignistag (= zum Todeszeitpunkt<br />
0):<br />
Wetterklasse 4: 18 % aller Ereignisse<br />
Wetterklasse 3: 15 % aller Ereignisse<br />
Wetterklasse 5: 20 % aller Ereignisse.<br />
Zwölf Stunden vor dem Todesereignis<br />
wurden 25 % der verstorbenen <strong>Kinder</strong><br />
mit der Wetterklasse 4 und 10 % mit der<br />
Wetterklasse 3 konfrontiert.<br />
Vernetzt traten 417 (57 %) der Ereignisse<br />
auf, mit einem Abstand von<br />
–24 Stunden 129 Fälle (32 %), von –48<br />
Stunden 160 Fälle (38 %) sowie mit einem<br />
Abstand von –72 Stunden 128 Fälle<br />
(31 %). In diesen Gruppen fanden sich<br />
44 Clusterpartner. Von den biotopen<br />
Wetterklassen war Gruppe 4 am Ereignistag<br />
in 20 % vertreten, im Zeitfenster<br />
–12 Stunden vorher in 25 % der Ereignisse,<br />
24 Stunden vorher in 23 % und<br />
Molz<br />
SID-Häufung bei bestimmten Wetterlagen?<br />
36 Stunden vorher in 20 % der Ereignisse.<br />
Es zeigt sich damit der Wert der<br />
differenzierten Beurteilung im Zeitfenster<br />
(12–36 Stunden vor dem Ereignis).<br />
Die Beobachtungen von Defila über signifikante<br />
Ereignishäufungen auch bei<br />
Herzerkrankungen in der Wetterklasse<br />
4 werden durch diese Beobachtungen<br />
unterstützt.<br />
Bezogen auf die einzelnen Wetterklassen<br />
zeigten sich bei kumulativer Betrachtung<br />
folgende Ereignis-Häufigkeiten<br />
(Cluster, n = 132 mit gleichen Sterbedaten):<br />
zum Ereignis<br />
(= Zeitpunkt<br />
0)<br />
vor Ereignis<br />
(–12 bis –36<br />
Stunden)<br />
Wetterklasse 1 17 % 19 %<br />
Wetterklasse 3 11 % 60 %<br />
Wetterklasse 4 16 % 94 % !!<br />
Wetterklasse 5 9 % 89 %<br />
Wetterklasse 5f 20 % 65 %.<br />
Die anfangs gestellte Frage nach SID-<br />
Häufung bei bestimmten Wetterlagen<br />
kann damit bejaht werden. Es sind die<br />
Zahlen, die sprechen. Was wir jedoch<br />
nicht wissen, ist, wodurch diese Häufung<br />
hervorgerufen wird.<br />
Goethes Betrachtung über hohen<br />
und tiefen Barometerstand kann vielleicht<br />
etwas trösten:<br />
„Hohes Barometer: Trockenheit – Ostwind.<br />
Tiefes Barometer: Nässe – Westwind.<br />
Weht aber einmal bei hohem Barometer<br />
und Ostwind ein nasser Nebel her, oder<br />
haben wir blauen Himmel bei Westwind,<br />
so kümmert uns dieses nicht, sondern ich<br />
85
86<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
sehe daraus bloß, dass auch manches Mitwirkende<br />
existiert, dem man nicht gleich<br />
beikommen kann.“ (11. April 1827)<br />
Literatur<br />
1 Defila C: Todesfälle und Wetterlagen in Schaffhauusen.<br />
Arbeitsberichte Nr. 193. Schweizerische<br />
Meteorologische Anstalt, März 1998<br />
3 Thuler A: Tod im ersten Lebensjahr. Clusterbildung<br />
bei Sterbefällen durch unerwarteten<br />
Säuglingstod (UST) oder durch klinischen Tod: zur<br />
Frage meteorologischer Einflüsse. Diss. Med. Fak.<br />
Zürich 1999 (Betreuerin: Prof. Dr. med. G. Molz)<br />
Autorin<br />
Prof. Dr. med. Gisela Molz<br />
Institut für Rechtsmedizin<br />
Universität Zürich
Der Plötzliche Säuglingstod ist eine<br />
Todesart, bei der es während des Schlafes<br />
bzw. der Schlafenszeit zum irreversiblen<br />
Versagen der zentralen autonomen (unwillkürlichen)<br />
Kontrolle aller lebenswichtigen<br />
Funktionen (Vitalfunktionen), einschließlich<br />
der für die Eigenwiederbelebung<br />
(self-resuscitation) unabdingbaren protektiven<br />
Reflexaktivitäten kommt.<br />
Von vielen wissenschaftlichen Studien<br />
zur Epidemiologie und Pathophysiologie<br />
des SID(S) ist bekannt, dass ein Teil der<br />
<strong>Kinder</strong>, die an einem SID(S) starben,<br />
mehr oder weniger lange Zeit vor dem<br />
fatalen Ereignis schon diskrete Symptome<br />
aufwiesen, die auf eine oder mehrere<br />
gestörte Funktionen des Autonomen<br />
Nervensystems (ANS) hindeuten: stark<br />
vermehrtes Schwitzen, auffällige nasale<br />
Sekretion („Schnupfen“ ohne Infektion<br />
oder Allergie), verändertes Schreien,<br />
mehr Schlafbedürfnis, vermehrte obstruktive<br />
Apnoen u. a.).<br />
Sowohl die o. g. Vitalfunktionen als auch<br />
die zum Überleben buchstäblich notwendigen<br />
autonomen Schutzreflexe können durch<br />
alle der bisher bekannten Risikofaktoren,<br />
speziell dann, wenn mehrere zusammenkommen,<br />
massiv beeinträchtigt werden.<br />
Das Rauchen während der Schwangerschaft<br />
kann (wie andere Toxine) dauerhaft<br />
und irreversibel bereits lange vor<br />
der Geburt schon die fötale Entwicklung<br />
stören, vor allem auch die Reifungsvor-<br />
Bentele<br />
Autonomes Nervensystem und Plötzlicher Säuglingstod<br />
Autonomes Nervensystem und Plötzlicher<br />
Säuglingstod<br />
Bentele KHP<br />
Klinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin, Pädiatrische Neurologie, Universitäts-Klinikum Eppendorf (UKE),<br />
Hamburg<br />
gänge und Funktionen des autonomen<br />
Nervensystems.<br />
Zu den Vitalfunktionen gehören Einschlafen,<br />
Schlafen in verschiedenen<br />
Schlaf-Stadien (aktiver und ruhiger Schlaf<br />
mit seinen Stufen, Wach(er)werden,<br />
Aufrechterhalten und Feinregulation<br />
der Körpertemperatur und somit auch<br />
des Schwitzens, Atmen und Herz-Kreislauffunktionen<br />
sowie die Kontrolle der<br />
Muskelaktivität und dabei insbesondere<br />
Aktivierung und Koordination von<br />
Zwerchfell, Thoraxmuskeln und Muskulatur<br />
der oberen Atemwege. Zu den<br />
protektiven Reflexen zählen wir das Seufzen<br />
(sighing) mit der darauf folgenden<br />
physiologischen Apnoe, das Husten, das<br />
Gähnen, das Einsetzen der Schnappatmung<br />
(gasping) und das unmittelbare<br />
Wach(er)werden bei drohender akuter<br />
Asphyxie im Schlaf.<br />
Alle Vitalfunktionen und protektiven Reflexe<br />
unterliegen der autonomen (unwillkürlichen)<br />
neuralen Steuerung und immerwährenden<br />
Kontrolle, deren funktionstragende<br />
anatomische Strukturen vorwiegend in der<br />
Medulla oblongata des Hirnstammes lokalisiert<br />
sind. Sie stehen mit vielen anderen<br />
Schaltstellen des zentralen Nervensystems<br />
(ZNS) in enger funktioneller Verbindung.<br />
Das ZNS besteht aus dem Gehirn,<br />
den Augen mit Sehbahn, und dem Rückenmark.<br />
Zum Peripheren Nerven-<br />
87
88<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
system (PNS) gehören die perípheren<br />
Nerven(bahnen) mit ihren efferenten<br />
(motorischen) und afferenten (sensiblen)<br />
und im Bereich der Hirnnerven auch<br />
sensorischen Anteilen. Unter dem Autonomen<br />
Nervensystem (ANS) verstehen<br />
wir die unwillkürlich arbeitenden (also<br />
nicht dem Willen unterliegenden) Anteile<br />
des Nervensystems, also primär<br />
das sympathische und das parasympathische<br />
(vagale) Nervensystem, allgemein<br />
„Sympathikus“ und „Parasympathikus“<br />
genannt. Auch im autonomen<br />
Nervensystem gibt es unendlich viele<br />
und komplexe Verbindungen, die zur<br />
Übertragung von Impulsen und fein<br />
abgestimmten Informationen spezieller<br />
biochemischer Botenstoffe (Neurotransmitter)<br />
bedürfen.<br />
Je nachdem, welchen Botenstoff, bzw.<br />
Neurotransmitter (Acetyl-Cholin, Adrenalin,<br />
Noradrenalin, Dopamin, GABA,<br />
Serotonin etc.), mit dem ein Teilsystem<br />
des ZNS, PNS oder ANS „arbeitet“,<br />
wird dieses als cholinerg, adrenerg, noradrenerg,<br />
GABA-erg oder serotoninerg<br />
usw. bezeichnet. Der sympathische Teil<br />
des ANS arbeitet vorwiegend (aber nicht<br />
nur) mit Adrenalin, Noradrenalin und<br />
Dopamin und somit adrenerg, noradrenerg<br />
oder dopaminerg. Die parasympathischen<br />
Anteile des ANS hingegen<br />
benutzen als Neurotransmitter neben<br />
anderen das Serotonin (5-Hydroxy-Tryptamin,<br />
bzw. 5-HAT).<br />
Alle diese Neurotransmitter werden in<br />
den vor jeder neuronalen Übertragungsstelle<br />
(Synapse) liegenden Nervenendigungen<br />
je nach Bedarf (d. h. Art, Dauer<br />
und Intenstät von zu übertragenden Informationen)<br />
produziert, gespeichert,<br />
und in den synaptischen Spalt hinein<br />
ausgeschieden, um an den spezifischen<br />
Rezeptoren der weiterführenden Nervenbahn<br />
wirken zu können. Nach Minderung<br />
oder Vollendung der Impulsübertragung<br />
wird die Restmenge des<br />
Neurotransmitters wieder aktiv in die<br />
Speicher der herstellenden Nervenendigungen<br />
aufgenommen (reuptake).<br />
Die anatomischen Strukturen des Autonomen<br />
Nervensystems mit ihren unendlich<br />
vielen Synapsen, ihren Neurotransmittern<br />
und deren sehr komplexem<br />
Stoffwechsel unterliegen schon während<br />
der frühen pränatalen Entwicklung und<br />
nach der Geburt bis über das Pubertätsalter<br />
hinaus einer fortgesetzten Entwicklung<br />
(development) mit ausgeprägten<br />
altersgebundenen Veränderungen im<br />
Sinne einer Ausreifung der Funktionsfähigkeit<br />
(maturation).<br />
Diese anatomische und funktionelle<br />
Entwicklung des autonomen Nervensystems<br />
(ANS) vollzieht sich in Stufen.<br />
Grundlage und Grundvoraussetzung eines<br />
jeden biologischen Entwicklungs- und Reifungsprozesses<br />
ist die genetische Anlage, bzw.<br />
Veranlagung (salopp: „Grundausstattung“).<br />
Die weitere Entwicklung wird zusätzlich<br />
durch epigenetische Mechanismen gesteuert,<br />
die ebenfalls höchst komplexer<br />
Natur sind.<br />
Alle prä- und postnatalen Entwicklungs-<br />
und Reifungsvorgänge zeichnen sich naturgemäß<br />
durch eine große zeitliche und funktionelle<br />
Variation aus. Diese natürliche<br />
„Streubreite“ ist keinesfalls primär als<br />
abnorm oder gar pathologisch zu betrachten.<br />
Sie ist in allen Lebensabschnitten<br />
als ganz normale Naturerscheinung<br />
bekannt. So kommt ein Teil der Heranwachsenden<br />
„schon“ im Alter von<br />
zehn Jahren in der Pubertät, ein anderer
Teil „erst“ mit 14 Jahren. Oder: manche<br />
Kleinkinder brauchen „schon“ mit 2 _<br />
Jahren keine pampers mehr, andere hingegen<br />
„erst“ im Alter von 5 Jahren.<br />
Der entscheidende Unterschied zwischen<br />
diesen beiden Lebensabschnitten<br />
und dem in vieler Hinsicht kritischen<br />
Säuglingsalter, in dem die volle Funktionstüchtigkeit<br />
des zentralen und vor allem<br />
nicht des Autonomen Nervensystems noch<br />
nicht erreicht ist, liegt darin, dass eine verzögerte<br />
oder gestörte Entwicklung und<br />
Ausreifung der autonomen zentralen<br />
Kontrolle von lebenswichtigen Körperfunktionen<br />
unter dem Einfluss nachteiliger<br />
äußerer Lebensbedingungen (Risikofaktoren<br />
Bauchlage, Rauchbelastung,<br />
Überwärmung, andere) zu akuten lebensbedrohenden<br />
Ereignissen (ALE),<br />
bzw. der Katastrophe des Plötzlichen<br />
Säuglingstodes führen kann.<br />
Nachdem schon während der 70er Jahre<br />
des letzten Jahrhunderts Forschungsergebnisse<br />
zur Physiologie und Pathophysiologie<br />
der altersabhängigen autonomen<br />
Kontrollfunktionen vorgelegt und wissenschaftlich<br />
bestätigt wurden, ist es in<br />
den letzen Jahren und ganz speziell im<br />
Jahre 2004 gelungen, auch die genetische<br />
Basis (Genotyp) für die funktionelle Entwicklung<br />
des Autonomen Nervensystems<br />
(ANS) weiter aufzudecken.<br />
Wegweisend waren nicht nur die<br />
Untersuchungen von Narita et al., (Pediatrics<br />
2001) über die genetische Heterogenität<br />
hinsichtlich der Entwicklung<br />
der Serotonin-Rezeptoren (5-HT1A<br />
und 5-HT2A), sondern vor allem die<br />
Arbeiten von Weese-Mayer et al., (Ped<br />
Res 2004) über die Veränderungen in<br />
den Genen (MASH1, BMP2, PHOX2a,<br />
Bentele<br />
Autonomes Nervensystem und Plötzlicher Säuglingstod<br />
PHOX2b, RET, ECE1, EDN1, TLX3 und<br />
EL1), deren Expression Voraussetzung<br />
für die embryonale Entwicklung des<br />
Autonomen Nervensystems (ANS) ist.<br />
Schon seit Jahren wurde vermutet,<br />
dass es zwischen dem Syndrom der<br />
congenitalen centralen Hypoventilation<br />
(CCHS, auch Undine Syndrom<br />
genannt) und dem SID(S) nicht nur<br />
pathophysiologische (bei beiden sehr<br />
starke Einengung der Variabilität der<br />
Herzfrequenz), sondern auch genetische<br />
Zusammenhänge gibt. Nun ist<br />
belegt, dass es für das CCHS und für das<br />
SIDS eine unterschiedliche genetische Disposition<br />
(Kijima et al., Tohoku J Exp Med,<br />
2004) gibt, die die differente Entwicklung<br />
der 5-HT1A und 5HT2A Rezeptoren<br />
im Hirnstamm erklärt (Ozawa und<br />
Okado, Neuropediatrics 2002).<br />
Trotz dieser so spannenden Ergebnisse<br />
sind die Beziehungen zwischen Genotypen<br />
und Phänotypen nur ansatzweise aufgeklärt<br />
und lassen viele Fragen offen (editorial<br />
von C. E. Hunt, Ped Res 56; 2004). Bei<br />
zahlreichen klinisch gut bekannten neuropädiatrischen<br />
Krankheitsbildern, z. B.<br />
der familiären Dysautonomie (Riley-<br />
Day Syndrom) oder bei den klinisch sehr<br />
unterschiedlichen Formen der Hereditären<br />
Senso-Motorischen Neuropathie<br />
(HSMN), inzwischen als Charcot-Marie-<br />
Tooth (CMT) Erkrankungen bezeichnet,<br />
gibt es nach wie vor eine große genetische<br />
Heterogenität und immer wieder neue<br />
Berichte über neue Mutationen (Ohto et<br />
al., Neuropediatrics 2004).<br />
Eine Früherkennung SID(S)-gefährdeter<br />
<strong>Kinder</strong> im Einzelfall ist daher auch<br />
mittels einer molekularbiologischen<br />
89
90<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Analyse der genetischen Disposition<br />
weiterhin nicht möglich,<br />
wenngleich damit mit mehr oder weniger<br />
großer statistischer Signifikanz<br />
Gruppen aus dem großen klinischen<br />
Spektrum anscheinend verwandter „Erkrankungen“<br />
(von scheinbar gesunden<br />
<strong>Kinder</strong>n, über <strong>Kinder</strong> mit „idiopathischem“<br />
oder cryptogenem ALTE und<br />
<strong>Kinder</strong> mit Undine-Syndrom (CCHS)<br />
bis hin zu <strong>Kinder</strong>n, die später plötzlich,<br />
unerwartet und nicht hinreichend erklärbar<br />
(also an einem SID(S)) sterben,<br />
unterschieden werden können.<br />
Auch das elektrophysiologische Monitoring<br />
der Herzfrequenzvariabilität hat keine<br />
prädiktive Bedeutung für die Risikovorhersage<br />
(für SID) im Einzelfall. Nicht nur bei<br />
späteren SID-Fällen und dem Undine<br />
Syndrom (CCHS) wurde diese Variabilität<br />
der Herzfrequenz als eingeengt<br />
beschrieben, sondern auch bei <strong>Kinder</strong>n<br />
mit Enuresis nocturna, Fehlbildungen<br />
und Traumata in der hinteren<br />
Schädelgrube. Auch weitere, schon lange<br />
bekannte Tests (Prüfung des okulokardialen<br />
Reflexes) einschließlich neuerer<br />
Verfahren (Messungen der Körpertemperatur<br />
und Schweißproduktion im<br />
Schlaf, Analysen der Stimmfrequenzen,<br />
Belastungstests für Ventilation<br />
und/oder Aufwachvermögen mit kontrollierter<br />
Hypoxie und Hyperkapnie)<br />
ermöglichen nicht die Eingrenzung von<br />
Hochrisikogruppen oder gar Aussagen zur<br />
Gefährdung im Einzelfall.<br />
Entscheidend für eine weitere Verminderung<br />
der Inzidenz des SID(S) ist somit<br />
auch in der näheren Zukunft noch die konsequente<br />
Vermeidung bekannter prä-, peri-<br />
und postnataler Risikofaktoren.<br />
Autor<br />
Prof. Dr. med. Karl H. P. Bentele<br />
Klinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin,<br />
Pädiatrische Neurologie<br />
Universitäts-Klinikum Eppendorf (UKE)<br />
Hamburg
Fitze<br />
Gibt es einen genetischen Hintergrund für den Plötzlichen Kindstod?<br />
Gibt es einen genetischen Hintergrund für den<br />
Plötzlichen Kindstod?<br />
Fitze G<br />
Klinik und Poliklinik für <strong>Kinder</strong>chirurgie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus,<br />
Technische Universität Dresden<br />
Da der Plötzliche Kindstod (SID) im<br />
medizinischen Sinn nicht zu behandeln<br />
ist, können wir diesem fatalen Ereignis<br />
nur über eine effektive Prävention habhaft<br />
werden. Denken wir jedoch an Prävention,<br />
so werden automatisch die Fragen<br />
nach den Ursachen gestellt. In den<br />
vergangenen Jahren wurden in vielen<br />
Studien Umgebungsfaktoren definiert,<br />
die mit dem Plötzlichen Kindstod signifikant<br />
in Verbindung stehen. Daraus<br />
sind Kataloge präventiver Maßnahmen<br />
abgeleitet worden, die mittlerweile ihre<br />
Effektivität unter Beweis gestellt haben.<br />
Diese Umgebungsfaktoren stehen aber<br />
in enger Wechselwirkung mit einer oder<br />
führen nur auf der Grundlage einer konstitutionellen<br />
Prädisposition zum Ereignis<br />
des Plötzlichen Kindstod. Ziehen<br />
wir jedoch die Konstitution in Betracht,<br />
so ist es nur noch ein kleiner Schritt zur<br />
genetischen Prädisposition. Tatsächlich<br />
gibt es Berichte über plötzlich und relativ<br />
zeitgleich verstorbene Zwillingspaare<br />
(Smialak 1986). Kelly beschrieb 1982<br />
eine höhere Frequenz von Apnoephasen<br />
bei neugeborenen Geschwisterkindern<br />
von SID-<strong>Kinder</strong>n im Vergleich zu einer<br />
unauffälligen Kontrollpopulation. Zehn<br />
Jahre später fand Weese-Mayer eine hohe<br />
Inzidenz von SID-Fällen in Familien, in<br />
denen ein Patient mit einem Kongenitalen<br />
Zentralen Hypoventilationssyndrom<br />
(CCHS; bekannt als Undine-Syndrom)<br />
vorkommt – insbesondere dann, wenn<br />
dieser mit einem Morbus Hirschsprung<br />
kombiniert ist. Diese Studien wurden<br />
in den letzten Jahren umfassend erweitert<br />
und beschreiben in diesen Familien<br />
allgemein eine höhere Inzidenz verschiedener<br />
Symptome einer autonomen Dysregulation.<br />
Dabei wird ein multifaktorielles<br />
Vererbungsmodell mit statistisch<br />
ähnlicher Wahrscheinlichkeit postuliert<br />
wie die Annahme eines Hauptgenortes<br />
(Marazita 2001, Weese-Mayer 1993,<br />
Weese-Mayer 2001).<br />
Wie ist nun so ein Genort zu finden?<br />
Üblicherweise sind verschiedene Ansätze<br />
etabliert, wobei neben genetischen<br />
Tiermodellen den genomweiten Kopplungsanlysen<br />
eine große Bedeutung zukommt.<br />
Tiermodelle zur Untersuchung<br />
pathophysiologischer Vorgänge in Abhängigkeit<br />
spezifischer prädisponierender<br />
Umgebungsfaktoren sind für SID<br />
vielfältig etabliert (Sayers 1999, Blood-<br />
Siegfried 2004, Neff 2004). Implikationen<br />
für genetische Prädispositionen lassen<br />
sich aus diesen Modellen meist nicht<br />
ableiten. Potentielle Kandidatengene<br />
wurden aber durch detaillierte Analysen<br />
des Phänotyps spezifischer Knock-out-<br />
Mausmodellen postuliert. Dabei kommt<br />
der Beschreibung von Alterationen des<br />
Atemantriebs eine besondere Bedeutung<br />
zu. Im Knock-out-Mausmodell des RET-<br />
91
92<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Protoonkogens konnte gezeigt werden,<br />
dass neben dem Morbus Hirschsprung<br />
in Abhängigkeit vom RET-Genotyp eine<br />
veränderte CO2-Atemschwelle nachweisbar<br />
war. Während die Wildtypmäuse<br />
bei einer Hyperkapnie mit einer Erhöhung<br />
des Atemzugvolumens und des<br />
Minutenvolumens reagierten, verloren<br />
die homozygot RET deletierten Mäuse<br />
dieses Anpassungsvermögen vollständig<br />
und verstarben innerhalb der ersten<br />
24 Stunden postpartum an einem<br />
Atemstillstand (Burton 1997). Da ein<br />
vergleichbarer Phenotyp ebenfalls im<br />
Knock-out-Mausmodell des GDNF-Gens<br />
– einem funktionellen Liganden des RET<br />
– beschrieben wurde (Pichel 1996, Sanchez<br />
1996), schlussfolgerte man, dass alle<br />
Gene die in den RET-Pathway involviert<br />
sind, ebenfalls eine potentielle Bedeutung<br />
für die Reifung des Atemzentrums<br />
haben könnten. Entsprechend wurde<br />
sowohl in CCHS Populationen (RET-<br />
Protonkogen und GDNF-Gen) als auch<br />
in einer SIDS Population (RET-Protoonkogen)<br />
vereinzelt Mutationen nachgewiesen<br />
(Amiel 1998, Fitze 2003, Weese-<br />
Mayer 2004).<br />
Als weiters Kandidatengen, dass einen<br />
Einfluss auf die Differenzierung von<br />
Zellen haben, die von der Neuralleiste<br />
abstammen und auf diese Weise identifiziert<br />
worden ist, muss das HOX11L2-Gen<br />
(auch als TLX3-Gen bezeichnet) genannt<br />
werden. Bei rnx-Gen deletierten Mäusen<br />
wurde ebenfalls eine zentrale Störung<br />
der Atemregulation beobachtet (Shirasawa<br />
2000). Folglich leitet sich die Frage<br />
nach der Bedeutung des humanen homologen<br />
Gens HOX11L2 für die Etiologie<br />
entsprechender Störungen des Atemantriebes<br />
ab. Während die Analyse dieses<br />
Gens bei 13 CCHS Patienten keine Sequenzvarianten<br />
der kodierenden Region<br />
zeigte (Matera 2002), wurde bei 92 SIDS<br />
Patienten in fünf Fällen zwei verschiedene<br />
Missense-Mutation nachgewiesen.<br />
Allerdings fand man eine dieser Mutationen<br />
ebenfalls bei zwei von 92 Kontrollindividuen<br />
(Weese-Mayer 2004).<br />
In PHOX2B defizienten Mäusen konnte<br />
gezeigt werden, dass dieses Gen einen<br />
essentiellen Einfluss auf die Entwicklung<br />
autonomer Derivate der Neuralleiste<br />
hat, die im gesamten Körper disseminiert<br />
nachweisbar sind und im adulten<br />
Organismus eine enorme funktionale<br />
Vielfalt aufweisen (Pattyn 1999). Folglich<br />
wurde vier Jahre später dieses Gen<br />
als Hauptgen für die Genese des Kongenitalen<br />
Zentralen Hypoventilationssyndroms<br />
identifiziert, wobei heterozygote<br />
Loss-of-function Mutationen einen autosomal<br />
dominanten Erbgang anzeigen<br />
(Amiel 2003). Weese-Mayer hat dieses<br />
Gen in einer Population von 92 SIDS<br />
Patienten untersucht, konnte aber eben<br />
keine Assoziation des PHOX2B-Gens mit<br />
diesem Phenotyp nachweisen (Weese-<br />
Mayer 2004).<br />
Das Long-QT-Syndrom (LQTS) stellt<br />
eine andere hereditäre Erkrankung dar,<br />
die unter bestimmten Umständen eine<br />
Prädisposition für den Plötzlichen Kindstod<br />
darstellen kann. Als ein Tiermodell<br />
für das Long-QT-Syndrom wurde 2002<br />
die Scn5a-Knock-out-Maus beschrieben.<br />
Während eine homozygote Deletion dieses<br />
Gens zu einem intauterinen Tod der<br />
Mäuse mit schweren morphologischen<br />
Defekten der Herzventrikel führte, war<br />
für die heterozygoten Tiere ein normales<br />
Überleben möglich. Physiologische Untersuchungen<br />
zeigten aber eine ca. 50 %
Fitze<br />
Gibt es einen genetischen Hintergrund für den Plötzlichen Kindstod?<br />
erniedrigte Aktivität der Natrium-Kanäle<br />
am Herzen, wodurch eine Alteration<br />
der atrioventrikulären Erregungsüberleitung<br />
sowie eine verlangsamte ventrikuläre<br />
Erregungsleitung mit erhöhter<br />
ventrikulärer Refraktionszeit resultierte<br />
(Papadatos 2002). Ein SIDS analoger<br />
Phänotyp konnte nicht induziert werden.<br />
Die Mutationsanalyse des humanen<br />
homologen Gens bei 93 angenommenen<br />
SIDS Patienten detektierte zwei Missense-Mutationen.<br />
Unabhängig davon wurde<br />
in einer Kasuistik eines SIDS Patienten<br />
eine weitere Missense-Mutation im<br />
SCN5A-Gen nachgewiesen. Weitere für<br />
Ionenkanäle des Herzens kodierende bekannte<br />
Gene (KVLQT1, HERG, KCNE1<br />
und KCNE2) sind analysiert worden,<br />
aber nur im KVLQT1-Gen sind in zwei<br />
unabhängigen Fällen jeweils dieselbe<br />
Missene-Mutation nachgewiesen worden<br />
(Opdal 2004).<br />
Genomweite Kopplungsanalysen können<br />
genomische Regionen definieren, in<br />
denen dann in einem weiteren Schritt<br />
Kandidatengene identifiziert werden.<br />
Voraussetzung für eine genomweite<br />
Kopplungsanalyse stellt ein möglichst<br />
genau charakterisierter Phänotyp mit einer<br />
hinreichenden Zahl von Eltern-Kind-<br />
Paaren dar. Während das Letztere für<br />
SIDS durchaus realisierbar erscheint, ist<br />
die Beschreibung des Phänotyps ein evidentes<br />
Problem. Die Diagnose des Plötzlichen<br />
Kindstod resultiert aus der Evaluierung<br />
der Todesumstände sowie den<br />
Ergebnissen einer gerichtsmedizinischen<br />
Untersuchung, die zum Ziel hat, andere<br />
kausale Erkrankungen auszuschließen.<br />
Demzufolge stellt der Plötzliche Kindstod<br />
eine Ausschlussdiagnose dar, der<br />
aber momentan kein pathomorphologisch<br />
fassbares Korrelat zu Grunde liegt.<br />
Wir müssen annehmen, dass das SIDS<br />
eine phänotypisch heterogene Population<br />
darstellt, die folglich auch genetisch<br />
heterogen erscheinen muss. Auf dieser<br />
Grundlage ist nicht zu erwarten, dass<br />
genomweite Kopplungsanalysen SIDS<br />
relevante Genorte benennen können.<br />
Schließlich werden in der wissenschaftlichen<br />
Praxis oft durch phänotypische<br />
Analogieschlüsse potentielle Kandidatengene<br />
postuliert.<br />
In diesem Kontext sind Störungen des<br />
Fettstoffwechsels zu diskutieren, wobei<br />
dem MCAD-Gen eine besondere Aufmerksamkeit<br />
gewidmet worden ist. Eine<br />
durch Mutationen bedingte Defizienz<br />
dieses Gens ist nicht selten und kann<br />
unter Stresssituation – beispielsweise<br />
fehlende Nahrungsaufnahme im Rahmen<br />
eines Infektes – durchaus fatale<br />
Folgen haben. Deshalb war dieses Gen<br />
Gegenstand mehrerer Studien in SIDS<br />
Populationen, wobei hauptsächlich die<br />
am häufigsten nachgewiesene Mutation<br />
(A985G) untersucht wurde. Insgesamt<br />
liegen Daten von 2 587 SIDS Patienten<br />
vor, bei denen die Mutation in 14 Fällen<br />
heterozygot (0,54 %) und in zwei Fällen<br />
homozygot (0,08 %) gefunden wurde.<br />
Dagegen konnte bei 4 636 Kontrollindividuen<br />
dieselbe Mutation in 39 Personen<br />
(0,84 %) heterozygot nachgewiesen werden.<br />
Aus diesen Daten kann kein Rückschluss<br />
auf eine Assoziation dieses Gens<br />
mit dem Plötzlichen Kindtod abgeleitet<br />
werden, sodass andere in den Fettstoffwechsel<br />
involvierte Gene zur Disposition<br />
stehen (Opdal 2004).<br />
93
94<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
In bis zu 50 % der SIDS <strong>Kinder</strong> wird im<br />
Vorfeld des Ereignisses ein blander Infekt<br />
der oberen Atemwege beschrieben.<br />
Es könnte daraus abgeleitet werden, dass<br />
eine vulnerable Immunantwort mit dem<br />
SIDS im Zusammenhang steht. Diese<br />
Überlegung führte zur Analyse des IL-<br />
10-Gens, dessen Expression in hohem<br />
Maße von Polymorphismen des IL-10-<br />
Promotors reguliert wird. In einer Studie<br />
an 23 SIDS Patienten wurde eine<br />
Assoziation zwischen einem spezifischen<br />
Haplotyp des IL-10-Promotors (ATA; Position<br />
–1082, –819 und –592) mit dem<br />
Phänotyp beschrieben (Summers 2000).<br />
Dieser Zusammenhang konnte von Opdal<br />
so allgemein nicht bestätigt werden,<br />
aber er fand eine analoge Verteilung bei<br />
SIDS Patienten mit einer Infekt-Anamnese<br />
(Opdal 2003).<br />
Serotonin beeinflusst verschiedene<br />
physiologische Regulationssysteme wie<br />
den Atemantrieb, das kardiovaskuläre<br />
System, die Temperaturregulation, den<br />
Schlaf-Wach-Rhythmus sowie Wechselwirkungen<br />
zwischen Immunsystem und<br />
Nervensystem. Beobachtungen einer erniedrigten<br />
Serotonin-Aktivität im Hirnstamm<br />
von SIDS <strong>Kinder</strong>n führte zu der<br />
Vorstellung, dass Serotonin eine vermittelnde<br />
Rolle beim Auftreten des Plötzlichen<br />
Kindstod spielen könnte. Im Serotonin<br />
Transporter Gen (SLC6A4 oder<br />
SERT) sind zwei polymorphe Regionen<br />
– Tandem-Repeats jeweils im Promotor<br />
und im Intron 2 – die die Genaktivität<br />
modulieren. In zwei unabhängigen Studien<br />
konnte gezeigt werden, dass eine<br />
signifikante Assoziation der jeweils langen<br />
Variante (12 Repeats bezeichnet als<br />
L-Allel) mit dem SIDS besteht. Dabei bedingt<br />
die lange Genvariante eine erhöhte<br />
Expression des Serotonin Transporter<br />
Proteins und damit eine niedrigere präsynaptische<br />
Serotonin Konzentration<br />
(Narita 2001, Weese-Mayer 2003).<br />
Wie in Tiermodellen gezeigt werden<br />
konnte, hat Testosteron einen wesentlichen<br />
Einfluss auf den Schwellenwert<br />
des durch Hyperkapnie oder Hypoxie<br />
vermittelten Atemantriebs in den zentralen<br />
und peripheren Atemzentren. Dabei<br />
setzt ein erhöhter Testosteronspiegel<br />
den Schwellenwert hoch (Tatsumi 1994,<br />
Emery 1994). Diese Erkenntnisse konnten<br />
kürzlich beim Menschen nachvollzogen<br />
werden. Bei prämenopausalen Frauen<br />
wurde nach Testosteron-Applikation<br />
der Schwellenwert für den Atemantrieb<br />
im Non-REM-Schlaf heraufgesetzt verglichen<br />
mit den Daten vor Testosterongabe<br />
(Zhou 2003). Daraus wurde geschlussfolgert,<br />
dass Testosteron die Ateminstabilität<br />
der Männer während des Schlafes<br />
erklären könnte. Außerdem ließe sich aus<br />
diesem Phänomen ebenfalls die höhere<br />
Inzidenz des männlichen Geschlechts<br />
unter den SIDS <strong>Kinder</strong>n erklären. Somit<br />
ist das Testosteron wesentlicher Ansatzpunkt<br />
für die Definition und genetische<br />
Analyse weiterer Kandidatengene des<br />
Plötzlichen Kindstod.<br />
Es könnte sich nun die Frage stellen,<br />
ob der Plötzliche Kindstod aus nosologischer<br />
Sicht überhaupt eine eigene Entität<br />
darstellt. Es wird abgeschätzt, dass ein<br />
plötzlicher Kindstod in knapp 50 % der<br />
Fälle im Zusammenhang mit einer anderen<br />
möglicherweise bisher nicht erkannten<br />
Krankheit steht (Opdal 2004). Somit<br />
wäre jedes zweite plötzlich verstorbene<br />
Kind im engeren Sinne als SIDS Kind<br />
zu betrachten. Analog zu den Ideen von
Karl-Heinrich Bauer – Chirurg und Begründer<br />
des Deutschen Krebsforschungszentrums<br />
in Heidelberg – der in seinem<br />
1928 erschienen Buch „Mutationstheorie<br />
der Geschwulstentstehung“ die Tumorgenese<br />
als eine Interaktion von endogenen,<br />
genetisch determinierten und<br />
exogenen Umgebungsfaktoren verstand,<br />
resultiert der Plötzliche Kindstod aus einem<br />
Zusammentreffen dieser Faktoren<br />
bezogen auf ein vulnerables Zeitfenster<br />
der ontogenetischen Entwicklung.<br />
Zweifelfrei ist die Beschreibung genetischer<br />
Faktoren mit einer etiologischen<br />
Bedeutung für den SID insbesondere<br />
in Anbetracht der modernen labortechnischen<br />
Möglichkeiten von großem Interesse.<br />
Jedoch können wir momentan<br />
nur eine Vielzahl von Kandidatengene<br />
benennen, die aktuell evaluiert werden.<br />
Der wünschenswerte Umstand, ein gut<br />
charakterisiertes Hauptgen mit einer klaren<br />
Genotyp-Phänotyp-Korrelation benennen<br />
zu können, wird wohl noch Ziel<br />
vieler wissenschaftlicher Studien bleiben<br />
müssen.<br />
Literatur<br />
Fitze<br />
Gibt es einen genetischen Hintergrund für den Plötzlichen Kindstod?<br />
1 Amiel J, Salomon R, Attie T, Pelet A, Trang H,<br />
Mokhtari M, Gaultier C, Munnich A, Lyonnet S.<br />
Mutations of the RET-GDNF Signaling pathway in<br />
Ondine’s curse. Am J Hum Genet 62 (1998) 715–7<br />
2 Amiel J, Laudier B, Attie-Bitach T, Trang H, de<br />
Pontual L, Gener B, Trochet D, Etchevers H, Ray P,<br />
Simonneau M, Vekemans M, Munnich A, Gaultier<br />
C, Lyonnet S: Polyalanine expansion and frameshift<br />
mutations of the paired-like homeobox gene<br />
PHOX2B in congenital central hypoventilationsyndrome.<br />
Nat Genet 33 (2003) 459–461<br />
3 Blood-Siegfried J, Shelton B: Animal models of<br />
sudden unexplained death. FEMS Immunol Med<br />
Microbiol 42 (2004) 34–41<br />
4 Burton MD, Kawashima A, Brayer JA, Kazemi<br />
H, Shannon DC, Schuchardt A, Costantini F, Pachnis<br />
V, Kinane TB: RET proto-oncogene is important<br />
for the development of respiratory CO2 sensitivity.<br />
J Autonomic Nervous System 63 (1997) 137–143<br />
5 Emery MJ, Hlastala MP, Matsumoto AM.<br />
Depression of hypercapnic ventilatory drive by<br />
testosterone in sleeping infant primate.<br />
J Appl Physiol 76 (1994) 1786–1793<br />
6 Fitze G, Paditz E, Schläfke M, Kuhlisch E,<br />
Roesner D, Schackert HK: Association of germline<br />
mutations and polymorphisms of the RET proto-oncogene<br />
with Idiopathic Congenital Central<br />
Hypoventilation Syndrome in 33 patients. J Med<br />
Genet 40 (2003) e10<br />
7 Marazita ML, Maher BS, Cooper ME, Silvestri<br />
JM, Huffman AD, Smok Pearsall SM, Kowal MH,<br />
Weese-Mayer DE: Genetic segregation analysis of<br />
autonomic nervous system dysfunction in families<br />
of probands with idiopathic congenital central hypoventilation<br />
syndrome. Am J Med Genetics 100<br />
(2001) 229–236<br />
8 Matera I, Bachetti T, Cinti R, Lerone M, ‚Gagliardi<br />
L, Morandi F, Motta M, Mosca F, Ottonello G,<br />
Piumelli R, Schober JG, Ravazzolo R, Ceccherini I:<br />
Mutational analysis of the RNX gene in Congenital<br />
central hypoventilation syndrome. Am J Med Genet<br />
113 (2002) 178–182<br />
9 Narita N, Narita M, Takashima S, Nakayama<br />
M, Nagai T, Okado N: Serotonin transporeter gene<br />
variation is a risk factor for sudden infant death<br />
syndromr in Japanease population. Pediatrics 107<br />
(2001) 690–692<br />
10 Neff RA, Simmens SJ, Evans C, Mendelovitz D:<br />
Prenatal nicotine exposure alters central cardiorespiratory<br />
responses to hypoxia in rats: implications<br />
for sudden infant death syndrome. J Neurosci 24<br />
(2004) 9261–9268<br />
95
96<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
11 Opdal SH, Opstad A, Vege A, Rognum TO: IL-<br />
10 gene polymorphisms are associated with infectious<br />
cause of sudden infant death. Hum Immunol<br />
64 (2003) 1183–1189<br />
12 Opdal SH, Rognum TO: The sudden infant<br />
death syndrome gene: Does it exist? Pediatrics 114<br />
(2004) 506–512<br />
13 Papadatos GA, Wallerstein PMR, Head CEG,<br />
Ratcliff R, Brady PA, Benndorf K, Saumarez RC,<br />
Trezise AEO, Huang CLH, Vandenberg JI, Colledge<br />
WH, Grace AA: Slowed conduction and ventricular<br />
tachycardia after targeted disruption of the cardiac<br />
sodium channel gene Scn5a. Proc Nat Acad Sci 99<br />
(2002) 6210–6215<br />
14 Pattyn A, Morin X, Cremer H, Goridis C,<br />
Brunet J-F: The homeobox gene Phox2b is essential<br />
for the development of all autonomic derivates of<br />
the neural crest. Nature 399 (1999) 366–370<br />
15 Pichel JG, Shen L, Sheng HZ, Granholm AC,<br />
Drago J, Grinberg A, Lee EJ, Huang SP, Saarma M,<br />
Hoffer BJ, Sariola H, Westphal H: Defects in enteric<br />
innervation and kidney development in mice<br />
lacking GDNF. Nature 382 (1996) 73–6<br />
16 Sanchez MP, Silos-Santiago I, Frisen J, He B,<br />
Lira SA, Barbacid M: Renal agenesis and the absence<br />
of enteric neurons in mice lacking GDNF.<br />
Nature 382 (1996) 70–3<br />
17 Shirasawa S, Arata A, Onimaru H, Roth KA,<br />
Brown GA, Horning S, Arata S, Okumura K, Sasazuki<br />
T, Korsmeyer SJ: Rnx deficiency results in<br />
congenital central hypoventilation. Nat Genet 24<br />
(2002) 287–290<br />
18 Smialek JE: Simultanious suddeen infant death<br />
syndrome in twins. Pediatrics 77 (1986) 816–821<br />
19 Summers AM, Summers CW, Drucker DB,<br />
Hajeer AH, Barson A, Hutchinson IV: Association<br />
of IL-10 genotype with sudden infant death syndrome.<br />
Hum Immunol 61 (2000) 1270–1273<br />
20 Sayers NM, Drucker DB: Animal models used<br />
to test the interaction between infectious agents<br />
and products of cigarette smoke implicated in sudden<br />
infant death syndrome. FEMS Immunol Med<br />
Microbiol 25 (1999) 115–123<br />
21 Tatsumi K, Hannhart B, Pickett CK, Weil JV,<br />
Moore LG: Effects of testosterone on hypoxic ventilatory<br />
and carotid body neural responsiveness. Am<br />
J Respir Crit Care Med 149 (1994) 1248–1253<br />
22 Weese-Mayer DE, Silvestri JM, Marazita ML,<br />
Hoo JJ: Congenital central hypoventiation syndrome:<br />
inheritance and relation to sudden infant death<br />
syndrome. Am J Med Genet 47 (1993) 360–367<br />
23 Weese-Mayer DE, Silvestri JM, Huffman AD,<br />
Smok Pearsall SM, Kowal MH, Maher BS, Cooper<br />
ME, Marazita ML: Case/Control Family Study of<br />
Autonomic Nervous System Dysfunction in Idiopathic<br />
Congenital Central Hypoventilation Syndrome.<br />
Am J Med Genetics 100 (2001) 237–245<br />
24 Weese-Mayer DE, Berry-Cravis EM, Maher BS,<br />
Silvestri JM, Curran ME, Marazita ML: Sudden infant<br />
death syndrome: association with a promoter<br />
polymorphism of the serotonin transporter gene.<br />
Am J Med Genetics 117 (2003) 268–274<br />
25 Weese-Mayer DE, Berry-Cravis EM, Zhou L,<br />
Maher BS, Curran ME, Silvestri JM, Marazita ML:<br />
Sudden infant death syndrome: case-control frequency<br />
differences at genes pertinent to early autonomic<br />
nervous systeme embryonic development.<br />
Pediatr Res 56 (2004) 391–395<br />
26 Zhou XS, Rowley JA, Demirovic F, Diamond<br />
MP, Badr MS: Effect of testosterone on the apneic<br />
treshold in women during NREM sleep. J Appl<br />
Physiol 94 (2003) 101–107<br />
Autor<br />
PD Dr. med. Guido Fitze<br />
Klinik und Poliklinik für <strong>Kinder</strong>chirurgie<br />
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus<br />
Technische Universität Dresden<br />
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Nowakowski und Schlüter<br />
Verzögerte funktionelle Hirnreifung bei <strong>Kinder</strong>n Methadon-substituierter Mütter<br />
Verzögerte funktionelle Hirnreifung bei <strong>Kinder</strong>n<br />
Methadon-substituierter Mütter. Bestimmung<br />
der funktionellen Hirnreifung anhand von EEG-<br />
Mustern und kardiorespiratorischen Parametern<br />
mittels Polysomnographie<br />
Nowakowski C, Schlüter B<br />
Schlaflabor der Vestischen <strong>Kinder</strong>klinik Datteln, Universität Witten/Herdecke<br />
Einleitung<br />
Es wird vermutet, dass intrauterine<br />
Drogenexposition zu Entwicklungsstörungen<br />
des kindlichen ZNS beitragen<br />
kann. Am Ende der Fetalzeit und in den<br />
ersten Lebensmonaten kommt es zu erheblichen<br />
Fortschritten der funktionellen<br />
Hirnreifung. Dies kann u. a. an einer<br />
tiefgreifenden Reorganisation des kindlichen<br />
Schlafzyklus abgelesen werden.<br />
Deshalb wurden polygraphische Schlafuntersuchungen<br />
bei Säuglingen Methadon-substituierter<br />
Mütter durchgeführt.<br />
Patienten und Methode<br />
Von 1989 bis 2002 wurden im Schlaflabor<br />
der Vestischen <strong>Kinder</strong>klinik Datteln<br />
126 Polysomnographien (PSG) an<br />
85 <strong>Kinder</strong>n drogenabhängiger Mütter<br />
durchgeführt. Die PSG umfasste neurophysiologische<br />
(EEG, EOG, EMG) und<br />
kardiorespiratorische Parameter (Atembewegungen,<br />
Luftstrom, transkutane<br />
Blutgase, EKG). Bei 46 Patienten ergab<br />
sich Methadon als Hauptkonsum der<br />
Mutter. In dieser Untergruppe lagen 25<br />
polysomnographische Registrierungen<br />
vor, bei denen eine vollständige Schlafsta-<br />
dienanalyse durchgeführt werden konnte.<br />
Insgesamt wurden 6 915 Epochen à<br />
30 Sekunden analysiert und folgende<br />
Stadien klassifiziert: Wach; Ruhigschlaf<br />
(EEG hochamplitudig-niederfrequent<br />
bzw. Tracé alternant); Aktivschlaf (EEG<br />
niederamplitudig-hochfrequent bzw. gemischtfrequent);<br />
Indeterminierter Schlaf<br />
und Movement Time (Bewegungsartefakte).<br />
Als Indeterminierter Schlaf wurden<br />
unreife Schlafmuster mit Diskordanz<br />
von elektroenzephalographischen<br />
und kardiorespiratorischen Mustern definiert.<br />
Ergebnisse<br />
Im Vergleich zu Referenzwerten aus<br />
der Literatur ergaben die kardiorespiratorischen<br />
Parameter in der Methadon-<br />
Gruppe keine Hinweise auf vermehrte<br />
kardiorespiratorische Instabilität. Hingegen<br />
war der Anteil des Indeterminierten<br />
Schlafs in der Methadon-Gruppe<br />
(n = 25, postkonzeptionelles Alter: Median<br />
41 Wochen, Spannweite 36–59 Wochen)<br />
mit 45 % (Interquartilsspannweite<br />
28–55 %) gegenüber Referenzangaben<br />
aus der Literatur (postkonzeptionelles<br />
Alter 35–37 Wochen, Indeterminierter<br />
97
98<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Schlaf: Spannweite 10–15 %) signifikant<br />
erhöht.<br />
Schlussfolgerung: Bei jungen Säuglingen<br />
Methadon-substituierter Mütter<br />
ergaben sich neurophysiologisch-polysomnographische<br />
Hinweise auf eine<br />
funktionelle Hirnreifungsverzögerung<br />
um mindestens vier Wochen. Dies kann<br />
als Risikofaktor für später klinisch manifest<br />
werdende Entwicklungsstörungen<br />
und Verhaltensauffälligkeiten sowie für<br />
eine erhöhte Mortalität im ersten Lebensjahr<br />
angesehen werden.<br />
Korrespondenzadresse<br />
PD Dr. med. Bernhard Schlüter<br />
Vestische <strong>Kinder</strong>klinik<br />
Dr.-Friedrich-Steiner-Straße 5, 45711 Datteln<br />
Bernhard.Schlueter@kinderklinik-datteln.de
Indikatoren für eine Arousal-Aktivierung bei Säuglingen:<br />
Seufzer, Startle, Schlafspindel-Suppression<br />
und Änderung der Herzfrequenz als Lebensrettungs-Mechanismus<br />
bei Atemwegsobstruktion<br />
Henning W 1 , Frances McNamara und Bradley Thach 2<br />
1 Eppendorfer Zentrum für <strong>Kinder</strong>neurologie, Hamburg<br />
2 Washington University, St. Louis, USA<br />
Wir haben nachgewiesen, dass Seufzer<br />
und Startle verlässliche Indikatoren<br />
für die Aktivierung einer Weckreaktion/Arousal<br />
darstellen (Wulbrand et al<br />
Ped Res 1989, 1995). Eine Suppression<br />
der Schlafspindel-Aktivität durch Aktivierung<br />
des „Ascending Reticular Activating<br />
System“/ARAS folgt dem Auftreten<br />
von Seufzer und Startle. In dieser Studie<br />
stellten wir die Hypothese auf, dass Seufzer<br />
und Startle durch sympathischen und<br />
parasympathischen Einfluss von einer<br />
Veränderung der Herzfrequenz begleitet<br />
werden.<br />
Wir untersuchten Seufzer und Startle<br />
bei zwölf Säuglingen (Alter zehn bis 19<br />
Wochen), die durch Atemwegsokklusion<br />
wir mit Hilfe einer Atemmaske auslösten<br />
unter Aufzeichnung von EEG, EKG,<br />
SaO2, submentalem und diaphragmalen<br />
sowie nuchalem und bicpes EMG. Die<br />
Intensität der mit dem Startle verbundene<br />
Körperbewegungen wurde mit Hilfe<br />
eine Infrrot-Video von 0 bis 3 eingeteilt.<br />
Die Änderung der Herzfrequenz (Maximum<br />
des Anstiegs sowie Minimum des<br />
folgenden Abfalls) wurden nach dem<br />
Startle ermittelt.<br />
Seufzer und Startle folgten allen 131<br />
Okklusions-Manövern im N-REM-Schlaf<br />
Wulbrand, McNamara und Thach<br />
Indikatoren für eine Arousal-Aktivierung bei Säuglingen<br />
mit drei Ausnahmen, die zum Erwachen<br />
führten.<br />
1) Allein auftretende Seufzer sowie<br />
kombinierte Seufzer und Startle wurden<br />
stets gefolgt von einer Suppression<br />
der Schlafspindeln bis zu 45 Sek<br />
(p < 0,001). Die dem Startle folgende<br />
Beschleunigung der Herzfrequenz von<br />
126.3 ± 0.9 auf 142.9 ± 0.9 /min (x ± SE,<br />
p
100<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
„Ascending Reticular Activating System“<br />
hin, die die Schlafspindeln im Thalamus<br />
blockiert, sondern auch auf eine enge<br />
Verknüpfung mit einer sympathischen<br />
sowie parasympathischen Aktivierung<br />
der Herzfrequenz.<br />
Diese Arousal-bedingte Aktivierung<br />
folgt aber nicht einem „Alles oder<br />
Nichts“-Prinzip, sondern tritt in sehr unterschiedlicher<br />
Intensität auf mit einem<br />
Verlust der sympathisch/parasympatischen<br />
Balance, die weit über den Startle<br />
hinausgehen.<br />
Seufzer und Startle stellen im Prinzip<br />
einen universellen reflexartig auftretendenLebensrettungsmechanismus<br />
bei einer internen oder externen<br />
Atemwegsobstruktion dar (extern durch<br />
Bauchlage, Bettdecke etc., intern bei obstruktiven<br />
Apnoen), dessen Intensität<br />
bzw. Versagen eine große Rolle beim<br />
Plötzlichen Kindstod spielen könnte.
Zusammenfassung<br />
Erler und Lindner<br />
Koordination der Handlungsträger bei Plötzlichem Säuglingstod vor Ort<br />
Koordination der Handlungsträger<br />
bei Plötzlichem Säuglingstod vor Ort<br />
Empfehlungen zur Vorgehensweise bei Auffinden eines toten Säuglings<br />
im häuslichen Milieu<br />
Erler T 1 , Lindner G 2<br />
1 Klinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin am Carl-Thiem-Klinikum Cottbus<br />
2 Polizeischutzbereich Cottbus<br />
Wir berichten über Empfehlungen für<br />
das praktische Management der schwierigen<br />
und tragischen Situation nach dem<br />
plötzlichen Tod eines Säuglings im häuslichen<br />
Milieu. Sie wurden bei einem Konsensustreffen<br />
leitender Mitarbeiter der<br />
Notrettung, Polizei, Staatsanwaltschaft<br />
und einer <strong>Kinder</strong>klinik entwickelt. Ihr<br />
Ziel ist es, zusätzliche Härten durch unberechtigte<br />
Anklage der trauernden Eltern<br />
zu verhindern, aber die Option einer<br />
kriminalistischen Ermittlung aufrecht zu<br />
erhalten, da eine kriminelle Todesursache<br />
niemals prima vista ausgeschlossen<br />
werden kann. Zusammenfassend wird<br />
hervorgehoben, dass bei Fehlen sicherer<br />
Todeszeichen der Transport des Säuglings<br />
unter Reanimationsmaßnahmen in<br />
ein Krankenhaus die wünschenswerteste<br />
Lösung im Sinne der Eltern und auch der<br />
pädiatrischen Forschung ist. Ist der irreversible<br />
Tod offensichtlich und ein Transport<br />
daher unmöglich, scheint es ratsam,<br />
eine unklare Todesursache zu bescheinigen<br />
und die Polizei zu informieren. Diese<br />
wird dann einen speziell geschulten Mitarbeiter<br />
entsenden. Eine Autopsie sollte<br />
mit Einverständnis der Eltern in allen<br />
Fällen angestrebt werden. Die Vermittlung<br />
an Selbsthilfeorganisationen (z. B.<br />
„GEPS“, „Verwaiste Eltern“, „Elternhelfen-Eltern-Liste“,„Regenbogen-Initiative“)<br />
kann für die Eltern im Prozess der<br />
Bewältigung des Verlustes ihres Kindes<br />
hilfreich sind.<br />
Aktueller Stand<br />
Zwar versterben heute in Europa<br />
Säuglinge plötzlich und unerwartet aus<br />
völligem Wohlbefinden heraus (SID =<br />
sudden infant death) deutlich seltener<br />
– die Inzidenz liegt jedoch in vielen<br />
hochindustrialisierten Ländern mittlerweile<br />
deutlich unter 1 ‰ – trotzdem<br />
bleibt SID in der Todesursachenstatistik<br />
bei Säuglingen die Nummer eins. Unterschiedliche<br />
Ätiologiemodelle werden<br />
weltweit als Ursache für das unerwartete<br />
Versterben diskutiert. Konsens besteht<br />
jedoch bisher nur in der Auffassung, dass<br />
es sich um ein multifaktorielles Geschehen<br />
handelt.<br />
Bekannt und statistisch belegt ist eine<br />
Reihe anamnestischer Risikofaktoren,<br />
die offensichtlich das Auftreten des<br />
101
102<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
plötzlichen Säuglingstodes begünstigen:<br />
z. B. die Bauchlage des Säuglings, frühes<br />
Abstillen oder fehlendes Stillen, aktives<br />
oder passives Rauchen während oder<br />
nach der Schwangerschaft oder im Vorfeld<br />
stattgefundene sog. Lebensbedrohliche<br />
Ereignisse (ALTE = apparently life<br />
threatening event),Überwärmung usw.<br />
Verbessertes perinatales Management,<br />
Realisierung präventiver Maßnahmen<br />
und breit angelegte Aufklärungskampagnen<br />
sind Maßnahmen, die zu einem<br />
spürbaren Rückgang der SID-Inzidenz in<br />
ganz Europa geführt haben.<br />
Die Situation des Notarztes<br />
Trotz der erfreulichen Entwicklung<br />
der SID-Inzidenz muss in der Bundesrepublik<br />
pro Jahr mit etwa 400 Plötzlichen<br />
Säuglingstodesfällen gerechnet werden.<br />
Häufig liegt die Zeit des Auffindens des<br />
bereits seit geraumer Zeit toten Kindes<br />
in den Morgenstunden, trotzdem wird<br />
von den Kindeseltern die hoffnungslose<br />
Situation nicht erkannt und der Notarzt<br />
hinzugerufen. Dieser steht dann vor<br />
der schwierigen Entscheidung, Reanimationsmaßnahmen<br />
einleiten, fortführen<br />
oder gar abbrechen zu müssen. Zu<br />
welchem Entschluss er auch kommen<br />
mag, in jedem Fall resultieren aus seiner<br />
Entscheidung weitere Konfliktsituationen.<br />
Bleiben Reanimationsmaßnahmen<br />
erfolglos, dann stellt sich die Frage eines<br />
Abbruchs im häuslichen Milieu. Erscheint<br />
eine Reanimation von vornherein<br />
aussichtslos, dann ist die heikle Frage<br />
nach der Todesursache zu beantworten:<br />
natürlicher Tod, ungeklärte Todesursache<br />
oder gar unnatürlicher Tod? In den<br />
beiden letzten Varianten ist der Notarzt<br />
verpflichtet, polizeiliche Ermittlungsorgane<br />
einzuschalten; eine rechtsmedizinische<br />
Sektion und damit die mögliche<br />
vorläufige Beschlagnahmung des Kindes<br />
sind die zwangsläufigen Folgen. Zu der<br />
dramatischen und tragischen Situation<br />
der Eltern kommt nun noch der Verdacht<br />
der Kindstötung.<br />
Eine Reihe derart gelagerter Fälle, die<br />
weder fachkompetent noch situationsgerecht<br />
geklärt wurden und letztlich zu<br />
einer unvertretbaren zusätzlichen Belastung<br />
der betroffenen Familien geführt<br />
hatten, veranlasste die Autoren zur Initiierung<br />
eines Konsensusgespräches<br />
zwischen Vertretern leitender Not- und<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte, leitenden Mitarbeitern der<br />
Polizei und der Staatsanwaltschaft. Im<br />
Ergebnis der Konferenz wurden Empfehlungen<br />
erarbeitet, über deren Inhalt im<br />
breiten Maßstab Polizisten und Notärzte<br />
informiert werden sollen.<br />
Fakten, die für einen Plötzlichen<br />
Säuglingstod sprechen<br />
Folgende Anamnesefaktoren lassen einen<br />
Plötzlichen Säuglingstod als wahrscheinlich<br />
in Betracht kommen und<br />
können zu entsprechendem Zeitpunkt<br />
gezielt erfragt werden:<br />
• Alter des Kindes zwischen acht und 14<br />
Wochen<br />
• Kind wurde in Bauchlage aufgefunden<br />
• Kind wurde nicht gestillt, Raucherhaushalt<br />
• Sterbezeitpunkt des Kindes liegt in<br />
den Nacht- bzw. frühen Morgenstunden<br />
bei aktuell kälterer Jahreszeit<br />
• das Kind war bis zum Ereignis völlig<br />
gesund
• die Kindsbettmatratze war besonders<br />
weich, im Bett befanden sich lose Kissen<br />
und/oder Decken<br />
• die Körpertemperatur des Säuglings<br />
war zum Zeitpunkt des Auffindens<br />
über 37 °C erhöht<br />
• Säugling ist männlichen Geschlechts<br />
• es ist das zweitgeborene Kind<br />
Vorschläge zur Verfahrensweise<br />
vor Ort<br />
Bei fehlenden Todeszeichen<br />
Erler und Lindner<br />
Koordination der Handlungsträger bei Plötzlichem Säuglingstod vor Ort<br />
Fehlen beim aufgefundenen Säugling<br />
Todeszeichen, wie z. B. Totenflecke, Leichen-starre,<br />
niedrige Körpertemperatur,<br />
sollten in jedem Fall Reanimationsversuche<br />
unternommen werden. Auch nach<br />
längerer Reanimationsdauer bietet sich<br />
dann die Übernahme des Säuglings unter<br />
Fortführung dieser Maßnahmen in<br />
die nächstgelegene Notaufnahme einer<br />
Klinik an. Die Kindeseltern (sofern anwesend)<br />
sollten den Transport in das Krankenhaus,<br />
in einem zweiten Fahrzeug,<br />
begleiten. Muss trotz aller Bemühungen<br />
der Tod des Kindes festgestellt werden,<br />
gilt die Zeit bei endgültiger Feststellung<br />
als Todeszeitpunkt. Im Konsilium wird<br />
dann in der Klinik über die Notwendigkeit<br />
der Einbeziehung polizeilicher Ermittlungsorgane<br />
entschieden. Eine Autopsie<br />
sollte im Einvernehmen mit den<br />
Eltern unbedingt veranlasst werden. Die<br />
Frage einer rechtsmedizinischen Sektion<br />
ist zu klären.<br />
Bei eindeutig nachweisbaren Todeszeichen<br />
Ist ein Transport des Kindes unter Reanimationsmaßnahmen<br />
wegen eindeutiger<br />
Todeszeichen (Totenflecke, Körperstarre,<br />
niedrige Körpertemperatur u. a.)<br />
nicht mehr möglich, muss vor Ort der<br />
Totenschein ausgestellt werden. Nach<br />
neuester internationaler Klassifikation<br />
der Krankheiten (ICD 10 – GM, Version<br />
2004) hat der erfahrene Notarzt prinzipiell<br />
die Möglichkeit, mit der Schlüssel-<br />
Nummer R95 einen natürlichen Tod<br />
bescheinigen zu können. Eine Obduktion<br />
sollte aber in all den Fällen veranlasst<br />
werden, in denen nicht der Staatsanwalt<br />
die rechtsmedizinische Leichenöffnung<br />
anordnet.<br />
Bei unklaren Todesumständen, jedoch<br />
bestehendem Verdacht auf Plötzlichen<br />
Säuglingstod kann in den meisten Bundesländern<br />
im Totenschein die Todesursache<br />
als unklar definiert werden. Eine<br />
Information an die polizeilichen Ermittlungsorgane<br />
ist dann sofort pflichtgemäß<br />
weiterzugeben. Sinnvoll ist es, dem<br />
diensthabenden Mitarbeiter der Polizei<br />
den Verdacht auf SID mitzuteilen, damit<br />
dieser dann einen speziell geschulten,<br />
zivilen Polizisten zum Notfallort entsenden<br />
kann. Bis zu dessen Eintreffen sollte<br />
der Notarzt nach Möglichkeit mit den<br />
Eltern im häuslichen Milieu verbleiben,<br />
um einfühlsam die eingeleiteten Schritte<br />
zu erläutern. Gemeinsam mit dem Kriminalisten<br />
wird über eine rechtsmedizinische<br />
oder pathologisch-anatomische<br />
Obduktion des Säuglings und über die<br />
Todesart (natürlich oder nicht geklärt)<br />
entschieden (Tab. 1 und 2).<br />
103
104<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
Tabelle 1<br />
Positive Aspekte der Klinikaufnahme<br />
von SID-<strong>Kinder</strong>n:<br />
• Das Kind wird aus der belasteten<br />
Todesumgebung entfernt.<br />
• Die Elterngespräche können mit<br />
einem zeitlichen Abstand vom Todeszeitpunkt<br />
begonnen werden.<br />
• Der „soziale“ Druck (Nachbarschaft,<br />
Polizei, Verwandtschaft) ist<br />
genommen.<br />
• Das Kind ist an einem „sicheren“<br />
Platz, die weitere Vorgehensweise<br />
kann geplant werden.<br />
• Die Durchführung einer Obduktion<br />
kann besprochen und organisiert<br />
werden.<br />
Tabelle 2<br />
Gründe für eine Autopsie bei an SID<br />
verstorbenen <strong>Kinder</strong>n:<br />
• definitionsgemäße Voraussetzung<br />
zur „Diagnosestellung“<br />
• Nachweis von schwerwiegenden<br />
Befunden, die SID ausschließen<br />
• Hilfe bei Trauerbewältigung<br />
• Vorgehensweise bei ähnl. Fällen<br />
• Möglichkeiten zum Ausschluss eines<br />
nichtnatürlichen Todes<br />
• Wissenschaftliches Interesse<br />
Konkrete Anleitung<br />
zum Krisenmanagement<br />
Vorfeldaufgaben:<br />
• dauerhaften, kompetenten Ansprechpartner<br />
bei Polizei und Staatsanwaltschaft<br />
im Vorfeld suchen; notfalls Vertreter<br />
benennen<br />
• regelmäßige Weiterbildung bei Polizei<br />
und Staatsanwaltschaft<br />
• Information über Vorgehensweisen<br />
bei vermutetem SID an Rettungsämter,<br />
Notärzte und regionale Notaufnahmen;<br />
regelmäßige Weiterbildung<br />
• evtl. dauerhafte Verbindung zu Seelsorger<br />
garantieren (Notfalltelefon!)<br />
• Information an regionale Institute für<br />
Pathologie und/oder Rechtsmedizin<br />
Krisenmanagement:<br />
• Kind nach Möglichkeit aus häuslicher<br />
Umgebung entfernen<br />
• sofortige Einleitung von Reanimationsmaßnahmen<br />
• wenn sicherer Todeseintritt im häuslichen<br />
Milieu: unklare Todesursache bescheinigen,<br />
nur vorinformierte Behördenmitarbeiter<br />
einbeziehen, als Notarzt<br />
bis zum Abtransport des Kindes bei<br />
Eltern bleiben, möglichst kirchlichen<br />
oder weltlichen Beistand organisieren<br />
• bei Transport ins Krankenhaus: konsiliarische<br />
Todesbescheinigung in Notaufnahme,<br />
erklärendes Gespräch mit<br />
Eltern, Sektion vereinbaren, Einbeziehung<br />
von vorinformierten Behörden<br />
im Bedarfsfall<br />
• kirchlichen oder weltlichen Beistand<br />
organisieren<br />
Korrespondenzadresse<br />
PD Dr. med. Thomas Erler<br />
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus<br />
Klinik für <strong>Kinder</strong>-und Jugendmedizin<br />
Thiemstraße 111, 03048 Cottbus<br />
Telefon (03 55) 46-23 36, Telefax (03 55) 46-20 77<br />
th.erler@ctk.de
Jachau, Heinrichs und Krause<br />
Computertomographie und Magnetresonanztomographie in der postmortalen Diagnostik<br />
Computertomographie und Magnetresonanz-<br />
tomographie in der postmortalen Diagnostik des<br />
plötzlichen Säuglingstodes (SIDS)<br />
Jachau K 1 , Heinrichs T 2 , Krause D 1<br />
1 Institut für Rechtsmedizin, Medizinische Fakultät, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg<br />
2 Klinik für Diagnostische Radiologie, Medizinische Fakultät, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg<br />
Einleitung<br />
Kommt der leichenschauhaltende Arzt,<br />
der eher selten ein Pädiater ist, bei der<br />
Leichenschau eines verstorbenen Säuglings<br />
zur Verdachtsdiagnose „Plötzlicher<br />
Säuglingstod“ oder ist die Todesursache<br />
unklar, sollte stets eine Obduktion angestrebt<br />
werden. Wie die Totenscheinanalyse<br />
im Rahmen der BMFT-Studie<br />
„Plötzlicher Säuglingstod“ zeigte, geschieht<br />
dies nicht allen Fällen, einerseits<br />
wegen nicht vorliegendem richterlichen<br />
Beschlusses, andererseits wegen fehlender<br />
Einwilligung der Eltern. Diese Fälle<br />
bleiben unaufgeklärt und unsicher für<br />
die Todesursachenstatistik.<br />
Neben konventionellen Röntgenaufnahmen<br />
spielen in der postmortalen Diagnostik<br />
moderne bildgebende Verfahren<br />
wie Computertomographie (CT) und<br />
Magnetresonanztomographie (MRT)<br />
eine zunehmende Rolle. Das Institut für<br />
Rechtsmedizin in Bern prägte den Begriff<br />
der „Virtopsy©“ (virtuelle Autopsie)<br />
[5]. Neben der vordergründigen Aufgabenstellung,<br />
CT- und MRT-Befunde als<br />
zusätzliche diagnostische Möglichkeiten<br />
zu evaluieren [2], sollte langfristig auch<br />
das Ziel verfolgt werden, angesichts der<br />
ständig sinkenden Obduktionszahlen<br />
alternative Möglichkeiten der postmortalen<br />
Diagnostik zu entwickeln. Die Er-<br />
fahrungen der forensischen Radiologie<br />
mit postmortal erstelltem Schnittbildmaterial<br />
sind aufgrund der wenigen in<br />
der Vergangenheit erfolgten CT- und<br />
MRT- Untersuchungen an Leichen oder<br />
Leichenteilen noch nicht sehr umfangreich<br />
und beschränken sich meist auf<br />
Fallberichte mit eng begrenzten Fragestellungen.<br />
Ziel unserer Untersuchungen<br />
war die Frage, ob und in welchem<br />
Ausmaß die postmortal computertomographisch<br />
und magnetresonanztomographisch<br />
gewonnene Befunde mit den bei<br />
der Obduktion eines Säuglings erhobenen<br />
korrelieren.<br />
Methodik<br />
Seit 2002 wurden in einer Zusammenarbeit<br />
zwischen der Klinik für Radiologie<br />
und dem Institut für Rechtsmedizin<br />
grundsätzlich verstorbene Säuglinge und<br />
Kleinkinder mittels Computertomographie<br />
und Magnetresonanztomographie<br />
vor der Obduktion durch einen <strong>Kinder</strong>radiologen<br />
und einen Rechtsmediziner<br />
untersucht. Alle computertomographischen<br />
Untersuchungen wurden an einem<br />
Siemens Somatom Plus 4 Spiral-<br />
CT vorgenommen. Die Untersuchung<br />
erfolgte in kontinuierlicher Schichtführung,<br />
die Schichtdicke betrug 3 mm. Die<br />
105
106<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
magnetresonanztomographischen Untersuchungen<br />
fanden an einem Magnetom<br />
Vision 1,5 Tesla der Firma Siemens<br />
statt. Die Untersuchung erfolgte immer<br />
sowohl in T1- als auch in T2-Wichtung.<br />
Dabei kamen Spin-Echo (se)-, Turbo-<br />
Spin-Echo (tse)- und Turbo-Inversion-<br />
Recovery (tirm)-Sequenzen zum Einsatz.<br />
Relevante Befunde dieser Schnittbilduntersuchungen<br />
lagen zur Obduktion in<br />
Bildform vor.<br />
Die Obduktion erfolgte stets nach dem<br />
Standardautopsieprotokoll der BMFT-<br />
Studie „Plötzlicher Säuglingstod“ [1].<br />
Die Ergebnisse der Obduktion, der feingeweblichen,<br />
toxikologischen und mikrobiologischen<br />
Untersuchungen wurden<br />
in einer Falldemonstration mit den<br />
Befunden der Schnittbilduntersuchungen<br />
verglichen.<br />
Insgesamt wurden bei 20 verstorbenen<br />
Säuglingen und Kleinkindern im<br />
Rahmen gerichtlicher Obduktionen vor<br />
der pathologisch-anatomischen Sektion<br />
CT- und MRT- Untersuchungen durchgeführt.<br />
Es handelte sich um 14 Jungen und<br />
sechs Mädchen, welche in einem Alter<br />
von drei Stunden bis vier Jahren verstarben.<br />
Die Leichenliegezeit vom Zeitpunkt<br />
der Auffindung der Leiche bis zu den<br />
radiologischen Untersuchungen variierte<br />
zwischen ein und vier Tagen. Neben<br />
frisch Verstorbenen wurden auch Fälle<br />
mit einer längeren Leichenliegezeit (Aufbewahrung<br />
der Leiche sechs Wochen in<br />
häuslicher Umgebung zur Verdeckung<br />
einer Straftat) untersucht. Ein entsprechendes<br />
Votum der Ethik-Kommission<br />
der Otto-von-Guericke-Universität an<br />
der Medizinischen Fakultät lag unter der<br />
Registriernummer 169/01 vor.<br />
Ergebnisse<br />
Für postmortale radiologische Befunderhebungen<br />
von Säuglingen und Kleinkindern<br />
sind für CT- und MRT-Untersuchungen<br />
deutlich andere Sequenzen<br />
notwendig als bei der Untersuchung<br />
Lebender. Mittels CT konnten die knöchernen<br />
Strukturen problemlos dargestellt<br />
werden und ein sicherer Frakturausschluss<br />
erfolgen. Mittels MRT gelang<br />
die Darstellung der Befunde an inneren<br />
Organen, insbesondere die Erhärtung<br />
der Verdachtsdiagnose einer Pneumonie<br />
[3]. Nicht immer gelang die radiologisch<br />
die Feststellung kleinerer anlagebedingter<br />
Herzfehler. Ertrinkungsbefunde<br />
waren gut nachweisbar. Insbesondere<br />
hinsichtlich von Entzündungsprozessen<br />
lag eine sehr gute Korrelation zwischen<br />
den radiologischen und den feingeweblichen<br />
Untersuchungsbefunden vor. Eine<br />
längere Leichenliegezeit führte zu keiner<br />
wesentlichen Einschränkung der Befundung.<br />
Hinsichtlich mikrobiologischer<br />
und toxikologischer Befunde konnten<br />
ergaben sich bei den radiologischen Untersuchungen<br />
keine Anhaltspunkte. Organe,<br />
die bei längerer Leichenliegezeit<br />
bereits bei der Obduktion die Zeichen<br />
fortgeschrittener Fäulnis aufwiesen und<br />
nur eingeschränkt zu beurteilen waren,<br />
konnten mittels der radiologischen Verfahren<br />
noch hinreichend befundet werden.<br />
Diskussion und<br />
Schlussfolgerungen<br />
Mittels Computertomographie und<br />
Magnetresonanztomographie konnten<br />
bereits vor der Obduktion zahlrei-
Jachau, Heinrichs und Krause<br />
Computertomographie und Magnetresonanztomographie in der postmortalen Diagnostik<br />
che relevante makroskopische Befunde<br />
nachgewiesen werden. Insbesondere<br />
hinsichtlich einer vorliegenden Entzündung<br />
des Lungengewebes bei unauffälliger<br />
Vorgeschichte, konnte bereits vor der<br />
Obduktion die Verdachtsdiagnose der<br />
Leichenschau „Plötzlicher Kindstod“ in<br />
Frage gestellt werden. Insbesondere hinsichtlich<br />
der Erhebung der Hirnbefunde<br />
ist eine postmortale MRT-Befundung<br />
besonders günstig, da eine hinreichend<br />
sichere Diagnostik sofort möglich ist,<br />
während sowohl die makroskopische<br />
als auch die mikroskopische Befunderhebung<br />
im Rahmen der Obduktion eine<br />
Formalinfixierung des unsezierten Gehirns<br />
von mindestens zwei Wochen voraussetzt.<br />
Aussagen zum Vorliegen einer<br />
Blutung, der Lokalisation und Ausdehnung<br />
derselben oder dem Abriss/Einriss<br />
von Brückenvenen können so bereits<br />
frühzeitig nach der MRT erfolgen. Eine<br />
Exkulpierung der Eltern oder die Einleitung<br />
polizeilicher Ermittlungen sind<br />
somit zeitnah möglich.<br />
Hinsichtlich der Durchführbarkeit der<br />
postmortalen radiologischen Untersuchungen<br />
ist eine enge Zusammenarbeit<br />
zwischen <strong>Kinder</strong>radiologen, Staatsanwaltschaft<br />
und Rechtsmedizin notwendig,<br />
da auch einfache Vorraussetzungen<br />
wie der Leichentransport entsprechend<br />
den gesetzlichen und ethischen Normen<br />
gegeben sein müssen. Deshalb entschieden<br />
wir uns auch, das maximal Mögliche<br />
an zur Verfügung stehender radiologischer<br />
Untersuchungstechnik zu nutzen,<br />
ohne dabei außer acht zu lassen, dass ein<br />
konventionelles Röntgen hinsichtlich<br />
des Ausschlusses ossärer Läsionen ebenfalls<br />
sehr hilfreich sein kann.<br />
Mit dieser Studie sollte ein Beitrag<br />
zur Evaluation radiologische Methoden<br />
für die postmortale Befunderhebung gegeben<br />
werden. Es konnten sehr gute<br />
Übereinstimmungen zwischen den in<br />
der Bildgebung aufgefallenen Veränderungen<br />
und den histologisch gesicherten<br />
makroskopischen Befunden gezeigt<br />
werden. Die klassische Obduktion wird<br />
jedoch dadurch noch sehr lange Zeit<br />
in ihrer Bedeutung für die forensische<br />
Medizin, die Qualitätssicherung in der<br />
Medizin, für Bildung und Forschung<br />
nicht eingeschränkt oder gar verdrängt<br />
werden. Sie wird auch in absehbarer Zukunft<br />
letzte kontrollierende Instanz und<br />
forensische Beweisführung bleiben. Jedoch<br />
besteht ein Bedarf an ergänzenden<br />
Methoden, um den negativen Konsequenzen,<br />
welche die sinkenden Sektionszahlen,<br />
insbesondere bei Säuglingen und<br />
Kleinkindern mit sich bringen, entgegen<br />
zu wirken. Dafür eröffnet die postmortale<br />
Schichtbilddiagnostik bzw. Virtopsy©<br />
vielversprechende ergänzende Möglichkeiten.<br />
Mittels entsprechender Software<br />
gelingt inzwischen die Fusion der CT-<br />
und MRT-Aufnahmen zu einem Bild, aus<br />
dem die entsprechenden Organe auch<br />
mittels Mouseklick isoliert betrachtet<br />
werden können, was insbesondere für<br />
den Pädiater für differenzierte Fragestellungen<br />
und bei der Untersuchung von<br />
Geschwisterkindern hilfreich sein dürfte<br />
[4]. Es müssen aber noch eine Vielzahl<br />
von weiterführenden Untersuchungen<br />
durchgeführt werden.<br />
Bei Ablehnung einer Obduktion könnte<br />
der kombinierte Einsatz beider radiologischer<br />
Verfahren einen wertvollen<br />
Ersatz zur Gewinnung postmortaler Befunde<br />
darstellen. Zur Komplettierung<br />
107
108<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
derartiger Befunde ist über die Einholung<br />
einer Einwilligung zu gezielten Organbiopsien<br />
und zur Entnahme von Körperflüssigkeiten<br />
nachzudenken.<br />
Sterbe-<br />
alter<br />
Diagnose<br />
Leichenschau<br />
Diagnose<br />
CT/MRT<br />
Ergebnis<br />
Obduktion<br />
Histologie Übereinstimmung<br />
CT/MRT-<br />
Obduktion<br />
1 38 Mon. TU unbekannt TU unbekannt Ersticken Ersticken nein<br />
2 02 Mon. SIDS V.a. Pneumonie Pneumonie Pneumonie ja<br />
3 48 Mon. V.a. Ertrinken Ertrinken Ertrinken Ertrinken ja<br />
4 05 Mon. TU unbekannt V.a. Pneumonie Pneumonie Bronchopneumonie<br />
ja<br />
5 27 Tage V.a. SIDS V.a. Bronchitis Bronchitis Laryngobronchitis<br />
ja<br />
6 25 Mon. Ertrinken Ertrinken Ertrinken Ertrinken ja<br />
7 08 Mon. SIDS Tracheitis Ersticken Ersticken,<br />
Tracheitis<br />
hinsichtlich des NB<br />
8 01 Mon. V.a. SIDS keine TU keine TU Endokard- ja<br />
24 d<br />
fibroelastose<br />
9 58 Mon. Stichverletzung HerzbeutelHerzbeutelHerzbeutel- ja<br />
tamponadetamponadetamponade 10 11 Mon. SIDS V.a. Pneumonie V.a. Pneumonie Pneumonie ja<br />
11 07 Mon. keine Angaben V.a. Vorhofs- Trisomie 21, Herzfehl- ja<br />
eptumdefekt Herzfehlbildung bildung<br />
12 09 Mon. V.a. SIDS V.a. Pneumonie V.a. Pneumonie Pneumonie ja<br />
13 11 Mon. TU unbekannt V.a. Pneumonie Pneumonie Pneumonie ja<br />
14 03 Mon. Aspiration Osteochondro- zentrale DysreOsteochon- ja<br />
dysplasiegulation bei OD drodysplasie<br />
15 03 Std. TU unbekannt Unreife Unreife Unreife ja<br />
16 03 Mon. Ertrinken keine TU keine TU Ertrinken ja<br />
17 10 Mon. V.a. SIDS V.a. Pneumonie Pneumonie Pneumonie ja<br />
18 26 Mon. TU unbekannt V.a. Pneumonie V.a. Pneumonie Pneumonie ja<br />
19 09 Mon. SIDS V.a. Pneumonie Pneumonie Pneumonie ja<br />
20 07 Mon. TU unbekannt V.a. Pneumonie Pneumonie Pneumonie ja
Jachau, Heinrichs und Krause<br />
Computertomographie und Magnetresonanztomographie in der postmortalen Diagnostik<br />
Literatur<br />
1 Findeisen M, Vennemann M, Brinkmann B,<br />
Ortmann C, Jachau K, Schmidt B et al.: German<br />
study of sudden infant death (GeSID): design, epidemiological<br />
and pathological profile. Int J Legal<br />
Med 18 (2004) 163–169<br />
2 Jachau K, Heinrichs T, Kuchheuser W, Krause<br />
D, Wittig H, Schöning R, Beck N, Jackowski C:<br />
CT-und MRT-Untersuchungen am isolierten Leichenherzen.<br />
Vergleich der radiologischen mit den<br />
pathologisch-anatomischen Befunden. Rechtsmedizin<br />
14 (2) (2004) 109–116<br />
3 Kleemann WJ, Bajanowski: Plötzlicher Tod im<br />
Säuglings- und Kindesalter. In: Brinkmann B, Madea<br />
B: Handbuch gerichtliche Medizin, Springer<br />
Verlag (2004) 1071–1115<br />
4 Preim B, Cordes J, Heinrichs T, Krause D, Jachau<br />
K: Quantitative Bildanalyse und Visualisierung<br />
für die Analyse von post-mortem Datensätzen. Informatik<br />
aktuell, Springer Verlag (2005), in press<br />
5 Thali MJ, Yen K, Schweizer W, Vock P, Boesch<br />
C, Ozdoba C, Schroth G, Ith M, Sonnenschein M,<br />
Doernhoefer T, Scheurer E, Plattner T, Dirnhofer<br />
R: Virtopsy, a New Imaging Horizon in Forensic<br />
Pathology: Virtual Autopsy by Postmortem Multislice<br />
Computed Tomography (MSCT) and Magnetic<br />
Resonance Imaging (MRI)- a Feasibility Studie. J<br />
Forensic Sci 48 (2) (2003) 386–403<br />
Autor:<br />
Dr. med. Katja Jachau<br />
Institut für Rechtsmedizin der Otto-von-Guericke<br />
Universität Magdeburg<br />
Leipziger Straße 44, 39120 Magdeburg<br />
Telefon (03 91) 6 71 78 75, Telefax (03 91) 6 71 58 10<br />
Katja.Jachau@medizin.uni-magdeburg.de<br />
109
Zusammenfassung<br />
Paditz, Mosshammer und Kramer<br />
Trauer nach Plötzlichem Säuglingstod: Folgen und Hilfsmöglichkeiten<br />
Trauer nach Plötzlichem Säuglingstod: Folgen und<br />
Hilfsmöglichkeiten<br />
Paditz E 1 , Mosshammer A 2 , Kramer J 3<br />
1 Klinik und Poliklinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der<br />
Technischen Universität Dresden<br />
2 Schlafmedizin Sachsen e. V. (Trägerverein des Programmes zur Prävention des plötzlichen Säuglingstodes<br />
in Sachsen)<br />
3 Sächsisches Staatsministerium für Soziales<br />
Der Plötzliche Säuglingstod ist mit<br />
großem Abstand die Todesart, die die<br />
gravierendsten Folgen bei den Hinterbliebenen<br />
hinterlässt, da er plötzlich<br />
und unerwartet eintritt sowie da keine<br />
Ursache benannt werden kann. Im Vergleich<br />
zu anderen Todesarten (Unfall,<br />
Mord, Suizid, Krebs) zeigen die betroffenen<br />
Eltern mehr als zehnfach höhere<br />
Werte in Angst- und Depressionsskalen,<br />
eine deutlich erhöhte Neigung<br />
zu vermehrtem Alkoholkonsum, eine<br />
erhöhte Herzinfarktinzidenz, eine erhöhte<br />
Scheidungsrate und Mortalität.<br />
Bei den Geschwister- und Folgekindern<br />
werden vermehrt Verhaltensstörungen<br />
und Folgen von Overprotektion<br />
bzw. von Zurückweisung beobachtet.<br />
Effektiv sind der Einsatz von gut geschultem<br />
Personal (Notärzte, Polizei,<br />
Kriseninterventionsdienste, Beratungsärzte,<br />
Traumapsychologen), die<br />
zeitnahe kompetente Übermittlung<br />
des Autopsieergebnisses durch einen<br />
Arzt sowie die rasche Schuldentlastung<br />
und weitergehende professionelle proaktive<br />
psychologische Stützung der<br />
betroffenen Familien. Diese Aussagen<br />
stützen sich auf die weltweit größte<br />
Datenbank (674 Publikationen/25 391<br />
Hinterbliebene), die im Rahmen eines<br />
Fachgutachtens der Arbeitsgruppe<br />
„Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes“<br />
des Sächsischen Staatsministeriums<br />
für Soziales nach den Kriterien<br />
der „Evidence based Medicine“ angelegt<br />
und kritisch analysiert wurde.<br />
In Sachsen ist die Häufigkeit des Plötzlichen<br />
Säuglingstodes (SID, sudden infant<br />
death) parallel zu einer zielgruppenorientierten<br />
Informationskampagne seit 1994<br />
deutlich zurückgegangen. 1992 starben<br />
noch 21 Säuglinge infolge SID, dies entsprach<br />
einer Häufigkeit von 0,83 Fällen<br />
pro 1 000 Lebendgeburten (21/25.298).<br />
Im Jahre 2002 lag die SID-Häufigkeit in<br />
Sachsen bei 0,25/1 000 (8/31.518). Im<br />
Regierungsbezirk Dresden, in dem das<br />
Präventionsprogramm im Jahre 1994<br />
in allen Entbindungseinrichtungen mit<br />
der Ausgabe von Informationsblättern<br />
für die Eltern begonnen wurde, konnte<br />
in den Jahren 1997 und 1999 bzw. 1998,<br />
2001 und 2002 das weltweit niedrigste<br />
Häufigkeitsniveau der Niederlande von<br />
0,11/1 000 mit 0,08/1 000 bzw. 0,16/1 000<br />
unterschritten bzw. nur knapp verfehlt<br />
werden.<br />
Es ist nachgewiesen worden, dass derartige<br />
Präventionsprogramme die Häu-<br />
111
112<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
figkeit des Plötzlichen Säuglingstodes<br />
um reichlich 80 % vermindern können,<br />
vollkommen beseitigen lässt sich das tragische<br />
Problem allerdings leider nicht,<br />
da die Ursache des SID bisher nicht<br />
gefunden werden konnte. In Sachsen<br />
sind zwischen 1990 bis 2003 insgesamt<br />
182 Säuglinge infolge SID gestorben. Es<br />
kursiert immer wieder einmal die Vorstellung,<br />
dass Trauer und Geburt zum<br />
Lebenskreis gehören, dass die Zeit alle<br />
Wunden heilt und dass es deshalb – gerade<br />
beim Tod eines Säuglings – für die<br />
Hinterbliebenen weniger schlimm sei als<br />
für die Hinterbliebenen, deren <strong>Kinder</strong><br />
oder Angehörigen nach anderen Todesarten<br />
plötzlich (z. B. nach Unfall, Mord<br />
oder Suizid) oder nach langfristig verlaufender<br />
Erkrankung (z. B. nach einer<br />
Krebserkrankung) gestorben sind.<br />
Vor dieser unsicher erscheinenden Datenlage<br />
aus bagatellisierenden Vermutungen<br />
und gravierenden Fallbeschreibungen<br />
mit langfristigen unbewältigten<br />
Trauerreaktionen hat die Arbeitsgruppe<br />
„Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes“<br />
des Sächsischen Staatsministeriums<br />
für Soziales ein Fachgutachten in Auftrag<br />
gegeben, in dem geklärt werden werden<br />
sollte, ob der Plötzliche Säuglingstod<br />
vermehrt zu komplizierten Trauerreaktionen<br />
führt und ob es Interventionsmöglichkeiten<br />
mit nachgewiesener Wirksamkeit<br />
gibt.<br />
Methodik<br />
Im Zeitraum August bis Oktober 2004<br />
wurde über Medline®, über Internetsuchmaschinen<br />
sowie über das zentrale<br />
Bibliotheksverzeichnis der TU Dresden<br />
nach Publikationen, Büchern und Dis-<br />
sertationen zu folgenden Stichworten<br />
gesucht: „Plötzlicher Tod, Verlust eines<br />
Kindes, Normale und pathologische<br />
Trauer nach unerwarteten Todesfällen,<br />
SID-Betroffenen-Betreuung“ (Sudden<br />
Infant Death, Crib Death, Cot Death,<br />
Unexpected death, Unexpected Loss,<br />
Unnatural Death, Grief, Mourn, Bereav,<br />
Coping, Psycho). Außerdem wurden an<br />
der Universität Göttingen vier Dissertationen<br />
aus den Jahren 1998, 2000, 2001<br />
und 2002 zu SID-Folgen eingesehen.<br />
Parallel dazu wurden mehrere Experten<br />
sowie mehrere betroffene Familien in<br />
halbstandardisierten Settings interviewt.<br />
Die Studien wurden kritisch nach EBM-<br />
Kriterien (Evidence based Medicine)<br />
analysiert. Expertenmeinungen ohne<br />
fundierte Datenbasis haben demnach<br />
das niedrigste Evidenzniveau, von mehreren<br />
Experten vorgetragene Meinungen<br />
erhöhen das Evidenzniveau nicht. Kasuistische<br />
Darstellungen liefern eindrucksvolle<br />
Berichte über einzelne Schicksale<br />
sowie über die beteiligten Handlungsträger.<br />
Quantifizierbare Studien mit Berichten<br />
über definierte Fallzahlen Hinterbliebener<br />
und deren Reaktionen erhöhen<br />
die Wahrscheinlichkeit, dass die Realität<br />
wahrheitsgemäß abgebildet wird. Auf<br />
Grund des großen Leidensdruckes und<br />
der hohen Emotionalität des Themas erschien<br />
es uns aus ethischer Sicht eher weniger<br />
wahrscheinlich, dass randomisierte<br />
Fall-Kontroll- oder prospektive Interventionsstudien<br />
zu diesem Thema zu finden<br />
sein werden.<br />
Ergebnisse<br />
Im Zeitraum 1972 bis 2004 ließen<br />
sich 674 Publikationen (620 Beiträge in
Paditz, Mosshammer und Kramer<br />
Trauer nach Plötzlichem Säuglingstod: Folgen und Hilfsmöglichkeiten<br />
Zeitschriften, 50 Monografien, vier Dissertationen)<br />
zu den o. g. Stichpunkten<br />
finden. In 232 Arbeiten fanden sich zumindest<br />
Fallbeschreibungen mit Aussagen<br />
zu physischen, psychischen oder sozialen<br />
Reaktionen der Hinterbliebenen<br />
auf plötzliche und unerwartete Todesfälle<br />
im Kindesalter. 113 Arbeiten bezogen<br />
sich auf den Plötzlichen Säuglinstod, 119<br />
auf andere plötzliche Todesarten. Diese<br />
232 stammten aus folgenden Ländern:<br />
USA 112, GB 32, Deutschland 27, Australien<br />
20, Norwegen sieben, Dänemark<br />
sechs, Kanada vier, Irland, Schweden,<br />
Israel, Niederlande je zwei, Neuselland<br />
je zwei, Japan, Mexiko, Finnland, Belgien<br />
und Frankreich je einer. Aussagen zum<br />
Plötzlichen Säuglingstod fanden sich in<br />
113 Arbeiten:<br />
• 15 Arbeiten stellten Fallbeschreibungen<br />
dar,<br />
• auf der Grundlage von 54 Arbeiten<br />
sind quantifizierbare Aussagen über<br />
Gruppen und zum Teil auch über Interventionseffekte<br />
möglich sowie<br />
• 44 Arbeiten liefern allgemeine Erörterungen<br />
über Trauerprozesse, Trauerbewältigung<br />
und Rituale bei plötzlichen<br />
Todesfällen von <strong>Kinder</strong>n und<br />
Säuglingen, insbesondere durch SID.<br />
Diese Datenbasis bezieht sich auf<br />
25 391 Personen, deren Reaktionen auf<br />
einen plötzlichen Kindstodesfall untersucht<br />
wurden; dazu gehören Mütter,<br />
Väter, Adoptivmütter und -väter, Geschwister,<br />
Großeltern, Rettungspersonal,<br />
Notärzte, Hausärzte, <strong>Kinder</strong>ärzte,<br />
Frauenärzte, Hebammen, Polizisten und<br />
Rechtsanwälte. 4 946 dieser Personen<br />
bzw. Paare trauerten um ihr Kind nach<br />
Plötzlichem Säuglingstod.<br />
Innerhalb der gesamten Datenbasis<br />
fanden sich zwei randomisierte Fall-Kontroll-Studien<br />
mit insgesamt 249 beteiligten<br />
Personen (Murray et al. 1999; Mc-<br />
Donell et al. 1999). Außerdem gab es 15<br />
nichtrandomisierte Fall-Kontoll-Studien<br />
mit 1 188 untersuchten Personen bzw.<br />
Paaren.<br />
14 Studien (2 601 Einzelpersonen bzw.<br />
Paare) befassten sich mit Interventionseffekten.,<br />
13 Studien (2 317 Personen bzw.<br />
Paare) davon waren prospektiv angelegt.<br />
Nur eine dieser Studien war als prospektive<br />
interventionelle und randomisierte<br />
Fall-Kontroll-Studie angelegt worden<br />
(Murray et al. 1999; n = 144 Todesfälle<br />
im ersten Lebensjahr, davon 19 %, entsprechend<br />
n = 27 SID).<br />
Übereinstimmend zeigen alle Studien,<br />
dass der Plötzliche Säuglingstod mit<br />
Abstand kurz-, mittel- und langfristig zu<br />
wesentlich stärkeren psychischen, psychosomatischen<br />
und sozialen Folgen bei<br />
den Hinterbliebenen führt, als dies bei<br />
anderen Todesarten mit klar benennbarer<br />
Todesursache der Fall ist, wie z. B.<br />
nach Unfall, Suizid, Mord oder Krebs.<br />
Väter, Mütter und Geschwisterkinder<br />
trauern in gleicher Intensität, aber sehr<br />
oft oder nahezu regelhaft in anderen<br />
Erscheinungsformen und mit erheblich<br />
anderem zeitlichen Abstand vom auslösenden<br />
Ereignis. Weiterhin lassen sich<br />
definierte Risikopersönlichkeiten charakterisieren,<br />
die in besonderem Maße<br />
zu komplizierten Trauerreaktionen neigen.<br />
Die zeitnahe Schuldentlastung der betroffenen<br />
Familie hat einen zentralen<br />
Stellenwert, um eine Chronifizierung<br />
und Verselbständigung dieser Schuldgefühle<br />
zu limitieren. Die Grundlage für<br />
113
114<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
dieses Gespräch muss die kompetente<br />
Übermittlung des Autopsieergebnisses<br />
durch einen Arzt sein, um allen bis dahin<br />
kursierenden Gerüchten, Vermutungen<br />
und Beschuldigungen den Boden zu entziehen.<br />
Für die Einsatzkräfte vor Ort (Notarzt,<br />
Kriseninterventionsdienste, Polizei) ist<br />
nachgewiesen worden, dass die Schulung<br />
dieser Handlungsträger entscheidend<br />
zur Verbesserung der Betreuungsqualität<br />
der betroffenen Familien beitragen<br />
kann. Derartige Schulungen werden zur<br />
Zeit vorbereitet und in Kürze in wiederholten<br />
Fortbildungen angeboten. Es erscheint<br />
wichtig, darauf hinzuweisen, dass<br />
auf dem Totenschein eindeutig vermerkt<br />
werden sollte „ungeklärte Todesursache“,<br />
da klinisch und anamnestisch ein<br />
Invaginationsileus, eine perakute Meningoencephalitis,<br />
eine Stoffwechselerkrankung<br />
oder auch eine Hirnblutung<br />
nach Schütteltrauma nicht ausgeschlossen<br />
werden kann. Damit wird obligat<br />
die Polizei eingeschaltet – die gebeten<br />
werden sollte, in Zivil, im Zivilfahrzeug<br />
und ohne Sondersignal zum Einsatzort<br />
zu kommen – und die staatsanwaltlich<br />
angeordnete Autopsie ist damit weitestgehend<br />
sichergestellt. Für die Polizei werden<br />
seitens der Babyhilfe Deutschland<br />
(www.babyhilfe-deutschland.de) zur<br />
Zeit konkrete Handlungsempfehlungen<br />
zur Beschreibung der Auffinde- und Umgebungssituation<br />
erarbeitet, die dann<br />
über Dienstanweisungen und Schulungen<br />
allen Polizeidienststellen zugänglich<br />
gemacht werden sollen.<br />
An dritter Stelle steht die zeitnahe<br />
und möglichst proaktive professionelle<br />
psychologische Stützung der betroffenen<br />
Familien. In diesen Gesprächen geht es<br />
neben der Bewältigung des Verlustes vor<br />
allem um die Erzeugung von Verständnis<br />
für die unterschiedlichen Reaktionsmuster<br />
von Müttern, Vätern und Geschwisterkindern<br />
innerhalb der betroffenen<br />
Familien. Auf dieser Grundlage wird die<br />
Chance messbar erhöht, dass das Verständnis<br />
füreinander verbessert wird,<br />
so dass weniger komplizierte Trauerreaktionen<br />
zu erwarten sind. Es erscheint<br />
weiterhin nicht übertrieben, diese Familien<br />
auch nach der Geburt des ersten<br />
Folgekindes weiter zu unterstützen, damit<br />
die häufig beschriebenen Folgen von<br />
Overprotektion oder elterlicher Zurückweisung<br />
vermieden oder zumindest wesentlich<br />
reduziert werden.<br />
Diskussion<br />
Darf man Trauerreaktionen und entsprechende<br />
Interventionsansätze mit<br />
den Maßstäben der „Evidence based<br />
Medicine“ beurteilen? Die vorliegende<br />
umfassende Datenbasis zeigt, dass<br />
gerade auf dieser Grundlage nützliche<br />
Argumente gesammelt werden können,<br />
die darauf hinweisen, dass der Plötzliche<br />
Säuglingstod wesentlich stärkere<br />
Trauerreaktionen hervorruft als andere<br />
Kindstodesfälle mit klar benennbarer<br />
Ursache. Weiterhin lassen sich deutliche<br />
Belege finden, dass diese Folgen<br />
durch frühzeitige gezielte Interventionen<br />
limitiert werden können. Das Fachgutachten<br />
(Broschüre á 90 Seiten) kann<br />
im Internet eingesehen werden unter<br />
www.babyschlaf.de oder beim Erstautor<br />
kostenlos angefordert werden.<br />
Die Arbeitsgruppe „Prävention des<br />
Plötzlichen Säuglingstodes“ des Sächsischen<br />
Staatsministeriums für Sozi-
ales erarbeitet zur Zeit gemeinsam<br />
mit dem Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
(www.babyhilfe-deutschland.de) entsprechende<br />
Handlungsempfehlungen<br />
für Notärzte, Polizisten und Kriseninterventionsdienste<br />
und ist für weitere Anregungen<br />
sehr dankbar.<br />
Autor<br />
Paditz, Mosshammer und Kramer<br />
Trauer nach Plötzlichem Säuglingstod: Folgen und Hilfsmöglichkeiten<br />
Prof. Dr. med. Ekkehart Paditz<br />
Arbeitsgruppe Prävention des plötzlichen Säuglingstodes<br />
des Sächsischen Staatsministeriums für<br />
Soziales;<br />
Klinik und Poliklinik<br />
für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin<br />
der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus<br />
der Technischen Universität Dresden<br />
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden<br />
Telefon (03 51) 4 58 31 60<br />
Telefax (03 51) 4 58 57 72<br />
Ekkehart.Paditz@uniklinikum-dresden.de<br />
115
Einleitung<br />
Die vorliegende Studie zeigt auf, wie<br />
Eltern den Tod ihres schwerkranken<br />
Neugeborenen erleben und welche äußeren<br />
Umstände dieses Erleben beeinflussen.<br />
Darüber hinaus wird dargestellt,<br />
welche Faktoren, insbesondere die Miteinbeziehung<br />
in eine Entscheidung zur<br />
Beendigung der Intensivmaßnahmen,<br />
die Trauerreaktion beeinflussen. Ziel<br />
dieser Analyse ist eine zukünftige Verbesserung<br />
der Hilfsangebote für ähnlich<br />
betroffene Familien.<br />
Methodik<br />
Im Rahmen einer deskriptiven Kohortenstudie<br />
wurden alle Eltern, deren<br />
Neugeborenes im Zeitraum zwischen<br />
dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember<br />
2003 auf der neonatologischen<br />
Intensivstation des Klinikums Großhadern<br />
verstarb, einbezogen. Von den in<br />
diesem Fünf-Jahres-Zeitraum verstorbenen<br />
48 <strong>Kinder</strong>n nahmen Eltern zu 31<br />
<strong>Kinder</strong>n teil, davon 19 Elternpaare und<br />
zwölf Mütter. Zwei weitere <strong>Kinder</strong> wurden<br />
zwar lange Zeit intensivmedizinisch<br />
auf der Neugeborenenstation in Großhadern<br />
behandelt, verstarben aber in<br />
Wermuth und Schulze<br />
Vergleich von Trauerreaktionen bei Eltern<br />
Vergleich von Trauerreaktionen bei Eltern,<br />
deren neugeborene <strong>Kinder</strong> unter verschiedenen<br />
Bedingungen auf der neonatologischen Station<br />
verstorben sind<br />
Wermuth I, Schulze A<br />
Neonatologie, <strong>Kinder</strong>klinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen <strong>Kinder</strong>spital, Klinik und Poliklinik für<br />
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Großhadern, Klinikum der Universität München<br />
auswärtigen Kliniken. Mit den Eltern<br />
dieser beiden <strong>Kinder</strong> wurden ebenfalls<br />
Interviews geführt, in der statistischen<br />
Auswertung wurden sie jedoch nicht berücksichtigt.<br />
In einem ersten Anschreiben wurden<br />
die Eltern nach ausführlicher Beschreibung<br />
des Vorhabens um Teilnahme an<br />
der Studie gebeten. In einem Rückantwortbogen<br />
konnten die Eltern eine Teilnahme<br />
ablehnen oder zwischen der nur<br />
schriftlichen Teilnahme durch Ausfüllen<br />
des Fragebogens und der Teilnahme<br />
am Interview wählen. Acht Familien<br />
konnten weder durch Anschreiben noch<br />
telefonisch kontaktiert werden. Neun<br />
Personen (fünf Mütter, vier Väter) nahmen<br />
nur per Fragebogen teil, während<br />
41 Personen (26 Mütter, 15 Väter) auch<br />
an einem Interview teilnahmen. 30 Personen<br />
lehnten eine Teilnahme an der<br />
Studie vollständig ab (42 % der Väter<br />
und 18 % der Mütter), wobei vor allem<br />
emotionale sowie zeitliche Gründe eine<br />
Rolle spielten.<br />
Der fünfteilige Fragebogen beinhaltete<br />
Fragen zu persönlichen Angaben sowie<br />
zu Schwangerschaft und Geburt mit dem<br />
verstorbenen Kind. Im Hauptteil wurden<br />
die Eltern zu den ärztlichen Gesprächen<br />
sowie zu einem evtl. stattgefundenen Ent-<br />
117
118<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
scheidungsprozess zur Beendigung der<br />
Intensivmaßnahmen befragt. Hier wie<br />
auch bei der Frage nach Betreuung und<br />
Unterstützung nach dem Tod des Kindes<br />
wurden sowohl der Ist-Zustand als auch<br />
die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern<br />
erhoben. Der letzte Teil des Fragebogens<br />
beinhaltete ein validiertes Messinstrument,<br />
die Perinatal Grief Scale (PGS).<br />
Die Skala basiert auf einer ausgiebigen<br />
Literaturdurchsicht, einigen Items des<br />
Erweiterten Texas Grief Inventory und<br />
den „six key signs of grief“, die Kennel<br />
et al in ihrer Studie herausgearbeitet hatten.<br />
Die 33 Fragen wurden drei Subskalen<br />
zugeordnet, wobei die erste Subskala<br />
„Active Grief“ Items wie Traurigkeit,<br />
Sehnsucht nach dem Baby und Weinen<br />
um das Baby enthält und damit eine<br />
normale Trauerreaktion repräsentiert.<br />
Die zweite Subskala „Difficulty Coping“<br />
schließt Items ein, die verdeutlichen,<br />
dass die entsprechende Person Schwierigkeiten<br />
im Umgang mit dem täglichen<br />
Leben und anderen Leuten hat. Die dritte<br />
Subskala „Despair“ schließlich repräsentiert<br />
Gefühle wie Hoffnungslosigkeit<br />
und geringe Selbstschätzung, sodass die<br />
zweite und dritte Subskala als Ausdruck<br />
einer zunehmend schwereren Trauerreaktion<br />
aufgefasst werden können. Neben<br />
der PGS diente vor allem die von den Eltern<br />
selbst einzuschätzende Zeit, die der<br />
aktive Trauerprozess gedauert hatte, zur<br />
Erfassung der Trauerreaktion. Die Items<br />
wurden mittels Likert-Skala oder als dichotome<br />
Antwortmöglichkeit erfasst.<br />
Im Interview hatten die Eltern die<br />
Möglichkeit, Inhalte des Fragebogens<br />
zu vertiefen und eigene Anliegen zur<br />
Sprache zu bringen. Die mediane Gesprächsdauer<br />
betrug 2,63 Stunden (Mini-<br />
mum 1,5 Stunden, Maximum 4,5 Stunden),<br />
die Interviews fanden im Median<br />
36,97 Monate nach dem Tod des Kindes<br />
statt (Minimum 5,27 Monate, Maximum<br />
62,37 Monate). In 73 % fand das<br />
Gespräch entsprechend dem Wunsch<br />
der Eltern beim Befragten zu Hause statt,<br />
die anderen Teilnehmer wurden in den<br />
Räumen der Seelsorge im Klinikum<br />
Großhadern befragt. Alle Gespräche<br />
wurden von einer Interviewerin geführt,<br />
die nicht an der Behandlung der verstorbenen<br />
<strong>Kinder</strong> beteiligt war. Statistische<br />
Vergleiche erfolgten mit nonparametrischen<br />
Verfahren: Wilcoxon- oder Mann-<br />
Whitney-U-Test, exakter Test von Fischer<br />
bzw. der _ 2 -Test mit Kontinuitätskorrektur.<br />
Daten werden als Median; 25., 75.<br />
Perzentile aufgeführt, p < 0,05 wurde als<br />
statistisch signifikante Differenz gewertet.<br />
Ergebnisse<br />
Trauerintensität und -dauer<br />
Die Trauerintensität (PGS) der Eltern<br />
bei Abbruch der intensivmedizinischen<br />
Behandlung (58,00; 50,00, 73,75) wich<br />
nicht signifikant von derjenigen der<br />
Eltern ohne eine solche Entscheidung<br />
(66,00; 55,00, 71,00) ab. Dies galt auch<br />
für alle drei Subskalen der PGS. Auch die<br />
selbsteingeschätzte Dauer der Trauerphase<br />
war diesbezüglich nicht signifikant<br />
unterschiedlich.<br />
Der PGS-Score der Mütter (62,50;<br />
50,00, 85,75) war signifikant höher als<br />
derjenige der Väter (58,50; 50,50, 68,50;<br />
p = 0,01). Dieser Unterschied war auch<br />
bei Subskala „Difficulty Coping“ statistisch<br />
signifikant (p = 0,045). Die Trauer-
phase war bei den Müttern (6,00; 3,25,<br />
14,25) ebenfalls signifikant länger als bei<br />
den Vätern (3,50; 1,00, 12,00; p = 0,031).<br />
Eltern, die zum Zeitpunkt des Todes<br />
bereits ältere <strong>Kinder</strong> besaßen, hatten<br />
einen höheren PGS-Score (65,00; 55,00,<br />
80,00) als Eltern ohne <strong>Kinder</strong> (51,00;<br />
44,00, 66,00; p = 0,008). Eltern, die im<br />
Zeitraum zwischen dem Verlust und<br />
dem Interview noch ein Kind bekamen,<br />
hatten eine niedrigere Trauerintensität<br />
(59,00; 44,25, 66,00) als Eltern, die in<br />
dieser Zeit kein weiteres Kind mehr<br />
bekommen hatten (66,00; 54,50, 81,25;<br />
p = 0,038).<br />
Der zeitliche Abstand vom Tod des<br />
Kindes korrelierte negativ mit dem<br />
PGS-Score (Spearman-rho = –0,423,<br />
p = 0,035).<br />
Folgende Parameter hatten weder Einfluss<br />
auf die Trauerintensität noch auf<br />
die Dauer der Trauerphase: vorherige<br />
Fehlgeburten, Jahre unerfüllten <strong>Kinder</strong>wunsches,<br />
Stärke des <strong>Kinder</strong>wunsches<br />
vor der Schwangerschaft, Art der Reproduktion<br />
(assistiert/nicht-assistiert),<br />
Gestationsalter des Kindes, Lebensdauer<br />
des Kindes, Kind vor dem Tod gesehen,<br />
Körperkontakt zum Kind vor dem Tod,<br />
Alter der Eltern, Schulabschluss, Familienstand,<br />
Selbsteinschätzung der eigenen<br />
Religiosität.<br />
Weitere Unterschiede in der Trauerreaktion<br />
zwischen Müttern und Vätern<br />
Mütter gaben signifikant häufiger als<br />
Väter an, dass die Trauer Auswirkungen<br />
auf das soziale Umfeld gehabt habe<br />
(p = 0,028). Das Empfinden von Schuldgefühlen<br />
nach Miteinbeziehung in die<br />
Wermuth und Schulze<br />
Vergleich von Trauerreaktionen bei Eltern<br />
Entscheidung bzw. von Schuldgefühlen<br />
allgemein war nicht signifikant häufiger<br />
bei Müttern als bei Vätern. Der Wunsch<br />
nach einem Gesprächspartner (professionell<br />
oder aus Bekannten- oder Verwandtenkreis)<br />
war ebenfalls nicht signifikant<br />
unterschiedlich.<br />
Einfluss der subjektiv empfundenen<br />
Unterstützung auf die Trauerreaktion<br />
Eltern, die nach dem Tod des Kindes<br />
das Gefühl hatten, nicht ausreichend<br />
Unterstützung bekommen zu haben,<br />
gaben häufiger an, dass sich die Trauer<br />
auf das soziale Umfeld ausgewirkt habe<br />
(p = 0,042 bzw. p = 0,03). 60 % dieser<br />
Eltern dieser Untergruppe sagten, dass<br />
das Ereignis die (Ehe-)Partner einander<br />
näher gebracht habe, während in der ausreichend<br />
unterstützten Gruppe 95,5 %<br />
der Eltern sagten, dass sich die Partner<br />
durch das Ereignis näher gekommen<br />
seien.<br />
Evaluation der Bedürfnislage<br />
der Eltern<br />
Phase I: Gesprächs- und Entscheidungssituation<br />
49 der 50 Teilnehmer der Studie gaben<br />
an, ein Gespräch, in dem es um<br />
die Prognose ihres Kindes sowie um<br />
Überlegungen zur Reduktion der intensivmedizinischen<br />
Therapie ging, mit Ärzten<br />
der neonatologischen Station geführt<br />
zu haben. Insgesamt fand zu jedem Kind<br />
mindestens ein Gespräch statt. Vonseiten<br />
des Klinikums waren dabei vornehmlich<br />
der Leiter der Abteilung (24 von<br />
31, 74,4 %), der Oberarzt (16 von 31,<br />
119
120<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
51,6 %) und/oder ein Stationsarzt (elf<br />
von 31, 35,5 %) anwesend. In 29,0 %<br />
der Gespräche (neun von 31) wurde<br />
eine Krankenschwester, in 6,5 % (zwei<br />
von 31) auch ein Seelsorger hinzugezogen.<br />
Vonseiten der Eltern waren jeweils<br />
nur einmal (3,2 %) weitere Personen<br />
wie Großeltern des Kindes, Tanten oder<br />
Onkel des Kindes oder ältere Geschwisterkinder<br />
am Gespräch beteiligt. Es fiel<br />
auf, dass vor allem die Anwesenheit der<br />
Ärzte (34 von 35 = 97,1% beim leitenden<br />
Arzt der Abteilung, 25 von 29 = 86,2 %<br />
beim Oberarzt und 15 von 18 = 83,3 %<br />
beim Stationsarzt) sowie des Ehepartners<br />
(40 von 40 = 100 %) von fast allen<br />
Eltern als hilfreich eingeschätzt wurde.<br />
Bei 32,3 % (zehn von 31) der Gespräche<br />
war das betreffende Neugeborene mit<br />
im Raum. Dies wurde von sechs Eltern<br />
(von zwölf, 50 %) als gar nicht beeinflussend,<br />
von den übrigen sechs Eltern (von<br />
zwölf, 50 %) als positiv empfunden. Die<br />
Gespräche fanden vor allem am Bett<br />
des Kindes (15 von 30, 30 %) oder im<br />
Zimmer der Mutter (15 von 30, 30 %),<br />
gelegentlich aber auch im Arzt- oder<br />
Stationszimmer (elf von 30, 23,4 %)<br />
statt. 44 der 47 Eltern (93,6 %) waren<br />
mit der Gesprächsumgebung zufrieden,<br />
48 von 48 Eltern (100 %) befanden den<br />
Zeitpunkt, zu dem das Gespräch stattfand,<br />
als angemessen.<br />
49 von 49 bzw. 47 von 47 Teilnehmern<br />
stimmten zu, dass die Informationsvermittlung<br />
verständlich war und die<br />
diagnostischen Einzelinformationen in<br />
koordinierter Weise weitergegeben wurden.<br />
Das Ansprechen von positiven und<br />
negativen Aspekten des <strong>Gesundheit</strong>szustandes<br />
ihres Kindes (drei von 48, 6,3 %)<br />
sowie von Zukunftsfragen (vier von 48,<br />
8,4 %) hatten einige Eltern als zu wenig<br />
empfunden. acht von 46 Teilnehmern<br />
(17,4 %) gaben an, dass nicht auf die<br />
Vermeidung medizinischer Fachsprache<br />
geachtet worden sei.<br />
97,9 % der Eltern (47 von 48) erachteten<br />
zur besseren Einschätzung der Situation<br />
ihres Kindes die mündliche Erläuterung<br />
des Krankheitszustandes als<br />
hilfreich. Zudem wurden aber auch die<br />
Demonstration und Erklärung von Röntgen-<br />
(zehn von 13, 76,9 %) oder Ultraschallbildern<br />
(22 von 25, 88,0 %), schematische<br />
Darstellungen (acht von zehn,<br />
80 %) oder die Nennung von konkreten<br />
Prozentzahlen (19 von 28, 67,9 %) als<br />
hilfreich eingeschätzt.<br />
Eltern, die Informationen zu Ressourcen,<br />
wie z. B. zu einem Seelsorger, einem<br />
Psychologen, einer Selbsthilfegruppe,<br />
entsprechende Literatur etc. erhalten<br />
hatten (24 von 48, 50 %), waren eher der<br />
Meinung, dass diese auch hilfreich waren<br />
(16 von 21, 76,1 %), während Eltern,<br />
die keine Informationen erhalten hatten<br />
(24 von 48, 50 %), in 54,6 % (zwölf von<br />
22) der Meinung waren, dass diese auch<br />
nicht erforderlich waren. Auf eine andere<br />
Frage wünschten sich aber 46,2 % (6 von<br />
13) der Eltern die Vermittlung zu einem<br />
Psychologen und 31,3 % (fünf von 16)<br />
der Eltern den Kontakt zu ähnlich betroffenen<br />
Eltern.<br />
91,7 % (44 von 48) der Eltern meinten,<br />
dass mit ihnen ausreichend über Details<br />
des Sterbeprozesses gesprochen worden<br />
sei, drei Personen (6,3 %) sagten, dass<br />
es eher zu wenig gewesen sei, und eine<br />
Person (2,1 %) hatte das Gefühl, dass das<br />
Gespräch über den Sterbeprozess zu ausführlich<br />
bzw. belastend gewesen sei.
Bei der Frage, ob die Eltern Furcht<br />
vor plötzlichen unerwarteten EreignisEreignissen oder dem Leiden ihres Kindes im<br />
Sterbeprozess empfunden hatten, ergab<br />
sich ein sehr gemischtes Bild: 28 bzw. 29<br />
der 49 Eltern (57,1 bzw. 60,4 %) gaben<br />
an, keine Furcht vor plötzlichen unerwarteten<br />
Ereignissen bzw. dem Leiden<br />
ihres Kindes gehabt zu haben. Hingegen<br />
bejahten 43 von 49 der Teilnehmer<br />
(87,7 %) die Frage, ob sie Angst davor<br />
gehabt hätten, dass ihr Kind hätte leiden<br />
müssen, wenn es weiter am Leben geblieben<br />
wäre. Diese Angst habe vor allem<br />
auch ihre Einstellung gegenüber der Beendigung<br />
der künstlichen lebensverlängernden<br />
Maßnahmen beeinflusst.<br />
Von den Eltern der 24 <strong>Kinder</strong>, bei denen<br />
künstliche lebensverlängernde Maßnahmen<br />
beendet oder nicht eingesetzt<br />
wurden in der Annahme, dass diese dem<br />
Kind bei der Schwere der Grunderkrankung<br />
nicht helfen konnten, gaben 34<br />
(von 39 Antworten, 91,9 %) an, dass<br />
es sich um die Beendigung der künstlichen<br />
maschinellen Beatmung gehandelt<br />
habe. Sieben der 39 Personen meinten,<br />
dass auch andere Therapieformen wie<br />
z. B. eine antibiotische Behandlung oder<br />
andere Medikamente abgesetzt worden<br />
seien. Die Eltern waren der Meinung,<br />
dass sie angemessen in die Entscheidung<br />
miteinbezogen wurden (37 von 39,<br />
94,9 %).<br />
92,1 % der Eltern (35 von 39) gaben<br />
an, die Miteinbeziehung in die Entscheidung<br />
nicht zu bedauern, und 84,6 % der<br />
diesbezüglich befragten Personen (33 von<br />
39) sagten, dass sie keine Schuldgefühle<br />
wegen der getroffenen Entscheidung gegehabt hätten, wobei es diesbezüglich keinen<br />
signifikanten Unterschied zwischen<br />
Wermuth und Schulze<br />
Vergleich von Trauerreaktionen bei Eltern<br />
Müttern und Vätern gab. Demgegenüber<br />
meinten 17 von 38 Eltern (44,7 %), sich<br />
in der Situation überfordert gefühlt zu<br />
haben. 17 % der Frauen und 5,6% der<br />
Männer gaben an, sich generell schuldig<br />
für den Tod ihres Kindes zu fühlen.<br />
Sieben der 39 Teilnehmer (17,9 %)<br />
hatten bei der Entscheidung Verwandte<br />
oder enge Freunde zu Rate gezogen,<br />
was dann auch von den entsprechenden<br />
Eltern als hilfreich empfunden wurde.<br />
Keine der Personen hatte sich mit Eltern<br />
besprochen, die in der Vergangenheit in<br />
einer ähnlichen Situation gewesen waren,<br />
wobei vier der 39 Eltern (10,3 %)<br />
angaben, dass sie dies als hilfreich empfunden<br />
hätten, wenn es ermöglicht worden<br />
wäre. Die Frage, ob die Entscheidung<br />
mit einem Seelsorger besprochen wurde,<br />
bejahten drei der 39 Eltern (7,7 %), und<br />
von den anderen 36 Personen gaben vier<br />
(11,1 %) an, dass sie ihre Entscheidung<br />
gerne mit einem Seelsorger besprochen<br />
hätten. Alle Eltern (39 von 39) hatten<br />
bei der Entscheidung das Gefühl gehabt,<br />
dass sie im Einvernehmen mit Ärzten<br />
und Schwester getroffen worden war.<br />
Phase <strong>II</strong>: Betreuung der Eltern<br />
vor, während und nach dem Tod<br />
des Kindes<br />
Zum Zeitpunkt des Todes des Neugeborenen<br />
lagen 19 Frauen noch stationär<br />
auf der Wochenbettstation. Die<br />
Unterbringung fand in zwölf der 19 Fälle<br />
(63,2 %) in Einzelzimmern statt, was<br />
von zehn der Mütter (83,3 %) als positiv<br />
empfunden wurde. Nur zwei Frauen<br />
(16,7 %) fühlten sich insbesondere in<br />
Anbetracht ihrer Situation isoliert. Drei<br />
der sebhs Mütter, die in Mehrbettzim-<br />
121
122<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
mern untergebracht waren, empfanden<br />
diese Umgebung nur teilweise als angemessen,<br />
da die Konfrontation mit anderen<br />
Mütter und deren gesunden Babys<br />
Schwierigkeiten bereitete.<br />
Die letzten Stunden verbrachten<br />
91,1 % (41 von 45) der Eltern am Bett<br />
ihres Kindes auf Intensivstation, nur<br />
vier Mütter (8,9 %) ließen sich das Kind<br />
auf ihr Zimmer bringen. In drei von 26<br />
Antworten (11,5 %) wurde die Umgebung<br />
als nicht angemessen beurteilt, wobei<br />
alle diese Teilnehmer die letzte Zeit<br />
auf Intensivstation verbracht hatten. Als<br />
Grund wurde die Anwesenheit anderer<br />
Eltern genannt, die als fremd und störend<br />
erlebt wurden. Elf der 35 Personen<br />
(31,4 %), die nach der von ihnen bevorzugten<br />
Umgebung befragt wurden,<br />
gaben an, dass sie sich einen separaten<br />
Raum, „einen Ort zum Abschiednehmen“<br />
gewünscht hätten. Eine Mutter<br />
hätte die letzten Stunden mit ihrem Kind<br />
gerne zu Hause verbracht. 95,9 % (46<br />
von 48) Eltern fanden, dass sie in dieser<br />
schwierigen Situation ausreichend Gesprächsmöglichkeiten<br />
vonseiten der Ärzte<br />
und Schwestern angeboten bekommen<br />
hatten. 23 der 31 <strong>Kinder</strong> (74,2 %)<br />
wurden vor ihrem Tod noch getauft. Der<br />
Rahmen der Taufe wurde von 33 der 34<br />
anwesenden Eltern (97,1 %) als angemessen<br />
und hilfreich empfunden.<br />
30 der 50 befragten Eltern (60 %)<br />
(hiervon zwölf der 19 Väter (63,2 %)<br />
und 18 der 31 Mütter (58,1 %)) waren<br />
anwesend, als ihr Kind verstarb, was von<br />
allen Personen als positiv empfunden<br />
wurde. Von denjenigen Eltern, die nicht<br />
anwesend waren, hätten sich 75 % (15<br />
von 20) im Nachhinein gewünscht, in<br />
diesem Moment doch bei ihrem Kind<br />
gewesen zu sein. 29 der 31 <strong>Kinder</strong><br />
(93,5 %) verstarben auf der neonatologischen<br />
Intensivstation, was von 87,8 %<br />
der Eltern (43 von 49) als angemessen<br />
beurteilt wurde. Ähnlich wie bei der Frage<br />
nach einer angemessenen Umgebung<br />
während der letzten Stunden mit dem<br />
Kind empfanden sechs Eltern (von 40,<br />
15 %) die Anwesenheit anderer Eltern<br />
und Babys als störend. Diejenigen zwei<br />
Elternpaare, deren Kind im Zimmer der<br />
Mutter verstarb, waren mit ihrer Situation<br />
zufrieden.<br />
In 58 % der Antworten (29 von 50)<br />
gaben die Eltern an, ihr Kind im Arm<br />
gehalten oder gestreichelt zu haben, als<br />
es verstarb. Dies wurde durchweg als<br />
positiv beurteilt. Diejenigen Eltern, die<br />
sich nicht dazu durchringen konnten, in<br />
dieser Situation Körperkontakt zu ihrem<br />
Kind zu halten (21 von 50, 42 %), hätten<br />
sich diesen in 78,9 % (15 von 19) im<br />
Nachhinein gewünscht.<br />
Betreut wurden die Eltern in 20 Fällen<br />
von anwesenden Ärzten und Schwestern.<br />
Bei vier <strong>Kinder</strong>n war auch ein Seelsorger<br />
anwesend. Die Anwesenheit des<br />
Ehepartners wurde in 23 der 24 Antworten<br />
(95,8 %) als hilfreich empfunden,<br />
diejenige von Arzt oder Schwester in<br />
65,2 % (15 von 23) bzw. 52,9 % (neun<br />
von 17). Eltern, die in dieser Situation<br />
mit ihrem Kind allein gewesen waren,<br />
hatten sich dies anscheinend bewusst so<br />
eingerichtet, da nur einzelne Personen<br />
den Wunsch nach einer anderen nicht<br />
anwesenden Person äußerten. 13 von 49<br />
Teilnehmern n (26,5 %) gaben an, ihr<br />
Kind nach dessen Tod selbst versorgt zu<br />
haben. Von den übrigen Teilnehmern gaben<br />
sieben (von 33 Antworten, 21,2 %)
an, sich dies im Nachhinein gewünscht<br />
zu haben. 96,6 % (28 von 29 Befragten)<br />
sagten, dass sie ausreichend Zeit bekommen<br />
hatten, um von ihrem Kind Abschied<br />
zu nehmen.<br />
25 von 29 Befragten (86,2 %) befanden,<br />
dass sie bei nach dem Tod des<br />
Kindes anfallenden Verwaltungsformalitäten<br />
ausreichend unterstützt worden<br />
waren.<br />
Auffällig war, dass das Bedürfnis nach<br />
einem Gesprächspartner in den ersten<br />
sechs Monaten nach dem Tod des Kindes<br />
sehr geteilt war, wobei acht der 19<br />
Väter (42,1 %) und 21 von 31 Müttern<br />
(67,7 %) angaben, kein Bedürfnis nach<br />
einem Gesprächspartner gehabt zu haben.<br />
Im Anschluss an das erste halbe Jahr<br />
nach dem Verlust verschob sich diese<br />
Antwort etwas zugunsten des Bedürfnisses<br />
nach einem Gesprächspartner: zehn<br />
der 18 Väter (55,6 %) und 22 der 30 Mütter<br />
(73,3 %) hatten jetzt den Wunsch<br />
nach einem Gesprächspartner. Sowohl<br />
bei Müttern als auch bei Vätern wurde<br />
dieser Wunsch für den zweiten Zeitraum<br />
häufiger genannt. In fast allen Fällen wurde<br />
das Bedürfnis nach einem Gesprächspartner<br />
auch erfüllt (34 von 47, 72,4 %),<br />
jedoch weniger bei den Vätern (61,1 %)<br />
als bei den Müttern (79,3 %). 55,0 % der<br />
Mütter (elf von 20) und 22,2 % der Väter<br />
(zwei von neun) gaben an, dass es bestimmte<br />
Zeitpunkte gebe, an denen das<br />
Bedürfnis nach einem Gespräch besonders<br />
groß sei. Hier wurden der errechnete<br />
Geburtstermin, die Jahrestage von<br />
Geburt oder Tod des Kindes sowie Feste<br />
und Feiertage genannt.<br />
Die von dem Verlust betroffenen Eltern<br />
nahmen in 26 % (13 von 50 Per-<br />
Wermuth und Schulze<br />
Vergleich von Trauerreaktionen bei Eltern<br />
sonen) die Möglichkeit wahr, sich mit<br />
ähnlich betroffenen Personen auszutauschen,<br />
wobei dies 19 der 50 (38 %) Teilnehmer<br />
gewünscht hatten, hiervon 15<br />
Mütter. Ebenso verhielt es sich mit dem<br />
Austausch in einem Netzwerk oder einer<br />
Selbsthilfegruppe, was von 22,3 % der<br />
Eltern (elf von 49) gewünscht wurde.<br />
Dabei gaben die Eltern an, dass nicht<br />
der Mangel an Informationen zu diesen<br />
Gruppen oder Institutionen ausschlaggebend<br />
für das Nichtaufsuchen war.<br />
Insgesamt fühlten sich 91,6 % der Eltern<br />
(33 von 36) in den ersten sechs Monaten<br />
nach dem Tod ihres Babys sowie<br />
89,6 % (43 von 48) im nachfolgenden<br />
Zeitraum ausreichend unterstützt. Von<br />
den 43 Personen, die die Frage bezüglich<br />
der im Klinikum Großhadern stattfindenden<br />
Trauerfeier beantworteten, gaben<br />
14 (32,6 %) an, dass sie an der Trauerfeier<br />
für die verstorbenen <strong>Kinder</strong> im<br />
Klinikum Großhadern teilgenommen<br />
hatten. Bei den Eltern, die nicht zu der<br />
Trauerfeier gekommen waren, hatten<br />
vornehmlich terminliche Gründe oder<br />
eine lange Anreise eine Rolle gespielt.<br />
In einigen Fällen wurde aber auch die<br />
Konfrontation mit der Institution Klinikum<br />
als belastend empfunden. Mütter<br />
nahmen häufiger (37 % im Gegensatz<br />
zu 25 % der Väter) an der Trauerfeier<br />
teil und empfanden diese auch eher als<br />
hilfreich (88,9 % im Gegensatz zu 75 %<br />
der Vätern).<br />
Vier der 31 <strong>Kinder</strong> wurden anonym<br />
beerdigt, was von den Eltern auch mit<br />
einem gewissen zeitlichen Abstand noch<br />
als richtige Entscheidung beurteilt wurde.<br />
Alle anderen Eltern hatten ihr Kind<br />
mittels Erd- oder Urnenbestattung beigesetzt.<br />
123
124<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
36 % der Befragten (18 von 50) gaben<br />
an, nach dem Tod des Kindes noch<br />
einmal oder regelmäßig Kontakt zur neonatologischen<br />
Station gehabt zu haben,<br />
wohingegen 56,2 % der Eltern (27<br />
von 48) angaben, dass sie sich einen<br />
weiteren Kontakt, insbesondere zu den<br />
behandelnden Ärzten und Schwestern<br />
gewünscht hätten.<br />
Phase <strong>II</strong>I: Trauerprozess<br />
Als aktiver Trauerprozess wurde die<br />
Zeit definiert, in der die Trauer den<br />
Hauptteil des Tages und der Gedanken<br />
einer Person einnahm und sie/ihn daran<br />
hinderte, ihren täglichen Aktivitäten<br />
wie gewohnt nachzugehen. Nach<br />
Auswertung von 32 Antworten ergab<br />
sich ein Median von sechs Monaten,<br />
wobei das Minimum bei null und das<br />
Maximum bei 36 Monaten lag. 30 der<br />
50 Eltern (62,5 %) gaben an, dass sie negativ<br />
besetzte bildliche Eindrücke vom<br />
Aufenthalt ihres Babys auf der neonatologischen<br />
Intensivstation in ihrer Erinnerung<br />
hätten, wobei sehr oft das eigene<br />
Kind in schlechtem <strong>Gesundheit</strong>szustand<br />
sowie das Kind im Inkubator „mit den<br />
vielen Schläuchen“ geschildert wurde.<br />
64,1 % der Eltern (25 von 39) berichteten<br />
von positiven bildlichen Eindrücken<br />
ihres Kindes in der Erinnerung, die vor<br />
allem durch den Anblick des zufriedenen<br />
Babys und den Körperkontakt mit ihm<br />
geprägt waren.<br />
78,3 % der Eltern (36 von 46) meinten,<br />
dass sich die Beziehung zu ihrem (Ehe-<br />
)partner seit dem Tod des Kindes verändert<br />
habe, wobei dies mehr Mütter (24<br />
von 29, 82,8 %) als Väter (zwölf von 17,<br />
70,6 %) empfanden. Von den 36 Eltern<br />
gaben 29 (82,9 %) an, dass sie das Ereignis<br />
einander näher gebracht habe. Sechs<br />
Personen (17,1 %) gaben an, dass sie sich<br />
durch das Ereignis vom Partner entfernt<br />
hätten. In 22 von 39 Antworten (56,4 %)<br />
bejahten Eltern die Frage, ob sich ihre<br />
Trauer um das verstorbene Baby auf<br />
die Geschwisterkinder ausgewirkt hätte.<br />
Hier schilderten die Eltern eher positive<br />
Veränderungen wie z. B. das bewusstere<br />
Glück über die gesunden lebenden <strong>Kinder</strong>.<br />
41,7 % der Eltern (20 von 48) meinten,<br />
dass sich ihre Trauer auch auf das<br />
soziale Umfeld ausgewirkt habe, wobei<br />
dies von 17 der 31 weiblichen Teilnehmer<br />
(54,9 %) und in 3 der 17 Antworten<br />
(17,6 %) von männlichen Teilnehmern<br />
angegeben wurde. Die Eltern sagten,<br />
dass sich nach dem Tod des Kindes der<br />
Freundes- oder Bekanntenkreis geändert<br />
habe, einige Eltern gaben an, dass auch<br />
ihr berufliches Umfeld betroffen gewesen<br />
sei.<br />
79,2 % der 48 Eltern, die Erinnerungsstücke<br />
ihres Kindes besaßen, bestätigten,<br />
dass ihnen diese in der Trauerphase geholfen<br />
hätten, wobei den Müttern diese<br />
Dinge wichtiger erschienen (26 von 31<br />
Müttern (83,8 %) bzw. 12 von 17 Vätern<br />
(70,6 %) bejahten diese Frage). Insbesondere<br />
Fotos des Kindes waren den Eltern<br />
hilfreich, aber auch Fuß- oder Handabdruck<br />
oder eine Haarlocke des Kindes<br />
hätten sich viele Eltern gewünscht.
Literatur<br />
1. Benfield DG, Leib SA, Vollman JH: Grief reresponse of parents to neonatal death and parent<br />
participation in deciding care. Pediatrics 62 (1978)<br />
171–177<br />
2. Giles PFH: Reactions of Women to Perinatal<br />
Death. Aust. N.Z.J. Obstet Gynaecol 10 (1970)<br />
207–210<br />
3. Kennell JH, Slyter H, Klaus MH: The mourning<br />
response of parents to the death of a newborn<br />
infant. N Eng J Med 283 (1970) 344–349<br />
4. Levetown M, Pollack MM, Cuerdon TT, Ruttimann<br />
UE, Glover JJ: Limitations and withdrawals<br />
of medical intervention in pediatric critical care.<br />
JAMA 272 (1994)<br />
5. Peppers LG: Maternal reactions to involuntary<br />
fetal/infant death. Psychiatry 43 (1980) 155–159<br />
6. Potvin L, Lasker J, Toedter L: Measuring grief:<br />
a short version of the perinatal grief scale. J Psychopathol<br />
Behav Assessment 11 (1989) 29–45<br />
7. Reilly-Smorawski B, Armstrong AV, Catlin EA:<br />
Bereavement support for couples following death<br />
of a baby: program development and 14-year exit<br />
analysis. Death Stud 26 (2002) 21–37<br />
8. Robinson M, Baker L, Nackerud L: The relarelationship of attachment theory and perinatal loss.<br />
Death Stud 23 (1999) 257–270<br />
9. Rowe J, Clyman R, Green C, Mikkelsen C,<br />
Haight J, Ataide L: Follow-up of families who experience<br />
a perinatal death. Pediatrics 62 (1978)<br />
166–170<br />
10. Seecharan GA, Andresen EM, Norris K, Toce<br />
SS: Parents’ Assessment of Quality of Care and<br />
Grief Following a Child’s Death. Arch Pediatr AdoAdolesc Med 158 (2004) 515–520<br />
11. Toedter LJ, Lasker JN, Alhadeff JM: The perinatal<br />
grief scale: development and initial validation.<br />
Am J Orthopsychiatry 58 (1988)<br />
Wermuth und Schulze<br />
Vergleich von Trauerreaktionen bei Eltern<br />
12. Toedter LJ, Lasker JN, Janssen HJEM: International<br />
comparison of studies using the perinatal grief<br />
scale: A decade of research on pregnancy loss. Death<br />
Stud 25 (2001) 205–228<br />
13. Walwork E, Ellison PH: Follow-up of families<br />
of neonates in whom life support was withdrawn.<br />
Clin Pediatr 24 (1985) 14–20<br />
Autorin<br />
Inga Wermuth<br />
Neonatologie, Klinik und Poliklinik<br />
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Klinikum Großhadern der<br />
Ludwig-Maximilians-Universität München<br />
Marchioninistraße 15, 81377 München<br />
Telefon 01 71/6 80 45 39<br />
inga.richter@gmx.de<br />
125
Stahn, Paditz, Grube, Walter, Stock, Mölle, Scharfe, Lindinger, P.-Langer, Keusch<br />
Proaktive telefonische Raucherberatung von Schwangeren und Müttern von Säuglingen<br />
Proaktive telefonische Raucherberatung von<br />
Schwangeren und Müttern von Säuglingen – ein<br />
Modellprojekt im Rahmen der Prävention des<br />
plötzlichen Säuglingstodes (SID)<br />
Stahn Katharina 1 , Paditz Ekkehart 2 , Grube Angelika 1 , Walter Beate 1 , Stock Katharina 1 , Mölle Stefanie 3 ,<br />
Scharfe Stefan 3 , Lindinger Peter 4 , Pötschke-Langer Martina 4 , Keusch Siegfried 5<br />
1 Klinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin des Städt. Krankenhauses Dresden-Neustadt<br />
2 Klinik und Poliklinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin Med. Fakultät TU Dresden<br />
3 <strong>Kinder</strong>arztpraxis Dresden<br />
4 Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg<br />
5 AOK Sachsen<br />
Einleitung<br />
Tabakrauchexposition während der<br />
Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr<br />
erhöht das SID-Risiko dosisabhängig<br />
bis zu acht- bis 16fach. Weitere gesicherte<br />
Risiken sind das Auftreten einer<br />
Fehl- oder Frühgeburt, sowie Geburt eine<br />
hypotrophen Kindes, außerdem Fehlbildungen<br />
wie Lippen-Kiefer-Gaumenspalten,<br />
Mikrocephalus, Klumpfussbildung<br />
[1,2,7].<br />
Nach aktuellen Erhebungen rauchen<br />
20–50 % aller Schwangeren[6]. Die<br />
Hälfte der Schwangeren unter 25 Jahren<br />
raucht [4], bei Schwangeren der<br />
niedrigeren sozialen Schichten mehr als<br />
40 % [3]. Durchschnittlich raucht eine<br />
Schwangere 13 Zigaretten am Tag [3], im<br />
Durchschnitt ist das ungeborene Kind<br />
demnach im Verlauf der Schwangerschaft<br />
dem Rauch von 3 640 Zigaretten ausgesetzt.<br />
Etwa ein Drittel der Schwangeren<br />
schafft den freiwilligen Ausstieg in der<br />
Schwangerschaft [4], postnatal steigt das<br />
Rückfallrisiko stetig mit wachsendem Alter<br />
des Kindes [1]. 1994–1999 rauchten<br />
22 % der Mütter von Säuglingen, die<br />
im dritten Lebensmonat im Schlaflabor<br />
untersucht wurden (43 % der unter 23jährigen<br />
und 19,8 % der über 23-jährigen<br />
Mütter) [5] . Am Ende des ersten Lebensjahres<br />
rauchen bereits wieder 30 % der<br />
Mütter [1].<br />
Telefonische Raucherberatungen haben<br />
sich bewährt aufgrund ihrer einfachen<br />
Zugänglichkeit bei relativ geringem<br />
Aufwand. Sie bieten außerdem den wesentlichen<br />
Vorteil einer individuellen<br />
Beratung. Verglichen mit anderen Möglichkeiten<br />
der Raucherberatung zeigen<br />
sie ähnlich gute, teilweise sogar höhere<br />
Erfolgsquoten. Dies gilt insbesondere<br />
für die proaktiven Beratungstelefone [8].<br />
Bei diesen werden die Klienten nach einem<br />
Erstkontakt vom Berater proaktiv<br />
angerufen, d. h. sie müssen sich nicht<br />
mehr von sich aus melden, sondern der<br />
(pro-)aktiv Handelnde ist der Berater.<br />
Methodik<br />
Im Jahr 2002 wurde das deutschlandweit<br />
erreichbare Info- und Beratungstelefon<br />
„Gesunder Babyschlaf“gestartet<br />
(Telefon 01 80/5 09 95 55). Dort kön-<br />
127
128<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
nen Interessierte einen Infotext sowie<br />
Faxabruf abrufen oder zu festgelegten<br />
Sprechzeiten von <strong>Kinder</strong>ärzten beraten<br />
werden. Im März 2003 wurde dieses Infotelefon<br />
um eine „Beratung für rauchende<br />
Schwangere und Mütter von Säuglingen“<br />
– ebenfalls mit Infotext, Faxabruf<br />
und der Möglichkeit, sich von speziell<br />
geschulten Raucherberaterinnen beim<br />
Rauchstopp unterstützen zu lassen- erweitert.<br />
Sprechzeiten sind dienstags bis<br />
donnerstags von 8:00 bis 10:00 Uhr und<br />
Dienstag und Donnerstag von 16:00 bis<br />
18:00.<br />
Für den proaktiven Ansatz wurden<br />
<strong>Kinder</strong>- und Frauenärzte sowie Hebammen<br />
in ganz Sachen gebeten, mittels<br />
eines speziell angefertigten Formblattes<br />
die schriftliche Einwilligung rauchender<br />
Schwangerer und Mütter von Säuglingen<br />
einzuholen, vom Raucherberatungstelefon<br />
angerufen zu werden. Die<br />
Raucherinnen werden über Tipps und<br />
Tricks zum Rauchstopp informiert. Mit<br />
ausstiegswilligen Raucherinnen wird ein<br />
Rauchstopptermin innerhalb der nächsten<br />
14 Tage vereinbart, begleitend erfolgen<br />
engmaschige Folgeanrufe bis zum<br />
Ende des ersten Lebensjahres des Kindes.<br />
Bei nicht ausstiegswilligen Raucherinnen<br />
wird mittels psychologischer Gesprächsführung<br />
die Ambivalenz beim Rauchern<br />
erhöht und eventuell in Folgekontakten<br />
ein Rauchstopp vereinbart. Rauchende<br />
Partner werden an die bekannten reaktiven<br />
Suchttelefone der BZgA (Telefon<br />
(02 21) 89 20 31) und des Deutschen<br />
Krebsforschungszentrums (Telefon<br />
(0 62 21) 42 42 00) verwiesen. Folgekontakte<br />
werden individuell vereinbart, erfolgen<br />
aber in jedem Falle vierWochen<br />
nach Geburt des Kindes sowie zum sechs-<br />
ten und zwölften. Lebensmonat um die<br />
erzielten Erfolge zu evaluieren.<br />
Ergebnisse<br />
Vom 11. März 2003 bis 31. Dezember<br />
2004 wurden 132 Erstanrufe und 305 Folgeanrufe<br />
getätigt. Von des Erstkontakten<br />
waren 103 Kontakte proaktiv und nur 29<br />
Kontakte reaktiv. 90 Klientinnen wurden<br />
über 305 Folgeanrufe weiterbetreut.<br />
Bei 40 % (36/90) der Frauen konnte ein<br />
Rauchstopp erzielt werden. Weitere 20 %<br />
(18/90) reduzierten den Zigarettenkonsum.<br />
Damit konnten über 60 % der erstkontaktierten<br />
Frauen zur kompletten Rauchfreiheit oder<br />
zumindest zur Reduktion des Zigarettenkonsums<br />
motiviert werden.<br />
6,6 % der Klientinnen waren zwischenzeitlich<br />
währen der Schwangerschaft Nichtraucherinnen,<br />
rauchten aber nach der Geburt<br />
bzw. am Ende der Stillzeit wieder.<br />
Von 11,1 % (10/90) liegen keine Angaben<br />
zum aktuellen Rauchverhalten vor.<br />
25 % der Erstanrufe waren einmalige<br />
Kontakte. Ursächlich waren neben einem<br />
Wiederruf des Beratungswunsches<br />
auch bereits erfolgter Rauchstopp, reiner<br />
Informationsbedarf, stationärer Aufenthalt<br />
der Klientin u.v.a.m. Von den Frauen,<br />
die einen Folgekontakt ablehnten,<br />
gaben 28 % (7/25) an, bereits Nichtraucherinnen<br />
zu sein und hatten nur weiteren<br />
Informationsbedarf.<br />
Zahlreiche weitere Frauen konnten<br />
motiviert werden, zumindest eine rauchfreie<br />
Wohnung schaffen, viele wurden –<br />
teilweise erstmalig – aufgeklärt über die<br />
zahlreichen unerwünschten Wirkungen<br />
des Rauchens auf das ungeborene oder
Stahn, Paditz, Grube, Walter, Stock, Mölle, Scharfe, Lindinger, P.-Langer, Keusch<br />
Proaktive telefonische Raucherberatung von Schwangeren und Müttern von Säuglingen<br />
neugeborene Kind. Außerdem wurden<br />
Informationen gegeben über die Möglichkeit<br />
des Stillens trotz Zigarettenkonsum<br />
und die beste „Technik“ (Rauchen<br />
direkt im Anschluss an die Stillzeit).<br />
Diskussion<br />
Das Projekt stellt das erste proaktive<br />
Raucherberatungstelefon in Deutschland<br />
dar. Inzwischen sind in Bayern und<br />
am DKFZ Heidelberg weitere spezielle<br />
proaktive Raucherberatungstelefone gegründet<br />
worden, z. B. für Krebspatienten.<br />
Die eigenen vorläufigen Ergebnisse<br />
zeigen, dass eine kurzfristige Beeinflussung<br />
des Raucherstatus insbesondere<br />
während der Schwangerschaft möglich<br />
ist. Das proaktive Vorgehen scheint der<br />
Schlüssel zum Erfolg zu sein, da dadurch<br />
die Hemmschwelle der Schwangeren<br />
überschritten wird, sich selbst zu melden.<br />
Für die Effizienz des proaktiven Vorgehens<br />
spricht auch das Verhältnis der<br />
proaktiven zu reaktiven Anrufe (103:29).<br />
Nicht zufriedenstellend ist dahingegen<br />
der Rücklauf der Einwilligungsbögen.<br />
Erst nach gezielten Anschreiben der zuständigen<br />
Ärzte und Hebammen werden<br />
Einwilligungsbögen zurückgesandt, so<br />
dass ein Jahr nach Start des Beratungstelefones<br />
eine erneute Mailing-Aktion<br />
stattfand. Weiterhin scheinen viele<br />
Geburtshelfer es vorzuziehen, das Thema<br />
Rauchen in der Schwangerschaft zu<br />
meiden, statt offen und ohne Wertung<br />
anzusprechen und Hilfestellungen zum<br />
Rauchstopp weiter zu vermitteln.<br />
Abstinenzquoten von Raucherberatungstelefonen<br />
liegen zwischen 15–45%.<br />
Damit zeigt sich die erreichte Abstinenzquote<br />
von 40 % im oberen Bereich. Die<br />
individuelle telefonische Beratung inkl.<br />
der Möglichkeit von Folgekontakten ist<br />
der Selbsthilfe und der Gruppentherapie<br />
überlegen. Eine intensive Weiterbetreuung<br />
zur Reduktion der Rückfallquote<br />
vor allem auch nach der Geburt ist erforderlich.<br />
Die eigenen Ergebnisse zeigen,<br />
dass auch nach erfolgreichem längeren<br />
Rauchstopp die Rückfallquote in einer<br />
als besonders belastend erlebten Zeit<br />
(Säuglings- und Kleinkindalteralter) erheblich<br />
ist.<br />
Ziel des Projektes ist die weitere Senkung<br />
der SID-Rate durch Vermittlung<br />
der drei Informationen: Babys schlafen<br />
am sichersten in Rückenlage und im<br />
Schlafsack sowie „Baby mag rauchfrei<br />
– auch schon vor der Geburt“.<br />
Literatur<br />
1 Bornhäuser A., Pötschke-Langer M: Passivrauchende<br />
<strong>Kinder</strong> in Deutschland – Frühe Schädigungen<br />
für ein ganzes Leben. Rote Reihe Tabakprävention<br />
und Tabakkontrolle Band 2, deutsches<br />
Krebsforschungszentrum, Heidelberg, S 11–23,<br />
2003<br />
2 Haustein K.-O. 2000: Rauchen, Nikotin und<br />
Schwangerschaft. Geburtsh Frauenheilk 60: 11<br />
– 19.<br />
3 Helmert U et al.: Rauchverhalten von Schwangeren<br />
und Müttern mit Kleinkindern. Sozial- und<br />
Präventivmedizin, 43, 51–58, 1998.<br />
4 Lang P: Förderung des Nichtrauchens in der<br />
Schwangerschaft. In: Hausstein K-O: Rauchen und<br />
kindliche Entwicklung – Raucherschäden und Primärprävention.<br />
Verlag Perfusion, Nürnberg, pp<br />
153–167, 2001.<br />
129
130<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
5 Maier U, Friebel D, Paditz E: Mütterliches Rauchen<br />
und Geburtsgewicht, Stillen, Infekte, Schwitzen<br />
und Blässe bei Säuglingen. In: Paditz E (Hrsg.):<br />
Gesunder Babyschlaf – Prävention des Plötzlichen<br />
Säuglingstodes in Sachsen. Hille Dresden 2002, S.<br />
55–57<br />
6 Paditz E et al.: Beratungstelefon „Gesunder<br />
Babyschlaf“ und „Beratung für rauchende Schwangere<br />
und rauchende Mütter von Säuglingen“ innerhalb<br />
der Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes:<br />
Telefon 01 80/5 09 95 55. <strong>Kinder</strong>- und Jugendarzt 3:<br />
482–488, 2003.<br />
7 Schellscheidt J, Oyen N, Jorch G: Interactions<br />
between maternal smoking and other prenatal<br />
risks factors for sudden infant death syndrome<br />
(SIDS). Acta Paediatr. Aug; 86 (8): 857–63, 1997.<br />
8 Stead LF, Lancaster T. Telephone counselling<br />
for smoking cessation (Cochrane Review) 2003:<br />
The cochrane library 3. Oxford: Update software.<br />
Korrespondenzadresse<br />
Dr. med. Katharina Stahn<br />
Klinik für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin<br />
Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt<br />
Industriestraße 40, 01129 Dresden<br />
Telefon (03 51) 8 56-25 80<br />
Telefax (03 51) 8 56-25 82<br />
katharina.stahn@khdn.de<br />
Weitere Informationen:<br />
www.babyschlaf.de<br />
www.babyhilfe-deutschland.de
Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
Gründungsaufruf<br />
Gründungsaufruf der Babyhilfe Deutschland<br />
Foto (von rechts nach links): Dr. Peter Lenk (Mitglied des Kuratoriums), Staatssekretär Dr. Albin Nees<br />
(Leiter des Länderbeirates), Dipl.-Med. Stefan Scharfe (Medizinalvorstand), Prof. Dr. med. Ekkehart Paditz<br />
(Vorsitzender), Bernd Hanke (Grafiker BDG, Herr Hanke entwarf und stiftete das Logo), Dr. med.<br />
Katharina Stahn (Stellvertretende Vorsitzende), Haike Korbl (Beirat Selbsthilfegruppen mit Ehemann und<br />
<strong>Kinder</strong>n), Ulrike Holzhauser und Ursula Herrmann, Direktorin Hotel und Restaurant Schloss Eckberg<br />
(Frau Herrmann, Frau Holzhauser und der Lions-Club Dresden Centrum stifteten die Buche, die anlässlich<br />
der Gründung der Babyhilfe Deutschland als Symbol des Lebens gepflanzt wurde), Constanze Geiert<br />
(Justiziarin des Vereins), Staatsminister a. D. Georg Brüggen (Vorsitzender des Kuratoriums), Gerd Pfetzer<br />
(Finanzvorstand mit Klein-Jonathan und Ehefrau), Maria Kunze auf dem Arm ihrer Mutter (Maria ist als<br />
Baby im Schlafsack schlummernd in Sachsen und inzwischen auch bundesweit durch das Informationsblatt<br />
für Eltern „bekannt“ geworden). Foto: Sandra Neuhaus für Babyhilfe Deutschland<br />
131
132<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
In Zuversicht und Vertrauen wenden wir uns an alle Menschen, die<br />
mit uns zusammen verhindern wollen, dass in Deutschland jährlich<br />
über 400 Babys am sog. plötzlichen Kindstod sterben. Wir wenden<br />
uns<br />
• an alle, die den Tod dieser Babys verhindern wollen;<br />
• an alle, die bereit sind, ihre Hand zu öffnen, wenn es gilt, wirklich etwas gutes zu<br />
unterstützen;<br />
• an alle, denen aus den Augen ihres Kindes des Lebens schönstes Glück entgegenlächelt;<br />
• an alle, die die bange Sorge kennen, wenn Krankheit ihrer Lieblinge Wohl bedroht;<br />
• an alle, die helfen wollen den Tod der <strong>Kinder</strong> und den unendlichen Schmerz der Eltern<br />
und Geschwister zu verhindern;<br />
• an alle die solche Not abwehren wollen.<br />
Wir wollen zusammen mit allen, die Ihre Hand öffnen, helfen und unterstützen:<br />
Aufklärung<br />
Wir brauchen eine umfassende Aufklärung der Menschen über die Gefah-ren lebensgefährlicher<br />
Baby- und Kleinkinderkrankungen, insbesondere des plötzlichen<br />
Säuglingstods und über entsprechende Präventionsmöglichkeiten.<br />
Unterstützung von Selbsthilfeaktivitäten<br />
Wir brauchen die Unterstützung von Selbsthilfeaktivitäten betroffener Familien.<br />
Professionelle, zielgruppenorientierte Informationskampagnen<br />
Wir brauchen noch mehr professionelle, zielgruppenorientierte Informationskampagnen.<br />
Verantwortung für den schlafenden Säugling<br />
Wir brauchen gut informierte Schwangere, Eltern, Großeltern, Babysitter und alle<br />
Personen, die Babys zum Schlafen legen, die wissen, wie ein Baby gesund schläft und<br />
was diesen gesunden Schlaf gefährdet.
Generationswissen<br />
Wir brauchen das Wissen, um den Gesunden Babyschlaf als sog. Generationswissen.<br />
Unterstützung der Menschen<br />
Wir brauchen Unterstützung in Geld, Wort und Tat, um denen zu helfen, die sich<br />
noch nicht artikulieren können, damit sie leben können.<br />
Unser Versprechen<br />
Wir, die Gründer der Babyhilfe Deutschland gewährleisten, dass jeder gespendete<br />
Euro zu 100 Prozent unseren Zielen zugute kommt. Jeder Unterstützer und Helfer<br />
kann sich darauf verlassen, dass jeder Euro, dass jede sonstige Unterstützung ausschließlich<br />
der Verwirklichung der Ziele dieses Gründungsaufrufs dient.<br />
Wir vertrauen in die Menschen, um den Säuglingen zu helfen. Wir wollen mit allen<br />
Menschen zusammen erreichen:<br />
Jeden Tag ein Babyleben retten!<br />
Erklärt und gezeichnet auf dem Lingner-Schloss zu Dresden<br />
am 22. Apriil 2004<br />
Gründungsmitglieder (alphabetisch):<br />
Georg Brüggen Constanze Geiert Bernd Hanke<br />
Ursuala Herrmann Ulrike Holzhauer Susanne Krevet<br />
Albin Nees Ekkehart Paditz Gerd Pfetzer<br />
Anne Katharina Stahn Stefan Scharfe<br />
Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
Gründungsaufruf<br />
133
Satzung<br />
des gemeinnützigen Vereines „Babyhilfe Deutschland e. V.“<br />
vom 22. April 2004 i. d. F. der Änderung vom 7. Juni 2004<br />
§ 1 Name und Sitz<br />
Der Verein führt den Namen „Babyhilfe<br />
Deutschland e. V.“. Der Verein hat<br />
seinen Sitz in Dresden.<br />
§ 2 Zweck<br />
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich<br />
und unmittelbar gemeinnützige<br />
Zwecke im Sinne des Abschnitts<br />
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der<br />
Abgabenordnung.<br />
(2) Zweck des Vereins ist die umfassende<br />
Aufklärung der Bevölkerung über<br />
die Gefahren lebensgefährlicher<br />
Baby- und Kleinkindererkrankungen,<br />
insbesondere des plötzlichen<br />
Säuglingstodes und über entsprechende<br />
Präventionsmöglichkeiten.<br />
Unter anderem soll die Aufklärung<br />
der Bevölkerung über die nachfolgenden,<br />
nicht abschließend genannten<br />
Projekte erreicht werden: Druck<br />
von Faltblättern für Schwangere<br />
und für Eltern, Druck von Plakaten,<br />
der Betrieb von Internetseiten,<br />
professionelle Presse- und Medienarbeit<br />
und die Organisation<br />
professioneller Hilfe für betroffene<br />
Familien. Darüber hinaus soll der<br />
Verein die Organisation von Fort-<br />
Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
Satzung<br />
bildungen und Schulungen für alle<br />
Berufsgruppen, die mit lebensgefährlichen<br />
Baby- und Kleinkindererkrankungen<br />
in Berührung kommen<br />
können, anstreben. Als Adressaten<br />
kommen neben Ärzten, Hebammen,<br />
<strong>Kinder</strong>krankenschwestern<br />
und Krankenschwestern insbesondere<br />
auch Polizisten und Staatsanwälte<br />
in Betracht, um den Umgang<br />
mit Notsituationen zu schulen und<br />
daraus Dienstanweisungen zu entwickeln.<br />
Der Satzungszweck wird<br />
verwirklicht insbesondere durch<br />
die Zuwendung von Vereinsmitteln<br />
an gemeinnützige Körperschaften,<br />
die dieselbe Zielstellung haben wie<br />
der Verein.<br />
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er<br />
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche<br />
Zwecke. Mittel des<br />
Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen<br />
Zwecke verwendet werden.<br />
Die Mitglieder erhalten keine<br />
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.<br />
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben,<br />
die dem Zweck der Körperschaft<br />
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig<br />
hohe Vergütungen<br />
begünstigt werden.<br />
137
138<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
§ 3 Mitgliedschaft, Eintritt<br />
Mitglied des Vereines können natürliche<br />
und juristische Personen werden.<br />
Über den schriftlichen Aufnahmeantrag<br />
entscheidet der Vorstand. Er ist bei Ablehnung<br />
des Antrages nicht verpflichtet,<br />
dem Antragsteller die Gründe der Ablehnung<br />
bekanntzugeben.<br />
§ 4 Mitgliedschaft, Verlust<br />
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod,<br />
Austrittserklärung oder Ausschluss.<br />
(2) Der jederzeit mögliche Austritt erfolgt<br />
durch eine schriftliche Erklärung<br />
an die Bundesgeschäftsstelle.<br />
(3) Ein Mitglied, das in erheblichem<br />
Maß gegen die Vereinsinteressen<br />
verstoßen hat, kann durch mit 2/3-<br />
Mehrheit gefassten Beschluss des<br />
Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen<br />
werden. Vor dem Ausschluss<br />
ist das betroffene Mitglied<br />
persönlich oder schriftlich zu hören.<br />
Die Entscheidung über den Ausschluss<br />
ist schriftlich zu begründen<br />
und dem Mitglied zuzusenden. Es<br />
kann innerhalb von einer Frist von<br />
einem Monat ab Zugang schriftlich<br />
Berufung beim Vorstand einlegen.<br />
Über die Berufung entscheidet die<br />
Mitgliederversammlung. Macht<br />
das Mitglied vom Recht der Berufung<br />
innerhalb der Frist keinen<br />
Gebrauch, unterwirft es sich dem<br />
Ausschließungsbeschluss.<br />
Als erheblicher Verstoß ist auch die<br />
Nichtzahlung des Vereinsbeitrages<br />
ohne hinreichenden Entschuldi-<br />
gungsgrund anzusehen. Das Mitglied<br />
ist vor Ausschluss mittels Einwurfeinschreibens<br />
letztmalig zur<br />
Zahlung binnen einer Frist von zwei<br />
Wochen ab Zugang des Schreibens<br />
aufzufordern und gleichzeitig der<br />
Ausschluss anzudrohen. Im Wiederholungsfalle<br />
ist diese Mahnung<br />
entbehrlich.<br />
(4) Das Erlöschen der Mitgliedschaft<br />
wird zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres<br />
wirksam.<br />
§ 5 Vereinsregister/Geschäftsjahr<br />
(1) Der Verein ist in das Vereinsregister<br />
einzutragen.<br />
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.<br />
§ 6 Beiträge<br />
(1) Von den Mitgliedern wird ein Beitrag<br />
erhoben, den die Mitgliederversammlung<br />
festsetzt. Die Beitragszahlung<br />
erfolgt jährlich und<br />
zwar im ersten Quartal des Jahres<br />
im Lastschrifteneinzugsverfahren.<br />
Vom Erfordernis des Lastschrifteinzugsverfahrens<br />
kann mit Zustimmung<br />
des Finanzvorstandes im Einzelfall<br />
abgesehen werden.<br />
(2) Der Vorstand kann auf Antrag den<br />
Beitrag aus sozialen Gründen ermäßigen<br />
und Mitglieder im Übrigen<br />
zu ehrenamtlichen Mitgliedern berufen.
(3) Es bleibt den Mitgliedern unbenommen,<br />
zusätzlich freiwillige Beiträge<br />
und Spenden zu leisten.<br />
§ 7 Rechnungsprüfung<br />
Die Rechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres<br />
ist von jeweils zwei Rechnungsprüfern<br />
zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung<br />
gewählt werden.<br />
§ 8 Organe des Vereins<br />
Organe des Vereins sind Vorstand,<br />
Mitgliederversammlung, Kuratorium,<br />
Beiräte und Arbeitsausschüsse.<br />
§ 9 Der Vorstand<br />
(1) Der Vorstand führt den Verein gemäß<br />
seiner satzungsmäßigen Aufgaben,<br />
Rechte und Pflichten. Er führt<br />
die Geschäfte ehrenamtlich.<br />
(2) Der geschäftsführende Vorstand besteht<br />
aus fünf Personen und zwar<br />
• dem Vorstandsvorsitzenden,<br />
• dem Stellvertretenden Vorsitzenden,<br />
• dem Medizinalvorstand,<br />
• dem Finanzvorstand und<br />
• dem Justitiar.<br />
Die Mitgliederversammlung kann<br />
bestimmen, dass der Gründungsvorstand<br />
abweichend von Satz 1 aus<br />
weniger Mitgliedern besteht.<br />
(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich<br />
jeweils durch zwei<br />
Mitglieder des geschäftsführenden<br />
Vorstandes, darunter dem Vorsitzenden<br />
oder dem stellvertretenden<br />
Vorsitzenden, vertreten.<br />
Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
Satzung<br />
(4) Der Finanzvorstand soll Steuerberater<br />
oder Wirtschaftsprüfer sein.<br />
Er führt die erforderlichen Finanzunterlagen.<br />
Der Medizinalvorstand<br />
soll über Erfahrungen als Facharzt<br />
für <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin verfügen.<br />
(5) Der Gründungsvorstand bleibt auf<br />
die Dauer von einem Jahr im Amt.<br />
Danach erfolgt die Wahl des geschäftsführenden<br />
und des Gesamtvorstandes<br />
jeweils durch die Mitgliederversammlung<br />
in geheimer<br />
Wahl auf die Dauer von zwei Jahren.<br />
Auf eine geheime Wahl kann verzichtet<br />
werden, wenn einem solchen<br />
Antrag keines der anwesenden Vereinsmitglieder<br />
widerspricht. Der<br />
Vorstand bleibt auch nach Ablauf<br />
seiner Amtszeit solange im Amt, bis<br />
ein neuer Vorstand gewählt wird.<br />
(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor<br />
Ablauf seiner Amtszeit aus, so kann<br />
der Vorstand bis zum Ablauf der<br />
Amtszeit des Vorstandes ein Vereinsmitglied<br />
in den Vorstand berufen<br />
oder die vakante Position mit<br />
einem aktuellen Vorstandsmitglied<br />
besetzen (Doppelamt).<br />
(7) Der geschäftsführende Vorstand<br />
kann weitere Vorstandsmitglieder<br />
berufen (Kooptation), ohne dass<br />
diese den Verein rechtsgeschäftlich<br />
nach außen vertreten. Sie gehören<br />
dem Gesamtvorstand an. Mit der<br />
nächsten Vorstandswahl durch die<br />
Mitgliederversammlung stellen<br />
sich die Kooptierten der Gesamtvorstandswahl,<br />
andernfalls sie aus<br />
139
140<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
dem Vorstand ausscheiden und nur<br />
in begründeten Ausnahmen wieder<br />
kooptiert werden dürfen.<br />
(8) Die Beiratsvorsitzenden sind geborene<br />
Mitglieder des Gesamtvorstandes.<br />
(9) Vorstandssitzungen werden vom<br />
Vorsitzenden oder dem Stellvertreter<br />
mit angemessener Frist unter<br />
Mitteilung der Tagesordnung einberufen.<br />
Die Entscheidungen des<br />
Vorstandes werden mit der Mehrheit<br />
der anwesenden Stimmen<br />
getroffen. Bei Stimmengleichheit<br />
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.<br />
In dringenden Fällen können<br />
Vorsitzender, der Stellvertreter<br />
und der Finanzvorstand gemeinsam<br />
vorab entscheiden. Ein schriftliches<br />
Umlaufverfahren ist nur zulässig,<br />
wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht<br />
oder mit Nein stimmt.<br />
(10) Werden Vorstandsbeschlüsse durch<br />
den Finanzvorstand, den Justitiar<br />
oder den Medizinalvorstand beanstandet,<br />
so bedarf der Beschluss des<br />
Vorstandes der 2/3-Mehrheit seiner<br />
Mitglieder. Zuvor ist der entsprechende<br />
Fachvorstand zu hören.<br />
(11) Zu den Sitzungen des Vorstandes<br />
ist der Vorsitzende des Kuratoriums<br />
einzuladen; an den Vorstandssitzungen<br />
können der Vorsitzende des<br />
Kuratoriums oder sein Stellvertreter<br />
teilnehmen. Sie haben das Recht,<br />
Anträge zu stellen und beratend<br />
an den Sitzungen teilzunehmen,<br />
jedoch kein Stimmrecht.<br />
§ 10 Beirat, Arbeitsausschüsse<br />
(1) Der Vorstand kann zur Erfüllung<br />
längerfristiger Vereinsaufgaben einen<br />
Beirat sowie für die Durchführung<br />
kurzfristiger Einzelaufgaben<br />
Arbeitsausschüsse berufen.<br />
(2) Beirat und Arbeitsausschüsse haben<br />
beratende Funktion und sollen dem<br />
Vorstand ermöglichen, sich bei der<br />
Erfüllung seiner Aufgaben der Kompetenz<br />
besonderer Persönlichkeiten<br />
zu bedienen.<br />
(3) Jeder Beirat wählt aus seiner Mitte<br />
einen Vorsitzenden und in der<br />
Regel zwei Stellvertreter. Der Vorsitzende<br />
hat die Aufgabe, den Vereinsvorstand<br />
über die Tätigkeit des<br />
Beirates regelmäßig sowie bei Anlass<br />
(„ad hoc“) zu informieren. Der<br />
Vorsitzende ist gleichzeitig geborenes<br />
Mitglied des Gesamtvorstandes.<br />
Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung.<br />
(4) Dem Beirat und den Arbeitsausschüssen<br />
können auch Nichtmitglieder<br />
angehören; dies gilt<br />
insbesondere für Vertreter von<br />
Selbsthilfegruppen und Initiativen<br />
betroffener Eltern.<br />
§ 11 Kuratorium<br />
(1) Das Kuratorium besteht aus ehrenamtlich<br />
tätigen Mitgliedern. Es soll<br />
sich in ausgewogenem Verhältnis<br />
aus Vertretern von Wissenschaft,<br />
Wirtschaft, Politik und anderen Gebieten<br />
des öffentlichen Lebens zusammensetzen.
(2) Seine ersten Mitglieder werden von<br />
der Mitgliederversammlung für die<br />
Dauer von drei Jahren vom Tag<br />
der Berufung an gerechnet, berufen.<br />
Weitere Mitglieder beruft der<br />
Vorstandsvorsitzende im Einvernehmen<br />
mit dem Kuratoriumsvorsitzenden.<br />
Eine erneute Berufung ist<br />
möglich.<br />
(3) Der Vorstand bestimmt die jeweilige<br />
Anzahl der Kuratoriumsmitglieder.<br />
Das Kuratorium wählt auf Vorschlag<br />
des Vorstandsvorsitzenden<br />
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden<br />
und dessen Stellvertreter. Der<br />
erste Kuratoriumsvorsitzende wird<br />
abweichend von dieser Regelung<br />
von der Mitgliederversammlung gewählt.<br />
(4) Das Kuratorium hat die Aufgabe,<br />
den Vorstand zu beraten und ihm<br />
Vorschläge für die Geschäftsführung<br />
zu machen. Es unterrichtet<br />
sich durch die Entgegennahme regelmäßiger,<br />
mindestens jährlicher<br />
Berichte des Vorstandes über die<br />
Angelegenheiten des Vereines. Seine<br />
Mitglieder können jederzeit vom<br />
Vorstand Auskunft über die Angelegenheiten<br />
des Vereines verlangen.<br />
(5) Mindestens zweimal jährlich soll<br />
eine Sitzung des Kuratoriums stattfinden.<br />
Das Kuratorium wird hierzu<br />
vom Vorsitzenden oder vom stellvertretenden<br />
Vorsitzenden schriftlich,<br />
fernmündlich oder telegrafisch<br />
mit einer Frist von mindestens drei<br />
Wochen einberufen. Das Kuratorium<br />
muss einberufen werden, wenn<br />
Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
Satzung<br />
mindestens drei seiner Mitglieder<br />
dies schriftlich vom Vorsitzenden<br />
verlangen. Wird diesem Verlangen<br />
innerhalb einer Frist von drei Wochen<br />
nicht entsprochen, sind die<br />
Kuratoriumsmitglieder, welche die<br />
Einberufung verlangt haben, berechtigt,<br />
selbst das Kuratorium einzuberufen.<br />
(6) Zu den Sitzungen des Kuratoriums<br />
haben alle Vorstandsmitglieder Zutritt<br />
und das Recht, an der Diskussion<br />
teilzunehmen. Ein Stimmrecht<br />
steht ihnen nicht zu. Alle Vorstandsmitglieder<br />
sind von den Sitzungen<br />
des Kuratoriums zu verständigen.<br />
(7) Sitzungen des Kuratoriums werden<br />
von dessen Vorsitzenden oder bei<br />
dessen Verhinderung vom stellvertretenden<br />
Vorsitzenden geleitet.<br />
Sind beide verhindert, wählt das<br />
Kuratorium aus seiner Mitte einen<br />
Versammlungsleiter.<br />
(8) Das Kuratorium ist beschlussfähig,<br />
wenn mindestens drei seiner Mitglieder<br />
anwesend sind. Eine Vertretung<br />
der Kuratoriumsmitglieder<br />
durch Bevollmächtigte ist zulässig.<br />
(9) Bei der Beschlussfassung entscheidet<br />
die Mehrheit der abgegebenen<br />
Stimmen. Bei Stimmengleichheit<br />
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.<br />
(10) Für die Kuratoriumsmitglieder sind<br />
Ergebnisprotokolle zu erstellen. Jedes<br />
Mitglied des Kuratoriums und<br />
des Vorstandes erhält eine Kopie<br />
141
142<br />
2. bundesweite Experten- und Fortbildungstagung<br />
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes in Deutschland<br />
der Protokolle. Die Originale werden<br />
beim Vorstand verwahrt.<br />
§ 12 Mitgliederversammlung<br />
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung<br />
findet einmal im Jahr<br />
statt. Sie wird vom Vorsitzenden<br />
des Vorstandes oder von einem seiner<br />
Stellvertreter mit einer Frist<br />
von zwei Wochen mittels einfachem<br />
Brief unter Angabe der Tagesordnung<br />
einberufen. Die Frist beginnt<br />
am dritten Tage der Aufgabe des<br />
Briefes zur Post zu laufen. Auf den<br />
tatsächlichen Zugang der Einladung<br />
bei allen Vereinsmitgliedern kommt<br />
es nicht an.<br />
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung<br />
ist auf Verlangen eines<br />
Drittels der Mitglieder einzuberufen.<br />
(3) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere<br />
zuständig für die Entgegennahme<br />
des Jahresberichtes und<br />
Entlastung des Vorstandes, sowie<br />
a) Wahl und Abberufung der Mitglieder<br />
des Vorstandes,<br />
b) die Wahl der Rechnungsprüfer,<br />
c) Beschlussfassung über Satzungsänderung<br />
und über Auflösung<br />
des Vereines,<br />
d) Festlegung der Höhe des Jahresbeitrages.<br />
(4) Die Mitgliederversammlung wird<br />
vom Vorsitzenden des Vorstandes<br />
oder einem der beiden Stellvertreter<br />
geleitet. Der Versammlungsleiter<br />
stellt zu Beginn der<br />
Mitgliederversammlung durch<br />
Mehrheitsbeschluss die Tagesordnung<br />
fest. Durch diese Feststellung<br />
kann die Tagesordnung geändert<br />
und Tagesordnungspunkte abgesetzt<br />
werden. Gegenstände, die<br />
nicht auf der festgestellten Tagesordnung<br />
stehen, können nicht verhandelt<br />
werden, wenn zehn vom<br />
Hundert der anwesenden Vereinsmitglieder<br />
widersprechen. In der<br />
Mitgliederversammlung hat jedes<br />
Mitglied eine Stimme. Die Ausübung<br />
des Stimmrechtes kann auf<br />
Dritte nicht übertragen werden.<br />
(5) Der Versammlungsleiter bestimmt<br />
die Art der Abstimmung. Sie muss<br />
schriftlich durchgeführt werden,<br />
wenn ein Drittel der erschienenen<br />
Mitglieder dies beantragt.<br />
(6) Die Mitgliederversammlung fasst<br />
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit<br />
der abgegebenen Stimmen.<br />
(7) Eine Änderung des Vereinszwecks<br />
und die Auflösung des Vereins kann<br />
nur mit Zustimmung von 4/5 aller<br />
Mitglieder beschlossen werden.<br />
(8) Eine Änderung der Satzung bedarf<br />
der Zustimmung von 3/4 der erschienenen<br />
Mitglieder. Beanstandet<br />
der Vorstandsvorsitzende oder<br />
der Justitiar einen Antrag auf Satzungsänderung<br />
in der Mitgliederversammlung,<br />
so bedarf die Satzungsänderung<br />
der Mehrheit von<br />
2/3 der Mitglieder des Vereins. Vor<br />
der Abstimmung ist dem Beanstan-
denden das Wort zur Begründung<br />
der Beanstandung zu erteilen.<br />
(9) Über die Mitgliederversammlung<br />
ist eine vom Vorsitzenden oder einem<br />
der beiden Stellvertreter und<br />
von dem von der Versammlung<br />
gewählten Protokollführer zu unterzeichnende<br />
Niederschrift aufzunehmen.<br />
§ 13 Auflösung<br />
Bei Auflösung oder Aufhebung des<br />
Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen<br />
Zwecks fällt das Vermögen des<br />
Vereins an den Freistaat Sachsen und die<br />
Stadt Dresden zu gleichen Teilen, die es<br />
zugunsten von <strong>Kinder</strong>n in <strong>Kinder</strong>heimen<br />
in Dresden, die in öffentlicher oder<br />
gemeinnütziger Trägerschaft stehen, zu<br />
ausschließlich gemeinnützigen Zwecken<br />
zu verwenden haben.<br />
Babyhilfe Deutschland e. V.<br />
Satzung<br />
143
Antrag auf Mitgliedschaft<br />
im Verein „Babyhilfe Deutschland e. V.“<br />
Verein zur Förderung der Prävention des Plötzlichen Säuglingstodes und anderer lebensbedrohlicher<br />
Erkrankungen im Säuglings- und Kleinkindesalter sowie zur Unterstützung<br />
betroffener Familien<br />
Name, Vorname:<br />
Titel/Akadem. Grad:<br />
Adresse: privat/dienstlich<br />
Beruf:<br />
Geburtsdatum:<br />
Telefon, Telefax, Mail:<br />
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein „Babyhilfe Deutschland e. V.“ als<br />
(Zutreffende Option bitte eindeutig erkennbar ankreuzen)<br />
natürliche Person (Jahresbeitrag 20,00 Euro)<br />
Firma bzw. juristische Person (Jahresbeitrag 200,00 Euro)<br />
natürliche Person mit folgendem freiwillig erhöhtem Jahresbeitrag: . . . . . . .<br />
Firma/juristische Person mit folg. freiwillig erhöhtem Jahresbeitrag: . . . . . . .<br />
Ich ermächtige Sie hiermit, den Jahresbeitrag bis auf Widerruf von meinem Konto<br />
abzubuchen. Meine Bankverbindung lautet:<br />
Konto-Nr., BLZ:<br />
Bank und Ort:<br />
Mir ist bekannt, dass die Babyhilfe Deutschland personenbezogene Daten speichert, die ausschließlich für<br />
den vereinsinternen Gebrauch verwendet werden.<br />
Ort, Datum Unterschrift<br />
Mitgliedsbeiträge und Spenden können gem. § 10b des EStG als Spende abgesetzt werden. Die Satzung<br />
der Babyhilfe Deutschland ist unter www.babyhilfe-deutschland.de hinterlegt und wird auf Wunsch gern<br />
übersandt.